
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
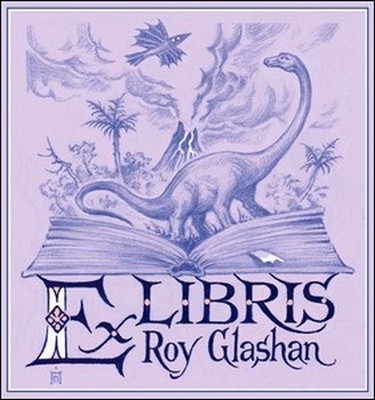

"Adeline," Franz Hass, Wien und Prag, 1797
Die Leser, welche die nächtliche Erscheinung im Schlosse Mazzini mit Vergnügen lasen, werden, wie ich hoffe, bey diesem Abentheuer im Walde nicht minder ihre Rechnung finden. Die wirklich reiche und lebhafte Einbildungskraft der Verfasserinn, welche oft eine beynahe despotische Gewalt über die Fantasie des Lesers ausübt; ihre glückliche Gabe, sowohl das Furchtbare und Schreckliche, als die sanften Schönheiten der Natur zu schildern; und ein durchaus feiner Hauch von Empfindung, verleugnen sich auch in diesem Werke nicht.
Abänderungen damit vorzunehmen, hätte ich für Versündigung an ihrer Originalität gehalten; nur hier und da, besonders im zweyten Theile, habe ich mir einige Abkürzungen erlaubt.
Möge der Leser eben die angenehme Zeitverkürzung beym Lesen finden, die ich beym Übersetzen fand, und der Beurtheiler mit meiner Arbeit nicht ganz unzufrieden seyn!
—M. F. im Novemb. 1792.

In dem Herzen, dessen einmahl schnöder Eigennutz sich bemächtigt, erstirbt die Quelle jedes warmen und edlen Gefühls; ein Gift der Tugend und des Geschmacks am Schönen, verdirbt er diesen, so wie er jene vernichtet. Es wird eine Zeit kommen, mein Freund, wo der Tod die Bande der Habsucht auflösen, und es der Gerechtigkeit vergönnt seyn wird, wieder in ihre Rechte zu treten.«
Mit diesen Worten nahm der Advokat Nemours von dem Herrn de La Motte Abschied, als dieser um Mitternacht in den Wagen stieg, der ihn von Paris, von seinen Gläubigern und der Verfolgung der Gesetze entfernen sollte. De La Motte dankte seinem Freunde für den letzten Beweis seiner Güte, für die Beförderung seiner Flucht, und sagte ihm noch ein letztes trauriges Lebewohl. Die Todtenstille der Stunde und seine äußerst bedrängte Lage versenkten ihn in stummen Tiefsinn.
Diejenigen Leser, welche Guyot de Pitaval kennen, den treusten der Schriftsteller, welche uns die Rechtshändel im Pariser Parlament während des siebenzehnten Jahrhunderts aufbehalten haben, werden sich gewiß der merkwürdigen Geschichte zwischen Pierre de La Motte und dem Marquis Philipp de Montalt erinnern; und ihnen sey hiemit zur Nachricht gesagt, daß der Flüchtling, den wir hier in ihre Bekanntschaft einführen, eben dieser Pierre de La Motte war.
Als Frau von La Motte sich aus dem Kutschenschlage lehnte, und den letzten Scheideblick auf die Mauern von Paris warf — diese Scene ihres vergangenen Glückes, den Aufenthalt so vieler, die ihrem Herzen theuer waren, wich die Standhaftigkeit, welche bisher sie aufrecht hielt, der Gewalt des Schmerzes.
»Lebt alle wohl!« seufzte sie, »noch diesen Blick, und wir sind auf immer getrennt.« —
Thränen folgten ihren Worten; sie sank zurück und überließ sich ihrer Wehmuth. Die Erinnerung vergangener Zeiten drang schwer an ihr Herz. Noch vor wenig Monathen hatte sie sich von Freunden umgeben gesehen, im Schooße des Überflusses und der Ehre! jetzt des allen beraubt, eine elende Verwiesene aus ihrem Geburtsort, ohne Heimath, ohne Trost — ohne Hoffnung besserer Zeiten! Es war nicht ihr geringstes Leiden, daß sie Paris hatte verlassen müssen, ohne von ihrem einzigen Sohne Abschied zu nehmen, der sich bey seinem Regiment in Deutschland befand; ja, man hatte sie so eilig fortgetrieben, daß sie nicht Zeit behielt, ihm von ihrer Abreise und der unglücklichen Veränderung in seines Vaters Umständen Nachricht zu geben, hätte sie auch den Ort, wo er im Quartier lag, gewußt.
Pierre de La Motte stammte aus einem alten adelichen Geschlecht in Frankreich. Er war ein Mann, dessen Leidenschaften oft seine Vernunft überwältigten, und auf eine Zeitlang die bessere Stimme in seinem Innern betäubten; doch erlosch das Bild der Tugend, welches die Natur seinem Herzen eingeprägt hatte, nie ganz, wenn gleich der vorübergehende Reiz des Lasters es oft verdunkelte. Mit etwas mehr Seelenstärke, um der Versuchung zu wiederstehen, würde er ein schätzbarer Mensch gewesen seyn; so war er stets ein schwacher, und oft ein lasterhafter. Sein Geist war thätig und unruhig; seine Einbildungskraft war feurig, und verblendete oft, von der Gewalt der Leidenschaft unterstützt, sein Urtheil, und warf seine Grundsätze um. Unstät in seinen Zwecken, ohne festen Begriff von Tugend, leitete mehr Empfindung des Augenblicks, als Grundsatz seine Handlungen, und seine Tugend — wenn er je welche besaß — vermochte nie dem Drange des gegenwärtigen Eindrucks zu widerstehen.
Er hatte sich in früher Jugend mit Constanze Valencia, einem schönen reizenden Mädchen, das an ihrer Familie hieng, und von ihr zärtlich geliebt ward, vermählt. Ihre Geburt war der seinigen gleich; ihr Vermögen größer, und ihre Verbindung wurde unter dem schmeichelnden Beyfall und den frohen Glückwünschen aller ihrer Bekannten gefeiert. Ihr Herz hing an La Motte, in welchem sie eine Zeitlang den zärtlichsten Gemahl fand, bald aber rissen die verführerischen Lockungen von Paris ihn hin, und nach wenig Jahren ging sein Vermögen und seine Liebe im Strudel der Zerstreuung verloren. Ein falscher Stolz verhindert ihn, seinem Besten gemäß zu handeln und sich mit Ehren zurückzuziehen, so lange es noch Zeit war; seine angenommene Gewohnheiten ketteten ihn an den Ort seiner bisherigen Vergnügungen, und er lebte auf großen Fuß fort, bis alle Mittel erschöpft waren.
Endlich erwachte er aus seiner Betäubung, aber nur um sich in neue Verirrungen zu stürzen, und Plane zur Wiederherstellung seiner Finanzen zu versuchen, die ihn nur tiefer zum Verderben führten. Die Folgen einer Geschichte, worin er sich verwickelt hatte; trieben ihn jetzt mit dem kleinen Rest seines gescheiterten Vermögens zu einer gefährlichen und schimpflichen Flucht.
Es war seine Absicht, in eine der südlichen Provinzen zu gehen, und an den Gränzen des Königreichs in einem entlegenen Dorfe eine Zuflucht zu suchen. Seine Familie bestand aus seiner Frau, ihrem Mädchen und einem Bedienten, welche treu dem Schicksal ihrer Herrschaft folgten.
Die Nacht war dunkel und stürmisch, und sie mochten kaum anderthalb Meilen zurückgelegt haben, als Peter, der die Stelle des Kutschers vertrat, auf einer wüsten Haide, wo mehrere Wege sich kreuzten, still hielt und seinem Herrn sagte, daß er nicht wüßte, welchen Weg er einschlagen sollte. Das plötzliche Stillhalten des Wagens weckte La Motten aus seiner Träumerey, und erfüllte die ganze Gesellschaft mit Furcht vor Nachsetzern: er konnte Petern keine Richtung anzeigen, und die tiefste Finsterniß machte es gefährlich, ohne Richtung weiter zu fahren.
In dieser Angst sahen sie in einer Entfernung Licht, und nach vielem Zweifeln und Bedenken stieg La Motte aus und ging, in Hoffnung, Menschen zu finden, die ihn zurechtweisen könnten, darauf zu: er ging langsam vorwärts, weil er unbekannte Abgründe fürchtete. Das Licht kam aus dem Fenster eines kleinen alten Hauses, das eine Viertelstunde weit von ihnen einsam auf der Haide stand.
Nachdem er die Thüre erreicht hatte, stand er einige Augenblick still und lauschte ängstlich — er hörte nichts als das Brausen des Windes, der hohl über die Wüste strich. Endlich wagte er anzuklopfen, und nach Verlauf einiger Zeit, wo er verschiedene Stimmen sich bereden hörte, wurde er gefragt, was er begehrte? La Motte antwortete: er sey ein Reisender, der den Weg verloren hätte, und um Zurechtweisung nach der nächsten Stadt ersuchte.
»Die liegt über drey Meilen von hier,« sagt der Mann, »und der Weg ist äußerst schlecht, wenn Sie ihn auch sehen könnten. Wenn Sie nichts weiter als ein Bette verlangen, so steht es Ihnen zu Diensten, und sie thäten besser, hier zu bleiben.«
Der heftige Sturmwind, der immer wüthender auf La Motte eindrang, ließ ihn nicht ohne Furcht daran denken, vor Tagesanbruch weiter zu fahren; indessen wünschte er doch den Mann, mit dem er sprach, zu sehen, ehe er seine Familie diesem Hause anvertraute, und verlangte eingelassen zu werden. Eine lange, hagere Gestalt mit einem Licht in der Hand, öffnete die Thüre und nöthigte ihn herein.
Er folgte dem Mann durch einen Gang in ein fast unmöblirtes Zimmer, wo in einer Ecke ein Bett auf der Erde gebreitet lag. Das öde, verfallene Ansehen dieses Gemachs erregte in La Motte einen unwillkührlichen Schauder, und er war im Begriff, wieder herauszugehen, als der Mann ihn zurückstieß und die Thüre hinter sich verschloß. Der Muth verließ ihn, doch machte er einen verzweifelten, wiewohl vergeblichen Versuch, die Thüre zu sprengen und rief laut um Hülfe. Er erhielt keine Antwort, hörte aber über sich Stimmen von Männern: und da er nicht zweifelte, daß sie über seine Beraubung und Ermordung zu Rathe gingen, überwältigte seine Angst beynahe alle Bestimmung.
Doch nahm er bey dem Schimmer eines verlöschenden Lichts ein Fenster wahr, allein die Hoffnung, welche jetzt in ihm auflebte, verschwand sogleich, als er es mit starken eisernen Stäben verwahrt fand. Solche Vorkehrungen zur Sicherheit machten ihn bestürzt, und bestärkten seinen Verdacht. Allein, unbewaffnet, ohne auf Hülfe rechnen zu dürfen, sah er sich in der Gewalt von Menschen, deren Handwerk wahrscheinlich in Rauben und Morden bestand.
Nachdem er fruchtlos alle Möglichkeiten, zu entweichen, durchdacht hatte, bestrebte er sich, dem Ausgang mit Fassung entgegen zu gehen; aber ach! diese Tugend war nicht La Mottes Eigenthum!
Die Stimmen schwiegen und eine Viertelstunde lang blieb alles still, bis er zwischen dem Sausen des Windes das Schluchzen und Winseln eines Weibes zu vernehmen glaubte: er horchte aufmerksam, und wurde in seiner Vermuthung bestärkt; es waren zu deutlich Töne des Jammers. Bey dieser Gewißheit verließ ihn jedes Fünkchen übrig gebliebenen Muths, und ein schrecklicher Gedanke flog mit Blitzesschnelligkeit durch sein Gehirn. Höchst wahrscheinlich, so glaubte er, hatten die Leute im Hause seinen Wagen entdeckt, sich des Bedienten bemächtigt, um ungestört plündern zu können, und Frau von La Motte hieher geschleppt.
Er schloß dieß um so mehr aus der Stille, die eine Weile vor diesen Tönen im Hause herrschte. Oder vielleicht waren diese Menschen nicht Räuber, sondern Personen, an die sein Freund oder Bedienter ihn verrathen, und die man bevollmächtigt hatte, ihn der Gerechtigkeit auszuliefern. Doch wagte er kaum, die Redlichkeit seines Freundes zu bezweifeln, dem er das Geheimniß seiner Flucht und den Plan seiner Reise anvertraut, und der ihm den Wagen, worinn er entfloh, verschafft hatte.
»Nein, solche Niederträchtigkeit,« rief La Motte, »kann nicht in der menschlichen Natur, am wenigsten in Nemours Herzen wohnen!«
Ein Geräusch in dem Gange zu seinem Zimmer unterbrach seinen Ausruf — es kam näher; die Thüre wurde geöffnet, und der Mann, der La Motten eingelassen hatte, führte, oder schleppte vielmehr ein schönes junges Mädchen herein. Ihr Gesicht schwamm in Thränen, und sie schien dem äußersten Jammer zu erliegen. Der Mann schloß die Thüre ab, steckte den Schlüssel in die Tasche, ging auf La Motte zu, der zuvor mehr Leute in dem Gange bemerkt hatte, und setzte ihm eine Pistole auf die Brust:
»Sie sind gänzlich in unserer Macht,« sagte er; »keine Hülfe kann Sie erreichen; wenn Sie Ihr Leben zu retten wünschen, so schwören Sie dieß Mädchen an einen Ort zu bringen, wo sie mir nie wieder zu Gesicht kommen kann; oder lassen Sie sich vielmehr gefallen, sie mit sich zu nehmen: denn auf Ihren Schwur darf ich mich nicht verlassen; wohl aber kann ich dafür sorgen, daß Sie mich nie wieder finden. Antworten Sie geschwind, Sie haben keine Zeit zu verlieren.«
Er ergriff jetzt die zitternde Hand des Mädchens, das todtenbleich vor Schrecken zurück sank, und schob sie La Motten zu, dem Erstaunen die Sprache raubte. Sie fiel ihm zu Füssen, und flehte mit Augen, die von Thränen strömten, sein Mitleid an. Bey aller seiner Angst und Erschütterung war es ihm doch unmöglich, die Schönheit und Betrübniß des Gegenstandes, der vor ihm lag, gleichgültig anzusehen. Ihre Jugend, ihre anscheinende Unschuld, der kunstlose Ausdruck ihres Betragens, drang ihm an das Herz, und er wollte reden, als der Kerl, der sein staunendes Schweigen für Unschlüßigkeit hielt, ihm zuvorkam.
»Ich habe ein Pferd bereit, Sie fortzuschaffen,« sagte er, »und will selbst Sie über die Haide bringen. Kommen Sie binnen einer Stunde zurück, so finden Sie den Tod; nach dieser Zeit aber steht es Ihnen frey, wieder zu kommen, wenn Sie wollen.«
La Motte hub ohne zu antworten, das liebenswürdige Mädchen von der Erde auf, und fühlte sich von eigener Besorgniß so sehr erleichtert, daß er die ihrige zu stillen sich bemühete.
»Lassen Sie uns gehen,« sagte der Mann, »und sparen Sie dieß Gewäsch. Sie haben von Glück zu sagen, daß Sie noch so davon kommen. Ich will gehen und das Pferd satteln.«
Diese letzten Worte erweckten La Motte und stürzten ihn in neues Schrecken: er fürchtete, seines Wagens zu erwähnen, um nicht die Räuber zum Plündern zu reizen; und mit diesem Menschen fort zu reiten, konnte noch schlimmere Folgen nach sich ziehen. Es ließ sich vermuthen, daß Frau von La Motte aus Angst und Ungeduld nach dem Hause schicken würde, wo sie dieselbe Gefahr laufen, und er noch den Schmerz mehr empfinden mußte, sich von seiner Familie getrennt und der Gefahr ausgesetzt zu sehen, den Dienern der Gerechtigkeit in die Hände zu fallen, wenn er ihr nachspürte.
Während diese Betrachtungen in tumultarischer Schnelligkeit vor seiner Seele vorüber kreuzten, hörte er ein neues Geräusch in dem Gange: es erfolgte ein Lärmen und Handgemenge, und in demselben Augenblicke erkannte er die Stimme seines Bedienten, den Frau von La Motte ihm nachgeschickt hatte. Entschlossen, nunmehr zu entdecken, was sich nicht länger verheelen ließ, rief er laut, daß er kein Pferd brauchte, weil sein Wagen nicht weit von hier hielte, und daß der Mensch, dessen sie sich bemächtigt hätten, sein Bedienter wäre.
Der Mann rief ihm durch die Thüre zu, er möchte sich nur noch einen Augenblick gedulden, bald sollte er mehr von ihm hören. La Motte richtete nun seinen Blick auf seine unglückliche Gefährtinn, die bleich und kraftlos sich an die Mauer lehnte. Ihre Züge von zartester Schönheit, hatten durch den Schmerz einen unaussprechlichen Zauber bekommen: ein Reisekleid von aschgrauem Kammalot zeigte ihren Wuchs, wiewohl es ihn nicht hob: es war vorn aufgerissen, und ein Theil ihrer Haare fiel unordentlich auf ihre Brust herab, während der dünne, eilends übergeworfene Schleier zurückgewichen war.
Mit jedem Augenblicke, wo er sie betrachtete, stieg La Mottes Erstaunen und warmer Antheil. Solche Schönheit und Eleganz im Kontrast mit dem öden Hause und den rohen Sitten der Bewohner schien ihm mehr ein Roman der Einbildungskraft als ein Vorfall aus dem wirklichen Leben.
Er bemühte sich sie zu trösten, und sein Mitleid war zu innig, um verkannt zu werden. Ihre Furcht machte nach und nach den Regungen des Dankes und Schmerzens Platz.
»Ach,« sagte sie, »der Himmel hat Sie mir zur Hülfe gesandt, und gewiß wird er Sie belohnen: ich habe keinen Freund in der Welt, wenn ich ihn nicht in Ihnen finde.«
La Motte versicherte sie seines warmen Antheils, als der Eintritt des Mannes ihn unterbrach: er verlangte zu seiner Familie gebracht zu werden.
»Alles zu seiner Zeit,« hieß die Antwort: »ich habe für eine Person davon gesorgt, und werde es auch für Sie, so St. Petrus will. Seyn Sie nur ruhig.«
Diese beruhigenden Worte erneuerten La Mottens Schrecken, der nun inständigst flehte, ihm zu sagen, ob seine Familie in Sicherheit wäre?
»O, was das betrift, sicher genug, Sie werden sogleich bey ihr seyn: aber bringen Sie nicht die ganze Nacht mit Schwatzen zu. Erklären Sie sich, ob Sie gehen oder bleiben wollen. Sie wissen die Bedingungen.« —
Mit diesen Worten band man La Motten und das junge Frauenzimmer, welches die Angst stumm machte; setzte sie auf zwey Pferde, ein Mann hinter jeden, und sprengte in Galop davon. Sie waren beynahe eine halbe Stunde auf diese Weise fortgeritten, als La Motte zu wissen verlangte, wohin es ginge.
»Das werden Sie schon erfahren,« hieß es, »seyn Sie doch nur still!« —
Da La Motte alles Fragen unnütz fand, schwieg er, bis die Pferde still hielten. Sein Führer rief: Hallo! in einiger Entfernung antworteten Stimmen; nach wenig Augenblicken hörte er den Wagen rasseln, und gleich darauf einen Menschen, der Peter zurecht wies, welchen Weg er fahren sollte. Als der Wagen näher kam, rief La Motte, und erhielt, zu seiner unaussprechlichen Freude, Antwort von seiner Frau.
»Nun sind Sie über die Gränze der Haide, und können fahren, wohin Sie wollen,« sagte der Mann; »wenn Sie binnen einer Stunde zurückkehren, werden Sie mit ein paar Kugeln bewillkommt werden.«
Diese Warnung war höchst überflüßig für La Motte, den sie jetzt losbanden. Die junge Fremde seufzte tief, als sie in den Wagen stieg, und die Kerls, nachdem sie Petern noch einige Anweisungen gegeben und noch mehr Drohungen ausgestoßen hatten, warteten, um ihn abfahren zu sehen. — Man ließ sie nicht lange warten.
La Motte erzählte nun in aller Kürze, was ihm in dem Hause begegnet war, und auf welche Art man die Fremde zu ihm gebracht hatte. Während dieser Erzählung erregte ihr tiefes Schluchzen oftmahls die Aufmerksamkeit seiner Frau, die sich nach und nach zum Mitleid gegen sie gestimmt fühlte, und ihr Trost zuzusprechen suchte. Das unglückliche Mädchen beantwortete ihre liebreichen Zureden mit kunstlosen, einfachen Ausdrücken, und versank dann wieder in Thränen und Schweigen.
Frau von La Motte enthielt sich für jetzt aller Fragen, die zur Entdeckung ihrer Bekanntschaften leiten, oder eine Erläuterung der letzten Begebenheit fodern konnten, welche ihrem Nachdenken einen neuen Gegenstand darboth, und das Gefühl ihres eigenen Unglücks einigermaßen verminderte.
Selbst La Mottens Kummer verschwand auf eine Weile; er dachte über den letzten Vorfall nach, der ihm wie ein Traumgesicht, oder eine von den ausschweifenden Dichtungen eines Romans vorkam; er konnte keine Wahrscheinlichkeit hineinbringen, noch ihn auf irgend eine Weise erklären. Die gegenwärtige Last, die man ihm aufgebürdet hatte, und die Gefahr der Unannehmlichkeiten, die ihm noch in Zukunft daraus erwachsen konnten, verursachten ihm einige Unzufriedenheit, doch würkte Adelinens Schönheit und sichtliche Unschuld mit den Regungen der Menschlichkeit, die für sie sprach, zusammen, und er beschloß, sie zu beschützen.
Der Aufruhr in Adelinens Brust begann endlich sich zu legen. Schrecken milderte sich in Bekümmerniß, und Verzweiflung in Trauren. Die sichtliche Theilnahme ihrer Gefährten, besonders der Frau von La Motte, that ihrem Herzen wohl, und flößte ihre Hoffnung auf bessere Tage ein.
Traurig und schweigend verstrich die Nacht: die Seelen der Reisenden waren zu sehr beschäftigt mit ihrem mancherley Kummer, um Unterhaltung zuzulassen. Der so ängstlich ersehnte Morgen brach endlich an, und machte die Fremden einander näher bekannt. Adeline schöpfte Trost aus den Blicken der Frau von La Motte, die sie oft und aufmerksam ansah, und nicht leicht ein einnehmenderes Gesicht, eine schönere Figur gesehen zu haben glaubte. Das Schmachten des Kummers warf einen schwermüthigen Reiz über ihre Züge, der unmittelbar zum Herzen drang, und aus ihrem blauen Augen sprach eine durchdringende Sanftheit, die einen reinen liebenswürdigen Geist verrieth.
La Motte sah ängstlich aus dem Wagen, um über den Weg zu urtheilen und zu sehen; ob man ihn verfolgte. Die Dämmerung beschränkte seine Aussicht; er erblickte niemand. Endlich färbte die Sonne die östlichen Wolken und die Spitzen der höchsten Berge, und bald stand sie in vollem Glanz da. La Mottens Furcht verschwand und Adelinens Kummer milderte sich.
Sie kamen auf eine Wiese, die ein hohes, von Bäumen eingefaßtes Ufer umgrenzte, an deren Zweigen der Morgenthau die ersten grünen Knospen des Frühlings beglänzte. Die frische Morgenluft belebte Adelinen, deren Gefühl für alle Schönheiten der Natur aufs zarteste geöffnet war. Wenn sie die reiche Pracht des Rasens, das sanfte Grün der Bäume betrachtete, oder zwischen Öffnungen des Ufers die mannigfaltige Landschaft schimmern sah, deren dichte Wälder in fernen blauen Gebirgen verschwanden, klopfte ihr Herz von aufwallender Freude.
Neuheit erhöhte bey Adelinen den Reiz der Natur: sie hatte selten die Größe einer weiten Aussicht, die Pracht eines ausgebreiteten Horizonts, oder die mahlerischen Schönheiten eines beschränkten Amphitheaters gesehn. Ihre Seele hatte durch langen Druck die elastische Kraft nicht verloren, welche dem Ungemach widersteht; sonst würden bey aller Reizbarkeit ihrer Sinne die Schönheiten der Natur sie nicht mehr so leicht, auch nur in augenblickliche Ruhe, gewiegt haben.
Sie wanden sich endlich einen Hügel hinab, und La Motte, der sich wieder ängstlich umsah, erblickte ein offnes Feld, durch welches der Weg, beynahe ganz unbedeckt, in gerader Linie fortlief. Die Gefahr beunruhigte ihn, denn man konnte ohne Mühe viele Meilen weit von den Bergen, die er jetzt hinabfuhr, seiner Flucht nachsehn. Er erkundigte sich bey dem ersten Bauern, der ihnen begegnete, nach einem Wege zwischen den Bergen hin, hörte aber von keinem. Er versank in seine vorige Angst; seine Frau suchte, ungeachtet ihrer eignen Besorgnisse, ihn aufzurichten, da sie aber ihre Bemühungen unwirksam fand, überließ sie sich ebenfalls der Betrachtung ihres Schicksals. So wie sie weiter fuhren, sah La Motte nach der verlaßnen Gegend zurück, und oft wähnte er, Nachsetzer zu hören.
Die Reisenden hielten still, um in einem Dorfe zu frühstücken, wo endlich Waldungen den Weg bedeckten, und La Mottens Muth lebte wieder auf. Adeline schien ruhiger als sie noch gewesen war, und La Motte wagte es, sie um eine Erläuterung des Auftritts von vergangener Nacht zu bitten. Diese Frage erneute allen ihren Schmerz, und sie bat ihn mit Thränen, sie für jetzt mit allen Fragen über die Sache zu verschonen. La Motte drang nicht weiter in sie, bemerkte aber, daß sie fast den ganzen übrigen Tag in schwermüthigem Nachdenken zubrachte.
Sie fuhren jetzt zwischen Bergen hin, und waren folglich weniger in Gefahr, bemerket zu werden; doch vermied La Motte sorgfältig alle Städte, und hielt nur so lange, als für die Pferde nöthig war, in abgelegenen Dörfern still. Nachmittags ging der Weg länger als zwey Stunden durch ein tiefes Thal, das von einem Bach durchwässert, und von Gesträuch überschattet wurde.
La Motte hieß Peter nach einem dick bewachsenen Orte zufahren, der zur Seite lag. Hier stieg er mit seiner Familie aus; Peter mußte ihren Mundvorrath auf dem Rasen ausbreiten; sie setzten sich und genossen ein Mahl, das ihnen unter andern Umständen gewiß köstlich geschmeckt hätte.
Adeline zwang sich zu lächeln, allein ihr Ausdruck des Schmerzes wurde jetzt durch Unpäßlichkeit erhöht. Die heftige Seelenerschütterung und körperliche Ermüdung, die sie seit den letzten vier und zwanzig Stunden erlitten, hatte ihre Kräfte erschöpft, und als La Motte sie wieder zum Wagen führte, zitterte sie am ganzen Körper: doch ließ sie keine Klage verlauten, sondern bemühte sich vielmehr, so viel sie konnte, die Niedergeschlagenheit ihrer Reisegefährten zu zerstreuen.
Sie setzten den Tag über die Reise ohne allen Zufall oder Unterbrechung fort, und langten ungefähr drey Stunden nach Sonnenuntergang in Monville an; eine kleine Stadt, wo La Motte zu übernachten dachte. Ruhe war in der That der ganzen Gesellschaft nothwendig, deren blasses, verstörtes Aussehen nur zu auffallend war, um nicht von den Wirthsleuten bemerkt zu werden.
Sobald die Betten bereit waren, begab sich Adeline in ihr Schlafzimmer, wohin Frau von La Motte sie begleitete, welcher Bekümmerniß für die schöne Fremde jedes Bemühn, sie zu trösten und aufzurichten, eingab. Adeline vergoß jetzt nicht mehr Thränen des Schmerzes allein; sie vermischten sich mit denen, welche aus dem dankbaren Herzen fließen, wenn es unerwartete Theilnahme findet. Frau von La Motte verstand sie — nach einigen Augenblicken des Schweigens erneute sie ihre freundlichen Tröstungen und bat Adelinen, ihrer Freundschaft zu vertrauen; doch vermied sie sorgfältig, den Gegenstand zu berühren, der sie zuvor so sehr erschüttert hatte. Adeline fand endlich Worte, ihr Gefühl dieser Güte auszudrücken, und that es auf so offne, natürliche Art, daß Frau von La Motte innigst gerührt ihr gute Nacht sagte.
Ungeduldig, seine Reise fortzusetzen, stand La Motte des andern Morgens in aller Frühe auf. Alles war bereit, das Frühstück hatte schon eine Weile gestanden, aber Adeline ließ sich nicht sehn. Frau von La Motte ging in ihr Zimmer und fand sie in unruhigem Schlummer. Ihr Athem war kurz und unordentlich, sie fuhr oftmahls auf, oder seufzte und lallte unzusammenhängende Worte.
Während Madame mit Bekümmerniß ihre erschlafften Züge betrachtete, erwachte sie, sah auf, und reichte ihr die Hand, die von Fieberhitze brannte. Sie hatte eine unruhige Nacht gehabt, und als sie aufstehn wollte, wurde ihr Kopf, der unerträglich schmerzte, zu schwer; ihre Kräfte verließen sie, und sie sank zurück.
Frau von La Motte gerieth in die äusserste Unruhe; sie sah zugleich, daß es für Adelinen unmöglich war, weiter zu reisen, und daß eine Verzögerung ihrem Manne gefährlich seyn konnte. Sie ging zu ihm, und sein Unmuth läßt sich besser denken als beschreiben. Er sah alle Unannehmlichkeit und Gefahr eines Aufschubs, und doch konnte er sich nicht so ganz von aller Menschlichkeit entblössen, Adelinen der Sorge, oder vielmehr der Vernachlässigung von Fremden zu überlassen. Er ließ sogleich einen Arzt hohlen, und dieser erklärte, daß sie ein heftiges Fieber hätte, und ohne äusserste Gefahr nicht von der Stelle könnte.
La Motte entschloß sich nunmehr, den Ausgang abzuwarten, und suchte die Regungen der Angst zu unterdrücken, die ihn nur zu oft befielen. Indessen nahm er alle Vorsicht, die seine Lage zuließ, und brachte den größten Theil des Tages ausser dem Dorfe an einem Orte zu, von wo er den Weg bis in einige Entfernung übersehen konnte. Durch die Krankheit eines ihm unbekannten, ja ihm recht eigentlich aufgedrungenen Mädchens sich der höchsten Gefahr aussehen zu müssen, war auf alle Weise ein Unfall, welchen mit Fassung zu ertragen, La Motte nicht Philosophie genug besaß.
Adelinens Fieber stieg den Tag über, und Abends, als der Arzt fort ging, sagte er zu La Motte, der Ausgang müßte sich bald entscheiden. La Motte hörte diesen Wink ihrer Gefahr mit natürlicher Bekümmerniß an. Adelinens Schönheit und Unschuld hatten unwillkührlich über die ungünstigen Umstände, welche sie ihm zuführten, gesiegt, und er beschäftigte sich jetzt weniger mit der Last, die sie ihm in der Folge verursachen konnte, als mit der Hoffnung auf ihre Genesung.
Frau von La Motte bewachte sie mit zärtlicher Sorgfalt, und sah mit Bewunderung ihr stilles Dulden und ihre sanfte Ergebung. Adeline belohnte sie reichlich, so unvermögend sie sich auch glaubte.
»So jung ich auch bin,« sagte sie, »und verlassen von denjenigen, auf deren Schutz ich berechtigt wäre, weiß ich doch keine Bekanntschaft, die mir das Leben so wünschenswerth macht, als die, welche ich mit Ihnen zu knüpfen hoffe. Wenn ich genese, so wird mein Betragen am besten von meiner Dankbarkeit für Ihre Güte zeugen — Worte sind nur schwache Beweise.«
Ihr sanftes Wesen nahm die Frau von La Motte so sehr ein, daß sie die Crisis ihrer Krankheit mit einer Ängstlichkeit erwartete, welche alle andere Rücksichten ausschloß. Adeline brachte eine sehr unruhige Nacht zu, und als der Arzt des andern Morgens erschien, erlaubte er, ihr alles zu geben, was sie nur verlangte, und beantwortete La Mottens Fragen mit einer Freymüthigkeit, die keine Hoffnung übrig ließ.
Indessen fiel die Kranke, nach einigen kühlenden Tränken, in einen Schlaf, der mehrere Stunden anhielt, und so fest war, daß der Athem allein ihr Leben verrieth. Sie erwachte frey vom Fieber, und ohne alle Krankheit, außer einer Schwäche, die sie aber nach wenig Tagen so gut überstand, daß sie mit La Motte nach B— fahren konnte, einem Dorfe, das außer der Landstrasse lag, die er zu verlassen für rathsam hielt.
Hier brachten sie die Nacht zu, und setzten des Morgens in aller Frühe ihre Reise durch einen wüsten, waldichten Strich Landes fort. Um Mittag hielten sie in einem einsamen Dorfe still, wo sie eine Mahlzeit zu sich nahmen und sich Anweisung geben ließen, um den großen Fontaneiller Wald zu passiren, an dessen Rande sie sich jetzt befanden. La Motte wollte anfangs einen Wegweiser nehmen, allein er fürchtete mehr Nachtheil von der Kundschaft seines Weges, als er sich Nutzen von einem Geleitsmann in den Wildnissen dieses unbebaueten Erdstrichs versprach.
Er dachte jetzt nach Lyon zu gehn, wo er entweder in der Nachbarschaft sich verbergen, oder die Rhone hinauf nach Genf fahren wollte, wenn seine Umstände es in der Folge nöthig machten, Frankreich zu verlassen. Es war ungefähr zwölf Uhr Mittags und er eilte weiter, um wo möglich vor Einbruch der Nacht durch den Wald zu kommen und die Stadt jenseits zu erreichen. Nachdem sie sich mit frischem Proviant versehen und die nöthigen Erkundigungen eingezogen hatten, machten sie sich wieder auf und gelangten bald in den Wald.
Es war im Ende Aprils, und das Wetter ungewöhnlich schön. Die balsamische Frische der Luft, vom ersten reinen Duft der Kräuter geschwängert, und die milde Wärme der Sonne, deren Strahlen jeden Hauch der Natur belebten und jede Blühte des Frühlings öffneten, flößten Adelinen neues Leben und Gesundheit ein. Mit der Luft, die sie einathmete, schienen ihre Kräfte wiederzukehren, und wenn ihre Augen auf den romantischen Aussichten verweilten, welchen der Wald sich öffnete, schwoll ihr Herz von süßem Wohlgefühl: allein wenn sie ihren Blick von diesen Gegenständen ab, auf Herrn und Frau von La Motte wandte, deren zärtliche Sorgfalt sie ihr Leben verdankte, und auf deren Gesicht sie Wohlwollen und Liebe las, so glühte ihre Brust von süßen Regungen, und sie empfand die höchste Gewalt der Dankbarkeit.
Sie reisten den Tag über fort, ohne nur eine Hütte, oder ein menschliches Wesen zu sehn. Es war nahe vor Sonnenuntergang, der Wald schloß von allen Seiten die Aussicht ein, und La Motte fing an zu fürchten, daß sein Bedienter den Weg verfehlt hätte. Der Weg, wenn man anders eine leichte Spur auf dem Grase so heißen konnte, war bald von üppigen Gesträuch überwachsen, bald von tiefen Schatten verdunkelt, und Peter hielt endlich still, weil er des Wegs ungewiß war. La Motte, der in einem so wüsten einsamen Aufenthalt von der Nacht überfallen zu werden scheute, und sich lebhaft vor Räubern fürchtete, hieß ihn auf alle Weise weiter fahren, und wenn er keine Spur fände, einen offnern Theil des Waldes suchen.
Mit diesem Befehl fuhr Peter wieder fort, nachdem er aber eine kleine Strecke zurück gelegt hatte, und sich noch immer von Aussichten und Fußwegen im Walde eingeschlossen sah, ließ er den Muth sinken und hielt aufs neue still. Die Sonne war jetzt untergegangen, allein La Motte sah aus dem Fenster bey dem hellen Schimmer des westlichen Horizonts, einige dunkle Thürme in kleiner Entfernung zwischen den Bäumen empor steigen, und befahl Peter, darauf zuzufahren.
»Wenn sie zu einem Kloster gehören,« sagte er, »so können wir Aufnahme für die Nacht hoffen.«
Der Wagen fuhr unter den Schatten melancholischer Buchen hin, über welche die Abendröthe, welche noch die Luft färbte, eine Feyer ausgoß, die in den Herzen der Reisenden stillen Schauer erregte. Erwartung hielt sie schweigend. In Adelinen erwachte die Erinnerung an die letzten schrecklichen Ereignisse, und ihre Seele nahm nur zu leicht die Ahndung neuen Unglücks auf.
La Motte stieg am Fuße eines grünen Hügels aus, wo die Bäume sich dem Licht öffneten, und eine nähere, wiewohl unvollkommene, Aussicht auf das Gebäude zuließen.
Er ging näher hinzu und entdeckte die gothischen Überreste einer alten Abtey: sie stand auf einem grünen Platze, den hohe Bäume beschatteten, welche mit dem Gebäude gleichzeitig schienen, und eine romantische Dunkelheit verbreiteten. Der größere Theil der Mauern schien in Ruinen zu verfallen, und die, welche der Verheerung der Zeit widerstanden hatten, gaben den verfallenen Überresten ein noch schauerliches Ansehn.
Die hohen Zinnen, dick mit Epheu umschlungen, waren halb verwüstet und der Aufenthalt von Raubvögeln geworden. Große Massen von dem östlichen, fast ganz verfallnen Thurme lagen zerschmettert im hohen Grase, das langsam in die Lüfte wehte. Ein gothisches Thor, reich mit ausgehauener Arbeit verziert, das zum Hauptflügel des Gebäudes führte, aber mit Strauchwerk verwachsen war, stand noch unversehrt. Über der weiten, prächtigen Wölbung dieses Thors stieg ein Fenster von derselben Bauart empor, in dessen Flügeln man noch Fragmente gemahlten Glases sah, einst der Stolz mönchischer Frömmigkeit.
La Motte, der es für möglich hielt, daß noch ein menschliches Wesen sich hier aufhalten könnte, trat zum Thore und hub einen schweren Klopfer auf. Der hohle Schall lief durch den leeren Platz. Er wartete einige Minuten und zwang dann das Thor zurück, das von Eisen schwer war und mit schrecklichem Getöse knarrte.
Er trat in einen Ort, der die Kapelle der Abtey gewesen zu seyn schien, wo einst die Hymne der Andacht empor stieg, und die Thräne der Buße vergossen ward: Töne, welche nur die Einbildungskraft wieder hervor rufen konnte; Thränen, die längst in der Wage des Richters gewogen waren.
La Motte stand einen Augenblick still: er fühlte einen gewissen Schauder, einen Mittelzustand zwischen Staunen und Ehrfurcht! Er übersah den weiten Raum, und indem er die verfallne Pracht betrachtete, trug die Fantasie ihn in verfloßne Zeiten zurück —
»Und diese Mauern,« sagte er, zittern jetzt über den Gebeinen der sterblichen Wesen, welche sie bewohnten!«
Die zunehmende Dunkelheit erinnerte La Motten, daß er keine Zeit zu verlieren hatte: allein Neugier drängte ihn vorwärts und er gehorchte ihrem Antriebe. So wie er über das gesunkne Pflaster ging, hallten seine Schritte durch das Gebäude wieder, und schienen gleich den mystischen Tönen der Todten dem frechen Sterblichen Vorwürfe zu machen, der ihren Umkreis zu betreten wagte.
Aus dieser Kapelle trat er in die große Kirche, in welcher ein Fenster, vollständiger als die andern, auf eine lange Vista des Waldes stieß, und die reiche Farbe des Abends zeigte, die unmerklich in die feyerliche Dunkelheit der höhern Luft hinwegschmolz. Dunkle Berge, deren Umriß deutlich im lebhaften Schimmer des Horizonts hervor ragten, schlossen die Aussicht. Verschiedne Pfeiler, die einst die Decke unterstützten, standen noch als stolze Denkmähler sinkender Größe, und schienen bey jedem Brausen des Windes zwischen den herabgefallnen Brüchstücken, die vor ihnen lagen, zu nicken. —
La Motte seufzte. Die Vergleichung zwischen ihm und dem allmähligen Verfall, wovon diese Säulen zeugten, drang sich ihm zu mächtig auf.
»Noch wenig Jahre,« sprach er, »und ich werde seyn, wie die Sterblichen, deren Überreste ich jetzt anstaune, und gleich ihnen zum Stoff des Nachdenkens für eine künftige Generation dienen, die ebenfalls nur kurze Zeit über dem Gegenstande ihrer Betrachtung hinschwanken wird, ehe auch sie in den Staub sinkt.«
Er riß sich von diesem Aufenthalt los, und ging durch die Kreuzgänge, bis eine Thüre, die mit einem hohen Theile des Gebäudes zusammen hing, seine Aufmerksamkeit anzog. Er öffnete sie und nahm quer vor einer Treppe vorbey, noch eine Thüre wahr; allein theils durch Furcht, theils durch die Betrachtung, wie sehr seine Abwesenheit seine Familie befremden mußte, zurück gehalten, kehrte er mit schnellen Schritten zu seinem Wagen zurück, und warf sich vor, einige kostbare Augenblicke der Dämmerung unnütz verschwendet zu haben.
Einige kurze Antworten auf die Fragen seiner Frau, und ein allgemeiner Befehl an Peter, sorgsam weiter zu fahren und sich nach einem Wege umzusehn, war alles, was seine Ängstlichkeit ihm zu sprechen erlaubte. Die Schatten der Nacht fielen dicht herab, durch die Dunkelheit des Waldes vertieft, und machten es bald gefährlich, den Weg weiter fortzusetzen.
Peter hielt, allein La Motte, der fest auf seinem ersten Entschlusse beharrte, befahl ihm zuzufahren. Peter wagte es, ihm Vorstellungen zu machen, Frau von La Motte bat, allein La Motte zankte — befahl und bereute zu spät: das hintere Wagenrad ging über den Stumpf eines alten Baums, den Peter bey der Dunkelheit nicht hatte sehen können, und der Wagen fiel in dem nähmlichen Augenblick um.
Die Gesellschaft gerieth, wie sich denken läßt, in äußersten Schrecken, doch war keiner wesentlich beschädigt, und sobald sie sich aus ihrer gefährlichen Lage aufgeholfen hatten, bemühten sich La Motte und Peter, den Wagen aufzuheben. Jetzt erst sahen sie den ganzen Umfang ihres Unglücks, das Wagenrad war gebrochen! Ihr Elend war groß, denn die Kutsche konnte eben so wenig weiter fahren, als ihnen eine Zuflucht vor dem kalten Nachtthau gewähren, weil es unmöglich war, sie in eine aufrechte Lage zu bringen.
Nach einigen Augenblicken des Stillschweigens, schlug La Motte vor, zu den Ruinen, von denen sie nicht weit entfernt waren, zurückzukehren, und die Nacht in dem wohnbarsten Theile des Gebäudes zuzubringen: sobald der Morgen anbräche, sollte Peter eins von den Kutschpferden nehmen, und einen Weg und eine Stadt suchen, wo er Leute bekommen könnte, um den Wagen wieder in Stand zu setzen.
Frau von La Motte widersetzte sich diesem Vorschlage: sie schauderte vor dem Gedanken, so viele Stunden im Finstern an einem so verödeten Orte zuzubringen. Schrecknisse, welche sie weder zu untersuchen noch zu bekämpfen sich Mühe gab, überwältigten sie, und sie sagte ihrem Manne, daß sie lieber in dem ungesunden Thau die Nacht über bleiben, als sich den verlaßnen Ruinen anvertrauen wollte.
La Motte hatte anfangs eine gleiche Abneigung gefühlt, wieder dahin zurückzukehren; nachdem er aber sein eignes Gefühl überwunden hatte, wollte er keinem andern nachgeben. Die Pferde wurden ausgespannt und die Gesellschaft machte sich nach dem Gebäude auf. Peter, der ihnen folgte, schlug Feuer an, und sie betraten die Ruinen unter Erleuchtung von dürren Stäben, die er zusammen gesucht hatte.
Der Schimmer, der nur auf einige Theile des Gebäudes fiel, schien die Verödung nur noch schauerlicher zu machen, während die Dunkelheit der größern Masse das Feyerliche erhöhte; und die Fantasie mit Schreckbildern erfüllte. Adeline, die bis jetzt geschwiegen hatte, stieß einen Ausruf der Furcht und Bewunderung aus. Ein nicht unangenehmer Schauder durchdrang sie: Thränen traten in ihre Augen — sie wünschte und fürchtete weiter zu gehn, sie hing sich an La Mottens Arm und sah ihn mit einem furchtsam fragenden Blicke an.
Er öffnete die Thüre der großen Halle und sie traten hinein: der weite Umfang verlor sich in Dunkelheit.
»Laßt uns hier bleiben,« sagte Frau von La Motte, »ich mag nicht weiter gehn.«
La Motte zeigte auf die eingefallne Decke und ging vorwärts, als ein ungewöhnliches Geräusch längs der Halle ihn stutzig machte. Alle schwiegen — es war das Schweigen des Schreckens.
Frau von La Motte sprach zuerst:
»Laßt uns diesen Ort verlassen; alles Ungemach ist der Empfindung, die mich hier niederdrückt, vorzuziehen. Laßt uns ohne Verzug zurückgehn!«
Es herrschte wieder eine ununterbrochne Stille, und La Motte, der sich seiner unwillkürlich verrathnen Furcht schämte, fand für gut, einen Muth zu erkünsteln, den er wirklich nicht besaß. Er verspottete die Angst seiner Frau, und bestand darauf weiter zu gehn. Sie mußte einwilligen, und ging mit zitternden Schritten durch die Halle. Sie kamen an einen schmalen Gang, und da Peters Holz beynahe aufgebrannt war, warteten sie hier, bis er mehr gehohlt hatte.
Das fast verlöschende Licht fiel schwach auf die Wände des Gangs und machte den Aufenthalt noch schrecklicher. Mitten durch die Halle, deren größre Hälfte im Schatten lag, verbreitete der schwache Strahl einen bleichen Schimmer, der die Spalten in der Decke zeigte, während viele Gegenstände in der Dämmerung nur unvollkommen sichtbar waren.
Adeline fragte La Motten lächelnd, ob er an Geister glaubte? Die Frage war etwas unzeitig, denn der jetzige Aufenthalt erfüllte ihn mit seinen Schrecknissen, und Trotz alles Strebens fühlte er eine abergläubige Furcht sich seiner bemeistern. Vielleicht stand er in diesem Augenblick auf der Asche von Todten! Wenn es jemahls Geistern erlaubt würde, die Erde wieder zu besuchen, so schien dieß die Stunde und der Ort ihrer Erscheinung zu seyn. La Motte schwieg. —
»Wäre ich zum Aberglauben geneigt,« fuhr Adeline fort — als die Wiederkehr des schon gehörten Geräusches sie unterbrach: es ertönte längs dem Gange, an dessen Eingang sie standen, und sank allmählig hinweg. Jedes Herz klopfte, und sie horchten schweigend.
Eine neue Besorgniß stieg in La Motte auf — dieß Geräusch konnte von Räubern herrühren, und stand an, ob es rathsam seyn könnte, weiter zu gehn.
Peter kam mit Licht; Frau von La Motte weigerte sich, den Gang zu betreten; La Motte selbst fühlte sich nicht sehr dazu geneigt; allein Peter, bey dem Neugier stärker war als Furcht, both bereitwillig seine Dienste an. La Motte ließ, nach einigem Besinnen, ihn gehn, und wartete am Eingang den Erfolg seines Forschens ab.
Der weite Weg entzog Petern bald seinem Blick, und der Wiederhall seiner Fußtritte verlor sich in einem Geräusch, das den Gang hinab tönte und immer schwächer und schwächer ward, bis es zuletzt sich ganz verlor. La Motte rief ihn jetzt mit lauter Stimme, erhielt aber keine Antwort; endlich hörten sie in der Ferne einen Fußtritt, und bald darauf erschien Peter, athemlos und bleich vor Entsetzen.
Sobald er nahe genug war, um von seinem Herrn gehört zu werden, rief er laut:
»Gott sey Dank, Ihro Gnaden, ich habe sie zu Boden geschlagen, aber meiner Seel, es war ein harter Strauß. Es war nicht anders, als föchte ich mit dem Teufel.« —
»Von wem sprichst du denn?« fragte sein Herr.
»Am Ende war es nichts als Eulen und Krähen, aber bey dem Licht flogen sie mir alle an den Kopf, und machten so ein verteufeltes Spektakel mit ihren Flügeln, daß ich anfangs glaubte, ich hätte es mit einer Legion Teufel zu thun. Allein ich habe sie alle heraus gejagt, gnädiger Herr, und Sie haben nun nichts mehr zu fürchten.«
Diese letzten Worte, die einen Verdacht in seinen Muth zu enthalten schienen, hätte La Motte entbehren können: um aber seinen gewissermaßen verscherzten Ruf der Herzhaftigkeit wieder herzustellen, setzte er sich vor, durch den Gang zu gehn. Sie gingen jetzt mit schnellen Schritten fort: wie Peter sagte, »sie hätten nichts mehr zu fürchten.«
Der Gang führte auf einen großen freyen Platz, an dessen einer Seite, über eine Reihe Kreuzgänge hin, der westliche Thurm und ein hoher Theil des Gebäudes hervorragte; die andere Seite lag dem Walde offen. La Motte nahm seinen Weg nach einer Thüre des Thurms, den er nunmehr für denselben erkannte, durch welchen er das erstemahl hereingekommen war; allein er fand es beschwerlich, weiter zu dringen, weil der Platz mit Brombeersträuchern und Nesseln verwachsen war, und Peters Licht nur einen unsichern Schein verbreitete.
Als er die Thüre öffnete, erneute der traurige Anblick des Orts Frau von La Mottens Ängstlichkeit und preßte Adelinen die Frage ab, wohin sie gingen? Peter hielt das Licht in die Höhe, um ihnen die schmale Treppe zu zeigen, die sich den Thurm hinaufwand; allein La Motte, der die zweyte Thür entdeckte, schob die verrosteten Riegel zurück, und trat in ein geräumiges Zimmer, das nach seiner Anlage und Verfassung sichtlich weit später erbaut war, als der andre Theil des Gebäudes. Wiewohl öde und leer, hatte es doch wenig von der Zeit gelitten; die Mauern waren feucht, aber nicht verfallen, und die Scheiben noch fest in den Fenstern.
Sie gingen durch eine Reihe Zimmer, die dem ersten glichen, und bezeugten ihre Verwunderung über das widersprechende Ansehen dieser Gemächer mit den zerfallnen Mauern, die sie hinter sich gelassen hatten. Sie führten zu einem gewundnen Gange, in welchen durch kleine, hoch in der Mauer eingehaune Löcher, Licht und Luft fiel, und den endlich eine mit Eisen beschlagne Thüre schloß; sie öfneten sie mit Mühe und traten in ein gewölbtes Zimmer. La Motte übersah es mit forschendem Auge und konnte nicht errathen, warum es durch eine so starke Thüre verwahrt war; allein er sah wenig, um seine Neugier zu befriedigen. Das Zimmer schien in neuern Zeiten nach einem Gothischen Plan erbaut zu seyn.
Adeline näherte sich einem großen Fenster, das eine Art von Vertiefung bildete, und um eine Stuffe höher war als der übrige Fußboden: sie zeigte La Motten, daß der ganze Fußboden mit mosaischer Arbeit eingelegt war, welches ihn zu der Bemerkung veranlaßte, daß dies Zimmer nicht ganz im Gothischen Geschmack gebaut sey. Er ging zu einer Thüre an der andern Seite des Zimmers, und nachdem er sie geöfnet hatte, fand er sich in der großen Halle, durch die er herein gekommen war.
Er sah jetzt, was die Dunkelheit ihn zuvor wahrzunehmen verhindert hatte, eine Wendeltreppe, die zu einem obern Gang führte, und nach ihrer Beschaffenheit zu urtheilen, mit dem neuern Theil des Gebäudes zugleich erbaut war, wiewohl man ihr ebenfalls ein Gothisches Ansehen zu geben gesucht hatte. La Motte zweifelte nicht, daß diese Treppe zu Zimmern führte, die den untern gleich wären, und war unschlüssig, ob er sie durchsuchen sollte: allein die Bitten seiner höchst ermüdeten Frau bewegten ihn, von aller weitern Untersuchung abzustehn. Nach einigem Berathschlagen, in welchem Zimmer sie die Nacht zubringen wollten, beschlossen sie, wieder in das, welches an den Thurm stieß, zurückzukehren.
Sie machten ein Feuer auf einem Kamin, der wahrscheinlich seit vielen Jahren keine gastfreye Wärme ertheilt hatte; Peter setzte ihnen den aus der Kutsche geholten Vorrath hin, und La Motte und seine Familie lagerten sich um das Feuer und genossen ein Mahl, das der Hunger ihnen würzte.
Ihre Furcht verschwand allmählig: denn sie sahen sich nunmehr in einem Aufenthalt, der einer menschlichen Wohnung glich, und hatten Muße, über ihr erstes Schrecken zu lachen; allein so oft der Wind die Thüre erschütterte, fuhr Adeline auf und sah sich furchtsam um. Sie sprachen und scherzten eine Weile fort, doch war ihre Fröhlichkeit, wo nicht erkünstelt, doch vorübergehend: denn das Bewußtseyn ihrer unangenehmen, höchst bedenklichen Lage drang sich zu mächtig auf und versenkte jeden in Traurigkeit und tiefsinniges Schweigen.
Adeline fühlte in aller Kraft ihren verlaßnen Zustand; sie dachte mit Staunen an das Vergangne, und sah mit furchtvollem Ahnden in die Zukunft. Sie fand sich durchaus abhängig von Fremden, an welche sie keinen andern Anspruch hatte, als was allgemeine Menschenliebe der Noth verwandter Geschöpfe gibt. Seufzer schwellten ihre Brust, und oft drängte sich eine Thräne in ihr Auge; allein sie preßte sie zurück, ehe sie auf ihrer Wange die Bekümmerniß verrieth, welche zu zeigen ihr undankbar däuchte.
La Motte brach endlich dieß tiefsinnige Schweigen, und gab Befehl, das Feuer auf die Nacht frisch anzumachen und die Thüre zu verwahren. Diese Vorsicht schien selbst in dieser Einöde nicht überflüssig, und wurde durch große Steine, die man gegen die Thüre aufthürmte bewirkt; keine andern Mittel zur Befestigung waren vorhanden.
Es war La Motten oft eingefallen, das dieß dem Anschein nach verlaßne Gebäude gar wohl ein Aufenthalt von Räubern seyn könnte. Sie fanden hier Einsamkeit, sich zu verbergen, und einen wilden, weit umfassenden Wald, der ihren räuberischen Absichten beförderlich seyn, und in seinen Krümmungen diejenigen irre leiten konnte, die kühn genug waren, sie hier zu verfolgen. Doch verbarg er diese Gedanken, um seinen Gefährten nicht neue Unruhe zu machen.
Peter mußte an der Thüre wachen, und nachdem sie das Feuer so gut als möglich zurecht geschürt hatten, legte sich die verlaßne Gesellschaft rings umher, und suchte im Schlaf kurze Vergessenheit ihres Kummers.
Die Nacht verstrich ungestört. Adeline schlief, aber unruhige Träume schwebten von ihrer Fantasie und sie erwachte frühzeitig: die Erinnerung an ihren Kummer bemächtigte sich ihrer; sie konnte jetzt diesem Gefühle nachhängen und ihre Thränen flossen reichlich. Um ihnen ungestörten Lauf zu lassen, trat sie in ein Fenster, das auf eine Öfnung des Waldes stieß: alles war dunkel und still; sie stand eine Weile und betrachtete die beschattete Gegend.
Der erste zarte Hauch des Morgens schimmerte am Rande des Horizonts und brach durch die Dunkelheit — so rein, schön und mild! Der Himmel schien sich der Aussicht zu öfnen. Die trüben Nebel rollten nach Westen zu, so wie die Beleuchtung sich verstärkte, verdunkelten jene Gegend der Hemisphäre und hüllten die tiefere Landschaft ein, während im Osten die Farben heller wurden und einen zitternden Schimmer rings um verbreiteten, bis ein gelber Glanz, der jene Gegend des Himmels befeuerte, der Verkündiger der aufsteigenden Sonne war.
Zuerst ging ein kleiner Streif mit unbeschreiblichem Glanz aus dem Horizont hervor, der sich schnell verbreitete, und die Sonne in aller Strahlenpracht zeigte, wie sie das ganze Antlitz der Natur entschleierte, jede Farbe der Landschaft belebte, und die bethauete Erde funkeln machte von schimmernden Edelstein. Der leise, sanfte Gesang der Vögel, durch die Morgenstrahlen erweckt, unterbrach das Schweigen der Stunde; ihr süßes Wirbeln stieg allmählig, bis sie den Chor allgemeiner Fröhlichkeit anstimmten. Auch Adelinens Herz schwoll von dankbarer Weihe!
Die Scene vor ihr, sänftigte ihren Kummer und trug ihre Gedanken empor zu dem großen Urheber der Schöpfung: unwillkührlich wurden sie zu Gebeth:
»Vater des Guten,« sprach sie, »der du diese Pracht schufest, ich ergebe mich in deine Hände, du wirst mich nicht sinken lassen in meinem Ungemach, und mich vor künftigem Übel schützen.«
So auf die Liebe ihres Gottes vertrauend, trocknete sie die Thränen von ihren Augen, und der süße Einklang ihres Gewissens und ihrer Betrachtung, belohnte ihre Zuversicht; ihre Seele fühlte sich befreyt von den Empfindungen, die sie niederdrückten, und sie ward ruhig und gefaßt.
La Motte erwachte bald nachher und Peter schickte sich zu seinem Zuge an. So wie er sein Pferd bestieg, sagte er zu seinem Herrn:
»Nichts für ungut, Ihro Gnaden, allein meinem Bedünken nach, thäten wir eben so gut, uns nicht weiter nach einem andern Aufenthalt umzusehn, bis bessere Zeiten kommen. Wenn man diesen Ort bey Tageslicht sieht, so scheint er nicht so übel, daß man ihn nicht mit leichter Mühe ganz bequem zum Wohnen machen könnte.«
La Motte antwortete nicht, allein er dachte über Peters Worte nach. In den Zwischenräumen der Nacht, wo Sorgen ihn nicht schlafen ließen, war ihm der nähmliche Gedanke beygefallen. Verbergung war seine einzige Sicherheit, und dieser Ort gewährte sie ihm. Die gänzliche Entlegenheit war ihm freylich zuwieder, allein er hatte einmahl nur unter Übeln zu wählen — ein Wald mit Freyheit war kein verwerflicher Aufenthalt für einen, der nur zu viel Ursache hatte, ein Gefängniß zu erwarten.
Als er die Zimmer aufmerksamer betrachtete, fand er, daß sie leicht wohnbar zu machen wären, und da er sie jetzt unter der Erheitrung des Morgens sah, wurde er in seinem Vorsatz bestärket. Er sann über die Mittel nach, ihn auszuführen, und nichts stand ihm im Wege, als die anscheinende Schwierigkeit, Lebensmittel zu bekommen.
Er eröfnete seinen Plan seiner Frau, die sich äußerst abgeneigt dagegen fühlte. Indessen pflegte La Motte sie selten um Rath zu fragen, ohne vorher beschlossen zu haben, wie er verfahren wollte, und er hatte sich bereits vorgenommen, es auf Peters Bericht ankommen zu lassen: wenn dieser eine Stadt in der Nachbarschaft des Waldes ausfindig machte, wo man Lebensmittel und andere Bedürfnisse haben könnte, so wollte er sich nicht weiter nach einem Ruheorte umsehn.
In Peters Abwesenheit, dessen Rückkunft er mit Ungeduld erwartete, beschäftigte er sich, die Ruinen zu untersuchen und in der Gegend umher zu gehn: sie war romantisch schön und die dicke Waldung schien diesen Fleck von der übrigen Welt abzusondern. Oft zeigte eine natürliche Vista eine Aussicht auf das Land, begrenzt von Bergen, die sich in die Ferne zurückzogen und im blauen Horizont verloren. Ein Bach, der in mannigfaltigen Krümmungen sonorisch strömte, wand sich um den Fuß des freyen Platzes, auf welchem die Abtey stand: hier glitt er sanft zwischen den Schatten hin, und verbreitete frische Kühlung: dort breitete er sich in größerer Fläche dem Tage entgegen und gab spiegelnd das Gebüsch und das Wild, das seine Wellen trank, zurück. La Motte bemerkte allenthalben Wild in Menge; die Fasanen flohen kaum vor seiner Annäherung und die jungen Rehe starrten ihm gutmüthig ins Gesicht, wenn er vorüber ging — sie kannten die Menschen nicht!
Als er wieder in die Abtey zurückkam, stieg er die Treppe hinauf, die in den Thurm führte. Ohngefähr halben Wegs nahm er eine Thür in der Mauer wahr: sie wich ohne Widerstand, allein ein plötzliches Geräusch von innen, dem eine Staubwolke folgte, machte, daß er zurück fuhr und die Thüre anzog. Nach einigen Minuten öfnete er sie wieder, und entdeckte ein großes Zimmer von dem neuern Gebäude. Fragmente von Tapeten hiengen um die Mauern und waren der Aufenthalt von Raubvögeln geworden, deren plötzliche Flucht bey Eröfnung der Thüre die Staubwolke hervorgebracht und das Geräusch erregt hatte. Die Fenster waren zerbrochen und beynahe ohne Scheiben, allein zu seiner Verwunderung sah er einige Überreste von Möbeln; Stühle, deren Form und Zustand die Zeit ihrer Herkunft verrieth; einen zerbrochnen Tisch und ein eisernes Feuerbecken, das vom Rost fast ganz verzehrt war.
An der andern Seite befand sich eine Thüre, die in ein Zimmer führte, welches wie das erste gebaut, aber mit nicht ganz so zerlumpten Tapeten behangen war. In einer Ecke stand eine kleine Bettstelle; und einige gebrechliche Stühle standen an der Wand. La Motte betrachtete diese Dinge mit Verwunderung und Neugier.
»Seltsam,« sagte er, »daß diese Zimmer, und diese allein, Spuren von Bewohnung verrathen: vielleicht daß ein elender Wanderer, wie ich, hier Zuflucht vor einer verfolgenden Welt gesucht, und vielleicht die Last eines beschwerlichen Daseyns hier niedergelegt hat: vielleicht bin ich nur seinen Fußtritten gefolgt, um meinen Staub mit dem seinigen zu vermischen!«
Er drehte sich schnell um, und wollte das Zimmer verlassen, als er nahe beym Bett eine Thür wahrnahm: sie führte in ein Kabinet, welches von einem schmalen Fenster Licht erhielt, und eben so beschaffen war als die andern Zimmer, nur daß auch nicht einmahl Überreste von Möbeln darin befindlich waren. Es kam ihm vor, als wenn eine Stelle des Fußbodens unter seinen Füßen schwankte; er untersuchte sie und fand eine Fallthüre. Neugier trieb ihn an, weiter zu suchen, und mit einiger Mühe gelang es ihm, sie aufzuheben: er sah eine Treppe die sich im Finstern verlor. Er stieg einige Stuffen hinab, allein da er es nicht wagte, sich diesem Abgrunde anzuvertrauen, machte er die Thüre wieder zu und verließ diese Zimmer voll Verwunderung, zu welchem Zwecke hier eine Treppe so heimlich angebracht seyn möchte.
Die Treppen im obern Thurm waren so sehr verfallen, daß er nicht hinaufzusteigen wagte: er ging wieder in die Halle zurück und gelangte durch die Wendeltreppe, die er den Abend zuvor bemerkt hatte, in den Gang, wo er eine Reihe Zimmer fand, die ohne alles Geräth waren, aber den untern sehr glichen.
Er erneute mit Frau von La Motte sein voriges Gespräch über die Abtey, und sie both alles auf, ihm sein Vorhaben auszureden. Zwar gab sie ihm die Sicherheit dieses Orts zu, meinte aber, es ließe sich wohl ein andrer finden, der zur Verbergung eben so gut und gemächlicher wäre. La Motte zweifelte daran; außerdem war in diesem Walde Wild in Menge, welches ihm Speise und Zeitvertreib zugleich verschaffen konnte: ein Umstand, der bey dem geringen Bestand seiner Kasse nicht zu verachten war — mit einem Worte: er hatte sich diesen Plan so fest in den Kopf gesetzt, daß alles Einreden nichts fruchtete. Adeline hörte mit stiller Angst dem Gespräch zu und wartete mit Ungeduld auf den Ausgang von Peters Bericht.
Der Morgen verstrich, allein Peter ließ sich nicht sehn. Unsre Einsiedler machten sich über den Proviant her, den sie zu gutem Glück mitgebracht hatten, und gingen nachher im Holze spazieren. Adeline, die nie ein Gutes unbemerkt ließ, weil es mit Übel begleitet war, vergaß eine Zeitlang die Öde der Abtey über die Schönheit der umliegenden Gegend. Die anmuthigen Schatten labten ihr Herz und die Abwechslung der Landschaft nährte ihre Fantasie — sie glaubte beynahe, vergnügt hier leben zu können. Schon nahm sie einen gewissen Antheil an den Angelegenheiten ihrer Gefährten, und für Frau von La Motte empfand sie noch mehr: es war die warme Regung von Dankbarkeit und Zuneigung.
Der Nachmittag verstrich und sie kehrten wieder nach der Abtey zurück. Peter kam noch immer nicht, und sie geriethen über seine Abwesenheit in Unruhe. Auch die Annäherung der Dunkelheit warf einen Schatten auf die Hoffnung der Wanderer: sie mußten noch eine Nacht unter eben so ungünstigen Umständen zubringen, und was noch schlimmer war, mit einem sehr geringen Vorrath von Lebensmitteln. Frau von La Motte verlor allen Muth und weinte bitterlich. Adelinens Herz war eben so beklommen, allein sie raffte ihre sinkenden Lebensgeister zusammen und gab einen Beweis ihrer Gutmüthigkeit, indem sie ihre Freundinn aufzurichten suchte.
La Motte ward rastlos und unmuthig; er verließ die Abtey und ging für sich allein Petern entgegen. Er war noch nicht weit gekommen; als er ihn neben dem Pferde zwischen den Bäumen wahrnahm.
»Was bringst du, Peter?« rief ihm La Motte entgegen.
Peter kam keuchend näher und sagte kein Wort, bis La Motte die Frage in einem mehr gebietrischen Ton wiederhohlte.
»Gott sey gedankt, gnädiger Herr,« sagte er, sobald er zu Athem kommen konnte, »daß ich Sie wieder sehe. Ich dachte schon, ich würde nie wieder zurück kommen. Ich habe aller Welts Unglück gehabt.«
»Nun, das kannst du nachher erzählen; jetzt laß mich nur hören, was du entdeckt hast.«
»Entdeckt« — unterbrach Peter — »ja, ich bin entdeckt, daß es Gott erbarme: Wenn Ihro Gnaden meine Arme betrachten wollen, werden Sie sehn, wie ich entdeckt bin.«
»Gefärbt, willst du wahrscheinlich sagen. Aber wie geriethst du in diesen Zustand?«
»Das wollte ich eben Ihro Gnaden erzählen. Sie wissen, daß ich von dem Engländer, der zuweilen mit seinem Herrn in unser Haus kam, ein wenig Baxen gelernt habe —«
»Ja, ja, sag mir nur, wo du gewesen bist!«
»Wahrhaftig, kaum weiß ich es selbst. Genug; ich gerieth in des Teufels Küche, allein da es in Ihro Gnaden Angelegenheiten war, so muß ich es schon verschmerzen. Wenn ich aber jemahls den Spitzbuben wieder treffe —«
»Deine erste Bewirthung scheint dir so wohl gefallen zu haben, daß du noch eine verlangst, und wenn du nicht ordentlicher sprechen willst, so kann dazu Rath werden.«
Diese Drohung setzte Petern in einiges Schrecken, und er bemühte sich, zusammen hängender fortzufahren.
»Als ich die alte Abtey verließ,« sagte er, »folgte ich dem Wege, den Sie mir angewiesen hatten, und wendete mich rechts nach jenen Bäumen, wo ich hiehin und dorthin sah, ob ich ein Haus, eine Hütte, oder nur einen Menschen erblicken könnte, aber nichts von allem; und so schlenderte ich beynahe eine Stunde weit fort, bis ich endlich auf einen gebahnten Weg kam. O ho, nun haben wir's, sagte ich, Wege können nicht ohne Füße gemacht werden. Doch wurde ich in meiner Rechnung irre, denn auch nicht ein Stück von einem Menschen konnte ich, ansichtig werden, und nachdem ich bald rechts bald links eine ganze Weile gegangen war, verlor ich meine Spur und mußte eine andere suchen.«
»Ist es dir denn gar nicht möglich, zur Sache zu kommen? Laß doch diese Possen weg, und sag nur, was du ausgerichtet hast.«
»Nun dann, um kurz zu seyn, denn nach allen ist das doch der nächste Weg, ich wanderte eine ganze Weile in der Irre und wußte nicht wohin, immer durch einen Wald fort, wie dieser, und gab mir alle Mühe zu merken, wie die Bäume standen, damit ich den Rückzug finden könnte. Endlich kam ich auf einen andern Weg und glaubte nun gewiß, ich würde etwas finden, ob ich gleich zuvor nichts gefunden hatte: denn zwey Mahl konnte ich doch nicht fehlen. Ich guckte zwischen den Bäumen durch, und entdeckte eine Hütte; husch gab ich dem Pferde die Peitsche, daß es durch den Wald schallte, und in einem Nu war ich vor der Thür. Die Leute sagten mir, daß es noch eine Viertelstunde bis zur nächsten Stadt wäre, und hießen mich dem Wege folgen, der Kerzengerade darauf hin führte: so war es auch wirklich, und mein Pferd mußte wohl Hafer riechen, denn es lief wie alle Teufel. Ich fragte nach einem Rademacher und hörte, daß einer in Orte wäre, allein niemand konnte ihn finden. Ich wartete in die Länge und Breite, denn ich wußte, daß ich nicht unverrichteter Sache zurück kommen durfte. Endlich kam der Kerl vom Felde zu Haus und ich sagte ihm, wie lange ich schon gewartet hätte: denn, sagte ich, ich wußte, daß ich nicht wieder fortgehen dürfte, wie ich gekommen war —«
»Sey doch weniger langweilig, ich bitte dich, wenn es in deiner Natur ist.«
»Es ist in meiner Natur, und wäre es noch mehr darin, so sollte es Ihro Gnaden zu Gute kommen. Sollten Sie sich wohl vorstellen, daß der unverschämte Esel einen Louisd'or für das Ausbessern des Rades forderte? Ich glaube in meinem Sinne, er merkte, daß ich in Noth war, und mir ohne ihn nicht helfen konnte. Ein Louisd'or! sagte ich: so soll sich mein Herr von einem Spitzbuben, wie du bist, nicht schnellen lassen. Der Kerl zog das Maul und gab mir eins hinter die Ohren: ich nicht faul und wieder drauf los, und würde ihn zu Boden gestreckt haben, wenn nicht ein anderer dazwischen gekommen wäre, so daß ich nachlassen mußte.«
»Und so bist du also eben so klug wieder gekommen, als du fortgingst.«
»Nicht doch, ich hoffe, ich bin zu gescheut, um mich von so einem Schurken verdutzen zu lassen; zudem habe ich ein halb Schock Nägel gekauft, um zu sehn, ob ich das Rad selbst flicken kann; ich hatte immer ein gut Geschick zur Zimmermannsarbeit.«
»Nun gut, ich lobe deinen Eifer für meinen Vortheil, aber hier war er etwas unzeitig angebracht. Was hast du denn in dem Korbe?«
»Ich dachte, Ihro Gnaden, daß wir nicht von hier könnten, bis der Wagen in Stand wäre, und unter der Zeit, dachte ich, da doch niemand ohne Speise und Trank leben kann, so will ich mein bischen Geld anwenden, und einen Korb mit Lebensmitteln mitnehmen.«
»Das ist noch das einzige Kluge, was du gethan hast, in dieser Rücksicht will ich dir deine andern dummen Streiche vergeben.«
La Motte erkundigte sich nun nach der Stadt, und fand, daß man Lebensmittel und die nothwendigsten Geräthschaften, um die Abtey bewohnbar zu machen, haben könnte. Diese Nachricht bestimmte beynahe seinen Plan, und er trug Petern auf, sich den andern Morgen wieder auf den Weg zu machen, und Erkundigung von der Abtey einzuziehn. Wann die Antwort gut ausfiele, so sollte er einen Schiebkarren kaufen, und sich mit einigem Geräth und nothwendigen Werkzeug zum Ausbessern der neuen Zimmer versehn. Peter starrte hoch auf —
»Wie — denken Ihro Gnaden hier zu bleiben?«
»Gesetzt nun ich dächte so?«
»Ey, dann hätten Ihro Gnaden einen klugen Entschluß gefaßt, wie ich zu verstehn gab, denn Sie werden sich erinnern, ich sagte —«
»Es ist unnöthig zu wiederhohlen, was du gesagt hast; vielleicht hatte ich die Sache schon vorher beschlossen.«
»Dem sey wie ihm wolle, Sie haben Recht gethan, und ich freue mich herzlich darüber: denn ich glaube, außer den Raben und Eulen wird uns hier so leicht niemand hindern. Lassen Sie mich nur machen: es soll so schön hier werden, daß ein König darin wohnen könnte, und was die Stadt anbetrifft, so ist dort alles zu haben; und gewiß denken die Leute dort eben so wenig an diesen Ort, als an Indien oder Amerika.«
Sie erreichten nun die Abtey, wo Peter mit großer Freude empfangen wurde: allein seiner Gebietherinn und Adelinens Hoffnung sank bald, als sie hörten, daß er wiederkam, ohne seine Sache verrichtet zu haben, und was für Bericht er von der Stadt brachte. Fast mit gleicher Bekümmerniß hörten Frau von La Motte und Adeline die Aufträge an, welche Peter erhielt, doch verbarg die letzte ihre Unzufriedenheit und wandte alles an, um ihre Freundinn zu erheitern. Ihr holdes Wesen und die Zufriedenheit, welche sie erzwang, machten einen tiefen Eindruck auf Frau von La Motte, und ließen sie eine Quelle des Trostes sehn, die sie bisher nicht geahndet hätte. Die zärtliche Aufmerksamkeit ihrer jungen Freundinn versprach ihr Ersatz für den Mangel anderer Gesellschaft, und ihre Unterhaltung Verkürzung der Stunden, welche sonst in peinlichem Unmuth würden verstrichen seyn.
Adelinens Beobachtungen und ganzes Betragen zeugten von einem gesunden Verstande und liebenswürdigen Herzen: allein sie besaß noch mehr, — wirkliches Genie. Sie war jetzt in ihrem neunzehnten Jahre, ihre Figur von mittler Größe, und äußerst wohl gebildet: ihr Haar war dunkelbraun, ihr Auge blau und gleich bezaubernd, wenn es von Feuer strahlte, oder in Zärtlichkeit schwamm: ihre Gestalt hatte das leichte Schweben einer Sylphide, und wenn sie lächelte, konnte ihr Gesicht Hebens jüngerer Schwester zum Urbild dienen; die Reize ihrer Schönheit wurden durch die Grazie und Einfalt ihrer Sitten erhöht, und befestigt durch den innern Werth ihres Herzens. —
Annette machte jetzt das Feuer für die Nacht an. Peters Korb wurde geöffnet, und das Abendessen bereitet. Frau von La Motte war noch immer still und nachdenkend.
»Es läßt sich kaum eine so schlimme Lage denken,« sagte Adeline, »daß wir nicht zu einer oder der andern Zeit wünschen sollten, sie nicht verlassen zu haben. Der ehrliche Peter wünschte sich gewiß herzlich nach der Abtey zurück, als er sich im Walde verirrt hatte, oder statt eines Feindes, zwey zu bekämpfen fand; und ich bin überzeugt, daß es keinen so hülflosen Zustand gibt, aus dem man nicht Trost schöpfen könnte. Die Flamme dieses Feuers leuchtet freundlicher im Contrast mit der traurigen Öde des Orts, und dieß reichliche Mahl ist köstlicher nach dem Mangel, den wir vorher litten. Lassen Sie uns das Gute genießen und das Böse vergessen.«
»Man hört aus Ihren Reden, meine Liebe,« sagte Frau von La Motte, »daß Ihr Geist noch nicht oft von Unglück niedergedrückt ward« — Adeline seufzte — »und Ihre Hoffnung noch alles Feuer hat.«
»Langes Leiden,« fiel La Motte ein, »hat in unsern Seelen diese Spannkraft erschlafft, welche dem Druck des Übels widersteht, und der Freude entgegen hüpft. Allein ich verfalle in Deklamation bey der Erinnerung an diese Zeiten. Auch ich, Adeline, konnte einst aus jeder Lage Freude schöpfen.«
»Und können es gewiß noch. Halten Sie es immer für möglich, und Sie werden es so finden.«
»Die Illusion ist verschwunden — ich kann mich nicht länger täuschen.«
»Verzeihen Sie mir, wenn ich sage, Sie täuschen sich jetzt, da Sie die Wolke des Kummers jeden Gegenstand, den Sie ansehn, schwärzen lassen.
»Es kann seyn, aber lassen Sie uns von etwas anderm reden.«
Nach Tische wurden die Thüren verrammelt, wie den Abend zuvor, und die müden Wanderer legten sich zur Ruhe.
Am folgenden Morgen machte sich Peter wiederum auf den Weg nach der kleinen Stadt Auboine, und Frau von La Motte brachte mit Adelinen wiederum die Stunden in Ängstlichkeit und schwacher Hoffnung hin: denn vielleicht konnten die Nachrichten, die er von der Abtey einziehen sollte, La Motten von seinem Vorhaben abbringen.
Gegen Abend spähten sie ihn aus — aber die Karre, die er bey sich führte, weissagte ihnen nichts Gutes. Er brachte Materialien zum Ausbessern des Orts, und einige Geräthschaft mit.
Er stattete einen Bericht folgenden Inhalts ab: — Die Abtey gehörte nebst einem großen Theile des angrenzenden Waldes einem Edelmann, der gegenwärtig mit seiner Familie auf einem entfernten Landgute wohnte. Er erbte sie durch seine Frau von seinem Schwiegervater, der die neuern Zimmer hatte erbauen lassen, und alle Jahre einige Monathe in der Jagdzeit daselbst zubrachte. Man trug sich mit dem Gerücht, daß kurz nachher, als sie dem jetzigen Besitzer zufiel, eine Person heimlich nach der Abtey gebracht und in diesen Zimmern eingesperrt wäre: wer es aber war, oder was aus ihr geworden, hatte niemand erfahren. Das Gerücht legte sich nach und nach, und viele glaubten gar nichts davon; soviel aber war gewiß, daß der gegenwärtige Besitzer nur zwey Sommer die Abtey besucht hatte, und daß die Möbeln einige Zeit nachher fortgeschafft wurden.
Dieser Umstand hatte anfangs viel Aufsehn gemacht, und man hatte mancherley daraus geschlossen; allein es war schwer zu sagen, was eigentlich an der Sache war. Unter andern hieß es, daß man seltsame Erscheinungen in der Abtey gesehn, und ungewöhnliche Töne gehört hätte: und wiewohl gescheute Leute dieser Sagen, als ungereimter Einbildungen des Aberglaubens, spotteten, hätten sie doch bey dem gemeinen Mann so fest Wurzel gefaßt, daß seit siebenzehen Jahren niemand sich in die Nähe des Orts gewagt hätte, und die Abtey folglich ganz verfallen wäre.
La Motte dachte über diesen Bericht nach. Anfangs erregte er unangenehme Vorstellungen bey ihm, allein diese wurden bald vertrieben, und Betrachtungen, die seinem Vortheil näher lagen, traten an ihre Stelle: er wünschte sich Glück, einen Ort gefunden zu haben, wo er nicht fürchten durfte, entdeckt oder beunruhigt zu werden; doch konnte er sich des Gedankens nicht entschlagen, daß eine wunderbare Übereinstimmung zwischen dem einen Theil von Peters Erzählung und der Beschaffenheit der Zimmer herrschte, die er im Thurm entdeckt hatte. Die Überbleibsel von Möbeln, die aus den andern Zimmern fortgeschafft waren, — das einsame Bette, — die Anzahl und der Zusammenhang der Zimmer, waren Umstände, welche seine Meinung bestärkten. Doch behielt er sie bey sich, denn er sah ohnehin, daß Peters Bericht eben nicht gedient hatte, seiner Familie diesen Aufenthalt angenehm zu machen.
Doch blieb ihnen nichts weiter, als sich stillschweigend zu unterwerfen, und so unangenehme Besorgnisse sie auch empfinden mochten, enthielten sie sich doch, sie zu äußern. Peter fühlte in der That nichts dergleichen: er kannte keine Furcht, und seine Seele war jetzt einzig mit dem auf ihn wartenden Geschäft erfüllt.
Frau von La Motte ergab sich mit der stillen Ruhe der Verzweiflung in das, was sie zu ändern nicht vermochte, und was durch Unzufriedenheit und Klagen nur noch unerträglicher werden mußte: auch sah sie in der That nicht ein, ungeachtet der Aufenthalt in der Abtey ihr in mancherley Rücksicht zuwider war, wie ihre Lage durch irgend eine Veränderung des Orts wirklich verbessert werden könnte, doch irrten ihre Gedanken oft nach Paris, und weilten bey dem Rückblick auf vergangene Zeiten, bey den Bildern um sie trauernder, vielleicht auf immer verlaßner Freunde! Der zärtliche Umgang ihres Sohnes, den sie bey der Gefahr seiner Lage und der Verborgenheit der ihrigen, nie wieder zu sehen, mit Recht fürchten mußte, stieg in ihrer Erinnerung auf, und überwältigte ihre Standhaftigkeit.
»Warum, o warum,« rief sie, »mußte ich diese Stunde erleben! und was werden meine künftige Jahre seyn!«
Adeline hatte keinen Rückblick auf vergangene Freuden, der das Gefühl des gegenwärtigen Ungemachs erhöhen konnte — keine trauernden Freunde, keine theuren, beweinten Gegenstände, um den Schmerz zu schärfen und einen kranken Schimmer auf ihre künftigen Aussichten zu werfen; sie kannte die Qualen getäuschter Hoffnung, die schärfern Stacheln innerer Vorwürfe noch nicht: sie litt kein Elend, das nicht Geduld mildern, und Standhaftigkeit überwinden konnte.
Mit Anbruch des folgenden Tages machte Peter sich an seine Arbeit: er rückte schnell fort, und in wenig Tagen waren zwey von den untern Zimmern so vortheilhaft verändert, das La Motte triumphirte, und seine Familie zu glauben anfing, ihre Lage würde doch nicht so übel seyn, als sie sich vorgestellt hatten. Die Möbeln, welche Peter schon gebracht hatte, wurden in diese Zimmer gestellt: eins davon war das große gewölbte Gemach, das Frau von La Motte zum gemeinschaftlichen Wohnzimmer einrichtete, weil sie wegen des großen, gothischen Fensters, das fast auf den Boden herabging und eine mahlerische Aussicht gewährte, ihm den Vorzug gab.
Peter verfügte sich nochmahl nach Auboine um noch mehr Zufuhr zu hohlen, und in wenig Wochen waren alle untern Zimmer nicht nur bewohnbar, sondern auch gemächlich. Weil diese indessen zur Bequemlichkeit der Familie nicht hinreichten, wurde ein oberes Zimmer für Adelinen zurecht gemacht: es stieß gleich an dem Thurm, und sie zog es den höhern vor, weil es nicht so entfernt von der Familie war, und weil die Fenster, die auf einen Eingang des Waldes stießen, eine weitere Aussicht gewährten, Die zerrissenen Tapeten, die an der Wand herum hingen, wurden wieder fest genagelt, und bekamen ein minder wüstes Ansehen; und ungeachtet das Zimmer bey seiner Geräumigkeit und schmalen Fenstern noch immer etwas schauderliches behielt, war es doch nicht ungemächlich mehr.
Die erste Nacht, welche Adeline hier zubrachte, schlief sie wenig: die Einöde des Orts drückte ihre Lebensgeister nieder, und vielleicht um so mehr, weil sie aus freundschaftlicher Schonung in Frau von La Mottens Gegenwart sich Zwang anthat. Sie erinnerte sich an Peters Erzählung, wovon einige Umstände, trotz ihrer Vernunft, fest in ihrer Einbildungskraft hafteten, und es wurde ihr schwer, ihre Ängstlichkeit ganz zu überwinden; ja einmahl bemächtigte sich Schrecken ihrer so ganz, daß sie wirklich die Thüre aufmachte, um Frau von La Motte zu rufen; nachdem sie aber eine Weile an der Treppe gelauscht hatte, und alles still blieb, hörte sie endlich La Motten ganz fröhlich sprechen, und beschämt, ihrer ungereimten Furcht so viel Raum gegeben zu haben, schlich sie still wieder in ihr Zimmer zurück.
La Motte brachte seinen kleinen Lebensplan bald in Ordnung: den Vormittag brachte er gewöhnlich mit Fischen und Jagen zu, und genoß das Mittagsmahl, welches er selbst herbeyschaffte, mit besserem Appetit, als er je an den üppigen Tafeln von Paris gekannt hatte. Die Nachmittage brachte er bey seiner Familie zu: oftmahls nahm er ein Buch aus seiner kleinen Sammlung, und versuchte seine Aufmerksamkeit auf die Worte zu heften, die seine Lippen aussprachen: allein seine Seele fand wenig Zerstreuung von ihrem Kummer, und die Grundsätze, die er vorlas, ließen keinen Eindruck bey ihm zurück. Zu Zeiten sprach er, öfter aber saß er in finsterm Stillschweigen da, brütete über dem Vergangenen und verfrühte die Zukunft.
Zu solchen Zeiten bemühte sich Adeline mit einer fast unwiderstehlichen Holdseligkeit, ihn aufzuheitern und von sich selbst abzuziehen. Selten gelang es ihr, wenn es aber geschah, so brachten Frau von La Mottens dankbare Blicke, und das süße Gefühl in ihrer eigenen Brust, wirklich die Heiterkeit bey ihr hervor, die sie anfangs nur angenommen hatte.
Adeline besaß die glückliche Kunst, oder vielleicht richtiger, die glückliche Natur, sich in jede Lage zu schmiegen. So traurig auch ihre jetzige war, gebrach es ihr doch nicht ganz an Trost, und ihre guten Eigenschaften erhöhten ihn. Sie erwarb sich die Zuneigung ihrer Beschützer in solchem Maße, daß Frau von La Motte sie als ihr eigenes Kind liebte, und La Motte selbst, so wenig er auch der Zärtlichkeit empfänglich war, nicht ganz unempfindlich gegen ihre Aufmerksamkeit bleiben konnte. Wenn er einmahl aus seinem mürrischen Trübsinn erwachte, so war es Adelinens Werk.
Peter brachte regelmäßig auf eine Woche Lebensmittel von Auboine, und verließ immer die Stadt nach einer entgegengesetzten Richtung als die nach der Abtey führte.
Einige Wochen waren ihm ohne alle Störung verstrichen, und La Motte ließ alle Furcht vor Nachsetzung fahren, und fand sich endlich so ziemlich in seine Lage.
So wie Gewohnheit und Bestreben die Standhaftigkeit der Frau von La Motte stärkten, schien sich das Gefühl ihres Unglücks zu mildern. Der Wald, der ihr anfangs eine schreckliche Einöde däuchte, hatte seinen furchtbaren Anblick verloren; und das Gebäude, dessen halb verfallene Mauern und finstere Verödung ihre Seele mit Schwermuth und Abscheu erfüllten, wurde jetzt als eine häusliche Zuflucht und sichere Schutzwehr vor den Stürmen einer höhern Gewalt, von ihr betrachtet.
Sie war eine gescheute und sehr talentvolle Frau, und Adelinens Ausbildung wurde ihr Lieblingsgeschäft. Dieß junge Mädchen vereinigte, wie wir bereits gesehen haben, die glücklichsten Anlagen mit einer sanften Gemüthsart, welche sie fähig machte, jeden Unterricht mit schnellem Fortrücken, jede Nachsicht mit Liebe zu belohnen. Sie übersah und führte die kleinen Geschäfte des Haushalts mit so bewunderungswürdiger Ordnung, daß Frau von La Motte sich gar nicht darum zu bekümmern brauchte; und in dieser abgeschiedenen Lage wußte sie sich manchen Zeitvertreib zu verschaffen, der das Andenken ihres eigenen Mißgeschicks oftmahls schwächte. La Mottens Bücher waren ihr vornehmster Trost. Oft ging sie mit einem davon in dem Walde spazieren, wo der Bach, der sich durch ein Gebüsch wand, Kühlung verbreitete, und durch sein Murmeln zur Ruhe einlud. Hier setzte sie sich an fein Ufer, und verbrachte, der Täuschung des Lesens hingegeben, manche Stunden in Vergessenheit des Kummers.
Frau von La Motte hatte oftmahls einiges Verlangen nach den Begebenheiten ihres Lebens geäußert, und zu wissen gewünscht, durch was für Umstände sie in die gefährliche und geheimnißvolle Lage gerathen sey, worin La Motte sie fand. Adeline sagte ihr dann mit wenig Worten, auf welche Art sie an jenen Ort gebracht wurde, bat aber immer mit Thränen, sie für jetzt mit einer nähern Erzählung ihrer Geschichte zu verschonen. Ihre Lebensgeister waren damahls eines solchen Rückblicks nicht fähig; jetzt aber, da sie durch Ruhe gesänftigt, durch Vertrauen gestärkt waren, theilte sie eines Tages der Frau von La Motte folgende Geschichte mit:
»Ich bin das einzige Kind von Louis St. Pierre, eines Edelmanns aus gutem Hause, aber von geringem Vermögen, der viele Jahre hindurch zu Paris wohnte. Meiner Mutter kann ich mich nur schwach erinnern; ich verlor sie, als ich erst sieben Jahre alt war, und dieß war mein erstes Unglück. Bey ihrem Tode gab mein Vater seinen Haushalt auf, that mich in ein Kloster, und verließ Paris. So wurde ich in so früher Zeit des Lebens Fremden überlassen! Mein Vater kam zu Zeiten nach Paris; er pflegte mich dann zu besuchen, und ich erinnere mich noch wohl, wie schmerzlich ich weinte, wenn er wieder fortging. Zwar schien er bey solchen Gelegenheiten, die mein Herz mit Wehmuth erfüllten, ganz ungerührt, so daß ich oft glaubte, er hätte wenig Liebe für mich; doch war er mein Vater und die einzige Person: von der ich Schutz und Zärtlichkeit erwarten konnte.
In diesem Kloster blieb ich bis in mein zwölftes Jahr. Tausendmahl hatte ich meinen Vater gebeten, mich nach Hause zu nehmen, allein anfangs hielten Bewegungsgründe der Klugheit und nachher des Geitzes ihn ab. Ich wurde aus diesem Kloster in ein anderes gebracht, wo ich erfuhr, daß mein Vater den Schleier für mich bestimmt hätte. Ich will nicht versuchen, mein Erstaunen und Schmerz zu schildern. Zu lange schon war ich in den Mauern eines Klosters vergraben gewesen, und meine Abneigung, die Bestimmung ihrer Gemüther zu theilen, war zu groß, um nicht Schrecken bey dem Gedanken zu empfinden, ihre Zahl zu vermehren.
Die Äbtissinn war eine Frau von strengen Sitten und strenger Frömmigkeit, äußerst pünctlich in der Beobachtung jedes kleinen Wohlstandes, und vergab nie einen Verstoß gegen das Herkommen. Es war ihre Art, wenn sie ihrem Orden neue Bekennerinnen erwerben wollte, mehr zu schrecken und zu drohen, als zu überreden und zu liebkosen. Ihre Künste waren die, welche durch Furcht wirken, nicht die, welche die Vernunft sanft gefangen nehmen. Sie bediente sich unzähliger Kunstgriffe, um mich zu ihrem Zweck zu bringen, und sie trugen alle die Farbe ihres Charakters. Allein ich sah bey dem Leben, welchem sie mich widmen wollte, zu viele Gestalten wirklichen Schreckens, um mich durch die erträumten, welche sie um mich her stellte, fangen zu lassen, und blieb fest entschlossen, den Schleier zu verwerfen. Hier brachte ich einige Jahre in elendem Widerstand hin. Meinen Vater sah ich selten; so oft es geschah, flehte ich ihn, meine Bestimmung zu ändern; allein er wandte mir ein, daß sein Vermögen nicht zureiche, mich in der Welt zu erhalten, und drohte mir endlich Strafe, wenn ich in meinem Ungehorsam beharrte.
Sie können sich keinen Begriff von dem Elende meines Zustandes machen: zu ewigem Gefängniß bestimmt, oder der Rache eines Vaters hingegeben, dem ich nichts entgegen setzen konnte. Meine Entschlossenheit nahm ab — eine Zeitlang schwankte ich zwischen der Wahl von Übeln; endlich aber stellten die Schrecknisse eines Klosters sich mir in so furchtbarer Gestalt dar, daß meine Fassung erlag. Ausgeschlossen von dem fröhlichen Genuß der Gesellschaft — von dem reizenden Anblick der Natur — beynahe vom Licht des Tages; zum Schweigen, zu strenger Förmlichkeit, Enthaltung und Buße verdammt; gezwungen, den Freuden einer Welt zu entsagen, welche die Einbildungskraft mir in den heitersten, anlockendsten Farben mahlte, nicht weniger zauberisch vielleicht, weil sie bloß idealisch waren — dieß war der Zustand, zu welchem man mich bestimmte. Auf das neue stärkte sich meine Entschlossenheit: meines Vaters Härte überwältigte mein kindliches Gefühl, und erregte Erbitterung in meinem Herzen. Da er die Zärtlichkeit eines Vaters vergessen, und ohne Gewissensbisse sein Kind der Verzweiflung und dem Elende Preis geben kann, sagte ich zu mir selbst, so sind die Bande kindlicher und väterlicher Pflicht unter uns zerrissen: er selbst hat sie aufgelöst, und ich will noch um Freyheit und Leben kämpfen.
Da die Äbtissinn mich bey ihren Drohungen unbeweglich fand, nahm sie ihre Zuflucht zu feinern Maßregeln: sie ließ sich herab, zu lächeln, ja sogar zu schmeicheln; allein ihr Lächeln war nicht das holde Kind der Güte: es erregte Ekel, statt Neigung einzuflößen. Sie schilderte den Charakter einer Vestalinn mit den schönsten Farben der Kunst seine heilige Unschuld; sanfte Würde, erhabene Reinigkeit. Ich seufzte bey ihren Worten. Sie hielt es für ein günstiges Zeichen, und fuhr mit größerer Lebhaftigkeit in ihrem Gemählde fort. Sie beschrieb die stille Heiterkeit eines klösterlichen Lebens; seine Sicherheit vor den verführerischen Reizen rastloser Leidenschaften, und vor den schmerzhaften Abwechslungen der Welt — die geistigen Entzückungen der Andacht und die süße, gegenseitige Zärtlichkeit der Schwestern.
Sie vollendete das Gemählde mit solcher Kunst, daß jede andere, als ich, vielleicht dadurch hingerissen seyn würde. Allein mein Gefühl und meine Erfahrung wiedersprachen diesem Gemählde. Zu oft hatte ich die geheime Thräne und den durchbrechenden Seufzer fruchtloser Reue gesehen, die trüben Qualen der Unzufriedenheit, die stumme Angst der Verzweiflung. Mein Schweigen und ganzes Benehmen verrieth die Festigkeit meines Entschlußes, und nur mit Mühe behielt sie ihre Fassung bey.
Mein Vater gerieth in höchsten Zorn über meine Beharrlichkeit, die er halsstarrigen Eigensinn nannte; allein, was nicht so glaublich scheint, er besänftigte sich bald, und bestimmte einen Tag, wo er mich aus dem Kloster nehmen wollte. Denken Sie sich meine Freude, als ich diese Nachricht erfuhr! Alle meine Dankbarkeit erwachte, ich vergaß seine vorige Härte; vergaß, daß diese Nachsicht weniger das Werk seiner Güte, als meiner Entschlossenheit war. Ich weinte aus Rührung, daß ich nicht jeden seiner Wünsche erfüllen konnte.
Welche Tage glücklicher Erwartung, die vor meiner Abreise hergingen! Die Welt, von der ich bisher abgesondert war, diese Welt, in welcher meine Fantasie so gern umherschwärmte, deren Pfade ich mit unverwelklichen Rosen bestreute, wo jede Scene mir in Schönheit entgegen lächelte, und mich zum Entzücken einlud — wo alle Menschen gut, alle Guten glücklich waren — Ach, diese Welt stand vor meinen Blicken. Lassen Sie mich die süsse Erinnerung haschen, ehe sie verschwindet! Sie gleicht den vergänglichen Lichtstrahlen des Herbstes, die einen Augenblick jenen Hügel beleuchten und dann ihn der Dunkelheit hingeben. Ich zählte die Tage und Stunden, die mich noch von diesem Feenlande schieden. Nur im Kloster wohnte nach meiner Meinung Elend. Ich sollte es verlassen; wie beklagte ich die armen Nonnen, die ich darin zurück ließ! Die halbe Welt, die ich so sehr schätzte, hätte ich gegeben, sie mit mir herausnehmen zu dürfen!
Endlich erschien der lange ersehnte Tag. Mein Vater kam, und für einen Augenblick verlor sich meine Freude in dem Schmerz, meinen armen Gefährtinnen Lebewohl zu sagen, für die ich noch nie so warme Zärtlichkeit empfunden hatte, als in dieser Stunde. Bald war ich außer den Thoren des Klosters. Ich sah mich rings umher, sah das weite Gewölbe des Himmels nicht länger von klösterlichen Mauern begrenzt, und die grüne Erde in Hügeln und Thal um den runden Kreis des Horizonts verbreitet! Mein Herz klopfte von Entzücken, Thränen stiegen mir in die Augen, und ich war einige Augenblicke unvermögend zu sprechen. Meine Gedanken stiegen zum Himmel auf, in Gefühlen des Dankes gegen den Geber alles Guten.
Endlich wandte ich mich zu meinem Vater:
›Theuerster Vater,‹ sagte ich, ›wie dankbar bin ich Ihnen für meine Befreyung! wie innig wünschte ich alles zu thun, um Ihnen gefällig zu seyn!‹
›So kehre in dein Kloster zurück!‹ sagte er im rauhen Ton.
Ich schauderte; sein Blick und Wesen erstarrten die frohe Stimmung meines Gefühls: sie brachten Misklang in mein Herz, das zuvor nur süßer Harmonie offen stand. Die Wärme der Freude wurde in einem Augenblick erstickt, und jeder Gegenstand um mich mit dem Schatten getäuschter Hoffnung verdunkelt. Nicht, daß ich glaubte, mein Vater würde mich wirklich in das Kloster zurück bringen, sondern weil seine Gefühle der Freude und Dankbarkeit so gar nicht zu entsprechen schienen, die ich einen Augenblick zuvor empfunden und geäußert hatte. Verzeihen Sie mir, Madame, die Erwähnung dieser an sich unbedeutenden Dinge: die starken Abwechslungen des Gefühls, die sie in meinem Herzen hervorbrachten, machen sie mir wichtiger scheinen, da sie Ihnen vielleicht lästig sind.«
»Nein, meine Liebe,« sagte Frau von La Motte, »nichts weniger als das; sie sind mir wichtig, weil sie kleine Züge des Charakters enthüllen, dessen Beobachtung mich freut. Sie verdienen meine ganze Liebe, und von diesem Augenblick an gelobe ich Ihrem Unglück mein zärtlichstes Mitleid und Ihrem guten Herzen meine wärmste Freundschaft.«
Diese Worte rührten Adelinen bis in das Innerste; sie küßte die Hand, welche Frau von La Motte ihr reichte und schwieg einige Minuten. Endlich sagte sie:
»Möchte ich diese Güte verdienen, und ewig dankbar gegen Gott seyn, der mir in einer solchen Freundinn Trost und Hoffnung schenkt! —
»Meines Vaters Landgut lag einige Meilen jenseits Paris, und wir kamen auf unserem Wege dahin durch diese Stadt. Welche neue Scene! Wo waren jetzt die frostigen Gesichter, das steife Betragen, das ich im Kloster zu sehen gewohnt war! jedes Gesicht war hier belebt, von Beschäftigung oder Freude; jeder Schritt war leicht, jedes Lächeln Vergnügen. Alle Menschen schienen Freunde zu seyn; sie sahen und lächelten mich an; ich lächelte wieder, und hätte ihnen sagen mögen, wie froh ich war! Welche Lust, sagte ich, von Freunden umgeben zu leben!
Welche gedrängte Straßen! Welche prächtige Gebäude! Kaum bemerkte ich, daß die Straßen enge, die Wege gefährlich waren. Welches Leben, welches Gefühl, welche Freunde! Ich konnte mich nicht glücklich genug preisen, daß ich aus meinem Kloster erlöst war. Aufs neue wollte ich meinem Vater meine Dankbarkeit ausdrücken, allein seine Blicke verbothen es mir und ich schwieg. Ich werde zu weitläuftig; selbst die schwachen Abdrücke, welche das Gedächtniß von vergangner Freude zurückgibt, sind dem Herzen süß. Mit schwermüthigem Genuß hängen wir noch an dem Schatten des Vergnügens, wenn gleich sein Wesen unsrer Erreichung entflohen ist!
Nachdem ich unter vielem Seufzen Paris verlassen und es noch angestaunt hatte, bis auch der letzte Kirchthurm in der Ferne schwand, kamen wir auf eine düstre, unbesuchte Straße. Es war Abend, als wir eine wilde Heyde erreichten — ich sah mich nach einer menschlichen Wohnung um, konnte aber keine entdecken, und nicht ein menschliches Wesen war zu sehen. Ich empfand etwas dem ähnliches, als ich im Kloster zu fühlen pflegte: mein Herz war noch nicht so schwer gewesen, seit ich es verlassen hatte. Ich fragte meinen Vater, der noch immer schweigend da saß, ob wir bald an Ort und Stelle wären? Er antwortete bejahend.
Die Nacht kam indessen heran, ehe wir den Ort unsrer Bestimmung erreichten. Es war ein einsames Haus auf der Wüste; doch ich brauche es Ihnen nicht zu beschreiben. Als der Wagen still hielt, zeigten sich zwey Männer an der Thüre und halfen uns heraus. Ihre Gesichter waren so finster, ihre Worte so karg, daß ich mich beynahe wieder im Kloster glaubte. Soviel ist gewiß, daß ich keine so traurigen Gesichter gesehn hatte, seit ich es verließ. ›Ist dieß ein Theil der Welt, die ich mit solchem Entzücken ansah?‹ sagte ich zu mir selbst.
Das Innere des Hauses war öde und schlecht: ich wunderte mich, daß mein Vater einen solchen Ort zu seiner Wohnung erwählt hatte, auch daß ich kein weibliches Geschöpf sah; allein ich wußte, daß Fragen mir nur Verweise zuziehen würden und schwieg also. Bey Tisch setzten sich die zwey Leute, die ich zuvor gesehn hatte, zu uns: sie sagten wenig, schienen mich aber aufmerksam zu betrachten. Ich wurde verlegen und mißmuthig: mein Vater merkte es und sah sie mit einem finstern Blick an, der mich überzeugte, daß er mehr im Sinn hatte, als ich begrif. Sobald abgegessen war, nahm mich mein Vater bey der Hand und führte mich in mein Zimmer; er setzte das Licht hin, wünschte mir gute Nacht, und überließ mich meinen einsamen Gedanken.
Wie verschieden waren sie jetzt von denjenigen, die mich wenig Stunden zuvor beschäftigten! Damahls hüpften Erwartung, Hoffnung und Freude um mich her. Jetzt ertödtete Schwermuth und getäuschte Erwartung die Wärme meines Herzens und trübte meine Aussicht in die Zukunft. Das Ansehn aller Dinge um mich her trug bey, mich niederzuschlagen. Auf der Erde war ein kleines Bette zurecht gemacht, ohne Überzüge und Umhänge; zwey alte Stühle und ein Tisch machten die ganze Möblirung aus. Ich ging ans Fenster, um in die Gegend zu sehn; es war mit Eisen vergittert. Dieser Umstand erschreckte mich, und wenn ich ihn mit der Entlegenheit und dem seltsamen Ansehn des Hauses, mit den Gesichtern und Betragen der Leute, die mit uns gegessen hatten, zusammen hielt, so verlor ich mich in einem Labyrinth von Vermuthungen.
Endlich legte ich mich nieder um zu schlafen: allein die Angst meiner Seele verscheuchte die Ruhe von mir: finstre, unangenehme Bilder schwirrten vor meiner Fantasie, und ich fiel in eine Art von wachenden Traum: mich däuchte, ich wäre mit meinem Vater in einem einsamen Walde; seine Miene war finster, seine Gebährden drohend; er warf mir vor, das Kloster verlassen zu haben, und zog, während er sprach, einen Spiegel aus der Tasche, den er mir vors Gesicht hielt: ich sah hinein und erblickte — noch gefriert mein Blut bey der Wiederhohlung — erblickte mich verwundet und heftig blutend. Dann glaubte ich mich wieder in dem Hause, und hörte plötzlich die Worte, und zwar so deutlich, daß ich lange nach dem Erwachen sie kaum für Einbildung halten konnte: Eile aus diesem Hause, Verderben schwebt über dir!
Ein Fußtritt auf der Treppe erweckte mich: es war mein Vater, der in sein Schlafzimmer ging: die späte Stunde fiel mir auf; es war Mitternacht vorbey.
Den folgenden Morgen versammlete sich die Gesellschaft vom vorigen Abend beym Frühstück; und alle waren eben so schweigend und finster als zuvor. Ein kleiner Bedienter meines Vaters deckte den Tisch, allein die Köchinn und das Hausmädchen, wer sie auch seyn mochten, waren unsichtbar.
Den andern Tag befremdete es mich, meine Thüre verschlossen zu finden, als ich aus dem Zimmer gehen wollte: ich wartete lange, ehe ich zu rufen wagte, — als ich es that, erhielt ich keine Antwort. Ich ging ans Fenster und rief lauter, aber meine eigne Stimme war der einzige Ton, den ich vernahm. Beynahe eine Stunde brachte ich in unbeschreiblicher Angst hin: endlich hörte ich jemand auf der Treppe und erneuerte mein Rufen; ich erhielt zur Antwort: mein Vater wäre diesen Morgen nach Paris gereist, von wo er in wenig Tagen zurückkommen würde; indessen hätte er befohlen, mich in meinem Zimmer eingesperrt zu halten. Als ich meine Angst und Befremdung hierüber ausdrückte, versicherte man mich, ich brauchte nichts zu fürchten, und sollte so gut hier leben, als wenn ich in Freyheit wäre.
Diese letzten Worte enthielten eine wunderbare Art von Trost: ich antwortete wenig, und unterwarf mich der Nothwendigkeit. Noch einmahl sah ich mich traurigen Betrachtungen hingegeben! welch einen Tag brachte ich zu! einsam, von Schmerz und Angst zerrissen. Ich bemühte mich, die Ursache dieser harten Behandlung zu errathen, und glaubte endlich, sie sollte Strafe meines Ungehorsams im Kloster seyn. Aber warum gab mein Vater mich in die Gewalt von Fremden? von Menschen, deren Gesichter den Stämpel der Nichtswürdigkeit in so starken Zügen trugen, daß selbst mein unerfahrnes Gemüth mit Abscheu erfüllt wurde?
Ich gerieth immer tiefer in Zweifel und Unruhe, doch war es mir unmöglich, meine Gedanken von diesem Gegenstande abzuziehn, und der Tag verstrich zwischen Klagen und Vermuthungen. Endlich kam die Nacht, und welch eine Nacht! Die Dunkelheit brachte neues Schrecken mit sich: ich sah mich in der Kammer um, ob ich nichts finden könnte, die Thüre von innen zu befestigen, aber ich sah nichts: endlich fiel ich darauf, die Lehne eines Stuhls gegen das Schloß zu stemmen.
Kaum hatte ich dieß gethan, und mich in meinem Zeuge aufs Bett geworfen, nicht um zu schlafen, sondern zu wachen, so hörte ich ein. Klopfen an der Hausthüre, die so geschwind auf- und wieder zugemacht wurde, daß der Anklopfende nur einen Brief oder eine Nachricht gebracht haben konnte. Kurz darauf hörte ich in einem Zimmer an der Erde Stimmen, die oft ganz leise sprachen, oft alle mit eins anhuben, als wären sie im Streit. Etwas mehr zu entschuldigendes als Neugierde, machte, daß ich mich bemühte sie zu verstehen, allein umsonst: dann und wann haschte ich ein Wort auf, und einmahl hörte ich meinen Nahmen nennen, weiter aber nichts.
So verstrichen die Stunden bis Mitternacht, wo alles still wurde. Ich hatte eine Weile zwischen Furcht und Hoffnung gelegen, als ich das Schloß an meiner Thüre leise umdrehen hörte: einen Augenblick war es still, dann kehrte das Geräusch wieder, und ich hörte ein Flüstern von aussen: meine Lebensgeister erstarben, ich hatte kaum noch Bewußtseyn. Gleich nachher geschah ein heftiger Stoß an die Thüre, als wollte man sie sprengen. Ich schrie laut auf und hörte sogleich die Stimmen der Leute, die ich an meines Vaters Tisch gesehn hatte: sie riefen laut, daß ich die Thüre öffnen sollte, und als ich keine Antwort gab, stießen sie schreckliche Drohungen aus. Ich behielt noch eben Kräfte genug, um aus Fenster zu gehn, in verzweifelter Hoffnung, von da zu entwischen: allein meine schwachen Versuche konnten nicht einmahl die Stäbe erschüttern. O nie kann ich mich dieser Augenblicke des Entsetzens erinnern und dankbar genug seyn, daß ich jetzt in Ruhe und Sicherheit bin!
Sie blieben eine Weile vor der Thüre, verließen sie dann und gingen die Treppe hinunter. Wie lebte bey jedem Schritt, dem sie fortgingen, mein Herz auf! Ich fiel auf meine Knie, dankte Gott; daß er mich dießmahl erhalten hatte, und flehte seinen fernern Schutz an. Ich wollte eben von diesem kurzen Gebeth aufstehn, als ich plötzlich ein Lärmen in einem andern Theil des Zimmers hörte; ich sah mich um und erblickte die Thüre eines kleinen Kabinets offen, und zwey Leute kamen herein.
Sie ergriffen mich, und ich sank leblos in ihre Arme, wie lange ich in diesem Zustande blieb, weiß ich nicht; als ich wieder erwachte, sah ich mich allein und hörte verschiedne Stimmen von unten. Ich hatte Gegenwart des Geistes genug nach der Thüre des Kabinets zu laufen, meine einzige Aussicht auf Entwischung allein sie war verschlossen! Ich besann mich nun, daß es möglich wäre, daß die Kerls das Schloß an der Kammerthüre zuzuschließen vergessen hätten, welches der Stuhl befestigte; allein auch hier wurde ich betrogen. Ich rang voll Verzweiflung die Hände, und stand eine Zeitlang unbeweglich da.
Ein heftiger Lärm von unten schreckte mich auf, und bald nachher hörte ich Leute die Treppe herauf kommen. Nun glaubte ich mich verloren die Schritte kamen näher, die Thüre des Kabinets wurde wieder geöffnet. Ich stand ruhig, und sah wieder die nähmlichen Kerls herein kommen; ich vermochte weder zu sprechen, noch zu widerstehen, die Kräfte meiner Seele versanken in Fühllosigkeit, gleich wie ein heftiger Schlag auf den Körper, eine Zeitlang das Gefühl des Schmerzes vernichtet. Sie führten mich die Treppe hinunter; die Thüre eines untern Zimmers wurde aufgerissen und ich sah einen Fremden. Nunmehr kehrten meine Sinnen wieder; ich schrie und sträubte mich, wurde aber fortgeschleppt. Es ist unnöthig zu sagen, daß dieser Fremde der Herr von La Motte war; oder hinzuzufügen, daß ich ihn ewig als meinen Befreyer segnen werde.«
Adeline hörte auf zu reden. Frau von La Motte schwieg. Einige Umstände in Adelinens Erzählung erregten ihre ganze Neugierde. Sie fragte Adelinen, ob sie glaubte, daß ihr Vater an dieser seltsamen Begebenheit Antheil gehabt hätte? Ungeachtet es unmöglich war, zu zweifeln, daß er mit dabey im Spiel, oder vielmehr die Hauptperson gewesen war, glaubte doch Adeline, oder sagte wenigstens, sie spräche ihn von allen Anschlägen auf ihr Leben völlig frey.
»Allein aus was für Gründen konnte man denn eine den Anschein nach so unnütze Grausamkeit ausüben?« fragte Frau von La Motte.
Hier war die Antwort am Ende, und Adeline gestand, sie hätte darüber nachgedacht, bis sie vor allem weitern Forschen zurück geschaudert sey.
Frau von La Motte bezeugte ihr nun alle Theilnahme, die ein so außerordentliches Schicksal verdiente, und diese Äußerungen befestigten das Band gegenseitiger Freundschaft. Adeline fühlte sich durch ihre Eröffnung gegen sie erleichtert, und ihre Freundinn erkannte den Werth ihres Vertrauens durch Vermehrung ihrer Zärtlichkeit.
La Motte hatte nun über einen Monath in dieser Abgeschiedenheit zugebracht, und seine Frau genoß die Freude, ihn einige Ruhe, ja sogar Heiterkeit wieder gewinnen zu sehn. Adeline nahm an dieser Freude warmen Antheil, und mit Recht hätte sie sich schmeicheln können, wesentlich dazu beygetragen zu haben: ihr Frohsinn und seine Aufmerksamkeit hatte bewirkt, was Frau von La Mottens größere Ängstlichkeit verfehlte. La Motte schien ihren liebenswürdigen Charakter nicht zu verkennen, und dankte ihr oft wärmer, als es ihm sonst gewöhnlich war. Sie, ihrer Seits, betrachtete ihn als ihren einzigen Beschützer, und empfand die Liebe einer Tochter für ihn.
Die Zeit, welche sie in dieser friedlichen Einsamkeit zugebracht, hatte die Erinnerung an vergangne Unfälle gemildert, und ihrer Seele den natürlichen Ton wieder gegeben. Wenn einmahl ihr Gedächtniß ihre vormahligen romanhaften Erwartungen von Glückseligkeit ihr zurückrief, so beklagte sie minder ihre Vereitlung, als sie sich ihrer gegenwärtigen Ruhe und Sicherheit freute.
Allein die Zufriedenheit, welche La Mottens heitere Stimmung unter ihnen verbreitete, war nur von kurzer Dauer: er wurde plötzlich mürrisch und zurückhaltend. Die Gesellschaft der Seinigen war ihm nicht länger angenehm, und er brachte ganze Stunden in den entlegensten Gegenden des Waldes zu, der Schwermuth und geheimen Kummer hingegeben. Er ließ nicht mehr, wie sonst, seinen Unmuth ohne Zwang in andrer Gegenwart aus, sondern suchte jetzt sichtlich ihn zu verheelen, und erzwang eine Munterkeit, die zu gekünstelt war, um Glauben zu finden.
Sein Bedienter, Peter, folgte ihm entweder aus Neugier, oder aus gutmüthigem Antheil, oftmahls ungesehn in den Wald. Er bemerkte, daß er sich häufig nach einer gewissen entlegnen Gegend begab, wo er immer verschwand, ohne daß Peter, der ihm nur in der Ferne folgen durfte, sah, wo er blieb. Alle seine Bemühungen, durch Verwundrung und vereitelte Erwartung verdoppelt, blieben fruchtlos, und er mußte die Pein unbefriedigter Neugier ertragen.
Die Verändrung im Betragen ihres Mannes war zu auffallend, um von Frau von La Motte unbemerkt zu bleiben, die durch alle kleinen Kunstgriffe, welche Zärtlichkeit oder weibliche Erfindungskraft ihr eingaben, sein Vertrauen zu gewinnen suchte. Er schien unempfindlich gegen die erstere, und wich der andern aus. Da sie alle Bemühungen vergebens fand, den Trübsinn, der ihn drückte, zu zerstreuen, oder seine geheime Ursache zu erforschen, ließ sie endlich ab und suchte diesen geheimnißvollen Kummer zu ertragen.
Woche nach Woche verstrich und die nähmliche unbekannte Ursache versiegelte La Mottens Lippen und nagte an seinem Herzen. Man hatte den Ort, welchen er im Walde besuchte, nicht aufspüren können. Peter hatte oftmahls die Gegend, wo sein Herr zu verschwinden pflegte, rings um durchsucht, ohne aber eine Höhle oder heimlichen Ort, der ihn verbergen könnte, zu entdecken. Das Erstaunen des Bedienten stieg endlich zu einer unerträglichen Höhe und er theilte seiner Gebietherinn die Sache mit.
Sie verbarg den Eindruck, den es auf sie machte, vor Petern, und verwies ihm die Mittel, deren er sich zur Befriedigung seiner Neugier bedient hatte; bey sich selbst aber überlegte sie diesen Umstand, und wenn sie ihn mit der sichtlichen Veränderung, die seit kurzen in ihrem Manne vorgegangen war, verglich, so wurde ihre Unruhe erneuert, und sie verwickelte sich immer tiefer in Muthmaßungen. Nach vielem Hin- und Herdenken konnte sie keine andere Ursache ausfinden, als den Eindruck einer unerlaubten Leidenschaft, und ihr Herz, das jetzt über ihre Vernunft den Meister spielte, bestärkte sie in diesem Verdacht, und ließ sie alle Qual der Eifersucht empfinden.
In Vergleich mit diesem hatte sie bisher noch keine Leiden gekannt: sie hatte ihre liebsten Freunde und Verwandten verlassen; alle Befriedigungen des feinern Lebens, ja beynahe seine nothwendigen Bedürfnisse hingegeben — sie war mit ihrer Familie in eine Verweisung geflohn, in die traurigste und trostloseste; hatte vereint die Übel der Wirklichkeit und der Vorstellung erfahren — alles dieß hatte sie geduldig ertragen, unterstützt durch die Liebe desjenigen, für den sie litt. Wiewohl diese Zärtlichkeit seit einiger Zeit abgenommen zu haben schien, hatte sie ihre Verminderung mit Standhaftigkeit ertragen, allein die Liebe, deren Verlust sie beweinte, auf eine andere übertragen zu sehen, war ihr zu viel, und sie erlag diesem letzten Streiche des Unglücks.
Die Wirkung einer starken Leidenschaft verwirrt die Kräfte der Vernunft und gibt ihnen eine einseitige Richtung. Ihr ungetrübtes Urtheil, von keinem Einfluß des Herzens irre geleitet, würde sie wahrscheinlich einige Umstände haben sehen lassen, die mit ihrem Verdacht nicht übereinstimmten, ja ihm widersprachen. Diese Dinge sah sie nicht und entschied ohne langes Besinnen, daß Adeline der Gegenstand seiner Liebe sey. Ihre Schönheit nicht zu rechnen, wer anders als sie konnte in einem von der Welt so abgeschiedenen Orte es seyn?
Dieselbe Ursache zerstörte fast in demselben Augenblicke den einzigen Trost, den sie bisher noch hatte, und wenn sie trauerte, in La Mottens Zärtlichkeit kein Glück mehr finden zu können, trauerte sie auch, daß sie in Adelinens Freundschaft keine Zuflucht mehr fand. Sie schätzte sie zu sehr, um in ihre Redlichkeit anfangs Zweifel zu setzen, allein trotz ihrer Vernunft konnte ihr Herz doch nicht mehr mit der gewohnten Wärme sich gegen sie ergießen. Sie vermied ihre Vertraulichkeit, und so wie das geheime Brüten der Eifersucht ihren Verdacht nährte, verminderte sich, selbst im äußern Betragen, ihre Freundlichkeit.
Adeline bemerkte die Veränderung und schrieb sie anfangs dem Zufall, und nachher einer vorübergehenden Unzufriedenheit mit irgend einem Versehen, daß sie unwissend begangen haben könnte, zu: sie verdoppelte dem zufolge ihre Sorgsamkeit; da sie aber, zu ihrem großen Leidwesen, wahrnahm, daß ihre Bemühung sich gefällig zu machen, ihre gewöhnliche Wirkung verfehlte, und daß Madams Zurückhaltung mehr dadurch vermehrt, als vermindert wurde, gerieth sie in ernstliche Unruhe und nahm sich vor, eine Aufklärung zu suchen: allein dieses suchte Frau von La Motte eben so angelegentlich zu verhindern, und es gelang ihr eine Zeitlang. Doch lag Adelinen die Sache zu sehr am Herzen, um sich so leicht abschrecken zu lassen, und sie drang so inständig in ihre Freundinn, daß diese anfangs in einige Verlegenheit gerieth, endlich aber eine leere Entschuldigung vorschützte, und über die Sache lachte.
Sie sah nun, wie nothwendig es sey, allen Schein von Kälte gegen Adelinen zu unterdrücken, und wiewohl ihre Kunst die Vorurtheile der Leidenschaft nicht überwinden konnte, lehrte sie ihr doch mit leidlichem Erfolg die Miene der Freundlichkeit annehmen. Adeline wurde hintergangen und war wieder ruhig. Vertrauen in die Güte und Aufrichtigkeit anderer war ihre Schwäche. Allein die Stacheln der Eifersucht sassen zu tief im Herzen der Frau von La Motte, und sie nahm sich vor, auf irgend eine Art Vergewisserung ihres Argwohns zu suchen.
Sie ließ sich zu einer Niederträchtigkeit herab, welche sie zuvor verachtet hatte, und trug Petern auf, seines Herrn Schritte zu beobachten, um wo möglich den Ort, den er besuchte, zu entdecken. Ja so sehr gewann, durch Zeit und Nachhängen, Leidenschaft den Sieg über ihre Vernunft, daß sie zuweilen Adelinens Redlichkeit zu bezweifeln wagte, und endlich so weit ging zu glauben, La Motte könnte unter seinen Spaziergängen eine Bestellung mit ihr verbergen. Sie gerieth auf diese Vermuthung, weil auch Adeline oft lange im Walde spatzieren ging, und oft mehrere Stunden von der Abtey abwesend war. Dieser Umstand, den Frau von La Motte anfangs ihrer Liebe zur schönen Natur zuschrieb, wirkte jetzt mächtig auf ihre Einbildungskraft, und sie sah es als einen bloßen Vorwand an, den geheimen Umgang ihres Mannes zu suchen.
Peter säumte nicht den Befehlen seiner Gebietherinn zu gehorchen, die von seiner eigenen Neugier auf das wärmste unterstützt wurden. All sein Bemühen war fruchtlos: er getraute sich nie, seinem Herrn nahe genug zu folgen, um den letzten Ort seines Verbergens zu erforschen. Madams Ungeduld wurde durch Warten erhöht, ihre Leidenschaft durch Schwierigkeit befeuert, und sie beschloß, von ihrem Manne selbst Erläuterung seines Betragens zu fordern.
Nach einigem Überlegen, auf welche Art sie es am besten angreiffen sollte, ging sie zu ihm; als sie aber in das Zimmer trat, wo er in tiefem Nachsinnen saß, vergaß sie ihre künstliche Anrede, fiel ihm zu Füßen und verlor sich einige Augenblicke in Thränen. Befremdet durch ihre Stellung und Betrübniß fragte er nach der Ursache, und erhielt zur Antwort, daß sie in seinem eigenen Betragen läge.
»In meinem Betragen? — Wie so?« sagte er.
»Ihre Zurückhaltung, Ihr geheimer Kummer und öftere Abwesenheit von der Abtey.«
»Ist es denn so sehr zu verwundern, daß ein Mann, der beynahe alles verlor, zu Zeiten sein Unglück beklagt? oder so strafwürdig, wenn er seinen Schmerz verbirgt, daß diejenigen, denen er den peinlichen Antheil daran ersparen will, ihm Vorwürfe machen müssen?«
Mit diesen Worten ging er aus dem Zimmer und verließ seine Frau in Erstaunen verloren, doch etwas erleichtert vom Druck ihres vorherigen Argwohns, wiewohl sie noch immer Adelinen mit forschendem Auge verfolgte und oft, wenn die Maske der Freundlichkeit abfiel, Spuren von Mißtrauen entdeckte.
Adeline, ohne selbst deutlich zu wissen warum, fühlte sich weniger froh und zufrieden in ihrer Nähe als sonst; ihre Heiterkeit verschwand, und sie beweinte oft, wenn sie allein war, ihren hülflosen Zustand. Vormahls verschwand die Erinnerung ihres vergangenen Leidens in Frau von La Mottens Freundschaft; jetzt aber, wiewohl ihr Betragen zu fein war, um auffallende Unarten zuzulassen, hatte sie ein gewisses Wesen, welches Adelinens Hoffnung niederschlug, wenn sie gleich nicht im Stande war, es zu erklären. —
Ein Umstand, der sich bald ereignete, hob eine Weile der Frau von La Motte Eifersucht auf und riß ihren Mann aus seiner finstern Betäubung.
Peter kam eines Tages von seiner Wanderschaft nach Auboine mit einer Nachricht zurück, die neue Furcht und Besorgniß in La Motten erregte.
»O gnädiger Herr, ich habe etwas gehört, das mich in Bestürzung gesetzt hat, so wie es auch Sie erschrecken wird, wenn Sie es erst erfahren. Als ich vor des Schmidts Thüre stand, indeß der Schmidt meinem Pferde ein Hufeisen anlegte (im Vorbeygehen zu sagen, es verlor es auf eine seltsame Art, wie ich Ihnen erzählen will) —«
»O ich bitte dich, laß das gut seyn, und komm nur zur Sache.«
»Nun also, gnädiger Herr, als ich vor des Grobschmidts Hause stehe, kommt ein Mann mit einer Pfeife im Munde, und einer großen Tabaksblase in der Hand, setzt sich auf die Bank, legt die Pfeife aus dem Munde und sagt zu dem Schmidt: ›Nachbar, kennt ihr einen gewissen La Motte hier in der Gegend?‹ — Bey meiner Treue, Ihro Gnaden, mich überfiel ein kalter Schweiß — wie? wird Ihnen nicht wohl? soll ich Ihnen etwas hohlen?«
»Nein, nein, fasse dich nur kurz.«
»›La Motte? La Motte?‹ sagte der Schmidt. ›Es ist mir als hätte ich den Nahmen gehört.‹ ›So,‹ sagte ich, ›so habt Ihr viel gehört, denn meines Wissens, ist hier niemand in der Nähe, der diesen Nahmen führt.‹«
»Verwünscht, warum mußtest du das sagen?«
»Weil ich sie nicht wissen zu lassen brauchte, daß Ihro Gnaden sich hier aufhielten, und hätte ich es nicht sehr klug angefangen, so würden sie mich doch ertappt haben. ›Meines Wissens ist hier niemand des Nahmens in der Nähe,‹ sagte ich — ›Ey seht doch,‹ antwortete der Schmidt, ›Ihr wißt wohl besser Bescheid hier als ich?‹ ›Ja,‹ sagte der Mann mit der Pfeife, ›so scheint es. Wie seyd Ihr denn in der Gegend so bekannt geworden? Ich lebe auf künftigen Michaelis sechs und zwanzig Jahre hier, und Ihr wißt mehr als ich?‹
Mit diesen Worten nahm er die Pfeife wieder in den Mund und blies mir den vollen Dampf ins Gesicht. So wahr ich lebe, Ihro Gnaden, ich zitterte am ganzen Leibe. ›Ja, was das betrifft,‹ sagte ich, ›so weiß ich nicht mehr als andere Leute auch, allein ich hörte noch niemahls einen solchen Nahmen nennen.‹ — ›Sagt mir doch,‹ fing der Grobschmidt an, und glotzte mir starr ins Gesicht, ›seyd Ihr nicht der nähmliche, der sich vor einiger Zeit so genau nach der St. Clairs Abtey erkundigte?‹ ›Nun,‹ sagte ich, ›und wenn auch, was folgt denn daraus?‹ ›Je nun, es heißt, daß sich jetzt jemand in der Abtey aufhält,‹ sagte der Mann zu dem andern, ›und das könnte ja wohl dieser nähmliche La Motte seyn.‹ ›Ja, ja, ich setze mein Leben darauf,‹ antwortete dieser, ›daß eben dieser La Motte sich jetzt in der Abtey aufhält.‹ ›Da irrt Ihr euch gewaltig,‹ fing ich an, ›denn er hält sich jetzt nicht mehr da auf.‹«
»Verfluchter Esel!« rief La Motte »warum hieltst du nicht dein Maul? aber geschwind, was wurde daraus?«
»›Mein Herr hält sich jetzt nicht mehr da auf,‹ sagte ich. ›So so,‹ sagte der Mann mit der Pfeife: ›es ist also euer Herr? Ey so sagt mir doch, seit wenn ist er fort, und wo ist er denn jetzt?‹ ›Halt,‹ sagte ich, ›nicht so geschwind: ich weiß wenn ich reden, und wenn ich das Maul halten muß — Aber wer hat denn nach ihm gefragt.‹
›Wie, er erwartet also, daß jemand nach ihm fragt?‹ sagte der Mann. ›Das eben nicht,‹ sagte ich, ›aber wenn auch, was folgte daraus?‹ — Er sah hierauf den Schmidt an, und sie gingen beyde mit einander in das Haus und ließen mein Pferd unbeschlagen stehen. Ich nicht faul, und jagte davon, so geschwind ich konnte; allein in der Angst, Ihro Gnaden, vergaß ich den Umweg zu nehmen, und kam gerades Wegs hierher.«
La Motte in äußerster Bestürzung über Peters Nachricht, antwortete weiter nichts, als daß er seine Dummheit verwünschte, und ging sogleich, um Madame aufzusuchen, die mit Adelinen am Flusse spazieren ging. Er war in zu großer Unruhe, um lange Einleitung zu machen.
»Wir sind entdeckt,« rief er, »die Gerichtsdiener haben zu Auboine nach mir gefragt, und Peter hat mich in das Verderben geplaudert!«
Er erzählte ihr darauf alles, und bat sie, sich anzuschicken, die Abtey zu verlassen.
»Aber wohin können wir fliehen,« sagte Frau von La Motte, die sich kaum aufrecht halten konnte.
»Wohin es auch sey, hier zu bleiben ist gewisses Verderben. Ich denke, wir müssen in der Schweitz Zuflucht suchen. Wenn ich in einer Gegend von Frankreich hätte verborgen bleiben können, so wäre es gewiß hier gewesen.«
»Gott, wie werden wir verfolgt!« erwiederte Madam. »Kaum haben wir diesen Aufenthalt menschlich gemacht, so müssen wir ihn schon wieder verlassen, ohne zu wissen, wohin wir gehen!«
»Ich wünsche nur, wir mögen es nicht wissen!« antwortete La Motte, »das ist das geringste Übel, welches uns droht. Laßt uns nur dem Gefängniß entwischen, so ist es mir eines, wohin wir gehen. Aber gehen Sie nur geschwind nach der Abtey zurück und packen Sie ein, was sich fortbringen läßt.«
Ein Strom von Thränen kam der armen Frau zu Hülfe, und schweigend und zitternd hing sie sich an Adelinens Arm. Adeline, wiewohl sie keinen Trost zu ertheilen hatte, suchte sich zu fassen, und ruhig zu scheinen.
»Kommen Sie,« sagte La Motte, »wir verderben nur Zeit; lassen Sie uns nachher klagen; jetzt wollen wir uns zur Flucht anschicken. Biethen Sie doch ein wenig von der Stärke auf, die zu unserer Rettung so nöthig ist. Adeline weint nicht, und doch ist sie eben so übel daran als Sie: denn ich weiß nicht, wie lange ich sie werde beschützen können.«
Ungeachtet ihres Schreckens traf dieser Vorwurf den Stolz der Frau von La Motte. Sie trocknete ihre Thränen, und sah Adelinen mißfällig an.
So wie sie schweigend nach der Abtey gingen, fragte Adeline Herrn La Motte, ob er auch gewiß wüßte, daß es Gerichtsdiener gewesen wären, die nach ihm gefragt hätten?
»Ich darf nicht daran zweifeln,« erwiederte er, »wer sonst könnte nach mir fragen? Zudem setzt das Betragen des Mannes, der meinen Nahmen nennte, die Sache außer Zweifel.«
»Vielleicht doch wohl nicht,« sagte Madame, »lassen Sie uns bis morgen warten, ehe wir fortgehen; wer weiß ob wir es dann nicht unnöthig finden.«
»Ohne Zweifel, die Gerichtsdiener werden bis dahin uns eben das gesagt haben.«
Er ging, um Petern Befehl zu geben.
»In einer Stunde fort?« sagte Peter, »Gott sey bey uns, Ihro Gnaden! Bedenken Sie doch nur das Kutschenrad, es würde wenigstens einen Tag erfordern, es auszubessern, denn Sie wissen, daß es das erste in meinem Leben ist.«
An diesen Umstand hatte La Motte gar nicht gedacht. Anfangs, als sie sich auf der Abtey niederließen, war Peter mit dem Ausbessern der Zimmer zu beschäftigt gewesen, um an den Wagen zu denken, und nachher hatte er in der Meinung, daß es so geschwind nicht nöthig seyn würde, es anstehen lassen. Alle Geduld verließ jetzt La Motten, und unter vielen Flüchen über Peters Nachläßigkeit befahl er ihm, sogleich an die Arbeit zu gehen; allein als man nach den Werkzeugen suchte, waren sie nirgends zu finden, und Peter besann sich — obschon er klug genug war diesen Umstand bey sich zu behalten, daß er die Nägel zum Ausbessern der Abtey verbraucht hatte.
Es war folglich unmöglich, diese Nacht den Wald zu verlassen, und es blieb nichts übrig, als einen Ort auszufinden, wo man sich am besten verbergen könnte, falls die Gerichtsdiener noch vor Morgen die Ruinen besuchten, ein Umstand, den des unbedachtsamen Peters Rückkehr auf dem geraden Wege von Auboine, nicht unwahrscheinlich machte.
Zwar kam ihm zuerst der Gedanke, daß, wenn auch seine Familie nicht fort könnte, ihn nichts abhielte, ein Pferd zu nehmen und vor Nachts aus dem Walde zu entwischen: allein er mußte demungeachtet in den Städten, durch die er kam, entdeckt zu werden fürchten, und bey alle dem konnte er doch die Vorstellung nicht gut ertragen, die Seinigen unbeschützt zurückzulassen, ohne zu wissen, wann er wieder zu ihnen zurückkehren, oder sie anweisen konnte, ihm zu folgen. La Motte war kein Mann von fester Entschlossenheit, und vielleicht war es ihm minder unangenehm, in Gesellschaft, als allein zu leiden.
Nach vielem Besinnen erinnerte er sich der Fallthüre des Kabinets, das an die obern Zimmer stieß: sie war dem Auge unsichtbar, und wohin sie auch führte, mußte sie doch gewiß wenigstens ihn, vor Entdeckung sichern. Nachdem er die Sache reifer erwogen hatte, beschloß er, den Abgrund, wohin die Treppen führten, zu untersuchen, und hielt es für möglich, daß auf eine kurze Zeit seine ganze Familie dort verborgen werden könnte. Es verstrich wenig Zeit zwischen dem Fassen des Plans und der Ausführung: die Dunkelheit brach an, und er glaubte in jedem Rauschen des Windes die Stimmen seiner Feinde zu hören.
Er ließ sich ein Licht geben und begab sich allein in das Zimmer. Es dauerte eine ganze Weile, ehe er die Fallthüre im Kabinet finden konnte, so genau paßte sie in die Fugen. Endlich fand er sie und hob sie auf. Die feuchten Dünste der lange eingesperrten Luft drangen aus der Öffnung hervor, und er blieb einige Augenblicke stehen, um sie herauszulassen, ehe er hinunter stieg. So wie er da stand, und in den Abgrund schaute, erinnerte er sich an die Geschichte, welche Peter von der Abtey erzählt hatte, und sie erregte in ihm eine gewisse Beklemmung, machte aber bald richtigern Rücksichten auf seine dringende Lage Raum.
Die Treppen waren steil, und schwankten an manchen Stellen unter seinen Füßen. Nachdem er eine Weile herunter gestiegen war, berührten seine Füße die Erde, und er fand sich in einem engen Gange; so wie er sich aber umdrehte, ihn zu verfolgen, kräuselten sich die feuchten Dünste um ihn und löschten das Licht aus. Er rief laut nach Peter, aber niemand konnte ihn hören, und mit vieler Mühe fand er die Treppe wieder, ging mit behutsamen Schritten hinauf, und verließ den Thurm.
Die Sicherheit, welche der eben verlaßne Ort zu versprechen schien, war zu wichtig, um so leicht aufgegeben zu werden, und er beschloß, unverzüglich noch einen Versuch zu machen. Er befestigte das Licht in einer Laterne, und stieg zum zweytenmahl den Weg hinab. Die Dünste hatten durch das Öfnen der Thüre sich vermindert, die eingelaßne frische Luft war in Umlauf gekommen und La Motte stieg ungehindert hinunter.
Der Gang war sehr lang und führte ihn zu einer befestigten Thüre. Er stellte die Laterne in einige Entfernung, damit der Zug sie nicht auslöschte, und setzte alle seine Kräfte an die Thüre: sie schüttelte unter seinen Händen, wich aber nicht. Bey näherer Untersuchung fand er, daß das Holz um das Schloß vermodert war, und dieß munterte ihn auf, es weiter zu versuchen. Nach einiger Zeit wich sie seiner Gewalt, und er befand sich in einem viereckigten steinernen Zimmer.
Er stand eine Weile still, um es zu übersehen. Die Mauern, die von Feuchtigkeit träuften, waren ganz kahl und hatten nicht einmahl ein Fenster. Nur ein schmales eisernes Gitter ließ die Luft ein. Am andern Ende, nahe bey einer Vertiefung, war noch eine Thüre. La Motte ging darauf zu und sah im Vorübergehen in die Gruft. Auf dem Boden stand ein großer Kasten — er hob den Dekel auf und sah die Überreste eines menschlichen Gerippes. Entsetzen bemeisterte sich seiner, er wich unwillkührlich zurück. Bald verschwanden diese ersten Regungen; die dringende Neugier, welche Gegenstände des Schreckens so oft in uns erregen, trieb ihn an, diesen traurigen Anblick zum zweytenmahle zu untersuchen.
La Motte stand bewegungslos da: dieser Gegenstand schien das Gerücht von einem hier ermordeten Menschen zu bestätigen. Endlich machte er den Kasten zu und ging zu der zweyten Thüre, die ebenfalls verschlossen war, in der aber der Schlüssel steckte. Er drehte ihn mühsam um und fand die Thüre noch mit zwey starken Riegeln verwahrt. Nachdem er sie zurückgeschoben hatte, sah er eine Reihe Stuffen, die er hinabstieg: sie endigten in einer Reihe tiefer Gewölbe, oder vielmehr Zellen, die, nach ihrem Bau und Zustande zu urtheilen, zu den ältesten Theilen der Abtey zu gehören schienen. La Motte hielt sie bey seiner damahligen Gemüthstimmung für Grabmähler der Mönche, die vormahls das obere Gebäude bewohnten; allein sie waren mehr zu Orten der Buße für Lebendige, als zur Ruhe für die Todten eingerichtet.
Am Ende der Zellen wurde der Weg wieder durch eine Thüre geschlossen. La Motte war unschlüssig, ob er noch weiter gehen sollte. Der Ort, wo er war, schien die gesuchte Sicherheit zu geben. Er konnte hier die Nacht, ohne Furcht entdeckt zu werden, zubringen, und es war zu vermuthen, daß die Gerichtsdiener, wenn sie in der Nacht kämen und die Abtey leer fänden, sie vor Tages Anbruch, oder ehe er genöthigt war, aus seinem geheimen Orte hervorzugehen, wieder verlassen würden. Diese Betrachtungen gaben ihm wieder Muth; seine einzige Sorge war nur, seine Familie so bald möglich hieher zu bringen, ehe die Gerichtsdiener sie unvermuthet überfielen, und er warf sich selbst vor, daß er die Zeit mit Dastehen versäumte.
Allein ein unwiderstehliches Verlangen zu wissen, wohin die Thüre führte, hielt seine Schritte auf, und er drehte sich um, in der Absicht, sie zu öffnen: sie war befestigt, und indem er sie aufzusprengen versuchte, glaubte er plötzlich ein Geräusch von oben zu hören. Er hielt es für möglich, daß die Gerichtsdiener schon da wären, und verließ eilends die Zellen, um an der Fallthüre zu horchen.
Zu einer großen Bestürzung sah er, daß er sie offen gelassen hatte, und als er eilends hinauf stieg um sie zuzumachen, hörte er Fußtritte durch die obern Zimmer heran nahen. Ehe er tief genug wieder herabsteigen konnte, sah er noch einmahl herauf, und sah durch die Öffnung einen Menschen, der auf ihn herabblickte:
»Gnädiger Herr!« rief Peter.
La Motte erhohlte sich bey dem Tone dieser Stimme, so aufgebracht er auch war, daß Peter ihm solches Schrecken verursacht hatte.
»Was willst du hier, und was gibt es unten?« —
»Nichts, gnädiger Herr, gar nichts; die gnädige Frau schickte mich nur, um nach Ihnen zu sehen.«
»Es ist also niemand unten?« fragte La Motte, indem er den Fuß auf die obere Stuffe setzte.
»O ja, meine gnädige Frau, Fräulein Adeline, und« —
»Gut, gut,« sagte La Motte hastig, »geh nur deiner Wege, ich komme schon.«
Er erzählte der Frau von La Motte, wo er gewesen war, daß er einen sichern Ort gefunden hätte, und ging nun über die Mittel zu Rathe, die Gerichtsdiener, im Fall sie kämen, zu überzeugen, daß er die Abtey verlassen hätte. Zu diesem Ende befahl er, alle tragbare Geräthschaft nach den untern Zellen zu bringen. Er leistete selbst hülfreiche Hand, und alles mußte helfen. In kurzer Zeit war der wohnbare Theil des Gebäudes fast eben so öde wieder als er ihn gefunden hatte.
Er befahl nun Petern, die Pferde eine Strecke von der Abtey zu führen und frey lauffen zu lassen. Auf einmahl fiel ihm bey, daß er die Leute am besten irre führen könnte, wenn er an einer in die Augen fallenden Stelle eine Innschrift anbrächte, worin er seine Lage und des Tages seiner Abreise von der Abtey erwähnte. Dem zu Folge grub er über der Thüre des Thurms, der zu dem wohnbaren Theile führte, folgende Zeilen ein:
»O ihr, die ein unglückliches Schicksal
nach diesem Orte führt, vernehmet, daß
es noch andere eben so Unglückliche gibt!
P—L—M —
ein unglücklicher Verbannter, suchte in diesen Mauern
Zuflucht vor Verfolgung am 27ten Aprill 1658,
und verließ sie am 12ten July desselben Jahres,
um einen bequemern Schutz zu suchen.«
Nachdem er mit einem Messer diese Worte eingegraben hatte, wurde der kleine Überrest von Mundvorrath (denn Peter war in der Angst unbefrachtet von seiner letzten Reise zurückgekommen) in einen Korb gepackt, und sie stiegen sämmtlich den Thurm hinan und gingen durch die Zimmer in das Kabinet. Peter ging mit dem Licht voran und fand mit einiger Mühe die Fallthüre. Frau von La Motte schauderte, als sie den finstern Abgrund sah; doch schwieg alles.
La Motte nahm nun das Licht und führte den Weg; seine Frau folgte, und nach ihr Adeline.
»Diese alten Mönche tranken so gern guten Wein, als andere Leute,« sagte Peter, der den Zug beschloß, »ich wette, Ihro Gnaden, daß dieß ihr Keller war; mich dünkt, ich rieche schon die Fässer.«
»Still,« sagte La Motte, spare deine Späße auf eine andere Zeit. Hier ist nicht der Ort dazu.«
Sie kamen an das gewölbte Zimmer. Der traurige Anblick, den er an diesem Orte gesehen hatte, hielt La Motte ab, die Nacht hier zuzubringen, und die Möbeln wurden auf seinen Befehl in die untern Zellen gebracht. Er suchte zu verhindern, daß seine Familie das Skelet nicht sähe; ein Gegenstand, der höchst wahrscheinlich einen Abscheu erregen mußte, den sie vielleicht nicht sobald wieder verloren hätten. Er ging schnell vor dem Kasten vorüber, und seine Frau und Adeline waren zu ängstlich mit sich selbst beschäftigt, um auf äußere Gegenstände zu achten.
Als sie die Zellen erreichten, weinte Frau von La Motte, sich nach einem so schrecklichen Orte begeben zu müssen.
»Großer Gott,« rief sie, »ist es wirklich so weit mit uns gekommen! Die obern Zimmer schienen mir ehemahls eine klägliche Wohnung zu seyn, aber gegen diese sind sie ein Pallast.«
»Das ist wohl wahr, meine Liebe, aber lassen Sie die Erinnerung, was sie Ihnen vormahls schienen, jetzt ihr Mißfallen lindern: diese Zellen sind auch ein Pallast gegen Bicetre oder die Bastille, und die Schrecknisse fernerer Strafe, die damit verbunden seyn würden: lassen Sie die Furcht vor dem größern Übel Sie die kleinern ertragen lehren: ich bin zufrieden, wenn wir hier die gesuchte Zuflucht finden.«
Frau von La Motte schwieg, und Adeline, die ihre vorige Unfreundlichkeit vergaß, suchte sie so viel in ihren Kräften war, zu trösten; während ihr eigenes Herz unter dem Elende erlag, das sie voraus ahnden mußte, schien sie gefaßt, ja sogar heiter. Sie bewies der Frau von La Motte die sorgfältigste Aufmerksamkeit und fühlte sich so dankbar, daß La Motte jetzt in dieser Höhle gesichert war, daß sie beynahe die Finsterniß und Ungemächlichkeit derselben vergaß.
Sie äußerte ihm dieß ganz kunstlos und er konnte nicht unempfindlich gegen ihre Zärtlichkeit seyn. Auch Frau von La Motte fühlte sie und eine schmerzhafte Empfindung wurde neu erregt. Sie mißdeutete die Ergießungen des Danks für Zärtlichkeit.
La Motte ging oft nach der Fallthüre zurück, um zu sehen, ob jemand in der Abtey wäre; kein Laut aber unterbrach die Stille der Nacht; endlich setzten sie sich, um ein trauriges Abendessen zu verzehren.
»Wenn die Gerichtsdiener sich heute nicht sehen lassen,« sagte Frau von La Motte, »wäre es dann nicht gut, wenn Peter morgen nach Auboine zurückginge? Vielleicht hört er mehr von der Sache, oder wenigstens könnte er einen Wagen schaffen, uns von hier zu bringen.«
»Unfehlbar!« versetzte La Motte mürrisch, »und auch Leute dazu. Peter wäre gerade die rechte Person, um den Gerichtsdienern den Weg zu zeigen, und sie von dem zu benachrichtigen, was sie noch etwa bezweifeln könnten.«
»Wie grausam ist dieser Spott,« versetzte Frau von La Motte. »Ich schlug nur vor, was ich zu unserem gemeinschaftlichen Besten gut glaubte; vielleicht war mein Urtheil unrichtig, aber meine Absicht war gewiß gut.«
Thränen traten ihr bey diesen Worten in die Augen. Adeline wünschte sie zu trösten, allein Delikatesse hielt sie ab. La Motte bemerkte die Wirkung seiner Worte, und fühlte einen geheimen Vorwurf. Er ging auf sie zu und faßte sie bey der Hand.
»Sie müssen mir die Verstörung meines Gemüths zu Gute halten, meine Liebe; ich wollte Sie nicht betrüben: der Gedanke, Petern nach Auboine zu schicken, wo er schon so viel Unfug angerichtet hat, verdroß mich, und ich konnte nicht umhin, es zu äußern. Nein, meine Liebe, unsere einzige mögliche Sicherheit ist jetzt zu bleiben, wo wir sind, so lange unser Vorrath dauert. Wenn die Gerichtsdiener heute nicht kommen, so werden sie es morgen, oder vielleicht übermorgen. Haben sie die Abtey durchsucht, ohne mich zu finden, so werden sie abziehen: dann können wir uns aus diesem Schlupfwinkel hervorwagen, und Maßregeln nehmen, in ein entferntes Land zu gehen.«
Frau von La Motte gestand, daß er Recht hatte; und da ihr Herz durch seine kleine Entschuldigung erleichtert war, gab sie sich völlig zufrieden. Nach verzehrter Mahlzeit stellte La Motte den treuen, wenn gleich einfältigen Peter zur Wache für die Nacht an die Treppe, die zur Fallthüre führte, und kehrte dann nach den untern Zellen zurück, wo er seine kleine Gesellschaft gelassen hatte. Die Betten wurden gemacht, man wünschte sich eine traurige gute Nacht und legte sich nieder, um vergebens den Schlaf zu suchen.
Adelinens Gedanken waren zu beschäftigt, um ihr Ruhe zuzulassen, und sobald sie ihre Gefährten eingeschlafen glaubte, hing sie ihren Kummer ungestört nach. Auch sie mußte der Zukunft mit den traurigsten Besorgnissen entgegen sehen. Wenn La Motte ergriffen wurde, was sollte dann aus ihr werden? Sie sah sich wieder in die weite Welt geworfen, ohne Freunde, sie zu schützen, ohne Geld, sich fortzuhelfen — die Aussicht war trübe — schrecklich! — Sie schauderte davor zurück: auch ihrer Freunde Noth, die sie zärtlich liebte, ging ihr tief zu Herzen.
Zuweilen dachte sie an ihren Vater zurück, aber sie sah in ihm nur einen Feind, vor dem sie fliehen mußte: dieser Gedanke erhöhte ihre Traurigkeit, doch betrübte sie nicht sowohl die Erinnerung an das Leiden, was er ihr auferlegt hatte, als das Gefühl seiner Unzärtlichkeit. Sie weinte bitterlich; endlich rief sie mit der kunstlosen Frömmigkeit, welche nur die Unschuld kennt, das höchste Wesen an und gab sich in seinen Schutz. Nach und nach wurde ihre Seele ruhig und getröstet, und bald sank sie in Schlummer.
Die Nacht verstrich ohne alle Störung. Peter war auf seinen Posten geblieben und hörte nichts, was seinen Schlaf verhinderte. La Motte hörte ihn lange vorher, ehe er ihn sah, wohllautend schnarchen, wiewohl nicht zu läugnen war, daß mehr vom Baß, als von einem anderen Theil der Scala der herrschende Ton seiner Musik war. Er wurde bald durch ein Bravo von La Motten erweckt, dessen Stimme Misklang in seine Ohren tönte, und die Betäubung seiner Ruhe zernichtete.
»Gott sey bey uns, gnädiger Herr! was gibts?« rief Peter erwachend. »Sind sie gekommen?«
»Ja, dir unbeschadet hätten sie es immer gekonnt. Was zum Teufel stellte ich dich hieher, um zu schlafen?«
»Mit Vergunst, gnädiger Herr, Schlaf ist noch das Beste, was man hier haben kann; ich wollte ihn an einem solchen Orte gewiß keinem Hunde verwehren.«
La Motte befragte ihn scharf, ob er in der Nacht nichts gehört hätte? und Peter verneinte es auf das kräftigste: eine Aussage nach der strengen Wahrheit, denn er hatte die ganze Zeit in tiefem Schlafe gelegen.
La Motte stieg bis zur Fallthüre hinauf und lauschte aufmerksam. Man hörte keinen Laut, und als er es wagte, sie aufzuheben, schien ihm das helle Sonnenlicht in das Gesicht. Er schlich leise durch die Zimmer und sah durch das Fenster; niemand war zu erblicken. Aufgemuntert durch diese anscheinende Sicherheit, wagte er sich die Treppe des Thurms herunter und, ging in das erste Zimmer. Er wollte nach dem zweyten gehen, als er sich plötzlich besann, und erst durch die Ritze der halb offnen Thüre blickte. Er sah deutlich einen Menschen, der, den Kopf auf den Arm gestützt, am Fenster saß.
Diese Entdeckung machte ihn so betroffen, daß er auf einen Augenblick alle Gegenwart des Geistes verlor, und durchaus unfähig war, sich von der Stelle zu rühren. Der Mensch, der ihm den Rücken zugekehrt hatte, drehte sich um. La Motte faßte sich, verließ das Zimmer so schnell und leise als möglich, und stieg nach dem Kabinet hinauf: er öffnete die Fallthüre, allein indem er sie zumachte, hörte er die Schritte eines Menschen, der in das äußere Zimmer trat. Die Thüre hatte weder Riegel noch andere Befestigungen und seine Rettung hing einzig von ihrem genauen Einpassen in die Fugen ab. Die äußere Thüre des Steinzimmers konnte gar nicht, und die innere nur von der äußern Seite verschlossen werden.
Sobald er dieß Zimmer erreicht hatte, stand er still und horchte aufmerksam — er hörte Fußtritte oben im Kabinet — eine Stimme rief ihn beym Nahmen, und er floh schnell in die untern Zellen, in augenblicklicher Erwartung die Fallthüre aufgehoben und sich erhascht zu sehen — er war nun so weit geflohen, daß er nichts mehr hören konnte. Er warf sich am äußersten Ende der Gewölbe auf die Erde, und lag lange athemlos vor Angst.
Frau von La Motte und Adeline fragten in äußerster Bestürzung, was geschehen sey? Es dauerte lange, ehe er die Sprache wieder erhielt, und als es geschah, war es beynahe überflüßig: denn das ferne Geräusch, was von oben tönte, verrieth ihnen einen Theil der Wahrheit.
Die Töne schienen nicht näher zu kommen, allein Frau von La Motte, unvermögend, ihrem Schrecken zu gebiethen, schrie laut: dieses verdoppelte La Mottens Verzweiflung.
»Sie haben mich zu Grunde gerichtet, dieser Schrey hat verrathen, wo ich bin.«
Mit gerungenen Händen, und schnellen Schritten lief er die Zelle auf und ab. Adeline stand bleich und stumm wie der Tod, und hielt Frau von La Motte, die einer Ohnmacht nahe war.
»O Düpras, Düpras, du bist schon gerecht!« rief er in einem Tone, der aus dem Herzen zu dringen schien. »Aber warum,« sagte er nach einigen Augenblicken des Schweigens, »warum soll ich mich noch mit der Hoffnung auf Entfliehen täuschen? Warum warte ich sie hier ab? Lieber laßt mich diese peinigende Qual endigen und mich ihnen auf einmahl in die Hände werfen.«
Er ging auf die Thüre zu, aber seine Frau hielt ihn zurück.
»Bleiben Sie,« rief sie in Todesangst, »um meinetwillen bleiben Sie. Verlassen Sie mich doch nicht so, und stürzen sich nicht muthwillig in das Verderben.«
»Gewiß,« sagte Adeline, »Sie sind zu übereilt: diese Verzweiflung ist eben so fruchtlos als ungerecht. Wir hören niemand kommen, wenn die Leute die Fallthüre entdeckt hätten, würden sie längst hier seyn.«
Adelinens Worte stillten den Aufruhr in seinem Innern; seine Angst ließ nach, und Vernunft zündete der Hoffnung einen schwachen Strahl an. Er lauschte nochmahls, und da er alles still fand, ging er behutsam nach dem Steinzimmer und von da bis an die Treppe zur Fallthüre. Sie war zu, kein Laut ließ sich oben hören.
Er wartete lange; die Stille dauerte fort; er fing endlich wieder an zu hoffen, und fand es wahrscheinlich, daß die Gerichtsdiener die Abtey verlassen hätten: doch wurde der Tag in ängstlicher Wachsamkeit hingebracht. Er getraute sich nicht die Fallthüre aufzuheben und glaubte oft fernes Geräusch zu hören. Indessen schien so viel gewiß, daß das Geheimniß mit dem Kabinet nicht entdeckt war, und auf diesem Umstand baute er mit Recht seine Sicherheit.
Die folgende Nacht verstrich gleich dem Tage in zitternder Hoffnung und unablässigen Wachen. Allein die Bedürfnisse des Hungers drohten ihnen jetzt. Der Vorrath, der mit der schärfsten Ökonomie ausgetheilt worden war, war beynahe verzehrt und sie mußten die traurigsten Folgen erwarten, wenn sie sich noch länger in dieser Einsamkeit verborgen hielten. Unter solchen Umständen überlegte La Motte, wie sie am klügsten verfahren sollten. Es schien kein anderer Ausweg, als Petern nach Auboine zu schicken, die einzige Stadt, von wo er in der für ihre Noth erforderlichen Zeit zurückkommen konnte. Zwar war Wildpret genug im Walde, allein Peter konnte weder mit Schiessen noch Angeln umgehen.
Es wurde demnach ausgemacht daß er nach Auboine gehen sollte, um Proviant zu hohlen und zugleich Werkzeug zum Ausbessern des Kutschrades mitzubringen, damit sie einen Wagen bereit hätten, sie aus dem Walde zu schaffen. La Motte verboth Petern, sich auf irgend eine Art nach den Leuten, die nach ihm gefragt hatten, zu erkundigen, oder herausbringen zu wollen, ob sie die Gegend verlassen hätten, damit seine Dummheit ihn nicht wieder verriethe. Er schärfte ihm ein, gänzliches Stillschweigen über alle diese Dinge zu beobachten, seine Sache auszurichten und den Ort mit aller möglichen Eile zu verlassen.
Indessen war noch eines zu bedenken: wer sollte sich zuerst in die Abtey wagen, um zu sehen, ob die Gerichtsdiener sie verlassen hätten? La Motte erwog, daß er durchaus verrathen werden müßte, wenn er sich noch einmahl sehen ließe, welches nicht so ausgemacht war, wenn einer von den andern gesehen ward: doch war es nothwendig, daß die abgeschickte Person Muth genug hätte, Fragen auszuhalten, und Klugheit genug, um sie vorsichtig zu beantworten. Peter hatte vielleicht das erste, am andern aber fehlte es ihm gänzlich. Annette besaß keines von beyden.
La Motte sah seine Frau an, und fragte sie, ob sie für ihn sich zu wagen getraute? Ihr Herz erbebte vor dem Antrage, doch mochte sie ihn nicht ablehnen oder gleichgültig bey etwas scheinen, das zur Sicherheit ihres Mannes so nothwendig war. Adeline las in ihrem Gesichte die Erschütterung ihres Innern, sie überwand die Furcht, die sie bisher stillschweigend hielt und erboth sich zu gehen.
»Sie werden mir nicht so leicht etwas zufügen; als einem Manne,« sagte sie. Schaam ließ La Motten nicht zu, ihr Erbiethen anzunehmen, und Madame, durch ihre Großmuth gerührt, fühlte auf einen Augenblick alle ihre vorige Neigung für sie wieder aufleben. Adeline drang mit so vieler Wärme und schien so ernstlich entschlossen, daß La Motte wankte.
»Sie retteten mich einst von der augenscheinlichsten Gefahr,« sagte sie, »und Ihre Güte hat mich seitdem geschützt. Verweigern Sie mir nicht die Freude, Ihre Güte durch dankbare Erwiederung zu verdienen. Lassen Sie mich in die Abtey gehen, und wenn ich dadurch ein Übel von Ihnen abwende, so werde ich reichlich für die kleine Gefahr, der ich mich aussehe, belohnt seyn.«
Frau von La Motte konnte bey Adelinens Worten sich kaum der Thränen enthalten, und La Motte sagte mit einem tiefen Seufzer:
»So sey es denn, Adeline, und von diesem Augenblick an betrachten Sie mich als Ihren Schuldner.«
Sie nahm sich nicht die Zeit, ihm zu antworten, sondern ergriff ein Licht und verließ eilends die Zellen. La Motte folgte ihr, um die Fallthüre aufzuheben, und sie nochmahls zur Behutsamkeit anzumahnen.
»Gott geleite Sie,« sagte er, »ich kann es nicht; und Ihre eigene Geistesgegenwart möge Ihnen helfen.«
Als sie fort war, machte nach und nach Frau von La Mottens Bewunderung ihrer Geistesgegenwart, andern Betrachtungen Platz. Mißtrauen untergrub ihr Wohlwollen und Eifersucht stieg mit neuem Verdacht auf.
»Es mußte wohl ein mächtigers Gefühl als bloße Dankbarkeit seyn,« dachte sie, »das Adelinens Furcht überwinden konnte! Was anders als Liebe konnte ihr ein so großmüthiges Betragen einflößen?«
Frau von La Motte vergaß, als sie es unmöglich fand, Adelinens Betragen anders als durch Eigennutz zu erklären, wie sehr sie einst die Feinheit und edle Gesinnung ihrer jungen Freundinn bewundert hatte.
Adeline stieg indessen zu den Zimmern hinauf: der freudige Strahl der Sonne schien wieder auf ihr Gesicht und belebte ihren Muth: sie ging mit leichtem Schritte durch die Zimmer und hielt nicht eher an, bis sie die Treppen des Thurms erreichte. Hier stand sie eine Weile still; hörte aber keinen Laut außer dem Pfeiffen des Windes zwischen den Bäumen, und ging endlich hinunter. Sie ging durch die untern Zimmer ohne einen Menschen zu sehen, und die wenigen Möbeln, die darin zurückgelassen waren, standen gerade so wie vorher.
Sie wagte es jetzt, aus dem Thurm heraus zu sehen: die einzigen lebendigen Geschöpfe, die sie erblickte, waren die Rehe, die ruhig unter dem Schatten der Wälder grasten. Ihr kleines Lieblingsreh erkannte sie, und hüpfte freudig auf sie zu: sie fürchtete, daß das Thierchen, wenn es bemerkt würde, sie verrathen möchte, und ging schnell durch die Kreuzgänge zurück.
Sie öffnete die Thüre, die in die große Halle der Abtey führte, allein der Weg war so finster und öde, daß sie ihn zu betreten fürchtete, und zurückfuhr. Doch war es nothwendig, weiter zu suchen, besonders auf der andern Seite der Ruinen, die sie bis jetzt noch nicht besichtigt hatte: allein ihre Furcht kehrte zurück, wenn sie bedachte, wie weit dieses sie von ihrem einzigen Zufluchtsorte abführen, und wie schwer es seyn würde, sich im Falle einer Entdeckung zurückzuziehen. Sie war unschlüssig, was sie thun sollte, als sie aber alle ihre Verbindlichkeiten gegen La Motte erwog, und daß dieß vielleicht die einzige Gelegenheit war, ihm einen Dienst zu leisten, beschloß sie, weiter zu gehen.
So wie diese Gedanken schnell durch ihre Seele flogen, hub sie ihre unschuldigen Blicke zum Himmel auf und athmete ein leises Gebeth. Mit bebenden Schritten ging sie über die verfallenen Ruinen, sah sich ängstlich um, und fuhr oft zusammen, wenn der Wind durch die Bäume rauschte, und sie ihn für Menschenstimmen hielt. Sie kam zu dem grünen Platz vor dem Hause, niemand ließ sich sehen, und ihr Muth lebte wieder auf.
Sie versuchte jetzt, die Thüre der großen Halle zu öffnen; da sie sich aber plötzlich besann, daß sie auf La Mottens Befehl befestigt war, ging sie nach dem nördlichen Ende der Abtey, und nachdem sie, so weit das dicke Laub der Bäume es zuließ, sich ringsum gesehen und niemand erblickt hatte, lenkte sie ihre Schritte wieder nach dem Thurm, aus dem sie gekommen war.
Ihr Herz war nun leicht und sie kehrte mit Ungeduld zurück, um La Motten von seiner Sicherheit zu benachrichtigen. In den Kreuzgängen begegnete sie ihrem kleinen Liebling wieder, und blieb einen Augenblick stehen, um ihm zu liebkosen. Das Thierchen schien sich bey dem Ton ihrer Stimme zu freuen und sprang an ihr auf; plötzlich aber fuhr es von ihrer Hand zurück, und als sie aufsah, fand sie die Thüre des Gangs, der zu der großen Halle führte, offen, und ein junger Mann in Uniform trat hervor.
Mit Pfeilschnelligkeit flog sie die Kreuzgänge hinunter und wagte nicht einmahl sich umzusehen; eine Stimme aber rief ihr zu und sie hörte schnell hinter sich her laufen. Ehe sie den Thurm erreichen konnte, ging ihr der Athem aus und sie lehnte sich bleich und erschöpft an einem Pfeiler. Der Fremde kam auf sie zu, sah sie mit Verwunderung und Neugier an, und versicherte sie mit sanfter Stimme, daß sie nichts zu fürchten hätte, und ihm nur sagen möchte, ob sie zu La Motte gehörte: da er sah, daß sie noch immer stumm und erschrocken blieb: wiederhohlte er seine Versicherung und Frage.
»Ich weiß, daß er in diesen Ruinen verborgen ist,« sagte er, »so wie ich auch die Ursache seiner Verbergung weiß; allein ich muß ihn durchaus sehen, und er wird dann überzeugt werden, daß er nichts von mir zu fürchten hat.«
Adeline zitterte so heftig, daß sie sich kaum aufrecht halten konnte: sie stockte, und wußte nichts zu antworten. Ihr Benehmen schien den Argwohn des Fremden zu bestärken und dieß Bewußtseyn vermehrte nur ihre Verlegenheit: er benutzte sie, um weiter in sie zu dringen. Adeline antwortete endlich, daß La Motte einige Zeit in der Abtey gewohnt hätte.
»Und er wohnt noch darin,« sagte der Fremde, »führen Sie mich zu ihm: ich muß ihn sehen, und« —
»Nimmermehr,« erwiederte Adeline, »und ich betheure Ihnen heilig, daß es vergebens seyn wird, ihn zu suchen.«
»Das muß ich denn sehen, da Sie, Madame, mir nicht behülflich seyn wollen. Ich bin ihm bereits durch einige Zimmer oben gefolgt, wo ich ihn plötzlich verlor; dort herum muß er also verborgen seyn, und es ist offenbar, daß sie einen geheimen Gang enthalten.«
Ohne Adelinens Antwort abzuwarten, sprang er nach der Thüre des Thurms. Sie glaubte nunmehr, es würde ein Bewußtseyn der Wahrheit seiner Vermuthung verrathen, wenn sie ihm folgte, und beschloß unten zu bleiben. Bald aber fiel ihr ein, daß er sich vielleicht leise in das Kabinet schleichen und La Motte an der Fallthüre überraschen könnte; sie eilte dem zu Folge hinter ihm her, um durch ihre Stimme dieser Gefahr vorzubeugen. Er war schon im zweyten Zimmer als sie ihn einhohlte, und sie fing sogleich laut zu reden an.
Er durchsuchte dieß Zimmer auf das sorgfältigste, da er aber weder eine geheime Thüre noch andern Ausgang fand, ging er in das Kabinet: jetzt bedurfte sie aller Fassung, um ihre Bewegung zu verbergen. Er setzte sein Suchen fort:
»Ich weiß, daß er in diesen Zimmern verborgen ist,« sagte er, »wiewohl ich bisher noch nicht habe entdecken können, auf welche Art. Bis hieher folgte ich einem Manne, den ich für ihn halte, und ohne geheimen Ausweg konnte er nicht entwischen: ich werde den Ort nicht verlassen, bis ich ihn gefunden habe.«
Er untersuchte Wände und Fußboden, ohne aber die Fallthüre zu finden, die in der That so genau einpaßte, daß La Motte selbst sie nicht durch das Auge, sondern nur durch das Zittern der Dielen unter seinen Füßen entdeckt hatte.
»Hier ist ein Geheimniß, das ich nicht ergründe, und vielleicht nie ergründen werde,« — sagte er, und wollte aus dem Kabinet gehen, als zu Adelinens unaussprechlichem Schrecken die Fallthüre leise aufgehoben wurde, und La Motte selbst erschien.
»Hah!« rief der Fremde, und ging hastig auf ihn zu.
La Motte sprang hervor, und sie lagen einander in den Armen.
Adelinens Erstaunen überstieg im ersten Augenblick selbst ihr voriges Schrecken; bald aber fuhr ihr eine Erinnerung durch die Seele, welche diesen Auftritt erläuterte, und ehe noch La Motte ausrief: »mein Sohn!« errieth sie, daß der Fremde es war.
Peter, der unten an der Treppe stand, und hörte, was oben vorging, flog, seiner Gebietherinn die freudige Nachricht zu bringen, und in wenig Augenblicken lag auch sie in den Armen ihres Sohnes. Dieser Ort, so kürzlich noch der Sitz der Verzweiflung, schien in den Pallast der Freude umgeschaffen, und die Wände hallten nur von Tönen froher Glückwünsche wieder.
Peters Freude überstieg allen Ausdruck; er spielte eine vollkommene Pantomime, sprang umher, schlug in die Hände, lief auf seinen jungen Herrn zu, faßte ihn bey der Hand, trotz La Mottens Stirnrunzeln, lief bald hier, bald dorthin, ohne zu wissen warum, und gab keine vernünftige Antwort auf alles was er gefragt wurde.
Nachdem die ersten Bewegungen sich gelegt hatten, nahm La Motte, als besänne er sich plötzlich, seine gewohnte Feyerlichkeit wieder an.
»Ich verdiene Tadel,« sagte er, »daß ich mich so der Freude überlasse, da ich vielleicht noch von Gefahren umringt bin. Laßt uns auf eine Zuflucht denken, weil es noch in unserer Macht ist,« fuhr er fort — »in wenig Stunden werden vielleicht die Gerichtsdiener wieder erscheinen.«
Louis verstand seines Vaters Worte und räumte durch folgende Erzählung seine Angst aus dem Wege:
»Ein Brief vom Herrn Nemours, der eine Nachricht Ihrer Flucht von Paris enthielt, erreichte mich zu Peronne, wo ich mit meinem Regimente in Quartier lag. Er meldete mir, daß Sie nach dem südlichen Frankreich gegangen wären, da er aber seitdem nichts von Ihnen gehört hatte, wußte er den Ort Ihres Aufenthalts nicht. Um diese Zeit wurde ich nach Flandern geschickt und brachte einige Wochen in peinlicher Angst um Sie zu. Am Ende des Feldzugs erhielt ich Urlaub und machte mich sogleich nach Paris auf, wo ich von Nemours Ihren Aufenthalt erfahren hoffte.
Allein er wußte ihn eben so wenig als ich; doch sagte er mir, Sie hätten ihm einmahl auf Ihrer zweyten Tagreise von Paris, von D. aus, unter angenommenen Nahmen, der Verabredung gemäß, geschrieben, und in diesem Briefe geäussert, daß Sie, aus Furcht verrathen zu werden, keinen zweyten wagen würden; er wußte folglich nichts von Ihrem Aufenthalt, vermuthete aber, daß Sie Ihren Weg südwärts fortgesetzt hätten. Auf diese schwache Nachricht verließ ich Paris, um Sie aufzusuchen, und ging unverzüglich nach V—, von wo meine Fragen mich glücklich bis M. führten. Hier, hörte ich, hatten Sie sich einige Tage wegen der Krankheit eines jungen Frauenzimmers verweilt, ein Umstand, den ich nicht zu reimen wußte; doch gelangte ich bis L—, wo ich aber alle Spur verlor. Als ich nachdenkend im Wirthshaus am Fenster saß, bemerkte ich eine Inschrift auf einer Scheibe, und müßige Neugier bewegte mich, sie zu entzieffern. Die Züge schienen mir bekannt, und die Zeilen selbst bestätigten meine Vermuthung; ich hatte sie oft von Ihnen wiederhohlen hören.
Ich erneuerte meine Fragen und endlich besannen sich die Leute im Wirthshause, daß ein Fremder sich nach dem Wege durch den Wald bis Auboine erkundigt hätte. Zu Auboine verlor ich Sie wieder, bis nach meiner Zurückkunft von einer vergeblichen Nachfrage in der Nachbarschaft, der Wirth des kleinen Gasthofes, wo ich logirte, mir sagte, er glaubte, etwas von Ihnen erfahren zu haben, und mir erzählte, was vor einigen Stunden bey dem Grobschmidt vorgefallen war.
Seine Beschreibung von Peter war so charakteristisch, daß ich nicht zweifelte, Sie müßten der Bewohner der Abtey seyn, und da ich wußte, wie nothwendig Ihnen Verbergung sey, machte Peters Läugnen mich nicht irre. Den andern Morgen fand ich, mit Hülfe meines Wirthes, mich hieher, und nachdem ich alle Winkel der Abtey vergebens durchsucht hatte, glaubte ich, Peter könne doch wohl die Wahrheit gesagt haben; Ihr Anblick vernichtete diese Furcht, und zeigte mir wenigstens, daß die Abtey noch bewohnt wurde; denn ob Sie es waren, wußte ich nicht gewiß, weil Sie zu schnell verschwanden. Ich suchte den ganzen Tag fort, und verließ das Zimmer, wo Sie verschwunden waren, nur auf Augenblicke. Ich rief Sie zu wiederholtenmahlen, in Hoffnung, daß Sie meine Stimme erkennen würden; als aber die Nacht einbrach und alles vergebens war, zog ich mich nach einer Hütte am Rande des Waldes zurück.
Diesen Morgen kam ich früh wieder, um mein Forschen zu erneuern, und hoffte, daß Sie sich jetzt sicher glauben und hervorwagen würden. Wie schmerzlich sah ich mich betrogen, als ich die Abtey eben so still und einsam fand, als den Tag zuvor. Ich war eben im Begriff die große Halle wieder zu verlassen, als ich die Stimme dieser Dame vernahm und nun entdeckte, was ich so ängstlich gesucht hatte.«
Diese kleine Erzählung zerstreute La Mottens Besorgnisse gänzlich; allein er fürchtete nun, daß seines Sohnes Nachfragen und der Vorfall mit Peter die Neugier der Einwohner von Auboine erregt haben, und ihn der Gefahr einer Entdeckung aussehen könnte. Doch suchte er für jetzt sich aller schmerzhaften Gedanken zu entschlagen und die Freude, die seines Sohnes Gegenwart ihm brachte, ohne bittere Mischung zu genießen. Die Möbeln wurden wieder an ihren vorigen Ort geschafft, und die Zellen ihrer traurigen Dunkelheit überlassen.
Die Ankunft ihres Sohnes schien der Frau von La Motte neues Leben eingeflößt zu haben, und aller Kummer schwand in dem süßen Gefühl des Wiedersehens. Sie hing oft mit den stillen Blicken mütterlicher Zärtlichkeit an ihm, und ihre Parteylichkeit erhöhte jeden Vorzug, den die Zeit in seiner Person und Betragen bewirkt hatte. Er war jetzt im drey und zwanzigsten Jahre, seine Figur war männlich, sein Anstand kriegerisch, sein Wesen mehr ungezwungen und einnehmend als erhaben; und wiewohl seine Züge nicht regelmäßig waren, bildeten sie doch ein Gesicht, das man gern wieder sah, wenn man es einmahl gesehen hatte.
Sie erkundigte sich angelegentlich nach den Freunden, die sie zu Paris verlassen hatte, und erfuhr, daß binnen den wenigen Monathen ihrer Abwesenheit einige gestorben, einige aus der Stadt gezogen waren. Auch La Motte vernahm, daß man eine strenge Nachsuchung seiner Person zu Paris angestellt hatte, und wiewohl diese Nachricht ihm nicht unerwartet war, traf sie ihn doch so sehr, daß er es nöthig glaubte, sich in ein fernes Land zu begeben. Louis nahm keinen Anstand, ihm zu sagen, daß er ihn auf der Abtey so sicher glaubte, als an irgend einem Orte in der Welt, und wiederhohlte, was er von Nemours gehört hatte, daß die Gerichtsdiener nicht im Stande gewesen wären, ihm jenseits Paris nachzuspüren.
»Zudem,« fuhr Louis lächelnd fort, »wird diese Abtey von einer übernatürlichen Macht geschützt, und keiner von den Bewohnern der Gegend wagt sich in ihre Nähe.«
La Motte fragte seinen Sohn mit angenommener Nachlässigkeit, was die Leute denn eigentlich von diesem Orte sprächen? —
»O sie erzählen so viel, daß ich mich kaum auf die Hälfte besinne: doch habe ich so viel behalten, daß vor vielen Jahren ein Mensch (den aber niemand gesehen hat, woraus wir schließen können, welchen Glauben dieß Mährchen verdient) heimlich hieher gebracht und in irgend einem Behältniß eingesperrt worden sey, und daß man starke Gründe hätte zu vermuthen, er wäre auf keine gute Art zu Tode gekommen.«
La Motte seufzte —
»Es heißt ferner,« fuhr Louis fort, »daß der Geist des Verblichenen seitdem alle Nacht zwischen den Ruinen erschienen sey; und um die Geschichte noch wunderbarer zu machen, setzt man hinzu, daß es einen gewissen Ort hier gäbe, von dem noch kein Sterblicher, der ihn zu erforschen gewagt, lebendig wiedergekehrt wäre. Auf solche Art schaffen Menschen, die sich um wenig wirkliche Dinge zu bekümmern haben, sich Hirngespinste der Einbildungskraft.«
La Motte saß tiefsinnig.
»Und was für Gründe geben sie an,« sagte er, indem er endlich aus seiner Träumerey erwachte, »die hier verhaftete Person ermordet zu glauben?«
»Sie bedienen sich keines so bestimmten Ausdrucks,« sagt Louis.
»Es ist wahr, sagte La Motte sich besinnend, sie sagen nur, daß er auf keine gute Art zu Tode kam.«
»Eine sehr feine Distinction!« fiel Adeline ein.
»Die Ursachen habe ich nicht eigentlich verstehen können,« sagte Louis — »die Leute sagen zwar, man hätte den Menschen, der hierher gebracht worden, nie wieder fortbringen sehen; (allein ist es denn gewiß, daß er wirklich her kam?) daß man während seines Hierseyns eine seltsame Heimlichkeit beobachtete, und daß der Besitzer der Abtey sie seitdem nicht mehr besucht hat. An alle diesem Gewäsch scheint nichts zu seyn, das Aufmerksamkeit verdient.«
La Motte richtete sich auf, als wollte er antworten, die Hereinkunft der Frau von La Motte brachte sie aber auf ein anderes Gespräch, und es wurde der Sache nicht weiter erwähnt.
Peter mußte sich nun auf den Weg machen, um Proviant zu hohlen, während La Motte und Louis überlegten, in wiefern es rathsam sey, auf der Abtey zu bleiben. La Motte konnte nichts anderes als glauben, daß Peters Geschwätz und seines Sohnes Fragen zu einer Entdeckung seines Aufenthalts führen müßten. Endlich fiel ihm ein, daß sich der letzte Umstand selbst zu seiner Sicherheit benutzen ließe.
»Wie wäre es, Louis,« sagte er, »wenn du wieder nach dem Wirthshause in Auboine gingest, und als im Vorbeygehen erwähntest, daß du die Abtey unbewohnt gefunden, die gesuchte Person aber in einer fernen Stadt entdeckt hättest. Wenn du noch außerdem dir Gegenwart des Geistes und Gewalt genug über dein Gesicht zutraust, um irgend eine fürchterliche Erscheinung, die du hier gesehen zu haben vorgeben mußt, zu beschreiben, so dächte ich in Zukunft diesen Ort ruhig als mein Schloß betrachten zu können.«
Louis fand diesen Einfall vortreflich und richtete am folgenden Tage seinen Auftrag so gut aus, daß die Ruhe der Abtey völlig wieder hergestellt wurde.
So endigte dieses Abenteuer, das einzige, was die Familie während ihres Aufenthalts im Walde beunruhigt hatte. Adeline, von der Besorgniß der Übel, womit La Mottens Lage ihr gedroht, und von dem Kummer, den Theilnahme an seinem Schicksal ihr verursacht hatte, befreyt, empfand eine mehr als gewöhnliche Heiterkeit: auch glaubten sie in ihrer Freundinn eine Wiederkehr ihres vorigen Wohlwollens zu entdecken; alle ihre Dankbarkeit erwachte auf das neue und ließ sie ein eben so lebhaftes als unschuldiges Vergnügen schmecken. Adeline zog fälschlich die Zufriedenheit, welche Frau von La Motte über ihres Sohnes Gegenwart empfand, auch auf sich, und strengte alle Kräfte an, um sich ihrer würdig zu zeigen.
Allein die Freude, welche seine unerwartete Ankunft bey La Motten hervorgebracht hatte, verrauchte schnell, und die Schatten des Trübsinns bedeckten auf das neue sein Gesicht. Er kehrte oftmahls zu seinem einsamen Gange im Walde zurück — derselbe geheimnißvolle Tiefsinn herrschte in seinem Wesen und erregte auf das neue die Besorgniß seiner Frau, welche sich entschloß, ihrem Sohne ihren Kummer anzuvertrauen und ihn um seine Hülfe zur Erforschung der Ursache zu bitten.
Ihre Eifersucht auf Adelinen konnte sie ihm indessen nicht mittheilen, so sehr sie auch wieder davon gequält wurde, und mit wundernswürdigem Scharfsinn jedes Wort, jede Miene ihres Mannes, ja selbst Adelinens kunstlose Äußerungen von Dankbarkeit und Freundschaft für Ausbrüche wärmerer Zärtlichkeit mißdeutete. Adeline. pflegte noch immer lange Spatziergänge im Walde zu machen, die Absicht, welche Madame vormahls gefaßt hatte, sie zu belauschen, war durch die letzten Vorfälle vereitelt worden, und wurde jetzt durch die Betrachtung, wie schwer und gefährlich es seyn würde, ganz verhindert. Petern bey der Sache gebrauchen, hieß ihm ihren Argwohn verrathen, und ihr selbst zu folgen, würde Adelinen aufgefallen seyn, und ihre Eifersucht entdeckt haben. Auf solche Art von Stolz und Delikatesse zurückgehalten, sah sie sich genöthigt, über die wichtigsten Stücke ihres Argwohns die Qualen der Ungewißheit zu erdulden.
Sie vertraute indessen ihrem Sohn die sonderbare Veränderung, die mit seinem Vater vorgegangen war. Er hörte ihr sehr aufmerksam zu, und die Verwunderung und Bekümmerniß auf seinem Gesichte verrieth, wie sehr sein Herz daran Theil nahm. Er wußte eben so wenig als sie, was er von der Sache denken sollte, und übernahm bereitwillig, La Mottens Schritte zu beobachten, in Hoffnung, seinen beyden Ältern durch seine Vermittlung nützlich zu seyn. Der Argwohn seiner Mutter blieb ihm nicht ganz verborgen; weil er aber sah, daß sie ihn zu verheelen wünschte, ließ er sie nichts davon merken.
Er erkundigte sich nunmehr nach Adelinen, und hörte ihre kleine Geschichte mit sichtlichem Antheil an. Ja, er bezeugte so viel Mitleid mit ihrer Lage und so viel Unwillen über das unnatürliche Betragen ihres Vaters, daß die Besorgnisse, welche seine Mutter anfangs gehabt hatte, ihm ihre Eifersucht verrathen zu haben, ganz andern Platz machten. Sie sah, daß Adelinens Schönheit seine Einbildungskraft bereits gefesselt hatte, und fürchtete, daß ihr liebenswürdiges Wesen sein Herz nicht minder einnehmen möchte. Hätte sie auch noch ihre erste Zärtlichkeit für Adelinen gehabt, so würde ihr doch eine Liebe zwischen ihr und ihrem Sohne, als Hinderniß einer glänzendern Verbindung, die sie in Zukunft für ihn hoffte, unangenehm gewesen seyn. Auf eine solche Verbindung gründete sie alle ihre Hoffnungen, und betrachtete sie als das einzige Mittel, wodurch er dereinst seine Familie aus ihrer gegenwärtigen unangenehmen Lage ziehen könnte.
Sie berührte dem zu Folge Adelinens Vorzüge nur obenhin, stimmte kalt in seine Mitleidsäußerungen mit ihrem Schicksal ein, und mischte in den Tadel von ihres Vaters Betragen, einige Worte, welche einen Verdacht verriethen, daß die Tochter nicht ganz ohne Schuld daran seyn möchte. Diese Mittel, wodurch sie ihres Sohns Neigung zu unterdrücken glaubte, brachten eine entgegengesetzte Wirkung hervor. Ihre anscheinende Kälte gegen Adelinen verstärkte sein Mitleid mit ihrer hülflosen Lage und die Schonung, womit sie den Vater zu beurtheilen sich das Ansehen gab, erhöhte seinen edeln Unwillen gegen ihn.
Als er Frau von La Motte verließ, sah er seinen Vater quer über den grünen Platz in den Wald gehen. Er hielt dieß für eine gute Gelegenheit, einen Anfang zur Ausführung seines Vorsatzes zu machen, und folgte ihm langsam in einiger Entfernung nach. La Motte ging mit starken Schritten vor sich hin und schien so ganz in Gedanken vertieft, daß er sich weder rechts noch links umsah, und kaum den Kopf aufhob. Ludwig war ihm wohl eine halbe Stunde weit gefolgt, als er ihn plötzlich einen andern Weg einschlagen sah: er beschleunigte seine Schritte, um ihn nicht aus dem Gesichte zu verlieren, fand aber die Bäume so dick verwachsen, daß er ihn kaum mehr sehen konnte.
Indessen verfolgte er den Weg, der vor ihm lag: er führte ihn durch die dunkelste Gegend des Waldes, die er noch gesehen hatte, bis er endlich in eine finstere Vertiefung endigte, die mit hohen Bäumen umgeben war, deren verflochtene Zweige die geraden Strahlen der Sonne ausschlossen und nur eine schauderliche Dämmerung zuließen. Louis sah sich rings um nach seinem Vater, erblickte ihn aber nirgends. Während er da stand und den Ort überschaute, wurde er einen Gegenstand in einiger Entfernung gewahr, den aber die dichten Schatten ringsumher ihn deutlich zu erkennen verhinderten.
Er ging näher und entdeckte die Ruinen eines kleinen Gebäudes, das, nach den übriggebliebenen Spuren zu urtheilen, ein Grabmahl gewesen zu seyn schien.
»Wahrscheinlich,« sagte er zu sich selbst, ruhen hier die Gebeine eines alten Mönches, vormahls ein Bewohner der Abtey, vielleicht ihr Stifter, der nach einem Leben der Enthaltsamkeit und des Gebets, im Himmel den Lohn seiner irrdischen Entsagungen suchte. Friede sey mit seiner Seele!«
Seine Augen blieben auf die Stelle geheftet, und er sah eine Gestalt unter der Wölbung des Grabmahls hervorgehen. Sie fuhr zurück; als würde sie ihn gewahr, und verschwand sogleich. Louis, so furchtlos er auch war, fühlte doch in diesem Augenblick eine gewisse Beklemmung, bald aber kam ihm der Gedanke, daß es La Motte selbst seyn könnte. Er ging näher hinzu, und rief ihn — keine Antwort erscholl; er wiederhohlte den Ruf, aber alles blieb still wie das Grab. Er wollte den Ort, wo er verschwunden war, untersuchen, allein die schattigte Dunkelheit vereitelte sein Bemühen. Doch bemerkte er zur Rechten einen Eingang und stieg einige Stuffen in einen dunkeln Gang hinab, als ihm plötzlich beyfiel, daß dieser Ort eine Räuberhöhle seyn könnte; seine Gefahr beunruhigte ihn und er zog sich eilends zurück.
Er ging auf dem nämlichen Wege, den er gekommen war, wieder nach der Abtey: niemand folgte ihm, sein erster Gedanke kehrte wieder, und er glaubte, daß sein Vater es wirklich gewesen wäre. Er dachte über diese seltsame Möglichkeit nach und bemühte sich vergebens, die Ursache dieses geheimnißvollen Betragens zu ergrübeln. Mit diesen Gedanken trat er in das große Zimmer, und erstaunte nicht wenig, La Motten da sitzen zu sehen, der mit Adelinen und seiner Mutter ganz ruhig ein Gespräch führte.
Er ergrif die erste Gelegenheit, seiner Mutter den Vorfall zu erzählen, und fragte sie, seit wie lange La Motte zurückgekehrt sey. Als er hörte, daß er fast eine halbe Stunde vor ihm zu Hause gekommen war, stieg seine Verwunderung, und er wußte nicht, was er denken sollte.
Während dessen wirkte die Wahrnehmung von Louis wachsender Neigung für Adelinen mit dem Gifte des Argwohns bey Frau von La Motte zusammen, um den Überrest von Neigung zu ersticken, den Mitleid und Achtung vormahls für Adelinen in ihr erzeugt hatten. Ihre Unfreundlichkeit war jetzt zu merklich, um dem Auge derjenigen, gegen die sie gerichtet war, zu entwischen, und verursachte Adelinen eine Pein, die sie kaum zu ertragen vermochte. Mit der Wärme und Offenheit der Jugend suchte sie eine Erklärung dieses veränderten Betragens und eine Gelegenheit sich von aller Absicht, es gereizt zu haben, zu reinigen. Allein dieser wich Frau von La Motte klüglich aus, während sie zu eben der Zeit Winke fallen ließ, die Adelinen nur tiefer verwirrten und ihren Schmerz herber machten.
»Ich habe die Liebe verloren, die mein Alles war,« sagte sie. »Sie war mein einziger Trost — und ich habe ihn verloren, ohne nur meine Schuld zu wissen. Doch bleibt mir das Bewußtseyn, keine Unfreundlichkeit verdient zu haben, und wenn gleich sie mich verlassen hat, werde doch ich sie immer lieben.«
So bekümmert verließ sie oft das Zimmer und hing in der Einsamkeit einer Traurigkeit nach, die sie bis jetzt nicht gekannt hatte.
Eines Morgens, da sie nicht schlafen konnte, stand sie sehr früh auf. Das schwäche Tageslicht dämmerte durch die Wolken, breitete sich allmählich über den Horizont aus und verkündigte die aufgehende Sonne. Jeder Reiz der Landschaft enthüllte sich langsam, feucht vom Thau der Nacht und glänzend durch die Dämmerung, bis endlich die Sonne erschien und den vollen Strom des Tages ausgoß. Die schöne Stunde lockte sie heraus, und sie ging in den Wald, um die Süßigkeit des Morgens zu genießen. Die Gesänge der neu erwachten Vögel begrüßten sie, und die frische Luft war gewürzt vom Hauche der Blumen, deren Farben heller durch die Thautropfen glänzten, die an ihren Kelchen hingen.
Sie wanderte fort, ohne die Entfernung zu merken, und die Krümmungen des Bachs führten sie in ein kleines Thal, welches mit Gruppen von Bäumen durchflochten eine so romantische Scene bildete, daß sie sich am Fuße eines Baumes niedersetzte, um den Anblick ganz zu genießen. Diese Bilder sänftigten unmerklich ihren Kummer, und flößten ihr die süße Melancholie ein, welche dem fühlenden Herzen so wohl thut.
Eine ganze Weile saß sie in Träumerey verloren, während die Blumen, die an dem Ufer neben ihr aufsprießten, in neuem Leben zu lächeln schienen, und ihr eine Vergleichung mit ihrem eigenen Zustande entlockten. Sie seufzte und sann, und sang dann mit einer Stimme, deren zaubrischer Wohlklang sich nach den zärtlichen Regungen ihres Herzens modelte, ein kleines Lied.
Ein fernes Echo verlängerte ihre Töne und sie hörte schweigend dem sanften Nachhall zu, bis sie endlich die letzte Strophe wiederhohlte, und sich von einer fast eben so zärtlichen und minder fernen Stimme antworten hörte. Verwundernd sah sie auf und erblickte einen jungen Mann im Jagdkleide, der sich an einem Baum lehnte, und sie mit der tiefen Aufmerksamkeit eines entzückten Herzen anstaunte.
Tausend Besorgnisse flogen durch ihre Gedanken, und erst jetzt besann sie sich auf ihre weite Entfernung von der Abtey. Sie stand eilends auf, um fortzugehen, als der Fremde sich ehrerbiethig nahte — wie er aber ihren ängstlichen Blick und ihr Zurückweichen bemerkte, stand er still. Sie verfolgte ihren Weg nach der Abtey, und wiewohl sie gern gewußt hätte, ob man ihr folgte, hielt doch Delikatesse sie ab, sich umzusehen.
Sie fand die Familie noch nicht zum Frühstück versammlet, und zog sich in ihr Schlafzimmer zurück, wo sie sich mit Vermuthungen über den Fremden beschäftigte. Sie glaubte, nur um La Mottens willen bey diesem Gegenstande interessirt zu seyn, und hing ohne Bedenken der Erinnerung an den edeln Anstand und an die einnehmende Figur nach, welche diesen jungen Fremden so sehr auszeichnete. Sie hielt es für unmöglich, daß ein Mensch von so edelm Ansehen in einen Plan zum Verrath eines Mitgeschöpfs verwickelt seyn könnte, und ungeachtet sie sich auf keine Weise seine Erscheinung in diesem Walde erklären konnte, verwarf sie doch jeden nachtheiligen Verdacht.
Sie nahm sich vor, La Motten nichts von diesem kleinen Vorfall zu sagen, weil sie wußte, daß er nur darüber in Angst gerathen und um einer wahrscheinlich eingebildeten Gefahr willen, wirkliches Leiden ausstehen würde, doch beschloß sie, auf einige Zeit ihre Spaziergänge im Walde einzustellen.
Als sie zum Frühstück herunter kam, bemerkte sie an Frau von La Motte eine mehr als gewöhnliche Zurückhaltung. La Motte kam kurz nach ihr herein, und machte einige unbedeutende Bemerkungen über das Wetter, worauf er nach einem gesuchten Bestreben, heiter zu scheinen, in seinen gewohnten Tiefsinn zurück fiel. Adeline beobachtete ängstlich Frau von La Mottens Gesicht, und wenn ein Strahl von Fröhlichkeit darauf erschien, war es Sonnenschein für ihre Seele; aber nur selten genoß sie diese Erquickung. Ihr Gespräch war gezwungen und zielte oft auf etwas mehr, als man verstand. Louis Eintritt war Adelinen eine willkommene Erleichterung, denn fast fürchtete sie schon, einige Worte zu sprechen, damit nicht ihre zitternde Stimme ihre innere Unruhe verriethe.
»Dieser schöne Morgen hat Sie früh aus Ihrem Zimmer gelockt,« sagte Louis zu Adelinen.
»Ohne Zweifel hatten Sie auch eine angenehme Gesellschaft,« fiel Madame ein; »ein einsamer Spaziergang macht selten Vergnügen.«
»Verzeihen Sie, ich hatte niemand als meine Gedanken.«
»Wirklich? So müssen Ihre Gedanken wohl sehr angenehm seyn.«
»Ach,« antwortete Adeline, indem unwillkührlich eine Thräne sich in ihr Auge drängte, »meine Gedanken haben jetzt wenig Gegenstände der Freude mehr, wobey sie verweilen können.«
»Das ist doch in der That sehr sonderbar« fuhr Madame fort.
»Kann es wohl wirklich sonderbar seyn, Madame, wenn diejenigen trauern, die ihren letzten Freund verloren haben?«
Frau von La Mottens Gewissen gestand den Vorwurf ein und sie erröthete.
»Das ist doch wohl nicht Ihr Fall, Adeline,« sagte sie endlich, und warf einen ausdrucksvollen Blick auf La Motte.
Adeline, zu unschuldig für allen Verdacht, bemerkte ihn nicht, sondern lächelte durch ihre Thränen und antwortete: ›es würde sie freuen, wenn es so wäre.‹
La Motte hatte während dieses Gesprächs in Gedanken vertieft gesessen, und Louis, der nur dunkel den Sinn errieth, blickte bald seine Mutter bald Adelinen um Erläuterung an. Die letzte betrachtete er mit einem so zärtlichen Ausdrucke des Mitleids, daß Frau von La Motte die Empfindung seiner Seele in seinem Blicke zu lesen glaubte, und unverzüglich mit sehr ernsthafter Miene auf Adelinens letzte Worte erwiederte:
»Ein Freund kann nur schätzbar seyn, wenn unser Betragen ihn verdient: die Freundschaft, welche den Werth ihres Gegenstandes überlebt, ist für beyde nur Schande.«
Der Nachdruck, womit sie diese Worte sagte, beunruhigte Adelinen auf das neue, und sie antwortete sanft: ›sie hoffte nie einen solchen Vorwurf zu verdienen.‹ Madame schwieg, Adeline aber fühlte sich so tief gekränkt, daß Thränen mit Gewalt aus ihrem Augen drangen und sie ihr Gesicht in ihrem Schnupftuch verbergen mußte.
Louis stand mit einiger Bewegung auf, und La Motte, aus seinem Tiefsinn erweckt, fragte, was es gäbe, schien aber, ehe er eine Antwort erhalten konnte, seine Frage vergessen zu haben.
»Adeline mag es Ihnen selbst erklären,« sagte Frau von La Motte.
»Ich habe dieß nicht verdient,« antwortete sie, »weil aber meine Gegenantwort Ihnen mißfällig ist, will ich mich zurückziehen.«.
Sie ging nach der Thüre, als Ludwig, der unruhig im Zimmer auf und ab schritt, sie sanft bey der Hand faßte.
»Hier liegt ein unglückliches Mißverständniß zum Grunde,« sagte er, und wollte sie wieder auf ihren Stuhl führen; allein sie war zu niedergeschlagen, um fernern Zwang ertragen zu können, und zog ihre Hand zurück.
»Lassen Sie mich fort,« erwiederte sie, »wenn ein Mißverständniß hier zum Grunde liegt, so bin ich unfähig es zu erklären.«
Mit diesen Worten verließ sie das Zimmer. Louis Blicke folgten ihr und er wandte sich ehrerbiethig zu seiner Mutter:
»Gewiß thun Sie ihr Unrecht,« sagte er, »bey allem was heilig ist, sie verdient eine zärtlichere Behandlung.«
»Du bist sehr beredt für sie, darf ich fragen, was dich so für sie gewonnen hat?
»Ihr liebenswürdiges Betragen, das man nicht sehen kann, ohne es zu schätzen.«
»Vielleicht traust du zu viel auf deine eigene Beobachtung: es könnte seyn, daß dieß liebenswürdige Betragen dich hinterginge.«
»Verzeihen Sie mir, es kann mich auf keine Weise hintergehen.«
»Du hast wahrscheinlich gute Ursachen zu dieser Versicherung, und ich sehe aus deiner Bewunderung dieser arglosen Unschuld, daß es ihr gelungen ist, auch dein Herz zu fangen.«
»Es ist ihr gelungen, meine wärmste Bewunderung auf sich zu ziehen, ohne daß sie je eine solche Absicht haben konnte.«
Frau von La Motte wollte antworten, wurde aber durch ihren Mann verhindert, der auf das neue aus seinen Träumen erweckt, nach der Ursache des Streits fragte.
»Lassen Sie doch die Kindereyen,« sagte er mit mißfälligem Tone. »Wahrscheinlich hat Adeline ein Versehen im Haushalten begangen, und eine so schreckliche Beleidigung verdient allerdings exemplarische Strafe. Nur bitte ich, mich mit Ihren Zänkereyen zu verschonen. Wenn Sie tyrannisiren müssen, Madame, so thun Sie es für sich.«
Mit diesen Worten ging er hinaus, Louis folgte ihm auf dem Fuße nach und Madame blieb ihren eigenen unmuthigen Gedanken überlassen. Ihre üble Laune entsprang aus der gewöhnlichen Quelle. Sie hörte, daß Adeline spatzieren gegangen war, und da La Motte sich ebenfalls in aller Frühe in den Wald begeben hatte, gab ihre Einbildung ihr ein, daß beyde eine Zusammenkunft verabredet hätten. Adelinens Eintritt, die kurz vor La Motten kam, bestärkte sie in ihrem Verdacht, und ihre Erbitterung stieg zu einem solchen Grade, daß weder die Gegenwart ihres Sohnes, noch ihre gewohnte gute Lebensart, den Ausbruch ihrer Leidenschaft zurückhalten konnte. Adelinens Betragen sowohl, als La Mottens anscheinende Gleichgültigkeit hielt sie für Verstellung; so wahr ist es, »daß die unbedeutendsten Kleinigkeiten dem verblendeten Auge der Eifersucht heilige Gewißheit sind.«
Adeline war in ihr Zimmer gegangen, um ihren Thränen freyen Lauf zu lassen. Sobald ihre erste Bewegung nachließ, ging sie ihr ganzes Betragen durch; und da sie nichts fand, dessen sie sich anschuldigen konnte, wurde sie ruhiger und fand ihren besten Trost im Bewußtseyn ihrer redlichen Gesinnung. Im Augenblick der Anklage kann zuweilen die Unschuld mit der Strafe sich bedrückt fühlen, welche nur dem Schuldigen gebührt; allein Betrachtung zerstört die Täuschung des Schreckens und führt der schmerzenden Brust den Trost der Tugend zu.
La Motte war in den Wald gegangen, wohin Louis ihm folgte, in der Absicht, den Gegenstand seiner Schwermuth zu berühren.
»Der Morgen ist sehr schön,« sagte Louis, »wenn Sie mir erlauben, will ich Sie begleiten.«
La Motte verbarg seine Unzufriedenheit, und nachdem sie eine Weile gegangen waren, veränderte er den Weg, und schlug einen Fußpfad ein, der nach der entgegen gesetzten Richtung führte, die Louis den Tag zuvor ihn hatte nehmen sehen.
Louis bemerkte, daß der Gang, den sie verlassen hätten, schattiger und angenehmer wäre. — La Motte that nicht, als wenn er es hörte.
»Er führt zu einem sonderbaren Ort, den ich gestern entdeckte,« fuhr Louis fort.
La Motte sah auf: Louis, beschrieb das Grabmahl und sein Abenteuer. La Motte faßte ihn bey dieser Erzählung scharf in das Auge, während er selbst sich sichtlich verfärbte.
»Du warst sehr verwegen,« antwortete er, nachdem Louis seine Erzählung geendiget hatte, »dich an diesen Ort zu wagen. Ich wollte dir wohl rathen, vorsichtiger beym Erforschen der Tiefen dieses Walds zu seyn! Ich habe mich noch nicht über eine gewisse Grenze hinein gewagt und weiß folglich nicht, was für Bewohner er enthält. Deine Nachricht beunruhigt mich, denn wenn Räuber sich in dieser Gegend aufhalten, so bin ich nicht sicher vor ihren Anfällen. Zwar habe ich wenig zu verlieren, mein Leben ausgenommen.«
»Und das Leben der Ihrigen,« fiel Louis ein. —
»Natürlich,« sagte La Motte.
»Ich möchte gern mehr Gewisheit über diesen Punct haben« fuhr Louis fort, »und überlege eben, auf welche Art wir sie erhalten könnten.«
»Das ist unnütz zu überlegen,« sagte sein Vater mit finsterer Miene, »die Nachforschung selbst ist Gefahr: vielleicht würdest du mit deinem Leben für deine Neugier büssen müssen. Unsere einzige Sicherheit ist, uns unentdeckt zu halten. Komm, laß uns wieder nach der Abtey gehen.«
Louis wußte nicht, was er denken sollte; allein er enthielt sich, weiter von der Sache zu reden. La Motte verfiel bald nachher in Tiefsinn, und sein Sohn ergriff die Gelegenheit, die Niedergeschlagenheit zu beklagen, die er seit einiger Zeit an ihm bemerkt hätte.
»Lieber beklage die Ursache davon,« sagte La Motte mit einem Seufzer.
»Das thue ich herzlich, was sie auch sey. Darf ich es wagen, Sie darum zu fragen?«
»Sind dir denn meine Unfälle so wenig bekannt, daß du eine solche Frage thun mußt? Bin ich nicht von meiner Heimath, von meinen Freunden, ja beynahe aus meinem Vaterlande vertrieben, und du kannst noch fragen, was mich bekümmert?«
Louis fühlte die Richtigkeit dieses Vorwurfs und schwieg einen Augenblick.
»Daß Sie bekümmert sind, darf mich freylich nicht befremden, theuerster Vater; es würde vielmehr zu verwundern seyn, wenn Sie es nicht wären.«
»Nun was befremdet dich denn?«
»Die Heiterkeit, die ich anfänglich an Ihnen bemerkte.«
»Eben klagst du, daß ich niedergeschlagen bin, und jetzt scheint es dir nicht recht, daß ich einst heiter war. Wie soll ich das nehmen?«
»Sie mißverstehen mich, mein Vater, nichts würde mich inniger freuen, als diese Heiterkeit wiederkehren zu sehen: die nähmliche Ursache des Kummers war auch damahls vorhanden, und doch waren Sie heiter.«
»Meine damahlige Erheiterung hättest du ohne Schmeicheley auf deine eigene Rechnung schreiben können; deine Gegenwart freute mich, und ich wurde zugleich von einer Last Besorgnisse befreyt.«
»Warum aber sehe ich Sie jetzt nicht mehr heiter, da noch derselbe Anlaß, den Sie so gütig äußern, da ist.«
»Und warum besinnst du dich nicht, daß du mit deinem Vater sprichst?«
»Ich besinne mich dessen, und nur Sorge für meinen Vater konnte mich so weit treiben: mit unbeschreiblichem Schmerz sehe ich, daß ein geheimer Kummer an Ihnen nagt: entdecken Sie ihn, liebster Vater, denen, die einen Antheil an allem, was Sie bekümmert, fordern, und lassen Sie durch Theilnahme seine Bitterkeit mildern.«
Louis blickte auf, er sah seines Vaters Gesicht bleich wie der Tod; seine Lippen bebten, indem er sprach:
»Dein Scharfsinn, so sehr du auch darauf bauen magst, hat dich dießmahl irre geführt. Ich habe keinen Kummer, als den ich dir bereits gesagt habe, und ich bitte mir aus, daß dieses Gespräch nie wieder angeknüpft wird.«
»Wenn Sie es befehlen, so muß ich gehorchen, aber verzeihen Sie mir, wenn —«
»Ich will nicht verzeihen, junger Mensch« — fiel sein Vater unwillig ein, »das Gespräch soll hier zu Ende seyn.« —
Hierauf beschleunigte er seine Schritte, und Louis, der es nicht weiter zu führen wagte, ging schweigend neben ihm, bis sie die Abtey erreichten.
Adeline brachte den größten Theil des Tages in ihrem Zimmer zu, wo sie ihr Herz gegen das unverdiente Mißfallen der Frau von La Motte zu stählen suchte. Dieses Geschäft war schwerer, als das, sich selbst loszusprechen. Sie liebte sie, und hatte auf ihre Freundschaft getraut, die ihr trotz des letzten Betragens, noch immer schätzbar war. Sie hatte nicht verdient, sie zu verlieren, allein Madame war so ungeneigt zu Erläuterungen, daß sie wenig Hoffnung sah, sie wieder zu erlangen, so ungegründet auch ihr Mißfallen seyn möchte. Endlich suchte sie sich zu beruhigen und gewaltsam ihr Herz zum Schweigen zu bringen.
Mehrere Stunden lang beschäftigte sie sich mit einer Nätherey, die sie für Frau von La Motte angefangen hatte, und zwar that sie dieß ohne die Absicht, dadurch um ihre Gunst zu werben, sondern weil sie eine gewisse Befriedigung dabey empfand, Unfreundlichkeit auf diese Art zu vergelten. Selbstliebe mag wohl der Centralpunct seyn, um den die menschlichen Neigungen sich drehen; denn alle Ursachen, die zur Selbstbefriedigung führen, lassen sich am Ende in Selbstliebe auflösen, doch sind einige dieser Neigungen so fein in ihrer Natur, daß sie beynahe den Nahmen Tugend verdienen, wenn wir gleich ihren Ursprung nicht läugnen können, und von dieser Art war gewiß Adelinens Gefühl.
Mit dieser Beschäftigung und mit Lesen brachte sie so viel als möglich vom Tage hin. Bücher machten in der That stets ihr Hauptvergnügen, und ihre Quelle des Unterrichts aus. La Motte hatte zwar wenige, aber diese waren sehr gut gewählt und Adeline konnte Vergnügen daran finden, sie mehr als einmahl zu lesen. Wenn ihre Seele durch ihrer Freundinn Behandlung, oder durch Rückblick auf ihr frühes Mißgeschick bekümmert war, so wiegte ein Buch sie in sanfte Ruhe. La Motte besaß verschiedene der besten italiänischen Dichter, deren Sprache Adeline im Kloster gelernt hatte. Sie konnte ihre Schönheiten fühlen, und sie begeisterten sie oft mit schwärmerischen Entzücken.
Gegen Abend verließ sie ihr Zimmer, um den Untergang der Sonne zu genießen, entfernte sich aber nicht weiter, als bis in eine Allee des Waldes, die nach Westen ging. Bey ihrer Zurückkunft in die Abtey kam ihr Louis entgegen, der nicht umhin konnte, ihr seyn Beyleid über den Auftritt des Morgens zu bezeugen, und sie seines wärmsten Eifers, wenn er zur Aufklärung des Mißverständnißes zwischen ihr und seiner Mutter beytragen könnte, zu versichern.
Adeline dankte ihm für sein freundschaftliches Anerbiethen, das sie tiefer fühlte, als sie zu äußern rathsam fand.
»Ich bin mir keines Vergehens bewußt,« sagte sie, »das mir den Unwillen der Frau von La Motte könnte zugezogen haben, und weiß ihn folglich auf keine Weise zu erklären. Ich habe oft eine Aufklärung gesucht, die sie aber eben so sorgfältig vermied, und halte es deßwegen für das Beste, die Sache nicht weiter zu berühren. Indessen erlauben Sie mir, Sie meines wärmsten Danks für Ihre Güte zu versichern.«
Ludwig seufzte und schwieg.
»Ich wünschte wohl,« sagte er endlich, »Sie möchten mir erlauben, mit meiner Mutter zu sprechen. Ich bin fast überzeugt, daß ich sie von ihrem Irrthum überführen würde.«
»Auf keine Weise,« erwiederte Adeline. »Die Unzufriedenheit Ihrer Frau Mutter hat mir sehr weh gethan, allein sie zu einer Erläuterung zwingen zu wollen, würde sie nur erhöhen; statt sie aus dem Wege zu räumen. Lassen Sie mich Sie bitten, keinen solchen Versuch zu machen.«
»Ich unterwerfe mich Ihrem Urtheil,« sagte Ludwig, »wiewohl es dießmahl ungern geschieht, ich würde mich glücklich schätzen, Ihnen nützlich seyn zu können.«
Er sprach diese Worte in einem so zärtlichen Ton, daß Adeline zum ersten Mahle die Empfindungen seines Herzens merkte. Hätte sie mehr Eitelkeit besetzen, so würde sie längst Louis Aufmerksamkeit für etwas mehr als bloße Höflichkeit gehalten haben. Sie that nicht, als ob sie seine letzten Worte bemerkte, sondern schwieg, und beschleunigte unwillkührlich ihre Schritte. Louis sprach nichts weiter, sondern schien in Gedanken versunken, und dieß Schweigen dauerte fort, bis sie die Abtey erreichten.
Beynahe ein Monath verstrich, ohne daß sich etwas merkwürdiges ereignete. La Mottens Schwermuth verminderte sich wenig, und seiner Frau Betragen gegen Adelinen, wiewohl etwas milder, war noch immer weit entfernt, gültig zu seyn. Louis bezeugte durch unzählige kleine Achtsamkeiten seine wachsende Neigung für Adelinen, die sie als leichte Höflichkeit zu behandeln fortfuhr.
An einem stürmischen Abend, als sie sich zum Schlafengehen anschickten, wurden sie durch ein Trampeln von Pferden nahe bey der Abtey beunruhiget: der Ton mehrerer Stimmen folgte darauf und ein lautes Klopfen am großen Thore der Halle bestätigte bald nachher ihr Schrecken. La Motte zweifelte nicht, daß die Gerichtsdiener endlich seinen Aufenthalt entdeckt hätten, und die Angst raubte ihm beynahe alles Bewußtseyn; indessen befahl er, die Lichter auszulöschen, und ein tiefes Stillschweigen zu beobachten, um auch nicht die kleinste Möglichkeit von Rettung unversucht zu lassen.
Kaum waren seine Befehle vollzogen, als das Klopfen erneuert wurde und mit vermehrter Heftigkeit. La Motte ging jetzt nach einem kleinen Gitterfenster am Thore, um die Zahl und das Ansehen der Fremden zu bemerken. Die Dunkelheit vereitelte seinen Vorsatz; er konnte nur einen Trupp Menschen zu Pferde sehen, doch hörte er bey scharfem Aufmerken einen Theil ihres Gesprächs. Einige stritten, daß sie sich in dem Orte geirrt hätten, bis ein Mann, der nach seiner gebiethrischen Stimme zu urtheilen, ihr Anführer zu seyn schien, behauptete, er hätte an dieser Stelle Licht gesehen, und wüßte gewiß, daß Menschen hier seyn müßten. Hierauf klopfte er nochmahls laut an, und erhielt nur hohlen Widerschall zur Antwort. La Mottens Herz erbebte, und er war unvermögend, sich zu bewegen.
Nachdem die Fremden eine Zeitlang gewartet hatten, schienen sie etwas zu berathschlagen, allein ihr Gespräch wurde so leise geführt, daß La Motte den Inhalt nicht verstehen konnte. Sie verließen das Thor als wollten sie fortgehen; gleich darauf aber glaubte er sie unter den Bäumen an der andern Seite des Gebäudes zu hören, und wurde bald überzeugt, daß sie die Abtey nicht verlassen hatten. Er hielt noch einige Minuten in peinlicher Ungewißheit aus, und verließ dann das Thor, an welches Louis sich stellte, um sich nach der Seite des Gebäudes zu begeben, wo er den Ort, an welchem sie sich seiner Meinung nach aufhielten, übersehen konnte.
Der Sturm tobte laut und die hohlen Windstöße, die zwischen den Bäumen rauschten, hinderten ihn, irgend einen andern Ton zu unterscheiden. Einmahl, als der Wind stille war, glaubte er deutlich Stimmen zu hören; allein er brauchte sich nicht lange mit Vermuthungen zu begnügen; das erneuerte Klopfen am Thore erschreckte ihn, und ohne auf seine Frau und Adelinen Rücksicht zu nehmen, lief er, um sein letztes Heil durch die Fallthüre zu versuchen.
Kurz darauf, da die Heftigkeit der Bestürmer mit jedem Windstoße zu wachsen schien, brach das alte verfallene Thor aus seinem Schwingen und ließ sie in die Halle. So wie sie hereintraten, bestärkte ein Schrey von Frau von La Motte, die an der Thüre des angrenzenden Zimmers stand, die Vermuthung des vornehmsten Fremden, der so schnell als die Dunkelheit es ihm zuließ, näher kam.
Adeline war in Ohnmacht gefallen, und Frau von La Motte schrie laut nach Hülfe. Peter trat mit Licht herein und sah die Halle voll Menschen und sein junges Fräulein sinnlos auf der Erde liegen. Ein Herr trat hervor, bat Madam um Verzeihung wegen seines unartigen Betragens, und wollte eine Entschuldigung vorbringen, als er Adelinen wahrnahm und auf sie zueilte, um sie aufzuheben; allein Louis, der jetzt zurückkam, nahm sie in seine Arme und bat den Fremden, sich nicht zu bemühen.
Der Mann, zu dem er dieß sagte, trug den Stern von einem der höchsten Orden in Frankreich, und hatte ein Ansehen von Würde, das seinen vornehmen Rang bezeugte. Er schien nahe an vierzig zu seyn, vielleicht aber machte das Feuer seines Gesichtes den Eindruck der Zeit auf seinen Zügen weniger merklich. Seine sanfte Miene und einnehmendes Wesen, während er, ohne auf sich selbst zu achten, nur um Adelinens Zustand bekümmert schien, zerstreute nach und nach Frau von La Mottens Angst und milderte Louis plötzliche Empfindlichkeit.
Adelinen, die noch immer nicht bey sich selbst war, staunte er mit einer heißen Bewunderung an, die alle Fähigkeiten seiner Seele zu verschlingen schien. In der That war sie auch ein Gegenstand, den man nicht mit Gleichgültigkeit betrachten konnte.
Ihre Schönheit, mit der Blässe der Unpäßlichkeit überzogen, gewann bey dem Gefühle, was sie an Blüthe verlor. Ihre nachlässige Kleidung, die man, um ihr Luft zu machen, geöffnet hatte, zeigte die glühenden Reize, welche ihre braunen, herabfallenden Locken nur beschatteten, aber nicht verheelen konnten.
Noch ein Fremder trat jetzt herein, ein junger Ritter, der eilends etwas zu dem ältern sagte, und dann zu der Gruppe trat, die Adelinen umringte. Er war schön gewachsen, und sein Gliederbau eben so sein proportionirt, als männlich; sein Gesicht war beseelt, aber nicht stolz; edel, doch unaussprechlich sanft. Es wurde noch interessanter durch den Antheil, den er an Adelinen zu nehmen schien, die jetzt auflebte, und ihn, den ersten Gegenstand, den ihre Augen trafen, in stummer Angst über sich hängen sah.
Eine schnelle Röthe überflog ihre Wangen, sie erkannte ihn für den Fremden, den sie im Walde gesehen hatte. Augenblicklich aber verwandelte sich ihre Farbe in die Blässe des Schreckens, als sie das Zimmer mit Menschen angefüllt sah. Louis führte sie in ein anderes Zimmer, wohin die beyden Herren ihr folgten, und sich auf das neue wegen des Schreckens, den sie verursacht hatten, entschuldigten. Der ältere wandte sich zu Frau von La Motte:
»Ohne Zweifel, Madame, ist Ihnen nicht bekannt, daß ich der Besitzer dieser Abtey bin;« — sie erschrack. — »Beunruhigen Sie sich nicht, Madame, Sie sind sicher willkommen. Ich habe diesen verfallenen Ort längst verlassen, und schätze mich glücklich, wenn er Ihnen eine Zuflucht gewährt hat.«
Frau von La Motte bezeugte ihren Dank für diese Güte, und Louis äußerte, wie sehr er die Höflichkeit des Marquis de Montalt zu schätzen wüßte: denn dieß war der Nahme des edeln Fremden.
»Ich halte mich meistens in einer fernen Provinz auf,« sagte der Marquis, »allein ich besitze ein kleines Lustschloß nahe an diesem Walde und bey der Rückkehr von einer kleinen Reise habe ich mich von der Nacht überfallen lassen und meinen Weg verloren. Ein Licht, welches durch die Bäume schimmerte, zog mich hieher, und die Dunkelheit außen war so tief, daß ich nicht wußte, woher es kam, bis ich vor der Thüre der Abtey war.«
Das edle Ansehen der Fremden, ihre vornehme Kleidung und mehr als alles, diese Worte, zerstreuten jeden übrig gebliebenen Zweifel bey Madame, und sie wollte eben Befehl geben ihnen Erfrischungen vorsetzen zu lassen, als La Motte, der gehorcht hatte, und nun überzeugt war, daß er nichts zu fürchten brauchte, in das Zimmer trat.
Er ging mit gefälliger Miene auf den Marquis zu, als er aber reden wollte, erstarben die Worte des Willkommens auf seinen Lippen, seine Glieder zitterten und Todtenblässe überzog sein Gesicht. Der Marquis war nicht viel weniger bestürzt, und legte im ersten Augenblicke der Überraschung die Hand an den Degen, besann sich aber, zog sie zurück und bemühete sich, die Bewegung seines Gesichtes zu verbergen. Es erfolgte eine Pause ängstlichen Schweigens. La Motte machte eine Bewegung gegen die Thüre, allein sein erschütterter Körper weigerte sich ihn zu unterstützen, und er sank in einen Stuhl.
Das Schrecken in seinem Gesichte und sein ganzes Betragen erregten die höchste Befremdung bey seiner Frau, deren Augen den Marquis mehr fragten, als er zu beantworten gut fand: seine Blicke vermehrten das Geheimniß statt es zu erläutern und verriethen ein Gemisch von Bewegungen, die sie nicht zu erklären wußte. Indessen suchte sie ihrem Manne beyzuspringen, allein er stieß sie zurück, wandte das Gesicht ab und bedeckte es mit beyden Händen.
Der Marquis, der seine Gegenwart des Geistes wieder zu erhalten schien, wollte nach der Thüre der Halle gehen, wo seine Leute versammelt waren, als La Motte, mit verstörtem Blick, ihn umzukehren bat. Der Marquis sah sich um und stand still, schien aber noch unentschlossen; ein Blick auf Adelinen, deren stumme Angst für La Motten zu flehen schien, bestimmte ihn, und er setzte sich nieder.
»Ich ersuche Sie, gnädiger Herr!« sagte La Motte, »mir eine geheime Unterredung von einigen Augenblicken zu erlauben.«
»Diese Foderung ist etwas stark und mehr, als ich gewähren kann. Sie können mir nichts zu sagen haben, was nicht Ihrer Familie bekannt wäre; tragen Sie also Ihre Sache vor, und fassen sich kurz.«
La Mottens Gesicht verändert sich bey jedem Worte dieser Rede.
»Unmöglich, gnädiger Herr,« sagte er, »meine Lippen sollen sich auf ewig schließen, ehe sie vor einem andern Sterblichen die Worte aussprechen, die Ihnen allein aufbehalten sind. Ich bitte Sie, ich flehe Sie nur um einige Augenblicke!«
Bey diesen Worten traten ihm Thränen in die Augen, und der Marquis, durch seinen Kummer besänftigt, willigte, wiewohl mit sichtlicher Unruhe und Widerwillen, in sein Verlangen.
La Motte nahm ein Licht und führte den Marquis in ein kleines Zimmer in einem entlegenen Theile des Gebäudes, wo sie beynahe eine Stunde blieben. Madame, durch ihre lange Abwesenheit beunruhigt, ging ihnen nach: eine Neugier, die unter diesen Umständen vielleicht nicht zu tadeln war, trieb sie an zu horchen. La Motte sprach, mit großer Bewegung.
»Der Wahnsinn der Verzweiflung,« sagte er — das Folgende konnte sie nicht verstehen. »Ich habe mehr gelitten, als ich sagen kann,« fuhr er fort, »dieses Bild hat mich in meinen nächtlichen Träumen, und bey meinen Wanderungen am Tage begleitet. Es gibt keine Strafe, außer dem Tode, die ich nicht erdulden wollte, um den Seelenzustand wieder zu erlangen, den ich mit in diesen Wald brachte. Ich flehe Sie nochmahls um Mitleid.«
Ein lauter Windstoß, der den Gang hinab scholl, wo Frau von La Motte stand, überwältigte seine Stimme und des Marquis Antwort; bald darauf aber hörte sie folgende Worte:
»Morgen, gnädiger Herr, wenn Sie wieder hierher kommen, will ich Sie nach dem Orte führen.«
»Das ist kaum nöthig, und dürfte gefährlich seyn,« erwiederte dieser.
»Ich kann Ihnen diese Zweifel nicht verdenken,« versetzte La Motte, »allein ich will schwören, was Sie mir vorlegen. Ja, was auch die Folge seyn mag, ich will schwören, mich Ihrem Ausspruche zu unterwerfen!«
Der Sturm verschlang auf das neue den Laut ihrer Stimmen, und Frau von La Motte bemühte sich vergebens die Worte zu hören, woran wahrscheinlich die Erläuterung dieses seltsamen Geheimnißes hing. Sie gingen jetzt nach der Thüre zu und sie begab sich eilends in das Zimmer zurück, wo sie Adelinen mit Louis und dem jungen Chevalier gelassen hatte.
Der Marquis und La Motte kamen bald nach ihr: der erste stolz und kalt; der letzte etwas gefaßter als zuvor, wiewohl der Eindruck des Schreckens noch nicht von seinem Gesichte verwischt war. Der Marquis ging nach der Halle, wo sein Gefolge wartete; der Sturm hatte sich noch nicht gelegt, allein er schien ungeduldig fortzukommen, und befahl seinen Leuten, sich bereit zu machen.
La Motte beobachtete ein finsteres Stillschweigen, ging mit schnellen Schritten im Zimmer auf und ab, und schien dann wieder in Nachsinnen verloren. Indessen setzte sich der Marquis zu Adelinen, und widmete ihr seine ganze Aufmerksamkeit, außer wenn plötzliche Anwandlungen von Geistesabwesenheit sich seiner bemächtigten und ihn in kurzes Stillschweigen versenkten: zu solchen Zeiten richtete der junge Chevalier sein Gespräch an sie, die zwischen Furchtsamkeit und Unruhe getheilt, gegen beyde gleich zurückhaltend blieb.
Der Marquis war nun beynahe zwey Stunden auf der Abtey gewesen, und da das Ungewitter noch immer anhielt, both ihm Frau von La Motte ein Bett an. Ein Blick von ihrem Manne machte sie für die Folge zittern. Doch wurde das Anerbiethen höflich abgelehnt, weil der Marquis sichtlich eben so ungeduldig fort verlangte, als sein Wirth ihn loszuwerden wünschte. Er ging oft in die Halle und sah ungeduldig nach den Wolken. Man konnte in der Finsterniß der Nacht nichts wahrnehmen, nichts hören, als das Pfeifen des Sturms.
Der Morgen dämmerte ehe sie fortgingen; als er sich anschickte, die Abtey zu verlassen, zog ihn La Motte nochmahls bey Seite und sprach einige Augenblicke leise mit ihm. Seine heftige Gestikulation, die Frau von La Motte aus einem andern Ende des Zimmers bemerkte, erhöhte ihre Neugier zu wilder Angst. Ihr Bemühen, die Worte zu verstehen, war vergebens, weil sie zu leise gesprochen wurden.
Endlich zog der Marquis mit seinem Gefolge ab, und La Motte, nachdem er mit eigener Hand die Thore befestigt hatte, begab sich schweigend und düster in sein Schlafzimmer. Sobald sie allein waren, drang Madame in ihn, ihr den vorgefallenen Auftritt zu erklären.
»Legen Sie mir keine Fragen vor,« sagte La Motte wild; »denn ich will keine beantworten; ich habe mir bereits alles Reden über die Sache verbethen.«
»Über welche Sache?« fragte seine Frau.
La Motte schien sich zu besinnen —
»Gleichviel ich irrte mich; ich glaubte, Sie hätten mich schon mit diesen Fragen gequält.«
»Ach,« sagte Frau von La Motte, »so ist es also, wie ich fürchtete. Ihre bisherige Schwermuth und die Angst dieser Nacht haben eine Ursache!«
»Und warum forschen, oder fragen Sie darnach? Soll ich ewig mit Vermuthungen verfolgt werden?«
»Verzeihen Sie mir, es war nicht meine Absicht, Sie zu verfolgen: allein meine Angst für Ihr Wohl wird mich unter dieser schrecklichen Ungewißheit nicht ruhen lassen. Lassen Sie mich das Vorrecht einer Gattinn fodern, und den Kummer theilen, der Sie niederdrückt. Verweigern Sie mir nicht —
La Motte unterbrach sie —
»Was auch die Ursache der Bewegungen seyn mag, die Sie mit angesehen haben,« sagte er, so schwöre ich hiemit, sie jetzt nicht zu entdecken. Vielleicht wird eine Zeit kommen, wo ich es nicht länger nöthig glauben werde, sie zu verheelen. Bis dahin schweigen Sie und stehen von allen Fragen ab: vor allen Dingen enthalten Sie sich, gegen irgend jemand zu erwähnen, was Sie ungewöhnliches an mir bemerkt zu haben glauben. Begraben Sie Ihre Zweifel in Ihrer eigenen Brust, wenn Sie meinen Fluch und Verderben zu vermeiden wünschen.«
Der schreckliche Ton, womit er dieses sprach, während eine hohe Röthe sein Gesicht überzog, machte seine Frau schaudern, und sie enthielt sich aller Antwort.
Frau von La Motte legte sich zur Ruhe, aber nicht zum Schlaf. Sie dachte über das Vorgefallene nach, und ihre Befremdung und Neugier über ihres Mannes Worte und Betragen wurde durch Nachdenken nur noch geschärft. Eine Wahrheit sah sie indessen: sie konnte nicht zweifeln, daß La Mottens geheimnißvolles Betragen, welches seit so vielen Monathen sie mit Angst erfüllt hatte, und der Auftritt mit dem Marquis aus der nähmlichen Ursache entsprangen.
Diese Überzeugung, die zu beweisen schien, wie ungerecht sie Adelinen in Verdacht gehabt hatte, brachte einen peinlichen Selbstvorwurf mit. Sie sah mit Ungeduld dem morgenden Tage entgegen, der den Marquis wieder nach der Abtey bringen würde. Endlich trat die ermattete Natur in ihre Rechte und gab einer kurzen Vergessenheit des Kummers Raum.
Den folgenden Tag kam die Gesellschaft erst spät beym Frühstück zusammen. Jedes Glied schien schweigend und abgezogen, sehr verschieden aber war der Ausdruck ihres Gesichts und mehr noch, der Inhalt ihrer Gedanken. La Motte schien von ungeduldiger Angst gequält, doch herrschte die Düsterkeit der Verzweiflung in seinen Zügen. Eine gewisse Wildheit in seinem Blicke verrieth oft das plötzliche Auffahren des Schreckens, und dann sanken wiederum seine Züge in trübe Niedergeschlagenheit zurück.
Frau von La Motte schien unter einer ängstlichen Unruhe zu arbeiten: sie beobachtete jeden Zug in ihres Mannes Gesicht und erwartete ungeduldig des Marquis Ankunft. Louis war still und nachdenkend.
Adeline schien ihr volles Maß von Unruhe zu empfinden. Sie hatte mit äußerster Befremdung La Mottens Betragen in der vergangenen Nacht bemerkt, und das glückliche Zutrauen, was sie bisher zu ihm fühlte, war sehr erschüttert worden. Auch fürchtete sie, daß dringende Umstände ihn wieder in die Welt werfen und ihn unfähig oder ungeneigt machen würden, ihr ferner eine Zuflucht unter seinem Dache zu geben.
La Motte ging während des Frühstücks oft an das Fenster und sah ängstlich hinaus. Seine Frau verstand die Ursache seiner Ungeduld nur zu gut, und bemühte sich die ihrige zu unterdrücken. Louis versuchte in diesen Zwischenzeiten oft einige Erläuterung von seinem Vater zu erhalten, allein La Motte ging immer wieder an den Tisch zurück, wo Adelinens Gegenwart ein ferneres Gespräch verhinderte.
Nach dem Frühstücke ging er auf dem freyen Platz, wohin Louis ihm folgen wollte; La Motte erklärte kurz, er wollte allein seyn, und entfernte sich bald nachher, da der Marquis noch nicht erschien, weiter von der Abtey. Adeline verfügte sich mit Frau von La Motte in ihr gewöhnliches Arbeitszimmer. Diese nahm ein heiteres, ja sogar freundliches Wesen an, und weil sie es nothwendig fühlte, eine Ursache wegen La Mottens auffallender Bewegung anzuführen und der Befremdung vorzubeugen, die des Marquis unerwartetes Wiederkommen Adelinen verursachen mußte, wenn sie es mit dem Betragen der vorigen Nacht zusammen hielt, erwähnte sie, daß der Marquis und La Motte einander lange gekannt hätten, und daß dieß unvermuthete Wiedersehen nach einer Trennung von vielen Jahren, und zwar unter so veränderten und beschämenden Umständen von Seiten ihres Mannes, ihm eine schmerzliche Empfindung verursacht hätte; dazu käme noch, daß der Marquis vormahls einige Umstände seines Betragens gegen ihn gemißdeutet, wodurch eine Aufhebung ihres freundschaftlichen Verhältnisses veranlaßt sey.
Die Erläuterung überzeugte Adelinen nicht, weil sie den Grad von Bestürzung, welche sowohl der Marquis als La Motte verrathen hatten, nicht zu rechtfertigen schien. Ihre Verwunderung und Neugier wurde durch die Worte, welche sie ablenken sollten, nur noch mehr erhöht, doch enthielt sie sich, ihre Gedanken zu äußern.
Madame fuhr fort, und sagte: ›sie erwartete den Marquis diesen Morgen und hoffte, alles noch übrige Mißverständniß würde dann ganz beygelegt werden.‹
Adeline erröthete und wollte antworten, aber ihre Lippen bebten. Sie fühlte ihre Bewegung, und daß Madame sie bemerkte; ihre Verwirrung stieg und wurde durch ihr Bemühen, sie zu verbergen, nur noch sichtlicher. Immer noch bemühte sie sich, das Gespräch anzuknüpfen, und immer fand sie es unmöglich, ihre Gedanken zu sammeln. Voll Angst, daß Madame die Empfindung entdecken würde, die bis jetzt ihr selbst Geheimniß gewesen war, verlor sie die Farbe, ihre Augen sanken zur Erde und sie konnte nicht mehr athmen.
Frau von La Motte fragte, ob ihr nicht wohl sey? und Adeline, froh, einen Vorwand gefunden zu haben, ging auf ihr Zimmer, um ihren Gedanken nachzuhängen, die jetzt ganz mit der Erwartung beschäftigt waren, den jungen Chevalier, der den Marquis begleitet hatte, wieder zu sehen.
Sie sah aus dem Fenster den Marquis zu Pferde mit verschiedenen Begleitern in der Ferne heran kommen und eilte, der Frau von La Motte seine Ankunft zu melden. In kurzer Zeit war er am Thore, und Madame und Louis gingen hinaus, ihn zu empfangen, weil La Motte noch nicht wieder gekommen war. Er trat in Begleitung des jungen Chevaliers in die Halle, begrüßte Madam mit etwas förmlicher Höflichkeit und fragte nach ihrem Manne, den Louis aufzusuchen eilte.
Der Marquis schwieg einige Augenblicke und fragte dann Frau von La Motte, wie sich ihre schöne Tochter befände? Madame merkte, daß er Adelinen meinte, und nachdem sie seine Frage beantwortet und leichthin gesagt hatte, Adeline wäre nicht mit ihr verwandt, wurde sie herunter gerufen, weil der Marquis einen Wunsch nach ihrer Gesellschaft äußerte. Sie trat mit bescheidenem Erröthen und einem furchtsamen Wesen herein, welches alle seine Aufmerksamkeit zu beschäftigen schien. Sie beantwortete seine Höflichkeit mit holder Anmuth, als aber der junge Chevalier sich ihr nahete, machte seine wärmere Anrede sie unwillkührlich zurückhaltender, und sie wagte kaum die Augen aufzuschlagen, um nicht den seinigen zu begegnen.
La Motte kam herein und der Marquis beantwortete die Entschuldigung seiner Abwesenheit nur durch eine leichte Verneigung mit dem Kopfe, indem er zugleich in seiner Miene Mißtrauen und Stolz verrieth. Sie verließen gleich darauf die Abtey mit einander, und der Marquis winkte seinen Leuten, ihm in einiger Entfernung zu folgen. La Motte hieß seinen Sohn zurückbleiben, doch bemerkte Louis, daß er den Weg in die dickste Gegend des Waldes nahm. Er verlor sich in einem Chaos von Vermuthungen, und Neugier und Besorgniß für seinen Vater bewegten ihn, in einiger Entfernung zu folgen.
Der junge Fremde, den der Marquis Theodor genannt hatte, blieb indessen bey den Frauenzimmern. Frau von La Motte konnte mit aller Kunst ihre Unruhe nicht ganz verbergen. Sie ging unwillkührlich nach der Thüre, so oft sie einen Fußtritt hörte, und begab sich mehrmahls in die Halle, um nach dem Walde zu sehen, kehrte aber eben so oft in ihrer Erwartung betrogen zurück. Niemand erschien. Theodor schien so viel von seiner Aufmerksamkeit auf Adelinen zu richten, als die Höflichkeit ihm von Frau von La Motte abzuziehen erlaubte. Sein so sanftes und zugleich edles Wesen überwältigte unmerklich ihre Furchtsamkeit und verbannte alle Zurückhaltung.
Ihr Gespräch litt nicht länger unter einem peinlichen Zwang, sondern enthüllte allmählich die Schönheit ihres Geistes, und schien ein wechselseitiges Vertrauen zu erzeugen. Bald verrieth sich eine Gleichheit ihrer Denkungsart und das ungeduldige Vergnügen, welches Theodors Gesicht beseelte, verrieth, daß er oft ihre Gedanken voraus las.
Ihnen däuchte die Abwesenheit des Marquis kurz, so lang sie auch der Frau von La Motte zu dauern schien, deren Gesicht sich aufklärte, als sie endlich die Pferde am Thore trampeln hörte.
Der Marquis zeigte sich nur einen Augenblick und ging mit La Motte in ein anderes Zimmer, wo sie eine kurze Zeit blieben, worauf er sich sogleich entfernte. Theodor nahm von Adelinen, die nebst La Motte und seiner Frau, sie bis an das Thor begleitete, mit einem Ausdruck zärtlichen Schmerzes Abschied, und sah sich um, bis die zwischenstehenden Bäume die Abtey seinem Blicke gänzlich verbargen.
Der vorübergehende Glanz der Freude verschwand mit dem jungen Fremden von Adelinens Wange, und mit einem Seufzer ging sie in die Halle zurück. Theodors Bild verfolgte sie bis in ihr Zimmer; sie rief sich jedes Wort seines Gesprächs zurück. Seine mit den ihrigen so gleich tönende Gefühle, sein so einnehmendes Wesen, ein seelenvolles Gesicht, so offen und edel, in welchem männliche Würde mit süssen Wohlwollen vereinigt war, — alles dieses und tausend andere Reize drangen vor ihre Fantasie, und eine süsse Schwermuth bemeisterte sich ihrer.
»Ich werde ihn nicht mehr sehen,« sagte sie zu sich selbst.
Ein Seufzer, der diesen Worten folgte, verrieth ihr mehr, als sie zu wissen wünschte. Sie erröthete und seufzte wieder, raffte sich dann plötzlich auf und suchte ihre Gedanken auf einen andern Gegenstand zu leiten. La Mottens Verhältniß mit dem Marquis beschäftigte eine Weile ihre Aufmerksamkeit, unfähig aber, das Geheimniß, welches hier im Grunde zu liegen schien, zu enträthseln, suchte sie Zuflucht vor ihren eigenen Betrachtungen in den angenehmern, die sie aus Büchern schöpfte.
Indessen wagte Louis, betroffen, und befremdet über die äußerste Bestürzung, welche sein Vater bey der ersten Zusammenkunft mit dem Marquis verrieth, ihn darüber zu befragen. Er zweifelte nicht, daß der Marquis in genauem Zusammenhange mit dem Vorfall stehen müßte, der La Motten nöthigte Paris zu verlassen, und sagte seine Gedanken unverhohlen, indem er zugleich den unglücklichen Zufall beklagte, der ihn an einem Orte Zuflucht suchen ließ, welcher unter allen sie am wenigsten gewähren konnte — das Haus seines Feindes. La Motte wiedersprach seines Sohnes Meinung nicht, wiewohl er alle deutliche Erklärung vermied, und beklagte ebenfalls das Mißgeschick, welches ihn hieher geführt hätte.
Louis Urlaub war nunmehr beynahe verflossen, und er äußerte seine Betrübniß, seinen Vater in so mißlicher Lage so bald verlassen zu müssen.
»Ich würde Sie mit weniger Schmerz verlassen,« fuhr er fort, »wenn ich nur den ganzen Umfang Ihres Unglücks kennte. So aber muß ich mich mit Vermuthungen von Übeln quälen, die vielleicht keine Wirklichkeit haben. Befreyen Sie mich, liebster Vater, aus dieser peinlichen Ungewißheit, und lassen Sie mir zu, mich Ihres Vertrauens würdig zu beweisen.«
»Ich habe dir über die Sache bereits geantwortet, und dir verbothen, ihrer wieder zu erwähnen; jetzt sehe ich mich genöthigt, dir zu sagen, daß deine Entfernung mir nicht sehr nahe gehen kann, wenn du fortfährst, mich mit solchen Fragen zu peinigen.«
Mit diesen Worten eilte er schnell fort, und ließ seinen Sohn in Zweifel und Bekümmerniß.
Des Marquis Erscheinung hatte die eifersüchtigen Besorgnisse der Frau von La Motte zerstreut, und sie zum Gefühl ihrer Grausamkeit gegen Adelinen gebracht. Wenn sie an ihre verwaiste Lage dachte, an die zärtliche Anhänglichkeit, die stets aus ihrem Betragen hervor leuchtete, an die Sanftheit und Geduld, womit sie ihre Ungerechtigkeit' verschmerzt hatte, so fühlte sie sich beklommen und ergrif die erste Gelegenheit, ihre vorige Güte zu erneuern. Allein sie konnte diese anscheinende Inconsequenz ihres Betragens nicht erläutern, ohne ihren gehabten Verdacht zu verrathen, an den sie jetzt mit Erröthen. gedacht, und eben so wenig ihr voriges Betragen entschuldigen, ohne diese Erläuterung zu geben. Sie mußte sich also begnügen, durch ihr bloßes Betragen ihre erneuerte Freundschaft zu zeigen.
Adeline fand sich anfänglich befremdet, empfand aber zu viel Freude über die Veränderung, um bedenklich nach der Ursache zu forschen. Allein ungeachtet der Zufriedenheit, die Adeline bey ihrer Freundinn erneuerten Güte fühlte, beschäftigten sich doch ihre Gedanken oft mit ihrer so besonders hülflosen Lage. Sie konnte nicht umhin, weniger Vertrauen in die Freundschaft der Frau von La Motte zu sehen, als zuvor; ihr Charakter mußte ihr minder liebenswürdig scheinen, als sie sich vormahls ihn gedacht hatte, und sie glaubte ihn abwechselnden Launen unterworfen.
Auch dachte sie oft an die seltsame Erscheinung des Marquis auf der Abtey, an die gegenseitige Bestürzung und anscheinendes Mißfallen zwischen ihm und La Motte, und konnte es nicht reimen, wie unter solchen Umständen La Motte in seinem Gebiethe bleiben, und der Marquis ihn darin dulden mochte.
Ihre Seele kehrte vielleicht öfter zu diesen Gegenständen zurück, weil er mit Theodor zusammen hing, doch war sie sich dieser Vorstellung nicht deutlich bewußt. Sie schrieb den Antheil, den sie bey dieser Sache fühlte, ihrer Sorge für La Mottens Wohl und für ihr eigenes künftiges Geschick zu, welches jetzt so tief mit dem seinigen verwebt war. Zuweilen ertappte sie sich zwar auf Vermuthungen über den Grad der Verwandtschaft zwischen Theodor und dem Marquis, dann aber that sie plötzlich ihren Gedanken Einhalt, und tadelte sich streng, zu einem Gegenstand übergeschweift zu seyn, den sie für ihre Ruhe nur zu gefährlich fühlte.
Wenig Tage nach der im vorigen Kapitel erzählten Begebenheit, als Adeline einsam in ihrem Zimmer saß, wurde sie durch das Trampeln von Pferden nahe beym Thore aus ihren Fantasien erweckt, und sah aus ihrem Fenster den Marquis de Montalt in die Abtey gehen. Diese Erscheinung befremdete sie, und eine Bewegung, in deren Ursache sie nicht forschen mochte, trieb sie sogleich vom Fenster zurück. Dieselbe Ursache indessen führte sie eben so schnell wieder dahin, allein der Gegenstand, den ihre Blicke suchten erschien nicht, und sie hatte keine Eile, sich zurückzuziehen.
Indem sie sinnend und getäuscht da stand, kam der Marquis mit La Motte heraus, und verbeugte sich gegen Adelinen, zu der er herauf sah. Sie erwiederte ehrerbiethig seinen Gruß und verließ das Fenster, unmuthig, daß man sie das selbst gesehen hatte. Sie gingen in den Wald, allein des Marquis Leute folgten ihnen dießmahl nicht. Als sie nach einer langen Zeit zurückkamen, stieg der Marquis sogleich auf das Pferd und ritt davon.
La Motte schien den Tag über düster und still, und war oft in Gedanken verloren. Adeline betrachtete ihn mit Aufmerksamkeit und Bekümmerniß: sie sah, daß jede Zusammenkunft mit dem Marquis ihn schwermüthiger machte, und erstaunte zu hören, daß dieser letzte den folgenden Tag auf der Abtey essen wollte.
Als La Motte dieses erwähnte, fügte er einige hohe Lobsprüche über den Charakter des Marquis hinzu, und pries besonders seine Großmuth und Adel der Seele. In diesem Augenblick erinnerte sich Adeline an die Geschichte, die sie von der Abtey hatte erzählen hören, und sie warfen einen Schatten über den Glanz von Vortreflichkeit, welche La Motte jetzt erhob. Doch schien das Gerücht nicht viel Glauben zu verdienen; ein Theil davon, so weit ein Nichtseyn einen Beweis abgeben kann, war bereits widerlegt: denn ungeachtet der Erzählung, daß es auf der Abtey spukte, hatten die gegenwärtigen Bewohner noch keine übernatürliche Erscheinung bemerkt.
Doch wagte Adeline zu fragen, ob es der jetzige Marquis wäre, von dem sich diese nachtheiligen Gerüchte verbreitet hätten?
La Motte antwortete mit einem spöttischen Lächeln:
»Mährchen von Geistern und Hexen haben immer bey dem Pöbel Bewunderung und Glauben gefunden. Ich für mein Theil, bin wenigstens eben so geneigt, mich auf das Zeugniß meiner eigenen Erfahrung als auf die Geschwätze dieser Bauern zu verlassen. Wenn Sie etwas gesehen haben, das Sie bestätigen kann, so theilen Sie mir es doch mit, damit sich mein Glaube stärkt.«
»Sie mißverstehen mich,« sagte sie, »ich wollte nicht nach übernatürlichen Dingen fragen, sondern hatte nur einen gewissen Theil des Gerüchts im Sinn, nähmlich von einem Menschen, der auf Befehl des Marquis hier eingesperrt und auf keine gute Art um das Leben gekommen seyn sollte. Man gab dieß zur Ursache an, weswegen der Marquis die Abtey verlassen hätte.«
»Lauter Gewäsch der Müßigkeit! eine fabelhafte Erzählung, um Verwunderung zu erregen: es ist genug den Marquis zu sehen, um es zu widerlegen; wenn wir die Hälfte von Geschichten, die aus der nähmlichen Quelle springen, glauben wollen, so zeigen wir uns wenig über die Einfältigen erhaben, die sie erfanden. Ihr Verstand, Adeline, sollte Sie, denke ich, vor solcher Leichtgläubigkeit schützen.«
Adeline erröthete und schwieg; doch schien ihr La Mottens Vertheidigung des Marquis weit wärmer und ausführlicher, als es seinem Charakter gewöhnlich war, oder hier erfodert wurde. Sein ehemahliges Gespräch mit Louis fiel ihr ein, und das jetzige befremdete sie um so mehr.
Sie sah dem morgenden Tage mit einer Mischung von Pein und Vergnügen entgegen: die Erwartung, den jungen Chevalier wieder zu sehen, beschäftigte ihre Gedanken und erregte ein Gemisch von Empfindungen in ihr: bald fürchtete sie seine Gegenwart, und bald zweifelte sie, ob er kommen würde. Endlich erröthete sie über sich selbst, ihre Gedanken so sehr mit ihm beschäftigt zu finden.
Der morgende Tag kam, der Marquis erschien — aber er erschien allein! und der Sonnenschein in Adelinens Seele wurde getrübt, wiewohl sie Fassung genug besaß, ihre gewohnte Heiterkeit beyzubehalten. Der Marquis war höflich, gesprächig und aufmerksam: mit den feinsten und angenehmsten Sitten vereinigte er die höchste Ungezwungenheit der großen Welt. Seine Unterhaltung war lebhaft, geistvoll, oft sogar witzig und verrieth große Kenntniß der Welt, oder wenigstens, was oft dafür gehalten wird: Bekanntschaft mit den höhern Zirkeln und den Gegenständen des Tages.
Hier war auch La Motte in seinem Fache, und sie sprachen mit Witz und Laune über die Charaktere und Sitten des Zeitalters, Frau von La Motte hatte ihren Mann noch nicht so vergnügt gesehen, seit sie Paris verließen, und oft wähnte sie beynahe, selbst dort zu seyn. Adeline hörte zu, bis sie die Munterkeit, die sie anfangs nur erkünstelt hatte, wirklich empfand. Die Anreden des Marquis waren so gefällig und leutselig, daß ihre Zurückhaltung nach und nach verschwand, und ihre natürliche Lebhaftigkeit die lange verlorne Herrschaft wieder gewann.
Beym Abschiede sagte der Marquis zu La Motte, er freute sich, einen so angenehmen Nachbar gefunden zu haben. La Motte verneigte sich.
»Ich werde Sie oft besuchen,« sagte er, »und beklage nur, daß ich Frau von La Motte und ihre schöne Freundinn nicht auf mein Schloß einladen kann; ich lasse jetzt an einigen Veränderungen arbeiten, die es zu einem sehr ungemächlichen Aufenthalt machen.«
La Mottens Munterkeit verschwand mit seinem Geiste, und er fiel bald in sein gewöhnliches Stillschweigen und Tiefsinn zurück.
»Der Marquis ist ein sehr angenehmer Mann,« sagte Frau von La Motte —
»Sehr angenehm,« versetzte er —
»Und scheint viel Herzensgüte zu haben,« fuhr sie fort —
»Sehr viel,« sagte La Motte.
»Sie scheinen nachdenkend, mein Lieber. Was fehlt Ihnen?«
»Nichts auf der Welt. Ich dachte nur, es ist doch Schade, daß mit so angenehmen Talenten und solcher Herzensgüte der Marquis —«
»Was, mein Kind?« fragte Madame ungeduldig —
»Daß der Marquis — daß er diese Abtey so verfallen läßt —« erwiederte La Motte.
»Ist das alles?« sagte Madame mit getäuschter Miene. —
»Alles, auf meine Ehre,« erwiederte La Motte, und verließ das Zimmer.
Adelinens Lebensgeister versanken in Mattigkeit, da die lebhafte Unterhaltung des Marquis sie nicht länger spannte, und sie ging, nachdem er fort war, tiefsinnig in den Wald. Sie folgte einem kleinen romantischen Wege, der sich am Strome hinwand und mit dicken Zweigen überschattet war. Die Ruhe der Gegend, welche der Herbst jetzt mit seinen goldenen Farben berührte, wiegte ihre Seele in eine sanfte Schwermuth, und sie ließ eine Thräne, die sich, sie wußte nicht warum, in ihr Auge geschlichen hatte, ungehindert herabrollen.
Sie kam an eine kleine Vertiefung, welche hohe Bäume beschirmten: der Wind seufzte klagend zwischen den Bäumen, und schüttelte ihre Blätter zur Erde, wenn er in ihren hohen Wipfeln wehte. Sie setzte sich auf einen kleinen Hügel und hing den schwermüthigen Gedanken nach, die sich zu ihrer Seele drängten.
»O könnte ich in die Zukunft tauchen und die Schicksale sehen, die noch meiner warten! vielleicht würde ich durch stetes Betrachten Stärke gewinnen, sie zu ertragen. Eine Waise in dieser weiten Welt — Fremden in die Arme geworfen, deren Güte ich sogar meinen Lebensunterhalt danken muß; was für Leiden muß ich nicht erwarten! O mein Vater, wie konntest du so dein Kind verlassen — es den Stürmen des Lebens überlassen, um vielleicht darin zu versinken. Ach! ich habe keinen Freund! —«
Ein Geräusch in dem gefallenen Laube unterbrach sie: sie sah sich um, und erblickte des Marquis jungen Freund.
»Verzeihen Sie diesen Einbruch,« sagte er, »Ihre Stimme zog mich hieher und Ihre Worte hielten mich zurück. Mein Vergehen führt seine eigene Strafe mit sich, denn da ich Ihren Kummer erfahren habe, wie kann ich umhin, ihn mit zu empfinden! Möchte meine Theilnahme, mein eigenes Leiden das Ihrige lindern können! —« Er stockte — »Möchte ich den Nahmen Ihres Freundes verdienen und von Ihnen selbst dessen würdig gefunden werden!
Adelinens Verwirrung erlaubte ihr kaum zu antworten: sie zitterte, und zog sanft ihre Hand, die er ergriffen hatte, aus der seinigen.
»Vielleicht haben Sie mehr gehört, als wirklich ist,« sagte sie. »Es ist wahr, ich bin nicht glücklich, allein ein trüber Augenblick hat mich unbillig gemacht, und ich habe mein Schicksal vielleicht härter geschildert, als es wirklich ist. Wenn ich sagte, ich hätte keinen Freund, so war ich undankbar gegen die Güte des Herrn und der Frau von La Motte, die mir wirklich mehr als Freunde, die mir Ältern gewesen sind.«
»Wenn das ist, so ehre ich sie,« rief Theodor mit Wärme, »und wäre es nicht verwegen, so würde ich fragen, warum Sie sich unglücklich schätzen? — Aber —«
Er schwieg. Adeline schlug die Augen auf, und sah, daß er mit inniger, wehmüthiger Zärtlichkeit sie anblickte, und ihr Auge sank wieder zur Erde.
»Ich habe Sie bekümmert,« sagte Theodor, »durch eine unschickliche Frage. Können Sie mir vergeben, und auch das noch, wenn ich hinzusetze, daß Bekümmerniß um Ihr Wohl meine Frage eingab.«
»Vergebung dürfen Sie nicht bitten. Gewiß bin ich Ihnen für die Äußerung Ihres Antheils verbunden. Allein der Abend wird kühl, wenn es Ihnen gefällig ist, wollen wir nach der Abtey gehen.«
Theodor ging eine Weile schweigend neben ihr her. Endlich sagte er:
»Erst eben bat ich Sie um Verzeihung, und jetzt muß ich es vielleicht wieder, allein Sie werden mir die Gerechtigkeit erweisen, zu glauben, daß ich starke, und vielleicht dringende Gründe habe, Sie zu fragen, wie nahe Sie mit Herrn von La Motte verwandt sind?«
»Ich bin gar nicht mit ihm verwandt, allein den Dienst, welchen er mir geleistet hat, kann ich nie vergelten, und hoffe, Dankbarkeit wird mich ihn nie vergessen lassen.«
»Ist es möglich?« sagte Theodor mit sichtlicher Verwunderung, »und darf ich fragen, wie lange Sie ihn gekannt haben?«
»Lieber lassen Sie mich fragen, wozu diese Erkundigungen?«
»Sie haben Recht, ich habe diesen Vorwurf verdient; ich hätte mich deutlicher erklären sollen. —«
Er sah aus, als wenn seine Seele unter etwas arbeitete, das ihm zu äußern schwer ward. —
»Allein Sie wissen nicht, wie bedenklich meine Lage ist,« fuhr er fort, »doch kann ich Ihnen nicht verheelen, daß meine Fragen durch die zärtlichste Bekümmerniß für ihr Wohl, ja selbst durch meine Furcht für Ihre Sicherheit eingegeben. wurden. —
Adeline sah ihn starr an. —
»Ja,« sagte er, »ich fürchte, Sie werden hintergegangen, und Gefahr schwebt um Sie.«
Adeline stand still, sah ihn ernsthaft an und bat ihn, sich zu erklären. Sie ahndete, daß La Motten ein Unglück drohte, und da Theodor schwieg, wiederhohlte sie ihre Frage.
»Wenn La Motte in Gefahr ist,« sagte sie, so erlauben Sie mir, ihn unverzüglich zu warnen; er hat nur zu viel Unglück zu besorgen.«
»Trefliches Mädchen,« rief Theodor, »wie verhärtet müßte das Herz seyn, das Sie betrüben könnte? Wie soll ich Ihnen zu verstehen geben, was ich fürchte, und wie kann ich unterlassen, Sie vor Ihrer Gefahr zu warnen, ohne —«
Ein Geräusch zwischen den Bäumen unterbrach ihn, und gleich darauf sah er La Motten quer durch den Gang gehen, worin sie waren. Adeline fühlte einige Verwirrung, auf diese Art mit dem Chevalier gesehen zu werden, und wollte auf La Motte, zueilen, allein Theodor hielt sie zurück.
»Es ist jetzt keine Zeit, mich zu erklären,« sagte er, »und doch ist das, was ich Ihnen zu sagen habe, von äußerster Wichtigkeit für Sie. Versprechen Sie mir also, morgen um diese Zeit in irgend einer entlegenen Gegend des Waldes zu seyn, und ich hoffe Sie dann zu überzeugen, daß weder gewöhnliche Umstände, noch gewöhnliche Achtung mein Betragen leiten.«
Adeline fand es anstößig, eine solche Bestellung einzugehen; sie besann sich und bat endlich Theodor, eine Erklärung, die so wichtig schiene, nicht bis morgen zu verschieben, sondern La Motte zu folgen, und ihn sogleich von seiner Gefahr zu benachrichtigen.
»Nicht mit La Motten wünschte ich zu sprechen,« sagte Theodor, »ich weiß von keiner Gefahr, die ihm droht — allein er kommt näher, ich bitte Sie, liebenswürdige Adeline, entschließen Sie sich schnell und versprechen, mich morgen zu sehen.«
»So will ich denn,« sagte Adeline mit bebender Stimme — »ich will eine Stunde früher als heute an dem Orte seyn, wo Sie mich fanden.«
Bey diesen Worten zog sie ihre zitternde Hand zurück, die Theodor zum Zeichen seiner Dankbarkeit an seine Lippen gedrückt hatte, und er verschwand sogleich.
La Motte kam jetzt näher, und Adeline, welche fürchtete, er möchte Theodor gesehen haben, fühlte sich in einiger Verlegenheit.
»Louis ist ja schnell fortgegangen,« sagte La Motte, und erfreut über seinen Irrthum, ließ sie ihn darin.
Sie gingen schweigend nach der Abtey und Adeline, zu voll von ihren eigenen Gedanken, um Gesellschaft ertragen zu können, begab sich auf ihr Zimmer. Sie dachte über Theodors Worte nach, und jemehr sie dachte, je verwirrter ward sie. Oft tadelte sie sich, eine Bestellung eingegangen zu seyn, und hing einem Zweifel nach, ob er sie nicht zu sehen wünschte, um von Liebe zu reden: bald aber strafte Delikatesse diesen Gedanken und verwies ihr die Eitelkeit, daß sie Liebe eingeflößt zu haben glaubte.
Sie erinnerte sich seines ernsthaften Tons und Betragens, als er sie um diese Zusammenkunft bat; und überhaupt von der Wichtigkeit der Sache, schauderte ihr vor der Gefahr, die sie nicht fassen konnte; mit ängstlicher Ungeduld sah sie dem morgenden Tage entgegen. Oft auch schlich eine Erinnerung an den zärtlichen Antheil, den er an ihrem Wohl bezeugt hatte, an seinen Blick und ganzes Wesen, sich in ihre Fantasie, und erweckte eine süße Regung und dunkles Hoffen, ihm nicht gleichgültig zu seyn.
Ein Ruf zum Abendessen riß sie von diesen Betrachtungen; die Mahlzeit war traurig — es war Louis letzter Abend auf der Abtey. Adeline, die ihn wirklich schätzte, beklagte seine Abreise, während seine Augen unablässig mit einem Blick an ihr hingen, welcher zu sagen schien, daß er den Gegenstand seiner heißesten Liebe verließe. Sie bemühte sich, die Gesellschaft aufzuheitern, und vor allen Frau von La Motte, die oft Thränen vergoß.
»Wir werden uns wieder sehen,« sagte sie, »und ich hoffe, glücklicher.«
La Motte seufzte. Louis Gesicht erheiterte sich bey ihren Worten.
»Wünschen Sie es?« sagte er mit innigem Ausdruck. —
»Ganz gewiß,« erwiederte sie, »können Sie an meinem Antheil, an meinen besten Freunden zweifeln?«
»Ich kann bey Ihnen an nichts zweifeln, was gut ist.«
»Du vergißt, daß du nicht mehr in Paris bist, mein Sohn,« sagte La Motte mit einem kleinen Lächeln. »Dort würde ein solches Compliment am rechten Orte seyn — für diese einsamen Wälder paßt es nicht.«
»Die Sprache der Bewunderung ist nicht immer Compliment, mein Vater,« sagte Louis.
Adeline, die dem Gespräch eine andere Richtung zu geben wünschte, fragte, nach welcher Gegend von Frankreich er ginge? —
Er antwortete, sein Regiment liege in Peronne, und dahin würde er jetzt gehen. Nach einigen gleichgültigen Gesprächen begab sich die Familie auf die Nacht in ihre Zimmer.
Die nahe Abreise ihres Sohnes beschäftigte Frau von La Mottens Gedanken, und sie erschien beym Frühstück mit geschwollenen Augen. Louis blasses Gesicht verrieth, daß er keine bessere Nacht zugebracht hatte. Als das Frühstück verzehrt war, zog sich Adeline zurück, um nicht durch ihre Gegenwart das letzte Gespräch zu stören. Sie ging auf dem Platze vor der Abtey auf und ab, und überdachte auf das neue den Vorgang des gestrigen Abends; ihre Ungeduld nach der verabredeten Zusammenkunft nahm zu.
Louis kam bald zu ihr.
»Es war nicht gütig,« sagte er, »daß Sie uns in den letzten Augenblicken meines Aufenthalts verließen. Könnte ich nur hoffen, daß Sie zu Zeiten meiner gedenken würden, wenn ich fern bin, so würde ich mit weniger Schmerz scheiden.«
Er äußerte nochmahls seinen Kummer, sie verlassen zu müssen, und wiewohl er sich bisher mit Stärke bewaffnet hatte, das Geständniß einer Liebe zu unterdrücken, die vergebens seyn mußte, so gab doch jetzt sein Herz der Gewalt der Leidenschaft nach, und er sagte Adelinen, was sie jeden Augenblick zu hören fürchtete.
»Diese Erklärung,« versetzte sie, indem sie ihre Bewegung zu verbergen suchte, »macht mir unaussprechlichen Kummer.«
»O sagen Sie nicht so,« unterbrach Louis, »sondern geben Sie mir eine schwache Hoffnung, die mich bey den Qualen der Abwesenheit aufrecht halten kann. Sagen Sie, daß Sie mich nicht hassen — Sagen —«
»Das sage ich von ganzem Herzen,« erwiederte Adeline mit zitternder Stimme; »wenn meine herzliche Achtung und Freundschaft Ihnen Freude machen kann, so empfangen Sie diese Versicherung — als Sohn meiner besten Wohlthäter — sind Sie berechtigt zu —«
»Reden Sie nicht von Wohlthaten — Ihr Werth übertrift sie alle, und lassen Sie mich eine minder kalte Empfindung als Freundschaft hoffen; lassen Sie mich nicht glauben, daß ich Ihr Wohlwollen nur den Handlungen anderer danke. Ich habe lange meine Leidenschaft still in mir verschlossen, weil ich die Schwierigkeiten, die damit verbunden seyn mußten, voraus sah; ja ich habe sogar ihr entgegen zu kämpfen gewagt. Ich war unsinnig genug, es für möglich zu halten, daß ich Sie vergessen könnte, und —«
»Sie betrüben mich,« unterbrach Adeline. »Dieß ist eine Unterhaltung, die ich nicht anhören sollte. Ich kenne keine Verstellung und muß Ihnen erklären, daß zwar Ihr Werth stets meine Achtung besitzen wird, Liebe aber nicht in meiner Macht ist. Wäre es auch anders, so müßte schon unsere beyderseitige Lage diesen Ausspruch thun. Wenn Sie wirklich mein Freund sind, so muß es Sie freuen, daß dieser Kampf zwischen Liebe und Klugheit mir erspart wird. Auch lassen Sie mich hoffen, daß die Zeit Sie lehren wird, Liebe in die Grenzen der Freundschaft zurückzuführen.«
»Nimmer,« rief Louis mit Heftigkeit. »Wäre das möglich, so würde meine Liebe ihres Gegenstandes unwerth seyn.«
Während er sprach, kam Adelinens kleines Reh zu ihr gehüpft. Louis wurde bis zu Thränen gerührt.
»Dieß kleine Thier,« sagte er nach einer Pause, »führte mich zuerst zu Ihnen; es war Zeuge des glücklichen Augenblicks, wo ich Sie zuerst sah, umschwebt von Reizungen, denen mein Herz nicht widerstehen konnte. Noch steht dieser Augenblick lebendig vor meiner Erinnerung, und dieß Geschöpf muß jetzt kommen, den traurigen meines Abschiedes zu sehen.«
»O Adeline,« rief er mit inniger Bewegung, wenn Sie Ihren kleinen Liebling sehen und liebkosen, so gedenken Sie des armen Louis, der dann weit, weit von Ihnen entfernt seyn wird! Verweigern Sie mir nicht den Trost dieser Hoffnung!«.
»Ich bedarf dieses Erinnerns nicht,« sagte Adeline, indem sie ihre eigene Rührung unter einem holden Lächeln verbarg; »Ihr Werth hat Anspruch genug auf mein bleibendes Andenken. Könnte ich Ihre schöne Vernunft die Herrschaft über eine fruchtlose Leidenschaft wieder gewinnen sehen, so würde meine Zufriedenheit meiner Achtung gleich kommen.«
»Hoffen Sie das nicht,« sagte Louis, »auch kann ich es nicht wünschen denn hier ist Liebe Tugend. —«
Er sah La Motte um eine Ecke der Abtey gehen.
»Die Augenblicke sind kostbar,« sagte er, »man unterbricht mich; — O Adeline, leben Sie wohl, und alle guten Engel über Ihnen!«
»Leben Sie wohl,« sagte Adeline innigst bewegt, »leben Sie wohl, und Ruhe begleite Sie. Ich werde stets mit der Zärtlichkeit einer Schwester an Sie denken.«
Er seufzte tief und drückte ihre Hand an seine Lippen, als La Motte wieder erschien. Adeline ließ sie beysammen und begab sich bekümmert in ihr Zimmer. Louis Leidenschaft und ihre Achtung waren zu aufrichtig, um ihr nicht einen starken Grad von Mitleid mit seiner unglücklichen Liebe einzuflößen. Sie blieb in ihrem Zimmer, bis er die Abtey verlassen hatte, weil sie sich dem Schmerz eines förmlichen Abschiedes nicht aussetzen mochte.
Gegend Abend stieg Adelinens Ungeduld, als aber die bestimmte Stunde wirklich anbrach, verließ sie ihr Muth und sie schwankte von ihrem Vorsatz. Es lag eine gewisse Indelikatesse und Verheimlichung in einer bestimmten Zusammenkunft, die sie zurückstieß. Sie erinnerte sich an Theodors zärtliches Benehmen, an verschiedene kleine Umstände, die ihr verriethen, daß ihr Herz nicht ganz dabey aus dem Spiel war. Auf das neue war sie geneigt, zu zweifeln, ob er nicht ihre Einwilligung zu dieser Zusammenkunft nur unter dem Vorwande eines vielleicht ungegründeten Argwohns gesucht hätte, und fast war sie entschlossen, nicht zu gehen: doch konnte seine Behauptung aufrichtig, ihre Gefahr wirklich seyn: diese Möglichkeit stellte ihr ihre Bedenklichkeiten lächerlich vor; sie wunderte sich, wie sie einen Augenblick gegen eine so wichtige Betrachtung sie hatte aufwiegen können, und sich selbst ihr langes Zögern verweisend, eilte sie dem bestimmten Orte zu.
Der kleine Fußweg, der dahin führte, war still und einsam, und als sie den Ort erreichte, war Theodor noch nicht da. Ein flüchtiger Stolz machte sie erröthen, daß sie pünctlicher gewesen war, als er, und sie schlug einen Fußweg ein, der sich rechts um die Bäume wand. Nachdem sie eine Weile gegangen war, ohne einen Menschen zu sehen, oder einen Fußtritt zu hören, kehrte sie um; — er war noch nicht da, und sie verließ den Ort. — Zum zweyten Mahle kehrte sie wieder dahin zurück, und Theodor kam noch nicht.
Sie erinnerte sich, wie lange sie schon von der Abtey abwesend war, und berechnete unruhig, daß die bestimmte Stunde längst verflossen seyn mußte. Sie fühlte sich beleidigt und verlegen, doch setzte sie sich auf den Rasen und beschloß, den Ausgang abzuwarten.
Endlich, als die Dämmerung in fruchtlosem Warten anbrach, gerieth ihr Stolz in wirklichen Aufruhr; sie fürchtete, daß er etwas von der Neigung, die er ihr eingeflößt, möchte entdeckt haben, und sie nun mit absichtlicher Vernachläßigung behandelte; voll von diesen Gedanken verließ sie mit Unmuth und Selbstvorwürfen den Ort.
Als diese Bewegungen nachließen und die Vernunft wieder in ihre Rechte eintrat, erröthete sie über diese kindische Aufwallung von Selbstliebe, so nannte sie es. Theodors Worte: »ich fürchte, Sie werden hintergangen, und Gefahr schwebt um Sie,« schallten in ihrem Ohr; sie sah nicht mehr den Beleidiger, nur den Freund. Der Sinn dieser Worte, deren Wahrheit sie nicht länger bezweifelte, beunruhigte sie auf das neue. Warum hätte er sich die Mühe gegeben, vom Schlosse herzukommen, um sie vor ihrer Gefahr zu benachrichtigen, wenn er nicht sie zu retten wünschte? Und wenn dieß sein Wunsch war, was anderes als Nothwendigkeit konnte ihn dann von der verabredeten Zusammenkunft abgehalten haben?
Diese Betrachtungen bestimmten sie auf einmahl. Sie nahm sich vor, den folgenden Tag um die nähmliche Stunde diesen Ort wieder zu besuchen: denn sie zweifelte nicht, daß sein Antheil an ihrem Schicksal ihm die Hoffnung eingeben würde, sie dort zu sehen. Sie glaubte ihm, daß ein Übel über ihr schwebte, worin es aber bestand, konnte sie nicht errathen. Herr und Frau von La Motte waren ihre Freunde, und wer sonst konnte außer ihrem Vater, aus dessen Gewalt sie sich jetzt glaubte, ihr Nachtheil zufügen? —
Aber warum sagte Theodor, sie würde hintergangen? —
Sie fand es unmöglich, sich aus dem Labyrinth von Vermuthungen herauszufinden, und bemühte sich ihrer Unruhe bis zum folgenden Abend zu gebiethen. Unterdessen suchte sie Frau von La Motte zu erheitern, die nach der Abreise ihres Sohnes Trost bedurfte.
So von eigenem Kummer und von dem ihrer Freundinn doppelt niedergedrückt, legte sich Adeline zur Ruhe. Sie verlor bald ihr Bewußtseyn, aber nur um in ängstlichen Schlummer zu fallen, wie er oft das Lager des Unglücklichen besucht. Endlich gab ihre gefolterte Fantasie ihr folgenden Traum ein:
Ihr dünkte, sie war in einem großen Zimmer der Abtey, älter und wüster als die übrigen, aber noch mit einigen Möbeln versehen. Es war stark vergittert, doch sah man niemand darin. Indem sie da stand und es ansah, hörte sie eine leise Stimme sie rufen, und entdeckte beym düstern Schein einer Lampe eine Gestalt, die auf einem Bette an der Erde ausgestreckt lag. Die Stimme rief noch einmahl; sie ging näher und sah deutlich die Züge eines Sterbenden. Eine Todtenblässe bedeckte sein Gesicht, doch trug es einen Ausdruck von Hoheit und Milde, der sie unaussprechlich bewegte.
Plötzlich veränderten sich seine Züge, und die Angst des Todes zuckte auf seinem Gesichte, Der Anblick erschütterte sie; sie bebte zurück, allein er streckte seine Hand nach ihr aus und ergrif die ihrige mit Heftigkeit. Sie kämpfte in Schrecken, sich loszumachen, und als sie ihm wieder in das Gesicht sah, erblickte sie einen Mann von etwa dreyßig Jahren, in aller Gesundheit und von der sanftesten Gesichtsbildung. Er lächelte sie zärtlich an, als wollte er reden, als mit eins der Boden des Zimmers sich öffnete, und er vor ihrem Blick versank. Die Gewalt, die sie sich anthat, um sich vom Nachstürzen zu retten, erweckte sie. —
Dieser Traum hatte einen solchen Eindruck auf ihre Fantasie gemacht, daß sie sich lange nicht wieder von ihrem Schrecken erhohlen, oder sich überzeugen konnte, daß sie wirklich in ihrem Zimmer sey. Endlich faßte sie sich und fiel wieder in einem Traum.
Sie hatte sich in den krummen Gängen der Abtey verirrt; es war beynahe dunkel und sie wanderte lange umher, ohne eine Thüre finden zu können. Plötzlich hörte sie über sich eine Glocke läuten und bald darauf ein Gewühl ferner Stimmen. Sie verdoppelte ihr Bemühen, sich herauszufinden. Alles war wieder still, und von Suchen ermüdet, setze sie sich auf eine Stuffe, die quer über den Weg ging.
Nicht lange hatte sie hier gesessen, als sie in einiger Ferne ein Licht an der Mauer schimmern sah, allein eine Krümmung in dem sehr langen Wege verhinderte sie, zu sehen, woher es kam. Es schimmerte eine Weile schwach fort und wurde dann stärker, worauf sie einen Mann in einem langen schwarzen Mantel, wie die Begleiter der Todten tragen, mit einer Kerze in der Hand, in den Gang treten sah. Er rief sie, ihm zu folgen, und führte sie durch einen langen Gang an den Fuß einer Treppe. Sie fürchtete sich, weiter zu gehen und wollte zurück laufen, als der Mann sich plötzlich umwandte, sie zu verfolgen, worauf sie vor Schrecken erwachte.
Durch diese Gesichter und mehr noch durch ihren anscheinenden Zusammenhang, der ihr jetzt auffiel, betroffen, suchte sie sich wach zu erhalten, damit nicht ähnliche Schreckbilder sie umschwebten: allein nach kurzer Frist sanken ihre ermatteten Lebensgeister wieder in Schlummer, wenn gleich nicht zur Ruhe.
Sie glaubte sich nun in einer großen Gallerie, an deren einem Ende sie ein Zimmer ein wenig offen stehen, und ein Licht von innen sah; sie ging darauf zu, und erkannte den Mann den sie zuvor gesehen hatte; er stand an der Thüre und winkte ihr hereinzukommen. Mit der in Träumen so gewöhnlichen Inconsequenz vermied sie ihn jetzt nicht, sondern folgte ihm in eine Reihe alter Zimmer, die mit Schwarz behangen und als zu einem Leichenbegängniß erleuchtet waren. Er führte sie immer weiter, bis sie sich endlich in demselben Zimmer befand, das sie im ersten Traum gesehen hatte: ein Sarg mit einem Leichentuch bedeckt, stand am fernen Ende des Zimmers; einige Lichter und verschiedene Personen, die sehr betrübt schienen, umgaben ihn.
Plötzlich schien es ihr, als wären alle diese Personen verschwunden und sie allein; sie ging an den Sarg, und während sie ihn betrachtete, hörte sie, als von innen, eine Stimme, sah aber niemand. Bald nachher stand ihr Führer wieder neben ihr; er hub das Tuch auf und sie sah einen Todten, den sie für den Sterbenden in ihrem ersten Traume hielt: seine Züge waren in Tod gesunken, aber noch heiter. Sie stand noch da, als ein Strom von Blut aus seiner Seite drang, und das ganze Zimmer überschwemte; zugleich wurden einige Worte von derselben Stimme, die sie zuvor gehört hatte, gesprochen; allein das Schreckliche des Anblicks überwältigte sie so ganz, daß sie erwachte.
Als sie wieder zur Besinnung gekommen war, richtete sie sich im Bett auf, um sich zu überzeugen, daß es wirklich ein Traum gewesen sey, und die Erschütterung ihrer Lebensgeister war so groß, daß sie sich fürchtete, allein zu seyn, und fast im Begriff war, Annetten zu rufen. Die Züge des Todten und das Zimmer, worin er lag, hatten sich ihrem Gedächtniß fest eingeprägt, und sie glaubte noch immer das Gesicht zu sehen, die Stimme zu hören, welche der Traum ihr vorstellte.
Je länger sie über diese Bilder nachdachte, je höher stieg ihre Befremdung; sie waren so fürchterlich, kamen so oft wieder und schienen so zusammenhängend, daß sie kaum sie für zufällig halten konnte; doch begriff sie nicht, warum sie übernatürlich seyn sollten. —
Sie schlief diese Nacht nicht mehr!
Als Adeline beym Frühstück erschien, fiel ihr blasses verstörtes Ansehen der Frau von La Motte auf, und sie fragte sie, ob ihr nicht wohl wäre? Adeline erzwang ein Lächeln, und erwiederte, sie hätte nicht gut geschlafen, und wäre von fürchterlichen Träumen gequält worden: sie war im Begriff, sie zu erzählen, aber ein starkes, unwillkührliches Widerstreben hielt sie ab. Zugleich verspottete auch La Motte ihre Beängstigungen so unbarmherzig, daß es sie fast gereute, ihrer erwähnt zu haben, und sie die Erinnerung daran zu überwinden suchte.
Nach dem Frühstück suchte sie durch Unterhaltung mit Frau von La Motte ihren Gedanken eine andere Richtung zu geben; allein die Vorfälle der zwey letzten Tage beschäftigten sie zu sehr. Sie hatten eine Weile beysammen gesessen, als der Laut von Stimmen vor dem großen Thore der Abtey erscholl; Adeline trat an das Fenster und sah den Marquis und seine Begleiter unten auf dem Platz. Das Thor der Abtey verbarg einige Personen vor ihr, und sie hielt es für möglich, daß Theodor, der noch nicht erschienen war, unter ihnen seyn könnte. Mit heißer Ungeduld blieb sie stehen, bis der Marquis nebst La Motte und einigen andern Personen in die große Halle trat; Madame ging hinaus, ihn zu empfangen, und Adeline zog sich in ihr Zimmer zurück.
Kurz darauf rief eine Botschaft von La Motte, sie zur Gesellschaft, wo sie vergebens Theodor zu finden hoffte. Der Marquis stand auf, als sie in das Zimmer trat, und nach einigen allgemeinen Höflichkeiten nahm das Gespräch eine sehr lebhafte Wendung. Adeline, der es unmöglich war, Munterkeit zu erkünsteln, da ihr Herz unter Kränkung und Ängstlichkeit erlag, nahm wenig Antheil daran; Theodors Nahme wurde nicht einmahl genannt. Sie hätte gern nach ihm gefragt, wenn es der Anstand erlaubt hatte; so aber mußte sie sich mit der Hoffnung begnügen, daß er vor Tisch, oder wenigstens vor der Abreise des Marquis erscheinen würde.
So verstrich der Tag in Erwartung und vereiteltem Hoffen. Der Abend nahete heran, und sie sah sich verdammt, in des Marquis Gesellschaft zu bleiben, und dem Scheine nach auf ein Gespräch zu merken, das sie in der That kaum hörte, während die Gelegenheit verstrich, die vielleicht ihr Schicksal entschieden hätte. Plötzlich aber wurde sie aus dieser Qual gerissen, und wo möglich in eine noch peinlichere gestürzt.
Der Marquis erkundigte sich nach Louis, und da er seine Abreise hörte, erwähnte er beyläufig, daß Theodor Peyrou diesen Morgen zu seinem Regiment in einer fernen Provinz abgegangen wäre. Er beklagte den Verlust seiner Gesellschaft und äußerte sich sehr vortheilhaft über die Talente seines jungen Freundes. Der Stoß dieser Nachricht überwältigte Adelinens lange geängstigten Lebensgeister; das Blut verließ ihre Wangen, und eine plötzliche Ohnmacht wandelte sie an, von der sie sich nur zu dem peinlichen Bewußtseyn erhohlte, ihre Bewegung verrathen zu haben, und in Gefahr eines zweyten Rückfalls zu seyn.
Sie begab sich in ihr Zimmer, wo in der Einsamkeit ihr Herz Linderung in Thränen fand, denen sie freyen Lauf ließ. Gedanke drängte sich so schnell an Gedanken, daß es lange dauerte, ehe sie zu einem vernünftigen Schlusse kommen konnte. Sie suchte Theodors plötzliche Abreise zu erklären.
»Ist es möglich,« sagte sie, »daß er an meinem Wohl Antheil nehmen, und dennoch mich der vollen Gewalt einer Gefahr Preis geben kann, die er selbst vorher sah? Oder soll ich glauben, daß er mit meiner Einfalt ein Spiel trieb, und mich nun den wundervollen Besorgnissen überläßt, die er in mir erregt? Unmöglich! ein so edles Gesicht, ein so liebenswürdiges Betragen kann kein Herz verbergen, das eines so abscheulichen Vorhabens fähig wäre. Nein! — was mir auch vorbehalten seyn mag, soll doch nichts mir das Vergnügen rauben, ihn meiner Achtung werth zu halten.«
Sie wurde aus diesen Betrachtungen durch einen fernen Donnerschlag erweckt, und sah nunmehr, daß das kommende Gewitter die Dunkelheit des Abends vertiefte; es rollte heran, und bald flammten Blitze durch ihr Zimmer. Adeline war über erzwungene Furcht erhaben, und kannte keine wirkliche; doch fand sie es unangenehm, jetzt allein zu seyn, und in der Hoffnung, daß der Marquis längst fort seyn würde, ging sie herunter; allein der drohende Anblick des Himmels hatte ihn bisher aufgehalten und jetzt bey dem wirklich eingetretenen Gewitter war es ihm lieb, daß er diese Zuflucht nicht verlassen hatte.
Das Gewitter dauerte fort, und die Nacht kam heran. La Motte nöthigte seinen Gast, ein Bett auf der Abtey anzunehmen, und er ließ es sich endlich gefallen; ein Umstand, der Madame in einige Verlegenheit setzte, weil sie nicht wußte, wohin sie ihn bringen sollte. Doch richtete sie bald alles zu ihrer vollen Befriedigung ein, gab dem Marquis ihr eigenes Zimmer, und seinen zwey vornehmsten Bedienten das, welches Louis bewohnte: Adeline mußte das ihrige an Herrn und Frau von La Motte abtreten, und sich nach einer innern Kammer verfügen, wo ein kleines Bett von Annetten für sie aufgeschlagen ward.
Bey Tisch war der Marquis weniger heiter als gewöhnlich: er beschäftigte sich oft mit Adelinen, und seine Blicke und Wesen schienen den zärtlichen Antheil auszudrücken, den ihre Unpäßlichkeit, die man noch immer auf ihrem blassen Gesichte las, erregt hatte. Adeline strengte, wie gewöhnlich, sich an, ihre Unruhe zu vergessen und froh zu scheinen; allein der Schleier erkünstelter Heiterkeit war zu dünn, um die Züge des Kummers zu verheelen, und ihr mattes Lächeln gab ihrem Gesichte eine rührende Anmuth.
Der Marquis sprach mit ihr über verschiedene Gegenstände und zeigte seinen aufgeklärten Geist. Adelinens Bemerkungen, die sie, so oft es die Gelegenheit mit sich brachte, mit bescheidenem Anstand in eben so einfachen als kraftvollen Worten äußerte, schienen seine Bewunderung zu erregen, die er oft durch einen anscheinend unvorsetzlichen Ausdruck verrieth.
Sie begab sich früh in ihr Schlafzimmer, das von einer Seite an Frau von La Mottens, und von der andern an das anfangs erwähnte Kabinet stieß. Es war hoch und geräumig, und die wenige Möblirung, die es noch enthielt, zerfiel in Stücke; vielleicht aber trug ihre Seelenstimmung mehr noch als diese Umstände bey, ihm das Ansehen von Melancholie zu geben, welches darin zu herrschen schien. Sie fühlte keine Neigung, sich schlafen zu legen, weil sie die Wiederkehr der Träume fürchtete, welche in der vorigen Nacht sie beängstigt hatten, und nahm sich vor, aufzubleiben, bis sie sich des Schlafs nicht mehr erwähren könnte, der alsdann wahrscheinlich fest seyn würde. Sie setzte das Licht auf einen kleinen Tisch und las über eine Stunde in einem Buche, bis ihre Seele sich einer längern Abziehung von ihren eigenen Sorgen verweigerte, und sie eine Zeitlang den Kopf nachdenkend auf ihrem Arm gestützt, da saß.
Der Wind war heftig, und wenn er durch die öden Zimmer strich, und die schwachen Thüren erschütterte, fuhr sie oft zusammen, und glaubte zu Zeiten sogar Seufzer zwischen den Windstillen zu hören; doch trieb sie diese Täuschungen zurück, welche sie durch die Stunde der Nacht und durch ihre trübe Einbildungskraft erregt glaubte.
Indem sie sinnend da saß, die Augen starr auf die Wand gegen ihr über geheftet, sah sie die Tapeten, womit das Zimmer behangen war, sich hin und her bewegen, und nachdem sie dieß einige Minuten angesehen hatte, stand sie auf, um es näher zu untersuchen. Der Wind war die Ursache und sie schämte sich ihrer augenblicklichen Furcht; doch bemerkte sie, daß auf einer Stelle die Tapete sich stärker bewegte, und daß ein Geräusch, welches mehr als bloßer Wind zu seyn schien, dort hervorging. Die alte Bettstelle, die La Motte in diesem Zimmer gefunden hatte, war aus der Stelle gerückt worden, um Adelinen bequemern Platz zu machen, und gerade an dieser Stelle schien der Wind mit besonderer Gewalt zu rauschen.
Neugier trieb sie zu näherer Untersuchung an: sie fühlte an den Tapeten umher, und da sie die Wand dahinter unter ihrer Hand schüttern fühlte, hob sie den Umhang auf, und entdeckte eine kleine Thüre, deren lose Angeln den Wind zuließen und das Geräusch verursachten.
Die Thüre war nur durch einen Riegel befestigt, und nachdem sie diesen zurückgeschoben und das Licht genommen hatte, stieg sie durch einige Stuffen in ein anderes Zimmer hinab: sie erinnerte sich sogleich ihrer Träume. Zwar glich das Zimmer nicht eigentlich dem, in welchem sie den Sterbenden und nachher die Todtenbahre gesehen hatte, doch erregte es ihr eine dunkle Erinnerung an eines, durch das sie gegangen war.
Bey näherem Besehen mit dem Lichte überzeugte sie die Bauart, daß es zu den ältern Anlagen gehörte. Ein zerbrochenes, hoch angebrachtes Fenster schien die einzige Öffnung zu seyn, welche Licht einließ. Sie bemerkte an der andern Seite eine Thüre, und nach einigen Augenblicken der Unschlüssigkeit, faßte sie Muth, ihre Untersuchung fortzusetzen.
»Ein Geheimniß scheint über diesen Zimmern zu schweben,« sagte sie, »welches zu enthüllen vielleicht mir aufbehalten ist; wenigstens will ich sehen, wohin diese Thüre führt.«
Sie machte sie auf, und ging mit wankenden Schritten durch eine Reihe Zimmer, die an Bauart und Beschaffenheit den ersten glichen, und mit einem endigten, welches genau dem ähnlich war, wo ihr Traum ihr den Sterbenden vorstellte. Diese Erinnerung bemächtigte sich ihrer so ganz, daß sie einer Ohnmacht nahe war, und sich im Zimmer umsehend, beynahe das Phantom ihres Traums zu erblicken erwartete.
Unvermögend den Ort zu verlassen, setzte sie sich auf einige alte Bretter, um sich zu erhohlen, während ihre Seele beynahe einer abergläubigen Angst, wie sie noch nie empfunden hatte, erlag. Sie begriff nicht, zu welchem Theile der Abtey diese Zimmer gehörten, und wie sie so lange hatten unentdeckt bleiben können. Die Fenster waren alle zu hoch, um hinaus zu sehen.
Als sie sich wieder genug gesammlet hatte, um die Lage betrachten zu können, zweifelte sie nicht, daß sie einen innern Theil des ursprünglichen Gebäudes ausmachten.
So wie sie diese Betrachtungen anstellte, fiel ein plötzlicher Mondschimmer auf einen Gegenstand außer dem Fenster. Da sie sich hinlänglich erholt hatte, um die Untersuchung fortzusetzen, und glaubte, dieser Gegenstand könnte ihr nähere Aufklärung über die Lage der Zimmer verschaffen, so bekämpfte sie ihr noch übriges Schrecken, und stellte, um ihn deutlicher zu unterscheiden, das Licht in ein anderes Zimmer; ehe sie aber zurückkommen konnte, trat eine dicke Wolke vor den Mond, und außen war alles dunkel: sie blieb einige Augenblicke stehen, um einen wiederentstehenden Schein zu erwarten, allein die Dunkelheit hielt an.
Als sie leise wieder nach dem Lichte ging, stieß sie mit dem Fuße an etwas auf der Erde, und während sie still stand, um es zu untersuchen, schien der Mond wieder so, daß sie durch das Fenster die östlichen Thürme der Abtey unterscheiden konnte. Diese Entdeckung bestärkte sie in ihren ersten Vermuthungen über die innere Lage der Zimmer. Die Dunkelheit des Orts verhinderte sie zu entdecken, was ihr unter die Füße gerathen war, als sie aber das Licht näher brachte, sah sie einen alten Dolch an der Erde liegen. Mit zitternder Hand nahm sie ihn auf, und fand ihn mit Blut befleckt, und verrostet.
Betroffen und erschreckt sah sie sich rings im Zimmer nach einem Gegenstande um, der den schrecklichen Verdacht, welcher jetzt in ihr aufstieg, bestätigen oder vernichten könnte: allein sie sah nur einen großen Stuhl mit zerbrochenen Lehnen in einer Ecke des Zimmers, und einen eben so gebrechlichen Tisch; außer einem Haufen alten Gerümpels, das in einem Winkel lag. Sie ging darauf zu, und fand eine zerbrochene Bettstelle, nebst einigen verfallenen Überresten von Möbeln, mit Staub und Spinneweben bedeckt, die seit vielen Jahren nicht angerührt zu seyn schienen.
Weil sie indessen weiter zu untersuchen wünschte, versuchte sie ein Stück von der alten Bettstelle aufzuheben, allein es fiel ihr aus der Hand, und indem es auf der Erde hinrollte, nahm es etwas von dem übrigen Schutt mit. Adeline fuhr zur Seite um sich in Sicherheit zu bringen; als das dadurch entstandene Geräusch vorbey war, hörte sie etwas rauschen, und sah es leise zwischen den Lumpen fallen.
Es war eine kleine Rolle Papier, mit einem Faden umwunden, und mit Staub bedeckt. Sie nahm es auf, und fand, als sie es öffnete, ein Manuscript. Sie versuchte es zu lesen, allein an der Stelle, da sie aufschlug, war die Handschrift so erloschen, daß sie es schwer fand, wie wohl die wenigen lesbaren Worte sie mit Neugier und Schauder erfüllten, und sie bewegten, es mit auf ihr Zimmer zu nehmen.
Sobald sie dieses erreicht hatte, verriegelte sie die geheime Thüre, und ließ den Vorhang herunter wie zuvor. Es war nun Mitternacht. Stille der Stunde, nur zu Zeiten durch das Geheule des Sturms unterbrochen, erhöhte den feyerlichen Ton ihres Gefühls. Sie wünschte nicht allein zu seyn, und ehe sie daß Manuscript vornahm, lauschte sie, ob Frau von La Motte noch nicht in ihrem Zimmer wäre: sie hörte keinen Laut, und öffnete leise die Thüre. Die tiefe Stille überzeugte sie beynahe, daß niemand mehr da wäre, um aber ganz gewiß zu seyn, nahm sie das Licht und fand das Zimmer leer. Sie wunderte sich, daß bey so später Stunde Frau von La Motte noch nicht in ihrem Zimmer war, und ging an die Treppe des Thurms, um zu hören, ob noch jemand auf wäre.
Sie vernahm Stimmen von unten, und La Motte sprach in seinem gewöhnlichen Ton. Beruhigt, daß alles wohl sey, wollte sie wieder in ihr Zimmer gehen, als sie den Marquis mit besondern Nachdruck ihren Nahmen aussprechen hörte. Sie stand still.
»Ich bete sie an,« sagte er, »und beym Himmel! —«
La Motte unterbrach ihn.
»Denken Sie an Ihr Versprechen, gnädiger Herr!«
»Ich denke daran,« versetzte der Marquis, »und werde dabey bleiben. Allein wir verlieren unnütze Zeit. Morgen will ich mich erklären, damit wir beyde wissen, woran wir sind, und wie wir zu verfahren haben.«
Adeline zitterte so sehr, daß sie sich kaum auf den Füßen halten konnte; sie wünschte wieder in ihr Zimmer zu gehen, doch war sie zu sehr bey den vernommenen Worten interessirt, um nicht mehr Aufklärung zu wünschen. Es entstand eine kleine Pause, worauf leiser fortgesprochen wurde. Adeline dachte an Theodors Winke und beschloß, wo möglich, sich aus ihrer schrecklichen Ungewißheit zu reißen; sie schlich leise einige Stuffen hinab, um die Töne der Sprechenden zu haschen, allein sie waren so leise, daß sie nur selten einige Worte verstehen konnte.
»Ihr Vater, sagen Sie? —« fragte der Marquis. —
»Ja, ja gnädiger Herr, ihr Vater, ich weiß wohl was ich sage.«
Adeline schauderte bey dem Nahmen ihres Vaters: ein neues Schrecken ergriff sie, und mit zunehmender Begierde bemühte sie sich, ihre Worte zu verstehen, fand es aber eine Zeit lang unmöglich.
»Hier ist keine Zeit zu verlieren,« sagte der Marquis, »morgen also.«
Sie hörte La Motten aufstehen, und in der Meinung, daß sie das Zimmer verlassen würden, eilte sie die Treppe hinauf in das ihrige, und sank beynahe leblos in einen Stuhl.
Nur an ihren Vater dachte sie jetzt. Sie zweifelte nicht, daß er sie verfolgt, und ihren Aufenthalt entdeckt hätte, und so unzusammenhängend dieß auch mit seinem vorigen Betragen schien, gab ihr doch die Furcht ein, daß es mit einer neuen Grausamkeit endigen würde. Sie hielt ohne Anstand dieß für die Gefahr, vor der Theodor sie warnen wollte, so wenig sie auch begreifen konnte, wie er diesen Umstand entdeckt, oder ihre Geschichte erfahren haben könnte; es müßte denn durch La Motte seyn, ihren vermeinten Freund und Beschützer, den sie ungern in Verdacht einer Verrätherey zog.
Warum sollte La Motte einzig vor ihr sein Wissen um ihres Vaters Vorhaben verbergen, wofern er nicht sie in seine Hände zu liefern, willens war? Doch konnte sie lange sich nicht dahin bringen, diesen Schluß zu ziehen. Niederträchtigkeit bey denjenigen zu entdecken, die wir liebten, ist einer der höchsten Qualen für eine schöne Seele und die Überzeugung wird oftmahls verworfen, bis sie sich endlich aufdringt.
Theodors Worte: er fürchtete, daß man sie hinterginge, bestätigten diesen peinlichen Argwohn auf La Motte und einen andern noch quälendern, daß auch seine Frau sich gegen sie verbunden hätte. Dieser Gedanke überwand auf einen Augenblick den Schrecken, und ließ sie nur Schmerz empfinden. Sie weinte bitterlich.
»Ist dieß die Menschheit?« sagte sie. »Bin ich verdammt, alle Welt falsch zu finden?«
Eine unerwartete Entdeckung des Lasters in denjenigen, die wir bewunderten, macht uns geneigt, unsern Tadel auf alle Einzelnen des ganzen Geschlechts zu erstrecken: wir verwerfen nachher den Schein und schließen nur zu leicht, daß keinem zu trauen sey.
Adeline nahm sich vor, den andern Morgen sich La Motten zu Füssen zu werfen und sein Mitleid und Schutz zu erflehen. Ihre Seele war jetzt zu geängstigt mit ihren eigenen Sorgen, um ihr die Untersuchung der Handschrift zuzulassen: und sie blieb nachdenkend auf ihrem Stuhle sitzen, bis sie Frau von La Motte zu Bette gehen hörte. La Motte ging bald nachher in sein Zimmer hinauf, und Adeline, die sanfte, die verfolgte Adeline, die jetzt zwey Tage peinlicher Angst und eine Nacht voll schrecklicher Träume durchlebt hatte, suchte sich in Schlaf zu wiegen.
Bei der dermahligen Stimmung ihrer Seele mußte sie leicht alles, was außer ihr vorging, gewahr werden, und kaum war sie in Schlummer gefallen, als sie durch ein lautes, ungemächliches Lärmen erweckt wurde. Sie horchte; es schien aus den untern Zimmern zu kommen, nach wenig Minuten aber hörte sie hastig an La Mottens Zimmer klopfen.
La Motte, der eben eingeschlafen war, ließ sie nicht so leicht erwecken, allein das Klopfen wurde so arg, daß Adeline, im äußersten Schrecken aufstand, und nach der Thüre ging, die aus ihrem Zimmer an das seinige stieß, um ihn zu rufen. Die Stimme des Marquis, den sie jetzt deutlich an der Thüre hörte, hielt sie auf. Er rief La Motten, daß er aufstehen möchte, und seine Frau bemühte sich zugleich ihn zu erwecken, bis er endlich in großen Schrecken aufstand und bald nachher mit dem Marquis die Treppe hinunter ging.
Adeline warf sich; so schnell ihre zitternden Glieder es erlaubten; in ihre Kleider und ging in das anstoßende Zimmer, wo sie Frau von La Motte äußerst bestürzt und erschrocken fand. Der Marquis sagte indessen mit sichtlicher Verstörung zu La Motte, er besänne sich, einige Leute in einer wichtigen Angelegenheit früh Morgens zu sich bestellt zu haben, und müßte aus dieser Ursache sich unverzüglich nach seinem Schlosse aufmachen.
Indem er dieß sagte und seine Leute zu rufen bat, konnte La Motte nicht umhin, die Todtenblässe seines Gesichts zu bemerken, und eine Besorgniß zu äußern, ob ihm nicht wohl sey? Der Marquis versicherte ihn, er befände sich vollkommen wohl, nur wünschte er unverzüglich fortzureiten. Peter mußte nun die andern Bedienten rufen, und der Marquis, der es abschlug, irgend eine Erfrischung zu sich zu nehmen, sagte ihm eilig Adieu und verließ, so bald seine Leute bereit waren, die Abtey.
La Motte kehrte in sein Zimmer zurück, nachdenkend über die plötzliche Abreise seines Gastes, dessen Unruhe ihn zu groß gedünket hatte, um von der angeführten Ursache herzurühren. Er stillte Frau von La Mottens Angst und erregte zugleich ihre Befremdung, als er die Ursache dieser Störung sagte. Adeline, die sich bey La Mottens Annäherung in ihr Zimmer zurückgezogen hatte, sah aus dem Fenster, als sie das Trampeln von Pferden hörte. Es war der Marquis der mit seinen Leuten in kleiner Entfernung vorüber ritt. Nicht im Stande, die Personen zu unterscheiden, erschrack sie, um diese Zeit eine solche Gesellschaft bey der Abtey zu sehen; sie rief La Motten, um ihn davon zu benachrichtigen, und erfuhr, was vorgegangen war.
Endlich legte sie sich zu Bette, und ihr Schlummer blieb diese Nacht ungestört von Träumen.
Als sie frühmorgens aufstand, sah sie La Motten allein vor dem Hause spazieren gehen, und eilte die Gelegenheit zu benutzen, die sich jetzt darboth, ihre Sache zu führen. Sie näherte sich ihm mit wankenden Schritten, während die Blässe und Ängstlichkeit auf ihrem Gesicht die Unruhe ihres Gemüths verrieth. Ohne sich auf eine Erklärung einzulassen, flehten ihre ersten Worte ihn um Mitleid.
La Motte stand still, sah ihr scharf in das Gesicht und fragte, womit er den Argwohn verdienet hätte, der in dieser Bitte zu liegen schien? Adeline erröthete, einen Augenblick seine Redlichkeit bezweifelt zu haben, allein die Worte, die sie gehört hatte, fielen ihr wieder ein.
»Ich wäre ungerecht und undankbar, wenn ich nicht anerkennen wollte, daß Ihr Betragen gütig und großmüthig gewesen ist, weit mehr als ich zu erwarten ein Recht hatte, aber —«
Sie schwieg und wußte nicht, auf welche Art sie äußern sollte, was sie zu glauben erröthete. La Motte sah sie in stummer Erwartung an und bat sie endlich weiter zu reden, und ihre Meinung zu erläutern. Sie bat ihn, sie vor ihrem Vater zu schützen. La Motte schien bestürzt und überrascht.
»Vor Ihrem Vater!« sagte er.
»Ja,« erwiederte Adeline, »es ist mir nicht unbekannt, daß er meinen Aufenthalt entdeckt hat. Ich muß alles von einem Vater fürchten, der mich mit solcher Grausamkeit behandelt hat, und flehe Sie nochmahls an, mich aus seinen Händen zu retten.«
La Motte stand in tiefen Gedanken und Adeline fuhr auf das rührendste fort, sein Mitleiden zu erflehen.
»Aus was für Ursachen vermutheten Sie oder vielmehr, wie haben Sie erfahren, daß Ihr Vater Sie verfolgt?«
Diese Frage machte Adeline verlegen; sie schämte sich zu gestehen, daß sie sein Gespräch behorcht hatte, und verabscheute es, eine Falschheit zu erfinden oder zu sagen; endlich gestand sie die Wahrheit. La Mottens Züge nahmen eine wilde Heftigkeit an, und mit einem scharfen Verweise wegen eines Betragens, zu welchem mehr Zufall als Vorsatz sie gereizt hatte, fragte er, was sie gehört hätte, das sie so sehr beunruhigen könnte? Sie wiederhohlte treulich die unzusammenhängenden Reden, die sie aufgefaßt hatte. Er sah sie mit scharfer Aufmerksamkeit an, während sie sprach.
»Und das war alles, was Sie gehört haben? Aus diesen wenigen Worten ziehen Sie einen so festen Schluß? Überdenken Sie sie näher, und Sie werden finden, daß dieses nicht daraus folgt.«
Sie sah nun, was ihre heftige Furcht sie zuvor nicht hatte bemerken lassen, daß die Worte, so unzusammenhängend als sie da waren, wenig enthielten, und daß ihre Einbildungskraft das Leere dazwischen so ausgefüllt hatte, um das gefürchtete Übel daraus zu folgen; dem ungeachtet waren ihre Besorgnisse wenig vermindert.
»Jetzt ist wahrscheinlich Ihre Furcht aus dem Wege geräumt, sagte La Motte, allein um Ihnen einen Beweis von der Aufrichtigkeit zu geben, die Sie bezweifeln konnten, will ich Ihnen sagen, daß Sie recht hatten. Sie scheinen zu erschrecken, und ich verdenke es Ihnen nicht. Ihr Vater hat Ihren Aufenthalt entdeckt, und Sie bereits gefodert. Zwar habe ich aus einer Regung von Mitleid Sie herauszugeben verweigert, allein ich habe weder Macht, Sie zurückzuhalten, nach Mittel Sie zu schützen. Wenn er kommt, um seine Forderung zu erzwingen, so werden Sie dieses gewahr werden. Machen Sie sich also auf das Übel gefaßt, das, wie Sie sehen, unvermeidlich ist.«
Adeline konnte eine Zeitlang nur durch Thränen reden. Endlich sagte sie mit einer Fassung, welche Verzweiflung ihr gab:
»Ich ergebe mich in den Willen des Himmels!«
La Motte sah sie schweigend an, und sein Gesicht verrieth eine starke Bewegung. Doch vermied er, das Gespräch wieder anzuknüpfen, und ging nach der Abtey zurück, indem er Adelinen, verloren in Schmerz, auf dem Vorplatze zurück ließ.
Ein Ruf zum Frühstück trieb sie in das Zimmer, wo sie den Morgen im Gespräch mit Frau von La Motte zubrachte, der sie alle ihre Besorgnisse und ihren Kummer klagte. Mitleid und oberflächlicher Trost war alles, was Frau von La Motte ihr geben konnte, so sichtlich sie auch durch Adelinens Rede gerührt ward. So verstrichen schwerfällig die Stunden, während Adelinens Angst wuchs, und die Crisis ihres Schicksals schnell heran zu nahen schien.
Kaum hatten sie zu Mittag gegessen, als zu ihrem großen Erstaunen der Marquis erschien. Er trat mit seiner gewöhnlichen Ungezwungenheit in das Zimmer, und entschuldigte sich, unter Wiederhohlung dessen, was er zu La Motte gesagt hatte, wegen der Unruhe, die er vergangene Nacht verursacht hätte.
Der Gedanke an das gehörte Gespräch verursachte anfangs Adelinen einige Verlegenheit, und zog ihre Seele von dem Gefühl der Übel ab, die sie von ihrem Vater besorgte. Der Marquis, der ihr wie gewöhnlich, seine Aufmerksamkeit widmete, schien bekümmert, sie nicht munter zu sehen, und äußerte vielen Antheil an der Niedergeschlagenheit, die aller Anstrengung ungeachtet, aus ihrem Wesen hervorleuchtete. Als Frau von La Motte hinausging, wollte Adeline ihr folgen: allein der Marquis bat sie um ein kleines Gehör und führte sie wieder zu ihrem Stuhl. La Motte verschwand sogleich.
Adeline wußte nur zu gut; wovon die Rede seyn würde, und des Marquis Worte vermehrten bald die Bestürzung, worin ihre Furcht sie gesetzt hatte. Während er die Wärme seiner Leidenschaft in Ausdrücken erklärte, die nur zu oft Heftigkeit für Aufrichtigkeit gelten lassen, unterbrach ihn Adeline, der diese Erklärung, wenn sie anständig gemeint, beängstigend, und auf andere Weise anstößig war, und dankte ihm für die Ehre einer Auszeichnung, die sie mit bescheidenem, aber entschlossenem Wesen ablehnen zu müssen, erklärte. Sie stand auf, um sich zu entfernen.
»Bleiben Sie, allzuliebenswürdige Adeline,« sagte er, »und wenn Mitleid mit meinem Leiden Sie nicht für mich gewinnen kann, so lassen Sie eine Erwägung Ihrer eigenen Gefahr es thun. Herr von La Motte hat mich von Ihrem unglücklichen Schicksal und von dem Übel, daß jetzt Ihnen droht, unterrichtet: nehmen Sie von mir den Schutz an, welchen er Ihnen zu geben nicht im Stande ist.«
Adeline wollte wieder nach der Thüre zugehen, als der Marquis sich ihr zu Füßen warf, und ihre Hand mit heißen Küssen bedeckte. Sie strebte, sich loszumachen.
»Hören Sie mich, süsses Mädchen,« rief er, »hören Sie mich! Ich lebe nur für Sie. Hören Sie auf meine Bitten, und alles, was ich habe, soll Ihre seyn. Treiben Sie mich nicht durch unzeitige Härte zur Verzweiflung, oder weil —«
»Gnädiger Herr,« unterbrach ihn Adeline mit unaussprechlicher Würde, indem sie sich noch immer das Ansehen gab, seinen Antrag für anständig zu halten, »ich erkenne die Großmuth Ihres Betragens, und finde mich durch die mir zugedachte Ehre geschmeichelt. Aus diesem Grunde halte ich es für meine Pflicht, zu der bestimmten Ablehnung Ihres Antrags noch das hinzuzusetzen, daß die wärmern Empfindungen meines Herzens nicht in meiner Macht sind, und daß es mir unmöglich ist, mehr als bloße Achtung gegen Sie zu hegen, welche durch nichts mehr erhöht werden kann, als wenn Sie in Zukunft mit ähnlichen Unterhaltungen mich verschonen.«
Sie versuchte aufs neue, das Zimmer zu verlassen, allein der Marquis verhinderte sie, und trug nach einigem Zögern seine Bewerbung nochmahls in Ausdrücken vor, die ihr nicht länger zuließen, ihn mißzuverstehen. Thränen stiegen ihr in die Augen; sie preßte sie gewaltsam zurück, und sagte mit einem Blick, worin Schmerz und Unwillen kämpften:
»Gnädiger Herr! dieß verdient keine Antwort. Entlassen Sie mich!«
Die Würde ihres Betragens setzte ihn einen Augenblick in Ehrfurcht, und aufs neue warf er sich zu ihren Füssen, um Vergebung zu erflehen. Sie winkte ihm schweigend abwärts und eilte aus dem Zimmer. So wie sie das ihrige erreichte, verschloß sie die Thüre, sank in einen Stuhl und gab allem Kummer ihres Herzens Raum.
Es war nicht das geringste ihrer Leiden, argwöhnen zu müssen, daß La Motte ihrer Achtung unwerth sey: denn fast unmöglich konnten ihm die wirklichen Absichten des Marquis unbekannt seyn. Frau von La Motte glaubte sie, wäre unter dem Vorwande einer anständigen Neigung getäuscht worden, und dieser Glaube ersparte ihr wenigstens die Qual, auch an ihrer Freundinn Redlichkeit zu zweifeln.
Sie sah mit Beben in die Aussicht, die vor ihr lag. Auf einer Seite ihr Vater, dessen Grausamkeit sich bereits zu deutlich gezeigt hatte; auf der andern der Marquis, der sie mit einer unwürdigen, schimpflichen Leidenschaft verfolgte. Sie beschloß, der Frau von La Motte den Inhalt seines Gesprächs mitzutheilen, und in Hoffnung auf ihren Schutz und Theilnahme trocknete sie ihre Thränen und war eben im Begriff das Zimmer zu verlassen, als Frau von La Motte hereintrat. Sie vergoß Thränen bey Adelinens Erzählung, und schien äußerst bewegt zu seyn; doch sprach sie ihr Trost zu, versicherte, sie wollte allen ihren Einfluß aufbiethen, um ihren Mann zu bewegen, daß er die Anträge des Marquis abwehrte.
»Sie wissen, meine Liebe,« sagte sie, »daß unsere jetzigen Umstände uns zu gewissen Rücksichten gegen den Marquis zwingen, und bitte Sie deßwegen, in Ihrem Betragen so wenig Empfindlichkeit als möglich, gegen ihn merken zu lassen. Seyn Sie so ungezwungen in seiner Gegenwart wie sonst, und ich zweifle nicht, daß diese Sache ohne weiterer Belästigung für Sie vorüber gehen wird.«
»Ach Madame, sagte Adeline, was für ein
schweres Geschäft legen Sie mir auf! Ich ersuche Sie inständigst, mir nie wieder die Demüthigung aufzulegen, in seiner Gesellschaft zu seyn, und so oft er die Abtey besucht, mir zu vergönnen, daß ich in meinem Zimmer bleiben darf.«
»Herzlich gern würde ich dieses zugestehen, ja vielleicht die erste seyn, die dazu riethe,« erwiederte Frau von La Motte, »wofern unsere Lage es zuließe. Allein Sie wissen, daß unsere Zuflucht in dieser Abtey von dem guten Willen des Marquis abhängt, den wir nicht muthwillig verscherzen dürfen. Ein solches Betragen würde alles bey ihm verderben; lassen Sie uns gelindere Maßregeln ergreifen, wodurch wir seine Freundschaft uns erhalten, ohne Sie einem ernsthaften Übel auszusetzen. Erscheinen Sie mit Ihrer gewöhnlichen Gefälligkeit — das Geschäft ist nicht so schwer als Sie glauben.«
Adeline seufzte:
»Ich gehorche Ihnen, Madame, weil es meine Pflicht ist, aber erlauben Sie mir zu sagen, mit äußerstem Wiederstreben.«
Frau von La Motte versprach, sogleich zu ihrem Manne zu gehen, und Adeline ließ einigermaßen beruhigt, wiewohl nicht überzeugt von ihrer Sicherheit, sie von sich.
Bald nachher sah sie den Marquis fortreiten, und da nun nichts mehr Frau von La Motte abhalten konnte, erwartete sie mit höchster Ungeduld ihre Zurückkunft. Nachdem sie beynahe eine Stunde in dieser Erwartung zugebracht hatte, wurde sie endlich heruntergerufen, und fand Herrn von La Motte im Zimmer allein. Er stand bey ihrem Eintritt auf, und ging schweigend einigemahl im Zimmer auf und ab; dann setzte er sich und redete sie an:
»Was Sie meiner Frau erzählt haben, würde mich sehr bekümmern, wenn ich des Marquis Betragen in eben so ernsthaftem Lichte betrachtete, als Sie. Ich weiß, daß junge Frauenzimmer geneigt sind, unbedeutende Modegalanterien zu mißdeuten, und Sie Adeline, können nie zu vorsichtig seyn, zwischen einer Plaisanterie dieser Art, und einem ernsthaften Antrage zu unterscheiden.«
Adeline fand sich befremdet und beleidigt, daß La Motte so gering von ihrem Verstande und Charakter dachte.
»Kann es möglich seyn,« erwiederte sie, »daß Sie würklich das Betragen des Marquis wissen?«
»Es ist sehr möglich und sehr gewiß,« versetzte La Motte mit einiger Bitterkeit; »und auch sehr möglich, daß ich die Sache mit weniger Vorurtheil ansehe als Sie. Doch will ich nicht über diesen Punct streiten. Ich bitte nur, daß, da Sie meine Lage kennen, Sie sich ein wenig darnach fügen, und mir nicht durch eine unzeitige Empfindlichkeit die Feindschaft des Marquis zuziehen. Er ist jetzt mein Freund, und es ist für meine Sicherheit nothwendig, daß er es bleibt; wenn ich aber zulasse, daß ihm von jemand in meiner Familie unartig begegnet wird, so muß ich erwarten, ihn mir zum Feinde zu machen. Sie können ihm ohne alles Bedenken wenigstens höflich begegnen.«
Adeline fand den Ausdruck unartig ein wenig stark, doch enthielt sie sich ihr Mißfallen zu äußern.
»Zwar hätte ich gewünscht,« sagte sie, »daß mir die Freyheit vergönnt wäre, mich zu entfernen, so oft der Marquis erscheine, allein, da Sie glauben, daß dieses Ihnen Nachtheil bringen würde, so muß ich mich unterwerfen.«
»Diese Klugheit und Gefälligkeit freut mich, und wenn es Ihr Wunsch ist, mich zu verbinden, so sage ich Ihnen, daß Sie es nicht stärker können, als wenn Sie den Marquis als Freund behandeln.«
Das Wort Freund in Verbindung mit dem Marquis war Mißlaut in Adelinens Ohr; sie sah La Motten bedeutend an:
»Als Ihren Freund werde ich suchen ihn zu behandeln, als den meinigen aber« —
Sie mochte ihre Rede nicht endigen, und bat ihn nur noch, sie vor ihrem Vater zu schützen.
»Auf den Schutz, den ich Ihnen geben kann, dürfen Sie sicher rechnen,« sagte er, »aber Sie wissen, wie wenig Recht sowohl als Mittel ich habe, mich ihm entgegen zu setzen, und wie sehr ich selbst schutzbedürftig bin. Da er Ihren Aufenthalt entdeckt hat, so sind ihm auch wahrscheinlich die Umstände nicht unbekannt, die mich hier halten, und wenn ich mich ihm widersetze, so muß ich befürchten, daß er mich den Gerichtsdienern verräth, als das sicherste Mittel, sich Ihrer zu versichern. Wir sind mit Gefahren umgeben, wollte der Himmel, ich sähe einen Ausweg, uns herauszuziehen.«
»Verlassen Sie diese Abtey und suchen in der Schweiz oder in Deutschland eine Zuflucht; Sie werden sich alsdann von aller fernern Verbindlichkeit gegen den Marquis so wie von der gefürchteten Verfolgung befreien. Verzeihen Sie mir, daß ich so frey meinen Rath anbiete, den allerdings größentheils Sorge für meine eigene Sicherheit mir eingibt, der mir aber zugleich das einzige Mittel zu seyn scheint, die ihrige zu befördern.«
»Ihr Plan wäre recht gut, wenn ich nur Geld hätte, ihn auszuführen. So aber muß ich mich begnügen, hier verborgen zu bleiben, und mir diejenigen, die mich kennen, zu Freunden zu machen. Vorzüglich liegt mir an der Gunst des Marquis. Er kann viel ausrichten, sollte auch Ihr Vater verzweifelte Maßregeln ergreifen. Doch warum rede ich so? Ihr Vater kann bereits zu diesen Maßregeln geschritten seyn, und vielleicht schwebt schon die Wirkung seiner Rache über meinem Haupt. Meine Freundschaft für Sie, Adeline, hat mich diesem ausgesetzt: hätte ich Sie ihm überliefert, so würde ich sicher geblieben seyn.«
Adeline fühlte sich durch diesen Beweis von La Mottens Freundschaft, den sie nicht bezweifeln konnte, so tief gerührt, daß sie keine Worte finden konnte. So bald sie zu reden vermochte, äußerte sie in den wärmsten Ausdrücken ihre Dankbarkeit.
»Ist das Ihr Ernst?« fragte La Motte.
»Könnte es möglich seyn, daß er es nicht wäre,« erwiederte Adeline, bis zu Thränen empfindlich über diesen Verdacht von Undankbarkeit.
»Empfindungen sind leicht ausgesprochen,« sagte La Motte, »wenn auch das Herz nichts davon weiß: ich kann sie nur in so fern für aufrichtig halten, als sie sich in unsern Handlungen zeigen.«
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Ich will sagen, ob Sie bey diesen Gesinnungen bleiben würden, wenn sich eine Gelegenheit zeigte, mir Ihren Dank zu beweisen?«
»Nennen Sie mir eine, und sehen Sie, ob ich sie ausschlagen werde,« versetzte Adeline mit Wärme.
»Wenn zum Beyspiel der Marquis in der Folge eine ernsthafte Liebe erklärte, und Ihnen seine Hand antrüge, würde nicht kleinliche Empfindlichkeit, oder Parteylichkeit für einen begünstigten Liebhaber Sie anreizen, ihn auszuschlagen?«
Adeline erröthete und sah zur Erde.
»Sie haben in der That das einzige Mittel meine Aufrichtigkeit zu beweisen genannt, das ich ausschlagen mußte. Ich kann den Marquis niemahls lieben, ja aufrichtig zu reden, ihn niemahls schätzen. Ich gestehe, daß die Ruhe eines ganzen Lebens, selbst für die Dankbarkeit ein zu großes Opfer ist.«
La Motte sah unzufrieden aus.
»Es ist, wie ich glaubte,« sagte er; »diese feinen Empfindungen lauten im Reden recht schön, und machen die Person, welche sie äußert, unendlich liebenswürdig; kommen sie aber zur That, so verfliegen sie in der Luft, und lassen nur den Schiffbruch der Eitelkeit hinter sich.«
Dieser unbillige Spott kränkte Adelinen tief:
»Weil denn Ihre Sicherheit von meinem Betragen abhängt, so geben Sie mich meinem Vater hin. Ich bin bereit, zu ihm zurückzukehren, weil mein Bleiben Sie in ein neues Unglück stürzt. Lassen Sie mich nicht des Schutzes, den ich bisher erhielt, mich unwürdig zeigen, indem ich mein Wohl dem Ihrigen vorzöge. Wann ich fort bin, so werden Sie keine Ursache haben, des Marquis Mißfallen zu fürchten, das Sie sich zuziehen könnten, wenn ich bliebe: denn es ist mir unmöglich, je seine Anträge anzunehmen, selbst wenn sie anständig wären.«
La Motte schien betroffen.
»Nein, auf keine Weise; lassen Sie uns nicht durch Aussinnen möglicher Übel uns quälen, und um sie zu vermeiden, zu wirklichen schreiten. Nein, Adeline, wann Sie gleich edel genug sind, sich meiner Sicherheit aufzuopfern, werde doch ich nie es zugeben. Ich werde Sie Ihrem Vater nimmermehr gutwillig überliefern. Seyn Sie also über diesen Punct ruhig, die einzige Vergeltung, die ich wünsche, ist ein höfliches Betragen gegen den Marquis.«
»Ich werde mich bemühen, Ihnen zu gehorchen, erwiederte sie.
Frau von La Motte trat jetzt herein, und das Gespräch wurde abgebrochen. Adeline brachte den Abend in traurigen Gedanken hin, und begab sich, so bald als möglich, auf ihr Schlafzimmer, um im Schlummer Zuflucht vor dem Kummer zu suchen.
Das Manuscript, welches Adeline den Abend zuvor gefunden hatte, war ihr den Tag über oft eingefallen; allein sie war entweder zu sehr mit den Vorfällen des Augenblicks beschäftigt, oder zu furchtsam vor Unterbrechung gewesen, um sich daran zu wagen. Jetzt zog sie es aus der Schieblade, worin sie es verborgen hatte, hervor, und in der Absicht, nur die ersten Seiten flüchtig zu überblicken, setzte sie sich damit an ihre Bette.
Sie öffnete es mit einer heißen Neugierde, welche die entfärbte und fast erloschne Dinte nur langsam befriedigte. Die ersten Worte waren gänzlich verloren, diejenigen aber, womit die Erzählung anzufangen schien, lauteten folgendermaßen:
»O Ihr, die vielleicht dereinst Unglück oder Zufall an diesen Ort bringt, wer ihr auch seyd, mit euch rede ich! Euch offenbare ich die Geschichte meines Wehs, und fordere euch auf, es zu rächen. Vergebene Hoffnung! doch gewährt mir der Gedanke einigen Trost, daß vielleicht eines Tages ein menschliches Auge lesen wird, was ich jetzt schreibe; daß die Worte, welche mein Leiden schildern, eines Tages dem fühlenden Herzen Mitleid entlocken werden.
Doch trocknet eure Thränen! euer Mitleid ist jetzt fruchtlos. Lange haben die Qualen des Elends geendet, die Stimme der Klage ist verhallt! Es ist Schwachheit, ein Mitleid zu wünschen, das nicht eher erregt werden kann, bis ich in die Ruhe des Grabes sinke, und den Lohn der Ewigkeit genieße!
So wisset denn, daß am zwölften October 1642 ich auf dem Wege nach Caux, auf der nähmlichen Stelle, wo dem Gedächtniß des unsterblichen Heinrichs eine Ehrensäule errichtet ist, von vier Kerls ergriffen wurde, die meinen Bedienten zu Boden streckten, und mich durch Wildnisse und Wälder nach dieser Abtey brachten. Ihr Betragen glich nicht gemeinen Räubern, und ich merkte bald, daß eine höhere Macht sich ihrer zu irgend einem schrecklichen Zwecke bediente. Vergebens wandte ich Bitten, bot ich ihnen Bestechungen an, mir ihrem Anstifter zu entdecken, und ihr Vorhaben aufzugeben: sie wollten nicht das geringste von ihren Absichten verrathen.
Als sie aber nach einer langen Reise, auf diesem Gebäude mit mir anlangten, erkannte ich auf einmahl ihren nichtswürdigen Anstifter, und übersah seinen schrecklichen Plan nur zu gut. Welch ein Anblick! Alle Donner des Himmels schienen auf dieß schutzlose Haupt geschleudert! O Stärke! stähle mein Herz zu —«
Adelinens Licht wollte jetzt im Leuchter erlöschen, und die bleiche Dinte, die schwach beschienen wurde, vereitelte ihr Bemühen, die Züge zu unterscheiden: sie konnte kein Licht heraufhohlen, ohne zu verrathen, daß sie noch auf war, welches Verwunderung erregen, und zu einer Erläuterung führen mußte, die sie nicht wünschte. Auf solche Art gezwungen, das Lesen aufzugeben, welches so viele Ursachen ihr schauderlich anziehend machten, legte sie sich in ihr niedriges Bett.
Was sie von der Handschrift gelesen hatte, erweckte einen furchtbaren Antheil an dem Schicksale des Verfassers und rief schreckliche Bilder vor ihre Seele.
»In diesen Zimmern!« sagte sie, und schloß schaudernd die Augen.
Endlich hörte sie Frau von La Motte zu Bett gehen, und die Schreckbilder der Furcht zerstreuten sich und gaben dem Schlafe Raum.
Den andern Morgen weckte Frau von La Motte sie auf, und sie fand zu ihrem großen Kummer es schon so weit über ihre gewöhnliche Zeit, daß sie das Manuscript nicht mehr vornehmen konnte. — La Motte schien ungewöhnlich finster und aus seiner Frau Gesicht leuchtete eine Niedergeschlagenheit hervor, die Adeline ihrer Bekümmerniß um sie zuschrieb.
Das Frühstück war kaum verzehrt, als das Getrampel von Pferden die Ankunft eines Fremden verkündigte. Adeline sah den Marquis absteigen, und wollte schnell nach ihrem Zimmer eilen, ohne an ihr Versprechen gegen La Motte zu denken; allein der Marquis war schon im Vorsaal und richtete, als er sie fortgehen sah, einen fragenden Blick auf La Motte. La Motte rief sie zurück, und erinnerte sie durch ein nur zu verständliches Stirnrunzeln an ihr Versprechen. Sie rief alle Fassung zu Hülfe, näherte sich aber doch mit sichtlicher Bewegung, während der Marquis sie mit seiner gewöhnlichen Ungezwungenheit und leichten Munterkeit anredete.
Diese sorglose Zuversichtlichkeit verdroß und befremdete Adelinen, wiewohl sie ihren Stolz erweckte, und ihr eine gewisse Würde gab, die ihn beschämte. Er sprach mit Verlegenheit, und schien oft abwesenden Geistes zu seyn. Endlich stand er auf, und ersuchte Adelinen, ihm eine kleine Unterredung zu gönnen. Herr und Frau von La Motte wollten das Zimmer verlassen, als Adeline sich zu dem Marquis wendete, und ihm erklärte, sie wünschte keine andere Unterredung als in Gegenwart ihrer Freunde. Allein dieß war vergebens, sie waren bereits fort, und La Motte sagte ihr im Hinausgehen durch einen Blick, wie sehr ein Versuch, ihm nachzufolgen, ihn beleidigen würde.
Sie saß eine Weile in stummer, ängstlicher Erwartung.
»Ich sehe,« fing der Marquis endlich an, »daß das Betragen, wozu mich das Feuer meiner Leidenschaft hinriß, mir in Ihrer Meinung geschadet hat, und daß es mir schwer werden wird, Ihre Achtung wieder zu erlangen; allein ich hoffe, der Antrag, den ich Ihnen jetzt mit meinem Rang und Vermögen mache, wird die Aufrichtigkeit meiner Liebe hinlänglich beweisen, und das Vergehen, welches Leidenschaft allein erzeugte, vergüten.«
Nach diesem Probestück von Alltagsberedsamkeit, welches der Marquis als ein Vorzeichen des Triumphs zu betrachten schien, wollte er Adelinens Hand küssen, die sie aber schnell mit den Worten zurückzog:
»Gnädiger Herr, Sie wissen bereits meine Meinung über diesen Punct, und es ist beynahe überflüssig, Ihnen zu wiederhohlen, daß ich die mir zugedachte Ehre nicht annehmen kann.«
»Erklären Sie sich, liebenswürdige Adeline, ich wüßte nicht, Ihnen bis jetzt diesen Antrag gemacht zu haben.«
»Sie thun sehr wohl, gnädiger Herr! mich daran zu erinnern, da ich nach ihrem ersten Antrage nur auf einen Augenblick einen andern anhören konnte.«
Sie stand auf, um das Zimmer zu verlassen.
»Bleiben Sie, Fräulein,« sagte der Marquis mit einem Blicke, worin beleidigter Stolz sich zu verbergen strebte, »lassen Sie nicht eine übertriebene Empfindlichkeit gegen Ihren wahren Vortheil wirken: erinnern Sie sich, welche Gefahren Sie umgeben, und verwerfen Sie nicht so obenhin einen Antrag, der Ihnen wenigstens einen anständigen Schutzort gewährt.«
»Was auch meine Unglücksfälle seyn mögen, gnädiger Herr, so bin ich mir doch nie bewußt, sie Ihrer Bemerkung aufgedrungen zu haben; erlauben Sie mir also zu sagen, daß Ihre Erwähnung derselben mehr einer Beleidigung als einem Mitleid gleich sieht.«
Der Marquis, wiewohl mit sichtlicher Verlegenheit, war in Begriff zu antworten; allein Adeline ließ sich nicht aufhalten, und begab sich in ihr Zimmer. So hülflos sie auch war, empörte sich ihr Herz gegen seinen Antrag, und sie beschloß fest, ihn nie anzunehmen. Allerdings kam zu ihrem Mißfallen an seinem Charakter und zu dem Unwillen über seinen vorigen Antrag noch der Einfluß einer andern Neigung und eines Andenkens, das sie nicht aus ihrem Herzen vertilgen konnte.
Der Marquis blieb zu Tisch, und aus Rücksicht für La Motte, erschien Adeline, fand aber seine Blicke so unerträglich, daß sie bald sich zurückzog. Frau von La Motte folgte ihr, und erst des Abends konnte sie ihr Manuscript wieder hervorziehen. Sobald Herr und Frau von La Motte in ihrem Zimmer waren, und alles still schien, setzte sie sich zu ihrem Licht und las folgendes:
»Die Kerls banden mich von meinem Pferde los, und führten mich durch die Halle die Windeltreppe hinauf; Widerstand war vergebens, doch sah ich mich um, ob ich nicht ein Wesen erblickte, das minder hart wäre, als die Menschen, die mich hieher brachten. Umsonst! niemand erschien, und dieser Umstand bestärkte meinen ärgsten Verdacht. Diese Heimlichkeit weissagte ein schreckliches Ende. Nachdem wir durch einige Zimmer gegangen waren, standen sie in einem still, das mit alten Tapeten behangen war: ich fragte, warum wir nicht weiter gingen, und erhielt zur Antwort, ich würde es bald erfahren.
In diesem Augenblick erwartete ich, das Werkzeug des Todes aufgehoben zu sehn, und befahl mich schweigend Gott. Allein noch war der Tod mir nicht bestimmt; sie huben den Vorhang auf, und öffneten eine Thüre, ergriffen mich beym Arm und führten mich durch eine Reihe düstrer Zimmer. Im letzten standen sie wieder still, die schreckliche Dunkelheit des Orts schien einer schwarzen That geneigt und flößte mir wieder Todesgedanken ein. Nochmahls sah ich mich nach dem Werkzeug der Zerstörung um, und nochmahls wurde ich verschont. Ich flehte zu wissen, was mir aufbehalten sey: es war jetzt nicht mehr nöthig, nach dem Urheber des Anschlags zu forschen. Sie schwiegen zu meinen Fragen, sagten mir aber endlich, dieses Zimmer sey mein Gefängniß. Nach diesen Worten setzten sie mir einen Krug Wasser hin, verließen das Zimmer und ich hörte die Thüre hinter mir verschließen.
O Ton der Verzweiflung! O Augenblick unaussprechlicher Angst! die Angst des Todes selbst kann nicht schrecklicher seyn. Vom Lichte des Tages, von Freunden, vom Leben ausgeschlossen — denn so weissagte es mein Herz — in der Blüthe meiner Jahre, auf dem Gipfel meiner Aussichten, und der Ahndung von Schrecknissen Preis gegeben, furchtbarer vielleicht als alle, welche die Gewißheit erzeugen konnte. Ich erliege unter —«
Hier waren verschiedene Seiten der Handschrift vermodert, und ganz unlesbar. Mit vieler Mühe brachte Adeline folgendes heraus.
»Drey Tage sind nun in Einsamkeit und Schweigen verstrichen; die Schrecken des Todes schweben stets vor meinen Augen, ich will mich auf den schrecklichen Wechsel vorzubereiten suchen. Wenn ich des Morgens erwache, ist es mit dem Gedanken, daß ich nicht mehr leben werde, noch eine Nacht zu sehen. Warum wäre ich hieher gebracht, warum so strenge verhaftet, als zum Tode? Und doch, welche Handlung meines Lebens hat dieses von der Hand eines Mitgeschöpfs verdient? — Von m—
— — — — —
O mein Kind! O meine fernen Freunde! Nie werde ich euch wieder sehen! nie mehr den Scheideblick der Liebe empfangen! nie einen Abschiedssegen ertheilen! — Ihr wißt meinen elenden Zustand nicht — ach! durch keine menschlichen Mittel könnt ihr ihn wissen. Ihr glaubt mich glücklich, sonst würdet ihr mir zu Hülfe fliegen. Ich weiß, daß mein Schreiben mir zu nichts helfen kann; doch ist es Trost, meinen Schmerz auszuschütten; und ich segne den Mann, der minder barbarisch als seine Gefährten, mir diese Mittel, sie aufzuzeichnen, verschaft hat. Ach! er weiß nur zu gut, daß er nichts zu fürchten braucht. Meine Feder kann keine Freunde mir zu Hülfe rufen, kann meine Gefahr nicht entdecken, bis es zu spät ist. O ihr, die ihr dereinst leset, was ich jetzt schreibe, schenkt eine Thräne meinem Leiden. Oft habe ich um das Elend meiner Mitgeschöpfe geweint.«
Adeline hielt inne. Hier wandte sich der unglückliche Schreiber unmittelbar an ihr Herz: er sprach in der Kraft der Wahrheit, und vermöge einer starken Täuschung der Fantasie schien es, als wären seine vergangenen Leiden in diesem Augenblick gegenwärtig. Sie war eine Zeitlang unvermögend fortzufahren und saß in tiefsinnigem Schmerz.
»In diesen nähmlichen Zimmern,« sagte sie, »war der arme Leidende verhaftet — hier —«
Sie fuhr zusammen, und glaubte einen Laut zu hören, aber die Stille der Nacht blieb ungestört.
»In diesen Zimmer,« fuhr sie fort, »wurden diese Zeilen geschrieben, Zeilen, bey denen der Gedanke sein Trost war, daß dereinst ein mitleidiges Auge sie lesen würde; diese Zeit ist jetzt gekommen. Dein Elend, o du Gekränkter, wird beklagt, da, wo es erduldet ward. Hier, wo du bittest, weine ich um dich!«
Ihre Einbildungskraft war erschüttert, und die Bilder eines verirrten Geistes erschienen mit der Kraft der Wirklichkeit. Aufs neue fuhr sie fort und lauschte, und deutlich glaubte sie von einer leise hinter ihr flüsternden Stimme hier wiederhohlen zu hören. Das Papier fiel aus ihrer Hand, doch dauerte ihr Schrecken nur einen Augenblick: sie wußte, daß es nicht seyn konnte, und überzeugt, daß nur Ihre Fantasie sie hintergangen hatte, nahm sie es wieder auf und las fort:
»Wozu werde ich aufbehalten? Wozu dieses Zögern? Wenn ich sterben soll, warum nicht schnell? Drey Wochen habe ich nun in diesen Mauern zugebracht, und in dieser ganzen Zeit hat kein Blick des Mitleidens meinen Kummer gesänftigt; keine Stimme, außer meiner eigenen, in mein Ohr getönt. Die Gesichter der Menschen, die zu mir kommen, sind finster und stier; ihr Stillschweigen unüberwindlich. Diese Stille ist furchtbar! ihr, die ihr erfuhrt, was es heißt, in der Tiefe der Einsamkeit leben; die ihr eure traurigen Tage ohne einen erheiternden Laut zu hören, zubrachtet, ihr, nur ihr könnt sagen, was ich fühle, nur ihr könnt wissen, wie viel ich erdulden wollte, um nur den Ton einer menschlichen Stimme zu hören!
O harte Nothwendigkeit! O Zustand lebendigen Todes! Welche schreckliche Stille! Alles rings um mich ist todt; und lebe denn ich wirklich? oder bin ich nur Bildsäule? Ist dieses ein Traumgesicht? Sind diese Dinge wirklich? Ach — meine Sinnen verwirren sich! Dieses todtengleiche, ewige Schweigen, dieses finstere Gemach — das Schrecken fernerer Qual hat meine Fantasie zerstört. O nur eine Freundesbrust, mein mattes Haupt daran zu lehnen, ein herzlicher Laut, meine Seele zu erquicken.
— — — — —
Ich schreibe verstohlen; er, der mir die Mittel dazu verschaft hatte, ist, wie ich fürchte, für einige Zeichen des Mitleids, die er verrathen haben mag, gestraft worden: ich habe ihn in vielen Tagen nicht gesehen, vielleicht war er geneigt, mir zu helfen, und man läßt ihn nicht mehr zu mir. — Vergebne, eitle Hoffnung! — Nie wieder werde ich diese Mauern verlassen, so lange Leben in mir ist. —
Noch kein Tag ist verstrichen, und ich lebe noch! morgen um diese Zeit werden vielleicht meine Leiden im Tode versiegelt seyn. Ich will mein nächtliches Tagebuch fortsetzen; bis die Hand, die es schreibt, im Tode erstarrt — wann dieses Tagebuch aufhört, so wisse der Leser, daß ich nicht mehr bin. Vielleicht sind dieß schon die letzten Zeilen, welche ich jemahls schreibe.« —
— — — — —
Adeline hielt inne, während ihre Thränen reichlicher flossen.
»O du Unglücklicher, und war keine erbarmende Hand, dich zu retten! Ewiger Gott, deine Wege sind wunderbar!«
Ihre Fantasie, die jetzt in den Regionen, des Schreckens wanderte, überwältigte nach und nach ihre Vernunft. Es stand ein Spiegel auf dem Tische vor ihr, und sie fürchtete sich, hineinzusehen, um nicht ein anderes Gesicht als das ihrige zu treffen: andere schreckliche Bilder und fremde, fantastische Erscheinungen schwebten durch ihre Seele.
Ein hohler Seufzer schien neben ihr hin zu streichen.
»Heilige Jungfrau,« rief sie, »stehe mir bey!« und warf einen furchtvollen Blick im Zimmer umher. »Dieß ist gewiß mehr als Einbildung.«
Ihre Angst überwältigte sie jetzt so ganz, daß sie auf dem Puncte stand, die Familie herbey zu rufen, aber Furcht verspottet zu werden, hielt sie zurück. Auch fürchtete sie, sich zu bewegen, ja nur zu athmen. So wie sie dem Winde horchte, der durch das Fenster ihres einsamer Zimmers strich, glaubte sie wieder einen Seufzer zu hören. Ihre Fantasie verweigerte sich aller Herrschaft der Vernunft, und indem sie die Augen aufschlug, schien eine Gestalt, die sie nicht deutlich erkennen konnte, durch einen dunklen Winkel des Zimmers zu schleichen: ein Todesschauer durchdrang sie, und sie saß starr auf ihren Stuhl geheftet: endlich erleichterte ein tiefer Seufzer ihre gepreßte Brust, und ihre Sinnen schienen wieder zu kehren.
Da alles ruhig blieb, fragte sie sich nach einiger Zeit, ob nicht ihre Fantasie sie getäuscht hätte, und überwand ihren Schrecken so weit, daß sie sich enthielt, Frau von La Motte zu rufen: doch war ihre Seele so geängstigt, daß sie sich nicht getraute, das Manuscript wieder hervorzusuchen, sondern nach einem Gebet um Fassung und Ruhe sich zu Bette begab.
Als sie des Morgens erwachte, spielten die freudigen Strahlen der Sonne am Fenster, und vertrieben die Schreckbilder der Dunkelheit: ihr Geist, durch den Schlaf gesänftigt und gestärket, verwarf die mystischen, unruhigen Eingebungen der Einbildungskraft. Erfrischt und dankbar stand sie auf; als sie aber zum Frühstück herunter ging, floh dieser vorübergehende Strahl des Friedens bey dem Anblick des Marquis, dessen häufige Besuche auf der Abtey, nach dem was vorgefallen war, ihr mißfielen, und sie beunruhigten. Sie sah, daß er entschlossen war, auf seinen Verfolgungen zu beharren; und die Kühnheit und Fühllosigkeit dieses Betragens erregte ihren Unwillen, während es ihren Abscheu vermehrte.
Aus Schonung gegen La Motte suchte sie diese Regungen zu verbergen, wie wohl sie zu glauben anfing, daß er zu viel von ihrer Gefälligkeit forderte, und ernstlich erwog, wie sie die Nothwendigkeit, sie fortzusetzen, vermeiden könnte. Der Marquis bezeugte ihr die ehrerbietigste Aufmerksamkeit, allein sie blieb still und zurückhaltend, und ergriff die erste Gelegenheit, das Zimmer zu verlassen.
Als sie die Wendeltreppe herauf ging, trat Peter unten in den Vorsaal, und da er sie sah, stand er still, und sah sie bedenklich an. Sie bemerkete ihn nicht, allein er rief sie leise beym Nahmen, und machte ein Zeichen, als hätte er ihr etwas mitzutheilen. In dem nähmlichen Augenblick aber öffnete La Motte die Thüre des gewölbten Zimmers und Peter verschwand eilends. Sie ging in ihr Zimmer, über diesen Wink, und die Behutsamkeit, womit Peter ihn gegeben hatte, nachdenkend.
Bald aber kehrten ihre Gedanken zu dem gewohnten Gegenstande zurück. Drey Tage waren nun verstrichen, und sie hatte nichts von ihrem Vater vernommen: sie fing an zu hoffen, daß er von den heftigen Maßregeln abgestanden sey, die La Motte zu verstehen gab, und einen sanftern Plan zu ergreifen dächte: wenn sie aber seinen Charakter in Erwägung zog, schien ihr dieses unwahrscheinlich, und sie fiel in ihre vorigen Besorgnisse zurück. Ihr Aufenthalt auf der Abtei war jetzt durch die Beharrlichkeit des Marquis und durch das Betragen, welches La Motte ihr auflegte, höchst peinlich geworden; doch konnte sie nicht ohne Furcht an eine Rückkehr zu ihrem Vater denken.
Theodors Bild schlich sich oft in ihre Gedanken, und seine sonderbare, schnelle Abreise quälte sie. Sie hatte eine dunkle Ahndung, daß sein Schicksal mit dem ihrigen verwebt sey, und ihr Kämpfen, sich des Andenkens an ihn zu erwehren, zeigte ihr nur stärker, wie sehr ihr Herz an ihm hing.
Um ihre Gedanken von diesen Gegenständen abzuziehen, und die Neugier zu stillen, die in der vorigen Nacht so sehr gereizt war, nahm sie jetzt das Manuscript zur Hand, wurde aber durch die Hereinkunft der Frau von La Motte gehindert, die ihr sagte, daß der Marquis fort wäre. Sie brachten den Morgen mit Arbeiten und gewöhnlichem Gespräch zu. La Motte ließ sich nicht sehen, bis bey Tisch, wo er wenig sprach, und Adeline noch weniger. Doch fragte sie ihn, ob er nichts von ihrem Vater gehört hätte?
»Gehört habe ich nichts von ihm,« erwiederte er, »allein nach dem, was ich von dem Marquis erfahren habe, muß ich glauben, daß er nicht weit ist.«
Adeline erschrack, doch war sie im Stande, mit gehöriger Festigkeit zu antworten:
»Ich habe Sie bereits nur zu sehr in mein Unglück verwickelt, und sehe jetzt ein, daß Widerstand Sie verderben wird, ohne mir zu nutzen; aus diesem Grunde bin ich bereit, zu meinem Vater zu gehen, und Ihnen fernere Unannehmlichkeit zu ersparen.«
»Das ist ein rascher Entschluß,« versetzte La Motte, »und wenn Sie dabey beharren, werden Sie es künftig bereuen. Ich rede jetzt als Freund mit Ihnen, Adeline, und bitte Sie, mich ohne Vorurtheil anzuhören. Der Marquis hat, wie ich vernehme, Ihnen seine Hand angetragen, und ich weiß nicht, ob ich mich mehr wundern soll, daß ein Mann von seinem Rang und Gewichte eine Verbindung mit einem Mädchen ohne Vermögen und Ansehen suche; oder daß ein Mädchen in solchen Umständen nur einen Augenblick bey sich anstehen kann, die angetragnen Vortheile sich zu Nutzen zu machen. Sie weinen, Adeline, lassen Sie mich hoffen, daß Sie von der Albernheit Ihres Betragens überzeugt sind, und nicht länger mit Ihrem Glück spielen wollen. Die Freundschaft, die ich Ihnen bewiesen habe, muß Sie überzeugen, daß ich Sie schätze, und keinen andern Grund. habe, Ihnen diesen Rath zu geben, als Ihr eigenes Bestes. Doch sehe ich mich genöthigt, Ihnen zu sagen daß, wenn auch Ihr Vater nicht auf Ihre Zurückgabe dringt, ich nicht weiß, wie lange meine Umstände mir erlauben werden, Ihnen selbst diesen dürftigen Unterhalt zu reichen. Sie schweigen? —«
Der Schmerz, welchen diese Worte ihr auspreßten, erstickte ihre Sprache, und sie fuhr fort zu weinen. Endlich sagte sie:
»Lassen Sie mich zu meinem Vater gehen! Ich würde in der That die Freundschaft, deren Sie erwähnen, schlecht verdienen, wenn ich nach dem, was Sie mir gesagt haben, wünschen könnte zu bleiben; und den Marquis anzunehmen, ist mir, nach meiner Empfindung, unmöglich.«
Theodors Bild stieg vor ihr auf, und sie schluchzte laut. La Motte saß eine Weile nachdenkend:
»Seltsame Verblendung,« rief er endlich! »Ist es möglich, daß Sie bey diesem romanhaften Heroismus beharren, und einen so unmenschlichen Vater als den Ihrigen, dem Marquis de Montalt vorziehen können! Ein Schicksal so voll Gefahr einem Leben der Pracht und des Vergnügens!«
»Verzeihen Sie mir, eine Verbindung mit dem Marquis würde wohl Pracht, aber nie Vergnügen seyn! Sein Charakter ist mir zuwider, und ich ersuche Sie inständig, seiner nie wieder zu erwähnen.«
Das eben erwähnte Gespräch wurde durch Peters Hereinkunft unterbrochen, der, als er das Zimmer verließ, Adelinen bedeutend ansah, und ihr mit den Augen winkte. Sie war begierig zu wissen, was er wollte, und ging bald nachher in den Vorsaal, wo er umherschlenderte. So wie er sie sahe, legte er den Finger auf den Mund, und winkte ihr, in einen Winkel zu kommen.
»Nun Peter, was ists?« fragte sie.
»Still, Fräulein, um Gotteswillen sprechen Sie leise, wenn man uns hörte, wären wir alle verloren.«
Adeline bat ihn, sich deutlicher zu erklären.
»Ja, ja, Fräulein das ists, was ich schon den ganzen Tag gesucht habe. Ich habe auf eine Gelegenheit gewartet und gewartet, gesehen und gesehen, bis ich fürchtete, mein Herr würde selbst mich zu sehen bekommen: allein es half alles nichts. Sie wollten mich nicht verstehen.«
Adeline bat ihn, sich kurz zu fassen.
»Ja Fräulein, ich bin nur Angst, daß man uns sieht; allein, was wollte ich nicht thun, um einem so guten jungen Frauenzimmer zu dienen, denn ich kann nicht daran denken, was Ihnen bevorsteht, ohne Sie zu warnen.«
»Um Gotteswillen, mache Er fort, oder man wird uns unterbrechen.«
»Nun denn! Zuvor aber müssen Sie mir bey der heiligen Jungfrau geloben, daß Sie niemahls wiedersagen wollen, was ich Ihnen offenbare. Mein Herr würde —«
»Ja, ja, ich verspreche alles!«
»Nun denn! Am Montag Abend, als ich — still, höre ich nicht einen Schritt? — O Fräulein, gehen Sie in den Kreuzgang — ich wollte um aller Welt Wunder nicht, daß man uns sähe. Ich will zur Saalthüre herausgehen, und Sie können durch den Gang gehen. Daß man uns ja nicht sieht!«
Adeline gerieth in die äußerste Unruhe über Peters Reden, und eilte in den Kreuzgang. Er erschien schnell, und nachdem er sich ängstlich umgesehen hatte, fing er sein Gespräch wieder an:
»Ja, wie ich sagte, Fräulein, Montags Nacht, als der Marquis hier schlief — Sie wissen, daß er lange aufblieb, und ich könnte die Ursache wohl rathen. Es kamen seltsame Dinge zum Vorschein, aber es ist nicht meine Sache, alles zu sagen, was ich denke.«
»Ums Himmelswillen, so komme er doch zur Sache,« rief Adeline ungeduldig; »was ist das für eine Gefahr, die mir droht? Mache Er fort, oder man wird uns gewahr werden.«
»Gefahr die Menge, Fräulein, wenn Sie alles wüßten; und wenn auch, was kann es nutzen, Sie können sich doch nicht selbst helfen. Allein das thut nichts zur Sache; genug, daß ich mir vorgenommen habe, es Ihnen zu sagen, wenn ich es auch bereuen sollte —«
»Oder vielmehr, Er hat sich vorgenommen, es mir nicht zu sagen, denn er macht keine Anstalt dazu. Allein, was meint er; er sprach von von dem Marquis. —«
»Still, Fräulein, nicht so laut! der Marquis, wie ich sagte, blieb lange auf, und mein Herr saß bey ihm. Einer von seinen Leuten ging in der eichnen Kammer zu Bett, und der andere blieb auf, um seinen Herrn auszuziehen. — Als wir nun zusammen sassen — Gott sey mir gnädig, die Haare stiegen mir empor — ich zittere noch, wenn ich daran denke. Als wir also zusammen sassen — aber so wahr ich lebe, dort kommt mein Herr. Ich sah ihn zwischen den Bäumen; wenn er mich sieht, so ist alles aus — ich wills Ihnen ein andersmahl sagen. —«
Mit diesen Worten eilte er in die Abtei, und verließ Adelinen in einem Zustande von Unruhe, Neugier und Verdruß. Sie ging in den Wald, und dachte über Peters Worte nach, die sie vergebens zu reimen sich bemühte; Frau von La Motte kam ihr nach, und sie sprachen über allerley Dinge, bis sie die Abtei erreichten.
Adeline wartete den Tag über vergebens auf Gelegenheit, Petern zu sprechen. Als er des Abends bey Tisch aufwartete, beobachtete sie ängstlich sein Gesicht, in Hoffnung einige Aufklärung darauf zu lesen. Beym Schlafengehen begleitete Frau von La Motte sie in ihr Zimmer und hielt sie mit allerley Gesprächen auf, so daß sie keine Gelegenheit fand, mit Peter zusammen zu kommen. — Frau von La Motte schien etwas auf dem Herzen zu haben, und als Adeline es bemerkete, und um die Ursache fragte, traten ihr Thränen in die Augen und sie ging schnell aus dem Zimmer.
Dieses Betragen, mit Peters Reden zusammengenommen, beunruhigte Adelinen, die nachdenkend sich auf ihr Bett setzte, und sich ihren Betrachtungen überließ, bis der Ton einer Glocke im untern Zimmer, die Zwölfe schlug, sie erweckte. Sie wollte sich zum Schlafen auskleiden, als sie sich des Manuscripts erinnerte, und es nun unmöglich fand, die Nacht zuzubringen, ohne es durchlesen zu haben. Die ersten Worte, die sie herausbringen konnte, lauteten folgendermaßen:
»Noch einmahl kehre ich wieder zu diesem armseligen Trost — noch einmahl ist mir vergönnt worden, einen neuen Tag zu sehen. Es ist jetzt Mitternacht! Meine einsame Lampe brennt neben mir, die Stunde ist schauderlich; allein für mich ist die Stille des Mittags wie die Stille der Mitternacht; eine dickere Finsterniß ist alles, wodurch sie sich unterscheiden. Die stillen, nie abwechselnden Stunden werden nur durch meine Leiden gezählt! Großer Gott, wann werde ich erlöst werden!
— — — — —
Aber warum dieses grausame Gefängniß? Ich habe ihn nie beleidigt. Wenn der Tod mir bestimmt ist, warum dieß Zögern? und wozu als zum Tode ward ich hieher gebracht. Diese Abtey — ach!« —
Hier war die Schrift wieder unleserlich und mehrere Seiten durch konnte Adeline nur unzusammenhängende Ausdrücke herausbringen.
»O bitterer Trank! wann, wann werde ich Ruhe genießen? O meine Freunde! will keiner mir zu Hülfe eilen, keiner von euch mein Leiden rächen? Ach wenn es zu spät ist, wenn ich auf immer dahin bin, dann werdet ihr mich zu rächen streben!
— — — — —
Noch einmahl ist die Nacht mir wiedergekehrt. Noch ein Tag in Einsamkeit und Elend hingebracht. Ich stieg ans Fenster herauf, weil ich glaubte, der Anblick der Natur würde meine Seele erquicken und mich stärken zu Ertragung dieses Leidens. Ach! auch dieser armselige Trost ist mir versagt: die Fenster gehen nach den innern Theilen dieser Abtey und lassen nur einen Schimmer des Tags ein, den ich nie wieder in vollem Lichte sehen soll. Vorige Nacht! Vorige Nacht! O Scene des Schreckens!« — —
Adeline schauderte: Sie fürchtete die nächsten Zeilen zu lesen, doch trieb Neugier sie weiter. — Noch zögerte sie — eine unerklärliche Bangigkeit bemächtigte sich ihrer.
»Eine schreckliche That ist hier begangen,« sagte sie, »die Reden der Bauern haben nicht gelogen. Mord —«
Diese Vorstellung erfüllte sie mit Entsetzen. Sie erinnerte sich des Dolchs, der ihre Schritte in dem geheimen Zimmer aufhielt, und dieser Umstand diente ihre schrecklichsten Vermuthungen zu bestärken. Sie wünschte ihn zu untersuchen; aber er lag in einem Winkel von jenem Zimmer und sie fürchtete sich.
»Unglückliches, unglückliches Schlachtopfer,« rief sie, »konnte kein Freund dich vom Untergange retten! O daß ich dir nahe gewesen wäre! aber was hätte ich für dich gekonnt! Ach, ich vergesse, daß ich vielleicht in diesem Augenblick gleich dir mit Gefahren umringt bin, in welchen kein Freund mich unterstützt. Nur zu gut ahnde ich den Urheber deines Elends!«
Sie hielt inne, und glaubte einen Seufzer zu hören, gleich wie in vergangener Nacht. Ihr Blut erstarrte, und sie saß einen Augenblick ohne Bewegung. Die einsame Lage ihres Zimmers, von der übrigen Familie abgeschnitten, (sie war jetzt wieder in ihrem alten Zimmer, das Frau von La Motte geräumet hatte) die kaum ihr Rufen hören konnte, machte einen solchen Eindruck auf ihre Einbildungskraft, daß sie beynahe umsank. Lange blieb alles still, und sie suchte ihre zerstörten Lebensgeister wieder zu sammeln.
Sie richtete ein kurzes Gebet an das Wesen, das bisher in aller Gefahr sie geschützt hatte. Nach und nach fühlte ihre Seele sich beruhiget und gestärkt: eine hohe Ergebung fühlte ihr Herz, und sie setzte sich noch einmahl zum Lesen nieder.
Einige Zeilen die unmittelbar folgten, waren erloschen
— — — — —
»Er sagte mir, ich würde nicht lange mehr zu leben haben, nicht länger als drey Tage, und ließ mir die Wahl zwischen Gift oder Dolch. O die Todesangst dieses Augenblicks! Großer Gott, du siehst mein Leiden! Oft sah ich, mit augenblicklicher Hoffnung zu entkommen, nach den hochvergitterten Fenstern meines Gefängnisses auf — ich nahm mir vor, alles, was im Kreise der Möglichkeit liegt, zu versuchen, und klimmte mit begieriger Verzweiflung die Fenster hinan, allein mein Fuß glitt aus, und ich stürzte betäubt zu Boden. Als ich mich wieder erhohlte, waren die Schritte eines Kommenden das erste, was ich hörte. Eine Erinnerung des Vergangenen kehrte wieder, und kläglich war mein Zustand. Ich schauderte vor dem, was kommen sollte. Derselbe Mann näherte sich — anfangs sah er mich mitleidig an, bald aber erhielt sein Gesicht seine natürliche Wildheit wieder. Doch kam er dießmahl nicht, um das Vorhaben seines Anstifters auszuführen — ich soll noch einen neuen Tage aufbehalten werden — Allmächtiger dein Wille geschehe!«
Adeline vermochte nicht weiter zu lesen. Alle Umstände, die das Schicksal dieses Unglücklichen zu bestätigen schienen, drängten sich vor ihre Seele: die Gerüchte von der Abtey — die Träume, die ihrem Auffinden der geheimen Zimmer vorhergegangen waren — die sonderbare Art, wie sie die Handschrift entdeckt hatte, und die Erscheinung, welche sie jetzt wirklich gesehen zu haben glaubte. Sie verwies sich, La Motten nichts von dem Manuscript und von den Zimmern gesagt zu haben, und nahm sich vor, die Eröffnung nicht länger als bis zum andern Morgen zu verschieben. Die Sorgen des Augenblicks, die unmittelbar ihr Gemüth beschäftigt hatten, und Furcht, das Manuscript zu verlieren, ehe sie es gelesen hätte, hatten sie abgehalten zu reden.
Eine solche Verbindung von Umständen konnte, wie sie glaubte, nur durch eine übernatürliche Macht bewirkt worden seyn, die den Schuldigen zur Rache bringen wollte. Diese Betrachtungen erfüllten ihre Seele mit einer schauerlichen Ehrfurcht, welche die Einsamkeit des alten großen Zimmers, worin sie saß, und die Stunde der Nacht bald in Schrecken erhöhten.
Sie war nie abergläubig gewesen, allein so seltsame Umstände waren bisher hier zusammen gekommen, daß sie es nicht für Zufall halten konnte. Ihre Einbildungskraft, durch diese Betrachtungen hinaufgespannt, wurde wieder jedem Eindruck geöffnet; sie fürchtete sich umzusehen, damit sie nicht wieder ein schreckliches Phantom erblickte, und fast wähnte sie, Stimmen in dem Sturme schwellen zu hören, der jetzt das Gebäude erschütterte.
Noch suchte sie ihren Empfindungen zu gebiethen, um nicht die Familie zu beunruhigen, allein sie wurden so peinlich, daß selbst die Furcht vor La Mottens Spott sie kaum abhalten konnte, ihr Zimmer zu verlassen. Ihr Gemüth war jetzt in einer solchen Verfassung, daß sie es unmöglich fand, die Geschichte auszulesen, wiewohl sie um der Qual der Ungewißheit zu entgehen, es versucht hatte. Sie legte es hin, und suchte sich wieder in Fassung zu sänftigen.
»Was habe ich zu fürchten?« sagte sie. »Ich bin wenigstens unschuldig, und werde nicht für das Verbrechen eines andern gestraft werden.«
Ein heftiger Windstoß, der jetzt durch die ganze Reihe von Zimmern fuhr, erschütterte die Thüre, die aus ihrem vorigen Schlafzimmer in die geheimen Zimmer führte, so stark, daß Adeline, nicht vermögend, länger in Ungewißheit zu bleiben, hinzu lief, um zu sehen, woher das Geräusch käme. Der Umhang, welcher die Thüre verbarg, wurde heftig erschüttert, und sie stand einen Augenblick, und betrachtete ihn mit unbeschreiblichem Schrecken, bis sie in dem Glauben, daß der Wind ihn bewegte, sich eine plötzliche Gewalt anthat, ihr Gefühl zu überwinden, und ihn aufzuheben.
In dem nämlichen Augenblick glaubte sie eine Stimme zu hören. Sie stand still, und horchte, aber alles war still, doch überwältigte ihre Angst sie so sehr, daß sie eben so unfähig war, das Zimmer zu untersuchen, als zu verlassen.
Nach wenig Augenblicken kam die Stimme wieder: sie war nunmehr überzeugt, daß sie nicht geirrt hatte, denn so leise sie auch war, hörte sie sie deutlich, und war fast gewiß, daß sie bey Nahmen gerufen ward. Ihre Fantasie war so rege, daß sie es sogar für die nähmliche Stimme hielt, die sie in ihren Träumen gehört hatte. Diese Überzeugung raubte ihr gänzlich ihr bischen Muth und in einen Stuhl sinkend, verlor sie alle Besinnung.
Sie wußte nicht, wie lange sie in diesem Zustande geblieben war, als sie aber wieder erwachte, raffte sie alle Kräfte auf, um die Wendeltreppe zu erreichen, wo sie laut rief. Niemand hörte sie, und sie eilte, so schnell ihre Kraftlosigkeit es zuließ, nach Frau von La Mottens Zimmer. Sie klopfte leise an, und erhielt Antwort von Madame, die in Schrecken gerieth, um eine so ungewöhnliche Stunde aufgeweckt zu werden, und glaubte, daß ihrem Manne eine Gefahr drohte. Als sie hörte, daß es Adeline war, die sich nicht wohl befand, eilte sie ihr schnell zu Hülfe. Das Schrecken, welches noch auf Adelinens Gesicht lag, erregte ihre Neugier, und sie erfuhr den Anlaß.
Madame gerieth durch diese Erzählung so sehr außer Fassung, daß sie La Motten aus seinem Bett rief, der mehr aufgebracht über diese unzeitige Störung, als theilnehmend an der Unruhe, die er vor sich sah, Adeline verwies, daß sie ihre Fantasie so sehr den Meister über ihre Vernunft spielen ließe. Sie erwähnte nun der innern Zimmer, die sie entdeckt hatte, und das Manuscript, Umstände, welche auf einmahl La Mottens Aufmerksamkeit so sehr erregten, daß er das Manuscript zu sehen verlangte, und sich entschloß, unverzüglich in die von ihr beschriebenen Zimmer zu gehen.
Frau von La Motte suchte ihn von seinem Vorsatz abzubringen, allein La Motte, bey dem Widerspruch immer das Gegentheil würkte, und der Adelinen das Lächerliche ihrer Furcht zu zeigen wünschte, beharrte darauf. Er rief Petern, um ihm zu leuchten, und verlangte, daß Frau von La Motte und Adeline ihn begleiten sollten. Madame bat um Entschuldigung, und Adeline erklärte anfangs, daß sie nicht zu gehen vermöchte, beide mußten aber nachgeben.
Sie stiegen den Thurm hinan, und traten mit einander in das erste Zimmer: denn keiner mochte der letzte seyn; im Zweyten war alles still und ruhig. Adeline gab das Manuscript her und zeigte auf den Umhang, der die Thüre verbarg. La Motte hob ihn auf und öffnete die Thüre, allein Madame und Adeline beschworen ihn nicht weiter zu gehen — nochmahls befahl er ihnen zu folgen.
Im ersten Zimmer war alles still; er äußerte seine Verwunderung, daß diese Zimmer so lange unentdeckt geblieben wären, und wollte in das Zweyte gehen, stand aber plötzlich still.
»Wir wollen unsere Untersuchung bis morgen verschieben,« sagte er, »der Dunst in diesen Zimmern ist zwar zu allen Zeiten ungesund, aber zur Nacht doppelt empfindlich. Ich ersticke beynahe. Peter, vergiß nicht, morgen früh die Fenster aufzumachen, damit die Luft durchstreichen kann.«
»Gott behüte, Ihro Gnaden,« sagte Peter, »sehen Sie denn nicht, daß ich nicht hinan reichen kann? Zudem glaube ich nicht daß sie gemacht sind, um geöffnet zu werden: sehen Sie nur die Stärken in eisernen Gitter. Das Zimmer sieht, so wahr ich lebe, einem Gefängniß gleich: ich stelle mir vor, dieß muß der Ort seyn, von dem die Leute sagten, daß keiner wieder herausgekommen sey.«
La Motte, der während dieser Rede die hohen Fenster aufmerksam betrachtete, unterbrach jetzt Peters Geschwätzigkeit, und befahl ihm, voran zu leuchten. Alle verließen willig diese Zimmer, und gingen in das untere, wo ein Feuer angemacht wurde, und sie eine Zeitlang zusammen blieben.
La Motte suchte aus Gründen, die ihm selbst am besten bekannt seyn mußten, Adelinen wegen ihrer Furcht und Entdeckungen aufzuziehen, bis sie ihn endlich mit einem Ernst, der ihn zurückhielt, aufzuhören bat. Er schwieg und bald darauf wagte Adeline, durch die Rückkehr des Tagslichts gestärkt, sich in ihr Zimmer und genoß einige Stunden ungestörten Schlafs.
Den folgenden Tag ließ sie ihre erste Sorge seyn, sich eine Zusammenkunft mit Peter zu verschaffen, den sie zu sehen hoffte, als sie die Treppe herunterging: allein er war nicht sichtbar, und sie ging in das Wohnzimmer, wo sie La Motte, dem Anschein nach, sehr unruhig fand. Adeline fragte ihn, ob er das Manuscript angesehen hätte?
»Ich habe es durchlaufen,« sagte er, »aber es ist durch die Zeit so sehr erloschen, daß man es kaum entziffern kann. Es scheint eine seltsame romanhafte Geschichte zu enthalten, und ich wundere mich nicht, daß Sie nach den schrecklichen Eindrücken, die Sie Ihrer Fantasie davon mittheilen ließen, Geister zu sehen wähnten, und wunderbares Geräusch hörten.«
Adeline glaubte, La Motte fände nicht für gut, sich überzeugen zu lassen und schwieg. Während dem Frühstück sah sie oft Petern (der aufwartete) mit ängstlichem Forschen an, und wurde aus seinen Blicken noch mehr überzeugt, daß er ihr etwas wichtiges mitzutheilen hatte. In Hoffnung mit ihm zu reden, verließ sie das Zimmer so bald als möglich, und ging in ihre gewöhnliche Allee, wo sie noch nicht lange gewesen war, als er erschien.
»Gott behüte Sie, Fräulein, es thut mir leid, daß ich Sie vorige Nacht so erschreckte.«
»Mich erschreckte,« sagte Adeline, »was hatte denn Er dabey zu thun?«
Er sagte ihr nun, als er geglaubt hätte, daß Herr und Frau von La Motte schliefen, hätte er sich an ihr Zimmer geschlichen, um die Erzählung vom Vormittage zu endigen; er hätte sie verschiednemahl so laut er sich getraut, gerufen; da er aber keine Antwort erhalten, gedacht, sie schliefe, oder wollte nicht mit ihm reden, und wäre also fortgegangen.
Diese Nachricht von der vernommenen Stimme erleichterte Adelinen; sie wunderte sich sogar, sie nicht erkannt zu haben, so wenig dieses auch bey der Verstörung ihres Gemüthes zu verwundern war.
Sie bat nunmehr Peter sich bey der Erläuterung der Gefahr, die ihr drohte, kurz zu fassen.
»Wenn Sie mich bey meiner eigenen Weise lassen, gnädiges Fräulein, so werden Sie es bald erfahren, allein wenn Sie mich übereilen, und mich in die Kreuz und Quere fragen, so weiß ich nicht was ich sage.«
»So will ich ihm denn seine Weise lassen; nur vergesse er nicht, daß man uns bemerken kann.«
»Ja, Fräulein, davor fürchte ich mich eben so sehr als Sie: denn ich glaube, ich würde fast eben so übel fahren: doch das thut nichts zur Sache; allein ich weiß, daß es schlimm für Sie aussehen wird, wenn Sie noch eine Nacht in dieser alten Abtey bleiben: denn wie ich zuvor sagte, ich weiß um alles,«
»Um was Peter?«
»Je nun, um diesen Anschlag, der im Werke ist.«
»Was, ist mein Vater —«
»Ihr Vater?« unterbrach Peter. »Das ist alles nur Wind, um Sie in Schrecken zu setzen: weder ihr Vater noch sonst jemand hat nach Ihnen gefragt, ja er weiß so wenig von Ihnen, als der Pabst —«
Adeline sah verdrießlich aus —
»Er spaßt,« sagte sie; »wenn er etwas zu sagen hat, so mache er fort, ich bin eilig.«
»Nun, nun Fräulein, ich meinte es nicht böse: werden Sie nur nicht ungehalten: allein Sie werden doch wohl nicht läugnen, daß Ihr Vater barbarisch ist. Aber, wie ich sagte, der Marquis de Montalt ist in Sie verliebt, und er und mein Herr (Peter sah sich rings um) haben Ihrenthalben die Köpfe zusammengesteckt.« —
Adeline erblaßte — sie begriff einen Theil der Wahrheit, und bat ihn begierig fortzufahren.
»Sie haben die Köpfe zusammen gesteckt. So viel hat Jakob, des Marquis Bedienter, mir gesagt. Peter, sagte er, du weißt wenig was vorgeht. Ich könnte dir alles sagen, wenn ich Lust hätte, allein es schickt sich nicht für die, denen man sich anvertraut, zu plaudern. Dein Herr wird wohl heimlich genug gegen dich seyn. Dieß verdroß mich, und ich wollte ihn sehen lassen, daß man mir so gut was anvertrauen könnte als ihm. Es könnte seyn, sagte ich, daß ich eben so viel wüßte, als du, wenn ich schon nicht damit groß thue — und dazu blinzte ich mit den Augen. So? sagte er, also weißt du Bescheid? Du bist heimlicher als ich gedacht hätte. Sie ist hübsch; sagte er, (er meinte Sie Fräulein) allein im Grunde ist sie doch nur ein armer Fündling; und so hat es nicht viel zu sagen. Ich wollte noch mehr von ihm heraushohlen, sonst hätte ich ihm eins aufs Mittel geben. Indem ich mich stellte, als wüßte ich so viel als er, lockte ich ihm alles aus, und er sagte mir — aber Sie werden ganz blaß, Fräulein, ist Ihnen nicht wohl?«
»Nein, nein,« sagte Adeline mit zitternder Stimme, und kaum im Stande, sich aufrecht zu halten, »fahr er nur fort.«
»Und so sagte er mir, daß der Marquis schon eine ganze Zeit um Sie herum gegangen wäre; allein Sie wollten ihn nicht erhören, und er hätte sogar vorgegeben, er wollte Sie heirathen, und es hälfe alles nichts. Was das Heirathen anbelangt, sagte ich, so wird sie vermuthlich wissen, daß die Marquise noch lebt, und auf andern Fuß wird sie sich nicht einlassen wollen.«
»Die Marquise ist also wirklich noch am Leben?«
»Ja freylich, Fräulein. Das wissen wir alle, und ich dachte, Sie hätten es auch gewußt. — Das werden wir sehen, sagte Jakob, wenigstens glaube ich, daß unser Herr sie überlisten wird. — Ich fuhr auf, ich konnte mir nicht helfen. Ja, ja, sagte er, du weißt, daß dein Herr ausgemacht hat, sie meinem Marquis auszuliefern.«
»Großer Gott, was soll aus mir werden?« rief Adeline.
»Ja Fräulein, ich bin recht Angst um Sie, aber hören Sie mich nur aus. Als Jakob dieses sagte, vergaß ich mich ganz. Ich glaube es nimmermehr, sagte ich, ich kann nimmermehr glauben, daß mein Herr im Stande ist, eine solche Schlechtigkeit zu begehen; er wird sie nicht ausliefern, so wahr ich ein Christ bin. — O sagte Jakob, steht es so! Ich dachte, du wüßtest alles, sonst hätte ich mein Maul gehalten. Doch kannst du dich bald überzeugen, wenn du an der Thüre horchen willst; so habe ichs auch gemacht; sie berathschlagen jetzt darüber.«
»Er braucht mir von diesem Gespräch weiter nichts zu widerhohlen, sage er mir nur, was er an der Thüre hörte.«
»Je nun, Fräulein, als er dieß sagte, nahm ich ihm beym Wort, und ging vor die Thüre, wo ich allerdings meinen Herrn und den Marquis zusammen über Sie sprechen hörte. Sie sagten mancherley, woraus ich nicht klug werden konnte; endlich aber hörte ich den Marquis sagen: Sie wissen die Bedingungen; nur unter diesen Bedingungen will ich versprechen, alles in Vergessenheit zu be — be — begraben, ja das war das Wort. Mein Herr sagt darauf zu dem Marquis, wenn er die und die Nacht, er meinte die künftige, Fräulein, wieder nach der Abtey kommen wollte, so sollte alles nach seinem Wunsch bereit seyn. Adeline soll dann Ihre seyn, gnädiger Herr, Sie wissen ihr Schlafzimmer.«
Bey diesen Worten rang Adeline die Hände, und sah in stummer Verzweiflung gen Himmel. Peter fuhr fort.
»Als ich dieß hörte, konnte ich nicht länger an dem zweifeln, was Jakob gesagt hatte. Nun was denkst du jetzt? sagte er. — Was sonst, als daß mein Herr ein Schurke ist. Nun ich denke, meiner ist auch einer, sagte er, was das anbelangt.« —
Adeline unterbrach ihn und fragte, was er weiter gehört hätte.
»In eben dem Augenblick,« sagte Peter, »hörten wir die gnädige Frau aus der andern Stube kommen, und retirirten uns in die Küche.«
»Sie war also bey diesem Gespräch nicht gegenwärtig?«
»Nein Fräulein, aber ich wette, mein Herr hat ihr alles gesagt.«
Diese anscheinende Treulosigkeit ihrer Freundinn erschütterte Adelinen fast so sehr, als das Verderben, welches ihr drohte. Nachdem sie einige Augenblicke, in äußerster Unruhe nachgedacht hatte, sagte sie zu Peter:
»Er hat ein gutes Herz, Peter, und fühlt einen gerechten Unwillen über seines Herrn Verrätherey. Will er mir zur Flucht behülflich seyn?«
»Ach Fräulein, wie wollte das möglich seyn? Zudem wohin können wir gehen? Ich habe keine Freunde hier herum, so wenig als Sie.«
»O,« antwortete Adeline in äußerster Bewegung, »wir fliehen vor Feinden: Fremde werden uns Freunde seyn; helfe er mir nur aus diesem Walde, und ich will ihm ewig danken, jenseits fürchte ich nichts mehr.«
»Ja, was diesen Wald anbelangt, so bin ich selbst ihn herzlich müde, obschon ich, als wir zuerst hieher kamen, glaubte, es würde sich recht schön darin leben lassen; wenigstens dachte ich, würde es ein anderes Leben seyn, als ich bisher geführt hatte. Allein diese Gespenster, die hier umgehen, — ich bin wohl nicht feigherziger als andere Leute auch, aber sie stehen mir doch nicht an: und dann sagt man so seltsame Dinge von dieser Abtey, und mein Herr — ich dachte sonst, ich würde ihm bis an das Ende der Welt treu dienen, aber jetzt kümmre ich mich nicht, ihn zu verlassen, da er sich gegen Sie so schlecht betragen hat.«
»Er will mir also entfliehen helfen?« sagte Adeline mit Lebhaftigkeit.
»Ja, was das anbelangt, Fräulein, so wollte ich herzlich gern, wenn ich nur wüßte wohin. Zwar habe ich eine Schwester in Steyer, aber das ist weit, und habe auch wohl ein wenig Geld von meinem Lohn über gespart, aber das würde uns nicht weit bringen.«
»Sehe er das nicht an; wenn ich nur erst einmahl aus dem Walde wäre, so wollte ich schon für mich selbst sorgen und ihn für seine Gutheit belohnen.«
»Fräulein, darum ist mirs nicht —«
»Nun wohl Peter, so lasse er uns überlegen, wie wir entkommen können. Diese Nacht, sagte er, diese Nacht will der Marquis wieder kommen?«
»Ja Fräulein, wenn es dunkel wird. Mir fällt so eben was ein. Meines Herrn Pferde grasen im Walde; wir könnten eines davon nehmen, und von der ersten Station zurückschicken: aber wie sollen wir es anfangen, daß man uns nicht sieht? Zudem, wenn wir bey Tage davon gehen, wird er uns bald nachsehen, und uns einhohlen, und wenn Sie bis Nachts warten, so wird der Marquis kommen, und dann ist alles vorbey. Wenn sie uns beyde zugleich vermissen, so werden sie rathen, wie es ist und sich gleich aufmachen. Könnten sie nicht zuerst gehen, und auf mich warten, bis der Lärmen vorüber ist? So könnte ich, während sie nach Ihnen um und um suchen, mich wegschleichen, und mit Ihnen im Sichern seyn, ehe sie daran dächten, uns nachzusetzen.«
Adeline sah ein, daß er Recht hatte, und konnte nicht umhin, sich über seinen Scharfsinn zu wundern. Sie fragte, ob er keinen Ort in der Nähe wüßte, wo sie verborgen bleiben könnte, bis er mit einem Pferde käme.
»Ich wüßte wohl einen Ort, wo Sie sicher genug wären, denn niemand wagt sich in die Nähe: allein es heißt, daß es nicht richtig darin wäre und vielleicht dürften Sie sich scheuen.«
Adeline dachte an die vergangene Nacht und wurde über diese Nachricht etwas betroffen; allein ein Gefühl ihrer gegenwärtigen Gefahr drängte sich wieder herbey, und überwältigte jede andere Furcht.
»Wo ist der Ort,« sagte sie, »wenn er mich verbergen kann, so will ich mich nicht lange besinnen.«
»Es ist ein altes Grab, das in der dicksten Gegend des Waldes steht, auf dem nächsten Wege ungefähr eine kleine Viertelstunde, und auf dem weitesten wohl eine halbe Stunde von hier. Als mein Herr sich noch im Walde zu verstecken pflegte, folgte ich ihm zuweilen dahin, allein das Grab habe ich nicht eher als gestern gefunden. Doch das hilft uns zu nichts; wenn Sie sich dahin wagen wollen, Fräulein, so will ich Ihnen den nächsten Weg zeigen.«
Mit diesen Worten zeigte er auf einen krummen Fußweg zur Rechten. Adeline sah sich rings um, und als sie niemand wahrnahm, bat sie Petern, sie nach dem Grabe zu führen. Sie verfolgte den Weg, bis er sich in eine finstere, romantische, und den Strahlen der Sonne beynahe unzugängliche Gegend verlor, und kamen an die Stelle, wo Louis einmahl seinem Vater nachgespürt hatte.
Die Stille und Feyerlichkeit der Gegend erfüllte Adelinens Herz mit Schauder, sie stand still und überschaute sie eine Zeitlang schweigend. Endlich führte Peter sie in das Innere der Ruinen, wo sie einige Stuffen hinab stiegen.
»Ein alter Abt wurde hier vor langer Zeit begraben; wie ich von des Marquis Leuten gehört habe,« hub Peter an, »und vermuthlich gehörte er zu jener Abtey: allein ich sehe nicht ein, warum er sichs gelüsten läßt, umher zu wandern; er wurde doch sicher nicht ermordet?«
»Ich hoffe nicht,« sagte Adeline.
»Das ist mehr, als man von allen sagen kann, die in der Abtey begraben liegen, und —«
Adeline unterbrach ihn:
»Still, ich höre ein Geräusch; der Himmel behüte uns vor Entdeckung.«
Sie lauschten, aber alles war still und sie gingen weiter. Peter öffnete eine niedrige Thüre und sie traten in einen dunkeln Gang, wo der Weg oft durch Schut und lose Steine erschwert wurde, und sie nöthigte, behutsam zu gehen.
»Wohin kommen wir? fragte Adeline.
»Ich weiß es wirklich selbst nicht,« antwortete Peter, »denn ich war noch nie so weit; aber der Ort scheint sicher genug.«
Plötzlich hemmte ihm etwas den Weg: es war eine Thüre, die seiner Hand wich und eine Art von Zelle zeigte, die man bey dem Schimmer, die durch ein Gitterfenster von oben hinein fiel, dunkel erkannte. Nur auf einen Theil des Platzes fiel ein Strahl, der die größere Hälfte in Schatten ließ.
Adeline seufzte.
»Dieß ist ein fürchterlicher Ort,« sagte sie, »doch wenn er mir Zuflucht gewährt, ist es für mich ein Pallast. Erinnere Er sich Peter, daß meine Ruhe und Ehre von seiner Treue abhängt; sey Er vorsichtig und entschlossen. In der Dämmerung kann ich mich am unbemerktesten von der Abtey schleichen und will Ihn in dieser Zelle erwarten. So bald Herr und Frau von La Motte mit Suchen in den Gewölben beschäftigt sind, bring Er ein Pferd hieher: drey Schläge mit der Peitsche an das Grab sollen das Signal seyn. Ums Himmelswillen sey Er vorsichtig und pünktlich.«
»Das werde ich, Fräulein, es mag auch kommen, was da wolle.«
Sie gingen wieder durch den Wald zurück, und Adeline, die bemerkt zu werden fürchtete, hieß Petern voraus nach der Abtey gehen, und einen Vorwand wegen seiner Abwesenheit aussinnen, wenn man ihn ja vermißt haben sollte.
Sobald sie wieder allein war, ließ sie einem Strom von Thränen Lauf, und hing dem Übermaß ihres Schmerzens nach. Sie sah sich ohne Freunde, ohne Verwandte, verlassen, hülflos und den entsetzlichen übeln Preis gegeben. Verrathen von den Menschen, die sie seit so langer Zeit als ihre Beschützer geliebt, als ihre Ältern geehret hatte! diese Betrachtungen erfüllten ihr Herz mit den bittersten Qualen und das Gefühl ihrer eigenen Gefahr wurde auf eine Zeitlang von dem Schmerz, solche Unwürdigkeit bey andern zu entdecken, verschlungen.
Endlich rief sie alle Stärke auf, lenkte ihre Schritte nach der Abtey und suchte geduldig die Abendstunde zu erwarten, und in Gegenwart des Herrn und der Frau von La Motte einen Schein von Fassung anzunehmen. Für den Augenblick wünschte sie den Anblick von beiden zu vermeiden, weil sie sich nicht getraute, ihre Bewegung zu verbergen, und eilte auf ihr Zimmer, so wie sie die Abtey erreichte. Hier bemühte sie sich ihre Aufmerksamkeit auf gleichgültige Gegenstände zu lenken, aber vergebens: die Gefahr ihrer Lage, die schmerzliche Täuschung in dem Charakter derjenigen, die sie so sehr geschätzt, ja sogar geliebt hatte, beschäftigte ihre Gedanken zu sehr.
Einem edeln Herzen kann nichts empfindlicher seyn, als Treulosigkeit in denjenigen zu entdecken, die unser Vertrauen besassen, selbst, wenn es uns auch keinen ausdrücklichen Nachtheil brächte. Vor allem aber empörte sie das Betragen der Frau von La Motte: die mit solcher Heimlichkeit an ihrem Verderben arbeiten könnte.
»Wie sehr hat meine Einbildungskraft mich getäuscht,« sagte sie, »welch ein Gemählde entwarf sie mir von der Güte der Welt! Und muß ich denn glauben, daß jedermann grausam und betrüglich ist? Nein, möge ich immer getäuscht werden, und immer leiden, ehe ich in einem solchen elenden Zustande des Mißtrauens lebe.«
Sie bemühte sich nun, Frau von La Mottens Betragen bey sich selbst zu entschuldigen, indem sie es der Furcht vor ihrem Manne zuschrieb.
»Sie darf sich ihm nicht entgegen setzen,« sagte sie, »sonst würde sie mich vor meiner Gefahr warnen, und mir helfen, ihr zu entgehen. Nein nimmermehr will ich sie fähig glauben, zu meinem Verderben behülflich zu seyn. Nur Furcht verschließt ihr den Mund.«
Adeline fand einigen Trost in diesem Gedanken. Die Güte ihres Herzens lehrte sie, hier zu sophistisiren. Sie sah nicht, daß sie Frau von La Mottens Schuld höchstens nur milderte, wenn sie ihr Betragen der Furcht zuschrieb; ein zwar etwas weniger niederträchtiger, aber nicht minder selbstsüchtiger Grund.
Sie blieb in ihrem Zimmer, bis sie zu Tisch gerufen wurde, und ging dann mit schwankenden Schritten und klopfendem Herzen herunter. Als sie La Motten sah, zitterte sie, Trotz aller Anstrengung und erblaßte: sie konnte den Mann, der sie dem Verderben bestimmt hatte, unmöglich, auch nur mit anscheinender Gleichgültigkeit ansehen.
Er bemerkte ihre Bewegung und fragte, ob sie sich nicht wohl befände. Sie sah, in welche Gefahr sie sich setzen konnte, und um ihn nicht die wahre Ursache ahnden zu lassen, raffte sie alle Kräfte zusammen und antwortete mit heiterem Gesicht, daß ihr nichts fehlte.
Bey Tisch erhielt sie sich in einer Fassung, welche würklich die mannigfaltige Angst ihres Herzens verbarg. Wenn Sie La Motten ansah, so waren Schrecken und Unwillen ihre herrschenden Gefühle; wenn aber ihr Blick auf seine Frau fiel, so empfand sie andere Regungen. Dankbarkeit für ihre vorige Zärtlichkeit hatte sich bey ihr lange in Zuneigung befestigt und ihr Herz schwoll jetzt von bittern Schmerz und Kränkung.
Frau von La Motte schien niedergeschlagen und sagte wenig. La Motte schien durch eine erzwungene Lustigkeit Gedanken zuvorkommen zu wollen: er lachte und sprach, und schüttete ganze Humpen Wein hinunter: es war die Lustigkeit der Verzweiflung. Seine Frau gerieth in Unruhe, und wollte ihm Einhalt thun, allein er beharrte bey seinen Bachusopfern, bis alle Besinnung ihn zu verlassen schien.
Frau von La Motte fürchtete, daß er in diesem Zustande sich verrathen möchte, und ging mit Adelinen in ein anderes Zimmer. Adeline erinnerte sich der glücklichen Stunden, die sie einst mit ihr zubrachte, als noch Vertrauen alle Zurückhaltung verbannte und Sympathie und Achtung, Gesinnungen der Freundschaft einflößten. Diese Stunden waren auf immer dahin; sie konnte der Frau von La Motte ihren Kummer nicht länger mittheilen, ja sie nicht länger mehr achten.
Doch war bey aller Gefahr, worein ihr sträfliches Schweigen sie gesetzt hatte, es ihr nicht möglich, mit ihr zu reden, da sie wußte, daß es das letztemahl war, ohne einen Grad von Schmerz zu empfinden, den Weisheit Schwäche nennen, Guthmüthigkeit aber mit einem sanftern Nahmen ehren wird.
Frau von La Motte schien beynahe einem gleichen Gefühl zu unterliegen: ihre Gedanken waren von dem Gegenstand des Gesprächs abwesend, und es herrschte oft eine lange Stille. Sie heftete oftmahls verstohlene Blicke der Zärtlichkeit auf Adelinen, und ihre Augen füllten sich mit Thränen. Adeline wurde hierdurch so sehr bewegt, daß sie verschiedenemal im Begriff war, sich ihr zu Füssen zu werfen und Mitleid und Schutz von ihr zu erflehen. Kältere Überlegung zeigte ihr, wie gefährlich und unbesonnen ein solches Betragen seyn würde: sie unterdrückte ihre Bewegung, fand sich aber endlich genöthigt, sich aus Frau von La Mottens Gegenwart zu entfernen.
Adeline wartete ängstlich vor ihrem Kammerfenster ab, bis die Sonne hinter den fernen Hügeln verschwand, und die Zeit ihrer Abreise nahe kam: sie ging mit ungewöhnlichem Glanze unter, und warf einen feurigen Schein über die Wälder und auf einige zertrümmerte Ruinen, die sie nicht mit Gleichgültigkeit ansehen konnte.
»Nimmer,« sagte sie, »nimmer werde ich die Sonne unter diesen Hügeln wieder versinken, oder diese Gegend erleuchten sehen! Wo werde ich seyn, wann sie wieder untergeht? vielleicht im Elende versunken? — Noch wenig Stunden und der Marquis wird kommen, wenig Stunden und diese Abtey wird sich in eine Scene des Aufruhrs und der Verwirrung verwandeln; jedes Auge nach mir forschen, jeder Winkel ausgespäht werden.«
Diese Betrachtungen flößten ihr neuen Schrecken ein, und verstärkten ihre Ungeduld, sich zu entfernen.
Nach und nach kam die Dämmerung heran, und sie glaubte es nun dunkel genug, sich herauszuwagen; ehe sie aber ging, kniete sie nieder, und betete zum Himmel. Sie flehte um Schutz und Stärkung, und gab sich dem Gott der Barmherzigkeit hin.
Dann verließ sie ihr Zimmer, und ging mit behutsamen Schritten die Treppe hinab. Niemand ließ sich sehen, und sie ging durch die Thüre des Thurms in den Wald. Sie sah sich rings umher: die Dunkelheit des Abends hüllte alle Gegenstände ein.
Mit klopfendem Herzen suchte sie den Weg, den Peter ihr gezeigt hatte, und ging furchtsam und verlassen darauf fort. Oft fuhr sie zusammen, wenn der Wind das lose Laub schüttelte, oder die Fledermaus durch die Dämmerung schwirrte, und noch öfter glaubte sie im Zurücksehen nach der Abtey Gestalten von Menschen durch die immer dichter werdende Finsterniß zu erkennen.
Nachdem sie eine Weile fortgegangen war, hörte sie plötzlich Pferde trampeln, und kurz darauf den Laut von Stimmen, worunter sie bald den Marquis erkannte, sie schienen aus der Gegend zu kommen, der sie zuging, und drangen immer näher. Schrecken hielt einige Minuten über ihre Schritte gefesselt; sie stand in ängstlicher Unentschlossenheit — weiter zu gehen; hieß dem Marquis in die Hände laufen; umkehren, sich in La Mottens Gewalt liefern.
Nachdem sie eine Weile unschlüssig gewesen war, wohin sie fliehen sollte, nahmen plötzlich die Töne eine andere Richtung, und die Gesellschaft trabte auf die Abtey zu. Adelinens Schrecken verschwand nun auf kurze Zeit. Sie sah jetzt, daß der Marquis nur auf seinem Wege nach der Abtey hier vorbey gekommen war, und eilte, sich in den Ruinen zu verstecken.
Endlich mit vieler Mühe fand sie sich dahin: denn die tiefen Schatten verbargen sie beynahe vor ihrem Suchen. Sie stand beym Eingange still, geschreckt durch die Feyerlichkeit, die von innen herrschte, und durch die gänzliche Dunkelheit des Orts; endlich beschloß sie, außen zu warten, bis Peter käme.
»Wenn Leute kommen,« sagte sie, »so kann ich sie hören, ehe sie mich sehen, und mich dann in der Zelle verbergen.«
In zitternder Erwartung lehnte sie sich an die Trümmer des Grabes und kein Laut brach das Schweigen der Stunde. Die Crisis ihres Schicksals hing an diesem Augenblick.
»Jetzt,« dachte sie, »hat man meine Flucht entdeckt; jetzt sucht man mich in jedem Winkel der Abtey. Ich höre ihre schrecklichen Stimmen mich rufen; ich sehe ihre feurigen Blicke!«
Die Macht der Einbildungskraft überwältigte sie beynahe; auf einmahl sah sie in einiger Ferne Lichter sich bewegen: oft schimmerten sie zwischen den Bäumen; oft verschwanden sie gänzlich.
Sie schienen in gleicher Richtung mit der Abtey zu seyn, und sie besann sich nun, diesen Morgen durch eine Öffnung des Waldes einen Theil des Gebäudes gesehen zu haben. Sie zweifelte also nicht, daß diese Lichter von Leuten kämen, welche sie suchten, und, wie sie fürchtete, ihren Weg nach dem Grabe nehmen könnten, wenn sie in der Abtey sie nirgends fänden. Ihre Zuflucht schien ihr nun ihren Feinden zu nahe, um sicher zu seyn, und sie wäre gern in eine entlegnere Gegend des Waldes geflohen, hätte sie sich nicht besonnen, daß Peter sie nicht würde zu finden wissen.
Während diese Gedanken durch ihre Seele fuhren, hörte sie ferne Stimmen im Winde, und eilte, sich in der Zelle zu verbergen, als sie die Lichter plötzlich verschwinden sah. Alles war wieder in Dunkelheit und Schweigen gehüllt, doch bemühte sie sich, den Weg nach der Zelle zu finden. Sie besann sich auf die Lage der äußern Thüre und des Ganges und erreichte glücklich die Thüre der Zelle. Es war stockfinster darin; sie zitterte heftig, ging aber doch hinein, und nachdem sie an den Wänden herumgetappt hatte, setzte sie sich endlich auf einen hervorragenden Stein.
Hier wandte sie sich wieder zum Himmel und suchte ihre Lebenskraft anzufeuern, bis Peter käme. Über eine halbe Stunde verstrich in dieser finstern Höhle, und kein Laut verkündigte seine Annäherung. Ihre Lebensgeister erlagen, sie fürchtete, ein Theil ihres Plans möchte entdeckt oder vereitelt seyn, und La Motte ihn zurückhalten. Diese Überzeugung wirkte zu Zeiten so stark auf ihre Furcht, daß sie einen Drang fühlte, die Zelle allein zu verlassen, und in der Flucht das einzige Rettungsmittel zu suchen.
Während dieser Vorsatz in ihrer Seele schwebte, vernahm sie von oben den Schall eines Pferdehufs. Das Geräusch kam näher, und hielt endlich bey dem Grabe an. Gleich darauf vernahm sie drey Peitschenschläge; ihr Herz klopfte, und einige Augenblicke war sie in so großer Bewegung, daß sie keinen Schritt thun konnte, um die Zelle zu verlassen.
Die Schläge wurden wiederholt; sie rafte ihren Muth auf, ging hervor und rief: »Peter!« denn die Finsterniß ließ ihr nicht zu, weder Mann noch Pferd zu unterscheiden. Sie erhielt schnell zur Antwort:
»Still Fräulein, unsere Stimmen werden uns verrathen.«
Sie stiegen auf und ritten so schnell davon, als die Dunkelheit es zuließ. Adelinens Herz lebte bey jedem Schritte, den sie weiter kamen, auf. Sie fragte, wie es auf der Abtey abgelaufen, und wie er fortgekommen wäre?
»Sprechen Sie leise, Fräulein, Sie sollen alles erfahren; jetzt nur still!«
Kaum hatte er dieß gesagt, als sie Lichter in der Ferne sahen; und da sie jetzt an eine offne Stelle des Waldes kamen, setzte er das Pferd in Gallop und jagte fort, bis es nicht länger konnte. Sie sahen sich um, und da sie keine Lichter wahrnahmen, ließ Adelinens Schrecken nach.
Sie fragte wieder, was auf der Abtey vorgegangen sey, und wie bald man ihre Flucht entdeckt hätte?
»Er kann ohne Furcht reden?« sagte sie, »ich hoffe, wir sind jetzt vor ihnen sicher.«
»Nun Fräulein, Sie waren noch nicht lange fort, als der Marquis kam, und Herr von La Motte entdeckte, daß Sie entwischt wären. Hierauf entstand ein großer Aufruhr, und er sprach viel mit dem Marquis.«
»Rede Er doch lauter, ich kann Ihn nicht verstehen.«
»Das will ich Fräulein! —«
»Himmel, was ist das für eine Stimme! Dieß ist nicht Peter. Um Gotteswillen, wer seyd Ihr, und wohin werde ich gebracht?«
»Das werden Sie bald genug erfahren, junges Fräulein,« antwortete der Fremde, denn es war würklich nicht Peter, »ich bringe Sie dahin, wo mein Herr befiehlt.«
Adeline, die nun nicht länger zweifelte, daß es ein Bedienter des Marquis sey, versuchte herunter zu springen; allein der Mensch stieg ab, und band sie ans Pferd. Ein schwacher Strahl von Hoffnung dämmerte endlich in ihr auf: sie bemühte sich, ihn zum Mitleid zu bewegen, und sprach mit aller Beredsamkeit des Schmerzes: aber er verstand seinen Vortheil zu gut, um nur einen Augenblick dem Mitleid Gehör zu geben, welches, trotz seiner selbst, ihr kunstloses Flehen in ihm erregte. —
Sie gab sich nun der Verzweiflung hin, und unterwarf sich in leidendem Stillschweigen ihrem Schicksal. Auf diese Art setzten sie ihre Reise fort, bis ein Regensturm, von Blitz und Donner begleitet, sie unter den Schutz dichter Bäume trieb. Der Mensch hielt das für eine sichere Lage, und Adeline war jetzt zu unbekümmert um ihr Leben, um ihm seinen Irrthum zu sagen.
Der Sturm war heftig und hielt lange an; sobald er sich aber legte, sprengten sie in vollem Gallop davon, und nachdem sie wohl zwey Stunden zurückgelegt hatten, kamen sie an die Gränze des Waldes, und bald nachher an eine hohe, einsame Mauer, die Adeline nur eben beym Mondlicht unterschied, welches jetzt durch die sich zertheilenden Wolken schimmerte.
Hier hielten sie still: der Mensch stieg ab, und nachdem er eine kleine Thüre in der Mauer geöffnet hatte, band er Adelinen los, die einen unwillkührlichen und unnützen Schrey that, als er sie vom Pferde herunter hob. Die Thüre stieß auf einen schmalen Gang, schwach erleuchtet von einer Lampe, die am andern Ende hing. Er führte sie weiter: sie kamen zu einer andern Thüre und traten nun in einen großen prächtigen Saal, der hell erleuchtet und im feinsten Geschmack verziert war.
Die Wände waren in Fresco, mit Ovidischen Scenen gemahlt, und mit aufgezogener reich mit Franzen besetzter Seide behangen. Die Sofas waren von gleicher Seide. Aus dem Plafond, der eine Scene aus Tassos Armide vorstellte, stieg ein silberner Kronleuchter herab, und verbreitete eine Flamme von Licht, die aus großen Spiegeln zurückstrahlte, und den ganzen Saal erhellte. Büsten von Horaz, Ovid, Anacreon, Tibull und andern Dichtern schmückten die Ecken, und Blumen aus prächtigen Vasen hervorragend; hauchten die köstlichsten Wohlgerüche aus.
In der Mitte des Zimmers stand ein kleiner Tisch; mit Früchten, Eis und Getränken besetzt. Niemand erschien — das Ganze schien das Werk der Bezauberung und glich mehr dem Pallast einer Fee, als einer Wohnung von menschlichem Bau.
Adeline fragte voll Erstaunen den Mann, wo sie wäre, allein er weigerte sich ihr zu antworten, und nachdem er sie gebethen hatte, einige Erfrischungen zu nehmen, verließ er sie. Sie ging ans Fenster, wo ein Mondstrahl ihr einen großen Garten entdeckte, in welchem Lustwäldchen und Rasenplätze und Wasser das im Mondenlichte glänzte, eine mannigfache, romantisch schöne Scene bildete.
»Was kann dieß bedeuten?« fragte sie sich. »Ist dieß ein Zauber, mich ins Verderben zu locken?«
Sie bemühte sich, in der Hoffnung, zu entwischen, die Fenster zu öffnen, allein sie waren alle befestigt: sie versuchte es bey den Thüren; auch diese waren verwahrt.
Da sie sah, daß alle Möglichkeit zu entkommen, vergebens war, blieb sie eine Zeitlang in Kummer und Nachdenken versunken; wurde aber bald durch die Töne einer sanften Musik erweckt, die so süße, zauberische Melodien hauchte, daß der Schmerz wich, und die Seele zu Zärtlichkeit und süssem Gefühl erweckt ward. Adeline lauschte voll Erstaunen und fühlte sich unmerklich gesänftigt und angezogen; eine süsse Schwermuth schlich sich in ihr Herz und überwand jedes herbere Gefühl: allein so wie die Harmonie aufhörte, verschwand der Zauber und das Bewustseyn ihrer Lage kehrte wieder.
Aufs neue ertönte die Musik, und aufs neue gab sie ihrer süssen Magie nach. Eine weibliche Stimme, von einer Flöte und einigen andern Instrumenten begleitet, schwoll nach und nach zu einer so hinreißenden Höhe, daß die Aufmerksamkeit in Entzücken stieg. Allmählig sank sie wieder und berührte einige einfache Töne mit rührender Sanftheit, als plötzlich das Tonmaß sich veränderte, und eine leichte, lebhafte Arie angestimmt ward.
Die Musik hörte auf, aber die Melodie schwebte noch immer vor ihrer Fantasie und sie versank in die süsse Erwartung, die sie ihr eingehaucht hatte, als die Thüre sich öffnete, und der Marquis de Montalt herein trat. Er näherte sich dem Sofa, wo Adeline saß und redete sie an — allein sie hörte seine Stimme nicht; sie war in Ohnmacht gesunken. Er bemühte sich, sie wieder zu sich selbst zu bringen, und es gelang ihm endlich; so wie sie aber die Augen aufschloß, und ihn vor sich sah, fiel sie aufs neue in Fühllosigkeit zurück, und da er vergebens allerley Mittel bey ihr versucht hatte, sah er sich genöthigt, Hülfe zu rufen.
Zwey junge Mädchen kamen herein, und so bald sie wieder Leben bekam, ging er hinaus, um sie auf seinen Empfang vorbereiten zu lassen. Sobald Adeline sah, daß der Marquis fort war, und sie sich unter der Sorge von Frauenzimmern befand, kehrten ihre Lebensgeister schnell wieder; sie sah ihre Gesellschafterinnen an und erstaunte, sie so schön und elegant zu finden.
Sie machte einen Versuch, sie zum Mitleid zu bewegen, allein sie schienen völlig unempfindlich gegen ihren Schmerz zu seyn, und ergossen sich in hohe Lobpreisungen des Marquis. Sie versicherten, es würde ihre eigene Schuld seyn, wenn sie nicht glücklich wäre, und riethen ihr, sich in seiner Gegenwart so zu stellen.
Mit äusserster Mühe überwand sich Adeline, den Unwillen auszudrücken, der auf ihre Lippen stieg, und ihren Reden schweigend zuzuhören: allein sie sah, wie unangenehm und fruchtlos hier Widerstand seyn müßte, und bekämpfte ihr Gefühl.
Sie fuhren noch in ihren Lobeserhebungen des Marquis fort, als er selbst erschien und ihnen mit der Hand winkte, das Zimmer zu verlassen. Adeline sah ihn mit einer Art von stummer Verzweiflung an, indeß er zu ihr trat, und ihre Hand ergriff, die sie eilends zurückzog, sich von ihm abwandte und in einen Strom von Thränen ausbrach.
Er schwieg eine Weile und schien gerührt durch ihren Schmerz, bald aber näherte er sich wieder, redete sie mit sanfter Stimme an, und bat sie um Verzeihung wegen eines Schrittes, wozu Verzweiflung und was er Liebe nannte, ihn bewogen hätten. Sie war zu versenkt in Schmerz, um ihm zu antworten, bis er um eine Erwiederung seiner Liebe flehte, und nun Kummer dem Unwillen Platz machte und ihr Kraft gab, ihm seyn Betragen vorzuwerfen.
Er schützte vor, daß er sie lange geliebt und auf anständigen Fuß um sie geworben hätte, und wollte seinen Antrag wiederholen, als er die Augen auf Adelinen richtete, und in ihren Mienen die Verachtung las, welche zu verdienen er sich bewußt war. Auf einen Augenblick gerieth er in Verwirrung und schien zu merken, daß sowohl sein Plan entdeckt, als seine Person verachtet war: bald aber gewann er seine gewöhnliche Herrschaft über seine Züge wieder, drang aufs neue in sie, und bat um Liebe.
Ein kleines Nachdenken zeigte Adelinen, wie gefährlich es sey, seinen Stolz durch eine Erklärung der Verachtung, welche sein Heiratsantrag ihr einflößte, zu reizen; und sie hielt es nicht für unwürdig, bey einer Gelegenheit, wo die Ehre und Ruhe ihres Lebens auf dem Spiele stand, sich der Verstellung zu bedienen. Sie sah ein, daß ihre einzige Möglichkeit, seinem Vorhaben zu entgehen, in Verzögerung desselben bestand, und wünschte also, ihn bey dem Glauben zu lassen, das sie von dem Leben der Marquise und der Betrüglichkeit seiner Anträge nichts wüßte.
Er bemerkte ihr Schweigen; und aus Begierde es zu seinem Vortheil zu deuten, erneuerte er seinen Antrag mit verstärktem Feuer.
»Der morgende Tag soll uns vereinigen, liebenswürdige Adeline; morgen müssen Sie einwilligen, Marquise de Montalt zu werden. Dann werden Sie meine Liebe erwiedern, und —«
»Zuvor müssen Sie meine Achtung verdienen, gnädiger Herr.«
»Ich will es, ich verdiene sie. Sind Sie nicht in meiner Gewalt, und enthalte ich mich nicht, einen Vortheil aus Ihrer Lage zu ziehen? Mache ich Ihnen nicht die anständigsten Anträge?«
Adeline schauderte.
»Wenn Sie meine Achtung wünschen, gnädiger Herr, so suchen Sie zuvor mich vergessen zu machen, durch was für Mittel ich in Ihre Hände kam; und wenn Ihre Absichten würklich anständig sind, so beweisen Sie es dadurch, daß Sie mich meines Verhaftes entlassen.«
»Können Sie, süsses Mädchen, vor dem zu fliehen wünschen, der Sie anbetet?« erwiederte der Marquis mit studirter Zärtlichkeit. »Warum wollen Sie einen so harten Beweis meiner Uneigennützigkeit fodern, der nicht mit Liebe bestehen kann. Nein, reizende Adeline, lassen Sie mich wenigstens das Vergnügen genießen, Sie zu sehen, bis die Weihe der Kirche jedes Hinderniß meiner Liebe aus dem Wege räumt. Morgen —«
Adeline sah die Gefahr, in welcher sie schwebte, und unterbrach ihn.
» Verdienen Sie meine Achtung, gnädiger Herr, und Sie werden sie erhalten; als den ersten Schritt dazu befreyen Sie mich aus einer Verhaftung, die mich zwingt, Sie nur mit Schrecken und Widerwillen anzusehen. Wie kann ich Ihnen Betheurungen von Liebe glauben, so lange Sie zeigen, daß Ihnen nichts an meiner Zufriedenheit liegt?«
So ließ Adeline, der bisher die Künste und Ausübung der Verstellung gleich unbekannt waren, sich dazu herab, um ihren Unwillen und Verachtung zu verbergen. Allein obschon sie diese Künste nur zu dem Zwecke der Selbsterhaltung gebrauchte, bediente sie sich ihrer doch mit Widerstreben und fast mit Abscheu; ihre Seele war in Gedanken, Worten und Handlungen mit der Liebe der Tugend erfüllt, und ungeachtet der unwidersprechlichen Güte ihres Zwecks, glaubte sie doch kaum die Mittel entschuldigen zu können.
Der Marquis beharrte auf seiner Sophisterey.
»Können Sie an der Wahrheit einer Liebe zweifeln, die, um Sie zu gewinnen, selbst Ihrem Unwillen sich auszusetzen, nicht scheute? Aber habe ich nicht selbst bey dem Betragen, welches Sie verdammen, Ihr Glück zu Rathe gezogen? Ich habe Sie von einsamen und öden Trümmern nach einer fröhlichen, prächtigen Villa gebracht, wo jeder Genuß Ihnen zu Gebote steht, und wo alles Ihren Wünschen gehorchen soll.«
»Mein erster Wunsch ist von hier zu gehen; ich bitte, ich beschwöre Sie, gnädiger Herr, mich nicht länger zu halten. Ich bin eine freundlose, arme Waise, mancherley Übeln ausgesetzt, und wie ich fürchte, dem Unglück Preis gegeben. Ich möchte nicht gern unartig seyn, allein erlauben Sie mir zu sagen, daß kein Elend dasjenige übersteigen kann, was ich hier fühle, oder eigentlicher allenthalben, wo ich mit Ihren Anträgen verfolgt werde.«
Adeline hatte jetzt ihre Politik vergessen. Thränen verhinderten sie, weiter zu reden, und sie wandte das Gesicht ab, um ihre Bewegung zu verbergen.
»Beym Himmel o Adeline! Sie thun mir Unrecht,« sagte der Marquis, indem er ihre Hand ergriff. »Ich liebe, ich bete Sie an, und doch zweifeln Sie an meiner Leidenschaft, und sind unempfindlich gegen meine Gelübde. Alles Vergnügen, was nur in diesen Mauern genossen werden kann, sollen Sie genießen; allein ihren Bezirk dürfen Sie nicht verlassen.«
Sie machte ihre Hand los, und ging in schweigender Angst nach einem fernen Ende des Saals: tiefe Seufzer quollen aus ihrem Herzen und beynahe kraftlos lehnte sie sich an ein Fenster, um nicht umzusinken.
Der Marquis folgte ihr:
»Warum weigern Sie sich so hartnäckig, glücklich zu seyn?Erinnern Sie sich, welchen Vorschlag ich Ihnen gemacht habe, und nehmen Sie ihn an, so lange es in Ihrer Macht ist. Morgen soll ein Priester unsere Hände vereinigen. — Gewiß, da Sie jetzt so ganz in meiner Macht sind, muß es Ihr Vortheil seyn, hierein zu willigen.«
Adeline konnte nur durch Thränen antworten: sie verzweifelte, sein Herz zum Mitleid zu erweichen, und fürchtete, durch Verachtung ihn aufzubringen. Er führte sie nunmehr, und sie ließ sich führen, zu einem Sitz neben dem Tische, und bat sie, einige Erfrischungen, besonders Liqueur anzunehmen, wovon er selbst reichlich trank. Adeline nahm nur einen Pfirsich.
Und nun nahm der Marquis, der ihr Stillschweigen als eine geheime Einwilligung deutete, alle seine Munterkeit und Feuer wieder an, und die langen, heißen Blicke, die er auf Adelinen heftete, erfüllten sie mit Verwirrung und Unwillen. Mitten bey der Mahlzeit ließ aufs neue eine sanfte Musik die zärtlichsten, leidenschaftlichsten Arien hören; allein ihre Wirkung war jetzt bey Adelinen verloren: ihre Seele war durch die Gegenwart des Marquis zu sehr niedergedrückt, um der süssen Eindrücke der Harmonie empfänglich zu seyn.
Ein Lied wurde gesungen, das mit der ohnmächtigen Kunst gedichtet war, wodurch gewisse wollüstige Dichter die Grundsätze des Lasters zugleich zu verbergen und zu empfehlen glauben. Adeline hörte es mit Verachtung und Mißfallen an, und der Marquis, da er diese Wirkung merkte, gab sogleich ein Zeichen, ein anderes anzustimmen, worin die Macht der Poesie mit dem Zauber der Musik vereint, ihre Seele von der gegenwärtigen Scene abziehen, und sie in süsses Vergessen einwiegen könnte.
Als die Stimme, die es sang, aufhörte, ertönte eine zärtlich klagende Melodie mit höchstem Ausdruck gespielt, aus einer fernen Flöte. Die Töne schwirrten in sanften Schwingungen durch die Luft, schwollen bald zu voller, eingreifender Melodie, und erstarben dann schwach: plötzlich stiegen sie und bebten in so zärtlich süssem Tone, daß Adeline in Thränen und der Marquis in Ausrufungen des Entzückens ausbrach. Er schlang seinen Arm um sie, und wollte sie an sich drücken, allein sie wand sich aus seiner Umarmung los, und schreckte durch einen Blick, worin die feste Würde der Tugend durch Schmerz gemildert war, ihn in Ehrfurcht.
Eine Übermacht fühlend, die er anzuerkennen sich schämte, und sich bestrebend, die Gewalt zu verachten, der er nicht widerstehen konnte, stand er einen Augenblick da, der Sclave der Tugend, wiewohl der Bekenner des Lasters. Bald aber gewann er seine Zuversichtlichkeit wieder, und redete aufs neue von Liebe, als Adeline, nicht länger durch den Muth, den sie zuvor bewies, belebt, und unter der Erwartung, welche die mancherley und heftigen Erschütterungen ihrer Seele erregten, beynahe erliegend, ihn anflehte, sie zur Ruhe zu lassen.
Die Blässe ihres Gesichtes und ihre bebende Stimme waren zu ausdrucksvoll, um verkannt zu werden: und der Marquis zog mit der Warnung, daß sie an Morgen sich erinnern möchte, sich ungern zurück.
Sobald sie sich allein sah, gab sie der brechenden Angst ihres Herzens nach, und war so ganz versenkt in Schmerz, daß es einige Zeit dauerte, ehe sie gewahr ward, daß sie sich in der Gegenwart der zwey jungen Mädchen befand, die zuvor bey ihr gewesen, und kurz darauf, als der Marquis den Saal verließ, wieder hereingekommen waren: sie erschienen, um sie in ihr Schlafzimmer zu führen.
Eine Zeitlang folgte sie ihnen schweigend, bis sie, von Verzweiflung getrieben, aufs neue ihr Mitleid zu erwecken suchte: allein wiederum wurde das Lob des Marquis wiederholt, und da sie sah, daß alle Versuche, sie zu gewinnen, vergebens waren, schickte sie sie fort. Sie verriegelte die Thüre, durch welche sie hinausgingen, und besah dann in der schwachen Hoffnung, eine Möglichkeit zur Flucht zu entdecken, das Zimmer.
Die feenmäßige Pracht, womit es ausgeschmückt war, und die üppige Bequemlichkeit, schienen bestimmt zu seyn, die Einbildungskraft zu blenden und das Herz zu verführen. Es war mit strohfarbner Seide behangen, mit einer Menge von Landschaften und historischen Gemählden verziert, deren Inhalt den wollüstigen Geist des Eigenthümers verrieth: auf dem Kaminstück, von Parischem Marmor, ruhten verschiedene antike Figuren. Das Bett war von Seide, gleicher Farbe mit den Tapeten, reich mit Purpur und silbernen Franzen besetzt, und oben in Form eines Thronhimmels. Die Stuffen, welche vorn angebracht waren, um hinein zu steigen, wurden von kleinen Cupidos, dem Ansehen nach von gediegnen Silber, getragen. Vasen, mit Wohlgerüchen angefüllt, standen in verschiednen Ecken auf Gestellen von eben der Form wie der Nachttisch, der äußerst prächtig und mit allen Zubehörden zum Putz geschmückt war.
Adeline warf einen flüchtigen Blick auf alle diese Pracht, und schritt zur Untersuchung der Fenster, die bis zum Fußboden herabgingen, und sich in Balcons nach den Garten, den sie vom Saale ab gesehen hatte, öffneten. Sie waren befestigt, und da sie alles Bemühen, sie aufzumachen, fruchtlos fand, stand sie endlich von dem Versuch ab.
Eine Nebenthüre erregte ihre Aufmerksamkeit; sie fand sie nicht verschlossen, und öffnete ein Ankleidekabinet, in welches sie durch einige Stuffen hinabging; sie sah zwey Fenster, und eilte darauf zu: das eine wollte nicht nachgeben, aber, o Freude! das andere wich ihrer Hand.
Im Entzücken des Augenblicks vergaß sie, daß seine Höhe von der Erde ihre Flucht dennoch verwehren könnte. Sie ging zurück, um die Thüre des Kabinets zu verriegeln, welches unnöthig war, da sie die Thüre des Zimmers bereits verwahrt hatte.
Sie sah nun aus dem Fenster: der Garten lag vor ihr, und sie fand, daß das Fenster, welches ebenfalls bis auf dem Fußboden stieß, der Erde so nahe lag, daß sie ohne Gefahr den Sprung wagen konnte. Fast in dem nähmlichen Augenblick sprang sie hinab und befand sich in einem großen Garten, dessen Anlage mehr einem englischen Luftort, als einer Reihe französischer Felder glich.
Sie zweifelte nunmehr nicht, entweder durch irgend eine lockere Stelle der Hecke, oder einen niedrigen Ort der Mauer entwischen zu können; leichten Fußes trippelte sie fort; denn Hoffnung spielte um ihr Herz. Die Wolken des Sturms waren verschwunden, und das Mondlicht, das auf dem Rasen hinlief und durch die Blumensträuche schimmerte, die noch schwer von Regentropfen waren, ließ sie einen fernen Blick auf die umliegende Gegend werfen.
Sie folgte der Richtung der hohen Mauer, die an das Schloß gränzte, bis ein dickes Gebüsch, sie ihr entzog. Es war mit Zweigen so sehr verflochten, und von der Finsterniß so verdunkelt, daß sie sich fürchtete, hinein zu gehen und seitwärts einen Weg zur rechten einschlug, der sie an den Rand eines mit hohen Bäumen überhangenen Teiches führte.
Die Mondstrahlen hüpften auf dem Wasser, dessen sanfte Wellen längs dem Ufer spielten, und die stille Schönheit dieses Anblicks würde ein minder geängstigtes Herz entzückt haben. Sie seufzte, und ging mit einem flüchtigen Blick schnell vorüber, um die Gartenmauer wieder zu suchen, von der sie weit abgekommen war.
Nachdem sie lange durch Alleen und Beete geirrt war, ohne etwas einer Gränze ähnliches zu sehen, befand sie sich wieder an dem See, und ging nun mit dem Schritt der Verzweiflung an seinem Ufer hin — Thränen liefen ihr die Wangen hinab. Die Gegend rings um sie zeigte nur Bilder des Friedens und Vergnügens: alle Gegenstände schienen zu ruhen; kein Lüftchen wehte in den Blättern, kein Laut schlich sich durch die Luft; nur in ihrer Brust herrschten Aufruhr und Kummer.
Sie folgte der Krümmung des Ufers nach, bis eine Öffnung im Walde sie eine lehne Anhöhe hinauf führte: der Weg wand sich an einem Hügel hin, wo die Dunkelheit so tief war, daß sie ihn nur mit Mühe finden konnte; plötzlich aber öffnete sich der Eingang in ein hohes Lustwäldchen und sie sah in einer Entfernung ein Licht aus einer Ecke schimmern.
Sie stand still und ihr erster Gedanke war, zurückzugehen, da sie aber lauschte und nichts vernahm, dämmerte eine schwache Hoffnung in ihr auf, daß sie die Person, zu der das Licht gehörte, vielleicht zur Begünstigung ihrer Flucht gewinnen könnte. Sie nahte sich mit zitternden behutsamen Schritten dem Lichte, um heimlich die Person betrachten zu können, ehe sie sich zu ihr wagte.
Ihre Bewegung stieg, so wie sie näher kam; und nachdem sie die Laube erreicht hatte, sah sie durch ein offnes Fenster den Marquis auf einem Sopha liegen, neben welchem ein mit Früchten und Wein besetzter Tisch stand. Er war allein, und sein Gesicht flammte.
Während sie vom Schrecken versteinert da stand, sah er nach dem Fenster auf: das Licht schien ihr hell ins Gesicht, allein sie blieb nicht, um zu sehen, ob er sie bemerkt hatte, sondern lief mit der Schnelligkeit des Blitzes fort, ohne zu wissen, ob man sie verfolgte.
Nachdem sie eine weite Strecke gelaufen war, mußte sie endlich aus Mattigkeit stehen bleiben, und halb ohnmächtig von Furcht und Müdigkeit warf sie sich an die Erde. Sie wußte, daß der Marquis, wenn er ihre Flucht entdeckte, aller Wahrscheinlichkeit nach die Gränzen überschreiten würde, worin er sich bisher gehalten hatte, und daß sie das ärgste erwarten mußte. Ihr Herz klopfte so stark, daß sie mit Mühe athmete.
Sie wartete und horchte in zitternder Angst, aber keine menschliche Gestalt traf ihr Auge, kein Laut ihr Ohr — in diesem Zustande blieb sie eine lange Zeit. Sie weinte, und die Thränen, die sie vergoß, erleichterten ihr gepreßtes Herz.
»O mein Vater,« sagte sie, »warum verliessest du dein Kind? Wann du die Gefahren wüßtest, welchen du es ausgesetzt hast, o gewiß, du würdest Mitleid haben, und mir zu Hülfe eilen. Ach, soll ich nie einen Freund finden — bin ich bestimmt zu vertrauen und betrogen zu werden? — Auch Peter konnte verrätherisch seyn.«
Sie weinte aufs neue und erwachte zu dem wiederkehrenden Gefühl ihrer Gefahr, und zu der Betrachtung, wie sie ihr entgehen könnte — ach sie sah kein Mittel!
Der Grund schien ihrer Einbildung gränzenlos, sie war von Rasen zu Rasen, von Wäldchen zu Wäldchen gegangen, ohne ans Ende zu kommen: sie konnte die Gartenmauer nicht finden, doch beschloß sie, weder nach dem Schlosse zurückzugehen, noch ihr Suchen aufzugeben.
So wie sie aufstand, um weiter zu gehen, sah sie einen Schatten in einiger Ferne sich bewegen, und stand still, um ihn zu beobachten. Er nahte langsam heran und verschwand wieder; plötzlich aber sah sie einen Menschen aus der Dunkelheit hervorgehen und sich dem Orte nähern, wo sie stand. Sie zweifelte nicht, daß der Marquis sie bemerkt hatte, und lief mit aller Eile nach dem Schatten einiger Bäume zur linken. Fußtritte verfolgten sie, und sie hörte sich beym Nahmen rufen, während sie mit kraftloser Anstrengung ihren Schritt zu beschleunigen suchte.
Plötzlich schien der Ton der Verfolgung eine andere Richtung zu nehmen: sie stand still, um Athem zu schöpfen, sah sich um, und niemand erschien. Sie ging nun langsam die Allee hinab, und hatte beynahe das Ende erreicht, als sie die Gestalt aus den Bäumen hervorgehen und quer in die Allee schießen sah; es verfolgte sie und kam näher. Eine Stimme rief sie beym Nahmen, allein sie konnte nicht von ihr erreicht werden, sie war fühllos zur Erde gesunken: es dauerte lange, ehe sie erwachte, und als sie endlich die Augen aufschlug, fand sie sich in den Armen eines Mannes, und strebte sich loszuwinden.
»Fürchten Sie nichts, holdes Mädchen,« sagte er, »fürchten Sie nichts; Sie sind in den Armen eines Freundes, der alles für Sie wagen, der Sie mit seinem Leben beschützen wird.«
Er drückte sie sanft an sein Herz.
»Haben Sie mich denn so ganz vergessen?« fuhr er fort.
Sie sah ihn scharf an, und erkannte Theodor. Freude war ihre erste Regung; als sie sich aber an seine unvermuthete Abreise zu einer für sie so gefährlichen Zeit, und daß er des Marquis Freund war, erinnerte, kämpften tausend gemischte Empfindungen in ihrer Brust und überwältigten sie mit Mißtrauen, Besorgniß und Kränkung.
Theodor hub sie von der Erde auf und sagte, während er noch sie umfaßt hielt:
»Lassen Sie uns eilends von diesem Orte fliehen; ein Wagen wartet auf uns: er soll fahren, wohin Sie befehlen, und Sie zu Ihren Freunden führen.«
»Ach ich habe keine Freunde,« sagte sie, »und weiß nicht, wohin ich gehen soll.«
Theodor drückte sanft ihre Hand zwischen den seinigen, und sagte mit dem Tone des zartesten Mitleids:
»So sollen meine Freunde die Ihrigen seyn, lassen Sie mich Sie zu ihnen bringen. Aber ich schwebe in Todesangst, so lange Sie an diesen Ort sind; lassen Sie uns hinweg eilen.«
Adeline wollte antworten, als sie Stimmen zwischen den Bäumen hörten, und Theodor sie mit seinem Arme unterstützend, eilends die Allee hinab führte: sie setzten ihre Flucht fort, bis Adeline nach Luft schnappend, nicht weiter konnte.
Nachdem sie eine Weile still gestanden waren, ohne Fußtritte hinter sich zu hören, erneuten sie ihren Lauf, Theodor wußte, daß sie nicht weit von der Gartenmauer waren, allein er wußte auch, daß in dem zwischenliegenden Raum verschiedene Wege aus fernen Alleen in diesen Gang stießen, aus welchen des Marquis Leute hervorkommen und sie einholen konnten. Doch verschwieg er seine Besorgnisse vor Adelinen und suchte sie nur zu trösten, und ihr Muth einzusprechen.
Endlich erreichten sie die Mauer, und Theodor wollte sie zu einer niedrigen Stelle führen, neben welcher jenseits der Wagen stand, als sie wieder Stimmen in der Luft hörten. Adelinens Kräfte waren erschöpft, allein sie strengte noch den letzten Rest an, und sah in einiger Entfernung die Leiter, durch welche Theodor in den Garten gestiegen war.
»Noch eine kleine Anstrengung,« sagte er, »und Sie sind im Sichern!«
Er hielt die Leiter, während sie hinan stieg: die Mauer war oben breit und eben, und Adeline blieb stehen, bis Theodor folgte, und die Leiter an der andern Seite niederließ.
Als sie herunter gestiegen waren, sahen sie den Wagen stehen, aber keinen Kutscher. Theodor fürchtete sich zu rufen, damit seine Stimme ihn verriethe: er hob Adelinen in den Wagen und ging, um den Kutscher zu suchen, den er nicht weit davon unter einem Baum schlafen fand; er weckte ihn auf, und kam mit ihm zu dem Wagen, der nun in äußerster Geschwindigkeit davon flog.
Adeline wagte noch nicht, sich für sicher zu halten; nachdem sie aber eine ganze Weile ungehindert fortgefahren waren, brach Freude in ihr Herz und sie dankte ihrem Befreier in den wärmsten Ausdrücken. Die Theilnahme, die aus seiner Stimme und seinem ganzen Wesen hervorschien, bewieß, daß seine Freude der ihrigen nicht nachstand.
So wie das Nachdenken sich wieder bey ihr einfand, trat Unruhe an die Stelle der Freude: im Aufruhr der letztern Augenblicke dachte Sie nur an Flucht, jetzt aber erschienen ihr die Umstände ihrer gegenwärtigen Lage in einem Lichte, welches sie still und nachdenkend machte: Sie hatte keine Freunde, zu denen sie fliehen konnte, und gieng mit einem jungen Manne, der ihr beynahe fremd war, ohne zu wissen, wohin.
Sie erinnerte sich, wie oft man sie hintergangen und verrathen hatte, wo sie am meisten vertraute, und ihr Muth erlag: auch erinnerte sie sich an die Aufmerksamkeit, welche Theodor ihr vormahls bewiesen hatte, und fürchtete, daß eine eigennützige Leidenschaft sein Betragen möchte eingegeben haben. Sie sah dieß für möglich an, doch verachtete sie, es wahrscheinlich zu finden, und konnte sich nichts schmerzlicheres denken, als an Theodors Rechtschaffenheit zu zweifeln.
Er unterbrach ihre Träumerey durch eine Erwähnung ihrer Lage in der letzten Zeit auf der Abtey.
»Sie mußten sehr befremdet, und wie ich fürchte, beleidigt werden,« sagte er, »daß ich nach den beunruhigenden Winken, die ich Ihnen bey unserm letzten Gespräch gab, mich nicht um die bestimmte Zeit einfand. Vielleicht hat dieser Umstand mir in Ihrer Achtung geschadet, wenn ich je so glücklich war einen Theil davon zu besitzen! allein die höhere List des Marquis de Montalt vereitelte meine Absichten, und ich darf sicher behaupten, daß mein Schmerz hiebey wenigstens Ihren Besorgnissen gleich kam.«
Adeline antwortete: ›Sie wäre allerdings durch die Winke, die er ihr von ihrer Gefahr gegeben hätte, und durch sein Unterlassen, ihr weitere Nachricht zu geben, sehr beunruhigt worden, so wie —‹
Sie hielt zurück, was noch auf ihren Lippen schwebte, weil sie sah, daß sie ohne daran zu denken, den Antheil, den er in ihrem Herzen besaß, verrathen wollte. Es entstand eine Stille von einigen Augenblicken, und keines von beyden schien sich ganz ruhig zu fühlen.
Theodor knüpfte endlich das Gespräch wieder an:
»Erlauben Sie mir,« sagte er, »Ihnen die Ursachen zu erzählen, die mich von der erbetnen Zusammenkunft abhielten; ich wünschte sehnlich, mich zu rechtfertigen.«
Ohne ihre Antwort abzuwarten, erzählte er ihr, daß der Marquis, er wußte nicht zu erklären, auf welche Art, den Inhalt ihres letzten Gesprächs erfahren, oder gemuthmaßt und aus Furcht, seine Absichten vereitelt zu sehen, wirksame Mittel ergriffen hätte, zu verhindern, daß sie keine weitere Nachricht davon erhielte. Adeline besann sich sogleich, daß La Motte sie mit Theodor im Walde gesehen hatte, und zweifelte nicht, daß er ihn erkannt, (ungeachtet er es sich nicht merken ließ) und Sorge getragen hätte, den Marquis zu benachrichtigen.
»Den Tag darauf, als ich Sie zuletzt gesehen hatte, fuhr Theodor fort, »hieß mir der Marquis, der mein Obrister ist, mich zu meinem Regiment zu begeben, und bestimmte den folgenden Morgen zu meiner Abreise. Dieser plötzliche Befehl befremdete mich einigermaßen, allein ich war nicht lange um die Ursache desselben verlegen: ein Bedienter des Marquis, der mir sehr ergeben war, trat bald, nachdem mich sein Herr verlassen hatte, in mein Zimmer, äusserte seine Bekümmerniß über meine plötzliche Abreise, und ließ einige Winke fallen, die mich befremdeten. Ich forschte weiter und wurde in dem Argwohn bestärkt, den ich seit einiger Zeit wegen der Absichten des Marquis auf Sie gehabt hatte.
Jakob sagte mir ferner, daß meine gestrige Zusammenkunft mit Ihnen bemerkt, und dem Marquis hinterbracht worden sey. Er hatte seine Nachrichten von einem andern Bedienten erhalten, und sie beunruhigten mich so sehr, daß ich mich anheischig machte, mir von Zeit zu Zeit Nachricht von des Marquis Verfahren zu geben. Ich sah nun mit Ungeduld dem Abend entgegen, der mich wieder zu Ihnen führen würde; allein die List des Marquis wußte mein Bemühen und meine Wünsche zu vereiteln. Er hatte eine Parthie auf der Villa eines Freundes, die einige Meilen von ihm lag, verabredet, und ungeachtet aller Einwendungen, die ich vorschützte, mußte ich ihn begleiten. So brachte ich mit höchstem Zwang einen Tag in mehr Angst und Unruhe hin, als ich noch jemahls erfahren hatte. Es war Mitternacht, ehe wir zurückkamen. Ich stand des andern Morgens in aller Frühe auf, um meine Reise anzutreten, und nahm mir vor, eine Zusammenkunft mit Ihnen zu suchen, ehe ich die Provinz verließe.
Als ich zum Frühstück ins Zimmer kam, erstaunte ich nicht wenig, den Marquis bereits da zu finden, der den schönen Morgen pries und seine Absicht erklärte, mich bis zum Chineau zu begleiten. Auf so unerwartete Art meiner letzten Hoffnung beraubt, mochte mein Gesicht wahrscheinlich ausdrücken, was ich fühlte: denn das forschende Auge des Marquis verwandelte sich augenblicklich von anscheinender Nachläßigkeit in Mißfallen. Chineau liegt wenigstens drey Meilen von der Abtey entfernt, doch war ich willens, von da zurückzukehren, sobald der Marquis mich verlassen hätte; als ich aber bedachte, wie unwahrscheinlich es wäre, ob ich Sie allein zu sehen bekommen, und ob nicht meine Erscheinung von La Motten bemerkt werden, und nicht nur seinen Verdacht aufs höchste bringen, sondern auch künftige Entwürfe zu Ihrer Rettung vereiteln könnte: diese Betrachtungen siegten endlich, und ich ging zu meinem Regiment.
Jakob schickte mir öfters Nachricht von des Marquis Verfahren, allein seine Art zu beschreiben, war so verworren, daß ich nur in Verlegenheit und Unruhe darüber gerieth. Sein letzter Brief aber, warf mich in solche Angst, daß mir der Aufenthalt bey meinem Regiment unerträglich wurde, und da ich es unmöglich fand, Urlaub zu erhalten, verließ ich es heimlich und verbarg mich in einer Hütte nicht weit vom Schlosse, wo ich alles, was der Marquis unternahm sogleich erfahren konnte. Jakob brachte mir täglich Nachricht, und endlich eine Erzählung von dem abscheulichen Anschlage, der auf die folgende Nacht gegen Sie geschmiedet war.
Ich sah keine Möglichkeit, Sie vor der Gefahr zu warnen. Wenn ich mich in die Nähe der Abtey wagte, so lief ich Gefahr, daß La Motte mich entdeckte und jeden Versuch Sie zu retten vereitelte; doch war ich entschlossen, es zu wagen, da es doch vielleicht möglich war, Sie zu sehen; und wollte gegen Abend mich eben nach dem Walde aufmachen, als Jakob kam, und mir berichtete, daß Sie nach dem Schlosse gebracht werden sollten. Der Marquis hatte die Absicht, Sie durch Reizungen der üppigsten Sinnlichkeit, womit er nur zu gut bekannt ist, zu seinen Wünschen zu verführen, und Sie durch eine erdichtete Heirath zu täuschen. Nachdem ich das für Sie bestimmte Zimmer erfahren hatte, bestellte ich einen Wagen, der an der Gartenmauer halten mußte, und begab mich in der Absicht, an Ihre Fenster zu steigen, und Sie von da wegzuführen, um Mitternacht in den Garten.«
»O wie kann ich Ihnen je warm genug für Ihre Großmuth danken,« rief Adeline.
»Ach, nennen Sie es nicht Großmuth; es war Liebe. —«
Er schwieg, selbst überrascht durch die Kühnheit dieser Worte. Auch Adeline schwieg mit hohem Erröthen.
»Verzeihen Sie,« fing er nach einigen Augenblicken stummer Bewegung wieder an, »verzeihen Sie diese rasche Erklärung: aber warum nenne ich sie rasch, da meine Handlungen bereits entdeckt haben müssen, was meine Lippen bisher nicht auszusprechen wagten.«
Er hielt inne. Adeline schwieg noch.
»Aber lassen Sie mir die Gerechtigkeit wiederfahren,« fuhr er fort, »mir zu glauben, daß ich das Unschickliche, jetzt von Liebe zu reden, fühle, und daß dieses Geständniß mir unwillkührlich entschlüpfte. Ich verspreche Ihnen, desselben nie wieder zu erwähnen, bis Sie in eine Lage gesetzt sind, wo Sie meine aufrichtige Weihe frey annehmen oder zurückweisen können. Wie glücklich würde ich für jetzt mich schätzen, wäre ich nur Ihrer Achtung und Freundschaft gewiß.«
Adeline fühlte sich befremdet, daß er nach dem großmüthigen Dienste, den er ihr geleistet hatte, noch hieran zweifeln konnte; sie kannte die zärtliche Besorglichkeit der furchtsamen Liebe nicht.
»Können Sie mich,« antwortete sie mit zitternder Stimme, »für so undankbar halten? Kann ich Ihre Freundschaft für mich ansehen, ohne sie innigst zu schätzen und zu erwiedern?«
Theodor drückte schweigend ihre Hand an seine Lippen. Sie waren beyde zu sehr bewegt, um reden zu können, und reisten mehrere Stunden fort, ohne ein Wort zu wechseln.
Die Morgendämmerung schimmerte durch die Wolken, als die Reisenden in einer kleinen Stadt anhielten, um Pferde zu wechseln. Theodor bat Adelinen, auszusteigen, und einige Erfrischungen zu nehmen, allein die Leute im Wirthshause waren noch nicht auf, und es dauerte einige Zeit, bis das Klopfen und Rufen des Postillions sie erweckte.
Nach einem leichten Frühstück stiegen Theodor und Adeline wieder in den Wagen. Den einzigen Gegenstand, wovon er mit Antheil hätte sprechen können, verbot ihm die Delikatesse zu erneuern; und nach einigen Bemerkungen über die schöne Gegend, und einigen andern Versuchen eine Unterhaltung zu führen, fiel er wieder in Stillschweigen. Seine Seele war zwar noch beklommen, aber doch jetzt von der Angst befreyt, die so lange ihn drückte.
Als er zuerst Adelinen sah, machte ihre Liebenswürdigkeit einen tiefen Eindruck auf sein Herz; aus ihrer Schönheit sprach ein Adel der Seele, den die seinige sogleich erkannte, und dessen Eindruck nachher ihr Betragen und Gespräch verstärkten. Ihre, ihm bekannte hilflose Lage und die Gefahren, womit sie umringt war, hatten in seinem Herzen das zärtlichste Mitleid erweckt, und waren dem Übergang von Bewundrung zu Liebe günstig gewesen.
Sein Schmerz, als er sie diesen Gefahren überlassen mußte, ohne sie einmahl warnen zu können, war unaussprechlich. Während seines kurzen Aufenthalts bey seinem Regiment war sein Innres ein steter Raub von Angst und Schrecken, die er zu lindern kein Mittel sah, als wenn er wieder in die Nähe der Abtey zurückkehrte, wo er frühzeitig Nachricht von des Marquis Anschlägen erhalten, und bereit seyn konnte, Adelinen beyzustehn.
Um Urlaub konnte er nicht ansuchen, ohne seine Absichten da zu verrathen, wo er sie gekannt zu wissen am meisten fürchten mußte, und endlich verließ er mit raschem Edelmuth, den die Tugend eingab, wiewohl er dem Gesetz Trotz both, heimlich sein Regiment. Mit ängstlicher Besorgniß bemerkte er den Fortschritt von des Marquis Plan, bis die Nacht, die Adelinens Schicksal und das seinige mit ihr entscheiden sollte, alle seine Thätigkeit aufrief, und ihn in einen Aufruhr von Hoffnung, Furcht, Schrecken und Erwartung stürzte.
Nicht eher bis jetzt hatte er sie in Sicherheit zu glauben gewagt; jetzt aber ließ ihn die Entfernung vom Schlosse, die sie glücklich erreicht hatten, alles hoffen, Es war unmöglich, an Adelinens Seite zu sitzen, Versicherungen ihres Danks und ihrer Freundschaft zu erhalten, ohne die kühnere Hoffnung auf Liebe zu nähren. Er pries sich glücklich, ihr Retter gewesen zu seyn, und genoß die Scenen der Glückseligkeit im Voraus, wenn sie unter dem Schutze seiner Familie seyn würde. Die Wolken des Trübsinns und der Ängstlichkeit verschwanden von seiner Seele und ließen sie nur dem Sonnenscheine der Freude offen. Wann zu Zeiten ein Schatten von Furcht zurückkehrte: oder er sich mit Beängstigung an die Umstände erinnerte, unter welchen er sein Regiment an den Grenzen und zur Kriegszeit verließ, so sah er Adelinen an, und ihr Gesicht strahlte mit schneller Zauberkraft Frieden in sein Herz.
Allein Adeline empfand eine Ursache der Ängstlichkeit, die ihn nicht drückte: die Aussicht ihrer künftigen Lage war in Dunkelheit und Ungewissheit gefüllt. Aufs neue ging sie der Güte von Fremden entgegen; aufs neue der Gefahr, dieser Güte nicht gewiß zu seyn: dem Ungemach der Abhängigkeit, oder der Schwierigkeit eines unsichern Lebensunterhaltes ausgesetzt. Diese Vorstellungen trübten die Freude über ihre Entwischung und das süße Gefühl, welches Theodors Betragen und Geständniß in ihr erregte. Seine Delikatesse, allen Vortheilen, die ihre gegenwärtige Lage ihm gab, zu entsagen, und von seiner Liebe zu schweigen, vermehrte ihre Achtung und schmeichelte ihrem Stolz.
In diesen Betrachtungen war Adeline versunken, als der Postillion still hielt, um ihnen auf einem Wege, der seitwärts einen Berg hinter ihnen herab ging, einige Reuter zu zeigen, die ihnen nachzusetzen schienen. Theodor bat ihn, so schnell als möglich zu fahren, und von der Landstraße ab, den ersten dunkeln Nebenweg einzuschlagen. Der Postillion ließ seine Peitsche durch die Lüfte schallen, und jagte davon, als gälte es ums Leben. Indessen bemühte sich Theodor, Adelinen aufzurichten, die ihrer Angst erlag, und jetzt glaubte, daß sie jeder Zukunft Trotz biethen könnte, wenn sie nur dem Marquis entwischte.
Sie kamen bald in einen Nebenweg, den dickes Gesträuch schützte, und überschattete. Theodor sah wieder aus dem Fenster; allein, die dichten Zweige verhinderten ihn weit genug zu sehen, um bestimmen zu können, ob man noch nachsetzte. Um seinetwillen suchte Adeline ihre Bewegung zu verbergen.
»Dieser Weg,« sagte Theodor, »führt gewiß zu einem Dorf oder Städtchen und dann haben wir nichts mehr zu fürchten; den obgleich mein einzelner Arm Sie nicht gegen die Zahl unsrer Verfolger würde schützen können, so zweifle ich doch nicht, einige von den Einwohnern für uns zu gewinnen.«
Adeline schien durch diese Hoffnung beruhigt zu werden, und Theodor sah wieder zurück; allein die Krümmung des Wegs verschloß ihm die Aussicht, und das Rasseln der Räder überwältigte jeden andern Laut. Endlich rief er dem Postillion still zu halten, und nachdem er aufmerksam gelauscht hatte, ohne Pferde zu hören, fing er an zu hoffen, daß sie in Sicherheit wären.
»Weiß Er, wohin dieser Weg führt?« fragt er. —
Der Postillion antwortete, er wüßte es nicht, allein er sähe einige Häuser zwischen den Bäumen und glaubte, daß es dahin ginge.
Diese Nachricht war Theodor sehr willkommen, der nun aufsah und ebenfalls die Häuser erblickte. Der Postillion fuhr weiter.
»Fürchten Sie nichts, meine angebetete Adeline,« sagte er; »Sie sind jetzt sicher; nur mit dem Leben will ich von Ihnen scheiden.«
Adeline seufzte, nicht nur um sich selbst, sondern um die Gefahr, worin Theodor für sie gerathen könnte.
Sie waren wohl eine halbe Stunde fortgefahren, als sie ein kleines Dorf erreichten, und vor einem Wirthshause still hielten. Als Theodor Adelinen aus dem Wagen hob, bat er sie aufs neue, alle Furcht fahren zu lassen, und sprach mit einer Zärtlichkeit, die sie mit einem Lächeln, das ihre Angst nur schwach verbarg, beantwortete. Nachdem er einige Erfrischungen bestellt hatte, ging er hinaus, um mit dem Wirth zu sprechen; kaum aber hatte er das Zimmer verlassen, als Adeline einen Trupp Reiter in den Hof sprengen sah, und nicht zweifelte, daß es die nähmlichen waren, die sie unterwegs bemerkt hatten. Zwey hatten das Gesicht nach ihr gewandt, doch schien es ihr nicht, daß sie dem Marquis ähnlich sähen.
Ihr Herz erstarrte, und auf einige Augenblicke wich ihre Vernunft. Ihr erster Vorsatz war, sich zu verstecken; allein indem sie an die Mittel dachte, sah einer von den Reutern zu ihrem Fenster herauf, und sprach etwas mit seinen Gefährten, worauf sie ins Wirthshaus herein gingen. Es war unmöglich, das Zimmer zu verlassen, ohne bemerkt zu werden; darin zu bleiben, allein und unbeschützt, war eben so gefährlich. Sie schritt in tödtlicher Angst das Zimmer auf und ab, rief oft insgeheim Theodor und wunderte sich, wo er so lange bliebe. Es waren Augenblicke unbeschreiblicher Qual. Ein lautes und verworrenes Gewühl von Stimmen stieg jetzt aus einer fernen Gegend des Hauses auf, und sie unterschied bald die Worte der Streitenden:
»Ich verhafte Sie im Nahmen des Königs,« sagte einer, »und Sie mögen es auf Ihre Gefahr wagen, ohne Wache von hier zu gehn.«
Gleich darauf hörte Adeline Theodors Stimme antworten:
»Ich will mich des Königs Befehlen nicht widersetzen, und gebe Ihnen mein Ehrenwort, nicht ohne Sie fortzugehen; nur machen Sie mir die Hände frey, damit ich in das Zimmer zu einer Person zurückgehen kann, mit der ich zu sprechen wünsche.«
Anfangs machten sie Einwendungen gegen diese Bitte, die sie nur als einen Vorwand zu entwischen betrachteten; nach vielem Wortwechsel aber gewährten sie es ihm. Er sprang schnell nach Adelinens Zimmer; ein Sergeant und noch ein Unterofficier folgten ihm bis zur Thüre, und die zwey Soldaten mußten in den Hof heruntergehen, um die Fenster des Zimmers zu bewachen.
Mit begieriger Hand öfnete er die Thüre, allein Adeline eilte ihm nicht entgegen: denn sie war fast beym Anfang des Streits in Ohnmacht gesunken. Theodor rief laut um Hülfe, und die Wirthinn erschien mit ihrem Vorrath von Hausmitteln, die vergebens bey Adelinen versucht wurden. Sie blieb ohne Gefühl, und verrieth nur durch Athemhohlen, daß sie noch lebte.
Theodors Pein wurde indessen noch durch den Eintritt der Unterofficiere erhöht, die bey dem Anblick der vorgeblichen Person ein lautes Gelächter aufschlugen, und erklärten, daß sie nicht länger warten könnten. Mit diesen Worten wollten sie ihn von Adelinens lebloser Gestalt fortreißen, über der er mit unaussprechlichem Schmerz hing, als er sich mit Heftigkeit umdrehte, den Degen zog, und schwur, daß keine Macht auf Erden ihn fortbringen sollte, ehe das Frauenzimmer wieder ins Leben gekommen wäre.
Die Leute, durch seine Handlung und entschloßne Miene aufgebracht, riefen: ›ob er sich des Königs Befehlen widersetzte?‹ und wollten ihn ergreifen, als er ihnen die Spitze seines Degens vorhielt, und sie auf ihre Gefahr näher kommen hieß. Einer zog sogleich — Theodor behauptete seinen Stand, trat aber nicht vor:
»Ich verlange nur hier zu warten, bis das Frauenzimmer sich erhebt, Sie wissen die Bedingung,« sagte er.
Der Sergeant, bereits aufgebracht durch seinen Widerstand, nahm diese letzten Worte als eine Drohung auf, und beschloß, seinen Punct nicht aufzugeben: er drang auf ihn ein, und während sein Kammerad die Soldaten aus dem Hofe herauf rief, verwundete Theodor ihn leicht in die Schulter, und erhielt selbst einen Hieb in den Kopf:
Das Blut stürzte in Strömen aus der Wunde: Theodor schwankte in einen Stuhl, als eben die andern ins Zimmer traten, und Adeline schlug die Augen auf, um ihn todtenblaß und mit Blut bedeckt zu sehn. Sie stieß einen unwillkührlichen Schrey aus, und fiel mit dem Ausruf: »sie haben ihn ermordet!« beynahe in ihren vorigen Zustand zurück. Bey dem Ton ihrer Stimme richtete Theodor der Kopf empor, und reichte ihr lächelnd die Hand.
»Ich bin nicht sehr beschädigt,« sagte er, »und werde mich bald wieder erhohlen, wenn nur Sie wieder hergestellt sind.«
Sie eilte zu ihm und gab ihm die Hand.
»Ist niemand nach einem Wundarzt gegangen?« fragte sie.
»Beunruhigen Sie sich doch nicht,« fing Theodor wieder an; »es ist nicht so schlimm als Sie denken.«
Das Zimmer war nun voll von Menschen, die das Gerücht des Streits herbey geführt hatte; unter diesen war ein Mann, der die Stelle des Arztes, Apothekers und Wundarztes im Dorfe vertrat und jetzt näher kam, um Theodor beyzuspringen.
Nachdem er die Wunde untersucht hatte, lehnte er es ab, seine Meinung zu sagen, befahl aber den Kranken sogleich ins Bett zu bringen, wogegen die Unterofficiere einwendeten, daß es ihre Pflicht erfordere; ihn zum Regiment zu liefern.
»Das kann nicht ohne große Lebensgefahr geschehn,« versetzte der Arzt, »und —«
»O sein Leben, damit haben wir nichts zu thun,« sagte der Sergeant; »wir müssen unsre Pflicht versehn.«
Adeline, die bisher in stummer Angst da gestanden hatte, konnte sich nun nicht länger halten.
»Da der Arzt,« sagte sie, »erklärt hat, daß dieser Herr nicht ohne Lebensgefahr weggebracht werden kann, so werden Sie bedenken, daß, im Fall er stürbe, die Verantwortung auf Sie fallen wird.«
»Ja,« fiel der Wundarzt ein, der seinen Patienten nicht gern einbüßen wollte; »ich erkläre vor diesen Zeugen, daß der Herr nicht ohne Gefahr weggebracht werden kann; Sie werden also gut thun, die Folgen zu bedenken. Er hat eine sehr gefährliche Wunde erhalten, die die sorgfältigste Behandlung erfordert, und der Ausgang wird dann doch noch zweifelhaft seyn; wenn er aber reist, so kann er sich ein tödtliches Fieber zuziehn.«
Theodor hörte diesen Ausspruch mit Fassung; Adeline aber konnte kaum den Jammer ihres Herzens verbergen. Sie both alle Stärke auf, um die Thränen, die in ihre Augen drangen, zurückzupressen, und ohngeachtet sie die Menschlichkeit der Leute zu bewegen, oder sie in Furcht zu setzen wünschte, wagte sie doch nicht, ihrer Stimme einen Laut zu vertrauen.
Das Mitleid der Leute, die das Zimmer erfüllten, befreyte sie von diesem innern Kampf; sie wurden alle laut und erklärten, die Soldaten würden sich eines Mordes schuldig machen, wenn sie ihn wegführten.
»Nun sterben muß er doch auf allen Fall,« sagte der Sergeant, »weil er seinen Posten verlassen, und auf mich gezogen hat, da ich in des Königs Nahmen handelte.«
Eine Schwäche überfiel Adelinen, und sie lehnte sich an Theodors Stuhl, dessen Bekümmerniß für sich selbst sich auf eine Zeitlang in seiner Angst um sie verlor. Er unterstützte sie mit seinem Arm, zwang sich zu lächeln und sagte mit leiser Stimme, die nur sie verstehen konnte:
»Dieß ist eine falsche Vorstellung; ich zweifle nicht, daß die Sache, wenn sie zum Verhör kommt, ohne ernsthafte Folgen wird, beygelegt werden.«
Adeline wußte, daß diese Worte nur gesagt wurden, um sie zu trösten, und maß ihnen nicht viel Glauben bey, wiewohl Theodor ähnliche Versicherungen wiederhohlte. Indessen fühlten sich die Umstehenden, deren Unwillen durch die Härte des Sergeanten erregt war, durch die anscheinende Gewißheit seiner Strafe, und durch die Fühllosigkeit, womit sie ihm angekündigt ward, zur höchsten Theilnahme und Mitleiden bewegt. In kurzer Zeit wurden sie so heftig, daß theils aus Furcht vor weitern Folgen, theils aus Scham wegen der Grausamkeit, deren sie ihn anklagten, der Sergeant einwilligte, den Kranken zu Bette zubringen, bis der commandirende Officier bestimmen könnte, was man mit ihm anfangen sollte. Adelinens Freude hierüber verschlang auf einen Augenblick das Gefühl ihres Unglücks und ihrer Lage.
Sie wartete in einem Nebenzimmer den Ausspruch des Wundarztes ab, der sich jetzt mit Untersuchung der Wunde beschäftigte; und ihr Schmerz war um so heftiger, da sie sich als die Ursache von allem betrachten mußte. Das Unglück ihres Geliebten, welches seine Liebe nur heller ins Licht setzte, band ihn näher an ihr Herz, und schien die Heftigkeit ihres Kummers zu schärfen. An die schreckliche Behauptung, daß Theodor, wenn er auch genäse, mit dem Tode würde gestraft werden, wagte sie kaum zu denken und bemühte sich, sie für nichts als eine grausame Übertreibung seines Feindes zu halten.
Bey alle dem aber erweckte Theodors Lage ihre ganze Zärtlichkeit und verrieth ihr den wahren Stand ihrer Empfindungen. Die schöne Gestalt, das edle geistvolle Gesicht und einnehmende Wesen, welches vom ersten Augenblick an sie zu Theodor hinzog, wurde noch interessanter durch die Schönheit seines Geistes und seiner Denkungsart, die er im Gespräch verrieth. Sein Betragen seit ihrer Flucht hatte ihre wärmste Dankbarkeit erregt, und die Gefahr, in die er sich jetzt um ihrentwillen gestürzt hatte, rief ihre Zärtlichkeit hervor, und erhöhte sie in Liebe. Der Schleyer war von ihrem Herzen gezogen, und sie sah zum erstenmahl seine ächten Empfindungen.
Der Wundarzt kam endlich aus Theodors Zimmer zu ihr. Sie fragte, wie es um die Wunde stände?
»Vermuthlich sind das gnädige Fräulein eine Verwandte von dem Herrn; vielleicht seine Schwester?«
Die Frage verdroß und verwirrte sie, und ohne sie zu beantworten, wiederhohlte sie die ihrige.
»Vielleicht sind Sie ihm noch näher verwandt,« fuhr der Wundarzt fort, indem er ihre Frage ebenfalls nicht zu beachten schien; »vielleicht sind Sie mit ihm verheyrathet?«
Adeline erröthete, und wollte antworten, allein er fuhr fort:
»Der Antheil, den Sie an seinem Befinden nehmen, ist wenigstens sehr schmeichelhaft, und ich möchte fast meinen Zustand mit ihm vertauschen, wenn ich eines so zärtlichen Mitleids von einer so schönen Dame gewiß wäre.«
Mit diesen Worten verneigte er sich bis zur Erde; Adeline nahm eine sehr ernsthafte Miene an und sagte:
»Nun, da Sie mit Ihrem Kompliment fertig sind, mein Herr, wird es Ihnen vielleicht gefällig seyn, meine Frage zu beantworten: ich erkundigte mich, wie Sie Ihren Kranken verlassen hätten?«
»Diese Frage läßt sich vielleicht nicht gar gut beantworten, so wie es überhaupt ein sehr unangenehmes Geschäft ist, böse Nachrichten zu sagen. — Ich fürchte, er wird sterben.«
Der Wundarzt öfnete seine Tobacksdose und both Adelinen eine Prise. — » Sterben!« rief sie mit schwacher Stimme — » sterben?«
»Erschrecken Sie sich nur nicht,« fuhr er fort, da er sie blaß werden ab, »erschrecken Sie nicht. Es ist möglich, daß die Wunde nicht bis an die« — er stockte — »im Fall die« — wieder stockend — »nicht beschädigt ist, so sind auch die innern Theile des Gehirns nicht berührt; in diesem Falle wird die Wunde vielleicht vor Inflammation bewahrt werden, und der Kranke kann möglicher Weise genesen. Allein wenn auf der andern Seite« —
»Ich ersuche Sie, mein Herr, drücken Sie sich verständlich aus, und spaßen Sie nicht mit meiner Angst. Glauben Sie ihn wirklich in Gefahr?
»In Gefahr, Madame? — in Gefahr? ja wohl in der höchsten Gefahr!«
Mit diesen Worten verließ er mit unzufriednem Gesicht das Zimmer. Adeline blieb einige Augenblicke in einem Übermaß von Schmerz, dem sie keinen Einhalt zu thun vermochte, dann aber trocknete sie ihre Thränen, und suchte ihr Gesicht in Ordnung zu bringen, um nach der Wirthinn fragen zu können, die sie durch einen Aufwärter rufen ließ.
Nachdem sie eine ganze Weile vergebens gewartet hatte, zog sie die Glocke und schickte ihr nochmahls eine dringendere Bothschaft. Die Wirthinn erschien immer nicht, und Adeline ging endlich selbst hinunter, wo sie die Frau mit einer Menge von Leuten umgeben fand, denen sie mit lauter Stimme und lebhaften Gestikulationen die nähern Umstände des Vorfalls erzählte. Sobald sie Adelinen gewahr ward, rief sie — »o hier ist das Fräulein selbst,« und die Augen der ganzen Versammlung waren sogleich auf sie gerichtet.
Adeline, durch das Gedränge verhindert, sich ihr zu nähern, winkte ihr, und wollte sich zurückziehn, allein die Wirthinn, die allzueifrig in der Fortsetzung ihrer Geschichte war, wollte den Wink nicht verstehn. Vergebens suchte Adeline ihren Blick aufzufangen: er fiel auf alle, nur nicht auf sie, die sich scheute, durch lautes Rufen die Aufmerksamkeit des ganzen Haufens auf sich zu ziehn.
»Gewiß es ist ein Jammer, daß er erschossen werden soll,« sagte die Wirthinn, »es ist so ein schöner Mann; allein sie sagen, es könnte nicht fehlen, wenn er wieder genäse. Herr! allein wahrscheinlich wird er dieß nicht erleiden: denn der Doctor sagt, er würde nimmermehr lebendig aus dem Hause kommen!«
Adeline wandte sich nun mehr an einen Mann, der neben ihr stand, und bat ihn, der Wirthinn zu sagen, daß sie mit ihr zu sprechen wünschte.
Nach ohngefähr zehn Minuten erschien sie endlich:
»Ach gnädiges Fräulein,« ragte sie, »mit Ihrem Herrn Bruder steht es sehr schlecht: sie fürchten, er wird es nicht überstehen.«
Adeline fragte, ob kein andrer Arzt im Orte wäre, als den sie gesehn hätte?
»Gott behüte, Fräulein, dieß ist ein schöner, gesunder Ort, wir brauchen hier wenig Doctors: solch ein Vorfall ist hier noch nicht geschehen. Der Doctor ist schon über zehn Jahre hier; allein es gibt wenig für ihn zu thun, und es mag ihm wohl selbst knapp genug gehen. Einer von dem Handwerk ist mehr als genug für uns.«
Adeline unterbrach sie mit einigen Fragen nach Theodor, den die Wirthinn mit in sein Zimmer hatte bringen helfen. Sie fragte, wie er den Verband der Wunde ausgehalten hätte, und ob ihm besser darauf geworden wäre? — Fragen, worauf die Wirthinn keine sehr befriedigende Antwort gab. Sie erkundigte sich hierauf, ob nicht in der Nähe ein andrer Wundarzt wäre, hörte aber, daß man von keinem wüßte.
Der Schmerz auf Adelinens Gesicht schien das Mitleid der Wirthinn zu rühren, und sie suchte zu trösten, so gut sie konnte. Sie rieth ihr, nach ihren Freunden zu schicken; und erboth sich, einen Bothen zu schaffen. Adeline seufzte und sagte, es wäre nicht nöthig.
»Ich weiß nicht, Fräulein; was Sie für nöthig halten; so viel aber weiß ich, daß es mir sehr hart vorkommen würde, an einem fremden Orte zu sterben, ohne daß ich jemand von den meinigen um mich hätte; und der arme Herr denkt gewiß auch so; und zudem; wer soll die Kosten bezahlen, wenn er stirbt?«
Adeline bat sie, nur unbekümmert zu seyn, und dem Kranken alle Pflege zu verschaffen, ihre Mühe sollte reichlich belohnt werden; und forderte sogleich Dinte und Feder.
»Nun, so ist es recht, Fräulein; Ihre Freunde würden es Ihnen nimmermehr vergeben, wenn Sie ihnen nichts zu wissen thäten; ich weiß das an mir selbst. Und was die Pflege anbelangt, so soll er alles haben, was das Haus vermag: und ich wette, es gibt kein besseres Wirthshaus im ganzen Lande, obschon der Ort nur klein ist.«
Adeline mußte nochmahls Feder und Dinte fordern, ehe die geschwätzige Wirthinn hinausging.
Der Gedanke, Theodors Freunde zu benachrichtigen, war ihr bey dem Tumult der letzten Auftritte nicht eingefallen, und die Aussicht auf Trost, die sich jetzt für ihn öfnete, erleichterte sie etwas. Sobald sie Schreibzeug erhielt, schrieb sie ihm folgende Zeilen:
»In Ihrem gegenwärtigen Zustande bedürfen Sie jeden Trost, der Ihnen verschafft werden kann, und gewiß gibt es in Krankheiten keinen würksamern, als die Gegenwart eines Freundes; erlauben Sie mir also, Ihre Familie von Ihrer Lage zu benachrichtigen: es wird mir zur Beruhigung und Ihnen hoffentlich zum Trost gereichen.«
Theodor ließ zur Antwort zurückfragen, er bäte sie inständigst, auf einige Minuten zu ihm zu kommen. Sie ging sogleich in sein Zimmer, wo ihre ärgsten Besorgnisse bestätigt wurden, als sie sein blasses Gesicht sah: der Eindruck, den es auf sie machte, und ihr Bemühen, ihre Bewegung zu verbergen, überwältigte sie beynahe.
»Ich danke Ihnen für diese Güte,« sagte Theodor, und reichte ihr die Hand entgegen, die sie hinnahm, und in einen Strom von Thränen ausbrechend, sich an sein Bette setzte. Als ihre Bewegung ein wenig nachgelassen hatte, sah sie ihn wieder an: ein Lächeln der zärtlichsten Liebe drückte aus, wie innig er den Antheil, der sie an ihm nahm, empfand, und goß einen kleinen Trost in ihr Herz.
»Vergeben Sie mir diese Schwäche,« sagte sie, »meine Lebensgeister sind seither auf so mancherley Art angegriffen.«
»Diese Thränen sind äußerst schmeichelhaft für mein Herz,« unterbrach sie Theodor; »aber um meinetwillen, suchen Sie sich zu fassen: ich werde gewiß bald besser seyn; der Wundarzt —«
»Er gefällt mir nicht;« fiel Adeline ein, »aber sagen Sie mir aufrichtig, wie Sie sich fühlen?«
Er versicherte sie, es wäre ihm weit leichter als zuvor, und bey Erwähnung ihrer gütigen Zeilen, kam er auf die Sache, weswegen er mit ihr zu sprechen verlangt hatte:
»Meine Verwandten,« sagte er, »wohnen weit von hier; und wiewohl ihre Liebe für mich groß genug ist, um sie auf den ersten Wink zu mir zu führen, könnten sie doch nicht eher hier seyn, bis ihre Gegenwart wahrscheinlich nicht mehr nöthig seyn wird:« — Adeline sah ihn bekümmert an — »denn ich werde wahrscheinlich wieder hergestellt sein,« sagte er lächelnd, »ehe ein Brief zu ihnen gelangen kann: es würde ihnen also nur unnützen Kummer, und eine unnöthige Reise machen. Um Ihrentwillen, Adeline, möchte ich sie hieher wünschen; aber in wenig Tagen wird sich der Ausgang meiner Wunde deutlicher zeigen, und so lange lassen Sie uns wenigstens warten.«
Adeline enthielt sich, weiter in ihn zu dringen, und kam auf etwas, das ihr noch wichtiger schien:
»Ich wünschte herzlich,« sagte sie, »daß Sie einen geschicktern Wundarzt hätten; Sie kennen die Gegend besser, als ich; liegt nicht eine Stadt in der Nähe, wo wir einen bekommen könnten?«
»Ich glaube nicht; allein dieß hat auch nichts zu sagen, denn meine Wunde ist so unbedeutend, daß eine sehr mäßige Geschicklichkeit zu ihrer Heilung hinreicht. Aber warum, meine geliebteste Adeline, geben Sie diesen Besorgnissen Raum? Warum quälen Sie sich durch diesen Hang, alles aufs Schlimmste zu deuten? Ich bin geneigt, vielleicht mit allzuviel Verwegenheit, es Ihrer Freundschaft zuzuschreiben, und erlauben Sie mir die Versicherung, daß sie meinen heißen Dank erregt, und meine höchste Achtung vermehrt. O Adeline, wenn Sie meine schnelle Genesung wünschen, so lassen Sie mich Sie ruhig sehen; so lange ich Sie bekümmert weiß, kann ich nicht wohl seyn.«
Sie versicherte ihn; sich alle Mühe zu geben, und aus Besorgniß ihm durch längeres Reden zu schaden, verließ sie ihn.
So wie sie aus dem Gange kam, begegnete ihr die Wirthinn, auf die gewisse Worte von Adelinen wie ein Talisman gewirket, und Nachlässigkeit und Unverschämtheit in dienstfertige Höflichkeit verwandelt hatten. Sie kam, um zu fragen, ob der Herr alles hätte, was er wünschte: denn sie wollte gewiß dafür sorgen, daß er es bekäme.
»Ich habe ihm eine Wärterinn kommen lassen, gnädiges Fräulein, die ihm gewiß gute Dienste thun wird; doch werde ich selbst öfters nachsehn, ob auch alles recht ist. Der arme Herr, wie geduldig er leidet! Man sollte nicht glauben, daß er wußte, daß er nicht davon kommen kann; doch hat es ihm der Doctor selbst gesagt, oder wenigstens eben so viel.«
Adeline war äußerst aufgebracht über das unsinnige Betragen des Menschen, und nachdem sie ein leichtes Mittagsessen bestellt hatte, schickte sie die Wirthinn fort.
Gegen Abend stellte sich der Wundarzt wieder ein, und nach einem Besuche bey seinem Kranken kam er zu Adelinen, um sie, auf ihr Verlangen, von seinem Zustande zu benachrichtigen. Er beantwortete ihre Fragen mit großer Feyerlichkeit.
»Es ist unmöglich, Madame, jetzt ein bestimmtes Urtheil zu fällen, allein ich habe Ursache bey meiner Meinung von diesem Morgen zu bleiben. Es ist in der That nicht meine Sache, aufs ungewisse zu urtheilen, wovon ich Ihnen ein Beyspiel erzählen will.
Vor ohngefähr vierzehn Tagen wurde ich zu einem Kranken einige Meilen weit von hier gerufen. Ich war nicht zu Hause, als der Bothe kam, und da die Sache dringend war, hatte man, ehe ich kommen konnten einen andern Arzt gerufen; dieser hatte Arzeneyen verschrieben, wie er für gut fand, und sie hatten dem Anscheine nach dem Kranken gute Dienste gethan. Seine Freunde wünschten sich zu seiner Besserung Glück, als ich kam, und waren einer Meinung mit dem Arzte, daß keine Gefahr vorhanden sey. ›Verlassen Sie sich drauf,‹ sagte ich, ›Sie irren; diese Arzney kann ihm nicht geholfen haben, der Patient ist ist der äußersten Gefahr‹. Der Kranke stöhnte, allein mein College blieb dabey, daß seine Arzney ihm nicht nur sichre, sondern auch schleunige Hülfe verschaffen würde, da sich bereits gute Wirkung davon gezeigt hätte. Hierüber verlor ich alle Geduld, und behauptete meine Meinung, daß diese Wirkung betröge und der Fall verzweifelt wäre; ich versicherte den Kranken selbst, daß sein Leben in der äußersten Gefahr sey. Ich bin keiner von denen, Madame, die ihre Kranken bis zum letzten Augenblick betrügen; — aber Sie sollen hören, wie es ablief.
Mein College schien über meinen festen Widerstand in Zorn zu gerathen; und machte ein grimmiges Gesicht, woran ich mich aber nicht im mindesten kehrte. Er wandte sich zu dem Kranken, und verlangte, er möchte entscheiden, welchem von uns er sich anvertrauen wollte; denn gemeinschaftlich mit mir könnte er nicht verfahren. Der Kranke that mir die Ehre,« (er sagte dieß mit wohlgefälligem Gesicht, indem er die Halskrause zurechte schob) »vielleicht höher von mir zu denken, als ich verdiente; denn er schickte meinen Gegner auf der Stelle fort. ›Ich hätte nicht geglaubt,‹ sagte er, als der Arzt hinausgegangen war, ›ich hätte nicht geglaubt, daß ein Mann, der so viel Jahre im Amte steht, so ganz unwissend seyn könnte.‹
›Auch ich nicht,‹ sagte ich — ›Ich bin erstaunt, daß er meine Gefahr nicht einsah,‹ fuhr der Kranke fort. — ›Ich auch,‹ erwiederte ich. — Ich nahm mir vor, alles was möglich war, für den Kranken zu thun: denn er war ein Mann von Verstand, wie Sie sehen, und ich schätzte ihn hoch. Ich veränderte also die Vorschriften und besorgte selbst die Arzney: allein es half alles nichts, meine Meynung bestätigte sich, und er starb vor dem nächsten Morgen.«
Adeline, die diese lange Geschichte hatte anhören müssen; seufzte bey dem Schlusse.
»Ich wundre mich nicht, Madame, daß Sie gerührt sind. Der Fall, den ich erzählt habe; ist allerdings sehr rührend. Es ging mir so nahe, daß ich lange nicht daran denken, oder davon reden mochte. Aber Sie müssen doch zugeben, Madam, daß es ein auffallender Beweis von der Unfehlbarkeit meines Urtheils war?«
Adeline schauderte bey dieser Unfehlbarkeit, doch schwieg sie; plötzlich aber fiel ihr ein guter Gedanke ein, und mit aller verstellten Gleichgültigkeit, die sie nur annehmen konnte, fragte sie:
»Wie hieß denn der Arzt, der sich Ihnen so unwissend entgegen setzte?«!
»Er heißt Lafance.
»Vermuthlich lebt er in der Dunkelheit, die er verdient?«
»Ach nein, Madame; er wohnt in einer Stadt von einiger Bedeutung, ohngefähr anderhalb Meilen von hier, und gibt einen Beweis mehr ab, wie unvernünftig das Publikum gewöhnlich urtheilt. Sie werden sich kaum vorstellen, was ich Ihnen versichre, daß dieser Mann sehr viel Praxis hat, während man mich vernachläßigt, und fast ungekannt hier leben läßt.«
Sie fragte ihn noch einiges über Theodors Wunde und hörte, es stände noch wie vorher, ausser daß ein Fieber hinzugekommen wäre.
»Allein ich habe befohlen, das Zimmer zu heizen,« fuhr er fort, »und noch einige Decken auf das Bett zu legen, wovon ich mir gute Wirkung verspreche. Indessen muß man ihm sorgsam alles Getränke verweigern, einige herzstärkende Tropfen ausgenommen, die ich schicken werde. Er wird natürlich zu trinken fordern, allein es darf ihm durchaus nicht gegeben werden.«
»Sie sind also kein Freund von der Methode, in solchen Fällen der Natur zu folgen.«
»Natur, Madame! — Natur ist der allerunsicherste Wegweiser, ich folge immer gerade dem Gegentheil von dem, was sie angibt; denn was kann die Kunst nützen, wenn sie bloß der Natur folgen soll? Dieß war meine Meinung so wie ich meinen Stand ergrif, und ich bin treulich dabey geblieben. Sie werden vielleicht aus meinen Reden abnehmen, Madam, daß man sich auf meine Meinungen verlassen kann; was sie einmahl sind, bleiben sie immer: denn mein Gemüth ist nicht von so leichter Art, daß es sich durch die Umstände bestimmen ließe.«
Adeline war seiner müde, und verlangte sehnlich, Theodorn ihre Entdeckung eines andern Arztes mitzutheilen, allein der Wundarzt schien auf keine Weise geneigt, sie zu verlassen, und wollte sich noch über verschiedne Gegenstände und neue Beyspiele seines bewunderungswürdigen Scharfsinns ausbreiten, als der Aufwärter ihm sagte, daß jemand nach ihm geschickt hätte. Er war indessen mit einer zu angenehmen Materie beschäftigt, um sich so leicht stören zu lassen, und erst als der Aufwärter zum zweyten Mahle erschien, machte er Adelinen eine Verbeugung, und empfahl sich. Sobald er fort war, schickte sie ein Billet an Theodor, und bat ihn um Erlaubnis, den Doctor Lafance rufen zu lassen.
Das eingebildete Wesen des Wundarztes hatte Theodor bereits eine ungünstige Meinung von seinen Talenten beygebracht, welche die letzte Vorschrift so vollkommen bestätigte, daß er gern zufrieden war. Adeline verlangte sogleich einen Boten, da sie sich aber besann, daß der Wohnort des Arztes ihr noch ein Geheimniß war, wandte sie sich an die Wirthinn, die es aber entweder nicht wußte, oder nicht wissen wollte. Alle andere Nachfragen waren gleich unwürksam, und sie brachte einige Stunden in äußerster Unruhe zu, während Theodor sich sichtlich verschlimmerte.
Als das Abendessen gebracht wurde, fragte sie den Knaben, der dabei aufwartete, ob er einen Arzt Namens Lafance in der Nachbarschaft kennte.
»Nicht in der Nachbarschaft, Madame, aber ich kenne einen Doctor Lafance in Chancy, denn ich bin aus der Stadt.«
Adeline fragte weiter und erhielt sehr befriedigende Antworten. Allein die Stadt lag einige Meilen entfernt, und diese Verzögerung beunruhigte sie aufs neue: doch schickte sie unverzüglich einen Eilboten ab, und nachdem sie sich nochmals nach Theodors Befinden erkundigt hatte, legte sie sich zu Bette.
Die anhaltende Ermüdung, die sie seit den letzten vierzehn Stunden erlitten hatte, überwältigte ihre Angst, und ihre abgematteten Lebensgeister sanken in Ruhe. Sie schlief bis an den hellen Morgen, und wurde von der Wirthinn aufgeweckt, die ihr sagte, daß Theodor sich weit schlimmer befände, und sie fragte, was geschehen sollte. Der Arzt war noch nicht gekommen. Adeline stand eilends auf, und erkundigte sich näher nach Theodor. Die Wirthinn sagte ihr, er hätte eine sehr unruhige Nacht gehabt, über Hitze geklagt, und verlangt, daß man das Feuer im Zimmer auslöschen sollte: allein die Wärterinn wüßte ihre Schuldigkeit zu gut, und hatte sich streng an des Wundarztes Vorschrift gehalten.
Sie setzte hinzu, er hätte regelmäßig die Tropfen genommen, wäre aber demohngeachtet immer schlimmer geworden, und hätte endlich fantasiert. — Indessen wäre der Bube, der nach dem Arzt gemußt hätte, noch immer nicht zurück.
»Und kein Wunder,« fuhr die Wirthinn fort, »es sind wenigstens drei Meilen von hier, und der Bube wird zu thun gehabt haben, den Weg bei der Dunkelheit zu finden. Aber gewiß, Fräulein, Sie hätten sich eben so gut auf unsern Doctor verlassen können: denn wir brauchen nie einen andern: und wenn ich meine Meinung sagen soll, so wäre es besser gewesen, zu des jungen Herrn Freunden zu schicken, als diesem fremden Doctor, den niemand kennt.«
Adeline hörte wenig auf dieses Gespräch und wartete mit Sehnsucht auf die Ankunft des Arztes. Sie fühlte jetzt stärker als je ihre verlaßne Lage, und Theodors Gefahr; und wünschte inständig, seinen Freunden Nachricht geben zu können. Allein diesen Wunsch konnte sie nicht befriedigen: denn Theodor, der einzig ihr den Ort ihres Aufenthalts sagen konnte, war des Bewußtseyns beraubt.
Als der Wundarzt kam, und den Zustand seines Kranken sah, bezeugte er nicht die mindeste Verwunderung, sondern ging nach einigen Fragen und allgemeinen Vorschriften zu Adelinen. Nachdem er die gewöhnlichen Complimente gemacht hatte, nahm er plötzlich eine wichtige Miene an.
»Es thut mir leid, Madame, daß es mein Amt ist, unangenehme Nachrichten, mitzutheilen, allein ich wünschte, daß Sie sich auf den Ausgang gefaßt machten, der, wie ich fürchte, nahe ist.«
Adeline verstand seine Meinung, und so wenig sie auch bisher auf sein Urtheil gebaut hatte, konnte sie ihr doch nicht von Theodors unmittelbarer Gefahr reden hören, ohne in Schrecken zu gerathen.
Sie bat ihn, ihr alles zu sagen, was er fürchtete, und er erklärte, daß Theodor, wie er vorher gesehen hätte, sich diesen Morgen weit schlimmer befände als den Abend zuvor; und da das Übel jetzt den Kopf angegriffen hätte, so wäre alle Ursache zu fürchten, daß es in wenig Stunden einen unglücklichen Ausgang nehmen würde.
»Es können die schlimmsten Folgen entstehen,« fuhr er fort; »wenn die Wunde in Entzündung geräth, so ist keine Hoffnung mehr da.«
Adeline hörte mit schrecklicher Ruhe diesen Ausspruch an, und äußerte ihren Schmerz weder durch Worte, noch Thränen.
»Ich vermuthe, der Herr hat Anverwandte, Madame, und je eher Sie ihnen seinen Zustand kund thun, je besser. Wenn sie weit von hier wohnen, so ist es freylich zu spät; allein es gibt andere nothwendige — Sie werden übel, Madame —«
Adeline wollte reden, aber die Stimme versagte ihr. Der Wundarzt forderte mit lauter Stimme ein Glas Wasser: sie trank es, und ein tiefer Seufzer schien ihr beklommenes Herz etwas zu erleichtern; Thränen folgten. Da der Wundarzt sah, daß sie besser war, obschon nicht wohl genug, um auf sein Gespräch zu hören, nahm er Abschied und versprach in einer Stunde wieder zu kommen. Der Arzt war noch nicht da, und Adeline erwartete seine Ankunft mit einer Mischung von Furcht und ängstlicher Hoffnung.
Um Mittag kam er, und nachdem er von dem Umstand, der das Fieber zuwege gebracht, und von der Behandlung des Wundarztes sich hatte Nachricht geben lassen, gieng er zu Theodor: in einer Viertelstunde kam er wieder in das Zimmer, wo Adeline ihn erwartete.
»Der Herr liegt noch immer im Fieber, allein ich habe ihm einen kühlenden Trank verschrieben.«
»Ist denn noch einige Hofnung?« fragte Adeline.
»Gewiß, Madame, die Sache ist zwar jetzt etwas zweifelhaft, in wenig Stunden aber werde ich mit mehr Sicherheit urtheilen können. Indessen habe ich verordnet, dem Kranken frische Luft zu verschaffen, ihn ruhig zu halten und ihn häufig trinken zu lassen.«
Er hatte kaum auf Adelinens Bitte einen andern Wundarzt statt des jetzigen empfohlen, als der alte erschien. So wie er den Arzt sah, warf er einen Blick voll Unwillen und Erstaunen auf Adelinen, die ihm in ein anderes Zimmer nahm, wo sie ihn mit einer Höflichkeit verabschiedete, die er nicht zu erwiedern würdigte, und gewiß nicht verdiente.
Den andern Morgen in aller Frühe kam der Wundarzt; allein entweder die Arzneyen, oder die Crisis der Krankheit hatten Theodor in einen festen Schlaf geworfen, worin er mehrere Stunden blieb. Der Arzt gab nunmehr Hofnung zu einem glücklichen Ausgang, und man trug alle Sorge, ihn nicht zu stören. Er erwachte vollkommen vernünftig und frei vom Fieber, und sein erstes Wort war nach Adelinen, die nunmehr bald vernahm, daß er außer Gefahr wäre.
In wenig Tagen war er hinlänglich genesen, um aus seiner Kammer in ein anderes Zimmer gebracht zu werden, wo Adeline ihn mit einer Freude empfing, die sie nicht zurückhalten konnte: er sah es, und sein Gesicht glänzte von Vergnügen: Adeline, höchst dankbar für seine so edel bewiesene Liebe, und erweicht durch die Gefahr, welche er ausgestanden hatte, that sich nicht länger Gewalt an, ihre zärtliche Achtung zu verheelen, und wurde endlich dahin gebracht, ihm den Antheil zu gestehn, den er vom ersten Augenblick an in ihrem Herzen erregt hatte.
Nach einer Stunde rührenden Gesprächs, worin das Glück einer ersten und gegenseitigen Liebe ihre Seelen ganz beschäftigte, und alle Vorstellungen ausschloß, die nicht mit ihrem Entzücken in Einklang standen, kehrten sie zu dem Gefühl ihrer mislichen Lage wieder zurück. Adeline erinnerte sich, daß Theodor wegen Ungehorsams gegen seine Ordre und Verlassung seines Postens verhaftet war, und Theodor, daß er in kurzem von Adelinens Seite würde gerissen werden, und sie allen Übeln, wovon er erst so kürzlich sie errettet hatte, aufs neue Preis geben müßte.
Dieser Gedanke überwältigte ihn mit Schmerz, und nach einer langen Stille wagte er vorzuschlagen, was seine Wünsche ihm schon oft eingegeben hatten — eine Trauung mit ihr, eh er den Ort verließe. Dieß sah er für das einzige Mittel an, ewige Trennung zu verhindern; und wiewohl er die mancherley gefahrvollen Unannehmlichkeiten nicht vergaß, denen eine Heirath mit einem Manne in seinen Umständen sie aussetzen mußte, schienen sie ihm doch so wenig denjenigen das Gewicht zu halten, welche sonst ihr allein drohten, daß seine Vernunft nicht länger Bedenken trug, zu genehmigen, was seine Liebe eingegeben hatte.
Adeline war eine Zeitlang zu bewegt, um zu antworten; und wiewohl sie seinen Gründen und Bitten wenig entgegen zu setzen wußte, wiewohl sie keine Freunde zu Rathe zu ziehn brauchte, und durch keine entgegenlaufende Vortheile in Verlegenheit gesetzt ward, konnte sie sich doch nicht dahin bringen, so übereilt in eine Heyrath mit einem Manne zu willigen, den sie seit so kurzer Zeit erst kannte, und in dessen Familie und Bekanntschaften sie nicht eingeführt war. Endlich bat sie ihn, von der Sache abzubrechen, und die Unterhaltung war den übrigen Tag allgemeiner, obgleich noch immer höchst interessant.
Die Ähnlichkeit in Geschmack und Denkungsart, welche zuerst sie zu einander hinzog, enthüllte sich mit jedem Augenblick mehr. Ihr Gespräch wurde durch Mittheilung schöner Kenntniße bereichert und durch gegenseitige Achtung erwärmt. Adeline hatte wenig Gelegenheit gehabt zu lesen, allein die Bücher, welche sie fand, wirkten auf einen Geist, der nach Kenntniß dürstete, und auf einen Geschmack, der allem Schönen und Erhabnen vorzüglich geöfnet war, und theilten ihren ganzen Inhalt ihrem Verstande mit.
Theodor hatte von der Natur viele Talente und von der Erziehung alles, was sie geben konnte, erhalten; zu diesen Vorzügen kam eine edle Unabhängigkeit des Geistes, ein fühlendes Herz und Sitten, die eine glückliche Mischung von Würde und Sanftheit verriethen.
Gegen Abend kam ein Gerichtsdiener, der auf Vorstellung des Sergeanten vom Kriegsgericht abgeschickt war, im Dorfe an; er trat in Theodors Zimmer, welches Adeline sogleich verließ, und sagte ihm mit einer Mine, in die er unendliche Wichtigkeit legte, daß er den folgenden Tag zu seinem Hauptquartier abreisen sollte. Theodor antwortete, er sey noch nicht im Stande, die Reise auszuhalten; und verwieß ihn an seinen Arzt: allein der Gerichtsdiener versicherte, daß er sich diese Mühe nicht geben würde, weil der Arzt wohl unterrichtet seyn würde, was er sagen sollte, und daß er sich nur anschicken möchte, morgen die Reise anzutreten.
»Es ist schon lange genug gezögert worden,« sagte er, »und Sie werden genug zu thun finden, wenn Sie im Hauptquartier ankommen; der Sergeant, den Sie schwer verwundet haben, ist willens, gegen Sie aufzutreten, und dieses nebst dem Vergehn, dessen Sie sich schuldig gemacht haben, da Sie von Ihrem Posten desertirt —«
Theodors Augen flammten Feuer.
» Desertirt!« rief er, stand von seinem Stuhl auf und schoß einen drohenden Blick auf seinen Ankläger — »wer wagt es, mich mit dem Nahmen Deserteur zu brandmarken?«
Augenblicklich aber besann er sich, wie sehr sein Betragen diese Beschuldigung zu rechtfertigen schien, suchte seine Bewegung zu unterdrücken, und sagte mit fester Stimme und Fassung, wenn er in seinem Quartier anlangte, so würde er bereit seyn, auf alles zu antworten, was ihm vorgelegt würde; bis dahin aber würde er schweigen.
Die Unverschämtheit des Gerichtsdieners wurde durch den Muth und Würde, womit Theodor diese Worte sagte, zurückgetrieben, und mit einer Antwort, die er so leise murmelte, daß man sie kaum verstand, verließ er das Zimmer.
Theodor saß nachdenkend über seine gefährliche Lage: er wußte, wie viel er von den besondern Umstanden seiner plötzlichen Abreise von seinem Regiment, das in einer Garnison an den Spanischen Grenzen lag, wo die Disciplin sehr streng war, und von der Macht seines Obersten, des Marquis de Montalt zu fürchten hatte, den Stolz und vereitelte Hoffnung zur Rache reizen und unermüdet in Bewirkung seines Verderbens machen mußten. Bald aber flohen seine Gedanken von seiner eignen Gefahr zu der, welche Adelinen umgab, und bey dieser Betrachtung verließ ihn aller Muth: er konnte den Gedanken nicht ertragen, sich allen Übeln, die er voraus ahndete, zu überlassen; so wenig als den Gedanken an die plötzliche Trennung, die jetzt ihm drohte; und als sie wieder ins Zimmer kam, erneute er sein Bitten um eine schleunige Verheyrathung mit allen Gründen, die nur Zärtlichkeit und Scharfsinn aufbiethen konnten.
Adelinen, als sie hörte, daß er morgen abreisen sollte, war, als fühlte sie sich ihres letzten Trostes beraubt. Ade Schrecknisse seiner Lage stiegen vor ihrer Seele auf, und in unaussprechlichem Schmerz wandte sie sich von ihm.
Er deutete ihr Schweigen als eine günstige Vorbedeutung und wiederhohlte seine Bitten, daß sie einwilligen möchte, die Seinige zu seyn, und dadurch ihm Sicherheit zu geben, daß ihre Trennung nicht ewig seyn würde. Adeline seufzte tief bey diesen Worten.
»Und wer kann bestimmen, ob nicht unsre Trennung dennoch ewig seyn würde, wenn ich auch in unsre Verbindung willigte? Aber klagen Sie wegen meines Entschlusses mich keiner Gleichgültigkeit an: denn Gleichgültigkeit gegen Sie würde nach allem, was Sie für mich gethan haben, in der That Verbrechen seyn.«
»Und ist eine kalte Empfindung der Dankbarkeit alles, was ich von Ihnen erwarten darf? Ich weiß, das Sie im Begriff sind, mich mit einem Beweise Ihrer Gleichgültigkeit zu kränken, den Sie fälschlich für Eingebung der Klugheit halten, und daß ich dahin gebracht werden soll, ohne Widerstreben auf die übel hinzusehn, die im Kurzen mich erwarten. Ach Adeline! wenn Sie meinen Vorschlag zu verwerfen gesonnen sind, vielleicht die letzte Bitte, die ich Ihnen je vortragen kann, so täuschen Sie sich nur nicht länger mit dem Gedanken, daß Sie mich lieben: dieser Traum schwindet selbst von meiner Seele!«
»Können Sie denn so leicht diesen Morgen vergessen,« sagte Adeline erröthend; »ach! wenn Sie das können; so werde ich allerdings wohl thun, auch zu vergessen, daß je ein Geständniß meiner Empfindung über meine Lippen kam, und daß Sie es hörten.«
»Vergeben Sie, o meine Adeline, vergeben Sie die Zweifel und Unmännlichkeit, die ich verrieth: lassen Sie die Ängstlichkeit der Liebe und meine bedrängte Lage für mich sprechen!«
Adeline lächelte schwach durch ihre Thränen, und reichte ihm ihre Hand, die er feurig an seine Lippen drückte.
»Aber treiben Sie mich nicht durch Verwerfung meiner Bitte zur Verzweiflung,« fuhr er fort; »denken Sie sich selbst, was ich leiden muß, wenn ich Sie ohne Freunde und Schutz hier zurücklassen soll!«
»Ich denke, wie ich eine so traurige Lage vermeiden könnte. Es soll hier in der Nähe ein Kloster seyn, wo man Kostgängerinnen annimmt, und dahin wünschte ich zu gehn.«
»Ein Kloster! Sie wollten in ein. Kloster gehn? Wissen Sie denn, welchen Verfolgungen Sie dort ausgesetzt seyn würden? und wie unwahrscheinlich es ist, wenn der Marquis Ihren Aufenthalt entdeckte, daß die Vorsteherinn desselben seiner Gewalt, oder seinen Bestechungen widerstehn würde?«
»Ich habe dieß alles überlegt, und bin gefaßt, lieber es zu wagen, als eine Verbindung einzugehn, die unter den jetzigen Umständen uns beyde nur elend machen kann.«
»Ach Adeline! könnten Sie das glauben, wenn Sie wirklich liebten? Ich stehe auf dem Puncte getrennt, vielleicht auf immer von dem Gegenstande meiner zärtlichsten Liebe getrennt zu werden, und kann den Schmerz nicht unterdrücken, der mein Innres zerreißt. Ich kann mich nicht enthalten, jeden Grund zu wiederhohlen, der auch nur die leichteste Möglichkeit zur Veränderung Ihres Entschlusses darbiethet. Aber Sie, Adeline, Sie sehen mit Heiterkeit auf das hin, was mich zur Verzweiflung bringt.«
Adeline, die lange gekämpft hatte, ihren Muth in seiner Gegenwart aufrecht zu halten, während sie auf einem Entschlusse beharrte, den die Vernunft eingab, so sehr auch die Gefühle ihres Herzens ihm widersprachen, konnte nun ihren Schmerz nicht länger verhalten, und brach in Thränen aus. Theodor fühlte sich zugleich von seinem Irrthum überzeugt und gekränkt über den Schmerz, den er ihr verursacht hatte. Er zog seinen Stuhl zu ihr hin, ergrif ihre Hand, bat sie aufs neue um Vergebung., und suchte in den zärtlichsten Ausdrücken sie zu besänftigen und zu trösten.
»Wie strafwürdig war ich, Ihnen durch unsinnige Zweifel diesen Schmerz zu verursachen! Vergeben sie mir, Adeline; sagen Sie nur, daß Sie mir vergeben, und was für Pein ich auch bey dieser Trennung fühlen mag, will ich mich doch nicht länger widersetzen.«
»Sie haben mir Schmerz gemacht, aber mich nicht beleidigt,« sagte Adeline, und ihre Lippen sanken auf seine Stirne. Er schlang seine Arme um sie, und preßte sie an seine Brust. Trennung und alles Bewußtseyn von Gefahr schwand im seligen Entzücken der Liebe. Endlich riß Adeline ihre glühenden Wangen von seinen Lippen los, und der Taumel der Empfindung mußte wieder den nothwendigen Überlegungen der Vernunft weichen.
Sie erwähnte aufs neue des Klosters. Theodor suchte den Schmerz der nahen Trennung zu bekämpfen, und mit Fassung über Plane der Zukunft mit ihr zu berathschlagen. Nach und nach trug sein Verstand über Leidenschaft den Sieg davon, und er sah ein, daß ihr Plan für ihre Sicherheit am zuträglichsten seyn würde. Er erwog, was er im Aufruhr seiner Seele vergessen hatte, daß er auf die gegen ihn eingebrachten Klagen könnte verurtheilt werden, und daß sein Tod sie nicht nur ihres Beschützers berauben, sondern sie noch unmittelbarer den Absichten des Marquis Preis geben müßte, der ohne Zweifel seinem Verhöre beywohnen, und auf diese Art erfahren würde, daß Adeline wieder in seiner Gewalt wäre.
Erstaunt, dieses nicht gleich bedacht zu haben, und erschrocken über die Unbesonnenheit, womit er in eine so gefährliche Lage sie zu stürzen im Begrif war, söhnte er sich auf einmahl mit dem Gedanken aus, sie in ein Kloster zu lassen. Es würde ihm lieber gewesen seyn, in seiner Familie ihr eine Zuflucht zu verschaffen, allein die Umstände, unter welchen sie auftreten mußte, waren so unangenehm und peinlich, und vor allem war die Entfernung so weit, daß er nicht daran denken konnte, sie der Gefahr einer solchen Reise auszusetzen. Er bat sie nur um Erlaubniß, ihr schreiben zu dürfen; da er sich aber besann, daß seine Briefe dem Marquis den Ort ihres Aufenthalts verrathen könnten, nahm er seine Bitte zurück.
»Auch dieses traurige Vergnügen muß ich mir versagen, damit nicht meine Briefe Ihre Wohnung verrathen, aber wie werde ich fähig seyn die Ungeduld und Ungewißheit zu ertragen, zu welcher Klugheit mich verdammt! Ich werde es nicht wissen, wenn Sie in Gefahr sind; — doch wenn ich es auch wüßte,« sagte er mit einem Blick der Verzweiflung, »könnte ich Ihnen ja doch nicht zu Hülfe fliegen. O Jammer! jetzt erst fühle ich alle Schrecken meines Gefängnisses — jetzt erst empfinde ich den ganzen Werth der Freyheit!«
Die heftige Erschütterung seiner Seele raubte ihm die Sprache; er stand von seinem Stuhle auf, und lief mit schnellen Schritten im Zimmer auf und ab. Adeline saß da, überwältigt von dem Bilde, welches Theodor von seiner herannahenden Lage entworfen hatte, von dem Gedanken, daß sie in der schrecklichsten Ungewißheit über sein Schicksal bleiben müßte. Sie sah ihn im Gefängniß — bleich — entkräftet, und in Ketten: — sie sah alle Rache des Marquis auf ihn herabgeschmettert, und dieß, weil er edelmüthig sich ihrer annahm! —
Theodor, beunruhigt durch die starre Verzweiflung auf ihren Zügen warf sich vor ihr hin; er ergrif ihre Hände und wollte ihr Trost zusprechen, aber die Worte erstarben auf seinen Lippen, und er konnte sie nur mit Thränen baden.
Dieses traurige Schweigen wurde durch das Rasseln eines Wagens, der vor dem Wirthshause still hielt, unterbrochen. Theodor lief ans Fenster, aber die Dunkelheit des Abends verhinderte ihn, die Gegenstände außen zu erkennen. Man brachte Licht aus dem Hause, und er nahm nun einen Wagen mit vier Pferden und von verschiedenen Bedienten umgeben wahr. Gleich darauf sah er einen Herrn in einen Mantel gewickelt aussteigen und ins Wirthshaus gehn, und hörte in dem nähmlichen Augenblick des Marquis Stimme.
Er war Adelinen zu Hülfe geflogen, die vor Schrecken umsank, als die Thüre sich aufthat, und der Marquis von Wache und Bedienten begleitet, herein trat. Wuth flammte aus seinen Augen, als er Theodorn erblickte, der mit ängstlicher Bekümmerniß über Adelinen hing.
»Ergreift den Verräther,« sagte er zur Wache, »warum hat man ihn so lange hier bleiben lassen.«
»Ich bin kein Verräther,« antwortete Theodor mit fester Stimme und der Würde selbstbewußten Werths; »sondern ein Beschützer der Unschuld, die der verrätherische Marquis de Montalt zerstören wollte.«
»Thut eure Pflicht!« sagte der Marquis zu der Wache.
Adeline schrie, klammerte sich fester an Theodors Arm und flehte die Wache an, sie nicht zu trennen.
»Nur Gewalt vermag es!« rief Theodor und sah sich nach einem Werkzeug der Vertheidigung um, erblickte aber keins, und wurde in demselben Augenblick umringt und ergriffen.
»Fürchten Sie alles von meiner Rache,« sagte der Marquis zu Theodor, als er Adelinens Hand ergrif, die alle Kraft zum Widerstande verloren hatte — »fürchten Sie alles von meiner Rache: Sie müssen sich bewußt seyn, sie verdient zu haben.«
»Ich trotze Ihrer Rache, und fürchte keine Quaalen des Gewissens, die Ihre Macht nicht auflegen kann, wenn gleich Ihre Laster Sie dazu verdammen.«
»Führt ihn augenblicklich aus dem Zimmer, und legt ihm starke Fesseln an,« rief der Marquis außer sich vor Wuth — »er soll bald erfahren, was einem Verbrecher, der Unverschämtheit mit Schuld vereinigt, bevorsteht!«
Theodor wurde aus dem Zimmer geschleppt, während Adeline, deren betäubte Sinne durch seinen letzten Blick und Abschiedsruf erweckt wurden, dem Marquis zu Füßen fiel, und mit Thränen bittrer Todesquaal Mitleid für Theodor flehte: ihr Flehn für seinen Nebenbuhler schien den Stolz des Marquis zu empören, und seinen Haß nur noch mehr zu reizen. Er gelobte Rache auf sein Haupt, und stieß Verwünschungen aus, vor welchen sich Adelinens Innres empörte. Endlich hob er sie auf, suchte die Ausbrüche der Wuth, die Theodors Gegenwart erregt hatte, zu ersticken, und redete sie in seiner gewöhnlichen Sprache der Bewundrung an.
Die unglückliche Adeline, die ohne auf seine Reden zu achten, fortfuhr, für ihren unglücklichen Liebhaber zu flehen, gerieth endlich über die Wuth, welche auf dem Gesichte des Marquis zurückkehrte, in Schrecken, und sprang mit Aufbiethung aller noch übrigen Kraft, von ihm weg nach der Thüre des Zimmers; allein er hatte sie ergriffen, ehe sie die Thüre erreichen konnte, führte sie zu ihrem Stuhle zurück und wollte reden, als man Stimmen im Vorsaal hörte, und der Wirth mit seiner Frau, durch Adelinens Geschrey erschreckt, herein traten. Der Marquis wandte sich wüthend zu ihnen und fragte, was sie wollten; ohne aber eine Antwort abzuwarten, hieß er sie folgen, und verließ das Zimmer, das er hinter sich zuschloß.
Adeline lief zu den Fenstern, die unbefestigt waren, und in den Hof gingen. Außen war alles dunkel und still. Sie rief laut um Hülfe, aber niemand erschien, und die Fenster waren so hoch, daß es unmöglich war, ohne Hülfe herab zu kommen. In aller Angst des Schreckens und Schmerzens ging sie im Zimmer umher, stand jetzt still, weil sie unten Stimmen im Zank zu hören glaubte, und beschleunigte jetzt wieder ihren Schritt, so wie die Unruhe ihrer Seele sie trieb.
Beynahe eine halbe Stunde hatte sie auf diese Art zugebracht, als sie plötzlich unten im Hause ein Lärmen hörte, welches zunahm, bis alles in Aufruhr und Verwirrung war. Leute gingen schnell hin und her; Thüren wurden auf und zugeschlagen. Ihr erster Gedanke war, daß Theodor ihr Schreyen gehört, und ihr zu Hülfe hätte eilen wollen, und daß der Widerstand der Wache diesen Tumult verursacht hätte. Da sie die Härte und Grausamkeit dieser Menschen kannte, fühlte sie sich von den schrecklichsten Besorgnissen für Theodors Leben ergriffen.
Ein verworrenes Gewühl von Stimmen scholl jetzt von unten herauf, und das Geschrey der Weiber überzeugte sie, daß gefochten würde: sie glaubte sogar, Degen klirren zu hören. Theodors Bild, wie er von der Hand des Marquis starb, stieg vor ihrer Einbildungskraft auf, und die Schrecken der Ungewißheit wurden beynahe unerträglich. Sie machte einen verzweifelten Versuch, die Thüre zu sprengen, und rief aufs neue um Hülfe: aber ihre zitternden Hände waren kraftlos, und im Hause schien alles zu sehr beschäftigt, um auf sie zu hören.
Ein lauter Schrey drang jetzt in ihr Ohr, und in dem Gelärm, das darauf folgte, unterschied sie deutlich tiefes Stöhnen. Diese Bestätigung ihrer Furcht raubte ihr alle noch übrige Lebenskraft, und ermattet sank sie in einen Stuhl neben der Thüre. Der Aufruhr ließ allmählig nach, bis alles still war, aber niemand näherte sich ihr. Bald nachher hörte sie Stimmen im Hofe, allein sie hatte nicht die Kraft, durchs Zimmer zu gehn, um nur die Fragen zu thun, deren Antwort sie ängstlich wünschte, und fürchtete.
Nach ohngefähr einer Viertelstunde wurde die Thüre geöfnet, und die Wirthinn trat mit todtenblassem Gesicht herein.
»Um Gotteswillen,« rief Adeline ihr entgegen, »sage Sie mir, was vorgegangen ist. Ist er verwundet? Ist er todt?«
»Nicht todt, Fräulein, aber« —
»Sterbend? — O wo ist er, lasse Sie mich zu ihm!«
»Halt Fräulein, Sie müssen hier bleiben: ich wollte nur das Hirschhorn hier aus dem Schranke hohlen.«
Adeline wollte durch die Thüre entwischen; allein die Wirthinn stieß sie zurück, schloß ab und ging die Treppe hinunter. Adelinens Jammer überwältigte sie nunmehr ganz, und sie saß ohne Bewegung, kaum sich bewußt, ob sie lebte, bis der Laut von Fußtritten an der Thüre sie erweckte, und drey Leute, die sie für des Marquis Bedienten erkannte, hereintraten. Sie hatte Bewußtseyn genug, um die Fragen, die sie vorhin der Wirthinn that, zu wiederhohlen; allein sie sagten statt aller Antwort, daß sie mit ihnen gehn müßte, weil unten ein Wagen auf sie wartete. Immer noch drang sie mit Fragen in diese Leute.
»Sagt mir nur, ob er lebt?« rief sie.
»Ja Fräulein, er lebt, allein er ist schwer verwundet, und so ist eben der Wundarzt zu ihm gegangen.«
Bey diesen Worten trieben sie sie den Gang hinan, und brachten sie, ohne auf ihr Bitten und Flehen, wohin man sie führe? zu achten, bis zum Fuß der Treppe, als ihr Schreyen verschiedene Leute an die Thüre brachte. Die Wirthinn erzählte diesen, das Frauenzimmer sey die Gemahlinn eines Herrn, der eben angekommen wäre, und sie auf der Flucht mit ihrem Liebhaber eingehohlt hätte — ein Bericht, den des Marquis Bediente bestätigten.
»Es ist der Herr, der sich eben geschlagen hat,« setzte die Wirthinn hinzu; »und das Duell war um ihrentwillen.«
Adeline, die theils es verachtete, auf dieß Mährchen zu achten, theils zu voll Begierde war, die nähern Umstände des Vorgangs zu wissen, begnügte sich, ihre Fragen zu wiederhohlen; worauf einer der Umstehenden endlich antwortete, daß der Herr gefährlich verwundet sey.
Des Marquis Leute wollten sie nun in den Wagen schleppen, allein sie sank leblos in ihre Arme, und ihr Zustand rührte die Menschlichkeit der Zuschauer so sehr, daß sie ohngeachtet ihres Glaubens an die vorgebliche Geschichte, sich laut widersetzten, sie in dieser Bewußtlosigkeit in den Wagen schleppen zu lassen.
Endlich brachte man sie in ein Zimmer, wo durch gehörige Mittel ihre Sinne zurückgerufen wurden. Sie bat nunmehr so flehentlich um eine Erläuterung von dem, was geschehen war, das die Wirthinn ihr einige Umstande erzählte.
»Als der kranke Herr Ihr Schreyen hörte,« sagte sie, »gerieth er ganz außer sich, wie ich gehört habe, und nichts konnte ihn stillen. Der Marquis, denn es heißt, daß er ein Marquis ist, wie Sie am besten wissen müssen, war gerade mit mir und meinem Manne in der Stube, und als er den Lärmen hörte, ging er hinunter, um zu sehen, was es gäbe; so wie er ins Zimmer kam, sah er den Capitain mit dem Sergeanten kämpfen. Der Capitain wurde nun noch wüthender als vorher, und ohngeachtet er seinen Degen hatte, und an einem Beine gefesselt war, wußte er doch dem Sergeanten den Degen von der Seite zu reißen, und flog wie ein Blitz auf den Marquis zu, dem er eine gefährliche Wunde beybrachte.«
»Der Marquis ist also der Verwundete?r. fiel Adeline schnell ein, »und der andere Herr ist nicht beschädigt?«
»Nein, nein« antwortete die Wirthinn, »aber er wird seinen Theil schon bekommen, denn der Marquis schwört, daß er der Strafe nicht entgehen soll.«
Adeline vergaß auf einen Augenblick alle ihr Unglück und alle Gefahr in freudiger Dankbarkeit, daß Theodors Leben gerettet war; sie wollte sich noch weiter nach ihm erkundigen, als des Marquis Bedienten herein kamen und erklärten, daß sie nicht langer warten könnten. Adeline, jetzt zum Gefühl der Übel, die ihr drohten, erweckt, suchte das Mitleid der Wirthinn zu gewinnen, die aber an die Wahrheit der vom Marquis erfundenen Geschichte glaubte, oder doch so that, und folglich gegen alles, was sie vortrug, unempfindlich blieb. Sie wandte sich wieder an die Bedienten, aber eben so vergebens; sie wollten sie weder länger im Zimmer bleiben lassen, noch ihr sagen, wohin man sie führte; und im Beyseyn verschiedener Personen, die bereits durch die ungünstige Aussage der Wirthinn gegen sie eingenommen waren, trieb man Adelinen in den Wagen; ihre Führer stiegen auf die Pferde, und in wenig Augenblicken war die ganze Partie aus dem Dorfe verschwunden.
So endigte für Adelinen ein Abenteuer, das mit einer Aussicht nicht nur auf Sicherheit, sondern auf Glück anfing; ein Abenteuer, welches sie fester an Theodor band, und ihn ihrer Liebe würdig zeigte; welches aber zugleich ihr die neue Kränkung mitbrachte, ihren edelmüthigen und jetzt angebeteten Geliebten, verhaftet und sowohl ihn als sie selbst in die Gewalt eines Nebenbuhlers geliefert zu sehn, den Verzögerung, Verachtung und Widerstand aufs höchste erbittert hatte.
Nachdem der Wundarzt des Ortes die Wunde des Marquis untersucht hatte, gab er sogleich seine Meinung und befahl, den Kranken zu Bette zu bringen: allein der Marquis, so krank er auch war, fühlte kaum eine andere Besorgniß, als die, Adelinen zu verlieren, und behauptete, er würde in wenig Stunden im Stande seyn, seine Reise anzutreten. In dieser Absicht ertheilte er Befehl, die Pferde bereit zu halten, als der Wundarzt mit fester Beharrlichkeit und sogar mit Zorn ausrief, daß diese Raschheit ihm das Leben kosten würde, und er endlich sich in ein Schlafzimmer bringen ließ, wo nur sein Kammerdiener zu ihm kommen durfte.
Dieser Mensch, der bequeme Vertraute aller seiner Händel, war das Hauptwerkzeug, das ihm zur Ausführung seiner Absichten auf Adelinen geholfen hatte, und war der nähmliche, der sie nach des Marquis Villa am Rande des Waldes brachte. Ihm gab der Marquis seine fernern Aufträge ihrentwegen; und weil er sowohl die Unannehmlichkeit als die Gefahr einsah, sie länger im Wirthshause zu lassen, hatte er ihm befohlen, sie mit Hülfe einiger andern Bedienten unverzüglich in einem Miethwagen fortzubringen. Nachdem der Kammerdiener hinweggegangen war, um diese Befehle auszuführen, blieb der Marquis seinen eigenen Betrachtungen und der Heftigkeit streitender Leidenschaften überlassen.
Die Vorwürfe und hartnäckige Widersetzlichkeit Theodors, des begünstigten Liebhabers von Adelinen, entflammten seinen Stolz und reizten seine ganze Bosheit. Er konnte keinen Augenblick an diese Widersetzlichkeit denken, die in einiger Rücksicht gelungen war, ohne ein Übermaß von Erbitterung und Haß zu fühlen, das nur die Aussicht auf schleunige Rache ihn konnte ertragen lassen.
Als er Adelinens Flucht von der Villa entdeckte, glich im ersten Augenblick sein Erstaunen seinem Verdrusse: und nachdem er den ersten Anfall seiner Wuth an seinen Domestiken ausgetobt hatte, schickte er sie sämmtlich auf verschiedenen Wegen aus, um ihr nachzusetzen; er selbst begab sich nach der Abtey, in der schwachen Hoffnung, daß sie, von aller andern Hülfe entblößt, vielleicht dahin zurück geflohn wäre.
Da er aber La Motten in nicht geringerm Erstaunen über ihre Flucht und gänzlich unwissend von ihrem Wege fand, kehrte er voll Ungeduld nach weitern Nachrichten zu seiner Villa zurück, wo einige von seinen Leuten wieder angelangt waren, ohne etwas von Adelinen entdeckt zu haben, so wenig als diejenigen, die nach ihnen zurückkamen.
Wenig Tage nachher schrieb ihm der Obristlieutenant des Regiments, daß Theodor seine Compagnie verlassen hätte, ohne daß man seinen Aufenthalt wüßte. Diese Nachricht bestärkte ihn in dem Verdacht, der schon oft in ihm aufgestiegen war, daß Theodor auf eine oder die andere Art zu ihrer Flucht behülflich gewesen wäre. Alle seine Leidenschaften schmiegten sich auf eine Zeitlang unter seine Rache, und er gab Ordre Theodor unverzüglich nachzusetzen und ihn zu ergreifen: allein dieser war schon indessen eingehohlt und in Sicherheit gebracht worden.
Die wachsende Neigung zwischen Theodor und Adelinen, die dem scharfen Auge des Marquis nicht entwischt war, und die Nachricht, welche La Motte, der ihre Zusammenkunft im Walde bemerkt hatte, ihm gab, hatten ihn zu dem Entschlusse gebracht, einen so gefährlichen Nebenbuhler zu entfernen, der so leicht seine Absichten erfahren und vereiteln konnte. Dem zu Folge sagte er auf so scheinbare Art als möglich zu Theodor, daß es nothwendig für ihn sey, zum Regiment zu gehn; eine Benachrichtigung, die diesem nur in Beziehung auf Adelinen unangenehm war und ihn um so weniger befremden durfte, da er bereits eine weit längere Zeit auf der Villa zugebracht hatte, als die vom Marquis eingeladenen Offiziere sonst pflegten. Theodor kannte im Grunde des Marquis Charakter sehr gut, und hatte seine Einladung mehr, um seinen Obristen nicht zu beleidigen als aus Neigung zu seiner Gesellschaft angenommen.
Der Marquis erhielt von den Leuten, die Theodor eingehohlt hatten, die Nachricht, welche ihn in Stand setzte, Adelinen zu verfolgen, und wieder zu bekommen: allein ohngeachtet ihm dieses gelungen war, wurde er doch innerlich von den bittern Empfindungen verschmähter Leidenschaft und verwundeten Stolzes zerrissen. Den Schmerz seiner Wunde vergaß er über seiner größern Seelenpein, und jede Quaal, die er fühlte, schien seinen Durst nach Rache zu entflammen, und neue Schärfe in sein Herz zu gießen.
In diesem Zustande hörte er die Stimme der unschuldigen Adeline um Hülfe flehn; allein ihr Geschrey erregte bey ihm weder Mitleid noch Gewissensbisse, und als bald nachher der Wagen abfuhr, und er nunmehr sie in Sicherheit und Theodor elend wußte, schien er einige Linderung seiner Seelenquaal zu fühlen.
Theodor litt in der That alles, was nur ein tugendhaftes Herz unter so schwerem Druck leiden konnte: doch war er wenigstens von den gehäßigen und boshaften Leidenschaften frey, die des Marquis Brust zerrissen, und die demjenigen, der sie fühlt, eine härtere Strafe auflegen, als sie ihn für einen andern können aussinnen lassen. Aller Unwillen, den er gegen den Marquis fühlte, war seiner ängstlichen Besorgniß für Adelinen untergeordnet. Seine Gefangenschaft war ihm schmerzhaft, weil sie ihn hinderte, eine anständige und ehrenvolle Rache zu suchen; allein sie war ihm schrecklich, weil sie ihn von der Rettung derjenigen zurückhielt, die er mehr als sein Leben liebte.
Als er die Räder des Wagen rollen hörte, der sie wegführte, empfand er eine Todesquaal, die beynahe seine Vernunft überwältigte. Selbst die harten Herzen der Soldaten, die ihn bewachten, blieben nicht ganz fühllos bey seinem Jammer, und wagten sogar das Betragen des Marquis zu tadeln, um ihren Gefangenen zu trösten. Der Arzt, der eben während dieses Anfalls von Verzweiflung zu ihm ins Zimmer trat, empfand wahre Bekümmerniß über seinen Zustand und fragte mit äußerster Befremdung, warum man ihn so plötzlich in dieß für einen Kranken so unschickliche Zimmer gebracht hatte?
Theodor erläuterte ihm die Ursache hievon, von seinem Schmerze und von den Ketten, die ihn schändeten; da er sah, daß der Arzt ihm mit Aufmerksamkeit und Mitleiden zuhörte, wünschte er, ihm noch mehr zu entdecken, und bat die Wache, sie allein zu lassen. Sie erfüllten sein Verlangen und stellten sich von außen vor die Thüre.
Er erzählte nunmehr den ganzen Zusammenhang des letzten Vorfalls und seines Verhältnisses mit dem Marquis. Der Arzt hörte seine Erzählung mit tiefem Beyleid an, und sein Gesicht drückte oftmahls starke Bewegung aus. Er schwieg eine Zeitlang und schien tief nachzusinnen; endlich erwachte er aus seiner Träumerey und sagte:
»Ich fürchte, Ihre Lage ist verzweifelt. Des Marquis Charakter ist zu bekannt, um auf Liebe oder Achtung Anspruch machen zu können; von einem solchen Manne haben Sie nichts zu hoffen, da er kaum etwas zu fürchten braucht. Ich wünschte, es wäre in meiner Macht, Ihnen nützlich zu seyn; allein ich sehe keine Möglichkeit.«
»Ach,« erwiederte Theodor, »meine Lage ist allerdings verzweifelt; und diese leidende Unschuldige —«
Tiefes Schluchzen erstickte seine Stimme, und seine heftige Bewegung ließ ihn nicht weiter fortfahren. Der Arzt konnte ihm nur sein inniges Mitleid bezeugen, und ihn bitten, sich zu beruhigen, als ein Bedienter vom Marquis herein kam, und ihn ersuchte, unverzüglich zu seinem Herrn zu gehn. Er versprach zu kommen; und nachdem er eine Fassung anzunehmen, sich bemüht hatte, die ihm schwer war, drückte er seinem jungen Freunde die Hand, und versprach wieder zu kommen, ehe er das Haus verließe.
Er fand den Marquis in äußerster Unruhe des Körpers und Geistes, und ängstlicher besorgt um die Folgen der Wunde, als er erwartet hatte. Seine Bekümmerniß für Theodor gab ihm jetzt einen Plan ein, durch dessen Ausführung er ihm dienen zu können hoffte. Nachdem er dem Kranken den Puls gefühlt und einige Fragen vorgelegt hatte, nahm er eine sehr bedenkliche Miene an; und der Marquis, der sein Gesicht ängstlich beobachtete, bat ihn, ohne Zögern, seine Meinung zu sagen.
»Es thut mir leid, Sie zu beunruhigen, gnädiger Herr, allein hier ist allerdings Ursache zu Besorgnißen; wie lange ist es her, das Sie die Wunde erhielten?«
»Großer Gott, also ist Gefahr vorhanden,« rief der Marquis und stieß einige bittre Verwünschungen gegen Theodor aus.
»Unstreitig ist Gefahr da,« erwiederte der Arzt — »in einigen Stunden werde ich von dem Grade derselben zu urtheilen im Stande seyn.«
»In einigen Stunden, Herr Doctor? — in einigen Stunden!« rief der Marquis.
Der Arzt bat ihn ruhiger zu seyn.
»Seltsam! ein Gesunder kann allerdings mit großer Fassung einen Sterbenden Ruhe predigen. Ein Trost ist es mir, daß Theodor auf dem Rade sterben wird.«
»Sie mißverstehen mich, gnädiger Herr! Wenn ich Sie für einen Sterbenden, oder auch mir dem Tode sehr nahe hielt, so würde ich nicht auf diese Art gesprochen haben. Allein es ist nur durchaus nothwendig zu wissen, seit wie lange Sie die Wunde bekommen haben.«
Des Marquis Schrecken ließ nun etwas nach; er erzählte ihm umständlich das Duell und gab vor, bey einer Sache niederträchtig behandelt zu seyn, wo er selbst sich vollkommen gerecht und menschlich betragen hätte. Der Arzt hörte diese Erzählung mit großer Kaltblütigkeit an, und so bald sie zu Ende war, sagte er dem Marquis, ohne eine Anmerkung darüber zu machen, er wollte ihm ein Arzney verschreiben, die er unverzüglich einnehmen möchte.
Der Marquis, aufs neue beunruhigt durch sein ernsthaftes Wesen, bat ihn, sich deutlich zu erklären, ob er ihn in unmittelbarer Gefahr glaubte. Der Arzt zögerte, und des Marquis Angst stieg:
»Es ist mir von äußerster Wichtigkeit, meinen Zustand genau zu wissen.«
Der Arzt sagte ihm nunmehr; wenn er einige weltliche Angelegenheiten in Ordnung zu bringen hätte, so würde er wohl thun, darauf bedacht zu seyn: denn es wäre nicht möglich, für den Ausgang gut zu sagen.
Er veränderte darauf das Gespräch, und sagte, daß er eben bey dem jungen Offizier gewesen wäre; er hoffte, daß man ihn gegenwärtig nicht fortbringen würde, weil ein solches Verfahren sein Leben in Gefahr setzen könnte. Der Marquis stieß einen schrecklichen Fluch aus, verwünschte Theodor, der ihn in seinen jetzigen Zustand gebracht hätte, und erklärte, er sollte noch in dieser Nacht von der Wade fortgeschaft werden.
Der Arzt versuchte gegen diesen grausamen Ausspruch Vorstellungen zu machen, und suchte eifrig die Menschlichkeit des Marquis für Theodor zu erwecken. Allein diese Verwendung, die ein eben so ungünstiges Licht auf des Marquis Charakter warf, als sie dem Charakter des Arztes Ehre machte, erregte nur seine Empfindlichkeit und zündete alle Heftigkeit seiner Leidenschaften aufs neue an.
Der Arzt begab sich niedergeschlagen fort; nachdem er auf Bitte des Marquis versprochen hatte, das Wirthshaus nicht zu verlassen. Er hatte gehoft, durch Übertreibung der Gefahr für Adelinen und Theodor etwas zu gewinnen, allein seine Absicht brachte gerade den entgegengesetzten Erfolg hervor. Die Furcht des Todes, die dem schuldigen Geiste des Marquis so schrecklich war, vermehrte, statt ihn zur Reue zu erwecken, seine Rachbegierde gegen den Mann, der ihn in diesen Zustand gebracht hatte. Er beschloß, Adelinen an einen Ort bringen zu lassen, wo Theodor, sollte er auch durch einen Zufall entwischen, sie nie erreichen könnte: und dadurch sich wenigstens ein Mittel zur Rache zu sichern. Doch wußte er, daß Theodors. Untergang gewiß war, wenn er nur erst sicher beym Regiment angebracht wäre; denn sollte er auch wider Vermuthung von der Absicht zu desertiren freygesprochen werden, so konnte er doch der Strafe, sich an seinem Obristen vergriffen zu haben, nicht entgehn.
Der Arzt ging wieder zu Theodor. Die Heftigkeit seines Schmerzes hatte sich jetzt in eine finstre Verzweiflung verwandelt, die schrecklicher war, als sein voriger Zustand. Die Wache verließ wiederum auf seine Bitte das Zimmer, und der Arzt erzählte ihm einen Theil seines Gesprächs mit dem Marquis. Theodor bezeugte ihm seinen Dank, und sagte, er hätte keine Hoffnung mehr. Für sich selbst empfand er wenig; nur für seine Familie und Adelinen blutete sein Herz. Er fragte, welchen Weg man sie gebracht hätte; und wiewohl er keine Aussicht hatte, von dieser Nachricht einigen Nutzen zu ziehn, bat er doch den Arzt, sich darnach zu erkundigen: allein der Wirth und die Wirthinn wußten oder wollten nichts davon wissen, und es war vergebens, sich an jemand anders zu wenden.
Der Sergeant trat jetzt mit Ordre vom Marquis zu Theodors unverzüglicher Abreise herein; dieser hörte den Befehl mit Ruhe an, wiewohl der Arzt sich nicht enthalten konnte, seinen Unwillen zu äußern. Theodor hatte kaum Zeit seinen Dank für die Güte dieses treflichen Mannes zu äußern, ehe die Soldaten eindrangen, um ihn in den Wagen zu bringen. Beym Abschiede drückte Theodor dem Arzt seine Börse in die Hand, und drehte sich schnell um; allein der Arzt rief ihn zurück, und schlug das Geschenk mit so edler Wärme ab, daß er es wieder nehmen mußte; er drückte seinem jungen Freunde die Hand, und eilte unvermögend zu sprechen fort.
Der Wagen fuhr schnell davon, und dem unglücklichen Theodor blieb nichts als die Erinnerung seiner verschwundenen Hoffnungen, seines Leidens und seiner Angst um Adelinens Schicksal; die Betrachtung seines gegenwärtigen Elends und dessen, was ihm die Zukunft noch aufbehalten hatte. Für sich selbst sah er nichts als gewisses Verderben und nur die schwache Hoffnung rettete ihn vom gänzlichen verzweifeln, daß sie, die er mehr liebte als sich selbst, eines Tages die Glückseligkeit wieder genießen möchte, deren Theilnahme ihm auf ewig abgeschnitten war.
Indessen setzte die verfolgte Adeline mit wenig Unterbrechung, ihre Reise die ganze Nacht durch fort. Ihre Seele lag in einem solchen Kampf von Schmerz, Sehnsucht, Verzweiflung und Schrecken, daß man nicht sagen kann, sie dachte. Der Kammerdiener des Marquis, der sich zu ihr in den Wagen gelegt hatte, schien anfangs zum Reden geneigt; allein ihre Unaufmerksamkeit brachte ihn bald zum Schweigen und sie blieb ungestört ihrem Jammer überlassen.
Sie schienen durch dunkle Feld- und Nebenwege zu fahren, durch welche die Kutsche mit so schmetternder Eile rollte, als die Dunkelheit es zuließ: beym Anbruch der Morgendämmerung sah sie sich an den Grenzen des Waldes, und erneute ihr Bitten, ihr zu sagen, wohin man sie brachte. Der Bediente antwortete, er hätte keinen Auftrag, es ihr zu sagen, allein sie würde es bald sehn.
Adeline, die bisher geglaubt hatte, es ginge wieder nach der Villa, fing jetzt zu zweifeln an; und da jeder Ort ihr minder schrecklich schien, als dieser, legte sich ihre Verzweiflung einigermaßen, und sie dachte nur an den unglücklichen Theodor, den sie zum Opfer der Bosheit und Rache geweiht wußte.
Sie fuhren jetzt in den Wald und sie kam auf den Gedanken, daß es nach der Abtey ginge: denn wiewohl sie sich der Gegend nicht erinnerte, war es darum nicht weniger wahrscheinlich, daß dieses der Fontaneiller Wald sey, dessen Grenzen viel zu weit waren, um in den Bezirk ihrer ehemaligen Spaziergänge gekommen zu seyn.
Diese Vermuthung erneute einen Schrecken, der nicht viel geringer war, als die Furcht vor der Villa: denn auf der Abtey war sie nicht minder in der Macht des Marquis und auch in der Macht ihres grausamen Feindes La Motte. Ihre Seele empörte sich vor dem Gemählde, das ihre Fantasie entwarf, und so wie der Wagen unter den Schatten hinfuhr, sah sie ängstlich aus dem Fenster, ob sie nicht einen Gegenstand entdeckte, der ihre Besorgniß bestätigen oder aufheben könnte; sie brauchte nicht lange umher zu blicken — eine Öfnung im Walde zeigte ihr bald die fernen Thürme der Abtey!
»So bin ich denn verloren,« sagte sie, und brach in Thränen aus.
Sie erreichten bald den Vorplatz, und Peter lief, das Thor aufzumachen, vor welchem der Wagen hielt. Als er Adelinen erblickte, sah er bestürzt aus, und machte einen Versuch zu sprechen, allein der Wagen fuhr vor die Abtey, wo an der Thüre der Halle La Motte selbst erschien. Als er herzu trat um sie aus dem Wagen zu heben, überfiel sie ein Zittern am ganzen Körper; mit äusserster Mühe konnte sie sich aufrecht halten, und einige Augenblicke lang, sah sie weder sein Gesicht noch hörte sie feine Stimme. Er both ihr den Arm, um sie herein zu führen, sie wies ihn anfangs zurück, mußte ihn aber ergreiffen, nachdem sie einige Schritte kraftlos fortgeschwankt war.
Sie traten in das gewölbte Zimmer, wo sie in einen Stuhl sank, und eine Fluth von Thränen ihr zu Hülfe kam. La Motte unterbrach ihr Stillschweigen nicht, und ging in anscheinender heftigen Unruhe im Zimmer auf und ab. Als Adeline wieder so viel Bewußtseyn hatte, um äußere Gegenstände zu bemerken, beobachtete sie sein Gesicht, und las da den Aufruhr seiner Seele, während er eine Festigkeit anzunehmen strebte, welche seine bessern Gefühle Lügen straften.
La Motte ergrif ihre Hand, und wollte sie aus dem Zimmer führen; allein sie stand still, und machte mit der Anstrengung der Verzweiflung einen Versuch, ihn um Mitleid und Rettung zu bitten.
Er unterbrach sie:
»Es ist nicht in meiner Macht,« sagte er in sichtlicher Erschütterung. »Ich bin nicht Herr über mich und mein Betragen. Fragen Sie nicht weiter — es ist genug, daß ich Sie beklage; mehr kann ich nicht.«
Er ließ ihr keine Zeit zu antworten, sondern nahm sie bey der Hand und führte sie die Treppe zum Thurm hinauf, und von da in das Zimmer, welches sie vormahls bewohnte.
»Hier müßen Sie fürs erste in einer Verhaftung bleiben, die vielleicht an meiner Seite eben so unfreywillig ist, als sie von der Ihrigen nur seyn sann. Ich wünsche sie Ihnen so leicht als möglich zu machen, und habe deswegen befohlen, Ihnen einige Bücher zu bringen.«
Adeline machte einen Versuch zu reden, allein er eilte aus dem Zimmer, weil er sich der Rolle zu schämen schien, die er übernommen hatte, und vielleicht ihre Thränen nicht ansehn mochte. Sie hörte die Thüre verschließen, und sah, daß auch die Fenster gesichert waren; auch die Thüre, die nach den andern Zimmern ging, war verschlossen. Solche Vorkehrungen zur Sicherheit erschreckten sie, und ohngeachtet sie schon längst alle Hoffnung aufgegeben hatte, fühlte sie doch jetzt ihre Seele tiefer in Verzweiflung sinken.
Als Thränen sie etwas erleichtert hatten, und sie fähig war, ihre Gedanken von den Gegenständen ihres unmittelbaren Zimmers abzuziehn, war ihr die gänzliche Abgeschiedenheit, die man ihr angewiesen, lieb, weil ihr die Pein, die sie in Herrn und Frau von La Mottens Gegenwart fühlen mußte, dadurch erspart, und ihr Freyheit gelassen ward, ungestört ihrem Kummer und eigenen Betrachtungen nachzuhängen; Betrachtungen, die ihrer traurigen Natur ohngeachtet, doch immer der Pein weit vorzuziehn waren, welche die Seele erleidet, wenn sie unter den Erschütterungen von Sorge und Furcht ein ruhiges Äusseres anzunehmen genöthigt ist.
Nach Verlauf einer Viertelstunde wurde ihre Thüre aufgeschlossen und Annette trat mit Erfrischungen und Büchern herein. Sie schien sich zu freuen, Adelinen wieder zu sehn, fürchtete sich aber zu sprechen, weil es wahrscheinlich gegen La Mottens Befehl war, der unten an der Treppe auf sie wartete. Als sie fort war, nahm Adeline einige Erfrischungen, deren sie in der That bedurfte, denn sie hatte nichts zu sich genommen, seit sie das Wirthshaus verließ. Es war ihr lieb, daß Frau von La Motte nicht zum Vorschein kam, die sichtlich ihren Anblick vermied, weil sie sich ihres unedlen Betragens bewußt war; ein Bewußtseyn, welches vermuthen ließ, daß sie noch nicht ganz unfreundschaftlich gegen sie gesinnt wäre.
Adeline dachte über La Mottens Worte nach: »ich bin nicht Herr über mich selbst und über mein Betragen,« und wiewohl sie ihr keinen Grund zur Hoffnung gaben, schöpfte sie doch einen kleinen Trost aus dem Gedanken, daß er Mitleid mit ihr hätte. Nachdem sie einige Zeit in traurigem Nachdenken und mancherley Vermuthungen hingebracht hatte, schienen ihre lange gequälten Lebensgeister Ruhe zu fordern, und sie legte sich auf ihr Bette.
Sie schlief einige Stunden ruhig und erwachte mit erquickter und beruhigter Seele. Um diesen kurzen Frieden zu verlängern und dem Einbruch ihrer eigenen Gedanken zu wehren, untersuchte sie die Bücher, die La Motte ihr geschickt hatte: sie fand einige darunter, die in glücklichern Tagen ihren Geist erhoben und ihr Herz erwärmt hätten; ihre Wirkung war jetzt geschwächt, doch enthielten sie noch immer genug, um das Gefühl ihres Unglücks auf eine Weile zu lindern.
Allein dieser Lethäische Balsam für ein verwundetes Herz war nur ein vorübergehender Segen: La Mottens Hereinkunft löste die Täuschung der Buchstaben auf, und erweckte sie wieder zum Bewußtseyn ihrer Lage. Er kam mit Essen, und sobald er es auf den Tisch gesetzt hatte, verließ er ohne zu reden das Zimmer. Aufs neue versuchte sie zu lesen, aber seine Erscheinung hatte den Zauber gelöst — bittere Betrachtungen kehrten wieder vor ihre Seele, und brachten Theodors Bild mit — Theodors, der auf immer für sie verloren war! —
La Motte erfuhr indessen alle Quaalen, die nur ein noch nicht ganz zum Verbrechen gehärtetes Gewissen auflegen kann. Leidenschaft hatte ihn zu Ausschweifung — Ausschweifung zu Lastern geführt; nachdem er aber einmal den Rand der Schande berührt hatte, folgten die fortschreitenden Stufen einander schnell, und er sah sich jetzt zum Kuppler eines Nichtswürdigen, zum Verräther eines unschuldigen Mädchens gemacht, welches jeder Anspruch der Gerechtigkeit und Menschlichkeit auf seinen Schutz berechtigte.
Er betrachtete sein Gemählde — er schauderte davor zurück, aber er konnte dessen Scheußlichkeit nur durch einen Schritt verändern, der zu edel und kühn für ein bereits von der Gewohnheit des Lasters entnervtes Herz war. Er sah das gefährliche Labyrinth, in welches er sich verwickelt hatte, und seinen Fortschritt im Bösen; fälschlich wähnte er, daß nur weiters Fortgehen ihn aus diesem Labyrinth herausziehen könnte.
Statt auf Mittel zu sinnen, wie er Adelinen retten, und sich selbst von der Schande befreyen könnte, zu ihrem Verderben behülflich zu seyn, bemühte er sich, die Stacheln seines Gewissens zu betäuben, und sich zu überreden, daß es jetzt zu spät sey, in dem einmal angefangenen Laufe umzukehren. Er wußte, daß er in des Marquis Gewalt war, und fürchtete diese Gewalt mehr, als die sichre, wenn auch ferne Strafe, welche auf den Schuldigen wartet. Adelinens Ehre und die Ruhe seines eigenen Gewissens, vermäkelte er willig gegen einige kurze Lebensjahre.
Er wußte nichts von der Krankheit des Marquis, sonst würde er vielleicht eine Möglichkeit, der angedrohten Strafe um einen minder abscheulichen Preis als Schande und Verbrechen zu entgehen, vor sich gesehn, und darauf gedacht haben, sich und Adelinen durch Flucht zu retten. Der Marquis war scharfsinnig genug, dieß vorher zu sehen, und hatte seinem Bedienten scharf anbefohlen, La Motten nichts von dem Umstande, der ihn im Bette zurück hielt, wissen zu lassen, sondern zu sagen, daß er in wenig Tagen selbst nach der Abtey kommen würde, wo sein Bedienter ihn erwarten sollte. Adeline konnte weder Lust noch Gelegenheit haben, des Vorfalls zu erwähnen, und auf solche Art blieb der Umstand La Motten unbekannt, welcher vielleicht ihn von fernern Verbrechen, und Adelinen vom Elende errettet hatte.
Höchst ungern hatte La Motte seiner Frau die Handlung eröfnet, welche ihn durchaus in des Marquis Willkühr geliefert hatte, aber die Unruhe seines Gemüths verrieth ihn größtentheils. Oftmals murmelte er im Schlafe unzusammenhängende Worte, und oft fuhr er aus unruhigem Schlummer auf, und rief Adelinen. Diese Anzeigen eines beängstigten Herzens hatten Frau von La Motte beunruhigt und erschreckt; sie belauschte seinen Schlaf, und erhielt bald aus seinen Worten einen dunkeln Begriff von des Marquis Absichten.
Sie ließ La Motte ihren Verdacht merken: er warf ihr vor, ihn gefaßt zu haben, aber die Art, wie er es that, statt ihre Furcht für Adelinen zu vernichten, vermehrte sie nur; eine Furcht, die des Marquis Betragen bald bestätigte. In der Nacht, wo er auf der Abtey schlief, war ihr eingefallen, daß jetzt wahrscheinlich über den vorhabenden Plan berathschlagt würde, und Besorgniß für Adelinen bewegte sie, sich zu einem Schritt herabzulassen, den sie unter andern Umständen als niederträchtig würde verachtet haben.
Sie ging leise aus ihrem Zimmer in ein Gemach, welches an das große Zimmer stieß, wo sie den Marquis und ihren Mann gelassen hatte, und behorchte ihr Gespräch. Er betraf den Gegenstand, den sie erwartet hatte, und enthüllte ihr den ganzen Umfang des Plans. Erschrocken für Adelinen, und empört über die sträfliche Schwäche ihres Mannes, war sie eine Zeitlang unfähig nachzudenken, oder einen Entschluß zu fassen. Sie wußte, wie große Verbindlichkeit ihr Mann dem Marquis schuldig war, dessen Gebieth ihm diese Zuflucht vor der Welt verschafte, und in dessen Macht es stand, ihn in die Hände seiner Feinde zu verrathen. Auch zweifelte sie nicht, daß der Marquis dazu fähig seyn würde, wenn man ihn reizte; doch glaubte sie, La Motte müßte bey einer solchen Gelegenheit einen Ausweg finden können, ohne seine Ehre Preis zu geben.
Nach einiger Überlegung wurde ihr Gemüthe ruhiger, und sie ging in ihr Schlafzimmer zurück, wohin La Motte ihr bald folgte. Doch waren ihre Lebensgeister jetzt nicht in der Verfassung, sich entweder seinem Unwillen oder seinem Widerspruch auszusetzen, welches beydes sie nur zu gewiß erwarten mußte, wenn sie die Ursache ihrer Bekümmerniß erwähnte; und sie beschloß es lieber bis morgen zu verschieben.
Des andern Morgens sagte sie ihrem Manne alles, was er in seinen Träumen geäußert hatte, und erwähnte noch andere Umstände, die ihn überzeugten, daß es vergeblich sey, ihr länger die Wahrheit läugnen zu wollen. Sie stellte ihm nunmehr vor, wie gut er die Schande, worein er sich zu stürzen im Begriff war, vermeiden konnte, wenn er des Marquis Gebiet verließe, und redete so warm für Adelinen, daß La Motte in finstern Schweigen über die Sache nachzudenken schien.
Allein seine Gedanken wurden bald auf ganz andere Art beschäftigt: er war sich bewußt, eine schreckliche Strafe von dem Marquis verdient zu haben, und sah wohl ein, daß er von Flucht wenig zu hoffen hatte, wenn er ihn durch Verweigerung seiner Wünsche aufbrachte: denn das Auge der Gerechtigkeit und Rache würde ihn mit unermüdeter Schärfe verfolgt haben.
La Motte dachte nach, wie er seiner Frau dieses beybringen sollte, denn er sah, daß kein andres Mittel war, ihrem edlen Mitleid für Adelinen, und den gefährlichen Folgen die er davon befürchten mußte, entgegen zu würken, als wenn er Furcht für seine Sicherheit ihm entgegen setzte; und dieses konnte er nur dadurch, daß er sie den ganzen Umfang der Übel sehn ließ, welche die Empfindlichkeit des Marquis begleiten mußte.
Das Laster hatte noch nicht so ganz sein Gewissen geschwärzt, daß nicht die Röthe der Schaam seine Wange bedeckt, und seine Zunge gestammlet haben sollte, als er im Begriff war, seine Schuld zu bekennen. Endlich, als er es unmöglich fand, das schreckliche Geheimniß zu entdecken, begnügte er sich ihr zu sagen, daß wegen einer Sache, welche zu erläutern ihn keine Bitten bewegen würden, sein Leben in des Marquis Hand sey.
»Sie sehn die Alternative,« sagte er, »wählen Sie zwischen Übeln, und wenn Sie es können, so sagen Sie Adelinen ihre Gefahr, und opfern Sie mein Leben, um sie von einer Lage zu befreyen, welche zu erlangen manchem Mädchen schmeichelhaft seyn würde.«
Frau von La Motte, in die schreckliche Nothwendigkeit gesetzt, die Verführung der Unschuld zuzulassen, oder ihren Mann dem Verderben zu widmen, versank in einen Schmerz, der ihr Innres aufs grausamste zerriß. Doch sah sie ein, daß Widerstand gegen des Marquis Absichten La Motten zu Grunde richten würde, ohne Adelinen zu helfen, und beschloß nachzugeben, und schweigend zu dulden.
Um die Zeit, wo Adeline mit ihrer Flucht umging, hatten Peters bedeutende Blicke La Motten argwöhnisch gemacht und bewogen, sie schärfer zu beobachten. Er sah sie im Vorsaal in sichtlicher Bestürzung aus einander gehn, und bemerkte sie nachher in den Kreuzgängen. So ungewöhnliche Umstände ließen ihn nicht zweifeln, daß Adeline ihre Gefahr entdeckt hätte, und mit Petern über Mittel zur Flucht zu Rathe gingen. Er stellte sich, als wüßte er die ganze Sache, beschuldigte Petern der Verrätherey, und drohte ihm mit der Rache des Marquis, wenn er nicht alles bekennte.
Diese Drohung jagte Petern in Furcht, und da er glaubte, daß doch alle Möglichkeit, Adelinen zu helfen, nunmehr vorbey sey, legte er eine umständliche Beicht ab, und versprach Adelinen nichts von der Entdeckung des Anschlags zu sagen. Bey diesem Versprechen folgte er zum Theil seiner eigenen Neigung, denn er fürchtete sich vor dem Schmerz und Unwillen, den Adeline äußern würde, wenn sie erführe, daß er sie verrathen hätte.
Am Abend des Tages, wo ihre vorgenommene Flucht heraus kam, wollte der Marquis sich auf der Abtey einfinden, und Adelinen nach seiner Villa entführen. La Motte sah auf den ersten Blick, wie sehr es ihnen zu statten kommen würde, wenn man Adelinen in dem Glauben, nicht entdeckt worden zu seyn, nach dem Grabe gehn ließe. Sie ersparten sich dadurch viel Mühe und Widerstand, und er selbst brauchte nicht die Quaal ihrer Gegenwart und ihre Vorwürfe zu leiden.
Ein Bedienter des Marquis konnte um die bestimmte Zeit sich nach dem Grabe verfügen, und in den Mantel der Nacht gehüllt, sie ruhig unter Peters Gestalt entführen. Auf solche Art kam sie ohne Widerstand nach der Villa, und entdeckte ihren Irrthum nicht eher, bis es zu spät war.
Als der Marquis anlangte, sagte ihm La Motte, der seine Besinnung nicht ganz im Rausche verloren hatte, was vorgegangen war, und was er ausgedacht hätte. Der Marquis fand es gut, und sein Bedienter wurde von der Rolle unterrichtet, die er spielen mußte, um Adelinen in seine Hände zu locken.
Ein tiefes Gefühl der unwürdigen Unthätigkeit, wozu sie sich bey Adelinens Sache hatte bewegen lassen, machte, daß Frau von La Motte sorgfältig ihren Anblick vermied, da sie jetzt wieder in der Abtey war. Adeline verstand ihr Betragen, und freute sich, daß ihr die Pein erspart ward, diejenige als Feindinn zu sehn, die sie einst als Freundinn liebte.
Mehrere Tage verstrichen ihr in Einsamkeit, in traurigern Rückblick auf das Vergangene und schreckliche Ahndungen der Zukunft. Theodors gefährliche Lage war der unabläßige Gegenstand ihrer Gedanken Oft athmete sie einen ängstlichen Wunsch für seine Sicherheit; oft sah sie im Kreise der Möglichkeit nach Hoffnung sich um: aber Hoffnung war aus dem Horizont ihrer Aussicht gewichen, und wenn sie erschien, ruhte sie nur auf dem Tode des Marquis, dessen Rache das sicherste Verderben drohte.
Der Marquis lag indessen in sehr zweifelhaftem Zustande in dem Wirthshause zu Caux. Der Arzt und der Feldscher, von welchen er keinen abschaffen, oder aus dem Dorfe lassen wollte, verfuhren nach entgegengesetzten Grundsätzen, und dem guten Mittel des einen wurde oft durch die unvernünftige Behandlung des andern entgegengewirket. Menschlichkeit allein bewegte den Arzt, seine Hülfe nicht abzuziehn.
Die Ungeduld des Marquis, die Furcht vor dem Tode und die Wallung seiner Leidenschaften verschlimmerten die Krankheit. Den einen Augenblick glaubte er sich dem Tode nahe, im andern konnte er kaum sich zurückhalten, Adelinen nach der Abtey zu folgen. So abwechselnd waren die Bewegungen in seinem Innern, und so schnell die Pläne, die einander verdrängten, daß seine Leidenschaften in stetem Kampfe lagen.
Der Arzt suchte ihn zu überzeugen, daß seine Genesung größtentheils von seiner Seelenruhe abhinge, und ihn wenigstens zu einiger Selbstbeherrschung zu bringen; allein er wurde bald durch die ungeduldigen Antworten des Marquis zu verdrüßlichem Stillschweigen gebracht.
Endlich kam der Bediente der Adelinen fortgeführt hatte, zurück, und der Marquis, der ihn an sein Bett kommen ließ, legte ihm so viele hastige Fragen in einem Athem vor, daß der Mensch sich nicht zu helfen wußte. Zuletzt zog er ein zusammengelegtes Papier aus der Tasche, welches Fräulein Adeline, wie er sagte, im Wagen hätte fallen lassen, und welches er in der Meinung, daß Ihro Gnaden es gerne lesen würden, zu sich gesteckt hatte. Der Marquis reichte begierig die Hand und empfing ein an Theodor gerichtetes Billet. Als er die Überschrift las, überwältigte die Wuth der Eifersucht ihn auf einen Augenblick so ganz, daß er unvermögend war es zu lesen.
Endlich brach er es auf und fand einige Zeilen, worin Adeline sich während Theodors Krankheit nach seinem Befinden erkundigte, und die sie ihm zu schicken wahrscheinlich durch einen Zufall verhindert war. Die zärtliche Besorgniß, die dieses Billet ausdrückte, schmerzte den Marquis bis in die Seele, und zwang ihm eine Vergleichung ihrer Gefühle bey seines Nebenbuhlers Krankheit und bey der seinigen ab.
»Um seine Genesung,« sagte er, »konnte sie ängstlich bekümmert seyn; die meinige aber fürchtet sie nur!«
Als wollte er die Pein verlängern, die diese Zeilen ihm verursachten, las er sie noch einmal; aufs neue verwünschte er sein Schicksal, und überließ sich wie gewöhnlich dem Sturm seiner Leidenschaften. Er wollte das Billet zerreissen, als ihm das Siegel in die Augen fiel, welches er sorgfältig betrachtete. Seine Wuth schien jetzt andern Betrachtungen zu weichen; er legte das Billet sorgsam in seine Brieftasche und schien einige Zeit in tiefem Nachdenken verloren.
Nach vielen Tagen der Hoffnung und Furcht überwand die Stärke seiner Natur die Krankheit, und er befand sich wohl genug, um verschiedene Briefe zu schreiben, wovon er einen sogleich an La Motten schickte, um ihm seine nahe Überkunft zu melden. Dieselbe Politik, die ihn bewogen hatte, seine Krankheit vor La Motte zu verbergen, ließ ihn jetzt schreiben, was, wie er selbst wußte, unmöglich war, das er den Tag nach seinem Bedienten auf der Abtey eintreffen würde. Er wiederholte seine Einschärfung, Adelinen scharf zu bewachen, und erneuerte sein Versprechen, La Mottens Dienste reichlich zu belohnen.
La Motte, dessen Verwunderung und Verlegenheit über des Marquis Abwesenheit mit jedem Tage gestiegen war, empfieng diese Nachricht mit Bekümmerniß: denn er hatte zu hoffen angefangen, daß der Marquis seine Absichten auf Adelinen aufgegeben hatte, weil entweder ein neues Abentheuer ihn beschäftigte, oder er vielleicht eine Reise nach seinen entfernten Gütern hätte unternehmen müssen: er wäre herzlich gern auf solche Art eines Handels losgeworden, der so viel Schimpf auf ihn werfen mußte.
Diese Hoffnung war nunmehr verschwunden und er befahl seiner Frau, sich zu des Marquis Empfang anzuschicken. Adeline brachte diese Tage in einem Zustande von Ungewißheit hin, den bald Hoffnung erheiterte, bald Verzweiflung schwärzte. Dieses Zögern, so weit länger, als sie erwartet hatte, schien zu beweisen, daß des Marquis Krankheit gefährlich war, und wenn sie auf die Folgen seiner Genesung hinblickte, konnte sie sich nicht darüber grämen. So verhaßt war ihrer Seele der Gedanke an ihn, daß sie seinen Nahmen nicht über ihre Lippen bringen, noch an Annetten eine Frage thun mochte, die für ihre Ruhe so wichtig war.
Ohngefähr eine Woche, nachdem La Motte des Marquis Brief empfangen hatte, sah Adeline aus ihrem Fenster einen Trupp zu Pferde die Allee herab sprengen, und erkannte den Marquis mit seinen Begleitern. Sie zog in einem Seelenzustande, der keine Beschreibung leidet, sich vom Fenster zurück, sank in einen Stuhl, und war sich eine zeitlang kaum der Gegenstände um sie her bewußt.
Als sie von ihrem ersten Schrecken sich erhohlt hatte, schwankte sie wieder ans Fenster; sie konnte die Reiter jetzt nicht sehen, hörte aber aus dem Trampeln der Pferde, daß der Marquis sich nach dem großen Thor der Abtey geschwenkt hatte. Sie flehte den Himmel um Schutz und Stärkung, und setzte mit etwas beruhigter Seele sich wieder, um den Ausgang abzuwarten.
La Motte empfing den Marquis mit Äußerungen der Verwunderung über seine lange Abwesenheit, worauf dieser bloß erwiederte, daß Krankheit ihn abgehalten hatte, und sogleich nach Adelinen fragte. Es hieß, sie wäre in ihrem Zimmer, und könnte sogleich gerufen werden, wenn er sie zu sehn verlangte. Der Marquis besann sich, sagte aber endlich, es wäre nicht nöthig, man sollte sie nur genau bewachen.
»Vielleicht, gnädiger Her,« sagte La Motte lächelnd, »ist Adelinens Hartnäckigkeit Ihrer Liebe zu mächtig gewesen; Sie scheinen nicht mehr den vorigen Antheil an ihr zu nehmen.«
»O nicht doch,« erwiederte der Marquis; »ich nehme wo möglich, mehr Antheil an ihr als je: in der That so viel, daß ich sie nicht zu scharf bewacht wissen kann, und deswegen ersuche ich Sie, La Motte, niemand zu ihr zu lassen, wenn Sie nicht selbst sie beobachten können. Ist das Zimmer, wo sie sich aufhält, hinlänglich verwahrt?«
La Motte bejahte es, äusserte aber zugleich den Wunsch, daß man sie nach der Villa bringen möchte:
»Wann sie auf eine oder die andere Art Mittel fände zu entwischen,« sagte er, »so weiß ich, was mir von Ihrem Unwillen, gnädiger Herr, bevorstehn würde; und dieser Gedanke hält mich in steter Angst.«
»Für jetzt kann sie nicht dorthin gebracht werden; sie ist hier sicherer: und Sie haben Unrecht, sich mit Besorgnissen wegen ihrer Entwischung zu ängstigen, wenn ihr Zimmer wirklich so gut verwahrt ist, als Sie vorgeben.«
»Ich kann keinen Bewegungsgrund haben, Sie hierin zu hintergehn, gnädiger Herr!«
»Ich habe Sie auch wegen keines in Verdacht; bewachen Sie sie nur sorgfältig, und glauben Sie mir, daß sie nicht entwischen wird. Ich kann mich auf meinen Bedienten verlassen, und wenn Sie es lieber sehn, soll er hier bleiben.«
La Motte hielt es nicht für nöthig, und es wurde beschlossen, ihn nach Hause zu schicken.
Der Marquis unterhielt sich ohngefähr eine halbe Stunde mit La Motte, und verließ dann die Abtey, von welcher Adeline ihn mit einer Mischung von Verwunderung und dankbarer Freude, ihr fast zu mächtig ward, abreisen sah. Sie hatte jeden Augenblick in Erwartung geschwebt, herunter gerufen zu werden, und sich mit Entschlossenheit zu waffnen gesucht, um seinem Anblick entgegen zu gehn. Sie hatte auf jeden Laut, der von unten herauftönte, auf jeden Fußtritt gehorcht, und ihr Herz klopfte von steter Furcht, daß La Motte hereintreten würde, um sie zu dem Marquis zu führen. Dieser Zustand ängstlicher Quaal hatte beynahe länger gedauert, als sie auszuhalten vermochte, als sie Stimmen unter ihrem Fenster hörte, und da sie aufstand, den Marquis fortreiten sah.
Nachdem sie der Freude und Dankbarkeit, die ihr Herz schwellten, Raum gegeben hatte, suchte sie sich dieses Fortgehn zu erklären, das nach allem vorgefallnen allerdings befremdend war. Sie konnte es nicht ergrübeln, und nach langem fruchtlosen Nachsinnen, ließ sie den Gegenstand fahren und suchte sich zu überreden, daß es nur etwas Gutes bedeuten konnte.
Die Zeit, wo La Motte gewöhnlich erschien, war jetzt nahe, und Adeline erwartete ihn, mit der zitternden Hoffnung, zu hören, daß der Marquis von seiner Verfolgung abgestanden sey; allein La Motte war wie gewöhnlich mürrisch und schweigend, und erst als er im Begriff war, wieder hinaus zu geben, faßte Adeline Muth ihn zu fragen, wenn er den Marquis wieder erwartete.
La Motte antwortete, die Thüre in der Hand, »Morgen,« und Adeline, die Furcht und Delikatesse verlegen machte, sah, daß sie nichts von Theodor erfahren konnte, ausser durch gerades Fragen: sie sah aus als wollte sie reden; La Motte stand still; allein sie erröthete und schwieg wieder, bis sie als er hinaus gehen wollte, ihn schwach zurück rief:
»Ich wollte nach dem unglücklichen Capitain fragen,« sagte sie, »der durch sein Bemühen mich zu retten, des Marquis Rache gereitzt hat. Hat der Marquis nichts von ihm erwähnt?«
»Allerdings und Ihre Gleichgültigkeit gegen den Marquis ist nun hinlänglich erläutert.
»Eben so gut, als ich Unwillen gegen die empfinden muß, welche mich beleidigen,« sagte Adeline ernsthaft, »wird es mir auch vergönnt seyn, denjenigen dankbar zu seyn, die mir Dienste leisten. Hätte der Marquis meine Achtung verdient, so würde er sie wahrscheinlich erlangt haben.«
»Gut, gut,« fiel La Motte ein, »dieser junge Held, Ihr Theodor, der wie es scheint, tapfer genug gewesen ist, sich an seinem Obristen zu vergreifen, ist in guter Verwahrung, und wird, wie ich nicht zweifle, bald den Preis seines Donquischottismus empfangen.«
Unwillen, Schmerz und Furcht kämpften in Adelinens Brust; sie verachtete es, La Motten Gelegenheit zu geben, noch einmahl Theodors Nahmen zu entweihn; doch trieb die Ungewißheit, worunter sie erlag, sie zu der Frage, ob der Marquis von ihm gehört hätte, seit er Caux verlassen.
»Ja,« sagte La Motte, »er ist sicher nach seinem Regiment gebracht, wo er verhaftet wird, bis der Marquis dem Verhör gegen ihn beywohnen kann.«
Adeline hatte weder Lust noch Muth, weiter zu fragen, und als La Motte das Zimmer verließ, blieb sie dem Schmerze, den er erneut hatte, überlassen. Wiewohl diese Nachricht keine neue Bestätigung ihres Unglücks enthielt, (denn sie hörte nun, was sie lange erwartet hatte) schien doch eine neue Last von Kummer auf ihr Herz zu fallen, und sie wurde gewahr, daß sie ohne es zu wissen, der heimlichen Hoffnung nachgehangen hatte, daß Theodor entwischen würde, ehe er seinen Bestimmungsort erreichte.
Jetzt war alle Hoffnung verschwunden, er schmachtete im Elend eines Kerkers und unter den Quaalen seiner Besorgnisse für sein eignes Leben, und für ihre Sicherheit. Sie mahlte sich das dunkle feuchte Gefängniß, wo er lag, mit Ketten beladen, bleich vor Krankheit und Kummer; sie hörte ihn in einer Stimme, die auf ihrem Herzen zitterte, ihren Nahmen rufen, und in stummen Flehn seine Hände zum Himmel aufheben: sie sah die Todesangst auf seinem Gesicht; die Thränen, die langsam seine Wangen hinab rollten, und erinnerte sich zugleich des Edelmuths, der ihn in diesen Abgrund des Elendes gestürzt; erinnerte sich, daß sie es war, um die er litt, — ihr Schmerz stieg zur Verzweiflung — ihre Thränen versiegten, und sie sank in einen Zustand schrecklicher Betäubung.
Der Marquis kam den andern Morgen und ging fort wie den Tag zuvor. Mehrere Tage verstrichen, ohne daß er sich wieder sehn ließ, bis er eines Abends, als La Motte und seine Frau in ihrem gewöhnlichen Zimmer saßen, hereintrat. Er sprach eine Weile von allgemeinen Gegenständen, verfiel aber bald in tiefes Nachdenken, stand auf, und zog La Motten ans Fenster.
»Ich möchte Sie gern allein sprechen, wenn Sie Zeit haben,« sagte er; »sonst aber kann es ein andermal geschehn.«
La Motte versicherte ihn, er habe vollkommen Zeit und wollte ihn in ein anderes Zimmer führen, allein der Marquis schlug einen Spaziergang ins Holz vor. Sie gingen zusammen fort, und als sie einen einsamen Platz erreicht hatten, wo die ausgebreiteten Zweige der Eiche und Buche die Schatten der Dämmerung vertieften, und eine feyerliche Dunkelheit rings umher verbreiteten, wandte sich der Marquis zu La Motten und redete ihn mit folgenden Worten an:
»Sie befinden sich in einer unglücklichen Lage, La Motte; diese Abtey ist ein trauriger Aufenthalt für einen Mann Ihres Gleichen, der Gesellschaft liebt und Talente besitzt, sie zu schmücken.« —
La Motte verneigte sich —
»Ich wünschte, Sie der Welt wieder geben zu können,« fuhr der Marquis fort, »und vielleicht könnte Ihnen mein Einfluß wirklich nützen, wenn ich von den nähern Umständen, die Sie daraus vertrieben haben, unterrichtet wäre. Mich dünkt von Ihnen verstanden zu haben, daß es eine Ehrensache war?« —
La Motte schwieg. —
»Ich möchte Sie nicht gern in Verlegenheit setzen; und es ist nicht gewöhnliche Neugier, die mir diese Fragen eingibt, sondern der aufrichtige Wunsch, Ihnen zu dienen. Sie haben mir schon einiges von Ihren Umständen gesagt: ich denke, Ihre Lebhaftigkeit verleitete Sie zu Ausgaben, die Sie nachher durchs Spiel zu bestreiten suchten.«
»Ja, gnädiger Herr, ich verschleuderte den größten Theil eines ansehnlichen Vermögens in üppigen Befriedigungen, und ergriff nachher unwürdige Mittel, es wieder zu gewinnen — allein ich wünschte, daß Sie mich dieses Gespräch überhöben. Wo möglich möchte ich die Erinnerung an eine Handlang verlieren, die meine Ehre auf immer beflecken muß, und deren harte Folgen zu mildern, wie ich fürchte, nicht in Ihrer Macht ist.«
»Darin könnten Sie sich doch vielleicht irren: mein Einfluß bey Hofe ist nicht gering. Fürchten Sie von mir keinen strengen Tadel: es ist nicht mein Fehler, hart über andere zu urtheilen. Ich weiß, was man den Umständen zu gute halten muß, und ich denke, La Motte, Sie haben mich bisher als Ihren Freund gefunden.«
»Das habe ich gewiß, gnädiger Herr!«
»Und wenn Sie sich erinnern, daß ich eine gewiße Sache aus spätern Zeiten vergeben könnte —«
»Gnädiger Herr, erlauben Sie mir zu sagen, daß ich Ihre Großmuth tief fühle. Die Handlung, deren Sie erwähnen, ist die schlimmste meines Lebens, und was ich außerdem zu erzählen habe, kann mich folglich in Ihrer Meinung nicht tiefer herabsetzen: Nachdem ich den größten Theil meines Vermögens in wollüstigen Vergnügungen verschwendet hatte, suchte ich im Spiel die Mittel, ihren Genuß zu verlängern. Ein anhaltendes Glück setzte mich eine Zeitlang dazu in Stand, und da es meine feurigsten Erwartungen begünstigte, fuhr ich auf dieser Laufbahn fort.
Bald aber zerstörte eine plötzliche Wendung des Glücks meine Hoffnungen, und brachte mich auf den äußersten Punct. In einer Nacht verminderte sich meine Casse bis auf zweyhundert Louisd'or. Auch diese beschloß ich zu wagen, und mein Leben mit ihnen. Denn ich war entschlossen, ihren Verlust nicht zu überleben. Nie werde ich das Schreckliche des Augenblicks vergessen, an dem mein Schicksal hing; nie die Todesangst, die mein Herz ergriff, als der letzte Einsatz dahin war! Ich stand eine Weile in gänzlicher Betäubung, bis das Gefühl meines Unglücks erwachte, und ich meinen Zorn in Flüchen gegen meine glücklichen Nebenbuhler, und in allem Wahnsinn der Verzweiflung austoben ließ. Während dieses Anfalls von Tollheit näherte sich mir ein Mann, der still schweigend alles, was vorging, beobachtete. — ›Sie sind unglücklich, mein Herr,‹ sagte er — ›Ich bedarf dieses nicht zu hören, mein Herr!‹ antwortete ich.
›Man hat Ihnen vielleicht übel mitgespielt,‹ fuhr er fort — ›Ja mein Herr, ich bin zu Grunde gerichtet, und kann also wohl sagen, daß mir übel mitgespielt ist.‹
›Kennen Sie Ihre Mitspieler?‹ — ›Nein, aber ich habe sie in den ersten Gesellschaften getroffen.‹ — ›Dann irre ich wahrscheinlich,‹ sagte er und ging fort.
Diese letzten Worte machten mich aufmerksam, und erregten die Hoffnung in mir, daß mein Geld vielleicht nicht auf ehrliche Art verloren wäre. Ich wünschte nähere Aufklärung und ging dem Manne nach, allein er war schon fort. Ich suchte meine Hitze zu unterdrücken, ging wieder an den Tisch, wo ich mein Geld verloren hatte, stellte mich hinter den Stuhl eines der Leute, die es gewonnen, und beobachtete das Spiel genau. Eine Zeitlang sah ich nichts, das meinen Verdacht bestätigen konnte, endlich aber wurde ich überzeugt, daß er gerecht war F3.
Nach geendigtem Spiel rief ich einen meiner Gegner heraus, und sagte ihm was ich bemerkt hatte, indem ich zugleich drohte, ihn augenblicklich preis zu geben, wenn er mir mein Geld nicht wieder schaffte. Er war eine Zeitlang eben so bestimmt als ich, spielte den Bravo und drohte mich für meine schimpflichen Behauptungen zu züchtigen.
Ich war indessen nicht in der Stimmung, mich so leicht schrecken zu lassen, und sein Betragen brachte meinen Zorn, der ohnehin durch mein Unglück schon entflammt war, aufs Höchste. Ich gab ihm seine Drohungen zurück, und war im Begriff ins Zimmer zurück zu gehen und öffentlich zu sagen, was geschehen war, als er mit verstelltem Lächeln und gemäßigter Stimme mich bat, nur einige Augenblicke zu warten, und ihn mit seinem Mitspieler reden zu lassen.
Dieß letzte war ich nicht willens zu gestatten, allein indem trat der Herr selbst herein. Sein Mitspieler erzählte ihm in wenig Worten, was zwischen uns vorgegangen war, und das Schrecken auf seinem Gesicht verrieth genugsam sein Bewußtseyn der Schuld.
Sie gingen bey Seite, und nach einem leisen Gespräch kamen sie mit dem Antrage eines Vergleichs, wie sie es nannten, zu mir. Ich wollte nichts von der Art hören, und schwur hoch und theuer, daß ich nichts geringers als die ganze verlorne Summe annehmen würde. — ›Wäre es nicht möglich, mein Herr, Ihnen etwas eben so vortheilhaftes als das Ganze, anzubiethen?‹ — Ich verstand ihre Meinung nicht; und nach einigen entfernten Winken von der nehmlichen Art, fanden sie für gut; sich deutlich zu erklären.
Da sie ihre Ehre ganz in meiner Gewalt sahen, wünschten sie mich zu sichern und sagten mir, sie gehörten zu einer Gesellschaft, die auf Kosten der Thorheit und Unerfahrenheit Anderer lebte; worauf sie mir antrugen, ihnen beyzutreten. Meine Umstände waren schlecht genug, und dieser Vorschlag konnte mir nicht nur unmittelbare Aushülfe verschaffen, sondern mich auch in Stand setzen, die ausschweifenden Vergnügungen wieder zu genießen, woran anfangs Leidenschaft und nachher lange Gewohnheit mich kettete. Ich wurde mit ihnen eins — und sank vom zerstreuten Leben in Schande.«
La Motte hielt inne, als wenn die Erinnerung dieser Zeiten ihn mit Vorwürfen erfüllte. Der Marquis verstand sein Gefühl.
»Sie urtheilen zu hart von sich selbst,« sagte er, »es gibt wenig Menschen, mögen sie auch einen noch so großen Anstrich von Redlichkeit haben, die unter solchen Umständen anders würden gehandelt haben. Die strenge Tugend, welche Sie verdammen würde, mag sich immerhin mit dem Nahmen Weisheit brüsten — ich mag sich nicht. Möge sie immerhin da wohnen, wo sie meistens gefunden wird, in den kalten Herzen derer, die, da Menschengefühl ihnen fehlt, sich mit dem Titel Philosophen schmücken. — Aber fahren Sie fort —«
»Unser Glück war eine zeitlang unbegrenzt: denn wir hielten das Rad der Göttinn und trauten ihren Launen nicht. Unbesonnen und wollüstig von Natur hielten meine Ausgaben gleichen Schritt mit meiner Einnahme. Endlich aber machte ein junger Deutscher eine unglückliche Entdeckung unsers Verfahrens, welche uns in die Nothwendigkeit setzte, auf einige Zeit mit äußerster Vorsicht zu Werke zu geben. Es würde langweilig seyn, Ihnen alle Umstände zu erzählen, die uns endlich so verdächtig machten, daß durch die entfernte Höflichkeit und kalte Zurückhaltung unserer Bekannten, uns die öffentlichen Gesellschaften sowohl unangenehm, als unnütz wurden. Wir dachten auf andre Mittel Geld zu bekommen, und eine sehr mißliche Verhandlung von hohem Belang, worauf ich mich unglücklicher Weise einließ, zwang mich bald Paris zu verlassen. Sie wißen das übrige, gnädiger Herr!«
La Motte schwieg, und der Marquis dachte eine Weile nach.
»Sie sehen, gnädiger Herr,« fing La Motte endlich wieder an, »Sie sehen, daß meine Lage hoffnungslos ist.«
»Schlimm ist sie allerdings, aber nicht ganz hoffnungslos. Ich bedaure Sie von ganzem Herzen. Doch glaube ich, wenn Sie in die Welt zurückkehren, und es darauf ankommen lassen wollten, Sie durch meinen Einfluß bey dem Minister vor schwerer Strafe schützen zu können. Allein Sie scheinen den Geschmack an Gesellschaft verloren zu haben, und vielleicht ist es nicht mehr ihr Wunsch, zu ihr zurückzukehren?
»Ach gnädiger Herr, können Sie daran zweifeln? — Aber das Übermaß Ihrer Güte beschämt mich. Wollte der Himmel, ich könnte Ihnen die Dankbarkeit beweisen, welche sie in mir erregt!«
»Reden Sie nicht von Güte,« versetzte der Marquis. »Ich will nicht behaupten, daß mein Wunsch, Ihnen zu dienen, von allem Eigennutz frey ist. Ich mache keinen Anspruch darauf, mehr als Mensch zu seyn, und glauben Sie mir, diejenigen, die es thun, sind, weniger. Sie haben es in Ihrer Macht, mir Ihren Dank zu bezeugen, und mich auf immer zu gewinnen.« —
Er schwieg.
»Sagen Sie mir nur wodurch,« rief La Motte, »sagen Sie mir wodurch, und wenn es in den Grenzen der Möglichkeit liegt, soll es geschehen.«
Der Marquis schwieg noch.
»Zweifeln Sie an meiner Aufrichtigkeit, gnädiger Herr, weil Sie schweigen? Fürchten Sie dem Manne Ihr Vertrauen zu schenken, den Sie bereits mit Verbindlichkeiten überhäuft haben, der durch ihre Schonung, ja fast nur durch Ihre Unterstützung lebt?«
Der Marquis sah ihn ernsthaft an, ohne aber zu reden.
»Ich habe dieß nicht von Ihnen verdient, gnädiger Herr, sprechen Sie, ich beschwöre Sie!«
»Es gibt gewisse Vorurtheile, die dem menschlichen Gemüth eingewurzelt sind,« sagte der Marquis mit langsamer, feyerlicher Stimme, »Vorurtheile, welche nicht auf unsre Glückseligkeit einwirken zu lassen, alle unsre Weisheit erfordern wird; gewisse eingeführte Begriffe die wir in der Kindheit einsaugen, und unwillkührlich mit dem Alter nähren: die in uns aufschießen und einen so trüglichen Schein annehmen, daß wenig Menschen in sogenannten civilisirten Ländern sich nachher davon losreißen können. Wahrheit wird oftmahls durch Erziehung verdreht. Während der verfeinerte Europäer sich rühmt; ein Maasstab der Ehre, ein erhabenes Muster der Tugend zu seyn, die ihn oft vom Vergnügen zum Elend, von der Natur zu Abirrungen führt, folgt der einfache, unaufgeklärte Amerikaner den Eingebungen seines Herzens, und gehorcht dem Triebe natürlicher Weisheit.«
Der Marquis hielt inne, und La Motte horchte mit begieriger Erwartung.
»Die von keiner falschen Verfeinerung befleckte Natur,« fuhr der Marquis fort, »handelt allenthalben bey wichtigen Vorfällen des Lebens sich gleich. Der Indianer entdeckt, daß sein Freund treulos ist, und ermordet ihn: der wilde Asiate macht es eben so: der Türke, wenn Ehrgeitz ihn befeuert, oder Rache ihn reitzt, befriedigt seine Leidenschaft auf Kosten des Lebens und nennt es nicht Mord. Selbst der feine Italiener, von Eifersucht geleitet, oder durch starke Versuchung gelockt, zieht seinen Dolch und führt sein Vorhaben aus. Es ist der erste Beweis einer größern Seele, sich von Vorurtheilen des Landes oder der Erziehung los zu machen. Sie schweigen La Motte — sind Sie nicht meiner Meinung?«
»Ich höre, gnädiger Herr, auf Ihr Raisonnement.«
»Es gibt Leute, ich wiederhole es,« sagte der Marquis, »deren Geist so schwach ist, daß er vor Handlungen zurückbebt, welche sie lange als unrecht anzusehn, gewohnt waren, so nützlich sie auch seyn mögen. Sie lassen sich nie von den Umständen leiten, sondern bestimmen einen gewissen Maasstab fürs Leben, von dem sie nichts abzubringen vermag. Selbsterhaltung ist das große Gesetz der Natur. Wenn eine Fliege uns flicht, oder ein Raubthier uns droht, so suchen wir ohne Bedenken es zu vernichten. Wann mein Leben, oder was zu meinem Leben wesentlich ist, ein andres, zum Opfer fordert, ja, wenn nur eine durchaus unüberwindliche Leidenschaft es fordert, so wäre ich unsinnig, wenn ich mich bedächte. — La Motte, ich denke ich kann Ihnen trauen — es gibt gewisse Wege, gewisse Dinge zu thun — Sie verstehn mich. — Es gibt Zeiten, Umstände und Gelegenheiten — Sie begreifen, was ich meine?«
»Erklären Sie sich gnädiger Herr!«
»Freundschaftsdienste, die — mit einem Worte, es gibt Dienstleistungen, die unsre ganze Dankbarkeit heischen, und die wir nie genugsam belohnen können. Es steht in Ihrer Macht, mich in diesen Fall zu setzen.«
»In meiner Macht, gnädiger Herr? sagen Sie mir die Mittel!«
»Ich habe sie bereits genannt. Diese Abtey ist dem Vorhaben günstig, alles bleibt in ihren Mauern verborgen: sie ist dem Auge der Beobachtung verschlossen — die Stunde der Mitternacht sieht die That, und der Morgen dämmert nicht auf, sie zu enthüllen: diese Wälder sind stumm! — O La Motte, habe ich Recht, Ihnen zu trauen; darf ich glauben, daß Sie wünschen mir zu dienen und sich selbst zu erhalten?
— Der Marquis schwieg und sah starr La Motten an, dessen Gesicht die Dunkelheit des Abends fast verbarg.
»Gnädiger Herr, Sie können mir in allem trauen; erklären Sie sich deutlicher.«
»Welche Sicherheit wollen Sie mir für Ihre Treue geben?«
»Mein Leben, gnädiger Herr, ist es nicht bereits in Ihrer Hand?«
Der Marquis zögerte, und sagte dann:
»Morgen um diese Zeit werde ich wieder hier seyn, und mich Ihnen erklären, wenn Sie mich wirklich noch nicht verstanden haben sollten. Sie mögen indessen Ihre Entschlossenheit prüfen und sich bereiten, entweder meinem Plan beyzutreten, oder das Gegentheil zu erklären.«
La Motte gab eine verwirrte Antwort.
»Adieu bis Morgen,« sagte der Marquis. »Bedenken Sie, daß Freyheit und Überfluß jetzt vor Ihnen liegt!«
Er ging nach der Abtey zu, stieg zu Pferde, und ritt mit seinen Bedienten davon.
La Motte schlich langsam und tiefsinnig nach Hause.
Der Marquis fand sich pünctlich ein. La Motte empfing ihn am Thore, allein er wollte nicht herein gehen, sondern sagte, ein Spaziergang im Walde wäre ihm lieber, und La Motte begleitete ihn also dahin. Nach einigem allgemeinen Gespräch fing der Marquis an:
»Nun La Motte, haben Sie überlegt, was ich Ihnen sagte, und sind Sie bereit, sich zu entscheiden.«
»Ich habe es, gnädiger Herr, und werde mich schnell entscheiden, wenn Sie sich näher erklären; eher aber kann ich keinen Entschluß fassen.«
Der Marquis schien unzufrieden und schwieg einen Augenblick.
»Sie verstanden mich also würklich nicht!« sagte er endlich. »Ich muß diese Unwissenheit für erkünstelt halten. La Motte, ich erwarte Offenheit. Sagen Sie mir also, ist es nöthig daß ich mich näher erkläre?«
»Ja, gnädiger Herr, es ist nöthig. Wenn Sie Bedenken tragen sich mir frey anzuvertrauen, wie kann ich denn Ihre Absicht erfüllen?«
»Ehe ich weiter rede, lassen Sie sich einen Eid vorlegen, der Sie zum Geheimniß verbindet: doch dieß ist kaum nothwendig: denn selbst, wenn ich an Ihrem Ehrenwort zweifeln könnte; so müßte die Erinnerung an eine gewisse Begebenheit Ihnen sagen, wie nothwendig es für Sie ist, eben so stumm zu bleiben, als Sie mich wünschen müssen.«
Es entstand eine Stille, während welcher sowohl der Marquis als La Motte einige Verlegenheit verriethen.
»Ich denke, La Motte,« fing der erste wieder an, »ich habe Ihnen hinlängliche Beweise gegeben, daß ich dankbar seyn kann: die Dienste, welche Sie mir bereits bey Adelinen geleistet haben, sind nicht unbelohnt geblieben.«
»Ich werde das stets anerkennen, gnädiger Herr, und beklage nur, daß es nicht in meiner Macht gewesen ist, Ihnen wirksamer zu dienen. Ich bin bereit, Ihre fernern Absichten mit ihr aus besten Kräften zu befördern.«
»Ich danke Ihnen: — Adeline —«
Der Marquis stockte.
»Adeline« wiederhohlte La Motte, begierig, seinen Wünschen zuvor zu eilen, »Adeline besitzt Schönheit, die Ihrer Bemühung würdig ist. Sie hat Ihnen eine Leidenschaft eingeflößt, auf die sie stolz seyn sollte, und was es auch koste, sie muß die Ihrige werden. Ihre Reize verdienen« —
»Ja, ja,« unterbrach der Marquis, »aber —«
Er schwieg.
»Aber sie haben Ihnen zu viel gekostet,« sagte La Motte, »und ich muß es selbst gestehen: aber dieß alles ist jetzt überstanden, und Sie können sie nunmehr ungehindert als Ihr Eigentum betrachten.«
»Das wollte ich auch« sagte der Marquis, und heftete einen durchdringenden Blick auf La Motte; » das wollte ich auch.«
»Nennen Sie nur die Stunde, gnädiger Herr; Sie sollen nicht gestört werden; solche Schönheit, als Adeline besitzt —«
»Bewachen Sie sie scharf,«, unterbrach der Marquis,, und lassen sie auf keinen Fall aus ihrem Zimmer gehn. Wo ist sie jetzt?«
»In ihr Zimmer gesperrt.«
»Recht gut, aber ich bin ungeduldig.«
»Bestimmen Sie nur Ihre Zeit, gnädiger Herr — morgen Nacht? —«
» Morgen Nacht — ja, morgen Nacht,« sagte der Marquis langsam und feyerlich. »Verstehen Sie mich nun?«
»Vollkommen, gnädiger Herr; diese Nacht wenn Sie es wünschen. Aber war es nicht besser, Sie schickten Ihren Bedienten fort, und blieben selbst im Walde. Sie wissen die Thüre, die auf den westlichen Thurm stößt. Kommen Sie um zwölfe dahin — ich will Sie alsdann in Adelinens Zimmer führen. Diese Nacht also —«
» Stirbt Adeline!« fiel der Marquis mit dumpfer, kaum menschlicher Stimme ein. »Verstehn Sie mich nun?«
La Motte fuhr bleich zurück —
»Gnädiger Herr!«
»La Motte!« — sagte der Marquis. —
Es entstand, eine Stille von einigen Minuten, während welcher La Motte sich zu fassen suchte.
»Erlauben Sie mir, gnädiger Herr, zu fragen, was dieß bedeutet,« sagte er, sobald er wieder Luft schöpfen konnte; »wie können Sie Adelinens Tod wünschen? den Tod der Adeline, die Sie noch vor kurzem so heiß liebten?«
»Fragen Sie nicht weiter,« sagte der Marquis mit furchtbar finsterm Blick — »fragen Sie nicht nach meinen Ursachen, aber es ist so gewiß als ich lebe, daß sie, die Sie eben nannten, sterben muß. Dieß ist genug!«
La Mottens Erstaunen glich seinem Entsetzen.
»Die Mittel sind mancherley,« fuhr der Marquis fort; »es wär mir lieber gewesen, kein Blut fließen zu lassen; es gibt Tränke, deren Wirkung schnell und sicher ist, allein sie lassen sich nicht so bald, oder heimlich genug herbeyschaffen, und ich wünschte, daß es geschehen wäre — es muß schnell geschehen — diese Nacht!« —
» Diese Nacht? gnädiger Herr!«
»Ja, La Motte, diese Nacht« — er faßte ihn fest bey der Hand, und sah ihm starr ins Auge — »diese Nacht! Haben Sie keinen bequemen Trank bey der Hand?«
»Keinen, gnädiger Herr?«
»Ich möchte mich nicht gern einem Dritten anvertrauen, sonst hätte ich dafür gesorgt. Da es nun einmahl nicht anders ist, so nehmen Sie diesen Dolch. Brauchen Sie ihn, wie die Gelegenheit es mit sich bringt, aber seyn Sie entschlossen.«
La Motte nahm mit zitternder Hand den Dolch und starrte ihn eine Weile an, ohne zu wissen wie ihm geschah.
»Stecken Sie ihn bey,« sagte der Marquis, »und seyn Sie ein Mann!«
La Motte that es, blieb aber in tiefsinnigem Schweigen.
Er sah sich in dem Netze gefangen, welches seine eigenen Verbrechen geflochten hatten. Er war einmahl in der Hand des Marquis, und wußte, daß er entweder in eine That, vor der er, Trotz aller seiner Versunkenheit, zurückschauderte, einwilligen, oder Glück, Freyheit, ja wahrscheinlich das Leben selbst aufopfern mußte. Er war durch langsame Stuffen von Thorheit zu Lastern fortgeschritten, bis er nun einen Abgrund der Schuld vor sich sah, vor welchem selbst sein so lange eingeschlummertes Gewissen zurück schrack. Der Rückweg war verzweifelt — das Fortschreiten war es ebenfalls.
Wenn er an Adelinens Unschuld und Hülflosigkeit, an ihren verwaisten Zustand, an ihr vormahliges zärtliches Betragen, ihr Vertrauen auf seinen Schutz dachte, so zerfloß sein Herz in Mitleid wegen des Leidens, das er bereits über sie gebracht hatte, und schauderte mit Entsetzen vor der That, die von ihm gefordert ward. Wenn er aber von der andern Seite bedachte, daß die Rache des Marquis ihm gewisses Verderben drohte, und dagegen die Vortheile der ihm angebornen Gunst, Freyheit und Reichthum abwog, so siegte die Versuchung über das Flehen der Menschlichkeit, und brachte die Stimme des Gewissens zum Schweigen.
In diesem Zustande tumultuarischen Hin- und Herschwankens blieb er lange stumm, bis die Stimme des Marquis ihn zur Überzeugung aufschreckte, wie nothwendig es sey, wenigstens zum Schein in seine Absichten zu willigen.
»Sind Sie unschlüßig? —« sagte der Marquis.
»Nein, gnädiger Herr, mein Entschluß ist gefaßt — ich will Ihnen gehorchen. Doch dünkt mich, es wäre besser, Blutvergiessen zu vermeiden. Seltsame Geheimnisse sind dadurch an den Tag —«
»Aber wie sollen wir es vermeiden?« fiel der Marquis hastig ein. »Gift mag ich nicht wagen herbeyzuschaffen. Ich habe Ihnen ein sicheres Werkzeug des Todes gegeben. Sie werden es ebenfalls gefährlich finden, nach einem Tranke zu fragen.«
La Motte begriff, daß er kein Gift kaufen könnte, ohne sich einer weit gefährlichern Entdeckung auszusetzen, als er zu vermeiden wünschte.
»Sie haben Recht, gnädiger Herr,« sagte er, »und ich will Ihren Befehlen unbedingt folgen.«
Der Marquis fuhr nun in abgebrochenen Reden fort, ihm fernere Anweisung wegen des schrecklichen Plans zu geben.
»In ihrem Schlafe,« sagte er, »um Mitternacht: die Familie wird alsdann zur Ruhe seyn.«
Nachher ersannen sie eine Geschichte, zur Erklärung ihres Verschwindens, nach welcher es scheinen sollte, als wäre sie aus Furcht vor den Anträgen des Marquis entflohen. Die Thüren des westlichen Thurms und ihre Zimmer sollten offen gelassen werden, um ihre Flucht wahrscheinlich zu machen und noch viele andere Umstände wurden zur Bestätigung des Verdachts ersonnen. Sie gingen nun weiter zu Rathe, auf welche Art der Marquis Nachricht von dem Ausgange erhalten könnte, und es wurde ausgemacht, daß er wie gewöhnlich den folgenden Tag nach der Abtey kommen sollte.
»Diese Nacht also,« sagte der Marquis — »kann ich mich auf Ihre Entschlossenheit verlassen?«
»Sie können es sicher, gnädiger Herr!«
»So leben Sie wohl! Wenn wir uns wieder sehn —«
»Wird es vollbracht seyn —« fiel ihm La Motte ins Wort.
Er begleitete den Marquis nach der Abtey und, so bald er ihn aufs Pferd hatte steigen sehn, wünschte er ihm gute Nacht und begab sich auf sein Zimmer, wo er sich einschloß.
Adeline gab indessen in der Einsamkeit ihres Gefängnisses der Verzweiflung ihrer Lage Raum. Sie suchte ihre Gedanken zu ordnen, um sich in eine Art von Ergebung hinein zu vernünfteln; allein die Betrachtung, die das Vergangne, die Vernunft, die das Zukünftige ihr vorstellte, brachten nur das volle Gemählde ihres Unglücks vor ihre Seele, und sie versank in Trostlosigkeit. An Theodor, der durch den höchsten Edelmuth seine Liebe bewiesen, und sich ins Verderben gestürzt hatte, dachte sich mit einem Schmerz, der ihr Innres zu zerreissen drohte.
Das gerade die Handlung, welche alle ihre Dankbarkeit verdiente, und ihre ganze Zärtlichkeit erweckte, die Ursache seines Unterganges seyn mußte, überstieg so sehr alles, was sonst Elend genannt wird, daß ihre Fassung davor erlag. Das Bild des leidenden — des für sie sterbenden Theodors, stand unabläßig vor ihrer Seele, und verbannte oft so ganz alle Gedanken an ihre eigne Gefahr, daß sie nur die seinige fühlte.
Zu Zeiten dämmerte die Hoffnung, die er ihr gegeben hatte, daß er im Stande seyn würde, sein Betragen zu rechtfertigen, oder wenigstes sich Begnadigung zu verschaffen, in ihr auf; allein sie glich dem schwachen Strahl einer Aprilssonne, der vorübergeht, ohne zu erquicken. Sie wußte, daß der Marquis, von Eifersucht erhitzt, nach Rache dürstend, ihn mit unabläßiger Bosheit verfolgen würde.
Was vermochte Theodor gegen einen solchen Feind? Das Bewußtseyn seiner Rechtschaffenheit konnte ihm den Streich nicht ablenken helfen, den verschmähete Leidenschaft und mächtiger Stolz auf ihn abzielte. Ihr Elend wurde um ein großes durch die Betrachtung erhöht, daß keine Nachricht von ihm auf der Abtey zu ihr gelangen konnte, und daß sie über sein Schicksal, wer wußte wie lange, in der schrecklichsten Ungewißheit bleiben mußte.
Sie sah keine Möglichkeit von der Abtey zu entwischen. Sie war eine Gefangne in einem Zimmer, zu welchem alle Zugänge verschlossen waren; sie hatte keine Gelegenheit, mit irgend jemand zu sprechen, wo sie nur eine Möglichkeit, Linderung zu finden, hoffen konnte, und sah sich verurtheilt, in duldendem Schweigen, das über ihr schwebende Geschick zu erwarten, das ihrer Einbildungskraft tausendmahl schrecklicher war, als der Tod selbst.
In einem solchen Zustande ließ sie dem Druck ihres Unglücks freyen Raum, und saß oftmahl ganze Stunden bewegungslos und in Gedanken verloren.
»Theodor!« rief sie oft, »du kannst meine Stimme nicht hören, kannst mir nicht zu Hülfe eilen; du bist selbst gefangen und in Ketten!«
Das Bild war zu schrecklich. Die schwellende Angst ihres Herzens erstickte ihre Stimme, Thränen benetzten ihre Wangen, und sie ward fühllos gegen alles, ausser gegen sein Elend.
Diesen Abend war ihre Seele ungewöhnlich ruhig gewesen; so wie sie von ihrem Fenster mit stillem, wehmüthigem Genuß die untergehende Sonne, den erlöschenden Glanz des westlichen Horizonts, die allmählige Annäherung der Dämmerung betrachtete, trugen ihre Gedanken sie in die Zeit zurück, wo sie in beglückterer Lage dieses Schauspiel erwartete.
Sie erinnerte sich des Abends vor ihrer kurzen Flucht von der Abtey, wo sie aus dem nähmlichen Fenster die herabsinkende Sonne ansah — wie ängstlich sie den Schatten der Dämmerung erwartete, — wie sie voraus blickte in die künftigen Ereignisse ihres Lebens — mit welcher bangen Furcht sie den Thurm hinunter ging, und sich in den Wald wagte. Diese Betrachtungen führten andere mit sich, die ihr Herz mit Wehmuth, und ihr Augen mit Thränen füllten.
In dieser schwermüthigen Träumerey versunken, sah sie den Marquis aufs Pferd steigen und aus den Thoren reiten. Sein Anblick erweckte in aller Kraft das Gefühl des Elends, das er über ihren geliebten Theodor gebracht hatte, und das Bewußtseyn der Übel, die unmittelbarer ihr selbst drohten. Mit bangen Thränen ging sie vom Fenster, bis sie endlich erschöpft vom Weinen sich früh zur Ruhe legte.
La Motte blieb in seinem Zimmer, bis ihn das Abendessen herunter rief. Sein wildes, zerstörtes Gesicht, das trotz aller Gewalt die Erschütterung seiner Seele verrieth, seine langen und häufigen Anfälle von Geistesabwesenheit befremdeten und erschreckten seine Frau. So bald Peter hinaus war, fragte sie zärtlich, was ihn beunruhigt hätte, und er versuchte mit verzerrtem Lächeln den Lustigen zu spielen; allein die Rolle war über seine Kunst, und bald fiel er in stummen Tiefsinn zurück; oder wenn seine Frau sprach und er die Abwesenheit seiner Gedanken zu verbergen strebte, so antwortete er so gänzlich verkehrt, daß seine Zerstreuung nur noch merklicher wurde.
Frau von La Motte that endlich, als merkte sie die Verstörung seines Gemüths nicht, und sie blieben in ununterbrochnem Schweigen bis zur Stunde des Schlafengehns sitzen, wo sie sich in ihr Schlafzimmer verfügten.
La Motte warf sich eine Zeitlang schlaflos umher, und seine Bewegungen weckten seine Frau auf; unterdessen schlief, sie durch eine unbedeutende Entschuldigung von ihm befriedigt, bald wieder ein. Diese Unruhe dauerte bis gegen Mitternacht, wo er sich besann, daß die Zeit, welche zu wichtigen Zwecken bestimmt war, in unnützen Betrachtungen verstrich, und leise aus dem Bette stieg. Er warf seinen Schlafrock um, nahm die Nachtlampe von Tisch und schlich die Wendeltreppe hinauf. Oft sah er sich um, und oft fuhr er auf, und horchte nach dem hohlen Seufzen des Windes.
Seine Hand zitterte so heftig, als er Adelinens Thüre aufschließen wollte, daß er die Lampe an die Erde setzen, und beyde Hände zu Hülfe nehmen mußte. Er glaubte, sie würde von dem Geräusch mit dem Schlüssel erwacht seyn, allein als er die Thüre öfnete, und tiefe Stille durchs ganze Zimmer herrschte, wurde er überzeugt, daß sie schlief.
So wie er sich in der rechten den Dolch und in der linken Hand die Lampe haltend dem Bette näherte, hörte er sie leise athmen und bald nachher seufzen — er stand still; als sie aber still ward, ging er wieder vorwärts, und hörte sie im Schlafe singen. Er horchte aufmerksam, und unterschied einige Töne eines schwermüthigen kleinen Liedes, das sie in ihren glücklichern Tagen ihm oft gesungen hatte. Der tiefe, klagende Ton, worin sie jetzt es lallte, verrieth nur zu deutlich die Stimmung ihrer Seele.
La Motte schritt nunmehr eilends zum Bette, als sie nach einem tiefen Seufzer wieder still ward. Er schlug den Vorhang auf und sah sie in tiefem Schlaf liegen, ihre Wange, noch naß von Thränen auf ihren Arm gelehnt. Er starrte sie einen Augenblick an, und indem er ihr unschuldiges liebliches Gesicht, blaß von Kummer, betrachtete, weckte das Licht, das ihr gerade in die Augen schien, sie auf, und da sie einen Mann sah, that sie einen Schrey.
Als ihre Besinnung zurückkehrte, erkannte sie La Motten, und in der Meinung, daß der Marquis nicht weit wäre, richtete sie sich im Bette auf, und bat ihn flehentlich um Schutz und Mitleid. La Motte stand da und sah sie starr an, antwortete aber nicht.
Seine wilden Blicke und finstres Schweigen vermehrten ihre Angst, und mit Thränen des Schreckens erneute sie ihr Flehen.
»Sie retteten mich einst vom Verderben,« rief sie, »o retten Sie mich auch jetzt! Haben Sie Mitleid mit mir: ich habe keinen Beschützer als Sie!«
»Was fürchten Sie denn?« sagte La Motte mit kaum hörbarer Stimme. —
»O retten, retten Sie mich vor dem Marquis!«
»So stehn Sie denn auf und kleiden sich schnell an. — Ich werde in wenig Minuten wieder kommen.«
Er zündete ein Licht an, das auf dem Tisch stand, und ging aus dem Zimmer. Adeline stand eilends auf und wollte sich anziehn: aber ihre Gedanken waren so verwildert, das sie kaum wußte was sie that, und ihr ganzer Körper zitterte so heftig, daß sie sich kaum einer Ohnmacht erwehren konnte. Sie warf sich so geschwind als möglich in ihre Kleider, und setzte sich nieder, um La Mottens Rückkunft zu erwarten.
Eine lange Zeit verstrich, ohne daß er erschien, und nachdem sie sich vergebens zu faßen gesucht hatte, wurde ihr die Pein des Wartens endlich so unerträglich, daß sie die Thüre ihres Zimmers öfnete, und an die Treppe gieng, um zu horchen. Sie glaubte unten Stimmen zu hören; da sie aber bedachte, daß, wenn der Marquis da wäre, ihre Erscheinung nur ihre Gefahr vergrößern müßte, hielt sie den Fuß zurück, den sie beynahe unwillkührlich schon auf die Treppe gesetzt hatte. Immer noch horchte sie, und immer glaubte sie, Stimmen zu vernehmen: bald darauf hörte sie eine Thüre zumachen, und dann Fußtritte — und eilte in ihr Zimmer zurück.
Beynahe eine Viertelstunde verstrich, und La Motte erschien noch nicht. Sie glaubte wieder Stimmen unten murmeln zu hören, und hin und her gehen dazu, und weil ihre Ängstlichkeit ihr nicht zuließ, in Zimmer zu bleiben, schlich sie sich leise durch den Gang, der auf die Wendeltreppe stieß, aber alles war wieder still. Doch schien nach wenig Augenblicken ein Licht vom Vorsaal herauf, und sie sah La Motten an der Thüre des gewölbten Zimmers. Er sah herauf, und da er sie erblickte, winkte er ihr, herunter zu kommen.
Sie zögerte, und sah sich nach ihrem Zimmer um; allein La Motte kam die Treppe herauf und sie ging ihm mit wankenden Schritten entgegen.
»Ich fürchte, der Marquis wird mich sehn,« sagte sie leise, »Wo ist er?«
La Motte faßte sie bey der Hand und führte sie fort, indem er ihr versicherte, daß sie nichts vom Marquis zu fürchten hätte. Doch schien die Wildheit seines Gesichts, und das Zittern seiner Hand dieser Versicherung zu widersprechen, und sie fragte, wohin er sie führte.
»In den Wald, damit Sie von der Abtey entfliehen können, ein Pferd wartet aussen auf Sie — ich kann Sie auf keine andre Weise retten.«
Ein neues Schrecken ergriff sie. Kaum konnte sie glauben, daß La Motte, der bisher mit dem Marquis einverstanden handelte, und sie in strengem Verhaft hielt, jetzt ihre Flucht selbst befördern wollte, und sie fühlte in diesem Augenblick eine bange Ahndung, die sie sich selbst nicht erklären konnte, daß er sie in den Wald lockte, um sie zu ermorden. Sie fuhr wieder zurück, und flehte um Barmherzigkeit. Er versicherte, daß er nur sie zu retten gesonnen sey, und bat sie, keine Zeit zu verderben.
Es lag etwas in seinem Wesen, welches Aufrichtigkeit sprach, und sie ließ sich von ihm zu einer Nebenthüre führen, die in den Wald ging, wo sie durch die Dunkelheit nur eben einen Mann zu Pferde unterschied. Dieses brachte ihr die Nacht ins Gedächtniß, wo sie im falschen Vertrauen auf den Mann, der am Grabe erschien, sich nach des Marquis Villa entführen ließ. La Motte rief, und Peter antwortete ihm, dessen Stimme Adelinen einigermaßen wieder aufrichtete.
La Motte sagte ihr nun, der Marquis würde morgen früh wieder nach der Abtey kommen, und dieß wäre die einzige Möglichkeit, seinen Anschlägen zu entfliehen. Sie könnte sich auf sein Wort verlassen, daß Peter Befehl hätte, sie zu bringen, wohin sie wollte; doch riethe er ihr, da der Marquis unermüdet sie aufsuchen würde, auf jeden Fall das Königreich zu verlassen, und mit Petern nach Savoyen zu flüchten, wo er eine Schwester hatte. Dort möchte sie bleiben, bis er selbst, für den jetzt kein längeres Verweilen in Frankreich mehr seyn würde, ihr nachkäme. Er bat sie, was ihr auch zustieße, nie der Vorfälle auf der Abtey zu erwähnen.
»Um Sie zu retten, Adeline,« sagte er, »habe ich mein Leben gewagt: vermehren Sie nicht durch unnöthige Entdeckung meine und Ihre Gefahr. Vielleicht sehn wir uns nie wieder, aber ich hoffe, Sie werden glücklich seyn;, und wenn Sie an mich denken, so erinnern Sie sich, daß ich nicht ganz so schlimm war, als man mich machen wollte.«
Mit diesen Worten gab er ihr etwas Geld, daß sie zu Bestreitung ihrer Reise bedürfen würde. Adeline konnte nun nicht länger an seiner Ehrlichkeit zweifeln, und die heftigen Regungen ihrer Freude und Dankbarkeit ließen sie kaum Worte finden. Sie hätte gern der Frau von La Motte Lebewohl gesagt, und bat wirklich darum; allein er wiederhohlte nochmahls, daß sie keine Zeit zu verlieren hätte, wickelte sie in einen großen Mantel und hob sie aufs Pferd. Sie sagte ihm mit Thränen der Dankbarkeit Adieu, und Peter sprengte so schnell, als die Dunkelheit es zuließ, mit ihr davon.
Als sie eine Strecke zurück gelegt hatten, fing er an:
»Ich freue mich von ganzem Herzen, Sie wieder zu sehn, Fräulein. Wer hätte denken rollen, daß nach allen diesem mein Herr selbst mir befehlen würde, Sie fortzubringen! — Nun, es bleibt einmahl gewiß, daß seltsame Dinge in der Welt vorgehen; allein ich hoffe, wir werden dießmahl besseres Glück haben.«
Adeline mochte ihm keine Vorwürfe über seine vorige vermeinte Verrätherey machen, sondern dankte ihm für seine guten Wünsche, und sagte, daß sie ebenfalls hoffte, sie würden dießmahl glücklicher seyn; Peter aber fuhr mit seiner gewöhnlichen Beredsamkeit fort, sie aus ihrem Irrthum zu reissen, und ihr jeden Umstand zu erzählen, den sein Gedächtniß — und gewiß hatte ihm die Natur ein sehr starkes gegeben — nur hergab.
Er äußerte eine so kunstlose Theilnahme an ihrem Wohlergehn, und solche Bekümmernis über alle ihre Kränkung, daß sie nicht länger an seiner Treue zweifeln konnte; und diese Überzeugung stärkte nicht nur ihr Vertrauen auf das gegenwärtige Unternehmen, sondern ließ sie auch mit Güte und Vergnügen auf sein Gespräch hören.
»Ich würde nimmermehr so lange auf der Abtey geblieben seyn,« sagte er, »wenn ich hatte fortkommen können: allein mein Herr setzte mich in solche Furcht vor dem Marquis, und ich hatte auch so wenig Geld, um in mein Land zu kommen, daß ich wohl bleiben mußte. Es ist recht gut, daß wir jetzt einige solide Louisd'or haben; denn ich zweifle sehr, Fräulein, ob die Leute unterwegs die Sächelchens, wovon Sie ehmals sprachen, statt Geldes, würden genommen haben.«
»Vielleicht wohl nicht,« sagte Adeline; »ich weiß es dem Herrn von La Motte Dank, daß er uns mit zuverläßigern Mitteln versehn hat. Welchen Weg müssen wir denn nehmen, Peter, wenn wir aus dem Walde kommen?«
Peter gab sehr genau einen großen Theil des Wegs nach Lyon an.
»Und von da,« sagte er, »können wir leicht zu meiner Schwester nach Savoyen kommen, das ist nur ein Sprung. Meine Schwester, Gott behüte sie, lebt hoffentlich noch, ich habe sie seit vielen Jahre nicht gesehen; allein sollte sie ja nicht mehr leben, so werden alle Leute sich freuen, mich wieder zu sehn, und Sie werden leicht ein Unterkommen finden, und alles was Sie brauchen dazu.«
Adeline beschloß, mit ihm nach Savoyen zu gehn. La Motte, der den Charakter und die Absichten des Marquis kannte, hatte ihr gerathen, das Königreich zu verlassen, und ihr gesagt, was ihre Furcht ihr ohnehin würde eingegeben haben, daß der Marquis sie unermüdet aufsuchen würde. Sein Bewegungsgrund zu diesem Rathe konnte nur der Wunsch seyn, ihr zu dienen; warum hätte er sonst, da sie in seiner Macht war, sie nach einem andern Orte geschaft, und ihr sogar Geld zur Bestreitung der Reisekosten gegeben?
Zu Leloncourt, wo Peter gut bekannt zu seyn sagte, konnte sie Schutz und Fortkommen hoffen, selbst wenn seine Schwester nicht mehr leben sollte; und die Entfernung und einsame Lage des Orts waren ganz nach ihrem Sinn. Diese Betrachtungen würden sie vermocht haben, nach Savoyen zu gehn, wenn sie auch in Frankreich nicht so ganz zufluchtslos gewesen wäre: in ihren jetzigen Umständen blieb ihr kein andrer Ausweg.
Sie erkundigte sich noch weiter nach dem Wege, den sie nehmen müßten, und ob auch Peter hinlänglich Bescheid wüßte?
»Wenn ich erst bis Tiers gekommen bin, so weiß ich mich wohl zu finden,« sagte Peter, »denn ich bin als Kind wohl hundertmahl den Weg gegangen, und jedermann weiß ihn zu sagen.«
Sie ritten nun einige Stunden in Stille und Dunkelheit fort, und erst als sie aus dem Walde kamen, sah Adeline das Morgenlicht die östlichen Wolken bestreichen. Der Anblick erquickte und erheiterte sie, und so wie sie schweigend dahin ritt, verweilte ihre Seele bey den Begebenheiten der vorigen Nacht, und sann auf Entwürfe der Zukunft. La Mottens letzte Freundschaft schien ihr von seinem vorhergehenden Betragen so sehr abzuweichen, daß es sie in Erstaunen und Verwirrung setzte, und sie konnte es nur durch eine der plötzlichen Anwandlungen von Menschlichkeit erklären, die zuweilen selbst auf das verworfenste Herz wirken.
Wenn sie sich aber seiner vorigen Worte erinnerte, »daß er nicht Herr über sich selbst wäre«, so konnte sie kaum glauben, daß bloßes Mitleid ihn sollte bewegt haben, die Bande zu brechen, die ihn bisher so stark fesselten; und wenn sie das veränderte Betragen des Marquis dazu nahm, so war sie geneigt zu glauben, daß sie ihre Freyheit einer Veränderung in dieses letztern Gesinnungen gegen sie verdankte: doch schien der Rath, den La Motte ihr gegeben hatte, das Königreich zu verlassen, und das Geld, womit er sie zu diesem Ende versah, dieser Meinung zu widersprechen, und verwickelte sie aufs neue in Zweifel.
Peter ließ sich nunmehr nach Tiers zurecht weisen; und sie erreichten ohne Unfall diesen Ort, wo sie still hielten, um ein wenig auszuruhn. Sobald Peter glaubte; daß das Pferd sich hinlänglich geruht hätte, machten sie sich wieder auf, und zum ersten Mahle sah Adeline von den reichen lyonnesischen Ebnen den Anblick der fernen Alpen, deren majestätische Häupter das Gewölbe des Himmels zu stützen schienen, und ihre Seele mit erhabenen Regungen erfüllten.
Nach wenig Stunden erreichten sie die Ebne, auf welcher Lyon, erbaut ist, dessen schöne Lage an zwey schiffbaren Flüssen, deren Ufer mit Lusthäusern geschmückt sind, Adelinen von der schwermüthigen Betrachtung ihrer eigenen Umstände und ihrer noch peinlichern Angst für Theodor abzog.
Sobald sie diese geschäftige Stadt erreichten, ließ sie ihr erstes seyn, sich nach einer Überfahrt über die Rhone zu erkundigen: doch fand sie es nicht rathsam, im Wirthshause darnach zu fragen, weil der Marquis ihr vielleicht bis dahin nachspüren, und auf solche Art ihren Weg erfahren konnte. Sie schickte also Petern ans Ufer um ein Boot zu miethen, während sie selbst nur eine leichte Mahlzeit zu sich nahm, um sogleich sich einschiffen zu können.
Peter kam bald zurück, und hatte ein Boot mit Leuten ausgemacht, die sie die Rhone hinauf nach der nächsten Küste von Savoyen bringen sollten, von wo sie zu Lande nach dem Dorfe Leloncourt gehen wollten.
Sobald sie ihre kleine Rechnung berichtigt hatte, ließ sie sich von ihm zu Schiffe führen, wo sich ein neues hinreissendes Schauspiel ihr darboth. Mit angenehmen Staunen sah Adeline den Fluß mit Schiffen besetzt, und den Landeplatz voll geschäftiger Gesichter, und fühlte den Abstand zwischen den fröhlichen Gegenständen rings um sie, und ihr selbst, einer verlaßnen hülflosen Waise, die vor Verfolgung und Vaterland floh. Sie sprach mit dem Schiffsherrn, und nachdem Peter das Pferd aus dem Wirthshause gehohlt hatte, (das La Motte ihm für rückständigen Lohn überließ) schifften sie sich ein.
So wie sie langsam die Rhone hinauf fuhren, deren steile, mit Gebürgen gekrönte Ufer den mannigfaltigsten wilden und romantischen Anblick darstellten, saß Adeline in stilles Träumen versunken. Die Neuheit der Scene, durch welche sie hin schwamm, die bald in schauerlicher Größe sich wölkte, bald in Fruchtbarkeit lächelte, belebt durch Dörfer und Städte, wiegte ihre Seele ein, und ihr Kummer sänftigte sich nach und nach in eine sanfte, nicht unangenehme Schwermuth. Sie hatte ich vorn ans Boot gesetzt, wo sie dessen Rand den schnellen Strom spalten sah, und dem Schlagen der Ruder zuhörte.
Das Boot fuhr einige Stunden langsam gegen den Strom an, und endlich hüllte der Schleyer des Abends die Landschaft ein. Die Luft war milde, und ohne den herabfallenden Thau zu achten, blieb Adeline im Freyen, sah die Gegenstande rings umher sich verdunkeln, die fröhlichen Farben des Horizonts schwinden, und allmählig die Sterne hervorkommen, die auf dem hellen Spiegel des Wassers zitterten.
Die Gegend war jetzt in tiefen Schatten gesunken, und die Stille des Abends wurde nur vom abgemeßnen Schlagen der Ruder, und zu Zeiten durch Peters Stimme, der mit den Schiffern sprach, unterbrochen. Adeline saß in Gedanken verloren: Das Verlaßne ihres Zustandes stellte sich im erhöhten Licht ihrer Einbildungskraft dar.
Sie sah sich von der Dunkelheit und Stille der Nacht umgeben, an einem fremden Orte, fern von allen Freunden, ging ohne zu wissen wohin, unter der Leitung von Fremden und vielleicht von einem gehäßigen Feinde verfolgt! Sie mahlte sich die Wuth des Marquis, wie er jetzt ihre Flucht entdeckt hätte, und wiewohl sie es sehr unwahrscheinlich fand, daß er ihr zu Wasser folgen würde, zitterte sie doch bey dem Gemählde, das ihre Fantasie entwarf. —
Dann wanderten wieder ihre Gedanken zu dem Plan ihres Lebens in Savoyen; und so sehr auch ihre Erfahrung sie gegen die Sitten eines Klosters eingenommen hatte, sah sie doch keinen schicklichern Zufluchtsort. Endlich begab sie sich in die kleine Cajütte, um einige Stunden zu ruhn.
Als Adeline die Abtey verließ, blieb La Motte eine Weile vor dem Thore stehn, um auf die Tritte ihres Pferdes zu horchen, bis der Schall der Hufe sich in der Ferne verlor, und kehrte dann mit einer Leichtigkeit des Herzens, die er lange nicht empfunden hatte, nach der Abtey zurück. Die Freude, sie, wie er hoffte, von den Absichten des Marquis errettet zu haben, überwog auf einige Zeit alles Gefühl der Gefahr, worein dieser Schritt ihn stürzen mußte.
Als er aber deutlich wieder an seine Lage. zurückdachte, traf das Schrecken vor des Marquis Rache wiederum mit voller Gewalt auf seine schuldige Seele, und er überlegte, wie er ihr am besten entgehn könnte.
Es war Mitternacht vorbey — der Marquis wollte in aller Frühe des folgenden Tages kommen, und in dieser Zwischenzeit glaubte er anfangs am sichersten aus dem Walde entfliehen zu können. Aber er hatte nur ein Pferd, und überlegte, ob es zuträglicher wäre, sich unverzüglich nach Auboine aufzumachen, wo er sich einen Wagen verschaffen konnte, um seine Familie und Sachen von der Abtey fortzubringen, oder ruhig des Marquis Ankunft abzuwarten, und zu versuchen, ob er ihn durch eine falsche Geschichte von Adelinens Flucht täuschen konnte.
Die Zeit, die darauf hingehn mußte, bis ein Wagen von Auboine nach der Abtey kam, würde ihm kaum noch so viel übrig gelassen haben, um aus dem Walde zu entwischen; das wenige Geld, was ihm von des Marquis Güte übrig blieb, konnte ihn nicht weit bringen; und wenn es ausgegeben war, sah er kein Mittel zum Fortkommen vor sich, im Fall er bis dahin noch unentdeckt seyn würde.
Wenn er auf der Abtey blieb, so gab er sich das Ansehen, als wäre er sich nicht bewußt, den Unwillen des Marquis zu verdienen, und wiewohl er nicht hoffen durfte, ihn glauben zu machen, daß seine Befehle vollzogen wären, konnte er doch vorgeben, daß nur Peter zu ihrer Flucht geholfen hatte, welches um so wahrscheinlicher war, da er ihn schon einmahl bey einem Anschlage ertappt hatte. Auch entging ihm nicht, daß er, im Fall der Marquis, ihm drohte, ihn in die Hände der Gerechtigkeit zu liefern, sich durch die Drohung retten könnte, das Verbrechen ebenfalls zu entdecken, dessen Begehung der Marquis ihm aufgetragen hatte.
Diese Gründe bestimmten ihn, auf der Abtey zu bleiben und den Ausgang von des Marquis Verdruß abzuwarten.
Als der Marquis wirklich erschien, und Adelinens Flucht hörte, schreckten und beunruhigten die starken Bewegungen seiner Seele, die auf seinem Gesichte erschienen, La Motten über alle Beschreibung. Er verfluchte sich selbst und sie in so rauhen, heftigen Ausdrücken, daß La Motte erstaunte, dieß von einem Manne zu hören, dessen Sitten und äußres Betragen bey aller Heftigkeit und Sträflichkeit seiner Leidenschaften stets gefällig und einnehmend waren. Diese Ausdrücke zu ersinnen und auszutoben schien ihm Lindrung, ja Freude zu seyn. Doch schien er tiefer getroffen durch den Umstand ihrer Flucht, als aufgebracht über La Mottens Nachlässigkeit, endlich besann er sich, daß er nur Zeit verlöre, und verließ die Abtey, um, wie er sagte, seine Leute auf verschiednen Wegen hinter ihr her zu schicken.
Sobald er fort war, empfand La Motte, in der Meinung, daß es ihm gelungen sey, den Marquis durch seine Geschichte zu hintergehen, wiederum das reine Vergnügen, seine Pflicht gethan zu haben, und hoffte, daß Adeline jetzt vor aller Nachstellung sicher wäre. Diese Freude war von kurzer Dauer. In wenig Stunden. kam der Marquis, von Gerichtsdienern begleitet zurück. Der erschrockene La Motte wollte sich verstecken, als er ihn heran kommen sah, wurde aber ergriffen, und vor den Marquis gebracht, der ihn bey Seite zog.
»Man hintergeht mich nicht so leicht durch ein übel ersonnenes Mährchen,« fing er an; »Sie wissen, daß Ihr Leben in meinen Händen ist; sagen Sie mir ohne Umstände, wo Sie Adelinen verborgen haben, oder ich will Sie öffentlich des Verbrechens, das Sie gegen mich begingen, anklagen. Wenn Sie mir aber den Ort ihres Aufenthalts anzeigen, will ich die Gerichtsdiener fortschicken, und wenn Sie es wünschen, Ihnen behülflich seyn, das Königreich zu verlassen. Sie haben keine Zeit sich zu besinnen, und konnten wissen, daß ich nicht mit mir spielen lassen will.«
La Motte versuchte den Marquis zu beruhigen, und behauptete wirklich, nicht zu wissen wohin Adeline geflohen sey.
»Sie werden nicht vergessen, gnädiger Herr, daß Ihre Ehre ebenfalls in meiner Hand ist, und daß, wenn Sie es aufs äusserste kommen lassen, Sie mich zwingen werden, im Angesicht des Tags zu entdecken, daß Sie mich zum Mörder machen wollten.«
»Und wer wird Ihnen glauben? Die Verbrechen, welche Sie aus der Gesellschaft verbannten, werden nicht für Ihre Wahrhaftigkeit zeugen, und das, womit ich jetzt gegen Sie auftrete, wird einen hinlänglichen Beweis mit sich führen, daß Ihre Anklage boshaft ist. — Gerichtsdiener thut eure Schuldigkeit.«
Sie traten herein und ergriffen La Motten, dem der Schrecken jetzt alle Kraft zum Widerstande raubte, hätte auch Widerstand ihm helfen können, und der in seiner Angst und Bestürzung dem Marquis sagte, daß Adeline den Weg nach Lyon genommen hätte. Diese Eröffnung kam jetzt zu spät, um ihm zu nützen; der Marquis benutzte den Vortheil, den sie ihm gab, allein der Schritt war geschehen, und mit dem Schmerz, Adelinen ausgesetzt zu haben, ohne sich dadurch zu nützen, unterwarf sich La Motte schweigend seinem Schicksal.
Die Gerichtsdiener ließen ihm kaum Zeit, seine wenigen Sachen zusammen zu packen, und führten ihn von der Abtey, doch ließ der Marquis aus Rücksicht auf der Frau von La Motte äussersten Jammer einen seiner Bedienten von Auboine einen Wagen herbey schaffen, damit sie ihrem Manne folgen konnte.
Indessen schickte der Marquis, erfreut, Adelinens Weg zu wissen, seinen treuen Kammerdiener hinter ihr her, mit dem Befehl, sobald er sich aufgespürt und gesichert hätte, nach der Villa zurück zu kommen.
Der Verzweiflung Preis gegeben, verließen La Motte und seine Frau den Fontaneiller Wald, der so viele Monathe ihnen eine Zuflucht verschafft hatte, und schifften sich noch einmahl ein in die stürmische Welt, wo die Gerechtigkeit in Gestalt des Verderbens auf La Motten wartete. Als Vertriebene, durch La Mottens Vergehungen, waren sie in den Wald eingegangen, und fanden eine zeitlang die gesuchte Sicherheit; andere Verbrechen aber — denn selbst in diesem abgeschiedenen Aufenthalt fehlte es nicht an Versuchung, folgten bald, und sein Leben, bereits durch die Strafe des Lasters gestämpelt, both ihm jetzt einen neuen Beweis der Wahrheit dar, daß wo Schuld ist, Friede niemahls wohnen kann.
Adeline und Peter setzten indessen ihre Reise ohne allen Unfall fort, und landeten in Savoyen; wo Peter sie aufs Pferd setzte, und zu Fuße neben her trabte. Als er seine väterlichen Gebirge zu Gesichte bekam, brach seine ausschweifende Freude in öftern Ausruffungen aus, und er konnte nicht aufhören, Adelinen zu fragen, ob sie jemahls in Frankreich solche Berge gesehen hätte.
»Nein, nein« sagte er, »für französische Hügel mögen sie gut genug seyn, mit unsern Gebirgen aber dürfen sie sich nicht messen.«
Adeline, in Bewunderung der erhaben und schauderlichen Scene verloren, stimmte sehr warm in Peters Behauptung ein, welches ihm Muth machte, sich noch ausführlicher über die Vorzüge seines Landes zu ergiessen: dessen Nachtheile vergaß er gänzlich, und wiewohl er seinen letzten Sous an die Kinder der Bauern verschenkte, die barfuß neben dem Pferde herliefen, sprach er doch von nichts als vom Glück und Zufriedenheit der Einwohner.
Sein Geburtsort machte in der That eine Ausnahme von der allgemeinen Beschaffenheit des Landes, er war blühend, gesund und glücklich, und hatte diese Vorzüge großentheils der Thätigkeit und Aufmerksamkeit des würdigen Landpredigers, der ihm vorstand, zu danken.
Adeline, die jetzt die Wirkungen langer Angst mit Erschöpfung zu fühlen anfing, wünschte sehnlich das Ziel ihrer Reise herbey, und fragte Petern ungeduldig, ob es noch nicht bald erreicht sey. Bey der geschwächten Stimmung ihrer Lebensgeister erregte die dunkle Größe der Gegenstände, die kurz zuvor Regungen entzückender Erhabenheit in ihr erweckten, nur schauderliche Empfindungen: sie zitterte bey dem Geräusch der Ströme, die zwischen den Klippen hinrollten, und in der Tiefe des Thals brüllten, und schauderte zurück vor dem Anblicke der Precipicen F4, die zu Seiten den Weg überhingen, dann wieder unter ihm sich beugten. So müde sie auch war, stieg sie doch häufig ab, um zu Fuße den steilen, steinigten Weg hinan zu klimmen, den sie zu Pferde zu reisen fürchtete.
Der Tag neigte sich, als sie einem kleinen Dorfe am Fuße der Savoyschen Alpen nahe kamen, und die Sonne, die jetzt im schönsten Abendglanz hinter ihren Gipfeln versank, warf die letzte, sanfte und glühende Beleuchtung über die Landschaft, und lockte Adelinen, so ermattet sie auch war, einen Ausruf des Entzückens ab.
Die romantische Lage des Dorfes zog bald ihre Aufmerksamkeit auf sich. Es stand am Fuße einiger ungeheuern Gebürge, die eine Kette rings um einen See in kleiner Entfernung bildeten, und deren herabhängende Wälder das Dörfchen umfaßten. Der See, auch nicht vom leisesten Lüftchen bewegt, strahlte die röthliche Schattirung des Horizonts mit der erhabenen Gegend, die seinen Rand einfaßte, zurück, und verdunkelte sich jeden Augenblick mit der einbrechenden Dämmerung.
Als Peter das Dorf erblickte, brach er in ein Freudengeschrey aus.
»Gott sey Dank,« sagte er, »wir sind jetzt unserer Heimath nahe; da ist mein lieber Geburtsort. Er sieht noch gerade so aus als vor zwanzig Jahren; und da stehn auch noch die alten Bäume rund um unsere Hütte, und der breite Felsen, der hinter ihr aufsteigt. Mein braver Vater starb hier, Fräulein. Gebe Gott, daß meine Schwester noch lebt; es ist lange her, seit ich sie nicht gesehn.«
Adeline horchte mit schwermüthigem Vergnügen auf Peters kunstlose Ausdrücke, der bey der Erinnerung an die Scenen seiner vorigen Tage, sie aufs neue wieder zu durchleben schien. So wie sie sich dem Dorfe näherten, zeigte er immer auf neue Gegenstände seiner Erinnerung:
»Und dort steht auch des guten Pfarrers Haus, das so gut ist als manches Schloß. Sehn Sie, Fräulein, das große weisse Haus dort, wo der Rauch sich kräuselt, am Rande jenes Sees! Mich soll wundern, ob er noch lebt. Er war noch nicht alt, als ich den Ort verließ, und von jedermann geliebt; aber der Tod verschont niemand.«
Sie hatten nunmehr das Dorf erreicht, das äusserst nett war, wiewohl es nicht viel Bequemlichkeit versprach. Peter war kaum zehn Schritte fortgegangen, als ihm ein alter Bekannter begegnete, der ihm die Hand gab, und sich gar nicht wieder von ihm trennen konnte. Er fragte nach seiner Schwester, und hörte, sie wäre wohl und am Leben. So wie sie weiter gingen, drängten sich so viele alte Freunde um ihn her, daß Adeline des Wartens ganz müde wurde. Manche, die er bey voller Kraft des Lebens verließ, schwankten jetzt unter den Schwachheiten des Alters, während ihre Söhne und Töchter, die er nur als spielende Kinder gekannt hatte, ihm aus dem Gedächtniß gewachsen waren, und in der Blühte der Jugend da standen. Endlich kamen sie an die Hütte, wo seine Schwester, der man seine Ankunft schon gemeldet hatte, ihm entgegen kam und ihn mit unverstellter Freude bewillkommte.
Adelinens Anblick schien sie in Verwunderung zu setzen; doch half sie ihr vom Pferde, und führte sie in eine kleine reinliche Hütte, wo sie mit einer gutmüthigen Freundlichkeit sie bewillkommte, die eine bessere Lage geschmückt haben würde. Adeline bat, auf einige Augenblicke allein mit ihr zu sprechen, weil das Zimmer von Peters Bekannten ganz erfüllt war, sagte ihr dann so viel als nöthig, von ihren Umständen, und fragte, ob sie eine Wohnung in der Hütte bekommen könnte.
»Ja, Fräulein, so gut als ich sie habe, es thut mir nur leid, daß sie nicht besser ist. Aber Sie scheinen sich nicht wohl zu befinden. Was soll ich Ihnen machen?«
Adeline, die lange mit Mattigkeit und Übelseyn gekämpft hatte, erlag jetzt. Sie sagte, daß ihr wirklich nicht wohl wäre, doch hoffte sie, Ruhe würde sie wieder herstellen, und sie bäte, daß man ihr so bald als möglich ein Bette zurecht machte. Die gute Frau ging sogleich und kam bald wieder, um sie in eine kleine Kammer zu führen, deren Reinlichkeit ihre einzige Empfehlung war.
Allein ohngeachtet ihrer Ermüdung konnte sie nicht schlafen; ihre Seele kehrte trotz alles Bestrebens in die vergangenen Scenen zurück, oder stellte ihr finstere und unvollständige Erscheinungen der Zukunft dar.
Der Abstand zwischen ihrer Lage und der Lage anderer Menschen, von ihrer ersten Erziehung an, traf sie gewaltsam und sie weinte.
»Sie haben Freunde und Verwandte,« sagte sie, »die sich bestreben, sie vor allem, was ihnen schaden, ja was nur ihnen mißfallen kann, zu verwahren; die nicht nur für ihre künftige Sicherheit, sondern auch für ihre Vortheile wachen, und sie sogar abhalten, sich selbst Nachtheil zuzufügen. Ich aber habe Zeit meines Lebens nie einen Freund gekannt, bin meistens von Feinden umringt und selten von Gefahren und Widerwärtigkeiten frey gewesen. Doch gewiß — ich bin nicht geboren, um ewig elend zu seyn; die Zeit wird kommen, wo — —«
Sie wollte eben dem Gedanken nachhängen, daß sie eines Tages noch glücklich seyn könnte, als plötzlich Theodors Lage ihr einfiel, und sich nun ausrief:
»O nein, niemahls kann ich nur Ruhe hoffen!«
Des andern Morgens in aller Frühe kam die gute Hausfrau, um zu fragen, wie sie geschlafen hatte, und fand, daß sie wenig Schlaf gehabt, und sich weit schlimmer befand als am Abend zuvor. Die Unruhe ihres Gemüths trug vieles bey, die fieberhaften Symptomen, die sich bey ihr zeigten, zu erhöhen, und noch an demselben Tage nahm ihre Krankheit ein sehr ernsthaftes Ansehn. Sie bemerkte ihren Fortschritt mit Fassung, ergab sich in den Willen der Vorsehung und fühlte wenig Kummer, das Leben zu verlassen.
Ihre gütige Wirthinn that alles, was sie konnte, um ihr Erleichterung zu verschaffen, und es war weder Arzt noch Apotheker im Ort, der der Natur hätte in den Weg treten, und ihr einen ihrer Vortheile rauben können. Demohngeachtet nahm die Krankheit schnell zu, und am dritten Tage fing sie an zu fantasieren, worauf sie in einen Zustand der Betäubung sank.
Sie wußte nicht, wie lange sie in diesem kläglichen Zustande gelegen hatte; als sie aber ihre Besinnung wieder erhielt, fand sie sich in einem Zimmer, das ihr ganz unbekannt war. Es war geräumig und schön, das Bett und alle Geräthschaften einfach und elegant. Einige Minuten lag sie in einer Verzückung von Erstaunen, und suchte ihre zerstreuten Vorstellungen von dem Vergangenen zu sammlen, indem sie beynahe fürchtete sich zu bewegen, damit nicht das angenehme Gesicht vor ihren Augen verschwände.
Endlich wagte sie, sich aufzurichten; sogleich hörte sie eine sanfte Stimme neben ihr sprechen, und sah den Vorhang an einer Seite leise von einem schönen Mädchen in die Höhe ziehn, das sich über das Bette bog, und mit einem Lächeln gemischter Zärtlichkeit und Freude fragte, wie sie sich befände?
Adeline staunte mit stummer Bewunderung das süßeste weibliche Gesicht an, das sie jemahls gesehn hatte; ein Gesicht, in welchem der Ausdruck von Sanftheit mit lebhaftem Geiste und Feinheit verbunden, durch edle Einfalt geadelt war.
Endlich sammelte sie sich so weit, um dem holden Geschöpfe danken zu können, und wünschte zu wissen, wo sie sey.
»Wir haben zu danken,« sagte das süße Mädchen und drückte ihr die Hand; »o wie freu ich mich zu sehn, daß Sie wieder zur Besinnung gekommen sind!«
Mit diesen Worten flog sie nach der Thüre und verschwand. In wenig Minuten kam sie mit einem ältlichen Frauenzimmer wieder, das sich mit zärtlicher Theilnahme dem Bette näherte, und nach Adelinens Befinden fragte: sie antwortete auf diese Frage so gut, als die Bewegung ihrer Lebensgeister es zuließ, und wiederhohlte ihren Wunsch zu wissen, wem sie so sehr verbunden sey.
»Das sollen Sie schon nachher erfahren,« sagte das Frauenzimmer, »für jetzt beruhigen Sie sich damit, daß diejenigen, die um Sie sind, sich durch Ihre Genesung reichlich für ihre Mühe belohnt halten werden. Unterwerfen Sie sich nur allem, was sie befördern kann, und halten Sie sich so ruhig als möglich.«
Adeline lächelte dankbar und nickte eine schweigende Einwilligung. Das Frauenzimmer ging hinaus um Arzney zu holen, die sie Adelinen eingab, den Vorhang wieder zuzog, und sie der Ruhe genießen ließ. Allein ihre Gedanken waren zu beschäftigt, um sie ruhen zu lassen. Sie betrachtete das Vergangene und sah das Gegenwärtige, und wenn sie beydes verglich, erfüllte der Abstand sie mit Erstaunen. Das Ganze schien ihr gleich einer der plötzlichen Verwandlungen, die in Träumen so häufig sind, wo wir von Schmerz und Verzweiflung ohne, zu wissen wie, zu Wohlgenuß und Entzücken übergehn.
Doch sah sie mit banger Angst, die ihre Genesung zu verspäten drohte, auf die Zukunft hin, und wenn sie der Worte ihrer Wohlthäterinn sich erinnerte, bemühete sie sich, diese Bangigkeit zu unterdrücken. Hätte sie die Denkungsart der Menschen, bey welchen sie jetzt sich befand, besser gekannt, so würde ihre Ängstlichkeit, in so fern sie nur ihre eigne Person betraf, sich sehr vermindert haben. La Lüc, der Besitzer dieses Hauses, gehörte zu den seltnen Menschen, zu welchem das Unglück nicht leicht vergebens um Hülfe blickte, und deren angeborne Güte, durch Grundsätze befestigt, einförmig und unanmaaßend sich in Handlungen zeigt. Folgendes kleines Gemählde seines häuslichen Lebens, seiner Familie und Sitten wird seinen Charakter in helleres Licht setzen: es wurde nach dem Leben gezeichnet, und seine Wahrheit wird hoffentlich dessen Länge vergüten.
Die Familie La Lüc.
In dem Dorfe Leloncourt, das wegen seiner pittoresken Lage am Fuße der Savoyischen Alpen berühmt ist, lebte Arnaud La Lüc, ein Geistlicher, geboren aus einer alt adlichen Familie in Frankreich, die ihr zertrümmertes Vermögen zu einer Zeit, wo die Wuth des bürgerlichen Aufstandes die Hugenotten verfolgte, eine Zuflucht in der Schweiz zu suchen zwang. Er war Pfarrer des Orts und eben so beliebt, wegen der Frömmigkeit und Menschenliebe, die den Christen bezeichnet, als geachtet wegen der Würde und erhabnen Gesinnung des Philosophen. Seine Philosophie war die der Natur, von gesundem Menschenverstande geleitet. Er verachtete das Geschwätz der neuern Schulen und die glänzende Ungereimtheit von Systemen, die ihre Schüler geblendet haben, ohne sie aufzuklären, und sie geführt ohne zu überzeugen.
Sein Geist war durchdringend; sein Blick weit und sein System, so wie seine Religion, einfach, der Vernunft gemäß und erhaben. Die Bewohner seines Kirchspiels sahen ihn als ihren Vater an; während seine Lehren ihre Gemüther lenkten, rührte sein Beyspiel ihre Herzen.
In früher Jugend verlor La Lüc ein zärtlich geliebtes Weib. Dieser Verlust warf einen Anstrich sanfter, rührender Schwermuth auf seinen Charakter, welcher ihm blieb, als schon die Zeit die Erinnerung daran geschmolzen hatte. Philosophie hatte sein Herz gestärkt, nicht verhärtet; sie machte ihn fähig, dem Druck des Kummers vielmehr zu widerstehen, als ihn abzuschütteln.
Eigne Widerwärtigkeit F5 lehrte ihn mit inniger Theilnahme das Leiden andrer empfinden. Sein Einkommen von seiner Pfarrey war klein, und der Überrest des getheilten und geschmolzenen Vermögens seiner Vorfahren vermehrte es nicht sehr: allein wenn er auch nicht immer allem Mangel des Dürftigen abhelfen konnte, reichte doch stets sein Mitleid und lehrreiches Gespräch dem geistig Leidenden Trost und Beruhigung.
Oft bewegten ihn bey solchen Gelegenheiten die süßen, erhabnen Empfindungen seines Herzens, zu sagen, daß der Wollüstling, könnte er nur einmahl dieses Gefühl schmecken, nie mehr den süßen Wohlgenuß, Gutes zu thun, vorbey lassen würde. Unwissenheit des wahren Vergnügens leitet weit häufiger; als Reiz des falschen zum Laster.
La Lüc hatte einen Sohn und eine Tochter, die beym Tode ihrer Mutter zu jung waren, um ihren Verlust zu beklagen. Er liebte sie mit äusserster Zärtlichkeit als Abkömmlinge derjenigen, die er nie zu beweinen aufhörte; und es war eine Zeitlang seine einzige Freude, die allmählige Entfaltung ihrer zarten Seelen zu beobachten, und sie zum Guten zu lenken.
Er behielt den tiefen, stillen Kummer seines Herzens für sich allein: nie drängten seine Klagen sich andern auf, und selten nannte er seine Verstorbene. Seine Schmerz war zu heilig für das gemeine Auge. Oft zog er in die tiefe Einsamkeit der Gebürge sich zurück, brütete zwischen ihren schauderlichen furchtbaren Abgründen über der Erinnerung vergangner Zeiten und gab sich dem vollen Genusse des Schmerzes hin.
Bey seiner Zurückkunft von diesen kleinen Wandrungen war er stets heitrer und zufriedner. Eine süße Ruhe, die fast bis zur Glückseligkeit stieg, war über seine Seele ausgegossen, und sein Betragen war wohlwollender, leutseliger als je. Wenn er seine Kinder anblickte und zärtlich sie küßte, schlich sich oft eine Thräne in sein Auge; allein es war die Thräne zärtlicher Wehmuth, unvermischt mit der scharfen Lauge des Schmerzes und seinem Herzen theuer.
Bey dem Tode seiner Frau, nahm er eine unverehlichte Schwester zu sich; ein verständiges, würdiges Frauenzimmer, die innigen Antheil an ihres Bruders Wohl nahm. Ihre zärtliche Aufmerksamkeit und vernünftiges Betragen, verfrühte F6 die Wirkung der Zeit in Milderung seines Kummers, und ihre unermüdete Sorgfalt für seine Kinder, welche die Güte ihres eignen Herzens bewies, brachte sie dem seinigen näher.
Mit unaussprechlichem Vergnügen spähte er in Claras Zügen das Bild ihrer Mutter aus. Dieselbe Sanftheit des Betragens, das holdselige Wesen der Verblichnen entwickelten sich bald, und so, wie sie heranwuchs, erinnerten ihre Handlungen ihn oft so stark an seine verlorne Gattinn, daß er in eine Träumerey versank, welche alle Kräfte seiner Seele zu verschlingen schien.
Mit den Pflichten seines Amts, der Erziehung seiner Kinder, und philosophischen Untersuchungen beschäftigt, flossen seine Jahre ruhig dahin. Die zarte Schwermuth, womit Kummer seine Seele gefärbt hatte, war durch langes Nachhängen, ihm werthgeworden, und er würde sie nicht um den glänzendsten Traum luftigen Glücks hingegeben haben.
Wenn ein vorübergehender Unfall F7 ihn bekümmerte, so suchte er Trost bey dem Bilde von ihr, die er so treu geliebt hatte, und einer sanften, von der Welt romanhaft genannten Wehmuth sich überlassend, gewann er allmählig seine Fassung wieder. Dieß war das geheime Wohlgefühl, zu dem er von kleinen Verdrüßlichkeiten sich zurückzog, der einsame Genuß, welcher die Wolke des Kummers zertheilte, seine Seele über diese Welt empor hob, und die Erhabenheit einer andern seinem Blicke öffnete.
Der Fleck Erde, den er jetzt bewohnte, die umliegende Gegend, die romantischen Schönheiten der nahen Spaziergänge waren ihm theuer: denn einst hatte Clara sie geliebt! sie waren die Zeugen ihrer Zärtlichkeit, seines Glücks gewesen.
Sein Haus stand am Rande eines kleinen Sees, den Berge von unermeßlicher Höhe fast umringten, die in mannigfaltigen grotesken Formen aufsteigend, eine wunderbar feyerliche, erhabne Scene bildeten. F8 Dunkle Wälder, mit kühnen Vorragungen der oft nackten, oft mit der Purpurblühte wilder Blumen bedeckten Felsen untermischt, hingen über den See, und schimmerten im klaren Spiegel des Wassers. Die wilden Alpengebürge, die in weiterer Ferne empor stiegen, waren entweder mit ewigem Schnee bedeckt, oder zeigten schreckliche Klippen und Massen von harten Felsen, deren Anblick stets wechselte, so wie die Strahlen des Lichts verändert auf ihrer Oberfläche spielten, und deren Häupter oft in undurchdringliche Nebel gehüllt waren. Einige Hütten und kleine Gruppen von Häusern, am Rande des Sees zerstreut, oder in pittoresken Prospecten oben am Felsen schwebend, waren die einzigen Gegenstände, die den Anstaunenden an die Menschheit erinnerten.
An einer Seite des Sees, schräg dem Hause gegenüber, wichen die Gebürge zurück, und eine lange Kette von Alpen dehnte sich perspectivisch aus. Ihre unzähligen Farben und Schattirungen, einige in blaue Nebel gehüllt, andre mit reichem Purpur bestrichen, und wieder andre nur, zum Theil in Licht schimmernd, gaben der Scene ein reiches und zaubrisches Colorit.
Das Haus war nicht übermäßig groß, aber sehr bequem, und zeichnete sich durch elegante Einfalt und gute Ordnung aus. Der Eingang war ein kleiner Vorsaal, der durch eine Glasthüre, die an den Garten stieß, eine Aussicht auf den See und das prachtvolle Schauspiel an seinen Ufern gab. Zur linken des Vorsaals lag La Lücs Studierzimmer, wo er gewöhnlich seinen Morgen zubrachte; und gleich daran stieß ein kleines Cabinet mit chymischen Apparaten, astronomischen Instrumenten und andern wissenschaftlichen Werkzeugen.
Zur Rechten war das gemeinschaftliche Wohnzimmer und hinter demselben ein Gemach, das ausschließend die Mademoiselle La Lüc bewohnte. Hier wurden verschiedne Arzneyen und Destillationen aus Kräutern nebst dem Apparat zu ihrer Bereitung aufbewahrt. Aus diesem Zimmer wurde das ganze Dorf reichlich mit physischen Trost versehn: denn Mademoiselle setzte einen Stolz darin, für erfahren in Heilung der Krankheiten ihrer Nachbarn gehalten zu werden.
Hinter dem Gebäude stieg eine Gruppe von Fichten auf, und vorn dehnte eine lehne F9 Anhöhe, mit Gras und Blumen bedeckt, sich bis zum See hin, dessen Wellen mit dem Rasen gleichflossen, und den Acacien, die über seiner Fläche hinwehten, glühende Frische ertheilten. Blühende Stauden, mit Ulmen, Cypressen und immer grünen Eichen untermischt, bezeichneten die Gränze des Gartens.
Wenn der Frühling wiederkehrte, war es Clarens Geschäft, die neu aufgeschoßnen Pflanzen zu binden, die Knospen der Blumen zu begießen, und sie mit den üppigen Zweigen der Sträuche vor den kalten Nordwinden, die von den Bergen herabbliesen, zu schützen. Im Sommer stand sie gewöhnlich mit der Sonne auf, und besuchte ihre Lieblingsblumen, wenn noch der Thau an ihren Blättern glänzte. Die Morgenkühle mit dem glühenden Colorit, welches dann die Gegend färbte, gaben ihrem unschuldigen Herzen ein reines und auserlesnes Vergnügen.
Mitten unter Scenen des Großen und Erhabnen geboren, hatte sie früh einen Geschmack für ihre Reize eingesogen, den die Einwirkung ihrer lebhaften Einbildungskraft erhöhte. Die Sonne über den Alpen aufgehn zu sehen, wie sie ihre beschneiten Häupter erleuchtete, und plötzlich ihre Strahlen über die ganze Natur ausschoß — den feurigen Glanz der Wolken im See unten sich spiegeln zu sehn, und den ersten Rosenhauch, der sich auf die emporragenden Felsen schlich, — waren die frühsten Vergnügungen, deren Clara empfänglich war.
Entzückt, die Natur selbst zu beobachten, gewann sie auch bald einen Geschmack für ihre Nachbildung und entwickelte frühzeitig eine glückliche Anlage zu Poesie und Mahlerey. Sie wählte aus ihres Vaters Bibliothek die italienischen Dichter, die wegen ihrer mahlerischen Schönheit am berühmtesten sind, und brachte oft die ersten Morgenstunden damit hin, unter dem Schatten der wilden Schlehen, die den Teich einfaßten, sie zu lesen. Hier versuchte sie auch oftmahls, rohe Abrisse von der umliegenden Gegend zu zeichnen, und endlich, durch wiederhohlte Versuche und durch einige Anweisung ihres Bruders, gelang es ihr so gut, daß sie zwölf Zeichnungen mit Crayon zu Stande brachte, die werth gefunden wurden, das große Wohnzimmer zu schmücken.
Der junge La Lüc spielte die Flöte und mit innigem Entzücken hörte sie ihm zu, wenn er am Rande des Sees unter ihren geliebten Acacien stand. Ihre Stimme war süß und langsam, wiewohl nicht stark, und sie lernte bald sie nach den Instrumenten moduliren. Von künstlichen Verwicklungen der Töne wußte sie nichts, ihre Arien waren einfach, und ihre Methode war es ebenfalls, allein sie gab ihnen bald einen rührenden Ausdruck, durch die Fühlbarkeit ihres Herzens eingeflößt, der selten ihre Zuhörer ungerührt ließ.
La Lüc fand sein Glück darin, seine Kinder glücklich zu sehn, und da er Claras Neigung und Talent zur Tonkunst sah, brachte er von einer kleinen Reise nach Genf ihr eine Laute zum Geschenk mit. Sie nahm sie mit mehr Dank und Freude auf, als sie aussprechen konnte, und nach dem sie ein Lied darauf spielen gelernt hatte, eilte sie zu ihren geliebten Acacien und spielte es wieder und wieder, bis sie alles andere darüber vergaß. Ihre kleinen häuslichen Geschäfte, ihre Bücher, ihr Zeichnen, selbst die Stunde, die ihr Vater zu ihrem Unterricht widmete, wo sie mit ihrem Bruder zu ihm in sein Studierzimmer kam, und gemeinschaftlich mit ihm Kenntnisse einsammelte, selbst diese Stunde wurde versäumt.
La Lüc ließ sie hingehn. Mademoiselle war unzufrieden, daß ihre Nichte die Hausgeschäfte vernachlässigte, und wollte ihr einen Verweiß geben; La Lüc aber bat sie zu schweigen.
»Möge Erfahrung sie ihren Fehler einsehen lehren,« sagte er, »Verweise bringen selten Überzeugung in junge Seelen.«
Mademoiselle wandte ihm ein, ›daß Erfahrung ein langsamer Lehrmeister sey‹.
»Er ist desto sicherer,« versetzte La Lüc, »und nicht selten der schnellste von allen; wenn keine ernstlichen Übel daraus entstehen können, so fährt man am besten, ihm zu trauen.«
Der zweyte Tag verstrich Claren wie der erste, und der dritte wie der zweyte. Sie konnte jetzt mehrere Stücke spielen und kam zu ihrem Vater, um ihm zu wiederhohlen, was sie gelernt hatte.
Beym Abendessen war der Crem nicht zurecht gemacht, und keine Früchte auf dem Tische. La Lüc fragte nach der Ursache — Clara wußte sie und erröthete. Sie bemerkte, daß ihr Bruder abwesend war, doch wurde nichts gesagt. Gegen Ende der Mahlzeit erschien er; sein Gesicht drückte ungewöhnliche Zufriedenheit aus, allein er setzte sich schweigend nieder.
Clara fragte, was ihn vom Abendessen abgehalten hatte, und hörte, daß er einer kranken Familie in der Nachbarschaft das gewöhnliche Wochengeld, welches sein Vater ihnen gab, gebracht hätte. La Lüc hatte die Sorge für diese Familie seiner Tochter aufgetragen, und sie hätte den Tag zuvor ihnen das ausgesetzte Wochengeld bringen sollen, aber sie hatte alles vergessen, außer ihrer Musik.
»Wie fandest du die Frau?« sagte La Lüc zu seinem Sohne.
»Nicht gut, lieber Vater, sie hatte ihre Arzney nicht ordentlich bekommen, und die Kinder hatten heute wenig oder gar nichts zu essen gehabt.«
Clara erschrack:
»Heute nichts zu essen gehabt,« sagte sie zu sich selbst, »und ich habe den ganzen Tag unter den Schlehen am Teiche auf meiner Laute gespielt!«
Ihr Vater that nicht, als wenn er ihre Bewegung merkte, sondern wandte sich zu seinem Sohne.
»Ich verließ sie besser,« sagte dieser, »die Arzney, die ich ihr brachte, verschaffte ihr Linderung, und ich hatte das Vergnügen, ihre Kinder eine fröhliche Abendmahlzeit verzehren zu sehen.«
Clara, vielleicht zum ersten Mahl in ihrem Leben, beneidete ihm sein Vergnügen: ihr Herz war voll, und sie saß stillschweigend.
»Heute nichts zu essen gehabt,« dachte sie!
Sie zog sich tiefsinnig in ihr Schlafzimmer zurück. Die süße Heiterkeit, womit sie sich gewöhnlich zur Ruhe legte, war verschwunden. Sie konnte nicht mit Zufriedenheit an den vergangenen Tag denken.
»Wie traurig,« sagte sie, »daß ein so angenehmes Vergnügen die Ursache so vieles Schmerzes seyn muß! Diese Laute ist meine Freude und meine Quaal! —«
Dieser Gedanke verursachte ihr einen schweren innern Kampf; aber ehe sie zu einem Entschluß über den streitigen Punct kommen konnte, fiel sie in Schlaf.
Sie erwachte sehr früh des andern Morgens, und erwartete ungeduldig den Anbruch des Tages; endlich erschien die Sonne, sie stand auf und eilte mit dem Vorsatz, alles, was sie versäumt hatte, soviel möglich gut zu machen, nach der Hütte.
Sie verweilte lange darin, und als sie wieder zurück kam, hatte ihr Gesicht alle gewohnte Heiterkeit wieder gewonnen. Doch nahm sie sich vor, diesen Tag über ihre Laute nicht anzurühren.
Bis zum Frühstück beschäftigte sie sich, die Blumen aufzubinden, und die üppigen Ranken abzuschneiden, und endlich fand sie sich ohne zu wissen wie, wieder unter ihren geliebten Acacien am See.
»Ach,« sagte sie mit einem Seufzer, »wie süß würde das Lied, was ich gestern lernte, jetzt über dem Wasser ertönen!« —
Allein sie erinnerte sich ihres Vorsatzes und hielt die Schritte zurück, die sie unwillkührlich nach dem Schlosse lenken wollte.
Um die gewöhnliche Zeit kam sie zu ihrem Vater ins Studierzimmer, und hörte aus seinem Gespräch mit ihrem Bruder über das seit zwey Tagen Gelesene, daß sie viel nützliche Kenntnisse versäumt hatte. Sie bat ihren Vater, ihr zu erklären, worauf sich dieses Gespräch bezog, allein er antwortete ganz ruhig: da sie zu der Zeit, wo diese Materie abgehandelt sey, ein anderes Vergnügen vorgezogen hätte, müßte sie sich gefallen lassen, dießmahl in der Unwissenheit zu bleiben.
»Du willst den Lohn der Arbeit von den Zeitvertreibern der Müßigkeit ernten,« sagte er, »lerne vernünftig seyn, und erwarte nicht zu vereinigen, was nicht zusammen bestehn kann.«
Clara fühlte die Richtigkeit des Verweises, und erinnerte sich ihrer Laute.
»Welches Unheil hat sie verursacht!« seufzte sie. »Doch, ich habe mir ja vorgenommen sie heute den ganzen Tag nicht wieder anzurühren. Ich will zeigen, daß ich fähig bin, meinen Neigungen zu widerstehn, wenn ich die Nothwendigkeit einsehe.«
Mit diesem Vorsatz befliß sie sich mit mehr als gewöhnlicher Emsigkeit des Lernens.
Sie blieb ihrem Entschlusse treu, und als der Tag sich neigte, ging sie in den Garten um sich zu ergötzen. Der Abend war still und ungewöhnlich schön. Man hörte nur das leise Rauschen der Blätter, das nur zu Zeiten die Stille unterbrach, um sie feyerlicher zu machen, und das ferne Murmeln der Ströme, die zwischen den Klippen hinrollten. So wie sie am See stand und die Sonne langsam unter die Alpen sinken sah, deren Spitzen mit Gold und Purpur gefärbt waren; wie sie die letzten Strahlen des Lichtes auf dem Wasser schimmern sah, dessen Fläche auch nicht das kleinste Lüftchen kräuselte, seufzte sie:
»O wie süß müßte jetzt meine Laute schallen; in diesem Augenblicke, auf dieser Stelle, wo alles rings um mich so still ist!«
Die Versuchung war zu mächtig für Claras Entschluß; sie lief ins Haus, kam mit dem Instrumente wieder zu ihren geliebten Acacien, und spielte unter ihren Schatten bis die umliegenden Gegenstände in Dunkelheit vor ihrem Anblick schwanden. Allein der Mond ging auf, und sein zitternder Glanz auf dem Wasser machte die Scene zaubrischer als je.
Es war unmöglich, einen so entzückenden Ort zu verlassen. Clara konnte sich an ihren Lieblingsarien nicht satt spielen. Die Schönheit der Stunde erweckte all ihr Genie; noch nie hatte sie mit solchem Ausdrucke gespielt, und mit zunehmendem Entzücken horchte sie auf die Töne, die über dem Wasser hinschwebten, und in der fernen Luft erstarben. Sie war ganz bezaubert.
›Nein, es ließ sich nichts entzückenders denken, als am Rande des Sees, beym Mondenlichte unter ihren lieben Acacien Laute spielen!‹
Als sie wieder ins Haus kam, war das Abendessen vorbey. La Lüc hatte Clara beobachtet, und wollte sie nicht stören lassen.
So wie die Begeisterung der Stunde verschwand, erinnerte sie sich, daß sie ihren Vorsatz gebrochen hatte, und dieser Gedanke verursachte ihr Schmerz.
»Ich war stolz darauf, meinen Neigungen Gewalt anthun zu können,« sagte sie, »und ich habe schwach ihrem Antriebe nachgegeben. Aber was habe ich Übels gethan, da ich ihnen diesen Abend folgte? ich habe keine Pflicht versäumt, denn ich hatte keine zu verrichten. Über was brauche ich mich also anzuklagen? Es würde ungereimt gewesen seyn, meinen Entschluß zu halten, und mir ein Vergnügen zu versagen, da kein Grund zu dieser Selbstverläugnung da war.«
Sie schwieg, nicht ganz befriedigt durch diese Vernünfteley. Plötzlich nahm sie die Frage wieder vor:
»Aber wie kann ich gewiß seyn, daß ich meinen Neigungen widerstanden haben würde, wäre auch wirklich Ursache dazu vorhanden gewesen? Ich fürchte, ich würde auch die arme Familie, hätte sie meiner heute Abend bedurft, über dem Lautenspiele am See wieder vergessen haben!«
Sie erinnerte sich nun, was ihr Vater ihr verschiedentlich über das Kapitel der Selbstbeherrschung gesagt hatte, und empfand einige Unruhe.
»Nein,« sagte sie, wenn ich nicht glaube, daß Beharrlichkeit bey einem Vorsatze, den ich einmahl feyerlich gefaßt habe, eine hinlängliche Ursache ist, meine Neigungen zu bekämpfen, so fürchte ich, daß kein anderer Bewegungsgrund ihn zurückhalten wird. Ich nahm mir ernstlich vor, meine Laute heute nicht anzurühren, und habe meinen Entschluß gebrochen! Morgen vielleicht werde ich in Versuchung gerathen, eine Pflicht zu vernachläßigen: denn ich habe entdeckt, daß ich mich auf meine eigene Klugheit nicht verlassen darf. Da ich also die Versuchung nicht zu überwinden fähig bin, will ich sie fliehn.«
Am folgenden Morgen brachte sie ihrem Vater die Laute, und bat ihn, sie wieder zu sich zu nehmen, und wenigstens so lange aufzubewahren, bis sie ihren Neigungen gebiethen gelernt hätte.
La Lücs Herz schwoll als sie sprach.
»Nein, meine Clara,« sagte er, »es ist unnöthig, dir deine Laute zu nehmen: das Opfer, welches du bringen wolltest, beweist, daß du mein Vertrauen verdienst. Nimm dein Instrument wieder mit: da du Muth genug hast, ihm zu entsagen, wenn es dich von deiner Pflicht abführt, so zweifle ich nicht, daß du fähig seyn wirst, seiner Gewalt über dich Einhalt zu thun, da es dir jetzt wieder gegeben wird.«
Clara fühlte einen Grad von Vergnügen und Stolz bey diesen Worten, wie sie noch nie empfunden hatte: allein sie glaubte, um das erhaltene Lob zu verdienen, müßte sie das angefangene Opfer vollenden. In der Tönen Begeisterung des Augenblicks vergaß sie die Freuden der Musik in den höhern, nach wohl verdientem Lobe zu streben, und als sie die ihr angebothene Laute ausschlug, war sie sich nur der süßesten Regungen bewußt.
»Liebster Vater,« sagte sie, indem Thränen der Freude ihr ins Auge stiegen, »erlauben Sie mir, Ihr Lob zu verdienen, und dann werde ich gewiß glücklich seyn?«
Noch nie hatte La Lüc sie ihrer Mutter so ähnlich gefunden, als sie ihm in diesem Augenblicke dünkte; er küßte sie zärtlich und weinte still.
»Du verdienst es schon,« sagte er, sobald er wieder zu reden vermochte; »und ich gebe dir deine Laute als Lohn deines Betragens zurück!« —
Diese Scene rief zu zärtliche Erinnerungen in La Lücs Herz — er gab Claren das Instrument und ging schnell aus dem Zimmer.
La Lücs Sohn, ein Jüngling von den vielversprechendsten Anlagen, war von seinem Vater für die Kirche bestimmt worden, und hatte eine vortrefliche Erziehung von ihm erhalten, welche er auf einer Universität zu vollenden für gut hielt. Er wählte die zu Genf. Sein Plan ging nicht nur dahin, seinen Sohn zum Gelehrten zu bilden, sondern ihn zum glücklichen Menschen zu machen. Von früher Kindheit an hatte er ihn zu Abhärtung und Ausdauer gewöhnt und so wie er zum Jüngling heranwuchs, ermunterte er ihn zu männlichen Übungen und machte ihn mit nützlichen Künsten so wie mit abstracten Wissenschaften bekannt.
Sein Geist war hoch, und feurig sein Temperament, aber sein Herz edel und fühlbar. Er sah mit den lebhaftesten Erwartungen der Jugend, Genf und der neuen Welt, die sich ihm bald aufschließen würde, entgegen; und in dem Entzücken dieser Erwartungen vergaß er den Schmerz, den er sonst bey der Trennung von seiner Familie würde empfunden haben.
Ein Bruder der verstorbenen Madame La Lüc, die von Geburt eine Engländerinn war, wohnte mit seiner Familie zu Genf. Mit seiner Frau verwandt gewesen zu seyn, war ein hinlänglicher Anspruch auf La Lücs Herz, und er hatte stets ein freundschaftliches Verhältniß mit Herrn Audley unterhalten, wiewohl die Verschiedenheit ihrer Gemüths- und Denkungsart dies Verhältniß nie zu Freundschaft reifen ließ. La Lüc schrieb ihm jetzt und äußerte ihm seine Absicht, seinen Sohn nach Genf zu schicken, den er seiner Aufsicht empfahl. Herr Audley beantwortete diesen Brief aufs freundschaftlichste, und kurz nachher, da ein Bekannter von La Lüc nach Genf berufen wurde, beschloß er, daß sein Sohn ihn begleiten sollte.
Die Trennung war dem Vater schmerzhaft, und Claren beynahe unerträglich. Mademoiselle war bekümmert, und trug Sorge, eine hinlängliche Quantität Hausarzeney in seinen Koffer zu packen; wobey sie nicht unterließ, ihn mit der Heilkraft und dem Gebrauch derselben bey verschiedenen Unpäßlichkeiten ausführlich bekannt zu machen; doch war sie so vorsichtig, die Vorlesung in Abwesenheit ihres Bruders zu halten.
La Lüc und seine Tochter begleiteten den jungen Mann bis zur nächsten Stadt, wo La Lüc nochmahls allen Rath, den er ihm schon über sein Verhalten, und die Einrichtung seiner Studien gegeben hatte, wiederhohlte, und ihm mit aller zärtlichen Schwäche eines Vaters, das letzte Lebewohl sagte. Clara weinte und empfand tiefere Betrübniß, als die Veranlassung rechtfertigte; allein es war beynahe das erstemahl, daß sie Kummer gekannt hatte, und sie gab kunstlos seiner Gewalt nach.
In stillem Nachdenken ritten La Lüc und Clara nach Hause, und der Tag neigte sich, als sie den See, und bald darauf ihre Wohnung zu Gesicht bekamen. Noch nie hatte sie düster geschienen bis jetzt; jetzt aber wanderte Clara traurig durch jedes verlassene Zimmer, wo sie ihren Bruder zu sehn gewohnt war, und erinnerte sich an tausend Umstände, die sie in der Gegenwart würde für unbedeutend gehalten haben, denen aber jetzt die Einbildungskraft einen Werth verlieh. Der Garten, die Gegenstände ringsumher, alles hatte ein melancholisches Ansehn, und lange Zeit verging, ehe sie ihr natürliches Gepräge, und Clara ihre Lebhaftigkeit wieder erhielten.
Beynahe vier Jahre waren seit dieser Trennung verflossen, als eines Abends, da Mademoiselle La Lüc und ihre Nichte bey der Arbeit zusammen saßen, eine gute Frau aus der Nachbarschaft sie zu sprechen wünschte. Sie kam, um sich einige Arzeneymittel und den Rath der Mademoiselle La Lüc auszubitten.
»Es hat sich ein trauriger Vorfall in unserer Hütte zugetragen,« sagte sie; »das Herz thut mir weh für die arme junge Person.«
Mademoiselle bat sie, sich näher zu erklären, und die Frau erzählte, daß ihr Bruder Peter, den sie seit so vielen Jahren nicht gesehen, angekommen wäre, und ein junges Frauenzimmer mitgebracht hatte, das wahrscheinlich sterben würde. Sie beschrieb ihre Krankheit, und theilte die Umstände, die Peter von ihrer traurigen Geschichte erzählt hatte, mit, wobey sie nicht unterließ, sich solche Übertreibungen zu erlauben, als ihr Mitleid für die unglückliche Fremde, und ihr Hang zum Wunderbaren ihr eingaben.
Diese Erzählung dünkte der Mademoiselle La Lüc sehr ausserordentlich: doch bewegte sie Mitleid mit dem unglücklichen Zustande der armen Leidenden, näher nachzufragen.
»Lassen Sie mich zu ihr gehen, liebe Tante,« sagte Clara, die mit bereitwilligem Mitleid der Erzählung der armen Frau zugehört hatte; »lassen Sie mich zu ihr gehen, sie muß Trost bedürfen, und ich wünsche sehr zu sehen, wie es ihr geht.«
Mademoiselle erkundigte sich noch weiter nach den Umständen der Krankheit, legte ihre Brille nieder und erklärte, sie wollte selbst gehen. Clara bat, mitgehen zu dürfen. Sie warfen ihre Mäntel um, und folgten der Frau in ihre Hütte, wo in einer kleinen engen Kammer, auf einem elenden Bette Adeline lag, blaß, abgezehrt und unbewußt von allem, was um sie her vorging.
Mademoiselle wandte sich zu der Frau und fragte sie, wie lange das junge Frauenzimmer schon so gelegen hätte? während Clara ans Bette trat, die beynahe leblose Hand, die auf der Decke lag, ergriff, und sie bekümmert ansah.
»Sie wird nichts gewahr,« sagte sie, »das arme Geschöpf! Wenn sie doch in unserm Hause wäre! Sie würde mehr Bequemlichkeit haben, und ich wollte sie verpflegen.«
Die Frau sagte der Mademoiselle La Lüc, daß die Kranke schon verschiedene Stunden so gelegen hätte. Mademoiselle fühlte ihr den Puls und schüttelte den Kopf.
»Diese Kammer ist sehr enge,« sagte sie.
»O gewiß, sehr enge;« rief Clara lebhaft, »sie würde in unserm Hause weit besser seyn, wenn man sie hinbringen könnte.«
»Das wollen wir erst sehen,« sagte ihre Tante, »indessen laß mich mit Petern sprechen; ich habe ihn seit vielen Jahren nicht gesehn.«
Sie ging in das vordere Zimmer, und die Frau lief aus der Hütte, um ihn zu suchen. Sobald sie fort war, sagte Clara:
»Dieß ist eine elende Wohnung für die arme Fremde, sie kann hier gewiß nicht besser werden: lassen Sie, liebe Tante, lassen Sie sie zu uns bringen, mein Vater wird es gewiß gerne sehen. Ausserdem liegt in ihrem Gesicht, so unbeseelt es auch ist, etwas, das mich ganz für sie einnimmt.«
»Wirst du denn niemahls die romanhaften Begriffe fahren lassen, die Leute nach ihrem Gesichte zu beurtheilen? Es kommt hier nicht darauf an, was für eine Art von Gesicht die Kranke hat; ihr Zustand ist beklagenswerth, und ich wünsche, ihn zu verbessern, aber zuvor muß ich mit Petern reden.«
»Ich danke Ihnen, meine beste Tante, ach so wird sie gewiß zu uns gebracht.«
Mademoiselle wollte antworten, aber indem trat Peter herein, und nach mancherley Freudensbezeugungen, womit er sie begrüßte, fragte sie ihn näher um Adelinens Geschichte, und erfuhr alles, was Peter selbst davon wußte, welches nicht mehr war, als daß sein voriger Herr sie in einer sehr bedrängten Lage gefunden, und daß er sie von der Abtey weggebracht hätte, um sie vor den Verfolgungen eines französischen Marquis zu retten.
Peters einfältiges, ehrliches Wesen ließ ihr nicht zu, seine Wahrhaftigkeit zu bezweifeln, wiewohl einige Umstände sie in ausserordentliche Verwunderung setzten, so wie sie ihr ganzes Mitleid erweckten. In Clarens Augen stiegen oftmahls Thränen bey seiner Erzählung, und als er sie geendigt hatte, sagte sie:
»Ich weiß gewiß, liebe Tante, wenn mein Vater die Geschichte dieses unglücklichen jungen Mädchens hört, so wird er sich nicht weigern, ihr an Vatersstatt zu seyn, und ich will sie als meine Schwester lieben.«
»Sie verdient es gewiß,« sagte Peter, »denn sie ist sehr gut.« —
Er ergoß sich nun in einen Schwall von Lobeserhebungen, die bey ihm ungewöhnlich waren. —
»Ich will nach Hause gehen, und die Sache mit meinem Bruder überlegen,« sagte Mademoiselle La Lüc; »allerdings müßte sie in ein luftigeres Zimmer gebracht werden. Unser Haus ist nahe, daß ich denke, man wird sie ohne Gefahr zu uns schaffen können.«
»Gott segne Sie, Mademoiselle,« rief Peter und schlug in die Hände, »Gott segne Sie für Ihre Güte gegen dieß arme Kind«
La Lüc war eben von seinem Abendspaziergange zu Hause gekommen, als sie herein traten. Sie sagten ihm, wo sie gewesen waren, und seine Schwester erzählte ihm Adelinens Geschichte und gegenwärtigen Zustand.
»O laßt sie auf alle Weise hierher bringen,« sagte La Lüc, dessen Augen von der Empfindlichkeit seines Herzens zeugten, »sie kann hier besser verpflegt werden, als in Susannens Hütte.«
»O das wußte ich, daß Sie so sagen würden, mein liebster Vater,« rief Clara; »ich will sogleich das grüne Bett für sie zurecht machen.«
»Nur nicht so hitzig, Nichte,« fiel Mademoiselle ein — »es ist keine so große Eile nöthig; man muß erst einige Dinge überlegen; allein du bist jung und romanhaft —«
La Lüc lächelte.
»Es ist schon spät und kühl,« fuhr sie fort, »und es dürfte gefährlich seyn, sie vor Morgen herzubringen. Morgen aber in aller Frühe soll ein Zimmer zurecht gemacht, und sie herüber gehohlt werden: indessen will ich ihr eine Arzeney zubereiten, die ihr gute Dienste leisten wird.«
Clara willigte widerstrebend ein, und Mademoiselle begab sich in ihr Kabinet.
Am folgenden Morgen wurde Adeline, in Decken gehüllt, und so gut als möglich vor der Luft verwahrt, nach dem Hause gebracht, wo der gute La Lüc wünschte, daß man alle Sorgfalt auf sie wenden möchte, und wo Clara mit unermüdeter Zärtlichkeit und Besorgniß ihrer wartete. Sie blieb fast den ganzen Tag über in Bewußtlosigkeit liegen; gegen Abend aber athmete sie freyer, und Clara hatte die Freude, endlich ihre Sinnen wieder hergestellt zu sehen.
In diesem Augenblick war es, als sie sich in der Lage fand, von welcher wir uns diese Abschweifung erlaubten, um eine nähere Beschreibung von dem ehrwürdigen La Lüc und seiner Familie zu geben. Der Leser wird finden, daß seine Tugenden und Freundschaft für Adelinen diese Erwähnung verdienten.
Adeline, durch einen guten Körperbau und durch die liebreiche Sorgfalt ihrer neuen Freunde unterstützt, fand sich in Zeit von einer Woche so weit wieder hergestellt, daß sie das Zimmer verlassen konnte. Sie wurde nun La Lüc vorgestellt, den sie mit Thränen einer Dankbarkeit empfing, die sie so lebhaft, und doch so kunstlos äusserte, daß er warm für sie eingenommen ward. Während des Fortschritts ihrer Genesung, hatte ihr sanftes Betragen Clarens Herz gänzlich gewonnen, und sie ihrer Tante lieb gemacht, deren Berichte von Adelinen, mit Clarens warmen Lobe zusammen genommen, La Lücs Aufmerksamkeit und Achtung erregt hatten: er kam ihr mit einem Ausdruck von Wohlwollen entgegen, der Frieden und Trost in ihr Herz goß.
Sie hatte der Mademoiselle La Lüc diejenigen Umstände ihrer Geschichte erzählt, welche Peter ausgelassen hatte, oder nicht mittheilen konnte, und nur aus einer, vielleicht falschen Delicatesse, das Geständniß ihrer Liebe mit Theodor unterdrückt. Diese Erzählung wurde La Lüc wiederhohlt, der, stets fühl: bar gegen das Leiden Anderer, einen besondern Antheil an Adelinens Unglück nahm.
Beynahe vierzehn Tage waren seit ihrem Aufenthalt in diesem Hause verstrichen, als eines Morgens La Lüc sie in sein Zimmer führte. Hier sagte er ihr auf die schonendste Art, da er sähe, daß sie so unglücklich in ihrem Vater wäre, bäte er sie, ihn in Zukunft an dessen Stelle, und sein Haus als ihr väterliches zu betrachten.
»Sie und Clara sollen auf gleiche Weise meine Tochter seyn, ich schätze mich glücklich, solche Kinder zu besitzen.«
Die stärksten Regungen von dankbarer Freude und Überraschung hielten Adelinen eine Zeitlang stumm.
»Danken Sie mir nicht, liebes Kind,« fuhr La Lüc fort. »Ich weiß alles, was Sie sagen möchten, und weiß auch, daß ich nur meine Pflicht thue. Ich danke Gott, daß meine Pflichten und meine Freude gewöhnlich in Einklang stehn.«
Adeline trocknete die Thränen, die seine Güte ihr auspreßte, und führte seine Hand an ihre Lippen. La Lüc drückte schweigend die ihrige und ging aus dem Zimmer, um seine Bewegung zu verbergen.
Adeline wurde nunmehr als ein Glied der Familie betrachtet, und würde in La Lücs väterlicher Zärtlichkeit, in Claras schwesterlicher Liebe, und der sich immer gleichen Freundlichkeit ihrer Tante, ebenso glücklich gewesen seyn, als sie dankbar war, hätte nicht unabläßige Angst um Theodor, von dem sie in dieser Einsamkeit weniger als je zu hören hoffen durfte, an ihrem Herzen genagt und jeden Augenblick des Nachdenkens verbittert.
Selbst wenn der Schlaf auf eine Weile das Andenken des Vergangnen vertilgte, stieg sein Bild häufig vor ihrer Fantasie auf, begleitet mit allen furchtbaren Gestalten des Schreckens. Sie sah ihn in Ketten; kämpfend gegen die Henkersknechte; sah ihn unter den schrecklichsten Anstalten zur Hinrichtung aufs Schaffot schleppen; sah die Todesangst seiner Blicke, und hörte in Tönen des Wahnsinns ihn ihren Nahmen rufen, bis kalte Schauder sie durchdrangen, und sie voll Entsetzen erwachte.
Gleichheit des Geschmacks und Charakters, fesselten sie an Clara, doch war der Jammer, der an ihrem Herzen nagte, von zu zarter Art, um davon zu reden; und sie nannte selbst gegen ihre Freundinn nie Theodors Nahmen. Ihre Krankheit hatte eine gewisse Schwäche und Mattigkeit bey ihr zurückgelassen, und die Unruhe ihrer Seele trug vieles bey, diesen Zustand zu verlängern. Sie gab sich alle Mühe, ihre Gedanken von diesem traurigen Gegenstande abzuziehn, und oft gelang es ihr. La Lüc hatte eine vortrefliche Büchersammlung und der Unterricht, den sie hier schöpfen konnte, befriedigte zugleich ihren Durst nach Kenntnissen, und zog ihre Seele von schmerzhaften Betrachtungen ab. Auch seine Unterhaltung gab ihr Zuflucht vor ihrem Kummer.
Ihr vornehmster Zeitvertreib aber war zwischen den erhabenen Gegenständen des umliegenden Landes umher zu wandeln, oft mit Claren, oft nur in Gesellschaft eines Buchs. Es gab in der That Zeiten, wo die Unterhaltung ihrer Freundinn, ihr einen peinlichen Zwang auflegte, und wenn sie in ihren Betrachtungen vertieft war, mochte sie lieber einsam in Gegenden wandeln, deren einsame Größe die Schwermuth ihres Herzens nährte und sänftigte. Hier rief sie jeden Umstand von ihrem geliebten Theodor sich zurück, und suchte sich sein Gesicht, sein Wesen, jede seiner Bewegungen vorzustellen.
Bald weinte sie bey der Erinnerung, und dann fiel ihr plötzlich der schreckliche Gedanke ein, daß er vielleicht bereits einen schmähligen Tod für sie erduldet hätte; den Tod um eben der Handlung willen, die ihr seine Liebe bewies — eine schreckliche Verzweiflung bemächtigte sich ihrer; ihre Thränen versiegten, und jeder Damm stürzte nieder, den Vernunft und Seelenstärke ihr entgegen setzen konnten.
Furchtsam, ihren eigenen Gedanken länger zu trauen, eilte sie nach Hause, und suchte in gewaltsamer Anstrengung, in La Lücs Gespräch die Erinnerung des Vergangenen zu verlieren. La Lüc schrieb ihre Schwermuth der grausamen Behandlung ihres Vaters zu, und Mitleid machte sie seinem Herzen noch theurer, während die Neigung zu vernünftiger Unterhaltung, die sie in ihren ruhigen Stunden so oft verwirrt, ihm eine neue Quelle des Vergnügens in der Aufklärung eines Geistes darboth, der nach Kenntniß dürstete, und jedes reinen Begriffs empfänglich war. Sie fand ein trauriges Vergnügen darin, den sanften Tönen von Clarens Laute zuzuhören, und wiegte oft ihr Herz dadurch ein, daß sie ihre Melancholie zu wiederhohlen versuchte.
Die Sanftheit ihres Wesens, die so viel Ähnlichkeit mit dem stillen Nachdenken hatte, welches La Lücs Charakter bezeichnete, that seinem Herzen wohl, und gab seinem Betragen einen Anstrich von Zärtlichkeit, der dem ihrigen tröstend war, und allmählich ihr ganzes Vertrauen und Zuneigung gewann. Sie sah mit äusserster Bekümmerniß den abnehmenden Zustand seiner Gesundheit, und vereinigte ihr Bemühen mit den Bemühungen seiner Familie, ihn zu zerstreuen und aufzuheitern.
Die angenehme Gesellschaft, in der sie lebte, und die Ruhe des Landlebens gab endlich ihrer Seele einige Heiterkeit wieder. Sie war jetzt mit allen wilden Spaziergängen auf den benachbarten Gebürgen bekannt, und ermüdete nie, ihren erstaunenswürdigen Anblick anzuschauen. Oft wagte sie sich auf ihre unbesuchten Pfade, wo nur selten ein Landmann aus einem nahen Dorfe die tiefe Einsamkeit unterbrach. Gewöhnlich nahm sie ein Buch mit, um, wenn ihre Gedanken sich nach dem steten Gegenstande ihres Schmerzes lenken wollten, sie gewaltsam zu einer für ihren Frieden minder gefährlichen Aufmerksamkeit zu zwingen. Sie erstieg alsdann eine wilde Anhöhe, setzte sich mit einem italienischen Dichter, oder einem Schriftsteller ihres Landes in der Hand, unter die Fichten, deren leichtes Murmeln ihr Herz einwiegte, und suchte durch die Träume des Dichters sich in Vergessenheit des Kummers zu senken.
La Lüc sah, wie vielen Geschmack Adeline an den großen Zügen der Gegend fand, und um die Schwermuth zu zerstreuen, die ohngeachtet ihres Bemühens nur zu oft durchschimmerte, wünschte er sie noch zu andern Scenen zu führen als im Bezirke ihrer gewöhnlichen Spaziergänge lagen. Er schlug eine Parthie zu Pferde vor, um eine nähere Ansicht der Eisgebürge zu suchen, zu ihnen hinauf zu klimmen war eine Beschwerde und Ermüdung, die weder La Lüc in seinem jetzigen Gesundheitszustande, noch Adeline aushalten konnte. Sie war nicht gewohnt, ein Pferd allein zu regieren, und die Bergstraßen, welche sie paßiren mußten, machten den Versuch etwas gefährlich; doch verheelte sie ihre Furcht, und war nicht geneigt, sich dadurch um einen solchen Genuß bringen zu lassen, als jetzt ihr angebothen ward.
Der folgende Tag wurde zu dieser Reise angesetzt. La Lüc und seine Gesellschaft standen in aller Frühe auf, und nach einem leichten Frühstück machten sie sich nach dem Monte Maledetto auf, der nur wenig Meilen von ihnen lag. Peter mußte einen kleinen Korb mit Lebensmitteln tragen, und es war ihr Plan, an irgend einer schönen Stelle unter freyem Himmel zu tafeln.
Es wäre überflüßig, Adelinens hohes Entzücken, La Lücs ruhiges Vergnügen, und Claras lebhaftere Freude zu beschreiben, so wie die Scenen des romantischen Landes sich vor ihren Augen veränderten. Bald runzelten in dunkler, furchtbarer Größe, schreckliche Felsen ihre Stirnen, und Wasserfälle stürzten in ein tiefes schmales Thal herab, über welches schäumend ihr vereinigtes Gewässer hinströmte, und in Regionen verbraußte, die jedem sterblichen Fuß unzugänglich waren; bald vermischte sich in der minder schauerlichen Gegend die Pracht der Wälder und der Schmuck der Saaten mit den rauhern Zügen der Natur, und während der Schnee auf den Gipfeln der Berge zu Eis fror, röthete der Weinstock ihre Füße.
In anziehende Gespräche und in die Bewunderung des Landes vertieft, ritten sie bis Mittag fort, wo sie sich nach einem angenehmen Ort umsahen, auf dem sie ruhen und Erfrischungen nehmen könnten, Sie sahn in einiger Entfernung die Ruinen eines alten Schlosses, es stand nahe an einer Felsenspitze, die über ein tiefes Thal hing, und seine zerbrochnen Thürme, die zwischen der einfassenden Waldung aufstiegen, erhöhten die pittoreske Schönheit des Anblicks.
Das Gebäude erregte ihre Neugier, die Schatten luden zur Ruhe ein. La Lüc und seine Gesellschaft eilten darauf zu.
Sie setzten sich auf das Gras, unter dem Schatten einiger hohen Bäume neben den Ruinen. Eine Öffnung im Walde gewährte eine Aussicht auf die fernen Alpen. Das tiefe Schweigen der Einsamkeit herrschte rings umher. Eine lange Zeit blieben sie im Nachdenken verloren.
Adeline fühlte ein süßes Behagen, daß sie lange nicht gekannt hatte. Sie sah La Lüc an, und sah eine Thräne seine Wangen herab schleichen, während die Erhebung seiner Seele sich stark auf seinem Gesicht ausdrückte. Er richtete seine Augen zärtlich auf Claren, und that sich Gewalt, sich zu fassen.
Peter kam jetzt zum Vorschein und fragte, ob es nicht gut seyn würde, wenn er den Korb öfnete, denn er dächte, Se. Ehrwürden und die jungen Fräuleins müßten hungrig seyn, nachdem sie so viel Berge auf und ab geklimmt wären. Sie gestanden, daß der ehrliche Peter sie nicht unrecht in Verdacht hatte, und machten sich seinen Wink zu Nutze.
Die Lebensmittel wurden auf dem Rasen ausgebreitet; sie setzten sich unter das Gewölbe wehender Bäume, hauchten von den süßen Düften wilder Blumen umgeben, die reine Luft der Alpen ein, die wohl Luftessenz genannt werden kann, und genossen eine köstliche Mahlzeit.
»Wie ungern verlasse ich diesen Ort,« sagte Clara, als sie aufstanden. »Ach wie süß müßte es seyn, sein ganzes Leben mit den Freunden, die man liebt, hier zuzubringen?« —
La Lüc lächelte über die romantische Einfalt dieses Gedankens; Adeline aber seufzte tief bey dem Bilde von Glückseligkeit und von Theodor, an den es sie erinnerte, und drehte sich zur Seite, um ihre Thränen zu verbergen.
Sie stiegen nun auf ihre Pferde und erreichten bald den Fuß des Monte Maldetto. Adelinens Empfindung, als sie die erstaunungswürdigen Gegenstände rings umher in verschiedenen Gesichtspuncten sah, übertraf allen Ausdruck; und die Gefühle der ganzen Gesellschaft waren zu stark, um ein Gespräch zuzulassen. Die tiefe Stille, die in diesen Regionen der Einsamkeit herrschte, flößte Ehrfurcht ein, und erhöhte das Erhabne des Anblicks auf einen unbeschreiblichen Grad.
»Es kommt mir vor,« sagte Adeline, »als wandelten wir über die Trümmer der Welt, und wären die einzigen Menschen, die den Schiffbruch überlebt hätten. Kaum kann ich mich überreden, daß wir nicht allein auf der Erde übrig sind.«
»Der Anblick dieser Gegenstände,« sagte La Lüc, »erhebt die Seele zu ihrem großen Urheber, und wir betrachten sie mit einem Gefühl, das beynahe zu groß für die Menschheit ist — die Erhabenheit seiner Natur in der Größe seiner Werke! —«
Ungern verließen sie diese Scenen, aber die Stunde des Tags, und das Ansehn der Wolken, die sich zu einem Gewitter zusammen zu ziehn schienen, trieb sie zur Beschleunigung ihrer Heimreise. Adeline hätte fast gewünscht, den schauerlichen Effekt eines Gewitters in diesen Regionen anzusehn.
Sie kehrten durch einen andern Weg nach Leloncourt zurück, und die Dunkelheit des Himmels vertiefte den Schatten der überhängenden Vorgebürge. Es war Abend, als sie den See ins Gesicht bekamen, dessen Anblick ihnen willkommen war, denn das Gewitter, das so lange gedroht hatte, stand jetzt nahe: der Donner grunzte zwischen den Alpen; und die dunkeln Dünste, die schwer an ihren Seiten hinrollten, erhöhten ihre schauderliche Erhabenheit.
La Lüc hätte gern seine Schritte beschleunigt; allein der Weg wand sich steil einen Berg herab und machte Vorsicht nothwendig. Die sich verdunkelnde Luft und die Blitze, die am Horizont flammten, schreckten Clara; doch hielt sie in Betracht ihres Vaters ihre Furcht zurück. Ein Donnerschlag, der die Festen der Erde zu erschüttern schien, und im furchtbaren Echo von den Felsen wiederhallte, brach über ihren Häuptern los.
Claras Pferd gerieth in Schrecken bey dem Schall, sprang davon, und setzte mit unglaublicher Geschwindigkeit den Berg herab nach dem See zu, der seinen Fuß bespülte. La Lücs Angst, der in fürchterlicher Erwartung, sie das Precipice, das den Rand begrenzte, hinab schleudern zu sehn, sie mit seinen Blicken verfolgte, läßt sich nicht beschreiben.
Clara hielt sich fest, aber Schrecken hatte sie ihrer Sinne beynahe beraubt. Ihr Bemühn, sich zu erhalten, war mechanisch: kaum wußte sie was sie that. Doch brachte das Pferd sich glücklich bis fast an den Fuß des Berges, wollte aber mit ihr in den See setzen, als ein Herr, der des Wegs kam, es beym Zaum faßte. Das plötzliche Stillestehn des Pferdes warf Claren zur Erde, und ungeduldig über den Zwang, riß das Thier sich von dem Fremden loß, und sprang in den See. Die Heftigkeit des Falls beraubte Clara ihrer Besinnung; und während der Fremde sie aufrecht zu halten suchte, lief sein Bedienter, um Wasser zu hohlen.
Sie erhohlte sich bald, und fand sich, als sie die Augen aufschlug, in den Armen eines Herrn, der sie mit Mühe zu halten schien. Das Mitleid in seinem Gesicht, als er nach ihrem Befinden fragte, belebte ihren Muth, und sie wollte ihm für seine Güte danken, als La Lüc und Adeline herzukamen. Clara sah ihres Vaters Schrecken auf seinen Zügen; so matt sie auch war, richtete sie sich auf und sagte mit einem schwachen Lächeln, das ihr Leiden verrieth, statt es zu verbergen:
»Bester Vater, ich habe keinen Schaden genommen!«
Ihr bleiches Gesicht, und das Blut, das ihre Wangen herablief, wiedersprach ihren Worten. La Lüc aber, dem seine Einbildungskraft das schrecklichste Übel vorgestellt hatte, freute sich, sie reden zu hören; er bekam einige Geistesgegenwart wieder, und während Adeline ihr Riechsalz vorhielt, rieb er ihre Schläfe.
Sie sagte ihm nunmehr, wie große Verbindlichkeit sie dem Fremden hätte. La Lüc suchte ihm seine Dankbarkeit zu bezeugen, allein der Herr unterbrach ihn und bat, ihm die Verlegenheit zu ersparen, sich dafür danken zu lassen, daß er dem Antriebe gewöhnlicher Menschlichkeit gefolgt hätte.
Sie waren nicht weit mehr von Leloncourt: aber die Nacht war schon beynahe eingebrochen, und der Donner brüllte tief zwischen den Bergen. La Lüc war in Verlegenheit, wie er Clara nach Hause bringen sollte.
Indem er sie von der Erde aufhob, verrieth der Fremde so heftige Zeichen von Schmerz, daß La Lüc ihn um die Ursache fragte. Der plötzliche Stoß, den das Pferd seinem Arme gegeben hatte, als es sich von ihm loßriß, hatte ihm die Schulter verrenkt, und seinen Arm beynahe unbrauchbar gemacht. Sein Schmerz war sehr groß, und La Lüc, dessen Angst um seine Tochter jetzt nachgelassen hatte, wurde bekümmert, und drang in den Fremden, ihn in sein Haus zu begleiten, wo sie ihm Hülfe verschaffen könnten. Er nahm die Einladung an, und Clara, die endlich auf ein Pferd, das ihr Vater führte, gesetzt wurde, trabte mit der übrigen Gesellschaft nach dem Hause zu.
Als Mademoiselle, die schon eine ganze Weile nach ihnen ausgesehn hatte, den Zug herannahen sah, gerieth sie in Unruhe, und ihre Besorgnisse wurden bestätigt, als sie ihrer Nichte Zustand entdeckte. Clara wurde ins Haus getragen, und La Lüc hätte gern einen Wundarzt hohlen lassen, allein es war innerhalb vieler Meilen keiner vorhanden, so wie überhaupt kein Arzt in der ganzen Gegend war.
Clara gelangte mit Adelinens Hülfe in ihre Kammer, und Mademoiselle übernahm es, die Wunden zu untersuchen. Das Resultat stellte die Ruhe der Familie wieder her, denn wiewohl sie sehr zerquetscht war, hatte sie doch keinen wesentlichen Schaden genommen: eine leichte Contusion an der Stirne hatte das Bluten verursacht, worüber La Lüc anfangs so sehr erschrack. Seine Schwester versprach, sie in wenig Tagen mit Hülfe eines selbst verfertigten Balsams wieder herzustellen, über dessen Kraft sie sich mit großer Beredsamkeit ergoß, bis La Lüc sie unterbrach, und an den Zustand ihrer Kranken erinnerte.
Nachdem Mademoiselle Claren mit Spiritus gewaschen, und ihr eine unvergleichliche Herzstärkung eingegeben hatte, verließ sie sie, und Adeline blieb bey ihr in ihrem Schlafzimmer, bis sie in ihr eignes ging.
La Lüc, der große Unruhe ausgestanden hatte, wurde nun durch seiner Schwester Bericht sehr beruhigt. Er stellte ihr den Fremden vor, und bat, indem er ihr seinen Unfall sagte, daß sie ihm unverzüglich zu Hülfe kommen möchte. Mademoiselle eilte in ihr Kabinet, und es dürfte vielleicht schwer zu bestimmen seyn, ob sie mehr Bekümmerniß über das Leiden ihres Gastes, oder mehr Vergnügen über die sich darbiethende Gelegenheit, ihre Geschicklichkeit an den Tag zu legen, empfand. So viel ist gewiß, daß sie das Zimmer in äußerster Geschwindigkeit verließ, und schnell mit einer Büchse von ihrem unvergleichlichen Balsam zurückkam, worauf sie nach der nöthigen Anweisung zu dessen Gebrauch, den Fremden der Sorge seines Bedienten überließ.
La Lüc bestand darauf, daß der Fremde, der sich Herr Verneuil nannte, diese Nacht das Haus nicht verlassen sollte, und er ließ sich nicht lange nöthigen. Sein Betragen war eben so freymüthig und einnehmend, als La Lücs Gastfreyheit und Dankbarkeit aufrichtig waren, und sie kamen bald in ein interessantes Gespräch.
Herr Verneuil sprach wie ein Mann, der viel gesehn und mehr noch gedacht hatte; und wenn er einige vorgefaßte Meinungen verrieth, so waren es sichtlich Vorurtheile eines Geistes, der die Gegenstände durch das Licht seiner eignen Güte sieht und ihnen die Farbe seines Charakters mittheilt. La Lüc war sehr zufrieden: denn in seiner abgezognen Lage hatte er nicht oft Gelegenheit, das Vergnügen zu genießen, welches aus der gegenseitigen Mittheilung aufgeklärter Menschen entspringt. Er fand, daß Herr Verneuil auf Reisen gewesen war, und seine Bemerkungen über die Länder und Menschen, die er gesehn hatte, verriethen den denkenden Kopf und feinen Beobachter.
Gegenseitig zufrieden mit einander trennten La Lüc und sein Gast sich nicht eher, bis die Mitternachtsstunde sie erinnerte.
Ruhe hatte Clara so gut wieder hergestellt, daß Adeline, die zärtliche Besorgniß früh in ihr Zimmer trieb, sie bereits aufgestanden und bereit fand, zum Frühstück mit herunter zu gehn, Herr Verneuil erschien ebenfalls, allein sein Aussehn verrieth, daß er nicht wohl geschlafen hatte. Wirklich hatte er auch in der Nacht einen Schmerz an seinem Arm empfunden, welchen stillschweigend zu ertragen, keine geringe Entschlossenheit erforderte. Er war angeschwollen und etwas entzündet, und dieses mochte zum Theil von dem Balsam der Mademoisell La Lüc herrühren, dessen Wunderkraft dießmahl gefehlt hatte. Die ganze Familie nahm an seinen Leiden Theil, und Mademoiselle gab auf Bitten des Herrn Verneuil ihren Balsam auf, und legte kühlende Salbe auf.
Der Gebrauch davon, stillte in kurzen seine Pein, und er kam sehr erleichtert wieder zum Frühstück zurück. Die Freude, welche La Lüc über seiner Tochter Rettung empfand, war sehr sichtlich; seinen Dank gegen ihren Retter aber fand er schwer auszudrücken. Clara sagte die aufrichtigen Empfindungen ihres Herzens mit ungeschmückten, bescheidnem Nachdruck, und bezeugte innige Bekümmerniß über die Schmerzen, die sie ihm zugezogen hatte.
Das Vergnügen, welches er in der Gesellschaft seines Gastes empfand, und Dankbarkeit für den wichtigen Dienst, den er ihm geleistet hatte, wirkten mit La Lücs natürlicher Gastfreyheit zusammen, und er drang in Herrn Verneuil, noch einige Zeit in seinem Hause zu verweilen.
»Ich kann niemahls den Dienst, den Sie mir geleistet haben, vergelten,« sagte La Lüc, »und doch suche ich meine Verbindlichkeiten gegen Sie durch Bitte um Verlängerung Ihres Besuchs, und Gelegenheit zu Ihrer nähern Bekanntschaft zu vermehren.«
Herr Verneuil der auf einer Reise von Genf nach einer fernen Gegend von Savoyen begriffen war, bloß um das Land zu sehn, war so zufrieden mit seinem Wirth und allem was ihn umgab, daß er bereitwillig die Einladung annahm. Klugheit kam hier allerdings mit seiner Neigung zusammen: denn es würde in seinem gegenwärtigen Zustande gefährlich, wenn nicht unmöglich gewesen seyn, seine Reise zu Pferde fortzusetzen.
Nach Tische führte La Lüc seinen Gast auf einen Spaziergang am See, der oft sich unter dem Schatten überhängender Waldungen hinbog, oft wieder über Rasenhügel sich dehnte, wo die Gegend in aller wilden Pracht sich eröfnete. Herr Verneuil stand mehrmahls in Entzückung still, um die Schönheiten zu betrachten, während La Lüc, den seine Empfindung freute, die Gegenstände, die ihn schon so oft bezaubert hatten, mit mehr als gewöhnlicher Befriedigung ansah. Nur lag eine zärtliche Schwermuth in seiner Stimme und auf seinem Gefühl, welche durch die Erinnerung entstand, wie oft er mit ihr, die ihnen ein ewiges Lebewohl gesagt, diese Gegenden durchwandelt und gemeinschaftlich empfunden hatte.
Sie verließen den See, und wanden sich eine kleine Anhöhe zwischen den Wäldern hinan, worauf sie nach dem Spaziergange einer Stunde zu einem grünen Hügel kamen, der unter den wilden Felsen, die ihn umringten, gleich der Blühte am Dorn schien. Es war ein Ort zum einsamen Entzücken geschaffen, und flößte die sanfte Zärtlichkeit ein, die dem fühlenden Herzen so süß ist, und der Erinnerung Bilder der Sehnsucht, durch Entfernung gesänftigt, durch öftere Wiederhohlung theuer gemacht, zurückruft.
Wildes Gesträuch wuchs aus den Felsenritzen unten hervor, und die hohe Fichte und Ceder, die von oben wehten, gaben einen melancholischen, romantischen Schatten. Die Stille der Gegend wurde nur von dem Lüftchen, das über die Wälder hinsäuselte, und von den einsamen Tönen der Vogel, welche die Klippen bewohnten, unterbrochen.
Von diesem Puncte beherrschte das Auge eine volle Ansicht auf die majestätischen, erhabnen Alpen, deren Gestalt die Seele mit Regungen unbeschreiblicher Ehrfurcht erfüllt, und sie zu einer edlen Natur zu erheben scheint. La Lücs Dorf und Haus erschien im Grunde der Gebürge; eine friedliche Zuflucht vor den Stürmen, die auf ihren Gipfeln sich sammelten. Alle Fähigkeiten des Herrn Verneuil waren in Bewunderung versenkt und er schwieg eine lange Zeit; endlich brach er in Ausrufungen aus, drehte sich um nach La Lüc und wollte ihn anreden, als er ihn in einiger Entfernung sich an eine ländliche Urne lehnen sah, über welcher in üppiger Fülle die weinende Weide hing.
So wie er sich ihm näherte, verließ La Lüc seine Stellung, und ging ihm entgegen; Herr Verneuil fragte, bey welchem Anlaß die Urne errichtet sey? La Lüc, unvermögend zu antworten, zeigte darauf hin, und ging schweigend fort, während Herr Verneuil darauf zuging, und folgende Inschrift las:
Dem
Gedächtniß von Clara La Lüc
hat auf der Stelle, die sie
vorzüglich liebte, diese Urne
zum Zeugniß seiner Liebe errichtet,
ihr Gatte.
Herr Verneuil begriff nun alles, und es that ihm weh, für das Gefühl seines Freundes; dieses Denkmahl seines Schmerzens bemerkt zu haben. Er ging wieder zu La Lüc, der auf der Spitze der Anhöhe stand, und die unten liegende Landschaft mit einer erheiterten Miene, rührend durch sanfte Frömmigkeit und Ergebung betrachtete, Er merkte, daß Herr Verneuil verlegen war, und suchte ihn zu beruhigen.
»Sie werden es als einen Beweiß meiner Achtung ansehn,« sagte er, »daß ich Sie hieher geführt habe. Dieser Ort ist nie durch die Gegenwart Unfühlender entweiht worden. Diese würden der Treue einer Anhänglichkeit spotten, die so lange ihren Gegenstand überlebt hat, und in ihrer eignen Brust sich schnell unter den Zerstreuungen der großen Welt würde verloren haben. Ich habe in meinem Herzen die Erinnerung eines Weibes bewahrt, dessen Treflichkeit alle meine Liebe fordert: ich habe sie bewahrt als einen Schatz, zu welchem ich von vergänglichen Sorgen und Bekümmernißen hinfliehen könnte, versichert milde, wenn auch schwermüthige Tröstung zu finden!«
La Lüc schwieg, Herr Verneuil äusserte die Theilnahme, die er empfand; allein er kannte die Heiligkeit des Kummers und verfiel bald wieder in Stillschweigen.
»Eine der glänzendsten Hoffnungen eines künftigen Zustandes,« fuhr La Lüc fort, »besteht darinn, diejenigen wieder zu finden, die wir auf Erden liebten. Und vielleicht wird ein großer Theil unsrer Seeligkeit, in der Gesellschaft unsrer Freunde bestehn, geläutert von den Gebrechen der Sterblichkeit, die feinern Gefühle süßer gestimmt, und die Fähigkeiten der Seele unendlich erhöhet, und erweitert. Wir werden dann fähig seyn, Gegenstände zu fassen, die dem menschlichen Verstande zu groß sind, zu fassen vielleicht die Erhabenheit des Wesens, das uns zuerst ins Daseyn rief. Diese Aussichten der Zukunft mein Freund, heben uns über die Leiden dieser Welt empor und scheinen uns einen Theil der Natur, die wir betrachten, mitzutheilen.
Nennen Sie sie nicht Träume eines schwämenden Gehirns,« fuhr er fort, »ich glaube an ihre Wahrheit; wenigstens bin ich davon gewiß, daß wir den Glauben daran um des Trostes willen, den er dem Herzen bringt, hegen und pflegen, und die Würde, die er der Seele mittheilt, ehren sollten. Solche Gefühle machen einen glücklichen und wichtigen Theil unsers Glaubens an künftiges Daseyn aus: sie geben der Tugend Kraft, und den Grundsätzen Festigkeit.«
La Lüc und sein Gast wandelten in Gesprächen dieser Art fort, bis die Sonne die Gegend verlassen hatte. Die Berge, von der Dämmerung beschattet, gewannen ein erhabneres Ansehn, während die Gipfel der höchsten Alpen noch von den Sonnenstrahlen beleuchtet waren, und einen auffallenden Abstich gegen die trübe Dunkelheit der untern Welt bildeten. So wie sie die Wälder hinab gingen und am Rande des Sees fortschritten, goß die Stille und Feyerlichkeit der Stunde eine süße Schwermuth über ihre Seelen, und versenkte sie in Schweigen.
Herr Verneuil war etwa zwey und dreyßig Jahre alt; seine Figur war männlich, seine Gesichtsbildung offen und einnehmend. Ein schnelles, durchdringendes Auge, dessen Feuer durch Güte und Wohlwollen gemildert ward, enthüllte die Hauptzüge seines Charakters: er war schnell im Auffinden, aber großmüthig im Entschuldigen der Thorheiten des Menschengeschlechts; nicht leicht konnte man schärfer als er ein Unrecht fühlen, aber auch niemand nahm bereitwilliger das Nachgeben eines Feindes an.
Er war von Geburt ein Franzose. Ein ihm kürzlich zugefallnes Vermögen hatte ihn in Stand gesetzt, den Plan auszuführen, den sein thätiger, forschender Geist entwarf, die merkwürdigsten Länder von Europa zu besehn. Er besaß vorzügliche Empfänglichkeit für das Schöne und Erhabene in der Natur. Einem solchen Geschmack mußte die Schweiz, und die angrenzenden Länder, das Intereßanteste von allen seyn, und er fand, daß das Schauspiel, welches er hier genoß, bey weitem alles übertraf, was selbst seine glühende Einbildungskraft sich entworfen hatte: er sah mit dem Auge eines Mahlers, und fühlte mit dem Entzücken des Dichters.
In La Lücs Wohnung fand er die Gastfreyheit, Freymüthigkeit und das Einfache, welche dieses Land auszeichnen; in seinem ehrwürdigen Wirth sah er die Stärke der Philosophie mit der zartesten Menschheit vereint; eine Philosophie, die ihn lehrte, seine Gefühle zu veredeln, nicht aber sie zu vernichten: in Claren die Blühte der Schönheit mit der vollkommensten Einfalt des Herzens, und in Adelinen alle Reize der Feinheit und Anmuth, verbunden mit einem Genie, welches der höchsten Ausbildung werth war. Auch die Gutmüthigkeit und der stille Werth der Mademoiselle La Lüc durften in diesem Familiengemählde nicht unbemerkt oder vergessen bleiben.
Die Heiterkeit und Eintracht im ganzen Hause entzückte; allein die Philanthropie, die aus dem Herzen des Predigers strömend, sich durchs ganze Dorf verbreitete, und die Einwohner in süße und feste Bande gesellschaftlichen Vertrags vereinigte, war göttlich. Die schöne Lage des Orts traf mit alle diesem zusammen, um Leloncourt beynahe zum Paradiese zu machen. Herr Verneuil seufzte; es so bald verlassen zu müssen:
»Ich brauchte nicht weiter zu suchen,« sagte er: »denn hier wohnen Glück und Weisheit zusammen.«
Das Wohlgefallen war gegenseitig: La Lüc und seine Familie fanden so viel Vergnügen in Herrn Verneuils Gesellschaft, daß sie mit Schmerz auf die Zeit seiner Abreise hinsahn, und ihn bewegten, seinen Aufenthalt noch um einige Tage zu verlängern. Er hatte nunmehr den Gebrauch seines Arms wieder erlangt, und sie machten verschiedne kleine Lustreisen zwischen den Gebürgen, wobey Adeline und Clara, die durch ihrer Tante Sorgfalt vollkommen wieder hergestellt war, sie meistens begleiteten.
Nach Verlauf einer Woche nahm Herr Verneuil endlich Abschied von seinem liebreichen Wirth und seiner Familie: sie trennten sich mit gegenseitiger Bekümmerniß, und der erste versprach auf seiner Rückreise von Genf, wieder über Leloncourt zu gehen. Als er dieses sagte, sah Adeline, die seit einiger Zeit mit großer Unruhe La Lücs abnehmende Gesundheit bemerkt hatte, sein mattes Gesicht traurig an, und that ein stilles Gebeth, daß er leben möchte, um Herrn Verneuils Besuch zu empfangen.
Mademoiselle war die einzige, die seine Abreise nicht beklagte: sie sah, daß die Anstrengung, welche ihr Bruder sich auflegte, um seinen Gast zu unterhalten, seinem jetzigen Gesundheitszustande zu schwer ward, und freute sich, daß er wieder in Ruhe kommen würde.
Allein diese Ruhe brachte La Lüc keine Linderung seiner Unpäßlichkeit mit: die Ermüdung seiner letzten kleinen Reisen schien sie vermehrt zu haben, und sie gewann im kurzem den Anschein einer Auszehrung. Auf das Bitten seiner Familie ging er nach Genf, um die dortigen Ärzte zu Rathe zu ziehn, die ihm die Luft von Nizza zu versuchen, empfahlen.
Die Reise dahin war lang, und da er sein Leben auf allen Fall für mißlich hielt, stand er bey sich an, ob er sie unternehmen sollte. Auch war er ungeneigt, die Pflichten seiner Pfarre so lange zu versäumen; doch würden ihn alle diese Betrachtungen nicht abgehalten haben, hätte er auf das Clima von Nizza eben so viel Vertrauen gehabt, als seine Ärzte.
Seine Pfarrkinder fühlten, wie wichtig das Leben ihres guten Predigers für sie war: sie betrachteten es als eine gemeinschaftliche Angelegenheit, und gaben ein Zeugniß seines Werthes und ihres Gefühls desselben, dadurch, daß sie in Gesammtheit zu ihm gingen, und ihn bathen, sie zu verlassen. Dieser Beweiß ihrer Liebe rührte ihn tief, und war mit den Bitten der Seinigen und der Betrachtung, daß es Pflicht gegen sie alle sey, sein Leben zu verlängern, zu mächtig, um zu widerstehn; er beschloß also sich nach diesem Orte aufzumachen.
Es wurde bestimmt, daß Clara und Adeline, für deren Gesundheit La Lüc eine Veränderung des Orts und der Scene sehr zuträglich glaubte, nebst dem treuen Peter ihn begleiten sollten.
Am Morgen seiner Abreise versammelte sich eine Menge seiner Pfarrkinder, um ihm Lebewohl zu sagen. Es war eine rührende Scene! Sie begleiteten ihn, nachdem er nebst Clara und Adelinen von seiner Schwester Abschied genommen hatte, noch eine große Strecke weit aus dem Dorfe. So wie er langsam fortritt, warf er einen letzten, zögernden Blick auf seine kleine Heimath, wo er so viele friedliche Jahre verlebt hatte, und die er jetzt vielleicht zum letzten Mahl ansah. Thränen stiegen ihm in die Augen, allein er verhielt sie.
Jeder Gegenstand, an dem er vorbey kam, regte eine zärtliche Erinnerung in ihm auf. Er sah nach dem Orte hin, der dem Gedächtniß seines geliebten Weibes gewidmet war: die thauigten Morgendünste hüllten ihn ein, und La Lüc fühlte einen Schmerz, ihn nicht noch einmahl sehn zu können, den nur diejenigen rechtfertigen werden, welche aus Erfahrung wissen, wie innig die Einbildungskraft an einem Gegenstande hängt, der mit dem Gegenstand unsrer Zärtlichkeit, wenn auch noch so entfernt, verbunden ist. In solchen Fällen ertheilt die Fantasie den Illusionen schwärmender Liebe den Stempel der Wirklichkeit, und sie sind dem sehnenden Herzen unaussprechlich theuer.
La Lüc und seine kleine Gesellschaft reisten in gemächlichen Tagereisen fort; und nachdem sie einige Tage zwischen den romantischen Gebürgen und ländlichen Ebnen von Piemont hingeritten waren, kamen sie in die reiche Landschaft Nizza.
Die fröhlichen, üppigen Aussichten, die sich jetzt ihrem Blicke öffneten, wie sie sich zwischen den Hügeln hinwanden, glichen den Scenen feenmässiger Bezauberung, oder denjenigen, welche die einsame Träumerey der Dichter schafft. Während die gewundenen Gipfel der Berge die beschneite Strenge des Winters zeigten, beschatteten die Fichte, Cypresse, Olive und Myrthe ihre Seiten mit den grünen Farben des Frühlings, und Wäldchen von Orangen, Limonen- und Citronenbäumen verbreiteten über ihren Fuß den vollen Glanz des späten Sommers.
Immer wurde die Gegend abwechselnder, und endlich haschte Adeline einen Schimmer des fernen Gewässers der Mittelländischen See, der schwach im blauen wolkenlosen Horizont erlosch. Sie hatte noch nie den Ocean gesehn, und dieser schnelle Anblick erweckte ihre Einbildungskraft und erfüllte sie mit ungeduldigem Verlangen nach einer nähern Aussicht.
Der Tag neigte sich, als die Reisenden, die sich um ein steiles Vorgebürge der Alpenreihe wanden, welche das Amphitheater von Nizza krönt, auf die grünen Anhöhen, die sich bis zu den Ufern erstrecken, auf die Stadt und ihre alte Festung und auf das weite Gewässer des Mittelländischen Meeres, mit den Corsischen Gebürgen in weiter Ferne, herabsahn.
Ein solcher Strich von See und Land, so abwechselnd vom Lebhaften, Prächtigen und Erhabnen würde jedes Auge zur Bewunderung gefesselt haben. Bey Adelinen und Clara erhöhten Neuheit und Enthusiasmus die Reize des Anblicks. Die milde, wohlthätige Luft schien La Lüc in dieser lächelnden Region zu bewillkommnen, und die heitre Atmosphäre unveränderlichen Sommer zu versprechen.
Endlich kamen sie auf die kleine Ebene herab, wo Nizza erbaut ist, die weiteste Fläche ebner Erde, durch welche sie seit ihrem Eintritt in diese Grafschaft gekommen waren. Hier, im Busen der Gebürge, vor dem Nord- und Ostwinde geschützt, wo nur der Hauch des Wests zu athmen schien, waren alle Blühten des Frühlings und Reichthümer des Herbstes vereinigt. Myrthen-Bäume faßten die Straße ein, die sich zwischen Orangen, Citronen- und Bergamotten-Wäldern hinwand, deren köstliche Wohlgerüche sich in den Duft der Rosen und Nelken mischten, die in ihrem Schatten blühten.
Die sanft schwellenden Hügel, welche aus dem Thale aufstiegen, waren mit Weinstöcken bedeckt, oder mit Cypressen-, Oliven- und Dattel-Bäumen gekrönt; jenseits erschienen die Wipfel der hohen Berge, die sie herabgekommen waren, an welchen der kleine Fluß Paglion hinfließt, und vom Schnee, der ihre Höhen herabrinnt, angeschwollen, durch das Thal sich schlängelt, bis er die Mauern von Nizza spült und in die See fällt.
Die Stadt verlor bey näherm Anblick vieles von ihrer Bezauberung: die engen Straßen und schlechten Häuser entsprachen der Erwartung nicht, welche die ferne Aussicht ihrer Wälle, ihres bunt mit Schiffen geschmückten Hafens zu berechtigen schien. Auch das Ansehn des Wirthshauses, wo La Lüc abstieg, trug nicht bey, seine getäuschte Erwartung zu mildern; es befremdete ihn, so schlechte Bequemlichkeit im Gasthofe einer Stadt zu finden, die als Zuflucht Genesender berühmt ist, und seine Verwunderung stieg, als er hörte, wie schwer es sey, meublirte Zimmer zur Miethe zu bekommen.
Nach langem Suchen verschaffte er sich eine Wohnung, in einem kleinen, aber angenehmen Hause, das eine kleine Strecke ausserhalb der Stadt lag; es hatte einen Garten und eine Terrasse, von welcher man die See übersah, und zeichnete sich durch eine gewisse Reinlichkeit aus, die in den Häusern von Nizza ungewöhnlich schien. Er bedang sich der Kost bey der Familie, die noch einen Herrn und Dame am Tische hatte, und war nunmehr fürs erste ein Einwohner dieses reizenden Climas.
La Lüc traf oftmahls auf seinen Spaziergängen angenehme Gesellschafter an, die gleich ihm, um Gesundheit zu suchen, nach Nizza gekommen waren. Er bildete sich bald aus ihnen einen kleinen, auserlesnen Zirkel, in welchem sich ein Franzose einfand, dessen sanfte Sitten, mit einer tiefen, anziehenden Schwermuth geprägt, La Lüc vorzüglich interessirten. Er sprach selten von sich selbst, und hüthete sich, irgend eines Umstandes zu erwähnen, der zur Kenntniß seiner Familie führen konnte; über andre Gegenstände aber sprach er mit Offenheit und Einsicht. La Lüc hatte ihn oftmahls in seine Wohnung geladen, allein er schlug immer die Einladung aus, und zwar auf eine so sanfte Art, daß er das Mißvergnügen entwaffnete, und La Lüc überzeugte, daß seine Weigerung nur die Folge einer gewissen Niedergeschlagenheit des Gemüths sey, die ihn von allem Umgang mit andern Fremden abgeneigt machte.
La Lücs Beschreibung von diesem Fremden hatte Claras Neugier, und die Sympathie, welche die Unglücklichen für einander fühlen — denn Adeline zweifelte nicht, daß er unglücklich sey — Adelinens Mitleid rege gemacht. Bey ihrer Zurückkunft von einem Abendspaziergang, zeigte La Lüc ihnen den Fremden, der still vor sich hin ging, und beschleunigte seinen Schritt, um ihn einzuhohlen. Adeline fühlte anfangs einen Trieb, ihm zu folgen; allein Delikatesse hielt ihre Schritte zurück; sie wußte, wie peinlich die Gegenwart eines Fremden oft dem verwundeten Herzen ist, und enthielt sich, um der bloßen Befriedigung einer eitlen Neugierde willen, sich ihm aufzudringen.
Sie schlug einen andern Weg ein; aber der Zufall vereitelte die zarte Schonung, die ihr Zusammentreffen verhindern sollte und La Lüc stellte den Fremden vor. Adeline empfing ihn mit einem holden Lächeln, suchte aber den Ausdruck von Mitleid zu unterdrücken, den unwillkührlich ihre Züge angenommen hatten: sie wünschte nicht von ihm bemerkt zu seyn, daß sie ihn für unglücklich hielt.
Er sah sie an, und schien von ihrem Anblick betroffen. Eine schnelle Röthe überzog sein Gesicht, doch faßte er sich sogleich, und beantwortete ihre Bewillkommung aufs verbindlichste. Von diesem Augenblick an schlug er La Lücs Einladungen nicht länger aus; er kam oft, und begleitete Adelinen und Clara auf ihren Spaziergängen. Die sanfte, geistvolle Unterhaltung der erstern schien seinem Herzen wohl zu thun, und er sprach in ihrer Gesellschaft oft mit einer Lebhaftigkeit, die La Lüc noch nie an ihm bemerkt hatte.
Auch Adeline fand in der Ähnlichkeit ihres Geschmacks, und in seinem aufgeklärten Gespräch eine Befriedigung, die mit dem Mitleid welches seine Niedergeschlagenheit ihr einflößte, zusammenwirkte, ihm ihr Vertrauen zu gewinnen, und sie sprach mit einer ungezwungnen Offenheit, die ihrer jetzigen Gemüthsstimmung ungewöhnlich war, mit ihm.
Seine Besuche wurden immer häufiger. Er ging mit La Lüc und seiner Familie aus; er begleitete sie auf ihren kleinen Wanderungen, um die prächtigen Überreste des Römischen Alterthums zu besehn, die Nizzas Gegend schmücken. Wenn die Frauenzimmer bey der Arbeit zu Hause saßen, erheiterte er ihre Stunden durch Vorlesen, und sie hatten das Vergnügen, ihn oft merklich erleichtert von seiner schweren Melancholie zu sehn.
Herr Amand war leidenschaftlich für Musik eingenommen. Clara hatte nicht vergessen, ihre geliebte Laute mitzubringen, oft berührte er die Saiten in den süßesten klagendsten Fantasien; nie aber ließ er sich bewegen ordentlich zu spielen. Wenn aber Clara oder Adeline spielten, saß er in tiefer Träumerey und verloren für alles andre, nur heftete er oft seine Augen in wehmüthigem Anstaunen auf Adelinen, und ein Seufzer entschlüpfte ihm.
La Lüc hatte jetzt beynahe vierzehn Tage in Nizza zugebracht, und seine Gesundheit, statt sich zu bessern, schien vielmehr abzunehmen, doch wünschte er, das Clima noch etwas länger zu versuchen. Die Luft, welche ihre Heilkraft bey Adelinens ehrwürdigem Freunde verfehlte, belebte diese, und die Mannigfaltigkeit und Neuheit der Gegenstände um sie her, unterhielt ihren Geist, wiewohl sie weder das Andenken des Vergangenen austilgen, noch die Qualen der ihr immer gegenwärtigen Sehnsucht unterdrücken, und folglich das kranke Schmachten der Schwermuth nicht zerstreuen konnten.
Gesellschaft, die sie zwang, ihre Aufmerksamkeit von dem Gegenstande ihres Trauerns abzuziehn, gewährte ihr nur eine vorübergehende Linderung, und meistens ließ die Spannung, worin sie sich setzte, nur noch tiefere Ermattung zurück. In der Stille der Einsamkeit, in der ruhigen Beobachtung der Natur, erhielt ihre Seele ihren Ton wieder, und fand im Nachhängen des stillen Tiefsinns, der ihr zur Gewohnheit geworden war, Linderung und Stärkung.
Von allen großen Gegenständen, welche die Natur hier zur Schau gelegt hatte, flößte keiner ihr höhere Bewundrung ein, als der weite Ozean. Sie mochte gern einsam an seinem Ufer wandeln, und wenn sie sich so lange von den Pflichten oder Formen der Gesellschaft fortschleichen konnte, saß sie oft zu ganzen Stunden am Ufer, beobachtete die rollenden Wellen, und horchte ihrem ersterbenden Gemurmel zu, bis ihre gesänftigte Fantasie ihr lange verfloßne Scenen zurückrief, und ihr Theodors Bild herstellte; — Thränen tiefen Jammers verdrängten dann nur zu oft die des sanftern Mitleids und der Sehnsucht. Doch erregten diese Traumgesichter, so schmerzlich sie auch waren, nicht mehr den Wahnsinn des Schmerzes in ihr, als vormahls in Savoyen: die Schärfe des Jammers war gestumpft, wiewohl sein schwerer Druck vielleicht nicht minder stark war. Auf diese einsame Trauer folgte meistens Ruhe, und was Adeline für Ergebung zu halten, sich bemühte.
Mehrere Tage waren verstrichen, ohne daß Herr Amand sich sehn ließ. Endlich traf ihn Adeline auf einem ihrer einsamen Spaziergänge am Ufer. Er war blaß und niedergedrückt, und schien sehr bewegt, als er sie zu Gesichte bekam, sie suchte ihn zu vermeiden, da sie dieses bemerkte, aber er ging mit schnellen Schritten auf sie zu, und sagte, daß er in wenig Tagen Nizza verlassen würde.
»Ich habe keinen Nutzen von dem Klima verspürt,« sagte er; »ach! welche Himmelsgegend kann wohl Krankheit des Herzens lindern! Ich gehe, um in der Abwechslung neuer Scene das Angedenken verschwundnen Glücks zu verlieren, aber vergebens. Wo ich auch sey, bin ich rastlos und elend!«
Adeline suchte ihm Hoffnung einzusprechen, daß Zeit und Ort seinen Kummer lindern würde.
»Die Zeit stumpft das schärfste Schneiden des Schmerzes,« sagte sie, »ich weiß es aus der Erfahrung.«
Doch widersprachen Thränen in ihren Augen, der Wahrheit ihrer Lippen.
»Sie waren also auch unglücklich, Adeline! — Doch ich wußte es vom Anfang an. Das Lächeln des Mitleids, das Sie mir schenkten, sagte mir, daß Sie wüßten, was Leiden ist! — Sie heißen mich von der Zeit hoffen,« fuhr er nach einem kurzen Stillschweigen fort — »o so wissen Sie denn, daß ich mein Alles, mein Liebstes — ein angebetetes Weib verlor. Viele Monden sind seit ihrem Tode verstrichen, und doch scheint es mir erst seit gestern zu seyn. — Verzeihen Sie mir Adeline, daß ich mein Elend Ihnen aufdringe — aber lebhafter steigt ihr Bild in mir auf, wenn ich Sie sehe, Ihre Stimme höre — Ach, diese Thränen aus Ihren Augen — aber noch einmahl vergeben Sie!«
Adeline wandte sich ab, um sie zu trocknen. Herr Amand zwang sich von etwas anderm zu reden, aber seine Stimme erlag unter der Anstrengung. Schweigend gingen sie nach dem Hause zu, La Lüc war ausgegangen, und Herr Amand wagte nicht, mit herein zu kommen, Adeline begab sich auf ihr Zimmer, niedergedrückt von ihrem eignen, und dem Leiden ihres liebenswürdigen Freundes.
Beynahe drey Wochen waren nunmehr zu Nizza verstrichen, und da La Lüc noch immer keine Lindrung, sondern vielmehr das Gegentheil verspürte, war der Arzt so redlich, ihm zu gestehn, daß er wenig vom Clima hoffte, und rieth ihm, den Erfolg einer Seereise zu versuchen; und wenn auch dieses fehlschlüge, so würde vielleicht die Luft von Montpellier ihm zuträglicher seyn, als die von Nizza.
La Lüc hörte diesen uneigennützigen Rath zwar mit Dankbarkeit, aber zugleich mit Kränkung an. Die Umstände, welche ihn abgeneigt gemacht hatten, Savoyen zu verlassen, machten ihn noch ungeneigter, seine Abwesenheit zu verlängern, und seine Ausgaben zu vermehren: allein die Bande der Zärtlichkeit, die ihn an die Seinigen knüpften, und die Liebe zum Leben, die so selten uns verläßt, siegten noch einmahl über minder wichtige Betrachtungen, und er entschloß sich, die See hinab bis Languedoc zu schiffen, wo er, im Fall die Fahrt seinen Erwartungen nicht entspräche, ans Land steigen und bis Montpellier gehn wollte.
Als Herr Amand hörte, daß La Lüc in wenig Tagen Nizza zu verlassen dachte, beschloß er, nicht vor ihm fortzugehn. Er besaß noch nicht Selbstbeherrschung genug, um sich in dieser Zwischenzeit Adelinens öftere Unterhaltung zu versagen, wiewohl ihre Gegenwart, die ihn an seine verlorne Gattinn erinnerte, ihm mehr Schmerz als Trost gab.
Er war der zweyte Sohn eines französischen Edelmanns und ohngefähr ein Jahr lang mit einem Weibe verheyrathet gewesen, das er lange zärtlich geliebt hatte, als sie im Kindbette starb. Das Kind folgte bald der Mutter nach, und überließ den trostlosen Vater dem Schmerz, der so heftig an seiner Gesundheit nagte, daß sein Arzt es für nothwendig hielt, ihn nach Nizza zu schicken.
Allein die dortige Luft hatte ihm wenig Nutzen gebracht, und er beschloß, weiter in Italien zu gehn, wiewohl er nicht mehr das warme Interesse für diese reizenden Gegenden empfand, die in glücklichern Tagen, und mit ihr, die er nie zu bejammern aufhörte, ihm den höchsten Seelengenuß würden verschafft haben. Jetzt suchte er nur sich selbst zu entfliehn, oder vielmehr dem Bilde, welches einst sein höchstes Glück ausmachte.
Nachdem La Lüc seine Einrichtung getroffen hatte, miethete er ein kleines Schiff, und sagte in wenig Tagen, mit der schwachen Hoffnung auf einem neuen Elemente die Gesundheit zu finden, die bisher seines Nachjagens gespottet hatte, den Ufern von Italien, und den gethürmten Alpen Lebewohl.
Herr Amand nahm einen traurigen Abschied von seinen neuen Freunden, die er bis ans Ufer begleitete. Als er Adelinen an Bord half, war sein Herz zu voll, um ihr Lebewohl sagen zu können; aber lange stand er am Ufer, verfolgte mit den Augen ihren Lauf übers Wasser, und winkte mit der Hand, bis Thränen sein Gesicht verdunkelten.
Der Wind wehte sanft das Schiff von der Küste, und Adeline sah sich von den kräuselnden Wellen des Ozeans umgeben. Das Ufer schien zurück zu weichen, die Berge sich zu verkleinern, die fröhlichen Farben der Landschaft in einander zu schmelzen, und in kurzen sah man Herrn Amands Gestalt nicht mehr: die Stadt Nizza mit ihrem Schloß und Hafen schwand zunächst in der Ferne und die Purpurfarbe der Berge war endlich alles, was vom Saume des Horizonts übrig blieb.
Sie seufzte, und ihre Augen füllten sich mit Thränen.
»So verschwand meine Aussicht auf Glück,« sagte sie, »und meine Zukunft gleicht der Wüste des Wassers, das mich umgibt.«
Ihr Herz war voll, und sie zog sich zurück in einen Winkel des Verdecks, wo sie ihren Thränen nachhing, so wie sie das Schiff seinen Weg durch das flüssige Glas schneiden sah. Das Wasser war so durchsichtig, daß sie bis zu einer beträchtlichen Tiefe die Sonnenstrahlen spielen, und Fische von mannigfaltigen Farben durch den Strom schimmern sehn konnte. Unzählige Seepflanzen breiteten ihre starken Blätter unten auf dem Felsen aus, und das reiche Grün bildete einen schönen Contrast mit dem glühenden Scharlach der Corallen, die sich neben ihnen reihten.
Endlich verschwand auch die ferne Küste gänzlich. Adeline staunte mit der erhabensten Empfindung die grenzenlose Fläche von Wasser an, die sich von allen Seiten ausbreitete: sie schien gleichsam in eine neue Welt getrieben: die Größe und Unermeßlichkeit der Aussicht überwältigte und betäubte sie; einen Augenblick zweifelte sie an der Wahrheit des Compaß, und hielt es beynahe für unmöglich, daß das Schiff seinen Weg durch die pfadlosen Gewässer hin zu einem Ufer finden könnte. Und wenn sie dann wieder dachte, daß nur ein Brett sie vom Tode trennte, verdrängte ein Gefühl unvermischten Schreckens das der Erhabenheit, und eilends wandte sie ihre Augen von der Aussicht, und ihre Gedanken von dem Gegenstande ab.
Gegen Abend steuerte der Capitain, um der Gefahr, auf einen barbarischen Corsaren zu treffen, aus dem Wege zu geht, nach der fränzösischen Küste, und Adeline unterschied im Glanz der untergehenden Sonne, die Ufer der Provence mit Wald gefiedert, und grün von Weide. La Lüc, matt und krank, hatte sich in die Cajütte zurückgezogen, wohin Clara ihn begleitete.
Der Steuermann am Helm, der das schlanke Fahrzeug durch das rauschende Wasser führte, und ein einsamer Bootsknecht, der sich mit übereinander gekreuzten Armen gegen den Mast lehnte, und von Zeit zu Zeit Stellen aus einem Trauerliede sang, waren ausser Adelinen alle lebendigen Gegenstände, die auf dem Verdeck blieben. Adeline beobachtete schweigend die untergehende Sonne, die einen gelben Glanz auf die Wellen und Seegel warf, die sanft in dem Winde, der jetzt erstarb, schwollen. Endlich sank die Sonne unter den Ozean; die Dämmerung schlich sich über die Scene, ließ nur noch die schattigten Ufer übrig, und berührte mit einem feyerlichen Hauch den weiten Kreis des Wassers.
So wie die Schatten sich verdickten, sank die Gegend in tiefe Ruhe. Selbst des Matrosen Gesang hatte aufgehört: man vernahm keinen Laut, als den des Wassers, das unter dem Schiffe anschlug, und sein schwächeres Murmeln an der mit Kieselsteinen besäeten Küste.
Adelinens Seele war im Einklang mit der Ruhe der Stunde: eingewiegt von den Wellen gab sie sich einer stillen Melancholie hin, und saß in Träumen verloren da. Der gegenwärtige Augenblick rief ihr die Fahrt auf der Rhone ins Gedächtniß, als sie vor dem gefürchteten Marquis de Montalt Zuflucht suchte, und so ängstlich in der Zukunft zu lesen wünschte. Sie betrachtete damahls, so wie jetzt, den Fall des Abends, und die schwindende Aussicht, und erinnerte sich, welch ein verlaßnes Gefühl damahls den Eindruck dieser Gegenstände begleitete. Damahls hatte sie keine Freunde, keine Zuflucht, keine Sicherheit, der Verfolgung ihres Feindes zu entgehn. Jetzt hatte sie zärtliche Freunde gefunden — eine sichre Zuflucht — war von den Schrecken, die sie damahls litt, befreyt, — aber noch immer war sie unglücklich.
Theodors Erinnerung — Theodors, der sie so herzlich geliebt, so viel für sie gewagt und erduldet hatte, von dessen Schicksal sie noch eben so wenig wußte, als da sie über die Rhone kreuzte, war ihrem Herzen eine unablässige Qual. Sie schien weiter als je von der Möglichkeit entfernt, von ihm zu hören. Oft schwebte eine schwache Hoffnung ihr vor, daß er der Bosheit seines Verfolgers entwischt sey; wenn sie aber den bittern Haß, und die Macht des Marquis bedachte, und das schreckliche Licht, worin das Gesetz einen Angriff auf einen Vorgesetzten betrachtet, so verschwand auch diese armselige Hoffnung, und überließ sie Thränen und Jammer, wozu diese Träumerey, die nur mit einer Regung sanfter Schwermuth begann, endlich führte.
Sie sann fort, bis der Mond aus dem Grunde des Ozeans aufstieg, und mit seinem zitternden Glanz auf den Wellen, Frieden ringsum ausgoß, und die Stille feyerlicher machte. Er strahlte ein sanftes Licht auf die weissen Seegel, und warf den langen Schatten des Schiffes, das jetzt, von keinem Gegenstrom mehr gehindert, hinweg zu gleiten schien, über das Wasser.
Ihre Thränen hatten einigermaßen den Schmerz ihrer Seele gelindert, und sie ruhte wieder in stiller Melancholie, als eine Melodie, so süß und überirrdisch, daß sie mehr einer himmlischen als sterblichen Musik glich, sich durch die Stille stahl, so sanft, so entzückend tönte sie in ihr Ohr, daß sie vom Jammer zu Hoffnung und Liebe sie rief. Sie weinte wieder — aber Thränen, die sie nicht für Fröhlichkeit und Freude ausgetauscht haben würde.
Sie sah sich um, wurde aber weder Schiff noch Boot gewahr, und so wie die schwebenden Töne auf der fernen Luft schwollen, schienen sie ihr vom Ufer zu kommen. Oft verwehte sie der Wind, und brachte sie wieder in sanft schmachtenden Tönen zurück. Da auf solche Art die Luft den Zusammenhang brach, war es mehr Musik, als Melodie, was sie auffing, bis der Steuermann dem Ufer näher kam, und sie die Noten eines ihrem Ohre vertrauten Gesangs unterschied. Sie sann nach, wo sie ihn gehört hatte, aber vergebens, doch klopfte beynahe unwillkührlich etwas der Hoffnung gleiches in ihrem Herzen.
Immer noch horchte sie, bis der Wind wieder die Töne stahl. Mit Bekümmerniß sah sie nun, daß das Schiff sich von ihnen fortbewegte, und endlich zitterten sie schwach auf den Wellen, sanken in der Ferne hinweg, und wurden nicht mehr gehört. Sie verweilte noch lange auf dem Verdeck, ungeneigt, die Erwartung, sie wieder zu hören, fahren zu lassen, und ihr Zauber ertönte noch immer auf ihrer Fantasie, bis sie endlich mit einem Grad von Unmuth, den die Veranlassung nicht zu rechtfertigen schien, sich in ihre Cajütte zurück zog.
La Lüc besserte sich merklich; seine Munterkeit nahm zu, und als das Schiff in den Golfe de Lyons einlief, war er munter genug, um vom Verdeck die edle Aussicht, welche die schwindenden Ufer der Provence, die sich in den Fernen von Languedoc endigen, dem Auge darbiethen, zu genießen. Die Zeit verstrich ihnen zwischen Vergnügen und Belehrung, denn La Lüc fand ein Vergnügen, seinen aufmerksamen Schülerinnen die Sitten und den Handel der verschiednen Bewohner der Küste, und die Naturgeschichte ihres Landes zu beschreiben; oder in der Einbildungskraft den fernen Wanderungen der Flüsse bis zu ihrer Quelle nachzuspüren, und die charakteristischen Schönheiten der Scene zu bezeichnen.
Nach einer angenehmen Reise von wenig Tagen wichen die Ufer der Provence zurück; die Küste von Languedoc, welche lange die Ferne begrenzt hatte, wurde der große Gegenstand der Scene, und die Matrosen steuerten dem Hafen zu. Sie landeten Nachmittags in einer kleinen Stadt, die am Fuße einer waldigten Anhöhe lag, zur Rechten die See, und zur Linken die reichen Thäler von Languedoc, geschmückt mit purpurnem Weine, beherrschte. La Lüc beschloß, seine Reise bis zum folgenden Tage aufzuschieben, und wurde nach einem kleinen Wirthshause am äußersten Ende der Stadt gewiesen, wo er mit der Bewirthung, so wie sie war, zufrieden zu seyn suchte.
Am Abend lockte die schöne Stunde und das Verlangen, neue Gegenden zu entdecken, Adelinen zu einem Spaziergang. La Lüc war zu müde; um auszugehn, und Clara blieb bey ihm. Adeline nahm ihren Weg nach dem Walde, der vom Rande der See aufstieg und klimmte die wilde Anhöhe hinan, an welcher er hing. Oft sah sie im Gehn zurück, um zwischen dem dunkeln Laube das blaue Wasser der Bay, das weisse Seegel, das neben ihr flatterte, und den zitternden Schein der untergehenden Sonne aufzufangen.
Als sie den Gipfel erreichte und über die dunkeln Spitzen der Wälder auf die weite, mannigfaltige Aussicht herab sah, bemächtigte sich ihrer ein stilles Entzücken, und ohne den Flug der Zeit zu merken, blieb sie stehn, bis die Sonne die Gegend verlassen hatte, und die Dämmerung ihren feyerlichen Schatten auf die Berge warf. Nur die See strahlte noch den erlöschenden Glanz des Westen nieder; ihre ruhige Fläche wurde nur stellenweise von dem tiefen Winde gestört, der in zitternden Linien auf dem Wasser hinschlich, und von da zu dem Walde empor steigend, das leichte Laub schüttelte und hinweg starb.
Endlich verließ Adeline die Höhen, und folgte einem kleinen Fußwege, der sich zum Ufer hinabwand: ihre Seele war jetzt schönen Eindrücken vorzüglich geöfnet, und die süßen Töne der Nachtigall zwischen der Stille der Wälder, weckten sie zu hoher Begeistrung.
Die sich verbreitende Dämmerung erinnerte sie plötzlich an ihre weite Entfernung vom Wirthshause, und daß sie durch einen wilden, einsamen Wald ihren Rückweg suchen mußte: sie sagte der Syrene Addieu, die so lange sie aufgehalten hatte, und verfolgte mit schnellen Schritten den Pfad.
Nachdem sie eine Weile darauf fortgeschritten war, verirrte sie sich im Dickigt, und die zunehmende Dunkelheit ließ ihr nicht zu, von der Richtung, in der sie sich befand, zu urtheilen. Ihre Angst machte ihr den Weg noch schwerer: sie glaubte in einiger Entfernung Menschenstimmen zu hören und beflügelte ihre Schritte, bis sie sich am Seeufer befand, das die Waldung überhing. Ihr Athem war jetzt erschöpft.
Sie stand einen Augenblick still, um sich zu erhohlen, und horchte ängstlich: allein statt menschlicher Stimmen hörte sie schwach in der Luft die Töne klagender Musik schwellen. Ihr Herz, stets den Eindrücken der Tonkunst offen, schmolz mit der Melodie, und auf einen Augenblick verlor sich ihre Furcht in süßer Bezaubrung. Bald mischte sich Erstaunen in dieß Entzücken, als sie beym Herannahen der Töne den Laut des Instruments, und die Melodie der wohl bekannten Arie unterschied, die sie vor wenig Abenden von den Ufern der Provence gehört hatte. Allein, sie hatte nicht Zeit zu Vermuthungen, Fußtritte näherten sich, und sie erneuerte ihre Eile.
Sie war nunmehr aus der Dunkelheit der Wälder hervorgegangen, und der hell scheinende Mond zeigte ihr längs der Sandfläche, in der Ferne Stadt und Hafen. Die Schritte, die ihr folgten, erreichten sie jetzt, und sie sah zwey Männer, die wie es schien, im Gespräch vorbey gingen, ohne sie zu bemerken; indem sie aber vorüber gingen, schien ihr die Stimme des einen bekannt. —
Jetzt folgte ein andrer Schritt, und eine grobe Stimme rief ihr, still zu stehn. So wie sie eilends sich umsah, erblickte sie unvollkommen bey Mondenlicht einen Mann im Schifferkleide, der hinter ihr her kam, und immer fortrief. Von Schrecken getrieben, flog sie den Sand hinab, aber ihre Schritte waren kurz und bebend — die ihres Verfolgers stark und schnell.
Sie hatte eben Kräfte genug, die Männer zu erreichen, die zuvor an ihr vorbey gegangen waren, und sie um Schutz anzuflehn, als ihr Verfolger heran kam, plötzlich aber sich in die Wälder drehte, und verschwand.
Ihr Athem war zu kurz, um die Fragen der Fremden, die sie unterstützten, zu beantworten, bis ein plötzlicher Ausruf und der Laut ihres eigenen Nahmens ihre Augen aufmerksam auf den Mann zog, der ihn aussprach, und sie in den Strahlen, die stark auf seine Züge fielen, Herrn Verneuil erkannte! —
Gegenseitige Freude und Erklärung folgte, und als er erfuhr, daß La Lüc und seine Tochter in dem Gasthofe waren, fühlte er ein doppeltes Vergnügen, sie dahin zu begleiten. Er sagte, daß er zufällig einen alten Freund, den er unter dem Nahmen Mauron ihr vorstellte, im Savoyengebürge gefunden, und daß dieser ihn bewegt hätte, seine Route zu verändern, und ihn an die Küste des Mittelländischen Meers zu begleiten. Sie hatten sich erst vor wenig Tagen am Ufer der Provence eingeschifft, und waren diesen Nachmittag in Languedoc bey Herrn Maurons Landgute ausgestiegen.
Adeline zweifelte nun nicht mehr, daß es Herrn Verneuils Flöte, die sie so oft zu Leloncourt entzückt hatte, gewesen war, die sie auf der See hörte.
Als sie das Wirthshaus erreichten, fanden sie La Lüc in großer Angst um Adelinen, nach der er verschiedene Leute ausgeschickt hatte. Diese Angst verwandelte sich in Erstaunen und Vergnügen, als er sie mit Herrn Verneuil kommen sah, dessen Augen bey Claras Anblick von ungewöhnlichem Feuer strahlten.
Nach den gegenseitigen Begrüßungen, bemerkte und beklagte Herr Verneuil, daß seine Freunde in diesem Wirthshause so sehr schlechte Bequemlichkeit hätten; und Herr Mauron lud sie sogleich mit einer gastfreyen Wärme, die jede Einwendung der Delicatesse oder des Stolzes aufhob, auf sein Gut. Der Wald, den Adeline durchstrich, machte einen Theil seines Gebieths aus, das sich fast bis ans Wirthshaus erstreckte; allein er bestand darauf, daß sein Wagen sie nach dem Gute bringen sollte, und ging fort, um Anstalt zu ihrem Empfang zu machen.
Die Gegenwart des Herrn Verneuil, und die Gefälligkeit seines Freundes gaben La Lüc eine ungewöhnliche Munterkeit: er sprach mit einer Stärke und Lebhaftigkeit, die sie lange nicht an ihm gesehen hatten, und Clara gab Adelinen durch ein frohes Lächeln zu verstehen, wie sehr sie ihn schon durch die Reise gestärkt glaubte. Adeline beantwortete ihren Blick mit einem weniger zuversichtlichen Lächeln, weil sie seine gegenwärtige Lebhaftigkeit auf Rechnung einer andern vorübergehenden Ursache schrieb.
Herr Mauron war noch keine halbe Stunde fort, als ein Aufwärter Adelinen eine Empfehlung von einem Herrn brachte, der sich in Wirthshause befände, und sie zu sprechen wünschte. Der Mann, der sie am Strande verfolgt hatte, fiel ihr ein, und sie zweifelte nicht, daß der Fremde ein Mensch wäre, der dem Marquis de Montalt angehörte, vielleicht gar er selbst, so unwahrscheinlich es auch war, daß er zufällig, an einem so verborgenen Ort, und so unmittelbar nach ihrer Ankunft sie entdeckt haben sollte.
Mit zitternden Lippen und einem todtenblassen Gesicht fragte sie nach dem Nahmen des Herrn. Der Aufwärter wußte ihn nicht. La Lüc fragte, was es für eine Art von Person wäre, allein der Mensch verstand sich so wenig auf die Kunst zu beschreiben, und gab eine so verworrene Nachricht von ihm, daß Adeline kaum so viel herausbringen konnte, daß er nicht übergroß wäre. Da indessen dieser Umstand sie überzeugte, daß es nicht der Marquis seyn könnte, der ein sehr großer Mann war, fragte sie La Lüc, ob er erlauben wollte, das der Fremde herein käme.
»Allerdings« antwortete La Lüc, und der Aufwärter ging hinaus. Adeline saß in ängstlicher Erwartung, bis die Thüre aufging und — Louis de La Motte herein trat. Er näherte sich mit beklommnen schwermüthigen Wesen, wiewohl sein Gesicht von einer augenblicklichen Freude glänzte, als er Adelinen zuerst sah — sie, die noch immer der Abgott seines Herzens war. Alle Besorgnisse vor dem Marquis waren nunmehr verschwunden, und sie hatte nichts angelegentlichers zu fragen, als wenn er Herrn und Frau von La Motte zuletzt gesehn hätte?
»Die Frage sollte ich vielmehr an Sie thun,« sagte Louis etwas verlegen, »denn ich glaube, Sie haben sie später gesehn als ich. Ich habe seit einiger Zeit nichts von meinem Vater gehört, wahrscheinlich, weil mein Regiment in ein anderes Quartier verlegt ist.«
Er sah aus, als möchte er gern wissen, bey wem Adeline jetzt wäre, allein da sich hiervon in La Lücs Beyseyn nicht sprechen ließ, leitete sie das Gespräch auf allgemeine Gegenstände, und sagte ihm bloß, sie hätte seine Ältern gesund verlassen. Louis sprach wenig, und sah Adelinen oft ängstlich an, während seine Seele unter einem schmerzhaften Druck zu arbeiten schien. Sie bemerkte es, und da sie seine Erklärung am Morgen seiner Abreise von der Abtey nicht vergessen hatte, schrieb sie seine Verlegenheit einer noch nicht vertilgten Leidenschaft zu, und schien sie nicht zu merken.
Nachdem er wohl beynahe eine Viertelstunde unter einem Kampfe von Gefühlen, die er weder unterdrücken, noch verbergen konnte, gesessen hatte, stand er auf, um das Zimmer zu verlassen, und sagte im Vorbeygehen leise zu Adelinen:
»Erlauben Sie mir, Sie nur auf fünf Minuten allein zu sprechen.«
Sie besann sich verlegen und sagte dann, ›da niemand als Freunde von ihr gegenwärtig wären, so bäte sie ihn, sich ohne Zwang hier zu äussern.‹
»Entschuldigen Sie mich,« sagte er in eben dem leisen Ton; »was ich zu sagen habe, geht Sie sehr nahe an, und nur Sie. Ich bitte, gönnen Sie mir auf einige Augenblicke Gehör.«
Er sagte dieß mit einem Blick, der sie befremdete, und nachdem sie Lichter in ein andres Zimmer bestellt hatte, führte sie ihn dahin.
Louis saß einige Augenblicke stumm und in sichtlich starker Bewegung. Endlich sagte er:
»Ich weiß nicht, ob ich mich über dieses unvermuthete Zusammentreffen freuen oder beklagen soll; wiewohl, wenn Sie in guten Händen sind, ich mich unstreitig freuen muß, so schwer auch das Geschäft, welches mir jetzt obliegt, mir wird. Ich bin nicht unbekannt mit den Gefahren und Verfolgungen, die Sie erlitten haben, und kann meinen ängstlichen Wunsch, zu wissen wie jetzt Ihre Lage ist, nicht unterdrücken. Sind Sie in der That bey Freunden?«
»Bey sehr guten Freunden,« antwortete Adeline; »Herr von La Motte hat Ihnen also gesagt —«
»Nein,« fiel Louis mit einem tiefen Seufzer ein; »nicht mein Vater,« — er schwieg — »aber ich freue mich — gewiß ich freue mich herzlich, daß Sie in Sicherheit sind. Wüßten Sie, liebenswürdige Adeline, was ich gelitten habe! —«
»Verzeihn Sie mir,« unterbrach ihn Adeline, »ich verstand, Sie hätten mir etwas wichtiges zu sagen. Darf ich Sie erinnern, daß ich nicht lange Zeit habe?«
»Es ist allerdings wichtig, allein ich weiß nicht, wie ich es anbringen, wie ich es sänftigen soll — o mein armer Freund!«
»Von wem reden Sie,« fiel Adeline hastig ein.
Louis stand vom Stuhl auf und ging im Zimmer umher.
»Ich wollte Sie vorbereiten auf das, was ich zu sagen habe,« fing er wieder an — »allein bey meiner Seele, ich bin es nicht im Stande.«
»Ich beschwöre Sie, halten Sie mich nicht länger in Ungewißheit,« sagte Adeline, der ein wilder Gedanke aufstieg, daß es Theodor sey, von dem er reden wollte. Louis zögerte noch. »Ist es — o ist es, ich beschwöre Sie, sagen Sie mir nur das ärgste,« rief sie mit Todesangst — »ich kann es ertragen, gewiß, ich kann es.«
»Mein unglücklicher Freund!« rief Louis —
»Theodor, Theodor« stammelte Adeline schwach — »lebt er noch?«
»Ja, aber —«
Er hielt inne.
»Aber was?« rief Adeline heftig zitternd. »Wenn er lebt, können Sie mir nichts schrecklicheres sagen, als meine Furcht mir eingibt. Ich beschwöre Sie nochmahls, zögern Sie nicht.«
Louis setzte sich wieder auf seinen Stuhl, und suchte eine gefaßte Miene anzunehmen.
»Er lebt,« sagte er, »aber im Gefängniß, und — denn warum sollte ich Sie täuschen — ich fürchte, er hat wenig in dieser Welt zu hoffen.«
»Das habe ich lange gefürchtet,« sagte Adeline mit einer Stimme erzwungner Fassung »Sie haben noch etwas schrecklichers zu sagen, und ich bitte Sie nochmahls, sich zu erklären.«
»Er hat alles von dem Marquis de Montalt zu fürchten. Ach warum sage ich zu fürchten? Sein Urtheil ist schon gesprochen — er ist zum Tode verurtheilt.«
Bey dieser Bestätigung ihrer schrecklichen Ahndung verbreitete sich eine Todtenblässe über Adelinens Gesicht: sie saß ohne Bewegung, und ein Seufzer erstickte in ihrer Brust. Erschrocken über ihren Zustand, und in Erwartung, sie ohnmächtig werden zu sehn, wollte Louis ihr zu Hülfe springen, allein sie winkte ihm, unfähig zu sprechen, mit der Hand von sich ab. Er rief um Hülfe, und La Lüc, Clara und Herr Verneuil eilten schnell herbey.
Bey dem Laute ihrer Stimmen sah sie auf, und schien sich zu besinnen; gleich darauf machte ein tiefer Seufzer ihr Luft, und sie brach in Thränen aus. La Lüc war es lieb, daß sie weinen konnte, wirklich fühlte sie sich auch bald erleichtert, und bath, so bald sie zu reden fähig war, daß man sie wieder ins andre Zimmer bringen möchte. Louis begleitete sie dahin, und als sie sich etwas besser befand, wollte er sich zurückziehn, allein La Lüc bath ihn zu bleiben.
»Vielleicht sind Sie ein Verwandter dieses jungen Frauenzimmers,« sagte er, »und haben ihr Nachricht von ihrem Vater gebracht?«
»Verzeihn Sie, ich bin nicht mit ihr verwandt,« antwortete Louis stockend.
»Dieser Herr,« sagte Adeline, die nunmehr ihre zerstreuten Gedanken wieder gesammelt hatte, »ist ein Sohn des Herrn La Motte, dessen Sie mich vielleicht haben erwähnen hören.«
Louis schien betroffen, als Sohn eines Mannes vorgestellt zu werden, der so unwürdig gegen Adelinen gehandelt hatte. Sie merkte es sogleich und suchte die Wirkung ihrer Worte zu mildern, indem sie hinzu setzte, daß La Motte sie aus einer dringenden Gefahr gerettet, und ihr viele Monathe lang eine Zuflucht unter seinem Dache verstattet hätte. —
Adeline saß in einem Zustande schrecklicher Angst und Begierde, die nähern Umstände von Theodors Lage zu wissen, und konnte nicht Muth fassen, in La Lücs Gegenwart das Gespräch zu erneuern: doch wagte sie es, Louis zu fragen, ob sein Regiment in dieser Stadt läge.
Er antwortete, sein Regiment läge zu Vaceau, einer französischen Stadt an der spanischen Grenze; er wäre eben von Lyon übergefahren und auf dem Wege nach Savoyen, wohin er in aller Früh morgen sich aufmachen wollte.
»Wir sind kürzlich daher gekommen,« sagte Adeline; »darf ich fragen, nach welcher Gegend von Savoyen Sie gehn?«
»Nach Leloncourt.«
»Nach Leloncourt?« wiederhohlte Adeline voll Verwunderung.
»Ich bin in dem Lande nicht bekannt,« versetzte Louis, »allein ich gehe um meinem Freunde zu dienen. Sie scheinen Leloncourt zu kennen, und wenn Sie wissen, daß Herr La Lüc daselbst wohnt, wie ich nicht anders vermuthe, so werden Sie den Zweck meiner Reise errathen.«
»O Himmel, ist es möglich,« rief Adeline — »ist es möglich, daß Theodor Peyrou mit Herrn La Lüc verwandt ist?«
»Theodor! was ist es mit meinem Sohne?« fragte La Lüc in Bestürzung.
»Ihr Sohn,« sagte Adeline, mit zitternder Stimme, »ihr Sohn!«
Das Erstaunen und der Schmerz auf ihrem Gesichte vermehrte die Besorgniß des unglücklichen Vaters, und er erneuerte seine Frage. Allein Adeline war gänzlich unvermögend, ihm zu antworten, und Louis Beängstigung, so unerwartet den Vater seines unglücklichen Freundes zu finden, und das harte Geschäft vor sich zu sehn, ihm das Schicksal seines Sohnes zu entdecken, raubte ihm eine Zeitlang alle Sprache. La Lüc und Clara, deren Angst durch dieß schreckliche Schweigen nur höher stieg, wiederhohlten ihre Fragen.
Endlich überwältigte ein Gefühl von dem herannahenden Leiden des guten La Lüc alle andre Empfindung, und Adeline überwand sich genug, um Claren die schreckliche Nachricht auf eine mildernde Art beyzubringen, und sie in ein anderes Zimmer zu führen. Hier sagte sie ihr mit so viel Fassung, als sie zusammen raffen konnte, und mit der zärtlichsten Schonung, die Umstände von ihres Bruders Lage und verheelte ihr bloß sein schon ausgesprochnes Urtheil.
Diese Erzählung brachte natürlich eine Eröffnung ihres Verhältnisses mit sich, und Clara entdeckte in der Freundinn ihres Herzens die unschuldige Ursache von ihres Bruders Verderben. Auch erfuhr Adeline, was daran Schuld gewesen war, daß ihr Theodors Verwandtschaft mit La Lüc so lange unbekannt blieb: Theodor hatte mit einem Gute, das ein Verwandter seiner Mutter ihm unter dieser Bedingung vermachte, seit etwa einem Jahre den Nahmen Peyrou angenommen. Er war zur Kirche bestimmt gewesen, allein sein Temperament machte ihn geneigter zu einem thätigen Leben, als die geistliche Tracht ihm verschaffen konnte, und so bald er sein Vermögen in die Hände bekam, kaufte er sich eine Capitains-Stelle in französischen Diensten.
Bey ihrem seltnen und oft unterbrochnen Zusammenseyn in Caux hatte Theodor seiner Familie nur im Allgemeinen erwähnt, und sie blieb also bey ihrer plötzlichen Trennung in Unwissenheit wegen seines Vaters Nahmen und Aufenthalt.
Claras Schmerz, als sie die Lage ihres Bruders erfuhr, ließ keine Mäßigung zu: Adeline die mit äusserster Anstrengung ihren Empfindungen so weit gebothen hatte, diese Nachricht mit leidlicher Fassung zu ertheilen, wurde nunmehr von ihrem eignen, und Claras hinzukommenden Leiden beynahe überwältigt.
Während sie beyde den Jammer ihres Herzens ausweinten, ging, wo möglich, ein noch rührenderer Auftritt zwischen La Lüc und Louis vor. Dieser sah wohl ein, wie nothwendig es war, den armen Vater, zwar mit großer Behutsamkeit und allmählig, von dem ganzen Umfang seines Unglücks zu unterrichten. Er sagte ihm also, ohngeachtet Theodor anfangs nur wegen des Vergehens, seinen Posten verlassen zu haben, vor Gericht gefordert sey, wäre er jetzt wegen eines Angriffs auf seinen Obristen, den Marquis de Montalt, verurtheilt worden.
Der Marquis hatte Zeugnisse beygebracht, daß sein Leben durch diesen Angriff in Gefahr gesetzt worden, und hatte die Verfolgung mit der bittersten Wuth betrieben, bis er endlich den Ausspruch erhalten, den das Regiment nicht verweigern konnte, jeder Offizier aber schmerzlich beklagte.
Louis setzte hinzu, daß das Urtheil in Zeit von vierzehn Tagen sollte vollzogen werden, und daß Theodor, äusserst unruhig, keine Antwort auf alle an seinen Vater geschickten Briefe erhalten zu haben, ihn noch einmahl zu sehn wünschte. Da nun keine Zeit zu verlieren gewesen sey, so hätte er es übernommen, nach Leloncourt zu gehen, und seinen Vater mit seiner Lage bekannt zu machen.
La Lüc nahm die Nachricht von seines Sohnes Zustand mit einem Schmerz auf, der weder Thränen noch Klagen zuließ. Er fragte, wo Theodor wäre, und verlangte zu ihm gebracht zu werden, dankte Louis für seine Freundschaft, und bestellte sogleich Postpferde.
Ein Wagen war bald bereit, und dieser unglückliche Vater, machte sich nach einem traurigen Abschiede von Herrn Verneuil, den er bath, ihn bey seinem Freunde Mauron zu entschuldigen, mit seiner Familie auf den Weg nach dem Gefängnisse seines Sohns.
Die Reise geschah in tiefem Schweigen. Jeder bemühte sich aus Schonung des andern, den Ausbruch seines Schmerzes zu unterdrücken; mehr aber vermochten sie nicht. La Lüc schien ruhig und gefaßt; er schien oft im Stillen zu beten, allein man sah ohngeachtet seiner Mühe, es zu verbergen, auf seinem Gesicht, wie schwer ihm das Streben nach Ergebung und Ruhe ward.
Wir kehren nunmehr zu dem Marquis de Montalt zurück, der, sobald er La Motten im Gefängniß zu D—y in sicherer Verwahrung gesehn und erfahren hatte, daß es noch nicht so bald zum Verhör kommen würde, sich wieder nach seiner Villa am Walde verfügte, wo er von Adelinen Nachricht zu vernehmen hoffte. Er war Anfangs willens gewesen, seinem Kammerdiener nach Lyon zu folgen; beschloß aber jetzt, einige Tage auf Briefe zu warten, denn er zweifelte nicht, daß seine Leute Adelinen einhohlen und sie wahrscheinlich schon in Sicherheit gebracht haben würden, ehe er die Stadt erreichen könnte.
In dieser Erwartung wurde er schmerzlich getäuscht; sein Kammerdiener meldete ihm, wiewohl sie ihr glücklich bis in diese Stadt nachgespürt hätten, wäre es ihnen doch nicht möglich gewesen, ihr weiter zu folgen, oder sie zu Lyon zu erfragen. Wahrscheinlich verdankte sie dieses Entkommen ihrer stillen Einschiffung auf der Rhone, denn wie es scheint, dachten des Marquis Leute nicht daran, sie auf diesem Flusse zu suchen.
Bald nachher wurde seine Gegenwart zu Vaceau erfordert, wo das Kriegsgericht Sitzung hielt; er ging dahin mit neu empörtem Zorn über seine letzte vereitelte Erwartung, und bewirkte Theodors Verurtheilung. Der Ausspruch wurde allgemein beklagt, denn Theodor war bey seinem Regiment seht beliebt, und da die Ursache von des Marquis Haß gegen ihn bekannt war, nahm jedes Herz an seiner Sache Theil.
Louis de La Motte lag um diese Zeit gerade in der nähmlichen Stadt im Quartier; er hörte einen verworrnen Bericht von der Sache und da er überzeugt war, der Gefangne müsse eben der junge Offizier seyn, den er mit dem Marquis auf der Abtey gesehn hätte, trieb ihn theils Mitleid, theils Hoffnung, von seinen Ältern Nachricht zu hören, zu ihm.
Die mitleidige Theilnahme, welche Louis äusserte, der Eifer, womit er ihm seine Dienste anboth, rührten Theodor, und erregten warme Erwiederung der Freundschaft in ihm. Louis besuchte ihn oft, that alles, was Freundschaft zur Lindrung seines Leidens nur eingeben konnte, und es entspann sich bald gegenseitige Achtung und Vertraulichkeit unter ihnen.
Theodor eröffnete endlich seinem Freunde den Hauptgegenstand seines Kummers, und dieser entdeckte zu seinem unaussprechlichen Schmerz, daß es Adeline war, die der Marquis so grausam verfolgt hatte, Adeline, um derentwillen der großmüthige Theodor litt! Auch merkte er bald, daß Theodor sein begünstigter Nebenbuhler war, allein er unterdrückte edel die eifersüchtige Qual, welche diese Entdeckung ihm verursachte, und beschloß, daß kein Vorurtheil der Leidenschaft ihn von den Pflichten der Menschlichkeit und Freundschaft abhalten sollte.
Er fragte begierig, wo denn Adeline jetzt wäre?
»Ich fürchte, sie ist noch in den Händen des Marquis!« sagte Theodor mit einem tiefen Seufzer. »O Sott, diese Ketten!« — und warf einen jammervollen Blick darauf.
Louis saß stumm und nachdenkend; endlich fuhr er aus seinem Tiefsinn auf, sagte, er wollte zu dem Marquis gehn, und verließ sogleich das Gefängniß. Der Marquis war schon nach Paris gereist, wohin er vorgeladen war, um bey La Mottens nahem Verhör zu erscheinen; und Louis, dem die letzten Vorfälle auf der Abtey noch unbekannt waren, ging wieder ins Gefängniß, wo er zu vergessen suchte, daß Theodor der begünstigte Nebenbuhler seiner Liebe war, und nur Adelinens Vertheidiger in ihm sah. Er trug ihm so ernstlich seine Dienste an, daß Theodor, den das Schweigen seines Vaters befremdete und betrübte, und der sehnlich verlangte, ihn noch einmahl zu sehn, sein Anerbiethen, nach Savoyen zu reisen annahm.
»Ich fürchte, der Marquis hat meine Briefe aufgefangen,« sagte Theodor, »wenn das ist, so wird mein armer Vater das ganze Gewicht seines Unglücks auf einmahl auszustehn haben, wenn ich nicht deine Freundschaft annehme; und ich werde nichts wieder von ihm sehn und hören, ehe ich sterbe. O Louis! es gibt Augenblicke, wo meine Stärke vor dem Kampf zurückbebt, und meine Sinnen mich zu verlassen drohn!«
Hier war keine Zeit zu verlieren: der Urtheilsspruch zu seiner Hinrichtung hatte schon des Königs Unterschrift erhalten, und Louis machte sich unverzüglich auf den Weg nach Savoyen. Theodors Briefe waren allerdings vom Marquis aufgefangen worden, der in Hoffnung, Adelinens Aufenthalt zu entdecken, sie erbrach und nachher verbrannte.
Aber es ist Zeit, wieder zu La Lüc zurückzukehren, der jetzt nach Vaceau zog, und in dessen Aussehn seine Familie seit Empfang der unglücklichen Nachricht eine sehr nachtheilige Veränderung wahrnahm; es war nur zu sichtlich, daß seine Krankheit einen schnellen Fortschritt gemacht hatte. Louis, der auf dieser Reise durch die zärtliche Aufmerksamkeit, die er dieser unglücklichen Gesellschaft bezeigte, die Güte seines Herzens bewies, verheelte seine Beobachtung über La Lücs Abnehmen, und suchte Adelinen zu überreden, daß ihre Besorgnisse grundlos wären.
Sie bedurfte in der That Unterstützung: sie war jetzt nur noch wenig Meilen von der Stadt entfernt, die Theodor einschloß; und während ihre immer wachsende Angst sie fast überwältigte, kämpfte sie, ruhig zu scheinen. Als der Wagen in die Stadt fuhr, warf sie einen furchtsamen ängstlichen Blick aus dem Fenster, um sich nach dem Gefängniß umzusehn; allein nachdem sie durch verschiedne Straßen gekommen waren, ohne ein Gebäude zu entdecken, welches ihrer Vorstellung gleich kam, hielt die Kutsche vor dem Wirthshause still.
Die häufigen Veränderungen in La Lücs Gesicht, verriethen, was in seiner Seele vorging, und als er auszusteigen versuchte, war er so schwach und kraftlos, daß er sich von Louis mußte führen lassen, dem er leise sagte:
»Ich bin in der That krank am Herzen; allein ich hoffe, es soll nicht lange dauern.«
Louis drückte ihm die Hand ohne zu reden, und eilte nach Adelinen und Clara zurück, die schon im Vorsaal waren. La Lüc wischte sich die Thränen ab; (die ersten, die er vergoß) als sie ins Zimmer traten.
»Ich möchte gern unverzüglich zu meinem armen Jungen gehn,« sagte er zu Louis — »Sie haben ein beschwerliches Amt übernommen, Lieber, bringen Sie mich zu ihm.«
Er stand auf, schwach aber und überwältigt vom Schmerz, mußte er sich wieder setzen, Adeline und Clara vereinten sich, ihn zu bitten, daß er sich erst erhohlen, und einige Stärkung zu sich nehmen möchte; und Louis, der ihm vorstellte, wie nothwendig es sey, Theodor zuvor auf diese Zusammenkunft vorzubereiten, bewegte ihn, sich zu gedulden, bis sein Sohn von seiner Ankunft benachrichtigt wäre, und verließ sogleich das Wirthshaus, um zu seinem Freunde ins Gefängniß zu gehen.
Als er fort war, versuchte La Lüc aus Pflicht gegen die, welche er liebte, einige Nahrung zu sich zu nehmen, allein die Krämpfe in seiner Brust ließen ihm nicht zu, den Wein, den er an seine trocknen Lippen brachte, hinunter zu schlucken, und er befand sich in solcher Zerrüttung, daß er in ein andres Zimmer sich zurückzog, wo er allein, und im Gebet die schreckliche Zwischenzeit in Louis Abwesenheit hinbrachte.
Clara ließ, an Adelinens Busen gelehnt, die in stillem Jammer da saß, die Heftigkeit ihres Schmerzes aus.
»Ich werde auch meinen Vater verlieren,« sagte sie. »Ich sehe es — Vater und Bruder zugleich!«
Adeline weinte eine Weile still mit ihrer Freundinn, und suchte dann sie zu überreden, daß La Lüc nicht so schlimm wäre, als sie fürchtete.
»Täuschen Sie mich nicht mit Hoffnung,« sagte Clara; »er wird diesen Stoß nicht überleben, ich sah es von Anfange an.«
Adeline, welche wußte, daß La Lücs Schmerz noch erhöht werden würde, wenn er seiner Tochter Schmerz sähe, und daß Nachgeben hier nur nachtheilig war, suchte sie zu einer Anstrengung ihrer Kraft aufzufordern, und stellte ihr vor, wie nothwendig es sey, in Gegenwart ihres Vaters über ihre Bewegung zu gebiethen.
»Und dieses ist möglich,« sagte sie, »so peinlich auch die Anstrengung ist. Sie müssen wissen, meine Liebe, daß mein Schmerz gewiß dem Ihrigen nicht nachsteht, und doch vermocht ich bisher, meine Leiden im Stillen zu ertragen, denn ich liebe und verehre Herrn La Lüc als meinen Vater.«
Louis erreichte indessen Theodors Gefängniß, der ihn mit einer Miene voll Erstaunen und Unruhe empfing.
»Was bringt dich so früh zurück,« sagte er, »hast du Nachricht von meinem Vater gehört?«
Louis brachte ihm nun nach und nach die Umstände ihrer Zusammenkunft und La Lücs Anwesenheit zu Vaceau bey. Ein Gemisch von Bewegungen wühlte auf Theodors Gesicht, als er diese Nachricht hörte.
»Mein armer Vater,« sagte er, »er ist also seinem Sohne an diesen Ort der Schande gefolgt! Ach ich dachte nicht, als ich mich zuletzt von ihm trennte, daß er mich in einem Gefängniß, unter Verurtheilung zum Tode, wieder finden würde.«
Dieser Gedanke erregte einen tobenden Schmerz, der ihn auf eine Zeitlang der Sprache beraubte.
»Aber wo ist er?« sagte er, sich endlich wieder fassend. »Nun er gekommen ist, erzittre ich vor der Zusammenkunft, die ich so sehnlich wünschte. Der Anblick seines Jammers wird mir tödtend seyn. Louis — wenn ich nicht mehr bin, so tröste meinen armen Vater!«
Schluchzen erstickte aufs neue seine Stimme, und Louis, der es nicht für rathsam gehalten hatte, ihn zu gleicher Zeit von seines Vaters und Adelinens Ankunft zu benachrichtigen, hielt es jetzt für gut, ihm durch diese letzte Nachricht ein Stärkungsmittel zu reichen.
Die Finsterniß des Kerkers und des Jammers schwand auf einen Augenblick. Wer Theodor gesehn hätte, würde geglaubt haben, daß Leben und Freyheit ihm in diesem Momente angekündigt wäre. Als seine ersten Bewegungen sich gelegt hatten, sagte er:
»Ich will nicht jammern, da ich weiß, daß Adeline gerettet ist, und daß ich meinen Vater noch einmahl sehn werde; nun sterbe ich gefaßt.«
Er fragte, ob La Lüc im Gefängniß wäre? und hörte, er sey mit Clara und Adelinen im Wirthshause.
»Wie,« rief er, »Adeline! ist Adeline auch da? das geht über meine Hoffnung. Aber warum frohlocke ich? Ich darf Sie nicht mehr sehn; dieß Gefängniß ist kein Ort für Adelinen.«
Aufs neue verfiel er in einen Anfall von Schmerz; aufs neue wiederhohlte er tausend Fragen wegen Adelinen, bis Louis ihn erinnerte, daß sein Vater ungeduldig verlangte, ihn zu sehn. Erschrocken, seinen Freund so lange aufgehalten zu haben, bat er ihn nun, seinen Vater nach dem Gefängniß zu führen, und suchte seine Kräfte zu der nahen Zusammenkunft zu sammeln.
Als Louis im Gasthofe erschien, war La Lüc noch in seinem Zimmer, und Clara ging, ihn zu rufen. Adeline ergrif mit zitternder Ungeduld die Gelegenheit, sich näher nach Theodor zu erkundigen, als sie in Gegenwart seiner unglücklichen Schwester zu thun wagte.
Louis schilderte ihn weit ruhiger, als er wirklich war; und ihre bisher verhaltnen Thränen flossen still und reichlich, bis La Lüc erschien. Sein Gesicht hatte seine Ruhe wieder erlangt, war aber mit einem tiefen, festen Kummer geprägt, der in allen, die ihn sahn, eine gemischte Empfindung von Mitleid und Ehrfurcht erregen mußte.
»Wie geht es meinem Sohn?« sagte er, als er hereintrat; »wir wollen sogleich zu ihm.«
Clara erneuerte ihre schon abgeschlagne Bitte, ihren Vater begleiten zu dürfen; allein er verweigerte es durchaus.
»Morgen sollst du ihn sehn,« setzte er hinzu, »aber bey unsrer ersten Zusammenkunft müssen wir allein seyn. Bleibe bey deiner Freundinn, meine Liebe: sie bedarf des Trostes.«
Sobald La Lüc fort war, legte sich Adeline, unvermögend länger gegen die Gewalt des Schmerzes zu kämpfen, ins Bett.
La Lüc ging schweigend, auf Louis Arm gestützt, nach dem Gefängniß zu: eine düstre Lampe, die oben hing, zeigte ihnen die Pforten, und Louis zog eine Glocke. La Lüc, von innrer Bewegung beynahe umsinkend, lehnte sich an die Pfosten, bis der Wärter erschien. Er fragte nach Theodor und folgte dem Manne: als er aber den zweyten Vorhof erreichte, schien er im Begrif, in Ohnmacht zu sinken, und stand wieder still. Louis bat den Mann, ein Glas Wasser zu hohlen; La Lüc aber, der die Sprache wieder erhielt, sagte, es würde bald besser werden, und ließ ihn nicht fort.
In wenig Minuten war er im Stande, Louis zu folgen, der ihn durch verschiedne finstre Gänge und einige Stufen hinan, zu einer Thüre führte, die, als die eisernen Stangen weggeschoben waren, ihm das Gefängniß seines Sohnes zeigte. Er saß an einem kleinen Tisch, auf welchem eine Lampe stand, die nur gerade so viel Licht auf den Ort warf, um seine Öde und Jämmerlichkeit zu zeigen. Als er La Lüc gewahr ward, sprang er vom Stuhl auf und warf sich in feine Arme.
»Mein Mein Vater!« rief er zitternd.
»O mein Sohn!« seufzte La Lüc, und sie hielten lange einander schweigend umfaßt.
Endlich führte ihn Theodor zu dem einzigen Stuhl, den das Zimmer enthielt, und setzte sich mit Louis auf den Fuß des Bettes, wo er nunmehr Musse fand, die Verheerung zu bemerken, welche Krankheit und Kummer auf seines Vaters Zügen gestiftet hatten.
La Lüc machte verschiedene Versuche zu reden; unvermögend aber, einen Laut herauszubringen, legte er die Hand auf die Brust und seufzte tief. Besorgt für die Wirkung eines so rührenden Auftritts auf seinen schwachen Körper, suchte Louis seine Aufmerksamkeit von dem unmittelbaren Gegenstande seines Kummers abzuziehn, und unterbrach das Schweigen; allein La Lüc schauderte, und sich über Frost beklagend, sank er in seinen Stuhl zurück. Sein Zustand weckte Theodor aus der Betäubung und während er seinem Vater zu Hülfe flog, lief Louis aus dem Zimmer, um andern Beystand zu holen.
»Mir wird bald besser werden, Theodor,« sagte La Lüc und schlug die Augen auf, »die Schwäche, die mich anwandelte, ist schon vorüber. Ich bin seither unpaß gewesen, und diese betrübte Zusammenkunft —«
Nicht vermögend, sich länger zu beherrschen, rang Theodor die Hände, und der Schmerz, der lange nach Äußerung gestrebt hatte, brach jetzt in krampfhaftem Schluchzen aus seiner Brust.
La Lüc lebte nach und nach wieder auf, und bemühte sich, die heftigen Bewegungen seines Sohnes zu stillen: aber diesen hatte jetzt alle Kraft verlassen, und er konnte nur ausrufen und jammern.
»Ach,« sagte er, »ich dachte nicht, das wir je unter so schrecklichen Umständen zusammen kommen würden! Aber ich habe sie nicht verdient, mein Vater! die Bewegungsgründe meines Verfahrens waren stets gerecht.«
»Das ist mein höchster Trost,« erwiederte La Lüc, »und muß auch dich in dieser Stande der Prüfung stärken. Der ewige, der unsre Herzen richtet, wird dir nach diesen lohnen. Traue auf ihn, mein Sohn; ich blicke nicht mit schwacher Hoffnung, sondern mit festem Vertrauen auf seine Gerechtigkeit zu ihm auf.«
La Lücs Stimme bebte; er schlug mit einem Blick sanfter Ergebung, seine Augen zum Himmel, während Thränen der Menschlichkeit leise seine Wangen herab rollten.
Noch tiefer bewegt durch seine letzten Worte, wandte sich Theodor von ihm, und ging mit unruhigen Schritten im Zimmer auf und ab. Louis Hereinkunft verschafte La Lüc eine sehr nothwendige Hülfe. Er nahm die Herzstärkung, die Louis ihm brachte, und gewann bald so viel Kraft, um über den Gegenstand, der ihm am meisten am Herzen lag, zu reden.
Theodor bemühte sich, die Herrschaft über seine Empfindung wieder zu erlangen, und es gelang ihm einigermaaßen. Er sprach über eine Stunde mit leidlicher Fassung, und La Lüc suchte in dieser Zeit das Gemüth seines Sohns durch fromme Hoffnung zu erheben, und ihn auszurüsten, der schauderlichen Stunde, welche herannahte, mit Fassung entgegen zu gehn.
Allein der Schein von Ergebung, den Theodor sich zu erreichen bestrebte, verschwand immer bey dem Gedanken, daß er seinen Vater als Beute des Kummers, und seine geliebte Adeline auf immer verlassen sollte. Als La Lüc sich zum Fortgehn anschickte, erwähnte er ihrer wieder.
»So traurig auch eine Zusammenkunft unter diesen Umständen seyn muß,« sagte er, »kann ich doch den Gedanken nicht ertragen, diese Welt zu verlassen, ohne sie noch einmahl zu sehn; doch weiß ich nicht, wie ich von ihr fordern soll, das sie um meinetwillen sich dem Schmerz einer Abschiedsscene unterzieht. Sagen Sie ihr, daß meine Gedanken nie, nur auf einen Augenblick von ihr weichen, das —«
La Lüc unterbrach ihn durch die Versicherung, daß er sie sehn sollte, da er es so sehr wünschte, wiewohl eine Zusammenkunft unter ihnen, nur den gegenseitigen Schmerz der letzten Trennung erhöhn könnte.
»Ich weiß es, ich weiß es zu gut,« sagte Theodor, »doch kann ich mich nicht entschließen, sie nicht wieder zu sehn. O mein Vater! wenn ich an diejenigen denke, die ich bald auf immer verlassen muß, so bricht mein Herz. Aber ich will mir Ihre Lehren und Beyspiele zu Nutze machen, und Ihnen zu zeigen suchen, daß Ihre väterliche Sorgfalt nicht vergebens bey mir angewandt war. Mein guter Louis! geh mit meinem Vater; er bedarf Unterstützung. Wie viel verdank ich diesem großmüthigen Freund!« setzte er hinzu. »Doch Sie wissen es, mein Vater!
»Ja, ich weiß es,« versetzte La Lüc, »und kann nie dankbar genug seine Freundschaft erkennen. Er hat uns allen beygestanden; aber du bedarfst jetzt mehr Trost als ich selbst — er soll bey dir bleiben — ich will allein gehn.«
Theodor wollte dieß nicht zugeben, und La Lüc widersetzte sich nicht länger: sie umarmten einander zärtlich, und trennten sich für die Nacht.
Als sie das Wirthshaus erreichten, ging La Lüc mit Louis über die Möglichkeit zu Rathe, zeitig genug eine Bittschrift für Theodor an den Monarchen zu bringen. Seine Entfernung von Paris, und die Kürze der Zeit bis zur Vollziehung des Urtheils machte dieß sehr schwer; weil er es aber doch für möglich hielt, beschloß La Lüc, so unfähig er auch zu einer so langen Reise war, es zu versuchen. Louis, welcher glaubte, daß dieß Unternehmen unglücklich für den Vater ablaufen würde, ohne dem Sohn zu nützen, versuchte, wiewohl schwach, ihm davon abzurathen, aber sein Entschluß war fest.
»Wenn ich den kleinen Überrest meines Lebens für mein Kind aufopfre, so verliere ich wenig,« sagte er; »wenn ich ihn rette, gewinne ich alles. Es ist keine Zeit zu verlieren; ich will sogleich fort.«
Er wollte Postpferde bestellen, aber Louis und Clara, die eben von ihrer Freundinn Bette gekommen war, stellten ihm dringend die Nothwendigkeit vor, einige Stunden Ruhe zu genießen; er mußte endlich selbst einsehn, daß er zu der unmittelbaren Anstrengung, wozu Vaterliebe ihn drang, nicht vermögend war, und willigte ein, Ruhe zu suchen.
Als er sich in sein Zimmer begeben hatte, bejammerte Clara den Zustand ihres Vaters.
»Er wird die Reise nicht aushalten,« sagte sie,«er hat sich in diesen wenigen Tagen sehr verändert.«
Louis war so ganz ihrer Meinung, daß er es nicht einmal so weit verbergen konnte, um ihr mit Hoffnung zu schmeicheln. Sie setzte hinzu, was eben nicht betrug, ihn bessern Muths zu machen, daß Adelinens Schmerz um Theodor, und um das Leiden ihres Vaters so groß wäre, daß sie Folgen für ihre Gesundheit fürchtete.
Die Leidenschaft des jungen La Motte war durch Zeit und Abwesenheit nicht vermindert worden: im Gegentheil hatten die Verfolgungen und Gefahren, welche Adeline ausgestanden, alle seine Zärtlichkeit erweckt, und sie seinem Herzen näher gebracht. Als er entdeckte, daß Theodor sie liebte, und wieder geliebt ward, empfand er alle Qualen der Eifersucht und getäuschter Liebe: denn wiewohl sie ihm zu hoffen untersagte, fand er es doch zu schwer, ihr zu gehorchen, und hatte insgeheim die Flamme genährt, die er hätte ersticken sollen.
Doch war sein Herz zu edel, um seinen Eifer für Theodor erkalten zu lassen, weil er sein beglückterer Nebenbuhler war, und seine Seele zu stark, um nicht den Schmerz, den diese Gewißheit erregte, zu verbergen. Die Liebe, welche Theodor Adelinen bewiesen hatte, machte ihm vielmehr seinen Freund nur noch theurer, so bald er sich von dem ersten Stoß erhohlte; und der Sieg über seine Eifersucht, wozu Grundsätze ihn auffoderten, und der mit schwerer Mühe erkämpft ward, wurde in der Folge sein Stolz und sein Ruhm.
Zwar, als er Adelinen wieder sah — sie sah in der sanften Würde des Kummers, anziehender [aus] als je; er sah, wie sie selbst unter seinem Drucke beynahe erlag, und dennoch liebreich und sorgsam die Leiden derer, die um sie waren, zu lindern suchte, da beharrte er nur mit äußerster Mühe auf seinem Entschluß, die Äußerung der Empfindungen, die sie ihm einflößte, zu unterdrücken. Wann er denn ferner bedachte, daß ihr bitterer Schmerz aus der Stärke ihrer Zärtlichkeit entstand, so wünschte er sich heißer als je zum Gegenstand der Liebe eines solcher Zärtlichkeit fähigen Herzens, und Theodor im Gefängniß und in Ketten, war ihm ein Gegenstand des Neides.
Am Morgen, als La Lüc von einem kurzen, unruhigen Schlummer aufstand, fand er Louis, Clara und Adelinen, die sich durch ihre Unpäßlichkeit nicht abhalten ließ, ihm diesen Beweiß der Ehrfurcht und Liebe zu geben, im Saale versammlet, um ihn abreisen zu sehn. Nach einem kleinen Frühstück, wobey sein Gefühl ihm wenig zu reden erlaubte, sagte er seinen Freunden ein trauriges Lebewohl, und stieg von ihren Thränen und Gebeten begleitet, in den Wagen.
Adeline begab sich sogleich in ihr Schlafzimmer, und befand sich zu übel, um es den Tag über zu verlassen. Gegen Abend verließ Clara das Bette ihrer Freundinn und ließ sich von Louis zu ihrem Bruder führen, den die Nachricht von seines Vaters Abreise in mannichfaltige und starke Bewegung setzte.
Wir kehren nunmehr zu Pierre de La Motte zurück, der nach einigen im Gefängniß zu D—y zugebrachten Wochen, zum Verhör nach den Gerichtshöfen von Paris gebracht wurde, wohin der Marquis de Montalt ihm folgte, um die Klage zu betreiben. Frau von La Motte begleitete ihren Mann ins Chatelet. Seine Seele erlag unter dem Gewicht seines Unglücks, und alle Bemühungen seiner Gattinn konnten ihn nicht aus der betäubenden Verzweiflung erwecken, welche die Erwägung seiner Umstände in ihm erzeugte.
Wenn er auch von der Anklage, die der Marquis gegen ihn einbrachte, losgesprochen wurde, (welches sehr unwahrscheinlich war) so befand er sich jetzt mitten im Schauplatz seiner vorigen Verbrechen, und der Augenblick, der ihn aus den Mauern seines Gefängnißes befreyte, mußte ihn aller Wahrscheinlichkeit nach, wieder in die Hände der beleidigten Gerechtigkeit liefern.
Die Anklage des Marquis war nur zu wohl gegründet und von zu ernsthafter Art, um nicht La Motten in das höchste Schrecken zu setzen. Bald nach seiner Niederlassung auf der St. Clairs Abtey sah er den kleinen Vorrath von Geld, den er bey seiner eiligen Flucht retten konnte, beynahe erschöpft, und die peinlichste Angst über sein künftiges Fortkommen nagte an seiner Seele.
Eines Abends, als er einsam in einer entlegnen Gegend des Waldes spazieren ritt, über seine bedrängten Umstände nachdachte und auf Pläne sann, das herannahende Elend abzuwenden, sah er zwischen den Bäumen in einiger Entfernung einen Herrn zu Pferde, der langsam vor sich hinritt, und ohne alle Begleitung schien. Ein Gedanke fuhr in La Mottens Seele, daß er sich von den ihm drohenden Übeln retten könnte, wenn er den fremden beraubte. Seine vorige Lebensart hatte ihn über die Schranken der Rechtschaffenheit hinaus geführt, Betrug war ihm gewißermaaßen vertraut geworden, und er verwarf den Gedanken nicht sogleich.
Doch zögerte er — jeder Augenblick des Zögerns verstärkte die Macht der Versuchung — eine so günstige Gelegenheit stieß ihm vielleicht nie wieder auf. — Er sah sich um und erblickte niemand, so weit die Bäume offen waren, als den Herrn, der seinem Ansehn nach ein Mann von Stande zu seyn schien. La Motte rief alle seine Herzhaftigkeit auf und fiel ihn an.
Der Marquis de Montalt, denn er war es, war unbewafnet; weil er aber wußte, daß seine Leute nicht weit waren, wollte er nicht nachgeben. Indem sie um den Sieg kämpften, sah La Motte verschiedene Leute zu Pferde in die Allee einlenken, und durch Widerstand und Zögern aufs äußerste getrieben, zog er ein Pistol aus der Tasche (das er aus Furcht vor Räubern immer bey sich trug, wenn er sich weit von der Abtey entfernte) und schoß auf den Marquis, der sogleich schwankte, und betäubt vom Pferde fiel.
La Motte behielt eben Zeit, einen brilliantnen Stern von seinem Rocke, einige Diamantringe von seinen Fingern zu stehlen, und ihm die Taschen auszuleeren, ehe seine Bedienten heran kamen. Statt den Räuber zu verfolgen, flogen sie alle in der ersten Bestürzung ihrem Herrn zu Hülfe, und La Motte entkam.
Ehe er die Abtey erreichte, stand er bey einigen Ruinen, dem vorhin erwähnten Grabmahl, still, um seine Beute zu untersuchen. Sie bestand aus einem Beutel mit siebzig Louisd'or; einem diamantnen Stern, drey Ringen von großem Werth, und einem mit Brillianten eingefaßten Bilde des Marquis, das er zum Geschenke für seine Favoritinn bestimmt hatte.
In La Motte, der noch wenig Stunden zuvor sich beynahe ganz entblößt gesehen hatte, erregte dieser Anblick ein Entzücken, über das er kaum Herr war: allein bald wurde es unterdrückt, als er sich erinnerte, welche Mittel er angewandt hatte, um diesen Reichthum zu erhalten, den er für Blut erkauft hatte. Von Natur heftig in seinen Leidenschaften, stürzte diese Betrachtung ihn vom Gipfel der Freude in den Abgrund der Niedergeschlagenheit. Er betrachtete sich als einen Mörder, und fuhr auf, gleich einen, der vom Traume erwacht, und hätte die halbe Welt gegeben, um wieder so arm, und vergleichungsweise, so rein von Verbrechen zu seyn, als er einige Stunden zuvor war.
Als er das Gemählde näher besah, fiel ihm die Ähnlichkeit auf, und in dem Glauben, daß seine Hand dem Urbilde das Leben geraubt hatte, starrte er es mit unbeschreiblicher Angst an. Auf die Schrecken des Gewissens folgte die Bestürzung der Furcht. Ahndend, er wußte nicht was, zögerte er bey dem Grabe, wo er endlich seinen Schatz niederlegte, weil er fürchtete, daß sein Vergehn an den Tag kommen, die Abtey untersucht werden, und diese Juwelen ihn verrathen könnten.
Es war ihm ein leichtes, vor Frau von La Motte den Anwuchs seines Reichthums zu verbergen: denn da er sie mit dem wahren Zustande seiner Finanzen nie bekannt gemacht hatte, argwöhnte sie die nahe Armuth, die ihm drohte, nicht; und da sie wie gewöhnlich zu leben fortfuhren, glaubte sie, daß ihre Ausgaben aus der gewöhnlichen Casse bestritten würden.
Nicht so leicht aber war es, die Regungen des Gewissens und Schreckens zu verheelen: er wurde finster und zurückhaltend, und seine häufigen Besuche am Grabe, wohin er theils, um seinen Schatz zu besehen, hauptsächlich aber, um dem schrecklichen Vergnügen, das Gemählde des Marquis zu betrachten, nachhängen zu können, so oft ging, mußten auffallen und Neugierde erregen. In der Einsamkeit des Waldes, wo keine Abwechslung von Gegenständen seine Ideen erneuerte, war die schreckliche Vorstellung, einen Mord begangen zu haben, ihm immer gegenwärtig. —
Als der Marquis auf der Abtey erschien, wurde La Mottens Schrecken und Erstaunen — denn anfangs wußte er kaum, ob er den Schatten oder das Wesen dieser ihm immer gegenwärtigen Gestalt sähe, — schnell durch die Furcht vor der seinem Verbrechen gebührenden Strafe verdrängt. Als sein dringendes Bitten den Marquis bewegt hatte, mit ihm in ein anderes Zimmer zu gehn, sagte er ihm, daß er von Geburt ein Edelmann wäre; er berührte diejenigen Seiten seines Schicksals, die Mitleid erregen mußten, äußerte solchen Abscheu gegen sein Verbrechen, und gab freywillig ein so feyerliches Versprechen, die Juwelen, die er noch unveräußert besaß, zurückzugeben, daß der Marquis ihn endlich mit einem Grad von Bedauern anhörte.
Diese günstige Gesinnung, von einem eigennützigen Bewegungsgrunde unterstützt, bewegte den Marquis, einen Vergleich mit La Motten einzugehn. Schnell und reizbar von Leidenschaft hatte er Adelinens Schönheit mit aufmerksamen Auge betrachtet, und beschloß, La Mottens Leben unter keiner andern Bedingung, als mit Aufopferung dieses unglücklichen Mädchens zu schonen. La Motte besaß weder Muth noch Tugend genug, diese Bedingung zu verwerfen — die Juwelen wurden zurückgegeben, und er willigte ein, die unschuldige Adeline zu verrathen..
Weil er aber ihr Herz zu gut kannte, um zu glauben, daß sie sich so leicht dem Laster hingeben würde, und noch immer einiges Mitleid und Zärtlichkeit gegen sie fühlte, suchte er den Marquis von heftigen Maasregeln abzuhalten, und ihn zur allmähligen Untergrabung ihrer Grundsätze durch sanftes Werben um ihre Liebe zu bewegen.
Der Marquis genehmigte und befolgte diesen Plan; das Fehlschlagen des ersten Versuchs bewegte ihn, die Kunstgriffe anzuwenden, deren er sich nachher bediente, um so Adelinens Unglück zu vergrößern.
Dieß waren die Umstände, welche La Motten in seine jetzige beklagenswerthe Lage gebracht hatten. Der Tag des Verhörs war erschienen, und er wurde aus dem Gefängniß in das Gericht geführt, wo der Marquis als sein Ankläger erschien. Als die Klage vorgebracht wurde, vertheidigte La Motte wie gewöhnlich seine Unschuld, und der Advokat Nemours, der seine Sache zu führen übernommen hatte, bemühte sich ins Licht zu stellen, daß die Klage von Seiten des Marquis falsch und böslich sey. In dieser Absicht erwähnte er den Umstand, daß der Marquis seinen Angeklagten zur Ermordung Adelinens hätte bewegen wollen; ferner, daß der Marquis mehrere Monathe vor La Mottens Verhaftung in vertraulichen Umgang mit ihm gelebt, und erst, als La Motte seine Absichten vereitelt, und den unglücklichen Gegenstand seiner Verfolgung in Sicherheit gebracht, es für gut gefunden hatte, La Motten des Verbrechens, um dessentwillen er festgesetzt war, anzuklagen.
Nemours zeigte, wie unwahrscheinlich es sey, daß ein Mann einen freundschaftlichen Umgang mit einem andern halten würde, der ihm das doppelte Unrecht der Beraubung und eines Angriffs auf sein Leben zugefügt hätte; und doch war es erwiesen, daß der Marquis verschiedene Monathe nach der angegebnen Zeit des Verbrechens oft mit ihm zusammen gekommen war. Wenn der Marquis ihn belangen wollte, warum that er es nicht gleich? und da er es nicht that, was konnte ihn so lange nachher dazu vermögen?
Der Marquis wußte hierauf nichts zu sagen: denn da er sein Betragen in dieser Sache nach seinen Absichten auf Adelinen abgemessen hatte, konnte er es nicht rechtfertigen, ohne Dinge an den Tag zu bringen, welche die Schwäche seines Charakters verrathen, und seine Sache entkräften mußten. Er begnügte sich demnach, einige von seinen Bedienten als Zeugen des Angriffs und der Beraubung auftreten zu lassen, die ohne Bedenken La Mottens Person beschwuren, wiewohl keiner von ihnen ihn anders als bey der Dunkelheit des Abends, und in vollem Gallop davon sprengend, gesehn hatte. Bey scharfer Untersuchung und Kreuzfragen widersprachen sie einander. Ihr Zeugniß wurde folglich verworfen; da aber der Marquis noch zwey andere Zeugen aufstellen wollte, deren Ankunft er stündlich erwartete, wurde das Verhör aufgehoben, und das Gericht verschob die Sitzung.
La Motte wurde eben so niedergeschlagen in sein Gefängniß zurückgebracht, als er es verließ. Als er durch einen Vorplatz ging, kam er an einem Manne vorbey, der still stand, um ihn vorüber zu lassen und ihn starr und aufmerksam ansah. La Motten dünkte, dieß Gesicht schon gesehn zu haben; allein der unvollkommene Anblick, den er an dem dunkeln Orte von ihm erhaschen konnte, machte ihn ungewiß, und zudem war seine Seele zu sehr von andern Dingen beunruhigt, um auf einen äussern Gegenstand zu achten.
Als er vorüber war, erkundigte sich der Fremde bey dem Aufseher des Gefängnisses, wer La Motte sey; und als er es erfuhr, und noch einige andere Antworten auf Fragen, die er that, erhielt, verlangte er mit ihm zu sprechen. Die Bitte wurde gewährt, da dieser Mann nur Schulden halber saß; weil aber die Thüren jetzt für die Nacht verschlossen wurden, mußte es bis morgen verschoben bleiben.
La Motte fand seine Frau im Zimmer, die schon einige Stunden gewartet hatte, um den Ausgang des Verhörs zu vernehmen. Sie wünschten nun sehnlicher als je, ihren Sohn zu sehn; allein sie waren, wie Louis vermuthet hatte, mit der Veränderung seines Quartiers unbekannt, weil seine Briefe, die er unter verabredeter Addresse an das Posthaus zu Auboine schickte, liegen geblieben waren.
Madame schrieb ihm also nach seinem bisherigen Aufenthalte, und er erfuhr weder seines Vaters Unglück, noch Abzug von der Abtey. Seine Mutter, befremdet, keine Antwort auf ihre Briefe zu erhalten, schickte einen neuen ab, worin sie ihm den Ablauf des Verhörs bis hierher meldete, und ihn bat, um Urlaub anzusuchen, und unverzüglich nach Paris zu kommen: allein dieser Brief, der noch immer an den vorigen Ort ging, mußte ihn, so wie die andern verfehlen.
Indessen war sein herannahendes Schicksal keinen Augenblick fern von La Mottens Seele, die von Natur schwach, und noch mehr entnervt durch Gewohnheit, ihm in diesem schrecklichen Zeitpunct allen Trost versagte.
Während diese Auftritte zu Paris vorgingen, langte La Lüc ohne weitern Unfall nach einer Reise, auf welcher einzig seine Seelenstärke ihn unterstützen konnte, daselbst an. Er eilte, sich dem Monarchen zu Füßen zu werfen, und so groß war das Übermaß seines Gefühls, als er die Bittschrift, welche das Schicksal seines Sohnes bestimmen sollte, überreichte, daß er nur schweigend aufzublicken vermochte, und in Ohnmacht sank. Der König nahm das Papier an, und nachdem er Befehl gegeben hatte, Sorge für den unglücklichen Alten zu tragen, ging er fort. Man trug ihn in seinen Gasthof zurück, wo er den Ausgang dieses seines letzten Versuchs erwartete.
Adeline blieb indessen zu Vaceau in einem Zustande von Qual, der ihrem lang zerrütteten Körper zu mächtig war, und befand sich so übel, daß sie ihr Zimmer hüthen mußte. Zu Zeiten wagte sie sich mit der Hoffnung zu schmeicheln, daß La Lücs Reise glücklich ablaufen würde; allein diese kurzen und täuschenden Zwischenzeiten des Trostes, schärften nur die Muthlosigkeit, die darauf folgte, und bey den abwechselnden Extremen ihrer Gefühle litt sie mehr Qual als das scharfe Stechen unerwarteten Unglücks oder der finstre Schmerz festgewurzelter Verzweiflung fühlen läßt.
So oft sie sich wohl genug befand, ging sie herunter in den Saal, um mit Louis zu reden, der ihr öftere Nachricht von Theodor brachte, und jeden Augenblick, den er von seinen Dienstpflichten abbrechen konnte, zur Tröstung und Unterstützung seiner bekümmerten Freunde anwandte. Adeline und Theodor erwarteten beyde nur von ihm den wenigen Trost, der ihnen vergönnt war: denn er brachte ihnen Nachricht von einander, und so oft er erschien, labte ein vorübergebendes schmerzhaft süßes Vergnügen ihre Herzen.
Er konnte Adelinens Unpäßlichkeit nicht vor Theodor verbergen, weil er einen Grund angeben mußte, warum sie den innigen Wunsch sie zu sehn, den er so oft wünschte, nicht erfüllte. Adelinen unterhielt er meistens mit der Standhaftigkeit und Ergebung seines Freundes, wobey er indessen die Zärtlichkeit, die er stets für sie äußerte, nicht zu erwähnen vergaß. Gewohnt; ihren einzigen Trost aus Louis Gegenwart zu schöpfen, und seine unermüdete Freundschaft gegen ihn, den sie so herzlich liebte, zu beobachten, fand sie, daß ihre Achtung für ihn in Dankbarkeit reifte, und er ihr täglich werther ward.
Louis stellte die Standhaftigkeit, womit sein Freund sein Unglück ertrüge, stärker vor, als sie wirklich war. Theodor konnte die Bande, welche ihn ans Leben knüpften, nicht genug vergessen, um seinem Schicksal mit Festigkeit entgegen zu gehn; aber so scharf und häufig auch die Anfälle seines Schmerzes waren, bestrebte er sich doch in Gegenwart seiner Freunde eine männliche Fassung anzunehmen, und es gelang ihm oft. Er hoffte wenig von seines Vaters Reise, doch war dieß wenige genug, um seine Seele in peinlicher Ungewißheit des Ausgangs zu erhalten.
La Lüc kam am Tage vor dem zur Vollziehung des Urtheils bestimmten, nach Vaceau zurück. Adeline stand an ihrem Kammerfenster, als der Wagen ans Wirthshaus fuhr; sie sah ihn aussteigen, und mit schwachen Schritten, von Peter unterstützt, ins Haus gehn. Sein mattes Ansehn verrieth ihr nichts Gutes, und fast erliegend unter der Heftigkeit ihrer Bewegung ging sie ihm entgegen, Clara war schon bey ihm, als Adeline ins Zimmer trat.
Sie näherte sich ihm, voll Furcht aber, eine Bestätigung der traurigen Bothschaft, die sein Gesicht weissagte, von seinen Lippen zu hören, sah sie ihn ausdrucksvoll an, und setzte sich nieder, unvermögend die Frage, die auf ihrer Zunge schwebte, heraus zu bringen. Er reichte ihr schweigend die Hand, sank zurück in feinen Stuhl, und schien unter dem Drucke seines Herzens zu erliegen. Sein Benehmen bestätigte alle ihre Furcht: bey dieser schrecklichen Überzeugung vergingen ihr die Sinne, und leblos und betäubt saß sie da.
La Lüc und Clara waren zu sehr beschäftigt mit ihrem eigenen Schmerz, um ihren Zustand zu bemerken, nach einiger Zeit hohlte sie einen tiefen Seufzer und brach in Thränen aus. Erleichtert durch Weinen, kehrten ihre Lebensgeister allmählig wieder, und endlich sagte sie zu La Lüc:
»Es ist überflüßig, Sie um den Ausgang Ihrer Reise zu fragen, doch wünschte ich, wenn Sie es ertragen können, davon zu reden.«
La Lüc winkte abwärts mit der Hand.
»Ach« sagte er, »ich habe nichts zu sagen, als was Sie bereits zu gut errathen — Mein armer Theodor!« —
Seine Stimme brach, und es folgten einige Augenblicke stummen Schmerzes.
Adeline war die erste, die Besinnung genug wieder erlangte, um La Lücs äusserste Ermattung zu bemerken, und ihm zu Hülfe zu eilen. Sie bestellte einige Erquickungen, und bat ihn einen Arzt rufen zu lassen, und sich zu Bett zu legen, weil Ruhe ihm über alles nöthig sey.
»Ich wünschte, daß ich sie finden könnte, mein liebes Kind,« sagte er, »in dieser Welt muß ich sie nicht mehr suchen, aber in einer bessern, und die soll, hoff ich, nicht ferne mehr seyn. Allein wo ist unser treuer Louis? Er muß mich zu meinem Sohn führen.«
Schmerz erstickte wiederum seine Stimme, und Louis Eintritt war eine sehr nothwendige Erleichterung für sie alle. Ihre Thränen ersparten ihm die Frage, die er hätte thun können. La Lüc erkundigte sich sogleich nach seinem Sohn, dankte Louis für alle Freundschaft gegen ihn, und bat, ihn in das Gefängniß zu führen. Louis suchte ihn zu bereden, seinen Besuch bis morgen zu verschieben, und Adeline sowohl als Clara traten ihm bey; allein La Lüc war entschlossen, noch heute zu gehn.
»Seine Zeit ist kurz,« sagte er, »noch wenige Stunden und ich werde ihn nicht mehr sehn; wenigstens in dieser Welt nicht mehr: laßt mich diese kostbaren Augenblicke nicht versäumen. Adeline! Ich hatte meinem armen Jungen versprochen, daß er Sie noch einmahl sehen sollte, aber Sie sind nicht vermögend zu dieser Zusammenkunft, und ich will ihn zu beruhigen suchen. Wenn es mir aber nicht gelingt, und Sie befinden sich morgen besser, so weiß ich, Sie werden Ihre Kräfte anstrengen, um diesen Besuch auszuhalten.«
Adeline sah ungeduldig aus, und versuchte zu reden. La Lüc stand auf um fortzugehn, ehe er aber die Thüre erreichen konnte, fiel er schwach und kraftlos in einen Stuhl.
»Ich muß mich der Nothwendigkeit unterwerfen,« sagte er, »ich sehe, daß ich nicht im Stande bin, heute Abend weiter zu gehn. La Motte, gehn Sie zu ihm und sagen ihm, ich befände mich etwas umpaß von meiner Reise, wollte aber morgen in aller Frühe bey ihm seyn. Schmeicheln Sie ihm nicht mit Hoffnung, bereiten Sie ihn auf das Schlimmste vor.«
Es entstand eine Stille: endlich faßte La Lüc sich wieder, und bath Claren, ihm sein Bett machen zu lassen, welches sie unverzüglich that. Als er fortging, erzählte Adeline, was wirklich überflüßig war, Louis den Ausgang von La Lücs Reise.
»Ich gestehe,« sagte sie, »daß ich mir zuweilen eine Hoffnung erlaubt hatte, und nun diesen Schlag um so härter fühle. Auch fürchte ich, daß Herr La Lüc darunter erliegen wird: er hat sich sehr verschlimmert, seit er nach Paris ging. Ich bitte, sagen Sie mir aufrichtig, wie er Ihnen vorkömmt.«
Die Verändrung war so sichtlich, das Louis sie nicht läugnen konnte, doch suchte er ihre Besorgniß zu mildern, indem er sie großentheils der Ermüdung der Reise zuschrieb. Adeline erklärte ihren Entschluß, La Lüc morgen zu begleiten, um von Theodor Abschied zu nehmen.
»Zwar weiß ich nicht, wie ich diese Zusammenkunft aushalten werde, sagte sie; »allein ihn noch einmahl zu sehn, ist meine Pflicht, die ich ihm und mir selbst schuldig bin, und es würde mich ewig martern, wenn ich ihm diesen letzten Beweis von Zärtlichkeit verweigert hätte.«
Nach einen kurzen Gespräch, begab Louis sich ins Gefängniß, und sann über die besten Mittel nach, seinem Freunde die unglückliche Nachricht mitzutheilen. Theodor hörte sie mit mehr Fassung an, als er erwartet hatte, fragte aber ungeduldig, warum er seinen Vater und Adelinen nicht zu sehn bekäme? und als er hörte, daß Unpäßlichkeit sie zurück hielt, stellte seine Einbildungskraft sich das ärgste vor, und gab ihm ein, daß sein Vater todt wäre.
Es dauerte lange ehe Louis ihn vom Gegentheil überführen, und ihn überzeugen konnte, daß auch Adeline nicht gefährlich krank sey — als er indessen die Versicherung erhielt, er würde sie morgen beyde sehn, wurde er ruhiger. Er bat seinen Freund, ihm diese Nacht nicht zu verlassen.
»Es sind die letzten Stunden, die wir mit einander hinbringen können, ich kann nicht schlafen, bleibe bey mir und erleichtre mir ihr schweres Gewicht. Ich bedarf Tröstung, Louis. Jung wie ich bin, durch so starke Bande gehalten, kann ich nicht mit Ergebung die Welt verlassen. Ich fasse die Beyspiele nicht, die man von philosophischem Gleichmuth uns erzählt. Weisheit kann uns nicht lehren, freudig ein Gut hinzugeben, und das Leben war es für mich!«
Die Nacht verstrich in Gesprächen, die oft durch langes Stillschweigen, oft durch Anfälle von Verzweiflung unterbrochen wurden; und der Morgen des Tages, der Theodor zum Tode führen sollte, dämmerte endlich durch die Gitter seines Gefängnisses.
La Lüc brachte indessen eine schlaflose und schreckliche Nacht hin. Er betete um Stärke und Ergebung für sich und Theodor: aber die Empfindungen der Natur waren zu mächtig in seinem Herzen, und ließen sich nicht unterdrücken. Der Gedanke an seine verstorbene Gattinn, an das, was sie empfinden würde, wenn sie gelebt hätte, um diesen schmähligen Tod ihres Sohnes anzusehn, war ihm oft gegenwärtig.
Es schien gleichsam, als schwebte ein Verhängniß über Theodors Leben, denn aller Wahrscheinlichkeit nach, würde der König des unglücklichen Vaters Bitte gewährt haben, wenn nicht gerade der Marquis am Hofe gewesen wäre, als das Papier überreicht wurde. Das Ansehn und die ausserordentliche Betrübniß des Alten hatte den Monarchen gerührt, und statt das Papier bey Seite zu legen, öfnete er es. Als er die Augen darauf warf, sah er, daß der Verurtheilte zu des Marquis de Montalts Regiment gehörte; er wandte sich zu ihm und fragte ihn um das Vergehn, weswegen der Gefangne den Tod leiden sollte. Die Antwort lautete so, wie man vom Marquis sie erwarten konnte, und der König wurde überzeugt, daß Theodor kein Gegenstand sey, der Mitleid verdiene.
Doch um zu La Lüc zurück zu kehren, der seiner Veranstaltung zu Folge frühzeitig geweckt wurde — Nachdem er einige Zeit im Gebet zugebracht hatte, ging er in den Saal herunter, wo Louis, pünctlich auf die Minute, bereits wartete, um ihn zu seinem Sohne zu führen. Er schien ruhig und gefaßt, aber eine tiefe Trauer, die seinen jungen Freund innigst rührte, war seinen Zügen aufgeprägt. Während sie auf Adelinen warteten, sprach er wenig, und schien zu kämpfen, um die Stärke zu erlangen, die er bedurfte um den herannahenden Auftritt zu übers stehen.
Da Adeline nicht erschien, schickte er endlich zu ihr, um sie anzutreiben, und hörte, sie hätte sich übel befunden, erhohlte sich aber wieder. Sie hatte wirklich eine Nacht in solcher Erschütterung zugebracht, daß ihr Körper darunter erlag, und bestrebte sich jetzt, Stärke und Fassung wieder zu gewinnen, um sich in dieser schrecklichen Stunde aufrecht zu halten. Jeder Augenblick, der sie ihr näher brachte, vermehrte ihre Bewegung, und die Furcht, verhindert zu werden, Theodor noch einmahl zu sehn, hatte allein sie vermögend gemacht, gegen den vereinten Druck von Krankheit und Schmerz zu kämpfen.
Sie kam jetzt mit Clara zu La Lüc, der ihnen entgegen ging, und sie beyde stillschweigend bey der Hand nahm. Nach einigen Augenblicken sagte er, sie wollten gehen, und sie stiegen in den Wagen, der sie zum Gefängniß führen sollte.
Der Pöbel fing bereits an sich zu versammlen, und es entstand ein verworrnes Gemurmel, wie der Wagen vorwärts fuhr, es war ein schmerzhafter Anblick für Theodors Freunde! — Louis unterstützte Adelinen, als sie ausstieg, sie war kaum vermögend zu gehn, und mit zitternden Schritten folgte sie La Lüc, den der Aufseher nach der Gegend des Gefängnisses führte, wo sein Sohn saß. Es war acht Uhr vorbey: das Urtheil sollte erst um 12 vollzogen werden, aber eine Wache stand bereits im Vorhofe, und die unglückliche Gesellschaft begegnete in den schmalen Gängen verschiednen Offizieren, die einen letzten Abschied von Theodor genommen hatten.
Als sie die Treppe hinauf stiegen, hörte La Lüc Ketten klirren, und seinen Sohn mit schnellen ungleichen Schritten oben gehn. Der unglückliche Vater, von dem Augenblicke, der jetzt auf ihn drang, überwältigt, stand still und mußte sich am Geländer halten. Louis fürchtete, daß die Folgen seines Schmerzes bey seinem schon so erschütterten Körper gefährlich seyn möchten, und wollte nach Hülfe eilen, allein er machte ihm ein Zeichen zu bleiben.
»Mir ist besser,« sagte er. »O Gott, stärke mich in dieser Stunde!« —
Und in wenig Minuten war er im Stande, weiter zu gehn.
Als der Wärter die Thüre aufschloß, erschreckte das harte Knarren des Schlüssels Adelinen; aber augenblicklich sah sie sich in Theodors Gegenwart, der ihr entgegen sprang, und sie in seinen Armen auffing, ehe sie zu Boden sank. Ihr Kopf ruhte auf seiner Schulter, und er sah noch einmahl das Gesicht, das ihm so theuer war, das so oft Entzücken in seine Seele gestrahlt hatte, und auch jetzt noch bleich und leblos ihn zu kurzem Entzücken erweckte.
Als sie endlich die Augen aufschlug, heftete sie einen langen, wehmüthigen Blick auf Theodor, der sie an sein Herz drückte, und ihr nur mit einem Lächeln gemischter Zärtlichkeit und Verzweiflung antworten konnte: die Thränen, die er zurückzuhalten strebte, zitterten in seinen Augen, und er vergaß auf einige Zeit alles, ausser Adelinen.
La Lüc, der sich auf den Fuß des Bettes gesetzt hatte, schien unbewußt von allem, was um ihn vorging und ganz versteckt in seinen eignen Jammer; Clara aber, die ihres Bruders Hand ergriff, und sich weinend an seinen Arm hing, äußerte laut alle Qual ihres Herzens, und erweckte endlich Adelines Aufmerksamkeit, die in kaum vernehmlicher Stimme sie bat, ihres Vaters zu schonen. Ihre Worte brachten Theodor zu sich selbst: er führte sie zu einem Stuhl und ging zu La Lüc.
»Mein Sohn, mein geliebter Sohn! —« sagte sein Vater, faßte seine Hand, und brach in Thränen aus.
Sie weinten mit einander. Nach langem Schweigen fing er endlich an:
»Ich hatte geglaubt, diese Stunde ertragen zu können, aber ich bin alt und schwach. Gott kennt meint Bestreben nach Ergebung, mein Vertrauen auf reine Güte.«
Theodor erzwang mit starker und plötzlicher Anstrengung eine gefaßte und entschloßne Miene, und suchte durch jeden sanften Trostgrund seine weinenden Freunde zu beruhigen. Endlich schien La Lüc sein Leiden zu überwinden; er trocknete seine Augen und sagte:
»Mein Sohn, ich hätte mit besserm Beyspiel dir vorgehn, und die Lehren der Seelenstärke ausüben sollen, die ich dir so oft gegeben habe. Allein es ist vorüber; ich kenne meine Pflicht und will sie erfüllen.«
Adeline hauchte einen schweren Seufzer aus, und ihre Thränen flossen unaufhaltsam.
»Beruhigen Sie sich, meine Liebe, wir scheiden nur auf kurze Zeit« — sagte Theodor, und küßte die Thränen von ihren Wangen. Er legte ihre Hand in die seines Vaters, und empfahl sie inständigst seinem Schutz.
»Nehmen Sie sie hin, mein Vater, als das kostbarste Vermächtniß, das ich schenken kann: sie sey von nun an Ihr Kind — sie wird Sie trösten, wenn ich dahin bin; sie wird Ihnen den Verlust Ihres Sohns mehr als ersetzen.«
»Laßt uns diese wichtigen Augenblicke nicht vernachläßigen,« sagte La Lüc, indem er gewaltsam aus seines Sohnes und Adelinens thränenheisser Umarmung sich loswand. »Adeline, meine Tochter, laßt unsre vereinigten Gebete zu ihm emporsteigen, der allein uns trösten und stärken kann!«
Sie knieten sämmtlich nieder, und er betete mit der einfachen erhabenen Beredsamkeit, welche wahre Frömmigkeit einflößt. Als er aufstand, umarmte er jedes seiner Kinder besonders, und da er zu Theodor kam, starrte er ihn mit innigem, klagendem Ausdruck an, und vermochte eine Zeitlang nicht zu reden. Theodor konnte dieß nicht ertragen — er hielt die Hand vor die Augen, und suchte vergebens das tiefe Schluchzen, welches seine Gestalt erschütterte, zu ersticken. Endlich erhielt er die Sprache wieder und flehte seinen Vater [an], ihn zu verlassen.
»Dieser Jammer ist für uns alle zu schwer,« sagte er, »lassen Sie ihn uns nicht verlängern. Die Zeit rückt näher — vergönnen Sie mir mich zu fassen. Die Schärfe des Todes besteht nur im Scheiden von denen, die wir lieben — wann dieses vorüber ist, hat er seine Waffen verloren!«
»Ich will dich nicht verlassen, mein Sohn,« erwiederte La Lüc, »meine armen Töchter sollen gehn, ich aber will in deinen letzten Augenblicken bey dir bleiben.«
Theodor fühlte, daß dieß für sie Beyde zu viel seyn würde, und both alle Überredung der Vernunft auf, um seinen Vater von diesem Vorhaben abzubringen. Allein er beharrte fest darauf.
»Keine selbstsüchtige Erwägung der Pein, die ich fühlen werde, soll mich vermögen, mein Kind zu verlassen, wenn es einer Unterstützung am meisten bedarf. Es ist meine Pflicht, dich zu begleiten, und nichts soll mich abhalten.«
Theodor nahm seinen Vater bey diesen letzten Worten:
»Da Sie wünschen, mich in meiner letzten Stunde unterstützt zu wissen, so flehe ich Sie an, nicht Zeuge davon zu seyn. Ihre Gegenwart mein Vater, würde alle Fassung vernichten — sie würde die wenige Standhaftigkeit überwältigen, die ich vielleicht noch erzwingen kann. Vermehren Sie nicht mein Leiden durch den Anblick Ihrer Qual, sondern lassen Sie mich, wo möglich, den theuren Vater vergessen, den ich auf immer verlassen muß!«
Seine Thränen flossen aufs Neue. La Lüc sah ihn nochmahls mit dem langen Blicke stummer Todesqual an.
»So sey es denn,« sagte er. »Wenn wirklich meine Gegenwart dich beängstigt, so will ich gehn!«
Seine Stimme war gebrochen. Nach einem Schweigen von einigen Augenblicken umarmte er Theodor nochmahls.
»Wir müssen scheiden,« rief er, »wir müssen, aber nur auf kurze Zeit! In einer höhern Welt werden wir wieder vereint seyn. O Gott, du siehst in mein Herz — du siehst, was es in dieser bittern Stunde fühlt.«
Der Schmerz überwältigte ihn von neuem. Er drückte Theodor in seine Arme, plötzlich aber schien er alle Kraft noch einmahl zu sammeln und wiederhohlte:
— »Wir müssen scheiden! O mein Sohn, lebe wohl auf ewig für diese Welt, die Barmherzigkeit des ewigen Gottes unterstütze und segne dich!«
Er drehte sich um, das Gefängniß zu verlassen, sank aber ganz entkräftet von Schmerz in einen Stuhl neben der Thüre, die er öfnen wollte. Theodor starrte mit zerrüttetem Gesicht bald seinen Vater, bald Claren, bald Adelinen an, die er an sein klopfendes Herz drückte, und seine Thränen in die ihrigen fließen ließ.
»Und soll ich denn,« rief er, »soll ich wirklich zum letztenmahle dieß holde Gesicht betrachten! — soll ich nimmer — nimmer es wieder sehn. — O Jammer über allen Ausdruck! — Aber noch einmahl, o noch einmahl —«
Er drückte seine Wange an die ihrige, aber sie war kalt und leblos wie Marmor.
Louis, der gleich anfangs das Zimmer verlassen hatte, um nicht durch seine Gegenwart das letzte, heilige Lebewohl der Traurenden zu stören, kam jetzt herein. Adeline hob den Kopf in die Höhe, und als sie ihn sah, sank er wieder auf Theodors Brust.
Louis schien sehr erschüttert. La Lüc stand auf.
»Wir müssen gehen,« sagte er; »Adeline, meine Liebe, raffen Sie sich zusammen — Clara — meine Kinder, laßt uns gehn. — Noch eine Umarmung, und dann! —«
Louis ging auf ihn zu und faßte ihn bey der Hand.
»Mein ehrwürdiger Freund, ich habe Ihnen etwas zu sagen, doch fürchte ich mich beynahe.«
»Was meinen Sie?« sagte La Lüc schnell. »Kein neues Unglück kann mich jetzt mehr treffen. Fürchten Sie sich nicht zu reden.«
»Ich freue mich, daß ich Sie nicht auf die Probe stellen kann,« erwiederte Louis. »Ich habe Sie das härteste Leiden mit Fassung ertragen sehn. Können Sie auch das Entzücken der Hoffnung tragen?«
La Lüc staunte ihn begierig an.
»Sprechen Sie, Louis —« sagte er mit schwacher Stimme.
Adeline richtete sich in die Höhe, und sah zitternd zwischen Hoffnung und Furcht Louis an, als wollte sie in seiner Seele lesen. Er lächelte freudig.
»Ist es, o ist es möglich?« rief sie plötzlich neu beseelt — »Er lebt; er soll leben?«
Sie sagte nichts weiter, sondern lief zu La Lüc, der in seinen Stuhl sank, während Theodor und Clara mit einer Stimme Louis zuriefen, sie aus der Qual der Ungewißheit zu reißen.
Er sagte ihnen nun, daß er so eben eine Frist für Theodor von dem commandirenden Offizier loßgewirkt hätte, und zwar zu Folge eines heute früh von seiner Mutter erhaltenen Briefes, worinn sie einiger seltsamen Umstände erwähnte, die bey einem Verhör zu Paris vorgefallen wären, und den Charakter des Marquis de Montalt so wesentlich angriffen, daß es vielleicht möglich seyn würde, noch Begnadigung für Theodor zu erhalten.
Diese Worte strahlten mit der Schnelligkeit des Blitzes in die Herzen der Zuhörer. La Lüc lebte wieder auf und das Gefängniß, vor wenig Minuten der Aufenthalt der Verzweiflung, hallte jetzt von Ausrufungen des Danks und der Freude wieder. La Lüc hub seine gefalteten Hände empor:
»Gütiger Gott,« rief er, »du hast mich in der Stunde der Trübsaal erhalten; halte mich auch jetzt — wenn mein Sohn lebt, so werde ich in Frieden sterben!«
Er umarmte Theodor, und da er sich des Schmerzens der letzten Umarmung erinnerte, flossen Thränen der gerührten Freude. So mächtig war die Wirkung dieser kurzen Frist, daß eine gänzliche Begnadigung schwerlich lebhafteres Entzücken in diesem Augenblicke hätte verbreiten können. Als aber die erste Bewegung sich gelegt hatte, sahen sie aufs neue die Ungewißheit seines Schicksals.
Adeline enthielt sich, ihr Bewußtseyn davon zu äußern; Clara aber bejammerte ohne Bedenken die Möglichkeit, das ihr Bruder dennoch von ihnen gerissen, und alle Freude in Trauern verwandelt werden könnte. Ein Blick von Adelinen bestrafte sie. Freude war indessen so sehr die herrschende Empfindung des Augenblicks, daß der Schatten, welchen Betrachtungen auf ihre Hoffnungen warfen, vorüber schwand, gleich der Wolke, welche von der Gewalt der Sonnenstrahlen zertheilt wird; nur Louis war nachdenkend und abwesend.
Als sie sich hinlänglich gefaßt hatten, sagte er ihnen, daß seiner Mutter Brief es ihm nothwendig machte, sogleich nach Paris abzureisen; und daß die darinn enthaltene Nachricht Adelinen so nahe anginge, das sie wahrscheinlich es nothwendig finden würde, ebenfalls dahin zu gehen, sobald ihre Gesundheit es zuließe. Er las nunmehr seinen ungeduldigen Zuhörern die Stellen vor, die ihnen zur Erläuterung dienen konnten: weil aber Frau von La Motte einige Umstände von Wichtigkeit ausgelassen hatte, so geben wir lieber unsern Lesern eine kurze Erzählung von dem, was seit kurzem zu Paris vorgegangen war.
Man wird sich erinnern, daß am ersten Tage seines Verhörs La Motte im Durchgehn durch die Vorhöfe seines Gefängnisses einen Mann sahe, dessen Züge ihm, ohngeachtet der Dunkelheit, bekannt schienen; und daß eben dieser Mann, als er seinen Nahmen erfuhr, zu ihm gelassen zu werden verlangte. Am folgenden Lage erfüllte der Gefangenwärter sein Begehren, und La Motte erkannte mit Erstaunen bey dem hellern Licht seines Zimmers, das Gesicht des Mannes, aus dessen Händen er vormahls Adelinen empfing.
Als der Mann Frau von La Motte im Zimmer sah, sagte er, daß er etwas wichtiges mitzutheilen hätte, und mit dem Gefangnen allein zu seyn wünschte. Nachdem sie fort war, sagte er zu La Motten, ›er hätte verstanden, daß er auf Klage des Marquis de Montalt verhaftet säße.‹ —
La Motte bejahte es —
»Ich kenne ihn als einen Schurken,« sagte der Fremde darauf. »Ihr Fall ist verzweifelt. Aber wünschen Sie das Leben zu behalten?«
»Eine überflüßige Frage!«
»Ich höre, daß man morgen wieder zu Ihrem Verhör schreiten wird. Ich sitze jetzt Schuldenhalber hier: wenn Sie mir aber Erlaubniß auswirken können, mit Ihnen ins Gericht zu gehn, und ein Versprechen von dem Richter, daß dasjenige, was ich entdecken will, mich nicht criminell machen soll, so will ich Dinge sagen, die diesen Marquis, verwundern sollen: ich will beweisen, daß er ein Schurke ist, und man soll dann urtheilen, in wie fern sein Wort gegen Sie gelten kann.«
La Motte, dessen Aufmerksamkeit aufs höchste erregt war, bat ihn sich deutlicher zu erklären: und der Mann fing eine lange Geschichte von den Unglücksfällen und der Verarmung an, die ihn dahin gebracht, sich von dem Marquis brauchen zu lassen, bis er plötzlich inne hielt:
»Wenn ich das verlangte Versprechen vom Gericht erhalte, will ich mich deutlich erklären; bis dahin aber kann ich nichts weiter sagen.«
La Motte konnte nicht umhin, einen Zweifel in seine Aufrichtigkeit und eine Neugier nach den Ursachen, die ihn zum Ankläger des Marquis machten, zu äußern.
»Was meine Ursache betrift, die ist sehr natürlich,« sagte der Mann, »es ist nicht so leicht, üble Behandlung zu verschmerzen, besonders wenn sie von einem Schurken kommt, dem man gedient hat.«
La Motte suchte um sein selbst willen, der Heftigkeit, womit der Mann dieses sagte, Einhalt zu thun.
»Es gilt mir gleichviel, wer mich hört,« fuhr der Fremde fort, der indessen doch seine Stimme leiser machte, »ich wiederhohle es, der Marquis ist schlecht mit mir umgegangen. Ich habe sein Geheimniß lange genug bey mir behalten, und er findet es nicht der Mühe werth, sich meines Schweigens länger zu versichern, sonst würde er mich nicht hier stecken lassen. Ich sitze Schulden halber, und habe ihn um Beystand gebeten: da er mir keinen gibt, so mag er die Folge empfinden. Ich wette, es wird ihn bald gereuen, daß er mich gereizt hat.«
La Mottens Zweifel war nun verschwunden: die Aussicht zum Leben öfnete sich wieder, und er versicherte Dü Bosse (so hieß der Fremde) mit vieler Wärme, daß er seinem Advokaten auftragen wollte, alles anzuwenden, um die Erlaubniß zu seiner Erscheinung beym Verhör und die geforderte Bedingung auszuwirken; worauf der Mann ihn verließ.
Erlaubniß zu Dü Bosse's Erscheinung wurde endlich gewährt, nebst dem Versprechen, daß seine Worte ihn nicht in Strafe bringen sollten, und er begleitete La Motten ins Gericht.
Die Bestürzung des Marquis, als er diesen Mensen erblickte, wurde von mehrern bemerkt, und besonders von La Motten, der eine günstige Vorbedeutung daraus zog.
Als Dü Bosse aufgefodert wurde, trug er dem Gericht vor, daß in der Nacht auf den ein und zwanzigsten April vergangnen Jahrs, ein gewisser Jean d'Aunoy, ein Mann, den er seit vielen Jahren gekannt, in sein Haus gekommen sey. Nachdem sie eine Zeitlang über ihre Umstände mit einander gesprochen, hätte d'Aunoy ihm gesagt, er wüßte ein Mittel, wie er aus seiner Armuth zum Wohlstand gelangen könnte; allein er wollte nichts weiter sagen, bis Dü Bosse sich erklärt hätte. Der elende Zustand, worinn Dü Bosse sich damahls befand, machte ihn begierig zu erfahren, auf welche Art er sich helfen könnte, und nach einigen Umständen erklärte sich sein Freund. Er sagte, daß ein vornehmer Herr, (den er nachher als den Marquis de Montalt nannte) ihm aufgetragen hätte, ein junges Mädchen aus einem Kloster in ein Haus, wenige Meilen von Paris zu bringen.
»Ich kannte das Haus recht gut, sagte Dü Bosse, denn ich war oftmahl mit d'Aunoy darinn gewesen, der sich vor seinen Gläubigern des Nachts darinn zu verstecken pflegte, wenn er auch oft am Tage nach Paris kam. —
Er wollte nicht weiter mit der Sprache heraus, sondern sagte nur, er würde Beystand brauchen, und wenn ich und mein Bruder, der seitdem verstorben ist, ihm behülflich seyn wollten, so würde sein Anstifter kein Geld sparen, und wir sollten reichlich belohnt werden. Ich drang in ihn, mir noch mehr von dem Anschlage zu entdecken, aber er wollte durchaus nicht, und nachdem ich ihm versprochen hatte, mit meinem Bruder zu reden, ging er fort.
Als er den andern Abend wieder anfragte, willigten mein Bruder und ich ein, und gingen mit ihm. Nunmehr sagte er uns, das junge Frauenzimmer, das er fortbringen sollte, wäre eine natürliche Tochter, von dem Marquis de Montalt, und eine Nonne bey den Urselinen: seine Frau hatte das Kind gleich bey seiner Geburt in Empfang genommen, und ein ansehnliches Kostgeld empfangen, um es als ihr eignes aufzuziehn, welches sie auch bis zu ihrem Tode gethan. Dann aber wäre das Kind in ein Kloster gebracht, und zur Nonne bestimmt worden; als sie aber das gehörige Alter zur Einweihung erreicht, hätte sie hartnäckig den Schleyer ausgeschlagen, durch welche Weigerung der Marquis in solche Wuth gerathen sey, daß er befohlen, wenn sie auf ihrer Halsstarrigkeit beharrte, sollte man sie aus dem Kloster bringen, und auf irgend eine Art über die Seite schaffen, weil sonst, wenn sie das Leben behielte, ihre Geburt an den Tag kommen, und ihre Mutter, für die er noch immer einige Liebe hegte, verurtheilt werden würde, ihr Verbrechen durch einen schrecklichen Tod zu büßen.«
Hier unterbrach des Marquis Advokat den Sprecher, und führte an, da die angeführten Umstände dahin abzweckten, seinen Clienten zu compromittiren, so wären sie sowohl gesetzwidrig als irrelevant. Man antwortete ihm, sie wären nicht irrelevant und folglich nicht gesetzwidrig: denn die Umstände, welche auf den Charakter des Marquis ein Licht würfen, hätten auf seine Aussage gegen La Motte Bezug — worauf Dü Bosse fortfahren mußte.
»D'Aunoy sagte hierauf, daß der Marquis befohlen hatte, sie aus der Welt zu schaffen, da er aber von Kindheit auf um sie gewesen sey, konnte er es nicht übers Herz bringen, was er ihm auch geschrieben hatte. Der Marquis hatte ihm darauf geantwortet, so sollte er jemand andern dazu suchen, und dieß also wollte er uns auftragen. Mein Bruder und ich waren dazu nicht ruchlos genug, und erklärten dieß gegen d'Aunoy, und ich konnte mich nicht enthalten zu fragen; was doch den Marquis bewegen konnte, lieber sein eignes Kind zu ermorden, als die Mutter in Gefahr zu setzen? D'Aunoy sagte hierauf: das Kind hatte der Marquis niemahls gesehn, und könnte also keine große Zärtlichkeit gegen dasselbe hegen, weit weniger es stärker lieben als die Mutter.«
Dü Bosse erzählte nun weiter, wie er und sein Bruder sich bemüht hätten, d'Aunoys Herz gegen des Marquis Tochter zu erweichen, und daß sie ihn dazu gebracht, nochmahls zu schreiben und für sie zu bitten. In dieser Absicht sey d'Aunoy nach Paris gegangen, um die Antwort zu erwarten, und hatte das junge Mädchen bey ihnen in dem Hause auf der Haide gelassen, wo sie sich gestellt hatten, als blieben sie, um die Befehle, welche kommen würden, auszuführen; im Grunde aber, um das arme Schlachtopfer vom Tode zu retten.
In wie weit dieses Vorgeben richtig war, muß dahin gestellt bleiben: denn auf jeden Fall mußte Dü Bosse sich wohl hüthen, eine Absicht der Ermordung einzugestehn. Dem sey wie ihm wolle, er sagte aus, daß er in der Nacht auf den sechs und zwanzigsten April einen Befehl zur Ermordung des Mädchens von d'Aunoy erhalten, und sie nachher in La Mottens Hände geliefert hätte.
La Motte hörte diese Erzählung mit Erstaunen an: als er erfuhr, daß Adeline des Marquis Tochter war, und sich des Verbrechens erinnerte, zu dem er sie einst bestimmt hatte, erbebte er vor Entsetzen. Er nahm nunmehr das Wort und fügte einen Bericht von dem, was auf der Abtey zwischen ihm und dem Marquis in Betref Adelinens vorgegangen war, hinzu; zugleich führte er als einen Beweis von der Böslichkeit der gegenwärtigen Klage des Marquis an, daß er sie gleich nachher angefangen hätte, als er Adelinen durch Flucht vor seinen mörderischen Absichten gerettet. Doch setzte er hinzu, da der Marquis seine Leute unverzüglich hinter ihr her geschickt, wäre es möglich, daß sie doch noch als ein Schlachtopfer seiner Rache gefallen sey.
Hier legte sich des Marquis Advokat aufs neue ins Mittel, und wurde wieder von dem Gericht zum Schweigen gebracht. Die ungewöhnliche Bewegung, welche des Marquis Gesicht während Dü Bosse und La Mottens Erzählung verrieth, war allgemein bemerkt worden.
Das Gericht verschob das Urtheil des letztern, befahl den Marquis unverzüglich in Verhaft zu bringen, und Adelinen (der Nahme, den ihre Pflegemutter ihr gegeben hatte, und den sie aus einer Art von zärtlicher Erinnerung beybehielt, wiewohl ihr vermeinter Vater sie anders zu nennen pflegte) sowohl als Jean d'Aunoy aufzusuchen.
Der Marquis wurde dem zu Folge von Gerichts wegen verhaftet, bis Adeline erschiene, oder Beweise ihres Todes beygebracht werden könnten; und bis d'Aunoy die Aussage des Dü Bosse und de La Motte bestätigte oder vernichtete.
Frau von La Motte, die endlich aus der Stadt, wo ihr Sohn vormahls im Quartier lag, Nachricht von seinem veränderten Aufenthalt erhielt, hatte ihm seines Vaters Lage und das Verfahren beym Verhör gemeldet; und da sie glaubte, daß Adeline, wenn sie so glücklich gewesen wäre, dem Marquis zu entwischen, sich noch in Savoyen aufhielte, bat sie Louis, um Urlaub anzusuchen, und sie nach Paris zu bringen, wo ihre unverzügliche Gegenwart erfordert würde, um die Aussage zu bekräftigen; und wahrscheinlich La Mottens Leben zu retten.
Bey Empfang ihres Briefs, der gerade an dem zu Theodors Hinrichtung angesetzten Morgen einlief, eilte Louis unverzüglich zu dem commandirenden Offizier, und hielt um Frist für Theodor an, bis des Königs fernerer Wille bekannt seyn würde. Er gründete sein Gesuch auf die Verhaftung des Marquis und zeigte den eben erhaltenen Brief vor. Der commandirende Offizier gewährte diese Frist mit Freuden, und Louis, der beym Empfang des Briefs sich enthalten hatte, seinem Freunde den Inhalt mitzutheilen, um ihn nicht mit falscher Hoffnung zu quälen, eilte nun, ihm die tröstende Nachricht zu bringen.
Adeline sah ein, wie nothwendig ihre schleunige Abreise nach Paris sey. La Mottens Leben, der ihr mehr als das ihrige gerettet hatte, vielleicht das Leben ihres geliebten Theodors hing von dem Zeugniß, das sie geben sollte, ab; und sie, die noch vor kurzem unter Krankheit und Verzweiflung erlag, die kaum ihr mattes Haupt empor heben, oder anders, als in den schwächsten Tönen reden konnte, traute jetzt, von Hoffnung neu belebt, gestärkt durch das Bewußtseyn der Wichtigkeit des ihr bevorstehenden Geschäfts, sich Kraft genug zu, eine schnelle Reise von einigen fünfzig Meilen zu machen.
Theodor bat sie zärtlich, aus Rücksicht auf ihre Gesundheit diese Reise wenigstens einige Tage zu verschieben: allein mit einem Lächeln bezaubernder Zärtlichkeit versicherte sie ihn, sie wäre jetzt zu glücklich, um krank zu seyn, und die nähmliche Ursache, welche ihr Glück befestigen würde, würde auch ihre Gesundheit stählen. So stark wirkte jetzt Hoffnung auf ihre Seele, daß sie Leiden und Kummer verdrängte, daß sie das Entsetzliche des Gedankens, eine Tochter des Marquis zu seyn, und jede andere schmerzhafte Betrachtung überwog. Sie sah nicht einmahl die Hindernisse, die sich ihrer Vereinigung mit Theodor entgegen stellen könnten, wenn ihm auch endlich das Leben geschenkt würde.
Es wurde beschlossen, daß sie in wenig Stunden mit Louis, und von Petern begleitet, nach Paris abreisen sollte. Diese Stunden brachte La Lüc mit seiner Familie im Gefängniß zu.
Als die Seit ihrer Abreise heranrückte, verließ ihr Muth sie aufs neue; und die Täuschung der Freude schwand. Sie sah Theodor nicht mehr als einen vom Tode Erretteten, sondern nahm mit einem traurigen Vorgefühl, daß sie ihn nicht wieder sehn würde, von ihm Abschied. So stark hatte diese Ahndung sich ihrer Seele eingeprägt, daß es lange dauerte, ehe sie Stärke genug fassen konnte, ihm Lebewohl zu sagen; und als sie schon das Zimmer verlassen hatte, kehrte sie nochmahls zurück, um noch einen letzten Blick zu hohlen.
Als sie zum zweytenmahl hinausging, stellte ihre finstre Einbildungskraft ihr Theodor auf dem Richtplatz, bleich und in Zuckungen des Todes vor: sie wandte nochmahls ihre zögernden Augen auf ihn: allein die Fantasie griff ihre Sinnen an, sie wähnte daß sein Gesicht sich unter ihrem Anschaun veränderte, und einen Geisterhauch annahm. Alle ihre Entschlossenheit schwand, und so groß war die Angst ihres Herzens, daß sie ihre Reise bis auf morgen zu verschieben beschloß, wiewohl sie dadurch Louis Schutz verlieren mußte, dessen Ungeduld, seinen Vater zu sehen, feinen Verzug zuließ.
Doch war der Sieg fantastischer Leidenschaft nur kurz; ihre Betäubung wich, und die Vernunft trat wieder in ihre Rechte: sie sah die Nothwendigkeit ihrer unverzüglichen Abreise ein, und faßte Entschlossenheit genug, sich ihr zu unterwerfen.
La Lüc würde sie begleitet haben, um nochmahls den König für seinen Sohn anzuflehn, hätte nicht seine äusserste Schwäche und Ermattung es durchaus unmöglich gemacht.
Endlich verließ Adeline mit schwerem Herzen ihren Theodor, ohngeachtet seines Bittens, bey ihrem so schwachen Zustande die Reise nicht zu unternehmen, und Clara und La Lüc begleiteten sie in den Gasthof. Die erstere trennte sich mit vielen Thränen und vieler Angst um ihr Wohl, doch mit der Hoffnung, sie bald wieder zu sehn, von ihrer Freundinn. Sollte Theodor begnadigt werden, so hatte La Lüc die Absicht, sie von Paris abzuhohlen, wo aber nicht, so wollte sie mit Petern zurückkommen. Mit Vaters-Zärtlichkeit sagte er ihr Lebewohl, und sie beschwur ihn in ihren letzten Worten auf seine Gesundheit zu achten: sein mattes Lächeln schien zu sagen, daß ihre Sorgfalt vergebens, und Genesung für ihn dahin sey.
Auf solche Art verließ Adeline die Freunde, die ihr mit Recht so theuer waren; die sie so spät gefunden, um in Paris, wo sie fremd, und beynahe schutzlos war, öffentlich vor Gericht einem Vater unter die Augen zu treten, der sie mit äusserster Grausamkeit verfolgt hatte.
Der Wagen, in welchem sie Vaceau verließ, fuhr vor dem Gefängniß vorbey; sie warf einen sehnlichen Blick darauf hin, seine dicken, schwarzen Mauern, und noch vergitterten Fenster schienen finster ihren Hoffnungen die Stirne zu runzeln — aber Theodor war da; er bog sich ans Fenster, und sie starrte nach ihm hin, bis eine Ecke der Straße das Gebäude schnell ihrem Blicke entzog.
Sie sank zurück in den Wagen, und hing still weinend der Wehmuth ihres Herzens nach. Louis war nicht gestimmt, sie zu unterbrechen; seine Gedanken hingen ängstlich an seines Vaters Lage, und die Reisenden legten viele Meilen zurück, ohne ein Wort zu wechseln.
Zu Paris, wohin wir jetzt zurück kehren wollen, betrieb man ohne Erfolg die Aufsuchung des Jean d'Aunoy. Das Haus an der Haide wurde leer gefunden, und an den öffentlichen Orten, wohin er sonst zu kommen pflegte, und wo die Polizeydiener ihm aufpaßten, war er seit langer Zeit nicht mehr erschienen. Es schien sogar zweifelhaft, ob er noch lebte; denn schon eine geraume Zeit vor La Mottens Verhör hatte er sich in den Häusern seiner gewöhnlichen Zusammenkünfte nicht mehr sehen lassen, woraus erhellte, daß die Vorgänge in den Gerichtshöfen wenigstens nicht an seinem Verschwinden Schuld waren.
In der Einsamkeit seines Verhafts hätte der Marquis de Montalt Muße gehabt, an das Vergangene zu denken, und seine Verbrechen zu bereuen; allein Nachdenken und Reue waren noch fern von ihm. Er wandte mit Ungeduld sich von Erinnerungen ab, die nur Schmerz erregten, und sah nur mit ängstlicher Bekümmerniß, wie er die Schande und Strafe, die über ihm schwebte, ablenken könnte, in die Zukunft hin. Die Feinheit und Anmuth seiner Sitten hatten die Schwäche seines Herzens so tief verheelt, daß er der Liebling reines Monarchen war, und auf diesen Umstand gründete er seine Hoffnung.
Doch bereute er bitterlich, daß er dem schnellen Geist der Rache, der ihn zur Verfolgung La Mottens anreizte, Gehör gegeben, und dadurch so unerwartet sich in eine gefährliche Lage verwickelt hatte — denn, wenn Adeline nicht gefunden ward, so mußte er in Verdacht ihrer Ermordung fallen.
Unter allen aber fürchtete er d'Aunoy's Erscheinung am meisten, und um der Möglichkeit derselben vorzubeugen schickte er verschiedene geheime Bothschafter ab, um seinen Aufenthalt aufzuspüren, und ihn zu seinen Gunsten zu bestechen. Allein diese waren eben so unglücklich in ihren Nachforschungen als die Gerichtsdiener, und der Marquis fing endlich an zu hoffen, daß er wirklich todt wäre.
La Motte erwartete indessen mit zitternder Ungeduld die Ankunft seines Sohnes, die ihn, wie er hoffte, einigermaßen aus seiner Ungewißheit wegen Adelinen reißen würde. An ihrer Erscheinung hing seine einzige Hoffnung des Lebens, weil die Aussage gegen ihn durch die Bestätigung, die sie von dem schlechten Charakter seines Verfolgers geben konnte, vieles von ihrer Kraft verlieren mußte: und wenn sogar das Parlament La Motte verdammte, konnte doch die Güte des Königs sein Urtheil noch mildern.
Adeline kam nach einer Reise von mehrern Tagen, auf welcher vorzüglich Louis zärtliche Aufmerksamkeit sie unterstützte, zu Paris an. Frau von La Motte eilte sogleich zu ihr: die Zusammenkunft war rührend von beyden Seiten. Ein Gefühl ihres vorigen Betragens erregte in Madam eine Verlegenheit, welche Adelinens Delikatesse und Güte ihr gern erspart hätte: indessen ertheilte sie die Verzeihung, die von ihr erbeten wurde, mit so bereitwilliger Gefälligkeit, und so ganz von Herzen, daß Frau von La Motte nach und nach Fassung und Zuversicht wieder erhielt.
Adeline hätte diese Vergebung bey aller Herzensgüte nicht so bereitwillig ertheilen können, wenn sie das Betragen dieser armen Frau für freywillig gehalten hätte: nur die Überzeugung, daß sie unter Zwang und Schrecken gehandelt hatte, bewegte sie, das Vergangene zu entschuldigen.
Sie vermieden bey dieser ersten Zusammenkunft alle nähere Erläuterungen. Frau von La Motte bat Adelinen, aus ihrem Gasthofe mit ihr in ihre Wohnung nahe beym Chatelet zu gehn, und Adeline, die einen Aufenthalt in einem öffentlichen Gasthofe für unschicklich hielt, nahm gern ihr Erbiethen an.
Madame ertheilte ihr einen umständlichen Bericht von La Mottens Lage, und endigte damit, daß man das Urtheil ihres Mannes aufgeschoben hatte, bis man zu größerer Gewißheit über die sträflichen Absichten des Marquis gelangt seyn würde; und da Adeline das hauptsächlichste von La Mottens Aussage bekräftigen konnte, ließ sich erwarten, daß das Gericht nunmehr, da sie erschienen war, sogleich fortschreiten würde.
Erst jetzt erfuhr sie den vollen Umfang ihrer Verbindlichkeit gegen La Motte; denn sie hatte noch nicht gewußt, daß er damahls, als er aus dem Walde sie schickte, vom Tode sie errettet hatte. Ihr Abscheu vor dem Marquis, den sie unmöglich als Vater betrachten konnte, und ihr Dank gegen ihren Befreyer verdoppelte sich, so daß sie mit Ungeduld das Zeugniß abzulegen verlangte, welches zu seiner Erhaltung so nothwendig war.
Madame glaubte, es würde nicht zu spät seyn, noch diesen Abend ins Chatelet zugelassen zu werden, und da sie wüßte, wie sehnlich ihr Mann Adelinen zu sehn wünschte, bat sie diese um Erlaubniß, sie hinzuführen. So ermüdet auch Adeline war, ließ sie sichs gefallen, und so bald Louis von Herrn Nemours, seines Vaters Advokaten, zurückkam, machten sie sich insgesammt nach dem Chatelet auf.
Der Anblick des Gefängnisses, das sie jetzt betraten, erinnerte Adelinen so lebhaft an Theodors Lage, daß sie kaum sich bis zu La Mottens Zimmer aufrecht halten konnte. Sobald er sie erblickte, schoß ein Strahl von Freude über sein Gesicht; bald aber versank er wieder in seine Niedergeschlagenheit, sah traurig sie, dann Louis an, und seufzte tief.
Adeline, bey der alle Erinnerung seiner vergangenen Grausamkeit sich in Dank für seine nachherige Güte verloren hatte, bezeugte ihre Dankbarkeit für das Leben, welches er ihr erhielt, und ihr Verlangen, ihm zu dienen, in den wärmsten Ausdrücken. Allein ihre Dankbarkeit beängstigte ihn sichtlich: statt ihn mit sich selbst zu versöhnen, schien sie eine Erinnerung an die schändlichen Absichten, die er einst unterstützte, aufzuwecken, und die Stacheln des Gewissens tiefer in sein Herz zu schlagen.
Um seine Bewegung zu verheelen, sprach er von seiner gegenwärtigen Gefahr, und unterrichtete Adelinen, wie sie bey dem Verhör sich zu verhalten hatte. Nach einer Stunde Gesprächs mit ihm, ging sie wieder mit Madame in ihre Wohnung, wo sie krank und ermattet, sich in ihr Schlafzimmer begab, und ihre Sorgen im Schlafe zu begraben suchte.
Das Gericht versammlete sich wenige Tage nach Adelinens Ankunft, und die zwey übrigen Zeugen des Marquis, auf die er seine Klage gegen La Motten jetzt stützte, erschienen. Sie wurde zitternd ins Gericht geführt, wo der Marquis de Montalt beynahe der erste Gegenstand war, der ihr ins Auge fiel. Sie sah ihn jetzt mit einer ihr ganz neuen Bewegung an, die stark mit Abscheu vermischt war.
Als Du Bosse sie erblickte, beschwur er sogleich ihre Identität, und der Eindruck, den sein Anblick auf sie machte, bestätigte sein Zeugniß: sie erblaßte, wie sie ihn sah, und ein Zittern ergriff ihren ganzen Körper. Jean d'Aunoy konnte nirgends gefunden werden, und La Motte verlor dadurch einen Zeugen, der seiner Sache wesentlichen Vortheil hätte bringen können.
Adeline trug, als sie aufgerufen ward, ihre kleine Erzählung bestimmt und deutlich vor; und Peter, der sie von der Abtey weggebracht hatte, unterstützte ihre Aussage. Diese Aussage war für die meisten Anwesenden hinreichend, den Marquis der Absicht der Ermordung zu beargwöhnen; allein sie war nicht gültig genug, um das Zeugniß seiner zwey letzten Zeugen zu entkräften, die bestimmt auf die Begehung des Raubes und auf die Person La Mottens schwuren, über den sogleich das Todesurtheil gesprochen ward.
Bey Anhörung dieses Ausspruchs sank der Unglückliche in Ohnmacht, und das Mitleid der Versammlung, deren Empfindung ungewöhnlich für den Ausgang aufgeregt worden war, äusserte sich in einem allgemeinen Seufzer.
Plötzlich aber wurde ihre Aufmerksamkeit auf einen neuen Gegenstand gerufen. — Jean d'Aunoy trat jetzt ins Gericht! Allein sein Zeugniß, wenn es auch La Motten hätte helfen können, kam zu spät. Er wurde ins Gefängniß zurückgeführt; Adeline aber, die vor Schrecken über seine Verurtheilung, beynahe ausser sich war, erhielt Befehl, während d'Aunoys Abhörung im Gericht zu bleiben.
Man hatte diesen Menschen endlich im Gefängniß einer Landstadt gefunden, wohin einige seiner Gläubiger ihn geworfen hatten, und aus welchem sogar das Geld, das der Marquis ihm vor seinem Verhaft zur Befriedigung von Dü Bosses ungestümen Forderungen geschickt hatte, nicht zu befreyen hinreichte. Dieses Geld, wovon Dü Bosse nichts erhielt, wurde von d'Aunoy üppig verschwendet, während jener durch vermeinte Vernachlässigung zur Rache gegen den Marquis aufgereitzt war.
Er wurde mit Adelinen und Dü Bosse confrontirt und befehligt, alles, was er von dieser dunkeln Sache wüßte, zu bekennen, oder sich der Tortur zu unterwerfen. D'Aunoy, der nicht wußte, wie weit der Verdacht gegen den Marquis sich erstreckte, und wohl fühlte, daß seine eignen Worte ihm das Urtheil sprechen könnten, beharrte eine Weile im hartnäckigen Schweigen: als er aber auf die Folter gebracht wurde, verließ ihn sein Muth, und er bekannte ein Verbrechen, das man sich gar nicht hatte einfallen lassen.
Es kam an den Tag, daß im Jahre 1642 d'Aunoy nebst einem gewissen Jacques Martigny und Francis Balliere, auf dem Wege überfallen und ergriffen hatten, Henry, Marquis de Montalt, Philipp de Montalts Halbbruder. Nachdem sie den erhaltnen Befehlen zu Folge, ihn beraubt, und seinen Bedienten an einen Baum gebunden hatten, brachten sie ihn nach der St. Clairs Abtey im fernen Fontaneiller Walde. Hier wurde er eine Zeitlang eingesperrt, bis fernere Verhaltungsbefehle von Philipp de Montalt, dem gegenwärtigen Marquis, einliefen, der sich damahls auf seinen Gütern in einer nördlichen Provinz von Frankreich befand. Diese Befehle waren zum Tode, und der unglückliche Henry wurde in der dritten Woche nach seinem Verhaft auf der Abtey in seinem Schlafzimmer ermordet.
Bey Anhörung dieser Worte fühlte sich Adeline einer Ohnmacht nahe: sie erinnerte sich des Manuscripts, das sie fand, nebst allen seltsamen Umständen, die mit dieser Entdeckung verbunden waren. Jede Nerve bebte vor Entsetzen, und als sie die Augen aufschlug, sah sie das Gesicht des Marquis mit der gelben Blässe der Schuld überzogen. Sie suchte ihre fliehenden Lebensgeister fest zu halten, während der Mann in seinem Bekäntniß fortfuhr.
Nach vollbrachtem Morde begab sich d'Aunoy zu seinem Anstifter, der ihm die ausgemachte Belohnung gab, und wenige Monathe nachher ihm die kleine Tochter des verstorbnen Marquis einhändigte, die er nach einer fernen Gegend des Königreichs brachte, wo er unter dem angenommenen Nahmen St. Pierre sie als sein eignes Kind aufzog und von dem jetzigen Marquis ein ansehnliches Jahrgehalt für seine Verschwiegenheit erhielt. —
Adeline, nicht länger vermögend mit dem Aufruhr an Bewegungen, die sich jetzt zu ihrem Herzen drängten, zu kämpfen, stieß einen lauten Schrey aus, und sank in Ohnmacht. Man trug sie aus dem Gericht fort, und als die durch diesen Umstand erregte Unruhe gestillt war, fuhr Jean d'Aunoy fort. Er erzählte, daß bey dem Tode seiner Frau, Adeline in ein Kloster gebracht, und nachher in ein andres gekommen sey, wo der Marquis sie zum Schleyer bestimmte, Ihre entschloßne Weigerung bestimmte ihn, ihr das Leben zu rauben, und sie wurde zu diesem Ende nach dem Hause auf der Haide gebracht.
D'Aunoy setzte hinzu, daß er nach dem Willen des Marquis dem Dü Bosse eine falsche Geschichte von ihrer Geburt aufgeheftet hätte. Nachdem er in der Folge erfuhr, daß seine Helfer ihn wegen ihres Todes hintergangen hatten, trennte er sich in Feindschaft von ihnen: doch beschlossen sie einstimmig, dem Marquis ihre Entwischung zu verheelen, um den Lohn ihres vermeinten Verbrechens nicht zu verscherzen.
Demohngeachtet erhielt d'Aunoy verschiedne Monathe nachher einen Brief von dem Marquis, worin dieser ihn der Wahrheit anklagte, und ihm Verzeihung und große Belohnung anboth, wenn er ihm gestünde, wohin er Adelinen gebracht hätte. Auf diesen Brief gestand er, daß seine Kameraden sie einem Fremden übergeben hätten. Wer aber dieser sey, oder wo er sich aufhalte, wüßten sie nicht.
Auf diese Aussagen wurde Philipp de Montalt wegen der Ermordung seines Bruders Henry zur Rechenschaft gezogen; d'Aunoy wurde in einen Kerker des Chatelets geworfen, und Dü Bosse befehligt, als Zeuge zu erscheinen.
Die Gefühle des Marquis, der durch eine von Rache eingegebne Verfolgung so unerwartet seine Verbrechen dem Auge des Gerichts bloß gestellt hatte, können nicht beschrieben werden. Die Leidenschaften, die ihn zur Begehung eines so abscheulichen Verbrechens, als Mord, verleitet hatten; ja was dessen Barbarey, wo möglich noch erhöhte, zum Morde eines, der durch Bande des Blutes und durch Gewohnheit kindlicher Vertraulichkeit mit ihm verbunden war, — die Leidenschaften, die zu einer so scheuslichen That ihn anreitzten, waren Ehrgeitz und Hang zum Vergnügen. Der erste wurde unmittelbar durch den Rang und Titel seines Bruders, der andre durch die Reichthümer befriedigt, die ihn in Stand setzten, seinen wollüstigen Neigungen nachzuhängen.
Der ermordete Marquis de Montalt, Adelinens Vater, erbte von seinen Vorfahren ein Vermögen, das dem Glanze seiner Geburt nicht angemessen war; allein er vermählte sich mit der Erbinn einer erlauchten Familie, deren Vermögen den Abgang des seinigen reichlich ersetzte. Er hatte das Unglück, sie bald nach der Geburt einer Tochter zu verlieren, ein Verlust, den er schmerzlich beklagte: denn sie war schön und liebenswürdig; und nunmehr entwarf der jetzige Marquis den teuflischen Plan, seinen Bruder umzubringen.
Die Verschiedenheit ihrer Gemüthsart verhinderte zwischen ihnen die Herzlichkeit, welche ihre nahe Verwandtschaft zu fordern schien. Henry war wohlwollend, sanft und ernst. In seinem Herzen herrschte die Liebe der Tugend; in seinen Sitten war die Strenge der Gerechtigkeit durch mitleidige Güte gemildert, nicht geschwächt; sein Geist ward durch Wissenschaft erweitert und durch schöne Litteratur geschmückt. Philipps Charakter ist bereits durch seine Handlungen geschildert; die Schatten desselben waren mit einem glänzenden Firniß überzogen, aber dieser Firniß diente nur, die Dunkelheit des ganzen Gemähldes durch den Contrast noch auffallender zu machen.
Er hatte sich mit einer Frau vermählt, die bey dem Tode ihres Bruders ansehnliche Güter erbte, worunter die St. Clairs Abtey, und die Villa am Fontaneiller Walde, die vornehmsten waren. Demohngeachtet brachte seine Liebe zur Pracht und Zerstreuung ihn bald in Schwierigkeiten, und ließ ihn fühlen, wie angenehm es seyn würde, seines Bruders Reichthum zu besitzen. Dieser Bruder und seine kleine Tochter standen seinen Wünschen einzig im Wege.
Auf welche Art er sich ihres Vaters entledigte, ist schon erzählt: warum er nicht dieselben Mittel anwandte, um das Kind in Sicherheit zu bringen, wissen wir nicht. Ein Verhängniß scheint hier seinen Arm zurückgehalten, und sie zum Werkzeug der Strafe an dem Mörder ihres Vaters aufbehalten zu haben. Ihre Erhaltung war gleichsam das Werk einer höhern Macht und ein auffallendes Beyspiel, daß die Gerechtigkeit, so lange sie auch zögert, oft durch wunderbare Wege die Schuldigen einhohlt.
Während der unglückliche Henry auf der Abtey litt, blieb sein Bruder, um Verdacht zu vermeiden, im nördlichen Frankreich, und verschob die Vollziehung der schrecklichen That aus der natürlichen Furchtsamkeit eines noch nicht zu aller Abscheulichkeit der Schuld gehärteten Herzens. Ehe er es wagte, seine letzten Befehle zu ertheilen, wartete er ab, ob die Geschichte, die er von seines Bruders Tode zu verbreiten suchte, sein Verbrechen vor allem Argwohn sichern würde.
Es gelang ihm nur zu gut. Der Bediente, dem man das Leben gelassen hatte, damit er die Geschichte erzählen könnte, glaubte natürlich, daß sein Herr von Räubern ermordet sey; und der Bauer, der wenig Stunden nachher den Bedienten verwundet, blutend, und an einen Baum gebunden fand, und zudem wußte, daß diese Gegend nicht sicher war, glaubte ihm eben so natürlich, und breitete das Gerücht aus.
Von dieser Zeit an besuchte der Marquis, dem die St. Clairs Abtey, vermöge seiner Frau gehörte, sie nur zwey Mahle nach sehr langen Zwischenräumen, bis er nach vielen Jahren zufällig La Motte als ihren Bewohner fand. Er hielt sich für gewöhnlich zu Paris, oder auf seinem nördlichen Gut auf; einen Monath des Jahrs aber brachte er gewöhnlich auf seiner reizenden Villa am Fontaneiller Walde zu. Er suchte im Gewühl des Hofes und in den Zerstreuungen der Freude, die Erinnerung seines Verbrechens zu vergessen; allein es gab Zeiten, wo die Stimme des Gewissens sich nicht betäuben ließ, wenn sie auch bald nachher im Getümmel der Welt wieder verstummte.
Wahrscheinlich rief in der Nacht, wo er so plötzlich von der Abtey abreiste, die einsame Stille und Düsterniß der Stunde an einem Orte, der Zeuge seines Verbrechens gewesen war, die Erinnerung seines Bruders mit einer für die Fantasie zu mächtigen Kraft in ihm hervor, und erweckte Schrecknisse, die ihn zwangen, diesen mit Blut befleckten Ort zu verlassen. Wenn dem so war, so ist es gewiß, daß die Dämonen des Gewissens mit der Dunkelheit verschwanden; denn am folgenden Tage kam er wieder nach der Abtey, wiewohl man bemerkt haben wird, daß er nie wieder eine Nacht daselbst zuzubringen wagte.
Allein dieß erregte Schrecken war nur von vergänglicher Dauer; weder Mitleid noch Reue folgte darauf; sobald die Entdeckung von Adelinens Geburt Besorgnisse für sein eignes Leben erregte, stand er nicht an, das nähmliche Verbrechen zu wiederhohlen, und wollte aufs neue seine Seele mit Menschenblut besudeln. Diese Entdeckung geschah vermöge eines Siegels mit ihrer Mutter Wappen, auf dem Billet, welches sein Bedienter zu Caux ihm brachte.
Man wird sich erinnern, daß er dieses Billet zuerst in eifersüchtiger Wuth von sich warf; als er es aber noch einmahl besehn hatte, es sorgfältig in seiner Brieftasche aufbewahrte. Die heftige Erschütterung, welche ein Verdacht der schrecklichen Wahrheit in ihm hervorbrachte, beraubte ihn auf eine Zeitlang aller Kraft zu handeln. Sobald er sich wohl genug befand, um schreiben zu können, schickte er einen Brief, dessen Inhalt schon erwähnt ist, an d'Aunoy, und erhielt von diesem die Bestätigung seiner Furcht.
Da er wußte, daß er sein Verbrechen mit dem Leben würde büßen müssen, wenn Adeline jemahls Wissenschaft von ihrer Geburt erhielte, und nicht wagte, der Verschwiegenheit eines Menschen nochmahls zu trauen, der einmahl ihn hintergangen hatte, so beschloß er nach einiger Überlegung ihren Tod. Er machte sich sogleich auf den Weg nach der Abtey, und gab die Anweisungen, welche Furcht für seine Sicherheit weit mehr noch, als das Verlangen, ihre Güter zu behalten, ihm eingab.
Da der Umstand mit dem Siegel, welcher Adelinens Geburt verrieth, allerdings merkwürdig ist, so dürfen wir nicht unterlassen zu erzählen, daß Jean d'Aunoy nebst einer goldnen Uhr es dem unglücklichen Marquis abnahm. Die Uhr veräußerte er bald, das Petschaft aber behielt seine Frau als ein niedliches Kleinod, und bey ihrem Tode kam es unter Adelinens Sachen mit ins Kloster. Adeline behielt es sorgfältig auf, weil es einst der Frau gehört hatte, die sie für ihre Mutter hielt.
Wir kehren jetzt wieder zu den Fäden der Geschichte und zu Adelinen zurück, die aus dem Gerichte in Frau von La Mottens Wohnung getragen wurde. Diese war inzwischen bey ihrem Manne im Chatelet, und litt allen Schmerz, den das gegen ihn ausgesprochne Urtheil ihr auspressen mußte.
Adelinens schwacher Körper, so lange von Kummer und Ermüdung gequält, erlag beynahe unter der Bewegung, welche die Entdeckung ihrer Geburt hervorbrachte. Ihre Empfindungen dabey waren zu verwickelt, um aus einander gesetzt zu werden. Aus einer Waise, die bloß von der Güte anderer lebte, ohne Familie, ohne Angehörige, und von einem grausamen, mächtigen Feinde verfolgt, sah sie sich auf einmahl in die Tochter eines erlauchten Hauses, und Erbinn unermeßlichen Reichthums verwandelt. Aber sie erfuhr zugleich, daß ihr Vater ermordet war — ermordet in der Blühte seiner Tage, — ermordet durch einen Bruder, gegen den sie jetzt auftreten, und indem sie den Verderber ihres Vaters straft, ihren Oheim zum Tode verdammen muß!
Wenn sie an die so sonderbar gefundene Handschrift dachte, und daß, als sie die darin beschriebenen Leiden beweinte, sie um ihren Vater Thränen vergoß; so übertraf ihre Bewegung allen Ausdruck. Die Umstände dieser Entdeckung schienen ihr nicht mehr ein Werk des Zufalls, sondern einer Macht, deren Absichten groß und gerecht sind.
»O mein Vater,« rief sie, »dein letzter Wille ist erfüllt! das mitleidige Herz, von dem du deine Leiden entdeckt wünschtest, soll sie rächen.«
Bey Frau von La Mottens Zurückkunft suchte Adeline wie gewöhnlich, ihre eignen Empfindungen zu unterdrücken, um ihrer Freundinn Trost einzusprechen. Sie erzählte, was nach La Mottens Entfernung im Gericht vorgegangen war, und erweckte selbst in dem bekümmerten Herzen seiner Gattinn einen kurzen Strahl von Freude.
Adeline nahm sich vor, die Handschrift wo möglich wieder zu bekommen, und erfuhr, daß La Motte bey der Verwirrung seiner Abreise sie unter andern Sachen auf der Abtey zurückgelassen hatte. Dieser Umstand war ihr um so unangenehmer, weil sie glaubte, daß dieses Papier vielleicht bey dem nahen Verhör von Wichtigkeit seyn könnte; doch beschloß sie fest, wenn sie zum Besitz ihres Rechts gelangt seyn würde, sie herbeyschaffen zu lassen.
Gegen Abend gesellte Louis sich zu der traurigen Gesellschaft, er kam von seinem Vater, den er weit ruhiger verlassen hatte, als er bisher noch gewesen war. Nach einer stillen, traurigen Abendmahlzeit trennten sie sich für die Nacht, und Adeline hatte in der Einsamkeit ihres Zimmers Musse, über die Begebenheiten dieses wichtigen Tags nachzudenken.
Das Leiden ihres gemordeten Vaters, so wie sie von seiner eigenen Hand es aufgezeichnet gelesen hatte, beschäftigte ihre Seele am meisten. Die Erzählung hatte schon damahls ihr Herz so tief gerührt, und sich ihrer Einbildungskraft so sehr eingeprägt, daß ihr Gedächtniß ihr treu beynahe jedes Wort zurückgab. Wenn sie aber bedachte, daß sie in dem nähmlichen Zimmer gewesen war, wo ihr Vater litt, wo sein Leben geopfert wurde, daß sie wahrscheinlich den Dolch gesehn, mit Rost, dem Rost seines Blutes befleckt, den Dolch gesehn hatte, durch den er fiel, so bebte jede ihrer Nerven mit eiskaltem Schauder.
Am folgenden Lage erhielt Adeline Befehl, sich gegen den Marquis de Montalt vor das Gericht zu stellen, welches seinen Anfang nehmen sollte, so bald die erforderlichen Zeugen herbeygeschaft werden könnten. Unter diesen befand sich die Äbtißinn des Klosters, die sie aus d'Aunoys Händen empfing; Frau von La Motte, die gegenwärtig war, als Dü Bosse Adelinen ihrem Manne aufzwang; und Peter, der nicht nur diesen Umstand ebenfalls ansah, sondern sie auch von der Abtey hergebracht hatte, um sie vor des Marquis Absichten zu retten. La Motte und Theodor La Lüc waren durch den Ausspruch des Gesetzes, unter welchem sie lagen, unfähig gemacht, bey dem Verhör zu erscheinen.
Als La Motte Adelinens Geburt und die Ermordung ihres Vaters auf der Abtey erfuhr, erinnerte er sich sogleich an das Skelet, das er in dem steinernen Zimmer an den unterirrdischen Zellen gefunden hatte. Er erwähnte es gegen seine Frau, und sie zweifelten nicht, daß es die Gebeine des unglücklichen Marquis gewesen waren. Doch nahm Madame sich vor, Adelinen diesen schauderlichen Umstand nicht eher zu sagen, bis es nothwendig wäre, ihn vor Gericht zu erklären.
So wie die Zeit des Verhörs näher rückte, nahm Adelinens Angst und Unruhe zu. Wiewohl die Gerechtigkeit das Leben des Mörders foderte, und Zärtlichkeit und Mitleid mit ihrem Vater sie zur Rache seines Todes aufrief, konnte doch ihr sanftes Herz nicht ohne Entsetzen sich als das Werkzeug betrachten, welches ein Mitgeschöpf des Daseyns berauben sollte; und es gab Zeiten, wo sie wünschte, das Geheimniß ihrer Geburt möchte nie ans Licht gekommen seyn. Wenn dieses Gefühl in ihren Umständen, Schwäche war, so war es wenigstens eine liebenswürdige Schwachheit, und verdient als solche geehrt zu werden.
Die Nachrichten, die sie von La Lücs Gesundheit aus Vaceau erhielt, trugen nicht bey, ihr Gemüth ruhiger zu machen. Die Symptome, welche Clara beschrieb, schienen zu verrathen, daß er sich auf der letzten Stuffe einer Auszehrung befand und sie drückte Theodors Schmerz bey dieser Besorgniß, mit der lebhaften Beredsamkeit aus, die ihr so natürlich war. Adeline liebte und verehrte La Lüc um sein Selbst willen sowohl, als wegen der väterlichen Zärtlichkeit, die er ihr bewies: noch theurer aber war er ihr als Vater Theodors, und ihr Kummer um seine abnehmende Gesundheit stand der Betrübniß seiner Kinder nicht nach.
Die Betrachtung vermehrte ihn, daß sie wahrscheinlich an der Verkürzung seines Lebens Schuld war: denn sie wußte nur zu gut, daß der Kummer um den Zustand, worin Theodor zu versetzen, ihr unglückliches Schicksal war, seinem Körper den letzten Stoß gegeben hatte. Dieselbe Ursache hielt ihn ebenfalls zurück, in dem Clima von Montpellier die Erleichterung zu suchen, die man ihn dort hoffen ließ.
Wann sie den Zustand ihrer Freunde rings um sich ansah, so erlag ihr Herz beynahe unter der Aussicht; es schien als wäre sie bestimmt, fast alle, die ihr am theuersten waren, ins Unglück zu stürzen.
Was auch La Mottens Laster und die Absichten seyn mochten, die er ehemahls gegen sie ausführen half, so vergaß sie doch alles in dem Dienst, den er zuletzt ihr geleistet hatte, und hielt es eben so sehr für ihre Pflicht, als ihr Herz sie dazu antrieb, alles für ihn anzuwenden. Doch konnte sie in ihrer jetzigen Lage nichts für ihn zu wirken hoffen: wenn aber der Proceß, von welchem die Wiedereinsetzung in ihren Rang, ihr Vermögen und folglich in ihr Ansehn abhing, zu ihrem Vortheil entschieden würde, so war es ihr Entschluß, sich dem Könige zu Füßen zu werfen und wenn sie um Theodors Leben bäte, auch für La Motte zu bitten.
Wenig Tage vor dem Verhör wurde Adelinen gemeldet, daß ein Fremder sie zu sprechen wünschte, und als sie in das Besuchzimmer ging, sah sie Herrn Verneuil vor sich. Ihr Gesicht verrieth Freude und Überraschung bey dieser unerwarteten Zusammenkunft, und sie fragte, obwohl mit wenig Erwartung auf eine bejahende Antwort, ob er von Herrn La Lüc gehört hätte?
»Ich habe ihn gesehn,« sagte Herr Verneuil, »ich komme geraden Wegs von Vaceau; allein es thut mir leid, Ihnen keine bessern Nachrichten von seinem Befinden geben zu können. Ich finde ihn sehr verschlimmert, seit ich ihn zuletzt sah.«
Adeline konnte bey der durch diese Worte erregten Erinnerung an die Unglücksfälle, welche an dieser traurigen Veränderung Schuld waren, kaum ihre Thränen zurückhalten. Herr Verneuil überreichte ihr einen Brief von Clara und sagte zugleich:
»Ausser dieser Einführung bey Ihnen, habe ich noch einen Anspruch von anderer Art, auf den ich stolz bin, und der mir vielleicht Berechtigung gibt; von Ihren Angelegenheiten mit Ihnen zu reden?«
Adeline verneigte sich, und Herr Verneuil sagte ihr mit der theilnehmendsten Miene, daß er von den letzten Vorfällen im Pariser Parlamente und von den Entdeckungen, die sie so nahe angingen, gehört hätte.
»Ich weiß nicht,« fuhr er fort, »ob ich dabey Ihnen Glück wünschen, oder Sie beklagen soll. Ich hoffe, Sie setzen keinen Zweifel in meine aufrichtigste Theilnahme an allem, was Sie betrifft, und kann mir das Vergnügen nicht verweigern, Ihnen zu sagen, daß ich ein Verwandter der verstorbenen Marquise, Ihrer Mutter, bin: denn daß sie Ihre Mutter war, kann ich nicht bezweifeln.«
Adeline stand eilends auf und ging auf ihn zu, während Freude und Überraschung ihre Züge plötzlich belebten.
»Sehe ich wirklich einer Verwandten? sagte sie mit süßer, bebender Stimme, »und einen, den ich als Freund bewillkommen darf?«
Thränen zitterten in ihren Augen, und sie erwiederte mit stummer Rührung seine Umarmung; einige Zeit verstrich, ehe sie wieder zu reden vermochte.
Für Adelinen, die von frühster Kindheit an Fremden überlassen, eine hülflose, unglückliche Waise gewesen war; die nie bis vor kurzem einen Verwandten gesehn hatte, und ihn auch dann nur in der Person eines erbitterten Feindes fand, war diese Entdeckung eben so süß als unerwartet; und so viele Empfindungen kämpften in ihrem Herzen, daß sie sich erst in der Einsamkeit erhohlen mußte, ehe sie einer zusammenhängenden Unterhaltung fähig war.
Der Antheil, den Herr Verneuil an La Lücs Angelegenheiten nahm, und vielleicht mehr noch eine geheime Leidenschaft für Clara, hatten ihn nach Vaceau geführt, wo er Adelinens jetzige Lage und Familienumstände erfuhr. Auf diese Nachricht eilte er sogleich nach Paris, um seiner neu entdeckten Verwandtinn seinen Schutz und Beystand anzubiethen, und wo möglich in Theodors Sache behülflich zu seyn.
Adeline kam bald wieder zu ihm, und konnte nun ein näheres Gespräch über ihre Familie ertragen. Herr Verneuil both ihr seine Unterstützung und Beyhülfe an, wenn sie Gebrauch davon machen zu können glaubte.
»Allein ich traue,« setzte er hinzu, »der Gerechtigkeit Ihrer Sache, und hoffe, sie wird keiner anderen Hülfe bedürfen. Für diejenigen, die sich der verstorbnen Marquise erinnern, sind Ihre Züge hinlängliches Zeugniß ihrer Geburt. Zum Beweise, daß kein Vorurtheil hier auf mich Einfluß bat, muß ich Ihnen sagen, daß schon zu Savoyen diese Ähnlichkeit mir auffiel, wiewohl ich die Marquise nur aus ihrem Gemählde kannte; und mich dünkt, Sie müssen sich erinnern, daß ich mehrmahls zu La Lüc sagte, Sie glichen einer verstorbnen Verwandtinn von mir. Doch, urtheilen Sie selbst!«
Bey diesen Worten zog er ein Miniaturgemählde hervor:
»Dieß war Ihre liebenswürdige Mutter.«
Adelinens Gesicht verwandelte sich: sie nahm begierig das Gemählde hin, starrte es lange schweigend an, und ihre Augen füllten sich mit Thränen. Nicht die Ähnlichkeit untersuchte sie; nur die Züge, die sanften, schönen Züge ihrer Mutter, deren blaue Augen, voll von dem süssesten Ausdruck, auf sie gerichtet schienen, während ein holdes Lächeln um ihren Mund schwebte. Adeline drückte das Bild an ihre Lippen, und staunte es wiederum mit schweigender Empfindung an. Endlich sagte sie mit einem tiefen Seufzer:
»Dieß war gewiß meine Mutter! O mein armer Vater, hätte sie gelebt, du wärst verschont worden.« —
Dieser Gedanke überwältigte sie ganz, und sie brach in Thränen aus. Herr Verneuil unterbrach ihren Schmerz nicht; er nahm sie bey der Hand und legte sich neben sie, ohne zu reden, bis sie ruhig ward. Sie küßte nochmahls das Bild und reichte es mit ungewisser Miene ihm hin.
»Nein,« sagte er, »es ist schon bey seiner rechten Besitzerinn,«
Sie dankte ihm mit unaussprechlich süßem Lächeln, und nach einiger Unterhaltung über das nahe Verhör, wobey sie sich seine Gegenwart ausbat, nahm er Abschied, nachdem er um Erlaubniß gebeten hatte, den folgenden Tag wieder zu kommen.
Adeline eröffnete nun ihren Brief, und sah Theodors wohlbekannte Hand: auf einen Augenblick fühlte sie sich in seine Gegenwart versetzt, und eine glühende Röthe überzog ihre Wangen: mit zitternder Hand erbrach sie das Siegel, und las die zärtlichsten Versicherungen seiner besorgten Liebe; sie hielt oftmahls inne, um die süßen Regungen, welche diese Versicherungen erweckten, zu verlängern — aber während Thränen der Zärtlichkeit auf ihren Augenwimpern zitterten, kehrte die bittere Erinnerung an seine Lage wieder, und sie träufelten schwer auf ihre Brust herab.
Er wünschte mit einer ihm eignen Delikatesse, ihr zu den Aussichten aufs Leben Glück, die sich ihr öffneten; sagte alles, was sie ermuntern und stärken konnte, vermied aber jede Erwähnung seiner eigenen Umstände, ausser daß er seinen Dank gegen den freundschaftlichen Eifer und die Güte des commandirenden Offiziers äußerte, und hinzufügte, er verzweifelte nicht daran, endlich Begnadigung zu erhalten.
Diese Hoffnung, so schwach sie auch ausgedrückt, und sichtlich nur um sie zu beruhigen geschrieben war, verfehlte ihre Wirkung nicht. Adeline gab ihrem bezaubernden Einflusse nach, und vergaß auf eine Zeitlang die vielen Ursachen der Sorge und Angst; die sie umgaben. Theodor sagte wenig von seines Vaters Befinden; dieses wenige aber war bey weitem nicht so niederschlagend als Claras Bericht, die, weniger sorgsam, Adelinen eine schmerzhafte Wahrheit zu verheelen, alle ihre Besorgnisse und Bekümmernisse ohne Rückhalt ausdrückte.
Der so ängstlich erwartete Tag des Verhörs, an dem das Schicksal so vieler Personen hing, brach endlich an. Adeline, von Herrn Verneuil und Frau von La Motten begleitet, erschien als Anklägerinn des Marquis de Montalt; und d'Aunoy, Dü Bosse, Louis de La Motte und verschiedene Andere, als Zeugen in ihrer Sache. Die Richter gehörten zu den angesehensten in Frankreich, und die Advokaten auf beyden Seiten waren Männer von entschiedenem Ruf. Bey einem so wichtigen Verhör, war, wie sich leicht denken läßt, das Gericht mit Personen vom Stande angefüllt, und das Schauspiel, welches sich darboth, feyerlich und prachtvoll.
Als Adeline vor dem Tribunal erschien, vernichtete ihre Bewegung alle Kunst der Verstellung; allein sie gab der natürlichen Würde ihres Anstandes einen Ausdruck sanfter Furchtsamkeit, und ihren niedergesenkten Augen, eine süße Verschämtheit, die sie doppelt interessant machte: sie zog das allgemeine Mitleid und die Bewunderung der ganzen Versammlung auf sich.
Als sie die Augen aufzuschlagen wagte, sah sie, daß der Marquis noch nicht da war; und während sie in ängstlichem Harren seine Ankunft erwartete, erhub sich in einer fernen Ecke des Zimmers ein verworrnes Gemurmel. Jetzt verließ sie beynahe ihr Muth: die Gewißheit, sogleich den Mörder ihres Vaters zu sehn, durchschauerte sie mit Entsetzen, und mühsam kämpfte sie gegen eine Ohnmacht.
Ein leises Murmeln lief jetzt durch den Saal, und es zeigte sich eine allgemeine Bestürzung, die sich bald dem Tribunal selbst mittheilte. Verschiedene Mitglieder standen auf; einige verließen den Saal, der ganze Ort gerieth in Unordnung, und endlich drang das Gerücht, daß der Marquis mit dem Tode ränge, bis zu Adelinen. Eine geraume Zeit verstrich in Ungewißheit: die Verwirrung aber dauerte fort, und auf Adelinens Bitte, ging Herr Verneuil, um bestimmtere Nachricht einzuziehn.
Er folgte einem Gedränge, das sich nach dem Chatelet zog, und erhielt mit vieler Mühe Zutritt ins Gefängniß; allein der Thürsteher, den er durch ein reichliches Geschenk gewann, konnte ihm keine gewisse Nachricht geben, und, da er seinen Posten nicht verlassen durfte, ihn nur unbestimmt nach dem Zimmer des Marquis bescheiden. Die Vorhöfe waren still und öde, wie er aber vorwärts ging, wies ein fernes Gesumse von Stimmen ihn zurecht, bis er verschiedene Personen nach einer Treppe queer vor dem Kreuzwege eines langen Ganges laufen sah, ihnen folgte, und vernahm, daß der Marquis wirklich in letzten Zügen läge.
Die Treppe war voll Menschen, er suchte sich durchzudrängen, und erreichte mit vieler Mühe und Stoßen die Thüre des Vorzimmers zum Gemach des Marquis, aus welcher verschiedene Personen heraus kamen. Hier erfuhr er, daß der Gegenstand seiner Nachfragen bereits todt sey. Doch drang er durch das Vorzimmer in das Gemach, wo der Marquis von obrigkeitlichen Personen und zwey Notarien, welche Aussagen niedergeschrieben zu haben schienen, umgeben, auf dem Bette lag. Sein Gesicht war mit einer schwarzen Todtenfarbe überzogen, und mit allen Schrecknissen des Todes geprägt. Herr Verneuil wandte mit Entsetzen sich von dem Anblick ab, und vernahm auf Befragen, daß der Marquis an Gift gestorben sey.
Überzeugt, daß alle Hoffnung für ihn verloren sey, schien er diesen Ausweg ergriffen zu haben, um einen schimpflichen Tode zu entgehen. In den letzten Stunden des Lebens, gefoltert von seinen Verbrechen, beschloß er, alle Vergütung zu leisten, die noch in seiner Macht stände; und nachdem er das Gift verschluckt hatte, ließ er einen Beichtvater kommen, um das volle Geständniß seiner Schuld zu empfangen, und zwey Notarien, um es niederzuschreiben; und setzte auf solche Art Adelinen, ausser einem beträchtlichen Vermächtniß aus seinem eigenen Vermögen, in die unbestreitlichen Rechte ihrer Geburt.
Zufolge dieser Aussagen, wurde sie bald nachher förmlich als Tochter und Erbinn von Henry, Marquis de Montalt anerkannt, und die reichen Güter ihres Vaters ihr wieder gegeben, Sie warf sich unverzüglich zu des Königs Füßen, um für Theodor und La Motten Begnadigung zu flehn. Der gute Ruff des erstern, die Sache, für die er sein Leben wagte, und die Ursache der Feindseligkeit des verstorbenen Marquis gegen ihn, waren so einleuchtend, und mußten so nachdrücklich für ihn sprechen, daß der Monarch wahrscheinlich auch einer weniger unwiderstehlichen Vorbitterinn, als Adeline de Montalt war, seine Begnadigung nicht würde verweigert haben. Theodor La Lüc erhielt nicht nur volle Begnadigung, sondern wurde auch bald nachher zur Belohnung seines tapfern Betragens gegen Adelinen, zu einem ansehnlichen Posten bey der Armee erhoben.
Für La Motten, der auf gültig befundenes Zeugniß wegen Räuberey verurtheilt und ausserdem des Verbrechens, das ihn vorher aus Paris trieb, angeklagt worden war, konnte keine Begnadigung ertheilt werden: doch wurde auf Adelinens dringendes Bitten, und in Rücksicht des Dienstes, den er ihr zuletzt geleistet, sein Urtheil vom Tode in Verbannung gemildert. Diese Nachsicht würde ihm indessen wenig genützt haben, hätte nicht die großmüthige Adeline, andere Verfolgungen, die auf ihn einzudringen drohten, abgelenkt, und ihm eine Summe geschenkt, die mehr als hinreichend war, ihn in einem fremden Lande anständig zu erhalten.
Diese Güte wirkte so tief auf sein Herz, das mehr durch Schwäche als natürliche Lasterhaftigkeit verderbt war, und erweckte so scharfe Gewissensbisse wegen des Unrechts, das er einst gegen eine so edle Wohlthäterinn begehen wollte, in ihm, daß seine vorigen Gewohnheiten ihm verhaßt wurden, und sein Charakter nach und nach die Farbe wieder erhielt, die er wahrscheinlich stets würde behalten haben, wäre er nie in die lockenden Versuchungen von Paris gerathen.
Die Leidenschaft, welche Louis so lange für Adelinen empfunden hatte, wurde durch ihr letztes Betragen beynahe zur Anbetung erhöht; allein er gab nunmehr auch die schwache Hoffnung hin, die bisher, fast ihm selbst unbewußt, noch in seiner Brust geglimmt hatte; und da das Leben, welches seinem Freunde geschenkt ward, dieß Opfer heischte, konnte er nicht klagen. Er beschloß, in Entfernung die verlorne Ruhe wieder zu suchen, und seine künftige Glückseligkeit im Glück der beyden Menschen, die ihm so herzlich theuer waren, zu finden.
Am Abend seiner Abreise nahm La Motte nebst seiner Familie einen sehr rührenden Abschied von Adelinen: er vertauschte Paris mit Deutschland, wo er sich niederzulassen gedachte, und Louis, der nicht schnell genug vor ihrem Zauber fliehen konnte, ging an dem nähmlichen Tage ab zu seinem Regimente.
Adeline blieb noch einige Zeit in Paris, um ihre Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, und wurde von Herrn Verneuil bey den wenigen, weitläuftigen Verwandten eingeführt, die noch von ihrer Familie am Leben waren. Unter diesen befanden sich der Graf und die Gräfinn D., und — eine Person die sie lebhaft intereßirte — Herr Amand, der zu Nizza ihr Mitleid und Achtung so sehr auf sich zog. Die Gattinn, deren Tod er beweinte, war aus der Familie Montalt, und die Ähnlichkeit, welche er zwischen ihren und Adelinens Zügen fand, war etwas mehr als bloße Fantasie. Der Tod seines ältern Bruders hatte ihn plötzlich aus Italien zurück geruffen; allein Adeline sah mit großer Freude, daß die schwere Melancholie, die zu Nizza auf ihm lag, einer stillern Ergebung Platz gemacht hatte, und das zu Zeiten sogar ein Strahl von Heiterkeit seine Züge wieder belebte.
Der Graf und die Gräfinn D., die durch ihre Güte und Schönheit sehr für sie eingenommen wurden, luden sie ein, während ihres Aufenthalts in Paris zu ihnen in ihr Hotel zu ziehn.
Ihre erste Sorge war, die Überreste ihres Vaters aus der St. Clairs Abtey herbeyschaffen, und im Gewölbe seiner Vorfahren begraben zu lassen. D'Aunoy wurde gehangen, und beschrieb auf dem Richtplatze den Ort, wo die Gebeine des unglücklichen Marquis verborgen waren. Herr Verneuil begleitete die abgeschickten Gerichtsdiener, und folgte der Asche des Marquis nach St. Maur, einem Gute in einer der nördlichen Provinzen. Hier wurde sie mit dem feyerlichen Leichenpomp, der seinem Range gebührte, beygesetzt: Adeline folgte als vornehmste Leidträgerinn, und nachdem diese letzte Pflicht dem Andenken ihres Vaters gezollt war, wurde sie ruhiger und gelaßener. Das Manuscript hatte Herr Verneuil auf der Abtey gefunden, und händigte es ihr ein; sie bewahrte es mit der frommen Schwärmerey, die eine so heilige Reliquie verdient.
Bey ihrer Zurückkunft nach Paris erwartete Theodor La Lüc, der von Montpellier herüber gekommen war, ihre Ankunft. Die Wonne dieses Wiedersehns wurde nur durch die Nachricht, die er von seinem Vater brachte, getrübt; dessen äusserste Gefahr allein Theodor abhalten konnte, gleich in dem Augenblick, wo er seine Freyheit erhielt, herbey zu eilen, und Adelinen für das Leben, welches sie ihm gerettet hatte, zu danken.
Sie empfing ihn jetzt als den Freund, dem sie ihre Erhaltung verdankte, und als den Geliebten, der ihre zärtlichste Neigung besaß und verdiente. Ihre Liebe zu Theodor hatte sie vermocht, verschiedene Bewerber abzuweisen, die ihre Güte, Schönheit und Reichthum ihr bereits zugezogen hatten, und die zwar an Vermögen ihn bey weitem übertrafen, zum Theil aber an alter Geburt und sämmtlich an Werth ihm weit nachstanden.
Die mannigfaltigen und tumultuarischen Bewegungen, welche die letzten Begebenheiten in Adelinens Brust erzeugen mußten, hatten sich nunmehr gelegt. Doch ließ das Andenken an ihren Vater noch immer eine gewiße Melancholie bey ihr zurück, welche nur die Zeit überwinden konnte, und sie verweigerte sich Theodors Bitten, bis die Zeit, die sie selbst zu ihrer Trauer angesetzt hatte, verflossen seyn würde. Die Nothwendigkeit, wieder zu seinem Regiment zu gehn, zwang ihn, vierzehn Tage nach seiner Ankunft, Paris wieder zu verlassen; doch nahm er die tröstende Hoffnung mit, sobald sie ihre Trauer abgelegt haben würde, ihre Hand zu empfangen.
Herrn La Lücs mißlicher Gesundheitszustand war eine Quelle unaufhörlicher Unruhe für Adelinen, und sie beschloß Herrn Verneuil, der jetzt Claras erklärter Liebhaber war, nach Montpellier, zu begleiten, wohin La Lüc gleich nach der Befreyung seines Sohns gegangen war. Zu dieser Reise schickte sie sich an, als ihre Freundinn ihr eine sehr günstige Nachricht von seiner Beßerung schrieb; da nun ihre Angelegenheiten ihre Gegenwart zu Paris noch erforderten, gab sie auf diesen Brief ihre Absicht auf, und ließ Herrn Verneuil allein reisen.
Als Theodors Sache ein günstigeres Anseht gewann, hatte Herr Verneuil an La Lüc geschrieben, und ihm das Geheimniß seines Herzens eröffnet. La Lüc, der ihn schätzte und liebte, und mit seinen Glücksumständen nicht unbekannt war, sah die angetragene Verbindung gern. Clara glaubte, noch nie einen Mann gesehn zu haben, den sie zu lieben so geneigt wäre; und Herr Verneuil empfing eine seinen Wünschen so günstige Antwort, daß er Muth faßte, selbst nach Montpellier zu reisen.
Die Wiederherstellung seiner Zufriedenheit und die Luft von Montpellier that für La Lüc alles, was nur seine besorglichsten Freunde wünschen konnten, und er gewann bald so viel Kräfte wieder, Adelinen auf ihrem Gute St. Maur zu besuchen. Clara und ihr Geliebter begleiteten ihn, und ein Friedensschluß zwischen Frankreich und Spanien erlaubte bald nachher Theodorn, diese glückliche Gesellschaft zu vermehren.
Wenn La Lüc, wiedergegeben denen, die ihm das theuerste waren, auf das Elend, dem er entgangen war, zurückblickte, so klopfte sein Herz von erhabnen Regungen der Freude und Dankbarkeit; und sein ehrwürdiges Gesicht, durch einen Ausdruck beschauenden Entzückens verklärt, zeigte ein vollkommnes Gemählde des glücklichen Alters.
Adeline mußte in der Gesellschaft so geliebter Freunde bald den Eindruck von Schwermuth verlieren, den das Schicksal ihres Vaters in ihr zurückgelassen hatte. Sie gewann alle ihre natürliche Lebhaftigkeit wieder, und als sie das Trauerkleid ablegte, welches zu tragen kindliche Frömmigkeit gefodert hatte, gab sie Theodor ihre Hand.
Der Graf und die Gräfinn D. schmückten die Hochzeit, die zu St. Maur gefeyert wurde, durch ihre Gegenwart, und La Lüc genoß das hohe Glück, das frohe Schicksal seiner beyden Kinder an einem Tage bestätigt zu sehn. Als die Ceremonie vorüber war, segnete und umarmte er sie beyde mit Thränen väterlicher Zärtlichkeit.
»Ich danke dir, o Gott!« sprach er, »daß du mir vergönntest, diese Stunde zu sehn: wenn es dir nunmehro gefallen mag, mich abzurufen, so werde ich in Frieden scheiden!«
»Lange, lange noch mögen Sie zum Glück Ihrer Kinder leben!« antwortete Adeline.
Clara küßte weinend ihres Vaters Hand.
»Lange, lange!« wiederhohlte sie in kaum hörbarer Stimme.
La Lüc lächelte heiter, und lenkte das Gespräch auf einen minder rührenden Gegenstand.
Allein die Zeit kam heran, wo er es für nothwendig hielt, zu den Pflichten seines Amtes zurückzukehren, von dem er so lange entfernt gewesen war. Auch seine Schwester klagte sehr über Einsamkeit, und dieß war ihm ein Bewegungsgrund mehr, zu eilen. Theodor und Adeline, die den Gedanken an Trennung von diesem ehrwürdigen Vater nicht ertragen konnten, suchten ihn zu bereden, seine Stelle niederzulegen, und zu ihnen nach Frankreich zu ziehn: aber zu starke Bande fesselten ihn an Leloncourt. Viele Jahre hindurch war er das Glück und der Trost seiner Pfarrfinder gewesen: sie ehrten und liebten ihn als Vater, er betrachtete sie ebenfalls beynahe mit Vaterzärtlichkeit. Auch hatte er den Beweis von Liebe, den sie bey seiner Abreise ihm gaben, nicht vergessen; diese Scene hatte einen tiefen Eindruck bey ihm zurückgelassen, und er konnte den Gedanken nicht ertragen, jetzt, da der Himmel seinen Segen über ihn ausgegossen hatte, sie zu vergessen.
»Es war süß, für sie zu leben,« sagte er, »und ich will auch unter ihnen sterben.«
Ein Gefühl von noch mehr zärtlicher Art und daß nicht der Stoische Richter es mit dem Nahmen Schwäche, oder der Weltmann es unnatürlich nenne, — ein noch zärtlicheres Gefühl zog ihn nach Leloncourt. — Dort ruhten die Gebeine seiner Gattinn!
Da La Lüc sich nicht bewegen ließ, in Frankreich zu wohnen, entschlossen sich Theodor und Adeline, für welche die glänzenden Freuden, die Paris ihnen darboth, wenig Reiz gegen die süßen häuslichen Vergnügungen und den höhern Genuß von La Lücs Umgang haben konnten, ihren Vater und Herrn und Madame Verneuil dahin zu begleiten. Adeline richtete ihre Angelegenheiten so ein, daß ihre Anwesenheit in Frankreich entbehrt werden konnte, und reiste nach einem zärtlichen Abschied von dem Grafen und der Gräfin D. und von ihrem lieben Herrn Amand, mit ihren Freunden nach Savoyen.
Sie reisten gemächlich, und verließen oft die gerade Straße, um alles zu sehn, was ihre Bemerkung verdiente. Nach einer langsamen angenehmen Reise sahn sie noch einmahl die Schweizergebürge, deren Anblick in Adelinens Seele tausend lebhafte Erinnerung weckte. Sie erinnerte sich der Lage, der Gefühle, womit sie zuerst sie sah — eine Waise, die vor Verfolgung floh, um Schutz unter Fremden zu suchen; verloren für den Einzigen auf Erden, an dem sie hing! — sie erinnerte sich an alles dieses, und mit inniger Rührung schmiegte sie sich fester an ihres Gatten Brust.
Claras Gesicht glänzte vom Lächeln des lebhaftesten Entzückens, als sie den geliebten Scenen ihrer kindlichen Freuden wieder nahe kam; und Theodor staunte mit patriotischer Begeistrung die prächtigen immer wechselnden Schauspiele an, welche die zurückweichenden Gebirge nach einander enthüllten.
Es war Abend, als sie Leloncourt vor sich sahen, und der Weg, der sich um den Fuß eines ungeheuren Felsen wand, gewährte ihnen eine volle Ansicht des Sees, und La Lücs friedlicher Wohnung. Ein Freudenausruf von der ganzen Gesellschaft kündigte die Entdeckung au und der Glanz der Freude strahlte aus jedem Auge wieder. Der Sonne letzter Schimmer fiel auf das Wasser, das in krystallner Reinheit unten ruhte, schmolz jeden Zug der Landschaft und tauchte die Wolken, die über den Bergen hinrollten, in Purpurglanz.
La Lüc bewillkommte seine Familie zu seiner glücklichen Heimath, und schickte ein schweigendes Dankgebet auf, daß ihm diese Rückkehr vergönnt ward. Adelinens Blick verweilte auf jedem wohl bekannten Gegenstande, und wiederum erinnerte sie sich an den Wechsel von Freude und Schmerz, an die wunderbare Glücksveränderung, die sie seit dem erfuhr. Sie blickte auf Theodor, den sie in eben diesen Gegenden als verloren auf immer beweinte; der, als sie ihn wieder fand, durch schmählichen Tod von ihr gerissen werden sollte; — der jetzt neben ihr saß, ihr sichrer und glücklicher Gatte, der Stolz seiner Familie und der ihrige!
Das Gefühl ihres Herzen strömte in Thränen von ihren Augen, während ein Lächeln unaussprechlicher Liebe ihm alles sagte, was sie empfand. Er drückte sanft ihre Hand an sein Herz und antwortete ihr durch einen Blick voll Zärtlichkeit.
Indem tönte eine Musik über das Wasser zu ihnen hin, und sie sahn einen großen Haufen der Dorfbewohner, die sich auf einen grünen Platze, der bis zum Saume der Wellen herabglitt, zum Tanze versammlet hatten. Es war der Abend eines Festes. Die ältern Bauern saßen unter dem Schatten der Bäume, die diese kleine Anhöhe krönten, aßen Milch und Früchte, und sahen ihre Söhne und Töchter fröhlich nach den Tönen der Pfeife und Trommel hüpfen, zu welchem sich die sanftere Melodie der Mandoline gesellte.
Der Anblick war äusserst interessant und seine mahlerische Schönheit wurde durch eine Gruppe von Rindvieh bereichert, das theils am Ufer, theils zur Hälfte im Wasser stand, während andere auf dem Rasen wiederkäuten, und verschiedne Dirnen, in der reinlichen Einfalt ihres Landes geschmückt, sich zum Melken anschickten.
Peter ritt voran; und bald versammelte sich eine Menge um ihn, die, als sie die Nähe ihres geliebten Predigers hörten, ihm entgegen eilten, um ihn zu begrüßen. Ihre warmen, herzlichen Freudenergüße strömten hohe Zufriedenheit in das Herz des guten La Lüc, der sie mit der Zärtlichkeit eines Vaters bewillkommte, und kaum die Thränen zurückhalten konnte.
Als der jüngere Theil der Versammlung seine Ankunft er fuhr, ging die allgemeine Freude so weit, daß sie, von Trommel und Pfeifen angeführt, vor dem Wagen hertanzten bis an sein Haus, wo sie aufs neue, ihn und die Seinigen mit der fröhlichsten Musik bewillkommten. Am Thore kam ihnen Mademoiselle La Lüc entgegen, und nie war wohl eine glücklichere Gesellschaft beysammen.
Weil der Abend ungewöhnlich milde und schön war, wurde das Essen im Garten aufgetragen. Nach geendigter Mahlzeit schlug Clara, deren Herz ganz Freude war, einen Tanz bey Mondenlicht vor.
»Seht,« sagte sie, »wie die Mondstrahlen schon auf dem Wasser hüpfen! welch einen Strom von Licht sie über den See hinwerfen, wie sie um das kleine Vorgebürge zur linken funkeln! Auch die kühle Stunde ladet zum Tanz ein.«
Alle waren es zufrieden.
»Und lasset auch die guten Leute, die uns so herzlich bewillkommten, herzurufen,« sagte La Lüc, — »sie sollen alle sich mit uns freuen. Peter bringt noch mehr Wein, und setzt einige Tische unter die Bäume.«
Peter flog, und in wenig Minuten war der Rasen mit Landleuten eingefaßt. Die ländlichen Instrumente wurden auf Claras Bitte unter ihre geliebten Acacien am Rande des Sees gestellt; die fröhlichen Noten erklangen; Adeline führte den Reihen an, und die Berge hallten die melodischen Töne der Freude wieder.
Der ehrwürdige La Lüc saß unter den ältern Bauern, und wenn er die Scene überschaute — seine Kinder und sein Volk so versammlet in einem großen Kreis der Eintracht und Freude sah, träufelten Thränen über seine Wangen, und er fühlte Vorschmack höhern Entzückens.
So ganz war jedes Herz zur Freude erweckt, daß schon die Morgendämmerung den Schauplatz röthete, als jeder Hüttenbewohner unter Segnungen des gütigen La Lüc in seine Heimath zurückkehrte.
Nachdem Herr Verneuil einige Wochen bey La Lüc zugebracht hatte, kaufte er sich ein Haus in Leloncourt, das einzige, was unbelegt war, Theodor sah sich nach einer Wohnung in der Nachbarschaft um. Einige Stunden weit, an den schönen Ufern des Genfer Sees, wo das Gewässer sich in eine kleine Bucht zusammen schmiegt, kaufte er ein Landhaus. Das Gebäude zeichnete sich mehr durch ein Ansehn von Einfachheit und Geschmack, als durch Pracht aus, wiewohl diese letzte der umliegenden Gegend ihren Stempel aufgedrückt hatte. Es lag beynahe eingefaßt von Waldung, die ein großes Amphitheater bildete, sich bis zum Rande des Waldes hinabsenkte, und die schönsten, romantischen Spaziergänge darboth.
Die Natur trieb hier in aller schönen Üppigkeit ihr Spiel, ausgenommen wo hie und da die Kunst das Laub gebogen hatte, um eine Aussicht auf das blaue Wasser des Sees und die weissen Segel, die auf ihm hin glitten, oder auf die fernen Berge zu geben. Vor dem Schlosse öffnete sich die Waldung in einen grünen Platz, und das Auge konnte über den See hinwegstreifen, dessen Busen ein immer sich bewegendes Gemählde darstellte, während sein bunter Rand, von Lusthäusern, Wäldern und Wohnungen eingefaßt, und jenseits mit den beschneyten, erhabnen Alpen gekrönt, die hinter einander in majestätischer Verwirrung sich aufthürmten, eine Scene beynahe beyspielloser Pracht zeigte.
Hier, den Schimmer falscher Glückseligkeit verachtend, im Genuß der reinen, höhern Entzückungen einer zur zärtlichsten Freundschaft gereiften Liebe, umgeben von den Freunden, die ihrem Herzen theuer waren, und besucht von einem kleinen, auserlesnen Zirkel, hier, im Schooße des wahren Glücks lebten Theodor und Adeline.
Louis de La Mottens Leidenschaft wich endlich der Gewalt der Zeit und Entfernung. Noch liebte er Adelinen, aber mit der ruhigen Zärtlichkeit der Freundschaft, und als er auf Theodors dringende Einladung sie besuchte, sah er unvergiftet von Neid ihr Glück mit Entzücken an. Er vermählte sich bald nachher mit einer Genferinn, legte seine Offiziersstelle nieder, um an den Rand des Sees zu ziehn, und vermehrte Theodors und Adelinens Freuden.
Ihr vergangnes Leben gab ihnen ein Beyspiel, wie das Schicksal wohl überstandne Prüfungen lohnt; und ihr jetziges Glück, das sie nicht engherzig nur auf sich selbst einschränkten, goß Freude über alle, die in die Sphäre ihres Einflusses kamen. Der Dürftige und Leidende freute sich ihrer Menschenliebe, der Edle und Aufgeklärte ihres Umgangs, und ihren um sie blühenden Kindern drückte ihr Beyspiel die Lehren ins Herz, die sie ihrem Verstande darbothen.

Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.