
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
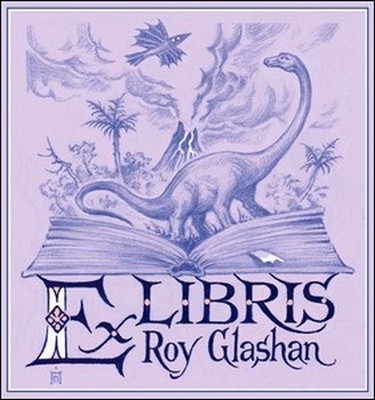
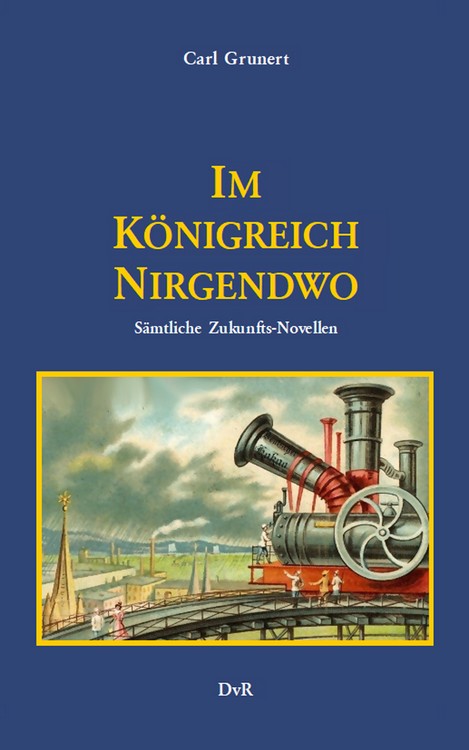
"Im Königreich Nirgendwom," DvR-Ausgabe
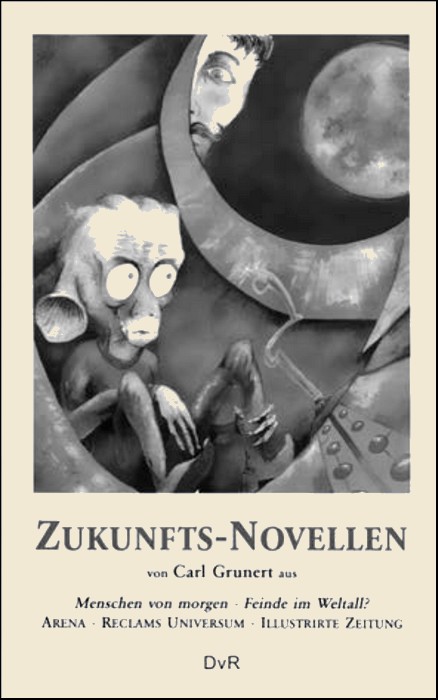
Zukunfts-Novellen aus Menschen von morgen,
Feinde im Weltall?, Arena, Reclams Universum
und Illustrirte Zeitung. Norderstedt:
Books on Demand (DvR-Buchreihe), 293 S.
Die dritte internationale Friedenskonferenz, die, wie die beiden ersten von 1901 und 1907 im Haag im Jahre 192* stattfand, ging zu Ende. Lord Lyell, der Sprecher Englands, hatte noch einmal vor den illustren Vertretern der sechsundvierzig Staaten den Wortlaut der Paragraphen präzisiert, die nach endlosen Verhandlungen definitive Gestalt gewonnen hatten, so den
»§ 7: Sonderbestrebungen eines Einzelstaates, die in irgendeiner Form der allgemeinen Abrüstung widersprechen, sind vor die in Permanenz tagende Konferenz zu bringen.
§ 10: Die internationale Vereinigung der Friedensmächte erhebt Einspruch
1. durch diplomatische Verhandlung,
2. durch allgemeine Repressalien und
3. durch Waffengewalt, falls eine fortgesetzte Verletzung des § 7 zu konstatieren ist.
§ 10a: Bei Eintritt der letzten Eventualität übernimmt der Staat die Führung der internationalen Friedensarmee, der von der Konferenz gewählt wird.
§ 14: Der überwundene Staat verliert für eine von Fall zu Fall zu bestimmende Zeit, mindestens aber auf drei Jahre, das Recht, an den internationalen Konferenzen und Abmachungen teilzunehmen; außerdem verliert er —«
»Ich protestiere!«, rief der Bevollmächtigte des Deutschen Reiches, Professor Ernst, der bekannte preußische Staatsrechtslehrer, den Redner plötzlich unterbrechend. »Nicht das war die Meinung meiner Regierung, als sie sich, durch allerlei Quertreibereien veranlaßt, herbeiließ, auch noch diese dritte sogenannte ›Friedenskonferenz‹ zu beschicken. — Um es zum letztenmal zu wiederholen: unmöglich kann hier für jeden Staat dieselbe haltlose Gleichmacherei in Kraft treten! Nicht jeder Staat hat politisch und geographisch dieselben Vorteile wie der andre. England mit seiner insularen Lage z. B. kann sich mit PreußenDeutschland nicht vergleichen wollen, ohne ein politisches Unrecht zu begehen —«
Der englische und der französische Vertreter riefen dazwischen; aber der hochaufgerichtete weißhaarige Gelehrte fuhr unbeirrt fort, und seine Augen sprühten Blitze hinter den goldgeränderten Brillengläsern:
»Eine Schematisierung aller Staaten nach Wehr und Waffen bleibt ein Unding! Wir haben der Welt in fast einem halben Jahrhundert bewiesen, daß wir unsere Rüstungen nicht zu einer Störung des Friedens benutzt haben —«
»Aber Sie haben sich stets geweigert, abzurüsten!«, rief M. Tartarin, der Sprecher Frankreichs. »Trotz Ihrer Friedensversicherungen ist Ihr Staat das internationale Schreckgespenst geblieben —«
Der Professor wandte sich M. Tartarin voll zu. »Mein Herr Abgesandter«, sagte er, seine Stimme hebend, »wir haben in unserer Geschichte Traditionen, deren wir würdig bleiben wollen! Gewiß haben wir uns geweigert, abzurüsten, und werden uns weigern! Denn die rauhe Welt der Wirklichkeit wird noch immer von der eisernen Notwendigkeit regiert. Wir werden nie mutwillig einen Krieg heraufbeschwören; aber wir werden auch nie eine papierne Entscheidung vom Haager Schiedsgericht in dem Ernstfalle annehmen, wo nach unserm Volksempfinden nur — das Schwert entscheiden kann! Das mag rückständig und barbarisch sein; wir können es nicht ändern. Jedenfalls hat uns unsere Nationalgeschichte in jahrhundertelanger Erfahrung gelehrt, daß ›Ausgebeutet oder beneidet!‹ immer unser Los im Völkerrate war — und daß ›Si vis pacem, para bellum!‹ für uns die Staatsmaxime bleibt. Ist es Ihnen aber in Wahrheit unumstößlicher Ernst mit der Abrüstung, so würde vielleicht Ihr Beispiel vermögen, was alle Doktrin nicht vermochte! Vielleicht ist«, er wandte sich zu Lord Lyell mit einer Verbeugung, »vielleicht ist die Regierung Ihres erlauchten Herrschers bereit, mit einer Abrüstung Ihrer Flotte den erstrebenswerten Anfang zu machen —?«
Lord Lyell erhob sich wieder, sehr kühl, sehr reserviert:
»Englands insulare Lage, die Zahl und Ausdehnung seiner Kolonien bedingen ein absolutes Festhalten an den Grundsätzen, die beim Ausbau seiner Flotte bisher maßgebend waren —«
»Wenn es aber hinfort nach den Beschlüssen einer hohen Konferenz nur noch lauter gute Freunde und getreue Nachbarn in der Welt geben wird — wozu dann die zehn neuen ›Dreadnoughts‹, die im Laufe der letzten Jahre gebaut worden sind? Nicht zu erwähnen der fünf allerneuesten, noch stärkeren ›Dreadnoughts‹, die schon wieder auf Stapel gelegt werden —?«
»Im Namen meiner Regierung kann ich erklären«, wandte sich der Lord in vornehmer Gelassenheit an die Konferenz, »daß von dieser ›allerneuesten‹ Flottenvermehrung in meinem Vaterlande nichts bekannt ist!«
»Wir wissen«, entgegnete ihm Deutschlands Abgesandter, »daß allerdings nicht England diese letzten fünf Riesenschiffe bauen läßt, sondern — Paraguay! Für diesen Abrüstungsmodus sind wir allerdings nicht zu haben. Wir lieben die Aufrichtigkeit —«
Ein allgemeines Gemurmel erhob sich; ja, der Vertreter der Republik San Marino fuhr entrüstet aus seinem karmoisinroten Sessel auf.
»Ich bitte um Entschuldigung«, sagte Professor Ernst, als sich der Lärm etwas gelegt hatte, »wenn sich einer der Anwesenden getroffen fühlte, und konstatiere gern, daß von einer Unaufrichtigkeit der Regierung von San Marino in meinem Vaterland nichts bekannt ist.«
Erregt setzte sich der erwähnte Abgesandte wieder hin; der Vertreter Frankreichs aber, M. Tartarin, ergriff nach einer kurzen Verständigung mit Mijnheer van Geduldjen, dem Präsidenten der Konferenz, das Wort und sagte nervös:
»Der Verlauf dieser unerfreulichen Debatte beweist wieder, was wir alle leider ja schon längst wissen, daß eben nur an einer Stelle die Hindernisse liegen, die ein gedeihliches internationales Zusammenwirken bisher illusorisch gemacht haben. Sie werden aber mit mir überzeugt sein, meine Herren Abgesandten, daß wir heute nicht mehr den Verhältnissen mit gebundenen Händen gegenüberstehen, wie früher: wir haben seit kurzem als die reifste Frucht unserer Vorverhandlungen die ›Lateinische Allianz‹, die im Ernstfall ein Truppenkontingent ins Feld zu stellen vermag, das von keinem Einzelstaat übertroffen wird —«
»Und wir haben seit gestern abend — die ›Atlantische Union!‹«, setzte Lord Lyell kurz und scharf hinzu, die Augenbrauen hochziehend. Diese wenigen Worte des englischen Bevollmächtigten entfesselten einen Beifallssturm in der Versammlung, der Lord Lyell veranlaßte, hinzuzusetzen: »Den rastlosen Bemühungen Sr. Majestät, meines erlauchten Herrschers, ist es endlich gelungen, das Werk langer Jahre zu einem guten Ende zu führen. Ja — meine Herren, wir sind aus dem unfruchtbaren Stadium der papiernen Vorschläge heraus; wir können nunmehr in Taten reden!«
Abermaliger lauter, minutenlanger Beifall.
Einen Moment noch schwieg der Vertreter Deutschlands — dann sagte er, seine Mappe schließend und den Sessel zurückschiebend:
»Das soeben Vernommene kann für mich, als den Bevollmächtigten Deutschlands, nur e i n e Konsequenz haben. Ich ziehe sie hiermit!«
In eisigem Schweigen verharrten die Mitglieder der Haager Friedenskonferenz, als jetzt Professor Ernst mit einer Verbeugung gegen den Präsidenten den Saal verließ. Gleichzeitig mit ihm stand auch Graf Josefy, Österreichs Vertreter, auf und entfernte sich.
Nur der greise Mijnheer van Geduldjen erhob sich bei ihrem Weggang zum Abschied aus dem Sessel...
Bei einem seiner täglichen Morgenspaziergänge im Berliner Tiergarten wurde der Deutsche Kaiser plötzlich von einem Bittsteller angesprochen, der ihm ein umfangreiches Schriftstück überreichte.
Auf einen Wink des Kaisers, der weitergeschritten war, wollte der Adjutant die Personalien des Mannes feststellen. Seltsamerweise aber blieb der Fremde jetzt völlig stumm. Der Adjutant glaubte nun, es mit einem Taubstummen zu tun zu haben, und machte eine entsprechende Gebärde. Der Bittsteller blieb bei seinem stereotypen Lächeln.
Noch einmal sprach der Adjutant ihm ins Ohr und faßte ihn dabei unwillkürlich am Ohrläppchen.
Da geschah etwas Unerwartetes: das Ohrläppchen samt dem ganzen Ohr blieb dem entsetzten Adjutanten in der Hand.
Ein Ausruf der Bestürzung entfuhr ihm, den auch der Kaiser vernahm, der nun verwundert zurückkehrte und das kuriose Malheur erfuhr. Man untersuchte nun genauer und entdeckte im Kopfe des Mannes, da, wo das Ohr gesessen hatte, eine Öffnung, durch die ein — Mechanismus sichtbar wurde.
Der Mann war ein Automat!
»Das ist ja ein Meisterstück der Mechanik«, sagte der Kaiser — »ähnlich den berühmten Droz'schen Androiden. Das macht mir dieses Bittgesuch, wenn es ein solches ist, allerdings sehr viel interessanter —«
Er wog das dickleibige Konvolut in der Hand.
»Geruhen Majestät zu bestimmen, was mit dem Automaten geschehen soll!«, meinte der Adjutant, der die einohrige, immer gleichmäßig lächelnde Figur immer noch mißtrauisch von der Seite ansah.
»Ja, Falkenried — da bin ich selbst im Zweifel! Vielleicht, wenn Sie ihn bis zum Automobil trügen?«
Aber der Automat ersparte dem Adjutanten die Sorge um seinen Transport. Der leichte Frühjahrsmantel, der seine Gestalt einhüllte, begann sich plötzlich zu blähen, wie vom Winde gepackt; flügelartig breitete sich die Pelerine auseinander, von den ausgestreckten Armen getragen.
Er erhob sich — erst wenige Zoll vom Erdboden — dann setzte sich ein innerer Mechanismus plötzlich mit einem hellklingenden Surren in Tätigkeit; nun stieg er senkrecht in die Höhe — über die Baumwipfel hinaus — dann wandte er sich, halb nach vornüber geneigt, wie ein Riesenvogel langsam mit den Flügeln schlagend, südwestwärts, immer höher und höher in den Morgenhimmel hineinsteigend.
Der Kaiser und sein Adjutant standen starr vor Verwunderung.
Jetzt machte der Kaiser das Schriftstück auf.
Nur einen Blick warf er auf die mit Formeln und Figuren bedeckten Bogen — dann ergriff er den Arm seines Begleiters.
»Schnell — das Auto! Zum Schloß! Den Mann kann ich brauchen!« — — —
Am Nachmittag des nämlichen Tages schon stand der Konstrukteur des kunstvollen Flugautomaten vor dem Kaiser.
Es war eine gedrungene, eher untersetzte als große Gestalt, in einem unbestimmten Alter. Sein Haar und sein kurzgehaltener Vollbart gaben ihm ein Aussehen, zu dem das Gesicht mit den rätselhaften, von großen Entbehrungen oder von Geistesanstrengung zeugenden Zügen nicht zu stimmen schien. Das Interessanteste an ihm aber waren seine Augen; scharf und sicher, beinahe nie von den Wimpern beschattet, blickten sie unter einer mächtigen Stirn hervor, als ob sie, wie die eines Königs der Lüfte, gewohnt seien, immer bergetief herabzublicken.
»Herr Draco«, redete ihn der Kaiser an, ihm die Hand reichend — »ich habe Ihre Zeichnungen und Berechnungen mit großem Interesse studiert. Erzählen Sie mir von Ihrem Leben und Schaffen! Sie sind von deutscher Herkunft?«
»Ja, Majestät. Mein Vater wanderte von hier aus und ging nach Australien — zur Zeit des Goldfiebers, nicht um Gold zu suchen, sondern um dem Druck elender heimatlicher Verhältnisse zu entgehen. Er erwarb eine große Farm um billiges Geld — sie waren damals halb umsonst zu haben; denn alles ging auf die Goldsuche — legte eine ausgedehnte Schafzucht an und wurde bald ein reicher Mann. Er heiratete eine Deutsche und begann nun, das große Problem seines Lebens in Angriff zu nehmen: das Problem des Fluges! Immer, wenn ich von der Stätte meiner Studien ins Elternhaus zurückkehrte, fand ich in seinen Konstruktionen — er hatte seine aeronautische Werft auf einer kleinen herrenlosen Insel im australischen Archipel aufgeschlagen — neue, geniale Fortschritte. Längst war die Leidenschaft des Vaters auch die meine geworden, und kurz vor seinem Tode konnte ich ihm noch die Entdeckung mitteilen, die mir eines Tages, wenn auch nach unablässigen Studien, doch wie ein Geschenk des Himmels zufiel: die Veränderung der Gravitation durch Beeinflussung des Weltäthers! Fieberhaft arbeitete ich an einem neuen Modell auf der Basis meiner Entdeckung. Es gelang mir; meine erste Probefahrt im Luftmeer war seine letzte Freude. Sterbend nahm er mir das Versprechen ab, seine und meine Erfindungen nur dann der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wenn dies im Dienste seines und meines Vaterlands geschehen würde. Deshalb, Majestät, stehe ich hier!«
»Ich danke. Aus Ihren schriftlichen Darlegungen habe ich ersehen, daß Sie das Flugproblem in ganz anderer Art gelöst haben, als die Flugtechniker unserer Tage. Wenn ich Sie recht verstehe, so ist Ihre Konstruktion die eines verbesserten Aeroplans —«
»Ja, Majestät — aber eines Aeroplans, bei dem die emportreibende Kraft eine immerwirkende Kraft unserer Erde selbst ist.«
»Und diese Naturkraft, lieber Draco?«
»Ist eine negative Beanspruchung der Schwerkraft.«
»Sie nannten es vorhin: die Veränderung der Gravitation durch Beeinflussung des Weltäthers!«
»Ja, Majestät — oder, um die Sache mehr nach ihrer konstruktiven Seite zu fassen: die Herstellung eines Ätherdruckminimums für die Flugbahn meines ›Draco‹«
»Ich möchte eine Probe sehen!«
»Majestät haben zu befehlen.«
»Apropos —«, unterbrach sich der Kaiser lächelnd, »eigentlich habe ich ja schon eine solche heute früh an Ihrem wunderbaren Automaten im kleinen vor Augen gehabt!«
»Ein kleines Modell meiner Erfindung, in einen Automaten eingebaut, um mir das Interesse und das Wohlwollen Ew. Majestät auf dem einfachsten und kürzesten Wege zu gewinnen.«
»Ist Ihnen gelungen, wenn Sie auch meinem Adjutanten einen Schreck mit dem abgerissenen Ohr eingejagt haben —«
»Ich weiß es, Majestät; ich stand, von einem Baume gedeckt, ganz in der Nähe.«
»Es sah famos aus, als der Einohrige sich so in die Lüfte hob. Sagen Sie, wo ist er geblieben?«
»Er — fliegt noch, Majestät, und wird fliegen, bis die Einflüsse der Witterung und der Kälte in den oberen Luftschichten seinen aus Wachs und Kautschuk gebildeten Leib zerstört haben —«
Der Kaiser schwieg ein Weilchen, dann sagte er:
»Und nun richte ich an Sie die Frage, weshalb Sie gerade den jetzigen Zeitpunkt gewählt haben, um Ihr altes Vaterland mit Ihrer Erfindung bekannt zu machen?«
Dracos von Natur ernstes, verschlossenes Gesicht wurde noch um einen Schein düsterer, als er jetzt entgegnete:
»Gestatten Majestät, daß ich ganz frei und rückhaltlos rede?«
»Sprechen Sie frei!«
»Mein Drachenflieger, der mich seit Jahren unbemerkt über Länder und Meere hinwegträgt, hat mir Dinge verraten, die mir wichtig genug erscheinen, dem Deutschen Kaiser in erster Linie offenbart zu werden. Wenn Majestät dabei vielleicht meinen Worten nicht glauben, Ihren Augen —« er entnahm einer Ledermappe eine Reihe von Photographien — »werden Majestät glauben müssen!«
»Was für Aufnahmen sind das? — Woher stammen sie?«
»Es sind von mir aufgenommene Momentphotographien aus der Vogelperspektive, und sie stammen sämtlich aus einem von der Schiffahrt völlig unbesuchten Winkel des Atlantischen Ozeans.«
»Ich sehe«, sagte der Kaiser, »Schlachtschiffe, Panzerschiffe vom allerneuesten Typ!«
»Leider ist die Nationalität der Schiffe nicht zu erkennen«, bemerkte Draco, »sämtliche Kennzeichen und Flaggen sind entfernt —«
»Ich erkenne sie aber trotzdem«, sagte der Kaiser, den Ton seiner Stimme ändernd.
Draco reichte ihm noch einige andre Bilder mit den Worten:
»Dann werden Majestät auch diese Phasen eines Massenangriffs in rechter Weise zu deuten vermögen?!«
Der Kaiser sagte nichts; aber sein scharfer Blick ruhte auf den verräterischen Photographien. Es wurde ganz still in dem Studierzimmer... Endlich brach der Kaiser das Schweigen:
»Die Bilder stammen aus neuester Zeit?«
»Das, was Majestät betrachten, ist — vorgestern aufgenommen —«
Wieder eine kleine Pause; dann aber sagte der Kaiser, sich voll zum Erfinder wendend:
»Meinen kaiserlichen Dank, Meister Draco! Sie haben dem Vaterlande und Ihrem Kaiser einen großen Dienst erwiesen. — Soviel für jetzt! Und nun: wann kann die Probefahrt mit Ihrem ›Draco‹ stattfinden? Heute nacht?«
Draco nickte. »Heute nacht! Morgens zwei Uhr kann mein Flugapparat hier im Hofe Ihres Schlosses zur Fahrt bereit liegen —«
»Am liebsten käme ich selbst mit als mein eigner Informator — indessen, es wird sich schwer machen lassen — absolut geheim muß alles vor der Hand bleiben — nun, wir werden sehen! Auf jeden Fall wird einer meiner Vertrauten heute nacht um zwei Uhr zur Fahrt bereit sein. Auf Wiedersehen, Meister!« — —
In der ersten Morgenfrühe des nächsten Tages lag der ›Draco‹ im Hofe des Schlosses zur Orientierungsfahrt bereit. Ohne Aufsehen hatte ihn sein Erfinder in der mondlosen Nacht hierher bugsiert. — Es war ein rätselhafter Bau; auf den ersten Blick schon frappierte das Solide, Stabile und doch Leichte in der Konstruktion, namentlich die äußerst kompendiös gebauten Motoren der Vor- und Rückwärtsbewegung. Das Wunderbarste aber waren die Kompensoren, jene geheimnisvollen Apparate zur Beeinflussung der Erdschwere, seltsame, riesigen Magneten ähnliche Gebilde, in deren Kraftfeldern funkensprühende Scheiben rotierten. — Nur zwei Männer saßen im Flugschiff: am Steuer Draco, an der Maschine sein Assistent Auxil.
Ein Lichtschein fiel aus einer kleinen Pforte. Zwei in Wettermäntel gehüllte Gestalten traten heraus und gingen auf den »Draco« zu. Eben schlug eine Uhr zwei.
Ein kurzer Anruf! — Eine Falltreppe fiel herab. Die beiden Männer stiegen die wenigen Stufen zum Flugschiff hinan.
»Im Namen des Kaisers!«, sagte der vorderste der beiden.
»Willkommen zur Fahrt!«, klang die Antwort aus dem Schiff.
Die zwei näherten sich Draco am Steuer. Ein Lichtmeer überflutete nun einen Augenblick lang den ganzen Bau mit sonnenhellem Glanze.
In diesem Moment ließ Draco das Steuer los und verneigte sich.
»Majestät wollen selbst —?«, flüsterte er.
»Nicht Majestät, lieber Draco — sondern der — Graf d'Urville, was Sie nicht vergessen wollen — für alle Fälle!«, war die Antwort des vordersten.
Draco verbeugte sich.
»Und hier — mein Begleiter, der Adjutant vom Dienst, der schon gestern früh im Tiergarten Zeuge Ihrer Erfindung war — Falkenried!«
Der junge Adjutant grüßte militärisch. Dann wandte er sich lächelnd zu dem regungslos an der Maschine stehenden Auxil und faßte ihn am rechten Ohr —
»Diesmal sitzt es fest!«, sagte er dann, während »Graf d'Urville« sein drolliges Beginnen mit einem vergnügten Lachen begleitete.
»Auxil — mein Maschinist, Herr Adjutant! Ein wirklicher Mensch und auch nicht — schwerhörig.« — Dann wandte sich Draco an den »Grafen«,
»Erwarten Majestät noch jemand zur Begleitung?«
»Weder die Majestät noch Graf d'Urville. Wir können abfahren!«
»Wie Sie befehlen, Herr Graf!«
Ein Wink zum Maschinisten.
Ein helleres Blitzen und Leuchten brach aus dem Kompensor. Erst langsam, dann schneller und schneller stieg der Flugdrache in die Höhe — umschrieb, wie ein riesiger Raubvogel, mehrere immer größer werdende Kreise und schoß dann wie ein Projektil, in zirka 1000 m Höhe sich haltend, in nordwestlicher Richtung davon.
Drei Stunden später. — In ungefähr 1000 m Höhe — im lichten Blau — über jenem verlorenen Winkel des Atlantischen Ozeans an Bord des »Draco«.
Unbeweglich, die Kraft seiner Propeller bremsend, hält das Flugschiff über der weiten Wasserfläche.
Von der Erde aus ist dieser im Äther schwimmende Punkt völlig unsichtbar. Aber die Bewohner dieses »Pünktchens« erblicken mit ihren Relieffernrohren jede kleine Einzelheit unter ihnen auf dem Wasser!
Infolge einer optischen Täuschung erscheint die in stumpfem Silberglanze schimmernde Ozeanfläche ausgehöhlt, wie ein metallenes Riesenbecken, in dem die großen und kleinen Panzerschiffe der »Atlantischen Union« wie das harmlose Spielzeug eines Riesenknaben schwimmen.
Und welches Leben gewinnt dieses Bild, als alle Schiffe sich plötzlich nach einem bestimmten Plane zu einem Flottenmanöver gruppieren! So fesselnd ist dies prompte und schnelle Manövrieren der gepanzerten Kolosse, dies Ab- und Einschwenken in die Gefechtslinie, dieses Anrücken gegen einen markierten Feind! — daß der junge Adjutant bei einem besonders gelungenen Vorstoß der fünf größten Panzerschiffe ein halblautes: »Bravo!« nicht zurückhalten kann.
»Ja, Falkenried — ›Bravo!‹ möchte ich auch ausrufen; denn die Sicherheit und Präzision dieser Flotte ist bewundernswürdig! — wenn ich nicht wüßte, daß sich das Spiel da unten im blutigen Ernste gegen uns wenden soll!«, sagte der Graf d'Urville ernst — und dann, sich zu Draco wendend:
»Ich verstehe, daß dieser Anblick Sie veranlassen mußte, mich aufzusuchen, Meister Draco! — Glauben Sie, daß es mich namenlose Überwindung kostet, hier noch immer tatlos zuschauen zu müssen, wie ein unbeteiligter Zuschauer aus einer FestspielLoge, indessen da unten schon die ehernen Würfel zu rollen beginnen, die Deutschlands Schicksal entscheiden! — Durch unsere Vertrauensmänner sind wir informiert, daß seit der letzten — dritten — Friedenskonferenz, von deren Beschlußfassungen sich Deutschland im Interesse seiner Selbständigkeit zurückziehen mußte, etwas gegen uns im Werke ist — und da unten üben die Schiffe der ›Atlantischen Union‹ den Tanz ein, mit dem sie uns zu überraschen gedenken! — Nun — überraschen soll man uns nicht; aber es wird ein Kampf werden gegen eine Welt in Waffen — doch was ist das? Was kommt dort oben — hier schräg über uns?«
Der Graf d'Urville deutete bei diesem plötzlichen Ausrufe auf einen Punkt im wolkenlosen Äther. —
Was kam da — gespenstisch grau — wie ein Riesenschatten aus den Tiefen des Weltenraumes?!
Der Graf ergriff den Arm Dracos —
»Wir sind verraten — das Geheimnis Ihrer Erfindung ist entdeckt und übertroffen! Sehen Sie: da kommt ein Flugschiff, dem Ihrigen ähnlich — aber ein Riese im Vergleich zu unserm!«
Draco blieb stumm: nur sein Blick haftete fest auf dem heransausenden Aeroplan, indes er den »Draco« schnell höher und höher steigen ließ —
»Sehen Sie! Da erscheinen plötzlich noch mehr solcher ›Riesen-Dracos‹ — eins — zwei — vier — acht — da! dort! Immer mehr! Eine ganze Drachenflotte! — Was gedenken Sie nun zu tun?«
Draco schwieg noch immer.
Noch einen Blick warf der Graf d'Urville auf die heransausenden Aeroplane — dann wandte er sich in ernster Bewegung an den ruhig das Steuer haltenden Erfinder.
»Draco! Sie wissen mehr, als Sie mir bisher vertraut! Lösen Sie das Rätsel — wenn ich nicht schließlich glauben soll, daß Sie mich hier herauf in 2000 m Höhe in Ihren Flugapparat gelockt haben, um mich denen da oben auszuliefern! — Ich gestehe, daß ich einen Moment diesen Verdacht gehegt habe —«
Dracos ernstes Antlitz wurde plötzlich hell, als er jetzt erwiderte:
»Majestät! — Gestatten Sie mir hier oben im freien, reinen Äther diese offene Anrede! — Majestät, ich mußte es auf diesen Verdacht gegen mich ankommen lassen, wenn ich meinen — unseren — Plan zu Ende führen wollte! — So hören Sie denn: nicht den Deutschen Kaiser will ich den herankommenden Aeroplanen da oben ausliefern; — sondern umgekehrt: diese ganze Drachenflottille will ich dem Kaiser und dem deutschen Vaterlande ausliefern — als ein Geschenk, Majestät, das ich im Laufe dieser letzten Jahre im stillen Auftrage einer Vereinigung reicher Deutscher Australiens und seiner Inseln auf meiner verborgenen Werft in der Südsee gebaut habe, um unserm Volke eine Waffe in die Hand zu geben, mit der es die Feinde da unten jederzeit im Zaume halten kann!«
Bei Dracos letzten Worten war das Flugschiff immer höher und höher gestiegen jetzt schwebte es mitten im Kreise der riesigen Aeroplane, die es wie eine Schutzmauer umgaben. —
Wie um dieses bedeutungsvolle Schauspiel den Blicken der Erde zu verbergen, hatte sich ein dichtes Wolkenmeer aus weißen Kumuluswolken unter den Flugdrachen gelagert, dessen wunderbar phantastische, ewig bewegliche Formen im Strahle der Morgensonne wie ein Meer aus flüssigem Golde schimmerten...
In keilförmiger Schlachtordnung dampften die hundert Schiffe der »Atlantischen Union« an einem trüben Herbstmorgen — von Norden kommend auf die friedliche deutsche Küste zu, an den Seiten flankiert von den riesigen »Dreadnoughts«, — Schon kam das erste deutsche Feuerschiff in Sicht.
Nun mußte man auf deutscher Seite den heranrückenden Feind signalisiert haben! Aber nirgends war eins der deutschen Panzerschiffe zu entdecken.
Es schien, als sollte die Überrumpelung der deutschen Nordseeküste eine vollkommene werden. Ohne von einem Hindernis aufgehalten zu werden, gelang es, die Feuerlinie der englischen Flotte bis in Seehöhe des Neuwerker Leuchtturms vorzuschieben.
Man lag den Küstenforts von Kugelbaake und Grimmerhörn nun gerade gegenüber. Sie waren, wie man wußte, erst neuerdings mit den Kruppschen 42,6 cmGeschützen versehen worden.
Keine Regung des Feindes! Aber man würde ihn zwingen, seine verkappten Panzerbatterien zu demaskieren: um 9 Uhr 20 Minuten schleuderte eins der riesigen ArmstrongGeschütze auf dem »Horror«, dem neuesten Panzerschiffe der letzten DreadnoughtKlasse, eine Granate an Land...
Man sah mit dem Fernrohr, wie das explodierende Riesengeschoß die mächtigen Erdwälle vor dem Fort aufriß — aber noch immer erwiderte keine der deutschen Küstenbatterien das Feuer.
Wagten die Deutschen überhaupt nicht, gegen die riesige Übermacht ihre Kraft zu versuchen? Eine neue unüberwindliche Armada war's, die da herankam. — — —
Längst aber hatten die an der deutschen Nordseeküste in See versenkten Unterseemikrophone das Herannahen der »Armada« signalisiert; lange, lange vorher, ehe die Schiffe der »Atlantischen Union« die deutsche Küste in Sicht bekamen, hatten die riesigen Stahlmassen der »Dreadnoughts« in ihrer Induktionswirkung auf die im Wasser ausgelegten Stromspulen sich auf den Marineämtern registriert! Und an ihren Riesengeschützen in den mächtigen Panzertürmen der Küstenforts bei Cuxhaven standen die Artilleristen, zum Feuern bereit.
Warum aber diese unheimliche, tatenlose Ruhe und Leere auf der See, die nun auch dem feindlichen Admiral verdächtig erschien, so daß er durch Flaggensignal die einzelnen Kommandanten der Geschwader auf seinem Flaggschiff zusammenrief? —
Der englische Admiral hatte Sondierungsfahrten der Unterseeboote an der deutschen Küste angeordnet, indessen das Gros der Flotte die Maschinen stoppte. Abermals flogen einige Granaten gegen die Küste; abermals o h n e Erwiderung!
Das hatte man sich nicht träumen lassen! Wo blieb der Riesenkampf zwischen Panzerschiff und Küstenbatterie, wie ihn die Fachliteratur so anschaulich als Zukunftsbild geschildert hatte?
Und nun?! —
Der Beamte am MarconiApparat auf dem englischen Flaggschiff erhielt in diesem Augenblick ein drahtloses Telegramm aus — London, das er erst eine lange Weile starr ansah, ehe er dessen Sinn überhaupt faßte; dann aber flog er damit aus der Kajüte zum Kapitän. —
Der Kapitän, unwirsch über die Störung — er war ein alter Seebär und der letzte aus einer Reihe von stolzen Seeleuten, deren Urahn schon unter Franz Drake Kompaß und Sextant gehandhabt — riß dem vor Aufregung zitternden Mann das Schriftstück aus der Hand.
Und auch er las die sonderbare Depesche, rieb sich die Augen, faßte sich an den Kopf, las sie abermals — dann aber eilte er, so schnell ihn seine Seemannsbeine tragen wollten — zum Kommandanten, gefolgt von dem MarconiTelegraphisten!
Der Kommandant der vereinigten Flotte der »Atlantischen Union«, Sir John Highblown Esq., las das Telegramm — las es abermals — halblaut, so daß die beiden andern seinen unglaublichen Wortlaut nochmals zu hören bekamen:
»FLOTTILLE VON FLUGSCHIFFEN SOEBEN ÜBER LONDON ERSCHIENEN! KÖNIGLICHER PALAST BEDROHT! VERSUCHE, SIE DURCH KANONENSCHÜSSE ZU VERTREIBEN, ERFOLGLOS! GROSSE BESTÜRZUNG! UM 9 UHR 20 FIEL DIE ERSTE BOMBE AUS DER LUFT! BEVÖLKERUNG FLÜCHTET.«
Und drei Minuten später brachte der zweite Telegraphist der Marconistation eine zweite drahtlose Depesche aus der Kabine der Elektriker. — Sie lautete:
»GRÖSSTES DER FLUGSCHIFFE SOEBEN AUF DEM KÖNIGLICHEN PALAST GELANDET. ABTEILUNGEN DEUTSCHER TRUPPEN BESETZEN DAS GEBÄUDE! IMMER NEUE FLUGSCHIFFE ERSCHEINEN, MIT SOLDATEN BEMANNT! FURCHTBARE PANIK!«
Zehn Minuten später kam das dritte Marconitelegramm. Es war in — deutscher Sprache abgefaßt und meldete:
»IM AUFTRAGE SR. MAJESTÄT DES DEUTSCHEN KAISERS:
SE. MAJESTÄT DER KÖNIG VON GROSSBRITANNIEN UND IRLAND IST IN UNSERER MACHT. WIR LIEFERN IHN NUR AUS, WENN:
1. DIE FLOTTE DER ›ATLANTISCHEN UNION‹ SOFORT NACH EMPFANG DIESER DEPESCHE DIE DEUTSCHEN GEWÄSSER VERLÄSST — WENN
2. DIE REGIERUNG SR. MAJESTÄT DES KÖNIGS VON GROSSBRITANNIEN UND IRLAND DER DEUTSCHEN REGIERUNG AUFRICHTIGE UND UNANFECHTBARE BEWEISE DAFÜR GIBT, DASS DIE ›ATLANTISCHE UNION‹ VON HEUTE AN AUFGEHÖRT HAT ZU EXISTIEREN — WENN
3. DIE REGIERUNG SR. MAJESTÄT DES KÖNIGS VON GROSSBRITANNIEN UND IRLAND SICH UNTER AUSREICHENDEN GARANTIEN VERPFLICHTET, DIE FÜNF NEUEN ›DREADNOUGHTS‹ ABGRÜSTET ALS KABEL- UND EXPEDITIONSSCHIFFE IN DEN DIENST DES INTERNATIONALEN VERKEHRS ZU STELLEN.
SOLLTE DIESES ULTIMATUM NICHT DIE GEBÜHRENDE WÜRDIGUNG FINDEN, SO BEGINNT BINNEN ZWANZIG MINUTEN DAS BOMBARDEMENT LONDONS — WIE WIR ÜBERHAUPT BISHER JEDE GEGEN DIE DEUTSCHE KÜSTE GESCHLEUDERTE GRANATE MIT EINER EBENSOLCHEN VOM BORD UNSERES FLUGSCHIFFS QUITTIERT HABEN.
DIE FRIEDENSDRACHEN.
GEZ. DRACO.«
Die Schlachtflotte H. M. von England zog es vor, umzukehren. So schnell geschah dieser Rückzug zur Rettung Londons und seines gefangenen Herrschers, daß Sir John Highblown total vergaß, den Schiffen seiner übrigen Verbündeten die nötigen Befehle zu signalisieren.
Indes schwenkten auch diese alle nach dem Beispiele ihres Verbündeten in Kiellinie ein und dampften zurück in die freie See...
Wohl wagte, als die heimatliche Küste AltEnglands wieder der zurückkehrenden Flotte sichtbar wurde und man von den Decks aus die wie eine Wetterwolke über der Hauptstadt hängende Drachenflottille sichtete, ein alter englischer Kanonier, sinnlos vor Wut über den ruhmlosen Heimzug der stolzen Flotte, den Lauf eines Geschützes auf die graue Unheilswolke droben zu richten und — ehe ihn jemand zu hindern vermochte — abzufeuern!
Aber das riesige Geschoß schien alle seine Flugkraft verloren zu haben; die ballistische Kurve seiner Bahn knickte kurz um — wie ein harmloser Ball sank es herab. — Denn um die Flugdrachen zog sich ein unsichtbarer Schutzmantel, in dessen Zone die Gesetze der Erdschwere vom Weltäther beeinflußt wurden.
Und auch die übrigen Punkte der »Kapitulation von London« wurden erfüllt, um so mehr, als man auch aus den englischen Kolonien das Erscheinen der Riesendrachen meldete... —
Seit diesem Erfolg der »Friedensdrachen« haben die Friedenskonferenzen im Haag viel an Ansehen verloren, und man überläßt höflich jedem Staate selbst das Hausrecht in seinen Grenzen. Auch Mijnheer van Geduldjen hat schließlich die Geduld verloren, uferlosen Verbrüderungs- und Abrüstungsverhandlungen zu präsidieren...
Aber dafür haben sich die deutschen »Friedensdrachen« recht erfreulich vermehrt, und selbst die allergrößten »Dreadnoughts« ducken ihren Vordersteven tiefer ins Meer, wenn eines der fliegenden, pfeilschnellen und unverwundbaren Wundergeschöpfe Meister Dracos am Horizont erscheint.
Ich habe einen Freund. — Der L e s e r wird sagen, das sei nichts so Besonderes, daß man damit ein so wichtiges Etwas wie eine Erzählung beginnen dürfte; aber — mit seiner Erlaubnis: ohne diesen Freund hätte ich an jenem schönen Junitage des Vorjahres meinen Spaziergang nach T e g e l nicht unternommen, und ohne diesen ominösen Spaziergang hätten wir beide das seltsame, unglaubliche Abenteuer nicht erlebt, und ohne dies Erlebnis hätte ich keine Veranlassung, die folgende Geschichte zu erzählen.
Man sieht also, daß ich mit meinem Freunde Hintze beginnen muß, wenn ich überhaupt einen Anfang finden will — und der L e s e r wird meinem Freunde schon aus diesem Grunde seine freundliche Gesinnung nicht versagen; also:
Ich habe einen Freund, mit dem ich häufig große Wanderungen unternehme; nur muß man dabei nicht an die Fortbewegung des Körpers durch eigene oder fremde Kraft denken. Die weitesten Wanderungen haben wir meistens unternommen, wenn unser körperliches Ich sich gar nicht im Raume bewegte, also wenn wir ruhig nebeneinander am Tische saßen.
»Mich hält kein Band, mich fesselt keine Schranke;
Frei schwing' ich mich in alle Räume fort —
Mein unermeßlich' Reich ist der Gedanke«
konnte cum grano salis ein jeder von uns von sich sagen.
»Gedankenwanderer« sind wir, l i e b e r L e s e r , mein Freund und ich. Mutter Natur hat unsere Wesen aus einer glücklichen Mischung empirischer und spekulativer Kräfte zusammengebraut, und wenn die Morgenstunden unserer Tage der ernsten, strengen Wissenschaft dienen, so feiern wir häufig dafür die Abende um so heiterer im Reiche lustiger und luftiger Phantasien.
Aber gerade die kuriose Mixtur in unserem Wesen bringt es mit sich, daß unsere phantastischen Ausflüge immer dann am weitesten führen, wenn wir vorher recht ernste, rein wissenschaftliche Probleme miteinander verhandelt und an der Hand der Minerva eine Höhe erstiegen haben, von welcher der Geist Umschau halten kann über das Erreichte. Erst dann vermag unsere Phantasie die Flügel zu heben, so wie — um einmal den stolzen Vergleich zu brauchen — der Adler nur dann zu fliegen vermag, wenn er sich auf hohem, steilem Felsgipfel befindet. Und auch darin gleicht sie dem Adler, daß sie keinen Schwindel kennt, wie hoch hinauf in den Äther sie sich auch schwingen mag.
Heute hatten wir aber wirklich eine Wanderung unternommen, d. h. wir waren mit dem Vorortzug vom Stettiner Bahnhof nach Tegel gefahren. Wir hatten den schönen Park, den alten, herrlichen Stammsitz der Familie Humboldt, kreuz und quer durchstreift, abends in einem Sommerlokal uns restauriert und saßen nun bei einer guten Zigarre und einem frischen Trunk und bewunderten den Mondschein auf dem Tegeler See.
Wir hatten ein Recht, uns auszuruhen. Wo waren wir heute nicht schon gewesen? Allerdings — unser sichtbares Ich war nur ein paar Stunden hin und her gewandert; aber das andere Ich — d a s h a t t e d a s W e l t a l l d u r c h s t r e i f t :
Wir hatten wieder einmal das große physikalische Problem der Schwerkraft durchgehechelt und — gelöst, lieber L e s e r , und es bedarf nur noch einer ganzen Kleinigkeit — dann kannst du mit uns durch die fernsten Fernen reisen, frei von aller irdischen Schwere.
Veranlassung dazu gab uns ein Experiment nach Professor Nescio, von dem der L e s e r vielleicht schon durch die Tagesblätter und Fachschriften unterrichtet ist, und das wir in Hintzes kleinem Laboratorium wiederholt hatten: Wir hatten ein Quantum des Ferroid, jenes neuentdeckten Minerals von der Insel Ceylon, in einem starken magnetischen Felde stundenlang zur Weißglut erhitzt und plötzlich in der Temperatur der flüssigen Luft gekühlt. Das Ferroid zeigte hierauf die rätselhafte Eigenschaft, nicht mehr senkrecht zu fallen, sondern in einer kleinen Kurve. Professor Nescio erklärt dies noch nie beobachtete Phänomen bekanntlich durch die verminderte Einwirkung der Gravitation auf das so behandelte Mineral und hofft durch geeignete Methoden das Ferroid gänzlich schwerefrei zu erhalten. Das heißt aber das Problem der Schwere überhaupt lösen, und wir waren, noch voller Verwunderung über das gelungene Experiment, hoffnungsfroh nach Tegel gefahren und hatten in Gedanken die noch im Wege stehenden Hindernisse glatt genommen — w i r s c h w e b t e n , wenigstens solange der Zug mit uns dahin sauste. Dann freilich nahm uns Mutter Erde wieder sorglich an ihr Gängelband, und wir gingen Schritt für Schritt wie sonst. — Aber auch in Gedanken durchwanderten wir noch einmal Schritt für Schritt all die mühsamen Wege, die den Menschengeist heran zu diesem Problem der Schwerkraft geführt haben.
»Ich sehe ihn deutlich vor mir«, sagte ich bei einer Biegung des Weges.
»Wen, lieber Freund?«, fragte Hintze aus einer nachdenklichen Stimmung heraus.
»Wen? Den großen Weisen von Hampton-Court, den größten Experimentator aller Zeiten.«
»Michael Faraday meinen Sie?«
»Ja — ich sehe ihn wieder einmal deutlich vor mir, den weißhaarigen Forscher mit den leuchtenden Kinderaugen, dessen wunderbar geschickte Hände zuerst die unbändigen Gesellen, die Gase, gezwungen, Magnetismus und Elektrizität verschwistert und den erlauchten Gast des Äthers, den Lichtstrahl, in die Fesseln des Magneten gebannt — wie er sich noch am Ende seiner Tage an das Problem der Schwerkraft heranwagt, und es ist mir immer rührend gewesen, zu lesen, wie er, am Ufer der Themse dahinwandelnd, seine Drahtspiralen zur Erde fallen ließ, um irgendeine Einwirkung der Schwere nachzuweisen.«
»Ja — Faraday wäre vielleicht der Berufenste dazu gewesen«, meinte Freund Hintze und zitierte wieder eines seiner Lieblingsworte:
»Der Kräfte Fäden zu entwirren,
Die um den Stoff geschlungen dicht,
Läßt selbst den großen Meister irren,
Weil die Natur in Rätseln spricht.«

»Es ist gar nicht auszudenken«, sagte ich nach einem Weilchen, »was für Umwälzungen die Lösung des Gravitationsproblems hervorrufen würde.«
»Die wunderbarste Konsequenz wäre ja doch die Beherrschung des Luftmeeres, ja des Weltraumes.«
»Und damit säßen wir beide wieder glücklich auf unserem Steckenpferde, lieber Freund, das sich in unserer Pflege ja nachgerade zum Flügelpferde Pegasus oder richtiger wohl, zu dem Wunderpferde aus den letzten Abenteuern Don Quichotes — ›Zapfenhölzern der Flüchtige‹ — umgewandelt hat. Also — aufgesessen, lieber Freund, gern lasse ich Ihnen den Vorsitz und nehme, wie Sancho Pansa, hinter Ihnen Platz; es trägt uns zwei, und es ist nur schade, daß wir bei unserem Ritt in die höheren Sphären nicht auch solch illustre Zuschauerschaft haben — Herzoginnen und Edeldamen — wie der Edle von la Mancha.«
Wir lachten uns beide gegenseitig aus, wir kannten beide unser gemeinschaftliches Lieblingsgebiet: mit Camille Flammarion hatten wir in seiner Urania das Weltall durchstreift, mit Kurd Laßwitz den Mars besucht; auf Palmyrin Rosettes Kometen hatten wir nach Jules Vernes Fahrplan die Sonnenwelt durchreist und mit dem Projektil des Gun-Klubs im Verein mit Barbicane, Nicholl und Michel Ardan die Reise nach dem Monde versucht, ja, schließlich mit H.G. Wells die ersten Menschen im Mond auf ihren wunderbaren Entdeckungsfahrten ins Innere des Mondes begleitet und die persönliche Bekanntschaft der Mondkälber gemacht.
»Es ist interessant und einer eigenen Betrachtung wert«, sagte mein Freund, »daß wir in den meisten phantastischen Schilderungen außerirdischer Verhältnisse nur eine Übersetzung des Menschlich-Irdischen ins Extramundane wiederfinden, und selbst das tolle Phantasiestück von Mister Wells, der den Mond von Insektenwesen bevölkert sein läßt, verleugnet nirgends seine irdischen Vorbilder.«
»Und das ist ja auch menschlich erklärlich. Der Mensch kann eben nicht aus seiner Haut heraus und aus seiner Seele mit ihren irdischen Vorstellungen ebensowenig; das ist der anthropomorphische Zug unseres Wesens, der auch das Weltall mit seinen unendlichen Formen unter menschliche Gesichtspunkte faßt, oder wie der alte griechische Weise sagte: »Der Mensch ist das Maß aller Dinge.«
»Ich glaube«, meinte Freund Hintze, »daß hierbei noch ein tieferer Grund mitspricht, der Gedanke, daß auch das große Universum denselben einfachen Gesetzen gehorcht wie unsere kleine Erde, daß dieselben ewigen Kräfte bauen am Sonnenball wie am Infusor, daß überall dieselben Ursachen dieselben Wirkungen zeitigen müssen, daß also die Kette des Weltgeschehens im anorganischen und organischen Reiche überall lückenlos ineinandergreift.«
»Gewiß, und es ist einleuchtend, daß zum Beispiel der Mond als der von der Erde abgeschleuderte, kleinere Weltkörper, der viel schneller zur Erkaltung kam, auch schneller seine Entwicklungsstufen durchlaufen mußte, die mehr oder weniger denen geglichen haben müssen, die unserer Erde beschieden waren und noch beschieden sind.«
Unsere letzten Reden führten wir schon in dem Sommerlokal am Tegeler See. Über uns stand in vollem Glanze die weise Luna, und es war mir heute abend mehrmals bei ihrem Anblick, als verzöge sie ihr Gesicht spöttischer als sonst.
»Überhaupt«, fuhr Freund Hintze nach einem Weilchen fort, während unsere Zigarren wie rotglühende Punkte durch die stille Sommernacht geleuchtet hatten, »überhaupt muß ich sagen, daß man bei all diesen Phantasmagorien doch ein wenig zu sehr am Menschen Maß und Zuschnitt nimmt. Nehmen wir wieder einmal als Beispiel den Mond dort oben an —«
Wieder erschien mir im Antlitz des stillen Himmelswanderers das spöttische Grinsen.
»— so ist klar, daß seine gegen die Erde verminderte Masse, die nur mit einem Sechstel unserer Erdschwere die Dinge da oben anzieht und beeinflußt, bei der Formation seiner Organismen von geringerem Einfluß gewesen sein muß als bei entsprechenden Bildungen auf unserem Planeten. Und wenn zum Beispiel beim Aufbau unseres eigenen Körpers, bei der Bildung unserer Knochen statische Momente gestaltend einwirken, die beispielsweise die Struktur unseres Oberschenkelknochens wie die eines Krans zusammenfügen, so wird bei den Mondbewohnern —«
»Sagen wir: den Lunäern —«
»Meinetwegen — so wird bei den Lunäern dasselbe Moment auch bildend einwirken, aber doch in viel schwächerem Grade. Ein Lunäer braucht auf seinem Planeten nicht unseren stabilen Körperbau; er kommt in seiner bimssteinartigen Welt mit viel kleineren und schwächeren Gliedern aus als wir — die Liliputaner Mister Gullivers würden vielleicht gerade für seine Schwereverhältnisse ausreichen!«, schloß mein Freund mit einer scherzhaften Übertreibung lächelnd seine Ausführungen.
»Da aber das Gesetz der Schwere gewiß in viel mehr Fällen und Formen sich durchsetzt, als wir so auf den ersten Blick anzunehmen gewöhnt sind, so wird auch die Pflanzen- und Tierwelt des Mondes, wenn eine solche einmal existiert hat, ganz andere Formen hervorgebracht haben als unsere Erde. Wenn ein Liter Wasser, das auf der Erde ein Kilogramm wiegt, auf dem Monde nur ein Gewicht von zirka 150 Gramm hat, so wird die Wirkung des Wurzeldrucks, des Saftstroms in den Pflanzenleibern viel riesigere Formen zeugen als bei uns, wo überall die Erdschwere hemmend eingreift — übrigens, lieber Freund«, unterbrach ich mich selbst, »könnte ich von hier aus zu einer ganz anderen Auffassung über die Gestalt der Lunäer kommen und Ihnen beweisen, daß der Mond nicht Liliput ist, sondern Brobdignac, das Land der Riesen —«
»Ja, wenn Darwin nicht gelebt hätte mit seinem Gesetz der Anpassung!«, warf mein Freund lächelnd ein. »Er hat dafür gesorgt, daß auch auf dem Monde weder die Bäume noch die Menschen bis in den Himmel wachsen — oder meinen Sie im Ernst, daß ein wie aus Hefenteig aufgegangener zehn Meter hoher Lunäer mit seinen wie Bohnenranken in die Höhe geschossenen Extremitäten mehr ausrichten würde in der Bearbeitung und Umformung seines mütterlichen Bodens als ein kleiner, aber muskulös gebauter?«
»Gewiß nicht, lieber Freund, und bei dem TroglodytenDasein, das die Mondbewohner, falls heute doch noch solche existieren, im Innern ihres Planeten bei den spärlichen Resten von Luft und Wasser führen müssen, um ihr Leben überhaupt fristen zu können, hat ein Maulwurfsgeschöpf entschieden die meisten Chancen —«
Mein Freund fuhr auf.
»Haben Sie das auch eben gesehen?«, fragte er, starr in die Sommernacht hineinschauend.
Ich hatte leider nichts gesehen: denn daß mir der Mond da oben schon wieder ein Gesicht geschnitten hatte, konnte ich meinem Freunde doch nicht als objektive Tatsache mitteilen.
»Was meinen Sie?«, entgegnete ich, auf ein Geräusch horchend, welches vom See herüberkam.
»Eben das!«
»Was?«
»Was jetzt durch die Luft kam?«
»Lieber Freund, wir haben zwar heute Johannisnacht, die laut uralter germanischer Tradition durch ihren Zauberspuk berühmt ist: aber ich hoffe, wir beiden Söhne des aufgeklärten Zeitalters der exakten Wissenschaften, sind frei von —«
Aber mein Freund hörte meine kluge Rede gar nicht mehr. Mit einer Raschheit, die ich gar nicht verstehen konnte, eilte er aus dem Gartenlokal nach dem See-Ufer. Ich folgte ihm, folgte ihm auch, als er ohne auf mein ungeduldiges Fragen zu antworten, in eins der am Strande liegenden Boote sprang, es loskettete und es mit ein paar geschickten Stößen mitten hinein in die Wasserfläche bugsierte.
Noch konnte ich nicht entdecken, was das Ziel seiner nächtlichen Fahrt war. Er schien mir ins ungewisse zu steuern. Stumm und voller Neugier starrte ich hinaus auf den im Mondschein glitzernden See.
Und endlich — endlich sah ich, was er suchte.
Leise von den Fluten geschaukelt, schwamm fast in der Mitte des Sees ein rätselhaftes Etwas, dessen aus dem Wasser ragender Teil beinahe aussah, wie die Spitze eines großen Zuckerhutes oder wie eins der großen Riesengeschosse unserer Festungskanonen.
»Jules Vernes Reise um den Mond«, flüsterte ich, »zwanzigstes Kapitel?«
Aber mein Freund antwortete nicht auf meinen Scherz. Den sonst so Besonnenen hatte fieberhafte Erregung erfaßt; mit hastigen Schlägen trieb er das kleine Boot an das seltsame Ding heran, als fürchte er, es könnte ihm noch vor den Augen versinken.
Nun hatten wir das rätselhafte schwimmende Ding erreicht. Es schimmerte im hellen Mondlicht wie gediegenes Silber.
Unser Boot stieß mit dem Bug an das blanke Metall. Es war, wie schon gesagt, ein schlankkegelförmiges Gebilde, und der Vergleich mit einem Zuckerhut verlor auch jetzt, wo ich es dicht vor mir sah, nichts von seiner Gültigkeit.
Mein Freund hob das eine Ruder aus dem Wasser und schlug damit auf die glänzende Wandung.
Es klang dumpf und hohl.
Er wiederholte dies »Anklopfen« mehrmals, aber nichts regte sich. Wir fuhren um das auf und nieder tanzende Ding herum; nirgends zeigte sich eine Öffnung, weder Tür noch Fenster.
Dabei ragte die »Bombe« so weit aus dem Wasser, daß wir, im Kahne stehend, mit dem hochgehaltenen Ruder kaum ihre schlanke Spitze erreichen konnten.
»Was ist das für ein kurioses Ding?«, fragte Freund Hintze, nachdem wir wieder und wieder vergebens nach einer Öffnung gesucht hatten.
»Eine Riesenbombe kann es ja nicht sein; denn erstens würde die nicht schwimmen, und zweitens gibt es hier in der Umgegend keine Festungswerke, die solch ein Monstrum schleudern könnten, und drittens leben wir ja mitten im Frieden.«
»Ich bleibe dabei, sie kommt direkt aus Jules Vernes Roman zu uns hergeflogen; es ist die Aluminiumbombe des GunKlubs«, sagte ich, die Sache ins Spaßige ziehend, »und ich erwarte, daß sich schließlich doch noch irgendwo ein verborgenes Fenster öffnet, und Michel Ardan, der ewige Schwätzer mit einem ›Bon soir‹ seinem Gefängnisse entsteigt!«
Hintze lächelte nun auch.
»Was machen wir mit dem herniedergefallenen Rätsel? Wir sind die Finder und haben ein Recht darauf?«
»Wir nehmen es ins Schlepptau und versuchen es ans Ufer zu bugsieren. Schade, daß kein Dampfer so spät mehr auf dem See ist; er könnte uns recht nützlich dabei sein!«
Wir nahmen die auf dem Grunde des Bootes liegende Kette auf und versuchten, sie um die Bombe herumzuschlingen.
Leider mißglückte der Versuch; die Schwankungen des Bootes und der auf und nieder tanzende, glatte Metallkörper vereitelten unsere Bemühungen, auch die Kette erwies sich als zu kurz für diesen Zweck.
»Wir wollen nach dem Ufer zurückrudern und uns nach Hilfe umsehen«, schlug ich vor.
Freund Hintze überlegte.
»Und wenn unterdes das Ding hier untergeht oder sonstwie abhanden kommt?«
»So wollen wir rufen! Vielleicht kommt uns vom Lokal drüben noch jemand zu Hilfe!«
Und eben wollte ich aus meinen Händen ein Sprachrohr machen, um »die Stimme, die rufende« hinüberzuschicken, als mich plötzlich mein Freund am Arme faßte.
Eine kreisrunde Stelle in der metallenen Wandung wurde mit einem Male durchsichtig und erschien wie ein von innen matt erleuchtetes Fenster von ungefähr einem Fuß im Durchmesser.
Der Leser kann jetzt an seiner eigenen Neugier die unsere ermessen, mit der wir uns an die runde Scheibe drängten, die ziemlich in Augenhöhe vor uns lag.
Und was sahen wir?
Zunächst — nichts. Leider!
Im Innern des rätselhaften Behälters herrschte ein so eigentümliches Dämmerlicht, daß es für unsere Augen eine geraume Zeit unmöglich war, etwas anderes zu erblicken als verschwommene Umrisse.
Aber nach einer Weile angestrengten Sehens vermochte die Retina unseres Auges doch etwas mehr Detail zu unterscheiden.
Und da sahen wir zunächst einen mit allerlei merkwürdigen Utensilien ausgestatteten Raum.
Mir war noch immer scherzhaft zumute, und ich konnte mich nicht enthalten, abermals mit lustigem Spott zu sagen:
»Am Ende ist es doch das Projektil des ›GunKlubs‹ — sehen Sie eine Spur seiner drei Mondrundreisenden Barbicane, Nicholl und Michel Ardan, lieber Freund?«
Freund Hintze antwortete nicht. Seine scharfen, mit der goldenen Brille bewaffneten Augen spähten unablässig ins Innere des geheimnisvollen Dinges. Sorgfältig schützte er sie dabei durch die vorgehaltenen Hände vor dem Nebenlicht.
»Ich sehe!«, sagte er dann zögernd, wie jemand, der im ungewissen ist und sich langsam orientiert, »ich sehe seltsam geformte Apparate an den Wänden — Metallteile, die in dem eigentümlichen Lichte funkeln, das den ganzen Raum erfüllt — aber lebende Wesen vermag ich bis jetzt nicht zu entdecken.«
»Trotzdem müssen sie vorhanden sein, wenn das erleuchtete Ding irgendeinen Zweck haben soll!«, rief ich.
»Oder — sie sind vorhanden gewesen«, erwiderte Hintze.
»Wollen wir nicht die durchsichtige Scheibe einschlagen?«, schlug ich vor. »Vielleicht gewinnen wir dann einen besseren Einblick in die Sache, vielleicht kann auch einer von uns versuchen, hineinzuklettern«, und ohne Hintzes Zustimmung abzuwarten, führte ich mit dem Ruder einen kräftigen Schlag gegen die Scheibe.
Sie klang hell wie eine Glocke; aber — sie zerbrach nicht! Auch unseren vereinten Anstrengungen gelang es nicht, sie zu zertrümmern.
»Das ist ein vollkommen elastischer, unzerbrechlicher Stoff«, sagte Hintze, das Vergebliche unserer Bemühungen konstatierend.
Und abermals klammerten wir uns, in dem schwankenden Boot auf den Zehen stehend, an die Metallfläche des rätselhaften Zuckerhutes und lugten durch die Scheibe.
Da sagte mein Freund:
»Sehen Sie einmal gerade gegenüber!«
»Tue ich.«
»Und nun von diesem Punkte vielleicht einen halben Meter nach unten.«
»Sehe ich — ein weißes Feld!«
»Ja — eine Art Karte oder Orientierungsplan, nicht wahr? Sehen Sie darauf — es ist allerdings nur mit großer Aufmerksamkeit zu entdecken — am oberen Rande den kleinen Kreis eingezeichnet?«, fragte mein Freund weiter.
Nach einer Weile angestrengten Sehens entdeckte ich, was er meinte.
»Ich sehe den Kreis, lieber Freund, das heißt durch Ihre Anleitung orientiert, glaube ich ihn zu sehen; es sind unregelmäßige Konturen auf seiner Fläche eingezeichnet!«
»Richtig. Und nun blicken Sie nach dem unteren Rande des Planes — was sehen Sie?«
»Einen zweiten Kreis — größer als den ersten.«
»Ja — und dieser größere Kreis zeigt keine volle Rundung, sondern hat eine bestimmte Phase, ähnlich unserem Monde.«
»Sehe ich, lieber Freund!«
»So — dann sehen Sie wohl auch die Konturen auf dieser größeren Scheibe?«
»Ja«, sagte ich leise, wie vor einer unglaublichen Entdeckung zögernd —
»Und sehen, daß diese große Scheibe die Umrisse der Kontinente Europa, Asien, Afrika und Australien eingezeichnet enthält —«
»Wahrhaftig — die große Scheibe stellt unsere Erde vor?«, rief ich in höchster Überraschung.
»Ja«, sagte Hintze bedeutungsvoll, »sie stellt unsere Erde so vor, wie sie nach der Meinung unserer Astronomen einem Mondbewohner während einer bestimmten Phase erscheinen müßte.«
»Dann soll also offenbar die kleinere Scheibe darüber der Mond sein?«
»Gewiß, und nun sehen Sie wohl auch die aus einzelnen Punkten sich zusammensetzende Kurve, die vom Monde bis fast zur Erde reicht.«
Ich sah, was mein Freund zuerst entdeckt; ich sah die aus einzelnen Stücken sich zusammensetzende, seltsam gekrümmte Kurve, die in der Nähe der Erde plötzlich abriß — aber ich sah noch mehr.
Auf dem im matten Dämmerlicht des Raumes hellschimmernden Plane sah ich plötzlich einen schwarzen Schatten gleiten.
Und dieser Schatten glich ungefähr einer Menschenhand.
Ich schrie auf vor Erregung.
Auch Freund Hintze sah das Phänomen.
Und plötzlich glitt die Hand hinweg von der Karte und haftete eine Sekunde später an dem Fenster.
Wir fuhren beide zurück — so schnell war sie vor uns aufgetaucht.
»Eine Hand«, sagte ich — ich hätte richtiger sagen müssen: ein handartiges Gebilde, feingliedrig wie die eines zarten Kindes, und dennoch anders, wie von Metall gegossen, mit einem seltsamen, bronzefarbenen Schimmer.
Die Hand verschwand wieder, und das Fenster ward wieder frei.
Nun wußten wir, daß das seltsame Ding bewohnt war, aber von was für einem Wesen? Woher stammte es?
»Wir müßten doch versuchen, das Ding ans Ufer zu schleppen«, sagte Hintze. »Hier auf dem Wasser, im schwankenden Boot und bei dem unsicheren Standpunkt gelangen wir doch zu keinem rechten Resultat.«
Ich antwortete nicht, mein Auge hing an dem Fenster.
Und jetzt kam uns ein Bundesgenosse, der Mond.
Er hatte mittlerweile seinen Standpunkt am Himmel geändert, und das helle Licht des Vollmondes fiel gerade hinein in das Fenster der rätselhaften Behausung.

Wir sahen bei seinem Lichte bis hinab auf den Boden des Raumes, und da fanden unsere Blicke endlich den Bewohner des rätselhaften Vehikels.
Er hockte zusammengesunken mitten auf der kreisrunden Fläche. Der Kopf war tief zwischen die Schultern hinabgedrückt. Wir sahen seine zierliche, feingebaute Gestalt, so groß kaum wie die eines sechsjährigen Kindes.
Und diese Gestalt schien krank zu sein.
Krampfhaft bewegte sie die feingegliederten Arme. Stoßweise hob und senkte sich der gebeugte Nacken. Die enganliegende, wie Metallgewebe schimmernde Kleidung verriet deutlich alle Bewegungen des kleinen Körpers.
»Er ringt nach Atem«, sagte ich entsetzt, »er scheint an Luftmangel zu leiden.«
Und abermals bearbeitete ich mit voller Kraft das Fenster mit dem Ruder, und abermals vergebens.
»Wir müssen versuchen, ihn nach dem Ufer zu schaffen«, sagte Hintze in dringendem Tone.
»Dann wollen wir Hilfe herbeirufen.«
Und aus Leibeskräften schrie ich nach dem Ufer um Hilfe.
Es schien uns niemand zu hören. Es war zum Verzweifeln.
Freund Hintze überlegte. »Wenn wir das Ding zum Umkippen brächten. Vielleicht gelingt es, obwohl sein Schwerpunkt ganz im unteren Teil zu liegen scheint. Dann finden wir vielleicht doch einen Zugang: der Bewohner muß doch irgendwo hineingekommen sein. Wissen Sie was? Ich will versuchen, mich auf die Spitze zu schwingen; vielleicht kippt das Ding um. Nötigenfalls helfen Sie nach.«
Gesagt, getan. Mit einem geschickten Satze und von mir unterstützt, schwang sich mein Freund rittlings auf den metallenen Kegel hinauf.
Und — der Kegel schlug um. Seine Grundfläche tauchte aus dem Wasser hervor.
Da fanden wir die Einsteigöffnung: aber sie war von i n n e n verschlossen, und alle unsere Versuche, die Verschlußplatte zu entfernen, umsonst.
Und dabei sahen wir die Not des eingeschlossenen Wesens viel deutlicher als vorher. Beim Umkippen war der Bewohner mehr nach der Spitze des Kegels gerutscht und lag nun gerade unter dem Fenster in unserer Gesichtslinie.
Und nun sahen wir auch das Gesicht des Mondmenschen, vollbeschienen von dem Strahl seines heimatlichen Planeten.
Hätten wir doch eine greifbare Erinnerung davon nehmen können, und wenn es eine flüchtige Bleistiftskizze gewesen wäre!
Es war kein Menschengesicht nach unseren Begriffen; es ähnelte auch nicht irgendeinem anderen irdischen Geschöpf: wir sahen — das fiel uns zuerst auf — zwei seltsam große, völlig kreisrunde Augen, die jede Spur eines Lichteindrucks aufzusaugen schienen; denn die blaugrün phosphoreszierenden Pupillen wechselten fortwährend ihre Farbe und Größe. Die Ohren glichen in ihrer seltsamen Form dem Schallbecher eines Mikrophons; Nase, Wangen, Mund und Kinn erschienen eigentümlich formlos, als ob sie ein Künstler nur ganz roh und hastig modelliert hätte, namentlich die Lippen litten unter diesem Mangel. Desto auffallender in ihrer Bildung war die Stirn; sie schob sich wie ein krönendes Kapitäl über den Bau des Untergesichts vor. Überhaupt hätte an der Schädelbildung des »Lunäers« ein Phrenologe à la Gall seine helle Freude gehabt, und der nur spärliche Haarwuchs hätte ihm die Untersuchung nach seinem System sehr erleichtert. Als ob das darunterliegende Gehirn sich die äußeren Räume seiner Werkstatt selbst ausgebaut hätte, um den großen Massen seiner hochentwickelten Struktur die nötige Ausdehnung zu verschaffen, zeigte die Form des Hauptes für menschliche Begriffe abnorme Dimensionen und kuriose Höcker und Wülste. Nicht der Meißel des Künstlers hatte diesen Kopf geformt, sondern die eherne Hand der Notwendigkeit, nichts Schönes nach unserem Empfinden, nichts Weiches, Harmonisches zeigten diese Züge, sondern etwas ErhabenEinfaches, StrengNotwendiges, als ob die Bildung dieser Lebewesen auf dem Monde in rascher Anpassung an die soviel schneller verlaufende Entwicklung nicht Zeit gehabt hätte, erst auf mannigfachen Umwegen sein höchstes Geschöpf zu erzeugen, sondern als ob sie mit wenig großen Schritten zum Ziel gelangt sei. Ebenso war es uns unmöglich, aus den Gesichtszügen einen Schluß auf das Alter des Mondmenschen zu ziehen.
Diese Reflexionen machten wir freilich in jenen Momenten nicht, wo wir das kleine Wesen in seiner Not vor Augen hatten. Noch jetzt sehe ich manchmal sein qualvoll verzerrtes Gesicht vor mir; sehe sein Ringen nach Atem und fühle, wie in jenen Augenblicken, die Pein, ihm nicht helfen zu können.
Er litt, aber offenbar nicht oder nicht nur unter Luftmangel.
Er litt unter der irdischen Schwere, die, sechsmal größer als auf dem Monde, auf den Geweben und Organen seines kleinen Körpers wie ein sichtbares, bleiernes Gewicht lastete, die feinen Strukturen im Zellgewebe seines Organismus zerstörend.
Was sollten wir tun?
Ratlos sahen wir uns an. Dagegen wußten wir Menschen kein Mittel; das überstieg noch das heutige menschliche Wissen.
Tief in die Seele schnitt uns die Angst des Mondbewohners, der Ausdruck der Hilflosigkeit, mit der er immer und immer wieder uns flehend die Hände entgegenhob, schwer und mühsam, als wären sie von Blei. Seine Lippen bewegten sich, und seine Augen blickten uns mit einem unsagbaren Ausdruck an.
Es war ein schauderhaftes, unerträgliches Gefühl, das uns dem seltsamen Wesen gegenüber beschlich.
»Donnerwetter!«, rief Hintze endlich, »wir m ü s s e n irgend etwas tun für den da drin; das ist ja gar nicht mehr mit anzusehen! Lieber Freund, fahren Sie nach dem Ufer und holen Sie Hilfe an Menschen und Material; ich bleibe vorläufig hier sitzen, bis Sie zurückkehren.«
»Und werden Sie auf diesem hin- und herschwankenden Dinge solange die Balance halten können? Kommen Sie lieber mit! Dann sind wir um so schneller wieder hier —«
Aber Hintze schüttelte den Kopf.
»Einer muß hier bleiben! Rudern Sie los, lieber Freund!«
Und ich ruderte, ruderte mit Anspannung aller meiner Kräfte. Mich trieb doppelte Sorge, um meinen Freund dort auf dem bedenklich hin- und herkippenden Vehikel und um den eingekerkerten »Mann aus dem Monde«,
Immer wieder drehte ich mich um und sah nach dem schwimmenden Zuckerhut da draußen auf der silberweißen Wasserfläche, und immer noch sah ich meinen lieben Freund dort hocken, den Kopf tief auf das Fenster herabgebeugt.
Endlich knirschte der Sand des Ufers unter dem Kiel. Ich stieg aus dem Boote und stürmte in rasender Eile in das Restaurant. Es war schon geschlossen, die letzten Gäste schon längst gegangen...
Lange mußte ich klopfen und rufen — endlich hörte ich die unwillige Stimme des Wirtes, der nach meinem Begehr fragte. —
Mit wenig hastigen Worten versuchte ich ihm mein Kommen zu erklären und verlangte einige Taue oder Ketten und noch einen Mann zum Mitrudern.
Endlich saß ich wieder mit einem Vorrat von Stricken im Boot — aber allein. Der Wirt wollte so spät sein Lokal nicht verlassen, und andere Hilfe war so schnell nicht aufzutreiben.
Kaum aber hatte ich die beiden Ruder wieder erfaßt, als laute Hilferufe vom See her ertönten.
Es war die Stimme meines Freundes?
Wie ich mich ins Zeug legte, um an Ort und Stelle zu kommen! Meine Brust flog, mein Herz hämmerte gegen die Rippen bei den raschen Ruderstößen. Jetzt erst merkte ich, wie weit die Entfernung vom Ufer war.
Noch immer sah ich nichts von dem metallenen Fahrzeuge und seinem Reiter — merkwürdig!
Ich stand einen Augenblick auf und spähte umher. — Wieder hörte ich die Stimme meines Freundes; sie klang immer noch wie aus weiter Ferne.
Aber das war ganz unmöglich! So weit draußen auf dem See konnte das Fahrzeug nicht schwimmen! Und ich glaubte doch die Richtung genau innegehalten zu haben.
Weit und breit war von dem Dinge nichts zu erblicken und auch von meinem Freunde nichts.
Doch — Himmel! da schwamm sein Hut!
Eine furchtbare Angst erfaßte mich —
Ich rief seinen Namen in die Runde —
Und abermals hörte ich seine Stimme!
Entsetzt blickte ich umher —
Da fiel ein Schatten in mein Auge, der den Strahl des Mondes verdunkelte.
Und nun sah ich, was ich suchte!
Schräg über mir schwebte das Projektil in der Luft. Es stieg, von einer geheimnisvollen Macht getrieben, langsam in die Höhe. Die Spitze hatte sich wieder nach oben gerichtet.
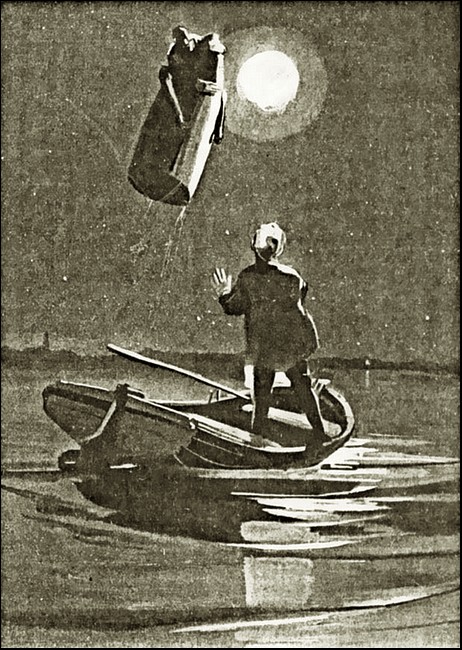
Und an seiner metallenen Wandung hing, krampfhaft festgeklammert, Freund Hintze.
»Lassen Sie los, ich bin hier — unter Ihnen!«, schrie ich aus Leibeskräften hinauf.
Und er ließ sich los und — fiel herab!
Aber es war kein Fallen im eigentlichen Sinne: er sank in einer schwach gekrümmten Kurve herab, so langsam, als trügen ihn unsichtbare, geheimnisvolle Schwingen —
Und ich konnte ihn mit dem Boote gerade auffangen, ehe er noch ins Wasser tauchte.
Ich umarmte ihn. »Mein lieber armer Freund — was machen Sie für Geschichten?«, sagte ich, froh, daß ich ihn heil wieder bei mir hatte. »Erzählen Sie! Wie kamen Sie zu der seltsamen Luftfahrt?«
Freund Hintze sah ein Weilchen still nach oben, wo das im Strahl des Mondes schimmernde Projektil, kleiner und kleiner werdend, ins Unendliche hineinflog —
Dann ergriff er meine Hand und sagte bewegt:
»Der da oben fliegt, hat das Problem gelöst, das uns Menschen vielleicht Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch noch verschlossen bleiben wird — die Beherrschung der Schwere.«
»Und doch hätte ihn die Schwerkraft unserer Erde fast erdrückt?«, fragte ich zweifelnd.
»Weil er nicht mehr Herr seines wunderbaren Apparates war, als er hier in den See stürzte«, entgegnete mein Freund, »weil ihn wahrscheinlich die irdische Schwere zu schnell beeinflußte, ehe er noch Zeit hatte, sich und sein Fahrzeug den veränderten Bedingungen hier unten anzupassen — oder weil die irdische Schwere trotz aller seiner Vorkehrungen die Widerstandsfähigkeit seines auf dem Monde gebildeten Organismus überstieg. Ich bleibe dabei: sein Vehikel ist ein Apparat, der die Schwerkraftstrahlen beliebig auszunutzen gestattet. Sehen Sie, wie es nach oben steigt, wie von der Erde unablässig abgestoßen? Es wirft einen unsichtbaren Schatten in den Raum, in dem die Gravitation der Erde wirkungslos bleibt —«
»Auch Ihr Herunterfallen war seltsam, lieber Freund!«
»Ja — haben Sie es auch bemerkt?«, entgegnete er. »Mir war, als würde ich während des Fallens immer noch von einer anderen Kraft schwebend erhalten!«
»Wunderbar! Wunderbar!«, rief ich. »Aber nun erzählen Sie, bitte, erzählen Sie!«
Und er erzählte:
»Als Sie dem Ufer zuruderten, um Hilfe zu holen, setzte ich durch das Fenster meine Beobachtungen fort. Und ich sah, daß der Eingeschlossene sich abermals aufzurichten versuchte. Zehnmal gewiß mühte er sich vergebens; immer wieder sank er, wie von einer unsichtbaren Macht niedergedrückt, hilflos zu Boden.
Ich merkte, weshalb er jetzt diese neuen Anstrengungen machte; seine immer und immer wieder ausgestreckten Hände hatten es mir verraten. In ihrer Nähe sah ich eine Kurbel, die an einem schaltbrettartigen Apparat befestigt war.

Es stand in meiner Macht, ihm zu helfen. Ich veränderte meinen Sitz, wodurch das Fahrzeug um seine Längsachse ins Drehen und er selbst ins Gleiten geriet, solange, bis er an die metallene Kurbel zu liegen kam. Nun endlich konnte er sie erfassen, und ich sah, wie er sich mit der ganzen Kraft seines kleinen Körpers dagegen stemmte, um sie zu bewegen.
Ich sah, daß sie sich drehte, fast um 90 Grad.
Und nun geschah etwas Wunderbares! Wie durch Zauber verwandelt, richtete sich die zusammengesunkene Gestalt plötzlich auf! Leicht und elastisch wurden mit einem Schlage alle seine Bewegungen; sein Kopf hob sich empor, und seine Augen blickten mich an wie die eines befreiten Gefangenen!
Und noch etwas Überraschenderes geschah: er glitt schnell durch den Raum und stand plötzlich dicht vor mir am Fenster. Seine Hände — jetzt sah ich erst, wie geschickt ihre kleinen Glieder sich bewegten — fingerten am Rande des Fensters.
Und plötzlich sprang das Fenster auf! Nach den Gesetzen des Luftdrucks hätte jetzt die umgebende viel dichtere Luft der Atmosphäre zischend in den Innenraum seines Fahrzeugs strömen müssen, beinahe wie in ein Vakuum — aber nichts davon ließ sich hören; folglich hatte der Bewohner den Ausgleich mit der umgebenden Luft längst hergestellt — und es war also weder Luftmangel noch Luftüberschuß, woran er gelitten, sondern nur die Erdschwere.
Jetzt sah ich ihn frei vor mir — den Mann aus dem Monde. Ich sah, wie er mit der Rechten erst auf sich, dann auf den Mond deutete; dann zeigte er auf mich und wies nach unten. Ich übersetzte mir das so: er stamme vom Monde, wie ich von der Erde.
Ich nickte. Ich sprach ihn an, aber er antwortete nicht — seine Gesten schienen anzudeuten, daß er jetzt nicht sprechen könne. Aber er streckte mir durch den schmalen Spalt des Fensters seine Hand entgegen.
Sie fühlte sich kühl und fest an. Und als ich sie wieder losließ, hielt ich einen festen Gegenstand in meinen Fingern.
Dann schloß sich das Fenster wieder. Noch einmal sah ich das Gesicht des Mondmenschen mit einem seltsamen Ausdruck auf mich gerichtet — und dann erst entdeckte ich, daß ich — hoch in der Luft schwebte!«
So sehr hatte mich das Interesse an den erzählten Vorgängen gepackt, daß ich die Veränderung meiner Lage gar nicht bemerkt hatte.
Dann wurde mir klar, daß die Drehung der Kurbel, welche dem Mondbewohner seine natürliche Leichtigkeit wiedergab, auch den ganzen Apparat dem Einfluß irdischer Schwere wieder entzogen haben mußte. Der ›Mann aus dem Monde‹ hatte die Existenz hier unten vermutlich ›zu schwer‹ gefunden; darum kehrte er zurück — wahrscheinlich wieder nach Hause!
Da wurde mir doch unheimlich zumute. Weiter wollte ich lieber nicht mitfahren! Ich rief um Hilfe und — das übrige wissen Sie, lieber Freund!«
»Wenn Sie der Mondmensch doch noch ein paar Dutzend Kilometer weiter mitgenommen hätte«, sagte ich. »Wenn er Ihnen gar den Zutritt in sein fliegendes Heim ermöglicht hätte! Wenn sich eine Verständigung zwischen Ihnen und dem ›Mann aus dem Monde‹ hätte anbahnen lassen! Wenn er Ihnen das Geheimnis seines Apparates zur Beherrschung der Schwere verraten hätte! Wenn er Ihnen authentische Aufschlüsse über den Mond und seine Bewohner gegeben hätte! Welcher Gewinn für die Wissenschaft! Um diesen Preis hätte ich mich gern die ganze Nacht um Sie gesorgt.«
»Ja — wenn! —«, seufzte Freund Hintze mit dem schmerzlichen Lächeln der Resignation.
»Und das Andenken, das Ihnen ›der Mann aus dem Monde‹ durchs Fenster gereicht?«, fragte ich
»Hier ist es!«
Er reichte mir einen viereckigen metallenen Gegenstand.
Es war ein — Buch, dessen Blätter aus einer dünnen Metallfolie bestanden.
So dünn es war, enthielt es doch eine große Anzahl Blätter, und alle, soviel sah ich beim Lichte des Mondes, waren mit seltsamen Zeichen bedeckt.
»Vielleicht das Tagebuch des Mondmenschen über seine Fahrt zur Erde«, sagte ich. »Ob wir es je entziffern werden?«
Freund Hintze antwortete nicht. Mein Blick folgte dem seinen. Er suchte noch einmal in den Höhen des Himmels den rätselhaften Weltwanderer und sein geheimnisvolles Fahrzeug...
Er war längst aus unserem irdischen Gesichtskreis entschwunden.
Am nächtlichen Himmel stand nur der Mond in vollem Glanze.
Und diesmal verzog er ganz deutlich das breite Gesicht zu einem spöttischen Grinsen.
Mr. Themistokles Bluff, der bekannte Direktor der U.S.P.C.L. (United-State-sPatent-Company-Limited) blickte ärgerlich von seiner Lektüre auf, als Jim, sein Diener, unerwartet bei ihm eintrat.
»Was ist, Jim?«
»Ein Fremder, Herr!«
»Was will er?«
»Er möchte Sie in einer wichtigen Angelegenheit sprechen, Herr Direktor!«
»Ach, das wollen sie alle —«
»In einer s e h r wichtigen Angelegenheit!«
»Kennen wir. Anmeldung eines Patents zur Verhütung des Schiefwerdens der Stiefelabsätze, nicht?«
Jim, der smarte Diener, der vordem bei einem richtigen Grafen in Stellung gewesen war, zeigte ein undefinierbares Lächeln.
»Also, sag ihm, ich sei nicht zu sprechen!«
Jim verschwand, und der Direktor versenkte sich wieder in das Studium der Kursberichte.
Einige Augenblicke später erschien der Diener wieder. »Herr Direktor!«
»Goddam! was wieder?«
»Der Mann will sich nicht abweisen lassen —«
»Welche Frechheit! Und womit begründet er seine Zudringlichkeit?«
»Er meint, eine Erfindung von solcher Bedeutung sei Ihnen überhaupt noch nicht angeboten worden —«
»Als ob nicht jeder von den Hunderttausenden der Erfindernarren das nämliche behauptete! Wenn er nicht bessere Argumente aufweisen kann —?«
»Doch, Herr Direktor — hier!«
Damit reichte Jim seinem Herrn ein eingewickeltes Päckchen.
Themistokles Bluff öffnete etwas ungeduldig das Paket.
Aus den Papierhüllen kam ein lebendiges, zappelndes Etwas hervor, das mit einem gewaltigen Satze an des Herrn Direktors Nase vorbei auf sein schönstilisiertes Schreibzeug hüpfte.
»Ein Frosch!«, sagte Jim zu seinem Herrn.
»Rufen Sie mir — bringen Sie mir den impertinenten Menschen herein, der sich das erlaubt hat!«, schrie der erboste Direktor. Jim verschwand wieder.
»Ich komme schon selbst«, ertönte plötzlich hinter ihm eine feste, wie Metall klingende Stimme. »Good evening, Mister Bluff!«
Der Herr Direktor wandte sich verblüfft um: er sah vor sich einen hochgewachsenen, mit weltstädtischer Eleganz gekleideten Mann in den mittleren Jahren, glattrasiert, mit klugen, durchdringenden Augen, einem energischen Zug um die schmalen Lippen. Eigentümlich fiel ein seltsamer Bronzeton des Antlitzes auf, der auch über dem vollen Haupthaare des Besuchers lag und ihm einen fast metallischen Schimmer gab.
»Wie können Sie es wagen, hier einzudringen — ohne Erlaubnis? Und wie können Sie es wagen, mir einen — einen«, der Direktor würgte an dem Worte, »einen Frosch im Paket überreichen zu lassen? Soll das etwa Ihre Erfindung sein, Herr — Herr?«
Die Stimme des erzürnten Direktors der U.S.P.C.L. überschlug sich vor Aufregung.
Der Fremde griff den Frosch, der mit seinen großen Glotzaugen angsterfüllt, noch immer dicht neben dem Tintenfasse hockend, in die Welt starrte, und hielt ihn dem Direktor vor die Augen.
»Wollen Sie nicht die Güte haben, Mister Bluff, sich diesen Frosch einen Augenblick genauer zu betrachten?«
Der Direktor stieß das kleine Amphibium von sich und schrie: »Gehen Sie zum Kuckuck mit Ihrem Frosch, Mister — Mister —«
»Infrangible!«, sagte der Besucher, sich verneigend.
»Goddam! Gehen Sie — ehe ich meinen Diener —«
Mr. Infrangible hatte den Frosch wieder auf die Platte des Schreibtisches gesetzt und schlug mit einem Brieföffner, den er vom Schreibzeuge genommen, auf den Rücken des Tierchens.
Es klang hell, wie eine metallene Glocke!
Der Direktor lachte. »Humbug, Mister Infrangible«, sagte er dann — »ein ganz netter kleiner Automat! Dachten Sie, ich sollte ihn für lebendig halten?«
Mr. Infrangible sagte nichts darauf, sondern deutete nur mit der Hand.
Eben nahte sich eine Fliege dem Frosche. Schnell hatten seine Augen die Beute bemerkt — ein Öffnen des Kiefers, ein Herausschnellen der Zunge — und sicher war die Fliege erfaßt und verschluckt!
Mit starren Blicken, als sähe er etwas Unbegreifliches, schaute der Direktor den eben erzählten Vorgang.
»Das ist —«, begann er.
»Kein Automat, Herr Direktor, sondern ein lebendiger Frosch!«
»Aber — er klingt ja wie aus Metall?«
Und der Direktor schlug nun selber mit dem Brieföffner auf das Rückenschild des Frosches.
»Er ist aus Metall, Herr Direktor!«
»Wie soll ich das glauben?«
Statt aller Antwort ergriff Mr. Infrangible die auf einem Nebentischchen stehende Kopierpresse, hob sie empor und setzte sie, ehe der Direktor noch zuspringen konnte, gerade auf den Körper des Frosches.
Natürlich erwartete der Direktor, daß das schwache Tierchen zu Brei zerdrückt war; wie aber erstaunte er, als Mr. Infrangible die schwere Presse wieder emporhob!
Der Frosch saß unverletzt auf der Tischplatte — wie vorher.
»Wie ist denn das möglich — wie ist denn das möglich?«, rief Mr. Bluff einmal über das andere; dann, sich zu seinem Besucher wendend: »Bitte, nehmen Sie doch Platz, mein Herr! Rauchen Sie?«
Damit bot er seinem Gegenüber die Kiste mit den Importen.
»Ich bin so frei —«, sagte Mr. Infrangible, lächelnd eine der großen Havanas aus der Kiste nehmend und in Brand setzend.
Ungeduldig saß ihm der Direktor gegenüber, immer wieder seine funkelnden Augen nach dem gepanzerten Frosche richtend — und endlich begann er:
»Sie sagen, er sei aus Metall, Mr. Infrangible. Ich glaube das so verstehen zu müssen, daß seine äußere Hülle aus Metall besteht, also eine Art Panzer um ihn bildet.«
»Nein, Herr Direktor — er ist durch und durch Metall!«
»Aber — Mister Infrangible?«
»Wie ich Ihnen sage, Mister Bluff. Alle Zellen seines Organismus sind mit einer flüssigen Metallegierung durchtränkt und gesättigt.«
»Also eine Galvanisierung des lebenden Organismus, nicht?«
»Nein, Herr Direktor — ein organischer Aufbau des ganzen Körpers aus metallhaltigen Nährstoffen!«
»Wie sagen Sie: aus metallhaltigen Nährstoffen?«
»Ja — metallhaltige Nährstoffe in einer kolloidalen Modifikation, welche es dem Organismus ermöglicht, sie aufzusaugen und sie zu assimilieren.«
»Und der Zweck der ganzen Sache?«
»Haben Sie nicht eben das kleine Experiment mit Ihrer Kopierpresse gesehen? War diese Belastungsprobe nicht überzeugend genug?«
»Ja — aber — was nützen uns metallisierte Frösche, Mister Infrangible?«
»Wer sagt Ihnen denn, daß meine Erfindung sich auf sie allein beschränkt, Mister Bluff? Jeder lebende Organismus nimmt meine Metallösung auf und absorbiert sie.«
»Auch der menschliche?«
»Der in besonders hohem Grade. Sehen Sie mich an! Gewiß erkennen Sie die eigentümliche Hautfärbung und den Metallglanz meines Haares?«
»Und Sie meinen, Sie würden mit Ihrem Körper proportional das gleiche Belastungsexperiment ertragen, wie Ihr Frosch? Eine derartige für jeden andern tödliche Probe auf Stoß- und Druckfestigkeit?«
»Ja, Herr Direktor! Nur — muß ich Ihnen sagen, und darum bin ich hier, daß der menschliche Organismus natürlich viel größere Mengen der betreffenden Metallmodifikation zur Sättigung seiner Zellen bedarf — ich nenne das Präparat Argentoferrin; denn seine chemischen Eigenschaften ähneln denen einer Legierung von Silber und Stahl! — als der Körper dieses kleinen Versuchsobjektes — und daß mir leider die Mittel zu fehlen beginnen, mich in vollkommener Weise zu metallisieren. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, Herr Direktor, ein wie langer Irrweg erst mich zu meiner Erfindung geführt hat! Wieviel kostspielige Fehlschläge, wieviel Opfer an Zeit und Geld! Erst seit ungefähr fünf Jahren bin ich auf dem richtigen Wege; erst seit dieser Zeit habe ich meine an Tieren ausgeführten Versuche an mir selbst begonnen! Aber nun sind meine Mittel zu Ende! Gewähren Sie mir diese, Herr Direktor! Ich bin bereit mich unter der Kontrolle Ihrer Gesellschaft so vollständig wie möglich zu metallisieren und mich dann jeder Festigkeitsprobe zu unterwerfen, die Ihre U.S.P.C.L. mit mir vornehmen will.«
Der Direktor griff sich an den Kopf.
»Ich — ich kann es noch nicht fassen, Mister Infrangible. Die Sache ist zu neu, zu seltsam! Ich kann auch nicht allein über die eventuelle Abnahme Ihrer Erfindung entscheiden.«
»Aber begreifen Sie denn nicht den ungeheuren Wert meiner Erfindung, Mister Bluff?«, rief der Erfinder ungeduldig.
»Ich begreife, daß Sie von Ihrer Erfindung eingenommen sind, wie jeder andere Erfinder, Mister Infrangible«, sagte der Direktor, kühler werdend.
»Denken Sie doch, welchen unschätzbaren Nutzen mein Metallisierungsverfahren für die Menschen haben muß — gerade in unserer Zeit!«
»In unserer Zeit?«
»Ja — heutzutage, wo der Tod auf Schritt und Tritt in den Straßen der Großstadt lauert, hinter jedem Alter und Geschlecht! Denken Sie an das sinnbetäubende Gewirr der Wagen, der Straßenbahnen und Automobile! An die zahllosen Opfer des Verkehrs! Denken Sie an die Eisenbahnzusammenstöße und entgleisungen, die sich in letzter Zeit geradezu unheimlich häufen! Und diese Gefahren werden von Tag zu Tag größer — bei der Sucht der Menschen, neue Geschwindigkeitsrekorde zu schaffen! Da kommt meine Erfindung wie gerufen: sie vergrößert die Widerstandsfähigkeit unseres Körpers in ungeahnter Weise. Die Kollisionen werden nicht verschwinden; aber ihre Gefahren für den menschlichen Organismus werden auf ein Minimum herabsinken! Nach meinen statistischen Berechnungen wird der normal metallisierte Menschenleib ohne nennenswerte Beschädigung das Überfahren durch Automobile, die Kontusionen bei Zugzusammenstößen überstehen! Und auch den allerschwersten Fall, der Abtrennung einzelner Glieder, angenommen, so erlaubt mein Verfahren auf biochemischgalvanoplastischem Wege ein tadelloses, kunstgerechtes Wiederanfügen, bzw. teilweises Ergänzen von Körperteilen.«
»Dann werden nach Ihrer Meinung wohl auch die Verwundungen in den Kriegen der Zukunft weniger gefahrbringend sein?«, sagte der Direktor, wider Willen, doch interessiert.
»Selbstverständlich! Die meisten Schüsse aus kleinkalibrigen Gewehren werden — um nur das zu erwähnen — wenn sie nicht gerade Kernschüsse aus allergrößter Nähe sind, glatt an den metallisierten Knochen des Körpers abprallen, und auch die Durchbohrung und Zerreißung der Weichteile wird erschwert oder verhindert werden, dank der schützenden Metallablagerung in den Geweben. Ich brauche Ihnen nicht erst zu sagen, was dies für die künftige Kriegsführung bedeutet. Aus begreiflichem Interesse habe ich Ihre Patentregister während der letzten Jahre eifrig verfolgt und weiß, wieviel Versuche gemacht worden sind und werden, kugelsichere Panzer herzustellen. Nun — der Staat, der im Besitze meines Verfahrens ist, kann sich gewissermaßen eine ›eiserne Legion‹, eine ›unsterbliche Phalanx‹ bilden, die an Kriegstüchtigkeit und Widerstandskraft alle Armeen der Welt übertrifft!«
Der Direktor lächelte etwas ironisch und sagte: »Wenn Sie auf dem Wege weitergehen, werden Sie noch den Tod selber mit Ihrer Erfindung aus der Welt schaffen, Mister Infrangible!«
»Den Tod nicht, Mister Bluff; aber — das Alter!«
»Das Alter?«, fragte der Direktor, nun wieder erstaunt.
»Ja — das Alter; wenigstens das Altern innerhalb des Zeitraums, in dem es jetzt bei den Menschen einzutreten pflegt. Und das war das Wunderbare, das mir bei meiner Erfindung als unverhoffte Zugabe in den Schoß gefallen ist: die Verjüngung der organischen Zelle und die damit zusammenhängende Konservierung der lebenden Gewebe durch mein Argentoferrin.«
»Sie meinen, daß nach längerem Gebrauche Ihres Mittels —«
»Nicht erst nach längerem Gebrauche, Herr Direktor! Schon nach den ersten Dosen beginnt dieser rätselhafte Prozeß! Eine ungeahnte Regeneration des gesamten Organismus tritt ein, die sich auch subjektiv in dem Gefühle unversieglicher Kraft geltend macht!«
»Das Wunderelixier des Grafen von St. Germain oder der Stein der Weisen, der uns ewige Jugend verschafft, ist also gefunden«, warf der Direktor lächelnd ein.
»Er ist gefunden!«, rief der Erfinder siegesgewiß aus, und es war, als ob er sich mit jedem Worte mehr an seiner Erfindung berausche — das ehemalige armselige Menschenwesen, das ungezählte jahrtausendelang auf der Erde dahingeschlichen ist, eine Beute der Elemente, ein Opfer aller Krankheiten, auf das sich nach wenigen Jahrzehnten das Alter mit all seinen Leiden und Gebrechen herabsenkt — mit m e i n e r Erfindung wird es verschwinden. Das Menschenleben wird nicht mehr nach Jahrzehnten — es wird nach Jahrhunderten zählen!«
Ein ungläubiges Lächeln ging über das Antlitz Mr. Bluffs.
Der Erfinder sah es. »Sie halten mich für einen Narren, Herr Direktor. Aber — wenn ich Ihnen doch eine Vorstellung zu geben vermöchte von dem Hochgefühle, das mir das Argentoferrin verleiht! Gefeit zu sein gegen alle Unbill und Gewalt! Mit metallisiertem Leibe den Stürmen des Lebens trotzen zu können — weit über menschliche Zeiträume hinaus! Trotzen zu können im Vollbesitze körperlicher und geistiger Energie — meinen Sie nicht, daß dies Bewußtsein mich über meine Zeitgenossen hinwegträgt, wie einen Gott? Die Fortschritte der Naturwissenschaften haben uns zu Herren des Raumes gemacht; mein Argentoferrin wird uns erhaben machen über die Zeit! Die Jahrhunderte werden zu unsern Füßen liegen; das menschliche Schaffen wird sich in grandioser Weise ausbreiten, wenn das Leben des Forschers und Künstlers Jahrhunderte zu umspannen vermag! Die Titanen der alten Mythe, die den Olympos stürmten und sich mit den Göttern maßen — mit meinem Argentoferrin werden sie geboren!«
Der Erfinder hatte sich erhoben. Ein inneres Feuer glühte wie verhaltene Lohe in seinen Augen. Seine Stimme klang dröhnend, wie aus eisernem Munde. Dem Direktor wurde unheimlich. Dieser Narr war ein zehnmal größerer als alle andern, die etwas erfunden zu haben glaubten.
Plötzlich stellte sich Mr. Infrangible gerade vor ihn hin und sagte:
»Sie glauben mir nicht, Herr Direktor? Nun — eine Probe! Sehen Sie mich an, Herr Direktor! Für wie alt halten Sie mich?«
Der Direktor blickte ihn an und sagte aufs Geratewohl:
»Anfangs der Vierzig!«
Mr. Infrangible sah einen Moment dem Direktor starr ins Gesicht. Seine Züge erschienen jetzt wie aus Erz gegossen, so ernst und ehern. Dann sagte er, und jedes seiner Worte fiel wie Blei von seinen Lippen:
»Ich bin mehr als zweimal so alt!«
Direktor Bluff sprang voller Verwunderung auf, setzte sich aber schnell wieder und sagte spöttisch:
»Es steht mir hoffentlich frei, das nicht zu glauben, Mister Infrangible?«
»Gewiß, Herr Direktor! Ich könnte Ihnen ja meinen Taufschein vorlegen oder irgendwelche Urkunde aus meinem Leben; aber auch jene schriftliche Beweise müßten Sie auf Treu und Glauben hinnehmen — wie mein Wort. Ich überlasse es also Ihnen vorläufig, mir zu glauben oder nicht — bis die Einführung meiner Erfindung nachträglich für mich die Beweise liefert.«
Der Direktor schwieg ein Weilchen und sagte dann:
»Wenn Sie sich doch selbst schon soweit metallisiert hätten, Mister Infrangible, daß ich Sie als Versuchsobjekt den Geschäftsteilhabern der U.S.P.C.L. vorstellen könnte! Das würde die beste und wirksamste Empfehlung für Sie und Ihre wunderbare Erfindung sein! Schade, wie gesagt, daß Sie noch nicht so weit sind.«
»Aber — Sie haben doch an diesem Versuchsobjekt« — er deutete auf den auf dem Schreibtische sitzenden Frosch — »einen einwandfreien Beweis für meine Behauptung, Mister Bluff!«
»Ein Frosch ist ein Frosch — und ein Mensch ist ein Mensch, Mister Infrangible!«, erwiderte der Direktor.
»Aber ich sagte Ihnen doch, daß meine Mittel mir leider nicht länger erlauben, das Experiment am eigenen Leibe zur vollkommenen Ausführung zu bringen! Denken Sie, ich würde meine Erfindung vor der Zeit verkaufen, wenn mich nicht die Not zwänge, Kapital aus ihr zu schlagen? Würde ich sonst vor Ihnen stehen!«
Direktor Themistokles Bluff zuckte die Achseln. »Ja — wie gesagt, ich kann da nicht viel machen. Versuchen Sie auf irgendeine Weise Ihre Metallisation bis zur Vollkommenheit durchzuführen — und kommen Sie dann wieder.«
In diesem Augenblick ertönte von einer Ecke des Zimmers her in Absätzen ein Klappern, wie das eines MorseTelegraphen.
»Außerdem ruft mich soeben, wie Sie hören, ein drahtloses Telegramm der MarconiGesellschaft an den Apparat dort«, fuhr der Direktor fort und wollte vom Schreibtisch aufstehen, blieb aber wie gebannt sitzen, als er noch einen Blick auf den seltsamen Fremden geworfen.
Mr. Infrangible schien plötzlich alle seine Haltung verloren zu haben: er schlotterte in den Knien, sein Körper flog krampfhaft hin und her, und seine Mienen zuckten in schauderhaften Verzerrungen. Seine Hände zitterten und, wie es dem Direktor schien, in demselben Rhythmus, in welchem der telegraphische Apparat arbeitete.
Auch das Versuchsobjekt, der metallisierte Frosch, wand sich in Konvulsionen auf der Tischplatte!
»Was haben Sie, Mann?«, rief der Direktor bestürzt aus.
Aber Mr. Infrangible deutete nur wie ein Gelähmter auf den Apparat in der Ecke; seine zitternden, verzerrten Lippen vermochten kein Wort hervorzubringen...
Endlich schwieg der MarconiEmpfänger. Und nun gewann auch Mr. Infrangible allmählich seine Ruhe und Fassung wieder.
»Wa—as — was war das?«, fragte er, und noch immer bebte der Schrecken in seiner Stimme.
»Die elektrischen Wellen der riesigen MarconiStation in GlaceBay, die ihren Abonnenten die neuesten Telegramme direkt in die Wohnungen übermittelt, Mister Infrangible!«
»Aber — woher diese entsetzlichen Zuckungen, diese furchtbaren Erschütterungen, diese namenlos schmerzhaften Vibrationen in meinem ganzen Körper? Sie selbst, Mister Bluff, haben doch nichts davon empfunden?«
»Nein, Mister Infrangible — und das bringt Ihre ganze Sache für mich schnell zur Entscheidung! So vorteilhaft Ihre Erfindung für den heutigen Verkehr mit seinen vielen Gefahren sein mag — so unpraktisch, ja, geradezu gefährlich ist sie für das Spiel der elektrischen Wellen. Ihr ganzer Körper mit all seinen Metallablagerungen in den Zellen ist weiter nichts als ein einziger, großer, hochempfindlicher Kohärer — so heißt bekanntlich der Empfangsapparat für die elektrischen Wellen nach Hertz und Marconi, die bei der drahtlosen Telegraphie verwendet werden! — der mit der Exaktheit eines elektrischen Apparates auf jene drahtlose Depesche reagiert hat. Und da die Anwendung der MarconiTelegraphie sich von Jahr zu Jahr mehr ausbreitet, so ist damit die Unverwendbarkeit Ihrer Erfindung von vornherein dokumentiert! Ich erinnere Sie an Ihr Gleichnis von der ›eisernen Legion‹, die Sie vorhin so beredt schilderten — als unverwundbar, unbesiegbar, gewissermaßen unsterblich! Nun — eine einzige starke elektrische Wellenentladung, wie wir sie heute auf den Stationen für drahtlose Telegraphie bequem erzeugen können, und Ihre ganze glänzende Schar würde sich in einen wüsten Haufen zuckender, sich in Konvulsionen windender Menschenleiber verwandeln! Da, sehen Sie«, fuhr der Direktor fort, auf den Frosch deutend, »ihm hat die MarconiDepesche kurzerhand den Garaus gemacht.«
Mit einem Aufschrei beugt sich der Erfinder über sein Präparat.
»Er ist tot — ist dahin!«, schluchzt er auf — »die Arbeit ganzer Jahrzehnte verloren — alles verloren!«
Immer wieder streicht seine zitternde Hand über den starren Körper des Tierchens; immer wieder hält er ihn ans Ohr, immer wieder haucht er ihn an: — der Frosch ist tot!
Da reckt sich der getäuschte Erfinder plötzlich hoch auf und ruft: »Sie werden mir Schadenersatz für die Zerstörung meiner Erfindung leisten, Mr. Bluff!«
»Ich denke gar nicht daran, Mister Infrangible. Wenden Sie sich doch an die MarconiGesellschaft! Was kann ich dafür, wenn Ihr Versuchsobjekt das Auftreffen der elektrischen Wellen nicht aushält?«
Da bricht die Wut der Enttäuschung in dem Erfinder aus. Mit einem Satze springt er auf den Direktor zu.
Direktor Bluff reißt den Revolver vom Schreibtische und feuert auf seinen Angreifer. Die Kugel trifft die Schulter des Gegners; aber wie von einem undurchdringlichen Panzer prallt sie an dem metallisierten Körper ab und fährt seitwärts in die Wand. — Ein zweiter, ein dritter Schuß ging fehl.
Und schon sah sich der Direktor verloren in den herkulischen Fäusten des Metallmenschen.
Da brach aus der Wand, in die vorhin die Kugel gefahren, plötzlich ein gewaltigflammender Blitzstrahl!
Die abprallende Kugel hatte die Isolation der Wechselstromleitung des Zimmers zerstört und Kurzschluß herbeigeführt. Knatternd und zischend bildeten sich die Flammenbogen der gewaltigen Entladung.
Und da sprang der züngelnde Funke auf Mr. Infrangible über!
Wie ein aus Flammen Geborener erschien er auf einmal den entsetzten Blicken des Direktors. Über seinem Haupte schwebte eine Aureole von bläulichweißen, zuckenden Blitzen! Immer heftiger, immer furchtbarer wurden die knatternden elektrischen Entladungen; ein kontinuierlicher Funkenstrom bildete sich zwischen der Wand und Mr. Infrangibles Körper: die ganze Gestalt schien sich im Feuer aufzulösen; Funken brachen aus allen Teilen seines Körpers hervor! Und nun noch ein gewaltiger Blitz, der den unglücklichen Erfinder in ein flammendes Lichtmeer hüllte — ein entsetzlicher Schlag, der den vor Schreck gelähmten Direktor betäubt zu Boden warf.
Von Mr. Infrangible, dem metallisierten Menschen, war keine Spur mehr zu entdecken.
Seit zehn Tagen ungefähr grub man schon in Pompeji an der freigelegten Stelle dicht an der Porta Ercolanese, ein wenig westlich von der sog. Villa des Diomed.
Den größten Teil des eigentlichen Landhauses hatten die Arbeiter bereits von der ungefähr sechs Meter hohen Aschenschicht befreit, und da man immer in horizontalen Schichten abtrug, so gewann man schnell einen Einblick in den Grundriß des ganzen Baues, der sich von dem der benachbarten Villen nur wenig unterschied.
Dr. Enrico Tommasi, der die Arbeiten an Ort und Stelle überwachte, hatte bei ihrem Beginn die leise Hoffnung gehegt, bei der Aufdeckung der neuen Villa vielleicht ebenso vom Glück begünstigt zu werden, wie man es vor mehr als hundert Jahren bei der Ausgrabung jener Villa des Diomed gewesen, wo man in den geräumigen Kellern des Hauses mehr als zwanzig Skelette und allerlei Geräte und Kostbarkeiten gefunden hatte.
So hatte sich sein besonderes Augenmerk naturgemäß auf den Inhalt der Keller gerichtet, und je näher die Arbeiter ihnen kamen, um so mehr suchte er sie in ihrer Behutsamkeit und Sorgfalt bei der Beseitigung der Lapillischichten anzuspornen.
Leider schien alle angewandte Mühe vergebens. Man fand in den Räumen des Hauses und Kellers wohl allerlei Geräte des täglichen Gebrauchs, aber doch nichts, was nicht schon in ähnlicher Form im Museo Nazionale in Neapel aufgespeichert war.
Man konnte wirklich glauben, mit der Arbeit des heutigen Tages alle Räume der zierlichen Villa freigelegt zu haben, und auf das Geheiß Dr. Tommasis stellten die Arbeiter die Spaten zusammen.
Der Archäolog war enttäuscht, um so mehr, als er für den letzten Teil seiner Grabung den Besuch eines alten Studienfreundes, eines Deutschen, erhalten, des Ingenieurs Lang, mit dem er gemeinsam einige Semester in Berlin studiert hatte. In der ersten Entdeckerfreude, an jenem Tage, da er beim Untersuchen der Lapillischichen auf die »Villa« stieß, da er seinem Freunde hoffnungsfroh von diesem Funde berichtete und die Erwartung aussprach, die Wissenschaft mit neuen Zeugnissen der versunkenen Jahrtausende zu bereichern, hatte er ihn eingeladen — der Ingenieur war gerade vertretungsweise beim Bau des Simplontunnels beschäftigt und hatte ihm längst einen Besuch zugedacht —, nach Beendigung seiner Arbeiten einen Abstecher nach Pompeji zu machen und Zeuge seiner Entdeckungen zu werden.
Und nun standen die beiden Studienfreunde — die Arbeiter hatten heute schon früher Feierabend gemacht — allein in den ausgegrabenen Räumen und sprachen über die Ergebnislosigkeit der Grabung. Ingenieur Lang gab die Hoffnung auf einen besondern Fund noch nicht auf.
»Aber, wo sollen wir noch etwas finden, amico?«, fragte Tommasi ungläubig. »Die Räume der Villa liegen offen zutage, die Keller sind geöffnet...«
Der junge Ingenieur antwortete zunächst nicht, sondern begann, indem er dem Freunde durch ein Zeichen bedeutete, stehenzubleiben, nochmals eine Wanderung durch die Räume der römischen Villa. Er durchschritt das kleine Vestibulum, das mit einem Gemälde, welches den Tanz der Grazien darstellte, geschmückt war, das dahinter gelegene Atrium und das sich daranreihende Peristylium, immer dabei mit einem im Vorbeigehen ergriffenen Spaten auf den Boden stampfend.
An einer Stelle des Peristyliums blieb er plötzlich stehen, sein Spatenmanöver mehrmals wiederholend.
»Hör' einmal, Enrico!« Und wieder stieß der Spaten gegen die Marmorfliesen.
Der Archäolog war mit zwei Sprüngen an seiner Seite.
»Wann hast du diese Stelle entdeckt, Ricardo?«, fragte er überrascht.
»Vorhin, als die Arbeiter die Spaten zusammentrugen. Der kleine Filippo, dem die Buddelei gewiß sehr langweilig vorkommen mag, machte sich zur Erheiterung das Extravergnügen, mit jedem Spaten, den er trug, einmal hier und einmal da auf den Boden zu stampfen, und da hörte ich den seltsamen Klang, obwohl ich gerade im Gespräch mit dir war. Bedenke, daß ich mein Ohr seit Monaten jetzt im Simplontunnel auf derartige Perkussions- und Auskultationsgeräusche trainiert habe!«
»Aber die Keller liegen doch gerade an der entgegengesetzten Seite des Landhauses!«, sagte Tommasi, noch immer zweifelnd.
Der Ingenieur antwortete nicht weiter, sondern warf seinen Rock ab und begann zu graben.
Im nächsten Moment tat Dr. Tommasi das gleiche. Und nun arbeiteten beide Freunde im Schweiße ihres Angesichts. indes die Sonne sich schon zum Untergang senkte. Ihre roten Strahlen übergossen die Trümmer versunkener Jahrtausende mit einem Schein warmflutenden Lebens.
Die Arbeit der beiden Freunde wurde belohnt: man stieß auf eine zweite, kleinere Kelleranlage, die sich bis in den gewachsenen Felsboden unterhalb des eigentlichen Fundaments fortzusetzen schien.
»Das sieht ja beinahe aus wie ein Kerker«, sagte der Ingenieur.
»Was sollte in der so freundlich angelegten Villa ein solcher?«, fragte Dr. Tommasi dagegen. »Eher glaube ich, daß es ein Versteck für die Schätze und Kostbarkeiten des gewiß sehr vermögenden Villenbesitzers gewesen ist, von dem nur er im Hause Kenntnis hatte.«
Er setzte den Spaten wieder an, zog ihn aber im nächsten Augenblick wieder zurück und hielt auch die Hand des Freundes fest.
»Sieh doch!«, flüsterte er erregt.
Und mit seinem Spaten beschrieb er in der Aschenschicht der aufgedeckten Kellerhöhlung eine seltsam umgrenzte Form, die eben zutage trat.
»Was bedeutet das?«, fragte der Ingenieur.
»So zeichnet sich ein von Lapilliasche eingehüllter menschlicher Körper ab«, antwortete Dr. Tommasi.
»Was wollen wir tun?«
»Nicht weitergraben, sondern nach vorsichtiger Feststellung der Umrisse gleich morgen früh die Vorkehrungen zu einem Gipsausguß treffen. Es ist anzunehmen, daß, wie bei allen derartigen Funden, sich die Form des einstigen Körpers getreulich in der erhärteten Schlammumhüllung erhalten hat. Das Fleisch verwandelt sich im Laufe der Jahrtausende zu Asche, aber die hohle Form, die es einst ausfüllte, bleibt unverändert in dem steinhart gewordenen, einst plastisch schmiegsamen Aschenteige bewahrt und erlaubt in besonders glücklichen Fällen Gipsabgüsse von jener Vollkommenheit, wie sie dich kürzlich im Museum von Neapel zu hellem Entzücken begeisterten.«
»Dann also auf morgen, Enrico.« —
»Auf morgen, amico — und wünsche mir Glück dazu!«
Am nächsten Morgen in aller Frühe hatte Dr. Tommasi bereits alles zum Gusse vorbereitet. Einige besonders in diesen heiklen Manipulationen geübte Leute hatten die in der Werkstatt der Natur im Laufe der Zeiten selbst entstandene Gußform hergerichtet, vorsichtig eine Eingießöffnung in der Lapillimasse angebracht und ebenso hier und da Öffnungen für die entweichende Luft, um ein ungehindertes Einließen der Gußmasse zu ermöglichen. Alles hing von der äußersten Sorgfalt dieser Vorarbeiten ab, denn ein Experiment wie das bevorstehende ließ sich nur ein einziges Mal machen.
Auf ein Zeichen des Archäologen begann der Guß, und langsam floß der weiße, flüssige Gipsbrei hinunter in die schwarze Aschenmasse.
Die Gießer hatten die Menge des einfließenden Gipses nach der ungefähr dem Aschenriß entsprechenden Größe des verborgenen Körpers bestimmt.
Seltsamerweise schien dabei ein Irrtum vorgekommen zu sein — die Form wollte sich nicht füllen, und es war ein Glück, daß Dr. Tommasi, einer unbewußten Eingebung folgend, ein bedeutend größeres Gießquantum hatte gußfertig machen lassen. Schier unersättlich schien der dunkle Schlund da unten in der Erde.
Endlich aber schloß sich die geheimnisvolle Höhlung in der Asche doch; der weiße Gipsbrei füllte mit einem Male die Gießöffnung an und floß über.
Nach einigen Stunden begann Dr. Tommasi mit der vorsichtigen, stückweisen Entfernung der verhärteten Lapillimassen, welche die Form gebildet hatten.
Und das Werk war gelungen — herrlicher, als es der junge Archäolog je zu hoffen gewagt. Tief ergriffen stand er mit seinem Freunde und den plötzlich still gewordenen Arbeitern vor der schneeweiß schimmernden Gestalt, die da aus dem Aschengrabe auferstanden war zum leuchtenden Sonnenlichte!
Eine Mädchengestalt in der Blüte ihres Lebens! Ein weiblicher Körper von der Formenschönheit antiker Statuen! Wunderbar das klassische Profil, der schöngebogene Hals, die vom warmen Leben scheinbar sich hebende schimmernde Brust!
Wahrlich. jener Kynthia glich die Auferstandene, von der Properz gesungen:
»Solche Menschengestalt — warum verweilt sie auf Erden?
Hier zu rauben, o Zeus, würde verzeihlicher sein. —
So sah, an dem böbeischen See, von Liebe berauschet,
Deinen jungfräulichen Leib, göttliche Brimo, Merkur!
Weicht, ihr Göttinnen alle, die ihr dem phrygischen Hirten
Auf dem Ida euch einst schleierenthüllet gezeigt!«
Und wie wunderbar ergreifend stimmte der Schluß jener zweiten Elegie des zweiten Buches auf den so köstlich im Schoße der Mutter Erde erhaltenen Fund:
»Nichts soll diese Gestalt, nichts diese Schöne verzehren,
Würd' an Jahren sie dir, kumische Priesterin, gleich!«
Die Haltung war die einer Knienden; aber nichts von den Qualen und Schrecken des Todes war in ihren Zügen zu entdecken. Die eine Hand stützte die weiße Stirn, indes die andere auf der schmalen, viereckigen Öffnung einer schweren, eisernen Türe lag, die jetzt erst sichtbar wurde. Eine zierliche Lampe aus Bronze, deren Henkel ein geflügelter Amor bildete, lag neben ihr.
Lange standen die Männer vor dem ergreifenden Bilde.
Da sagte plötzlich der Ingenieur:
»Aber diese eiserne Pforte, durch welche die Ärmste sich flüchten wollte, kann doch unmöglich ins Freie geführt haben, sie liegt ja tiefer als die Fundamente des Hauses?«
Und schon war er nahe an die dick mit dem Rost der Jahrtausende bedeckte kleine Tür herangetreten und untersuchte sie eifrig.
Plötzlich richtete er sich auf.
»Enrico, wir sind noch nicht am Ende unserer Entdeckung; bereite dich vor, eine neue, ebenso überraschende zu machen!«
Damit wies er auf die schmale Öffnung in der eisernen Tür. Und nun entdeckte Dr. Tommasi, was der Freund meinte. Die andere Hand der Knienden faßte durch diese Öffnung hindurch — in einen zweiten Raum, der sich weit hinein in den Erdboden zu erstrecken schien.
Und als er vorsichtig noch einige verhüllende Aschenanhäufungen entfernt hatte, sah er in stummer Überraschung — eine dritte Hand, welche von innen die des Mädchens umklammert hielt.
Eine z w e i t e Gestalt war in dem neuen Versteck verborgen! Der die Aschenform ausfüllende Gipsbrei hatte also nicht eine, sondern zwei gebildet. Damit war auch der sonderbare Mehrverbrauch an Gießmasse und die längere Dauer des Gusses erklärt. Die durch die Öffnung in der Erztür fassende Hand wurde die Eingußstelle für die zweite noch in der Erde verborgene Gestalt.
Und nun arbeitete man mit fieberhaftem Eifer an ihrer Freilegung, die wegen der Lage des Objekts auf ganz besondere Schwierigkeiten stieß. Endlich gelang es, von außen an das Verlies im Innern der Erde heranzukommen.
Als die Sonne sank, war auch die zweite Gestalt von der verhüllenden Aschenkruste befreit. Wie ein weißes Marmorbild kam sie aus der umgebenden steinharten, schwärzlichen Lapillischicht hervor.
Ein junger Mann in fast liegender Stellung, den Kopf wie lauschend zu der kleinen Öffnung in der eisernen Tür emporhebend, mit der Rechten die Hand der Geliebten erfassend!
Ein Paar junger, blühender Menschen, hier vor Jahrtausenden vom jähen Tode überrascht! Ein antikes Liebespaar! Geheimnisvoll im Schoße der Erde erhalten in all der Schönheit und Jugendpracht ihrer Glieder, in all ihrer Hingebung und Liebe, die auch ihr gemeinsamer Tod nicht zu zerstören vermochte.
Lange standen die beiden Freunde vor dem Doppelbildnis, das gleich einem Kunstwerk aus Alabaster im letzten Strahl der Abendsonne leuchtete, von ihrem roten Schein mit einem verklärenden Schimmer rosigen Lebens überflutet!
»Ist es nicht«, sagte Enrico leise, »als wenn sie lebten? Als wenn sie sich erheben müßten, befreit von aller Todesnot und Qual, mit frohem Auge die schöne Erde zu grüßen?«
Der Freund nickte. Dann sagte er. »Ich grüble noch immer über die Situation, in der das Verhängnis sie uns überliefert hat. Offenbar hat sie doch jene schwere Eisentür voneinander getrennt?«
»Ja«, erwiderte Dr. Tommasi, und sein dunkles Auge richtete sich wie in visionärem Schauen in eine versunkene Welt, »es war ein Kerker, in dem der Jüngling schmachtete. Sie aber, die Liebliche, fand in jenen entsetzlichen Stunden des Untergangs, am 24. August des Jahres 79 n. Chr., da alle Bande der Menschlichkeit zerrissen waren, da ein jeder nur an sich und die eigne Rettung dachte, da grauenvolle Nacht wie eine bleierne Last sich herniedersenkte auf das lebensfrohe Pompeji, da der Tod mit giftigem Anhauch auf Schritt und Tritt seine ungezählten Opfer forderte; sie fand den Weg hierher in das einsame Landhaus, geführt vom Lichte nimmer erlöschender Liebe. Und sie fand ihn — im Kerker! Und die Hand der Geliebten, die so oft gewiß dem Jüngling die Sorgen des Tages von der Stirn gescheucht, sie war zu schwach, den schweren Erzriegel zu bewegen. Und so hat der Tod sie überrascht.«
Dr. Tommasi schwieg. Der Ingenieur trat noch einmal in die gewölbte Felsenkammer, die das Gefängnis gewesen war. Sein scharfes Auge hatte an der glatten Kalkwand sonderbare Ablagerungen entdeckt, wellen- und streifenförmige Bildungen.
Unvermittelt sagte er nun. »Erlaubst du mir, diese sonderbaren Oberflächengebilde wissenschaftlich einmal genauer zu untersuchen, Enrico? Ich müßte aber dann mit allem physikalischchemischen Rüstzeug hier hausen dürfen, und ich weiß auch nicht, wie lange meine Untersuchungen dauern...«
»Morgen früh lasse ich diesen Abguß in das Museo Nazionale schaffen, amico. Ich will ihn in der nächsten Sitzung des Internationalen Archäologischen Kongresses, der in einigen Wochen in Neapel tagt, den Gästen vorstellen. Von morgen früh an darfst du hier deine chemischen Experimente machen, und ich will dir gern ein paar meiner anstelligsten Leute als Gehilfen geben.«
»Eben wollt' ich darum bitten, Enrico — ein paar, die im Abformen und Gießen erfahren sind.«
»Den Luigi und den Gabriele sende ich dir. Und nun komm! Heute abend trinken wir Asti spumante!«
Einige Wochen später.
Im Sitzungssaale des Nationalmuseums zu Neapel drängte sich heute eine illustre Gesellschaft. Aus Italien nicht nur, auch aus Deutschland und Frankreich und England waren die Archäologen von Ruf herbeigeeilt, um, der Einladung Dr. Tommasis folgend, den neuen Fund aus der »Villa dell' Allianza« — so hatte der glückliche Entdecker sie im Hinblick auf das im Tode verbundene Liebespaar sowohl als auch zu Ehren seiner Freundschaft mit dem Ingenieur getauft, der ja einen Anteil an seiner Entdeckung hatte — in Augenschein zu nehmen.
Noch war der kostbare Fund, der auf einem schwarzen Postament neben dem Podium des Redners stand, dicht verhüllt. Dr. Tommasi schritt im Gespräch mit einem seiner auswärtigen Fachgenossen, dem weißhaarigen amerikanischen Altertumsforscher Mr. Navy, auf und ab, der einen zufälligen Aufenthalt in London zu einem Abstecher benutzt hatte.
Da stand plötzlich sein Studienfreund Lang vor ihm.
»Oh«, rief Dr. Tommasi, seine Unterredung unterbrechend, mit froher Überraschung aus, »das ist schön, amico! Schon glaubte ich, deine eifrigen physikalischen Studien hätten dich den heutigen Termin vergessen lassen. Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Wie weit bist du übrigens mit deiner Untersuchung über die Bildung der vulkanischen Ablagerungen?«
»Ich habe sie zum Abschluß gebracht, Enrico, und deshalb komme ich hierher. Ich wollte dich fragen, ob du als Redner des Tages mir wohl gestattest, durch das Resultat meiner Untersuchungen einen Beitrag zu liefern, gewissermaßen das Korreferat zu deinen Ausführungen, die physikalischen Fundamente deiner Entdeckung.«
»Aber, bedarf das noch der Frage, Ricardo? Wie schön wird sich dein Thema an das meine anschließen!«
»Ich habe zur Demonstration meiner und deiner Untersuchungen Abgüsse der Fundstätte herstellen lassen. Du erlaubst«, — er öffnete eine Seitentür des Saales — »daß die Beweisobjekte hier aufgestellt werden?«
Dr. Tommasi winkte den Trägern, und sie setzten einen ziemlich umfangreichen, kastenartigen Behälter auf einen Seitentisch in der Nähe des Rednerpultes.
Dr. Enrico Tommasi begann seinen Vortrag.
Er gab zunächst eine Schilderung seiner Arbeiten an der Porta Ercolanese. Mit der ihm eignen Anschaulichkeit hob er die einzelnen Phasen seiner Entdeckung hervor. Dabei nahm er Gelegenheit, den Anteil seines Studienfreundes zu betonen und der Versammlung die Untersuchungen des Ingenieurs als Erweiterung seines eignen Vortrags anzukündigen.
Und nun begann er intuitiv mit dichterischem Schwung die Vorgänge an jenem Augusttage in Pompeji zu erzählen: die Schrecken des plötzlichen Vesuvausbruchs, die Verwirrung und Zerstörung in den Straßen der griechisch- römischen Stadt, das Zusammenstürzen menschlicher Behausungen, das Zertrümmern der antiken Tempel und Statuen, die Verzweiflung der umherirrenden Bevölkerung, die, niedergedrückt von dem Gifthauch aus den Schlünden des Tartarus, zu Tausenden durch das nächtliche Dunkel keuchte, alle Gesetze der Ordnung, alle Bande der Familie durchbrechend.
Und auf diesem düstern Hintergrunde, dessen Mittelpunkt der grauenhaft wie ein höllisches Fanal lodernde Mons Vesuvius bildete, zeichnete der Redner die lichte, still und treu dahinschreitende Gestalt des einsamen Mädchens, das in all dem entsetzlichen Wirrwarr nur ein Ziel kennt: die Vereinigung mit dem Geliebten! Und da sie ihn entdeckt in dem tiefsten Verlies des abgelegenen Landhauses, da vermag die zarte Hand den Kerker nicht zu öffnen. Und so ereilt sie beide der Tod.
Auf ein Zeichen Dr. Tommasis fiel die Hülle.
Einige Augenblicke lang herrschte tiefe, feierliche Stille. Wie eine Offenbarung wirkte das ergreifende Doppelbild.
Dann aber brach ein Sturm des Beifalls und der Bewunderung aus, wie ihn der hohe Sitzungssaal mit seiner ernsten Architektonik kaum je vernommen hatte. Die Begeistertsten verließen ihre Plätze und drängten sich in die Nähe der Statuen.
Nachdem wieder ein wenig Ruhe eingetreten war, fuhr der Redner fort: »Wer aber vermöchte das Rätsel der beiden jungen Menschenkinder völlig zu lösen? Wer bannte den Jüngling in das geheime unterirdische Gewölbe da draußen in der einsamen Villa? Denn ein Kerker war es für ihn, das beweist die mit schweren Riegeln verwahrte Erztür, das beweist der Wasserkrug, dessen Scherben am Boden lagen. War es ein Übeltäter, den man hier vorläufig in Gewahrsam hielt? Waren es politische Motive, die sein Verschwinden bewirkten? Oder war er das Opfer privater Rache? Wer doch den Mund der Jahrtausende zum Reden bringen könnte!«
Der Sprecher unterbrach sich plötzlich.
Ein rätselhafter Laut kam irgendwo aus der Tiefe des Raumes! Ein Klagelaut!
Und abermals der erschütternde Klang wie von zögernd sich öffnenden, schmerzlich zuckenden Menschenlippen.
Geschah ein neues Wunder? Belebten sich die beiden weißen Gestalten und gewannen die Sprache wieder?
Und jetzt klang es ganz deutlich, wie aus weiter Ferne, abermals: »Dione, Dione!«
Wie gebannt starrte alles auf die beiden Gestalten. War es nicht, als ob das starre Weiß ihres Leibes sich leise rötete? Hob sich nicht die hüllenlose Brust der Dione in tiefem Atemzuge?
Und wieder kamen die Klänge durch den weiten Raum. »Dione? Du? Wie hast du mich gefunden?«, sprach's in altem klassischen Latein.
Wie war das möglich?
Alle, am meisten Dr. Tommasi, blickten in namenlosem Schrecken und Staunen auf die beiden Figuren.
Und von neuem ertönten Stimmen, nun im Wechselgespräch: »Mein Geliebter! Den Göttern Dank, daß ich dich gefunden!«
»Wie fandest du den Weg zu mir, süße Dione?«
»Venus führte mich, Geliebter. Oh, wie finster und schaurig war mein Weg durch die Straßen, mein Lucilius! Denn das Ende der Welt scheint gekommen, die Erde speit Feuerströme aus, der finstere Orkus hat seine Pforten gesprengt.«
»Ich fühle, daß die Erde erzittert in unheimlichem Rollen, meine Dione. Giftige Dünste dringen herab bis zu mir und dörren mir die Eingeweide.«
»Der Mons Vesuvius schleudert Feuer und Steine in die Luft, und dicker Aschenregen fällt vom Himmel hernieder. Der Tod lauert auf den Straßen unserer Stadt. Und ich suchte dich! Seit drei Tagen hattest du mir keine Botschaft gesandt, Geliebter. Zum Altar der Venus eilte ich heute früh. Und sie erhörte das Flehen deiner Dione. Sie lenkte meinen zagen Schritt hierher in das Landhaus deines Vaters. Hundertmal drohte mir das Lämpchen zu erlöschen, das du mir jüngst geschenkt. Endlich fand ich das Herkulaneische Tor und den schmalen Pfad zu deinem Landhause. Ach, überall suchte ich dich, Geliebter! Überall rief die arme Dione deinen lieben Namen. ›Lucilius!‹, klang's mir von den leeren Wänden droben überall entgegen, aber mein Lucilius kam nicht! Warum verbargest du dich tief unter der Erde?«
»Nicht ich habe mich verborgen, süße Dione; mein Vater hat mich hier eingekerkert, deinetwegen!«
»Dein Vater, meinetwegen?«
»Weil ich nicht von dir lassen wollte, angebetete Dione! Er aber hat mir die Tochter des Prokonsuls, die feile Mamilia, zur Gattin bestimmt. Du weißt, daß er durch den Prokonsul seine ehrgeizigen Ziele in Rom zu erreichen hofft, und ich soll das Opfer seiner Pläne werden.«
»Mein armer, teurer Lucilius! Um deiner kleinen Dione willen! Aber wo ist dein Vater? Hat er dich vergessen in dieser schrecklichen Stunde?«
»Er hat nur an sich gedacht und seine Reichtümer. Wenn er d i e nur retten kann! Aber er hat uns beide doch nicht zu trennen vermocht, denn du bist bei mir, Dione!«
»Ach, wenn ich doch diese schwere Tür zu öffnen vermöchte, Geliebter.«
»Dazu ist deine weiße Hand zu schwach, Geliebte! Klage nicht: wir sind ja beieinander, ich darf deine Hand fassen, süßeste Dione.«
»Wird dir das Atmen auch so schwer, mein Lucilius? Wie schwül und dunstig ist auf einmal die Luft! Mein Lämpchen — kaum glimmt die kleine rote Flamme noch...«
»Geh, süßes Mädchen! Rette dich! Eile von hier! Merkst du nicht, wie die Festen dieses Hauses erzittern? Flieh und überlaß mich meinem Geschick.«
»Dione — fliehen? Nein, mein Geliebter! Habe ich nicht dir gelobt, die Deine zu sein? Denkst du noch jener ersten Stunde, da Dione dein wurde? Ein Tag, düster und trüb, fast wie der heutige! Jupiter zürnte und ballte schwarze Wolken am Himmel und schleuderte den zuckenden Blitz. Mit den Freundinnen war ich zum fröhlichen Feste der Ernte in den Hain der Ceres gegangen. Da überfiel uns das Unwetter. Jeder flüchtete, jeder dachte nur an sich, allein stand Dione am Strande der kleinen Bucht. Da erschienst du! Auch dich hatten die ländlichen Freuden hinausgelockt zu Spiel und Tanz. ›Komm, liebes Mädchen‹, sagtest du zu mir, ›dahinten naht noch ein letzter Nachen, der soll uns beide tragen.‹«
»Aber meine liebliche Dione fürchtete sich, denn wild schäumte die Flut und schwarz war der einsame Nachen, uralt, wie Charon, sein Fährmann, und sie sagte zu mir: ›Gib mir die Hand, denn ich fürchte mich ohne dich.‹«
»Oh, Lucilius, mein Geliebter! Dione fürchtet sich abermals ohne dich! Gib mir die Hand!«
»Dione!«
»Siehst du ihn nicht, den schwarzen Nachen von einst? Dahinten aus den düsteren Zypressen kommt er hervor — immer näher — immer näher — Schwarz fluten um ihn die Wasser — endlos! — Und schauriges Dunkel rings um mich — Deine Hand — Geliebter — Geliebter!«
»Dione! Dione! Nicht allein — nimm mich mit dir! — Dione!«
Es war still geworden in dem weiten Raum.
Der Mund der jäh erwachten Jahrtausende schweigt.
Und wieder erstarrt in ihrer bleichen Schönheit, leuchten die weißen Gestalten von dem dunkeln Postament hernieder...
Auf dem Podium aber stand der junge Ingenieur.
»Nur ein paar Worte, meine hochverehrten Anwesenden. Sie alle sind soeben Zeugen geworden eines Triumphes der Wissenschaft und ihrer Gesetze, wie er bisher wohl einzig dasteht auf dem Gebiete archäologischer Forschung. Ein Wunder hat sich vor Ihnen allen begeben, ein wahrhaftiges Wunder, das doch auf streng logischem, natürlichem Geschehen sich aufbaut. In jenem Kellergewölbe, das den Leichnam des Lucilius barg, entdeckte ich bei der Freilegung des Fundes an der glatten Kalkwand sonderbare Ablagerungen in seltsam symmetrischer Anordnung und wunderbar feiner Struktur, gewissermaßen erstarrte Wellenzüge eines vibrierenden Mediums. Durch die Untersuchungen des französischen Forschers Brun war mir bekannt, daß die von Vulkanen ausgeworfenen Dämpfe der Hauptsache nach aus Kohlensäure, Chlorwasserstoff und Ammoniak bestehen. Sie bildeten auch an dem verhängnisvollen 24. August des Jahres 79 die giftige, todbringende Atmosphäre, die, alles durchdringend, alles Lebendige erstickte. Auch jenes verborgenste Gewölbe der ›Villa dell' Allianza‹, in dem der junge Lucilius schmachtete, füllte sich mit diesem Gasgemisch, immer dichter, immer vollständiger, allmählich jedes Restchen atembarer Luft verdrängend. Aber noch vermochte Lucilius zu atmen und zu sprechen; noch klang seine Stimme und die seiner Dione durch den eng abgeschlossenen Raum, und die dadurch erzeugten Schallwellen setzten das eingeschlossene Gasgemisch in Schwingungen. Die eigentümliche geometrische Form des unterirdischen Gewölbes setzte sie um in stehende Wellen. Die hierdurch bedingte Form der Luftbewegung wirkte wahrscheinlich mehr oder minder beschleunigend auf die Bildung chemischer Umsetzungen innerhalb der Gasmenge. Die Lippmann'sche Theorie der Photographie stehender Lichtwellen liefert hierzu vielleicht ein Analogon. An den Stellen periodischer Molekularbewegung bildeten sich entsprechende chemische Veränderungen. Wo diese Wellenzüge die glatte Kalkwand berührten, da entstanden so in rhythmischer Aneinanderlagerung Niederschläge von Salmiak. So bildete sich eine auf chemischem Wege entstandene Aufzeichnung der Schallwellen auf der Kalkwand, ähnlich der auf der Wachswalze eines Phonographen. Die spätere Bedeckung des Gewölbes mit Lapilliasche hat die feinen Anätzungen der glatten Kalkwand nicht zerstört, sondern sie dem verwitternden Einfluß der Atmosphäre entzogen, so daß sie bei der Ausgrabung in aller ursprünglichen Schärfe und Feinheit wieder zutage traten. Und ich habe einfach von diesem Phonogramm von Pompeji Wachsabgüsse genommen und sie in einem zu diesem Zwecke besonders konstruierten Wiedergabeapparat zum Sprechen gebracht, mit welchem Erfolge, das haben Sie alle gehört. Und Ihr andächtiges Schweigen hat mir bewiesen, daß das Werk gelungen ist.«
Damit endete der Ingenieur. Jubelnder Beifall brach los, man umringte den Redner und seinen Freund Dr. Tommasi.
Ingenieur Lang aber wandte sich leise an den letztern: »Du verzeihst mir die Überraschung, Enrico, nicht wahr?«
Enrico drückte ihm die Hand. »Hätte die sorgsamste Vorbereitung je eine solche Wirkung zeitigen können?«, fragte er dagegen.
Lang öffnete den kastenartigen Behälter. Und alle drängten sich herzu.
Da sah man die mit äußerst feinen Liniaturen bedeckten Wachsplatten und den von einer Schlittenvorrichtung darüber hinweg geführten Wiedergabeapparat.
Das war das Zauberwerk, das die schweigende Stimme versunkener Jahrtausende wieder zum Leben geweckt hatte in einer Schönheit und Lauttreue, wie sie bisher noch kein Lebender vernommen — die rührende Todesklage des jungen Lucilius und seiner Dione.
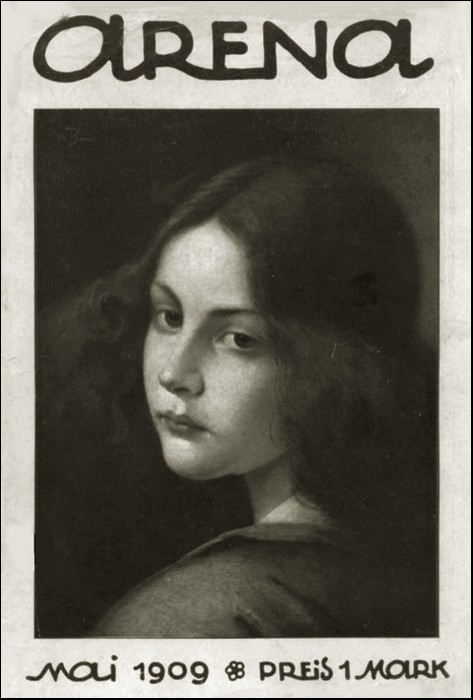
Arena, Mai 1909, mit »Das weiße Rätsel«.
Aus der letzten SonntagsNummer der »Times«: »Eine sehr sonderbare Kunde kommt aus Indien, die, wenn sie sich als wahr erweist, Grund zu allerlei abenteuerlichen Hypothesen geben muß:
Wie der Telegraph aus Dardscheeling meldet, hat Oberst Younghusband, der berühmte ›Entzauberer Tibets‹, bei seiner neuesten Expedition auf einer weiten Schneefläche südlich von Lhassa, von wo aus sich das gesamte Panorama der Himalajakette in unvergleichlicher Herrlichkeit bewundern läßt, eine rätselhafte Spur in der hartgefrorenen Schneedecke entdeckt, die sich auf verschiedenen Orten fast in mathematischer Regelmäßigkeit wiederholt: drei rätselhafte Punkte, die immer ein Dreieck bilden!
Auf der weiten, weißen, von keinem Lebewesen noch betretenen Fläche erregen die verstreuten Spuren in ihrer sonderbaren Gleichheit den Eindruck, als ob ein riesenhafter Vogel seine dreizehigen Fänge einen Moment — wie im Flug rastend — auf den Boden gesetzt habe. Dazu kommt, daß sich in der nächsten Nähe der ominösen Punkte auch fast immer ein halbverwischter Eindruck findet, als ob ein breites Etwas über den Schnee geglitten — etwa der nachschleppende Schweif des gigantischen Fliegers.
Selbstverständlich knüpft man bereits die ungeheuerlichsten Kombinationen an die rätselhafte Entdeckung. Wir haben eine Enquete bei den bekanntesten Gelehrten der einschlägigen Wissenschaften veranstaltet, aus der wir folgende Stimmen zum Abdruck bringen:
Das Ehepaar Morton, berühmt durch seine Besteigung des Nanda Dewi, wohl die besten lebenden Kenner der indischen Alpenwelt, schreibt:
›Nach unserem Dafürhalten läßt sich die rätselhafte Spur kaum auf einwandfreie, die natürlichen Ursachen berücksichtigende Art erklären. Die uns vorgelegten Zeichnungen davon haben ja allerdings eine frappante Ähnlichkeit mit einer Vogelspur von riesigen Dimensionen; aber soweit unsere Erfahrung reicht, gibt es im Himalaja keinen solchen Raubvogel, dessen Zehenspannweite die unserer größten Kondorarten um das Zehnfache mindestens übertrifft. Wenn nicht eine sonderbare Eigentümlichkeit des darunterliegenden Felsbodens die Ursache bildet, oder, wenn nicht doch menschliche Hände bei der Erzeugung des Phänomens im Spiel waren, so bleibt unseres Erachtens nur — das Luftschiff übrig. Ein solches könnte am ersten die sich regelmäßig wiederholende Spur beim Übersegeln der Schneefläche erzeugt haben, vielleicht durch sein Schleppseil oder Ankertau, das vergebens auf der dünnen, hartgefrorenen Fläche, die das kahle Felsplateau bedeckt, einen Halt gesucht hat.‹
Damit hatten die Luftschiffer das Wort. Und Kapitän M., einer der Führer vom ›Nulli Secundus‹, bemerkt dazu:
›Allerdings könnte die Spur von einem Luftschiff herrühren. Aber soviel mir bekannt, besitzt die indische Regierung keine solchen, und auch von indischen Privat-Aeronauten weiß ich nichts. Es läge also die Möglichkeit vor, daß ein »verflogenes« Luftschiff irgend einer andern Macht sich auf das tibetanische Grenzland »verirrt« hat, ein Fall, der mir eher geeignet erscheint, unsere Politiker, als unsere Aeronauten zu interessieren!‹
Wir kommen auf die Anspielung, die in den letzten Zeilen enthalten ist, am Schlusse unserer ›Enquete‹ zurück. Hier möchten wir noch Mr. Heaven, einen der Astronomen der indischen Sternwarte, zum Worte kommen lassen. Er sagt:
›Der Fall ist einer von denen, die der Phantasie unbegrenzten Spielraum lassen. Von der verehrlichen Redaktion der »Times« aufgefordert, möchte ich mich hier aber nur an die Beantwortung der beiden Fragen halten, die sie mir gestellt hat.
Sie lauten:
Erste Frage: Ist die Annahme erlaubt, daß es sich bei der Entstehung der rätselhaften drei Punkte in Triangelform um außerirdische, extramundane Einflüsse handelt?
Zweite Frage: Wenn diese Frage bejaht wird — welches sind nach Ihrer geschätzten Meinung die Möglichkeiten, durch welche die rätselhafte Spur entstanden sein kann?
Meine Antworten:
Auf Frage eins: Ja — die Annahme extramundanen Ursprungs der Zeichen ist erlaubt — mit der Einschränkung, daß die Spur auf außerirdische Art entstanden sein k a n n, aber nicht sein muß.
Auf Frage zwei: Da wir Erdbewohner nur über menschliches Wissen und Können verfügen, so vermögen wir uns nur in der begrenzten Form menschlichen Denkens vorzustellen, wie die Zeichen auf der Schneefläche entstanden sein können. Am einfachsten ließe sich die dreifache kreisrunde Spur im Schnee vielleicht durch ein parallel gerichtetes Bündel dreier Lichtstrahlen erklären, das von außen auf die betreffende Stelle unseres Planeten gerichtet wurde. Dabei mußte bei hinreichend langer Einwirkung der Strahlen auf der Schneedecke ein Schmelzen eintreten, daß durch das Tiefersickern des Schmelzwassers die scharf begrenzte Durchlöcherung der Schneedecke zur Folge hatte. Freilich vermögen wir mit unseren irdischen Mitteln bis jetzt noch nicht solche schmalen parallellaufenden Lichtbüschel auf weite Entfernungen zu erzeugen — das Licht unserer riesenhaften Scheinwerfer bleibt nie parallel — aber da gilt eben meine Anmerkung, daß wirFragenach m e n s c h l i c h e m Wissen urteilen; was uns noch unmöglich ist, braucht es jenen außerirdischen Intelligenzen nicht zu sein.‹
Das meteorologische Institut erklärt durch den Mund seines Direktors, daß große Wahrscheinlichkeit dafür bestehe, die sonderbare Schneespur auf einen Meteoritenfall auf jenen eisigen Hochplateaus Indiens zurückführen zu können. Die Vertiefungen im Schnee ließen sich so ungezwungen durch das Eindringen winziger Partikelchen kosmischer Materie erklären. Bekanntlich habe auch Nordenskjöld auf seiner ›VegaFahrt‹ solchen kosmischen Staub auf den Eis- und Gletschermassen des Polargebietes entdeckt. Die regelmäßige Anordnung der Punkte sei wahrscheinlich rein zufällig. —
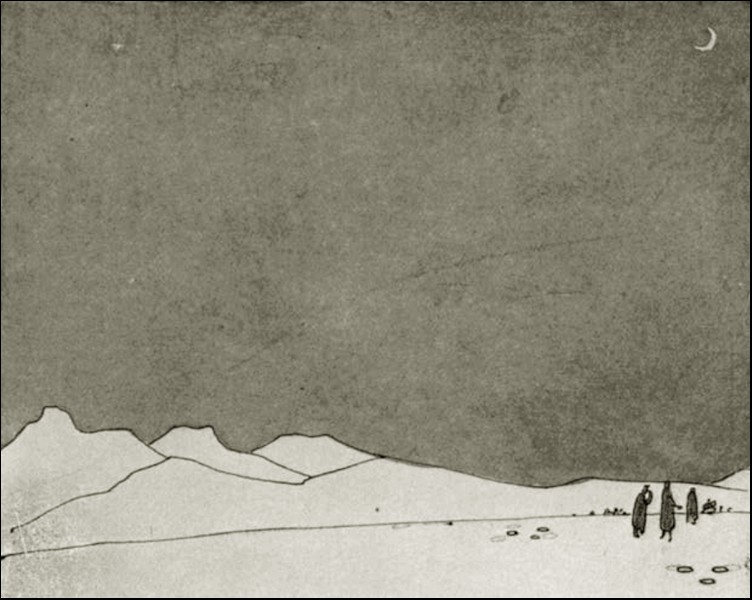
Schließlich sei hier noch Rudyard Kipling zitiert. Er schreibt:
›Man spricht so oft von einem »Lande der unbegrenzten Möglichkeiten« und meint damit Amerika; aber viel mehr verdient Indien diese Bezeichnung! Längst habe ich es aufgegeben, indische Begebenheiten mit der Logik meines Denkens erklären zu wollen. Nehmen Sie die glühendste Phantasie eines Dichters zu Hilfe und zaubern Sie sich irgend eine Ausgeburt des Wunderbaren hervor: die nackte Wirklichkeit indischer Vorgänge wird sie hundertfach übertreffen. Die Sonne Indiens schafft Märchen am lichten Tage! Wenn Sie mich fragen, ob ich es für möglich halte, daß ein Indischer oder tibetanischer »Heiliger«, ein Yogi oder Mahatma, die geheimnisvollen Zeichen in das Gletscherfeld südlich von Lhassa gezaubert hat, so sage ich: Ja! — Und wenn Sie mich dann wieder fragen, ob ich an die Existenz eines solchen Riesenvogels glaube, der die dolchspitzen Krallen seiner Fänge in das hartgefrorene Weiß der Einsamkeit da droben gegraben hat, so sage ich wieder: Ja! Und jeder Kenner Indiens wird mich verstehen.‹
Damit mag es genug sein. Es erübrigt noch, auf die oben ausgesprochene Vermutung Kapitän M.'s einen Augenblick einzugehen, nach der die Angelegenheit eventuell politischer Natur sei, d. h. daß irgend ein anderer Staat sich zu seinen Expeditionen in das noch immer umstrittene tibetanische Grenzgebiet des modernsten aller Verkehrsmittel, des lenkbaren Luftschiffs, bedient. Als politisch interessiert kämen da vor allem Rußland und China in Frage. Aber weder von dem einen noch dem anderen Lande hat man je vernommen, daß es lenkbare Luftschiffe baue. Aber diese Möglichkeit einmal zugegeben, so sprechen alle Gründe nüchterner Wirklichkeit gegen ein derartiges verstecktes Manövrieren. Schon der eine Umstand, daß es bis heute noch immer nicht gelungen ist, die Dauerfahrt der lenkbaren Luftschiffe über ein bestimmtes Maß hinaus zu steigern, macht sie für die Fahrten in jenen endlosen Eiswüsten des indischtibetanischen Hochplateaus einfach unbrauchbar. Dabei denken wir noch gar nicht an die abergläubische Stimmung und die religiöse Erhitzung der dortigen Völkerschaften, die ein solches Werk böser Geister gewiß bald vernichten würden. —
Inzwischen hat die Angelegenheit weitere Kreise gezogen. Die Frage der rätselhaften Triangelform erhält internationales Interesse. Wie der Telegraph meldet, ist eine illustre Gesellschaft von Geographen und Forschern aller Länder mit dem Dampfer ›Pendschab‹ nach Indien unterwegs. Nach den letzten Berichten wird die Expedition im Laufe dieses Monats noch das eisige Hochplateau mit den geheimnisvollen drei Punkten betreten.
Den Grund dieser streng wissenschaftlichen Untersuchung der Entdeckung soll nach unseren Informationen die Hypothese bilden, daß man es mit einem in der Menschheits- und Erdgeschichte bisher noch nie beobachteten Novum zu tun zu haben glaubt: mit einem Verständigungsversuche außerirdischern Planetenbewohner, vielleicht des Mars. Die Veranlassung und finanzielle Sicherung des Unternehmens geht von Mr. Rockefeller aus. Wie man sich erinnert, mehren sich die Zeichen dafür, daß die Bewohner anderer Planeten es versuchen, mit uns in Korrespondenz zu treten. Wie denken dabei an die drei seltsamen Punkte auf der Marsoberfläche, die im Jahre 1901 zuerst beobachtet wurden. Wir denken an die drei geheimnisvollen Klopftöne auf den Marconistationen um Mitternacht! Und nun scheint es, als ob es den außerirdischen Wesen gelungen sei, mit ihrer Intelligenz den trennenden Weltraum zu überbrücken und mit einem Zaubergriffel in das fleckenlose Weiß jener unendlichen Schneeflächen am Himalaja zu schreiben, wie auf eine Riesentafel. — — So scheint am Ende Mr. Heaven der Wahrheit der Sache am nächsten zu kommen. Wir werden unseren Lesern das Weitere berichten.« —
In der Nähe des westlichen Grenzpasses nach Tibet, auf einem weiten Hochplateau, lagert die Expedition.
Der Hierherweg ist mit größeren Schwierigkeiten verknüpft gewesen, als man anfangs vermuten konnte. Das Erscheinen einer so großen Anzahl verhaßter Fremder auf den einsamen Pfaden des indischen Alpenlandes hat die ohnehin mißtrauische scheue Bevölkerung noch störrischer und feindseliger gemacht, und ohne die gutbewaffnete Begleitmannschaft, welche Oberst Younghusband der Expedition mitgegeben, hätte man wahrscheinlich das Ziel — die öde eisige Hochebene mit ihren ominösen Punkten — kaum erreicht.
Die Zelte der Expedition stehen am Rande der weiten, weißen Fläche, die an ihrem Südrande die schimmernden Gletscherstirnen der höchsten Häupter unseres Erdballs zeigt. Vor allem der Götterthron Nanda Dewi, der Sitz des bösen Gottes Schiwa und seiner Gemahlin Parbati prangte in unvergleichlicher Reinheit und Hoheit; ja es schien infolge der in Hochgebirgen oft beobachteten optischen Verkürzungen der Sehdistanzen, als führe die weiße Schneefläche in ununterbrochenem Zusammenhange geradewegs bis hinan zu dem Götterthrone, wie ein Teppich, den Parbati selbst ausgebreitet, um darauf mit ihrem Gemahl promenieren zu können — unbelästigt von den sterblichen Menschen. Diese religiösen Anschauungen der Bergvölker hatten nicht am wenigsten die Hierherreise erschwert; nur mit sehr hohen Belohnungen hatte man die Kulis zum Transport des Expeditionsgepäcks bestimmen können, und diese Scheu nahm immer mehr zu, je näher man zu den noch unbetretenen Gebieten des westlichen Himalajas kam. Es mehrten sich überdies die Anzeichen, daß die Bevölkerung des ganzen Landes heimlich die Flamme des Aufstandes nährte. So war die Lage der Forscher hier in der öden Eiswüste keine beneidenswerte.
In ungefähr hundert Meter Entfernung von den Zelten der Expedition markiert sich auf der nur leicht geneigten weiten Schneefläche ein unregelmäßig begrenztes Viereck: das ist die Stelle, wo man in dem hartgefrorenen Schnee die drei rätselhaften Punkte in mannigfaltigen Wiederholungen gefunden hat. Die Reinheit der Atmosphäre in Verbindung mit der strengen Kälte hier oben hat die sonderbaren Zeichnungen nun schon Monate lang treu bewahrt. Die Punkte sehen aus, als ob man einen Augenblick eine ungefähr armesdicke glühende Eisenstange in den Schnee eingetaucht hätte, so scharf abgegrenzt und zirkelrund!
Aus dem letzten der Zelte treten soeben zwei Männer heraus. Instinktiv lenken sich ihre Schritte zur Einzäunung. Vor der nächsten der rätselhaften Punktfiguren bleiben sie stehen.
»Wir werden nichts ergründen«, sagte der eine, ein hochgewachsener Schotte, Mac Lure, ein Geologe, zu seinem Begleiter, einem Deutschen Dr. Ernst, der als Arzt die Expedition begleitete. »Gerade so klug wie am ersten Tage stehen wir hier und starren die drei Löcher im Schnee an — —«
Der junge Deutsche sah noch ein Weilchen auf die Spur im Schnee und erwiderte dann, halb wie zu sich selber sprechend:
»Rätselhaft! Rätselhaft — wie dieses ganze Land! Wenn man doch nur aus den Leuten hier etwas darüber erfahren könnte! Denn nach meiner Überzeugung wissen diese Kulis mehr von der Entstehung und Bedeutung dieser Schneespuren — als wir mit all unseren wissenschaftlichen Apparaten!«
»Da können Sie recht haben, Herr Doktor«, antwortete der Schotte. »Mich wundert bei alledem nur, daß der Pandit(*) Nan Shing, der unsere Expedition offiziell führt, bei der Erörterung der ganzen Sache so gar nicht mit der Sprache heraus will — während er doch sonst über all die religiösen Anschauungen seiner Landsleute ziemlich frei sich äußert — wie geht es übrigens diesem Ihrem neuen Patienten?«
(*) Indischer Eingeborener als Kundschafter der englischen Regierung.
»Er fiebert immer noch sehr stark. Wenn ich doch nur wüßte, wo sich der Mann diese Wunde geholt hat? Er ist doch immer in unserer Gesellschaft geblieben.« —
»Auch nachts?«, fragte der Schotte leise.
»Das kann ich allerdings nicht behaupten; aber auch da würde es ihm doch wohl schwer geworden sein, unsere Wachen zu täuschen.«
»Da ruft uns Herr Robert N. zur Sitzung. Kommen Sie! Ich wünsche und hoffe, daß es die letzte sein möge.« —
Wenige Minuten später saßen die Mitglieder der Expedition im großen Zelte beisammen. Der Vorsitzende Sir Robert N., F.R.S.M.A., erhob sich von seinem Klappsitz und begann:
,»Ich habe Sie rufen lassen, meine Herren Kollegen, um einen endgültigen Beschluß mit Ihnen fassen zu können über unsere Arbeiten. Das Herannahen der Schneesturmperiode hier oben macht einen längeren ersprießlichen Aufenthalt in diesen Höhen unmöglich; dazu kommen noch allerlei Alarmnachrichten, die mir heute ein Kurier des Oberst Younghusband überbracht hat, wonach wir diesmal einen furchtbaren Aufstand der indischen Bevölkerung zu erwarten haben. Es scheint, als ob es sich dabei nicht um die fast alljährlich wiederkehrenden Unruhen infolge schlechter Ernten handle, sondern um einen gewaltigen Aufstand religiöser Natur. Das Sonderbarste ist, wie mir Oberst Younghusband schreibt, daß sich von der Südspitze Indiens bis hierauf an die Eiswüsten der tibetanischen Grenze die gleichen der Regierung als geheime Verschwörerzeichen längst bekannten Merkmale gefunden haben. Es ist, als ob das von den Führern verblendete Volk diesmal auf eine Hilfe des Himmels, das heißt also in diesem Falle übernatürlicher Mächte rechne; sonst wäre eine so maßlose Überschätzung ihrer Kräfte den wohldisziplinierten Truppen unserer indischen Armee gegenüber nicht zu erklären« —
»Ich bitte ums Wort«, sagte der Meteorologe.
»Bitte Mr. Weathercock.« Und Mr. Weathercock begann:
»Ich glaube im Sinne der meisten von Ihnen zu sprechen, wenn ich die sonderbare Angelegenheit, die uns hierhergeführt und nun monatelang beschäftigt hat, skeptisch betrachte; jedenfalls weiß ich, daß meine Kollegen von der anderen Fakultät mit mir einig sind, die Entstehung der drei Punkte im Schnee als eine rein zufällige zu betrachten. Dabei möchte ich von meinem speziellen Fachstandpunkte noch betonen, daß bei keiner der vorgenommenen Proben Meteorstaub nachzuweisen war, eine Entstehung durch einen Meteoriteneinfall meines Erachtens ausgeschlossen ist.« —
»Den Ausführungen meines verehrten Kollegen möchte ich insofern beipflichten«, sagte der Physiker der Gesellschaft, »als sich die fragliche Erscheinung keinesfalls unter bekannte physikalische Vorgänge in der Atmosphäre subsumieren läßt. Sie bleibt auf jeden Fall eine willkürlich entstandene Zufälligkeit, wie sich dergleichen auch auf anderen Gebieten in Menge finden.«
Mr. Heaven, der indische Astronom, dessen Urteil in der Enquete der »Times« wahrscheinlich die Entschließungen des amerikanischen Milliardärs Rockefeller beeinflußt hatte, äußerte sich hierauf folgendermaßen:
»Es tut mir leid, meine Herren Vorrednern heute im ganzen und großen zustimmen zu müssen. Heute darf ich es ja wohl aussprechen, daß ich als einer der überzeugtesten Anhänger der ›PlanetenKorrespondenzHypothese‹ hierher an Ort und Stelle kam. Ich hoffte bestimmt, aus der astronomischen Lage der Punktfiguren, aus ihrer Stellung zueinander, aus ihrer Entfernung usw. irgend einen Anhaltspunkt zu finden, von dem ich weiteres über die Art ihres Ursprungs schließen konnte. Heute leider mußte ich bekennen — so verlockend auch gerade augenblicklich der Planet Mars in seiner größten Erdnähe herniederwinkt! — daß sich nichts von meinen Hoffnungen bisher erfüllt hat.« —
»Und Sie, Mr. Avis?«, wandte sich der Vorsitzende an den Ornithologen der Expedition, der, sein großes Notizbuch auf den Knien, eifrig eine Reihe geometrischer Konstruktionen zeichnete.
Mr. Avis fuhr auf. »Ich — möchte mich eigentlich gar nicht äußern«, sagte er dann nervöshastig, sein Buch auf- und zuklappend.
»Aber im Interesse unserer gemeinsamen Entschließungen muß ich Sie doch um ein Für und Wider in unserer Angelegenheit ersuchen«, begann der Vorsitzende von neuem.
»Meine Stellung unter Ihnen«, sagte nun Mr. Avis zögernd, »ist insofern eine exzeptionelle, als eine Entstehung der rätselhaften Schneespur durch ein Geschöpf aus der Vogelwelt im weitesten Sinne noch immer die meiste Wahrscheinlichkeit für sich hat. Meine Entscheidung muß also von gewichtigerer Bedeutung sein, als die meiner — hm — hm — Kollegen —«
Die Mitglieder der Expedition sahen sich lächelnd untereinander an. Der Ornithologe aber fuhr fort:
»Daraus entspringt aber für mich auch eine höhere Verantwortlichkeit, und dies Gefühl macht mich eben unschlüssig, um so unschlüssiger, als ich der einzige unter Ihnen zu sein scheine, der noch Gewicht auf die rätselhafte Angelegenheit zu legen scheint. Unsere wissenschaftlichen Annalen verzeichnen in den letzten Dezennien eine Reihe von Entdeckungen, die uns vorsichtig machen müssen in der Beurteilung derartiger Vorkommnisse. Unsere Märchen und Sagen haben Jahrhunderte lang von mythischen Ungeheuern erzählt, und eine sogenannte aufgeklärte Wissenschaft hat alle diese Giganten des Tierreiches, die Lindwürmer und Drachen, in das Reich der Phantasie verwiesen und als Hirngespinste des fabulierenden naiven Volksgemütes hingestellt: — nun — die Auffindung der weit über alles Maß hinausgehenden Dinosaurier im Pampastone Südamerikas hat bewiesen, daß jene ›Drachen‹ einst leibhaftig über diese Erde gewandelt sind! Ja — noch heute erzählen die Lieder der UrwaldIndianer von den ›frischen Fährten‹ solcher Ungeheuer. Wer will es für unmöglich erklären, daß sich nicht an besonders geeigneten Gegenden noch verspätete Nachkommen jener ›Schreckentiere‹ lebend erhalten haben? Die Sagen und Märchen aller Völker des indogermanischen Sprachstammes erzählen von einem Riesenvogel — ich erinnere an die Harpyien, die stymphalischen Vögel der griechischen Heldensage, an den Riesenvogel der persischen Heldensagen des Firdusi, an den Vogel Greif in unserer nordischen Mythologie. Warum kann nicht ein letzter Sproß jener geflügelten Giganten noch hier oben in den unzugänglichen Eisklüften hausen? Nach meinen Berechnungen könnten die Schneespuren bestimmt von der im Fluge aufgesetzten Riesenkralle eines solchen Vogels herrühren.« —
»Verzeihen Sie meine Einrede«, versetzte der Physiker, »ich dächte, daß eine Vogelspur, wie ich das häufig im weichen Erdreich beobachtet habe, doch immer auch den Eindruck der Z e h e n wiedergeben müßte, also nicht nur den der Krallen?« —
»Mit Ihrer Erlaubnis: Sie haben wahrscheinlich die Spur von Laufvögeln beobachtet; ein Raubvogel, der gewohnt ist, fast immer in den Lüften zu schweben, setzt bei der Berührung des Erdbodens den Fuß viel flüchtiger auf.« —
»Könnte die rätselhafte Spur nicht sogar noch von einem verspäteten Repräsentanten der Flugsaurier stammen, verehrter Kollege, der bei dem Verschwinden der Kreideformation den Anschluß versäumt hat und uns nun als Pterodaktylus Himalajalis seine dreifachen Rätsel aufgibt?«, fragte der Meteorologe scheinbar ernsthaft.
Der Ornithologe fixierte den Sprecher mit herausfordernden Blicken und sagte dann:
»Wenn die Ornithologie und die vergleichende Tierforschung freilich so unsichere Wissenschaften wären, wie es die Meteorologie noch heute ist — dann allerdings!«
Die sehr ernsten Mitglieder der Expedition lachten nun doch, am lautesten der Meteorologe. Mitten in der allgemeinen Heiterkeit erhob sich plötzlich der Vorsitzende, entfaltete einen Brief und sagte:
»Ich halte es für meine Pflicht im gegenwärtigen Moment ein Schreiben zur Kenntnis der geehrten Mitglieder zu bringen, das ich heute durch einen Boten von Oberst Younghusband erhalten habe. Ich bitte um Entschuldigung, daß der Inhalt dieses Schreibens so wenig geeignet ist, den wissenschaftlichen Eifer unserer Expedition zu ermutigen. Der Brief lautet:
»An den sehr ehrenwerten Sir...
Auf einer Weltreise soeben in Honolulu eingetroffen, erfahre ich von der sonderbaren Veranstaltung, welche Sie und eine Anzahl hervorragender Gelehrter auf das Hochplateau des westlichen indischtibetanischen Grenzgebietes geführt hat.
Ich beeile mich daher, Ihnen das Folgende mitzuteilen, weil ich nämlich selber die unschuldige Veranlassung zu dieser seltsamen Mystifikation zu sein glaube. Als nämlich Oberst Younghusband vor kurzem seine erste Bereisung Tibets unternahm, befand auch ich mich unter den Teilnehmern. Allerdings unter einer Verkleidung. Meine Pläne — ich bin leidenschaftlicher Amateurphotograph und meine Spezialität sind vor allem Erstaufnahmen von noch unbekannten Punkten unseres Erdballs — machten dies notwendig. Schwerlich hätte Oberst Younghusband einen französischen Amateurphotographen unter die Mitglieder seiner Expedition aufgenommen; aber gegen einen französischen Koch hatte er nichts einzuwenden! Als solcher fungierte ich offiziell während der Expedition, und ich denke, meine Rolle zur leidlichen Zufriedenheit meiner Gäste gespielt zu haben. Keiner der Teilnehmer ahnte, daß in den Trägerlasten, welche meine Kulis schleppen mußten, sich sorgfältig verpackt eine vollständige photographische Ausrüstung befand. Keiner wußte, daß der französische Koch, M. Jean, von seinem Küchenzelte geschützt, eine große Zahl der herrlichsten Hochgebirgs-Aufnahmen jener noch unbetretenen Region unseres Erdballs auf die Platte brachte!
Leider führte der Weg unserer damaligen Expedition gerade an dem überwältigend schönen Panorama des Nanda Dewi und Nanda Kot ziemlich weit entfernt vorüber, um dessen photographischer Aufnahme willen ich eigentlich die ganze Maskerade vorgenommen hatte. So blieb mir nichts anderes übrig, als mich eines Nachts — die Wache hatte ich bestochen — mit meiner Kamera und dem zusammenschiebbaren Stativ auf Schneeschuhen aus meinem Zelte zu stehlen.« —
»O du heiliger Brahma!«, unterbrach hier der Schotte den Vorleser — »da haben wahrscheinlich die drei Stativbeine seines Apparates schuld an unserm Hiersein!« —
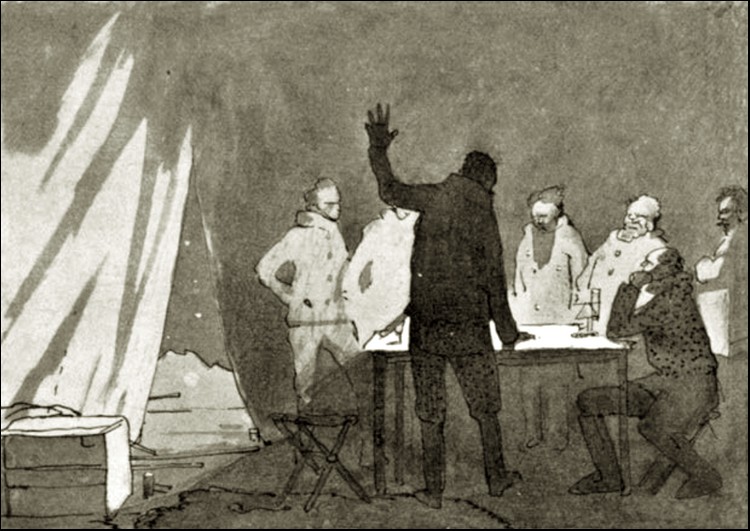
Der Vorsitzende klappte lächelnd den Brief zu und sagte bestätigend:
»Der verehrte Kollege hat recht — und ich kann mir den Schluß des Schreibens ersparen. Die Geschichte verhält sich so.« —
»Wie«, riefen verschiedene Mitglieder zugleich, »die drei Stativbeine sollen die Schneespuren hervorgebracht haben? Unmöglich!«
Der Vorsitzende entgegnete: »Ich habe es auch für unmöglich gehalten, aber eine vorhin gemachte Probe spricht mehr für als gegen die Wahrheit dieser Aufnahme. Die Ähnlichkeit zwischen den neuen und den alten Spuren läßt sich nicht leugnen.« —
Ein Lärm erhob sich. Die sonst so ernsten und ruhigen Gelehrten gerieten in gewaltige Aufregung.
»Eine Mystifikation!«, rief der Astronom einmal über das andere erregt aus — »das kann nicht sein. Unmöglich — wenn ich einen Augenblick die Ähnlichkeit zugeben will — hätten sich die Vertiefungen solange in der Schneedecke unverändert erhalten.«
»Dieser Gedanke hat auch mich wieder stutzig gemacht,« sagte der Vorsitzende zustimmend, »ich dachte auch an die Schneeschuhe des photographierenden Kochkünstlers, deren Spur sich dann doch auch erhalten haben müßte. Allerdings erschüttert der Schluß des Briefes diese Zweifel wieder.« — —
Er entfaltete das Schreiben nochmals und las:
»Mein Plan gelang vollkommen: es glückte mir, eine Reihe von Aufnahmen, darunter einige bei Mondschein und in den allerersten Strahlen der Morgensonne, von dem grandiosen Panorama des Nanda Dewi und Nanda Kot auf die Platte zu bringen. Ebenso unentdeckt, wie ich gekommen, kehrte ich von dem schneebedeckten Hochplateau wieder heim, wobei ich zur Vorsicht die Spuren meiner nächtlichen Schneeschuhübungen so gut als möglich zu verwischen suchte, was mit einer langen Schleppe aus Zeltleinwand, die ich hinter mir herzog, besser gelang, als ich dachte. —«
»Damit wäre auch der famose Schweif des imaginären Riesenvogels glücklich erklärt, dessen Andeutungen wir hie und da im Schnee zu erblicken glaubten!« rief der Meteorologe lachend aus. »Es wird schon so sein, wie der ingeniöse Koch, M. Jean, da schreibt; apropos, darf ich fragen, wie er sich in seinem heutigen Briefe unterschreibt?
Der Vorsitzende schlug lächelnd das Papier auseinander und sagte, es ihm hinreichend:
»Er unterschreibt gar nicht; er macht — drei Punkte, den Zeichen ähnlich, die uns nun schon monatelang genarrt haben!«
Aufs neue erhob sich die Aufregung unter den Anwesenden. Der Astronom aber wandte sich an Sir Robert N.:
»Ich möchte auf Grund des uns verlesenen Briefes den sehr ehrenwerten Sir Robert ersuchen, uns seine Überzeugung kundzugeben, ob er ihn für ausreichend erachtet, die mysteriösen Punkte einwandfrei zu erklären.«
Sir Robert N. räusperte sich und sagte reserviert:
»Ich kann auf diese Frage augenblicklich weder ja — noch nein sagen; aber ich stelle dafür die Gegenfrage: Hat einer der Herren vielleicht noch eine neue Deutung der rätselhaften Punkte gefunden, welche geeignet erscheinen könnten, die Angaben des verlesenen Briefes umzustoßen?«
Einen Augenblick lang blieb alles stumm. Dann erhob sich plötzlich Dr. Ernst und sagte kurz:
»Ich bitte ums Wort!«
»Bitte, Herr Doktor!«
Und der junge Deutsche begann: »Es ist eigentlich ein Krankenbericht, meine Herren, den ich Ihnen vortragen möchte. Sie kennen alle Nan Shing, unsern Führer. Seit drei Tagen liegt er an einer sonderbaren Verletzung darnieder, einer tiefen Wunde am Halse. Gestern abend trat heftiges Wundfieber auf — und in diesem Fieber spricht er sonderbare Worte —«
»Aber, Herr Doktor!«, rief der Physiker dazwischen, »Fieberphantasien können doch kaum Gegenstand einer wissenschaftlichen Erörterung sein?«
»Ich — möchte das doch nicht so unbedingt gelten lassen«, entgegnete Dr. Ernst und fuhr fort:
»Nan Shing spricht in seinen Delirien immer von drei Lichtern, die heute nacht auf den Götterbergen angezündet werden müssen. Und er gerät dabei in eine seltsame Aufregung: denn das eine der Lichter sei erloschen, und er müsse hinauf, es anzuzünden.«
Die Gelehrten sahen sich kopfschüttelnd untereinander an; der Doktor. aber sagte weiter: »Anfangs hielt ich natürlich seine Reden nur für das wirre Geschwätz des Fieberkranken. Aber je länger ich seinen Phantasien lauschte, desto mehr logischen Zusammenhang glaubte ich darin zu entdecken. Und ich vernahm aus dem heißen Munde des fiebernden Inders eine Kunde, die in gewissen Sinne schon die Vollendung alles dessen zu verraten scheint, was wir hier oben auf dem öden, eisigen Hochplateau zu entdecken gedachten.«
»Sprechen sie, Doktor, Sprechen Sie!«, drängten nun die Zunächstsitzenden ungeduldig.
Der Doktor griff in seine Brusttasche und zog sein Notizbuch hervor.
»Ich werde Ihnen einfach die abgerissenen Äußerungen des Kranken vorlesen, wie ich sie gestern stenographisch festgehalten habe«, sagte der Doktor und las:
»Das dritte Licht. Siehst du nicht, daß es erlischt? O eile, eile, es wieder anzuzünden! Sie verlangten ein Zeichen von uns, die Gewaltigen auf der anderen Erde. — Die heilige Dreizahl! Drei Punkte im Schnee — drei Lichter in der Nacht! Auf! Dein Volk wartet auf dich! — Drei schwarze Punkte im weißen Schnee! — drei weiße Lichter in schwarzer Nacht! So wollten es die Gewaltigen auf der anderen Erde! So sprach der Weise von DschosiMath! Auf! Du hast es ihm gelobt! Die Himmlischen harren! Auf! Hinauf! Entfache die reine strahlende Flamme, daß sie leuchte den Kommenden! Denn die Gewaltigen werden kommen von der anderen Erde und helfen seinem armen Volke! — Zaudere nicht länger! Sieh, wie sie spielen, die goldenen Fäden, die sichtbaren Zeichen der anderen Welt! Sieh', wie sie über die weißen Fluren gleiten in heiliger Dreizahl! — Säume nicht! — Willst du warten, bis die Fremden mit ihren Zauberkünsten das Geheimnis deines Volkes entdecken? Die weißen Toren! — Hahaha! Brücken möchten sie bauen zu jener anderen Erde — und ahnen nicht, daß längst schon unsere Geisterboten, die körperlosen Dschins, geheimnisvoll ihre Wege gehen von hier nach dort, von dieser Erde zu jener Erde! Er hat sie gesandt in himmlische Fernen, um Hilfe zu holen für unser geknechtetes Volk — der Weise von DschosiMath! — Und sie werden kommen — auf feurigen Wagen aus ewigen Fernen, die Männer der rötlichstrahlenden Erde — sie werden kommen! — Aber das Zeichen verlangen sie — das Zeichen!«
Dr. Ernst schwieg. Eine lange, tiefe Stille trat ein. Es war, als ob die schweren, schwülen Fieberphantasien auf den Gemütern lasteten. Endlich brach der Meteorologe das eigentümliche Schweigen:
»Für einen Fieberkranken ganz sinnreich. — Aber bestes Doktorchen, was wollen Sie damit beweisen? Etwa, daß die drei seltsamen Punkte im Schnee mit Nan Shing und seinen Faseleien über den ›Weisen von DschosiMath‹ in irgend einem tatsächlichen Zusammenhange stehen könnten? Im Gegenteil: das Fieber hat in seinem erhitzten Gehirn erst diesen scheinbaren Zusammenhang zwischen so heterogenen Vorstellungen geschaffen, der in der nüchternen Wirklichkeit eben nicht vorhanden ist! Es wäre gar nicht so schwer, das eben Gehörte auf seinen natürlichen Ursprung zurückzuführen: heimatliche Sagen und Erzählungen mischen sich mit unverstandenen Begriffen, die er im Verkehr mit uns aufgeschnappt hat. Und das gefällige Fieber hat uns dabei gleichzeitig verraten, daß selbst dieser scheinbar ganz anglisierte Pandit Nan Shing, der bisher durch dick und dünn mit der Regierung gegangen ist und auf seine Landsleute mit hochmütiger Verachtung herabzusehen schien, im innersten Herzen doch noch ein ebenso fanatischer Hindu ist, als alle anderen.«
Der junge Doktor klappte sein Notizbuch zu und sagte nur, wie sich entschuldigend, zu dem Vorsitzenden gewandt: »Ich hielt es für meine Pflicht, der geehrten Versammlung meine Wahrnehmung mitzuteilen.«
»Und ich möchte mich zu Ihrem Sekundanten aufwerfen«, sagte da plötzlich der Schotte, sich erhebend, »ich halte mit Ihnen, Herr Doktor, diese Fieberphantasien durchaus nicht für leere Hirngespinste — und ich stelle die Behauptung hier auf: dieser Nan Shing ist ein anderer als er scheint! Ich kann Sie nicht alle zu meiner Überzeugung bekehren; aber ich kann Ihnen kurz ein Erlebnis mitteilen, das mir den Beweis für meine Behauptung geliefert hat. Vor drei Tagen kehrte ich mit Anbruch der Abenddämmerung von einer kleinen Kletterpartie heim, die ich allein, wie so manchmal, unternommen hatte. Kurz vor unserem Zeltlager, da, wo der für unsere Expedition angelegte Saumpfad den eigentlichen Grenzpaß erreicht, sah ich plötzlich eine zierliche, schmiegsame Gestalt sich zum Gletscher emporwinden, einen Eingeborenen, den ich zu meiner Verwunderung als Nan Shing erkannte —«
»Nan Shing?«, fragte der Doktor überrascht, »vor drei Tagen?«
»Jawohl, Herr Doktor — an demselben Abend, als Sie noch in später Stunde in mein Zelt kamen und mir die seltsame Verwundung des Pandit meldeten. Doch um fortzufahren: Ich rief ihn mit einem Scherzwort an; aber er antwortete nicht, sondern suchte sich durch schnelles Umklettern eines Felsvorsprungs meinen Blicken zu entziehen. Natürlich wurde mir die Geschichte nun verdächtig: ich bog also schnell von meinem Wege ab und folgte ihm. Mit gewaltigen Sätzen stürmte ich über das Steingeröll am Fuße des Gletschers und erreichte mit einem letzten Schwunge den Felsblock, hinter dem Nan Shing verschwunden war. Vor mir lag das weite Gletscherfeld. Ungläubig starrte ich vor mich hin: ich glaubte plötzlich zwei Gestalten zu sehen, statt einer —und beide glichen — Nan Shing! Ich dachte an eine optische Täuschung; ehe ich mich aber noch recht zu besinnen vermochte, schien sich die eine Gestalt in Nebel aufzulösen; die andere aber verwandelte sich vor meinen erstaunten Augen! Und was sich jetzt drohend gegen mich wandte, war kein Mensch mehr, sondern — ein Schneeleopard, ein gewaltiges Exemplar seiner Gattung —«

Der Erzähler wurde von allen Seiten mit Gelächter und Zwischenrufen unterbrochen. Er ließ das Stimmengewirr erst ein Weilchen sich legen; dann aber wiederholte er Wort für Wort:
»Es war kein Mensch mehr, sondern ein Schneeleopard!«
»Wahrscheinlich haben Sie schon anfangs den Vierfüßler im Dämmerlicht für den zweibeinigen Nan Shing gehalten, lieber Freund!«, neckte ihn der Meteorologe.
Der Schotte antwortete weder auf diesen noch auf andere Einwürfe, sondern fuhr unbeirrt fort: »Jetzt bedauerte ich, daß ich außer meinem Bergstock keine andere Waffe bei mir hatte. Kurz entschlossen, schleuderte ich den Bergstock auf ihn, der ihn an der linken Seite des Halses traf. Ich hörte, wie die eiserne Spitze auftraf. Leider vermochte ich das seltsame Exemplar nicht zu erwischen; er war im nächsten Augenblick in einer Gletscherspalte verschwunden.« —
»Wo haben Sie das Tier nach Ihrer Meinung getroffen?«, fragte der Doktor mit verhaltener Erregung.
»An der linken Seite des Halses, oberhalb des Schulterblatts«, erwiderte der Schotte.
»Sonderbar — sonderbar!«, sagte Dr. Ernst leise, wie zu sich selbst.
»Nun — nun!«, rief der Meteorologe spottend aus, »wir haben uns ja die abenteuerliche Geschichte des verehrten Kollegen gefallen lassen, aber doch nur als — Jagdgeschichte, und Jägerlatein pflegt nicht allzu scharfe Prüfungen zu vertragen!«
Aber der junge Doktor wandte sich nochmals an Mac Lure: »Und Ihr Bergstock? Zeigt er nicht irgendwelche Spuren des seltsamen Angriffs?«
»Leider, Herr Doktor — die Eisenspitze ist abgebrochen, und ich muß mir nächstens eine neue anschrauben.« —
Damit fasste er hinter sich nach seinem Klappstuhl, wo sein Bergstock angelehnt stand.
»Hier«, sagte er, »ist das Corpus delicti.« —
Und er legte den Stock auf den Tisch.
Da griff der Doktor plötzlich in die Tasche und zog ein in Papier gewickeltes Etwas hervor. —
»Und hier«, sagte er, heiser vor innerer Erregung, »ist das abgebrochene Stück dazu!«
»O — wo haben Sie denn das gefunden, Herr Doktor?«, fragte der Schotte verwundert.
»Ich habe es aus der Halswunde Nan Shings an jenem Abend gezogen!«, antwortete Dr. Ernst, jedes Wort betonend.
Wie elektrisiert sprangen alle von ihren Sitzen auf. Ein wildes Durcheinander von Fragen stürmte auf den Doktor und den Schotten ein.
»Zufällige Übereinstimmung!«, riefen die einen, die das abgebrochene Stück an das übriggebliebene angepaßt hatten, »Selbsttäuschung! Autosuggestion!« die anderen.
Aber ein Teil der Anwesenden betrachtete stumm die seltsamen Beweisstücke auf dem Tische des Zeltes. Das Wunderbare, das Unerklärliche trat mit seinem stillen, aber um so mächtigeren Zauber an ihre Seele. —
Der Vorsitzende, Sir Robert M., erhob sich wieder, um die Diskussion über den Fall zu eröffnen. —
Da wurde plötzlich der Zeltvorhang zurückgerissen. —
Tommy, der Wachposten, stürzte atemlos herein und rief:
»Nan Shing ist aus seinem Zelte entflohen!«
Am Abend dieses Tages — nachdem man vergebens die ganze Umgebung nach dem Verschwundenen abgesucht hatte — bat Sir Robert M. den Doktor und Mac Lure nochmals zu einer Besprechung in sein Zelt. Er wünschte dabei von beiden unumwunden ihre Meinung über Nan Shing zu hören, wobei er zugab, daß der Hindu offenbar nicht der harmlose, diensteifrige Diener der englischen Regierung sei, für den er ihn bisher gehalten.
Der Doktor suchte in seinen Ausführungen zu beweisen, daß Nan Shing wahrscheinlich ein heimlicher Yogi sei, ein Angehöriger jener Sekte heiliger Büßer, die mit ihren wunderbaren Seelenkräften die Natur zu meistern scheinen: Dinge erscheinen und verschwinden lassen, Fruchtbäume zusehends aus dürrem Sande hervorzaubern, das Gewicht der Körper willkürlich zu verändern vermögen, ja — mit der Kraft des eigenen Willens selbst des eigene Herz zum Stillstand bringen können!
»Aber«, — wandte Sir Robert fragend ein, »was konnte Nan Shing veranlassen zu heimlicher Flucht? Wir haben ihn doch human behandelt und seine nationalen Eigentümlichkeiten in jeder Weise respektiert! Und er schien doch viel zu klug und welterfahren, als daß er sich von den religiösen Schwärmern seines Volkes hätte zu Torheiten verleiten lassen!«
»Eben das beweist mir«, entgegnete der Schotte hierauf, »daß der jetzige Aufstand gewiß von tieferer, gefährlicher Art ist, daß jetzt die Führer der Bewegung mehr Aussicht auf den Erfolg ihrer Sache zu haben glauben als sonst! Ich teile durchaus nicht die Meinung hiesiger Regierungskreise, daß es sich diesmal wie immer um die gewöhnlichen Unruhen handle, wenn auch in diesem Jahr mehr das religiöse Element hervorzutreten scheine; ich möchte den verantwortlichen Stellen hier im Lande im Gegenteil recht laut in die Ohren rufen: ,Videant consules!'«
Der sehr ehrenwerte Sir Robert M. zog etwas mißfällig die Schultern in die Höhe und nahm ein paar stumme Züge aus seiner Zigarette. Dann sagte er gedehnt:
»Aber warum dann erst die Übernahme seiner jetzigen Rolle als Führer unserer Expedition?«
»Sie war sicher nur ein Programm, das er im Auftrage seiner Obern auszuführen hatte.« —
»Und glauben Sie im Ernst, daß er über die drei Punkte im Schnee mehr weiß als wir, Herr Doktor?«
»Das glaube ich bestimmt, Sir Robert«, entgegnete der junge Deutsche, »denn ich halte seine Fieberreden durchaus nicht für lauter Phantasmen! Sicher hatte er auch irgendeinen geheimen Auftrag auszuführen, vielleicht gar ein Rendezvous mit einem der Verschworenen — als er vor drei Tagen jenes Renkontre mit Ihnen« — er wandte sich an Mac Lure — »zu bestehen hatte.«
»So halten die Herren eine Selbsttäuschung, ein Falschsehen, das bei der gerade einsetzenden Dämmerung doch immerhin möglich ist, für ausgeschlossen?«
»Ich will einräumen, mich geirrt zu haben, Sir Robert«, entgegnete der Schotte, »wenn Sie mir erklären können, wie die Spitze meines Bergstocks in Nan Shings Halswunde gekommen ist!«
Sie Robert zuckte wieder mit den schmalen Schultern: »Das ist unmöglich...«
»Aber vom ärztlichen Standpunkte vermag ich trotzdem eine Erklärung für dieses scheinbare Wunder zu geben«, meinte Dr. Ernst.
»Und welche, Herr Doktor?«
»Es gehört zu den uralten Mitteln der indischen Yogis, mit ihren phänomenalen Willenskräften den Vorstellungskreis der Menschen so zu beeinflussen, daß diese alles zu sehen glauben, was der Yogi ihnen suggeriert. Auch unsere moderne Heilkunst arbeitet ja mit der Hypnose als einem mächtigen Heilfaktor. Freilich handelt es sich hier um viel höhere Grade seelischer Fernwirkung, als in der gewöhnlichen Schlafhypnose; denn Nan Shings in der Gefahr gewiß bis zum äußersten gespannte Willensenergie vermochte sogar das optische Bild seiner Person innerhalb des Sehzentrums seines Gegenübers zu beeinflussen und umzuwandeln — ja —«, er wandte sich dabei an den Schotten — »was Sie uns erzählt haben von einem Doppeltsehen der Gestalt Nan Shings ist mir eben ein untrüglicher Beweis für den Beginn einer Wachhypnose Ihrerseits und erklärt sich physiologisch aus dem Auseinandergleiten der Sehachsen beider Augen mit der beginnenden Unterordnung Ihres seelischen Zustandes unter die Willenssphäre des Yogi.«
»Und der Schneeleopard hat demnach gar nicht existiert, meinen Sie?«
»Er hat existiert; — aber nur für Mac Lure, vielleicht auch für Sie und mich, wenn wir beide ebenfalls Augenzeugen des Vorganges gewesen wären, Sir Robert. Allerdings eben nur in der Vorstellung unseres Gehirns; und diese suggerierte Vorstellung eines drohenden Schneeleoparden war das Phantom, hinter welchem Nan Shing seine eigene Erscheinung verbarg. Die Erscheinung des Raubtieres sollte den unerwarteten Beobachter zur schleunigen Umkehr bringen und Nan Shing den Weg zu seinem geheimen Vorhaben frei machen. Leider scheiterte das Gelingen des Experiments an der Unerschrockenheit des erprobten Jägers, und so erhielt Nan Shing den Wurf mit dem Bergstock, der dem Leoparden galt —«
Sir Robert schüttelte wiederholt den Kopf und lächelte. »Ich vermag es nicht zu glauben, Herr Doktor! — Aber eins lassen Sie mich noch fragen: Wie denken die Herren über sein h e u t i g e s Verschwinden?«
»Ist wahrscheinlich im Fieberwahne geschehen; jedenfalls aber liegt seiner schon Tage lang gezeigten namenlosen Unruhe und Aufregung noch irgend ein tieferes Moment zugrunde, das vielleicht auch mit jenem vor drei Tagen schon beabsichtigten Verschwinden im Zusammenhang steht — wer weiß es!«
Sir Robert stand auf. »Jedenfalls danke ich Ihnen, meine Herren,‹ sagte er — auch im Namen und Interesse der Expedition! Ich wünsche ja von Herzen, daß es uns noch gelingen möchte, alle uns hier umgebenden Rätsel zu lösen; — ich fürchte nur nach den heute erhaltenen Meldungen des Obersten Younghusband, daß man uns vorzeitig heimrufen wird — good night!«
Drei Tage später brach die Expedition ihre Zelte ab und wandte sich heimwärts. Es war nicht gelungen, etwas Näheres über die Entstehung und Bedeutung der rätselhaften drei Punkte im Schnee des Himalaja festzustellen. Oberst Younghusband hatte dringend um sofortigen Aufbruch der Expedition ersucht und Verstärkung der Begleitmannschaft heraufgesandt. —
— — — Nur einer blieb auf dem eisigen Hochplateau — Dr. Ernst. Er blieb aus freiem Entschlusse und auf eigene Gefahr. Sir Robert hatte allerdings nur unter heftigem Widerstreben darein gewilligt und ihm zum Schutze einige Bewaffnete zurücklassen wollen. Aber Dr. Ernst kannte keine Furcht und bat nur um Überlassung einiger Kulis, die sein Gepäck transportieren sollten.
Ein seltsames Etwas, über das er sich selbst kaum hätte Rechenschaft geben können, bannte ihn an diese weite, weiße Fläche hier an den Grenzen irdischen Lebens. Auch sein ärztliches Gewissen hatte für sein längeres Hierbleiben gesprochen: noch immer hoffte er, Spuren von dem verschwundenen Nan Shing wieder aufzufinden.
Aber all sein Suchen nach dem Verschwundenen blieb vergebens! Wohl fand er die Spur des Vermißten bis zu einer steilen Geröllhalde, über der sich der schneeweiße Doppelgipfel des Nanda Dewi greifbar nahe zu erheben schien — aber von da aus fehlte jeder weitere Anhalt.
Als aber Dr. Ernst in der dritten Nacht seines Alleinseins aus dem Zelte trat und zum nächtlichen, sternübersäten Himmel emporblicken wollte, da stand am Götterthron des Nanda Dewi still und rein und groß ein rätselhafter, weißer Glanz!
Und er dachte an Nan Shing und seine Fieberträume —
War es doch ein Signal, das die irdischen Verschworenen den geheimnisvollen Helfern anzündeten da droben auf der »anderen Erde?« Oder nur ein Widerschein, ein letzter Strahl verschwimmender Dämmerung? —
Sieben Tage noch blieb der junge deutsche Doktor einsam auf der stillen Hochebene. Und nichts zeigte sich seinen Blicken, das sein Interesse erregte.
Da dachte auch er an den Abstieg. Die Kulis erhielten den Befehl, für den nächsten Morgen alles zum Aufbruch vorzubereiten.
Die letzte Nacht kam für den jungen Deutschen. Er wollte sie wachend verbringen — hier oben in fast fünftausend Metern Höhe, umgeben von den höchsten Gipfeln des Erdballs! Märchenhaft griffen die weißen zackigen Gipfel in den Sternenhimmel hinein — wie erhabene, weiße Hände! Wie gut verstand er die uralten indischen Mythen, welche die heiligen Götter thronen ließen auf jenen schneeweißen Riesengipfeln in majestätischer Pracht! Denn eins erschienen hier oben Himmel und Erde! —
So saß er schauend und schweigend, dicht in seinen Mantel gehüllt. Er hätte tausend Augen haben mögen, um die ganze überirdische Schönheit dieser Hochgebirgsnacht in seine Seele aufnehmen zu können.
Und die Mitternacht kam.
Wie ein gewaltiger großer Stern stand am Nanda Dewi wieder der rätselhafte Glanz.
Und wieder dachte Dr. Ernst an seinen Patienten, und ein Klang ging ihm erinnernd durchs Ohr aus dem fiebernden Munde des verschwundenen Hindu: »Drei Lichter in dunkler Nacht!«
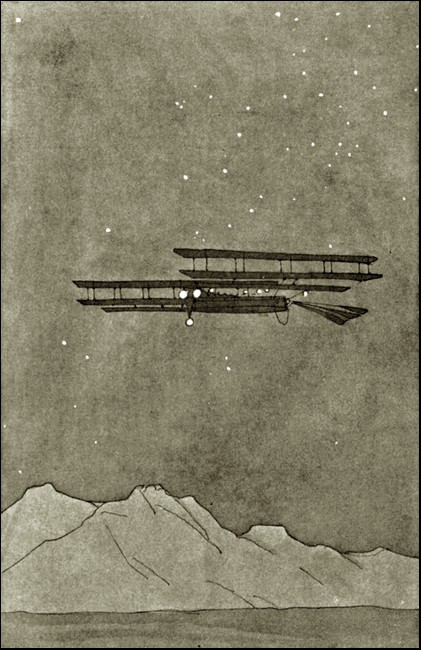
Da entdeckte sein Auge weit — weit in der Ferne östlich und südlich vom Nanda Dewi, tief am Rande des Himmels einen gleichen weißen Lichtschimmer.
Drei Lichter in dunkler Nacht! War das doch also ein Signal? Ein Zeichen für außerirdische Beobachter?
Aber dann hatte Nan Shing trotz seines Fiebers doch die Wahrheit gesprochen! Und immer wieder suchte sein Blick die weißen Lichter am Firmament. —
Aber als er seine Augen wieder herniederwandte aus jenen nächtlichen Fernen, zurück auf seine Umgebung, da blieben sie wie gebannt auf der weiten, weißen Fläche haften, die sich vor ihm dehnte. —
Denn — über die endlose schneebedeckte Ebene gingen geheimnisvoll drei leuchtende Lichtstrahlen, die wie Stäbe aus flimmerndem Diamant herabragten aus himmlischen Höhen!
Es hielt ihn nicht länger am Eingange seines Zeltes; so schnell ihn seine Füße tragen wollten, eilte er über das Schneefeld, um das wunderbare Phänomen aus nächster Nähe zu schauen. —
Und je näher er kam, desto mehr weiteten sich seine Blicke in wortlosem Erstaunen! Und sie folgten den schimmernden Lichtstäben hinauf in den dunklen Himmel:
Wie eine Vision des »jüngsten Gerichts« schien sich da über ihm das nachtdunkle Firmament zu öffnen! Ein wunderbares Wogen und Weben begann dort oben; seltsame überirdische Gebilde in phantastischen Formen, von bunten Flammengarben umsprüht, schossen hin und her, in rastlosem Durcheinander sich immer tiefer herniedersenkend. —
Und mit ihnen ging und kam die rätselhafte Trias der Lichtstrahlen über das Schneefeld. —
Und der junge Deutsche sah aus dem Chaos der hin- und herflutenden Formen und Gestalten plötzlich ein riesiges schwarzgeflügeltes Ungeheuer sich losmachen und auf Riesenfittichen die Luft durchsausen, dem Götterthrone des Nanda Dewi zu. —
Und er dachte an Mr. Avis, den possierlichen Ornithologen und seinen hypotetischen Riesenvogel.
Aber das fliegende Ungeheuer, das soeben über seinem Haupte dahingerauscht ist, war — ein künstlicher Vogel; deutlich hatte er die elektrischen Signallichter am Vorderteil gesehen, deutlich das Sausen seiner Maschinen vernommen.
Und immer weiter schreitet sein Fuß auf dem weißen Felde; magisch ziehen und locken ihn die lichten Strahlen, die sich hier und da in den hartgefrorenen Schnee einzubohren scheinen!
Plötzlich stockt sein Schritt. Vor ihm taucht eine dunkle Gestalt auf — wie aus dem Boden gewachsen. —
N a n S h i n g !
Sein im flimmernden Strahlenscheine wie Bronze glänzender, hochemporgehobener Arm gebietet ein stummes: »Zurück!«
»Nan Shing!«, ruft der Doktor in namenlosem Erstaunen. — »So hattest Du doch die Wahrheit geredet! Was ists mit den drei Lichtern und den drei Punkten? Kennst Du das Geheimnis? So löse mir das Rätsel!«
Aber Nan Shing antwortet nicht. Der Doktor will an ihm vorbei — nach der Stelle, wo aufs neue die funkelnden Lichtstäbe zu wandern beginnen.
Doch er vermag es nicht; die schweigsame Gestalt dicht vor ihm hält ihn fest an seinem Platze — wie gebannt.
Und immer schneller und immer leuchtender werden die wandernden Strahlen — und immer tiefer senken sich die himmlischen Legionen mit ihren schimmernden Fahrzeugen! Oder wird er von unsichtbaren Händen emporgehoben? Er weiß es nicht. Aber immer deutlicher wird das wunderbare Luftbild über seinem Haupte! Schon vermag sein trunkenes Auge die Bemannung der rätselhaften Luftfahrzeuge zu erkennen — kleine, nie geschaute Gestalten! Und sein lauschendes Ohr vernimmt wunderbare, nie gehörte Laute, aber nicht wie von Menschenstimmen!
Und er ahnte, daß es »die Gewaltigen der andern Erde« waren, die da auf den einsamen Hochebenen der höchsten Erhebung unseres Planeten zum erstenmale ihren Fuß auf die neue Erbe setzen wollten, gerufen von »dem Weisen von DschosiMath«
Und dann sah er nichts mehr — — —
Am anderen Morgen suchten die Kulis vergebens nach dem weißen Sahib.
Sie fanden die Spur seiner Tritte, die weit hinein in das weiße Schneefeld führte —Aber da war sie plötzlich zu Ende — wie ausgelöscht! Nichts war zu entdecken: keine Spalte — kein Schneerutsch!
Weiß und rein und — schweigend lag die endlose Fläche wie alle Tage.
Aber da und dort fanden sich aufs neue die drei rätselhaften Punkte...
Der Assyriologe Professor Schalk las noch einmal den Brief, den sein Kollege Professor Ziegel der letzten Sendung beigelegt. Er lautete:
»Lieber Herr Kollege!
Ihr alter Streit mit Professor Monkey wird mit meiner heutigen Sendung wieder aufleben! Die Entzifferung beifolgender Tontafel wird Ihnen verraten, daß Sie damals doch das fragliche Schriftzeichen (hier war in Keilschrift eine Reihe von Zeichen wiedergegeben!) falsch gedeutet haben. Der strittige Ausdruck lautet tatsächlich so, wie Ihr Gegner annahm. Doch Sie werden ja selber prüfen und urteilen. Jedenfalls — ein Zweifel an der Echtheit ist völlig ausgeschlossen! — klingt die Geschichte höchst seltsam, und wenn ich die Tafel nicht eigenhändig gefunden und untersucht hätte, würde ich jetzt dasselbe ungläubige Gesicht machen — wie Sie! Wissen Sie vielleicht, wo Professor Monkey sich augenblicklich aufhält? Er sollte hier in der Nähe mit der französischen Expedition Grabungen veranstalten, ist aber nicht dabei. Eine kurze Nachricht, die ich ihm in der gleichen Angelegenheit gesandt habe, ist als unbestellbar zurückgekommen. Doch ist der Fund ja nun in guten Händen und wird Früchte bringen.
Leben Sie wohl — bis zur nächsten Sendung!
Ihr
Timotheus Ziegel.«
Der Gelehrte ergriff von neuem die Lupe und untersuchte die aus den Ruinen von Babylon stammende, mit einem Gewirr von Schriftzeichen bedeckte Tontafel.
Der Text — es war ein Bruchstück aus spätbabylonischer Zeit — hatte einen sehr sonderbaren Wortlaut; er hieß in deutscher Übersetzung ungefähr:
»— — — und flüchtete nach Kemi und lebte daselbst bei Neko, dem Sohn der Sonne. Als aber die Meerleute, die nach Kemi gekommen waren, wieder von dannen zogen, ging Deinam mit ihnen zu Schiffe. Und sie fuhren hinaus ins unendliche Meer — und eines Tages sahen sie die Mittagssonne nicht mehr zur Linken, sondern zur Rechten des Steuerruders. Und sie sandten Boote aus an das unbekannte Land, das vor ihnen lag. Und die im Boote waren, fanden das Land fruchtbar, aber Ungeheuer auf Bäumen sitzen, die waren gestaltet gleichwie Menschen; aber ihre Haut war wie eines Tieres Fell. Und sie flohen vor ihnen und ruderten zum Schiffe. Aber Deinam blieb bei den Ungeheuern —«
(Hier war eine größere Lücke in der Tontafel; der Rest lautete):
»— — — kamen abermals im anderen Jahr bis zu der Anfurt, da Deinam sie verlassen hatte. Und siehe: Deinam saß am Strande und um ihn saßen die Ungeheuer und schrieben in den weichen Sand des Meerufers die Worte, die Deinam ihnen vorsprach —«
Hier endete das Bruchstück.
Professor Schalk ließ Tontafel und Lupe sinken und blickte vor sich hin. Eine rätselhafte Inschrift! Ihres uralten Gewandes entkleidet, hieß sie nichts anderes, als daß Deinam, wahrscheinlich ein ehrgeiziger, vertriebener Prinz aus der letzten babylonischen Dynastie, nach Ägypten an den Hof des Pharaos Necho geflüchtet und von dort mit den Phöniziern, die in Nechos Auftrag um das Jahr 600 v. Chr. Afrika umschifft hatten, an einer unbekannten Küste, vielleicht Guinea, gelandet war. Aus Furcht vor den dort hausenden menschenähnlichen Ungeheuern, das heißt also Menschenaffen, seien seine Begleiter geflohen; er selbst aber sei bei den Affen geblieben und habe sie — nach dem Schluß des Berichtes — in der Kunst des Schreibens unterrichtet!
Vielleicht hätte Professor Schalk dem Wortlaut der Tontafel weniger Wert beigelegt und in ihrem rätselhaften Berichte nur eine jener landläufigen Übertreibungen und märchenhaften Ausschmückungen erblickt, mit denen die Seefahrer früherer Zeiten und namentlich die Phönizier ihre Erzählungen bestandener Abenteuer zu würzen wußten — wenn die seltsame Angelegenheit nicht aus zwei Ursachen für ihn tiefere Bedeutung gewonnen hätte.
Zunächst hatte sie für ihn ein persönliches Interesse, insofern dabei seine wissenschaftliche Autorität in Frage kam. Professor Monkey in London hatte schon vor einigen Jahren eine fast gleichlautende Tontafel in den Ruinen von Babylon ausgegraben, nicht so gut erhalten als die vorliegende, aber in einzelnen Teilen deutlich entzifferbar. Und eine Stelle hatte zwischen Monkey und ihm eine längere Polemik veranlaßt. Auch auf der Monkey'schen Tafel fanden sich die Schlußworte des obigen Berichtes:
»— und um ihn saßen die Ungeheuer und schrieben in den weichen Ufersand die Worte, die Deinam ihnen vorsprach —«
Professor Schalk bezweifelte nun die richtige Übersetzung des Wortes »Ungeheuer»; er suchte in einer sehr geistvollen Untersuchung die Hypothese zu verfechten, daß für jene Keilschriftstelle die Konjektur »Urbewohner« oder »Eingeborene« allein den richtigen Sinn ergebe. So übersetzt, habe die Stelle keinerlei Schwierigkeit, und alle an sie geknüpften mehr oder weniger geistreichen Kombinationen über die »Weiterbildung des tierischen Intellekts« usw. seien damit haltlos geworden. Freilich gelang es Professor Schalk nicht, seinen Gegner zu überzeugen, ja — Monkey ward sein erbitterter Feind.
Zweitens hatte vor einigen Wochen ein Bericht der französischen Akademie der Wissenschaften von einer unglaublich klingenden Entdeckung gesprochen, die ein junger Afrikaforscher, M. Ernest Frédéric, in einem bisher völlig unerforschten Gebiete Innerafrikas gemacht hatte: in einem der neuen, lenkbaren Luftschiffe die Äquatorialgegend überfliegend, hatte er in einem ganz unzugänglichen, wahrhaft idyllischen Gebirgstal in primitiv angelegten Baumhütten ein Affenvolk angetroffen und in einer dieser Hütten einen Affen, der auf die sonnengebleichte Fläche eines Palmblattes mit einer Art Rohrfeder schrieb — buchstabenartige Zeichen schrieb! Bei der Annäherung des Luftschiffs waren leider alle Vierhänder, auch der schreibende, geflohen; eines der beschriebenen Palmblätter aber hatte er in der Hast liegen lassen, und die Photographie davon lag dem Berichte der französischen Akademie bei. Auch Professor Schalk besaß eine Kopie davon, die er nun einem Fach seines Arbeitstisches entnahm.
Der Gelehrte verglich die Schriftzüge der Tontafel unwillkürlich mit denen des Palmblattes. Auf den ersten Blick zeigten sie kaum die Spur einer Ähnlichkeit.
Trotzdem vermochte Professor Schalk bei der wiederholten Vergleichung beider Inschriften nur schwer den Gedanken abzuweisen, der durch die seltsame Aufeinanderfolge der beiden Entdeckungen nur noch verstärkt wurde: daß trotz des ungeheuren Zeitunterschiedes zwischen beiden rätselhaften Dokumenten ein Zusammenhang bestehen müsse!
Das Unerwartete, das so oft im Leben den Gang unserer Entschließungen beeinflußt, sollte auch für Professor Schalk Bedeutung gewinnen! Wenige Tage nach dem oben Erzählten ließ sich ein Fremder bei ihm melden. Zerstreut las Professor Schalk die Visitenkarte und wußte im Augenblick kaum, was den Gemeldeten zu ihm führen könne. Aber schon nach den ersten Worten der Begrüßung erkannte der Gelehrte, wen er vor sich hatte: Frédéric, der junge Afrikaforscher, der Entdecker des rätselhaften »schreibenden Affen«, stand vor ihm und trug ihm seine Bitte vor, ihn auf dem kürzesten Wege in die Kenntnis der — Keilschrift und der damit verwandten Schriftarten der vorderasiatischen Völker einzuführen.
Er teilte dem Assyriologen seinen Plan mit, in kurzer Frist eine neue Entdeckungsfahrt im lenkbaren Ballon nach Zentralafrika zu unternehmen, um Genaueres über das bisher unerklärliche Phänomen der »Affenschrift« zu erforschen. Seit Professor Garner die Affensprache entdeckt habe, sei die Hypothese ja nicht ganz abzuweisen, daß die hohe Intelligenz der afrikanischen Menschenaffen auch auf eine schriftliche Fixierung des Gesprochenen gefallen sei, so unwahrscheinlich das Faktum auch erscheine. Schriftkundige hätten ihm gesagt, daß der Charakter der von ihm aufgefundenen Palmblattschrift am meisten der einer vereinfachten Keilschrift ähnlich sei, und hätten ihn an seine Adresse gewiesen. Er hoffe auf seiner neuen Entdeckungsfahrt die rätselhaften Geschöpfe wieder aufzufinden, ihr Leben und Treiben längere Zeit zu beobachten und an Ort und Stelle Forschungen über die Affenschrift zu machen. Unzweifelhaft müsse die Kenntnis der Keilschrift, falls eine lautliche Verwandtschaft mit ihr vorhanden sei, bei der Entzifferung der Affenschrift von großem Vorteil sein.
Professor Schalk hatte den jungen, lebhaft für seine Pläne begeisterten Franzosen ausreden lassen und überreichte ihm dann die Tontafel. »Was werden Sie sagen, M. Frédéric, wenn Sie hören, daß diese halbzerbrochene Tontafel aus den Ruinen von Babylon eine Nachricht enthält, die — vor Jahrtausenden geschrieben — doch wie für Sie und Ihre Entdeckung allein bestimmt scheint?«
»Für mich, Herr Professor?«, fragte der junge Forscher, mit grenzenloser Verwunderung ihn ansehend.
»Ja — für Sie, M. Frédéric!«, bestätigte der Professor. »Diese Tafel enthält gewissermaßen das erste Kapitel der rätselhaften Geschichte, zu der Ihre außerordentliche Entdeckung die Fortsetzung liefert —«
»Unmöglich, Herr Professor! Wie soll ich das verstehen?«
»Sie werden es sogleich verstehen, M. Frédéric. Ich muß Ihnen dabei auch gestehen, daß die Entzifferung dieses Tontäfelchens mich einen schweren Kampf gekostet hat, den Kampf meiner bisherigen wissenschaftlichen Überzeugung mit dem ihr widerstreitenden Faktum. Doch hören Sie —«
Und nun teilte Professor Schalk ihm den Inhalt der Tafel mit und schloß daran die Folgerungen über den wahrscheinlichen Zusammenhang der Tätigkeit des babylonischen Flüchtlings unter den Menschenaffen Zentralafrikas mit den von dem französischen Forscher aufgefundenen »schreibenden Affen«, Die heute lebenden schriftkundigen Vierhänder seien allem Anscheine nach die direkten Nachkommen jener, die einst zu den Füßen Deinams, im Ufersand schreibend, gesessen.
Der junge Entdecker mußte dem Assyriologen immer mehr beistimmen, je länger er seinen Ausführungen zuhörte.
»Und ist sonst über diesen ›Deinam‹ nichts aus der babylonischen Geschichte bekannt?«, fragte er im Laufe des Gesprächs.
»Nur wenig, M. Frédéric; aber es hat für mich einen außerordentlichen Reiz, aus diesen spärlichen geschichtlichen Überlieferungen mir das Charakterbild dieses außerordentlichen, ich möchte fast sagen ›modernen‹ Menschen zu rekonstruieren. Denken Sie sich eine Herrennatur, einen ›Übermenschen‹, mit allen Vorzügen des Geistes und Körpers ausgestattet, einen geborenen Herrscher! Denken Sie sich einen solchen Mann durch die damalige Staatsraison zur Tatlosigkeit verurteilt, von der Thronfolge ausgeschlossen, dabei erzogen in aller Chaldäerweisheit, an Wissen und Wollen seine Zeitgenossen turmhoch überragend! Intrigen verbannen ihn vom väterlichen Hofe; als heimatloser Flüchtling wandert er von einem Lande ins andere. Überall hofft er auf eine Unterstützung seiner ehrgeizigen Bestrebungen, überall vergebens! Gegen das übermächtige Babylon wagt keiner der umliegenden Staaten aufzutreten. Ist es ein Wunder, wenn ihm die Menschennatur, von der er als Priesterzögling und Königssproß überhaupt nur geringe Meinung hegte, immer erbärmlicher, immer hassenswerter erschien? Ist es ein Wunder, wenn sich dieses Gefühl allmählich zu völliger Menschenfeindschaft ausbildete, die ihn schließlich mit den Affen Afrikas Gemeinschaft halten ließ? Denn der Text dieser neu aufgefundenen Tafel läßt darüber keinen Zweifel mehr.«
»Aber dieser Einfall, den Affen die Kunst des Schreibens — und sie ist undenkbar ohne das Verständnis einer Lautsprache — bringen zu wollen?«, rief der französische Forscher dazwischen.
»Ihr Einwurf führt uns zur interessantesten Seite dieses seltsamen Mannes«, entgegnete Professor Schalk. »Vergessen Sie einmal einen Augenblick Ihre moderneuropäische Erziehung; denken Sie sich in die Seele eines Asiaten vor zwei Jahrtausenden. Für ihn war die Kluft zwischen Mensch und Tier noch nicht so tief und weit: seine Götter trugen häufig Tiergestalt — ich erinnere Sie nur an die löwenköpfige Göttin Sechmet der Ägypter, an Hanuman, den Affenkönig der Inder! — seine Könige leiteten ihre Herkunft häufig von sagenhaften Tieren ab! Was heute die Entwicklungslehre mühsam als das Ergebnis langwieriger Forschungen hinstellt, die Verwandtschaft aller Geschöpfe, das war in jener naiven Vorzeit etwas Selbstverständliches. Genug, der Schlußsatz dieser Tontafel beweist es: Deinam hat die Kluft überbrückt und die Affen die Kunst des Schreibens gelehrt —«
»Zu welchem Zweck aber?«
»Zu welchem Zweck — fragen Sie? Nun, zuerst wohl, um seinem nie ruhenden Geist eine Beschäftigung zu verschaffen, die ihn seine Mißerfolge unter den Menschen vergessen ließ — dann aber, wenn diese Hypothese nicht gar zu gewagt klingt, um die in jener Zeit gewiß in weit größerer Zahl existierenden Menschenaffen weiterzubilden, zu vermenschlichen, sie wohl gar gegen die Menschheit zu organisieren!«
Ernest Frédéric sah den Professor voller Überraschung an.
»Gewissermaßen eine Demonstration à la Darwin v o r Darwin — Herr Professor?«
»Wenn wir uns recht verstehen — ja! Und, einmal angenommen, Darwin habe recht mit seiner Hypothese, nach welcher Mensch und Affe von einem gemeinsamen Urgeschöpf abstammen, das in sich die Ansätze zur anthropoiden wie zur pithekoiden Weiterbildung trug, so mußte vor mehr als zwei Jahrtausenden die Kluft zwischen den beiden ›Vettern‹ etwas geringer sein als heute; sie waren ja beide eine kleine Zeitspanne dem Punkte näher, wo die Gabelung ihrer Entwicklung begonnen hatte, nicht wahr?«
»Ich muß Ihnen beistimmen, Herr Professor, und muß Ihnen außerdem bekennen, daß durch Ihre überraschenden Darlegungen mein Interesse an meiner Entdeckung, aber auch meine Ungeduld und mein Eifer gewachsen sind, die Kenntnis der Keilschrift mir anzueignen. Darf ich hoffen, daß Sie mich als Schüler annehmen?«
»Ja, M. Frédéric. Ich will Sie gern auf dem kürzesten Wege in der Keilschrift unterrichten; aber ich bitte dafür um eine Gegenleistung —«
»Wenn ich irgend dazu imstande bin, verehrter Herr Professor! Verfügen Sie über mich.«
»Nun denn: Sie sollen bei Ihrer nächsten Expedition zu jenem geheimnisvollen schreibenden Affenvolk mir einen Platz in Ihrem Luftschiff reservieren. Wollen Sie das?«
»Ob ich will! Derselbe Gedanke ruhte als unausgesprochene Bitte in mir, als ich mich bei Ihnen melden ließ.«
Professor Schalk hielt dem jungen Forscher die Hand hin. »Abgemacht! Mitte August können Sie Keilschrift lesen!«
Der junge Forscher schlug ein. »Abgemacht, Herr Professor! Ende August fliegen wir zu den schreibenden Affen!«
Am 29. August dieses Jahres schwebte über einem zerklüfteten Felsgebiete Zentralafrikas ein zigarrenförmiges Luftschiff. Seine unregelmäßigen Bewegungen im Luftmeer schienen darauf hinzudeuten, daß es auf der Suche nach einem bestimmten Punkte des unter ihm in launischem Wirrwarr sich ausbreitenden Terrains sei. Es stieg höher, beschrieb einige Kurven, kam dann wieder tiefer herab und fuhr eine Weile in derselben Richtung, stieg dann von neuem empor und wiederholte dies Manöver eine geraume Zeit.
In der schiffartigen Gondel des Ballons saßen drei Männer: Professor Schalk, M. Ernest Frédéric und der Maschinist.
»Nun, M. Frédéric«, sagte der Professor, als der junge Franzose abermals dem Maschinisten das Zeichen zum Höhersteigen gegeben hatte, »Ihre frühere Ortsbestimmung scheint doch einen kleinen Fehler zu haben. Unsere Ablesung ergibt für unseren jetzigen Ort 0° 37 Minuten 42,5 Sekunden nördl. Br. und 10° 32 Minuten 45 Sekunden östl. L., also fast auf die Sekunde genau den Punkt Ihrer ersten Entdeckung; aber noch ist keine Spur der gesuchten Gegend zu erblicken.«
»Ich glaube mich trotzdem nicht geirrt zu haben«, entgegnete M. Frédéric, abermals sein Relieffernrohr gebrauchend — »wir müssen am Ziele sein! Ja — sehen Sie, Herr Professor, dort unten das grüne Fleckchen?«
Der Professor nickte.
»Das ist der riesige Baobab oder Affenbrotbaum, der am Eingang des von mir entdeckten Tales steht. Und nun heißt es, Vorbereitungen zur unbemerkten Landung zu treffen. Wir wollen jene Terrainfalte zur Verankerung unseres Ballons benutzen!«
Damit wandte er sich zum Maschinisten und gab ihm die nötigen Anweisungen...
Eine Stunde später ruhte der Ballon auf einer Bergmatte, fest am Boden verankert, von dem Maschinisten Dion bewacht.
M. Frédéric aber und der Professor kletterten vorsichtig abwärts, um unbemerkt den Eingang ins Tal der schreibenden Affen zu gewinnen. Fast zehn Stunden waren vergangen, als die beiden Forscher endlich die Talsohle erreichten.
Ein in üppigster Vegetation prangendes Paradies lag vor ihnen. Der fruchtbare Boden trug farbenglühende Tropenpflanzen, balsamischer Duft gewürzreicher Stauden erfüllte die Lüfte, buntfarbige Vögel wiegten sich in den Zweigen der Bäume, deren Wurzeln von einem schnellfließenden, geschwätzig murmelnden Bergwässerchen getränkt wurden.
»Wir haben Glück, Herr Professor!«, rief M. Frédéric, leise einen verdeckenden Zweig beiseite schiebend, »sehen Sie dort, auf der kleinen Anhöhe, die am Boden hockenden Affen?«
»Ja«, entgegnete der Professor flüsternd, sein Doppelfernrohr ans Auge führend, »und unter ihnen sitzt das vierhändige Wunder, der schreibende Affe!«
Vorsichtig jede Deckung benutzend, pirschten sie sich näher an die Affenherde heran. Schon waren sie, seitlich heranschleichend, an den Fuß des kleinen Hügels gekommen und vermochten aus nächster Nähe die ganze Gruppe, vor allem den schreibenden Affen zu beobachten.
Der schreibende Affe hielt den Kopf über ein Palmblatt geneigt und schrieb mit einer Art Pinsel aus gespaltenem Schilfrohr Zeichen um Zeichen, ab und zu das Schreibrohr in eine mit dunklem Farbstoff gefüllte halbe Kokosnußschale tauchend. Jetzt — noch ein paar Schritte — noch einer! Mit einem gewaltigen Satze stürmen die beiden Männer auf die Affenherde los.
Ein ohrenbetäubendes Kreischen: Schwärme buntbefiederter Vögel fliegen auf; im Nu stiebt die vierhändige Gesellschaft auseinander und schwingt sich auf die rettenden Zweige über ihnen!
Aber den einen von ihnen, den schreibenden Affen, halten die nervigen Fäuste der beiden Forscher gepackt. Wütend sträubt er sich gegen seine Angreifer! Da — bei einem neuen Versuch, sich ihnen zu entwinden, zerreißt plötzlich das Affenfell an Brust und Armen und das Weiß der menschlichen Haut leuchtet aus dem Risse hervor.
»Das ist ja gar kein Affe!«, ruft M. Frédéric verblüfft aus — »das ist ja ein Mensch!«
»Professor Monkey!«, entringt es sich in demselben Augenblick Professor Schalks Lippen.
Der PseudoAffe hat eine Maske heruntergerissen, die bisher den oberen Teil seines Gesichts verhüllte.
»Ja — Professor Monkey! Was stören Sie mich in meinen wissenschaftlichen Arbeiten, meine Herren?«, kommt es grollend aus seinem Munde, »was suchen Sie hier?«
»Herr Professor, verehrter Herr Kollege! Verzeihen Sie zunächst gütigst die Überrumpelung; aber die Täuschung war zu frappant! Wir suchen nämlich hier in diesem äquatorialen Paradies den ›schreibenden Affen‹, von dem Sie gewiß durch die Entdeckungen eines jungen französischen Forschers, M. Frédéric, den ich Ihnen hiermit vorzustellen die Ehre habe, ebenfalls gehört haben.«
»Ja — ich habe davon gelesen: es war mir äußerst interessant und belustigend, Sie und die gesamte Wissenschaft so mystifiziert zu haben, mein Herr.«
»Was meinen Sie damit, mein Herr?«, fragte M. Frédéric scharf.
»Mich haben Sie entdeckt, mein Herr, als ich, wie heute, im Affenkostüm unter meinen Vierhändern saß, um ihren Nachahmungstrieb mit meinen Schreibübungen zu erregen. Sie kennen ohne Zweifel den wissenschaftlichen Zwist zwischen Professor Schalk und mir?«
»Und bis hierher hat Sie unsere kleine Polemik getrieben, Herr Kollege«, fiel Professor Schalk ein, »bis hierher in die afrikanischen Urwälder?«
»Ja — bis hierher — wie Sie, mein Herr!«, bestätigte spöttisch Professor Monkey.
»Hätte ich ahnen können, daß sich die rätselhafte Ähnlichkeit der von Ihnen auf jenem Palmblatte gefundenen Schriftzüge mit den Urformen der Keilschrift so aufklären würde, M. Frédéric«, sagte Professor Schalk, nun ebenfalls gereizt, »so hätte ich mir die Unbequemlichkeiten und Entbehrungen unserer Reise gespart.«
»Ich auch!«, rief M. Frédéric enttäuscht aus, »und die Akademie der Wissenschaften wird es mir wenig Dank wissen, daß ich mich so habe düpieren lassen! Von allen sonst für meine Expedition gebrachten Opfern will ich dabei gar nicht reden! Aber, daß meine ganze wissenschaftliche Ehre durch eine solche Maskerade vernichtet werden soll —«
Der junge, leichtbewegte Franzose wandte sich in bitterem Unmut ab.
Professor Schalk hatte eins der am Boden verstreuten, beschriebenen Palmblätter aufgenommen und überflog es mechanisch. Eine lange Pause entstand unter den drei Männern. Da sagte auf einmal Professor Monkey, zu dem französischen Forscher herantretend und ihm die Hand auf die Schulter legend:
»Ihre wissenschaftliche Ehre ist nicht vernichtet, junger Freund!«
»Wie soll ich Sie verstehen, mein Herr?«, fragte M. Frédéric.
»Zwar war ich es, den Sie vor einigen Monaten hier am Baobab im Affenkleide schreibend überraschten — aber das Palmblatt mit den keilschriftähnlichen Hieroglyphen, welches Sie am Boden fanden, stammt in Wahrheit von einem schreibenden Affen!«
Mit lauten Ausrufen der Überraschung und Verwunderung wandten sich die beiden Männer zu Professor Monkey.
»Ja, mein Herr Kollege und Gegner: es stammt in Wahrheit von einem noch existierenden, schreibenden Affen und — wie Sie selbst bestätigen sollen! — von einem letzten überlebenden Nachkommen jener vielbezweifelten vierhändigen Schüler Deinams!«
»Den Beweis, verehrter Herr Kollege?«, rief Professor Schalk in begreiflicher Erregung aus.
»Den Beweis will ich Ihnen in einigen Stunden liefern, wenn Sie mich hier am Fuße des Baobab wieder erwarten wollen.« Damit wandte er sich und verschwand im Gebüsche...
3 .
Wie verabredet, erschien Professor Monkey wieder, diesmal in »menschlichem Gewande, und die drei Forscher machten sich auf den Weg.
Der Pfad stieg immer bergan, immer am Rande der Schlucht, durch welche Professor Schalk und M. Frédéric vom Luftschiff aus zur Talsohle hinabgeklettert waren...
»Mit allen unsern gerühmten Erfolgen sind wir doch vom Glück der Stunde abhängig«, sagte Professor Monkey im Verlaufe der Unterhaltung. »So sehr war ich und blieb ich trotz aller Gegengründe damals von der Wahrheit meiner Keilschriftübersetzung überzeugt, daß ich beschloß, auf eigene Faust hier in Innerafrika Unterrichtsversuche mit Menschenaffen anzustellen. Unter furchtbaren Strapazen gelangte ich schließlich aus dem Grenzgebiete des NyamNyam hierher in dieses idyllische, selbst den umwohnenden Negerstämmen unbekannte Gebirgstal. Ich hüllte mich in meine Verkleidung und begann meine Versuche. Wohl gelang es mir, die Neugier des unruhigen, ewig beweglichen Affenvölkchens zu erregen, seine angeborene Scheu zu bannen und es an meine Erscheinung zu gewöhnen; wohl fanden sich einige, die wie spielende Kinder meine Rohrfeder in die Finger nahmen — aber sie zum Nachmalen von Zeichen nur rein mechanisch zu bewegen, daran glaubte ich schließlich verzweifeln zu müssen! Aber dies Verzweifeln bedeutete für mich zugleich ein Eingestehen meines wissenschaftlichen Irrtums, also eine Niederlage — und Sie können denken, daß mich der Gedanke daran immer von neuem wieder die Versuche beginnen ließ.«
»Es fehlt eben das Bindeglied einer Lautsprache, einer hörbaren Vermittlung der Zeichen!«, warf Professor Schalk ein.
»Gewiß; — aber auch die Taubstummen lernen schreiben, wenn auch bei ihnen eine ganz andere intellektuelle Veranlagung zu Hilfe kommt. Immer wieder spornte mich — wie noch heute — das Vorbild Deinams, dessen Erfolge ich nur in einer einzigen Stunde meines Hierseins in verzagendem Kleinmut bezweifelt habe — in jener Stunde, die mir mitten in der Verzweiflung zugleich den schönsten Trost bescherte, jenes beschriebene Palmblatt, beschrieben von der Hand eines wirklich schreibenden Affen.«
»Und wie erhielten Sie es?«, fragte M. Frédéric.
»Ich saß, wie alle Tage, unter meinen Vierhändern und schrieb, ab und zu einem der zutraulichsten, zunächsthockenden eine eingetauchte Feder reichend und ihm die Hand führend. Ich bemerkte dabei, daß einer der zutraulichsten, intelligentesten meiner Affen fehlte, der sonst immer ganz dicht bei mir saß und mit emsiger Aufmerksamkeit meine Schreibübungen verfolgte. Als ich endlich aufstand, um etwas zu meiner leiblichen Stärkung zu genießen, sprang mir plötzlich dicht vor meiner Hütte der vermißte Affe entgegen und hielt in der Hand — jenes Palmblatt! Ich brauche Ihnen nicht die namenlose Aufregung zu schildern, in die ich geriet. Auf den ersten Blick erkannte ich Keilschriftcharaktere, wie sie von einigen jungbabylonischen Gelehrten zu einer Art vereinfachter Kurzschrift benutzt worden sind! Durch allerlei Zeichen suchte ich von dem vierhändigen Überbringer die Herkunft jenes Blattes zu erfahren. Er verstand mich; mit lustigen Klettersprüngen eilte er vor mir her, ungefähr den Pfad einhaltend, den ich Sie jetzt führe — bis hierher, an diese steile Felswand —«
Professor Monkey deutete auf eine fast senkrecht abfallende Steinwand zur Rechten ihres Weges.
In grenzenlosem Staunen standen die beiden anderen Forscher vor der riesigen Felsplatte: sie war von oben bis unten mit — Keilschrift bedeckt!
Professor Monkey deutete auf ein paar Schriftzeichen ungefähr in der Mitte des Textes: »Deinam« lasen seine Begleiter, den Namen, der sie geheimnisvoll bis hierher geleitet hatte, wie ein strahlendes Gestirn!
»Zweifeln Sie noch, Herr Kollege«, sagte Professor Monkey, »daß Sie hier auf den Spuren des großen heimatlosen Babyloniers wandeln? Wenn noch ein Restchen Zweifel in Ihrer Seele lebt — im nächsten Augenblick wird es vergehen im Lichte der Wahrheit!«
Professor Monkey schritt voran; schroff hinter der Felsplatte bog der Pfad steil abwärts und ein gähnender Spalt tat sich auf. Und da, durch den schmalen Felsenschlitz am Boden, durch dessen Enge höchstens der schmiegsamgelenkige Körper eines jungen Affen sich durchzuzwängen vermochte, blickten Professor Schalk und sein junger Begleiter wie durch ein Guckloch hinab in ein kleines, tief unten liegendes, rings von steil überhängenden Felsen eingeschlossenes Tal, ein Miniaturabbild dessen, aus dem sie aufgestiegen waren. Und mitten in diesem Tal, unter einem Felsvorsprung saß der, den sie suchten, dessen Existenz Professor Schalk noch bis zu diesem Augenblick angezweifelt hatte — der schreibende Affe.
Ein wunderbares Geschöpf! Der ganze obere Teil des Körpers, namentlich der Kopf fast völlig, wie der eines Menschen, die Stirne höher als bei den heute lebenden Menschenaffen, der Nasenrücken stark hervorspringend, die Kiefer stark, aber nicht so tierisch, wie es sonst der Typus zeigt, Hals und Brust fast nackt, von rötlichbrauner Hautfarbe, die Behaarung auf dem Kopf und an den Wangen schneeweiß!
Vor ihm lag ein Haufe übereinander geschichteter, beschriebener Palmblätter; auf das obere malte die zierliche schreibende Hand des linken Armes Zeichen um Zeichen.
»Er schreibt, er schreibt wirklich«, flüsterte Professor Schalk seinem jungen Begleiter zu.
»Ja — er schreibt, meine Herren«, sagte Professor Monkey einfach — »und mit Ihrem Fernrohr werden Sie auch die Art seiner Schriftzüge erkennen. Und jetzt richtet er sich auf.«
Hoch aufgerichtet stand der Affe vor seinem Felsensitze.
»Sehen Sie das schurzartige Gewand, das er trägt, meine Herren? Die Hand, die das Schreiben erlernte, ist auch geübt in allerlei primitivem Flechtwerk! Sehen Sie die bunten Ketten am Halse, die bunten Schnüre an seinen Armen? Er hat sie aus lebhaft gefärbten, haselnußgroßen Früchten verfertigt!«
»Wie weiß sein Haarkleid erscheint!«, rief M. Frédéric.
»Er ist alt, uralt«, entgegnete Professor Monkey darauf, »und ich wage nicht, sein Alter zu bestimmen! Er ist der letzte seines Stammes und, seit ein gewaltiger Felsblock diesen engeren Teil des Gebirgstales von dem übrigen wahrscheinlich bei einem Erdbeben absperrte, ein Gefangener! Aber in seinem Gefängnis fließt der Bach, der auch uns mit Wasser versorgt, und die Früchte reifen weiter für ihn, wie seit langer Zeit.«
»Schade, daß wir keinen Sprengstoff in unserem Ballon mitgeführt haben, um diese schmale Felsenspalte zu erweitern«, sagte M. Frédéric.
»Nun, was hindert Sie, wiederzukommen und sich durch solche Hilfsmittel Zugang zu ihm zu bahnen?«, fragte Professor Schalk.
»Aber dann beeilen Sie sich, lieber junger Freund!«, sagte Professor Monkey, »er wird immer schwächer; seit meinem letzten Hiersein hat er sein Arbeitsplätzchen viel näher an den kleinen Wasserlauf heranverlegt, das Gehen und Wasserschöpfen wird ihm immer schwerer.«
»Wollen wir ihn einmal anrufen?«, fragte Professor Schalk.
»Tun Sie es, Herr Kollege! Er wird scheu umherblicken und wird — weiter schreiben. Es ist, als ob er jedes Verständnis für die Außenwelt verloren habe; nur seine Schreiblust und Schreibfertigkeit, das Erbe ungezählter Generationen seines Stammes, ist ihm lebendig geblieben.«
»Deinam!«, rief der Professor Schalk mit lauter Stimme durch den Felsspalt hinab — »Deinam!«
Wie Donner rollte der uralte Klang an den Wänden der engen Schlucht dahin.
Und da geschah etwas Wunderbares: der schreibende Affe, der sich wieder über seine Palmblätter gebeugt hatte, ließ die Rohrfeder fallen, erhob sich, magisch von dem Klange belebt, und kam langsam und feierlich, mit erhobenen Armen, auf eine bestimmte Stelle der Felswand zu. In atemloser Spannung beobachteten die drei Forscher sein seltsames Gebaren.
Jetzt stand er still, berührte mit den Händen seine Stirn und neigte sich, wie ein Betender im alten Babylon.
»D e i n a m« stand in uralten, tiefeingehauenen Riesenzeichen in Keilschrift dort an der steilen Felswand.
»— und ich glaube nun beinahe, daß Rabbi Ben Akiba recht hat!«, sagte mein Freund Hintze.
Wir standen in seinem Laboratorium. Mein Freund hatte soeben die verblüffend kühne Behauptung aufgestellt, daß das geheimnisvolle Radium und die radioaktiven Stoffe lange vor Madame Curie schon einmal entdeckt worden seien.
»Und wer war der geheimnisvolle Entdecker?«
»Ein griechischer Gelehrter, Theodulos Energeios«, antwortete mein Freund, »und das Wunderbarste an seiner Entdeckung scheint mir, daß er wahrscheinlich gar keine Ahnung von seinem wundersamen Funde gehabt hat, ja, darüber hinweggestorben ist, ohne ihre eigentliche Bedeutung erkannt zu haben.«
»Wenn Sie etwas weniger mystisch sich äußern würden, lieber Freund«, konnte ich mich nicht enthalten zu bemerken, »würde es für die Sache selbst und für mein Verständnis entschieden besser sein!«
»Schön«, erwiderte Freund Hintze, »ich weiß aber im voraus, daß die ganze Sache Ihnen absurd erscheinen wird, wenn ich sie mit dem Namen nenne, den Theodulos Energeios ihr gegeben hat; er gehört leider zu den sonderbaren Käuzen, die da glauben, das ›Perpetuum mobile‹ erfunden zu haben.«
Ich wandte mich enttäuscht ab.
»Sehen Sie«, sagte mein Freund lächelnd, »ich wußte es. Mir ging es ja ebenso! — Aber ich freue mich, daß ich trotzdem der kuriosen Geschichte nähergetreten bin — und mit Ihrer Assistenz bis auf den Grund zu kommen hoffe.«
»Aber ein Perpetuum mobile kann nur ein Ignorant zu erfinden glauben!«, warf ich verächtlich ein.
»Seien wir nicht zu stolz«, sagte mein Freund. »Als die ersten Nachrichten von der Entdeckung des Radiums und seiner schier unerschöpflichen Energieabgabe durch die Welt schwirrten, tauchten in so manchem Kopfe unsrer naturwissenschaftlich geschulten Generation die alten Träume von der Möglichkeit eines solchen Perpetuum mobile wieder auf! Deswegen laß ich mir den alten Theodulos Energeios nicht schelten.«
»Und welche Arbeit leistete denn diese wunderliche Maschine?«, fragte ich spöttisch.
»Sie ist nach dem Berichte ihres Erbauers eine Universalmaschine: Sie liefert je nach der Einschaltung: Wärme, Licht, Elektrizität oder chemische Arbeit.«
»Also eine Idealmaschine, wie wir sie auch in unsern Tagen immer noch sehr gut brauchen könnten.«
»Ja«, bestätigte mein Freund, »und wie wir sie eben bisher en miniature nur in einem einzigen Stoffe der Welt, im Radium, vor uns haben.«
Ich mochte wohl noch immer ein sehr ungläubiges Gesicht machen; denn der Freund setzte hinzu:
»Relata refero. — Wieviel davon in Wahrheit geleistet wird, kann ich freilich nicht sagen.«
»Aber — woher haben Sie denn überhaupt die Nachricht von dem Perpetuum mobile des Theodulos Energeios, lieber Freund?«
»Von ihm selber!«
»Also nicht aus einer wissenschaftlichen Publikation?«
»Aus einem Manuskripte des Theodulos Energeios!«
»Und wie sind Sie dazu gekommen?«
»Ich habe es gefunden!«
»Wie? Gefunden? Aber wo?«
»Unter alten Papieren! — Theodulos Energeios ist — seit hundert Jahren tot!«
Abermals starrte ich meinen Freund erstaunt an.
»Hören Sie zu, lieber Freund; ich will nicht länger mit Ihnen Versteck spielen! — Sie wissen, daß mir der amtliche Auftrag wurde, die wissenschaftliche Hinterlassenschaft Professor Bambergs für das hiesige Naturwissenschaftliche Institut zu sichten. Wahre Unika finden sich darunter! — Beim Durchstöbern der Kataloge und Beschreibungen und so weiter stieß ich auf ein altes Manuskript — in griechischen Lettern — neugriechisch! — Und darin beschreibt Theodulos Energeios — das Schriftstück stammt aus dem Jahre 1808! — ausführlich seine Entdeckung und gibt auch eine — leider fast verblichene, sehr schlecht erhaltene Zeichnung der auf Grund seiner Entdeckung erbauten Maschine.«
»Eine Mystifikation!«, warf ich zweifelnd ein.
»Durchaus nicht, lautere Wahrheit! Das Manuskript trägt nämlich einen später hinzugefügten Anhang, in welchem die Behörde Athens beglaubigt, daß der Verfasser des Schriftstücks, eben unser Theodulos Energeios, den jedermann als einen rüstigen Fünfziger gekannt, plötzlich zum schneeweißen, zitternden Greise geworden sei, und daß man auf seinen Wunsch bei seinem Tode die von ihm konstruierte Maschine an einer verborgenen Stelle seines Gartens begraben habe.«
»Sonderbar! — Und seine Maschine? Ruht sie noch in klassischer Erde?«
»Nein!«, entgegnete mein Freund mit geheimnisvollem Lächeln.
»Und wo ist sie geblieben?«
»Sie steht heute unter dem ausrangierten Apparatengerümpel, das wir auf dem Boden des Professor Bamberg'schen Laboratoriums gefunden haben.«
»Haben Sie sie schon gesehen?«
»Ja! Das heißt die Kiste, in der sie verborgen wurde!«
»Nun und —?«, fragte ich in großer Spannung.
»Gestern habe ich eine schwere, dick mit Eisen beschlagene Kiste entdeckt, auf deren Deckel ein vergilbter Papierstreifen klebt — mit der gleichen Aufschrift, wie sie das Manuskript trug.«
»Und wann gedenken Sie die geheimnisvolle Kiste zu öffnen, lieber Freund?«
»Wollen Sie mir dabei helfen?«
»Selbstverständlich! — Selbst auf die Gefahr hin, daß uns der alte Grieche noch nach hundert Jahren an der Nase führt!«
»Das hoffe ich nicht. Aber auf etwas andres muß ich Sie vorher aufmerksam machen: Für mich steht es fest, daß zwischen der Maschine des Theodulos Energeios und seinem plötzlichen Greisentum ein ursächlicher Zusammenhang existiert! Das Dynamin — so heißt nämlich der Stoff, den er als unerschöpflichen Generator in seiner Maschine verwendet, ist meines Erachtens nichts andres, als eine höchst energische radioaktive Substanz — und ihre verderbliche Strahlung hat ihn vorzeitig seiner körperlichen Kraft und Gesundheit beraubt. Wir wissen zwar noch nichts über die Wirkung größerer Radiummengen auf den menschlichen Körper, aber es ist sicher anzunehmen, daß sie diejenige der Röntgenstrahlen gewaltig übertreffen wird. Unser Experimentieren mit der mysteriösen Maschine birgt also eine Gefahr in sich, um so unbekannter und unberechenbarer, als die Wissenschaft bisher keinen Präzedenzfall über das Arbeiten mit so großen Mengen radioaktiver Stoffe kennt! — Dabei muß ich Ihnen doch mitteilen, wie Theodulos Energeios diese von ihm zu spät erkannte organismusstörende Wirkung seines ›Dynamins‹ sich zu erklären versucht hat.«
Er entnahm seiner Brieftasche ein Blatt.
»Hier — lesen Sie, bitte. Ich habe Ihnen die Stelle — es ist der Schluß seines Manuskriptes — aus der Übersetzung abgeschrieben.«
Und ich las:
»Darum fing meine Maschine plötzlich an, langsamer zu gehen! Nicht das Dynamin also war die Quelle seiner bisher ununterbrochenen Tätigkeit gewesen, sondern — ich selbst! Meine Lebenskraft war das Agens meiner Maschine! Und nun das Öl auf meiner Lebenslampe zu versiegen begann, versagte auch die kunstvoll erdachte Maschine! Mein Dynamin war kein Generator lebendiger Energie, sondern nur ein Transformator. Vom Kapitale meines Organismus hatte die gefräßige Maschine die Kosten ihres Betriebes bestritten! Ich Tor habe in Wahrheit meine Entdeckung mit meinem Leben erkauft! — Wenn die kunstreiche Maschine in wundervollem Rhythmus schwang, daß mein trunkenes Auge sich nicht satt zu sehen vermochte an dem Spiel ihrer glitzernden Wellen und Scheiben und Räder; mein Leben pulsierte in ihr, meines Daseins Faden haspelte sich ab auf ihrer rastlos sausenden Spule! Ich Tor, ich blinder, stolzer Tor! Über Nacht bin ich plötzlich um mein Leben betrogen worden. Ein Spielzeug der Parzen hab' ich gebaut! Mein entsetztes Auge sieht sie plötzlich in einem Winkel meiner stillen Werkstatt hocken: Klotho, Lachesis und Atropos! Und schon hebt Atropos die grausige Schere.«
Damit brach das Manuskript ab. Ich gab es meinem Freunde zurück.
»Nicht wahr«, sagte er lächelnd, »für einen trockenen Gelehrten viel Phantasie! An dem alten Theodulos Energeios ist ein Dichter verdorben! Aber wir haben ja Mittel, uns gegen die schädliche Wirkung der ! " - und
Strahlen zu schützen. Ich frage Sie daher: Wollen Sie mir helfen, die Maschine des Theodulos Energeios auszupacken und in Betrieb zu setzen?«
Freund Hintze sah mir gerade ins Gesicht. Um keinen Preis der Welt hätte ich in diesem Augenblicke nein sagen mögen, so unbehaglich mir auch bei der ganzen Sache zumute war!
»Ich will!«, sagte ich.
»Ich hatte es erwartet«, antwortete mein Freund.
»Wann wollen wir beginnen?«, fragte ich nun in nervöser Ungeduld.
»Morgen früh, lieber Freund.«
»Aber — warum nicht noch heute?«
»Heute bin ich nicht ganz Herr meiner Zeit — leider, so sehr ich Ihre Neugier verstehe und teile. Also — morgen früh!«
Damit trennten wir uns.
Ich hatte eine schlechte Nacht.
Die Maschine des Theodulos Energeios spukte in meinen Träumen. Deutlich erblickte ich die niegesehene vor mir: über die Wand des Zimmers vor mir breitete sich ein riesiges Netz feiner Fäden, und in der Mitte des verwirrenden Gewebes hing wie eine ungeheure Spinne ein sausendes und schnurrendes Ungetüm mit funkelnden Augen; gierige Fangarme schossen gleich züngelnden Schlangen aus dem schwarzen Körper hervor und haschten nach mir.
Und sie packten mich, so sehr ich mich auch sträubte und wehrte, und rissen mich heran an das schnaubende Ungetüm, immer näher, immer näher.
Schweißgebadet erwachte ich.
Es war Morgen. Ich kleidete mich an und ging zu meinem Freunde, wenn ich offen sei soll, sehr zögernd, sehr in Gedanken.
Freund Hintze hatte bereits die schwere eisenbeschlagene, ziemlich umfangreiche Kiste in das Laboratorium schaffen lassen.
Ich begrüßte ihn und erzählte ihm meinen Traum!
Er lächelte eigen. »Messen Sie ihm irgendeine besondere Bedeutung bei? Haben Sie Ihren Entschluß geändert? Fürchten Sie sich vor der Maschine des Theodulos Energeios?«, fragte er.
»Gewiß nicht. — Aber ganz soll man solche ›inneren Warner‹ doch nicht mißachten.«
»Das unterschreib' ich! Mit aller Vorsicht wollen wir zu Werke gehen; wir sind ja gewarnt durch den Entdecker selber! Sein Dynamin ist gewiß kein harmloser Körper. Deshalb habe ich hier für Sie und mich Schutzkleidungen besorgt, wie sie bei längeren Arbeiten mit Röntgen- und Radiumstrahlen nötig sind: den mit Bleiplättchen dicht benähten Schutzkittel, die bleierne Gesichtsmaske und die Handschuhe aus Aluminiumgewebe!«
Damit legte er seinen »Strahlenschützer« an, und ich tat das gleiche.
Ich mußte doch lachen, als ich uns beide so maskiert erblickte.
»Ans Werk!«, sagte Freund Hintze.
Wir traten an die ominöse Kiste heran. Hintze deutete auf die vergilbte Aufschrift.
Und schon hatte er Hammer und Stemmeisen ergriffen und begann den Deckel zu lüften.
Mir wurde doch etwas schwül dabei. — Aber mein Freund arbeitete unbeirrt weiter, und bald war der Deckel ringsum gelöst und ließ sich abheben.
Da lag das unheimliche Ding vor uns, in einer Umhüllung von Papier und Leinwand, beides vergilbt von der Länge der Zeit!
Vorsichtig hoben wir sie aus der Kiste heraus und entfernten stückweise die Hüllen. Das Herz klopfte mir, und auch Freund Hintzes Hände zitterten nervös, als die letzte fiel.
Das also war die Maschine des Theodulos Energeios, aus hundertjähriger Verborgenheit wieder ans Licht gebracht!
Ein kompendiöser, fast zierlich zu nennender Apparat, beinahe überall metallisch geschlossen, eine Reihe von Zifferblättern an seiner Vorderseite tragend.
Unbeweglich ruhten die Zeiger auf ihren weißen Scheiben — in hundertjähriger Ruhe.
»Was nun?«, fragte ich, nachdem wir von allen Seiten den Apparat betrachtet hatten.
»Nach der Beschreibung ihres Erbauers«, damit brachte mein Freund ein ziemlich umfangreiches Heft zum Vorschein, »befindet sich im Zentrum der Maschine der Dynaminbehälter.«
»Dabei möchte ich doch fragen«, warf ich ein, »was der Erfinder über die Herkunft dieser mysteriösen Substanz Dynamin verrät?«
»Leider — sind seine Aufzeichnungen gerade über diesen Punkt, der mich schließlich am meisten interessierte, sehr lückenhaft: Er sagt nur, daß er nach jahrelangem Suchen im Kaukasus ein Mineral entdeckt habe, aus dem — ich zitiere wörtlich! — ›sich durch Ätzen und Glühen ein metallisches Pulver abschied, dem an Glanz und Gewicht kein Metall der Erde gleichkam.‹ — Von dem Dynaminbehälter aus gehen leitende Verbindungen nach allen Teilen des Apparates.«
»Und die Zifferblätter? Welche Bedeutung mögen sie haben?«
Freund Hintze zeigte auf die linke der vier mit einer Kreisteilung versehenen Scheiben. Ich folgte seinem deutenden Finger und entdeckte unter ihr, in das Metall graviert, ein paar griechische Buchstaben.
»Thermos«, buchstabierte ich.
»Und unter der nächsten steht ›Phos‹«, setzte mein Freund hinzu.
»Wärme und Licht also messen die Angaben dieser beiden Zifferblätter«, sagte ich, »aber unter dem dritten und vierten Kreise fehlt eine solche Angabe.«
»Was soll die Spindel?«, fragte ich verwundert, und der Schluß des Manuskripts fiel mir wieder ein mit den drei Parzen, die den Lebensfaden abspinnen.
»Der alte Theodulos Energeios war ein origineller Kauz und liebte das Seltsame«, antwortete mein Freund. »Die vornehmen griechischen Frauen zu den Zeiten Homers benutzten bekanntlich Spindeln aus Bernstein. An diesen Bernsteinspindeln hafteten beim fleißigen Gebrauche die Fasern des Flachses fest, weil der Bernstein elektrisch wurde.«
»Elektron — Elektrizität!«, rief ich rasch aus, und ohne Hintzes Bestätigung abzuwarten, setzte ich mit aufblitzendem Verständnis hinzu: »Nun finde ich auch die Gedankenbrücke zum Zeichen des vierten Zifferblattes: die zum Ringe geschlossene Schlange findet sich als Symbol der Ewigkeit auf vielen ägyptischen Denkmälern; Ägypten, das uralte ›Kemi‹, ist die Heimat der ›Alchemie‹ — Chemie soll das letzte Zeichen bedeuten! Habe ich es getroffen?
Mein Freund nickte. »Wenn ich nicht Ihre Vorliebe für das alte Ägypten kennte, müßt' ich eigentlich diese Kombinationsgabe bewundern«, sagte er dann lächelnd. Dann fuhr er fort: »Was der Apparat liefert, wissen wir also; wenn wir nur erst wüßten, wie er liefert! Ins Innere der Maschine kommen wir damit noch immer nicht hinein.«
»Und doch spricht der alte Theodulos Energeios von ›dem Spiel der Wellen und Räder und Scheiben‹, das ihn so manches Mal entzückt habe?«
»Freilich — freilich«, antwortete mein Freund nachdenklich.
»Und das Manuskript — die Zeichnung? Gibt sie keinen Aufschluß?«, fragte ich weiter.
Mein Freund antwortete nicht. Sein Auge haftete wie gebannt auf den den Zifferblättern der Maschine.
»Was sehen sie?«
»Haben Sie sich die anfängliche Zeigerstellung gemerkt?«, fragte er zurück.
Ich verneinte. Aber ich ahnte, was er meinte! Starr betrachtete nun auch ich die weißen Scheiben.
Aber es war doch wohl nur eine Augentäuschung gewesen: unbeweglich standen die vier Zeiger — wie seit hundert Jahren.
Nein — nicht unbeweglich! Langsam — ganz langsam wanderte der Zeiger des Zifferblattes, unter dem das Symbol der Ewigkeit stand!
»Die Maschine arbeitet!«, sagte mein Freund flüsternd zu mir, »sie geht — nach hundertjährigem Stillstand — geht von selbst —«
»Vielleicht — hat sie überhaupt noch nicht stillgestanden«, setzte ich ebenso hinzu, »und wenn das Dynamin ein radioaktiver Stoff ist, wäre dies ja auch nichts Unmögliches; nur schade, daß wir so gar nichts von ihrer Arbeit zu sehen bekommen!«
Wir traten näher und näher an den sonderbaren Apparat heran. Und mir war, als ob von der Maschine des Theodulos Energeios rätselhafte magnetische Anziehungskräfte ausgingen; ich vermochte mich nicht wieder loszureißen — eine sonderbare Willenlosigkeit, wie beim Beginn einer Hypnose, eine wohlige Mattigkeit, ein einlullendes Gefühl lässigen Behagens erfüllte mich!
Und plötzlich vernahm ich ein leises rhythmisches Klopfen aus dem Innern der Maschine — ein helles metallenes Klingen!
Und mit einem scharfen Klappen fiel mit einem Male die metallische Umhüllung der Maschine auf allen vier Seiten herab — das Innere des geheimnisvollen Wunderwerks lag plötzlich vor uns!
Und da war der durchsichtige Behälter mit seiner schimmernden Substanz; da waren die glitzernden Räder und Wellen und Scheiben, die einst das stille Entzücken des alten Theodulos Energeios gewesen!
Und immer schneller, immer rasender schienen sich die funkelnden Glieder dieses Zauberwerkes zu bewegen, ja, es war, als ob blitzende Strahlen aus allen Teilen seines Mechanismus heraussprühten!
Ich konnte mich nicht sattsehen an dem wundersamen Spiel; Freund Hintze aber forschte an der Hand der alten Zeichnung, die er seiner Brusttasche entnommen, nach den Geheimnissen der inneren Konstruktion. Und seine sichere, unbeirrte Ruhe gab mir die meine wieder.
Unter jedem der vier Zifferblätter fanden wir ein vorher verdecktes Elfenbeinknöpfchen. Freund Hintze drückte das erste nieder.
Der Zeiger des darüberstehenden Zifferblattes begann zu wandern; aber sonst schien sich nichts an dem Gange der Maschine zu ändern.
Und doch! Die eine der rotierenden Scheiben verlangsamte allmählich ihre Bewegung. Nun stand sie plötzlich still — und im gleichen Augenblicke war es mir, als ob eine flammende Glut mein Gesicht versengte!
»Strahlende Wärme!«, rief ich aus, vom Apparat zurückprallend. Und mein Freund empfand das gleiche. Rasch drückte er das zweite Knöpfchen nieder.
Eine Lichtflut brach da plötzlich aus der Maschine hervor, wie aus dem Fokus eines riesigen elektrischen Scheinwerfers, daß wir geblendet die schmerzenden Augen schließen mußten!
»Den dritten Knopf!«, rief ich, die Augen noch mit der vorgehaltenen Hand schützend, »das ist ja, als ob man in die Sonne selber sähe!«
Aber mein Freund zögerte.
»Wir kennen nicht die Höhe der elektrischen Spannung, die der Apparat zu erzeugen vermag«, sagte er nachdenklich, »wir wollen uns nicht den Entladungen der Maschine unnötig aussetzen.«
Damit übersprang er den dritten Knopf der Maschine und drückte auf den letzten, der den Apparat auf chemische Wirkung einstellte.
Und da geschah etwas Seltsames, das unsre beiderseitige Aufmerksamkeit so sehr fesselte, daß wir uns selbst und die ganze sonderbare Situation vergaßen.
Der Dynaminbehälter stand durch gläserne Verbindungsröhren mit einer Anzahl kugelförmiger Vorlagen in leitendem Zusammenhange.
In dem Augenblicke, als Freund Hintze den vierten Knopf niederdrückte, trübte sich die eine der durchsichtigen Phiolen! Ein feiner, wolkiger Dunst erfüllte sie, der immer dichter und dichter wurde; plötzlich bildeten sich an der durchsichtigen Wandung Tropfen, die immer zahlreicher wurden und schließlich fast die Hälfte der Vorlage mit einer leichtbeweglichen, scheinbar lebhaft siedenden, schwach opalisierenden Flüssigkeit anfüllten.
»Was mag das für ein chemischer Stoff sein, der sich da vor unsern Augen bildet?«, fragte ich.
Mein Freund zuckte die Achseln und wollte eben etwas erwidern. Da ertönte ein betäubender Knall, der uns auf Minuten die Besinnung raubte!
Als wir uns wiederfanden, heil und unverletzt, fielen unsre Blicke auf den geheimnisvollen Apparat.
Er stand — scheinbar unberührt — noch auf seinem alten Platze. Noch immer wanderte der Zeiger —!
Aber die eine der gläsernen Vorlagen war durch die Explosion von dem Dynaminbehälter losgerissen und in Stücke zerschmettert worden!
»Woher kam die Explosion?«, fragte ich den Freund. Er antwortete nicht; sein Auge hing wieder an dem Apparat.
Hatten wir doch unrichtig experimentiert? War die Übergehung der elektrischen Vorrichtung der Maschine doch ein Fehler gewesen, der ihre Energie zu rasch gesteigert? Oder — war in der Maschine noch von früher her ein Kraftvorrat aufgespeichert, der ihr nun verderblich wurde?
Ich weiß es nicht.
Dicht vor mir auf dem Fußboden lag ein größeres Stück der zersprungenen Phiole. Ich bückte mich, um es aufzuheben. Dabei lockerte sich meine Gesichtsmaske; ich nahm sie ab, um besser beobachten zu können.
Mit einem Ausruf der Verwunderung gab ich das Bruchstück meinem Freunde.
Die ganze Innenwand des Scherbens war mit phosphoreszierenden Kristallen übersät!
Und diese Kristalle lebten!
Unaufhörlich änderten sie Form und Größe, wuchsen und wanderten!
Es gelang meinem Freunde, einen der größten, schnell beweglichen Kristalle mit der Pinzette zu fassen. Er legte ihn sich in die hohle Hand. Aber auch hier wechselte das wunderbare Gebilde unaufhörlich seine Lage.
Er faßte den Kristall mit den Fingerspitzen.
»Er ist elastisch!«, rief er, ihn mir in die Hand legend.
Ich prüfte ihn auch und schloß die Hand fest zusammen. Mir war, als ob ich ein lebendes Etwas in den Fingern hielt, das sich gegen die Einsperrung sträubte.
Da faßte mich plötzlich mein Freund am Arme und sagte, wie von einem Schreck ergriffen:
»Wissen Sie, was sich in diesen Kristallen aufgespeichert hat, die uns das verunglückte Experiment geliefert?«
»Nun — was?«
Er sah mich nochmals ernst prüfend an, dann führte er mich vor den kleinen Spiegel, der über der Waschvorrichtung des Laboratoriums hing.
Da sah ich mich — plötzlich um Jahre gealtert!
Und als die Maske vom Antlitz des Freundes sank, da entdeckte ich auch bei ihm die gleichen verräterischen Zeichen!
Leben war in den hüpfenden Kristallen aufgespeichert, Leben von unserm Leben, Sein von unserm Sein, Kraft von unsrer Kraft!
Der alte Theodulos Energeios hatte doch recht gehabt! Trotz aller unsrer Schutzmaßregeln gegen die radioaktiven Stoffe hatte sich an uns beiden die verderbliche Wirkung der Maschine wiederholt: uns beiden zugleich hatte die unheimliche Maschine ihre Energie entnommen, aus den Lebenskräften unsrer Organismen durch Vermittlung des rätselhaften Dynamins die Triebkraft ihres Mechanismus gesogen! Und ich dachte an die Schlußzeilen aus dem Manuskripte des alten Theodulos Energeios von den Parzen und ihrem Spielzeug — und an meinen sonderbaren Traum.
Leben von unserm Leben!
War die Maschine des gelehrten alten Griechen es wert, daß wir zu ihrer Untersuchung dies unersetzliche Kapital darangegeben?
Ich will darüber nicht rechten.
Und schließlich — gleicht nicht eine jede unsrer Tätigkeiten und Beschäftigungen ein wenig der Maschine des Theodulos Energeios? Spinnen sie nicht alle schneller oder langsamer den kostbaren Faden unsers Lebens ab — bis die Parze die Schere hebt —?
Und die geheimnisvolle Maschine?!
Sie steht noch immer in einem verschlossenen Seitenkabinett des Naturwissenschaftlichen Instituts und wartet — wartet auf neue Opfer.
Hast du den sonderbaren Schwärmer gesehen?«, fragte ich meinen Freund Hintze. »Ich denke, deine Beschreibung war ja so ausführlich! Ich bin nach deiner Angabe auf den Flugplatz BerlinJohannistal gefahren — und —«
»— hast da an der Umzäunung eben den Mann gesehen: einen auffallend schlanken Menschen in den Vierzigern, mit blondem Haar und Bart, im grauen Ulster, trotz der kalten Jahreszeit mit einer Art von Strohhut als Kopfbedeckung, nicht wahr? Also das ist er, Hjalmar Ätherström, wie ich seit gestern weiß, seit ich die Ehre habe, ihn persönlich und genauer zu kennen.«
»Du hast — du bist —«, warf Freund Hintze ein.
»— gestern fast den ganzen Nachmittag und Abend in seiner Gesellschaft gewesen und habe dir viel Neues von diesem Erdbewohner zu erzählen —«
»Dann also — schieß los!«
Und ich erzählte:
»Du weißt, daß dieser Ätherström von Haus aus ein nordischer Flieger ist, der vor zirka fünfzehn Jahren, als man kaum an eine praktische Durchführung des Fliegens im Aeroplan zu denken wagte, mit einem Apparat seiner Konstruktion an der Küste seiner Heimat Flugversuche anstellte; daß er bei dem letzten, dem gelungensten, wie er selbst meint, von einem der drei horizontal laufenden Propellerflügel der Tragfläche getroffen und ihm die Schädeldecke an der oberen Rundung ihrer Wölbung glatt wegrasiert wurde. Der Flieger samt seinem Flugzeug fiel ins Meer, wo er von Fischern gerettet und ins Krankenhaus nach Bergen transportiert wurde. Hier erkannten die Ärzte, daß Ätherström insofern Glück im Unglück gehabt hatte, als die wie eine Kreissäge wirkende Propellerschraube ihm tatsächlich wie bei einer fachmännisch ausgeführten Trepanation nur die äußere Kopfhaut und ein nicht ganz handgroßes Stück der Schädeldecke entfernt, aber das darunterliegende Gehirn wunderbarerweise völlig unverletzt gelassen hatte. Keine seiner geistigen oder körperlichen Funktionen zeigte irgendeine Abnormität —«
»Wenn seine jetzige Idee nicht eine Kette von Abnormitäten darstellt«, fiel Freund Hintze mit skeptischer Frage ein.
»Du wirst ihn heute abend kennen lernen — ich habe dich bereits angemeldet — und du sollst selbst urteilen!«, war meine Antwort. »Doch weiter: er mußte eine Platte aus Weichgummi tragen, die genau dem fehlenden Stück der Schädeldecke entsprach, und die an der Oberseite zum Schutze mit einer dünnen Metalldecke überkleidet ist, die er unter einer kleinen Perücke verhüllt —«
»Daher auch der Strohhut, wenn's draußen schneit!«, scherzte mein Freund.
»Ja«, sagte ich, »er behauptet, jede andre Kopfbedeckung sei ihm eine Last und schaffe ihm Beängstigung. Aber weiter! Du kennst seine Hypothese, daß alle unsre geistigen Funktionen Spannungserscheinungen, Wellen oder Schwingungen des Weltäthers seien, wie in der unbeseelten Welt das Licht oder die Elektrizität und so weiter.«
»Diese Hypothese war es ja, die mich so frappierte!«
»Also höre! Ich habe gestern einen Beweis davon erhalten. Wie ich dir schon erzählt habe, ist ihm vor etwa ungefähr vier oder fünf Jahren etwas Sonderbares begegnet —«
»Ja«, ergänzte Freund Hintze, »Ätherström stolperte über eine im Moos versteckte Baumwurzel und kam zu Fall, dabei flog ihm der Hut und die Perücke vom Kopf und die Metallplatte mit dem daran haftenden Weichgummistück auch —«
»So war's, und er blieb eine kurze Zeit wie betäubt im Moose liegen. Da fühlte er in seiner Seele ein unerklärliches Schwingen, das immer schneller und schneller ward, je näher die Sonnenstrahlen seinem bewußtlosen Körper kamen, und das zu einer überwältigenden Symphonie von Tönen und Farben wie ein rasendes Universum zusammenklang, als die Sonnenstrahlen sein Haupt trafen. Er fühlte sich aufgelöst, zu riesenhaften Dimensionen auseinandergerissen — bis zur Sonnenferne... Als die Sonne einen Zoll weitergerückt war und seine geschlossenen Augen traf, verebbte der rasende Wellentanz in seiner Seele, und es erwachte sein körperliches Ich. Er paßte die Weichgummiplatte, die dicht neben ihm lag, wieder kunstgerecht in die Schädelöffnung, fand die kleine Perücke wieder und auch seinen Hut dicht dabei und war wieder ein gewöhnlicher Mensch.
Und doch nicht!
Denn als er aus dem Walde trat, schien ihm alles verwandelt, so — das sagte er wörtlich —, als ob man ein altes Ölbild mit neuem Lack überzogen habe, seine Gedanken waren zehnfach schärfer, seine Gefühle tausendmal lebendiger geworden...«
»Da war's, wo ich mit meinen Zweifeln einsetzte«, entgegnete mein Freund. »Ich hielt das Ganze für eine Selbsttäuschung, die nach der voraufgegangenen kurzen Bewußtlosigkeit nur zu erklärlich erscheint.«
»Du sollst recht haben, wenn du mir folgendes Experiment erklärst, das ich gestern bei ihm sah. Wir sprachen erst von allerlei, namentlich vom Flugsport, dem er wegen seiner Schädelverletzung nicht mehr huldigen darf, obschon er jede Neuerung mit dem Interesse des Fachmannes verfolgt. Ich erzählte ihm von deiner und meiner Lieblingshypothese, die Schwerkraft unsrer Erde als eine Wellenbewegung des uns umgebenden, das ganze All erfüllenden Weltäthers aufzufassen, wie dies die Wissenschaft unsrer Tage für das Licht und die Elektrizität nachgewiesen hat.«
»Nun — und —?«
»Und er sagte mir, daß er alle Veröffentlichungen darüber kenne und daß er auf einem andern Wege zum Ziele zu kommen hoffe. Genaueres wollte er mir nicht mitteilen, er wies nur auf ein großes, postfertiges Kuvert hin, das, an das Kriegsministerium adressiert, auf seinem Schreibtische lag. Ich wollte in dieser Angelegenheit nicht weiter in ihn dringen; aber er unterbrach sich selbst noch einmal, indem er sagte: »Da hätt' ich doch beinah' vergessen, nachzuwiegen, ob ich das Höchstgewicht von zweihundertfünfzig Gramm für Briefe hier in Deutschland nicht überschritten habe. Sie erlauben —«
Damit holte er eine Briefwage der gewöhnlichen Art von einem Regal herunter, stellte sie auf seinen Schreibtisch und legte das erwähnte Kuvert darauf.
Ich las ab: »Zweihundertfünfunddreißig Gramm!«, rief ich.
Er prüfte die Zeigerstellung selbst. Dabei kam er mit seiner Rechten zufällig in die Nähe des Briefes — Der Zeiger schnellte plötzlich bis auf zweihundertfünfzig Gramm.
»Erlauben Sie!«, rief ich, von dem Licht einer plötzlichen Entdeckung durchflammt, und zog seine Hand von dem Briefe zurück.
Da ging der Zeiger zurück auf zweihundertfünfunddreißig Gramm, wie zu Anfang. Aber als ich seine Hand wieder über den auf der Wagschale liegenden Brief in ungefähr zehn Zentimeter Entfernung hielt — da schnellte der Zeiger abermals höher, diesmal bis zum Anschlage. In diesem Augenblicke war ich meiner Sache gewiß: Hjalmar Ätherström konnte mehr als wir andern Menschen, er lügt sich und andern nichts vor, wenn er von seinen sonderbaren Empfindungen und Erfahrungen spricht, in ihm arbeitet der Weltäther mit höherer Intensität als in uns allen, denn er kann mit seiner Person die Erdschwere beeinflussen!«
Ich schwieg und sah meinen Freund fragend an.
»Freilich«, sagte er, und sein Blick zeigte ernstes Nachdenken, »das ist ein Beweis, und schon darum leiste ich deiner Einladung für heute abend gern Folge.«
Am Abend wanderte ich mit Freund Hintze nach der Wohnung des Nordländers. Es war ein stilles, aber geschmackvoll und behaglich ausgestattetes Junggesellenheim.
Er begrüßte uns, und ich stellte meinen Freund vor.
Wir kamen gleich auf die gestrige Briefgeschichte.
»Ja«, sagte er mit einem halben Lächeln, »ich habe heute früh noch eine Entdeckung gemacht.«
Wir setzten uns und warteten auf seine Erklärung.
»Sehen Sie, wenn ich meine Hände einander gegenüber halte, kann ich kleine Gegenstände frei in der Schwebe halten!«
Er nahm eine Visitenkarte aus einer Bronzeschale, legte sie auf die eine Handfläche, kippte dann die Hand schnell um, daß die Karte herabfallen mußte, dann hielt er schnell die andre Hand unter die fallende Karte. Diese hörte plötzlich auf zu fallen und blieb zwischen beiden Händen in der Luft schweben!
»Das ist wie ein magnetisches Feld«, sagte mein Freund.
Atherström brachte die Hände nach und nach in eine wagrechte Richtung; aber die Karte blieb senkrecht dazwischen schweben!
Hintze nickte, als hätte er nichts andres erwartet. Und doch war diese Erscheinung ein Phänomen so ungeheuerlicher Art, daß es die begeisterte Bewunderung nicht nur des lebenden Menschengeschlechts, sondern aller Geschlechter der Vor- und Nachwelt verdiente. Denn das ungelöste Problem der Schwerkraft war hier von den Händen eines Menschen gemeistert. Hier war die Pforte, von der die Menschheit die Beherrschung der Schwere in Angriff nehmen konnte!
So ungefähr drückte ich mich Ätherström gegenüber aus.
Ätherström sah mich mit einem seltsamen Blick an, dann sagte er einfach:
»Ich begreife mich selbst nicht! Gewiß verdanke ich meiner Kopfverletzung und der damit zusammenhängenden Durchlässigkeit und Empfänglichkeit meines Gehirnes diese sonderbare Gabe. Aber nun sind mir auch meine früheren seelischen Erlebnisse, von denen ich Ihnen« — er wandte sich zu mir — »öfter gesprochen, keine Träume mehr, sondern wirkliche Erlebnisse. Sehen Sie hier«, — er faßte nach einigen schlichten Heften, in Wachstuch gebunden mit rotem Schnitt, und durchblätterte sie vor unsern Augen (sie waren eng beschrieben mit seiner klaren, zierlichen Handschrift) — »das sind die Aufzeichnungen oder Tagebücher meiner Wanderungen —«
»Welcher Wanderungen?«, unterbrach ich ihn. »Sie sagten doch, Sie wären wenig in der Welt herumgekommen?«
»Meiner Seelenwanderungen also, um es klipp und klar herauszusagen«, sprach er fest — und seine Züge hatten einen Augenblick etwas ungemein Bestimmtes, Stählernes, als wappne er sich von vornherein gegen jeden Widerspruch unserseits.
»Nämlich«, fuhr er erläuternd fort, »ich bin fest davon überzeugt, daß meine Seele — oder wie Sie das geistige Agens in uns nennen wollen — schon manche riesenhafte Entfernung durchwandert hat: ich bin außerhalb unsrer Erde gewesen, im Weltäther, weit, weit von hier — auf fernen Planeten! Sie sollen diese Blätter einmal durchlesen, wenn ich die Erlebnisse meiner heutigen Ätherreise hinzugeschrieben habe. Denn, meine verehrten Herren, als ich Sie beide auf heute abend zu mir bat, hatte ich mir meinen Plan schon zurechtgelegt. Alle diese Aufzeichnungen habe ich gemacht, wenn ich von meinen Seelenwanderungen wiederkam; so genau erinnerte ich mich ihrer. Aber mir fehlt die Kontrolle, daß ich doch nicht bloß träume! Nämlich, die Wanderung meiner Seele, um den Ausdruck für das Unerklärliche beizubehalten, vollzieht sich unter dem Einfluß des Sonnen- oder Mondlichtes. Ich pflege mich dann in den Lehnstuhl dort am Fenster zu setzen, hebe die Schutzkappe vom Kopfe und lasse die Strahlen des Mondes — wenigstens habe ich das in den letzten Monaten getan — voll auf meinen Scheitel fallen. Ich halte die Augen offen, es dauert aber nur einige Minuten; dann beginnen mir die Gegenstände im Zimmer zu verblassen, ein Nebel legt sich um mich, der immer dichter wird, obwohl ich noch die Uhr schlagen höre und meine Hände noch frei bewegen kann — dann beginnt ein seltsamer Zustand, wo ich mich gewissermaßen von außen sehe, dann fühle ich ein Schweben, als glitte mein seelisches Ich in die Lichtstrahlen hinein, die mich umfluten, und dann — beginne ich zu wandern. Das rätselhafte Schwingen in mir, das Kreisen im ewig pulsierenden Äthermeer des Alls, das ich bei meinem ersten Erlebnisse im Walde empfand, ist immer schwächer geworden, um es kurz zu machen: ich bin nicht mehr ein verlorenes Atom im Unendlichen, ich bin ätherisch dichter oder begrenzter geworden, ein Individuum, eben ein seelisches Einzelwesen. Aber die Schwingen des Weltäthers tragen mich und führen mich, wenn ich einmal diese Phase der Verwandlung erreicht habe.«
Er hatte ganz schlicht, natürlich gesprochen, nichts von Überschwang oder Phantasterei war in seinen Worten. Das empfand auch Freund Hintze, als er impulsiv zu ihm sagte:
»Rechnen Sie ganz auf uns, wir wollen Ihnen gern bei dem Experiment behilflich sein.«
Ätherström nahm seine Hand und schüttelte sie herzlich. Dann sagte er: »Es ist heute genau einen Monat her, daß ich meinen letzten ›überirdischen‹ Ausflug unternahm. Die Ätherströmung führte mein körperloses Ich in rasender Geschwindigkeit auf der Bahn der Mondstrahlen hinein in die Welt der Sterne. Ich glitt im Wellengetriebe des Äthers an das Ufer einer neuen Welt!«
Er sah eine kurze Weile seltsam vor sich hin, so, als scheue er sich, weiterzusprechen, dann aber sagte er rasch:
»Wahrhaftig — eine neue Welt! Die Sterne standen riesengroß am nachtschwarzen Himmel über mir; unter mir aber breitete sich Land, fruchtbares Land, auf das ich zuschwebte!
Es war, als ob ich in ein Paradies gekommen wäre. Blumen oder blumenähnliche Gebilde bedeckten in vieltausendfachen Formen und Farben den Boden. Aber als ich nähergetragen wurde, entdeckte ich ein Wunder: die Blumen zeigten Leben wie angewachsene Geschöpfe! Und ganz dicht vor mir hob sich aus dem Kelch eines schlanken Gewächses ein Antlitz, schön wie das einer Huri des Paradieses!
Ich versuchte mich ihr zu nähern, aber immer trieb mich der Wellenschlag des Äthers wieder von ihr fort. Endlich hörte ich — so muß ich mich menschlich verständlich ausdrücken —, wie dieses wunderbare Blumengeschöpf sagte:
›Komm wieder! Nur in einer Knospe, die sich im Lichte der Sterne entfalten will, kannst du Gestalt gewinnen, der meinen ähnlich, aber nicht gleich. Rings um mich siehst du die werdenden Wesen, aber ich bin die erste, die sich dem Licht erschlossen. Komm wieder, Saïvula wartet!‹«...
Er hörte auf, ganz plötzlich, als scheute er sich, uns das gesagt zu haben.
Wir hatten lautlos zugehört.
Ich wollte eben ein Wort entgegnen, er kam mir zuvor, indem er seine Aufzeichnungen aufschlug und uns die letzte beschriebene Seite zeigte.
Da stand als Schluß eines Abschnittes dasselbe, das er eben gesprochen:
»Saïvula wartet!«
Ich schwieg. Er aber sagte, auf den hellen Lichtstreif deutend, der eben durch das eine Fenster fiel: »Es wird Zeit. Ich muß zu ihr. Ein festes inneres Gefühl sagt mir, daß ich in dem unendlichen All meinen Weg dort sicher zu ihr finden werde, denn ich will ihn finden!«...
Er rückte den Lehnstuhl ans Fenster und nahm darin Platz. Ich sah nach der Uhr: sie zeigte fast auf die Minute zehn Uhr.
»Noch eins!«, rief ich. »Haben Sie irgendeine Vorstellung, wie lange Sie — unterwegs bleiben werden?«
»Bis jetzt hat der seltsame Trennungszustand meines inneren und äußeren Menschen höchstens drei Stunden gedauert, meine Herren. Diese Zeit bitte ich mir also zu schenken. Mein Körper bietet, wie ich aus ein paar automatisch aufgenommenen Blitzlichtphotographien von mir weiß — er blätterte in seinen Aufzeichnungen und schob uns einige Bilder zu — »völlig das Bild eines ruhig Dasitzenden, ja Schlafenden, nur die Augen sind nicht geschlossen.«
»Wenn Sie aber da oben auf dem Stern, von dem Sie sprachen, jenes wunderbare Wesen wiederfinden?«, fragte Freund Hintze.
Hjalmar Ätherström lächelte eigen. »Ich bin immer wiedergekommen, ich gehöre ja seit vierzig Jahren zu meinem Körper, und ohne seine Organe hätte sich meine Seele nicht entwickeln können. Sorgen Sie sich darum nicht. Auf Wiedersehen! Bitte, schrauben Sie die Lampe noch etwas kleiner — so, danke — «
Es war ein Uhr nachts.
Wir saßen, halblaut nur unsre Gedanken tauschend, am Tische. Unsre Blicke folgten den Rauchwölkchen der Zigarren, nur ab und zu streiften sie den Mann dort im Lehnstuhl. Endlich stand Freund Hintze auf und beugte sich über ihn. Das breite Mittelfenster ließ das Licht des Vollmondes jetzt voll über das Haupt des Dasitzenden fallen.
»Er atmet ganz ruhig«, sagte mein Freund. Eben schlug die altertümliche Standuhr eins.
Wir saßen und warteten — noch eine Stunde.
Hjalmar Ätherström zeigte keinerlei Veränderungen, sein Puls ging völlig normal, sein Atmen war jetzt langsamer und tiefer.
Ich brachte meine kleine elektrische Taschenlampe vor seine Augen.
»Die Pupillen reagieren auf den Lichteinfall«, flüsterte ich.
»Was sollen wir aber tun?«, fragte Freund Hintze nach einer Weile. Keiner von uns beiden wußte zu raten.
Freund Hintze rüttelte ihn am Arm. Aber er blieb in dem Zustand, in dem er war!
Wir riefen ihn an — vergebens.
»Haben Sie Saïvula wiedergefunden?«, sagte ich ihm laut ins Ohr.
Keine Muskel seines Gesichtes zuckte.
Eben verschwand der Mond hinter den Häusergiebeln.
Wir saßen und warteten... umsonst.
Endlich sagte mein Freund:
»Hier kann er doch nicht die ganze Nacht sitzen! Wir wollen ihn in sein Bett bringen.«
Ich öffnete die Tür seines Schlafzimmers.
Gemeinsam brachten wir ihn zu Bett, ohne daß eine Veränderung mit ihm vorging.
»Vielleicht findet er im Schlaf die Brücke wieder zu seinem körperlichen Ich«, meinte Hintze.
Ich untersuchte nochmals seinen regelmäßigen Puls, behorchte Herzschlag und Atmung und spritzte ihm schließlich ein wenig Wasser ins Gesicht.
Unter der Wirkung der eiskalten Tropfen zuckten die Augenlider —
Aber Hjalmar Ätherström erwachte nicht.
Rabbi Ben Akiba kommt mit seinem oft zitierten Spruch: »Es ist alles schon einmal dagewesen!« im Zeitalter der Naturwissenschaft in die Klemme. Und wenn wir Menschen von heute nicht schon den Errungenschaften der Wissenschaft und Technik gegenüber im Laufe der Jahrzehnte so — blasiert geworden wären, würden wir keinen Augenblick aufhören zu staunen. Trotzdem hoffen wir heute, unsern verehrten Lesern etwas Neues aus dem Gesamtgebiete der angewandten Naturwissenschaften darbieten zu können, was sie doch zu staunender Bewunderung hinreißt.
Da ist zuerst le dernier cri auf dem Gebiete der praktischen Verwertung naturwissenschaftlicher Kenntnisse, ein wahrer Triumph der Kälteindustrie:
Dem auf diesem Gebiete als Autorität seit Jahren bekannten Professors Spürnas in M... ist es vor kurzem gelungen, Töne von tiefer Schwingungszahl (vom subkontraC aufwärts) in Verbindung mit darauf folgenden schrillen Dissonanzen durch einen besonders dazu konstruierten zweistimmigen Posaunenmotor zu erzeugen und sie in einen orchesterartigen Schallfänger, der die gewaltigen Schwingungen bis zu 98,5 Proz. der aufgewendeten Energie reflektiert, aufzufangen und in eine Gefriermaschine hineinzusaugen. Durch einen sogenannten Gegenstromapparat geschieht hier ihre Abkühlung bis auf etwa —50 bis 52° C und die Kompression bei fast 1000 Atm. Druck, wodurch die Vereisung der flüssig gewordenen Materie beginnt, die in wenigen Sekunden vollendet ist. Die Abbildung zeigt rechts deutlich die gefrorenen kegelförmigen Posaunentöne, die von einem Arbeiter aus dem Kältereservoir in kleine Sammelkarren entleert und an die Verpackungsstelle transportiert werden. Sie kommen in dicken Filzpackungen zum Versand und werden am Sprengort einfach in ein Bohrloch eingelassen. In das Bohrloch der Felswand führt gleichzeitig eine aus Hartstahl geformte Düse, die durch eine Hochdruckschlauchleitung mit einem Heißluftmotor in Verbindung steht. Das Auslösen der Blasebalgdruckfeder bewirkt die fast momentane Verwandlung des »Eiszapfens« aus dem festen in den gasförmigen Aggregatzustand: die kolossale Spannung der ihr altes Volumen einnehmenden, dabei gleichzeitig im Rhythmus schwingenden Töne wird frei, und die Detonation geht mit furchtbarer Gewalt vor sich — aber o h n e R a u c h , der sonst das sichere Resultat der Sprengung dem Blick des Beobachters längere Zeit entzieht. —
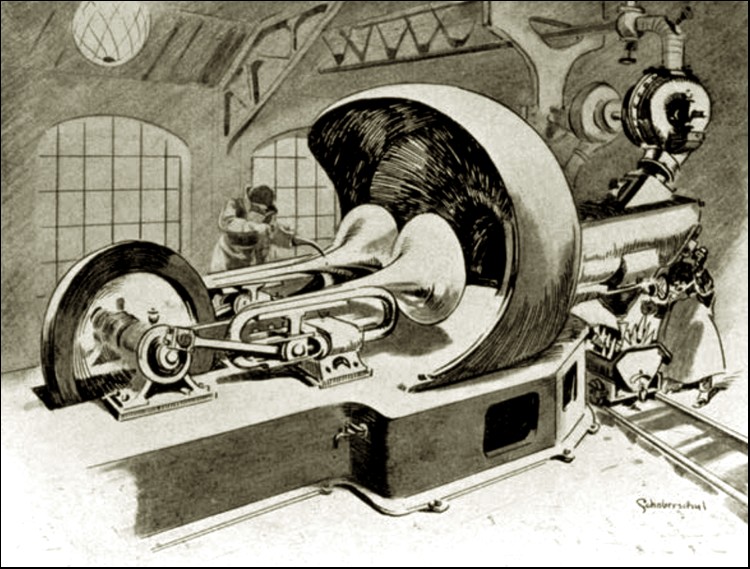
Der zweistimmige Posaunenmotor mit Schallfänger und die
Gefriermaschine, in der die Töne vereist werden.
In dem
Sammelkarren die gefrorenen eiszapfenförmigen Posaunentöne.
Und hier wird der geneigte Leser einwerfen: »Aber — das ist doch schon einmal dagewesen! Durch den Schall der Posaunen fielen einst die Mauern von Jericho!« — Nun, so hat Ben Akiba doch recht; ebenso darf man dann aber den Freiherrn von Münchhausen nicht länger einen Lügner nennen, wenn er uns von den im Posthorn eingefrorenen und dann im gemütlich warmen Zimmer zum Ergötzen der Gäste wieder auftauenden Klängen erzählt.
Eine echt amerikanische, großartige Erfindung, die auf streng mathematischen Berechnungen beruht, welche in geradezu verblüffend einfacher, genialer Weise das Problem löst, Brückenbauten auch mit den größten Spannweiten in kurzer Zeit, in ebensoviel Wochen herzustellen, wie man sonst Jahre brauchte. Das Verfahren ist so einfach, und man wäre versucht, an Humbug zu denken, wenn nicht die Zeichnung der eben im Bau begriffenen Brücke über einen Arm des Missouri die Echtheit dokumentierte: An jedem Ufer ein nach seiner Belastung mehr oder weniger mächtiger Pfeiler — auf dem einen eine Zwillingsspritze mit Motorantrieb — auf dem gegenüberliegenden eine eigenartige, aus Stahl konstruierte Saugmaschine, ebenfalls in Zwillingsform — die Zwillingsspritze spritzt aus ihren Doppeldüsen zum anderen Pfeiler hinüber flüssigen Gußstahl in verstellbarem Bogen, der in der Luft in Form zweier gleicher Parabeln erstarrt. An diesen stählernen Bogen läßt sich der eigentliche Brückenkörper leicht anbringen.

Sprengung einer Felswand. Vorn ein Heißluftmotorwagen, an den eine
Hochdruckschlauchleitung angeschlossen ist, durch die die heiße Luft
zu den gefrorenen Tönen hingetrieben wird und diese schmelzt, so daß sie
ihr altes Volumen einnehmen und infolgedessen die Sprengwirkung ausüben.
Ein Triumph der Kälteindustrie: Gefrorene Posaunentöne als Sprengmittel.
Die Geschichte der Erfindung ist zu originell, als daß wir sie unseren Lesern vorenthalten möchten.
Ende August 1912 brannte im eigentlichen Geschäftsviertel Neuyorks ein »Wolkenkratzer« nieder. Tausende von Zuschauern starrten das grausige Schauspiel an, das gerade um die Mittagszeit vor sich ging. Die Sonne drang siegreich durch die nur wenig Rauch verursachenden Brandmassen und zeigte die ungeheuren Anstrengungen der Feuerwehr, des Feuers Herr zu werden. So hatte man zu einem etwas entfernter stehenden Wolkenkratzer die Schläuche der riesigen Dampfspritzen gelegt, um von seinen oberen Stockwerken aus die löschenden Wasserstrahlen auf das flammende Nachbargebäude zu richten. Zischend und prasselnd sausten die gewaltigen Wassermassen durch die Luft auf das Feuermeer hernieder!
In demselben Augenblick kam auf der durch die Policemen freigehaltenen Seite der Straße ein Auto dahergerast. Wütende Drohrufe schallten hinter dem Chauffeur her, der, hart die Zuschauermenge streifend, möglichst nahe an das siebenundzwanzigstöckige brennende Ungetüm heranzukommen strebte. In diesem Auto saß — der Besitzer des Wolkenkratzers, Mr. Bridge, einer der »Stahlkönige« des amerikanischen Großhandels. »Meine Pläne! Meine Zeichnungen! Meine Skizzen!« rief Bridge einmal über das andere aus, sich wie unsinnig die Haare ausraufend. Da hielt das Auto; ein Policeman hatte dem Chauffeur Halt geboten und öffnete die Tür des Wagens. Er schrak zurück — »Mr. Bridge!« — Jeder Mensch in Neuyork kannte den »Stahlmenschen«, »Excuse me!« rief er, als er den vor Erregung leichenblassen Insassen erblickte. Mr. Bridge sagte nichts, und eben drängte sich ein ungefähr fünfzehn bis sechzehn Jahre alter, frischer Bursche mit seinen Zeitungen an Mr. Bridge heran.
»Excuse me«, sagte er auch. Aber seine großen, dunklen Augen strahlten dabei; dann fuhr er außer Atem fort: »Mr. Bridge, sehen Sie die großen Wasserstrahlen, die dort von einem Bau zum andern hinübersausen?«
Der Beherrscher des Stahls sah den Boy einen Augenblick verdutzt an. »Goddam«, brach er dann los, »'s ist mein Haus, das da brennt. Was kümmern mich die Dampfspritzen und ihre Strahlen, wenn sie's nur löschen!«
»Mr. Bridge«, sagte der Junge unentmutigt, »was geben Sie mir für eine Idee, durch die Sie tausendfach verdienen können, was Sie hier verlieren?«
Mr. Bridge packte den Zudringlichen, um ihn hinauszuwerfen. In diesem Augenblick flogen aus zwei der mächtigsten Dampfspritzen in schöner parabolischer Krümmung zwei parallele Wasserstrahlen, im Sonnenlichte wie flüssiges Metall funkelnd, auf den brennenden Wolkenkratzer zu, sekundenlang wie starr zwischen zwei Riesenpfeilern ausgespannt.
»Die Brücke!«, rief der Junge, seinen Hals mit Gewalt aus der Umklammerung Mr. Bridges freimachend, »da — sehen Sie! die Bogenbrücke, Mr. Bridge! Das ist meine Idee; Ihnen bleibt die Ausführung — es müßte eine Zwillingsspritze sein — mit der man flüssigen Gußstahl so bequem wie Wasser von einem Pfeiler eines Stromes, so breit dieser auch sein mag, nach einem gegenüberliegenden Pfeiler sendet!«
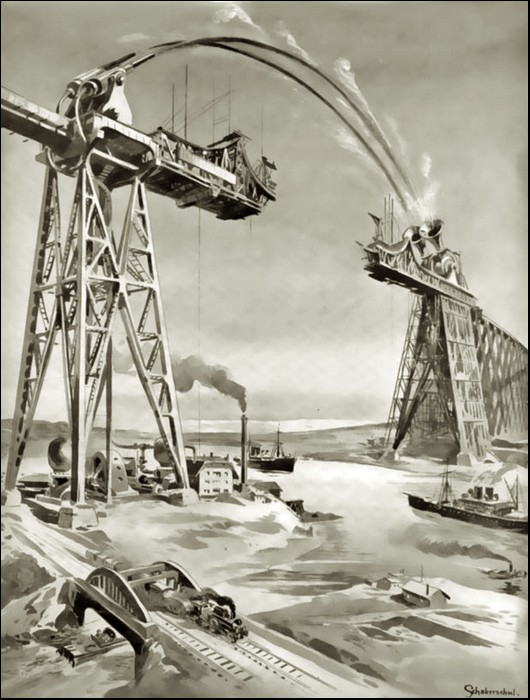
Eine Erfindung von epochemachender Bedeutung: Die Gußstahlbogenspritze
(für Brückenbauten mit größten Spannweiten). Links die Zwillingsspritze mit
Motorantrieb, rechts die Saugtrichtermaschine. Der flüssige Gußstahl wird
in verstellbaren Bogen von einem Pfeiler zum andern gespritzt,
bis er an der Luft erstarrt.
Mr. Bridge hob den Boy in sein Auto.
»Junge, wie heißt du?« — »Bob Steel.« — »Wo wohnen deine Eltern?« — »Habe keine Eltern mehr. Ma starb vor einem Monat.« — »Wieviel wolltest du für deine Idee von mir haben, Bob?« — »Was Sie mir geben wollen, Mr. Bridge.«
Mr. Bridges Augen ruhten einen Augenblick prüfend auf dem Antlitz des Jungen; dann sagte er mit einem raschen Entschluß: »Du sollst mir wie ein Sohn sein, armer Boy — zwar habe ich schon ein zehnjähriges Girl daheim — ich will für deine Ausbildung sorgen von heute an! Heute nachmittag schon machen wir einen ersten Versuch mit deiner Gußstahlbogenspritze: deine Idee ist Millionen wert! Komm, laß den Plunder brennen!«
Und er winkte dem Chauffeur. —
Sehr originell ist auch das augenblicklich an der französischen Mittelmeerküste viel gebrauchte
Man weiß, daß die Fische im Wasser das Läuten der Glocke hören, die sie zur Fütterung ruft. Auf diese seit langem bekannte Tatsache hat der Erfinder, M. Potéphan, seinen Apparat gegründet.

Eine Revolution der Fischerei: Das Unterwasser-Grammophon als Lockmittel.
Der Musikapparat ist vollständig eingekapselt. Der Antrieb geschieht durch
Tretmotore von der Wasseroberfläche aus. Der mit seinen Kollegen telephonisch
verbundene Taucher bedient sich eines Fangnetzes mit portemonaieartiger
Schnappvorrichtung.
Man denke sich auf dem Meeresboden in der Nähe der Küste ein Riesengrammophon in vollständig wasserdichter Einkapselung, das allerdings nicht die neuesten Schlager, sondern einfache, aber doch harmonische Weisen, Akkordfolgen oder Märsche spielt. Die Schalltrichter sind mit schalldurchlässigen Gelatine- oder Gummiplatten geschlossen. Der Antrieb des seltsamen Apparats geschieht durch sogenannte Tretmotoren, die von der Oberfläche aus bedient werden; die Übertragung der Rotation besorgen biegsame Wellen in Gummischläuchen, die zum Schutz mit feinem Messingdraht umsponnen sind. Die Tretmotoren vermitteln auch den Antrieb der Luftpumpe und regeln die Luftzufuhr für den in der Nähe des Grammophons mit seinem Fangapparat fischenden Taucher. Der Fangapparat ist eigentlich ein großes Netz, dessen obere Ränder durch einen Handgriff des Tauchers an der Netzstange wie die Bügel eines Portemonaies zuschnappen oder sich öffnen. Zur Sicherheit ist der Taucher mit seinen Kollegen an der Oberfläche telephonisch verbunden.
Nach den einwandfreien Beobachtungen, deren Ziffern sich zurzeit über sechzehn Monate erstrecken, hat der Fischfang an den zehn Versuchsstationen fast um das Zehnfache (9,825 ist der genaue Faktor) zugenommen. Die Fische müssen also viel musikalischer sein, als wir Menschen gemeiniglich denken.
Noch kurz seien hier zwei epochemachende Erfindungen erwähnt, welche die Aufspeicherung der Energie zum Gegenstande haben. Die eine stammt vom Rhein; sie bezweckt
ein oft versuchtes Problem, dessen Lösung dem Chemiker Dr. Niersteiner endlich unter Benutzung des schon von Dr. Heinz Sucher entdeckten, Sonnenlicht aufsaugenden Elementes Apollonium(*) gelungen ist. Die Abbildung zeigt unten im Gelände des Vordergrundes die aufgestellten Maschinen, welche die Sonnenstrahlen in ihren mit fein verteiltem Apollonium überzogenen Flächen aufsaugen; oben auf den Höhen stehen die riesigen Scheinwerfer, welche das im Apollonium konzentrierte Sonnenlicht wieder auf die Rebenhügel ausstrahlen. Es liegt also jetzt in der Hand des Menschen, zur Erzielung eines guten »Jahrgangs« schön Wetter zu machen, wenn auch Nebel und Wolken »noch so dicht sich vor den Blick der Sonne« drängen.
(*) Vergl. »Chemische Berichte 35, 298! — 1 Vgl. Gefangener Sonnenschein (S. 43—64).
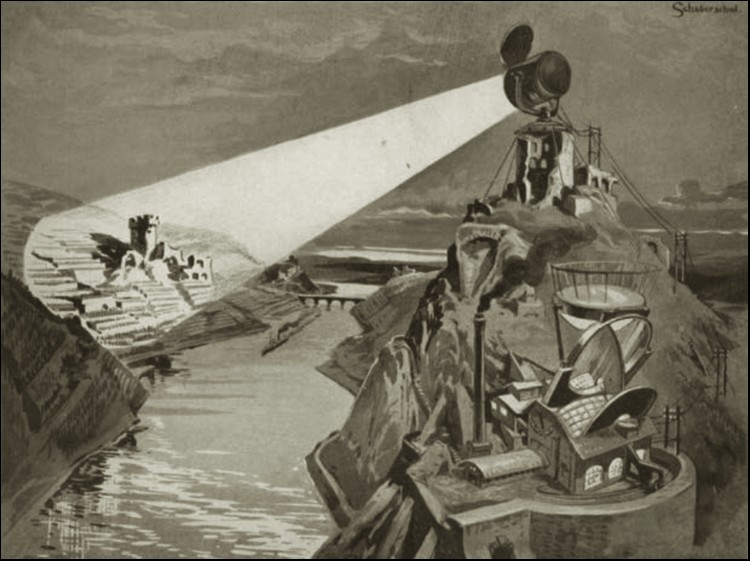
Die Lösung der Weinernten-Frage: Riesen-Sonnenscheinwerfer zur
Bestrahlung der Rebenberge bei bedecktem Himmel. Die Sonnenstrahlen
werden bei schönem Wetter aufgesaugt und aufgespeichert und an wolkigen
Tagen zu den Scheinwerfern hinaufgeleitet, um von dort auf die Weinberge
geworfen zu werden.
Die zweite Erfindung ist das Werk des Mannes, dem die Welt schon so manche Errungenschaft auf elektrischem Gebiete verdankt; sie ist von Ni ko l a Te s l a, dem Erfinder des T r a n s f o r m a t o r s, ohne den eine Fortleitung des elektrischen Stromes auf weite Entfernungen hin noch heute nicht möglich wäre, des
T e s l a - L i c h t e s, der T e s l a - S tr ö m e. Er nennt sie den
und dieser Name gibt in seiner Einfachheit die ganze gewaltige Bedeutung seiner Erfindung wieder. Um nichts weniger nämlich handelt es sich dabei als um das Aufsammeln der gewaltigen Elektrizitätsmengen der Blitze mit ihren millionenmal Millionen Pferdekräften in besonders konstruierten Auffanggefäßen und um ihre durch Transformatoren geregelte Entnahme zu beliebiger Zeit, zu beliebiger, sich dem technischen Gebrauch bequem anpassender Verwendung. Die Abbildung zeigt vorn einen der Angestellten Teslas in seinem Schutzgewande von dünner Messinggaze, der bei einem gerade stattfindenden Gewitter das Voltmeter und das Ampèremeter abliest. Ein erschreckter Besucher ist auch von dem Zeichner auf dem Bilde festgehalten worden. Die Treppe führt nach dem Hintergrunde zu, um ein solches Auffanggefäß, einen riesigen »Bottich«, herum nach dem Obergeschoß, dem eigentlichen Laboratorium des berühmten Erfinders.
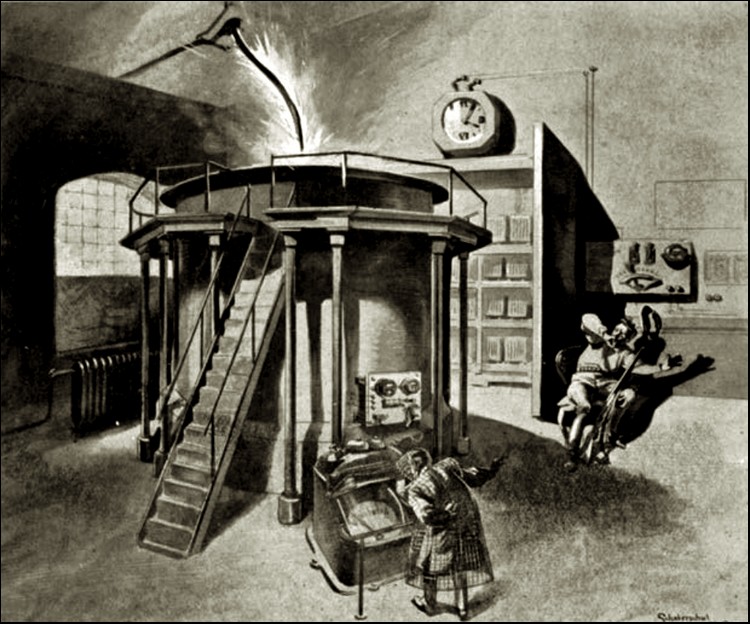
Die neueste Erfindung Nikola Teslas:
Der Blitzesammler, ein Elektrizitätsreservoir.
Wie Tesla den Blitzesammler konstruiert hat, hüllt er natürlich in Schweigen. Doch die Tatsache der Erfindung steht fest, und seine begeisterten Anhänger drüben im »Lande der unbegrenzten Möglichkeiten« haben ihm schon bereitwillig die eine Hälfte der Grabinschrift Benjamin Franklins zugestanden: »Eripuit fulmen coelo!« (Er entriß dem Himmel den Blitz!)
Vielleicht enthüllt er im kommenden Jahre der Mitwelt das Geheimnis seiner wunderbaren Erfindung — und dann wollen wir es unserseits an nichts fehlen lassen, unseren verehrten Lesern davon die schnellste und genaueste Kunde zu geben.
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.