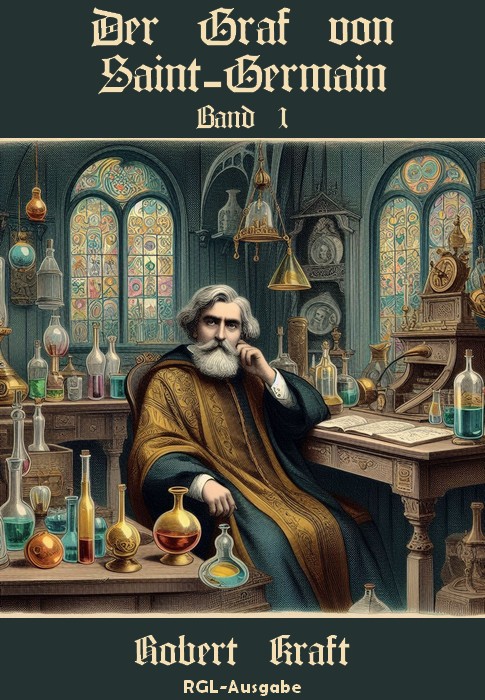
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.
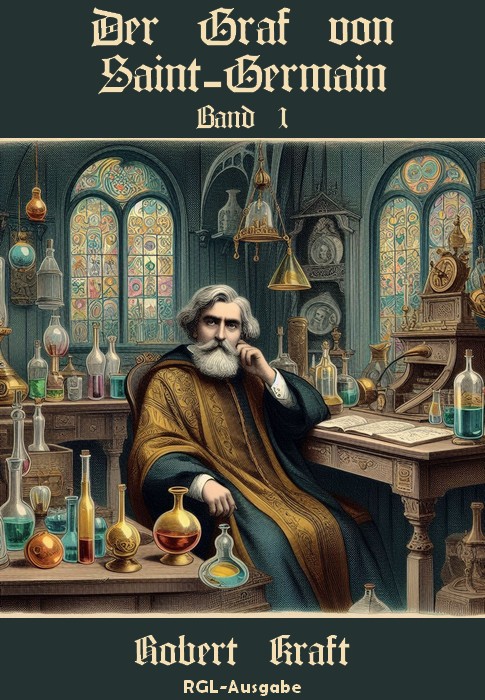
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
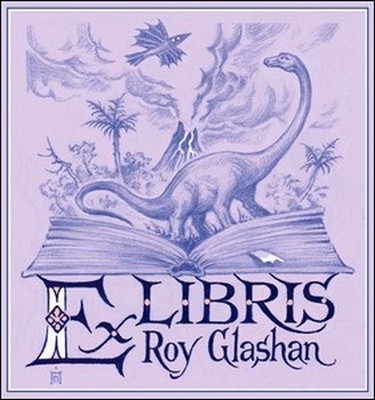
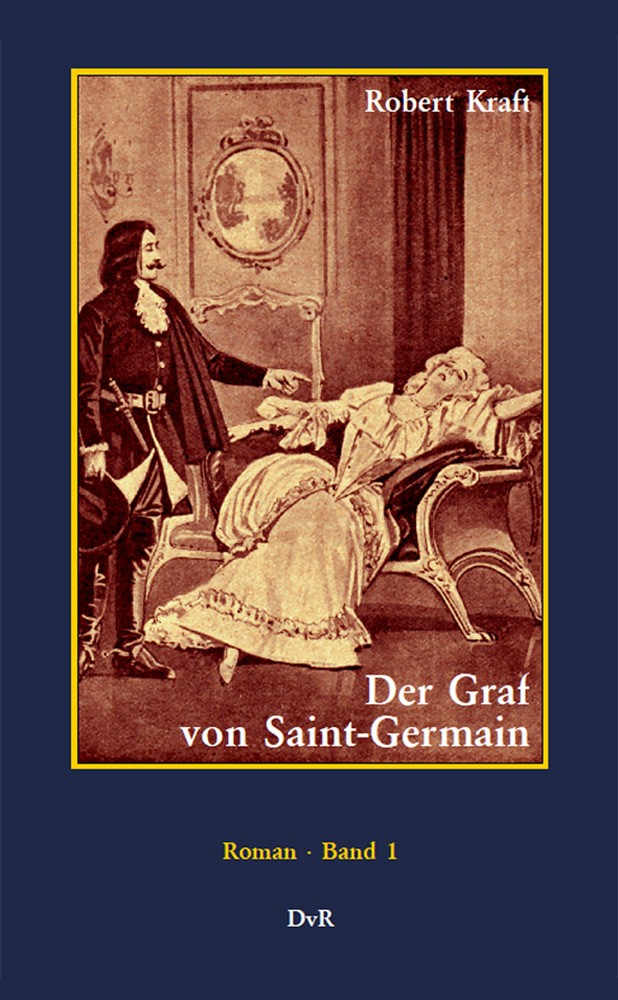
"Der Graf von Saint-Germain," Band 1, Verlag Dieter von Reeken, 2023
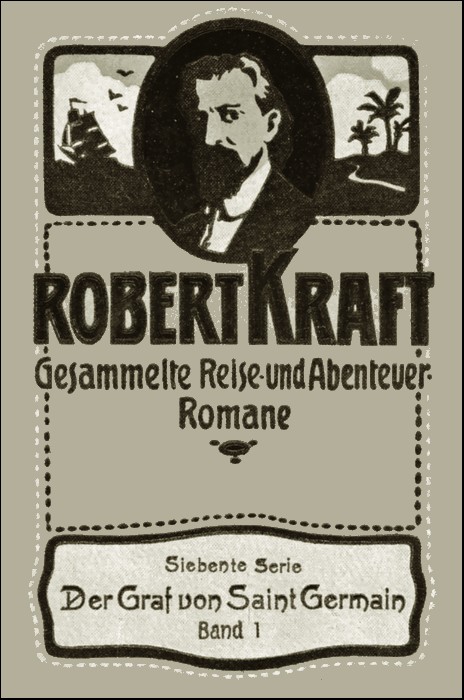
Der vorliegende erste Band [1] dieser Neuausgabe enthält den ungekürzten Text des ersten Bandes des von Robert Kraft (1869-1916) verfassten Romans
Der Graf von Saint-Germain. Roman von Robert Kraft. Illustrierte Ausgabe. Niedersedlitz-Dresden: H.G. Münchmeyer G.m.b.H.o.J. [1910]. Buchblockformat ca. 12,0 x 18,5 cm, 748 S. mit 15 Tondruck- und 12 Strichzeichnungen von Adolf Wald.
[1] Band 2 enthält bei einem Umfang von 766 Seiten 13 Tondruck- und 14 Strichzeichnungen von Adolf Wald.
Der Roman ist erstmals 1909 in 21 Lieferungen im gleichen Verlag erschienen. Die Lieferungshefte enthielten neben Der Graf von Saint-Germain den ebenfalls von Robert Kraft verfassten Roman Wenn ich König wäre. Wegen der Daten zu weiteren Auflagen und Ausgaben verweise ich auf die umfassende Bibliografie von Thomas Braatz.[2] Ausführliche Informationen über Robert Kraft und sein Werk enthält die farbig illustrierte Biografie von Walter Henle und Peter Richter.[3]
[2] Thomas Braatz: Robert Kraft — Farbig illustrierte Bibliographie zum 100. Todestag. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer, 3., erweiterte Aufl. 2016. — 1032 S. mit über 1000 farbigen Abb.
[3] Henle, Peter Richter: Unter den Augen der Sphinx. Leben und Werk Robert Krafts zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2005.
Der Verlag stellte den Roman u. a. auf den hinteren Umschlagseiten der Lieferungshefte wie folgt vor:
Die Kunst, aus unedlen Metallen Gold zu machen, hat schon in alten Zeiten die Menschheit beschäftigt, und es gab viele Fürsten, die durch die Alchimie ihren Finanzen aufhelfen wollten. Um diese Fürsten gruppierten sich natürlich viele Abenteurer, die aber mitunter über erstaunliche Kenntnisse verfügten und ihrer Zeit um viele Jahre voraus waren. — Zu den bedeutendsten Alchimisten aller Zeiten gehörte der Graf von Saint-Germain. Seine ans Fabelhafte grenzen den Künste, die ihm die Gunst der höchsten Personen brachten, ihn aber auch für viele zum Schrecken werden liessen, sind in dem Tagebuch eines deutschen Fürsten niedergelegt. Dasselbe wurde nur in wenigen Exemplaren gedruckt und gehört heute zu den kostbarsten Raritäten der Bibliotheken. Der bekannte Schriftsteller Robert Kraft, der auf seinen weiten Reisen ein Exemplar dieses Tagebuches in die Hände bekam, hat den Stoff verarbeitet und in dem Roman »Der Graf von Saint-Germain« ein Werk geschaffen, das zu den spannendsten
Erzeugnissen der Weltliteratur gehört, sich dabei aber streng an die bekannten Ereignisse hält. Der Roman führt uns aus den Laboratorien der Goldmacher in die geheimen Gesellschaften und Logen der römischen Aristokratie, nach Afrika und Indien. Der Roman zeigt uns aber auch den nachmaligen berühmten Alchimisten und Geisterbeschwörer Cagliostro, der auf ein äusserst reichbewegtes Leben zurückblicken konnte, als Zauberlehrling des Grafen, und es ist interessant, den Werdegang dieses ungewöhnlichen Mannes kennen zu lernen.
Es versäume daher niemand, auf den Roman »Der Graf von Saint-Germain« zu abonnieren.[4]
[4] Der Graf von Saint-Germain. Roman von Robert Kraft. 1. Band. Illustrierte Ausgabe. Niedersedlitz-Dresden: H.G. Münchmeyer G.m.b.H. 1909, Lieferung 1, hintere Umschlagseite.
Der im Original in Fraktur gesetzte Text ist in Antiqua (Garamond Standard) umgewandelt und an die sei [1996 geltenden neuen Rechtschreibregeln angepasst worden. Offensichtliche Rechtschreibfehler und überholte Schreibweisen sind stillschweigend berichtigt worden, z. B. »Boller« in »Poller«, »an der Tiber« in »am Tiber«, »Indier« in »Inder«, »Sennor/Sennora/Sennorita« in (spanisch) »Señor/Señora/Señorita« bzw. (portugiesisch-brasilianisch) »Senhor/Senhora/Senhorita«, »Wage« in »Waage« usw.
Fußnoten mit Sternchen (*) stehen so auch im Originaltext, solche mit hochgestellten Zahlen (1) sind vom Herausgeber eingefügt worden.
Die Wiedergabequalität der Abbildungen war abhängig von der jeweiligen Druckqualität der Vorlagen. Da die den Lagen vorangestellten ganzseitigen Abbildungen in der vorliegenden Neuausgabe dem Fließtext räumlich zugeordnet werden konnten, ist auf die fast textgleichen Bildunterschriften verzichtet worden.
Für freundliche Unterstützung durch den Originaltext der Erstausgabe, für Bilder, Hinweise und die bibliografischen Anmerkungen bedanke ich mich bei Thomas Braatz, für die die Korrektur bei Ellen Radszat und Mike Neider.
Die Zusammenarbeit zwischen dem Verlag Münchmeyer bzw. seinen jeweiligen Eigentümern und Robert Kraft war kompliziert. In der Zeit, als Pauline Münchmeyer den Verlag anführte, wurde Kraft entdeckt und erhielt einen Vertrag über vier Kolportageromane. Mit dem Verkauf des Verlages an Adalbert Fischer änderte sich manches. Einige Werke Krafts erschienen in überarbeiteter Fassung und gediegener Buchausstattung mit neuen Illustrationen. Fischer lehnte aber auch Stoffe ab, die der Autor dann teilweise bei anderen Verlagen unterbrachte. Kraft wollte kürzere Texte schreiben, die jedoch nicht in das Vertriebsschema der Kolportage passten. 1907 bekannte er sich in Nächtliches Ahnen, seiner Kurzbiografie, als Volksschriftsteller ganz zur Kolportage.
Man fand eine Lösung, die beide Seiten zufriedenstellte. In der Reihe ›Die Augen der Sphinx‹ konnte man nacheinander einige seiner Romane unterbringen.
Nach dem Erfolg bot er unter dem Titel Der Graf von Saint-Germain ein neues Werk an, das ursprünglich in Lieferungsheften, komplett hintereinander wie üblich, erscheinen sollte. Der Seitenumfang betrug 48 Seiten, das entsprach der vorhergehenden Serie ›Die Augen der Sphinx‹. Bis zu Heft 6 wurde das so praktiziert. Ab Lieferung 7 wurden 16 Seiten von Wenn ich König wäre! beigeheftet, ohne dass dies auf dem Umschlag des Heftes sichtbar gemacht wurde. Zu jeder folgenden Lieferung wurden Seiten eines anderen KraftTextes dazu geheftet, allerdings mit eigener Nummerierung.
Man kann nur vermuten, warum der Verlag so vorging. Vielleicht war Kraft nicht in der Lage, entsprechend dem Erscheinungsrhythmus zu liefern. Man füllte also die Seitenzahl mit einem anderen Stoff auf, der sich ebenfalls über mehrere Hefte verteilte. Diese Vorgehensweise war nicht typisch für Kraft, aber bereits bei dem Lieferungsroman Das Mädchen aus der Fremde wurde es so gehandhabt. Oder dem Autor war während des Schreibens bewusst geworden, dass der Stoff nicht für 60 Lieferungen reichen würde. Der Verlag hatte bereits mit der ersten Lieferung angegeben, wie viel die komplette Reihe kosten würde, dazu war er gesetzlich verpflichtet. Bei einem Preis von 20 Pfg. wurde folglich der Gesamtpreis von 12 Mark angegeben, was der Anzahl von 60 Lieferungen entsprach. Anders als bei Nobody schrieben diesmal keine anderen Autoren mit, man schloss also die Lücken (in der Regel 16 Seiten) mit anderen schon vorhandenen KraftTexten. So konnte Der Graf von Saint-Germain wenigstens bis zur 57. Lieferung durchgehalten werden.
Da ich lange Zeit keine Exemplare der Lieferungen dieses Romans besaß — sie sind sehr selten —, rätselte ich über die genaue Aufteilung. Es gab keine Lieferungshefte mit den Titeln Wenn ich König wäre!, Das Glück von Robin Hood usw. Sind sie vielleicht unter dem Übertitel Der Graf von Saint-Germain erschienen? Nirgendwo fand ich Informationen darüber, in welchem Lieferungsheft sich welcher Text befand. Walter Henle verortete die Romane in die Reihe ›Robert Kraft. Gesammelte Reise- und Abenteuerromane‹ in 60 Lieferungen, 6 (Einzel)Bänden. Ihm lagen die Lieferungshefte ebenfalls nicht vor. Die Annoncen von Münchmeyer aus dieser Zeit halfen auch nicht weiter. In der Robert-Kraft-Bibliographie von 2005 stehen deshalb falsche Angaben.
Mit dem Erwerb eines Konvolutes der Hefte und mit Hilfe von Werner Kocicka gelang es, die richtige Publikationsreihenfolge zu finden. Die bibliografischen Angaben wurden in der Robert-Kraft-Bibliographie 2016 entsprechend korrigiert und ergänzt. Den Lieferungen 7—22 waren Wenn ich König wäre!, den Lieferungen 23—34 Das Glück von Robin Hood, den Lieferungen 34—39 Die Arbeiten des Herkules und den Lieferungen 40—57
beigeheftet.
In den Buchausgaben wurden die eingefügten Texte zusammengestellt und erschienen als Einzelbände mit eigenständigen Titeln. Später wurden sie unter den Reihentiteln ›Robert Kraft — Gesammelte Reise- und AbenteuerRomanerslaquo; und ›Berühmte Reise- und AbenteuerRomane‹ in Buchform publiziert.
[1] Der Graf von Saint-Germain. Rezension von Dr. Friedrich Wallisch. In: Neues Wiener Journal. Unparteiisches Tagblatt, 7. September 1924, Nr. 11.065, 32. Jahrgang, Lippowitz & Co, S. 18, übertragen von Thomas Braatz. Die damalige Rechtschreibung wurde beibehalten.
Eine der rätselhaftesten Abenteuerfiguren des 18. Jahrhunderts ist der Graf von Saint-Germain. Über ihn ist weit weniger geschrieben worden als über seinen Nachfolger Cagliostro, dessen Lebensschicksal eine reiche biographisch-kritische Literatur erzeugt hat. Immerhin sind über Saint-Germains Abstammung nicht weniger als vier Streitschriften entstanden. Die eine kam zu dem Ergebnis, er sei ein Portugiese namens Betmar gewesen, die zweite bezeichnete ihn als einen spanischen Jesuiten Aymar, die dritte als den Sohn des Steuereinnehmers Ronaldo zu St. Germano in Savoyen, die vierte als elsässischen Juden Simon Wolf.
Als er im Frühjahr 1750 — es soll der 3. Juni gewesen sein — in Rom auftauchte, in einem Sarge als wiedererwachte Leiche, und mit seinen »übernatürlichen« Fähigkeiten und Fertigkeiten die ganze heilige Stadt auf den Kopf stellte, war allerdings von einem Simon Wolf oder einem Steuereinnehmerssohn nicht die Rede. Er gab sich vielmehr als einen der irdischen Unsterblichkeit teilhaftigen Wundermann aus und behauptete, statt Speise und Trank hin und wieder eines ungefähr hundertjährigen Todesschlafes zur Regeneration seiner Kräfte zu bedürfen. Er behauptete, zur chaldäischen Zeit in Babylon gelebt zu haben, um 600 v. Chr. in Phönizien, zu Buddhas Zeit in Indien, als Hasdrubal zu Hannibals Zeit in Karthago, mit Christus in Jerusalem, als portugiesischer Kapitän unter Heinrich dem Seefahrer, als Begleiter des Kolumbus nach Amerika gekommen zu sein und unter Ludwig XIII. in Frankreich gelebt zu haben. Von Heinrichs IV. Gattin Maria von Medici habe er den Titel eines Grafen von Saint-Germain erhalten. Am 15. Oktober 1647 sei er zum letztenmal »gestorben«.
Trotzdem seine Wundertaten unzählige Gläubige fanden, wurde ihm der Boden in Rom bald zu heiß, er verschwand spurlos, soll sich mehrere Jahre in Indien aufgehalten haben und erschien 1756 in Paris, wo er als Lehrmeister der Alchimie die Gunst Ludwigs XV. und der Pompadour gewann. Im Jahre 1762 brachte er es zum französischen Gesandten in London. Aber bald folgten wieder Jahre abenteuerlichen Wanderns. Er gelangte nach Rußland, nahm dort, angeblich mit Recht, Namen und Titel eines Grafen Soltykow an, tauchte bald in Berlin, bald in Schwabach als Freund des Markgrafen Karl Alexander von Ansbach auf (1774) und kehrte in dessen Begleitung als Soltykow, nicht mehr als Saint-Germain, nach Italien, in das Land seiner alten Triumphe, zurück. Er versäumte nicht, durchblicken zu lassen, daß er von der Zarin Katharina II. in wichtiger diplomatischer Mission ausgeschickt sei. Später hielt er sich am Hofe des Landgrafen Karl von Hessen auf und starb im Jahre 1780 in Eckernförde eines durchaus natürlichen Todes.
Daß es sich wohl verlohnt, dem verworrenen Lebensschicksal dieses wunderlichen Mannes nachzuforschen, hat neuerdings Robert Kraft bewiesen: in einem zweibändigen Werk von mehr als 1500 Seiten Umfang, »Der Graf von Saint-Germain«, Verlag H. G. Münchmeyer, Niedersedlitz, Dresden, erzählt er die Geschichte dieses Abenteurers. Als reichlich geheimnisvolle Quelle führt er das Tagebuch eines deutschen Fürsten an, das angeblich noch heute im Geheimarchiv eines Schlosses liegt. Von diesem Tagebuch des vertrautesten Freundes des Grafen von Saint-Germain — aus »diskreten« Andeutungen ist zu schließen, daß es sich um den Markgrafen Karl Alexander von Ansbach handelt — sei nach Krafts Angaben ein englischer Auszug in die Öffentlichkeit gelangt, der zu den seltensten Kostbarkeiten einiger weniger Bibliotheken des Auslands gehören soll.
Kein Zweifel, die Darstellung von Saint-Germains Lebenslauf, wie ich sie nach diesem Buche oben skizziert habe, ist ein Roman, und Kraft will auch nichts anderes geschrieben haben als einen Roman, vielleicht einen historischen Roman. Das Gerüst der Handlung aber ist geschichtlich, und im wesentlichen ist nur eines die Arbeit dichterischer Phantasie: Kraft läßt den Grafen nicht bloß Alchimisten und betrügerischen Wundermann sein, wie den späteren Cagliostro, sondern er hat auch den reizvollen Einfall, in dem Grafen von Saint-Germain einen geistig und körperlich außergewöhnlich entwickelten, genialen Menschen hinzustellen, der die Erfindungen und Fertigkeiten später Jahre und Jahrhunderte bereits kennt. Er kennt sie zum Teil als glücklicher Schüler namenlos gebliebener Gelehrter, zum Teil selbst als Forscher und Mann der Tat. Und das Tragische dieser Gestalt ist es, daß Saint-Germain — zum Unterschied von seinem habgierigen und gewissenlosen Schüler und Nachahmer Josef Balsamo, dem späteren Grafen Cagliostro — nur auf dem Wege der frommen Lüge, des gutgemeinten mundus vult decipi, als Apostel einer Menschheitsveredlung sich durchzusetzen meint. Derartige dichterische Bereicherung der geschichtlichen Gestalt des Abenteurers versöhnt mit manchen bedenklichen Schwächen dieses Buches, das nicht zuletzt durch allzu breite lebhafte Exkurse an Bündigkeit einbüßt.
Der Graf von Saint-Germain hat wie Cagliostro zweifellos Suggestion und Hypnose wissentlich angewandt, er war wie Cagliostro ein Bauchredner; Robert Kraft geht von der Tatsache aus, daß diese Hexenmeister spätere Allgemeinkenntnisse vorweggenommen haben, und fabuliert in fesselnder Weise weiter: Saint-Germain war der erste Europäer, der die indische Atemtechnik beherrscht hat, er war vor dem Zeitalter der Virtuosen Geigen- und Klaviervirtuose, er war ein unvergleichlicher Fechtmeister, Taschenspieler und Rechenkünstler, er kannte bereits die Elektrizität und ihre praktische Verwertung, die Dampfmaschine und sogar den — künstlichen Zahnersatz. Ein reizvoller Gedanke: Wer vor anderthalb Jahrhunderten die Technik unserer Zeit beherrscht hätte, wäre als Künder des Übernatürlichen gepriesen worden.
Aber gerade damit sind tatsächlich die historischen Möglichkeiten des Wundermannes aufgezeigt. Sie alle, die Hexen des Mittelalters, die Alchimisten, die wunderlichen Geisterseher des 18. Jahrhunderts, ein Swedenborg, ein Garner und in entsprechendem Abstand der Graf von Saint-Germain und Cagliostro haben unbewußt oder wissend über Fähigkeiten verfügt, die den Gesichtskreis der Zeit überstiegen. Darin liegt die gefährliche Macht dieser Menschen.
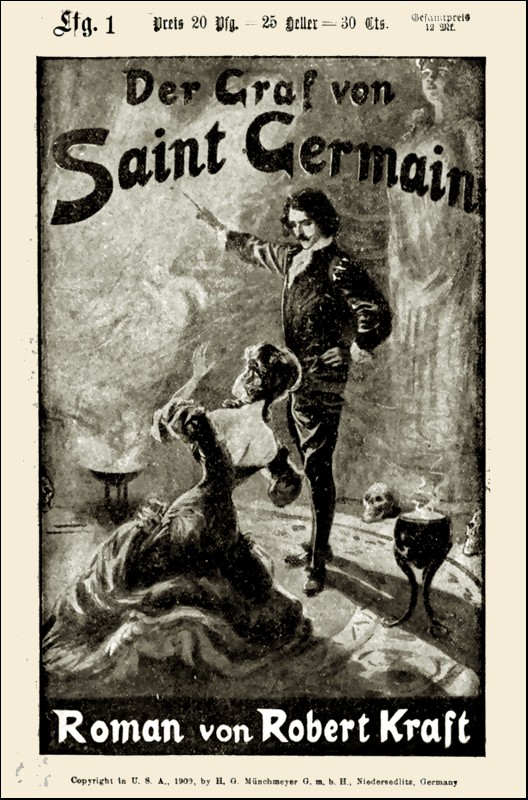
Lieferungsumschlag von Der Graf von Saint-Germain. Roman
von Robert Kraft. Illustrierte Ausgabe. Niedersedlitz-Dresden:
H.G. Münchmeyer G.m.b.H. o.J. [1909], Lfg. 1, Umschlagseite 1
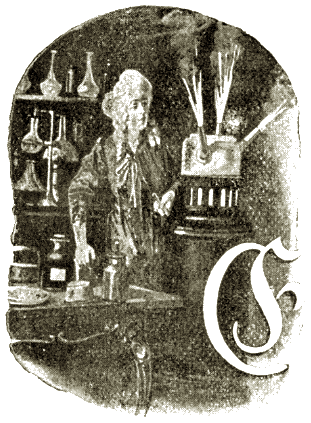
Ein düsteres Gewölbe, vollgepfropft mit gläsernen und kupfernen Destillierkolben, Phiolen, Flaschen und Büchsen, ein glühender Ofen, auf dem es in einem Kessel brodelt und zischt, und vor dem Ofen ein junges, schönes, blasses Weib in säurezerfressenem Arbeitskittel, das mit atemloser Spannung den chemischen Vorgang beobachtet.
In dem Kessel steigt schäumend eine grüne Masse empor — jetzt, jetzt ist es so weit! — nun schnell eine Schale mit Quecksilber hineingegossen, wodurch der grüne Schaum zurücksinkt, nun schnell das Ganze in ein kaltes Wasserbad gestellt, tüchtig umgerührt...
Nach zehn Minuten ist die Masse erkaltet, und was daraus zum Vorschein kommt, ist ein roter Sirup. Jetzt ist das blasse, sonst so schöne Antlitz vor Aufregung fast verzerrt, als sie mit einem Glasstabe in dem Kessel sucht — aber es bleibt bei dem roten Sirup, nichts anderes ist darin zu finden.
Da sinkt das Weib gebrochen und ächzend auf einen Stoß Pergamentbücher nieder.
»Wiederum betrogen! Der goldene Löwe hat den gelben Drachen noch immer nicht besiegt! Und morgen habe ich zehntausend Dukaten zu zahlen!« —
Es war in der höchsten Blütezeit des Wahnes, Gold machen zu können. Noch höher ging das Streben, wenn man den Stein der Weisen entdecken wollte, der seinem Besitzer ewige Jugend verlieh, im höchsten Grade ihm alle Geheimnisse des Himmels und der Erden offenbarte.
Aber unedle Metalle in Gold verwandeln zu können, das genügt ja schon. Und wie ein Fluch war es über die ganze zivilisierte Menschheit gekommen. Papst und Kaiser, Klosterdiener und Arbeiter, alle betrieben die Goldmacherkunst, meist ohne sonst auch nur eine Ahnung von der Chemie zu haben, und wehe dem, der der einmal einen kleinen Erfolg gehabt zu haben glaubte oder sich aus einem anderen Grunde diesem Hirngespinste ganz ergab. Mancher bisher fleißig gewesene Handwerker verkaufte sein Werkzeug, um sich Retorten und Tiegel anzuschaffen, ließ über seinen planlosen Experimenten Frau und Kinder verhungern.
Immer von Neuem genährt wurde dieser Wunderglaube von professionellen Alchimisten, die sich Adepten nannten und vorgaben, Gold machen zu können. Ihre Rezepte dazu verkauften sie an Fürstenhöfe wie dem kleinen Manne. Ehe diese Rezepte aber wirksam auszuführen waren, musste man eine lange Vorbereitungszeit durchmachen, man musste fasten und nachtwachen und so und so viele Gebete sprechen oder Teufelsdienste verrichten, Eidechsenschwänze und andere widerliche Dinge sammeln, den Strick eines Gehängten, oder einem totgeborenen Kinde den Finger abschneiden, dann kam noch die Stellung der Gestirne hinzu — und glückte nun das Experiment nicht, so hatte man eben in ›geistiger Hinsicht‹ etwas verfehlt. Der Adept aber wusste durch geschickte Gaukeleien immer wieder vorzutäuschen, dass er unedle Metalle in Gold verwandeln könne, und wurde er einmal als Betrüger entlarvt, so tauchten für den einen zehn neue Adepten auf, die sich nicht so leicht entlarven ließen.
Auch die Herzogin Ludmilla Borghesia hatte sich seit dem Tode ihres Gatten diesem Wahnsinn ergeben. Sie stammte aus einer ganz einfachen Familie, war aber die Nichte des Papstes. Der Herzog hatte auch nichts weiter als seinen uralten Titel gehabt, aber er hatte eben die Nichte des Papstes geheiratet, der die beiden reichlich mit Palästen und Gütern ausstattete. Das junge Ehepaar hatte diese dazu benutzt, Hypotheken aufzunehmen und das meiste Geld am Spieltisch zu verlieren. Auch nach dem Tode ihres Gatten setzte die Herzogin ihr luxuriöses Leben fort, ihr päpstlicher Onkel, der sie über alles liebte, die schöne Nichte vergötterte, bezahlte ja noch — bis es eben nicht mehr ging. Es hat alles seine Grenzen. Nun hatte sie es noch einmal mit der Goldmacherei versucht, schon seit einem halben Jahre, war so fest davon überzeugt gewesen, dass es ihr doch noch gelingen würde, sodass sie auf das zukünftige Gold schon immer Schulden gemacht hatte.
Und nun war es wieder nichts! Ein neuer Gauner hatte sie betrogen, obgleich er ihr Empfehlungsbriefe von allen europäischen Fürstenhöfen vorgelegt hatte.
Umsonst hatte sie eine Woche lang nur trocknes Brot gegessen, umsonst eine lebendige Kröte auf der bloßen Brust getragen, umsonst während dieser Zeit die unnatürlichsten und widerwärtigsten Dinge getrieben — anstatt des glitzernden Goldes war da ein roter Sirup entstanden, den man nicht einmal essen konnte.
»Wiederum betrogen! Der goldene Löwe hat den gelben Drachen noch immer nicht besiegt! Und morgen habe ich zehntausend Dukaten zu zahlen!«
Nein, nicht erst morgen. Die Ampel verlosch. Durch die erblindeten Fensterscheiben graute der neue Tag herein. Schon heute würden die Gläubiger kommen und sie aus diesem Palaste vertreiben. Was sie noch besaß, das war nicht der Rede wert. Und der Papst würde nicht mehr für die einst so geliebte Nichte eintreten.
Da klopfte es an der eisenbeschlagenen Tür, welche dieses unglückselige Heiligtum verschloss.
Unwirsch fuhr die Herzogin empor.
»Wer wagt es, mich hier zu stören?!«, rief sie zornig, aber im Geheimen angstvoll an einen Diener denkend, der die Herrin in der frühesten Morgenstunde selbst hier aufsuchen könne, um den rückständigen Lohn zu fordern.
»Dein Vater«, erklang draußen eine fette Stimme.
Erleichtert stand die Herzogin auf, um die Tür zu öffnen. Es war nicht ihr leiblicher Vater — den hatte sie nicht mehr — sondern ihr Beichtvater, ein entfernter Verwandter, den ebenfalls der Papst von einem armen Mönchlein zum wohlbestallten Prior eines Bettelklosters gemacht hatte.
Hastig trat die dicke Gestalt ein, in dem feisten Gesicht funkelte die Nase ganz verdächtig.
»Was führt dich so früh hierher, Antonio?«, redete die Herzogin ihn, der jetzt Pater Hilarion hieß, mit seinem früheren, weltlichen Namen an. »Bringst du mir die zehntausend Dukaten?«
Die zwinkernden Augen hatten schnell das ganze Laboratorium durchflogen.
»Du träumst, Ludmilla! Viertel, halbe und auch ganze gebratene Hühner genug, gestern erst hat mir so eine Vettel, der ich wieder einmal die Hölle erließ, ein ganzes Fass Falerner geschickt — zu hungern und dursten brauchst du nicht, solange ich lebe — nur kein Geld. Wir stehen unter zu strenger Kontrolle. Was war es mit dem Rezept?«
»Da, der rote Teig ist dabei herausgekommen.«
»Hätte ich dir schon vor drei Tagen sagen können. Dein Professor Dorio Vittore war ein Schwindler.«
»Was?! Woher weißt du...?«
»Wie lange hältst du dich hier eingeschlossen?«
»Seit einer Woche faste ich, habe keinen Menschen gesehen.«
»Eben deshalb kannst du es nicht wissen. Dein Professor ist als Betrüger entlarvt worden, alle seine Zeugnisse waren gefälscht, gestern ist er gerädert worden.«
Noch einmal sank die Herzogin ganz gebrochen zusammen. Und dabei hatte ihr Pater Hilarion diesen Betrüger, dem sie für sein Rezept ihren letzten Schmuck geopfert, erst empfohlen. Denn die beiden arbeiteten oft zusammen, mindestens unterhielten sie sich während der Beichtstunden nur über die Goldmacherkunst.
»Höre mich an, Ludmilla«, fuhr der Pater fort. »Jetzt habe ich wirklich den roten Löwen gefunden...«
»Ach, wie oft hast du das nicht schon gesagt!«
»Das war immer nur meinem eigenen Kopfe entsprungen, diesmal ist es etwas anderes. Lass dir nur erzählen. Ich habe diese Nacht einen Traum gehabt. Erst vorhin. Erschöpft von langen Gebetsübungen, war ich erst gegen Mitternacht eingeschlafen. Plötzlich erfüllte sich meine Zelle mit einem überirdischen Lichte, und in diesem stand vor mir der Erzengel Michael.
»Er winkte mir, ich erhob mich gehorsam, ganz ohne Furcht, er nahm mich bei der Hand, wir verließen das Kloster, gingen durch die Straßen Roms — das musst du dir alles so im Traume vorstellen, ich sah immer nur mich und den Erzengel Michael, oder vielmehr den Erzengel Michael und mich — wir betraten deinen Palast, befanden uns plötzlich hier in diesem Laboratorium — und alles sah ich genau so, wie ich es jetzt sehe — hier stand diese Flasche, und dort lag der halbe Zwieback mit den Spuren deiner Zähne — und nun nahm ich dich bei der Hand, alles ohne ein Wort zu sprechen, als müsste das so sein, wir verließen dein Haus, jetzt schritt uns der Erzengel Michael voran. wir betraten die Villa der heiligen Thekla...«
»Was, die Wohnung des Lords Walter Moore?!«, fuhr da das blasse Weib plötzlich mit flammenden Wangen empor.
Bisher hatte sie still zugehört, wohl mit Spannung, aber auch mit sichtlichem Unglauben. Sie glaubte an den ganzen Traum nicht. Und doch, sie glaubte daran. Ihr Beichtvater hätte ihr noch etwas ganz anderes vormachen können. Es waren eben damals noch die Zeiten, da das ganze Volk, hoch und niedrig, in den Banden des tiefsten Aberglaubens lag. Neunundneunzigmal ließ man sich täuschen, man schwur hoch und heilig, dass dies das letzte Mal gewesen sei, um zum hundertsten Male doch wieder jedem Märchen zu glauben, und das ganz besonders, wenn es aus dem Munde einer kirchlichen Person kam.
Dass die erwähnte Villa auf die Herzogin solch einen Eindruck machte, hatte seinen besonderen Grund.
Es war ein in schönster Gegend am Tiber gelegener Palast, noch aus der alten Glanzzeit Roms stammend. Die heilige Thekla sollte in ihm verschieden sein. Seit zwei Jahren residierte darin der englische Gesandte Lord Walter Moore. Der alte Pitt, Englands Reichskanzler, hatte für diesen verantwortlichen Posten eine ganz eigentümliche Wahl getroffen, aber doch wieder beweisend, dass er der englische Bismarck war.
Der noch junge Lord Walter Moore, Earl und Peer von England, war nicht nur Protestant, sondern er hätte auch noch in unserer aufgeklärten Zeit als der ausgesprochenste Freigeist gegolten, der an nichts glaubte, was er nicht mit den Händen fassen konnte. Und den nun nach Rom zu schicken! Und trotzdem, England hatte mit dem noch immer allmächtigen Rom nie auf besserem Fuße gestanden als durch Vermittlung dieses jungen Diplomaten. Abgesehen von seiner verschwenderischen Freigebigkeit, die ihm sein ungeheueres Vermögen gestattete, war es besonders seine Liebenswürdigkeit, sein ganzes Wesen, das jeden wie durch Zauberei fesselte. Er konnte spotten, wie er wollte, ihm verzieh man alles. Er, der an nichts glaubte, war in Wahrheit der Zauberer von Rom. Und gerade durch dieses sein offenes, ehrliches Glaubensbekenntnis harmonierte er ausgezeichnet mit Papst Benedikt XIV., dem trefflichsten, tolerantesten, aufgeklärtesten Manne, der je auf Petri Stuhle gesessen hat.
Wenn sich die Herzogin Borghesia in ihrer Not an diesen Lord gewendet hätte, es wäre ihr sofort geholfen worden. Aber sie tat es nicht. Und das sprach am besten für ihren Charakter.
Sie war nur, wie schon ihr Gatte, sehr leichtsinnig gewesen, hatte über ihre Mittel gelebt, nichts weiter. Und da ihr päpstlicher Onkel sie nicht mehr empfangen hatte, war ihr auch jedes andere anständige Haus verschlossen. Ohne dass es ausgesprochen, war sie in die Acht erklärt worden. Kein Mensch wagte sich ihr mehr zu nähern. Wucherer, ja. Nur Lord Moore schickte ihr nach wie vor Einladungen zu seinen Festlichkeiten, und er hätte sich jedenfalls gar nichts daraus gemacht, wenn ihretwegen alle anderen Gäste gegangen wären. Aber sie war nie gekommen.
Ein Hauptgrund zu ihrer Sündhaftigkeit mochte allerdings auch der sein, dass sie immer hoffte, doch noch das große Geheimnis des Goldmachens zu entdecken. — —
»Nun, und was weiter?«
»Wir betraten die Villa, der Erzengel Michael immer voran, und da kam uns schon der Lord Moore entgegen, wir fassten einander bei den Händen, ich in der Mitte, du links, der Lord rechts, und dann hatte plötzlich jeder eine Hacke in der Hand, und so gingen wir, dem Erzengel folgend, in den Keller hinab, immer tiefer, durch lange Gänge, immer links und rechts abzweigend — ich weiß den Weg noch ganz genau, kann ihn aber nicht beschreiben — und dann deutete der Erzengel gegen die Wand und war plötzlich verschwunden — und wir drei nahmen unsere Hacken und zertrümmerten die Wand — eine Höhlung zeigte sich — und da lag ein großer Löwe aus rotem Golde. Siehst du, da liegt der rote Löwe vergraben. Ich erwachte, der Tag graute, ich eilte sofort hierher.«
Die roten Wangen der Zuhörerin waren wieder erblasst, in dem schönen Antlitz kämpfte wieder Spannung mit Unglauben.
»Pater, Pater, so ein Traum!«
»Ja, im Traume wird es denen offenbar, welche Gott liebt«, war die salbungsvolle Antwort.
»Du willst doch nicht etwa gar jetzt da hin?«
»Aber sofort! Und du musst mit!«
»Nimmermehr!«, fuhr sie wieder mit flammenden Wangen empor.
»Du musst! Es muss alles ganz genau so eingehalten werden, wie es mir der Erzengel im Traume offenbart hat. Gehe ich allein hin oder nur mit dem Lord, so finden wir vielleicht eine Nische, aber sicher keinen roten Löwen darin.«
Der Aberglaube war bei dem Weibe stärker als alles andere. Immer schwächer wurde ihr Widerstand.
»Aber jetzt, in so früher Morgenstunde!«
»Der Lord sitzt mit Morgengrauen am Schreibtische, das ist bekannt genug, mit Ausnahme, wenn er einem Feste beigewohnt hat, und das war gestern nicht der Fall. Wir Bettelmönche wissen doch gar viel.«
»Der Lord lacht uns sicher aus, lässt uns ja gar nicht vor!«
»Er wird uns vorlassen und mit uns kommen, zumal wenn du dableibst.«
»Ah, jetzt durchschaue ich dich!«, rief sie mit funkelnden Augen. »Auf diese Weise willst du mich dem Lord Moore verkuppeln?«
»Habe ich dies etwa schon einmal versucht?«
»Oft genug hast du mir schon geraten, ich soll mich an ihn wenden.«
»Das ist etwas ganz anderes und töricht genug von dir, dass du es nicht getan hast. Nun gut — ich habe Ähnliches von dir zu hören erwartet — so tritt auch du als Mönch auf, ich habe zu diesem Zwecke gleich eine zweite Kutte angezogen. Du ziehst die Kapuze über den Kopf, bist der Frater Augustus aus meinem Kloster, hast ein Gelübde, einen Monat dein Gesicht zu verhüllen. Du musst unbedingt mit dabei sein. Allerdings stimmt das dann nicht so ganz, der goldene Löwe verwandelt sich vielleicht in einen silbernen — aber das ist immer noch besser als gar nichts.«
Immer schwächer und schwächer wurden ihre Widersprüche. Der fromme Pater hätte ihr ja noch etwas ganz anderes vormachen können, sie hätte schließlich alles, alles geglaubt.
»Schwöre mir, mich nicht zu verraten!«
»Ich schwöre es dir bei meinem Schutzpatron.«
Da war ihr letztes Bedenken besiegt. Sie brauchte nur den Arbeitskittel abzustreifen, unter dem sie eine Haustoilette trug, dafür die Mönchskutte anzuziehen, und die beiden traten ihre abenteuerliche Wanderung an.
Schon seit einer Stunde saß Lord Walter Moore im bequemen Morgenkostüm am Schreibtisch. Sein englischer Leibdiener, der ihn auch bei allen Ausgängen begleitete, trat ziemlich ungeniert ein.
»Zwei Mönche wünschen Eure Lordschaft in dringendster Angelegenheit zu sprechen. Der eine ist der Pater Hilarion, der Prior eines Benediktinerklosters. Den anderen nennt er Frater Augustus, der wegen eines Gelübdes das Gesicht verhüllt haben und schweigen muss. Aber unter der Mönchskutte steckt offenbar ein Weib, und da der Pater der Beichtvater der Herzogin Ludmilla Borghesia ist, so vermute ich fast, dass es diese ist.«
Man sieht, vor den Augen dieses Leibdieners nützte keine Verkleidung.
Überrascht hatte der Lord aufgeblickt.
»Die schöne Herzogin Ludmilla!«
»Ich vermute nur.«
»Zu solch früher Morgenstunde!«
»Auch ihre Gläubiger können heute sehr früh kommen.«
»Ja — sind denn gestern nicht die zehntausend Dukaten an den Halsabschneider bezahlt worden?«
»Das wohl, aber davon weiß sie noch nichts. Sie wird sich nur wundern, wenn die Gläubiger nicht kommen, um sie zu plündern.«
»Und sie wird nicht erfahren, dass es von mir bezahlt worden ist?«
»Dafür ist gesorgt, und ebenso, dass der venezianische Jude seinen Schuldschein nicht zum zweiten Male präsentieren kann.«
»O, das glaube ich dir wohl, Ralph. Apropos — der kleine Marquis nannte dich gestern Baron.«
»Nur aus Scherz. Niemand ahnt, wer unter der Maske Ihres Leibdieners steckt.«
»Und was wollen nun die beiden?«
»Eure Lordschaft in dringendster Angelegenheit sprechen. Mehr sagte der Prior nicht, und ich ließ es mir genügen.«
»Lass sie eintreten.«
Ja, dieser Leibdiener musste wirklich ganz besondere Augen besitzen. Es war sonst gar nicht zu unterscheiden, ob sich unter der formlosen Kutte des Vermummten ein Mann oder ein Weib befand, zudem die Herzogin noch sehr geschickt den stärkeren Schritt eines Mannes nachzuahmen verstand.
Pater Hilarion hatte seinen Segensspruch gemurmelt und begann dann ohne weitere Umschweife:
»Heute Nacht erschien mir im Traume der Erzengel Michael...«
Und er erzählte sein ganzes Märlein, nur an Stelle der Herzogin jetzt immer den Frater Augustus, hier seinen vorgeblichen Begleiter, einen Mönch seines Klosters, einschiebend.
Aufmerksam, gar nicht mit spöttischer Miene, hatte Lord Moore alles angehört. Er glaubte die vorliegende Absicht gleich zu durchschauen, sprach es auch aus.
»Ihr wollt mir eine Falle stellen, Pater!«
»Eine Falle?!«
»Ich bin als der ungläubigste Thomas bekannt. Gehe ich nun mit Euch in den Keller, hacken wir hier und da herum, ohne natürlich etwas zu finden, so könnt Ihr dann doch noch immer triumphierend erzählen: Seht da, auch Lord Walter Moore, der sich so als Freidenker aufspielt, auch er lässt sich von jedem vorerzählten Traume beeinflussen... ist es nicht so, Pater?«
Abwehrend hob der Prior beide Hände empor.
»O, Mylord, was trauen Sie mir zu! Wie würde ich so etwas wagen! Bei meiner Seligkeit, ich spreche die Wahrheit!«
Der Lord wurde ganz irre. Nicht durch den Schwur, sondern durch den ganzen Gesichtsausdruck des Paters. Er hielt diesen solch einer Vorstellung nicht für fähig.
Und was für eine Ursache hatte die Herzogin, ihn so blamieren zu wollen? Dass sie sich unter der Kutte eines Mönchs verbarg, das konnte er hingegen recht gut begreifen.
»Nun gut. Ich bin bereit, mitzugehen. Ob ich mich dadurch blamiere oder nicht, das ist mir ganz gleichgültig, deswegen bleibe ich für mich selbst noch immer derjenige, der ich bin — auf die Meinung anderer Leute gebe ich nichts. Und ich halte es geradezu für meine Pflicht, Euch zu beweisen, dass ihr wiederum einmal von einem Traume getäuscht worden seid. Nicht wahr, es ist unbedingt nötig, dass ich selbst mit in den Keller gehe? Denn ich weiß ja, wie Ihr das mit solchen Träumen handhabt, das muss alles ganz genau ausgeführt werden, sonst habt Ihr immer eine Entschuldigung, weshalb es nicht in Erfüllung geht.«
»Jawohl, ich in der Mitte, Eure Lordschaft rechts und der Frater links an meiner Seite. So durchschritten wir den Keller.«
»War nicht auch mein Leibdiener dabei? Den möchte ich mitnehmen.«
»Das wird sicher nichts schaden, wenn er sich hinter uns hält.«
»Und wer soll die Rolle des Erzengels Gabriel spielen?«
»Es war der Erzengel Michael«, verbesserte der Pater zunächst.
»Konntet Ihr das so genau unterscheiden, obwohl der Engel sonst kein einziges Wort gesprochen, sich also auch nicht vorgestellt hat?«, erklang es zum ersten Male mit einigem Spott.
»Ich kenne die Erzengel alle«, war die bescheidene Antwort.
»So! Das freut mich. Möchte auch solche intime Bekanntschaften im Himmel haben. Nun, wo blieb der Herr Erzengel? Muss der nicht auch sichtbar dabei sein?«
»Das ist nicht nötig. Das war nur eine — eine... Traumfigur.«
»Gut. Und die Hacken?«
»Die hatten wir plötzlich in den Händen, als wir den Keller betraten.«
»Gut! Soll alles nach Wunsch geschehen. Ralph, du begleitest mich! Sorge zunächst dafür, dass am Kellereingang drei Hacken sind!«
»Die liegen schon unten. Im Hofe sind Arbeiter, die ihr Handwerkszeug immer dalassen«, entgegnete der Diener, der im Zimmer geblieben war.
Er wollte durch ein Augenblinzeln seinen Herrn offenbar zur Seite ziehen, um erst noch einmal allein mit ihm zu sprechen, aber dieser wehrte durch ein leises Kopfschütteln ab.
Lord Moore wusste schon, was er tat. Er vermied mit Absicht alle weiterem Fragen. Was nützte es denn, wenn er fragte, ob der Pater dieses Haus kenne, schon einmal im Keller gewesen sei. Er wurde ganz einfach belogen.
Nein, so schnell wie möglich auf alles eingehen und dann gut aufpassen, weshalb ihm eigentlich diese Falle gestellt ward.
»Dann brauchen wir wohl auch noch Licht? Oder wie war es sonst mit der Beleuchtung?«
»Die ging von der strahlenden Gestalt des Engels aus.«
»Diese strahlende Gestalt fehlt uns aber.«
»O, dann tut's auch eine Lampe, die der Diener hinter uns trägt. Das muss alles in irdische Verhältnisse übersetzt werden.«
»Ralph, eine Lampe!«
»Finden wir gleichfalls unten.«
»Und die Kellerschlüssel?«
»Nehme ich unterwegs mit.«
»Dann vorwärts! Ein halbes Stündchen will ich der Geschichte opfern.«
Die vier traten auf den Korridor hinaus, der Diener schritt schnell voran, verschwand um eine Ecke.
»Wir wollen uns doch lieber schon hier bei den Händen fassen, um ja keine Vorschrift außer acht zu lassen«, meinte der Prior.
Es geschah. Links der vermummte Mönch, rechts der Lord, in der Mitte der Pater. Der Lord machte einmal ein Gesicht, als wollte er in ein schallendes Gelächter ausbrechen. Er beherrschte sich.
»Nun führt uns, Pater.«
»Wo geht's nach dem Keller hinab?«
»Ja, das müsst Ihr doch wissen. Ihr habt doch schon den ganzen Weg unter sicherster Führung im Traume gemacht.«
»Nein, nicht so mit allen Einzelheiten. Erst von der Kellertüre an bin ich meiner Sache sicher. Vorher war das immer nur ein traumartiges Schweben.«
Wenn das Wahnsinn war, so lag doch Methode drin.
»So will ich jetzt noch den Führer spielen.«
Sie schritten Hand in Hand den Korridor entlang und eine Treppe hinab, bis der Lord im Erdgeschoss vor einer schweren Holztür stehen blieb.
»Ralph ist noch nicht da mit den Hacken.«
Der Pater blickte kopfschüttelnd die Tür an und schaute sich verwundert um.
»Was habt Ihr?«
»Von hier an, wo es in den Keller ging, kann ich mich auf alles schon ganz deutlich entsinnen. Die Tür, die sich vor uns öffnete, sah ganz anders aus.«
»Wie sonst?«
»Die war viel größer und war mit eisernen Bändern beschlagen.«
Er hatte recht. Diese Tür hier verschloss gar nicht den Kellereingang, sondern nur ein kleines Gewölbe.
»Seid Ihr denn schon einmal hier gewesen?«, durfte der Lord jetzt schon eher fragen.
»Noch nie!«
Eine weitere Frage aber hielt der Lord doch nicht für nötig, ebenso wenig wie eine Entschuldigung oder doch Erklärung, als er seine Begleiter weiterführte. Wer mag da für ihn spioniert haben?, dachte er unterwegs. Und wozu das alles?
Als sie um die Ecke bogen, sahen sie Ralph vor der eisenbeschlagenen Tür schon mit drei Hacken und einer Lampe stehen. Auch zwei Brecheisen hatte er gleich mitgebracht.
»Jetzt sollen wir also die Hacken schon in die Hand nehmen?«
»So zeigte es mir der Traum.«
Sie taten es, deshalb konnte der Pater noch immer die Hände seiner Begleiter halten, sie schritten die Treppe im Scheine der hinter ihnen gehaltenen Blendlaterne hinab.
»Links oder rechts?«, fragte der Lord unten.
»Rechts ab ging es.«
Und es ging immer weiter links und rechts ab in den labyrinthähnlichen Gängen, der Pater schien des Weges todsicher zu sein.
»Noch um die nächste Ecke, dann muss gleich rechterhand eine kleine Tür sein.«
So war es in der Tat. Doch der Lord wunderte sich nicht mehr.
»Wohin führt diese Tür?«, fragte er, und er wusste es wirklich nicht.
»In den zweiten Keller.«
»In den zweiten Keller?«
»Habe ich Eurer Lordschaft nicht erzählt, wie mich der Erzengel in den zweiten Keller hinabführte?«
»Es ist möglich. Ich habe aber noch nicht einmal gewusst, dass dieses Haus überhaupt einen zweiten Keller hat. Ralph, hast du den Schlüssel?«
Der Diener hatte ein ganzes Schlüsselbund. Mit bewundernswertem Scharfblick fand er sofort den richtigen Schlüssel heraus, einen sehr verrosteten, hatte dann große Mühe, das Schloss zu öffnen. Doch es ging.
Ächzend drehte sich die Tür in den Angeln. Eine modrige Luft schlug ihnen entgegen.
Sie schritten die wieder sehr lange Treppe hinab. Der Diener wusste ihnen von hinten sehr geschickt vor die Füße zu leuchten.
Wieder labyrinthische Gänge, in denen sich der Pater links und rechts wandte, ohne jemals zu zögern.
»Alles ganz, wie ich es im Traume gesehen«, erklärte er zufrieden. »Hinter der nächsten Ecke muss ein Pfeiler sein, gleich seitwärts an der rechten Wand ist die Stelle, die mir der Erzengel bezeichnete.«
Der Pfeiler, sonst sehr selten, kam wirklich.
»Da ist die Stelle, wo die Hacke angesetzt werden muss«, sagte Pater Hilarion, mit der Hand in Kniehöhe gegen die Wand deutend.
Nun ward auch der Lord doch von einer kleinen Aufregung erfasst.
»Jetzt aufgepasst!«, flüsterte er bei der ersten Gelegenheit seinem Kammerdiener zu.
»Ich halte meine Augen schon offen, es soll mir nichts entgehen«, gab dieser ebenso unbemerkt zurück.
Aber da halfen keine Argusaugen. An dem Mörtel der Wand war an dieser Stelle kein Unterschied von der Umgebung zu bemerken.
»Nun, da wollen wir uns mal in Abbruchsarbeiter verwandeln. Wir alle drei, nicht wahr?«
»So zeigte es mir der Traum. Wir alle drei schwangen die Hacken.«
»Keine Zauberformel oder sonst etwas?«
»Gar nichts.«
»Na, dann mal los!«
Die drei griffen zu den Hacken. Der Diener leuchtete. Der Prior fasste die seine nicht minder ungeschickt an als die Herzogin, die zudem ihre zarten Hände aus den langen Ärmeln nicht zum Vorscheu kommen lassen wollte, und da auch der Lord mit der Hackenspitze nur an der Wand herumkritzelte, war das Resultat gleich Null.
»Nein, so geht das nicht«, lächelte der Lord. »Wir stehen ja einander im Wege. Tretet mal zur Seite, ich will die Geschichte allein besorgen...«
»Das darf nicht sein, wir alle drei müssen...«
»Ach was, da sind wir übers Jahr noch immer nicht durch...«
»Dann finden wir aber keinen goldenen Löwen!«
»Na, dann einen silbernen. Weg!«
Und der junge Lord spuckte in seine diamantfunkelnden Hände, holte aus und schmetterte los, handhabte die Spitzhacke mit einer Kraft und Virtuosität, als habe er Zeit seines Lebens nichts anderes gemacht, als Mauern durchbrochen.
Es gab hierfür wie für alles eine Erklärung.
Man hat ja schon seltsame Sportmoden gehabt. Sie kommen und gehen wieder, werden mit Leidenschaft betrieben und werden wieder vergessen. So ist es heute mit unserem Rodeln. Vor zehn Jahren wurde es den Kindern verboten, vielleicht schon nach zehn weiteren Jahren schüttelt man wiederum die Köpfe darüber, wie die erwachsenen Leute mitmachen konnten. Damals wetteten in England die Anhänger eines besonderen Sportes, den man ›lumbing‹ nannte, in welcher Zeit sie mit der Axt einen starken Baum fällen konnten. ›Lumber‹ Gerümpel, als Zeitwort wäre es vielleicht mit Kleinholzmachen zu übersetzen. Die kanadischen Holzschläger heißen noch heute lumbers. Aber das musste geübt werden. Da gab es Championlumberer, da wurden Rekorde aufgestellt und geschlagen. Da aber schon damals in England der Wald selten war, war das ein gar kostbares Vergnügen, ein teurer Sport, den sich nur reiche Leute leisten konnten, Aristokraten in ihren Wäldern und Parks.
Staunend sahen die beiden Italiener, wie der junge englische Lord in seinen Händen die Spitzhacke schwang, dass die Steinsplitter nur so umherstoben, in zehn Minuten war er durch, jetzt setzte er in das vorhandene Löchelchen das Brecheisen ein, hierbei unterstützte ihn sein Diener mit nicht minder großer Geschicklichkeit. Die beiden wuchteten von den fußgroßen Granitsteinen einen nach dem anderen heraus, und schon nach weiteren zehn Minuten war das Loch groß genug, um bequem durchkriechen zu können.
Gleich, als die erste Öffnung entstanden war, hatte sich ein intensiver Kampfergeruch bemerkbar gemacht.
»Merkwürdig, da scheint doch etwas drin zu stecken«, flüsterte der Lord einmal, weiter nichts.
Die Öffnung war groß genug. Der Diener leuchtete mit der Lampe hinein.
»Vorsicht, dass keine Explosion entsteht, Kampfer ist feuergefährlich.«
»Es riecht nicht schlimmer als in jedem Pelzgeschäft.«
»Und was siehst du?«
»Einen Sarg.«
»Vorwärts, hinein!«
Es war ein kleines Gewölbe, in dessen Mitte am Boden ein geschlossener Sarg stand, offenbar aus Zink, ganz schmucklos. »Siehst du sonst Spuren?«, flüsterte der nachgekommene Lord.
Nein, der Diener, der wohl eher ein persönlicher Sicherheitsdetektiv war, konnte absolut nichts bemerken. Staub hatte sich allerdings hier gar nicht abgelagert. Die Luft war gut atembar, der Kampfergeruch, wenn man sich erst daran gewöhnt, gar nicht so schlimm.
»In diesem Sarge liegt der rote Löwe!«, erklärte der Pater, der seinen dicken Leib durch das Loch gezwängt hatte, feierlich.
Die beiden wurden scharf beobachtet. Aber beider Verhalten war ganz normal. Der Pater war seiner Sache von vornherein sicher gewesen, auch das Zittern seines Begleiters war begreiflich, zumal wenn unter der Kutte wirklich die Herzogin Borghesia steckte.
»Ich denke, Ihr habt hier einen großen, goldenen Löwen liegen sehen.«
»Das ist doch nur als Symbol zu verstehen«, entgegnete der Pater. »Der rote Löwe wird nun schon in dem Sarge liegen — vielleicht nur eine Flasche mit der goldmachenden Tinktur.«
»Nun gut, öffnen wir den Sarg — mit aller Vorsicht!«
Der Deckel war unverschlossen, nur mit einigen hebelähnlichen Vorrichtungen angezogen, deren Aufmachen einige Kraftanstrengung erforderte, dann konnte der nur dünne Zinkdeckel von einem Manne zurückgeschlagen werden.
Zunächst schlug ihnen jetzt ein so intensiver Kampfergeruch entgegen, dass alle zurückprallten. Hierbei verriet sich auch der vermummte Mönch als Weib. Hinter der Kapuze war ein gar zu quiekender Laut erklungen. Er blieb unbeachtet. Was da erblickt wurde, war danach angetan, auch ein zweites Zurückprallen zu rechtfertigen.
In dem Sarge lag lang ausgestreckt ein Mann in voller Kleidung, die Hände über der Brust gefaltet, das klassisch schöne, wachsgelbe Gesicht mit einem starken, schwarzen Schnurrbart geziert, von schwarzen Locken eingerahmt, die Augen geschlossen.
Das war der erste Anblick, den man hatte.
Unverzagt griff der Lord sofort nach den ebenfalls wachsgelben Händen, bewegte die Finger, faltete sie auseinander.
»Wenn er wirklich tot ist, so macht er den Eindruck einer noch ganz frischen Leiche«, lautete seine erste, ganz sachliche Erklärung.
»Beachten Sie die Kleidung!«, flüsterte sein Diener.
Ja, die Kleidung! Man trug damals Kniehosen, Kniestrümpfe und Schnallenschuhe — das Wams zwar verschieden je nach Geschmack, aber doch immer eine einzige Grundform, die Spitzen nach gewisser Mode arrangiert, vor allen Dingen immer die Ärmel sehr eng.
Dieser Mann hier trug ebenfalls Wams und Kniehosen, aber die Kinder wären ihm auf der Straße nachgelaufen. Hauptsächlich wegen seiner unförmigen Puffärmel, und dann waren seine Schnabelschuhe viel zu lang und zu spitz.
»Das ist die Mode von vor hundert Jahren«, sagte der Lord.
»Und die Mode ist schon so alt, dass sogar alles schon vermodert ist«, ergänzte der Diener mit einem Wortspiel.
Ja, man durfte nicht viel anrühren, die ganze Kleidung zerfiel unter den Fingern nicht gerade in Staub, aber doch in Fetzchen, zerbrach eben wie Moder.
Eine weitere Untersuchung ergab, dass in dem Sarge hier und da durchlöcherte Lederbeutel mit Kampfer lagen, ein Kissen, auf dem der Kopf geruht, war ebenfalls ganz vermodert...
»Hier ein Paketchen«, sagte Ralph, ein solches neben dem Kopfe zum Vorschein bringend.
Die äußere Umhüllung bestand aus echtem Pergament, Ralph wickelte ein goldenes Fläschchen aus.
»Der goldene Löwe!«, flüsterte der Pater entzückt. Mit diesem Namen bezeichneten die Alchimisten die Tinktur oder sonst eine Substanz, welche die Kraft besaß, unedle Metalle in Gold zu verwandeln. Die feindliche Macht, welche dies zu verhindern suchte, hieß der gelbe Drache, vorher aber galt es noch die grüne Schlange zu besiegen, und so war alles in symbolische Ausdrücke gekleidet, und jeder Hokuspokusmacher brachte immer neue auf.
»Und das Pergament ist beschrieben. Es ist wohl Lateinisch, Mylord?«
Der Lord nahm es, las die krausen Schriftzüge und übersetzte sie gleich in neueres Italienisch.
Wer mich findet, spritze mir etwas aus beiliegender Phiole in die Adern oder imp
fe mir nur davon ein. Sollte die Tinktur zu dick geworden sein, muss sie mit so
viel Wasser, wie die Phiole fasst, verdünnt oder aufgelöst werden. Sobald ich
Lebenszeichen gebe und schlucken kann, flöße man mir ein Löffelchen voll ein.
Dann werde ich mündlichen Bericht geben. Geschrieben an meinem letzten
Todestage im Jahre des Herrn 1647.
»Also richtig schon seit hundert Jahren tot — ganz genau seit hundertunddrei Jahren«, sagte der Lord ungerührt. »Nun, dass wir hier anstatt des goldenen Löwen eine hundertjährige Leiche finden, daran dürfte schuld sein, dass der Dritte im Bunde nicht, wie der Erzengel vorschrieb, Frater Augustus ist, sondern die Duchessa Borghesia.«
Jetzt durfte er es sagen, denn die Herzogin hatte in ihrer furchtbaren Spannung, um besser sehen zu können, die Kapuze zurückgeschlagen.
Nun freilich war ihr Schreck ein großer.
»O, mein Gott...«
»Bitte, Mylady — ich kann vollkommen begreifen, weshalb Sie es vorzogen, in der Maske eines Mönchs in mein Haus zu kommen — Ihr Inkognito ringt mir nur Achtung ab. Aber ist es nicht so, frommer Pater — begleitete Euch im Traume nicht die Herzogin, Euer Beichtkind?«
»Ja«, gab dieser kleinlaut zu, »aber die Herzogin —«
»Das ist bereits erledigt. Nun haben wir dadurch aber etwas anderes gefunden als einen goldenen Löwen, nicht wahr?«
»Na, dann ist es eben der silberne Löwe«, beharrte der Pater.
Er ging in keine ihm gestellte Falle.
»Gut, bringen wir diese hundertjährige Leiche nach Vorschrift wieder zum Leben, dann wird sich ja zeigen, ob der Kerl wenigstens Silber machen kann. Eigentlich aber müsste er auch Gold machen können, die Vorschriften sind ja schließlich doch ganz streng eingehalten worden, die kleine Maskerade wird der Erzengel Gabriel doch nicht gleich so streng bestrafen.«
..Es war der Erzengel Michael«, musste der Pater wiederum verbessern.
»Na, der ist erst recht nicht so gehässig.«
Der Lord wechselte einige englische Worte mit dem Diener, dieser kroch durch das Loch hinaus.
»Sie glauben auch an dieses Wunder nicht, Mylord, weil Sie immer so spotten?«, fragte die Herzogin leise.
»Was heißt glauben? Ein geheimnisvolles Rätsel liegt ja unbedingt vor, und ich will versuchen, ob ich es nicht im hellen Tageslichte lösen kann.«
Ralph kehrte schon wieder zurück, einige Arbeiter mitbringend, welche das Loch erweitern und dann den wieder geschlossenen Sarg auf Tragstangen nehmen mussten. So ging es die Treppe hinauf bis in das Arbeitszimmer des Lords.
Die Arbeiter gingen.
»Einen Augenblick«, sagte der Lord, in das Nebenzimmer tretend und sich gleich so stellend, dass er in einem Spiegel durch die offene Tür sowohl den Sarg als die beiden Mönche beobachten konnte, ohne selbst gesehen zu werden.
So fand ihn der erst später nachkommende Diener.
»Alles in Ordnung, Ralph?«, flüsterte der Lord.
»Die untere Kellertür ist wieder verschlossen, an der Öffnung und an anderen Stellen in dem Gewölbe und außerhalb habe ich mir kleine Zeichen gemacht, falls jemand dort herumspioniert.«
»Gut. Auf dich kann ich mich verlassen. Und was sagst du zu alledem?«
»Es ist mir alles noch vollkommen unerklärlich.«
»Sehr gut! Dieses offene Bekenntnis ist viel gesünder, als wenn man sich immer gleich in allerhand Vermutungen ergeht.«
»Wie verhalten sich die beiden?«
»Ganz normal, sie flüstern, deuten nach dem Sarg, die Herzogin ist heftig erregt, der Pater zuckt die Achseln, als müsste das alles so sein.«
»Die Herzogin halte ich für düpiert, den Pater für eingeweiht.«
»So denke auch ich. Gehen wir hinüber!«
Der Lord rieb sich die Hände, die er sich zuletzt noch gewaschen hatte.
»Gehen wir nun an eine weitere Untersuchung der Leiche. So eilig haben wir es ja nicht. Wenn der schon hundert Jahre tot ist, kommt es auf ein paar Stunden mehr auch nicht an.«
Der Sargdeckel ward wieder zurückgeschlagen. Hier im hellen Tageslicht war wohl alles deutlicher zu sehen, sonst aber veränderte sich nichts.
Ungeniert befühlte der Lord hier und da den Körper, drückte die Finger in die Wangen. Das Fleisch war nachgiebig, aber doch fest, wie bei einem gesunden Menschen in der Vollkraft seines Lebens.
»Äußerst kräftig gebaut! Das strotzt ja alles von Muskeln. Und was dennoch der Kerl für feine Hände hat! Was für wunderbare Finger! Wie aus Wachs modelliert — nein, wie aus Elfenbein geschnitzt — nein, wie aus gelbem Marmor gemeißelt. Bin doch wirklich gespannt, als was er sich dann vorstellen wird.«
»Sie glauben, dass er wirklich wieder zum Leben erwacht?«, flüsterte die Herzogin.
»Er hat's ja schriftlich hinterlassen. Und wie sind die Augen beschaffen?«
Dass Herz und Puls nicht schlugen, davon hatten sie sich schon zur Genüge überzeugt. Zum ersten Male versuchte der Lord, die Augenlider zurückzuschieben, endlich gelang es ihm, dann blieben sie auch oben. Die Augen waren tadellos beschaffen, die Pupillen ganz groß, aber alles starr, gläsern.
Der Lord nahm einen Handspiegel, reflektierte die ins Zimmer fallenden Strahlen der Morgensonne in diese Augen. Das erträgt kein Mensch ohne mindestens zu blinzeln. Man sollte dieses Mittel auch niemals bei einem vermutlichen Scheintoten unterlassen. Diese großen Pupillen zogen sich nicht im Geringsten zusammen.
»Hm, das sieht wirklich bald aus, als ob... legen wir ihn auf das Sofa!«
Herr und Diener fassten zu.
»Dass Sie das nur wagen!«, flüsterte die Herzogin mit bleichen Lippen.
»Sie meinen, dass etwas abbrechen könnte?«, lächelte der Lord ungerührt. »O, das ist alles ganz schlapp.«
Er entblößte ihm einen Arm und die Brust.
»Was für eine Muskulatur dieser Kerl nur hat! Und dabei doch nicht plump, alles wie von einem Künstler gemeißelt. Ralph, dein Besteck!«
Unterdessen zog Lord Moore der Leiche den linken Schuh aus, den Strumpf konnte er gleich abschälen.
»Ich will ihn einmal zur Ader lassen, ob Blut fließt«, erklärte er dabei. »Mein Kammerdiener ist ein durchgebrannter Student der Medizin, so erspare ich mir den Bader.«

Diese Erklärung wäre gar nicht nötig gewesen. Das ›ZurAderlassen‹ war damals etwas ganz Gebräuchliches, man hielt es der Gesundheit für zuträglich, wöchentlich einmal sich etwas Blut, aber auch recht viel, abzapfen zu lassen; in Klöstern und anderen Anstalten war es Vorschrift.
Der Diener legte sehr geschickt eine Bandage um das Bein, um bei starkem Blutfluss gleich knebeln zu können, dann öffnete er an der Fußsohle eine Arterie. Es kam kein Tropfen Blut hervor, gar nichts, wie Ralph auch drückte.
»Hm«, brummte der Lord, »der Mann ist tot. Versuchen wir ihn nun nach seiner Vorschrift wieder lebendig zu machen.«
Aus der mit aufschraubbarem Stöpsel verschlossenen Goldphiole fielen nur einige grünschwarze Kristallblättchen heraus. Alles vertrocknet! Es schien am Boden noch eine starke Kruste zu sein. Die Blättchen wurden wieder hineingetan, die ganze Phiole mit Wasser gefüllt, tüchtig geschüttelt, mit einer langen Nadel darin gestochert, die feste Kruste löste sich überraschend schnell auf, ein herausgenommener Tropfen zeigte eine klare, gelbe Farbe.
»Der rote Löwe!«, flüsterte der Pater.
»Meiner Ansicht nach eher der gelbe Drachen. Geben wir ihm eine Einspritzung!«
Ralph hatte schon eine kleine Spritze in der Hand, sie wurde mit der gelben Flüssigkeit gefüllt und in den Arm gestochen. Der Fuß mit der durchschnittenen Ader war schon unterbunden.
Kaum war die Glasspritze durch Druck entleert, als sich auch schon mit einem Klapp, den man fast zu hören meinte, die Augen des Toten von selbst schlossen.
»Nur eine Reflexbewegung der gespannt...«
Dem Lord erstarb das Wort im Munde.
Kein Zweifel, das gelbe Gesicht des Toten hatte gezuckt, jetzt aber wurde die gelbe Farbe eine weiße, die Wangen röteten sich etwas, eine leise Bewegung der Brust, der Finger, des Fußes...
»Einen kleinen Löffel!«, kommandierte der Lord kaltblütig.
Ralph hatte ihn schon in der Tasche gehabt, der Lord nahm ihn selbst, füllte ihn mit der Tinktur, leicht konnte er den Mund des Mannes öffnen, da auch ein Seufzer, willig schluckte er die Flüssigkeit.
Eine kleine Pause. Dann öffnete er die Augen, ein traumbefangener Blick, er schloss die Augen wieder, bewegte sich stärker, legte sich bequemer, wie um weiterzuschlafen — plötzlich richtete er sich mit einem Ruck empor, bis er auf dem Sofa saß, schaute verwundert die Anwesenden an.
»Wo bin ich?«
Eine gebieterische Handbewegung nach den anderen, und Lord Moore setzte sich ihm gegenüber.
»In Rom, in der Villa der heiligen Thekla.«
Das Staunen war sofort wieder vorüber.
»In der Villa der heiligen Thekla. Ja, so hieß sie schon damals. Was für ein Jahr schreiben wir jetzt?«
Er sprach ein etwas veraltetes Italienisch.
»Das Jahr 1750.«
Jetzt doch wieder etwas Staunen.
»Was, schon 1750?!«
»Den 3. Juni 1750.«
»So hätte ich diesmal hundert Jahre geschlafen. Am 15. Oktober 1647 ließ ich mich einsargen. Ja, das war ein langer Schlaf, ich fühle mich auch wie neugeboren.«
Und er stand auf, ging etwas hinkend im Zimmer auf und ab. Der Lord folgte ihm mit gespannten Augen, desgleichen Ralph, während der Pater unausgesetzt Kreuze schlug und die Herzogin sich zitternd in eine Ecke gedrückt hatte. Nicht minder nämlich wurde deren Verhalten von den beiden anderen beobachtet.
Der lebendig gewordene Tote hatte sich wieder gesetzt.
»Mit wem habe ich die Ehre?«, fragte er.
»Lord Walter Moore, englischer Gesandter in Rom. Sie befinden sich in meinem Hause.«
»Ah! Wer ist jetzt Papst? Wer ist in England... doch was interessiert mich dies alles!«, unterbrach er sich resigniert. »Ich werde mich sofort in der Einsamkeit vergraben.«
»Ehe Sie das tun, erlauben Sie wohl, dass ich mich etwas für Ihre Person interessiere.«
Der Lord konnte eine Spur von Spott nie lassen. Aber der andere schien es nicht zu beachten.
»Bitte. Selbstverständlich bin ich Ihnen erst Aufklärung schuldig. Ich bin im Keller dieses Hauses hier gefunden worden?«
»Ja. Vor einer halben Stunde. Sie lagen in diesem Sarge.«
»Ich bin wohl in den Fuß geschnitten worden?«
»Ich wollte sehen, ob Blut flösse.«
»Das war nicht nötig. Ist die Ader gut unterbunden? Dann macht es nichts. Wie fand man mich? Zufällig?«
»Nein. Vorhin kam hier dieser Pater zu mir...«
Der Lord erzählte, soweit es nötig war.
»Merkwürdig! Durch solch einen Traum werde ich immer gefunden, wenn ich einmal zu lange schlafe, und immer erscheint dem Betreffenden der Erzengel Michael.«
»So liegen Sie öfters in solch einem Todesschlaf?^
»Habe ich das gesagt?«
»Deutlich genug.«
»Das tut mir leid. Ich möchte von mir gar nichts erzählen, man würde mir ja doch nicht glauben.«
»Aber Sie werden mir doch erzählen, wie Sie in meinen Keller gekommen sind.«
»Dies alles finden Sie ausführlich beschrieben in der Hauptchronik der Bibliothek, die sich in diesem Hause befindet, elfter Band. Ach so, das ist nun freilich schon hundert Jahre her, da kann sich viel verändern...«
»Die Bibliothek, die von Kardinal Lebrune hier angelegt wurde?«
»Der eben war mein Gönner, ich sein Bibliothekar. In diesem Hause habe ich zwanzig Jahre lang unter Büchern gelebt.«
»Ich kenne die Geschichte dieses Hauses, früher Villa des Fluvius genannt, sehr gut, habe mich dafür interessiert. Diese wertvolle, aus 30 000 Bänden bestehende Bibliothek ist im Jahre 1705 verbrannt.«
»O weh! Alle die kostbaren Manuskripte?!«
»Das ganze zweite Stockwerk, in der sie sich befand, brannte ab.«
»Dann allerdings muss ich mündlich berichten, Sie werden sonst kaum noch etwas Schriftliches über mich finden, denn der vortreffliche Kardinal Lebrune gab mir sein Wort...«
»Einen Augenblick, bevor Sie beginnen. Ich darf Ihnen doch etwas vorsetzen?«
»Ich danke.«
»Aber wenn man einen hundertjährigen Schlaf hinter sich hat...«
»Ich brauche nichts.«
»Wenigstens ein Glas Wein.«
»Ich bedarf überhaupt nichts.«
»Heißt das vielleicht, dass Sie überhaupt keiner Nahrung bedürfen?«, fragte der Lord gleich direkt.
»So ist es auch. Ich bedarf weder fester noch flüssiger Nahrung.«
Wir wollen nicht die Gesichter der anderen zu schildern versuchen. Nur der Lord blieb ganz ungerührt.
»Wie lange gedenken Sie denn nun wieder zu leben?«
»So lange es Gott gefällt.«
»Vielleicht noch zehn Jahre? Nur ein Jahr?«
»Ich hoffe doch.«
»Nun gut, nehmen wir nur ein Jahr an. In diesem Jahre wollen Sie nichts essen, nichts trinken? Keinen Bissen Brot? Keinen Schluck Wasser?«
»Gar nichts.«
»Geehrter Signore, vielleicht haben Sie schon vor hundert Jahren etwas vom Stoffwechsel gehört...«
»Gewiss, was der Mensch durch den Lebensprozess verbraucht, muss er auch wieder ergänzen. Das gilt für jedes Lebewesen, auch für die Pflanze.«
»Und wie halten nun Sie es mit dieser Ergänzung?«
»Ich nehme einfach alles, was ich brauche, direkt aus der atmosphärischen Luft.«
»Durch die Atmung?«
»Ja.«
»Hm. Das sollten alle Menschen können. Also Sie assimilieren, wie man sagt, die Bestandteile der Luft in Ihrem Körper zu Nahrungsmitteln?«
»Ja. Nur dass ich gar nicht erst einen Übergang brauche. Die Assimilation geschieht direkt.«
»Hm. Das lässt sich hören. Nur eins begreife ich nicht dabei. Eiweiß, Fett usw. bestehen aus Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff. Das ist alles in der Luft vorhanden, letzteres in der Kohlensäure. Das begreife ich, wenn ich nun durchaus begreifen will. Nun braucht der Mensch aber doch unbedingt auch Salze, selbst die Knochensubstanz erneuert sich fortwährend.«
»Und ist das alles nicht in der Luft vorhanden? Sehen Sie sich doch einen Sonnenstrahl im dunklen Zimmer an, wie die Stäubchen darin zittern. Es gibt nichts auf der Erde, keinen Stein und kein Metall, das nicht in kleinsten Teilen in der Luft schwebe, und dies alles verleibe ich, soweit ich es brauche, durch den Atmungsprozess meinem Körper ein, und was ich nicht brauche, atme ich wieder aus.«
»Hm! Wenn es so ist, dann allerdings gebe ich mich geschlagen. Wenn das nur alle Menschen könnten! Oder wenigstens ich! Da ließe sich viel sparen. Lässt sich das nicht lernen?«
»O doch! Auch ich habe es ja einst erst lernen müssen.«
»Wie denn? Wo denn?«
»Durch vielhundertjährige asketische Übungen in den Katakomben Babylons, und meine Lehrer waren chaldäische Priester.«
Diesmal fiel Lord Moore aus der Rolle. Etwas sarkastisch war er ja schon manchmal geworden, jetzt aber knickte er zusammen, als habe er einen Hexenschuss bekommen.
»Ach — ach — Sie haben schon in Babylon bei den alten Chaldäern gelebt!!«
Aber der andere verlor nichts von seiner wirklich majestätischen Ruhe.
»Mylord! Ich habe Ihnen sofort gesagt, dass ich nichts erzählen möchte, weil man mir ja doch nichts glaubt. Was fragen Sie mich erst und verspotten mich dann? Ich wollte Ihnen nur berichten, wie ich hier in diesen Keller gekommen bin. Das bin ich Ihnen schuldig. Dann werde ich mich sofort wieder in die tiefste Einsamkeit zurückziehen, keinen Menschen mehr mit meinen Märchen belästigen.«
Schnell hatte sich der Lord wieder beherrscht.
»Bitte, berichten Sie.«
»Vor hundertdreißig Jahren lebte ich in Paris, in der Vorstadt Saint-Germain, wohl unter Menschen, aber doch als ganz einsamer Einsiedler, unter meinen Büchern, wurde höchstens auf der Straße gesehen, wenn ich in die Bibliotheken ging. Die liebe Straßenjugend nannte mich, da ich mich etwas veraltet trug, spottweise den Grafen von Saint-Germain. Ich führte damals auch wirklich gar keinen Namen. Eines Tages konnte ich dem König einen großen Dienst erweisen.«
»Ja, wie kommen Sie denn plötzlich zum König?«
»Ich schrieb ihm, oder vielmehr der KöniginMutter, dass gegen den König ein Komplott vorliege. Er sollte vergiftet werden. Eigentlich war mir das gleichgültig, ich kümmerte und kümmere mich noch heute um keinen Menschen, aber der schwachsinnige Louis tat mir leid, gerade wegen seiner Wehrlosigkeit, und so zeigte ich das Komplott an...«
»Ja, woher wussten Sie denn davon?!«
»Ich hatte meine Aufmerksamkeit zufällig einmal auf die Person des armen Königs konzentriert, ich sah ihn in größter Lebensgefahr, ließ meinen Geist nach der Quelle führen...«
»Sind Sie denn hellsehend?«
»Ja. Zu gewisser Zeit. Wenn ich will.«
Eine Pause. Lord Moore hob die Schultern.
»Bitte, fahren Sie fort.«
»Ich denunzierte einen Koch und einen Diener, musste es tun, sie gestanden, es wurde noch eine Menge anderer Personen aus der Umgebung des Königs hingerichtet. Es tat mir fast leid. Die KöniginMutter ernannte mich...«
»Wer war diese Königinmutter?«
»Maria von Medici. Heinrichs IV. zweite Gemahlin. Doch«, konnte auch der von den Toten Auferstandene einmal etwas kurz werden, »wollen Sie die französische Herrscherchronik hören oder meine Geschichte?«
»Ihre Geschichte«, blieb jetzt wieder der englische Lord ganz ruhig.
»... ernannte mich, mit Bezug auf meinen Spottnamen, in allen Ehren zum Grafen Saint-Germain. Das muss alles noch in den alten Pariser Akten zu lesen sein. Mir war's höchst unangenehm. Ich hatte doch gestehen müssen, dass ich hellsehend war. Nun wollte man mich doch an den Hof fesseln. Besonders auch Richelieu. Zum Glück für mich kam ihm der Kardinal Lebrune, der damals gerade am Pariser Hofe weilte, zuvor. Der erkannte mich besser. Er entführte mich förmlich. Nach Rom. Und hier in diesem Hause habe ich noch zwanzig Jahre gelebt, ganz einsam in der großartigen Bibliothek. Bis ich endlich des Lebens überdrüssig wurde...«
»Sie waren schon alt?«
»Bereits hundertvierzig Jahre.«
»So. Und Sie waren wirklich ein alter Mann?«
»Ob ich wie ein alter Mann aussah? Nein. Immer so wie jetzt.«
»Sie besitzen ein Verjüngungsmittel?«
»Ja, auch das. Hier kommt nur ein Mittel in Betracht, um sich scheinbar immer in gleichem Alter zu erhalten.«
»Nun erzählen Sie erst weiter, wie Sie sich einbalsamieren ließen.«
»Der alte Kardinal war damit einverstanden...«
»Wollte denn der alte Kardinal nicht wieder jung werden?«, unterbrach der Lord noch einmal.
»Nein, der war klüger als ich. Der war mit seinem hohen Alter sehr zufrieden, wollte nicht noch einmal jung werden oder später wieder zum Leben erwachen.«
»So. Und Sie?«
»Nun, ich nahm mein Schlafmittel ein, bekam eine Einspritzung, wurde in den Zinksarg gelegt, dieser wurde in ein Gewölbe im untersten Keller eingemauert.«
»Und da haben Sie also hundertunddrei Jahre gelegen?«
»Ja.«
»Sie brauchen dabei keine Luft?«
»Nein.«
»Schlafen Sie denn da oder sind Sie tot?«
»Ich weiß nicht. Ich weiß gar nichts von mir. Es ist wie ein Schlaf, aber alle Lebensfunktionen stehen dabei vollständig still. Zum Beispiel wächst auch mein Haar nicht.«
»Warum lassen Sie sich da einmauern?«
»In der Hoffnung, einmal gefunden zu werden. Ich will ja wieder leben, das Leben fortsetzen.«
»Ich verstehe noch nicht, warum Sie sich deshalb in ein Kellergewölbe einmauern lassen.«
»Nun, ich könnte mich ja auch in einen Glasschrank setzen lassen. Mein Sarg würde angestaunt werden, aber vielleicht noch in demselben Jahre könnte ein Ungläubiger, der die Macht dazu besitzt, mit mir Experimente anstellen. Und nur ein Jahr zu schlafen, das ist die Sache nicht wert. Denn mich in den Todesschlaf zu versetzen, das ist doch nicht so einfach....«
»Dann lassen Sie sich doch gleich ganz begraben.«
»Entweder würde ich auch da aus Neugier bald wieder hervorgeholt werden, oder man würde mein Grab vergessen.«
»Was würde dann aus Ihnen? So etwa nach tausend Jahren?«
»Das weiß ich nicht. Das mag ich mir auch gar nicht ausmalen. Ich fülle den luftdicht schließenden Zinksarg mit Kampfer, um mich gegen Insektenfraß zu schützen. Aber absolut luftdicht schließt nichts ab. Auch das größte Quantum Kampfer verflüchtigt sich einmal. Und wenn dann die Insekten und Würmer von außen... ich mag es mir gar nicht ausmalen.«
Der junge Lord konnte einen Schauder nicht unterdrücken. Alles, was der Mann sprach, hatte sozusagen Hand und Fuß. Sein Register wollte durchaus kein Loch bekommen.
»Sie würden aufgefressen werden.«
»Doch jedenfalls.«
»Sie würden davon nicht erwachen?«
»Niemals.«
»Ja, sind Sie denn nur dabei tot? Wo weilt Ihr Geist?«
»Das weiß ich nicht. Ich bin nicht etwa allwissend. Das konnten mir damals auch die chaldäischen Magier nicht sagen.«
»Wie lange haben Sie schon einmal so im Schlafe gelegen?«
»Die längste Zeit betrug ziemlich dreihundert Jahre.«
»Wo war das?«
»Da ließ ich mich in einem Grabgewölbe bei Jerusalem in einem Steinsarge beisetzen.«
»Wann war das?«
»Sechzehn Jahre nach dem Tode unseres Heilandes«, sagte der Graf, neigte das Haupt und schlug ein Kreuz vor der Brust, wie stets, wenn er den Namen Christi gebrauchte.
»Wie, Sie haben zu Christi Zeiten gelebt?!«
»Ja, warum nicht? Allerdings ein Zufall war es, dass ich damals gerade in Jerusalem, überhaupt in dem jetzigen Palästina lebte. Oder schließlich auch kein Zufall. Der Ruf des Wunderdoktors, welcher der Sohn des Zimmermanns aus Nazareth damals für die meisten ja nur war, hatte auch mich aus Syrien nach Judäa gezogen.«
»Sie kannten Christus?!«
»Ich habe«, erklang es feierlich, »mit unserem Herrn und Heiland oft, gar oft so gesprochen, wie ich jetzt mit Ihnen spreche.«
Schon längst starrte auch der englische Detektiv, wie wir den Leibdiener gleich nennen wollen, nach dem Sprecher wie nach einem Phantom aus dem Jenseits. In seiner ganzen Sprechweise lag eine Sicherheit, eine Überzeugungskraft, die sich eben schriftlich nicht wiedergeben lässt. Von den anderen beiden, dem Pater und der Herzogin, wollen wir gar nicht sprechen.
Nur der Lord, hier jedenfalls der überlegenste Geist, verhielt sich wieder ganz anders. Er hatte den Kopf gesenkt und trommelte sich mit den Fingern gegen die Stirn.
»Da ich nun einmal davon begonnen habe«, fuhr der Graf mit seiner herrlichen Baritonstimme, die immer einen etwas melancholischen Klang hatte, fort, »muss ich auch die Wahrheit bekennen. Ich muss! Immer die Wahrheit! Ja, ich habe in jener gewaltigen Zeit, an der die ganze Welt noch heute zehrt und ewig zehren wird, eine gar jämmerliche Rolle gespielt. Nur einen kühnen Schritt hätte ich zu tun brauchen, und mein Name wäre mit dem unseres Herrn und Heilandes für alle Ewigkeit verbunden gewesen, so wie die der zwölf Apostel. Aber ich tat einen feigen Schritt nach der anderen Richtung, und... mein Name ward aus der Weltgeschichte ausgelöscht für alle Ewigkeit. Wie hieß der Jüngling, von dem der Evangelist Markus im 14. Kapitel erzählt, Vers 51 und 52? Kennt jemand diese Stelle?«
Jawohl, Pater Hilarion war doch recht gut in der Bibel beschlagen, und er fing sofort zu deklamieren an:
»Und es war ein Jüngling, der folgte ihm nach (Christus, nachdem er von den Häschern ergriffen), der war mit Leinwand bekleidet auf der bloßen Haut, und die Häscher griffen ihn. Er aber ließ die Leinwand fahren und floh bloß von ihnen.«
Tief ließ der Graf den Kopf sinken.
»Namenlos mit unauflöslicher Schmach bedeckt!«, murmelte er dumpf. »Dieser Jüngling war ich!«
Da, als er den Kopf noch tiefer auf die Brustniedersinken ließ, warf der Lord den seinen zurück. schnellte plötzlich empor, streckte beide Arme aus.
»O ungeheuerliche Vermessenheit!!«, rief er. »Nun ist es genug! Ich will Klarheit haben, ob oder ob nicht...«
Jäh fuhr er wieder gegen den Grafen herum.
»Wohin wollen Sie sich jetzt begeben?«
»In die Einsamkeit.«
»In die Wüste?«
»Nein, ich bleibe in Rom, ich will die in den letzten hundert Jahren entstandene Literatur lesen, dieses Interesse ist das einzige, weshalb ich hin und wieder noch zum Leben erwache.«
»Besitzen Sie Mittel?«
»Nein.«
»Wovon leben Sie denn da?«
»Ich brauche nichts.«
»Sie leben von der Luft?«
»Wie ich Ihnen schon schilderte.«
»Und ich wollte das von Ihnen nur noch einmal bestätigt hören. Aber Sie müssen doch Kleidung kaufen, die Wohnung bezahlen.«
»Wenn ich Geld brauche, so habe ich es.«
»Sie können Gold machen?«
»Sie sagen es.«
»Der rote Löwe — es ist dennoch der rote Löwe!!«, jauchzte Pater Hilarion förmlich auf.
Eine gebieterische Handbewegung des Lords befahl ihm Schweigen.
»Also auch Gold können Sie machen! Das wollte ich ebenfalls nur von Ihnen hören. Nun hören Sie mich, Mann! Ich durchschaue Sie vollkommen. weiß alles, was Sie beabsichtigen. Sie haben sich auf irgendeine Weise in einem Sarge hier in mein Haus geschmuggelt. Sie verstehen die Kunst der indischen Fakire, sich für einige Zeit lebendig begraben zu lassen. An Jahre natürlich gar nicht zu denken. Dennoch muss ich der Wahrheit gemäß bezeugen, Sie hier in einem zugemauerten Gewölbe in einem luftdicht schließenden Sarge gefunden zu haben, scheinbar als Toten, der zum Leben zurückgerufen werden konnte — das muss gerade ich bezeugen, ich, Lord Walter Moore, der als der größte Freidenker gilt. Und darauf kam und kommt es Ihnen an. Was Sie da alles sonst noch schwatzen, davon ist Ihnen ja gar nicht das Gegenteil zu beweisen. Sie sind nicht zu kontrollieren. Die alten Bücher und Akten, auf die Sie sich berufen, existieren nicht mehr, dafür haben Sie selbst gesorgt oder doch hierauf spekuliert. Nur auf mein Zeugnis kommt es Ihnen an! Lord Moore hat mich in seinem Keller als Leiche gefunden. Und nun wollen Sie sich mit scheinbarer Bescheidenheit in die Einsamkeit zurückziehen, auf dass Ihr Triumph nur umso größer ist, wenn man Sie mit Gewalt daraus hervorholt. Gold, Gold will man von Ihnen haben, den roten Löwen! Denn wer schon solch wunderbare Dinge verrichten kann, der muss doch auch Gold machen können. Das ist der ganze Witz, und ich bezweifle nicht, dass Sie so schlau sind, dass ich niemals aufklären kann, wie Sie in meinen Keller gekommen sind. Aber, geehrter Herr Graf, Sie haben sich in Ihrer übergroßen Schlauheit selbst die Falle gebaut und sind freiwillig hineingegangen! Sie haben behauptet, keiner Nahrung zu bedürfen, keines Schluckes Wasser. Hier haben Sie sich festgenagelt, hier will ich Ihnen einmal auf die Zähne fühlen, hier sind Sie zu kontrollieren, was bei Ihnen Lüge und was Wahrheit ist. Wohlan, Sie sind mein Gefangener!! Luft und Staub sollen Sie genug zum Einatmen bekommen, sonst aber auch weiter nichts! Und nach acht Tagen wollen wir uns einmal wieder sprechen, mein Freundchen!«
Die mit besonderem Pathos gerufenen Worte. ›Sie sind mein Gefangener!!‹ hatten auf die Zuhörer wie ein Paukenschlag im stillen Theater gewirkt. Nur auf den Grafen nicht. Dieser hatte sich ganz ruhig erhoben.
Er bot nicht gerade eine glückliche Figur, wie er dastand, mit nur einem Strumpf und Schuh, der Ärmel abgerissen. Und dennoch, und das eben war das Merkwürdige dabei, dies alles vergaß man ganz über seiner sonstigen Erscheinung, die von der würdevollsten Majestät durchdrungen war. Und wenn er auch in Lumpen, in ein Harlekinkostüm gekleidet gewesen wäre, man hätte doch immer den geborenen König erkannt.
Er war und blieb der Herr der Situation, er war der Überlegene. auch über diesen englischen Lord, der sonst in dieser Hinsicht noch nie seinen Meister gefunden hatte.
»Gut, ich bin damit einverstanden.«
Der Lord bekam gleich ein verdutztes Gesicht.
»Nur Luft und Staub allein ist etwas wenig.«
Noch einmal glaubte der Lord triumphieren zu können.
»Aha, aha, schon knüpfen Sie Unterhandlungen an!«
»Ich bin gewohnt, wenn ich unter Menschen wandle, täglich ein Bad zu nehmen.«
»Aha, aha, jetzt kommt es schon! Sind Sie ein schlauer Fuchs! Dass ein Mensch acht Tage ohne Nahrung ausgehalten hat, das ist schon oft genug vorgekommen, aber ohne Wasser...«
»Sie irren vorkommen«, sagte der Graf nach wie vor ganz ruhig und immer mit edelstem Anstande. »Ich stellte mir bei den Worten ›Luft und Staub‹ zuerst nur eine schmutzige Kerkerzelle vor. Ich liebe Komfort. Den werden Sie mir doch nicht verweigern. Dann werden Sie mir wohl auch alle gewünschten Bücher besorgen. Unter solchen Verhältnissen bin ich sogar höchst gern bereit, für immer Ihr Gefangener zu bleiben. Denn ob ich hier oder dort in der Einsamkeit lebe, das ist mir ganz gleichgültig. Wenn ich nur ungestört bleibe. Und wenn Sie das als Beweis meiner Wahrhaftigkeit ansehen, wenn Sie glauben, ich könnte mein Badewasser trinken, so bin ich gern bereit, einmal acht Tage oder auch vierzehn Tage auf ein Bad zu verzichten.«
Des Lords schon wieder triumphierendes Gesicht war nur noch verdutzter geworden.
»Sie wollen sogar vierzehn Tage ohne Nahrung und Wasser aushalten?!«
»Jahrelang, für immer, solange ich in Ihrer Gefangenschaft bin.«
»Und doch nicht etwa gar, ohne dabei im Gewicht zu verlieren?«
»Wiegen Sie mich, und wenn ich nach einem Jahre auch nur ein Quäntchen abgenommen habe, so sollen Sie mich einen Lügner und Betrüger nennen.«
»Mann, Mann!!«, rief der Lord, plötzlich ganz außer sich. »Wenn Sie diese Probe auch nur vierzehn, nur acht Tage bestehen, so will ich vor Ihnen niederknien und Sie als einen Gott anbeten!«
»Sie hätten die Wette bereits verspielt. Aber ich nehme sie nicht an. Fern sei mir solch ein Frevel. Ich bin ein irdischer Mensch, der nur den Tod bemeistert und sich im Laufe der Jahrtausende einige ungewöhnliche Kenntnisse und Fähigkeiten angeeignet hat.«
Lord Moore hatte sich energisch wieder empor gerafft.
»Es bleibt dabei. Folgen Sie mir!«
Schon in der achten Morgenstunde wusste es ganz Rom. Dafür hatte die Herzogin und noch mehr der Bettelprior gesorgt. Die Aufregung, von der die ganze Stadt erfasst wurde, lässt sich nicht beschreiben. Das Haus der englischen Gesandtschaft ward von einer ungeheuren Volksmenge belagert, welche den geheimnisvollen Mann zu sehen wünschte, sogar mit drohenden Worten seine Freilassung begehrte.
»Den Grafen von Saint-Germain heraus, er hat den roten Löwen, er soll uns Gold machen!!«
Nur das beschwichtigte die Menge einigermaßen, dass Lord Moore bereits vom Papst in den Vatikan gebeten worden war... und die Herzogin Borghesia zur Audienz befohlen!
Und als die Herzogin dann wieder auf der Straße erschien, da saß sie mit glücklichem Lächeln in einer päpstlichen Luxussänfte, begleitet von der goldstrotzenden Schweizergarde — und da fragten sich schon alle die Besitzer und Besitzerinnen der Schlösser und Paläste hoffnungszitternd, wem die vergötterte Nichte des Papstes wohl den ersten Besuch machen würde, und der Gläubiger, der die in Gnaden Wiederaufgenommene noch zu belästigen gewagt hätte, der wäre doch gleich gelyncht worden.
Fürstengunst, Kaiserhuld — sie war damals nicht im Entferntesten zu vergleichen mit der des Papstes —
In der elften Vormittagsstunde kehrte auch Lord Moore auf Umwegen in sein Haus zurück. Unten trat ihm sein Leibdiener entgegen, ganz mit Staub und Erde bedeckt.
»Nichts gefunden?«
»Es ist ganz unerklärlich, wie er in den Keller gekommen ist. Keine Spur von einer frischen Mauerung. Ich habe den ganzen Boden aufreißen lassen — gar nichts.«
»Und der Bettelmönch? Sind da schon Nachrichten eingelaufen?«
»Ja. Bisher haben meine Spione noch nicht den geringsten Argwohn schöpfen können, dass Pater Hilarion mit dem Manne unter einer Decke stecke.«
»Ich habe dem Papst ausführlich berichtet. Er interessiert sich sehr dafür. Aber erst soll ich ihn nur etwas hungern lassen, das wird ja entscheiden. Ich sorgte gleich dafür, dass auch die Herzogin kommen musste. Ich habe die ganze Sache arrangiert. Sie tat den Fußfall und sagte pater peccavi. Nun ist sie wieder Liebkind. Wenn der Mann sonst auch gar nichts wert ist, so hat er doch wenigstens diesen Segen gestiftet.«
»Nein, Mylord, Sie waren es — Sie sind ein edler Mann!«, durfte dieser Diener so seinen Herrn loben.
»A — bah! Was macht der Graf?«
»Er hat seine Bücher geordnet und dann gelesen. Scheint sich ganz schlau zu befinden.«
»Keine Wünsche gehabt?«
»Doch! Einmal hat er geklingelt. Er wünschte Sie zu sprechen, den Lord. Mich als den Stellvertreter wollte er nicht haben. Wenn Sie aber bis elf Uhr nicht zurück seien, dann solle ich doch noch zu ihm zurückkommen. Punkt elf. Es sind nur noch einige Minuten hin, ich befinde mich gerade auf dem Wege zu ihm.«
»Was hat er um elf mir oder dir mitzuteilen?«
»Das weiß ich eben nicht. Er behandelt mich überhaupt etwas herablassend — wenn auch sonst ganz liebenswürdig — wie so'n gnädiger König — hat ja auch ein Recht dazu — ich bin ja in seinen Augen nur ein Kammerdiener.«
Unter solchen Gesprächen hatten die beiden die erste Etage erreicht. Es war eine mächtige Halle, und in der Mitte stand als Kiosk die Portiersloge, solid aus Stein gebaut. Alle drei Fenster waren vergittert, allerdings mit goldenen Stäben, die geschlossenen Glasfenster trugen Siegel, ebenso die Tür, und um den Kiosk herum schritten langsam zwei Diener, auf deren Wachsamkeit und Unbestechlichkeit der Hausherr sich wohl verlassen konnte.
Der Lord blickte durch eins der Fenster. Der ziemlich große Raum, der noch genügend indirektes Tageslicht empfing, war sehr hübsch möbliert, das Schlafsofa diente wohl als Bett, auf Regalen standen sehr viele Bücher, vor dem eleganten Schreibtisch saß in einem bequemen Lehnstuhl der Graf und schrieb. Er trug jetzt ein kleidsames Kostüm aus schwarzem Samt.
»Der schreibt ja mit der linken Hand!«, flüsterte der Lord.
»Tut er? Er mag links sein.«
Der Lord schloss mit eigenem Schlüssel die Tür auf, zerriss beim Öffnen das mit seinem Petschaft geprägte Siegel, trat ein.
»Ich störe doch nicht? Sie wünschten mich zu sprechen.«
Der Schreibende hatte sich erhoben, nach einigen formellen Redensarten setzten sich beide.
»Meine Unterbringung ging vorhin doch etwas schnell. Mir ist verschiedenes noch eingefallen. Es ist wegen des Schlafens...«
»Sie wünschen ein Bett. Ich dachte nur wegen...«
»Nein, ganz das Gegenteil. Ich schlafe überhaupt nicht.«
Der Lord beherrschte sich.
»Sie schlafen überhaupt nicht? Niemals?«
»Niemals. Das ist es eben. Durch die Bemeisterung des Todes habe ich den Schlaf verloren. Leider. Das ist nicht etwa angenehm. Deshalb eben setze ich mich manchmal in künstlichen Todesschlaf.«
Humbug, dachte der Lord. Der will mir immer mehr weismachen, und das ist auch viel schwerer zu kontrollieren als das Nichtessen und Nichttrinken. Der macht schon manchmal sein Nickchen, während wir glauben, er hat den Kopf aufs Buch gebeugt.
»Nur eine Stunde jeden Tages«, fuhr der Graf fort, »muss ich dem Tode einen Tribut zollen.«
»Wie machen Sie das, wenn ich fragen darf?«
»Jeden Mittag punkt zwölf Uhr falle ich in Starrkrampf. Genau eine Stunde. Punkt ein Uhr komme ich wieder zu mir.«
»Ach!«
»Und dass ich dann nicht gestört werde, das wollte ich nur bitten.«
»Gewiss nicht«, sagte der Lord, und für sich dachte er: »Dann macht er eben in dieser Stunde sein Nickchen, und wenn's auch wenig ist, so doch besser als nichts.«
»Denn dann befinde ich mich wieder in einem ganz anderen Zustande als bei dem scheinbaren Tode. Dann sind meine Glieder ganz steif, wie Glas, mir kann leicht ein Finger oder ein Ohr abgebrochen werden.«
»Seien Sie ganz ohne Sorge, wir brechen Ihnen nichts ab. Warum aber haben Sie sich zu dieser Stunde nicht lieber die der Geister ausgesucht? Nachts von zwölf bis eins?«
»Darüber habe ich nicht zu bestimmen. Diese Nachtstunde gehört eben den Toten, die Tagesstunde den Lebenden.«
»So so. Und in dieser Stunde sind Sie wohl hellsehend?«
»Sie sagen es.«
»Können Sie mir da nicht auch einmal meine Zukunft prophezeien?«
»Zukunft prophezeien? Ich kann überhaupt nicht in die Zukunft blicken.«
»Das ist schade! Nur was zur Zeit in der Ferne passiert, sehen Sie?«
»So ist es.«
»Wollen wir da nicht gleich dann einmal eine Probe davon machen, wenn Sie in Starrkrampf fallen? Ich tue anderswo etwas, Sie erzählen mir es dann.«
»Auf solche zwecklose Experimente lasse ich mich prinzipiell nie ein, das heißt Gott versuchen.«
Der Lord unterdrückte eine Bewegung des Unwillens.
»Da schweift Ihr Geist also in die Ferne?«
»Wohin ich ihm zu gehen befehle.«
»Das muss nett sein. Da wissen Sie also auch schon, wie es auf dem Monde aussieht?«
»Mein Geist kann nur dahin gehen, wohin ich als körperlicher Mensch auch gelangen könnte.«
»Ach so!«
Es war diesem Manne wirklich nicht beizukommen. Der war mit allen Hunden gehetzt.
»Sie können auch nach fremden Erdteilen gehen?«
»Gewiss. Jetzt bin ich in Indien, im nächsten Augenblick in Amerika. Das geht alles wie in Gedanken vor sich. Der vom Körper befreite Geist gehorcht dem Willen im Augenblick. Und dann habe ich den Vorteil, dass ich auch alles sehe und höre und mich auch nach dem Erwachen noch auf alles besinne, als hätte ich es mit meinen körperlichen Augen und Ohren gesehen und gehört.«
»Wunderbar, wunderbar! Da haben Sie aber doch eigentlich gar keine Bücher nötig. Sie gehen im Geiste einfach in die Bibliotheken und lesen da in den Büchern. Oder müssen Sie die da erst von den Regalen nehmen und aufklappen, was allerdings etwas aufhalten würde?«
»Durchaus nicht. Das ist im Geiste alles ganz anders. Der durchschaut alles, alles. Aber die Sache ist die, dass ich auch im körperlosen Geiste, wenn ich es für später behalten will, nicht schneller lesen kann als im bewusstlosen Zustande, und da ist täglich eine einzige Stunde Lektüre etwas wenig, wenn man vierundzwanzig Stunden zu seiner Verfügung hat.«
Infamer, schlauer Fuchs!, dachte der Lord und beugte sich, nur um auf andere Gedanken zu kommen, weil er sich immer mehr ärgerte, auf das beschriebene Blatt nieder. Es war mit Hieroglyphen bedeckt.
»Ist das Russisch oder Türkisch, wenn ich fragen darf?«
»Nein, das ist Chaldäisch.«
»Ach was, Chaldäisch! Gibt es denn eine chaldäische Schrift?«
»Erhalten hat sie sich allerdings nicht, es war dies eine Geheimschrift der chaldäischen Priester und Magier. Ich bediene mich ihrer am liebsten, habe mich an sie am meisten gewöhnt, denn in Babylon habe ich die längste ununterbrochene Lebenszeit verbracht — fast vierhundert Jahre.«
Nun hatte es aber bei dem Lord bald dreizehn geschlagen! Sollte man dem einmal beweisen, dass das keine chaldäische Geheimschrift sei! Einfach nicht zu fangen.
Und doch, der Lord simulierte immer, wie er irgendeine Falle aufbauen könne.
»Sie schreiben mit der linken Hand?«
»Links oder rechts, das ist mir ganz gleich.«
In diesem Augenblick war die Falle in des Lords Kopfe auch schon fertig!
»Sie können die linke Hand genau so gebrauchen wie die rechte?«
»Ganz genau so.«
»Mit welcher Hand führen Sie den Degen?«
Damals trug jeder freie Mann an der Seite den Degen oder durfte ihn doch tragen. Jedenfalls wurde das Fechten viel mehr geübt als das Schreiben. Mit der linken Hand schreiben zu lernen, wenn man es schon mit der anderen kann, die linke Hand sonst zu allerhand Beschäftigungen geschickt zu machen, das ist gar nicht so schlimm. Anders mit dem Fechten. Da kommt ganz anderes in Betracht. Wer einmal die rechte Hand zum Fechten ausgebildet hat, der wird es mit der linken niemals noch zu etwas bringen.
»Das ist mir ganz gleich«, lautete des Grafen Antwort.
»Sie können mit der linken Hand genau so gut fechten wie mit der rechten?«
»Ganz genau so gut.«
Der Lord erhob sich. Diesmal sollte der Kerl nicht wieder solche Ausflüchte machen, etwa dass er keine Waffen in die Hand nähme. Jetzt sollte er der Renommage und Flunkerei einmal überführt werden!
»Fred, zwei Stoßrapiere!«
»Nein, mit Rapieren fechte ich nicht, mich bindet ein Schwur.«
Aha, da kam es schon!
»Nein, mein Freund, diesmal...«
»Es müssen geschliffene Degen sein.«
Der Lord stutzte.
»Was? Sie wollen wohl mit mir einen Gang auf Leben und Tod...«
»O nein, ich werde Ihnen nicht die Haut ritzen.«
»Mann, sehen Sie sich vor, ich bin ein gar guter Fechter!«
»Möglich, aber mit mir können Sie sich nicht messen.«
»Mann, wie können Sie denn so etwas behaupten?!«, lachte der Lord ob solch einer furchtbaren Renommage.
»Das sehe ich in Ihrem Auge, an jeder Ihrer Bewegungen. Lassen Sie doch gleich vier Degen bringen.«
»Wozu gleich vier?«
»Nun, Sie werden doch noch einen guten Fechter hier haben, ich soll doch beweisen, dass ich mit der rechten Hand wie mit der linken fechten kann, das machen wir gleich zusammen ab.«
»Was, Sie wollen doch nicht etwa gleichzeitig gegen uns beide fechten?!«
»Das werde ich allerdings tun.«
Der Lord geriet ganz außer sich, grübelte nur nach, wie sich dieser Fuchs nun wieder aus dieser Falle ziehen wollte.
»Herr, der andere wird mein Leibdiener sein, und das ist der ehemalige Meisterfechter von England, und dem habe ich diesen Titel erst abtreten müssen!«
»Der Herr, den Sie Ralph nennen?«
»Jawohl, derselbe.«
»Mit dem nehme ich es ebenfalls auf, gleichzeitig mit Ihnen. Das sehe ich jedem Menschen sofort im Auge an — und noch anderes mehr.«
»Gut, Sie sollen Ihren Willen haben!«
Ralph brachte gleich die vier Degen mit.
Vor dem Kiosk verständigte sich sein Herr mit ihm.
»Der hat schon eine Gegenfalle gebaut. Aber wie dem auch sei, einen Denkzettel muss er bekommen. Du schlitzt ihm das Ohr auf deiner Seite auf, ich besorge das andere.«

Der Kiosk wurde für hell und geräumig genug befunden. Der Graf betrachtete und bog einen seiner beiden Degen.
»Ganz gut, aber... als ich einmal einen Gang mit dem großen Saladin machte, die Klinge hätten Sie sehen sollen!«
Er nahm ein Blatt Papier, teilte es.
»Wohin an die Wand soll ich dieses eine Blatt heften?«
»Wozu das?«, fragte der Lord.
»Bitte, wohin an die Wand soll ich es heften?«
»Nein, ich will erst wissen, was das bedeuten soll.«
»Bringen Sie doch mich und sich selbst nicht um eine kleine Überraschung.«
»Nun gut — ich lasse mich durch nichts irritieren — dorthin.«
Der Graf heftete das Papier, so groß wie ein Kartenblatt, zwischen den beiden Fenstern in Kopfhöhe an die holzbelegte Wand.
»Und dieses zweite Blatt? An eine möglichst andere Stelle, aber Sie sollen bestimmen.«
»Dorthin.«
Es wurde im Hintergrunde des Zimmers ganz unten an der Wand befestigt.
»Was soll das?«
»Sie werden es sofort erfahren. Postieren wir uns.«
Es geschah, sie nahmen Distanz, der Graf in jeder Hand einen Degen.
»Mylord geben wohl das Zeichen. Fallen Sie gleichzeitig gegen mich aus, mit voller Kraft, alle Finten sind erlaubt. Schonen Sie mich nicht! Beim ersten Ausfall ringe ich Ihnen die Degen aus den Händen.«
»Ach was!!«, lachte Ralph hell auf.
»Los!«
Beide fielen gleichzeitig aus, jeder hatte es auf ein Ohr des Gegners abgesehen, aber da...
Da hatten sie schon keine Degen mehr in den Händen! Wie es geschehen war, wussten sie jetzt nicht und dann nicht. Wie blitzende Schlangen hatte es sich um ihre Klingen gewunden, und da waren ihnen diese schon aus den Händen gerissen gewesen. Und der eine Degen steckte mit der Spitze in diesem Papierstück, der andere in jenem, mitten drin, noch zitternd in der Wand heftend. Und das zweite kartengroße Papier befand sich weit hinter dem Grafen, er hatte den entrissenen Degen mit seiner eigenen Klinge über seinen Kopf geschleudert.
Ein erstarrter Blick nach den noch zitternden Degen in den Wänden, ein wahrhaft entsetzter Blick nach dem Grafen, und Lord Moore brach gleich auf dem Sofa zusammen.
»Ich — bin — fassungslos!«, ächzte er.
Ralph starrte mit offenem Munde noch immer den in der Wand steckenden Degen an.
»Mei — mei — mein Degen! Ja, wie kommt denn der da in die Wand hinein?!«
»Das ist Zauberei!«, ließ sich wieder der Lord vernehmen.
Der Graf tat, als wenn gar nichts geschehen wäre, setzte sich wieder vor den Schreibtisch, ordnete Papiere und Schreibzeug.
»Nein, es ist gar keine Zauberei dabei. Das geht alles auf ganz natürlichem Wege vor sich. Ich bin von jeher ein leidenschaftlicher Fechter gewesen, und bedenken Sie doch, wenn man sich 5000 Jahre lang — oder 4000 will ich sagen, 1000 habe ich ja davon verschlafen — wenn man sich 4000 Jahre lang fast täglich übt, was für eine Fertigkeit man darin erreichen muss. Freilich ist es da mit der Geschicklichkeit noch nicht abgetan. Zu diesem doppelten Fechten muss auch der Blick ein doppelter werden, man muss sogar seinen Geist teilen können. Aber das lässt sich durch Übung alles erlernen. Ja, ich kann meinen Blick und meine Geistesaufmerksamkeit sogar verdreifachen. Hiervon möchte ich Ihnen einen Beweis geben. Bitte, Mylord, wollen Sie näher treten — auch der Diener.«
Die beiden, schon in der Erwartung, etwas noch Sensationelleres zu sehen, kamen hin. Der Graf hatte zwei Blatt Papier vor sich hingelegt, in jede Hand einen Federkiel genommen.
»Nun, bitte, diktieren Sie mir einmal etwas. Gleichzeitig, womöglich in zwei verschiedenen Sprachen.«
»Aus einem Buche?«
»Nein, eben nicht. Sie könnten annehmen, dass ich es auswendig weiß.«
»Aber Sie können doch nicht jedes Buch auswendig wissen.«
»O doch.«
»Was, Sie wüssten jedes Buch auswendig?!«, fing der Lord schon wieder ungläubig zu staunen an.
»Ja, wenn ich es einmal gelesen habe. Nun dürfen Sie das allerdings nicht gar zu wörtlich nehmen. In den 4000 Jahren mag ich wohl eine Million Bücher und Handschriften gelesen haben, denn ich lese Tag und Nacht. Die kann ich nun freilich nicht alle mehr auswendig. Aber sonst — geben Sie mir das dickste Buch, ich lese es einmal schnell durch und sage es Ihnen Zeile für Zeile und Wort für Wort auf, und das noch nach Jahren.«
»Es — ist — nicht — möglich!!«
»Ich werde Ihnen gleich eine kleine Probe geben. Übung, nichts als Übung! Und Sie sollen nicht glauben, ich kenne das Diktierte schon, was bei einem Buche auch wirklich möglich wäre. Diktieren Sie mir etwas aus dem Kopfe. Oder haben Sie einen nicht belanglosen Brief bei sich?«
Ralph hatte schon einige Briefe aus der Brusttasche gezogen.
»Ein russischer Brief.«
»Gut. Auch russisch geschrieben?«
»Jawohl.«
»Sie können russisch Geschriebenes lesen?«
»Ich bin ein geborener Russe.«
»Desto besser, so können Sie dann dem Lord seinen Brief vorlesen, den ich russisch schreiben werde, so wird die Sache noch komplizierter, In welche Sprache nun soll ich Ihren russischen Brief übersetzen?«
»Können Sie Französisch?«
»Pfff«, machte der Graf. »Also ich werde Ihren russischen Brief hier mit der linken Hand ins Französische übersetzen. Und Sie Mylord?«
»Ich habe hier einen englischen Brief.«
»In welche Sprache soll ich ihn mit der rechten Hand übersetzen?«
»Sie können wohl alle Sprachen?«
»Bitte, in welche Sprache. Einer von Ihnen muss Sie natürlich kennen, sonst weiß man ja nicht, ob's auch stimmt.«
»Nun, ins Deutsche.«
»Gut, ins Deutsche, aber ich werde mich dabei der russischen Schriftzeichen bedienen. Und nun das dritte. haben Sie sonst noch einen Brief, dessen Inhalt ich wissen darf? Vielleicht wieder in einer anderen Sprache?«
»Hier ist ein spanischer.«
»Darf ich ihn selbst lesen?«
»Gewiss.«
Der Graf legte den spanischen Brief, eine große, eng beschriebene Quartseite, vor sich hin, tauchte beide Gänsekiele in die Tinte.
»So. Es kann beginnen. Nun lese jeder Herr seinen Brief vor. Gleichzeitig. Ganz ungeniert. Geläufig. Ich schreibe so schnell, wie Sie sprechen.«
Es geschah. Mit rasender Schnelligkeit rutschten die beiden Gänsekiele über das Papier. Die Linke schrieb lateinische Buchstaben, die Rechte russische, und dabei starrte der Graf immer vor sich auf den spanischen Brief.
Nach noch nicht fünf Minuten hatten die beiden gleichzeitig geendet.
»So«, sagte der Graf, den spanischen Brief zurückgebend, »und hier sind die beiden Übersetzungen.«
Es stimmte. Ralphs russischen Brief hatte er mit der linken Hand in lateinischen Buchstaben ins Französische übersetzt, des Lords englischen Brief mit der anderen Hand mit russischen Schriftzeichen ins Deutsche — und zwar tadellose Übersetzungen.
»Und was sollte der spanische Brief?«, fragte der Lord, den plötzlich ein Zittern befiel.
»Den habe ich gleichzeitig gelesen, und zwar lautete er...«
Er sagte den spanischen Brief, fünfunddreißig lange Zeilen mit den schwierigsten Ausdrücken, Wort für Wort her.
Jetzt erst brach es bei dem jungen Lord hervor. Er war ganz außer sich.
»Herr Graf — oder wer Sie sonst sind — ich habe an Ihnen zu zweifeln gewagt — habe Sie für einen Betrüger gehalten... befehlen Sie mir, und ich knie vor Ihnen nieder und bete Sie an!!«
Ruhig hatte sich der Graf erhoben, dabei aber ein dickes Buch vom Tisch geworfen.
»So etwas liegt mir ganz fern. Wenn Sie, My...«
Er war dem herzuspringenden Ralph zuvorgekommen, hatte selbst das Buch aufgehoben, streckte den Arm aus, um es in ein Regal zu setzen... da plötzlich erstarb ihm das Wort auf der Zunge, und er selbst erstarrte mitten in der Bewegung, und so stand er wie eine Statue da, das schwere Buch weit vorgestreckt, den rechten Fuß vorgesetzt, und wollte sich nicht verändern.
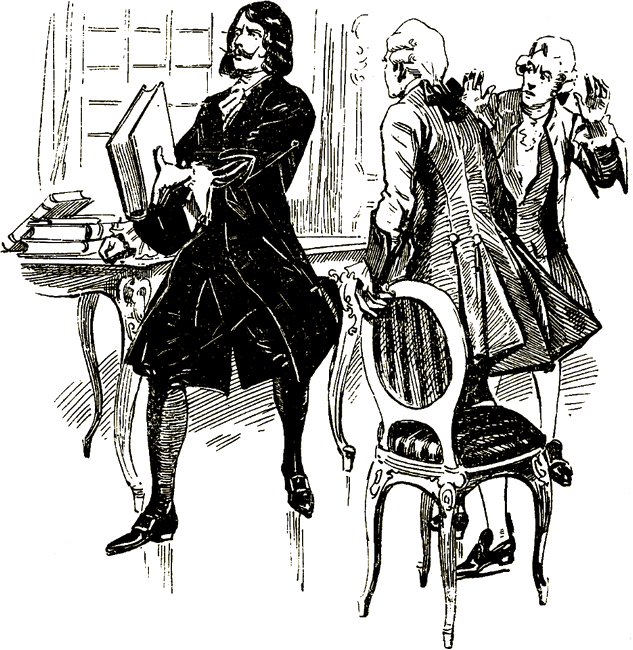
»Was hat denn das zu bedeuten?«, flüsterte Ralph nach einer Weile.
Auch der Lord war zuerst ganz erstaunt, dann bestürzt gewesen, bis ihm die Erkenntnis kam. Er zog seine Uhr hervor.
»Richtig, punkt zwölf Uhr ist der Starrkrampf eingetreten, mitten im Gespräch!«
Er berichtete seinem Diener mit kurzen Worten, was ihm jener zuvor gesagt hatte. Scheu betrachteten die beiden dann den Erstarrten. Die Augen hatte er noch offen, aber auch diese waren ganz starr geworden.
»Dass er nicht umfällt! Dass er das schwere Buch nur so lange in der ausgestreckten Hand halten kann!«, meinte Ralph.
»Das eben ist ein Beweis, dass hier keine Verstellung vorliegen kann«, entgegnete Lord Moore und schickte den Diener hinaus.
Er setzte sich auf das Sofa, die Uhr in der einen Hand, den Kopf in die andere Hand gestützt, so blieb er die ganze Stunde sitzen, mehr vor sich hingrübelnd als den Erstarrten beobachtend.
»Wunderbar, wunderbar!«, murmelte er immer wieder vor sich hin. »So muss also endlich auch ich daran glauben, dass es Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, von denen sich unsere Schulweisheit nichts träumen lässt.«
Als es nach des Lords genau gehender Uhr Punkt eins war, kam plötzlich wieder Leben in den Erstarrten, er vollendete die angefangene Bewegung, setzte das schwere Buch, das er in dieser ganzen Stunde mit langgestrecktem Arm auch nicht um eine Linie gesenkt hatte, in das Regal und wandte sich gegen den Lord.
»Verzeihen Sie«, sagte er mit trübem Lächeln, und etwas Melancholisches hatte er überhaupt immer an sich. »Es hat mich einmal im Stehen überrascht. Ich muss mich nach dem langen Todesschlafe erst wieder daran gewöhnen, dass ich mich immer rechtzeitig darauf vorbereite.«
Der Lord war aufgestanden. In dieser langen Stunde des einsamen Nachdenkens hatte sich bei ihm nichts geändert.
»Herr Graf! Ich habe Sie furchtbar beleidigt und gekränkt. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Doch Sie haben mich besiegt. Haben aus einem Saulus einen Paulus gemacht. Und wie ein glaubend feuriger Paulus will ich fernerhin für Ihre Sache kämpfen. Bitte, folgen Sie mir, das ist hier kein Ort für Sie.«
»Aber ich sollte hier doch vierzehn Tage...«
»Bitte, kein Wort mehr! Seien Sie als Sieger dem Besiegten gegenüber edelmütig!«
Und der Lord führte den Mann, den er noch vor wenigen Stunden als einen Betrüger hier für vierzehn Tage bei Wasser und Brot oder vielmehr bei Luft und Staub hatte einsperren wollen, in eins der Prunkzimmer, bestimmt, Könige zu beherbergen. —
Der Graf war allein. Er stand in der Mitte des Zimmers, wieder wie eine Statue, aber nicht im Starrkrampf, in seinem schönen Antlitz zuckte es, und dann kamen, triumphierend und doch wieder im bittersten Schmerze, leise Worte über seine Lippen.
»Mein Ziel ist erreicht — ich habe gesiegt — und in diesem Lord habe ich die ganze Menschheit besiegt... und bin darüber zum ehrlosen Betrüger geworden!«
Im Festsaale der englischen Gesandtschaft wogte, wie sich heute ein Zeitungsberichterstatter ausdrücken würde, die ›geladene Menge‹. Der Damenflor unterschied sich in seiner Toilette wenig von einer heutigen Gesellschaft der exklusiven Kreise. Die Kaiserin Eugenie, erfinderisch wie wenige, hatte noch nicht die Krinoline eingeführt, um delikate Verhältnisse zu bemänteln. Unten so viel wie möglich, oben so wenig wie möglich, Diamanten und Perlen, wo sie nur Halt fanden — das wurde von der Dame gefordert, wenn sie eine Kritik bestehen sollte, gerade wie noch heute.
Anders die Herren. Die trugen damals noch keine schwarzen Schwalbenschwänze, die konnten damals noch Farbenpracht entwickeln, Originalität, Geschmack und Phantasie beweisen.
Es gab natürlich nur einen einzigen Unterhaltungsstoff: Der Graf von Saint-Germain.
Der schon ganz heiser gewordene Lord Moore hatte berichtet. In der Mitte des Saales hatte er alles erzählt, an sämtlichen Pfeilern, in sämtlichen Fensternischen, in sämtlichen Ecken, in sämtlichen Winkeln es fehlte nur noch, dass er unter die Möbel kroch, um von seinem Gastfreund zu berichten. Daher die Heiserkeit. Und mit der letzten Kraft seiner Stimme konnte er stets noch hinzusetzen.
»Er kommt! Er kommt selbst! Er wollte durchaus nicht, aber ich habe ihm so lange zugesetzt, bis ich ihm das Versprechen abrrrrr...«
Die letzten Worte des Lords waren nie recht verständlich. Sie waren auch gar nicht für die Gäste bestimmt, denn sie lauteten: »Heilige Trappisten, nehmt mich in euer Kloster des ewigen Schweigens gnädig auf!«
Und er kam.
Und stille ward es in dem Saale, als ob die Gottheit nahe wäre.
Und es war auch ganz richtig so.
»Es ist die Vermählung des Engels der Finsternis mit dem Engel des Lichtes«, flüsterte eine Dame in der gesucht geistreichen Weise der damaligen Zeit, und doch hatte sie das Rechte getroffen.
Ein wunderbarer, rätselhafter Zauber ging von dem ganzen Manne aus. In seinem Doppelwesen musste es liegen, das sich in allem und jedem offenbarte.
Sein schwarzes Samtkostüm war das einfachste im ganzen Saale, und es überstrahlte die prächtigste Herrentoilette. Die ganze Gestalt wie aus Erz gegossen und dabei zierlich wie die eines eingeschnürten Mädchens. Der feste Schritt leicht wie eine Feder. Die überaus feine Hand musste Eisen zermalmen können. Das feurig funkelnde Auge blickte so melancholisch. Alles überlegene Kraft und Selbstbewusstsein, und dabei immer wie um Entschuldigung bittende Bescheidenheit. Und nun schließlich noch diese weiche, schmelzende Baritonstimme, welche dennoch dazu bestimmt sein musste, im Schlachtengetümmel und Kanonendonner zu kommandieren.
In einer dunklen Ecke standen zwei Priester. Ihren finsteren Augen entging nicht das Geringste, und diese Priesteraugen verstanden zu beobachten.
»Wehe!«, flüsterte der eine. »Wehe für Rom!«
Ziemlich isoliert, nur von einigen alten Damen und Kuttenträgern bewacht, saß Prinzess Polima, die Tochter des polnischen ExKönigs Stanislaw Lesczynski. Schön wie ein Engel, aber kalt wie Eis. Zum letzten Male stellte sie ihre Reize zur Schau aus. In wenigen Tagen, an ihrem 19. Geburtstage, würde sie den Schleier nehmen. Römische Politik, aber ohne dabei auf Widerstand zu stoßen. Ob sich hier langweilen oder im Kloster, als unterste Nonne oder als fürstliche Priorin, was für ein Unterschied war dabei? Wenn die Regel gilt, dass bei jedem Weibe nur der richtige Mann zu kommen braucht — bei Prinzessin Polima traf sie nicht zu. Das wusste man, da brauchte man nicht erst noch einmal zu probieren. Dem schönen Körper fehlte die Seele. Wer hatte sie jemals lachen oder weinen sehen, erröten oder erbleichen?
Mit einem älteren Herrn plaudernd, schritt der schwarze Graf an dieser isolierten Gruppe vorbei. Zu den Füßen der Prinzessin lag unbeachtet eine herabgefallene rote Rose. Mit einer Gewandtheit und Grazie, welche ganz ausschloss, dass er heute Mittag beim Aufstehen das schwere Buch unabsichtlich vom Tische geworfen haben könne, beugte sich der Graf, kaum ohne im Gehen zu stocken, hob die Rose mit den Fingerspitzen auf, überreichte sie der Prinzessin, eine Verbeugung, ein Blick, und er war schon wieder weit entfernt.
Die Prinzessin saß mit der roten Rose in der Hand da. An der schneeweißen Stirn fing es an. Es ergoss sich über das Antlitz, über den feinen Hals, hier teilte es sich, ging bis tief in den Busen und in den Nacken hinab — noch eine andere Röte als die der purpurnen Rose.
Den finsteren Priesteraugen in der dunklen Ecke war nichts entgangen.
»Wehe!«, flüsterte jetzt der andere Kirchenfürst. »Er kann wirklich Tote lebendig machen — wehe, hiermit hat er sein eigenes Todesurteil gesprochen — er ist ein Teufelszauberer!«
Gleich in der ersten Minute war der Graf mitten drin in der Gesellschaft, als habe er mit all diesen Damen und Herren alltäglich kameradschaftlich verkehrt. Aber doch immer dasselbe Rätsel. Die unbefangenste und trotzdem bescheidenste Liebenswürdigkeit selbst und dabei von unnahbarem Stolze. Wie von einem unwiderstehlichen Magneten fühlte sich alles zu ihm hingezogen — bis zu einer gewissen Distanz, da trat sofort das rätselhafte Etwas dazwischen. Und was er nun sprach, erzählte! Von Hunderten nur ein einziges Beispiel in dieser Beziehung.

»Bitte? Ob ich die zwölf Apostel kannte? O, gewiss! Ich war ja selbst ein Jünger des Meisters« — nie vergaß er ein Kreuz zu schlagen — »wenn natürlich auch nicht unter die zwölf aufgenommen. Ich wartete beim letzten Abendmahl, welches unser erstes heiliges ist, als dienender Bruder auf. Da passierte mir noch das Unglück, dass ich dem Jakobus die ganze Brühe in den Schoß goss. Judas Ischarioth? Ein ganz angenehmer Mensch. Gutmütig, offen, ehrlich... was dem plötzlich in den Kopf fuhr, den Verrat zu begehen — ich begreife es heute noch nicht. Er muss unzurechnungsfähig gewesen sein. Übrigens war er durchaus nicht rothaarig. Ein ganz normales Hellblond. Das ist ebenso wie mit Maria Magdalena. Die wird jetzt immer blond dargestellt, und in Wirklichkeit war sie schwarz. Auf der rechten Wange hatte sie so einen kleinen Büschel Haare, was ihr ganz reizend stand. Maria und Martha? O, gewiss, in deren Hause habe ich gar viel verkehrt! Sehen Sie, das ist auch wieder so. Die Maria war durchaus nicht so unhäuslich. Vor allen Dingen kochte sie gern. Und gut kochte sie, sehr gut. Sie kochte mit Liebe. Mir machte sie immer Eierkuchen mit Salat.«
Und so ging das weiter. Aber nicht etwa nur von Christi Umgebung. Ach, der hatte ja schon den Turmbau von Babel mitgemacht. Da hätte ihn beinahe ein schwerer Stein erschlagen. Glücklicherweise war er nur mit dem kleinen Finger darunter gekommen. Dann war er mit Kolumbus in Amerika gewesen. Übrigens stieß Kolumbus etwas mit der Zunge an. Ist das bekannt? Vorher hatte er unter Xerxes als erster Baumeister die Brücke über den Hellespont geschlagen. Und so weiter, und so weiter.
Und das Publikum? Das lauschte mit demselben ehrfurchtsvollen Staunen, wie heute das Publikum mit ehrfurchtsvollem Staunen dem Vortrage des Professors lauscht, der nach der Darwin'schen Theorie mit Hilfe von Lichtbildern erläutert, wie sich der Mensch nach und nach aus dem Affen entwickelt hat!
Geneigter Leser, willst du dir für diesen ganzen Roman eins merken: Der Mensch als Mensch verändert sich nie — niemals! Wehe uns, wenn wir unsere Vorfahren verlachen! Dann haben unsere Nachkommen ein gutes Recht, auch uns wieder zu verlachen! —
Ja, es waren einige darunter, welche nicht daran glaubten. Solche Köpfe gibt es immer. Hat doch schon Plato nicht glauben können, dass sich die große Sonne um die kleine Erde drehe.
Wohl mochten alle Schilderungen des englischen Gesandten, was er mit dem geheimnisvollen Grafen erlebt, was ihm dieser Erstaunliches vorgemacht, auf Wahrheit beruhen. Aber war das irgendein Beweis, dass der Mann auch nur vor hundert Jahren schon gelebt hatte?
Wohl nicht umsonst hatte Lord Moore die bedeutendsten Gelehrten aller Fakultäten, die sich in Rom aufhielten, herangezogen. Aber durch diese war der geheimnisvolle Mann nicht auf den Sand zu setzen. Dem einen antwortete er auf assyrisch, dem zweiten erläuterte er sachgemäß die peruanische Knotenschrift, dem dritten übersetzte er sofort eine ägyptische Keilschrift, über welche sich tatsächlich schon die ganze Gelehrtenwelt den Kopf zerbrochen hatte. Von den Vertretern der verschiedensten Nationen, denen er in ihrer Muttersprache geläufig Rede und Antwort stand, gar nicht zu sprechen.
Doch war das ein Beweis, dass dieser Mann übernatürliche Fähigkeiten besaß?
Schon damals gab es Wunderkinder, die in der Gedächtniskunst das Phänomenalste leisteten. Schon der berühmte Astronom Tycho de Brahe im 16. Jahrhundert benutzte als Rechenmaschine ein kleines Mädchen, das mit zehnstelligen Logarithmen im Kopfe rechnete, und bis zu ihrem 15. Jahre, da sie starb, wusste sie alles, alles Wort für Wort auswendig, was sie jemals gelesen oder gehört hatte.
Kann es denn nun nicht einmal ein Wunderkind geben, welches von allen anderen Wunderkindern als Wunderkind angestaunt wird?
Es ist alles möglich. Es ist erstaunlich, aber nicht übernatürlich.
Doch was hatten solche nörgelnde Zweifler zu sagen! Die haben die Welt überhaupt noch niemals bestimmt. Wird allgemein gezweifelt, so ist das Modesache, und wer gegen den Strom schwimmt, der ersäuft.
Und das Allerwunderbarste dabei erkannten auch die nicht, die sich für so scharfsinnig und scharfsichtig hielten.
Wenn dem Grafen eine Frage unbequem war, dann beantwortete er sie nicht, wusste sie zu umgehen — ohne dass die anderen das Geringste davon merkten!
Das war eigentlich der wahre Zauber! Aber eben von niemand gemerkt. Hierin war der Graf ein wirklicher Hexenmeister!
Und dann geschah etwas, was alle perplex machen sollte. Der Graf lieferte einen handgreiflichen, einen mathematischen Beweis, den man über alle Meere schicken konnte, dass er Kenntnisse besaß, wovon die übrige Menschheit noch gar nichts wusste.
Es war doch eigentlich merkwürdig, dass man ihn gar nicht anging, er möchte etwas von seinen Fähigkeiten zeigen, etwas vormachen, wie er es heute früh dem Lord gegenüber getan. Daran war eben die geheimnisvolle Schranke schuld, die der Graf um sich zu errichten verstand.
Diese Schranke sollte er selbst durchbrechen!
Zwei Gäste stellten sich noch nachträglich ein, die so lange auf der Sternwarte zugebracht hatten, zwei berühmte Astronomen, der eine noch mehr als analytischer Mathematiker.
Der Graf von Saint-Germain wurde ihnen vorgestellt.
»Ah, Mathematik! Ich habe auch sehr viel Mathematik getrieben. Ebenfalls bei den chaldäischen Priestern. Wir beschäftigten uns viel mit Mathematik. Allerdings in anderer Weise als jetzt. Mehr mit den Geheimnissen, mit der Magie der Zahlen......«
»Wie jeder Mensch seine besondere Zahl hat, die bei allen wichtigen Ereignissen seines Lebens eine Rolle spielt?«, fragte eine vorwitzige Dame.
»Auch das. Jetzt aber meine ich das anders. Jede Zahl hat ihre besondere Eigenschaft, ihr Geheimnis, ihre... nun, gleich ein Beispiel. Wollen Sie mir irgendeine Zahl nennen? Irgendeine. Eine einstellige oder eine hundertstellige, ganz gleichgültig.«
»Die Sieben«, sagte der eine Mathematiker sofort.
..Die Dreizehn«, der andere.
Die beiden gelehrten Herren hatten nicht umsonst kleine Primzahlen gewählt. Was soll man denn mit solch einer indifferenten Zahl groß anfangen können?
»Nein«, erhob aber der Graf Widerspruch, »ich mache alles nur einmal. Die Sieben oder die Dreizehn. Oder irgendeine andere Zahl. Irgendeine. Aber nur eine einzige.«
»Die Dreizehn, die Dreizehn!!«, erklang es sofort im ganzen Chore.
Hier muss erst etwas eingeschaltet werden. Es ist ganz merkwürdig, was für eine Vorliebe das italienische Volk bis in die tiefsten Schichten hinab für Mathematik, oder mehr für Zahlen überhaupt hat. Alle Vorkommnisse, das ganze Leben sucht man in Zahlen zu zwängen. Das ist schon vor der Einführung des staatlichen Lottospieles mit seinen unzähligen Kombinationen so gewesen, hat dieses aber jedenfalls erst ins Leben gerufen, und noch heute sieht man ja in allen italienischen Städten die Eseljungen und Strolche das bekannte Fingerspiel treiben, die Zahl der ausgestreckten Finger zu erraten.
Wenn die Zweifler glaubten, der Graf wolle eine ihm unbequeme Zahl zurückweisen, so hatten sie sich geirrt. Jedenfalls hatte dieser unvergleichliche Virtuose auch der menschlichen Seele diesen zweifelnden Glauben mit Absicht erweckt.
»Die Dreizehn«, wiederholte er sinnend, die Hand am Kinn, und dann streckte er schnell seine Hand aus und malte mit dem Finger in der Luft.
»Die — Drei—zehn... die Dreizehn geht ohne Rest auf in jeder sechsstelligen Zahl, die aus zwei gleichen dreistelligen Zahlen besteht. Bitte, machen Sie die Probe!«
Die Formel kapiert hatte jeder hier sofort. Wer Bleistift und Papier besaß, fing an zu rechnen, sonst wurde anderes zu Hilfe genommen.
285 285 : 13 = 21 945 100 000 : 13 = 7 700 404 404 : 13 = 31 108 752 752 : 13 = 57 904
Und so fort. Man konnte Zahlen wählen, welche man wollte. Setzt man hinter eine dreistellige Zahl noch einmal dieselbe, so geht in der Gesamtzahl die 13 ohne Rest auf.
Aber das hatte hier niemand gewusst. Hier war alles ganz perplex. Ganz besonders, weil die meisten eben Italiener waren. Aber auch die anderen fingen kopfschüttelnd immer wieder zu rechnen an. Wer hätte denn das der unschuldigen oder auch niederträchtigen Dreizehn angesehen!
»Das geht nur jetzt, weil Sie hier sind?«, fragte ein kleines Dämchen ganz naiv.
Der Graf zeigte einmal, dass er auch herzlich lachen konnte.
Aber den beiden Professoren der Mathematik ging es nicht viel anders.
»Ja, bin ich denn nur verhext, wie kommt denn das nur?«, murmelte der eine, in seinem dicken Notizbuche Seite nach Seite verschmierend.
Aber der ging dem Rätsel schon mit der analytischen Mathematik zu Leibe. Es muss sich doch, wie alles in der Mathematik, beweisen lassen, dass es nicht anders möglich sein kann. Jawohl, das geht auch zu beweisen. Aber die Geschichte ist nicht so einfach. Das sollte besonders der andere Herr Spezialmathematikus erfahren.
Der hatte sein bisschen Papier bald vollgeschmiert, und als er sich nach anderem umsah, kam ihm eine große, schon abgedeckte, aber noch mit einem weißen Tischtuche belegte Tafel gerade recht gut zu passe, also er fing an, mit seinem Bleistift auf dem Tischtuch zu rechnen, und sechs Stunden später, als er von den Dienern sanft zum entleerten Saale hinausgeschoben wurde, war er glücklich bei acht Unbekannten angelangt, mit diesen hatte er das ganze Tischtuch vollgerechnet, nur unten die rechte Ecke war noch frei, und er ließ sein Tischtuch nicht fahren, er nahm es mit, und draußen aus der Straße rechnete er im Scheine einer Öllampe weiter auf dem noch weißen Zipfel, und dabei schüttelte er sein mathematisches Denkerhaupt noch genau so wie vor sechs Stunden.
Doch so weit sind wir noch nicht vorgeschritten in der Zeit.
»Und was ist denn nun die geheimnisvolle Eigenschaft der Sieben?«
»Bedaure — ich mache alles nur ein einziges Mal.«
Und dabei beharrte der Graf. Und man konnte ihm nicht vorwerfen, er scheue nur eine weitere Prüfung.
Er hatte ja die Wahl zwischen 1 und 100 freigestellt, ja, hatte wohl sogar von hundertstelligen Zahlen gesprochen, unter denen man wählen könne.
»Aber auch die Sieben hat solch eine geheimnisvolle Eigenschaft?«
»Überhaupt jede, jede Zahl, einfach oder zusammengesetzt. Dieses Aufspüren des Geheimnisses — der magischen Eigenschaft, wie wir uns damals ausdrückten — wurde von den Chaldäern leidenschaftlich betrieben. Es war sogar die Pflicht eines jeden, das Geheimnis einer Zahl aufzuspüren. Aber das war nicht nur ein planloses Probieren, das wurde wissenschaftlich berechnet. So zum Beispiel habe ich selbst die magische Eigenschaft der Zahl 78 043 berechnet — ein wunderbares Resultat! — habe daran freilich auch fast zweihundert Jahre lang ununterbrochen gerech...«
Fast alle zuckten zusammen, die meisten krümmten sich. Nicht etwa wegen des zweihundertjährigen ununterbrochenen Rechnens. O nein, und wenn der Graf dabei auch ununterbrochen auf dem Kopfe gestanden hätte, sie hätten es gläubig hingenommen.
Im Saale spielte ein kleines Streichorchester. Soeben hatte ein junger, vielversprechender Künstler das höchste und allerhöchste Publikum mit einem Geigensolo erfreuen wollen und hatte dabei einmal seinem Wimmerkasten einen ganz niederträchtigen Misston entlockt, so recht hübsch langgezogen. Es war nicht anders gewesen, als wenn man in einem Rosengarten ein faules Ei öffnet. Das war den sensiblen Italienern doch gleich durch alle Nerven bis in den Magen gegangen.
»Schade«, sagte der Graf, »er spielt überhaupt sehr wenig rein, und dabei hat er eine echte Frescobaldi.«
»Was, eine Frescobaldi?!«, riefen die Herren.
»Das höre ich sofort heraus.«
Die Herren eilten. Frescobaldi war im Anfange des 17. Jahrhunderts ein wohl mehr sagenhafter als tatsächlicher Orgel- und Geigenspieler. Nur sein Nachruhm ist auf uns gekommen, und da hört man so Wunderbares, dass man es kaum glaubt. Gegen ihn muss dann Paganini, der König aller Geigenvirtuosen, der reine Waisenknabe gewesen sein.
Die Geige wurde dem Grafen gebracht. Wohl sehr alt, aber sonst wie jede andere Geige aussehend.
»Ja, die kenne ich«, sagte er nach kurzer Besichtigung, dann etwas stimmend.
»Eine Frescobaldi!! Ja, woran erkennen Sie denn das?«
»Weil ich sie selbst gemacht habe. Ich selbst bin Frescobaldi gewesen.«
Sprach's mit der bescheidensten Wahrheitsliebe, setzte den Bogen an und......
Und wenn er dann gesagt hätte, er wäre Orpheus, draußen vor der Tür harre sein dressierter Delfin, er müsse jetzt heimreiten — niemand wäre ihm nachgegangen, um sich zu überzeugen, ob's auch wahr sei, wie er das mache, auf einem Fische durch die Straßen zu reiten — man hätte es ihm einfach geglaubt.
Das klagte und jubelte und weinte und schwoll und schwand und zerfleischte das Herz, um es im Himmel alle Seligkeiten genießen zu lassen...
Der Graf setzte den Bogen ab.
Ob er eine Minute oder eine Stunde gespielt hatte — niemand wusste es.
Niemand wagte sich zu rühren — niemand vermochte dies.
»Hier, mein Sohn, ich schenke sie dir«, sagte der Graf mit freundlicher Herablassung zu dem Jüngling, dem die Geige eigentlich bereits gehörte, denn er hatte vierzig Lire für sie bezahlt.
Der Jüngling nahm sie, ging hin und... hatte am anderen Tage zwar keine Geige mehr, dafür aber eine Equipage mit zwei Pferden und drei Freundinnen, und irgendein reicher Kauz hatte in seiner Raritätenkammer eine Zehntalergeige, für die er so und so viel tausend Dukaten bezahlt hatte.
Doch wir versetzen uns in den Saal zurück.
Es kam wieder Leben in die Erstarrten, die der Welt entrückt gewesen.
»Himmel, stürz ein über mir, denn ich brauche nicht länger zu leben!!«, schrie mit ausgebreiteten Armen, den verzückten Blick zur Decke gerichtet, ein alter Herr, und das war kein geringerer als der Altmeister Corelli von der Geigenschule zu Padua, und dessen Verzückung sagt mehr, als wir über des Grafen Geigenspiel hätten sagen können.
War das nicht wiederum ein unanfechtbarer Beweis, dass dieser Graf mehr konnte, als sonst irdischen Menschen gestattet ist?
So dachten auch die beiden Priester, die noch immer in der dunklen Ecke standen.
»Wehe uns, wenn wir diese Ausgeburt der Hölle nicht baldigst vernichten!«, knirschten sie zwischen den Zähnen hervor.
Das andere Publikum hielt sich, nachdem es wieder aufgetaut war, zwischen Himmel und Hölle.
»Noch einmal, Herr Graf, bitte, bitte, noch etwas vorspielen!!«
»Bedauere. Alles und jedes nur ein einziges Mal«, beharrte der Graf jetzt und immerdar.
»Gilt das auch für die Liebe, Herr Graf?«, wurde hinter ihm gefragt.
Der Graf wandte sich um. Der Anblick hätte erfreulicher sein können. Die Fragerin war ein pompös aufgedonnertes Knochenskelett, das ihm kokett die letzten beiden Vorderzähne entgegenfletschte. Dafür aber waren diese auch sehr lang. Nur so gelb hätten sie nicht zu sein brauchen.
Trotz alledem war dieses weibliche Knochengerüst ohne ein Lot Fleisch einmal recht hübsch gewesen. Freilich war das schon lange, lange her. Und außerdem schon damals viel zu mager. Und dann hatte der Zahn der Zeit fürchterlich an ihr genagt, sogar an ihren eigenen Zähnen.
»Dies gilt auch für die Liebe, gnädigste Durchlaucht!«
Es war eine Fürstin, die Gattin des französischen Gesandten, und ein vollgültiger Beweis dafür, dass es kein Schönheitsmittel gibt. Denn die hatte nicht nur getrocknete und frische Krötenaugen geschluckt und ihre Knochen mit Sachen eingeschmiert, die man lieber gar nicht nennt — nein, die hatte schon Perlen und Diamanten und Smaragde und Rubine in Paradiesvogelfett gebraten und so äußerlich und innerlich verwendet. Denn das war eine geborene mexikanische Silberminenbesitzerin, die nicht genau wusste, ob sie zehn oder fünfzehn Millionen jährliche Einkünfte besaß.
Der Graf betrachtete die Gestalt, die sich mit äußerlich aufgelegten Diamanten zu verdicken versucht hatte, ergriff plötzlich die diamantgepanzerten Spinnenfinger und blickte in die Hand hinein.
»Bitte, Durchlaucht, folgen Sie mir!«
Und mit edlem Anstande führte er die Überraschte nach der nächsten Säule, wo sie allein standen. Hier musterte der Graf noch einmal die Knochenhand.
»Sie können wohl in der Hand lesen?«, flüsterten die beiden letzten Zähne.
»Ja, ich kann es.«
»Und was lesen Sie?«
»Dass mich das Schicksal bestimmt hat, in Ihr Leben einzugreifen. Das las ich auch sofort in Ihren Augen, hier lese ich es noch viel deutlicher, meinen direkten Befehl. Durchlaucht, das Schicksal lässt Sie durch mich wählen. Wählen Sie: entweder Reichtum, oder Schönheit, oder Weisheit, oder Liebesglück, oder Gesundheit. Wählen Sie! In dieser Minute steht Ihr Stern über Ihrer Hand!«
Dann war die Fürstin auch kurz entschlossen.
»Reich bin ich schon...«
»Halt! Nur eins können Sie von den fünfen wählen. Haben Sie das eine, verlieren Sie das andere. Verstehen Durchlaucht?«
Ja, sie verstand sofort und war dann auch nicht um die Antwort verlegen.
»Dann Schönheit...«
»Halt! Bedenken Sie! Sie verlieren Ihre Reichtümer, Sie werden krank, finden kein Liebesglück, und die höchste Freude gewährt die Weisheit!«
Aber die Fürstin wusste, was sie wusste.
»Nein, ich wähle die Schönheit. Denn wenn ich schön bin, wirklich sehr schön, dann werde ich auch immer genug Geld haben; das Liebesglück habe ich bereits genossen, da ist nicht viel dran; in meinem Triumphe der Schönheit werde ich alle Schmerzen der Krankheit vergessen, und aus Weisheit mache ich mir überhaupt nichts.«
Die war gar nicht so dumm!
»Wohlan! Es ist ausgesprochen! Heute über ein Vierteljahr werden Sie die gefeiertste Schönheit Roms sein!«
Der Graf sprach's und schritt, die Fürstin einfach stehen lassend, wieder der Gesellschaft zu.
»Die ist gar nicht so dumm!«, murmelte er unterwegs, was wir schon vorher wiedergegeben, als er es sich nur gedacht hatte. »Bei der muss ich höllisch vorsichtig sein.«
»Sie haben der Fürstin aus der Hand gewahrsagt?!«, wurde er empfangen.
»Ja.«
»Und was haben Sie ihr prophezeit?«
»Bitte, fragen Sie die Durchlaucht selbst, und ob nicht alles, alles schon so gut wie in Erfüllung gegangen ist, ganz genau so, wie ich ihr vorausgesagt habe.«
Ja, nun sollte man die Fürstin einmal danach fragen! Ob die wohl sagte, dass sie in einem Vierteljahre die gefeiertste Schönheit Roms sein sollte!
Und wir werden noch sehen, wie diese Unmöglichkeit dennoch in Erfüllung ging, und wie der Graf dies fertig brachte.
Zunächst gab es für die Gesellschaft einen kleinen Schreck. Es hatte zuerst ausgesehen, als wolle die zurückgelassene Fürstin mit ihren letzten beiden Zähnen in die Porphyrsäule hineinbeißen, sie hatte dieselbe mit beiden Armen umschlungen und ihr Gesicht dagegengepresst. Plötzlich schlug die Fürstin heftig zu Boden.
Jetzt sprang alles erschrocken hinzu. Eine Ohnmacht, nichts weiter, sie erholte sich schnell wieder, hatte sich aber bei dem Sturze unglücklicherweise ihren vorletzten Zahn ausgeschlagen.
Sie wurde von ihrer Kammerdame in Empfang genommen, ward von Dienern in ihre Sänfte expediert, und die Sache war erledigt.
Was für einen Eindruck aber musste die Prophezeiung auf die Fürstin, deren Pferdenatur sprichwörtlich war, gemacht haben, dass sie ohnmächtig geworden war!
»Ist es denn nur etwas so furchtbar Schlimmes gewesen, was Sie in ihrer Hand lasen?«, wurde zaghaft geflüstert.
»Ganz im Gegenteil«, lächelte der Graf, »etwas höchst Erfreuliches — sie ist vor lauter Entzücken in Ohnmacht gefallen. Sie konnte ihr Glück nicht fassen. Und passen Sie auf, Sie werden es selbst erleben — heute über ein Vierteljahr... was für ein Datum haben wir heute?«
»Den 3. Juni.«
»Also am 3. September vierzehnhundertund...«
»Siebzehnhundert, siebzehnhundert«, kam man dem Grafen zu Hilfe.
»Ah, pardon! Sehen Sie, solche Vergesslichkeiten können einem passieren, wenn man schon 5000 Jahre auf dem Rücken hat. Ich fühlte mich plötzlich 300 Jahre zurückversetzt, an den Hof von Madrid, als ich das erste Mal mit Kolumbus von Amerika zurückkam. Da passierte etwas ganz Ähnliches. Es war die Königin Isabella selbst, die beim Anblick der ersten federgeschmückten Indianer, die wir mitbrachten, in Ohnmacht fiel, und auch sie hielt sich an einer Säule fest. Daher der Zeitirrtum. Ja, also am 3. September dieses Jahres werden Sie alle selbst sehen, was sich mit der Fürstin ereignet hat.«
Mehr äußerte der Graf nicht.
Wie musste dieser Mann aber seiner Sache sicher sein, dass er solch einen bestimmten Termin angab! Oder wollte er nur das Leben einer Eintagsfliege führen, bis dahin schon wieder verschwunden sein? Er wäre ja töricht gewesen! Nein, wir werden noch sehen, was dieser Mann alles fertig brachte.
Zunächst wurde er mit anderen Bitten bestürmt.
»Wahrsagen Sie mir auch einmal aus der Hand, bitte, bitte!!«, erklang es, und von allen Seiten wurden ihm Hände entgegengestreckt.
»Bedaure, ich mache alles und jedes nur ein einziges Mal!«
Und dabei beharrte der Graf nach wie vor.
»Auch nicht, wenn man Sie einmal besucht?«, wurde keck von schönen Damenlippen gefragt.
Der Graf brauchte wohl eine halbe Minute, um die Schultern zu heben und wieder fallen zu lassen, und es war eine Antwort gewesen, wie sie mit Worten gar nicht besser hätte ausgedrückt werden können.
»Nun gut«, ergriff Lord Moore rasch das Wort. »So wären Sie also auch nicht bereit, den Damen und Herren einmal zu zeigen, wie Sie mit beiden Händen gleichzeitig Verschiedenes schreiben und Ihren Kopf noch immer mit etwas anderem beschäftigen können?«
»Sie haben bereits davon erzählt?«
»Ja, und Sie werden es mir doch nicht verübeln.«
»Nein, durchaus nicht — aber dann tut es mir leid.«
»So geben Sie uns doch eine andere Probe Ihrer übernatürlichen Fähigkeiten.«
»Sie sind nicht übernatürlich.«
»Geben Sie mir eine Probe Ihres erstaunlichen Gedächtnisses.«
»Sie haben eine solche von mir bereits erhalten — nichts zum zweiten Male!«, blieb sich der Graf konsequent.
»So beweisen Sie uns, dass Sie wirklich Gold machen können, das haben Sie auch mir gegenüber noch nicht getan.«
»Wohlan, ich bin bereit dazu«, erklang es ohne Zögern. »Ich bitte um ein Gefäß mit glühenden Kohlen.«
Eine ungeheure Erregung bemächtigte sich der ganzen Gesellschaft. Gold! — Es war doch die Hauptsache, auch für die diamantglitzernden Damen und Herren. Jene französische Fürstin war als mexikanische Minenbesitzerin nur eine Ausnahme.
Bis die glühenden Kohlen kamen, hielt der Graf einen kurzen Vortrag, auf welche Weise unedle Metalle in Gold verwandelt werden könnten, sprach etwas vom Urstoff und von der Weltseele, die auch aller toten Materie innewohne, und wie es nur darauf ankäme, diese Weltseele im Urstoff zu transformieren.
Mag das genügen. Der Leser würde die Erklärung ebenso wenig verstehen wie diese Herrschaften, und er dürfte stolz darauf sein, dass sein gesunder Verstand solchen Unsinn nicht fassen kann, während dieses Publikum hier ob solch tiefer Weisheit bass erstaunte.
Dann aber fügte der Graf noch etwas hinzu, was unbedingt wörtlich wiedergegeben werden muss.
»Nun haben Sie mich wohl verstanden. Auf diese Weise also bin ich imstande, durch meine eigene Nervenkraft Zink in Eisen zu verwandeln, Eisen in Blei, Blei in Zinn, Zinn in Kupfer, Kupfer in Quecksilber, Quecksilber in Silber und Silber schließlich in Gold.«
Und hiermit hatte der Graf von Saint-Germain den definitiven Beweis geliefert, dass er wissenschaftliche Kenntnisse besaß, von denen die damalige Menschheit noch gar nichts wusste!
Freilich nicht für dieses Publikum hier, das doch zur Menschheit gehörte, daher auch nichts davon wissen konnte.
Er hatte nämlich die bekanntesten Metalle nach der sogenannten elektrischen Spannungsreihe aufgezählt. Zink ist das positivste, Gold das negativste Metall. Alle Zwischenmetalle hatte er ganz richtig der Reihe nach aufgezählt. Zwischen Eisen und Blei hätte er noch das Nickel nennen können. Mit dem wusste man indes damals noch nichts anzufangen.
Nun ist aber diese elektrische Spannungsreihe der Metalle, überhaupt das Wesen der ganzen elementaren Elektrizität, erst vierzig Jahre später von Luigi Galvani, Professor der Anatomie zu Bologna, entdeckt worden, im Jahre 1790. Von diesem Zeitpunkte bricht für die Menschheit die Ära der Elektrizität an.
Und es ist später historisch nachgewiesen worden, dass dieser unbekannte Abenteurer, der sich Graf von Saint-Germain nannte, dessen Vergangenheit niemals aufgeklärt werden konnte, diese elektrische Spannungsreihe schon vierzig Jahre früher gekannt hat, in das Wesen der Elektrizität überhaupt schon tief eingedrungen war.
Dieser Mann war vom Himmel dazu bestimmt, das Rad der Zeit für die Menschheit, soweit ihr Fortschritt von Wissenschaft und Technik abhängig ist, vorwärts zu drehen. Statt dessen hat er es gebremst, um seine eminenten Kenntnisse und Fähigkeiten nur zu Gaukeleien zu benutzen!
Das ist aber auch das Einzige, was man diesem Manne vorwerfen kann. Freilich, Gaukeleien sind, wenn man sie für Tatsachen ausgibt, immer betrügerisch. Insofern war der Graf von Saint-Germain ein Betrüger. Aber auch nur insofern! Im Grunde genommen wurde er von den idealsten, edelsten Motiven geleitet, er hatte immer nur das Glück der ganzen Menschheit vor Augen, tatsächlich hat er auch Segen über Segen gestiftet — aber er wählte dazu, durch seine ungeheuere Phantasie verblendet oder sonst durch ein grausames Verhängnis gezwungen, den falschen Weg, verwickelte sich selbst immer mehr in ein Netz von Lug und Trug — und diesen Mann deswegen zu entschuldigen, das ist der Hauptzweck dieses Romans — — —
Ein Becken mit glühenden Holzkohlen wurde gebracht und auf den Tisch gesetzt, wie der Graf es bezeichnete. Alles hatte sich um ihn aufgebaut, die Hinteren auf Tischen und Stühlen stehend.
»Ich bitte um einen Bleistift!«
O weh, das hätte nicht kommen dürfen!
»Der macht es auch mit dem Wachsstock!«, wurde enttäuscht geflüstert. »Und den dürfen wir nicht einmal kontrollieren!«
Alle Experimente der sogenannten Adepten, wenn sie in Gegenwart von Anderen Gold machten, liefen nämlich immer auf denselben Trick hinaus. Sie rührten mit ihrem Zauberstock, den sie unbedingt dazu haben mussten, in dem Tiegel, der Quecksilber oder eine andere flüssige Substanz enthielt, aber immer heiß, und dann zeigte sich beim Untersuchen am Boden des Tiegels gediegenes Gold, von dem man nicht wusste, wie es hineingekommen sein könnte. Bis man den Schwindel erkannt hatte. Der Zauberstock war hohl, mit Goldstaub oder körnern gefüllt, das Ende mit Wachs verschlossen. Dieses schmolz in der heißen Substanz, so kam das Gold in den Tiegel.
Trotz der Aufdeckung des Schwindels blieb es bei diesem Manöver. Die Adepten ließen vorher ihren Zauberstock untersuchen, ließen sich einen anderen Stock zum Umrühren geben — trotzdem blieb es immer die alte Geschichte. Es mussten nur immer neue Taschenspielertricks ausgesonnen und eingeübt werden, wie man Stöcke geschickt vertauschte, wie man eine Person aus dem Publikum für sich gewann, freiwillig oder unfreiwillig — es blieb immer bei dem hohlen ›Wachsstock‹, wie der Zauberstab gleich genannt wurde.
Ein Zufall wollte es, dass dem Experimentierenden gerade damals immer andere Zauberstäbe zur Verfügung standen. Damals hatte nämlich ein Pariser Fabrikant namens Conté, der französische Hardtmuth, sehr lange, dicke Bleistifte, wahre Knüppel, wie man sie ja noch heute zu sehen bekommt, in den Handel gebracht, und wie die Mode nun einmal ist, wie es etwa heute genug junge Herren gibt, die vor ihre ganz gesunden Augen zwei Fensterscheiben auf die Nase quetschen, weil sie denken, kein Mann ohne Klemmer — so musste damals jeder echte Kavalier solch einen Riesenbleistift haben, mit dem bei der Unterhaltung kokettiert wurde, wie die Dame mit dem Fächer, und da gab es gar kostbare Bleistifte, aus edelstem Holze, mit Perlmutter ausgelegt, oben unbedingt als Knopf ein Edelstein oder doch gefärbtes Glas darauf, und der Bleistift war immer umso riesenhafter und umso kostbarer, er wurde beim Sprechen umso mehr geschwenkt, je weniger sein Besitzer schreiben konnte.
Diese Bleistifte machten dem Adepten die Sache also sehr bequem. Es galt nur, im Publikum seinen Helfershelfer zu haben, zuletzt war der fremde Bleistift doch immer wieder ein ›Wachsstock‹, der statt des Grafits Gold enthielt, und wurde ein ›Adept‹ einmal bei dem Betruge erwischt, so tauchten für ihn zehn andere auf, die wieder ihre ganz neuen Tricks hatten. Aber doch immer wieder die alte Geschichte mit dem ›Wachsstock‹, den es schließlich in die Hand zu bekommen galt.
»Ach, der macht es auch mit dem Wachsstock!«, erklang es also enttäuscht, natürlich im leisesten Tone. »Und den dürfen wir nicht einmal kontrollieren!«
Man musste ihm einige reichen, er konnte wählen, und was half es, wenn der, den er nahm, dem alten Marquis Besville gehörte, von dem ganz ausgeschlossen war, dass er mit einem Betrüger zusammen unter einer Decke steckte, und was half es, dass der Bleistift mit Perlmutter und Elfenbein ausgelegt war und als Knopf einen haselnussgroßen Rubin trug? Diese schwindelhaften Adepten waren mit allen Hunden gehetzt, die brachten die unglaublichsten Vertauschungen fertig, auf eine so komplizierte und im Grunde genommen doch so einfache Weise, dass ein normaler Mensch gar nicht auf so etwas gekommen wäre, und wenn man ihn direkt mit der Nase darauf gestoßen hätte.
Hatte der Graf das Flüstern gehört, dass er so eigentümlich lächelte? Schon die enttäuschten Gesichter mussten ihm alles sagen.
Aber er selbst sagte nichts, bat noch um ein Stück Papier, malte auf dieses mit dem Bleistift einige Hieroglyphen und... gab den Bleistift zurück.
»Danke. Das ist die einzige Vorbereitung, die ich nötig habe. Das Feuer muss gereinigt werden.«
Er streifte die Samtärmel, an denen sich Spitzen befanden, bis an die Ellbogen zurück, faltete das Papier langsam zusammen, warf es auf die glühenden Kohlen, wo es zu Asche verbrannte.
»So, das Feuer ist gereinigt. Das war die einzige Vorbereitung, die ich nötig hatte. Nun also kann ich ein Metall ins andere verwandeln, nach jener Reihenfolge, die ich Ihnen vorhin nannte. Aber ich mache jedes Experiment nur einmal. Und Sie wollen Gold sehen. So bitte ich um irgendeine Silbermünze, die ich in Gold verwandeln werde.«
Es gab noch genug, selbst unter den Damen, welche nicht nur diese wunderbaren Arme, wie aus Elfenbein gedrechselt, anstaunten, sondern die ihm auch scharf auf die Finger schauten. Nein, mit dem Papier hatte er nichts anstellen können. Das war nur eine Zauberformel gewesen, mit welcher das magische Experiment eingeleitet werden musste.
Der Graf machte, sicherlich in schlauester Vorausberechnung, sonst gar keinen Hokuspokus, wie es regelmäßig die Adepten taten, machte nicht erst darauf aufmerksam, wie er dies nicht tat, aber eine Zauberformel, um das Feuer zu reinigen, zu heiligen, hatte er doch nötig gehabt, und das Publikum fand das vollständig in der Ordnung. Gar zu natürlich, zu nüchtern hätte es auch nicht sein dürfen.
Die Herren beeilten sich, ihre Geldbörsen zu ziehen.
Wolle der geneigte Leser nun daraus achten, wie es geschah. Gleich einige der Herren legten ihre Geldbörsen auf den Tisch, der sie von dem Grafen trennte, oder handhabten die Börsen so, wie man es immer macht, wenn man einer aus zwei zusammenhängenden Beuteln bestehenden Börse Geld entnimmt — man schüttet den Inhalt zusammen, und ist ein Tisch vorhanden, so legt man gewöhnlich die Börse dann auf den Tisch, um die gewünschte Münze zu suchen.
So geschah es also auch hier, gleichzeitig an verschiedenen Stellen des Tisches, und der Graf wartete nicht erst, bis man ihm eine Silbermünze gab, sondern er griff sofort in den zusammengeschütteten Inhalt einer offenen Börse, entnahm ihr eine kleine Silbermünze.
»Irgendeine, erlauben Sie«, hatte er dabei nur noch gesagt.
Jetzt besah er sich die groschengroße Silbermünze, sie zwischen den Fingern haltend, auf beiden Seiten.
»Ein Paolo[*], mit dem Bildnisse des vorigen Papstes, Clemens XII., die Jahreszahl 1736 tragend. Wollen Sie sich überzeugen, dass es so ist.«
[*] Eine Münze des Kirchenstaates, gleich 45 Pf. Ist noch jetzt im Kurs, kann aber verweigert werden. Zehn Paolis sind ein Scudo, wie ein Dollar aussehend, dieser hat 100 kupferne Bajocchi.
Die Silbermünze ging von Hand zu Hand. Sie war schon ziemlich abgenutzt, die Prägung aber noch deutlich erkennbar. Gerade diese mit der Jahreszahl 1736 ist von Clemens XII. zu Millionen geprägt worden, der Fremde bekommt sie noch heute in Italien oft genug angeschmiert und wird sie dann nicht wieder los.
»Wollen Sie nicht ein Zeichen hineinmachen? Recht deutlich, nur ein Ritz könnte in der Feuerhitze verschwinden.«
Zuletzt hatte die Münze wieder der alte Marquis Besville in Händen, ein Mann, der keines Betruges fähig war, der seinen einzigen, heißgeliebten Sohn wegen eines geringfügigen Fehltritts verstoßen und dadurch in den Tod getrieben hatte.
Dieser nahm sein Messer und schnitt von dem ziemlich weichen Silber ein Stückchen ab.
»Nun wollen Sie, bitte, die Münze selbst auf das Feuer legen oder werfen.«
Es geschah. Das Silberstück lag auf den glühenden Holzkohlen. Es veränderte seine Farbe, ward immer unscheinbarer, aber deutlich noch konnte man die abgeschnittene Kante sehen.
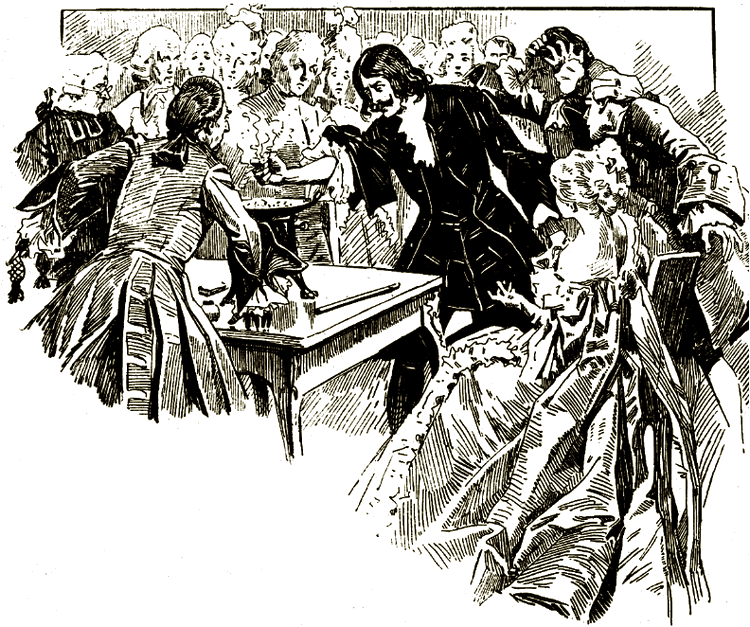
Ehe die Münze zu schmelzen begann, was im nächsten Augenblick geschehen musste, ergriff sie der Graf geschickt mit den Fingerspitzen, nahm sie in die Hand, schloss diese zur Faust und streckte den Arm aus.
»Nach allen natürlichen Gesetzen«, sagte er mit geschlossenen Augen, wohl mehr zu sich selbst als zur Erklärung, aber mit lauter Stimme, »müsste die glühendheiße Silbermünze jetzt meine Hand verbrennen. Kraft meines Willens hebe ich dieses Naturgesetz auf und transformiere die dadurch freigewordene und untätige Elementarkraft so um, dass sich die silberne Seele des Urstoffes in eine goldene verwandelt. Ich will, ich will!!! Es — ist — geschehen!!!«
Mit kolossalem Nachdruck hatte er die letzten Worte gerufen, in furchtbarer Anstrengung ballte er die Hand, sie etwas schüttelnd, plötzlich quoll zwischen den Fingern etwas Rauch hervor, dann öffnete er sie... die auch auf der Innenseite wunderbar feine, weiße Hand zeigte keine Spur einer Brandverletzung, und in ihr lag ein glänzendes Goldstück.
Es wurde geprüft, es hatte genau die Größe des ehemaligen Paolos, dieselbe abgeschliffene, aber noch deutlich erkennbare Prägung, also den Kopf des vorigen Papstes mit der Zahl 1736 und noch anderer Umschrift, die beschnittene Kante — es war derselbe Paolo, dessen Silber sich nur in Gold verwandelt hatte, und dementsprechend war die Münze auch bedeutend schwerer.
Es war gediegenes Gold. Da waren Kenner genug vorhanden, um das zu konstatieren, deshalb hätte man die Münze nicht erst durchzubrechen brauchen. Ein jüdischer Kaufmann hatte gleich seine Goldwaage zur Hand — damals wurden die Goldmünzen viel beschnitten — ein anwesender Physiker berechnete, dass die Gewichtszunahme genau den Gesetzen entsprach.
»Dieses zugekommene Gewicht ist meine materialisierte Nervenkraft«, erklärte der Graf noch, ehe er dann verschwand.
Der moderne Leser wird dies alles auf natürliche Weise zu erklären wissen. Alles Taschenspielerei, nichts weiter.
Die Hauptsache war offenbar, dass der Graf die Silbermünze hatte. Wer sagte denn, dass der Paolo, den er dann zeigte und herumgehen ließ, auch noch derselbe war? Da konnte er die Silbermünze bereits vertauscht haben. Der Paolo mit der Jahreszahl 1736 war die am meisten verbreitete Silbermünze. Nun hatte er sich schon vorher eine Goldmünze selbst hergestellt, ganz solch einem Paolo entsprechend, nur eben aus Gold, verbarg diese in der Tasche oder sonst wo, hatte sie vielleicht schon in der Hand. Was ist denn einem geschickten Taschenspieler unmöglich? Der Silbermünze wurde am Rande ein Spänchen abgeschnitten. Gut, das machte der Taschenspieler auch sofort mit seiner Goldmünze, genau an derselben Stelle. Womit er das Gold abschnitt? Wir werden noch sehen, dass dieser König aller Gaukler jeden einzelnen Finger zu einer besonderen Fähigkeit ausgebildet hatte. Zum Bespiel konnte dieser Mann mit seinen Daumennägeln wie mit scharfen Messern schneiden. Dass er er seine Hand nicht verbrannte? Er hatte sie mit irgend etwas präpariert. Oder nicht einmal das war nötig. Allein im Zugreifen lag es. Fast in jeder Eisengießerei findet man einen Mann, der für fünf Groschen seine Hand in das feurigflüssige Metall taucht, ohne dass ihm das etwas schadet. In der Physik bewanderte Leser seien an den sphäroidalen Zustand des sogenannten Leidenfrost'schen Wassertropfens auf einer weißglühenden Platte erinnert.
Ja, so sagen wir jetzt, die wir durchaus an nichts Übernatürliches glauben wollen, die wir unbedingt für alles eine Erklärung haben müssen.
Jenes Publikum aber gehörte einem Jahrhundert an, in dem selbst ein Isaac Newton, der Berechner der Erdschwere, der Erfinder der Differenzialrechnung, sich noch mit magischen Geheimwissenschaften beschäftigte.
Nein, sie zweifelten nicht, dass hier wirklich einmal Silber in Gold verwandelt worden war.
Doch ehe man den Grafen mit weiteren Fragen bestürmen konnte, war dieser aus dem Saale verschwunden.
Es war zwei Uhr, als Lord Moore den Dienern den Auftrag gab, den letzten der Gäste, den noch immer auf dem Tischtuch rechnenden Mathematikprofessor, mit sanfter Gewalt hinauszubefördern. Denn mit guten Worten war da nichts auszurichten.
Ehe der Lord sein Schlafzimmer aufsuchte, klopfte er noch einmal an die Tür des Mannes, der ja keines Schlafes bedurfte.
Der Graf hatte sich schon wieder zwischen Büchern vergraben.
»Wunderbarer Mann!«
»Bitte, Mylord!«
Mehr noch hatte der Augenaufschlag gesagt, und der Lord verstand und fügte sich, er forderte keine weiteren Erklärungen über das, was er nun wieder heute Abend zu sehen und zu hören bekommen hatte.
»Aber wenn Sie noch etwas mit mir plaudern wollten — nichts wäre mir angenehmer.«
Der Lord hatte eine lange schlaflose Zeit hinter sich. Er war gewohnt, bei normaler Lebensweise um Mitternacht zu Bett zu gehen und um vier schon wieder aufzustehen, dann aber auch mittags von eins bis vier zu schlafen. Durch die heutigen Ereignisse war er um diesen Mittagsschlaf gekommen, trotzdem fühlte er nicht die geringste Müdigkeit.
»Was für ein Gebäude ist das, das ich hier von meinen Fenstern aus erblicke?«, eröffnete der Graf das Gespräch. »Zu meiner Zeit, als ich hier als Bibliothekar lebte, stand es noch nicht da, da hatten wir noch freien Ausblick über den Tiber.«
»Das stimmt, das ist ein Kapuzinerkloster, das erst im Jahre 1670 bis etwa 75 gebaut wurde. Der Klostergarten stößt an meinen Park. Aber es ist verlassen, alles total verwildert.«
»Weshalb verlassen?«
»Das ist eine eigentümliche Geschichte, eigentlich so recht für Sie — eine Gespenstergeschichte. Das Kloster wurde also von Kapuzinern gebaut und bezogen, der damalige Papst gab die Mittel dazu her. Zehn Jahre später baten die Mönche, das Kloster wieder verlassen zu dürfen. Es waren auch schon immer eigentümliche Gerüchte über dieses Kloster gegangen, seine Bewohner hätten alle ein so scheues Wesen, mit denen müsste etwas nicht richtig sein, die hätten etwas auf dem Gewissen. Und jetzt gestanden sie es denn auch. Die Untersuchung von dem päpstlichen Richter ward natürlich hinter verschlossenen Türen geführt, es drang aber doch genug in die Öffentlichkeit. Gleich in den ersten Jahren hatte ein jähzorniger Mönch den missliebigen Prior erschlagen. O, unerhörter Frevel! Die Mönche waren unter sich einig, sie verrieten nichts, aber der ermordete Prior ließ ihnen keine Ruhe, quälte sie als Geist, bis sie selbst ihre Tat gestanden. Sie verschwanden alle zusammen von der Bildfläche. Das Kloster stand lange Zeit leer — na ja, schön ist so etwas ja auch nicht — schließlich wurde die Geschichte aber doch vergessen, eine neue Kapuzinergemeinde bezog das Kloster — nur wenige Wochen, dann konnten es auch diese Mönche nicht mehr aushalten, die ruhelose Seele des ermordeten Priors quälte sie. Und das wiederholte sich noch mehrmals, bis sich keine Mönche mehr fanden, die das Spukkloster, wie es bereits allgemein genannt wurde, beziehen wollten, und so ist es noch heute.«
»Das ist ja merkwürdig!«, sagte der interessiert zuhörende Graf. »Ist denn die Sache nicht untersucht worden?«
»Was heißt untersucht! Ja, für die ruhelose Seele sind Messen genug gelesen worden, das Kloster ist ganz unter geweihtes Wasser gesetzt worden, dass alle Ratten und Mäuse ersoffen — nur der Geist des alten Priors nicht. Man hat berühmte Geisterbeschwörer von weither geholt, sie sind mit der Versicherung gegangen, jetzt sei das Gespenst gebannt — nein, es kam immer wieder. Vagabunden, Falschmünzer wollten sich in dem idealen Schlupfwinkel niederlassen — sie sind mit Entsetzen davongeflohen, haben gleich gestanden, was für eine lichtscheue Tat sie dort vorhatten...«
»Ja, dann muss aber doch auch wirklich etwas daran sein!«
Der Lord blickte den Grafen an.
»Sie glauben an Geister?«
»Ich... möchte jetzt hierüber meine Ansicht nicht äußern«, lautete die ausweichende Antwort.
Eine Pause trat ein.
»Für mich«, hob der Lord dann mit leiser Stimme wieder an, »war bisher alles nur Einbildung, Gespensterfurcht, Gespensterglaube, der eben in der Einbildung am helllichten Tage Gespenster sieht, weil er solche sehen will. Jetzt... weiß ich nicht mehr recht, was ich davon denken soll. Ach, meine Ansichten haben sich im Laufe eines einzigen Tages sehr, sehr geändert.«
Etwas seufzend hatte es zuletzt geklungen. Jedenfalls hatte sich der Lord wohler befunden, als er nur an das glaubte, was er mit seinen Händen fassen konnte.
»Ist denn die Sache nicht einmal von Männern untersucht worden, die an so etwas nicht glauben?«
»Ja, auch das. Die haben eben keinen Geist sehen können. Aber was gilt deren Zeugnis denen, die an Gespenster glauben?«
»Haben Sie selbst Ihr Nachbargrundstück daraufhin untersucht?«
»Nein. Nie. Dadurch hätte ich doch nur bewiesen, dass ich überhaupt die Existenz von Geistern und Gespenstern in den Bereich der Möglichkeit ziehe.«
»Könnte nicht jemand einen Vorteil davon haben, die Rolle des Geistes zu spielen?«
»Auch das ist erwogen worden. Besonders von unserem jetzigen Papst, für den es keine Geister gibt. Die Polizei hat erfolglos nachgeforscht — wenn sie nicht durch ein Gespenst in die Flucht geschlagen wurde.«
»So liegt das Kloster jetzt ganz verlassen?«
»Wie ich sage.«
»Kann es denn nicht für einen industriellen Zweck verkauft werden?«
»Es ist Kirchenbesitz und daher unverkäuflich.«
»Auch vermietet kann es nicht werden?«
»Das wohl, aber die Kirche kennt keinen Kontrakt, nur eine Erlaubnis, die jederzeit wieder aufgehoben werden kann, und welches industrielle Unternehmen wird sich auf so etwas einlassen!«
»Hat auch sonst niemand darin gewohnt?«
»Doch. Öfter. Alle sind schleunigst wieder ausgezogen. Erst vor zwei Jahren quartierte sich ein Engländer mit Familie und Dienerschaft darin ein. Mr. Holly wollte ein durchaus aufgeklärter Mann sein, aber auch er hielt es drüben nicht aus.«
»Auch er hat den Geist gesehen?«
»Das wohl nicht, er sprach nur von Ächzen und Stöhnen — kurz und gut, auch er räumte das Spukkloster schnell wieder. Einbildung, alles Einbildung — so sagte ich mir damals.«
»O, dieses einsame Kloster wäre gerade etwas für mich!«, rief der Graf begeistert.
»Also Sie fürchten sich nicht vor Geistern?«
»Eben weil ich an Geister glaube, fürchte ich mich nicht vor ihnen«, erklang es mit einiger Feierlichkeit.
»Ich hoffe, etwas mehr von Ihrer Geistertheorie zu hören.«
»Sie werden es, nur nicht jetzt.«
»Und Sie wollten wirklich das Kloster beziehen?«
»Es wäre mein größter Wunsch.«
»Ich hoffte, Sie als meinen Gastfreund für immer hier zu behalten.«
»Was heißt: für immer?«
»Sie haben recht. Aber was wollen Sie ganz allein in dem trostlosen Kloster?«
»Erstens liebe ich die Einsamkeit und gerade solche verrufene Orte, und dann dürfte ich bald Besuche genug bekommen, die Ihnen unangenehm sein könnten.«
»Was für Besuche?«
»Ich denke, Sie werden es schon morgen erfahren.«
»Ja, ich verstehe«, meinte der Lord [1] sinnend. »Und Sie werden die Neugierigen und Hilfesuchenden, die offen und heimlich in hellen Scharen kommen werden, empfangen?«
[1] Im Originaltext heißt es hier »Graf«.
»Soweit es zweckdienlich ist, wenn sie lautere Absichten haben, ja.«
»Nun, ich werde mit dem Papste deswegen sprechen.«
»Wenn ich Sie bitten darf.«
Immer mehr wurde der Lord von der jetzt eintretenden Müdigkeit befallen, und ehe er sich aufraffen konnte, um fortzugehen, war er schon auf dem Sofa eingeschlafen.
Einige Minuten beobachtete ihn der Graf, dann erhob er sich leise, mit offenbarem Triumphe blickte er auf den Schläfer herab.
»Da ist gleich die herbeigewünschte Gelegenheit, die Lord Walter Moore, den größten Freigeist unserer Zeit, völlig in meine Macht gibt«, flüsterte er. »Und jetzt schnell, der erste Schlaf ist der tiefste...«
Mit ausgestreckten Händen beugte er sich über den Schläfer herab.
Am anderen Morgen musste der Portier herzlich lachen.
Kommt da ein Bettelmönchlein, um wie gewöhnlich das sich angesammelt habende ›Hundefutter‹ für die zweibeinigen Kameraden seines Klosters abzuholen, und dabei hat der Kerl seinen Zwerchsack schon so gestrotzt voll, dass er die Last kaum tragen kann.
»O, unschuldvolle Dreistigkeit! Pfäfflein, wer hat dich denn heute schon so reichlich beschenkt?«
Scherzend schlug der Portier auf den gefüllten Bettelsack, der unmöglich noch etwas fassen konnte, es hatte eigentümlich geklungen, und der Portier machte gleich ein ganz langes Gesicht. Er wusste auch gleich alles, er war, wenn auch ein protestantischer Engländer, schon lange genug in Rom und Portier in der englischen Gesandtschaft.
»Das alles ist für den Grafen?«
»Ich dachte, weil der Graf ja nichts isst«, entgegnete das Mönchlein mit pfiffigem Augenblinzeln, »er könnte für uns etwas übrig haben...«
»Schon gut, schon gut. Dass du dem Grafen nichts zu essen bringst, weiß ich. Fred, führe den Kerl hinauf zum Grafen. Dann mag er das Hundefutter mitnehmen. Aber so viel Briefe — das ist ja unerhört!«
Dies bedarf einer Erklärung.
Es dürfte wenig bekannt sein, dass die Reformation auch die Post ins Leben gerufen hat, wenigstens die Stadtpost, die Briefbeförderung in engen Bezirken.
Das Bedürfnis, in der Stadt selbst schriftliche Mitteilungen auszutauschen, ist doch von jeher vorhanden gewesen, und nicht immer ist es dem Absender und dem Empfänger lieb, wenn davon gleich der Nachbar oder gar die ganze Stadt erfährt, wobei man gar nicht gleich an verbotene Korrespondenzen zwischen Liebespärchen zu denken braucht. Aber der typischste Fall wird der doch wohl sein, so wollen wir diesen annehmen.
Dann also durfte kein Hausdiener, auch nicht der erste beste, von der Straße geschickt werden, der konnte ja alles verraten; es war schon schwierig genug, das geheime Briefchen an eine Person zur Beförderung zu bringen.
Heute haben wir das mit der Post ja sehr bequem, noch bequemer durch die postlagernden Chiffresendungen, vielleicht auch vermittelst der Zeitungen.
Das gab es damals alles noch nicht, die Postwagen fuhren nur von Stadt zu Stadt, und wenn ein Brief ins Haus kam, so wusste es mindestens die ganze Straße.
Doch auch damals schon hatten die liebesbedürftigen, auf mehr oder minder verbotenen Wegen wandelnden Männlein und Weiblein ihre verschwiegenen postillons d'amour.
Schon in der Kirche wurde da viel gemacht. Da wurden die Briefchen heimlich ausgetauscht. Aber es gab auch eine richtige Briefbeförderung. Das besorgten die Beichtväter, die erteilten gleich vornweg Absolution, und war der Adressat kein eigenes Beichtkind, so erhielt den Brief der andere Geistliche, der jenem die Beichte abnahm, oder er schickte den Brief ihm durch einen Bettelmönch zu, und so konnte man auch gleich einen der Bettelmönche benutzen, die ja tagtäglich jedes einzelne Haus abklapperten und noch weit hinaus in die Umgegend kamen.
Auf diese Weise hatte sich ein regelrechter Postdienst entwickelt, der an Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit gar nicht zu übertreffen war. Täglich hatte das liebesbedürftige Mädchen mehrmals Gelegenheit, hinter dem Rücken der strengen Mutter einem Bettelmönche das Briefchen an den ›Herrlichsten von allen‹ zuzustecken, und da nützte keine Scharfsichtigkeit, diese Kuttenträger waren schlauer als die schlaueste Mutter, natürlich erwarteten sie einen reichlichen Bakschisch, aber es wurde auch ohne den pflichtgetreuest besorgt. Die Briefe, welche vollständige Adresse enthalten konnten oder vielmehr mussten, kamen zunächst in das Kloster, hier wurden sie regelrecht sortiert, indem ja jeder Bettelmönch sein eigenes Revier hatte, und da dies auch für ganze Klöster galt, so tauschten selbst die einzelnen Klöster, ganz gleichgültig, zu welchem Orden sie gehörten, die Briefsäcke untereinander aus. Das war eine gegenseitige Gefälligkeit, wobei keine andere Feindschaft galt.
Allerdings wurde jeder Brief in den Klöstern gelesen, auch der versiegelte erbrochen, und zwar nicht heimlich, er blieb erbrochen. Aber gerade das garantierte für die absolute Verschwiegenheit der anderen Welt gegenüber. Nahm ein Priester im Beichtstuhl solch einen Brief zur Besorgung an, so war er eo ipso mit dem Gelübde des Beichtgeheimnisses versiegelt, und das galt in diesem Falle auch für jeden Bettelmönch, der sonst die Weihen noch nicht erhalten hatte. Und für Brechen des Beichtgeheimnisses gibt es nach kanonischem Recht eigentlich noch heute nur eine einzige Strafe: lebenslängliche Einkerkerung. Zweifellos wird doch so mancher katholische Verbrecher seine Tat, von Gewissensbissen gequält, im Beichtstuhl gestehen, besonders Frauen, man denke nur an Kindesmörderinnen und dergleichen, die sich im Innersten wirklich oft gar nicht so strafbar fühlen, die Staatsjustiz weiß nichts von einem Beichtsiegel — aber man wird wohl selten hören, der Verfasser, der sich hierfür sehr interessiert, hat noch keinen Fall vernommen, dass die im Beichtstuhl gestandene Tat angezeigt worden wäre.
Wo die Reformation Einzug hielt, wurde den Bettelmönchen, gerade im ersten Eifer, das Haus verboten. Für die fehlenden Briefbeförderer stellten sich zuerst fahrende Schüler und Vagabunden zur Verfügung, die Vehicularenden oder Postulanten hießen. Aber die Bettelmönche konnten sie nicht ersetzen, und so kamen spekulante Köpfe auf die Idee, eine regelrechte Stadtpost einzurichten, auch mit postlagernder Chiffrebestellung, und offene Fenster waren die ersten Briefkästen, das beliebige Bestellgeld, wenn es nur nicht zu wenig war, wurde auf dem Briefe angesiegelt — — —
Der Portier hatte heute schon eine ganze Masse Briefe für den Grafen von Saint-Germain in Empfang genommen, von herrschaftlichen Dienern und anderen Boten gebracht. Dass auch der täglich kommende Bettelmönch, ein Franziskaner, welche bringen würde, hatte der Portier erwartet. Aber nun gleich so einen ganzen Sack voll, von dem kräftigen Manne kaum zu tragen! Das mussten ja viele, viele Hunderte von Briefen sein!
Zu dieser Zeit, in der zehnten Morgenstunde, befand sich Lord Moore bereits beim Papste. Wenn nicht etwas anderes vorlag, begab er sich täglich zu dieser Stunde in den Vatikan. Nicht als englischer Gesandter, nicht als Diplomat, sondern als Freund, um ein Stündchen zu verplaudern. Die beiden verstanden einander vortrefflich, und wer um vier aufsteht, der kann die zehnte Stunde schon zur Erholung benutzen.
Wer und was Benedikt XIV. gewesen ist, mag man im Konversationslexikon nachlesen. Hier nur eins: Als sich nach dem Tode Klemens XII. die Kardinäle durchaus nicht über die Wahl des neuen Papstes einigen konnten, sagte jener endlich die historischen Worte. »Ei, warum zerquält ihr euch mit Erörterungen und Untersuchungen? Wollt ihr einen Heiligen, so nehmt Gott, braucht ihr einen Politiker, so nehmt den Kardinal Aldobrandini, wollt ihr aber einen guten Alten haben, so nehmt mich!« Sich selbst zur Wahl vorgeschlagen, gleich so direkt, das hat wohl noch kein Kardinal gemacht. Und doch, diese offenen Worte wirkten wie eine Erlösung. Prosper Laurentins Lambertini, wie sein eigentlicher Name war, wurde einstimmig zum Papste gewählt.
Aber mit dem ›guten Alten‹ war es nicht abgetan. Was Rom heute als Kunststadt ist, hat es ihm zu verdanken, indem er in das Chaos der Kunstschätze Ordnung brachte, die ersten von seiner eigenen Hand geschriebenen Kataloge sind noch nicht übertroffen worden, auch sonst einer der größten Gelehrten seiner Zeit, der toleranteste Papst gegen Andersgläubige, von echtester Frömmigkeit, dabei frei von jedem Aberglauben. Mag das hier genügen.
Lord Moore, der eine lange Tonpfeife rauchen durfte oder vielmehr musste, hatte über die gestrige Abendgesellschaft berichtet.
Mit gutmütigem Lächeln hatte es der Heilige Vater vernommen. Nichts als dieses gutmütige Lächeln.
»Hätten Sie ihn nur erst einmal eine Woche lang eingesperrt, ohne Essen und Trinken, was dann aus ihm geworden wäre, das zu hören wäre mir interessanter gewesen«, sagte er dann, nichts weiter, fing gleich von etwas anderem an.
Aber Lord Moore hatte eine Verpflichtung auf sich genommen.
»Er möchte gern das Spukkloster beziehen, das an die englische Gesandtschaft grenzende, verlassene Kapuzinerkloster.«
»Wozu?«
»Er sucht doch eine einsame Wohnung und...«
»Schon gut, schon gut — kann er haben, kann er haben!«
Und dabei lächelte der Papst, wohl einer der größten Menschenkenner und der schlaueste Diplomat — denn wie er damals die Kardinäle zu seiner einstimmigen Wahl gebracht hatte, das war doch auch nicht so ›ohne‹ gewesen — stillvergnügt vor sich hin.
»Wollen Eure Heiligkeit dem Wundermanne nicht einmal eine Audienz gewähren? Dann wird er doch gewiss...«
»Nein. Ich mag ihn nicht sehen. Haben Sie schon von dem neuen Cupido gehört, der im Garten der roten Villa ausgegraben worden ist? Kommen Sie mit, ich will Ihnen ein wirkliches Wunder zeigen — ein Wunder von menschlichem Schönheitssinn und menschlicher Geschicklichkeit.«
Zum dritten Male durfte der Lord nicht beginnen. Ja, er bedauerte recht sehr, dass ihm der Graf seine Ungläubigkeit genommen hatte.
Eine halbe Stunde später rollte der Lord in seiner Karosse der Gesandtschaft zu. Er hätte eine Wette abschließen mögen, und er hätte sie wirklich gewonnen. Bereits seit einer Viertelstunde wartete auf ihn ein päpstlicher Adjutant, ein Offizier der Schweizergarde, um ihm das Dokument zu bringen, wonach der Graf von Saint-Germain das verlassene Kapuzinerkloster zum St. Georg beziehen durfte.
Dabei konnte sich der Lord gar nicht besinnen, dass ihn der Papst einmal allein gelassen hätte, um hierzu Anweisung zu geben. Aber so war es immer. Die Bequemlichkeit selbst, immer zu allem Zeit habend, und dabei ging alles wie am Schnürchen, ohne jede Vergesslichkeit.
Der Lord brachte das Dokument seinem Gastfreunde auf das Zimmer. Diesmal fand er den Grafen nicht zwischen Büchern, sondern zwischen Briefen vergraben.
»Meinen verbindlichsten Dank!«, sagte der Graf, nachdem er die Erlaubnis gelesen.
»Wegen der Einrichtung stehe ich ganz zu Ihrer Verfügung, und ich hoffe, dass Sie die Umfassungsmauer durchbrechen, damit wir auf kürzestem Wege öfters zusammenkommen. Was für eine Unmenge von Briefen haben Sie da erhalten?«
Der Lord konnte sich alles lebhaft vorstellen, auch die Art, wie die meisten hierher gelangt, aber solch eine Flut hätte er denn doch nicht erwartet.
Die meisten hatten denselben Inhalt. Gold, Gold, Gold! Um die Kunst zu erlernen, Gold machen zu können, waren sie bereit, sich dem Teufel zu verschreiben, und zu noch etwas ganz anderem. Das wurde in vielen Briefen gleich ganz offen gesagt. In allen allerdings nicht. Sehr viele dachten an ernsthaftes Studium und asketische Übungen. Eine Hauptrolle spielte dabei das Hungern, wie das zu erlernen sei — d. h., das Nichtbedürfen aller Nahrung.
Dann wünschten eine Unmenge eine Verjüngungstinktur, wenn nicht gleich ewige Jugend, also auch gleich ewiges Leben, mit und ohne Schlaf, starke Nachfrage nach Schönheitsmitteln, andere zogen die höchste Weisheit vor, einige wollten gleich alles zusammen haben, das Gold dabei nicht zu vergessen, Enthüllung der Zukunft, usw., usw.
Der Graf hatte die meisten Briefe ihren Wünschen nach schon in Stapeln geordnet, und er musste fabelhaft schnell lesen können, selbst wenn er sich nur von dem ungefähren Inhalte überzeugte. Immer nur so einen Blick hinein, und er legte ihn auf den betreffenden Stapel, während er mit der anderen Hand schon einen zweiten Brief öffnete.
»Sie werden diese Briefe doch nicht etwa alle beantworten?«
»Keinen einzigen.«
Diese Abweisung fand der Lord nun doch wieder etwas zu übertrieben.
»Jeder muss selbst zu mir kommen, und zwar ganz offen, das ist unbedingt nötig«, setzte der Graf noch hinzu.
»Ach so! Aber da bürden Sie sich ja eine ungeheuere Last auf, Sie werden doch überlaufen.«
»Ist es nicht Pflicht eines jeden Menschen, seinem Nächsten zu helfen, soweit er es kann?«
»Und Sie werden alle diese manchmal ungeheuren Wünsche erfüllen?«
»Wie ich sagte: Soweit ich es kann. Und ob ich es kann, das hängt ganz von dem Betreffenden selbst ab.«
»Der hier begehrt gleich ewiges Leben und so ziemlich alle Schätze der Erde. Sie werden ihm beides verschaffen?«
»Wenn er ihrer würdig ist, soll er beides haben«, entgegnete der Graf mit seiner vornehmen Sicherheit. unablässig einen Brief nach dem anderen öffnend.
Der Lord blickte ihn an, griff, wie um seine Gedanken abzulenken, nach dem obersten Briefe eines anderen Stapels.
»Und was haben die hier aus dem Herzen?«
»Bitte, lesen Sie selbst.«
Der Lord musste sich auf die Lippen beißen. Diese Briefe stammten fast ausschließlich von Frauen, welche etwas unter dem Herzen zu haben wünschten, denen der Kindersegen versagt geblieben war. Mit einem Worte: ob der Wundermann ihnen zu Kindern verhelfen könne. Natürlich nur durch Vermittlung seiner magischen Fähigkeiten. Aber meistens war das nicht so deutlich ausgedrückt, und es war dem Lord wirklich zu verzeihen, dass er sich auf die Lippen beißen musste.
»Und dieser nicht minder beträchtliche Stapel?«
»Krankheiten und Gebrechen. Die Lahmen wollen gehen, die Tauben hören, die Blinden sehen.«
»Wie fertigen Sie diese ab?«
»Ich werde sie empfangen, gegebenenfalls auch selbst hingehen.«
Lord Moore bekam plötzlich ganz große Augen.
»Und sie gesund machen?!«
»Das kommt ganz auf den Betreffenden an.«
»Sie können die Lahmen gehend machen?!«
»Wenn sie des Gehens wert sind, ja.«
»Sie können die Tauben hörend und die Blinden sehend machen?!«
»Mylord, ich bin ein Mensch, sogar weit entfernt davon, ein Heiliger zu sein, aber ich habe in den fünftausend Jahren, die ich, abgesehen von dem zeitweiligen Todesschlafe, mit vollem Bewusstsein verbracht habe, manches gelernt — ja, ich kann Blinden das Augenlicht wiedergaben und... was ist die Uhr?«
Plötzlich war der Graf, der eben in einen neuen Brief geblickt, zusammengezuckt, freilich gehörten ganz andere Augen als die des Lords, dazu, so scharf diese auch sein mochten, um das zu erkennen, wir wollen aber verraten, dass es ein furchtbarer Schreck gewesen war, den ihm dieser Brief eingeflößt — für den Lord aber wandte er sich nur hastig der Wanduhr zu, ganz unwillkürlich tat der Lord das gleiche, und in demselben Augenblick verschwand der ziemlich umfangreiche Brief in der Hand des Grafen wie durch Zauberei. Nur ein Taschenspielerkunststück, aber wunderbar ausgeführt. Der Brief verschwand einfach spurlos zwischen seinen Fingern, und es hätte jemand noch so scharf hinblicken können, er hätte nicht gewusst, wohin eigentlich.
Die Uhr zeigte zwanzig Minuten vor zwölf.
»Geht sie genau?«
»Ganz genau«, sagte der Lord, nach seiner eigenen blickend.
»Ich möchte mich nicht wieder überraschen lassen. Sie wissen. Doch wir haben noch Zeit, ich brauche mich nur dort auf das Sofa zu legen. Haben Sie die Stunde von zwölf bis eins frei?«
»Gewiss, und ganz besonders, wenn ich Ihnen zur Verfügung stehen darf.«
»Da können wir gleich noch ein Experiment machen. Nicht wahr, Mylord, Sie bezweifeln, dass mein Geist während dieses Zustandes in fernen Ländern umherschweifen kann, oder wo er sonst will?«
»O, Herr Graf...«
»Bitte, Mylord, seien Sie mir gegenüber ganz offen!«
»Ich kann es nicht begreifen.«
»Ich werde Ihnen einen Beweis davon geben. Ich kann meinen Nervengeist, der von mir ausgeht, durch die Nervenkraft auch materialisieren.«
»Dass er sichtbar wird?!«, rief der Lord.
»Ja. Und dass er sogar Kraftäußerungen von sich gibt. Es strengt mich allerdings etwas an, aber auch dieses Experiment werde ich ja nur ein einziges Mal machen. Ich lege mich hier auf das Sofa hin, werde Punkt zwölf Uhr in Starrkrampf fallen. Das beobachten Sie noch, dann treffen Sie Vorsichtsmaßregeln, dass ich mich nicht etwa entferne. Sie hüllen mich vielleicht in ein Tuch ein, oder besser noch in durchsichtige Gaze, versiegeln die Umhüllung so, dass ich unmöglich heraus kann, setzen neben mich auch noch einen zuverlässigen Mann, der mich ständig beobachtet...«
»O, das ist alles gar nicht nötig...«
»Doch, ich will Ihnen einen Beweis liefern, der hinterher absolut keinen Zweifel zulässt. Sie selbst könnten mich ja dabei im Auge behalten, dann aber müssten Sie in diesem Zimmer hier bleiben, und ich möchte das Experiment so kompliziert wie möglich machen. Sie begeben sich also in ein anderes Zimmer, in irgendeins, verschließen die Tür. Es kann helles Tageslicht herrschen, dann werden Sie die Erscheinung aber kaum sehen können. Nicht umsonst suchen sich die Geister immer die Nachtstunden aus oder werden vielmehr nur bei Nacht gesehen. Doch es ist bloß nötig, dass Sie das Zimmer ein klein wenig verdunkeln, etwa durch Herablassen der Jalousien. Dann wird die leuchtende Äthersubstanz schon vollkommen und Sie können auch noch alles andere erblicken. Legen Sie ein Blatt Papier und einen Bleistift zurecht, ich werde etwas schreiben. Nur bemerke ich, dass ich durch den hundertjährigen Todesschlaf etwas aus der Übung gekommen bin, ich muss mich an solche Kraftäußerungen erst wieder gewöhnen. Aber es wird schon gehen. Wahrscheinlich werde ich hörbare Laute hervorbringen können, ehe ich mich sichtbar zu machen vermag. Legen Sie etwa eine Violine hin oder sonst ein Musikinstrument. Nun aber noch etwas, damit Ihnen nicht gleich Zweifel auftauchen, die mich sehr stören würden. Der körperlose Geist ist doch etwas ganz anderes, als der von der Materie gefesselte. Mein zu Ihnen kommender Geist will Ihnen etwas auf der Violine vorspielen. Ich nehme die Geige, den Bogen und spiele. Das geschieht aber nur in meiner Einbildung. Trotzdem hören Sie Töne und die ganze Melodie, die ich in der Einbildung spiele. Denn für mich ist das Wirklichkeit. Ich bin nur noch nicht fähig, so viel Kraft zu entwickeln, dass ich die Geige wirklich aufheben kann. Aber auch das kommt. Dann wird die Violine wirklich in der Luft schweben, der Bogen Bewegungen ausführen. Im Übrigen ist keine Vorsicht nötig. Sie können mich anreden, Ihre Wünsche äußern, obgleich Sie dazu Worte gar nicht nötig haben, denn ich lese als Geist Ihre Gedanken. Das heißt, Ihre Gedanken sind für mich schon hörbare Worte. Wenn Sie wollen, können Sie mich auch mit dem Degen durchstechen, wie es bei Geistererscheinungen ja so beliebt ist. Doch nun müssen wir uns beeilen, der große Zeiger rückt auf die Zwölf, und wenn ich einmal im Starrkrampf liege, bitte ich mich ja nicht mehr stark zu berühren, es könnte etwas abbrechen.«
Der Lord war sprachlos. Er konnte kaum die Anordnungen treffen, die der Graf begehrte. Dieser wünschte unbedingt, dass er noch durch eine andere Person kontrolliert würde.
»Aber Sie können doch schon nicht durch die verschlossene Tür, und überhaupt, wenn Sie nach und nach sichtbar werden...«
Der Graf blieb dabei, er verlangte die strengste Kontrolle.
Ralph wurde gerufen, er musste schnell noch ein großes Stück Gaze holen, der Graf wurde im Stehen ganz darin eingewickelt, so legte er sich auf das Sofa, veranlasste den Lord, die offenen Stellen zuzusiegeln, sein eigenes Petschaft in den Siegellack zu drücken.
Die Uhr zeigte nach Ortszeit genau auf zwölf, als mit dem Grafen, der unter dem dünnen Gewebe vollkommen sichtbar war, eine große Veränderung vor sich ging. Ohne dass er sich streckte, sah man doch förmlich, wie alle Glieder erstarrten, der ganze Körper, das weit geöffnete Auge wurde ganz gläsern, die sonst gesunde Gesichtsfarbe leichenfahl.
Er bot einen ganz schauerlichen Anblick. Der Lord wagte einmal, seine Wange zu berühren. Es war ganz unmöglich, mit dem Finger etwas ins Fleisch zu drücken. Alles wie aus Stein, was doch damals, als man ihn als scheinbare Leiche gefunden hatte, durchaus nicht der Fall gewesen war, und auch nicht zu verwechseln mit Muskelhärte.
Ralph brauchte nur instruiert zu werden, dass er sitzen zu bleiben und den Grafen immer im Auge zu behalten habe, nichts weiter, dann begab sich der Lord auf sein in einem ganz anderen Flügel gelegenes Arbeitszimmer.
Zuerst war er ganz kopfscheu. Er raffte sich zusammen, verschloss alle drei Türen, ließ vor den Fenstern die Jalousien herab. Trotzdem war es noch so hell im Zimmer, dass er alles unterscheiden konnte, den kleinsten Gegenstand.
Eine Violine hatte er nicht hier, er hatte zuvor nicht daran gedacht, wohl aber im Schranke eine Mundharmonika, ein damals sehr beliebtes Instrument, auf dem es ja noch heute Virtuosen gibt.
Er legte sie auf den Tisch, daneben ein weißes Blatt Papier und darauf einen Bleistift. Dann setzte er sich in einiger Entfernung davon auf einen Stuhl und harrte der kommenden Dinge.
Seine erste Aufregung hatte er vollkommen niedergerungen.
»Ich schlafe nicht, ich träume nicht, bin vollkommen bei Sinnen«, sagte er sich wiederholt.
Dass er auch nicht hypnotisiert sei, davon sagte er nichts. Friedrich Anton Mesmer machte seine Entdeckung, die er ›tierischen Magnetismus‹ nannte, worunter er aber den heutigen Hypnotismus verstand, der daher von vielen Leuten auch Mesmerismus genannt wird, erst fünfundzwanzig Jahre später, im Jahre 1775. Wolle sich das der Leser wohl merken.
Der Spiritismus tauchte erst im 19. Jahrhundert auf und erzeugte eine wissenschaftliche Untersuchung, ob die Phänomene, die sich nicht leugnen lassen, auf natürliche Weise zu erklären sind oder nicht. Bis dahin gab es in dieser Hinsicht nur zweierlei Sorten von Menschen: solche, die an Geister glaubten, und solche, die nicht an Geister glaubten.
Nicht lange dauerte es, als ein quietschender und dann etwas knarrender Ton erscholl, ganz genau so, wie vorhin die Tür gequietscht und geknarrt hatte, als der Lord sie beim Eintreten geöffnet und wieder geschlossen hatte.
Jetzt also trat der Geist ein, natürlich ohne dass er dabei die Tür zu öffnen brauchte.
Wir wollen uns hier durchaus nicht mit der Geistertheorie befassen, auch der Lord hatte es noch nie getan, aber so viel wusste er doch, dass dieses Quietschen und Knarren ganz in der Ordnung war. Das hatte ihm schon seine Amme erzählt. Der Geist, ganz besonders wenn es ein verstorbener Mensch ist oder auch einem noch lebendigen Kerl angehört, der aber nicht so ganz fest in seiner irdischen Hülle steckt, kann zum Passieren nur das Loch benutzen, welches der Zimmermann gelassen, in Gedanken öffnet er dabei die Tür, freilich ohne sichtbare Wirkung, es ist bei ihm alles nur Einbildung. Weil er es für unmöglich hält, durch die Wand zu kommen, kann er auch nicht durch — und wenn nun die Tür quietscht, so muss sie auch in seiner Einbildung quietschen, selbst wenn er davon vorher noch gar nichts gewusst hat, und diesen Ton können unter Umständen sogar andere hören.
Mag diese Erklärung für das Phänomen, welches man heute ›magisches Seelenleben‹ nennt, weil das Kind doch unbedingt einen Namen haben muss, genügen und hiermit abgeschlossen sein.
Unwillkürlich hatte der Lord nach der Türe geblickt. Er sah nichts, und es wollte auch nichts weiter kommen.
Dass er einen Geist im Zimmer förmlich zu wittern meinte, hielt der Lord selbst für eine Einbildung.
Nicht lange, so erscholl ein Klopfton, der wie aus der Wand zu kommen schien, einige andere folgten.
Wenn es nun einmal zu einer Geistererscheinung kommen sollte, so hielt der Lord das alles für ganz in der Ordnung. Jetzt ließ er sich nicht mehr aus der Fassung bringen.
»Ich will doch versuchen, ob ich ihm nicht mit meiner eigenen Willenskraft zu Hilfe kommen kann«, dachte er nach einiger Zeit ganz vernünftig, als gar nichts kommen wollte, das Klopfen sich auch nicht wiederholte, und laut sagte er in festem Tone: »Materialisiere dich, dass ich dich sehen kann, ich will es!«
Aber es nützte nichts, es wurde nichts sichtbar.
Da jedoch zitterte mit einem Male ein Akkord durchs Zimmer, leise, nur wenig anschwellend, eine Melodie wurde daraus, ein bekanntes italienisches Lied aus alten Zeiten.
Es wurde Harmonika gespielt. Aber das Blasinstrument lag bewegungslos auf dem Tische.
Unverzagt nahm es der Lord, das Lied klang weiter, und es war gar nicht, als ob es aus diesem Instrument herauskäme, nichts von einem Lufthauche zu spüren.
Dennoch stammten die Töne aus dieser Harmonika, denn sie hatte einen kleinen Fehler, und ganz deutlich kehrte dieser in der Melodie immer wieder.
Der Lord spielte selbst, ganz leise, aber jenes Lied klang fort, bis es zu Ende war.
Eben eine magische Sache, für die man heute so wenig Worte hätte wie damals.
Hierauf bewegte sich der Bleistift, ruckte hin und her, richtete sich etwas auf, fiel wieder hin.
Plötzlich ein heftiges Klopfen, wie aus dem mit bunten Steinfliesen belegten Boden herauskommend, und als der Lord unwillkürlich hinblickte, gewahrte er dort auch schon einen hellen Fleck, wie ein begrenztes Stück Sonnenlicht, das aber nicht durch die Jalousie kommen konnte.
Der Fleck veränderte wiederholt seine Form, und nicht nur am Boden selbst, jetzt ging er auch in die dritte Dimension über, ging in die Höhe, das Ganze wurde etwas nebelhafter, wuchs zu einer mannesgroßen Säule empor, die sich unruhig hin und her bewegte, dann schossen aus ihr wie Hände hervor — nur Hände, keine Arme, und auch nicht dort, wo die Arme sitzen, sondern unten und oben, und zwar sehr viele Hände, die sich blitzschnell wieder zurückzogen, bis endlich doch zwei stehen blieben, und zwar so ziemlich an der naturgemäßen Stelle, die Arme erst nachträglich wachsen lassend, und gleichzeitig formte sich auch immer mehr ein Kopf, an dem schließlich Nase und Ohren und Mund und Augen sichtbar wurden.
Es war der Graf, kein Zweifel! Freilich alles nicht so ganz deutlich. Es war wie ein Schattenbild, hell, wolkig, überhaupt wie eine Wolke, welche die Gestalt des Grafen und sogar seine Gesichtszüge annahm, aber wie von einem Windhauch hin und her getrieben wurde. Alles so unruhig, zitternd. Von den Beinen war nichts zu sehen, der untere Teil war eine formlose Wolke. Am allerdeutlichsten waren die Hände. Jeder Finger war deutlich zu unterscheiden. So schwebte die Wolke auf den Tisch zu, die eine Hand griff nach der Harmonika, tastend, es war, als ob die Hand das Instrument aufheben wollte, was ihr aber nicht gelang. Und dabei erklang schon wieder ein anderes Lied, eben von dieser Harmonika gespielt.
Doch verstummte es bald wieder. Plötzlich verdichtete sich die Wolke, besonders die eine Hand wurde dunkler und bekam noch schärfere Formen, und jetzt konnte sie die Harmonika aufheben.
In demselben Augenblick aber zerrann die Wolke in ein Nichts. Trotzdem blieb die Harmonika in der Luft schweben, wurde weitergeführt, bis nach jener Stelle, wo sich der Kopf der unsichtbaren Gestalt befand, das angefangene Lied wurde weitergespielt, und jetzt kam nach und nach auch die Gestalt wieder zum Vorschein, wobei sich aber nun auch die Harmonika wie in Nebel auflöste.
Das Lied war verklungen, und plötzlich lag die Harmonika wieder auf genau derselben Stelle des Tisches, wo sie vorher gelegen, der Lord hatte sie nicht durch die Luft fliegen sehen.
Die Gestalt war sichtbar geblieben. Jetzt verdunkelte oder verdichtete sie sich noch mehr, denn weiß blieb sie immer, die Hand griff nach dem Bleistift, erst einige ungeschickte Versuche, der Bleistift fiel in der Hand selbst um, dann blieb er aufrecht stehen, malte quer über das Papier, große, schräge Buchstaben. Die Worte, einige Zeilen bildend, lauteten.
»Das Leben ist eine Krankheit, von der wir im Tode genesen.«
Dann kamen ganz andere Buchstaben, weit zierlicher und verschnörkelt — Graf von Saint-Germain.
Der Bleistift fiel um, kam aber merkwürdigerweise auf genau derselben Stelle und genau in derselben Richtung zu liegen, wie er vorhin gelegen hatte. Dabei war es dem Lord gewesen, als wenn er an einer ganz anderen Stelle ganz einfach umgefallen wäre — alles Erscheinungen, wie sie in spiritistischen Sitzungen vorkommen, die kein ehrlicher Mensch ableugnen kann, der solchen Sitzungen, wobei Materialisationen vorkommen, beigewohnt hat. Freilich muss man eben wirklich hingehen und ein paar Taler opfern. Dass dies alles mit ›Geistern‹ gar nichts zu tun hat, werden wir später noch sehen. Diese Phänomene können auf ganz verschiedene Weise zustande kommen.
Die Gestalt, mit einem Ruck ganz durchsichtig und dann wieder fester werdend, hatte sich etwas zurückgezogen, und jetzt sah der Lord ganz deutlich den Mund, plötzlich dunkler als die Umgebung, wie er sich bewegte, und da kamen hauchende Worte.
»Ja, ja, siegeln Sie.«
In der Tat, der Lord hatte sich eben gefragt, ob es nicht angebracht sei, auf das Papier mit eigner Hand Datum und Uhrzeit zu schreiben und sein Siegel darauf zu drücken. Das war dann eine Garantie dafür, dass er nicht nur eine Halluzination gehabt.
Also er schrieb Datum und Uhrzeit darauf, nahm sein Kästchen, welches das Siegelmaterial barg, machte mit Feuerzeug Licht, um den Siegellack zu erhitzen, drückte sein Petschaft ein.
»Fragen Sie, fragen Sie!«, wurde wieder gehaucht, als der Lord eben dachte, was er jetzt fragen sollte.
»Dann müssen Sie doch auch schon wissen, was ich fragen will.«
»Geben Sie mir Ihr Terzerol.«
An dieses hatte der Graf wahrhaftig gedacht. Ob es der Geist abfeuern könne, dass auch andere den Schuss hörten.
Er zog eine Pistole aus der Tasche, der Geist nahm sie ihm ganz ordentlich aus der Hand, hob sie und... feuerte ihm das scharf geladene Terzerol dicht vor der Nase ab!
Unter dem Donner war der Lord tödlich erschrocken zurückgeprallt. Aber nicht tödlich getroffen. Er hatte die Feuererscheinung gesehen, aber nicht gespürt, obgleich er hätte total verbrannt sein müssen. Statt dessen war es nur wie ein kühler Luftzug gewesen, der ihn getroffen.

Die Gestalt war etwas zurückgegangen, und zwischen ihr und dem Lord schwebte frei in der Luft die Bleikugel, er konnte sie nehmen, sie entstammte seiner Pistole.
Der Lord war jetzt doch mehr erschrocken als erstaunt.
»Muss gehen — strengt mich zu sehr an«, begann da der Mund wieder zu hauchen. »Wollen Sie — einen Blick — in Ihre Zukunft — jetzt — jetzt kann ich ihn gewähren — nur einen einzigen.«
Schnell hatte sich der Lord zusammengerafft.
»Wohlan denn! Eine Lebensfrage! Wenn ich heiraten werde — wer wird es sein?«
Die wolkigen Arme der Gestalt reckten sich aus, die Hände begannen in der Luft zu formen, und wirklich, es ward etwas daraus, eine zweite Nebelgestalt bildete sich, aber viel deutlicher als die des Grafen, die Umrisse wurden immer schärfer, jetzt konnte der Lord ganz deutlich die schönen, wenn auch farblosen Gesichtszüge der Frauengestalt unterscheiden.
»Die Prinzess Polima von Leszczynski!«, schrie er außer sich. »Es — ist — nicht — möglich!«
Da ein Donnerschlag, und die beiden Gestalten waren verschwunden.
Immer noch ganz außer sich, stürzte der Lord nach der Tür, schloss sie auf, hinaus.
Da kamen zwei Diener angerannt, und bei ihrem Anblick hatte sich der Lord ganz in der Gewalt.
»Habt ihr einen Pistolenschuss gehört?«
»Das ist es eben! Was ist passiert.?!«
»Nichts weiter. Auch einen zweiten Knall, eher wie ein Donnerschlag?«
Nein, den hatten die Diener nicht gehört, und das war auch ganz in der Ordnung, wenn das mit dem Verschwinden des Geistes zusammenhing. Dann hatte das Geräusch nur der gehört, der den Geist auch gesehen hatte.
Aber der Pistolenschuss war eine Realität gewesen.
Lord Moore begab sich erst noch einmal ins Zimmer zurück, nahm das Papier mit der Schrift und seinem Siegel zu sich.
Die abgeschossene Pistole, nach frischem Pulverrauch riechend, wie das ganze Zimmer noch mit solchem erfüllt war, lag neben der Harmonika auf dem Tisch. Ob der Geist sie dorthin gelegt hatte oder ob der Lord sie vielleicht wieder in die Hand genommen hatte, wusste er nicht. Auch Nebensache.
Jetzt begab sich der Lord in das andere Zimmer, wo der Graf lag, ganz gefasst.
Der Graf lag unverändert da, daneben saß Ralph. Eine Prüfung der Siegel war gar nicht nötig.
»Hat er sich gerührt?«
»Nicht im Geringsten.«
»Auch sonst nichts passiert?«
»Gar nichts. Fiel vorhin nicht ein Schuss?«
»Er gehörte zur Sache. Gut, Ralph, lass mich mit ihm allein.«
Eine halbe Stunde hatte das Experiment gewährt, die zweite halbe Stunde saß der Lord regungslos auf dem Stuhle, ganz in Gedanken versunken.
Punkt ein Uhr kam plötzlich wieder Leben in den Grafen. Er wusste sofort alles.
»Darf ich die Siegel erbrechen?«
Er schälte sich aus der Umhüllung und richtete sich auf.
»Sind Sie mit dem Gesehenen zufrieden?«
»Wunderbarer, rätselhafter Mann!!«, rief der Lord, noch einmal ganz außer sich. »Ich zweifle an nichts mehr, und wenn Sie mir sagen, dass Sie mit Göttern verkehren, selbst ein Gott sind — ich glaube es!«
»Bitte, Mylord, keine frevelnden Worte. Ich bin ein sündhafter Mensch, der nur einiges gelernt hat. Ich habe Sie zuletzt sehr erschreckt, als ich die Pistole dicht vor Ihrem Gesicht abfeuerte. Das beabsichtigte ich nicht, ich wollte Ihnen zeigen, wie ich Feuer kalt machen und sonstige Naturgesetze aufheben kann, die Kugel im Laufe aufhalten, ich bereitete Sie auch darauf vor, aber nur in Gedanken, zurzeit nicht wissend, dass Sie meine Gedanken ja nicht so hören können wie ich die Ihren. Ich bin eben doch sehr aus der Gewohnheit gekommen, habe solche Materialisationen auch sonst nie gemacht. Nur in ganz seltenen Ausnahmen. Nun, geschadet hat es Ihnen nichts.«
»Und das letzte, was Sie mir zeigten?!«, fragte der Lord atemlos.
»Ich zeigte Ihnen, was Sie wünschten, Ihre zukünftige Gattin. Ich besinne mich nämlich hinterher auf alles.«
»Sie kennen doch diese Dame.«
»Ich habe sie gestern Abend in der Gesellschaft gesehen, aber vorgestellt wurde sie mir nicht, auch sonst hörte ich ihren Namen nicht. Doch Sie riefen vorhin einen Namen.«
»Tat ich's?«
»Die Prinzess Polima von Leszczynski!, riefen Sie und setzten noch hinzu: Es — ist — nicht — möglich!«
»Und diese Prinzessin soll meine Gattin werden?!«
»Ganz sicher.«
»Nimmermehr!!«
»Mylord, ich weiß gar nicht, wer diese Prinzessin ist, ich konzentrierte meinen Willen darauf, Ihre zukünftige Gattin zu formen, dass Sie ihr Bild sehen möchten, das Formen geschah ganz mechanisch, unbewusst, und zu meinem eigenen Erstaunen sah ich jenes Mädchen entstehen, das mir durch ihre Schönheit und durch ihr ganzes Wesen höchst sympathisch auffiel.«
»Aber die Prinzessin Polima — nimmermehr! Das ist ja ganz ausgeschlossen! Wissen Sie, wer diese Prinzessin ist?«
»Wie ich sagte — ich weiß sonst gar nichts.«
»Die Tochter des polnischen Exkönigs Stanislaw Leszczynski, sie wird in den nächsten Tagen ins Kloster gehen, freiwillig.«
»Möglich«, meinte der Graf achselzuckend, »aber Ihre Gattin wird sie dennoch.«
»Das wäre auch das Wenigste«, stimmte der freimütige Lord bei, »es haben schon genug Klosterfrauen geheiratet, und auch das hätte nichts zu sagen, dass ich der ausgesprochenste Protestant bin und sie die strenggläubigste Katholikin ist. So etwas zu arrangieren, ist ja dem Schicksal eine Kleinigkeit. Aber dieses Mädchen hat überhaupt keine Seele!«
»Wieso nicht?«
»Weil sie eben keine Seele hat. Noch kein Mensch hat sie weinen oder lachen sehen, erbleichen oder erröten.«
Der Lord hatte jenen Vorgang mit der roten Rose also nicht beobachtet, es war ihm auch von anderer Seite nichts davon erzählt worden, auch jetzt teilte ihm der Graf nichts davon mit.
»Ich bedaure sehr, Ihnen einen Blick in die Zukunft gestattet zu haben; man soll so etwas eben nie tun.«
»Nein, Sie brauchen es nicht zu bedauern. Wenn das Schicksal dieses Mädchen für mich bestimmt hat, dann... nehme ich den Kampf mit dem Schicksale auf!«
»Hoffnungslos!«
»Wir werden sehen. Nun, Herr Graf, Sie haben mich wiederum von Ihren magischen Fähigkeiten überzeugt. Ich finde keine Worte dafür. Befehlen Sie nur, ich soll mich aus dem Fenster stürzen, es würde mir nichts schaden, denn Sie wollen unterwegs die Schwerkraft aufheben — ich tue es sofort.«
»Ganz fern liegen mir solch unnütze Experimente, und am wenigsten tue ich es vor den Augen des Volkes.«
»Ich meinte auch nur so. Und doch, ich meinte und meine es noch jetzt ernst. So will ich Ihnen gleich noch etwas mitteilen, woraus Sie meine gläubige Offenheit erkennen werden. Ich war heute früh wieder beim Papst, berichtete ihm nochmals über Sie, über Ihre gestrigen Experimente in der Gesellschaft. Der Papst nahm es in seiner Weise ganz gelassen hin. Ob er Sie nicht einmal zu sehen wünsche. Nein, sagte er, weiter nichts. Nur noch etwas anderes sagte er: Hätten Sie ihn nur lieber einmal acht Tage lang unter sicherem Verschlusse hungern lassen. Das waren seine letzten Worte.«
»Ich weiß nicht recht, Mylord, wo Sie jetzt eigentlich hinauswollen. Haben Sie mich nicht selbst aus dem Gefängnis entlassen?«
»Gewiss, gewiss. Ich erzähle das, um Ihnen mein gläubiges Vertrauen zu beweisen. Verstehen Sie nicht?«
»Doch, ich verstehe.«
»Ich glaube, dass Sie niemals Speise und Trank und Schlaf brauchen, denn Sie haben es mir gesagt, und das genügt mir.«
»Ich bin aber sofort bereit, mich auf beliebige Zeit einschließen zu...«
»Nein! Nein!! Jeder Verdacht, dass ich ungläubig sein könnte, ist für mich eine Beleidigung, und jetzt darf selbst der Papst so etwas nicht wieder zu mir sagen — oder wir sind als Freunde geschieden!«
»Ich verstehe Sie, und ich danke Ihnen. Dann gleich noch eins, falls Sie in Anspruch genommen sind und wir uns nicht so bald wiedersehen. Ich möchte gern einmal Rom besichtigen, wie es sich in den letzten hundert Jahren verändert hat.«
»Wünschen Sie Begleitung?«
»Nein, aber ich ziehe die Nacht vor, da ich auch damals schon, wo ich hier als Bibliothekar weilte, nur nächtliche Spaziergänge gemacht habe. Also Sie gestatten doch, dass ich diese Nacht ausbleibe?«
»Ja, Herr Graf, habe ich Ihnen denn überhaupt etwas zu gestatten oder zu verbieten?«
»Es ist doch besser, dass ich Ihnen davon Mitteilung mache, wenn ich die ganze Nacht ausbleibe. Es Ihnen durch einen Diener zu hinterlassen, widerstrebt mir.«
»So sehen wir uns also erst morgen früh wieder. Denn ich habe heute Nachmittag wirklich viel zu tun. Übrigens, darf ich Ihnen mit irgend etwas dienen? Mit Garderobe? Alles sieht zu Ihrer Verfügung.«
»Dieser Anzug genügt vollkommen, sonst haben Sie mich ja auch schon reich ausgestattet. Nur wenn ich um etwas kleines Geld bitten dürfte.«
Der Lord zog seine schwere Geldbörse, drängte sie ihm auf.
Dort, wo die alte römische Mauer mit der von einem späteren Kaiser angelegten zusammenstößt, ist ein Winkel entstanden, als Ortsbezeichnung Baja genannt, wörtlich Bucht, in dem zumeist kleine Handwerker ihr Quartier aufgeschlagen haben.
Die geachtetste Stellung unter ihnen nahm eine Familie ein, deren Ernährer wieder einen ganz anderen Beruf hatte, aber im Grunde genommen doch auch zu diesen kleinen Handwerkern gehörte.
Antonio Roscall war Skribent, Schreiber, speziell Briefschreiber.
Mit dem Schreiben sieht es ja in Italien noch heute trüb aus. Die in Gegenwart von bekannten Zeugen gemalten Kreuze werden noch heute als vollgültige Unterschrift angenommen, und ach, da werden täglich von alten und jungen Personen noch so viele Kreuze gemalt! Also nicht einmal bis zu ihrer Namensunterschrift haben sie es gebracht.
Nun aber damals erst! Auf hundert Köpfe kam ein Skribent, und dieser Beruf war nicht etwa überfüllt.
Antonio Roscalli war kein Stadtschreiber, sondern hatte seinen Kundenkreis in der Umgegend Roms. Er klapperte die einzelnen Dörfer ab, schrieb den Bedürftigen die Briefe, las empfangene vor, schrieb Einladungen zu Taufen und Hochzeiten und anderen Familienfesten, und dem Gemeindevorstand führte er die erforderlichen Register.
Er hätte nicht nötig gehabt, dieses durch die langen Wanderungen sehr strapaziöse und auch gefährliche Leben zu führen, das ihn oft wochenlang von Hause fernhielt. Er konnte es mit dem gesuchtesten Stadtschreiber aufnehmen, niemand verstand für die verliebten Mädchen und Jünglinge innigere Liebesbriefe zu stilisieren, niemand verfügte über solch eine Anzahl der kosigsten Schmeichelnamen, niemand konnte die Anfangsbuchstaben der Sätze so schön mit bunten Farben, den allerersten mit Silber und Gold, ausmalen, auch war kein Stadtschreiber so in allen Rechtsbüchern bewandert wie dieser zigeunerhafte Landskribent.
Aber Antonio wusste schon, warum er bei der Landkundschaft blieb. Bei seiner Rückkehr brachte er jedes Mal einen dicken Lederbeutel mit, und manches Goldstück hatte er einwechseln müssen, weil der Beutel die Silber- und Kupfermünzen nicht mehr gefasst hatte. Da konnte nun freilich kein Stadtschreiber mit ihm antreten, die lebten fast alle von der Hand in den Mund.
Und dabei ein guter Mensch! Wenn er sich zu Hause von den Strapazen erholte, schrieb er der ganzen Nachbarschaft die erforderlichen Briefe mit allem Aufgebote seiner Kunst und wollte dann durchaus nichts dafür annehmen — »das mache ich hier einmal zu meinem Vergnügen, steckt eueren Kindern in die Sparbüchse, was ihr mir zugedacht habt« — und während Antonios Abwesenheit wirkte seine Marietta, sein jugendschönes Weib, als guter Engel in diesem Stadtwinkel, in dem gar oft die Not, sogar der Hunger an die Türen der kleinen Hütten klopfte. Aber da brauchte kein Hilfsbedürftiger zu ihr zu kommen, keine arme Wöchnerin erst nach ihr zu schicken — Marietta kam von selbst mit gefülltem Korb und Geldtäschchen, und da wurde nicht gerechnet; in dem Stübchen an der einen Wand hing der letzte Vers aus dem 6. Kapitel Matthäi, gegenüber der 12. Vers ans dem nächsten Kapitel — das A und das O aller bestehenden Religionen, wodurch sofort alles Elend aus der Welt geschafft wäre.
Marietta wusste ja auch am besten, wo hier Hilfe angebracht war. Sie stammte selbst aus diesem Winkel. Vor vier Jahren hatte sie den Skribenten auf einem Volksfest kennen gelernt, von allen Seiten war ihr abgeraten worden, solch einen zigeunerhaften Landstreicher zu heiraten — und er hatte sich als der eigentliche Engel bewiesen, den sie hierher geführt. Seine Einkünfte hätten ihm eine ganz andere Wohnung gestattet, da aber Marietta gern in Baja wohnen bleiben wollte, hatte auch er dort sein Heim aufgeschlagen.
Sollte da dieses so überaus mildtätige Ehepaar in der Nachbarschaft Feinde haben? Feinde wohl nicht, aber doch Neider. Denn die größte Güte kann den Neid noch nicht besiegen.
Dieses Ehepaar jedoch hatte nicht einmal Neider.
Aus einem ganz besonderen Grunde.
Dieses sonst mit Glücksgütern so reich gesegnete war von Gott im Zorne mit Unglück geschlagen!
Inwiefern, das werden wir gleich sehen.
Vor einer Stunde war die Nacht angebrochen. Marietta bereitete am Herd das Abendessen, nach der Gewohnheit die Hauptmahlzeit, immer sehr spät eingenommen. Und sie kochte nicht nur für sich und ihr Kind, sondern für drei und sogar vier Personen. Denn sie wusste ja niemals, wann Antonio nach Hause kommen würde, aber kommen konnte er jeden Abend, und zwar fast nur abends, weil er die Tagesstunden ausnutzen musste, und dann brachte er stets einen Heißhunger mit — und kam er nicht, so wurde das überreichliche Essen, und zwar immer solches, wie man es in diesem Viertel höchstens des Sonntags auf den Tischen von begüterten Handwerkern sah, bedürftigen Nachbarn zugeteilt.
Auch noch in anderer Weise war Marietta jeden Abend vorbereitet, den vielleicht heimkehrenden Gatten zu empfangen. Wenn sie auch nicht ihr Feiertags- oder Kirchenkleid trug, so schmückte sie sich doch jeden Tag nach besten Kräften — nach jenem Naturgesetz, dass die Frau dem Manne gefallen soll — und sie schmückte sich mit jenem geradezu instinktiven Schönheitssinn, welcher jedes italienische Bäuerlein veranlasst, vor seiner armseligen Hütte einige Bäume nach perspektivischem Gesetz zu pflanzen, die Bäuerin, dass sie aus dem Blumengarten, der den Ertrag des kleinen Feldes schmälert, eine Rose bricht, um sie sich ins wohlfrisierte Haar zu stecken, ehe sie die Kuh melken geht — und am allerausgeprägtesten ist dieser angeborene Schönheitssinn ja bei dem Römer und der Römerin, auch in den tiefsten Schichten des Volkes, und Marietta war eine echte Römerin, die stolze Schönheit des Antlitzes wie des Nackens widersprochen durch die Sanftmut des Charakters, der üppige Busen widersprochen durch die Keuschheit des Herzens und der Gedanken. Bleibt doch sogar die gesunkenste Römerin, wie schon Goethe unübertrefflich schildert, immer noch ein anmutiges Weib, mit dem man sich über alles Schöne und Edle unterhalten kann. Von Gemeinheit können sie gar nicht berührt werden.
Das Essen konnte in den Töpfen kochen, Marietta ging in die Ecke, wo ein Bettkorb stand, beugte den edlen Nacken, wie ihn in der ganzen Welt nur die Römerin besitzt, über das darin liegende, schon ziemlich große Kind.
»Heute kommt der Vater — meinst du nicht auch, Pippa?«, fragte sie mit unendlicher Zärtlichkeit.
Sie hob das Kind herauf.
Ach, was kam da zum Vorschein!
Das Mädchen war schon über drei Jahre alt, auch dementsprechend groß, aber es konnte noch nicht laufen, noch nicht sprechen — nicht hören und nicht sehen. Taubstumm und blind, verwachsen, und ein viel zu großer Kopf auf der Schulter.
Die Geburt war eine ganz normale gewesen. Die Eltern ein so schönes, herrliches, kerngesundes Menschenpaar!
Wer löst dieses Rätsel?
Das kann niemand. Wohl aber eine andere Frage lässt sich beantworten.
Kann denn ein Ehepaar, das solch ein Unglück ständig vor Augen hat, noch glücklich sein? Nämlich wirklich glücklich? Ja, es ist möglich. Ohne Sorge kann überhaupt kein Mensch sein, aber mit Sorgen, sogar mit sehr vielen und schweren Sorgen wie ohne Sorgen zu leben und dabei auch noch glücklich, das ist möglich. und das eigentlich ist der Anfang und das Ende der ganzen Philosophie, der Lebensweisheit, was freilich nicht von hohen Kathedern herab gelehrt werden kann, womöglich noch gar gegen Bezahlung. Alles andere ist gelehrter Firlefanz, keinen Pfifferling wert!
Ach, wie war die Mutter glücklich, wenn ihre kleine Pepita einmal zusammenschrak, als es zufällig einmal gerade gepoltert hatte. Dann konnte sie gewiss schon ein bisschen hören. Oder wenn das Kind den Löffel brauchte und ihn beim Ausstrecken der Hand zufällig erwischte. Dann konnte ihr Liebling sicher schon ein bisschen sehen. Und wenn das arme Kind heute ein grunzendes pa sagte, morgen ein papa, übermorgen ein papapa, dann war ja ganz ersichtlich, wie es nach und nach sprechen lernte, und traten dann wieder wochenlange Pausen ein, da das Kind keinen einzigen Laut hervorbrachte — die hoffende Mutterliebe fand das in der Entwicklung der Sprache ganz in Ordnung.
Was gibt es wohl Rührenderes, als solch eine Mutterliebe zu beobachten, die sich auf ein verkrüppeltes, zurückgebliebenes Kind erstreckt! Ach, wie armselig ist dagegen alles, was sie einem im Theater vormachen, um das Publikum zum Weinen zu bringen!
Lieber Leser, schaue nur mit offenen Augen, die ihren Sitz im Herzen haben, um dich — — wenn du den größten Humor sehen oder zu Tränen gerührt sein willst, brauchst du wahrhaftig nicht ins Theater zu gehen!
Die Nachbarn freilich verstanden dieses Glück nicht, das kann ohne eigene Erfahrung nur der verstehen, dem Zeus schon bei Lebzeiten den Himmel zur Verfügung gestellt hat, weil er sonst auf Erden nichts besitzt — und eben deshalb hatte dieses Ehepaar auch keine Neider.
Das große Kind gurgelte und umklammerte krampfhaft mit den ebenfalls verkrüppelten Fingern die Daumen der Mutter.
Da kam dieser einmal zum Bewusstsein, wie es mit ihrem Kinde beschaffen war, aber auch jetzt hatte sie gleich wieder Trost und Hoffnung.
»Lass nur, meine Pippa«, sagte sie mit von Tränen erstickter Stimme, das Kind an die Mutterbrust pressend. »Du wirst schon noch wie andere Kinder, dann holst du alles nach — — wenn unser Heiland noch auf Erden wandelte, ich würde dich zu ihm tragen, und wenn ich auch mit bloßen Füssen auf spitzen Nägeln um die Erde wandern müsste — er würde dich nur anrühren, und mein Glaube hätte dir geholfen — ach, muss das damals schön gewesen sein! — aber jetzt hat der liebe Gott wieder einen anderen Mann aufleben lassen, der viel, viel mehr kann als alle anderen Menschen — er wird dir dein Köpfchen gerade machen und dir Gehör und Gesicht und die Sprache geben — ich habe an ihn geschrieben, und ich glaube, glaube, glaube...«
Da schnelle Schritte, sie verdrängten alle anderen Gedanken. Mit dem angekleideten Kinde auf dem Arme eilte Marietta nach der Tür.
»Der Vater kommt, ich wusste es ja, und diese Ahnung nehme ich als ein Zeichen des Himmels an!«
Er war es. Er hatte etwas Zigeunerhaftes an sich. Das schöne Gesicht brauner gebrannt als das eines Hirten in der Campagna, das schwarze Haarwild zerzaust, der starke Schnurrbart lang herabhängend.
Die Hände des Schreibers zeigten natürlich keine Spuren einer schweren Arbeit, aber sie waren verbrannt wie das Gesicht, auch nicht eben gepflegt, das ließ dieses Leben ja gar nicht zu.
Er war mit einem wetterfesten Anzuge bekleidet, der schon seit Jahren alle Strapazen durchgemacht hatte, um die Waden Lederstreifen gewickelt, wie sie die Hirten trugen. Seine Tasche mit Papier und Schreibgerät ließ er immer auf dem letzten Dorfe, von wo er sie dann wieder abholte.
»Mein Kind, meine liebe, liebe Pepita!!«
Die Mutter fand es ganz selbstverständlich, dass seine erste Zärtlichkeit dem Kinde galt.
Und was für eine Zärtlichkeit!!
Der starke Mann weinte, als er es küsste und liebkoste, immer und immer wieder — aber es waren nur Tränen des Glückes. Vielleicht auch ein wenig Weh dabei — doch das ist nur die Würze der Freude, des wahren Glückes, das nicht größer sein kann und dennoch nicht berauscht.
Und das idiotische Kind wusste, auf wessen Arm es saß. Es schlang die dürren Ärmchen um den Hals des Vaters und gurgelte papapapa.
Das war ganz merkwürdig! Seine Mutter erkannte es nicht. Jede fremde Frau konnte es nehmen, es benahm sich nicht anders als gegen die eigene Mutter. Aber wehe, wenn ein fremder Mann es anfasste, oder auch der am häufigsten kommende Nachbar. Dann war das Gezeter schrecklich. Nur die Nähe des Vaters ahnte es schon, jauchzte ihm entgegen, nur auf seinem Arm konnte es ununterbrochen papapapa sagen, während es dies sonst nur ganz selten tat, wochenlang gar keinen Laut hervorbrachte, wie es sich auch anstrengte.
»Denke dir, Antonio, gestern hat sie mir meine Rose aus den Haaren gezogen, von ganz allein, sie griff danach und hatte sie auch gleich in der Hand«, sagte die glückstrahlende Mutter.
Und so berichtete sie weiter, was Pepita während Antonios Abwesenheit, die diesmal anderthalb Woche gedauert hatte, alles getan, gedacht, gesehen und gehört hatte. Lächerliche Kleinigkeiten! Ja, lächerlich!
Der nicht minder glückstrahlende Vater lauschte den Berichten, ließ sich alles immer wieder erzählen, als vernähme er das Evangelium.
Dabei hatte er unter der Joppe einen großen, schweren Lederbeutel zum Vorschein gebracht, schüttete den Inhalt aus den Tisch, wollte die vielen Kupfer- und Silbermünzen und auch einige Goldstücke sortieren — aber das Kind schob mit einer energischen Handbewegung, sicher nur zufällig, die ganze Geschichte vom Tisch herunter, dass alles auf dem Boden dahinrollte.
»So ist es recht, immer weg damit, immer weg damit, gerade wie der Vater!!«, lachte dieser im ganzen Gesicht, und auch die Mutter fand darin natürlich wieder einen Beweis für den geistigen Fortschritt ihres Kindes, und dann musste es die Münzen auch gesehen haben, wenn auch nur ganz undeutlich, und weil es jetzt ganz unabsichtlich die Händchen einmal zusammenschlug, musste es gleich vor Jubel in die Hände geklatscht haben.
Das Kind schlief bald ein, der Vater bettete es sorgsam in den Korb, Marietta deckte den Tisch.
»Nun vernimm eine Kunde, Marietta«, begann hierauf Antonio, »ich muss in der Nacht wieder fort...«
»Was, in dieser Nacht schon?!«
Das war noch nie vorgekommen, einen ganzen Tag blieb er sonst mindestens zu Hause.
»Wenigstens noch vor Tagesanbruch, und diesmal kann ich wieder zwei Wochen ausbleiben, denn es gilt die Geschäfte zu erledigen. zu denen ich mich verpflichtet habe, ich muss meiner Kundschaft kündigen — denn ich werde sie nicht mehr besuchen...«
Er hielt an, die Wirkung erwartend, und sie hatte ihn auch sofort verstanden.
»Wie? Du willst nur noch in der Stadt schreiben, dass du dann jeden Abend heimkommst?!«, jubelte sie überglücklich.
»Es wird sogar noch viel schöner, als du jetzt denkst«, jubelte auch er, sie erst jetzt in seine Arme schließend. »Höre nur, was mir vorhin passiert ist. Wie ich vorhin... aber da muss ich erst etwas fragen: Hast du schon etwas von dem Grafen Saint-Germain gehört?«
Wer in Rom hätte nicht alles, alles gewusst! Nur des Lords Geistererscheinung war noch unbekannt, sonst wussten selbst die Wächter in den unterirdischen Katakomben jeden einzelnen Vorgang, als wären sie dabei gewesen.
Also auch Marietta wusste alles, alles. Aber dass sie an den Grafen schon heute früh geschrieben, ob der Wundermann nicht ihr armes Kind heilen könne, ihm mit rührenden Worten alles schildernd, noch rührender bittend, den Brief durch einen Bettelmönch besorgen lassend, das sagte sie dem Gatten nicht, denn dadurch hätte die ganze Sache die ›Kraft‹ verloren.
Was sie hiermit meinte, ist nicht so deutlich zu definieren, sie selbst aber empfand es ganz klar, und sie hatte ganz recht. Der wahre Glaube ist immer verschwiegen, und wer etwas ausplaudert, was er ausführen will und kann, der hat schon den besten Teil des Erfolges verloren. Deshalb bringen es Schwätzer auch niemals zu etwas.
»Wie ich vorhin durch die via della Padua gehe — es ist schon dunkel, die Gasse ganz einsam — hole ich einen Mann ein, in einen Mantel gehüllt, und zuvor sehe ich nicht weit hinter ihm eine Brieftasche liegen. — Der müsste sie doch ebenfalls gesehen haben, denke ich. — Denn sie lag gerade unter einer Laterne. —Signore, haben Sie etwas verloren?, frage ich, die Brieftasche versteckend — Er dreht sich um — Nicht dass ich wüsste — Seht einmal Eure Taschen nach. — Er tut es — Bei Gott, meine Brieftasche!, ruft er — Ich frage zur Vorsicht noch, was darin ist — Viele tausend Scudi, in genuesischen Bankpapieren. — Ich sehe nach, stimmt — Funkelnagelneue Genueser — Da gab ich ihm die Tasche. Sie musste ja ihm gehören — Ihr seid ein ehrlicher Mensch, sagte er, mit einer Geldbelohnung ist's bei Euch nicht abgetan. Wer seid Ihr? Vielleicht kann ich Euch mit etwas dienen — Im Weitergehen erzählte ich ihm von mir — Ein Skribent? Ich könnte einen Sekretär gebrauchen. Kennt Ihr mich? — Er zeigte mir das edelste Gesicht, das ich je gesehen. Nur weiß wie der Tod — Habt Ihr schon vom Grafen Saint-Germain gehört? — Er war es — Und er brauche einen Schreiber, weil er gleich am ersten Tage viele, viele hundert Briefe empfangen habe, die von einem einzigen Menschen gar nicht zu lesen seien, geschweige denn zu beantworten, und er vermute, dass er fortan täglich so viele Briefe bekommen würde —
Marietta, der Graf will mich als seinen Sekretär annehmen, ich wohne bei ihm, und du mit mir. Jetzt gibt es keine Trennung mehr!!«
Ja, auch Mariettas Jubel war grenzenlos, aber sie hatte auch gleich einige besondere Fragen.
»Er kannte dich sonst gar nicht?«
»Nein, woher denn?«
»Hast du ihm von mir erzählt?«
»Freilich, dass ich Frau und Kind habe.«
»Auch, dass unsere Pepita so... schwächlich ist?«
»Nein, davon berichtete ich nicht.«
Dann hat er meinen Brief auch noch nicht gelesen, dachte Marietta. Freilich, wenn er so furchtbar viele bekommen hat.
Dann schüttelte die junge Frau nachdenklich den Kopf.
»Es war wirtlich der Graf von Saint-Germain, der solche Wunder verrichtet?«
»Wie könnte es der Signore sonst gesagt haben! Ich muss ja morgen noch einmal zu ihm, ehe ich meine Verpflichtungen auf den Dörfern erledige, und so lange hält er die Stellung eines ersten Sekretärs für mich offen.«
»Dann begreife ich nur eins nicht.«
»Was nicht?«
»Wie dieser Graf dann seine Brieftasche verlieren kann.«
Die simple Frau hatte ein ganz richtiges Gefühl. Wohl eben, weil sie so simpel war.
»Ja, warum denn nicht?«, wunderte sich dagegen der Gatte.
»Ich weiß nicht recht — weil — weil... wenn jemand Gold machen kann, nicht mehr zu sterben braucht — der sollte doch nichts versehentlich verlieren, aus der Tasche fallen lassen können.«
»Aber, Marietta, schließlich ist er doch auch nur ein Mensch, das betont er ja immer selbst. Und doch, du hast recht. Wer sagt dir denn, dass dieser fast allwissende Mann nicht schon wusste, wer hinter ihm war, und er ließ die Geldtasche mit Absicht fallen, um meine Ehrlichkeit zu prüfen?«
»So ist es, so wird es gewesen sein!«, konnte sie schon wieder glaubensselig aufjubeln.
Sie hätte noch so gern hinzugesetzte dann wird er auch unserem Kinde helfen können! — aber sie tat es nicht, es hätte die Kraft ihrer Hoffnung geschwächt.
»Ja aber, Antonio«, hatte sie nur noch einzuwenden, »du hättest doch schon immer Stadtschreiber werden können...«
»O, wo denkst du hin, Marietta, was für ein Vergleich! Ich werde fest angestellter Sekretär, und das beim berühmtesten Manne, den Roms Mauern bergen. Und hier gibt es überhaupt keine Trennung mehr für uns, ich wohne doch bei ihm.«
»Ach, du wohnst gleich bei ihm!«
»Ja, gewiss, und du ziehst zu mir.«
Sich von diesem Winkel zu trennen, in dem sie geboren worden war, hatte für sie nichts Schmerzliches mehr. Eigentlich war es damals Antonio gewesen, der hierher hatte ziehen wollen. Damals hatte auch ihre Mutter gelebt, die er bis zu ihrem Tode wie seine eigene behandelt.
»Ach, das wird ja herrlich!!«, jubelte sie immer wieder. »Und wohin ziehen wir da?«
»Nun, in die Wohnung des Grafen.«
»Ja, aber der wohnt doch bei Lord Moore. Bleibt er dort?«
»Nein, und das hat er mir ebenfalls schon erzählt. Der Papst hat ihm die Erlaubnis gegeben, das Kloster von St. Georg zu beziehen, da wird er sich mit all dem Glanze einrichten, der solch einem vornehmen und gelehrten Herrn gebührt, und da werden auch wir unsere eigene Wohnung haben.«
»In dem Spukkloster?«, fragte da die junge Frau etwas ängstlich.
Ihr Gatte lachte belustigt.
»Wenn da wirklich ein böser Geist umgeht, den wird dieser Graf von Saint-Germain bald ausgetrieben haben.«
»Du meinst, dass er die bösen Geister austreiben kann?«, fragte sie mit großen Augen, ganz Spannung.
»Ganz sicher, der hat noch mehr gelernt, wenn er auch einmal seine Brieftasche verlieren kann.«
Jetzt zog bei der jungen Mutter erst recht die freudigste Hoffnung ein.
Denn dass ihr Kind von Geistern besessen war, die keine guten sein konnten, stand bei ihr fest, wenn sie es auch nie aussprach. So aber hatte sie oft genug die Nachbarn heimlich sagen hören, und... sie durfte es auch der heiligen Schrift nach glauben, die sie als Katholikin allerdings nur von Geistlichen vorgelesen bekam. Christus trieb doch auch oft genug böse Geister aus.
Zu ihrem Manne durfte sie freilich darüber nicht sprechen. Allerdings ging er, wenn er einmal des Sonntags zu Hause war, mit ihr in die Kirche, versäumte auch auf dem Lande keinen Gottesdienst, ging zur Beichte — sonst war er aber doch etwas Freigeist, wenigstens insofern, als er nicht an Geister und nicht einmal an mögliche Wunder glaubte. Er war in dieser Hinsicht wie alle die anderen Männer.
Jetzt aber hatte er selbst zugegeben, dass dieser Graf von Saint-Germain recht wohl imstande sei, böse Geister auszutreiben.
Mariettas Plan war schon jetzt gefasst.
Die Speisen waren aufgetragen, Antonio ließ sich nieder und aß mit dem Appetit, den er stets nach solch langer Abwesenheit mit nach Hause brachte. Es war doch sehr angebracht, dass Marietta immer gleich für vier Personen kochte. Dann kam noch ein Stündchen des Plauderns, das Ausmalen des zukünftigen Glücks, Antonio hatte das schöne Weib auf dem Schoß, vor ihm stand die dickbauchige, strohumflochtene Rotweinflasche, und dann gingen sie schlafen.
Ungeduldige Hähne, als Zeitmesser ebenso gut zu gebrauchen wie als Wetterpropheten, kündigten den Anbruch des Tages zwei Stunden zu früh an, als sich Antonio vom Lager erhob.
Ohne ein Licht anzuzünden, schlüpfte er in seine Kleider, und es war nicht nötig, dass er sie ordentlich gelegt hatte.
Er hatte zu wiederholten Malen zeigen müssen, dass er zu den seltenen Menschen gehörte, welche im Finstern ebenso gut sehen können wie am hellen Tage, ohne dass seine Augen dabei besonders leuchteten, etwa wie Katzenaugen.
So sah er jetzt auch ganz deutlich das noch vom letzten Liebesglück verklärte Antlitz seiner jungen Frau, die er nicht geweckt hatte, so leise und behutsam hatte er sich bewegt.
Wir aber wollen im Finstern sein eigenes Gesicht sehen, und dieses war vom Schmerz durchzogen, als er das der Schläferin betrachtete.
»Armes Weib, arme Marietta!«, flüsterte er. »Was will ich dir antun, wie furchtbar dich betrügen! Und doch, ich führe den Plan aus, den ich mir diese Nacht zurechtgelegt habe, ich will dich ja nur beglücken.«
Nun noch schnell Abschied von dem Kinde genommen.
»Mein armes, liebes Kind, was ich auch getan habe und noch tun werde, durch dich habe ich es bereits im Voraus abgebüßt...«
Furchtbar erschrak er. Das Kind hatte wach in dem Bettchen gelegen. Jetzt umklammerte es plötzlich krampfhaft seinen Hals und gurgelte ein papapa hervor, und man konnte bei aller Unbeholfenheit dennoch ein Jauchzen unterscheiden.
Die Tränen stürzten dem Manne hervor.
»Ja, deinen Vater sollst du behalten, und er wird dir die Mutter ersetzen, die er dir rauben will.«
Mit sanfter Gewalt machte er sich frei und schlüpfte zur Tür hinaus, diese hinter sich mit einem eigenen Schlüssel verschließend.
Rasch eilte er durch die Straßen, von denen nur die hauptsächlichsten mit Öllampen erleuchtet waren, und auch das spärlich genug.
Nach einer Viertelstunde führte ihn der Weg an der Villa der englischen Gesandtschaft vorbei.
Was hätte der Skribent in dieser zu suchen gehabt, noch dazu in solch nächtlicher Stunde?
Gleich darauf versiegten wieder die Öllaternen, und im Schutze der Finsternis schwang sich Antonio auf die Mauer hinauf, die hier die Straße begrenzte.
Es hatte noch etwas ganz anderes als ein Katzensprung dazu gehört, um den Rand der vier Meter hohen Mauer zu erreichen, mindestens der Sprung eines Panthers, und mit spielender Leichtigkeit hatte ihn das Schreiberlein, das allerdings sehr kräftig gebaut war, ausgeführt.
Diese Mauer gehörte nicht mehr zur englischen Gesandtschaft, sondern sie umschloss den Garten des benachbarten Gebäudes, des verrufenen Kapuzinerklosters, und mit einem zweiten Sprunge befand Antonio sich in diesem total verwilderten Garten.
Er lauschte. Alles war totenstill. Er sog durch die Nase die Luft ein und... wir können gleich verraten, dass dieses Schreiberlein auch sofort gewittert hätte, wenn sich ein fremder Mensch in einem Umkreis von 30 Schritten befunden, und er hätte durchaus nicht parfümiert zu sein brauchen.
Mit einer Sicherheit, als ob er jede Nacht hier spazieren ginge, drang Antonio durch die Büsche. Von Wegen war nichts mehr zu bemerken, alles überwuchert, alles ein Buschholz, wenn nicht Urwald. Aber unter den Füßen dieses Mannes raschelte kein trockenes Blatt, kein Zweig machte beim Zurückschnellen ein Geräusch. Wie eine Katze, die den Vogel beschleicht, bewegte er sich vorwärts, und dennoch mit der größten Schnelligkeit.
An einem Seitenpförtlein war die Tür aus den Angeln gefallen. Der letzte Bewohner des Spukklosters, jener Engländer, hatte nicht lange genug hier ausgehalten, um dergleichen Schaden reparieren zu lassen.
Hier drang Antonio ein. Wieder lauschte und witterte er. Kein fremder Geruch mischte sich der dumpfen Luft bei. Die Ausdünstung von Ratten, Mäusen, Mardern und Eulen war ganz normal.
Wir können den finsteren Weg nicht verfolgen, den er ohne Licht zu finden wusste. Wir wollen nur sehen, wie er sich im Keller an einer Wand zu schaffen macht, worauf sich ein Stück Mauer herausdreht.
Aber man hätte das ganze Kloster abbrechen können und hätte diese geheime Tür vielleicht doch nicht gefunden.
Unter dem Keller ging es tiefer hinab, noch eine geheime Tür und immer noch tiefer hinab.
Dann abermals eine Tür, und in der Hand des Schreibers flammte es so schnell auf, dass er unmöglich nur Stahl und Feuerstein hatte benutzen können, damals das einzige Feuerzeug, wenn man nicht zum reibenden Feuerbohrer der Wilden zurückkehren wollte. Schon die alten Römer gebrauchten den Holzbohrer nur, um das einmal ausgegangene heilige Feuer der Vesta wieder zu entzünden.
Gleich darauf brannte eine an der Decke hängende, sehr große Lampe, so hell und überhaupt von so besonderer Konstruktion, dass es wiederum keine der sonst bekannten Öllampen sein konnte.
Sie beleuchtete einen weiten, hohen Raum, alle Wände bis zur Decke bedeckt mit Tausenden von Büchern, in Schweinsleder gebunden, nicht alle gedruckt, die meisten handschriftlich geschrieben, und wir wollen gleich verraten, dass darunter sehr viele waren, deren Verlust heute von unseren Gelehrten als unersetzlich beklagt wird, besonders von solchen, welche Geheimwissenschaften treiben oder doch ihre historische Entwicklung, weswegen sie ja noch keine magischen Studien und Experimente zu treiben brauchen.
So zum Beispiel weist Agrippa von Nettesheim, ein zweiter Doktor Faust des 16. Jahrhunderts, aber von historischer Existenz, ein ganz bedeutender Gelehrter — wenn er von magischen Künsten und Geistererscheinungen und dergleichen übernatürlichen Dingen spricht, immer auf sein Hauptwerk hin, wo man dies alles ausführlich beschrieben fände.
Das heißt, wie man dies alles auf ganz natürlichem Wege machen könne! Denn Agrippa war damals der gewaltigste Gegner des Hexen- und anderen Aberglaubens. Deshalb auch wurde er rastlos verfolgt.
Dieses sein Hauptwerk, welches die seltsamsten Rezepte enthalten haben muss, ist verloren gegangen.
Hier stand es in acht dicken Bänden in einem Regal.
Die Titel lauteten in lateinischer Sprache: Wie man Geister erscheinen lassen kann — Wie man Tote beschwört — Wahrhaftige Liebestränke, und wie man sich gegen fremde Willensbeeinflussung wehrt — Magische Künste der verschiedensten Art und ihre Aufklärung. — Und so fort.
Und solcher verschollener Bücher, meistens mit Magie, aber fast immer mit aufklärender, sich beschäftigend, waren hier noch zahllose vorhanden.
Auch auf dem Studiertisch lag ein solches aufgeschlagen, verfasst und selbst geschrieben von dem berühmten Giordano Bruno, dem Meister der damals sogenannten lullischen Kunst, die wir heute Mnemotechnik nennen, und auch Giordano Bruno machte sich schon im 15. Jahrhundert anheischig, jedes ihm einmal vorgelesene Buch, mochte es noch so dick sein, Wort für Wort zu wiederholen, und das noch nach Jahren. Denn dass es in der Gedächtniskunst nicht nur Kniffe gibt, durch deren Anwendung man Wunderbares leisten kann, sondern dass es da auch noch andere Wege gibt, um das Fabelhafteste zu erreichen, das ist gar keine Frage. Natürlich müssen die nötigen Anlagen dazu schon vorhanden sein. Einen Blechkopf kann man schütteln wie man will, er klingt immer nach Blech.
Giordano Bruno hatte sein Geheimnis mit ins Grab genommen. Er hatte allerdings gesagt, er würde es schriftlich hinterlassen, aber man hatte nichts gefunden. Hier lag es auf dem Tische.
Über der Tür, die in einen Nebenraum führte, standen auf dem Schlusssteine lateinische Worte eingemeißelt, mit roter Farbe ausgefüllt. Sie lauteten: In verbis, in herbis, in lapidubus.
In Worten, in Kräutern und in Steinen. Fürwahr, ein ganz vortrefflicher Sinnspruch für einen Magier oder sonstigen Hexenkünstler! Darin nämlich besteht ihre Kraft, daraus schöpfen sie diese. Das ›in Worten‹ hat ganz besonders für unsere Tage Geltung.
Denn der scharfsinnige Leser wird natürlich schon wissen, wie der Graf von Saint-Germain jene Geistererscheinung und alle anderen Phänomene zustande gebracht hatte, was von alledem zu halten ist, in welchem Zustande sich Lord Moore befand.
Die Tür, der dieser Sinnspruch galt, führte in ein Laboratorium, aber ganz anders eingerichtet als das der Gräfin Borghesia.
Der Retorten und Destillierkolben und sonstigen Utensilien waren nicht gerade in großer Menge vorhanden, doch alles in ganz anderem Zustande gehalten, hier wurde wissenschaftlich gearbeitet, und dann nun freilich auf den Regalen Büchsen und Gläser zu Hunderten und Aberhunderten, da gab es kaum eine Chemikalie oder sonstige Substanz, kein Kraut, was auf der bekannten Erde wächst, das hier nicht vorhanden gewesen wäre, da konnte keine Apotheke mit antreten, und die damaligen Apotheken zeichneten sich durch einen ungeheueren Reichtum von Quacksalberbüchsen aus, sie übertrafen darin noch unsere heutigen, die an Auswahl ja auch etwas ganz Hübsches leisten.
Am meisten aber wären auch unseren Augen vier gewaltige, urnenähnliche Gefäße aufgefallen, aus denen Metallplatten hervorsahen, die unter sich mit Drähten verknüpft waren — eine galvanische Batterie, von der die Menschheit damals noch gar nichts wusste!
Zur Speisung des Lichtes genügte der erzeugte Strom allerdings nicht, oder die wirkende Kraft hätte sich doch bald erschöpft — aber immerhin, was für Wunder musste man damals dem Publikum mit solch einer elektrischen Batterie vormachen können!
Das gleiche galt von einer hydraulischen Presse, deren Führungsstangen bis zur Decke hinaufgingen. Von ihr wusste man damals auch noch nichts. Außerdem war sie durch starke Röhren noch mit einem großen Kessel verbunden, der offenbar dazu bestimmt war, zusammengepresste Luft aufzunehmen, die durch ein ganzes Röhrensystem fortgeleitet wurde, und wenn das in Betrieb war, da mussten sich auch recht staunenswerte Überraschungen herbeiführen lassen.
Wo das zum Betriebe nötige Wasser herkam? Nun, der Tiber war dicht in der Nähe, dieser tiefe Keller lag vielleicht, obgleich die Wände vollkommen trocken waren, noch unter dem Strombett, da musste sich schon ein gewaltiger Druck erzeugen lassen, der hier noch verhundertfacht werden konnte, man brauchte wohl nur einen Hahn aufzudrehen, und für den Abfluss des Wassers hatte der geniale Kopf, der dies alles angelegt, wohl auch einen Weg gefunden.
Dann waren noch einige andere seltsame Apparate und Maschinen aufgestellt, deren Zweck wir später kennen lernen werden.
Eine zweite Tür führte in einen dritten Raum. Als auch hier die Öllampe brannte, die aber durch irgendeine Substanz oder Vorrichtung ein für damalige Verhältnisse wunderbar helles Licht ausstrahlte, beleuchtete sie viele Glasschränke, welche ursprünglich wohl nicht dazu bestimmt gewesen waren, die Kleidungsstücke der verschiedensten Zeiten aufzunehmen, bis vor Jahrhunderten, vom Schuh an bis zur Perücke, auch die falschen Bärte nicht zu vergessen, obgleich die Mode sich nie bis zu künstlichen Bärten erstreckt hat. Oder doch? Die alten Ägypter, die man ja immer mit den sorgfältigst zugeschnittenen, künstlich gelockten Bärten abgebildet sieht, sollen diesen Schmuck durch fremde Haare verstärkt haben. Nun, hier fehlten nicht einmal altägyptische Kostüme.
Antonio zog seine Tracht eines wandernden Skribenten aus und wählte dafür... nicht irgendein fremdes Kostüm, sondern den schwarzen Samtanzug, den Lord Moore seinem Gastfreunde geliehen hatte.
Ehe er sich völlig ankleidete, ging er noch einmal hinüber in das Laboratorium, entnahm einer Büchse, welche die Aufschrift ›sandaracum sine sulf‹ trug, eine Handvoll Pillen, steckte sie in die Tasche eines breiten Ledergürtels, den er um den bloßen Leib trug.
»So, mit diesen halte ich es einige Wochen ohne Nahrung und Wasser aus«, sagte er befriedigt. »Merkwürdig, dem einen ist das Arsenik der Tod, dem anderen das Leben. Freilich hat mich mein Meister oft genug vor dem Genusse gewarnt, aber schon kann ich davon nicht mehr lassen. Pillen zur Vertreibung des Schlafes habe ich ja noch genug.«
Er vollendete in dem Kleiderraume seine Toilette. wusch sich an einem Wasserständer, gebrauchte einige Tinkturen, die braune Hautfarbe verwandelte sich in eine blütenweiße, nun Haar und Bart anders gebürstet, und der Graf von Saint-Germain war fertig.
[*] Der eigentliche Name des später bis auf den heutigen Tag so bekannt gewordene Cagliostro, der nie vergaß, sich einen Schüler des Grafen von Saint-Germain zu nennen. Dass dieser nicht so bekannt geworden ist wie sein Schüler, kommt daher, weil er nicht solche Reklame von sich machte. Der immer auf Erwerb bedachte Cagliostro wurde oft genug der betrügerischen Gaukelei überführt, dann sprach alle Welt davon, bis er im Kerker erdrosselt wurde. Der völlig uneigennützige Saint-Germain hat bis zuletzt die angesehensten und geachtetsten Stellungen eingenommen.
Der Wundermann war in das Spukkloster eingezogen. Er hatte gleich die ganze, sehr kostbare Wohnungseinrichtung eines großen Hauses gekauft, dessen Besitzer Rom schnell verlassen musste. Lord Moore hatte seinem Gastfreunde diesen Kauf vorgeschlagen und war beleidigt gewesen, als der Graf von einer späteren Bezahlung gesprochen hatte.
Der Graf hätte auch wirklich keine Einrichtung zu kaufen brauchen. Als bekannt wurde, dass er die kahlen Wände der Klosterzellen und sonstigen Räumlichkeiten mit Teppichen belegen wollte — in den besseren Häusern Italiens sind die Wände mit Steinmosaik ausgelegt oder mit Freskogemälden geschmückt — waren die zum Teil kostbarsten Teppiche und Decken wagenweise eingetroffen, aber auch andere Sachen in Massen, Möbel, ganze Einrichtungen — jeder suchte eine Ehre darin, den Grafen beschenken zu dürfen.
Aber dieser hatte auch nicht die kleinste Kleinigkeit angenommen, alles musste wieder zurückgehen.
Konnte der Graf, der wohl seine Goldmacherkunst nicht für eigenen Nutzen anwenden wollte, so gar nicht in Verlegenheit kommen, so sah es schlimmer mit der zu engagierenden Dienerschaft aus.
Denn der Graf schien seinen ursprünglichen Entschluss, als Einsiedler leben zu wollen, geändert zu haben. Oder auch nicht. Dass er in keine Höhle zu zu ziehen beabsichtige, hatte er ja gleich gesagt, und auch mit aller Dienerschaft kann man ja noch immer als perfekter Einsiedler in so gut wie absoluter Einsamkeit leben.
Den Umzug bis vor das Kloster hatten professionelle Lastträger besorgt, diese aber waren schon kaum zu bewegen gewesen, das Spukhaus zu betreten, ebenso fanden sich nur einige wenige Handwerker, welche am hellen Tage darin arbeiteten, und als bekannt wurde, dass der Graf Diener suchte, meldete sich auch nicht ein einziger. Höchstens aushilfsweise den Tag über. Ständig wohnen, schlafen wollte in dem verfluchten Kloster niemand.
Doch das war nur so der erste Eindruck gewesen, als ob sich kein einziger Diener melden würde. Sie kamen schon noch. Es wäre doch auch merkwürdig gewesen, wenn sich in einer Stadt wie Rom nicht auch geisterfeste Menschen befunden hätten.
Sie kamen. Aber da brauchte man nicht die Augen und die Menschenkenntnis dieses fünftausendjährigen Wundermannes zu besitzen, um gleich zu erkennen, was für Leute das meistenteils waren. Sie hatten alle eine so eigenartige Physiognomie.
Ja, das waren lauter Männer, die sich weder vor dem Teufel noch vor einem sonstigen Geiste fürchteten — also leider auch nicht vor Gott. Es war lauter Lumpengesindel. Wer noch nicht im Kerker gesessen, hatte es nur einem glücklichen Zufall zu verdanken, der ihn noch nicht hatte auf einer verbrecherischen Tat erwischen lassen.
Ein Blick, und der Graf wusste alles, und diese Individuen wurden sämtlich fortgeschickt.
Dann stellten sich aber nach und nach doch noch andere ein.
Wir beschreiben die Annahme eines solchen ausführlicher.
Zunächst muss noch erwähnt werden, dass Lord Moore seine Dienerschaft dem Grafen zur Verfügung gestellt hatte. Das heißt, es sollte gefragt werden, ob einer oder der andere Lust habe, in des Grafen Dienste zu treten. Wer lieber dem Lord diente, der ging ja sowieso nicht, an einem anderen, den etwa die Neugier trieb, war nicht viel verloren.
Aber der Graf hatte von vornherein dieses Anerbieten dankend abgelehnt. Die Dienerschaft der Gesandtschaft bestand ausschließlich aus protestantischen Engländern, und der Graf wollte aus leicht begreiflichen Gründen nur gute Katholiken haben.
Nur einstweilen hatte er einen einzigen mit hinübergenommen. der ihm vorläufig aufwarten oder noch mehr eben die sich meldenden Diener zuführen sollte. Dazu hatte er sich den schon öfters erwähnten Fred ausgesucht, der ihn auch im Hause des Lords bedient, ein sehr intelligenter Bursche, wahrscheinlich ebenso wenig wie Ralph nur so ein einfacher Lakai.
»Jetzt hat sich einer gemeldet, der einen recht guten Eindruck macht. Er heißt Camillo Reggio, hat von Jugend auf bei römischen Herrschaften gedient, hat gute Zeugnisse, auch sein letztes, von einem reichen Kaufmanne, ist ganz ausgezeichnet, der etwa vierzigjährige Mann ist freiwillig gegangen, um sich eine bessere Stellung zu suchen.«
Mit dieser Meldung war Fred bei dem Grafen eingetreten.
Dieser hatte sich in der im Parterre gelegenen geräumigen Zelle des früheren Priors häuslich eingerichtet, der erste Raum, dem etwas mehr Sorgfalt gewidmet war. In den anderen Räumen stand und lag noch alles wild durcheinander.
Ja, der Graf liebte Komfort und hatte Geschmack. Nicht nur dass Boden und Wände mit den besten Teppichen bekleidet waren, die ihm jene verkaufte Wohnungseinrichtung geliefert, sondern der Graf hatte schon mit eigenen Händen arrangiert, türkische Wasserpfeifen, Nippsachen und Raritäten aufgestellt und aufgebaut — es war alles, als hätte er dieses Zimmer schon immer als intimes Boudoir bewohnt.
Jetzt saß er vor dem reichgeschnitzten Schreibsekretär, las und sortierte die vielen Briefe, die ihm Diener und Bettelmönche immer wieder brachten.
Durch das vergitterte Fenster konnte er gerade nach dem Haupteingange blicken, ein in die Umfassungsmauer eingelassenes Tor, vor welchem sich die Gaffer drängten und an dem Fred Wache hielt.
»Es ist nicht nötig, lieber Freund, dass Sie mir immer solche ausführliche Meldungen bringen«, sagte der Graf, ohne sich in seiner Beschäftigung stören zu lassen, mit größter Liebenswürdigkeit, obgleich er immer der unnahbare Herr blieb. »Macht der Mann Ihnen einen guten Eindruck? Entspricht er sonst den Bedingungen? Gut, dann führen Sie ihn zu mir. Nur nicht wieder solche Individuen wie vorhin. So viel Menschenkenntnis haben Sie doch. Und immer nur einen einzigen, Sie schließen jedes Mal das Tor ab. Bitte!«
Fred ging, und bald sah ihn der Graf in Begleitung eines anderen durch den verwilderten Garten zurückkommen.
»Simpler Diener, wird angenommen«, sagte der Graf zu sich selbst. Er hatte nur einen einzigen Blick durch das Fenster geworfen, ließ sich in seiner Beschäftigung sonst gar nicht stören.
Der Mann trat ein, hinter ihm ward die Tür geschlossen, der Graf, in einen scharlachroten Talar gehüllt, ein Morgenkostüm aus der Garderobe des Lords, erhob sich.
»Wie heißen Sie? Wo haben Sie bisher gedient?«
Der Diener berichtete. Die vorgelegten Zeugnisse und sonstigen Papiere wollte der Graf gar nicht sehen.
Bemerkt sei dabei noch, dass der Graf ihn durchaus nicht mit dem bei solchen Figuren stereotypen durchbohrenden Blick, der sich bis ins Herz einbrannte und dort alle Geheimnisse las, ansah. Ganz und gar nicht. Er stand da und benahm sich ganz wie ein normaler Mensch. Allerdings immer mit königlicher Majestät und dabei doch die Freundlichkeit selber. Und dann war sehr die Frage, ob bei diesem Manne nicht alles und jedes Berechnung war, sodass er auch in bewusster Absicht sich zu dem Empfange des Mannes erhoben hatte.
»Sie kennen doch dieses Kloster?«
»Gewiss, Herr Graf, ich bin in Rom geboren.«
»Und Sie fürchten sich nicht, in einem Hause zu wohnen, in dem der ruhelose Geist eines Ermordeten umgeht?«
»Umgehen soll, Herr Graf. Ich glaube an so etwas nicht.«
»Haben Sie dieses Kloster daraufhin schon untersucht?«
»O nein, an so etwas habe ich nie gedacht.«
»Sie sind Katholik?«
»Ja.«
»Sie gehen regelmäßig zur Beichte?«
Es waren dies Fragen, welche der Graf nie vergaß, und wir werden später sehen, was für einen besondern Zweck er damit verfolgte. Denn dieser Mann tat sicher nichts umsonst, stellte auch keine unnötige Frage.
»Nicht so ganz regelmäßig — hin und wieder.«
»Weshalb gehen Sie zur Beichte?«
»Weil — weil... es ist nun einmal so Sitte.«
»Sie werden, wenn Sie in meinen Diensten stehen, regelmäßig zur Kirche und Beichte gehen, soweit es Ihnen der Dienst erlaubt.«
»Wie Herr Graf befehlen. Ich bin ja auch durchaus nicht so ein...«
»Schon gut! Antworten Sie nur, wenn ich frage. Dann aber auch ganz freimütig. Sie bekommen bei mir alles, was Sie brauchen, aber kein Gehalt.«
Der Mann bekam plötzlich ein ganz langes Gesicht.
»Gar kein Geld?«
»Nein. Man soll seinen Mitmenschen umsonst dienen.«
Es war gut, dass der Graf so etwas nicht erst jenen Individuen gesagt hatte; so weit war es bei diesen gar nicht gekommen. Da hätte der Wundermann trotz aller seiner Herrlichkeit etwas zu hören bekommen können!
Ein kleines Überlegen, und ebenso plötzlich ward das lange Gesicht dieses Mannes hier wieder ganz normal.
»Ich bin damit einverstanden, Herr Graf.«
»Mir völlig umsonst zu dienen?«
»Ja.«
»Weshalb gehen Sie auf diese Bedingung ein? Offen!! Ich weiß es nämlich schon!«
»Weil ich, wenn ich dem Grafen von Saint-Germain auch nur drei Tage gedient habe, dann überall die glänzendsten Stellungen bekommen werde.«
Auch das schöne, sonst immer tiefernste und sogar melancholische Gesicht des Grafen konnte lächeln.
»Sehr gut! Sie sind engagiert. Aber Sie werden bei mir bleiben. Denn das hängt von mir ab, und dafür werde ich sorgen. Ich sagte, dass Sie alles bekommen, was Sie brauchen. Wenn Sie ausgehen, so brauchen Sie Geld. Wenn Sie ein Hilfsbedürftiger, etwa ein Verwandter, um Unterstützung bittet, so ist es Ihre Pflicht, ihm zu helfen. Dann kommen Sie zu mir. Was Sie brauchen, erhalten Sie. Alles! Verstehen Sie?«
Wieder veränderte sich das Gesicht des Dieners. Mochte er sonst auch so noch aller Ideale bar sein — solche Worte mussten doch einen gewaltigen Eindruck auf ihn machen! Hatte er bis jetzt noch kein Ideal gekannt — jetzt musste er ein solches vor Augen haben.
»Einen der üblichen Kontrakte mache ich nicht«, fuhr der Graf fort. »Ich kann Sie jederzeit fortschicken, auch Sie können gehen, wann Sie wollen. Dennoch muss ein gewisser Kontrakt gemacht werden, ein Bund geschlossen, und da halte ich es, wie es vor zweitausend... doch das interessiert Sie nicht.«
Der Graf nahm aus dem Schranke des Schreibsekretärs zwei geschliffene Gläser und eine Flasche Wein, Malaga, schon entkorkt, etwas angebrochen. Im Keller des verkauften Hauses war ein ziemlicher Vorrat Wein gewesen, und der Graf hatte überhaupt alles übernommen, schon hierher bringen lassen.
Er schenkte beide Gläser voll.
»Mit diesem gegenseitigen Trunke eines Weines, der in einer Flasche gewesen ist, treten wir in ein Verhältnis zueinander, das man auch einen Bund nennen kann. Ich bin Ihr treuer Herr, und Sie sind mein treuer Diener. Einverstanden?«
»Sehr wohl, Herr Graf.«
Jetzt ward der Diener aber doch etwas erregt. Die Geschichte war ihm neu. Und wie der Graf mit seiner herrlichen Stimme das nun so sagen konnte, so feierlich, obgleich er durchaus kein Pathos gebrauchte.
»Mit dem nächsten Trunke auf diese Weise ist dieser unser Bund wieder gelöst.«
»Ich hoffe doch, dass dies niemals geschehen wird.«
»Von ewiger Dauer ist nichts. Nun trinken Sie, ohne ein Wort weiter zu verlieren.«
Der Diener tat es, auch der Graf leerte mit einem Zuge sein Glas.
Also auch er, der keiner Speise und keines Trankes bedürfen wollte, trank ganz öffentlich ein Glas Wein. Dieser Mann wäre nicht das gewesen und geworden, was er war und wurde, hätte er nicht für alles Ausnahmen gehabt, hätte er nicht stets so gehandelt, wie er zu handeln für gut befand. Sonst wäre er immer einer der gewöhnlichen Scharlatane geblieben.
»Nun setzen Sie sich dort auf den Stuhl, ich habe noch etwas zu erledigen, dann sprechen wir weiter über Ihre Dienstpflichten.«
Der Diener gehorchte. Kaum hatte er sich gesetzt, als ihn eine große Müdigkeit befiel. Wie kam das?
Er war doch sonst an jeden Wein gewöhnt? Auch bei ganz nüchternem Magen hatte er oft genug im Keller den Geschmack seiner verschiedenen Herrschaften nachgeprüft, und niemals...
Ehe er sich weitere Rechenschaft darüber geben konnte, war er in dem Lehnstuhl eingeschlafen.
Ohne einmal nach ihm geblickt zu haben und noch ehe der Schläfer etwas zu schnarchen begann, war der Graf sofort wieder von dem Schreibsekretär aufgestanden.
Er trat vor den Schläfer hin, der jetzt zu schnarchen anfing, und schob ihm mit zwei gespreizten Fingern geschickt die Augenlider in die Höhe.
Nur das Weiße vom Auge war zu sehen, die Pupillen hatten sich ganz nach oben verschoben. Doch ist das der Zustand des Auges auch im natürlichen Schlafe, nicht etwa nur in der Hypnose. Übrigens ist auch die Hypnose nichts weiter als ein ganz natürlicher, sehr tiefer Schlaf.
Denn der Graf von Saint-Germain konnte schon fünfundzwanzig Jahre vor Mesmer hypnotisieren! Es ist dies historisch nachgewiesen worden. Er kannte die Hypnotik mit all ihren Erscheinungen und praktischer Ausnutzung, auch den posthypnotischen Befehl. Nur eins ging ihm ab: Er wusste nicht, dass man solchen Schlaf durch magnetische Striche, durch Anstarrenlassen eines glänzenden Gegenstandes und durch andere Manipulationen, ja, nur durch scharfes Ansehen, künstlich erzeugen kann. Der Graf von Saint-Germain gab die hypnotischen Suggestionen entweder im natürlichen Schlafe oder er führte diesen erst durch ein Schlafmittel herbei. Die Methode, die dann Mesmer einführte, kannte er nicht, und er scheint nie auf den Gedanken gekommen zu sein, dass man einen Menschen schon durch Willensbeeinflussung allein, nur durch Hilfsmittel unterstützt, welche die Aufmerksamkeit konzentrieren, einschläfern kann.
Sonst experimentierte er genau so wie unsere heutigen Hypnotiseure, wandte dieselben Proben an.
Es sei hier kürzer wiedergegeben, als es in Wirklichkeit geschah.
»Sie hören mich sprechen!«
Derselbe Befehl musste mehrmals wiederholt werden, dann lallte der Schläfer mit schwerer Zunge ein Ja.
»Sie werden mir gehorchen! Was werden Sie tun?«
»Ihn — Ihnen — ge — ge...«
»Sie können ganz leicht und fließend sprechen! Ich befehle es Ihnen! Was werden Sie tun?«
»Ihnen gehorchen«, erklang es jetzt ganz anders.
Das wurde noch viel ausführlicher behandelt. Der Graf machte den Diener zum willenlosen Sklaven, auch für den bewussten Zustand.
»Sie haben mir immer die absolute Wahrheit zu antworten.«
»Immer absolute Wahrheit.«
»Sind Sie schon einmal gerichtlich bestraft worden?«
»Nein.«
»Haben Sie einmal etwas begangen, wofür Sie gerichtlich bestraft zu werden verdienten?«
»Nein«, erklang es wiederum, aber anders als vorhin, das Ohr des Grafen wenigstens hatte sofort etwas herausgehört.
»Sie müssen mir unbedingt die Wahrheit gestehen, ich befehle es Ihnen!!«
Aber statt dessen ward das Zögern nur stärker, ohne dass der Mann gestand.
Es hat eben alles seine Grenzen, alles, also auch die Macht der Hvpnotik. Der liebe Gott sorgt schon dafür, dass keine Bäume in den Himmel wachsen können. Es gibt innere Widerstände, die durch keine hypnotischen Befehle zu überwinden sind.
Allerdings gibt es hierfür immer noch Mittel, und der Graf wandte sie an.
»Ich bin Ihr Freund. Nicht wahr, ich bin Ihr bester Freund? Ich war doch überhaupt dabei, Sie haben es mir ja schon einmal gestanden.«
So und anders sprach der Graf, wusste auf diese Weise den Mann zu einem Geständnis zu bringen.
Er hatte einmal, schon vor vielen Jahren, eine kleine Summe unterschlagen, deren er in einer Geldverlegenheit dringend bedurfte, hatte sie bei der ersten Gelegenheit zurückerstattet, allerdings so, dass sein Vergehen dabei nicht zutage gekommen war, und diese Tat lag doch noch immer schwer auf seinem Gewissen — ein Zeichen, dass es ein über den Durchschnitt ehrlicher Mensch war.
Aber wer sagte denn, dass er hiermit auch die Wahrheit sprach, dass er durch Gestehen dieses kleinen Vergehens nicht nur ein viel größeres verdecken wollte?
Nein, unsere Justiz ist vollkommen im Recht, wenn sie von der ganzen Hvpnotik nichts wissen will. Es ist denkbar, und es ist auch schon oft genug vorgekommen, dass sich ein Verdächtiger, bei dem man die Hypnose anwendete, nur schlafend stellte, er hat sich mit Nadeln stechen lassen, ohne mit einer Wimper zu zucken, um dann seine Tat abzuleugnen, oder auch in wirklicher Hypnose blieb sein Willenswiderstand größer als die Macht des Hypnotiseurs, noch im Schlafe behielt er seine Schlauheit bei, wusste die Richter durch ein scheinbares Geständnis auf eine falsche Spur zu führen. Wohin sollte das also führen, wenn man jedem Geständnisse im hypnotischen Schlafe definitive Gültigkeit beilegte. Vielleicht mag es noch einmal so weit kommen, aber heute darf es noch nicht sein.
Und auch der Graf von Saint-Germain wusste schon, wie unzuverlässig in dieser Hinsicht die Hypnose ist. Ohne sich weiter durch Fragen zu überzeugen, ob diese Angaben auch wirklich auf Wahrheit beruhten, zog er aus seiner Tasche eine Kapsel, entnahm dieser eine Zitrone, von der er bereits eine Scheibe abgeschnitten hatte. Also er war schon vollständig darauf vorbereitet gewesen, die Diener, welche er annehmen wollte, zu hypnotisieren, die Zitrone spielte die Rolle der jetzt so beliebten rohen Kartoffel, die der Hypnotisierte als einen Apfel essen muss.
»Nehmen Sie diese Apfelsine!«
Der Hypnotisierte, der die Augenlider zuletzt von selbst wieder geschlossen hatte, streckte die Hand aus und bekam die Zitrone.
»Das ist eine schöne, süße Apfelsine, zuckersüß. Was ist das?«
»Eine schöne, zuckersüße Apfelsine«, wurde wiederholt.
»Essen Sie dieselbe.«
Gehorsam biss der Hypnotisierte hinein, und obgleich der Graf wohl eine möglichst saure Frucht ausgewählt hatte, verzog jener doch keine Miene.
»Wie schmeckt die Apfelsine?«
»Schön, zuckersüß!«
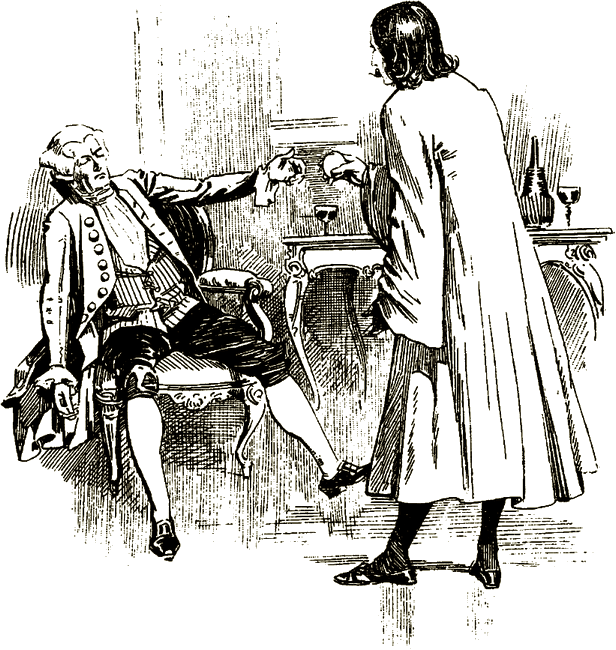
Die Zitrone wurde ihm weggenommen. Der Graf zog aus der Rockklappe eine lange Nadel.
»Ich habe hier eine Nadel, mit der werde ich Sie in den Arm stechen.«
Sofort durch Verziehen des Gesichtes schon jetzt Zeichen des Schmerzes, schwache Versuche, die Hand mit der Nadel von sich abwehren zu wollen.
..Aber Sie werden keinen Schmerz verspüren. Verstehen Sie? Ich befehle Ihnen, nicht den geringsten Schmerz zu verspüren!«
Der Graf bohrte ihm die Nadel ganz nachdrücklich in den fleischigen Teil des Oberarms. Der Hypnotisierte zuckte mit keiner Wimper.
»Fühlen Sie einen Schmerz?«
»Nein.«
Obgleich dies alles, wie schon erwähnt, noch längst kein definitives Beweismittel war, dass sich jener wirklich im hypnotischen Schlafe befand — besonders hysterische Frauen leisten in der Verstellungskunst Außerordentliches, da ist ein Unterscheiden von Wahrheit und Lüge heute überhaupt noch gar nicht möglich — glaubte der Graf seiner Sache jetzt doch so ziemlich sicher zu sein. Er besaß eben keine anderen Prüfungsmittel mehr.
»Wie heißen Sie?«
»Camillo Reggio.«
»In welchen Stellungen sind Sie bisher gewesen?«
Der Diener zählte die einzelnen Herrschaften auf.
»Weshalb haben Sie die letzte verlassen?«
Er hatte sich verändern wollen.
»Weshalb haben Sie sich bei mir gemeldet?«
Wie man eben auf eine andere Stellung reflektiert, und bei dem Wundermanne zu dienen, hatte noch einen besonderen Reiz.
»Sie erhalten aber bei mir keinen Lohn.«
»Nein.«
»Sie sind damit zufrieden.'«
»Ja.«
»Wie können Sie mit solch einer Bedingung zufrieden sein?«
»Wenn ich nur drei Tage bei dem Grafen von Saint-Germain gedient habe, so werde ich dann überall die glänzendsten Stellungen angeboten bekommen.«
Der Diener wiederholte also ganz genau dasselbe, was er schon im bewussten Zustande gesagt hatte — und weiter wollte der Graf ja auch nichts hören. Er wollte sich nur davon überzeugen, dass die Diener, die sich bei ihm meldeten, nicht etwa Hintergedanken hätten.
Wie der Graf von solchen Geständnissen, die man ihm im hypnotischen Zustande offenbarte, niemals einen verwerflichen Gebrauch machte, das werden wir im Laufe des Romans erkennen.
»Sobald ich das Wort ›Alatos‹ ausspreche, werden Sie erwachen. Wie heißt das Wort?«
»Alatos.«
Es war dies ein aus der Luft gegriffenes Wort, ohne jede Bedeutung, welches also im Laufe einer Unterhaltung niemals vorkommen konnte, und dies zeigte wieder, was für eine Erfahrung der Graf im Hypnotisieren schon hatte, oder aber, was für einen Lehrmeister er darin gehabt. Er konnte es mit dem modernsten Hypnotiseur aufnehmen.
»Sie werden vollständig erinnerungslos erwachen.«
Das wurde noch des Längeren angeführt. Der Mann durfte keinen sauren Geschmack mehr im Munde haben, nichts von dem Nadelstiche mehr fühlen — was alles recht wohl möglich ist.
»Sie sind nach dem Glase Wein etwas schläfrig geworden, Sie reiben sich einmal die Augen, und die Müdigkeit ist sofort verschwunden. Sie haben keine Ahnung davon, dass Sie wirklich eingeschlafen sind.«
»Keine Ahnung davon.«
»Sobald Sie mich jemals das Wort ›Teloka‹ aussprechen hören, fallen Sie sofort wieder in Schlaf.«
»Ja.«
»Wie heißt das Wort?«
»Teloka.«
»Was tun Sie dann?«
»Dann falle ich wieder in Schlaf.«
»Und wenn dieses Wort nun ein anderer ausspricht?«, fragte der vorsichtige Graf noch.
»Dann — dann...«
So ganz hatte es der Mann doch noch nicht begriffen, der Graf musste es ihm klarzumachen.
»Nur, wenn ich dieses Wort ausspreche, hat es diese Wirkung.«
Er vergewisserte sich, dass der Diener ihn verstanden hatte. Aber das ging noch weiter.
»Sie werden mir auch in völlig wachem Zustande immer bedingungslos gehorchen.«
»Immer bedingungslos gehorchen.«
»Und wenn ich Ihnen befehle, Sie sollen Ihren Freund ermorden, so werden Sie es tun.«
Zeichen von großer Unruhe, Widerstand des Willens.
»Sie werden es tun, ich befehle es Ihnen, und Sie haben mir willenlos zu gehorchen!!«
»Ich werde es tun«, gab der Hypnotisierte schließlich nach und wiederholte auch, was er tun werde: seinen besten Freund ermorden.
»Sprechen Sie Französisch?«, lautete dann plötzlich eine andere Frage.
»Nein.«
»Aber Sie wissen doch, was das heißt: ›au revoir‹.«
Ja, das hatte der Diener schon oft genug gehört.
»Sie gebrauchen diesen Abschiedsgruss sonst niemals?«
»Niemals.«
»Wenn ich Sie dann hinausschicke, werden Sie im Hinausgehen zu mir sagen: ›au revoir, monsieur‹. Was werden Sie sagen?«
»Au revoir, monsieur.«
Die Lektion war beendet. Der Graf begab sich an den Schreibsekretär zurück, setzte sich.
»Alatos«, sagte er in scharfem Tone, sich über die Briefe beugend.
Mit einem Ruck fuhr der Schläfer zusammen, rieb sich die Augen, blickte dann ganz normal nach dem Grafen, als wäre gar nichts geschehen. Er sollte ja ohne Müdigkeit erwachen.
»Nun, es ist gut. Bleiben Sie draußen im Vorzimmer, bis ich Sie rufe. Da ich vorläufig nur einen einzigen Diener habe, könnten Sie doch einmal gebraucht werden. Sie können dann heute Abend ausgehen, da Sie doch noch etwas zu besorgen haben werden.«
Der Diener stand auf, schritt nach der Tür.
»Au revoir, monsieur«, sagte er, als er diese öffnete.
»Was sagten Sie da?!«, rief der Graf ihm mit scheinbarer Überraschung nach.
Der Diener machte ein ganz verblüfftes Gesicht.
»Ich weiß selbst gar nicht, wie ich dazu komme...«
»Schon gut, gehen Sie.«
Als der Graf allein war, schüttelte er nachdenklich und wie wehmütig den Kopf.
»Wehe, wenn diese geheimnisvolle und doch so leicht auszuübende Macht bekannter und wenn sie von unrechten Händen ausgeübt würde! Was für unsägliches Unglück könnte damit angestiftet werden!«
Hiermit hatte sich der Graf eigentlich schon das beste Zeugnis ausgestellt, nämlich, dass er selbst diese Macht niemals zu unrechten Zwecken benutzen wolle.
Er nahm aus dem Schranke des Sekretärs ein Büchlein, dessen Blätter mit einer Geheimschrift beschrieben waren, trug etwas ein.
Wir wollen diese Geheimschrift entziffern können. Er schien seinem Gedächtnis doch nicht allzu sehr zu vertrauen, denn er trug unter dem Namen dieses Dieners die beiden Stichworte ein, die er ihm gegeben, das Datum und noch einige andere Bemerkungen, die dem Manne nur zur Ehre gereicht hätten. Das Haupturteil über ihn lautete: biederer, zuverlässiger Charakter.
Vor dem Namen des Dieners stand die Nummer 18.
Unter Nummer 17 war vermerkt: Fred Miller, scheinbar einfacher Diener bei Lord Moore, in Wirklichkeit englischer Kriminalbeamter — und dann folgten die beiden aus der Luft gegriffenen Stichworte, die auch diesen Mann einschläferten und wieder erwachen ließen.
Nummer 16: Ralph Marusko, genannt Oxley, Leibdiener von Lord Moore, in Wirklichkeit der englische Baronet Oxley, der den Detektivberuf aus Liebhaberei betrieb, wegen seiner Verdienste zum Baronet ernannt wurde — und wieder zwei Stichworte.
Unter Nummer 15 war Lord Walter Moore selbst unter den Hypnotisierten aufgeführt, die jetzt willenlos dem Grafen dienen mussten.
Nummer 14 war der Pater Hilarion, betrunken in einem Straßenwinkel gefunden und so hypnotisiert. Beichtvater der Herzogin Ludmilla von Borghesia, Nichte des Papstes, lautete hier die hauptsächlichste Bemerkung.
Auch unter den anderen dreizehn Personen waren einige Mönche, aber auch zwei Nonnen, sonst noch Handwerker, Arbeiter und verschiedene Individuen, deren Adresse der Graf auch in der Hypnose nicht hatte erfahren können, weil sie eben keine Wohnung hatten.
Die Hypnotisierung dieser dreizehn Personen lag zum Teil schon um viele Jahre zurück, mit den letzten vier war es schnell gegangen.
Am dritten Juni war der Graf im Keller der Villa der heiligen Thekla als hundertjährige Leiche gefunden worden, und doch hatte er den Pater Hilarion erst am Tage zuvor hypnotisiert. Am vierten Juni war der Lord Moore darangekommen, wozu aber noch die Bemerkung gemacht worden: eigentlich am fünften früh um drei von selbst durch Übermüdung eingeschlafen — und noch an demselben Tage hatten Ralph und Fred daran glauben müssen — durch unbemerkt beigebrachtes Schlafpulver.
Der Graf legte das Büchelchen weg, griff zu den Briefen.
Einige hatte er schnell gelesen, als er stutzte.
»Was für eine merkwürdige Handschrift ist das?!«
Dieser Brief war erst heute durch einen Bettelmönch gekommen. Der Schreiber nannte sich Joseph Balsamo, musste nach den angeführten Personalien ein neunjähriger Knabe sein. War Waise, geboren zu Palermo, war zuerst im dortigen Seminar des heiligen Rochus erzogen worden, später im Ordenskonvent der barmherzigen Brüder zu Caltagirone, war dort wegen schlechter Behandlung entlaufen, hatte sich nach Rom durchgeschlagen, trieb sich seit einigen Tagen obdachlos umher, beschwor den hochedlen Grafen, ihn doch als Diener anzunehmen, er würde sein Bestes tun, der Graf würde es nie bereuen, und so fort mit noch einigen flehenden Bitten.
Vor allen Dingen wunderte sich der Graf jetzt über diese steile, feste, ausgeprägte, ganz merkwürdige Handschrift.
»Ein felsenstarker, durchaus origineller Charakter«, analysierte er diese Handschrift, und wir werden noch sehen, wie der Graf das Beurteilen von Handschriften zu seinem Spezialstudium gemacht hatte, was ja vor noch gar nicht so langer Zeit wieder in Flor gekommen ist. »Aber die Verbindung der einzelnen Buchstaben ist verdächtig, das ist das Zeichen eines schlauen, ganz raffinierten Charakters, der eigentümliche Schnörkel lässt auf maßlose Habgier und Böswilligkeit schließen, der Stil wiederum auf Verschwendungssucht. Wie, ein neunjähriger Knabe hätte den Brief geschrieben? Ganz ausgeschlossen! Das ist die Schrift eines reifen Mannes, der genau weiß, was er will. Und wehe dem, der von diesem Manne abhängig wird! An diesem könnte selbst ich meinen Meister finden. Diesen Mann muss ich unbedingt kennen lernen, den muss ich an mich...«
Erschrocken brach der Graf ab. Auch dieser Mann konnte erschrecken. Und es war danach angetan. Es musste etwas durchs Fenster geflogen gekommen sein, das wusste der Graf ganz bestimmt, er hatte die weiße Erscheinung sofort im Auge gehabt — und er sah es noch jetzt durch das geräumige Zimmer fliegen, es war nahe der Tür oben an der Decke, wie ein weißer Winkel, dort kehrte er, einen Bogen beschreibend, aber ohne die Wand berührt zu haben, um, flog, sich senkend, durch das Zimmer und lag gerade vor dem Grafen auf der Tischplatte.
Vollständig verblüfft starrte der Graf den Papierwinkel an. Ja, es war ein Stück Papier, mehrmals zusammengefaltet, sodass es mehrfache Winkel bildete, schon mehr eine Halbkreisform, als solche aber noch immer einen ziemlich rechten Winkel beschreibend.
Hätte der Graf schon etwas von einem australischen Bumerang gehört, so würde er sofort darauf gekommen sein, dass hier ein solcher durch Papier nachgebildet worden war. Da er aber auch später hiervon nichts sagte, so kannte er augenscheinlich diese merkwürdige Waffe der Australneger nicht, über die sich noch heute unsere Gelehrten den Kopf zerbrechen, wie nämlich diese armseligen Wilden dieses Wurfgeschoss erfunden haben, wie sie gerade diesen Winkel herausgetüftelt haben, der unbedingt gerade diese Biegung haben muss, dass das Stück Holz, wenn es sein Ziel verfehlt hat, nach dem Werfer zurückkehrt, oder überhaupt in der Luft umbiegt und dorthin fliegt, wohin der geübte Schleuderer es haben will. Diese am tiefsten stehenden Australneger haben hierdurch tatsächlich das Problem des UmdieEckeSchießens gelöst.
Scheu, als habe er eine Mitteilung aus dem Jenseits erhalten, griff der Graf nach dem Papierwinkel. Aber ehe er ihn nahm, blickte er noch einmal nach dem Fenster.
Dieses war vergittert. Die viereckigen Felder waren so groß, dass man eben den Kopf durchstecken konnte. Unbedingt musste dieser Winkel durch eins dieser Quadrate geworfen worden sein. Draußen war niemand zu sehen.
»Und wenn auch — wie konnte dieser Winkel nur dort in der Ecke umdrehen und gerade hierher fliegen?!«
Sich zusammenraffend, da er hierfür jetzt doch keine Antwort fand, öffnete der Graf das zusammengefaltete Papier.
Wieder die merkwürdige, charakteristische Handschrift!
Hochedler Herr Graf! Ich habe mir erlaubt, Ihnen einen Brief zu schreiben, in dem ich Sie bitte, mich als Diener anzunehmen. Sie müssen den Brief schon bekommen haben. Bitte, bitte, nehmen Sie mich an. Sie werden es nicht bereuen. Wenn ich auch erst neun Jahre alt bin, so kann ich Ihnen doch Dinge vorma>chen, die Sie und noch kein anderer Mensch gesehen haben. Ich stehe draußen vor dem Klostertor, Ihr Diener will nichts von mir wissen, ich sei noch zu klein.
Joseph Balsamo.
Noch einige Minuten starrte der Graf, scheinbar ganz fassungslos, das Schreiben an, dann wusste er, was er zu tun habe. Er nahm einen Klöppel und schlug gegen eine über dem Tisch hängende Glocke. Der Ton war so gellend, dass der draußen harrende Diener sofort wissen musste, er sei gerufen worden, ohne dass ihm das vorher erst gesagt worden war.
»Herr Graf befehlen?«
»Hole mir den draußen vor dem Tore stehenden anderen Diener.«
Fred kam.
»Steht draußen ein etwa neunjähriger Junge, der seine Dienste anbietet?«
Fred fing gleich an zu lächeln.
»Ja, mehr ein noch ungelenker Bär als ein Mensch, er besteht hauptsächlich aus einem Rumpfe mit einem ungeheuren Kopfe, viel mehr ist nicht an ihm. Er wollte partout den Herrn Grafen...«
»Hat er ein Stück Papier zusammengefaltet und hier hereingeworfen?«
»Hier hereingeworfen?«, wiederholte Fred verwundert. »Wie soll denn das möglich sein. Er sagte, er habe dem Herrn Grafen geschrieben — das haben noch viele Hundert andere — dann zeigte er mir noch einen Brief, ich sollte ihn Ihnen jetzt gleich abgeben, aber das wollen alle anderen auch... hereingeworfen soll er den Brief haben? Da müsste er ja geradezu in den Garten gekommen sein.«
»Er war nicht im Klostergarten?«
»Ganz unmöglich! Hier ist kein lebendiger Mensch hereingekommen.«
»Führe den Knaben zu mir!«
Der Graf sah ihn schon durch den Garten kommen, und das genügte bereits, um seine Augen ganz groß zu machen, und dann stand der Junge vor ihm.
Ein ganz, ganz merkwürdiger Bursche! Noch sehr klein für sein Alter, verfügte er über einen sehr ansehnlichen Rumpf, gegen den die anderen Gliedmaßen gar nicht in Betracht kamen, und auf diesen für einen neunjährigen Knaben ungeheuer breiten Schultern nun ohne Hals ein wahrer Büffelkopf, in dem das Bemerkenswerteste wiederum die großen, durchdringenden, feurigen Augen waren.
Er war sehr dürftig gekleidet, aber ganz unbefangen war er eingetreten, stand so vor dem Grafen, der, im Lehnstuhl sitzend, ihn unverwandt mit offenbarem Staunen betrachtete, lange, lange Zeit.
Wusste dieser unvergleichliche Menschenkenner schon, dass ihm das Schicksal in diesem Knaben den zukünftigen Mann zuführte, der einst seinen eigenen Ruhm, freilich stark gepaart mit Berüchtigtkeit, weit in den Schatten stellen sollte?
Aber auch dieser Knabe musste schon etwas ahnen, auch er musterte den vor ihm Sitzenden mit so herausfordernden Blicken.
Jedenfalls war es im Reiche der historischen Abenteurer eine bedeutende Begegnung, diese erste hier, und schon bei dieser konnte man den gewaltigen Unterschied der beiden erkennen, trotz aller sonstigen Gemeinschaft. Der Graf ein wirklich feiner, vornehmer Mann, ein geborener Aristokrat vom Scheitel bis zur Sohle, nur durch ein falsches Ideal vom rechten Wege abgelenkt — auf der anderen Seite der plumpe Emporkömmling, alles Berechnung, Schlauheit, Tatkraft und Rücksichtslosigkeit — der neunjährige Cagliostro, zu dem später selbst ein Kardinal Rohan und ein Lavater gläubig emporblickten, und am besten vielleicht wird der Einfluss dieses Mannes auf seine Zeit durch die Erwähnung charakterisiert, dass damals Damen und Herren ihre Fächer, Ringe, Hüte, Westen, Hosen usw. à la Cagliostro trugen.
Minutenlang hatten sich die beiden betrachtet, gemessen, und Minuten bedeuten für so etwas schon eine kleine Ewigkeit!
»Wie heißt du? Wer bist du?«
Joseph Balsamo hatte über sich nichts weiter zu berichten, als er schon in dem Briefe erwähnt hatte.
»Du hast diesen zweiten Brief hier hereingeworfen?«
»Ja.«
»Dort von dem Tore aus?«
Dieses befand sich mindestens 30 Meter von dem Fenster entfernt.
»Ja. Das heißt, daneben. Ich musste auf die Mauer klettern. Durch die Mauer kann ich nicht werfen. Da sah ich Sie sitzen, und ich schleuderte meinen schon zusammengefalteten Brief.«
»Mit der Bestimmung, dass der Brief hier in dieses Zimmer fliegen sollte?«
»Gewiss.«
»Das Fenster ist vergittert «
»Das konnte ich sehen, danach zielte ich.«
»Du konntest von dort aus sehen, dass dieses Fenster vergittert ist?!«
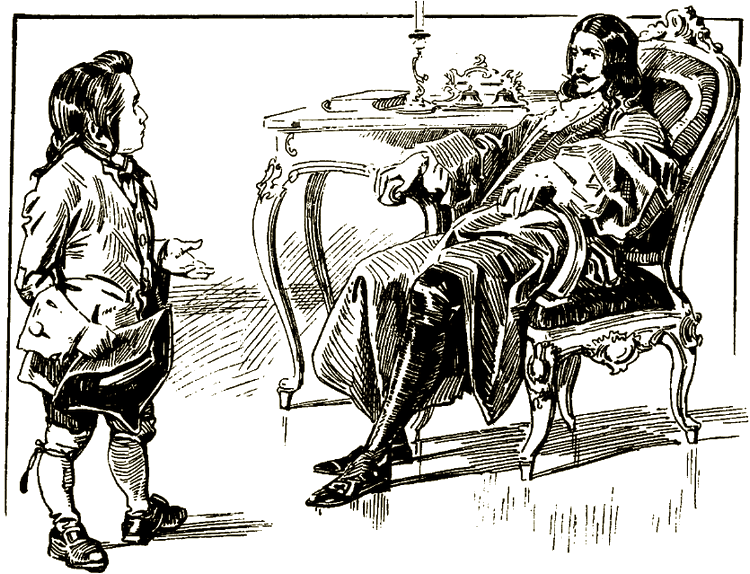
»Gewiss.«
»Und du warfst so, zieltest so, dass der Brief gerade durch eine der kleinen Abteilungen, keinen Quadratfuß groß, fliegen musste?«
»Ich kann so gut werfen.«
»Gar nicht glaublich!!«
»Wenn man etwas kann, was andere Menschen nicht können, so ist es immer gleich Hexerei, und es ist ganz gut, dass es so ist, und man muss nur dafür sorgen, dass es so bleibt.«
Starr blickte der Graf den Jungen an. Ahnte er schon etwas?
»Du hast dich im Werfen geübt?«
»Ja.«
»Weshalb?«
»Es machte mir Spaß, ich hatte auch immer großes Talent dazu, schon als ganz kleiner Junge konnte ich auf dreißig Schritt jeden Vogel mit dem Stein treffen, dann sogar im Fluge.«
»Hattest du denn im Waisenhause Zeit zu solchen Übungen?«
»Zeit und Gelegenheit hat man immer, wenn man sie haben will. Natürlich ließ ich mich niemals dabei beobachten.«
»Warum sagtest du: natürlich?«
»Mit solchen Übungen wären meine Lehrer wohl nicht einverstanden gewesen. Ich wollte überhaupt nicht, dass jemand von dieser meiner Geschicklichkeit etwas erführe.«
»Warum nicht?«
»Das habe ich schon vorhin gesagt. Es ist immer gut, wenn man etwas kann, was andere Menschen nicht können, nur muss man seine Geschicklichkeit nicht gleich so zeigen.«
»Du hast deine Geschicklichkeit im Werfen niemals gezeigt?«, examinierte der Graf, der wohl zu examinieren verstand, weiter, und er examinierte doch jedenfalls auch nicht ohne Grund. Er durchschaute diese Kindesseele sofort — — soweit diese sich durchschauen ließ.
»Niemals. Ich benutzte sie nur, um jemand einmal einen Possen zu spielen, warf ihm von Weitem einen Stein oder sonst einen Gegenstand in die Tasche, und dann war das natürlich Zauberei.«
»Und du hast niemals Aufklärung gegeben?«
»Ich hätte mich doch gehütet, dann wäre es ja gleich vorbei gewesen!«, lachte der Junge.
Der Graf examinierte noch weiter, und er erfuhr, dass der Junge in den beiden Erziehungsanstalten schon immer einen künstlichen Spuk in Szene gesetzt hatte.
»Und warum offenbarst du das jetzt mir?«
»Weil ich denke, dass Sie mich deswegen recht gut gebrauchen können.«
Der Graf zuckte zusammen — so leicht, dass es wohl niemand bemerkt hätte. Ob es aber auch diesen funkelnden Augen entgangen, das war sehr die Frage.
»Wieso soll ich... genug! Musste der Brief dazu unbedingt so eigentümlich zusammengefaltet sein?«
»Ja, wenn er in der Luft umkehren soll, sodass es aussieht, als ob das Papier zuletzt aus einer anderen Ecke geflogen käme.«
Der Junge erläuterte die Faltung näher. Mit Macht musste der Graf sein Staunen unterdrücken. Der neunjährige Junge hatte selbstständig das geometrische Flugphänomen des australischen Bumerangs entdeckt, von dem freilich auch der Graf noch nichts wusste, und eben deswegen bekam er hier etwas völlig Neues zu hören und zu sehen, und sein scharfer Geist erkannte auch gleich das Wunder.
Dann musste ihm der Junge einige Wurfübungen im Zimmer vormachen, und von Neuem konnte der Graf staunen, wie Joseph den Papierwinkel nach einer ganz anderen Richtung warf und doch genau wieder auf der Stelle niederfallen ließ, die der Graf vorher bezeichnet hatte.
»Aber das muss gelernt sein, das ist nicht so einfach, probieren Sie's nur einmal.«
Der Graf war klug genug, solche Versuche nicht anzustellen, er hatte nur eine abweisende Handbewegung dafür.
»Das ist ja ganz interessant, aber du denkst, wegen dieser Geschicklichkeit werde ich dich gleich engagieren?«
»Ich dachte, solche Gaukelei könnten Sie gerade recht gut brauchen.«
»Was werde ich brauchen können?!!«, stieß der Graf hervor.
Der Junge schaute sich pfiffig um.
»Wir sind doch hier allein, dass uns niemand belauscht?«
»Das sind wir wohl, aber... was für eine Sprache wagst du da?!«
»Na, ich habe doch schon alles über den Herrn Grafen gehört.«
»Was hast du gehört?!«
Eben alles, was jetzt ganz Rom wusste, über etwas anderes wurde ja gar nicht mehr gesprochen, und dazu war nun noch die Geistererscheinung gekommen, wie der dematerialisierte Geist des im Starrkrampf Liegenden dem Lord erschienen war.
Dieser hatte den Grafen gefragt, ob er davon erzählen dürfe, und der Graf hatte nichts dagegen einzuwenden gehabt. Nur über die Erscheinung der polnischen Prinzessin hatte der Lord im eigenen Interesse geschwiegen, auch den Grafen deswegen um Diskretion gebeten.
»Wie man so seine eigene Figur als Geist erscheinen lassen kann«, fuhr der kleine Joseph unverzagt fort, »wie das gemacht wird, das weiß ich freilich noch nicht, aber sonst... ich kann auch schon viel machen.«
»Was kannst du machen?!«, konnte der Graf immer nur hervorbringen.
»Nun, zum Beispiel Gold kann ich machen.«
»Was kannst du machen?!«, blieb es seitens des Grafen dabei, und wunderbar war es nur, wie dieser Mann sich sonst in der Gewalt hatte.
»Gold! Wie Sie das mit dem Paolo machten, weiß ich freilich nicht, aber wenn Sie's mir einmal vormachen, werd' ich's schon nachmachen können. Und dann habe ich mein eigenes Mittel, Gold machen zu können, und nicht etwa mit dem Wachsstock.«
Von der Platte des Schreibsekretärs flatterte ein Papier herab, der Graf bückte sich schnell, wohl nur, um sich unbemerkt einmal auf die Lippen beißen zu können.
»Du hast wohl gar schon selbst Alchimie getrieben?«
Erst jetzt stellte es sich heraus, dass der kleine Joseph im Ordenskonvent zu Caltagirone ausschließlich in der Klosterapotheke beschäftigt worden war, in der die Mönche aber weniger heilende Medizinen, als vielmehr Gold herzustellen versucht hatten, wie es damals eben allgemein üblich gewesen war.
Und nun erzählte der Junge ganz offen, wie er solch einen alten Pater, der Tag und Nacht in seinem eigenen kleinen Laboratorium experimentierte, immer gefoppt habe, indem er ein Quecksilber bereitete, welches beim Verdampfen einen Rückstand von Gold hinterließ. Der alte Quacksalber glaubte eben, wirklich Gold machen zu können, und da ihm der kleine Joseph immer dabei assistiert hatte, verlebte dieser im Kloster die herrlichsten Tage.
Freilich gestand er auch gleich — und seine Offenherzigkeit war sicher nicht ohne Berechnung — dass er zuletzt dabei erwischt worden sei, wie er unter das Quecksilber Gold mischte, da war es mit den schönen Tagen vorbei, und Joseph zog vor, heimlich Reißaus zu nehmen, anstatt die härtesten Strafen zu erleiden.
»Aber das geht auch noch ganz anders zu machen, dass einen niemand dabei so leicht erwischen kann.«
»Wie denn?«
»Ich will's Ihnen mal vormachen. Dann werden Sie das gerade so unerklärlich finden wie die Leute Ihre Gaukelei mit dem silbernen Paolo, und wenn Sie mir dann sagen, wie man Ihre Geschichte macht, besonders womit man sich die Hände einreibt, dass man sie nicht verbrennt, dann erzähle ich Ihnen auch mein Geheimnis. Denn das kriegen Sie niemals heraus.«
Der Graf starrte auf den Jungen wie auf ein Phantom herab.
»Und wegen der Geistererscheinung«, fuhr dieser fort, »da will ich Ihnen etwas vormachen, was nun wieder Sie mir nicht nachmachen können.«
»Was denn?«
»Geben Sie mir doch einmal irgendeinen kleinen Gegenstand, den Sie genau kennen. Vielleicht Ihr Petschaft.«
Des Grafen Hand zitterte leise, als er dieses vom Tische nahm.
Der Junge nahm es, betrachtete es, gab es dem Grafen zurück.
»Ist das Ihr Petschaft?«
»Natürlich.«
»Dass Sie mir dann nicht etwa sagen können, ich hätte es vertauscht.«
»Das ist mein Petschaft«, lächelte der Graf aber schon ganz unsicher.
»Wollen Sie Ihr Petschaft nun einmal dort hinten auf den Tisch legen?«
Im Hintergrunde des Zimmers stand ein Tisch, der Graf ging hin, legte das Petschaft daraus, begab sich zurück an das Fenster, in dessen Nähe die beiden gestanden hatten.
»Wissen Sie sich zu erklären, wie ich das Petschaft hierher bekomme, ohne selbst hinzugehen?«
»Das ist nicht möglich.«
»Ich werde es hierher bekommen. Nur dürfen Sie nicht hinsehen.«
»Weshalb nicht?«
»Weil ich auch meine Geheimnisse habe. Liegt das Petschaft noch dort?«
Der Graf sah es ganz deutlich auf dem sechs Meter entfernten Tische liegen, und dass es das seine war, wusste dieser Mann, der geschickteste Taschenspieler, ja am allerbesten.
»So drehen Sie sich um — fassen Sie meine Hände — so —...«
Der Graf musste sich dem Fenster zudrehen, der Junge umschlang ihn sofort von hinten, ließ seine Hände vorn auf des Grafen Brust halten.
»Und nun sage ich einfach: hamoga este fama samboris... es ist geschehen, das Petschaft ist bereits hier.«
Der Graf musste sich sofort umdrehen, der erste Blick belehrte ihn, dass das Petschaft dort vom Tische verschwunden war, und der Junge, der ihn mit keinem Schritte verlassen hatte, griff in seine Rocktasche, brachte aus dieser das Petschaft zum Vorschein.
Es war das des Grafen, das er sich erst gestern hatte machen lassen, und er hatte daran bereits sein kleines, unmerkliches Kennzeichen, was niemand hätte nachmachen können. Solch kleine Zeichen gibt es doch an jedem Gegenstande.
Der Graf war vollständig verblüfft, starr, so sehr er auch mit sich rang.
»Wie ist das möglich?!«
»Ich habe meine Nervenkraft hingeschickt, die hat mir das Petschaft geholt«, grinste der Junge, und jetzt biss sich der Graf ganz unverhohlen auf die Lippen.
»Mache das noch einmal!«
»Bedaure, ich mache jedes Experiment nur ein einziges Mal.«
Der Junge hatte schon etwas gehört, vielmehr alles, er benutzte des Grafen eigene Waffen.
Und der Graf hielt sich nicht weiter mit Fragen auf, er wusste ein anderes Mittel, um schnellstens zum Ziele zu gelangen.
»Gut, du bist ein brauchbarer Bursche, ich engagiere dich.«
»O, ich kann dem Herrn Grafen noch ganz andere Sachen vormachen.«
»Später. Ich werde wegen deiner Flucht doch nicht Unannehmlichkeiten haben?«
»Wie kann denn ein Herr wie Sie überhaupt Unannehmlichkeiten bekommen!«, musste sich der wiederum von dem Jungen belehren lassen.
»Du hast alles frei, bekommst aber kein Geld.«
»Habe ich auch nicht nötig, das mache ich mir selbst.«
»Ich habe ein eigentümliches Verfahren, um mit einem Diener einen Kontrakt zu machen. Wir trinken hier zusammen aus dieser Flasche ein Glas Wein...«
Der Graf hatte die beiden Gläser schon vollgeschenkt.
»Indem wir aus ein und derselben Flasche Glas Wein trinken, bin ich dein treuer Herr, und du bist mein treuer Diener. Verstanden?«
O, der Knirps sah gar nicht danach ans, als ob er da erst einer längeren Erklärung bedürfe. Aber er zögerte, blinzelte listig mit den Augen.
»Der Herr Graf sagten vorhin, wir tränken zusammen ein Glas Wein.«
»Nun, das ist doch auch der Fall.«
»Nein, das sind zwei verschiedene Gläser.«
»Das ist doch ganz dasselbe.«
»Durchaus nicht.«
»Das ist doch ein und derselbe Wein aus derselben Flasche.«
»Nein.«
»Was nein?!«, stutzte der Graf.
»Sie haben in Ihrem Glase etwas ganz anderes als ich.«
»Was?!«
»Natürlich, Ihr Wein ist nicht so rot wie meiner und — und — sieht überhaupt ganz anders aus als die Flüssigkeit in meinem Glase.«
Auch der Blick des Grafen konnte einmal furchtbar drohend werden. Doch er beherrschte sich. Aber seine Hand fing leise zu zittern an.
»Du irrst!«
»Nein, nein, ich irre mich nicht. Das sind zwei verschiedene Flüssigkeiten.«
»Aber ich habe sie doch aus derselben Flasche eingeschenkt!«
»Ja, freilich, das ist recht merkwürdig — wie das gemacht wird, weiß ich auch nicht — aber schließlich — möglich ist alles — darüber muss ich einmal nachdenken — das werde ich schon noch austüfteln. O ja, das ist ein recht feiner Kniff — man schenkt aus ein und derselben Flasche ein, und doch kommen zwei verschiedene Flüssigkeiten heraus. Ei, damit muss man viel machen können.«
Der Graf presste die Lippen zusammen.
»Trink!«, stieß er dann fast wild hervor.
»Ja, wenn der Herr Graf mit aus meinem Glase trinken will.«
»Trink! Oder glaubst du etwa, ich will dich vergiften?«
»Nein, das glaube ich allerdings nicht, und ich möchte erfahren, was für Folgen das hat, was Sie eigentlich mit mir vorhaben. Also, auf Ihr Wohl, Herr Graf, dass wir noch recht gute Freunde werden!«
So sprach der neunjährige Knirps, an dem der Graf, wenn nicht seinen Meister, so doch wohl einen ziemlich Ebenbürtigen gefunden hatte, und leerte wie der Graf unverzagt sein Glas.
»Malaga. Hm — die Konventbrüder hatten besseren im Keller — und der hat auch so einen Nebengeschmack — so nach — nach... ei verflucht, ich werde ja mit einem Male ganz müde!«
»Einbildung, du bist nur keinen Wein gewöhnt...«
»Doch doch doch...«
»Einbildung, sage ich dir! Setz dich dorthin auf den Stuhl!«
Der Junge musste sich wohl setzen, denn er begann schon zu wanken.
Der Graf setzte sich an den Schreibsekretär, wozu er aber zwei Schritte tun musste, und in demselben Augenblick, da er dem Jungen den Rücken wendete, machte dieser eine Handbewegung, deren Zweck wir vorläufig nicht verraten dürfen.
Als sich der Graf gleich darauf wieder erhob, fand er einen tief Schlafenden, dessen Augen sich ganz nach oben verschoben hatten.
Es mussten die gemischtesten Empfindungen sein, mit denen der Graf den kleinen Schläfer betrachtete, und sein schönes Gesicht drückten sie aus.
»Der erste Mensch«, murmelte er, »der mich durchschaut — und gerade ein Kind noch muss es sein! — aber durchaus keins von jenen Kindern, denen das Himmelreich gehört, weil sie noch reinen Herzens sind — gerade das Gegenteil davon. Ein Glück, dass dieser Knabe nicht von vornherein feindlich gegen mich auftritt, sondern sich mit mir zu verbinden wünscht! Nun, holen wir ihn erst einmal auf diese Weise aus, der kein Mensch widerstehen kann.«
Es war ganz ersichtlich, wie der Graf all seine Willenskraft konzentrierte.
»Joseph Balsamo, du hörst mich sprechen!«
Dreimal wiederholte es der Graf in den verschiedensten Tonarten — die Folge davon war nur, dass der Junge zu schnarchen anfing.
Und wir wollen es kurz machen — was für Manipulationen der Graf auch anwandte, es gelang ihm nicht, den Jungen in Hypnose zu bringen oder ihn für suggestive Einflüsterungen empfänglich zu machen.
Was ist eigentlich Hypnotik? Wir können uns hier nicht mit einer gelehrten Erklärung befassen, wenn sie überhaupt möglich wäre. Nur das eine können wir hier mit Bestimmtheit sagen: Die Hypnotik ist durchaus nicht die geheimnisvolle, magische Kraft, für welche die meisten Menschen, wenn sie überhaupt daran glauben, sie halten. Die sind geradeso im Irrtum, wie alle die, welche die ganze Hypnotik überhaupt bezweifeln, welche etwa sagen: Den möchte ich doch sehen, der mich hypnotisieren kann!
Lieber Leser, gehörst du zu denen, welche jede Herrenmode mitmachen, etwa ihren Hals in drei Zoll hohe Stehkragen einzwängen, weil der König von England das Kommando hierzu gegeben hat?
Dann bist du ganz einfach hypnotisiert, hast dich vom ›first gentleman of the world‹ hypnotisieren lassen, der zuerst seine nächste Umgebung hypnotisiert hat, und diese Hypnotisiererei hat immer weitere Kreise gezogen, bis sie auch dich getroffen hat.
Dasselbe gilt dir, schöne Leserin, wenn du dir heute ein Wagenrad und morgen einen Blechtopf auf den Kopf setzest — dann ist die erste hypnotische Suggestion hierzu wahrscheinlich von einer Pariser Schauspielerin ausgegangen.
Und so ist es nicht nur in Sachen der Mode, sondern dasselbe finden wir fast im ganzen menschlichen Leben. Alles Suggestion, fremde Willensbeeinflussung!
Wenn diese nun schon im wachen Zustande so stark ist, dass man ihr zuliebe mit Freuden die größten Schmerzen erträgt, eine empfindsame Dame zum Beispiel, die sonst beim kleinsten Nadelstiche in Ohnmacht fallen würde, jahrelang in zu engen Stiefeln die grimmigsten Schmerzen aussteht, bis sie ihren Fuß vollständig verkrüppelt hat, so wirkt diese Suggestion noch viel mehr im Schlafe.
Was ist der Schlaf? Wir wissen es nicht, absolut nicht. Das, was da immer gesagt wird von der Ergänzung der verbrauchten Lebenskraft oder gar von Fütterung des Gehirns mit Blut, das sind alles leere Redensarten. Da soll man lieber gleich bei dem Symbol bleiben, dass der Schlaf ein Tribut ist, den wir dem Tode täglich zollen. Denn wir wissen auch nicht, was der Tod ist. Nicht, was das Leben ist. Wir wissen nicht, was im Schlafe der sonst rastlos arbeitende Geist macht.
Die Erfahrung aber, eben durch Experimente mit der Hypnose, hat gelehrt, dass der Geist, oder nennen wir jenes unbekannte Ding gleich die Seele, im Schlafe für fremde Willensbeeinflussung noch viel, viel empfänglicher ist als im wachen Zustande. Und das ist der eigentliche Kern der ganzen Hypnotik. Sonst ist der hypnotische Zustand, wie schon einmal gesagt, ein ganz normaler Schlaf. Und in diesem kann jeder Mensch durch fremden Willen beeinflusst werden, also kann auch jeder Mensch hypnotisiert werden, jeder!! Die Sache ist nur die, dass er einen willensstärkeren Hypnotiseur haben muss. Deshalb also ist ein energischer Mann nicht so leicht zu hypnotisieren wie eine hysterische Person. Aber schließlich findet doch jeder seinen Meister.
Dass man so oft hört: Den möchte ich doch sehen, der mich hypnotisieren kann — das hat insofern seine Berechtigung, als man dabei immer an das künstliche Einschläfern denkt. Aber das ist ja ganz Nebensache. Die Hauptsache ist der Schlaf selbst. Schläft der Betreffende einmal, was auch durch Betäubungsmittel herbeigeführt werden kann — und gegen die Wirkung des Alkohols zum Beispiel ist doch niemand gefeit — dann kann der erfahrene Hypnotiseur auf der sozusagen freigewordenen Seele spielen wie auf einem Instrument — vorausgesetzt eben, dass sein Wille stärker ist als der des Betreffenden im wachen Zustande, und ist er stark genug, so kann er jenem suggerieren, was er will, kann ihm befehlen, auch im wachen Zustande dies und jenes zu tun oder zu sehen, und der Willensunterjochte wird es gehorsam tun.
Das ist im Grunde genommen das ganze Geheimnis der Hypnotik, soweit es sich überhaupt erklären lässt — — —
Der Graf konnte tun, was er wollte, diesen kleinen Schläfer vermochte er nicht zu beeinflussen, nicht einmal so weit, dass jener ihn sprechen hörte, und die Folge davon war, dass der Graf, nachdem er die verschiedensten Manipulationen probiert hatte, förmlich zusammenbrach.
»Dieser Knabe spottet der Kunst meines Meisters!«, ächzte er. »Was für ein rätselhafter Mensch ist das, was wird aus ihm erst noch werden?!«
Da mit ihm sonst nichts anzufangen war, machte er sich daran, sehr prosaisch, seine Taschen zu visitieren.
Es war herzlich wenig, was da zum Vorschein kam: eine harte Brotrinde, ein altes Messer, eine leere Schachtel — das war alles.
Nein, weder mit dem Messer noch mit der Schachtel hatte der Junge jenes Phänomen, welches man heute einen spiritistischen Apport nennt, durch Taschenspielerei erzeugen können. Aber da der Graf, wie wir schon einmal angedeutet haben, manches selbst am eigenen Leibe trug, so visitierte er auch den Jungen daraufhin. Er fand absolut nichts.
Jetzt war es mit der Weisheit des Grafen, sich jenes Phänomen durch mechanische Hilfsmittel erklären zu wollen, zu Ende.
Zunächst gebrauchte er noch einmal die Nadel.
»Du wirst keinen Schmerz fühlen, absolut keinen Schmerz, ich befehle es dir!!«, sagte er auf das Nachdrücklichste und stach dabei den Schläfer etwas in den Arm.
Aber der Junge hatte ja noch gar nicht zugesagt, dass er gehorchen wolle, weil er überhaupt gar nicht hypnotisiert war, und so war die Folge des Stiches, dass er durch den Schmerz auch aus seinem Betäubungsschlafe erwachte.
»Au! Was ist denn das?«
Aber dann war er schon wieder eingeschlafen, der Trank war zu stark gewesen.
Noch lange Zeit betrachtete der Graf den kleinen Schläfer, bis sein Mund auch wieder Worte fand:
»Wohl mir, dass er gleich freiwillig meine Dienste suchte, so ist es noch möglich, dieses rätselhafte Wunderkind meinen Zwecken dienstbar zu machen.«
So sprechend hob der Graf den Knaben auf und trug ihn in die benachbarte, durch eine Zwischentür erreichbare Zelle, in der die Möbel noch unordentlich durcheinander standen, bettete ihn auf einem Diwan.
Kaum war der Graf zurückgekehrt, als es klopfte. Ein dritter Diener meldete sich, der von dem Grafen engagiert zu werden wünschte.
Ein Mann trat ein, der sich besonders durch seine fortwährenden Verbeugungen ganz lakaienhaft betrug, wozu auch die Worte und Redensarten passten. Er hatte zuletzt bei der und der römischen Herrschaft gedient, aber das war schon ein Jahr her, inzwischen hatte er von seinem ersparten Gelde gelebt.
Aber der Graf ließ sich nicht täuschen, er sah dem Manne gleich etwas ganz anderes an, und die Hypnose sollte es ihm dann bestätigen.
Es war in Wirklichkeit ein römischer Edelmann, der in der Gesellschaft eine ziemliche Rolle spielte, sich ebenso wohl durch seinen freien Geist wie durch Abenteuersucht auszeichnend. Er wollte sich dem Grafen von Saint-Germain als Diener verdingen, um hinter dessen Geheimnisse zu kommen, ob diese nun wirklich übernatürlicher Natur oder Gaukeleien seien. Das Abnehmen seines Bartes und einige andere kleine Veränderungen, besonders auch ein seinem sonstigen Auftreten ganz verschiedenes Benehmen hielt er für genügend, um vor einer Entdeckung gesichert zu sein, auch seinen Bekannten gegenüber, die ihn bei dem Grafen sehen würden. Sonst hatte er nur zwei Freunde in sein Vorhaben eingeweiht, es war daraus gleich eine Wette geworden. Nachgewiesen konnte ihm nicht viel werden, er wollte nur bei einer einzigen Herrschaft gedient haben, die sonst ständig ihr Personal gewechselt hatte und schon seit Jahresfrist spurlos aus Rom verschwunden war.
So offenbarte der Edelmann in der Hypnose. Trotzdem wurde er dann als einfacher Diener angenommen. Klüger konnte der Graf ja auch gar nicht handeln, so konnte er den Wolf in Schafskleidern immer im Auge behalten.
Im Laufe des Tages nahm der Graf noch zehn weitere Diener an, bis er in seinem Hause zusammen einundzwanzig hatte. Die Zahl dreimal sieben spielte bei ihm als heilige oder magische überhaupt eine große Rolle. Unter diesen waren noch verschiedene andere, welche sonst ganz andere Lebensstellungen einnahmen, nur durch Neugierde oder auch durch Wissbegierde herbeigeführt, wenn es auch nicht alle Edelleute waren. Der eine hingegen war sogar ein Marquis, ein anderer ein Jesuit, von dem der Graf in der Hypnose recht nette Dinge erfuhr, was wir aber erst später wiedergeben wollen. Jedenfalls hatte der Graf allen Grund, auf seiner Hut zu sein. Es meldeten sich in den folgenden Tagen immer noch mehr, aber der Graf ließ sie gar nicht erst vor sich, um sie in der Hypnose wenigstens auszuforschen. Darin war er nun wieder ganz sorglos, schien es mit dem Worte zu halten: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
Zwei Stunden lang lag der kleine Joseph in seinem Betäubungsschlafe, dann erwachte er mit schwerem Kopfe, und wenn der Katzenjammer diesem Schädel entsprach, dann musste es ein ganz mächtiger sein.
»Also, Sie haben mir doch einen Schlaftrunk eingegeben!«
Der Graf wurde mit ihm schon fertig. Die beiden einigten sich.
Der zukünftige Cagliostro wurde des Grafen Leibpage, der auch im Zimmer des Meisters schlief, der selbst keines Schlafes bedurfte, und das lässt schon auf vieles schließen.
Morgen, meine Tochter, ist dein höchster Ehrentag, an dem du deine Vermählung feiern wirst.« So sprach unter dem Kronleuchter eines Prunkzimmers im bischöflichen Palaste eine Matrone, deren Einfachheit man nicht ansah, dass sie die Stammmutter einer slawischen Woiwodenfamilie war, die Europa schon verschiedene gekrönte Häupter geschenkt hatte — Polen zum Beispiel einen König, Frankreich eine Königin, die Gemahlin Ludwigs XV.
Und ihre Worte waren an die gerichtet, welche die Tochter dieses Königs, der jetzt allerdings verabschiedet, aber doch mit königlichem Hofstaate in Lunéville residierte und die Schwester dieser Königin Maria war.
Aus tiefen Träumen fuhr das weiße Marmorbild plötzlich empor.
»Was sprichst du da, Tante?! Meine Vermählung soll ich morgen feiern?! Mit wem denn?!«
Besorgt musterte die Großtante das schöne Mädchen.
Mit Polima musste in den letzten Tagen etwas vor sich gegangen sein. Ein Marmorbild war sie ja immer gewesen, aber... ein Marmorbild kann doch nicht erschrecken und erröten, so wie es jetzt wiederum geschehen war, und das war in den letzten Tagen eben nicht das erste Mal.
»Was hast du nur, Polima?«
»Mit wem soll ich morgen meine Vermählung feiern?«, wiederholte sie nur.
»Ich verstehe nicht, wie du nur noch so fragen kannst! Du bist doch schon immer die Braut des Herzens Jesu gewesen, und morgen wirst du unserem Heiland für immer angetraut...«
Zum Tode erschrocken brach die Matrone ab.
Zunächst war die jäh aufsteigende Purpurröte wieder der Marmorblässe gewichen, mit einem Male aber fing der jungfräuliche Busen, auf den Polima die Hände presste, zu arbeiten an, wie es die Großtante, die sie von Kind an erzogen, noch nie gesehen hatte, noch nie, und nicht genug damit, jetzt bekam diese Marmorstatue auch noch ganz anderes Leben, sie sprang auf, um im Zimmer hin und her zu laufen.
Ja, zum Tode erschrocken war die Großtante. Sie starrte das sich plötzlich so verwandelt habende Mädchen wie ein Gespenst an.
»Ich kann nicht, und ich kann ja nicht — nun muss es endlich heraus — und ich kann ja nicht!!!«
So erklang es in herzzerreißendem Weh, und das war nicht danach angetan, um der alten Dame den Glauben an ihre Vernunft wieder zu geben.
»Was kannst du nicht, Polima?«, vermochte sie doch noch zu fragen.
»Ich kann nicht ins Kloster gehen, ich kann nicht!!«
Jetzt war es mit der alten Dame vollends vorbei. Aber ehe sie in Ohnmacht fiel, sprang sie auf und flüchtete zum Zimmer hinaus.
Und das lebendig gewordene Marmorbild warf sich auf einen Diwan und schluchzte und weinte — weinte mit Bewusstsein die ersten Tränen seines Lebens.

Wohl eine Viertelstunde verging so.
Nur das Schluchzen erscholl in dem einsamen Prunksaal, und die schlanke Mädchengestalt erzitterte.
»Meine Tochter!«, erklang es da salbungsvoll.
Neben der Weinenden stand schon seit längerer Zeit ein älterer Mann im violetten Talar, der Fürstbischof, dem auch jenes Kloster unterstellt war, in das morgen unter größter Feierlichkeit und auch öffentlichem Gepränge die Tochter des polnischen Königs als zukünftige Priorin treten sollte.
Er hatte sie angeredet, nachdem er sattsam ihr Weinen und Zittern beobachtet hatte. Hinter ihm hielt sich ängstlich die Tante verborgen.
Polima richtete sich auf, schlug die verweinten Augen zu dem Manne empor, der auch ihr Beichtvater war und dem sie niemals etwas zu gestehen gehabt, höchstens Kleinigkeiten, auf deren Nichtigkeit sie dieser strenge Mann selbst hatte aufmerksam machen müssen. Denn wenn man aus Versehen eine Fliege getötet hat, das bedarf keiner Absolution.
»Ich kann nicht, mein Vater, ich kann nicht!«, erklang es unter erneutem Jammern.
»Was kannst du nicht, meine Tochter?«
»Ich... liebe ihn!«
Das große Wort, welches das Weltgetriebe erhält, war ausgesprochen.
Der fromme Bischof fasste es natürlich von seiner Seite auf.
»Du liebst Jesus mehr, als einer von ihm geheiligten Braut gestattet ist?«
Aber mit solchen Spitzfindigkeiten kam er nicht weit.
»Nein, ich liebe ihn — ihn — ihn!!!«, war die einfache Antwort, nur im entsprechenden Tonfall hervorgebracht.
Jetzt aber wusste auch der Bischof genug, sogar die alte Tante machte schon das Zeichen gegen den Teufel.
»Du liebst... doch nicht einen... irdischen Menschen?!«
»Ja, ja — und ich kann ja nicht anders — kann ja nicht anders!!«
Ein Glück, dass sie ihrem Beichtvater gegenüber so unbedingt gehorsam war!
»Einen Mann?«, musste der Bischof sich auch noch vergewissern.
»Polima!«, schrie die Matrone und konnte sich nicht mehr aufrecht halten. »Nein, das ist nicht wahr, das ist ein Trug der Hölle — Polima!!«
»So wird es sein«, erklärte der Bischof nach wie vor salbungsvoll. »Und wer ist dieser Mann?«
»Das... kann ich nicht verraten!«
Oho! Zum ersten Male ein Widerstand?!
Aber er wusste diesen bald genug zu brechen, und da kam es heraus.
»Den Grafen von Saint-Germain.«
Das freilich war auch für den Bischof zu viel, er wurde ganz fassungslos, während jetzt die Tante wieder aufzutauen begann — weil sie beweisen konnte dass sie recht behalten hatte, und das ging ihr doch über alles.
»Habe ich es nicht immer gesagt! Von dem Abend an, wo der Graf ihr die Rose aufhob, hat es mit ihr angefangen! Schon da, als sie ihm die Rose abnahm, wurde sie röter als diese Rose, dieser Teufelsanbeter hat sie einfach mit verhext!!«
Ja, das wusste auch schon dieser Bischof. Denn er war einer der beiden Priester gewesen, die in ihrer dunklen Ecke alles beobachtet hatten. Aber der Woiwodin gegenüber hatte er dies niemals Wort haben wollen, es hatte sein Geheimnis bleiben sollen.
Freilich, dass dieser Wundermann in dem marmorgleichen Mädchen nicht nur das Leben, sondern auch Liebe zu sich selbst erweckt, das hatte auch er nicht geahnt.
»Du sagst es«, entgegnete er jetzt, »dieser Graf ist ein Teufelszauberer, und hiermit ist sein Maß nun auch voll. Lass uns allein, Veronika.«
Die Matrone verließ das Zimmer.
Der Bischof nahm sein Beichtkind vor, und es war ganz und gar geständig. Aber was sollte Polima eigentlich gestehen?
»Ich liebe ihn — ich liebe ihn — ich kann nicht anders!«
Das war das einzige, was sie zu gestehen hatte.
Dabei wusste sie noch gar nicht, was das eigentlich sei, die Liebe. Nun, dazu brauchte sie auch keine besondere Erklärung, erklärt hat das überhaupt noch kein Mensch. Es wird einem mit einem Male so warm im Herzen, man sieht plötzlich die Welt in ganz anderem Licht. Viel mehr von Erklärung gibt es nicht.
Nein, sie hatte kein Briefchen von ihm empfangen, auch nicht ein einziges Wort mit ihm gewechselt.
»Er sah mich an — und ich sah ihn — und da — und da...«
Ja, und da war es eben geschehen gewesen.
»Liebe auf den ersten Blick«, definierte der würdige Bischof, aber nur für sich selbst.
Zu seinem Beichtkinde sprach er ganz anders.
Zunächst machte er den Grafen als einen Teufelszauberer schlecht, dass auch kein sauberes Härchen mehr an ihm blieb, und dann schilderte er ganz, ganz ausführlich, was das morgen für glänzende Festlichkeiten und Prozessionen gebe, wenn sie ins Kloster übergeführt würde, und dann weiter erging er sich in den Ehren, die der zukünftigen fürstlichen Priorin warteten.
Und er erreichte sein Ziel. Auch dieser Bischof war wie noch manch anderer seinesgleichen ein Hexenmeister. Schon längst waren die Tränen versiegt, das schöne Mädchen lauschte mit glänzenden Augen der herrlichen Zukunft, die ihr der Bischof da mit glühenden Farben vorzumalen verstand.
Eine Stunde später konnte Polima ruhig zu Bett geschickt werden. Sie war gerettet. Freilich konnte sich solch ein Anfall noch einmal wiederholen, aber dann wurde der Teufel eben wiederum ausgetrieben. Und heute passierte das auch nicht noch einmal. Morgen aber war sie schon im Kloster. Da konnte sie noch ganz anders vorgenommen werden. Sie sollte nur einmal beiwohnen, wenn erst eine Nonne in Verzückung fiel, dann drei, dann ein ganzes Dutzend, bis sich das ganze Nonnenkloster in Verzückungskrämpfen wälzte — ob sie da nicht auch angesteckt würde.
Und heute wiederholte sich der irdischsinnliche Anfall ganz bestimmt nicht wieder.
So dachte der Bischof. Sein Beichtkind dachte anders. Schon dass Polima solch glänzende Augen bekommen, hatte einen ganz anderen Grund gehabt. Da hatte sie ihm einfach gar nicht zugehört, hatte an etwas ganz anderes gedacht.
So sicher war der Bischof seiner Sache, dass er auch gar keine Vorsichtsmaßregel ergriff. Polima schlief allein in einem Parterrezimmer, und dabei blieb es. Wer hätte diesem spröden Mädchen auch irgend etwas Abenteuerliches zugetraut!
Dieses Mädchen hatte aber eben mit einem Male seine eigenen Gedanken bekommen.
Es war in der elften Stunde, eine Stunde nach jenem Geständnis, als sich Polima, die bisher ruhig im Bett gelegen, ohne einen Mucks von sich zu geben, aufstand, geräuschlos ihr Morgenkleid überwarf, ebenso geräuschlos das Fenster öffnete und kurzerhand hinaussprang.
Nicht so ganz springend, sondern die üppigen Weinreben hatten ihr dabei etwas zum Halt dienen müssen, und die Weinreben halfen ihr ebenso mit leichter Mühe über die Gartenmauer.
Einsam lag die spärlich beleuchtete Straße vor ihr.
Wohin? Das hatte sie sich bereits im Bett überlegt, in dem sie den letzten und einzigen Abschiedsgruß hinterlassen — die Abdrücke ihrer Zähnchen in dem Kopfkissen, und die Umgebung von Tränen genetzt.
Sie kannte in Rom keine einzige Person, der sie sich hätte anvertrauen können.
Zu dem Geliebten selbst? Das war nun wieder bei der Natur dieses und des Weibes überhaupt ganz ausgeschlossen.
Nur eine Person kannte sie, der sie sich anvertrauen konnte, bei der sie Hilfe zu finden hoffte, obgleich sie mit dieser Person noch kein Wort gewechselt hatte.
Es war die Herzogin Borghesia. Wie sie gerade auf diese gekommen war, wusste sie selbst nicht. Es war das freie, offene, gutmütige, sogar leichtsinnige Wesen, das sie immer so angezogen hatte oder sie gerade jetzt so anzog, da sie sich alles Früheren erinnerte.
»Bei ihr allein finde ich Hilfe, sie wird mich verstehen, und sie ist der Liebling des Papstes, sie wird alles in Güte regeln können.«
So sagte sie sich, um ihren sonderbaren Einfall nur einigermaßen zu motivieren, und sie eilte die Straße hinab, dem nahen Palaste zu, in dem die Herzogin wohnte.
Oft genug war ihr dieses Haus gezeigt worden, als Wohnung derjenigen, die ein so gotteslästerliches Leben geführt, dass sie der päpstliche Onkel zuletzt verstoßen hatte.
Aber hatte er sie nicht erst kürzlich wieder in Gnaden aufgenommen?
»Der heilige Vater wird auch mir verzeihen, wenn sie mich zu ihm führt!«
So sagte sich die Unschuld, als sie den Klopfer in Bewegung setzte.
Der schlaftrunkene Pförtner öffnete. Wenn er die polnische Prinzessin erkannte, so hielt er es doch nicht für möglich, dass sie es sei. Nur eine große Ähnlichkeit.
Die Herzogin war schon längst zur Ruhe gegangen.
»Ich muss sie sprechen, ich muss!«
»Wen darf ich melden lassen?«
»Ich bin... eine Unglückliche!«
Die Extravaganzen der Herzogin waren bekannt genug. Aus dem Schlummer geweckt, war sie sofort bereit, den nächtlichen Damenbesuch zu empfangen.
Wenn sich ihr roter Sirup noch nachträglich in Gold verwandelt hätte, sie wäre nicht erstaunter gewesen, als da sie die Prinzess Polima erkannte. Diese musste noch besonders gestehen, dass sie es auch wirklich war.
»Um Gott, was führt Sie denn um solch nächtlicher Stunde noch zu mir!«
Die Prinzess ward sich des Schrittes, den sie getan, nun wohl bewusst, und eben deswegen hatte sie, die zum allerersten Male dieses eigentümliche Gefühl empfand, nur eine einzige Antwort:
»Ich liebe ihn, ich liebe ihn!«
»Wen? Doch nicht eine irdische Liebe? Sie, die Sie morgen den Schleier nehmen sollen?«
»Den Grafen von Saint-Germain.«
Um das zu gestehen, deshalb war sie ja eben hierher gekommen.
Die Herzogin war zuerst ganz fassungslos. Halb freute sie sich, dass auch diese stadtbekannte Marmorfigur, deren Eiseskälte so oft das Thema der Gesellschaft gebildet hatte, nun doch auch dieser Liebe unterlegen war — halb entsetzte sie sich, weil sie schon im Voraus sah, wie furchtbar sie kompromittiert werden konnte, weil die Geflohene gerade zu ihr gekommen war. Das konnte ihr wiederum die Gunst des päpstlichen Onkels und alles andere kosten, das konnte sie in die schwersten Verwicklungen ziehen, vielleicht gar in den Kerker bringen.
Aber der heimliche Triumph, dass sie die Hauptrolle in dieser Skandalaffäre spielen sollte, siegte, und vielleicht mehr noch ihre angeborene Gutmütigkeit, gepaart mit der ganzen Sorglosigkeit, die nie an den künftigen Tag dachte.
»Ja, wie ist denn das nur gekommen?«
Was sollte die Prinzess erzählen? Liebe auf den ersten Blick.
»Und liebt der Graf Sie denn wieder?«
Wie sollte das Polima wissen?
»Hat er Ihnen nicht wenigstens ein heimliches Zeichen gegeben, woraus Sie darauf schließen können?«
Nein, gar nichts.
Weil die Prinzess plötzlich heftig zu weinen anfing, tat die Herzogin dasselbe.
»Ach, Sie Ärmste, so lieben auch Sie unglücklich und hoffnungslos!«, schluchzte sie, obgleich die andere noch gar nichts von einer Hoffnungslosigkeit gesagt hatte.
Aber die hatte nur ein einziges gehört. Das Weib in ihr war plötzlich voll und ganz erwacht, sie holte das bisher Versäumte schnellstens nach.
»So lieben auch Sie unglücklich?«, weinte sie.
»Hoffnungslos, hoffnungslos!«, schluchzte Ludmilla.
»Einen Mann?«, weinte die Prinzess.
»Der nie — nie — der meine werden kann... und wenn auch mein Trauerjahr bald vorüber ist«, weinte die Herzogin.
»Weil er Sie nicht wiederliebt?«, weinte die Prinzessin.
»Weil er — weil er — Protestant ist«, weinte die Herzogin.
»Ja, dann treten Sie doch auch zum Protestantismus über«, riet weinend die zukünftige Priorin.
»Ja, wenn es ein anderer wäre...«
»Ich kenne ihn?«, wurde weinend weitergeforscht.
»Der edelste Mann, den es auf Erden gibt.«
»Noch — noch — noch edler als der Graf?«, fragte schluchzend die zum ersten Male erwachte Liebe, die ja nur einen Herrlichen kannte.
»Es ist — es ist... Lord Walter Moore.
Es war heraus. Es hatte unbedingt gestanden werden müssen. Bei dieser Gelegenheit. Sonst war die Prinzess wirklich die einzige Person, die davon erfuhr... wenn es nicht schon stadtbekannt war.
»Und er liebt Sie nicht wieder?«
»Ich weiß nicht — nein — ich glaube nicht — und — und — mein Trauerjahr ist ja noch nicht vorüber.«
»Ja, was soll aber nun aus mir werden?«, erinnerte sich die Prinzess wieder ihrer selbst.
Es wirkte. Die Herzogin raffte sich zusammen. Sie sah wieder die eigene Gefahr.
»Ja, hier können Sie nicht bleiben!«
»Aber wohin soll ich sonst?«
»Morgen, diese Nacht schon, sobald man Ihre Flucht entdeckt, ist ganz Rom in Aufruhr. Es bleibt nur eins übrig: Sie müssen sich in den Schutz des Grafen selbst begeben.«
In das Haus des Geliebten? Nein, nein, nur das nicht!
»Nur der Graf allein ist imstande, mit dieser kirchlichen Macht fertig zu werden, ihm ist ja nichts unmöglich...«
Und die Herzogin schilderte weiter, was der Graf von Saint-Germain alles fertig bringen könnte. Ihr Vertrauen auf die Macht dieses Wundermannes war unbeschränkt.
Aber die Prinzessin dachte anders. Nur nicht in das Haus des Geliebten! Ja, wenn dieser seine Liebe zu ihr bereits gestanden — aber so... das manchmal ganz eigentümliche Schamgefühl des Weibes war stärker als alles andere.
»Dann weiß ich nur noch einen einzigen Rat: Sie müssen zu Lord Moore. Der hat noch keinen Unglücklichen im Stiche gelassen, der fürchtet sich vor keiner Kirchenmacht und vor nichts, der wird Ihnen auch weiter zu helfen wissen, und für Sie bin ich bereit, Sie selbst hinzubringen. Durch den Grafen von Saint-Germain bin ich mit dem Lord überhaupt in engere Beziehungen gekommen, die mir schon mehr Freiheit erlauben. Soll ich Sie in die englische Gesandtschaft bringen?«
Ja, damit war Polima gleich einverstanden.
Die Herzogin hüllte ihre Schutzbefohlene besser ein, sich selbst darauf, beide verließen durch ein Seitenpförtchen den Palast.
Zu derselben Zeit saß Lord Moore in seinem Toilettenzimmer, um sich für die Nachtruhe zu entkleiden. Er verzögerte es von Minute zu Minute. Seit einer Viertelstunde schon betrachtete er tiefsinnig den ausgezogenen Schuh in seiner Hand.
Seit einigen Tagen ging der sonst so energische Mann wie im Traume umher. Zu jeder Handlung, zu jedem Worte musste er sich erst aufraffen.
Seit jenem Tage, da er die Geistersitzung gehabt, währte diese Stimmung.
Weil ihm der Graf seinen materialisierten Nervengeist und anderen Spuk vorgeführt hatte?
Nein, das war es nicht. Wohl war der Lord dadurch um seinen ganzen bisherigen Glauben gekommen, aber damit hatte er sich bereits als mit etwas Unwiderlegbarem abgefunden.
Nein, der zweite Geist, nur eine Wolke, die ihn der wesenlose Graf in der Luft vorgemalt hatte, war daran schuld.
Lord Walter Moore hatte gelebt und geliebt. Und er verstand zu leben und zu lieben. Er hätte sich, wenn er es auch niemals getan, rühmen dürfen, dass ihm noch kein Weib widerstanden, obgleich er dabei immer auf ziemlich reines Gewissen gehalten hatte. Viel Unglück hatte er noch nicht angerichtet. Die Auswahl, die ihm zur Verfügung stand, war gar zu groß. Auch gebunden hatte er sich noch niemals. So eigentlich richtig geliebt, dass er vor Seufzen nicht einschlafen konnte, hatte er überhaupt noch nie. Es war ihm eben alles zu leicht gemacht.
Bis auf die eine. Vom ersten Blick an, da er sie gesehen. Die polnische Prinzessin. Die richtig Liebe war ja das eigentlich auch noch nicht, sondern... ein Ideal!
Nachdem der Lord das schöne, stolze Marmorbild erblickt. hatte er sein allererstes Gedicht gemacht. Ein Lied an die Keuschheit. Mag das genügen. Mehr kann man in solch einer Sache überhaupt nicht sagen. Wenn ein Mann wie Lord Walter Moore zu dichten anfängt, dann... steht es schlimm.
Aber, wie gesagt, es war nur ein Ideal. Ein ideales Idol. Na ja, in dem Gedichte hatte er mehrmals gewünscht, er könne diesem kalten Marmor warmes Leben einhauchen, hatte sogar an einer Stelle angedeutet, dass er dazu die Figur am liebsten in seine Arme schließen möchte... aber das war nun doch einmal eine Unmöglichkeit, kalten Stein lebendig zu machen, auch noch warmlebendig, und Lord Moore hatte bisher eben nur an greifbare Möglichkeiten geglaubt.
Und da kommt dieser Wundermann, macht nicht nur Gold und anderes, legt sich nicht nur aufs Sofa, bleibt darauf liegen und geht dennoch in ein anderes Zimmer, um dort Mundharmonika zu blasen, sondern er zaubert dem Lord auch noch seine zukünftige Gattin vor, und das ist niemand anders als... die Prinzessin Polima, das marmorne Idol!
Das war es, was den Lord ganz aus der Fassung gebracht hatte.
Dass wir dies damals gar nicht so erwähnt haben, war ganz folgerichtig. Es war eben der englische Gesandte, der sich doch wohl etwas in der Gewalt haben muss, sonst hätte ihn der alte Pitt sicher nicht nach Rom geschickt.
Seine stärksten Worte, die er dazu geäußert, als ihm der Graf versichert, diese Schicksalsprophezeiung trüge nicht, waren gewesen: »Gegen dieses Schicksal werde ich ankämpfen!«
Diese Worte waren eines Lord Moores würdig gewesen! Ein anderer hätte etwas ganz anderes gesagt.
Ja, so konnte dieser Diplomat wohl sprechen, aber aus dem Kopfe kam ihm die ganze Sache deswegen nicht, und das war der Grund, dass er seit jener Zeit wie im Traume einherging und jetzt seit einer Viertelstunde einen ausgezogenen Schuh betrachtete.
»Wenn ich diesem weißen, kalten Marmorbilde jemals in meinen Armen warmes Leben einhauchen könnte, dann wollte ich... ach, das ist ja dummes Zeug!«
Es klopfte.
»Sind Mylord noch wach?«, fragte Ralphs Stimme.
»Ja. Komm herein!«
»Mylord, da sind schon wieder zwei mönchartige Gestalten, die Sie in dringendster Angelegenheit zu sprechen wünschen, und in der einen habe ich wieder die Herzogin Borghesia erkannt.«
Der Lord machte ein förmlich erschrockenes Gesicht.
»Was? Die will mich doch nicht schon wieder in den Keller führen, dass ich dort nochmals eine hundertjährige Leiche auspaddeln soll?«
»Das hat sie nicht gesagt!«, lächelte Ralph. »Dringendste Angelegenheit!«
»Und der andere Mönch? Doch nicht wieder der Pater Hilarion?«
»Nein, diesmal ist das ebenfalls ein Weib, kalkuliere ich.«
»Die Herzogin Borghesia — hm — ich bin zu allem bereit geworden — ich empfange sie.«
Der Lord brauchte nur seinen Schuh wieder anzuziehen, und der Spiegel sagte ihm, dass er empfangsfähig war.
In dem Salon befand sich zunächst nur die Herzogin, die gleich ihr Gesicht zeigte.
»Mylord, Prinzess Polima ist entflohen!«
Es wirkte auf den Lord wie ein Donnerschlag — allein der Name, der seinen ganzen Gedankenkreis ausfüllte.
»Entflohen? Wem denn?«
»Dem bischöflichen Palaste, den sie einstweilen bewohnte, bis sie morgen den Schleier nehmen sollte.«
»Ja, warum denn?!«
»Weil sie den Schleier eben nicht nehmen will.«
»Das ist ja gar nicht möglich, das ist doch schon so lange vorbereitet, das war doch ihr eigener Wille!«
»Sie hat ihren Willen eben in der letzten Minute geändert.«
Der Lord sah förmlich schon das Schicksal kommen, das alle Pläne der Menschen zuschanden macht. Das Richtige ahnte er freilich noch nicht.
»Sie will der Welt erhalten bleiben?«
»Sie will nicht ins Kloster.«
»Ja, warum denn nicht? Das muss doch irgend einen besonderen Grund haben.«
»Das können Sie noch fragen, Sie, der gewiegteste Diplomat und Menschenkenner?«
»Doch nicht etwa, weil sie...«
Das letzte Wort wagte Moore gar nicht auszusprechen, und die Herzogin hätte es ihm auch nicht gelassen.
»Weil sie liebt. Die Liebe ist ihr ins Herz geschlagen.«
Der Lord hätte sich so gern gesetzt. Jetzt freilich begann der Diplomat etwas zu ahnen — aber immer noch nicht das Richtige.
»Sie liebt? Wen liebt sie?«, fragte er unschuldig.
»Lord, stellen Sie sich doch nicht so!«
Ja, der Lord konnte aber doch nicht sagen: dann ganz gewiss mich.
»Ihre Großtante...«
»O, Lord! Lassen Sie mir gegenüber doch Ihre diplomatischen Ausflüchte, die anderen Menschen manchmal geradezu töricht klingen. Den Grafen von Saint-Germain!«
Jetzt setzte sich der Lord doch noch. Er fiel von ganz allein in den Lehnstuhl.
»Es — ist — nicht — möglich!«
»So habe auch ich mir zuerst gesagt. Lassen Sie sich erzählen.«
Und sie erzählte, was sie selbst soeben zu hören bekommen hatte.
Der Lord hatte sich schnell ganz wieder in seiner Gewalt. Wie es in seinem Innern aussah,. wollen wir nicht zu schildern versuchen.
»Also den Grafen von Saint-Germain! Das wird ja eine nette Skandalaffäre. Und Sie haben sie doch nicht etwa mit hierher gebracht?!«
»Sie ist hier. Wir zählen auf Ihre Hilfe.«
Jetzt überwogen die diplomatischen Sorgen doch zunächst alles andere.
»Herzogin, was fädeln Sie da ein?! Was muten Sie mir zu?!«, rief Moore in wirklichem Schreck. »Ich, der Vertreter Englands...«
»Die unglückliche Prinzessin baut auf Ihre Hilfe, und ich habe ihr erst dazu geraten.«
»Ich habe hier das Ansehen Englands zu wahren, ich muss sowieso schon ganz, ganz vorsichtig...«
»Wir bauen auf Ihre Hilfe, die Sie noch keinem Unglücklichen versagt haben«, wiederholte die Herzogin ganz einfach.
Und gar schnell war auch des Lords Widerstand gebrochen. Sein gutes, edles Herz siegte über alle Bedenken. Er war bereit, die Geliebte, die einen anderen liebte, in Sicherheit zu bringen.
»Na, meinetwegen, und sollte ich dabei selbst zum Teufel gehen. Habe die Geschichte hier überhaupt schon längst satt, mich hält nur noch das Pflichtgefühl, und weil es ein feiges Zurückweichen bei mir überhaupt nicht gibt. Zu dem Grafen will sie also nicht...«
»Das ist das einzige, worauf sie durchaus nicht eingehen will.«
»Verstehe schon, verstehe schon, sonst brauchte sie doch auch nicht erst zu mir zu kommen. Dann vorwärts, dann muss diese Nacht auch noch ausgenutzt werden. Die Prinzess kann doch reiten?«
»Sicher. Sie ist ja auf den polnischen Gütern ihres Vaters groß geworden. Aber wozu reiten? Können Sie sie nicht hier verbergen?«
»Das ist ganz ausgeschlossen, wenn sie wirklich verborgen bleiben soll. Was meinen Sie wohl, wie morgen ganz Rom auf den Kopf gestellt wird!«
Moore setzte der Herzogin seinen Plan auseinander. Die Prinzess musste unbedingt über die Grenze, ins Ausland, womöglich nach England. Dort war sie am gesichertsten.
»Aber die Landtour ist unmöglich. Auch sie im nächsten Hafen einzuschiffen, dürfte seine Schwierigkeiten haben. Dazu sind unbedingt Vorbereitungen nötig, und mit der Schnelligkeit der Kirche kann ich mich nicht messen. Da habe ich schon meine Erfahrungen gemacht. Und vielleicht ist jetzt schon die Flucht der Prinzessin entdeckt, alles in Aufruhr, wenn auch in aller Stille. Wir müssen versuchen, die Prinzessin nach Palo zu bringen.«
Es ist dies ein Hafenstädtchen, fünf Meilen von Rom entfernt, welches allein nicht zum Kirchenstaate gehörte, durch eigentümliche Verhältnisse seine vollständige Neutralität und sogar Selbstständigkeit gewahrt hatte. Es war damals ein Sammelpunkt aller zum Protestantismus übergetretenen Italiener, die in der Nähe Roms bleiben wollten. Groß war die Bevölkerung freilich nicht, aber zum Teil eine ganz gediegene.
»Sie kennen doch dort meinen Landsmann, den Mr. Morphin?«
Wer in Rom hätte nicht den Kapitän Morphin gekannt, wie er allgemein genannt wurde? Ein schwerreicher Engländer. ein durch und durch verrückter Kerl, der in der Nähe von Palo ein altes Kastell gekauft und wohnlich wieder aufgebaut hatte, um dort als alter Land- und Seeraubritter zu hausen. Das heißt, nur in seiner Einbildung. Er war Kapitän gewesen, Schiffsbesitzer, hatte ein Menschenalter lang an der chinesischen Küste Opiumschmuggel getrieben, daraus stammte sein Riesenvermögen, und daher auch sein Name, der gar nicht trefflicher passen konnte, denn Morphium ist die Quintessenz von Opium, und bei diesen Schmugglerfahrten mochte es ja heiß und abenteuerlich genug zugegangen sein. Nebenbei hatte er wohl noch ein bisschen Seeräuberei getrieben, wenigstens auf Dschunken, und das alles steckte dem alten Seebären nun noch im Kopfe, das musste auf seinem Seekastell alles ganz seeräubermäßig zugehen, so mit einer Anlehnung ans mittelalterliche Raubrittertum.
Aber auch in Wirklichkeit trieb er Fehde auf eigene Faust. Mit dem Kirchenstaat lag er in ewigen Grenzstreitigkeiten, allerdings nur auf dem Wege des Prozesses. Ernstlicher betrieb er die Fehde auf dem Wasser. Er hatte die Fischereigerechtigkeit von Palo gepachtet, oder sich zum Schutzherrn aufgeworfen, wofür er eine stattliche Summe bezahlte, und da pirschten seine wie Kriegsschiffe ausgestatteten kleinen Segelboote nun auf die fremden italienischen Fischer, die auf verbotenem Gebiet fischten, er nahm sie gefangen, verurteilte sie zum Tode — um sie dann reich bewirtet und beschenkt zu entlassen, und in ihren konfiszierten Booten fanden die armen Kerls dann neue Netze.
Dieser geschworene Feind des Kirchenstaates war also die beliebteste Person. Wenn er in Rom erschien, heute nackt mit einem Bärenfell über der Schulter, morgen in einer zwei Zentner schweren Eisenrüstung, mit einem dementsprechenden Gefolge, dann war jedes Mal für ganz Rom ein Festtag. Das erste war regelmäßig dass er das von ihm mit Waffengewalt eingenommene Rom der Plünderung preisgegeben erklärte, wonach er mit seiner Keule oder Streitaxt die Schaufenster einschlug, deren Inhalt den Gaumen der Jugend und auch der Männer am meisten reizte, dann natürlich alles bezahlend.
Doch wir werden diesen originellen Kauz, an dessen Verrücktheit wohl viel eine noch im Kopfe steckende Kugel schuld war, noch zur Genüge kennen lernen.
»Bei dem ist sie vorläufig in Sicherheit, Kapitän Morphin wird es sich zur höchsten Ehre anrechnen, und der lässt sich nichts aus den Fingern nehmen, und von dort kann sie auch am leichtesten auf ein englisches Schiff kommen.«
Die Herzogin schlug sich vor die Stirn.
»Bei der Madonna, dass ich nicht gleich an Kapitän Morphin gedacht habe!«
»Sie hätten mir dadurch alles ersparen können, dass nun auch ich mit in diese Affäre hineinkomme.«
»Ja, aber wie soll ich sie hinbringen, ich habe keine zuverlässigen Diener, müsste mir erst Pferde besorgen!«
»Stimmt, es war ganz gut, dass Sie gleich zu mir gekommen sind. Na, und wenn's hier reißt, dann akkompagniere ich mich mit meinem Freunde Morphin, wie er es schon .immer gewünscht hat. Jetzt aber keine Zeit mehr verlieren!«
Der gerufene Ralph war sofort zur Stelle. Er wurde mit kurzen Worten eingeweiht und erhielt seinen Auftrag. Er selbst ging nicht, es waren noch andere zuverlässige Diener genug vorhanden, und die sattelten jetzt schon die Pferde.
»Wollen Sie denn aber die Prinzess nicht selbst erst sehen, Mylord?«
Nein, das war das einzige, was der Lord nicht über sich brachte. Er hatte an Selbstverleugnung schon das Menschenmöglichste geleistet — und noch mehr an uneigennützigem Edelmut.
Er rechtfertigte seine Weigerung mit der Schnelligkeit, mit der sie fort müsse, und er wollte auch ein gewisses Recht zur Behauptung haben, dass er die Prinzess gar nicht gesehen habe, und tatsächlich hatte Ralph sie bereits hinabgeleitet.
»Dann muss wenigstens ich noch Abschied von ihr nehmen«, sagte die Herzogin, ihm die Hand entgegenstreckend. »Gute Nacht, Sie edelster aller edlen Männer.«
Der Lord hatte die Hand genommen. Das schwärmerische Auge der Herzogin war ja schließlich ganz angebracht.
»A bah, was heißt edel?«, entgegnete der Lord leichthin. »Es tut jeder, was ihm sein Herz befiehlt — zuletzt ist doch alles Egoismus.«
»Gute Nacht, gute Nacht!«
»Gute Nacht, gnädigste Herzogin.«
Aber sie wollte seine Hand durchaus nicht loslassen, ihr Auge und ihr ganzes Gesicht ward nur immer verklärter.
»Schlafen Sie wohl, mein Lord.«
»Ich wünsche Ihnen das Gleiche.«
»Träumen Sie recht angenehm.«
»Nanu«, fing jetzt schon der Lord zu denken an, »was will die denn eigentlich?«
Und die Herzogin war noch immer nicht fertig. »Gute Nacht, gute Nacht, mein edler Lord.«
»Gute Nacht, gnädigste Herzogin, wünsche angenehme Ruhe.«
»Gute... Nacht!«
Endlich hatte sie seine Hand losgelassen und war hinaus.
Ganz verblüfft stand Lord Moore da.
»Ja, was wollte denn die? Gute... Nacht! und dieser Augenaufschlag dazu, dieser verzückte Blick! Himmel, jetzt hat die sich doch nicht etwa auch noch... ach, Polima! — Ach! — Der Graf von Saint-Germain!«
Die Flucht der Prinzessin war sehr bald entdeckt worden. Durch einen Zufall schon zu früh. Nachts gegen eins war ein Diener durch das Konzert verliebter Katzen geweckt worden, es war überhaupt seine Pflicht, hier als Polizei Ruhe zu stiften, also er hatte sich mit der gefüllten Handfeuerspritze bewaffnet, durch das Fenster waren die Untiere nicht zu erblicken, so war er hinaus in den Garten gegangen.
Als er ums Haus schlich, bemerkte er im Sternenschimmer, dass das Fenster des Parterrezimmers aufstand, in welchem die Prinzessin schlief.
Das musste ihn sehr stutzig machen. Damals wurde Rom noch nicht von jedem, der es sich leisten konnte, während der heißesten Sommermonate verlassen, obgleich schon damals die Sümpfe der Umgegend Fieberdünste aushauchten. Die Erkrankungen waren auch nicht so groß. Die Naturen mochten stärker sein, oder wahrscheinlicher gab es damals noch nicht solche Angsthasen, und die Bakterien und dergleichen Mikroben waren überhaupt noch gar nicht ›erfunden‹ worden.
Aber bei offenem Fenster schlafen, das durfte man auf keinen Fall. Das konnte allerdings tödlich ablaufen! Dann lieber im glühenden Zimmer ersticken.
Also der Diener hatte die Pflicht, dieses Fenster zu schließen. Aber hinaufklettern, das konnte er auch nicht. Da musste er erst jemand wecken, der sich der Prinzessin bei Nacht nähern durfte. Und schließlich erkannte er auch noch, wie hier die Weinreben abgerissen waren. Das brachte ihn vollends gleich auf ganz andere Gedanken.
So eilte er ins Haus zurück und pochte ohne Weiteres an der Tür des Schlafzimmers des Bischofs.
Dieser, der keinen Leibdiener in der Nähe hatte, meldete sich alsbald.
»Das Fenster der Prinzessin steht auf, ich glaube, sie ist fort!«
In der nächsten Minute war der Bischof draußen. Eine weibliche Bedienung gab es in diesem Hause gar nicht, außer der Prinzessin befand sich nur die Woiwodin hier, mit deren Wecken hielt sich der Bischof auch nicht erst auf, und als sein Klopfen und Donnern gegen die verschlossene Tür der Prinzessin ungehört blieb, musste ein Diener durch das Fenster eindringen.
»Die Prinzessin ist geflohen!«
»Oder entführt!«
»Der Graf von Saint-Germain!«
Nur der Bischof und die unterdessen herbeigeeilte Tante hatten diese Worte gewechselt, und der Bischof hatte gleich dafür gesorgt, dass sie von keinem anderen gehört wurden.
»Dann befindet sie sich im Hause des Grafen. — O, die Schmachvolle! Sofort hin, sofort hin!!«
»Halt!«, ermahnte der Bischof. »Natürlich geht sofort eine Wache nach der Wohnung des Grafen ab, aber wir wollen auch sonst nichts außer acht lassen.«
So verging doch noch einige Zeit mit dem Absuchen des Gartens, mit dem Konstatieren, dass die Prinzess an dieser Stelle über die Mauer gegangen war, ehe eine Patrouille, die aber doch auch erst requiriert werden musste, sich nach dem Spukkloster begab.
Als diese abrückte, mit Informationen versehen, um im Namen des Papstes Haussuchung zu halten, eventuell den Grafen zu verhaften, war es zwei Uhr.
Wir aber drehen das Rad der Zeit um eine Stunde zurück.
Es war noch nicht halb zwei, als gegen das Tor des Spukklosters gedonnert wurde. Der neu angestellte Pförtner eilte aus dem Kloster, wo er seine Wachstube hatte, nach dem Gartentor.
»Wer ist da?«
»Päpstliche Wache! Aufgemacht!!«
Der Pförtner öffnete natürlich sofort. Hier gab es doch gar keine Weigerung. Der Papst war damals noch unumschränkter Monarch des Kirchenstaates.
Der Diener sah ein halbes Dutzend Männer, zum Teil Mönche, zum Teil die Uniform der Schweizergarde tragend.
»Wo ist der Graf von Saint-Germain?«
Die Männer warteten aber gar keine Antwort ab, mit Ungestüm drangen sie gleich ein, den Pförtner nur deshalb vor sich her stoßend, um sich das Zimmer des Grafen zeigen zu lassen.
Doch das fanden sie auch von ganz allein, es war bekannt genug, dass der Graf noch dasselbe Parterrezimmer bewohnte, in dem er sich gestern häuslich eingerichtet hatte.
»Aufgemacht, aufgemacht im Namen des Papstes!!«, pochte ein Schwertknauf gegen die Tür.
»Wer ist denn draußen?«, fragte drin eine volle, schon ziemlich tiefe Stimme, die aber doch noch einem Knaben angehören musste.
»Päpstliche Wache, aufgemacht!«
»Der Graf liegt im Starrkrampf«, ließ sich Joseph wieder vernehmen.
»Bah! Aufgemacht, oder wir erbrechen die Tür!«
Da öffnete Joseph. Das Zimmer war hell erleuchtet, das Fenster durch Läden verschlossen, und auf dem Diwan lag der Graf, jetzt mit einem schwarzen Samtanzug bekleidet, mit todesstarrem Gesicht.
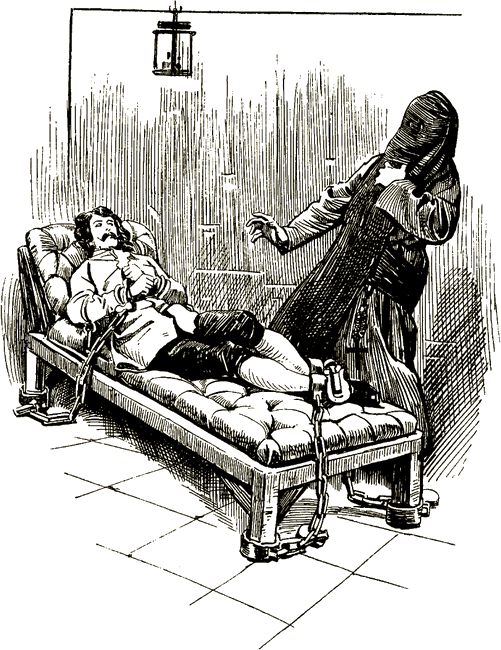
»Ich denke, der braucht überhaupt nicht zu schlafen?«, sagte zunächst der führende Offizier.
»Braucht er auch nicht, er hat sich vor einer halben Stunde in Starrkrampf versetzt«, entgegnete der kleine Joseph unverzagt.
Dass der Graf einen Jungen als Leibpagen engagiert hatte, war ja ebenfalls schon bekannt.
»Er will doch nur mittags von zwölf bis eins in Starrkrampf fallen.«
»Da muss er unbedingt, da kommt's von selbst. Sonst kann er sich aber in Starrkrampf versetzen, wann er will, und er wollte im Geiste einmal nach Indien gehen.«
»So, nach Indien! Und wo ist er sonst die ganze Nacht gewesen?«
»Immer hier.«
Die Diener waren angeschlichen. Eigentlich hätte auffallen müssen, wie wenig sich der Offizier für die Prinzessin interessierte, er hatte es allein auf den Grafen abgesehen.
»Ist innerhalb der letzten drei Stunden hier eine Dame ins Haus gekommen?«, fragte er wohl einmal.
Als dies erstaunt verneint wurde, wandte er seine Aufmerksamkeit sofort wieder dem Grafen zu.
»Aufgewacht, ich muss ihn sprechen!«
»Um Gottes willen, fasst ihn nicht an!«, schrie der Page. »Ihr könnt ihm etwas abbrechen, alles ist wie Glas an ihm!«
»A bah, ich habe meine Instruktionen, denen auch alle Teufel und Geister zu gehorchen haben. Wann wacht er auf?«
»In einer halben Stunde.«
»So lange kann ich nicht warten. Und desto besser, wenn er sich nicht rührt. Angefasst, fort mit ihm nach der Wache!«
Und die anderen Männer griffen zu, Mönche wie Soldaten. Wohl kämpften sie alle mit furchtbarer Scheu, das Aussehen des Grafen war auch danach angetan, und nun diese Gliederstarre, wie ein Brett ließ er sich emporheben — aber der Offizier wusste nichts von solcher Furcht, der kannte als echter Soldat nur seinen Befehl, und das ermutigte auch die übrigen.
Der Page zeterte furchtbar, ermahnte immer wieder, dem Grafen doch ja nichts abzubrechen, zeigte dabei vielleicht etwas mehr Angst, als nötig war — und die Hauptsache war auch, dass an dem Erstarrten kein Ohr noch sonst etwas abbrach.
So wurde der Graf wie ein Brett oder vielmehr wie ein Stamm hinausgetragen, durch den Garten, und da kam auf der Straße auch schon eine von zwei Männern getragene Sänfte, in die der Graf, nachdem er noch eine Kapuze über den Kopf bekommen, gepackt wurde.
»Niemand verlässt dieses Haus! Aus Befehl des Papstes! Ich stelle eine Wache vor das Tor!«
So rief der Offizier noch einmal, zog das Tor hinter sich zu, und die Sänfte setzte sich, von den bewaffneten Männern umringt, in Bewegung, ohne dass wirklich eine Wache zurückgelassen worden wäre.
Dies konnte gleich darauf auch Joseph konstatieren. Denn der Junge hatte sich nicht einschüchtern lassen; er war, als sich das Tor kaum geschlossen hatte, an einer finsteren Stelle über die Mauer gesetzt, um der Sänfte heimlich nachzuschleichen.
Das war ja sehr treu und klug von ihm, er musste auch aus anderen Anzeichen darauf schließen, dass hier etwas nicht in Ordnung sein könne, der Offizier hatte es mit dem Fortschaffen des Grafen gar so eilig gehabt, und nun ließ er auch, obgleich er es doch soeben gesagt, keine Wache zurück; infolge dieses Nachschleichens aber, was sich dann als zwecklos herausstellen sollte, wurde Joseph nicht Zeuge der zweiten Szene, die sich eine halbe Stunde später abspielte.
Es war noch nicht einmal eine halbe Stunde vergangen, als es wiederum gegen das Tor des Klosters donnerte.
»Päpstliche Wache, aufgemacht!!«, erklang es zum zweiten Male.
Die noch gar nicht zur Besinnung gekommenen Diener erblickten eine zweite Patrouille, diesmal nur aus Soldaten der Schweizergarde bestehend, von einem anderen Offizier geführt. Auch diese drangen sofort ein.
»Wo ist der Graf von Saint-Germain? Ist hier in den letzten drei Stunden eine Dame aufgenommen worden?«
Was sollten die Diener davon denken?
»Der Graf ist doch soeben von einer päpstlichen Wache abgeholt worden.«
»Was?!«, schrie der Offizier. »Von einer päpstlichen Wache abgeholt worden?! Von welcher denn?«
Die Diener berichteten. Der Offizier wollte es nicht glauben, musste es aber zuletzt wohl.
»Das ist eine Gaukelei gewesen, der Graf hat sich mit Absicht schon so entführen lassen, es kann noch gar keine päpstliche Wache hier gewesen sein, das waren maskierte Schurken, die sich nur für päpstliche Soldaten ausgegeben haben!«
Ja, so schien es gewesen zu sein. Der Offizier schickte nach allen Stationen, die in Betracht kommen konnten, und es musste bestätigt werden, dass nirgends eine päpstliche Wache abgegangen war, um den Grafen zu verhaften.
»Hat sich der vorgebliche Offizier denn legitimiert?«
Nein, nach so etwas zu fragen, hätten die Diener doch niemals gewagt.
»Hat er denn Haussuchung abgehalten?«
Auch nicht. Und jetzt dachten die Diener ebenfalls daran, wie merkwürdig das doch alles zugegangen war.
»Ihr seid die Opfer eines Betruges geworden!«
Es war nicht mehr zu ändern, wenigstens nicht von hier aus. Der Offizier tat seine ihm vorgeschriebene Pflicht, er durchstöberte das ganze Kloster, ohne eine Spur vom Grafen, den er verhaften sollte, oder von der entflohenen Prinzessin zu finden.
Ebenso wenig Erfolg hatten die Patrouillen, welche ganz Rom durchstreiften. Niemand hatte die sechs Soldaten und Mönche mit der Sänfte verschwinden sehen, eine Beschreibung ihrer Gesichter konnten die Diener gar nicht geben, und wie sicher sich die Banditen gefühlt hatten, das zeigte, dass sie nicht einmal für nötig gehalten hatten, ihre Gesichtszüge zu vermummen.
Auch des kleinen Josephs Verfolgung hatte wenig Zweck gehabt. Im Eilmarsch war die Wache abgerückt, immer die entlegensten und finstersten Straßen aufsuchend. Unterwegs machten die der Sänfte Zunächstgehenden sich mit dem Darinliegenden durch die offenen Seitenwände zu schaffen. Joseph glaubte annehmen zu dürfen, dass sie ihn noch nachträglich fesselten, ohne dabei auch nur ihren Schritt stocken zu lassen.
So erreichten sie den Tiber, die Sänfte ward eine Wassertreppe hinabgetragen, an der nur ein einziges, großes Boot lag, auf dieses ward die Sänfte gesetzt, alle anderen gingen hinein, das Boot stieß ab, verschwand bald auf dem finsteren Wasser.
Da musste auch Joseph seine Verfolgung aufgeben, er kehrte zurück, und zwar ohne besondere Sorge um seinen Herrn.
»Was ich bisher über ihn erfahren habe und was er mir selbst schon offenbart hat, lässt mich annehmen, dass er sich schon zu helfen wissen wird.«
Am Kloster angelangt, fand er das Tor wiederum von päpstlichen Soldaten besetzt. Er kletterte wieder über die Mauer, ließ sich dann abfassen, erzählend, er habe sich unterdessen in dem finsteren Garten versteckt gehabt.
Erst jetzt erfuhr er von dem zweiten Besuche, und der intelligente Bursche hatte wohl gleich das Richtige erkannt.
»Man will nicht haben, dass er ordnungsmäßig in die Hände der Polizei kommt, er soll in ganz anderer Weise verhört werden, da liegen Privatinteressen vor.«
So sagte sich der schlaue Bursche sofort und behielt es für sich, wo er die Sänfte mit dem Grafen hatte verschwinden sehen.
Mit einem Seufzer schlug der Graf die Augen auf, bewegte die noch eben völlig starr gewesenen Glieder, und es klirrte.
Er war mit recht ansehnlichen Ketten an Händen und Füssen gefesselt, die man deshalb nicht hatte zu biegen brauchen, wenn dies überhaupt möglich gewesen wäre, und diese Ketten waren auch noch an der Pritsche befestigt, auf der er, auf Lederpolster gebettet, lag, den Kopf etwas erhöht, sodass er ziemlich freie Umschau halten konnte.
Was er so sonst noch sah, war eine nackte Zelle, durch eine Lampe erleuchtet, und ein vor der Pritsche stehender Mönch mit herabgelassener Kapuze, hinter der nur die Augen leuchteten.
Man darf wohl glauben, dass dieser Mann, der Graf, wenn er überhaupt wirklich so gänzlich bewusstlos gewesen war, sofort wusste, wie es mit ihm stand. Mindestens durfte er nicht erst ein erstauntes oder gar erschrockenes ›Wo bin ich?‹ haben.
»Was habe ich getan«, fragte er statt dessen sofort, »dass man mich bei nächtlicher Weile aus meiner Wohnung holt und mich wie einen Verbrecher fesselt?«
»Ah, das Leben ist mit dem Geiste zurückgekehrt!«, erklang es hinter der Kapuze spöttisch, und einer, der sich auf so etwas versteht, konnte erkennen, dass dabei nicht vergessen wurde, die Stimme zu verstellen.
»Ist das alles, was man mir auf meine Frage zu antworten hat?«
»Gemach, Herr Graf — ich bin es, der zu fragen hat, und Ihr werdet antworten!«
»Wenn mir's beliebt.«
»Oho!«
»Was wollt Ihr von mir wissen?«
»So ist es recht, gebt lieber nach. Denn bei mir kommt Ihr mit Euren halb vom Betrug und halb vom Wahnsinn diktierten Redensarten nicht weit.«
»Seid Ihr ein Ehrenmann, so werdet Ihr zunächst beweisen, inwiefern ich jemals etwas gesagt habe, was von der Lüge oder vom Wahnsinn diktiert war.«
»Gut, das sollt Ihr gleich zu hören bekommen. Ich denke, Ihr fallt nur in der Mittagsstunde von zwölf bis eins in diesen Starrkrampf?«
»Dann befällt mich dieser Zustand von allein, dagegen kann ich mich nicht wehren, das ist mein täglicher Tribut, den ich dem Tode zollen muss, den ich sonst bemeistert habe.«
»Na, ich will erst einmal tun, als ob ich Euch das glaube, um noch etwas mehr solchen Wahnsinn zu hören. Also, Ihr könnt Euch auch zu anderer Zeit in diesen Starrkrampf versetzen?«
»Gewiss, wann ich will.«
»Weshalb habt ihr es diesmal getan?«
»Laut einer längst vereinbarten Verabredung.«
»Verabredung, mit wem?«
»Mit denen, welche das Schicksal der Menschheit lenken.«
»Aha! Wo hat denn die Versammlung stattgefunden? Doch natürlich auf dem Vesuv.«
Der Graf musste sofort merken, dass man ihm hier einen Strick drehen wollte.
Der Hexenglaube stand ja damals noch immer im besten Flor. Gerade zu jener Zeit, im Jahre 1749, war zu Würzburg die Priorin eines Klosters, die Renata Singer, als Hexe öffentlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden, ein Jahr darauf mussten fast alle Weiber eines polnischen Dorfes auf Betreiben der Kirche die Wasserprobe aushalten; die letzte Hexe wurde wohl 1796 im damaligen Großherzogtum Posen verbrannt.
Allerdings ist in Italien niemals gegen die vermeintlichen Hexen so furchtbar vorgegangen worden, wie in den nördlichen Ländern. Aber es sind auch genug verbrannt und zu Tode gefoltert worden. Dass bei den italienischen Hexen der Vesuv dieselbe Rolle spielte wie bei uns der Blocksberg, ist leicht begreiflich. Auf dem Vesuv sollten sie ihre Zusammenkünfte abhalten, dort mit ihren Buhlteufeln Orgien feiern.
»Doch natürlich auf dem Vesuv!«
»Nein. auf dem höchsten Gipfel des Himalajas.«
»In Indien?«
»Jawohl, der Himalaja liegt in Indien.«
»Kommen dort auch Hexen zusammen?«
»Hexen? Was habe ich mit Hexen zu tun? Die gibt es ja gar nicht.«
»Nun, mit wem seid Ihr denn sonst dort zusammengekommen?«
»Mit den Mahatmas.«
»Und das sind Teufel.«
»Nach Eurer Anschauung müsste dann auch unser Herr und Heiland ein Teufel gewesen sein.«
»Mann, frevelt nicht so furchtbar!«, fuhr der Vermummte empor.
»Ihr frevelt, nicht ich.«
»Wer sind denn die Mahatmas?«
»Diejenigen, welche die Geschicke der Menschheit lenken.«
Dem Leser, der sich etwas mit Okkultismus beschäftigt hat oder gar der modernen Theosophie angehört, dürfte das Wort ›Mahatma‹ nicht unbekannt sein. Wir werden uns später noch damit zu beschäftigen haben.
Der Mönch wusste es nicht, interessierte sich nicht dafür, ließ dieses Thema jetzt auch ganz fallen.
»Graf, Ihr habt die Prinzess Polima Leszczynski entführt!«, kam er jetzt gleich zur Hauptsache.
Nicht das geringste Zeichen der Überraschung.
»Nein.«
»Ah, Ihr wisst aber, dass sie entflohen ist!«
»Ja.«
»Woher denn, wenn Ihr immer ohne Besinnung im Starrkrampf gelegen haben wollt?«
»Ihr vergesst wohl, dass mein Geist frei ist und selbstständig denken kann. Als er auf dem Himalaja weilte, wusste er doch sofort, was hier geschah, dass seinem seelenlosen Körper Gefahr drohte, und in einem Momente kehrte er zurück, um ihm schützend zur Seite zu stehen, bis er von der irdischen Hülle wieder Besitz nehmen durfte.«
»Und das durfte erst um zwei geschehen?«, fragte der Vermummte zunächst.
»Er muss so lange ohne Körper verharren, wie er sich vorgenommen hatte, da er sich noch im Körper befand.«
»Graf, Ihr bleibt Euch immer konsequent, das muss man wirklich loben«, erklang es spöttisch hinter der Kapuze. »Nur schade, dass ich an all diese Geschichten nicht glaube. Ihr mögt Euch in eine Art von Starrkrampf versetzen können, während desselben aber hört und seht Ihr alles, was um Euch her gesprochen wird und vorgeht.«
»Meinetwegen nehmt das an«, erklang es gleichmütig zurück.
»Die Prinzess liebt Euch.«
Wiederum nicht das geringste Zeichen einer Überraschung.
»Das ist nicht wahr.«
»Sie hat es selbst gesagt.«
»Um Euch zu täuschen.«
»Um wen zu täuschen?!«, fuhr der Vermummte wiederum empor.
»Euch.«
»Was wisst Ihr denn, wer ich bin?«
»Der Fürstbischof von Rom.«
Wie tödlich getroffen prallte der Vermummte zurück.
Denn er war es wirklich, der Beichtvater Polimas.
Er selbst hatte, bevor er öffentlich Alarm schlug, die maskierte Wache abgeschickt, um den Zaubergrafen in seine Gewalt zu bringen, ehe dieser unter die geregelten Gesetze der Justiz kam.
Aber die falsche Wache, meist aus Mönchen bestehend, konnte unmöglich wissen, wer sie gesandt hatte, das war wieder von einem anderen ausgegangen, den der Bischof schnell erst eingeweiht hatte, dessen absolute Zuverlässigkeit er kannte, und so war auch ganz ausgeschlossen, dass die Wache unterwegs von so etwas gesprochen hätte, was der Graf gehört haben konnte. Dass der Fürstbischof von Rom seine Hand in einem so frevelhaften Spiele gehabt, der Macht des Papstes zuvorkommen zu wollen, einen solchen Verdacht hätte im Kirchenstaate niemand auszusprechen gewagt.
Da es aber nun einmal ausgesprochen war, hier von diesem in Ketten Liegenden, gab es der Bischof auch gleich zu. Nach diesem furchtbaren Erschrecken wäre auch jedes Ableugnen lächerlich gewesen. Und jetzt herrschte der erste Schreck auch noch vor.
»Mann, wer seid Ihr, dass Ihr das wissen könnt?!«
»Ich bin eben ein Mahatma. Oder ich will Eurer Eminenz eine einfachere Erklärung geben: Ich habe als wesenloser Geist meinen seelenlosen Körper einfach bis hierher begleitet, und so habe ich Euer Gesicht auch schon unverhüllt gesehen, ehe Ihr zu mir hier hereinkamt.«
Nur ein neues Zittern befiel den Vermummten.
»Wo befindet Ihr Euch hier?«
»In dem sogenannten schwarzen Turme auf der rechten Seite des Tibers.«
Das konnte der Graf allerdings auch wissen, wenn er doch nicht so bewusstlos gewesen war. Aber an so etwas dachte der Bischof jetzt gar nicht mehr. Er wollte sich in anderer Weise Gewissheit verschaffen.
»Mit wem habe ich gesprochen, ehe ich zu Euch kam? Was habe ich gesprochen?«
»Examiniert mich nicht auf diese Weise! Ich spreche überhaupt nicht über das, was ich im Geiste geschaut habe.«
»Aha, jetzt versucht Ihr wieder auszuweichen!«
»Nehmt es an. Ich weiß, was ich weiß.«
»Ihr müsst mich an der Stimme erkannt haben.«
»Ich habe Euch noch nie sprechen hören, kenne Euch ja gar nicht. Doch nehmt nur alles an, was Ihr gern glauben möchtet.«
»Mann, Ihr seid mein Gefangener!«, fuhr der Bischof drohend empor.
»Ach, wie könnt Ihr mich gefangen halten!«, erklang es verächtlich zurück.
»Das könnte ich nicht?!«
»Nimmermehr. Mich können keine Ketten halten.«
»So befreit Euch doch von Euren Fesseln.«
»Mir ein leichtes.«
»So tut es doch!«
»Ich verzichte darauf!«
»Eitler Prahler!«
»Ich habe es nicht nötig, denn innerhalb einer Stunde werdet Ihr mir selbst die Fesseln lösen und mich tausendmal um Entschuldigung bitten.«
Hinter der Kapuze lachte es schrill. Aber es klang sehr erkünstelt.
»Wisst Ihr, was ich mit Euch vorhabe?«
»Ja.«
»Nun?«
»Ich spreche niemals darüber, was mir im Geiste offenbar wurde.«
»Ein schlauer Gaukler seid Ihr, sonst aber doch nur ein eitler Prahler!«
»Nun denn: Mein gerichtliches Verhör soll nicht den regelrechten Weg gehen, ich soll mich gar nicht verteidigen können, denn Ihr fürchtet die Milde und noch mehr die Gerechtigkeit Eures höchsten Vorgesetzten, des Papstes.«
»Um das zu erkennen, braucht Ihr nicht erst Euren Geist nach Indien zu schicken, dazu habt Ihr sogar sehr wenig Scharfsinn nötig.«
»Was fragt Ihr mich da erst? Nur, um mich auch noch zu verspotten? Das ist sehr wenig edel von Euch.«
»O, mein Graf, Ihr werdet gleich ganz anders sprechen. Dass ich Euch nach einer Stunde die Fesseln selbst löse, daraus wird nichts. Ich werde Euch vielmehr erst einmal sieben Tage hungern lassen, und denkt nicht, dass ich Euch gleich wieder so laufen lasse, wie es Lord Moore in unbegreiflicher Verblendung getan hat. Ihr habt ihn mit Euren Teufelskünsten ganz einfach behext oder auch auf ganz natürliche Weise verblendet. Aber bei mir gibt es so etwas nicht! Ich lasse Euch eine Woche oder auch zwei hier in Ketten liegen, ohne Euch einen Bissen Brot und einen Trunk Wasser zu geben! Und wenn Ihr dann zum Skelett zusammengeschnurrt seid, dann führe ich Euch dem verblendeten Volke vor und sage: Seht, das ist Euer Wundermann, so sieht er aus, wenn er einige Zeit ohne Nahrung gewesen ist. Versteht Ihr wohl?«
Ja, der Graf verstand. Dem Bischof kam es viel mehr darauf an, den Wundermann als einen natürlichen Menschen hinzustellen, als ihn zu strafen, weil er die polnische Prinzessin der Kirche abtrünnig gemacht hatte.
»Ich bin ja freiwillig bereit, diese Probe zu machen — und nicht nur auf eine Woche. Beobachtet mich strengstens, ob ich innerhalb eines ganzen Jahres irgendwelche Nahrung zu mir nehme, ohne auch nur ein Quäntchen an Gewicht zu verlieren.«
»Freiwillig oder nicht — Ihr müsst!«
»Ich muss gar nicht.«
»Oho, das wollen wir doch sehen! Und Ihr bleibt in Ketten! Denn wenn Ihr auch nur eine Hand frei habt — Euch ist alles zuzutrauen.«
»Bischof, Ihr seid eigentlich doch ganz inkonsequent, wisst ja gar nicht, was Ihr sprecht. Und ich sage Euch: Innerhalb einer Stunde befreit Ihr selbst mich von diesen Ketten und entlasst mich in allen Ehren.«
»Hahaha, Ihr redet irre! Jetzt, da Ihr mich erkannt habt, kann von einer Entlassung überhaupt keine Rede mehr sein. Und wenn ich Euch öffentlich zeige, so darf man doch nicht wissen, dass ich es gewesen bin, der Euch entführt hat.«
»Wie wollt Ihr denn verhindern, dass man das erfährt? Dann kann ich doch zu dem Volke reden.«
»Dass Ihr das nicht wisst, beweist mir, dass ich Eure Allwissenheit nicht sehr zu fürchten habe, das spricht auch nicht gerade für Euren Scharfsinn.«
»Ich bin nicht allwissend. Ihr wollt mich stumm machen.«
»Ja, und dazu habe ich nicht einmal nötig, Euch die Zunge auszureißen.«
»Dass Ihr auch nur auf solch einen Gedanken kommt, das verrät Euren Charakter.«
»O, um die Welt von solch einem Teufelszauberer zu befreien, bin ich noch zu etwas ganz anderem fähig.«
»Auch zur Folter?«
»Auch das, und bei Euch werde ich sie anwenden, wenn Ihr mir nicht gesteht, wohin Ihr die Prinzess gebracht habt.«
»Davon wollen wir später reden, wenn Ihr mich als Euren Gast bewirtet...«
»Mann, macht Euch doch nicht lächerlich!«
»Ich meinesteils vermeide solche Ausdrücke, obgleich sie aus meinem Munde viel angebrachter wären. Eminenz, sprechen wir doch ganz ruhig zusammen. Was wollt Ihr denn nur mit mir beginnen? Ja, Ihr könnt mich töten. Aber auf wie lange? Mein Geist formt sich ganz einfach einen neuen Körper, wo er will, ich bleibe immer derselbe Graf von Saint-Germain...«
»O ungeheurer Frevel!! Jetzt will er auch noch Gottschöpfer selbst sein!«
»Dann etwas anderes. Ihr wisst doch, wie ich dem Lord Moore als Geist erschienen bin, während ich im Starrkrämpfe lag.«
»Wenn es wahr ist. Der Lord kann mit Euch schon unter einer Decke stecken.«
»Diese Eure Meinung werde ich dem Lord selbst berichten.«
»Wie denn? Wann denn?«
»Jetzt sofort. Ich versetze mich in Starrkrampf, mein freier Geist fliegt in die englische Gesandtschaft, materialisiert sich dem Lord, offenbart ihm, wo ich mich befinde, wer mich entführt hat, weswegen, und so weiter. Oder mein Geist kann sich auch in den Vatikan begeben, ich kann mich auch gleich direkt dem Papst offenbaren, ihm alles erzählen. Nun?«
Unter der formlosen Kutte war ganz deutlich sichtbar, wie der Bischof zu zittern begann. Der Mut schwand ihm einfach immer mehr. Er wollte es ja nicht glauben, daher auch wieder das höhnische Lachen, aber eben das sagte alles, diese Gezwungenheit!
Die Hauptsache war nämlich dabei, wie der Graf zu sprechen wusste, mit solch einer Sicherheit und daher auch Überzeugungskraft, die gar keinen Unglauben auskommen ließ. Diese Sprechweise, hauptsächlich im Tone liegend, lässt sich nur leider schriftlich nicht wiedergeben.
»O, Ihr wahnsinniger Prahler!!«
»Eminenz, man soll seinen Nächsten keinen Narren nennen! Wehe dem, der es tut! Aber das kann ich Euch sagen: Mit meiner Entführung habt Ihr die größte Torheit Eures Lebens begangen. Ihr glaubt nicht, dass ich das alles ausführen kann? Gut, ich werde es Euch beweisen. Ich versetze mich in Starrkrampf, jetzt gleich, ich begebe mich zunächst zum englischen Gesandten, mit dem ich auf freundschaftlichstem Fuße stehe, mit ihm werde ich besprechen, ob es nicht besser ist, gleich zum Papste zu gehen — und dass noch in dieser Nachtstunde die päpstliche Wache hier ist, und auch in Eurem Palaste, darauf könnt Ihr Euch verlassen. Oder ist es eine Lüge, dass ich über hundert Jahre im Keller der Villa zur heiligen Thekla gelegen habe?«
In den Worten, im Tone hatte es gelegen. Der Bischof brach ganz zusammen. Jetzt sah er ein, wie überstürzt er gehandelt hatte, diesen Wundermann heimlich entführen zu lassen.
Jetzt handelte es sich für ihn nur darum, wie er auf anständige Weise aus dieser Patsche wieder heraus konnte.
»Aber Ihr kommt doch sofort nur in eine andere Gefangenschaft.«
»Das lasst meine Sache sein. Ich werde mich schnell rechtfertigen.«
»Ihr habt die Prinzess wirklich nicht entführt?«
»Ich denke ja gar nicht an so etwas.«
»Die Prinzessin liebt Euch.«
»Das ist nicht wahr.«
»Sie hat es mir selbst gebeichtet.«
»Dann hat sie Euch getäuscht.«
»Weshalb hätte sie das tun sollen?«
»Weil sie einen anderen liebt.«
»Wen?«, fuhr der Bischof empor, jetzt doch von diesem neuen Gedanken beherrscht.
»Einen Mann, den sie Euch niemals nennen wird.«
»Weshalb nicht?«
»Weil ihre Liebe zu ihm als die fluchwürdigste Sünde erscheint, obgleich sie doch nicht von ihm lassen kann.«
»Einen Ketzer?«
»Nehmt es an.«
Der Bischof wiegte sinnend das noch vermummte Haupt hin und her.
»Wer könnte das sein?«
»Von mir erfahrt Ihr es nicht.«
»Aber Ihr wisst es?«
»Ja.«
»Hat sie selbst es Euch gesagt?«
»Das am allerwenigsten.«
»Ihr wisst es, weil Ihr allwissend seid?«
»Wenigstens ist mir vieles bekannt. Aber darüber darf ich eben nicht sprechen.«
»Doch nicht etwa... Lord Moore selbst?!«
»Da Ihr es selbst ausgesprochen habt, darf ich es Euch bestätigen.«
»Was? Prinzess Polima liebt diesen Lord?!«, rief der Bischof außer sich.
»So ist es. Aber ich hoffe, dass Euch hier niemand hören kann.«
»Nein, nein. Doch das ist ja ganz und gar unmöglich!! Prinzess Polima liebt diesen ketzerischsten aller Ketzer!!«
»Bah, was fragt die Liebe nach so etwas!«
»Und warum hat sie da erst Euch genannt?«
»Sie hat den ersten besten bekannten Mann genannt, um Euch über den Gegenstand ihrer irdischen Liebe, die sie Euch nun einmal gestehen musste, zu täuschen. So dachte sie im Moment an mich.«
»Ihr habt diese Liebe zu dem Lord ihr erst eingeflößt!!«, rief der Bischof, der jetzt mit einem Male über den Grafen ganz anders dachte.
»Nehmt es an«, entgegnete dieser wiederum ganz kaltblütig.
Zuerst war der Bischof über dieses Geständnis ganz sprachlos.
»Und das wagt Ihr auch noch zu gestehen?!«, rief er dann.
»Und warum nicht?«
»Die Prinzess war für das Kloster bestimmt, vom heiligen Vater selbst...«
»Das bezweifle ich, das sieht diesem Papste gar nicht ähnlich.«
»Dann überhaupt von der Kirche.«
»Das ist etwas ganz anderes, die mag auch mit der Liebe Politik treiben.«
»Und Ihr habt sie nun gerade für diesen ketzerischen Lord bestimmt!«
Der Bischof rechnete also schon ganz direkt mit Liebeskünsten.
»Nun, und ist das nicht die geschickteste, klügste Diplomatie?«
Hinter der Kapuze hervor starrten die Augen auf den Gefesselten, der aber bereits der Sieger war.
»Was sagt Ihr da?«
»Überlegt nur: Der englische Gesandte wird die Prinzessin heiraten...«
»Nimmermehr!!«
»Sicher.«
»Dann ist diese polnische Prinzessin, mit der wir noch so viel vorhatten, doch erst recht für uns verloren.«
»Wieso?«
»Dann muss sie doch zum Protestantismus übertreten.«
»Ganz im Gegenteil. Der Lord wird in den Schoß der allein seligmachenden Kirche zurückkehren.«
Der Bischof machte eine Bewegung, als wollte er die Arme über dem Kopf zurückschlagen oder ein Gespenst von sich abwehren.
»Der Lord? Der englische Gesandte?! Lord Walter Moore?! Ehe ich das glaube, glaube ich eher an den Untergang der Welt!«
»Nein, vorher wird Lord Walter Moore als guter Katholik die Prinzess Polima heiraten. Merken Sie es sich: Heute über einem halben Jahre beantragt Lord Walter Moore, in die katholische Kirche aufgenommen zu werden, um Prinzess Polima heiraten zu können. Und nicht nur das, sondern er tritt aus innerster Überzeugung zur allein seligmachenden Kirche über.«
Wieder diese unerschütterliche Gewissheit in der Stimme. Der Bischof geriet immer mehr außer sich.
»Ja, dann kann er aber doch nicht mehr der Gesandte Englands sein...«
»Nein, das gewiss nicht. Aber sollte die katholische Kirche solch einen Mann nicht ebenso gut brauchen können?«
»Das wohl — Lord Walter Moore einer der Unsrigen! — ich wage noch gar nicht an diesen Triumph zu denken!«
»Und wem habt Ihr diesen Triumph zu verdanken? Allein mir.«
So sprach der gefesselte Mann, der, wie wir gleich verraten wollen, von alledem noch gar keine Ahnung haben konnte. Höchstens, dass der Lord die Prinzess liebte oder sie vielmehr als sein Ideal verehrte. Das konnte er aus dem Lord in der Hypnose herausbekommen haben, aber auch nur das, nichts weiter. Alles andere war nur ein Hirngespinst von ihm, das er freilich in Wirklichkeit umzusetzen gewillt war. Und hierin, wie er das alles so spann, hatte sich der Graf als unübertrefflicher Diplomat bewiesen. Mit welcher Moral, das ist eine andere Frage. Er selbst aber hielt sich für gerechtfertigt, hatte nach seinen eigenen Ansichten immer das Beste, Edelste im Auge, wie wir noch erfahren werden. Im Übrigen war er eben ein Kind seiner Zeit.
»Und wo befindet sich die Prinzess jetzt?«
»Ich weiß es nicht.«
»Doch, Ihr wisst es!«, behauptete der plötzlich so veränderte Bischof.
»Nun gut.«
»Ihr wisst es also?«
»Ja.«
»Wo da?«
»Das werde ich nie verraten. Ich spreche wohl einmal über mich selbst oder sonst über das, wozu ich gezwungen werde, im Übrigen aber verrate ich keinen Menschen.«
Also kam es nur auf das Fragen an.
»In Rom?«
»Ich weiß nichts«, beharrte aber diesmal der Graf — einfach, weil er es selbst nicht wusste. Dass die Prinzess behauptet hatte, ihn, den Grafen, zu lieben, musste ihm ja selbst furchtbar überraschend gekommen sein, die Hauptsache war nur immer, dass er sich davon nichts merken ließ, immer den anderen ausholte. Ebenso wenig wusste er wohl schon, wie er dies alles noch regeln solle.
»Dann ist sie gewiss zum Lord selbst geflohen.«
»Ich verrate nichts.«
»So ist es!«
»Habe ich das etwa zugestanden? Ich weiß nichts. Aber wollt Ihr mich nun nicht freigeben? Denn das beste ist vielleicht, wenn ich selbst mit dem Lord spreche. Allerdings könnte ich mich ja allein befreien, doch ich möchte Euch keinen Schreck einjagen.«
Schon suchte der Bischof in der Tasche den Schlüssel, der die Kettenschlösser öffnete, hatte nur noch einen einzigen Einwand zu machen.
»Ja, wie soll nun aber Ihr Wiedererscheinen gerechtfertigt werden?«
»Nichts ist leichter als das. Ich bin unterwegs aus meinem Starrkrampfe erwacht, bin aus der Sänfte gesprungen, meinen Entführern entkommen.«
»Das sieht aber einem Grafen von Saint-Germain gar nicht ähnlich, dass er einfach seinen Wächtern entspringt, sich nicht einmal vergewissert, wohin der Transport gehen soll.«
»Doch! Die Sänfte befand sich schon im Boote, ich sprang direkt ins Wasser, die Wächter bemerkten es nicht, oder doch, gerade! Da aber flohen sie mit dem Boote davon. Und im Wasser konnte ich dem schnellen Boote nicht folgen, das geht doch über meine Fähigkeiten. Ich schwamm ans Ufer.«
Dieser Graf wusste einfach für alles Rat, ließ sich niemals in Verlegenheit bringen.
»Ja, das geht!«, stimmte auch der Bischof bewundernd bei. »Aber Sie dürfen natürlich auch nicht wissen, wer Ihre Entführer gewesen sind. Sie haben sie nicht gekannt und erkannt.«
»Doch, ich weiß es, und ich werde daraus kein Hehl machen. Ich darf nicht lügen.«
Der Bischof sah jetzt keine Inkonsequenz, er erschrak nur.
»Und Sie werden mich verraten?«
»O nein, was für einen Zweck hätte sonst das alles, ich verrate überhaupt keinen Menschen, wie ich Ihnen durch meine Weigerung, den Lord zu nennen, doch schon bewiesen habe.«
»Ich kann mich also unbedingt aus Sie verlassen?«
»Unter der Bedingung, dass Sie auch nicht offenbaren, was ich Ihnen soeben gestanden habe.«
»Was? Erklären Sie das deutlicher.«
»Nun, dass die ganze Liebe der Prinzessin zu dem Lord erst von mir ausgeht«, sagte der Graf mit dem größten Gleichmut.
»Wenn Sie aber nun gezwungen werden, die Namen Ihrer Entführer zu nennen?«
»Das lassen Sie ruhig meine Sorge sein. Man kann mich überhaupt nicht zwingen. Doch ich vermute, dass meine Wohnung mit Beschlag belegt worden ist. Können Sie dafür sorgen, dass dies alsbald wieder aufgehoben wird?«
»Ja, das kann ich«, erklärte der Bischof nach kurzem Besinnen.
»Auf welche Weise?«
»Indem ich den Befehl einfach wieder zurücknehme. Der Aufenthalt der entflohenen Prinzessin sei bereits bekannt. Das genügt vorläufig. Das geht ja alles erst von mir aus.«
»Ah, ich verstehe!«
»Und wann erfahre ich den Aufenthalt der Prinzessin?«
»Wenn es Zeit ist«, sagte der noch immer Gefesselte, der aber immer mehr als Herr auftrat. »Doch beeilen Sie sich, ich muss diesen Turm noch in finsterer Nacht verlassen, muss ja aus dem Tiber kommen, und zwar mit diesen Ketten.«
»Warum in Ketten?«, fragte der Bischof noch, schon den Schlüssel aus der Tasche ziehend.
»Weil es seltsam wäre, wenn ich nicht noch unterwegs in Fesseln gelegt worden wäre.«
»Aber Sie können in Fesseln doch nicht schwimmen.«
»Warum nicht? Ich kann es, mich hindern beim Schwimmen keine Bande, und außerdem habe ich die Fesseln abgestreift, nehme die Ketten aber als Andenken an dieses Abenteuer mit.«
»Sie könnten sich wirklich aus diesen Ketten befreien?«
»Mich vermögen überhaupt keine Bande und keine Ketten und keine Mauern zu halten. Soll ich es Ihnen vormachen, wie ich die Ketten abstreife? Aber so einfach ist das allerdings nicht, es ist etwas Übernatürliches dabei — das heißt, übernatürlich für Sie — Sie dürften furchtbar erschrecken.«
Der Bischof beeilte sich, die Fesseln aufzuschließen. Und das hatte der Graf ja nur gewollt. Wenn er auch wirklich imstande war, wie er noch oft genug bewies, dass er Hand und Fuß ohne Anstrengung auch aus der engsten Fessel ziehen und wieder hineinstecken konnte — diesen Triumph, dass der Bischof demütig selbst die Fesseln ausschloss, noch ehe die erste Stunde vorbei war, den hatte er doch noch genießen wollen. Ja, der Graf hatte wieder einmal einen glänzenden Sieg davongetragen, und zwar ohne jede Gaukelei, nur durch seine diplomatische Gewandtheit. Aus seinem größten Feinde hatte er sich — nicht einen Freund, sondern einen willenlosen Sklaven gemacht. Denn den Fürstbischof von Rom hatte er doch nun ebenfalls vollständig in seiner Tasche, und zwar ohne die Macht der Hypnotik angewendet zu haben.
Der Morgen begann noch nicht zu grauen, als die beiden Wachen vor dem Klostertore entsetzt vor dem Manne zurückprallten, der plötzlich vor ihnen stand, in triefender Kleidung, über den Schultern einige schwere Ketten.
»Der Graf von Saint-Germain!!!«
Dieser Schrei rief sofort den Hauptmann herbei, der das Kloster nicht verlassen durfte.
So sehr ihn das Erscheinen des gesuchten Grafen, der sich dazu noch so präsentierte, auch außer Fassung brachte, so tat er doch erst seine Pflicht.
»Im Namen des Papstes, Sie sind verhaftet!«
»Auf wie lange denn, mein Freund?«, fragte der Graf in seiner gelassenen Freundlichkeit zurück, und er hatte sofort wieder das Übergewicht.
»Wissen Sie nicht, dass ich schon einmal irrtümlich gefangen davongeführt worden bin?«, fuhr der Graf fort.
»Das hat mit meiner Sache nichts zu tun, hier liegt kein Irrtum vor...«
»Dort scheint schon jemand zu kommen, der Sie belehren wird, dass auch in diesem zweiten Falle ein Irrtum vorliegt.«
Wirklich, da kamen schon zwei andere päpstliche Offiziere angeeilt, welche mit kurzen Worten den Verhaftungsbefehl gegen den Grafen aufhoben.
Der Bischof hatte alles Weitere schnellstens eingeleitet, der wusste hierfür dann schon eine Ausrede, er war ja in Wirklichkeit der Herrscher von Rom; der Papst, der Monarch des Kirchenstaates, kümmerte sich nicht viel um so etwas — und soeben räumten jetzt die kommandierten Soldaten Hals über Kopf das Kloster, das sie besetzt gehalten hatten.
Der Graf war wieder ein freier Mann. Mit seinen Ketten klirrend, begab er sich auf das Zimmer, das er ständig bewohnte.
Joseph war es, der hinter ihm die Türe schloss.
»Um Gott, Herr Graf, wo kommen Sie her?! Wohin hat man Sie gebracht?!«, rief er erschrocken beim Anblick seines triefenden, mit Ketten behangenen Herrn.
»Lass das jetzt, Joseph«, entgegnete dieser, die Ketten in eine Ecke werfend. »Ich werde dir später alles ausführlich erzählen. Hilf mir beim Umziehen, und dabei berichte erst du mir alles, was sich unterdessen hier zugetragen hat.«
Während sich der Graf umkleidete, hatte Joseph alles erzählt.
»Gut, du bist ein braver Bursche, dass du mich nicht im Stich lassen wolltest, und die Erfolglosigkeit hat dabei nichts zu sagen. Ich werde aus dir noch etwas Großes machen, wozu du schon die besten Anlagen hast. Lass dir vorläufig genügen, dass wir jetzt aus allen Kalamitäten sind. Hast du unterdessen erfahren, wohin sich die entflohene Prinzessin gewendet haben könnte?«
Nein, Joseph hatte gar nichts gehört.
»Die Prinzessin ist meinetwegen geflohen, um nicht den Schleier nehmen zu müssen.«
»Ihretwegen?!«
»Sie liebt mich.«
Der Graf wollte wohl nur die Wirkung dieser seiner Worte abwarten. Aber der spätere Cagliostro hatte sich auch schon gut in der Gewalt.
»Das kann ich ihr nicht verdenken«, meinte er pfiffig, was die verschiedensten Deutungen zuließ.
»So sagt sie wenigstens, aber es ist nicht wahr.«
»Was ist nicht wahr?«
»Dass sie mich liebt. Jetzt geh, Joseph, ich will allein sein.«
Der Page begab sich ins Nebenzimmer, und der Graf überzeugte sich noch einmal davon, dass er durch die Tür nicht beobachtet werden konnte, und außerdem war diese so dick, auch noch hüben und drüben mit einem Teppich behangen, sodass selbst ein ziemlich lautes Wort nicht durchscholl.
Denn so sehr sich der Graf auch schon diesem Pagen anvertraut hatte, seine eigenen Heimlichkeiten hatte er doch noch vor ihm, und wie gern der Junge beobachtete und lauschte, davon hatte er sich schon mehrmals überzeugt, natürlich ohne sich selbst etwas davon merken zu lassen.
Kaum war der Graf allein, als er zeigte, dass er doch nur ein mit irdischen Schwächen behafteter Mensch war. Seine Erregung war außerordentlich.
»Die Prinzess Polima liebt mich! Himmel, wie sollte ich mir dies träumen lassen! Und wie soll ich diese verwickelte Affäre nun arrangieren, dass doch noch alles nach meinem Willen geht!«
Er setzte sich auf den Diwan und versank in angestrengtes Nachdenken.
So begann der Tag zu grauen, und der Graf sann noch immer, regungslos wie eine Statue.
Da klopfte es an die Tür mit dem besonderen Zeichen des aufwartenden Dieners.
»Seine Herrlichkeit Lord Moore wünscht den Herrn Grafen zu sprechen.«
»Er ist willkommen«, entgegnete der Graf, sich mit würdevoller Ruhe erhebend, und so empfing er auch den vermummten Lord, der hier aber gleich seinen Namen genannt hatte, und er hatte auch nicht etwa den Weg über die Grenzmauer der beiden Grundstücke genommen. Es war ja bekannt genug, auf welch vertrautem Fuße er mit dem Wundermanne stand, den er im wirklichen Sinne des Wortes erst ans Tageslicht gezogen hatte, und es war begreiflich, dass er, nachdem er von dem nächtlichen Abenteuer des Grafen gehört, sobald wie möglich zu ihm eilte.
»Herr Graf, was höre ich da für Sachen?!«
»Bitte, setzen Sie sich, Mylord. Nun, Sie sehen ja, dass mich die Häscher bereits wieder freigegeben haben.«
»Ja, Sie sollen aber doch von einer unrechtmäßigen Wache entführt worden sein, kamen in ganz nasser Kleidung und in Ketten hier wieder an.«
»Nicht in Ketten gefesselt, sondern ich trug sie über der Schulter, wollte sie als Andenken mitnehmen. Dort liegen sie.«
»Sie sind den Männern entsprungen?«
»So ist es. Lassen Sie sich erzählen.«
Und der Graf erzählte ganz dasselbe, was er mit dem Bischof vereinbart hatte.
»Sie wissen nicht, wer das gewesen sein kann?«
»Ich konnte ja gar nichts sehen, da man mir eine Kapuze über den Kopf gezogen hatte.«
»Ihr frei gewesener Geist hat nichts beobachten können?«, fragte der schon völlig geistergläubig gewordene Lord.
»Der hat allerdings alles beobachten können.«
»Nun, und was hat er gesehen?«
»Mylord, Sie wissen doch, dass ich nichts verraten darf, was nur mein Geist in diesem Zustande offenbart.«
Der Lord war von alledem schon so felsenfest überzeugt, dass er gar nicht weiter fragte.
»Schade! Dass Sie auch gerade ins Wasser springen mussten! Wäre es nicht besser gewesen, Sie hätten sich bis ans Ziel bringen lassen, um noch alles zu erfahren?«
»Das habe ich ja auch erfahren.«
»Nun, und?«
»Von der mir offenbarten Zukunft spreche ich niemals«, entgegnete der Graf mit einer abweisenden Handbewegung. »Es handelt sich also um die Prinzess Polima.«
»Auch das wissen Sie schon — doch natürlich, das weiß ja schon jedes Kind, das jetzt in Rom auf den Beinen ist. Und was sagen Sie nun dazu?«
»Bitte, sagen Sie mir lieber erst, wie Sie darüber denken.«
Der Graf hatte sich ja von vornherein das Vorrecht reserviert, dass er nicht darüber reden durfte, was er schon auf andere als auf natürliche Weise erfahren hatte.
»Wir können hier doch unbelauscht sprechen?«, fragte der Lord zunächst.
»Ja, wenn es auch gut ist, etwas die Stimmen zu dämpfen.«
»Die Prinzess liebt Sie.«
»So hat sie wenigstens gesagt.«
Der Lord hatte gleich etwas aus dem Tone gehört.
»Und dem wäre nicht so?!«
»Nein.«
»Ja, das hat sie aber ihrem Beichtvater gestanden!«
»Um ihn irrezuführen.«
»Ich verstehe nicht.«
»Sie liebt einen anderen.«
»Einen anderen?!«, flüsterte der Lord atemlos, ohne eine Ahnung zu bekommen.
»Hat sie es Ihnen nicht heute Nacht selbst gesagt?«
»Mit keinem Worte.«
Hiermit aber hatte der Lord bereits gestanden, dass die Prinzess ihn aufgesucht, der Graf hatte ihn in seiner unübertrefflichen Weise einfach ›ausgeholt‹.
»Erzählen Sie nur doch erst, wie die Prinzess heute Nacht zu Ihnen kam«, durfte der Graf sogleich auffordern, und doch musste der Lord jetzt fast annehmen, dass dieser Mann wirklich allwissend sei.
Der Lord hatte schon vorsichtig gelauscht — nein, es schien gut abgegangen zu sein, vorläufig schien noch niemand Misstrauen geschöpft zu haben. Auch die Herzogin war noch nicht belästigt worden, wie er bereits erfahren hatte.
»Und die Prinzessin ist in Sicherheit?«
»Sie dürfte bereits in Palo sein, und bei Kapitän Morphin ist sie sicher aufgehoben wie im Grabe.«
Wieder hatte der Graf etwas erfahren, was er noch nicht gewusst — mit die Hauptsache — ohne deswegen gefragt zu haben. Aber wenn dieser Mann so ziemlich allwissend war, weshalb sollte es ihm der Lord denn da nicht gleich sagen?
»Weshalb ist die Prinzess nicht gleich zu mir gekommen, den sie lieben will, um bei mir Schutz zu suchen?«
»Angeborene Frauenscham.«
»Durchaus nicht.«
»Was nicht?!«
»Sonst wäre sie doch nicht zu Ihnen gekommen.«
»Ich verstehe nicht.«
»Sie hat sich nur durch die Herzogin noch besonders bei Ihnen einführen lassen.«
»Ich verstehe Sie nicht.«
»Dann muss ich es Ihnen, Sie Schwerverstehender, ganz deutlich sagen«, lächelte der Graf. »Sie selbst haben in dem Herzen der kalten Jungfrau die Fackel der Liebe entzündet!«
Ein starrer Blick, und bleich wie der Tod prallte Lord Moore zurück, um sich dann gleich purpurrot zu färben.
»Ich selbst...«
»Niemand anders. S i e liebt die Prinzess, S i e allein!«
Der Lord bedurfte einiger Minuten, ehe er seine Fassung wieder hatte.
»Herr Graf«, begann er dann wieder mit leuchtenden Augen, ganz verändert, »ich habe schon so manches Wunderbare von Ihnen gesehen — ich beschwöre Sie — treiben Sie kein grausames Spiel mit mir...«
»Sie sind der Mann, dessentwegen die Prinzessin diese Nacht geflohen ist, um heute nicht mit halber oder auch mit ganzer Gewalt ins Kloster gebracht zu werden.«
Jetzt hatte der Lord kaum noch etwas zu entgegnen. Er schenkte diesem Manne unbedingten Glauben, und dazu wäre vielleicht gar keine Hypnose nötig gewesen.
»O, wie soll ich das fassen!«, stöhnte er.
»Nun, fassen Sie es nur recht glücklich auf.«
»Glücklich?«
»Mylord, verstellen Sie sich doch nicht. Auch Sie lieben doch die Prinzessin Polima.«
»Woher wissen Sie...« versuchte der Lord noch einmal empor zu fahren.
»Ich weiß gar manches, und das allerdings darf ich Ihnen gestehen.«
»Wunderwunderbarer Mann«, konnte der Lord nur flüstern, weiter nichts.
Dann stiegen ihm wieder Bedenken auf.
»Ja, ich liebe dieses schöne Mädchen!«, rief er mit ebenso viel Begeisterung wie mit Schmerz. »Aber was soll daraus werden?!«
»Nun, wenn Sie sich gegenseitig lieben, so ist doch die Sache in Ordnung.«
»Ich bin Protestant...«
»So wird sie Ihnen zuliebe eben auch Protestantin«, entgegnete der Graf, hier ganz anders sprechend als zu dem Bischof.
»Ich bin — ach...«
Mit diesem letzten Worte, jauchzend gerufen, wollte Lord Moore der Türe zustürzen; mit eisernem Griffe hielt ihn der Graf zurück.
»Halt, Mylord, wohin?«
»Wohin, fragen Sie noch? Zu ihr, zu ihr!!«
»Nicht so eilig. Überlassen Sie es mir, den Freiwerber für Sie zu spielen, wenn ich bitten darf.«
»Sie selbst wollen...«
»Ja, ich möchte doch erst noch ein Wort mit der Prinzess sprechen, weshalb sie mich erst als denjenigen vorgegeben hat...«
»Sie hat einfach den ersten besten Mann genannt, der jetzt in aller Munde ist«, sagte jetzt der Lord, »und nun stellen Sie sich nur die fürchterliche Verlegenheit des armen Mädchens vor...«
»Ich kann mir alles lebhaft vorstellen; es war Bestimmung, dass sie meinen Namen nannte — und so ist es auch Bestimmung, dass ich erst noch einmal mit ihr spreche.«
»Was wollen Sie ihr erst noch sagen? Darf ich es nicht erfahren?«
»Sie wird es Ihnen selbst sagen. Und Sie wollten jetzt sofort nach Palo eilen?«
»Ich hatte es vor.«
»Mylord, Sie sehen furchtbar übermüdet aus.«
Der Lord wusste und fühlte es selbst. Er hatte ja die ganze Nacht kein Auge zugetan.
»Schlafen Sie wenigstens erst einige Stunden.«
»Ja, ich glaube, es ist das Beste«, murmelte jener. »Und überhaupt, ich kann ja gar nicht fort, nicht in den nächsten Tagen, ich habe das ganze Haus voller Gäste, die angesehensten Männer Englands, Vertreter anderer Staaten sind mit diplomatischen Sendungen in Rom, fortwährend finden Sitzungen statt, und wenn ich mich in Palo auch nur einige Minuten aufhalte, so nimmt der Hin- und Herritt selbst auf dem schnellsten Pferde doch mindestens sechs Stunden in Anspruch — ich kann gar nicht fort!«
»Nehmen Sie als eine göttliche Fügung an, dass Sie nicht fort können«, entgegnete der Graf.
»Es ist doch überhaupt gut, wenn die Prinzess erst vorbereitet wird. Meinen Sie nicht?«
»Ja, ja, es muss sogar unbedingt geschehen!«
»Und finden Sie nicht, dass dies am besten durch mich geschieht?«
»Natürlich, Sie sind die geeignetste Person da zu, sie ist Ihnen ja auch Rechenschaft schuldig.«
»Und ich werde mich meiner Mission mit möglichster Zartheit entledigen, dass die Prinzess dabei nicht die geringste Scham, gar keine Verlegenheit empfinden soll. So eile ich jetzt sofort nach Palo. Darf ich um ein Pferd aus Ihrem Stalle bitten?«
»Das beste soll sofort gesattelt werden!«, rief der Lord, sich der Türe zuwendend, ward aber vom Grafen noch einmal zurückgehalten.
»Ich bin noch immer nicht dazu gekommen, mir eigene Garderobe zu verschaffen, trage immer noch Ihre Kleider, und so muss ich auch noch um ein Reitkostüm bitten...«
»Es wird für Sie bereit liegen — oder ich werde es lieber herüberschicken, nicht wahr?«
»Wenn ich bitten darf.«
Der Lord begab sich in sein Haus zurück; fünf Minuten später brachte ein Diener aus der Gesandtschaft ein Reitkostüm, für eine längere Reise berechnet, nicht nur für so einen Promenierritt durch die Straßen, aber an Eleganz nichts vermissen lassend, und zu ihm gehörte sowohl die große Ledertasche, die ›Katze‹, wie der mehr schwertähnliche Degen, dessen Wert bei ganz einfachem Äußeren in der Klinge lag, ferner auch noch zwei kleine Terzerole, mit dazugehöriger Munition, im Lederbeutelchen am Gürtel getragen.
Es sei hier gleich im Voraus bemerkt, dass der Graf von Saint-Germain niemals eigene Kleidung, überhaupt etwas Eigenes besessen hat. Bis an sein Lebensende — und seinen Tod aus Altersschwäche wusste der ›Unsterbliche‹ natürlich ebenfalls ganz glaubwürdig zu rechtfertigen — hat er immer fremde Kleider getragen, die er sich sozusagen von Fall zu Fall pumpte. Gekauft hat er sich niemals auch nur eine Stecknadel, aber eigentlich hat er sie sich auch nicht schenken lassen: Selbst die Stecknadel ließ er sich immer nur so leihweise geben.
Dass dies aus Berechnung geschah, ist selbstverständlich. Aber was heißt Berechnung? Der Graf von Saint-Germain war ein Original in jeder Hinsicht. Man hat ihm später vorgeworfen, er habe damit Christus nachahmen wollen, von dem man sich doch auch schwer vorstellen kann, dass er in einen Krämerladen trat, um sich etwa ein Stück Seife zu kaufen. Doch das sind Vorwürfe von solchen Leuten, die alle Originalität leugnen, in allem und jedem eine Nachahmung sehen, weil sie selbst aller Originalität bar sind.
Der Diener musste fast eine Viertelstunde warten, ehe der Graf erschien.
»Ich hatte doch erst noch einige Vorbereitungen zu treffen. Hoffentlich wartet Lord Moore nicht auf mein Abreiten, sondern hat sich gleich schlafen gelegt.«
»Seine Herrlichkeit lassen fragen, ob der Herr Graf das Pferd hier vorgeführt haben oder ob Sie selbst noch einmal in die Gesandtschaft kommen wollen.«
»Hat sich Lord Moore noch nicht zur Ruhe gelegt?«
»Er hat im Stall selbst das Satteln des Pferdes überwacht und harrt jetzt dort Ihrer Antwort durch mich.«
»O weh! Dann komme ich selbst hinüber. In fünf Minuten bin ich drüben. Eilen Sie! Halt! Was sollen diese Pistölchen?«
»Die zwei großen Pistolen stecken in den Satteltaschen.«
»Das meinte ich nicht. Nehmen Sie die Waffen nur wieder mit.«
In noch nicht einmal fünf Minuten betrat der Graf den Hof der Gesandtschaft. Mit zauberartiger Geschwindigkeit hatte er sich umgekleidet, und das für den Lord gefertigte Kostüm saß ihm wie angegossen, noch besser als jenem selbst; sogar die hohen Reitstiefel passten ihm, obgleich Lord Moores kleiner Fuß, wie man ihn sonst bei Engländern gar nicht findet, selbst von den Italienern bewundert wurde.
In dem Hofe scharrte ungeduldig ein prächtiger Rappe.
»Verzeihen Sie, Mylord, — weshalb haben Sie auf mich gewartet?«
»Wie könnte ich schlafen, bevor ich Sie unterwegs weiß! Sie wollen doch nicht etwa überhaupt keine Waffen mitnehmen?!«
»Nein, ich danke, ich trage sehr ungern Waffen.«
»Aber der Weg nach Palo ist nicht ungefährlich; auf einsame Reisende haben Landstreicher, regelrechte Wegelagerer, schon wiederholt Überfälle gemacht, erst kürzlich wieder...«
»Mit solchen bedauernswerten Leuten werde ich auch ohne Waffen, welche der Waffenschmied macht, in aller Güte fertig«, lächelte der Graf. »Ist es nach Palo noch immer der alte Weg wie vor hundert Jahren?«
»Ich wüsste nicht, dass unterdessen ein neuer angelegt worden wäre. Er ist in vorzüglichem Zustande. Nun, Herr Graf, ich durfte mich gar nicht zur Ruhe niederlegen, ich habe unterdessen hier einen Empfehlungsbrief an meinen Freund den Kapitän Morphin für Sie geschrieben. Kennen Sie diesen seltsamen Kauz?«
»Wie soll ich ihn kennen?«
»Sie könnten durch Zufall schon etwas von ihm gehört haben.«
»Gar nichts.«
»Dann werden Sie ihn noch kennen lernen, und es ist doch gut, wenn ich Ihnen einen Empfehlungsbrief mitgebe. Weshalb, das werden Sie erfahren, wenn Sie mit dem Kauz selbst in Berührung kommen. Beleidigt kann ein Mann, wie Sie, ja von seinen Firlefanzereien nicht werden.«
Dankend nahm der Graf den versiegelten Brief in Empfang und steckte ihn in die Ledertasche.
»Schon heute Abend hoffe ich wieder hier zu sein«, sagte er, die Zügel des immer ungebärdiger werdenden Rosses ergreifend.
Mit einiger Besorgnis beobachtete ihn der Lord dabei. Entweder hatte der Graf seine eigenen Handgriffe, um die Zügel beim Aufsteigen zu fassen, oder er verstand überhaupt gar nichts vom Reiten, hatte noch niemals Zügel in die Hand genommen. Jedenfalls sah es sehr ungeschickt aus. Auch hatte er nicht die mitgeschickten Sporen angeschnallt, woraus man wieder auf Doppeltes schließen konnte: Entweder er hatte sie einfach vergessen, oder er fühlte sich mit Sporen unsicher. Denn ein Reitersmann, der die Sporen nicht wirklich zu gebrauchen weiß, wird natürlich auch vom sonst sanftmütigsten Gaule sofort in den Sand gesetzt.
»Der Herr Graf haben in der langen Zeit doch nicht etwa das Reiten verlernt?«
»O nein, in diesem Zustande verlernt man überhaupt nichts, nicht einmal ungelenkig wird man durch das lange Liegen.«
»Sie haben keine Sporen, und es ist doch manchmal angebracht...«
»Nein, ich mag auch dem geringsten Tiere nichts zuleide tun.«
Die Reitknechte stoben auseinander, auch der Lord sprang, dieses Ross kennend, erschrocken zurück.
Ganz unvermutet hatte sich der Graf, sich mit der Hand nur leicht auf die Kruppe stützend, in den Sattel geschwungen, den erst unbenutzt lassenden Steigbügel dann sofort findend, und das war mit einer Gewandtheit und Grazie geschehen, um die ihn jeder professionelle Kunstreiter beneidet hätte.
Nach dem bekannten Charakter dieses rassigen Pferdes musste es über dieses schnelle Besteigen selbst sehr erschrocken sein, musste steigen, sich bäumen, um dann im Galopp davonzugehen, worauf es nur von der Kunst des Reiters abhing, von seiner kräftigen Hand, ob es dann in Karriere durchging oder sich zum gemäßigten Schritt bändigen ließ — und so stieg es denn auch hoch empor, aber nur einen Augenblick, bald hatte es die Hand des Meisters erkannt, mit freudigem Nicken tänzelte es stolz zum Hoftor hinaus, um dann in einen eleganten Trab zu fallen.
Noch einmal hatte der Graf den breitrandigen Schlapphut gelüftet, und er war um die nächste Ecke verschwunden.
»Sapristi!«, sagte der Stallmeister. »Da möchte man eher glauben, der hätte die ganzen hundert Jahre, anstatt im Sarge zu liegen, im Sattel gesessen!«
Noch immer war es erst die vierte Morgenstunde. Aber die Bevölkerung Roms, soweit sie um das tägliche Brot arbeitete, entwickelte in den Straßen schon volles Tagesleben. Trotzdem blieb alles bis in die späte Nacht auf. Dafür wird eben in den heißen Mittagsstunden eine ausgiebige Siesta gehalten, selbst alle Geschäfte schließen für einige Stunden. Das gilt natürlich nur für den Hochsommer. Und das eigentliche, charakteristische Leben fehlt ja auch zu solch früher Morgenstunde. Der einzelne Reiter erweckte keine Aufmerksamkeit. Eben ein Reisender, der schon so früh aufbrach.
Ja, hätte man gewusst, dass dies der Graf von Saint-Germain war! Aber wie konnte das jemand ahnen. Von Angesicht kannte man ihn ja noch gar nicht.
Nicht einmal die wenigen, die ihn aus der englischen Gesandtschaft hatten herauskommen sehen, dachten sofort an den Wundermann.
In schnellem Trabe ritt der Graf durch die Straßen, Passanten und Karren und vollbepackte Maultiere, denen er selbst nicht ausweichen konnte, durch das markante ›schschschiiihhh!‹ aufmerksam machend.
So war es hier schon vor hundert Jahren gewesen, und auch die Richtung war doch noch dieselbe geblieben.
Das Tor, durch welches es nach Palo geht, weniger frequentiert als alle übrigen, liegt in Baja, in der Bucht, im Winkel.
Auch hier waren die kleinen Handwerker schon bei der Tagesarbeit, saßen in ihren offenen Werkstätten, am meisten Schneider und Schuster; bis zur Bereitung des zweiten Frühstücks taten sich die Weiber schon zu einem kleinen Disput zusammen — auf gut Deutsch mit Klatsch übersetzt.
Der Graf ließ sein Ross Schritt gehen.
»Ja, warum soll ich nicht?«, murmelte er. »Da der Graf gebunden ist, drängt mich nichts, und, ach, wie ich mich sehne, und wie sie warten wird...«
Er lenkte in eine Gasse ein, vorsichtig die Kinder warnend, die vor Staunen ob des vornehmen Reitersmannes so starr wurden, dass sie mitten auf dem engen Fahrweg stehen blieben.
»Wo wohnt hier Antonio Roscalli, der Skribent?«, rief er.
Er hatte Mühe, es zu erfahren. Auch die Frauen und Männer vergaßen über dem Anblick des vornehmen Reiters, der sich in Baja zeigte, alles andere.
Endlich aber erfuhr es der Mann, der hier so ganz und gar fremd war. Gleich dort die hübsche Loggia, die unter einem pompösen Anstriche ihre Baufälligkeit versteckte.
Der Graf sprang ab, hing den Zügel über den für diesen Zweck, wenn hier auch mehr für kleine Esel und Maultiere, bestimmten Eisenhaken.
Die Tür stand offen. Marietta badete ihr Kind. Ach, da konnte man erst richtig erkennen, was für ein missgestaltetes Menschlein das vierjährige Mädchen war!
»Ist es erlaubt, einzutreten?«, fragte der Graf mit merkwürdig heiserer Stimme.
Erschrocken hüllte die junge Mutter ihr Kind, das sie soeben aus dem Wasser genommen, in das Badetuch, obgleich sie sich sonst beim Eintritt eines anderen Fremden durchaus nicht so benommen hätte. Es war nur die elegante Erscheinung dieses Mannes, die sie erschrecken ließ.
Ohne die Erlaubnis abzuwarten, die hier auch nicht nötig, war der Graf eingetreten.
»Sind Sie die Signora Marietta Roscalli, die Gattin des Skribenten?«, fragte er, mit immer noch heiserer Stimme, die erst nach und nach ihren herrlichen Klang wieder annahm.
»Ja, das bin ich«, flüsterte Marietta, ihr Kind an sich pressend und den Fremden wie ein Gespenst anstarrend, und das war jetzt bald etwas merkwürdig.
Aber davon, dass sie in dem Fremden den eigenen Gatten erkannt hätte, davon konnte keine Rede sein. Wäre der Graf nicht seiner Sache todsicher gewesen, so hätte er sich doch nicht hierher gewagt.
Eine Ahnung mochte ja dabei sein, ein Gefühl, ein Etwas, für das es eben keinen Ausdruck gibt — aber an ein sicheres Bewusstsein war gar nicht zu denken, sie selbst gab sich über dieses Gefühl, das überdies schnell genug wieder schwand, auch gar keine Rechenschaft.
»Ist Ihr Mann noch nicht zurück?«, fuhr der Graf mit seiner bezaubernden Liebenswürdigkeit fort, und jetzt klang seine Stimme auch schon ganz anders.
»Nein, aber ich erwarte ihn jeden Tag, er ist schon eine Woche fort. Haben Sie für ihn einen Auftrag?«
»Ja, auch ich erwarte sehnlichst die Rückkunft Ihres Gatten, dass er mir meine Briefe schreibt.«
»Ihre — Briefe — schreibt...?!«
»Ich bin der Graf von Saint-Germain.«
Da, wie von etwas Höherem überwältigt, ließ die junge Mutter plötzlich das Badetuch fallen, sie stürzte vor dem Grafen auf die Knie nieder, hielt ihm ihr verkrüppeltes Kind hin.
»Der Graf von Saint-Germain!! Herr, erbarmt Euch meines Kindes, macht mein armes Kind gesund!!«
Jauchzend vor Hoffnung hatte sie es im größten Schmerze unter hervorbrechenden Tränen gerufen.
Und der Graf wurde fassungslos, zur Statue erstarrt stand er da. Diese Urplötzlichkeit war es, die ihn so furchtbar überrumpelte.
Und da kam noch etwas anderes hinzu — kaum hatte es die Mutter gerufen, so streckte das blinde Kind die dürren Ärmchen mit den verkrüppelten Fingerchen nach ihm aus, ein mühsam ausgestoßener Laut, aber doch ein helles Jauchzen, und dann ein langes ›papapapa!‹
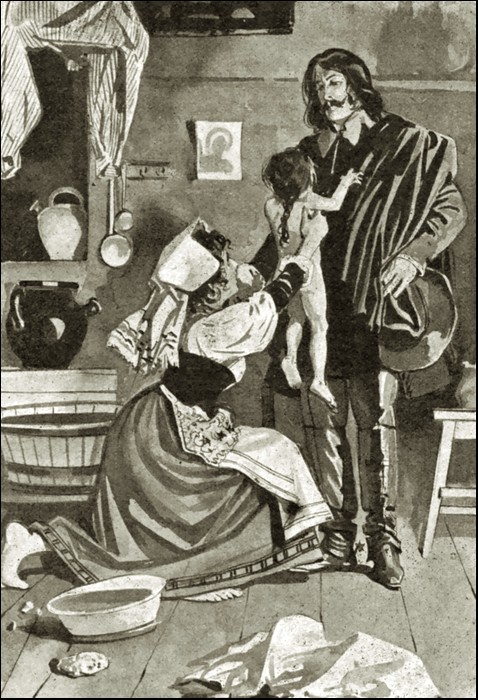
Die Gattin ließ sich täuschen, nicht das blinde und taubstumme Kind. Die Mutter hatte natürlich dafür gleich eine andere Erklärung.
»O, Wunder, o, göttliches Wunder!!«, jubelte sie unter Tränen. »Seht, das Kind, das sonst jeden anderen Mann fürchtet — es kommt Euch gleich so entgegen, wie sonst nur dem Vater — weil es weiß, dass nur Ihr es gesund machen könnt — und ich weiß es auch — denn ich glaube, glaube, glaube!!!«
Mit einer furchtbaren Kraftanstrengung hatte der Graf seine grenzenlose Bestürzung niedergerungen, aber das konnte er nicht verhindern, dass auch ihm die Tränen hervorstürzten, als er das Kind auf seinen Arm nahm, dann, sich setzend auf seinen Schoß, und er hielt sich auch nicht zurück, es zu küssen und zu liebkosen, wie es sonst nur Antonio tat; und das Kind wusste ja, wessen Hals es umschlang.
»O, Wunder, göttliches Wunder!!«, staunte und jubelte die junge Mutter immer wieder.
»Ich habe überhaupt Kinder so gern, und gerade, wenn sie schwächlich sind!«, suchte der Graf seine Teilnahme und seine Tränen zu entschuldigen. »Ach, dieses arme, liebe Kind!«
»Gnädigster Herr, erbarmt Euch seiner, macht es gesund, dass es so ist wie andere Kinder!«, flehte die Mutter.
Der Graf war seiner Tränen wieder Herr geworden.
»Ist dieses Kind nicht blind?«
»Und taubstumm. Gnädigster Herr, gebt meiner armen Pepita Sprache und Gehör, macht es sehend wie andere Kinder!«
Der Graf stellte sich erstaunt.
»Weib, wofür haltet Ihr mich, dass Ihr so etwas von mir verlangt?!«
»Ihr könnt es, ich weiß es!«
»Bin ich denn ein Gott?!«
»Dann hat Gott Euch geschickt!«
»Traut Ihr mir denn solche Kraft zu, wie sie von unserem Herrn und Heiland ausging?«
»Ja, ich glaube es.«
»Weib, wie kommt Ihr nur auf solch eine Idee?!«, rief der Graf jetzt in ungekünsteltem Staunen.
»Ich weiß, dass Ihr es könnt, weil ich es glaube, weil ich es glaube, glaube!!«
Sichtlich war die furchtbare Erschütterung des Grafen, wie er auf das Weib, auf sein eigenes Weib herabblickte, das mit gefalteten Händen vor ihm kniete — und es war auch ein Bild, nicht nur festzuhalten durch den Pinsel des Malers — das Bild des unbeschränktesten, felsenfestesten Glaubens, auch durch Worte ausgesprochen.
Und da brach es bei dem Grafen nochmals hervor.
»Ach«, rief er in schmerzlichstem Tone, den Blick zu der verrußten Decke empor gerichtet, die aber jetzt kein Hindernis für ihn bildete, um den Himmel zu sehen, »ach, könnte doch auch ich jetzt zu Euch sagen: Weib, Euer Glaube hat Euch geholfen — Euch und Euerm Kinde!«
»Und ich glaube, dass Ihr es könnt, ich glaube es, ich glaube!!«, erklang es immer noch einmal.
Der Graf hatte es wohl schon nicht mehr gehört, er war in tiefes Sinnen versunken, nur unbewusst spielte er mit den spärlichen, blonden Haaren des Kindes, die sich gewiss noch einmal schwarz färben würden, und dem Kinde genügte es, den Vater umschlingen, den unförmlichen Kopf an seine Brust schmiegen zu können.
Mit einem Ruck richtete sich der Graf wieder empor.
»Ich habe in meinem langen, langen Leben gar manches gelernt. Ja, ich will versuchen, dem armen Kinde zu helfen...«
»Ihr könnt es auch, Ihr könnt es!!«
»Lasst mich sprechen. Ich will es versuchen, mehr kann ich nicht. Ist das Kind so geboren? Sein Vater hat mir damals gar nichts davon gesagt, ich bin höchst überrascht. Erzählt nur alles, auch wie sich das Kind sonst benimmt — alles.«
Und der eigene Vater ließ sich über sein Kind berichten. Marietta vergaß nichts, sie erzählte alle, alle jene Kleinigkeiten, die wir schon einmal erwähnt, und der eigene Vater hörte mit gespanntester Aufmerksamkeit zu, immer mehr leuchteten seine Augen, wenn die Mutter so schilderte, was für eine hohe Intelligenz dieses blödsinnige Kind manchmal bewies.
Weshalb seine Augen dabei immer mehr leuchteten? Weshalb er sich das alles erzählen ließ, da er es selbst doch am besten kennen musste? Nun, eben weil es der eigene Vater war.
Immer forderte er durch weitere Fragen zu ausführlicherem Berichte auf. Eine halbe Stunde opferte er so.
»Und Ihr seid dennoch glücklich, Signora?«, war seine letzte Frage, etwas aus dem Stegreife.
»Ja, edler Herr, ich bin glücklich in meinem Schmerze!«, lautete die Antwort, und wie das nun die junge Römerin mit ihrer weichen Stimme gerufen hatte!
Der Graf stand auf, er gab das Kind zurück, und dessen Schreien, weil es den erkannten Vater nicht lassen wollte, ernüchterte ihn vollends.
»Ich werde mein Möglichstes tun. Wann wird Ihr Gatte zurückkommen?«
»Ich weiß nicht. Länger als zwei Wochen wollte er nicht fort sein.«
»Sobald er kommt, schickt ihn zu mir. Ich brauche ihn sehr, sehr notwendig. Und Ihr kommt morgen Abend mit dem Kinde zur mir.«
»Ihr wollt es heilen?«, erklang es jauchzend.
»Wie gesagt — ich bin kein Gott. Wäret Ihr bereit, Euch einige Zeit von dem Kinde zu trennen?«
»Wenn es sein muss, wenn es dadurch wie andere Kinder werden würde — für immer!«
»Kommt morgen Abend zu mir mit dem Kinde«, wiederholte der Graf, verließ schnell das Häuschen und schwang sich auf sein Ross.
Das von einer Wache besetzte Tor war gleich in der Nähe. Soeben wurde es von einer Maultierkarawane passiert, deren Führer nur mit dem Offizier gesprochen hatte, während einige Fremde ihre Legitimationen vorzeigen mussten.
Lord Moore hatte gar nicht daran gedacht, den Grafen darauf aufmerksam zu machen, dass er zum Verlassen der Stadt und Wiederhereinkommen einen Pass brauchte, der nur bekannten Personen erlassen blieb. Es war doch der Graf von Saint-Germain.
Aber er sollte auch keine Unannehmlichkeiten haben, denn von diesen Soldaten hier wurde der geheimnisvolle Graf einmal erkannt, und zwar waren darunter einige, die heute Nacht sein Haus hatten besetzen müssen.
»Es ist kein anderer als der Graf von Saint-Germain!«, wurde geflüstert, und es genügte.
Denn sollte etwa der, dessen Verhaftung noch in derselben Stunde durch Eilbefehl wieder aufgehoben worden, nach einem Passe gefragt werden? Der ganz kopfscheu gewordene Offizier überlegte nur, ob es noch angebracht sei, die ganze Wache unter Trommelwirbel herauszurufen, und diesen Umstand benutzten zwei jener deutschen Handwerksburschen, deren auch Goethe bei seinem Aufenthalt in Rom gedenkt, um schnell durchzuschlüpfen, ohne den Pass vorzuzeigen, den sie nicht besaßen.
Der Graf selbst schien gar nicht zu wissen, wo er sich befand. Mitten im Gewühle der Maultiere ließ er die Zügel fallen, um die Arme gegen den Himmel auszubreiten und ziemlich laut zu rufen:
»Großer Gott, allmächtiger Gott, gib nur die Kraft, dass ich mein Vorhaben ausführen kann, denn es geschieht ja nur aus Liebe zu ihr!«
So rief er, und das hatte gar nicht geklungen, als ob dabei Berechnung gewesen wäre, es war gar zu sehr aus überströmendem Herzen gekommen.
Dann aber hatte er eben ohne Berechnung einen großen Vorteil davongetragen.
Denn diese Worte waren von vielen gehört worden, nicht nur von den Soldaten der Wache.
»Habt ihr's gehört?«, wurde alsbald geflüstert. »Er hat Gott den Allmächtigen um Hilfe angerufen! Dann kann er doch auch nicht ein Teufelszauberer sein.«
Ja, der sonst auf alles aufmerksame Graf, dem auch nicht das Geringste entging, wusste diesmal selbst nicht, was für einen bedeutenden Vorteil er eben gewonnen hatte.
Hierzu kam noch etwas anderes.
»Aus Liebe zu ihr bat er um Kraft? Wen liebt er denn?«
Nun, die Loggia des Skribenten war ja nur um die Ecke herum, und bald wusste ganz Rom, dass der Graf von Saint-Germain dort abgestiegen war, was er mit der Frau des Skribenten verhandelt hatte.
Denn diesmal war Mariettas Glaube an die Wunderkraft dieses Mannes größer gewesen als der Glaube an die Macht des Schweigens, über welche gerade jetzt in der wahren Erkenntnis der Tatsache schon Bücher geschrieben werden, wie überdies schon Goethe gesagt hat: »Wenn ich ein Buch schreiben will, darf ich nicht darüber sprechen, sonst gelingt es mir nicht.«
Marietta hatte geplaudert, hatte es jedem erzählt, der es hören wollte, und wer wollte es nicht! Ihr Herz war gar zu übervoll.
»Der Zaubergraf macht mein Kind gesund!!«
Von einem ›VersuchenWollen‹ wusste sie gar nichts.
Hier nun hätte ein Verdacht sehr leicht aufsteigen können. Kurz nach dem Verlassen jenes Hauses hatte der Graf die Worte gerufen: ›Aus Liebe zu ihr!‹
Was lag da näher, als dass er dabei an die schöne, junge Frau gedacht hatte!
Aber die Sache war eben die, dass niemand auf solch einen Verdacht auch nur kam, auch der spöttischste Zweifler nicht, der sonst nichts ungeschoren lassen konnte.
Zölibat und Heiligkeit — ja, es hängt doch gar eng zusammen, niemand sollte die vorgeschriebene Ehelosigkeit der katholischen Priester verspotten! Es steckt etwas gar Ernstes, Tiefes, Feierliches dahinter!
Und mit der Heiligkeit eng verknüpft ist wiederum alles Können, was anderen Menschen abgeht.
Der Graf hatte das Tor schon längst hinter sich, in tiefes Sinnen versunken ließ er sein Ross auf der Landstraße traben.
»Ich tu's, ich tu's«, murmelte er wiederholt. »Das dürfte der furchtbarste Betrug meines Lebens sein und bleiben, ein so ungeheurer Frevel, dass ihn die ganze Hölle nicht zu fassen vermag — und doch, ich tu's, denn ich will sie ja nur beglücken, und sei dieses Glück auch nur eine Täuschung!«
Da der Graf nun einmal darauf gebracht war, konnte er wohl weiter darüber philosophieren, ob das ganze Glück nicht überhaupt auf Täuschung beruht, auf fremder oder auf eigener.
Erst als ihm bei einer Wendung die Sonne ins Gesicht schien, erwachte er aus seinen Träumen, er schaute um sich, und — dem Manne, der hundert Jahre in einem Zinksarge und in einem Keller gelegen hatte, musste da ja das Herz ganz besonders weit werden.
Die Getreideernte war in diesem südlichen Lande jetzt schon eingefahren. Viel Getreide wurde hier aber überhaupt nicht gebaut. Alles nur Wiesen. Denn in Italien wie in Frankreich dient die Milch noch heute als tägliches Volksnahrungsmittel, ganz mit Recht, denn es ist das billigste, und die Milch konnte ja damals noch nicht von weither transportiert werden.
Und diese Wiesen strotzten im saftigsten, wenn auch im zweiten Grün, und dieses nun vergoldet vom Morgensonnenscheine!
Ich bin allein auf weiter Flur...
Es war damals noch nicht geschrieben, wohl aber wurde es schon von manchem Menschenherzen gar oft gedichtet.
Und wiederum ließ der Graf die Zügel fallen, um die Arme auszubreiten, aber nicht zum Himmel, sondern als wolle er die vor ihm liegende Welt umschlingen.
»O Welt, wie bist du so wunderschön!!«, konnte auch dieser Mann jauchzen, der sonst immer eher schwermütig als nur tiefernst aussah. »Ach, könnte ich doch die ganze Menschheit umarmen und an mein Herz drücken — denn ich liebe euch Menschen, ich möchte euch glücklich sehen, wie im Paradiese lebend, und euch dieses Glück zu verschaffen, das ist eben mein Ziel!!«
So jauchzte der Mann, dessen ganzes Leben aus Lug und Trug bestanden hat!
Und er setzte daraufhin auch selbst noch etwas hinzu:
»Und um euch dieses höchste Glück zu verschaffen, das nur dem reinsten Herzen entspringen kann, deshalb gebe ich mehr noch als mein Leben hin — meine Ehre!«
Anderthalb Stunden schon war der Graf geritten, meist im Galopp, ein scharfes Traben dem edlen Rosse nur als Erholung gönnend, als er eine Maultier- und Karrenkarawane überholte.
Der eigentliche Hafen von Rom war Fiumicino. Palo war ganz bedeutend weiter entfernt, es gab dazwischen keine Stationen, dieser Freihafen erhob auch einen großen Einfuhr- und Ausgangszoll.
Trotzdem gab es viele Kaufleute und Karawanenunternehmer, welche Palo dem Haupthafen vorzogen. Die intelligenten Palenser hatten ganz andere Ladevorrichtungen angelegt, hauptsächlich aber hatte man hier nicht so viel Scherereien mit den Behörden.
Am meisten jedoch freuten sich die Kärrner und Maultiertreiber und sonstigen Karawanenarbeiter, wenn es nach Palo ging. Vorausgesetzt allerdings, dass der Capitano Morphin daheim war! Dann gab es stets einen Festtag.
Mit dem Verkehr von Fiumicino war der in Palo freilich nicht zu vergleichen. Auf jener Landstraße ging es immer hin und her, hier hatte der Graf erst eine einzige Karawane überholt, war noch gar keiner begegnet, auch keinem einzelnen Reisenden, und erst wieder anderthalb Stunden später sah er eine zweite Karawane vor sich herziehen.
Da aber erblickte er, und zwar hinter einem Walde ganz plötzlich sehr nahe auftauchend, das Hafenstädtchen, und vor allen Dingen die auf einem hohen Felsenvorsprunge thronende Zitadelle, von der aus Kapitän Morphin nicht nur Palo beherrschte, auch nicht nur ganz Italien, sondern die ganze Erde — oder einfacher noch die ganze Welt.
Eine Zitadelle, die so viel Macht ausüben will, muss ja danach beschaffen sein. Nun, an Türmen und Zinnen und Schießscharten fehlte es denn auch nicht; die sowieso ganz und gar verrückt gebaute Burg, was sich nicht weiter beschreiben lässt, sah von Weitem aus, als hätten Ameisen sie siebartig durchlöchert, und alles von Kanonenmündungen starrend, und über was für Kanonen dieser moderne Raubritter verfügte, das zeigte er an den sechs Geschützen, die er oben auf der Plattform frei stehen hatte — Dinger, gegen welche unsere jetzigen Krupp'schen Riesengeschütze die reinen Kinderspielzeuge gewesen wären.
Solch ungeheure Kanonen hat man im Mittelalter tatsächlich gehabt. Man denke zum Beispiel an die bekannt gewordene ›faule Grete'. Die schoss Steine, die in kein heutiges Geschütz mehr gehen. Ein Vergleich mit der Leistungsfähigkeit ist natürlich nicht zu ziehen, man hat diese kolossalen Kanonen als ganz unpraktisch sehr bald wieder aufgegeben.
Nun, der Kapitän Morphin hatte sich solch vorsintflutliche Ungeheuer zugelegt, um mindestens der Welt zu imponieren. Woher er sie eigentlich hatte, das war gänzlich unbekannt.
Übrigens sah es tatsächlich imposant aus, wie diese riesenhaften Ungeheuer ihre Feuerschlünde nach allen Himmelsrichtungen reckten, besonders, wie das blankpolierte Metall in der Sonne gleißte.
Es gab noch viel Bemerkenswertes an dieser Seefeste. Wir wollen nur noch das zurzeit in die Augen Springendste erwähnen, dass an einem langen Stamme, der aus einer Schießscharte oder einem Fenster ragte, 50 Meter hoch über dem Meeresspiegel, ein aufgeknüpfter Schimmel hing, der sich leise mit dem Winde drehte und dazu melancholisch mit den Beinen baumelte, und daneben hing an einem zweiten Galgen ein Mensch, jedenfalls der zu dem armen Schimmel gehörende Reitersmann.
Als der Graf die hinteren Karren der Karawane erreichte, passierten die vordersten soeben die Grenze. Hier auf dieser Seite hatte der Kirchenstaat seine buntfarbigen Grenzsteine aufgestellt, drüben waren die des Freiheitshafens, außerdem aber noch ein anderes, sehr merkwürdiges Grenzzeichen zu sehen.
Neben jedem der beiden stand eine Dame — oder wir wollen gleich sagen: eine Vogelscheuche, ein in den Boden gerammter Pfahl, mit Stroh umgeben, als Dame angezogen, nur dass diese als Kopf einen riesigen Kamelschädel hatte, auf dem wiederum ein koketter Damenhut thronte.
Wie das nun aussah, die sonst sehr elegante Dame mit dem weißgebleichten Kamelschädel, der die langen, gelben Zähne dem Kommenden entgegenfletschte, mit dem koketten Damenhütchen darauf — die Wirkung lässt sich leider nicht beschreiben. Jedenfalls urkomisch!
Die Karawanentreiber aber erblickten hierin nur eins, und sie flüsterten es sich einander zu:
»Der Kapitän ist zu Hause und erwartet uns schon! Also Achtung, dass niemand aus der Rolle fällt, immer ernst oder furchtsam, ganz wie es sein müsste, auf alles eingehen! Denn sonst kriegen wir natürlich kein Frühstück, wie es besser der Papst nicht einem königlichen Gaste vorsetzt.«
Was für eine Überraschung der verrückte Kapitän, der sich auf diese Weise gewissermaßen anmeldete, bereithielt, das wusste noch keiner. Zwar wiederholten sich die Überraschungen, aber doch immer wieder in ganz anderer Weise.
Und da kam er auch schon! Kaum hatten die letzten die Grenze passiert, als aus dem nahen Wäldchen eine Reiterschar hervorgesprengt kam, mittelalterliche Raubritter, auf jämmerlich mageren Gäulen, und ebenso beschaffen waren auch die Reiter, wenigstens vom Scheitel bis zur Sohle in Eisenrüstungen gehüllt, die nicht rot von Gold, sondern rot von Rost waren. Alles ein einziger Rost. Gott wusste, woher der verrückte Kapitän diese Panzerrüstungen hatte! Wenn er sie nicht erst so präparierte!
Mit eingelegten Lanzen trieben sie auf ihren stolpernden Rosinanten an, vorneweg der Führer mit hochgeschlagenem Visier, und das war wirklich so ein echtes, altes Raubrittergesicht, mit der gewaltigen Hakennase, die fast die ganze Physiognomie ausmachte, abgesehen von dem weißen Schnurrbart, der bis über die Ohren hinausging.
»Auf die Knie nieder, ihr blutigen Hunde, ihr elenden Krämerseelen, ihr Leuteschinder, die ihr eure eigenen Kinder verschachert...«
So und anders brüllte der Alte. Und die Plünderung begann. Die Karawanenleute mussten ihr Geld und die sonstigen Wertsachen hergeben, die sie in den Taschen trugen, diese wurden ihnen von den abgesessenen Reitern noch besonders visitiert, alles einfach in einen Korb geworfen, der Raubritter erklärte die ganze Ware für sein Eigentum, die Leute mussten als Gefangene mit nach seiner Burg kommen, wo sie der Raubritter noch zu seinem Vergnügen schinden ließ.
Das war der ganze Witz. Für den Kapitän war aber gar kein Witz dabei. Der Alte war wirklich verrückt. Er bildete sich heute wieder einmal ein, ein Raubritter zu sein, und die Rolle spielte er mit aller Wirklichkeit, nur zum eigenen Vergnügen. Für andere wollte er dabei durchaus keine Witze machen.
Zum Schlusseffekt, zur Schinderei, kam es natürlich nicht. Er jagte den Gefangenen wohl noch möglichst großen Schrecken ein, aber zuletzt, wie schon erwähnt, bewirtete und beschenkte er sie reichlich. Nur mussten auch die anderen mitspielen. Fingen die etwa an zu lachen, dann hörte er auf zu spielen, wurde aber dafür wirklich eklig, wenn auch nur mit Worten. Dann gab es nichts.
Nun, auch die Karawanenarbeiter, die zum ersten Male so etwas mitmachten, waren gut instruiert worden und machten ihre Sache brav.
Die meisten standen steif, die besseren Komödianten fingen an zu jammern und die Hände zu ringen; einer hatte so viel Intelligenz, noch nachträglich, als ihm die Taschen visitiert wurden, ein Terzerol zu ziehen und es auf den Raubritterhauptmann anzuschlagen. Dieser aber, der noch zu Pferde saß, war schneller als jener, im Nu hatte er aus dem Sattelhalfter — obgleich zur Zeit dieser Rüstungen das Pulver noch gar nicht erfunden sein durfte — eine mächtige Pistole hervorgerissen, schon mehr eine Handkanone.
Diese Handkanone entsprach nun allerdings schon mehr den verrosteten Ritterrüstungen. Erstens hatte die Pistole noch ein Radschloss, und zweitens ging sie überhaupt nicht los.
Es rasselte einmal, es rasselte zweimal, zum dritten Male — Funken ließ das Stahlrad auf dem Feuersteine wohl sprühen, aber kein Schuss wollte fallen, und doch war die Handkanone geladen, weshalb sie vorsichtig über den Kopf des Todeskandidaten ziemlich gen Himmel gerichtet war.
Und nun muss man bedenken, dass der Karawanenhirt, der einmal A gesagt hatte, doch auch B sagen musste, aber seine Pistole war wirklich scharf geladen, und er hatte keine Lust, sein Pulver unnötig zu verschießen, und so stand er da, die Pistole auf den Kapitän gerichtet, immer darauf wartend, dass dessen Kanone losging.
Endlich hatte der Kapitän heraus, woran es lag.
»Ei verflucht, da ist ja gar kein Pulver auf der Pfanne!! Balthasar, lang mir mal das Pulverhorn her!«
Also, der Kapitän schüttete erst Pulver auf die Pfanne, dann krachte der Schuss endlich gen Himmel, und gehorsam stürzte der zu Tode Getroffene nieder, nachdem er mindestens drei Minuten lang auf den Ritter gezielt hatte.
Aber das störte den nicht im Geringsten.
»Da seht«, brüllte der Kapitän mit furchtbarer Stimme und rollenden Augen, »so geht es jedem, der eine Hand gegen mich zu erheben wagt! Meine Hand ist schneller als der schnellste Blitz, und meine Kugel fehlt überhaupt prinzipiell niemals!«
Was sich der Kapitän bei alledem eigentlich dachte, das konnte auch Lord Moore nicht sagen, der ihn am besten kannte. Er selbst schien es nicht als Witz aufzufassen, wollte auch anderen keine Witze vormachen. Eben verrückt!
»Soll der Tote eingescharrt werden, Herr Kapitän?«, fragte ein riesiger Knecht. Denn, Herr Kapitän, wollte er immer angeredet werden, Kapitän Morphin, ob er sich nun als Raubritter fühlte oder als nackter Affenmensch.
»Nein, nehmt den Hund mit, meine Hunde sollen ihn fressen — nein, die dürfen kein Hundefleisch fressen — lasst den Halunken liegen, den Rrraben zum Frrraß!«
Und so ging es weiter. Es waren lauter Italiener, die gar keinen Sinn für Humor haben, oder doch in ganz besonderer Weise. Die hier warteten nur darauf, dass die Komödie bald zu Ende sei, um sich dann an vollen Schüsseln und Weinkrügen gütlich zu tun. Die Sachen im Korbe fanden schon wieder ihre rechtmäßigen Besitzer.
Der Kapitän war langsam von dem Gaul herabgeglitten, wobei er stark in die Knie sackte, und mit schmerzverzogenem Gesicht rieb er sich das Eisenbein.
»Auuutsch, das verdammte Zipperlein!«, stöhnte er mit leichtem Wimmern, setzte aber dann gleich in ganz anderem Tone hinzu: »He, hallo, wer ist denn das?! Hiergeblieben, Canaille...«
Diese Worte hatten dem davonreitenden Grafen gegolten. Dieser hatte die ganze Szene beobachtet, hauptsächlich aber das Gesicht des alten Kapitäns studiert, dann hatte er wieder sein Pferd zum schnellsten Trabe angetrieben.
Jetzt wandte er sich noch einmal im Sattel um.
»Wegen dieser Canaille sprechen wir uns noch, Herr Kapitän!«, rief er zurück.
Lag es im Ton, dass der alte Haudegen, der er wirklich war, plötzlich ganz betroffen wurde? Doch der Ton war eigentlich durchaus nicht drohend gewesen.
»Wer war denn das?«, fragte er.
Niemand konnte es ihm sagen. Man hatte den fremden Reiter überhaupt noch nicht bemerkt gehabt, auch dann hatte den Grafen niemand erkannt.
Der Kapitän war schnell wieder der alte, setzte seine Kapriolen noch eine Weile fort und der Graf seinen Weg zur Stadt.
»Der verrückte Kerl hätte versucht, mich lächerlich zu machen«, murmelte er, »das habe ich ihm gleich angesehen, ohne dass ich eine Möglichkeit gehabt hätte, ihm zuvorzukommen, und Lächerlichkeit tötet, und ein toter Mann kann sich nicht mehr wehren.«
Er passierte das Städtchen, ritt die steile Rampe zur Zitadelle hinauf. Dann ein breiter Wassergraben, wohl von einer eigenen Quelle gespeist, die hier oben entsprang, eine solide Zugbrücke — nichts fehlte, auch nicht die Glocke, um sich bemerkbar zu machen, und zwar eine Glocke, auf die manches Dorfkirchlein stolz gewesen wäre.
Der Graf handhabte den keulenartigen Klöppel, möglichst zart, aber einer zartbesaiteten Dame, die in der Nähe gestanden, wären von dem dröhnenden Läuten doch die Trommelfelle zerrissen worden.
Alsbald zeigte sich auf dem Söller des nächsten Turmes ein Mann in mittelalterlicher Heroldstracht, an der Seite eine Trompete — oder Trommete, muss es hier wohl heißen.
»Was wollt Ihr, Fremder?«
»Den Kapitän Morphin sprechen.«
»Der Burgherr ist nicht daheim. Woher kommt Ihr?«
»Von Rom.«
»Da müsst Ihr den Burgherrn doch auf der Grenze getroffen haben.«
»Nicht, dass ich wüsste!«
»Seid Ihr denn nicht von einem Ritter angehalten worden?«
»Ach, der alte Harlekin in der verrosteten Rüstung, das war Kapitän Morphin?! Das habe ich nicht gewusst!«
Der Herold machte ein Gesicht, als habe er nicht recht gehört.
»Was sagt Ihr da?!«
»Dass der alte, verrückte Harlekin der Kapitän Morphin gewesen ist, das habe ich nicht gewusst«, wiederholte der Graf.
»Mensch, wer seid Ihr denn, dass Ihr so etwas zu sagen wagt?«
»Der Graf von Saint-Germain.«
Auch hier musste man schon viel von dem Wundermanne gehört haben, der Name machte doch einen gewaltigen Eindruck.
»Wie? Ihr wäret der Hexenmeister, der Gold...«
»Ja, ich bin es, ich möchte den Kapitän Morphin sprechen, hier auf seiner Burg, ich bringe ein Schreiben von Lord Walter Moore mit.«
Das genügte. Mochte die Burgmannschaft auch andere Instruktionen haben, keinen Fremden einzulassen, wer es auch sei — hier lag eine Ausnahme vor, die alles rechtfertigte.
Der Mann verschwand vom Söller, die Trompete erscholl, die Zugbrücke senkte sich rasselnd und quietschend herab, ein mächtiges Eisentor öffnete sich, und der Graf ritt in den Schlosshof, wurde vom Kastellan empfangen, der ebenfalls mittelalterlich gekleidet war, wie alle übrige Dienerschaft, und wohl auch auf einen mittelalterlichen Empfang dressiert war, dem Grafen gegenüber aber alle mittelalterlichen Redensarten vergaß. Nachdem dem Grafen das Pferd abgenommen, wurde er von dem Kastellan mit ganz moderner Höflichkeit in das Innere der Burg und in ein Zimmer geführt, das nach altenglischem, aber für damalige Zeiten dennoch modernem Geschmacke eingerichtet war, ohne alle Bizarrerien.
»Der Herr Kapitän wird wohl gleich zurückkommen. Darf ich dem Herrn Grafen eine Erfrischung auftragen lassen?«
»Ich danke, ich...«
»O, ich weiß, ich bitte tausendmal um Entschuldigung.«
»Hier befindet sich doch die Prinzess Polima von Leszczynski?«
»Sehr wohl, Herr Graf«, gab der Kastellan nach einigem Zögern zu.
»Bitte, wollen Sie mich der gnädigen Prinzess melden — Graf von SaintGermam.«
Was sollte der Kastellan tun? Der Kapitän hatte wegen seines Schützlings, der erst heute Nacht, erst beim Morgengrauen hier angekommen war, die schärfste Order hinterlassen, hatte in seiner Weise geschworen, dass er eher die ganze Welt zusammenkartätsche, ehe er die Prinzess wieder den Pfaffen ausliefere — aber ebenso war hier schon bekannt, dass der Graf von Saint-Germain derjenige war, welcher... kurz, das war doch etwas ganz anderes.
»Ich werde den Herrn Grafen sofort melden lassen.«
»Sie ist doch auf, hoffe ich?«
»Ja, sie hat schon gefrühstückt.«
Der Kastellan ging, der Graf stellte sich ans Fenster, ohne der herrlichen Aussicht Beachtung zu schenken.
»Sie wird mich auf keinen Fall vorlassen«, dachte er, »sie wird außer sich sein vor Scham. Aber in einer Verkleidung wäre es mir kaum möglich gewesen, in die Burg dieses verrückten Engländers zu dringen, noch viel weniger, vor die Prinzessin zu kommen. So schnell wäre es mir wenigstens nicht gelungen da wären viele Listen und Vorbereitungen nötig gewesen. Und diese Angelegenheit muss unbedingt schnellstens erledigt werden, allerschnellstens!«
Der Kastellan kehrte zurück. Schon sein Gesicht sagte alles.
»Nein, daran ist nicht zu denken — sie ist außer sich vor, vor, vor...«
»Vor Scham! Sprecht es nur ruhig aus!«
»Vor Verlegenheit, wollte ich nur sagen. Sie verkroch sich gleich in einem Winkel und wollte sich unter ihrem Taschentuche unsichtbar machen.«
Der Graf hatte es so erwartet. Und auch Lord Moore musste ganz kopflos gewesen sein, dass er trotz all seiner Welt- und besonders Damenkenntnis geglaubt haben konnte, die Prinzess würde den, den sie liebte oder doch zu lieben vorgegeben hatte, so ohne Weiteres empfangen und sich mit ihm wegen ihrer wirklichen Liebe zu ihm selbst, zu Lord Moore, auseinandersetzen. Oder er hatte vergessen, dass dieses unberührte Marmorbild jetzt plötzlich zu warmem Leben erwacht war.
»Und doch, ich muss sie sprechen.«
»Aber daran ist nicht zu...«
»Führen Sie mich zu ihr!«
»Um Gott, wenn der Herr Kapitän...«
»Führt mich zu ihr!«
»Aber wenn sie nicht...«
»Wissen Sie, wie ich zu der Prinzess stehe?«
»Das wohl, aber...«
»Führt mich zu ihr!!«
Der schon bejahrte Kastellan erlag der jugendlichen Willenskraft, ohne dass der Graf hierzu Hypnose notwendig gehabt hätte, ohne einen herrischen Befehl. Der Graf wäre wohl auch entschlossen gewesen, den Eintritt sich zu erzwingen, mit halber und sogar mit ganzer Gewalt.
»Aber wenn sie sich nun eingeschlossen hat!«, wagte der Kastellan nochmals einen Widerspruch, aber schon als Führer auf dem Wege.
»Wenn ich nur erst einmal mit ihr spreche, dann wird sie schon öffnen.«
Doch das Zimmer, in dem sie sich befand, und das sie noch nicht verlassen hatte, war nicht verschlossen.
In dem Augenblick, da sie den Grafen erblickte, wollte sie vom Sofa, in dessen Polstern sie ihr Gesicht vergraben, aufspringen, aber sie brachte es nur bis zu einem leisen Schrei und blieb sitzen, lehnte sich behaglich zurück.
Der Graf hatte sofort erkannt, was vorlag, er sorgte dafür, dass der Kastellan draußen blieb, trat schnell auf die Ohnmächtige zu.
Nichts kam ihm erwünschter als das, denn er wusste, dass auch in der tiefsten Ohnmacht seine geheimnisvolle Kunst, die wir heutzutage Hypnose nennen, wirksam war, nur mussten erst einige Vorbereitungen getroffen werden.
So rieb er zunächst ihre Schläfen mit Wasser, das er einer Karaffe entnahm, und ehe sie vollkommen erwachte, schläferte er sie richtig ein, wozu er jetzt nur seine Willenskraft nötig hatte, nur durch einen gegebenen Befehl.
»Hören Sie mich sprechen?«
»Ja «
»Sie werden mir gehorchen!«
»Ich gehorche.«
Wir wollen es nicht schildern. Die Hauptsache war, dass er ihr gegen sich selbst Gleichgültigkeit einflößte, gegen Lord Walter Moore Liebe.
»Sie werden ihn lieben!«
Sofort verklärte sich das schöne, marmorweiße Antlitz vor Seligkeit.
»Ich liebe ihn«, erklang es flüsternd in dementsprechendem Tone.
»Wen lieben Sie?«
»Lord Walter Moore.«
»Seit wann lieben Sie ihn?«, examinierte der Graf noch einmal alles.
»Schon immer.«
»Wann aber sind Sie sich dieser Liebe erst richtig bewusst geworden?«
»Damals bei der Festlichkeit.«
»Bei welcher Festlichkeit?«
»Als der Graf von Saint-Germain vorgestellt wurde.«
»Wie kam plötzlich dieses Bewusstsein, dass Sie den Lord liebten?«
»Ich... weiß es selbst nicht.«
Es waren nur ihr schon suggerierte Antworten, die sie ihm gab.
»Kennen Sie den Grafen von Saint-Germain?«
»Gewiss.«
»Lieben Sie ihn?«
Die Seligkeit verwandelte sich in Erstaunen.
»Nein.«
»Wie ist Ihr Empfinden gegen diesen Grafen?«
»Ein ganz gleichgültiges.«
Dieses Thema ward nochmals ausführlich behandelt.
»Weshalb haben Sie zuerst gesagt, Sie liebten den Grafen von Saint-Germain?«
»Ich musste doch, nachdem ich einmal meinem Beichtvater gestanden, dass ich aus irdischer Liebe zu einem Manne nicht ins Kloster wolle, irgendeinen anderen nennen, wenn ich die Liebe zu Lord Moore verheimlichen wollte, und da fiel mir gerade der Graf von Saint-Germain ein — weshalb gerade der, das ist mir selbst ganz unbegreiflich.«
So deklamierte die Schlafende mit geläufiger Zunge ihre Lektion her, die sie gut gelernt hatte.
Der erste Teil war beendet, der zweite kam daran. Sie musste erinnerungslos erwachen und dennoch alles das wissen, was ihr suggeriert worden war, das musste ihr in Fleisch und Blut übergegangen sein. Der Graf hatte ja allen Grund, sich zu beeilen. Zum Glück konnte er von dem Fenster aus, an dem er stand, die Zugbrücke sehen. Den Eintritt eines anderen fürchtete er wenig, da hatte er schon ein Stichwort bereit, es handelte sich nur darum, möglichst lange Zeit zu gewinnen. Mit der Rückkunft des Kapitäns war es natürlich vorbei. Dieser war auf der Rampe noch nicht zu erblicken, als der Graf seiner Sache sicher war.

»Eledias!«
Es war das Stichwort, das sie zum Erwachen brachte, und sofort schlug die Prinzess die Augen auf, sah den Grafen vor sich sitzen.
Aus ihrem Gedächtnis war etwas gestrichen, sie glaubte eine schon begonnene Rede fortsetzen zu müssen.
»O, Herr Graf, Sie glauben nicht, wie fürchterlich unangenehm mir das ist!«, sagte sie mit nur wenig Verlegenheit, denn die hatte sie der Graf schon im Traume durchmachen lassen.
»Bitte, das ist ja nun alles erledigt.«
»Sie können mir verzeihen? Ich weiß selbst nicht, wie ich zu der ungeheuerlichen Behauptung kam.«
»O, bitte, gnädigste Prinzess, sprechen wir doch gar nicht mehr darüber. Doch Sie verzeihen, ich muss baldigst wieder aufbrechen. Darf ich vielleicht Grüße an meinen Freund, Lord Walter Moore, bestellen?«
Mit diesen Worten war der Graf aufgestanden, tat mit Absicht, als sähe er nicht, wie sich über das weiße Antlitz eine Purpurröte ergoss.
Und mehr hatte er auch nicht sehen wollen. Es genügte, seine Suggestion hatte gewirkt.
Die Unterredung war beendet. Kein Wort weiter über den Lord, auch keine Frage, warum sie denn plötzlich geflohen sei.
Noch einige förmliche Abschiedsworte, der Graf führte die weiße Hand an die Lippen, und er verließ das Zimmer, um sich nach jenem zurückzubegeben, in das er zuerst geführt worden war.
Wieder stand er sinnend am Fenster.
»So, das hat genügt, mein Ziel ist erreicht. Alles übrige bleibt dem Lord überlassen — und ihr selbst. Denn dass ich jetzt gleich den Freiwerber spiele, das ist eine Unmöglichkeit, die der Lord wohl selbst nicht bedacht hat, als ich ihm diesen Vorschlag machte, nur um einen Grund zu haben, um schleunigst nach Palo zu reiten. Ja, mein Ziel ist erreicht. Die plötzlich emporlodernde Leidenschaft dieses Weibes für mich ist ein für allemal erloschen. Und dass sie nun den Lord liebt, eigentlich unfreiwillig, habe ich da etwa unedel gehandelt? Was heißt freiwillig? Was ist Liebe? Schon die alten Griechen und Römer hatten erkannt, dass die Liebe überhaupt etwas ganz Unfreiwilliges ist, indem sie die Liebe als einen Knaben darstellten, welcher seine Liebespfeile dem Menschen ins Herz schießt, und wen der Pfeil trifft, in dem ist die Liebe entzündet, ob er will oder nicht. Wohl, so habe eben ich einmal die Rolle Cupidos gespielt. Und der Lord liebt sie ja schon längst, das ist die Hauptsache, ich habe einen glücklichen Menschen gemacht, und die Prinzess wird nicht minder glücklich werden — — vor mir selber kann ich diese meine Tat wiederum voll und ganz verantworten, zumal ich selbst ja gar keinen Nutzen davon habe. Sonst mag das Schicksal seinen freien Lauf gehen.«
So dachte der Graf. Er sollte aber noch erkennen, dass es noch stärkere Mächte gibt als die Hypnotik, oder wie er die geheimnisvolle Kunst, die ihm auf irgendeine Weise offenbart worden war, nun sonst nannte.
Klirrende Schritte näherten sich, nicht nur von Sporen klirrende, die Tür öffnete sich, und stürmisch trat der Burgherr ein, Kapitän Morphin, noch immer in der verrosteten Rüstung steckend. Nur den Helm hatte er abgelegt, sonst nicht einmal die Eisenhandschuhe.
Mit ausgebreiteten Armen eilte er aus den Grafen zu, im ganzen Gesicht lachend.
»Aaahh, alter Freund und Bettgenosse, endlich sehen wir uns wieder! Junge, Junge, wer hätte das gedacht!«
Was sollte der Graf dazu sagen? Nun, er war ja auf den Kapitän Morphin vorbereitet worden, hatte vorhin schon selbst ein Pröbchen zu sehen bekommen, und... er war nicht umsonst schleunigst davongeritten, um eine Begegnung, wenigstens die erste, in der Öffentlichkeit zu vermeiden. Dieser Menschenkenner hatte eben gleich geahnt, wie der Kapitän die gestalten würde. So kam er erst jetzt, aber doch wenigstens unter vier Augen.
Da er sich nicht rührte, blieb auch der Kapitän mit ausgebreiteten Eisenarmen stehen.
»Nu, olle Antitante, du kennst mich wohl nicht mehr?!«
»Sie verkennen mich, Herr Kapitän — mein Name ist Graf Saint-Germain.«
»Ja freilich, ich hab's doch gleich gewusst, wer das ist. Aber erkennst du mich denn nicht mehr? Freilich, ich bin ein bisschen alt geworden; mich auch wieder jünger zu machen, das verstehe ich noch nicht, das hoffe ich erst von dir zu lernen, das hast du ja nun raus — du hast doch schon früher immer davon gesprochen — na, kennst du denn den alten Pontifex nicht mehr, den Budiker gleich links neben der Brücke — wir haben doch oft genug zusammen gepokert — du Luder mogeltest nur immer so viel. Na, olle Antitante, kannst du dich nun noch auf den Pontifex besinnen?«
Dem Grafen war nun schon längst ein Licht aufgegangen, wo der hinaus wollte. Er war doch Baumeister unter Xerxes gewesen, hatte den Brückenbau über den Hellespont geleitet, damals hatte er Antidantos geheißen — — das war nun schon zu Ohren des Kapitäns gekommen, der wollte jetzt ebenfalls bei dem Brückenbau unter Xerxes gewesen sein, dort für die Arbeiter eine Weinbudike gehabt haben, und aus Antidantos machte er eine ›olle Antitante‹.
Was sollte der Graf tun? Er tat das Klügste, was er tun konnte.
Immer freudigeres Erstaunen ging über seine Züge.
»Pontifex, Himmel, ja, jetzt erkenne ich dich!!«
Und die seit zweitausend Jahren getrennten Freunde lagen einander in den Armen!
Und dann musterten sie einander mit glückstrahlenden Blicken, aber doch von etwas Wehmut getrübt.
»Nein, Antitante, bist du aber wieder jung geworden!«
»Und ich finde, du armer Kerl bist recht gealtert.«
»Ja, ich habe das Mittel immer noch nicht entdeckt. Du legst dich immer, wenn du dich ein paar hundert Jahre ausschlafen willst, in einen Zinksarg?«
»Es kann auch ein Steinsarg sein, wenn nur völliger Luftabschluss hergestellt ist.«
»Luftabschluss, so! Und ich setze mich immer in Spiritus ein, daher mag's kommen. Apropos, Spiritus — als wir das letzte Mal zusammen waren, weißt du, als wir Abschied feierten — Herrgott, warst du besoffen, Junge, Junge, Junge!!!«
»Habe ich denn alles bezahlt?«, fragte der Graf ungerührt.
Welch ein Glück aber, dass der verrückte Kerl dies nicht in der Öffentlichkeit mit ihm vorgenommen hatte! Lächerlichkeit tötet, sagt der Franzose, und schon die Anwesenheit der Maultiertreiber hätte genügt.
»Alles bezahlt, alles bezahlt!«, bestätigte der Kapitän mit entsprechender Bewegung der Eisenhand.
»Habe ich dir auch die tausend Popelos zurückgegeben, die du mir einmal geliehen hast?«
»Popelos?«
»So hießen doch damals die kleinen Silbermünzen, etwa wie die Paoli.«
»Richtig, richtig — wir nannten sie immer einfach Popels. Nach dieser gangbarsten Silbermünze sind ja auch alle diese Städtenamen entstanden — Philippopel, Adrianopopel, Konstantinopopel und was sich sonst noch alles popelt.«
»Und die tausend Popelos habe ich dir damals also zurückgegeben?«
»Gewiss, gewiss, gleich den anderen Tag.«
»Na, ganz so schnell ging es wohl nicht — eine Woche später.«
»Jawohl, es kann auch eine Woche gewesen sein.«
»Und zwar gab ich sie dir mit drei Prozent Zinsen zurück. Denn du weißt doch, das war damals Gesetz, es durfte nur zu drei Prozent geliehen werden, und zwar musste man Zinsen nehmen, man war gezwungen dazu, und die Zinsen wurden immer gleich auf ein ganzes Jahr berechnet, auch wenn man das Geld gleich am anderen Tage zurückzahlte. Kannst du dich noch darauf besinnen, mein lieber Pontifex?«
»Auf alles, alles«, schmunzelte der Alte, der sich ja nur freute, hier einmal einen gefunden zu haben, der so gut auf seine Ideen einging.
»Und da brauchte nichts Schriftliches abgemacht zu werden, das war Ehrensache.«
»Natürlich — Ehrensache, Ehrensache!«
»Und ich gab dir die tausend Popelos zurück.«
»Mit Zinsen. Noch nicht eine Woche später zahltest du mir eintausendunddreißig harte und blanke Popels auf den Tisch.«
»Und sonst bin ich dir gar nichts weiter schuldig?«, vergewisserte sich der Graf noch einmal, natürlich ohne Grund.
»Gar nichts! Gar nichts! Kein Geld und keinen Regenschirm und keinen Hemdenknopf. Hosenknöpfe gab es damals ja noch nicht, die Hosen wurden 32 Jahre später erst erfunden.«
»Nun entsinnst du dich aber wohl noch, lieber Pontifex — es war am letzten Tage, als ich schon meine Brücke abgebrochen hatte und du deine Budike, da kam ein Mann zu dir, der von dir zehn Popelos für eine kleine Rechnung zu bekommen hatte, du hattest kein kleines Geld in deiner Hemdentasche...«
»Und du halfst mir mit den zehn Popelos aus, was?!«
»Jawohl, so war es.«
»Siehst du, wie genau ich mich noch auf alles besinnen kann! Als wäre es erst gestern geschehen und nicht vor 2000 Jahren.«
»Dann weißt du aber auch, dass ich die zehn Popelos noch von dir zu bekommen habe.«
»Und ob ich das weiß! Du warst ja schon am anderen Tage weg, spurlos verschwunden. Ich habe dich deswegen die ganzen zweitausend Jahre lang in allen Erdteilen gesucht, sogar in dem damals noch gar nicht entdeckten Amerika!«
»Hast du die zehn Popelos nicht auf einer Bank deponiert?«
»Auf einer Bank deponiert? Nee, des hielt ich die Sache denn doch nicht für wert. Und überhaupt, weißt du, ich habe mit den Banken schon zu viel traurige Erfahrungen gemacht. Dass ich beim alten Pharao Hofmundbäcker gewesen bin, habe ich dir ja schon damals erzählt...«
»Der Hofmundbäcker, der mit Joseph zusammen im Gefängnis saß?«
»Nu freilich, das war doch mein bester Freund, der Joseph! Er mauschelte ein bisschen und wackelte dabei mit den Ohren, aber sonst ein ganz gediegener Kerl. Sonntags früh musste ich ihm immer einen Käsekuchen backen. Der alte Pharao zog Speckkuchen vor, Käsekuchen und Speckkuchen, das waren nämlich meine Spezialitäten, dafür hatte ich einen ganzen Haufen Goldmedaillen bekommen und ja auch den großen Staatspreis für Kunst und Wissenschaft...«
Na, dieser Kapitän hatte von dem Grafen ja schon etwas gelernt!
»Aber der Hofmundbäcker wurde doch gehenkt.«
»Ganz richtig, ich wurde aufgehangen. Aber ich hielt die Luft an, da hat's mir nichts weiter geschadet. Und dann setzte ich mich für einige hundert Jahre in Spiritus ein. Ja, was ich nun sagen wollte wegen der Bank — siehst du, ich hatte mir ja damals ganz schöne Ersparnisse gemacht, und die wurden immer größer, je kleiner ich meine Hofmundsemmeln machte — und dann die vielen Goldmedaillen — und das trug ich nun, wie es damals üblich war, in einen Tempel zum Aufheben. So ein Tempel vertrat damals doch ungefähr die Stelle einer Depositenbank. Das eingezahlte Gold wurde eingeschmolzen, Tempelgeräte daraus gemacht. Die konnte man nach halbjähriger Kündigung auch immer wieder zurückbekommen. Zinsen gab's freilich nicht, aber doch todsicher. Jawohl, todsicher! Wie da Moses mit den Kindern Israels von Ägypten abreist, ohne ›Leben Sie wohl‹ zu sagen, nimmt der die ganzen Tempelgerätschaften mit, geht mit dem ganzen Goldschatze durchs Rote Meer über die Schweiz nach Amerika — oder nein nach Asien. Und wir haben's Nachsehen. Alle die sauren Ersparnisse auf Nimmerwiedersehen futsch! Außerdem auch noch mit sieben Plagen geschlagen. Ich hatte die Krätze...«
»Das ist sehr bedauerlich«, entgegnete der Graf, ohne eine Miene zu verziehen, »aber ich hoffe, dass du jetzt wieder in der Lage bist, mir die zehn Popelos zurückzuzahlen.«
»Kunststück!«, sagte der Kapitän, gleich die Tür öffnend und hinausrufend: »Zibethäus, hole mal aus meiner Geldkiste zehn Paoli!«
»Und die Zinsen nicht vergessen, wenn ich bitten darf«, schaltete der Graf ein.
»Und noch drei Bajocchi!«, schrie der Kapitän zur Türe hinaus.
»Was sollen drei Bajocchi? Die dürften wohl nicht langen.«
Mit einem Male erstarrte der Blick des Kapitäns, als er nach jenem zurücksah.
»Ach, Du meinst wohl... Zinseszinsen?«
»Ganz selbstverständlich. Ehrensache, Ehrensache. Das ist doch auch heute noch so üblich.«
Immer starrer wurde der Blick des Kapitäns, der doch nicht umsonst sein ganzes Leben lang mit Chinesen gefeilscht hatte.
»Auf 2000 Jahre Zinseszinsen zu drei Prozent?«
Selbstverständlich.«
»Ja, wie viel soll denn das werden?!«
»Bitte, rechne es dir doch aus.«
Gut, der Kapitän fing gleich mit seinem Eisenfinger an der Tapete zu kritzeln an, und der alte Kaufmann kannte die Formel zur Zinseszinsrechnung, und je mehr er Nullen hinmalte, desto länger wurde sein Gesicht.
»Das wird ja... eine Zehn mit 30 Nullen... die Zahl kann ich ja gar nicht aussprechen!«
»Es werden zehn Quintillionen sein«, sagte der Graf kaltblütig, ohne hinzublicken. »Also, zehn Quintillionen Paoli, wenn ich bitten darf. Ehrensache, Ehrensache. Oder wollen Sie etwa Ihre Ehrenverpflichtungen umgehen?«
Da plötzlich änderte sich die Sache. Der alte Ritter brach plötzlich in ein brüllendes Lachen aus und klatschte sich dabei immer mit den Eisenhänden auf die Eisenknie.
»Hohohoho, lassen Sie sich aber veralbern! — ich bin ja gar nicht der Hofmundbäcker vom alten Pharao gewesen, hohohoho — Ich war ja auch gar nicht beim Brückenbau unterm alten Xerxes, hohohoho — ich bin ja erst im Jahre 1678 nach Christi Geburt in Winkliff zu England zum allerersten Male geboren, wie soll ich Ihnen denn da schon vor 2000 Jahren zehn Popels geborgt haben? Hohohoho.«
Der Graf betrachtete sich den unbändigen Lacher, wie er so gebückt dastand, sich immer auf die verrosteten Eisenschienen klatschend. Was sollte er mit ihm beginnen? Er konnte den armen Greis nur bemitleiden. Wenn er nur gewusst hätte, wie er sich sonst vor dieser Verrücktheit schützen konnte!
Da veränderte sich der Alte wiederum, wurde ganz ernst, zog seinen rechten Eisenhandschuh aus, hielt jenem die knochige Hand hin.
»Herr Graf, Sie sind in diesem Turnier Sieger geblieben, Sie haben mich glänzend in den Sand gesetzt. Ich hoffe und weiß, dass Sie einem Besiegten gegenüber edelmütig sind.«
Noch zögerte der Graf, die Hand zu nehmen.
»Sie haben versucht, mich zu beleidigen, mich zu verspotten.«
»Verübeln Sie es einem alten, schrullenhaften Manne nicht, der nur noch Freude an solchen Späßchen hat«, erklang es mit ehrlich bittendem Blicke, der sogar etwas Kindliches an sich hatte, zurück. »Ich weiß es, Sie werden es mir altem Manne, von dem Sie doch sicher schon gehört haben, verzeihen. Oder glauben Sie etwa, ich hätte so etwas gemacht, wenn noch jemand anders zugegen gewesen wäre?«
»Das hätten Sie nicht getan?!«
»Wo denken Sie hin! Ich weiß doch, dass Sie der Freund meines einzigen Freundes sind, des Lords Moore.«
»Aber Sie haben mir vorhin, als ich davonritt, einen Schimpfnamen nachgerufen.«
»Habe ich?!«, rief der Alte mit ehrlichem Schreck.
»Ich mag es gar nicht wiederholen.«
»O, ich bitte tausendmal um Verzeihung. Ach ja, ich weiß — oder ich weiß vielmehr oftmals nicht, was ich tue... ach, diese vermaledeite Kugel, wenn Sie ahnten, was für Schmerzen ich manchmal auszustehen habe, wie ich darunter leide!«
Mit fast weinerlicher Stimme hatte es der alte Kapitän zuletzt gesagt, und er setzte sich, stemmte die Eisenarme aus den Tisch und drückte die Hände gegen die Schläfen.
Der Graf war Sieger geblieben, und zwar glaubte er, vielleicht die größte Gefahr seines jetzigen Lebens hinter sich zu haben.
Teilnahmsvoll blickte er auf den Alten herab, an dessen Kopf er seitlich ein tiefes Loch sah.
»Haben Sie große Schmerzen?«, fragte er leise.
Rasch stand der Alte wieder auf, jovial wie immer.
»Es ist schon wieder vorbei. Jetzt ist die Zeit nicht, wo es mich befällt, ich weiß schon immer im Voraus, wenn's kommt. Und nun, Herr Graf, wollen Sie mir die Hand geben?«
»Herzlich gern!«
Und sie schüttelten sich die Hände.
»Und wie konnte ich denn nur wissen, dass es der Graf von Saint-Germain sei, der vorhin die Karawane verließ, ohne meinen Zuruf zu beachten!«, entschuldigte sich noch der Kapitän.
»Das ist vorbei, sprechen wir nicht mehr darüber. Ich habe hier auch einen Brief mit von Lord Moore.«
Der Alte erbrach und las ihn.
Dann betrachtete er den Grafen mit noch ganz anderen Augen.
»Also, so sieht der berühmte Mann aus«, sagte er in seiner Weise, die immer etwas Possenhaftes an sich hatte, »der meinen einzigen Freund, den Lord Moore, davon überzeugt hat, dass es doch etwas gibt, was wir nicht mit unseren Sinnen fassen können, und... so also sieht der Mann aus, in den sich auch eine Prinzess Polima Leszczynski verlieben kann!«
»Das letztere ist ein Irrtum.«
»Was ist ein Irrtum?«
Der Graf setzte ihm auseinander, was wir nicht noch einmal zu wiederholen brauchen. Die Prinzess hatte ihn eben nur vorgeschoben, der Wundermann der in aller Munde war, war ihr eben gerade eingefallen.
»Ich ahnte das ja gleich, es konnte ja gar nicht anders sein, und sie hat es denn auch zugegeben.«
»Nein, diese Weiber, diese Weiber!!«, konnte der Kapitän, ein alter Junggeselle, nur immer wieder rufen. »Ja, wen liebt sie denn da aber sonst?«
»Das hat sie mir natürlich nicht gesagt, und ich konnte sie deswegen doch auch nicht fragen«, lächelte der Graf. »Es ist ja auch gar nicht nötig, dass sie einen anderen liebt.«
»Aber sie hat es doch ihrem Beichtvater und der Herzogin Borghesia und auch mir gesagt.«
»Sie musste doch einen Grund haben, weshalb sie nicht ins Kloster wollte, und da fiel ihr im Augenblick nichts anderes ein, als das Geständnis einer irdischen Liebe, und sie schob, dazu gedrängt, eben mich vor, so aus dem Stegreif. Das hat sie nun auch anderen gegenüber aufrecht erhalten. Mir gegenüber konnte sie es freilich nicht mehr.«
»Nein, diese Weiber, diese Weiber! Was für ein Glück, dass ich nicht geheiratet habe! Ja, weshalb will sie denn nicht ins Kloster?«
»Nun, es ist ihr eben in letzter Stunde zum Bewusstsein gekommen, was für ein Los ihrer da wartet. Sie will lieber dem Leben erhalten bleiben.«
»Ganz richtig, ganz richtig«, stimmte der Alte, der trotz aller sonstiger Schlauheit sicher sehr konfus war, gleich bei. »Nun, bei mir ist sie hier sicher aufgehoben, und die Pfaffen sollen nur einmal kommen, ich kartätsche die ganze Welt zusammen... haben Sie schon meine Kanonen gesehen?«
»Erst von Weitem.«
»Sollen Sie zu sehen bekommen, sollen Sie zu sehen bekommen. Also, Sie brauchen nichts zu essen und sogar nie etwas zu trinken?«
»Haben der Herr Kapitän schon davon gehört?«
»Alles, alles, und mein Freund, der Lord, schreibt mir hier, dass auch alles wirklich so ist — und dann glaub' ich's auch — ich glaube alles, alles. Und Gold können Sie auch machen?«
»Herr Kapitän, ich...«
»Well, ich glaub's, ich glaub's, weil's mein Freund glaubt. Mir brauchen Sie kein Gold zu machen, ich habe genug von dem Zeuge. Und als Gespenst können Sie auch herumspazieren?«
»Herr Kapitän, ich...«
»Well, ich glaub's, ich glaub's und was ich schon habe erzählen hören, ist Tatsache, der Lord schreibt's mir hier ja selber. Die Königin von Saba haben Sie wohl nicht gekannt?«
»Nein«, entgegnete der Graf ganz ernst. Denn auch der Kapitän schien die Sache jetzt ganz ernst zu nehmen. Eben verrückt — oder doch mit einem mächtigen Spleen behastet.
»Auch den alten Salomo nicht?«
»Nein, zu jener Zeit hielt ich gerade einen langen Todesschlaf.«
»Schade! Wirklich sehr schade! Der alte Salomo war doch so groß im Rätsellösen, und Rätsel aufgeben, das ist nämlich meine Spezialität. Können Sie gut Rätsel lösen?«
»Nun, wenn Sie es einmal probieren wollen«, lächelte der Graf, wirklich belustigt, denn jetzt sah er keine Gefahr mehr für sich.
»Gut! Essen Sie gerne Heringe? Ach so, Sie essen gar nichts. Schade! Sie sind ja ein so großer Mathematikus. In der Schüssel liegen zwölf Heringe, um den Tisch sitzen dreizehn Personen, und zwar vier Männer, fünf Frauen und drei Kinder und jede Person soll einen ganzen Hering bekommen, es sind aber bloß zwölf da — wie wird das gemacht?«
»Vier Männer, fünf Frauen und drei Kinder machen zusammen erst zwölf Personen«, entgegnete der Graf zunächst.
»Pardon — vier Kinder dann. Es sind wirklich dreizehn Personen. Und nur zwölf Heringe. Nun?«
»Und jede Person soll einen ganzen Hering bekommen?«
»Ja. Wie wird das Rätsel gelöst?«
»Dann wird einfach noch ein Hering dazugeholt.«
»Bravo, bravo!!«, rief der Kapitän, jenem die Hand schüttelnd. »Sie lassen sich nicht so leicht aufs Glatteis führen. Oder kannten Sie die Geschichte schon?«
»Nein, diese großartige Rätselausgabe war mir fremd.«
»Ist auch von mir, ist auch von mir! Ganz neu. Die halbe Nacht nämlich, wenn ich nicht schlafen kann, grüble ich mir solche Rätsel aus. Und was ist das? Auch wieder etwas ganz Neues, erst diese Nacht ausgegrübelt.«
Er hatte aus einem Schranke einen Zinnteller genommen.
»Nun, was ist das?«
»Ich halte das für einen Zinnteller.«
»Richtig! Was ist aber nun das?«
Er hatte den Teller dem Grafen auf den Kopf gesetzt.
»Na, was ist das?«
Der Graf überlegte keinen Augenblick.
»Vielleicht Zinnober?«
»Bravo, bravo!«, spendete der Kapitän wieder Beifall. »Und nun ein drittes Rätsel...«
Ein Diener trat ein.
»Der Schmuhl ist wieder da und erneuert sein Angebot. Tausend Scudi will er für den Blauschimmel geben.«
»Der Kerl soll hereinkommen.«
Der Jude erschien, hüben und drüben die Löckchen heraus, wollte einen zum Verkauf stehenden Schimmel haben, aber nicht die verlangten 1200 Scudi geben, kam immer wieder, von fünfzig zu fünfzig höhergehend, fing gleich wieder zu schachern an.
»Sei still, Schmuhl! Du sollst den Schimmel für tausend Scudi haben, wenn du mir ein Rätsel lösen kannst. Kannst du Rätsel lösen?«
»Der Gott meiner Väter wird mir beistehen«, entgegnete Schmuhl, den alten Kapitän ja zur Genüge kennend.
»Du bist doch im alten Testamente bewandert, was?«
»Wird' ich doch kennen die heiligen Bücher unseres Volkes.«
»Dann pass auf! Wie nennt man den Mund einer Ente?«
»Wie haißt der Mund einer Ente? Wird er doch haißen Schnabel.«
»Richtig. Aber nur das Wort sagen, weiter nichts. Also Schnabel. Und wie sagt man für eine kleine Geschichte, ein kleines Märchen?«
»Fabel«, entgegnete der Jude sofort, der ja nicht auf den Kopf gefallen war.
»Fabel, richtig! Und wie hieß die Stadt, in der der Turm gebaut wurde — der Turmbau zu...«
»Babel.«
»Richtig! Und wie hieß der erste Brudermörder?«
»Abel«, reimte Schmuhl natürlich weiter.
»Was sagst du Schuft da?!!«, donnerte ihn da aber Kapitän Morphin an. »Abel wäre der erste Brudermörder gewesen? Kain war's, Kain, der hat den Abel erschlagen!! Und du willst das alte Testament kennen? Was ficht dich an, den armen Abel so zu verleumden? Hinaus, du Schuft, tausendzweihundert Scudi und kein Bajaccho weniger!!«
Ganz geknickt schlich der Jude hinaus.
Der Graf zeigte einmal, dass er auch herzlich lachen konnte.
»Hören Sie, Kapitän, auf dieses SchnabelFabelBabelAbel wäre wahrscheinlich auch ich hereingefallen, des hätte ich mich nicht versehen. Übrigens ein ganz famoser Witz.«
»Und dass Sie gestehen, dass auch Sie vielleicht darauf hereingefallen wären, das gereicht Ihnen zur Ehre, nun kann ich Ihnen auch keine Rätsel mehr vorlegen, und Ihretwegen soll Schmuhl dann auch den Blauschimmel für tausend Scudi haben. Apropos, Gräfchen — wir sind unter uns und können nicht belauscht werden — so darf ich's sagen. Neulich war die Fürstin de la Roche hier — sie besucht mich öfters — und da sagte sie, dass Sie ihr versprochen hätten... na?«
»Die Gattin des französischen Gesandten in Rom?«
»Jawohl, das alte Skelett mit den zwei Zähnen, und den zweiten hat sie sich vor freudigem Schreck ausgefallen, als Sie Ihr die frohe Botschaft brachten.«
»Und sie hat darüber gesprochen?«
»Wohl nur zu mir. So sagte sie wenigstens. Mag auch sein. Alte Freundschaft. Ich habe ihr einmal einen großen Dienst erweisen können. Sie halten Ihre Behauptung aufrecht?«
»Gewiss. Es stand in ihrer Hand geschrieben.«
»Heute über ein Vierteljahr soll diese gelbe Knochenstange die gefeiertste Schönheit Roms sein?«
»In nicht mehr einem Vierteljahr. Als ich ihr das sagte, schrieben wir den 3. Juni. Also am 3. September.«
Das Staunen des Kapitäns schien gar nicht erkünstelt zu sein.
»Sie können das doch nicht so sicher behaupten, wenn es nicht wahr werden sollte.«
»Es wird auch buchstäblich wahr werden.«
»Durch Ihre Hilfe?«
»Durch meine Kunst.«
»Sie haben tatsächlich ein Verjüngungsmittel?«
»Ich habe es.«
»Herr Graf, Herr Graf«, fing der Alte plötzlich an zu flehen, »dann wenden Sie das auch bei mir an, ich will Ihnen...«
»Bedaure«, fiel ihm der Graf ins Wort, »ich kann und darf jedes Experiment nur einmal ausführen, jedes Mittel nur ein einziges Mal anwenden.«
»Also auch bei so etwas halten Sie Ihr altes Prinzip aufrecht?«
»Bei allem und jedem.«
»Sie können einen Lahmen gehend und einen Blinden sehend machen?«
»Sie wählen gleich den richtigen Ausdruck: ja, in jedem meiner Lebensläufe immer nur einen einzigen.«
»Wie kommt das?«
»Das kann ich Ihnen nicht näher erklären. Ich habe eben noch keine größere Macht, ich bin doch nicht etwa mit unserem Herrn und Heilande zu vergleichen.«
Auch hier vergaß der Graf nicht, ein frommes Kreuz vor seiner Brust zu schlagen.
»Haben Sie jemand schon das Zipperlein ausgetrieben?«
»Einen Gichtkranken geheilt? Nein, in diesen wenigen Tagen, seit ich wieder zu neuem Leben erwacht bin, noch nicht. «
»Haben Sie in diesem Ihrem neuen Leben jemand schon eine Kugel aus dem Kopfe genommen?«
»Soll ich Sie von Ihrer Kugel befreien?«
»Herr Graf«, fuhr da der alte Haudegen mit leuchtenden Augen empor, »wenn Sie das könnten, wenn Sie mich von dem bleiernen Teufel befreiten, der in meinem Kopfe manchmal ein Höllenfeuer entzündet, ich... stehe Ihnen mit allem, was ich habe, als Ihr Sklave zur Verfügung — ich will Ihr Vasall sein, Sie brauchen nur zu pfeifen, und wo Sie auch sind, ich rücke mit meiner Streitmacht heran, und ich kommandiere über zehntausend arabische Lanzen, zwanzigtausend indianische Tomahawks und dreißigtausend eskimoische Fitschepfeile. Das ist doch eine ganz bedeutende Streitmacht, was, he?«
Prüfend betrachtete der Graf den. Alten. Wenn er einmal einige Zeit vernünftig gesprochen hatte, so kam zuletzt doch immer wieder der Spleen zum Durchbruch. Oder es war doch schon etwas mehr Verrücktheit, wirklicher Irrsinn. Das drückten auch schon diese unter den buschigen Brauen unruhig flackernden Augen aus.
Jedenfalls überlegte der alles berechnende Graf jetzt, ob er diesen alten Mann noch für seine Zwecke benutzen könne, ob er es wert sei, sich mit ihm zu beschäftigen, und die Wägung schien nicht ungünstig für ihn auszufallen.
»Es sei! Kommen Sie in den nächsten Tagen zu mir nach Rom, ich werde Sie von der Kugel befreien.«
»Und von dem verdammten Zipperlein, das mich nicht minder plagt.«
»Darüber werden wir noch sprechen.«
Länger ließ sich der Graf nicht halten. Zu bewirten war er ja auch nicht.
Der ganz glücklich gewordene Kapitän geleitete ihn nach dem Schlosshof auf einem anderen Wege, wobei sie eine freie Plattform passierten, auf der zwei jener Riesengeschütze standen, aus Bronze, in der Sonne wie Gold gleißend.
»Sehen Sie, Herr Graf, dieses Geschütz habe ich den Sarazenen abgenommen, als sie die Alhambra be... nanu!!«
Als Götz von Berlichingen vor den Ratsherren stand, schlug er bekanntlich mit seiner eisernen Faust von dem Tische eine Ecke ab. Dieser moderne Raubritter hier brachte noch etwas ganz anderes fertig. Kapitän Morphin hatte mit seiner rechten Hand, von der er den Eisenhandschuh abgezogen, auf die Kanone geschlagen, gar nicht so derb, aber es genügte, um das ganze eherne Ungetüm gleich in sich zusammenfallen zu lassen, und zwar ohne viel Geräusch von sich zu geben.
Die Riesenkanone bestand einfach aus zusammengeleimter Pappe, außen mit Goldbronze bestrichen.
Aber Kapitän Morphin ließ sich durch diesen Zusammenbruch durchaus nicht irritieren.
»Sehen Sie, aus solchen Pappkanonen schossen damals die Sarazenen zentnerschwere Steine. Und das geht, das geht! Es ist nämlich ein Geheimnis damit verbunden, das ich mit ausgeliefert bekommen habe, musste deshalb freilich erst einige hundert Sarazenen zu Tode foltern, ehe sie es gestanden. Ich brauche die Pappe außen bloß mit einer Flüssigkeit zu bestreichen, dann wird sie fester als der härteste Stahl — wenigstens innen — außen darf man noch immer nicht viel draufschlagen, sonst aber kann man das Rohr mit Pulver füllen, eine ganze Tonne geht hinein — rührt die Kanone gar nicht.«
»Einige hundert Sarazenen haben Sie deswegen gefoltert?«, fragte der Graf zunächst, von hier oben auch nur die Landseite der Umgebung musternd.
»Gespießt, gebrannt, gerädert, gevierteilt — bis ich endlich den richtigen erwischte, der mir das Geheimnis mitteilen konnte.«
»So!«, sagte der Graf trocken, und hierüber weiter nichts. Er fragte auch nicht, was für eine Bewandtnis es mit dem Pferde und dem Manne habe, die er von hier aus recht deutlich an ihrem herausgereckten Galgen hängen sah.
Überdies erkannte der Graf sofort, dass nur das Pferd ein wirkliches war, der Reitersmann eine ausgestopfte Strohpuppe, so genau sie auch einem Menschen nachgeahmt war. Aus dem Munde musste sogar die Zunge heraushängen.
Der Kapitän hätte ihm ja doch nur wieder ein Märchen aufgebunden — in seiner Einbildung allerdings es wohl selbst für wahr haltend, selbst daran glaubend, also sich gar keiner Lüge bewusst.
»Was für ein Wald ist das?«, fragte er stattdessen.
Es war ein recht ansehnlicher Wald, kaum zu überblicken, der sich nach Nordosten hinzog.
»Das ist — das ist... eben der palonische Wald.«
»Der Freistadt Palo gehörend?«
»Jawohl.«
»Ist er bewohnt?«
»Nein, er ist sehr feucht«, erklärte der Kapitän, der wieder einmal ganz vernünftig wurde, »sumpfig, wenn er auch keine Fieberdünste aushaucht. Die armen Leute sammeln nicht einmal Holz darin, bei dem großen Schiffsverkehr fällt im Hafen selbst genug Brennholz für sie ab.«
»Es steht kein Haus darin?«
»Auch nicht eine einzige Hütte.«
»Aber die Ruine eines ziemlich stattlichen Gebäudes muss sich darin doch noch finden.«
»Was für eine Ruine denn?«, staunte der Kapitän.
»Ziemlich in der Mitte des Waldes.«
»Nein, da ist nichts von einer Ruine, und ich kenne doch den Wald.«
»Vor ungefähr hundertfünfzig Jahren war dort... doch ich darf davon nicht sprechen, wenn es nicht schon bekannt ist.«
»Wie? Sie waren schon vor hundertfünfzig Jahren hier?!«
»Ja, als auch dieses Kastell hier schon in Trümmern lag. Ich spreche nicht darüber.«
Der Kapitän fügte sich.
»Wollen Sie sich von der Prinzess verabschieden?«
»Nein, es hat keinen Zweck, und ich muss mich beeilen.«
»Weshalb beeilen?«
»Es ist elf Uhr, und Sie wissen doch, dass mich von zwölf bis eins der Scheintod befällt.«
»Ja, wollen Sie diese Stunde nicht hier durchmachen?«
»Ich danke, ich ziehe vor, sie in Gottes freier Natur zu erwarten.«
»Auf dem Pferde sitzend?«
»Auch das wäre möglich, selbst bei schnellster Gangart, aber ich werde mich einmal dort in den Wald legen, werde mir ein idyllisches Fleckchen aussuchen.«
»Dann will ich Ihnen einen Führer mitgeben...«
»Habe ich nicht nötig, ich kenne den Wald.«
»Aber der sumpfige Boden verändert sich fortwährend, Sie können...«
»Seien Sie ohne Sorge um mich.«
»Es gibt Schlangen, Sie werden mindestens von Mücken gefressen...«
»Bitte, seien Sie ganz ohne Sorge um mich«, erklang es nochmals zurück, diesmal mit einigem zurechtweisenden Stolz, und der Kapitän gab seine Bemühungen auf.
Sie betraten den Schlosshof, auf dem einige Pferde geputzt wurden, darunter ein Schimmel von bläulicher Farbe, ein prächtiges Tier, an dem aber jener noch anwesende Jude vielerlei Fehler fand — nämlich deshalb, weil er es kaufen wollte. Beim Anblick des Burgherrn verstummte er freilich sofort.
»Tausendundfünfzig Scudi und keinen Bajoccho mehr!«, rief er und beschwor beim Gott seiner Väter, dass er nicht mehr zahlen könne und der Schimmel auch nicht mehr wert sei.
»Schmuhl, du hast eine glückliche Stunde gehabt — diesem meinem Besuche zu Ehren sollst du ihn schon für tausend Scudi bekommen. Mein Wort gilt.«
Wer war glücklicher als der Jude! Wahrend des Grafen Rappe vorgeführt wurde, trat dieser selbst hin, wurde Zeuge, wie der Pferdehandel durch Handschlag rechtskräftig wurde, hörte vom Kapitän noch, dass es nicht sein eigenes Pferd sei, sondern nur von einem Freunde, dessen Interesse er natürlich wahren müsse, hier zum Verkauf eingestellt sei.
»Ein sehr edles Tier, aber es hat einen großen Fehler«, meinte der Graf.
»Was für einen Fehler?«, fragte der Kapitän mit einigem Unmut.
»Das ist gar kein richtiges Pferd.«
»Was?!«
»Der Jude hat für die tausend Scudi einen Leichnam, einen Pferdekadaver gekauft, dem durch Zauberkünste nur einmal für einige Zeit Leben eingeblasen worden ist.«
»Was?!«, erklang es wiederum.
Der Graf gab keine Erklärung weiter, er trat vor das unruhig scharrende Pferd hin, griff ihm an die Nüstern, blies es an, beobachtete dabei die Beine, wartete darauf, bis der Schimmel einmal mit allen vieren breitbeinig stand, oder wusste dies auch durch gewisse Griffe künstlich zu erreichen — dann ein schneller Griff in den Nacken, und plötzlich stand das so überaus unruhige Pferd ganz starr da, breitbeinig wie ein Holzbock.
Das Erstaunen der Umstehenden lässt sich denken. Es verwandelte sich in Entsetzen. Das Pferd war eben steif und leblos wie ein Holzbock, man hätte es nur mit Gewalt umwerfen können, wobei aber die breitstehenden Beine ganz bedeutenden Widerstand geleistet hätten.
Der einzige, der dieses Wunder mit besonderen Augen betrachtete, war der Kapitän.
»Ja, da ist nichts zu machen, das ist ein todesstarrer Kadaver«, sagte er phlegmatisch, »never mind, der Handel ist gültig, der war schon abgeschlossen.«
»Waih geschrien, ich bin betrogen!«, heulte dagegen der Jude.
Der Mann, der dieses Wunder zustande gebracht, kümmerte sich nicht um alles dies, er hatte sich auf seinen Rappen geschwungen, ritt ohne Abschied davon, der sich senkenden Zugbrücke zu, ohne sich noch einmal nach der staunenden, entsetzten und zeternden Menge umzublicken.
Aber als er sich schon auf der Zugbrücke befand, stieß der Graf einen eigentümlichen, durchdringenden Schrei aus, alsbald kam wieder Leben in das erstarrte Pferd, es benahm sich wie zuvor, als wäre nichts geschehen.
Auf diese Weise hatte sich der Graf verabschiedet. Es wäre gar nicht nötig gewesen, dass er zum Schlusse doch noch etwas zum besten gab, zeigend, dass er mehr könne als jeder andere Mensch. Er hatte den Kapitän bereits für sich gewonnen gehabt, nur durch Worte, durch Versprechungen, brauchte dessen Verrücktheiten und Spott nicht mehr zu fürchten.
Übrigens konnte dieses öffentlich gezeigte ›Wunder‹, welches man heute manchmal von indischen und ägyptischen Gauklern an kleinen Tieren, etwa an Hunden, ausführen sieht — man denke auch an Mosis Stab, den er in eine Schlange und wieder in einen Stock verwandelte — dem Grafen noch sehr verhängnisvoll werden. Denn selbst der in China, das ja auch die geschicktesten Gaukler in Menge hat, bekannte Kapitän Morphin hatte so etwas noch nicht gesehen.
Aber der Graf, obgleich er jedenfalls immer an alles dachte, sich nie eine Blöße gab, schien dergleichen nicht zu fürchten.
[*] Dies der Name der späteren Gattin Cagliostros, die mit seinem Wissen und Willen das Leben einer Dirne führte.
Die ihm Nachschauenden hatten ihn in dem losen Walde verschwinden, ihn aber nicht wieder hervorkommen sehen. Dies zu beobachten hätte auch seine Schwierigkeiten gehabt, er konnte ja quer durch den ganzen Wald reiten, wäre an der äußersten Nordostgrenze, wo er gar nicht mehr zu erblicken war, auf einen anderen der vielen Wege gekommen, welche bekanntlich alle nach Rom führen.
Diese weit entfernte Landstraße benutzte der Graf denn auch wirklich, nur dass er sie erst betrat, als die Abenddämmerung schon anbrach, während er den ganzen Wald, selbst wenn er sein Pferd langsam am Zügel führte, bequem in einer Stunde hätte durchqueren können.
So hatte er sich also acht Stunden in dem Walde aufgehalten. Was er während dieser langen Zeit darin getrieben, brauchen wir noch nicht zu wissen. Mögen zweifelnde Leser annehmen, er habe sich einmal gründlich ausgeschlafen, was er auch sehr nötig gehabt, wenn er wie ein jeder anderer Mensch des Schlafes bedurfte. Dann aber wäre schon die letzte Zeit, die er wachend verbracht, eine kolossale Leistung gewesen, und auch sein Leibpage hätte ihn deswegen nicht Lügen strafen können.
Die Sonne war schon untergegangen, es herrschte Dämmerung, als der Graf aus dem Walde kam und in schnellstem Trabe jene andere Landstraße nach Rom ritt.
Weit und breit kein Mensch zu sehen, kein Gehöft. kein einzelnes Haus. Wohl aber konnten solche in den kleinen Wäldchen versteckt liegen, die sich hier und da auf freiem Felde erhoben. Sie wurden und werden noch heute in Italien angepflanzt, um sich auch noch in den Wohnungen vor dem glühenden Scirocco und der eisigen Bora zu schützen. Rechterhand begleitete die Landstraße ein ziemlich breiter Bach, meist verdeckt durch dichtes Buschholz. Da ein gellender Schrei, dem ein länger anhaltendes Zetern nachfolgte, offenbar aus einem Kindermunde kommend.
Im Nu war der Graf, sein Ross nur noch einige Galoppsprünge machen lassend, aus dem Sattel, warf die Zügel über einen Baumast und drang in das Gebüsch.
Er hatte die Stelle, von welcher der Hilfeschrei erklungen war, ganz genau herausgehört, und er kam im letzten Augenblick.
An einem sich weit über das Wasser reckenden Weidenaste hing ein Kind, ein kleines Mädchen, das rote Röckchen hatte sich festgehakt, sonst hing das Kind ganz frei in der Luft, den Kopf in gleicher Höhe mit den Füßen, gerade über der Mitte des Wasserspiegels.
Kaum hatte das der Graf erblickt, als das Röckchen riss, die Hälfte blieb oben hängen, das Kind stürzte ins Wasser.
Sein Tod wäre besiegelt gewesen. Der Bach floss nur träge, war aber gerade tief genug, um auch einen erwachsenen Menschen vom Leben zum Tode zu befördern, und kein Zufall hätte das Kind das rettende Ufer gewinnen lassen. Noch einmal tauchte es auf, um mit den Händchen verzweifelt um sich zu greifen, dann wäre es nicht eher wieder in die Höhe gekommen, als bis es nach den Gesetzen der Natur geschehen musste.
Da aber befand sich der Graf schon im Wasser. Auch er fand keinen Grund, musste schwimmen. Das hatte er von dem Bache wohl nicht erwartet, sonst wäre er gleich so gesprungen. So schöpfte er erst noch einmal Atem, tauchte unter, nur wenige Sekunden blieb er aus, dann hatte er das Kind in den Armen, gewann das Ufer.
Es war alles so schnell gegangen, dass das Kind darüber noch nicht die Besinnung verloren hatte. Der Schreck war natürlich groß. Doch schien ihm die Gefahr noch gar nicht richtig zum Bewusstsein gekommen zu sein.
Es war ein bildschönes kleines Mädchen, vielleicht vier Jahre alt, das Gesichtchen, von den nassen, blonden Haaren eingerahmt, wie Milch und Blut.
»Kind, ohne mich hättest du dein Leben eingebüßt, wärest jetzt schon eine Leiche!!«
Am merkwürdigsten war vielleicht, wie furchtbar erschüttert der Graf war, ganz außer sich, er zitterte an allen Gliedern, es fehlte nur noch, dass er auch geweint hätte.
Das kleine Mädchen hingegen hatte den ersten Schreck sofort überstanden, lachend zeigte es die blitzenden Zähnchen.
»Das war aber schön!«, rief es jubelnd.
Auch der Graf hatte sich gleich wieder in der Gewalt, betrachtete jetzt nur das Kind mit einem aufmerksamen Blick, wie der Naturforscher eine neu entdeckte Spezies.
»Wie heißt du?«, begann er dann das Examen..
»Lorenza Feliciani.«
»Wo wohnst du?«
»Dort drüben bei Onkel und Tante Casparos.«
Sie deutete dabei in den Busch hinein, der auch das andere Ufer des Baches begrenzte.
»Das sind wohl Bauersleute?«
»Ja, das sind meine Tante und Onkel.«
»Sie haben ein Gehöft?«
»Ja, mit vielen Schweinen und Ziegen und Hühnern und auch zwei Kühen.«
Ein großer Gutshof konnte es demnach nicht sein.
»Du siehst aber gar nicht wie ein Bauernkind aus. Hast du keine Eltern mehr?«
»Doch, in Rom, und morgen soll ich wieder hingebracht werden.«
»Ach so, du warst hier nur auf Besuch?«
»Ja, viele, viele Tage lang, und wenn ich wieder nach Hause komme, da hat der Klapperstorch mir einen kleinen Bruder gebracht.«
»Was ist dein Vater?«
»Das ist der Gürtlermeister Feliciani.«
»Wo wohnt er in Rom? Weißt du das?«
»Ich weiß überhaupt alles, alles — im Fogli«, entgegnete die kleine Lorenza, die zwar das reizende Kind blieb, aber immer altklüger wurde, was nicht nach jedermanns Geschmack ist.
Fogli ist auch solch ein Stadtviertel, in dem meist kleine Handwerker wohnen.
Und immer starrer wurde der Blick des Grafen, der aus dem schönen Antlitz des Kindes ruhte. Offenbar arbeitete sein Hirn auf's Angestrengteste, und dabei sah er auch manchmal nach dem roten Fetzen, der fest in dem Weidenaste hing.
»Wie kamst du dahinauf?«, examinierte er dann weiter.
»Nun, ich bin hinaufgeklettert«, war die fröhliche Antwort.
»Bist du allein?«
»Ganz allein.«
»Wirst du denn nicht zu Hause erwartet?«
»Erst, wenn es finster wird, und es ist ja noch nicht ganz finster. Aber nun musst du mich auch wieder hinüberbringen übers Wasser, es gibt hier keine Brücke.«
Wenn der Graf etwas vorhatte, so war sein Entschluss bereits gefasst.
»Ja, komm, ich bringe dich hinüber. Fürchtest du dich denn gar nicht?«
»Wovor soll ich mich denn fürchten?«
»Du wärest ertrunken.«
»Weil ich ins Wasser gefallen bin? Ach ich wäre schon wieder herausgekommen.«
Wieder starrte der Graf die kleine Sprecherin mit ganz merkwürdigem Blicke an.
»Dieses leichtfertige Kind verspricht dereinst nichts Gutes, und es ist vielleicht besser so...«, murmelte er, als er das kleine Mädchen wieder auf die Arme nahm, ohne Weiteres in den Bach sprang und am anderen Ufer, wo die Weide stand, hinaufkletterte.
Auf dieser Seite sollte auch das Gehöft liegen, das wegen des Gebüsches nicht zu sehen war, des Grafen Pferd stand auf der anderen Seite.
Ohne das Kind aus den Armen zu lassen, schlüpfte der Graf mit der Gewandtheit einer Katze durch die dichten, hohen Büsche, bis er den Saum erreicht hatte, sich noch hinter diesem haltend, nur vorsichtig die Zweige zur Seite biegend.
»Wo ist das Gehöft deines Onkels?«
Lorenza bezeichnete ein Wäldchen, dessen Umrisse in der immer stärker werdenden Dunkelheit noch eben zu erkennen waren, zwischen den Bäumen blitzten schon Lichterchen auf.
»Nun muss ich aber fort, es wird finster.«
»Was werden Onkel und Tante sagen, wenn du so nass nach Hause kommst?«
»Ach, die sagen niemals etwas!«
»Und willst du nicht wenigstens die andere Hälfte deines Röckchens mitnehmen?«
»Ach, das mag nur hängen bleiben.«
Ein sehr, sehr verzogenes Kind!
»Warum lässt du mich denn nicht herunter? Ich kann doch allein gehen«, wurde die kleine Lorenza jetzt aber doch stutzig.
»Weil ich dich...«
Er brauchte keine weitere Erklärung zu geben, plötzlich erstarrte das Kind unter einem Griffe so in seinen Armen, wie vorhin das Pferd erstarrt war.
Ohne das Gebüsch auf dieser Seite verlassen zu haben, kehrte er zurück, legte das Kind hin, erstieg die Weide, befestigte den roten Fetzen noch besser, stieg wieder zu Boden, nahm das wie leblos und ganz starr daliegende Kind in den Arm, ging nochmals durchs Wasser, schnallte hinter dem Sattel die zur Reiseausrüstung gehörende Decke ab, wickelte das Kind hinein, schwang sich in den Sattel und setzte seinen Weg fort, ohne sich zu beeilen.
Hauptsache war, dass er sich überzeugte, wie er von jenem Gehöfte aus nicht mehr erblickt werden konnte, auch wenn es heller Tag gewesen wäre, das hohe Gebüsch, welches den Fluss begleitete, lag dazwischen, und jetzt war auch schon die finstere Nacht angebrochen.
»Und wenn ich gesehen und erkannt worden wäre«, murmelte er, jetzt sein edles Ross in Galopp setzend, »so würde ich schon eine Ausrede wissen und alles zu meinen Gunsten wenden. Und was wird nun sein? Es wird ein jammerndes Elternpaar geben und nicht minder verzweifelte Verwandte, denen das Kind anvertraut wurde. Aber haben diese ihre Pflicht nicht aufs gröbste vernachlässigt? Wäre dieses Kind nicht ohne mich dem Tode geweiht gewesen? Kann es nicht ganz mit Recht als tot betrachtet werden und lebendig als mein Eigentum? Ja, ganz gewiss, ich habe das größte Anrecht auf das Kind. Und du sollst eine neue Mutter mit innigster Liebe wiederfinden, auch an der deines neuen Vaters soll es dir nicht fehlen, so sehr ich mich dazu auch werde zwingen müssen, und außerdem werde ich aus dir etwas ganz anderes machen, als was du sonst unter der Leitung deiner Eltern geworden wärest. Denn ich glaube, ich glaube, dein leichtfertiger Übermut hätte dich bald auf schlimme Wege gebracht, die zum Abgrund führen; davor aber will ich dich mit aller Kraft bewahren, und das kann ich, ich kann dich zur Edelsten deines Geschlechtes erziehen.«
So sprach der Mann, der das Schicksal spielen wollte, seine Tat gerechtfertigt zu haben glaubte — und gerade an diesem Kinde sollte ihm das Schicksal furchtbar beweisen, dass es nicht mit sich spielen lässt, keine fremde Einmischung duldet!
Es war in der zehnten Stunde, als der gerötete Horizont die Nähe der erleuchteten Hauptstadt ankündigte.
Vorher hatte der Graf noch einen ansehnlichen Wald zu passieren, in dem einige Grundstücke lagen, die Landstraße wurde auch in dieser Nachtstunde immer noch ab und zu von Fußgängern, Reitern und Wagen benutzt.
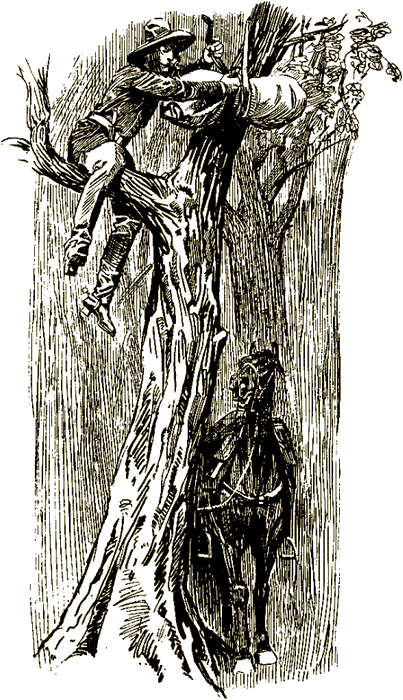
Nahe dem Ausgange des Waldes schwenkte der Graf einen schmalen Seitenpfad ab. Mochte er auch im Finstern sehen können, so konnte er diese Wege und Stege doch nicht schon vor mehr als hundert Jahren kennen gelernt haben. Nur ein kurzer Ritt in den stockfinsteren Wald hinein, und er hielt an, stieg ab, band das Pferd fest, schnallte einen Ledergürtel ab, den er noch unter der Weste trug, wickelte das regungslose und ganz starre Kind besser in die Decke, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, dass es Luft bekam, so erklomm er mit der Gewandtheit einer Katze, oder richtiger eines Affen, eine derbreitästigen Eichen, die hier süße Eicheln tragen, schnallte das zum Paket gemachte Kind mit dem Riemen hoch oben an dem Baumstamme fest.
»Es kann ihm nichts geschehen, in spätestens zwei Stunden werde ich zurück sein, und sollte es doch durch irgend einen Zufall gefundenwerden — nun, so mögen dieLeute das Wunder anstaunen.«
So murmelnd, stieg er wieder herab und jagte der jetzt im Lichterglanze auftauchen den Stadt zu.
Diesmal wurde er an dem Tore angehalten.
»Der Graf von Saint-Germain.«
Nur ein erstaunter Blick und dann ein ehrerbietiges Zurücktreten. Eine Viertelstunde später ließ der Graf an der Pforte seines Klosters den Klopfer erschallen.
»Ist während meiner Abwesenheit etwas passiert?«, fragte er, als er sich im Hofe aus dem Sattel schwang.
»Gar nichts.«
»Hat jemand nach mir gefragt.'«
»Immer dieselben wie täglich. Lord Moore schickte alle zehn Minuten herüber, ob der Graf noch nicht zurück sei.«
Da kam er schon selbst, des Grafen Rückkunft erfahren habend, im Gesellschaftsanzug, seine Gäste im Stich lassend, nur für wenige Minuten Zeit habend.
Der Graf führte ihn in sein Arbeitszimmer und erstattete Bericht, so weit er es durfte.
Die Prinzess hatte zugegeben, den Grafen nur als Grund zu ihrer Flucht vorgeschoben zu haben, und jetzt sah der Lord es ein, hatte es schon längst eingesehen, dass der Graf unmöglich als Freiwerber für ihn hatte auftreten können.
»Doch der eigentliche Grund sind Sie, die Prinzess liebt Sie, verlassen Sie sich darauf, nur bitte ich Sie, nicht zu fragen, woher ich das weiß.«
Es genügte, der Lord war glücklich.
»Ich weiß nicht, wie ich Ihnen dafür danken soll!«
»Wofür denn?«
»Ich hoffe unsere Nachbarschaft noch inniger zu gestalten, dass wir nicht immer einen so weiten Weg haben. Ist es Ihnen recht, wenn ich die Grenzmauer unserer Grundstücke durchbrechen und eine Tür einfügen lasse?«
Es war dem Grafen nicht anzumerken, dass ihm das ganz und gar nicht angenehm war.
»Wenn es möglich ist? Aber dieses Kloster ist doch nicht mein Eigentum, ich darf nichts daran ändern...«
»Die Grenzmauer gehört zur englischen Gesandtschaft.«
»Dann sehe ich der Herstellung dieses kürzeren Weges natürlich mit Freuden entgegen. Noch eins, Mylord: Hinten auf dem Sattel war eine Reisedecke angeschnallt, wohl nicht fest genug — ich habe sie auf dem Heimritt verloren.«
»Sonst nichts weiter?«, lachte der Lord und eilte davon, um seinen gesellschaftlichen und diplomatischen Verpflichtungen nachzukommen.
Während sich der Graf umkleidete — das Reitkostüm war unterdessen natürlich vollkommen getrocknet, hatte durch das Wasser auch sonst nicht gelitten, auf solche Strapazen war es ja trotz aller Eleganz berechnet — hatte er eine kurze Unterredung mit seinem Pagen, ohne Belang.
»Ich begebe mich jetzt ins Sanktuarium und will nicht gestört sein, bin für niemand zu sprechen, mag kommen, wer will. Hörst du, Joseph?«
»Wie Herr Graf befehlen. Wenn aber nun wieder eine päpstliche Wache kommt, die man doch nicht so zurückweisen kann?«
»Dann zeige ihnen nur die Tür, hinter der ich mich befinde, dann mögen sie sie nur selbst öffnen, mit Gewalt erbrechen — aber für die Folgen stehe ich nicht. Darauf mache sie gleich aufmerksam.«
»Was würde dann geschehen?«, durfte Joseph noch weiter fragen, auch ganz mit Recht, denn er hatte darüber noch gar keine Instruktionen empfangen.
»Sie würden Schreckliches erblicken, das lass auch dir genügen.«
Mit diesen Worten öffnete der Graf auf dem Korridor im Parterre eine sehr schwere, eisenbeschlagene Eichentür, ohne weitere Vorsicht, und trat ein, wozu er aber, nachdem er die Tür hinter sich schon geschlossen und verriegelt hatte, noch einen Vorhang zurückschlagen musste.
Der ziemlich weite, fensterlose Raum, der immer künstlich erleuchtet werden musste, war das ehemalige Sanktuarium des Klosters gewesen, das Heiligtum, in dem eben die Heiligtümer, zum Teil wirklich kostbare, aufgehoben wurden, soweit sie nicht in der nur kleinen Kapelle untergebracht gewesen waren. Das Allerwertvollste hatte man lieber hier aufgehoben, wie in einem riesigen Geldschrank, hatte es nur, wenn es nötig war, nach der Kapelle hinübergebracht, die aber schon längst abgebrochen war.
Dieses alte Sanktuarium hatte der Graf gleich in den ersten Tagen als sein zweites, eigenstes Zimmer in Anspruch genommen, ohne es vorläufig zu beziehen. Die besten Möbel waren hineingebracht worden, sehr viele Teppiche und Decken und Portieren, Handwerker und Diener hatten oben an der Decke Stangen von Wand zu Wand spannen müssen, an denen in Ringen Portieren liefen, sodass der ganze Raum in die verschiedensten Abteilungen zerlegt werden konnte.
»Das wird mein Empfangszimmer«, hatte der Graf einmal gesagt, hatte es dann abgeschlossen, selten nur einmal für kurze Zeit betreten, um noch etwas hineinzubringen, etwas anders arrangieren zu lassen.
Jetzt zum ersten Male äußerte er gegen den Pagen, dass er dieses Sanktuarium auch als sein eigenes Heiligtum betrachten wolle, in das er sich manchmal zurückzöge und dann unter keinen Umständen gestört werden dürfe.
Das musste den pfiffigen Jungen, der später ein Cagliostro werden sollte, ja gleich stutzig machen, und so in nachdenklicher Stellung stand er auch noch draußen, die gewaltige Tür betrachtend, hinter der sein Herr verschwunden war.
»Was macht er da drin? Sich einmal ausschlafen und satt essen an dem, was er da heimlich hineingeschmuggelt hat? Zwar weiß ich selbst am besten, dass er einmal wirklich dreimal vierundzwanzig Stunden nicht geschlafen und weder etwas gegessen noch getrunken hat, wobei jeder andere Mensch tot gegangen wäre — und doch glaube ich nicht, dass er überhaupt keinen Schlaf und keine Nahrung braucht, weil's einfach unmöglich ist.
Trotzdem glaube ich auch nicht, dass er sich da hinter der verschlossenen Tür einfach satt isst und sich dann schlafen legt, dazu halte ich den Grafen doch für zu schlau. Dafür wird der schon andere Gelegenheiten haben als hier in seiner eigenen Wohnung.
Also, jetzt fängt er an, sich da hinein zu verkriechen, ohne zu sagen, wann er wieder zum Vorschein kommt, und niemand darf ihn stören, sonst soll man Schreckliches erleben.
Hm, was mag er da drin Heimliches treiben? Das muss ich natürlich ausspionieren. Und ich denke, da drin finde ich die Quelle, aus der auch erst der Graf seine Kenntnisse schöpft. Denn der hat das nicht von sich allein, der hat irgend etwas.
Und wenn ich das habe, und es genügt mir, dann gehe auch ich meiner Wege. Denn hier gefällt es mir durchaus nicht. Der Graf hält nicht, was er mir versprochen hat. Mein Geheimnis, wie ich einen entfernten Gegenstand auf Befehl durch die Luft herkommen lasse, hat er mir glücklich abgegaunert — durch Versprechungen. Und was hat er mir dafür gegeben? Gar nichts. Er hat mir noch nicht einmal verraten, wie man seine Hände feuerfest macht. Lernen, sagte er, immer lernen, sich geistig und körperlich bis zur höchsten Vollkommenheit ausbilden, und vor allen Dingen seinen Charakter immer mehr veredeln, bis man ganz ohne Sünde lebt, dann käme das alles von ganz alleine. Hahaha, der tut, als besäße er wirklich übernatürliche Fähigkeiten! Als ob das nicht nur lauter Gaukeleien wären! Wie ich das mit dem Herholen machte, das nannte er einen Schwindel, verbot es mir fernerhin! Als ob er nicht der allergrößte Schwindler wäre! Und er spricht, er wolle die ganze Menschheit veredeln, hahaha!
Na, bis ich weiß, wie er seine Gaukeleien macht, oder woher er seine Geheimnisse hat, so lange bleibe ich noch, und bis dahin ist es doch ganz gut, wenn ich lerne, was er mir aufgegeben hat, denn lernen kann man wirklich etwas bei ihm.«
So sprach zu sich selbst der frühreife Knabe, der hiermit bewies, dass sich auch ein Graf von Saint-Germain einmal vollständig in einem Menschen täuschen konnte. Denn er hatte seinem Pagen trotz alledem schon ziemliches Vertrauen geschenkt, was er sicher nicht getan, wenn er seinen eigentlichen Charakter durchschaut hätte.
Joseph begab sich in seine Zelle, die er neben dem Arbeitszimmer seines Herrn hatte, und studierte Mnemotechnik, Gedächtniskunst, nicht aus jenem Hauptwerk, sondern nach schriftlichen Lektionen des Grafen, die er ihm von Zeit zu Zeit gab. Denn auch der spätere Cagliostro leistete in der Gedächtniskraft Erstaunliches, obschon nicht zu vergleichen mit dem Grafen von Saint-Germain. Er hatte eben nicht alle Lektionen erhalten, hatte sich dann auch nicht allein weiter ausbilden können.
Und was er dabei zu schreiben hatte, schrieb er nach Anweisung des Grafen mit der linken Hand, diese so nach und nach ausbildend — der neunjährige Knabe, der noch der größte Handschriftenfälscher seiner Zeit, wenn nicht aller Zeiten werden sollte!
Wir kehren zu dem Grafen zurück.
Als er die Tür hinter sich geschlossen und den Vorhang zurückgezogen hatte, flammte in seiner Hand wieder das geheimnisvolle Lichtchen auf, einer Dose entspringend, welche der damaligen Menschheit wie Aladins Wunderlampe vorgekommen wäre.
Mit dieser zündete er eine der Lampen an, deren mehrere von der Decke herabhingen, durch Drähte hin und her zu schieben.
Hierauf hob er den an der Tür liegenden Teppich empor, unter dem sich ein Strick befand, in den sechs Knoten geschlagen waren. So sah es wenigstens aus. Dann griff er tiefer unter den Teppich und zog zwei starke, graue Fäden hervor, die am Ende in blanke Kupferdrähte ausliefen.
Also nichts anderes als eine elektrische Leitung, und das im Jahre 1750, da von der Naturkraft, die wir heute Elektrizität nennen, noch so gut wie gar nichts bekannt war! Auch die Kupferdrähte verstand dieser Graf schon zu isolieren, nur nicht mit einem Seidengespinst, sondern er tauchte sie wohl in eine Kautschuklösung, was aber doch wiederum schon für damalige Zeiten erstaunliche Kenntnisse voraussetzte.
Den einen Draht verband er mit der dicken Knotenschnur, den anderen hakte er in einen kleinen Ring unten an der Tür, breitete den Teppich wieder darüber.
»So, sechs Explosionen genügen«, sagte er zufrieden. »Wem sechsmal unter Donner und Knall ein Feuermeer entgegengeschlagen ist, der wird wohl nicht noch den Mut haben, in diese vermutliche Hölle einzudringen — und tut er es dennoch, nun, dann erfolgt eben noch eine ganz andere Explosion, die alles vernichtet.«
Hierauf löschte er das Licht wieder aus, schob von der hinteren Wand die Teppichverkleidung zurück, die ganze Steinwand wich zurück, und... der Graf nahm denselben Weg in die Tiefe hinab, den er damals als Skribent genommen hatte. Denn auch damals war er durch dieses Sanktuarium gegangen, das nur nicht verschlossen gewesen war.
Als er wiederum eine Lampe anbrannte, hatte er die unterirdische Bibliothek und Apotheke schon hinter sich, befand sich bereits in dem Raum mit den vielen Garderobeschränken.
Er entkleidete sich schnell und verwandelte sich in einen römischen Flussfischer oder Fährmann.
Dann begab er sich immer wieder in einen anderen Raum, wie es solche hier noch viele zu geben schien, hob vom Boden eine Eisenplatte — ein Schacht von einem Meter Durchmesser zeigte sich, in den eine eiserne Leiter hinabführte, die aber gleich in einem schwarzen Wasserspiegel verschwand.
»So hoch ist der Tiber selten gestiegen«, murmelte er, als er sich den Gürtel fester schnallte.
Ein tiefer Atemzug, schnell sprang er senkrecht in den Schacht hinein, ergriff, als sich die Fahrt mäßigte, weil der Mensch, wenn er die Lungen voll Luft hat, im Wasser immer nach oben getrieben wird, die Leitersprossen und stieß sich an ihnen abwärts, bis er eine horizontale Öffnung fühlte, in diese hinein, hier konnte er schon Schwimmbewegungen machen, dabei sich auch noch mit den Füßen an den Wänden abstoßen, so zählte er sekundenweise bis zehn, wobei er mindestens zehn Meter zurücklegte, dann stieg er, ohne erst gefühlt zu haben, nach oben, die ersten Sekunden auch mit den Händen arbeitend, dann nur noch mit der einen, die andere emporstreckend, und... stieß mit dieser gegen eine unter dem Wasser befindliche Decke, die nicht hätte kommen dürfen, hier im freien Strome!
Aber dieser Mann, der sich schon eine Minute unter Wasser befand, ließ sich dadurch nicht außer Fassung bringen.
Seine Hand tastete.
»Holz! Ein Flachkahn!«
Mit beiden Händen stieß er sich wieder zurück, schwamm seitlich, wieder empor, aber immer wieder mit ausgestreckter Hand, und das war gut, denn sie stieß zum zweiten Male an ein Hindernis. Ein guter Schwimmer, der nicht nur so im Wasser herumschwabbelt, steigt so scharf empor, dass er sich an einem Hindernis einfach den Kopf zerschmettert.
Dieser Schwimmer hier war so vorsichtig gewesen, die Beschaffenheit der unbekannten Oberwelt erst zu prüfen, und obgleich jetzt schon eine Minute vergangen war, behielt er sogar noch Humor dabei.
»Heute habe ich Glück! Was ist das? Holz. Ein Balken. Und daneben auch wieder ein Balken. Und hier sind sie mit Stricken zusammen gebunden. Also ein Floß. Nun, wenn nicht der Zimmermann, so wird doch der Flussgott irgendwo ein Loch gelassen haben, der Tiber ist doch wahrhaftig breit genug, dass eine Wasserratte noch einen Durchschlupf finden muss!«
Also wiederum hinab, seitwärts geschwommen, aber nicht etwa nach der Richtung, nach welcher die Floßbalken hinliefen, jetzt fühlte die vorausgestreckte Hand die Wassergrenze, der mit einem ledernen Schlapphut bedeckte Kopf folgte nach.
Jetzt zeigte sich, wie wenig für diesen Mann anderthalb Minuten ohne regelmäßige Lungenfunktion waren, ein tiefer Atemzug, und der Betrieb war wiederhergestellt.
Er durchschwamm den ganzen Strom, nach der anderen Seite hinüber, mit langen, ruhigen Stößen, schwamm wie ein...
Nein, nicht wie ein Fisch, auch nicht wie ein Seehund oder eine Wasserratte, sondern wie ein Mensch, der durch Talent und Ausbildung Meister geworden ist.
Man soll nicht immer solche Ausdrücke wählen: mit dem Sprunge eines Panthers; er schwimmt wie ein Fisch; mit der Gewandtheit eines Affen.
Der Schreiber dieses ist gerade kein besonderer Bewunderer der Menschheit im Allgemeinen, aber er schwärmt für den Menschen als für das höchste Produkt der Schöpfungskraft dieser Erde.
O, was kann der Mensch doch auch in körperlicher Hinsicht alles erreichen, wenn er seine Fähigkeiten bis zur Grenze der Möglichkeit ausbildet!!
Turner führen Weit- und Hochsprünge aus, die ihnen kein Panther nachmacht; es gibt Menschen genug, die ein Pferd aufheben und davontragen können; der gewandteste Affe kann sich doch nicht etwa mit einem geübten Turner an Reck und Barren messen; der Geißbub muss die sich verstiegen habende Ziege befreien, also, er nimmt es auch mit der Gämse auf, kein Adlernest ist ihm unerreichbar; man sieht Schwimmkünstler, die fünf Minuten unter Wasser bleiben, und länger halten es auch der Seehund und der Wal nicht aus, und was das Schwimmen selbst anbetrifft, so muss man nur einmal einen richtigen Schwimmer sehen, wie der durchs Wasser fegt! Nun soll man aber einmal von einem Walfisch verlangen, er solle zu einem Adlernest hinaufklettern! Und der Adler hat Flügel, das ist keine Kunst. Aber ohne Flügel da hinauf zu kommen, wie der Mensch es macht, das ist der Witz!
Ja, von gewisser Seite aus betrachtet, sind es gerade seine körperlichen Fähigkeiten, wenn er sie möglichst ausbildet, die den Menschen zum edelsten Schöpfungsprodukt machen. Das haben auch schon die alten Griechen, die uns auch geistig ganz bedeutend überlegen waren, obgleich sie noch keine Eisenbahn und kein Telefon besaßen, zu würdigen gewusst, indem sie hauptsächlich Athleten in Marmor verewigten, und die Sieger in den olympischen Spielen waren von Staats wegen befreit von allen Steuerabgaben.
Und es ist tatsächlich so, gerade bei geistiger Aufklärung kommt man nicht darüber hinaus: Im Sinne der Natur ist nicht d e r Geistesheld, der all sein Knochenmark im Kopfe konzentriert, sondern der seine körperlichen Fähigkeiten bis zur Meisterschaft ausgebildet habende Athlet der wahre Repräsentant des Menschengeschlechtes! — — —
Eine Wassertreppe, an der kein Fahrzeug lag, war des Schwimmers Ziel. Oben standen einige schwatzende Menschen, aber sie gewahrten nicht, dass der von unten kommende Mann dem Wasser entstiegen war. Das aus dünnem Leder bestehende Gewand musste eingefettet sein, der letzte Tropfen war bereits von ihm abgeflossen.
Schnellen Schrittes ging er den Kai hinauf, fing erst in der Nähe der Stadtmauer wieder zu bummeln an, um unbemerkt eine zweite Wassertreppe benutzen zu können, wieder in den Strom zu gehen.
Denn am Tore hätte er nach Papieren gefragt, angehalten werden können. Ehe er sich dieser Eventualität aussetzte, schwamm er lieber die kurze Strecke stromaufwärts bis hinaus ins Freie.
Zwar wurde hier auch der Strom durch Boote bewacht, aber wer dachte an einen Schwimmer, noch dazu an einen auswärts schwimmenden?
Der Tiber ist nicht gerade reißend, aber der Wind muss sehr günstig sein, wenn ein Segelboot stromaufwärts kommen will. An ein Schwimmen ist nicht zu denken, für einen normalen Schwimmer. Es gibt aber eben auch anormale Schwimmer, und zu diesen gehörte unser Graf.
Unter dem Schlapphut, den man auf dem dunklen Wasser gar nicht bemerkte, die Nase kaum hervorgereckt, schoss er mit noch ganz bedeutender Schnelligkeit vorwärts, und kam er in die Nähe eines Wacht- oder Zollbootes, so tauchte er unter und kam in tieferen Schichten des Wassers nach dem jedem Schwimmer bekannten Gesetze noch schneller vorwärts.
In zehn Minuten hatte er die Stadtmauer schon weit hinter sich, er erstieg das linke Ufer des Stromes, durch einen Promenadenweg von Villen mit Gärten getrennt, und jetzt begann er zu rennen, einen schnellen Hundetrab anzuschlagen.
So hatte er in einer halben Stunde jenen Wald erreicht, drang ein, fand sich wie in seinem eigenen Hause zurecht, erstieg eine Eiche, schnallte dort oben das Paket ab.
Das in die Decke vollständig eingewickelte Kind regte sich nicht, war starr wie ein Klotz. Der Graf überzeugte sich auch nicht, ob es überhaupt noch lebe, schien seiner Sache ganz sicher zu sein.
In ebenso schnellem Laufe eilte er zurück, bis er bei jenen Villen wieder ins Wasser ging. Den Kopf des Kindes hielt er dabei übers Wasser, das war aber auch alles, und es hatte wenig Zweck, denn durch die dichte Decke konnte es doch sowieso keine Luft bekommen.
Jetzt verließ er den Strom auch nicht wieder, als er die Stadtmauer schon hinter sich hatte, sondern ließ sich weitertreiben, durch Schwimmbewegungen die Schnelligkeit noch vergrößernd. Booten ging er aus dem Wege; war das aber nicht möglich, so kam es ihm nicht darauf an, mit dem Kinde im Arm auch unterzutauchen; nur einmal, als vor ihm eine Reihe von Booten lag, blieb er wohl zwei Minuten unter Wasser, ohne sich dann davon zu überzeugen, wie es mit dem Kinde stehe.
Der Graf wusste schon, wie weniger Luftzuführung der Mensch in diesem Zustande des Starrkrampfes bedarf, und es ist kein Märchen, dass sich indische Fakire wochenlang lebendig in der Erde begraben lassen, wozu sie sich ebenfalls in Starrkrampf versetzen.
So erreichte er die Mauer seines Klosters, an der das Wasser des Tibers spülte.
Mit der Hand längs der Steinquadern tastend, ließ er sich daran vorbeitreiben, dann ein Heben des ganzen Körpers, ein tiefer Atemzug. und, sich umdrehend, ging es kopfüber hinab, das Kind im Arm.
Es war in der achten Morgenstunde, als der noch schlafende Joseph von einem der wachhabenden Diener geweckt wurde. »Die Glocke des Sanktuariums ist gezogen worden, der Herr Graf begehrt Sie.«
Zu der Einrichtung des geheiligten Raumes gehörte auch eine auf den Korridor hängende Glocke, die der Graf erst hatte anbringen lassen, wie auch für sein Schreibzimmer, und durch diese Klingelzeichen rief er immer nur seinen Pagen. Daraufhin waren die Diener von vornherein instruiert worden, und infolge alles dessen wurde der Junge von ihnen mit Hochachtung behandelt, sogar mit Sie angeredet. Wodurch der fremd zugelaufene Bengel diese Bevorzugung vom Grafen verdiente, wusste man noch gar nicht. Nun, der Graf hatte sich eben einen Leibpagen zugelegt, dem er volles Vertrauen schenkte.
Sofort war Joseph aus dem Bette und griff nach den abgeschabten Kleidern, schon mehr Lumpen zu nennen, die er noch immer trug.
»Der Schneider hat vorhin unsere Livreen gebracht, auf einem Wagen einige Kisten, da werden doch auch die Ihren dabei sein«, bemerkte der Diener noch, ehe er sich entfernte.
Denn der Graf hatte noch an demselben Tage, da er die Diener angenommen, beim ersten Schneidermeister Roms, einem Kleiderkünstler, der nur für die exklusivsten Herrschaften lieferte, für jeden eine doppelte Livree bestellt, eine einfachere und eine Galauniform, bei der sogar Goldstickerei verwendet werden musste, der Graf hatte sich dazu Muster und Zeichnungen vorlegen lassen, alles nach Maß; so etwas wie Konfektionsgeschäfte mit Fabrikarbeit gab es damals überhaupt noch nicht, und besonders der kleine Joseph hätte für seine unförmliche Gestalt, die ungefähr mit der eines verzwergten Herkules zu vergleichen war, wohl auch schwerlich etwas Passendes gefunden. Das Gleiche war dann auch bei den später hinzutretenden Dienern, bis die heilige Zahl 21 voll war, geschehen.
»Sind sie endlich angekommen? Habt ihr die Kisten schon aufgemacht?«
»Das dürfen wir doch wohl nicht, ich sage es Ihnen eben, dass Sie es dem Herrn Grafen gleich melden.«

»Hat Signor Ravelli auch die Rechnung mitgeschickt?«
»Die wird wohl drin liegen, abgegeben wenigstens ist kein Brief worden, es waren auch nur Bedienstete des Schneidergeschäftes, die die Packe gefahren brachten.«
Joseph hatte noch einmal gezögert, dann war er in seine alten Sachen geschlüpft, und ehe sich der Diener entfernte, überzeugte er sich erst noch einmal ganz ungeniert davon, mit offenbarer Absicht, dass jener es sehen sollte, ob die Seitentür, die zu dem Arbeitszimmer des Grafen führte, auch gut verschlossen sei. Denn außer dem Grafen besaß nur Joseph die Schlüssel zu diesen beiden Türen.
Dann begab er sich hinaus, verschloss in Gegenwart einiger Diener, die aus dem Korridor zu tun hatten, recht auffällig die Tür seiner eigenen Zelle und begab sich nach dem Sanktuarium hinüber.
»Fort hier, dass niemand beobachtet, wenn ich eintrete!«, rief er den Dienern gebieterisch zu, ehe er anklopfte.
Gehorsam entfernten sich die Diener oder blickten doch weg, und wenn sie dabei auch nicht brummten, so mochten sie sich doch ihr Bestes denken. So musste man wenigstens annehmen.
Wenn der Graf seine Diener an sich fesseln wollte, dass er jedem einzelnen unbedingt vertrauen konnte, so hatte er in der Wahl dieses kleinen Leibpagen gerade keinen sehr glücklichen Griff getan. Der neunjährige Bengel war sich seiner Unentbehrlichkeit schon voll und ganz bewusst, trat gegen die anderen Diener viel herrischer auf als der Graf, von dem dies übrigens gar nicht galt. Denn er war wohl unnahbar, aber sonst immer die Liebenswürdigkeit selbst gegen seine Untergebenen.
Als er kräftig geklopft hatte, ertönte noch einmal die über der Tür angebrachte Glocke, zum Zeichen, dass er eintreten dürfe.
Die mächtige Klinke ließ sich niederdrücken, was in verschlossenem Zustande nicht möglich war, die schwere Tür drehte sich leicht in den Angeln. Joseph trat ein, sah im Scheine des noch vom Korridor kommenden Tageslichtes ein kleines Vorzimmer, oder nur eine Kammer, kaum größer als ein Rauchfang, und befand sich, als er die Tür geschlossen hatte, in einer Stockfinsternis.
Das alles war dem Jungen nichts Fremdes, er hatte ja mit geholfen, diese ganze Einrichtung anzubringen, allerdings nicht mit eigener Hand, hatte gegenüber Dienern und Handwerkern immer den Meister gespielt, und zwar wirklich stets mit größtem Geschick.
So wusste er, dass ihn von dem eigentlichen Sanktuarium noch ein Vorhang von schwarzem Samt trennte, den musste er zurückschlagen, dann erst bekam er Licht, vorausgesetzt, dass der fensterlose Raum auch künstlich erleuchtet war, und zwar so, dass die brennenden Lampen nicht immer noch von Vorhängen, die vom Boden bis zur Decke reichten, verhüllt waren.
Im Augenblick bedauerte der zukünftige Cagliostro nur, dass er nicht im Finstern sehen könne, was er auch niemals erlernen sollte. Denn er bemerkte, dass die Klinke der Tür nach dem Schließen wieder unbeweglich wurde, und diesen Mechanismus hatte er früher an der Tür nicht gewahrt.
»Das muss der Graf alles selbst gemacht haben. Schließt die Tür von selbst oder dirigiert das der Graf von Weitem?«
So dachte der neunjährige Junge, dem als späterem Cagliostro nicht die geringste Schwäche eines Menschen entging, um sie gleich zu seinem Vorteil auszubeuten, als er den Samtvorhang zurückschlug.
Auch in dem Sanktuarium war es ziemlich finster, nur durch einen einzigen Lichtstreifen wurde es etwas erhellt. Dieser kam aus der Spalte eines zum Teil zurückgezogenen Vorhanges, Joseph sah seinen Herrn schon an einem Schreibtisch sitzen, der gleichfalls hier hereingekommen war, mit allem was dazu gehörte.
»Dem scheint das Schreibzimmer drüben noch nicht sicher genug zu sein, er will sich hier ganz zurückziehen«, dachte der Junge zunächst.
»Bist du's, Joseph?«
»Ja, Herr Graf.«
»Hast du die Tür wieder gut zugemacht?«
»Sie schließt von selbst.«
»Ja, du musst sie aber erst anziehen, bis es schnappt.«
»Das habe ich getan, die Tür geht gar nicht mehr auf.«
»Dann komm her, mein Sohn.«
Joseph folgte dem Lichtstreifen und trat durch die Spalte des Vorhangs.
Durch Zuziehen mehrerer Vorhänge war ein Kabinett entstanden, und an dem Schreibtisch saß der Graf, in dem Kostüm, das ihm gestern Abend Joseph hatte reichen müssen, also alles aus der Garderobe des Lords stammend, und beschrieb zwei Briefbogen gleichzeitig mit beiden Händen, und nach allem, was Joseph sonst sah, konnte er doch nicht schließen, dass sein Herr sich hierher zurückgezogen habe, um die ganze Nacht in ruhigem Schlafe zu verbringen.
Auf dem Schreibtisch lagen eine Unmenge von Briefen — zweiundvierzig waren es, wie Joseph später erfuhr — vom Grafen geschrieben, und wenn sie auch nicht alle so lang waren wie die beiden, an denen er jetzt noch schrieb, und wenn er auch beide Hände gleichzeitig benutzte und die Feder mit fabelhafter Schnelligkeit über das Papier gleiten ließ, so musste er doch die ganze Nacht von gestern Abend an zum Schreiben gebraucht haben.
So dachte wenigstens der neunjährige Junge, der, eine so ausgeprägte Handschrift er auch schon hatte, doch noch kein besonderer Federheld war.
Leider konnte er nicht von hinten lesen, und so hatte er sich gerade gestellt, konnte seine Stellung nicht noch verändern.
Nur die schon adressierten Kuverts, jedes auf dem dazugehörenden Briefe liegend, konnte er lesen — fast nur die angesehensten Personen Roms, Männer wie Frauen, darunter auch einige Kardinäle.
»Ich bin gleich fertig, das sind die beiden letzten Briefe. Zusammen sind es zweiundvierzig. Daraus machen wir dann ein Paket, welches du mit einem besonderen Begleitbriefe zu Lord Moore hinüberträgst. Möglichst unauffällig, mein lieber Joseph, nicht wahr?«
»Es soll niemand etwas davon erfahren, dass Lord Moore diese Briefe erhält?«
»Nein. Diese Briefe sollen durch die Diener des Lords ausgetragen werden, als wären es etwa Einladungen von ihm. Verstehst du?«
»Ich verstehe, Herr Graf. Aber kann nicht Ihre Handschrift erkannt werden?«
»Ich habe gar keine eigene Handschrift. Außerdem bitte ich den Lord, wenn er es für besser findet, die Kuverts noch einmal selbst zu schreiben — oder sie von seinem Sekretär schreiben zu lassen. Die Empfänger wissen dann sowieso, dass die Einladungen von mir kommen. Wir haben nämlich heute Abend und an den nächstfolgenden Abenden immer große Gesellschaft.«
Der schlaue Junge musste wohl einen Grund haben, deswegen keine weitere neugierige Frage zustellen, obgleich sie ihm erlaubt gewesen wäre. Er wollte eben nicht neugierig erscheinen.
Sich erstaunt zu stellen, von Bewunderung diktierte Fragen zu tun, das war etwas ganz anderes.
»Haben denn Herr Graf alle diese Briefe erst jetzt geschrieben?!«
»Nun, während dieser Nacht. Als ich mich gestern Abend zurückzog, setzte ich mich gleich an den Schreibtisch«, entgegnete der Graf, ohne einen Moment die beiden Hände ruhen zu lassen.
»Zweiundvierzig solch lange Briefe?!«
»O, da sind noch viel längere darunter.«
»Ja, wie ist denn das nur möglich?!«
»Wirst auch du noch lernen, mein Joseph. Sei du nur immer ein so folgsamer Schüler, wie du jetzt bist.«
»Da haben Sie also keine Minute geschlafen?«
»Zweifelst du denn noch daran, dass ich wirklich keines Schlafes bedarf?«
»Nein, das kann ich ja gar nicht mehr, aber... es ist nur eben wieder ganz unbegreiflich, wenn ich daran denke, dass ich jede Nacht wie ein Murmeltier schlafe.«
»Wirst du ebenfalls noch lernen. Tu nur immer deine Pflichten, vervollkommne deine Tugenden, und eine der ersten ist die Treue.«
Der Junge nahm einen Ansatz, als wollte er eine Grimasse schneiden, beherrschte sich aber noch rechtzeitig.
Er zog es vor, sich lieber recht naiv zu stellen, seinem Alter entsprechend, das freilich schon so schlecht zu seinem sonstigen Aussehen passte.
»Dass Sie das aber alles allein schreiben müssen! Kommt denn der Schreiber nicht bald, den Sie zu Ihrem Sekretär machen wollen?«
Denn von jenem Antonio Roscalli, den er zu seinem Sekretär machen wollte, hatte der Graf schon zu seinem Pagen gesprochen, freilich nicht sagend, dass dies sein zweites Ich war.
»Ja, ich weiß auch nicht, wo der bleibt — ich erwarte ihn jeden Tag. Und das ist es auch, weshalb ich dich gleich sprechen wollte. Wenn du das Paket Briefe zu Lord Moore hinübergebracht hast, gehst du dann nach... bist du in Rom bekannt?«
»Sehr wenig.«
»Kennst du das Viertel Baja?«
Nein, und der Graf beschrieb ungefähr den Weg.
»Du brauchst ja nur zu fragen. Und dort fragst du nach Signora Marietta Roscalli. Das ist die Gattin jenes Skribenten. Sie möchte nicht erst heute Abend, sondern sobald wie möglich, wenn es geht, sofort, mit ihrem Kinde zu mir kommen. Verstehst du?«
»Sehr wohl, Herr Graf. Mit ihrem Kinde?«
»Mit ihrem Kinde! Es ist verkrüppelt, taubstumm und blind. Ich will es zu heilen versuchen. Ich habe es meinem zukünftigen Sekretär und der Mutter selbst bereits versprochen — soweit man da etwas versprechen kann.«
So sehr sich dieser Junge auch schon in der Gewalt hatte — so weit war er doch noch nicht, dass er nicht gleich einen ganz anderen, über alle Maßen erstaunten Gesichtsausdruck bekommen hätte, der diesmal durchaus nicht erkünstelt war.
»Blind und taubstumm?!«
»So geboren.«
»Kann nicht sehen, nicht hören und nicht sprechen?!«
»Auch nicht gehen. Eben ein ganz zurückgebliebenes, sogar idiotisches Kind.«
»Und Sie können es gesund machen?!«
»Ich hoffe es«, wurde der Graf jetzt etwas kürzer. »Also, du gehst dann gleich hin zu dieser Frau. Erst aber in die englische Gesandtschaft hinüber.«
Der kleine Joseph hatte sich schnell wieder beherrscht.
»Herr Graf«, begann er dann wieder, als sein Herr die Briefe in die Kuverts steckte, »Signor Ravelli hat vorhin auch die Livreen geschickt.«
»Hat er endlich? Nun, da kannst du dich ja bei deinem Ausgang gleich in ein besseres Kostüm stecken. Passen dir die Anzüge überhaupt?«
»Ich habe sie ja noch gar nicht gesehen.«
»Warum denn nicht? Sind deine nicht mit dabei?«
»Die Kisten sind ja noch gar nicht geöffnet worden.«
»Ja, weshalb denn nicht?«
»Wie hätten wir das ohne des Herrn Grafen Erlaubnis wagen dürfen!«
»Das hättest du tun dürfen, du wenigstens.«
Der Graf hörte sogar mit seiner Beschäftigung auf, um den Jungen eindringlich anzublicken.
»Joseph, merkst du denn gar nicht, was für ein Vertrauen ich dir schenke?«, fragte er in ebensolchem Tone.
»O doch, Herr Graf...«, stellte sich der Junge demütig.
»Weißt du auch, warum ich dir solch ein großes Vertrauen schenke?«
»Weil — weil... Sie eben ein so edler Herr sind.«
»Weil ich aus dir einen wirklich edlen Menschen machen will, wozu du die Anlagen hast, die aber bei deiner Verwilderung niemals zum Durchbruch kommen würden. Ich habe gemerkt, Joseph, dass du die bevorzugte Stellung, die ich dir gegeben habe, dazu benutzt, um gegen die anderen Diener herrisch und gar unfreundlich zu sein. Ist das recht, Joseph?«
Immer noch ganz freundlich, wenn auch eindringlich genug hatte der Graf es gesprochen. Der Junge wollte sich verteidigen.
»O, Herr Graf, das ist gar nicht so...«
»Ist es so oder nicht? Keine Lüge! Wehe dem, der lügt!«
»Ja, es ist so«, stellte sich der Junge schnell wieder ganz zerknirscht.
»Bist du dir dessen bewusst?«
»Ja, Herr Graf.«
»Dann bist du schon einen großen Schritt weiter, denn... wie heißt der Spruch, den ich dir als Einleitung gegeben habe?«
»Selbsterkenntnis ist der Anfang aller Weisheit«, deklamierte der Junge, der ja schon manche Lektion in der Moral erhalten hatte, wie wir aus seinem gestrigen Selbstgespräch erfahren haben.
»Richtig! Weshalb also bist du so herrisch und unfreundlich gegen die anderen Diener?«
»Ich will mich bessern, Herr Graf«, erklang es immer zerknirschter.
»Tu das, und wie du dich selbst überwindest, wirst du, wie ich dich immer gelehrt habe, auch die ganze Welt überwinden.«
»Dann werde ich auch nicht mehr zu schlafen und zu essen brauchen?«, wurde der Junge jetzt wissbegieriger.
»Das kommt von ganz allein, je mehr du dich selbst überwindest, nämlich in deinen Untugenden.«
»Und dann werde ich auch Krüppel heilen können?«
»Du wirst mehr leisten können, als ich, der ich noch immer ein schwacher Mensch bin. Und nun nimm hier diese Briefe und gib sie dem Lord persönlich. Hierauf erst kleidest du dich um und gehst nach Baja.«
Der Graf hatte unterdessen die kuvertierten Briefe in ein Paket gewickelt, ein besonderer Brief kam dazu.
»Geh! Die Tür wird sich von allein öffnen.«
So geschah es. Joseph konnte die Klinke plötzlich wieder niederdrücken, was ihn zunächst in Verwunderung setzte.
Erst als er draußen auf dem Korridore war, auf dem sich keine Diener mehr befanden, verzog sich sein breites Gesicht zu einem verächtlichen Grinsen. Diese neue Lektion in der höheren Moral schien bei dem Jungen sehr wenig gefruchtet zu haben, hatte seinen Entschluss, Güte mit schnödem Undank zu belohnen, nicht geändert.
»Deine Geheimnisse werde ich schon auf andere Weise herausbekommen«, murmelte er, als er davoneilte, nach der Gesandtschaft hinüber.
Der Graf hatte gelauscht, bis er das Schnappen des Türschlosses hörte, dann zog er aus dem Schreibtisch die oberste große Schublade hervor, in der außer anderen, zum Teil sehr seltsamen Gegenständen auch ein Brett lag, das mit schwarzen Knöpfchen besetzt war, von denen nach hinten in die Schublade Kupferdrähte liefen — also ganz wie bei einem modernen elektrischen Schaltbrett.
»Die Vorrichtung funktioniert, die Tür ist geschlossen, der Riegel hat sich selbsttätig vorgeschoben, die Feuerwerkskörper können wieder explodieren. Sonst hätte sich dies hier nicht herausschieben können, davon brauche ich mich nicht erst noch einmal zu überzeugen, was sonst zur Gewohnheit würde, und dann hätte ich nicht erst diese Vorrichtung nötig. Und wie funktioniert das?«
Er drückte auf einen Knopf des Brettes, schloss die Schublade, und zwar musste das sehr schnell geschehen, denn schon begann der ganze Schreibtisch sich zu senken.
Als die obere Platte eben noch etwas aus dem Boden hervorsah, trat er darauf, fuhr mit in die Tiefe. Dabei entstand ein Geräusch, wie wenn ein entferntes Wasser rauschte.
»Das muss ich noch beseitigen, das könnte mir doch einmal gefährlich werden, und ich weiß auch, wie es zu vermeiden geht«, murmelte er während seiner Fahrt in die finstere Tiefe, und zwar hatte sich die Decke über ihm sofort selbsttätig wieder geschlossen.
Also der Graf besaß schon einen Fahrstuhl, einen ganz modernen Lift, wenn auch nicht elektrisch, sondern hydraulisch. durch Wasserdruck betrieben.
Gestern Abend hatte er ihn noch nicht benutzen können, da war er so, wie schon früher, die Wendeltreppe in der hohlen Wand hinabgestiegen. Demnach konnte er in dieser Nacht wirklich nicht geschlafen haben, er hatte nicht nur die vielen Briefe geschrieben, sondern auch noch diesen Fahrstuhl in Ordnung gebracht.
Denn dass er dies alles in den wenigen Tagen, seitdem er dieses Kloster öffentlich bezogen, mit eigener Hand im Geheimen erbaut hätte, davon konnte natürlich keine Rede sein.
Wer war nun der Konstrukteur und Erbauer aller dieser technischen Einrichtungen, die für die Öffentlichkeit zum Teil erst hundert Jahre später erfunden wurden?
Es war möglich, dass es der Graf selbst gewesen, der ja, wie der Leser nun doch schon weiß, bereits längst hier unten gehaust hatte.
Aber wir haben ihn auch schon des öfteren von einem ›Meister‹ sprechen hören, stets mit der größten Ehrerbietung.
Und noch etwas anderes kommt hinzu.
Jene ersten Kapuzinermönche, die ihren allzu strengen Prior, Klaudius mit Namen, aus Rachsucht ermordeten, hatten ihn zu ihrer eigenen Entschuldigung als Zauberer angeklagt, der mit dem Teufel im Bunde stand, als hätten sie mit ihrem Morde also nur ein gutes Werk getan.
Der ganz sonderbare Prior, übrigens für seinen Rang noch ziemlich jung, habe sich Tag und Nacht in einem besonderen Raume aufgehalten, den niemand betreten durfte, da habe man ihn hämmern und feilen hören, habe da die wunderbarsten, höllischsten Dinge gefertigt, und geholfen habe ihm dabei ein Gerippe, welches man sich habe ganz richtig bewegen sehen.
Was die Mönche sonst alles aussagten, kam ja nicht in die Öffentlichkeit, denn, wie schon erwähnt, die Mörder oder überhaupt die sämtlichen Bewohner dieses Klosters verschwanden gleich von der Bildfläche, ihr Verhör wurde ganz im Geheimen vorgenommen, sie kamen auch nie wieder zum Vorschein.
Nur das von dem teuflischen Gerippe, das er sich für seine Zauberarbeiten dienstbar gemacht, war in die Öffentlichkeit gedrungen. Doch das war ja nun auch alles länger als siebzig Jahre her.
Was lag da näher, als dass sich der talentvolle Prior mit mechanischen Künsten beschäftigte, unter anderem auch ein automatisches Skelett gefertigt hatte, und von diesem rührten der Fahrstuhl, die elektrische Batterie und alles andere her.
Ja, so können wir sagen, die wir eben schon etwas mehr wissen und alles auch mit ganz anderen Augen betrachten.
Sonst aber ahnte kein Mensch etwas von diesem Fahrstuhl und allem anderen, niemand stieg jemals der Verdacht auf, dass der Graf von Saint-Germain schon früher in diesem verrufenen Kloster gelebt haben könnte; auch dem Lord fiel es niemals ein, der Graf könnte von diesem Kloster aus durch einen unterirdischen Gang in den Keller seines Hauses gelangt sein.
Der moderne Schreibtisch, aus jenem römischen Patrizierhause stammend, war in einem engen Gewölbe gelandet, jedenfalls stand er auf einer in Schienen laufenden Plattform, der Graf sprang herab, schlug einen Vorhang zurück und befand sich in seiner unterirdischen Bibliothek, schon durch die große Hängelampe erleuchtet, welche sich aus einem Behälter selbsttätig mit Öl speiste.
Hier unten war sein eigentliches Sanktuarium, sein eigentliches Heiligtum, in dem er erst des richtigen Nachdenkens fähig zu sein schien.
So weit die Wände nicht mit Büchern bedeckt, waren sie mit Teppichen verhangen, aber es zeigte sich, dass diese nicht etwa eine kahle Mauer verhüllen sollten.
Hinter einem dieser Teppiche war der Graf hervorgekommen, jetzt schlug er einen zweiten zurück, der wiederum nur den Zugang zu einem anderen Gewölbe abschloss. Vielleicht besaß das ganze, sehr geräumige Klostergrundstück solch einen zweiten Keller, von dem die Außenwelt gar nichts wusste. Wenn man hin und wieder hatte dem Spukgeiste zu Leibe rücken wollen, hatte man wenigstens niemals an solch einen zweiten Keller gedacht, fehlte doch auch jede Andeutung von einer aus dem gewöhnlichen Keller noch tiefer führenden Treppe.
Der Graf lauschte in das Gewölbe, von dem er jetzt die Portiere zurückgeschlagen hatte, hinein, sein Auge konnte ja auch die Finsternis durchdringen, aber er mochte nichts Beunruhigendes hören und sehen, denn mit sichtbarer Befriedigung ließ er den Teppich wieder fallen.
Mit über der Brust verschränkten Armen begann er in der Bibliothek auf und ab zu wandern, und es mussten freundliche Gedanken sein, die ihm erst unangenehme nach und nach verdrängten, denn immer mehr hellte sich sein anfangs so düster gewesenes Antlitz auf.
Manchmal schweifte sein Blick über die endlosen Reihen der alten Pergamente, dann leuchteten seine Augen jedes Mal erst recht auf, und das Ende dieses langen, langen Wanderns und Nachdenkens war, dass er vor dem großen, einfachen Tische, der schon immer hier gestanden, stehen blieb und mit schnellem Griff an einer von der Decke herabhängenden Schnur zog.
Dieser Tisch, auf dem einige aufgeschlagene Folianten lagen, schien mit dem Rücken gegen die Wand zu stehen, die ebenfalls mit einem dünnen Teppich oder dicken Tuche behangen war. Aber dies war hier wiederum nicht der Fall, durch den Zug an der Schnur rollte die Portiere zurück, hinter dem Tische zeigte sich eine neue geräumige Abteilung... und dann ein Anblick, der jeden, der sich hier unter der Erde allein glaubte, mit Schrecken erfüllt hätte.
Von dem großen Tische ging, durch die Portiere getrennt gewesen, ein kleinerer ab, und an diesem saß ein alter Mann, in einen schwarzen Talar gehüllt, den Kopf, von dem der schneeweiße Bart bis auf die Brust herabfloss, in die eine Hand gestützt, die Finger der anderen zwischen den Pergamentblättern eines Folianten, in dessen Lektüre er ganz versunken war.
Es musste, wenn man den Ausdruck wählen darf, ein uralter Mann sein. Zu dieser Ansicht kam man, obgleich das marmorweiße Gesicht, noch weißer als Haar und Bart, kein einziges Fältchen zeigte. Und es war das Antlitz eines Mannes, welcher die Welt mit allen ihren Leidenschaften hinter sich hat, daher auch mit all ihren Schwächen und Gebrechen — ein Repräsentant des Menschengeschlechtes, der in sich alles Gute und alle Geistesfähigkeiten vereinigt — eines jener Ideale, von denen die mystischen Adepten von jeher geträumt haben, von Plato und Aristoteles an, und von denen die modernen Theosophen noch heute träumen — ein Übermensch, der sich auch in seinem irdischen Leibe schon vollkommen mit Gott vereinigt hat, der dadurch auch den Tod überwunden hat, seinen irdischen Leib, wenn dieser nach den ewigen Gesetzen der Natur doch zu gebrechlich wird, nur schnell einmal ablegt, um sich sofort wieder mit einem anderen, jugendlichen zu umkleiden.
Wir wollen es gleich verraten: Es war kein lebendiger Mensch. Es fehlte der Atem, es fehlte... das Leben. Aber nur ein ganz Unerfahrener wäre auf die Vermutung gekommen, eine Wachsfigur vor sich zu haben. In Wachs kann man ein menschliches Gesicht wohl am besten modellieren, die Hand, die Finger bis auf den Nagel — in Holz oder gar in Stein ist die Täuschung niemals so zu erreichen, die Ausführung mag noch so kunstvoll und sorgfältig wie die Farbe sein. Aber auch eine Wachsfigur bleibt doch immer eine Wachsfigur. Da lässt sich auch kein vernünftiges Kind täuschen, so wenig wie ein witternder Hund. Ein lebendiger Mensch kann sich eine Zeitlang als Figur ausgeben, aber einer Figur kann niemals Leben eingehaucht werden, auch nicht schon erloschenes Leben.
Und dennoch, dies hier war keine von Menschenhand gefertigte Figur. Es war eine präservierte Leiche, die Menschenkunst vollkommen zu erhalten verstand, und so etwas lässt sich allerdings denken, ist auch schon da gewesen. Man dürfte sich, als eklatantestes Beispiel, an jenen italienischen Gelehrten erinnern — es standen darüber lange Berichte in allen Zeitungen — der vor etwa zehn Jahren der italienischen Regierung sein Geheimnis verkaufen wollte, Leichen zu präservieren, dass sie sich in tadellosem Zustande, als wären sie soeben erst gestorben, wahrscheinlich Jahrhunderte lang hielten, also nicht etwa zu vergleichen mit der Mumifizierung der alten Ägypter oder der bekannten Kunst unserer heutigen Ärzte. Dieses Schützen vor Verwesung ist doch sehr illusorisch. Der Mann zeigte drei menschliche Leichen, einen Mann, eine Frau und ein Kind, konnte beweisen, dass der erstere schon vor mehr als 20 Jahren gestorben war, und es sah aus, als sei er gestern in rüstiger Jugendkraft verschieden. Diese drei Leichen sind jetzt im anatomischen Museum von Mailand zu sehen, sie haben sich noch immer nicht verändert. Der Gelehrte forderte von der Regierung für seine Erfindung eine Million Lire; die Regierung begann zu feilschen; jener, ein stolzer Sonderling, zog sich sofort zurück, ist über den Handel gestorben, hat sein Geheimnis mit ins Grab genommen. Die Spezialgelehrten stehen immer noch vor einem Rätsel. Die drei Leichen haben ihre vollständigen Eingeweide, die Augen blicken wie im Leben.
Dies war auch hier bei diesem alten Manne der Fall, wie er lesend in das Buch schaute.
Und immer strahlender blickten auch die Augen des in seiner ganzen Jugendkraft stehenden Grafen auf den Alten, und dennoch drückte sein Antlitz immer mehr etwas wie Schmerz oder doch Wehmut aus.
»Mein edler Meister!«, flüsterten einmal zitternd seine Lippen.
Er hatte es ausgesprochen. Von diesem also hatte er alle seine Künste und Kenntnisse, von denen die damalige Menschheit noch gar nichts wusste, er war der eigentliche Beherrscher dieses wissenschaftlichen Reiches unter der Erde.
War das vielleicht der zauberhafte Prior, den die Mönche ermordet haben sollten oder wollten? War er vielleicht dem Tode entgangen, hatte sich in dieses sein unterirdisches Reich, welches er schon früher angelegt, für immer geflüchtet?
Die Öffentlichkeit hatte nichts davon erfahren, nicht einmal, auf welche Weise Prior Klaudius seinen Tod gefunden haben sollte, ob man seine Leiche verborgen habe, und der Graf sprach es jetzt nicht aus. Andere Worte waren es, die über seine Lippen kamen. diktiert von seliger Freude und schmerzlicher Wehmut zugleich.
»O, herrlicher Mann, was bist du mir gewesen, was habe ich dir zu verdanken! Als ausgesetzten Findling, dem sicheren Tode verfallen, fandest du mich auf dem verschneiten Wege, nahmst mich zu dir in dein unterirdisches Reich, wurdest mir Vater und Mutter. Schon als Kind habe ich von deinen gütigen Lippen die erste Weisheit eingesogen. Dann, als ich Fragen stellte, ob es denn nicht eine andere Welt gäbe als diese hier, schicktest du mich unter sicherer und fast nicht minder weiser Führung, die du mir zu verschaffen wusstest, in die schöne, weite Welt hinaus, die ganze Erde bereiste ich, und alles, alles wurde mir gezeigt und erklärt, was sonst nur die Eingeweihtesten der geheimen Gesellschaften erst im höchsten Alter erfahren dürfen, und noch viel mehr, was sonst keinem Menschen offenbar wird.
Dann, als mein Führer sich dem Tode nahe fühlte, brachte er mich zu dir zurück, um spurlos zu verschwinden, du aber nahmst den zweiten oder dritten Teil des Unterrichtes vor, zu meiner letzten Ausbildung.
Ach, wie wusstest du zu lehren und zu erzählen! Ach, was für köstliche, herrliche Stunden habe ich hier verlebt, und das noch fast zehn Jahre lang! Wenn wir uns hier so gegenübersaßen, und ich lauschte deinen schier allweisen Lippen, und jetzt erst bekam ich die Erklärung von alledem, was ich während meiner Reisen in allen Erdteilen geschaut hatte, und ich vernahm alles, alles, was nur je ein Mensch getan, gesprochen oder auch nur gedacht hat!
Und wozu tatest du das alles? Um aus mir einen Menschen zu machen, einen wirklichen, echten Menschen, wie du fortwährend betontest, auf dass ich als solch ein echter Mensch, für den es nichts Fremdes mehr gibt, meinen armen, von der Sünde, welche Blindheit und Tod ist, geplagten Mitmenschen helfen könne, sie aus ihrer Knechtschaft zum Lichte der freien Sonne empor zu führen, welche die Wahrheit ist!«
Eine Pause. Das verklärte Lächeln erstarb vollends, nur die schmerzliche Wehmut blieb in den männlich schönen Zügen des Grafen zurück, und tief sank sein schwarzlockiges Haupt auf die Brust.
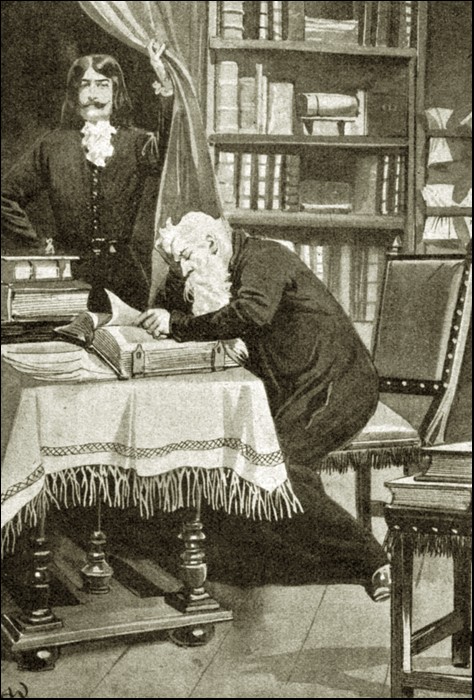
»Zur Wahrheit, welche allein diese Erde in ein Paradies verhandeln kann. Den Weg dazu, den ich die Menschheit führen sollte, hattest du nur deutlich genug vorgeschrieben. Du starbst. Und ich — wohl hatte ich dasselbe edle Ziel vor Augen, habe es noch immer, aber ich wollte meine eigenen Wege gehen, wollte klüger sein als du. Edler, weiser Mann, auch du warst doch nur ein irdischer Mensch gleich mir. So hattest auch du einen großen, großen Fehler in meiner Erziehung begangen. Du hättest mich nicht erst in die weite Welt schicken, mich unter sachgemäßer Führung die Menschen kennen lernen lassen sollen. Die Menschen in ihrer ganzen Jämmerlichkeit! Diesen jämmerlichen Menschen als ein edler Apostel zu kommen, um sie die Wahrheit zu lehren, als ein zweiter Heiland, den sie ganz sicher ebenso wieder ans Kreuz schlagen würden — — kreuzige, kreuzige ihn, den Gott der Liebe, und ihn, den verruchten Mörder, gib uns frei — — hahahaha...«
Nach diesem bitteren, furchtbar höhnischen Lachen warf der Graf in stolzem Trotz den Kopf zurück.
»Ja, mein Ziel ist noch dasselbe edle, ich will die Menschheit bis zu den höchsten Stufen führen, zu denen sie fähig ist, aber nicht durch Verkünden der ungeschminkten Wahrheit ist dies möglich — nie und nimmer!! — — die Welt will betrogen sein und sie muss betrogen werden, will man etwas erreichen — so ist es von jeher gewesen, und so wird es immer, immer bleiben — — wohlan, nur aus den edelsten Motiven habe ich den Weg des Luges und Betruges betreten, und nun schreite ich diesen Weg auch fort!!!«
Mit einer schnellen Bewegung zog der Graf an der Schnur, hinter dem Vorhang verschwand die Figur.
Der Graf nahm seine Wanderung in der Bibliothek wieder auf.
»Und doch, schön war es! Er, der die Herzen der Menschen wie kein zweiter kannte, wusste ja auch, wie es mit mir Jüngling stand, was für ein heißes Blut durch meine Adern rollte. Er selbst forderte mich auf, mich nächtlicherweile manchmal unter Menschen zu begeben, machte noch viel stärkere Andeutungen. Alles andere fand sich von ganz allein. Bei solch einem nächtlichen Ausfluge, als Rom ein Volksfest feierte, sah ich sie, sie! Sie passte zu mir wie — wie — wie eben solch eine ungebildete Tochter des Volkes zu einem Manne der Welt und Wissenschaft, zu dem ich systematisch ausgebildet worden war. Und doch, wie herrlich passten wir zueinander und passen noch zusammen, eben indem wir uns gegenseitig ergänzen. Ach, was für eine glückliche Zeit war das, wenn ich wöchentlich mindestens einmal von hier schlich, meinen Weg durch den Garten oder durchs Wasser nehmend, als armer Skribent nach Hause kam, wie sie sich freute, und als sie mir dann ihr süßes Geheimnis ins Ohr flüsterte... ach, dann kam das Kind!!«
Plötzlich ganz gebrochen, sank er mit diesen letzten Worten auf einem Stuhle zusammen.
»Der Fluch der Sünde, der Fluch der Lüge!«, erklang es noch einmal in demselben furchtbaren Schmerze. »Anderen Menschen will ich helfen können und kann nicht einmal meinem eigenen — ach, so über alles geliebten Kinde helfen!!«
Doch nicht lange, so erhob er sich und war wieder ganz gefasst.
»Wohlan, an diesem meinem unglücklichen Kinde habe ich im Voraus bereits alles, alles gebüßt, was ich an der Menschheit noch sündigen werde — ihr nur zum Segen. So betrachte ich dies als einen Fluch, den ich für die ganze Menschheit auf mein eigenes Haupt nehme. Aber Marietta will ich davon befreien — durch Täuschung. Nur so, wie ich es ursprünglich geplant hatte, kann ich es doch nicht machen.
Es lässt sich auf die Dauer nicht durchführen, dass ich für die ganze Dienerschaft und womöglich auch für die Außenwelt bald als der Graf von Saint-Germain, bald als der Skribent Antonio auftrete. Nur Marietta gegenüber kann ich diese Rolle durchführen, das ist mir möglich. Freilich muss sie dadurch auch viel entbehren, aber ihr Glück wird sie für alles entschädigen, und dann kann auch ich...«
Ein schrilles Klingeln unterbrach seinen Gedankengang, in Worte gekleidet, und dieses Klingeln konnte von nichts anderem herrühren als von einem elektrischen Läutewerk, wie man ein solches damals freilich noch nicht kannte, und der Graf hütete sich, an der Oberwelt etwas von seinen vorzeitigen Erfindungen zu verraten.
»Die Klinke des Sanktuariums wird niederzudrücken versucht! Sollte das schon Marietta sein? Nein, erst wird Joseph mit ihrem Bescheid zurückkommen. Und wenn sie es auch schon selbst mit dem Kinde wäre, es ist alles zu ihrem Empfange bereit.«
Der Graf war wieder in jene Kammer geeilt, stand mit einem Sprunge auf dem Schreibtisch, sofort begann dieser in die Höhe zu gehen, bis er in dem Sanktuarium wieder an der alten Stelle stand.
An der Tür wurde stark gepocht.
»Wer ist da?«
»Joseph.«
Der Graf öffnete die schwere, eisenbeschlagene Tür, wozu er selbst keinen Schlüssel brauchte, und... fast hätte er seine Selbstbeherrschung verloren, wäre zurückgeprallt.
Denn dass Marietta gleich mitgekommen war, in solcher Schnelligkeit, schon hier vor der Türe stand, mit ihrem Kinde, das hätte er denn doch nicht erwartet, und nun kam noch dazu, dass sie schon wieder Miene machte, vor ihm auf die Knie zu sinken und ihm als zweitem Heiland mit flehender Gebärde das arme Kind entgegenzuhalten.
Doch schnell hatte er sich wieder aufgerafft.
»Kommt hier herein! Ihr allein!«
Er schloss wieder die Tür vor dem ausgesperrten Joseph, führte sie in das erleuchtete Abteil, machte durch Zurückziehen eines Vorhanges mehr Licht.
»Setzt Euch dorthin!«
Die schöne junge Frau gehorchte, ließ sich auf den Diwan nieder, auf der äußersten Kante, ihr in ein Tuch gewickeltes Kind im Arm, selbst wie ein hilfloses Kind sich benehmend, gar nicht recht bei Besinnung.
Und das war begreiflich. Abgesehen von alledem, was ihr jetzt bevorstand, weshalb sie hierher gerufen worden, befand sie sich doch auch vor dem Manne, gegen dessen zauberhaften Nimbus schon das päpstliche Ansehen verblasst war, und dieses Zusammensein hier in diesem fensterlosen Raume, in dem der schwarze Samt vorherrschte, war doch etwas ganz anderes, als gestern in ihrem eigenen, freundlichen Häuschen.
Während sie so ganz hilflos dasaß, wanderte der Graf einige Male sinnend auf und ab, um dann mit einem Rucke vor ihr, vor seiner eigenen Frau, stehen zu bleiben.
»Über das Kind haben wir schon gesprochen«, begann er. »Ihr habt mir alles ganz ausführlich erzählt, ich habe es mir genau besehen, ich habe seitdem angestrengt darüber nachgedacht, und jetzt darf ich Euch die gewisse Versicherung geben, dass ich Euer Kind von allen seinen Gebrechen heilen kann... was wollt Ihr?«
Was sie wollte, konnte er auch noch fragen!
Sie vermochte nicht mehr, als ein ›Herr, Herr!‹ zu lispeln, suchte seine Hand zu erhaschen, um sie an ihre Lippen zu ziehen.
Er wehrte ihr, entzog ihr schnell die Hand.
»Halt! Ja, Euer Kind kann ich heilen, aber... alles in der Welt geschieht unter Bedingungen, alles! Was für Lebens- und Schicksalsgesetze hier vorliegen, also auch Gesetze, denen auch das Schicksal — oder mag man gleich Gott sagen — unterworfen ist, das kann ich Euch nicht erklären, Ihr würdet mich gar nicht verstehen. Oder ein Beispiel: Fünferlei steht Euch zu wählen frei: Reichtum, oder Schönheit, oder Gesundheit, oder Glück, oder Weisheit. Nun wählt. Aber nur eins von diesen fünfen könnt Ihr wählen, und habt Ihr dieses eine, so werdet Ihr alle vier anderen Güter nie gewinnen oder verlieren, wenn Ihr sie schon hättet. Nun wählt unter den fünfen!«
Genau dasselbe hatte der Graf zu der mexikanischen Fürstin gesagt, und wir werden es noch öfters von ihm hören. Diese Lehre vom Verzichten auf alles andere, um nur das Eine in voller Größe zu gewinnen, war ein Lieblingsthema von ihm.
Die Fürstin hatte schnell eine Wahl getroffen — die Schönheit, diese Wahl ganz originell begründend — diese arme Frau aus dem Volke hier war nicht so schnell fertig mit ihrer Wahl, sie wählte überhaupt nicht, wohl aber hatte auch sie sofort eine Antwort.
»Mein Kind möchte ich gesund haben«, sagte sie einfach, aber mit welchem Augenaufschlag!
Über das Gesicht des Grafen, des Vaters dieses Kindes, ging ein kurzes Zucken. Denn er war wohl der richtigste Mann, der diese Antwort und diesen Augenausschlag zu würdigen wusste.
Aber er war zunächst mit dieser Antwort nicht ganz zufrieden.
»Die normale Gesundheit dieses Kindes braucht durchaus noch nicht Euer eigenes Glück zu bedeuten, so wenig wie Eure eigene Gesundheit...«
»Schlagt mich mit allen Krankheiten, die es gibt, nur macht mein Kind so wie andere Kinder!«, erklang es wiederum in rührendem Tone.
»Aber Ihr braucht dadurch noch nicht selbst glücklich zu werden, Ihr könnt in anderer Weise vom schwersten Unglück...«
»Herr, macht mein Kind gesund, macht nur mein Kind gesund!!«, erklang es nach wie vor.
Da hatte der Graf keine Einwendungen mehr zu machen, wenigstens nicht in dieser Hinsicht.
»Wohlan! Ich will das Kind heilen. Und trotzdem bleibt der ewige Grundsatz bestehen! Wenn Ihr etwas Begehrenswertes haben wollt, so müsst Ihr etwas lassen, was Ihr bereits besitzt.«
»Herr, fordert von mir, was ihr wollt — nur macht mein Kind gesund!«
»Wohlan! Ihr seid gewiss nicht reich, aber Ihr habt wahrscheinlich auch noch keine Not gelitten. Wie?«
Die arme Mutter wusste hierfür sofort die beste Antwort.
»Herr, nehmt mir alles, was ich besitze, ich will Zeit meines Lebens betteln gehen — nur macht mein Kind gesund!«
»Denkt Euer Mann ebenso?«, fragte der Graf ungerührt.
»Ja, edler Herr, ja!!«, erklang es aus tiefstem Herzensgrunde.
Ein schluchzender Laut aus des Grafen, aus des eigenen Vaters Brust, weiter nichts.
»Ihr seid glücklich — Ihr führt sonst ein glückliches Leben, wie man es so nennt, nicht wahr?«
»Ja, ich bin glücklich!«
Aber wie das nun hervorgebracht worden war, mit diesem unsäglichen Schmerze dazwischen!
»Trotz dieses Kindes seid Ihr glücklich«, fuhr der Graf unbarmherzig fort.
»Ja, trotz dieses armen Kindes war und bin ich glücklich.«
»Und ebenso Euer Mann?«
»Ja, edler Herr, auch Antonio ist trotzdem glücklich!«
»Ihr liebt euch?«
»Ich liebe ihn, und er liebt mich, und eben deswegen waren und sind wir zusammen glücklich, trotz alledem und alledem!«
Der Graf kreuzte die Arme über der Brust, und plötzlich nahmen seine Züge etwas Mephistophelisches an, wie er auf die Sitzende herabblickte, die am liebsten vor ihm niedergekniet wäre.
»Wohlan! Aber ein Opfer müsst Ihr dennoch bringen, das Gesetz des Schicksals verlangt es.«
»Fordert, edler Herr, fordert alles, was Ihr wollt.«
»Alles?«
»Alles, alles!«
»Auch Eure Ehre darf ich fordern?«, fragte der Graf langsam.
»Ehre?«
Verwundert blickten die tränenumflorten Augen zu ihm empor, und dass sie überhaupt etwas begriffen hatte, ging höchstens daraus hervor, dass sie in ihren Bewegungen plötzlich innehielt.
»Ehre? O, edler Herr Graf, ich gehöre zu dem armen Volke, dem man kein Ehrenwort abfordert, wir müssen immer gleich schwören...«
»Machen wir keine Redensarten mehr«, unterbrach sie der Graf, und plötzlich wurde seine Stimme ganz heiser. »Umsonst ist der Tod. Auch bei mir das Leben, die Gesundheit. Ja, ich will Euer Kind gehend, hörend und sprechend machen, ganz gesund, wenn... Ihr mir zu Willen seid. Und das noch heute, jetzt! Das habt Ihr doch wohl verstanden, das war doch deutlich genug gesprochen. Liebt Ihr Euer Kind wirklich, so werdet Ihr dieses Opfer bringen, Eure Ehre. Ich gebe Euch zehn Minuten Bedenkzeit, dann verlange ich ein bündiges Ja oder Nein. Ich begebe mich hier in das Nebenabteil. Ruft mich, wenn Ihr Euren Entschluss gefasst habt, in spätestens zehn Minuten!«
Ganz erstarrt waren die Augen des schönen, jungen Weibes, einer echten Mater dolorosa, und so erstarrt folgten ihm auch die Augen, als er hinter der Portiere verschwand.
Hier, in dem nächsten Abteil, ging der Graf geräuschlos auf und ab, und furchtbar arbeitete seine Brust, sein edles Antlitz war gar nicht wiederzuerkennen, so hatte es sich verzerrt.
»O, was für ein Mensch bin ich!! Ja, bin ich denn nur wirklich ein normaler Mensch? Ich verstehe selbst nicht, was manchmal in mir vorgeht! Dieses arme Weib, meine unschuldige Marietta, die ich über alles liebe, so furchtbar, furchtbar zu martern! Und warum nur das alles? Mir kommt es durchaus nicht darauf an, ihre Treue zu prüfen, denn diese ist über jeden Zweifel erhaben. Nein, aus reinem Vergnügen! Aber was für ein furchtbares Vergnügen ist das! Nur um mich selbst zu martern, um mich grausam ins eigene Fleisch zu schneiden, mein eigener Schmerz bereitet mir Wollust! O, was für ein schrecklicher Mensch bin ich! Ich bin mir selbst ein Rätsel.«
Der Graf, in Wirklichkeit die Güte selbst, der kein Tier leiden sehen konnte, hatte sich einmal ein eigenes Zeugnis über seinen Charakter ausgestellt, das von keinem fremden Urteil übertroffen werden kann.
Ja, die Selbstpeinigung machte ihm ein grausames Vergnügen.
Er war mit diesem kurzen Selbstgespräch kaum fertig, als sein Name gerufen wurde.
Er begab sich wieder hinüber, und war ganz verblüfft, als ihm die schöne, junge Frau entgegentrat, zwar noch Tränen im Auge, aber sonst heiter, lächelnden Angesichts.
»Nun?«, fragte der Graf hart.
»Ich glaube es nicht«, erklang es unter dieser Verklärung.
»Was glaubt Ihr nicht? Ja oder nein!«
Aber die Verklärung schwand unter dem rauen Tone nicht, sie trat nur noch mehr hervor.
»Nein, ich glaube Euch nicht, edler Herr, dass Ihr im Ernste so etwas von mir fordern könnt. Ihr wollt mich nur prüfen, ob ich auch wert bin, dass mein Kind gesund wird. Denn wenn Ihr so etwas im Ernste von mir fordertet, dann wäret Ihr gar nicht imstande, so etwas auszuführen. Gold könntet Ihr dann vielleicht machen, auch andere Sachen, die mit Hilfe des Teufels möglich sind, aber Ihr könntet niemals ein unglückliches, unschuldiges Kind heilen, das ist nur mit Gottes Hilfe möglich — und überhaupt, ich weiß auch so, dass Ihr mich nur prüfen wollt, Ihr seid ein viel zu edler Mann, ich sehe es Euch gleich an — oder ich glaube es doch, nein, ich weiß es — denn ich glaube an Euch, ich glaube, glaube, glaube!«
So erklang es von den schönen Lippen der jungen Frau, die wie eine in heiterem Lächeln verklärte Heilige aussah, alles Schmerzliche war jetzt von ihr gewichen — und da plötzlich war es auch mit dem Grafen vorbei. Dass er sie in seine Arme schloss, konnte er noch verhindern, aber nicht, dass auch ihm plötzlich Tränen entstürzten.
»Weib«, schluchzte er, »dein Glaube hat dir...«
Erschrocken brach er ab.
... hat dir geholfen, hatte er sagen wollen und das wären die Worte des Heilands gewesen.
»Dein Glaube hat dich nicht betrogen! Ja, ich wollte dich nur prüfen, und du hast die Prüfung herrlich bestanden — durch deinen Glauben. Nein, nein, ganz ferne liegt mir, irgend etwas zu fordern — und dein Kind werde ich gesund machen.«
Jetzt erst brach bei Marietta der wirkliche Jubel aus, sie wollte sich vor ihm auf die Knie werfen, er musste es mit sanfter Gewalt verhindern.
»Setz dich her zu mir! Wir haben doch noch ein ernstes Wort zusammen zu reden. Es ist wirklich ein ewiges Weltgesetz, dass der Mensch nichts erreichen kann, ohne etwas anderes dafür zu verlieren. Hast du schon etwas von deinem Gatten gehört?«
Nein, sie hatte noch keine Kunde von ihm bekommen.
»So lass dir etwas mitteilen. Aber du brauchst nicht gleich so zu erschrecken, es ist im Grunde genommen gar nicht so schlimm. Dein Mann befindet sich bereits hier.«
»Bereits hier?!«, fuhr sie halb jubelnd halb erschrocken empor.
»In dieser Nacht ist er heimlich zu mir gekommen, als... ein verfolgter Flüchtling. Lass dir erzählen. Du weißt doch, dass der Kirchenstaat mit Österreich Konflikte hat. Es kann vielleicht zum Kriege kommen. Dein Gatte stand nun schon längst im Verdachte, ein österreichischer Spion zu sein — ganz unschuldigerweise. Gestern Abend wurde er auf der Landstraße von einer päpstlichen Wache angehalten, die sich nicht gleich zu erkennen gab, Antonio hielt sie für Wegelagerer, er glaubte sich seines Lebens wehren zu müssen...«
»Heilige Jungfrau, er hat doch keinen getötet?!«, rief Marietta entsetzt.
»Nein, so weit kam es nicht, nur zu einem Handgemenge, bis er seinen Irrtum erkannte. Zwei niedergeschlagen aber hatte er doch schon. Und das Unglücklichste für ihn war, dass er von einem Offizier, der in der Campagna stationiert ist, einen nach Österreich adressierten Brief mitbekommen hatte. Der wurde sofort erbrochen, enthielt tatsächlich verräterische Geheimnisse. In Anbetracht alles dessen zog es Antonio vor — meiner Ansicht nach auch ganz richtig — seinen Wächtern zu entspringen, und er tat das Klügste, was er tun konnte, als er sich gleich zu mir begab, und es gelang ihm, ganz unbemerkt hier ins Kloster hereinzukommen.«
Händeringend saß die junge Frau in stummer Verzweiflung da. Hätte der Graf gewusst, dass dieses Märlein sie so in Schrecken versetzte, so hätte er ein noch harmloseres ersonnen.
»O, was wird nun aus ihm werden?!«
»Es ist gar nicht so schlimm«, kam sein Trost jetzt nachträglich. »Die Hauptsache ist, dass Antonio unschuldig ist, er muss sich nur versteckt halten, bei mir hier ist er am sichersten, und ich werde alles schon wieder in Ordnung bringen.«
Das wirkte, ihr Vertrauen zu ihm war grenzenlos, sie war sofort wieder ganz ruhig.
»Bei Euch ist noch keine Wache gewesen, hat etwa Haussuchung gehalten?«
Natürlich nicht.
»Die Sache wird jedenfalls auch gar nicht der Öffentlichkeit preisgegeben werden. Ihr seid zu mir gekommen, dass ich Euer Kind heile, das ist ja in Eurer Nachbarschaft schon bekannt, es ist dazu nötig, dass Ihr hier bleibt, und im Übrigen überlasst nur alles mir, ich werde schon mit allem fertig. In der Öffentlichkeit dürft Ihr und Antonio euch allerdings nicht sehen lassen, ihr müsst hier ganz verborgen leben.«
»Und auch Antonio ist hier?«
»Kommt, er wartet schon sehnsüchtig auf seine liebe Marietta, und mein Sekretär bleibt er trotz alledem.«
Wer war glücklicher als die junge Mutter, die ja auch immer in der Nähe ihres Kindes bleiben sollte! Diesmal benutzte der Graf nicht den Schreibtisch als Fahrstuhl, sondern er öffnete, ohne Vorsicht vor Marietta, die Tür hinter dem Vorhang, beide stiegen die Treppe hinab.
Und auch diese finstere Treppe musste verschiedene Ausgänge haben, denn diesmal kamen sie nicht zuerst in die Bibliothek, sondern sie mussten einen längeren Gang passieren, und in den Raum, denn sie dann betraten, fiel helles Morgenlicht, schien sogar die freundliche Morgensonne.
Auch sonst sah es in diesem tiefen Kellergewölbe ganz freundlich und behaglich aus. Es war sehr hübsch, wenn auch sehr altertümlich möbliert, nichts war darin zu vermissen, auch nicht ein breites Himmelbett.
Das Licht drang durch ein stark vergittertes Fensterchen, durch das man den von Kähnen belebten Tiber überblicken konnte. Der Wasserspiegel befand sich noch in beträchtlicher Tiefe unter diesem Fenster.
Demnach befanden sie sich auch noch im ersten Keller, wie diesmal der Graf auch nicht so tief hinabgestiegen war. Jedenfalls hatte der Fuchs hier die verschiedensten Ein- und Ausgänge, das ganze Kloster musste labyrinthisch unterbaut sein.
»Wirst du hier einige Zeit leben können?«, lächelte der Graf. »Dieses Zimmer liegt zwar schon unter der Erde, aber das gilt nur für die Straßenseite. Der Strom liegt ja sehr tief, und du hast durch diese Fenster Früh, Mittags- und Abendsonne.«
»Ob ich hier leben kann, wenn ich Antonio und mein Kind hier habe! Für immer, für immer! Aber können wir durch das Fenster nicht gesehen werden? Wenn nun ein Boot landet, jemand hier hereinblickt?«
»Das ist nicht so einfach. Da müsste von einem Boote aus schon eine sehr lange Leiter angelegt werden, und ganz dicht heran kann gar kein Boot. Auch beim stärksten Hochwasser ist der Strom hier an der Mauer sehr seicht, sonst ist daran ein schmaler Landvorsprung, der als Scherbenablagerungsstätte des Klosters von jeher gedient hat, und ich habe dafür schon gesorgt, dass neue Scherben hinzugekommen sind. Jede Katze würde auf diesen Glas- und Porzellanscherben ein großes Geräusch verursachen, und Antonio ist bereits instruiert, er wird es an der nötigen Vorsicht nicht fehlen lassen.«
»Und wo ist Antonio jetzt?«
»Bereits als mein Sekretär bei der Arbeit. Ich gehe, ihn zu holen. Das Kind wird er doch erst noch einmal sehen wollen, dann aber musst du es mir geben.«
»Euch geben?!«
»Marietta, ich bin kein Heiland, der das Kind nur anzurühren braucht, und es ist gesund. Ich muss es in eine besondere Behandlung nehmen, es muss ganz dicht mit Bandagen umwickelt werden, es muss ganz allein in einem anderen Raume liegen. Aber jeden Tag sollst du es einige Male zu sehen bekommen und wirst erleben, wie es nach und nach zu sprachen beginnt, auch zu hören und zu sehen, wie es sich überhaupt mit der Zeit verändert. Genügt dir täglich solch ein mehrmaliger Besuch?«
Und ob es der Mutter genügte!
»So hole ich jetzt Antonio.«
Der Graf ging und kam nach wenigen Minuten als der Skribent Antonio wieder.
Jauchzend fiel ihm die junge Frau in die Arme.
Nicht das geringste Misstrauen stieg in ihr auf — —
So hatte der Graf seine Doppelrolle nur noch unter der Erde zu spielen, und da er sich für die nächste Zeit fast ganz in sein Sanktuarium zurückzog, brauchte Marietta nicht zu klagen, dass ihr Gatte sie vernachlässigte. Sie glaubte, auch Antonio würde im Geheimen hier im Keller mit schriftlichen Arbeiten beschäftigt, und zu seiner Umwandlung bedurfte der Graf immer nur zweier Minuten.
In der Öffentlichkeit, besonders in Baja, konnte das Verschwinden der Skribentenfrau mit ihrem Kinde nicht auffallen. Man wusste ja, dass der Graf ihr Kind heilen wollte, er hatte sie doch selbst noch vor der verabredeten Zeit holen lassen. Sie befand sich zur Behandlung ihres Kindes bei ihm. Um Antonio selbst kümmerte man sich nicht, seine lange Abwesenheit war man ja gewohnt.
Dasselbe galt auch für die Dienerschaft des Klosters. Die machten sich ebenso wenig Kopfschmerzen darüber, was die fremde Frau in dem Sanktuarium oder wo sie nun sonst untergebracht worden war, triebe.
Merkwürdig war dabei nur, dass niemand den Verdacht aussprach, der Graf könne mit ihr ein unerlaubtes Verhältnis unterhalten. Doch die Gründe für diese Vertrauensseligkeit sind schon früher ausgeführt worden.
Der Verwandlungskünstler trat als Antonio auf, als er Marietta zum ersten Male zu ihrem Kinde führte, das er als Graf und Wunderdoktor bereits in Behandlung hatte.
Sie mussten einen längeren, finsteren Weg gehen, dann betraten sie einen kleinen, spärlich beleuchteten Raum, in dem Pepita in einem Bettchen lag.
Das verkrüppelte Kind war vollkommen in Bandagen gewickelt, auch die Hände, die Augen verbunden, von dem Gesicht war nur die Nase freigelassen und eine kleine Öffnung für den Mund.
Es wachte, verhielt sich aber ganz teilnahmslos.
»Keine sechs Wochen, dann ist es völlig hergestellt«, versicherte Antonio im Namen des Grafen.
Dieser jungen Römerin hätte man ja noch etwas ganz anderes vormachen können.
»Dann kann sie sehen?«
»Sehen und hören und sprechen und alles — der Graf versichert es aus das Bestimmteste. Das Sprechen muss Pepita natürlich erst nach und nach lernen, ebenso wie das Laufen.«
»Und die Finger?«, fragte die arme Mutter in glücklichster Schüchternheit.
»Die wachsen zusammen.«
»Und der Kopf?«
»Es wird alles, alles ganz normal, und sobald es so weit ist, kann es auch zu uns kommen, wir selbst lehren sie sprechen und laufen. Das wird schon in vier Wochen so weit sein. Jetzt aber muss Pepita noch ganz allein und still liegen, nur der Graf reicht ihr von Zeit zu Zeit Medizin und eine gewisse Nahrung.«
»Ach, Antonio, bin ich glücklich, bin ich grenzenlos glücklich!!«, jauchzte die junge Mutter, so laut sie es hier durfte. »Ach, mein Antonio, wie sollen wir das nur diesem edlen Grafen danken!«
Antonio sagte nichts, er machte eine Gebärde des Stillschweigens, führte Marietta in den gemeinschaftlichen Wohnraum zurück und durchschritt abermals einen langen Gang, aber nach der entgegengesetzten Richtung.
Wieder war es ein mit altertümlichen Möbeln freundlich eingerichtetes Zimmer, welches er betrat, in einem Bettchen lag wiederum ein Kind, aber nicht in Bandagen gewickelt, nur durch die Erschütterung des Bodens hatte es vernommen, dass sich jemand nähere, und trotz der erloschenen oder überhaupt gar nicht vorhandenen Augensterne wusste es doch sofort, wer sich näherte, zwei dürre Ärmchen mit verkrüppelten Fingerchen streckten sich dem Kommenden entgegen.
»Papapapapa«, lallte eine unbeholfene Zunge.
Und an diesem Bettchen benahm sich Antonio ganz anders, hier kniete er nieder, umschlang das arme Kind und versicherte es unter tausend heißen Tränen seiner Vaterliebe, die der kleinen Pepita auch die verlorene Mutter ersetzen solle.
Zwei Monate waren vergangen, seitdem der rätselhafte Graf seinen Zinksarg verlassen hatte. Was ist die Zeit? Komische Frage! Und doch — ein leeres Wort.
Schon die ältesten Philosophen, besonders die indischen, haben es behauptet, Emanuel Kant hat es zum ersten Male deutlicher erklärt, Artur Schopenhauer, Kants größter Schüler, hat es weiter ausgeführt: nämlich dass es überhaupt gar keine Vergangenheit und Zukunft gibt, sondern allein eine ewige Gegenwart, ein ewiges Jetzt. Das, was wir Vergangenheit und Zukunft nennen, ist eine Täuschung. Auch was vor Tausenden von Jahren passiert ist, passiert in Wirklichkeit eben jetzt in diesem Augenblick, wie auch das, was scheinbar erst in Tausenden von Jahren passieren wird. Die Endlosigkeit der Zeit haben wir Menschen uns nur gemacht, ebenso wie die des Raumes, weil wir die Täuschung nicht begreifen können.
So lehren diese Geister. Wer es fassen kann, der fasse es. Und wer es nicht fassen kann, der wolle deshalb nicht gleich diese Geister verspotten, die nichts von Vergangenheit und Zukunft wissen wollen, deren Existenz einfach abstreiten. Es gibt schon Geister, welche etwas mehr Erkenntnis haben als die übrigen Millionen von Herdenmenschen. Wolle man doch auch bedenken, dass dieser selbe Emanuel Kant, dieser alte, vertrocknete Bücherwurm, der nie aus den Mauern Königsbergs herausgekommen ist, für die südamerikanischen Gewässer Navigationstafeln entworfen hat, Windbestimmungen, nach denen sich die Segelschiffe noch heute richten.
Übrigens hat auch unsereins in seinem beschränkten Kopfe manchmal helle Augenblicke, da man plötzlich ahnt, dass an dieser großen Welttäuschung, von den Indern Maja genannt, wirklich etwas sein muss. Dass diese Maja nur einmal den Schleier zu lüften brauchte, und wir würden erkennen, dass wir geblendete Narren sind! Ja, für diese Täuschung über Vergangenheit und Zukunft gibt es auch ein ganz reelles Beispiel. Wir kennen Fixsterne, deren Licht Tausende von Jahren braucht, ehe es nach unserer Erde gelangt. Solch ein Stern kann also schon vor Tausenden von Jahren zugrunde gegangen sein, existiert gar nicht mehr, und wir sehen ihn doch noch immer am Himmel stehen.
Nun, lassen wir das — vorläufig wissen wir recht gut, was der Lauf der Zeit zu bedeuten hat. Die sich grau färbenden Haare und die Schmerzen der mürbe werdenden Zähne sind ja auch recht gute Realitäten.
Und dennoch, da gibt es wieder etwas, wodurch man fast zu dem Glauben kommt, dass nur wir Menschen selbst das Schwungrad der Zeit schneller treiben oder bremsen können.
Was hat heute die Entfernung Berlin—Rom zu bedeuten! Mit dem Blitzzuge ist man in zwei Tagen dort. Durch Telegramm kann man eine Botschaft in nur wenigen Stunden übermitteln, und die Stunden kommen nur durch Umschaltungen auf den Zwischenstationen, wo die Depeschen der Reihe nach befördert werden, auch die Eildepeschen — mit Ausnahme der diplomatischen und überhaupt staatlichen, die allen vorangehen, da wird die ganze Linie gesperrt, die Schaltungen sind bereits hergestellt, denn solch eine Depesche darf nicht mitgelesen werden, und die in Berlin ausgegebene Depesche hat der deutsche Botschafter in Rom unter Umständen schon fünf Minuten später in Händen.
Nun aber damals! Da brauchten Briefe und Passagiere drei Wochen, um von Berlin nach Rom zu kommen, und das war sogar Extrapost. Und was jetzt der Telegraf ist, das war damals der Depeschenreiter, von Regierungen ausgesandt, von großen Kaufmannsgesellschaften, von Privatpersonen, die aber über einen entsprechenden Geldsack verfügen mussten, um sich so etwas leisten zu können.
Der Depeschenreiter! — Was für eine Romantik steigt empor, wenn man diesen Namen hört — wenigstens für die geistigen Augen desjenigen, der schon etwas mehr davon gehört hat!
Ja, der Pfiff der ersten Lokomotive bedeutete das Todessignal für eine Kategorie von Männern, abenteuerlichen Helden, von denen wir uns heute nicht einmal mehr träumen lassen, die wir total vergessen haben.
Es ist hierbei etwas recht Trauriges. Wir alle wohl, die wir jetzt Männer sind, haben einst als Knaben für die Helden der nordamerikanischen Wildnis geschwärmt, für den letzten Mohikaner und für die anderen roten Söhne des großen Geistes, ebenso auch für die weißen Trapper und Wildtöter und Wald- und Prärieläufer und Pfadfinder, haben mit ihnen alle Gefahren durchgemacht, sind mit ihnen auf dem Bauche gerutscht, haben skalpiert und sonst alles mitgemacht, was dazu gehört, und... sie war wirklich schön, diese Träumerei, angeregt durch sogenannte Indianerschmöker.
Aber hatten wir es denn nicht viel näher? Wozu denn erst nach Amerika gehen, um solche ›Helden‹ zu finden? Ha, diese europäischen Depeschenreiter, was waren das erst für Kerls! Denen, die in Wirklichkeit existierten, konnten doch alle jene zum größten Teile nur erdichteten Rothäute und Blassgesichter des wilden Westens Nordamerikas nicht das Wasser reichen, was auch Jugendschriftsteller und ernstere aus ihnen zu machen versuchten und noch versuchen.
Also das Bedürfnis, wichtige Mitteilungen schnellstens auszutauschen, ist doch von jeher vorhanden gewesen, und früher vielleicht sogar in noch stärkerem Maßstabe als heute. Die Verhältnisse waren so ganz anders. Damals war der absolute Monarchismus noch weit größer, mochte er auch an irgendwelche Gesetze gebunden sein, die Presse hatte noch keine Macht, das Volk durfte doch gar nicht wagen, eine Veröffentlichung der diplomatischen Verhandlungen zu fordern, da ging also alles viel, viel geheimer zu. Die Landesfürsten tauschten die wichtigsten Mitteilungen nur unter sich aus, zogen nicht einmal erst ihre Minister zu Rate — und was für diplomatische und private Intrigen mögen da gesponnen worden sein, von denen die Weltgeschichte gar nichts erfahren hat!
Wie aber sollten sie solche Botschaften übermitteln? Das konnte doch nur durch Personen geschehen, welche die Briefe überbrachten, durch Personen, denen man absolut vertrauen konnte und welche die nötigen Fähigkeiten dazu besaßen, sie schnellstens zu besorgen.
Ebensolche Personen benötigte auch, und nicht viel weniger, die Kaufmannschaft, die damals, als es noch keinen Telegrafen und keine Eisenbahn gab, verhältnismäßig doch auf keiner geringeren Höhe stand als jetzt. Man denke nur an das Haus Rothschild — von Mayer Anselm allerdings erst am Ende des 18. Jahrhundert gegründet — oder man denke noch besser an die Fuggers, deren Reichtum und sonstige Geldmacht, mit der sie die ganze Welt beherrschten, heute überhaupt kaum noch ein gleichartiges Beispiel hat. Eben jetzt höchstens die Rothschilds, ohne die, wenn sie nicht wollen, wohl schwerlich ein Krieg geführt werden kann. Wenn die Gebrüder Rothschild nicht freiwillig KnöppaufdenBeutel machen, ist Russland heute bankrott, und andere Staaten sind es ebenfalls.
Und da gab es doch noch andere solche Geldfirmen, deren Fäden durch die ganze Welt liefen, die an diesen Fäden die ganze Welt tanzen ließen, und da gab es die städtischen Kaufmannsgesellschaften, die Hamburger und die Bremer und die Nürnberger und so weiter und so weiter, um nur von den deutschen zu sprechen.
Diese Handelshäuser, einzeln oder vereint, spekulierten doch, damals genau schon so, wie sie es noch heute tun und wie es schon die alten römischen und griechischen Kaufleute getan haben und jedenfalls auch schon die phönizischen. Gibt es in diesem oder jenem Lande Krieg oder Frieden — das war und ist immer die Hauptsache — was kostet heute der Speck, und was wird er morgen kosten, Hausse oder Baisse. Und schlägt der ganze Zentner irgendeiner Ware auch nur um einen Silbergroschen aus, so sind gleich einige Millionen Taler verdient... oder verloren.
Heute wird das durch den Telegrafen abgemacht. Damals gab es nur den Depeschenreiter. Und was für Kerls das nun waren, denen man solch eine wichtige Botschaft anvertraute, das kann sich der geneigte Leser, wenn er die damaligen Kommunikationsverhältnisse in Betracht zieht, wohl selbst ausmalen.
Vor allen Dingen musste es ein Mann sein, auf dessen Treue man sich felsenfest verlassen konnte, von dem man wusste, dass er gegebenenfalls erst den ihm anvertrauten Brief vernichtete, ehe dieser in fremde Hände fiel, und dass er sich dann auch noch sengen und brennen und schinden ließ, sich lieber selbst die Zunge abbiss, ehe er das Geheimnis, das ihm doch immer etwas bekannt war, verriet.
Dann natürlich ein Kerl, der jeden Tag drei Pferde totreiten konnte, erhaben über Hunger und Durst und alle anderen menschlichen Schwächen, mehr ein Halbgott und noch mehr ein Teufel, mit allen Hunden gehetzt, ein Meister in allen Waffen, selbst ein Spürhund, der instinktiv jeden Weg fand, ohne ihn vorher schon zu kennen, mit demselben Instinkt das Gift oder den Betäubungstrank in dem Becher witternd, den man ihm reichte, andererseits einen ganzen Liter Branntwein samt dem darin enthaltenen Opium verschluckend, ohne dass ihm das besonders auf die Nerven schlug, und so weiter und so weiter.
Denn auf solch einen Depeschenreiter hatte es irgendeine Konkurrenz ja immer abgesehen, entweder ein anderer Landesfürst oder eine andere Kaufmannschaft. Bei kaufmännischen Sendungen gab es gewöhnlich einen Wettritt zwischen mehreren Depeschenreitern, dann war deswegen wieder eine andere Kategorie von Menschen entstanden, in den alten Chroniken gleich direkt Fanghunde genannt, die nur darauf eingeübt waren, solche Depeschenreiter abzufangen, sich ihrer Briefe zu bemächtigen.
Fürwahr, es lässt sich doch nicht so leicht klarmachen, was solch ein Mann alles leisten und ertragen musste. Indem es immer auf die höchste Schnelligkeit ankam, konnte auch nur immer ein einziger abgeschickt werden. Das war überhaupt das sicherste. Nun war aber doch nicht immer solch ein schnell begehrter Meldereiter zur Stelle.
Oder wir wollen annehmen, der russische Zar in Petersburg hatte dem spanischen König in Madrid etwas Wichtiges mitzuteilen, einen völkerstürzenden Plan, der ihm plötzlich eingefallen. Nun waren aber bloß Depeschenreiter vorhanden, die immer nur nach Osten gingen, oder nur bis nach Moskau, bis nach Warschau, nur zwischen diesen Linien jeden Weg und Steg kannten.
Gleichgültig, der Brief musste unbedingt fort!
Da wurde nun der genialste Teufel von der Bande ausgesucht — willst du, glaubst du's fertig zu bringen? — Ja, ich will — und fort nach Madrid, durch Länder, deren Sprache er gar nicht kannte, nicht die Sitten und Gebräuche der Einwohner — und dennoch ganz, ganz allein auf sich angewiesen, denn da konnte er nicht etwa einen Empfehlungsbrief an einen anderen Depeschenreiter mitbekommen, da gab es keine Art von Stafettenreitern — der Mann durfte sich ja keinem anderen Menschen anvertrauen, durfte keine Städte passieren, keine Brücke, immer im Freien geschlafen, immer auf der Jagd nach einem frischen Pferde, also auch immer als Pferdedieb verfolgt...
Dieser Depeschenritt eines einzelnen Mannes zwischen Petersburg und Madrid ist wohl das stärkste Beispiel, aber als Tatsache historisch zweimal zu beweisen, unter Peter dem Großen. Natürlich folgte dann noch eine andere, wohlausgerüstete Gesandtschaft mit derselben Botschaft nach, zu Lande oder zu Wasser, denn man wusste ja nicht, ob der Depeschenreiter auch wirklich sein Ziel erreichte. Es wurde aber riskiert, die Botschaft auf die damals schnellste Weise das Ziel erreichen zu lassen, durch einen Mann, von dem man wusste, dass er, wenn er seine Mission nicht erfüllen konnte, den ihm anvertrauten Brief noch rechtzeitig vernichtete. Übrigens hatten die Depeschenreiter schon von Stadt zu Stadt dieselben Fährlichkeiten zu erwarten, besonders durch die professionellen Fanghunde.
Was die Depeschenreiter für ihre Dienste bekamen? Nun, wahrscheinlich so viel, wie sie verlangten, wenn die Sache es wert war. Und wenn es sich bei kaufmännischen Geschäften um Millionen handelte, da konnte für so etwas doch auch bezahlt werden, und ebenso, wenn es sich bei Monarchen um Kriegspläne und dergleichen handelte.
Und was machten die Depeschenreiter mit den tausend Speziestalern, die sie manchmal an einem Tage verdienten, oder auch mit den zehntausend, wenn sie einen längeren Ritt über die Alpen hinter sich hatten? Sie machten es genau so, wie noch heute die amerikanischen Trapper, die Biberfänger es machen, wenn sie nach einem entbehrungsreichen, furchtbaren Winter mit ihren erbeuteten Fellen in die nächste Stadt kommen: Der so schrecklich sauer erworbene Verdienst wird so schnell wie möglich durch die Gurgel gejagt und in anderer Weise verlumpt, natürlich in Gesellschaft von Frauenzimmern, möglichst in einem einzigen Tage, und dann... hat die liebe Seele wieder Ruhe, dann geht es aus auf neuen Gelderwerb — so, wie es ja auch die Seeleute tun.
Merkwürdig ist, dass alle diese Depeschenreiter, welche in den alten Chroniken erwähnt werden — allerdings selten genug — deutschen Stammes waren! Oder auch nicht so merkwürdig. Der Deutsche hat ja immer ein so eigentümliches Blut in den Adern gehabt. Man denke an die Völkerwanderungen. Die Landsknechte, die sich unter fremden Fahnen in aller Welt schlugen, waren immer Deutsche. Noch heute sind die Handwerksburschen, die man mit dem Felleisen sogar in Afrika und Indien trifft, ausschließlich Deutsche, oder Österreicher, seltener Schweizer, was aber daran nichts ändert. Und wenn ein fremder Krieg ausbricht, so werden die fremden Offiziere, die sich der schwächeren Macht zur Verfügung stellen, immer nur deutsche Namen führen.
Es ist dies einesteils die Abenteuersucht — und zwar eine ideale, nicht die geldgierige, die hat der Spanier noch viel mehr — der fröhliche Wagemut des echt germanischen Blutes, gemischt mit einer starken Romantik, zweitens hat dies von jeher mit den feudalen Gesetzen des deutschen Adels zu tun gehabt, mit den Majoratserbschaften und dergleichen. Nur der Erstgeborene erbt alles, die andern Söhne müssen sehen, wo sie bleiben, und nicht für jeden kann von Staats wegen oder durch Protektion gesorgt werden, was anzunehmen auch nicht jedermanns Sache ist.
So ist es noch heute, so war es von jeher. Wir bleiben bei Anno dazumal. Was sollte solch ein durch Gesetz enterbter Spross eines edlen Hauses nun anfangen? Er hatte nichts weiter gelernt als Reiten, Fechten, Schießen und dergleichen Leibesübungen... und Geldverwichsen. Da nahmen sie eben mit Vorliebe fremde Kriegsdienste an oder sonstige Beschäftigungen, wo sie diese ihre Fähigkeiten, in denen sie auch gewöhnlich wirklich Meister waren, verwenden konnten. So rekrutierten sich fast alle diese Depeschenreiter, welche Jahrhunderte lang ganz Europa durchquerten, aus den Söhnen von deutschen Adelsfamilien, darunter die höchsten, sogar fürstliche Namen.
Da hatten sie ihren richtigen Beruf gefunden. Einige Zeit der furchtbarsten Strapazen, dann dafür die Tasche voll Gold bekommen, welches in einer Nacht verhauen wurde, bis... sie einmal auf irgendeine Weise aus dem Register der Lebenden gestrichen waren.
Wie kommt es nur, dass diese Kategorie von Menschen, die Jahrhunderte lang als das Muster von verwegenen Abenteurerhelden gegolten haben, so gänzlich vergessen worden sind, dass wir gar keinen Roman, gar keine Erzählungen über sie haben, während einige von ihnen zu ihrer Zeit doch dieselbe Rolle gespielt haben wie heute etwa ein Buffalo Bill?
Nun, wie für alles, so gibt es auch hierfür eine Erklärung.
Es hat doch auch schon seit Jahrhunderten in Amerika Indianerhäuptlinge und Waldläufer gegeben, aber niemand fiel es ein, sie zu verherrlichen. Da musste erst Fenimore Cooper kommen! Cooper hat mit seinem im Jahre 1826 erschienenen ›Letzten Mohikaner‹ die ganze Indianerliteratur, wie sie heute noch ist, erst ins Leben gesetzt. Bis dahin dachte kein Mensch daran, in solch einer amerikanischen Rothaut oder einem Blassgesicht einen Helden zu finden.
Weshalb sind denn die afrikanischen Negerstämme noch nicht verherrlicht worden? Die Zulukaffern zum Beispiel verdienten es sicher nicht minder als die ›edelsten‹ Rothäute, und die Hereros werden ihren amerikanischen Brüdern in Grausamkeit und sonstiger Menschenschinderei sicher nichts nachgeben, und dass sie sich verteidigen, das kann man ihnen doch wahrhaftig nicht verargen, und in Afrika gibt es sicher ebensolche Helden unter den blassgesichtigen Jägern. Diese Afrikaner haben eben ihren Cooper noch nicht gefunden, alle Schriftsteller, die Erzählungen über das afrikanische Jagd- und Kriegsleben geschrieben haben, besaßen nicht die gewaltige, idealisierende Kraft jenes amerikanischen Autors.
Und so ist es auch mit jenen europäischen Depeschenreitern gegangen, die an Verwegenheit, Spürsinn und Ausdauer und dergleichen Tugenden sicher das ganze amerikanische Heldentum der Wildnis übertrafen. Sie haben nicht ihren Cooper gefunden.
Wir aber wollen solch einen damaligen Volkshelden der Vergessenheit entreißen und zu schildern versuchen, und zwar... ohne jeden idealen Nebengeschmack.
Den ganzen Tag hatte es in Strömen vom Himmel gegossen. Die Torwache hatte große Mühe, ihre Bekannten, welche von draußen in die Stadt kamen, herauszufinden, dass sie nicht nach dem Pass gefragt zu werden brauchten, so waren die Hereinkommenden alle mit dem Schlamme der Landstraße bedeckt.
Aber am allermeisten war das bei dem Reiter der Fall, der jetzt das Tor passierte. Einfach alles eine noch nasse Schlammkruste. Die Farbe des Pferdes war gar nicht mehr zu unterscheiden, von dem darauf sitzenden Manne aber auch nichts mehr. Diese Verschmierung war denn doch gar zu toll! Der musste doch geradezu mit Absicht durch einen Sumpf geritten sein oder noch wahrscheinlicher sich samt seinem Pferde im Schlamme der Landstraße herumgewälzt haben.
Der wachehabende Korporal trat ihm entgegen.
»Halt, wer seid Ihr?«
»Ach, geht und hängt Euch!«, knurrte der schlammige Reiter.
Na, das gab es natürlich nicht! Und wenn es der Bischof von Rom oder der erste weltliche Fürst im Kirchenstaate war, vor der päpstlichen Torwache hatte er sich zu legitimieren, und jetzt nun gerade.
»Im Namen des...«
Der Korporal kam nicht weiter. Er war dem Pferde bereits in die Zügel gefallen — da aber beugte sich der fremde Reiter etwas vor, holte aus und schlug dem Manne mit der Faust ins Gesicht, dass dieser sofort die Zügel fahren ließ, zu Boden stürzte und mit blutüberströmtem Gesicht wieder aufsprang.
Die Folgen lassen sich denken. Ein Wutschrei der Soldaten, alles stürzte vorwärts, um den Kerl vom Pferde zu reißen — aber nur ein Augenblick, dann erstarrte alles. Die Erkenntnis war ihnen gekommen.
»Ein Depeschenreiter!«, wurde scheu geflüstert, und niemand setzte dem Weiterreitenden nach.
Es möchte hier keine lange Erklärung mehr gegeben werden. Aber einige Worte sind doch wohl nötig.
Ein sich in der Stadt aufhaltender Räuber konnte wohl auf diese Weise aus dieser auszubrechen versuchen, welcher Hereinkommende aber hätte gewagt, einen von der Wache so zu behandeln, ihn blutig zu schlagen? Und wenn das ein Edelmann aus dem freiherrlichsten Geschlechte gewesen wäre, er wäre am nächsten Tage an den Galgen gekommen, und der Bischof und der erste Fürst im Kirchenstaate hätte mindestens am Geldbeutel furchtbar bluten müssen.
Ach, so etwas war ja überhaupt ganz ausgeschlossen! Zu solch einer brutalen Handlung, diese überhaupt nur zu wagen, war eben nur ein Depeschenreiter fähig, der eine Meldung für den Papst oder für eine fremde Gesandtschaft brachte.
Ja, wie sollte sich so ein Mann aber auch verhalten, wenn er an dem Tore angehalten wurde? Der hatte überhaupt keine Legitimation bei sich. Der musste sich durchhelfen, wie und wo er konnte. Jede Legitimation hätte ihm ja vielleicht zum Verräter werden können. Der durfte sich überhaupt von keinem einzigen Menschen anhalten lassen, das stand in seinem Kontrakt, oder sonst wäre es um sein ganzes Renommee geschehen gewesen. Der durfte sich nicht einstweilen auf der Wache hinsetzen und sagen: Holt mir den Papst oder den und den, dem gegenüber werde ich mich schon legitimieren. Dann hätte man nicht solche Kerls gebraucht, die sich weder vor Gott noch Teufel fürchteten, also sich doch auch nicht etwa von solch einem Korporal oder Toroffizier anhalten ließen. Durch, nur immer durch!!!
Mag diese Andeutung genügen, was für eine Macht die Depeschenreiter in gewisser Hinsicht besaßen. Die hatten von vornherein Absolution für alles, was sie taten. Es konnte ja auch gar nicht anders sein. Die lagen doch immer mit aller Welt im eigenen Faustkriege. Mitten in Friedenszeiten mussten sie Totschläge begehen, für sie selbst aber eben ganz ehrliche Zweikämpfe. Die konnten nicht bestraft werden, für gar nichts. In dem betreffenden fremden Lande, bei dessen Durchquerung sie die Tat begangen, durften sie sich natürlich nicht erwischen lassen.
Die eigentümliche Stellung eines damaligen Depeschenreiters ist so recht vergleichbar mit der eines Kapitäns, der ja an Bord seines Schiffes eine unumschränkte Macht besitzt, die noch die eines absoluten Monarchen übertrifft. Wer gegen ihn mit drohender Bewegung nur den kleinen Finger erhebt, den darf er auf der Stelle niederschießen, und kein Gericht verurteilt ihn.
»Ein Depeschenreiter!«
Na, was war da anderes zu erwarten? Diese vielbewunderten Runkse kannte man. Aber da war nichts zu wollen. Der vielbewunderte und vielgehasste Depeschenreiter trieb seinen schlammigen Gaul weiter, und er kannte den Weg durch die Straßen Roms, brauchte nicht zu fragen.
Die englische Gesandtschaft war sein Ziel. Deren Fenster waren in allen Etagen schon hell erleuchtet, durch die weitausgeschwungene Pforte fuhren Karossen und wurden Sänften getragen, denen Herren in Galatracht und juwelengeschmückte Damen entstiegen.
Diese Festlichkeit war nichts Auffallendes, seit einiger Zeit fand in der englischen Gesandtschaft fast jeden Abend eine solche statt. Eine Ausnahme bildete nur, wenn Lord Moore nach Palo hinübergeritten war, eine ganze Nacht bei seinem Freunde Morphin verblieb.
Staunend betrachteten die beim Aussteigen behilflichen Diener den aus dem Schlamme gezogenen Reitersmann, ängstlich die Herren und Damen, nämlich für ihre Toiletten besorgt, und kreischend fuhren die letzteren auseinander, die Herren fluchten und schimpften, soweit sie es hier durften, denn als sich der Reiter vom Pferde schwang, mitten in einer Gesellschaft, um die er sich gar nicht kümmerte, war es schon geschehen: Der noch ganz nasse Schlamm war bei der Drehung aus dem Sattel von ihm abgespritzt, hatte einige der eleganten Toiletten und zum Teil geschminkten Gesichter gelb gemustert.
»Sapristi, was ist denn das für ein rücksichtsloser Kerl!!!«
Der machte dieser Bezeichnung noch einmal alle Ehre.
»Ach, Larifari, wen das geniert, der mache es ebenso wie ich.«
Mit diesen Worten schritt er nach der im Hofe stehenden Pumpe, zum Stalldienst bestimmt, setzte den Schwengel in Bewegung.
»Hier, pumpe«, herrschte er einen danebenstehenden Stallknecht an, gab seinem Wunsche gleich handgreiflichen Nachdruck, packte den ihn anstarrenden Mann beim Genick und schob ihn heran, und als die Sache funktionierte, legte er sich einfach unter den dicken Wasserstrahl, direkt an den Boden, oder sich auch einmal auf Hände und Knie stützend, sich immer herumdrehend und seine Lage verändernd, sodass alle Teile seines Körpers von dem Wasserstrahle getroffen und abgespült wurden.
Auf diese Weise kam nach und nach ein grauer Lederanzug zum Vorschein, schon tüchtig abstrapaziert, aber noch immer für die Ewigkeit berechnet, ein ebensolcher Schlapphut, ein Paar bis an den Leib hinaufreichender Stiefel; aus den mächtigen Erdklößen, die an den Hacken gehangen, entpuppten sich silberne Pfundsporen, am Gürtel entwickelten sich ein Paar im Verhältnis ebenso mächtige Pistolen, die er vor diesem Wasserbade zu schützen nicht für nötig befunden hatte, dann noch ein kurzer, aber sehr breiter Hirschfänger, mehr ein riesiges Schlachtmesser, und als die Metamorphose so weit gediehen war, ehe man sonst noch etwas unterscheiden konnte, sprang der Mann unter der Dusche hervor und schritt, seinen im Schlamm zu erstarren beginnenden Gaul einfach stehen lassend, dem Portale zu.
Es war eine Szene gewesen, wie man sie auf der Straße nicht beim Karneval erlebte, solch rohe Späße liebt der Italiener überhaupt nicht, am allerwenigsten am eigenen Leibe, und das war hier nun im Empfangshofe der heiligen Gesandtschaft geschehen, die ihre Tore nur einmal geöffnet hatte, um die geladenen Gäste einzulassen!
Aber es wäre ja merkwürdig gewesen, wenn diese Herren, nicht zum kleinsten Teile zur Diplomatie gehörig, und überhaupt Kinder ihrer Zeit, nicht gleich gewusst hätten, was für ein Mann das nur sein konnte, der sich hier so zu betragen wagte, sich überhaupt so betrug, sein lehmiges Kostüm einfach unter der Pumpe abzuwaschen.
»Ein Depeschenreiter!«, wurde geflüstert, und zwar nicht minder scheu und zaghaft als vorhin von der Torwache, nur aus einem anderen Grunde.
Denn was konnte er bringen? Vielleicht hatte er in seiner Tasche den Krieg, einen ganzen Völkerkrieg, der vielleicht schon seit vielen Wochen ausgebrochen war.
Ach, was für eine Zeit muss das damals gewesen sein, als noch nicht alle Stunden ein Eisenbahnzug mit Briefen und Zeitungen kam, vom Telegrafen gar nicht zu sprechen!
Unter Umständen konnte schon vor vierzehn Tagen in der lombardischen Tiefebene eine Völkerschlacht geschlagen worden sein, und hier in Rom hatte man noch keine Ahnung davon! Der Sieger bewachte die Grenzen zu streng.
Es wäre dies allerdings der stärkste Fall gewesen, doch immerhin denkbar. Zwischen Spanien, Holland und England konnte aber tatsächlich schon längst der blutigste Krieg zu Lande und zu Wasser ausgebrochen sein, da dauerte es drei Wochen, ehe die schnellste Post die erste Nachricht davon brachte.
Krieg?! Den Diplomaten stockte der Herzschlag, die Vertreter der Wehrmacht richteten sich höher empor, die Geistlichkeit faltete die Hände über der Brust, die Kaufleute zitterten für ihre unterwegs befindlichen Karawanen und Schiffe.
In diesem Augenblicke konnte der reichste Mann schon seit langen Wochen ein Bettler sein, und es vergingen wiederum viele, viele Wochen, vielleicht Monate, ehe er das definitiv erfuhr!
Ja, es war damals doch etwas ganz anderes, als man noch in so furchtbarer Ungewissheit schwebte, und eben deshalb kamen bei Handelsgeschäften auch noch ganz andere Gewinne heraus, weil eben wegen dieser Ungewissheit noch ganz andere Preise gefordert werden mussten.
Mit solch gemischten Empfindungen blickten sie alle dem aus dem Wasser gezogenen Manne nach, der mit elastischem Schritt dem Portale zuging.
Man wusste ja auch gar nicht, von wem er kam. Dass es gerade ein Depeschenreiter der englischen Regierung war, weil er zum englischen Gesandten wollte, das war ja durchaus nicht nötig.
Dann raffte man sich auf, wenigstens die Herren drängten sich ihm nach, in der Hoffnung, in der Portiersloge etwas aus seinem Munde erhaschen zu können.
Der Portier hatte die Szene im Hofe beobachtet, fassungslos starrte er den triefenden Mann an, dessen Lederkostüm zwar das Wasser nicht sehr hielt, aber es doch auch nicht gänzlich ablaufen ließ. Wo die kraftvolle Figur stand, bildete sich immer ein kleiner Teich am Boden.
»Depeschenreiter für Lord Walter Moore!«, schnauzte, wenn man diesen Ausdruck gebrauchen darf, der Ledermensch den mit goldenen Troddeln und Klunkern behangenen Portier an.
Dieser starrte nicht mehr die ganze wie aus Erz gegossene Gestalt an, sondern nur noch in das braunschwarz gebrannte Gesicht, in dem das spärliche hellblonde Bärtchen fast weiß erschien, aus dem sich die gerade, edle Nase trotzig hervorreckte und in dem die hellblauen Augen wie zweischneidige Schwerter blitzten.
»Hallo, hallo, Mann, seid Ihr auch schon von dem Geistergrafen eingelullt? Wacht auf aus Euren Träumen, oder ich mache Euch Beine! Lauft, lauft, führt mich zum englischen Gesandten!«
Erschrocken fuhr der Träumer bei diesen barschen Worten denn auch empor, lief zwar nicht selbst, sorgte aber schnellstens dafür, dass der Mann Führung bekam.
»Von der englischen Regierung?«, fragte leise ein goldstrotzender Kavalier, ehe der Depeschenmann den kostbaren Treppenläufer durchnässte.
Der Ledermann blickte den Frager über die Schulter an, er sah sofort, dass er hier einen ganz, ganz Vornehmen vor sich hatte, aber gerade danach fiel seine Antwort aus.
»Nein, vom Sultan von Bagdad, gottverfluchter Einfaltspinsel, dämlicher!«, schnauzte er den Zurückprallenden an, um dann seinen Weg fortzusetzen.
Es ist unbedingt nötig, dass wir diese Sprache des Depeschenreiters wiedergeben, ihn in seiner ganzen Runksigkeit schildern, und der Leser wird bald erfahren, weshalb dies nötig ist. Es handelt sich hierbei um einen historischen Prozess in der Weltgeschichte, welcher auch unseren Friedrich von Schiller gezeitigt hat. Das war einer von den Vorläufern jener Periode, in der die ›Räuber‹ entstanden, geradezu entstehen mussten. Doch später mehr davon, mag diese Andeutung vorläufig genügen.
Der Depeschenträger wurde in den Empfangssalon geführt, der sich neben dem Arbeitszimmer des Lords befand, zum Wartenlassen auch von Fürsten bestimmt, danach eingerichtet.
Den prachtvollen Teppich betrat der Kerl nicht, er blieb auf dem schmalen Streifen, der davon freigelassen, stehen, setzte nur auf das Steinmosaik des Bodens einen großen Teich, und dabei war sehr die Frage, ob diese Rücksicht nicht bloß ein Zufall war.
»Kommt der Lord?«
»Seine Herrlichkeit sind benachrichtigt«, sagte der Diener, sonst einer der am selbstbewusstesten auftretenden, vor diesem Ledermanne aber mit einem Male ganz demütig geworden.
»Seine Herrlichkeit sind... hahahaha, sehr gut! Mensch, lasst Euch Euer Schulgeld wiedergeben und geht dafür bei einem Bandwurm in die Lehre. Und dann sorgt, dass ich etwas zu essen bekomme, habe Hunger wie ein Wolf — wie drei Wölfe.«
»Wie dero Gnaden befehlen.«
»Macht, dass Ihr mit Eurer glatten Galgenphysiognomie verschwindet, sonst gibt es noch einen Tritt!«
Als der Kavalier, der er trotz alledem blieb, weil das einfach ›Reiter‹ heißt, allein war, nestelte er unter seinem Lederwams.
Da trat durch die andere Tür schon der Lord im Gesellschaftsanzuge ein, der Depeschenmann kannte ihn wohl bereits, sonst hätte er erst eine Gewissheit gefordert, ob dies auch wirklich der Vertreter Englands sei, und vor diesem schlug er doch die Hacken sporenklirrend zusammen.
»Depeschenreiter der englischen Regierung«, meldete er, unter dem Wams hervor ein in Wachstuch gehülltes Paketchen zum Vorschein bringend.
Jetzt aber war es der Lord, der sich erst vergewissern musste. Denn da konnte ja einmal ein falscher Depeschenreiter kommen, der ihm die verhängnisvollsten Instruktionen brachte, und ehe das ans Tageslicht kam, war das Unglück schon geschehen.
Der Lord musterte den Mann, trat dicht heran.
»Losung?«
»Das Denkmal, das ich schuf, steht ewiger als Erz«, deklamierte der lederne Reiter leise, und zwar in lateinischer Sprache.
»Wer in Unschuld lebt und rein des Frevels«, gab der Lord ebenso zurück.
Es waren zwei Strophen aus ganz verschiedenen Gedichten des Horaz. Der Depeschenreiter brauchte ja gar nicht Lateinisch zu können, noch weniger den Horaz — man hatte ihm die beiden lateinischen Strophen eingebläut, die eine zum Geben, die andere als richtig zum Empfangen.
Jetzt nahm der Lord das Paket in Empfang.
»Setzt Euch, mein Freund«, sagte er und begab sich in sein Arbeitszimmer hinüber.
Lord Walter Moore wurde als der englische Gesandte in Rom nach London beordert, ohne Angabe eines Grundes — einstweilen wurde er vom Herzog Malborough vertreten, der sich bereits seit vierzehn Tagen von London nach Rom unterwegs befand. Diesen hatte er innerhalb eines Tages — innerhalb von 24 Stunden — in seine Geschäfte einzuweihen, dann hatte Lord Moore sofort die kürzeste Rückreise ohne Aufenthalt anzutreten.
Das war das hauptsächlichste der Schreiben, und bei dem jungen Lord brachte es nur ein freudiges Lächeln hervor.
»Entlassen! Nicht einmal in Gnaden. Einfach fortgeschickt. Well, ich wusste, dass es so kommen würde.«
Also nur ein Lächeln, und zwar ein freudiges, hatte er für diese Gewissheit.
Er las schnell noch die anderen Schreiben durch, schloss einige in seinen Schreibtisch, andere steckte er in die Tasche, begab sich wieder hinüber.
Dort stand der Depeschenreiter noch immer auf dem schmalen Steinstreifen in einer immer größer werdenden Pfütze, und dass diese den Teppich noch erreichen würde, suchte er dadurch zu verhindern, dass er durch mehrmaliges Verändern seiner Stellung die Pfütze seitlich in die Länge zog. Also konnte dieser sonst so rohe Patron doch wirklich rücksichtsvoll sein — oder er ließ sich von dem Prunk imponieren, der ihm ungewohnt war.
»Warum habt Ihr Euch denn nicht gesetzt?«, redete ihn der Lord, der also von seiner Entlassung ganz ungerührt blieb, freundlich an.
»Kann stehen, habe genug gesessen«, wurde zurückgeknurrt.
»Ja, aber wohl nur im Sattel. Wie ich aus dem Begleitschreiben ersehe, habt Ihr London heute vor zwölf Tagen verlassen?«
»Stimmt.«
Mit offenem Staunen betrachtete der Lord den Mann, dessen ganze Erscheinung auch wirklich Bewunderung abnötigte. Einmal schon diese Ritterlichkeit, und dann alles wie aus Erz gegossen, und schließlich dieses schwarzbraune Gesicht und diese Augen! — die sagten schon genug, was für ein Mut und eine Kraft und eine durch nichts zu beugende Energie in diesem Manne steckten!
»In zwölf Tagen von London bis hierher nach Rom?!«, fing der Lord erst jetzt richtig zu staunen an.
»Meinetwegen glaubt's nicht«, war die immer barscher werdende Antwort.
»Über die Alpen?«
»Meine Sache. Sir, ich habe Hunger.«
Der Lord wusste wohl, was für einen Menschen er vor sich hatte, der ihn einfach mit Sir anredete.
»Verzeiht. Ich werde sofort einen Diener beauftragen...«
»Habe ich schon selbst getan.«
Der Mann drehte sich der Tür zu.
»Halt!!«, rief aber der Lord, und der Kerl drehte sich denn auch um. »Wohin wollt Ihr gehen?«
»Ins Bedienstetenzimmer, wohin ich gehöre.«
»Oho! Ihr also seid der berühmte Axel, der berühmteste aller deutschen Depeschenreiter?«
»Der Depeschenreiter Axel bin ich wohl, und es gibt keinen anderen dieses Namens, oder ich würde ihm diese Namensverwandtschaft schnell genug austreiben, aber wenn Ihr denkt, ich werde durch solche Lobhudelei satt, dann irrt Ihr Euch.«
»Ich wollte nur den Depeschenreiter Axel bitten, dass er sein Abendbrot hier verzehrt.«
»Das macht, wie Ihr wollt, wenn's nur schnell kommt, und wenn Ihr mir dabei zusehen wollt, dann werdet Ihr wenig vom Verzehren zu sehen bekommen.«
»Was meint Ihr damit?«
»Na, habt Ihr etwa schon einmal einen Wolf etwas verzehren sehen? Und überhaupt — eine Majestät bis zur Durchlaucht herab, zu der auch Ihr gehört, speist; die anderen Vons und Aufs und Zus essen; und so ein Kerl wie ich frisst.«
Der Lord wandte sich dem Klingelzuge zu, um ein belustigtes Lächeln zu verbergen.
Das Abendessen war hier in diesen Salon beordert worden.
»Bitte, setzt Euch — ich bitte Euch«, sagte der Lord, vor den in der Mitte des Salons stehenden Tisch einen Stuhl rückend.
»Ich verderbe Euch den schönen Fetzen.«
»Den Teppich? Hat nichts zu sagen. Woher seid Ihr denn so nass? Es regnet doch längst nicht mehr.«
»Habe mich unten abgepumpt.«
»Wart so mit dem Schmutze der Landstraße bedeckt?«
»Ja.«
»Aha. Dann setzt Euch, bitte.«
Aber als sich der Mann noch immer nicht rührte, fuhr der Lord plötzlich gegen ihn herum.
»Zum Teufel, Kerl, seid Ihr denn nur taub?!!«, fing er jetzt an zu schnauzen. »Ich hab's Euch einfach gesagt, ich habe Euch zweimal, dreimal gebeten — — ja, glaubt Ihr denn, ich falle vor Euch noch auf die Knie? Setzt Euch!!«
Fest blickten sich die beiden Männer an, die miteinander nur eine gewisse und dennoch sehr große Ähnlichkeit hatten — echte, unvermischte Germanen vom Scheitel bis zur Sohle — und über das bronzene Antlitz des Depeschenreiters huschte ein leises Lächeln.
»Danke«, sagte er kurz, schritt sporenklirrend über den Teppich und ließ sich mit seinen nassen Sachen auf den kostbaren Polsterstuhl nieder.
Es war eigentümlich, mit welch scharfen Blicken ihn der Lord von der Seite beim Hinsetzen beobachtet hatte.
Weiß man, dass man bei einiger Übung, schon mehr Studium, daraus, wie ein Mensch sich auf einen Stuhl setzt, gleich beurteilen kann, wes Geistes Kind er ist, mindestens was für eine Erziehung er genossen hat und in welchen Kreisen er sich bewegt?
Der Lord setzte sich ihm gegenüber.
»Ihr erlaubt wohl, dass ich Euch Gesellschaft leiste?«
»Habe Euch gar nichts zu erlauben«, wurde nach wie vor geknurrt.
Doch der Lord ließ sich nicht abschrecken.
»Also der berühmte Axel!«
»Depeschenreiter Axel bin ich — ob berühmt oder nicht, ist mir ganz egal.«
»Ihr rittet doch früher zwischen Holland und Spanien.«
»Ich reite, wo ich will. Verflucht, ich habe Hunger.«
»So ein Depeschenreiter muss doch über Hunger und Durst erhaben sein.«
»Sir, wollt Ihr mich narren? Bin ich denn hier auf der Landstraße oder in einem Hause, wo ich endlich zur Ruhe komme? Und wisst Ihr denn, seit wie vielen Tagen ich schon ohne einen Bissen bin?«
Zwei eintretende Diener unterbrachen dieses Gespräch. Dabei aber ist zu bemerken, dass von einer Gereiztheit seitens des Depeschenreiters gar keine Rede war. Das erkannte der Lord, das war eben die Sprechweise dieses Mannes, der auch in dieser Beziehung ganz mit einem amerikanischen Cowboy oder sonstigen Hinterwäldler zu vergleichen war, und er hatte offenbar seine Freude daran, solch einen Mann einmal näher zu studieren.
Die beiden Diener wussten, für wen sie aufzutragen hatten. Hauptgegenstände auf den silbernen Schüsseln bildeten ein ganzer Schinken und ein ganzer Schweinskopf, in dessen Schnauze auch die Zitrone nicht fehlte, und das waren also nur die umfangreichsten Exemplare der kalten Abendmahlzeit. Ferner auch eine jener dickbauchigen Rotweinflaschen, die zwei Liter fassen.
»Kein warmes Essen?«, fragte der Lord zunächst mit gerunzelter Stirn.
»Es hätte erst zubereitet werden müssen«, entschuldigte sich der erste Tafeldecker.
»Ihnen wäre wohl aber eine warme Abendmahlzeit lieber gewesen, Mister Axel?«
»Bah! Und was fragt Ihr mich überhaupt, wenn Ihr's nicht habt?
Der Lord lachte, wohl ebenso sehr über die Gesichter der Diener. Diese entfernten sich wieder.
»Nun, da wünsche ich Euch gesegneten Appetit.«
»Den habe ich schon von alleine«, entgegnete der Ledermann, der nicht einmal seinen Schlapphut abgesetzt hatte, zog sein ellenlanges Schlachtmesser, griff zunächst nach der mächtigen Flasche, die noch zugekorkt war, und... schlug ihr einfach mit dem starken Rücken des Hirschfängers den Kopf ab, sie so gegen den Mund setzend.
Eine gewisse Berechtigung zu dieser Handlungsweise hatte der Mann. Die Diener hatten das Glas vergessen. Wenn auch nicht mit Absicht. Dieser Salon war ja ein besonderes Heiligtum, hier bewirtete der englische Gesandte seine vornehmen Gäste stets selbst, entnahm die silbernen Becher dem Büffetschranke, es war seine Eigentümlichkeit, die gebrachte Flasche hier auch stets selbst zu entkorken.
Diesem Ledermanne gegenüber hatte der Lord nicht an solche Aufmerksamkeiten gedacht, und was er nun infolgedessen zu sehen bekam, machte ihn doch etwas starr.
Nicht nur, wie der einfach die Flasche köpfte und den scharfen Glasrand sans façon an seine Lippen führte, sondern auch, wie er trank. Er machte gulck, gulck, gulck, und hörte nicht eher aus zu gulcksen, als bis er die ganze Zweiliterflasche ausgegulckst hatte, und dazu brauchte er nur wenige Minuten.
»Aaah«, sagte er dann tief aufatmend, »ich habe schon weit besseren Rotspon getrunken als diesen, er hat überhaupt einen fatalen Beigeschmack, aber immerhin glaube ich, es sei noch niemals ein solches Labsal gewesen.«
Im nächsten Augenblick wurde des Lords Staunen vom Bedauern überwunden.
»Armer Mann, was für einen Durst müsst Ihr ausgestanden haben!«
»Durst? Gott bewahre, erst vor einer Stunde wäre ich beinahe ersoffen, und das im reinsten Wasser.«
Dann aber musste er sicher schon lange Zeit vom nagendsten Hunger gepeinigt worden sein.
Himmel, was konnte dieser Mansch vertilgen! Es war wirklich angebracht, dass er das Tafelmesser verschmähte, gleich mit seinem Schlachtschwerte absäbelte, einmal vom Schinken, einmal vom Schweinskopf, denn solche Scheiben, wie der brauchte, um seinen Mund zu füllen, die Stücke einfach hinabschlingend, hätte er mit dem Messerchen niemals abgebracht. Ganz passend war dazu auch, dass er die Gabel verschmähte, und wurden seine Hände zu fettig, so wischte er sie oben an dem auf dem Kopfe behaltenen Lederhute ab.
Der Lord war in eine tiefsinnige Bewunderung gesunken. Wirklich, er betrachtete den Schlingenden wie ein ideales Kunstwerk. Und weswegen das, das drückte er aus, als er dann ein klassisches Wort, das einst Alexander der Große zu Diogenes gesagt, in Variation wiederholte:
»Fürwahr, wenn ich nicht Lord Walter Moore wäre, so möchte ich solch ein Depeschenreiter sein!«
»Werdet's, ich kann's Euch nur raten«, antwortete der kauende Mund.
Der Lord hatte es nur zu sich selbst gesagt, er erwachte aus seinen Träumen.
»Wie meintet Ihr?«
»Was hindert Euch, ein Depeschenreiter zu werden? Ich kalkuliere, Ihr habt das Zeug dazu. Oder weil Ihr ein englischer Lord und Peer seit? Pppaaa?«
Verächtlicher hätte er das letzte Wort gar nicht hervorstoßen können.
Und der Lord glaubte noch etwas gehört zu haben, er wurde aufmerksam.
»Ihr seid ein seltsamer Mann. Ein seltener, meine ich. Ich habe ja schon mit manchem Depeschenreiter zu tun gehabt, sie unterschieden sich im Betragen nicht viel von Euch, aber... doch wieder etwas so ganz, ganz anderes. Na ja, Ihr seid ja eben der weltberühmte Axel...«
»Sonst noch etwas?«, unterbrach ihn der schlingende Mund.
»Darf ich an Euch verschiedene Fragen richten? Aber sagt nicht wieder, Ihr hättet mir überhaupt gar nichts zu erlauben oder zu verbieten.«
»Sir, denkt Ihr, ich spräche etwas Unnötiges?«
»Also darf ich Euch verschiedenerlei fragen?«
»Ja.«
»Und ihr werdet auch antworten?«
»Wenn ich will.«
»Was seid Ihr früher gewesen, ehe Ihr Depeschenreiter wurdet?«
»Meine Sache!«
»Wenn Ihr dabei bleibt, werde ich von Euch nicht viel erfahren.«
»Mir egal!«
»Antwortet wenigstens mit einem Ja oder Nein.«
»Meinetwegen... das heißt immer nur, wenn es mir passt.«
»Ihr seid ein Deutscher?«
»Ja — leider.«
»Weshalb leider?«, stutzte der Lord.
»Ich schäme mich, ein Deutscher zu sein.«
Der Lord stutzte nicht mehr, fragte nicht noch einmal, weshalb.
Ach, es sah damals traurig aus im heiligen deutschen Reiche, in das sich mehr als 50 Fürsten teilten, einer immer ein größerer Blutsauger als der andere!
»Ihr seid kein gewöhnlicher Mann des Volkes?«
Statt eine Antwort zu geben, wischte sich der Depeschenreiter wieder die Hände an seinem Hute ab, ihn dazu aber diesmal vom Kopfe nehmend, denn er wischte auch gleich die blitzende Klinge des Hirschfängers, die wie ein Rasiermesser schnitt, daran ab, steckte ihn in die Scheide zurück, setzte den Hut wieder auf und erhob sich.
Den ganzen Schinken und den ganzen Schweinskopf hatte er freilich nicht verzehren können, aber er hatte das Ungeheuerlichste geleistet.
»Ihr habt mich auszuzahlen.«
»Ja, ich weiß. Ihr wollt schon gehen?«
»Deshalb fordere ich mein Geld. Hätte es vorhin beinahe vergessen.«
Der Lord zog den Begleitbrief hervor, las ihn noch einmal.
Der Depeschenreiter hatte im Auftrage der englischen Regierung vom Empfänger nach richtiger Auslieferung des Hauptschriftstückes, über das aber gar nicht quittiert zu werden brauchte, für fünfzehn Tage 300 Pfund Sterling zu bekommen. Also pro Tag 400 Mark. Für jeden Tag aber, den er an diesen fünfzehn ersparte, erhielt er noch eine besondere Prämie von 20 Pfund oder 400 Mark.
»Ich hab's in zwölf Tagen gemacht. Stimmt's?«
»So habt Ihr zusammen 360 Pfund Sterling zu bekommen.«
»Stimmt!«
»Wollt Ihr es in italienischem Gelde haben?«
»Am liebsten.«
»Eine Minute.«
Der Lord begab sich in sein Arbeitszimmer hinüber, rasselte mit Schlüsseln, kam bald zurück und zählte die über 7000 Lire auf den Tisch, in Papier und Gold, den Rest in Silber und bis auf die letzte Kupfermünze ausgerechnet.
»Es ist jetzt nur der Ordnung wegen. Stimmt es?«
»Es stimmt.«
»Hierfür muss ich Eure Quittung haben.«
Er hatte sie schon mitgebracht, der Depeschenreiter setzte ein einfaches Axel mit einem besonderen Schnörkel darunter, strich ohne ein Danke das ganze Geld zusammen und steckte es in die Hosentasche.
»Was macht Ihr nur mit dem vielen Gelde?«, lächelte der Lord, aus die Gefahr hin, eine saugrobe Antwort zu bekommen.
Aber der Herr war jetzt etwas gnädiger gestimmt.
»Wird versoffen, verlumpt«, war die prompte Antwort.
»Und wie lange braucht Ihr dazu?«, lächelte der Lord noch immer.
»Diese Nacht.«
»Und dann?«
»Na, was dann?«
»Habt Ihr schon einen neuen Ritt in Auftrag?«
»Noch nicht. Wird sich aber finden, sobald ich ihn suche.«
Der Lord lächelte nicht mehr, machte vielmehr ein fast schwermütiges Gesicht.
»Mann, um Euch ist es doch jammerschade!«, sagte er in entsprechendem Tone.
»Und um Euch nicht minder, Mylord.«
Die Schwermut war verschwunden, betroffen blickte der Lord, zum ersten Male mit seinem Titel angeredet, auf. Im Tone besonders hatte es gelegen.
»Was sagtet Ihr da?!«
»Dass es jammerschade um Euch ist, Mylord.«
Mochte sich dieser Depeschenreiter, einem besonderen Menschengeschlecht angehörend, auch noch so frei fühlen — es war doch immer ein Lord und Peer, der Vertreter Englands, dem er dies sagte! Aber es war eben Lord Walter Moore, der das in seiner Weise hinnahm.
»Warum ist es um mich schade?«
»Sogar jammerjammerschade! Warum? Ihr kennt doch die Worte des Mannes, den die sogenannten Christen als einen Gott verehren; man kann nicht zweierlei Herren dienen.«
Zunächst wurde der Lord von der unangenehmsten Empfindung getroffen, wollte das Gespräch schnell ablenken.
»Ihr seid kein Christ?«
»Nein.«
»Ja, was seid Ihr denn sonst?«
»Ich glaube an einen einigen Gott.«
Noch viel verwunderter als vorhin blickte der Lord den Sprecher an.
»Ihr glaubt an Gott?«
»Gewiss.«
»An den Gott der Bibel?«
»Ob er in der Bibel steht oder nicht, ist mir ganz egal — ich glaube an den Gott, der mich und die ganze Welt geschaffen hat.«
»Ich verstehe nicht«, sagte der Lord kopfschüttelnd. »Ihr glaubt an Gott und wollt kein Christ sein?«
»Nein, ich mag mit dieser sogenannten Christengemeinschaft nichts zu tun haben. Denn das ist Lüge — alles Lüge und Frevel und Abgötterei. Wie lautet das erste Gebot? Ich bin der Herr dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Aber die Menschen sind nicht fähig, dieses erste, allereinfachste Gebot zu halten, sie kommen nicht aus ohne andere Götter, und sie sind so schwach und so verlogen, dass sie dies nicht einmal ehrlich gestehen wollen. Von den Katholiken wollen wir gar nicht sprechen, die haben sich im Laufe der Zeit gleich einige hundert Götter und Götzen gemacht. Aber ist es mit uns Protestanten denn anders? Ob hundert oder nur drei Götter, darauf kommt es doch an. Wir können nun einmal nicht an einen einigen Gott glauben, so mussten wir uns wenigstens noch Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist dazu fabrizieren. Ich aber, ich bin zu ehrlich, um solche Abgötterei mitzumachen — ich glaube allein an Gott den Herrn, ihm allein diene ich — und deshalb bin ich aus der sogenannten Christenheit ausgetreten, ohne deshalb unter die Mohammedaner gegangen zu sein, obgleich diese das einige Gottwesen viel wahrhaftiger aufgefasst haben als die Christen.«
Wie ein Phantom starrte der Lord den Sprecher an.
Denn es waren ungeheuerliche Worte gewesen — für damalige Zeiten! Denn damals durfte man so etwas nicht aussprechen, wie es wohl heute erlaubt sein mag, damals war es nicht so einfach, aus der Kirche zu treten.

»Mann, Mann«, warnte der Lord leise mit erhobenem Zeigefinger, »überschätzt Eure Verdienste als Depeschenreiter nicht — wohl weiß ich, dass man Euch, wenn eine wichtige Botschaft fortzubringen ist, vom Schafott herunterholen würde, aber... es hat alles seine Grenzen, ganz unersetz
lich ist niemand. Das habt Ihr jetzt zu mir gesagt — lasst diese Worte nicht öffentlich in Rom hören!«
Die reckenhafte Gestalt richtete sich noch höher empor, die Augen blitzten noch anders als zweischneidiger Stahl.
»Ich spreche, wie und wo ich will! Deshalb bin ich ein freier Mann geworden. Ihr aber... seid ein willenloser Sklave!«
Wie von einem furchtbaren Hiebe getroffen, zuckte der Lord zusammen.
»Wir wollen gar nicht mehr von Religion sprechen«, fuhr jener unbeirrt fort, »ich will es Euch nicht unter die Nase reiben, dass Ihr, der Ihr Euch den größten Freigeist nennt oder nanntet, doch immer mit dem Munde bejaht, was Ihr im innersten Herzen verneint. Auch Ihr seid ja nur ein kriechender Wurm. Ich will Euch anderes sagen, weshalb es um Euch jammerschade ist. Ihr wollt so ein Depeschenreiter werden wie ich? Ganz und gar unmöglich, und wenn Ihr auch alle körperlichen und selbst geistigen Fähigkeiten dazu habt. Die Hauptsache für diesen Beruf geht Euch ab. Ihr seid kein freier Mann. Und mehr noch: Ihr dient zwei Herren...«
»Ja, wieso denn nur?!«, rief der Graf, nur um in seiner furchtbaren Verlegenheit seine eigene Stimme zu hören.
»Ihr wollt Eurem Vaterlande dienen und dient zugleich und mehr noch einem... Schwindler.«
Den sonst so weltgewandten Lord verließ alle Fassung.
»Einem... Schwindler?«, konnte er ganz geistesabwesend nur wiederholen. »Wer soll denn das sein?«
»Na, was ist denn dieser Graf von Saint-Germain anders als ein Schwindler? Ihr könnt wirklich glauben, dass er schon einmal vor Tausenden von Jahren gelebt und dazwischen manchmal einige hundert Jahre als Scheintoter in einem Sarge gelegen hat, zuletzt in Eurem eigenen Keller? Ihr könnt glauben, dass alle seine Gaukeleien Tatsachen sind? Und dabei glaubt Ihr nicht einmal an einen ewigen Gott? Geht, Lord, macht Euch nicht lächerlich oder lasst Euch selbst begraben, aber gleich für immer. Nein, Mylord, Ihr könnt niemals ein Depeschenreiter werden — das heißt so ein Kerl, wie ich einer bin — dazu gehört etwas ganz anderes! Da muss man voll und ganz für seine Sache eintreten, nur einem Herrn in unwandelbarer Treue dienen, erhaben über all solchen Larifari und Schnickschnack, dass man sich nicht von jedem Schwindler betrügen lässt... und nun gehabt Euch wohl!«
Sporenklirrend schritt der Mann hinaus.
Und hinter ihm brach der Lord zusammen.
Er hatte etwas zu hören bekommen, was er niemals für möglich gehalten.
Und vor seinem geistigen Auge stiegen zwei Gestalten empor, Hand in Hand standen sie da, als die beiden Repräsentanten des Menschengeschlechtes, obgleich ihr Unterschied der denkbar größte war, eben die beiden Pole: der Papst als die höchste Potenz der kultivierten Christenheit und damit der ganzen Welt — und auf der anderen Seite dieser gotteslästerliche Depeschenreiter, trotz aller seiner Unentbehrlichkeit zum Auswurf der Menschheit gehörend — und sie beide, die denkbar größten Gegensätze, glaubten ehrlich an einen Gott und wollten von dem bereits alle beherrschenden Wundermanne nichts wissen, hatten nur Spott und Verachtung für ihn — nur diese beiden!
Als Axel den Hof betrat, kamen noch immer Equipagen angerollt, deren Ausspannung von Knechten unter Aufsicht des reichlivrierten Stallmeisters geschah.
»Wo ist mein Gaul?«, wandte sich Axel an diesen, in englischer Sprache, denn ein ganz englisches Jockeygesicht hatte der Mann.
»Ihr Ross steht geputzt und wohlversorgt im Stall, Sir.«
»Den Klepper nennt Ihr ein Ross? Ja, reif für den Rossschlächter. Es es nicht mein Pferd. Kennt Ihr das Städtchen Ventiglia?«
»Noch im Kirchenstaat, zehn Meilen nördlich von hier.«
»Richtig, es gibt nur ein Ventiglia im Kirchenstaat. Seid so gut und lasst es morgen hinbringen.«
»Wer ist der Besitzer?«
»Weiß ich nicht. Hab's heute Nachmittag dort von der Weide genommen — gestohlen, sagt man wohl. Der Besitzer wird sich schon melden, wenn der Gaul gesehen wird. Oder vielleicht ist er schon in Rom. Hier ein paar Goldfüchse. Aber die sind für Euch und die anderen, nicht etwa für den Besitzer des gestohlenen Pferdes. Dafür bezahlt ein Depeschenreiter nichts, sonst würde er von seinem Lohne wenig übrig behalten.«
Bei diesen Worten hatte Axel in die Tasche gegriffen und dem sich tief verneigenden Stallmeister gleich eine gute Handvoll Dukaten überreicht.
Dann trat er auf die schon erleuchtete und jetzt sehr belebte Hauptstraße, schlenderte sie hinab.
Nur ein einziger der Passanten brauchte zu wissen, dass dies ein Depeschenreiter war — ob nun der berühmte Axel oder nicht — so wusste es bald jeder, der den Mann in dem abgeschabten Lederanzuge mit dem Hirschfänger und den mächtigen Pistolen sah, und er erregte nicht weniger staunendes Aufsehen als wie ein... nicht gerade wie ein siegreicher Feldherr, das wäre zuviel gesagt — — etwa wie ein berühmter Tenor oder eine sonstige Bühnengröße, wie in Spanien ein berühmter Stierkämpfer, der sich auf der Straße zeigt, und der hat allerdings bei einem gewissen Teile der Bevölkerung noch mehr zu bedeuten als ein siegreicher Feldherr, ganz besonders bei der Jugend und bei der holden Weiblichkeit.
»Ein Depeschenreiter! Er ist aus der englischen Gesandtschaft gekommen. Das ist sogar kein anderer als der Axel, der berühmteste und daher begehrteste aller deutschen Depeschenreiter! Der reitet nicht unter hundert Dukaten den Tag. Ach, hat's so einer gut! Jawohl, gut, wenn ihr nur wüsstet...«
So und anders klang es um den Ledermann her, die Menge staute sich, sie verrenkten sich die Hälse, und die Augen der schönen Italienerinnen funkelten.
Den Bewunderten ließ das alles kalt, er schlenderte weiter, klimperte in der Tasche mit den Goldstücken.
Da kam des Weges ein Mann daher, der noch viel mehr Bewunderung verdiente, wenigstens seiner äußeren Erscheinung nach, die aber hier nichts Auffälliges mehr war.
Es war ein Hauptmann von der Schweizergarde, und diejenigen, welche als Petri Nachfolger das Muster des armen Lebens Jesu führen sollen, haben oder hatten mit ihren Soldaten von jeher den höchsten Luxus getrieben, hierin hatte es auch der vernünftige und sonst so einfache Benedikt IX. beim Alten gelassen.
Mit Goldstickereien überladen, die trichterförmigen Rembrandtstiefel wie Teller an den sporenklirrenden Füßen, auf dem Haupte das mit wallenden Straußfedern geschmückte Rembrandtbarett, den endlosen Stoßdegen unter dem Arm, so kam er schnellen Schrittes daher, und dabei war er wirklich das Bild von einem schönen Manne.
Der Depeschenreiter vertrat ihm sans façon den Weg.
»Hallo, Kamerad — wo gibt es hier den besten Wein und die schönsten Menscher?«
Er hatte es deutsch gesagt, und für ›Damen‹ einen damals in Studenten- und Offizierskreisen üblichen Ausdruck gewählt.
Denn so südländisch der brünette Offizier mit dem schwarzen Knebelbart auch aussehen mochte, was konnte er denn anders sein als ein guter Deutscher!
Der alte Ruf der schweizerischen Tapferkeit, der durch die glorreichen Kämpfe der Eidgenossen gegen Österreich nicht wenig erhöht ward, bewirkte, dass die schweizerischen Söldner gegen das Ende des Mittelalters sehr gesucht waren.
König Ludwig XI. von Frankreich nahm als erster 6000 Schweizer in seine Dienste, bildete aus ihnen eine Leibwache, alle anderen Staaten ahmten dies nach, respektive deren Fürstenhöfe, der von Holland, Spanien, Piemont, Neapel, Genua und auch der des Kirchenstaates.
Und diese Einrichtung blieb bestehen. Im Jahre 1828 zählte man an den verschiedenen Höfen noch 20 000 Schweizer. Dann aber begann die Auflösung dieser Leibgarden, die trotz aller schweizerischen Tapferkeit immer mehr zum Luxus gedient hatten. 1856 entließ Neapel die letzten.
Aber da waren das schon längst, längst keine Schweizer mehr gewesen. Die hatten sich gar nicht bewährt. Sie desertierten zu viel, und das umso mehr, ein je größeres Faulenzerleben sie führen mussten. Das unbezwingbare Heimweh des Schweizers. Einmal einen kurzen Feldzug mitmachen, da die ganze Kraft einsetzen, ja, aber zu ständigen Leibgardisten eigneten sie sich nicht.
Die Soldaten der Schweizergarden waren schon längst durch regelrechte Deutsche ersetzt. In gutem Rufe standen sie niemals. Roh und lasterhaft — aber das, wozu man sie haben wollte, taten sie voll und ganz. Andere als Deutsche kamen gar nicht hinein, und dass ein Nichtdeutscher Offizier wurde, war ganz ausgeschlossen, so etwa wie bei der heutigen französischen Fremdenlegion ein Nichtfranzose.
Diese Schweizergarden waren auch so ein Institut, in das sich gefallene Existenzen flüchten konnten, besonders in Neapel wurden sie einfach ›deutsche Studenten‹ genannt.
Der Hauptmann ließ sich gern anhalten, betrachtete den Ledermann mit dem größten Interesse, wusste schon etwas.
»Ihr seid der Depeschenreiter Axel?«
»Bin ich, und ich denke, Ihr könnt mir hier die duftigsten Spelunken zeigen, in denen man seine Goldfüchse los wird.«
Ja, Axel hatte gerade den Richtigen getroffen. Zunächst aber zwirbelte der Hauptmann in offenbarer Verlegenheit seinen prachtvollen Knebelbart.
»Ja, verflucht und gottver...«
Der Hauptmann fluchte erst noch einige Meter weiter, ehe er die Erklärung abgab:
»Jetzt kann ich nicht, ich habe Dienst.«
»Wo?«
»Hauptwache im Vatikan.«
»Wie lange dauert die?«
»Von heute um acht bis morgen früh um acht.«
»So lange kann ich nicht warten. Ich habe Euch einiges zu sagen.«
»Mir?«
»Ja, Euch.«
»Kennt Ihr mich denn?«
»Ich denke doch. Wie heißt Ihr? Wie nennt Ihr Euch hier?«
»Hauptmann Cheruscio.«
»Stimmt, Hermann der Cherusker.«
»Was, Ihr kennt mich schon von früher?!«
»Und Ihr mich nicht?«
Der Hauptmann musterte den vor ihm Stehenden. Nein, er erkannte ihn nicht.
»Wer seid Ihr?«
»Nicht hier auf der Straße.«
»Dann kommt doch mit!«
»Wohin?«
»Mit auf meine Wache. Dort bin ich so gut wie frei, nur dass ich nicht fort kann. Und auch Wein genug, bloß keine Mädels.«
Gut, der Depeschenreiter kam mit. Unterwegs suchte der Hauptmann immer wieder zu erfahren, wer jener denn sei, aber der Depeschenreiter wollte auf der Straße sich nicht offenbaren.
Der Vatikan, in dem der Papst residiert, ist ein ganzes Stadtviertel für sich, nicht weiter zu beschreiben.
Sie betraten das besondere Wachtgebäude, der Hauptmann führte seinen Gast in einen ganz hübsch möblierten Raum, hieß ihn nur fünf Minuten warten, dann stehe er ihm ganz zur Verfügung, habe stundenlang nichts zu tun, wenn sich nicht etwas Besonderes ereigne, stellte schon jetzt ein paar Flaschen Wein und Gläser auf den Tisch, ging.
»Bin doch gespannt, als wen Ihr Euch entpuppen werdet«, sagte er, als er wieder eintrat.
»Und du kennst mich wirklich nicht mehr, Hermann?«, erklang es fast mit leiser Wehmut zurück. »Na, mich freut wenigstens, dass du deinen Barontitel abgelegt hast.«
»Was, auch das wisst Ihr?«, wurde der andere immer verdutzter.
»Kannst du dich nicht mehr auf deinen Herzbruder entsinnen, wie wir beide auf der Universität Göttingen die Alemannen totgefochten haben?«
Da kam die Erkenntnis, da breitete der Hauptmann die Arme aus.
»Ist es möglich, Prinz Alex!!«
Und sie lagen einander in den Armen — der eine ein Fürstensohn und jetzt ein sprichwörtlich roher Depeschenreiter — der andere ebenfalls einem der höchsten Adelsgeschlechter Deutschlands entstammend und jetzt auch als päpstlicher Hauptmann ein von jedem anständigen Menschen gemiedener Abenteurer — — zwei akademische Vertreter des revolutionären Jungdeutschlands.
Man wird finden — wenigstens der, der mit offenen Augen um sich schaut und mit selbstdenkendem Kopfe die Weltgeschichte liest — dass in jedem Volke immer alles, alles vorhanden ist, was es in der Welt nur gibt, aber es ist ein ewiges Hin- und Herbalancieren.
Sollen diese wohl sehr dunklen Worte gleich durch einige Beispiele erläutert werden, und nehmen wir von allem, was existiert, nur Bildung und Unbildung, feine Umgangsformen und Rohheit an. Wir sprechen immer von der hohen Geistesstufe, auf der die alten Griechen gestanden haben, und vergessen dabei ganz die armen Heloten, die griechischen Sklaven, eigentlich überhaupt die ganzen unteren Volksklassen des alten Hellas.
Als dann die Griechen und Römer — das heißt eben die obersten Klassen, von denen allein wir immer sprechen — zu verweichlichen begannen, geistig zu verrohen, nur noch an den grauenvollen Zirkusspielen Wohlgefallen fanden, waren es eben diese Sklaven, aus denen die größten Geister hervorgingen.
Ganz deutlich ist diese wechselvolle Einseitigkeit in Deutschland ersichtlich.
Als im raubritterlichsten Mittelalter der Adel in tiefste Unwissenheit und unflätigste Rohheit versunken war, gediehen Kunst und Wissenschaft und gute Sitten nur im einfachen Bürgertum.
Als sich dann aber das höfische Wesen immer mehr verfeinerte, artete das Leben der unteren Klassen immer mehr in Rohheit aus.
So stand es auch zu der Zeit, in der unser Roman spielt. An den mehr als fünfzig Fürstenhöfen Deutschlands herrschte eine Abgeschliffenheit der Manieren, eine Galanterie und Sentimentalität, von der wir uns heute gar keine Vorstellung mehr machen.
Es wurde ständig geseufzt und geschwärmt und gedichtet, alles drehte sich um die Damen, die man nur mit Glacéhandschuhen anfassen durfte, es wurde ausschließlich über schöngeistige Dinge gesprochen, man arrangierte die unschuldigsten Schäferspiele — und im Innern war dabei alles bis aufs Mark verfault, unter dieser ästhetischen Tünche herrschten Lug und Trug und das gemeinste Laster.
Das breite Volk hingegen stand wiederum auf einer ziemlich tiefen Stufe der Bildung, war grob, sinnlich veranlagt, aber treu und bieder.
Nun hat es von jeher zwischen Volk und Adel ein Mittelding gegeben, in dem sich die Grenzen beider vermischten. Das ist immer die Studentenschaft gewesen, die akademische Jugend, von den fahrenden Schülern an bis auf unsere Tage. Die akademische Jugend hat immer und stets die Balance zwischen diesen beiden Gegensätzen gehalten, aus ihr sind regelmäßig die großen Geistes- und auch politischen Revolutionen hervorgegangen, welche der Welt plötzlich ein ganz anderes Gepräge gaben. Ja, eine völlige Umprägung der bisher vorhandenen Werte.
Woher dies kommt, ist nicht schwer zu verstehen, so wenig auch mancher hochbedeutsame Diplomat schon darüber nachgedacht haben mag. Die Universitäten stehen frei für jeden, der die dazu nötige Bildung besitzt, vor dem Forum der Wissenschaft und überhaupt des Geistes gibt es keinen Geburtsunterschied, dazu kommt noch das nach alter Tradition in Fleisch und Blut übergegangene freie Burschenleben, und schließlich ist es eben das Feuer der für alles Schöne und Große und Edle begeisterten Jugend, das dahinter steckt. Und mag ein Fürstensohn von verknöcherten Hofmeistern und Schranzen auch noch so wohl dressiert worden sein, auf der Universität wird das alles abgeschüttelt, da bricht die urwüchsige Natur der kraftvollen Jugend hervor.
Die damalige akademische Jugend erkannte die entsetzliche Hohlheit, die an den deutschen Höfen herrschte. Sie wollte diesem verlogenen Spiele ein Ende machen, durch Verhöhnung, durch eigenes Beispiel. Die zukünftigen Fürsten und Landesväter hatten sie ja als Kameraden unter sich, die waren noch zu erziehen. Aber große Ideen lassen sich nicht mit Kleinigkeiten durchführen, da muss Begeisterung dahinter sitzen, und die Extreme berühren sich.
So kam es, dass die deutsche Studentenschaft in eine Rohheit verfiel, wie sie in solchen gebildeten Kreisen noch gar nicht da gewesen war. Weil die ›dort oben‹ vor weichlicher Sentimentalität kaum noch einen Tropfen Blut sehen konnten, waren bei den Jüngern der Wissenschaft die blutigsten Raufhändel an der Tagesordnung; für die zierlich gedrechselten Redensarten setzten sie die stärksten Ausdrücke, die immer unflätiger wurden; anstatt schöngeistiger Dichtungen sangen sie die gemeinsten Zotenlieder, mit Vorliebe auch Räuberlieder, denn sie wollten sich in ihrer Einbildung als vogelfreie Straßenräuber fühlen, und das ging schließlich in Fleisch und Blut über. Dabei aber doch unter sich immer die treueste Freundschaft.
Aus diesen Kreisen ist auch Schiller hervorgegangen. So entstanden im Jahre 1777 — aber erst vier Jahre später veröffentlicht — seine ›Räuber‹, denen ›Kabale und Liebe‹ folgte. Schiller ist der erste gewesen, der es wagte, in diesen beiden Dramen ein Spiegelbild seiner Zeit zu geben, diese beiden riesenhaften Gegensätze zwischen dem bis ins Rückgrat zerfressenen Hofe und der akademischen Jugend als dem Repräsentanten oder Vorfechter der kernigen Volkskraft. Was für ein Wagemut dazu gehört hat, solche Dramen zu veröffentlichen, können wir heute gar nicht mehr erfassen.
Nun lese man die ›Räuber‹ im Original. Was für kräftige Ausdrücke da zwischen den Räubern, die doch fast alle ehemalige Studenten sind, fallen. Und das hat der idealste, keuscheste aller Dichter geschrieben, von denen Goethe am Grabe sagte: ›Und was uns alle bändigt, das Gemeine, lag hinter ihm in wesenlosem Scheine.‹ Und die allerkräftigsten Ausdrücke dieser Räuberstudenten konnte er doch immer noch nicht wiedergeben.
Hier hatten sich zwei solche Studenten nach langen Jahren wiedergefunden. Vor länger als zehn Jahren hatten sie auf der Universität Göttingen zur ewigen Freundschaft gegenseitig ihr Blut getrunken, wozu aber nicht nur die Ader etwas geritzt werden durfte, das Blut musste immer gleich knüppeldick fließen, und als Nachtrunk wurde ein ansehnliches Fässchen Wein draufgesetzt, und wer das nicht mit steifen Armen heben und den Wein sich direkt aus dem Spundloch in weitem Bogen ins Maul laufen lassen konnte, der war kein Mann.
Sie waren beide wegen blutiger Raufereien, Duelle und wegen anderer Streiche relegiert worden, von den Universitäten ausgestoßen, verbannt aus allen deutschen Landen, Baron Hermann sowohl wie Prinz Alexander; dass dieser ein legitimer Fürstensohn war, hatte ihn davor nicht schützen können, bei thronstürzenden, revolutionären Gedanken hört jede Gemütlichkeit auf, und es war ja auch ein später geborener, ein überflüssiger Prinz.
Sie hatten sich gar viel zu erzählen, und sie taten es beim vollen Humpen, der schnell das lächerlich kleine Glas verdrängt hatte.
Sie waren nicht gemeinschaftlich gegangen, das Schicksal hatte sie gleich am Anfange getrennt. Nun, des Barons Lebensgang war schnell erzählt. Er war sofort nach Rom gegangen, zur päpstlichen Schweizergarde, war als Fähnrich eingetreten, hatte es im Laufe von ungefähr zehn Jahren bis zum Hauptmann gebracht, konnte es nun auch nicht weiter bringen. Es ging ihm so là là, er war zufrieden mit seinem Lose.
Der Prinz, der aber von seiner Prinzenschaft nichts mehr wissen wollte, konnte anderes erzählen. Der war nach Amerika gegangen, hatte den Unabhängigkeitskrieg der englischen Kanadier gegen das französische Joch mitgemacht, hier hatte er sich unter indianischen Lehrmeistern zum Depeschenreiter ausgebildet. Dann hatte er diesen Beruf nach Europa übertragen, hatte aber von den deutschen Depeschenreitern noch gar viel lernen müssen, bis er deren begehrtester Meister geworden war. Es gab keine Hauptstadt in Europa, von oder nach der er noch keine Depeschen gebracht hatte.
Von seinen erlebten Abenteuern wollte er lieber gar nicht erst anfangen, da wäre er niemals fertig geworden. Sein Freund durfte auch nicht fragen, wie er denn in einem fremden Lande, das er zum ersten Male betrat, Weg und Steg zu finden wisse, ohne jemand danach zu fragen.
»Das kann ich eben. Das ist bei unsereinem Instinkt, ohne den geht es nicht, und bei mir ist er in den amerikanischen Prärien und Urwäldern und Tundren wie urplötzlich gekommen. Mit einem Male war er da. Frage den Wandervogel, wie er sein altes Nest in Deutschland und das andere in Südafrika immer wieder zu finden weiß, mag ihn der Sturm auch noch so weit verschlagen — frage mich nicht.«
»Und gefällt dir dieses Leben?«
»Was heißt gefallen! Ich kann nicht anders mehr. Es liegt ein Fluch auf uns allen. Ich habe ihn erkannt. Es ist mir gar nicht mehr möglich, in einem Bett zu schlafen. Ich wälze mich so lange in den Decken und Federn, bis ich alles heraus habe und glücklich auf der harten Pritsche liege, dann erst kann ich sanft einschlafen, und da lege ich mich doch lieber gleich auf die Diele, um sofort Schlaf zu finden. Aber selbst jedes Zimmer wird mir bald zu eng. Schon oft bin ich bei Nacht aus dem Fenster eines gastlichen Hauses gestiegen, um auf einer Bank zu schlafen oder in einem Straßenwinkel. Nur Luft, Luft! Bloß beim Saufen halt' ich die Stubenatmosphäre aus. Sonst kennst du ja unser Leben. Kein König hat solche Macht. Wir haben Absolution schon vorher für jeden Mord und Totschlag, den wir begehen. Und dann, wenn die Ruhepause kommt, die ganze Tasche voll Gold.«
Mit diesen Goldstücken in der Tasche klimperte er jetzt, während er mit der anderen muskulösen Hand, die aber noch immer den Aristokraten verriet, auf den Tisch trommelte. Er sah mit einem Male recht gedankenvoll aus, etwas niedergeschlagen.
»Vor vier Jahren ging es mir einmal recht nahe«, fuhr er dann nach einer Pause fort, »da wäre ich beinahe vom Gaul aufs Schaf umgesattelt. Ich ritt eine diplomatische Note von Brüssel nach Paris. Es war nur ein winziges Zettelchen, ein Ja und eine Unterschrift. Die Folge von diesem Ja war dann der englischfranzösische Krieg. Da lief ich doch einmal den Fanghunden in die Zähne, zum ersten und hoffentlich zum letzten Male. Als sie mich gestellt hatten, verschluckte ich die kleine Kapsel.
Sie schonten mein Leben, wollten mir das Geheimnis auspressen, knuteten mich. Sie wurden verscheucht, ließen mich halbtot liegen. Als ich wieder zu mir kam, lag ich in einer Dorfschenke. Ein Reisewagen mit zwei Passagieren hatte mich gefunden. Es war ein alter Herr und ein junger, halb ein Kind, halb ein gereifter Mann. Der pflegte mich persönlich. Eine Woche lang. Da haben wir viel geplaudert, über — über... ja, was weiß ich. Über Sonne, Mond und Sterne und über die Erde und die ganze Welt. Und wie der zu sprechen verstand! Da ging etwas in mir vor.«
Immer tiefsinniger werdend, malte Axel mit dem verschütteten Wein mystische Figuren auf den Tisch.
»Was ging da in dir vor?«, fragte der Hauptmann.
Wie aus Träumen fuhr der andere empor.
»Ja, was weiß ich? Lehren, Lehren, nichts als Lehren. Aber wie nun und was für welche! Er malte, malte und malte, bis ich die ganze Welt in einem ganz anderen Lichte sah und dann — und dann... ja, und dann fing ich stets wie ein altes Weib zu flennen an, Gott ver...«
Axel schüttelte sich wie ein dem Wasser entstiegener Hund und stürzte den ganzen Inhalt des Riesenkruges mit einem Zuge hinunter.

»Es wurde nichts daraus, was ich mir vorgenommen hatte. Erst musste ich doch Rache an diesen verfluchten Fanghunden nehmen, gut ein Vierteljahr brauchte ich, bis ich den letzten hatte und zu Tode karbatschte, und dann... war es natürlich vorbei. Aber das weiß ich: Wenn ich diesem Jüngling heute noch einmal wieder begegnete, ich würde mich ihm abermals zu Füßen werfen und ihn als einen Gott anbeten — nein, ihn so verehren, wie ich Jesus Christus verehre, als den gotterleuchtetsten und daher weisesten und vollkommensten Menschen, der je auf Erden gewandelt hat.«
Erstaunt blickte der Hauptmann seinen Freund an. Ideale Gespräche hatten sie vor zehn Jahren allerdings genug geführt, trotz alles sonstigen rohen Gebarens. Sein Staunen hatte mehr einen anderen Grund.
»Du musst ja da ein seltsames Erlebnis gehabt haben!«
»Sprechen wir nicht mehr darüber«, entgegnete Axel, seinen Krug frisch füllend.
»Wie hieß denn der Fremde, der solch einen mächtigen Eindruck auf dich gemacht hat?«
»Wie hieß der barmherzige Samariter? Genug, sprechen wir nicht mehr darüber, ich hab's nicht gern, weil ich... damals so schwach gewesen bin — hinterher nämlich, dass ich ein Gelübde nicht gehalten habe. Es reißt mich noch jetzt manchmal schwer herum. Sprechen wir von etwas anderem. Was ist das nun eigentlich für eine Geschichte mit diesem Grafen von Saint-Germain?«
»Was weißt du darüber schon? Dass ich nicht erst ganz von vorn anfangen muss. Das würde sonst eine lange Geschichte.«
Der aus London Kommende kannte den Inhalt der ersten vierzehn Tage in der neuen Lebenslaufbahn des Wundermannes von da an, da er dem Zinksarge entstiegen, bis dahin, wo er nach Palo geritten war und der Skribentenfrau zuvor versprochen hatte, ihr idiotisches, verkrüppeltes Kind normal zu machen.
Alles dies wusste Axel mit allen Einzelheiten, denn das war unterdessen schon nach London gekommen, bildete auch dort das Tagesgespräch. Zuerst hatten Briefe davon berichtet, die ersten durch Extrapost befördert, wenn die auch nicht gerade deswegen gefahren war, dann durch einfache Post, schließlich hatten auch schon von Rom nach London gehende Handelsleute und selbst Besatzungen von Schiffen davon ausführlicher erzählen können.
Dann war Axel abgeritten, als das schnellste Beförderungsmittel, das es damals gab.
»Ja, dann weißt du eigentlich alles«, entgegnete der Hauptmann, als sein Freund den Bericht über seine Kenntnisse geschlossen hatte.
»Ist denn nichts Neues hinzugekommen?«
»Nein.«
»Verstehe ich nicht. Was treibt denn der Graf jetzt?«
»Der lebt in seinem Kloster, kommt gar nicht zum Vorschein — seit sechs Wochen ist er nicht mehr gesehen worden.«
»Ist er etwa entlarvt worden?«
»Durchaus nicht.«
»Verstehe ich nicht.«
»Wieso nicht?«
»Nun, er hat doch verschiedenes versprochen.«
»Was denn?«
»Zum Beispiel hat er doch das Kind der Skribentenfrau heilen wollen.«
»Ja, das ist auch ein kurioser Fall. Diese Frau hat er mit ihrem Kinde schon vor sechs Wochen zu sich kommen lassen, in sein Kloster, aber niemand weiß, wo Mutter und Kind geblieben sind.«
»Sind sie denn noch in dem Kloster?«
»Schwerlich. Davon müssten die Diener doch etwas wissen. Nein, die sind nicht mehr drin.«
»Ja, wo sind die beiden denn sonst hin?«
»Nun, der Graf hat sie eben wieder herausgelassen, so sagt er auch selbst. Die Diener haben das nur zufällig nicht bemerkt. Auch der Skribent selbst, Roscalli heißt er wohl, ist verschwunden. Das war ja immer so ein halber Zigeuner, wenn nicht ein ganzer. Seine Frau hat sich mit dem Kinde eben zu ihm gesellt. Deswegen nimmt hier niemand Anstoß.«
»Hat er denn das Kind geheilt?«
»Das weiß man nicht.«
»Er hat es doch versprochen.«
»Wem? Nur der Mutter. Alex, da muss man gerecht sein! Er hat hierüber der Öffentlichkeit gegenüber kein Wort verloren, hat also auch nicht etwa geprahlt.«
»Du stehst wohl gar auf Seiten dieses Gauklers, Hermann, glaubst an ihn?!«
»Vorläufig spreche ich nur gerecht.«
»Recht so«, stimmte der Freund ihm da bei. »Aber der Wundergraf hat doch andere Versprechungen öffentlich gemacht, wo man wirklich etwas Handgreifliches hätte.«
»Welche Versprechungen?«
»Nun, wollte er nicht die Fürstin de la Roche, dieses alte Scheusal, das ich nämlich auch schon persönlich kenne, nicht zur ersten Schönheit Roms machen?«
»Innerhalb eines Vierteljahres, hat er damals gesagt, gleich am ersten Tage, als er aus dem Keller kroch. Oder vielmehr genau nach einem Vierteljahr soll sie die gefeiertste Schönheit Roms sein, hat er gesagt. Er hat ja sogar genau den Termin genannt. Am dritten September dieses Jahres. Bis dahin sind es noch reichlich vier Wochen.«
»Und bis dahin ist auch dieses dürre Skelett verschwunden, dass er sein Versprechen nicht zu halten braucht. Der Tod und Unsichtbarkeit löst alle Versprechen.«
»Davon weiß ich nichts«, entgegnete der wirklich gerecht denkende Hauptmann. »Halt, da fällt mir übrigens etwas ein. Da ist doch ein handgreifliches Beispiel vorhanden.«
»Welches?«
»Weißt du, wie der Graf damals nach Palo geritten ist?«
»Das war das letzte, was ich vom Grafen erfuhr.«
»Er war bei Kapitän Morphin...«
»Der die polnische Prinzessin in Schutz nahm. Ja, was ist eigentlich aus der geworden? Das konnte damals eine böse Geschichte werden!«
»Kann es auch noch werden, noch heute, jede Stunde...«
»Die Prinzess ist noch immer in Palo?!«
»Davon später mehr. Kennst du den Kapitän Morphin, genannt Morphium?«
»Und ob ich den verrückten Kerl kenne!«
»Woher kennst du den? Bist du überhaupt schon einmal in Rom gewesen?«
»Davon später mehr«, sagte jetzt der prinzliche Depeschenreiter. »Ist der alte Kerl immer noch so spleenig?«
»Er wurde es immer mehr, je älter er ward. Du weißt doch, dass er aus seiner früheren Piratenzeit noch eine Kugel im Kopfe stecken hat.«
»Weiß ich.«
»Und dass er manchmal furchtbar von der Gicht geplagt wird.«
»Gerade in meiner Anwesenheit bekam er einmal einen bösen Anfall.«
»Nun, als ihn der Graf damals wegen der Prinzessin besuchte, versprach er dem Kapitän, ihn von seiner Kugel und vom Zipperlein zu befreien. Aber der Öffentlichkeit gegenüber hat er darüber kein Wort verloren, auch der Kapitän nicht, und hätte man dennoch von diesem Versprechen gehört und die Kur wäre misslungen, so hätte man doch kein Recht, darüber zu sprechen.«
»Ganz meine Meinung. Und was wurde daraus?«
»Aber der Graf hat sein Versprechen glänzend gelöst. Der Kapitän kam zu ihm, blieb zwei Tage im Kloster, und als er wieder zum Vorschein kam, sprang er mit seinen gichtigen Beinen wie ein junger Ziegenbock. Sie waren eben nicht mehr gichtig. Der Graf hatte ihm das Zipperlein vertrieben — und ihm die Kugel aus dem Kopfe entfernt.«
»So«, sagte Axel trocken. »Und das nennst du einen Beweis, dass der Graf übernatürliche Fähigkeiten besitzt?«
»Du etwa nicht? Hier hat man doch handgreifliche Tatsachen!«
»Wer sagt denn, dass der Kapitän wirklich eine Kugel im Kopfe gehabt hat?«
»Er ist von seinen manchmal wütenden Kopfschmerzen tatsächlich geheilt.«
»Nur Einbildung. Der Graf, doch offenbar ein ganz geschickter Taschenspieler, hat getan, als ob er ihm eine Kugel operiere, hat eine solche, genügend präpariert, in der Hand gehabt, sie ihm gezeigt, und der Kapitän war seiner Einbildung ledig, dadurch auch seiner Kopfschmerzen.«
»Na, Alex, wenn du freilich an die Kraft solcher Einbildungen glaubst...«
»Jawohl, so etwas gibt es.«
»Und die Gicht, welche vor Schmerzen die Glieder verrenkt, ist die etwa auch nur Einbildung, die durch eine Gegeneinbildung für immer vertrieben werden kann?«
»Nein, das ist wieder etwas ganz anderes. Aber warum soll es nicht ein Mittel geben, welches die Gicht aus dem Körper treibt? Und dass dieser abenteuerliche Graf manche geheime Kenntnisse besitzt, das glaube ich schon. Geradeso wie die Zigeuner, die wissen auch manches, was uns ganz rätselhaft erscheint. Es fragt sich nur immer, wie lange solch ein Mittel vorhält. Es ist stets ein Gegengift, welches dann eine andere, und zwar immer noch weit bösere Krankheit auslöst. Denke nur an Paracelsus und an seine Quecksilberkuren, mit denen er zu seiner Zeit Wunder ausführte. Ja, dieses Wunder besteht auch heute noch. Aber Paracelsus hat mit seinem Quecksilber der Menschheit durchaus keinen Dienst erwiesen, ganz im Gegenteil. Doch gut, ich glaube also, dass der Graf den Kapitän von Gicht und Kopfschmerzen befreit, ihm meinetwegen auch wirklich eine Kugel aus dem Kopfe, gleich aus dem Gehirn geschnitten hat. Melden sich denn da nicht noch viele andere, die von Gicht und sonstigen Krankheiten und Gebrechen geheilt sein wollen?«
»Das wohl, der Graf erhielt, zumal anfangs, zahllose Briefe mit solchen Anfragen, man hat sich bei ihm auf jede Weise einzuschleichen versucht. Es ist ja nicht nur wegen Krankheiten, sondern man will doch auch Gold machen lernen, Geister beschwört haben.«
»Und was antwortet der Graf?«
»Gar nichts. Es ist auch nicht nötig. Er hat öffentlich oftmals genug betont, dass er jedes Experiment nur ein einziges Mal ausführt, und dazu gehört doch auch das Heilen von Krankheiten. Er will das krüppelhafte Kind normal gemacht haben — das ist allerdings ganz seine Sache, davon hat er öffentlich sonst gar nicht gesprochen — den Kapitän Morphin hat er wirklich von seinen Leiden geheilt, dem Lord Moore hat er eine Geistererscheinung vorgemacht, er hat öffentlich gezeigt, vor vielen einwandfreien Zeugen, dass er ein Silberstück in eine Goldmünze verwandeln kann — und damit genug. Jedes Experiment nur ein einziges Mal, und dabei bleibt es.«
»Aha, da liegt der Hase im Pfeffer! Ein schlauer Fuchs!«
»Alex — oder Axel, wie du dich jetzt nennst — man muss gerecht sein. Hast du gehört, wie er den Paolo in Gold verwandelte?«
»Ganz ausführlich.«
»Weißt du, wer bei diesem Experiment alles zugegen war?«
»Ich weiß es. Trotzdem war es nur Taschenspielerei.«
»Hast du erzählen hören, wie er seinen eigenen Geist, oder seinen Astralleib, dem Lord Moore erscheinen ließ?«
»Auch das habe ich ganz ausführlich berichtet bekommen, so wie es der Lord selbst erzählt hat.«
»Und was hältst du davon?«
»Ebenfalls nur Gaukelei.«
»Hältst du Lord Moore einer Lüge für fähig?«
»Nein«, erklang es im bestimmtesten Tone, »aber das ändert doch nichts daran, dass der Lord ebenfalls das Opfer einer Gaukelei geworden ist. Doch lassen wir das, sonst drehen wir uns immer im Kreise. Ich begreife nur nicht, dass der Graf aus alledem, was er schon gezeigt hat, gar keinen Nutzen zieht.«
»Wie meinst du das?«
»Nun, dass dies alles jetzt so im Sande verläuft.«
»Ich verstehe, was du meinst. Nein, so einfach ist die Sache denn doch nicht. Es geht im Geheimen etwas vor sich, und nächstens wird es hier einen furchtbaren Krach geben...«
Der Hauptmann, der zuletzt mit sehr gedämpfter Stimme gesprochen hatte, brach ab, schaute vorsichtig um sich, nach dem geschlossenen Fenster, stand auf, blickte hinter eine Gardine, die einen Wandschrank verhüllte, blickte unter die Tischdecke... allerdings nicht, um sich zu überzeugen, ob etwa unter dem Tische ein Lauscher versteckt sei, sondern er nahm unter dem Tische aus einem Kasten nur zwei neue Weinflaschen hervor.
Trotzdem, sein Verhalten war ein sehr eigentümliches gewesen.
»Was ich jetzt zunächst sage, ist allgemein bekannt, obgleich ein Geheimnis daraus gemacht werden soll. Der Graf erhält jeden Tag, mindestens jeden Abend zahlreichen Besuch. Aber nicht öffentlich. Es hat niemand Zutritt zu ihm, er weist jeden Besuch ab, beantwortet keine Briefe. Das geht alles durch die englische Gesandtschaft. Seit sechs Wochen schon hat Lord Moore fast jeden Abend große Gesellschaft. Wenn dann alles zusammen ist, und es ist dunkel genug, dann geht es von der englischen Gesandtschaft hinüber in das Kloster. Da weilen die Herren und Damen immer bis nach Mitternacht, oft bis zum Tagesanbruch. Dann kommen sie wieder zur englischen Gesandtschaft heraus, deren Festsäle dabei ständig erleuchtet bleiben, und auch sonst wird dafür gesorgt, den Eindruck zu erwecken, als ob sich die Gesellschaft in des Lords Hause aufhielte. So zum Beispiel muss ab und zu die Musikkapelle, die der Lord bei solchen Gelegenheiten immer engagiert, aufspielen. In Wirklichkeit aber sind die Herrschaften drüben im Kloster. Das weiß hier in Rom schon jedes Kind.«
»So so. Gibt es denn zwischen der Gesandtschaft und dem Kloster eine Verbindungstür?«
»Die ist acht Tage später durch die Mauer gebrochen worden, nachdem der Graf das Kloster bezogen hatte.«
»Und diese Tür wird benutzt?«
»Jedenfalls.«
»Dann scheint dieses Geheimnis doch gar nicht so ängstlich bewahrt zu werden.«
»Von einer Ängstlichkeit ist eigentlich dabei auch gar keine Rede. Es ist eben eine geschlossene Gesellschaft. In das Kloster geht es nur durch die englische Gesandtschaft, die beiden sind ja von Anfang an dicke Freunde gewesen, und wen der Lord nicht formell einladet, der kommt auch nicht ins Kloster. Das ist die Sache.«
»Und was treiben nun die Damen und Herren da im Kloster?«
»Ja, Axel, da fragst du mich zu viel. Da kann niemand davon erzählen, als wer selbst dabei gewesen ist.«
»Was für Personen sind das?«
Der Hauptmann konnte sehr viele nennen. Nur die angesehensten Namen Roms, darunter auch ziemlich viele Geistliche.
»Und was ist die öffentliche Meinung hierüber?«
»Es sind Illuminaten, wenn nicht gar Rosenkreuzer.«
Draußen auf der Wache entstand ein Lärmen, der Hauptmann sprang auf und eilte hinaus.
Aber er hatte es zuvor ausgesprochen, und zwar wirklich ein gewichtiges Wort, hier im heiligen Rom eine furchtbare Anklage.
Von dem Freimaurertum, dessen Ursprung sich gar nicht mehr erforschen lässt, hat wohl schon jeder gehört. Nun hat es immer Freimaurer gegeben, denen das Geheimnisvolle dabei noch nicht geheimnisvoll genug war, die sich noch mehr in Mystizismus und Hokuspokus verirren mussten. So entstand als Abzweigung der Freimaurerlogen die Sekte der Illuminaten, das heißt Erleuchtete, die nämlich direkt von Gott erleuchtet sein wollten. Sie führten verschiedene Namen, in Spanien hießen sie Alomprados, in Frankreich Guerinets, aber in der Gesamtheit wurden sie als Illuminaten bezeichnet, ganz speziell auch der deutsche Orden, der im Jahre 1776 gegründet wurde, von Adam Weishaupt, Professor des kanonischen Rechtes zu Ingolstadt. Ihm hat auch Goethe einige Zeit angehört, was ganz sicher Veranlassung zu seinem ›Faust‹ gegeben hat.
Trieben schon die Illuminaten jene Wissenschaften, welche man okkulte oder geheime nennt, Alchimie und Astrologie, schwarze und weiße Magie, eben Zauberei, gleichgültig ob mit Hilfe von Engeln oder Teufeln, so war dies noch vielmehr bei den Rosenkreuzern der Fall.
Sonst ist über diese Zweigsekte der Freimaurerlogen nicht viel zu sagen. Mit Christian Rosenkreuz bezeichneten sie den wahren Christen in seinen Freuden und Leiden, gegründet sollte der Bund schon von Adam und seinen Söhnen sein, in Wirklichkeit ist die geheime Gesellschaft wohl im Jahre 1622 zu Haag entstanden. Also auch wieder Pflege der geheimen Wissenschaften, der Zauberei, um in Besitz von übernatürlichen Kräften zu kommen, mit Toten und Geistern verkehren zu können und so weiter.
Sind schon die einfachen Freimaurer in den katholischen Landen mit aller Kraft verfolgt worden, so galt dies noch viel mehr für die Illuminaten und Rosenkreuzer. Gegen die ging man, als dies noch möglich war, mit Feuer und Schwert vor, mit Foltern, es wurde zu ihrer Verfolgung eine besondere Inquisition eingesetzt, und der Katholizismus hatte dazu ja auch allen Grund. Denn ein heimlicher Kampf gegen die katholische Kirche, gegen die Allmacht des Papstes, ist ja auch das ganze Freimaurertum.
Hier nun im heiligen Rom selbst solch eine geheime Sekte der Illuminaten oder gar der Rosenkreuzer aufleben zu lassen, deren Mitglieder Versammlungen abhielten, das war eine Ungeheuerlichkeit, die der ehemalige deutsche Akademiker recht wohl erkannte.
Es hatte ja auch für ihn schon sehr nahe gelegen, jetzt aber, da es ausgesprochen worden war, machte er ein ganz bestürztes Gesicht.
Der Lärm draußen war verstummt, der Hauptmann kehrte zurück.
»Nichts weiter. Seit einigen Wochen irrt in den Straßen Roms eine Frau umher, die ihr Kind sucht. Sie hat das kleine Mädchen zum Besuch zu ihren Verwandten aufs Land geschickt, da ist es offenbar in den Bach gestürzt und ertrunken. Man hat einen Fetzen von seinem roten Unterröckchen auf einem Baumast gefunden, der sich über den Dorsbach streckte. Das Kind ist hinaufgeklettert, ist ins Wasser gestürzt.
Die Mutter, die Frau eines Gürtlers im Fogli, hatte gerade eine sehr schwere Niederkunft überstanden, als sie den Tod dieses Kindes erfuhr, da hat sie den Verstand verloren. Sie glaubt nicht, dass ihre Tochter wirklich tot sei, irrt mit dem roten Fetzen in der Hand in der Stadt umher, sucht ihr Kind, macht überall Szenen. Jetzt versuchte sie hier einzudringen, wollte den Papst sprechen, der hätte ihr das Kind geraubt. Weshalb die arme Frau noch nicht ins Irrenhaus gesperrt worden ist, weiß ich nicht.«
Der Hauptmann schenkte diesem Falle, dessen Bedeutung wir besser kennen, also weiter gar keine Beachtung, und so konnte es auch sein Freund nicht tun.
»Also Illuminaten!«, wiederholte dieser.
»Oder wahrscheinlicher sogar Rosenkreuzer.«
»Woraus will man denn dies schließen?«
»Aus der veränderten Lebensweise aller derer, die in dem Spukkloster bei nächtlicher Weile ein und aus gehen, immer durch die englische Gesandtschaft hindurch. Alle diese Herren und Damen, die sonst gar nicht wussten, wie sie in Essen und Trinken schwelgen sollten, essen plötzlich kein Fleisch und trinken keinen Wein mehr. Das ist schon ganz illuminatisch. Denn die gewöhnlichen Freimaurer essen Fleisch und trinken Wein, recht guten sogar. Aber nicht die Illuminaten. Man beobachtet da gewisse Grade. Die einen wissen ihre Lebensweise, die man eine vegetarische nennt, ganz gut zu gestalten, essen die teuersten Gemüse, alles vortrefflich zubereitet, andere essen noch Käse und trinken Milch, andere hingegen verschmähen alles, was vom Tiere kommt, also auch Eier und Milch, ja, sie essen nicht einmal mehr gekochte Gemüse, auch kein gebackenes Brot mehr, nähren sich nur von Obst und Nüssen, von vielen weiß man, dass sie sogar Getreidekörner roh kauen. Das ist die Lebensweise der Illuminaten. Nun aber wollen sie alle nicht einmal etwas von dem Wasser wissen, welches die römische Leitung liefert, sondern sie alle trinken ausschließlich nur noch Regenwasser, das sie von den Dächern ihrer Häuser auffangen oder sich sonst verschaffen, und damit haben sie sich das Urteil gesprochen, dass sie Rosenkreuzer sind.«
Denn so war es. Die Rosenkreuzer, die unter modernen Theosophen noch jetzt bestehen mögen, tranken und trinken nur Regenwasser, das sie möglichst rein aufzufangen suchen, erst nach einem starken oder längeren Regenguss. Diesem vom Himmel kommenden Wasser schreiben sie ihre ›innere Reinheit‹ zu, durch die sie zu höheren Dingen fähig sind, hierdurch wollen sie auch ein sehr hohes Alter erreichen.
Und hieran ist etwas, wenigstens der Theorie nach, was wohl einer kleinen Besprechung würdig ist.
Was ist eigentlich das Altern? Wir wissen es nicht. Was über die Abnahme der Lebenskraft gesprochen wird, sind nur leere Worte. Wir wissen nicht, was Lebenskraft ist, wie das entsteht und wie und warum es wieder vergeht. Wohl aber kennen wir recht gut die Erscheinungen des Alterns. Die Runzeln, die Erschlaffung der Haut und der anderen Zellengewebe ließe man sich noch gefallen, wenn nur die Glieder, die Knochen nicht so steif würden. Das Altern ist, das ist wohl die richtigste Definition, eine allmähliche Verkalkung des ganzen Körpers. Dass die Knochen des Kindes so biegsam sind und mit dem Altern hart und immer härter werden, das ist die auffälligste Erscheinung, davon hängt alles andere ab. Auch beim alten Manne können Fleischwunden noch recht gut heilen, aber ein Fall mit Knochenbruch hat bei ihm etwas ganz anderes zu bedeuten als bei einem Kinde. Und die Verkalkung bleibt nicht nur bei den Knochen, sie ergreift auch andere Teile, an den Fingergelenken entstehen Kalkknorpel, die Adern verkalken, wodurch der Schlagfluss entsteht, durch Verkrustung der inneren Gehirnschale entsteht Gehirnerweichung, das Kindischwerden im Alter ist ebenfalls eine Folge der Verkalkung der Äderchen im Gehirn, dieses kann nicht mehr genügend mit Blut ernährt werden.
Wie kommt dieser Kalk in den Körper? Durch jede Speise, hauptsächlich aber durch das Trinkwasser. Wir trinken meist Quellwasser. welches sehr viel Kalk enthält, meist kohlensauren. Es ist manchmal so ›hart‹, dass es zum Waschen der Wäsche und zum Kochen von Hülsenfrüchten ganz untauglich ist. Deshalb setzen wir ihm Soda zu. Über die chemische Veränderung hierbei wollen wir nicht sprechen. Für Nahrungszwecke aber hätte dieses Zusetzen von Soda oder einfachem oder doppelkohlensaurem Natron gar keinen Zweck. Der nun einmal im Wasser enthaltene Kalk wird dennoch vom Körper absorbiert, wenigstens zum großen Teil. Das kann man nachweisen.
So gelangt besonders durch das Trinkwasser, dessen der Mensch täglich ungefähr zwei Liter bedarf, gleichgültig ob als reines Wasser oder als Bier oder als Kaffee oder sonst etwas, sehr viel Kalk in den Körper, macht die Knochen immer härter, verkalkt zuletzt auch die Adern.
Sollte es nicht möglich sein, diesen überflüssigen und sicher überschüssigen Kalk, der nach und nach unsere Knochen so ungelenk macht, wieder zu entfernen und gewissermaßen eine Verjüngung herbeizuführen?
Der Verfasser hat dies nicht von sich, es ist aber auch keine ärztliche Erkenntnis, sondern die diesbezügliche Theorie, deren Richtigkeit auch schon in der Praxis erprobt worden ist, stammt von Männern, die man vielfach als träumerische Narren verspottet: von den modernen Theosophen und mehr noch von den Mitgliedern einer Sekte, zumal in Amerika verbreitet, die sich ›Neugedankenbewegung‹ nennt. Eine Abart der indischen Theosophie.
Sie sind zuerst darauf gekommen, als sie das alte Sektenwesen der Rosenkreuzer studierten. Die meisten von diesen sollen — und das lässt sich ja auch noch als Tatsache nachweisen — ein sehr hohes Alter erreicht haben. Hundert Jahre bei vollkommener Frische des Körpers und des Geistes waren keine Seltenheit.
Dass die Rosenkreuzer nur ›Himmelstau‹ tranken, das heißt Regenwasser, obgleich sie auch wirklich den Morgentau gesammelt haben mögen, war immer bekannt. Aber das galt immer nur als eine mysteriöse Handlung in ihrer an strenge Vorschriften gebundenen Lebensweise. Erst diese amerikanischen Neugedankler, die allermodernsten Mystiker, haben darauf hingewiesen, dass daraus das sprichwörtlich gewesene hohe Alter aller derjenigen, die gewürdigt wurden, in den Geheimbund der Rosenkreuzer aufgenommen zu werden, zu erklären sei. So entstand neuerdings die Theorie, wie das reichliche Trinken von Regenwasser die Verkalkung des Körpers hemme, den überflüssigen Kalk sogar wieder herausschaffe; zur Bekräftigung der Richtigkeit dieser Theorie haben die Neugedankler durch umfassende Statistik, hauptsächlich in England angestellt, nachgewiesen, wie alle die Gegenden, die dafür bekannt sind, dass die dort ständig lebenden Personen ein hohes, gesundes Alter erreichen, ein vorzüglich reines, sehr wenig Kalk haltendes Wasser haben, und die Neugedankler haben auch langjährige Experimente angestellt.
Was man da von Verjüngungskuren zu lesen bekommt, klingt etwas märchenhaft. Unsere Zeitungen tun vielleicht ganz recht, wenn sie solche Berichte nicht wiedergeben, obgleich es wieder ein Fehler von uns Deutschen ist, dass wir immer alles erst bezweifeln, als amerikanischen Humbug verspotten, um dann langsam nachzuhinken.
Eine zweiunddreißigjährige Dame, die schon starke Spuren des frühen Alterns zeigte, hat drei Jahre lang täglich fünf Liter Regenwasser getrunken, die Folge davon war, dass die Runzeln schwanden, die schon steif gewordenen Knochen wieder gelenkig wurden, kurz, sie blühte wieder auf.
Es ist dies das stärkste Beispiel. Größere Versuche sind auch noch nicht vorgenommen worden, die ganze Geschichte mit dem Regenwasser ist ja erst in den letzten Jahren entstanden, es mag ja auch etwas Übertreibung dabei sein.
Sei dem aber auch, wie es wolle — die ganze Sache hat eine zwingende Logik. Es ist bereits wissenschaftlich festgestellt worden, dass der Harn noch immer dieselbe Menge oxalsauren Kalk enthält, auch wenn dem Körper durch die Nahrung keine Spur von Kalk mehr zugeführt wird. Auf diese Weise wird also Kalk aus dem Körper entfernt, und wenn die zunehmende Menge des Kalkes eine Folge oder ein Zeichen des Alterns ist, gleichgültig ob Ursache oder Wirkung, so muss eine Verminderung des Kalkes eine Verjüngung, mindestens einen Stillstand des Alterns bedeuten. Das ist ganz logisch.
Das hat übrigens schon immer in der Luft gelegen. Daher schon immer die Obstkuren, bei denen man nicht Wasser trinken darf, bei welcher saftreichen Nahrung das andere Getränk ja auch überflüssig wird. Und was solch ein reichlicher Genuss von Äpfeln und Weintrauben auf längere Zeit zu bedeuten hat, das weiß ein jeder, der es einmal probiert hat. Man fühlt ganz deutlich, wie sich die Säfte im Körper verbessern, man wird wirklich jünger, körperlich und geistig. Und auch das Obst hat nur winzige Spuren von Kalk, der Saft aber das größte Vermögen, Kalksalze aufzulösen, diese also aus dem Körper herauszuschaffen.
Kann man den Saft des Obstes als von der Sonne destilliertes Wasser betrachten, so gilt das doch noch viel mehr von den atmosphärischen Niederschlägen. Der erste Regen ist ja mit Staubpartikelchen und Gasen, hauptsächlich mit Ammoniak, überladen, aber sehr bald ist er fast so rein wie destilliertes Wasser. Und vor diesem soll der Regen noch einen sehr großen Vorzug besitzen, eben weil er noch immer mit Luft gesättigt ist. Diese Theosophen und sonstigen modernen Mystiker sehen die Welt ja mit ganz anderen Augen an. Sie wittern überall Geist, bei ihnen gibt es nichts Totes, auch jedes Stück der Materie hat seine Seele. Und nun fällt jeder der späteren Regentropfen aus himmelhoher Höhe durch die reinste Luft, welche überhaupt möglich ist, jedes Tröpfchen ist gesättigt von dem Element, ohne das aus der Erde kein Leben existieren kann, durch welches das Leben erst entsteht, ist gesättigt von Sonnenwärme und Sonnenkraft — und daher soll Regenwasser das beste und einzige wahre Verjüngungselixier sein, welches es gibt.
Es hat, wie schon gesagt, alles Hand und Fuß. Jedenfalls kann es nichts schaden, einmal so eine Regenwassertrinkkur zu machen. Es ist ein ungefährliches Experiment. Man legt sich unter eine Dachrinne, sperrt's Maul auf und...
Doch Scherz beiseite! Reines Regenwasser ist überall zu haben. Nur darf man nicht erwarten, gleich am nächsten Tage zum Embryo zu werden.
Man braucht nun auch nicht gleich das Gelübde abzulegen, von jetzt ab nichts weiter als Regenwasser zu trinken. Das ist ja das Leiden im Charakter der Menschen, die von allen Lebewesen allein auch Herr über ihre Neigungen sind, dass sie niemals Maß halten können, immer gleich ins Extreme verfallen. Weil mit dem Alkohol Missbrauch getrieben wird, er seine schlimmen Eigenschaften hat, werden sie gleich totale Abstinenzler, und weil hin und wieder eine Enthaltsamkeit von Fleischgenuss dem Körper sehr zuträglich ist, möchten sie am liebsten jeden Tag einen Zentner Heu fressen.
Diese Ausführungen die länger geworden sind, als geplant, dürften wohl einmal angebracht gewesen sein. Also, wer es einmal mit täglich einigen Litern Regenwasser versuchen will... prost!!
Die beiden ehemaligen Akademiker hier kannten die Rosenkreuzer, wussten, dass sie immer nur Regenwasser getrunken und Wiesentau genascht hatten, wussten aber noch nichts von Arterienverkalkung und dergleichen, auch nicht, dass die Rosenkreuzer dieses Himmelswasser als Verjüngungs- oder Konservierungsmittel benutzt hatten. Das war für sie nur ein Symbol, womit die Rosenkreuzer ihre innere Reinheit beweisen wollten.
»Auch Lord Moore säuft aus der Regenwassertonne?«, war des prinzlichen Depeschenreiters nächste Frage.
»Na, so gar auffallend wird das nicht getrieben. Das Wasser kann doch auch erst filtriert werden, man kann doch auch Kaffee oder Tee damit kochen...«
»Und Grog davon machen.«
»Nee, du, das gibt's nun freilich nicht. Und überhaupt, da fällt mir ein: Alle diese Geheimbündler trinken nicht einmal mehr Kaffee oder Tee oder Schokolade — nichts als reines Himmelswasser.«
»Und auch Lord Walter Moore frisst nur noch Kraut und rohe Getreidekörner?«, interessierte sich Axel immer wieder nur für diesen.
»Wenigstens verschmäht er wie die anderen alle Fleischnahrung. Es muss für ihn besonders gekocht werden, nur Pflanzenkost.«
»Dann kann er freilich kein Depeschenreiter werden.«
»Was meinst du?«
»Ich dachte nur so«, wich Axel aus, mit einem Holzspänchen aus seinen Zähnen die letzten Reste des Schinkens und Schweinskopfes entfernend, »rohe Rüben und Getreidekörner wären nichts für mich. Ich bin mehr für tellergroße Beefsteaks. Ja, was treiben die denn nun aber des Nachts in dem Kloster?«
»Weiß man absolut nicht.«
»Da muss es doch einmal einen geben, der darüber schwatzt.«
»Ist noch nicht vorgekommen, das kann ich am besten versichern. Unsereiner erfährt ja hier sonst so manches.«
»Das ist merkwürdig, zumal so viele Frauenzimmer dabei sind. Sind es denn immer dieselben?«
»Nein, fast täglich kommen neue hinzu. Sie erhalten von dem Lord eine Einladung, und wenn sie hingehen, dann sind sie auch für den Geheimbund gewonnen.«
»Das ist noch merkwürdiger. Werden da vielleicht Orgien gefeiert, was?«
»Keine Ahnung. Glaube aber kaum. Die haben überhaupt alle so ein merkwürdiges Betragen angenommen.«
»Wieso?«
»Nun, nicht gerade, dass sie in Sack und Asche gehen, aber... sie zeigen jetzt alle so ein demütiges Betragen. Da ist zum Beispiel die Herzogin Borghesia — die wusste früher gar nicht, wie sie ihr Geld durchbringen sollte, wenn sie welches hatte — und jetzt hat sie gerade welches — aber die lebt mit einem Male zurückgezogen wie eine Nonne. Und so ist es mit allen anderen. Die geben alle gar keine Festlichkeiten mehr, zeigen keinen Prunk mehr, tragen, wenn sie auch nicht gerade ihre sonstige Tracht aufgegeben haben, keinen Fingerring. Es lässt sich schwer definieren.«
»Da lässt der Graf ihren Geldbeutel wohl tüchtig bluten?«
»Weiß ich nicht. Aber ich glaube kaum. Er selbst gibt ja gar nichts aus.«
»Hat er Geld?«
»Er gibt nichts aus.«
»Sein Unterhalt kostet aber doch Geld, er hat doch so viele Diener, wer bezahlt denn das?«
»Alle Rechnungen kommen in die englische Gesandtschaft, der Lord begleicht sie.«
»So so. Und was sagt nun zu alldem der Papst?«
»Ach der — unser Benedikt ist ja eine Seele von einem Menschen, die Gutmütigkeit selbst.«
»Trotzdem, dass hier solche Geheimbündelei getrieben wird, womöglich gar Rosenkreuzerei, hier im heiligen Rom selbst, das ist doch nicht angängig. Oder macht da der Papst etwa gar selbst mit?«
»Nein, das nicht. Ganz im Gegenteil. Wie gesagt, unsereiner, der hier immer Wache hat, erfährt ja so manches, was sonst nicht an die Öffentlichkeit kommen darf. Wenn die Kardinäle und Prälaten in den Bogengängen promenieren, erlauscht man doch manches, und wenn es auch nicht das Wichtigste sein mag, so ist es doch gerade genug.«
»Und was ist das zum Beispiel?«
»Der Graf von Saint-Germain hat sich von jeher die größte Mühe gegeben, beim heiligen Vater wenigstens einmal eine Audienz zu bekommen. Zwar nicht selbst hat er sich darum bemüht, sondern immer durch Vermittler. Lord Moore hat anfangs fortwährend davon begonnen, auch der Fürstbischof...«
»Was, auch der Fürstbischof von Rom gehört mit zu dem Geheimbund?!«, rief Axel überrascht, wenn auch mit unterdrückter Stimme.
»Der verpasst keinen Abend, um durch die englische Gesandtschaft in dem geheimnisvollen Kloster zu verschwinden. Allerdings ist das der einzige Prälat, der da mitmacht, freilich auch gleich der mächtigste. Alle übrigen Prälaten halten sich der ganzen Geschichte ängstlich fern, ebenso wie die Kardinale. Da wird der Papst wohl schon scharfe Instruktionen gegeben haben. Wer von den kirchlichen Größen aber schon einmal in dem Zauberkloster verkehrt, der wird trotzdem in Ruhe gelassen. Das ist nun einmal so die Art dieses über alle Maßen toleranten Benediktus. Nur keine Aufregung, von einem öffentlichen Skandal gar nicht zu sprechen. Trotzdem, wie ich schon sagte, zu einem Krach kommt es doch einmal....«
»Erlaube erst — Benedikt lässt sich nicht bewegen, den Grafen zu empfangen?«
»Der Name des Wundermannes darf in seiner Gegenwart gar nicht mehr erwähnt werden.«
»Und wie verkehrt er jetzt mit dem englischen Gesandten?«
»Ja, mit der dicken Freundschaft ist es schon längst vorbei. Der Lord kommt nicht mehr jeden Morgen, um mit dem heiligen Vater ein Stündchen zu plaudern, wobei er eine Pfeife rauchen durfte oder musste — er kommt nur noch, wenn er eine diplomatische Verhandlung hat, selten genug, und dann geht es ganz formell zu. Möglich aber, dass dieses neue Verhalten erst der Lord eingeführt hat. Denn Benedikt ist doch sonst gar nicht so. Dazu ist er ja entweder viel zu gut oder viel zu klug. Den Fürstbischof zum Beispiel empfängt er freundlich nach wie vor. Nur kein Wort wegen des Grafen, aber auch wieder kein Verbot, in dem Kloster zu verkehren. Dieses Verbot haben offenbar nur diejenigen bekommen, die noch nicht drin gewesen sind. Denn, scheint mir, und so wird ja auch in den Bogengängen ganz offen gesprochen, wer einmal mit dem Zaubergrafen in Berührung gekommen ist, der befindet sich ganz in seinem Banne, wird von ihm wie in ehernen Fesseln gehalten, die auch im Beichtstuhl nicht zu brechen sind. Deshalb sollen die, bei denen das noch nicht der Fall ist, gar nicht erst in Versuchung kommen.«
»Seltsam, ganz seltsam!«, meinte der Depeschenreiter kopfschüttelnd. »Was für ein Zauber mag das nur sein, den dieser Mann gebraucht? Nimmt er einen Schwur ab?«
»Der würde im Beichtstuhle wohl nicht standhalten. Du sagst es ja selber: Es ist eben ein Zauber.«
»Dass man sich aber hier nur solch eine Geheimbündelei gefallen lässt!«
»O, es wird schon noch einmal zum Krach kommen, das dauert gar nicht lange mehr.«
»Von diesem Krache hast du nun schon ein paar Mal angefangen.«
»Du selbst hast mich ja niemals aussprechen lassen, wenn ich davon beginnen wollte.«
»Nun, und?«
»Der Zaubergraf wird nächstens einfach ausgewiesen. Der Jesuitengeneral hat darum nachgesucht, in dem Spukkloster eine Schule errichten zu dürfen, für zukünftige Jesuiten, und ich weiß, dass er die Erlaubnis vom Papst hierzu bereits bekommen hat. Aus dem Kloster heraus muss der Graf also auf alle Fälle. Dann aber habe ich auch schon etwas davon munkeln hören, dass er ganz aus dem Kirchenstaate verbannt wird, und das hat zu bedeuten, dass er auch in jedem anderen katholischen Reiche unmöglich ist. Das wird wohl die einzige Maßregel sein, die der Papst gegen ihn trifft — das genügt aber auch schon.«
»Und was ist es nun mit der polnischen Prinzessin?«
»Die ist noch immer in Palo beim Kapitän Morphin, Lord Moore besucht sie hin und wieder. Die beiden sind eben ein Paar.«
»Eine Heirat?«
»Weiß nicht, ob es so weit kommt, und ob es überhaupt möglich ist. Jedenfalls kann das noch eine ganz schlimme Geschichte werden.«
»Wieso?«
»Hast du nichts darüber in London gehört?«
»Gar nichts.«
»Solltest du deswegen auch nichts in deiner Depeschentasche gehabt haben?«
»Und wenn ich es wüsste, so würde ich doch nicht darüber sprechen.«
»Hast du dem Lord seine Entlassung gebracht?«
»Nun kein Wort mehr hierüber!«, sagte Axel unmutig. »Du kennst schlecht die Verpflichtungen eines Depeschenreiters, wenn du so fragst. Und wenn das, was du als päpstlicher Hauptmann hier erlauscht hast, Geheimnisse sind, so will ich auch gar nichts davon hören.«
»Das wegen der Prinzessin und überhaupt wegen Palo ist ein ganz öffentliches Geheimnis oder überhaupt keins. Dass die Prinzessin, von Jugend auf für das Kloster bestimmt, plötzlich entflohen ist und in Palo bei einem fremden Manne Schutz gefunden hat, der ihre Herausgabe einfach verweigert, hier dicht an der Grenze des Kirchenstaates, ist ja, besonders wenn man die Verhältnisse kennt, ganz ungeheuerlich, aber es ist auch gar nichts dagegen zu machen. Du kennst doch die politischen Verhältnisse der kleinen Hafenstadt Palo?«
»So ziemlich. Es ist ein Freihafen mit eigener Verwaltung.«
»Ja, aber noch lange keine selbstständige Republik. Schon seit mehr als hundert Jahren geht der Streit um dieses kleine Nest, wem es eigentlich gehört. Es ist einmal durch Zufall bei den Friedensbedingungen vergessen worden. Der Kirchenstaat kann auf diesen Hafen genau so gut Anspruch machen wie Genua und wie Neapel. Es hat zu allen dreien einmal gehört. Um des lieben Friedens willen lässt man es seitdem ganz beiseite, tut, als wäre es wirklich eine freie Stadt mit eigener Verwaltung, schon mehr eine winzige Republik für sich. Jede Streitfrage deswegen würde sofort einen Krieg mit Genua und Neapel hervorrufen, und das ist die Tochter des polnischen Exkönigs denn doch nicht wert. So hat der Papst nur einen Boten zu Kapitän Morphin hinschicken können, mit der höflichen Frage, ob er die Prinzess nicht wieder herausgeben wolle. Vielleicht noch einige Vorstellungen, aber sonst nichts weiter. Und da der Kapitän natürlich Nein sagte, ist dagegen nichts zu machen, so lange die Prinzess nicht selbst will, die den Boten gar nicht vor sich ließ. Jetzt aber ist die Sache in ein anderes Stadium getreten. Weißt du, dass diese Polima die Schwester der französischen Königin ist?«
»Jawohl, das weiß ich.«
»So mischt sich jetzt Frankreich ein, ja auch mit einer gewissen Berechtigung. Ein mehrmaliger Notenwechsel per Schiff ist schon hin und her gegangen. Zuerst hat der französische König persönlich beim Papste, mit dem er ja nicht eben gut steht, anfragen lassen, ob er nicht die Macht habe, seine Schwägerin aus Palo zu holen, eventuell mit Waffengewalt. Dieselbe Anfrage ist aber auch an die Republik Genua und an das Königreich Neapel ergangen. Alle drei mussten antworten, dass Palo außerhalb ihrer Macht läge. Gut, hat hierauf Ludwig gesagt, so werde ich mir meine ungehorsame Schwägerin selbst aus Palo holen. Und damit wird es Ernst. Nach den letzten Nachrichten, die wir bekommen haben, durch einen schnellen Segler, ist eine französische Kriegsflotte bereits unterwegs, um Palo einzunehmen. Und was daraus wird, kannst du dir wohl denken. Wegen dieses Weibes wird wahrscheinlich ein Völkerkrieg entstehen, hier auf italienischem Boden. Der Kirchenstaat kann ja nicht viel dagegen machen, aber Genua und Neapel lassen sich nicht gefallen, dass ihnen dieser immerhin wichtige Hafen von einer anderen Macht nun definitiv weggenommen werden soll, und natürlich mischt sich dann auch wieder Österreich ein, und schließlich dann ebenso England.«
Dem internationalen Depeschenreiter schien dieser eventuelle Völkerkrieg sehr gleichgültig zu sein, er hatte gleich eine ganz andere Frage.
»Der Graf behauptet immer noch, dass er weder zu essen noch zu trinken braucht, alles, was er zur Ergänzung der verbrauchten Lebenskraft bedarf, direkt aus der atmosphärischen Luft bezieht?«
»Noch kein Mensch hat ihn essen und trinken sehen.«
»Was für Menschen sind das, die du meinst?«
»Seine Diener.«
»A bah«, sagte Axel verächtlich, »die werden doch nicht gegen ihren Herrn zeugen, wenn der sie zu behandeln weiß! Und das wird dieser Graf schon verstehen. Nein, hat er schon den definitiven Beweis geliefert, dass er keiner Nahrung bedarf? Hat er sich öffentlich einmal eine Woche einsperren lassen?«
»Nein, du weißt doch, wie Lord Moore ihn zuerst hat...«
»Ich weiß es. Mit dem Lord ist eben auch nichts mehr zu machen. Hm, ich möchte gern einmal solch einer nächtlichen Versammlung in dem Kloster beiwohnen. Wenn man nun da des Nachts anklopft...«
»Ganz ausgeschlossen, dass jemand hereinkommt. Auch bei Tage nicht. Das haben schon viele versucht, besonders Engländer, hochangesehene Personen. Sie werden einfach abgewiesen, und wenn sie Vertreter ihres Landes sind. Es gibt keinen anderen Weg als durch die englische Gesandtschaft, da scheint aber der Eintritt auch ziemlich leicht zu sein. Dem Lord scheint daran gelegen zu sein, dem Wundergrafen möglichst viele neue Proselyten zuzuführen, also mit dessen eigenem Willen.«
»Aber dieser Weg dürfte mir jetzt verschlossen sein.«
»Warum? Solltest du als ein Mann, der dem Lord eine Depesche überbracht hat...«
»Nein, bei dem habe ich es verschüttet. Ich habe ihm gleich zu sehr die Wahrheit gesagt. Denn ich kann wohl einen Feind täuschen, sonst aber habe ich das Herz immer auf der Zunge.«
»Was für eine Wahrheit hast du ihm gesagt?«
»Meine Meinung über diesen Grafen. Doch lassen wir das. Ist in Rom der Kardinal Luigo?«
»Ja, er befindet sich gegenwärtig sogar hier im Vatikan. Was hast du denn mit diesem mächtigsten aller Kardinäle zu tun?«
»Hm«, brummte Axel nachdenklich, »ich möchte ihn gern einmal sprechen.«
»Du den Kardinal Luigo sprechen?«, wiederholte der andere in zweifelndem Staunen, dem auch etwas Spott beigemischt war. »Was meinst du denn, was dieser Kardinal zu bedeuten hat? Dann verlange doch lieber gleich den Papst zu sprechen. Und da nützt es nichts, auch wenn man deine eigentlichen Personalien kennt. Die haben hier in Rom gar nichts zu bedeuten. Nein, Junge, das schlage dir aus dem Kopfe...«
Da öffnete sich die Tür, auf der Schwelle erschien ein Greis, in eine violette Kutte gehüllt, die Ehrwürdigkeit und Majestät selbst.
Wie zum Tode erschrocken war der Hauptmann sofort aufgesprungen.
»Seine Eminenz der Kardinal Luigo — er kommt in meine Stube!«, flüsterte er.
Jener blickte nur auf den Depeschenreiter, der ebenfalls aufgestanden war, freilich ganz anders, in seiner phlegmatischen Weise.
»Signor Axel?«
»Zu dienen, Euer Eminenz«, kam es einmal recht höflich aus dem Munde des Depeschenreiters, wenn auch ohne weitere Ehrfurcht.
»Ich hörte, dass ihr Euch hier befindet. Habt Ihr Zeit?«
»Für Euer Eminenz habe ich immer Zeit.«
»Seid Ihr noch nicht verpflichtet?«
»Noch nicht.«
»Dann, bitte, folgt mir.«
Der Kardinal wandte sich, sporenklirrend folgte ihm der Depeschenreiter, während der Hauptmann noch lange Zeit ganz bestürzt dastand.
»Teufel«, machte er seinem grenzenlosen Staunen endlich Luft, »was für vornehme Bekanntschaft hat mein alter Kumpan! Denn das sah doch fast gerade so aus, als träfen sich zwei intime Freunde. Und dass er ein geborener Prinz ist, das hätte dabei gar nichts zu sagen. Diese Bekanntschaft muss eine viel nähere sein.«
Schon vor einer Stunde hatte sich die Gesellschaft. aus mehr als vierzig Köpfen bestehend, aus der englischen Gesandtschaft nach dem Kloster hinüberbegeben.
Der Graf hatte sie nicht empfangen, kümmerte sich auch jetzt nach einer Stunde noch immer nicht um sie.
Nur wenn neue hinzu kamen, empfing er diese persönlich, beschäftigte sich einige Zeit mit ihnen, mit jedem einzeln, bis sie dann in das eigentliche Heiligtum, obgleich dies noch nicht das Sanktuarium zu sein brauchte, eingeführt wurden. Die übrigen wussten schon immer, wohin sie sich zu begeben und was sie dort zu tun hatten, nämlich mysteriöse Übungen vornehmen, wie wir sie bald mit eigenen Augen beobachten werden.
Der Graf saß, in seinen roten Samttalar gehüllt, der also wie alle anderen Kleider aus der Garderobe des Lords stammte, in seinem alten, ursprünglichen Schreibzimmer, das er noch immer oft benutzte, und las beim Lampenscheine in einem handschriftlichen Pergamentbuche.
Es war dies ein Band jenes Hauptwerkes, auf das, wie schon erwähnt, der alte Adept Agrippa von Nettesheim so oft hinweist, was in seinem Nachlasse nicht gefunden worden ist, und zwar war es der Band, welcher magische, scheinbar übernatürliche Geheimnisse und Experimente, mit denen sogenannte Magier die Welt von jeher geblendet haben, auf natürliche Weise erklärt.
Doch in Wirklichkeit las der Graf nicht. Die Ellenbogen auf den Tisch und den Kopf in die Hände gestemmt, träumte er nur vor sich hin, und sein schönes Antlitz war schwermütiger denn je, bis seine Gedanken auch durch leise Worte ausgedrückt wurden.
»Ach, ich Unglücklicher! Da will ich nun die ganze Menschheit beglücken und schneide mich dabei immer tiefer ins eigene Fleisch!
Unter der Erde mein geliebtes Weib, von mir mit einem höllischen Betrug umgarnt — und mein noch geliebteres Kind im Sterben!
Und der edle Lord durch meine teuflischen Künste dem Verderben, der Schmach und Schande ausgesetzt, auch wenn er selbst nichts davon wissen will, das Gegenteil behauptet! Ach, es ist alles so ganz anders gekommen, als ich ursprünglich geplant habe!
Das aber ist der Fluch, den ich frevelhaft auf mich genommen habe...«
Ein starkes Klopfen unterbrach dieses Selbstgespräch, und mit einem Schreck, den man bei diesem Manne in Gegenwart einer anderen Person sonst nie wahrnahm, schlug er das Buch zu und warf es schnell in ein Schubfach des Schreibtisches, es verschließend und den Schlüssel einsteckend. Dabei war gar nicht hier an seiner Tür geklopft worden, sondern es war weit entfernt gewesen, ein eiserner Klopfer musste stark angeschlagen worden sein.
»Es begehrt jemand Einlass an dem Gartentor. Ganz zwecklos. Auch der erst Zugereiste muss doch sofort erfahren, dass es aus diese Weise keinen Zutritt bei mir gibt. Es gibt keinen anderen Weg als durch die englische Gesandtschaft.«
Da ward auch an seiner Tür geklopft. Jetzt hätte der Graf die geheimnisvolle Handschrift doch noch verbergen müssen.
»Herein!«
Der aus dem Korridor wachehabende Diener trat ein. Nicht der Page, der war jetzt anders beschäftigt.
Man sah dem Manne gleich an, dass er etwas Besonderes zu melden hatte. Er hatte ganz große Augen.
»Herr Graf, ein päpstlicher Nuntius!!«
Auch die schärfsten Augen hätten nicht bemerken können, wie furchtbar der Graf zusammenzuckte, denn das geschah nur innerlich. Und zwar war es ein freudiger Schreck.
Äußerlich blieb er ganz gelassen.
»Wer ist es? Ein Prälat? Du bist doch ein geborener Römer.«
»Es ist ein Mönch, mit verhülltem Gesicht, er lüftet nicht seine Kapuze, und so etwas dürfen wir doch auch nicht verlangen.«
»Hat er denn schon seine Vollmacht gezeigt?«
»Jawohl — ich selbst habe sie gesehen — und es stimmt — er hat eine päpstliche Vollmacht — ist ein päpstlicher Gesandter — ein ganz richtiger Nuntius — so gut, wie der Papst selbst.«
»Ich lasse bitten.«
»Hier in diesem Zimmer wollen Herr Graf ihn empfangen?«
»In diesem Zimmer.«
Als der Diener gegangen war, hatte sich der Graf schnell erhoben, mit plötzlich sprühenden Augen, ganz verklärt blickte er zur Decke empor.
»Ein päpstlicher Nuntius«, flüsterte er, »ein Bevollmächtiger des Papstes, so gut, wie der Papst selbst. Wenn der Beherrscher der Christenheit erst selbst zu unserem Bunde gehört, dann kann noch alles gut werden, dann habe ich gewonnenes Spiel! Und wer mir nur den kleinen Finger reicht, nur die Spitze davon, der gehört mir auch mit Leib und Seele!«
Der Graf traute sich also eine Fähigkeit zu, die man sonst nur dem Teufel zuschreibt.
Zwei Minuten später trat auf lautlosen Sohlen ein Mönch herein, in brauner Kutte, die Kapuze über den Kopf gezogen, die Öffnungen darin so klein, dass man nichts von den Augen sah. Es ist eine Folge der Optik, dass sonst hinter jeder Maske die Augen immer blitzen, mögen sie eigentlich auch noch so ausdruckslos sein. Hier war das also nicht der Fall.
Der in der Mitte stehende Graf hatte nicht einmal ein Neigen des Hauptes.
»Bevollmächtigter Seiner Heiligkeit des Papstes«, erklang es dumpf hinter der Kapuze.
»Ich muss erst um eine Legitimation bitten.«
Unter dem weiten Kuttenärmel kam eine Hand zum Vorschein, aber... ebenfalls mit einem braunen Handschuh bekleidet! Das musste gleich sehr auffallen. Sonst trugen Geistliche nur im strengsten Winter auf der Straße Handschuhe.
Die Hand hielt ein Pergament, welches von selbst ausrollte, ein großes Siegel hing daran.
Der Graf nahm es, las es, und machte doch eine ehrfürchtige Verbeugung, als er das Pergament, mit des Papstes eigenhändiger Unterschrift und Siegel versehen, zurückgab.
»Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung, bin Ihr untertänigster Diener. Wie darf ich anreden?«
»Signore«, erklang es dumpf und schroff.
»Wie Signore befehlen. Womit kann ich dem Signore dienen?«
»Mit einer Unterredung.«
»Bitte, wollen Signore Platz nehmen. «
Der Mönch, wie wir ihn einfach nennen wollen, setzte sich aus den zurechtgeschobenen Stuhl, wobei ein Paar Sandalen an bestrumpften Füßen und Gamaschen zum Vorschein kamen.
»Setzen auch Sie sich, Herr Graf.«
Dieser nahm gegenüber Platz.
»Sie werden mir als päpstlichem Nuntius nichts verweigern«, begann hierauf der Vermummte.
»Nichts, was in meiner Macht steht.«
»Werden mir Antworten auf alle meine Fragen geben.«
»Selbstverständlich.«
»Der Wahrheit gemäß.«
Das war eigentlich gleich etwas stark. Aber es war eben ein allmächtiger Nuntius. Der brauchte jetzt nur ein Wort zu sprechen, so musste der Graf augenblicklich mit Sack und Pack dieses Haus und Rom und den ganzen Kirchenstaat verlassen.
»Wenn Sie mich näher kennten, würden Sie dies ebenfalls für selbstverständlich finden. Ich spreche nur die Wahrheit.«
»Sie haben in diesem Kloster Gäste?«
»Ja.«
»Wie viele?«
»Zweiundvierzig.«
»Wer sind das? Wie heißen sie? Halt, nennen Sie nicht alle die Namen. So stark ist mein Gedächtnis nicht, um die alle im Kopfe zu behalten. Bitte, schreiben Sie nur alle die Namen mit Rang auf.«
»Ich habe die Liste gleich hier.«
Der Graf nahm aus einem Schubfach einen Bogen Papier, mit Namen bedeckt.
»Ich fertige jeden Abend solch eine Liste an. Diese sind nur heute hier. Soll ich noch die dazusetzen, welche sonst regelmäßig kommen, nur heute einmal daran verhindert sind?«
»Nein, danke, das genügt«, entgegnete der Mönch, nahm die Liste, warf nur einen Blick darauf und ließ sie ebenfalls in seinem Kuttenärmel verschwinden.
Dass er nicht wissen wollte, wer sonst noch hier verkehrte, war eigentlich merkwürdig. Aber er hielt sich eben nicht mit Kleinigkeiten auf.
»Diese Gäste kommen und gehen nur durch die englische Gesandtschaft?«
»Nur durch die englische Gesandtschaft«, bestätigte der Graf.
»Weshalb das?«
»Damit ich nicht von Neugierigen überlaufen werde.«
»Ein genügender Grund«, wurde hinter der Kapuze gleich beigestimmt, und einen gewöhnlichen Kopf hatte der Papst doch auch sicher nicht mit seiner Vollmacht ausgestattet und hierher geschickt.
»Sind heute Neue darunter, die sonst noch nicht hier waren?«
»Nein, heute nicht.«
»Gestern?«
»Gestern sind zwei Neue aufgenommen worden.«
»Aufgenommen, in was?«
»In unseren Bund.«
»Was für ein Bund ist das? Doch halt, ich erwarte hierauf keine Antwort! Ich will anders fragen. Die beiden, die gestern neu aufgenommen worden sind, gehören nun schon zu den Eingeweihten?«
»Vollkommen.«
»Und wenn ich Sie jetzt bitte, auch mich in diesen Bund aufzunehmen, so werde ich...«
»Innerhalb einer halben Stunde bei den übrigen sein, und man wird Ihnen keine Geheimnisse vorenthalten«, ergänzte der Graf.
»So bitte ich Sie, mich in diesen Bund aufzunnehmen.«
»Dann müssen Sie vom englischen Gesandten zu mir geführt werden«, war die ziemlich kecke Antwort.
»Herr Graf, ich bin...«
»Bitte, es war dies nur erst der Wahrheit gemäß geantwortet und Auskunft gegeben. Machen wir bei Ihnen eine Ausnahme, ich werde mir einbilden, Sie seien ebenfalls durch die englische Gesandtschaft gekommen, seien durch Lord Moore bei mir eingeführt worden.«
»So ist es recht. Also, Herr Graf, ich bitte, in Ihren Bund aufgenommen zu werden. Die vorher nötige Einleitung ist bereits erledigt.«
»Gut! Ich muss zunächst Ihr Gesicht sehen.«
»Aber meins bekommen Sie nicht zu sehen.«
Bei einem päpstlichen Nuntius war das eben immer etwas anderes.
»Auch Ihre Hand nicht?«
»Wozu das?«
»Ich verstehe mich auf die Handlinien, gebe viel darauf.«
»Herr Graf...«
»Bitte, ich verstehe die Ausnahme, die hier vorliegt, werde nicht mehr dagegen verstoßen. Wie ist Ihr Name? Ich frage jetzt also genau so, wie ich jeden anderen frage. Wie ist Ihr Name?«
»Giovanni Laperto.«
Es war natürlich nur ein aus der Luft gegriffener.
»Was für einen Beruf haben Sie?«
»Ich bin Glaskünstler, habe mir mit einem heißen Glasflusse arg Gesicht und Hände verbrannt, deshalb trage ich Verbände.«
Auf diese Weise war die Sache gleich geregelt.
»Weshalb wollen Sie unserem Bunde beitreten?«
»Weil ich gehört habe, dass man hier die wunderbarsten Dinge lernen kann.«
»Was für wunderbare Dinge?«
»Gold zu machen«, begann der Vermummte gleich mit der allgemeinen Hauptsache, »ein fabelhaftes Gedächtnis zu erreichen, Kranke heilen zu können — überhaupt magische Fähigkeiten, das sagt wohl alles.«
»Und Sie haben recht gehört, das kann man durch meine Anleitung erlernen.«
Es war ausgesprochen.
»Also, Sie sind wirklich im Besitze von magischen, übernatürlichen Fähigkeiten?«, vergewisserte sich der Mönch noch einmal.
»Ich bin es. Sind Sie davon unterrichtet, was ich damals an meinem ersten Tage in der englischen Gesandtschaft gezeigt habe?«
»Ja, davon habe ich ausführlich gehört.«
»Sie haben es nicht selbst gesehen?«
»Nein, ich gehörte nicht zu dieser exklusiven Gesellschaft.«
»Wissen Sie auch, wie ich schon vor Jahrtausenden gelebt habe?«
»Ich weiß es.«
»Wie ich mich manchmal absichtlich in einen längeren Todesschlaf versetze?«
»Auch das. Ich weiß, was jetzt ganz Rom weiß.«
»Jedes Experiment, welches mit der Magie zusammenhängt, darf ich nur ein einziges Mal ausführen.«
»Auch das ist mir bekannt. Weshalb aber das?«
»Eine Erklärung hierfür kann ich Ihnen nicht geben, Sie würden sie nicht verstehen. Erst wenn Sie selbst so weit sind, kommt Ihnen diese Erkenntnis von ganz allein, dann ist es aber mit Ihnen ebenso. Auch Sie können dann jedes derartige Experiment nur ein einziges Mal machen. Nämlich in jedem einzelnen Leben. Das ist der Grund, weshalb ich mich manchmal in Todesschlaf versetze. Um ein neues Leben zu beginnen, um wieder meinen Mitmenschen helfen zu können, was ich aber eben in jedem Falle nur ein einziges Mal kann. Verstehen Sie?«
»Nicht so ganz.«
»Was nicht?«
»Wenn Sie Ihren Mitmenschen so gern helfen, weshalb kürzen Sie da Ihren jeweiligen Lebenslauf nicht immer möglichst ab, fallen etwa alle acht Tage in einen Todesschlaf, um dann immer wieder eine Wunderkur auszuführen?«
»Weil auch mir da Schranken gesetzt sind. So ganz willkürlich kann ich das denn doch nicht bestimmen. Wie lange schlafen Sie täglich, Signore?«
»Sieben Stunden.«
»Können Sie auch, wenn Sie wollen, täglich zehn Stunden schlafen?«
»Nein, das bringe ich nicht fertig. Es sei denn, ich hätte einmal eine längere schlaflose Periode hinter mir.«
»Oder könnten Sie Ihren täglichen Schlaf auf nur vier Stunden verkürzen?«
»Ja, für einige Tage, dann aber müsste ich einmal längere Zeit ausschlafen.«
»Da sehen Sie! Und was für Sie und jeden anderen normalen Menschen vom täglichen Wachen und Schlafen gilt, das gilt bei mir vom Lebenslauf und Todesschlaf. Es ist sogar genau dasselbe Verhältnis. Etwa wie drei zu eins. Lebe ich einmal dreihundert Jahre, so muss ich auch hundert Jahre schlafen. Eine normale Lebensdauer muss ich überhaupt immer durchmachen. Ich kann nicht nur dreißig Jahre schlafen und zehn Jahre im Todesschlafe liegen, noch weniger nur drei und ein Jahr, so wenig wie ein normaler Mensch immer nur drei Stunden wachen und eine Stunde schlafen kann, das würde ihn bald völlig aufreiben, von drei Minuten und dann einer Minute gar nicht zu sprechen. Und an dieselben Gesetze sind auch meine Lebensläufe und Todesperioden gebunden.«
Wenn man nun einmal daran glaubte, dass der Graf wirklich immer solche lange Lebensperioden durchmachte, während deren er keinen natürlichen Schlaf brauchte, dann war das alles auch ganz logisch.
»Aber Sie haben ganz recht«, fuhr der Graf fort. »Es ist mein heißester Wunsch, meinen Mitmenschen noch mehr zu helfen, und jetzt habe ich das Mittel hierzu gefunden, habe es erst gelernt. Denn auch ich muss ständig lernen. In meinem vorigen Lebenslaufe konnte ich es noch nicht, da habe ich mich erst dazu in der Einsamkeit ausgebildet, nämlich um Schülern dasselbe zu lehren, was ich kann. In dieser neuen Lebensperiode mache ich zum ersten Male Schule. Verstehen Sie?«
»Ich verstehe. Dann kann auch jeder Ihrer Schüler eine Wunderkur ausführen?«
»So ist es.«
»Aber immer nur eine einzige.«
»Immer nur eine einzige. Weshalb, das wird, wie schon gesagt, jeder Schüler sofort begreifen, wenn er so weit ist.«
»Und wie lange dauert solch eine Ausbildung?«
»Das kommt ganz auf die Befähigung und noch mehr auf den Eifer, auf den guten Willen des Einzelnen an.«
»Ist die Ausbildung in einem Leben beendet?«
»Gewiss.«
»Weil es bei Ihnen so lange gedauert hat.«
»Ich aber habe jetzt ein besonderes Lehrprogramm. So ist es doch überall, zumal in jeder Wissenschaft. Bedenken Sie, was für ein kolossales Sammelmaterial dazu gehört, von den größten Geistern in vielen Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden, zusammenzutragen, was ein Universitätsprofessor, ja nur ein gewöhnlicher Volkslehrer seinen Schülern nur in einer einzigen Stunde vorträgt. Nehmen Sie etwa eine Geografiestunde über Asien an.«
»Auch dieses Gleichnis begreife ich. Und Ihre Schüler sollen wieder andere Schüler ausbilden können, so weit können sie von Ihnen in diesem einen Lebenslaufe auch schon gebracht werden.«
»So ist es!«, stimmte der Graf mit offenbar aufrichtiger Freude über das leichte Begreifen seines neuen Schülers bei.
»Dann werde auch ich unedle Metalle in Gold verwandeln können?«
»Sie werden es können, es aber nicht tun.«
»Weshalb nicht?«
»Ach, dass dieses rote Gold doch immer das Hauptziel der Menschen ist!«, rief der Graf in einer Art humoristischer Verzweiflung. »Sobald jemand hier...«
»Halt, bei mir sind Ihre weiteren Auseinandersetzungen nicht nötig. Ich weiß, weshalb ich dann kein Gold machen werde.«
»Nun?«
»Wenn ich die Fähigkeit dazu besitze, sie nur mühsam errungen habe, dann hat das Gold gar keinen Wert mehr für mich.«
»Na, endlich einmal einer, der gleich von selbst darauf kommt.«
»Aber andere Fragen habe ich doch noch.«
»Fragen Sie!«
»Auch ich werde dann keiner Nahrung mehr bedürfen?«
»Weder Speise noch Trank.«
»Auch ich werde Jahrhunderte leben können, um dann nach einem langen, künstlichen Todesschlafe mit vollem Bewusstsein zu erwachen?«
»Genau so wie ich.«
»Ich werde auch sonst magische Fähigkeiten erwerben?«
»Sie sollen Herr der Elemente werden, Sie sollen dem Sturm gebieten können, Sonne und Mond werden auf Ihren Befehl stille stehen.«
»Was, das könnten Sie auch?!«
»Ich kann es, aber ich tue es nicht.«
»Weil Sie sich den bestehenden Naturgesetzen, oder der Ordnung Gottes, wollen wir gleich sagen, fügen«, kam ihm der Mönch entgegen.
»Sie sind der einzige, dem ich deswegen keine lange Erklärung zu geben brauche, und das immer wieder. Trotzdem, meinen Schülern gebe ich häufig Proben meiner Macht, schon um sie aufzumuntern.«
»Wohlan, ich will Ihr Schüler werden!«, erklang es mit einiger Begeisterung hinter der Kapuze, und soll man denn nicht auch begeistert werden, wenn einem so etwas in Aussicht gestellt wird.
»Da habe ich erst noch einige Fragen und Bedingungen zu stellen.«
»Ich höre und werde antworten.«
»Der Grund, weshalb Sie solche magische Fähigkeiten besitzen wollen, muss der lauterste und uneigennützigste sein.«
»Er ist es.«
»Sie müssen es nur tun, um Ihren Mitmenschen helfen zu wollen.«
»Ich bin bereit dazu.«
»Müssen bereit sein, aus Liebe zu Ihren Mitmenschen alles, alles zu opfern.«
»Mein Geld und alles, alles, wenn ich diese magischen Fähigkeiten erringe.«
»Schon vorher, ehe Sie nur den kleinsten Erfolg sehen, müssen Sie bereit sein, alles hinzugeben.«
»Ich bin bereit dazu.«
Mehr Worte machte der Graf deswegen nicht, lachte auch nicht etwa: Ja, das sagen Sie jetzt! Das wäre auch töricht gewesen. Jede Umwandlung im Charakter, jede heroische Tat entspringt nur einem momentanen Entschlusse.
Und der Graf nahm aus einem Schränkchen des Sekretärs wieder eine schon entkorkte Flasche und zwei Gläser.
»Haben Sie vielleicht gehört, wie ich meine Diener engagiere?«
»Ich habe davon gehört.«
»Ich schließe mit ihnen gewissermaßen einen Bund, der durch einen Trunk Wein aus derselben Flasche bekräftigt wird. Dass ich bei dieser Gelegenheit einmal ein Glas Wein trinke, wundert Sie wohl nicht.«
»Durchaus nicht.«
»Dasselbe tue ich, wenn ich einen neuen Schüler aufnehme.«
Der Graf schenkte die beiden Gläser ein.
»Durch diesen gemeinsamen Trunk bin ich Ihr Lehrer, und Sie sind mein Schüler.«
Der Vermummte nahm das Glas in seine behandschuhte Rechte.
»Dazu muss ich aber meine Kapuze lüften, und da gestatten Sie wohl, dass ich mich umdrehe.«
»Bitte sehr.«
Der Mönch wandte sich im Stuhl, ohne aufzustehen, machte seinen Mund frei, setzte das Glas an die Lippen... und der Graf war so vorsichtig, sich etwas vorzubeugen, nur um sich zu vergewissern, dass jener auch wirklich trank.
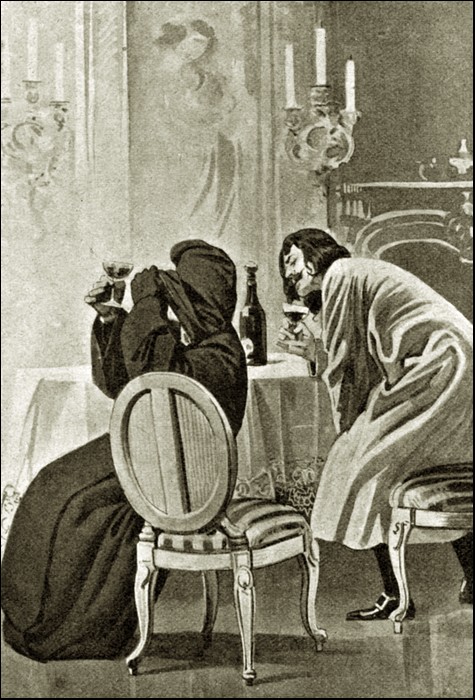
Ja, er hatte das ganze Glas mit einem Zuge geleert, der Graf, der sicher nicht so leicht zu täuschen war, hatte es ganz deutlich gesehen, und jetzt leerte auch er schnell sein Glas, ehe sich jener mit herabgelassener Kapuze wieder umkehrte.
Der Wein hatte diesmal ein noch viel stärkeres Betäubungsmittel enthalten als jener, den die Diener bekommen hatten. Der Mönch konnte sich gerade nur wieder zurechtsetzen, so ließ er auch schon die Hand mit dem Glase schlaff sinken, lehnte sich zurück, sein Kopf fiel auf die Brust.
Der Graf nahm ihm schnell das Glas aus der Hand, setzte es auf den Tisch, dann verschränkte er die Arme über der Brust und betrachtete mit triumphierender Miene sein Opfer.
»Der päpstliche Nuntius — willenlos in meiner Hand — und an mir liegt es nun, ihn so zu behandeln, dass ich den Papst selbst bemeistere. Das Spiel ist gewonnen!«
Noch eine halbe Minute wartete er, dann schlug er die Kapuze zurück.
Ein tiefgebräuntes Antlitz zeigte sich, von einem weißblonden Bärtchen geschmückt.
Der Graf schien maßlos erstaunt, und hier machte er kein Hehl daraus.
Ein langes Starren, und das Staunen verwandelte sich in Bestürzung.
»Ja, wie ist mir denn, das ist doch... jener junge Mensch, den ich vor vier Jahren...«
Er nahm die schlaffe Hand, streifte den Handschuh ab, besah aufmerksam die Innenfläche der braunen, muskulösen und dennoch feinen Hand.
»Gewiss, dass sind dieselben Handlinien, die bei jedem Menschen anders sind, und die sich niemals verändern — das ist kein anderer als der junge belgische Edelmann, Gustave de Beranger, den ich damals in der Nähe von Paris in einem Wäldchen fand, von Räubern angefallen, ich hielt ihn schon für tot, den ich dann in der Dorfschenke eine Woche lang pflegte, bis wir ihn sich selbst überlassen konnten, weil wir unsere Reise fortsetzen mussten!«
Der Leser weiß nun, dass es kein anderer als der Depeschenreiter Axel war, der hier als päpstlicher Nuntius auftrat.
Aber der Graf wusste es noch nicht, wusste auch nicht, dass es ein Depeschenreiter gewesen war, dem er damals das Leben gerettet hatte. Der zur Besinnung Gekommene hatte sich nicht verraten, hatte auch seinem Wohltäter gegenüber sein Geheimnis wahren müssen, hatte sich für einen belgischen Edelmann ausgegeben.
»Wie kommt der dazu, zu mir als päpstlicher Nuntius geschickt zu werden? Nun, ich werde es ja gleich erfahren. Erkannt kann er mich nicht haben, die vier Jahre haben aus mir einen völlig anderen Menschen gemacht, und außerdem kann ich ja jetzt dafür sorgen, dass er mich niemals erkennt oder nichts mehr davon weiß, falls er mich wirklich schon erkannt hätte, was ja aber ganz ausgeschlossen ist.«
Das hypnotische Experiment begann.
Wenn es noch einmal ausführlich geschildert wird, so hat das seinen besonderen Grund, wie der geneigte Leser bald erkennen wird.
Zunächst überzeugte sich der Graf, dass die Augen des Schlafenden ganz nach oben verdreht waren.
»Sie hören mich sprechen! Hören Sie mich sprechen?«
»Ja«, wurde gemurmelt.
»Sprechen Sie deutlich und geläufig! Wiederholen Sie! Was sollen Sie tun?«
»Deutlich und geläufig sprechen«, wurde auch dementsprechend wiederholt.
»Sie haben mir zu gehorchen! Wiederholen Sie selbststständig! Was sollen Sie tun?«
»Ich habe Ihnen zu gehorchen.«
Der Graf nahm eine lange Stecknadel.
»Ich habe hier eine Stecknadel, werde sie Ihnen in den Arm bohren.«
Sofort verzog sich das Gesicht schmerzhaft, schon schwache Bewegungen mit den Händen, um die Stecknadel abzuwehren.
»Seien Sie ruhig, Sie werden keinen Schmerz empfinden.«
»Keinen Schmerz empfinden«, wurde gehorsam wiederholt.
»Auch nicht den geringsten Schmerz! Verstanden?«
»Ich werde nicht den geringsten Schmerz empfinden.«
Der Graf stach die lange Nadel in den rechten Oberarm, bis zur Kuppe, zog sie mehrmals hin und her.
Offenbar wusste dieser Hypnotiseur mit seiner vielen Erfahrung eine Stelle zu treffen, an der keine Ader verletzt wurde, sodass kein Blut floss, damit der Erwachte die Folgen des Stiches nicht hinterher gewahrte. Der Schmerz selbst konnte ja auch für später heraushypnotisiert — wenn man sich so ausdrücken darf — werden.
Die Hauptsache war, dass der Schlafende mit keiner Wimper zuckte. Die Hypnose war eine perfekte. Ein anderes oder besseres Mittel, um zu prüfen, ob der hypnotische Schlaf echt oder erkünstelt ist, gibt es nicht — das heißt, der Graf kannte kein anderes. Wir werden dann noch ein besseres kennen lernen, eigentlich überhaupt das einzige.
»Sie werden jede meiner Fragen mit absoluter Wahrheit beantworten!«
»Mit absoluter Wahrheit.«
»Wie heißen Sie?«
»Giovanni Laperto.«
Dass er diesen doch nur vorgeblichen, wohl aus der Luft gegriffenen Namen nannte, trotzdem er willens war, ganz der Wahrheit gemäß zu antworten, war ganz folgerichtig. Die ganze Hypnotik ist ja durchaus keine Zauberei. Jetzt träumte er noch von seinem letzten wachen Zustande. Das musste der Graf erst regulieren.
»Was sind Sie?«
»Glaskünstler.«
Da war es ja schon.
»In Wirklichkeit heißen Sie doch aber gar nicht Giovanni Laperto.«
»Nein.«
»Wie ist Ihr wirklicher Name? Die absolute Wahrheit will ich wissen! Wer sind Sie?«
»Der Depeschenreiter Axel.«
Der Graf prallte fast zurück. Aus keinem andere Grunde, als weil er alles andere eher erwartet hätte, als dass sich dieser päpstliche Nuntius als der Depescheneiter Axel entpuppen würde.
Und der Graf hatte noch einen anderen Grund, diesen Mann mit finsteren Augen zu betrachten.
Wenn es in diesem Geheimbunde auch keine Ohrenbeichte geben mochte — vielleicht aber war es dennoch der Fall, auch die protestantischen Rosenkreuzer mussten ihren Oberen die weitestgehende Beichte ablegen — Lord Moore war nicht der Charakter, von einem Freunde etwas Übles zu hören, ohne dies dem Freunde zu sagen.
Lord Moore hatte dem Grafen gesagt, wie ihn jener Depeschenreiter einen Schwindler genannt habe, ohne eine Erklärung dafür zu geben, hatte die ganze Szene erzählt.
Wir haben diese Auseinandersetzung nicht dramatisch geschildert, sie war zu belanglos, jedenfalls hatte der Graf seinen Freund schnell genug zu überzeugen gewusst, dass er kein Schwindler und Betrüger war, und er hatte dem Lord für diese seine Offenheit, die keine Ohrenbläserei duldet, nur dankbar sein können.
»Sie sind der Depeschenreiter Axel?«
»Ja.«
»Sie haben heute Nachmittag dem englischen Gesandten die Depeschen aus London gebracht?«
»Ja.«
»Dabei haben Sie im Laufe des Gespräches zu dem Lord gesagt, er sei sehr zu bedauern. Entsinnen Sie sich?«
»Es sei jammerschade um ihn«, konnte der Hypnotisierte auch im Traume immer selbstständiger denken.
»Weshalb sei es jammerschade um den Lord?«
»Weil er davongejagt würde.«
»Das ist nicht der eigentliche Grund Ihres Bedauerns.«
»Doch.«
»Aber die Ursache hierzu ist eine andere. Nicht wahr? Denken Sie nach.«
»Weil er sich von dem Grafen von Saint-Germain mystifizieren lässt«, erklang es nach einer kleinen Pause.
»Sie nannten diesen Grafen einen Schwindler und Betrüger.«
»Ja.«
»Was für einen Grund haben Sie dazu?«
»Weil er einer ist.«
»Inwiefern?«
»Weil er Gold machen und Geister beschwören können will.«
Diese Erklärung genügte eigentlich schon vollkommen.
»Sie glauben an nichts Übernatürliches?«
»Nein, so etwas gibt es nicht.«
Gut, hieran ließ sich der Graf genügen, der die Menschen ja kannte. Er hatte auch Wichtigeres zu fragen.
»Der Graf von Saint-Germain bin ich selbst.«
»Ja.«
»Erkennen Sie mich?«
Die Antwort blieb aus.
»Haben Sie mich früher schon einmal gesehen?«
»Nein.«
»Erinnern Sie sich, vor vier Jahren, es war im April, wie Sie einige Meilen vor Paris von Räubern überfallen wurden?«
»Und ob ich mich erinnere!«
»Sie, halbtot geschlagen, wurden von zwei Herren in einem Wäldchen gefunden, in ihre Postkutsche genommen...«
»Da war ich ohne Bewusstsein«, konnte der Schlafende im Traume immer selbstständiger denken.
»Als Sie wieder zu sich kamen, befanden Sie sich in einer Dorfschenke. Der alte Herr kümmerte sich nicht viel um Sie, aber der jüngere ist eine Woche lang, bis er Sie verlassen durfte, nicht von Ihrem Bette gewichen. Erinnern Sie sich?«
Das Gesicht des Schlafenden nahm einen förmlich verklärten Ausdruck an.
»Und ob ich mich noch erinnere!«, wiederholte er wie vorhin.
»Was ist Ihnen so angenehm bei dieser Erinnerung?«
»Dieser Jüngling erschien mir wie ein vom Himmel herabgestiegener Engel.«
»Weshalb?«
»Über was wir uns während dieser Woche alles unterhalten haben!«
»Worüber denn?«
»Über die höchsten Ideale der Menschheit, wie durch die wahre, uneigennützige Liebe alles Elend von dieser Erde zu verbannen sei, dass sie sich wieder in ein Paradies verwandle.«
»Das machte aus Sie so großen Eindruck?«
»Ja, ich schwärmte mit, und... ich war krank, todkrank, da hat man immer einen ganz anderen Charakter.«
»Richtig. Aber jetzt denken Sie wieder anders?«
»Ich träume noch gern von jenen Stunden, da ich für ein unerreichbares Ideal schwärmte.«
»Sie halten es für unerreichbar?«
»Ja.«
»Nun gut. Das ist jetzt Nebensache. Wie nannte sich der junge Mann?«
»Charles Renard.«
»Aber...?«
»Der alte Herr sollte sein Vater sein, da aber hörte ich zufällig einmal, wie dieser ihn Adolf nannte, und auf meine Frage hin gestand mir jener, dass der alte Herr gar nicht sein Vater sei, die beiden hätten einen Grund, unter falschem Namen zu reisen.«
»Was offenbarte er Ihnen sonst noch?«
»Nichts weiter, ich wollte nichts mehr wissen, es genügte mir.«
»Dieser Charles Renard, den Sie einst so verehrten, bin ich selbst.«
Das größte Staunen im Gesicht des Hypnotisierten.
»Sie, der Graf von Saint-Germain?!«
»Ja.«
»Es ist nicht möglich!!«
»Es ist so, und ich befehle Ihnen überdies, es zu glauben.«
»Ich glaube es«, wurde sofort mit gehorsamer Miene gemurmelt.
Dem Grafen konnte nichts daran gelegen sein, von jenem auch im wachen Zustande wiedererkannt zu werden, er hatte doch hundert Jahre lang im Zinksarge zu Rom gelegen, hatte diesen vor acht Wochen erst wieder verlassen — aber um dem Schlafenden diese Erinnerung wieder herauszuhypnotisieren, dazu war ja noch Zeit.
Jetzt musste der Graf zur eigentlichen Hauptsache kommen.
»Wie kommen Sie dazu, zu mir als päpstlicher Bevollmächtigter geschickt zu werden?«
»Ich soll mich als Ihr Schüler aufnehmen lassen und dann berichten, was hier in diesem Kloster des Nachts getrieben wird.«
»Ja, aber wie ist die Wahl gerade auf Sie, einen einfachen Depeschenreiter, gefallen?«
»Der Kardinal Luigo schlug mich dem Papste vor.«
»Der Kardinal Luigo kennt Sie?«
»Sehr gut.«
»Woher?«
»Vor zwei Jahren begleitete ich ihn als Schutz von Mailand nach Rom. Es war eine sehr schwierige Reise, durch Feindesland, der Kardinal wurde noch ganz besonders verfolgt, ich hatte die größte Mühe, ihn überall glücklich durchzubringen.«
»Und dabei haben Sie natürlich die nähere Bekanntschaft des Kardinals gemacht und sein Vertrauen gewonnen.«
»So ist es.«
Alles Weitere war dem Grafen nun ganz klar, er hätte deswegen gar nicht weiter zu fragen brauchen. Auf solch einer gefährlichen Kriegsreise lernt man doch einen Menschen kennen, und wer wusste, was für Bravourstückchen dieser Depeschenreiter dabei ausgeführt, was für Beweise von seiner Ausdauer, Kühnheit, List und unbestechlichen Treue er dem Kardinal dabei geliefert hatte.
Sollte der Papst nicht schon manchen Vertrauten in das Kloster geschickt haben, mit der geheimen Mission, sich von dem Grafen als Schüler aufnehmen zu lassen und ihm dann zu berichten, was hier getrieben würde?
Wir wissen es nicht, aber wir können es mit Sicherheit annehmen. Die Sache war nur die, dass der Graf durch seine nur ihm bekannte Kunst, die wir heute Hypnotik nennen, diesen Abgesandten stets auszuhorchen und dann auf seine Seite zu bringen wusste, und er hatte gar nicht nötig, solch einem Spion das Ehrenwort oder einen Schwur abzunehmen, er verbot ihm ganz einfach durch posthypnotischen Befehl, etwas von dem hier Gehörten und Geschauten zu verraten, und dem Spion war der Mund für immer geschlossen, vor dem Papste sowohl wie im Beichtstuhle, vielleicht selbst unter der Folter.
Nun hatte man es noch einmal mit diesem von allen Hunden gehetzten Depeschenreiter versucht, dessen außerordentliche Fähigkeiten wenigstens der erste Kardinal schon persönlich kennen gelernt hatte.
Der Graf kalkulierte also ganz richtig. Nur zeigte er in diesem Falle einmal, dass er selber ein Mensch war, zu dessen verschiedenen Schwächen auch die Vergesslichkeit gehört; der Graf dachte nicht daran, den Depeschenreiter zu fragen, was er denn früher gewesen sei. Er hielt ihn eben für einen Mann des Volkes, der nun allerdings durch seinen eigenartigen Beruf etwas ganz Besonderes aus sich gemacht hatte — und das genügte ihm.
Außerdem musste sich der Graf wohl jetzt beeilen.
»Sie werden mir bedingungslos gehorchen, jetzt und immerdar!«
»Jetzt und immerdar.«
»Auch im wachenden Zustande.«
»Auch im wachenden Zustande.«
»Was ich Ihnen sage, das glauben Sie mir, und was ich Ihnen zu sehen befehle, das werden Sie erblicken.«
Das wurde noch ausführlicher behandelt.
»Öffnen Sie die Augen!«, war der nächste Befehl.
Die Lider des Schlafenden gingen hoch, er zeigte seine ganz nach oben verdrehten Augen.
»Blicken Sie mich an!«
Es war mit einiger Schwierigkeit verbunden, aber es gelang — der Schlafende blickte mit normalen Augen geradeaus. Das ist in der Hypnose alles möglich.
»Sehen Sie mich?«
»Ja.«
»Was mache ich jetzt?«
»Sie heben Ihre Hand.«
»Welche Hand?«
»Die rechte.«
»Was habe ich in dieser Hand?«
»Nichts.«
»Doch, einen Apfel.«
»Ja, einen Apfel.«
»Einen großen, schönen, rotwangigen Apfel.«
»Einen großen, schönen, rotwangigen Apfel«, wurde gehorsam wiederholt.
»Jetzt aber verwandelt sich dieser Apfel in einen Vogel, in einen Sperling.«
Das Gesicht des mit offenen Augen Träumenden drückte das größte Staunen aus.
»Wie ist das möglich?«, murmelte er.
»Ja, das ist eben meine magische Kraft. Dieser Sperling lebt, nicht wahr?«
»Er lebt.«
»Woraus sehen Sie das?«
»Er sträubt sich in Ihrer Hand.«
Wenn der Traum einmal angeregt war, ging das naturgemäß alles weiter vor sich.
»Jetzt lasse ich den Sperling fliegen — er fliegt im Zimmer herum — sehen Sie es?«
Jawohl, staunend folgten die Augen einem eingebildeten Sperling, der im Zimmer herumflog. Da konnte er ja nun träumen, was er wollte — soweit es der Hypnotiseur erlaubte.
»Strecken Sie Ihre Hand aus — locken Sie den Vogel.«
Axel tat es, pfiff leise und sagte ›Mätzchen‹ und dergleichen.
»Der Sperling fliegt Ihnen auf die Hand — fassen Sie ihn — so... und nun haben Sie wieder den schönen, rotbäckigen Apfel in der Hand, nicht wahr?«
Grenzenloses Staunen.
»Essen Sie diesen Apfel!«
Der Hypnotisierte biss in die Luft und versicherte auf Befragen, dass der Apfel ausgezeichnet schmecke.
Das Experiment wurde zu Ende geführt, dem Schlafenden wurde suggeriert, erinnerungslos zu erwachen, so weit dies nötig war, es wurde ihm noch besonders befohlen, nichts von alledem zu verraten, was er hier erlebt hatte und noch zu sehen bekommen würde, auch nicht unter Folterqualen.
Wir wollen dies nicht alles ausführlich wiederholen. Jedenfalls vergaß der Graf in diesem Falle auch nicht das Geringste.
Dann erhielt der Hypnotisierte zwei Stichworte, die bei einer Unterhaltung niemals vorkommen. Bei dem einen musste er erinnerungslos erwachen, bei dem anderen sofort wieder in hypnotischen Schlaf fallen, aber auch nur, wenn der Graf selbst diese Worte aussprach.
Der Schlafende bekam wieder das geleerte Weinglas in die Hand.
»Sie haben soeben, sich von mir abwendend, den Wein getrunken, schlugen dann die Kapuze wieder zurück und wandten sich mir wieder zu. Von einer Sie befallenden Müdigkeit haben Sie auch nicht das Geringste bemerkt.«
»Nicht das Geringste.«
»Fühlen sich auch nachträglich nicht müde?«
»Gar nicht.«
»Sie wissen nicht anders, als dass Sie soeben das Glas Wem in ganz normaler Weise getrunken haben.«
»Ich weiß auch nichts anderes.«
Der Mönch schlug die Kapuze wieder herunter. Die Handschuhe hatte er schon vorher wieder übergestreift, sorgfältig darauf achtend, dass ihn nichts verraten konnte.
»Alekta!«
Der vermummte Mönch hob das leere Glas und setzte es langsam auf den Tisch, so wie der Graf das seine, das er wieder zur Hand genommen hatte.
»Der Bund ist geschlossen. Sie sind als mein Schüler aufgenommen.«
»Und Sie sollen an mir den eifrigsten haben.«
Der Graf hatte sich ihm wieder gegenübergesetzt.
»Also, Sie wollen magische Fähigkeiten erlangen?«
»Wessen sehnsüchtigster Wunsch wäre das nicht?«
»Und es ist doch so einfach, sie zu erlangen.«
»So einfach? Na, das bezweifle ich.«
»Haben Sie schon einmal einen mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestatteten Menschen gesehen?«
»Nein. Ich habe wohl schon öfters Vorstellungen von Magiern beigewohnt, aber das ließ sich schließlich alles mit taschenspielerischen Gaukeleien erklären, bin auch mehrmals selbst dabeigewesen, wie solche sogenannte Adepten, Goldmacher sowohl wie Geisterbeschwörer und dergleichen, als Betrüger entlarvt wurden.«
»Kennen Sie eine Person, die wirklich übernatürliche Fähigkeiten besaß, wirkliche Wunder verrichtete?«
»Sie meinen sich selbst?«
»Von mir jetzt gar nicht zu sprechen.«
»Jesus Christus dann?«
Während der Vermummte, der als päpstlicher Nuntius doch offenbar ein Geistlicher sein musste, diesen Namen ziemlich gleichgültig ausgesprochen hatte, vergaß der Graf nicht, sich zu verneigen und ein Kreuz vor der Brust zu schlagen.
»Sie sagen es. Unser Heiland.«
Sonst fragte er nicht, ob jener auch glaube, dass Christus die in den Evangelien beschriebenen Wunder wirklich ausgeführt habe. Einmal musste er doch eben annehmen, einen Geistlichen vor sich zu haben, der seinen Zweifel nie gestanden hätte, und dann war das damals noch gar nicht die Zeit für solche Zweifel.
»Und wodurch konnte Christus solche Wunder verrichten?«
»Weil er Gottes Sohn war.«
»Das ist nicht die richtige Antwort, die ich erwartete. Christus bezeichnete sich oft genug als einfachen Menschensohn, und er hat gesagt: Es werden welche kommen, die Größeres tun als ich.«
»Weil er sündenfrei lebte.«
»Das ist es, das wollte ich hören. Leben Sie sündenfrei, und die Engel vom Himmel steigen hernieder, um Ihnen zu dienen, und wenn Sie sprechen: Erhebe dich, Berg, und stürze dich ins Meer — er wird Ihnen gehorchen.«
»Sündenfrei leben«, wiederholte der Vermummte gedankenvoll, gleich auf die Hauptsache eingehend, »sehr leicht gesagt — doch eine Unmöglichkeit.«
»Aber man soll es versuchen, muss es wollen! Auf den Willen kommt es an! Besiege dich selbst, und du besiegst die ganze Welt. Wer hat schon jemals die ganze Welt besiegt? Noch niemand. Weil noch niemand sich selbst völlig besiegt hat. Christus allein hat ohne Fehl und Sünde gelebt, deshalb auch besaß er alle Macht des Himmels und der Erden. Wir sollen wenigstens mit aller Kraft danach streben, ihm nachzufolgen. Und wie tun wir das, wie leben wir ganz sündenfrei? Im Grunde genommen ist es höchst einfach. Indem wir die zehn Gebote halten. Nun sagen Sie mir die zehn Gebote her, setzen aber noch hinter jedem hinzu: auch nicht in Gedanken. Denn vor Gott ist auch der Gedanke schon Tat.«
Der Vermummte tat es, anfangs ohne weiteres hinzuzufügen. Bis er zum sechsten Gebot kam.
»Du sollst nicht ehebrechen — auch nicht in...«
Hier stockte er plötzlich.
»Nun, warum vollenden Sie nicht?«
»Die ersten fünf Gebote glaube ich halten zu können, dieses sechste nicht, am wenigsten in Gedanken.«
Es war ein großes Wort gewesen, das der Mönch ausgesprochen hatte, und der Graf wusste eine Antwort darauf.
»Dass Sie dieses Geständnis ablegen, das gereicht Ihrem Charakter zur höchsten Ehre. Das hat mir an dieser Stelle bei demselben Examen noch kein anderer Schüler gesagt, auch wenn ich von ihm wusste, dass er zum Halten dieses Gebotes am wenigsten befähigt, es täglich, stündlich übertritt. Und eben deswegen freue ich mich, Sie als meinen Schüler aufnehmen zu können und werde Ihrer Ausbildung ganz besondere Sorgfalt widmen, dass Sie schnellstens vorwärts kommen. Aber Sie brauchen ja auch noch gar nicht stark genug zu sein, um dieses sechste Gebot halten zu können, nur den festen Willen dazu sollen Sie haben.«
»Den habe ich.«
»So sind Sie bereits auf dem rechten Wege. Vollenden Sie die zehn Gebote!«
Der verkappte Mönch tat es, ohne noch Einwendungen zu machen.
»Tun Sie nun mit aller Kraft Ihr Möglichstes«, nahm der Graf wieder das Wort, »diese zehn Gebote zu halten, ohne sich beunruhigen zu lassen, wenn Sie eins davon übertreten. Es muss Ihnen wohl stets sehr leid tun, aber zerknirscht dürfen Sie deshalb niemals sein. Sie sind ein irdischer Mensch, der erst nach Vervollkommnung strebt. Nehmen wir nun speziell das fünfte Gebot an: Du sollst nicht töten — auch nicht in Gedanken. Ist da irgendwie angedeutet, dass es sich nur um unsere Mitmenschen handelt? Durchaus nicht. Nein, du sollst überhaupt kein lebendes Wesen töten — soweit es sich vermeiden lässt. Den Tod des Tieres aber, dessen Fleisch wir essen, haben wir auch verschuldet, und zwar gar nicht so indirekt. Also dürfen wir kein Fleisch essen. Und verstehen Sie wohl! Es gibt Menschen, die werden Vegetarier genannt, welche kein Fleisch essen, weil sie glauben, es sei ihrem Körper nicht zuträglich. Sie sind in der Meinung, die Natur selbst habe sie zu Pflanzenessern gemacht; der Geschmack an Fleisch sei eine barbarische Verirrung. Nein, diese Vegetarier befinden sich in einem Irrtume, in einem Wahne. Die Natur, oder sagen wir Gott, hat vielmehr den Menschen dazu bestimmt, dass er sowohl Fleisch wie Pflanzen genießen kann, denn nur dadurch ist er befähigt, wirklich der Herr der Erde zu werden. Nachdem der Mensch aber Herr der Erde geworden ist, sich als das bevorzugteste Exemplar der Schöpfung fühlt, in diesem Augenblick kommt für ihn noch eine andere Erkenntnis hinzu. Es ist die wahre Bedeutung des fünften Gebotes. Meinetwegen braucht und soll kein Tier zur Schlachtbank geführt werden, meinetwegen soll kein lebendiges Wesen irgendwelcher Art auch nur eine Spur von Schmerz empfinden und sein Leben lassen. Verstehen Sie, wie in meinen beiden so entgegengesetzten Behauptungen durchaus keine Inkonsequenz liegt?«
»Ich verstehe vollkommen, und es ist das Herrlichste, was ich je zu hören bekommen habe, obgleich es mir nicht so ganz neu ist.«
»Sie kennen wohl den Buddhismus?«
»Ja.«
»Wohl, es ist dieselbe Lehre, die ich meinen Schülern und Schülerinnen beibringe. Also, handeln Sie danach, enthalten Sie sich allen Fleischgenusses, nicht etwa aus Besorgnis um Ihre Gesundheit — das wäre schließlich doch nur Egoismus, der bis auf die kleinste Spur aus unserem Wesen verbannt werden muss — sondern immer in dem Gedanken, dass Ihretwegen kein Tier Schmerz und den Tod zu erleiden braucht. Noch mehr lassen Sie diesen Gedanken in Kraft treten, wenn Sie doch einmal Fleisch essen, was sich wohl kaum vermeiden lässt. Das oberste Gesetz, das uns beherrscht, muss immer die Vernunft bleiben, die ist das wahre Göttliche. Wären Sie einmal dem Hungertode ausgesetzt, Sie hätten nur Fleisch und wollten lieber Hungers sterben, so wäre das töricht, ungerecht, gottlos. Um anderen helfen zu können, müssen Sie zuerst immer Ihr eigenes Leben erhalten. Dann aber stillen Sie Ihren Hunger an dem Fleische mit dem schmerzlichen Gedanken, dass dieses unschuldige Tier Ihretwegen den Tod hat erleiden müssen, und je mehr Ihnen dabei der Bissen im Munde quillt, desto mehr zum Segen soll es Ihnen gereichen, allen Hypothesen oder Ansichten entgegen, welche Ärzte hierüber haben. Denn dann verdauen Sie nicht mit dem Munde und dem Magen, sondern mit der Seele, und die Kraft dieser Mysterie werden Sie an Ihrem eigenen Körper erfahren. Sonst kann man eine Mysterie überhaupt nicht weiter erklären.«
Der Mönch schwieg. Die Augenausschnitte in der Kapuze waren unverwandt auf den Sprecher gerichtet. Was sonst in seinem Innern vorging, konnte man so nicht wissen.
»Ebenso«, fuhr der Graf fort, »verschmähen Sie Butter, Milch und Eier, weil diese gleichfalls von Tieren stammen. Zwar bereiten Sie durch deren Genuss den Tieren nicht direkt Schmerzen, aber... seien Sie konsequent. Und schließlich zwingen wir dadurch die unschuldigen Tiere ja doch zu Unnatürlichkeiten. Wollen wir überhaupt nicht philosophieren. Den Segen, wenn Sie sich aus ethischen Gründen aller und jeder Fleischnahrung enthalten, werden Sie sehr bald verspüren. Wenn es so weit ist, dann können wir uns weiter darüber unterhalten. Enthalten Sie sich des Weines in jeder Form. Ferner empfehle ich Ihnen, nur noch Regenwasser zu trinken...«
»Wozu das?«
»Haben Sie von den Rosenkreuzern gehört?«
»Ja, und von ihnen weiß ich, dass sie nur Regenwasser tranken, das sie Himmelstau nannten.«
»Tun Sie dasselbe. Es ist keine Pflicht, aber ich empfehle es Ihnen. Den näheren Grund werden Sie von mir erfahren, wenn Sie die Folgen des reichlichen Trinkens von Regenwasser an Ihrem eigenen Körper verspüren, noch mehr an Ihrer Seele, an Ihrer inneren Spannkraft. Nun schließlich noch eins, mit die Hauptsache. Wir wollen nicht über Gott disputieren. Es wäre mir sogar gleichgültig, wenn Sie zu denen gehörten, welche überhaupt an Gott gar nicht glauben. Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geiste und in der Wahrheit anbeten. Alles und jedes ist Gott. Um Sie herum ist Gott. Gott ist in der Luft. Ohne Luft wäre kein Leben. Was wir in der Bibel mit Seele übersetzen, heißt im griechischen Urtext pneuma, was richtiger mit Luft übersetzt würde. An der Stelle, wo Gott dem ersten Menschen durch die Nase das Leben einbläst, wird dann auch einmal pneuma mit Odem übersetzt. Also, sage ich, ohne es jetzt weiter zu definieren: Gott und Luft und Odem ist alles eins. In der Luft, die wir einatmen, ist Gott, das Lebensprinzip, selbst. Bisher haben Sie immer unbewusst geatmet. Von jetzt an atmen Sie stets bewusst, und zwar nur durch die Nase. Sagen Sie sich bei jedem einzelnen Atemzuge: Jetzt atme ich Gott, das allmächtige und allgütige Lebensprinzip ein, jetzt fühle ich es durch meinen ganzen Körper strömen, jetzt sauge ich die ganze Kraft auf, alles für mich Unnütze und Schädliche stoße ich beim Ausatmen wieder aus, sauge neue Lebenskraft ein, und so fort. Dadurch werden die Atemzüge von ganz allein immer intensiver, es wird mit der Zeit zur Gewohnheit, zuletzt können Sie gar nicht mehr atmen, ohne dabei diese Gedanken zu haben, und Sie werden bald merken, wie trotzdem Ihr anderer Gedankengang dabei nicht im Geringsten gestört wird, und ebenso werden Sie bald die wunderbare Wirkung dieses Gottatmens verspüren, so wunderbar, dass sie aller Worte spottet. Lassen Sie sich daran vorläufig genügen. In diesem Falle muss erst die Praxis geübt werden.«
Der Graf hatte gesprochen. Es ist dies alles die Lehre der modernen Theosophen und amerikanischen Neugedankler, die sie aber auch erst von den Buddhisten übernommen haben. Und man darf doch nicht glauben, dass diese Lehre während der langen Zeit einmal verloren gegangen ist. Im Orient hat sie ja überhaupt immer gelebt, bis noch auf den heutigen Tag. Aber auch in den Büchern unserer mittelalterlichen Mystiker und Kirchenväter lässt sie sich immer wieder finden.
Und nun eine Behauptung: Dieser uralte buddhistische und selbst brahmanistische Mystizismus wird unseren ganzen heutigen Realismus und Materialismus verdrängen! Das wird gar nicht mehr so lange dauern. Wer Augen hat, zu sehen, der schaue um sich. Es gibt nichts Ewigbeständiges, auch nicht, und das sogar am wenigsten, in Gesinnungsrichtungen, in Weltanschauungen. Die sind sogar von den Strömungen der Mode gar nicht so verschieden. Und bei so etwas gibt es auch kein eine Verbindung herstellendes Mittelding. Extreme, Gegensätze berühren sich. Die meisten englischen und amerikanischen Tageszeitungen, welche in ihren Feuilletonromanen noch bis vor Kurzem dem krassesten Realismus gehuldigt haben, bringen bereits mit Vorliebe Romane mit rein mystischer Tendenz, und die englische Literatur ist — leider — stets tonangebend gewesen. Als Mittelding, als Übergangsstufe kann man vielleicht betrachten, wie sich gerade die scharfsinnigsten Denker nach und nach immer mehr vom Darwinismus abwenden. Die ganze realistische, sogenannte wissenschaftliche Weltanschauung hat sich ausgelebt, liegt im Sterben. An ihre Stelle wird der Mystizismus treten, nur leider auch gleich wieder gepaart mit dem größten Aberglauben. Das lässt sich nicht vermeiden. Die Folgezeit wird die Richtigkeit dieser Behauptung beweisen. Für den, der für so etwas sensitiv ist, liegt das alles in der Luft — —
»Mehr brauche ich Ihnen jetzt nicht zu sagen. Alles andere erfahren Sie nach und nach, was Sie tun müssen, um magische Fähigkeiten zu erwerben. Die Hauptsache ist immer: ein reines, keusches, sündenfreies Leben. Aber die Ehe wird nicht etwa von diesem Gebot betroffen. Missverstehen Sie mich da ja nicht. Die Ehe ist das heiligste Gebot der Natur, Gottes. Durch die Ehe wird der Mensch Gottschöpfer selbst. Aber auch in der Ehe muss die heilige Ordnung befolgt werden, welche die ganze Welt beherrscht, ohne die sie in ein wüstes Chaos versinken würde. Jetzt nehmen Sie an unseren gemeinsamen Übungen teil. Sie bestehen in dem geschilderten Atmen. Auf welche spezielle Weise, das werden Sie gleich sehen. Nebenbei wird auch noch etwas anderes geübt: Geisteskonzentration, das A und das O von allem Erfolg im menschlichen Leben. Hierbei ist ebenfalls etwas Mystisches, was ich Ihnen später ausführlich auseinandersetzen werde. Jetzt nur kurz folgendes: Der Gedanke ist eine ganz reelle Kraft. Je intensiver ein Gedanke gedacht wird, desto kräftiger wirkt er, bis zum Sichtbarwerden des Gedankens. Dasselbe ist der Fall, wenn viele Menschen zusammen nach vorheriger Abmachung mit bewusstem Willen und mit aller Kraft ein und denselben Gedanken denken. Für heute haben wir ausgemacht, intensiv den Wunsch zu haben, dass unser Bund gedeihen und möglichst viele Anhänger bekommen möge. Stellen Sie sich dann, wenn Sie die Gesellschaft sehen, lebhaft vor, wie sich der kleine Kreis immer mehr erweitere, immer mehr Ansehen gewinne. Das genügt vorläufig. Das denken Sie mit aller Kraft sowohl beim Einatmen wie beim Ausatmen, aber auch immer zugleich mit dem Bewusstsein, dass es der lebendige Gott selbst ist, den Sie in dem Atem durch Ihren Körper gehen lassen. Ist das Ihnen verständlich?«
»Sehr wohl, und das umso leichter, weil mir das nichts so gänzlich Neues ist.«
»Sie haben schon von solchen Übungen gehört?«
»Sie sind buddhistischen Ursprungs, auch die Jesuiten bedienen sich dieser allgemeinen Gedankenkonzentration, um für Ihre Unternehmungen Erfolg zu erzielen.«
»Ganz richtig. Ich habe nur eine etwas andere Methode. Wir fassen uns dabei an, was weder die Buddhisten noch die Jesuiten tun, und dazu ist es nötig, dass Sie die Handschuhe ausziehen.«
»Weshalb?«, fragte der Mönch mit leichtverständlichem Misstrauen.
»Es kommt auf eine körperliche Berührung an. Alles Weitere erkläre ich Ihnen später. Oder Sie versäumen diese Übung, was ich nicht gern möchte. Sie sollen sofort ein Bild von unserem Treiben bekommen. Sie brauchen mir Ihre Hände nicht zu zeigen, in dem Saal ist es ziemlich dunkel, Sie ziehen die Handschuhe unbemerkt aus, ergreifen die Hände der beiden Personen, zwischen denen ich Sie platziere. Dann können Sie Ihre Handschuhe sofort wieder anziehen. Nun, bitte, folgen Sie mir. Einige Instruktionen gebe ich Ihnen im Saale selbst.«
Sie verließen das Schreibzimmer, durchschritten den Korridor und betraten das Refektorium. Nach allem, was der päpstliche Nuntius schon gehört hatte, besonders zuletzt, musste er ja darauf vorbereitet sein, etwas ganz Mysteriöses zu sehen. So recht erfüllte sich das zwar nicht, es war kein Teufelsspuk und dergleichen, aber immerhin, er hatte nun einmal die mysteriöse Spannung in sich, und dem entsprach auch so ziemlich das, was er zu sehen bekam.
In dem geräumigen ehemaligen Refektorium, dessen nackte Wände mit Teppichen bekleidet waren, standen in weitem Kreise gegen fünfzig Stühle. Der Kreis hätte noch bedeutend erweitert werden können. Auf jedem Stuhle saß ein Herr oder eine Dame, welche durch Anfassen der Hände eine Kette bildeten. Gäste waren es ja nur zweiundvierzig, aber auch mehrere Diener des Grafen waren darunter, ebenso der kleine Joseph. Also sogar einige oder wahrscheinlich alle Diener gehörten mit zu dem geheimen Bunde, machten die mysteriösen Übungen mit, waren dann wohl auch in alles andere eingeweiht, so weit wenigstens die vornehmen Herrschaften schon eingeweiht waren.
Wenn nun einmal in einer Freimaurerloge — und um so etwas Ähnliches handelte es sich doch hier — auch Leute geringeren Standes aufgenommen werden, so ist es ganz selbstverständlich, dass diese wenigstens innerhalb der Loge, innerhalb der Versammlungen auch mit den vornehmsten Mitgliedern ganz gleichberechtigt sind. Höchstens können sie durch Rangunterschiede der Loge voneinander geschieden sein. Sonst aber muss in solch einem Bunde doch der Spruch gelten: Vor Gott sind wir alle gleich.
Sonst wäre die ganze Geschichte ja nur Mumpitz.
Diese Gleichberechtigung der dienenden Geister mit den Gästen war schon dadurch ausgedrückt, dass sie mitten unter ihnen saßen, wie es wohl nur der Zufall gefügt hatte.
Der kleine Joseph zum Beispiel, dieser verzwergte Herkules, der auf dem Stuhle seine Bratwurstbeine in der Luft baumeln ließ, hatte die eine seiner ziemlich schmutzigen Pfoten in der schneeweißen, zarten, reichberingten Hand einer Fürstin, die andere in der eines Herrn, die sich von jener gar nicht so viel unterschied.
Das Auffälligste nun war eine rotleuchtende Lampe, eine Ampel, die in der Mitte des Kreises von der sehr hohen Decke herabhing. Aber nicht bewegungslos, sondern sie ging immer auf und nieder, von der Decke herab etwa drei Meter tief und dann wieder bis dicht zur Decke empor.
Hätte man mit der Uhr gemessen, so würde man gefunden haben, dass sie zum Aufstieg acht Sekunden brauchte, dann blieb sie an der Decke zwei Sekunden halten, erreichte in dreizehn Sekunden ihren tiefsten Punkt, blieb zwei Sekunden stehen und ging wieder in die Höhe.
Nach diesen Bewegungen der Lampe wurde gemeinschaftlich durch die Nase geatmet. Beim Emporgehen ein, beim Heruntergehen aus, beim Stillstehen musste der Atem angehalten werden. Im Verhältnis waren diese Zeitlängen normal. Der Mensch atmet länger aus als ein, vor dem neuen Atemzug setzt die Lunge etwas aus. Nur die Ruhepause vor dem Ausatmen war anormal, mindestens ganz übertrieben lang. Und so ja überhaupt die ganze Langsamkeit des Atmens. Der erwachsene, normale Mensch atmet in der Minute durchschnittlich zwölfmal. Es soll zwischen neun und fünfzehn schwanken. Doch ist diese Bestimmung außerordentlich schwierig und trügerisch. Denn sobald man den Atem zählt, an sich oder einer anderen Person, bei der es niemals unauffällig geht, verlangsamt sich das Atmen unbewusst ganz bedeutend, und im Schlafe und im betäubten Zustande sind die Zeiten wieder ganz andere. Also im normalen Durchschnitt soll der erwachsene Mensch zu jedem vollständigen Atemzuge fünf Sekunden brauchen. Hier nach dem vorgeschriebenen Takte wurden dazu fünfundzwanzig Sekunden gefordert. Diese Länge ist selbstverständlich ganz und gar unnatürlich. Aber man braucht es nur zu probieren, man wird ja sehen, wie leicht es zu ermöglichen ist. Asthmatisch darf man dabei natürlich nicht sein. Aber wer dieses langsame Atmen täglich auch nur zehn Minuten übt, oder täglich zu drei verschiedenen Zeiten einige solche langsame Atemzüge tut, der wird tatsächlich zu ganz erstaunlichen Resultaten kommen. Nämlich wie sich das Atmen in kürzester Zeit ohne jede Beschwerde immer mehr verlangsamen lässt. Nach einer Woche Übung machen einem Atemzüge, die eine Minute lang währen, gar keine Mühe mehr. Und das geht immer weiter. Und zwar ganz von selbst. Ganz unbewusst atmet man immer und immer langsamer, schließlich auch im Schlafe.
Und das Resultat von diesem zuerst mit Absicht bedeutend verlangsamten Atmen?
Auch der deutsche Büchermarkt wird jetzt geradezu überschwemmt mit Schriften, welche die ›Mysterie des Atmens‹ behandeln. Meistenteils sind es Übersetzungen aus dem Englischen, am häufigsten aus Amerika kommend, aber wir haben auch schon deutsche Originalwerke genug, darunter allerdings viele, deren Veröffentlichungszweck vom Schwindel nicht weit entfernt ist, es gibt indes auch solche, gerade deutsche, die als Verfasser die größten ärztlichen und andere wissenschaftliche Kapazitäten haben.
Ja, es ist etwas mit dem Atmen. Es ist ein Unterschied, wie man atmet. Die Inder haben es seit uralten Zeiten gewusst und sich damit beschäftigt, aber es wurde als Geheimnis betrachtet, und gelangte es an die Öffentlichkeit, so wurde es nicht beachtet, oder die sich damit Beschäftigenden galten als Narren, so etwa wie einst Dr. Jenner mit seiner lächerlichen Pockenimpfung und andere mehr, oder es wurde vergessen — — kurz, jetzt fängt man an, diese ›Mysterie des Atmens‹ wieder aus der Rumpelkiste hervorzuholen. Der Mensch bleibt ja immer derselbe.
Alle jene genannten Schriften, soweit sie okkulten Inhalts sind und ihren Verfassern wenigstens ehrliche Überzeugung zuzutrauen ist, behandeln die ›Mysterie des Atmens‹ nur als einen Teil der vorzunehmenden magischen Übungen. Aber es ist auch die Hauptsache dabei, das Anfangsstudium. Man soll die Atemzüge immer länger und länger ausdehnen, allerdings ohne sich Qual zu bereiten, das kommt alles von ganz allein, und so soll man es so weit bringen, bis man Atemzüge von fünf und mehr Minuten Länge machen kann. Und wenn man schließlich überhaupt gar nicht mehr zu atmen braucht, so tritt das Überbewusstsein ein, in dem einem göttliche Dinge offenbart werden.
Aber schon vorher würde man erstaunliche Resultate wahrnehmen. Schon nach wenigen Tagen würden sich Veränderungen zeigen. Auch das sonst trübste Auge würde hell und strahlend, die Stimme volltönender, Hautausschläge verschwinden — und dann vor allen Dingen verschwänden etwaige Melancholie, eine ganz besondere Lebensfreudigkeit kehre in den sich Trainierenden ein, man fühle seine innere Spannkraft wachsen.
Der Schreiber dieses enthält sich hierüber jedes eigenen Urteils, deshalb spricht er in der Möglichkeitsform. Er erzählt nur, was in solchen Büchern zu lesen ist. Das aber kann er behaupten, dass solche Übungen, nicht das lange Atemanhalten, sondern das möglichst verzögerte Ein- und Ausatmen, dem Körper durchaus nicht schädlich sind. Das kann er verantworten.
Hier soll überhaupt nur eins konstatiert werden: dass der sogenannte Graf von Saint-Germain bei seinem ersten Auftreten in Rom wohl als der erste Mensch in Europa solche Atemübungen öffentlich treiben ließ, wenn auch in geschlossener Gesellschaft. Dies ist erwiesen, darüber berichten dann seine Zeitgenossen. Und hieraus lässt sich schließen, dass dieser Wundermann schon früher in Indien gewesen ist oder anderswo bei einem indischen Guru, das ist ein praktischer Lehrer der indischen Geheimwissenschaft, Yogi genannt, Unterricht genommen hat. Denn in der ganzen abendländischen Literatur findet sich bis dahin nichts von der ›Mysterie des Atmens‹, wenigstens nicht so, wie dieser Graf ganz methodisch gelehrt hat. Ebenso konnte der Graf von Saint-Germain alle jene Verwandlungs- und andere Kunststücke der indischen Gaukler ausführen. Und wie diese zustande kommen, das ist erst nach dem indischen Aufstande im Jahre 1857 bekannt geworden, als einige Hindusekten zur Rettung von Heiligtümern das Geheimnis brachen. Da sind die ersten Europäer von Gurus als Schüler aufgenommen und ausgebildet worden — wer das Ziel erreichte oder nicht schon vorher im Wahnsinn endete. Bis dahin wurden die Phänomene, die heute jeder indische Gaukler mitten auf der offenen Straße für wenige Kupfermünzen ausführt, als reelle Tatsachen ausgenommen. Eine andere Erklärung, als dass dies mit Hilfe von übernatürlichen Kräften geschehen könne, gab es nicht. Und wer es nicht gesehen hatte, der verlachte das alles einfach als Märchen, so wie es ja auch heute noch geschieht. Hieran änderte auch nichts Mesmers Entdeckung des Hypnotismus. Nur ein deutscher Gelehrter, Dr. PrunerBey, geboren 1808 zu Pfreimd in Bayern, drei Jahrzehnte lang Leibarzt des ägyptischen Khediven, hatte schon vorher über die scheinbaren Wunder der orientalischen Gaukler eine völlig aufklärende Schrift veröffentlicht, aber sie blieb ganz unbeachtet, ist vergessen worden, findet sich höchstens noch in Liebhaberbibliotheken.
Der Graf von Saint-Germain besaß von alledem schon vollständige Kenntnis, praktisch und theoretisch. — — —
Die rote Ampel, welche die einzige, sehr schwache Beleuchtung in der weiten Halle gab, ging regelmäßig auf und nieder, nach diesem Takte atmeten die 50 Personen regelmäßig durch die Nase, immer starr nach der Lampe blickend, ganz in Gedanken versunken.
Die beiden standen zunächst noch halb hinter einem Vorhang verborgen, ihr Kommen war nicht bemerkt worden.
Wenn man nicht wusste, worum es sich handelte, nicht erst so mysteriös vorbereitet worden war, die ganze Sache mit nüchternen Augen betrachtete, so konnte man leicht Lächerliches herausfinden.
Beschwerden machte dieses ums fünffache verlangsamte Atmen keinem mehr. Sie mussten alle schon längere Übung haben, oder da genügt auch schon ein Tag.
Aber es waren komische Typen dabei. Da war ein alter Herr, der hatte offenbar den Stockschnupfen, er schnappte manchmal mit offenem Munde wie ein Karpfen nach Luft. Einem anderen kitzelte es in der Nase, er kämpfte mächtig mit dem Niesen. Eine alte Dame schnitt während des Atmens aus anderem Grunde die schauderhaftesten Grimassen. Vielleicht war es derselbe Grund, weshalb sich der kleine Joseph mit der linken Stiefelspitze so krampfhaft an der rechten Wade kratzte, er hätte gar zu gern die Fingernägel zur Hilfe genommen. Und so waren noch verschiedene andere humoristische Figuren darunter. Wenn man freilich darauf vorbereitet war, und die Lektion hatte im Herzen schon Wurzel gefasst, so sah man diese geheimnisvolle Szene mit anderen Augen an, fand durchaus nichts Lächerliches dabei.
»Also, Sie verstehen«, flüsterte der Graf seinem neuen Schüler zu, der ihn beim Papste verraten sollte. »Beim Emporgehen der Ampel atmen Sie ein, beim Niedergehen aus, sind sich dabei bewusst, wie Gott, die allmächtige Lebenskraft, hierbei in Ihrem Innern wirksam ist. Gleichzeitig suchen Sie sich möglichst lebhaft auszumalen, wie sich hier unser Bund immer mehr verbreitet, über ganz Rom, durch ganz Italien, über die ganze Welt, wie er blüht und gedeiht, die liebevolle Einigkeit seiner Mitglieder, und so weiter und so weiter. Verstehen Sie?«
»Ganz so, wie es die Jesuiten von jeher gemacht haben.«
»Woher wissen Sie das?«
»Ich habe es im Buche des Paters Helvetius gelesen, wo er die ersten Missionen der Gesellschaft Jesu nach Südamerika schildert.«
Ja, in diesem Buche, im 16. Jahrhundert verfasst, ist davon zum ersten Male öffentlich die Rede. Von jeher, wenigstens noch zu Lebzeiten ihres Stifters Loyola, versammelten sich, wenn sie ein wichtiges Unternehmen vor sich hatten, etwa die Gründung einer neuen Missionsanstalt, die Eroberung eines ganzen Landes, möglichst viele Jesuiten; vom besten Redner wurde ein Vortrag gehalten, das Bild des erhofften Erfolges mit möglichst glühenden Farben ausgemalt, und dann mussten sich alle schweigend in die Betrachtung dieses vorgemalten Bildes versenken, von dem Wunsche beseelt, dass sich diese Hoffnungen verwirklichen mögen. Oder diese Verwirklichung als vollendete Tatsache in der Phantasie schon annehmend, sich lebhaft vorstellend. Je mehr sich daran beteiligten, je intensiver dieses Träumen gehandhabt wurde, desto größer sollte der Erfolg werden. Wenn möglich, wurden auch andere Gemeinden davon benachrichtigt, alle zusammen mussten diese mystische Übung zur gleichen Stunde vornehmen. Und so soll es noch heute sein, nur dass davon nichts mehr an die Öffentlichkeit kommt.
Aberglaube? Ja, was ist denn Aberglaube? Im Jahre 1819 wurde wissenschaftlich bewiesen, dass es ein Aberglaube sei, die im Museum zu Wien aufgehobenen Meteoriten für vom Himmel gefallene Steine zu halten. Vom Himmel dürfen keine Steine herabfallen und damit basta. Und da hat man die armen Meteorsteine, wirklich echte, auf die Straße oder in die Aschengrube geworfen. Erst zehn Jahre später machte man den Aberglauben zum Glauben, suchte von den Meteoriten wieder zusammen, was noch zu finden war. Nun, und an die Erfolge der Jesuiten darf man wohl auch glauben, trotz allen Aberglaubens.
»Ja, auch die Jesuiten bedienen sich dieser Geisteskonzentration zur Verwirklichung ihrer Ziele und Wünsche. Aber von diesem Atmen wissen sie nichts, und doch ist es die Hauptsache. Außerdem sind wir keine Jesuiten.«
»Wie nennt sich dieser Bund eigentlich?«
»Ich wollte eigentlich gar keinen sogenannten Bund haben, sondern nur zwanglose Zusammenkünfte, konnte ihm daher doch auch keinen Namen geben. Aber nun gerade hierdurch ist der Bund der Namenlosen entstanden. Das ist so ganz von selbst gekommen. Das Kind muss doch einen Namen haben. Also stellen Sie sich vor, wie sich der Bund der Namenlosen im herrlichsten Gedeihen über die ganze Erde erstreckt. Jetzt führe ich Sie ein, stelle Sie vor. Als päpstlicher Nuntius darf ich doch, nicht wahr?«
»Wie Ihnen beliebt.«
Der Graf klatschte, vortretend, schallend in die Hände.
Einem scharfen Beobachter, der die Menschen zu beobachten versteht, musste auffallen, dass kein einziger in der Gesellschaft zusammenschrak. Vorher gesehen war der Graf nicht worden, man hatte die beiden nicht flüstern hören, alle waren in die tiefsten Gedanken versunken gewesen, in dem Raume herrschte absolute Stille, urplötzlich trat der Graf vor und klatschte gleichzeitig sehr stark in die Hände.
Trotzdem also war kein einziger, auch nicht die zartestbesaitete Dame, erschrocken zusammengefahren. Ruhig wandten sie die Köpfe und blickten nach dem Grafen, lösten zum Teil die Hände, der eine Herr nieste herzhaft, Joseph kratzte sich noch herzhafter — nichts weiter.
Dieses ruhige Verhalten, das sich nicht erschrecken ließ, war wirklich ganz auffallend, wenigstens für den, der dies eben zu würdigen weiß. Das ist eine Folge der absoluten Geisteskonzentration, des Insichversenkens in einen einzigen Gedanken. In solch einem Zustande kann man geweckt, aber nicht erschreckt werden, so paradox das auch klingen mag. Es ist eben ein vollkommen anderer Zustand als ein gedankenloses Hinträumen. Deshalb sagt auch Schopenhauer, dass der erste Beweis einer echten Geistererscheinung, das heißt einer richtigen Vision, der ist, dass man vor ihr nicht erschrickt, sich nicht vor ihr fürchtet. Dieser Zustand wird durch das langsame Atmen künstlich hervorgerufen.
Das Händeklatschen bedeutete eine Pause, die meisten der Herren und Damen standen auf, wischten sich Gesicht und Hände mit Spitzentüchern, der in die Mitte des Kreises getretene Graf wurde umringt.
»Herr Graf«, fing zuerst eine schon ältliche Dame an zu flöten, sich gleich an ihn hängend, »vorhin kam es einmal, der heilige Geist...«
»Oooooohhhh«, erklang es alsbald ringsum im Chore, als hätte die Dame etwas Schreckliches gesagt. Aber in der Tat, die Nervenkraft machte sich einmal bemerkbar.
Die Sache war also die, dass der Graf nichts mit dem heiligen Geiste zu tun haben wollte, der bei solchen Versammlungen etwa die Quäker und Schäker überfällt. Er wollte dasjenige, was da vorhin einmal gekommen war, nur Lebenskraft oder Nervenkraft genannt haben, aber auch ohne das Prädikat ›heilig‹. Der Graf war eben sehr vorsichtig. Und was für ein geheimnisvolles Etwas das nun war, das wird der geneigte Leser sehr bald erfahren.
Mit diesem geheimnisvollen Etwas ging es noch einige Zeit durcheinander.
»Sie haben es gefühlt?«
»Sie nicht? Ich ganz deutlich.«
»Aber das war diesmal doch stärker denn je zuvor!«
»Ach, ein göttliches Gefühl, diese durchströmende Lebenskraft!«, flötete wiederum eine Dame.
»Ja, es geht durch alle Glieder, geradeso, wie Champagner auf der Zunge schmeckt«, bestätigte ein feister, als großer Gourmand bekannter Pfaffe. Denn auch solche waren darunter.
»Oder wie kohlensaures Wasser«, war ein schmächtiger Jüngling nüchterner Ansicht.
»Ach, liebster. bester Herr Graf«, wurde dieser jetzt allgemein bestürmt, am meisten allerdings von den Damen, »setzen Sie sich doch einmal zwischen uns, schließen Sie mit uns die Kette! Wenn Sie dabei sind, kommt diese herrliche Nervenkraft immer viel eher und stärker und hat auch ein viel wonnigeres Gefühl.«
»Ich bin gern bereit dazu. Zunächst aber stelle ich den Damen und Herren als Schüler einen neuen Bundesgenossen vor.«
Erst jetzt bemerkte man den vermummten Mönch, der sich bisher im Hintergrunde gehalten hatte.
Beim Anblick der herabgelassenen Kapuze allgemeines Misstrauen, wenn nicht Scheu, besonders auf Seiten der Geistlichen, unter denen sich sogar der Fürstbischof von Rom befand.
Denn wenn dieser anscheinend ganz einfache Mönch, dessen Orden nicht zu unterscheiden war, seine Kapuze unten behielt, so konnte das doch eben kein so ganz einfacher Mönch sein.
»Ein päpstlicher Nuntius«, erklärte der Graf weiter, »der sich im Namen Seiner Heiligkeit des Papstes als mein Schüler hat aufnehmen lassen, er ist bereits einer der Unsrigen, möchte aber vorläufig noch unbekannt bleiben, was ja schließlich in unserem Bunde der Namenlosen auch ganz angebracht ist.«
Ein päpstlicher Nuntius, ein Bevollmächtigter des Papstes, so gut wie dieser selbst — das konnte nicht beruhigen, am allerwenigsten die Geistlichen, aber auch die Herzogin Borghesia nicht.
Der Graf war neben dem Fürstbischof zu stehen gekommen.
»Ist schon auf unserer Seite, ist wirklich einer der Unsrigen«, flüsterte er diesem zu.
»Wer ist es?«, gab dieser ebenso schnell leise zurück.
»Sie kennen ihn nicht — schadet nichts — vollkommen harmlos — bereits gewonnen.«
Erleichtert atmete der Bischof auf, die Geistlichen schienen unter sich eine geheime Zeichensprache zu haben, denn bald wussten sie alle, dass sie von dem päpstlichen Abgesandten nichts zu fürchten hätten, im Gegenteil, besser hätte es gar nicht kommen können, jetzt hatte die geheime Gesellschaft in Rom und im ganzen Kirchenstaate gewonnenes Spiel. Das hatten gewiss schon die intensiven Atemübungen mit Gedankenkonzentration bewirkt.
Währenddessen hatte der Graf leise mit dem kleinen Joseph gesprochen, dieser verließ das Refektorium, war von dem Grafen bis zur Tür begleitet worden.
»Du wartest also bis er kommt«, sagte er noch, ehe er die Türe verschloss, und da schien ein geheimer Mechanismus dabei zu sein.
Draußen auf dem Korridor stand der zukünftige Cagliostro.
»Jawohl, kennen wir«, brummte er grimmig. »Allemal, wenn die Hauptsache kommt, wenn er seinen richtigen Hokuspokus vormacht, muss ich hinaus, und immer weiß er mich hinzuschicken, wo ich nicht fortkann. Außerdem hält er die Türe verschlossen, und ein Löchelchen gibt's da auch nicht. Wenn ich nur erst wüsste, wie er das mit der Lebenskraft macht, oder was das nun ist, was so in allen Gliedern prickelt, dann gehe ich hier meiner Wege.«
Und brummig schritt er weiter.
»Nehmen wir nun unsere Übungen wieder auf«, sagte drinnen der zurückgekehrte Graf. »Auf was hatten Sie Ihre Wünsche konzentriert?«
»Dass unser Bund die ganze Welt erobere, aller Menschheit zum Segen.«
»Richtig, und bleiben wir heute bei diesem Thema! Nur eine Viertelstunde noch, oder wenige Minuten, falls sich die Nervenkraft bald einstellt, dann werde ich den Herrschaften zur Aufmunterung noch einige Experimente vormachen.«
Allgemeine Freude herrschte über dieses Versprechen, so nahmen sie auf den Stühlen wieder Platz, ohne die alte Reihenfolge einzuhalten. Durch den Fortgang des Jungen war ein Stuhl freigeworden, obgleich im dunklen Hintergrunde ja auch noch andere stehen mochten, der Nuntius kam neben eine Dame zu sitzen, neben ihm nahm der Graf Platz.
»Aber jetzt müssen Sie Ihre Hände freimachen. Oder wollen Sie nicht, dass gerade ich Ihre Hand fasse? Dann wechseln wir die Plätze. Ich dachte nur, falls ich Ihnen einige Erklärungen zuteil werden lasse. Oder Sie können auch fragen. So störend ist das nicht. Nur, bitte, nicht gar zu laut.«
»Ich habe keinen Grund, meine entblößten Hände nicht anfassen zu lassen«, wurde sich der Nuntius jetzt inkonsequent, und er streifte die Handschuhe ab.
Die Kette war geschlossen. Auch diesen Ausdruck hatten sie schon. Doch dieser liegt gar zu handgreiflich nahe. Auch eine Eimerkette hat es schon immer gegeben.
Bei dem Händeklatschen vorhin hatte die rote Ampel ihre Bewegungen eingestellt, jetzt begann sie, sich ohne besonderes Zeichen wieder zu heben und zu senken. Das besorgte einfach von oben ein Diener, oder der Graf konnte dazu ja auch eine Maschinerie haben.
»Aaaaatmen«, kommandierte zuerst der Graf, der als Herr und Meister aller Geister dies alles doch im kleinen Finger haben musste, zuerst mit leiser Stimme, auch wunderbar schön ausmalend, wie der Bund der Namenlosen zuletzt die ganze Welt ausfüllen würde, worin ihn kein Sozialdemokrat mit der Schilderung des Zukunftsstaates hätte übertreffen können, in dem sich jeder die Stiefel selber zu wichsen hat.
Dann hörte er mit dieser Direktion der Atemzüge und Gedanken auf, und es wäre auch nur störend gewesen, denn nach der ersten allgemeinen Unruhe war die tiefste Stille eingetreten. Dabei war merkwürdig, dass dennoch manchmal leise gesprochen wurde und dass dies trotzdem die Todesruhe scheinbar gar nicht unterbrach.
So verging einige Zeit. Auch zu seinem neuen Schüler hatte der Graf nichts mehr zu sagen.
»Da — da — jetzt kommt's!«, flüsterte da Axels schöne Nachbarin, ein blutjunges, zierliches Dämchen, und machte ein ganz verklärtes Gesicht.
»Na, da halten Sie's mal feste«, dachte der päpstliche Nuntius, der früher ein patenter Prinz und jetzt ein saugrober Depeschenreiter war.
Er dachte vielleicht auch noch anderes. Was mochte bei der eigentlich kommen? Was mochte die fühlen?
»Ja — ja — jetzt fühle ich's auch — ach, ist das herrlich!«, flüsterte gegenüber, aber deutlich hörbar, eine andere Dame, machte dazu allerdings weniger ein verklärtes als ein ängstliches Gesicht.
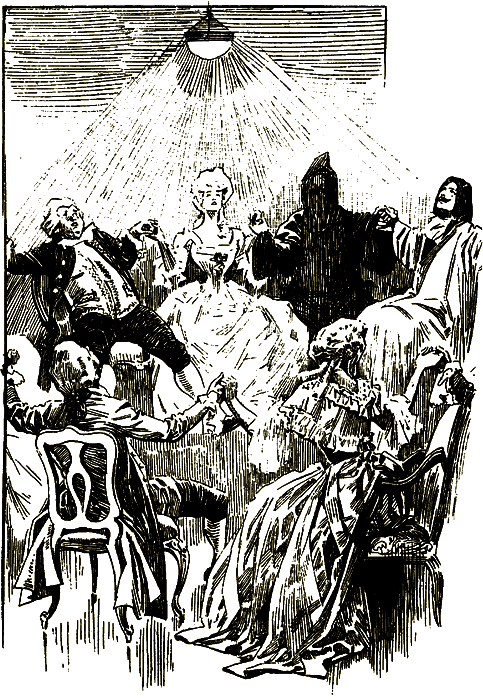
»Die heilige Nervenkraft, sie ist da, aaaahhh!!«, flötete eine andere Dame, ihrem angepinselten Gesicht einen ganz verzückten Ausdruck gebend.
»Ich fühle nischt, ich fühle nischt!«, ließ sich zum ersten Male ein Mann vernehmen, ein dicker Schweinezüchter aus der Umgegend, dessen Italienisch wir in entsprechender Übersetzung wiedergeben wollen.
»O ja — aaah, wie das zuckt, wie das prickelt — köstlich!«, stimmte da aber den Damen ein zweiter Herr bei.
»Nu, ich fühle nischt, ich fühle nischt!«, beharrte aber der Schweinezüchter.
Und das ging weiter. Alle hatten zwar das mehr oder weniger angenehme Prickeln und Zucken in allen Gliedern noch nicht, aber doch die meisten. Und als endlich auch der dicke Schweinezüchter das Prickeln und Zucken empfand, erklärend, das wäre gerade so schön, als wenn ihn dreijährige Säue am ganzen Körper leckten, während es andere mehr mit Ameisenlaufen verglichen, da hatte endlich auch Axel das gleiche Gefühl.
Es kribbelte ihm zuerst in den Fingerspitzen, lief den ganzen Arm entlang, zum anderen durch die Fingerspitzen wieder hinaus, es verbreitete sich im ganzen Körper...
Wir brauchen es nicht weiter zu beschreiben. Der Leser hat es ja schon längst erraten. Der Graf schickte durch die geschlossene Menschenkette einen galvanischen Strom. Das konnten diese Herrschaften freilich nicht wissen, was ihnen so prickelnd durch den ganzen Körper fuhr. Auch Cagliostro hat die Elektrizität erst in den Bereich seiner Gaukeleien ziehen können, nachdem Mesmer mit seiner Entdeckung, die er mit der Galvanis zu vereinigen wusste, in Paris öffentlich auftrat, auch recht scharlatanisch. Cagliostro konnte da gar nichts Neues mehr bringen.
Also die meisten dieser Herrschaften empfanden diesen galvanischen Strom recht angenehm, einige sogar himmlisch, entzückend, dass sie dabei ganz verklärte Gesichter machten.
Nun, das ist Geschmacksache. Der Geschmack ist bekanntlich verschieden, es lässt sich darüber nicht streiten. Der Chinese liebt verfaulte Eier, wie der Ägypter verfaulte Fische, und wenn wir das nicht begreifen können, so ekeln sich jene wieder vor unserem verfaulten Quark, Käse genannt.
Elektrizität ist zwar etwas anderes, man isst sie nicht, und doch läuft es auf dasselbe hinaus. Es hängt alles von der Einbildung ab, alles. Wenn in Amerika ein Todeskandidat auf den elektrischen Stuhl geschnallt wird, und es fängt an zu surren, der erste schwache Strom geht durch seine Glider, so wird er das wohl schwerlich als angenehmes Gefühl empfinden. Diesen Herrschaften aber hier war schon seit langer Zeit suggeriert worden, dass dieses Prickeln die eigentliche Lebens- oder Nervenkraft sei, die sich einmal ganz materiell durch Gefühl offenbare, so etwa wie der heilige Geist den Heiligen umfließt, wenigstens für Maler erkenntlich, und einen Heiligenschein um den Kopf zu haben, das ist gewiss etwas Schönes, und wenn die Nervenkraft nach des Grafen Lehre das ganze Leben bedingte, so musste es diesen Leutchen eben sehr angenehm sein, dieses Lebenselement einmal mit handgreiflicher Deutlichkeit in ihrem Körper prickeln und zucken zu fühlen. Dann hatten sie richtig geatmet, richtig ihre Gedanken konzentriert, vielleicht auch genügend Regenwasser getrunken — kurz und gut, dann war alles bei ihnen in Ordnung, sie fühlten sich in der schwarzen oder in der weißen Kunst einen großen Schritt vorwärts gekommen, und daher die allgemeine Freude bis zur himmlischen Verklärung.
Wie der Graf den galvanischen Strom bis hierher brachte, brauchen wir nicht zu wissen. Der hatte schon seine verborgenen Drähte. Nur einen Fehler hatte er dabei begangen, oder eins war noch nicht ganz in Ordnung: Er musste bei der Zusammensetzung dieser menschlichen Kette sorgsamer auswählen, musste mehr auf die Nerven und auf die ganze Körperkonstitution sehen.
Die Empfindlichkeit für den galvanischen Strom ist ja bei den Menschen durchaus nicht die gleiche. Das zierliche Dämchen hatte den Strom schon gemerkt, als der Graf kaum mit der Fußspitze auf den geheimen Knopf getippt hatte. Der Strom wurde stärker und stärker, der päpstliche Nuntius musste doch auch etwas von der heiligen Nervenkraft abbekommen. Nun aber hatte dieser deutsche Depeschenreiter leider noch dickere Nervenstricke als der italienische Viehhändler, und so kam es, dass, als der päpstliche Nuntius das erste Prickeln fühlte, der Schweinezüchter schon einen ganz hübschen Strom durch die Adern pulsieren hatte — und dass die zarte Jungfer und einige andere schon laut kreischten, während sich die meisten der anderen, aber auch viele Herren, damit begnügten, mit den Beinen zu zappeln. Sie hätten ja gern die Hände losgelassen, aber das kann man bekanntlich nicht, wenn der Strom erst einmal richtig angefasst hat.
Doch der Graf brauchte ja nur die Hand zu lösen, so war es vorbei. Und damit auch das Kreischen. Es war ja schließlich gar nicht so schlimm gewesen. Sofort erscholl überall ein erlösendes Lachen.
»Herrlich, köstlich! So intensiv haben wir diese göttliche Nervenkraft noch nie empfunden! Ich fühle mich wie neugeboren. Ich mich noch viel jünger. Sehen Sie, Herr Graf, es ist doch etwas ganz anderes, wenn Sie selbst mit in der Kette sitzen.«
So und anders klang es durcheinander. Also nur allgemeiner Beifall, und das am meisten von denjenigen Damen und Herren, die am lautesten gekreischt und am kräftigsten mit den Füßen gestrampelt hatten.
»Haben Sie es gefühlt?«, wandte sich der Graf an seinen neuen Nachbar.
»Verdammt und zugenäht!«, brummte da der Stellvertreter des Papstes hinter seiner Kapuze, allerdings auf Deutsch und auch so leise, dass es selbst die feinen Ohren des Grafen nicht hatten verstehen können.
Und laut aus italienisch fragte er dann:
»Ja, was war denn das, was mir wie Champagner durch die Adern prickelte?«
»Die fühlbar gewordene Nervenkraft, das eigentliche Lebensprinzip, das sonst nur immer latent im Körper liegt.«
»Und wie wird diese denn frei?«
»Eben durch das intensive Atmen mit vollem Bewusstsein, dieses Lebensprinzip auch wirklich in uns einzuziehen.«
»So so«, erklang es jetzt mehr trocken als erstaunt hinter der Kapuze, »da werde ich von jetzt ab immer so intensiv atmen, da kann ich den Champagner sparen. Oder vielleicht verwandele ich mich auch in einen Sauerbrunnen.«
Der Hexenmeister im roten Talar hielt es nicht unter seiner Würde, über diese Bemerkung zu lachen. Überhaupt vermied er alle Effekthascherei. Sonst hätte er sich nicht nur mit diesem roten Hauskostüm begnügt, hätte sich noch ganz anders herausgeputzt.
Er war in die Mitte des Kreises getreten, und nach den Gesichtern wussten die anderen schon, was nun kommen würde.
»Diese Übung ist für heute beendet. Morgen nehmen wir ein anderes Thema vor. Meine hochverehrten Damen und Herren, ich habe eine kleine Einleitung nötig, wie immer, wenn ein neuer Schüler zugegen ist. Signore«, wandte er sich an den päpstlichen Nuntius, »Sie haben gehört, und ich wiederhole es ja auch bei jeder Gelegenheit, dass ich jedes Experiment nur ein einziges Mal vorführe. Hier in unserem internen Bunde ist das etwas anderes, da gibt es Ausnahmen. Zur Anfeuerung meiner Schüler, dass sie alle Kraft anstrengen, um baldigst magische Kräfte zu erlangen, führe ich zum Schluss immer noch einige Experimente vor, obgleich ich mich dadurch selbst schädige. Ich hindere mich dadurch an meiner Weiterentwicklung. Trotzdem, ich bringe dieses Opfer gern. Nur eine gewisse Gruppe von Experimenten, oder wie man die Phänomene nennen will, darf ich auch hier nicht zum zweiten Male ausführen. Solche mit bleibender Wirkung. Also ich darf auch hier zum Beispiel keine Kranken heilen. Sonst fordern Sie von mir zu sehen, was Sie wollen. Haben Signore einen speziellen Wunsch?«
Der Nuntius wusste offenbar gar nicht, was er eigentlich fordern dürfe, dass er so lange zögerte. Die anderen hielten ihre Ungeduld nicht aus.
»Machen Sie sich doch noch einmal unsichtbar, Herr Graf. — Nein, mich, bitte, mich! Machen Sie sich doch noch einmal gewichtlos, Herr Graf, schweben Sie in der Luft herum — Nein, bitte, mich gewichtlos machen, ich möchte so gern einmal fliegen! — Beschwören Sie doch einmal den Geist von Cäsar! — Nein, den von der Kleopatra möchte ich gern einmal sehen. — Ach nein, meine selige Frau — meinen Großvater — meine Urgroßmutter, ich muss sie noch etwas fragen...«
So und anders schwirrte es durcheinander. Der Graf musste hier schon gar viel vorgegaukelt haben, es wurden immer Wiederholungen mit Variationen verlangt.
»Bitte, Signore, Sie haben als ein neu hinzugekommener Schüler zu bestimmen«, beharrte aber der Graf.
Der Nuntius schien aus tiefem Sinnen zu erwachen.
»Sie können sich wahrhaftig unsichtbar machen?«, erklang es in grenzenlosem Staunen hinter der Kapuze.
»Soll ich Ihnen dieses Phänomen vorführen?«
»Und auch gewichtlos können Sie sich machen, dass Sie frei in der Luft schweben?«
»Auch das. Mir ist überhaupt so ziemlich nichts unmöglich. Nur nicht solche Wünsche, bitte, wie den Mond vom Himmel herunterholen. Der ginge nicht in dieses Zimmer hinein, und dann muss dies alles hier unter uns geschehen. Ließe ich zum Beispiel die Sonne stillstehen, so würden das doch auch die anderen Menschen bemerken, und... das möchte ich nicht, das darf überhaupt nicht sein.«
»Was, selbst die Sonne könnten Sie stillstehen lassen, respektive die Erde?!«
Der Graf zuckte langsam die Achseln.
»Hierüber spreche ich nicht — bleiben wir doch bei der Zimmermagie.«
»Er kann es, er kann es!«, rief da eine männliche Stimme. »Und nicht nur die Sonne stillstehen lassen, er hat mir noch ganz, ganz andere Wunder gezeigt!«
Der Nuntius drehte sich dem zu, der das gerufen hatte. Es war Lord Walter Moore gewesen.
Ein langer Blick auf den Lord, und der Nuntius wandte sich wieder dem Grafen zu.
»Außerdem«, nahm dieser schnell noch einmal das Wort, »mache ich Sie darauf aufmerksam, dass ich jeden Abend nur drei solche Experimente vorführe. Sonst würde ich mich gar zu sehr schädigen. Also bitte, wählen Sie!«
»Dann machen Sie sich einmal unsichtbar«, entschied sich jetzt der Nuntius schnell.
Dazu bedurfte der Magier gar keiner weiteren Vorbereitungen. Die Anwesenden traten zurück, setzten sich wieder, der Graf stellte sich in die Mitte.
»Die richtig ausgebildete Willenskraft«, begann er, »vermag, wenn sie im Überfluss vorhanden ist, im Einverständnis mit Gottes Willen, alles, alles. Ich strecke meine Hand aus, ich will, dass diese meine Hand von Ihren irdischen Augen unsichtbar wird — ich will! ich will!! — Sie sehen, wie meine Hand verschwindet, sich wie in der Luft aufzulösen scheint, zunächst bis an das Handgelenk, die Unsichtbarkeit erstreckt sich weiter über den Arm, bis an den Ellbogen...«
Und so sprach der Graf weiter. Und so geschah es auch. Das heißt, so sahen es die Zuschauer auch. Der Graf löste sich vor ihren Augen nach und nach in ein Nichts auf. Bis er zuletzt ganz unsichtbar war. Aber fühlen konnte man ihn noch. Oder auch nicht. Ganz, wie er wollte. Dann ließ er auch nur eine Hand, den Kopf, andere Gliedmaßen wieder zum Vorschein kommen, die frei im Zimmer herumschwebten, und dann verband er dieses Experiment gleich mit einem zweiten, indem er sich gleichzeitig in die Luft erhob, in den verschiedensten Stellungen dieselben Wandlungen durchmachte.
Betont sei noch, dass er nur anfangs immer dazu gesprochen, alles, was eintreten würde, schon vorher geschildert hatte. Später tat er das nicht mehr. Da hielt er es mit den indischen Gauklern. Auch die schwatzen beim Vorführen ihrer Experimente zuerst unaufhörlich, nach und nach immer weniger, zuletzt haben sie es gar nicht mehr nötig.
Die meisten hatten dieses Phänomen von dem Grafen schon vorführen sehen. Ihr erneutes Staunen war nicht geringer als das der anderen, als das des Nuntius, der daraus gar kein Hehl machte.
»Ja, wie ist das nur möglich, wie ist das nur möglich!«, wiederholte er nur immer und immer nieder.
Der Magier, am Boden stehend oder in der Luft schwebend, sichtbar oder unsichtbar, konnte keine andere Erklärung geben als er schon gegeben hatte: die Macht der Willenskraft und des Glaubens, der Berge versetzt, und wie man das erlangt, wussten sie ja nun alle: durch ein sündenloses Leben, wenigstens der Hauptsache nach.
Unter den Zuschauern befanden sich einige Herren, die in Indien gewesen waren.
»Perfekter haben wir das auch nicht von indischen Magiern ausführen sehen!«, riefen diese.
Wenn sie dergleichen in Indien gesehen, so hatten sie Glück gehabt, sie hatten intim an Fürstenhöfen oder mit heiligen Brahmanen verkehrt. Denn damals durften die Fakire, wie wir sie nennen — obgleich es durchaus keine Fakire zu sein brauchen — solche Zaubervorstellungen noch nicht auf der Straße geben, wie es heute geschieht. Da wurde das noch als heilige Handlung betrachtet. Aber dieser Tempelbann ist gebrochen worden. Und heute blickt der Europäer, der es zweimal gesehen, gar nicht mehr hin, wenn der Gaukler mit Trommel und Schellentamburin zur Vorstellung einladet. Denn es sind immer dieselben Gaukeleien, welche diese Leute zeigen — aus einem Grunde, den wir später kennen lernen werden, wenn es der Leser nicht selbst schon errät — und selbst der ungebildetste Matrose, dessen Schiff in Bombay vor Anker liegt, weiß ja, wie die Geschichte gemacht wird.
Damals aber war die Fotografie noch nicht erfunden. Das ist die Sache!
Übrigens irrten sich jene, welche glaubten, die indischen Fakire brächten diese Levitation und Unsichtbarkeit nicht so vollkommen fertig, wie es der Graf hier ihnen vormachte. Der Unterschied war nur der, dass in diesem geschlossenen Raume alles viel intensiver, geheimnisvoller wirkte, und dann befand man sich in Europa, in der christlichsten und damals kultiviertesten Stadt, im heiligen Rom, und war dieser Graf doch mehr Fleisch von ihrem Fleische als solch ausgemergelter, wie in der Kaffeetrommel gerösteter indischer Fakir.
Es sei hier einmal geschildert, wie ein Sannyasin, das ist ein indischer Heiliger, der durch Askese die Welt überwunden hat, vor Buddha zeigt, dass er schon im Besitze der höchsten Kraft ist. Nach der metrischen Übersetzung des Acvagoshas Carita, der das Leben Buddhas schildert. Der Asket heißt Kacyapa, unter Samadhi versteht man den Zustand der Extase, unserem heutigen Somnambulismus entsprechend.
Alsbald trat Kacyapa in Samadhi ein, zusammenschließend seines Leibes Glieder, und stieg vor aller Augen dann im Luftraum langsam empor, wo er sich gehend zeigte und stehend, sitzend, liegend, glühende Dämpfe aus seinem Leibe stoßend, Wasser rechts und links Feuer, unverbrannt und unbenetzet. Dann gingen Wolken von ihm aus und Regen, durch Blitz und Donner wurden Erd' und Himmel >erschüttert, so zwang er die Welt...
Daraus macht Buddha dasselbe Kunststückchen, es noch übertreffend, diese Wunderkraft aber nicht durch grausame Askese, durch Fleischabtötung erlangt habend, sondern nur durch Geisteskraft, durch klare Erkenntnis seines Wesens in Beziehung zur Gottheit.
Um ihm des Geistes Auge zu eröffnen, und Mitleid fühlend für des Volkes Menge, erhob er sich bis in des Luftraums Mitte und fasste mit den Händen Mond und Sonne. Darauf bewegt' er hin und her im Raume sich, die Gestalt in mannig facher Weise umwandelnd; seinen Leib in Stücke teilend, vereint' er diese dann zum Ganzen wieder. Auf Wasser ging er wie auf festem Lande, sank in die Erde ein als wär' sie Wasser, ging ungehindert durch Steinmauern, Feuer und Wasser strömten ihm aus beiden Seiten.
So weit trieb es der Graf von Saint-Germain nicht, diesmal nicht. Er behielt seine Gliedmaßen hübsch beisammen, sank nicht in die Erde ein, ging nicht durch die Wand, ließ aus seinen Seiten auch weder Feuer noch Wasser hervorströmen. Er blieb ›ganz natürlich‹. Nur dass er manchmal in der Luft herumschwebte und sich manchmal unsichtbar machte.
Dann stand er wieder als normaler Mensch am Boden.
»Was wünschen Sie jetzt zu sehen, Signore?«
Statt des unbewanderten Neulings baten die anderen, der Graf möchte ihm doch einmal zeigen, wie er jemand verhindern könne, etwas vom Boden aufzuheben. Das sei das handgreiflichste Beispiel seiner außerordentlichen Willenskraft — oder Nervenkraft, wie sie gewöhnlich sagten.
Vorhin war beim hastigen Ausstehen die obere Leiste von einem Stuhle abgebrochen, der Graf nahm das Stück Holz, gab es dem Vermummten.
»Bitte, legen Sie die Leiste auf den Boden, wohin Sie wollen.«
Axel tat es, trat zurück.
»Wollen Sie das Holz noch einmal aufheben.«
Auch das tat der Vermummte.
»Nun legen Sie es abermals hin — so, jetzt können Sie das Stück Holz nicht mehr aufheben«, sagte der weit entfernt stehende Graf. »Ich hindere Sie durch meine Willenskraft daran. Es wird Ihnen immer sein, als wenn Sie etwa in einen Sandhaufen hineingriffen, zuerst können Sie mit der Hand etwas eindringen, aber der Widerstand wird immer fester. Sie werden auch fühlen, wie Sie förmlich von einer unsichtbaren Macht zurückgezogen werden... Probieren Sie es.«
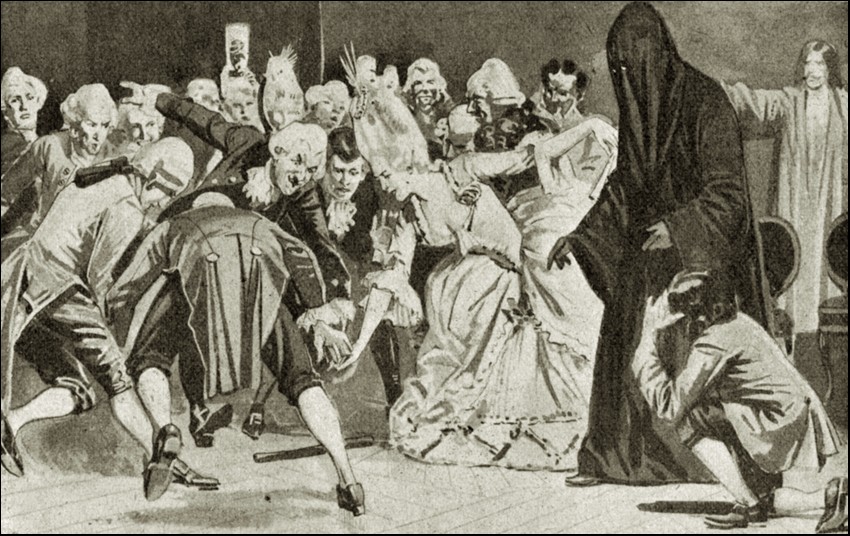
Da aber schien den päpstlichen Nuntius der Mut zu verlassen. Er wollte nicht. Es sollte ihm erst von anderen vorgemacht werden.
Gut, andere hatten darauf nur gewartet. Erst gingen sie einzeln, dann mehrere zugleich vor, in der Bemühung, das Stück Holz aufzuheben. Es gelang ihnen nicht. Das Holz wich nicht zurück. es war eben genau so, wie der Graf es geschildert hatte, wie er es auch noch mehrmals tat, wenigstens anfangs, sie konnten die Hände nur bis zu einer gewissen Entfernung heranbringen, dann schienen sie wie auf Widerstand zu stoßen, sie wurden manchmal auch wie von einer unsichtbaren Kraft zurückgezogen.
Bald war unter Lachen eine allgemeine Balgerei im Gange, schließlich beteiligte sich auch der päpstliche Nuntius daran, machte dann auf seine Bitte, um mehr Raum zu haben, den Versuch auch allein, ohne dass es ihm gelingen wollte, das Holz zu fassen.
»Das dritte und letzte Experiment an diesem Abend werde ich selbst wählen. Es ist eins von jenen, die ich eigentlich gar nicht machen, mindestens nicht wiederholen darf. Ich mache eine Ausnahme. Ich möchte Ihnen einen noch handgreiflicheren Beweis meiner Willenskraft geben, den Sie gewissermaßen mit nach Hause tragen können — oder nicht nur gewissermaßen, sondern in Wirklichkeit. Giacobbe, besorge mir einen Topf mit Gartenerde, ferner bringe aus dem Speisesaal eine Schale mit Früchten.«
Der Diener ging, der Graf wusste seine Gäste mit Belehrungen zu unterhalten, bis der Diener das Begehrte brachte, einen gewöhnlichen Blumenasch, mit Erde gefüllt, und eine Schale, auf der außer Mandeln und Rosinen einige Äpfel, Birnen und Apfelsinen lagen.
»Ist der Topf erst frisch gefüllt, Giacobbe?«
»Es ist ganz frische Erde.«
»Woher hast du die Erde genommen?«
»Aus dem Klostergarten.«
»Wollen die Herrschaften den Topf mit der Erde untersuchen?«
Man hätte gar nicht gewusst, warum. Der Graf wollte ein Experiment vorführen, das hier noch niemand gesehen hatte.
»Nun, bitte, Signore, wählen Sie irgendeine Frucht aus.«
Der Nuntius nahm eine Apfelsine.
»Es wäre mir sehr lieb, wenn Sie dieselbe verspeisten, wenigstens ein Stück davon, damit Sie nicht glauben, es sei eine besondere, eine präparierte Apfelsine. Sie können die Stücke ja verteilen.«
Gut, der Nuntius, der nicht mehr für nötig befunden hatte, seine zwar ziemlich gut gepflegten, aber für einen Kirchenmann sehr gebräunten Hände zu verhüllen, schälte und zerteilte die Apfelsine ohne Hilfe eines Messers geschickt, verteilte die Scheiben an die Umstehenden, sie wurden gegessen.
»Es ist doch hoffentlich eine reife Apfelsine, die Kerne hat?«
»Ganz vorzüglich«, wurde geantwortet, und man brachte möglichst elegant die Kerne aus dem Munde zum Vorschein.
»Bitte, Signore, wollen Sie mir einen der Kerne geben — Doch halt, ich will ihn gar nicht anfassen. Stecken Sie selbst ihn hier in die Erde. Machen Sie selbst mit dem Finger erst das Loch hinein.«
Der Nuntius tat, wie gefordert wurde. Der Apfelsinenkern befand sich in der Erde des Blumentopfes, der Graf setzte diesen an den Boden, bückte sich, hielt die Hände wie segnend darüber.
»Ich werde jetzt den Apfelsinenkern kraft meines Willens keimen und aufblühen lassen, er soll sich zur vollständigen Pflanze, zu einem Orangenbäumchen entwickeln, soll Blüten und Früchte tragen, und das geht gar schnell — da, schon sprießt ein grünes Hälmchen hervor...«
So war es. Und so ging es weiter. Und zwar sehr schnell. Ganz so schnell, wie der Graf es schilderte. Denn er schilderte immer den Vorgang, stets schon etwas vorher. Aber nicht bis zum Ende. Zuletzt wuchs das Bäumchen auch ohne seine erklärenden Worte weiter.
Das grüne Blättchen war in die Höhe geschossen, verdickte sich schnell, der Stängel verholzte, Seitentriebe schlugen aus, Blätter setzten sich an, Blüten sprossten, gegen ein Dutzend, die Hälfte davon fiel ab, fünf verdickten sich am Fruchtboden zu kleinen, grünen Knollen, diese schwollen schnell an, immer mehr, färbten sich gelb, dann rot... und noch waren keine zehn Minuten vergangen, als in dem Topfe ein meterhohes Bäumchen stand, mit fünf reifen Früchten daran.
Das Staunen lässt sich denken.
»Das ist Zauberei!!«
Es war ein ganz naiver Mensch, der das gerufen hatte. Als ob das nicht schon alles Zauberei gewesen wäre.
»Das ist Sinnestäuschung!«, rief ein anderer, und der kam der Sache schon näher.
»Sinnestäuschung?«, wiederholte der Graf lächelnd »Bitte, pflücken Sie ab.«
Die Apfelsinen ließen sich abbrechen, ließen sich auch essen.
Jetzt erst brach das grenzenlose Staunen richtig aus. Ein ähnliches Experiment hatte der Graf hier noch nicht ausgeführt.
»Signore, es wäre mir sehr lieb, wenn Sie Ihre Apfelsine nicht verspeisten, sondern mit nach Hause nähmen.«
»Wunderbar, wunderbar! Ich werde sie Seiner Heiligkeit mitbringen.«
Weiter hatte der Graf ja auch nichts gewollt.
Dann schloss er, nur noch einige gute Ermahnungen wegen des sündenlosen Lebenswandels gebend, sehr kurz die heutige Sitzung. Die Gäste konnten ja noch länger hier verweilen, die wurden dann von dem Lord wieder nach der englischen Gesandtschaft hinübergebracht, er selbst entfernte sich immer ohne Weiteres.
»Signore, Sie aber möchte ich vorher erst noch einmal sprechen«, wandte er sich an den Vermummten.
Er wusste nicht, wie er diesem entgegengekommen war. Genau dasselbe hatte der Nuntius zu dem Grafen sagen wollen.
Die beiden betraten wieder das kleine Schreibzimmer. »Alekta!!«, sagte der Graf in scharfem Tone in demselben Augenblick, da er hinter sich die Türe schloss.
Es war das Stichwort gewesen, durch welches der Nuntius aus dem hypnotischen Schlafe erwachen musste. Aber war er denn überhaupt hypnotisiert gewesen? Man hatte ihm durchaus nichts angemerkt, dass er sich bisher in schlafwachem Zustande befunden hätte. Und der Graf hatte doch nicht vor seiner Verabschiedung zu den übrigen Zuschauern solche Worte gebraucht. Doch sei dem, wie ihm wolle, wir können unmöglich alle die Kniffe und Schliche schildern, die dieser Mann anwandte, er mochte ja auch seine besondere Methode haben — — hier beim Eintritt hatte er in scharfem Tone das Stichwort gesagt, welches den Nuntius aus dem hypnotischen Schlafe zum Erwachen bringen musste.
»Wie meinten Sie?«
»Ich rief nur einem Diener etwas zu. Bitte, wollen Sie Platz nehmen.«
Sie saßen einander gegenüber, der Vermummte noch seine Apfelsine in der Hand.
»Nun, wie gefiel Ihnen diese Vorstellung?«
»Ganz außerordentlich, ich habe mich köstlich dabei amüsiert.«
»Köstlich amüsiert?«, wiederholte der Graf etwas langgedehnt.
»Na ja, wie Sie den mit offenen Augen Schlafenden solchen blauen Dunst vormachten.«
Das Gesicht und Auge des Grafen erstarrten.
»Paralla!!«, stieß er plötzlich scharf hervor.
»Alekta!«, erklang es in demselben Tone hinter der Kapuze zurück.«
Das Gesicht des Grafen wurde noch starrer, ein wilder Blick mischte sich bei.
»Paralla!!!«, stieß er nochmals hervor.
Da schlug der päpstliche Nuntius die Kapuze zurück, zeigte als Depeschenreiter sein kühnes, bronzefarbenes Antlitz, und gleichzeitig brachte er unter der Kutte ein Doppelterzerol zum Vorschein.
»Nein, Herr Graf«, sagte er phlegmatisch, sogar gutmütig, die Pistole ziemlich sorglos auf seinen Knien haltend, »geben Sie sich keine Mühe mit Ihrem Paralla. Mich können Sie weder paralysieren noch faszinieren, ich bin gefeit gegen solchen indischen Humbug.«
Ganz merkwürdig war es, wie sich der Graf benahm. Nachdem er es einmal gehört hatte, war er plötzlich auch ganz gelassen, nahm die Sache hin, wie sie nun einmal lag. Hätte er aber nicht so gehandelt, dann wäre er eben nicht der gewesen, der er war.
Er kreuzte die Arme über der Brust, lehnte sich in den Stuhl zurück, schlug auch noch die Beine übereinander — das war alles.
»So!«
»Ja, so! Wir können hier doch ungeniert sprechen?«
»Ganz ungeniert.«
»Das freut mich. Nun, Herr Graf?«
Eine Pause. Der eine spielte mit dem Terzerol, der andere baumelte mit dem Beine.
»Nun, Herr Graf? Wollen Sie die Unterhaltung nicht eröffnen?«
»Ja, ich habe gar viel zu fragen.«
»Bitte, fragen Sie. Hoffentlich antworten Sie mir dann ebenso ehrlich wie ich Ihnen jetzt.«
»Sie haben vorhin nichts gesehen?«
»Nur träumende Menschen, die sich possierlich wie die Affen benahmen.«
Es wäre für uns schwer, zu schildern, was der nüchterne Depeschenreiter in Wirklichkeit gesehen hatte. Man denke an die Szene im ›Faust‹, wie Mephistopheles in Auerbachs Keller die Studenten ›fasziniert‹, wie die sich gegenseitig an die Nasen fassen, glaubend, sie hätten Weintrauben in der Hand, die sie abschneiden wollen.
Während seines Aufenthaltes in Rom 1787 und 1788 arbeitete Goethe auch viel an seinem ›Faust‹, obgleich der erst 1806 abgeschlossen wurde. Sollte Goethe nicht von dem Grafen von Saint-Germain gehört haben? Für Cagliostro interessierte er sich sehr, hat ja auch dessen Verwandte aufgesucht. Es hängt vielleicht eng zusammen.
»Sie haben wirklich nichts gesehen?«
»Wenigstens nichts von alledem, was Sie uns vormachen wollten und was die anderen gesehen haben wollen. Während Sie in der Luft herumschweben wollten, zum Teil unsichtbar, standen Sie immer ganz gemütlich da und erzählten Ihre Märchen.«
»Sie konnten doch ebenfalls das Stück Holz nicht aufheben.«
»Ich tat nur so.«
»Da haben Sie sich ausgezeichnet zu verstellen gewusst.«
»Ich dächte, Komplimente wären jetzt recht unangebracht. Ich kann Ihnen solche nicht einmal machen. Bei dem Orangenbäumchen zum Beispiel waren Sie recht sorglos. Sie ließen das Bäumchen dann zu schnell aus der Imagination der Zuschauer verschwinden. Man wusste gar nicht, wohin es plötzlich gekommen war. Das hätte Misstrauen erwecken können. Ich hätte das anders gemacht.«
»Woher habe ich denn die Apfelsinen bekommen?«
»Na, die haben Sie einfach aus der Tasche geholt, wir mussten glauben, wir brächen sie von dem eingebildeten Bäumchen ab. Ich hatte meine liebe Not, ernsthaft zu bleiben. Diese dummen Gesichter der Faszinierten!«
»Also Sie sind nicht fasziniert gewesen, wie Sie das ganz richtig nennen. Hm. Mir fehlt hier ein Übergang...«
»Darf ich Ihnen behilflich sein?«, fragte der Depeschenreiter spöttisch.
»Woher kennen Sie das Stichwort, durch welches ich Sie aus der Faszination wecken wollte?«
»Na, das haben Sie mir doch einzutrichtern versucht.«
Da schon bekam der Graf etwas zu hören, was sein Gesicht wiederum erstarren machte, und wieder so ein wilder Blick, dass der Depeschenreiter es doch für besser hielt, sein Terzerol etwas schussbereiter zu halten.
»Was, Sie haben wohl...«
Er wagte das Ungeheuerliche gar nicht auszusprechen.
»... gar nicht geschlafen?«, kam ihm der andere zu Hilfe. »Nein, nicht im Geringsten. Ich habe mich nur schlafend gestellt.«
Als der Graf Gewissheit hatte, wie es stand, dass er das Spiel verloren habe, war er auch gleich wieder der Alte, unerschütterlich. Dann wollte er nur weitere Erklärung haben.
»Sie bekamen von mir einen Schlaftrunk.«
»Das habe ich gemerkt.«
»Er war außerordentlich stark.«
»Jawohl, sehr stark.«
»Und er hat nicht auf Sie gewirkt?«
»Ebenso wenig wie bei Ihnen.«
»Wie meinen Sie?«
»Na, wir haben den Wein doch aus ein und derselben Flasche getrunken.«
Im Augenblick glaubte der Graf, die Flasche hätte einmal versagt. Aber der Depeschenreiter hatte ja schon gesagt, er habe gemerkt, dass in dem Weine ein starkes Betäubungsmittel gewesen war.
»Wie kommt es, dass der Schlaftrunk bei Ihnen nicht gewirkt hat?«
»Wie kommt denn das bei Ihnen?«
»Weil ich das Opiat natürlich nur in Ihr Glas geschüttet habe«, erklärte der Graf nicht ganz der Wahrheit gemäß, was ja aber hierbei gar nichts zu sagen hatte.
»So? Das müssen Sie höllisch geschickt gemacht haben. Aber ich war von vornherein auf so etwas vorbereitet.«
»Auf was vorbereitet?«
»Dass ich irgendwie betäubt werden sollte.«
»Und wie haben Sie sich dagegen geschützt?«
»Durch ein Mittel, welches die Wirkung jedes Schlaftrunkes und dergleichen aufhebt.«
»Was für ein Mittel ist das?«
»So fragt man kleine Kinder aus. So ein Depeschenreiter, der in der ganzen Welt Feinde hat, hat auch seine Geheimnisse.«
»Also, Sie haben nicht geschlafen, sich nur so gestellt?«
»Zweifeln Sie noch daran?«
»Sie können die Augen so ganz nach oben verdrehen?«
»Muss ich Ihnen das erst noch einmal vormachen?«
»Bitte.«
»Nein, jetzt möchte ich meine Pupillen lieber auf Sie gerichtet halten«, lachte Axel.
»Sie fürchten sich vor mir?«
»Ich kenne überhaupt keine Furcht.«
»Sie haben nicht nötig, die Pistole schussbereit zu halten.«
»Meine Sache. Bleiben wir doch bei dem Thema, wenn Sie Aufklärung haben wollen, die ich Ihnen gern geben will, weil ich solche dann auch von Ihnen erhoffe.«
»Richtig, bleiben wir bei der Sache! Ich stach Sie doch mit einer Nadel in den Arm.«
»Denken Sie, das weiß ich nicht mehr? Herr, da hatte ich die größte Lust, Ihnen ein paar herunterzuhauen. Aber ich tat's nicht, um nicht aus der Rolle zu fallen, und nachträglich bin ich nicht.«
»Sie wussten von vornherein, was ich mit Ihnen vorhatte?«
»Von vornherein.«
»Sie kennen diese geheimnisvolle Kunst, die Sie ganz richtig Faszination nennen?«
»In diesem Falle richtiger Faszinierung. Muss ich Ihnen das erst noch versichern?«
Jetzt entrang sich doch des Grafen Brust ein leises Stöhnen, wenn er auch äußerlich ganz kaltblütig blieb.
Der kleine Joseph war der erste Mensch gewesen, der von ihm im Schlafe nicht in Hypnose zu versetzen war — deshalb hatte er den Jungen vor jener Vorstellung hinausgeschickt — hier traf er einen Menschen, der das ganze Geheimnis wusste, in dessen alleinigen Besitz er zu sein glaubte. Aber was heißt alleiniger Besitz? So klug, um sich das zu sagen, war der Graf auch. Nur Gewissheit wollte er haben.
»Woher haben Sie dieses Geheimnis?«
»Meine Sache!«
»Wenn Sie so antworten, werde auch ich dann sehr wortkarg sein.«
»Gut. Ich war einige Jahre in Amerika. Da lernte ich einmal einen englischen Indianermissionar kennen, erwies ihm einen großen Dienst. In meiner Gegenwart nahm er mit einem Indianerhäuptling, in dessen Hände wir gefallen waren, eine merkwürdige Manipulation vor. Gab ihm einen Schlaftrunk, faszinierte ihn so, wie Sie es machen. Der Missionar offenbarte mir schließlich sein Geheimnis. Auch in Indien war er lange Zeit Missionar gewesen, hatte das Geheimnis auf zufällige Weise von einem Brahmanen erfahren. Denn auch die Fakire machen ihre Gaukeleien ja nur durch Faszination...«
»Aber sie geben den oftmals sehr vielen Zuschauern doch keinen Schlaftrunk.«
»Nein, die ermöglichen die Faszination wieder auf andere Weise. Wie, das wusste auch jener Missionar nicht. Er wusste nur, dass man denselben schlafwachen Zustand, oder wie man es nun nennen mag, auch erzeugen kann, wenn man dem Betreffenden vorher einen Schlaftrunk gibt. Oder auch im normalen Schlafe ist die Faszination, noch für später wirksam, zu erzeugen. Sonst habe ich Ihnen hierüber kaum etwas mitzuteilen.«
»Wissen Sie, ob noch andere Menschen dieses Geheimnis kennen?«
»Weiß nicht. Bin in meiner zehnjährigen Karriere als Depeschenreiter mit einer guten Portion Leuten zusammengekommen — habe noch nicht gemerkt, dass ein anderer so etwas kann. Sie sind der erste.«
»Lebt der Missionar noch?«
»Starb in meinen Armen.«
»Haben Sie Ihr Geheimnis jemand anvertraut?«
»Fiel mir gar nicht ein.«
»Haben Sie es öfters angewandt?«
»Ein paar Mal, um mich aus einer bösen Klemme zu ziehen oder um einen Gegner auszuforschen. Aber auch nur in der höchsten Not, wenn's gar nicht anders möglich war. Bin sonst kein Freund von solchem Humbug.«
»Mir ist natürlich bekannt, dass Sie der Depeschenreiter Axel sind.«
»Ich hab's Ihnen ja selbst gesagt, als Sie mich fasziniert glaubten. Da musste ich ziemlich der Wahrheit gemäß antworten. Sie hätten mich ja sowieso erkennen können.«
»Dann wissen Sie also auch, dass ich... doch lassen wir das zunächst...«
»Ja, lassen wir das zunächst«, stimmte Axel gleich bei, sehr wohl wissend, wovon jener erst hatte anfangen wollen — von der alten Bekanntschaft.
»Sie sind kein gewöhnlicher Depeschenreiter«, nahm der Graf wieder das Wort.
»Nein.«
»Sondern?«
»Der berühmteste oder doch gesuchteste Depeschenreiter.«
»Ich meine, Sie sind... ein Edelmann?«
»Jeder ehrliche Arbeiter ist für mich ein Edelmann.«
»Sie sind von keiner gewöhnlichen Geburt«, versuchte es der Graf immer noch einmal.
»A bah! Meine Geburt war so ordinär, dass ich nicht einmal ein Hemd anhatte. Nein, Herr Graf, darüber spreche ich nicht — das haben Sie verpasst, als Sie die Gelegenheit dazu hatten.«
»Da hätten Sie mir doch auch nicht der Wahrheit gemäß geantwortet, wenn Sie nun einmal etwas verschweigen wollen.«
»Das war sehr scharfsinnig«, erklang es mit einigem Spott; »aber, Herr, eigentlich bin ich doch wohl derjenige, der hier zu examinieren hat. Wollen Sie sonst noch etwas wissen? Dann beeilen Sie sich.«
»Wie kommt es, dass der Papst gerade Sie, einen gewöhnlichen Depeschenreiter, der Sie nun einmal sein wollen, auserwählt, als seinen Nuntius hierher geschickt hat?«
»Auf Empfehlung des Kardinals Luigo.«
»Wie kommt dann dieser dazu?«
»Das habe ich ich Ihnen bereits der Wahrheit gemäß erzählt, und die Depeschenreiterei ist eben doch keine so gewöhnliche Sache. Es sind ja schon mehrere im Auftrage des Papstes oder vielmehr dieses Kardinals hierher gekommen. Sie erzählten ja dann auch, was sie hier erlebt und gesehen haben. Sie befehlen Ihren Schülern doch gar nicht, darüber zu schweigen. Sonst hätte schon Lord Moore nicht erzählen dürfen, wie Sie ihm als Geist erschienen sind. Der Kardinal, als der Stellvertreter des Papstes auch in dieser Hinsicht, möchte nur gern erfahren, wie Sie diese Hexerei zustande bringen. Denn dass Sie wirklich mit übernatürlichen Kräften ausgestattet sind, das will eben nicht in den Kopf dieses Kardinals, so wenig, wie in den des Papstes. Dazu sind die beiden zu — zu — aufgeklärt ist noch nicht das richtige Wort... zu ehrlich, möchte ich lieber sagen. Dieser Kardinal Luigo ist eben eine wirkliche Eminenz — das heißt, ein ganz eminenter Kerl. Er war auch lange in Indien, hat an Fürstenhöfen die besten Fakire experimentieren sehen — wie sie's machen, das ist ihm völlig unerklärlich — aber dass diese schmierigen, verhungerten Kerls wirklich hexen könnten, dass ihnen die Naturkräfte oder gar Geister gehorchen sollten, das will ihm nicht in den Kopf. Irgendein Geheimnis, das sich schließlich auf ganz natürliche Weise erklärt, steckt dahinter. Wenn man's nur einmal herausbekommen könnte. Und so ist's eben auch mit Ihnen. Aber wer zu Ihnen geschickt wurde, der glaubte nicht nur an Ihre Wunderkraft, sondern stand auch immer gleich voll und ganz auf Ihrer Seite. Das war ihm stets anzumerken. Er schwärmte gleich so mit ganzer Seele für Sie. Kurz und gut, Sie schienen auch die Spione immer zu behexen. Sehen Sie, so kam der Kardinal auf mich. Wie ich seine nähere Bekanntschaft machte, habe ich Ihnen ja erzählt. Als er hörte, dass ich in Rom sei, sagte er sich gleich: ›Haah, den Axel müssen wir hinschicken, das ist ein Kerl, der hat mehr Haare auf den Zähnen als unter der Nase, der lässt sich nicht so leicht besoffen machen.‹ Auf diese Weise bin ich lümmelhafter Depeschenreiter einmal päpstlicher Nuntius geworden. Na, habe ich nicht ausführlich berichtet?«
Er hätte zum Schlusse — man hätte es eher erwartet — sagen sollen: Na, habe ich meine Sache nicht gut gemacht?
Der Graf hatte noch immer die Arme über der Brust verschränkt. Er musste doch fühlen, dass dies für ihn eine fürchterliche Niederlage war. Statt dessen ruhten seine Augen mit bewundernder Teilnahme auf dem bronzefarbenen Gesicht seines Feindes.
»Ja, Mister Axel, Sie sind ein großartiger Kerl. Kerl kommt von Karl und bedeutet Held...«
»Keine Komplimente, sage ich noch einmal — sie sind ganz unangebracht — ich habe Ihr Genick in der Hand, kann es mit einem Rucke umdrehen.«
»Das ist doch bereits so gut wie geschehen.«
»Wieso denn? Noch sitze ich ja in ganz gemütlicher Unterhaltung Ihnen gegenüber.«
»Der Kardinal weiß doch natürlich schon, dass Sie im Besitze dieses Geheimnisses sind, wie man derartige Kunststücke ausführen kann.«
»Wieso denn natürlich?«
»Haben Sie ihm nicht schon früher davon berichtet?«
»Ist mir nicht im Traume eingefallen. Wie ich schon sagte: Noch keinem einzigen Menschen habe ich derartiges erzählt. Während jenes Rittes mit dem Kardinal habe ich es auch nicht angewendet. Überhaupt nur dreimal oder eigentlich nur zweimal in den langen Jahren.«
»Dann haben Sie es ihm doch jetzt gesagt.«
»Ist mir nicht eingefallen.«
»Ich verstehe nicht.«
»Was verstehen Sie nicht?«
»Der Kardinal hat Ihnen doch erst erzählt, was für Dinge hier getrieben werden.«
»Das tat er.«
»Wie ich meinen Gästen magische Vorstellungen gebe.«
»Experimente, denen der indischen Fakire gleich — ja, das tat er.«
»Und als Sie das hörten, da war Ihnen doch auch klar, dass ich diese scheinbar übernatürlichen Phänomene mit Hilfe einer suggerierten Einbildung zustande bringe, nur in den Köpfen der Zuschauer.«
»Ja, das war nur sofort klar, gleich als ich in London die ersten Berichte über den Grafen von Saint-Germain vernahm. Aha, dachte ich, der kennt dasselbe Mittel, das mir der Missionar gegeben hat, was die indischen Fakire schon seit Jahrtausenden benutzen.«
Plötzlich begann es in den Augen des Grafen zu leuchten.
»Und Sie haben dem Kardinal nicht gesagt, dass Sie wissen, wie so etwas gemacht wird?«
»Ist mir gar nicht eingefallen. So ein immer gehetzter Depeschenreiter wird mit der Zeit ein ganz merkwürdiger Mensch.«
»Sie haben auch nicht gesagt, dass Sie ein Gegenmittel besitzen, um sich vor einer eventuellen Täuschung oder Blendung zu schützen?«
»Auch das nicht. Sie sind überhaupt unlogisch, Graf. Da hätte ich doch schon mindestens andeuten müssen, dass ich annehme, Ihr ganzer Hokuspokus beruhe nur auf einer Blendung. Hätte ich gesagt: Da werde ich zuvor mein Schlafgegenmittel einnehmen, dann hätte ich doch schon gewusst, dass Sie Ihre Gäste einschläfern. Ja, ich wusste oder ahnte es, aber... kein Wort davon verlauten lassen, nicht die geringste Andeutung gemacht. Das Wahren eines Geheimnisses ist die erste Pflicht des Depeschenreiters. Wir werden dadurch zu ganz hinterlistigen Füchsen, die sich nichts merken lassen, auch wenn sie ein Bein im Eisen gelassen haben.«
Immer mehr leuchteten die Augen des Grafen auf, jetzt veränderte er auch zum ersten Male seine Stellung, neigte sich vor.
»Ja, da ist doch eigentlich für mich noch gar nichts verloren«, begann er zu flüstern.
Aber bei dem Depeschenreiter kam er da nun freilich an den Unrechten, der durchschaute ihn doch sofort.
»Ach, Sie dachten wohl, ich würde jetzt gemeinschaftliche Sache mit Ihnen machen?«
»Herr, lassen Sie mit sich sprechen...«
»Geben Sie sich keine Mühe. Sie sind ein ganz nichtswürdiger Schwindler.«
Es war ausgesprochen. Und es hatte gesessen. Sollte es auch!
Totenbleich sank der Graf, sich nicht mehr beherrschen könnend, zurück. Doch mit einem Rucke richtete er sich sofort wieder auf.
»Ja, Sie kennen mich nun...«
»Sie haben es mir selbst offenbart, als Sie mich für willenlos hielten und glaubten, ich würde ohne Erinnerung erwachen. Sie haben sich Ihr Grab selbst gegraben. Sonst hätte ich Sie niemals wiedererkannt. Sie haben sich in den vier Jahren total verändert.«
Axel war aufgestanden, das Terzerol in der herabhängenden Hand, aber man sah, wie deren Muskeln gespannt waren, also auch die des ganzen Armes.
Der Graf versuchte es noch einmal mit Diplomatie. Wie er sich dabei benahm, können wir nicht weiter schildern.
»Ja, ich bin es...«
»Schade!«
»Der Mann, den Sie noch immer so verehren...«
»Jammerschade!«
»Und wissen Sie noch, über was wir uns damals unterhalten haben?«
»Leider. In vier Jahren kann man sich eben sehr verändern, und nicht nur dem Äußeren nach — Sie haben es nicht zu Ihrem Vorteil getan.«
»Wissen Sie denn gar nicht, was für edle Ziele ich auch jetzt noch verfolge?«
Der Depeschenreiter schritt langsam rückwärts, der Türe zu. Unter der Kutte sah man gar nicht seine Füße sich bewegen.
»Larifari! Edle Ziele kann man nicht mit unlauteren Mitteln erreichen. Ich wenigstens huldige diesem Grundsatze nicht — ich nicht!«
»Sie gehen fort?«
»Wie Sie sehen. Sonst noch etwas?«
»Zum Papst?«
»Zum Kardinal Luigo.«
»Bleiben Sie noch, bleiben Sie noch!«, begann der Graf fast zu flehen.
»Nein.«
»Ich habe Ihnen noch eine wichtige Offenbarung zu machen.«
»Kann mich nicht reizen. Ich weiß schon genug, um mir ein Urteil zu bilden. Die Sache ist übrigens die, dass ich höllisch müde bin. Zwei Tage und Nächte lang höchstens im Sattel geschlafen, und mein Gegenmittel hält nicht auf die Dauer an. Jetzt beginnt der Schlaftrunk noch nachträglich zu wirken.«
»Bleiben Sie noch, ich beschwöre Sie!«
»Schwören Sie lieber nicht. Ihr Sündenregister, Sie fleckenreiner Herr, ist schon ziemlich voll. Doch warten Sie ab, legen Sie sich noch nicht gleich in Ihr selbstgegrabenes Grab. Ich muss die ganze Sache erst beschlafen. Wie gesagt, der Mensch ändert sich manchmal total, und dazu genügt schon eine Spanne Schlaf, auch ohne beeinflussenden Traum. Ich weiß nämlich noch gar nicht, was ich dem Kardinal berichten werde. Vielleicht berichte ich nur das Günstigste über Sie. Vielleicht aber breche ich Ihnen das Genick. Das werde ich ganz machen, wie ich will. Wie gesagt, ich muss erst einmal ordentlich ausschlafen. Ich fühle, wie ich nervös zu werden anfange. Ihre Sachen können Sie ja unterdessen packen, auch ein schnelles Pferd besorgen und in Ihrem Fuchsbau ein Loch offen halten. Aber in Ihr selbstbereitetes Grab brauchen Sie sich noch nicht zu legen. Sie werden meine Entscheidung schon rechtzeitig genug erhalten. Auf Wiedersehen, Sie mein edler Retter, den ich noch immer verehre und bewundere, und Sie gottverdammter, schuftiger Schwindler, den ich maßlos verachte.«
Mit diesen Worten, ganz dem Charakter dieses Depeschenreiters entsprechend, hatte er, immer rückwärts gehend, hinter sich die Tür geschlossen.
Der Graf eilte ihm nach. Kaum war die Tür ins Schloss gefallen, als der sonst über alle Schwächen erhabene Mann zusammenbrach. Im buchstäblichsten Sinne des Wortes.
»Ausgespielt!!«
Mit diesem einzigen Worte warf er sich mit dem Oberkörper über den Tisch, das Gesicht in den Armen vergrabend.
Und so blieb er stundenlang liegen. Deshalb konnte ja sein Hirn rastlos arbeiten.
Nichts regte sich in dem Hause.
Der Morgen musste bald grauen, als sich der Graf endlich wieder erhob.
»Mein Kind, mein armes Kind!«
Dies war das Ende der alten und der Ansang der neuen Gedanken, und er hatte es mit schmerzlichstem Gesicht geflüstert.
Dann, als er sich erhob, wurde er ehern.
»Er hat recht«, murmelte er, »Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich werde meine Sachen packen. Und ich werde es nicht umsonst tun. Er wird mich ja doch verraten, ich weiß es, gerade, weil er dann ganz nüchtern erwacht, und er ist ein viel zu gerader, ehrlicher Charakter. Ausgespielt!«
Er schellte die Glocke, welche den Pagen rief. Dass dieser jetzt schlief, daran dachte er wohl nicht, hatte wahrscheinlich ganz die Zeit vergessen.
»Den kleinen Joseph werde ich mitnehmen. Es ist eine treue Seele. Weiß selbst nicht, warum ich den Jungen so ins Herz geschlossen habe. Ich werde ihn dennoch erziehen, trotz alledem und alledem. Was mir für immer misslungen zu sein scheint, soll er dereinst fertig bringen, nur in ganz, ganz anderer Weise. so wie es mein Meister...«
Bei diesem Worte übermannte ihn noch einmal der Schmerz.
Wie in heller Verzweiflung breitete er die Arme aus.
»Ach, du mein edler Meister, wie furchtbar wahr hast du gesprochen! O, hätte ich dir doch gefolgt!«
Schon war es wieder vorbei.
»Zu spät. Meinen einmal eingeschlagenen Weg kann ich nicht mehr ändern, ebenso wenig aber fortsetzen. Ausgespielt! Was aus mir wird, ist dem Schicksal überlassen. Hier bleiben kann ich natürlich nicht. Ich kann mir doch nicht beweisen lassen, dass ich vor vier Jahren nicht dort drüben im Keller im Zinksarge gelegen, sondern bei Paris den Krankenpfleger gespielt habe? Hahahaha!«
Auch dieser Ausbruch von Hohn über sich selbst war schnell wieder vorüber.
»Wo bleibt Joseph?«
Verwundert bemerkte er, dass draußen der Tag zu grauen begann, die ersten Vogelstimmen laut wurden. Er blickte nach der Uhr.
»Was, schon vier? Ich muss doch geradezu geschlafen haben! Ach, wäre es nur ein Traum gewesen! Aber nein, es ist eine bittere, furchtbare Wirklichkeit! Als Betrüger entlarvt. Ja, was wollte ich eigentlich? Richtig, Joseph mitnehmen. Er schläft, der glückliche Junge!«
Er begab sich hinüber in Josephs Zelle. Hier waren die Läden geschlossen, aber der Graf konnte ja im Finstern sehen, und dann brauchte er sich auch nur durch Tasten zu überzeugen, dass Joseph nicht im Bett lag.
»Ist der Junge schon auf?«
Er begab sich in sein Schreibzimmer zurück, ließ eine andere Klingel ertönen, welche den auf dem Korridor wachenden Diener hereinrief.
»Wo ist mein Page?«
»Der ist doch in seinem Zimmer.«
»Nein, er ist schon aufgestanden.«
»Herausgekommen ist er aber noch nicht.«
»Du hast ihn einfach nicht bemerkt. Suche ihn, schicke ihn zu mir. Halt! Hat der — der... du weißt ja, wer es war — hat der päpstliche Nuntius das Kloster schon verlassen?«
»Schon?«, wiederholte der Diener erstaunt, denn so zerstreut hatte er seinen Herrn noch nie gesehen, das kam ihm bei diesem Manne überhaupt ganz unfasslich vor. »Das war um eins, vor drei Stunden!«
»Ach, richtig!«, fuhr sich der Graf mit der Hand gegen die Stirn. »Also, hole mir den Pagen. Was ist der Schlingel denn nur schon so früh aufgestanden?«
Als der Graf wieder allein war, betastete er noch energischer seine Stirn.
»Ruhe, Ruhe!«, murmelte er. »Gerade jetzt darf ich nicht vergesslich sein. Diese mich anwandelnde Schwäche wollen wir schnell bannen.«
Der Graf stellte sich aufrecht hin, zog langsam den Atem ein — und nun wie langsam!
Es war schade, dass er dieses Kunststück nicht dem Depeschenreiter vorgemacht hatte. Dann häte dieser vielleicht doch noch einen anderen Begriff von den — wenn nicht übernatürlichen, so doch außerordentlichen Fähigkeiten dieses Mannes bekommen. Den anderen Schülern, die schon länger bei ihm waren, hatte er es zur Aufmunterung, wie weit es der Mensch bringen kann, wohl schon gezeigt, aber eben dem päpstlichen Nuntius nicht.
Zwei Minuten dauerte es mindestens, ehe er sich voll Luft gepumpt hatte, durch einen einzigen Atemzug, und zwar begann er erst den Unterleib zu füllen, dann erst die Brust, und ganz erstaunlich war es, wie sich seine Brust dabei erweiterte. Sein Brustkasten schien fast den doppelten Umfang angenommen zu haben. Dann hielt er eine Minute den Atem an, und zwei Minuten brauchte er, um ihn langsam, ganz langsam wieder auszustoßen. Und dann atmete er, ohne einmal nach Luft geschnappt zu haben, wie zuvor, wobei man, wenn man dies beobachtete, allerdings bemerkte, dass er überhaupt außerordentlich langsam atmete.
»Das Buch in den Keller zurück, den ich mir doch noch zu reservieren gedenke«, war sein erster Gedanke nach dieser Übung, bei der er sicher an etwas anderes gedacht hatte, denn diese mysteriösem Atemübungen werden ja nach ganz besonderen Methoden gelehrt. »Und auch der Fürstin de la Roche muss ich mein Versprechen halten, das kann mir sogar vielleicht noch zur Ehrenrettung dienen, wenn überhaupt noch etwas zu retten ist. Aber jung und schön soll die wieder werden, und wenn ich mir's auch nur zum Spaß mache.«
Der Graf, jetzt unbeobachtet, konnte schon wieder ganz heiter lächeln.
»Da sieht man doch, was so ein Atemzug wert ist. Einmal habe ich sofort die nächstliegenden Gedanken richtig erfasst, ohne mich irgendwie darauf zu besinnen, denn Agrippas Buch hätte ich sonst wirklich vergessen, hier oben liegen lassen, und dann vor allen Dingen auch plötzlich die heitere, ruhige Stimmung. Es kommt, wie es kommt, und da hilft weder Weinen noch Beten. Eine heitere Ruhe ist das Beste, was der Mensch besitzen oder erringen kann.«
Er zog den Schlüsselbund aus der Tasche, wollte das Schubfach aufschließen, in das er gestern Abend das Buch geworfen hatte.
»Was ist denn das?«
Der Schlüssel schloss nicht. Der richtige war es. Noch einiges Proben — er schloss nicht, ließ sich nicht umdrehen.
Der Graf betrachtete das Schloss, das von der Hängelampe hell beleuchtet wurde.
Man darf wohl glauben, dass dieser Mann, dessen Hauptkunst darin bestand, die Schwächen der Menschen zu erkennen, auch den geschicktesten Detektiv abgegeben hätte.
»An dem Messingschilde sind ganz frische Risse. Das sieht ja fast aus, als ob da mit einem spitzen Instrument herumgekritzelt worden wäre!«
Doch einen direkten Argwohn fasste der Graf noch nicht. Er suchte an seinem Bunde nach einem anderen Schlüssel, konnte aber sofort erkennen, dass keiner passen würde.
»Höchstens dieser hier brauchte einige Feilstriche, die ihm auch nichts schaden würden...«
Er wurde durch das Klopfen und den Eintritt des Dieners unterbrochen.
»Herr Graf, der Page ist im ganzen Kloster nicht zu finden.«
»Er wird im Garten sein.«
»Auch nicht im Garten. Wir haben doch gerufen und gepfiffen.«
Die Unauffindbarkeit Josephs interessierte ihn jetzt am meisten. Ob der Page etwa das Kloster verlassen habe, brauchte er doch nicht erst zu fragen.
Der Graf begab sich in Josephs Schlafgemach hinüber, zündete die Lampe an. Den Diener hatte er nicht mitgenommen, dieser hatte, da er zum Bleiben keine Aufforderung erhalten, das Zimmer gleich wieder verlassen.
Nur ein Blick nach dem Bett und...
»Joseph hat gar nicht darin gelegen, er hat das Bett künstlich eingerissen!«
So etwas lässt sich ja unterscheiden. Einige Erfahrung gehört freilich dazu, beobachtende Studien, die man doch schließlich auch mit einem Bett anstellen kann, so gut, wie ein englischer Gelehrter sein ganzes Leben dem Studium der Wanzen gewidmet hat.
Hier war der Unterschied schwerer zu erkennen als an einem Federbett, ob ein Mensch längere Zeit darin gelegen oder sich nur einmal hineingelegt hatte, denn es war nur eine mit einem Leinen überzogene Rosshaarmatratze mit unüberzogenen Decken.
Aber der Graf erkannte es sofort. Dazu freilich hatte er jetzt Lampenlicht nötig.
»Joseph hat den Eindruck erwecken wollen, als habe er die ganze Nacht im Bett gelegen! Doch halt, vorsichtig im Urteil! — Weshalb den Eindruck erwecken wollen? Kann er sich nicht mit Absicht zum längeren Schlafe niedergelegt haben, ist aber bald wieder... nein, nein, diese Decken sind in hinterlistiger Absicht so herumgewürgt worden!«
Woraus das der Graf erkannte, können wir natürlich nicht schildern.
Seine Augen suchten im Zimmer umher. Nichts Auffälliges.
Er öffnete den Kleiderschrank. Da hing die Galauniform, dort die eine der beiden einfacheren, die er hin und wieder wechselte.
»Die hier hat er gestern angehabt.«
Woher der Graf das wissen wollte, obwohl sich diese beiden Kostüme so ganz glichen, das war seine Sache. Diesem Auge entging eben so leicht nichts.
»Jawohl, hier oben an der blauen Hose ist das rote Tüpfelchen.«
Es war nur ein Punkt, den er meinte. Dabei hatte sein Finger diese Stelle berührt. Und die Spitze dieses schlanken und doch so kräftigen Fingers musste auch sehen können, denn das Gefühl konnte doch nicht genügen.
In der Tasche befand sich ein längerer Gegenstand, etwa wie ein Schlüssel — das wusste der Graf, ehe er hineingriff, und der Page hatte des Nachts keinen der ihm anvertrauten Schlüssel in der Tasche zu behalten, — also der Graf griff in die Tasche und brachte einen starken Draht zum Vorschein, an einem Ende ringförmig gebogen, am anderen zum Haken — einen Dietrich.
Nur einen starren Blick darauf, und der Graf entfärbte sich, wusste gleich alles.
»Mit diesem spitzen Haken ist das Messingschloss geritzt worden — mit diesem Dietrich hat Joseph das Schloss geöffnet!«
Hinüber in die Schreibstube. Jawohl, das widerspenstige Schloss war mit diesem Dietrich, wenn man etwas davon verstand, mit Leichtigkeit zu öffnen. Und das Fach war leer, das Buch daraus verschwunden, so wie Agrippas ganzes Hauptwerk für die Menschheit verschwunden ist.
Der Graf sagte nichts, legte den Dietrich auf den Tisch, ein Schritt nach dem Diwan, ließ sich darauf nieder und schlug die Hände vors Gesicht.
Und das sagte mehr als jedes Wort, auch kein Stöhnen war nötig.
Was galt ihm noch die Erwägung, wie und wann Joseph geflohen war? Wohin er sich gewendet hatte? Er brauchte nur die goldenen Knöpfe abzuschneiden, und er hatte einen für damalige Zeiten tadellosen Straßenanzug.
Der Knabe, dem er so viel Vertrauen geschenkt, den er so ins Herz geschlossen hatte — weshalb, das wusste der Graf selbst nicht — hatte ihn bestohlen! Er hatte den Grafen hier in diesem Schreibzimmer in dem alten Folianten die letzte Zeit öfters lesen sehen, denn Josephs wegen versteckte er das Buch nie. Ob er es einmal liegen gelassen hatte, ob Joseph wusste, was für Geheimnisse es enthielt, die besser die Welt gar nicht erfuhr, die mindestens nicht ein Einzelner, der sie geheim halten wollte, wissen durfte, das war dem Grafen jetzt ganz gleichgültig.
Joseph hatte ihn bestohlen und verlassen — als Dieb böswillig verlassen!!
Doch diesmal währte es nicht lange, so erhob sich der Graf wieder. Erst hinterher kam ein leises Stöhnen aus seiner Brust.
»Recht so! Da ist mir einmal bewiesen worden, dass ich auch nur so ein blinder Dummkopf bin, wie alle die anderen Menschen, die ich an der Nase herumführen will. Dieser Junge hat mich eines anderen belehrt, hat mir meinen Hochmut hoffentlich für immer ausgetrieben. Was mag er mit dem Zauberbuche machen wollen? Nun, mag er es verkaufen oder sonst damit glücklich werden.«
Gerade durch diese Gleichgültigkeit verriet er aber ja, wie furchtbar nahe ihm diese Treulosigkeit des Jungen ging, und das hatte er ja auch schon vorhin deutlich genug ausgedrückt.
Auf diese Weise kam der spätere Cagliostro in den Besitz von taschenspielerischen Geheimnissen, verbunden mit Physik und Chemie, mit denen er viele Jahre lang alle Welt täuschte, sich einen wirklich berühmten Namen machte, jedenfalls viel bekannter wurde als der Graf von Saint-Germain, dafür aber auch ein ganz anderes Ende nahm.
Von dieser Benutzung des geraubten Buches konnte der Graf freilich damals noch nichts ahnen. Sein geliebter Page sollte auch noch viel, viel schmerzlicher in sein Leben eingreifen.
»Ans Werk! Zuerst alle Spuren vernichten, die in meinen letzten Schlupfwinkel führen, und den will ich mir schon zu sichern verstehen, oder... ich sprenge das ganze Kloster in die Luft!«
Er begab sich ins Sanktuarium, entfernte hier unter den Teppichen Drähte und andere Vorrichtungen, zog auch aus der einen Wand zwei sehr lange Drähte hervor, die durch winzige Löchelchen in das benachbarte Refektorium geführt hatten.
Dabei arbeitete sein Hirn aufs Angestrengteste.
Was konnte kommen? Verbannung aus dem Kirchenstaate. Das war aber das Mildeste. Nein, jedenfalls wurde er verhaftet und vor ein Inquisitionsgericht gestellt. Er hatte Täuschungen, Blendwerk, für Tatsachen ausgegeben, und wenn er auch den Namen Gottes und andere Anspielungen noch so sorgfältig dabei vermieden hatte — man hatte ihn ganz ohne seinen Willen doch immer mit Jesus Christus verglichen, er besäße dieselbe Wunderkraft — und war das an sich schon furchtbar vermessen, wie nun erst, da sich alles als Blendwerk, als Betrug herausstellte.
Dabei aber war sich der Graf bewusst, dass man ihn, wenn es gerecht zuginge, gar nicht viel anhaben konnte. Was galt denn die Aussage dieses Depeschenreiters? Bewies er, dass er dieselben Phänomene erzeugen konnte — nun gut, so besaß er eben dieselbe wunderbare Kraft.
Mit der Hypnotik ist es eine ganz eigentümliche Sache. Der eine sieht etwas, kann ganz ehrlichen Herzens auf die Wirklichkeit schwören, und der andere sieht absolut nichts. Wer hat nun recht?
Der Graf war überzeugt, dass seine Anhänger durchaus nicht an ihm zweifeln würden, mochte kommen, was da wollte, wenn er nur selbst bei seinen Behauptungen blieb.
Es liegt hierbei etwas vor, was nicht so leicht zu erklären ist, aber wir haben genug andere Beispiele. Nehmen wir den Spiritismus an. Die einen glauben daran, die anderen nicht. Man mache den Ungläubigen, die nun einmal bloß an das glauben, was sie mit Fäusten packen können, noch so viel Phänomene vor, die mit menschlichem Verstande auf sogenannte natürliche Weise gar nicht zu erklären sind — nützt alles nichts, sie lassen sich nicht überzeugen, dass es Geister gibt, leugnen den ganzen Schwindel. Auf der anderen Seite mögen noch so viel Medien als Betrüger entlarvt werden, die Spiritisten mögen noch so oft selbst dabei sein, den Schwindel richtig mit Händen greifen können — nützt alles nichts, sie glauben ruhig weiter an ihre Geister. Und wenn nun unter den letzteren selbst solche Köpfe sind wie ein Gladstone und ein Edison, ja, was soll man dazu sagen? Wer hat recht?
Das ist überhaupt eine ganz merkwürdige Geschichte. Die einen glauben an einen Gott, die anderen nicht. Wer hat recht? Dieser Kampf geht doch nun schon seit Jahrtausenden, das muss sich doch endlich einmal entscheiden lassen!
Nun gibt es eine indische Philosophie, die aber auch im Abendlande ganz bedeutende Anhänger hat, auch Kant nähert sich ihr schon sehr — diese Anhänger, es brauchen gar keine Gelehrten zu sein, leugnen überhaupt die ganze Welt! Die existiert in Wirklichkeit gar nicht, das sehen und fühlen und erleben wir alles nur in unserer Einbildung, obgleich wir selbst gar nicht existieren. Das ist alles nur ein großer Weltentraum. Und auch unsereins hat manchmal helle Augenblicke, wo einem das gar nicht so unrichtig erscheint. Das alles, was wir wahrzunehmen meinen, existiert nur in unserer Einbildung. Auch die sogenannten Naturgesetze sind überhaupt gar nicht vorhanden. Denn es braucht nur eines kleinen Eingriffs in unser Gehirn, mechanisch durch Menschenhand vollzogen, dann könnte sich alles umdrehen, wir sehen den fallenden Stein nach oben fliegen, den Geruch fühlen wir, das Gefühl schmecken wir, und so fort. Und wenn diese Korrektur am Gehirn bei jedem einzelnen Kinde vorgenommen würde, dann entstände für die ganze Menschheit eben auch eine ganz andere Welt. Oder sie kann sogar vollständig ausgelöscht werden, und wir leben dennoch weiter.
Jedenfalls also, wenn die Materialisten und Realisten, die nur an das glauben, was sie greifen und begreifen können, die Geistergläubigen verlachen, dann haben jene Philosophen genau dasselbe Recht, auch diese Realisten zu verlachen. Jene glauben ja ebenfalls an etwas, was gar nicht existiert.
Wenn man auf diese Weise vorgeht, wird man sich ewig im Kreise drehen. Wahrscheinlich ist alles Schwindel. Nur soll man niemand verspotten, ob er nun den Adam oder einen Pavian für seinen Ahnen hält. — —
Alles, was der Graf von der Diele und den Wänden entfernt hatte, legte er auf den Schreibtisch, stellte sich selbst darauf und fuhr in die Tiefe. Unten angekommen, räumte er den Tisch ab und ließ ihn wieder hinaufgehen.
»So, das wäre besorgt, und den möchte ich sehen, der diesen Mechanismus findet oder sonst hier einzudringen weiß. Da sind nicht nur einige Mauern zu durchbrechen, da müsste erst das ganze Kloster in Trümmer gelegt werden, und dann würde man noch immer nichts finden, dafür kann und werde ich sorgen. Ach, und nun mein Kind!«
Er durchschritt einen langen Gang, öffnete eine Tür.
In dem von einer Ampel matt erleuchteten Zimmer lag in einem Bettchen sein Kind, die der Mutter genommene Pepita.
Etwas Furchtbares musste in dem Manne vorgehen, als er auf den Zehenspitzen nach dem Bettchen schlich. In seinen Zügen war es zu lesen.
Er erwartete es ja schon seit Tagen, wir haben es ihn selbst sagen hören — etwas von einem sterbenden Kinde — und dennoch wollte er es selbst nicht glauben.
So erreichte er das Bettchen, und er brauchte nur das verkrüppelte Händchen zu fühlen, so wusste er alles.
»Tot, meine Pepita tot!«
Mit diesen wimmernden Worten war er auf die Knie gestürzt.
Der ganze Schmerz brach erst dann aus, als er sich wieder aufrichtete und die Arme zu der gewölbten Decke ausstreckte.
»Du in den Straßen umherirrende Mutter, der ich dir dein Kind geraubt, die ich in den Wahnsinn getrieben habe... du — bist — gerächt!!«
Und mit diesem Aufschrei namenloser Verzweiflung schlug der starke, sonst über alle Schwächen erhabene Mann schwer zu Boden.
Es war mittags gegen elf Uhr, als in den belebten Straßen Roms wiederum der lederne Depeschenreiter das größte Aufsehen machte, und zwar diesmal wirklich als Reiter, hoch zu Ross, und man wusste zum Teil auch schon, dass der zwar nicht sehr edle und schöne, aber starke, schnelle und ausdauernde Gaul heute in aller Frühe von einem päpstlichen Beamten im Stalle eines Pferdehändlers gekauft worden war, obgleich in den Stallungen des Vatikans doch genug Reitpferde standen.
Axels Ziel war das Spukkloster. Sich im Sattel beugend, ließ er den schweren Klopfer donnernd erschallen.
Alsbald öffnete sich in dem Tore eine kleine Klappe.
»Ich will den Grafen sprechen — ich, Depeschenreiter Axel.«
»Der Herr Graf ist für keinen Menschen zu sprechen.«
»Weshalb nicht? Ist er nicht in seiner Höhle?«
»Im Kloster ist er wohl, aber er empfängt überhaupt keinen Besuch.«
»Was Besuch! Ich komme dienstlich vom Papste. Sagt nur, dass ich es bin, der Depeschenreiter Axel. wie schnell er mich empfangen wird. Und nun überhaupt: Aufgemacht, oder ich trete die Türe ein! Oder denkt Ihr etwa, ich bin so einer, der sich vor der Türe mit Redensarten abspeisen lässt?! Vorwärts, aufgemacht, du blutiges Kaninchen!«
Er hatte in seine Rede auch noch andere schöne Worte immer eingeflochten, die wir aber auslassen wollen.
Eingeschüchtert öffnete der Diener. Mit dem Grafen war doch etwas im Gange. Schon gestern Abend war ja ein päpstlicher Nuntius dagewesen, mit dem zugleich auch des Grafen Leibpage verschwunden war. Hier musste irgend etwas nicht in Ordnung sein, es lag in der Luft.
Die Erbauer und auch die späteren Bewohner des Klosters hatten nicht mit einer Einfahrt gerechnet. Von dem Tore führte durch den Garten nach dem Haupteingange des Klosters nur ein Fußweg, sogar ein sehr schmaler, jetzt, nachdem der ganze Garten in Ordnung gebracht, war mit Kies bestreut und geharkt.
Dem Ledermanne fiel es gar nicht ein, abzusteigen und sein Pferd an den für diesen Zweck eingelassenen Ring zu hängen, er ritt den Kiesweg entlang, klinkte die Klosterpforte auf und ritt, sich etwas bückend, in die Vorhalle, die aber durch Möbel schon ganz wohnlich eingerichtet worden war, der Boden auch mit einem Teppich belegt. Es fehlte nur noch, dass Axel auch noch die Treppe hinaufritt.
Aber der Depeschenreiter zog doch vor, sich hier aus dem Sattel zu schwingen und die Zügel über den Arm eines ehernen Jupiters zu legen, während das Pferd zu den gestickten Früchten des Teppichs noch einige natürliche, wenn auch nicht essbare, hinzufügte.
»Wo ist der Graf?«, rief Axel den starrenden Dienern zu.
Da trat dieser schon selbst aus dem Sanktuarium, bleich wie der Tod.
»Guten Morgen! Teufel, wie sehen Sie aus?! Sie sollten sich doch bald wieder einmal in Todesschlaf versetzen, wenigstens für ein paar Stunden. Also, Graf, halten Sie sich bereit — die Bulle ist schon gefüllt, braucht nur noch zugestöpselt zu werden.«
Was sollte der Graf von alledem denken? Doch er blieb ganz kalt.
»Was für eine Bulle?«
»Na, die Bannbulle. Heute Nachmittag Punkt vier werden Sie rausgeschmissen. Kann ich Sie sprechen? Habe noch ein paar Minuten Zeit.«
Also in den Bann erklärt! Dann musste dieser Mann doch, wie der Graf ja auch erwartet, gegen ihn gesprochen haben. Und dennoch suchte er ihn noch einmal auf?
Nun, im Kopfe eines solchen Mannes, der einfach in die gute Stube ritt, mochte es eben etwas anders aussehen als bei normalen Menschen.
»Bitte, folgen Sie mir.«
Sie betraten wieder das kleine Schreibzimmer.
»Können wir hier belauscht werden?«
»Sprechen Sie ganz ungeniert.«
»Also, Graf, ich habe mir die Sache beschlafen. Als ich gestern gegen eins in den Vatikan zurückkam, wo man mir ein Bettchen zurechtgemacht hatte, wollte Kardinal Luigo durchaus sofort das Resultat meiner Mission hören. Aber da gab es nichts bei mir. Ich sei hundemüde, ließ ich ihm sagen, legte mich neben das Bettchen und habe bis gegen acht wie ein Bär geschnarcht. Dann überdachte ich die Sache noch einmal ganz nüchtern und ging zum Kardinal.«
»Und haben alles berichtet«, ergänzte der Graf finster.
»Ja, natürlich zu Ihren Gunsten.«
»Was, zu meinen Gunsten?!«
»Dieser Graf ist einfach ein Patentengel, habe ich gesagt, und wenn ein wirklicher Engel vom Himmel herabstiege, der könnte kein besseres Evangelium verkünden als dieser Graf, und mehr Wunder ausführen könnte er ebenfalls nicht. Der kann eben mehr als Brot essen. Der kann sich unsichtbar machen, kann in der Luft herumkutschieren, sich oben an der Decke hinlegen, kann ganze Obstgärten und Gemüsebeete wachsen lassen — — doch nein, ich habe ohne Übertreibung geschildert, alles das, was die anderen gesehen haben wollen, und was auch ich gesehen hätte, hätte ich mich eben nicht dagegen zu wehren gewusst. Dass ich das berichtet habe, das ist die Folge einer halben Stunde Nachdenkens heute früh gewesen.«
Immer größere Augen bekam der Graf.
»Ja, Sie haben aber doch gesagt, wie Sie mich schon vor vier Jahren gesehen haben...«
»I Gott bewahre — Mensch, wofür halten Sie mich denn?! Dann hätte ich Ihnen doch das Spiel verdorben. Und das will ich eben nicht. Nein, ich bin vollkommen auf Ihrer Seite. Immer spielen Sie lustig diese Puppenkomödie weiter. Wenn's auch Schwindel ist. Aber was ist denn Theaterspielerei weiter als Schwindel? Überhaupt die ganze Welt ist Schwindel. Also schwindeln auch Sie weiter. Mir recht! Wenn ich Zeit hätte, machte ich gleich selber mit.«
»Und dennoch bin ich in den Bann erklärt worden?«, konnte der Graf noch immer nicht begreifen.
»Dennoch? Na, Gräfchen, was meinen Sie denn, was mit Ihnen passiert wäre, wenn ich dem Kardinal reinen Wein eingeschenkt hätte? Sie wären doch gleich festgenommen worden! Und wie fest! Sie wären vor ein Inquisitionsgericht gekommen. Und das wäre schnell mit Ihnen gegangen. Falls man nicht mehr einen öffentlichen Scheiterhaufen abbrennen will — das kann aber immer noch passieren, die Volksstimmung braucht nur danach beschaffen zu sein — hätte man Sie einfach von der Bildfläche verschwinden lassen. Und man hätte nicht noch einmal die Hungerprobe mit Ihnen gemacht, Sie wären einfach, wenn nicht öffentlich, so doch im Geheimen gehenkt worden. Das wäre die sofortige Folge gewesen, wenn ich der Wahrheit gemäß berichtet hätte. Oder meinen Sie nicht?«
Ja, dieser Mann hatte recht, hundertmal recht! Jetzt gingen dem Grafen hierüber die Augen auf.
»Dass über Sie«, fuhr Axel fort, »dennoch die Bannbulle ausgegossen wird, das ist nicht zu vermeiden. Der Papst wurde sofort von alledem benachrichtigt, was ich erzählt hatte, hörte es wahrscheinlich hinter einem Vorhange gleich mit an. Nun ist dieser Benediktus ja ein kurioser Kauz. Der glaubt ebenso felsenfest an einen Teufel und an Engel wie an den lieben Gott, aber nur an den einzigen Teufel und an diejenigen Engel, die in der Bibel vorgeschrieben sind Von den indischen Fakiren und ihren Wundern hat er sicher schon gehört. Kardinal Luigo ist selbst lange Zeit in Indien gewesen, der wird ihm schon davon erzählt haben. Gut, sagt nun Benediktus, mögen die schwarzen Kerle in Indien treiben, was sie wollen, da habe ich nichts zu sagen, aber hier bei mir gibt's so etwas nicht. Christus hat Wunder getan, und das darf ihm keiner nachmachen, und wenn er's auch könnte. Hier bei mir wenigstens nicht. Der macht ja meine ganze Herde verrückt. Der Kerl muss raus. Das war also schon längst beschlossene Sache. Sie hat sich nur immer hinausgeschoben. Der gutmütige Benedikt wollte auch Ihre Schüler nicht gern kompromittieren, suchte immer nach einem Ausweg, wie das in aller Stille zu arrangieren sei.
Nun ist heute noch etwas hinzugekommen. Gerade als ich mit meinem Berichte fertig war, Sie als einen Heiligen in alle Himmel erhoben hatte, kam Lord Moore, zeigte dem Papste seine Entlassung als englischer Gesandter an. Oder doch so gut wie seine Entlassung. Er wartet nur noch auf den Herzog Malborough, der ihn ablösen soll.
Das schlug dem Fasse den Boden aus. Benedikt hat den Lord sehr lieb gehabt. Es war eine herzliche Freundschaft. Oder er liebte ihn wie ein Vater seinen Sohn. Diese Freundschaft ist in der letzten Zeit durch Sie getrübt worden. Sie wissen schon, weshalb. Und nun gar die Entlassung seines Lieblings, auch nur Ihretwegen! Das ist schon vor drei Wochen in ganz London bekannt gewesen. Einen Gesandten, den Vertreter eines Reiches, der intim mit Hexenmeistern und Geisterbeschwörern verkehrt, kann man nicht brauchen. Das passt zusammen wie die Faust aufs Auge. Und da ist der alte Pitt nun gerade der rechte, der so etwas duldet. Und das mag auch in dem Briefe der englischen Regierung gestanden haben, den der Lord dem Papste unentsiegelt zu übergeben hatte... was wollen Sie?«
»Lord Moore nimmt seine Entlassung nicht nur ganz gleichmütig auf, sondern er freut sich sogar sehr darüber.«
»Na ja, aber was kümmert das den Papst? Ich hörte den alten, sonst nicht aus der Ruhe zu bringenden Herrn vorhin einmal brüllen. Raus mit dem Kerl, nun hat's dreizehn geschlagen!! Das heißt, das hat Benediktus nicht gebrüllt. Ich konnte die Worte nicht verstehen. Aber gebrüllt hat er. Und dann erfuhr ich durch Zufall, dass die Bannbulle bereits fabriziert wird. Heute Nachmittag um vier wird sie Ihnen mit den nötigen Zeremonien überreicht. Sie werden regelrecht mit dem Bannfluch belegt. Und wenn noch die alten guten Zeiten wären, so würde überall in der Welt, wohin davon die Nachricht gelangt, jedes christliche Haus lieber die Pest als Gast aufnehmen als den mit dem Bannfluch Beladenen. Diese Zeit der absoluten Macht des Papstes ist Gott sei Dank ja vorüber, aber immerhin, es hat auch heute noch etwas zu bedeuten. Ein wirklich gläubiger Katholik wird Sie nicht mehr aufnehmen. Na, die Welt ist ja groß genug. Nur im Kirchenstaat dürfen Sie sich natürlich nicht mehr aufhalten. Wohin werden Sie gehen?«
»Sie sagten ja selbst, dass die Welt groß genug ist«, entgegnete der Graf, dessen bleiches, düsteres Antlitz sich bei dieser langen Rede des Depeschenreiters immer mehr aufgehellt hatte, und schon oftmals hatte er eine Bewegung gemacht, als wolle er jenem mit überwallendem Herzen die Hand entgegenstrecken, hatte es aber vorläufig immer noch unterlassen. »Und meine Schüler und Schülerinnen die werden doch nicht etwa auch von dem Bannfluch betroffen? Ich für meine Person werde davon ja sehr wenig berührt, aber diese ganz unschuldigen Herren und Damen...«
»Nein, für die ist nichts zu fürchten. Das würde denn doch auch ein gar zu großer Zusammenbruch Dem mit dem Bannfluch Beladenen werden die Güter konfisziert. Wenigstens hier im Kirchenstaate kann und muss das noch so gehandhabt werden. Und das sind doch gar zu vornehme Herrschaften, die alle hier ansässig sind. Es sind ja auch die höchsten Geistlichen darunter, sogar der Fürstbischof. Nein, die bleiben ungeschoren. Nur verkehren dürfen sie natürlich nicht mehr mit Ihnen, hier nicht und anderswo nicht. Selbst wenn sie im Auslande mit Ihnen zusammenkommen, und es käme heraus, dann natürlich würden auch sie als Aussätzige behandelt, sie würden von hier verbannt, ihre Güter konfisziert. Nun aber habe ich genug geschwatzt. Ich muss fort...«
»Schon?!«
»Ich muss nach Palo. Apropos, gehen Sie doch nach Palo, wenn Sie Ursache haben, in der Nähe des Kirchenstaates bleiben zu wollen.«
»Palo wird sicher dem Kirchenstaate einverleibt werden.«
»Ist es aber noch nicht, und geschieht es, gehen Sie eben anderswo hin. Adjüs. Vielleicht sehen wir uns einmal wieder.«
Und ohne weiteres wandte sich der Depeschenreiter der Tür zu.
»Halt, Signore!«
»Was gibt's noch? Mich drängt die Zeit. Das Gespräch ist länger geworden, als ich wollte.«
Jetzt brach es bei dem Grafen hervor, und er suchte sich nicht zu beherrschen.
»Und warum dies alles?«, rief er mit wogender Brust und leuchtenden Augen.
»Was alles?«
»Warum haben Sie mich denn nicht verraten, sondern sogar für mich gesprochen, da Sie mich doch erst einen... Betrüger nannten?«
»Der sind Sie auch«, klang es kalt zurück. »Aber ich habe mir die Sache heute früh eben reiflich überlegt. Ihre Absichten sind ja hochedle. Schließlich sind Sie immer noch derselbe, als den Sie sich mir vor vier Jahren offenbart haben. Ich könnte Sie noch immer bewundern und muss es wirklich tun. Und was Sie sonst von Ihren Schülern fordern, das sündenlose Leben und so weiter und so weiter, das ist ja ebenso hochedel, geradezu heilig. Wenn Sie nur den betrügerischen Firlefanz dabei nicht machen wollten...«
»Er ist unbedingt nötig; als einfacher Lehrer eines möglichst vollkommenen Lebens würde ich niemals einen Erfolg...«
»Lassen Sie mich aussprechen. Ich muss fort. Sie sind trotz alledem ein Schwindler. Aber wenn ich meinen Wohltäter, der mir das Leben gerettet, mich wie ein Kind gepflegt hat, verraten wollte, dann wäre ich noch mehr als ein Schwindler — dann wäre ich ein Lump. Das ist mir heute früh zum Bewusstsein gekommen. Deshalb habe ich selbst den Pfaffen etwas vorgelogen. Macht mir nichts aus. Unsereins wird mit der Zeit überhaupt ein ganz verlogenes Luder. Also — wenn Sie sonst niemand von früher her mehr erkennt, wenn Sie nicht wieder so unvorsichtig sind, wie Sie es bei mir gewesen sind, indem Sie mich für schlafend hielten, wo ich es gar nicht war — — von mir wird niemand etwas erfahren, und wenn man mir auch die Glieder stückweise absengt. Und nun good bye — meinetwegen machen Sie Ihren Hokospokus weiter — es ist gleich zwölf, ich wünsche vergnügten Starrkrampf.«
Und der einzige Mensch, der den Grafen von Saint-Germain hätte entlarven können, es aber nicht getan hat, der auch noch andere Beweise von germanischer Treue und Dankbarkeit geben sollte, schwang sich auf sein Ross und ritt zur Halle und zum Garten hinaus.
Der Graf stand noch in der offenen Tür mit ausgestreckter Hand — er hatte sie ihm nicht mehr geben können.
Aber sein Gesicht war ganz verklärt — denn was er auch in den letzten Stunden furchtbar Schmerzliches durchgemacht, dieser grobe Depeschenreiter hatte ihm wohltuenden, erquickenden Balsam auf seine sich meist durch eigene Schuld geschlagenen Wunden geträufelt.
»Aus Wiedersehen, mein Freund, auf Wiedersehen!«, rief er ihm nach.
»Hoffentlich nicht«, erklang es mit gewöhnlicher Grobheit zurück, obgleich er es doch vorhin selbst gesagt hatte.
Der nun allbekannte Depeschenreiter war anstandslos durch das nach Palo führende Tor gelassen worden, die ganze draußen befindliche Wache hatte vor dem Manne, der diese Nacht im Vatikan geschlafen hatte, wenigstens stramm Stellung genommen.
Gemächlich ritt Axel den schönen Weg entlang. Er schien es doch nicht so eilig zu haben, hatte wohl nur die Unterredung mit dem Grafen abkürzen wollen.
Drei Stunden später sah er die Seefeste von Palo vor sich auftauchen mit ihren in der Sonne gleißenden Riesenkanonen, und wenn heute auch der samt seinem Schimmel aufgehängte Reitersmann fehlte, so machte sie durch ihre Mittelalterlichkeit doch noch immer einen ganz merkwürdigen Eindruck.
»Ganz so, wie es mir beschrieben wurde. Na, da bin ich doch gespannt, was mein alter Freund treibt. Eigentlich aber wäre es schade, wenn der Zaubergraf ihm wirklich die Kugel aus dem Kopf genommen hätte, sodass er jetzt ganz vernünftig wäre. Es war doch ein origineller Kauz. Ja, und ob der Graf ihn nur wirklich von seiner Gicht befreit hat? Ob er da wirklich ein Mittel besitzt, selbst wenn es eine andere Krankheit dafür hervorriefe?«
Hiermit hatte Axel verraten, dass er noch nicht wusste, wie man durch Hypnose, besonders durch posthypnotischen Befehl, auch Krankheiten heilen kann. Gar zu viel darf man da freilich nicht verlangen, die ganze Hypnotik ist eben keine Zauberei, die Unnatürliches ermöglicht. Aber besonders Schmerzen kann man damit beseitigen oder wenigstens lindern, den Kranken mehr unempfindsam machen als heilen, das ist erwiesen, und das wusste auch schon der Graf. Aber nicht hier dieser Depeschenreiter, der seine Kenntnisse aus einer anderen Quelle hatte. Der betrachtete die geheime Kunst, die er Faszination nannte, nur als ein Hokuspokusmittel, oder höchstens dazu verwendbar, einmal einen Menschen in willenlosen Zustand zu versetzen und ihn so auszuhorchen.
Die Rampe war erreicht und erklommen. Auf das dröhnende Läuten erschien jenseits der Zugbrücke der altertümliche Turmwart.
»Was ist dein Begehr, Fremder?«
»Ist Kapitän Morphium in seiner Burg?«
»Das wohl, aber...«
»Dann gibt es auch kein Aber. Herunter mit der Planke!«
»Wie ist dein Name?«, musste der mittelalterliche Herold auf höheren Befehl duzen.
»Den nenne ich nicht. Soll eine Überraschung sein.«
»Ich darf dich nicht als Unbekannten hereinlassen.«
»Sein bester Freund, und wenn du den nicht hereinlässt, dann wird dir Kapitän Morphin das Genick umdrehen, darauf kannst du dich verlassen.«
Es wirkte. Die Zugbrücke ward herabgelassen.
»Wo ist der Kapitän?«, fragte Axel, als er in dem Hofe, in dem den ganzen Tag Pferde geputzt zu werden schienen, sich aus dem Sattel schwang.
»Auf dem Söller.«
»Führe mich zu ihm.«
»Das geht unmöglich.«
»Weshalb nicht?«
»Er darf absolut nicht gestört werden.«
»Was treibt er denn da oben?«
»Mystische Übungen.«
»Was für Mist?«, fragte Axel, und die zuhörenden Pferdeknechte begannen zu grinsen, nämlich noch aus einem anderen Grunde, den wir gleich erfahren werden, nicht nur wegen dieses ziemlich plumpen Witzes.
»Was, auch Kapitän Morphium treibt mystische Übungen?! Na ja, ich weiß schon. Immerhin, es ist stark. Vorwärts, wo ist der Aufgang? Den muss ich überraschen. Und wenn der bei meinem Anblick nicht vor Freuden deckenhoch springt, vorausgesetzt, dass er wirklich kein Zipperlein mehr hat, dann sollt ihr mich hängen.«
Das ganze Auftreten des Depeschenreiters war ein solches, dass man ihm sofort Tür und Treppe zeigte, welche zu dem betreffenden Turme führten, auf dessen Söller Kapitän Morphin mystische Übungen treiben sollte.
Ja, ein ganz seltsamer Anblick erwartete den Besucher.
Auf dem Söller, auf den die Mittagssonne mit voller Glut brannte, lagen nebeneinander zwei Bretter, und auf einem derselben lag der alte Kapitän, aus dem Rücken, so wie Gott ihn geschaffen hatte, auch nicht mit einem Feigenblatte zugedeckt, und er musste schon sehr lange so gelegen haben, nicht nur heute, denn sein ganzer Körper war schon mehr schwarz als braun gebrannt, und zwar, wie man schon bemerken konnte, auch auf der Rückseite, sodass er sich also auch manchmal auf den Bauch legte.
Während er so da lag, jetzt also auf dem Rücken — und es war ein noch recht kraftvoller Greis, hatte sogar noch immer gar keine so üble Figur — hatte er den Mund sperrangelweit auf, sagte beim sehr langsamen Einatmen hörbar hhhaaaaaaa und beim noch langsameren Ausatmen aaaaaaahhhhh.
Axel war ganz leise gekommen, weidete sich erst ein Weilchen an diesem Anblick.
»Maul zu«, ließ er sich dann vernehmen, »immer nur durch die Nase aaaaatmen!!«
Der Liegende begnügte sich, ohne den Kopf zu wenden, damit, die Augen zu verdrehen. Eine kleine Überraschung war ja in dem martialischen Negergesicht mit dem schneeweißen, ungeheuren Schnurrbart zu lesen, sonst aber auch weiter nichts.
»Aaaaaaaahhhh...xel das bist doch du?! Haaahhh.«
»Maul zu, Maul zu, Morphium, nur durch die Nase atmen!«
»Hhhhaaaaat sich was, wenn man zwei Stöpsel in der Nase haaaaaaaaat.«
»Stöpsel in der Nase? Dann mache sie doch raus, putz dir mal die Nase.«
»Hhhhaaaaabe Polypen in der Nase oder so etwas Ähnliches — aaaaaahhhh.«
Wirklich, der alte Kapitän atmete immer durch den Mund, nur dass er ihn dabei gar so unmäßig weit öffnete.
»Musst du denn aber dazu dein Maul so sperrangelweit aufreißen?«
»Daaaaaamit recht viel hineinkommt — haaaaa«, atmete der Kapitän immer ruhig weiter, auch ohne den anderen noch anzusehen.
»Was hineinkommt?«
»Pferdemist?«
»Pferdemist? Du scheinst unterdessen deinen Verstand vollkommen verloren zu haben.«
»Ich hhhaaaatme Sonnenluft und lebe nur noch von Pferdemist — aaaahhhh.«
Noch ein verdutzter Blick, und dann brach Axel in ein schallendes Gelächter aus.
Dieser mit allen Hunden gehetzte Depeschenreiter brauchte ja nur eine leise Andeutung, dann hatte er schon begriffen.
Nach mikroskopischen Untersuchungen bestehen die sogenannten Sonnenstäubchen zum größten Teil aus Haferpartikelchen, welche schon den Leib eines Pferdes passiert haben. In den Großstädten bis zu siebzig Prozent, unter fünfzig niemals!!
Das klingt eigentlich schrecklich! Wir atmen und schlucken lauter solches Zeug hinter, um welches sich auf der Straße für gewöhnlich nur die Sperlinge balgen. Aber es lässt sich nicht vermeiden. Und gestorben ist auch noch niemand daran. Der Graf von Saint-Germain lebte ja schon seit Jahrtausenden von diesem Zeuge, war groß und stark davon geworden und blieb es.
Und wirklich, wenn man auch den Scherz beiseite lässt, es ist manchmal belustigend, wenn man das weiß und es sich bei Gelegenheit in Erinnerung ruft. Wenn ein zartbesaitetes Dämchen beim Anblick von etwas mehr oder minder Widerwärtigem die Nase rümpft oder ihr Fläschchen darunter hält, am liebsten gleich in Ohnmacht fällt, und sie weiß nicht, was für eine Unmenge von jenem verrotteten Stoffe sie mit jedem Atemzuge hinunterschluckt! Fünfzig bis siebzig Prozent! Das andere besteht aus Staubteilchen von Steinen und besonders auch aus den abgeschabten Partikeln der Wollkleider, die auch in selten oder oberflächlich gereinigten Zimmern unter den Möbeln die bekannten Flocken bilden. Und was für eine Unmenge von alledem in der Luft schwebt, das zeigt ja, wie schnell eine Staubschicht entsteht, wobei doch immer am meisten nur der schwerere, also viel spärlicher vorhandene Mineralstaub in Betracht kommt.
Mikroskopische Untersuchungen über die Zusammensetzung dieser Sonnenstäubchen hatte man damals noch nicht angestellt. Aber man wusste schon, was ihren Hauptbestandteil bildet. Ein beobachtender und denkender Mensch, der sich für so etwas interessiert, kommt von ganz allein darauf. Es kann ja gar nicht anders sein. Das Pferd ist in den Straßen das einzige Tier, das so etwas schaffen kann. Nun, und hier, auf dem Hofe, wo immer Pferde standen, auch keine besondere Sauberkeit herrschte, die Stalltüren immer offen waren, würden bei Windstille sich in der Atmosphäre wohl nicht weniger Prozente von diesem Stoffe konstatieren lassen.
Also Axel hatte, gleich den richtigen Sinn verstehend, herzlich lachen müssen.
»Was, auch du lebst bloß noch von den eingeatmeten Sonnenstäubchen?!«
»Hhhhhuuuund von Pferdemist«, atmete der Mystiker einmal mit zugespitztem Munde ein, wenigstens anfangs, um das ›und‹ hervorzubringen.
»Na, na. Du siehst mir recht wohlgenährt aus.«
»Haaaaa hhhaaaaaa tschi«, musste der Kapitän erst einmal niesen, und dann setzte er wie gewöhnlich sehr schnell hinzu: »Pferdemist macht fett.«
»Und was trinkst du dazu? Auch nur Regenwasser?«
»Hhhhaaaaa...«
Da fiel dort unten auf dem Hofe ein Kanonenschuss, ganz nahe, die Luft erzitterte noch hier oben, und als ob der alte Kapitän in dieser Kanone gesteckt hätte, so schoss er empor und dem Ledermanne an die Brust, ihn umarmend.
»Herzensjunge!!!«
Also eine Begrüßung fand dennoch statt. Wenn man das als eine solche gelten lassen will, besonders deswegen, was dann noch hinterherkam, wie diese Begrüßung endete.
Obgleich dieser Depeschenreiter doch seinen Mann stand, diesem aus der Kanone geschossenen Anprall war er nicht gewachsen, er taumelte bis an die Söllerbrüstung zurück, gerade dorthin, wo von außen ein dickes Rohr in die Höhe ging und oben in einer Biegung endete, an dieser war etwas wie ein Sieb angebracht, und kaum standen die beiden an dieser Stelle, gerade unter dem Siebe, als von diesem eine mächtige Wasserdusche herabkam, den Depeschenreiter im Lederkostüm mehr durchweichend als den Alten im Adamskostüm. Dieser bekam hauptsächlich das Wasser auf den Rücken, und das genügte ihm wohl, denn mit dem Sprunge eines Frosches sprang er nach dem anderen Brette, auf dem er vorhin nicht gelegen, platschte auf den Bauch und blieb so liegen.
»So, Axel, jetzt können wir uns besser unterhalten — wenn ich auf dem Bauche liege, brauche ich nicht so zu aaaatmen.«
Axel hatte es gar nicht so eilig gehabt, aus der Traufe herauszukommen, für ihn hatte das ja nichts zu sagen, das haben wir schon einmal gesehen, und als er so seitwärts stand, betrachtete er sich erst aufmerksam den Duschapparat, der bald aufhörte, Wasser zu spenden, und dann den auf dem Bauche liegenden Nacktfrosch.
»Na, Onkel Morphium, was treibst du denn hier für mystische Übungen?!«, erklang es im humoristischsten Tone, während noch das Wasser von ihm ablief.
»Ich muss so viel wie möglich in der Sonne liegen — eine halbe Stunde auf der einen Seite, eine halbe Stunde auf der anderen, und ehe ich mich hinlege, muss ich mich allemal nass machen, und damit ich die Zeiten richtig einhalte, wird alle halbe Stunden unten mit der Kanone geschossen — na, und da springe ich jedes Mal unter die Dusche. Gleichzeitig wird unten gepumpt.«
»Und wozu denn das?!«, staunte Axel.
»Damit meine Gicht vollends aus dem Körper geht oder nicht wiederkommt.«
»Und dann legst du dich in die brennende Sonne, machst dich vorher auch noch nass?!«, staunte Axel immer mehr. »Wer hat dir denn zu dieser Pferdekur geraten?«
»Der Graf von Saint-Germain.«
»Na, wenn dir's bekommt — mir soll's recht sein. Ich würde mich schön hüten.«
Der Depeschenreiter, der nur sein Gesicht der Sonne aussetzte, war ein Kind seiner Zeit. Aber er hätte auch hundert Jahre später geboren sein können, ja, noch vor 25 Jahren, von heute ab gerechnet, hätte er nicht anders gesprochen, selbst nicht dieser wetterharte Mann. Oder, wollen wir gleich direkter sagen: im Jahre des Heils 1880.
Denn um diese Zeit, um das Jahr 1880 herum, durfte man sich beileibe nicht nackt in die Sonne legen. Die Jungen taten es ja so leidenschaftlich gern in der Schwimmanstalt, rin ins Wasser und sich dann in der brennenden Sonne trocknen lassen, und dann mit dem heißen Körper wieder ins Wasser und wieder in die Sonne. In den ersten Sommertagen wurde dann der Körper krebsrot, dann gab's große Blasen, zuerst zwischen den Schulterblättern, dann ging unter einem infamen Jucken die ganze Haut ab, und der neue Adam erstand als ein kaffeebrauner Mensch, der immer dunkler wurde.
Das heißt, das taten nur diejenigen Jungen, ums Jahr 1880, die von zu Hause aus gar keine Aufsicht hatten. Solche unvernünftige Eltern, die das erlaubt hätten, gab es damals gar nicht. Und die Folgen dieser Sonnenrösterei? Zuerst natürlich Sonnenstich, dann Rückenmarkauszehrung, dann Gehirnerweichung. und dann... ganz einfach der Tod.
So warnten die vernünftigen Eltern die artigen Knaben. Denn so sagten die Ärzte mit hochgelehrter Miene — und alle Welt sprach Amen.
Variatio delectat vitam — Abwechslung ergötzt das Leben. Heute hat sich das Urteil der Männer der medizinischen Wissenschaft nun wieder geändert. Nur merkwürdig, dass solche radikale Umwälzungen auf dem Gebiete der Hygiene immer von Leuten ausgehen, die so ganz und gar nichts mit der Wissenschaft zu tun haben.
»Ob mir das bekommt? Ich fühle mich wieder wie ein Jüngling. Hier...«
Und der mehr als siebzigjährige Herr unterbrach einmal sein Sonnenbad, richtete sich auf die Knie empor, stellte den Kopf aufs Brett, dessen Ränder er mit den Fäusten packte, hob erst das eine Bein, dann das andere — so stand er aus dem Kopfe, wollte es wohl bleiben, was ihm freilich nicht gelang. Er schlug einen regelrechten Purzelbaum, und das vom Brett ab auf den harten Stein, mit einem ganz anständigen Plauz.
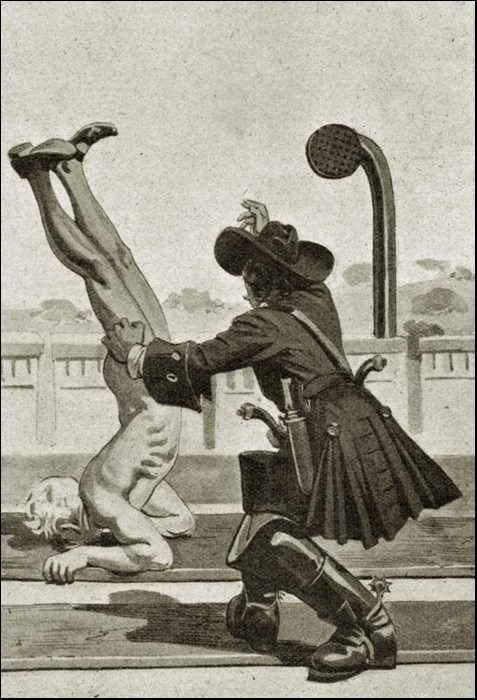
Doch es hatte nichts zu sagen gehabt, gleich legte er sich gemütlich wieder auf den Bauch.
»Hast du's gesehen?«
»Alle Hochachtung!«, sagte Axel, der erst erschrocken, als jener die Balance verlor, hinzuspringen wollte, mit aufrichtiger Bewunderung. »Ich glaube sogar, das hat mir beim Zusehen weher getan als dir. Ich fühlte schon meine eigenen Knochen gebrochen.«
»Ja, und das nun mit meinem zusammengeflickten Schädel, den ich noch vor vier Wochen nicht beugen durfte, ohne die fürchterlichsten Kopfschmerzen zu bekommen. Von der Gicht gar nicht zu sprechen.«
»Hat der Graf dir tatsächlich eine Kugel aus dem Kopfe geschnitten?«
»Tatsache. Hier überm Ohr hat er mich geschnitten. Ich habe bis vor einer Woche einen Verband getragen.«
»Betäubte er dich erst?«
»Jawohl, ich musste was trinken, es schmeckte ganz gut, da schlief ich ein, und als ich wieder aufwachte, hatte ich einen Verband um den Kopf. Hatte nicht das Geringste von dem Schneiden bemerkt. Und die Kugel war raus. Na, wie die aussieht!«
Wenn Axel anderer Meinung war, so behielt er sie hier doch für sich, so vernünftig war er selbstverständlich.
Zunächst wunderte er sich am meisten, wie der alte Kapitän immer an seinem nackten Körper herumfingerte.
»Was soll denn das? Ist das auch eine mystische Übung?«
»Was denn?«
»Dass du immer so an deinem Köper herumgreifst.«
»Na, ich suche die Kugel, ich will sie dir zeigen — und — und — na, zum Henker, wo ist sie denn nur, ich habe Sie doch immer in der Westentasche...«
»Ja, du hast aber gar keine Weste an, du bist doch ganz nackt.«
»Ach so, richtig, drum finde ich nicht einmal die Westentasche. Aber die Kugel musst du dann sehen, die mir damals die Chinesen in den Kopf geschossen haben. Das ist ein merkwürdiges Ding, sage ich dir. Die ist nicht rund, sondern ganz gebogen, so ungefähr wie ein Regenwurm, nur nicht so lang, dafür aber viel dicker, so ungefähr wie ein Mehlwurm, wenn er sich zum Schlafen legt — das ist nämlich überhaupt gar keine Kugel, sondern ein eiserner Topphenkel, den mir die Chinesen in den Kopf geschossen hatten.«
Ja, dann freilich, mochte Axel denken, wenn der einen eisernen Topfhenkel im Kopfe hatte, wahrscheinlich sogar noch jetzt — dann war dieser mächtige Spleen zu erklären.
»Trinkst du auch Regenwasser?«
»Regenwasser? Na und ob! Nur noch Regenwasser. Nichts als Regenwasser. Und wenn's kein Regenwasser gibt, dann mach ich's mir selber. Am liebsten aber ist es mir, wenn's regnet. Dann lege ich mich auch hier auf die Bretter. Aber dann mache ich's umgekehrt, dann lege ich mich auf diesem hier auf den Rücken und auf dem dort auf den Bauch. Dann nehme ich Regenbäder. Natürlich, wenn's regnet, kann ich doch keine Sonnenbäder nehmen. Dann lege ich mich am liebsten auf den Rücken. Da brauche ich nur's Maul aufzusperren, dann fallen mir die Regentropfen direkt in den Magen. Schmeckt köstlich, sage ich dir.«
»Hm. Mischst du die Regentropfen, ehe sie dir direkt in den Magen fallen, vorher nicht vielleicht mit ein bisschen Rum? Machst du vorher nicht vielleicht jeden Regentropfen heiß und tust ein Stückchen Zucker nein?«
»Ob ich aus dem Regen zuvor Grog mache? Nee, Junge, Grog ist nicht mehr. Der einzige Luxus, den ich mir erlaube, ist, dass ich aufs Dach Himbeersaft schmiere.«
»Was, aufs Dach Himbeersaft schmieren?«, lachte Axel. »Was soll denn das bedeuten?!«
»Na ja, um das Regenwasser doch etwas schmackhafter zu machen. Und ich kann doch, wenn ich Durst habe, nicht immer erst warten, bis es einmal regnet, und was mir dann ins Maul regnet, reicht doch auch nicht hin, da gehen doch von all den Regentropfen, die vom Himmel kommen, gar zu viel vorbei. Da muss ich immer für Vorrat sorgen, ich trinke einfach das Regenwasser, was vom Dache kommt.«
»Und da schmierst du das Dach mit Himbeersaft ein?«
»Jawohl, das vom Pferdestall. Dieses Regenwasser hat den Vorzug, dass es auch mit nährenden Substanzen gemischt ist, die sonst nur so spärlich in der Luft herumfliegen.«
»Ja, warum gießt du denn da den Himbeersaft nicht hinterher ins Wasser oder meinetwegen doch in die Regentonne?«
»Jaaa, Junge, dabei ist ein Geheimnis — der Regen muss so recht auf das Dach ausplatzen — und auf den Himbeersaft — dadurch entsteht eine ganz andere Mischung — die Reibung, weißt du, auf die Reibung kommt es an — da steckt noch eine besondere Kraft dahinter, so eine — eine... na, irgend so eine Kraft.«
Der Sonderling meinte wahrscheinlich die dynamische Kraft, so etwa, wie es die Homöopathen meinen, wenn sie die möglichst verdünnte Medizin immer tüchtig reiben und schütteln.
Auch der Depeschenreiter schüttelte etwas, nämlich seinen Kopf.
»Morphium, Morphium! Ich glaube zwar, dass du mir da nur etwas Fürchterliches vorflunkerst, aber noch mehr freut es mich, dass du auch ohne Kugel oder Topfhenkel im Kopfe doch noch der Alte geblieben bist. Nur ohne dein tägliches Quantum Grog kann ich dich mir nicht recht vorstellen. Na, und von den Sonnenstäubchen allein wirst du wohl auch nicht so wohlgenährt sein. Denn du bist im Gegensatz zu früher geradezu dick geworden.«
»Nein, da will ich ehrlich sein«, gestand denn auch der für damalige Zeit allermodernste Naturmensch. »So weit, dass ich nur von der in der Luft befindlichen Materie lebe, wie es der Graf Germain macht, so weit bin ich noch nicht. Vorläufig brauche ich noch etwas kompakte Nahrung. Jeden Tag drei rohe Kartoffeln und...«
»Rohe?!«
»Gekocht wird nicht mehr. Das ist unnatürlich. Täglich drei rohe Kartoffeln und eine gute Portion Gras. Auch Klee ist mir angenehm. Heu will mir noch nicht recht schmecken. Höchstens mit Essig und Öl zum Salat angerührt. Nun übe ich mich auch schon im Wiederkäuen... Kerl, was hast du zu lachen?! Denkst du, ich erzähle dir Märchen?! Ha, wenn du wüsstest, wie ich durch diese natürliche Lebensweise wieder jung geworden bin, gleich um hundert Jahre jünger, ich sage dir, ich fühle eine Jugendkraft in mir, ich kann jetzt gleich...«
Und wieder schnellte der Greis wie ein Gummiball auf, auch ohne Kanonenschuss, nahm gegen die Söllerbrüstung einen Anlauf und...
»Um Gottes willen!!«, schrie Axel, zu Tode erschrocken, nicht mehr hinspringen könnend, um den Wahnwitzigen zurückzuhalten.
Dieser aber war mitten im Laufe ganz von selbst stehen geblieben, blickte schelmisch zurück, soweit solch ein Greis schelmisch blicken kann, mit listig blinzelnden Augen.
»Ach, du dachtest wohl, ich würde über die Brüstung springen? Da zwanzig Ellen tief in den Hof hinunter? Nee, Junge, da hast du falsch gedacht, so verrückt ist Kapitän Morphium nicht mehr, der ist ganz, ganz vernünftig geworden.«
Mit diesen Worten legte er sich wieder auf den Bauch, und seine nächste Äußerung, der neuen Jugendkraft entspringend, war:
»Und nun heirate ich zu guter Letzt doch noch.«
»Du und heiraten!«, lachte Axel.
»Na, warum denn nicht? Bin ich mit meinen siebzig Jahren nicht noch ein ganz stattlicher Kerl? Und wenn man mindestens dreihundert Jahre alt wird, was haben da siebzig zu bedeuten? Dann wäre ich im Verhältnis, wenn die anderen Menschen höchstens neunzig Jahre alt werden, doch erst dreiundzwanzig Jahre. Das ist ein ganz hübsches Alter zum Heiraten. Und außerdem werde ich mit jedem Regentropfen und mit jeder rohen Kartoffel immer jünger. Ich werde sogar sehr bald heiraten, damit ich nicht gar zu jung werde. Sonst bekomme ich am Ende wieder eine Rotznase und habe noch immer keine Frau. Und, weißt du, es ist mir doch manchmal ein bisschen langweilig hier oben, wenn ich so ganz allein in der Sonne oder im Regen liege. Ach, das kann ich mir so schön ausmalen, wenn ich so hhhaaaa und aaaahhh mache — hier neben mir liegt meine liebe Frau — wir ergänzen uns gegenseitig, wie es zwischen Ehepaaren der Fall sein muss — wenn sie auf dem Bauche liegt, dann liege ich auf dem Rücken, und wälzt sie sich auf den Rücken, dann wälze ich mich auf den Bauch — und dann kommt eine große Schüssel mit rohen Kartoffeln — und dann ein Bündel Heu — und nun sehe ich, wie mir meine liebe Frau mit ihren zarten Händchen den Salat zurechtmacht... ach, Axel, das wird herrlich. Da musst du uns mal besuchen. Du kannst ja auch mitmachen. Und dann ist auch noch etwas anderes dabei, dass ich heiraten will. Ich kann nur eine reiche Frau gebrauchen. Meine Frau muss Bimbim haben.«
Axel hatte sein Lachen über diese Schilderung glücklich niedergerungen.
»Na, du brauchst doch nicht nach Geld zu heiraten, du hast doch genug von dem Zeuge.«
Der alte Kapitän machte wirklich ein sehr besorgtes Gesicht.
»Junge, sage das nicht. In meiner Geldkiste ist eine schmähliche Ebbe. Die ich dir damals zeigte, die ganz voll war, das war die letzte. Ja, ja, auch Millionen werden einmal alle. Ich hab's ja auch ein bisschen toll getrieben. Du hast doch selbst gesehen, wie ich's mache. Als wir uns das letzte Mal in Neapel trafen — wie ich die 5000 Weiber vor uns beiden tanzen ließ — das kostete Geld, mein Junge — schon allein das Tanzen — und nun die teuren Kostüme, die die Mädels dabei anhatten...«
»Was, Kostüme? Die hatten doch überhaupt nichts an!«
»Nu ja, eben, weil sie gar nischt anhatten, das war die kostspielige Kostümierung. Und nun waren das doch nicht solche von der Straße, das waren nur Frauen und Jungfrauen aus den besten neapolitanischen Familien — — ei, ei, da habe ich böse aus meiner Geldkiste schaufeln müssen. Und das ging immer so fort. Und nun wieder der Graf Germain, der hat mich wieder hunderttausend Scudi gekostet.«
»Was, hunderttausend Scudi?«, rief Axel mit ganz großen Augen. »Wofür denn?«
»Nu, weil er mir die Kugel herausgeschnitten hat — und für das Zipperlein.«
»Und dafür hat der Graf hunderttausend Scudi verlangt?!«
»Gefordert hat er sie nicht, aber angeboten habe ich sie ihm.«
»Und er hat sie angenommen?«
»Nee, angenommen hat er sie auch nicht. Der nimmt keinen Penny an. Bezahlen tut er freilich auch nichts, der macht immer fröhlich Schulden und lässt fürs Bezahlen den lieben Gott sorgen. Aber annehmen tut er nichts. Und was meinst du, was der haben könnte, wenn er wollte! Gibt's nicht bei ihm. So war's auch bei mir. Hunderttausend Scudi, wenn Sie mich von meinen Kopfschmerzen und vom Zipperlein befreien, sagte ich. Der Graf machte seine Sache. Ich wollte ihm das Geld hinschicken, tat's auch wirklich. Nahm's nicht an. Was sollte ich machen? Ich bin doch ein Mann von Wort, Kapitän Morphium lässt sich doch nicht etwa lumpen. Da habe ich die hunderttausend Scudi nach Griechenland hinübergeschickt, wo jetzt eine Hungersnot ist.«
Das bronzene, kühne Gesicht des Depeschenreiters hatte vorhin, als der Kapitän zuerst dieses ärztliche Honorar erwähnte, etwas wie eine ängstliche Spannung angenommen, mit einem Male verklärte es sich förmlich. Was ihn erst so bedrückt und dann so erleichtert hatte, braucht wohl nicht näher erklärt zu werden, eine Andeutung genügt: Der Graf von Saint-Germain hatte einen Beweis seiner vollständigen Uneigennützigkeit gegeben, und Uneigennützigkeit entschuldigt alles, denn sie kann wohl irren, aber nicht sündigen.
Der Depeschenreiter hatte sich auf das andere Brett gelegt, sodass jetzt zwei ein Sonnenbad nahmen, der eine nur in seiner nassen Lederkleidung.
»Das ist ja hochedel von dir gewesen, mein lieber Morphium, du darfst die Sache nur nicht übertreiben. Und hast du schon nach einer reichen Braut Umschau gehalten?«
»Hm. Kennst du die Eudoxia?«
»Ich kenne nur eine Eudoxia, die wohnt in Nürnberg, hat acht Kinder und eine Würstchenbude...«
»Nee, hier in Rom, die Fürstin de la Roche meine ich.«
»Heißt die mit dem Vornamen Eudoxia? Das wusste ich noch nicht. Sonst aber kenne ich sie. Also auf die hast du dein Freiersauge geworfen?«
»Ahem«, nickte der jugendliche Greis.
»Du, da hast du gar keinen schlechten Geschmack. Erstens ist sie wohl die reichste Frau der Erde, hat so 30 bis 40 Millionen Einkünfte, wobei es ziemlich gleichgültig ist, ob das Taler oder Groschen sind. Dann hat sie einen ganzen Haufen Knochen, außerdem zwei Zähne...«
»Einen — nur einen«, korrigierte der Kapitän.
»Als ich sie das letzte Mal sah, hatte sie zwei Zähne, und das genügte vollkommen, die ersetzten durch ihre Größe ein ganzes Gebiss. Jetzt hat sie nur noch einen? Wo ist denn der andere geblieben?«
»Den hat sie sich von einer Porphyrsäule ausziehen lassen. Jetzt hat sie nur noch einen.«
»Na, dann geht's ja immer noch. Ein einziger Zahn ist besser als gar nischt. Dann, dünkt mich, hätte sie nur einen einzigen großen Fehler.«
»Welchen denn? Die lebt schon ganz sündenlos, die frisst nur noch ungeschrotenen Hafer.«
»Als diejenige, welche du heiraten willst, meine ich, hat sie einen großen Fehler. Die hat doch bereits einen Mann.«
»Stimmt. Der französische Gesandte. Hast du schon gehört, wie's dem geht?«
»Nein. Ist er krank?«
»Galoppierende Schwindsucht. Sieht ganz gesund aus, blüht wie eine Rose, kann aber jeden Tag abfahren. Darauf warte ich nur. Dann heirate ich seine Witwe.«
»So. Das, lieber Morphium, ist weniger edel von dir. Na, never mind, Geschäft ist Geschäft. Aber nun sage einmal ernstlich: Dieses alte Knochengerippe könntest du wirklich ehelichen? Ich nicht, und wenn sie aus allen Schätzen Perus und Mexikos zusammengeschmolzen wäre. Ich fürchte mich wahrhaftig nicht so leicht, aber wenn ich an die beiden langen, gelben Zähne denke...«
»Sie hat nur einen einzigen.«
»Der genügt auch schon. Wenn die mir einen Kuss geben will, mit dem gefährlichen Hauer... nee, da gruselt's mich.«
»Jaaa, mein Freundchen — wenn sie so bliebe — aber in vier Wochen, spätestens am 8. September, wird dieses alte Scheusal die gefeiertste Schönheit Roms sein.«
Dieser Depeschenreiter ging ja auf alles ein, auf alles — jetzt aber fiel er doch einmal aus der Rolle.
»Na, du denkst doch nicht etwa, dass der Zaubergraf da sein Versprechen halten kann?!«
»Am 8. September dieses Jahres wird meine zukünftige Frau die größte Schönheit Roms sein,« sagte aber der Kapitän mit einer Überzeugung, die sicher durch nichts zu erschüttern war.
»Wie will er denn das nur anfangen?«
»Das ist seine Sache.«
»Dass er das alte Knochenskelett durch gewisse Mittel verschönern kann, das glaube ich ja, dieser Wundermann mag ja manches Geheimnis kennen — aber die Zähne, die Zähne, die kann er doch nicht wieder frisch wachsen lassen!«
»Wie er's macht, ist mir ganz egal. Ich und ganz Rom nebst weiterer Umgebung, wir verlangen, dass Eudoxia de la Roche am 8. September eine Schönheit ist, bei deren Anblick auch noch ein Methusalem in Verzückung fallen muss.«
Axel lenkte wieder ein, spielte seine alte Rolle weiter. Mit diesem Kauze war ja doch nichts anzufangen. Von dem Grafen begann er gar nicht erst. Er wollte sich ja hier nur mit einem Plauderstündchen amüsieren, nichts weiter.
»Na gut. Ich glaube, dass du dereinst, wenn der Fürst glücklich tot ist, die größte Schönheit der Erde heiraten wirst. Du vergisst wohl nur eins dabei, mein lieber Morphium.«
»Und das wäre?«
»Ich kenne die ganze Geschichte. Der Graf stellte ihr die Wahl zwischen fünferlei. Darunter war auch Reichtum. Den hatte sie schon. Aber sie konnte nur eins wählen. Und besaß sie das eine, so verlor sie das andere. Also, wenn sie die größte Schönheit ist, wozu doch wohl auch ein vollständiges, gesundes Gebiss gehört, 32 Zähne, so verliert sie ihre 32 Millionen...«
Der alte Kapitän machte ein ganz erschrockenes Gesicht.
»Alle Wetter, ja — du hast recht — daran hatte ich wirklich nicht gedacht!«
»Siehst du! Entweder 32 Zähne oder 32 Millionen Dollar — oder wenn's auch nur Groschen sind. Aber was sollst du mit den 32 gesunden Zähnen anfangen? Die helfen nur das auffressen, was du noch hast — und wenn sie auch nur Hafer kauen. Dann, mein lieber Morphin, wenn du durchaus eine Eudoxia haben willst, rate ich dir doch lieber zu der Nürnberger. Die hat noch eine ganze Menge Zähne — wie viele, weiß ich nicht, habe sie noch nicht gezählt, aber so viele können es gar nicht sein, die der fehlen — dann ist sie schon Witib, da brauchst du nicht erst so lange zu warten, sie hat eine sehr gut gehende Würstchenbude die ihren Mann nährt — 5000 Weiber darfst du freilich nicht mehr tanzen lassen, nur ab und zu eins — und dann acht lebenskräftige Kinder, das ist doch auch ein ganz hübsches Kapital... was willst du?«
Der alte Sünder hatte den Finger an die Hakennase gelegt und machte plötzlich wieder ein ganz pfiffiges Gesicht.
»Halt, ich hab's!«
»Was hast du?«
»Ich heirate sie trotzdem — hier die mexikanische Eudoxia. Erst heirate ich die größte Schönheit — vorausgesetzt, dass ihr Mann tot ist — und wenn sie unterdessen auch arm wie eine Kirchenmaus geworden ist, egal, ich heirate die gefeiertste Schönheit. Und dann schlage ich meiner Frau die 32 Zähne wieder ein — dann kommt doch auch ihr Geld wieder, was?«
Axel brachte es über sich, ernst zu bleiben, musste aber dazu aufstehen.
»Dann bleibt noch immer ihre sonstige Schönheit, welche Reichtum ausschließt.«
»Meinst du, dass sie ohne Zähne schön aussehen kann, wenn sie es sonst auch wirklich ist?«
»O ja, wenn sie's Maul nicht aufmacht, warum nicht?«
»Nu, dann schrubbe ich ihr auch noch die andere Schönheit ab, und...«
Wieder donnerte auf dem Hofe ein Kanonenschuss, wieder war es nicht anders, als ob der Kapitän in dieser Kanone gesteckt hätte, so schnellte er empor.
Axel hatte zufällig wieder gerade unter der Brause gestanden, erschrocken sprang er, die Folgen schon sehend, seitwärts.
Allein seine Vorsicht war diesmal unnötig gewesen.
»Die letzte halbe Stunde. Mein Sonnenbad ist für heute beendet. Du speist doch natürlich mit mir?«
»Ätherischen Pferdemist und...«
»Sei ohne Sorge, es gibt eine ganze Menge Gänge. Es wird hier oben aufgetragen. In der Sonne muss ich mich möglichst viel aufhalten. Ich lebe ganz hier oben. Inzwischen aber will ich dir etwas zeigen. Du hältst mich wohl für leichtsinnig? Ich werde dir beweisen, wie ich für meine Zukunft sorge. Warte, ich will mich erst anziehen. So viehisch, dass ich alter Kerl mich meinen Leuten ganz nackt zeige, bin ich denn doch nicht. Bei dir ist das ja etwas anderes.«
»Wo hast du denn deine Sachen?«
»Hier oben«, entgegnete Morphin, der zunächst noch seine Glieder reckte.
Vergebens schaute Axel um sich. Von abgelegten Kleidern war nichts zu bemerken. Nur um das Wasserrohr war ein kleiner Fetzen geschlungen...
Und richtig, nach diesem griff der Kapitän, es war ein ganz dünnes Gewebe, so dünn und durchsichtig wie ein Damenschleier, und den band sich der Alte um die Hüften, und zu mehrmaligen Umschlingungen war der Schleier zu kurz. Der Kapitän hätte auch gar nichts umzubinden brauchen.
»Das nennst du eine Kleidung?«, musste Axel aus vollem Halse lachen.
»Ist das etwa keine, ist das nicht ein ganz anständiger Schurz? Der Graf hat mir eine möglichst poröse Kleidung verordnet, damit immer recht viel frische Luft den Körper umspielt, und eine porösere Kleidung als diesen Gazeschleier habe ich nicht auftreiben können. Es müsste denn ein Fischernetz sein — aber das ist mir denn doch zu genant.«
»Was macht eigentlich die polnische Prinzessin?«, fragte Axel plötzlich ohne Übergang.
»Danke, der geht's recht gut. Die ist vergnügt wie eben ein glücklich verliebtes Mädel. Aber, Junge, ich durchschaue dich, wo hinaus du mit deiner Frage willst. Wo die aus ihren Fenstern hinsehen kann oder wo sie sonst hinkommt, da bin ich nicht zu erblicken. Oder du dachtest wohl, ich präsentierte mich ihr in diesem Kostüm? Nein, Junge, da hast du wieder einmal falsch gedacht. Kapitän Morphin ist ein Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle und weiß, was Anstand ist. Wenn ich vor die hintrete — immer fein, immer nobel, in tadellosem Gesellschaftsanzug — blankgeputzte Stahlrüstung mit gewichstem Zylinder.«
»Na, du bist doch schon früher oft genug nackt in Rom erschienen.«
»Nackt? Niemals. Immer geschlossene Badehose und Halsbinde. Und damals hatte ich noch den Topfhenkel im Kopfe, das ist jetzt etwas ganz anderes.«
Sie hatten sich hinab begeben, vom Hofe aus noch immer tiefer, in den Keller hinab, der freilich noch ganz bedeutend hoch über der Erdoberfläche lag, er war ja in den hohen Felsen hineingehauen, erhielt auch helles Tageslicht. In dem Gewölbe, in das der Burgherr seinen Besuch führte, stand ein großer Zinksarg, und Axel wusste genug.
»Aha, auf diese Weise sorgst du für deine Zukunft! Das ist schon der Sarg, in den du dich einmal legen willst.«
»Erraten!«
»A la Graf von Saint-Germain.«
»Um meinen Todesschlaf zu halten.«
»Das heißt, du meinst einen künstlichen.«
»Selbstverständlich — künstlich, alles künstlich. Und ist das nicht ein künstlerischer Sarg? Hat mich einen ganzen Haufen Geld gekostet.«
»Und wann gedenkst du dich in den künstlichen Todesschlaf zu versetzen?«
»Wann ich will«, lautete die bescheidene Antwort. »Wenn ich des Lebens überdrüssig bin. Vorläufig bin ich's noch nicht. Ein paar hundert Jahre werde ich's wohl noch aushalten.«
»So so. Was ist denn das hier oben am Kopfende für ein Loch im Deckel?«
»Ein Luftloch.«
»Ich denke, der Graf lag in einem absolut luftdicht schließenden Sarge.«
»Meiner schließt ebenfalls absolut luftdicht. Alles Kautschukfalze.«
»Ja, aber wozu dann trotzdem das Luftloch?«
»Das ist meine eigene Erfindung«, war die selbstgefällige Antwort.
»Damit du atmen kannst, wie?«
»Atmen? Wenn man tot ist, braucht man doch nicht zu atmen. Oder hast du etwa schon einmal einen Toten atmen sehen? Ich nicht.«
»Dann begreife ich immer noch nicht, wozu du trotz des luftdichten Abschlusses ein Luftloch angebracht hast.«
»Axel, dein früherer Scharfsinn scheint etwas gelitten zu haben. Es soll keine Luft hinein, aber hinaus soll sie, hinaus — der Qualm, weißt du, der Qualm.«
»Was für ein Oualm?«
»Nu, der Qualm, den ich mache... höööhh.«
Der Kapitän hatte den Deckel hochgewuchtet Der Sarg war innen mit braunen Hobelspänen ausgefüttert, oben ein schöngesticktes Kopfkissen mit einem ›Ruhe sanft‹, eine zusammengerollte Decke, und dann noch eine ganze Menge Beutel, Schachteln, Büchsen und andere Gegenstände. Es war nicht so leicht zu überblicken.
»Das Kissen hat mir die Prinzess gestickt, als sie von meinem Vorhaben hörte. Ein liebes Mädel, nicht? Wenn sie nicht schon einen anderen hätte, würde ich sie heiraten.«
Also die Prinzess ging ebenfalls auf seine Schrullen ein, machte mit. Daraus konnte man auf ihre Stimmung schließen.
»Was sind denn das für braune Hobelspäne? Wäre eine Matratze nicht weicher? Oder wenigstens Sägespäne, die haben auch noch den Vorteil, dass sie die Feuchtigkeit aufsaugen.«
»Hobelspäne? Das ist virginischer Tabak.«
»Ach sooo! Richtig, jetzt sehe ich's, das sind Tabakblätter. Ja, aber wozu denn die?«
»Du kannst noch fragen? Ich verstehe dich nicht mehr. Na, zum Rauchen! Falls ich einmal aufwachen sollte, und ich habe noch keine Lust, aus dem Sarge zu kriechen, damit ich ab und zu mein Pfeifchen rauchen kann.«
Der Kapitän öffnete eine Schachtel, die einige Kalk- und Holzpfeifen enthielt.
»Siehst du, ich habe an alles gedacht. Das ist ein ganzer Zentner Tabak, mit dem reicht man schon ein Weilchen. Und ich dampfe doch auch nicht immer, nur so, denke ich mir, alle Vierteljahrhunderte einmal ein paar Pfeifen — und dazu also das Luftloch, damit der Qualm abzieht. Es kommt auch noch ein Schornstein drauf. Und hier ein paar Pfund echt persisches Insektenpulver, hier eine große Flasche mit Wasser, hier ein Stück Seife, hier ein Handtuch, hier eine Büchse ungarische Bartpomade...«
Wieder krachte ein Kanonenschuss, der den Kapitän auf andere Gedanken brachte, und das war gut, denn wenn er die ganzen Säckchen und Büchsen erklären wollte, das hätte gar lange gedauert.
»Es ist zum Essen geschossen worden«, sagte er, den Sargdeckel zuklappend. »O, ich werde mich hier drin schon ganz wohl fühlen. Nun komm, dass die Suppe nicht kalt wird.«
Sie begaben sich wieder zum Söller hinauf. Auf diesem hatte sich unterdessen aber auch noch gar nichts geändert. Die zwei Bretter lagen noch da — nichts weiter.
»Bitte, nimm Platz, es wird sofort aufgetragen«, sagte der Kapitän, eine einladende Handbewegung nach dem Steinboden machend.
»Du verschmähst jetzt wohl auch Tisch und Stuhl?«
»Tisch und Stuhl? Ist etwas ganz Unnatürliches. Merke dir, nein lieber Axel: Sei wahrhaftig, sei natürlich! Durch unsere Unnatürlichkeit verscherzen wir das ganze Lebensglück. Hast du je in der freien Wildnis einen Affen gesehen, der sich einen Stuhl gezimmert hat, um sich draufzusetzen? Nein, das macht nur der Mensch, und deshalb ist er unglücklich, dadurch ist das ganze Elend in die Welt gekommen. Der Mensch, der den ersten Stuhl gebaut hat, hat nicht minder gesündigt als Adam, da er in den verbotenen Apfel biss. Und der Tisch war die zweite Sünde. Und so ging das weiter. Von der Halsbinde will ich gar nicht erst anfangen. Wenn man die Halsbinde nicht erfunden hätte, würde es in der Welt auch keinen Verbrecher geben, der gehangen werden muss. Denn man würde gar nicht wissen, wie man ihn aufhängen sollte. Dasselbe gilt vom Messer, von allem — genug. Kapitän Morphin hat gesprochen. Wenn dir Weichling der Steinboden zu hart ist, dann suche dir von diesen beiden Brettern das weichste aus. Mir genügt die Polsterung, die mir der liebe Gott gegeben hat.«
Und damit hatte sich der nackte Greis gravitätisch mit untergeschlagenen Beinen niedergelassen. Nun, Axel tat dasselbe ihm gegenüber.
Wieder ein donnernder Kanonenschuss, dass die Luft erzitterte und bald eine mächtige Rauchwolke aufstieg.
»Aaah, jetzt kommt die Suppe, es ist geläutet worden — oder geschossen, wenn du Wortklauber das nun einmal hören willst.«
»Hier werden die Uhrzeiten wohl mit Kanonen abgeschossen?«
»Nicht immer. So pedantisch bin ich nicht. Nur die Hauptmomente werden durch Kanonenschüsse markiert. Jetzt kommt die Suppe.«
Ein Diener brachte sie denn auch, auf silbernem Servierbrett zwei rauchende Teller. Sie wurden zwischen die beiden hingesetzt, jeder bekam einen Löffel dazu, und der Diener ging wieder.
»Teller und Löffel sind aber eigentlich doch auch ganz unna...«
»Haltes Maul, Junge. Ich weiß alles schon, noch ehe du es gesagt oder überhaupt nur gedacht hast. Ich gehe nicht umsonst beim Grafen in die Lehre. Das mache ich ganz, wie ich will. Na, wie schmeckt die Suppe?«
Axel ließ die dampfende Flüssigkeit vom Löffel herablaufen.
»Sieht verdammt dünn aus.«
»Dünn? Hast du schon einmal eine Suppe gegessen, die man beißen und kauen muss? Klar, willst du wohl sagen. Ja, das ist eine kristallklare Suppe mit Vermeidung jeglicher Bei- und Einlage. Aber nun erst der Geschmack, der Geschmack, Junge!«
»Hm. Ich dachte, die schmeckte sozusagen nach gar nichts. Das ist einfach eine heiße Wassersuppe ohne Salz und Schmalz.«
»Stimmt, du hast einen ganz feinen Geschmack, aber iss sie mit Verstand, Junge, da ist jeder einzelne Tropfen aus einer Höhe von tausend bis dreitausend Ellen vom Himmel heruntergefallen.«
»Also eine Regenwassersuppe.«
»Jetzt hast du's erfaßt — eine echte, unverfälschte Regenwassersuppe. Was stocherst du immer mit dem Löffel in der Suppe herum? Essen, essen, nicht stochern!«
»Ich suche, ob da nicht vielleicht ein Regenwurm drin ist. Regenwürmer müssten die Regenwassersuppe doch noch etwas verbessern.«
»Du bist ein unverbesserlicher Spötter. Löffle nur deine Suppe aus, du verkalkter Überproduktionsmensch, und du wirst sehen, wie jung du dich hinterher fühlst.«
Axel war kein Spielverderber, er löffelte seine unverfälschte Regenwassersuppe aus. War er doch gespannt, was dann noch kam. Denn der Kapitän sah gar nicht danach aus, als wenn er nur von Regenwassersuppen, rohen Kartoffeln und dergleichen lebe, der sah vielmehr nach tellergroßen Beefsteaks aus.
Wieder donnerte ein Kanonenschuss.
»Der zweite Gang kommt.«
Der Diener erschien, setzte zwischen die beiden eine große Schüssel mit rohen Kartoffeln, sauber abgewaschen, konnte leider ein Grinsen nicht unterdrücken.
»Bitte, lang zu«, lud der Gastgeber ein.
»Nach dir.«
»Nein, erst kommt der Gast. Seit wann lässt du dich denn überhaupt nötigen? Du warst doch früher gar nicht so.«
»Ich gestehe offen: Rohe Kartoffeln sind nicht gerade nach meinem Geschmack.«
»Nicht? Schade. Hätte ich das gewusst. Dann erlaubst du wohl, dass ich ein paar allein verzehre. Nach der Suppe kommen bei mir immer ein paar rohe Kartoffeln.«
»Bitte, bitte, geniere dich nicht.«
Und wahrhaftig, der verrückte Kapitän nahm eine der rohen Kartoffeln, biss hinein, aß sie ganz auf.
Axel begann zu starren.
»Na, nun wird's mir aber doch bald etwas zu bunt!«, rief er, als der Kapitän nach einer zweiten griff und auch diese verzehrte. »Das ist denn doch etwas gar zu toll — rohe Kartoffeln zu fressen, auch noch samt der Schale!«
»Gerade die Schale ist das Gesündeste dabei. Und was willst du, essen wir nicht auch die Äpfel roh? Und bei der Kartoffel braucht man nur hinter den Geschmack zu kommen — wirklich delikat. Probier's nur einmal. Das sind echte Malteser. Probiere nur eine einzige. Hast du schon überhaupt einmal in eine rohe Kartoffel gebissen? Nein. Na, dann probier's nur, nur einmal unverzagt hineingebissen, dann kommst du gleich hinter den Geschmack, wirst noch so weit kommen, dass du an keinem Kartoffelacker vorbeireiten kannst, ohne abzusteigen und einmal mit den Zähnen zwischen die Erdäppel zu fahren...«
Der Kapitän gab sich noch mehr Mühe, seinen Gast dazu zu bewegen, einmal einen Versuch zu machen, allein Axel war nicht dazu zu bringen.
»Ich glaub's schon, ich glaub's schon, dass rohe Kartoffeln ganz ausgezeichnet schmecken, allein... ich habe nun einmal eine Antipathie gegen rohe Kartoffeln. Eine Hökerfrau, der ich den Korb umritt, hat mich einmal mit Kartoffeln geschmissen, und zwar mit ungekochten, eine traf mich ins Auge, es wäre mir bald ausgelaufen... weiß der Teufel, seit dieser Zeit kann ich kaum noch eine rohe Kartoffel sehen, mir tränt immer gleich das Auge.«
So ging das noch eine Weile hin und her, und der Kapitän verzehrte dabei immer noch einige der Erdfrüchte.
Ein drittes Kanonensignal, und der Diener brachte den dritten Gang, für jeden einen Teller mit einem ansehnlichen Haufen Heu, außerdem noch Essig und Öl, für diese Mahlzeit auch Messer und Gabel.
Grinsend entfernte sich der nicht ganz wohldressierte Mann.
»Junge, Junge, Junge, Junge«, sagte jetzt Axel, »wenn du auch dieses Heu frisst, dann... zweifle ich nicht, dass du auch noch das Wiederkäuen lernst.«
»Na, nicht gleich so roh. So ein richtiger Ochse ist der Mensch denn doch nicht. Das muss erst alles hübsch zubereitet werden. Bitte, bediene dich, wir machen uns nach italienischer Sitte den Salat selbst — hier ist Essig, hier Öl.«
Und der Kapitän machte es vor, wie ein richtiger Heusalat zubereitet wird, erst muss das Öl daran kommen, nun so durcheinandergemischt, damit womöglich jedes Hälmchen eine Fettschicht bekommt, dann erst der Essig. Wird der zuerst daran getan, so haftet das Öl nicht mehr. Das Salatmachen wird in Italien, der Heimat des Salats — salato heißt gesalzen — wirklich wie eine Kunst betrieben, jeder Gourmand hat sein eigenes Rezept, so auch Kapitän Morphin. Auf das Mischen kommt es hauptsächlich an.
»Hast du's begriffen? Nun mach's auch so. Eigentlich ist es fast schade, aus dem Heu Salat zu machen. Es duftet gar zu lieblich, und ein wenig von dem Aroma geht dabei doch verloren. Es ist auch etwas Klee dazwischen. Oder soll ich dir deinen Salat zubereiten?«
»Nein, nein, nein, ich danke wirklich. Oder ich möchte doch erst sehen, wie du deinen Heusalat isst.«
»Na, denkst du etwa, ich mache mir den Salat nur zum Spaß?!«
»Ja, ja, iss ihn nur.«
»Also dann isst du auch deine Portion?«
»Erst musst du's mir vormachen.«
»Gut, ein Mann, ein Wort!«
Und Kapitän Morphin machte sich über seinen Heusalat, pfropfte sich den Mund voll, kaute und schluckte. Und das ging gar schnell. Bald war der halbe Teller geleert.
»Na, nun man los! Soll ich dir deinen Salat zurechtmachen?«
Immer starrer wurden Axels Augen, als er den Salatschlinger betrachtete.
Plötzlich ergriff er seinen Teller, führte das Heu an die Nase, nahm seine Gabel und stach schnell hinüber in des anderen Teller, gabelte eine Portion von dem Heusalat auf, roch daran, steckte das Häufchen in den Mund, kaute und schluckte, und dann nahm er seine ganze Portion Heu, ballte es zusammen und tat, als wollte er es seinem Gegenüber an den Kopf werfen.
»I du verfluchter Schlingel!!! Du isst ganz gemütlich ägyptische Fula, und mich willst du hier richtiges Heu fressen lassen!«
Der Alte sagte nichts, er brach nur in ein unauslöschliches Gelächter aus, dass er dabei auf den Rücken fiel und auch noch die Beine gegen den Himmel reckte, also doch so ziemlich direkt über den Speisetisch.
Axel hatte es also schließlich doch erraten. In Ägypten gibt es ein getrocknetes Gemüse, welches, in feine Streifen geschnitten, akkurat wie unser Heu aussieht. Denn in Ägypten sieht wieder das dort gewachsene Gras und Heu ganz anders aus, es wachsen dort eben andere Grasarten. Dieses getrocknete Fula wird wirklich roh als Salat gegessen, schmeckt recht gut.
Endlich hatte sich der Alte wieder beruhigt, nahm seinen durchsichtigen Schurz ab, um sich damit die tränenden Augen zu trocknen.
»Aber lieber wäre es dir wohl gewesen, wenn ich mein Heu gefressen hätte, mit oder ohne Essig und Öl, was?«
»Ach, Axel, den Spaß hättest du mir auch noch machen können! Na, es war schon köstlich genug, wie du mich immer anstiertest. Zuerst hast du doch wirklich geglaubt, ich äße Heu, geradeso wie vorhin rohe Kartoffeln.«
»Das waren auch keine rohen Kartoffeln, die du vorhin aßest?«
»Gott bewahre, denkst du wirklich, ich fresse rohe Kartoffeln?«, triumphierte der Alte immer wieder unter schallendem Gelächter.
»Gekochte waren es auch nicht. Ich gestehe, dass ich zur Hälfte hereingefallen bin, nun gib mir aber auch eine Erklärung.«
Der Kapitän tat es. Auf seiner Seite hatten einfach Äpfel gelegen, von jener Sorte, welche sich dem Aussehen nach kaum von rohen Kartoffeln unterscheiden, man muss von diesen nur die richtige Art haben.
Also es war dem Kauze leider nicht geglückt, seinen Gast hineinzusenken, der Depeschenreiter war zu vorsichtig gewesen. Allein auch schon dieser Spaß hatte genügt, wie er zuerst geglaubt, der Kapitän äße wirklich rohe Kartoffeln und Heu mit Essig und Öl.
»Und die Regenwassersuppe?«
Die hatte auch der Kapitän mitgegessen.
Schon wollte er eine begeisterte Lobrede über solch eine Regenwasserkur halten, als wieder ein Kanonenschuss donnerte.
»Der vierte Gang. Allerdings abermals Heu...«
»Na, Morphin, ich dächte, nun verschontest du mich mit weiteren derartigen Späßen.«
»... aber diesmal ist das Heu von ganz anderer Zubereitung, das wird auch dir schmecken.«
Noch ehe der Diener erschien, hob Axel die Nase und witterte wie ein Jagdhund, machte dabei ein ganz verklärtes Gesicht.
»Haha, das ist mir ein bekannter Geruch!«
Der Diener kam und brachte zwei appetitliche Beefsteaks, welche die sehr großen Teller völlig einnahmen. Dieser Gang war schon mehr die Mahlzeit eines südamerikanischen Gauchos, auf deutsch ›Fleischfresser‹, weil dieser Rinderhirt keine andere Nahrung kennt als Fleisch. In der einen Hand hält er ein Stück gebratenes, in der anderen ein Stück gekochtes Fleisch, beißt abwechselnd ab und isst dazu gewissermaßen als Brot noch gedörrtes Fleisch, und nun was für Quantitäten. Aber mit solch einem Beefsteak hier wäre auch der gefräßigste Gaucho zufrieden gewesen.
»Das lasse ich mir gefallen!«, schmunzelte der Depeschenreiter, der übrigens etwas recht Gauchoähnliches hatte, mit Vergnügen auch das Vorhandensein von Salz, Pfeffer, Senf und zwei großen Gläsern konstatierend. »Und das nennst du alter Sünder eine vegetarische Nahrung?«
»Gewiss, auch das ist Heu. Aber mir fällt doch gar nicht ein, unverdauliches Heu zu essen. Das lasse ich erst einen Ochsen fressen — und dann fresse ich den Ochsen. Na, nun darf ich wohl gesegnete Mahlzeit wünschen.«
Sie machten sich über die Beefsteaks her. Alle Gewürze verschmähte der Naturmensch aber doch, die waren nur für den Gast bestimmt.
»Und was sollen die beiden Gläser bedeuten? Da fehlt noch die Weinpulle.«
»Hast du Durst? Siehst du, das macht nur dein Salz und Senf. Doch schließlich trinke ich auch ganz gern ein Glas Himbeerwasser.«
»Himbeerwasser?«, wiederholte Axel langgedehnt.
»Ja, mein lieber Freund, mit Wein und dergleichen ist es bei mir wirklich vorbei. Ich habe so etwas überhaupt gar nicht mehr im Keller.«
»Na, meinetwegen, dann Himbeerbrühe — ich habe wirklich Durst — wo ist denn das Zeug?«
»Bitte, bediene dich selbst. Mache dort die Brause ab und klopfe mit dem Messer gegen das Rohr, dann wird unten gepumpt.«
»Da kommt aber doch Regenwasser heraus.«
»Jawohl, aber jetzt ist das Rohr in die Tonne gesteckt, die Himbeerregenwasser enthält. Du weißt — wo der Regen das mit Himbeersaft eingeschmierte Dach abgespült hat. Klopfe nur, dann wartest du, bis sich der Wasserstrahl rot zu färben beginnt, und wenn er rot genug ist, dann hältst du dein Glas unter — und meins auch gleich mit.«
Gut, Axel gehorchte der Aufforderung. Verrückt musste hier ja alles zugehen.
Richtig, kaum hatte er an das Rohr geklopft, als oben, nachdem er die Brause abgenommen, ein dicker Wasserstrahl hervorkam, der sich bald rötlich färbte, immer röter wurde, bis Axel glaubte, nun würde sich das Mischungsverhältnis nicht mehr ändern, und deshalb die beiden Gläser füllte, was gar nicht so einfach war, denn es war ein ganz wuchtiger Wasserstrahl.
»Ja, wie stellt man denn diese Himbeerflut nun wieder ab?«
»Da klopfst du einfach wieder gegen das Rohr.«
Axel tat es, das Rohr hörte nach und nach auf, Himbeerlimonade zu speien. Es war eine sinnlose Verschwendung. Wenn der Boden des Söllers nicht etwas schräg gewesen wäre und in der Mauerbrüstung ein Abflussloch gehabt hätte, so hätten die beiden jetzt schon in Himbeerlimonade schwimmen können. Der Kapitän saß auch bereits mit seinem natürlichen Polster in einer Himbeerpfütze, was bei seiner Kostümierung nun freilich nicht viel zu sagen hatte.
Aber dieser Burgherr war doch Kapitän, ein alter Seebär, und das war so ein echtes Seemannsstückchen gewesen. Die meisten Seeleute sind Verschwender. Das heißt an Land. Das auf See schwer verdiente Geld muss so schnell wie möglich durchgebracht werden. Es muss alles fließen, immer alles fließen. Wenn ein abgemusterter Matrose, die Taschen voll Geld, in Hamburg an einer Würstchenfrau vorbeikommt, er hat Appetit zu einem Paar Würstchen — es ist zehn gegen eins zu wetten, dass er der Frau gleich den ganzen Kessel abkauft. Er nimmt sich ein Paar, den Kessel lässt er auf der Straße stehen, zur allgemeinen Verfügung. Halten sich die Kinder und Passanten nicht dazu, so kann die Frau ihre bezahlten Würstchen auch wiedernehmen und sie noch einmal verkaufen. Darum kümmert sich so ein echter Matrose nicht. Dazu ist er zu stolz. Ganz selten einmal, dass er seine Freude daran hat, die Würstchen zu verteilen, vorüberfahrende Wagen damit zu bombardieren.
Das ist noch ein ganz harmloser Fall. Es muss eben alles fließen, alles. Es gibt alte Kapitäne genug, die sich an Land nicht minder toll gebärden. Wenn man in die richtigen Spelunken kommt, in denen die Segelschiffskapitäne verkehren, die für jeden an der normalen Fahrtdauer ersparten Tag eine sich immer steigernde Prämie bekommen, die Tausende ausgezahlt erhalten — ach, du lieber Gott, wie es da zugeht! Wer das nicht kennt, dem darf man es nicht erzählen, er würde es nicht glauben.
Na, und Kapitän Morphin hatte sein Geld auch auf so eigentümliche Weise verdient, die nicht gerade zum Sparen ermuntert, halb als Schmuggler, halb als Pirat. Und außerdem hatte er eine Kugel im Kopfe, sogar einen Topfhenkel Was war denn da von ihm zu verlangen! Wenn dem ärztlich verordnet worden, sich täglich mit Branntwein abzureiben — bah, abreiben! — solange er das Geld dazu hatte, setzte er sich täglich in eine Badewanne voll französischen Kognak mit drei Sternen.
Also, dass hier die Himbeerlimonade herumfloss, hatte absolut nichts zu sagen, und der Depeschenreiter war ja nun auch so einer, der hatte deswegen gar keinen Blick, noch weniger ein ›o wie schade!‹
Axel kehrte mit den beiden gefüllten Gläsern zurück, kostete von dem seinen, kostete nochmals, trank gleich das ganze Glas aus.
»Aaaahh!!«, schmunzelte er zungenschnalzend. »So eine Himbeerlimonade lass' ich mir gefallen.«
»Fein, was?«, schmunzelte auch der Kapitän, an seinem Glase saugend. »Jaaa, Junge, ich sage dir — erst den Himbeersaft aufs Dach schmieren und ihn so vom Regen abspülen lassen — da wird eine ganz besondere Himbeerlimonade daraus — das macht die Reibung, Junge, die Reibung der einzelnen Tropfen, die tausend bis zehntausend Ellen hoch vom Himmel herunterkommen.«
»Na, da wollen wir die Gläser nur noch einmal mit Himbeerlimonade füllen.«
»Ja, mein lieber Junge, fülle sie — brauchst nur zu klopfen, immer nur klopfen.«
Und Axel klopfte und ließ die Gläser wieder volllaufen, und das noch zahllose Male, das heißt ohne zu zählen — aber nicht voll Himbeerlimonade, sondern der rote Stoff, der da herauskam und erst immer über die beiden Gläser wegsprudelte und den Boden überschwemmte, das war nichts anderes als ein ganz ausgezeichneter Rotwein.
Aber darüber sprachen die beiden kein Wort. Sie tranken eben Regenwasserhimbeerlimonade, die durch das eigentümliche Mischungsverfahren einen sehr angenehmen, feurigen Rotweingeschmack angenommen hatte, dadurch auch sehr sprithaltig geworden war, und mochte der Depeschenreiter ein Beefsteak essen — für Kapitän Morphin war das einfach Heu, das er aber mit Hilfe eines Ochsens für seinen Magen verdaulicher hatte machen lassen.
Auf diese Weise wusste der alte Schmugglerkapitän, der noch jeden Chinesen übers Ohr gehauen hatte, als perfekter Vegetarier und Abstinenzler zu leben.
Die Mahlzeit war beendet, die Beefsteaks hatten genügt, die beiden saßen sich gegenüber und tranken nur noch Regenwasserhimbeerlimonade, konnten nicht genug von dem Zeuge bekommen, hoben die Gläser und blinzelten einander pfiffig an.
»Fein, was? Meine Erfindung, das mit dem Dacheinschmieren.«
»Morphin, ich möchte einmal ernst mit dir sprechen.«
»Bin immer ernst.«
»Eine französische Kriegsflotte ist unterwegs.«
»Lass sie kommen, mein Junge.«
»Was werden die Einwohner von Palo tun?«
»Was man von ihnen verlangt. Ob der Kirchenstaat oder Neapel oder Genua oder Frankreich Palo annektiert — doch diesen feigen Hunden ganz egal. Wenn sie nur satt zu fressen bekommen.«
»Und du?«
»Was ist mit mir?«
»Du gibst doch deine Burg nicht heraus?«
Der alte Kapitän lachte nur höhnisch.
»Mit Gewalt? Ich werde den ersten Schuss abgeben.«
»Deine Zitadelle wird einfach zusammenkartätscht.«
»Weiß es. Unter ihren Trümmern werde ich in meinem Zinksarge liegen.«
Es war etwas Furchtbares dabei, wie sich die beiden so lakonisch unterhielten.
Man hätte es als Henkersmahlzeit des alten Kapitäns betrachten können — eine lustige Henkersmahlzeit.
Axel hatte es gehört, und er wusste alles. Er war hierher gekommen, um seinen alten Freund noch einmal lebendig zu sehen, um von ihm Abschied zu nehmen — Abschied für immer.
Eine französische Kriegsflotte war unterwegs, um Palo zu annektieren, wenn nicht innerhalb einer gewissen Frist der Kirchenstaat oder Neapel oder Genua das kleine Hafenstädtchen als sein Eigentum erklärt hatte.
Den Palensern war es gleichgültig, wem sie angehörten. Zu machen war hier nichts, sie hatten ihre Rolle als freie Hanseaten eben endlich ausgespielt. An einen heroischen Untergang dachten sie nicht, es wäre auch wirklich sinnlos gewesen.
Zu Palo gehörte auch die Zitadelle. Die war Privatbesitz des Kapitäns Morphin gewesen. Privatbesitz, nichts weiter. Es hätte ebenso gut eine Villa sein können. Der Burgherr hatte immer als Protektor, als Herrscher von ganz Palo gegolten — aber das war ja alles nur Spielerei gewesen, wofür er sogar bezahlt hatte. Er war hier einfach ein Privatmann und noch nicht einmal ein Bürger, war gar nicht naturalisiert.
Wenn es förmlich zuging, so wurde die Burg weder von den Palensern noch von den Franzosen beachtet. Jedenfalls aber würden sich die Franzosen in dieser Seefeste gleich festsetzen.
So etwas aber gab es doch bei einem Kapitän Morphin nicht! Der ließ seine Zugbrücke nicht herab, der führte Krieg auf eigene Faust, der verteidigte sich so lange, bis die Trümmer der zusammengeschossenen Feste ihn unter sich begruben.
Der Depeschenreiter kannte doch seinen alten Freund. Jedes abratende Wort wäre da überflüssig gewesen.
»Hast du Leute, die bei dir aushalten?«
»Fünf Mann. Von vierundzwanzig.«
»Die fünf wissen, um was es sich handelt?«
»Ja.«
»Und sie sind bereit, sich mit dir begraben zu lassen?«
»Ja.«
»Und was für Kerls sind das?«
»Seeratten. Drei Engländer, ein Deutscher und ein Neger. Treue Burschen. Lassen sich für mich sengen und brennen.«
»Das sind nicht viele.«
»Das sind genug.«
»Nun, du musst es ja am besten wissen. Und was für Geschütze? Aber fange nicht mit deinen Pappkanonen an.«
»Drei schwere Schiffsgeschütze, einige Mörser und zwei Feldschlangen.«
»Munition?«
»Massenhaft vorhanden. Sonst wäre ich nicht schon jetzt mit der Schießerei so spendabel.«
»Das Wasser kann dir nicht abgeschnitten werden?«
»Kommt aus meinem eigenen Felsen.«
»Und Proviant?«
»Habe mich mit allem vorgesehen. Das musste ja einmal so kommen. Für uns sechs Mann Mehl für drei Jahre, aber auch anderes genug.«
»Ja, Morphium, da sieht deine Sache eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich kenne deine Burg ja noch nicht, aber so weit ich sie dem Aussehen nach beurteilen kann — zu stürmen von der Landseite ist sie gar nicht, der Feind kann sich an der Felsenmauer nur den Kopf einrennen, oder er müsste die senkrechten Wände hinaufklettern können — und sonst ist doch hier alles in die Felsen eingehauen — und wenn du deine Geschütze geschickt zu montieren weißt, dass sie dir nicht demoliert werden können — und wenn du dich auf deine Leute verlassen kannst — drei Jahre sind da eine gar lange Zeit, die du die Franzosen in Schach halten kannst.«
Der alte Kapitän beugte sich vor, hob den Finger, und sein martialisches Gesicht mit der Hakennase nahm dabei einen ganz gefährlichen Ausdruck an.
»Ich sage dir, Axel — wenn man mich von hier fortekeln will, von meinem rechtmäßigen Grund und Boden, an dem mein altes Herz mit seiner letzten Faser hängt — — — Axel, diese Franzosen sollen etwas erleben! Die sollen einmal so einen alten Opiumschmuggler kennen lernen, der sich ein Menschenalter lang mit chinesischen Dschunken herumgeschlagen hat — und nicht nur mit elenden Dschunken, auch mit englischen und anderen Zollkuttern — und doch, von diesen Chinesen hat er das meiste gelernt — — ich sage dir, Axel, die Franzosen sollen einmal alle Heimtücken kennen lernen, die ein schwacher Gegner gegen die Übermacht anwenden kann — ich will denen einmal zeigen, wie man einen Brander zwischen die Schiffe schickt — und ich kenne auch noch anderes — unter Wasser brennendes Feuer und immer noch anderes — ich sage dir, Axel, und wenn die ganze französische Kriegsflotte ansegelt, verbündet mit allen anderen Flotten — die sollen sich an uns sechs Mann, die wir hier die Zitadelle halten, die Zähne ausbrechen. Ha, das soll in der Weltgeschichte einmal eine Überraschung geben!«
Eine größere Überzeugungskraft, als wie sie hier der alte, nackte Mann in seine Worte zu legen wusste, war gar nicht möglich.
»Hm. Ich glaub's schon, dass du etwas kannst, was die wahrscheinlich noch gar nicht gesehen haben. Wir beide passten zusammen. Oder wir ergänzten uns gegenseitig. Was ich auf dem Lande bin, bist du auf dem Wasser. Ein Seefuchs, wie dich die Chinesen ja auch nannten. Nur die fünf Mann kommen mir ein bisschen wenig vor.«
»Sie genügen.«
»Könntest du dich noch nach ein paar anderen umsehen? Abenteurer gibt es doch überall genug, immer sind tüchtige Burschen darunter...«
»Meine fünf Mann genügen«, wiederholte der Kapitän. »Jeder andere ist nur ein unnützer Esser.«
»Auch mich würdest du nicht noch unter deine Verteidigungsmannschaft aufnehmen?«
Die hellste Freude malte sich in dem verwetterten Gesicht, einer echten Piratenphysiognomie.
»Was, Axel, du wolltest...«
»Ja, ich will.«
Mehr war zwischen diesen beiden gar nicht nötig. Sie schüttelten sich nur die Hand, und die Sache war abgemacht. Was Axel dann noch hinzufügte, war etwas Überflüssiges.
»Ich möchte mich auch einmal zu Wasser versuchen. Wenigstens so halb und halb. Möchte mal einen regelrechten Seefestungskrieg spielen. Möchte sehen, wie du das hier machst, was du alles kannst. Und dann möchte ich auch diesen Franzosen etwas auswischen. Das heißt, so der Regierung, durch Kriegsschiffe vertreten. Die hat nämlich bei mir etwas auf dem Kerbholze. Und vielleicht kannst du mich auch einmal als Depeschenbringer brauchen, wenn nicht als Depeschenreiter, dann als Depeschenkriecher oder Schwimmer. Da habe ich nämlich auch was drin los. Ich will jede Botschaft hinaus- und hereinbringen, zu Lande und zu Wasser. Unter den Trümmern lasse ich mich freilich nicht begraben, das sage ich dir gleich. Bis zum Tode geht meine Treue nicht — nicht in diesem Falle.«
»Das kannst du machen, wie du willst.«
»Und wie stellst du dir die Sache nun eigentlich vor?«
»Ich übergebe eben meine Zitadelle nicht.«
»Du musst aber doch gewissermaßen einen Gegendruck ausüben, musst auch deine Bedingungen haben, und so einfach machst du doch überhaupt die Geschichte nicht, da kenne ich dich doch zu gut.«
»Nun, wenn du's hören willst — das habe ich mir schon längst überlegt. Die Palenser haben mich ihren Herrn und Gebieter genannt, ihren Diktator, ihren Tyrannen und so weiter, haben mir dementsprechende Ehren erwiesen. Das war nur Spielerei. Jawohl, ich bin ein Spielhans, ich weiß es. Nun werde ich denen aber einmal zeigen, dass ich das nicht nur als Spielerei aufgefasst habe. Jetzt werfe ich mich zum König von Palo auf. Sollen's von mir verrücktem Kauze nur auch als Spielerei auffassen, sollen's schon sehen! Ich befehle den Palensern, den Franzosen Widerstand zu leisten. Sie tun's natürlich nicht — well, dann sind meine Untertanen abtrünnig, dann kartätsche ich das rebellische Palo in Grund und Boden. Ich bin der König von Palo.«
Der Depeschenreiter sagte kein abmahnendes Wort. Wozu auch? Dieser Mann kannte die Welt. Wie war denn die Republik Genua, wie das Königreich Neapel entstanden? Wie sind überhaupt die meisten Königreiche entstanden? Wer die Kraft hat, sich zum König aufzuwerfen, der tut es, sonst ist er ein Schwächling.
»Na, meinetwegen. Ich mache so lange mit, wie es geht. Weit wirst du ja damit nicht kommen...«
»Oho, das werden wir sehen!«
»Gut, werde du König von Palo. Dann machst du mich doch hoffentlich auch zu einem großen Tier.«
Der Kapitän streckte mit feierlicher Miene die Hand aus. Ohne sich erheben zu müssen, konnte man über die Brüstung das offene Meer sehen. Vor dem Hafen von Palo, etwas seitlich, lag im Wasser eine Felsenklippe, ganz flach, bei Flut jedenfalls unter Wasser kommend, von eigentümlicher Form, nach allen Seiten liefen strahlenförmig Zacken aus.
»Siehst du dort jene Insel?«
»Wenn du den Stein im Wasser eine Insel nennst, so sehe ich sie.«
»Diese Insel gehört noch zu Palo, zu meinem Königreiche. Riccio ist ihr Name. Axel, du mein treuer Vasall, ich schenke dir diese Insel mit allem, was sich darauf befindet, die darauf lebenden Menschen sind deine Untertanen... ich ernenne dich hiermit zum Herzog von Riccio!«
»Sehr gut das«, lachte der neugebackene Herzog, »zum Herzog von und zum Igel![*] Der Igel ist nun freilich kein sehr großes Tier.«
[*] Il riccio heißt der Igel.
»Dafür aber klug und mit Stacheln bewehrt, sodass man es nicht anfassen kann. Selbst der Löwe wagt den Igel nicht anzufassen, der Elefant nicht, ihn zu zertreten. Außerdem hat diese Insel noch den Vorzug, dass sie sich unsichtbar machen kann. Alle vier Stunden versinkt sie im Meere, kommt erst nach vier Stunden wieder zum Vorschein. Komm, ich will dir sofort den Ritterschlag geben — einen Schlag, wie du noch keinen bekommen hast...«
»Halt, lass jetzt den Unsinn!«, sagte Axel, den Kapitän, der schon aufstehen wollte, zurückhaltend. »Da fällt mir gerade ein: Wie wird es nun mit der polnischen Prinzess? Die kann doch nicht hier bleiben, und die französische Flotte kann doch jede Stunde gesichtet werden.«
Der Kapitän beugte sich vor und legte den Finger aus des jungen Freundes Knie, schaute ihn mit bittendem Blicke an.
»Als ich dir vorhin von der Prinzess berichtete, sie wäre puppenlustig, wie jedes verliebte Mädel, hatte ich doch keinen Grund, dir die Wahrheit zu sagen.«
»Was meinst du damit? Sie ist doch nicht krank?!«, fragte Axel mit unverkennbarer Teilnahme.
»Sie ist bereits nicht mehr hier. Vorgestern ist sie fort. Hier bleiben konnte sie eben nicht. Ehe Lord Malborough in Rom ist, sodass Lord Moore frei wird, sind die Franzosen doch sicher schon hier.
Wohin sollte sie? Natürlich nach England. Aber der Lord könnte sie dann sowieso nicht mitnehmen, der muss zu schnell reisen, das hält das zarte Mädel nicht aus. Der Lord mag sie aber auch nicht ohne seine Begleitung über Land reisen lassen. Die Landstraßen in der Lombardei sind gerade jetzt sehr unsicher. Also per Schiff. In Fiumicino lag der ›Salamander‹, ein englisches Schiff, ein fixer Segler, Kapitän Rudyard ist der tüchtigste und zuverlässigste Kerl. Der geht keinem maurischen oder türkischen Piraten in die Fänge. Lord Moore kennt ihn auch sonst gut. Dem hat er sein Liebstes anvertraut. Das als Geheimnis unter uns gesagt. Die Prinzess ging nämlich heimlich an Bord. Der ›Salamander‹ verließ abends den Hafen Roms, nahm direkten Kurs, steuerte aber bei Nacht nach Norden. Ich selbst habe die Prinzess an Bord gebracht. Vorgestern.«
»Weshalb geschah das heimlich?«
»Frage nicht so. Die polnische Prinzess ist doch ein gar zu kostbares Objekt. Wegen der lohnte es sich schon, die Straße von Gibraltar mit einer Schiffslinie zu sperren, und noch jetzt könnte ein Expressreiter schnell genug nach Belgien oder Nordfrankreich kommen, damit noch von dort aus der ›Salamander‹ abgefangen wird.«
»Ich verstehe schon, wollte es nur noch einmal von dir hören. Und was sagt der Lord dazu?«
»Der ist natürlich sehr unglücklich, wie Verliebte nun einmal sind. Grund zur Besorgnis hat er ja schließlich auch. Diese polnische Prinzessin ist eben kein so einfacher Passagier. Das ist ein Wild, auf das sich eine Jagd lohnt.«
»Will er sie heiraten?«
»Sicher. Sie ist bereit, zum Protestantismus überzutreten.«
»Und was erwartet den entlassenen Gesandten in London?«
»Das musst du doch besser wissen als ich.«
Der Depeschenreiter blieb die Antwort schuldig, er streckte die Hand aus.
»Du, das ist ein mächtiger Kasten, der dort kommt. Das könnte schon ein Vorbote der französischen Kriegsflotte sein.«
Erschrocken sprang der Kapitän auf. Aber wie er auch mit überschatteten Augen, die noch nichts an Sehschärfe eingebüsst zu haben schienen, spähte, er konnte nichts erkennen als in der Nähe und in der Ferne einige kleine Segel.
»Wo denn?«
»Dort, dort — vorläufig freilich nur ein Punkt.«
»Ich sehe nichts. Und das wäre mir doch auch schon durch zwei Kanonenschüsse gemeldet worden. Drei Mann stehen ständig mit dem Fernrohr auf Posten, suchen den ganzen Horizont ab.«
»Verlass dich lieber auf dich selbst. Dort, dort — gewiss, es ist ein Viermaster.«
Da donnerten auch schon hintereinander zwei Kanonenschüsse.
»Ein Dreimaster in Sicht!!«, erklang der Ruf.
»Es ist ein Viermaster«, korrigierte der Depeschenreiter.
»Na, wo denn nur?«
Endlich waren die Augen des Kapitäns auf einen schwarzen Punkt am Horizont gelenkt worden.
»Was, und das willst du schon als einen Viermaster erkennen?!«
»Ja, ich habe ganz merkwürdige Augen, ich kann sie wie ein Fernrohr verschrauben.«
»Das ist überhaupt nur ein Rumpf ohne Masten.«
»Es sind vier Masten, wahrscheinlich aber ausnahmsweise schwarz angestrichen, ich glaube sogar, schon schwarze Segel unterscheiden zu können.«
Sie begaben sich hinab und in einen anderen Turm, der als Seewarte für die Zitadelle diente.
Als der alte Kapitän das schärfste Fernrohr zur Hand genommen hatte, konnte er nur von Neuem über die Sehkraft seines jungen Freundes staunen: Es war tatsächlich ein Viermaster mit schwarzen Segeln.
»Schwarze Segel? Was für eine neue Mode ist denn das?!«
War es das erste Schiff der französischen Kriegsflotte? Nun, die Zitadelle war in vollständigem Verteidigungszustande. Nur die neunzehn überflüssigen Diener brauchten fortgeschickt zu werden, die Zugbrücke wieder hoch, und der Krieg hätte beginnen können. Aber der Kapitän zögerte noch mit dieser Entlassung, noch zeigte sich kein anderes Schiff, und dieses hier nahm seine Aufmerksamkeit völlig gefangen, erregte sein Staunen immer mehr.
Es steuerte mit voller Leinewand mit dem herrschenden Nordwind direkt auf Palo zu, in einer Viertelstunde konnte man schon alles deutlich unterscheiden, das Fernrohr erzählte noch mehr.
Wir haben noch heute ganz stattliche Segler, wer einmal in Hamburg oder Bremerhaven gewesen ist, wird über die kolossalen Kästen mit ihren himmelhohen Masten staunen. Aber von den Kriegsschiffen, wie sie waren, ehe die Dampfmaschine die Welt eroberte, können wir uns heute kaum noch einen Begriff machen. Auf Bildern, welche sie wiedergeben, fehlt immer der Maßstab, wonach man sie messen könnte, und Zahlen sagen da gar nichts.
Fünfdeckige Korvetten mit 400 Kanonen an Bord, wie sie noch in der Schlacht von Trafalgar verwendet wurden — was für Kolosse müssen das gewesen sein! Und wie die nun manövrieren können mussten! Denn da gab es doch keinen Dampfer, der ein Segelschiff in den Hafen schleppte und wieder heraus, der Segler war ganz auf sich selbst angewiesen. Fürwahr, wie diese Kolosse, ganze Flotten, ein- und ausgesegelt sind, wir können uns heute gar keine Vorstellung mehr machen. Solch ein Manöver wagt heute ein großes Segelschiff gar nicht mehr, bringt es gar nicht fertig. Die Segelkunst unserer Vorfahren ist uns verloren gegangen.
Es war ein mächtiges, hochbordiges Kriegsschiff. Von Geschützen war nichts zu bemerken, die geschlossenen Stückpforten waren nicht zu erkennen, also nicht zu zählen, während man sonst immer mehr Klappen anmalte, als sich wirklich öffnen ließen, um den kriegerischen Eindruck zu verstärken. Alles schwarz gemalt, Rumpf und Masten und Segel und alles. Sonst konnte man an Deck noch über zwei Dutzend Boote zählen, von dem größten, das schon wieder ein kleines Kriegsschiff für sich war, bis zu dem niedlichsten Dingi. An Deck sah man, wenigstens durch das Fernrohr, Matrosen exerzieren oder arbeiten, ebenfalls ganz schwarz gekleidet, sodass sie kaum zu unterscheiden waren, man ihre Zahl gar nicht beurteilen konnte. Die Kommandobrücke war vollständig geschlossen.
Kapitän Morphin schien ganz kopfscheu geworden zu sein.
»Was in aller Welt ist nur das, was ist nur das?«, murmelte er immer wieder.
»Schicke die überflüssigen Leute fort, mach dich kriegsbereit«, riet Axel, »das ist eben schon ein Franzose, der erst spionieren soll.«
»Ein französisches Kriegsschiff? Wo denkst du hin!«
»Ja, warum denn nicht?«
»Glaubst du denn, ein regelrechtes französisches Kriegsschiff würde sich ganz schwarz anpinseln und ohne Flagge ansegeln? Ja, wenn es eine nächtliche Maskerade gilt. Aber so doch nicht.«
»Hm, du hast recht, das kommt mir dann allerdings ebenfalls sehr merkwürdig vor. Aber was soll das dann sonst sein?«
»Was weiß ich? Nur eine Möglichkeit bliebe.«
»Nun?«
»Ein Pirat.«
»Ein Pirat? Solch ein mächtiger Kasten muss doch einen Hafen haben, und wo soll denn der sein?«
»Und weißt du denn, was sich in der Weltgeschichte zugetragen hat?«
Axel musste es zugeben. Es war die alte Geschichte von dem Fehlen aller Verbindungsmittel. Nur menschliche Beine, das Pferd und das Segelschiff kamen in Betracht. In der Welt gab es damals — und das bis zum Anfang des neunzehnten Jahrhunderts — zwei vollkommen organisierte Seeräuberstaaten: in Südamerika die sogenannte Banda orientala, das jetzige Uruguay, und in Nordafrika die maurischen Barbareskenstaaten. Diese beiden Piratenverbindungen lähmten den ganzen Welthandel, wenn nicht immer die Kriegsflotten aller hierin verbündeten Nationen auf den Beinen waren oder wenn sich nicht Ritterorden, wie der der Malteser, den Kampf mit solchen Piraten zum Beruf machten. Und konnte nicht jeden Tag ein neues solches Piratenreich entstehen? Konnten von Südamerika aus nicht einmal noch ganz andere Piratenschiffe als bisher zu größeren Expeditionen ausgeschickt werden? Es war alles möglich, und das konnte vielleicht jahrelang fortgehen, ehe es die andere Hälfte der Erdkugel erfuhr.
»Da, sie zeigen Flaggen!«
Die bunten Fähnchen kletterten am vordersten Maste in die Höhe. Eine vollkommen internationale Flaggensprache existierte schon damals, schon längst, jedes Schiff besaß sein Signalbuch.
Die Zitadelle hatte für Palo schon immer als Seewarte gedient, das Flaggenbuch war zur Hand, und das wäre nicht einmal nötig gewesen, der alte Kapitän hatte es im Kopfe, sein Gedächtnis hatte unter dem bleiernen oder eisernen Logierer, der keine Miete zahlte, nicht gelitten.
»Ist — dort — Kapitän Morphin?«, übersetzte er sofort. »Also auch die kennen mich schon — natürlich, welcher Seemann kennt mich nicht — aber was ist das für eine Sache, etwas zu fragen, ehe man sich vorgestellt hat? Die JaFlagge hoch, Jim, und dann erst angefragt, was für ein Schiff das ist.«
Die in Ordnung liegenden Flaggen waren im Nu an der Leine befestigt, gingen durch eine Luke zum Signalmast des Söllers hinauf. Drüben kam alsbald die Antwort.
»Namenlos«, buchstabierte der Kapitän. »Hallo, soll das etwa der Schiffsname sein?«
»Namenlos, merkwürdig!«, brummte Axel. »Gehört das Schiff etwa zum Bunde der Namenlosen?«
Der alte Kapitän warf ihm nur einen erstaunten Blick zu, sonst sagte er deshalb nichts.
»Unsinn! Heimathafen und Namen des Kapitäns will ich wissen.«
Die Frage wurde gestellt. Sie ward nicht beantwortet. Einige Reihen von Flaggen, schnell hintereinander auf- und wieder herabgezogen, drückten etwas ganz anderes aus.
»Zwanzig Meilen hinter uns segelt eine französische Kriegsflotte denselben Kurs. Drei Korvetten, vier Linienschiffe und sechs kleinere. Seid auf eurer Hut. Verstanden?«
So groß auch die Erregung ob dieser Mitteilung war, wurde doch erst das VerstandenZeichen gegeben. Dann knüpfte der Kapitän selbst die nächste Frage hastig an.
»Wer seid ihr?«
Drüben kam gar keine Flagge mehr, die Rahen schwenkten herum, das mächtige Schiff wendete nicht gegen, sondern mit dem Winde und ging mit vollgeschwellten Segeln direkt nach Süden.
Weshalb die in dem Fort so erstarrt waren, lässt sich wohl mitfühlen, sonst aber nicht erklären.
»Ein Piratenschiff, das uns vor der französischen Kriegsflotte gewarnt hat!!«, rief Axel, als erster das Schweigen brechend. »Ja, wenn dieses Schiff sich selbst ›Namenlos‹ nennt und nicht seinen Heimathafen angeben will, auch nicht den des Kapitäns, nicht einmal seine Nationalitätsflagge zeigt, dann zweifle auch ich nicht, dass es ein Piratenschiff ist!!«
»O, Wunder über Wunder!!«, begann jetzt auch Kapitän Morphin seinem Staunen Luft zu machen.
Nun aber wusste Axel wieder nicht, was für ein Wunder dabei sein sollte.
»Das Piratenschiff will der französischen Flotte eben einen Streich spielen, dass es die bedrohte Festung warnt.«
»Weiter siehst du nichts darin?!«
»Nein. Was denn?«
»O du unschuldige Landratte du! Schon mehr harmlose Feldmaus. Da sieht man doch, wie auch Depeschenreiter in Wasserfragen der ganze vielgerühmte Scharssinn verlässt...«
»Willst du mir nicht lieber eine bündige Erklärung geben, inwiefern hier ein Wunder geschehen sein soll, anstatt mich und meine Berufsgenossen zu verhöhnen?«
»Na, dieses schwarze Schiff hat mir doch gemeldet, dass die französische Flotte zwanzig Seemeilen zurück ist. Zwanzig Seemeilen sind aber eine Strecke, die man nicht etwa überblicken kann. Da muss das schwarze Schiff doch erst einmal in Sichtweite gewesen sein. Nun ist aber gar nicht denkbar, dass ein Kriegsschiff, noch viel weniger eine ganze Kriegsflotte, die sich auf einer Kriegsfahrt befindet, ein anderes Schiff, das es einmal erblickt und das dieselbe Richtung steuert, voraus lässt, und bei solch einer Flotte sind doch immer ganz schnelle Segler. Verstehst du noch immer nicht? Dass dieses schwarze Schiff melden kann, wie zwanzig Seemeilen hinter ihm die französische Kriegsflotte segelt, ist für den, der etwas davon versteht, einfach ein unlösbares Rätsel, und wie...«
Der alte Kapitän brach ab und starrte wie die anderen mit ganz entgeisterten Augen nach dem schwarzen Schiffe.
»O, Wunder über Wunder!!«, rief jetzt auch Axel aus.
Ja, jetzt passierte wirklich etwas, was auch jedem NichtSeemanne gleich als ein übernatürliches Wunder erscheinen musste. Das schwarze Schiff, an sich schon ein Rätsel, hatte also mit dem Nordwinde unter vollen Segeln nach Süden gewendet. Weit war es in diesem neuen Kurs noch nicht gekommen, die Unterhaltung der beiden hatte ja keine Minute gewährt.
Da rollten plötzlich und gleichzeitig alle die vierundzwanzig schwarzen Segel in die Höhe, welche an den vier Masten anzubringen waren, an jedem sechs. Dies war an sich noch keine Zauberei. Dieses Segelreffen, nicht zu verwechseln mit dem wirklichen Festmachen, kann von Deck aus besorgt werden, und darin war man damals sogar viel weiter als heute. Denn heute genügen zur Bedienung eines Viermasters zwölf Matrosen, die allerdings immer nur einen Mast zur gleichen Zeit bedienen können, aber das genügt eben, weil beim schwierigsten Manöver, beim Einlaufen in einen Hafen, ja Schleppdampfer zur Verfügung stehen. Damals aber brauchte man mindestens die doppelte Anzahl von Matrosen, eben weil alle Masten gleichzeitig bedient werden mussten, sonst hätte man solche Manöver gar nicht ausführen können.
Die Plötzlichkeit und Gleichmäßigkeit des Segelreffens war überraschend gewesen, aber das eigentliche Wunder geschah erst hinterher.
Der schwarze Koloss ging mit einem Male rückwärts, gegen den Wind an, zwar sehr langsam, aber man konnte es deutlich unterscheiden, weil er sich gerade hinter der kleinen Felsklippe befand, aus der Veränderung gegen diese war es untrüglich erkennbar, abgesehen davon, dass auch an dem breiten, mächtigen Heck das Wasser schäumte, obgleich dort nicht die geringste Strömung war.
»Hölle und Teufel, trügen mich denn nur meine Augen?«, flüsterte der alte Kapitän mit ganz weiß gewordenen Lippen. »Ist es denn nur wirklich wahr, dass das schwarze Schiff dort mit gerefften Segeln gegen den Wind angeht?!«
Die anderen konnten es nur bestätigen, und sie waren nicht minder entsetzt, eben ganz besonders deshalb, weil sie, die hier die Flaggen bedienten, Seeleute waren.
So kam das schwarze Schiff zurück, direkt gegen den ziemlich starken Wind und auch noch gegen eine Strömung, mit einer Schnelligkeit, die man auf mindestens vier Knoten in der Stunde veranschlagen musste.
Was die Zuschauer dabei dachten, können wir unmöglich schildern, heute gar nicht mehr begreifen. Hätte dort in der Luft plötzlich ein Engel geschwebt, mit der Posaune das jüngste Gericht verkündend, sie hätten mit keinem größeren staunenden Starren, dem sich zum Teil Entsetzen beimischte, hingeblickt.
»Fürwahr, es geschehen noch immer Zeichen und Wunder!!«, konnte Axel als erster hervorbringen.
»Und das ist keine Faszination, das ist handgreifliche Wirklichkeit, und wenn so etwas passiert, dann halte ich auch für möglich, dass der Wundergraf aus der vertrockneten Fürstin Eudoxia noch die gefeiertste Schönheit der Welt macht!«
So rief der Depeschenreiter in hellem Staunen, mit der letzten Bemerkung durchaus keinen Witz machen wollend, sondern das war eben sein ganz folgerichtiger Gedankengang.
Der zweite, der sich empor raffte, war Kapitän Morphin.
»Sie zeigen wieder Flaggen!!«
So war es. Auf dem vorwärts- oder vielmehr rückwärtsgehenden Schiffe wurden am hintersten Maste Flaggenreihen gehisst, und da wurde der alte Burgherr auch wieder nichts weiter als Kapitän.
»Könnt ihr einen schnellen Reiter nach Rom schicken?«, übersetzte er und signalisierte sofort ein Ja zurück.
»Darf Kapitän an Land kommen zur persönlichen Besprechung?«
»Bitte.«
Das schwarze Schiff hatte unterdessen ungefähr wieder jene Stelle erreicht, wo es zuerst signalisiert und gewendet hatte, jetzt stoppte es, aber ohne einen Anker auszuwerfen, hielt sich also nur durch die ihm innewohnende, geheimnisvolle Kraft gegen Wind und Strömung, sofort schoss ein Boot herab, schon mit Mannschaft besetzt, strebte im nächsten Augenblick mit voller Ruderkraft der noch etwa zweihundert Meter entfernten Bucht zu.
»Jetzt wird sich das Rätsel lösen, jetzt wird sich das Rätsel lösen«, flüsterte der Kapitän, aber es klang fast wie ein Ächzen, und dann setzte er mit Begeisterung hinzu: »Und was war das für ein schneidiges Bootsmanöver! Und wie die Kerls rudern, wie die rudern!!«
Hastig wandte sich Axel an ihn, den einen Fuß aber nach einer anderen Richtung setzend.
»Kapitän, bedenkt, dass es schon der Feind sein kann, der die Burg überrumpeln will.«
»Durch dieses eine Boot? Bah. Und ich bin auf alles vorbereitet... wo willst du hin, Axel?«
Dieser rannte schon nach der Zugbrücke.
»Ich muss dabei sein, wenn das Boot unten anlegt«, rief er zurück und jagte schon die Rampe hinab, in seiner Weise alle Förmlichkeit, die man jedem Besuche schuldig ist, beiseite lassend.
Ganz Palo hatte ja dies alles beobachtet, die Hälfte der Bevölkerung sich am Strande eingefunden, mit furchtsamer Neugier die Ankunft des Bootes erwartend.
Rücksichtslos, die Ellenbogen und auch gleich die Fäuste zu Hilfe nehmend, drängte sich Axel durch die Massen und kam gerade zur rechten Zeit, als das Boot an dem niedrigen Kai anlegte.
Ja, hier hatte man es mit einem Geheimnis zu tun, das zeigte der erste Blick auf die Insassen des schwarzen Bootes.
Es waren sechs Matrosen, welche die Riemen handhabten, in schwarze Trikotanzüge gekleidet, wie griechische Handelsmatrosen sie tragen, aber ohne Schärpe, wie jene sie lieben — ganz schwarz, ohne jeden Schmuck und sonstiges Abzeichen, und nun vor allen Dingen diese Gesichter!
Es waren durchweg ältere Leute, mindestens über vierzig Jahre, und alle diese von Sonne und Sturm gebräunten und verwetterten Gesichter, echten Seeleuten angehörend, drückten eine gewisse Melancholie, eine stumme Resignation aus. Dieses Übereinstimmen der glattrasierten, meist sehr hageren Gesichter war wirklich ganz auffallend, es wirkte geradezu unheimlich.
Der siebente Mann saß am Steuer, nicht anders gekleidet als die übrigen, ebenfalls ohne jedes Abzeichen, aber bedeutend jünger, eine hohe, schlanke, kraftvolle Gestalt, und doch ebenfalls solch eine traurige Niedergeschlagenheit in den sonst so energischen Zügen, die nur durch eine brennend rote Narbe. die quer über das Gesicht lief, einen Ausdruck von furchtbarer Wildheit erhielt, während die Augen doch mehr noch sanft als melancholisch blickten.
Auch das Anlegen des Bootes war mit einem Rätsel verbunden. Man kann sich doch so ein Bootsmanöver nicht ohne Ruderkommandos vorstellen. Wenigstens nicht, wenn alles klappen soll. Da darf doch nicht jeder rudern oder streichen wie er will. Dieses schwarze Boot hier mit seiner schwarzen Besatzung schoss in voller Fahrt heran, drehte mit einem Ruck bei, lag augenblicklich bewegungslos am Kai — Riemen hoch, Riemen ein — der vorderste Matrose schlang im selben Moment das Tau um den Poller — und dabei war kein Kommando erschollen, keinen Wink hatte der Steuerer gegeben.
Während die Matrosen regungslos auf den Duchten sitzen blieben, erhob sich der Steuermann und betrat leichtfüßig die Steinmauer.
Sofort wandte er sich an Axel, der durch den breiten Hirschfänger, die beiden mächtigen Reiterpistolen und sein sonstiges ganzes Aussehen allerdings auch die auffallendste Gestalt hier war. Das neugierige Volk hielt sich scheu zurück. Man dachte jedenfalls nicht mit Unrecht an Piraten. Denn französische Kriegsschiffsmatrosen konnten das nimmermehr sein.
»Sind Sie hier, um mich zu empfangen?«, fragte eine sonore Stimme auf italienisch.
»Ich bin der, den Ihr nach Rom schicken könnt — Depeschenreiter Axel«, lautete die bündige, etwas selbstbewusste Antwort.
Die eigentlich so melancholisch blickenden Augen nahmen einen ganz durchbohrenden Ausdruck an, als der Schwarze den vor ihm Stehenden musterte.
»Depeschenreiter Axel — kenne ich. Wollt Ihr für mich nach Rom reiten?«
»Wer seid Ihr?«
»Der Kapitän jenes Schiffes dort.«
»Ihr? So. Hm. Diese Auskunft ist mir ein bisschen zu kurz.«
»Wollt Ihr für mich nach Rom reiten?«
»Wie ist denn Euer Name?«
»Wollt Ihr für mich nach Rom reiten?«, erklang es zum dritten Male.
Da wusste dieser Depeschenreiter, wen er vor sich und was er zu tun hatte. Wenn er noch einmal eine Frage stellte, die jener nicht beantworten wollte, hatte er sich hier überflüssig gemacht. Entweder ging das Boot zurück, oder dieser schwarze Kapitän fragte nach einem anderen Depeschenreiter.
»Ja, ich will.«
»Ihr seid frei?«
»Absolut.«
»Kommt Ihr mit an Bord meines Schiffes?«
»Wozu?«, durfte Axel jetzt fragen, bereute es aber gleich, wenn es auch gut ausging.
»Habe Euch einen größeren Auftrag zu geben, lieber mündlich als schriftlich.«
»Wohl, ich komme mit.«
»Habt Ihr ein eigenes Pferd?«
»Ja.«
»Wo?«
»Dort oben auf der Burg.«
»Wird es an den Hafen gebracht, wenn ich mit einem Signal darum bitte?«
»Sicher.«
»Dann kommt!«
Der Kapitän, wie er sich nannte, stieg ins Boot zurück, Axel sprang ihm nach, nahm neben ihm Platz. Diesem Manne war ja ganz gleichgültig, wohin er fuhr, was noch kam. Je abenteuerlicher, desto besser! Der war doch nicht nur Depeschenreiter geworden, um sein täglich Brot zu verdienen!
Wieder kein einziges Kommando, kein Wink, und doch klappte alles tadellos, im nächsten Augenblick schoss das Boot in voller Fahrt wieder dem schwarzen Schiffe zu.
»Ihr kommandiert wohl nur mit den Augen?«, fragte Axel, der wirklich die Augen des Kapitäns beobachtet hatte.
»Keine Fragen, wenn ich bitten darf.«
»Das finde ich seltsam.«
»Möglich.«
Schon hatte das Boot das Schiff wieder erreicht, legte an einem herabgelassenen Fallreep bei.
»Bitte, folgt mir«, sagte der Kapitän immer höflich, als erster die lose Leiter hinaufsteigend.
Alles schwarz, auch die Deckplanken. Nein, um eine Maskerade konnte es sich hier nicht handeln, das hätte eine Heidenarbeit gekostet, die schwarze Farbe wieder abzuwaschen — wenn es eine solche gewesen wäre. Aber das war alles schwarz gebeizt, wenn nicht eine schwarze Holzart, obgleich wohl schwerlich Ebenholz. Dann wäre dies alles ja gar nicht zu taxieren gewesen.
Nirgends ein Schiffsname zu lesen. Gegen fünfzig Matrosen waren mit den verschiedensten Arbeiten beschäftigt, nahmen von dem Fremden nicht die mindeste Notiz.
Axel folgte dem Kapitän eine Treppe hinab, direkt in einen Raum, der nicht gerade die Kajüte zu sein brauchte. Oder dieses mächtige Schiff hatte wohl gar viele Kajüten.
Ebenfalls alles schwarz, die holzverkleideten Wände sowohl wie der große Tisch, wie die darumlaufende Polsterbank. Das Auge erblickte keinen Gegenstand, der nicht auf irgendeine Weise schwarz gefärbt gewesen wäre. Auch die über dem Tisch hängende Lampe war schwarz bronziert, auf dem schwarzen Tintenfass, übrigens eine höchst kostbare Schnitzarbeit, lagen einige schwarze Gänse- oder sonstige Federkiele, vielleicht von einem schwarzen Schwan, und Axel hätte sich gar nicht gewundert, wenn auch die schwarze Briefmappe schwarzes Papier enthalten hätte. Dann freilich hätte die Tinte wohl weiß sein müssen.
»Bitte, nehmen Sie Platz.«
Die drehbare Lehne wurde nach dem Tisch herumgeklappt, sie setzten sich.
»Ist Ihnen das Italienische geläufig?«
»Italienisch, Deutsch, Englisch, Französisch — mir egal!«
»Dann bleiben wir bei der Sprache des Landes, in dem wir uns befinden, wenn auch auf dem Meere. Ich habe schon sehr viel von Ihnen gehört, Signor Axel.«
»Freut mich.«
»Sie gelten als der beste und zuverlässigste Depeschenreiter Europas.«
»Haben Sie mich an Bord genommen, um nur Schmeicheleien zu sagen?«
Kein verwunderter Blick, kein Lächeln. Eines solchen war dieses Gesicht auch gar nicht fähig. Dann mochte der schwarze Kapitän diesen brüsken Depeschenreiter auch schon kennen.
»Es freut mich aber, dass ich zu meiner Mission gerade den besten und zuverlässigsten Depeschenreiter bekomme — gerade den Depeschenreiter Axel.«
»Na, und?«, ward dieser womöglich noch gröber.
»Wollen Sie für mich einen Ritt nach Rom machen?«
»Ja doch. Natürlich nicht umsonst.«
»Ich bezahle, was Sie verlangen.«
»Das kommt drauf an. Zu wem?«
»Sie sind im Vatikan bekannt?«
Axel unterdrückte ein Stutzen.
»Woher wisst Ihr das?«
»Es ist mir bekannt.«
»Woher denn? Ihr kommt doch von hoher See.«
»Bitte... Sie kennen den Kardinal Luigo persönlich?«
»Ja«, gab Axel jetzt ohne weitere Frage zu. Das konnte ja auch weiter bekannt geworden sein.
»Sie kennen ebenso den Grafen von Saint-Germain?«
»Ja, ziemlich gut.«
»Der Graf ist verhaftet worden und vor ein Inquisitionsgericht gekommen.«
Einige Sekunden wurde Axel regungslos, ehe er empor sprang.
»Was sagen Sie da?! Ist ja nicht möglich.«
»Er ist heute Mittag kurz nach zwölf, als er im Starrkrampf lag, von einer päpstlichen Wache nach dem Vatikan gebracht worden, nach seinem Erwachen kam er vor ein Inquisitionsgericht, sollte dort seine Experimente vorführen, und da er sich weigerte, mit der Begründung, dass er sich zu nichts zwingen ließe, wurde er in ein Gefängnis gebracht, in eine Zelle, einen Raum, der früher dazu diente, um Delinquenten bei lebendigem Leibe zu rösten.«
Axel starrte den ganz gelassen Sprechenden an, blickte suchend um sich, sah keine Uhr.
»Es ist jetzt gleich um vier«, sagte der Kapitän, seine Gedanken erratend.
»Und das ist zwischen zwölf und eins passiert? Woher wollen Sie das wissen?«
»Nun, schon in drei Stunden kann man hier Nachricht von Rom haben.«
»Das stimmt, aber... es stimmt auch wieder nicht so ganz. Das mit dem Inquisitionsgericht hat sich doch nicht so im Handumdrehen abgewickelt.«
»Sie haben recht. Der Graf ist sogar erst vor anderthalb Stunden in die Marterzelle geführt worden.«
»Und woher wollen Sie da das wissen?«
»Bitte, das lassen Sie unsere Sache sein.«
»Können Sie etwa hellsehen?«
»Nehmen Sie es an«, war die gleichmütige Antwort.
»Na, meinetwegen. Wenn jemand gegen den Wind anfahren kann, dann kann er vielleicht auch hellsehen und noch viel mehr. Meinetwegen mögen Sie auch fliegen können. Die Hauptsache ist doch, dass Sie mir hier keine Märchen erzählen!«
»Was für einen Grund hätte ich dazu?«
»Ja, das ist es eben! Und der Graf ist faktisch vor ein Inquisitionsgericht gekommen, steckt schon in der Folterkammer?!«
»Wie ich Ihnen berichte.«
»Himmel und Hölle!«, fuhr jetzt Axel los. »Und mir haben die schuftigen Pfaffen gesagt, um vier Uhr solle er den Bannbefehl erhalten, müsse sofort Rom und den Kirchenstaat verlassen, aber sonst auch nichts weiter.«
Er wollte nach der Tür stürzen, brauchte aber nicht zurückgerufen zu werden, kam nur zu einem einzigen Schritt.
»Er wird schon gefoltert?«
»Nein, und er wird es auch schwerlich werden. Es kommt den hohen Geistlichen, die ihm aus gutem Grunde feindlich gesinnt sind, hauptsächlich darauf an, ihn erst eine lange Hungerkur durchmachen zu lassen, um den Wundermann dann als abgemagertes Skelett dem Volke zu zeigen.«
Hier hatten sich die beiden Richtigen gefunden nämlich insofern, als Axel nicht weiter fragte, woher denn der Kapitän das alles wissen wolle, sich über das vorgebliche Hellsehen gar nicht weiter wunderte, und der schwarze Kapitän, indem er nicht fragte, was jenen denn so furchtbar aufrege. Sie nahmen eben den Fall, wie er gegeben war, blieben nur bei der Hauptsache — — und das ist eine Charaktereigenschaft, welche den Mann der Tat ausmacht.
»Ah, ich verstehe! Diesen Kardinal Luigo werde ich furchtbar zur Rechenschaft ziehen.«
»Und Sie können mich als Ihren Verbündeten betrachten, sollen mich und mein Schiff hinter sich haben.«
»Wie das? Erklären Sie sich näher.«
»Wie lange brauchen Sie zum Ritt nach Rom?«
»In zwei Stunden bin ich dort. Habe ein gutes Pferd und werde es nicht schonen.«
»Und in zwei Stunden kann ich mit meinem Schiffe auch vor Fiumicino liegen, von wo die schnellste Stafettenpost aber auch noch zwei Stunden bis nach Rom braucht. So eilen Sie, Ihr Pferd ist bereits beordert. Sie melden sich dem Kardinal, müssen unbedingt sofort vor ihn kommen...«
»O, das soll mir wohl nicht schwer werden!«, hohnlachte Axel.
»... aber fordern Sie weiter keine Erklärung, sondern sagen Sie einfach: In Fiumicino liegt ein großes Schiff, dessen Kapitän den Grafen von Saint-Germain als seinen Gastfreund zu sich an Bord ladet. Diese Einladung muss dem Grafen sofort überbracht werden. Oder Sie bestehen darauf, dass Sie selbst es ihm mitteilen. Dann natürlich hängt es von des Grafen Willen ab, ob er meiner Einladung folgt oder ob er es vorzieht, im Inquisitionskerker zu bleiben. Verstehen Sie mich?«
Nein, wohl nicht so ganz — Axel machte ein etwas verdutztes Gesicht.
»Der Kardinal wird mich einfach auslachen. Oder er wird doch erst nach Fiumicino schicken, respektive warten, bis er von dort wegen des Schiffes Nachricht bekommt. Und überhaupt, weshalb soll er denn da gleich nachgeben?«
»Sehr einfach! Ich erwarte, dass Sie sofort, wenn Sie Bescheid haben, nach Fiumicino eilen oder einen anderen Boten schicken. Ja, sagen Sie dem Kardinal gleich, dass wir seine Antwort, ob er den Grafen frei gibt oder nicht, gar nicht erst durch einen menschlichen Boten abzuwarten brauchen. Wir besitzen ein Mittel, um immer zu wissen, was dort vorgeht. Nehmen Sie doch an, wir hätten mit Rom eine Brieftaubenpost eingerichtet, Sie brauchen gar nicht an ein magisches Hellsehen zu denken. Also: Wenn ich nicht innerhalb von zwei Stunden, nachdem Sie den Kardinal Luigo oder auch gleich den Papst gesprochen haben, die Versicherung habe, dass der Graf von Saint-Germain entlassen ist, dann... bombardiere ich Fiumicino.«
Nur eine kleine Pause hatte der Sprecher vor seiner furchtbaren Drohung gemacht, sonst hatte er es ganz gleichmütig gesagt.
Mit einem Ruck aber war Axel emporgefahren.
»Ha, das lässt sich hören!«
»Die Mittel, um meine Drohung wahr zu machen, besitze ich.«
»Daran zweifle ich nicht im Geringsten. Dieses Schiff sieht nicht gerade wie ein Spielzeug aus. Und was soll ich sagen, von wem diese Drohung kommt?«
»Berichten Sie nur von dem schwarzen Schiffe, etwas von seiner Größe, das wird schon genügen. Oder soll ich Ihnen erst unsere Batterien zeigen?«
»Es ist nicht nötig, so gern ich dieses Schiff auch näher kennen lernen möchte. Aber gar kein Name?«
»Unser Schiff hat keinen Namen, und wenn Sie durchaus einen gebrauchen wollen, so sprechen Sie eben vom ›Namenlos‹.«
»Und Ihr Name, Herr Kapitän?«
»Wir alle haben keine Namen mehr. Sprechen Sie nur vom schwarzen Kapitän wie vom schwarzen Schiffe.«
»Von einem Piratenschiffe und einem Piratenkapitän?«
»Nein, wir sind keine Piraten. Wir sind freie Beherrscher des Meeres, haben keinen Heimathafen, führen keine Flagge und gar nichts. Aber wir sind entschlossen, gegen die Ungerechtigkeit zu Felde zu ziehen, wo und wie wir können.«
»Well, das gefällt mir«, rief Axel, seinen Fuß wieder zur Tür wendend, denn durch das Bullauge, durch welches er den Hafen überblickte, sah er dort schon sein Pferd stehen. »Also Sie laden den Grafen zu sich an Bord ein?«
»Ich bitte darum.«
»Er kennt Sie und Ihr Schiff?«
»Nein. Bestellen Sie nur meine Einladung, womöglich persönlich, erzählen Sie ihm, was ich mit Ihnen gesprochen habe, was Sie sonst gesehen haben, weiter nichts.«
»Und der etwa schon ausgesprochene Bannfluch, soll der wieder aufgehoben werden?«
»Nein, das geht mich nichts an. In solche kirchliche Angelegenheiten mag ich mich nicht mischen, wir gehören überhaupt nicht mehr der Erde an. Nur den Grafen will ich zu mir an Bord haben.«
»Well, ich eile. Über meinen Lohn sprechen wir später.«
Und Axel eilte hinaus, sprang in das noch mit Matrosen besetzte Boot, nur ein anderer Steuermann saß jetzt am Ruder, und fünf Minuten später jagte er mit verhängten Zügeln nach Rom zu.
Als der Graf von dem Depeschenreiter verlassen worden war, hatte er sich gleich wieder ins Sanktuarium begeben. Erst hier, wo er sich absolut sicher fühlte, ließ er seinen Gefühlen freien Lauf.
»Gerettet! Noch einmal gerettet! Denn der Aufrichtigkeit dieses Mannes traue ich. Gott, ich danke dir, dass du, wenn es nun doch einmal kommen musste, mich gerade von diesem Mann durchschauen ließest!«
Es hatte fast ausgesehen. als wolle der Graf bei diesen Worten auf die Knie stürzen. Aber die kühle Vernunft behielt die Herrschaft.
»Fort muss ich dennoch von hier. Dem Bannspruche ist nicht zu widerstehen. Darf mich nicht blicken lassen, nicht mit meinen Schülern und Schülerinnen verkehren. Wenigstens nicht öffentlich. Ich würde sie nur ins Unglück stürzen. In Verbindung bleibe ich natürlich trotzdem mit ihnen. Ich darf Rom nicht eher verlassen, als bis ich der Fürstin de la Roche und der ganzen Welt gegenüber mein Versprechen gelöst habe. Ha, das soll eine Überraschung geben! Ob ich dann nicht auch die größten Zweifler bedingungslos auf meine Seite bekommen werde? Wohin soll ich mich unterdessen begeben? Palo ist mir zu weit, abgesehen davon, dass ich bei einer Belagerung dort festgenagelt werden könnte. Ebenso weit sind die pontinischen Sümpfe, in denen ich ja ebenfalls zu Hause bin. Nein, ich weiß ein besseres Versteck, hier in Rom. Der Zugang zu meiner unterirdischen Werkstatt hier ist mir ja auf dem Wasserwege jederzeit frei, und ich habe der Fürstin wegen noch gar viel darin zu arbeiten. Es ist nur Mariettas und des Kindes halber. Lasse ich sie hier unten? Nein, es geht nicht. Wohl wird man mein unterirdisches Geheimnis niemals entdecken, aber.... bei einem Eindringen in mein unterirdisches Reich würden auch die beiden durch eine furchtbare Explosion spurlos verschwinden. Sie müssen mit. Am Tage kann ich sie aber nicht herausbringen. Es muss in der Nacht geschehen. Wohlan, so werde ich Marietta vorbereiten, dass sie wegen Unsicherheit ihres Mannes das Kloster verlassen muss. In dem anderen Versteck ist sie vielleicht noch sicherer, und auch an Bequemlichkeit gebricht es dort nicht, es ist ja noch alles eingerichtet. Vielleicht gelingt es mir auch, die neuen Bewohner des Klosters, die Jesuiten sein sollen, wieder herauszuschrecken. Ich will denen schon einen gehörigen Spuk vormachen. Sonst lasse ich hier ja nichts zurück als... ach, meine arme Pepita!!«
Mit über der Brust gekreuzten Armen auf und ab gehend hatte der Graf dieses Selbstgespräch geführt. Bei dem Gedanken an sein Kind, an dessen Totenbettchen wir ihn zuletzt gesehen, brach noch einmal nach den kalt überlegenden Worten der ganze Jammer durch, in grenzenloser Verzweigung hatte er beide Arme ausgebreitet.
In diesem Augenblick verkündeten die Kirchtürme Roms dröhnend die Mittagsstunde, auch noch hinter diesen dicken, fensterlosen Mauern deutlich zu vernehmen.
Aber der Graf hatte sich diesmal nicht von der zwölften Stunde überraschen lassen, blieb nicht so mit ausgebreiteten Armen stehen, fiel also nicht in Starrkrampf, sondern trat an die Wand, schlug den Teppich zurück, ließ den Mechanismus spielen, der die geheime Tür entstehen ließ, und begab sich in sein eigentliches Reich hinab.
Erst in dem Garderoberaum machte er Licht. Während darin sonst die peinlichste Ordnung herrschte, lag jetzt am Boden ein schmutziges Arbeitsgewand, daneben lehnte an der Wand eine schwere Hacke.
Beim Anblick dieser Gegenstände ward der Graf immer wieder von einer schmerzlichen Verzweiflung übermannt.
»Mein Kind, meine arme, kleine Pepita — ach, dass ich dich verlieren musste — ich Vermessener, der ich anderen helfen wollte, und nicht einmal mein eigenes, über alles geliebtes Kind konnte ich dem Leben erhalten!«
Denn dieses Arbeitsgewand hatte er getragen, als er mit dieser Hacke vorhin der kleinen Leiche in dem Keller ein Grab bereitet hatte.
Er ermannte sich wieder, brachte die Sachen an Ort und Stelle, wozu er vorhin keine Zeit gehabt, und begann sein Äußeres zu verändern.
In zwei Minuten hatte er sein elegantes Kostüm abgestreift und einen einfacheren Anzug angelegt, die sonstige Veränderung machte er ebenso schnell vor einer Waschtoilette, über der ein großer Wandspiegel hing.
Ein leichtes Einreiben des Gesichts und der Hände, seine Haut war viel brauner geworden, der Bart angefeuchtet und durch Bürstenstriche in eine ganz andere Lage gebracht, wobei nur das Merkwürdige war, dass der Bart in dieser Lage auch verharrte, woran eben die Flüssigkeit schuld sein musste, dann mit den Fingern etwas das Gesicht massiert, und da zeigte es sich, dass der Graf von Saint-Germain auch die Kunst verstand, seine Gesichtszüge vollständig zu verändern. Die Nase war wohl dieselbe geblieben, auch Kinn und Mund, im Grunde genommen aber war es doch ein vollständig anderes Gesicht, das er im Spiegel erblickte. Er hätte so, auch in seinem gewohnten Kostüm, ruhig auf die Straße gehen können, keiner seiner Schüler, auch die Detektivaugen von des Lords Leibdiener, hätten ihn nicht wiedererkannt.
So verändert, als der ehemalige Skribent und jetziger gräflicher Sekretär Antonio, verließ er den Garderoberaum, nur die Tür zuklinkend, die aber wohl ihre geheime Sicherheit hatte, durchschritt im Finstern einen längeren Gang, öffnete mehrmals Türen, stieg eine kurze Treppe hinauf und befand sich so im ersten oberen Kellergeschoss, aber noch immer in einer Region, von deren Existenz man gar nichts mehr wusste.
Ein Gang zeigte sich, in dem ständig eine Lampe brannte, und da öffnete sich schon eine Tür, ein kleines, hübsch gekleidetes Mädchen eilte dem Kommenden entgegen und umschlang jubelnd seine Knie.
»Papa, Papa — endlich kommst du — Mama wartet schon mit dem Mittagessen auf dich!«
Der Graf, jetzt zu seinem Sekretär Antonio geworden, den er irgendwo, wohin Marietta nie kommen durfte, mit schriftlichen Arbeiten beschäftigen wollte, hob das Kind auf seine Arme.
»Meine liebe, kleine Pepita!«
So machte er es täglich, wenn das Kind um diese Zeit durch die Türspalte nach dem vermeintlichen Vater spähte und ihm dann in dem Korridor, den er sonst vermied, entgegeneilte, stets war es wirklich die herzlichste Liebe, die aus seinen Worten sprach, wenn er das stellvertretende Kind auf seine Arme hob — diesmal aber musste er diese Worte förmlich herauswürgen.
Doch das sonst so ausgeweckte und selbst sehr frühreife Kind hatte nichts bemerkt, es erzählte in einem Atem, was es heute gespielt habe und was es zu essen gäbe.
Wir haben nicht des Längeren geschildert, wie der Graf seiner Frau den Glauben beigebracht hatte, dieses schöne, so kerngesunde Kind sei ihre ehemals so verkrüppelte, blinde und taubstumme Pepita, wie er diese Umwandlung so nach und nach arrangiert hatte.
Der Graf hätte es ja sehr leicht gehabt. Er hätte Marietta nur zu hypnotisieren brauchen. Dann hätte er ihr aber doch suggerieren müssen, sie solle das verkrüppelte Kind in ihrer Einbildung in ganz normalem, gesundem Zustande sehen, und da hätte er ihr ebenso gut auch eine Holzpuppe in den Arm geben können.
Derartiges hatte der Graf nicht getan. Der Grund hierzu liegt sehr nahe. Gesetzt den Fall, dass solch eine hypnotische Täuschung auf die Dauer möglich ist, was nämlich der Graf selbst bezweifelte — hätte ihn das etwa selbst glücklich gemacht, sein Weib, das er über alles liebte, ständig in solch einer suggerierten Einbildung zu sehen, die doch mit Wahnsinn die größte Ähnlichkeit hat? Man stelle sich das vor, und man wird zugeben, dass so etwas ganz ausgeschlossen war.
Außerdem aber wusste der Graf eben schon, dass seine geheime Kunst, für die er noch gar keinen Namen kannte, ihre Grenzen hatte, und das ganz besonders, wenn es sich um posthypnotische Suggestionen handelte. Da mochte er schon seine Erfahrungen gemacht haben. Jemand Liebe zu einer bisher ganz gleichgültigen Person suggerieren — ja, das ist doch etwas ganz anderes. Durch die Gewohnheit wird mit der Zeit wirkliche Liebe daraus. Alle die Liebestränke, die im Altertum und im Orient noch heute eine so große Rolle spielen, und von denen so viel erzählt wird, dass doch irgend etwas Wahres daran sein muss, haben offenbar ebenfalls eine hypnotische Wirkung.
Aber hierbei handelte es sich doch um etwas ganz anderes. Vielleicht sollte Marietta mit ihrem Kinde auch wieder einmal unter den Leuten erscheinen, und was sollte denn daraus werden, wenn sie von der plötzlichen Umwandlung ihres Kindes erzählt hätte?
Also, der Graf hatte das alles ganz anders arrangiert. Mit der kleinen Lorenza freilich hatte er wohl hypnotische Suggestionen vorgenommen. Das bisher ganz normal gewesene Kind hatte zuerst nicht mehr sehen, hören und sprechen können. Aber das war alles mit der Zeit gekommen. Als der Graf nach acht Tagen in Mariettas Gegenwart zuerst die Bandagen von den Händchen genommen hatte, waren diese zum unaussprechlichen Glücke der Mutter ganz normal gewesen. Dann war, etwas langsamer, das Gesicht daran gekommen. Zuerst konnte der Graf es ja künstlich etwas entstellt haben, vielleicht nur durch Farbe.
Kurz, die Umwandlung war ganz langsam nach und nach geschehen, nach und nach hatten sich Gesicht und Gehör eingestellt, unter der Mutter und des Vaters Anleitung hatte die kleine Lorenza von Neuem sprechen gelernt. Und die Erinnerung an alles Frühere mochte ihr der Graf aushypnotisiert haben. Sie war ja auch noch ein vierjähriges Kind, da ließ sich das schon leichter machen. Jetzt wusste sie nicht anders, als dass sie Pepita hieße und die Tochter dieser beiden sei.
In Marietta stieg nicht der geringste Zweifel auf. Sie hätte noch ganz anderes geglaubt. Sie war eine in den untersten Ständen geborene Römerin, und... sie war eben ein Kind ihrer Zeit. Damals gab es noch einen Teufel, die Engel spazierten noch überall herum. Schließlich ist es ja in gewissen Teilen der aufgeklärtesten Länder, und nicht in den kleinsten und wenigsten Teilen, heute noch gar nicht anders geworden. Es muss nur der Richtige kommen, der die Sache versteht, und die Leute glauben ihm einfach alles, alles!
Der Graf hatte sein Ziel erreicht. Er sah sein geliebtes Weib glücklich. Das war die Hauptsache. Und er wusste sogar, dass sie für immer in diesem unterirdischen Reiche bleiben würde, ohne sich je nach der Außenwelt zu sehnen, wenn nur ihr Kind bei ihr war und ihr Gatte zu den regelmäßigen Zeiten, zu denen auch immer die ganze Nacht gehörte, sich bei ihr einstellte.
Marietta trug das Essen auf den Tisch. Von dem Wohn- und Schlafzimmer führte eine Tür in eine kleine Küche, die Marietta schon vollkommen eingerichtet gefunden hatte, eine Speisekammer gefüllt mit Vorräten aller Art, die von Zeit zu Zeit ergänzt wurden, wie die Holzkohlen und alles andere.
Dieses Wiedersehen beim Mittagessen, welches regelmäßig von zwölf bis eins währte — also die Zeit, während welcher der Graf eigentlich im Starrkrampf liegen und seinen Geist auf Reisen schicken sollte — geschah so regelmäßig, dass weiter keine Begrüßung erfolgte, wenn sonst auch die Freude groß genug war.
Heute musste Antonio diese Freude stören. Um vier Uhr sollte dem Grafen der Bannbefehl überbracht werden. So hatte der Depeschenreiter gesagt.
Aber konnte der das so ganz genau wissen? Konnte sich nicht sonst etwas an dieser Zeit ändern?
Nein, der Graf wollte lieber nichts auf die lange Bank schieben.
»Antonio, dein Leibgericht!«, sagte die junge Frau, freudestrahlend die dampfende Schüssel auf den Tisch setzend.
»Leider kann ich ihm nicht die gewöhnliche Ehre erweisen. Marietta, ich muss dir etwas mitteilen.«
Ach, dieser Schreck!
Aber es war gar nicht so schlimm, wenigstens so nicht, wie Antonio es zu schildern verstand.
Er wurde von den Häschern noch immer als Hochverräter gesucht. Jetzt hatte man endlich doch den Verdacht gefasst, der Graf von Saint-Germain könne ihn in seinem Kloster versteckt haben. Es sollte Haussuchung gehalten werden.
»Wir müssen das Kloster verlassen. Aber da ist ja gar nichts weiter dabei. Der Graf, mein Herr und Gönner, weiß für mich ein anderes Versteck, wo wir noch viel sicherer sind, wo du noch viel weniger entbehrst als hier...«
So und anders sprach der Graf, der erst so schreckhaften Nachricht jeden Stachel nehmend.
»Also heute Nacht werde ich dich...«
Furchtbar schrak die schon beruhigt gewesene Frau zusammen.
Ein eigentümlich trommelnder Laut war erschollen. Sie kannte dieses Geräusch, es war das Signal, durch welches der Graf seinen Sekretär zu sich rief. Deshalb also war sie nicht erschrocken. Sondern nur über die fluchtähnliche Hast, mit welcher diesmal Antonio dem Rufe nachkam.
»Der Herr Graf ruft mich, ich muss eilen!«, stieß er hervor und eilte hinaus.
Denn dieses Zeichen bedeutete natürlich etwas anderes, als dass der Graf seinen Sekretär rief.
Wenn die über der Tür des Sanktuariums hängende Glocke gezogen wurde, so entstand hier unten durch eine besondere Vorrichtung ein trommelndes Geräusch. Elektrisch hatte das der Graf niemals gemacht, und das war gut, denn jetzt hätte er diese Vorrichtung entfernen müssen, mindestens die Leitungsdrähte, sollten diese nicht zum Verräter werden. So klingelte es jetzt auch nicht mehr hier unten, wenn oben an der Klinke der Tür gedrückt wurde. Diese Vorrichtung hatte er bereits beseitigt. Nur beim Ziehen an der Klingel funktionierte noch das Trommelsignal.
Es kam ja öfters vor, dass die Glocke gezogen wurde. wenn sich der Graf einmal in sein Sanktuarium eingeschlossen hatte — wenn man ihn darin wenigstens glaubte. Besonders wenn Lord Moore den Grafen sprechen wollte. Oder es waren auch einige Male Beamte gekommen, dieses Kloster war ja päpstlicher Besitz, es waren noch immer Förmlichkeiten zu erledigen.
Die Diener waren scharf instruiert, diese Glocke schon zu ziehen — vorausgesetzt, dass sich der Graf im Sanktuarium befand — wenn sich solch ein Besuch an der Klosterpforte oder schon am Gartentor meldete. Auf diese Weise konnte der Graf sich aus seinem unterirdischen Reiche immer noch rechtzeitig in das Sanktuarium begeben, tuend, als habe er sich darin befunden.
Es kam zwar selten vor, dass er durch dieses Zeichen gerufen wurde, immerhin war es doch nichts ganz Ungewöhnliches. Trotzdem durchfuhr den Grafen jetzt ein jäher Schreck, den er unter der Maske Antonios vor seiner Gattin auch wenig zu bemänteln suchte.
In fluchtähnlicher Hast stürzte er also davon, unterwegs sich schon seiner Kleidung entledigend.
»Wenn das bereits die Vollstrecker des Bannbefehls wären...«
Er suchte sich zu beruhigen, der Bannbefehl sollte ihm ja erst um vier Uhr zugehen, ganz sicher würde es Lord Moore sein — — aber bald sollte es sich zeigen, eine wie glückliche Ahnung dieser Schreck gewesen war, der ihn veranlasste, mit noch größerer Schnelligkeit als sonst sich wieder in den Grafen zu verwandeln und sich nach oben zu begeben.
Kaum hatte er die geheime Wandöffnung hinter sich geschlossen, als es auch schon gegen die Tür donnerte.
»Aufgemacht im Namen des Papstes!!«
Wahrhaftig, da waren sie schon! Die Beamten, die ihm den Bannbefehl brachten, benahmen sich dazu recht grob. Es wurde immer weiter gegen die Tür gedonnert.
Aber dem Grafen fiel es gar nicht ein, zu öffnen. Er musste ja jetzt im Starrkrampf liegen, und er legte sich denn auch gleich auf einem Diwan zurecht.
Und es war gut, dass er sich durch das Pochen nicht aus seiner Ordnung bringen ließ.
»Wird nun bald aufgemacht?!«, wurde draußen gebrüllt.
»Aber der Herr Graf liegt ja drin im Starrkrampf!«, hörten seine feinen Ohren trotz der dicken Tür die klägliche Stimme eines seiner Diener sagen.
»Ach was, Starrkrampf oder nicht — wir müssen hinein, und wir sind nicht solche maskierte Soldaten wie die damals, bei uns ist es bitterer Ernst — Achtung vor der päpstlichen Wache! Aufgemacht!«
»Ja, wie soll er denn aber öffnen, wenn er bewusstlos daliegt?«
Der führende Offizier ließ doch mit sich handeln.
»Dann machst du auf.«
»Ich habe ja keinen Schlüssel«, erklang es immer kläglicher.
»Wer hat den Schlüssel zu diesem Raume?«
»Niemand, nur der Herr Graf selbst hat einen zum Sanktuarium.«
»Dann muss ich die Tür erbrechen lassen, das hilft alles nichts, ich kann nicht warten, bis es dem Herrn gefällt, aus seinem Schlafe zu erwachen.«
Und noch ganz anders wurde gegen die Tür gedonnert, offenbar mit der Absicht, sie aufzubrechen, was es bei dem außerordentlich starken, eisenbeschlagenen Holze nun freilich nicht gab, und zum Ansetzen eines Hebebaums hätte der Platz auf dem Korridore nicht gereicht. Das sah der Offizier schnell genug ein.
»Habt Ihr noch andere Schlüssel? Vielleicht passt einer. Ach was, nicht aufgehalten! Einen Schlosser mit Dietrichen her!«
Schnell erhob sich der Graf, ging leise nach der Tür, machte sich an dem Schlosse zu schaffen. Aber nicht etwa, dass er eine besondere Vorrichtung anbrachte, um ein Öffnen durch einen Dietrich unmöglich zu machen, sondern im Gegenteil, er beseitigte solch eine Vorrichtung. Denn wollten die nun einmal eindringen, so konnte er sie doch schließlich nicht daran hindern.
Dann legte er sich wieder auf den Diwan, und nicht lange dauerte es, so rasselte und knirschte es in dem Schlosse, der Riegel ging zurück, die Tür auf, und eine Schar päpstlicher Soldaten drang ein, an der Spitze ein Hauptmann.
Sie fanden den Grafen in völlig erstarrtem Zustande auf dem Diwan liegen. Wir dürfen aber nun wohl glauben, dass er diese Katalepsie nur täuschend nachzuahmen verstand, dass er also auch alles hören, vielleicht sogar sehen konnte, dass sich sein Geist noch im Körper befand und nicht wesenlos auf Reisen ging.
»Nicht anfassen, nicht anfassen«, jammerten die mit hereingekommenen Diener, »es bricht alles wie Glas ab!«
»Werden schon vorsichtig sein«, knurrte der Hauptmann, durch solch ungebärdiges Wesen aber nur seine Scheu verbergen wollend. »Ist die Sänfte da? Gut, also doch wieder eine Sänfte.«
Ja, zum zweiten Male war eine Sänfte nötig, um den Grafen fortzubringen, diesmal aber geschah es am helllichten Tage, und da konnte nicht wieder von einer Maskerade die Rede sein, dass etwa Unrechtmäßige den Grafen verhaften und fortbringen wollten.
Wiederum wurde er an Händen und Füßen gefesselt, ohne dass diese deswegen gebogen zu werden brauchten, die Ketten waren lang genug oder konnten verlängert werden, die Sänfte war zur Stelle, der völlig starre Körper, der sich wie ein Balken heben ließ, ward hineingelegt.
Fort ging es durch die Straßen. Bald wusste es ganz Rom.
»Der Wundergraf ist schon wieder von einer päpstlichen Wache verhaftet, wird wieder in einer Sänfte davongetragen!«
Niemand konnte ihm helfen, niemand dachte an eine Befreiung. Aber der Schreck bei gewissen Personen war groß.
Das Ziel der Wache war der Quirinal, das Untersuchungsgefängnis, besonders auch für Geistliche oder sonst mit der Kirche in Verbindung stehende Personen bestimmt, damals noch zum Vatikan gehörend, der Residenz des Papstes, ein Stadtviertel, eine ganz ansehnliche Stadt für sich bildend.
In diesem Untersuchungsgefängnis verschwand die Wache mit der Sänfte.
* Ein gewölbter, fensterloser Raum, der, wenn er auch nicht unter der Erde lag, doch ganz den Eindruck eines Kellerverlieses machte, ein langer mit einem roten Tuche bedeckter Tisch, darauf brennende Wachskerzen — und ein großes Kruzifix, auch die in dunkle Gewänder gehüllten Inquisitoren fehlten nicht.
Dies alles hätte einen ganz schauerlichen Eindruck gemacht, an ein mittelalterliches Femgericht erinnernd, wie es aber auch, wie schon einmal erwähnt, noch damals vorkommen konnte — wenn diese Inquisitoren vorläufig nicht noch unter sich gewesen wären, so in aller Gemütlichkeit, gewissermaßen hinter den Kulissen, und sich danach betrugen.
Sie hatten die Kapuzen noch nicht heruntergezogen. Wohl waren einige recht finstere, asketische Gesichter darunter, die zu allem fähig schienen, die gleich so als Richter hätten Platz nehmen können, aber im Allgemeinen herrschten doch die feisten, gemütlichen oder salbungsvollen Pfaffengesichter vor. Es war mehr spannende, neugierige Erwartung, was die ganze Gesellschaft beherrschte, und danach waren auch die Gespräche beschaffen, die laut oder leise geführt wurden. Allerdings war die Hauptsache der Graf, der noch im Starrkrampf lag und so hereingetragen werden sollte. Oder sollte man lieber warten, bis er in der Gefängniszelle wieder zu sich gekommen war?
Dann aber wurden auch Unterhaltungen geführt, die mit dieser ganzen Sache gar nichts zu tun hatten.
Ein feistes Pfäfflein klagte seine liebe Not, dass er sich von den zwölf Spickaalen, die er gestern zum Frühstück verzehrt, noch immer nicht erholt habe, nachdem er schon die ganze Nacht mit dem Tode gerungen; ein spindeldürrer Prälat — denn es waren fast nur Kardinale und Prälaten und andere höchste Würdenträger — dessen hageres Gesicht fast ausschließlich aus einer glühend roten Nase bestand, rühmte sich, dass er allein in den letzten Tagen ein ganzes Fass Falerner auf einen Sitz ausgetrunken habe noch jetzt nicht nüchtern sei, und auf der anderen Seite klatschten vier der höchsten Geistlichen Roms über die Stadtneuigkeiten, besonders über Skandalgeschichten, wie alte Weiber im Kaffeekränzchen.
Eine Tür ging auf, helles, sogar sonniges Tageslicht flutete herein, was dieser Szene den letzten Rest von grausigem Reiz nahm. Allerdings schloss sich die Tür gleich wieder, dann konnte man sich auch wieder bei nächtlicher Weile in ein Kellergewölbe versetzt denken, aber für den, der dies beobachtet, musste die Illusion doch vorbei sein. Es war einfach ein fensterloses Zimmer, mit Absicht wie ein Keller gewölbt, draußen war sonnige Mittagsstunde.
Ein neuer Geistlicher war eingetreten, in dessen Gegenwart sich die anderen doch etwas mehr zusammennahmen — Kardinal Luigo.
»Seine Heiligkeit hat ein für allemal abgelehnt, dem Verhör mit beizuwohnen.«
»Aber wir dürfen die Inquisition einleiten?«, wurde lebhaft gefragt.
»Selbstverständlich. Hätten wir sonst den Grafen gefangen hierher transportieren dürfen?«
»Er ist doch auch schon einmal verhaftet worden, wobei unbedingt einer von uns die Hand im Spiele gehabt haben muss«, ließ sich einer vernehmen.
Sofort trat große Unruhe ein, als habe jener mit dieser Äußerung eine große Unvorsichtigkeit begangen, und so war es auch.
»Sprechen wir gar nicht mehr über diesen Fall«, entgegnete der erste Kardinal, »der noch nicht aufgeklärt ist und hoffentlich auch nie aufgeklärt wird.«
Wer also damals der wirklichen Wache, die den Grafen verhaften sollte, zuvorgekommen, das war noch immer in absolutes Dunkel gehüllt.
Bemerkt sei, dass sich der Fürstbischof von Rom nicht mit in dieser Versammlung befand, weil er mit zu den Schülern des Grafen gehörte, wie ja noch manch anderer hoher und allerhöchster Geistliche. Sonst war noch niemand auf den Verdacht gekommen, dieser habe sich damals unter der Hand des Grafen bemächtigen wollen, gerade deswegen nicht, weil er doch gleich darauf ein Anhänger des geheimen Bundes geworden war. Da lag die Vermutung viel näher, dass hier einer dieser Kardinale und Prälaten der Urheber jener Maskerade gewesen war.
»Dass nur Seine Heiligkeit dieser interessanten Vorstellung nicht beiwohnen will!«
»Er will nicht — dixit!«
»Um uns mehr freien Willen zu lassen.«
»Wenn aber dieser Hexenmeister sich nun weigert?«
»Ja, was dann?«, fragte der Kardinal mit einiger Hinterlist zurück. Im Übrigen ging es hier noch immer ganz kordial zu.
»Können wir ihn zwingen?«
»Was heißt zwingen?«
»Foltern.«
»Oooooooo!«, erklang es auf diese freie Äußerung unisono im Chor, aber dabei wurden Bewegungen und Gesichter gemacht, welche verrieten, dass man hier zu allem entschlossen war.
»Ich dächte«, nahm Kardinal Luigo nieder das Wort, »da wäre angebrachter, ihn erst einmal einige Tage hungern zu lassen.«
»Sehr richtig, sehr richtig!«, erklang es wieder
»Eventuell einige Wochen.«
»Schon einige Tage werden genügen.«
»Und vorher sein Gewicht auf der Waage bestimmen.«
»Und den Wundermann dann als ein ausgemergeltes Gerippe dem Volke präsentieren — da seht, so bekommt ihm eine Hungerkur.«
»Natürlich, natürlich, das wirkt besser als jede aufgeschriebene Gewichtsabnahme.«
»Meine hochwürdigen Herren«, übertönte Kardinal Luigo das allgemeine Durcheinander, wenn dieses auch nie laut wurde. »Vor allen Dingen handelt es sich jetzt um ein Experiment, das wir mit dem Grafen vornehmen wollen, wozu aber keine Zeit verloren werden darf. Liegt er noch im Starrkrampf?«
»Gewiss, er will doch immer Punkt eins daraus erwachen.«
»Das ist es eben, worauf es ankommt. Welche Zeit haben wir jetzt?«
Die meisten zogen unter ihren Kutten Taschenuhren hervor, und was für kostbare oder seltsame zum Teil! Unsere Museen geben Zeugnis davon, was man früher mit Taschenuhren für Luxus getrieben hat, als noch keine Fabrikation eingeführt war, als noch jede Künstlerphantasie freien Spielraum hatte, und diese Geistlichen hier hatten immer das Beste, was die Welt bot.
»Genau fünf Minuten nach halb eins.«
»Stimmt«, sagte der erste Kardinal, unter seiner Kutte ebenfalls eine Uhr zum Vorschein bringend, und das war nun allerdings ein Monstrum, bei dessen Anblick alle eher an einen Witz dachten.
Es war nämlich eine suppentellergroße Uhr, auch dementsprechend dick, einfach eine Wanduhr, mit Federmechanik.
»Die Herren dachten wohl, das sei meine Taschenuhr?«, ging der Kardinal denn auch lächelnd gleich darauf ein, als er die verblüfften Gesichter sah. »Nein, die habe ich nur mitgebracht, um sie an die Wand zu hängen, sodass der Scheintote sie eventuell sehen kann. Nun drehe ich die Uhr aber fünf Minuten vor — so. Wenn es nun an dieser Wanduhr fünf Minuten vor eins ist, fangen wir schon an vernehmlich zu flüstern: In fünf Minuten muss er erwachen. Das geht die fünf Minuten so weiter. Bis der große Zeiger auf die zwölf zeigt. Jetzt, jetzt muss er erwachen. Erwacht er wirklich, so hat er sich einfach von uns beeinflussen lassen, dann kann es mit seinem magischen Scheintod auch nicht so weit her sein. Haben die hochwürdigen Herren meine Ausführungen verstanden?«
Und ob! Alle diese Geistlichen waren doch nicht auf den Kopf gefallen, die waren in ihrer Weise ebenso mit allen Hunden gehetzt wie der Depeschenreiter in der seinen.
Diese List fand allgemeinen Beifall, dann war aber auch keine Zeit zu verlieren. Die Uhr ward von einem bereits vermummten Diener, der auf einen Wink aus dem finsteren Hintergrund getreten war, an der Wand befestigt, sodass sie noch vom Kerzenlicht beschienen wurde, ein anderer Vermummter, Diener oder Mönch, ging, um den Grafen bringen zu lassen.
»Aber was nützt das denn?«, nahm noch einmal einer das Wort. »Wenn der Graf so im Starrkrampf liegt, ist sein Geist ja frei vom Körper, kann auch hier sein, hört also, was wir jetzt ausmachen, und da hat es doch gar keinen...«
Noch ehe der Sprecher vollenden konnte, fuhr Kardinal Luigo jäh gegen ihn herum.
»Wie? Sie glauben daran, Sie sind überzeugt, dass dieser Hokuspokus auf Wirklichkeit beruht?! Ja, Hochwürden, dann müssen Sie sich in den Bund der Namenlosen aufnehmen lassen, aber nicht hier zu Gericht sitzen wollen!«
Beschämt schwieg der voreilige Sprecher, ein zwar hoher, aber doch tief unter dem Kardinal stehender Geistlicher, murmelte bloß eine Entschuldigung, er habe nur so gemeint.
Und doch war gerade dieser Mann der ehrlichste Richter. Kardinal Luigo war, obgleich er in bester Absicht handeln wollte, der allerbefangenste, seine ganze Handlungsweise war unlogisch.
»Nun ist aber keine Zeit mehr zu verlieren, wollen die Herren Platz nehmen!«
Es geschah, sie ließen sich hinter dem roten Tische nieder, zwei rückten Papier und Schreibzeug zurecht, die Kapuzen verhüllten die Gesichter, und nun war die unheimliche Szene eines Inquisitionsgerichtes wirklich vervollkommnet.
»Sind die Richter bereit?«, fragte der Vorsitzende, Kardmal Luigo.
»Wir sind es«, erklang es dumpf hinter den Kapuzen.
Ein Klingelzeichen, eine andere Tür öffnete sich, durch welche aber kein Tageslicht hereinflutete, und aus der schwarzen Öffnung hervor wurde von zwei ebenfalls vermummten Männern eine Bahre getragen, auf welcher der Graf lag, gefesselt, die Glieder so starr wie die geöffneten Augen.
Die Bahre wurde in einiger Entfernung von dem Tische niedergesetzt, zwei andere Männer, die Kuttenärmel etwas über sehr muskulösen Armen aufgeschlagen, postierten sich daneben — Sicherheitswächter, Polizisten, jedenfalls verborgene Waffen zur Hand habend.
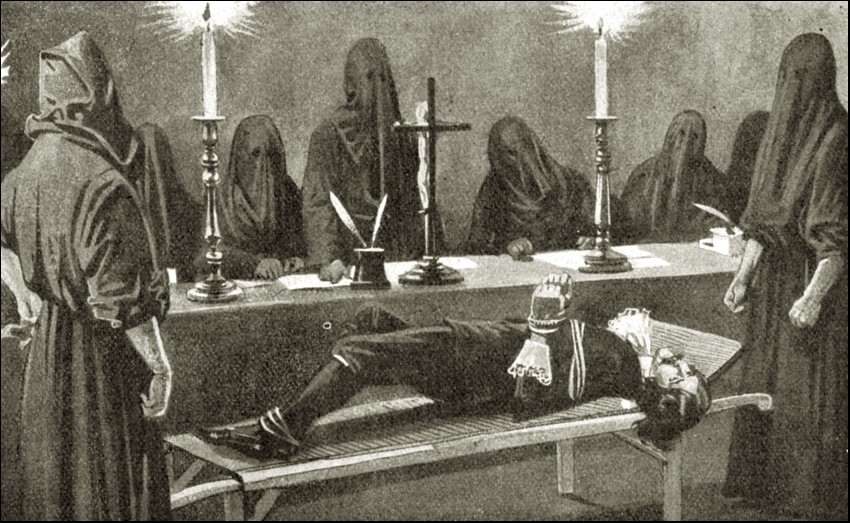
Der Körper des Grafen war bereits in der Gefangenenzelle untersucht worden. Vollkommener Starrkrampf ohne jedes Leben, ohne Herz- und Pulsschlag. Das geöffnete Auge reagierte auch nicht auf das blendendste Licht, völlige Unempfindlichkeit gegen jeden Schmerz. Davon hatte man sich bereits überzeugt. Doch man war mäßig vorgegangen, hatte nur etwas mit einer Nadel gestochen, nicht gebrannt, nicht geschnitten, auch keine Ader geöffnet.
Ehe man bei einem zweiten Starrkrampfe solche Experimente anstellte — vielleicht — wollte man den Verhafteten vernehmen. Das hatte der erste Kardinal streng angeordnet.
Nun lag hier zwar schon ein großes Rätsel vor, aber doch nicht ohne Beispiel. Die Erscheinung des Scheintodes war schon damals recht gut bekannt, man hatte damals vor dem Lebendigbegrabenwerden sogar noch viel mehr Angst als heute, man kannte auch den Starrkrampf, römische Bettler konnten ihn sogar künstlich erzeugen, um das Mitleid der Fremden zu erregen, und auch sie waren dann so empfindungslos gegen Schmerz und gegen alles.
Der Graf wollte mit diesem sich bei ihm regelmäßig einstellenden Starrkrampf nur etwas ganz anderes verbinden, bei ihm sollte das übernatürlich sein, magisch, sein Geist sollte dann nicht im Körper sein usw. Das war also Zauberei.
Jetzt handelte es sich zunächst darum, wie Kardinal Luigo vorgeschlagen, zu prüfen, ob der Graf in diesem Zustande die Zeit kontrollieren könne, wie er behauptete. Denn er wollte ja von ganz allein Punkt zwölf in Starrkrampf fallen, wo und in welcher Stellung er sich auch befände, Punkt eins wieder daraus erwachen. So hatte auch schon Lord Moore von ihm erzählt, er wollte gleich am ersten Tage Zeuge davon geworden sein. Das galt es jetzt zu prüfen — aber auch wieder in ganz parteilicher ungerechter Weise, denn man suchte dem Angeklagten ja eine Falle zu stellen.
Es geschah, wie ausgemacht worden. Die Kirchturmglocken waren hier nicht zu hören. Jetzt richtete man sich nach der falsch gestellten Wanduhr.
»Noch fünf Minuten, dann ist es eins, dann muss er erwachen«, wurde vernehmlich geflüstert. »Geht die Uhr genau? Ganz genau. Noch drei Minuten — noch eine — jetzt, jetzt muss er erwachen...«
Aber der Graf erwachte nicht. Es vergingen noch immer fünf Minuten, und erst als die richtig gestellten Taschenuhren genau um eins zeigten, streckte der Graf die Glieder, richtete sich ohne jeden Seufzer auf, bis er auf der Bahre saß, erhob sich vollends.
Der Beweis war erbracht, dass er in diesem Zustande die Zeit kontrollieren konnte. Aber es ging, wie es gewöhnlich geht. Nun, da der Beweis erbracht war, war es gar keiner für die Richtigkeit gewesen. Der Erstarrte wusste sich eben in anderer Weise die richtige Uhrzeit zu verschaffen. Und diesmal hatten die Richter ja nun darin recht, wenn sie es sich auch nicht weiter zu erklären vermochten.
Unter den Vermummten war doch einige Bewegung entstanden, während der vom Tode Erwachte ganz gelassen dastand. Nicht das geringste Zeichen von Staunen oder Schreck. Als wüsste er schon alles, wo er sich befand, als müsste das alles so sein.
»Wisst Ihr, wo Ihr Euch hier befindet?«, nahm der in der Mitte Sitzende endlich mit dumpfer Stimme das Wort.
»Vor der heiligen Inquisition des Kirchenstaates.«
»Ihr sagt es. Das müsst Ihr auch sofort erkennen. Und wisst Ihr, wozu diese Institution besteht?«
»Um religiöse Vergehen zu ahnden.«
»Um über Anklagen, die religiöse Vergehen betreffen, zu Gericht zu sitzen, wir können auch freisprechen«, wurde korrigiert.
»Was für einen religiösen Frevel soll ich begangen haben?«
»Ihr seid der verbotenen Zauberei angeklagt.«
»Ich habe nie verbotene Zauberei getrieben.«
»Das wird sich finden. Erst Eure Personalien. Wie heißt Ihr?«
»Graf von Saint-Germain.«
»Habt Ihr irgendwelche Papiere, um zu beweisen, dass Ihr diesen Namen mit Recht führt?«
»Nein, solche Papiere besitze ich nicht«, erklang es ohne Zögern.
»Also Ihr habt Euch diesen Namen selbst gegeben?«
»Nein, das habe ich nicht. Ich bin vor hundertundfünfzig Jahren...«
»Lassen wir das jetzt noch. Wann seid Ihr geboren?«
»Ich glaube, es ist hier doch schon alles bekannt. Wollte man alles zu Protokoll nehmen, was ich zu erzählen habe, dürfte man mich eher nicht verurteilen, so werden das meine Herren Richter nicht mehr erleben, während ich noch einige Jahrhunderte vor mir habe. Also, soll ich es erzählen?«
Mit leisem Spotte hatte es der Graf gesagt.
Es machte auf die Vermummten gar keinen Eindruck, die mussten über so etwas erhaben sein.
»Ihr wollt schon vor 5000 Jahren gelebt haben?«
»Ja, im chaldäischen Babylon.«
»Erzählt Näheres hierüber, auch Eure anderen Lebensläufe, so kurz wie möglich!«
Der Graf tat es. Hauptsächlich aber musste er Fragen beantworten. Der Gänsekiel des Protokollschreibers fuhr knirschend über das Papier.
Wir wollen die Fragen und Antworten nicht wiedergeben. Der Vorsitzende war ein geschichtlich durchaus gebildeter Mann und verstand äußerst geschickt zu fragen. Er versuchte dem Angeklagten Fallen zu stellen. Ob ihm dies gelang oder nicht, das heißt, ob der Graf sich wirklich fangen ließ, das wurde jetzt nicht erörtert, das ergab ja dann später das Protokoll. Wir können aber gleich erwähnen, dass es dem Kardinal Luigo nicht gelang, dem Grafen irgendeine historische Unmöglichkeit nachzuweisen, wenigstens nicht für die Zeiten, in denen er persönlich gelebt haben wollte. Da war er in allen historischen Ereignissen sattelfest, und ob Xerxes wirklich etwas gehinkt habe, das war ihm doch nicht zu beweisen.
Aber auf solche Kleinigkeiten ließ sich der examinierende Kardinal gar nicht ein. Doch der Graf war in Hauptsachen erst recht nicht zu fangen. Auch auf alte, ausgestorbene Sprachen hatte man sich schnell etwas präpariert, oder vorher schon gründliche Studien getrieben, diese Verhaftung des Grafen war doch von langer Hand vorbereitet, es hatte nur noch der Einwilligung des Papstes bedurft — vergebens, dieser Mann schien allwissend zu sein. Man konnte nur bestätigen, was damals nach der ersten Gesellschaft die größten Gelehrten über ihn ausgesagt hatten.
Dann ward er besonders auch über die Zeit Jesu befragt, mit dem er ja persönlich verkehrt haben wollte. Dies spielte schon in den zweiten Teil des Examens hinüber. Hier versuchte man ihm erst recht Fallen zu stellen, um ihn dann der Gotteslästerung anklagen zu können.
Allein vergebens, der Graf war schon zu Christi Zeiten nicht nur ein guter Christ gewesen, sondern sogar schon ein strenggläubiger Katholik, und das ist gar nicht scherzhaft aufzufassen, indem er damals als einer der ersten den Apostel Petrus auf seinen Missionsreisen begleitet hatte.
»Ihr wart der Jüngling, weicher floh, als Christus gefangen wurde?«
»Ich war es.«
Was war dagegen zu tun? Sollte man ihm doch einmal das Gegenteil beweisen!
Jetzt war der erste Teil des Examens wirklich beendet, der zweite kam daran.
»Ihr besitzt magische Fähigkeiten?«
»Was versteht Ihr unter magisch?«
»Ihr könnt zaubern?«
»Was versteht Ihr unter Zauberei?«
So kam man nicht weiter, es musste direkter gefragt werden, und zwar immer in der Absicht, ihn... hineinzulegen, das ist der richtigste Ausdruck.
»Könnt Ihr Wasser in Wein verwandeln?«
»Ich kann es.«
Halt, jetzt hatte man ihn! Das war eine sehr geschickte Frage zur Einleitung gewesen, jetzt musste man nur die bejahende Antwort ausnutzen.
»Also, Ihr rühmt Euch, dasselbe zu können, was Jesus Christus gekonnt hat.«
»Ich rühme mich nichts, ich gebe allein Gott den Ruhm«, wich der Graf vorsichtig aus, jedes Wort auf die Goldwaage legend.
»Ihr könnt dieselben Wunder verrichten, die Jesus Christus verrichtet hat?«
»Das waren keine Wunder, sondern... doch ich will gar nicht mehr ausweichen. Ja, ich kann es.«
Es war ausgesprochen! Jetzt doch eine große Bewegung unter den vermummten Richtern.
»Mensch, Frevler!«
»Weshalb soll ich ein Frevler sein?«, klang es gleichmütig zurück.
»Du wagst, dich mit unserem Herrn und Heiland zu vergleichen?!«
»Das tue ich durchaus nicht. Aber hat Christus nicht selbst gesagt: Es werden nach mir welche kommen, die Größeres tun denn ich? Und hat er nicht gesprochen: Wenn ihr nur Glauben habt so viel wie ein Senfkorn, so werdet ihr Berge versetzen können? Wohlan, ich habe so viel Glauben — ich glaube, dass Christus Gottes Sohn war und für unsere Sünden unschuldig am Kreuze gestorben ist — mein Glaube hieran ist felsenfest, weit größer als ein Senfkorn, so groß wie die ganze Welt — deshalb kann auch ich Berge versetzen.«
Wenn es gerecht zugegangen wäre, so hätten sich die Richter geschlagen geben müssen — mit ihren eigenen Waffen geschlagen.
An solch eine Auffassung war hier natürlich nicht zu denken. Man griff nur das heraus, was im allgemeinen Sinne gegen den Angeklagten sprach.
Wieder eine Bewegung.
»Ungeheuerlicher Frevel!!«
»Was habe ich gefrevelt?«
»Weißt du denn gar nicht, was du soeben gesprochen hast?!«
»Ich hoffe, dass meine Worte ganz genau protokolliert werden.«
»Du kannst dich unsichtbar machen?«, vollführte der Vorsitzende jetzt gleich einen sehr kühnen Sprung, dadurch aber seinem Ziele bedeutend näher kommend.
»Ich kann es.«
»Mache dich unsichtbar!«
»Ich darf es nicht.«
»Aah. Weshalb denn nicht?«
»Ich darf alles nur ein einziges Mal machen.«
»Diese Ausrede kennen wir, wollen den Grund dazu gar nicht noch einmal hören. Hier aber habt Ihr Euch doch einmal widersprochen, Euch selbst gefangen.«
»Inwiefern?«
»Wir wissen, was in dem sogenannten Bunde der Namenlosen vor sich geht. Ihr habt Euch da unter anderem auch verschiedene Male unsichtbar gemacht.«
»Ja, dreimal.«
»Weshalb habt Ihr es denn da mehrmals gemacht?«
»Das ist eine Ausnahme, das geschieht zur Aufmunterung meiner Schüler.«
»Zu welcher Aufmunterung?«
»Dass sie ein reines Leben führen, die zehn Gebote befolgen, wodurch sie dann auch solche magische Fähigkeiten erlangen. Ich lehre ihnen, dass sie...«
»Halt! Von Euren heiligen Lehren wollen wir nichts wissen, die sind gotteslästerlich...«
»Wieso denn?«
»Unterbrecht mich nicht! Das wird Euch später bewiesen werden!«, erklang es noch strenger als sonst. »Aber eine andere Frage: Habt Ihr denn schon einmal in der Öffentlichkeit gezeigt, dass Ihr Euch unsichtbar machen könnt?«
»Nein.«
»Wohlan, so hindert Euch ja nichts daran — macht Euch hier einmal unsichtbar.«
»Ich tue es nicht.«
»Weshalb nicht?«
»Wäre die Sache nicht gar so ernst, möchte man fast lachen...«
»Mann, hütet Euch! Ihr steht vor der heiligen Inquisition!«
»Es ist so. Aber ich lache ja nicht. Ich bemitleide Euch nur...«
»Mann, hütet Eure Zunge!«, erklang es noch einmal in furchtbarem Tone.
»Ich tue es nicht.«
»Weshalb nicht, frage ich wieder, und nun kurze Antwort!«
»Weil ich die Macht, die mir gegeben, nicht missbrauchen will, nicht darf, nicht kann. Ihr wollt ein Wunder von mir sehen. Das hat man auch von Christus verlangt. Hat Christus da je nachgegeben und...«
»Ihr vergleicht Euch also mit Gottes Sohn.«
»Das tue ich nicht, ich ziehe ihn nur als Beispiel heran...«
»O, furchtbare Lästerung über Lästerung!«, erklang es im Chor.
»Macht Euch unsichtbar, hier auf der Stelle!!«, nahm der Vorsitzende wieder das Wort.
»Ich tue es nicht, führe hier kein einziges Experiment oder sogenanntes Wunder vor, und ich will Euch auch noch in anderer Weise erklären, warum ich es nicht kann. Ihr wollt mich vernichten. Und zu meiner Selbsterhaltung, zu meinem eigenen Vorteil darf ich kein sogenanntes Wunder verrichten. Das ist der Grund.«
Es hatte alles Hand und Fuß, was der Graf sagte. Nur für diese Richter nicht, sie hatten nur eins gehört.
»Also Ihr weigert Euch, uns hier irgendeine Probe von Euren magischen Fähigkeiten zu geben?«
»Ja! Ich rufe als Zeugen, dass ich es wirklich kann, alle die Herren und Damen an...«
»Halt! Keine Namen! Wir wollen sie nicht hören. Hier auf der Stelle sollt Ihr solche Wunder, nur ein einziges, ausführen.«
Ja, wenn der Graf das nur gekonnt hätte! Aber die ganze Gesellschaft hier konnte er nicht so ohne Weiteres hypnotisieren, wozu er auch ihnen erst einen Schlaftrunk beibringen musste, wenn sie nicht von allein einschliefen.
So konnte er nur wiederholen:
»Ich tue es nicht.«
Dann aber setzte er noch hinzu:
»Kommt in meine Wohnung, da will ich Euch alle die magischen Fähigkeiten vorführen.«
»Weshalb dort, weshalb nicht hier?«
»Weil Ihr dann meine Gäste, meine Schüler seid. Ihr müsst gläubig zu mir kommen — zwingen lasse ich mich nicht.«
»Oho! Wir werden Euch zwingen, uns eine Probe von Euren übernatürlichen Fähigkeiten zu geben.«
»Man kann mich nicht zwingen.«
»Doch, nämlich dass Ihr den Beweis liefert, wie Ihr gar keine übernatürlichen Fähigkeiten besitzt.«
»Wie wollt Ihr diesen indirekten Beweis anstellen?«
»Ihr braucht doch keine Nahrung zu Euch zu nehmen, weder Speise noch Trank.«
Jetzt sah sich der Graf wirklich gefangen. Aber er musste antworten, hatte dennoch auch gleich einen Ausweg gefunden.
»Nein.«
»Niemals?«
»Niemals.«
»Wohlan, das sollt Ihr uns vormachen. Wir werden Euch einige Wochen einsperren, und zwar anders als damals Lord Moore. Ihr sollt uns beweisen, dass Ihr keiner Nahrung bedürft.«
»Ich werde dabei zum Gerippe abmagern und schließlich sterben, des Hungers und Verschmachtungstodes.«
Alle horchten hoch auf! Wie? Jetzt gab dieser Mann plötzlich ohne Weiteres zu, dass er auch nur ein sterblicher Mensch war?
O nein, der Fuchs hatte eben nur schon wieder einen Ausweg gefunden, und dabei behielt er auch immer seine überlegene Ruhe.
»Ihr werdet verhungern?!«
»Gewiss.«
»Ja, wie reimt sich denn das mit Euren früheren Behauptungen zusammen?«
»Sehr einfach. Ich tue nichts gezwungen. Lasse ich mich nur ein einziges Mal zwingen, dass ich meine äußere und noch mehr meine innere Freiheit verliere, so verliere ich auch sofort all meine magischen Fähigkeiten. Als ich damals Lord Moore den Vorschlag machte, geschah es von mir freiwillig...«
»So tut es doch auch hier freiwillig.«
»Wohl, dann bin ich bereit.«
Wieder eine große Unruhe. Man witterte, dass der Fuchs sich irgendwie einen Ausweg bahnte, wusste nur gar nicht wie und wo.
»Haltet mich sieben Tage in Gewahrsam...«
»Vierzehn Tage.«
»Vierzehn Tage, gut. Also wohl im sichersten Gewahrsam, aber nicht eigentlich als Gefangener. Das heißt, nicht dem Sinne nach. Habe ich die vierzehn Tage überstanden, und ich habe von meinem Körpergewicht auch nicht ein Quäntchen verloren, so habt Ihr mich als freien Mann zu entlassen und mir öffentlich Genugtuung zu geben.«
Wiederum die größte Unruhe unter den Vermummten, wie sie sich so stark noch gar nicht gezeigt hatte.
»Vierzehn Tage ohne Speise und Wasser, ohne dass Ihr ein Lot an Gewicht verloren habt?«
»Soll ich das immer noch einmal wiederholen?«
»Aber bei uns bekommt Ihr nichts zugesteckt!«
»Ja, haltet Ihr mich denn für einen Betrüger? Oder kann denn ein Betrüger solche Vorschläge machen?«
Der Vorsitzende sah ein, dass er sich selbst widersprach.
»Und was waren Eure sonstigen Bedingungen?«
»Dass ich dann ein freier Mann bin.«
»Das ist nicht angängig.«
»Was nicht?«
»Der Bannfluch ist über Euch bereits verhängt, Euer Bild*) schon verbrannt worden.«
»So wird der Bannfluch eben zurückgenommen. Das ist auch die einzige Genugtuung, die ich verlange.«
»Unmöglich. Ihr müsst den Kirchenstaat verlassen, damit Ihr nicht noch mehr Personen verführt. Genug, kein Wort mehr hierüber!«
Dann war dem Fuchse auch der letzte Ausweg verlegt. Er hätte noch gefordert, erst noch einmal in sein Kloster zurückzukehren, um sich für diese Hungerkur vorzubereiten, wenn auch in magischer Weise, denn etwas Übernatürliches war das ja, wäre es auch heute noch, wenn jemand nur drei Tage hungern will, ohne etwas an Gewicht zu verlieren. Er hätte gesagt, er müsse beten, Buße tun und dergleichen — in Wirklichkeit hätte er noch einmal
*) Eine kleine Wachsfigur. sein Haus oder vielmehr seinen Keller bestellen wollen, denn Marietta und das Kind durften so lange nicht ohne Nachricht von ihm bleiben.
Um diese kurze Frist brauchte er nun nicht erst zu bitten, es war alles vergeblich gewesen, jetzt war der Fuchs todsicher gefangen.
Anzumerken von dieser Niederlage war ihm freilich nichts, immer noch stand der Graf wie ein Sieger da.
»Ihr behaltet mich in Haft?«
»Ja.«
»Wozu das, wenn ich nun einmal schon durch Verbannung bestraft bin?«
»Ihr sollt beweisen, dass Ihr ohne Nahrung leben könnt.«
»Wenn ich gezwungen werde, so werde ich absichtlich verhungern.«
»Und genügt dieser Beweis etwa nicht, wenn man Eure abgezehrte Leiche dem Volke ausstellt, dass Ihr doch auch nur ein sterblicher Mensch wart, dessen Gaukelspiel andere zum Opfer gefallen sind?«
Der Sprecher hatte recht, furchtbar recht. So oder so, der Graf musste in der Gefangenschaft sterben.
Dass er wirklich lange Wochen hungern konnte, ohne etwas am Körpergewicht zu verlieren, werden wir noch sehen, und es wird auch erklärt werden, wie er das zustande brachte. Der scharfsinnige Leser wird die Erklärung hierfür auch schon selbst gefunden haben, es ist schon einmal eine starke Andeutung gemacht worden.
»Und nun kurz! Entweder Ihr macht uns alle die Wunder hier vor, die wir von Euch fordern werden, oder Ihr wandert in die Kerkerzelle zurück und müsst uns beweisen, ob Ihr ohne Nahrung und Wasser leben könnt oder nicht. Nun wählt. Wollt Ihr uns hier Eure Experimente vormachen, Euch in die Luft erheben und Euch unsichtbar machen, dass wir an Eure magischen Fähigkeiten glauben können?«
»Und wenn Tote wiederkämen, Ihr würdet nicht daran glauben, dass sie wirklich aus dem Grabe auferstanden sind«, entgegnete der Graf, sich an einen Ausspruch Christi lehnend, und dementsprechend war auch die Wirkung.
»O, Frevel und Gotteslästerung, er vergleicht sich mit unserem Herrn und Heiland!«, erklang es wiederum. »Fort mit ihm in den Kerker!«
Und gleich war der Gefesselte denn auch von den vermummten Henkersknechten gepackt, ein besonderer Wink hatte ihnen hierzu das Zeichen gegeben, dass sie jetzt zugreifen sollten.
Es sollte wahrscheinlich ein brutales Hinausschleppen werden, so hatten die herkulischen Arme der Vermummten zugegriffen, das wurde es aber nicht. Mit stolz erhobenem Haupte zwischen ihnen schreitend, verließ der Graf den Raum, kettenklirrend zwar, aber als Sieger.
Ja, er war in dem Verhör Sieger geblieben. Inwiefern, das konnte schwer geschildert werden. Er war in seiner stolzen Haltung und gelassenen Sprechweise den vermummten Richtern gegenüber, die sich oft hatten hinreißen lassen, immer der Überlegenere gewesen.
Aber es war ein sogenannter Pyrrhussieg gewesen. Er hatte sich dabei selbst vernichtet. Das erkannte er vor allen Dingen mit furchtbarer Deutlichkeit, als er nach Durchschreiten eines kurzen Ganges in eine Zelle gestoßen wurde und hinter ihm die schwere Tür wieder ins Schloss fiel.
Wenn der Graf vielleicht geglaubt hatte, sich durch Flucht einer längeren Gefangenschaft entziehen zu können, und wenn diesen Mann vielleicht auch keine Ketten und keine Eisengitter zu halten vermochten — von hier gab es kein Entweichen, das erkannte er auf den ersten Blick.
Es war gegen sechs Uhr. Kardinal Luigo erteilte als erster Minister im Vatikan Audienz, oder richtiger als Kardinalstaatssekretär, dem alle übrigen Minister, welche nur Prälaten sind, unterstehen.
Jeder hatte jetzt Zutritt zu ihm, um ihm eine Bitte vorzutragen, der einfachste Mann des Volkes. So stand es wenigstens im Gesetz. Nur schade, dass man sich dazu erst anmelden lassen, die ganze Sache erst schriftlich einreichen musste, und wenn dem Allmächtigen oder nur seinem Sekretär die Geschichte nicht behagte, so wurde der Bittsteller eben schon vorher abgewiesen. So ist es ja überall, wo solche scheinbar so patriarchalische Verhältnisse existieren. Es muss ja auch schließlich so sein. Was sollte denn sonst daraus werden, wenn sich jeder zum Staatsoberhaupt oder dessen Stellvertreter drängen könnte? Da hat nicht einmal Ohm Krüger eine Ausnahme gemacht.
Gegenwärtig befand sich niemand im Vorzimmer, der vorgelassen werden sollte. Der Kardinal, der zwei Stunden hier zu verweilen hatte, wovon erst eine verstrichen war, hatte den Polizeipräfekten von Rom zu sich befohlen, einen Prälaten, um gleich noch andere Verhandlungen mit ihm zu pflegen.
»Wie ist die Volksstimmung wegen der Verhaftung des Grafen?«
»Sehr ruhig. Alles ist überzeugt, dass es dem Wundergrafen ein leichtes sein wird, das Inquisitionsgericht auf seine Seite zu bringen.«
»So, so. Haben die Jesuiten das Spukkloster noch nicht bezogen?«
»Zunächst werden noch die Möbel des Grafen ausgeräumt.«
»Wohin?«
»Einfach auf die Straße gesetzt. Bei Anbruch der Nacht werden sie von den Gesellen des Henkers abgeholt und dann auf dem Forum Cane verbrannt. Dann muss das von dem mit dem Bannfluch Beladenen geschändete Haus doch auch erst wieder geweiht werden, ehe die Jesuiten es beziehen können.«
»Und was sagt das Volk zu diesem Ausräumen der Möbel?«
»Man ist felsenfest davon überzeugt, dass es nicht zu einem Verbrennen kommt.«
»Sondern?«
»Dass die Sachen des Grafen noch heute Nacht mit allen Ehren wieder eingeräumt werden«, vollendete der Präfekt nach einen. kleinen Zögern.
Der Kardinal musste auch wirklich etwas ihm höchst Unangenehmes zu hören bekommen haben, er presste lange die Lippen zusammen, ehe er wieder ein ›so so‹ murmelte. »Ach, dieser vermaledeite Graf«, setzte er dann noch hinzu, »dass der sich als Operationsfeld seiner Gaukeleien gerade den Kirchenstaat, auch noch Rom, aussuchen musste!«
»Alles Berechnung!«
»Selbstverständlich! Haben Sie gehört, wie sich Lord Moore zu der Verhaftung des Grafen verhält?«
»Er soll außer sich gewesen sein, hat sich gleich zum Papst begeben...«
»Weiß ich, ist abgewiesen worden.«
»Das ist doch eigentlich.... als Vertreter Englands...«
»Hier liegt etwas ganz anderes vor. Lord Moore ist bereits so gut wie entlassen, spielt nur noch die Rolle einer Puppe. Übrigens handeln wir ja ganz im Einverständnis mit England...«
Durch die Portiere trat ein päpstlicher Hauptmann ein, und zwar der, der sich hier Capitano Cherusco nannte, früher Baron Hermann hieß, Axels Freund. Er hatte heute hier im Vorzimmer des Kardinals Dienst.
»Der englische Gesandte, Seine Herrlichkeit Lord Moore, bittet um Audienz«, meldete er.
»Hat er denn im Sekretariat sein schriftliches Gesuch um eine Audienz eingereicht?«
Der Hauptmann machte ein ganz verdutztes Gesicht. Die hohen Würdenträger brauchten solch ein Gesuch doch nicht erst einzureichen, am wenigsten der Vertreter einer ausländischen Macht.
»Der englische Gesandte? Lord Walter Moore? Nein.«
»Ich bedaure. Er soll ein schriftliches Gesuch einreichen, mit der ausführlichen Erklärung, was er will. Ab.«
Ganz bestürzt entfernte sich der Hauptmann.
»Dieser Lord Moore«, fuhr der Kardinal zum Präfekten fort, »ist ebenfalls ein Opfer dieses Grafen und...«
Da kam der Hauptmann schon wieder, sich noch immer nicht von seinem Schreck erholt habend, den Vertreter Englands so kurzerhand abgewiesen zu sehen.
»Der Depeschenreiter Axel bittet Eure Eminenz um eine Audienz«, meldete er etwas kleinlaut.
»Der Depeschenreiter Axel!«, fuhr der Kardinal jäh empor.
»Er hat sich aber auch nicht schriftlich vorher angemeldet.«
Es war nur eine freudige Überraschung gewesen, die den Allmächtigen, jedenfalls ein Mächtigerer noch als der Papst selbst, so hatte empor fahren lassen, das drückte jetzt sein Gesicht aus.
»Der Depeschenreiter Axel — o, das ist doch etwas ganz anderes! Vortrefflich! Ich hatte an den Burschen gerade gedacht, ich brauche einen zuverlässigen Depeschenreiter, habe eine wichtige Botschaft...«
Diese Worte waren an den Präfekten gerichtet gewesen, jetzt wandte er sich schnell an den Hauptmann, der nicht recht wusste, ob er das Zimmer verlassen sollte oder nicht, er hatte einen richtigen Bescheid ja auch noch nicht bekommen.
»Herein, herein mit ihm!!«
Der Hauptmann verschwand. Gleich darauf ein Tritt, dessen Sporenklirren man trotz der Teppiche bis hier herein vernahm. Dann fand der Kommende auch noch einigen Widerstand, und zwar von seinem Freunde, der nicht daran dachte, dass man ihn hier noch hören konnte.
»Aber, Mensch, wie siehst du denn aus — du hast dich wohl im Staube gewälzt...«
»Ach was, ich kann nicht erst Toilette machen...«
»Dann wenigstens erst die Sporen ab — und unbedingt die Waffen, die Waffen — Mensch, wo denkst du denn hin...«
»Meine Pistolen soll ich ablegen? Und gar meinen Hirschfänger? Mensch, du bist ja verrückt. Platz da...«
Der sporenklirrende Tritt kam näher.
»Es sind rohe, unflätige Burschen, diese Depeschenreiter«, wandte sich Luigo an den Präfekten, aber lächelnd. »Doch was soll man mit ihnen tun? Sie sind eben unentbehrlich, und nun gerade dieser Axel...«
Da trat er schon ein, so aussehend, wie sein Freund ihn geschildert hatte.
»Was für eine verdammte Geschichte ist denn das nun wieder!«, fing er gleich zu schnauzen an.
Da freilich erstarb dem Kardinal gleich das Lächeln, und der Polizeipräfekt machte Augen, als sähe er ein Gespenst. Das war ja toller als toll.
»Mann, sind Sie betrunken!«, schrie der Kardinal erschrocken auf.
»Ich betrunken? Ich habe ja nichts weiter als drei Eimer Regenwasser gesoffen — na ja, es kam freilich von einem Dache, das mit Himbeersaft eingeschmiert war. Doch Spaß beiseite. Der Graf von Saint-Germain ist also in Inquisition gekommen? Steckt gar schon in einer Folterkammer? Well, wenn er nicht sofort herauskommt, bombardiere ich Fiumicino zusammen.«
So sprach oder brüllte vielmehr unser Axel. Sehr geschickt hatte er sich seiner diplomatischen Sendung nun nicht gerade entledigt, er war sozusagen mit der Tür ins Haus gefallen, und zwar gleich mit einem donnernden Krach. Aber wer wusste, vielleicht hatte er doch dabei den richtigen Ton getroffen.
Die erste Wirkung dieser Worte war freilich, dass der Kardinal nach der Klingelschnur stürzte und daran riss, während sich der Polizeipräfekt im geistlichen Talar lieber schon nach einem Versteck umschaute.
»Ein Wahnsinniger, ein Wahnsinniger!«, zeterte der Kardinal, und die Wache stürmte herein, an der Spitze Hermann der Cherusker.
»Ein Irrsinniger. er ist irrsinnig geworden, nehmt ihn fest!«
Aber der Hauptmann besann sich erst, und nicht nur deshalb, weil es sein ehemaliger Studienfreund war, mit dem er Blut getrunken hatte, sondern hauptsächlich, weil Axel blitzschnell sein Schlachtmesser gezogen hatte und mit der anderen Hand den Soldaten eine seiner Riesenpistolen entgegenhielt.
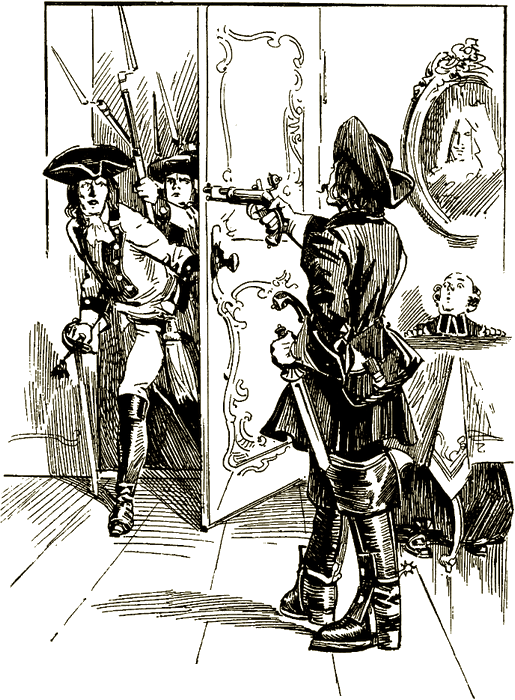
»Mich festnehmen? Das gibt es nicht! Und, Kardinal Luigo, ich bin nicht irrsinnig, bin bei vollem Verstande, ich spreche die Wahrheit: in Fiumicino liegt ein riesiges Kriegsschiff mit 400 Kanonen, und was für Dinger, und es befindet sich in Händen von Piraten, und dieses Schiff heißt ›Namenlos‹ — Ihr versteht wohl, Namenlos — der Bund der Namenlosen — und wenn der Graf von Saint-Germain nicht augenblicklich entlassen wird, kartätschen die Piraten Fiumicino zusammen. Die paar lumpigen Kanonenboote des Pfaffenstaates sind bereits in ihrer Gewalt. Der Graf soll sofort hinkommen. Bin ich in zwei Stunden mit dem Grafen nicht in Fiumicino, ist es ein Trümmerhaufen, ihr sollt die Flammen bis hierher sehen. Na, wird's bald? Den Grafen heraus!«
Seltsam! Dieser Mann hatte doch den Weg gewählt, der am schnellsten zum Ziele führte. Wie lange hätte ein anderer zu dieser Verhandlung gebraucht, bis man ihm geglaubt hätte.
Diesem brüsken Manne hier wurde sofort geglaubt. Da gab es gar keinen Zweifel mehr. Allerdings war ja Axel nicht ganz bei der Wahrheit geblieben, hatte gleich von 400 Kanonen gesprochen, die Flotte des Kirchenstaates, aus sieben kleinen Fahrzeugen bestehend, war schon genommen, er hatte den schwarzen Kapitän zu einem Piraten gemacht, was dieser doch durchaus von sich abgewehrt hatte — aber das machte ja alles nichts, die Hauptsache war, dass der Depeschenreiter schnellstens zum Ziele gelangte, wie man es eben von einem Depeschenreiter verlangte.
Das sonst immer etwas gerötete Gesicht des Kardinals war plötzlich weiß wie der Tod geworden. Und dann war dieser Mann doch nicht umsonst der erste Kardinal, der brauchte nicht lange Überlegung, um alles zu begreifen, und eben deshalb zweifelte er gar nicht an der Wahrheit dieser furchtbaren Drohungen.
»Ein Piratenschiff in Fiumicino?!«, stieß er hervor.
»Mit 400 Kanonen.«
»Woher kommt es?«, fragte der Kardinal jetzt schon kaltblütiger.
»Weiß ich nicht.«
»Wer ist der Kapitän?«
»Will seinen Namen nicht nennen.«
»Ihr wart an Bord?«
»Jawohl, ich habe diesen Auftrag an Bord erhalten.«
»In Fiumicino?«
»Gleichgültig wo«, wich Axel jetzt lieber aus.« »Der Pirat liegt in Fiumicino und droht mit Bombardement, wenn der Graf nicht freigelassen wird. Seid sicher, in zwei Stunden, um acht, wird Euch eine Stafettenpost von alledem benachrichtigen. Aber zu dieser Zeit, Punkt acht, beginnt der Pirat auch schon das Bombardement, wenn ich bis dahin nicht mit dem Grafen dort eingetroffen bin.«
Was sollte der Kardinal tun? Er glaubte unbedingt. Ja, wenn er aber nun doch nur durch eine Drohung eingeschüchtert werden sollte?
»Ich bringe den Grafen selbst hin.«
Seltsamerweise ging der Depeschenreiter sofort darauf ein. Er war eben doch nicht so ein ungeschliffener Diplomatiker, wie er sich erst gestellt hatte. Er erkannte das Misstrauen oder die Vorsicht des Kardinals sogar gleich an, kam ihm auch deswegen noch entgegen.
»Als Gefangenen?«
»Ja, ich möchte gern...« meinte der Kardinal zögernd.
»Well, damit bin ich einverstanden. In Ketten, nicht wahr?«
»Wenigstens unter Bewachung...«
»Auch das, und meinetwegen auch in den schwersten Ketten. In einem Wagen?«
»Und mit Begleitmannschaft.«
»Ihr denkt, der Graf könnte auf dem Wege nach Fiumicino befreit werden?«
»Es wäre doch...«
»Well, denkt das. Ich gehe von meinen ursprünglichen Forderungen zurück, obgleich das nicht dem Verlangen des Piratenkapitäns entspricht. Eigentlich sollte der Graf sofort freigelassen werden und mit mir gehen. Aber das will ich verantworten und mit dem Kapitän schon fertig werden. Jetzt aber will ich vor allen Dingen zu dem Grafen...«
»Er wird sofort vorgeführt werden...«
»Nein, ich selbst will ihn in seiner Zelle aufsuchen, — sofort! — will zuerst mit ihm sprechen, werde auch immer bei ihm bleiben. Denn euch Pfaffen sind doch alle Teufelslisten zuzutrauen, ihr könntet den verhassten Menschen noch vorher kaltmachen, habt dann eine Entschuldigung, sprecht etwa von einem Selbstmord...«
»Herr, wofür haltet Ihr uns...«
»Genug! Führt mich sofort zu dem Grafen! Den Bannfluch könnt Ihr aufrecht halten.«
»Der Bannfluch braucht nicht zurückgezogen zu werden?«, fragte der Kardinal überrascht. »Das ginge auch nicht so leicht, und wenn darüber selbst Fiumicino in Feuer aufgehen sollte...«
»Hört Ihr nicht? Die Bannbulle könnt Ihr zugestöpselt halten, da macht sich doch so ein Kerl wie dieser Graf nichts daraus.«
Der Depeschenreiter, der ja hier ganz nach eigenem Ermessen auftrat, hatte nur seine Verachtung gegen diese kirchlichen Maßregeln zeigen wollen.
»Nun aber vorwärts! Führt mich hin zum Grafen! Der Piratenkapitän zögert nicht, jede Minute bringt Fiumicino dem Verderben näher.«
Der Kardinal selbst machte den Führer, und man merkte, wie seine Knie zitterten.
Etwas Derartiges war im heiligen Rom ja kaum zu den Hunnenzeiten passiert!
Der Graf hatte sich also verloren gegeben, sobald er die Zelle betreten hatte und die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen war.
Es war ein schmaler Raum, der nur eine Pritsche mit einer Matratze enthielt, ohne Fenster. Trotzdem war er hell erleuchtet, nur in eigentümlicher Weise. Die Decke zeigte viele Löcher, kaum so groß, dass man einen Finger durchstecken konnte, und durch einige dieser Löcher drangen Lichtstrahlen, sich nach unten verbreiternd, und zwar in solcher Anzahl, dass auch der äußerste Winkel noch vollkommen erhellt wurde.
Da nun aber nicht alle Löcher solche Lichtstrahlen aussandten, war doch ganz sicher anzunehmen, dass die anderen als Gucklöcher dienten, um den Gefangenen immer beobachten zu können, und zwar noch in ganz anderer Weise, als es sonst in Gefängniszellen gehandhabt wird, wo sich der Arrestant nur dicht unter der Tür zu ducken braucht, wenn er einmal nicht be obachtet sein will.
Als der Graf beim zweiten Schritt zufällig gegen die Pritsche stieß, fand sein Fuß gleich einen Widerstand. Also die Pritsche war nicht nur so ein Gestell, sondern völlig massiv, oder doch nach außen verkleidet. Ob Holz oder Metall, konnte der Graf nicht beurteilen. Jedenfalls, zuckte es ihm im Augenblick nur durch den Kopf, war hier auch daran gedacht worden, dass sich der Delinquent einmal unter der Pritsche verkriechen könnte, um eine Handlung vorzunehmen, die nicht beobachtet werden sollte.
Denn der Graf hatte eben solche heimliche Manipulationen nötig, darum dachte er gleich an alles derartige.
Ferner empfand er es sehr unangenehm, dass die Wände nicht von Stein, sondern von Metall waren, von Eisen oder Bronze, das konnte er nicht genau unterscheiden, und dasselbe galt sogar vom Fußboden, woraus man schließen konnte, dass auch die Pritsche oder der Block, auf dem die neu aussehende Matratze lag, aus Metall bestand.
»Das sieht aus, als ob diese Wände und der Fußboden schon öfters stark erhitzt worden wären. Kein Zweifel, ich bin in der verrufenen Röstkammer des Quirinals. Dann fahrt wohl, alle Hoffnungen!«
Ja, dann brauchte er auch gar nicht erst die Tür oder das Schloss zu untersuchen, von dem übrigens gar nichts zu sehen war. Abgesehen davon, dass man ihn ja bei solchen Untersuchungen beobachtet hätte, was doch nicht zu seinen Gunsten gesprochen hätte.
Der Graf gab sich verloren. Er hatte in der Tasche des Ledergürtels, den er auf bloßem Leibe trug, eine große Anzahl Arsenikpillen.
Es dürfte wohl bekannt sein, dass das Arsenik, das stärkste anorganische Gift, das wir kennen, von einigen Menschen gegessen wird. Allerdings in ganz, ganz schwachen Dosen, die sich aber allmählich steigern müssen, soll die Wirkung dieselbe bleiben. Diese Wirkung besteht in einer scheinbaren oder auch wirklichen Konservierung des Körpers und der Lebenskräfte, ohne dass deren Verbrauch durch natürliche Nahrung ersetzt werden muss.
Im Übrigen wollen wir uns auf diese Arsenikesserei nicht weiter einlassen. Auch unsere heutigen Gelehrten sind sich noch vollkommen unklar darüber, woher diese Wirkung des Arseniks kommt, und es ist total verschieden, wie viel einer nimmt, wie er die Dosis steigert und wie sie ihm bekommt.
Bemerkt sei höchstens noch, dass das Arsenikessen hauptsächlich in Gebirgsländern verbreitet ist, besonders unter Bergführern, Gämsenjägern, Wilddieben und dergleichen Leuten, die zeitweilig außerordentliche Strapazen durchzumachen haben. Früher wurden auch Rindern vor dem Verkauf kleine Arsenikdosen eingegeben, wodurch sie schnell sehr fett wurden und ein schönes, glänzendes Aussehen bekamen. Werden aber die Dosen nicht regelmäßig gegeben, so fallen Mensch und Tier in unglaublich kurzer Zeit zusammen. Es ist wie eine Art Morphium.
Der Graf von Saint-Germain war also ein Arsenikesser. Es ist dies später erwiesen worden.
Mag dies genügen. Er mochte ja für die Pillen, die er sich bereitete, sein eigenes Rezept haben, dass sie viel intensiver und andauernder und dennoch nicht schädlich wirkten.
Mit diesen Arsenikpillen konnte er sich lange Zeit ohne Nahrung und Wasser am Leben erhalten, ohne eine Spur am Gewicht zu verlieren. Wenn er wollte, konnte er dabei sogar noch zunehmen.
Aber einmal ging es doch zu Ende, entweder sein Arsenikvorrat oder die Wirkung. Es hatte eben alles seine Grenzen. Dann würde man nur noch staunen, oder sich vielmehr davor entsetzen, dass seine Leiche, wenn man sie länger aufbewahrte, gar nicht verwesen wollte. Sein Aussehen auch im Tode würde noch nach einem Vierteljahr ein vollkommen frisches bleiben, mit gesunder Gesichtsfarbe. Denn das hat man schon konstatiert bei Arsenikessern, die man nach einem Vierteljahr wieder ausgegraben hat.
Auch das hat natürlich seine Grenzen, aber immerhin... dann würde man den Zaubergrafen nach seinem Tode erst recht für einen Hexenmeister halten, der mit dem Teufel im Bunde gestanden hatte, für einen Werwolf, für einen Vampir oder dergleichen.
So oder so, er war geliefert. Und er dachte ja nur an seine Marietta, die mit dem Kinde auf seine Rückkehr harrte. Was sollte aus ihnen werden, wenn er nicht zurückkam?
Nun, man brauchte wenig Phantasie dazu, um sich das ausmalen zu können. Das günstigste Schicksal war, wenn die dem Hungertode Preisgegebenen sich durch Schreien bemerkbar machen konnten — dann aber war es, wenn man da hinabdrang, falls dies möglich war, mit dem Grafen von Saint-Germain natürlich erst recht vorbei.
»Vorbei!«
Mit diesem leisen Seufzer legte er sich kettenklirrend auf die Matratze. Mochten die Beobachter oben glauben, er schlafe. Was ging das ihn noch an, was die glaubten?
So ganz einfach freilich ergab er sich nicht in sein Schicksal. Mit fieberhafter Anstrengung arbeitete sein Hirn, wie er sich noch einmal aus dieser Schlinge ziehen könne.
Weshalb hatte er sich nur nicht vorher dieser Verhaftung durch Flucht entzogen? Dann hätte er als freier Mann ja noch alles arrangieren können!
Doch zu spät, um jetzt noch solche Erwägungen anzustellen, sich Vorwürfe zu machen.
Konnte er nicht dennoch diese metallenen Wände durchbrechen?
Ganz, ganz aussichtslos!
Sollte er sich dem Leben vorläufig erhalten, seinen Richtern beweisen, dass er wirklich wochenlang keiner Nahrung bedurfte?
Und auch betreffs der Enthaltung des Schlafes konnte er ihnen Erstaunliches vormachen, respektive seine Beobachter täuschen.
Hatte er dann Hoffnung, dass auch sie seine magische Kraft anerkennen würden?
Sollte er klein beigeben?
Nie und nimmer! Dann lieber stolz sterben wie ein anderer normaler Mensch! Er zog den Tod solch einer sklavischen Gefangenschaft vor, und das hatte er ja auch schon gesagt.
Aber Marietta...
Der Gedanke an die Eingeschlossene, dem Hungertode Preisgegebene spannte immer wieder all seine Gehirnkraft an, nachdem er sich schon in sein Los hatte fügen wollen.
Oder konnte er von seinen Schülern, von Lord Moore Hilfe erwarten?
Ach, da hatte er so wenig Aussicht...
Diese Grübeleien hatten, während der Graf bewegungslos, aber mit offenen Augen, auf der Pritsche lag, schon stundenlang angehalten, sie hätten sicher noch länger gewährt, als es plötzlich an der Tür rasselte.
Sich aufrichtend, wenn auch ohne jähen Schreck, sah er die Tür aufgehen, und herein trat als erster...
»Mein Engel, er kommt, um mich zu retten, und an ihn habe ich mit keinem Gedanken gedacht!«
So flüsterte der Graf, als er den Depeschenreiter Axel sah, ihn sporenklirrend eintreten hörte.
Wieso er diesen Mann als seinen rettenden Engel betrachten konnte, wusste er selbst nicht. Im Augenblick hätte er sich eher sagen können, dass er diesem Manne alles zu verdanken habe, der ihm doch offenbar heute früh die Unwahrheit berichtet hatte.
Aber eine innere Ahnung flüsterte ihm anders zu.
»Wie geht's, Gräfchen?«, begann Axel in seiner jovialen Weise.
Der Graf hatte sich erhoben, und gleich dieses Gesicht sagte ihm nun vollends alles.
Hinter dem Depeschenreiter standen Kardinal Luigo und einige andere Geistliche und Mönche, aber nicht mehr vermummt, und es war unverkennbar, wie Axel dafür sorgte, dass nicht hinter ihm die Tür zugeworfen werden konnte, ohne dass wenigstens sich noch der Kardinal in der Zelle befand, wenn er diesen auch nicht direkt vor sich treten ließ.
»Ihr denkt doch nicht etwa, ich bin daran schuld, dass Ihr vor die sogenannte heilige Inquisition — verdammt soll sie sein — gekommen seid, und jetzt hier sitzt?«
»Ich habe an Euch nicht gezweifelt.«
»Recht so! War nicht schlecht ergrimmt, als ich davon erfuhr. Ich bringe Euch die Freiheit.«
»Die Freiheit? Ihr?«
»Kennt Ihr ein schwarzes Schiff?«, fragte der Depeschenreiter in seiner bündigen Weise, immer nur sein Ziel vor Augen habend.
»Ein schwarzes Schiff?«, wiederholte der Graf verwundert.
»Ein großes Schiff, das ganz schwarz angemalt ist.«
»Ich weiß nicht, was Ihr meint.«
»Kennt keinen schwarzen Kapitän, der sich für Euch interessiert?«
»Einen schwarzen Kapitän?«, wiederholte der Graf immer wieder.
»Genug, Ihr wisst nichts davon. Oder Ihr wollt hier nicht sprechen. Never mind. Die Hauptsache ist, dass Ihr hier herauskommt. So kommt! Also in Ketten, Herr Kardinal?«
»Nein, es ist wirklich nicht nötig.«
»Wenn Ihr Eure Absicht darin geändert habt, so macht sie ihm ab.«
Es geschah von einem Mönche noch hier in der Zelle, dann durchschritt die ganze Gesellschaft, den Grafen in der Mitte, einen langen Gang, dem ein Labyrinth von Kreuzgängen folgte, bis auf einem offenen Hofe die Abendsonne sie begrüßte.
Auf dem Hofe hielt eine unförmliche, vierspännige Karosse mit der Kardinalsmütze als Wappen, auch eine Abteilung päpstlicher Reiter, schwerbewaffnet.
»Graf, Ihr sollt in dieser Kutsche als freier Mann nach Fiumicino gebracht werden«, sagte Axel.
»Ich verstehe nicht...«
»Es ist auch nicht nötig, ich berichte Euch nichts, Ihr werdet schon noch alles begreifen lernen — mehr noch sogar, als ich jetzt weiß. Der Kardinal fährt mit Euch, ferner noch zwei Begleiter. Macht nicht etwa einen Fluchtversuch.«
»Ich denke nicht daran.«
»Die Kutsche ist von Soldaten umgeben, Hauptsache aber ist, dass ich selbst hinter Euch reite. Mag mich nicht in die Kutsche setzen.«
»Und wozu nur das alles?«
»Fragt nicht so! Es steht Euch nicht. Wollt Ihr zuvor... ach so, Ihr braucht ja nichts zu essen. Na, dann hinein mit Euch in die Karre!«
Es war alles schon vorher vorbereitet worden, ging daher aufs schnellste.
Der Graf stieg einfach in den Wagen, in dem schon zwei päpstliche Offiziere saßen, ihm nach der Kardinal, und sofort zogen die Pferde an. Axel schwang sich auf sein bereitstehendes Pferd und schloss sich der Kavalkade an, sich dann aber so haltend, dass er von hinten immer die beiden Wagenfenster im Auge hatte.
In raschester Fahrt ging es auf der Landstraße nach Fiumicino dahin, der Rosselenker war angehalten, seine Pferde nicht zu schonen, man meinte nicht anders, als das Viergespann ginge durch, obgleich der reichbetresste Kardinalskutscher noch immer auf sie losknallte.
Wir wollen uns nicht bei dem Grafen aufhalten. Von dem Kardinal erfuhr er nichts, dieser stellte auch keine Fragen, war ganz in seine Sorgen versunken.
Der Sorgenvollste aber war wohl Axel.
Wenn nun in Fiumicino gar kein schwarzes Schiff lag? Wenn es auch nicht in Bälde kam? Überhaupt niemals? Wenn es unterdessen gesunken war? Oder wenn er diese ganze abenteuerliche Geschichte überhaupt nur geträumt hatte?
Doch zum Glück war dieser Depeschenreiter ein Mann, der nicht so leicht glaubte, dass er mit offenen Augen geträumt haben könne oder einen Traum für Wirklichkeit nahm. Und das schwarze Schiff hatte er noch einmal gesehen, als er nach dem Abreiten zurückgeblickt: Mit geschwellten Segeln war es mit schäumendem Bug wie ein Pfeil nach Süden geschossen, den Reiter sicher an Schnelligkeit übertreffend, denn ein gutes Segelschiff macht ja bei günstigem Winde sehr wohl 12 Knoten in der Stunde, wo ein Reiter nicht mitkommt, am allerwenigsten auf die Dauer, und nur durch die Wendung der Landstraße hatte Axel nicht noch sehen können, wie er von dem Schiffe überholt wurde.
Nein, das schwarze Schiff würde schon daliegen, und wenn nicht, dann.... na, dann kam es eben anders.
Schließlich also hatte Axel doch keine Sorge mehr, sondern blickte nur vergnügt und höchstens erwartungsvoll in die Zukunft.
So vergingen anderthalb Stunden. Der Abend brach an, machte aber der Belebtheit dieser Verbindungsstraße zwischen Rom und seinem Haupthafen kein Ende. Immer hin und her gingen die Karrenzüge. Denn Rom war damals nicht kleiner als heute und war vielleicht noch mehr frequentiert, musste mit Lebensmitteln versehen werden, die nur zum kleinsten Teile aus der Provinz kamen, und was jetzt die Eisenbahn besorgt, mussten damals Karrenzüge tun, und dann vor allen Dingen ging damals überhaupt alles, weil der billigere Seeweg bevorzugt wurde, erst nach diesem Hafen.
Die Karrenzüge wurden von Reitern überholt, alles wich der ausfälligen Kardinalskarosse ehrfürchtig oder auch scheu aus, nur der Reiter nicht, der jetzt angesprengt kam, durch Schärpe und Armbinde als Stafettenpost erkenntlich.
Nur noch fünf Minuten hätte er zu reiten gehabt, dann gab er die Depesche, die er zu übermitteln hatte, einem anderen Reiter ab, der an einem Posthause neben gesatteltem Rosse stand, und solcher Stafettenstationen waren auf der fünf Meilen langen Landstraße acht — aber noch in einiger Entfernung vor der ihm entgegenrasenden Karosse parierte er sein Pferd und schwenkte ein Tuch.
Er hatte ein Kardinalsgefährt erkannt. Dieses fuhr etwas langsamer.
»Eine Eminenz?«
»Seine Eminenz der Kardinalstaatssekretär.«
»Richtig, an ihn ist diese Depesche vom Stadtpräfekten von Fiumicino.«
Der Kardinal hatte es gehört, er ließ sich die Depesche durch das Wagenfenster reichen.
Auch Axel hatte es gehört, drängte sein Pferd heran.
»Ist das schwarze Schiff da?«
»Ja, und es ist Tatsache, der Piratenkapitän hat schon eine öffentliche Warnung ergehen lassen, die Stadt muss geräumt werden!«, rief der Kardinal außer sich. »Vorwärts, vorwärts, dass wir nicht zu spät kommen!!«
Es genügte Axel, was er vernommen hatte, und er schloss sich nicht wieder dem Wagen an, sondern gab seinem Rosse die Sporen und jagte voraus, soweit dies bei der Schnelligkeit der Karosse noch möglich war.
Die ansehnliche Hafenstadt glich einem Ameisenhaufen, in den ein böser Bube mit dem Stocke gestochert hat. Die Ameisen brachten ihre Puppen in Sicherheit, diese zweibeinigen hier alles das, was sie am wertvollsten dünkte und was sie tragen konnten.
Der böse Bube war dort das schwarze Schiff, welches dicht an der schmalen Hafeneinfahrt vor Anker lag.
Wir wollen nicht noch nachträglich schildern, wie alles gekommen war. Kurz, vor einer Viertelstunde war dieses schwarze Schiff erschienen, hatte sich so verankert, dass es den ganzen Hafen sperrte, ohne sich um die paar Kanonenboote und Schoner zu kümmern, welche die Kriegsflotte des Kirchenstaates bildeten.
Durch Flaggensignale war der Stadtpräfekt an Bord befohlen worden, dieser hatte von dem schwarzen Kapitän erfahren, um was es sich handelte: Wenn sich innerhalb von zwei Stunden der Graf von Saint-Germain nicht hier bei mir an Bord befindet, bombardiere ich Fiumicino in Grund und Boden, die Einwohner mögen sich schon darauf vorbereiten.
Der Schreck des Stadtoberhauptes lässt sich denken. Ein Pirat! Und was für einer! Und kein freundschaftliches Kriegsschiff in der Nähe! Die Kriegsflotte des Kirchenstaates kam ja gar nicht in Betracht, dieses schwarze Schiff brauchte nur zu pusten, dann waren diese Nussschalen fortgeblasen. Und auch die Befestigungen dieses Hafens waren nur Kinderspielereien, so wie die ganze Armee, aus päpstlichen Wachen bestehend.
Und dabei wusste der Stadtpräfekt noch gar nichts von der Verhaftung des Grafen!
Der schwarze Kapitän schilderte es ihm mit kurzen Worten und wiederholte seine Drohung.
»Ja, wie kann er denn aber schon in zwei Stunden hier sein, wo es doch zwei Stunden dauert, ehe mein Stafettenbote nur nach Rom kommt!«, jammerte der Bürgermeister.
»Mein Bote ist bereits in Rom, und bringt der in zwei Stunden den Grafen nicht mit, lege ich die Stadt in Trümmer. Basta!«
Der Präfekt wurde von Bord gebracht, konnte nur berichten und die Bürger auffordern, ihre Sachen zu packen.
Weiter wollen wir es nicht ausmalen, höchstens noch hinzusetzen, dass der schwarze Kapitän wohl noch etwas gewartet hätte, ganz so pünktlich konnte er doch nicht sein.
Hierbei zeigte sich auch, dass sich das schwarze Schiff doch sehr verspätet hatte. Es hatte ja zu der gleichen Zeit in Fiumicino sein wollen wie Axel in Rom. Jedenfalls war es absichtlich langsamer gefahren oder hatte sonst noch einen Abstecher gemacht.
Es war noch keine halbe Stunde verstrichen, als die furchtbar geängstigten Bürger die Kardinalskarosse kommen sahen, und wie ein Lauffeuer verbreitete sich die erlösende Kunde, dass Kardinal Luigo den höllischen Grafen selbst mitbringe.
Auch von dem schwarzen Schiffe aus musste die Ankunft der Karosse schon von Weitem beobachtet worden sein, ja, man musste dort noch mehr wissen, wirklich etwas allwissend sein, denn sofort ging von dort ein Boot ab, das am Kai beilegte, gerade, als Axel, welcher dem Wagen nur wenig voraus war, angejagt kam.
Der am Ruder Sitzende war nicht der Kapitän, aber das war ja gleichgültig.
»Der Graf kommt, er ist frei!«, rief Axel, vom Pferde springend.
Die Leute in den Booten saßen wie die Statuen.
Da kam der Wagen, hielt, der Kardinal und der Graf stiegen aus.
»Hier ist das Boot, welches Sie nach den. schwarzen Schiffe bringen wird«, erklärte Axel.
»Ich verstehe durchaus nicht«, meinte der Graf kopfschüttelnd, einmal aus seiner Verwunderung gar kein Hehl machend.
»Hat Ihnen der Kardinal nichts erklärt?«
»Gar nichts.«
»Konnte es wohl auch nicht. So wenig wie ich. Aber die Sache ist ganz einfach die: Der Kapitän jenes schwarzen Schiffes dort hat Sie zu Gaste geladen, Sie möchten ihn besuchen...«
»Ja, wer ist denn dieser Kapitän?!«
»Werden's schon erfahren. Jedenfalls alter Bekannter von Ihnen, war wohl kommandierender Admiral der phönizischen Kriegsflotte. Nun vorwärts ins Boot, sonst knallt's doch noch!«
Der Graf ließ es sich nun nicht noch zum dritten Male sagen, er stieg ins Boot.
»Einen Augenblick!«, rief Axel, sich nach einem Manne umsehend, der ihm das Pferd abnehmen könne, gleichgültig, wohin es gebracht würde.
Als er nicht gleich eine geeignete Person in der Nähe sah, winkte er einem der berittenen Soldaten, blickte zufällig nach dem Boote...
»Hallo, was ist denn das?! Heda, ich will auch mit!«
Das Boot war mit dem Grafen ohne ihn abgestoßen, infolge des Fehlens aller Kommandos ganz lautlos.
»Ich will auch an Bord, will doch noch meinen Lohn haben!«
So und anders rief Axel, aber vergebens, das Boot setzte seinen Weg fort, obgleich auch der Graf auf den Steuernden einsprach. Dieser schüttelte nur den Kopf, dabei blieb es, und kaum hatte das Boot das Schiff erreicht, so wurde es gehievt, und gleichzeitig rollten auch die Segel herab, die Anker waren bereits gelichtet worden, und in rauschender Fahrt ging das schwarze Schiff nach Süden davon.
Der unfreiwillig zurückgebliebene Depeschenreiter stieß eine furchtbare Verwünschung aus, sonst schimpfte er nicht weiter.
»Gut, geht nur hin! Meinen Lohn hole ich mir doch noch. Und wieso dieses schwarze Schiff ohne Segel gegen Wind und Strömung anfahren kann, und was für eine Bewandtnis es sonst mit diesem schwarzen Schiffe und seinem Kapitän hat, das will ich auch noch herausbekommen, so wahr ich der Depeschenreiter Axel bin!«
Der Graf hatte nur schwache Versuche gemacht, den Steuermann zu veranlassen, den Depeschenreiter, dem er so viel verdankte und dessen Wunsch, mitgenommen zu werden, er erkannte, zur Umkehr zu bewegen.
Auch er war ja ein Mensch, war von alldem, was er da zu sehen und zu hören bekam, grenzenlos überrascht.
Diesmal brauchte man das Boot nicht erst zu verlassen, es wurde gleich mit der ganzen Mannschaft gehievt, erst dann wurde der Graf höflich zum Aussteigen gebeten, was auf bequeme Weise geschehen konnte, und da also befand sich das schwarze Schiff schon wieder in voller Fahrt nach Süden.
»Bitte, folgen Sie mir zum Herrn Kapitän.«
Der Graf hatte keine Zeit, sich an Deck umzusehen, er betrat denselben Raum, in dem vorher auch Axel empfangen worden war.
Der junge Kapitän begrüßte den Eintretenden.
»Habe ich die Ehre, den Grafen von Saint-Germain zu sehen?«
»Der bin ich.«
»Bitte, nehmen Sie Platz. Hat Ihnen der Depeschenreiter über mich und mein Schiff berichtet?«
»Sehr wenig — so gut wie nichts.«
»Viel konnte er Ihnen auch nicht erzählen. Wie wir ihn von der Zitadelle Palo abgeholt haben?«
»Nein.«
»Schadet auch nichts. Übrigens brauchen auch Sie mir nicht viel zu berichten, wir wissen alles.«
»Sie wissen alles?!«
»Was in den letzten Stunden mit Ihnen vorgegangen ist.«
»Ja, woher denn?«
»Aus einer besonderen Quelle. Doch lassen wir das.«
Der Kapitän war äußerst höflich, konnte aber sehr bestimmt sprechen.
»Bitte, wundern Sie sich jetzt nicht. Sie werden später alles ausführlich erfahren — vielleicht...«
Der Kapitän selbst machte eine Pause.
»Vielleicht?«
»Wenn Sie auf meine Bedingungen eingehen.«
»Was für Bedingungen sind das?«
»Sie werden diese gleich hören. Herr Graf, ich brauche nichts über Ihre früheren Lebensschicksale zu erfahren, denn... ich kenne diese. Außerdem darf ich gar nicht fragen. Ich bin wohl Kapitän dieses Schiffes, aber... nur nautischer Lenker. Der Besitzer befindet sich an Bord, ihm habe ich zu gehorchen.«
»Und wer ist dieser Besitzer?«
»Sie werden ihn dann kennen lernen. Er wird Ihnen auch alles Weitere offenbaren. Jetzt zu der Sache, die ich auf höheren Befehl zu erledigen habe. Wir haben Sie doch aus einer schweren Kalamität befreit, nicht wahr?«
»So ist es«, gestand der Graf hier ohne Weiteres.
»Sie hätten sich schwerlich selbst befreien können.«
»Ja, woher wissen Sie denn das nur?!«
»Bitte, antworten Sie mir. Hätten Sie sich allein befreien können?«
»Ich bezweifle es.«
»Wären Sie von anderer Seite befreit worden?«
»Kaum.«
»Was wäre Ihr Schicksal gewesen?«
»Ich wäre... verhungert.«
»Ich denke, Sie brauchen keine Nahrung?«
Des Grafen Hirn arbeitete furchtbar, dabei ganz kühl, er wappnete sich immer mehr.
»Ich wäre freiwillig gestorben, durch Anhalten des Atems, ehe dass ich mich so gefangenhalten oder mich zu irgend etwas zwingen lasse.«
»Ganz richtig«, stimmte ihm der Kapitän gleich bei. »Aber hatten Sie auch Ihr Haus bestellt?«
»Das Kloster, in dem ich wohnte?«
»Ja «
»Nun, da kämen doch nur die Diener in Betracht, die mussten eben sehen, wo sie blieben.«
»Sonst niemand?«
»Wer sonst noch?«
»Nun, ich fragte nur so. Also, nur die Diener ließen Sie zurück?«
»Gewiss, nur die Diener.«
»Die Sache ist nämlich die, dass wir Sie hier gern an Bord behalten möchten.«
»Wozu?«
»Das wird Ihnen dann mein Gebieter erklären. Nun treten wir aber eine weite Reise an...«
»Wohin?«
»Werden Sie alles später erfahren. Und wenn Sie nun hier an Bord bleiben...«
»Halt! Ich habe in Rom doch noch Verschiedenes zu erledigen.«
»Was?«
»Da Sie so gut über alles orientiert sind, werden Sie vielleicht auch gehört haben, dass ich der Gemahlin des französischen Gesandten...«
»Die Fürstin de la Roche, Sie wollen mit der Dame eine Verjüngungskur vornehmen.«
»Auch das wissen Sie?«
Hierüber brauchte der Graf gar nicht weiter zu staunen. Das ging ja nun schon seit acht Wochen, das konnte unterdessen weit berichtet worden sein.
»O, das hat ja noch ziemlich vier Wochen Zeit, bis dahin sind wir wieder zurück.«
»Aber ich muss die Dame in eine persönliche Kur nehmen, und das nun bald, dreier Wochen bedarf ich dazu.«
Keine Frage deshalb, wie er denn das fertig bringen wolle. Über jede Neugier war dieser Kapitän überhaupt erhaben.
»Dann schlage ich vor, wir nehmen die Fürstin gleich mit an Bord.«
»Die wird nicht gehen.«
»O, das bringen wir schon fertig.«
»Ich muss diese Verjüngungskur unbedingt in Rom vornehmen.«
»Das ist nicht wahr.«
»Was?!!«
Die beiden Männer blickten einander an. Der Graf mit jäh auffunkelnden Augen, die des schwarzen Kapitäns hingegen blieben ruhig, sanft und melancholisch wie immer.
»Herr Graf, warum sind Sie nicht offen? Warum verheimlichen Sie mir den eigentlichen Grund, weshalb Sie Rom nicht verlassen wollen, wenigstens erst noch einmal zurück müssen? Sie haben doch zwei Personen zurückgelassen, denen auch in der Röstzelle Ihre ganze Sorge galt...«
»Zwei Personen, meine ganze Sorge?«, wiederholte der Graf mit stockendem Atem, so sehr er sich auch bezwang.
»Im Keller Ihrer bisherigen Klosterwohnung.«
Hätte der Graf gestanden, so wäre er wohl zusammengesunken. So lehnte er sich nur auf der Bank zurück und simulierte Gleichmut, indem er die Beine übereinander schlug.
»Was wissen Sie davon?«
»Wir wissen es.«
»Sind Sie hellsehend?«
»Nicht so ganz, wie Sie vielleicht denken — aber doch so etwas Ähnliches. Ja, Herr Graf, wir haben sehr, sehr viel Ähnlichkeit zusammen. Vielleicht aber besitzt der eine, was der andere nicht hat, und so könnten wir uns vielleicht gegenseitig ergänzen.«
Bei diesen Worten hatte der Kapitän die Hand ausgestreckt, nach dem Tintenfass, berührte es an der einen Ecke, wo bei näherem Hinsehen ein kleiner, schwarzer Knopf sichtbar ward, und plötzlich schrillte ein Klingeln durch die Kajüte.
Wie von einer Tarantel gestochen fuhr der Graf, sich jetzt nicht mehr beherrschen könnend, zusammen, blickte dorthin, woher der Ton gekommen war, halb von der Wand, halb von der Decke, und da entdeckten seine scharfen Augen es auch gleich, obwohl die ganze Vorrichtung schwarz lackiert war und sich kaum von der schwarzen Täfelung abhob — dieselbe Klingelvorrichtung, die er selbst in seinem unterirdischen Heiligtum besaß.
»Sie haben...«
»Eine elektrische Batterie, ja, ebenso wie Sie«, ergänzte der Kapitän.
»Wie kommen Sie...«
»Kennen Sie einen Monsieur Armand?«
Fassungslos starrte der Graf den Frager an.
»Monsieur Armand, mein Meister«, murmelte er geistesabwesend. »Mann, wer sind Sie...?«
»Es hat einmal noch einen anderen Menschen gegeben, den dieser geniale Mann, dieses Universalgenie zu seinem Nachfolger erziehen wollte...«
»Sie?!«
»Nein, nicht ich. Wohl aber meinen Vater. Und dessen Geheimnisse erfuhr wiederum ich. Nur ich. Sie und ich, wir sind jetzt die beiden einzigen, welche die Geheimnisse kennen, entweder zusammen oder uns darein teilen. Mir scheint, mein Vater hat etwas mehr von den psychischen Kenntnissen, Sie mehr von den physikalischen oder sogar von den physiologischen Kenntnissen des Alten geerbt. Und Sie vor allen Dingen die Bibliothek, nicht wahr?«
Der Graf war vollständig fassungslos. Doch schnell hatte er sich wieder zusammengerafft.
»Armand hat mir gegenüber nie solch eine Andeutung gemacht, dass er einmal noch einen anderen Schüler gehabt hat — doch gleichgültig, ich empfinde nicht den geringsten Groll gegen ihn.«
»Sie sind der Erbe seiner Bibliothek gewesen?«
»Ja.«
»Nun, Herr Graf, ich dächte doch, da legten wir zusammen, was wir geerbt haben. Sind Sie damit einverstanden?«
»Ich bin es.«
»Gut. Nur dieses eine Zugeständnis sollte ich von Ihnen erlangen, nichts weiter. Oder eben Ihre Absage. Da ich nun Ihre Zusage habe, ist meine Pflicht Ihnen gegenüber beendet. Bitte, folgen Sie mir.«
Der Kapitän erhob sich, schritt nach dem Hintergrunde, öffnete eine Tür, die gar nicht zu unterscheiden war.
Zuerst musste der Graf geblendet die Augen schließen, so intensiv weiß war das Licht, das ihm entgegenflutete, und dann, als er sie öffnen konnte, war er wieder ganz geblendet von der Erscheinung der Dame, die vor ihm stand.
Der schwarze Kapitän war zurückgeblieben, schloss hinter ihm die Tür, ging nach dem Tisch und setzte sich wieder.
Lange saß er hier, den Kopf in die Hand gestützt, ganz in Gedanken versunken, und es konnten keine freudigen sein, denn nur immer größere Traurigkeit prägte sich in seinem an sich schon so melancholischen Antlitz aus.
»Die Entscheidung naht«, murmelte er tonlos, »ob ich diesem unbekannten Manne weichen muss oder ob ich...«
Er brach ab, es schien etwas zu sein, was er nicht auszusprechen wagte.
Da drang durch jene Tür eine Stimme, das erste Mal, die Person musste ganz dicht an der Tür stehen und ausnahmsweise sehr laut sprechen, und zwar war es eine glockenhelle Frauenstimme.
»Und doch, Sie haben ein Mittel, um mir zu beweisen, dass Sie es wirklich sind... hier.«
Gleich darauf zitterten durch den Raum süß und schmelzend die Klänge einer Violine, ein Adagio wurde gespielt, nur ganz kurz, aber es genügte, dass der einsame Mann plötzlich mit einem schluchzenden Laute den Kopf zwischen den auf den Tisch gelegten Armen vergrub.
»Du hast gesiegt, jetzt hab' ich sie verloren!«, erklang es leise schluchzend.
Erst nach einer Viertelstunde trat der Graf wieder aus dem Nebenraume, in dem ein für damalige Zeiten überirdisches Licht herrschte, in die schwarze Kajüte zurück, in die durch die runden Fensterchen die letzte Abenddämmerung drang. Er hatte einen kleinen Briefbogen in der Hand, mit wenigen Zeilen offenbar von einer Frauenhand herrührend.
Der schwarze Kapitän hatte sich erhoben, nichts war mehr in dem sonnenverbrannten Antlitz zu lesen, was er in dieser Viertelstunde durchgemacht, nur seltsam, dass die sonst rotleuchtende Narbe plötzlich ganz weiß geworden war.
»Dies schickt Ihnen die Lady durch mich, Herr Kapitän.«
Jener nahm das Papier und überflog die Zeilen, machte eine wenig seemännische Verbeugung.
»Herr Graf, ich bin Ihr gehorsamer Diener, Sie haben über mich wie über dieses ganze Schiff zu befehlen.«
»Nicht so — ich hoffe vielmehr, dass wir Freunde und Kameraden sein werden.«
Er hielt jenem die Hand hin, sie wurde zeremoniell genommen. Die des Grafen war glühend heiß, die des Kapitäns kalt wie Eis.
»Und nun zurück nach Fiumicino, ich muss, ehe ich für immer hier bleiben kann, noch einmal nach Rom — Sie wissen ja selbst, warum.«
Gleich darauf schrillten die Bootsmannspfeifen, das mächtige Schiff wendete und fuhr denselben Kurs zurück, direkt gegen den Wind, ohne zu kreuzen, mit festgemachten Segeln, und der Graf bekam sofort die Erklärung, wie dies damals Unmögliche möglich war, und er erfuhr alles andere.
Es war Mitternacht, von keinem Stern erhellt. Das auf dem Tiber stromauf fahrende Boot, schon mehr eine Rudergaleere zu nennen, ein zwölfriemiger Kutter, groß genug, um hundert Menschen oder eine ganze Wohnungseinrichtung aufzunehmen, wäre mit seinem schwarzen Anstrich und seiner schwarzgekleideten Rudermannschaft in der Finsternis ganz unsichtbar gewesen, hätte es nicht selbst am Heck und Bug je eine hellstrahlende Laterne gehabt.
Vor ihnen tauchte das Lichtmeer Roms auf, aber schon im Erlöschen begriffen. Die Bevölkerung bereitete sich für einen Festtag vor, da ging man heute etwas zeitiger schlafen, und eine allgemeine Straßenbeleuchtung während der ganzen Nacht gab es damals nicht, wenigstens nicht mit unserer heutigen zu vergleichen.
So erreichte das schwarze Boot das westliche Stromtor Roms. Es war breit genug, nur wenig wurde der Strom durch Steinmauern eingeengt, auch die Beleuchtung durch Blendlichter, welche die ganze Stromfläche erhellen sollte, war nur eine sehr mangelhafte, trotzdem wäre es dem schwarzen Boote auch mit gelöschten Lichtern nicht möglich gewesen, ungesehen hier durchzukommen, es hätte sich denn unsichtbar machen können.
Die Bewachung dieses Zolltores war doch eine sehr scharfe, und dann war quer über den ganzen Strom eine Kette gezogen, noch unter Wasser liegend, so wie es noch heute in allen Häfen ist, welche ein Gebiet haben, in dem die Schiffe zollfrei sind.
Jedes Schiff und jeder Kahn, die durch eine Schleuse in dieses zollfreie Gebiet eindringen, müssen erst über diese Kette hinweg, die je nach Bedarf höher oder tiefer gehangen wird, sodass sie den Kiel des Fahrzeugs streift.
Wozu das? Falls die Schiffer durchzuschmuggelnde Fässer, Kisten und dergleichen am Kiele des Fahrzeugs befestigt haben. Die Seiten des Schiffes oder Kahnes lassen sich leicht durch Stangen absuchen, die letzte Visitation, die des Kieles, besorgt diese Streichkette. So war es schon von jeher, so ist es noch heute. Die Schmuggler sind schlau, die Zollbeamten nicht minder, und dennoch werden sie durch immer neue Tricks an der Nase geführt.
Ein Zollboot schoss auf die beiden Laternen zu.
»Halt! Was für ein Fahrzeug ist das!«
»Der Graf von Saint-Germain, ein Boot von dem schwarzen Schiffe, das wieder in Fiumicino liegt«, erklang es zurück.
Das Zollboot stoppte sofort ab. Diese Erklärung hatte genügt. Der fremde Kutter wurde nicht aufgefordert, die Stelle zu passieren, wo sein Kiel von der Kette gestrichen wurde, und überhaupt hätte er ja erst seinen Inhalt deklarieren müssen.
Wer aber wagte den Grafen von Saint-Germain anzuhalten, der sich noch dazu in einem Boote des schwarzen Piratenschiffes befand?
Die Schmuggler hatten Gelegenheit zu einem neuen Trick. Sie mussten sich ihre Boote schwarz anmalen und sich schwarz kleiden. Lange wäre das freilich nicht geglückt.
Dieses erste Boot, das sich nur durch eine kurze Antwort so legitimiert hatte, kam ungehindert durch.
Die Stromfläche mitten in der Stadt war viel finsterer als hier, so finster wie draußen in der freien Landschaft, wenigstens nach der Mitte des Stromes zu.
Jetzt wurden die beiden Laternen verlöscht, und der große Kutter war wirklich gänzlich unsichtbar. Jetzt hörte man auch das Knirschen der Riemen in den Gabeln nicht mehr, sie mussten schnell umwickelt worden sein oder sonst eine Vorrichtung besitzen, um jedes Geräusch aufzuheben, und das schwarze Boot konnte dicht an einem anderen vorbeifahren, wenn es nicht in den Bereich der Laterne kam, war nichts von ihm zu bemerken. Wie ein wesenloser Schatten flog es dahin.
Die Ufer waren nur so weit beleuchtet, wie dort die Straße entlang lief, auf der noch Verkehr herrschte oder ein Haus stand, dessen Fenster nach der Wasserseite gingen, und diese Fenster waren noch erleuchtet.
Denn hier gab es Stellen genug, die immer in Dunkelheit lagen, Laternen und Fenster erloschen auch immer mehr, und solch einer finsteren Stelle strebte der Kutter zu.
Der Graf, schwarz gekleidet wie die übrigen, stand vorn im Boot, er gab mit leiser Stimme Kommandos, nicht gerade seemännische, ließ noch einige Schläge machen und beilegen, er selbst befestigte das Tau an einem im Mauerwerk eingelassenen Ring.
Dann tastete er, und in Leibeshöhe des stehenden Mannes ging eine große Steinplatte zurück, ein ganzer Quaderstein.
Die entstandene Öffnung führte in den Keller des Spukklosters. Es war ein zweites Schlupfloch nach dem Wasser zu, welches die heimlichen unterirdischen Bewohner dieses Klosters schon immer besessen hatten. Durch dieses konnte man auch ein Boot benutzen, freilich nur zu gewissen Zeiten, wenn die Höhe des Wassers eine angemessene war. Bei zu hohem Stand musste auch dieser Stein unter Wasser kommen.
»Nur eine Minute, ich will erst vorbereiten«, flüsterte der Graf, ehe er hineinschlüpfte.
Die Wartenden wussten ja, worum es sich handelte, das war ja schon alles zur Genüge besprochen worden.
Nach kurzem Kriechen konnte sich der Graf wieder aufrichten, schnellen Schrittes durcheilte er die ihm so wohlbekannten finsteren Gänge.
Nicht die geringste Sorge beunruhigte ihn, dass während seiner längeren Abwesenheit den Zurückgelassenen etwas zugestoßen sein könne. Einmal handelte es sich ja doch nur um zwölf Stunden, und dann wusste der Graf ganz genau, wie es mit Marietta und ihrem Kinde stand, was die beiden noch vor wenigen Stunden getrieben hatten.
Woher er das wusste, werden wir später sehen.
Unter seiner Hand öffnete sich eine Tür, Ampellicht beleuchtete den Raum, den er selbst als sein eigener Sekretär mit seinem Weibe teilte.
Marietta saß, mit einer Näharbeit beschäftigt, unter der Lampe. Freudig blickte sie auf, und ihre Freude verminderte sich nicht, als sie statt des sehnsüchtig erwarteten Gatten den Grafen erkannte, wenn sie auch etwas respektvoller wurde.
Auch der Graf hatte sich ihr als solcher in diesem unterirdischen Reiche ja oft genug gezeigt, war immer die höfliche Liebenswürdigkeit selbst gewesen. Aber zuvor war sie doch sehr besorgt gewesen, so lange war sie noch nie allein gelassen worden...
»O, Herr Graf...«, stieß sie mit freudigem Schreck hervor.
»Sie haben sich geängstigt? Es war nicht nötig, Signora, Ihr Gatte befindet sich bereits in Sicherheit, ich komme nur, um Sie und Pepita nachzuholen. Das Kind ist doch wohlauf?«
»Es schläft.«
»So machen Sie sich bereit, packen Sie die Sachen zusammen, die Sie mitnehmen wollen. Es gibt erst eine Bootsfahrt den Strom hinab und dann — Sie werden jetzt für immer auf einem Schiffe leben. Wären Sie damit einverstanden?«
Der Schreck war nur sehr gering, hatte auch nur einen einzigen Grund.
»Und Antonio?«
»Der bleibt ebenfalls für immer auf diesem Schiffe, so wie ich, es soll unsere Heimat werden. Und was für ein schönes Schiff das ist!«
Da war der Schreck schon wieder vorbei, machte sogar der größten Freute Platz. Die Hauptsache war, dass sie nicht von Mann und Kind getrennt wurde, und eine Seefahrt hatte sie schon einmal gemacht, nach Neapel, und es hatte ihr köstlich gefallen, obgleich es nur eine erbärmliche Feluke gewesen var. Ja, auf einem richtigen großen Schiffe, da könnte sie wohl für immer leben — so dachte sie jetzt.
»Antonio ist schon darauf?«
»Jawohl.«
»O, wie ich mich darauf freue!«
»Sie brauchen sich nicht zu beeilen. Eine Stunde wird sicher noch vergehen, vielleicht auch zwei. Wecken Sie das Kind noch nicht, nur dass dann alles bereit ist, wenn ich wiederkomme.«
Er wandte sich der Türe zu — da stürzte das schöne, junge Weib, ehe er es verhindern konnte, ihm zu Füßen.
»O, Sie edler Mann, wie soll ich Ihnen danken, was haben wir getan, dass Sie sich ständig so um uns bemühen, uns mit Wohltaten überschütten...«
Der Graf ließ diesen plötzlichen Ausbruch von Dankbarkeit nicht vollenden, er entfernte sich schnell.
»Nun habe ich in meiner Doppelrolle doch glücklich zwei Frauen bekommen«, murmelte er, als er durch die finsteren Gänge eilte. »Als Antonio meine Marietta, als der Graf von Saint-Germain die rätselhafte Lady von der See. Die ist ja damit zufrieden, dass sie teilt, wie ich teilen muss, von ihr geht der Vorschlag, Marietta mit an Bord zu nehmen, ja erst aus. Aber wenn es wahr ist, dass zuletzt doch alles an das Licht der Sonne kommt, wie soll das enden? Mindestens gibt es ein gebrochenes Herz oder... ich traue dieser jungen Römerin auch noch etwas ganz anderes zu.«
In seiner Hand flammte es auf, es war die Lampe der Bibliothek, die er anbrannte.
Sein Blick wanderte die Regale entlang, auf denen die alten Folianten standen, er begrüßte sie mit wehmütigem Kopfnicken, er zog den Vorhang hinter dem Schreibtische zurück, die Mumie des alten Mannes erschien, wie in völligem Leben noch immer in dem Pergament lesend, stumm betrachtete er den lebensfrischen Toten, den er seinen Vater genannt und dessen richtigen Namen wir nun auch schon gehört haben — Monsieur Armand.
»Leb wohl, leb wohl, du teurer Mann«, flüsterte er endlich. »Zwar kommst du mit mir, ich werde dich noch immer in meiner Gesellschaft haben, dich so sitzen sehen, aber das Richtige ist es doch nicht mehr. Ach, diese schönen Zeiten sind vorbei! Ja, nur in der unbekannten Einsamkeit erblüht das wahre Glück.«
Er brannte noch die Lampen in den übrigen Räumen an, in dem Laboratorium und in der Garderobe, dann begab er sich nach dem Boote zurück.
»Kommt, es ist alles bereit.«
Einige Männer folgten ihm nach, der erste war der schwarze Kapitän.
Schon in der unterirdischen Bibliothek blickten sie scheu um sich, noch mehr auf den alten Mann, der so bewegungslos dasaß.
»Da ist er, unser Meister«, sagte der Graf, »der alle Geheimnisse des Himmels und der Erden erforscht hatte, so weit sie für einen irdischen Menschen zu erforschen sind, der uns vorsichtigerweise nur einige wenige seiner Kenntnisse vermachte — und es war gut so, das habe ich schon langst eingesehen.«
Der Kapitän entblößte sein Haupt, alle folgten seinem Beispiele, nur der Graf nicht, der ihnen auch nicht viel Zeit zur ehrfürchtigen Bewunderung ließ.
»Nun vorwärts«, sagte er im Tone eines Mannes, der zu befehlen hat, wenn auch durchaus nicht schroff, »zuerst diese Bücher, alle ohne Auswahl. Hier darf nichts zurückbleiben, ebenso wenig hier...«
Er führte den Kapitän durch die verschiedenen Räume, bezeichnete, was alles mitgenommen werden sollte.
Der Kapitän war über Staunen erhaben, und die beiden mächtigen Elemente, eine elektrische Batterie, griff er, schon jetzt prüfend, wie sie von der Wand abzunehmen waren, in einer Weise an, dass man gleich daraus schließen konnte, wie ihm diese für jeden anderen damaligen Menschen völlig rätselhafte Vorrichtung nicht fremd sein konnte.
»Nur diese beiden?«
»Nur diese beiden.«
»Damit konnten Sie doch kein Licht erzeugen?«
»Nein. Ich wusste wohl, dass man durch die Blitzkraft Metalldraht zum Erglühen bringen konnte, habe aber nie daran gedacht, ich gestehe es offen, diese Kraft so zu verwenden.«
»Diese beiden Behälter hätten dazu auch nicht genügt. Übrigens frage ich nur wegen der Drähte, die wir abnehmen müssen.«
»Die laufen doch alle von hier aus, meistenteils nur, um Klingeln ertönen zu lassen.«
»Sie hätten sie schon abnehmen können.«
»Das ist nur im oberen Teile des Klosters geschehen, hier unten finden Sie alles, wenn Sie die Drähte verfolgen, und übrigens bin ich in einer Stunde spätestens zurück, dann helfe ich selbst noch.«
Es war bereits abgemacht, dass der Graf, nachdem er bezeichnet hatte, was mitzunehmen war, sich noch einmal entfernen würde.
Er benutzte nicht den Fahrstuhl, der durch die hydraulische Presse getrieben wurde, die man jetzt schon zu demontieren begann, und zwar mit recht sachkundiger Hand, sondern stieg durch die hohle Mauer die Treppe hinauf, ließ oben die Öffnung in der Wand entstehen, betrat das Sanktuarium.
Wenn die Jesuiten nun schon Einzug gehalten hätten oder sich andere Menschen hier befanden?
Nein, der Graf wusste ganz genau, dass er sorglos hier eintreten durfte. Ausgeräumt war wohl alles, auch im Sanktuarium die vielen Teppiche und Portieren entfernt, aber das Spukkloster wurde mehr gemieden denn zuvor.
Der Graf durchschritt die finsteren, jetzt verödeten Korridore, trat durch das unverschlossene Tor ins Freie, nahm seinen Weg quer durch den Garten und schwang sich über die Umfassungsmauer, wie er dies alles früher so oft getan hatte.
Auf der Straße standen hochaufgetürmt die Möbel, die man heute Nachmittag hier ausgeräumt hatte, dass sie von Henkershand verbrannt würden. Es hätte schon geschehen sein sollen, man hatte noch gezögert, es war eben doch alles etwas anders gekommen.
Der Graf hielt sich nicht auf. In einen Mantel gehüllt, eilte er durch die menschenleer gewordenen Straßen. Er hätte auch ruhig sein Gesicht zeigen können, auch der, der sich seine Züge am besten eingeprägt, hätte ihn nicht erkannt, dafür hatte er gesorgt.
Sein Ziel war der Palast der französischen Gesandtschaft, noch weit prächtiger als der der englischen.
Das Fenster, hinter dem sich innen die Portiersloge befand, war immer erleuchtet, der Graf brauchte nur den Klopfer erschallen zu lassen, sofort ward geöffnet, in dem Flur standen gleich drei bewaffnete Wächter.
»Ist Ihre Hoheit die Fürstin de la Roche zu sprechen?«
Der Portier starrte den mit dem Mantel Vermummten an, nicht wissend, was er aus ihm machen sollte.
»Es ist gleich eins«, sagte er nur, »Ihre Hoheit schlafen natürlich.«
»Natürlich? Gebt ihr diesen Brief!«
»Und wenn sie schläft?«
»Wird sie geweckt! Vorwärts!«
Der Portier schickte mit dem dargereichten Briefchen einen wachehabenden Diener ab, und das schnellstens.
Die Sache war die, dass die Fürstin, mit Respekt zu sagen, die Hosen anhatte, und... auch mit ihrem einzigen Zahne und ihren vielen Knochen hatte sie ihre Launen. Mindestens gefiel sie sich in Kapricen, und der immer aus dem letzten Loche pfeifende Ehegemahl, obgleich er noch viele Jahre leben und alle seine Pflichten erfüllen konnte, hatte überhaupt nichts zu sagen.
»Ihre Hoheit warten; bitte, Eure Exzellenz möchten nur folgen«, meldete der zurückgekehrte Diener atemlos, dem nächtlichen Besuch irgendeinen hohen Titel gebend.
In dem Boudoir, dessen Pracht kaum zu beschreiben wäre, befand sich die Fürstin, angetan mit einem nicht minder prächtigen Schlafrock, dessen Goldstickerei und sonstiger Besatz aber nicht die Hässlichkeit seiner Besitzerin zu verbergen vermochte, so wenig wie es ihr geholfen, dass sie wenigstens erst ihre Haare etwas geordnet hatte, und zwar wirklich schwere, blauschimmernde Flechten, die jeder anderen zur höchsten Zierde gereicht hätten. Nur bei dieser Ruine nützte alles nichts mehr.
Wenn sie sich im Spiegel besah, jetzt ohne Puder und Schminke — sie musste vor sich selber erschrecken.
Sie streckte dem Eintretenden... nicht ihre Hand, sondern vorläufig nur ihren langen, einzigen Zahn entgegen.
»Herr Graf, was führt Sie zu mir?«, flüsterte sie mit allen Zeichen der Angst.
»Können wir hier ungestört sprechen?«
»Das wohl — sonst würde ich gar nicht wagen, Sie so anzureden — Sie sind mit dem Bannfluch belegt!«
Ja, das war heute Nachmittag öffentlich geschehen, trotz alledem, und die Mexikanerin war natürlich eine gute Katholikin.
»Erkennen Sie mich denn?«
»Nein, das nicht — Sie sehen vollkommen anders aus — aber was ist Ihnen denn unmöglich? Sie könnten ebenso gut zu mir als kleines Mädchen kommen — nicht wahr, Sie können eine vollkommen andere Gestalt annehmen?«
»O ja, es wäre mir möglich«, bestätigte der Graf bescheiden.
»Aber wer anders als Sie kann mir denn diese Zeilen schreiben?«
»Nun, wenn ich so unmöglich erkannt werden kann in dieser Gestalt, die ich jetzt angenommen habe, wenn auch nicht die eines kleinen Mädchens, so hat es ja also gar keine Gefahr auf sich. Geben Sie mir zunächst den Brief zurück.«
Der Graf ließ das Briefchen, welches bei einer Unvorsichtigkeit zum Verräter hätte werden können, in seiner Hand spurlos verschwinden.
»Der heilige Vater ist außer sich gewesen, dass der Kardinal Luigo Sie gleich freigegeben hat«, fuhr die Fürstin fort.
»So sehr außer sich wird er wohl nicht gewesen sein.«
»Ich versichere Sie...«
»Nein, das stände diesem Manne gar nicht.«
»Der Kardinal ist in Ungnade gefallen.«
»Das glaube ich schon eher, das ist etwas ganz anderes.«
»Der heilige Vater hat Sie mindestens in Gefangenschaft behalten wollen, er hätte es darauf ankommen lassen.«
»Besser, dass der Kardinal nachgegeben hat, der Papst wird das schon noch einsehen.«
»Ja, was für ein schwarzes Piratenschiff ist das eigentlich?«
»Sie werden es sehr bald erfahren.«
»Ich? Wann?«
»Wollen Sie nicht erst den Zweck meines nächtlichen Besuches erfahren?
»Ja doch, verehrtester Graf.«
»Bis zu unserem Termin sind nur noch drei Wochen, Durchlaucht.«
Der freudige Schreck zuckte dem klappernden Gerippe durch alle Knochen bis in die Spitzen der Krallenfinger.
Dabei blickte sie zufällig in den Spiegel und... die Freude schwand, nur der Schreck blieb, als sie ihr Spiegelbild den einzigen Zahn fletschen sah, und was nun sonst noch alles hinzukam.
»Herr Graf, Sie sind ein wunderbarer Mann — Sie sind wahrhaftig ein mit übernatürlichen Kräften begabter Zauberer — ich habe ja mit eigenen Augen genug der Wunder von Ihnen gesehen — ich zweifle nicht im Geringsten daran... aber was für Hoffnungen Sie mir da gemacht haben — und das immer wieder...«
»In drei Wochen, genau am 3. September, wird sich mein Versprechen erfüllt haben.«
Die Freude kehrte wieder, schon mehr Verklärung, wenn auch noch mit einigem Zweifel vermischt.
»Daun — dann — werde ich — die — ge — ge — feiertste Schönheit von Rom sein?«
Es war ihr schon schwer genug geworden, und sie hätte es auch sicher nicht herausgebracht, wenn sie dabei in den Spiegel geblickt hätte.
»Mein Wort darauf.«
»Mit — mit — allen...«
Sie genierte sich doch, es auszusprechen. Von ihren Zähnen, die sie einst besessen, durfte niemand anfangen, der hatte es bei ihr verspielt.
»Die bewundertste Schönheit Roms. Kann ich mehr sagen? Aber, wie ich schon öfters betonte: Dazu muss ich Sie erst vierzehn Tage in die Kur nehmen. Es ist eine richtige Verjüngungskur.«
»Ja so nehmen Sie mich doch!«, jubelte die Fürstin schon.
»Wohlan, die Zeit beginnt jetzt auch zu drängen. Aber die Kur muss unter meiner ständigen Aufsicht ausgeführt werden.«
»Ich bin bereit dazu.«
»Nun werde ich aber nicht mehr im Kirchenstaat geduldet.«
»So gehen wir außerhalb.«
»Auf mir ruht der Bannfluch...«
»Ach, da finden wir schon ein sicheres Plätzchen, und wenn es auch bei einem der Hölle verfallenen Ketzer ist.«
»Nein, Durchlaucht, und nun hören Sie gleich meine Bedingung: Sie müssen zu mir an Bord des schwarzen Schiffes kommen.«
Wieder ein ziemlich großer Schreck.
»Auf das Piratenschiff?!«
»Es ist gar kein Piratenschiff.«
»Sondern?«
»Sie werden es erfahren. Jedenfalls ein ganz harmloses Schiff.«
»Und es gehört Ihnen, nicht wahr?«
»Woraus entnehmen Sie das?«
»Nun, schon der Name — oder vielmehr kein Name — eben ›Namenlos‹ — wie unser Bund — und wie es Ihnen zu Hilfe kam — und über welche sonstige Hilfsmittel Sie wunderbarer Mann sonst noch verfügen mögen... ganz Rom, alle Welt weiß ja, dass dieses schwarze Schiff Ihnen gehört, wenn es auch vom Himmel herabgekommen zu sein scheint.«
»Sie sagen es«, bestätigte der Graf unbefangen.
»Es ist wirklich vom Himmel herabgekommen?«, flüsterte die Fürstin ganz erregt. »Andere freilich behaupten lieber, es stamme aus der Hölle, dort hätten Sie es inzwischen vor Anker liegen lassen.«
»O nein, so war meine Bestätigung nicht gemeint«, lächelte der Graf. »Ich meinte: Dieses Schiff ist wirklich mein Eigentum. Und wollen Sie auch dann nicht an Bord mein Gast sein?«
»O gewiss, das ist dann ja etwas ganz anderes! Wo soll ich mich an Bord begeben?«
»Davon wollte ich soeben anfangen. Sie kennen doch Massola?«
»Wer kennt nicht den Badeort Massola!«
»Wohlan, so seien Sie heute über drei Tage in Massola. Eine genauere Zeit will ich nicht bestimmen. Sollten Sie kein schwarzes Schiff ankommen sehen, so doch ein schwarzes Boot...«
»Sie können das ganze Schiff unsichtbar machen?«, wurde naiv wie immer gefragt; und wenn sich der Graf selbst unsichtbar machen konnte, warum schließlich nicht auch ein ganzes Schiff? Andere Menschen hatte er in seinen Vorstellungen auch wirklich schon unsichtbar gemacht.
»Das Schiff könnte weit draußen liegen bleiben, ich meine, ein großes, schwarzes Boot wird wohl genügen, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Oder haben Sie in Massola eine bestimmte Wohnung?«
»Sogar meine eigene Villa, die Villa Pamperi.«
»Wohl, dann werde ich Sie von dort abholen, wahrscheinlich bei Nacht.«
»Ich werde die ganze Nacht wachen, heute über drei Tage, nicht wahr?«
»Heute über drei Tage, den heutigen schon als voll gerechnet. Und nicht wahr, Sie werden nicht über die erwartete Ankunft unseres Bootes sprechen?«
»Mit keinem Worte, denn ich weiß schon, dass Sie davon nur Unannehmlichkeiten haben könnten, obgleich man Ihnen, allmächtiger Mann, ja im Bösen gar nichts anhaben kann. Und in vierzehn Tagen bringen Sie mich wieder an Land?«
»Am 3. September werden Sie wieder in Rom sein.«
»Als — als — als —...«
Sie wagte es wiederum nicht auszusprechen, hätte dabei unbedingt in den Spiegel schielen müssen, und es wäre gar zu schrecklich gewesen.
»Als die bewundertste Schönheit Roms.«
Der Graf, der sich gar nicht gesetzt, hatte sich schon wieder der Tür zugewandt.
»Sie sind hier doch durch nichts weiter gebunden?«, fragte er noch, an der Türe zögernd.
»Durch gar nichts.«
»Ihr Gatte ist...«
»Mein Mann hat überhaupt gar nichts zu sagen«, erklang es in dem Tone zurück, in dem eine Frau so etwas sagt — besonders wenn sie nur noch einen Zahn hat.
»Ich meine, Ihr Herr Gemahl...«
»Wird sich sehr freuen, wenn er mich so wieder sieht, wie er mich vor zwanzig Jahren geheiratet hat. Denn ich war wirklich ein Bild von einem Mädchen — Sie kennen ja wohl das Bild. Apropos, Gräfchen — eine Ausnahme können Sie mir gegenüber doch einmal machen — mir noch einmal die Zukunft prophezeien, nur in einer Kleinigkeit — bitte, bitte.«
»In welcher Kleinigkeit?«, kam ihr der Graf entgegen, der ja schon ganz genau wusste, um was es sich handelte.
»Sehen Sie, wenn ich wieder jung und schön werde — und — mein Mann ist doch schon sehr alt — und... Sie wissen schon, was ich meine...«
Verschämt fletschte sie ihren Zahn.
»Wann Ihr Gatte Sie als Witwe zurücklässt?«
»Wenn Sie es gleich so erraten...«, wurde noch verschämter geflüstert.
»Ich habe Ihnen nicht umsonst noch drei Tage Zeit gelassen. Denn ich könnte Sie ja auch gleich mit an Bord nehmen, selbstständig genug, um sofort mitzukommen, gleich in der Nacht, sind Sie ja.«
Die Mexikanerin hatte gleich etwas herausgehört, sie hob lauschend den Kopf, auf den sie doch nicht gefallen war.
»Wie? Wozu geben Sie mir noch die drei Tage Frist?«
»Ich denke, in drei Tagen ist wohl ein Begräbnis mit allen Feierlichkeiten beendet, dann haben Sie auch sonst alles schon reguliert.«
»Schon in drei Tagen?!«, erklang es immer hoffnungsvoller, wie sich das ganze Gesicht verklärte, soweit das möglich war. »In drei Tagen endlich wird mein innigstgeliebter Mann von seinen grenzenlosen Schmerzen erlöst sein?!«
»Hat er denn solch grenzenlose Schmerzen?«
»Jedes Mal, wenn er niest, tut ihm alles im Innern und sogar der Kopf weh.«
Der Graf, die Klinke in der Hand, zog die Uhr.
»Wann haben Sie Ihren Gatten zuletzt gesehen?«
»Beim Nachtessen.«
»Wann war das?«
»Halb elf standen wir vom Tisch auf, er begab sich sofort zu Bett.«
»So werden Sie Ihren Gatten tot im Bett finden, halb zwölf ist er verstorben. Aus Wiedersehen in Massola.«
Der Graf sprach und hatte das Boudoir verlassen.
Er begab sich in seine ehemalige Wohnung zurück, den Weg über die Klostermauer nehmend, ohne in der Stockfinsternis von den beiden Wächtern bemerkt zu werden, die neben den ausgeräumten Möbeln Wache halten mussten.
Auch unten im Keller war schon alles ausgeräumt worden, was der Graf bezeichnet hatte. Zum Beispiel auch der Schreibtisch, der als Lift diente oder doch auf der betreffenden Plattform stand, der ja aus der oberen Möblierung stammte.
»Diesen darf man nicht hier unten finden, wenn man doch einmal hier eindringt«, erklärte der Graf.
»Es soll keine Explosion mehr erfolgen, wie Sie früher wollten, sobald jemand eine gewisse Stelle betritt?«, fragte der Kapitän.
»Nein, ich mag kein Menschenleben opfern, wenn es nicht mehr nötig ist, so wie es früher nötig gewesen wäre, um mich zu sichern.«
»Es gibt hier unten aber doch noch andere möblierte Räume, wie Sie uns erzählten.«
»Die mögen bleiben, mögen gefunden werden. Die waren schon vor meiner Zeit hier, die Entdecker mögen nach einer Erklärung suchen, meinethalben auch den ganz richtigen Schluss ziehen, dass ich sie benutzt haben könnte. Kam die Leiche gut hinaus?«
»Sie ist wohl untergebracht im Boot.«
»Dann ist noch dieser Raum hier auszuräumen.«
Sie durchschritten das ehemalige Laboratorium, dessen Regale einst wie in einer Apotheke mit zahllosen Büchsen und Flaschen besetzt gewesen waren, jetzt waren selbst die Regale schon entfernt, nichts als ein leerer Raum, der Graf öffnete durch einen geheimen Mechanismus eine andere Tür, ein kleines Gewölbe zeigte sich, das wir den Grafen noch nicht haben benutzen sehen.
Die Einrichtung dieses Raumes wäre auch schwer zu beschreiben. Die Hauptsache darin war ein Arbeitstisch, eine Feilbank, aber alles ganz niedlich, mit Werkzeugen, wie sie der Feinmechaniker und Uhrmacher benutzt, und doch wieder so ganz anders. Abfallspänen nach musste der Graf hier in Elfenbein arbeiten, zur Bearbeitung dieses Materials gehört aber wohl auch eine Drehbank, welche fehlte, und dann wieder waren andere Instrumente vorhanden, die sich gar nicht erklären lassen.
Der Graf packte einige Elfenbeinsächelchen, deren Zweck aber dem Aussehen nach ganz unbekannt war, selbst sorgfältig ein, dann wurde diese ganze Werkstatt ebenfalls abgebrochen und ins Boot getragen.
Während die Matrosen hiermit noch beschäftigt waren, entfernte sich der Graf noch einmal, kehrte mit einer jungen Frau und einem Kinde zurück.
Dann begaben sich alle in den vollbepackten Kutter, der aber noch immer eine ganz andere Last getragen hätte, und außerdem türmte es sich in dem hochbordigen Fahrzeug auch noch nicht auf, und als das schwarze Boot bei der Durchfahrt durch das Wassertor erblickt wurde, wagten die Zollbeamten es gar nicht erst anzurufen.
So gewann es wieder den offenen Strom und auch bei Nacht noch das freie Meer, wo es von dem schwarzen Schiffe aufgenommen wurde, und kein Mensch ahnte, dass der Graf von Saint-Germain aus seinem unterirdischen Reiche, von dem man ja ebenfalls nichts wusste, ausgezogen war.
Kapitän Morphin hatte beobachtet, wie Axel, der die Ankunft des schwarzen Kapitäns nicht hier oben hatte erwarten können, mit dem Boote sofort nach dem Schiffe genommen worden war, hatte das sehr merkwürdig gefunden, aber nichts daran ändern können, war dann auch noch der durch Flaggen signalisierten Bitte nachgekommen, das Pferd des Depeschenreiters an den Hafen zu bringen — dass aber dann sein Freund Axel abritt und das schwarze Schiff absegelte, ohne noch einmal wiederzukommen, das war ihm doch zu toll gewesen.
»Teufelskerl und Teufelsschiff, ist denn das Land- oder Seeroutine?!«, fluchte er. »Ist das von einem Depeschenreiter oder von einem Schiffe Anstand, sich so auf englische Weise zu verabschieden? Was hast du zu grinsen, Sam? Französischen Abschied, meine ich natürlich. Wenn ich englisch sage, dann meine ich allemal französisch, wenigstens in solch einem Falle. Nun ist's aber genug, jetzt will ich zeigen, dass ich der König von Palo bin. Antrrrreten zur Musterung!!!«
So brüllte der alte, nackte Kapitän, der noch immer mit seinem Schleier um die Lenden kokettierte, und die 24 Diener versammelten sich um ihren König.
Der König entließ sein Volk, wenigstens 19 von den 24. Es waren dies meist Italiener aus Palo, die hier oben wenig mehr zu tun gehabt hatten als Pferde zu putzen und zu füttern oder auf die sonstigen Tollheiten des Burgherrn einzugehen. Die Entlassenen wurden ausgezahlt, mussten sofort ihr Bündel schnüren und über die Zugbrücke abmarschieren.
»Und sprecht mal beim Bürgermeister mit vor«, rief er ihnen noch nach, »er soll mal heraufkommen, aber sofort, und wenn ich ihm erst durch einen Gesandten eine Einladung zuschicken muss. dann steht heute bei Sonnenuntergang in ganz Palo kein Stein mehr über dem anderen.«
»So, nun sind wir hübsch allein, der Kriegszustand ist erklärt, nun mögen die Franzosen kommen, wir wollen auch ohne den Depeschenreiter mit ihnen fertig werden«, wandte er sich dann an die zurückgebliebenen fünf Mann.
Es waren dies also zwei Engländer, ein Deutscher, ein Norweger und ein Neger, lauter Individuen, die so beim ersten Anblick durchaus keinen vertrauenweckenden Eindruck machten. Ein vollkommener Mensch war keiner unter ihnen — und das zwar körperlich gemeint, nicht moralisch, das wäre auch zu viel verlangt. Dem einen Engländer fehlte das linke Auge, dem Norweger das rechte, der Deutsche hatte an der linken Hand nur einen einzigen Finger, dem anderen Engländer fehlte das rechte Ohr, und der Neger hatte gar keine Ohren mehr, und zerfetzte Gesichter hatten sie überhaupt alle.
Ja, es war eine auserlesene Gesellschaft, die Kapitän Morphin oder der jetzige König von Palo als seine Ritter und Vasallen um sich versammelt hatte. Jedenfalls waren sie alle Seeleute, das sah man ihnen gleich an, und seinen Mann stand jeder, vielleicht auch seine zwei bis vier Männer.
Sonst wollen wir sie jetzt nicht näher beschreiben, wir werden sie nach und nach kennen lernen.
»August von Burgund, wappne deinen König zum Streite, und du, Sam, du gehst in die Kemenate, und sobald der Schuft von Bürgermeister den Burghof betritt, fängst du zu singen an: Wenn ich ein Vöglein wär'...«
So erhielt jeder seinen Auftrag zugewiesen, und sie trennten sich.
Wir begleiten Sam, den Neger. Es war ein ganz riesenhafter schwarzer Bursche, aber nur oben. Neger haben bekanntlich durchweg sehr kurze untere Extremitäten, das heißt Beine, und darin war Meister Sam ein Repräsentant seines Geschlechtes. Der Oberkörper gehörte einem Riesen an, die Beine einem Zwerge, und außerdem waren sie auch noch stark nach außen geschweift. In dieser Hinsicht war er ein menschlicher Dackel, der auf den Hinterbeinen steht, und dazu kam nun noch, dass er, während er die Arme eines Herkules besaß, überhaupt gar keine Schultern hatte, diese muskulösen Arme schienen am Halse zu sitzen, und wenn er so mit geschlossenen Hacken dastand, glich er ganz einer Null, auf die oben ein langer Strich gesetzt ist, also so ungefähr dem Zeichen, welches die Astronomen für den Planeten Mars haben, nur oben ohne Widerhaken, weil die Ohren fehlten.
»Ay, ay, Massa Käpten«, hatte dieses Monstrum von einem Neger geantwortet, mit einer so tiefen Stimme, dass gegen sie ein normaler zweiter Bass noch ein Kinderstimmchen zu nennen war, dabei von grunzenden und schnalzenden Kehllauten begleitet, und er begab sich auf den ihm zugewiesenen Posten.
Es war dies dasjenige Zimmer der Prinzessin, in dem sie bis vorgestern jeden Morgen und Abend Toilette gemacht hatte, dessen Fenster nach dem Hofe hinausliefen.
Seltsam war es, dass in diesem sonst aufgeräumten Toilettezimmer auf einem Stuhle eine große Schüssel mit Mehl stand, seltsam war es ja schon, was der Kapitän zu dem Neger gesagt hatte — doch hier war ja überhaupt alles seltsam, und die Hauptsache war nur, dass Sam wusste, was er zu tun hatte. Er machte Toilette, goss Wasser in das Waschbecken, das vorgestern noch die schöne polnische Prinzess benutzt hatte, tauchte seine pechschwarze, ohrenlose Galgenphysiognomie hinein, und als das Wasser noch daran herunterlief, tauchte er dasselbe schwarze Gesicht schnell in den Mehltopf. Als er den Kopf wieder hob, war das schwarze Gesicht natürlich weiß geworden.
Hierauf drapierte er um seinen schulterlosen Oberkörper einen weißen Schleier, der auch das schwarze, wollige Haar verhüllen musste, ordnete alles vor dem Spiegel, sich wohlgefällig betrachtend, und als er mit sich zufrieden war, erscholl auch schon die Brückenglocke, welche die Ankunft des gehorsamen Bürgermeisters von Palo verkündete.
Schnell zog der im Gesicht weißgepuderte Neger auch noch weiße Handschuhe an, die ihm bis an die Ellenbogen gingen, nahm von der Wand eine Laute, setzte sich an das offene, nach dem Hofe führende Fenster, und so, eine graziöse Stellung einnehmend, begann er die Laute zu schlagen und dazu zu singen: ›Wenn ich ein Vöglein wär', flög' ich wohl übers Meer, flög' ich zu dir...‹
Und wie nun dieser Kerl sang! Nicht etwa mit seinem grunzenden und schnalzenden Primaprimabass, sondern mit Fistelstimme, aber diese Fistelstimme war silberrein, wirklich ein ganz herrlicher, schmelzender Frauensopran, und er wusste auch wirklich das Lied ganz herrlich vorzutragen und auf der Laute zu begleiten.
Wozu dieser Mummenschanz? Nun, der Bürgermeister sollte eben glauben, die Sängerin dort oben am Fenster sei die Prinzess Polima, und es fiel ihm auch gar nicht ein, etwas anderes zu glauben. Und seit zwei Tagen hatten auch die anderen neunzehn Diener dasselbe geglaubt.
Die Sache war doch die, dass die Prinzess ihre Reise nach England ganz heimlich angetreten hatte, ganz heimlich war sie in der Nacht an Bord gebracht worden. Wie schon einmal ausführlich gesagt, war diese polnische Prinzessin doch ein gar zu kostbares Objekt, da hätte es sich verlohnt, auf ihr Schiff Jagd zu machen, und hatte es schon glücklich die Straße von Gibraltar passiert, so konnte noch immer ein Depeschenreiter nach Nordfrankreich oder Belgien geschickt werden, dann war noch immer Zeit, von dort aus ihr Schiff abzufangen.
So sollte also die ganze Welt glauben, die Prinzess befände sich noch immer hier in der Zitadelle von Palo unter dem Schutze des verrückten Burgherrn. Auch den neunzehn anderen Dienern, denen nicht recht zu trauen war, war ihre Abreise verheimlicht worden, die mussten dasselbe glauben, die Prinzess befände sich noch immer hier.
Allzu schwer war das auch nicht zu machen gewesen. Weiber gab es hier nicht, die Prinzess war schon immer von dem Neger bedient worden, höchstens dass ihn darin August von Burgund, der Deutsche, einmal abgelöst hatte. Und die Prinzess war bei Nacht so heimlich an Bord des weit draußen liegenden Schiffes gebracht worden, dass die anderen Diener, die nichts davon merken sollten, auch wirklich nichts davon gemerkt hatten, so wenig wie ganz Palo. Denn so etwas verstand doch dieser alte Schmugglerkapitän.
Nun hatte die Prinzess überhaupt hier immer ganz zurückgezogen gelebt, niemals ihre Zimmer verlassen, so fiel ihr Fehlen gar nicht auf, Sam brachte ihr nach wie vor die Mahlzeiten auf ihr Zimmer, fraß sie dort natürlich schnell selbst, der Burgherr machte ihr zu regelmäßigen Zeiten seine Visiten, der weißgepuderte Neger zeigte sich manchmal am Fenster und sang mit vortrefflich imitierter Frauenstimme Lieder zur Laute, so wie es auch die Prinzess manchmal getan hatte.
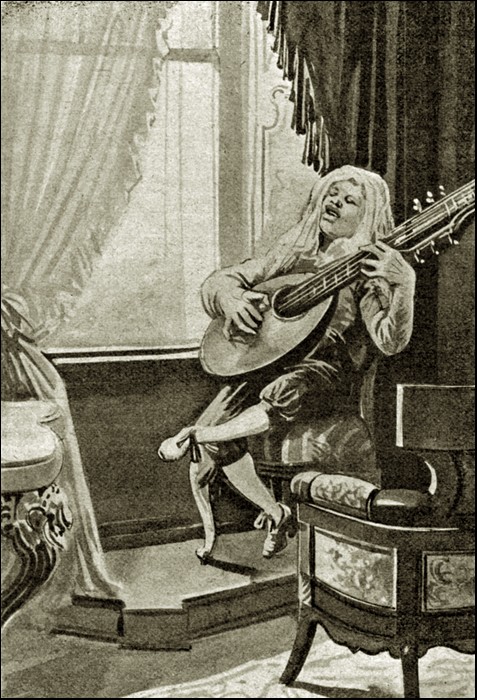
So tat er also auch jetzt, als der Bürgermeister von Palo kam. Der Burgherr hatte sich unterdessen schon in Wichs geworfen, das heißt, eine Rüstung angelegt, und zwar diesmal keine verrostete.
Wir wollen nicht ausführlich wiedergeben, was der Kapitän dem Bürgermeister mitteilte. Kurz, man habe ihn ja schon immer als Schutzherrn von Palo anerkannt, ihm sogar königliche Ehren erwiesen, so werfe er sich jetzt wirklich zum König von Palo auf, in zwei Stunden würde die französische Kriegsflotte erscheinen, die waffentragenden Männer von Palo hätten sie als Feind zu empfangen, und täten sie das nicht, so wären sie eben treulose Vasallen, der Kapitän würde ganz Palo zusammenkartätschen.
Was sollte der arme Bürgermeister tun? Mit diesem verrückten Kerl war ja gar nicht zu sprechen. Händeringend entfernte er sich.
So, nun konnte die französische Kriegsflotte kommen, der Burgherr war gewappnet, brauchte gar keine Vorbereitungen mehr zu treffen.
Mit was für Plänen sich der Kapitän trug, ist wohl ganz klar. Der alte Mann war eben des Lebens überdrüssig, und er wollte eines heroischen Todes sterben, von dem noch die ganze Welt sprechen sollte. Gleichzeitig brachte er dadurch ja dem Lord Moore das größte Freundschaftsopfer. Hinwiederum war er dadurch, dass man meinen musste, er habe die polnische Prinzessin bei sich, ja auch geschützt. Die französischen Schiffe würden doch nicht so ohne Weiteres die Mauern beschießen, hinter denen sich die Schwester der französischen Königin befand.
Mit einiger Wehmut nur blickte der alte Held hinab in den Hafen, in dem seine Schiffe lagen. Freilich waren das meistenteils nur armselige Boote, phantastisch herausgeputzt, mit denen er in seiner Phantasie oder auch in halber Wirklichkeit bisher immer ›Seeräuber‹ gespielt hatte. Aber auch ein recht stattlicher, zweimastiger Schoner — heute würden wir ihn Jacht nennen — befand sich darunter, auf dem der Kapitän noch in seinen alten Tagen so schöne Zeiten verlebt hatte.
Diese seine Jacht, an der sein ganzes Herz hing, musste er dem Feinde opfern, und wenn dieser sie nicht zusammenschoss, so tat er es selbst.
Richtig, nach zwei Stunden tauchten am westlichen Horizonte zahlreiche Segel auf, und ehe die Sonne sank, beleuchtete sie drei Fregatten, vier hochbordige Linienschiffe und sechs kleinere Fahrzeuge, von denen zwei nach Süden gingen, während sich die anderen noch im neutralen Wasser, außerhalb jeder Kanonenschussweite, vor Anker legten.
So brach die finstere Nacht an. Draußen leuchteten die Bordlichter. Der neue Tag kam, und nichts geschah.
Wir wollen es auch sonst kurz machen. Zwei Tage vergingen, und die Kriegsflotte blieb ruhig draußen vor Anker liegen, signalisierte nicht, schickte keinen Parlamentär ab, verhielt sich ganz passiv.
Kapitän Morphin wusste nicht, was er davon denken sollte. Er selbst konnte auf diese Weise den Kampf nicht eröffnen. Am zweiten Tage, an dem sich der Wind gedreht hatte, kam einer der Avisos zurück, der doch jedenfalls in Rom respektive in Fiumicino gewesen war. Dort hatten unbedingt diplomatische Verhandlungen stattgefunden. Aber der Burgherr erfuhr nichts davon. In Palo kamen auch Reiter an und gingen wieder, aber den Burgherrn ließ man nichts wissen, was für Verhandlungen da gepflegt wurden, und da man ihn so ignorierte, war er auch zu stolz dazu, einen Boten hinabzusenden, so furchtbar es ihn auch wurmte.
Am dritten Tage endlich lichteten die französischen Kriegsschiffe die Anker und gingen nach Süden von dannen, ohne sich wieder blicken zu lassen.
»Hölle und Teufel!«, fluchte der alte Kapitän. »Ist das eine ehrliche Kriegführung?!«
Ja, es wurmte ihn furchtbar, dass man ihn so gänzlich ignorierte.
Dabei war auch ein großes Rätsel verknüpft. Sollte man denn die polnische Prinzessin, die Schwester der französischen Königin, hier wirklich so ruhig sitzen lassen? Nicht einmal ein Parlamentär wurde geschickt?
Schon wollte der Kapitän ein Signal aufziehen, das den Bürgermeister heraufbeorderte, als ein Reiter erblickt wurde, der nach der Rampe zu hielt und in dem man Axel erkannte.
»Nun, bin ich noch nötig, die Zitadelle verteidigen zu helfen?«, war sein erstes Wort, als er sich aus dem Sattel schwang.
»Was ist da in Rom zwischen den Federfuchsern ausgemacht worden?«, fragte Morphin grimmig.
»Ganz einfach: Es sind Gesandte von Neapel und Genua gekommen, man ist sich einig geworden. Der Freihafen Palo ist dem Kirchenstaate zugesprochen worden, und damit ist diese Geschichte erledigt.«
»Das lasse ich mir nicht gefallen, ich, ich bin der König von Palo!!«, brauste der Burgherr auf.
»Bah, alter Junge, mache keine Flausen. Alles hat seine Grenzen, hier auch deine Komödienspielerei.«
»Dann bombardiere ich die Stadt!«
»Weswegen denn? Was haben dir denn all diese braven Bürger mit ihren Frauen und Kindern getan, dass du ihre Heimstätten in Trümmer legen willst?«
Mit finster abgewandtem Gesicht presste der Alte die Lippen zusammen.
»Verflucht, dass du recht hast!«, brummte er dann, sich hiermit nur ein allerbestes Moralitätszeugnis ausstellend.
»Du bist und bleibst hier einfach Besitzer einer burgähnlichen Villa«, fuhr Axel fort.
»Willst du mich auch noch foppen?!«, stieß der alte Seebär wild hervor.
»Foppen wieso? Doch lassen wir das. Und ehe ich dir einen Vorschlag mache, immer noch etwas anderes: Hast du das schwarze Schiff wieder einmal gesehen?«
»Nein.«
»Jetzt möchte ich zu fluchen anfangen. Seit drei Tagen liege ich auf der Lauer, um mich irgendwie an Bord dieses rätselhaften Schiffes zu schmuggeln, und es ist nicht zu erblicken. Dabei aber treibt es sich immer hier herum. Vor drei Tagen, als es hier war, ist es... du weißt doch, was unterdessen mit dem Grafen passiert ist?«
»Nein, was denn?«
Morphin wusste wirklich gar nichts, Axel erzählte alles, soweit er konnte. Der alte Kapitän war höchlichst erstaunt.
»Der schwarze Kapitän hat sich den Grafen also aus der Gefangenschaft herausgeholt. Dabei wusste dieser gar nichts von einem schwarzen Schiffe, das ihm zu Hilfe kommen könnte. Er ging an Bord, mich zurücklassend, obgleich, schien mir, nicht mit seiner Absicht. Das gespenstische Schiff ging auf und davon. In derselben Nacht aber passierte das südliche Wassertor ein großes, schwarzes Boot, in dem sich auch der Graf befand.«
»Er gab sich zu erkennen?«, fragte Morphin, sich immer mehr für diese Sache interessierend.
»Ja, er nannte seinen Namen.«
»Und was wollte das Boot in Rom?«
»Weiß man nicht. Drei Stunden blieb es auf dem Tiber, innerhalb der Stadtmauern, dann kam es wieder heraus.«
»Und was hat es auf dem Tiber gemacht?«
»Weiß man nicht. Die Nacht war stockfinster. Nach drei Stunden fuhr es zurück durch das Südtor, verschwand.«
»Und inzwischen lag das schwarze Schiff im Hafen von Fiumicino?«
»Nein, das nicht. Oder es muss sich auch unsichtbar machen können. Aber die Hauptsache dabei ist, dass ich immer an der Küste herumspionierte, während sich das Boot in Rom befand. So entging mir wieder eine Gelegenheit. Es ist alles wie verhext, nichts will mir mehr glücken.«
»Hm, merkwürdig!«
»Und dann... weißt du, dass der französische Gesandte gestorben ist?«
»Ist er? Geht mich nichts an«, brummte der Alte verdrießlich, wohl vergessend, dass er ja die Witwe freien wollte.
»In derselben Nacht, da der Graf mit dem schwarzen Boote in Rom war. Die Fürstin de la Roche hat ihren Gatten mit allem Pomp begraben lassen, nach zwei Tagen begab sie sich nach Massola in ihre Villa, die sie dort hat — heute Nacht ist sie aus dieser verschwunden, spurlos, niemand weiß, wohin. Ich war vorhin in Massola sah und hörte die ganze Komödie mit an.«
Jetzt wurde der Alte doch aufmerksam.
»Du, der Graf hat die alte Schachtel doch wieder schön machen wollen — sollte der die auch mit an Bord genommen haben?«
»Das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Die in Massola wollen freilich nichts von einem schwarzen Schiffe gesehen haben...«
»Lord Walter Moore!!«, rief mit schallender Stimme in diesem Augenblicke einer der beiden Wächter, die mit Fernrohren ständig Meer und Land abspähten.
»Der hat es eilig«, meinte der Kapitän.
»Gestern Abend ist der Herzog von Malborough angekommen«, erklärte Axel, »Lord Moore hat ihm sein Portefeuille abgegeben, sich vom Papste verabschiedet. Soll sehr kalt dabei zugegangen sein. Der ist bereits jetzt auf dem Wege nach England, mich wundert nur, dass er nicht schon in der Nacht abgeritten ist. Jetzt will er sich wohl nur noch von dir verabschieden und dir sagen, dass du ein Narr bist, wenn du hier eventuell wirklich noch Widerstand leistest.«
Der Lord hatte die Rampe erreicht, und jetzt wurden die beiden stutzig, weil sie bemerkten, dass sein Pferd dem Zusammenbrechen nahe war und er es noch immer zum schnellsten Laufe antrieb.
»Der ist nicht in Reiseausrüstung!«, rief Axel.
»Und sieht auch sonst gar nicht danach aus, als wolle er schon jetzt nach London«, ergänzte der Kapitän.
Die Zugbrücke senkte sich. Einer der ersten, der dem Abspringenden entgegentrat, war der Neger Sam, wohl um das Pferd zu halten.
Es schien hier trotz aller sonstigen Disziplin doch sehr frei zuzugehen, oder eben: Wie der Herr, so's Geschirr, das heißt, die Diener waren auch schon ganz kuriose Käuze geworden.
»Endlich, o, du Geliebter meiner Seele!«, begann also der Neger mit Fistelstimme zu deklamieren, die Arme nach dem Lord ausbreitend, als wolle er ihn umarmen.
So hatte er den Lord zwar noch nicht empfangen, eben weil bisher noch andere Diener zugegen gewesen waren, die doch nicht wissen durften, dass dieser schwarze menschliche Dackel dort oben am Fenster immer die Prinzess imitierte. Dort oben aber mochten schon öfters solche Szenen vorgekommen sein, dieser englische Lord und Peer war ja gerade so einer, der auf jeden Scherz gern einging.
Jetzt aber war er nicht in solcher Laune, er stieß den Schwarzen zurück, dass dieser bald zu Boden gestürzt wäre.
»Zur Hölle mit dieser Komödie!!«, schrie er dabei.
Da erkannten auch die anderen, wie entstellt des Lords sonst offenes Gesicht war, und umsonst hatte er sein Pferd auch nicht halbtot geritten.
»Um Gott, Lord, was ist geschehen, was bringt Ihr für eine Kunde?«
Zunächst lachte der Lord grimmig auf.
»Du hast nicht mehr nötig, Morphium, dich unter den Trümmern deiner Zitadelle begraben zu lassen, wenigstens nicht meinetwegen. Du wunderst dich wohl, dass die französische Kriegsflotte so ruhig wieder abgesegelt ist? Weil sie hier gar nichts zu suchen hat.
Die Demonstration hat genügt, schnell sind sich die Rivalen einig geworden, Palo ist dem Kirchenstaate zugesprochen worden...«
»Ja aber...«
»Lass mich ausreden! Weshalb die Franzosen sich gar nicht um die polnische Prinzessin und Schwester ihrer Königin kümmern? Einfach weil sie wissen, dass, wenn Polima noch hier sein soll, nur ein Mummenschanz getrieben wird.«
»Was, das wäre bekannt geworden?!«, fuhr der alte Kapitän empor.
»Dich trifft keine Schuld, Morphium. Schon vor vier Tagen, gleich am zweiten nach der Abreise, ist der ›Salamander‹ von eben dieser selben französischen Kriegsflotte gekapert worden, Polima befindet sich bereits in Frankreich, vielleicht schon in Paris.«
Was das zu bedeuten hatte, war daraus zu erkennen, wie es der Lord mit so einem grimmigen Lachen hervorgebracht, und auch auf den alten Kapitän machte es einen furchtbaren Eindruck.
»Das ist nicht möglich!!«
»Dann weißt du's besser. Und warum soll es denn nicht möglich sein?«
»Von wem hast du's denn erfahren?«
»Von den französischen Offizieren, die jetzt in Rom sind. In letzter Stunde erfuhr ich's, in letzter Stunde ist es erst bekannt geworden, so lange wurde es als Geheimnis bewahrt, und die Matrosen durften nicht an Land. Jetzt ist es bekannt geworden, Admiral Royan selbst hat es mir vorhin mitgeteilt. Da bin ich hierher gejagt.«
»Aber Kapitän Rudyard sich fangen lassen, das ist's, was ich nicht begreife!«, ächzte Morphin.
»Es trifft ihn keine Schuld. Wer kann für Unglück? Außerdem liegt Verrat vor. Der ›Salamander‹ hatte ja wirklich Kriegskonterbande an Bord, für Amerika gegen Frankreich, und doch war er ja eben deshalb das beste Schiff, um meine Braut sicher nach England zu bringen, wohin der ›Salamander‹ zunächst wollte, und auf Kapitän Rudyard konnte ich mich doch auch sonst verlassen.
Am zweiten Morgen, in aller Frühe, brach das Ruder, ein Unfall, der doch auf dem besten Schiffe pausieren kann. Da aber tauchte auch gerade das französische Kriegsgeschwader auf, verlangte Auskunft, was für ein Schiff das sei. Mit gebrochenem Ruder war natürlich an keine Flucht zu denken. Kapitän Rudyard gab das Signalement. Die Franzosen gaben sich nicht damit zufrieden, vielleicht auch hatten sie schon ein verräterisches Zeichen erhalten. Eine Fregatte segelte heran. An Widerstand war doch so nicht zu denken. Die Fracht hatte Rudyard jetzt sowieso verloren, es handelte sich nur noch darum, Polima, die ich ihm als meine Braut ans Herz gelegt, zu retten. Er versteckte sie. Die Visitierer haben offenbar von einem verräterischen Matrosen des ›Salamanders‹ eine Mitteilung erhalten. Sie fanden die versteckte Prinzess gar zu schnell. Sie war instruiert, allein der französische Kapitän sagte ihr auf den Kopf zu, dass sie die entflohene Prinzess Polima sei. Da konnte sie es nicht leugnen. Sie kam an Bord der Fregatte, welche sofort zurück nach Marseille segelte. Jetzt ist sie für mich auf immer verloren!«
Während der letzten Worte war der Lord auf einen Poller gesunken, schlug die Hände vors Gesicht. Erst zuletzt brach sein ganzer Jammer hervor.

Mit größter Teilnahme betrachteten ihn die anderen, besonders Kapitän Morphin und der Depeschenreiter. Denn diese beiden wussten am allerbesten, dass der Lord seine Braut wirklich auf alle Zeiten verloren harte. Auf der einen Seite ein protestantischer Engländer, der in Ungnade gefallen war, dessen Titel daher gar nichts mehr zu sagen hatte, der seine Rolle einfach ausgespielt — — auf der anderen Seite eine polnische Prinzessin, aus Diplomatie fürs Kloster bestimmt, die Schwester der französischen Königin, jetzt dort am Hofe... es war die reine Unmöglichkeit, da noch eine Vereinigung zustande zu bringen, und auch mit einer listigen Entführung war da nichts zu machen, von Gewalt gar nicht zu sprechen.
»Und Kapitän Rudyard?«, fragte Morphin leise.
»Der ›Salamander‹ wurde von französischen Kriegsmatrosen besetzt, ist als Konterbandenschiff ebenfalls nach Marseille überführt worden.«
»Verflucht«, knirschte der alte Kapitän zwischen den Zähnen, »und diese Himmelhunde von Franzosen haben mir nicht einmal Gelegenheit gegeben...«
»Das schwarze Schiff!!«, rief da Axel mit ausgestreckter Hand.
Niemand hatte in der Zwischenzeit das Meer beobachtet.
Ja, da kam es, den Westwind voll in den schwarzen Segeln, herangerauscht, es war schon ziemlich nahe herangekommen, und der Anblick dieses rätselhaften Schiffes ließ im Moment alles andere vergessen.
»Da möchte man ja fast an den fliegenden Holländer glauben!«, rief der Lord, der es also zum ersten Male erblickte.
War es nicht fast merkwürdig, dass man sich zum ersten Male an den fliegenden Holländer erinnerte?
Nein, wir haben sehr wohl gewusst, was wir taten, als wir eine Vergleichung mit dem fliegenden Holländer bisher immer vermieden.
Die Sage vom fliegenden Holländer ist eine rein nordische. Unter Blitz und Donner auf furchtbar tobendem Meere und besonders in nebelhafter Verschleierung muss er dem Seefahrer erscheinen. Das sonnige Südeuropa hat niemals Raum für solch ein Gespensterschiff gehabt.
Nun waren hier ja allerdings auch nordische Seeleute, die es schon erblickt hatten, Engländer, Deutsche und sogar ein regelrechter Norweger, und sie hätten sich, besonders für damalige Zeiten, schon auf einer sehr, sehr hohen Stufe der Bildung befinden müssen, um nicht an einen fliegenden Holländer zu glauben — gewiss, alle diese verwetterten Seeleute, die hier versammelt, waren von der Existenz eines fliegenden Holländers fest überzeugt — aber einmal hielt jeden eine gewisse Scham davon ab, dies als erster so ohne Weiteres zu gestehen, und zweitens hatten sie sich von dem nordischen Gespensterschiffe schon ein ganz besonderes Bild gemacht.
Jetzt war einmal die Scham gebrochen, die so merkwürdig auf jedem Aberglauben lastet, mag dieser auch auf noch so ehrlicher Überzeugung beruhen, jetzt kam es einmal zum Durchbruch.
»Nein, der fliegende Holländer führt rote Segel«, riefen die sechs Mann der Burgbesatzung wie aus einem Munde, der Burgherr nicht ausgeschlossen, eben sowenig der schwarze Sam, der nämlich schon längst ein nordischer Seefahrer geworden war, und dann gab noch jeder einzeln seine Weisheit zum Besten: »Der fliegende Holländer hat nur drei Masten — und ist viel, viel kleiner — hat nur ein Dutzend Mann Besatzung — den sieht man auch nie im Sonnenschein, da verschwindet er«, und so fort.
»Hast du denn den echten fliegenden Holländer schon einmal gesehen?«, wandte sich Axel an den alten Kapitän.
»Ahem. Ich habe. Zweimal. That's a fact.«
»Wo denn das?«, musste Axel lachen, weil das gar zu merkwürdig herausgekommen war.
»Einmal bei den Lofoten, das zweite Mal, als ich Kap Hoorn umsegelte.«
Da haben wir's. Wenn der alte Kapitän log, so log er doch ganz logisch.
Norwegen und Kap Hoorn, das passt zusammen. Wer aber dem fliegenden Holländer im sonnigen Mittelmeere begegnen wollte, der würde Fiasko machen, und auch der wütendste Taifun der Südsee ist für das holländische Geisterschiff, einen ewigen Juden der See, kein passender Rahmen.
Für den Lord war der fliegende Holländer unterdessen schon längst wieder abgetan gewesen, sein Unglück erwachte wieder, er dachte an etwas anderes, was aber auch nur für seinen Aberglauben sprach, in dessen Bann sich der ehemalige absolute Freigeist hatte schlagen lassen.
»Und der Graf befindet sich an Bord!«, rief er mit offenem Jubel. »Er wird mir Rettung bringen!«
»Rettung, wieso?«, musste Axel fragen, der einzige, der noch dem Grafen von Saint-Germain widerstanden hatte.
»Er wird Mittel und Wege wissen, wie ich doch noch meine Polima wiederbekomme. Amen.«
Wahrhaftig, Lord Moore hatte ein Amen hinzugesetzt — ja, ja, es soll also geschehen.
Axel blickte den feierlich Sprechenden an — zuckte die Achseln und hatte keine Widerrede mehr.
Das Ziel des schwarzen Schiffes war der Hafen von Palo, das wurde jetzt ganz offenbar.
Aber dieser Hafen war für das mächtige Schiff wohl nicht tief genug, es ging noch draußen auf Reede vor Anker.
»Da, da, da, da, da!!!«, schrien die Seeleute, die hier versammelt waren und alles beobachteten, denen nicht das geringste Manöver entging.
»Bei Gott, es kann sich durch eine geheimnisvolle Kraft selbstständig bewegen, sogar direkt gegen den Wind!«, flüsterte der Lord, denn auch er war als Sportsman auf der See zu Hause.
Aber auch der Depeschenreiter, der wenig oder noch gar nichts vom Seewesen verstand, hatte es beobachtet, dank seiner Augen, denen nichts entging.
Während die Anker zum Herablassen bereit gemacht wurden, war das schwarze Schiff beim Segelreffen aus dem Wind gegangen. Die Bewegungen, die es dabei ausführte, kann man so natürlich nicht schildern. Ein Laie hätte dabei alles ganz selbstverständlich gefunden, höchstens über die elegante Gewandtheit gestaunt, mit der solch ein Koloss solche Drehbewegungen ausführen kann, wo ihn der Steuernde doch in der Gewalt haben muss.
Hingegen jeder wirkliche Seemann erkannte noch etwas anderes. Das schwarze Schiff hatte dabei eine Bewegung gemacht, noch etwas vorwärts fahrend, die unmöglich dem Gesetze des Beharrungsvermögens folgte. Es war durch eigene Kraft noch ein Stück vorwärts gegangen, sich dabei drehend. Und das war auch den Augen dieses Depeschenreiters nicht entgangen, die gewohnt waren, jede Kleinigkeit aufs Schärfste zu beobachten, die in Amerika unter indianischer Anleitung gelernt hatten, aus jedem niedergedrückten Grashalm Schlüsse zu ziehen, und schließlich war das doch ein Mann, der auch etwas vom Parallelogramm der Kräfte und anderen mathematischen und physikalischen Gesetzen wusste.
»Bei allen Göttern!«, rief er jetzt in grenzenlosem Staunen, dieses gar nicht zu verbergen suchend. »So habe ich damals doch nicht nur geträumt, was ich mir schon manchmal einreden wollte — dieses Schiff kann sich wirklich durch eigene Kraft bewegen!!«
»Ja, weil sich dieser Wundermann, weil sich der Graf an Bord befindet«, ergänzte Lord Moore in Begeisterung.
Axel sah ihn mit eigentümlichen Blicken an.
»Das tat dieses Schiff aber schon damals, als sich der Graf noch nicht an Bord befand.«
»Aber es ist sein Schiff...«
»Von dem er zuvor noch gar nichts gewusst hat«, unterbrach Axel mit einigem Spott.
»Doch, doch, er hat nur so getan, als ob er nichts davon wisse.«
»Na, meinetwegen«, lenkte Axel ein. »Selig sind, die da glauben, und ganz besonders, wenn sie dabei nicht einmal sehen und hören. Die Hauptsache ist schließlich, dass der Graf da wirklich kommt.«
Das schwarze Schiff hatte die Anker fallen lassen, ein Boot war schon ausgesetzt worden, mit raschen Ruderschlägen schoss es dem Hafen zu.
»Ob sich auch der Graf darin befindet?«, erklang es zweifelnd.
»Na, da sitzt er doch neben dem Steuernden!«, sagte Axel, der einzige, der kein Fernrohr vor dem Auge hatte.
Noch einmal brach unter den Versammelten ein Staunen aus, diesmal aber galt es den Augen dieses Depeschenreiters.
Ja, neben dem Steuernden saß noch ein anderer, ebenfalls in einen schwarzen Trikotanzug gekleidet — aber obgleich sie also alle Fernrohre benutzten, musste das Boot doch erst den Kai erreicht haben, ehe sie durch das Fernrohr erkannten, dass es wirklich die Gesichtszüge des Grafen waren, worüber allerdings hauptsächlich nur der Kapitän und der Lord urteilen konnten.
Was aber musste nun dieser Depeschenreiter für Augen besitzen, dass er von Anfang an so ganz bestimmt hatte behaupten können, es sei der Graf von Saint-Germain, der dort neben dem Steuernden saß!
Axel hatte es einmal selbst gesagt: er besäße Augen, die er wie Fernrohre auseinander- und wieder zusammenschrauben könne. Da musste auch wirklich etwas Wahres daran sein. Es gibt außerordentlich weitsichtige Menschen. Sie leisten in der Fernsichtigkeit Dinge, die ein anderer Mensch, der in solche Verhältnisse niemals gekommen ist, einfach für unmöglich hält. Man findet solche Personen am häufigsten unter Seeleuten und unter Beduinen, das heißt, überhaupt unter Wüstenbewohnern. Bei denen muss sich im Laufe der Zeit das Auge wohl ganz anders entwickeln, vielleicht ist es ja auch Vererbung. Die Bedingung, unter welcher solche enorme Weitsichtigkeit gedeiht, ist die, dass das Auge ständig Flächen überblickt, auf denen es keine Anhaltspunkte zur Abschätzung der Distanz findet. Das ist also hauptsächlich das Meer und die freie Wüste. Unter Bergbewohnern findet man ja auch scharfe Augen, aber doch kein solches Phänomen — und um ein Phänomen handelte es sich hierbei. Auch unter den Bewohnern von Wüsten, die hüglig sind, trifft man es nur als ganz seltene Ausnahme an. Eben endlose Flächen ohne jede Erhebung, wie im Innern der Sahara, oder wie schon die Libysche Wüste... oder wie das Meer. Was es unter den Seeleuten für närrische Distanzabschätzer gibt, davon wissen die Unteroffiziere in der Marine bei der Rekrutenausbildung ein Lied zu singen.
Es ist wirklich ganz, ganz merkwürdig. Nicht eigentlich, dass die Matrosen die Distanz direkt falsch abschätzen — vielleicht gerade das Gegenteil — aber sie sehen ganz anders. Wenn sie schießen sollen — die meisten haben ja noch gar kein Gewehr in der Hand gehabt — so melden sie vorschriftsmäßig: Unteranker abgekommen — sie haben tatsächlich den unteren Strich im Visier gehabt, aber die Kugel geht zwei Meter hoch über die Scheibe weg. Und besonders, wenn sie älter werden, so mit vierzig Jahren, leisten die Seeleute im Fernsehen ganz Erstaunliches. Aber für die Nähe sind sie fast blind, bei der für Weitsichtigkeit schärfsten Brille müssen sie die Schrift noch armweit mit zurückgeneigtem Nacken halten. Noch mehr aber findet man das bei Beduinen, bei denen das Auge im Kampfe ums Dasein alles bedeutet. Beispiele ihrer Fernsichtigkeit dürfen gar nicht angeführt werden, man würde sie nicht glauben. Da kommt kein Fernrohr mit. Und hier findet man für die Nähe fast wirkliche Blindheit.
Nun kommen aber Fälle vor, dass solch ein Seemann und öfters noch ein Beduine trotz der wunderbaren Weitsichtigkeit auch in der Nähe ganz scharf sieht. Solche bevorzugte Exemplare der Menschheit werden auch unter ihresgleichen als außergewöhnliche Phänomene angestaunt. Sie besitzen ein besonderes Auge, von Natur aus oder vielleicht auch durch Übung erzeugt, sie können ihre Linse mehr wölben, als das sonst bei jedem anderen Menschen der Fall ist.
Wir haben uns hierbei so lange aufgehalten, weil über so etwas wohl noch gar nichts geschrieben worden ist. Wir könnten auch noch weiter gehen, den okkultistischen Schriftsteller Baron Dr. Karl du Prel zitieren, welcher behauptet und ausführt, wie es überhaupt gar kein Instrument gibt, das von einem menschlichen Organ nicht übertroffen wird — freilich handelt es sich immer um bevorzugte Exemplare und richtige Ausbildung — dass Fernrohr und selbst Mikroskop immer nur Stümperei bleiben gegen das, was das menschliche Auge leisten kann, wenn es nur richtig trainiert wird, allein wir wollen es bei dieser Andeutung genügen lassen.
Nun, dieser Depeschenreiter hatte eben auch solche Augen, die er wie ein Fernrohr verschieben konnte, wie er sich wenigstens einmal ausgedrückt hatte.
Es war tatsächlich der Graf, der jetzt eben solch einen schwarzen Trikotanzug trug, wie die ganze Besatzung, ein breiter Schlapphut beschattete sein Gesicht.
»Er kommt, er kommt wirklich, und er wird mich auch aus diesem Unglück erretten!!«, jubelte Lord Moore abermals.
Axel wollte etwas entgegnen, schluckte es zurück.
Der Graf stieg aus dem Boote, kam die Rampe herauf. Selbst der Lord musste sich zurückzuhalten, dass er ihm nicht entgegeneilte. Aber auf dem Burghofe fand die Begegnung doch noch statt.
Der Graf, dessen edle, schlanke und dennoch so kraftvolle Gestalt durch das enganliegende Kostüm herrlich zum Vorschein kam, ging gleich auf den Lord zu.
»Mein armer Freund!«
Mit diesen Worten streckte er ihm die Hand entgegen.
»Sie wissen...?«
»Alles.«
»Ja, was kann Ihnen auch unbekannt bleiben?!«
»O doch, gar manches. Für gewöhnlich bin ich ja täglich nur eine Stunde in diesem Zustande des Hellsehens, und dann sehe ich auch nur das, wohin ich mit Absicht meinen Geist schicke.«
Also der Graf blieb sich nach wie vor konsequent, sprach über seine magischen Fähigkeiten nur noch freier als bisher, und die Folge davon war, dass Axel eine ärgerliche Bewegung machte.
»Aber Sie können Ihren Geist doch in einem Nu durch die ganze Welt schicken!!«, rief er in demselben Tone.
Ganz ruhig blickte ihn der Graf an.
»Wie meinen Sie das?«
»Na, ich kann mich doch auch nach Honolulu versetzen, und im nächsten Augenblick bin ich schon auf dem Monde.«
»So, können Sie das?«
»In Gedanken, meine ich natürlich.«
»Das Umherschweifen meines Geistes oder richtiger Astralleibes hat aber mit einem phantasierenden Denken gar nichts zu tun. Das ist etwas vollkommen anderes. Mein Astralkörper kann nur dorthin, wohin auch mein irdischer Leib kann. Die Sterne sind also ganz ausgeschlossen, so gut wie der Meeresgrund. Außerdem bedarf mein körperloser Geist zum Sehen und Hören derselben Zeit, wie sie der irdische Leib gebraucht. Verstehen Sie den Unterschied, lieber Freund?«
Axel hielt es für das Beste, sich gleich abzuwenden. Mit diesem Kerl war eben nichts anzufangen. Der wusste sich doch überall wieder herauszubeißen, und wenn er auch noch so fest schon in der Falle saß.
Doch bald sollte Axel sich ihm wieder zudrehen.
»Aber noch ist nichts verloren, lieber Freund«, wandte sich der Graf wieder an den Lord.
»Sie geben mir Hoffnung...?«
»Es ist sogar alles ganz, ganz anders gekommen, als Sie denken.«
»Ganz anders?!«
»Sie werden erfahren haben... nun?«
»Der ›Salamander‹ ist von der französischen Flotte genommen worden.«
»Und?«
»Eine Fregatte bringt meine Braut als Gefangene nach Marseille.«
»Nun, nicht gerade als... doch das bleibt sich ja gleich. Wie hieß die Fregatte?«
»Die ›Saverne‹.«
»Wo ist der ›Salamander‹ gekapert worden?«
»Hinter der Straße von Korsika und Sardinien.«
»Und wann geschah das?«
»Bereits vor vier Tagen — heute ist Sonnabend — also am Dienstag — in der Mittagsstunde.«
»Von wem haben Sie diesen Bericht?«
»Von französischen Offizieren — vom Admiral Royan selbst.«
»Er konnte Ihnen nichts anderes erzählen?«
»Was anderes noch?«
»Nein, er konnte auch nicht. Ihrer Meinung nach also könnte die Prinzess jetzt schon in Marseille sein.«
»Wahrscheinlich schon auf dem Wege nach Paris. Aber was haben Sie denn nur? So sprechen Sie doch nur!«
Aber bei diesem Manne war alles Berechnung. Ein Gaukler und Taschenspieler war er ja doch, trotz alledem und alledem, und er wusste sein Publikum zu behandeln. Jede Bewegung war bei ihm berechnet.
Jetzt, nachdem er den Lord und alle anderen so lange hatte zappeln lassen, brachte er es mit einem Schlage hervor.
»Auch die ›Saverne‹ ist genommen worden —von tunesischen Seeräubern.«
Ja, das war allerdings ein Schlag gewesen — so gleichmütig es auch der Graf gesagt hatte — wie ein Blitz aus heiterem Himmel hatte es gewirkt.
»Es — ist — nicht — möglich!«
»Wie ich sage. Oder halten Sie es für unmöglich, dass tunesische Seeräuber eine französische Fregatte nehmen können?«
Nein, daran zweifelte damals niemand. Das war damals noch alles möglich und noch viel mehr.
»Noch an demselben Tage, aber in der Nacht. In einem Schlupfwinkel der sardinischen Küste lagen tunesische Piraten versteckt, ein Dutzend ganz ansehnlicher Galeeren, auf Beute lauernd. Es herrschte dort Windstille. In der finsteren Nacht griffen die Piraten lautlos an, sie haben die unvorsichtige Fregatte mit einem Schlage überwältigt.«
Alles starrte fassungslos den Sprecher an. Nur der alte Kapitän hatte gleich seine eigenen Gedanken.
»Bravo, bravo!«, jubelte er. »Wenn ich so etwas höre, dann werde ich gleich wieder jung, und ich glaube, ich mache doch noch einmal mit.«
»Dazu ist jetzt die beste Gelegenheit, Herr Kapitän, ich würde Sie dazu schon aufgefordert haben.«
»Wozu, wozu??!«
Erst aber kam doch der Lord daran.
»Mein Gott, Polima ist doch nicht etwa in den Händen von arabischen Seeräubern?«, brach bei ihm der Jammer hervor.
»So ist es. Es kann ja gar nicht anders sein. Aber fürchten Sie nichts. Die Piraten wissen, wen sie gefangen haben, und behandeln die Prinzess danach. Mit dem größten Respekt...«
»Um ein hohes Lösegeld zu erpressen.«
»Selbstverständlich. Die Rudergaleeren, obgleich sie auch durch Segel unterstützt werden können, haben eine sehr widrige Fahrt gehabt, sind aber vor zwei Stunden glücklich an der tunesischen Küste gelandet. Weiteres weiß ich auch noch nicht.«
Der Lord hatte genug gehört.
»Gerettet, gerettet!«, jubelte er auf. »Polima ist noch nicht für mich verloren, sie wird doch noch mein!!«
Der Graf machte ein sehr ernstes Gesicht, als er den Jubelnden ansah.
»So Gott will«, sagte er ebenso ernst. »Und wollen Sie nicht dem danken, der diese Fügung zum Guten in ihrem Sinne veranlasst hat?«
So sprach der Graf, und da geschah etwas sehr, sehr Merkwürdiges, etwas, was nicht übergangen werden dürfte, denn es bildet vielleicht die Hauptsache dieses ganzen Buches, soweit dieses dazu bestimmt ist, den Charakter des Grafen von Saint-Germain zu schildern.
Vorher aber eine kleine Betrachtung. Es ist doch etwas ganz Merkwürdiges um das Beten. Die größten Philosophen, die scharfsinnigsten Denker haben es behauptet, erwiesen und begründet, nämlich dass das Beten eine unnatürliche Handlung ist, deren sich der gebildete Mensch — was dabei unter ›gebildet‹ zu verstehen ist, soll hier nicht erörtert werden, das weiß jeder allein — deren sich der gebildete Mensch schämt. Und so ist es! Leider, leider!! Aber man schaue nur mit offenen Augen um sich. Wer wagt es, auf offener Straße niederzuknien und Gott für etwas zu danken, was solch eines öffentlichen Dankes wirklich wert ist? Solch ein Fall kann doch einmal vorkommen. Man ist etwa unter einem Wagen hervorgeholt worden, ein Balken hätte einen bald erschlagen. Wer wagt da, auf der Straße niederzuknien? Oder ist es unbedingt nötig, dass man erst in sein Kämmerlein geht? Ist denn die Kirche nicht auch ein öffentlicher Ort? Nein, man schämt sich ganz einfach — man schämt sich, darüber kommt man mit ehrlichem Gewissen nicht hinaus.
Doch das ist nun ein extremer Fall. Es gibt viel einfachere. In ziemlich vielen Familien, in den reichsten wie in den ärmsten, wird doch noch ein Tischgebet verrichtet. Und zwar mit aufrichtigem Herzen. Von solchen Menschen, die das nur aus Angewohnheit tun, oder gar nur gewissermaßen aus Mode, vielleicht weil der altväterliche Stil des Speisezimmers auch ein Tischgebet erfordert, es passt eben zum Stile, und wenn der Hausvater nun gesprochen hat: Komm Herr Jesu, sei unser Gast — und gleich darauf klingelt ein armer Handwerksbursche, dann wird diesem die Tür vor der Nase wieder zugeworfen, wenn man nicht gleich nach dem Schutzmann ruft — von solchen frommen Menschen wollen wir hier nicht sprechen. Das sind moralische Lumpen.
Nein, solche, die ihr Tischgebet mit aufrichtigem Bewusstsein sprechen. Aber an einer öffentlichen Tafel, in einer fremden Gesellschaft oder im Restaurant tun sie es nicht. Oder sie beten höchstens ganz verstohlen.
Warum tun sie es nicht, warum beten sie höchstens ganz verstohlen? Weil sie sich schämen — weil sie sich schämen, man kommt darüber nicht hinaus. Ausnahmen bestätigen nur die Regel.
Das sind Tatsachen, die jeder manchmal zu beobachten die Gelegenheit hat. So mag sich auch jeder selbst dieses doch offenbar vorliegende Rätsel lösen. Der Schreiber dieses kann es nicht.
Aber ein anderes, nicht minder großes Rätsel ist gelöst worden, und zwar von dem deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer, wodurch er eben bewiesen hat, dass er der scharfsinnigste Denker vielleicht aller Zeiten gewesen ist.
Über etwas Tiefernstes, Hochheiliges darf man doch, wenn es ehrlich gemeint ist, offen sprechen. So sei es: Wie kommt es, dass jede Frau, die beim Zeugungsakt überrascht wird, fast vor Scham vergehen will, während sie die Folgen davon ohne Befangenheit, ja, oftmals geradezu mit Stolz zur Schau trägt?
Hast du, ernster Leser, dir schon einmal gesagt, dass hier ein Rätsel vorliegt? Die größten Philosophen haben diese Tatsache schon immer als Rätsel erkannt und sich mit seiner Lösung beschäftigt, ohne zum Ziele zu gelangen. Nur Schopenhauer ist es gelungen. Die Lösung dieses Rätsels ist eigentlich das A und das O der ganzen Schopenhauer'schen Philosophie, dadurch wird er fast noch über seinen Lehrer Kant gestellt — — —
Also, der Graf von Saint-Germain hatte den Lord Moore ermahnt, dem zu danken, der dies alles für seine Zwecke so gut gefügt hatte.
Und da geschah ein Wunder, welches, in richtigem Sinne betrachtet, alles weit übertrifft, was dieser Graf und andere Hexenmeister, ob sie nun Adepten oder Gurus oder Yogis heißen, je an Wundern geleistet haben.
Der Lord zuckte bei dieser Ermahnung zusammen, und der Mann, wirklich ein hochgebildeter Mann, der noch vor sechs Wochen wirklich der größte Freigeist gewesen war, er entblößte sein Haupt, kniete nieder und verrichtete ein stummes Gebet, angesichts dieser sechs mehr oder weniger rohen Seeleute.
Verwundert blickten diese auf den Knienden, und nicht nur verwundert, sondern auch mit einer gewissen Scheu. Hier ging etwas vor sich, was sie nicht begreifen konnten, obgleich sie sich gar nicht Rechenschaft geben konnten, was über ihre Begriffe ging.
Der einzige, der dieser Situation gewachsen war, der den Kern erkannte, wenn auch für ihn ein geheimnisvolles Rätsel, war Axel. In seinem Gesicht war das zu lesen, wie er in grenzenlosem Staunen bald auf den Knienden, bald auf den Grafen blickte, der mit gesenktem Haupte, wohl ebenfalls betend, dastand, und dieses grenzenlose Staunen steigerte sich nur immer mehr in dem bronzefarbenen, kühntrotzigen Gesicht.
Ja, dieser Depeschenreiter, dessen Tagebuch wir hier folgen, wovon noch später die Rede sein wird, war durch seine Bildung und besonders durch seine Charakterveranlagung unter vielleicht Hunderttausenden von Menschen der einzige, der hier ein Urteil fällen konnte, der tiefer schaute, und er erkannte den wahren Zauber, der von diesem Grafen ausging, nämlich wie in den Händen dieses Mannes jeder, der sich ihm einmal genähert hatte, wie weiches, knetbares Wachs wurde, dass er sogar den ganzen Charakter in einem Nu umformen konnte, und zwar auch ohne jenes rätselhafte Hilfsmittel, das wir heute Hypnose nennen.
»Amen«, sagte der Lord und erhob sich, und mit einem Ruck hatte auch Axel sein Staunen gebannt.
»Wann soll das geschehen sein?«, wandte er sich an den Grafen.
»Das Kapern der Fregatte durch die Piraten? Heute vor vier Tagen — am Dienstag — gegen Mittag.«
»Und wann sind die Piraten an der tunesischen Küste gelandet?«
»Vor zwei Stunden.«
»Woher wissen Sie denn das, Herr Graf?«
»Ich weiß es.«
»Darf ich nicht um eine etwas deutlichere Auskunft bitten?«, wurde der sonst so grobe Depeschenreiter einmal recht höflich, ließ freilich auch gleich Spott durchklingen.
»Vor zwei Stunden habe ich sie zuletzt erblickt.«
»Ach was, jetzt ist es doch erst gegen elf, und ich denke, Sie liegen immer nur zwischen 12 und l im Starrkrampf.«
»Das kann der Graf machen wie er will«, übernahm jetzt sogar der alte Kapitän Morphin in seiner Weise des Grafen Verteidigung, was ihm ganz merkwürdig stand. »In der Mittagsstunde ist er nur gezwungen, tot dazuliegen und seinen Geist auf Reisen herumzuschicken.«
»So ist es«, lächelte der Graf, welches Lächeln auch ganz angebracht war. »Und doch wieder nicht so einfach. Ich kann nur in Starrkrampf fallen, also hellsehend werden, wenn ich dazu disponiert bin. Vorhin war ich es.«
»Aaah sooo!«, machte der unverbesserliche Axel. »Da haben Sie also die Prinzess, respektive die Piraten unterdessen mehrmals beobachtet?«
»Woraus schließen Sie das?«
»Sie sagten, sie würde von den Piraten mit der größten Hochachtung behandelt.«
»Nun, das könnte ich ja auch erst vorhin beobachtet haben.«
»Nein, für mich ist noch ein dunkler Punkt dabei. Wenn Sie nun...«
»Genug, genug, genug!!«, fiel ihm Lord Moore ins Wort. »Wollen wir hier philosophisch disputieren oder handeln?«
»Handeln!«, ging Axel sofort darauf ein, als ein ganzer Mann, der jede gerechtfertigte Zurechtweisung annimmt — seinen Spott freilich konnte er niemals lassen, und so musste er auch jetzt noch hinzusetzen, und zwar in jüdischem Jargon mauschelnd: »Handeln, immer handeln, so lange 's was ssu handeln gibt — Gott dr G'rachte.«
»Ich vertraue Ihrer Allwissenheit«, wandte sich dann Moore an den Grafen. »An welcher Stelle der tunesischen Küste sind die Piraten gelandet?«
»Da tun Sie wieder zu viel, wenn Sie an eine Allwissenheit meinerseits glauben. Ich bin durchaus nicht allwissend, mein Fern- und Hellsehen ist sogar sehr bescheiden. Ich weiß nur, wie die Küste aussieht, wo sie gelandet sind.«
»Das haben Sie in Ihrem Zustande gesehen?«
»Ganz genau.«
»Sie würden die Stelle wiedererkennen?«
»Sicher.«
»Bei Tunis kommen hauptsächlich zwei Küsten in Betracht, eine östliche und eine nördliche.«
»Das, Mylord, konnte mein frei schweifender Geist freilich nicht unterscheiden, es ist doch ganz genau dasselbe, als wenn ich körperlich dort gewesen wäre, und es war gerade...«
»War die Küste ganz flach, oder fiel sie als steiles Gebirge ins Meer?«, ließ sich zum ersten Male ein Matrose vernehmen, und zwar war es der deutsche, August, dem sein Herr aus irgendeinem, jedenfalls gar nicht zutreffenden Grunde noch den Titel ›von Burgund‹ gegeben hatte.
»Ah, sie kennen wohl die Küste von Tunis?«, rief der Graf.
»Jawohl, bin zweimal dort herumgeschifft.«
»Nun, Sie haben mich vorhin unterbrochen. Auch ich habe vor zwei Stunden nähere Umschau gehalten. Ich wartete nur, dass die Sonne hinter einer großen Wolke wieder zum Vorschein kam, dann flog ich im Geiste hin und her, und da erkannte ich, dass die Küste im Osten flach und sandig ist, im Norden da gegen von hohen, furchtbar zerrissenen Gebirgen begrenzt...«
»Und wo landeten die Piraten?«, fiel der Lord ein.
»Am Gebirge, an der Nordküste, und ich habe mir die bizarre Felspartie gemerkt.«
»Dunnerwetter, Dunnerwetter, nun bleibt mir aber der Verstand doch bald stehn!«, murmelte Axel.
»Schieb ihn, Axel, schieb ihn weiter«, munterte der alte Kapitän, der das Murmeln gehört hatte, seinen jungen Freund auf.
»Bald, habe ich gesagt, bald.«
»Und außerdem«, fuhr der Graf unberirrt fort, »hörte ich auch wiederholt, dass die Piraten diese Bucht Tala el schehen nennen. Kennt jemand von euch Seeleuten vielleicht diese Bucht, was übersetzt Höllenloch heißt?«
Nein, keiner kannte diese Bucht oder hatte den Namen schon einmal gehört, dafür aber platzte Axel los;
»Was, sogar hören kann Ihr Geist, wenn er so ohne Körper herumspaziert?!«, rief er mit wahrhaftem Entsetzen, das vielleicht gar nicht so erkünstelt war.
»Selbstverständlich«, lautete die würdevolle Antwort, »genau so, wie mit meinem irdischen Körper.«
Wieder machte Axel ein anderes Gesicht, als er sich an seinen alten Freund wendete, der noch immer in seiner blitzenden Reiterrüstung prangte.
»Du«, sagte er leise, »da müssen wir fernerhin vorsichtig bei unseren Dummheiten sein, i dr Deiwel, wenn der so im Geiste nicht nur sehen, sondern sogar hören kann...«
»... und und und und vielleicht sogar riechen!«, ergänzte der alte Sünder, von dem man übrigens ebenfalls nicht so ganz genau wusste, ob er von der Wundergabe des Grafen so felsenfest überzeugt war. Oder es war eben seine Ausdrucksweise.
»Ja, dann fehlt mir nur noch ein Schiff!«, rief der Lord.
»Das meine kann ich Ihnen leider nicht zur Verfügung stellen...«
»Das Ihre?«, musste Axel sofort einfallen, weil der Graf eine Handbewegung nach dem schwarzen Schiffe gemacht hatte.
»Gewiss, es ist das meine.«
»Aber neulich hatten Sie doch noch nicht einmal etwas von einem schwarzen Schiffe gehört!«
»Nun, wusste ich denn, dass sich meine Freunde ein solches zugelegt hatten? Jetzt aber ist es mein Eigentum.«
»Von diesen Ihren Freunden hätten Sie aber doch in Ihrem Starrkrampfe...«
»Zum Teufel, Mann, wer seid Ihr, dass Ihr Euch hier immer einmischt?!«, wurde jetzt aber auch der Lord barsch, und der ehemalige Prinz und jetzige Depeschenreiter gab sich denn auch gleich zufrieden.
»Der Mann hat eigentlich recht, ich habe mich hier gar nicht einzumischen«, musste er nur noch zu seinem alten Freunde sagen.
»Also, mein Schiff kann ich Ihnen leider nicht zur Verfügung stellen«, fuhr der Graf zu Moore fort. »Das heißt, ich kann Sie nicht an Bord nehmen. Ich darf beim besten Willen nicht. Wohl aber werde ich Ihnen auf meinem Schiffe als Führer dienen. «
»Dann nur ein Schiff! Morphium, ist Ihre Jacht noch tauglich? Oder Ihr kommt doch überhaupt mit, Ihr und Eure fünf Matrosen.«
Es war nicht anders, als ob in den Eisenmann ein Blitz gefahren wäre.
»Klar den Pipin, klar den Pipiiniin!!!«, jauchzte er, stürzte von dannen, oder wollte es doch tun, stürzte erst einmal direkt in eine der Riesenkanonen hinein und brach mit dieser gänzlich zusammen, was nicht zu verwundern war, weil die Rüstung aus wirklichem Eisen, die Kanonen aber nur aus Pappe bestanden.
Doch gleich hatte er sich zwischen den Papptrümmern wieder aufgerafft, eilte in einen Turm, und sein noch mehrmaliges »klar den Pipinin!!« brachte auch die fünf Matrosen auseinander. Die einen folgten ihrem Herrn in den Turm, die anderen eilten an den Hafen hinab.
»Was ruft der da, ›klar den Pippiieee‹?« musste Axel zunächst verwundert fragen.
»Nicht Pippie, sondern Pipin«, erklärte der Lord, und er konnte schon wieder lächeln. »So heißt seine Jacht dort unten.«
»Pipin? Na, konnte der dem Kasten nicht einen anderen Namen geben?«
»Warum? Ist er für das Schiffchen nicht ganz angebracht? Pipin der Kurze.«
»Stimmt, richtiger als Karl der Große«, gab Axel jetzt zu.
»Wird der kleine Schoner dort unten genügen?«, wandte sich der Lord wieder an Saint-Germain.
»Ich denke, es ist ein schneller Segler?«
»Jedenfalls der schnellste an dieser Küste, und ganz besonders unter meines Freundes Morphiums Führung. Ich habe die Jacht segeln und manövrieren sehen! Auch Geschütze sind an Bord, allerdings nur kleine, aber alles in tadelloser Ordnung, auch sonst immer fertig zur Abfahrt. Darin ist doch Kapitän Morphium ein Muster. Da seht, schon gehen die Segel in die Höhe, alles wie am Schnürchen. Ich meine nur wegen der Mannschaft...«
»Wie viele?«
»Der Kapitän und fünf Matrosen, wozu ich noch komme.«
»Und ich«, schaltete Axel ein.
»Auf Ihre Begleitung habe ich allerdings auch stark gerechnet«, sagte der Graf sofort und schien damit einen Widerspruch des Lords abzuschneiden. Denn besondere Freundschaft konnte dieser für den groben Depeschenreiter ja gerade noch nicht empfunden haben.
»Wir können noch mehr Männer auftreiben, in Palo sind genug tüchtige Seeleute...«
»Nein, nein, das genügt vollkommen, und dann nur keine Fremden! Außerdem bin ich ja mit meinen zweihundert Matrosen immer zur Stelle...«
»Was, zweihundert Matrosen sind auf dem schwarzen Kasten dort?«, rief Axel.
»Zweihundert Matrosen. Ist das viel für solch ein Schiff? Wäre es ein Kriegsschiff, müsste es mindestens die dreifache Anzahl aufnehmen. Also ich führe Sie hin nach jener Stelle, und brauchen Sie bewaffnete Mannschaft, etwa zu einer Landexpedition — ich stelle sie Ihnen zur Verfügung. Ich möchte nur schon deshalb ein kleineres Fahrzeug bei mir haben, weil es sich doch wohl um flaches Küstengewässer handeln wird, in das mein tiefgehendes Schiff nicht dringen kann. Außerdem wäre es möglich, dass mein Schiff noch vor der Zeit zurück müsste...«
»Weshalb?«, unterbrach der Lord erschrocken.
»Sie und mein Freund, dieser Depeschenreiter, können es hören: weil ich die Fürstin de la Roche an Bord habe, die am dritten September in Rom sein muss.«
»Schön, dick und mit Zähnen«, ergänzte Axel, den der Graf jetzt gleich seinen Freund genannt hatte.
»Schön, dick und mit Zähnen«, bestätigte der Graf lächelnd. »Wenigstens so dick, wie es mit Schönheit vereinbar ist.«
Diese Unterhaltung ward zunächst dadurch unterbrochen, dass aus dem Turm wieder Kapitän Morphin zum Vorschein kam.
Himmel, hatte sich der bisherige Rittersmann verändert! Ein köstlicher Anblick!
Er trug einen roten Anzug nach Seemannsschnitt, an dem aber kein Stück mehr ganz war, alles so zerlumpt wie möglich, danach war auch die schmutzige Färbung beschaffen, mit schwarzen Teerflecken getigert, ein verwegenes Barett mit roter Flamingofeder von Meterlänge, um die Hüfte eine blaue Schärpe, gespickt mit einem ganzen Arsenal von Dolchen und Pistolen, an der Seite ein ungeheurer Entersäbel, und unter dem Arm eine dementsprechende Donnerbüchse, schon mehr eine Art Kanone.
So kam der knochige, hünenhafte Greis mit dem martialischen Haudegengesicht, in dem die enorme Hakennase die Hauptsache war, breitbeinig einhermarschiert, eine richtige Seeräubergestalt aus schon für damalige Verhältnisse verklungener Zeit, so ungefähr aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, und alsbald begann er denn auch ein dementsprechendes Lied zu brüllen:
Auf Matrosen, die Kanonen geladen
Mit Bomben, Haubitzen und mit Granaten,
Gebt Feuer auf den Bauch
Und unten auch!
So sang er, brüllte er. Nun stimmt es ja, solch ein Seeräuberlied darf nicht eben melodiös vorgetragen werden, aber der alte Kapitän hatte auch absolut keine Stimme, es war ein schreckliches Gegröle.
»Du, Morphium«, musste Axel denn auch gleich kritisieren, »als du vorhin in der Eisenrüstung mit der Pappkanone zusammenprasseltest, das hat einen viel besseren Klang gegeben als hier deine Singerei. Mir ist es lieber, wenn du pfeifst und dazwischen rülpst.«
»Ha, Knabe, was verstehst du von Musik! Fertig, Herr Graf, es kann losgehen.«
Jeder der beiden Matrosen, die ihm gefolgt waren, hatte einen Sack auf dem Rücken.
»Sie sind tatsächlich fix und fertig, um in See zu stechen?«
»Fix und fertig — brauche nur noch von draußen meine Burg zuzuschließen.«
Was während der Abwesenheit des Besitzers aus dieser werden würde, darum brauchte man sich nicht zu kümmern, das musste der Burgherr am besten wissen. Und dem war das eben ganz egal, der fühlte sich jetzt als Seeräuber.
»Auch genug Proviant an Bord?«
»Alles voll Hafer, alles voll Hafer.«
»Was, voll Hafer?«
»Na ja, seit ich meine Lebensweise geändert habe, verproviantierte ich auch meine Jacht dementsprechend. Bei mir muss immer alles in Ordnung sein. Und auf hoher See fliegt doch kein Pferdemist in der Luft herum, den man zur Ernährung einatmen kann — da habe ich die ganze Jacht voll Hafer gepfropft — und ein paar Zentnerchen Heu nicht vergessen — du weißt doch, Axel, Heu!«
Und er gab seinem Freunde dabei einen Rippenstoß.
»So können wir ja die Reise antreten.«
»Marsch!«
Sie überschritten die Zugbrücke, der Kapitän als letzter, sofort ging diese hinter ihm von allein wieder hoch, und er setzte seinen Weg die Rampe hinab fort, ohne sich noch einmal umzublicken.
»Und die Pferde, Morphium?«, fragte Axel nur noch.
»Ha, Knabe, denkst du, dass ich die vergessen habe?! Die sind bereits alle fort.«
»Verkauft?«
»Nee, geschlachtet, gepökelt und eingesalzen. Kriegsverproviantierung, weißt du. Aber noch nicht reif zum Mitnehmen. Bis ich zurückkomme, werden sie wohl gut sein.«
»Müssten Sie nicht eigentlich nach London, Mylord?«, fragte der Graf unterwegs.
»Ja, sofort, wenn mich der neue Gesandte abgelöst hat. So lautet eigentlich meine Instruktion.
Aber ich habe eine wichtigere Pflicht zu erfüllen, als mich vor meiner Regierung zu verantworten.«
Der Lord musste ja am besten wissen, was er zu tun hatte; es wurde deswegen kein Wort mehr verloren.
»Brauchen vielleicht Sie noch etwas an Proviant?«, fing dann der Lord an, noch ehe sie den Hafen erreicht hatten. »Diese Burg hier ist überreichlich mit allem versehen.«
»Danke, ich brauche nichts«, entgegnen der Graf kurz.
»Oder vielleicht Wasser? Hier ist eine vortreffliche Gelegenheit zur Wassereinnahme, von dort oben wird ein Lederschlauch herabgelassen, das Wasser fließt von selbst und direkt in die Tanks...«
»Wir brauchen kein Wasser.«
Der Lord fragte nicht weiter, er glaubte eben, das schwarze Schiff sei mit allem genügend versehen, der hinter ihnen gehende Axel aber hatte gleich noch etwas anderes herausgehört.
»Sie wollen doch nicht etwa sagen, Graf, dass Ihr Schiff überhaupt niemals Wasser einzunehmen braucht?«
»Nein, braucht es auch nicht.«
»Was, alle diese zweihundert Matrosen können wohl ebenfalls ohne Nahrung und Wasser existieren?!«
»So ist es. Aber, bitte, fragen Sie jetzt deshalb nicht weiter. Ich werde Ihnen später alles offenbaren — Ihnen, Mister Axel.«
Der Graf hatte das letzte mit ganz besonderer Betonung gesagt, und von jetzt an war es nicht mehr Lord Moore, an den er sich immer wendete, sondern nur noch Axel, den er überhaupt in jeder Weise bevorzugte.
Er hatte hierzu ja allerdings einen starken Grund. Dieser Mann wusste mehr von ihm als alle die anderen, hatte ihn gewissermaßen in der Hand. Aber dieser Depeschenreiter sollte auch sonst noch sein intimer Freund werden, und es war ganz offenbar, wie der Graf dies zu beschleunigen suchte.
Die anderen hatten es deutlich vernommen, wie der Graf den Depeschenreiter als Hauptperson betrachtete, und sie richteten sich danach, brauchten sich auch nicht dazu zu zwingen, denn die Überlegenheit dieses Mannes hatte auch Lord Moore schon immer herausgefühlt.
Sie hatten den Hafen erreicht.
»Nun zuerst nach Ihrer Jacht, ich möchte sie besichtigen«, sagte der Graf, dabei eine kleine Handbewegung machend, und sofort löste sich das schwarze Boot vom Kai ab und strebte ebenfalls mit langsamen Ruderschlägen der Jacht zu.
Der Graf betrat das Deck, schaute sich um. Es war nichts Bemerkenswertes darauf.
»Was ist das?«, fragte er, einen ziemlich großen, mit Leinewand verhüllten Gegenstand meinend, mitten an Deck stehend.
»Eine Drehbasse, eine kleine, drehbare Kanone«, erklärte der Kapitän.
»Sie werden sie hoffentlich nicht gebrauchen müssen. Nun, Mister Axel«, wandte er sich jetzt wie später nur an diesen, »die Sache ist folgende. Sie lassen die Jacht also immer dem schwarzen Schiffe nachfolgen, auf dem ich selbst mich befinde. Leider kann ich Ihnen nicht Gesellschaft leisten, so gern ich es auch möchte. Wir haben ganz günstigen Wind, können die tunesische Küste schon in vierundzwanzig Stunden erreichen.
Aber es dürfte bald Windstille eintreten...«
»Denke ich auch, denke ich auch«, stimmte Kapitän Morphium ein, wie ein Jagdhund in der Luft schnüffelnd.
»Wir können uns doch einmal verlieren, Sie möchten vielleicht manchmal wissen, wie es mit den Piraten und der Prinzess steht, die ich immer möglichst im Auge behalten werde, oder ich habe Ihnen sonst eine Mitteilung zu machen, oder Sie mir, und dazu habe ich ein Mittel...«
»Einfach Flaggensignale und bei Nacht farbige Lichter.«
»Und wenn wir nun außer Sichtweite kommen? Nein, ich habe zu unserer Verständigung ein anderes Mittel, welches ganz unabhängig von Raum und Zeit ist. Herr Kapitän, wollen Sie Ihre Winde in Bereitschaft setzen, es soll aus meinem Boote etwas heraufgeholt werden.«
Es geschah, das unten liegende Boot veränderte etwas seine Lage, bis die Matrosen das Seil mit dem Haken fassen konnten, und erst jetzt bemerkte man, dass sich in dem Boote eine große Kiste befand, recht seltsam aussehend, um welche die Matrosen sofort das Seil schlangen.
Die Kiste wurde an Deck gehievt, der Graf warnte, dass sie gestürzt würde. Sie war ungefähr sechzig Zentimeter im Kubik, wobei erinnert sei, dass die normale Tischhöhe achtzig Zentimeter beträgt, aus braunem, wohl sehr kostbarem Holze, mit zwei Handhaben versehen, also mehr eine Truhe zu nennen, und dann vor allen Dingen über und über mit Schnitzereien bedeckt, Figuren darstellend, meist fabelhafte Tiere, geflügelte Schlangen, Drachen und dergleichen, Menschen mit vielen Köpfen und Armen, in den Händen die merkwürdigsten Gegenstände haltend — — man konnte wohl stundenlang betrachten, man fand immer wieder Neues.
»Macht einen recht indischen Eindruck«, meinte Axel.
»Stimmt«, bestätigte der Graf, »diese Truhe blickt auf mehr als dreitausend Jahre zurück, stammt aus einer Zeit, da Buddha Sakjamuni Gautama noch nicht auf Erden wandelte.«
»Da hat die sich für dieses Alter recht gut gehalten.«
»Es ist das unverwüstliche Holz eines Baumes, der gar nicht mehr auf Erden wächst, dessen Früchte dem Elefantenkönig Aradschawardan zur Nahrung dienten, und dieser Baum hatte die Eigenschaft, sein ganzes Holz in Fruchtfleisch zu verwandeln, sodass sich auch sonst solches Holz nicht mehr vorfindet. Wo könnte diese Truhe nun hingesetzt werden? Ich möchte, dass sie an Deck steht, möglichst von frischer Luft umspült, aber natürlich vor überkommenden Wogen gesichert.«
Dann kam sie am besten unter die Back, unter das erhöhte Vorderteil, welches die kleine Jacht besaß, freilich alles nur en miniature. Aufrecht konnte man darunter nicht stehen, sie bildete den Zugang zum Mannschaftslogis, stand für gewöhnlich offen, konnte aber durch Schotten wasserdicht geschlossen werden.
»Ja, der Platz an diesem Pfeiler ist ganz geeignet. Wollen Sie die Truhe gleich in meiner Gegenwart festbinden lassen — oder festlaschen, wie der seemännische Ausdruck dafür lautet — ich glaube schon, Herr Kapitän, dass es Ihre Matrosen verstehen, die Truhe so zu befestigen, als ob sie mit dem Deck verwachsen wäre, aber es dient zu meiner Beruhigung, wenn ich es selbst beobachte.«
Die Truhe wurde an die bezeichnete Stelle getragen, und zwar konnten zwei Männer sie mit Leichtigkeit aufheben, für einen einzelnen hätte sie schon ein größeres Gewicht bedeutet, die Matrosen begannen mit Stricken zu arbeiten.
»Soll der Deckel nicht geöffnet werden können?«, fragte Axel, als ein Strick auch oben darüber geschlungen wurde.
»Bemerken Sie denn etwas von einem Deckel?«
»Nun, ich kalkuliere, dass der Zimmermann hier oben doch — ein Loch gelassen haben muss.«
»Sie haben recht. Es ist zwar nicht nötig, dass der Deckel geöffnet wird, ich bitte Sie auch, es nicht zu tun, aber die Notwendigkeit könnte schließlich doch einmal eintreten. Lassen Sie den Dackel also lieber frei.«
Es geschah, die Kiste wurde etwas anders gelascht.
»So, das wird wohl jeder Schlingerbewegung standhalten. Nun, mein lieber Signor Axel, hier haben Sie das Mittel, durch welches wir uns immer verständigen können.«
»Durch diese Kiste?«
»Durch diese Truhe. Habe ich Ihnen eine Mitteilung zu machen, so wird in dieser Truhe ein Glockenton erschallen, laut genug, dass er im ganzen Schiff hörbar ist. Es braucht also nicht immer jemand daneben Wache zu stehen. Dann begeben Sie sich hin, ich werde Ihnen mit vernehmlicher Stimme sagen, was ich Ihnen mitzuteilen habe.«
Was für Gesichter die andern machten, lässt sich denken.
»Aus dieser Kiste heraus?«
»Aus dieser Truhe heraus.«
»Ja, wie ist denn das möglich? Oder wollen Sie da hineinkriechen?«
»O nein, ich begebe mich an Bord meines schwarzen Schiffes.«
»Dann versetzen Sie ihren Geist in diese Kiste?«, fragte der Lord in einer Weise, als finde er so etwas ganz selbstverständlich.
»Nein, da steckt schon ein anderer drin.«
Und der Graf fasste den Deckel an dem wenig vorstehenden Rand, klopfte erst einmal in besonderer Weise darauf, dann schlug er ihn zurück — und da allerdings bekamen die Umstehenden etwas Seltsames zu sehen.
In der Kiste, sie so ziemlich ganz ausfüllend, kauerte eine menschliche Gestalt, nackt, nur aus Knochen und braunschwarzer Haut bestehend. Der haarlose Schädel war so vornüber geneigt, dass man das Gesicht nicht sehen konnte.
»Ein indischer Fakir!«, flüsterte der Lord.
»Ein Paramahamsa«, verbesserte der Graf. »Ein Fakir ist ein Yogi, der die höchste Stufe der Heiligkeit hat erlangen wollen, sie aber nicht erlangt hat, auf einer unteren Stufe stehen geblieben ist, auf der er nur gewisse, nur bescheidene Phänomene ausführen kann, und zwar nur durch physische, nicht durch psychische, geistige Kraft. Dies hier aber ist ein Brahmane, und zwar ein Paramahamsa, der die letzte Station des heiligen Pfades erreicht hat, schon in der Gottheit aufgegangen, nur aus einem besonderen Grunde, aus freiem Willen, doch noch durch seinen irdischen Körper mit der Erde verbunden.«
Die Umstehenden achteten weniger auf diese ja überhaupt für sie unverständliche Erklärung, sie starrten nur auf das scheußliche, braunschwarze Skelett. Bei längerem Hinsehen bemerkte man als ganz Auffallendes, dass die Poren in der Lederhaut außerordentlich groß waren, jede einzelne mindestens so groß wie ein Stecknadelkopf, man glaubte durch eine solche in das Innere des Körpers sehen zu können, sodass dieser siebartig durchlöchert zu sein schien.
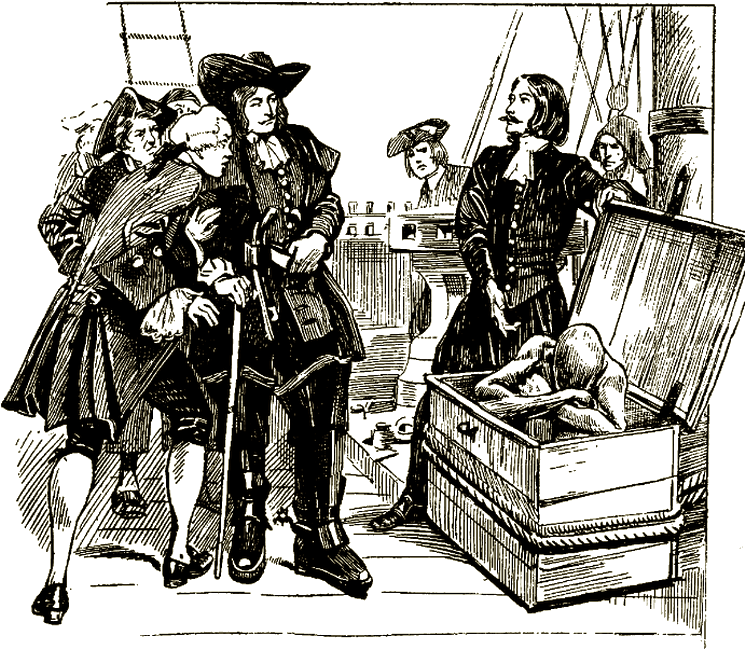
»Paramahamsa«, wiederholte da Axel, »ja, ich weiß.«
»Wie? Sie kannten dieses Wort schon?«, fragte der Graf mit einiger Überraschung.
»Ich habe mich viel mit indischer Literatur beschäftigt, weil es immer mein Wunsch war, das Wunderland Indien noch einmal mit eigenen Augen kennen zu lernen«, fiel der einfache Depeschenreiter etwas aus der Rolle, worauf aber jetzt nicht geachtet wurde.
»Haben Sie auch die Buddha Charita gelesen?«
»Die Lebensbeschreibung Buddhas von Acvagoshas — jawohl.«
»Im Sanskrit?!«, machte der Graf aus seinem Staunen gar kein Hehl.
»O nein, so weit gehen meine Kenntnisse noch nicht. In englischer Übersetzung.«
»Können Sie sich noch entsinnen, wie der größte Schüler Buddhas heißt, an den er, ehe er ins Nirwana eingeht, zuletzt immer das Wort richtet?«
»Wenn ich nicht irre — Anuruddha hieß er wohl.«
»Bei Gott, Ihr Gedächtnis lässt nichts zu wünschen übrig!«
Nach diesem Ausrufe der unverhohlenen Verwunderung streckte der Graf mit einer Geste die Hand über die Kiste mit der regungslosen Mumie aus.
»Nun — dies ist kein anderer als jener Anuruddha, der größte Schüler des letzten Buddhas.«
Während sich die anderen damit begnügten, möglichst dumme Gesichter zu machen, Lord Moore nicht ausgeschlossen, wie er die Mumie betrachtete, machte Axel nur ein verblüfftes Gesicht.
»Donnerwetter! Der hat sich aber gut gehalten! Natürlich ist er tot.«
»Was heißt tot? So etwas wie einen Tod gibt es überhaupt gar nicht.«
»Hm, Ansichten! Und richtig, er soll ja auch noch sprechen können!«
»Sein Geist ist bereits im Nirwana, aber er behält seinen Körper, um, wenn er will, noch in diesen zurückzukehren. Denn er hat damals die große Entsagung nicht getan, die ihm Buddha Sakjamuni vorgemacht hat, als er sich von den Devas empor tragen ließ. Immerhin, auch dieser Paramahamsa wird dereinst noch ein Buddha werden.«
Mit möglichster Feierlichkeit hatte es der Graf gesagt, was die Wirkung hatte, dass Axel den Mund aufsperrte.
»Schon seit mehr als 2500 Jahren tot, und er kann noch immer sprechen?«
»Wenn er seinen Geist zurückruft.«
»Und er soll noch einmal als Buddha, als neuer Erlöser der Menschheit, diese Erde betreten?«
»Er ist dazu bestimmt.«
»Doch nicht in demselben Körper?«
»In demselben Körper.«
»Der neue Buddha wird von den Indern erst in 4000 Jahren wiedererwartet.«
»In 4000 Jahren wird dieser Paramahamsa als Buddha Anuruddha wieder in demselben Körper, den Sie hier noch sehen, auf Erden wandeln und lehren.«
»Donnerwetter, Donnerwetter!!«, konnte Axel nur noch staunen, während von den anderen auch Lord Moore keines Wortes fähig war. »Da müssen wir allerdings gut aufpassen, dass der Kerl uns nicht etwa über Bord gewaschen wird!«
»Ja, ich lege ihn Ihnen natürlich ans Herz. Wenn er im Grunde genommen auch gar nicht zerstörbar ist, denn selbst wenn dieser sein irdischer Rest durch Feuer vernichtet würde, so würde er sich einfach einen neuen Körper aufbauen — das aber würde er doch eben erst nach 4000 Jahren tun, und mancher Vorteil ginge dadurch denen verloren, denen er diesen seinen alten Körper zur Aufbewahrung anvertraut hat.«
Der Graf klappte den Deckel wieder zu.
»Wir gebrauchen also«, fuhr er in seiner Erklärung fort, »diesen Kasten als Sprechmaschine, durch die wir uns auf jede Entfernung hin verständigen können. Wenn ich Ihnen etwas mitzuteilen habe, so erschallt ein lauter Glockenton, Sie begeben sich hin, klopfen einmal an den Kasten, dieses Klopfen höre auch ich, nun weiß ich, dass Sie zur Stelle sind — Sie werden mich sprechen hören. Und haben Sie mir etwas zu sagen, so klopfen Sie gleichfalls gegen die Truhe, bücken sich etwas, sprechen gegen den Deckel, ich vernehme es, werde Ihnen Antwort geben. Nur bitte ich Sie sehr, den Deckel dabei niemals zu öffnen. Jeder fremde Atemhauch würde den Paramahamsa in seinem Todesschlafe stören, könnte ihm verderblich werden. Sie haben mich doch in allem verstanden?«
Jetzt aber machte auch der Depeschenreiter ein Gesicht, dessen grenzenloses Staunen nichts von Erkünstlung an sich hatte.
»Da ist Gedankenübertragung im Spiele!«
»So ist es. Also wenigstens an die Möglichkeit einer Gedankenübertragung glauben Sie sonst so ungläubiger Thomas.'«
»Ein einziges Mal habe ich den untrüglichen Beweis bekommen, dass es wirklich eine Gedankenübertragung von Gehirn zu Gehirn gibt — aber auch gleich durch eine ganze Reihe von Experimenten, vorgenommen an einem mondsüchtigen Mädchen — und — schon seit jener Zeit zweifle ich nicht mehr an der Wahrheit dieser Berichte, wonach die indischen Fakire auf dem Gebiete der Gedankenübertragung das Fabelhafteste leisten sollen.«
»Daran tun Sie sehr recht. Nun, so ist wohl nichts weiter zu besprechen, ich begebe mich an Bord meines Schiffes...«
»Welcher Sprache wollen wir uns denn dabei bedienen?«
»Behalten wir doch das Italienische bei. Diese volltönende, meist in Vokalen endende Sprache lässt auch die wenigsten Verwechslungen zu, ist jedenfalls viel deutlicher zu verstehen als die englische, denn etwas dumpf werden die Worte doch aus der Truhe kommen.«
»Ja aber — kann denn dieser indische Fakir, ob er nun schon 2500 Jahre alt ist oder jünger, Italienisch sprechen?«
»O, das ist doch ganz anders, der spricht überhaupt nicht...«
»Ich denke doch...«
»Nein, es sind meine eigenen Worte, die Sie vernehmen werden, mit meiner eigenen Stimme. Dieser Paramahamsa schläft, oder Sie können auch gleich sagen: Er ist wirklich tot. Und dennoch ist die Prama, die allgemeine Weltkraft, lebendig in ihm. Durch diese Prama, hier einfach Willenskraft genannt, fängt er meine Worte auf, wo ich diese auch spreche, ob hier oder am anderen Ende der Welt, oder auch nur meine Gedanken, und wandelt sie durch seine Willenskraft in tönende Worte um, ohne dabei seinen Mund zu bewegen, ohne überhaupt in Wirklichkeit zu sprechen. Das ist ja alles nur geistig. Materialisierte Geisteskraft. Wie eigentlich alles auf Erden und im Weltall. »Alles was ist, ist das Ergebnis von dem, was wir gedacht haben, ist auf unsere Gedanken gegründet, ist aus unseren Gedanken gemacht.« So lehrt die Dhammapada, das heilige Buch der Inder. Eine nähere Erklärung kann ich Ihnen jetzt nicht geben. Vielleicht später einmal. Ebenso vermittelt der Paramahamsa doch auch Ihre Worte nur durch Gedankenkraft zu mir herüber.«
Ja, das war jetzt ungekünstelte Fassungslosigkeit, mit der Axel auf die geschnitzte Truhe starrte.
»Und dabei ist der Kerl schon seit 2500 Jahren tot«, murmelte er. »Das ist ja noch viel toller als damals die Geschichte mit dem mondsüchtigen Mädchen!«
»Ich will mich übrigens nicht mit fremden Federn schmücken«, nahm der Graf immer noch einmal das Wort. »Ich selbst bin es gar nicht, der dem Paramahamsa die Gedanken überträgt.«
»Sie nicht?«
»Nein. Wohl kann ich es, aber nur, wenn ich im Starrkrampf liege, zu meiner bestimmten Zeit, oder wenn ich mich mit Absicht hineinversetze, was aber seine Schwierigkeiten hat. Ich bediene mich dazu eines zweiten Yogis oder eines Fakirs, wie Sie lieber sagen, den ich drüben an Bord habe...«
»Auch in so einer Kiste?«
»Nein, das ist überhaupt wieder etwas ganz anderes. Er hat bei Weitem noch keine so hohe Stufe der Vollkommenheit wie dieser Paramahamsa hier, ist ein ganz gewöhnlicher Fakir, kann sich aber zu jeder Zeit in den Zustand des Fernsehens versetzen, sodass ich durch ihn auch ständig die Prinzess beobachten kann. Und dann vor allen Dingen ist es mit diesem Medium hier gleichgestimmt, wenn man sich so ausdrücken darf. Jawohl, die Gedankenwellen der beiden machen die gleiche Anzahl von Schwingungen, darauf kommt es nämlich an. So werde ich gleich jetzt und gleich hier etwas tun, was ich dann erst von Bord meines Schiffes aus tun wollte. Ich kann Ihnen die Sache ja erst einmal vormachen. Apropos, Kapitän Morphin, bald hätte ich die Hauptsache vergessen — Sie sind doch im Besitze eines Sextanten?«
»Gewiss doch.«
»Und allem, was zur Berechnung einer geografischen Ortsbestimmung notwendig ist?«
»Logarithmentafeln und alles vorhanden.«
Ob er damit auch umzugehen wisse, das durfte der Graf nicht noch fragen, dann hätte sich der alte Kapitän wirklich beleidigt gefühlt. Auch zwei seiner Matrosen waren eigentlich Steuerleute.
Dieses astronomische Berechnen der geografischen Lage eines Ortes oder sogar Punktes, nach Breiten- oder Längengraden bis zur Sekunde war ja schon damals so weit, wie es heute ist, wo das ein zwanzigjähriger Steuermann halb im Schlafe macht, der auf der Schule wenig mehr als Lesen, Schreiben und Rechnen nach den vier Spezies gelernt hat. Diese astronomischen Berechnungen lernt er dann, wenn er ein guter Kopf ist, in einem halben Jahre auf der Steuermannsschule. Freilich, ohne den Kern der Sache zu verstehen. Die Formeln, welche die Astronomen mit unsäglicher Mühe berechnet, werden ihm eingepaukt, er hat dazu seine Handbücher, so viel Trigonometrie, wie er braucht, das Rechnen mit Logarithmen ist gar keine Kunst — und nun die Übung! Wenn man so einen jungen Kerl durch sein Instrument nach Sonne oder Mond oder einem sonstigen Sterne visieren sieht, wenn er dann mit zehnstelligen Logarithmen rechnet, so denkt mancher, der sei trotz seiner großen Pfoten ein halber oder gar ein ganzer Gelehrter — Gott bewahre, das ist alles nur eingetrichterter Kram und wird nach der Schablone gemacht.
Möglich wurde diese Einfachheit erst, als Isaac Newton den bisher üblichen Oktanten durch den Spiegelsextanten ersetzte, gegen das Jahr 1860. Dann wäre die Schnelligkeit der Berechnung auch nicht ohne Logarithmen auszuführen, welche Rechnungsart aber auch schon im Anfange des 17. Jahrhunderts gleichzeitig von dem schottischen Lord Napier und dem Deutschen Justus Byrg erfunden wurde, ganz unabhängig voneinander, wie es ganz merkwürdig ist, dass die Differentialrechnung in ein und demselben Jahre von Newton in England und von Leibniz in Deutschland entdeckt wurde, ohne dass die beiden irgendwie im Verkehr gestanden hätten.
Auch gute Chronometer gab es schon damals, die erste Bedingung für eine richtige Ortsbestimmung. Aber die Sache war die, dass die Schiffsuhren so schwer auf ihre Richtigkeit kontrolliert werden konnten.
Das ist durch die Einführung der Telegrafie ermöglicht. Heute ist doch jeder größere Hafen telegrafisch verbunden, und wenn es in Greenwich Punkt 12 ist, durchläuft ein elektrischer Funke das ganze die Erde umspannende Telegrafennetz. Danach wird für jede Nation die Ortszeit berechnet, und wenn nun über dem betreffenden Hafen die Sonne ihren höchsten Stand erreicht hat, fällt auf der Seewarte, nachdem schon fünf Minuten vorher ein Kanonenschuss aufmerksam gemacht hat, mit der Sekunde ein großer Ball herab, jeder Kapitän hat die Ortszeit schon vorher in Greenwicher umgerechnet, und nun weiß er ganz genau, wie viel sein Chronometer nach- oder vorgeht, zieht das mit in die Berechnung. Gestellt darf daran nichts werden.
Damals aber, als es noch keine Telegrafie gab, war das eine schwierige Sache. Denn mag solch eine Schiffsuhr auch noch so gut und noch so sorgfältig platziert und ausbalanciert sein, sie erleidet doch immer viele Erschütterungen, das Schiff kommt aus der kältesten Zone in die heißeste, da müssen ja Differenzen eintreten, da sind, wenn ein Segelschiff ein halbes Jahr unterwegs ist, zehn Minuten doch noch gar nicht so viel, und eine halbe Zeitminute, ins Gradmaß umgerechnet, genügt schon, um es beim schönsten Wetter zwischen sonst wohlbekannte, aber unsichtbare Riffe rennen zu lassen.
Damals also musste sich immer ein Kapitän auf den anderen verlassen, die Uhrzeit war immer die erste Frage zwischen zwei sich begegnenden Schiffen, in der Hoffnung, dass das andere die richtigste astronomische Zeit hatte, ohne jede Gewähr, dass es auch wirklich so war — — —
»Was für Zeit haben Sie jetzt, Herr Kapitän?«
Der mittelalterliche Seeräuber war schon nach dem Glasfenster gegangen, unter dem sein Chronometer hing.
»Ungefähr dreizehn Minuten vor elf. Die Sekunden stimmen doch nicht, das weiß ich schon.«
»Das ist doch Pariser Zeit.«
»Pariser Zeit.«
Denn damals — und bis vor noch gar nicht so langer Zeit — stritten sich sowohl Paris wie die kleine spanische Insel Ferro mit Greenwich um die Ehre, dass über sie der erste oder vielmehr der nullte Meridian gezogen sei.
»Der Chronometer ist ausgezeichnet, aber das ist freilich schon ein Vierteljahr her, dass ich mir von einem genuesischen Kriegsschiffe richtige Zeit geben ließ«, gestand der alte Kapitän noch freiwillig.
»Und dann ist doch noch die Frage, ob der Genuese auch wirklich richtige Zeit hatte«, entgegnen der Graf, »er war doch schon wieder unterwegs. Ich aber besitze das Mittel, um an Bord meines Schiffes selbst auf astronomische Weise die Meridianzeit bis zur hundertstel Sekunde bestimmen zu können «
»Bis zur hundertstel Sekunde?!«, rief Axel mit offenem Zweifel.
»Bis zur hundertstel Sekunde«, wiederholte der Graf in seiner vornehm phlegmatischen Weise. »Nun passen Sie auf, ich werde Ihnen jetzt die richtige Pariser Zeit geben. Sie sehen dabei auch gleich, wie die Verständigung erfolgt.«
Der Graf klopfte mit dem Knöchel gegen die Truhe, und alsbald scholl in dieser ein voller Glockenton, so etwa, wie wenn ein Gong, ein Becken geschlagen würde.
Jetzt bückte sich der Graf etwas und sprach gegen den Kistendeckel laut und deutlich auf Italienisch:
»Hier ist der Graf von Saint-Germain, wer ist dort?«
»Der Kapitän selbst«, erscholl es im nächsten Augenblick ebenso klar und deutlich, nur ein wenig durch die Holzwand geschwächt, aus dem Kasten heraus.
Der Graf hatte ja genügend vorbereitet, und doch war alles starr vor Staunen. Da sprach eben der Inder in dem Kasten, es konnte ja gar nicht anders sein.
Nur Axel dachte gleich etwas anderes. Dieser Depeschenreiter hatte doch ein gar zu feines Ohr.
»Bei Gott, das ist die Stimme des schwarzen Kapitäns, so, wie er damals an Bord zu mir sprach«, flüsterte er.
Die Unterhaltung par distance nahm ihren Fortgang, und es war nicht anders, als sprächen die beiden durch ein heutiges Telefon, und wäre dies schon damals erfunden worden, so wären die üblichen Ausdrücke eben schon damals entstanden.
»Können Sie mich gut verstehen, Herr Kapitän?«
»Ganz deutlich.«
»Was ist genaue Pariser Chronometerzeit? Bitte.«
»Einen Augenblick... es wird sofort elf Minuten vor elf sein — wenn ich jetzt sage... jetzt!!«
»Lassen Sie doch zehn Minuten vor elf, möglichst bis zur Zehntelsekunde genau, einen lauten Glockenton erschallen.«
»Sehr wohl.«
Der Graf blickte nach dem etwas entfernt stehenden Kapitän. Sein Chronometer ging ungefähr eine Viertelminute nach, wie er berichtete.
»Also, wenn jetzt ein Glockenton erschallt, dann stellen Sie Ihren Chronometer genau auf zehn Minuten vor elf.«
»Ich habe es bereits gehört.«
Die Minute verging unter atemloser Spannung — da aus der Kiste wieder ein Glockenton, diesmal aber ein ganz anderer, schrill und kurz, ohne Nachklang, und Morphin justierte seinen Chronometer.
»So, nun haben Sie gesehen, wie es gemacht wird, und nun wollen wir uns nicht länger aufhalten, es gilt die Befreiung der gefangenen Prinzess. Wie es dieser geht, werde ich Ihnen von Zeit zu Zeit mitteilen, und auch sonst stehe ich Ihnen immer zur Verfügung.«
So sprach der Graf noch, schwang sich über die Bordwand in sein Boot und ließ sich nach dem schwarzen Schiffe zurückrudern.
In der sehr komfortabel ausgestatteten, aber winzigen Kajüte saß Axel, einen Fuß gegen die Wand, den anderen gegen den Tischrand gestemmt, und diese Stellung war auch sehr nötig, denn die südwärts segelnde Jacht schlingerte unter dem starken Westwind, als wolle sie manchmal kieloberst gehen.
Wie und warum sich Axel hier herabbegeben hatte, wusste er selbst nicht. Die Abfahrt der beiden Schiffe hatte er gar nicht beobachtet. Er hatte so schnell wie möglich allein sein wollen mit seinen Gedanken.
Lange war ihm das nicht beschieden. Lord Moore trat ein, immer von einer Wand zur anderen taumelnd, bis auch er sich einen festen Sitz geschaffen hatte. Er war schon tüchtig durchnässt.
»Ha, so eine Jacht! An Deck sich aufzuhalten, ist gar nicht mehr möglich, oder man muss sich festbinden lassen. Es sind auch für uns Ölkleider vorhanden, Sam sucht sie schon hervor.«
Axel antwortete nicht, träumte weiter vor sich hin.
»Nun«, begann der Lord nach einer Weile wieder, »was sagen Sie zu alledem, was dieser Graf uns da wieder vorgemacht hat?«
»Wunderbar, wunderbar!«, murmelte Axel.
»Nicht wahr? Glauben Sie nun endlich, dass dieser Graf etwas mehr kann als wir sterblichen Menschen? Denn bisher haben Sie es ja niemals an Spott fehlen lassen, so oft Sie nur mit dem Grafen sprachen, und dieser selbst nannte Sie ja einen ungläubigen Thomas.«
»Ja, ich glaube«, ging Axel jetzt darauf ein, »ich glaube, so weit ich es kann.«
»Also immer noch nicht so ganz?«
»Sie sagten soeben: dass dieser Graf etwas mehr kann, als wir sterblichen Menschen. Sie halten den Grafen also für einen ganz anderen Menschen?«
»Na, ist er das etwa nicht?!«, erklang es fast beleidigt zurück.
»Sie halten ihn wirklich für unsterblich?«
»Na, zweifeln Sie denn immer noch daran? Genügt Ihnen denn nicht schon meine Erklärung, dass ich ihn als Leiche, wenigstens als scheinbare, in dem Keller meines Hauses gefunden habe?«
Dass der Graf in diesem nicht hundert Jahre eingemauert gelegen hatte, darüber hätte Axel den Lord belehren können, aber... er tat es nicht! Er fing gleich von etwas anderem an.
»Ja, das mit dem sprechenden Fakir in der Kiste, das ist nun wieder eine ganz merkwürdige Geschichte.«
So sprach Axel, um ein anderes Thema einzuleiten. Aber der Lord ging gleich wieder zu dem vorigen zurück, nur auf diesem Umwege.
»Nun, Sie selbst haben ja gelesen, dass ein Anuruddha wirklich zu Buddhas Zeiten existiert hat.
Wie nun der Graf zu diesen gekommen ist? Das ist doch sehr einfach. Oder wissen Sie nicht, dass auch der Graf ein Schüler Buddhas gewesen ist?«
Axel hob den Kopf, machte wieder ein ganz eigentümliches Gesicht.
»Wie? Auch zu Buddhas Zeiten hat der Graf schon gelebt?!«
»Ja, gewiss doch. Und warum denn nicht? Wenn er schon vor 5000 Jahren im alten Babylon gelebt hat! Er hielt sich gerade in Persien auf, als er von den Wundertaten des indischen Königsohnes, der den Bettlerstab ergriffen, hörte...«
Der Lord berichtete weiter. Aber es war sehr die Frage, ob ihm Axel auch zuhörte. Er war wieder ganz in Gedanken versunken.
Und nun wollen wir hier eine Erklärung einschieben.
Über den Grafen von Saint-Germain kann man in jedem Konversationslexikon nachlesen, unter dem Stichwort Germain. Viel ist es ja freilich nicht, was da angeführt wird. Ein berühmter Abenteurer, Alchimist und Geisterbanner, es wird zu erörtern versucht, wer er wohl in Wirklichkeit gewesen sein mag; die einen halten ihn für einen spanischen Jesuiten, die anderen für einen elsässischen Juden. Jedenfalls ein Schwindler. Aber auch das sachliche Konversationslexikon erkennt rückhaltlos die enormen ans Übernatürliche grenzenden Fähigkeiten dieses Mannes an, sein fabelhaftes Gedächtnis, wie er jedes Buch, das er einmal gelesen, auswendig konnte, wie er jedes Instrument und besonders die Violine mit wunderbarster Fertigkeit spielte, wie er gleichzeitig mit beiden Händen in verschiedenen Sprachen schreiben konnte, usw.
Das steht in jedem Konversationslexikon, man lese darüber nach. Als Literatur über den Grafen von Saint-Germain, aus der diese Angaben geschöpft sind, wird dann angeführt: ›Mémoires de Madame Duhauaset‹, ferner das ebenfalls französische Werk ›Souvenirs de la Marquise de Créqui‹; und schließlich und vor allen Dingen ›Der Graf von Saint-Germain‹ von E. M. Oettinger, erschienen 1846 in Leipzig.
Alle diese Biografien erzählen von des Grafen erstem Auftreten in Rom, im Jahre 1750, was für Wundertaten er verrichtete, in der Absicht, eine geheime Sekte nach Art der Rosenkreuzer zu gründen, was ihm misslang; dann tauchte er kurz hintereinander in Venedig, Neapel, Genua, Pisa und Mailand auf, aber immer unter anderem Namen, sodass man nicht genau weiß, ob der Mann, der da besonders Schatzgräberei trieb und Geister beschwor, auch wirklich der Graf von Saint-Germain gewesen ist — und dann müssen alle diese Biografen einen Sprung von sieben Jahren machen.
Erst im Jahre 1756 erschien der Graf wieder in Paris, und hier erst beginnt der eigentliche Bericht seiner Biografen und nachträglichen Erforscher seines Lebenslaufes. Von hier an spielt der Graf von Saint-Germain nämlich eine ganz bedeutsame politische Rolle. Er gewann die Gunst des französischen Königs Ludwig XV., dem er Unterricht in der Alchimie gab, noch mehr gewann er die Gunst der Madame Pompadour, ging von Paris als französischer Gesandter nach London, um die Friedensverhandlungen zu leiten, wurde für einen russischen Spion gehalten, floh auch wirklich nach Russland, wo er im Jahre 1762 bei der Thronumwälzung die wichtigste Rolle spielte, wenn auch mehr hinter den Kulissen. Dann lebte er einige Zeit in Berlin, 1774 tauchte er in Schwabach als der vertrauteste Freund des Markgrafen Karl Alexander von Ansbach auf, begleitete diesen nach Italien, lebte dann wieder am Hofe des Landgrafen Karl von Hessen und starb schließlich, des Lebens überdrüssig, im Jahre 1780 zu Eckernförde eines seligen Todes. Sein Bild hängt heute noch im Schlosse zu Triersdorf in dem von ihm einst bewohnten Zimmer.
Das ist mit kurzen Worten der Lebensgang des Grafen von Saint-Germain.
Aber wo er nun die sieben Jahre von seinem Verschwinden aus Rom bis zu seinem Wiederauftauchen in Paris gewesen ist, davon weiß niemand zu erzählen. Er selbst gab später immer an, er habe während dieser Zeit bei den Mahatmas, bei den Geisterfürsten, die auf dem höchsten Gipfel des Himalajas thronen und von dort aus die Geschicke der Völker lenken, geweilt. Dass dies ihm die Biografen nicht glauben, kann man ihnen nicht verargen.
Sie alle aber wissen von dem schwarzen Schiffe zu erzählen, auf dem der Graf Rom verlassen hat, durch dessen Drohung mit einem Bombardement Fiumicinos er erst aus dem Inquisitionskerker geholt wurde. Dass dieses Schiff eine geheimnisvolle Kraft zur Eigenbewegung besessen habe, davon berichtet nur die Marquise de Créqui, nur einmal andeutungsweise, das könne auch ein Irrtum gewesen sein. Sonst berichten hierüber nicht einmal diejenigen Chronisten, welche den Grafen selbst gekannt haben, dieses Schiff selbst sahen, während sie doch sonst über den Grafen solche Fabeln erzählen, dass sie eben gar nicht als Historiker zu gelten haben.
Nur der deutsche Biograf beschäftigt sich mit diesem Schiffe, glaubt bestimmt, dass.... nun, auf welche Weise sich dieses Schiff von selbst fortbewegen konnte, das hat der Leser natürlich schon längst erraten. Sonst wollen wir nicht vorgreifen.
Im Übrigen hat dieses schwarze Schiff auch nie eine besondere Rolle gespielt in den Berichten der Chronisten. Es hatte sich zu wenig bemerkbar gemacht, war zu selten beobachtet worden, nur wenige Seemannsaugen hatten bemerkt, wie es gegen den Wind fahren konnte, die hatten sich sicher getauscht — — denn man hielt damals eher für möglich, dass sich ein Mensch frei in der Luft erheben und sich unsichtbar machen konnte — warum auch nicht? Die katholische Kirche hat mehr als vierzig Heilige, die das konnten, von Apollonius von Tyana haben wir ›verbürgte Beweise‹, dass er sich im Augenblick aus einer Stadt in die andere versetzte — das war damals also viel mehr möglich, als dass sich ein Schiff durch eigene Kraft fortbewege. So etwas ging damals den Leuten doch etwas über... die Hutschnur. (Und da sieht man wieder einmal, wie beschränkt der Horizont des menschlichen Geistes ist.)
Dann gibt es über den Grafen von Saint-Germain noch eine umfangreiche Handschrift, die nie gedruckt wurde, nicht gedruckt werden darf, verschlossen im Archive eines Schlosses liegt, verfasst von einem der damals so zahlreichen deutschen Potentaten — — verfasst von dem Depeschenreiter Axel, der doch noch auf einen Thron umsattelte.
Eine gedruckte englische Übersetzung dieser Handschrift liegt dem Schreiber dieses vor, wenigstens ein Auszug davon, auch schon ein äußerst seltenes, längst vergessenes Buch, im Jahre 1792 zu London erschienen. Wie die besonders wegen kompromittierender Anklagen ängstlich behütete Handschrift übersetzt werden konnte, weiß der Schreiber dieses nicht. Aber man braucht nur die Einleitung zu lesen, um zur Überzeugung zu kommen, dass dieses Buch nur von einem Manne geschrieben sein kann, der mit dem Grafen von Saint-Germain im vertrautesten Umgange gestanden hat.
Es ist der deutsche Fürst, der als Depeschenreiter Axel den Grafen nach Indien begleitet, während der sieben Jahre mit ihm eine Reise um die ganze Erde gemacht hat, auf dem geheimnisvollen Schiffe, das aber sehr bald seine Farbe änderte und auch sonst alle die Geheimnisse hütete, die es in seinem Innern barg.
Und kein anderer Mensch war wohl imstande, den Grafen von Saint-Germain so genau und so gerecht zu beurteilen, wie dieser Depeschenreiter. Er hatte die glücklichste Veranlagung dazu. Wiederholt sagte er von sich selbst: Ich sehe und höre viel, was ich nicht begreifen kann, aber ich leugne nicht, dass es möglich sein könne. Denn was ist ein Wunder? Eine Erscheinung, die nicht mit den Naturgesetzen übereinstimmt. Aber was wissen wir denn von den Naturgesetzen? Es muss vielmehr heißen: Ein Wunder ist eine Erscheinung, welche scheinbar im Widerspruche mit dem steht, was wir von den Naturgesetzen wissen, herzlich wenig. Ja, mir kommt es immer vor, als ob wir Menschlein es sind, welche der Natur Gesetze vorschreiben wollen.
Und an anderer Stelle sagt er: Gibt es etwas Übersinnliches? Gewiss. Massenhaft. Wer alles so genannte Übersinnliche leugnet, stellt sich selbst das Zeugnis eines Dummkopfes aus. Beweis: Die Erde dreht sich um die stillstehende Sonne. Meine Sinne, Gesicht und Gefühl, versichern mir das Gegenteil. Und ich bin nicht imstande, zu beweisen, dass es trotzdem anders ist, dass sich die Erde um die stillstehende Sonne dreht, dass ich mit ungeheurer Geschwindigkeit durch den Weltraum sause und manchmal mit dem Kopf nach unten hänge. Um das zu beweisen, dazu müsste ich erst noch ganz andere mathematische und astronomische Studien treiben, und dann wäre ich wahrscheinlich noch immer nicht fähig, den mathematischen und logischen Beweisen von Geistern wie Kopernikus, Galilei, Kepler und Newton zu folgen. Ich nehme die Richtigkeit ihrer Behauptungen auf Treu und Glauben hin, obgleich mir meine gesunden Sinne das Gegenteil erzählen. Tue ich dies aber das erste Mal, so kann und muss ich es auch das zweite Mal tun, wenn mir eine vertrauenswerte Person, die mehr kann als ich, nach bestem Sinne versichert: So ist es! — während ich durch meine Sinne doch das Gegenteil wahrnehme. — — —
Wer so scharfsinnig und ehrlich über sich selbst urteilt, der ist auch am befähigtsten, über andere und anderes scharf und gerecht zu urteilen, und das ist es, was den wahren Forscher ausmacht!
Was nun den Grafen von Saint-Germain selbst betrifft, so gibt auch über ihn dieser ehemalige Depeschenreiter das treffendste Urteil ab, und zwar fügt er das erste da ein, wo er schildert, wie er mit Lord Moore in der kleinen Kajüte der Jacht saß, nachdem sie die sprechende Kiste verlassen hatten.
»Mit diesem Grafen hat sich wohl die Schöpfung selbst betrogen. Sie hat ihm etwas zu viel, andererseits etwas zu wenig gegeben. Was könnte dieser Graf für die Menschheit bedeuten! Ausgestattet mit den eminentesten Fähigkeiten, geistige sowohl wie körperliche, die er durch rastlose Übung noch ständig zu vervollkommnen sucht. Vom Geschick dazu auserkoren, der Miterbe eines Mannes zu sein, über den ich bisher noch nichts Positives erfahren habe, der aber jedenfalls in jeder Hinsicht den größten Menschengeistern weit vorausgeeilt war. Ja, dieser Graf könnte ein Beglücker der Menschheit werden, aber er hat von vornherein einen Irrweg betreten, er hat geglaubt, die Welt wolle betrogen sein und müsse auch betrogen werden. Und von diesem Irrwege kann er nun gar nicht wieder abkommen, selbst wenn er es wollte. Außerdem lastet ein Fluch auf ihm: der Fluch, renommieren, aufschneiden, alles übertreiben zu müssen. Ja, das scheint mir bei diesem Manne gar keine lasterhafte Schwäche, sondern wirklich mehr ein Fluch zu sein, für den er nicht verantwortlich zu machen ist. Er, der sonst edelste, uneigennützigste Charakter, wird wie von einer geheimen Macht getrieben, alles zu übertreiben, an jede Zahl einige Nullen zu hängen, aus jeder Mücke einen Elefanten zu machen. Nehmen wir nun zum Beispiel die sprechende Kiste an. Der darin steckende Fakir lag in starrem Todesschlafe, brauchte keine Luft, keine Nahrung und gar nichts. Wenn er selbst noch hellsehend war, so besaß er doch die Gabe der Gedankenübertragung im höchsten Maße. War dies alles nicht schon wunderbar genug? Nein, nicht für den Grafen. Der musste aus diesem Fakir nun gleich einen vollendeten Heiligen machen, der sogar schon zu Buddhas Zeiten gelebt, seit dreitausend Jahren in dieser Kiste gesteckt hatte, und so musste der Graf auch gleich noch angeben, er selbst habe Buddha schon persönlich gekannt. Anders brachte er es nicht fertig. Und so war es mit allem und jedem. Immer die fürchterlichste Übertreibung.«
Treffender ist dieser Graf wohl von keinem anderen charakterisiert worden.
Also, dies alles dachte der spätere Fürst schon damals, als er als Depeschenreiter in der kleinen Kajüte saß und vor sich hinträumte, ohne darauf zu achten, was ihm Lord Moore da alles erzählte.
Der schwarze Sam trat ein, eine weiße Küchenschürze vorgebunden.
»Der Herr Kapitän lässt fragen, ob die Herren gleich zu speisen wünschten.«
»Dass Kapitän Morphium so höflich fragen lässt, bezweifele ich sehr«, entgegnete Axel, »und was mich betrifft, so brauche ich überhaupt nie gefragt zu werden, ob ich speisen möchte. Dazu bin ich immer bereit und noch zu etwas ganz anderem als nur zum Speisen. Soll das Frühstück sein oder Mittag?«
»Zum Frühstück ist es schon zu spät und zum Mittag noch zu früh«, grinste der Neger.
»So wollen wir gleich beides vereinigen. Wenigstens, wenn es nach mir geht. Was gibt es denn?«
»Hafer und Heu«, grinste Sam noch mehr.
»Wenn diese Vegetabilien nach dem Rezepte meines Freundes Morphium von einem Ochsen oder sonst einem Tierchen schon einmal gefressen worden sind, dann lasse ich mir das gefallen, sonst nicht. Dann serviere los. Ich werde unterdessen...«
»Halt, Massa, nicht an Deck«, sagte der Schwarze, dem Aufstehenden den Weg vertretend. »Ich soll auch noch bitten, die Herren möchten jetzt nicht an Deck gehen, und deshalb soll ich fragen, ob die Herren jetzt gleich zu speisen wünschten.«
»Ja, warum sollen wir denn nicht an Deck gehen?«, fragte auch Lord Moore verwundert.
»Weil draußen alles Wasser ist, würde hereinfließen.«
Der Neger hatte recht. Ein Öffnen der Tür hätte genügt, die tiefliegende Kajüte ganz unter Wasser zu setzen. Das musste man doch vermeiden, solange kein zwingender Grund vorlag, die Tür zu öffnen.
So kam es, dass die beiden Männer noch zwei Stunden in der Kajüte gefangen waren.
Sam hatte in der Miniaturküche bereits das Essen zubereitet, trug es auf, verschiedene Fleischspeisen, sowohl frische wie gesalzene oder gepökelte, denen aber allein Axel mit bestem Appetite zusprach. Der Lord begnügte sich mit Brot und einigen Feigen und Datteln, wollte auch von dem vorgesetzten Weine nichts wissen.
»Ist das Regenwasser?«, fragte er, als er nach der festgeklemmten Karaffe griff.
»Ganz frisch vom Himmel heruntergekommen, noch ganz warm«, versicherte Sam, der hier an Bord überhaupt immer zu grinsen schien.
Axel warf dem Regenwassermanne einen bedauernden Blick zu, sonst sagte er nichts, dachte wahrscheinlich nur an die arme Braut und an die noch ärmere zukünftige Frau des Lords, der sich innerhalb von sechs Wochen so gänzlich verwandelt hatte.
Dann ward der Lord immer ungeduldiger, er wollte durchaus hinaus.
»Dass nur der Kiste nichts passiert!«
»O, die steht ganz gut unter der Back, die jetzt geschlossen ist«, beruhigte Sam.
»Was macht der Fakir?«
»Danke, der ist ganz gesund tot, sagt keinen Mucks.«
»Wenn der Graf aber nun uns etwas mitzuteilen hat?«
»Dann muss der Tote doch erst Bimbam machen, und das hören wir schon, ein Matrose ist immer unter der Back.«
Endlich ließ das tolle Schlingern und Tanzen der Jacht schnell nach, es war möglich, an Deck zu gelangen, ohne das ganze Fahrzeug voll Wasser zu bekommen.
Der Kapitän selbst forderte seine Gastfreunde hierzu auf, ließ ihnen wasserdichte Ölsachen bringen.
Der Aufenthalt an Deck war freilich noch immer gefährlich genug, alles immer unter Wasser. Unter der Back waren sie geschützt.
Geläutet hatte die Kiste noch nicht, auch sonst keinen Ton von sich gegeben. Das schwarze Schiff war eine Seemeile voraus, hatte alle Segel gesetzt, während die Jacht ihre Fahrt manchmal mit Absicht mäßigen musste, um jenem nicht vorauszukommen.
»Es wird wohl erlaubt sein, noch einmal hineinzublicken«, meinte Axel, den Deckel heben wollend.
Es gelang ihm nicht.
»Da ist wohl ein geheimer Mechanismus dabei«, sagte der Lord.
»Das habe ich nicht beobachtet, bei dem Grafen ging es so leicht, und...«
Erschrocken prallten die Umstehenden zurück, denn während Axel noch immer den Deckel zu heben versuchte, wobei er die Kiste auch etwas gerüttelt hatte, erscholl aus dieser plötzlich jener überaus volle Glockenton, von dem man gar nicht annehmen konnte, eine menschliche Kehle vermöge ihn hervorzubringen.
Er war gar zu unvermutet gekommen, daher der allgemeine Schreck. Nur Axel war ganz gelassen geblieben, er beugte sich sofort hinab.
»Will jemand sprechen?«, fragte er mit lauter Stimme.
»Ja, hier der Graf Germain«, hörte man ganz deutlich des Grafen sonore und doch so schmelzende Stimme aus der Truhe sprechen. »Signor Axel, sind Sie es?«
»Ich bin's.«
»Es versuchte soeben jemand, den Deckel mit Gewalt zu öffnen.«
Das Staunen der Umstehenden lässt sich denken.
»Das war ich«, entgegnete Axel.
»Bitte, unterlassen Sie das doch, wenigstens auf diese Weise. Der Deckel ist nicht eigentlich geschlossen, sondern der Paramahamsa hält ihn nur fest, aber nicht etwa mit seinen Händen, sondern nur durch seine Willenskraft. Wollen Sie den Deckel öffnen, so klopfen Sie erst an, äußern vernehmlich den Wunsch, und Sie werden ihn ohne Mühe öffnen können.«
»Merkwürdig, überaus merkwürdig«, brummte Axel, und laut sagte er: »Es wird fernerhin so geschehen, ich bitte sehr um Entschuldigung.«
»Nicht nötig. Haben Sie sonst eine Frage?«
»Haben Sie sich wieder einmal nach der Prinzess umgesehen?«, kam Axel dem Lord zuvor.
»Sie ist bei einer Karawane, die sich auf dem Marsche durch die Wüste befindet.«
»Ist die Karawane von jenen Piraten gebildet?«, fragte Axel sofort sachgemäß.
»Nur zum Teil. Es sind noch andere Araber hinzugekommen, Beduinen mit Pferden und Kamelen.«
»Wissen Sie auch, wohin sie gebracht wird?«
»Nein, das konnte ich nicht erfahren. Als ich vorhin im Starrkrampf lag, aus dem ich erst vor einer Viertelstunde erwacht bin, wurde bei der Karawane kein einziges Wort gewechselt, so konnte ich auch das Ziel nicht erfahren. Und der hellsehende Fakir, den ich hier habe, kann nur fern sehen, nicht fern hören. Doch seien Sie beruhigt, die Prinzess wird auf das respektvollste behandelt. Sobald ich etwas Gewisses erfahre, teile ich es Ihnen mit. Haben Sie mir sonst etwas mitzuteilen?«
Nein, Axel nicht und auch der Lord nicht.
»So vorläufig Schluss. Der Wind wird sich bald legen.«
Diese Prophezeiung, die aber auch Kapitän Morphin hätte geben können, erfüllte sich sehr bald.
Immer mehr flaute der Wind ab, bis gegen sechs Uhr völlige Windstille herrschte.
Doch brauchte das nicht dieselbe Windströmung zu sein, welche sich abgeschwächt hatte. Das Mittelländische Meer ist ein ganz eigentümliches Gewässer, es ist wie in Regionen eingeteilt, deren jede ihre eigenen Winde hat. Auf dem Mittelmeer sieht man häufig zwei Segelschiffe sich begegnen, nur wenige Seemeilen voneinander getrennt, und beide haben den Wind direkt hinter sich. Ebenso ist es auch mit der Wellenbewegung beschaffen. Man kommt aus aufgewühlter See in ganz ruhiges Wasser.
So befanden sich auch in der sechsten Stunde die beiden Schiffe in ganz ruhigem Wasser, und es wehte ein so leises Lüftchen, das eben noch die leichte Jacht etwas vorwärts trieb, während die kolossale Fregatte anscheinend schon ganz still lag.
Diese letzte Veränderung war sehr plötzlich gekommen.
»Ich lasse die Segel streichen und festmachen.« sagte Morphin, als seine Jacht keinen halben Kilometer mehr von dem schwarzen Schiffe entfernt war.
Hastig wandte sich ihm Axel zu.
»Nein, heran, heransegeln!«, flüsterte er ebenso hastig.
»Wir wollen doch einmal durch den Fakir anfragen, ob wir hier liegenbleiben sollen«, meinte der Lord, der Axels Aufforderung nicht gehört hatte.
Er fand keine Beachtung, Kapitän Morphin verstand auch sofort, was sein junger Freund beabsichtigte, richtete die Segel etwas anders, um noch das letzte Lüftchen auszunutzen, und so waren noch keine fünf Minuten vergangen, als die Jacht gegen die Steuerbordseite des schwarzen Riesen antrieb.
»So ist es recht, bleiben wir nebeneinander liegen«, ließ sich die Stimme des Grafen vernehmen, der über die hohe Brüstung herabspähte, der einzige, der zu erblicken war.
»Wie lange?«, fragte Lord Moore.
»Ja, bis wir wieder Wind haben.«
»Sie können aber doch durch eigene Kraft fahren.«
»Durch eigene Kraft? Wie meinen Sie das?«
»Nun, Sie können doch Ihr Schiff durch — durch — irgendeine Zauberkraft vorwärtstreiben, sogar direkt gegen den Wind.«
»Woher wissen Sie denn das?«
»Nun, ich habe dieses Manöver doch heute früh selbst beobachtet, als Sie gegen Palo fuhren.«
»Da haben Sie sich wohl geirrt. Nein, so einfach ist das nicht. Wir müssen warten, bis wir wieder Wind bekommen.«
Der Graf sprach's und verschwand, kam nicht wieder zum Vorschein.
Es war ganz offenbar, dass er wegen dieser rätselhaften Kraft nicht befragt werden wollte.
Der Lord war trostlos, er wurde ja durch diese Windstille immer weiter von seiner Geliebten getrennt, der Graf wollte plötzlich nicht mehr Rede und Antwort stehen... doch hatte er nicht erlaubt, ihn jederzeit durch die rätselhafte Truhe anzurufen?
Also der Lord ging unter die jetzt offene Back und klopfte gegen die Truhe. Sofort erscholl aus dieser als Gegenzeichen der Glockenton.
»Wünscht mich jemand zu sprechen?«, fragte des Grafen Stimme.
»Ich bin es, Lord Moore. Darf ich eine Frage an Sie stellen?«
»Zu jeder Zeit.«
»Haben Sie wieder etwas von Prinzess Polima gesehen?«
»Ich wollte es Ihnen soeben mitteilen, Sie anrufen. Die Karawane ist in einem Bergschloss oder richtiger einer Felsenburg eingetroffen, jedenfalls dem letzten Schlupfwinkel dieser Piraten, oder der Residenz ihres Scheichs, in welchem die wertvollere Beute, soweit sie sich fortbringen lässt, untergebracht wird. Die Prinzess befindet sich gegenwärtig in einem sehr bequem und mit dem höchsten Luxus ausgestatteten Gemach, hat vorhin vortrefflich gespeist, wird von schwarzen Sklavinnen bedient und auch sonst nach wie vor mit der höchsten Ehrfurcht behandelt. Mehr kann ich Ihnen sonst nicht berichten.«
»Und wo liegt dieses Bergschloss?«
»Das freilich kann ich Ihnen nicht sagen. Die Karawane ist anderthalb Stunden durch die Wüste marschiert, immer südwestlich, dann begann eine halbstündige Klettertour, immer im Zickzack, auch unter Zuhilfenahme von Leitern und Seilen. Der hellsehende Fakir kann die Lage sehr genau beschreiben, das heißt die Umgegend des Felsennestes, eine furchtbar wilde Einöde ohne jeden Grashalm, kann pittoreske Felsenbilder schildern — aber eine geografische Bestimmung des Ortes vermag er natürlich nicht zu geben...«
Das klang für den Lord wenig trostreich.
»Werden wir diese Felsenburg denn finden?«, fragte er kleinlaut.
»Seien Sie dessen versichert.«
»Aber wenn wir nun hier lange Zeit untätig liegen müssen, vielleicht tagelang?«
»Warten Sie den Anbruch der Nacht ab.«
»Und was ist dann?«
»Sie werden es erfahren. Schluss. Oder, bitte, sagen Sie dem Signor Axel, er möchte sich zu mir an Bord bemühen.«
Der in jeder Weise so bevorzugte Depeschenreiter hatte diese Unterredung mit angehört, und da kam von der hohen Bordwand des schwarzen Schiffes auch schon ein Fallreep herab, eine Strickleiter mit hölzernen Sprossen, von den Seeleuten auch Himmelsleiter genannt.
Axel stieg hinauf, ward von dem Grafen selbst empfangen und in die schwarze Kajüte geführt, die schon öfters zu solchen Unterredungen gedient hatte.
»Bitte, nehmen Sie Platz. Haben Sie das Gespräch mit angehört, welches ich soeben mit Lord Moore führte?«
»Von Anfang bis zu Ende.«
»Ich habe dem Lord nicht ganz die Wahrheit gesagt.«
»Inwiefern nicht?«
»Die Sache scheint sich nicht so einfach abwickeln zu wollen, wie ich es anfangs gedacht hatte. Ich glaubte doch nur an ein Lösegeld, auf welches die Piraten es abgesehen hätten, und mochte dieses auch noch so groß sein, wir hätten es bezahlen können. Nun aber beschreibt der hellsehende Fakir, dessen ich mich für gewöhnlich bediene, im Innern dieser Felsenburg einen märchenhaften Reichtum, dort muss alles geradezu von Gold und Edelsteinen strotzen, und der Herr der Burg ist ein noch junger, feuriger Araber, und wie er die Prinzess in seinem Heim empfangen hat, wie er dem schönen Weibe entgegenkommt... Signor Axel, ich bezweifle, dass dieser Araber das schöne Mädchen gegen irgendwelches Lösegeld zurückgibt.«
»O weh«, zeigte Axel gleich sein Verständnis für die Sachlage, »da haben Sie allerdings gut daran getan, das dem Lord vorläufig zu verheimlichen. Es würde ihn vollends zur Verzweiflung bringen. Da haben die Piraten die Gefangene wohl schon an den Burgherrn verkauft?«
»Nein, dieser Burgherr ist selber der Piratenkapitän.«
»Woher wissen Sie das?«
»Einfach weil er die Bande angeführt hat, er befehligte die erste Galeere, erklomm als erster das Deck der französischen Fregatte.«
»So genau ist dies alles von dem Fakir beobachtet worden?«
»Ja, durch Zufall, indem ich gerade damals seine Aufmerksamkeit auf die Prinzess konzentrieren ließ. So wurde ich Zeuge des ganzen Kampfes. Und dann habe ich die Piraten nicht wieder aus den Augen des hellsehenden Fakirs kommen lassen, soweit das möglich ist. Außerdem sind die Piraten in jener Felsenburg zu Hause, das lässt sich ganz deutlich erkennen. Sie haben dort ihre Weiber und alles, mancher Anführer einen ganzen Harem.«
»Auch der Scheich hat einen Harem?«
»Bisher ist er in einem solchen noch nicht gesehen worden. Das wäre in Bezug auf die Prinzess ja auch gleichgültig. Und doch, es lässt wieder auf etwas schließen, dass der Fakir, der den Scheich ständig beobachten muss, diesen noch nicht mit anderen Weibern hat verkehren sehen. Nun hat dieser Scheich nämlich auch einen roten Bart...«
Der Graf brach kurz ab, als wolle er erwarten, was für eine Wirkung die Erwähnung dieses roten Bartes auf den anderen hervorbringe.
»Ein Araber mit einem roten Barte?!«, rief Axel denn auch. »Das ist mir etwas ganz Neues!«
»Nun, es brauchte ja gar kein echter Araber zu sein. Merkwürdig dabei ist nur, dass der Mann schwarze Kopfhaare hat...«
»Schwarze Haare und einen roten Bart?!«
»Da ist anzunehmen, dass er sich den Bart rot gefärbt hat.«
»Oder das Kopfhaar schwarz. Ja, warum denn das? Graf, Sie verheimlichen mir etwas, oder Sie wollen mich prüfen!«
»In der Tat. Kommen Sie nicht von allein auf etwas?«
»Ich weiß nicht, was Sie meinen.«
»Haben Sie noch nichts von Barbarossa Maladenne gehört?«
»Barbarossa Maladenne?«, wiederholte Axel sinnend. »Ja, wie ist mir denn — den Namen Barbarossa kenne ich — und ich denke dabei nicht an unseren Kaiser Rotbart, wo wir von arabischen Seeräubern sprechen, — es hat wohl einmal einen maurischen Piraten gegeben, der diesen Namen führte und der sich furchtbar machte, wirklich eine historische Berühmtheit...«
»Darf ich Ihrem Gedächtnis zu Hilfe kommen?«
»Bitte sehr. Die Weltgeschichte ist überhaupt meine schwache Seite.«
»Sie haben bereits das Richtige getroffen. Es waren gleich zwei Barbarossas, zwei Brüder, die sich als arabische Seeräuber im Anfange des 16. Jahrhunderts furchtbar machten, die ganze Welt in Atem hielten, wenigstens die Kriegsflotten aller Staaten — Barbarossa Horuk und Barbarossa Dschereddin...«
»Richtig, richtig, jetzt entsinne ich mich, da Sie diese Namen nennen! Aber, bitte, erzählen Sie nur weiter, es interessiert mich wirklich sehr.«
»Der später so genannte Barbarossa Horuk, dessen eigentlichen Namen man nie erfahren hat, war ein Grieche, von Lesbos, vielleicht ein Jude, und unter Juden findet man doch öfters rotes Haar, und es hat auch genug jüdische Kriegshelden gegeben — andere sagen wieder, er habe germanisches Blut in seinen Adern gehabt. Er war ursprünglich ein Fischer, wandte sich aber mit seinem Bruder Dschereddin bald ausschließlich dem Seeräuberhandwerk zu, trieb es immer größer, die beiden wurden bald der Schrecken des Mittelmeeres, dann traten sie in die Dienste Mohammeds, des damals mächtigen Sultans von Tunis, begründeten hier die heute noch existierenden sogenannten Barbareskenstaaten, eine Verbindung von ganz regelrechten Piratenreichen. Als erster Anführer dieser Seeräuber, die damals über eine gewaltige Flotte verfügten, schlug Horuk die spanische Armada, die gegen ihn ausgesandt war, 1518, fand aber selbst bald darauf seinen Tod.
Noch viel intensiver begann nun sein Bruder Dschereddin zu arbeiten. Der machte gleich mit dem türkischen Sultan ein Bündnis, der ihm Schiffe lieferte und Soldaten zur Verfügung stellte, unter diesen sogar 10 000 der auserlesensten Janitscharen. Danach können Sie also ermessen, was für eine Macht diese Seeräuber damals besessen haben. Von Tunis, seinem Hauptsitze, aus suchte er mit seinen mehr als hundert stattlichen Schiffen alle Küsten des Mittelmeeres heim, schlug noch einmal eine spanische Flotte, eine französische, eine maltesische, und im Golf von Arta besiegte er sogar den furchtbaren Doria. Endlich hatte der rote Pirat genug. Dreißig Jahre lang hat er so im Mittelmeer gehaust. Er war auch schon alt genug, 88 Jahre, als er nach Konstantinopel ging und hier noch in demselben Jahre als frommer Klausner eines seligen Todes starb.
Das sind die beiden Brüder Barbarossa, unter denen die Barbareskenstaaten die höchste Stufe ihrer Macht erreichten. Unter Dschereddins Sohn und Nachfolger Hassan ging es dann schnell bergab bis auf den jetzigen Grad. Wie es jetzt mit den Barbareskenstaaten steht, wissen Sie ja wohl. Es sind noch immer furchtbare Seeräuber, gegen welche die europäischen Mächte noch immer nichts ausrichten können, aber dass sie einer ganzen Kriegsflotte eine Schlacht liefern, damit ist es natürlich nichts mehr. Das macht: Die alte Einigkeit fehlt. Jetzt treibt jeder Scheich das Seeräuberhandwerk mit seiner Bande auf eigene Faust. Das ist schlimm genug, eben deshalb muss jede Bande einzeln in ihrem Schlupfwinkel aufgesucht werden, wobei ja der Malteserorden mit seinen dazu eingerichteten Schiffen die vorzüglichsten Dienste leistet. Aber während hier eine Bande vernichtet, wird dort schon wieder von den Piraten ein Segelschiff bei Windstille angegriffen und ist dann regelmäßig rettungslos verloren. Doch mit der alten Herrlichkeit ist es nun vorbei. Von politischer Bedeutung gar nicht mehr zu sprechen.
Da tauchte, es ist zwei Jahre her, ein tunesischer Piratenscheich auf, der sich Barbarossa Maladenne nannte, das ist Rotbart der Weiberfeind, mit der Behauptung, er sei ein echter, direkter Abkömmling jener Barbarossas vor 200 Jahren, deren Geschlecht sonst für ausgestorben gilt. Seine Behauptung unterstützt er durch alte Dokumente, dann auf das Phänomen, dass er bei schwarzem Haupthaar einen roten Bart besitzt, dessen echte Farbe jeder prüfen könne, und schließlich wisse er auch, wohin damals Dschereddin seine Schätze gebracht habe, er sei im Besitz derselben.
Da muss ich also etwas nachholen. Dschereddin ist ein einziges Mal geschlagen worden. Aber auch nur, weil er in der Schlacht nicht selbst zugegen war. Auch war Verrat dabei. Während Dschereddin mit seiner Flotte vor Nizza lag, um dieses einzunehmen, fuhr Karl der Fünfte mit 500 Schiffen und 30 000 Mann, mit denen er scheinbar nach Amerika hatte segeln wollen, schleunigst nach Tunis und nahm mit leichter Mühe Goletta, die Zwingburg des Piratenfürsten.
Dem Kaiser fielen 85 Schiffe und ungeheure Vorräte von Proviant und Munition in die Hände. Aber nicht die noch ungeheureren Schätze, auf welche es Karl hauptsächlich abgesehen hatte. Denn in diese für uneinnehmbar geltende Zwingburg hatte Dschereddin alles geschleppt, was er im Laufe von 20 Jahren zusammengeraubt hatte, und wie hat dieser Kerl zu rauben verstanden, was hat der nicht für Beute gemacht! Erstens diese reichen Städte an den französischen, italienischen und griechischen Küsten, die er brandschatzte, die Kirchen, die er ausgeplündert hat, und dann kamen damals von Peru und Mexiko nach Spanien noch die mit Schätzen aller Art beladenen Schiffe, die er ebenfalls wegfing, noch im Atlantischen Ozean.
»Es müssen fabelhafte Reichtümer gewesen sein, die in Goletta aufgehäuft waren. Aber Karl fand nichts mehr davon. Der Vertrauteste Dschereddins namens Muley, so eine Art von Minister, hatte erkannt, dass die Burg nicht zu halten sei, hatte die Schätze rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Eine ganze Karawane war dazu nötig, Kamellasten von Gold und Edelsteinen, vor allen Dingen kostbare Kirchengerätschaften nicht zu vergessen. Wohin Muley die Schätze gebracht hat, das weiß niemand. Die ganze Karawane war verschwunden, niemand von ihr kehrte zurück. Nur Dschereddin soll es erfahren haben. Vielleicht aber auch nicht. Denn er stak in einer großen Geldklemme. Bis er wieder genug zusammengeplündert hatte.
Doch das ist ja alles viel zu lange her, um noch kontrolliert werden zu können. Wie dem auch sei — jetzt tritt dieser junge tunesische Piratenscheich mit der Behauptung hervor, er sei ein Nachkomme jenes Barbarossa Dschereddins und als solcher auch der Besitzer jener unermesslichen Schätze. Daraufhin sucht er alle die zahllosen Piratenscheichs an der ganzen afrikanischen Küste wieder zu vereinigen, um die Barbareskenstaaten wieder in alter Herrlichkeit erstehen zu lassen, natürlich unter seinem Zepter. Es scheint ihm nicht zu gelingen, man glaubt seinen Behauptungen nicht, denn er ist nicht zu bewegen, einem der Piratenscheichs schon vorher seine Schätze zu zeigen. Er verlangt, dass man in bedingungslosem Vertrauen zu ihm kommt.
Nach dem aber, was mir nun der hellsehende Fakir geschildert hat, zweifle ich nicht mehr, dass dieser rothaarige Weiberfeind wirklich jenen Schatz besitzt, denn dort in der Felsenburg muss alles von Gold und Juwelen strotzen, und dann vor allen Dingen sind überall die kostbarsten Kirchengerätschaften zu erblicken, auch Altardecken und dergleichen.«
Der Erzähler schwieg. Axel hatte ihm aufmerksam zugehört, ohne ihn einmal zu unterbrechen.
»Das ist eine sehr merkwürdige Geschichte. Und Sie wissen nicht, wo dieses Felsennest liegt?«
»Nein. Um das zu bestimmen, dazu reicht die hellsehende Gabe des Fakirs nicht aus. Was ich sonst weiß, haben Sie wohl schon erfahren. Die Piraten zogen anderthalb Stunden südwestlich durch eine ziemlich ebene Wüste, dann stieg jäh ein Gebirge empor, in dem noch mindestens eine halbe Stunde im Zickzack geklettert wurde, unter Benutzung von Leitern und Seilen. Ein furchtbar beschwerlicher Weg.«
»Das rechnen Sie von dort aus, wo die Piraten landeten?«
»Jawohl, von jener Bucht aus, in der auch ihre Rudergaleeren liegen, deren Namen ich auch mehrmals nennen hörte — tala el schehen, das ist Höllenloch.«
»Und dieses Höllenloch werden Sie finden?«
»Ganz sicher. Ich brauche nur ein kurzes Stück die gebirgige Küste entlang zu fahren, dann erkenne ich die Bucht und Schlucht sofort wieder, ich habe damals, als ich im Geiste die Piraten begleitete, gründlich Umschau gehalten.«
»So, als Sie im Geiste dort waren«, sagte Axel trocken. »Nun, ich hoffe, dass wir dieses Räubernest nicht nur im Geiste ausnehmen, und auch nicht nur geistige Schätze dort finden. Ich kann Gold und Edelsteine gerade recht gut gebrauchen...«
»Sind Sie geldbedürftig?«, fiel ihm der Graf ins Wort.
»Welcher Mensch ist das nicht? Wenigstens welch kultivierter Mensch, der sich nicht mit Heuschrecken begnügen mag? Wollen Sie mir vielleicht Kredit eröffnen?«
»Meine Kasse steht Ihnen immer zur Verfügung, und sie ist jetzt überreichlich gefüllt...«
»Nein, ich danke«, lehnte Axel ab. »Ich strebe nur nach Geld, um es immer möglichst schnell und in möglichst sinnloser Weise durchzubringen, und dazu muss es auf eine besondere Weise verdient worden sein, so mehr erbeutet oder selbst ergaunert, nur nicht so ganz durch ehrliche Arbeit verdient, sonst macht mir das Vergnügen auch wieder keinen Spaß. Aber bleiben wir doch zunächst bei der Hauptsache. Also Sie meinen, dieser allerneuste Barbarossa ist für seine schöne Gefangene entflammt.«
»Das muss man unbedingt daraus schließen, wie er ihr entgegenkommt.«
»Wie macht er denn das?«
»Der Fakir hat schon zweimal beobachtet, wie er vor ihr niedergekniet ist.«
»Und dabei bedeutet Maladenne so viel wie Weiberfeind? Wie reimt sich denn das zusammen?«
»Es mag eben seine erste Liebe sein, denn gegen die Liebe ist kein Mensch gefeit.«
»Auch Sie nicht, Herr Graf?«
Der Graf verlor bei dieser unverfrorenen Frage einmal ganz seine Fassung.
»Ich?! Wie kommen Sie denn...«
»Pardon, ich sagte das nur so hin. Ich dachte eben angestrengt nach, und wenn ich das tue, muss ich dabei immer irgend etwas sprechen, und da kommt manchmal ungereimtes Zeug heraus. Und wie verhält sich die Prinzessin?«
»Die wehrt ihn immer ab, das heißt, dreht ihm den Rücken, weint, ringt die Hände. Schade, dass der Fakir nicht auch hellhörend ist.«
»So gehen Sie doch einmal selbst im Geiste hin.«
»Das kann ich erst morgen Mittag.«
»Lagen Sie nicht vorhin im Starrkrampf?«
»Da war die Piratenkarawane noch unterwegs nach dem Bergschloss.«
»Können Sie sich nicht jederzeit in Starrkrampf versetzen?«
»Nur wenn ich dazu disponiert bin.«
»Und Sie sind es jetzt nicht?«
»Ganz und gar nicht.«
»Schade! Na, da müssen wir uns eben mit dem behelfen, was uns der Fakir offenbart, der leider nur sehen kann«, sagte Axel in einem Tone, als gehöre er schon mit zu dieser geheimnisvollen Familie. »Ist denn der Scheich gegen die zimperliche Prinzessin noch nicht gewalttätig vorgegangen?«
»Mit keiner Fingerspitze.«
»Hm, das sieht solch einem Piraten ja eigentlich gar nicht ähnlich. So ein Kerl lässt sich doch von einem Weibsbild nicht lange den Rücken zukehren, dann packt er einfach zu und dreht sie herum.«
»O doch — das sind immerhin edle Araber, welche die Seeräuberei für einen ritterlichen Beruf halten. Ein gewisses hohes Ehrgefühl ist diesen arabischen Piraten wirklich nicht abzusprechen.«
»Aber dem Weibe gegenüber gibt es bei den Arabern keine ritterliche Ehre, ich kenne das, wenn auch nur vom Hörensagen.«
»Sie haben recht. Der Mohammedaner hat für die Frau ja nicht einmal Himmel und Hölle, die ist nur für den Mann, die Seele des Weibes zerfließt nach dem Tode wie die des Tieres in Nichts. Nun gäbe es aber doch einen Grund, aus dem sich die Glut und dennoch die ehrerbietige Zurückhaltung für und gegen das schöne Mädchen, wie der Fakir immer schildert, erklären ließe.«
»Und was für ein Grund wäre das?«
»Den Namen Weiberfeind wird dieser Piratenscheich doch nicht mit Unrecht führen. Wenn bei den sinnlichen Arabern jemand so genannt wird, so muss das seine ganz bestimmte Ursache haben...«
»Sie meinen, der Mann sei nicht ganz normal?«
»Mindestens nicht geistig. Ich habe auch schon so etwas erzählen hören. Er hält sich nämlich selbst für einen Propheten, der die vor Mohammed herrschende Religion wieder einführen möchte, die überdies ja noch Anhänger genug hat. Jedenfalls besteht seine ganze Bande aus lauter solchen mohammedanischen Ketzern, und das mag auch ein Hauptgrund mit sein, weshalb die anderen Piratenbanden trotz der glänzendsten Versprechungen nichts mit ihnen zu tun haben wollen. Und diese alte Religion der Wüstenbewohner hatte eine Unmenge von Göttern und Göttinnen. Ja, nach den Schilderungen des Fakirs kommt es mir fast vor, als wenn der Araber in seiner glühenden Phantasie das blendendweiße und blendendschöne Mädchen, wie er noch keins gesehen haben mag, so wenig wie ich, für eine Göttin hält, die er anbetet.«
»Ah, Sie haben recht!«, stimmte Axel gleich bei. »So ließe sich sein Niederknien mit seiner Ehrerbietung gleich zusammenreimen. Selbst wenn dabei wirkliche Liebe im Spiele wäre. Auch die brünstigste Liebe kann mit unnahbarer Heiligkeit vereinbart werden. Das haben wir ja bei uns auch, wir Protestanten gar nicht ausgenommen. Nun, dann ist für die Prinzess erst recht nichts zu fürchten.«
»Nein, dann ist es aber auch nichts mit einem Lösegeld.«
»Dann wird die Gefangene eben auf andere Weise befreit.«
»Das denke auch ich«, lächelte der Graf, mit sichtlichem Wohlgefallen den jungen Mann betrachtend, der diese Sache so einfach nahm. »Es ist aber wohl besser, den Lord in dem Glauben zu lassen, er könne seine Braut durch ein Lösegeld wiederbekommen. Die Wahrheit wird er noch zeitig genug erfahren, und das mit der Göttin könnte ihn jetzt auch nicht beruhigen.«
»Ganz meine Ansicht«, stimmte Axel bei. »So wäre die Hauptsache vorläufig in der Theorie erledigt. Dann darf ich wohl jetzt auch an etwas Materielles denken...«
»An die Schätze, wenn wir das Räubernest genommen haben.«
»Ja. Was werden Sie mit dem Zeug anfangen?«
»Es ist christlicher und fast selbstverständlicher Brauch, mit dem, was man arabischen Piraten abnimmt, Christensklaven freizukaufen.«
»Hochedel! Und ich bin ja auch durchaus nicht so einer. Aber... jeder Arbeiter ist doch seines Lohnes wert. Man muss ja schließlich auch etwas zum Leben haben. Des Lords Braut befreien, das tue ich natürlich unentgeltlich. Ich biete Ihnen auch sonst meine Dienste an, und Sie werden vielleicht noch erfahren, dass diese nicht zu verachten sind. Könnte ich da nicht irgendwie an der Beute partizipieren?«
»Sie kommen mir zuvor. Ich wollte Ihnen gerade den Vorschlag machen, sich mit mir sogar zu akkompagnieren. Auf halb und halb. Und zwar kommt nur Gewinn in Betracht. Einen Verlust hat unsere Firma niemals zu fürchten.«
Axel sah den anderen erst einige Zeit starr an, offenbar angestrengt nachdenkend, ehe er eine Antwort gab.
»Sie meinen, die Hälfte der den Piraten abgenommenen Schätze soll mir gehören?«
»Es soll genau geteilt werden.«
Wieder ein längeres Anstarren.
»Herr, wie komme ich dazu?«
»Weil ich Sie eben zu meinem Kompagnon haben möchte, mit dem ich natürlich redlich teilen muss.«
»Herr, was haben Sie eigentlich mit mir vor? Denn das ist ja ganz ausfallend, wie Sie mich in jeder Weise bevorzugen.«
»Ich möchte Sie für immer an mich fesseln.«
»Warum?«
»Sie können noch fragen?«
»Ich tue es.«
»Weil Sie mein Feind sind.«
»Ihr Feind? Sie träumen, Graf!«
»Sie haben mich in Ihrer Hand.«
»Ah bah, lassen wir das doch! Herr Graf, ich halte Sie für einen großen Menschenkenner.«
»Ja, der bin ich wirklich — bei aller Bescheidenheit gesagt, weil Sie es hören wollen.«
,So wissen Sie doch auch, dass ich nicht Ihr Feind bin.«
»Aber auch nicht mein Freund.«
»Nein, der bin ich allerdings nicht«, gab Axel mit gewöhnlicher Offenheit zu.
»Und ich möchte, dass Sie mein Freund werden.«
»Da muss ich immer wieder fragen: weshalb?«
»Weil mir an Ihnen am meisten von allen Menschen gelegen ist. Denn ich habe Sie als den ehrlichsten und gerechtest denkenden Mann erkannt, der mir je vorgekommen ist, und deshalb möchte ich, dass Sie einst derjenige werden, der den Grafen von Saint-Germain beurteilen soll — mit einem Wort: dass Sie mein Biograf werden.«
Axels Staunen war ungekünstelt.
»Sie scherzen wohl, Herr Graf!«
»Ich spreche im Ernst.«
»Ich, ein Depeschenreiter — Ihr Biograf?!«
»Sie sind kein einfacher Depeschenreiter.«
Es war ja sehr leicht möglich, dass der päpstliche Hauptmann geplaudert und auch der Graf davon erfahren hatte.
»Was wissen Sie von mir?«
»Gar nichts.«
»Hat Ihnen jemand etwas von mir erzählt?«
»Kein Wort.«
»Woher wollen Sie da wissen, dass ich kein so gewöhnlicher Depeschenreiter sei?«
»Ich habe es in Ihrer Hand gelesen.«
»In der Innenfläche meiner Hand?«
»Ja.«
»Die haben Sie ja noch gar nicht gesehen.«
»Doch.«
»Nicht so genau, um darin die Handlinien prüfen zu können.«
»Doch.«
»Wann?«
»Als Sie damals als päpstlicher Nuntius bei mir waren.«
»Da hütete ich mich gerade, meine braunen Pfoten sehen zu lassen, trug Handschuhe.«
»Aber ich zog Ihnen den einen doch aus, als ich Sie für fasziniert hielt.«
»Ach, richtig! Ich kann mich nur nicht darauf besinnen, dass Sie meine Hand so eingehend geprüft hätten.«
»Ich tat es, und ein Blick genügt mir.«
»Und was sagten Ihnen meine Handlinien — vorausgesetzt, dass an dieser Handleserei wirklich etwas Wahres ist?«
»Vor allen Dingen, dass Sie noch einmal auf einen Thron kommen.«
»Hm, mich zum Herrscher eines womöglich noch unentdeckten Landes aufzuwerfen, und wenn seine Bewohner auch nur schwarze Wilde sind, dazu hatte ich wohl schon immer Lust. Oder eine größere Insel besiedeln, mich als König proklamieren lassen — o ja, das wäre etwas für mich.«
»Sie werden den schon bestehenden Thron eines zivilisierten Landes einnehmen.«
»Nein, nein lieber Graf, daraus wird nichts,« lachte Axel.
»Können Sie mir daraufhin Ihr Ehrenwort geben, dass Sie solch ein Anerbieten ausschlagen würden?«
»Oho!«, fuhr da der junge Mann empor. »Fordern Sie so leicht ein Ehrenwort ab?! Das gefällt mir gar nicht an Ihnen.«
»Nun gut — nehmen Sie aber mein Ehrenwort an, dass ich nichts von Ihnen weiß, niemals etwas über Sie gehört habe.«
»Ich glaube Ihrer einfachen Versicherung.«
»Aber aus Ihrer Hand habe ich gelesen, dass Ihre Wiege eine Fürstenkrone getragen hat.«
Etwas unsicher betrachtete Axel die Innenfläche seiner Hände.
»Lassen wir das«, sagte er dann kurz.
»Wie Sie wünschen. Mir kommt es aber sehr darauf an, gerade Sie zum Biografen zu haben. Nun wissen Sie schon eher, warum.«
»Gut, ich werde mir demnächst ein Notizbuch zulegen und dann jeden Ihrer Schritte überwachen.«
»Und noch etwas anderes habe ich in Ihrer Hand gelesen, weshalb ich Sie gern an mich fesseln möchte.«
»Immer noch etwas?«
»Dass unserer beiden Schicksale miteinander verbunden sind.«
»Inwiefern?«
»Das weiß ich freilich nicht. Die Folge wird es lehren.«
»Aber, geehrter Herr Graf, wenn es ein Kismet gibt, und es ist nun einmal bestimmt, dass unsere Schicksalswege zusammengehen, so brauchen Sie sich doch gar keine Mühe erst zu geben, mich an sich fesseln zu...«
In diesem Augenblick erscholl in ziemlicher Nähe, wohl nur durch eine Zwischenwand getrennt, ein donnerndes Gebrüll, vermischt mit einem ganz anderen, einem gellenden Laut.
Bleich wie der Tod war der Graf ausgesprungen.
»Um Gott, meine Ahnung — meine Warnung war vergebens — Isabel ist von dem seiner Dressur zu früh entlassenen Tiger angefallen worden!!«
So sprechend, stürzte er nach der Nebentür, sich aber im letzten Augenblick bemeisternd — ganz ruhig öffnete er sie.
Ein ebenso grandioser wie schrecklicher Anblick erwartete ihn.
In der Mitte des prächtigen, von blendend weißem Lichte durchfluteten Salons lag auf dem Teppich ein in grüne Gaze gehülltes junges Weib, von ihrem roten Haare wie von einem Mantel umgeben, das schöne Antlitz, das sie im Liegen der Tür zuwendete, jetzt vor Entsetzen ganz entstellt, und dazu hatte sie auch allen Grund, denn neben oder über ihr stand ein mächtiger Königstiger, in jener Stellung, die das Raubtier einnimmt, wenn es eine leichte Beute niedergeschlagen hat, die eine der furchtbaren Tatzen halb erhoben.
So stand der König des Dschungels da, jetzt aber nach dem Eintretenden blickend, die Zähne etwas zeigend, stoßweise leise knurrend, immer noch bereit, mit der Tatze auf sein Opfer einzuhauen.
Ganz ruhig blieb der Graf in der Tür stehen.
»Bist du verwundet, Isabel?«, fragte er mit leiser Stimme, der man kaum ein Zittern anmerkte.
»Nein, nein«, flüsterten die schneeweißen Lippen. »Er schlug mich nur nieder — rufe Sirbha, rufe Sirbha.«
Aber der Graf wusste, dass es nichts nützte, den Wärter zu rufen. Es war zu spät. Dieses bisher in Demut gehaltene Raubtier war sich durch irgendeine Gelegenheit plötzlich seiner Kraft bewusst geworden, hatte die ihm von Menschen auferlegte unsichtbare Fessel abgeschüttelt.
Auch durfte der Graf gar nicht den Rückzug antreten, sonst wäre der Tiger sicher sofort über sein vorläufig nur niedergeschlagenes Opfer hergefallen.
Hier gab es nur eins, um die Dame zu retten: Ein anderer Mensch musste sich opfern.
»Oder ich muss ihn durch meine Willenskraft faszinieren«, murmelte der Graf.
Den hypnotischen Blick haben die Raubtierbändiger schon immer angewandt, ehe noch jemand etwas von der Hypnotik wusste, auch Menschen sind schon immer hypnotisiert worden, ohne dass sie es wussten, ohne dass sie Hokuspokus machen mussten — — ja, doch: Meistenteils mussten sie tanzen, nämlich nach dem Willen des Hypnotiseurs, den sie aber nicht als solchen erkannten.
Langsam, Schritt für Schritt, näherte sich der Graf dem knurrenden und jetzt auch fauchenden Ungeheuer.
»Hier, Assam — kusch dich, Assam — komm, sei ein gutes Tierchen, Assam...«
So und anders sprach der Graf in passendem Tone, mochte von seinen durchbohrenden Augen den ausgiebigsten Gebrauch machen — aber die Sache war die, dass sich das ›Tierchen‹ weder faszinieren noch hypnotisieren lassen wollte.
Der Graf sah sich verloren!
Jetzt duckte sich der Tiger auf dem Leibe der Dame zum Sprunge zusammen, sprang...
Gleichzeitig krachte es hinter dem Grafen, und der geplante Satz des Tigers verwandelte sich mehr in eine Art von Froschsprung, er hüpfte nur etwas von der Dame ab, fiel mit einem kurzen Röcheln um, streckte sich mit einem Ruck und blieb still und stumm liegen.
»Ich ziehe ein bisschen Pulver und Blei doch unbedingt aller HinduFaszination und sonstigen Magie vor«, sagte Axel phlegmatisch, in der Hand das rauchende Taschenterzerol, dessen Kugel dem Tiger durchs Auge ins Hirn gedrungen war — und das hatte allerdings intensiver gewirkt als der hypnotische Blick.
Anderthalb Stunden war Axel an Bord des schwarzen Schiffes gewesen, während die Unterredung, der wir gelauscht, doch kaum eine Viertelstunde gedauert hatte, es dunkelte schon stark, als er wieder das Fallreep herabstieg.
Aller Augen waren erwartungsvoll auf ihn gerichtet, am erwartungsvollsten die des Lords, aber Axel erzählte ihm nicht, was er dann an Bord dieses geheimnisvollen Schiffes noch alles erfahren und mit eigenen Augen gesehen hatte, jetzt nicht und niemals.
»Auf, Kapitän, an die Arbeit! Die Jacht muss hinter das Schiff gebracht und durch ein Tau mit ihm verbunden werden. Nun kleide das in etwas mehr seemännische Kommandos.«
»Das schwarze Schiff will uns ins Schlepptau nehmen?«, fragte der Lord.
»Erraten«, lautete Axels kurze Antwort, und er beteiligte sich selbst mit an der Arbeit, wie er es schon den ganzen Nachmittag getan hatte, den Matrosen jeden Handgriff ablauschend, und dieser Mann brauchte sicher keine lange Lehrzeit.
An Bord des schwarzen Schiffes war man der Jacht bei dem Manöver behilflich, sie wurde an einem Tau nach hinten gezogen, dieses Tau blieb am Heck hängen, ward auf der Jacht vorn um einen Poller geschlungen.
»So, nun braucht es nur noch vollständig finster zu werden, dann kann die Reise losgehen«, sagte Axel.
»Halt, was soll das?«
Ein Matrose hatte gerade die beiden Seitenlaternen anbrennen wollen, an Steuerbord, rechts, die grüne, an Backbord, links, die rote.
»Nun, wir müssen doch Lichter anstecken.«
»Nein, eben nicht! Kein Mensch soll beobachten, wenn das schwarze Schiff durch eine andere Kraft fährt als durch die des Windes, uns so schleppend, und es würde dies auch nicht tun, wenn es nicht gerade eine mondlose Nacht wäre. Die Bewegung der Lichter aber würde doch genügen, um zu verraten, dass sich hier ein Fahrzeug bei Windstille schnell vorwärts bewegt, was nicht allein durch Rudern zu erklären wäre.«
Also jetzt nahte der Augenblick, da das schwarze Schiff seine geheimnisvolle Kraft deutlich offenbaren würde, und man gehorchte, ohne vorläufig weitere Fragen zu stellen.
Nur wenige Minuten noch, und dann hatte sich über das Meer die finstere Nacht herabgesenkt, und der Sternenschimmer genügte nicht, um in einer Entfernung von nur hundert Metern selbst ein weiß angestrichenes Schiff unterscheiden zu lassen, und dazu war der Himmel auch noch meist mit Wolken bedeckt.
Und da entfernte sich das schwarze Schiff langsam von der Jacht, oder man glaubte vielmehr, diese ginge zurück, das Tau spannte sich, am Bug der Jacht begann das Wasser zu rauschen — bis man nicht mehr im Zweifel sein konnte, dass sich das schwarze Schiff wirklich durch eigene Kraft vorwärtsbewegte, und zwar mit ganz bedeutender Schnelligkeit, die Jacht nach sich ziehend.
Fassungslos blickten sie alle hinten an den Kiel des Schiffes, an dem das Wasser schnell vorüberrauschte und dann schäumend an dem Bug der Jacht emporstieg.
»Das sind acht bis zehn Knoten in der Stunde!«, stieß der alte Kapitän hervor, ohne das Log befragt zu haben. »Ja, das ist wirklich Hexerei!!«
»Mann, Mann«, flüsterte Lord Moore ebenso in furchtbarer Erregung. »Gebt mir eine Erklärung, wie das möglich ist, oder ich werde wahnsinnig!«
»Lasst Euch doch nicht auslachen«, entgegnete Axel in seiner phlegmatischen Weise, »wenn Ihr Euch habt überzeugen lassen, dass der Graf schon vor 5000 Jahren gelebt hat, wenn er sich unsichtbar machen und frei in der Luft schweben kann, dann werdet Ihr doch nicht den Verstand verlieren, wenn sich dieses Schiff durch eigene Kraft fortbewegt. Wie er das macht? Nun, dieser Zaubergraf will es einfach, er befiehlt, und das Schiff gehorcht. Na ja, das ist eben Zauberei.«
So sagte Axel, weiter nichts. Mochten die doch glauben, was sie wollten. Und schließlich hatte er ja auch ganz recht. Was brauchten die sich denn noch über so etwas zu wundern.
Nachdem Axel noch einige Minuten die Seiten des schwarzen Schiffes beobachtet hatte, besonders das unten rauschende Wasser, soweit er das von hier aus und bei der Dunkelheit konnte, legte er die Hand auf das straff gespannte Tau.
»Ich begebe mich wieder an Bord hinüber. Dass mir niemand folgt, nicht wahr? Jedem anderen ist der Zutritt verboten, er würde auch nicht weit kommen.«
Indem er so sprach, war er auf die niedrige Bordwand getreten und griff sich an dem straffen Tau, ohne dass dieses etwas nachgab, Hand über Hand hinüber, verschwand in der Dunkelheit.
Einige an Deck beschäftigte Matrosen sahen ihn wohl kommen, kümmerten sich aber nicht um ihn, und Axel wusste den Weg auch allein zu finden, denn er hatte ihn schon einmal gemacht.
Er stieg durch eine Luke eine Leiter hinab, es ward etwas heller, im Scheine einer Lampe konnte er den Anfang einer zweiten Leiter sehen, dann eine Tür, nach deren Öffnen flutete ihm blendendweißes Licht entgegen, und dann stand er auf einer Art von Galerie an einem eisernen Geländer und schaute hinab auf das Getriebe von Stangen und Rädern, das sich da unter ihm bewegte, ziemlich geräuschlos, eine Fläche von etwa 40 Quadratmetern einnehmend, aber ganz lang gestreckt und von ziemlicher Höhe, und dort im Hintergrunde ein mächtiger Kessel, in dessen beide rotglühende Feuerlöcher Arbeiter fast ununterbrochen Kohlen schaufelten.
Eine Dampfmaschine! Und zwar eine solche von ganz bedeutenden Dimensionen.
Wann und von wem ist die Dampfmaschine erfunden worden?
Ach, da wird gar sehr gesündigt, wenn man da einfach einen Namen und eine Jahreszahl anführt.
Das erste Ding, was den Namen einer Dampfmaschine verdient, wurde von dem Philosophen Heron in Alexandrien ums Jahr 120 vor Christi Geburt erfunden — die Aeolipile oder der Aeolusball. Nicht zu verwechseln mit dem Heronsball, von demselben Manne erfunden, der aber mit Dampf gar nichts zu tun hat. Die Aeolipile ist in physikalischen Kabinetten zu sehen. Eine in Achsen bewegliche Kugel, mit Wasser gefüllt, über Feuer erhitzt, der Dampf entweicht durch nach einer Richtung gebogene Röhrchen, dadurch setzt sich die Kugel in schnelle Rotation.
Es ist nur eine Spielerei. So sagen wir superklugen Menschen heute. Es ist zweifellos eine ganz richtige Dampfmaschine. Dieser Heron hat die Kraft des Dampfes in Bewegung umzusetzen verstanden. Und bei größeren Dimensionen könnte man diese Maschine auch recht gut zu bedeutenderen Kraftleistungen benutzen. Die Wirkung unserer heutigen Dampfmaschine beruht im Grunde genommen auf genau demselben Prinzip.
Dann freilich kommen siebzehn Jahrhunderte der Ruhe. Das heißt, menschliche Geister werden sich wohl immer damit beschäftigt haben, denn solche große Sprünge gibt es gar nicht, aber wir wissen davon nichts.
Erst im Jahre 1601 hört man wieder etwas davon, der Neapolitaner Torta veröffentlicht seine Experimente über die Kraft des Wasserdampfes. Fünfzehn Jahre später nimmt der Franzose Salomon de Caus, damals Architekt im Heidelberger Schlossgarten, diese Versuche Tortas wieder auf, konstruiert eine Maschine, welche durch Dampfkraft, das heißt, durch Dampfspannung, Wasser hebt, dieses stürzt auf ein Rad, setzt es in Umdrehung, und diese kann weiter verwandt werden.
Dann kommen von 1640 bis 1650 die theoretischen und praktischen Untersuchungen Galileis, Toricellis und Otto von Guerickes, die zwar keine Dampfmaschine zeitigten, nur die Luftpumpe, ohne welche aber nicht die Dampfzylindermaschine hätte erfunden werden können.
Das besorgte erst im Jahre 1690 Papin, noch bekannter geworden durch seinen papinianischen Topf, was ja aber alles eng zusammenhängt. Der zeigte zuerst eine richtige Maschine, dadurch getrieben, dass ein Kolben in einem Zylinder durch Wasserdampf immer hin und her ging.
Nach diesem Prinzip stellte Savery die erste wirklich brauchbare Dampfmaschine her, patentiert 1689. Das heißt, wohl brauchbar, aber sie kam nicht in Gebrauch. Die ganze Geschichte war den Menschen damals noch zu dumm.
Erst sechs Jahre später trat das ein, als sich Savery, ein Seekapitän, mit dem Grobschmied Newcomen verband, auch so ein alter Tüftelbruder, der eine bedeutsame Verbesserung erfunden hatte.
Von da an wurde die Newcomen'sche Dampfmaschine schon in Bergwerken verwendet, zum Auspumpen des Wassers, aber auch nur hierzu, zu nichts anderem, und das 60 Jahre lang, zu großen Kraftleistungen war sie gar nicht brauchbar, bis der Universitätsprofessor Watt in Glasgow 1764 zufällig einmal das Modell einer Newcomen'schen Dampfmaschine in die Hände bekam, etwas ihm noch ganz Fremdes sah, sich für die Sache interessierte — und Watt ließ die Maschine entstehen, die heute im Grunde genommen noch ganz dieselbe ist.
Also, schon mehr als 50 Jahre hatten solche Dampfmaschinen in englischen Bergwerken gearbeitet, und zum ersten Male sieht ein englischer Professor der Physik das Modell einer solchen, interessiert sich für die ›Geschichte‹.
Kann man da sich noch darüber wundern, dass auch der Depeschenreiter etwas ganz Neues, Wunderbares sah, in grenzenlosem Staunen dieses lebendige Getriebe von Stangen, Kurbeln und Rädern betrachtete?
Heute ist es ja anders, wenn solch eine Erfindung gemacht wird. Wir haben aber auch die schnelle Briefpost, den noch viel schnelleren Telegrafen, und vor allen Dingen sind die Zeitungen unablässig auf der Suche nach Stoff, um den Leser zu unterhalten.
Und dennoch, derselbe Fall kann noch heute eintreten.
Nehmen wir ein Beispiel an: Doch schon seit langer Zeit sind die Bedingungen gegeben, um ein lenkbares Luftschiff konstruieren zu können. Den Luftballon kennt man doch schon seit mehr als 100 Jahren, seit der Erfindung der leichten Benzinmotore sind doch auch schon eine beträchtliche Anzahl von Jahren verstrichen.
Lag denn da nicht schon immer die Idee ganz nahe, die Hebekraft des Gases mit der Triebkraft eines Flügelmotors zu verbinden?
Gewiss, es sind schon früher viele Versuche gemacht worden, aber die Welt hat so gut wie gar nichts davon erfahren, man kümmerte sich nicht darum, höchstens gespottet hat man darüber. Da muss ein alter Reiteroffizier kommen, der dieses Problem mit einem Male löst. Und da ist ja auch so etwas ganz Merkwürdiges dabei. Der, welcher die erste brauchbare Kolbendampfmaschine konstruierte, war ein Seekapitän, der gar nicht daran dachte, seine Maschine zur Fortbewegung eines Schiffes zu benutzen, und ein Reiteroffizier erobert das Reich der Luft! Das ist auch so etwas, woraus man viele Schlüsse ziehen kann! Schopenhauer behauptet gleich direkt, dass die ganze Fachwissenschaft etwas Passives an sich hat, nichts vor sich bringt, schon deshalb nicht, weil sie immer für Geld arbeitet, weswegen es wie ein Fluch auf ihr lastet. Der sogenannte Dilettantismus, das heißt, die nicht anerkannte Wissenschaft, ist es von jeher gewesen, die immer die Hebel des Fortschrittes in Bewegung gesetzt hat; und Schopenhauer hat recht!
Zeppelins Versuche und Forschritte konnte man immer beobachten. Freilich tat man das ohne viel Interesse. Mehr hatte man Spott und Hohn dafür, und gerade wieder in Kreisen der Fachleute. Von Fortschritten war ja freilich auch nicht viel zu merken. Bis dann mit einem Male der Erfolg in seiner ganzen Größe da war.
Gesetzt aber nun den Fall, Zeppelin hätte zur Werkstätte eine einsame Insel im Weltmeer gehabt, von der auch nicht die geringste Kunde über sein Vorhaben in die Öffentlichkeit gedrungen wäre. Und plötzlich erhebt sich von dort eine hundert Meter lange Riesenzigarre und fährt in eleganten Wendungen über dem Festlande hin und her, direkt gegen den Wind. Was dann? Nun, dann hätte die ganze Welt so gestaunt, wie jetzt Axel diese Dampfmaschine anstaunte, wie draußen auf der Jacht die anderen das selbstständig fahrende Schiff als ein unlösbares Rätsel anstarrten.
Denn auch diese Kinder ihrer Zeit hätten dieses Rätsel eigentlich selbst lösen können.
Das Dampfschiff ist viel älter als die Lokomotive. Diese wurde zuerst von Stephenson, der seine Laufbahn als Kohlenjunge begonnen, im Jahre 1814 gebaut. Für Schiffe wurde die Kraft der Dampfmaschine schon verwendet, als diese noch nicht einmal in Bergwerken benutzt wurde, und hierbei zeigt sich auch, dass man sich doch nicht erst im Jahre 1601 wieder mit der Erfindung Herons beschäftigt haben kann.
Denn die Chroniken spanischer Klöster berichten übereinstimmend, dass am 17. Juni 1543 ein Kapitän Blasco de Geray im Hafen von Barcelona dem Kaiser Karl V. ein großes, zugedecktes Boot vorgeführt hat, das an jeder Seite ein Schaufelrad besaß, durch deren Umdrehung bewegte sich das Boot vorwärts, sogar gegen Wind und Strömung, wobei weißer Dampf entwich, inwendig wurde mit Holz gefeuert, und dann ging das ganze Boot in Flammen auf.
Was sonst daraus geworden ist, weiß man nicht. Die Chroniken schweigen. Jedenfalls aber hat dieser spanische Kapitän das erste Dampfboot besessen, soweit sich das historisch nachweisen lässt.
Im Jahre 1618 wurde in England das erste Patent angemeldet, um Boote und Schiffe mit Dampfkraft zu treiben, es folgte dann ein Patent nach dem anderen, aber keins wurde in Praxis ausgeführt. Auch Papin machte nur einen schriftlichen Vorschlag zu einem Dampfboot, desgleichen Savery, der sogar schon das Projekt zu einer Dampfschifffahrt aufstellte, welche die ganze Welt umspannen sollte. Aber das blieb alles nur auf dem Papiere.
Nun aber kommt etwas Merkwürdiges. Im Jahre 1707 ist jener Papin mit einem von ihm erbauten Dampfboote auf der Fulda von Kassel nach Münden gefahren, wo es von den dortigen Schiffern als ein Teufelswerk zertrümmert wurde.
Hiervon ist gar nichts bekannt geworden, man wüsste heute noch nichts davon, hätte man nicht in der königlichen Bibliothek zu Hannover in Handschriften und Briefen von Leibniz darüber berichtet gefunden, und die weiteren historischen Untersuchungen, die man jetzt erst anstellte, haben ergeben, dass dem wirklich so gewesen ist. Papin hat wirklich auf der Fulda eine Fahrt in einem Dampfboot gemacht, wobei er die treibende Kraft dadurch erzeugte, dass er vorn eingepumptes Wasser hinten durch Röhren mit großer Gewalt ausstieß. Aber gehört hatte man damals nichts davon, und im Laufe von 70 Jahren wurden dann wohl sehr viele Vorschläge gemacht, die Dampfkraft zum Vorwärtsbewegen von Wasserfahrzeugen zu benutzen, aber kein einziges Projekt ausgeführt. Erst vom Jahre 1774 an, wo Graf Auxiron und Ingenieur Perrier mit zwei kleinen Dampfern die Seine befuhren, beginnt die historische Ära der Dampfschifffahrt.
Diese lange Erklärung war nötig, um zu rechtfertigen, dass ein Schiff damals, im Jahre 1750, schon recht gut eine Dampfmaschine besitzen und sich damit treibende Kraft verleihen konnte, ohne dass selbst die gebildetste Welt davon wusste, solch ein Schiff einfach als eine Zauberei betrachten musste.
Axel hatte diese Maschinerie schon vorher gesehen, aber in Ruhe, und jetzt, da sie sich lebendig zeigte, machte er aus seinem grenzenlosen Staunen vor den putzenden und schmierenden Arbeitern gar kein Hehl.
Was sollte jemand auch zu alledem sagen, der sich von so etwas noch gar nichts hatte träumen lassen?
Nun freilich war ja die Konstruktion dieser Dampfmaschine eine ganz andere als die unserer heutigen, nicht zu vergleichen — und dennoch, das Grundprinzip war schließlich dasselbe, und auch hier hätten die Studenten der technischen Hochschule schon singen können:
Kurbel und Exzenter laufen
Sich einander nach ganz dicht,
Doch trotz Ärger, Wut und Schnaufen
Kriegen sie sich niemals nicht.
Der Graf war neben ihn getreten.
»Nun, was sagen Sie jetzt, da Sie das Maschinchen in Bewegung sehen?«
»Wunderbar, wunderbar«, konnte Axel nur flüstern, und der Gang des ganz kolossalen ›Maschinchens‹ war so ruhig, dass man auch dieses Flüstern vernahm.
»Diese Maschine ist aber keine Erfindung jenes geheimnisvollen Mannes, von dem ich Ihnen schon vorhin ausführlich erzählte und von dem ich selbst wenig mehr weiß, als dass er Jules Renard hieß und ein eminenter Geist war, der alles, was menschliches Wissen bisher erreicht hat, schon damals weit hinter sich gelassen hatte.«
»Und wer hat diese Maschine erfunden?«
»Ein Mann namens Savery, und bedeutend verbessert ist sie von Newcomen worden. Haben Sie diese beiden Namen denn noch nicht gehört?«
Nein, noch nicht einmal das, also noch viel weniger hatte Axel, so weit er als Depeschenreiter auch schon in der Welt herumgekommen war, solch eine Maschine gesehen. Man lebte damals eben in einer ganz anderen Zeit, und erwähnt mag auch noch werden, dass damals die maschinellen Einrichtungen der Bergwerke als die tiefsten Geheimnisse gewahrt wurden, kein Fremder hatte Zutritt, alle damit Beschäftigten wurden auf Verschwiegenheit vereidigt.
Solche Erfindungen existierten schon, allerdings nicht in solcher Größe, und auch noch in keinem Schiffe. Außerdem ist die Newcomen'sche Erfindung noch ganz bedeutend verbessert worden.
»Dass ich nicht der einzige Schüler jenes Renards gewesen bin, habe ich Ihnen schon vorhin erzählt, wie ich Sie auch schon um Entschuldigung bat, Ihnen nicht immer ganz die Wahrheit berichtet zu haben.
Ich selbst also erfuhr erst kürzlich hier auf diesem mir vorher ganz unbekannten Schiffe, dass Renard schon lange vor mir einmal einen genialen Mann ins Vertrauen gezogen hatte, um ihn zu seinem Nachfolger zu machen.
Es war dies Sir Eugen Dalton, ein englischer Edelmann, der sich schon frühzeitig den technischen Wissenschaften zugewandt hatte. Ebenfalls ein ganz eminenter Kopf, dabei, wie man das so häufig findet, ein menschenscheuer Sonderling.
Im Laufe der Jahre machte er viele außerordentliche Erfindungen, hütete sich aber, sie der Welt zu offenbaren. Was er entdeckt hatte, das wollte er immer nur für sich allein besitzen und verwenden. Es gibt ja solche Menschen, und das mögen sie mit sich selbst ausmachen.
Endlich, obgleich immer noch jung an Jahren, führte Sir Dalton sein Vorhaben aus, das er schon längst geplant hatte. Er hatte die Welt schon weit bereist, hatte im Stillen Ozean zufällig einmal eine Insel entdeckt, die noch heute, soviel ich weiß, den Seefahrern unbekannt ist, und an der auch nicht so leicht ein Schiff und nicht einmal ein Boot beilegen kann. Sie hat nur einen Hafen mit einem nur den Eingeweihten passierbaren Zugang.
Sir Dalton war ein schwerreicher Mann. Die geeigneten Leute, denen er vertrauen durfte, hatte er sich schon zusammengesucht, mit diesen begab er sich auf eigenem Schiffe nach jener Insel, mit allem versehen, was zu einer Schiffswerft gehört. So richtete er auf der Insel erst diese ein, auf dieser Werft erbaute er dann von Grund auf dieses Schiff, diese Maschine und alles andere...«
»Ja, da muss er aber doch eine ganze Maschinenfabrik mitgenommen haben!«, unterbrach Axel den Erzähler.
»Und warum nicht? Sie meinen, weil die Maschine aus Eisen besteht, das zu bearbeiten ist? Dieses ganze Schiff besteht aus Eisen, sogar aus Stahlplatten.«
»Was? Dieses ganze Schiff bestände statt aus hölzernen Planken aus eisernen?!«, rief Axel.
Denn eiserne Schiffe gab es damals noch nicht. Wohl probierte man es ab und zu schon einmal mit einem kleinen eisernen Fahrzeug, besonders die leichtere Erzeugung von Eisenblech ermunterte zu solchen Versuchen, aber ein ganzes großes Schiff aus Eisen herzustellen, daran hatte noch niemand gedacht.
Andererseits war Axel kein solcher Mann, der nicht begreifen konnte, wie Eisen schwimmen könne — denn solche Leute trifft man sogar noch heute hin und wieder, und nicht nur auf dem Dorfe, so unglaublich das auch manchem klingen mag.
Jene Insel birgt Eisen und Kohlen, es sind erst Hochöfen angelegt worden, und wenn die Werkzeugmaschinen nicht langten, so wurden eben erst neue hergestellt. Wollen Sie nur nicht vergessen, dass Sir Dalton auf jener Insel ein ganzes Menschenalter zugebracht hat, auch zum Bau dieses Schiffes.
Vor einem halben Jahre ging es zum ersten Male auf die Reise, und zwar zu keinem anderen Zwecke, als mich aufzusuchen. So muss ich erst noch etwas anderes erwähnen. Sir Dalton ist nicht ständig auf seiner Insel geblieben, hat in der Zwischenzeit auch große Reisen gemacht. Auf einer solchen machte er die Bekanntschaft jenes Monsieurs Renard. Dieser erkannte die Fähigkeiten des Mannes, nahm ihn als Schüler an. Das war schon zwanzig Jahre vorher, ehe ich mit Renard zusammenkam. Nach einigen Jahren des Unterrichts ging Sir Dalton nach seiner Insel zurück, Renard blieb in Rom, jetzt wurde ich also sein Schüler. Dass er schon früher einmal einen solchen gehabt hat, hat er mir allerdings verschwiegen, und das erfüllte mich auch mit einiger Bitterkeit, als ich es erst kürzlich erfuhr, aber es ist überwunden.
Durch Gedankenkraft konnte Renard mit seinem früheren Schüler immer in Verbindung bleiben. So wussten sie also auch von mir. Diese besaßen auch die Mittel, mit mir in Verbindung zu treten, denn Sir Dalton hatte allerhand mit merkwürdigen Fähigkeiten ausgestattete Menschen um sich versammelt, besonders viele indische Fakire. Und ich selbst besitze ja gleiche Fähigkeiten. Aber da ich überhaupt gar nichts von jener geheimen Gesellschaft wusste, so gelang es trotzdem nicht, die geistige Verbindung herzustellen. Solch eine vorherige Kenntnis ist dazu natürlich unbedingt notwendig.
Nun, Sir Dalton oder seine Nachfolger sahen mich doch wenigstens im Geiste, und sie lenkten den Lauf ihres geheimnisvollen Schiffes aus dem Stillen Ozean nach Italien, nach Rom. Diese seine Nachfolger waren und sind seine Tochter Isabel, welche Sie bereits kennen gelernt haben, und sein Stiefsohn, von seiner zweiten Frau stammend, der jetzt der Kapitän dieses Schiffes ist. Er heißt Franz Römer, ist ein Deutscher. Ihnen kann ich es ja sagen. Sonst will er keinen Namen haben, wie alle diese Leute hier nicht. Sie müssen nur bedenken, dass die meisten von ihnen auf jener einsamen Insel geboren sind, die älteren ein Menschenalter darauf verbracht haben, in aller Einsamkeit, sich ganz der Arbeit widmend — es sind dadurch ganz merkwürdige, ganz andere Menschen geworden, zu deren Eigentümlichkeit auch gehört, dass sie keine Namen haben wollen, nur Nummern. Nicht einmal ihrem Schiffe haben sie einen Namen gegeben.
Der alte Sir Dalton konnte die Reise nicht mit antreten, er starb kurz vorher. So führten seine Tochter und der Stiefsohn seinen letzten Willen aus, der aber schon jahrelang vorher besprochen worden war: mich aufzusuchen, der ich in den Besitz von weiteren Geheimnissen Renards gekommen war, besonders auch in den Besitz äußerst wertvoller Handschriften.
So kam das schwarze Schiff neulich vor Rom an, gerade zur Zeit, als man mich in den Inquisitionskerker geworfen hatte. Durch jene hellsehenden Fakire, von denen Sie nun schon einige gesehen haben, wusste man hier ganz genau, wie es mit mir stand. Zwar hätte ich mich selbst befreien können, aber es war mir schließlich doch recht lieb, dass es so kam.
Und nun bin ich hier, wir haben des geheimnisvollen Mannes, der sich Renard nannte, Erbschaften zusammengelegt, und durch den letzten Willen Sir Daltons bin ich zum Kommandanten dieses Schiffes ernannt und anerkannt worden. Was ich nun vorhabe, habe ich Ihnen bereits mitgeteilt, und Sie haben sich bereit erklärt, mich zu begleiten.«
So sprach der Graf von Saint-Germain. Dass er von dem schwarzen Schiffe noch gar nichts gewusst, hatte er ja Axel gegenüber schon früher zugegeben, wenn auch indirekt. Dass er nicht hundert Jahre in dem Keller der englischen Gesandtschaft gelegen hatte, sich in diesen erst auf irgendeine Weise eingeschmuggelt hatte, wusste Axel ja selbst am besten. Vorhin schon hatte ihm der Graf auch gestanden, dass er in dem Keller des Spukklosters schon seit Jahren gehaust habe, dort Renards Unterricht empfing. Aber dass er trotz alledem schon vor 5000 Jahren gelebt habe, nur ab und zu in einen künstlichen Todesschlaf fiel, täglich in Starrkrampf, wobei sein Geist umherschweife, wo er wolle, von dieser Behauptung wich der Graf auch diesem Manne gegenüber nicht ab, jetzt nicht und niemals.
Übrigens hatte Axel diese Erklärungen nur mit halbem Ohre angehört, sein Auge war ganz befangen von alledem, was er da unten zu schauen bekam.
»Ja, wie wird denn das Schiff nun eigentlich vorwärtsgetrieben?«
»Das erklärte ich Ihnen doch schon vorhin. An den Seiten sind Röhren angebracht, in diese wird durch Dampfkraft Wasser eingesaugt, Meerwasser, und hinten wieder ausgestoßen, und durch diesen Druck bewegt sich das Schiff vorwärts, kann auch so gelenkt werden, sich sogar auf der Stelle umdrehen.«
Also das papinianische System. Dass Axel von alledem zurzeit noch wenig verstand, war begreiflich. Er fragte deshalb lieber gar nicht weiter.
»Und wie wird denn der Dampf erzeugt?«
»Durch Feuerung mit Kohlen — mit Steinkohlen.«
»Wo bekommen Sie die denn her?«
Es war gar keine so naive Frage. Damals gab es noch nicht überall Kohlenstationen. Steinkohlen wurden überhaupt äußerst wenig gebraucht. In den südlichen Ländern Europas werden die allgemein üblichen offenen Kamine zur Stubenfeuerung noch heute ausschließlich mit Holzkohlen oder auch noch mit Holz geheizt.
»Wir haben unsere bestimmten Orte, hauptsächlich einsame Inseln, wo wir uns mit Kohlen versorgen. Das werden Sie alles noch kennen lernen.«
Der Graf tat, als wäre er schon immer hier auf diesem Schiffe gewesen, hätte schon immer hier zu befehlen gehabt und kenne daher das alles schon aus eigenster Anschauung. Und wenn er nun einmal den Erklärer spielen wollte, so war es auch wirklich das Einfachste, wenn er so tat.
»Was für ein wunderbares Licht ist denn das hier?«, fragte Axel, von der Maschine gleich zu der runden Glocke aus Milchglas überspringend, die neben ihm an zwei Kupferdrähten hing und ein solch intensiv weißes Licht ausstrahlte, wie es Axel noch nie gesehen hatte.
»Die wird mit Blitzkraft gespeist.«
»Blitzkraft? Was ist denn das?«
»Ja, dazu ist eine lange Erklärung nötig.«
Axel erhielt sie, aber verstehen konnte er sie nicht, damals wenigstens noch nicht, und der Graf selbst hatte ja nur ganz schwache oder sogar falsche Vorstellungen von dem Wesen der Elektrizität, die er Blitzkraft nannte.
So vergingen Stunden mit Fragen und Erklärungen, immer Neues und immer Wunderbareres entdeckte Axel, bis von Deck die Meldung kam, dass wieder ein frischer Nordwind zu wehen begänne.
Ein neuer Morgen war angebrochen, mit geschwellten Segeln strebte das schwarze Schiff dem Süden zu, im Kielwasser gefolgt von der Jacht.
Es war gegen Mittag, als in der Ferne graue Massen auftauchten, die ein Unkundiger sicher für eine Wolkenwand gehalten hätte.
»Die Küste von Tunis!«, rief der Graf, der schon längst auf der hohen Back gestanden, neben ihm Axel, der an Bord des schwarzen Schiffes auch geschlafen hatte.
»Also hier haben Sie sich gestern schon im Geiste herumgetrieben«, sagte letzterer, in einem Tone, aus dem er den Spott überhaupt nie ganz verbannen konnte. Wenn man sich daran gewöhnt hatte, merkte man davon auch gar nichts mehr.
»Ja, und ich habe mir die bizarrsten Felsgebilde sehr sorgfältig eingeprägt, die will ich gar bald wiederfinden.«
»Na, auch Sie, wo Sie das dickste Buch auswendig können, wenn Sie es nur einmal durchflogen haben, das will ich wohl meinen!«
»Sie glauben wohl, das könnte ich nicht wirklich?«, lächelte der Graf, der in Gesellschaft Axels sich überhaupt immer recht heiter zeigte.
»Habe ich denn jemals daran gezweifelt?«, lautete die Gegenfrage.
»O, ich werde Sie schon noch eines Besseren belehren!«
»Ja, was wollen Sie denn eigentlich von mir? Ich glaube ja alles, alles.«
»Haben Sie ein gutes Schätzungsvermögen, Mister Axel?«
»Darin hege ich nun wieder an mich selbst großen Glauben.«
»Wie schnell schätzen Sie die Fahrt unseres Schiffes?«
»Auf elf Knoten in der Stunde, und da gehe ich in meiner Schätzung schon deshalb nicht irre, weil ich erst vor zwei Minuten den ersten Steuermann zum Kapitän berichten hörte, dass das Schiff so viel Knoten mache, an dem Log, an einem anderen Instrumente abgelesen.«
»Ah so!«, lachte der Graf. »Nun gut — und wann, glauben Sie, werden wir die Küste dort erreicht haben? Sodass wir vielleicht noch eine Seemeile von ihr ab sind?«
Der Depeschenreiter äugte scharf nach der grauen Felsenmasse hinüber.
»Wenn die Fahrt so bleibt? Hm. Zwei Stunden durften da wohl noch vergehen.«
»Sie scherzen wohl!«
»Durchaus nicht.«
»In einer halben Stunde sind wir dort.«
»Wenn Sie viermal so schnell fahren, ja. Sonst aber rechne ich auf mindestens zwei Stunden.«
»Nein, da sind Sie im Irrtum. Ich selbst rechnete eine Stunde, glaubte aber, Sie würden sich täuschen und kaum eine halbe Stunde taxieren. Herr Kapitän Römer«, wandte er sich an den hinter ihm Stehenden, der mit einem Fernrohr nach Süden spähte, verbesserte sich aber gleich. »Ah, pardon — aber wirklich, es ist mir zu ungewohnt, einen Menschen nur mit einer Zahl anzureden — Mister Two oder Signor Duo oder Herr Zwei zu Ihnen zu sagen — und da ich nun einmal Ihren richtigen Namen erfahren habe...«
»Aber bitte, das hat doch nichts zu sagen, ich habe ja gar keinen Grund, meinen Namen zu verbergen, die Zahlenbenennung ist bei uns nur einmal so eingeführt.«
»Dann gestatten Sie mir doch lieber, dass ich Sie Kapitän Römer nenne.«
»Steht ganz in Ihrem Belieben, Herr Graf.«
»Wann werden wir dort die Küste erreicht haben, wenn das Schiff diese Schnelligkeit beibehält?«
»Der Signore hat ganz richtig taxiert — zwei Stunden vergehen mindestens noch.«
»A la bonheur, da haben Sie mich richtig blamiert!«, rief der Graf mit offenem Staunen. »Ich selbst glaubte, richtig zu taxieren, wenn ich eine Stunde annahm, glaubte, Sie würden sich täuschen lassen und die Entfernung nur auf eine halbe Stunde schätzen. Ja, ja, mit so einem Depeschenreiter kann man in so etwas doch nicht antreten. Nun, wenn wir noch zwei Stunden Zeit haben, da wollen wir unterdessen Mittagessen einnehmen.«
»Sie mit?«, fragte Axel, als sich jener anschickte, die Back auf der Treppe zu verlassen.
»Sie gestatten wohl, dass ich Ihnen Gesellschaft leiste. Oder wir beide sind vielmehr Gäste der Lady Isabel.«
»Lebt diese Dame auch nur wie Sie von der Luft?«
»Wie ich? Ja, haben Sie aufgeklärter Mensch denn wirklich geglaubt, dass ich weder Speise noch Trank bedarf? Das zu glauben ist doch nur für diejenigen bestimmt, welche nun einmal etwas Phänomenales haben müssen, um aus den Fesseln ihrer fünf Sinne befreit werden zu können.«
So sprach der Graf lachend, und das verblüffte Gesicht Axels war begreiflich. Geglaubt hatte er es ja allerdings niemals, aber dass ihm der Graf das nun selbst plötzlich so gestand, auch noch so geradezu frivol dazu lachend — einfach unbegreiflich — ein menschliches Rätsel.
»Schwindel, Schwindel alles Schwindel«, dachte Axel während dieses Ganges, was er dann später auch niederschrieb, »und dabei dennoch wirkliche Wunder über Wunder, die durch Menschenverstand nicht zu erklären sind, und das Allerwunderbarste dabei vielleicht ist, wie sich der Graf in diesem Mischmasch von Lüge und Wahrheit noch zurechtfinden kann.«
Er sollte denn auch noch sofort mehrere Wunder sehen, welche weder zu erklären noch zu leugnen waren.
»Bis das Essen angerichtet wird, haben wir doch noch einige Zeit, und da können wir erst einmal die beiden Yogis besuchen, von denen ich den einen in diesem Falle zum Hellsehen, den anderen zur Übermittlung meiner Botschaften nach der Jacht gebrauche, nicht wahr?«
Axel war mit diesem Besuche sehr einverstanden. Er hatte gestern während der anderthalb Stunden an Bord dieses Schiffes schon eine ganze Menge der merkwürdigsten Personen gesehen, darunter besonders viele Inder, hatte von ihren abnormen Eigenschaften gehört, die sie meistenteils auch äußerlich durch irgend etwas Besonderes ausdrückten, aber zu jenen beiden war er noch nicht gekommen.
Nachdem sie im Zwischendeck einen Korridor halb durchwandert waren, öffnete der Graf eine Schiebetür.
In der kleinen, sonst nackten Kabine saß auf einem Lehnstuhl mit untergeschlagenen Beinen ein Mann, eine abgezehrte Gestalt, in einen weißen Burnus gehüllt, den rechten Arm über den Kopf gelegt, aber dieser Arm bestand nur noch aus einem Knochen. Auch von Sehnen und Adern war nichts mehr zu sehen, so wenig wie an den Knochenfingern. Die linke Hand war im Gegensatz dazu, wenn auch äußerst mager, ganz normal. Er hatte sie, als die beiden eintraten, zur Faust geballt, und sollte sie auch nicht wieder öffnen, was seinen guten Grund hatte.
Mit geschlossenen Augen kauerte er da, sie nicht aufmachend, vielleicht schlafend, ganz, ganz langsam atmend, zu jedem Atemzuge mindestens zwei Minuten brauchend.
»Guru Yogi Asitan, unser bester Fernseher, wenigstens für den Fall, den wir jetzt vorhaben«, stellte der Graf ihn vor.
Mit unverhohlenem Grausen betrachtete Axel das atmende Gerippe.
»Der Arm ist doch ganz abgestorben!«, flüsterte er.
»Vollkommen. Wenn man seinen Arm länger als zwanzig Jahre über den Kopf gelegt trägt, so genügt das wohl, um ihn absterben zu lassen. Natürlich kann er ihn auch nicht mehr herabnehmen.«
»Und die linke Hand, die er zur Faust geballt hat, was ist mit der?«, flüstere Axel nur immer scheuer.
Denn er hatte an dieser Faust, die doch noch etwas Fleisch an sich hatte, besonders aber traten die Sehnen und Adern daran wie Stricke hervor, schon etwas Besonderes erkannt. Aus dem Handrücken wuchsen lange, krallenähnliche Ansätze hervor.
»Gleichzeitig, als er den rechten Arm über den Kopf legte, schloss er die linke Hand zur Faust, mit dem Vorsatze, sie nie wieder zu öffnen — und da genügen wohl auch zwanzig Jahre, um die Fingernägel durch den Handrücken wachsen zu lassen.
»Schrecklich, schrecklich«, flüsterte Axel nach wie vor, und es war ganz merkwürdig, dass dies solch einen erschütternden Eindruck auf den sonst eisernen Mann machte. »Und wozu diese furchtbaren Selbstquälereien?«
»Nicht um das Fleisch, den Körper zu töten, wie man oft sagen hört, sondern um den Lebenswillen mit all seinen fleischlichen Begierden unter die Herrschaft der Seele zu bringen — um eine Wiedergeburt zu vermeiden, oder doch die Zahl der sonst endlosen Wiedergeburten in dieses Jammertal abzukürzen. Dieser Inder hat wie jeder andere Fakir einmal in einer lichten Stunde, vielleicht nur in einem Moment, die ganze Nichtigkeit dieses Daseins erkannt, hat wie Buddha Sakjamuni selbst unter dem Bodhibaume einmal erkannt, wie jeder Geburt unbedingt Alter, Krankheit und Tod nachfolgen muss, verbunden mit all den körperlichen und seelischen Schmerzen, welche die Folgen unserer Begierden sind — er hat vielleicht auch das heroische Beispiel eines anderen Fakirs oder Paramahamsas gesehen, ist dadurch entflammt worden — und da plötzlich hat er den Entschluss gefasst: jetzt oder nie! — und er hat den rechten Arm über den Kopf gelegt und die linke Hand geballt — für immer.
Doch das ist schließlich nur Nebensache. Das sind nur Äußerlichkeiten. Das ist nur eine Bestätigung dieses Willensaktes, gewissermaßen eine Unterschrift. Die Hauptsache ist natürlich eine ganz andere: das ständige Sichversenken in Gott, in Brahma, in die Weltseele, sich mit dieser eins fühlend. Schließlich aber hat es noch einen anderen großen Zweck. Wir Abendländer mögen über diese indischen Asketen lachen. Wären diese noch eines spöttischen Lachens fähig, so würden sie uns verlachen. Und das mit viel größerem Rechte. Denn was sehen wir denn rings um uns her? Nichts als Jammer und Elend und Hunger. Wir Abendländer sind es, wir vermeintlich hochgebildeten Europäer, die wir uns ständig die größten Selbstquälereien auferlegen, freiwillig. Im Kampfe um die Existenz, im ewigen Konkurrenzkampfe gehen wir aller Freuden verlustig, die uns dieses Leben vielleicht noch gewähren könnte. Millionen von Menschen arbeiten von früh bis abends mühsam wie die Sklaven um ihr kärglich Brot, kaum dass man ihnen noch die Luft gönnt, den freien Sonnenschein schon nicht mehr, das Wort, dass Kinder ein Segen des Himmels sind, ist zum blutigen Hohn geworden, jedes Kalb wird mit Freuden begrüßt, aber jedes neue menschliche Kind, zum Ebenbilde Gottes bestimmt, bringt in die meisten Familien nur neue Armut, neues Ringen mit dem Hunger, neue Sorgen und Kümmernisse aller Art. Und dies alles nur, um einige wenige Reiche noch reicher zu machen. Aber dass sie durch diesen ihren Reichtum glücklich werden, davon ist keine Rede. Hier ganz genau dasselbe, ja vielleicht in noch größerem Maßstabe, als in den Hütten der Armen, es wird viel mehr empfunden: Alter, Krankheit und Tod, und dazwischen verzehrender Hass, Neid, Eifersucht, Sorgen, Kummer, Verzweiflung... muss ich Ihnen erst schildern, wie an Fürstenhöfen mehr bittere Tränen geweint werden als in armen Hütten?«
»Nein, nein, fahren Sie fort«, flüsterte Axel nach wie vor.
»Das alles hat so ein Mann eingesehen. Und da wird er plötzlich zu einem heroischen Entschlusse entflammt und spricht: Ich mache nicht mehr mit! Dieser hier, der Sohn eines reichen Kaufmannes, eines Diamantenhändlers, begnügte sich nicht damit, nur den Arm über den Kopf zu legen und die Faust zu ballen, sondern er setzte sich auch schon mit gekreuzten Beinen nieder, um nicht wieder aufzustehen. So, hier sitze ich, hier erwarte ich meinen Tod.
Nun können Sie vielleicht fragen: Ja, warum beging der Mann denn nicht gleich Selbstmord...«
»Nein nein, das tue ich nicht!«, rief Axel.
»Der Selbstmord bedeutet kein Ende dieses Lebens...«
»Nein, nein, ich weiß, ich weiß, der Selbstmord ist sogar die stärkste Bejahung des Willens zum Leben!«
»So ist es. Doch wir wollen von philosophischen Spekulationen absehen. Diese Buddhisten glauben an eine Wiedergeburt, durch Selbstmord wird das begonnene Leben nur einmal unterbrochen, in einem zweiten Leben müssen sie doch noch ihr Karma, ihr selbstgeschaffenes Schicksal, vollenden, die Früchte ihrer Taten ernten.
So durfte sich dieser Manu also auch nicht an eine Stelle setzen, wo er verhungert wäre. Oder hätte er sich an eine von Pilgern belebte Straße des Waldes gesetzt, so wäre er bald von Schlingpflanzen eingehüllt worden, Würmer und Insekten hätten seinen Körper angefressen...«
»Um Gott, um Gott!!«
»Ich selbst habe zwei solche in Schlingpflanzen eingewachsene Fakire gesehen, von Insekten halb aufgefressen und doch noch lebend. Aber die richtige Askese ist das nicht, sie verkürzen das Leben, während es gilt, es möglichst zu verlängern, wozu allerdings keine sich schonende, diätetische Lebensweise gehört. Allein die Kraft der Seele ist es, die den Körper erhält. Anfressen darf man ihn natürlich nicht lassen.
So setzte sich dieser Mann auf die Stufen eines Tempels zu Delhi, wo ihn die Pilger fütterten, fromme Hände ihn manchmal säuberten. Mehr als 20 Jahre hat er hier gesessen.
Nun werden Sie wohl nicht glauben, dass solch eine Haltung des Armes, der Hand und auch der Beine ohne Schmerz abgeht. Das erste Jahr hat der Mann fürchterliche Schmerzen ausgestanden, schon in der allerersten Zeit, in der ersten Stunde, als der Arm zu erlahmen begann. Was für eine ungeheure Willenskraft gehört nicht dazu, ihn nicht herunter zu nehmen, aufzuspringen und davonzulaufen, mit dem Rufe: Es ist ja doch alles Unsinn, freuen wir uns lieber des Lebens!! Und dann später, als die Nägel ins Fleisch zu wachsen begannen, furchtbare Geschwüre erzeugend! Und noch immer wäre es Zeit gewesen, das Schlimmste zu verhüten. Aber nein, die Willenskraft siegte. Und da blieben die Früchte dieser Selbstbesiegung auch nicht aus. Was für eine Art Früchte das ist, das kann ich Ihnen nun freilich nicht schildern. Dieser hat das ganze Leben mit all seinem Leid überwunden. In dem einen Jahre hat er so viele Schmerzen durchgemacht wie ein anderer in einem ganzen Leben, und wäre es auch das schmerzreichste gewesen. Nun weiß er von alledem nichts mehr. Kein Schmerz kann ihm noch etwas anhaben, weder körperlicher noch seelischer, keine Begierde reizt ihn zu einer Torheit — er hat die Welt überwunden.«
»Kennt er aber keinen Schmerz mehr, so auch kein Glück«, warf Axel ein.
»O doch. Sagen Sie das nicht. Er ist sogar beständig glücklich. Ständig vereint mit Gott, mit der unendlichen Weltseele. Was für eine Art von Glück das ist, das freilich vermag ich Ihnen nicht zu schildern. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich diesen Mann oft stundenlang glückselig vor sich hinlächeln sehe.«
»Und die magischen Fähigkeiten?«
»Die stellen sich ganz von selbst ein. Wer derartige Askese treibt, um magische Fähigkeiten zu gewinnen, wird sie entweder nicht bekommen, oder er bleibt auf einer ganz niederen Stufe stehen, wie alle die Fakire, die ihre Künste auf offener Straße sehen lassen. Das ist alles nur physisch, sogar mechanisch, nicht psychisch, da fehlt das eigentliche Glück. Hinwiederum schadet es gar nichts, wenn Schüler erst diese Laufbahn nur aus dem Grunde betreten, um solche magische Fähigkeiten zu erringen, wenn man die Schüler erst dazu ermuntert, so wie ja auch ich es tue. Dann kommt mit der Zeit die Erkenntnis von ganz allein, dass es mit diesen magischen Fähigkeiten auch nichts ist, dass man ja gar keinen Nutzen davon hat. Denn wer einmal eine so hohe Stufe erreicht hat, dass sich diese magischen Fähigkeiten bei ihm von ganz allein einstellen, der benutzt sie dann nicht mehr, wenigstens niemals zum eigenen Vorteil. Denn der ergibt sich dann ganz in den Lauf des ewigen Schicksals.«
»Ich verstehe vollkommen. Dieser Fakir aber benutzt seine magischen Fähigkeiten —«
»Nur für andere.«
»Wie sind Sie zu ihm gekommen?«
»Mister Dalton hat ihn in Indien kennen gelernt, sein Vertrauen erworben — für ihn und für seine Nachfolger ist Asitan immer bereit, seine magischen Fähigkeiten benutzen zu lassen... wenn ein guter Zweck vorliegt, überhaupt wenn er es für gut findet, sonst nicht.«
»Was für magische Fähigkeiten sind das?«
»Die verschiedensten. Er hat die Welt überwunden, es ist ihm so ziemlich nichts unmöglich, die Elemente gehorchen ihm, die Sonne steht auf sein Geheiß still.«
Axel blickt den Sprecher an. Aber er dachte nur sein Bestes. Der Graf verlor sich wieder einmal ins Ungeheuerliche.
»Aber das will er natürlich nicht«, setzte dieser denn auch gleich hinzu. »Er wird nie etwas tun, was gegen die Weltordnung geht oder was einem anderen Menschen Schaden bringen könnte. Gesetzt zum Beispiel den Fall, wir hätten in der Nacht Wind gewünscht. Dieser Yogi ist imstande, in unsere Segel Wind blasen zu lassen, aus welcher Richtung wir ihn brauchen. Aber derselbe Wind könnte einem anderen Schiffe die größten Gefahren bringen. Verstehen Sie?«
»Hm, könnte er da nicht nur den Wind direkt in unsere Segel blasen, und anderswo lässt er's Blasen sein?«
»Das ginge doch gegen die Weltordnung, gegen alle Naturgesetze.«
»Na ja, na ja — freilich. Er soll also lieber nicht blasen. Und hellsehend ist er auch?«
»Das ist seine vorzüglichste Eigenschaft. Darin ist er von Mister Dalton besonders ausgebildet worden. Nämlich um so richtig zu sehen — das heißt mehr noch, um richtig beschreiben zu können, auf gestellte Fragen richtig zu antworten, das ist nicht so einfach — verstehen Sie?«
»O ja, ich verstehe. Und dieses Hell- oder Fernsehen geht nicht gegen die allgemeine Weltordnung?«
»Nein, wieso denn? In Ihnen selbst liegt ja diese Kraft, Sie brauchen sie nur zu entwickeln — durch Selbstüberwindung. Nur darf sich dem Zweck, weshalb man fragt, nichts Schlechtes, Gemeines, Niedriges, nicht einmal etwas Egoistisches beimischen. Sonst antwortet der Fakir nicht.«
»Die geraubte Prinzess darf er aber sehen?«
»Gewiss. Wir haben doch nur das Gute im Auge, sie zu befreien.«
»Gesetzt nun den Fall, ich habe einen Feind, ich weiß, er schreibt jetzt einen Brief, in dem er mich schmäht...«
»Der Fakir würde Ihnen keine Auskunft geben. Da ist etwas sehr Egoistisches dabei. Man soll seinen Feinden immer verzeihen.«
»Ja, wenn ich den Fakir aber nun täusche, der kann doch nicht wissen...«
»Doch, das weiß er, das fühlt er sofort, aus welchem Beweggrunde eine Frage an ihn gerichtet wird, und er wird Ihnen auch nicht antworten, wenn Ihnen die Erkenntnis dessen, was Ihnen sonst unbekannt bliebe, schädlich sein würde. Diesen Ihren Schaden fühlt er schon im Voraus.«
»Er kann auch in die Zukunft blicken?«
»Nein, das kann er nicht, und könnte er es, so würde er es nicht tun. Es ist nur ein Gefühl, das ihn davon zurückhält.«
»So so. Nun, wollen Sie ihn nicht jetzt gleich einmal fragen, wie es gegenwärtig der Prinzess ergeht? Ich möchte gern einmal sehen, wie das eigentlich gemacht wird.«
Axel war sicher, dass der Graf wieder eine Ausrede zur Hand haben würde, diesmal irrte er sich jedoch.
»Gewiss. Deshalb komme ich hierher, wollte Sie einmal zum Zeugen des Experimentes machen. Ich schicke voraus, dass ich den Fakir gar nicht anzusprechen brauche. Er liest schon meine Gedanken, allerdings nur, wenn ich einen Kontakt mit ihm herstelle, am besten mit der Hand seine Stirn berühre. Ihretwegen werde ich Englisch sprechen. Denn auch dieser Fakir versteht Englisch. Sonst will ich noch bemerken, dass ihn dieses Fragen und Antworten durchaus nicht in seinem Gottversunkensein stört, das alles macht er ganz unbewusst so nebenbei. Dann müssen Sie bedenken, dass er nur das sieht, was die Augen der Prinzessin sehen. So, jetzt stelle ich den Kontakt her...«
Der Graf berührte einfach mit den Fingerspitzen des Fakirs Stirn und fragte auf Englisch, mit gewöhnlicher Stimme:
»Asitan, was siehst du?«
»Ich sehe sie«, erklang es sofort aus zahnlosem Munde in knarrendem Tone zurück, ohne dass der Mann dabei die Augen öffnete.
»Wen?«
»An den du denkst — ein Weib.«
»Was tut Sie?«
»Sie liegt auf einem Bett.«
»Was siehst du mit ihren Augen?«
»Nichts.«
»Weshalb nichts?«
»Sie schläft.«
Au!, dachte Axel, auf diese Weise könnte ich auch den Hellseher spielen.
»Schade«, sagte der Graf. »Wenn sie schläft, kann sie natürlich nichts sehen — und der Fakir auch nichts. Wenigstens nichts von ihrer Umgebung. Aber er sieht sie doch selbst, oder... es ist mehr ein Fühlen. Es ist schwer zu beschreiben, ich kenne das selbst am besten. Doch nehmen Sie nur an, er könnte die betreffende Person, auf die er sein Hellsehen konzentriert, wirklich erblicken — Asitan! Wie ist die Dame gekleidet?«
»Sie hat ein weißes Kleid an, trägt einen roten Turban.«
Jetzt wurde Axel doch aufmerksam. Hier wurde etwas Positives gegeben, das dann auf seine Richtigkeit kontrolliert werden konnte. Ja, der Graf wollte sich offenbar rechtfertigen, kam dem Ungläubigen entgegen.
»Bemerkst du sonst etwas Auffallendes an ihrer Kleidung?«
»Das weiße Gewand ist mit einem goldgestickten Saum begrenzt.«
»Wie breit ist dieser Saum?«
»Ungefähr dreiviertel Zoll.«
»Erkennst du in der Stickerei ein Muster?«
»Es sind Arabesken — lauter zusammenhängende Ringe — dazwischen Striche — die Striche sind silbern.«
»Bemerkst du noch etwas an dem Turban?«
»Er wird von einer Agraffe zusammengehalten.«
»Wie sieht diese Agraffe aus?«
»Es ist eine goldene Schlange, die im Maule ein grünes Ei hat.«
»Mir ist nicht bekannt«, wandte sich der Graf an Axel, »dass die Prinzess bei ihrer Abreise von Palo in ihrer spärlichen Garderobe einen roten Turban mit solch einer Agraffe gehabt hat, ganz sicher ist das alles doch, ebenso wie das Kleid, ein Geschenk des Scheichs. Darüber können Sie ja auch bei dem Lord und bei Kapitän Morphin Erkundigungen einziehen...«
»Genug, ich glaube, dass dieser Fakir wirklich hellsehend ist«, fiel ihm Axel ins Wort.
»Das freut mich. So wollen wir die Prinzess schlafen lassen. Jetzt können Sie selbst... «
In diesem Augenblick erscholl ein heller Glockenton, wie aus dem Nebenraum kommend.
»Die Jacht ruft durch den Paramahamsa an. So wollen wir die zweite Büßerzelle besuchen, in der sich das andere lebendige Mittel befindet, dessen wir uns gegenwärtig bedienen.«
Sie betraten die angrenzende Kabine, welche überhaupt gar nichts enthielt, nur dass an der nackten Wand ein Mann lehnte, gleichfalls ein ausgezehrter Inder, aber bloß oben äußerst mager. Im Gegensatz zu dem skelettartigen Oberkörper hatte er auffallend dicke Beine, was die engen Hosen, wie solche die Hindus lieben, wenn sie keinen Kaftan tragen, erkennen ließen. Er lehnte also an der Wand, regungslos, blickte die Eintretenden mit starren Augen an.
»Das ist Sirbha, unser Gedankenübertrager«, erklärte der Graf mit einigem Humor. »Der hat zur Abwechslung das Gelübde abgelegt, sich nicht zu setzen und zu legen. Seit einem Vierteljahrhundert schon steht dieser Mensch auf seinen Füßen. Wollen Sie sich das vorläufig genügen lassen. Es ist gleichgültig, in welcher Sprache ich frage oder Antwort gebe, er überträgt einfach die gehörten Laute, welche durch den Paramahamsa ebenso nur durch Gedankenkraft wieder hörbar werden. — Wer ist dort?«, setzte der Graf mit lauter Stimme auf Italienisch hinzu.
Der Fakir öffnete den Mund, und Axel war doch fast entsetzt, als er aus diesem indischen Munde ganz deutlich die Stimme seines alten Freundes herauskommen hörte, des Kapitäns Morphin, selbst der kleine Zungenanstoß wegen des Fehlens einiger Schneidezähne war derselbe.
»Hier Kapitän Morphium. Ach, ich habe nur einmal so gegen die Kiste geklopft, wollte es auch einmal probieren.«
Auch dasselbe fehlerhafte Italienisch mit oft merkwürdigen Ausdrücken war es.
»Ja wie ist das möglich?!«, stieß Axel hervor.
»Auch hier ist Gedankenübertragung im Spiel, auch dieser Mann weiß gar nicht, dass er spricht, nehmen Sie an, er ist fasziniert, dient in Wirklichkeit nur als Medium, nur dass dieser hier die Laute wirklich mit seinen Sprachwerkzeugen wiedergibt. Weiter kann ich es Ihnen nicht erklären — Was wünschen Sie, Herr Kapitän?«
»Ich wollte — ich wollte — wie geht es meiner Braut?«
»Sie meinen wohl Eudoxia?«, fragte der Graf verständnisvoll, denn des alten Kapitäns Heiratspläne waren wohl auch ihm bekannt.
»Eudoxia? Nee, die Fürstin de la Roche meine ich, was meine Braut ist.«
»Na ja, die heißt doch mit Vornamen Eudoxia.«
»So? Das habe ich noch gar nicht gewusst. Wie geht es ihr?«
»Nun, sie befindet sich in meiner Kur, wobei sie immer schlafen muss.«
»Kann sie denn dabei auch essen?«
»Sie wird dabei sogar gemästet.«
»Ist sie schon etwas dicker?«
»Sie hat in zwei Tagen, seitdem ich sie an Bord habe, schon vier Pfund zugenommen.«
»Pro Tag zwei Pfund?«
»Ja.«
»Wenn Sie sie aber schon in vierzehn Tagen abliefern wollen, so hat sie ja nur zweiunddreißig Pfund zugenommen, und das hat bei dem Knochengerippe doch wenig zu sagen.«
»Meinen Sie? O, die tägliche Gewichtszunahme steigert sich immer mehr.«
»So, dann geht's. Machen Sie sie nur recht dick.«
»Soweit es mit Schönheit vereinbar ist.«
»Nein, nein, machen Sie sie nur recht sehr dick. Dicke Frauen sind immer schön. So kugelrund.«
»Morphium hat fast sein ganzes Leben in China zugebracht«, flüsterte Axel, »dort sind die Ansichten über weibliche Schönheiten andere, da muss eine Frau wirklich möglichst dick sein, soll sie das Wohlgefallen eines Mannes erregen.«
»Ich werde Ihren Wünschen Rechnung tragen«, entgegnete der Graf durch dieses menschliche Telefon, welches man sogar schon als ein drahtloses bezeichnen konnte.
»Hat sie auch wieder Zähne?«
»Die ersten Spuren von Milchzähnen zeigen sich bereits.«
»Na, dann geht's. Aber der lange Schweinshauer darf dann nicht dazwischen stehen bleiben.«
»Der ist auch schon heraus.«
»Na, dann geht's. Hübsch braucht sie nicht weiter zu sein...«
»Die schönste Frau Roms wird die Ihre werden, verlassen Sie sich darauf.«
»Wenn sie nur recht dick ist, das ist schon Schönheit genug.«
»Sonst noch etwas?«
»Ich wüsste nichts.«
»Dann Schluss.«
Abgeklingelt brauchte nicht zu werden. Der Fakir schloss den Mund, sah nach wie vor mit starren Blicken vor sich hin, dass man gleich merkte, wie er von alledem gar nichts wusste, was hier vor sich ging. Auch er war ganz in Gott versunken.
»Nun gehen wir zum Essen«, sagte der Graf, »es wird gleich zwölf sein.«
»Und Ihr Starrkrampf?«
»Der bleibt heute einmal aus«, war die gleichmütige Antwort.
»So, also das ist auch möglich?«
»Gewiss, wenn ich nur rechtzeitig Urlaub nehme. Sonst wäre ich ja kein vollkommen freier Mann, und darauf habe ich immer gehalten.«
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.