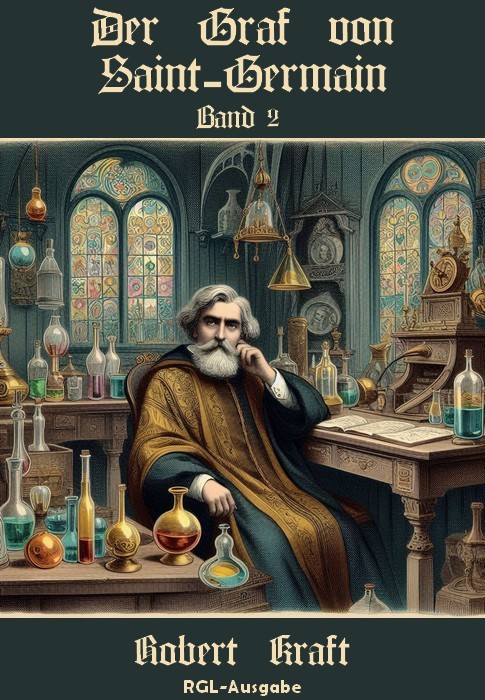
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.
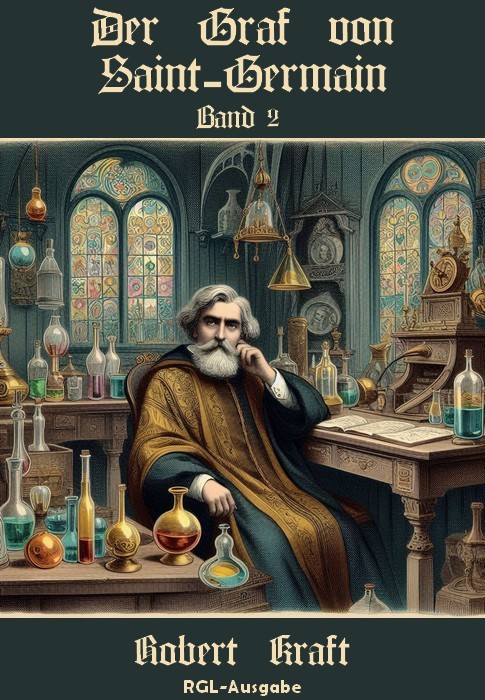
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
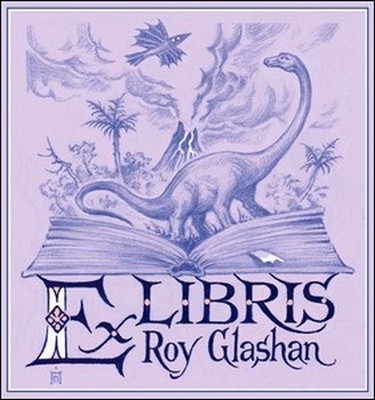
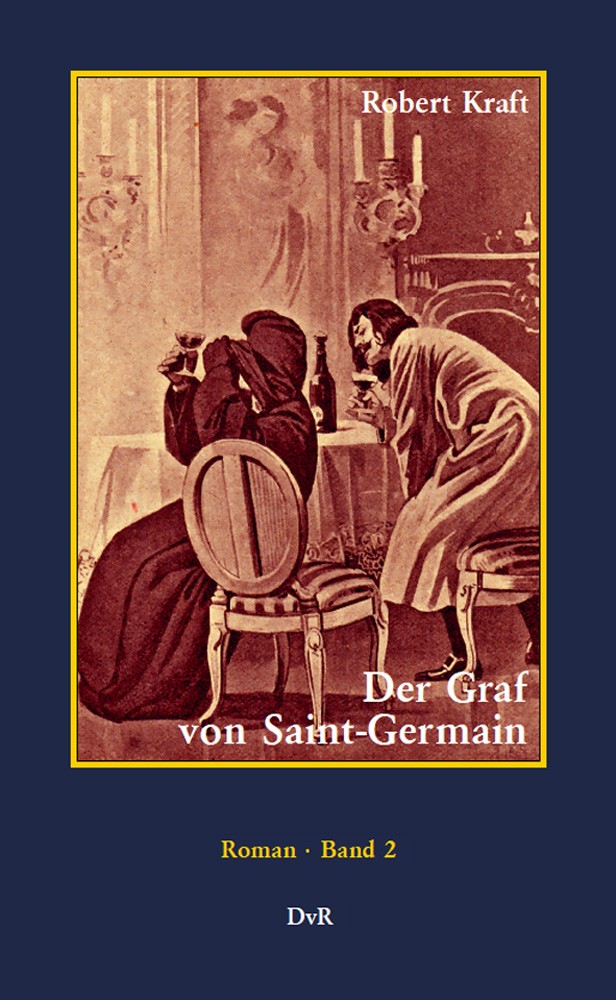
"Der Graf von Saint-Germain," Band 2, Verlag Dieter von Reeken, 2023
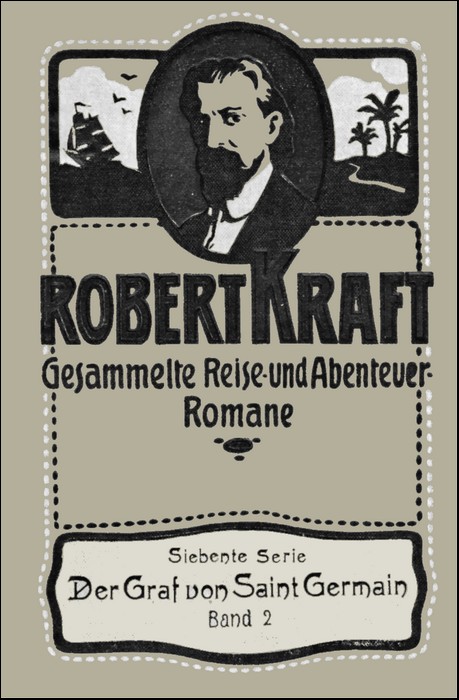
Axel hatte richtig taxiert, Kapitän Römer richtig bestätigt. Erst in zwei Stunden war man der Gebirgswand so nahe gerückt, dass man die einzelnen Formationen mit bloßen Augen unterscheiden konnte.
Es war eine furchtbar zerrissene Felswand, 800 bis 1000 Meter hoch, die sich an den meisten Stellen glatt wie eine Mauer in das Meer hinabsenkte, das an ihrem Fuße schrecklich brandete. In ausgewaschenen Höhlen zischte und brodelte es wie in einem Höllenkessel.
»Etwas mehr östlich!«, kommandierte der Graf auf der Back, wie er es schon seit einer Viertelstunde tat. »Dort ist bereits der Felsen, der wie eine vierfingerige Hand aussieht. Keinen Kilometer dahinter ist die Höhle, in der die Galeeren verschwanden, von den Piraten tala el schehen genannt.«
Axel hatte schon immer konstatiert, dass der Graf seiner Sache ganz sicher war. Es musste doch etwas daran sein.
»War das Meer ruhiger, als die Piraten mit ihren Galeeren in die Höhle eindrangen?«, fragte er zunächst.
»Ich weiß, was Sie meinen. Nein, eben nicht. in dieser Höhle tobte die Brandung furchtbar, sie war ganz von Gischt erfüllt.«
»Und dennoch drangen die Rudergaleeren ein?«
»Ohne Weiteres.«
»Ja, wie ist das möglich?«
»Es war und ist mir selbst ein Rätsel. Wir werden es lösen.«
»Konnten Sie die Galeeren denn nicht im Geiste hineinbegleiten?«
»Gewiss, das tat ich auch, und... dort ist das Höllenloch!«
Das schwarze Schiff war unterdessen nach Anweisung des Grafen immer weiter nach Osten gefahren, kaum einen halben Kilometer von der Küste entfernt. Der Kapitän verließ sich doch lieber auf die Lotleine als auf die hellsehende Eigenschaft eines Fakirs, ununterbrochen mussten vorn einige Matrosen loten. Doch zeigte das Wasser überall noch einige Faden Tiefe.
Die steile Felsenwand war ganz von ausgewaschenen Höhlen zerfressen, so, wie es heute jeder Reisende, dessen Ziel das Mittelmeer ist oder der den Suezkanal benutzen muss, an der portugiesischen Küste beobachten kann, an der die allgemeine Dampferroute dicht vorbeigeht. Denn dieser Küstenweg ist auf beträchtlicher Breite nun einmal seit Jahrhunderten am besten bekannt, hier sind doch schon die alten Phönizier nach Britannien gefahren, und auch der heutige von Wind und Strömung ganz unabhängige Dampfer hütet sich, ohne Not einen neuen Weg zu gehen, wo unausgesetzt gepeilt werden muss, um nicht auf eine unterseeische, noch unbekannte Klippe zu rennen.
Nur dass die portugiesische Küste nicht allzu hoch ist, während diese Gebirgsmassen hier also 800 bis 1000 Meter emporstiegen, was man recht gut als ›himmelhoch‹ bezeichnen kann.
Die Höhle, welche der Graf durch Beschreibung einiger bizarrer Felsgebilde bezeichnete, unterschied sich durch nichts von den anderen links und rechts, auch nicht durch Größe. So breit und hoch, dass ein Fischerfahrzeug selbst mit aufgerichtetem Mast in sie hätte einfahren können, waren die meisten, aber daran hätte freilich niemand gedacht, denn auch in dieser Höhle oder Grotte sah man immer das Wasser, obgleich draußen die See ziemlich ruhig war, bis zur Decke empor spritzen, sie war ganz mit Gischt gefüllt.
Dieses scheinbare Rätsel kann man auch so recht an der portugiesischen Küste beobachten. Dort ist die See, die spanische, manchmal ganz ruhig, sie kann sogar glatt wie ein Spiegel sein, und dennoch wütet in den Höhlen eine furchtbare Brandung. Das ist die potenzierte Kraft der Strömung, die aus dem Atlantischen Ozean aus einer Entfernung von Hunderten oder sogar Tausenden von Meilen herbeikommt. Ein schwimmender Gegenstand wird gar nicht bewegt, er treibt eben mit, aber einen festen Widerstand kann diese Kraft nicht vertragen, dagegen bäumt sie sich auf.
»Wir gehen ihr gegenüber vor Anker, ohne uns ihr weiter zu nähern«, sagte der Graf.
So geschah es. Die Anker rasselten herab. Die Jacht war benachrichtigt worden, sie segelte mit gereffter Leinwand heran, wurde auf der der Küste abgekehrten Seite mit dem schwarzen Schiffe vertäut, wobei die Taue durch Bullaugen, das sind die runden Fensterchen, des dritten Decks gezogen wurden.
»Mylord, es steht Ihnen jetzt frei, an Deck zu kommen — auch Ihnen, Herr Kapitän Morphin.«
So, nun konnten sie sich das Höllenloch betrachten. Sehr interessant, aber... sonst war nichts daran, vor allen Dingen von Piraten keine Spur.
»In dieses Sprudelloch sollen die zwölf Rudergaleeren hineingefahren sein?!«, war auch des Lords erste zweifelnde Frage, während sich Kapitän Morphin damit begnügte, den Kopf zu schütteln.
»So geschah es. Bitte, Signor Axel, wollen Sie mir folgen.«
Axel gehorchte, ohne eine Ahnung zu haben, was der Graf nun wieder von ihm wollte.
Sie durchschritten im ersten Zwischendeck einen Korridor, der Graf öffnete auf Backbordseite eine Tür, Axel betrat eine sehr geräumige Kabine, die als Gesellschaftssalon hätte dienen können, aber als Laboratorium oder doch als Apotheke eingerichtet war. An den Wänden waren hölzerne Regale gezogen, auf denen Büchsen und Flaschen in zahlloser Menge standen. Die Regale machten einen recht neuen Eindruck, ein kundiges Auge merkte, wie sie erst in letzter Zeit schnell zusammengezimmert worden waren.
Es war die Laboratoriumseinrichtung, die aus dem Keller des Spukklosters hier untergebracht worden war. Dass der Graf also in diesem Spukkloster schon immer gehaust hatte und dort vollkommen eingerichtet gewesen war, dort besonders chemische Studien getrieben, hatte Axel von ihm schon gestern erfahren, auch, wie alles hier an Bord geschafft worden war. So brauchte er jetzt keine weitere Erklärung, er konnte sich alles allein denken.
Durch die offene Nebentür blickte man in eine zweite Kabine, deren Wände mit Büchern dicht besetzt waren, meist mit ehrwürdigen Pergamenten, ebenfalls aus dem Keller des Spukklosters stammend. Aber das Klavier, welches dort in der Ecke stand, hatte der Graf in jenen Kellern nicht gehabt.
Für Leser, die sich dafür interessieren, sei noch erwähnt, dass sich der Ursprung des Klaviers merkwürdigerweise nicht mehr nachweisen lässt. Im Anfange des 16. Jahrhunderts war es schon bei reichen Leuten zu Hause, im Allgemeinen mit dem französischen Namen Clavecin genannt, nur in Italien Clavicembalo, mit derselben Tastatur wie heute, aber nur bis zu fünf Oktaven umfassend, und dann die Metallsaiten nur nach unten gehend. Also eigentlich auch noch nicht das spätere Tafelklavier. Eher wie das heutige kleine Harmonium aussehend. Im Anfange des 17. Jahrhunderts war das Clavecin schon in jeder besseren Bürgersfamilie eingeführt. Daraus entwickelte sich dann das Fortepiano, heute nur noch Piano genannt, das sich auch kaum noch verändert hat. Das Verdienst, das alte Instrument zum vollkommensten gemacht zu haben, was die Musik hat, gebührt einem Deutschen, Gottfried Silbermann zu Freiberg, der sein Fortepiano 1717 zuerst dem Hofe zu Dresden vorführte. Nicht vergessen aber werden darf, dass er die Idee dazu erst von dem Organisten Gottfried Schröter in Nordhausen hatte. Der baute auch schon das Tafelklavier, woraus dann der Flügel wurde.
Das hier war ein Clavecin, auf dem es aber auch schon berühmte Virtuosen gab, nur dass der edle, nicht mehr zu übertreffende Klang fehlte.
»Bitte, nehmen Sie Platz«, sagte der Graf. »Setzen wir uns so, dass wir die Höhle im Auge behalten, falls dort inzwischen doch etwas passiert oder sich nur etwas Lebendiges zeigt.«
Die Höhle war durch die Bullaugen zu sehen, auch noch ein gut Teil der Felswand darüber, und gerade bei dieser engen Umrahmung fiel einem auf, dass auch diese obere Felswand viele kleine Löcher hatte.
»Signor Axel«, begann der Graf, »Sie halten mich für einen Schwindler.«
Sollte Axel über diese Einleitung nicht verblüfft sein?
»Herr Graf...«
»Für einen Betrüger, mindestens für einen starken Renommisten.«
»Na, dann ja — wenn Sie es hören wollen.«
»Sie glauben nicht, dass ich schon vor 5000 Jahren im alten Babylon gelebt habe, bis heute, dazwischen immer nur einmal einen längeren, manchmal Jahrhunderte währenden Todesschlaf halte, aus dem ich mit demselben Körper in voller Erinnerung erwache.«
»Es ist mir unbegreiflich.«
»Sie glauben nicht, dass ich täglich in Starrkrampf falle und dass mein Geist dann frei umherschweift, wohin ich ihn schicke, in die fernsten Weltteile, wo er dann alles sieht und hört.«
»Herr Graf, ein Wort!«
»Bitte.«
»Dass es Menschen mit sogenannten magischen Fähigkeiten gibt, die zum Beispiel hellsehen können, daran habe ich überhaupt nie gezweifelt. Ich habe davon schon zu glaubwürdige Männer berichten hören, ich habe Ihnen doch von jenem Missionar erzählt, der in Indien gewesen war, von diesem habe ich ja selbst eine ganz geheimnisvolle Kunst gelernt, die ich Faszination nenne, über deren Wesen ich mir absolut keine Rechenschaft geben kann, und Sie haben mir doch erst vorhin die beiden Fakire vorgeführt. Da ist ja gar nicht mehr daran zu zweifeln.«
»Nun, und?«
»Herr Graf, wenn Sie sich nur nicht immer so furchtbar inkonsequent wären.«
»Inwiefern?«
»Erst brauchen Sie überhaupt gar nichts zu essen und zu trinken, und nun, da Sie unter Ihresgleichen sind, keinen Verrat mehr zu fürchten haben, lassen Sie sich den Pökelbraten ganz vortrefflich schmecken, futtern sogar, mit Respekt zu sagen, wie ein Scheunendrescher, der ausgezeichnete Rotwein mundet Ihnen nicht minder. Und ebenso haben Sie an Bord dieses Schiffes plötzlich nicht mehr nötig, mittags dem Tode Ihren stündlichen Tribut zu zollen.«
»Ganz richtig«, nickte der Graf mit tiefernstem Gesicht. »Wenn ich diese Ausnahmen öffentlich zeigen würde, so wäre ich gleich als Schwindler gebrandmarkt — selbstverständlich. Aber ich hoffte, Sie würden diese Ausnahmen verstehen.«
»Nein, auch ich kann es mir nicht zusammenreimen.«
»Kann ich in diesem neuen Leben nicht ein Mittel gefunden haben, um diesen Tribut, den ich dem Tode täglich zollen muss, zu umgehen?«
»O ja. Das lässt sich hören. Da müssen Sie jetzt also auch essen wie jeder andere Mensch?«
»Ja, denken Sie denn etwa, das macht mir Spaß, wenn ich immer zusehen muss, wie es den anderen schmeckt, wie sie sich an den Gaben delektieren, die uns Gott doch nicht umsonst vorsetzt, und ich lebe nur von der Luft?«
»Eigentlich haben Sie recht.«
»Ich — möchte — sterben.«
Langsam, schwermütig hatte es der Graf gesagt, und das war nun wieder so ganz unvermutet gekommen.
»Sterben?«
»Auch ich möchte einmal sterben — richtig sterben — in die Nacht der Vergessenheit versinken«, erklang es noch schwermütiger als zuvor, mit unsäglicher Traurigkeit.
Eine kleine Pause entstand. Axel war doch gepackt worden. Er war wirklich der Richtige, den sich der Graf zum Anhören dieses Geständnisses ausgesucht hatte.
»Herr Graf, Sie sind ein unglücklicher Mensch«, sagte er dann leise.
Tief ließ der Graf das Haupt auf die Brust sinken.
»Sie sagen es, ich bin es. Ach, wenn Sie wüssten, wie ich manchmal...«
Mit einer trotzigen Bewegung warf er den Kopf zurück.
»Genug hiervon! Wenn Sie ein hohes Alter erreichen — und Sie werden es — werden Sie mich sterben sehen oder von meinem natürlichen Tode hören. Genug davon — ich möchte ein natürlicher Mensch werden wie die anderen, und ich habe ein Mittel dazu gefunden. Mit Aufnahme natürlicher Nahrung beginnt es. Deshalb bin ich noch immer imstande, wochen- und monate- und jahrelang ohne Speise und Trank auszuharren, noch immer brauche ich keinen Schlaf.
Doch lassen wir das. Bleiben wir bei der Hauptsache, die hier in Betracht kommt. Ja, ich falle manchmal von selbst in einen Zustand oder kann mich auch mit Absicht hineinversetzen, in dem ich hellsehend und auch hellhörend bin. Ich bin — wenn Sie es einfacher finden — somnambul veranlagt. Mein Geist schweift während dieses Zustandes in die Ferne, sieht und hört, fühlt und schmeckt sogar, als wenn er noch an den irdischen Körper gebunden wäre.
Aber so ganz einfach ist die Sache doch nicht. Erstens ist meinem Geiste nur das erreichbar, was auch für meinen Körper, für jeden anderen Menschen erreichbar ist. Vergebens würde ich meinem Geiste befehlen, in diesem Zustande nach dem Nordpol zu gehen und dort Umschau zu halten. Er würde sich auf den Weg machen, mit Gedankenschnelle, aber im Moment in Eisbarrieren unübersteigliche Hindernisse finden, müsste vor diesen resultatlos verharren, und ist dort die Kälte für einen Menschen zu groß. so müsste er sogar schnellstens wieder umkehren, sonst würde hier mein Körper erfrieren. Verstehen Sie das?«
»Ich verstehe, und das ist alles ganz logisch«, entgegnete Axel.
»Noch weniger also könnte ich meinen Geist etwa nach fremden Himmelskörpern schicken, wie meine Schüler schon von mir gefordert haben. Es hat doch alles in der Welt Grenzen. Was wir magisch nennen, ist ja gar nichts Über- oder gar Unnatürliches. Der Mensch, jeder, hat in sich Fähigkeiten, die nur nicht entwickelt werden, tut es aber einer, so ruft gleich die Welt in ihrer Borniertheit: Wunder, Wunder, das ist Zauberei...«
Der Graf brach ab, stand schnell auf und ging nach der Nebentür.
»Wollen Sie lachen oder weinen?«
Axel wusste natürlich nicht, was diese seltsame Frage bedeuten sollte, ahnte erst etwas, als der Graf sich an das Klavier setzte und den Deckel öffnete.
»Ich habe schon von Ihrer wunderbaren Virtuosität auf der Violine gehört. Da könnten Sie mir eigentlich etwas zum Besten geben. Ich bin nicht gerade musikalisch, aber sehr empfänglich für Musik. Für das Clavecin schwärme ich weniger.«
Der Graf antwortete nicht, schlug einige Akkorde an, spielte eine ganz einfache Volksmelodie, begann darüber zu phantasieren, immer kühner und schneller, es wurde eine Rhapsodie daraus, und... zuletzt war von den über die ganze Tastatur fliegenden Händen nichts mehr zu sehen. geschweige denn von den Fingern.
Und Axel saß mit offenem Munde da, seinen Ohren nicht trauend, noch weniger seinen Augen. Er hatte schon manchen Klavierspieler gehört und gesehen, aber so etwas noch nicht. Es war auch wirklich ein Wunder, was ihm der Graf da vormachte, wie er seine Finger und sogar seine ganzen Hände durch die Schnelligkeit einfach verschwinden ließ. Es wäre für jeden anderen, auch für einen damaligen Virtuosen, ein Wunder gewesen. Denn die Technik des Klavierspiels ist erst in letzter Zeit so ungeheuer worden. Woran das eigentlich liegt, weiß man nicht. Vor hundert Jahren hatte man schon genau dieselbe Tastatur, die Virtuosen werden genau so viel geübt haben wie die heutigen.
Weshalb ist die fabelhafte Technik des Klavierspiels erst mit Liszt gekommen? Denn alle Klaviergrößen, welche vorher als unübertreffliche Meister bewundert wurden, waren Stümper gegen diesen, das berichten sämtliche Zeitgenossen. Mit Franz Liszt erst bricht urplötzlich die Ära desjenigen Klaviervortrags an, welcher nur das Verständnis, die Seele in Betracht zieht, die Beherrschung jeder technischen Schwierigkeit aber als etwas ganz Selbstverständliches voraussetzt, bis zu Rubinstein und d'Albert.
Es gibt keine Erklärung für diesen plötzlichen Umschwung in der technischen Vollkommenheit des Klavierspielens. Und doch, es gibt eine. Aber neunundneunzig Prozent der Menschheit will sie nicht annehmen. Man muss an eine individuelle Wiedergeburt glauben. Was der Mensch gelernt hat, bringt er bei seinem nächsten Erdenleben als Anlage wieder mit. Dann ist alles erklärt. Dann ist auch sofort erklärt, wie ein vierjähriger Mozart eine Klavierstunde seiner älteren Schwester belauscht und beobachtet, sich dann ans Klavier schleicht, zum ersten Male die Tasten berührt und sofort das der Schwester aufgegebene, schon ziemlich schwierige Stück spielt, und wie er ein Jahr später schon als Klaviervirtuose auftreten kann.
Sonst ist es doch nicht zu erklären. Sonst muss die Menschheit an ein Wunder glauben, muss offen bekennen, dass es Wunder gibt, während jene, die an die Wiedergeburt glauben, jedes Wunder leugnen. Versteht der Leser dieses Paradoxon? Nun, in diesem Jahrhundert, im 20., wird sich der Glaube an eine individuelle Wiedergeburt, wie immer von Osten nach Westen gehend, unsere Erde erobern, und wer dann noch immer nicht daran glaubt. der wird ebenso lächerlich dastehen, wie heute einer, der noch immer behauptet, die Sonne drehe sich um die stillstehende Erde. Du musst, mein Freund, du musst!! Und sie bewegt sich doch!!!
Wenn wir dem Bericht des ehemaligen Depeschenreiters Glauben schenken dürfen, so besaß der Graf von Saint-Germain eine Fingerfertigkeit, die auch noch heute das Staunen der ersten Kenner hervorgerufen hätte. Der Berichterstatter vermag es gar nicht zu schildern.
Mit einem mächtigen Akkord hatte der Spieler seine Rhapsodie geschlossen, blickte nach dem Zuhörer. Axel war aufgesprungen, ganz außer sich.

»Bei Gott, ich habe in Paris den Petri spielen hören — nein, spielen sehen, will ich lieber sagen — aber das war ja Kinderspiel gegen Ihre Virtuosität — Mann, Mann, wer sind Sie, dass Sie das Clavecin so wunderbar beherrschen...?«
»Das macht einfach die Übung. Woher ich die habe? Ich selbst habe vor vierhundert Jahren das Clavecin erfunden.«
So sprach der Graf mit größter Gemütsruhe.
Hierzu macht Axel als dieses Mannes Biograf in seinem Tagebuche folgende treffende Bemerkung:
Immer dasselbe und immer dasselbe. War es nicht genug, dass der Graf im Kla
vierspielen das Menschenmöglichste und selbst Unmöglichste leistete? Nein, ich
glaube, er wäre sofort erstickt, wenn er bei dieser Gelegenheit nicht auch behaup
ten musste, er selbst hätte vor vierhundert Jahren das Clavecin erfunden, und
wäre der Name des Erfinders allgemein bekannt gewesen, hätte er August Schulze
geheißen, so wäre der Graf unbedingt auch dieser August Schulze gewesen. Er
musste, er musste — das war der Fluch, der auf dem unglücklichen Mann lastete.
Damals aber stellte Axel nicht solche Erwägungen an. Er war noch ganz fassungslos und hätte in diesem Zustande noch viel mehr geglaubt.
»Sie fassen diese meine Fingerfertigkeit wohl gar als ein Wunder auf?«
»Ja, da möchte man wirklich glauben, dass das gar nicht mit natürlichen Dingen zugehen kann — diese Schnelligkeit und Sicherheit der Finger!«
»Nun nehmen Sie aber an, ich gehe mit einem Klavier nach Feuerland hinunter, oder nach einem sonstigen Lande, wo man noch niemals ein Klavier gesehen hat — oder auch nach Indien, ich will solchen Fakiren etwas vorspielen...«
»Sie haben recht, tausendmal recht!!«, rief Axel, sofort wissend, wo hinaus der Graf wollte. »Ja, diesen Fakiren, und könnten sie auch durch ihre magische Willenskraft den Mond stillstehen lassen, würde wiederum diese ihre Kunst als ein magisches Wunder erscheinen!«
Axel hatte ganz richtig gleich den Kern der Sache erfasst.
Der Graf setzte sich wieder im Sessel zurecht.
»Nun will ich Ihnen aber noch eine andere Magie zeigen, die diesem Instrument innewohnt. Mit Worten einfach zu erklären, und im Grunde genommen doch absolut unfassbar. Wollen Sie lachen oder weinen?«
Axel raffte sich zusammen.
»O, auf diese Weise wollen Sie mich faszinieren? Nein, ich will nicht! Ich habe mich gegen Weinen wie gegen Lachen gewappnet!«
»Wollen sehen. Dann packe ich Sie anders, ich werde Sie dennoch überrumpeln.«
Und wieder begann der Graf zu spielen, diesmal einen Marsch.
Was ist ein Marsch? Musik kann man schriftlich doch überhaupt nicht wiedergeben, höchstens kann man die Folge schildern.
Diese Folge war, dass sich Axel immer mehr aufzurichten begann, immer mehr leuchteten seine Augen auf, und ehe er es selbst wusste, marschierte er taktmäßig in der großen Kabine auf und ab, schlug auch mit den Händen den Takt dazu, selbst ganz Musik. Wolle der geneigte Leser nicht lächeln. So etwas kann man eben nicht weiter schildern. Heute ist uns der RadetzkyMarsch etwas ganz Geläufiges, er ist ›abgedroschen‹, gar nicht mehr salonfähig. Als dieser Marsch zum ersten Male von der Janitscharenmusik gespielt wurde, soll er die Leute in eine Art von Raserei versetzt haben! Und man darf den alten Berichten glauben. Was ist es denn anders, wenn irgendeine Tanzmusik alle Weiberfüße zucken lässt?
Und Musik vermag noch ganz andere Stimmungen auszulösen. Das ist ja auch das Thema von Tolstois ›Kreutzersonate‹.
Nun, und der Graf konnte ja vielleicht noch einen ganz anderen Marsch spielen, der noch viel faszinierender wirkte.
Er hatte geschlossen.
»Nun«, wandte er sich lächelnd an den Marschierenden.
Mit einem Ruck war Axel stehen geblieben, ein starrer, erstaunter Blick um sich, und er warf sich in einen Stuhl.
»Sie sind ein Hexenmeister!«, ächzte er, und er ächzte wirklich. Die eine Minute hatte ihn ganz aufgerieben.
»Ist das nicht auch eine Magie?«
»Ja, ja, das ist Hexerei!«, ächzte Axel noch einmal.
»So wollen wir zu jener anderen Magie zurückkehren, die sich aber im Grunde genommen von dieser hier durch nichts unterscheidet. Magie ist ein leeres Wort, das irgendein ebenso leerer Kopf erfunden hat, um nur irgendeinen Namen für das Kind zu haben, dessen Fähigkeit er nicht begreift.«
Der Graf hatte sich wieder neben Axel gesetzt, die Wasserhöhle im Auge haltend.
»Wo war ich stehen geblieben? Bei meinem Hellsehen im Starrkrampf. Das ist sehr beschränkt. Ich kann nicht im Geiste eine Seereise machen und auf diese Weise noch unbekannte Inseln entdecken. Ja, das wäre wirklich etwas Über- und sogar Unnatürliches! Aber Gott lässt keine Bäume in den Himmel wachsen. Ich kann mich im Geiste nur immer dorthin versetzen, wo ich schon einmal gewesen bin. Oder ich muss einen anderen Menschen begleiten, der dorthin fährt, mit dessen Augen kann ich dann sehen, aber das ist doch gar langweilig, da ich ja die ganze Reise mitmachen muss. Das ist die Sache! Verstehen Sie?«
»Ich verstehe, ich verstehe«, murmelte Axel.
»Oder ich schließe mich im Geiste einem Menschen an, der schon dort ist, wo ich Umschau halten will, kann aber immer nur mit den Augen dieser Person sehen, und dann muss ich diese Person auch gut kennen, muss Interesse für sie haben.
Solch eine Person ist doch die Prinzess Polima. Ich hatte mich einmal in Starrkrampf versetzt, zu außergewöhnlicher Zeit, mit der Absicht, zu sehen, wie sie sich befinde. Nämlich, nachdem ich gehört, dass der ›Salamander‹ von der französischen Flotte genommen worden war. Und da musste ich gerade Zeuge werden, wie wieder die französische Fregatte von den Piraten gekapert wurde, beobachtete den Kampf mit der Prinzess Augen, so weit es möglich war.
Die Zeit meines Starrkrampfes ist immer eine beschränkte. Länger als eine Stunde währt er niemals. Nun befand ich mich aber schon auf diesem schwarzen Schiffe, hatte bereits die Fähigkeiten der Fakire und Derwische kennen gelernt. Wir haben deren drei, die sich in den Zustand des Fernsehens versetzen können. Der beste Hellseher ist jener Asitan, der zwar ebenfalls eine Person haben muss, mit deren Augen er sieht, sie aber nicht zu kennen braucht. Seine Aufmerksamkeit muss nur auf diese Person gelenkt werden. Wie das gemacht wird, sehr umständlich, kann ich jetzt nicht schildern. Hat Asitan diesen Vorzug vor mir, so kann er dafür wieder in diesem Zustande nicht hören, nur sehen.
Auf diese Weise, durch Asitans Vermittlung, verrmochte ich die Piraten auf ihrer langwierigen Fahrt bis hierher zu begleiten. Angesichts der Küste, das heißt, als Polima die Küste erblickte und sich die Piraten offenbar zu einer Landung vorbereiteten, versetzte ich selbst mich wieder in Starrkrampf, um das Weitere zu beobachten.
So begleitete ich die Piraten im Geiste. Ich kann nur sagen, dass die zwölf Galeeren einfach in die Höhle hineinfuhren, durch alles Wassertosen hindurch, unbeschädigt in eine weite Höhle hineinkamen.
Nun muss ich aber immer wiederholen: Ich kann nichts weiter sehen, als was die betreffende Person sieht, hier also die Prinzess. Und dass die keine große Umschau gehalten hat in ihrer Todesangst, können sie sich wohl denken. Eine weite Höhle, viele Menschen — dann wurde es dunkel, sie ging einen langen Gang, und dann kam die anderthalbstündige Wüstenwanderung, die nach einer Klettertour in der Felsenburg endete. Das ist alles, was ich in diesem Zustande sehen konnte, und dann hörte ich noch, dass Polimas Begleiter diese Höhle tala el schehen nannte. Verstehen Sie?«
»Nein.«
»Was verstehen Sie nicht?«
»Sie wollen doch im Geiste die Küste entlang gewandert sein und Umschau gehalten haben. Da hatten Sie doch auch keine vermittelnden Augen.«
»Stimmt. Ich kann es auch ohne vermittelnde Augen machen. Aber dann ist es eine höchst unsichere Geschichte. Ich weiß hinterher nie, ob ich richtig gesehen habe. Das alles ist ja überhaupt nur wie ein Traum. Und ich kann auch tatsächlich falsch träumen. Und nun will ich die Sache kurz machen: Ich habe noch ein ganz anderes Mittel, um in die Ferne zu blicken...«
Als hätte der Graf etwas überaus Wichtiges gesagt, verraten, hielt er erwartungsvoll inne, den anderen anblickend.
»Und was für ein Mittel ist das?«
Der Graf neigte sich zu Axel hin, begann jetzt im leisesten Tone zu flüstern.
»Signor Axel, Sie sind mein Freund, oder sollen es werden. Ich vertraue Ihnen jetzt mein größtes Geheimnis an. Sprechen auch Sie leise. Die anderen, das heißt, die leitenden Personen, die hier auf diesem Schiffe etwas zu sagen haben, wissen wohl schon davon, haben aber doch nur etwas läuten hören. Das ist auch der Hauptgrund, weshalb die mich aufgesucht, mir gleich das ganze Schiff übergeben haben, nur um mich zu gewinnen. Es ist der reine Egoismus.
Ich kann mich noch in einen anderen Zustand versetzen als in jenen Starrkrampf. In einen rein somnambulen. Da kann ich überhaupt alles sehen, was ich will. Allerdings nicht hören, nur sehen. Aber dann auch alles, alles, ohne fremde Augen benutzen zu müssen. Aber ich erwache aus diesem Zustande erinnerungslos. Es muss mich also jemand immer fragen, und ich werde antworten, was ich erblicke. Verstehen Sie?«
»Ja, und das ist ja echter Somnambulismus.«
»So ist es. Nur dass er bei mir nicht angeboren, krankhaft ist, sondern ich kann ihn künstlich durch ein Mittel erzeugen. Nun ist die Sache aber die, dass ich dadurch auch sonst willenlos in die Hände desjenigen komme, der mich fragt. Verstehen Sie?«
Ja, Axel verstand, und er begann schon etwas zu ahnen.
»Es gibt keinen Menschen auf der Erde, dem ich mich in diesem Zustande anvertrauen möchte.«
»Sie möchten über gewisse Sachen nicht gefragt werden.«
»Nehmen Sie es an. Mein Meister, Monsieur Renard, von dem ich Ihnen ja schon viel erzählt habe, besaß ein Buch, in dem das Rezept zu diesem Mittel angegeben war. Bei mir wirkte es sofort, denn ich bin ja überhaupt schon somnambul veranlagt, ohne dabei krankhaft zu sein...«
Dieser letzten Behauptung widersprach Axel im Stillen. Ganz geistig normal war dieser Mann jedenfalls nicht.
»Renard hat mir dieses Buch immer vorenthalten, denn er meinte, selbst der lauterste Charakter, für den er mich hielt, könnte in einer schwachen Stunde damit doch einmal Missbrauch treiben. Als mein Meister seinen Tod, den er nach jahrtausendlangem Leben endlich freiwillig herbeisehnte, so wie auch ich es jetzt tun werde, herbeikommen fühlte, hat er dieses Buch zuvor vernichtet. Aber da hatte ich mir dieses Rezept und einiges andere daraus schon heimlich abgeschrieben. Sir Dalton nun wusste, dass es solch ein Rezept gibt und dass Renard es besaß, Daltons Nachfolger hatten es auf dieses Buch abgesehen, hofften es von mir zu erlangen. Aber ich weiß nichts davon, gar nichts von solch einem Mittel. Verstehen Sie?«
»Ja, Sie wollen sich von diesen Leuten nicht in Ihrem willenlosen Zustande aushorchen lassen.«
»Das ist es! Ich habe vor diesen Menschen meine Geheimnisse zu wahren. Und schließlich auch... vor Ihnen.«
»Jeder Mensch hat seine Geheimnisse«, gab Axel gleich zu. »Ich möchte mich auch meinem intimsten Freunde doch nicht so gänzlich offenbaren.«
»So geben Sie mir Ihr Wort darauf, mich niemals etwas zu fragen, was nicht zur Sache gehört, was wir nicht vorher ausgemacht haben.«
»Mein Ehrenwort und hier meine Hand darauf«, sagte Axel kurz.
Die Hand wurde genommen, fest blickte ihn der Graf an.
»Ja, schon dieser Blick würde mir genügen. Sie sind der einzige Mensch, dem ich in dieser Hinsicht vertraue. Denn es ist eine furchtbare Versuchung dabei, wenn man einen Menschen so ganz willenlos vor sich hat.«
»Bei mir haben Sie nichts zu fürchten, sonst wäre ich ein Lump.«
»Ich vertraue Ihnen. Nun passen Sie auf. Es ist ganz einfach. Ich nehme das Mittel, werde bald schlafend im Stuhl zurücksinken. Dann können Sie mich fragen, ich bin hellsehend, werde antworten, was Sie wünschen. Also, es kommt darauf an, zu erfahren, wie es dort in jener Höhle aussieht. So kommandieren Sie, aber möglichst in leisem Tone: ›Versetzen Sie sich in die bewusste Höhle!‹ Gleich werde ich antworten: ›Ich bin darin.‹ Nun fragen Sie weiter: ›Was sehen Sie darin?‹ Ich werde zu beschreiben anfangen. Aber Sie müssen mich immer durch Fragen unterstützen. Wie viele Menschen sehen Sie? Wie viele Fahrzeuge? Was für welche sind es? Was tun die Menschen? Und so weiter. Sie verstehen doch.«
Axels Züge drückten unverhohlenes Staunen aus.
»Wie ich fragen soll, habe ich wohl kapiert, aber... sonst unfassbar!«
»Gesetzt den Fall, ich sehe eine Tür — wobei es aber besser ist, mich erst zu fragen, ob ich eine Tür sehe — Ja. Nun befehlen Sie ›Passieren Sie diese Tür! Wo führt sie hin?‹ Und so weiter. Nicht wahr?«
»Und das wird alles den Tatsachen entsprechen?«, staunte Axel.
»Absolut. Sie können erst einen Versuch machen, wobei auch eine Gedankenübertragung ausgeschlossen ist. Denn wenn Sie hinter meinem Rücken etwas tun, so wissen Sie das doch selbst, und da könnte bei einer richtigen Antwort von mir doch auch eine Gedankenübertragung vorliegen, wodurch sich die sachlichsten Okkultisten so oft täuschen lassen. Es ist bei mir nicht der Fall. Sie könnten fragen, was gegenwärtig an Deck gemacht wird, was Sie doch selbst nicht wissen, was etwa der Kapitän zu der und der Minute tut, ich würde es Ihnen beschreiben, und Sie könnten sich hinterher überzeugen, dass meine Antwort stimmt. Aber diese Probe ist gar nicht erst nötig, Sie werden schon in anderer Weise Gewissheit erhalten, dass dieses mein Hell- und Fernsehen ein ganz reelles ist.«
»Und da können Sie irgend etwas sehen, was ich gern sehen möchte?«
»Was Sie bestimmen, was Sie zu sehen wünschen. In diesem Zustande, der etwas ganz anderes ist als der Starrkrampf, gibt es überhaupt nichts, was mir zu sehen unmöglich wäre.«
»Sie kennen doch nicht mein Geburthaus.«
»Habe keine Ahnung, wo Sie geboren sind.«
»Wenn ich nun verlange — ich will es jetzt nur einmal annehmen — Sie sollen sich im Geiste in mein Geburtshaus versetzen...«
»Ich würde Ihnen beschreiben, was Sie wünschen, und es würde alles der Wirklichkeit entsprechen. Aber vergessen Sie nicht, dass man da auch auf Gedankenübertragung schließen könnte.«
»Aber wenn das Haus und der Garten nun unterdessen verändert worden sind...«
»Dann würde ich alles so beschreiben, wie es jetzt ist, und das wäre ein Beweis, dass keine Gedankenübertragung vorliegt, wenn Sie sich später von der Richtigkeit meiner Beschreibung überzeugt haben. Dabei ist mir auch ganz gleichgültig, wie Sie sich selbst das Objekt in Ihrer Phantasie ausmalen. Ich habe eben absolut nichts mit Ihren Gedanken zu tun. Wollen wir jetzt anfangen?«
»Ja, das liegt doch nur an Ihnen.«
»Dann bloß noch eins. Dieser Zustand ist auch wieder etwas anderes als jener, den Sie Faszination nennen oder in dem diese möglich ist. Mein somnambuler Schlaf verwandelt sich nach und nach in einen natürlichen, was Sie dadurch merken, dass meine Zunge schwer wird, und da hilft auch kein Befehl mehr, und aus dem natürlichen Schlafe wache ich sehr bald auf, oder ich bitte Sie, dieses Erwachen durch Rütteln zu unterstützen. Dann ist mir gewöhnlich sehr unwohl, ich werde mich wahrscheinlich erbrechen. Aber das hat nichts zu sagen. Wie lange dieser somnambule Zustand dauert, ist ganz verschieden. Manchmal eine Stunde, manchmal nur wenige Minuten. Jedenfalls also nutzen Sie die Zeit nach besten Kräften aus. Nun liegt mir aber ein persönlicher Fall seit langer Zeit schon am Herzen. Dem möchte ich einige Minuten widmen. Ist Ihnen bekannt, dass ich in einem Kloster zuerst einen Pagen hatte?«
»Ich habe davon gehört.«
»Er ist mir entflohen.«
»So? Das weiß ich nicht.«
»Ich möchte wissen, wo der Junge steckt. Er hat mir eine schwere, schwere Enttäuschung bereitet. Also bitte, lassen Sie Ihr erstes Kommando sein: Erblicken Sie Ihren Pagen Joseph Balsamo!«
»Ich werde es tun.«
»Dann versuchen Sie aus mir herauszubekommen, wo er sich befindet, in welchem Lande, welcher Stadt. Nicht wahr?«
»O, das verstehe ich, auch ich habe ja schon öfters fasziniert, wo ja dasselbe Fragensystem in Betracht kommt.«
»Sehr richtig, und eben deshalb sind Sie der geeignetste Mann dazu. Aber nur fünf Minuten dürfen dieser Sache gewidmet werden, keine Sekunde mehr «
»Wie Sie bestimmen.«
»Ich bin vor allen Dingen meinem Schüler, dem Lord Moore, schuldig, ihm seine Braut wiederzuverschaffen, und dazu müssen wir erst wissen, was dort jene Höhle beherbergt, ob ich... nicht doch vielleicht nur falsch geträumt habe.«
»Wie, das wäre möglich?!«
»Ja, die Träume im Starrkrampf haben mich schon oft getäuscht«, gestand jetzt der Graf, er hatte ja aber deswegen auch schon Andeutungen gemacht. »In diesem Zustande aber gibt es keine Täuschung. Haben Sie eine Uhr?«
»Nein. Ich kann die fünf Minuten abschätzen.«
»Nehmen Sie lieber hier meine Uhr.«
Der Graf gab ihm seine einfache, silberne Taschenuhr, die er wohl auch erst von Lord Moore bekommen hatte.
»Also nur fünf Minuten werden diesem Balsamo gewidmet. Und nun ans Werk!«
Der Graf stand auf, ging an ein Schränkchen, machte sich, ohne einen Schlüssel zu gebrauchen, an dem Schloss zu schaffen, öffnete die Tür, nahm ein Fläschchen mit einer grünen Flüssigkeit heraus, zählte davon einige Tropfen in einen Becher, füllte mit Wasser nach.
»Ich besitze das Mittel auch in Pillenform, möchte aber den mir hergestellten Vorrat nicht unnötig angreifen«, sagte er dabei.
»Ich vermute, dass das Gift ist, da es Ihnen hinterher unwohl wird«, flüsterte Axel, wie überhaupt immer nur im leisesten Tone gesprochen wurde.
»Eins der stärksten Pflanzengifte, die wir kennen — Schierlingssaft — auch noch in ganz konzentriertem Auszuge.«
»Schierlingssaft?! Und das schadet Ihnen nichts, tötet Sie nicht?«
»O, ich habe meinen Körper schon an manches Gift gewöhnt, es gehört zu meinem Berufe«, sagte der Graf mit recht bitterem Lächeln. »Außerdem steht schon das Gegenmittel bereit, das ich gleich nach dem Erwachen trinke. Deshalb eben sollen Sie mich sofort, wenn ich richtig einschlafe — was Sie daraus merken, dass ich nicht mehr antworte — mit Gewalt wecken.«
»Ich werde es nicht versäumen. Soll ich nicht lieber die Tür schließen, dass wir nicht überrascht werden können?«
»Sie ist bereits verschlossen. Achtung!«
Der Graf stürzte den Inhalt des Bechers hinab, ging schnell nach dem Stuhl, setzte sich, lehnte sich zurück, schloss die Augen.
Mit einem Male wurde sein Gesicht, das in letzter Zeit etwas mehr Farbe bekommen hatte, leichenblass.
Axel war vor ihn hingetreten, hielt die Zeit schon für gekommen, und der Graf, der selbst wenig Erfahrung darin besaß, hatte ja alles Weitere ihm überlassen.
»Herr Graf, hören Sie mich sprechen?«
»Ja«, kam es deutlich aus dem Munde des offenbar schon Schlafenden.
»Kennen Sie einen Knaben namens Joseph Balsamo?«
»Er war mein Page«, wurde ganz selbstständig geantwortet.
»Wo befindet er sich jetzt?«
»Ich weiß es nicht.«
»Ich befehle Ihnen, dass Sie ihn sehen.«
Ein krampfhaftes Verzerren der Gesichtszüge, und dann erklang es mit veränderter, etwas heiserer Stimme:
»Ich sehe ihn.«
»Wie sehen Sie ihn?«
»Er sitzt an einem Tische und liest.«
»Wo steht dieser Tisch?«
Axel zeigte jetzt, dass er von dieser Fragemethode wirklich schon etwas verstand.
»In einem Zimmer.«
»Sehen Sie sich in diesem Zimmer um!«
»Ich tue es.«
»Was erblicken Sie?«
»Ein Bett, einen Stuhl, eine Kiste...«
»Ist es ein ärmliches Zimmer?«
»Ja. Ein Dachzimmer, die Fensterwand ist ganz schief.«
»Sind noch andere Menschen in dem Zimmer?«
»Nein.«
»Stellen Sie sich ans Fenster!«
»Ich stehe am Fenster.«
»Was erblicken Sie durch das Fenster?«
»Ein gegenüberliegendes Haus.«
»Und unten auf der Straße?«
»Eine schmale Gasse, einige Leute, einen bepackten Esel.«
»Wofür halten Sie diese Leute? Es sind Spanier, nicht wahr?«
»Nein, sie sind ganz italienisch gekleidet.«
Wieder hatte Axel bewiesen, wie richtig er zu fragen verstand, um sich vor einem Irrtum zu bewahren, und der Graf, dass er in diesem Zustande selbständig denken und urteilen konnte.
»Kennen Sie die Gasse? Ahnen Sie, zu welcher Stadt sie gehört?«
»Nein.«
»Sie sollen sich orientieren, was für eine Stadt das ist.«
»Ich... weiß es nicht.«
»Sehen Sie ein Straßenschild?«
»Nein.«
»Verlassen Sie das Zimmer, begeben Sie sich die Treppe hinab.«
»Ich tue es.«
»Sehen Sie etwas Bemerkenswertes?«
»Nein.«
»Jetzt sind Sie auf der Straße.«
»Ich bin es.«
»Hat das Haus, aus dem Sie kamen, eine Nummer?«
»Nummer elf.«
»Noch einen besonderen Namen?«
»Nein.«
»Gehen Sie die Gasse entlang, bis Sie ihr Namensschild sehen.«
»Vicolo da ponte«, ward das gefundene Straßenschild auch sofort gelesen. Brückengasse — daraus ist nicht viel zu nehmen.
»Versetzen Sie sich auf den Marktplatz dieser Stadt.«
»Das... kann ich nicht so schnell.«
»Weshalb nicht?«
»Den muss ich erst durch Sie suchen.«
Axel bekam etwas Neues zu hören, hielt sich jetzt aber nicht mit solch erklärenden Fragen auf, das konnte der Graf im bewussten Zustande besser tun.
»Wohin mündet die Gasse?«
»In eine breitere Straße.«
»Sehen Sie von dieser das Namensschild?«
»Via della Roma.«
»Erkennen Sie jetzt, was für eine Stadt das ist?«
»Nein.«
»Wandern Sie die Straße schnell entlang.«
»Ich tue es... die fünf Minuten sind vergangen.«
Wahrhaftig! Axel hatte die Zeit dennoch verpasst. Und also auch in dieser Weise konnte der Somnambule selbstständig denken.
Nun, Axel wusste, wie er gleich weiterzufragen hatte.
»Kennen Sie an der tunesischen Nordküste eine Meeresgrotte, die tala el schehen genannt wird?«
»Wir liegen davor.«
»Versetzen Sie sich in diese Höhle!«
»Ich bin darin.«
Jetzt wurde Axel doch von einer gewaltigen Aufregung erfasst. Was für eine Perspektive eröffnete sich ihm da! Er bezwang sich.
»Was sehen Sie? Schildern Sie die Höhle!«
»Sehr groß und hoch, ringsherum läuft eine breite Galerie, in dem Wasser liegen viele Fahrzeuge...«
»Wie viele und was für Fahrzeuge?«
Der Graf zählte nach und nach vierzehn Rudergaleeren und drei Sambuks, jene ziemlich großen Segelboote, wie sich ihrer die Araber schon vor Tausenden von Jahren, nämlich schon zu Salomos Zeiten, bedient haben, mit niedrigem Maste und dreieckigem Bastsegel. Dann noch kleinere Boote.
Axel ließ ihn nicht bis zu Ende alles einzeln aufzählen.
»Ist das Wasser dieses Höhlenhafens denn ruhig?«
»Ganz ruhig.«
»Aber der Zugang ist ganz mit Wassergischt erfüllt.«
»Ganz erfüllt.«
»Ist die Höhle größer als der Zugang?«
»Viel, viel größer und höher — es ist eine weite Halle.«
»Wie lang ist dieser mit Gischt gefüllte Zugang?«
»Das weiß ich nicht.«
»Begeben Sie sich durch diese Einfahrt wieder zurück ins Freie.«
»Das... kann ich nicht«, erklang es zögernd, wie damals, als er in der fremden Stadt sich sofort nach dem Marktplatz versetzen sollte.
»Warum können Sie das nicht?«, fragte Axel diesmal.
»Ich... fürchte mich. Ich würde ertrinken.«
Der scharfsinnige Axel begann etwas zu ahnen. So hielt er sich jetzt deswegen nicht weiter auf, der Graf würde ihm dieses Rätsel später erklären.
»Sie sind noch in der Höhle?«
»Ja.«
»Ist sie erleuchtet?«
»Durch brennende Lampen, die hier und da an den Wänden hängen. Dort oben dringt durch Löcher auch Tageslicht ein. Aber hoch oben.«
»Versetzen Sie sich an solch ein Loch!«
»Ich bin dort.«
»Blicken Sie hindurch! Was sehen Sie?«
»Das Meer. Das schwarze Schiff.«
»Was fällt Ihnen sonst in der Höhle auf?«
»Viele Nischen, alle gefüllt mit Kisten und Fässern und Ballen.«
»Sehen Sie keine Menschen?«
»Sehr viele.«
»Was für Menschen sind das?«
»Männer, Araber, wilde Gestalten.«
»Was tun sie?«
»Ganz verschieden. Jetzt tragen ein — zwei — drei — acht Mann ein großes Kanonenrohr die Treppe hinauf.«
»Wohin führt diese Treppe?«
»Nach einer Galerie an der Vorderwand, wo die Löcher sind, durch die man das Meer sieht.«
»Sind dort oben schon andere Geschütze?«
Axel hatte gleich richtig kalkuliert. Ja, dort oben waren schon andere Geschütze, der Hellseher zählte deren fünf, aber viel kleinere als das, das jetzt hinaufgetragen und montiert wurde.
Die Piraten setzten sich in Verteidigungszustand oder wollten auch zum Artillerieangriff übergehen, das große Schiff erforderte ein größeres Geschütz als die, mit denen man sich sonst für einen feindlichen Besuch vorgesehen hatte.
»Wie viele Männer sind es ungefähr?«
In dem Durcheinander war schwer zu zählen. Der Graf schätzte die Zahl auf ziemlich hundert.
»Aber die Hälfte davon meißelt an der rechten Wand.«
»Was meißeln sie da?«
»Einen Tunnel. Sie sind schon sehr tief eingedrungen.«
»Wie tief?«
»Ich schätze es auf... vierzig Ellen. Ich zähle die Schritte — es sind dreiundzwanzig Doppelschritte.«
Das war ja ganz wunderbar, dass der Schlafende im Geiste sogar Schritte machen und zählen konnte! Aber war überhaupt nicht alles ganz wunderbar? Worüber brauchte man noch zu staunen?
Und es mussten auch ›geistige‹ Schritte gewesen sein, denn das Abschreiten war für die Wirklichkeit viel zu schnell gegangen, der Graf hatte nur eine Pause von kaum zwei Sekunden gemacht. Es geschah eben alles nur im Traume — freilich im hellsehenden Traume eines Somnambulen.
»Sie arbeiten wie die Ameisen«, begann da der Schläfer von selbst zu schildern, »mit fabelhafter Emsigkeit.«
Dann mochte die schnellste Fertigstellung dieses Tunnels mit dem Erscheinen des schwarzen Schiffes zusammenhängen, er war zur Verteidigung der Höhle nötig oder zum Angriff, und da wäre es sehrwünschenswert gewesen, zu erfahren, wozu denn dieser Tunnel dienen solle.
Axel hatte eine Idee. Er bezweifelte, dass der Hellseher das Verlangte ausführen könne. Er hatte sich ja nicht einmal in jener Stadt schnell nach dem Marktplatz versetzen können, hätte diesen erst mit den normalen Schritten eines Menschen aufsuchen müssen. Es war überhaupt etwas Ungeheuerliches, was Axel jetzt von ihm verlangen wollte. Trotzdem — es kam ja nur auf einen Versuch an.
»Ist der Tunnel ganz gerade?«
»Schnurgerade.«
»Macht keine Ecken?«
»Nein.«
»Steigt oder senkt sich auch nicht?«
»Ganz horizontal.«
»Suchen ihn die Arbeiter zu verbreitern oder zu verlängern?«
»Nur zu verlängern.«
»Wo mündet er zuletzt aus?«
»Er endet ja blind, er wird doch erst noch verlängert.«
»Aber wo wird er enden, wenn der Tunnel fertig ist?«
»Wie kann ich das wissen?«
»Können Sie nicht im Geiste durch die Felsenwand dringen, in derselben Richtung?«
Der Schläfer drückte im Gesicht und durch Bewegungen Unruhe aus.
»Nein, das kann ich doch nicht«, murmelte er dann gedrückt.
Axel war durch dieses ganze Verhalten stutzig geworden.
»Ich befehle es Ihnen aber, verfolgen Sie die Richtung des Tunnels durch die Felsenwand hindurch!«, sagte er mit Nachdruck.
»Ich bin durch«, erklang es sofort, zu größtem Erstaunen, wenn er es ja auch schon erwartet hatte.
Alle weiteren Grübeleien ließ er jetzt sein, das konnte später erörtert werden.
»Wo befinden Sie sich?«
»In einem Raume.«
»Was erblicken Sie?«
»Im Scheine von Laternen meißeln arabische Arbeiter an der Felswand.«
»Durch die Sie soeben gegangen sind?«
»Ja.«
»Aha, auf der anderen Seite wird entgegengearbeitet! Wie stark ist die Felswand, die noch zu durchbrechen ist?«
»Wie soll ich denn das wissen?«, erklang es wiederum so eigentümlich zögernd.
»Sie sind doch selbst soeben durchgegangen. Überzeugen Sie sich von ihrer Stärke, ich befehle es Ihnen!«
»Keine Elle mehr ist sie stark«, wurde jetzt gleich zugegeben, und Axel wusste nun, wie er sich in solchen Fällen zu verhalten hatte.
»Was sehen Sie sonst?«
»Nur Arbeiter, die meißeln und den Schutt in kleinen Körben forttragen.«
»Eine Tür?«
»Nein.«
»Wohin tragen denn die Araber den Schutt?«
»Eine Treppe hinauf.«
»Eine Steintreppe?«
»Ja.«
»In den Felsen hineingehauen?«
»Ja.«
»Empfängt sie Tageslicht?«
»Nein. Ich sehe einige brennende Laternen.«
»Verfolgen Sie die Treppe hinauf.«
»Ich tue es.«
Einige Zeit verstrich, Axel erwartete eine Auskunft, die freiwillig nicht kommen wollte.
»Was sehen Sie?«
»Nichts. Arbeiter und hin und wieder eine Laterne.«
»Sie gehen wohl mit den Arbeitern die Treppe hinauf?«
»Wie Sie befahlen.«
»Nein, ich befehle Ihnen, sich schnellstens an das Ende dieser Treppe zu versetzen, ich befehle es Ihnen!«
»Ich bin oben.«
»Was erblicken Sie?«
»Einen Felsenraum, in dem eine andere Treppe nach oben geht.«
»Verfolgen Sie auch diese Treppe, schnell, schnell!«
Der Graf schilderte nur noch, wenn wieder solch ein Raum kam, nichts weiter als ein Treppenabsatz, und Axel vergewisserte sich nur noch, dass die endlos lange Steintreppe, ganz in den Felsen gehauen, immer im Zickzack lief.
»Jetzt bin ich in einem viel größeren Raume.«
»Was erblicken Sie darin?«
»Arbeiter — mehrere Türen — mehrere Fenster.«
»Was sehen Sie durch die Fenster?«
»Durch die auf der einen Seite schütten die Araber ihre Schuttkörbe...«
»Und was sehen Sie durch diese Fenster?«
»Die gelbe Wüste.«
»Und auf der anderen Seite?«
»Das Meer — da liegt auch das schwarze Schiff tief, tief unten.«
»Wohin führen die Türen? Benutzen Sie die eine.«
»Ich... ah, den Mann kenne ich!«, wurde der Träumende immer selbstständiger und konnte in diesem Zustande auch staunen.
»Wer ist es?«
»Barbarossa Maladenne.«
»Was tut er?«
»Jetzt geht er durch die eine Tür...«
»Folgen Sie ihm!«
»Ich tue es.«
Wieder verging eine kleine Weile, und Axel fragte nicht, besonders weil die Züge des Träumenden immer größere Spannung annahmen.
»Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin!«
»Wo?«
»In der Felsenburg.«
»In der Felsenburg, in der sich die Prinzess befindet?«
»Ja, ja!!«
»Das ist doch gar nicht möglich!«
»Doch, doch — jetzt sehe ich auch...«
Immer schwächer war des sprechenden Träumers Stimme geworden, Axel war es nur in seiner eigenen großen Erregung nicht aufgefallen, bis jener ganz schwieg, auch durch Befehl nicht wieder zum Sprechen zu bringen war.
Der somnambule Schlaf war einem natürlichen gewichen. Getreu seinem gegebenen Versprechen rüttelte ihn Axel derb.
»Wachen Sie auf, Graf!«
Der Schläfer bewegte sich, sein schon totenblasses Gesicht färbte sich gelb — plötzlich schnellte er vom Stuhle empor, direkt an jenen Schrank, trank aus einer kleinen Flasche einige Schlucke.
Ein Übelsein war dann nicht mehr zu bemerken, schnell kehrte auch die gesunde Gesichtsfarbe zurück.
»Habe ich Joseph Balsamo gesehen?«, war seine erste Frage.
Axel gab wieder, was jener ihm berichtet hatte, ohne von dem Marktplatz beginnen zu wollen Der Graf selbst fing davon an.
»Haben Sie mich nicht nach einem Gebäude geschickt, wo ich Gewissheit erlangen konnte, was für eine Stadt das war? Etwa nach dem Rathaus, an dem doch immer Bekanntmachungen mit vollständiger Unterschrift des Magistrats angeheftet sind.«
»Jawohl, daran dachte ich allerdings, ich verlangte von Ihnen, dass Sie sich nach dem Marktplatz versetzen sollten.«
»Und ich tat es nicht?«
»Sie sagten, das könnten Sie nicht ohne Weiteres, Sie müssten den Marktplatz erst Schritt für Schritt aufsuchen, und dazu war keine Zeit mehr.«
»Aha! Sie hätten es mir nur energisch befehlen sollen. Sie müssen immer bedenken, dass ich auch in diesem traumartigen Zustande — und es ist ja nichts anderes als ein Traum — mich immer in dem Wahne befinde, ein normaler Mensch mit Fleisch und Blut zu sein. Was ich mit meinem Körper nicht ausführen kann, halte ich auch in diesem traumhaften Zustande für unmöglich. Ich weiß schon, ich will immer mit den anderen Menschen Schritt für Schritt gehen. Aber da brauchen Sie nur energisch zu befehlen. So bilde ich mir auch ein, jede Tür regelrecht öffnen zu müssen, ich forme mir im Geiste sogar erst einen Schlüssel, während mir doch überhaupt gar nichts einen Widerstand bietet...«
»Zu dieser Erkenntnis bin ich schon selbst gekommen, wie ich Ihnen dann berichten werde. Nur damals, als Sie sich plötzlich auf den Marktplatz versetzen sollten und sich dann weigerten, wusste ich das noch nicht. Dann waren auch die fünf Minuten verstrichen.«
»Nun gut. Die praktische Fertigkeit, die Sie mit der Zeit bei jeder Sitzung immer mehr erlangen werden, ist besser als alle theoretischen Ratschläge, die ich Ihnen geben könnte. Ich weiß ja überhaupt selbst wenig davon, ich selbst kann mich ja gar nicht kontrollieren, weiß nur, was mir mein Meister dann hinterher darüber immer mitteilte, und ich glaube, der hat mir gar viel verschwiegen. Nun — eine vicolo da ponte, die in die via della Roma mündet — daraus kann man schon viel schließen. Es wird ein Städtchen in der Nähe Roms sein. Ich werde Erkundigungen einziehen. Oder wir können ja auch eine Sitzung mit diesem Thema wiederholen. Ließen Sie sich das Buch beschreiben, in dem der Junge las?«
»Nein.«
»Waren es Pergamentblätter, handschriftlich beschrieben?«
»Sie sagten nur, dass er in einem Buche läse, weiter fragte ich deshalb nicht.«
»Schade! Und was dann weiter?«
»Als ich Sie weiter durch die Stadt schicken wollte, machten Sie mich selbst darauf aufmerksam, dass die fünf Minuten verstrichen seien.
»Tat ich das? Ja, schon Monsieur Renard sagte einmal, dass ich in diesem Zustande einen ganz erstaunlich ausgeprägten Sinn für Zeitmaß besäße. Nun kam also die Höhle dort daran.«
Axel schilderte alles. Der Graf unterbrach ihn mit keinem Wort.
»Als Sie eben erkannt hatten, dass Sie sich in jener Felsenburg befänden, wurde Ihre Stimme immer schwächer, bis Sie ganz schwiegen — ich weckte Sie auf.«
Der Graf vergewisserte sich noch einmal, dass er immer senkrecht emporgestiegen war, nur im Zickzack.
»Dann befindet sich diese Felsenburg, in der auch die Prinzess ist, einfach dort oben, direkt über der Höhle.«
»Ja, wie ist das möglich?«
»Weshalb nicht?«
»Die Piraten, die Polima bei sich hatten, haben nach Ihrer näheren Schilderung die Höhle doch durch einen hinteren Ausgang verlassen, sind dann anderthalb Stunden in südwestlicher Richtung durch die Wüste marschiert, bis die halbstündige Klettertour begann.«
»Ja, so sah ich mit Polimas Augen, als ich im Geiste die Karawane begleitete. Mir war ja die Richtung mit die Hauptsache, aber es gab nichts anderes zu tun, als aufzupassen, wenn sie einmal zufällig Schatten erblickte. Daraus schloss ich auf eine südwestliche Richtung. Das ist jedoch eben alles sehr, sehr unsicher. Nein, die Karawane hat einfach einen Kreis beschrieben, oder doch einen Halbkreis, freilich einen ganz gewaltigen, um das Gebirge herum, bis zu der Stelle, wo der Aufstieg zu der Felsenburg beginnt. Und diese liegt hier über der Höhle.«
»So wird die direkte vertikale Verbindung zwischen der Hafenhöhle und der Burg erst jetzt hergestellt.«
»Ganz sicher ist es so. Oder die Piraten haben bisher immer nur von der Burg aus in die Tiefe gemeißelt. Nun ist einmal die Not da, es ist nur noch eine ellendicke Felswand zu durchbrechen, da wird jetzt schnell auch noch von der Höhle aus gemeißelt.«
In dem Laboratorium ließ sich mit trillerndem Tone eine Glocke vernehmen — eine elektrische Klingel, die Axels Staunen immer wieder hervorrief, noch mehr natürlich das elektrische Licht.
»Ich werde an Deck gerufen«, sagte der Graf. »Es muss etwas Wichtiges sein, dass man es tut. Gehen wir. Natürlich kein Wort von dem, was wir hier unten vorgenommen und dabei erfahren haben. Also wissen wir auch nichts davon, dass die Burg dort oben liegt. Das werden die anderen schon noch rechtzeitig erfahren, und es genügt ja, wenn wir beide es wissen, um bei dem Angriffsmanöver damit zu rechnen.«
Sie begaben sich an Deck. Kapitän Morphin führte das Wort, hatte alle Schiffsoffiziere um sich versammelt, schien ihnen einen Vortrag zu halten. auch Kapitän Römer war dabei, was deshalb bemerkenswert war, weil Axel schon beobachtet hatte, wie dieser dem Grafen und seinen Gästen auf jede mögliche Weise aus dem Wege ging. Und die rothaarige Lady ließ sich überhaupt gar nicht an Deck sehen.
Freilich war ja Axel erst vierundzwanzig Stunden an Bord, hatte davon die meiste Zeit geschlafen oder sich mit sich selbst beschäftigt, da durfte er aus diesen Beobachtungen noch keine Schlüsse ziehen.
»Sie wissen bestimmt, dass die Piratengaleeren dort in das Wasserloch eingedrungen sind?«, wandte sich Kapitän Morphin jetzt an den Grafen.
»Ich habe es ja mit eigenen Augen gesehen.«
»Aber schließlich doch nicht in Wirklichkeit.«
»Nein, das allerdings nicht.«
»Wie können Sie sich erklären, dass ein Boot durch solch einen brandenden Wasserstrudel kommt?«
»Es ist mir ein Rätsel.«
»Nun, ich aber halte es für möglich. Ich hatte an der Küste von Formosa einen Schlupfwinkel. Ein alter Chinese wollte mir einen noch besseren zeigen. Den Zugang bildete eine Grotte, in der es noch viel toller brandete als in der dort. Ich hielt den Alten für wahnsinnig, dort einfahren zu wollen, aber er machte es mir vor, kam glatt durch und wieder heraus, ich machte dann mit. Es war dort förmlich eine ganz andere Art von Wasser. Die Spritzer und Strudel hoben das Boot kaum, das war alles mehr wie Äther, wie Staub, obschon es ganz richtiges Wasser war. Wie das kommt, weiß ich nicht, ich berichte nur die Tatsache. Und nicht etwa, dass man das Experiment bei einer anderen Höhle machen durfte. Schon in der nächsten Höhle wurde ein Boot, das wir versuchsweise hineinschickten, sofort in tausend Splitter geschlagen. Nur in dieser einen ging es glatt wie auf stillem Wasser durch, obgleich es gerade in dieser fürchterlich brandete. Benutzt habe ich die Höhle sonst nicht, sie war hinten zu eng.«
Die meisten, welche dies mit anhörten, waren Seeleute, welche ihre seltsamen Erfahrungen schon gemacht hatten, und auch die anderen, wie der Graf und Axel, waren gebildet genug, um zu wissen, dass die Elemente aller menschlichen Berechnung spotten.
Eine der Erfahrungen, welche Seeleute oft machen, ist etwa die, dass auf der Back ein Anker mit Ketten festgelascht liegt. Die fürchterlichsten Sturzwogen sind schon darüber hinweggegangen — der Anker liegt sicher. Da kommt einmal eine ganz kleine Woge, der man kaum Beachtung schenkt — und plötzlich brechen die starken Ketten wie Glas, weg ist der Anker. Das Allermerkwürdigste aber dabei ist, dass dieselbe Woge andere, viel leichtere Gegenstände, welche neben dem Anker liegen, ganz unberücksichtigt lässt. Ein Mensch kann daneben gestanden haben, er empfindet die Kraft der Woge gar nicht.
Wie kommt das? Kein Mensch kann es erklären.
Axel konnte auch gleich noch ein anderes Beispiel anführen.
»Richtig, da weiß ich einen ganz ähnlichen Fall. auch so ein Naturphänomen, wie man es wohl nennen kann. Ein Nebenfluss des Wisconsin, in Amerika, bildet einen Wasserfall von fast zwanzig Ellen Höhe, sieht ganz schrecklich aus, unten alles ein Strudel und Gischt, und die Indianerkinder fahren den Wasserfall in den gebrechlichsten Booten zum Vergnügen hinab. Es ist wie eine Wasserrutschbahn. Das Boot gleitet unten ganz sanft über die Strudel, als wäre das alles eigens dazu eingerichtet. Ich selbst bin oft genug hinabgerutscht, staunte immer von Neuem. Dann kommt ein anderer Fall, nur halb so hoch, gegen jenen ganz unschuldig aussehend, aber wenn man bei dem solch eine Rutschpartie versuchen wollte, das würde einem schlecht bekommen. Alles zertrümmert und verschlungen.«
»Nun wohl«, sagte der Graf. »also auch in diese Höhle ist einzudringen, so wollen wir jetzt unseren Kriegsplan...«
Der Graf brach ab und lauschte wie all die anderen. Ein gellender Ton, aus weiter Ferne kommend, war ein sein Ohr gedrungen. »Eine menschliche Stimme! Sie kommt dort von der Felswand!«
Da war der Rufer auch schon entdeckt. Schon mit bloßen Augen konnte man deutlich genug die menschliche Gestalt erkennen, welche dort auf einem Felsenvorsprung stand und ein sehr großes, blaues Tuch schwenkte, wenn sie nicht die Hände trichterförmig vor den Mund legte, um einen durchdringenden Schrei auszustoßen. Es handelte sich ja um eine Entfernung von mindestens einem Kilometer.
Der Felsvorsprung an der sonst ganz glatten Wand befand sich etwa zwanzig Meter von jener in Betracht kommenden Wassergrotte nach links entfernt, dazwischen war noch ein kleineres Wasserloch, über die Meeresoberfläche erhob er sich so weit, dass die höchsten Spritzer eben noch hinaufkommen konnten, Bei stärkerer Brandung musste er überspült werden.
»Ein Pirat!«
»Sie wollen mit uns unterhandeln!«
So und anders klang es durcheinander.
Bald aber kam man zu der Ansicht, dass hier etwas anderes vorliegen müsste.
Die Piraten hatten ja nicht das geringste Lebenszeichen von sich gegeben, und wollten sie unterhandeln, so hatten die es doch viel bequemer.
»Hier wird uns eine Falle gebaut«, warnte Axel zuerst. »Natürlich ist das dort einer der Piraten, aber er hat den Vorsprung auf Umwegen erreicht oder sich sonst wie hingeschlichen, soll sich für einen Schiffbrüchigen ausgeben, wir sollen ihn an Bord nehmen, dass er uns aushorchen kann, warum wir hier liegen.«
Ähnliches hatten schon die anderen gedacht, Axel hatte es nur als erster klar ausgesprochen.
»Aber wie will er rechtfertigen, dass er schon seit längerer Zeit dort oben ist und unser Schiff jetzt erst erblickt, wo wir schon seit zwei Stunden hier liegen?«, wurde nur noch einmal eingewandt.
»Er sagt einfach, er hätte geschlafen.«
Nun handelte es sich nur darum, ob man den Mann, der doch offenbar um Hilfe rief und winkte, abholen sollte.
Sicher! Dass das zu Hilfe kommende Boot von der Höhle aus oder dort aus den Löchern beschossen würde, das war nicht zu befürchten. Das wäre ja ganz zwecklos gewesen. Die Piraten wollten doch von ihrer Anwesenheit hier offenbar nichts verraten, glaubten oder hofften wahrscheinlich, die Anwesenheit des schwarzen Schiffes hier hätte einen ganz anderen Zweck. Um diesen zu erfahren, suchte man auf eine harmlose Weise einen Spion an Bord zu schmuggeln.
Man gab Zeichen zurück, dass die Hilferufe gehört worden seien, ein Boot wurde ausgesetzt, der Graf wollte mitgehen, desgleichen Axel.
»Nun bloß noch eins«, sagte der Graf, ehe er ins Boot stieg, »etwas, was wir schon längst hätten ausmachen müssen. Wir sind hier, um die tunesische Küste geografisch aufzunehmen. Was das zu bedeuten hat, wissen diese arabischen Seeräuber auch schon recht gut, die verstehen mit dem Sextanten genau so umzugehen wie wir, die Astronomie kommt ja erst von den Arabern. Wir haben schon die Ostküste aufgenommen. Es ist der reine Zufall, dass wir gerade hier vor Anker gegangen sind. Die Felsenwand betrachten wir so interessiert, weil sie uns den besten Anhalt zu trigonometrischen Messungen gibt. Es ist ein Privatschiff, ein amerikanisches, wollen wir sagen. Für diese Araber hat alles Amerikanische noch etwas Märchenhaftes an sich. Alles andere bleibt mir überlassen. Nur dass mir niemand dazwischenredet.«
Der Graf hatte wie immer als Befehlshaber gesprochen, der er auch in diesem Falle wirklich war. Doch etwas Herrisches war in seinem Wesen nicht zu merken.
Das Boot mit sechs Ruderern ging ab, ein Offizier steuerte.
Bis auf hundert Meter konnte man sich der steil ins Meer abstürzenden Felswand nähern, ohne etwas von der Brandung zu merken. Dann musste gegen diese mit stoppenden Riemen angekämpft werden.
Um den Mann heil von dort oben herunter und ins Boot zu bekommen, dazu gab es nur eins. Man musste so nahe wie irgend möglich heranzukommen versuchen und ihm dann ein Seil zuwerfen, dessen Ende er in die Hand nahm, sich fest um den Leib band und damit ins Wasser sprang, in die Brandung hinein, aus der er möglichst schnell herausgerissen werden musste, ehe er an den Klippen zerschellte.
Dass es nicht anders geschehen konnte, war von vornherein klar gewesen, dazu waren die geeignetsten Matrosen ausgesucht worden. Nun, wenn sich der Mann mit Absicht in diese Lage begeben hatte, dann würde er auch schon wissen, dass es mit Hilfe geschickter Seeleute möglich war, sie ohne besondere Lebensgefahr auch wieder zu verlassen.
Der Mann befand sich in weißer Unterkleidung. Das große blaue Tuch, welches er vorhin geschwungen hatte, war sein blaues Hemd, ein ganzer Kaftan, wie ihn die arabischen Arbeiter in jener Gegend tragen, besonders auch die Fischer, und es war solch einem arabischen Arbeiter entsprechend, dass er sein Hemd nicht im Stiche lassen wollte, sondern es wieder angezogen hatte, auch auf die Gefahr hin, dass das lange Gewand ihn sehr an der Bewegungsfreiheit hindern würde.
Bis auf zwanzig Meter wagte sich das Boot heran, dann hätte jeder weitere Ruderschlag Tod und Verderben bedeutet.
Ein Matrose stand mit dem aufgerollten Seile zum Wurfe bereit.
»Fang und binde es dir fest um den Leib!«, schrie der steuernde Offizier, und der Graf übersetzte die englischen Worte noch ins Arabische.
»Der wird schon wissen, was er zu tun hat, mir scheint nur, der Matrose wird das Ende nicht hinüberbringen.«
Axel hatte es gesagt, und erstaunt blickte der Graf ihn an. Denn auch Axel hatte sich der arabischen Sprache bedient.
»Was? Auch Sie sprechen Arabisch?!«
»Nur so für den Hausbedarf. Sie wissen ja, dass ich nicht immer Depeschen geritten habe — ich hatte mich einmal auf die orientalischen Sprachen gelegt. Da — da — dachte ich's mir doch, und gar keine Ahnung, dass der Kerl jemals den Felsen erreichen wird!«
Ein Seil, das sich während des Werfens aufrollen muss, also doch an Schwere immer zunimmt, will zwanzig Meter weit geschleudert sein. Das Ende durchflog kaum die Hälfte, dann klatschte es ins Wasser.
Axel sprang in dem tanzenden Boote nach vorn, nahm dem Matrosen das Seil aus der Hand, wickelte es in ganz anderer Weise auf, machte vorn eine Schlinge, wirbelte diese mehrmals um seinen Kopf, die Schlinge sauste durch die Luft und hatte sich im nächsten Augenblick auch gleich um den Körper des Arabers gelegt, Axel hätte ihn sofort herunterreißen können.

»À la bonheur, so etwas habe ich auch noch nicht gesehen!«, rief der Graf, und nicht minder staunten die anderen, soweit sie in dieser Situation Zeit dazu hatten.
»Ein alter Cowboy, was meinen Sie wohl, wird doch das Lassowerfen verstehen!«
Aber das gab nicht viel Aufklärung. Damals wurde Europa noch nicht von schaustellernden Indianern und Cowboys bereist.
Nun, der Mann wusste, was er zu tun hatte, er befestigte die Schlinge besser an seinem Körper, gab ein Zeichen, dass er springen würde, und verschwand mit einem weiten Satze in dem weißen Gischt. Zwei Matrosen zogen schnellstens die Leine Hand über Hand ein, während Axel die Beobachtung außenbords übernahm, er griff ins Wasser, packte zu und schleuderte den Mann wie einen blauen Sack ins Boot.
Schleunigst ging es davon. Erst auf ruhigerem Wasser konnte man sich den Geretteten näher betrachten. Ein kaffeebrauner Araber, noch hagerer als die Wüstenbewohner gewöhnlich sonst schon sind. Mit geschlossenen Augen lag er regungslos da, schien bewusstlos zu sein. Axel hatte ihn schnell einmal untersucht, hatte außer einer kleinen Hautabschürfung keine Lädierung finden können.
»Sieht auch bald wie so ein in der Kaffeetrommel gerösteter Heiliger aus«, meinte Axel. »Vielleicht bekommen Sie zur Abwechslung zu Ihren indischen Fakiren auch einen arabischen Derwisch.«
»Zwei arabische Derwische sind schon am Bord«, entgegnete der Graf.
»Auch schon? Was für einen Zweck erfüllen denn die? Auch Hellseher?«
»Nur der eine soll ein ausgezeichneter Schlangenbeschwörer sein.«
»Na, dann beschwört der hier vielleicht Geister. Oder das können Sie wohl am allerbesten, wie, Gräfchen? Das können Sie mir übrigens mal vormachen, ich möchte auch schon längst gern einen Geist zitiert haben.«
Der Araber regte sich, schlug die Augen auf, stierte recht wild um sich.
»Moia — Wasser, Wasser!«, stöhnte er.
»Wir sind gleich an Bord. Wie kommst du dort auf den Felsen?«, wollte Axel das Examen schon jetzt beginnen.
»Wasser, Wasser!«, ächzte der Mann nochmals.
Solches war nicht im Boot, wenigstens kein trinkbares, anderes genug. Schon war das Schiff erreicht, der Mann, der ganz kraftlos zu sein schien, wurde mit einer Schlinge an Deck gehievt.
»Diese Kraftlosigkeit kommt mir recht wie Verstellung vor«, flüsterte der Graf Axel zu, als er sich anschickte, das Fallreep zu ersteigen.
»Vorsicht«, warnte Axel, »der Mann, den man zum Spion auserwählt hat, könnte gar feine Ohren haben und mehrere Sprachen beherrschen. Gehen wir nur auf alles ein, und halten Sie dann alle Elemente fern, die uns dabei stören könnten.«
An Deck brach der Mann wieder zusammen.
»Wasser, Wasser — ich verdurste.«
Falls man es doch mit einem Verschmachtenden zu tun hatte, und um überhaupt die eventuell nötige Gegenlist zu wahren, flößte man ihm das Wasser zuerst vorsichtig in ganz kleinen Quantitäten ein.
Der Mann schluckte mit furchtbarer Gier, strafte auch sonst durch sein Aussehen die Behauptung nicht Lüge, den größten Durst zu leiden. Besonders im fieberglühenden Auge lag es.
Doch schnell erholte er sich, konnte vernehmlicher sprechen, verlangte nur immer mehr Wasser, flehte darum.
»Seit wann durstest du?«, fragte Axel.
»Seit gestern schon«, erklang es noch immer röchelnd.
»Seit gestern früh?«
»Gestern Nachmittag ist dort an der Höllenklippe mein Boot zerschellt.«
»Hattest du noch Trinkwasser im Boot?«
»Ja, aber schon seit vierundzwanzig Stunden liege ich dort oben in der Höllenglut — Wasser, mehr Wasser!«
»Na, dann ist es auch noch nicht so weit mit dir, dann stirbst du nicht gleich an Magenkrämpfen. Hier, trink.«
Den vorgehaltenen vollen Eimer leerte der Mann allerdings fast zur Hälfte. Er musste doch von einem furchtbaren Durst geplagt werden. Oder aber... er konnte es mit einem deutschen Studenten aufnehmen, der ja auch ohne jeden Durst seinen Magen bis zum Platzen vollpumpen kann — freilich nimmt er dazu nicht gern Wasser.
Der Mann erholte sich sichtlich, konnte aufstehen und gehen. Er wurde in die Kajüte geführt, auch Kapitän Morphin und Lord Moore blieben bei ihm. Von der Besatzung des schwarzen Schiffes war nur Kapitän Römer zugegen, der sich dabei auch ganz passiv verhielt.
Jetzt stellte sich bei dem Manne auch Hunger ein, er sprach den ihm schnell vorgesetzten Speisen mit größtem Appetit zu, nur dass er dabei Gabel und Messer verschmähte, jeden Bissen zu einem Kloß formte und ihn mit den Fingern der rechten Hand zum weit aufgerissenen Munde führte. Die linke Hand ist des Teufels, auch die Lippen dürfen beim Essen nicht verunreinigt werden.
Während er aß, übernahm der Graf das Verhör, ließ sich erzählen.
Der Mann stammte aus dem arabischen Fischerdorfe Adar, ungefähr sechs Seemeilen westlich von hier entfernt.
Wegen der Gegend waren ja schon die Seekarten und die der Nordküste Afrikas und speziell von Tunis befragt worden. Aber mit solchen Karten war es damals noch schlecht bestellt. Die eigentliche Erforschung der Erde, wo man so fast jeden Punkt der Küste aufgenommen hat, beginnt erst im Anfange des neunzehnten Jahrhunderts, der von Wind und Strömung unabhängige Dampfer hat dazu am meisten beigetragen. Von da an haben die Engländer — es kommen nur Engländer in Betracht, bloß für das östliche Asien noch Russen — eine fabelhafte Tätigkeit entwickelt. Wenn man die Seekarten betrachtet, aller Meere, wie die ganz mit Zahlen bedeckt sind, die Tiefen angebend und die Küstengliederung und alles andere — das ist ausschließlich englische Arbeit, in den letzten hundert Jahren geleistet.
Auf der besten Karte war nur ein Kap angegeben, welches den Namen Ras Adar führte, sonst kein Fischerdorf, aber dann konnte das wohl stimmen.
Abdallah war kein gewöhnlicher Fischer, sondern als Bruder des Scheichs jenes Fischerdorfes ein Unterhäuptling, war nur zum ritterlichen Vergnügen auf den Fischfang gezogen, ganz allein in einem Boote.
An der Küste hatte sich eine Herde Thunfische gezeigt, ganz allein hatte Abdallah eins der Ungeheuer erlegen wollen, das so viel Fleisch wie ein Ochse gibt und auch so schmackhaftes, obwohl der Thun ein echter Fisch ist, nicht wie der ihm sehr ähnliche Delfin ein Seesäugetier.
Es war ihm auch geglückt, nahe an die spielende Herde heranzukommen und eins der größten Tiere zu harpunieren, aber nicht, es so bald vollends zu töten.
In voller Flucht hatte das Ungetüm, größer als ein großer Hai, das Boot nach Westen davongezogen, Abdallah hoffte, das Tier würde sich doch noch verbluten, dachte nicht an ein Kappen der Leine. Immer die Küste entlang war es gegangen, nahe der Brandung, die aber aufzusuchen der Thun sich hütete.
»Und da plötzlich«, dem Erzähler quoll der Bissen im Munde, und sein Zittern harte gar nichts Erkünsteltes an sich, »da erkannte ich, wo ich mich schon befand — vor der tala el schehen vor dem Eingang zur Hölle — und da auch der Fisch auf die Höhle los — es war kein Thun, es war ein Schokin — gerade auf das Höllenloch los — und ehe ich mich noch ganz vom Entsetzen packen ließ, durchschnitt ich das Lanzenseil.
Trotzdem, ich musste verloren sein. Was das Höllenloch einmal anzieht, gibt es nicht wieder frei. Den Thun sah ich denn auch blitzschnell in der Gischt verschwinden. Oder er war eben ein Schokin, der in die Dschehenna gehört. Mit mir aber war Allah. Erst jetzt merkte ich, dass ich gar keine Ruder mehr hatte. Sie mussten durch den Ruck beim Anziehen herausgeschleudert worden sein. Sie hätten mir auch nichts genützt. Schon war mein Boot von der Brandung erfasst worden. aber Allah wollte nicht, dass ein rechtgläubiger Moslem zur Hölle fährt, die Brandung schleuderte mich zurück, unter mir zerbarst das Boot — ich lag gerettet dort oben, wo ihr mich gefunden habt. Und dann schickte Allah mir auch noch euch, zum Beweis, dass die Ungläubigen dem Moslem dienen müssen.«
Es hatte ja alles Hand und Fuß, was der Araber da erzählte, und er sprach ganz wie ein Moslem aus der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts. Noch hundert Jahre früher wurde ein christlicher Fürst, ein Kaiser, vom türkischen Sultan selbst im sonst ganz liebenswürdigsten Briefe nur ›du Hund‹ tituliert.
»Wann hast du denn zuerst unser Schiff gesehen?«
»Erst vorhin. Ihr hörtet mein Rufen sofort.«
»Wie kommt es, dass du uns nicht schon eher gesehen hast?«
»Heute früh habe ich kein Schiff gesehen, und vorhin war ich vor Mattigkeit eingeschlafen.«
Es war dem Manne nichts Gegenteiliges oder Unglaubwürdiges zu beweisen.
»Du sahst den Thunfisch dort in der Höhle verschwinden?«
Die betreffende Wasserhöhle war von hier aus durch ein Bullauge zu sehen.
»Wie ein Blitz.«
»Er flüchtete sich hinein?«
»Nein, er wurde hineingezogen. Oder er war ein Schokin.«
»Was ist das, ein Schokin?«
»Ein Seeteufel, ein Bewohner der Hölle, der sich aber außerhalb derselben nur im Wasser aufhalten kann, weil schon früher die See seine Heimat gewesen ist.«
»Ah, warte, jetzt entsinne ich mich — die ungläubigen Seeleute, die nach ihrem Tode zur Hölle verdammt sind, werden nach eurer Lehre in Schokins verwandelt, nicht wahr?«
»Du sagst es, Effendi.«
»Wie die ungläubigen Wüstenbewohner in Hyänen.«
»Wenn sie Zauberei getrieben haben. So ist es auch mit den Seeleuten, die Zauberer gewesen sind.«
»Die Schokins sind aber doch Haifische.«
»Warum soll einer nicht auch einmal ein Thunfisch werden? Ist das ein besseres Los?«, war die ziemlich naive Gegenfrage.
»Nun, streiten wir uns nicht hierüber. Oder meinst du, es mag auch ein ganz normaler Thunfisch gewesen sein, der durch die Kraft des Strudels in die Höhle gezogen wurde?«
»So ist es, Effendi.«
»Hat denn diese Wasserhöhle solch eine Kraft?«
»Das weißt du noch nicht? Alles, was in den näheren Bereich dieses Zugangs zur Hölle kommt, wird mit unwiderstehlicher Kraft hineingezogen.«
»In die Hölle hinein?«
»Um dort zu bleiben.«
»Wir empfinden nichts von dieser Anziehungskraft.«
»Ihr braucht nur hundert Ellen näher zu kommen, dann werdet ihr es merken.«
Den Mann zu fragen, ob er wisse, dass hier Seeräuber hausten, hatte gar keinen Zweck. Er war doch eben instruiert, erst auszuhorchen, ob sie etwas davon wüssten, weshalb sie sonst hier lägen. Einstweilen sollte er sie vor dieser Wasserhöhle bange machen.
Der Araber hatte seine Mahlzeit beendet, der Kaffee ward ihm gebracht, der im Orient und überhaupt im Süden der Mahlzeit unwiderruflich nachfolgt, und des braunen Mannes Augen leuchteten freudig auf, als er die winzige Mokkaschale sah, die ihm sagte, dass auch hier der Kaffee nach seiner arabischen Art zubereitet wurde, und nicht minder beim Anblick des feingeschnittenen Tabaks, auf dem ein Päckchen Zigarettenpapier lag.
Der Graf nahm dem Steward das silberne Präsentierbrett aus der Hand, um dem Gaste die Ehre zu erweisen, ihn selbst zu bedienen.
»Ah, das duftet köstlich!«, sagte er, als er aus dem niedlichen Kännchen einschenkte, darauf achtend, dass möglichst viel des gepulverten Kaffeesatzes mit in den Eierbecher hineinkam; denn für den Orientalen bildet der staubähnliche Satz, der zuletzt mit dem Finger umgerührt wird, beim Kaffeetrinken die größte Delikatesse.
Unbewusst schmunzelnd nahm der Araber von dem sehr heißen Getränk ein Schlückchen, noch eins — mit einem Male sank er hintenüber, blieb mit geschlossenen Augen regungslos sitzen, fing auch gleich etwas zu schnarchen an.
Der Graf hatte ihm das Tässchen rechtzeitig aus der Hand genommen.
Staunend hatten Lord Moore und Kapitän Morphin diesen ihnen ganz unerklärlichen Vorgang beobachtet, obgleich sie ihn doch selbst wohl schon öfters durchgemacht hatten — ihnen selbst freilich ganz unbewusst.
»Hallo, der Kerl hat wohl etwas in den Kaffee bekommen, dass er so plötzlich eingeschlafen ist?«, flüsterte Morphin.
Aber der Graf gab keine Erklärung.
»Bitte, helfen Sie mir, ihn in mein Laboratorium zu tragen, dass wir nicht erst Matrosen zu rufen brauchen. Ich habe dort einige Manipulationen mit ihm vorzunehmen.«
Mehr sagte der Graf hierüber nicht, Morphin verlangte auch keine weitere Erklärung, er hatte den Schläfer schon unter den Armen gepackt, Axel fasste die Beine, so trugen sie den Mann hinaus, dem vorausgehenden Grafen in sein Laboratorium nach, wo er in einen Lehnstuhl gelegt wurde.

»Signor Axel, nur Sie möchte ich als Beihilfe hier behalten.«
Morphin entfernte sich, ohne ein Wort zu verlieren. Der Graf verriegelte die Tür.
»Sie haben ihn fasziniert?«, fragte Axel.
»Ich will ihn erst faszinieren, wenn auch ich diesen Ausdruck gebrauchen darf, den ich erst von Ihnen habe, während ich früher für diese rätselhafte Kunst noch gar keinen Namen hatte.«
»Nun wohl, jetzt schläft er erst. Sie haben ihm in dem Kaffee ein Schlafmittel beigebracht?«
»Als ich ihm einschenkte, ließ ich gleichzeitig ein Pillchen in die Schale fallen.«
»Alle Wetter, das müssen Sie geschickt gemacht haben! Ich sah gerade scharf hin, merkte nicht das Geringste davon.«
»Zweifeln Sie, dass ich ein geschickter Taschenspieler bin?«, lächelte der Graf.
»Nein, daran habe ich allerdings niemals gezweifelt.«
Hiermit hatte der Graf also ein Zugeständnis gemacht. Aber über seine Goldmacherei und dergleichen hatten die beiden noch kein Wort gesprochen.
»Sie müssen dem Betreffenden erst ein Schlafmittel eingeben, um ihn faszinieren zu können?«, fragte Axel noch, während der Graf den Schläfer besser in dem Stuhle zurechtrückte.
»Schlafen muss er doch.«
»Ja, aber dazu braucht man ihn ja nur fest anzusehen.«
»Wie? Man braucht ihn nur fest anzusehen?«, wiederholte der Graf verwundert.
»Mit dem festen Willensvorsatz, dass er einschlafen soll. Noch schneller gelingt es, wenn man ihn dabei einen glänzenden Gegenstand fixieren lässt.«
Also Axel kannte schon die heute allgemein übliche Methode des Hypnotisierens, von jenem amerikanischen Missionar hatte er sie gelernt, davon wiederum der Graf noch gar nichts wusste, er hörte etwas ihm ganz Neues.
»Ich verstehe nicht«, sagte er. »Doch jetzt muss ich erst diesen Mann abtun. Sie erzählen mir dann davon. Von Ihnen scheint man doch viel lernen zu können, wir werden uns wohl immer mehr gegenseitig ergänzen.«
Die Operation mit dem schlafenden Araber begann. Wir brauchen sie nicht noch einmal zu schildern. Nachdem sein Widerstreben, einen Verrat zu begehen, besiegt worden war, gestand er alles. Freilich musste alles erst durch endlose Fragen aus ihm herausgeholt werden.
Man hatte sich nicht geirrt. Er gehörte mit zu den Höhlenpiraten, spielte eine führende Rolle. Jener Felsvorsprung stand durch einen kleinen, natürlichen Tunnel mit der Höhle in Verbindung, erst vorhin hatte er sich nach langer Beratung dorthin begeben, um den Schiffbrüchigen zu spielen, sich an Bord des fremden Schiffes nehmen zu lassen, den Zweck seines Hierseins auszuspionieren.
Die Piraten waren untereinander so eng verbrüdert, hatten ihr Versteck immer so geheimgehalten, dass sie gar nicht glauben konnten, ein anderer wisse darum. Und doch, warum war denn das große, schwarze Schiff hierher gekommen?
»Seid ihr gläubige Mohammedaner?«
Nein, auch in diesem träumenden Zustande fluchte dieser Araber den Anhängern des falschen Propheten Mohammed und nannte sich mit größtem Stolze einen echten Kaabiten und Dschoramiden.
Wir können uns hier nicht des Längeren auf die arabische Religion vor Mohammeds Zeiten einlassen. Es war die, welche im alten Testament immer geschildert wird, die auch die Israeliten von Zeit zu Zeit annahmen, wenn sie in den Götzendienst ihrer Nachbarn verfielen. Im Allgemeinen war es eine Sonnenanbetung. Die asiatischen Völker semitischen Stammes verehrten sie unter dem Namen Baal, die afrikanischen, mit Ausnahme der Karthager, welche ebenfalls Baal hatten, als Moloch oder Molech. Wenn nun der Moloch als Stier dargestellt wurde und man ihm Menschen opferte, die in seinem ehernen Leibe lebendig verbrannt wurden, so hatte das seinen gewissen Grund. Das Rind ist der hauptsächlichste Reichtum der afrikanischen Völkerstämme, und ohne Regenperioden versengt die Sonne alles mit ihrer Hitze, in Afrika mehr als in Asien, mit Ausnahme im asiatischen Arabien, das ja überhaupt einen ganz afrikanischen Wüstencharakter hat, diese Grenzen sind doch nur von Geografen gezogen, und dementsprechend huldigten die Bewohner des eigentlichen Arabiens auch nicht dem ziemlich unschuldigen Baaldienst, bei dessen Festen nur Jungfrauen der Menge preisgegeben wurden, sondern dem mörderischen Moloch, da wurden die Jungfrauen und Kinder gleich verbrannt.
Dann verehrten die Araber und ihre Nachbarn noch die Kaaba. Das war ursprünglich ein ummauertes Viereck, in dem der erste Mensch geschaffen worden war, von ihnen ebenfalls Adam genannt. Hierzu kam später ein großer schwarzer Stein, durch einen Engel vom Himmel gebracht, der diesen heiligen Ort näher bezeichnen sollte. Dieser schwarze Stein ist die heutige Kaaba, der ummauerte Raum Mekka, zur ganzen Stadt angewachsen. Mohammed hat wohlweislich die Kaaba als das größte Heiligtum mit in seine Religion aufgenommen. Der arabische Stamm, der die Kaaba und ganz Mekka zu behüten hatte, war der der Dschoramiden. Sie wurden besiegt, aus Mekka vertrieben. Daher nennen sich noch heute alle die Araber und sonstigen Orientalen, welche nicht an Mohammeds Prophetenschaft glauben, Dschoramiden oder auch Kaabiten.
Einige Fragen des Grafen zeigten, dass er hierin ganz genau bewandert war.
»Dient ihr dem Baal?«
»Dem Baal?«, wurde verwundert wiederholt.
»Dem Beltrak, meine ich.«
Ja, diesen Namen kannte der Araber, gab aber gleich stolz zur Antwort:
»Nein, dem allein allmächtigen Molek.«
Der Graf fragte weiter nach der Hauptsache und erhielt Antwort.
Es waren hundertzweiundfünfzig Piraten, die sich gegenwärtig hier befanden. Diese Zahl konnte wechseln.
Das Dorf Adar gab es wirklich, fünf Seemeilen östlich von hier entfernt. Dort spielten sich die Piraten als ehrsame Fischer auf, es tat ihrer Religion auch nichts, sich für die gläubigsten Mohammedaner auszugeben. Dort hatten sie ferner ihre Frauen und Kinder, während sich nur die Vornehmeren, die Anführer, Harems hielten.
»Auch Barbarossa Maladenne?«
»Weshalb heißt der denn Maladenne, wenn er nicht die Weiber hasste?«, war die für einen Scheich stolze Antwort. »Und eben deshalb seine unwiderstehliche Kraft, daher ist er auch unbesiegbar, weil er sich von keinem Weibe besiegen lässt.«
»Haltet ihr Sklaven?«
»Nein.«
»Ihr macht aber doch Gefangene.«
Nein, niemals. Diese andersgläubigen Araber wollten nichts von Sklaven wissen, bei einem Beutezug, beim Nehmen eines Schiffes, wurde regelmäßig alles niedergemacht, auch was sich wehrlos ergab.
»Selbst die Weiber?«
»Die Weiber erst recht.«
»Ihr habt aber doch von der französischen Fregatte die Prinzessin mitgenommen.«
»Das war einmal eine Ausnahme, Barbarossa bestimmte es so.«
»Weshalb diese Ausnahme?«
»Unser Scheich hielt dieses schöne weiße Weib für würdig, dem Molek geopfert zu werden.«
Hoch horchten die beiden auf!
»Die Gefangene soll dem Molek geopfert werden?«
»Ja «
»Verbrannt werden?«
»Ja.«
»Wann?«
»Sobald unser nächster Beutezug glücklich ausgefallen ist.«
»Was für ein Beutezug?«
Abdallah erzählte, musste aber immer durch Fragen unterstützt werden.
Die nächste Hafenstadt westlich von hier war Bona, fünfundzwanzig geografische Meilen entfernt. Wie in den meisten Hafenstädten an der nordafrikanischen Küste, so hatten diese ganz besonderen Piraten, indem sie nämlich einer ganz anderen Religion angehörten, auch ihre Spione, mit denen sie durch Brieftauben korrespondierten. Die Brieftaubenpost haben wir Europäer erst afrikanischen Völkerstämmen, zum Teil noch ganz wilden, nachgeahmt.
Bona ist zwar nicht groß, aber als Ausgangspunkt von Karawanen, die nach dem Inneren gehen, von ziemlicher Bedeutung. Es wird oder wurde Algier deshalb vorgezogen, weil hier die hohen Abgaben in Wegfall kommen.
Heute Morgen nun hatten die Piraten aus Bona durch Brieftaubenpost die Nachricht bekommen, dass dort ein großes französisches Schiff angekommen war, mit reichen Warenvorräten, besonders Kleidungsstoffe, die durch eine Karawane ins Innere befördert werden sollten. Ehe die Karawane aber zustande kam, würde noch einige Zeit vergehen.
Sofort war es bei den Piraten beschlossene Sache, dieses Schiff zu erbeuten, und es war nicht das erste Mal, dass sie ein Fahrzeug mitten in einem Hafen angriffen und nahmen, was natürlich immer bei Nacht geschehen musste.
Bis nach Bona hatten sie auch beim widrigsten Winde nur einen Tag und eine Nacht zu rudern, bei Segelwind ging es noch viel schneller, es war aber besser, wenn sie sich schon am Nachmittage dort in der Nähe befanden, sich bis zum Anbruch der Nacht in einem Schlupfwinkel der gebirgigen Küste versteckend.
So hatten sie schon heute Mittag mit allen ihren Galeeren aufbrechen wollen. Da war das schwarze Schiff, von einer kleinen Jacht gefolgt, gesichtet worden. Und dieses schwarze Schiff hatte sich gerade vor ihrer Wasserhöhle vor Anker gelegt!
Was sollte das bedeuten? Hatte man Kenntnis von dem versteckten Räubernest bekommen?
So war Abdallah, ein Unterhäuptling, abgeschickt worden, um Erkundigungen einzuziehen, hatte sich als vorgeblicher Schiffbrüchiger an Bord schmuggeln sollen, was ihm denn auch geglückt war.
»Und wenn das schwarze Schiff nun hier liegen bleibt?«
»Dann muss es heute Nacht genommen werden.«
»Könnt ihr es nicht beschießen?«
»Wir werden uns hüten.«
»Weshalb?«
»Wenn unsere Kanonen es nicht sofort zum Sinken bringen, so geht es davon, der Wind ist günstig dazu, und wir haben uns für immer verraten.«
Der Mann hatte ganz recht,
»Da greift ihr es lieber heute Nacht mit dem Enterhaken an?«
»Unbedingt.«
»Weshalb unbedingt?«
»Weil wir ja sonst nicht aus der Höhle heraus können, ohne dass ihr uns seht.«
»In der Nacht, und es ist noch immer Neumond.«
»Ihr könntet aber noch näher herankommen, und da greifen wir euch doch lieber gleich an, da machen wir ja doppelte Beute.«
»Wie erfolgt der nächtliche Angriff?«
»Wie gewöhnlich. Lautlos in den Booten heranschleichen und dann unter einem Höllenlärm über die Bordwand schwingen, mit Pistole, Dolch und Säbel arbeiten.«
»Wenn wir aber noch rechtzeitig die Anker lichten, dann lasst ihr uns gehen?«
»Warum nicht? Doch es kommt darauf an, was ich von euch zu berichten weiß. Wisst ihr hier von unserem Versteck, so müsst ihr vernichtet werden.«
Der Graf erkundigte sich über die Felsenburg.
Ja, sie lag dort oben direkt über der Wasserhöhle. Die Burg wurde seit viel, viel längerer Zeit benutzt als die Höhle. Es war Tatsache, dass in dieser Burg alle die erbeuteten Schätze der beiden Barbarossas aus dem 16. Jahrhundert angehäuft waren, hierher hatte sie jener Muley gebracht. Nach dieses Arabers Ansicht war — selbstverständlich — sein Scheich wirklich ein echter Abkömmling jener furchtbaren Piratenbrüder und daher ihr rechtmäßiger Erbe. Wie er sonst dazu gekommen war, wie er die seit Jahrhunderten verlassene und vergessene Felsenburg wiedergefunden hatte, das wusste Abdallah wohl selbst nicht, oder der Graf hielt sich mit solchen nebensächlichen Fragen, die mehr ein historisches Interesse gehabt hätten, gar nicht auf.
Dass sich unter dieser Felsenburg eine Wassergrotte befand, hatte man natürlich schon immer gewusst, die ganze Felsenküste war ja so ausgewaschen, aber wohl erst Maladenne hatte zufällig entdeckt, dass die eine trotz der furchtbarsten Brandung eine ganz glatte Einfahrt erlaubte. Eben ein Naturphänomen, nach Ansichten dieser Araber ein Geschenk ihrer Götter.
Sofort war man darangegangen, eine vertikale Verbindung zwischen Burg und Höhle herzustellen. Von der Burg aus war schon, unbewusst, gewaltig vorgearbeitet worden, indem schon immer dort oben ein Brunnen existiert hatte, aus dem man das Wasser mehr als tausend Meter tief empor holte, die Quelle lag noch weit unter dem Meeresboden. Dieser schon vorhandene Brunnenschacht brauchte nur noch erweitert, mit Stufen versehen zu werden, um ihn benutzen zu können. Das war in den letzten vier Jahren geschehen, so lange existierte diese Piratenkolonie erst, gleichzeitig hatte man auch schon immer von der Höhle aus entgegengearbeitet, in wenigen Stunden würde die letzte Scheidewand fallen.
»Sie haben also recht gesehen«, flüsterte Axel, als der Graf den Schlafenden so weit ausgeholt hatte.
»Gibt es sonst noch etwas Wichtiges zu fragen?«
»Wie viele Männer an dem Beutezuge nach Bona teilnehmen, wie viele zurückbleiben.«
Der Graf stellte die betreffenden Fragen. Zwei Drittel, also hundert, wären schon zur Bedienung der Galeeren nötig. Wenn möglich, blieben nur zwanzig Mann zurück, meist sogar Verwundete oder sonst zum Kampfe Unfähige.
Weiter erkundigte sich der Graf, ob ein Aufstieg zur Burg von außen möglich sei, auf dem Wege, den auch die Piraten bisher immer benutzt hätten.
Nein, wenigstens keine Erstürmung. Ein einzelner Mann genüge, um ganze Bataillone von dem Felsengrat hinabzustürzen.
»Und was für Vorsichtsmaßregeln sind getroffen, um ein Eindringen in die Burg von der Wasserhöhle aus unmöglich zu machen?«
Von solchen Vorsichtsmaßregeln wusste Abdallah noch gar nichts. Als er vorhin gegangen. war die Wand ja noch nicht durchbrochen gewesen, man hatte deswegen noch gar keine Beratung abgehalten.
»Ich glaube, jetzt wissen wir alles«, meinte der Graf.
»Ich denke auch.«
»Noch über eines möchte ich mich vergewissern, Abdallah«, wandte sich der Graf nochmals an den Schläfer, »wenn du nun ausgekundschaftet hast, dass wir hier nur zufällig oder aus einem ganz harmlosen Grunde vor Anker gegangen sind, was tust du dann?«
»Dann gebe ich meinen Genossen ein Zeichen.«
»Was für ein Zeichen?«
»Ich werde an Deck zu Allah beten, ihm für meine Rettung danken.«
»Das soll also heißen: Die Fremden wissen nichts, dass hier Piraten ihr Versteck haben.«
»Ja.«
»Und wenn du glaubst, wir wissen von diesen Piraten?«
»So bete ich ebenfalls, verbeuge mich aber nicht nur dreimal, sondern fünfmal.«
»Und wenn wir nun dich nicht beten und verbeugen lassen?«
»Komme ich nicht bald an Deck, so wissen meine Genossen schon, wie es mit mir steht, dass ich wahrscheinlich gefangengehalten werde.«
»Würdest du dann nicht zu fliehen versuchen?«
»Ja, ich würde wahrscheinlich über Bord springen und nach der Höhle schwimmen, aber nur, wenn ihr irgendwie schon erfahren habt, dass man die Höhle so leicht passieren kann.«
»Und im anderen Falle? Wie kommst du dann zurück?«
»Ich werde euch bitten, mich in meine Heimat zu bringen.«
»Nach dem Dorfe Adar?«
»Ja.«
»Und wenn wir das nicht gleich tun, hier liegen bleiben?«
»Desto besser.«
»Dann beteiligst du dich an dem nächtlichen Überfall, nur dass du gleich schon bei uns an Deck bist.«
»So ist es.«
»Alles ganz fein ausgesponnen«, wandte sich der Graf an seinen Freund, wie er Axel jetzt wohl schon nennen durfte. »Jetzt können wir ihn wohl wecken, und — und — es — es — wird — auch bald Zeit...«
Immer mühsamer hatte der Graf gesprochen, und Axel erschrak, als er sein Gesicht erblickte, dass jener ihm abgekehrt gehalten hatte.
Dasselbe war also während der somnambulen Sitzung leichenblass gewesen, auch kurz hinterher noch, dann hatte es wieder seine gesunde Farbe angenommen — und jetzt sah es ganz grün aus. Außerdem wankte der Graf auch plötzlich, taumelte, griff mit den Händen in die Luft.
»Um Gott, Graf, was ist Ihnen!!«, rief Axel, hinspringend, um den Taumelnden zu halten.
Aber mit einem Ruck richtete sich der Graf empor.
»Nichts, nichts, es ist schon wieder vorbei...«
»Sie sehen ja ganz grün im Gesicht aus!«
»So, tue ich?«, lächelte der Graf mühsam. »Das macht das Schierlingsgift — oder wohl mehr noch das Gegenmittel. Schnell wirkende Gegenmittel sind manchmal schädlicher als das Gift selbst. Bitte, fassen Sie mit an, wir beide wollen selbst den Mann...«
»Ich will einen Matrosen rufen, Sie sind ja gar nicht imstande...«
»Was, ich nicht imstande. den Mann mitzutragen? Ha, der Graf von Saint-Germain, der sich die ganze Welt zu Füßen legen wollte, wird sich doch nicht von so einem bisschen Schierlingssaft niederwerfen lassen!«
Die grüne Farbe wich denn auch schnell wieder aus dem Gesicht, und der Graf, der eben noch hatte zu Boden sinken wollen, brachte es fertig, kraftvoll mit anzufassen und den Mann in die Kajüte zurück zu tragen.
Hier warteten noch die drei anderen. Besonders der Lord und Kapitän Morphin wunderten sich wiederum nicht wenig, als der Araber noch immer schlafend hereingetragen und von dem Grafen auf der Kajütenbank in seine frühere Sitzstellung zurückgebracht wurde. So ausführlich das Examen auch gewesen war, hatte es doch kaum eine Viertelstunde gewährt.
»Wo ist der Kaffee geblieben?«, fragte der Graf.
»Ich habe dafür gesorgt, dass frischer vorhanden ist«, entgegnete der schwarze Kapitän, der wohl wusste, was hier geschehen war und wie das gehandhabt wurde.
»Ah, das erspart schon wieder einige Minuten. Ist das Tässchen auch gut ausgespült worden, dass nichts passieren kann?«
»Ich selbst habe den Inhalt über Bord geschüttet und die Schale gereinigt.«
Schon brachte der Steward ein neues Service mit einem dampfenden Kännchen, der Graf schenkte ein, gab dem Schlafenden das Tässchen in die Hand.
Alles, was sonst nötig war, hatte er dem Hypnotisierten natürlich schon suggeriert, wie er erinnerungslos erwachen solle und so weiter, hatte ihm auch zwei Stichworte gegeben. Wir haben ja nur die Hauptsache geschildert.
Dann sorgte der Graf noch dafür, dass die anderen wieder jene Stellung einnahmen, wie sie vorhin gestanden hatten, wobei sich zeigte, wie genau er sich das alles gemerkt hatte.
»Arkandola!«, sagte er hierauf mit scharfer Betonung.
Der Araber schlug die Augen aus und nahm von dem heißen Gebräu ein drittes Schlückchen, seine braunen Gesichtszüge drückten sein Wohlbehagen aus, er schmunzelte genau so, wie er vor einer Viertelstunde geschmunzelt hatte.
»Schmeckt er?«
»Besser kann ihn nicht der Padischah in Stambul trinken — schade, dass ihr Ungläubige seid.«
Zuletzt hatte der Mann also vor der Anziehungskraft des Wasserloches gewarnt, der Graf wollte die Sache jetzt möglichst abkürzen.
»Nun, wir wollten sowieso gerade die Anker lichten und zurücksegeln.«
»Weshalb seid ihr erst in diese gefährliche Nähe gekommen?«
»Weißt du, was ein Meridian ist?«
Ja, das wusste der Fischer, gerade weil es ein arabischer war. Die Erdberechnung ist erst von Arabern eingeleitet worden, und dann gehört das auch zum Fach.
»Ihr macht eine Meridianmessung?«
»Wir berechnen den vierzigsten Meridian.«
»Meridian, ja, ja, ich weiß, ohne diese Meridiane findet sich kein Schiff zurecht. Und dieser Meridian trifft genau den Zugang zur Hölle?«
»Ziemlich genau.«
»Das ist merkwürdig.«
»Ein Zufall.«
»Und ihr seid jetzt fertig damit?«
»Wir segeln sofort nach Athen zurück.«
»Kommt nicht wieder?«
»Haben keinen Grund dazu.«
Lange genug hatten die Offiziere ja auch nach jener Felswand mit Instrumenten gespäht und geografische Ortsbestimmungen gemacht.
»Aber wie soll ich nach Adar zurückkommen?«, fragte der Araber nur noch.
»Nun, wenn dein Dorf nur vier Meilen von hier entfernt ist, so bringen wir dich gleich selbst hin, hier auf diesem Schiffe, der Nordwind ist ja günstig dazu, wir brauchen nicht erst ein Segelboot deshalb besonders abzuschicken.«
»Wie soll ich euch für eure Gute danken! Ich werde euch täglich in mein Gebet einschließen. Erlaube, dass ich jetzt, nachdem ich gesättigt bin, erst dem meinen Dank zolle, dem er zuerst gebührt.«
»Bitte, wir werden dich nicht dabei stören.«
Abdallah ging an Deck, zog seinen blauen Kaftan aus, ihn als Gebetsteppich benutzend, kniete, nach Mekka gewandt, umständlich nieder und verrichtete sein stummes Gebet, zum Schluss drei Verbeugungen nach Osten machend.
Er hatte seinen Kameraden das Zeichen gegeben, dass dieses Schiff ein ganz harmloses sei, nichts von den Piraten wisse, nur zufällig hierher gekommen war.
»Auf, Kapitän, die Anker hoch! Ostwärts die Küste entlang, Abdallah wird ja am besten den Kurs angeben können.«
Es geschah, das schwarze Schiff ging mit dem Nordwind nach Osten, die Jacht folgte.
Abdallah gab sich dem Genusse des feinen Tabaks hin, beobachtete die Arbeiten der Matrosen, fand selbst wenig Beachtung, und nach einer halben Stunde schon tauchte das aus elenden Hütten bestehende Fischerdörfchen auf, an einer Bucht gelegen.
Ein Boot wurde ausgesetzt, Abdallah noch mit Tabak und einem Säckchen Kaffee beschenkt, würdevoll bedankte er sich nochmals, dann wurde er an Land gebracht.
Als das Boot zurück war, setzte das schwarze Schiff seinen Weg nach Osten fort, dabei aber etwas mehr gegen den Wind angehend.
Der Abend hatte völlige Windstille gebracht. Finstere Nacht herrschte, man musste sehr nahe sein, um in dem schwachen Sternenschein das schwarze Schiff zu erkennen, das mit bedeutender Schnelligkeit dem Süden zustrebte. Kein Lichtchen verriet seine Anwesenheit, jeder erleuchtete Raum im Innern war hermetisch verschlossen.
Die Offiziere hatten nach den Sternen eine geografische Ortsbestimmung gemacht, die aufgeschriebenen Zahlen waren im Kartenhaus erst auszurechnen. Als sie es betraten, war es finster, erst nach geschlossener Tür flammte das rätselhafte, das elektrische Licht auf, erlosch noch vor dem Hinaustreten.
»Nun?«, wandte sich Axel an den wiedererscheinenden Offizier.
»Keine zehn Meilen mehr ab, direkt nördlich.«
»Welche Zeit ist es?«
»Gleich Mitternacht.«
»Und soeben haben dreizehn Galeeren mit hundertsechsundzwanzig Mann das Teufelsloch verlassen, rudern nach Westen«, sagte da eine andere Stimme.
Sie gehörte dem Grafen, der die Kommandobrücke betrat, sich seit sechs Stunden zum ersten Male überhaupt wieder sehen ließ. So lange hatte er sich in seinem Laboratorium oder in sonst einem der ihm zur Verfügung gestellten Räume eingeschlossen gehabt.
»Herr Graf, Sie sehen schrecklich leidend aus«, flüsterte Axel.
»Können Sie das in dem Sternenlichte erkennen? Sie scheinen so gute Augen zu haben wie ich. Ja, es hat mich etwas angegriffen.«
»Und Sie haben sich schon wieder in diesen Zustand versetzt?«
»O nein, da müsste ich doch einen haben, der mich fragen kann.«
»Woher wissen Sie sonst, dass die Piraten jetzt die Höhle verlassen?«
»Ich habe mich in Starrkrampf versetzt.«
»Und das strengt Sie nicht so an?«
»Durchaus nicht, das erquickt mich sogar wie ein gesunder Schlaf.«
»In diesem Zustande müssen Sie aber doch jemand haben, mit dessen Augen Sie beobachten können, den Sie auch schon persönlich kennen.«
»Nun, habe ich nicht solch eine Person?«
»Welche? Die Prinzess kann doch nicht in Betracht kommen.«
»Abdallah.«
»Ah richtig! Sie sehen, wie schwer ich mich in diese geheimnisvolle Wissenschaft hineinfinden kann. Dann bitte ich um Beantwortung einer anderen Frage. Es wird doch unten ganz mächtig gefeuert. Wie kommt es, dass nichts von Rauch und Funken zu merken ist? Wo ist überhaupt der Schornstein?«
»Dort hinten. Durch eine Erfindung des genialen Dalton wird der Rauch vollkommen absorbiert.«
Es wurde Zeit, sich zu rüsten. Der Kriegsplan war schon längst fertig.
Die Jacht wurde jetzt nicht geschleppt, wohl aber befanden sich an Bord des schwarzen Schiffes Kapitän Morphin mit seinen fünf Matrosen, die nicht hatten zurückbleiben wollen.
Die Jacht war einstweilen von Matrosen dieses Schiffes bemannt worden, war bei der Windstille liegen geblieben. Nach Ausmachung einer geografischen Bestimmung konnte sie ja überall auf dem Meere wieder aufgefunden werden.
Unausgesetzt spähten die Offiziere durch das Nachtfernrohr nach Süden. Die Benutzung des Fernrohres auch in finsterster Nacht ist dadurch möglich, dass durch eine Spiegelvorrichtung ein Lichtstrahl durch das Rohr geschickt wird, der aber nicht als Blendstrahl wirkt. Dazu genügt ein an sich so schwaches Licht, das hier aus einer Wandöffnung des Kartenhauses kam, dass es auf keine zehn Meter weit erblickt wurde.
»Dort taucht das Gebirge auf!«
Noch eine geografische Berechnung nach den Sternen, noch etwas den Kurs geändert, und das Schiff stoppte, lag still.
Kaum war noch ein leises Kommando nötig. Drei schwarze Boote wurden ausgesetzt, achtzig schwarze Gestalten verteilten sich in sie.
Im ersten Boote befanden sich der Graf, Axel, Lord Moore und Kapitän Morphin mit seinen fünf Matrosen, die auch mit solchen schwärzen Trikotkostümen versehen worden waren. Sie hatten es sich nicht nehmen lassen, die ersten beim Angriff, beim Kampfe, der der Befreiung der Prinzess galt, sein zu wollen.
Außerdem befand sich in diesem ersten Boote noch ein Ingenieur mit einigen Leuten, die hauptsächlich mit einem großen Kasten zu tun hatten, der vorn im Boot aufgebaut war. Die übrige Besatzung des Bootes hatte nur zu rudern, vorläufig wenigstens.
Mit umwickelten Riemen ging es vorwärts. Bald hörte man die Brandung brausen, und da sah man auch schon die Höhlen in phosphorischem Scheine leuchten.
Das Wasser des Mittelmeeres phosphoresziert sehr wenig, für gewöhnlich ist gar nichts davon zu merken. Aber jene selbstleuchtenden Infusorien enthält es ja doch, und deren Leuchtkraft ist davon abhängig, dass das Wasser stark mit Luft gemischt wird, mit Sauerstoff, und dazu ist ja in solch einer Höhle, die mit ständig sich erneuernder Gischt erfüllt ist, die günstigste Bedingung gegeben.
Wie riesenhafte Mondscheiben traten die fast zirkelrunden Höhlen aus der schwarzen Finsternis hervor, zwar kein Licht verbreitend, wohl aber deutlich erkennen lassend, wie furchtbar es in ihrem Innern kochte und spritzte.
Einige Unregelmäßigkeiten am Umfassungsring hatten die runden Scheiben ja aber doch, und die am Tage Beobachtenden hatten sich das alles wohl gemerkt, außerdem kam nur die allergrößte Grotte in Betracht.
In wenigen Minuten war das erste Boot dicht davor, jetzt kam auch noch das donnernde Brüllen der Brandung hinzu. Und in dieses Loch, ein wirkliches Höllenloch, sollte ein von Menschenhänden erbautes Fahrzeug hinein?
Der im Boote befindliche Ingenieur machte eine Bewegung, als wolle er noch im letzten Augenblick zur Umkehr auffordern — Axel packte seine Schulter und deutete gebieterisch auf den Kastenapparat — »Das ist deine Pflicht, um alles andere hast du dich nicht zu kümmern!«, sollte diese Handbewegung sagen, eine menschliche Stimme war ja gar nicht mehr zu vernehmen — und da schoss das Boot auch schon in den Strudel hinein.
Alles Wasser, nichts als Wasser, von allen Seiten kommend, nicht zum wenigsten von oben, man befand sich wie unter einer Dusche, und nun unter was für einer! — aber merkwürdig war, dass das Boot selbst gar keine Erschütterung erlitt — und da war man auch schon wieder heraus aus dieser Dusche, man befand sich in einer trockenen, ruhigen, stockfinsteren Nacht, in der nur zwei matte Lämpchen leuchteten, und dann einige gellende Schreie...
Und da plötzlich wurde die zweite Halle von Tageshelligkeit erfüllt, durch mehrere intensiv weiße Strahlen, die unter leisem Knattern aus dem im Boot aufgebauten Kasten hervorkamen, ein elektrischer Scheinwerfer, unserer heutigen Einrichtung kaum nachstehend, gleich mehrere.
Entsetztes Schreien, fliehende Männergestalten, meist in wogende Gewänder gehüllt — der Graf, der zuvorderst im Boote stand, sah nur, dass das Boot schon an der Galerie, die um das ganze Wasserbassin lief, beigelegt hatte, er war ans Ufer gesprungen, mit einem gezückten Degen in der Hand eilte er den Fliehenden nach, denn wenn irgend möglich, sollten Gewehrschüsse vermieden werden — aber er wurde noch von Axel überholt, dessen schwertähnlicher Hirschfänger durchbohrte einen der Flüchtlinge, einen zweiten, dann befand er sich in dem Tunnel, nach den alle die Fliehenden gestrebt hatten, in diesem stieß er einen dritten Piraten nieder, einen sehr alten Mann, einen hilflosen Greis, der sich nicht mehr zur Wehr gesetzt hätte, aber wer sah sich hier den Feind an, und dann jagte Axel, immer vier und fünf Stufen auf einmal nehmend, die Steintreppe hinauf, die auf jedem Absatz durch Lampen genügend erleuchtet war.
Es handelte sich also darum, jeden Flüchtling, der den nun schon fertig durchbrochenen Tunnel benutzt hatte und nach oben in die Felsenburg wollte, einzuholen und unschädlich zu machen. Die Wächter oben in der Felsenburg durften nicht erfahren, was hier unten passiert war, auch sie mussten überrumpelt werden. Das war der ganz selbstverständliche Kriegsplan gewesen. Deshalb auch kein Schuss. Gelang es nun noch, auch den ins Freie führenden Ausgang der Burg rechtzeitig zu besetzen, ehe jemand hinausgekommen war, so war das Meisterstück vollbracht. Dass noch rechtzeitig eine Brieftaube abgelassen wurde, mit einer warnenden Nachricht, nach jedem Dorfe oder sonst wohin, das war nicht zu fürchten; in der Nacht fliegt keine Taube ab.
Kurz, es handelte sich darum, auch oben die Burg in die Gewalt zu bekommen, ehe irgend etwas zur Verteidigung oder zur Warnung der außerhalb befindlichen Piraten unternommen werden konnte.
Deshalb also sprang Axel wie ein auf der Flucht vor dem Tode befindlicher Steinbock die Treppe hinauf. Wir sagen: wie ein Steinbock, weil dieser eine Gämse an Sprungkraft noch weit übertreffen soll, und es war wirklich fabelhaft, was dieser Mann, der doch eigentlich auf dem Rücken des Pferdes zu Hause war, in seinen Kniegelenken für eine Sprungfähigkeit besaß. Das musste alles federnder Stahl sein.
Aber er durfte sich über die Länge des Treppenaufstieges nicht täuschen. Die Felswand war hier mindestens tausend Meter hoch, und die Burg lag doch ganz oben!
Tausend Meter! Wenn auf den Meter vier Stufen kamen, so waren das viertausend Stufen. Der Graf hatte sie im Geiste zurückgelegt, nur im hellsehenden Traume, da freilich hatte er es sehr bequem gehabt, war dabei nicht außer Atem gekommen.
Dieser Mann hier aber, Axel, war auf seine ganz reellen Beine und Lungen angewiesen. Und wenn er nun in jeder Sekunde vier Stufen zurücklegte, so brauchte er zur Überwindung der ganzen Treppenhöhe doch mindestens eine Viertelstunde. Und eine Viertelstunde lang ununterbrochen so eine steile Treppe hinaufspringen, das will doch gemacht sein!
Wir geben die Gedanken wieder, die Axel selbst hatte, als er so vier bis fünf Stufen mit jedem Sprunge nahm.
Es gibt einen bekannten Witz. Der kleine Moritz soll in einem Schulaufsatz die Gedanken schildern, die er beim Besteigen eines hohen Berges in der Morgenröte hat. Und Moritzchen schreibt einfach hin: Ach, wenn ich doch schon droben wäre!
So dachte auch Axel. Schon nach der ersten Minute hätte er sich ja Zeit lassen können. Denn dass ihm noch ein Flüchtling voraus sein könne, das war jetzt ausgeschlossen. Wen er jetzt noch einholte, der hatte unten die Höhle schon vorher verlassen, wusste gar nichts davon was sich da unten ereignet hatte, so toll hatten die überrumpelten Piraten auch gar nicht geschrien, und hatte er es dennoch gehört, so würde er wohl erst zurückkehren, um sich zu überzeugen, weshalb denn seine Kameraden so schrien.
Aber dieser Depeschenreiter zu Fuß war nicht nur ein ganz prosaischer Charakter, sondern auch ein ganz gewissenhafter. Also er setzte seine Springtour mit der größten Schnelligkeit fort.
Aber eben viertausend Stufen! Und dieser Mann war doch schließlich auch ein Mensch.
»Ich fühlte, wie meine Kniegelenke zu brechen und meine Lungen zu platzen drohten, aber ich, ich wollte es nicht, und ich sprang und sprang immer weiter!«
So hielt er es wirklich eine Viertelstunde aus. Da eröffnete sich vor ihm ein längerer Gang, ebenfalls durch Lampen erleuchtet, wie es die ganze, endlose Treppe gewesen war. Sonst hätte Axel eine der brennenden Lampen mitnehmen müssen.
Und in diesem Gange, eben als er um die Ecke bog, sah er zwei Araber, sich entgegenkommend.
»Inschallah!!«, riefen die beiden gleichzeitig, als sie den schwarzen Mann dahergestürmt kommen sahen, den blanken Stahl in der Faust; weiter riefen sie nichts, und ob sie nun an ein Gespenst glaubten oder nicht, jedenfalls ergriffen sie nicht die Flucht, sondern setzten sich zur Wehr, der eine brachte unter seinem braunen Burnus einen krummen Säbel zum Vorschein, um ihn gegen den irdischen Menschen oder auf das höllische Gespenst zu schwingen, der andere riss einen langen Dolch aus dem Gürtel.
Da hatte Axel sie schon erreicht. Den Säbelhieb parierte sein Hirschfänger, im nächsten Moment hatte sich dieser dem Araber in die Brust gebohrt, mit einem Röcheln brach der Mann zusammen.
Das wäre aber bald die letzte Tat gewesen, die Axel verrichtete. Jetzt, da er einmal stillstand, trat bei ihm die Reaktion ein, er sollte nicht ungestraft Menschenunmögliches geleistet haben.
Seine Knie trugen ihn plötzlich nicht mehr, er selbst brach zusammen, vermochte auch seinen Hirschfänger nicht mehr aus der Brust des Gegners zu ziehen.
Sein Schicksal war besiegelt. Der andere hatte schnell erkannt, einen irdischen Menschen vor sich zu haben, und er hatte ja auch schon den Dolch gezückt, um es selbst mit einem Geiste aufzunehmen.
Der in dem Lampenlicht blitzende Stahl zuckte nach Axels Herzen — da aber zuckte von hinten über Axels Schultern hinweg ein anderer Blitz, ein anderer Stahl bohrte sich in des Arabers eigenes Herz, er stürzte und blieb liegen, ohne einen Laut von sich gegeben zu haben.
Neben dem auf den Knien liegenden Axel stand der Graf von Saint-Germain, den blutigen Degen in der feinen Hand, in dem schwarzen Trikotanzug sah sein Gesicht vollends blass wie der Tod aus.
Also er war dem menschlichen Gamsbock dicht aus dem Fuße gefolgt, wovon aber Axel keine Ahnung gehabt hatte. Und während Axel vor Überanstrengung, an allen Gliedern zitternd, mühsam nach Luft rang, mit furchtbar arbeitender Brust, stand der blasse Graf gelassen und eisern wie in der Mensur auf dem Fechtboden da.
Ja, Axel staunte, denn es kam ihm zum Bewusstsein, was für ein rätselhaftes Wunder hier vorlag, dieser Graf war eben selbst ein rätselhaftes Wunder; aber dieses Staunen währte nur einen Moment, jetzt gab es anderes zu tun.
»Weiter, weiter, in die Burg hinein, und den Hauptausgang finden, ihn besetzen, ich komme nach!!«
Der Graf stürmte denn auch sofort weiter, und gleich darauf erhob sich auch Axel wieder, folgte ihm nach.
Wir wollen nicht zu ausführlich werden. Fünf Minuten später drangen auch die Leute von der Jacht, die zuerst auf die Galerie gesprungen waren, in die eigentliche Burg ein, an der Spitze der greise Kapitän, der jetzt sicher keine Gicht mehr hatte, hinter ihm Lord Moore. Später folgten noch die Besatzungen der anderen Boote.
Sie hatten gar nichts mehr zu tun. Was den beiden in den Weg gekommen, war niedergemacht worden, einer der Piraten hatte schon gestanden, dass es nur einen einzigen Ausgang gab, der auf der anderen, auf der Langseite hinab, in die Tiefe führte, noch niemand hatte ihn benutzt. Was also noch lebte, musste sich auch noch in der Burg befinden, und schnell ward dafür gesorgt, dass auch nachträglich niemand fliehen konnte.
»Wo befindet sich die gefangene Prinzessin, sprich!«, donnerte Axel einen jungen Araber an, ihm die Spitze seines Hirschfängers auf die Brust setzend.
Der Jüngling war kein besonderer Held, und diese Überrumpelung hatte überhaupt alles niedergebrochen.
»Wo ist das blaue Gemach? Führe mich hin!«
Es geschah. In dem luxuriösen Zimmer erwartete Axel ein Anblick, eine Erkenntnis, woran er auch nicht gedacht hatte. Wenn dieser Kampf nur der Befreiung der entführten Prinzess gegolten hatte, so war er umsonst gewesen.
Der Graf hatte die Gesuchte schon eher gefunden, befand sich bereits bei ihr. Sie lag auf einem Schlafdiwan, und neben ihr lag in seinem Blute ein Araber, ein sehr dicker Mann, offenbar ein Eunuche, in seiner starren Faust einen blutigen Dolch.
Mit einem Blick sah und erkannte Axel alles, oder er ahnte doch gleich alles.
»Um Gott, was ist hier geschehen?!«
Der Graf, der neben dem Diwan stand, sich über die Liegende beugend, wandte ihm sein ganz entgeistertes Antlitz zu.
»Die Türe zu, die Türe verriegeln, dass Lord Moore nicht hier hereinkommt!!«, stieß er mit rauer, heiserer Stimme hervor.
Ganz mechanisch gehorchte Axel, schob den Riegel vor.
»Der Wächter hat sie getötet — in dem Augenblick, da ich hereinstürzte, stieß er ihr den Dolch in die Brust!«
»Ich ahnte es!«, ächzte Axel.
Er sah es ja selbst — das Blut, welches aus der weißen Brust des schönen Mädchens floss.

Aber sie lebte noch, und Axel sollte noch etwas anderes zu sehen und zu hören bekommen.
Jetzt streckte sie dem Grafen, der sich ihr wieder zugewandt hatte, die Arme entgegen.
»Ich sterbe«, flüsterte sie mit brechender Stimme, »ich wusste — dass du kommen würdest — um mich zu befreien — aber du kamst zu spät — es hat nicht sein sollen — dich, nur dich habe ich geliebt — das mit dem Lord war nur ein böser Traum, den ich nicht begreife — nur einmal küsse mich noch, dann...«
Es war gleichgültig, ob der Graf sie noch küsste oder nicht. Der Tod hatte ihr das irdische Bewusstsein genommen — der Tod hatte den ihr in der Hypnose gegebenen fremden Zwang gebrochen.
Einige Minuten der tiefsten Ruhe.
Der Graf hatte ihr die Augen zugedrückt.
Dann wandte er sich Axel zu, der fassungslos dastand.
Er glaubte nicht recht gehört zu haben. Oder aber...
»Das war eine Todesphantasie!«, flüsterte er.
»Haben Sie es gehört?«, stieß der Graf mit heiserer Stimme hervor. »Sie sagen es, es war nur eine Todesphantasie. Aber der Lord darf nicht erfahren, was sie zuletzt gesagt hat!«
»Nie, nie!«
»Ihre letzten Worte waren... grüßt mir den Lord, meinen Walter, meinen Geliebten... Verstanden?«
Axel starrte den Sprecher an. Aber er hatte verstanden.
»Ja, ja, der letzte Abschiedsgruß galt ihm.«
Jäh fuhr der Graf empor.
»Es kommen Schritte...«
Mit einem Sprunge stand er an der Tür, hatte sie wieder aufgeriegelt.
Es war Lord Moore, der ebenfalls erfahren hatte, wo er seine Braut finden würde.
Er fand sie denn auch... als Tote. Er brach neben der Leiche zusammen.
Dann konnten ihm nur die letzten Abschiedsworte berichtet werden, die ihm gegolten hatten — vorgeblich.
So endete die Prinzess Polima, die zweite Tochter des polnischen ExKönigs Leszczynski, die Schwester der französischen Königin.
Die Retter waren zu spät gekommen, Lord Walter Moore glaubte sein Lebensglück für immer verloren zu haben, sein Schmerz war grenzenlos. Doch schließlich heilt die Zeit jede Wunde. Er kehrte dann nach England zurück, um sich vor seiner Regierung zu rechtfertigen, und was aus diesem Manne, der sich in wenigen Wochen so furchtbar verändert hatte, wenig zu seinem Vorteile, durch die Intrigen des Grafen von Saint-Germain, sonst noch wurde, werden wir später sehen.
Dass seine ganze Liebe zu der polnischen Prinzessin nur ein Hirngespinst gewesen war, eine von fremder Seite aus erzeugte künstliche Gaukelei, wenigstens was die Gegenliebe der Prinzessin betraf, das hat der Lord niemals erfahren.
Auch Axel erfuhr erst viel später, als der Graf selbst ihm alles gestand, was er mit dem englischen Gesandten in Rom vorgehabt, wie er ihn getäuscht hatte. Es war alles ganz anders gekommen, das Schicksal hatte sich wieder einmal stärker erwiesen als alle menschliche Berechnung.
»Mag Gott ihm ein gnädiger Richter sein — ich könnte es nicht«, sagte Axel darüber in seinem Tagebuch, dem wir folgen.
Zehn Tage sollten sich die Hauptpersonen hier in dieser Felsenburg aufhalten. Zunächst galt es die Rückkehr der Piraten abzuwarten, ob ihr Angriff auf das französische Schiff in Bona nun geglückt oder abgeschlagen worden war. Einige würden doch auch in letzterem Falle zurückkehren, zu Lande oder zu Wasser, und auch diese mussten noch vernichtet werden, das war man der Menschheit schuldig.
Nachträglich sei noch erwähnt, dass schon vorher, als es noch Zeit gewesen, eine Beratung stattgefunden hatte, ob man nicht das in Bona liegende französische Schiff vor dem Plane der Piraten warnen solle. Man war davon abgekommen. Die Jacht oder ein anderes Segelboot hätte hingehen müssen, und die Piraten hatten dort ihre Spione — sie hätten noch rechtzeitig davon erfahren können, und dann wäre auch hier alles vereitelt worden. Die Hauptsache aber war die Vernichtung dieser menschlichen Hyänen.
So beschloss man, das französische Schiff seinem Schicksale zu überlassen, und das mit Recht.
Wenn ein Schiff sich mitten in einem Hafen von Seeräubern überrumpeln ließ, dann war es sozusagen gar nicht existenzberechtigt, dann fiel es auch auf offener See bei Windstille jedem Piraten, der es erblickte, todsicher zum Opfer.
Die Nacht wurde noch benutzt, um in der Bergfeste Umschau zu halten.
Ja, hier strotzte es von Schätzen aller Art, und nicht die wenigsten goldenen und silbernen Gerätschaften, oftmals reich mit Juwelen geschmückt, entstammten christlichen Kirchen, und zwar stammten sie aus keiner späteren Zeit als aus der Mitte des 16. Jahrhunderts.
Eine besondere Schatzkammer oder ein anderes Versteck fand man nicht. Der Burgherr hatte alle die Kleinodien auf die Wohnräume verteilt, und es genügte auch schon, was man hier erblickte. Zu schätzen war das so gar nicht, und es würde einige Tage währen, ehe man alles nach dem Schiffe hinabgebracht hatte.
Zunächst aber musste das schwarze Schiff wieder verschwinden, noch vor Tagesanbruch. Erst nachdem die ahnungslosen Piraten zurückgekehrt und vernichtet waren, durfte es wiederkommen. So ging es zurück, dorthin, wo auch die Jacht liegen geblieben war.
Als Verständigungsmittel blieb wieder die geheimnisvolle Truhe mit dem schlaftoten Fakir hier, der von der Jacht wieder aus das schwarze Schiff gekommen war. Dieses nahm auch Polimas Leiche mit, der unglückliche Lord begleitete sie.
Von den wenigen Piraten, die sich in der Burg und in der Höhle befunden, hatte man nur zweien Pardon gegeben, um von ihnen zu hören, was man wissen wollte. Sie waren geständig, aber es war nichts von Bedeutung, was man von ihnen erfuhr.
Sonst fand man noch siebzehn Frauen vor, die Haremsweiber einiger Anführer und wenige Kinder. Es waren echte Orientalinnen, die von dem Treiben ihrer Männer kaum etwas wussten, sicher nicht dafür verantwortlich zu machen waren.
Was man mit diesen begann, wohin sie zu schicken seien, würde die Zukunft entscheiden, ebenso, ob die Bevölkerung jenes Dorfes noch zur Rechenschaft zu ziehen sei.
Jetzt galt es erst abzuwarten, ob von dort aus vielleicht Boten oder doch Brieftauben nach der Burg kämen, diese musste man abfangen.
Zwei Tage vergingen. Aber kein Araber kam den steilen Felsenweg hinauf, keine fremde Taube begehrte Einlass in den Schlag.
Schon argwöhnte man, dass die Überrumpelung der Burg draußen doch bekannt geworden wäre, als die Späher von ihrer hohen Warte neun große Boote meldeten, welche mit dem Nordwestwinde längs der Küste gesegelt kamen.
Ja, es waren die Piratengaleeren. Aber von den dreizehn ausgegangenen kamen nur neun zurück, auch sonst fehlte wohl ein Viertel der Leute, und dann waren die großen Boote, welche zusammen die Ladung eines ansehnlichen Schiffes fassen konnten, auch gar nicht bepackt. Offenbar war der Beutezug missglückt, das französische Schiff hatte den Angriff abgeschlagen, was sich dann auch bestätigte.
Die Masten wurden niedergelegt, und sorglos ruderten die neun Galeeren durch das Höllenloch, eine hinter der anderen, und die Wassergrotte sollte für sie wirklich der Eingang zur Hölle werden.
In der Höhle brannten trübe die üblichen Lampen, in ihrem Scheine bewegten sich einige arabische Gestalten.
Kaum aber befand sich die letzte Galeere in dem überdachten Hafen, als es zischte, der elektrische Scheinwerfer trat in Tätigkeit, die Zurückkehrenden mit blendendem Lichte übergießend.
Es war kein Kampf zu nennen. Achtzig Gewehre waren es, welche die Piraten unter Kreuzfeuer nahmen. In weniger als einer Minute war es geschehen. Die wenigen, die zufällig von der tödlichen Kugel verschont blieben, berichteten nur noch von dem erfolglosen Raubzuge, dann ward auch an ihnen das Urteil vollstreckt, was sie verdient hatten.
Der Graf beschäftigte sich mit der Truhe, und noch an demselben Tage kam das auf telepathischem Wege herbeigerufene schwarze Schiff wieder angesegelt, gefolgt von der Jacht.
Nun konnten die Schätze an Bord gebracht werden. Man war noch gar nicht dazu gekommen, sie wenigstens aus den einzelnen Räumen zusammenzutragen, was nun auch nicht mehr erst geschah. Sie hätten einige große Zimmer angefüllt, das Hinabtragen würde einige Tage in Anspruch nehmen, so viele Hände auch damit beschäftigt wurden.
»Was soll nun aus dem goldenen Gelumpe werden?«, fragte Axel den Grafen, als die erste Ladung auf dem Rücken von schwarzen Matrosen abging.
»Vorläufig wird es an Bord meines Schiffes verstaut. Sie sind doch damit einverstanden? Denn, wie ausgemacht, die Hälfte gehört Ihnen.«
Axel machte bei dieser goldenen Aussicht ein recht missvergnügtes Gesicht.
»Ich weiß nicht — mir ist die ganze Freude verdorben. Und dann Kirchengerätschaften und dergleichen — das ist gar nicht nach meinem Geschmack. Das müsste doch erst an einen Juden verkauft werden. Ich tu's nicht, da schämte ich mich.«
»Es ist genug anderes dabei.«
»Wenn auch. Kann das Zeug nicht den Kirchen zurückgestellt werden?«
»Ganz unmöglich, noch zu konstatieren, welchem Kloster oder welcher Kirche dies und jenes gehört. Oder es würde nur Streit deswegen entstehen, sogar blutiger.«
»Ja, ja, das liebe Gold. Sprechen wir einmal gar nicht mehr von meinem Teile. Ich bin immer erst lustig, wenn mir die Goldstücke in der Tasche klimpern, wenn ich sie verhauen kann, und dann brauchen es ja gar nicht so viele zu sein. Nur ein paar Hände voll, so für eine tolle Nacht. Wohin bringen Sie nun das Zeug?«
»Nach jener Insel.«
»Im Stillen Ozean, wo dieses Schiff seinen Heimathafen hat?«
»Ja.«
»Wo liegt denn eigentlich diese Insel? Das haben Sie mir noch gar nicht gesagt.«
»Kann ich Ihnen auch nicht sagen.«
»Weshalb nicht?«
»Das wird mir selbst nicht offenbart.«
»Nanu! Wo man Sie hier als unumschränkten Herrscher anerkennt?«
»Es ist ein Geheimnis damit verknüpft. Ich erfahre es selbst erst auf der Insel.«
»Und das Schiff geht jetzt dorthin?«
»Ja, um Amerika herum. Es ist eine gar weite Reise. Und Sie begleiten mich doch?«
»Wie ich Ihnen schon gesagt habe. Ich will mir endlich einmal die Welt ansehen. Amerika war mir noch zu klein, habe da ja überhaupt nicht viel gesehen.«
»So sprechen wir dort darüber, wie wir uns die Schätze teilen und was wir sonst damit anfangen wollen.«
»Einverstanden. Und während hier das Zeug eingeladen wird, schlage ich vor, jenem Dorfe Adar einen Besuch abzustatten.«
»Wollen Sie mit der Jacht hinsegeln?«
»Das hatte ich allerdings vor. Hoffentlich erleben wir dort etwas anderes, das hier war schon ja gar kein Kampf zu nennen, mehr ein Abschlachten. Kommen Sie nicht mit?«
Nein, der Graf wollte hier bleiben, um die Schätze beim Verpacken näher kennen zu lernen, sie zugleich zu sortieren. So segelte der ›Pipin‹ mit seiner ursprünglichen Mannschaft ab, wozu nur noch Axel kam.
Der Graf wollte ihm wieder die sprechende Truhe mitgeben, aber Axel nahm sie nicht an.
»Wenn ich solchen Hokuspokus vermeiden kann, tue ich es. Ich verlasse mich lieber auf meine eigenen Sinne.«
Die Jacht segelte ab, hatte das in einer Bucht gelegene Dörfchen bald erreicht. Da aber zeigte sich, dass die Dorfbewohner doch noch auf irgendeine Weise von den Geschehnissen in der Raubburg Kunde oder doch Witterung bekommen haben mussten. Das Dorf war verlassen worden, und offenbar hatte man alles mitgenommen, was des Mitnehmens wert war.
Einige Stunden trieb sich Axel in und zwischen den Hütten herum, dann lichtete die Jacht wieder die Anker.
Aber der Rückweg konnte nicht angetreten werden, wenigstens nicht der direkte. Gegen diesen Westwind war nur in meilenlangen Strecken aufzukreuzen. So ging es nach Norden, nicht nur einige Meilen, sondern bis nach Sardinien hinauf, in der Hoffnung, eine andere Windströmung aufzufinden. Aber diese wollte nicht kommen, immer Westwind, und als man nach Südwest hinunterkreuzen wollte, flaute der Wind schnell bis zur völligen Stille ab.
Diese Windstille währte fünf Tage. Höchstens dass die Jacht einmal wie eine Schnecke kriechen konnte. Es hatte nichts zu sagen. Es waren Seeleute, die auf so etwas immer gefasst sein müssen, sie wussten sich die Zeit zu vertreiben, und Axel ergab sich dem Träumen, ohne Missmut oder Sorge zu äußern.
An Bord des schwarzen Schiffes konnte die Jacht ja immer beobachtet werden, aber davon ward hier gar nicht gesprochen.
Am sechsten Tage ging es mit einer steifen Brise nach der tunesischen Küste zurück, gegen Mittag sah man das schwarze Schiff auftauchen, noch immer vor jener Höhle liegend.
»Sie sind lange ausgeblieben«, sagte der Graf, als sich Axel über die Bordwand schwang. »aber so lange haben wir auch gebraucht, um die Sachen einzunehmen. Es ist eine ungeheuere Last, ich habe doch wieder die Schätzung verloren. Sie haben das Dorf verlassen gefunden?«
»Sie wissen es?«
»Ich habe Sie im Geiste begleitet, auch sonst mehrmals während der Windstille besucht. Wohin sich die Piraten oder Dorfbewohner geflüchtet haben, weiß ich nicht. Schadet auch nichts. Die Hauptsache ist, dass Sie zur rechten Zeit kommen.«
»Wieso zur rechten Zeit?«
»Um das Endresultat eines Experimentes mit anzusehen. Auch Kapitän Morphium muss mit dabei sein, den wird es am meisten interessieren.«
Auch Morphium kam an Bord des schwarzen Schiffes; der Graf, der in vorzüglichster Laune war, führte die beiden unter Deck in eine Kabine.
In dem Augenblick, da sie eintraten, verschwand durch eine Nebentür eine Gestalt, in der Axel noch ein Weib zu erkennen geglaubt hatte. Dann konnte das nur die sonst immer unsichtbare Lady Isabel gewesen sein. Sonst befand sich, soviel Axel wusste, kein Weib an Bord.
Die Hauptsache in dieser ebensalls schwarz ausgeschlagenen Kabine bildete ein in der Mitte stehender Diwan, über den ausnahmsweise eine farbige Decke gebreitet lag, welche offenbar eine menschliche Gestalt verhüllte.
»Nun, Sie wissen wohl, was Sie jetzt sehen sollen«, begann der Graf.
»Ein neue Spezies von Fakir?«, fragte Axel.
»Ein Fakir? Gott bewahre! Sie ahnen nichts?«
Nein, die beiden ahnten wirklich nichts.
»Desto besser!«
Der Graf fasste einen Zipfel der Decke, zog sie schnell fort — auf dem Diwan lag ein Weib, in bunte orientalische Gewänder gehüllt, mit Geschmeide und Juwelen reich geschmückt, wo solche nur anzubringen waren.
Es war auch eine Orientalin, und zwar ein bildschönes Weib. Wie nun noch dazu alles arrangiert war, allein schon die Frisur, das üppige blauschwarze Haar, durch das sich eine in Gold gefasste Korallenschnur schlang, die phantastischen Ohrgehänge, die gleißenden Armringe und Fußspangen, und nun überhaupt das ganze Kostüm, wozu auch die zierlichen Saffianpantöffelchen gehörten — heutzutage hätte man gleich an das Reklamebild einer Zigarettenfabrik gedacht. Jedenfalls waren die beiden von dem Anblick ganz bezaubert, der alte Morphium nicht minder als der junge Axel.
»Dunnerwetter! Is die lewendg?«, wollen wir den alten Kapitän einmal in einem deutschen Dialekt sprechen lassen. Die italienische Sprache, deren man sich meist bediente, können wir hier doch sowieso nicht wiedergeben.
»Sie sehen es ja.«
Ja, sie schlief nur, sie atmete. Unter dem zarten Seidengewebe hob und senkte sich der volle Busen, die Korallenlippen, zu dem ganzen Gesicht von Milch und Blut passend, waren etwas geöffnet, sodass man die weißen Zähnchen blitzen sah.
Noch besser als mit einem Zigarettenreklamebild konnte man die Schläferin mit einer Wachsfigur vergleichen, die bekannte schlafende Haremsdame darstellend. Nur hatte sie etwas mehr an, als die hohe Polizei es auf den Jahrmärkten trotz aller Moralität sonst erlaubt.
»Wer ist denn das nur?«, flüsterte Axel.
»Sie ahnen es noch immer nicht?«
»Eine von den Haremsweibern aus der Burg?«
»Nee, nee«, gab statt des Grafen der alte Kapitän hierauf die Antwort. »Die habe ich mir ganz genau von allen Seiten angeguckt. Ja, da sind ja ein paar ganz famose Weibsen dazwischen — aber so eine Schönheit — i, da findet man ja gar keine Worte, da wird man ja fast blind! Dunnerwetter, die möcht' ich heiraten!«
Und leckend steckte der alte Sünder den Finger in den Mund.
»Das sollen Sie ja auch.«
»Was soll ich?«
»Diese Schönheit, welche die gefeierteste Roms sein wird, heiraten. Vorausgesetzt, dass diese Dame damit einverstanden ist, was Sie doch hoffentlich schon vorher schriftlich abgemacht haben.«
Da kam den beiden die Erkenntnis, und auch Axel erstarrte.
»Sie wollen doch nicht etwa sagen, dass...«
Axel wagte es gar nicht auszusprechen.
»Nun?«
»Dass dies die Fürstin de la Roche wäre?!«
»Ja, wer denn sonst?«
Da bückte sich Axel im Herumdrehen etwas, um dabei ein leises, pustendes Lachen auszustoßen.
»Graf«, sagte er dann, »Sie haben mir schon manchen Hokuspokus vorgemacht — manchmal hab' ich dran geglaubt, manchmal nicht — aber was Sie mir nun da weismachen wollen — nein, das ist denn doch etwas gar zu toll, das verträgt auch der Magen des Depeschenreiters Axel nicht.«
»Und doch, es ist die Fürstin de la Roche«, entgegnete der Graf ruhig. »Finden Sie denn so gar keine Ähnlichkeit wieder? Hier, betrachten Sie ihr Bild, erst vor zehn Jahren gemalt. Diese Mexikanerin war wirklich einmal eine blendende Schönheit.«
Der Graf hatte es in einem Tone gesagt, dass Axel vollständig verwirrt wurde. Er drehte sich wieder um, betrachtete die Schläferin, betrachtete das kleine, farbige Bild, das ihm der Graf vorhielt, von dem wir schon einmal gesprochen haben, eine bezaubernd schöne Mexikanerin in Nationaltracht darstellend, und aus diesem Bilde konnte man ungefähr noch schließen, dass es wirklich die spätere Fürstin de la Roche war.
Axel starrte und starrte und rieb sich die Stirn.
»Wahrhaftig — es ist eine Ähnlichkeit vorhanden — ich kenne die Fürstin ja schon von früher, als sie freilich auch schon so eine skelettartige Hexe war — ja, eine Ähnlichkeit ist vorhanden...«
»Sie ist es, ich versichere es Ihnen. Wie könnte ich denn hier solch einen Mummenschanz treiben!«
»Na, nun bleibt mir aber der Verstand stehen!«, ächzte Axel. »Ja, jetzt glaube ich wirklich, dass Sie zaubern können.«
»Meine Frau — wenigstens meine zukünftige«, fand jetzt auch Morphium endlich Worte, fing erst zu zappeln an und fiel dann gleich mit gefalteten Händen auf die Knie nieder. »Nein, ist es möglich! In noch nicht acht Tagen so groß und dick zu werden — so dick! Und und und und... das ganze Maul hat sie auch wieder voller Zähne!«
»Das ist doch selbstverständlich«, lächelte der Graf. »Ohne gute Zähne gibt es ja keine Schönheit.«
»Und und und und... wo ist denn der andere hin, der große lange gelbe?«, stotterte der alte Kapitän nach wie vor.
»Wünschten Sie vielleicht, dass der zwischen den neuen Perlenzähnchen stehen geblieben wäre?«
»Nee. O o o o o o nöööhh! Ich frage nur so, wo der geblieben ist. Sie haben ihn rausgeruppt?«
»Nein, das war gar nicht nötig. Er ist von den nachwachsenden Zähnchen verdrängt worden.«
Da wurde der Graf von Axel vorn an der Brust gepackt und gerüttelt. Axel war wieder zur Besinnung gekommen und musste sich aus diese Weise Luft machen.
»Graf, Graf«, rief er außer sich, »geben Sie mir meinen Verstand wieder — ja, es ist die Fürstin, jetzt zweifle ich nicht mehr daran — wie haben Sie dieses Zauberwerk zustande gebracht?«
Der Graf hatte sich ruhig abschütteln lassen, stand auch wie im Boden gewurzelt.
»Es ist keine Zauberei, ich besitze auch nicht eigentlich eine Verjüngungstinktur, mit der die sogenannten Adepten so viel Humbug treiben. Ich muss jeden Fall anders behandeln, individuell. Die Fürstin ist noch gar nicht so alt und war doch bis vor wenigen Jahren ein wirklich schönes Weib, wäre es auch ohne diese meine Kur noch heute, wäre sie nicht plötzlich von einer Abmagerung befallen worden, die ihren Körper in kürzester Zeit bis auf die Knochen abzehrte. Dabei ist das nicht eigentlich eine Krankheit gewesen. Eben eine körperliche Veranlagung, die bei den Südländern sehr häufig zur gewissen Zeit eintritt. Nun besitze ich ein Mittel, um jedem mageren Körper, wenn er sonst normal ist, schnellstens wieder volle Formen zu geben. Das ist das ganze Geheimnis.«
»Eine Mastkur?«, konnte Axel wieder etwas ruhiger fragen. »Und in acht Tagen soll die so anschlagen?«
»Wie Sie sehen. Allerdings ist dazu noch ein besonderes Präparat nötig. Aber die Hauptsache ist doch die reichliche Ernährung — und dann die Aufhebung aller energischen Lebensfunktionen.«
»Die Fürstin hat dabei wohl immer geschlafen?«
»So ist es. Sie wurde von mir immer in einer Betäubung gehalten, kaum dass sie atmete und ihr Herzschlag gehen durfte. Trotzdem funktionierte die Verdauung. Die Nahrungsmittel mussten ihr natürlich künstlich eingeflößt werden, und eben deshalb musste ich sie auch immer unter meiner Aufsicht haben. Das Leben könnte doch einmal ganz erlöschen.«
»Na, wenn's so ist, dann hätte ich sie doch auch gleich noch ein bisschen dicker gemacht«, ließ sich Morphium vernehmen.
»Das kannst du ja später selbst besorgen, wenn sie erst deine Frau ist«, meinte Axel. »Aber in acht Tagen — die muss doch wenigstens fünfzig Pfund zu genommen haben — das ist ja kaum glaublich!«
»Sie vergessen wohl, dass ich die Dame eigentlich bereits acht Wochen in der Behandlung habe. Schon während dieser ganzen Zeit hat sie immer etwas einnehmen müssen. Ihr allerdings unbewusst. Es handelt sich um eine besondere Diät. Ich selbst lieferte ihr den Himbeersaft, mit dem sie sich das Regenwasser schmackhafter machte, und diesem Himbeersaft war etwas beigemischt. Aber die Wirkung dieses Mittels äußert sich nicht so bald. Da muss noch etwas anderes hinzukommen, und das geschah eben erst in den letzten acht Tagen, während welcher die Fürstin wie im Scheintode lag.«
Axel hatte schnell begriffen.
»Also so eine Art zurückgehaltenes und dann beschleunigtes Wachstum, wie es die Inder bei gewissen Pflanzen anzuwenden wissen.«
»Fast ganz genau so ist es.«
»Ja, aber nun die Zähne, die Zähne!«, staunte Axel immer von Neuem.
»Ich verstehe die Kunst, neue Zähne wachsen zu lassen.«
Und hierbei beharrte der Graf. Und hierdurch wurde er wieder zum Betrüger.
Für die schnelle Zunahme des Körpergewichtes hatte er eine ziemlich natürliche oder doch plausible Erklärung gegeben, aber betreffs der Zähne fiel er in sein altes Laster, da musste er sich wieder mit dem Nimbus umgeben wollen, als besäße er dennoch übernatürliche Fähigkeiten.
Wie der Graf der Fürstin neue Zähne gegeben hatte, weiß heute natürlich jedes etwas erfahrene Kind, und wir haben auch schon Andeutungen gemacht, als der Graf in dem Keller des Spukklosters in einem besonderen Gewölbe die Utensilien eines Werktisches abräumte und einpackte. Er hatte da mit Elfenbein gearbeitet.
Wann das erste künstliche Gebiss oder nur einzelne Zähne gefertigt und an defekten Stellen eingesetzt wurden, ist nicht mehr zu verfolgen. Es heißt, man habe schon bei altmexikanischen Mumien künstliche Gebisse gefunden. Das ist aber eine sehr trügerische Behauptung. An ägyptischen Mumien hat man hohle Zähne mit Gold, Silber und Kitt plombiert gefunden. Doch auch diese Kunst ist dann wieder ganz vergessen worden, ist im Anfange des neunzehnten Jahrhunderts neu erstanden.
Jedenfalls kam damals, als die Fürstin de la Roche, die Rom als klapperdürre Hexe verlassen hatte und dann als jugendschönes Weib wieder auftauchte, kein einziger Mensch auf dem Verdacht, das könnten künstliche Zähne sein. Das erkannte man erst nach ihrem Tode, der noch nach dem des Grafen von Saint-Germain erfolgte. Und dieser Abenteurer muss ein wunderbarer Zahnkünstler gewesen sein, hatte eine ganz besondere Art von Befestigung des künstlichen Gebisses, denn obgleich es die Fürstin dreißig Jahre im Munde getragen, hat sie selbst sicher nichts davon gewusst.
»Ja, wie ist denn das möglich, neue Zähne wachsen zu lassen?!«, rief Axel.
Der Graf hob bedächtig die Schultern.
»Das allerdings... muss mein Geheimnis bleiben. Es lässt sich mit Worten überhaupt gar nicht erklären.«
»Das geschieht wirklich auf magische Weise?«
»Nehmen Sie es an.«
»Ja, das ist auch ganz offenbar — und schon diese schnelle Körperzunahme genügt für mich, diese ganze Verjüngung — Graf, da haben Sie wirklich ein handgreifliches Wunder geleistet!«
»Ja, ein ganz handgreifliches Wunder«, bestätigte auch Kapitän Morphium.
»Kapitän, was machen Sie denn da!«, rief der Graf in diesem Augenblick mit einiger Entrüstung.
Die beiden hatten während dieser Unterhaltung nicht hingesehen, und so bemerkten sie erst jetzt, wie der alte Kapitän sich ganz handgreiflich von diesem handgreiflichen Wunder überzeugte, und jetzt war er gerade dabei, ihr mit dem Finger im Munde herumzufummeln.
»Na, was denn — die ist doch schon so gut wie meine Frau. Nee, wahrhaftig, die hat ganz richtige Zähne wiederbekommen!«
»Sie werden sie wecken!«
Der alte Sünder ließ nun wenigstens von seinen Untersuchungen ab.
»Ist sie seitdem noch nicht erwacht?«, fragte Axel.
»Nein, der Betäubungsschlaf ist erst vor Kurzem in einen natürlichen übergegangen, und daraus muss das Erwachen von selbst geschehen. Es wird auch gleich eintreten.«
»Die Fürstin hat sich noch nicht in dieser Verjüngung gesehen?«
»Mit keinem Blick.«
»Sie weiß noch gar nicht, was sie im Spiegel erblicken wird?«
»Nur, dass sie am dritten September die gefeierteste Schönheit Roms sein soll, das ist ja nun bald schon zur sprichwörtlichen Redensart geworden. Sie wusste auch, dass vor acht Tagen die eigentliche Kur begann, dass ich sie in Betäubung versetzen wollte. Aber sonst hat sie noch keine Ahnung. Sie wird beim Erwachen, wenn sie sich zuerst im Spiegel sieht, nicht wenig verblüfft sein.«
»Ach, da möchte ich dabei sein, wenn dieser Moment eintritt!«
»Deshalb habe ich Sie ja eben hergeholt. Ja, wir wollen sie heimlich beobachten. Es ist alles dazu vorbereitet. Auch dieses Kostüm hatte sie beim Einschlafen vor acht Tagen noch nicht an, das habe ich ihr erst jetzt angezogen, dazu das schönste und phantastischste ausgesucht, das in der reichen Garderobekammer der Felsenburg zu finden war.«
»Wawawawas?«, musste sich zunächst Kapitän Morphium vernehmen lassen. »Sie haben meine Frau angezogen? Bei ihr die Kammerjungfer gespielt?!«
»Beruhigen Sie sich«, lächelte der Graf, »ich tat es nicht selbst, das sagte ich jetzt nur so der Kürze halber. Das haben Frauenhände besorgt.«
»Lady Isabel?«, wurde jetzt auch Axel neugierig. »Die macht gar nicht den Eindruck, als ob sie sich für derartige Maskeraden so interessiere, dass sie sich zur Kammerzofe hergebe.«
»Nein, Lady Isabel allerdings nicht.«
»Ja, welche Frau denn sonst? Haben Sie denn sonst noch mehr Weiber an Bord?«
»Gewiss«, entgegnete der Graf einfach, und da es nun einmal so war, ließ sich Axel das auch genügen. In die internen Angelegenheiten dieses Schiffes hatte er auch noch gar keinen Einblick gewonnen, wusste noch nicht einmal, ob die ganze Mannschaft wirklich nur von der Luft lebe.
Der Graf zog an der Wand ein schwarzes Tuch zurück und enthüllte einen Spiegel. der vom Boden bis zur Decke reichte.
»So, das ist die Hauptsache. Nun begeben wir uns dort hinüber und beobachten, wenn sie erwacht. Lange wird es wohl nicht mehr dauern.«
Sie gingen in die benachbarte Kabine, in der an der betreffenden Wand einige kleine Löcher angebracht waren, durch die man diesen Raum hier bequem übersehen konnte.
»Einige Minuten werden wohl noch vergehen«, meinte der Graf, als sie ihre Posten eingenommen hatten. »Das Erwachen wird von mehrfachem Gähnen eingeleitet werden.«
»Wie gewöhnlich, wenn man erwacht«, stimmte der Kapitän bei.
»Nein, es ist etwas anderes, ein krampfhaftes Gähnen, verursacht durch den langen Mangel an Luft.«
»Sie wird dann doch auch's Maul wieder zu bekommen?«, fragte der vorsichtige Morphium.
»Aber, Morphium«, sagte Axel vorwurfsvoll, »spricht man so von seiner Frau oder Braut, zumal wenn es solch eine Schönheit ist?«
»Ja, Herr Graf, das ist ja alles ganz wunderbar und recht schön, aber... wird das auch auf die Dauer anhalten?«
»Wie meinen Sie?«
»Dass sie nicht gleich in den nächsten Tagen wieder zusammenklappert.«
»Nein, das ist für immer.«
»Für immer? Die ist wohl nun auch gar... unsterblich geworden?«
»Nein, so war das nicht gemeint. Es ist, meine ich, eine ganz normale Körperfülle...«
»Na, dann hätte ich sie aber doch gleich noch ein bisschen dicker gemacht.«
»Still, sie erwacht!«
Die schöne Schläferin hatte einige Bewegungen gemacht, gähnte mehrmals, rieb sich die Augen, richtete sich langsam auf, schaute verwundert um sich. Sie hatte so gelegen, dass die Beobachter gerade ihr Gesicht sehen mussten, ihnen gegenüber war der große Spiegel, in dem sie ja alles andere erblicken konnten.

Wirklich, auch im wachen Zustande war es ein bezauberndes Gesicht. Die Fürstin hatte je eigentlich auch alles immer dazu gehabt, besonders die schönen, großen, nachtschwarzen Augen, von herrlichen Brauen überwölbt — nur eben ihre furchtbare Magerkeit, sie auch das ganze Gesicht voll Runzeln gemacht hatte — und dann freilich zuletzt noch nur der einzige Zahn, der mit dem vorletzten das Wachstum aller anderen zusammen angenommen hatte.
»Wo bin ich denn?«
Sie rieb sich nochmals die Augen oder wollte es tun, hielt mitten in der Bewegung inne, betrachtete staunend ihre kleinen, weißen, fleischigen Hände.
»Sind denn das... meine... Hände?!«
Das musste sie auch noch ganz besonders deshalb bezweifeln, weil sie jetzt andere Ringe trug. Die früheren, die sie sich wohl mit abnehmender Körperfülle immer enger hatte machen lassen, hätten ihr ja gar nicht mehr gepasst.
Immer noch betrachtete sie ganz erstarrt jeden einzelnen Finger.
»Richtig, der Graf hat mich ja verjüngen wollen, aber Sie erstarrte vollends. Sie hatte sich weiter umgeschaut, ihr Blick war in den Spiegel hinter ihr gefallen.
Langsam stand sie auf, geduckt. Dass sie sich zunächst entsetzte, vor ihrem eignen Spiegelbilde, so verlockend dieses auch war, das war ihr gar nicht zu verübeln. Wenn sie sich dabei nicht entfärbte, das Gesicht wie Milch und Blut behielt, so kam das nur daher, weil der Graf dieses Gesicht genügend angepinselt hatte. Ohne dies ging es denn doch nicht, das erforderte überhaupt die Mode.
»Es ist... doch nicht... möglich! Das bin doch ich nicht, die Fürstin Eudoxia de la Roche!«
So schlich sie, wenn man sich so ausdrücken darf, immer um ihr Spiegelbild herum, machte verschiedene Bewegungen und musste sich überzeugen lassen, dass das Spiegelbild dieselben Bewegungen wiederhole, sie verschmähte auch nicht, sich an der Nase und an den Ohren zu ziehen.
Plötzlich stieß sie ein gellendes Zetergeschrei aus, stürzte nach der Tür, und zwar nach derjenigen, welche in die Nebenkabine führte, riss sie auf und... lag auch gleich in Kapitän Morphiums Armen.
Dieser hatte, wie wohl auch die anderen beiden, geglaubt, sie sei vor Schreck über ihr Spiegelbild, das sie nicht begriff, plötzlich halb wahnsinnig geworden, und es war auch wirklich ein etwas gewagtes Experiment gewesen.
Aber sofort zeigte sich, dass es nur ein freudiger Schreck war.
»Ich bin wieder jung — jung und schön!!«, jubelte sie ein übers andere Mal.
Und nun fing die Posse erst richtig an. Von Kapitän Morphiums Heiratsideen wollte sie jetzt nichts wissen, höchstens, dass sie einmal den Zaubergrafen umarmte und ihn ihrer ewigen Dankbarkeit versicherte, dann rannte sie immer wieder gleich vor den Spiegel, bewunderte sich in den kokettesten Stellungen, und dann küsste sie sich selbst im Spiegel.
Nach und nach aber verrauchte ihr Enthusiasmus doch etwas. Erst fand sie ein Pickelchen auszusetzen, das sie an ihrer Wange entdeckte, dann fand sie ihre Nase etwas zu wenig edel, und schließlich klang ihre Kritik in den Worten aus:
»Ich finde, Herr Graf, Sie haben mich doch viel zu korpulent gemacht. Ich möchte Sie überhaupt einmal allein sprechen.«
Die beiden anderen begaben sich gehorsam in die Kajüte.
»Willst du sie wirklich heiraten, Morphium?«, begann Axel.
»Ich denke ja nicht im Traume daran«, lautete die Antwort, »und wenn ich wollte, jetzt will die mich alten Knax doch nicht mehr haben.«
»Na, dann lass dich doch ebenfalls wieder verjüngen.«
»Da hätte ich eher kommen müssen.«
»Wieso?«
»Du weißt doch, dass der Graf jedes Experiment nur ein einziges Mal macht.«
»Auch in diesem Falle?«, stutzte Axel.
»In jedem einzelnen Falle.«
»Aber er hat seinen Schülern doch ein und dieselben Experimente wiederholt vorgeführt.«
»Welche?«
»Nun, zum Beispiel, dass er sich selbst und andere frei in der Luft schweben ließ.«
»Das ist etwas ganz anderes. Solche gewissermaßen handgreifliche Experimente, deren Resultat man mit nach Hause nehmen kann, macht er immer nur ein einziges Mal. Ich kann mich jetzt von ihm nur noch älter machen lassen, ganz zum Knochengerippe, mir ein Horn auf der Stirn wachsen lassen, einen Elefantenrüssel — aber Jungmachen und Zähnewachsenlassen ist nun schon vergeben, das macht er jetzt nicht wieder.«
Hiervon war der alte Kapitän felsenfest überzeugt.
»Ja, was meinst du nur, wie er dieses Wunder fertig gebracht hat?«
Es war eine fast törichte Frage von Axel. Er musste ja selbst einfach an ein Wunder glauben, und auch die Zunahme des Körpergewichtes, also dieser Ansatz von Fleisch innerhalb von acht Tagen, war doch noch immer ein Wunder zu nennen, der Graf hatte durchaus keine natürliche Erklärung gegeben.
Da kam dieser schon wieder.
»Es ist doch immer die alte Geschichte«, lachte er. »Sie kennen doch das mit dem Schustergesellen, der sich nichts weiter als hundert Taler wünscht, und wie er die hat, möchte er tausend Taler haben, dann hunderttausend, dann eine Million, dann hundert Millionen Taler — bis ihm zuletzt der liebe Gott die Hälfte des ganzen Weltalls abtritt. Da aber beweist ihm der Kerl klipp und klar, dass er die schlechtere Hälfte des ganzen Weltalls bekommen hat, er will auch noch die andere dazu haben. So ist es auch mit der Fürstin. Sie ist sich immer noch nicht schön genug, ich hätte ihr die Fußspanne nicht hoch genug gemacht, die Handknöchel müssten etwas runder sein, und so weiter.«
»Und sie soll nun nach Rom zurück?«, fragte Axel.
»Ja, und zwar sofort. Heute ist der erste September, und am dritten muss sie unbedingt in Rom sein.
»Ich will mein Wort halten. Sie kleidet sich schon zu der Fahrt an.«
»Auf dem schwarzen Schiffe?«
»Nein, das bleibt hier liegen. Es sind noch einige andere Sachen mitzunehmen, besonders auch... doch das ist Nebensache. Wir haben unter einigen großen Segelbooten die Auswahl...«
»Weshalb soll da nicht gleich die Jacht benutzt werden?«
»Ich wollte Kapitän Morphin soeben deshalb fragen. Es ist nur, weil sie von einer langtägigen Reise zurückkommt.«
Das hatte nichts zu sagen, die Jacht war sofort wieder seeklar.
»Auch Sie kommen mit, Herr Graf?«
»Ja, ich muss unbedingt einmal nach Rom.«
»Um den Effekt zu beobachten, den die neu erstandene Fürstin machen wird?«
»Das soll mich wenig interessieren. Mich zieht ein anderes Geschäft nach Rom, hoffentlich das letzte, das ich in Europa abzumachen habe.«
»Aber ich möchte doch gern dabei sein, wenn die Fürstin, das ehemalige Scheusal, als die gefeierteste Schönheit Roms sich präsentiert.«
»Ja, so kommen doch auch Sie mit.«
Schon eine Stunde später segelte die Jacht wieder nach Nordosten, außer der Fürstin auch Lord Moore als Passagier an Bord habend.
Er hatte von einer Einbalsamierung der Leiche Polimas nichts wissen wollen, hatte sein Liebstes unter christlichen Zeremonien dem Meere übergeben. Er selbst wollte noch einmal nach Rom zurück, um von dort seine Heimreise nach England anzutreten.
Es war eine sehr stürmische Rückfahrt, von der nichts weiter zu erzählen ist. Die Fürstin lag während dreißig Stunden seekrank in ihrer engen Kabine, auch Lord Moore, der kaum noch wiederzuerkennen war, wusste sich unsichtbar zu machen.
In der Nacht lief die Jacht in den Hafen von Fiumicino ein, der Graf ging sogleich von Bord.
»Wenn ich morgen um dieselbe Zeit nicht zurück bin, so lasse ich Ihnen durch einen Boten wissen, wann ich zurückkomme«, hatte er nur zu Axel gesagt und war gegangen, ohne sein Ziel anzugeben.
Während der ganzen Fahrt war keine Minute Gelegenheit gewesen, sich gegenseitig zu beobachten. An Deck ein fortwährender Kampf mit überstürzenden Wogen und peitschenden Segeln, an welchem Kampfe sich Axel redlich beteiligt hatte, und unter Deck ein ebenso fortwährender Kampf mit dem aufgetragenen Geschirr, oder man hatte schon immer genug damit zu tun gehabt, sich festzustemmen.
Axel hatte seine Mahlzeiten immer mit der Freiwache gehalten und bemerkt und erfahren, dass der Graf während der ganzen Reise keinen Bissen genossen hatte, aber deswegen keine Frage gestellt, und erst jetzt erkannte er, als der Graf an Land gehen wollte, wie niedergeschlagen dieser war. Da war er schon gegangen.
Am Abend des anderen Tages, als Axel eben wieder einmal nach der am Kai vertauten Jacht zurückgekehrt war, sich in der kleinen Toilettenkabine zu schaffen machte, wohl um sich für eine längere Nacht an Land vorzubereiten, erschien auch der Graf wieder, nicht mehr niedergeschlagen, sondern mit der ruhigen Miene wie immer, die allerdings stets etwas Melancholie ausdrückte, selbst wenn er lachte.
»Hallo, schon zurück?«
»Meine Mission ist beendet.«
»Glück gehabt?«
»Nein, eben nicht.«
Axel fragte nicht weiter, er ahnte aber, dass die Exkursion jenem verschwundenen Leibpagen gegolten und dass ihn der Graf nicht gefunden hatte.
»Waren Sie in Rom?«, fragte Axel nur noch, aber nur, um ein anderes Thema anzuschlagen.
»Nein, viel weiter.«
»Aber Sie sind doch durch Rom gekommen.«
»Auch nicht, ich habe es sogar mit Absicht umgangen.«
»Dann haben Sie sich etwas entgehen lassen. Nämlich wie die Fürstin empfangen wurde. Sie wissen auch nichts davon?«
»Gar nichts, mich interessiert aber, es jetzt von Ihnen zu hören.«
»Nun, ich selbst begleitete die verwandelte Fürstin nach ihrem Palaste. Er war noch offen, alle Dienerschaft noch vorhanden. Es war schwer, den Leuten glaubhaft zu machen, dass dies wirklich die Hausherrin sei. Ach, was für ein Menschenapparat musste da aufgeboten werden, Richter und Advokaten erfüllten das Haus. Zuletzt musste man aber doch glauben, dass das junge, schöne Weib wirklich die Fürstin Eudoxia de la Roche sei. Na, dieses Staunen, Sie machen sich gar keinen Begriff. Oder was heißt da Staunen. Und sie entsetzten sich vor ihr, kann man da schon eher sagen, um mit der Bibel zu reden, wobei nämlich mit diesem Entsetzen etwas ganz Besonderes gemeint ist. Den ganzen Tag wurde der Palast von einer ungeheuren Menschenmenge belagert, welche die Verjüngte sehen wollte, und die eitle Fürstin geizte nicht mit Präsentationen auf dem Balkon, immer in einer verrückteren Toilette. Und nun diese Besuche! Und dann fand eine Völkerwanderung nach hier statt, man wollte unsere Jacht erstürmen. Erst der am Abende einsetzende Platzregen trieb die Menge auseinander und dann nach Rom zurück. Unterdessen aber auch diese Karossen, diese Briefboten! Einige Schreiben waren offen, ich habe sie vorhin gelesen, ja auch sonst genug zu hören bekommen. Graf, wenn Sie sich hier als Verjüngungsdoktor niederlassen — Sie verdienen jeden Tag eine Million, können überhaupt fordern, was Sie wollen. Sie sind der reichste Mann der Erde.«
»Alles nur ein einziges Mal.«
»Ja, aber sagen Sie das mal denen. Die lassen Ihnen keine Ruhe, die machen Sie tot. Nein, diese Weiber! Und wenn sie schon noch so schön sind — wirklich, es waren brillante Weiber dazwischen, die hier vorsprachen, und die mich auch schon in Rom stellten — sie wollen immer noch schöner werden. Und dann diese Zahnkur — Sie machen sich keinen Begriff, wie es jetzt in Rom aussieht. Entweder ist ganz Rom halb wahnsinnig oder halb Rom ganz wahnsinnig.«
»Haben Sie gehört, was meine früheren Schüler und Schülerinnen machen?«
»Um so etwas mich zu kümmern, dazu hatte ich gar keine Zeit. Ich komme nur einmal an Bord, um die Sachen zu ergänzen, die man mir vom Leibe gerissen hat. Ein Glück, dass mein Lederanzug unzerreißbar ist, sonst wäre ich nackt hier angekommen — Ja, aber nun, Graf, sind Sie denn nur wirklich allwissend?!«
Das letztere hatte Axel in einem ganz anderen, staunenden Tone gesagt, wie es ja schon die Worte ausdrückten.
»Ich bin nicht allwissend«, lautete die sehr korrekte Erklärung, als wiese der Graf eine Anschuldigung zurück.
»Gibt es denn nur wirklich so ein Schicksalsgesetz, dass der Mensch etwas immer nur gewinnen kann, wenn er etwas anderes dafür verliert?«
»Die Fürstin hat ihr Vermögen bereits verloren?«
»Sie wissen also doch schon...?«
»Ich weiß gar nichts. Es ist eine eiserne Notwendigkeit.«
»Seltsam. Doch sprechen wir über diese Philosophie ein anderes Mal, bleiben wir jetzt bei den Tatsachen. Als die Fürstin vor acht Tagen ihren Mann glücklich unter der Erde hatte und gleich Rom verließ, um sich auf das schwarze Schiff in Ihre Kur zu begeben, war das Testament des Toten noch nicht geöffnet worden. So hat die Fürstin erst jetzt erfahren, dass ihr Mann alles, was er hat, seinen Blutsverwandten und einer Kirche vermacht hat, seine Frau geht ganz leer aus.«
»Das war, soviel ich weiß, schon vorherige Abmachung, viel hat der französische Fürst überhaupt nicht gehabt, und diese Mexikanerin hatte doch wahrhaftig keine reiche Heirat nötig.«
»Hatte sie nicht. Erst gestern ist das Schiff aus Mexiko hier angekommen, welches ihr alljährlich ein paar Säcke voll Silber oder wohl mehr noch voll Gold bringt — statt dieser Säcke bringt es diesmal die Nachricht mit, dass in Mexiko Rebellion ausgebrochen ist. Alle ihre Silberminen sind von der revolutionären Partei mit Beschlag belegt worden.«
»Sie hat alles verloren?«
»Es sieht gar nicht danach aus, als ob die Silberminen jemals wieder als Privatbesitz herausgegeben werden würden.«
»So ist also eingetreten, was ich der Fürstin vorausgesagt habe.«
»Es ist wunderbar!«
»Und wie fasst sie es auf?«
»Nun, erstens ist ja da noch genug vorhanden. Schon ihr Schmuck! Freilich, wie die lebt, und nun noch ganz besonders in ihrem ersten Rausche — das wird bald durchgebracht sein. Aber was macht die sich daraus! Sie ist glücklich.«
»Dann wohl ihr.«
»Die kann ja jetzt auch sofort wieder die reichste Heirat machen. Den Kapitän Mophium nimmt sie nun freilich nicht. Das war ja überhaupt nur immer eine Alberei. Oder Sie glauben auch nicht, dass sie jetzt noch eine reiche Heirat machen kann? Sie müsste nun kraft eines Schicksalsgesetzes das Elend der Armut durchmachen?«
»Die Folgezeit wird es lehren«, wich der Graf aus. »Wo ist Kapitän Morphin?«
»Er war heute nach Palo geritten, ist aber schon wieder zurück, schläft gerade in seiner Kabine.«
»Wie sah es in Palo aus?«
»Gehört jetzt zum Kirchenstaat, sonst alles beim Alten.«
»Des Kapitäns Burg?«
»Gilt eben als sein Privateigentum. Wenn er seine Steuern zahlt, dann ist ja alles in Ordnung.«
»Sind Sie bereit, wieder in See zu gehen?«
»Sofort.«
Aber diese Nacht wurde noch nichts daraus, auch am folgenden Tage nicht.
Heftig geweht hatte es immer, und in der Nacht setzte ein Sturm ein, der zum Orkan ausartete, wie ihn die italienische Bevölkerung selten erlebt hatte.
In einer Nacht wurden ganze Dörfer zerstört, in den Städten die festesten Häuser abgedeckt, auf dem Mittelmeer gingen wie im Atlantischen Ozean zahllose Schiffe zu Grunde.
Nur in einer einzigen Nacht. Am Morgen ließ der Sturm schnell nach, ein furchtbarer Regenguss beruhigte schnell die empörte See.
Auch der Hafen von Fiumicino bot ein Bild der Zerstörung. Überall treibende Planken. Die kleine Jacht konnte nicht helfen, das musste der Landbevölkerung überlassen bleiben, sie ging in See. Von den Männern fehlte nur Lord Moore, der ohne Abschied davongegangen war, und Axel wusste nichts von seinem Aufenthalt zu erzählen.
»Ob das schwarze Schiff diesen Orkan, der aus Norden kam, an der felsigen Küste überstanden hat?«, fragte Axel einmal mit leisem Zweifel, als in der kleinen Kajüte das Mittagsessen aufgetragen wurde.
Diese Frage lag so nahe, auch der Zweifel, Axel war es so schwer gefallen, sie zu stellen, aber es musste doch einmal sein.
»Ja, wie soll ich das wissen? Wir werden ja sehen!«, lautete des Grafen etwas ungeduldige Antwort.
Auch dieser sonst so eiserne Mann zeigte einmal, dass er nervös sein konnte. Sein ganzes ruheloses Wesen drückte dies aus, selbst jetzt in der engen Kajüte, die nur drei Schritte erlaubte, musste er hin und her gehen.
Als es Mittag glaste, balancierte der schwarze Sam das Essen herein, für zwei Personen bestimmt. Axel saß schon, hatte sich festgeklemmt, der Graf aber verließ die Kajüte.
Erst nach zehn Minuten kam er wieder herein, doch nur, um einer Schublade etwas zu entnehmen, wollte gleich wieder gehen.
»Wollen Sie denn nicht essen?«
»Ich brauche nicht zu essen.«
»Nanu! Ich habe doch schon zweimal gesehen, wie es sich ganz trefflich schmecken ließen.«
»Ach, dass ich es tat!«, erklang es mit einem quälenden Seufzer zurück. »Habe ich Ihnen damals nicht gesagt, dass ich nur esse, um auch einmal die materiellen Freuden dieses Daseins zu kosten, weil ich die anderen Menschen deshalb manchmal beneide?«
»Und Sie brauchen wirklich nicht zu essen?!«, staunte Axel.
Dieses Staunen kam etwas spät. Vielleicht kam es nur daher, weil er geglaubt hatte, dass der Graf vor ihm die Maske habe fallen lassen, und nun band er sie plötzlich doch wieder vor. Einfach unberechenbar! Denn dass ein Mensch nichts zu essen und zu trinken brauche, konnte dieser kerngesunde Depeschenreiter eben am allerwenigsten begreifen.
»Ach, dass ich mich einmal und sogar zweimal dazu verleiten ließ, materielle Nahrung zu mir zu nehmen!«, erklang es nochmals so qualvoll, während der Graf in der Schublade wühlte.
»Hat denn dies etwa üble Folgen gehabt?«, fragte Axel ganz kleinlaut.
»Fällt Ihnen denn nichts auf?«
»Was?«
»Es ist zwölf Uhr — jetzt müsste ich doch eigentlich schon im Starrkrampf liegen.«
»Ich denke, von dieser regelmäßigen Pünktlichkeit sind Sie abgekommen, können sich jetzt Urlaub nehmen.«
»Ach, dass ich mich davon losgemacht habe!«, erklang es nach wie vor, nur immer verzweifelter. »Nun kann ich mich auch nicht mehr willkürlich in Starrkrampf versetzen.«
Und der Graf verließ die Kajüte.
Axel schüttelte den Kopf und aß, ganz in Gedanken versunken, auch die für den Grafen bestimmten reichlichen Portionen mit auf.
Der Tag verging, eine Nacht. Rastlos wanderte der Graf auf und ab, teils an Deck sich den überstürzenden Wogen aussetzend, teils in der engen Kajüte, in der er es niemals lange aushielt.
Ja, er war nervös geworden oder doch furchtbar unruhig.
Länger als vierundzwanzig Stunden hatte Axel den Grafen schon öfter nicht schlafen sehen, und er musste später bestätigen, was in dem Konversationslexikon noch heute zu lesen ist, dass nämlich den Grafen von SaintGernmin tatsächlich niemals jemand hat essen, trinken und schlafen sehen. Wir sagen also nicht, dass er es nicht getan hätte, sondern nur, dass ihn niemand dabei beobachtet hat. Und auch Axel, obgleich sich ihm gegenüber der Graf im Essen schon schwach gezeigt hatte, sollte deswegen noch Staunenswertes erleben. Jedenfalls besaß dieser Abenteurer die ganze Lebensfunktion aufhebende oder aber stärkende Mittel, von der die Menschheit heute noch nichts weiß; denn mit Arsenikessen allein wäre es da nicht abgetan gewesen.
Die Sonne eines neuen Tages rollte herauf, das Meer hatte sich ziemlich wieder beruhigt.
»Küste von Tunis!«
Kapitän Morphin machte eine geografische Ortsbestimmung, Axel lernte dabei, der Graf führte alle die umständlichen Rechnungen im Kopfe aus.
»Wir segeln gerade auf die Höhle los.«
Eine Stunde später konnte kein Zweifel mehr bestehen: Das schwarze Schiff lag nicht mehr vor der Höhle!
»Wohin kann es sich gewendet haben?«
»Es wird bei Einsetzung des Sturmes diesem entgegengefahren sein, mit Hilfe der Dampfkraft. Hier an dieser Küste konnte es ja gar nicht liegen bleiben, es wäre durch den Sturm darangeschleudert worden.«
»Alles nur Vermutungen, nichts als Vermutungen.«
In den Grotten brandete es furchtbar. Man durfte sich nicht so weit nähern wie damals.
»Dort treibt eine Planke!«
Es gelang, sich ihr so weit zu nähern, um sie auffischen zu können.
Schon die schwarze Farbe sagte viel — eine Bootsplanke.
Als Axel den Grafen anblickte, sah er ein entgeistertes Gesicht.
»Sie haben Boote ausgesetzt!«, hauchten die farblosen Lippen.
»Das ist nur die Planke eines einzigen Bootes, und dieses kann auch durch Sturzwellen weggeschlagen worden sein.«
»Das schwarze Schiff ist untergegangen!«
»Wie wollen Sie denn das behaupten? Und kann denn überhaupt auch diesem Schiffe so etwas passieren?«
Auch Axel war in einen großen Fehler verfallen. Aber er war verzeihlich. Die Maschine, die er gesehen, musste ja ganz wunderbare Vorstellungen von der ausübenden Kraft in ihm erweckt haben. Als die ersten wirklich brauchbaren Dampfschiffe aufkamen, glaubte die Menschheit auch gleich, nun könnten Schiffbrüche gar nicht mehr vorkommen, wenigstens keine Scheiterungen mehr. So ein Dampfschiff ist doch von Wind und Strömung unabhängig.
»Es war trotzdem ein natürliches Schiff, ein ganz natürliches«, flüsterte der Graf.
Weitere Trümmer waren nicht zu erspähen.
»Ich muss mir Gewissheit verschaffen, ich versuche es doch noch einmal«, murmelte der Graf und schloss sich in seiner Kabine ein.
Als er nach einer Viertelstunde wieder zum Vorschein kam, sah er nicht mehr blass aus, sondern sein Gesicht glühte, auf der Stirn perlten große Schweißtropfen.
»Nun?«
»Nichts!«
»Sie haben versucht, sich in Starrkrampf zu bringen?«
»Es gelang nicht, ich habe diese Gabe verloren, ach!«
Nie wieder hat Axel den Grafen so furchtbar niedergeschmettert gesehen.
»Haben Sie denn nicht das andere Mittel bei sich?«
»Um mich vollständig zu betäuben, somnambul zu machen, dass ich noch besser hellsehend werde? Ja, ich habe es in Pillenform bei mir, auch das Gegenmittel, aber, aber...«
Wie von einem geheimen Grauen erfasst, schüttelte sich der Graf, auch sein Gesicht verzerrte sich plötzlich.
»Um Gott, Graf, was haben Sie?«, rief Axel erschrocken.
»Ach, wenn Sie wüssten, was ich durchgemacht habe, diese Schmerzen!«
»Was, Schmerzen haben Sie damals durchgemacht? Ich sah wohl, wie Sie plötzlich ganz grün wurden, wie Sie taumelten...«
»Im Kopfe, hinterher im Kopfe! Ein schmerzhafter Zustand, der gar nicht zu schildern ist. Mein Hirn dehnte sich durch das ganze Weltall aus, und das bis in alle Ewigkeit. Furchtbar!«
Und der Graf zitterte noch einmal mit verzerrtem Gesicht an allen Gliedern.
»Ich denke aber, Monsieur Renard hat Sie öfter in diesen Zustand versetzt?«
»Ja, aber er hatte offenbar ein anderes Gegenmittel. Dieses hier habe ich nach meinen eigenen Spekulationen zusammengebraut, es wirkt doch nicht so...«
»Na dann natürlich wiederholen Sie dieses gefährliche Experiment nicht wieder!«
»Und doch, es muss sein, ich muss wissen, wo sich Ma... Ich muss über das Schicksal des schwarzen Schiffes beruhigt werden! Kommen Sie mit in die Kajüte!«
»Graf, ich bin überhaupt nicht für solche Hellseherei, wir wollen doch Gott dankbar sein, dass er uns Augen gegeben hat...«
»Es muss sein — kommen Sie mit in die Kajüte, fragen Sie mich aus!«
Der Graf ließ sich nicht bereden, schließlich war ihm Axel zu Willen.
In der Kajüte nestelte der Graf unter seinem Wams, füllte ein Glas mit Wasser, warf eine Pille hinein, eine andere verschluckte er, nachdem er sich zurechtgesetzt hatte. Er schloss die Augen, schien zu schlafen oder doch betäubt zu sein, aber diesmal wurde sein Gesicht gleich wieder ganz grün, außerdem von Schmerz entstellt.
»Hören Sie mich sprechen?«
»Ja — o — o!«
Und so wimmerte er weiter, offenbar von den furchtbarsten Schmerzen gefoltert. Herauszubringen war aus ihm nichts, und lange hielt sich Axel auch nicht auf, er rüttelte ihn, zwang ihn, das Wasser zu trinken, in dem sich die Pille unterdessen aufgelöst hatte.
Bald kam der Graf wieder zu sich, aber nur, um sich vor Schmerzen am Boden wie ein Wurm zu winden. Ein schrecklicher Anblick! Er wurde in seine Koje gepackt, Axel flößte ihm Rum ein, der auch bald eine wohltätige Wirkung ausübte, die Schmerzen ließen nach. Aber der Graf sah noch lange Zeit schrecklich aus, zitterte an allen Gliedern.
»Vorbei, vorbei«, stöhnte er, »mit mir ist es vorbei!«
Er meinte, dass er nun seine Sehergabe verloren habe, und in der Tat hat Axel auch Derartiges nie wieder an ihm beobachtet, der Graf fiel fernerhin nicht mehr in Starrkrampf, versuchte sich nicht wieder auf andere Weise in somnambulen Zustand zu setzen.
In den großen Konversationslexika liest man, wie der Graf von Saint-Germain öfter in Starrkrampf gefallen sei, in eine Art von Scheintod, während welcher Zeit sein Geist in den fernsten Gegenden umhergeschweift sei, auch in die Zukunft blicken konnte, wie er wenigstens behauptete, und in dem Abschnitt dieses vorliegenden Lexikons heißt es, was sich wohl auch in anderen wiederholen wird: »Und in der Tat hat er nach glaubwürdigen Berichten seiner Zeitgenossen den Tod Ludwigs XV. mit allen Einzelheiten vorausgesagt.«
Und Ludwig XV. starb bekanntlich in seinem 64. Jahre an einer höchst merkwürdigen Krankheit, an den Kinderblattern, er wurde in einer Mühle von einem Kinde angesteckt. Ein ganz merkwürdiger Fall bei so einem alten Manne. Und dass er an einer Kinderkrankheit sterben würde, hat der Graf von Saint-Germain ihm viele Jahre vorher prophezeit.
Das ist als Tatsache noch jetzt dokumentarisch nachzuweisen, steht also auch im Konversationslexikon, was doch immerhin etwas zu bedeuten hat. Nebenbei bemerkt, für den, den so etwas interessiert: In der Mitte des 16. Jahrhunderts lebte in Frankreich ein berühmter Astrologe, auch so ein Adept und Wundermann, zugleich aber auch ein bedeutender Arzt, Michel de Notre Dame, bekannter geworden unter seinem latinisierten Namen Nostradamus. Er hatte sich in einer Ruine bei Salon häuslich niedergelassen, als Eremit, schickte von hier aus seine Prophezeiungen schriftlich in alle Welt. Diese sind noch heute unter dem Namen ›Centurien‹ erhalten, allerdings in sehr spärlichen Exemplaren. Das Buch wurde 1781 in Rom öffentlich verbrannt, alle Exemplare, deren man habhaft werden konnte, wurden konfisziert und vernichtet, es ist katholischerseits noch heute verbotene Lektüre. Nämlich, weil darin der allmähliche Untergang des päpstlichen Reiches prophezeit wurde. Nun muss man aber wissen, was das damals zu bedeuten hatte, in der Mitte des 16. Jahrhunderts! Soll heute jemand einmal mit der Behauptung auftreten, das Deutsche Reich würde sich bald auflösen, die ganze germanische Rasse verschwinden! Das wäre genau dasselbe. Und dennoch, hat dieser Nostradamus nicht wahr gesprochen?
Außerdem nun prophezeite Nostradamus, noch heute in seinen ›Centurien‹ zu lesen, im Jahre 1552 geschrieben, dass der französische König Heinrich II. an einem Splitter im Auge sterben würde. Und am 1. Juli 1559 hatte dieser König in einem Turnier einen Waffengang mit dem Grafen Montgomery, nur ein unblutiges Kampfspiel, beider Lanzen zersplitterten, und dem König drang ein Spänchen ins rechte Auge: Zehn Tage später war er tot.
Solche Beispiele von eingetroffenen Prophezeiungen mit historischer Bedeutung gibt es noch viele.
Ganze Bücher gibt es. Aber unsere Zeit ist nicht danach, sich mit so etwas zu beschäftigen. Tut man es, so kommt man leicht in den Verdacht, ein Narr zu sein. Wir leben im Zeitalter der Bakterien und beschäftigen uns statt mit der Zukunft lieber mit der Vergangenheit des Affenmenschen. Da wir nun unsere Ahnen verspotten, so wird die ewige Gerechtigkeit bestimmen, dass dereinst unsere Enkelkinder auch uns auslachen werden.
Was aber nun die anderen Biografen erst von des Grafen Saint-Germain Prophezeiungsgabe zu berichten wissen! Unser Axel jedoch weiß hiervon nichts zu erzählen, nach ihm hat der Graf niemals einen Blick in die Zukunft getan, weder für sich noch für andere. Und was sein Hellsehen anbetrifft, so wurde sich auch dieser Biograf nicht klar, ob der Graf wirklich diese Gabe besaß oder ob er da nicht wiederum ein Schwindelchen getrieben hatte.
Allerdings hatte er ja auch Axel hiervon überzeugende Beweise gegeben. Aber ließ sich das nicht dennoch auf natürliche Weise erklären?
So war er im Geiste in jene Höhle eingedrungen, sogar auch die Felswand hindurch, in die Burg hinauf.
Musste er denn im Geiste wirklich dort gewesen sein? Konnte er sich das alles nicht zusammengereimt haben?
Oder konnte er, der vorzüglichste Schwimmer, der Höhle nicht in seinem materiellen Leibe einen Besuch abgestattet haben, man hatte von seiner Abwesenheit an Bord nur nichts gemerkt, seine schwarze Kleidung schützte ihn auch in der düsteren Höhle vor einer Entdeckung?
Diese Erklärung war etwas bei den Haaren herbeigezogen worden, zumal da der Graf dann diese Schwimmtour am hellen lichten Tage hätte ausführen müssen, wozu er doch lieber erst die Nacht abgewartet hätte — immerhin, es lag im Bereiche der Möglichkeit.
Oder aber der Graf hatte seine Kenntnisse von einem der hellsehenden Fakire, die sich an Bord befanden. Denn dass davon einige wirklich hellsehend waren, davon hatte sich Axel mit absoluter Gewissheit überzeugen lassen müssen, er zweifelte überhaupt nicht, dass es wirklich solche Menschen gibt.
Nur dass sich der Graf wieder einmal mit fremden Federn geschmückt hatte.
Doch sei dem, wie es sei — von jener Zeit wollte der Graf nichts mehr von der ganzen Hellseherei wissen, wenigstens nichts von seiner eigenen, behauptete, sie plötzlich verloren zu haben, und dabei war auch gleichgültig, ob er wirklich solche Schmerzen litt oder sich nur so stellte, was bei diesem Manne nämlich alles möglich war.
Und es war gut so, dass er seine magischen Fähigkeiten verloren hatte, wie er behauptete. Denn wenn der Graf nur die Fähigkeiten benutzt hätte, die die Natur ihm verliehen und die er bis zur höchsten Vollkommenheit ausgebildet hatte, so wäre er noch ein ganz anderer Mann gewesen, ein wirklicher, untadelhafter Mann vom Scheitel bis zur Sohle — — —
»Zu diesem Versuche bringen Sie mich nicht mehr!«, sagte Axel, als sich der Graf noch immer in Schmerzen wand.
»Es ist auch nicht nötig — ich habe diese Gabe verloren — ich weiß es.«
»Na dann desto besser.«
»Wo aber ist das schwarze Schiff?«
»Entweder auf oder unterm Meere.«
»Wenn sie untergegangen wären!«
»Wäre Ihnen das ein so unersetzlicher Verlust?«
»Nicht meine Bücher, mein Laboratorium — aber — aber — die Menschen, die Unglücklichen!«
Axel wusste nicht, wer an Bord dem Grafen so ans Herz gewachsen gewesen wäre. Mit dem Kapitän Römer schien er sich nicht gut gestanden zu haben. Dass der Graf mit der rothaarigen Lady ein Verhältnis gehabt habe, hielt er wohl für möglich, daher wohl auch des schwarzen Kapitäns Antipathie gegen den neuen Herrn, aber ein so gar inniges konnte das wohl auch nicht gewesen sein. Diese Lady Isabel war ein ebenso schönes wie kaltes Weib gewesen, mehr brauchen wir von ihr nicht zu sagen, da sie in unserem Romane nie eine Rolle gespielt hat und nicht wieder vorkommt, so tief sie auch in des Grafen Leben eingegriffen hat. Denn ohne dieses Weib wäre der Graf jetzt wohl noch in Rom gewesen.
Und von Marietta und dem Adoptivkinde hatte Axel damals noch keine Ahnung.
Aber natürlich war es eben Marietta, deren Schicksal den Grafen so tief bekümmerte. Nur Gewissheit wollte er haben!
Aber wo sich diese holen? Man musste in die Höhle, in die Burg eindringen, in der man die siebzehn arabischen Frauen und ihre Kinder zurückgelassen hatte, und laut Verabredung mit dem schwarzen Kapitän hatte es auch dabei bleiben sollen. Nahrungsmittel hatten sie darin im Überfluss, und es würden sich schon wieder Piraten einstellen, die sie abholten, wenn sich das schwarze Schiff nur erst wieder entfernt hatte.
Diese Frauen konnten doch vielleicht den Untergang oder hoffentlich die Abfahrt des schwarzen Schiffes bemerkt haben, da gerade die Fenster der Frauengemächer nach dem Meere hinausgingen. Oder aber — auch Piraten konnten es beobachtet haben, die sich unterdessen in der Burg wieder eingefunden hatten, den Ankommenden diesmal einen warmen Empfang bereiteten. Hiermit hatte man zu rechnen.
Trotzdem, es musste riskiert werden, obgleich es in der Höhle jetzt ganz gefährlich aussah und durch die Brandung auch wirklich war.
Kaum, dass von der verankerten Jacht ein Boot ausgesetzt werden konnte, ohne dass es zersplitterte, und von den Matrosen konnten nur zwei entbehrt werden.
Das Wagnis gelang, und als man erst aus der zurückprallenden Brandung war, ging das Boot wiederum glatt durch die Höhle hindurch, obgleich in derselben das Wasser zu toben schien.
Tiefste Finsternis empfing sie, und jetzt hatten sie keinen elektrischen Scheinwerfer, die mitgenommene Blendlaterne vermochte die mit Wasserstaub erfüllte Atmosphäre kaum zu durchdringen.
Die Hauptsache aber war, dass sie kein Schuss, kein Feind empfing, der die kühnen Bootsfahrer aus dem Hinterhalt im Nu hätte kaltmachen können.
Axel wie der Graf waren jeden Augenblick bereit, sich über Bord zu stürzen, um so dem Feinde von der Seite beizukommen.
Es war nicht nötig. Sie erstiegen die Galerie, drangen mit aller Vorsicht in die Burg hinauf. Kein Mensch zu finden. Auch die arabischen Frauen hatten mit ihren Kindern die Burg verlassen, auf der Landseite, was sich aus der offen gebliebenen Tür ergab. Ob sie abgeholt worden waren, ließ sich nicht erkennen, so genau Axel als amerikanischer Pfadfinder deshalb auch nach Spuren suchte. Man musste annehmen, dass sich die Frauen eben allein entfernt hatten.
Wohin? Von hier oben aus, wo man doch die weiteste Fernsicht hatte, war kein Mensch zu erblicken, nichts als die gelbe Wüste, und auf der Wasserseite auch kein Schiff, kein Fahrzeug.
Es ging wieder an Bord, die Jacht segelte nach Adar. Das Dorf war noch immer verlassen.
Die Nacht war angebrochen. Die Jacht lag noch vor Adar vor Anker.
»Mister Axel, der Graf möchte Sie sprechen«, meldete ein Matrose dem an Deck Befindlichen.
Axel begab sich hinab in die Kajüte, in der sich der Graf schon seit langer Zeit befand, im Scheine der Petroleumlampe seinen Gedanken nachhängend.
»Signor Axel, ich muss Sie sprechen.«
»Bitte.«
»Glauben Sie, dass das schwarze Schiff untergegangen ist, hier an dieser Küste oder sonst wo?«
»Wie soll ich das wissen! Die Bootsplanke, die wir fanden, sagt gar nichts. Der Sturm war freilich danach.«
»Mit der Dampfkraft konnte es nicht dagegen aufkommen.«
»Das müssen Sie besser wissen als ich.«
»Signor Axel — ich habe meine Hellsehergabe verloren — ich weiß es — für immer.«
»Das, dächte ich, wäre doch bereits erledigt.«
»Sie sind recht kurz.«
»Umso besser lässt sich das erledigen, was Sie mit mir zu erledigen haben.«
»Ich möchte fast glauben, dass sich das schwarze Schiff entfernt hat, mit der Absicht, wir sollen an einen Schiffbruch denken.«
»Woraus schließen Sie das?«
»Ich habe meine Verdachtsgründe.«
»Welche? Wenn Sie mich einweihen wollen, müssen Sie auch ganz offen sprechen.«
»Was für Personen dieser Kapitän Römer und seine Stiefschwester und alle die übrigen Männer, die an Bord waren, sind, habe ich Ihnen ausführlich geschildert, soviel ich selbst wusste, das heißt, soviel sie mir selbst offenbarten. Kapitän Römer ist nur dem Namen nach ein Deutscher, Lady Isabel nur dem Namen nach eine Engländerin. Es sind selbstständige Insulaner, auf einer Insel irgendwo geboren und groß geworden, wohl sonst mit aller Welt vertraut, aber doch sich ganz selbstständig entwickelt habende Menschen.«
»Ja, dass es ganz eigentümliche Charaktere sind, bemerkte ich selbst«, bestätigte Axel, »und das gilt von jedem einzelnen Matrosen.«
»Sie haben mich ausgesucht, um von mir die alten Handschriften und meine sonstigen Kenntnisse zu bekommen, die mir Monsieur Renard beigebracht hat, die ihnen selbst abgingen, wir wollten uns gegenseitig ergänzen, so, wie ich Ihnen schon geschildert habe. Meine Bibliothek und mein Laboratorium, vor allen Dingen die höchst kostbaren Chemikalien, haben sie denn auch richtig bekommen, und meine sonstigen Kenntnisse... die standen ja alle in jenen Büchern.«
»Und nun, meinen Sie, hat diese Gesellschaft Sie nicht mehr nötig, hat Sie kaltgestellt«, ergänzte Axel.
»Fast will es mich so dünken.«
»Wie kam es denn, dass man Sie gleich als Herrn anerkannte?«
»Nun, um ganz mein Vertrauen zu gewinnen.«
»Aus sonst keinem anderen Grunde?«
»Doch. Sie haben Lady Isabel kennen gelernt?«
»Ich habe zweimal an ihrem Tische gespeist — mit Ihnen zusammen.«
»Weh mir, dass ich es tat!«
»Ah bah! Es freut mich, dass Sie es sich schmecken ließen, und hoffentlich tun Sie das noch öfter, nicht nur alle Jahre zweimal.«
»Was sagen Sie zu dieser Lady?«
»Sie haben mit ihr ein Verhältnis gehabt.«
»Ja«, gestand der Graf jetzt.
»Ein richtiges Liebesverhältnis?«
»Ja.«
»Wie ist das so schnell gekommen?«
»Gott, wie das so kommt! Gleich vom ersten Blick an. Doch muss ich, ohne irgendwie renommieren zu wollen, sagen, dass dies ganz auf der Seite Isabels lag.«
»Hm, ich verstehe«, brummte Axel. »Wenn Sie nicht in Rom so zurückhaltend gewesen wären, hätten Sie schon dort die schönsten Abenteuerchen erleben können, und dabei wäre nicht nötig gewesen, dass Sie so als Wundermann galten. Sie sind überhaupt der richtige Mann danach, Weiberherzen zu entflammen. Waren Sie denn, erlauben Sie mir jetzt offen zu sprechen, bei der rothaarigen Lady der erste?«
»Ja.«
»Kommt da nicht der Kapitän Römer in Betracht, der sich ihr als Stiefbruder vielleicht ungestraft nähern durfte, wenn ein ganz selbstständiger Insulaner darin überhaupt etwas Strafbares sieht?«
»Jetzt kommen wir darauf! Haben Sie nicht bemerkt, dass Kapitän Römer die Lady mehr liebte als eine Schwester?«
»Mit keinem Auge, wohl aber, dass er eine Antipathie gegen Sie hatte.«
»Das haben Sie gemerkt?!«, rief der Graf überrascht.
»Wenigstens, wie er Ihnen in jeder Weise aus dem Wege ging.«
»So ist es, so war es! Das ist auch der einzige Grund, aus dem ich auf seine Liebe zu der schönen Stiefschwester schließe.«
»Sonst haben Sie nichts davon erfahren?«
»Gar nichts.«
»Die Lady wusste selbst gar nichts davon?«
»Schwerlich.«
»War sie Ihnen gegenüber denn nicht offen?«
»Das... ist schwer zu sagen. Es war eben ein ganz, ganz merkwürdiges Weib — außerhalb aller Welt stehend, nur in ihrer eigenen lebend — wie ja auch alle jene Männer.«
»Und nun glauben Sie, dass Kapitän Römer der Urheber ist, dass das schwarze Schiff von hier abgesegelt ist, ohne Ihre Rückkunft zu erwarten, ohne etwas zu hinterlassen?«
»Das ist meine feste Überzeugung.«
»Und die Lady?«
»Die hatte nichts zu sagen.«
»Ich denke, sie ist als richtige Tochter des Sir Dalton die eigentliche Herrin.«
»Nur dem Namen nach.«
»So wäre sie gezwungen worden, dem Plane beizustimmen.«
»Ja, was sollte sie denn dagegen tun? Höchstens über Bord springen. Sie ist einfach eingeschlossen worden. Das sind doch auch nur Menschen, wenn sie auch etwas mehr gelernt haben.«
»Hm, da hat man Sie also, nachdem man von Ihnen bekommen, was man von Ihnen haben wollte, einfach kaltgestellt.«
»Anders ist es nicht.«
»So glauben wenigstens Sie, Herr Graf.«
»Wie soll es denn anders sein!«
»Das Schiff kann doch auch untergegangen sein!«
Der Graf sprang auf, um in dem engen Raum einige Schritte zu machen.
»Nein, ich — ich — ich... weiß es bestimmt, dass es auf und davon gegangen ist, dass jener Mann wohl aber gern möchte, ich soll an einen Schiffbruch glauben!«
»Woher wissen Sie das so bestimmt?«
»Ich — ich — ich... habe so eine ganz bestimmte Ahnung.«
»Sind Ihre Ahnungen immer ebenso zutreffend, wie Ihr Hellsehen, von dessen Richtigkeit ich mich überzeugen lassen musste?«
»Das nicht — das ist ja etwas ganz anderes — aber — es ist doch eine so felsensichere Ahnung!«
»Hm, wenn es sich um eine solche Ahnung handelt, wie sie jeder Mensch einmal hat — dann gebe ich nicht viel darauf. Auch ich habe in meinem Leben schon öfter Ahnungen gehabt, und ich hätte doch gleich meinen Kopf auf den Block gelegt, dass sie sich erfüllen müssten — ja, manchmal traf es zu, öfter noch aber hätte ich meinen Kopf verspielt. Es kommt mir überhaupt merkwürdig vor, dass jemand, der sich einer Verbindlichkeit entledigen will, so einfach ohne Abschied davongeht — und hier handelt es sich doch noch dazu um ein mächtiges, ganz auffallendes Schiff!«
»Ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass man mir die Lage jener Insel vorenthielt.«
»Ja, mit welchen Gründen konnte man das eigentlich Ihnen als dem anerkannten Herrn gegenüber verheimlichen?«
»Man sagte, in diese Mysterien würde jeder nur unter gewissen Zeremonien eingeweiht — nicht, dass das gerade unbedingt nötig sei, aber eben so Sitte, eine gewisse Feierlichkeit, von Sir Dalton eingeführt, es handelt sich hierbei doch ebenfalls um eine geheime Sekte, in der nächsten Vollmondnacht würde ich alles erfahren...«
»Aha, das genügt mir, nun verstehe ich schon! Und dieser Kapitän Römer hat den Vollmond eben nicht abgewartet, nicht einmal den halben — ist schon vorher auf und davon gegangen.«
»So ist es, der Lump hat mich betrogen.«
»Halt, Graf, da muss ich diesen Kapitän mit dem deutschen Namen doch erst noch in Schutz nehmen. Ihr belastender Verdacht beruht vorläufig nur auf einer ganz haltlosen Ahnung!«
Der Graf begnügte sich, die Achseln zu zucken.
»Also vorläufig nicht wieder solch eine Beleidigung, ehe Sie nicht Gewissheit haben.«
»Ich bedauere bereits, dieses Wort gebraucht zu haben.«
»War denn auch Ihre Geliebte — ich will diese Lady gleich so nennen — Ihnen gegenüber zurückhaltend?«
»Die wusste selbst nicht, wo jene Insel liegt. Im Stillen Ozean, eine Koralleninsel. Lady Isabel hatte von der ganzen Nautik und was damit zusammenhängt, absolut keine Ahnung, also auch nicht von geografischen Ortsbestimmungen. Sonst hätte sie es mir mitgeteilt.«
»Und Sie meinen nun, das schwarze Schiff geht nach dieser geheimnisvollen Insel zurück, um sie sobald nicht wieder zu verlassen?«
»Nein, das wird es nicht tun.«
»Sondern?«
»Hierüber konnte mir Isabel Verschiedenes mitteilen. Zunächst erwähnte ich, dass der alte Sir Dalton ein leidenschaftlicher Raritätensammler gewesen ist. Ja, das alles, was er da angelegt hat, entspringt eigentlich erst dieser Leidenschaft. Er hat die ganze Welt bereist, nur um alle Seltenheiten zusammenzuschleppen, die für ihn erreichbar waren, nur zu diesem Zwecke hat er auch dieses Schiff gebaut, es mit einer Dampfmaschine ausgerüstet, um schneller und bequemer in der Welt umherfahren zu können. Jene Insel hat ein Museum, viele Museen, und nach dem, was mir Isabel erzählte, muss es wunderbar sein, was diese Museen schon alles enthalten. Auf Einzelheiten kann ich mich hier gar nicht einlassen. Sir Dalton hat ganze Denkmäler nach seiner Insel geschafft, und das aus aller Welt. Ich erwähne nur, dass er aus Ägypten ganze, mächtige Obelisken per Schiff hinübergebracht hat, und wäre es möglich, eine Cheopspyramide abzubrechen und mitzunehmen, er hätte auch das getan. So hat er aber auch die Westküste von Grönland besucht, welche bekanntlich zur Zeit, da sie von isländischen Schiffen zuerst entdeckt wurde, noch im sommerlichen Grün prangte, wodurch eben der Name Grünland entstand, im Gegensatz zu Island, und die Isländer errichteten dort ganz mächtige Steinbauten, die man noch jetzt findet, wenn man nur unter das Eis und den Schnee dringen kann. Selbst solche grönländische Reste einer verschollenen Kultur und eines vergangenen Klimas hat Sir Dalton nach seiner Insel gebracht, da können Sie also sehen, was für Fahrten er deshalb gemacht hat — und seine Erben setzen das nun fort, Kapitän Römer ist ein nicht minder wütender Raritätensammler.
Überhaupt hatte es Sir Dalton immer auf alte Ruinen abgesehen, Kapitän Römer jetzt nicht minder. Es gibt ja zahllose Städte, Zeugen vergangener Macht und Herrlichkeit, die jetzt in Trümmern liegen, gar nicht mehr an der Erdoberfläche sichtbar sind, obwohl sonst noch manches wohlerhalten sein mag. Denken Sie nur an Pompeji und Herculaneum, da kommen aber Städte aus noch viel, viel früheren Zeiten in Betracht, denken Sie an Babylon, Tyrus und Sidon, an Troja, an Karthago, an das ägyptische Theben — ach, da kann man ja gar nicht aufzählen, und nun Indien, die malaiischen Inseln, was für Trümmer von Städten die enthalten!
Was mag nun zwischen und unter diesen Trümmern noch alles enthalten sein, an Schätzen und sonstigen Merkwürdigkeiten, was den Plünderern seinerzeit entgangen ist! Denn in jeder Stadt liegt doch etwas vergraben, das Vergraben war ja früher noch viel mehr Sitte als heute, denken Sie an Geldmünzen, an Familienreliquien, an Tempelheiligtümer und dergleichen. Fürwahr, es muss höchst interessant sein, da Nachforschungen zu halten. Wenn das nur nicht so außerordentlich schwierig wäre! Diese Ruinen sind doch schon gründlich untersucht worden, besonders in neuerer Zeit, von Engländern — aber das Resultat war immer ein höchst dürftiges. Eben alles verschüttet, die Ausgrabungen erforderten gar zu ungeheuerliche Anstrengungen und Kosten, es lässt jemand sein ganzes Leben lang viele Hunderte von Arbeitern graben, um — zuletzt vielleicht ein Bronzemesser zu finden oder auch absolut nichts.
Ja, wenn man nur immer wüsste, wo man zu graben hätte! Nun, hierzu kannte Sir Dalton ein Mittel. Er sammelte nicht nur tote Raritäten, sondern auch lebendige Menschen, die sich durch irgendeine besondere Gabe vor allen anderen auszeichnen. Sie haben solche ja selbst an Bord gesehen — hellsehende Fakire und dergleichen. Und auf jener Insel soll, wie mir Isabel berichtete, noch ein ganzes Museum von solchen lebendigen Raritäten sein.
Was hierbei in Betracht kam, waren Hellseher. Sir Dalton hat sich solche zu verschaffen gewusst, hauptsächlich in Indien. Gelang es nicht seiner Überredungskunst, dass sie ihn begleiteten, so wurden sie dazu gezwungen. Auch der Mann in der Truhe, der Paramahamsa, ist einfach aus einem indischen Kloster geraubt worden. Darauf kam es dem Sir Dalton gar nicht an.
Mit Hilfe dieser Hellseher also suchte er in das Innere solcher Ruinen einzudringen, geistig, mit geistigen Augen, von seiner Insel aus. Das ist natürlich nicht so einfach. Es hat eben alles seine Grenzen, Unnatürliches gibt es auch in dieser Beziehung nicht. Solch einem indischen Fakir konnte nicht einfach gesagt werden: Versetze dich nach dem alten Troja, durchstöbere im Geiste die Ruinen — was siehst du? Nein, so geht die Sache nicht. Da versagt auch die größte Hellsehergabe. Da muss der Fakir überhaupt etwas von Troja wissen. Es hat nicht einmal viel Zweck, ihn mit an Ort und Stelle zu nehmen. Entweder der Somnambule sieht überhaupt nichts, oder er phantasiert aus sich selbst etwas heraus, was sich dann eben als Trug erweist. Ich kenne das ja alles von mir selber.
Trotzdem, es ist möglich. Nur gehört dazu eine ganz besondere Methode. Lady Isabel schilderte mir ungefähr, wie es ihr Vater machte, um trotzdem zum Ziele zu gelangen. Es ist ein Frage- und Antwortspiel. Ich will es Ihnen nicht schildern, kann es nicht. Ich selbst verstand es nicht, weil auch Isabel es mir nicht deutlich genug erklären konnte.
Kurz, durch so ein kompliziertes Frage- und Antwortspiel erlangte Sir Dalton von den hellsehenden Fakiren betreffs der Ruinenstädte zuletzt doch noch erstaunliche Resultate. Die Somnambulen erblickten während ihrer geistigen Wanderung durch unterirdische Gänge, deren Schutt kein Hindernis bot, Schätze und Götzen und dergleichen.
Aber dieses Resultat genügte noch immer nicht. Die Somnambulen konnten niemals angeben, wo denn das läge, was sie erblickt hatten, weder im Schlafe noch im wachen Zustande, auch nicht an Ort und Stelle. Es wäre doch immer noch ein planloses Nachgraben gewesen.
»Da, im letzten Jahre seines Lebens, erhielt Sir Dalton einen anderen Somnambulen zugeschickt, einen finnischen Steuermann, der durch eine schwere Kopfverletzung nach langer Krankheit somnambul geworden war — epileptisch, sagten die Ärzte, aber der erfahrene Dalton fand bald etwas anderes heraus. Und der finnische Steuermann besaß die Gabe, auch im Traume an jeder Stelle, an die er sich geistig versetzte, geografische Ortsbestimmungen zu machen, die an Richtigkeit nichts einbüßten. Halten Sie das für möglich?«
»Ich muss es wohl, wenn Sie es sagen«, entgegnete Axel.
»Der Mann träumte, er habe einen Sextanten in der Hand, die Logarithmentafeln und was sonst noch dazu gehört, träumte, er spiegele nach der Sonne, mache seine Berechnung — und wenn er erwachte, gab er die geografische Lage des Ortes an, in Zahlen, bis zur Zehntelsekunde. Halten Sie das für möglich?«
»Gesetzt den Fall, der Steuermann hatte noch gar nichts von dem Chimborazo im südamerikanischen Staate Ecuador gehört, auch Dalton kannte durchaus nicht seine geografische Lage, und er verlangte, der Steuermann soll sich im Traume aus den Gipfel des Chimborazos versetzen — der Mann machte im Traume mit eingebildeten Instrumenten eine geografische Berechnung, die sich dann als richtig erwies?«
»Bis zur Zehntelsekunde — halten Sie das für möglich?«, fragte der Graf noch einmal, weil es ihm wohl selbst etwas gar zu ungeheuerlich vorkam.
»Ich habe in Ihrer Gesellschaft schon Wunderbares genug mit eigenen Augen gesehen, dass ich an nichts mehr zweifle.«
»Es ist so. Wenigstens, wenn ich dem Bericht Glauben schenken darf. Freilich war das nicht so einfach. Eine ganz verzwickte Verbindung zwischen dem Hellsehen eines arabischen Fakirs oder Derwischs mit der träumenden Berechnung des Steuermannes war dazu nötig. Aber auf diese Weise wurde das phänomenale Wunder vollbracht. Auf jener Insel. Dass es stimmte, konnte ja schon dort erwiesen werden, eventuell auf anderen Inseln, und dann ja auch der Landkarte nach. Aber man vergrub auch irgend etwas, der Derwisch sah es im Traume, der Steuermann berechnete im Traume die Lage bis zur Zehntelsekunde, und zwar wurde die wirkliche Berechnung erst hinterher vorgenommen, sodass auch eine Gedankenübertragung, die so oft täuscht, ganz ausgeschlossen war.
Ein halbes Jahr hat Sir Dalton mit diesen beiden experimentiert. Immer auf jener Insel. Er war sehr leidend, konnte keine Seereise antreten, hoffte aber immer auf Besserung. Inzwischen nahm er alle hauptsächlichsten der Ruinenstädte in aller Welt durch. Dann starb der Steuermann, ein Ersatz für ihn war nicht vorhanden. Und dann folgte ihm Sir Dalton selbst nach. Nun hat sein männlicher Erbe, sein Stiefsohn Kapitän Römer, die Weltreise angetreten, um alles das zu untersuchen, was der Steuermann angegeben hat.«
»In den Ruinenstädten Nachgrabungen zu halten?«
»Wenigstens hauptsächlich handelt es sich um verschüttete Städte. Aber auch noch um vieles andere.«
»Und was ist da alles von dem Steuermann erblickt worden?«
»Darüber konnte mir Isabel nichts berichten. Sie kümmerte sich um so etwas absolut nicht.«
»Merkwürdig!«
»Sie lebt in einer eigenen Welt — ich will Ihnen gleich sagen: Sie war bigott, wenn Sie das vielleicht auch nicht so gemerkt haben. Jedenfalls kümmerte sie sich nicht um die Welt.«
»Und Kapitän Römer, sagte der Ihnen nichts davon?«
»Mit dem habe ich mich auf so etwas gar nicht eingelassen. In der nächsten Vollmondnacht sollte ich ja in alles eingeweiht werden, und ich bin doch nicht etwa ein ungeduldiges Kind, das den Weihnachtsmann nicht erwarten kann.«
»Oder wissen Sie wenigstens, ob solche Ruinen untersucht worden sind?«
»Nein, das ist nicht geschehen. Von jener Insel im Stillen Ozean ist es ohne Aufenthalt um das Kap der guten Hoffnung herum hierher gegangen, direkt nach Rom.«
»Weshalb das?«
»Weil es erst galt, in den Besitz meiner Person zu kommen, oder vielmehr in den meiner Bibliothek und sonstigen Geheimnisse. Meine Bücher hat man nun — mich selbst hat man als eine unbedeutende Nebensache erkannt.«
»Und Sie meinen, jetzt gehe das Schiff nun auf die Suche nach jenen angegebenen Punkten?«
»Ohne jeden Zweifel.«
»Ja, wenn wir nur wüssten, was für Punkte das wären!«
»Ich weiß es.«
»Was, das wissen Sie?!«, rief Axel mit großen Augen. »Und da halten Sie mich so lange hin?!«
»Ein Zufall hat mir die Erkenntnis in die Hand gespielt — glaube ich wenigstens.«
Der Graf hatte wieder einen Gang durch die Kajüte gemacht, als er wieder vor Axel stand, hatte er ein Stück Papier in der Hand, einen halben Briefbogen, auf dem Axel, so weit es jetzt möglich war, Zahlen zu erkennen glaubte. Das ganze Papier war auf beiden Seiten mit winzigen Zahlen eng bekritzelt.
»Lassen Sie sich erzählen. Es war kurz vor Ihrer Rückkehr von jener Exkursion nach Adar. Ich hatte eben der Lady Salon betreten, wollte ihr etwas Schriftliches zeigen, das ich in meiner Brieftasche hatte. Also, noch während des Eintretens zog ich die Brieftasche hervor. Ich bemerkte, dass kurz vor mir Kapitän Römer der Lady eine sachliche Meldung gebracht hatte. In dem Augenblick, da ich zu sprechen beginnen wollte, erklang der Ruf, dass die Jacht zurückkäme. Das war jetzt das Wichtigste, ich eilte sofort wieder hinaus, die Brieftasche, die ich schon geöffnet hatte, schnell wieder einsteckend. Da rief mir die Lady nach, ich hätte etwas verloren. Ich drehte mich um — richtig, hinter mir, unter dem Tische, von der lang herabhängenden Decke halb verborgen, lag ein Stück Papier. Es ist zwar nicht meine Gewohnheit, etwas aus der Brieftasche zu verlieren — aber ich bin doch auch ein irdischer Mensch, warum soll mir das nicht auch einmal passieren! Also, ich hob das Papier auf, steckte es unbesehen in die Brieftasche, ging hinauf, um Sie zu empfangen. Es kam gleich die Sache mit der Fürstin.
An das Papier dachte ich gar nicht mehr. Weshalb auch? Erst vorhin kam mir die Erkenntnis. Ich habe etwas aus meiner Brieftasche zu nehmen — da erblickte ich dieses Papier hier. Was ist das? Lauter Zahlen, offenbar geografische Ortsbestimmungen, von einer fremden Hand geschrieben? Doch nein, keine fremde Hand! Ich habe schon wiederholt Kapitän Römers Handschrift gesehen, ihn ja beim Rechnen beobachtet. Die Zahlen sind von ihm. Lauter geografische Ortsbestimmungen, die meisten bis zur Zehntelsekunde. Und da kam nur natürlich die Erkenntnis. Das sind die aufzusuchenden Punkte, die Sir Dalton mit Hilfe des Derwischs und des finnländischen Steuermannes bestimmt hat!«
Axel hatte den Zettel in die Hand bekommen, er wurde von einer großen Erregung befallen.
»Donnerwetter, Donnerwetter, da gäbe es eine höchst interessante Aufgabe zu lösen! Diese Angaben erstrecken sich ja über die ganze Erde!«
»Wie ich sagte — Sir Dalton hat die ihm zur Verfügung stehenden geistigen Augen über die ganze Welt geschickt.«
»Aber diese Masse, das sind doch fast...«
»Sie brauchen nicht erst zu zählen, ich habe es vorhin bereits besorgt — es sind zweihundertundvierzehn Bestimmungen.«
»Zweihundertundvierzehn!«, wiederholte Axel staunend.
»Nun ja, in einem halben Jahre konnte da wohl viel gemacht werden.«
»Und meistens handelt es sich um solche alte Ruinenstädte?«
»Das weiß ich nicht — und doch, bei einigen habe ich mich auf der Karte überzeugt — zum Beispiel auch die alte Lage von Troja bezeichnet gefunden.«
»Und hier, hier... eine Karte — wo ist eine große Weltkarte?«
Auf dem Tische lag noch ein großer Atlas, den der Graf schon benutzt hatte.
»Nach Pariser Zeit, nicht wahr?«, fragte Axel, während er eine Karte aufschlug.
»Es wurde hier immer nach Pariser Meridian gerechnet, und bei Troja zum Beispiel stimmte das auch ganz genau.«
»Ja, aber hier, hier... 42. Längengrad, 36. Breitengrad — dieser Punkt läge ja mitten im Atlantischen Ozean!«
»Nun, da könnte eine Insel in Betracht kommen.«
»Die ist aus dieser Karte nicht angegeben.«
»Nur eine ganz kleine, nur eine Klippe.«
»Nein, gerade dieser Teil des Ozeans ist schon erforscht, das sagen ja schon alle die Tiefenzahlen. Da ist auch keine unterseeische Klippe vorhanden.«
»Nun, dann liegt dort eben etwas auf dem Meeresgrund.«
Ganz gespannt blickte Axel auf.
»Ein Wrack? In erreichbarer Tiefe? Der Untersuchung wert!«
»Ja, geehrter Signore, was weiß denn ich? Vielleicht ein Wrack, vielleicht auch etwas anderes. Jedenfalls aber etwas, was des Aufsuchens wert ist.«
»Donnerwetter, Donnerwetter«, murmelte Axel nochmals, »das wird ja höchst interessant, diese Punkte alle aufzusuchen! Denn das werden Sie doch tun, Graf, was?«
»Sicher. Wenn auch aus einem anderen Grunde als Sie.«
»Aus welchem Grunde?«
»Nun, um diesem schwarzen Schiffe wieder zu begegnen.«
»Weil der Kapitän, wie Sie wenigstens annehmen, Ihnen mit den Piratenschätzen durchgegangen ist?«
Es war doch fast merkwürdig, dass über diese Schätze zwischen den beiden noch kein einziges Wort gesprochen worden war! Sie hatten noch gar nicht an diesen Verlust gedacht. Die beiden waren in Bezug auf Geld und Geldeswert eben ganz gleiche Charaktere. Der Graf von Saint-Germain hat erwiesenermaßen für alle seine Dienste, die er anderen leistete, niemals etwas verlangt, hat niemals etwas angenommen, und Axel hatte ja selbst gesagt, dass er nur hin und wieder die Tasche voll Geld brauche. Diese seine letzten Worte hatte er auch in fragendem Tone gestellt.
,»Bah«, lautete denn auch die Antwort des Grafen» ,was kümmern mich diese goldenen Spielereien! Nein, ich will von diesem Kapitän meine...«
Kurz brach er ab. Auch dieser sein selbsterwählter Biograf sollte von ihm nicht so bald etwas von seiner Marietta erfahren.
»Zur Rechenschaft muss ich ihn aber doch stellen«, ergänzte er, »das ist doch ganz selbstverständlich.«
»Mir will es nicht in den Kopf, dass dieses Schiff nicht untergegangen ist, sondern uns nur so einfach in Stich gelassen hat«, meinte Axel, aber ganz in die Karten versunken.
»Und ich sage Ihnen: Es ist nicht untergegangen, es ist nicht untergegangen!!«, rief der Graf in schwer verständlicher Leidenschaftlichkeit — eben weil er noch nichts von seiner Marietta erzählt hatte, und dass das Verhältnis mit der Lady Isabel kein gar so inniges gewesen sein konnte, wenigstens nicht von seiner Seite aus, das hatte, wie schon gesagt, Axel von vornherein erkannt, das hatte der Graf ja selbst bestätigt.
Doch Axel war eben so in die Karten vertieft, dass er dieser Leidenschaftlichkeit keine besondere Beachtung schenkte.
»Nun, mir recht, — hoffentlich trügt Sie Ihre Ahnung nicht.«
»Niemals niemals!! Und ich muss dieses schwarze Schiff wiederfinden, und mag es sich noch so maskieren, ich werde es sofort wiedererkennen!«
»Eine ganze Menge von Punkten liegt mitten im Meere — oder auch an Küsten — aber doch im Wasser, und das in den verschiedensten Gegenden der Erde.«
»Es wird sich wohl um gesunkene Schiffe handeln.«
»Hat die Lady Ihnen nichts von solchen gesunkenen Schiffen erzählt, die man aufsuchen wollte?«
»Nein.«
»Nun, das wird sich ja finden. Höchst interessant, höchst interessant! Jetzt bekommt mein Leben eine ganz neue Richtung, ich fühle endlich etwas wie einen Daseinszweck vor mir aufsteigen. Warum mögen einige der Zahlenreihen unterstrichen sein?«
»Das habe ich selbst vorhin getan. Es sind sieben geografische Ortsbestimmungen, die sich nur auf Inseln der Südsee beziehen können, und darunter wird wohl auch der geheime Heimathafen des schwarzen Schiffes sein.«
»Richtig, diese Zahlen beziehen sich auf die Südsee! Sind aber alle ziemlich weit voneinander getrennt.«
»Schadet nichts, wir werden sie alle einzeln aufsuchen.«
»Was ist aber nun der uns nächste geografisch bestimmte Punkt? Diese ungeheuer vielen, nur so gekritzelten Zahlen — wenn man länger draufsieht, laufen die ja wie Ameisen durcheinander.«
»Auch das habe ich bereits konstatiert — hier, diese ist es.«
Der Graf hatte sich in dem Gewirr sofort zurechtgefunden, deutete mit der Bleistiftspitze aus die betreffende Zahl.
»Siebenunddreißig Grad nördliche Breite, elf Grad östliche Länge«, las Axel verwundert, die Minuten und Sekunden, letztere auch noch eine Dezimalstelle habend, auslassend. Ja, das muss doch hier in unserer allerdichtesten Nähe sein!«
»Gewiss, wir sind hier keine drei englische Meilen davon entfernt«
»Und was kommt denn da in Betracht?«
»Sie brauchen nicht erst nachzusehen, ich habe es bereits getan — es sind die Ruinen von Karthago.«
»Was, denen sind wir so nahe?!«
»So ist es. Wir brauchen nur hier in die tunesische Bucht einzubiegen. Auf dieser nautischen Karte sind die Ruinen freilich nicht angegeben, wohl aber die Landzunge, auf der das alte Karthago gelegen hat.«
»Und da wollen wir jetzt natürlich hin!«
»Ja, wenn ich auch wenig Hoffnung habe, dass das schwarze Schiff dort vor Anker liegt. Dann hätte es nicht erst nötig gehabt, sich vor mir unsichtbar zu machen. Aber ich möchte doch sehen, ob diese Bestimmungen wirklich so genau sind, oder ob sich vielleicht Spuren vorfinden, dass die schwarze Mannschaft schon dort gewesen ist.«
»Gut, halten Sie es mit dem schwarzen Schiffe, ich bin mehr für die geheimnisvollen Funde, die uns dort erwarten. Diese Bestimmungen sind ja bis auf ein Quadrat von drei Ellen Durchmesser gemacht, da muss sich doch wahrhaftig etwas finden lassen! Und wir brauchen ja nur hier über den Golf von Tunis zu segeln!«
»Jawohl, nicht einmal nach jener Höhle zurück. Wir sind schon an den Ruinen von Karthago vorbeigekommen. Zu sehen ist da freilich nicht viel, wenigstens nicht aus der Ferne.«
»Dann auf, nach den Ruinen Karthagos!«, rief Axel in heller Begeisterung, musste freilich noch bis zum Anbruch des Morgens warten.
Das phönizische Reich konzentrierte sich in zwei Seestädten, in Sidon und Tyrus, die miteinander um die Herrschaft der Macht und des Seehandels rangen.
Um das Jahr 880 vor Christi Geburt herrschte über Tyrus ein König Sichäus, der von seinem Schwager ermordet wurde, und infolgedessen entfloh die vielleicht mitschuldige Königin namens Dido mit einer Schar Missvergnügter.
Die Abenteurer landeten an der Nordküste Afrikas, ungefähr dort, wo jetzt Tunis liegt, befreundeten sich mit den dort hausenden halb oder auch ganz wilden Nomaden. Dido erbat für einen geleisteten Dienst als Eigentum so viel Land, wie sie mit einer Ochsenhaut umspannen könne.
Diese doch sehr bescheidene Bitte ward ihr natürlich gewährt. Da schnitt das schlaue Weib eine Ochsenhaut in schmale Streifen und konnte mit diesen ein ganz beträchtliches Gebiet umspannen, auf dem Karthago gegründet wurde.
So weit die Sage. Oder auch keine Sage. Und ganz besonders das mit der Ochsenhaut kann schon stimmen, auf ähnliche Weise sind die Eingeborenen noch öfter von den kommenden Kolonisten übers Ohr gehauen worden und werden es heute noch.
Eine weitere Geschichte Karthagos ist hier nicht am Platze. Am Anfange des dritten punischen Krieges hatte die Stadt, auf einer Halbinsel liegend, einen Umfang von anderthalb geografischen Meilen, was man noch heute an den bloßgelegten Umfassungsmauern nachmessen kann, und beherbergte 700 000 Einwohner. Handel und Raub hatten ungeheuere Schätze zusammengehäuft und allen damaligen Luxus eingeführt.
Dass Hannibal, ein karthagischer Feldherr, vor den Toren Roms erschien, war der letzte Triumph der afrikanischen Weltstadt. Zuletzt machte ihr Cornelius Scipio ein vollständiges Ende, im Jahre 146, immer noch vor Christi. Die Riesenstadt wurde dem Erdboden gleichgemacht.
Aber noch einmal sollte sie aufblühen, nur unter römischer Herrschaft. Noch für Jahrhunderte. Bis im Jahre 439 der germanische Vandalenkönig Geiserich kam, das römische Karthago stürmte und plünderte. Die Schätze aus früheren Zeiten waren ja schon von den ersten Siegern nach Rom gebracht worden, und man darf wohl glauben, dass auch die Vandalen nicht viel des Mitnehmens wertes zurückgelassen haben, oder was sie nicht mitnehmen konnten, das wurde vernichtet, daher eben Vandalen.
Diese blieben zwar hier sitzen, es ward die Hauptstadt des Vandalenreiches, aber doch schon nur noch ein Trümmerhaufen. Die Vandalen wurden wieder von den Sarazenen vertrieben — und so ging das fort, bis im Anfange des 16. Jahrhunderts dort, von wo aus einst die damals bekannte Welt regiert wurde, nur noch ein Araberdorf von wenigen elenden Hütten übrig blieb, und auch dieses verschwand, als der Wüstensand immer weiter wanderte und infolgedessen auch der letzte Brunnen versiegte.
Drei Jahrhunderte lang lagen die Ruinen Karthagos gänzlich verlassen, für die Welt gänzlich vergessen, bis im Anfang des 19. Jahrhunderts Franzosen und Engländer Nachgrabungen vornahmen. An antiken Gegenständen wurden herzlich wenig gefunden, wohl aber Wasser, der Brunnen wurde gut eingefasst, er ermöglicht, dass heute dort drei kleine arabische Dörfer existieren können, Sidi Bour Said, Malga und Douar el Schat.
Zur Zeit unserer Erzählung gab es diese Dörfer also noch nicht.
Außerdem muss noch erwähnt werden, dass die Trümmer Karthagos jetzt an einer anderen Stelle zu liegen scheinen. Früher lag es auf einer Landzunge, wurde auf beiden Seiten vom Meer umspült, hatte auf jeder einen Hafen. Jetzt liegen die Trümmer eine geografische Meile von der Küste entfernt. Der Wüstensand ist gewandert, hat die Küste weiter ins Meer hinausgeschoben.
Die Morgensonne blickte neugierig erst halb über den Horizont, als über den Wüstengürtel vier Männer schritten: der Graf, Axel und zwei Matrosen. Jeder trug ein Gewehr, entweder einen Wasserschlauch oder einen Proviantsack und entweder eine Hacke oder eine Schaufel.
Nach dem gestrigen Gespräch war Axel gleich schlafen gegangen. Als er beim ersten Morgengrauen geweckt wurde, lag die Jacht vor der betreffenden Küste bereits an sicherer Ankerstelle, der Graf hatte alles zur Expedition Nötige schon bereitlegen lassen, sofort war es ins Boot gegangen, das von den zwei anderen Matrosen zurückgerudert wurde.
Seit einer Viertelstunde marschierten die vier Männer durch die Wüste, nicht gerade durch den gelben Sand watend, aber doch immer knöcheltief.
Es war noch sehr kühl, im Gegensatz zum glühend heißen Tag der Morgen geradezu eisig zu nennen.
Wie es gewöhnlich bei solch einer frühen Expedition ist, wurde auch hier kein überflüssiges Wort gewechselt. Das ist dort etwas anderes als bei uns ein Spaziergang im taufrischen Wald, wenn schon beim ersten Morgengrauen alle Vöglein zu jubilieren anfangen, dort muss auch der Mensch wie die ganze Natur erst auftauen.
So war eine Viertelstunde schweigend vergangen. Die beiden Matrosen, die sich in der Nacht so gefreut hatten, dass sie als Begleiter zu dieser Expedition erkoren worden waren, zeigten sogar eine gewisse Verdrießlichkeit.
Da blieb der Graf stehen, blickte sich um, schüttelte den Kopf.
»Ach, wie sehr hat sich doch das alles, alles verändert«, sagte er melancholisch.
Der Bann war gebrochen. Zunächst machte Axel ein verdutztes Gesicht.
»Ja, waren Sie denn schon einmal hier?!«
»Gewiss.«
»Wann denn?«
»Auch ich bin einmal Bürger von Karthago gewesen — zur Zeit des zweiten punischen Krieges.«
Jetzt begann Axel den Grafen anzustarren, bis er langsam hervorbrachte:
»Ach ach ach ach ach sooooo! Sie haben selbst hier im alten Karthago gelebt! Sie haben den zweiten punischen Krieg mitgemacht! Zweihundert Jahre vor Christi Geburt! Da sind Sie wohl gar der Hannibal selbst gewesen?«
»Nein, aber sein Bruder Hasdrubal.«
Axel begann womöglich noch mehr zu starren.
»Ach ach ach ach ach sooooo! Sie sind der alte Hasdrubal! Das hätten Sie doch gleich sagen sollen!«
Und Axel warf plötzlich Gewehr, Hacke und Proviantsack hin, legte sich daneben in den Sand auf den Rücken und brach in ein Gelächter aus, dass die Wüste widerhallte, reckte auch einmal die Beine in die Höhe.

Jetzt waren es die beiden Matrosen, welche zu starren begannen. Die glaubten doch, der Depeschenreiter habe plötzlich den Verstand verloren. Der Graf hingegen blieb ganz gelassen, schaute sich nach wie vor die Gegend an.
Endlich hatte sich Axel ausgelacht, stand wieder auf.
»Herr Graf, nichts für ungut!«
»Was?«
»Ich freue mich so, dass Sie der alte Hasdrubal gewesen sind.«
»Sie glauben's nicht?«
»Gewiss, ich glaube Ihnen alles, alles. Und wenn Sie mir ins Gesicht spucken und behaupten, es regnete — ich glaub's. Na, nun erzählen Sie einmal ein bisschen mehr von anno dazumal. Wie waren denn die karthagischen Mädels.«
Und Axel henkelte seinen Arm in den des Grafen, so wurde der Marsch als gemütlicher Spaziergang fortgesetzt.
Dieser Graf von Saint-Germain hatte einen ganz, ganz merkwürdigen Charakter. Beleidigen konnte man ihn überhaupt nicht. Gegen jeden Spott ganz unempfänglich. Er hatte eben entweder etwas zu viel oder etwas zu wenig. Ein ganz kurioser Kauz. Oder aber.... er veralberte zu seiner eigenen Belustigung die ganze Welt, doch immer mit tiefernstem Gesicht. Und in dieser Rolle ist er sich treu geblieben bis zu seinem Tode, und man weiß immer noch nicht, ob er nur eine Harlekinade aufgeführt hat oder ob er es ernst meinte.
Jetzt begann er vom alten Karthago zu erzählen, in dem er als Hannibals Bruder Hasdrubal doch eine der bedeutendsten Rollen gespielt hatte. O ja, er konnte erzählen, die interessantesten Einzelheiten, und das hatte auch alles Hand und Fuß. Freilich war ihm ja nichts nachzukontrollieren.
Was er erzählte, wollen wir hier nicht wiedergeben, nur später manchmal Einzelheiten. Jedenfalls war das höchst interessant, zugleich äußerst lehrreich. Wenn es nicht aus selbsterlebter Tatsache beruhte, so hielt eben ein Professor mit einer Universalkenntnis einen Vortrag über das alte Karthago, reich mit Anekdoten geschmückt. Axel war schon längst der Spott vergangen, er lauschte mit gespanntester Aufmerksamkeit.
»... ich erinnere mich noch so lebhaft, als wäre es erst gestern geschehen, wie mir mein Weib Archdea, während mir mein numidischer Lanzenträger den Panzer anlegte, mein jüngstes Kind zum letzten Kuss entgegenhielt. Dann stieg ich auf den niederknienden Kriegselefanten... doch da liegt sie ja, meine alte Heimatstadt — ach!«
Das letzte enttäuschte Ach war berechtigt. Die Wüste war immer welliger geworden, nach dem Ersteigen des letzten Hügels lagen noch immer andere vor ihnen, die aber ganz anders aussahen, hin und wieder sah aus den Sandhaufen ein kantiges Stück Gemäuer hervor. Im Übrigen glaubte man kaum, eine Ruinenstadt vor sich zu haben. Alles total versandet, die Gemäuer hätte ein Unkundiger eher für kantige Felsblöcke gehalten, die ja auch mitten in der Sandwüste vorkommen.
Das Trümmerfeld dehnte sich aus, so weit das Auge reichte.
»Das alte Karthago, die afrikanische Rivalin Roms«, sagte Axel mit sichtlicher Erschütterung, ganz in den ersten Anblick versunken.
»Meine Geburtsstätte, meine Heimat«, setzte der Graf noch hinzu. »Wohl mir, dass ich ihren Untergang nicht mehr erlebte!«
Axel fuhr aus seinen Träumen empor.
»Na, nun lassen Sie das endlich sein«, sagte er mit seinem gewöhnlichen Freimut etwas ärgerlich.
»Wie Sie wünschen«, war die Antwort des über alles erhabenen Grafen.
»Zuletzt glauben Sie noch selber, dass Sie der alte Hasdrubal gewesen sind, mich hätten Sie auch bald schon so weit gebracht.«
»Signor Axel, Sie sind ein merkwürdiger Kauz«, musste sich jetzt dieser den Vorwurf gefallen lassen.
Zunächst lachte er.
»Na, wenn Sie wirklich Hasdrubal gewesen sind, dann müssen Sie doch in Karthago recht gut Bescheid wissen.«
»Jetzt noch? Das liegt ja alles in Trümmern.«
»Aber Karthago hat doch sicher, wie alle die alten Städte, sehr viele unterirdische Gänge gehabt, in denen müssen Sie sich doch noch zurechtfinden können.«
»Sie vergessen wohl, dass da viele, viele Jahrhunderte vergangen sind! Was kann da nicht alles von selbst in Trümmer fallen, besonders auch unterirdische Gänge, und dann ist Karthago doch einmal auch gänzlich neu aufgebaut worden, da wurden also die unterirdischen Gänge doch mindestens renoviert, wenn nicht verlegt!«
Der Fuchs war nicht zu fangen. Übrigens hatte der neugeborene Hasdrubal auch ganz recht, Axel selbst musste es zugeben.
Noch standen sie auf dem letzten Hügel, mehr eine ganze endlose Sandwelle, die noch keine solche Erhebungen von Menschenhänden zeigte.
»Ja, ich entsinne mich«, nahm der Graf wieder das Wort, »bis hierher ging damals noch das Meer.«
»Erhob sich nicht dicht am Meere eine Mauer?«
»Jawohl, eine nur zwölf Ellen hohe — karthagische Ellen, Monas genannt, ein klein wenig kürzer als die italienische Elle, die noch jetzt die römische ist. Die Mauer auf der Landseite dagegen war dreißig Ellen hoch.«
»Dann müssten sich doch wenigstens noch Reste dieser Mauer finden lassen, wo wir stehen.«
»Eigentlich ja. Wenn sie nicht gründlich geschleift wurde.«
»Da wollen wir doch gleich einmal sehen.«
Und schon hatte Axel Gewehr und Hacke fallen lassen, dafür einem Matrosen die Schaufel abgenommen, und er schippte los.
Wahrhaftig, er war noch keinen Meter tief gedrungen, was bei dem Sande wenig Arbeit bedeutet, als er auf festes Gemäuer stieß, und bald hatte er auch ihre seitlichen Grenzen gefunden. Es war wirklich der obere Rand einer Mauer.
Dabei war ausgeschlossen, dass der Graf dies erraten hätte, weil sich der Sand hier zu einem wellenförmigen Hügel angehäuft hatte. Über solche Sandwellen, sich von dieser nicht im Geringsten unterscheidend, waren sie schon fortwährend geklettert.
»Sehen Sie, ich irrte mich nicht, hier ist die Wassermauer.«
Axel grübelte nicht weiter darüber nach, ob hier ein Zufall vorläge oder was sonst.
»Na, da wollen wir weiterpilgern.«
Bald befanden sie sich mitten zwischen den Hügeln, und jetzt konnte man schon eher unterscheiden, dass es eine Ruinenstadt war. Auf der gegen den herrschenden Wind geschützten Seite ließen sich manchmal doch noch recht stattliche Mauern sehen. Es ist eben schwer, eine ganze Stadt dem Erdboden gleich zu machen, wie es immer heißt. Aber von einem eigentlichen Gebäude war nichts mehr zu erblicken, keine Spur mehr.
Zunächst musste nach der Sonne eine geografische Ortsbestimmung gemacht werden. Axel hatte sich hierin in den letzten Tagen gründlich ausgebildet, der Graf machte die Berechnungen, nur ab und zu einen Blick in das Logarithmenbuch werfend, sonst alles frei im Kopfe. Es war wunderbar, wie er rechnen konnte, Axel musste immer wieder staunen. Das war so etwas, wobei der Graf zeigte, dass er in anderer Hinsicht ein ganz phänomenaler Mensch war. Zwei dreistellige Zahlen hatte er im Augenblick im Kopfe multipliziert, das war noch die kleinste Leistung.
Die geografische Bestimmung, die hierfür auf dem Zettel gegeben worden, drückte, wie die meisten Bestimmungen, die geografische Breite und Länge bis auf Zehntelsekunden aus.
Die Entfernung von Breitengrad zu Breitengrad beträgt rund 15 geografische Meilen oder noch unter 112 500 Meter. Man hat den Grad — leider — wie die Stunde in 60 Minuten, die Minute in 60 Sekunden geteilt. Hieraus ergibt sich durch einfache Division, dass eine Breitensekunde rund — und zwar wird der frühere Abrundungsfehler hier wieder nach unten verbessert — 30 Meter beträgt, eine Zehntelsekunde also drei Meter.
Der Abstand von Breitengrad zu Breitengrad ist überall derselbe, der der Längengrade verkürzt sich nach Polen zu natürlich immer mehr, oder man kann auch sagen: die Längengrade sind alle gleich lang, die Breitengrade werden immer kleiner. Der 90. ist als der Pol nur noch ein Punkt.
Ist eine Ortsbestimmung bis zu Zehntelsekunden gegeben, so muss es sich direkt auf dem Äquator um ein regelmäßiges Viereck, also um ein Quadrat von drei Metern Seitenlänge handeln. Je weiter der zu suchende Punkt nach Norden oder nach Süden liegt, desto schmaler wird dieses Viereck, während die Länge immer dieselbe von drei Metern bleibt.
Es fragt sich nur, ob man imstande ist, solch ein Viereck durch astronomische Berechnung zu bestimmen. Ja, das kann man, sobald man eine Uhr hat, die bis zur Zehntelsekunde richtige Meridianszeit hat. Und solche Uhren hatte man schon damals — man sagt sogar, die alten Chronometer waren besser als die heutigen. Der große Chronometer der Jacht hielt die Zehntelsekunde wochenlang, ein vorzüglicher Taschenchronometer, der sich an Bord befand, war zuletzt nach dem großen Vater bis zur Zehntelsekunde gestellt worden.
Sonst bietet ja, wie schon einmal erwähnt, eine geografische Berechnung nach der Sonne gar keine Schwierigkeit, ist gar keine so große Kunst. Man muss es eben nur gelernt haben. Auf dem Lande ist sie ja noch viel einfacher als auf dem schwankenden Schiffe. Anstatt nach dem Meereshorizont als einer unverrückbaren Linie — denn auch bei dem furchtbarsten Seegange bilden Himmel und Meer doch immer eine schnurgrade Linie — spiegelt man auf dem festen Lande mit dem Sextanten nach einer an den Boden gesetzten Dose, die mit Quecksilber gefüllt ist. Es könnte auch Wasser sein, selbst schon ein Tropfen genügte, man brauchte nur einmal kräftig auf einen Stein zu spucken. Aber Quecksilber, beweglich wie das Wasser, spiegelt am besten.
Nach Axel nahm auch der Graf den Sextanten, machte dieselbe Bestimmung noch einmal — seine Berechnung stimmte mit der Axels genau überein.
So, jetzt wussten sie, auf welchem Viereck von drei Metern Länge und etwas kürzerer Breite sie gegenwärtig standen. Das war aber natürlich noch nicht der gesuchte Punkt, sondern erst einmal ein ausprobierter. Von hier aus hätte man nun den gesuchten mit Hilfe der Magnetnadel und eines Messbandes auffinden können oder auch durch Schritte, deren Länge man kannte. Aber das hätte bei diesem hügeligen Terrain doch seine Schwierigkeiten gehabt, zumal man sich von dem gesuchten Punkte fast noch einen Kilometer nördlich befand; so zog man vor, diesem Punkte durch noch mehrmalige geografische Sonnenberechnungen näher zu rücken, bis man ihn hatte.
Wir haben eine derartige geografische Ortsbestimmung nur dieses Mal so ausführlich geschildert, werden es nicht wiederholen.
»Ja«, sagte Axel, »das geht jetzt so genau zu machen, wo wir uns noch auf unseren Chronometer verlassen können. Wenn aber nun später dieses Werk von Menschenhand keine richtige Pariser Zeit mehr angibt?«
»So machen wir nach den Gestirnen ohne Zeit eine freihändige geografische Ortsbestimmung und stellen danach unseren Chronometer immer wieder richtig.«
»Das geht?«
Ja, das geht. Man kann auch ohne Sextanten und ohne Uhr die Lage eines Punktes irgendwo auf der Erde ganz, ganz genau berechnen, und hieraus rückwärts erst die Zeit. Es ist dazu nichts weiter nötig als ein Metermaß und ein Bindfaden, das als Senklot dient. Es gibt hierzu mehrere Verfahren, das beste soll die sogenannte Harze'sche Fadenmethode sein.
Ja, das kann ›man‹. Aber der Schreiber dieses kann es nicht. Hier hören seine Kenntnisse auf. Das kann auch der Marineoffizier nicht, der in der Astronomie so weit vorgedrungen ist, wie ihm möglich gewesen. Wenn er das könnte, dann wäre er kein Marinenoffizier geworden. Denn wer das kann, der hat nichts mehr auf dieser Welt zu suchen, der betrachtet sie nur noch als Standort für sein Fernrohr, der hat dem Leben Valet gesagt, er lebt nur unter seinen Sternen — das ist dann einer jener Astronomen, welche, wenn sie einen Kometen auftauchen sehen, sofort dessen elliptische Laufbahn um die Sonne oder vielmehr im Weltenraum bestimmen und den Tag angeben, an welchem dieser Komet nach Hunderten oder auch nach vielen Tausenden von Jahren wiederum von einem Menschen erblickt werden wird — vorausgesetzt, dass es dann noch einen Menschen der Erde gibt — und dann wird der Kern dieses Kometen an dem und dem Tage zu der und der Stunde doch immer noch so und so viele Millionen oder Billionen von Meilen von der Sonne entfernt sein, und es wird ganz genau stimmen, auch wenn es auf unserer vereisten Erde keines Menschen Auge mehr erblicken kann!
Nein, wer so etwas versteht, der wird kein Marineoffizier, ein solcher hat keine Zeit zu solchen ›Kinkerlitzchen‹.
Da wir nun einmal bei der Astronomie und bei den Astronomen sind, seien zwei reizende Anekdoten über Isaac Newton erzählt, um zu zeigen, wie furchtbar unpraktisch solch ein Mann im irdischen Alltagsleben doch sein kann.
Unpraktisch? Ist ein Mann, der mit eigener Hand ein Riesenfernrohr fertigt, wie es die damalige Welt noch nicht kannte, der jedes Schräubchen selbst schnitt, die Linsen selbst schliff, erst die hundertste für tadellos fand — ist solch ein Mann etwa unpraktisch zu nennen?
Isaac Newton musste immer Tiere um sich haben. So hatte er auch einmal als ständige Mitbewohner seines Studierzimmers zwei Katzen, eine alte und eine junge, noch ganz kleine. Die beiden Tiere wollten doch öfter hinaus, wünschten durch Miauen wieder Eintritt, und da es dem Gelehrten zu viel war, immer vom Schreibtisch aufstehen zu müssen, um die Tür zu öffnen, sägte er in diese kurzerhand unten zwei Löcher — ein größeres für die große Katze und ein kleineres für die kleine.
So wird von einem Zeitgenossen Newtons als Tatsache erzählt.
Die zweite Anekdote behandelt eine Periode aus Newtons Bräutigamsstand. Der Berechner der Erdschwere war einmal auch irdischen Liebesgefühlen zugänglich geworden. Wohl um es nicht so weit zu haben, hatte er sich gleich die Tochter seiner Logiswirtin erkürt. Also, als er einmal mit der allein war, Newton hatte sich gerade eine frische Pfeife gestopft und angebrannt, fasste er des Mädchens Hand und zog sie innig an seine Brust, holte zur Liebeserklärung aus, das Mädchen wusste ja längst, was geschehen würde, und wartete nur noch darauf. Aber es blieb beim Ausholen zur Liebeserklärung und bei der Hand an der Brust. Der junge Gelehrte war wieder ins Rechnen gekommen, starrte, des Mädchens Hand an seine Brust gezogen, vor sich hin und dampfte dazu mächtig. Trotzdem wartete die Jungfrau mit glückseligem Lächeln geduldig. Mit einem Male schrie sie laut auf und rannte hinaus — Isaac hatte nämlich ihren Finger als Pfeifenstopfer benutzt. (Gewissenhaften Lesern sei noch bemerkt, dass die angebrannte Jungfrau trotzdem seine Frau wurde.)
Ja, wem die Menschen etwas durchsichtiger sind, der versteht nicht, wie unsere humoristischen Blätter den zerstreuten Professor, der überall Schirm und Gummischuhe stehen lässt und andere ›Dummheiten‹ macht, als stereotype Witzfigur führen können. Gewiss, es wirkt ja manchmal humoristisch — aber es ist fast etwas Heiliges dabei, was man nicht lächerlich machen sollte. Dadurch bezeugt man nur, dass man gar nicht den Kern der Sache versteht. Diese Männer sind im Grunde genommen gar nicht zerstreut, ganz im Gegenteil, sie konzentrieren ihre ganze Gedankenkraft auf das einzige Ziel, das sie ständig vor Augen haben, da haben sie nicht Zeit, an solche Nebensächlichkeiten zu denken. Ein Fatzke hingegen, der in jeden Spiegel blickt, ob seine Krawatte auch richtig sitzt, der lässt natürlich Schirm und Gummischuhe nicht stehen, dessen kleines Hirn ist ganz mit solchen Kleinigkeiten angefüllt, während jene zerstreuten Männer es sind, die von ihrer stillen Studierstube aus die Erde immer mehr für die Menschheit unterjochen. Denn das sind die wahren Welteroberer, ganz andere als ein Alexander oder Cäsar oder Napoleon!
Der Schreiber dieses kannte persönlich solch einen Mann, einen Professor der Physik an einer technischen Hochschule.
Eines Nachmittags rannte das kleine Männchen, flink wie ein Wiesel, viermal an seiner Haustür vorbei, ehe es glücklich das Loch fand. Ein andermal saß er in einem Café, streifte während des Zeitunglesens mit den Zehen erst die Schuhe ab, dann knöpfte er den Kragen ab, dann zog er, schnell einmal aufspringend, den Rock aus, und schließlich knöpfte er auch noch die Hosen auf, nicht das Geringste merkend, wie diese Dekolletierung auf die herumsitzenden Herren und Damen wirkte. Bis ein Kellner endlich wagte, den Herrn Professor darauf aufmerksam zu machen, dass er sich nicht zu Hause befände. Genierte ihn gar nicht, er zog sich einfach wieder an und las weiter. Für einen Mann, einen wirklichen Mann, hat solch eine Kleinigkeit eben nichts zu sagen.
Aber nun im Laboratorium, im Hörsaal, dieser klare Vortrag — obgleich dabei immer beide Backentaschen voll Kautabak — und nun vor allen Dingen wie der experimentierte, wie der die Apparate aufbaute, diese phänomenale praktische Handfertigkeit, wie der, ein Vergrößerungsglas ins Auge geklemmt, die winzigen Fädchen zusammenknüpfte, und wenn etwas brach, wie der Glas blies, wie der feilte und lötete — fabelhaft!
Doch nun genug davon.*) — — — — —
Der Graf gab eine Erklärung, wie das gemacht würde, eine geografische Ortsbestimmung ohne Uhrzeit, wodurch man sogar erst die richtige Meridianzeit gewinnt. Axel war doch gewiss nicht auf den Kopf gefallen, der Heidelberger Student hatte doch auch sonst etwas gelernt, aber von dem, was er da zu hören bekam, verstand er absolut nichts.
»Sie haben auch Astronomie studiert?«, fragte er dann etwas kleinlaut.
»Gewiss. Durchaus.«
»Wo denn, wenn ich fragen darf?«
»Nun, in Babylon.«
»Ach so, als Sie vor dreitausend Jahren bei den alten Chaldäern waren?«
Aber diesmal hatte Axel gar keinen Spott in seine Worte gelegt. Die mathematischen Formeln und astronomischen Berechnungen, die er vorhin zu hören bekommen, waren gar zu grässlich gewesen, hatten ihm gleich die Luft abgeschnitten.
»Jawohl. Die chaldäischen Magier standen unseren heutigen Astronomen nicht viel nach, obgleich sie noch nichts von einer Uhr wussten. Übrigens ist das ganz einfach. Sie brauchen von dem errichteten Dreieck nur den Kosinus und die Kotangente zu berechnen...«*)
*) Anmerkung des Verlags: Der Verfasser wird uns nicht verübeln, wenn wir eine Anekdote über ihn selbst hinzufügen, wie auch er einmal in unserer Gegenwart eine Probe von seiner ›Gedankenkonzentration‹ gab. Herr Robert Kraft besuchte uns, um eine Verlagsangelegenheit zu besprechen. Im Redaktionszimmer stand neben dem Ausgang ein sehr großer Kleiderschrank, dessen Türen bis auf den Boden reichten. Nach Beendigung der Unterhandlungen verabschiedete sich Herr Kraft schnell, ergriff Stock und Hut, schritt, noch ganz mit den neuen Ideen beschäftigt, dem Ausgange zu, öffnete die Tür und... trat mit einem großen Schritt in den Kleiderschrank hinein. Tableau! Bei seinem nächsten Besuche war an dem Kleiderschrank bereits ein Plakat befestigt: Eintritt verboten!
»Bitte, bitte, Herr Graf, hören Sie um Gottes willen auf. Ich sehe schon, wie ich im nächsten Traume von meiner Cousine an so einer meterlangen Zahl aufgehangen werde und die Enten kommen und bekleckern mich. Wissen Sie nichts anderes von dem alten Babylon zu erzählen? Wie waren denn die bubobabylonischen Mädchen beschaffen?«
»Ich war Priester.«
»Na, trotzdem. So'n dralles Mädel ist doch etwas ganz anderes als eine trigonometrische Kotangente.«
Es wurde wieder eine Ortsbestimmung gemacht, die ergab, dass sie sich keine 20 Meter weit von dem gesuchten Punkte entfernt befanden. Diese Strecke konnte ausgemessen werden, noch einige Sonnenaufnahmen, und der Graf zeichnete mit seinem Ladestock, der damals noch zu jedem Gewehre gehörte, in den Sand ein Viereck von drei Meter Seitenlänge, nur wenig von der Form eines Quadrats abweichend.
»In diesem Viereck soll es liegen.«
»Muss es liegen«, verbesserte Axel mit Nachdruck, der in eine immer bessere Stimmung zu geraten schien.
»Nun, es ist doch noch die Frage, ob wir beim Nachgraben auch wirklich etwas finden.«
»I dr Deiwel noch einmal, ich bin doch nicht umsonst hier anderthalb Stunde durch den Sand gelatscht! Wo sind denn überhaupt hier die berühmten arabischen Pferde? Oder haben die alten Karthager nicht so einen Kriegselefanten übrig gelassen? Dem wollte ich einmal zeigen, was so'n Depeschenreiter alles zwischen seinen Schenkeln zerquetschen kann. Nur darf er mich dabei nicht mit seinem Rüssel am Bauche krabbeln, da bin ich kitzlig.«
Und Axel sah sich nach einem Kriegselefanten um, musterte die Umgebung. Sie sah wie überall aus. Alles Sandhügel, aus denen hin und wieder ein behauener Stein hervorsah.
Der Graf setzte die Untersuchung noch weiter fort, verschwand hinter einem Hügel. Axel zog zunächst einmal die Karte zu Rate.
Als er wieder aufblickte, sah er die beiden Matrosen faul dastehen, sich auf ihre Schippen stützend.
»Na nun los mal!«, schnauzte er sie an. »Was steht ihr denn da wie die über die Unsterblichkeit der Mehlwürmer philosophierenden australischen Goldklumpensucher! Los, die Kosinusse genommen und losgekost, und das etwas hurra! Morgen früh will ich auf der anderen Hälfte der Erdkugel wieder zum Vorschein kommen! Ich werde als Sinus euch mit gutem Beispiele vorangehen, werde die schwerste Arbeit übernehmen, werde euch anleiten, wie ihr den Sand von der Schippe zu werfen habt. Das ist Kopfarbeit, die strengt mehr an, verbraucht mehr Nervensubstanz. Aber so bin ich immer gewesen.«
So sprach Axel, warf sich in den Sand nieder, öffnete einen Schnappsack, zog einen Schinken hervor, aus der Scheide sein Schlachtschwert und begann loszusäbeln.
Die beiden Matrosen lachten und begannen die Arbeit. Freilich nicht gleich zu schaufeln. Das erforderte erst Vorbereitungen, da wurde erst der Mund voll losen Tabak gepfropft, die Pfeife gestopft und angebrannt, was mit Stahl und Feuerstein seine Weile haben wollte, dann wurde in die Hände gespuckt...
»Na los, los doch!«, munterte Axel mit kauendem Munde auf. »Ich bin hier schon halb mit dem Schinken fertig, und ihr habt noch nicht einmal angefangen. Da hättet ihr früher mich mal schaufeln sehen sollen, was ich für'n Arbeiter gewesen bin! In die Hände spucken und die Schippe wieder hinwerfen war bei mir eins, und da war die Arbeit schon fertig.«
Die Matrosen grinsten, machten den ersten Spatenstich, warfen den Sand zur Seite...
»Halt!«, kommandierte Axel, sich etwas emporrichtend. »Wie weit seid ihr denn schon nach dem Mittelpunkte der Erde vorgedrungen? Nu, da seid ihr ja schon ganz hübsch vorwärts gekommen. Na da macht erst mal Frühstück. Nur nicht alles gleich übertreiben. Nur nicht immer gleich die Arbeit umschmeißen wollen, die fällt schon von ganz alleine um. Eile mit Weile. Man kann im Tun auch etwas ruhn, man kann im Ruhn auch etwas tun. Na, Jungens, da frühstückt erst mal.«
Die Matrosen, die aus dem Grinsen nicht herauskamen, ließen sich das nicht zweimal sagen. Sie kannten ja diesen Mann nun schon, aber heute musste er seinen besonders guten Tag haben.
Der Graf tauchte wieder auf.
»Haben Sie schon etwas gefunden, Graf?«
»Gar nichts.«
»Da sind wir glücklicher gewesen.«
»Wie? Sie haben schon etwas gefunden?!«
»Ja«, nickte Axel mit kauendem Munde.
Der Graf blickte nach dem durch zwei Spatenstiche entstandenen Loche.
»Schon in dieser unbedeutenden Tiefe?«
»Nu, ist das für die kurze Arbeitszeit vorm Frühstück nicht schon eine ganz beträchtliche Tiefe? Wir haben uns bannig dazugehalten, ganz besonders ich.«
»Und was haben Sie denn gefunden?«
»Wir haben gefunden, dass es doch nicht so schnell geht, sich durch die ganze Erde zu paddeln, bis man auf der anderen Seite wieder herauskommt.«
»Sonst nichts weiter?«, konnte auch der Graf einmal lachen. »Sie sind ein unverbesserlicher Spötter.«
»Na, da kommen Sie her, Graf Hasdrubal, frühstücken Sie mit.«
»Ich? Sie wissen doch...«
»A bah! Jetzt sind Sie nicht mehr der Graf von Saint-Germain, sondern der karthagenische Feldherr Hasdrubal, und der soll doch eine gute Klinge geschlagen haben, in der Männerschlacht sowohl wie beim Schlachtfest. War ihre Todesart nicht die, dass Sie an einem gebratenen Tintenfisch erstickten? Nicht? Dann war das ein anderer, von dem ich das einmal gelesen habe. Setzen Sie sich her, frühstücken Sie mit.«
»Ihnen zuliebe.«
»Nu, was das anbetrifft — dadurch beweist man seinem Nächsten nicht gerade christliche Liebe, dass man ihm das Frühstück wegfrisst.«
Der Graf setzte sich und langte zu. Die beiden Matrosen wunderten sich nicht besonders, den Wundermann essen zu sehen. Die waren über Vorurteile erhaben.
Noch einen Trunk aus einem der Lederschläuche, das schon warm werdende Wasser, in dem Schlauche einen unangenehmen Geschmack annehmend, wurde im Becher durch etwas Rotwein verbessert, und das Frühstück war beendet.
»So«, sagte Axel, sein Schlachtmesser an der Lederhose abwischend und es in die Scheide zurücksteckend, »nun wollen wir die kurze Zeit bis zum Feierabend noch mit krampfhafter Arbeit ausfüllen.«
Sie erhoben sich, die beiden Matrosen fingen wieder zu schaufeln an, der Graf und Axel sahen einige Zeit zu.
»Nein, Jungens«, sagte Axel, als die Matrosen erst wenige Spatenstiche getan hatten, »ich habe euch an Bord arbeiten sehen, da seid ihr ja ganz patent und flink, aber von der höheren Kunst der Sandschipperei habt ihr keine Ahnung. Ihr fasst ja die Schippe an. als wäre es ein Besen, mit dem ihr einen Parkettsalon fegen wollt. Das will ich euch einmal vormachen, bei mir fleckt's anders.«
Und Axel nahm den einen Spaten, und es war eine Tatsache, dass er mit ganz anderer Wucht in den Boden stieß, er fasste ihn schon ganz anders an. Offenbar musste der Depeschenreiter und ursprüngliche Fürstensohn in dieser Arbeit schon Erfahrung haben, denn schließlich will wie alles andere auch Erdarbeit gelernt sein.
»Mein Vater war nämlich konzessionierter Bieranzapfer und meine Mutter vereidigte Bezirkshebamm...«
So sprach er, als er ansetzte, um die Schaufel mit Sand herauszuwerfen, konnte aber das letzte Wort nicht ganz vollenden.
Er verrichtete ein Wunder in der Kunst der Erdarbeit, des Sandschaufelns. Nicht nur, dass er eine gehörige Portion Sand auf der Schaufel zum Vorschein brachte, sondern gleich eine ganze Sandwelle, diese folgte dem Spaten nach, das heißt, der ganze Boden hob sich, immer mehr und mehr, und ein Knall, etwa wie ein Champagnerpfropfen fliegt, und so flog eine meterdicke Sandsäule haushoch empor.
Was die vier Männer beim Anblick dieses Phänomens, erzeugt durch einen einzigen Spatenstich, dachten, können wir nicht schildern. Wahrscheinlich dachten sie gar nichts. Höchstens, dass sie dies wohl nur träumten.
Im nächsten Augenblick stoben sie entsetzt auseinander, doch auch nur wenige Schritte, denn kaum fühlten sie den Sand auf sich herabprasseln, als jeder es für besser hielt, sich platt auf den Boden zu werfen. Oder vielleicht wurden sie auch dazu gezwungen, denn der Sand kam mit ganz gehöriger Wucht auf sie herabgeregnet. Hatten sie doch auch die dicke Sandsäule sich bis in den Himmel erheben sehen, oder doch wenigstens so hoch wie ein vierstöckiges Haus. Im Nu waren die vier Männer spurlos von der Erdoberfläche verschwunden. Der Sand hatte sie vollständig zugedeckt.
Da regte es sich in einem der vier neu entstandenen Sandhügel, ein lederner Schlapphut tauchte auf, Axels Kopf folgte nach.
»Himmelbombenelement!! Was war denn das? Und wo sind denn...«
Nicht weit von ihm entfernt tauchte aus dem gelben Sande ein zweiter Kopf auf, der des Grafen, und der schaute sich weit verstörter um.
»Guten Morgen«, begrüßte ihn Axel. »Da sind Sie ja. Warum haben Sie sich denn so mit Sand zugedeckt?«
Jetzt kamen die Köpfe der beiden Matrosen zum Vorschein, mit nicht minder verstörten Gesichtern als das des Grafen.
»Was war denn das?!«
Nur Axel hatte sich nicht aus der Fassung bringen lassen.
»Na, glaubt ihr nun, dass ich etwas mehr vom Sandschaufeln verstehe? Seht, so geht's zu, wenn mal so'n Depeschenreiter die Schippe in die Hand nimmt. Ja, ja, man hat nicht umsonst eine Hebamme zur Mutter gehabt.«
Er machte sich vollends frei von der dünnen Sandhülle, die ihn bedeckte, die anderen drei standen gleichfalls auf. Es war ganz feiner Flugsand, der ihnen nichts hatte anhaben können. In Folge der Schwere waren es nach dem bekannten physikalischen Gesetz nur wenige größere Sandkörner gewesen, die zuerst auf sie niedergeprasselt waren, und diese hatten auch nicht so hoch geschleudert werden können.
»Ja, was ist das eigentlich gewesen?«, fragte der Graf.
Dort wo sie vorhin geschaufelt hatten, zeigte sich ein rundes Loch, sich oben trichterförmig erweiternd, soweit sich das aus der Entfernung unterscheiden ließ. Sie alle waren ja erst einige Schritte davongelaufen.

Axel war der erste, der sich hinbegab.
»Vorsicht!«, warnte der Graf. »Das war eine Explosion!«
»Geknallt hat es wohl, aber doch gar nicht so stark, dass man an eine Pulverexplosion glauben könnte.«
»Trotzdem — seien Sie vorsichtig — es können giftige Gase im Spiele sein.«
An Vorsicht ließ es Axel denn auch nicht fehlen.
In der Nähe des Loches legte er sich an den Boden, vielleicht einen weiteren Nachsturz des Sandes fürchtend, so kroch er wie eine Schlange über diesen, bis er langsam den Kopf über das Loch steckte.
»Hm«, hörte man ihn bald brummen. »Nach tannengewürzter Frühlingsluft riecht es eben nicht, sonst aber scheint sie ganz atembar zu sein. Kommt nur her, es ist ein ganz solid gemauerter Schacht, ein Nachsturz kann nicht erfolgen.«
Der Graf war wohl nur deshalb nicht gleich gefolgt, weil er einen solchen gefürchtet hatte; jetzt tat er es, auch die beiden Matrosen kamen heran.
Man blickte in einen gemauerten Schacht von etwa einem Meter Durchmesser, in dem sich der Anfang einer eisernen Leiter zeigte, deren Sprossen nur wenig von der Wand abstanden. Dieses Mauerwerk begann etwa dreiviertel Meter unter dem Sand, dieser war durch den Luftdruck oben noch mehr zur Seite geschleudert worden, sodass erst eine trichterförmige Öffnung kam, und der Winkel war groß genug, dass der Sand nicht nachrieseln konnte.
»Also mit der geografischen Bestimmung, bis auf zehntel Sekunden gegeben, hat es doch etwas auf sich gehabt«, meinte Axel. »Gerade hier befindet sich ein in die Tiefe führender Schacht.«
»Durch welche Kraft mag der Sand herausgeschleudert worden sein?«
»Um das, was wir heute eine Explosion nennen, kann es sich nicht gehandelt haben, dazu war der Knall viel zu schwach.«
»Dort unten war die Luft stark zusammengepresst.«
»Das denke ich auch. Es handelt sich gewissermaßen um einen artesischen Brunnen, dessen Wasser in dem unterirdischen Reservoir unter starkem Luftdruck steht, sodass es aus jeder geschaffenen Öffnung herausgeschleudert wird. Nur dass es sich hier nicht um Wasser, sondern um Sand handelt. Der ganze Schacht war mit Sand angefüllt, und die Last war größer als der unten herrschende Luftdruck. Nun mag schon der letzte Orkan hier oben tüchtig abgeräumt haben. Und dann waren nur noch drei Spatenstiche nötig, um das letzte Übergewicht wegzunehmen, dann schoss die Sandsäule nach oben. Denn bei einem Mehr oder Weniger handelt es sich im Grunde genommen doch immer nur um eine Kleinigkeit, der Theorie nach sogar nur um ein Atom, dann schlägt die Waagschale aus. Der letzte Spatenstich, von mir getan, als ich die Schaufel Sand in die Höhe hob, das genügte vollkommen, um die Waagschale zum Ausschlagen zu bringen — die ganze in dem Schacht befindliche Sandsäule schoss wie aus einer Kanone gefeuert in die Höhe.«
Also Axel war es gewesen, der dies gesprochen hatte, und der Graf bestätigte seine Ansicht, die er wohl selbst schon gehabt. Gerade der Graf musste ja mit allen pneumatischen Erscheinungen recht gut Bescheid wissen, er hatte in seinem Keller doch eine hydraulische Presse gehabt.
Jim, der englische Matrose, dachte sich wohl gar nichts dabei, er starrte nur in die schwarze Tiefe hinab, August hingegen musste doch auch seine eigene Meinung aussprechen.
»Aber dass Sie nur gleich mit einem einzigen Spatenstich diese ganze Sandsäule herausheben konnten!«, sagte er staunend, also beweisend, dass er die Erklärung nicht im Geringsten verstanden hatte, und Axel gab sich auch keine Mühe mehr.
»Ja, siehst du, mein Junge, wenn man eben gelernt hat. Und dann allerdings die Mutter, die Mutter! Solch eine Geburt hatte die freilich auch nicht gehabt, mit solcher Vehemenz, mit einem Knall — nur der Blitz fehlte noch dabei. Nun wollen wir an die weitere Untersuchung gehen, was uns dort unten erwartet.«
Zunächst wurde oben noch mehr Sand beseitigt, um ein Nachrutschen zu verhindern. Der englische Matrose meinte einmal, ob der Schacht vielleicht nicht mit einem Deckel, den man nur nicht hatte fliegen sehen, verschlossen gewesen sei, wurde aber bald eines Besseren belehrt. Es war eine so ungeheure Menge Sand emporgeschleudert worden, dass man nicht anders annehmen konnte, als dass der unverschlossene Schacht ganz mit Sand angefüllt gewesen war.
Da man schon mit unterirdischen Gängen gerechnet hatte, waren zwei Petroleumlaternen mitgenommen worden. Die Luft roch etwas modrig, war aber sonst ganz gut atembar. Jetzt wurde eine Laterne brennend an dem Seil, welches ein Matrose um die Hüften gewickelt trug, hinabgelassen. Giftige Wasserstoffgase waren nicht mehr zu fürchten, die wären zu allererst in die Höhe gestiegen, wohl aber noch Kohlensäure, die sich wegen ihrer Schwere am Boden ansammelt und dort verharrt.
Das mitgenommene Seil war zehn Meter lang, die Laterne verlöschte nicht, hatte aber auch den Boden noch nicht erreicht, es war von diesem noch nichts zu sehen.
»Wir müssen unsere Ladestöcke zusammenbinden und das Seil so verlängern«, meinte einer der Matrosen.
»Oder es klettert eben einer hinab«, ergänzte Axel, »wo die Laterne brennt, kann man wohl auch atmen. Aber sollte es d a s nicht tun?«
Bei diesen Worten hatte er seinen ledernen Rock aufgeknöpft, es zeigte sich, dass er darunter auch eine lederne Weste trug, die aber ein recht merkwürdiges Aussehen hatte, als bestände sie aus lauter einzelnen Streifen — und so war es auch in der Tat, Axel zog an einem Ende, griff Hand über Hand nach und brachte auf diese Weise ein ledernes Band von mindestens zwölf Meter Länge zum Vorschein, das er sich wie eine Weste um die Brust gewickelt gehabt hatte.
»Was für eine merkwürdige Weste tragen denn Sie da?«, fragte der Graf. »Ist das ein Koller, so ein lederner Panzer?«
»Allerdings, dieses starke Lederhemd hat mich schon vor manchem Stich bewahrt, und eine Kugel, die mir sonst das Herz durchbohrt hätte, raubte mir, dank dieses aufgewickelten Lederstreifens, nur kurze Zeit die Besinnung. Sein Hauptzweck aber ist ein anderer. Wissen Sie nicht, was das ist?«
»Nein. Ein langer, breiter Lederriemen.«
»Das ist ein Lasso.«
»Ein Lasso?«, wiederholte der Graf, einmal zeigend, dass er doch nicht alles wusste.
»In Nordamerika waren Sie nicht?«
»Nur in Südamerika.«
»Nun, die Gauchos haben eine ganz ähnliche Vorrichtung.«
»Gauchos? Ach so, ich weiß, was Sie meinen — die südamerikanischen Rinderhirten, den nordamerikanischen Cowboys entsprechend. Die gab es aber zu meiner Zeit noch nicht, ich war auch nur auf den westindischen Inseln.«
»Wann war denn das?«
»Ich bin mit Kolumbus dort gewesen.«
»Ah so, das ist etwas anderes! Damals freilich gab es in Amerika weder Gauchos noch Cowboys, auch noch kein Lasso.«
Axel erzählte, während er das Lasso mit dem Seile verknüpfte, etwas von dieser Wurfschlinge, die tatsächlich erst mit den Cowboys entstanden, für diese zur richtigen Waffe geworden ist, bei den südamerikanischen Gauchos und mexikanischen Vaqueros zur Bola und Riata.
Nun bloß wenige Meter noch, und die Lampe hatte, ohne zu verlöschen, den Boden erreicht.
Das Mauerwerk war überall das gleiche, die unbeschädigte Leiter führte bis auf den Boden hinab, und dort unten schien, so weit man dies von hier oben aus erkennen konnte, ein seitlicher Gang abzuführen.
Bis hierher also war der Wüstensand eingedrungen, durch diesen seitlichen Tunnel war der Luftdruck gekommen und hatte den Sand hinausgepustet, und zwar so gründlich, dass dort unten kein Körnchen mehr zu liegen schien.
»Nun, dann wollen wir hinab.«
Aber nur der Graf und Axel, die beiden Matrosen sollten oben bleiben. Diesen Ein- und Ausgang zu bewachen, das war doch sehr wichtig. Ein Schuss sollte das Zeichen sein, das hier oben etwas nicht in Ordnung war. Wenn der Schuss direkt in den Schacht hineingefeuert wurde, mussten die Mauerwände den Schall sehr weit leiten.
»Aber bitte, nicht feuern, wenn ich dort unten gerade meinen Kopf oder sonst ein Glied meines Körpers habe«, sagte Axel.
»Wir lassen doch unten die brennende Laterne stehen«, meinte der Graf.
»Gewiss, schon deshalb, damit wir selbst das Loch wiederfinden, falls wir in ein unterirdisches Labyrinth kommen.«
Axel, der schon ein Bein in dem Schacht hatte, untersuchte noch einmal seine beiden gewaltigen Reiterpistolen, die man stets in seinem Gürtel sah.
»Wir werden dort unten doch keinem Feind begegnen«, meinte der Graf.
»Wenn auch — Vorsicht ist besser als Nachsicht. Nehmen auch Sie lieber das Gewehr mit.«
Sie stiegen hinab, Axel als erster.
Am Grunde angekommen, zeigte sich der seitliche Schacht bei Meterbreite anderthalb Meter hoch, sodass man etwas gebückt gehen musste.
Die zweite mitgenommene Laterne wurde angebrannt, der Graf hatte auch die Flasche Petroleum zum Ersatz bei sich, so traten sie die Wanderung an, Axel immer noch voran.
Ein ausgemauerter Schacht, nichts weiter.
»Achtundzwanzig«, sagte Axel nach einer Weile und blieb stehen.
Der Tunnel führte noch weiter, aber sowohl links wie rechts führte ein Seitengang ab.
»Stimmt, achtundzwanzig Schritte haben wir gemacht«, bestätigte der Graf.
»Können Sie diese Zahl im Kopfe behalten? Denn wir dürften noch mehr Schritte zu zählen haben. Sonst will ich es mir notieren.«
»Es ist nicht nötig, ich vergesse nichts.«
»Gut, dann dürfen wir uns aber auch nicht trennen. Wohin nun, links oder rechts oder geradeaus?«
Der Graf besichtigte die einzelnen Gänge. Hier erweiterten sie sich, wurden etwas breiter und zwei Meter hoch. Sonst glichen sie sich ganz.
»Einerlei. Bestimmen Sie.«
»Wer die Wahl hat, hat die Qual, und bekanntlich verhungert der Esel zwischen zwei Heubündeln — — das heißt, ein menschlicher Esel, ein vierbeiniger ist klüger, der frisst alle beide auf. Gehen wir doch erst geradeaus.«
Sie taten es, konnten sich jetzt aufrichten, auch nebeneinander gehen.
Diesmal zählten sie gegen fünfzig Schritte, bis der Tunnel aufhörte. Die Blendlaterne, denn eine solche war es, sandte ihren Strahl etwa zehn Meter weit voraus, dann verlor er sich nach allen Seiten in der Finsternis, ohne eine Mauer zu treffen, und erst in einer Höhe von acht Metern war die Decke sichtbar, in schwacher Wölbung gemauert.
Sie befanden sich in einer Halle, deren Größe noch auszumessen war.
Zunächst wandten sie sich nach links, schritten die Seitenwand entlang, hatten gegen neunzig Schritte zu zählen, ehe sie gegen eine andere Wand stießen. Seitengänge hatten von hier nicht abgezweigt, sie hatten nichts als die glatte, von kleinen Quadersteinen ausgeführte Mauer beobachten können.
Eben schickten sie sich an, diese neue Wand abzuschreiten, als sich etwas hören ließ, was danach angetan war, das Blut auch des kühnsten Mannes zu Eis erstarren zu machen — hier tief unter der Erde, in den Ruinen einer vergessenen Stadt.
Ein donnerndes Gebrüll erscholl, das in einen heulenden, durch Mark und Bein gehenden Ton ausklang.
Die beiden Gesichter, die sich anblickten, suchten nichts von ihrem Schreck zu verbergen.
»Was war das?«, flüsterte zuerst der Graf. »Es klang wie das Brüllen eines Elefanten.«
»Haben Sie schon einmal einen Elefanten brüllen hören?«
»Ein einziges Mal.«
»Nein, das war kein Elefant — ich kenne das Brüllen eines Elefanten zu gut — alle Töne, die er von sich geben kann — der Ansatz war wohl ungefähr so, aber der nachfolgende heulende Ton gehörte keinem Elefanten an.«
Sie warteten — das schreckliche Brüllen wollte sich nicht wiederholen.
»Und doch, ein Tier muss es gewesen sein«, begann Axel wieder zu flüstern.
»Da denkt man unwillkürlich an den Minotaurus, an das fabelhafte Ungetüm, das in dem ägyptischen Labyrinth hauste.«
»Von dort kam der Ton, uns voraus — vorwärts, das müssen wir untersuchen.«
Sie schlichen weiter, die Wand entlang.
Da zweigte wieder ein Seitengang ab, sehr breit, und so hoch wie die ganze Halle, Axel sandte den Blendstrahl hinein... er erstarrte zu Stein.
Zuerst war der scharf begrenzte Blendstrahl auf zwei Säulen gefallen, welche aus dem Boden herauswuchsen, der nach oben wandernde Strahl beleuchtete die Vereinigung der beiden Säulen, und dann sah Axel einen ungeheuren Elefantenkopf, mit riesigen Stoßzähnen und dementsprechendem Rüssel, aber nun ein Elefant von wenigstens sechs Metern Höhe, also mehr als doppelt so groß wie ein auf der Erdoberfläche lebender, und außerdem an der Stirn noch ungeheure Hörner tragend.
Es war an sich schon ein schrecklicher Anblick — man bedenke nur die ganze Situation, hier unter der Erde in dem ungeheuren Grabgewölbe... und in diesem Augenblick zeigte sich, dass man nicht nur eine Statue vor sich hatte, jetzt schwenkte das fabelhafte Ungetüm seinen Rüssel auf und ab, öffnete den Rachen, wieder das furchtbare Brüllen mit dem nachfolgenden heulenden Ton, und jetzt setzte sich das Ungetüm in Bewegung, die Säulen waren Beine, welche wie die eines Elefanten mit lautlosem Gange zu marschieren begannen!

Im ersten Moment dachte Axel an Flucht, wandte sich schon dazu, und es war begreiflich. Aber er tat es nicht, er schmiegte sich geduckt gegen die Wand und starrte mit weit aufgerissenen Augen das fabelhafte Ungeheuer einer Unterwelt an, so wie es auch der Graf tat. Der vierfach gehörnte Elefant von sechs Meter Höhe kam aus dem Tunnel heraus und schritt weitausgreifend an den beiden vorüber, den Rüssel, seinem Körpermaße entsprechend, auf und nieder bewegend, mit jenem geräuschlosen, leisen, fast elegant zu nennenden Gange, der bei dem Riesen des Tiergeschlechts so seltsam gegen seine Körpermasse absticht. Denn der Gang des Elefanten hat etwas Tänzelndes an sich, ist ungemein elastisch, das kann man ja bei jedem gefangenen Elefanten in seinem Zwinger beobachten.
So schritt das Ungeheuer an den beiden vorüber, Axel wagte es, ihm den Blendstrahl nachzuschicken, bis es in der Finsternis verschwunden war.
»Alle guten Geister!«, ächzte Axel dann. »Jetzt glaube ich auch an eine Hölle! Was frisst das Luder hier unten?«
Es war diesem materiell veranlagten Depeschenreiter ganz entsprechend, dass er sich zuerst die Frage vorlegte, wovon sich das Ungetüm hier unten ernähre.
Der Graf ließ denn auch ein Lachen hören, was freilich nicht recht angebracht war — oder er hatte eben einen Grund dazu.
»Heureka, ich hab's gefunden!«, ließ er sich in erleichtertem Tone vernehmen, ohne seine Stimme zu dämpfen. »Das Rätsel ist gelöst — wissen Sie, was das ist?«
»Etwas, was mir den Verstand still stehen lässt. Ich muss geradezu annehmen, dass der Moloch der alten Karthager wirklich lebendig gewesen ist und dass er noch immer hier unten haust.«
»Sie sagen es. Aber der phönizische Moloch Melkart hatte bei den Karthagern seltsamerweise den griechischen Namen Kronos, und aus dem Stier hatten die Afrikaner einen Elefanten gemacht, nur die Stierhörner hatten sie ihm gelassen, dafür auch gleich vier.«
»Was? Dieser Moloch oder Kronos hätte wirklich gelebt und er lebte noch heute?«
»Einfach ein mechanischer Automat.«
Ja, wenn man es weiß, dann ist alles einfach.
So wunderte sich auch Axel jetzt nicht mehr, gerade weil er in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts lebte.
Denn früher war man in Automaten weiter als heute. Unser Zeitalter eignet sich nicht mehr recht zur Herstellung von solchen beweglichen Figuren, obgleich wir im Maschinenjahrhundert leben. Es ist dies gar kein Widerspruch. Wir stellen alles mit Maschinen her, die Handarbeit wird nicht mehr bezahlt, wahrscheinlich sogar haben wir die Geschicklichkeit der Handarbeit etwas verloren. Dann fehlen wohl auch die Liebhaber für solche Sachen, das ist doch auch nur eine Geschmacksmode.
Als die ältesten Automaten werden erwähnt die fliegende hölzerne Taube des Archytas von Tarent, die kriechende Schnecke des Demetrius Phalereus, der Adler des Pausanias, der gehende und sprechende Mensch des Ptolemäus Phildelphus. Alle vor Christi Geburt, nicht mehr vorhanden. Im Mittelalter werden Roger Bacon, Albertus Magnus und Regiomontanus als Verfertiger wunderbarer Automaten genannt, woraus man ersieht, dass sich damals die berühmtesten Gelehrten mit der Verfertigung solcher Spielereien abgegeben haben.
Ja, was ist denn das, eine Spielerei? Lässt es sich nicht denken, dass dereinst die ganze Malerei, der Versuch, eine natürliche Landschaft, die Schöpfung Gottes, durch Aneinanderfügen von Farben auf einem Stück Leinwand wiedergeben zu wollen, nur als eine kindliche Spielerei betrachtet werden könnte? O ja, es lässt sich recht wohl denken.
Dann beginnt die eigentliche Blütezeit der Automaten mit der Erfindung der durch Federkraft getriebenen Taschenuhren durch Peter Henlein, im Jahre 1500. Besonders das kunstfertige Nürnberg war es, welches alle die musizierenden, sprechenden, tanzenden und kegelnden Maschinenmenschen in alle Welt schickte, Tiere und alles andere, was Gott erschaffen und ihm einen lebendigen Odem eingeblasen hat. Die Automatenmacher Werner, Bullmann, Hautsch und Förster hatten damals solche berühmte Namen wie heute noch die Meister der italienischen und holländischen Malerschule. Reiche Leute kauften die Automaten auf wie heute Gemälde und Statuen. Man machte deshalb die weitesten Postreisen, nur um sie gesehen zu haben, um damit renommieren zu können. Über diese Automaten wurde in den Salons gesprochen und kritisiert wie heute über Gemälde und Werke der Literatur, man musste es, sonst konnte man eben nicht mitsprechen, es gehörte mit zur Bildung.
Gerade zu der Zeit, in der unsere Erzählung spielt, in der Mitte des 18. Jahrhunderts, hatte der Pariser Mechaniker Vaucanson seine fressende Ente ›herausgebracht‹. Diese Ente aus Holz bewegte Flügel und Kopf wie eine natürliche, soff Wasser, fraß Körner und ließ nach einiger Zeit hinten eine grüne Materie fallen. Paris war schon dabei, dem Mechaniker wegen dieser Ente ein Denkmal zu setzen, als diese Automatenmanie endlich wieder nachließ. Glücklicherweise. Denn es gab damals Menschen genug, welche wahrhaftig glaubten, man könne dem Gottschöpfer auch noch das letzte Geheimnis ablauschen, wirklich lebende Wesen auf künstliche Weise herstellen, auch noch ein selbstständig funktionierendes Gehirn mit Nervenfasern verfertigen. Zu diesem Wahne trug viel Kempelens automatischer Schachspieler mit bei, der die besten Schachmeister zum Kampfe herausforderte und sämtlich schlug, ohne dass man sich erklären konnte, wie das automatisch zu machen sei. Kempelen war selbst daran schuld, dass er zuletzt als Schwindler entlarvt wurde. Denn er behauptete, dass der Automat wirklich ganz selbstständig spiele, also auch selbst denke. Natürlich steckte ein genialer Schachspieler dahinter. Hätte er gleich die Wahrheit bekannt, so wäre der Automat als sein geniales Werk angestaunt worden. So wurde er als Schwindler entlarvt. Das führte dann die Ernüchterung herbei, die Automaten kamen aus der Mode, wer sich noch ernstlich damit beschäftigte, wurde verspottet — die gewöhnliche Gegenreaktion.
Der letzte leidenschaftliche Automatensammler war wohl Professor Beireis in Helmstedt, ein merkwürdiger Sonderling durch und durch, ein Universalgenie mit eminenten Kenntnissen, dabei bis ins höchste Alter ein Athlet bleibend, der aber seine außerordentlichen Fähigkeiten auch immer nur zu Hokuspokusmachereien gebrauchte — ein Mann, über den man fast ebenso wie über den Grafen von Saint-Germain einen ganzen Roman schreiben könnte. In seinem Raritätenkabinett, das von Fürsten besucht wurde, befand sich auch die Ente und der Flötenbläser von Vaucanson, die dann nach Holland verkauft wurden. Dieser Beireis hat auch, nebenbei bemerkt, bis zu seinem Tode im Jahre 1909 behauptet, dass er Gold machen könne, und man hat es ihm geglaubt, weil nicht zu erweisen war, woher seine unerschöpflichen Geldmittel flossen. Erst nach seinem Tode erfuhr man, dass er an chemische Fabriken sehr viel Rezepte verkauft hatte, hauptsächlich neue Farbstoffe, aber in jedem Rezepte etwas auslassend, eine Substanz, die nur er allein lieferte, und nach seinem Tode sind alle diese Erfindungen wieder verloren gegangen. — — —
Diese Erklärungen sollten zeigen, weshalb es auf Axel gar keinen so großen Eindruck machte, als er hörte, es handele sich hierbei nur um einen Automaten. Axel war eben ein Sohn seiner Zeit, die sich sehr viel mit Automaten beschäftigte, in dieser Beziehung gar nichts mehr für unmöglich hielt.
»Also ein Automat, aha! Nun natürlich, denn weiter! Folgen wir ihm!«
Sie taten es, schritten in der Richtung vor, in der der riesenhafte Elefant verschwunden war.
Dass der Graf als ehemaliger Hasdrubal weitere Erklärungen gab wegen des Molochs, dazu war jetzt natürlich keine Zeit.
Sie verfolgten die Richtung, welche das Ungetüm eingenommen hatte, und brauchten nur wenige Schritte zu tun, als der vorausgeschickte Blendstrahl den Koloss auch schon erreichte.
Er war stehen geblieben, ohne an ein Hindernis gestoßen zu sein, der Mechanismus war abgelaufen, und zwar stand er in wenig natürlicher Stellung da, indem er mitten im Laufen Halt gemacht hatte, den linken Hinterfuß sehr hoch erhoben.
»Ja, wodurch ist der Mechanismus eigentlich in Bewegung gekommen, dass er brüllen und gehen konnte?«, wurde diese Frage erst jetzt aufgeworfen.
Da man nicht an einen Menschen glaubte, der hier unten hauste, so gab es keine andere Erklärung, als dass sie selbst durch Betreten einer Platte oder sonst wie einen Mechanismus ausgelöst hatten. Das war später zu untersuchen, jetzt galt es erst das Ungeheuer näher zu besichtigen.
Es war offenbar präparierte Elefantenhaut, mit der ein Gestell überzogen worden war, nur dass gleich einige Elefanten ihre Häute dazu hatten lassen müssen, jetzt gewahrte man die Nähte, die im Laufe der Zeit etwas gelitten, sich gespannt hatten; auch die Gelenke, aus vielen Ringen bestehend, waren an den Füßen und am Rüssel sichtbar.
Aber vergebens suchten die beiden nach einem Loch, durch das man ins Innere dringen oder wenigstens spähen konnte. Auch der Rachen, dessen Unterkiefer in Kugelgelenken ging, wollte sich in keiner Weise wieder öffnen lassen, wie sie auch an den verschiedensten Stellen drückten und selbst ziemlich Gemalt anwendeten.
Das Ganze schien dem Klopfen nach aus Metall zu bestehen, aus ehernen Platten, Axel zweifelte, dass ein einzelner Mann auch bei größter Körperkraft das Ungeheuer umwerfen könne, und daraus wieder musste man auf den inneren Mechanismus schließen — — jedenfalls ein Kunstwerk allerersten Ranges, besonders wenn man an eine Vergangenheit von etwa zweitausend Jahren dachte.
»Hat es diesen gehörnten Elefantenmoloch schon damals gegeben, als Sie als Hannibals Bruder Ihre Gastrolle auf Erden und speziell in Karthago gaben?«, fragte Axel.
Jetzt war die Frage gestellt. Jetzt kam der Graf in sein Fahrwasser. Gleich hier an Ort und Stelle begann er vom Moloch oder Melkart oder Kronos zu erzählen, wie ihm Menschen, hauptsächlich Kinder, geopfert wurden, manchmal gleich massenhaft.
Axel glaubte ihm zwar nicht, dass er selbst mit dabei gewesen war, aber höchst interessant war es jedenfalls, was er da alles erzählte, und jeder Geschichtsforscher, der durch Entziffern alter Hieroglyphen oder sonst wie in das Leben der alten Karthager eingedrungen war, hätte ihm beistimmen müssen, hätte auch alle einzelneu Details ganz glaubhaft gefunden.
Dieser Abenteurer, der sich zuerst Graf von Saint-Germain nannte, muss eben auch in der Weltgeschichte ein Universalgenie gewesen sein, wie ja schon öfter gesagt wurde.
Die erste Tatsache, welche er berichtete, war, dass die Karthager im Gegensatz zu den alten Phönikern ihrem Molch niemals gefangene und fremde Kinder opferten, sondern immer nur ihre eigenen. Der Opfertod musste ganz freiwillig geschehen, um den zürnenden Gott günstig zu stimmen oder ihm für einen Sieg oder eine reiche Ernte oder für sonst etwas zu danken. Durch den Mund seiner Priester forderte der furchtbare Gott etwa hundert Männer, hundert Frauen und dreihundert Kinder. Denn Kinder, noch ganz hilflose, waren ihm immer am liebsten. Ganz freiwillig mussten sich die zweihundert erwachsenen Menschen melden, und zwar echte Karthager aus den edelsten Geschlechtern. Nur wenn sich viele meldeten, dann erst entschied unter diesen das Los. Die Kinder freilich konnten sich nicht freiwillig melden, aber von den Eltern mussten diese freiwillig dargebracht werden, und zwar nur von solchen, die nicht selbst in den Opfertod gingen. Und diese mussten dann mit an den freudigen Opfertänzen und sonstigen Festlichkeiten teilnehmen, und sie taten es auch wirklich freudigsten Sinnes.
Uns ist es ja heute ganz unverständlich, wie so etwas möglich sein kann, aber... die Zeiten ändern sich eben. Ob auch wir uns heute nicht manchmal in einem furchtbaren Wahne befinden, Opfer bringen, die man tausend Jahre später gar nicht mehr begreiflich findet? Und wenn wir heute gar nicht wissen, was für furchtbare Wahnopfer denn das sein sollten, die wir irgend einer Mode oder einem Glauben bringen, so ist das ja eben ganz richtig. Wir empfinden den Irrwahn gar nicht als solchen. Und wer ihn empfindet der... soll lieber gar nicht daran rühren.
Und doch, wenigstens eine kleine Andeutung: unser ganzes Heiratswesen, das Heiraten nach Geld. Einer unserer edelsten Geister, die schriftstellerisch tätig sind, um aufklärend auf das Volk zu wirken, sagt frei heraus, dass das Verheiraten der Töchter in den höchsten und mittleren Schichten nach Geld, um sie zu ›versorgen‹, ohne nach ihrer Zustimmung zu fragen, der schmachvollste Sklavenhandel ist, der je in der Weltgeschichte getrieben worden, die brutalste Vergewaltigung aller menschlichen Gefühle und daher der Gesetze der Natur Gottes, und dann diese Heiratsannoncen, welche die Spalten der Zeitungen füllen, diese Angebote, um den Kindersegen zu verhindern... wehe uns!!! Gott lässt sich nicht ungestraft spotten, rächt sich alles noch einmal, und wenn man es nicht glaubt, dass jeder am eigenen Leibe empfinden muss, so wird ein ganzes Volk dadurch zugrunde gehen!
So sprach auch der Graf. O, dieser Mann wusste Gleichnisse aufzustellen! Nein, es war für die damaligen Karthager gar nichts so Furchtbares, die eigenen Kinder dem feuerspeienden Gotte zur Verbrennung in die Arme zu legen. Sie tanzten dabei, wie heute die Eltern bei der Hochzeit ihrer in lebenslängliche, oftmals schmählichste Sklaverei verkauften Töchter tanzen, und das vor Gottes Thron.
»Ich selbst habe zwei von meinen Kindern dem menschenfressenden Gotte zugeführt, und ihre Mutter, meine Gattin, war genau so stolz und glücklich darüber. dass er sie als Opfer annahm. Auch wir waren eben Kinder unserer Zeit.«
So fügte der Graf noch hinzu. Er hätte es doch nicht fertig gebracht, dem Moloch nicht auch eigene Kinder geopfert zu haben.
Axel hielt diesmal seine Meinung zurück, wollte anderes hören.
»Sie wurden im Innern des Ungeheuers verbrannt, darunter ein Feuer entzündet?«
»O nein. So wurde es in Phönizien gehalten, wo Moloch ein eherner Stier war. Hier war es ein lebendiger Elefant, oder doch eine Verbindung mit einem Elefanten, dem afrikanischen Karthager entsprechend. Der furchtbare Moloch galt vollständig für lebendig, er kam anmarschiert, bis zur heiligen Stätte, die ich Ihnen dann beschreiben werde, er selbst nahm mit seinem Rüssel das dargebotene menschliche Opfer, legte es quer auf seine Zähne, öffnete seinen Rachen, stieß das schreckliche Gebrüll aus, das wir vorhin zweimal hörten, und mit dem letzten, heulenden Tone schlug aus seinem Rachen eine Feuergarbe hervor, die es bis zur Asche verzehrte. Die Asche fiel in eine Urne, die dann aufbewahrt wurde.«
»So war das ganze Innere mit einer feurigen Masse gefüllt?«
»Nein, nicht der ganze Leib, der enthält ja den Mechanismus, wahrscheinlich war auch ein Mann darin verborgen, ein Priester, der den Mechanismus dirigierte. Nur der Kopf enthielt das Feuer, wahrscheinlich glühende Holzkohlen, durch künstlichen Luftzug wurde eine Stichflamme erzeugt.«
Es hatte ja alles Hand und Fuß, was der Graf da schilderte, aber...
»Man hielt dieses Ungetüm doch nicht für einen Automaten?«
»Gewiss nicht. Das war ein lebendiger Gott, ein furchtbar lebendiger, der nur zu gewissen Zeiten sichtbar wurde.«
»Glaubten denn auch Sie daran — Sie mit Ihrer in schon vielen Lebensläufen gesammelten Erfahrung?«
»Ich war damals kein Priester, sondern ein Krieger, ein Feldherr«, war die ausweichende Antwort. »Ich hatte keinen anderen Glauben als das Volk. Die Erinnerung an meine früheren Lebensläufe ist mir eigentlich erst später gekommen, früher waren das immer nur so dunkle Ahnungen.«
»So so, hm. Nun, wenn wir hier unten nichts anderes finden, so dürften Sir Dalton und seine Erben es wohl nur auf diesen alten Moloch abgesehen gehabt haben. Denn der ist es ja wert, einem Museum einverleibt zu werden.«
»Das denke auch ich.«
»So hat Sir Dalton durch die Augen jenes Derwisches diesen gehörnten Elefanten hier in den unterirdischen Ruinen schon gesehen?«
»Darüber kann ich Ihnen gar nichts sagen, solche Einzelheiten wurden ja auch mir verschwiegen, oder Lady Isabel wusste mir darüber nichts zu berichten. Jedenfalls aber wusste der finnländische Steuermann bis zur Zehntelsekunde genau den Eingang zu bestimmen, durch den man am leichtesten hier dringen konnte.«
»Und die schwarze Mannschaft scheint unterdessen noch nicht hier gewesen zu sein.«
»Davon ist keine Spur vorhanden.«
»So sehen wir uns weiter um, ehe wir beraten, was nun mit diesem großen dicken Kerl zu machen ist.«
Eine Stunde noch widmeten sie der weiteren Untersuchung dieses unterirdischen Reiches. Sie durchschritten viele Gänge, kamen in noch andere Säle, fanden in den Wänden Nischen, aber sonst nichts. Es war alles vollständig ausgeräumt worden. Auch an keine Treppe, keinen sonstigen Ausgang kamen sie.
Der Moloch musste wohl in jenem Gange gestanden haben, aus dem er vorhin herausgekommen war. Auf welche Weise sich der Mechanismus in Bewegung gesetzt hatte, das war und blieb ein Rätsel.
Es musste wohl etwas mit dem Luftdruck oder vielmehr Luftzug zu tun haben, der vorhin hier durchgesaust war, und hatte es einmal hier abgelagerten Staub gegeben, in dem sich irgendwelche Spuren abgedrückt hatten, so war auch dies durch den Luftzug alles verwischt worden.
Die Auslösung des Mechanismus war nur nicht sofort eingetreten, erst nach einiger Zeit, als sich die beiden schon hier befanden, und dann konnte es noch immer sein, dass sie irgend einen Knopf berührt oder eine lose Platte betreten hatten, wenn sie so etwas auch nicht fanden.
Nach einer Stunde also gaben sie die weitere Untersuchung auf, kehrten zu dem Ungeheuer zurück, und anderen Menschen wie dem Grafen und diesem Depeschenreiter wäre solch eine Rückkehr vielleicht gar nicht so leicht gefallen. Es war ein wirkliches Labyrinth, in dem sie sich befanden.
Was sollten sie nun mit dem Ungeheuer anfangen? Es war absolut so gar keine Handhabe da, wie man es hätte auseinandernehmen sollen, nur um einmal ins Innere blicken zu können.
Der aus vielen breiten Ringen bestehende Rüssel klapperte etwas, das war alles, sonst war er unbeweglich wie der ganze Koloss.
»Lassen wir ihn doch hier stehen, vielleicht nehmen wir ihn ein andermal mit, für unser eigenes noch anzulegendes Museum, wenn wir besser auf so etwas vorbereitet sind«, schlug Axel vor.
Der Graf war damit einverstanden. So begaben sie sich nach dem vertikalen Schachte zurück, auf dessen Boden sie die brennende Laterne schon von Weitem sahen.
In die Nebentunnel, die sie schon vorhin passiert waren, blickten sie nur einmal hinein, hatten keine Neigung, sie weiter zu untersuchen, Sie würden ja doch nichts finden.
Axel äußerte ganz unverhohlen, welche Sehnsucht er habe, das Licht der Sonne zu erblicken, wieder frische Luft zu atmen, mochte es auch heiße Wüstenluft sein. Es herrschte hier doch eine sehr dumpfige, ganz stickige Atmosphäre. Axel fühlte immer mehr, wie schwer ihm das Atmen ward. Ja, wenn sie hier unten noch etwas gefunden hätten, was sie in Aufregung hielte!
Auf dem letzten Gange nach jenem nach oben führenden Schachte aber sollten sie noch etwas entdecken, was ihnen vorhin entgangen war. Auf dem Boden lag ein flacher Eisendeckel, nicht ganz quadratisch, wie auch der vertikale Schacht beschaffen war. Offenbar passte er oben auf die Mündung. Sie nahmen ihn mit, und eben weil er nicht ganz quadratisch war, konnten sie ihn auch mit leichter Mühe durch den Schacht bringen, und richtig zeigten sich oben nach vorsichtiger Wegräumung des Sandes Fugen, in die der Deckel genau hineinpasste.
Erst machte sich der Graf noch gewisse Zeichen, woran er später erkennen konnte, falls der Deckel unterdessen einmal abgenommen worden war, dann wurde der Sand darüber geschaufelt und der Rückweg angetreten.
Zu berichten hatten die oben gebliebenen Matrosen nichts gehabt.
Sie befanden sich wieder an Bord der Jacht. »Wohin nun?«, fragte Axel. »Was ist der nächste Punkt, der in Betracht kommt?«
Der Graf hätte den Zettel gar nicht zu befragen brauchen, er hatte alle Bestimmungen im Kopfe, auch schon der geografischen Ordnung gemäß.
»Noch vier Bestimmungen beziehen sich auf die nordafrikanische Küste, drei auf Algerien und eine auf Marokko«, sagte er, auf die betreffenden Zahlen mit dem Bleistift deutend.
»Diese Zahlen stehen recht weit auseinander«, bemerkte Axel.
»Ja, sie können nicht im Zusammenhang genannt worden sein.«
»Alle Punkte liegen an der Küste?«
»Ziemlich dicht an der Küste.«
»Und was liegt jetzt dort? Haben Sie schon auf der Karte nachgesehen?«
»Ich habe es. Höchstens ein elendes Araberdorf, so weit das diese Karten angeben.«
»Und was lag früher dort?«
»Darüber habe ich mich in unseren spärlichen Handbüchern nicht orientieren können, dazu reichten auch meine historischen Kenntnisse nicht aus, zu sagen, ob hier vielleicht alte Städte gelegen haben«, gab der Graf einmal offen zu.
»Weshalb denken Sie gerade an alte Städte?«
»Diese Vermutung, dass es sich um solche handelt, liegt doch sehr nahe. Wir kommen aus dem alten Karthago. Alle Aufzeichnungen innerhalb Ägyptens beziehen sich auf alte Städte, auf Theben, auf Memphis, auf das alte Labyrinth am alten Mörissee und auf andere Ruinen. Darüber habe ich mich schon vergewissert. Und an der Nordküste Afrikas haben die Phönizier und Karthager noch manche Kolonie mit Stadt gegründet gehabt, deren Namen wir jetzt nicht einmal mehr kennen.«
»Wollen wir diese Punkte aufsuchen?«
»Ich schlage vor, erst einmal zu untersuchen, was solch eine geografische Bestimmung mitten im Meere zu bedeuten hat.«
»Ah, ist solch ein Punkt auch für das Mittelländische Meer gegeben?«
»Ja, nur ein einziger, und zwar gar nicht so weit von hier.«
Der Graf nannte die Zahlen, die wir hier nicht wiedergeben wollen. Hier fehlten einmal bei den Sekunden die Dezimalstellen, also konnte es sich nur um ein Gebiet von dreißig Meter Länge und etwas schmalerer Breite handeln, und dieses lag etwa fünfunddreißig geografische Meilen von hier und gegen zehn geografische Meilen von der algerischen Küste entfernt.
»Wollen wir hinsegeln?«
»Ich schlage es vor. Es liegt ja sowieso an unserem Wege.«
Der Wind war günstig zu dieser westlichen Fahrt, sofort wurden die Anker gelichtet.
Am Mittag waren sie aufgebrochen, am anderen Morgen kurz nach Sonnenaufgang hatten sie die fünfunddreißig Meilen hinter sich. Von der algerischen Küste war trotz ihrer felsigen Höhe auf diese Entfernung hin natürlich nichts zu sehen. Auch kein Schiff, kein Fahrzeug war zu erblicken. Es ist auch heute eine ganz einsame Gegend. Das Meer, nichts als das blaue Meer. Und dann allerdings noch etwas anderes, schließlich auch Land zu nennen: der Meeresboden.
Seit sich der Tag gelichtet hatte, konnten sie über die Bordwand den Grund erblicken. Denn das Meer war sehr ruhig und das Wasser klar wie Glas; als die Sonne höher kam, konnte man die gelben Kiesel erblicken, die den Meeresboden dicht bedeckten. Die Tiefe, die damals für hier noch nicht auf Seekarten angegeben war, betrug durchschnittlich fünf Faden... neun Meter.
Noch eine Sonnenaufnahme und Berechnung wurde gemacht.
»Es stimmt, wir sind direkt am gegebenen Ort.«
Aber vergebens spähten sie über die Bordwand. Nichts als größere und kleinere Kiesel, ganz regelmäßig über den ebenen Grund ausgestreut.
»Trotzdem, hier muss es sein — lasst fallen den Anker!«
Der Hauptanker rasselte herab, fand sofort festen Halt.
Dadurch trübte sich erst das Wasser, bald aber hatte es sich wieder geklärt. Es war nichts Auffälliges zu erblicken.
»Entweder hat hier überhaupt niemals etwas gelegen«, meinte Axel, »da haben sich die Hellseher eben einmal geirrt, oder es ist vom schwarzen Schiffe bereits abgeholt worden.«
»Oder es liegt unter den Kieseln«, ergänzte der Graf.
»Was könnte das sein?«
»Es könnte noch immer ein Wrack in Betracht kommen. Das Gebiet ist ein so großes. Wenn es sich wirklich nur um einen kleinen Gegenstand handelte, weshalb sollte der finnländische Steuermann nicht wie sonst fast immer eine Bestimmung bis zur Zehntelsekunde gemacht haben?«
»Ja, aber wie dort unten graben?«
»Herr Kapitän, haben Sie einen Taucherapparat an Bord?«
Die Jacht war sonst so ziemlich mit allem versehen, was auch das größte Schiff an Bord hat, und der Taucherapparat war schon damals ziemlich vervollkommnet — aber daran hatte Kapitän Morphin doch einmal nicht gedacht.
Es gab kaum ein Mittel, um den Meeresgrund auch nur aufzuwühlen. Zwei lange Hakenstangen hätten zusammengebunden werden müssen, und das bekommt doch niemals einen festen Halt, um eine größere Kraftleistung ausführen zu können. Höchstens mit einem kleineren Anker an einem Seile unten herumrühren, aber das war doch alles nichts. Man fuhr noch in einem Boote hin und her, nach irgend etwas Auffallendem spähend. Vergebens! So vergingen zwei Stunden.
»Diesmal war es nichts. Oder wir müssen uns erst mit einem Taucherapparat versehen, ehe wir die Hellsehergabe der beiden Wundermenschen verurteilen können.«
»Ja, ich schlage vor«, bestätigte der Graf, »wir fahren erst nach dem nächsten großen Hafen, gleich nach Marseille, und verschaffen uns dort einen Taucherapparat, den wir immer gebrauchen können. Wenn nicht hier, dann anderswo.«
Schon wurden die Vorbereitungen getroffen, um den Anker wieder zu lichten, als der schwarze Sam aus der Luke, die direkt in seine Kombüse führte, an Deck gestürzt kam.
»Frischwasser«, rief er, »es ist Frischwasser!«
Er musste eine nähere Erklärung geben, ehe man ihn verstand, und dann wollte man ihm noch immer kaum glauben.
An Bord jeden Schiffes wird ja das Frischwasser möglichst gespart, auch in der Küche, selbst die Kartoffeln werden meistens in Seewasser gekocht. So hatte Sam vorhin eine ›Pfütze Wasser ausgeschlagen‹, wie der seemännische Ausdruck lautet, nur zum Aufwaschen, es war ihm sofort aufgefallen, als er nur die Hand hineintauchte und die Finger rieb, wie weich es war, er hatte gekostet — vollkommen trinkbares Wasser, nicht der geringste Salzgeschmack dabei.
»Es ist ja nicht möglich, du irrst!!«, riefen Axel und der Graf aus einem Munde.
Überzeugung macht wahr. Auch sie brauchten nur einen Eimer Wasser heraufzuholen — es war Süßwasser, wenn auch ohne Zucker. Die beiden staunten ein Rätsel an, welches sie sich zwar nach einiger Überlegung erklären konnten, das aber deshalb an Wunderbarlichkeit nicht abnahm.
Die Untersuchung wurde im Boot fortgesetzt, und sie ergab, dass sich hier mitten im Mittelländischen Meere, das sich durch besonders hohen Salzgehalt auszeichnet, ein Prozent mehr als im Atlantischen Ozean, ein Gebiet von etwa 16 Quadratmetern befand, in dem es frisches Wasser gab ohne Salzgehalt. An den Grenzen dieses Gebietes wurde es nach und nach brach, bis es richtiges Seewasser war.
Also, dort unten auf dem Meeresboden war eine süße Quelle. Das konnte man jetzt, da man es wusste, auch konstatieren, indem man Schnitzelchen von schwerem Papier, Zeugfleckchen hineinwarf, die langsam untersanken. In der Nähe des Bodens wurden sie wieder nach oben geführt.
Gewiss, eine Erklärung gab es für jeden verständigen Kopf. Weshalb muss denn das Quellwasser immer an der Oberfläche der Erde zutage treten? Es kann doch auch einmal auf dem Meeresgrunde zum Vorschein kommen. Die tiefe Lage hat dabei nichts zu sagen, ebenso wenig die Entfernung. Es gibt einsam in einer großen Ebene liegende Hügel genug, welche ganz oben auf ihrem Gipfel jahraus jahrein eine starke Quelle entspringen lassen. Dass hier nicht angesammeltes Regenwasser in Betracht kommen kann, das haben die Umwohner von jeher gewusst, ohne sonst irgendwelche geologische Kenntnisse zu besitzen. Das ist der Abfluss des Regenwassers, das sich auf einem anderen, höheren, vielleicht viele, viele Meilen entfernten Gebirge ansammelt, durch einen unterirdischen Kanal wird es hierher und herausgedrückt.
So war es auch hier. Anders konnte es ja gar nicht sein. Die Küste Algiers ist sehr gebirgig, Ausläufer des Atlas. Regen fällt hier genug, nur ohne viel Vorteil für Pflanzen- und Tierwelt. Wohl gibt es genug Quellen, aber auf der Landseite verlaufen sie nutzlos im Sand, auf der anderen fallen sie ebenso nutzlos ins Meer. Sie können aber auch weit entfernt vom Gebirge mitten in der Wüste zutage treten. Was sind denn alle Oasenbrunnen anderes, wenigstens soweit ihr Wasser abläuft?
Hier nun ging dieses Gebirgswasser einmal bis unter den Meeresgrund und noch weit, weit unter diesen hin, ward in die Höhe gedrückt. Frisches Wasser ist leichter als salziges, es drückte dieses nach oben, ganz beiseite, vermischte sich erst nach und nach mit ihm. Dieses Vermischen geschieht überhaupt gar nicht so leicht. Wenn man eine hohe Glasröhre zur Hälfte mit einer Salzlösung füllt, dann ganz vorsichtig frisches Wasser nachgießt, so bilden die beiden Wasserarten zuerst eine ganz scharfe Grenze, sogar mit bloßem Auge ganz deutlich erkenntlich, und es dauert, wenn die Röhre ganz ruhig steht, tagelang, bis sich die beiden Flüssigkeiten vermischt haben, dass das Wasser überall den gleichen Salzgehalt zeigt. In diesem Falle kam noch in Betracht, dass das Mittelländische Meer nur eine ganz schwache Ebbe und Flut hat, und das Aufwühlen des Meeres durch Sturm geht überhaupt nicht so tief hinab, in einer Tiefe von schon fünf Metern herrscht ewige Ruhe, und so müsste man dieses Frischwasser auch beim stärksten Seegange doch immer noch durch einen herabgelassenen Schlauch heraufpumpen können.
Ja, diese Erklärung war schließlich ganz einfach — wenn man die Tatsache einmal kannte. Unsere beiden Freunde standen staunend vor eben dieser Tatsache. Eine süße Quelle mitten im Meere! Das hätte ihnen einmal jemand erzählen sollen!
Heute ist das bekannter. Aber auch erst dem Anfang des neunzehnten Jahrhunderts blieb es vorbehalten, drei oder vier solche Süßwasserquellen im Meere an der Ostküste Nord- und Zentralamerikas zu entdecken, und zwar durch reinen Zufall. Ja, wie soll man solche Quellen auch finden? Da gibt es eigentlich nichts anderes, als dem Meere fortwährend Proben zu entnehmen und das Wasser zu kosten oder sonst wie zu prüfen. Aber wie soll das ermöglicht werden? Gewiss, das sind doch nicht nur die drei oder vier Süßmeerquellen, da mag es noch viele Tausende geben, und wenn diese alle gefunden und geografisch genau bezeichnet würden, würde das ja die ganze Wasserfrage der Schiffe, überhaupt die ganze Schifffahrt ändern! Aber wie eben solche Quellen finden, wenn nicht einmal ein Zufall zu Hilfe kommt? Wenn jemand gehört hat, dass irgendwo in der Lüneburger Heide ein Schatz vergraben liegt und er macht sich auf, ihn zu suchen, so kann er diesen durch Zufall eher finden als tausend Schiffe solch eine Süßwasserquelle.
»O, Wunder über Wunder, eine süße Quelle mitten im Meere!«, musste Axel seinem Staunen immer noch Luft machen.
Der Graf gab für die Möglichkeit eine physikalische Erklärung, Axel stimmte bei, konnte sie sogar ergänzen, aber das Wunder blieb trotzdem bestehen, und auch der Graf machte aus seinem Staunen kein Hehl.
»Ja, wie sind die denn nur überhaupt darauf gekommen, hier eine Süßwasserquelle zu suchen.'«
»Durch die beiden Hellseher, in ihrer Verbindung, zusammen.«
»Ja, da muss Sir Dalton erst gewusst haben, dass es überhaupt solche Süßwasserquellen im Meere gibt. Und wie hat er es dann gemacht, die Aufmerksamkeit des arabischen Derwischs auf so etwas zu lenken?«
Dafür konnte Axel natürlich keine Erklärung geben.
Es war nicht so seltsam, dass die hier gemachte Entdeckung auf den Grafen und auf Axel noch ganz anders wirkte, als der in den Ruinen Karthagos aufgefundene Moloch, von Kapitän Morphin und seinen Leuten gar nicht zu sprechen.
Eine Süßwasserquelle mitten im Meere, aus der man das Trinkwasser ergänzen konnte, wie man jetzt auch gleich tat — es war etwas gar zu Ungeheuerliches, trotz aller Erklärungen, man hatte an solch eine Möglichkeit eben noch nicht im Traum gedacht.
»Wie viele solcher Punkte im Meere gibt es sonst noch?«
Von den gesamten 214 Bestimmungen bezogen sich nicht weniger als 38 auf das Meer, die angegebenen Punkte verteilten sich über die ganze Erde, so weit diese mit Wasser bedeckt ist, zum größten Teil auch wieder bis zur Zehntelsekunde bestimmt.
»Ob da lauter solche Süßwasserquellen sind?«, fragte Morphin, der nun schon von der Bedeutung dieses Zettels etwas zu hören bekommen hatte.
»Ja, wie soll ich das wissen!«, entgegnete der Graf.
»Werden wir sie alle aufsuchen?«, fragte jetzt Axel.
Sinnend blickte der Graf auf den Zettel in seiner Hand nieder.
»Für das Mittelmeer kommt nur eine solche Bestimmung in Betracht, und die ist erledigt.«
»Und wo liegt der nächste Punkt im Meer?«
»Da kommt erst der Atlantische Ozean in Betracht, oder — das Rote Meer, von dem wir aber durch die Landenge von Suez getrennt sind.«
»Ja, was wollen Sie jetzt eigentlich tun? Was ist Ihr Ziel?«
Ein quälender Seufzer rang sich aus des Grafen Brust.
»Mir Gewissheit verschaffen, ob das schwarze Schiff untergegangen ist oder nicht — nur Gewissheit, nur Gewissheit!«
»Wie sich aber diese Gewissheit verschaffen, wenn Sie sich nicht damit begnügen wollen, jedes uns begegnende Schiff anzurufen, ob es nicht einen solchen schwarzen Kasten gesehen hat, mit derselben Frage jeden Hafen anzulaufen...«
»Das hätte ja gar keinen Zweck.«
»Weshalb nicht?«
»Will sich das schwarze Schiff unsichtbar machen, so verändert es einfach seine Farbe, sein Aussehen, wie ich schon einmal gesagt habe.«
»Sie wollten doch um Afrika herum in die Südsee, ob Sie dort vielleicht die Heimatinsel dieses Schiffes finden.«
»Ja, das war mein erster Plan. Und wenn ich sie nicht finde, dann nach Indien.«
»Haben Sie in Indien etwas Besonderes vor?«
»Nur das Auskundschaften des schwarzen Schiffes.«
»Wie das?«
»Ich bin in Indien schon gewesen, und auch sonst... ich denke an einen hellsehenden Fakir, dessen Gabe ich benutze, da ich selbst diese Gabe verloren.«
»Hm. Immer wieder diese Hellseherei...«
»Es ist der kürzeste Weg.«
»Nun gut. Aber sollte man solch einen Mann nicht näher finden können?«
»Das habe ich mir unterdessen auch überlegt. An Bord jenes Schiffes war ebenfalls ein hellsehender arabischer Derwisch, alle diese Bestimmungen stammen von einem solchen. Auch in Ägypten müssen sich solche finden lassen.«
»Sind Sie in Ägypten bekannt?«
»Weniger als in anderen Ländern«, war die ausweichende Antwort. »Ich schlage vor, wir segeln nach Alexandrien, vielleicht ist der Nil schon hoch genug gestiegen, dass wir ihn auch mit dieser Jacht hinauffahren können. Sonst mieten wir eine Barke. Oder eben zu Land. Begleiten Sie mich?«
»Selbstverständlich, und auch meinen Freund Morphium brauchen Sie nicht erst zu fragen.«
»Dann aber eine andere Frage: Verfügen Sie über Barmittel?«
Kapitän Morphin hatte noch gegen dreitausend Dukaten besessen und diese mitgenommen.
»Das genügt überreichlich«, erklärte der Graf, »und sonst, wenn wir Geld brauchten.... ich wüsste schon solches zu verschaffen. Es ist nur wegen der ersten Ausgaben.«
So segelte die Jacht immer noch einmal nach Osten.
In Ägypten lebt ein besonderer Menschenschlag, den man den der Kopten nennt, etwa 150 000 Seelen, die sich schon seit Jahrhunderten weder vermehren noch vermindern, soweit sich das konstatieren lässt.
Es sind Christen, aber mit einem ganz besonderen Dogma, das schon im fünften Jahrhundert von der griechischen Kirche sowohl wie von der römischen verdammt wurde und auch heute noch nicht anerkannt wird. Also Heiden, vielleicht sogar noch schlimmer als die Mohammedaner, weil sie einer christlichen Irrlehre huldigen. Und trotzdem sind diese Kopten die ältesten Christen, weil sich die aus Rom vertriebenen Christen meist in Alexandrien ansiedelten, aus diesen gingen alle die Anachoreten, die Wüsteneremiten hervor, von diesen sollen die Kopten abstammen. So wenigstens behaupten sie selbst, und etwas Wahres ist auch daran. Den Bannfluch haben sie dadurch auf sich geladen, dass sie von der Bibel nichts wissen wollen, indem sie behaupten, ihre Priester ständen mit Gott in direktem Verkehr, außerdem lebe der verkörperte Christus selbst unter ihnen, allerdings nur ihnen bekannt. Sie sind eben das auserwählte Volk Gottes, blicken mit unsäglicher Verachtung auf alle übrigen Christen herab, und dass sich diese das nicht gefallen lassen, kann man ihnen nicht verdenken.
Im Übrigen ein ganz merkwürdiges Volk, aber nicht etwa zu ihrem Vorteil. Sie leben durch ganz Ägypten in kleinen Gemeinden zerstreut, mehr noch schweifen sie ziellos umher, sie bedeuten für Ägypten unsere Zigeuner, treiben auch solche ähnliche Beschäftigungen, flicken Kessel, heilen kranke Tiere durch Versprechen, fangen Ratten und Mäuse, wahrsagen und stehlen, wie und wo sie können. Schmutzige, hinterlistige, unsittliche Menschen. auch vom ebenfalls ganz verkommenen mohammedanischen Fellah wie die Pest gemieden — wenn man sie nicht einmal braucht.
Am merkwürdigsten aber ist ihre Ähnlichkeit mit den alten Ägyptern, wie wir sie heute noch in Bildhauer- und Skulpturarbeiten dargestellt finden. Kein Zweifel, diese Kopten sind die letzten echten, alten Ägypter. Wie die nun dazu gekommen sind, in Afrika die ersten Christen zu werden, das freilich ist unseren Geschichtsforschern noch heute ein Rätsel. Außerdem sei bemerkt, dass sie auch gar keine Verwandtschaft mit unsern Zigeunern haben. Deren Typus ist wieder ein ganz anderer.
Um dieses zerstreut lebende ›heimatlose Gesindel‹ doch wenigstens etwas unter Kontrolle zu haben, hat die ägyptische Regierung erlaubt, oder befiehlt sogar, dass ihr Patriarch, Badrak genannt, zusammen mit seinen zwölf Bischöfen in Kairo residiert — ganz ärmlich. Diese sind in dem nur in der Luft liegenden Kirchenstaate auch gar nicht die Hauptpersonen; das sind die Priester, die Vorsteher der einzelnen Gemeinden und der Klöster.
Die Kopten haben in Ägypten einige Klöster.
Die wichtigsten davon sind die vier, welche, immer etwa eine Stunde voneinander entfernt, im Tale der Natronseen liegen.
Dieses Tal, das Wadi Natrun der Araber, erstreckt sich von der Oase Rosette an 22 geografische Meilen durch die Libysche Wüste nach Westen bei einer Breite von über fünf Meilen. Es liegt gar nicht so außerhalb der zivilisierten Welt. Noch einige Meilen vor Kairo, von Alexandrien kommend, braucht man nur das dichtbevölkerte Niltal zu verlassen, eine kleine Anhöhe ist zu übersteigen, und man befindet sich sofort im Tale des Todes. Der Schreiber dieses kann so sprechen, denn er ist selbst dort gewesen.
In eins der koptischen Klöster ist er freilich nicht hineingekommen, dazu gehört etwas anderes als ein gewöhnlicher Reisepass. Aber angesehen hat er sich die Klöster von außen doch, sogar im Vorraum gespeist — steinhartes Durrabrot, das er in einer mit Öl angefetteten Zwiebelwassersuppe aufweichen durfte, und etwas anderes gibt es hier überhaupt nicht.
An wenigen bevorzugten Stellen einiges dorniges Gestrüpp, sonst gedeiht auf dem mehr als hundert geografische Quadratmeilen umfassenden Gebiet kein einziger Grashalm.
In dieser furchtbaren Einöde liegen acht beträchtliche Seen, deren Wasser mit Kochsalz und Soda gesättigt ist. Wenn der Nil fällt, versiegt das Wasser, trocknet vollkommen aus, auf dem Grunde bleibt eine anderthalb Ellen dicke Schicht Salz zurück.
Sie besteht regelmäßig aus zwei Schichten. die man für sich abheben kann. Oben eine Kruste Kochsalz von 18 Zoll Dicke, darunter sind mindestens 27 Zoll ziemlich reine Soda, kohlensaures Natron. So ist es bei jedem See, und die Kruste kann immer abgenommen werden, sie ist beim nächsten Fallen des Wassers immer wieder da. Dieses sättigt sich eben aus dem Boden heraus mit dem Doppelsalz, und diese Quelle ist unerschöpflich.
Dann sind noch vier Süßwasserquellen vorhanden, von Osten nach Westen immer eine Stunde voneinander entfernt, und ehe man von dem letzten Dorfe zur ersten kommt, hat man zwölf Stunden auf dem Kamel zu reiten oder drei Tage lang kräftig zu marschieren, besser bei Nacht.
Die Ausbeutung dieser natürlichen Sodafabriken wäre ein unlösbares Problem, hätten sich dort nicht vier Koptenklöster etabliert, an jeder Süßwasserquelle eins. Wann das geschah, weiß man gar nicht mehr. Seit Christi Geburt oder doch Tod, behaupten die Kopten.
Das Kochsalz kommt gar nicht in Betracht, auch Soda ist ja schon billig genug, nun muss es auch erst noch gereinigt werden, und so würde wegen des weiten Marsches jeder Arbeiter mehr Proviant mitnehmen müssen, als er dann an Sodawert wieder mit zurückbrächte.
Aus dieser Kalamität helfen die Koptenklöster.
Alljährlich pilgern zu diesen Heiligtümern viele Tausende von glaubensfrommen Kopten, teils einzeln, mehr noch in ganzen Karawanen, und das geschieht oder muss geschehen gerade zu einer Zeit, da die ausgetrockneten Seen feste Soda enthalten, und jeder Pilger ist verpflichtet, auf Befehl der Regierung, einen Sack Soda mitzubringen, so viel er außer Proviant und Wasser noch tragen kann, und ihn in Rosette abzuliefern. Sonst darf diese Pilgerei eben nicht stattfinden.
Auf diese Weise kommt die ägyptische Regierung ganz kostenlos zu Rohsoda, die sie nur noch weiter zu raffinieren braucht, und dafür erlaubt sie großmütig, dass die etwa 3000 Koptenmönche dort in ihren vier Klöstern ungestört ihre Zwiebelsuppe essen dürfen, wirklich dabei von keinem Beamten beunruhigt.
So war es vor Hunderten von Jahren, genau so ist es noch heute. Es wollen einige europäische Reisende in diese Koptenklöster eingedrungen sein, aber es ist sehr fraglich, ob sie das nicht nur in ihrer Phantasie getan haben.
Übrigens weiß man auch gar nicht, was diese armseligen Klöster für Geheimnisse bergen sollten. Diese schmutzigen Mönche sind zufrieden, wenn sie faulenzen können und dazu Brot, Zwiebeln und Öl haben.
Die Nachmittagssonne näherte sich dem Horizonte, als zwei Kamelreiter durch die furchtbare Wildnis trabten.
Man musste die in weiße Burnusse gehüllten Gestalten für Beduinen halten, zudem der eine noch mit einer langen Lanze bewaffnet war, und auf dem Kamele waren die beiden zu Hause. Sie ritten nicht gerade edle Hedjins, Rennkamele, die im Preise den edelsten Vollblutpferden wenig nachstehen, immerhin waren es schlanke Reitkamele, keine schweren Lasttiere, die kaum in Trab zu bringen sind.
Auch die Gesichtstücher hatten sie heruntergelassen, die nur zwei kleine Löcher für die Augen hatten, und das war nötig, denn einmal ritten sie direkt der blendenden und immer noch heißen Sonne entgegen, und dann trieb ihnen ein ziemlich heftiger Westwind einen feinen Sand entgegen, so glühend, dass er an jeder unbeschützten Stelle des Körpers auf der Haut Blasen zog.
Von den jetzt ausgetrockneten Seen, die sich vielleicht auch schon wieder mit Wasser zu füllen begannen, war nichts zu sehen, obgleich sie einige schon hinter sich hatten. Aber die lagen viel weiter nördlich.
Das eine Kamel begann zu schnauben, das andere stimmte mit ein.
Der eine Reiter, der ohne Lanze, streckte die Hand aus.
»Suriani«, erklang es dumpf hinter dem Gesichtstuch.
»Wo?«, stieß der andere, der mit der Lanze, heiser hervor.
»Dort, vor uns — das langgestreckte Mauerwerk mit dem Türmchen daneben.«
»Wahrhaftig! Na, Graf, nun bewundern Sie mich nicht mehr wegen meiner Augen, Sie haben viel bessere als ich. Dieser verdammte Sand macht mich ganz blind.«
»Mir geht es nicht anders. Ich wurde nur durch das Schnaufen der Kamele aufmerksam. Sie wittern schon das frische Wasser.«
»Die armen Tiere haben heute oft genug geschnauft.«
»Aber das hier war ein ganz anderes Schnaufen.«
»Freilich, auf Kamele verstehe ich mich nicht so recht. Es ist das erste Mal, dass ich wie so'n Türke mit gekreuzten Beinen auf solch einem Vieh sitze.«
»Um so bewundernswürdiger ist, dass Sie es gleich zehn Sunden ausgehalten haben.«
»Graf, sind wir ins Tal der Natronseen geritten, um uns gegenseitig Komplimente zu machen?«
»Sie haben zuerst damit angefangen.«
»Na, da prost, dann wollen wir uns wieder vertragen.«
Axel, der Lanzenreiter, sprach's und brachte vorn unter seinem Burnus das dünne Ende eines noch halb gefüllten Lederschlauchs zum Vorschein, hob ihn und trank mit gierigen Zügen.
»Nun aber, dicht vor unserem Ziele, brauchen doch auch Sie sich nicht mehr zu genieren«, sagte er mit nassen Lippen, dem Grafen den Schlauch hinhaltend.
Die Sache war die, dass auch der Graf solch einen gefüllten Schlauch mitgenommen hatte, aber gleich zu Beginn des Wüstenrittes war er ihm geplatzt und ausgelaufen. Axel hatte ihm jedes Mal, wenn er getrunken, den seinen angeboten, deshalb auch mäßiger getrunken, aber immer hatte der Graf abgelehnt. Er sei nicht durstig. Und so tat er auch jetzt wieder.
»Ich danke, ich bedarf wirklich keines Wassers. Sie hätten sich nicht einzuschränken brauchen, Sie müssen mich auch nicht für gar so edelmütig halten. Ich habe nicht etwa gedurstet, damit Sie sich satt trinken können.«
»Sie bedürfen überhaupt keines Wassers?«
»Wie ich immer gesagt habe...«
»Sie behaupten, dass Sie tagelang durch solch eine glühende Wüste reiten können, ohne einen Schluck Wasser zu sich zu nehmen?«
»Ich hoffe nicht, dass wir solche Touren durchzumachen haben, um es Ihnen erst beweisen zu müssen.«
Axel ließ den Lederschlauch wieder unter seinem Burnus verschwinden, und auch noch bei diesem schaukelnden Reiten merkte man, wie er die Achseln zuckte.
»Graf, Gräfchen, an Ihnen wird man manchmal irre. Na, lassen wir es, des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Mögen wir noch weit entfernt sein von der Stelle, die der finnische Steuermann auch in diesem Salztale mit seinem erträumten Instrumente berechnet hat?«
»Das kann ich allerdings nicht sagen, weil wir ja keine Karte bekommen konnten, auf der die Klöster schon genau angegeben gewesen wären. Immer nur andeutende Kreuze. Wir können ja aber gleich einmal eine Sonnenberechnung machen.«
»Nee, Graf, nee«, wehrte Axel jedoch energisch ab, »ich lasse mich von diesem Schaukelstuhle nicht eher herabfallen, als bis ich direkt in eine im Schatten stehende Zwiebelsuppe hineinfalle. Ein Glück nur, dass unser Mann gleich hier im ersten Kloster wohnt. Ich habe diese Wüstenritte schon herzlich satt, das ist meiner Mutter Sohn nicht gewohnt.«
Das Kloster, nach einem koptischen Heiligen Suriani genannt, hob sich deutlicher ab.
Über diese vier koptischen Klöster, die sich alle ähneln, hatten die beiden schon genügend erfahren, sogar aus bester Quelle, soweit diese offenbaren durfte.
Das Kloster ist ein viereckiges, einstöckiges Gebäude aus Quadersteinen. die man aus dem Grund herausgeholt hat, sodass noch eine Kelleretage dazu kommt. Das Dach ist ganz flach, mit Steinplatten zugedeckt, indem die Zellen der Mönche nur ganz eng sind, sodass die Mauern als Stützen für diese Dachplatten dienen. Nur in der Mitte ein Hof, sonst, wie ja allgemein bei maurischen Häusern, kein Fenster, keine Tür, wenigstens keine sichtbare.
Natürlich muss ein Eingang vorhanden sein. Der befindet sich auf der Südseite in einem Vorbau, der die Vorhalle enthält, und weiter als in diese kommt kein Fremder.
Die Hauptsache vom ganzen Kloster aber ist der Turm. Dieser steht immer — weshalb das so ist, weiß man nicht, eben Sitte — außerhalb des Klosters, und zwar zirka fünf Meter von ihm entfernt.
Es ist ein massiver, runder Turm, sich nur wenig über das eigentliche Kloster erhebend. Ringsherum läuft ein Graben, etwa acht Meter tief und fünf Meter breit, sodass er durch diesen also auch vom Kloster getrennt ist. Mauer steht Mauer gegenüber, und auf dieser Seite, der westlichen, hat die Klostermauer doch noch eine Tür, welche mit der des Turmes durch eine in Ketten hängende Zugbrücke verbunden werden kann.
Diese Zugbrücke, zu der zwei starke Ketten und zwei Zahnräder gehören, ist wirklich erwähnenswert. Man findet sie bei jedem der vier Klöster von ganz gleicher Beschaffenheit, und man muss dann doch bedenken, dass dazu sechs Meter lange Bretter gehören, die in solch einer Wüste schon eine Kostbarkeit bedeuten, es müssen auch unbedingt Ketten sein, keine Stricke, die Mönche halten auf deren Sauberkeit bedeutend mehr als auf ihre eigene. Einfacher sind für arabische Verhältnisse die Zahnräder, aus steinhartem Holz gefertigt, mit Zapfen versehen. Solche Zahnräder weiß man in Ägypten für die Schöpfwerke seit uralten Zeiten herzustellen.
Oben in dem Turm hängt wohl eine kleine Glocke, die zur Andacht geläutet wird, aber die Kirche selbst oder der Andachtsraum befindet sich im eigentlichen Kloster. Der Turm enthält nur einen Brunnen, eine Mühle, einen Backofen und die Lebensvorräte. Vielleicht noch eventuell vorhandene Bücher und sonstige Schätze, die Gaben der Pilger.
Im Gegensatz zu dem Kloster hat dieser Turm nun gleich vier Türen, nach jeder Himmelsrichtung eine, immer offen stehend, von denen freilich nur die eine über die Zugbrücke hinweg zu betreten ist. Sonst ist ja der Graben dazwischen. Die anderen Türen mögen nur wegen der Lüftung angebracht sein.
Diesen fünf Meter breiten Graben nun, unten mit spitzen Nägeln und sonstigen Schutzmitteln gefüllt, halten die koptischen Mönche für völlig genügend, um jeden zwei- und vierbeinigen Räuber von ihren Lebensmitteln und sonstigen Schätzen abzuhalten.
Dieses Urteil ist wirklich höchst bemerkenswert. Über solche Hüpferei wird in unseren Romanen und Jugendschriften nämlich sehr viel geflunkert — unbewusst! Einen Graben von fünf Meter Breite überspringt kein Pferd. Ganz ausgeschlossen. Auch kein Tiger, kein Panther. Das ist ausprobiert worden. Der Tiger kann wohl solch eine breite Schlucht überspringen, aber er wagt es nicht, mit Ausnahme in plötzlicher Todesnot oder von der Mutterliebe getrieben, also in der Verzweiflung. Sonst wagt er solch eine fünf Meter breite Schlucht auch beim größten Hunger nicht zu überspringen, und tut er es zuletzt doch, so ist er zur Ausführung nicht mehr fähig. Das kann allein der Mensch, und eben durch so etwas wird er, wie schon einmal an anderer Stelle ausgeführt, zum Herrn der Schöpfung. Ein kreuzlahmes Schreiberlein darf es freilich nicht sein. Aber bei turnerischen Wettkämpfen wird noch viel weiter gesprungen, auch ohne Sprungbrett, und solch ein bis in die kleinste Muskel ausgebildeter Turner hat doch noch etwas anderes zu bedeuten als so ein Indianerhäuptling oder Wüstenräuber; dem bliebe nichts anderes übrig, als unterm Arme ein mindestens fünf Meter langes Brett mitzubringen, und solche Bretter sind in der Wüste rar. — — — —
Die beiden Reiter waren bis auf Rufweite herangekommen, und ihre Kamele liefen noch immer im scharfen Trab.
»Ob wir nicht schon beobachtet werden?«, meinte Axel.
»Sicherlich.«
»Da ist aber gar nichts vorhanden, was aussieht wie ein Fenster.«
»O, kleine Gucklöcher sind in der Mauer schon angebracht.«
»Waren Sie in einem Ihrer früheren Lebensläufe auch schon einmal Kopte, natürlich koptischer Oberpriester?«
»Darüber haben Sie mich schon einmal gefragt, Sie unverbesserlicher Spötter«, erklang es unbeleidigt zurück.
»Ah, pardon — richtig, das hatte ich wirklich vergessen.«
»Sie müssen sich ein besseres Gedächtnis anschaffen, sonst hat Ihre Unsterblichkeit oder Wiedergeburt wenig Zweck.«
»Aber es ist doch schön, wenn man... hallo, da steht ja schon jemand! Ja, wohin ist denn der Kerl plötzlich verschwunden? Der ist doch richtig durch die Wand gekrochen?«
Anders hatte es nicht ausgesehen. Von der grauen Mauer hatte sich eine ebenso gefärbte menschliche Gestalt abgelöst, hatte nach den Reitern gespäht, hatte sich plötzlich zu Boden geworfen und war in die Mauer hineingekrochen.
Die Reiter waren unterdessen schon so nahe herangekommen, dass sie erkennen konnten, wie sich der Mann nicht etwa zu Boden geworfen hatte. Nein, er war richtig in die Mauer hineingekrochen.
Eine Minute später hatten sie die betreffende Stelle erreicht und erkannten, dass sie sich nicht getäuscht hatten. Dicht über dem Boden, der in dieser Wüste mehr steinig als sandig ist, befand sich in der Mauer ein Loch, das so klein aussah, als könne ein Mensch eben nur den Kopf durchstecken. Etwas größer mochte es ja sein, aber sonst ein richtiges Mauseloch, nur eben für einen Menschen berechnet.
»Das nennt man nun ein Eingansportal!«, lachte Axel aus vollem Halse. »Oder das ist wohl das berühmte Nadelöhr, durch welches eher ein Kamel geht, als dass ein Reicher in den Himmel kommt? Aber da wird es wohl nicht viel nützen, auch wenn wir unsere Reichtümer abpacken, da geht kein Kamel durch.«
Dieser Depeschenreiter, der freiwillig in Heidelberg studiert hatte, wusste besser, was für eine Bedeutung dieses Gleichnis hat. Denn, ach, was bekommt man da manchmal zu hören, um diesen Drohspruch abzuschwächen, um es doch noch möglich zu machen, auch als reicher Mann in den Himmel zu kommen!
Die Sache ist viel einfacher, ist gar nicht so bedrohlich. Nadelöhre hießen im alten Jerusalem die schmalen, niedrigen Nebentore in der Stadtmauer, die von voll- und hochbepackten Kamelen nicht passiert werden konnten; sie mussten erst abgeladen werden. Das ist der ganze Witz.
»Da gibt es schon noch einen anderen Eingang«, tröstete der Graf.
»Ach, Sie dachten wohl, ich würde da hineinkriechen?«, lachte Axel noch immer. »Nein, Gräfchen, dieses Entree sieht mir doch zu mausefallenlochähnlich aus. Aber, parbleu, wenn ich noch einmal Hausbesitzer werden sollte, so einen Eingang lasse ich mir auch bauen, nur für meine Gäste — oder für alle die, die Rechnungen bringen — besonders für den Schneider. Und dann wird dahinter eine richtige Mausefalle aufgesetzt.«
»Die wird wohl auch hier nicht fehlen«, musste jetzt auch der Graf lachen.
»Also kriechen wir lieber nicht durch. Wo ist hier aber nun der Eingang für ehrliche Menschen mit steifem Nacken?«
»Kommen Sie, auf der Südseite, wir reiten hier um den Turm herum.«
Sie taten es. Axel lenkte sein Kamel dicht an den Rand des Grabens, dessen gemauerte Wände steil abfielen.
»Richtig, dort unten scheinen wirklich Fußangeln zu liegen.«
»Die werden sich schon zu schützen wissen.«
»Aber von giftigen Dämpfen, die da unten lagern sollen, bemerke ich nichts.«
»Sie sind eben unsichtbar.«
»Was?«, wandte sich Axel betroffen an seinen Gefährten. »Sie glauben doch nicht daran, was uns da der Badrak vorschwatzte?«
»Und warum nicht? Wenn es keine giftigen Dämpfe sind, so sind eben die Spitzen der Fußangeln vergiftet.«
»Na, meinetwegen. Ich springe nicht hinunter. Und überhaupt, hier ist doch noch eine offene Tür, die ins Allerheiligste führt, da noch eine — ja, da springt man doch einfach gleich über den ganzen Graben und ist drin.«
»Ja, springen Sie mal.«
»Da springt doch jedes Kind hinüber.«
»Machen Sie's dem Kind erst mal vor. Die Entfernung täuscht, mein Bester.«
Unter solchen Gesprächen, ohne Belang, waren sie um das ganze Kloster herumgekommen, nach der Südseite, wo der schmalere Vorbau vorsprang.
Es zeigte sich, dass hier auch für berittene Gäste gesorgt war. Längs der Mauer waren ausgehöhlte Nischen zur Aufnahme des Tränkwassers, darüber eingelassene Ringe.
Axel sprang ab, ohne sein Kamel erst niederknien zu lassen, was der Araber es schon deshalb stets tun lässt, damit es dies nicht verlernt. Der Graf befolgte diese allgemeine Regel.
»He, hallo, Gasthaus!«, schrie der ehemalige deutsche Student, sich auch des Deutschen bedienend.
»Bitte, lassen Sie mich sprechen.«
»Nein, bitte, zur Einführung erst ich. Hier bin ich in meinem Fahrwasser. Was meinen Sie denn wohl — ich bin schon Kopte gewesen, als Sie noch an gar keine Wiedergeburt dachten, als Sie sich erst überlegten, ob sie den großen Sprung vom vierbeinigen zum zweibeinigen Menschen machen sollten, ob Sie den Affenwickelschwanz ablegen sollten oder lieber nicht.«
Da öffnete sich die hölzerne Tür, ein langbärtiger Greis trat heraus, sehr würdig, aber noch viel schmutziger — starrend vor Dreck. Selbst sein Bart hätte eine ganz andere Farbe bekommen, wenn er ihn einmal gewaschen hätte. Seine einzige Kleidung bestand in einem Kaftan, der auch das Hemd und alles andere vertrat.
Gleichgültig musterte er die Ankömmlinge. Einen Gruß hatte er nicht, wodurch sich auch schon die Kopten so unvorteilhaft von jedem Mohammedaner unterscheiden.
»Sind das männliche Kamele?«, war dann seine erste Frage, auf Arabisch gestellt.
»Sogar mehr als männlich, die haben ihre Männlichkeit schon hinter sich«, entgegnete Axel, das Kopftuch zurückschlagend und sein bronzefarbenes, trotziges Gesicht zeigend, in dem die blauen Augen wie zweischneidige Stahle blitzten.
»Wer seid ihr?«, klang es durchaus nicht höflicher.
»Christen wie ihr.«
»Du lügst.«
»Oho! Diesmal will ich dir dieses Wort noch verzeihen.«
»Ihr seid Franken.«
»Sind wir Franken etwa keine Christen?«
»Nein, ihr seid Franken.«
»Gut, dann sind wir Franken«, gab Axel nach, sein Kamel anhängend.
»Woher kommt ihr?«
»Von Kahira.«
»Wohin wollt ihr?«
»Uns die Natronseen ansehen.«
»Da ist nichts mehr zu sehen, die sind schon abgestochen.«
»Dann ist immer noch etwas daran zu sehen.«
»Warum reitet ihr nicht in das nächste Kloster, nach Amba Bischoi?«
»Weil die Sonne schon sinkt. Sonst noch etwas?«
»Habt ihr einen Pass?«
»Den haben wir.«
»Kommt herein!«
Es war ganz selbstverständlich, dass die Fremden aufgenommen werden mussten, sie durften nicht aufgefordert werden, den Pass zu zeigen. Wohl in keiner Wildnis, sicher aber in keiner Wüste, darf die Gastfreundschaft versagt werden, der Fluch würde die ganze Familie bis aufs Kindeskind treffen, gleichgültig, welcher Religion oder Volksrasse der Wohnungsbesitzer angehört, das liegt wie in der Wüstenluft. Auch der Todfeind muss gespeist und getränkt, ihm eine Nachtruhe gegönnt werden, er muss sich erst wieder eine gewisse Strecke entfernt haben, ehe er verfolgt werden darf.
Schon waren zwei Mönche herausgetreten, minder alt, minder würdig. aber nicht minder schmutzig, brachten schon Wasser in Holzkannen, das sie in die Steintröge gossen, und während die Kamele schlürften, wobei die Mönche allerdings noch oftmals zu laufen haben würden, schnallten Axel und der Graf ihre Mantelsäcke ab und trugen sie dem Alten nach.
Es war offenbar der Oibt, der Priester und Prior dieses Klosters — ein merkwürdiger Name, wohl auch nicht arabischen Stammes, aber er ist nun einmal so, und die alte koptische Sprache ist schon längst vergessen worden. In Ägypten werden sogar die Kopten im allgemeinen Oibta genannt, was aber nicht richtig ist; so heißen nur die Priester, im Singular Oibt.
»Hier wohnt Jehova«, sagte der Alte mit einiger Feierlichkeit, sich nach dem Eintritt seinen Gästen zuwendend.
»So?«, meinte Axel trocken, sich in dem Raume umsehend, soweit das bei dieser Beleuchtung möglich war.
In der Mitte hing von der Decke herab an einem zerfaserten Strick eine Lampe, von einem stinkenden Öl gespeist, eine Funzel, deren Licht kaum genügte, um die dicht darunter liegenden schmutzigen Binsenmatten zu erkennen.
»Ihr seid meine Gäste, setzt euch«, fuhr der Priester mit einer einladenden Handbewegung nach den Schmutzlappen fort.
Gut, sie ließen sich mit untergeschlagenen Füßen nieder. Eigentlich hätte sich nach orientalischer Sitte, ob nun mohammedanisch oder christlich, erst das Anbieten von Waschwasser gehört, vielleicht auch nach abendländischer Sitte, aber man brauchte nur diesen Kerl anzusehen, um zu erkennen, wie hier mit dem Wasser gespart wurde. Gut schon, wenn die Kamele genug bekamen.
Merkwürdigerweise hatten sie auch die Waffen nicht draußen zu lassen brauchen, selbst seine lange Lanze hatte Axel mit hereingenommen, balancierte sie über seinen Knien.
»Ei, ei, ei, ei«, sagte er, als er noch beim Niederlassen war, zuerst in internationaler Sprache, dann auf Deutsch fortfahrend, »wenn wir hier erst wieder glücklich heraus sind, dann müssen wir uns aber lange bis an den Hals ins Wasser setzen, bis die alle ersäuft sind.«
»Was meinen Sie?«, fragte der Graf verwundert. »Wen wollen Sie ersäufen?«
»Sie werden's schon bald genug erfahren, was ich gemeint habe — wenn's zu krabbeln und zu beißen und zu jucken anfängt.«
»Was sprecht ihr da zusammen?«, fragte der Priester unmutig.
»Ich erklärte meinem Freunde, dass wir hier wahrscheinlich im Allerheiligsten sind.«
Axel sprach jetzt und immerdar in einem Tone, den man unmöglich als Ironie auffassen konnte. Der Ernst lag in seinem Gesicht, in seinen Augen — darüber vergaß man die richtige Bedeutung der Worte.
»Im Allerheiligsten? Pffff, du träumst, Chawaika. In das Innere des Klosters kommt kein Franke.«
»Ich dachte wegen der kostbaren Einrichtung hier.«
»Da musst du erst einmal unsere Klosterzellen sehen. Ich bin der Oibt Albidrak.«
»Axel«, stellte sich dieser seinerseits vor.
»Das ist dein Name?«, fragte der Oibt mit großen Augen.
»Zu dienen.«
»Die Axel ist eine Schlange.«
»Ist sie? Das habe ich noch nicht gewusst. Beruhige dich, ehrwürdiger Oibt, ich bin keine.«
»Und wie heißt dein Begleiter?«
»Das ist der Graf de Bellamare.«
Denn unter diesem Namen hatte sich der bisherige Graf von Saint-Germain in Kairo bei den Personen eingeführt, mit denen er zu tun gehabt. Gerade Axel hatte darauf bestanden, dass er, wenn er seinen Namen ändern wolle, wenigstens den Grafentitel beibehalten solle, auf einen Grafen mehr oder weniger auf der Erde käme es doch nicht an, und er sei diese Anrede nun einmal gewöhnt. Allerdings kam immer mehr ein ›Comte‹ in Betracht, aber wir sprechen hier Deutsch.
Und der bisherige Graf von Saint-Germain hatte de Bellamare hinzugefügt, weil er bestimmt behaupten könnte, dass ein Comte de Bellamare gar nicht existiere. Also wurde auf diese Weise auch niemand geschädigt — falls, wie Axel gesagt hatte, der Comte de Bellamare einmal eingespunnt würde.
Im Übrigen war dieses neubackenen Grafen beste Empfehlung die elegante Jacht, mit der er bis nach Kairo hinaufgefahren war. Nun noch das nötige Auftreten dazu, da hatte kein Konsul eine Legitimation gefordert, vielmehr hatte der neue Graf ganz ohne sein Zutun solche von ihm erhalten, durch Empfehlungsbriefe und dergleichen.
»Ist das dein Diener?«, wurde Axel weiter examiniert.
»Ja, heute.«
»Heute?«
»Morgen bin ich wieder sein Diener. Wir wechseln immer ab.«
»Ja, ja, ich weiß, wie ihr Franken das macht«, meinte der Alte, der von den Franken anscheinend gar nichts wusste, aber seine Unkenntnis nicht eingestehen wollte, und das hatte Axel natürlich sofort heraus.
»Was machst du? Bist du ein Krieger?«
»Nein, ich mache Politik.«
»Po — li — tik — — — ja, ich weiß, sehr gut.«
Während die zwei ersten Mönche noch immer mit ihren Holzkrügen hin und her gingen, um den unersättlichen Kamelen Wasser zu bringen, erschien jetzt ein dritter mit einem Kruge, setzte vor jeden eine hölzerne Schale, füllte sie mit Wasser, nicht zum Waschen, sondern zum Trinken.
»Das ist Wasser aus dem heiligen Kloster Suriani«, erklärte der Priester, als er seine Schale wieder absetzte.
»Das habe ich mir gleich gedacht.«
»Dieses Wasser fließt aus den offenen Wunden des heiligen Suriani.«
»Das habe ich gleich geschmeckt.«
»Dieses Wasser ist so kostbar, dass es überhaupt gar nicht zu bezahlen ist.«
»Daran habe ich noch gar nicht gedacht«, entgegnete der unverbesserliche Axel.
Ohne den Spott herauszuhören, hatte der Alte doch verstanden, und er bekam plötzlich ein ganz langes Gesicht. Jetzt schleppten die beiden Kamelwärter einen schweren Sack, aus dem etwas Durra hervorrieselte.
Durra ist afrikanische Hirse, Kaffernkorn, in Ägypten allgemein angebaut.
»Deine Kamele sind sehr hungrig«, nahm der Oibt wieder das Wort.
»Dann wird es ihnen schmecken.«
»Unser Kloster ist sehr arm.«
Nun hatte Axel genug. Er wusste es ja schon längst, wollte sich nicht länger zum ›Bakschisch‹ nötigen lassen. Eigentlich ist es im Orient nicht üblich, eigentlich auch im Abendland nicht, Gegengeschenk und Trinkgeld schon vorher zu geben, aber es waren eben Kopten.
Axel griff neben sich in den Mantelsack, brachte eine ziemlich umfangreiche Dose zum Vorschein, präsentierte sie geöffnet — ein Pfund feingeschnittener Tabak, in hocheleganter Verpackung.
Solch einem verführerischen Anblick kann kein Orientale widerstehen. Selbst wenn er schon einen Diamantring erwartet hat. Da vergisst er ihn. Tabak ist eben Tabak.
Auch der Graf hatte schon in seinen Rucksack gegriffen, aber noch gezögert, und das war gut so. Das konnte dann noch später nachkommen.
Ganz verklärt in dem verkrusteten Gesicht, griff der Priester mit zitternden Händen zu.
»Mein?«
»Dein.«
»Alles?«
»Alles.«
»Du bist wohl sehr reich?«
»Steinreich.«
»Bist du schon verheiratet?«
Au weh, dachte Axel, der hat eine auf Lager, will sich auf diese Weise revanchieren.
»Nein«, gestand er dann mit gewöhnlicher Wahrheitsliebe — wenn's ihm gerade so passte.
»Ich habe drei Töchter.«
»Dürfen denn die Koptenpriester verheiratet sein?«
»Müssen es.«
»Du hast deine Familie hier?«
»Nein, wo denkst du hin, das darf nicht sein. In Abischede.«
»Da besuchst du sie wohl manchmal?«, hoffte Axel die Gedanken des Alten vom Heiraten abzulenken.
»Bin zu alt dazu. Du aber bist jung, du kannst drei Frauen, sechs Frauen, zehn Frauen, zwanzig Frauen...«
Zum Glück für Axel wurde die Mahlzeit gebracht, sonst wäre der Alte noch in die Tausende gekommen.
Ein vierter Mönch, noch schmieriger als seine Vorgänger, breitete zwischen den dreien über die schmutzigen Binsenmatten ein grauschwarzes Tuch und setzte auf dieses eine dampfende Holzschüssel, die berühmte Zwiebelsuppe. Außerdem wurde neben den Oibt noch eine kleine, aber sehr weithalsige Flasche gesetzt, die eine gelbe Flüssigkeit enthielt.
So, in dem heißen Wasser schwammen große und kleine Zwiebeln, die Mahlzeit konnte beginnen. Axel vermisste nur das Brot.
Aber da irrte er sich, das war bereits vorhanden.
Nur durch ein Schmunzeln zum Zulangen auffordernd, riss der Alte aus seiner Seite einen Fetzen von dem grauschwarzen Tischtuch ab, ergriff mit diesem Fetzen eine Zwiebel und steckte beides in den Mund, kaute ein wenig und schluckte beides schnell hinter, die Zwiebel sowohl wie den Tischtuchfetzen, und da riss er sich schon wieder einen neuen ab.
Axels Staunen war nur gering. Jetzt wusste er es. Er hätte es gleich wissen können. Hier wurde das Tischtuch mitgegessen. Das heißt, dieses bestand aus einem Durrafladen, der ausnahmsweise noch ziemlich frischbacken und daher weich war. Sonst wird das essbare Tischtuch eben einfach abgehackt. So machen es auch die Perser und noch andere asiatische Völkerscharen. Die fressen immer gleich das Tischtuch mit, so wie ein richtiger Appenzeller den ›Kas‹ samt den Teller.
Nun, auch Axel wollte abreißen, der Graf hatte es schon getan, sie kamen aber nicht zum Eintauchen. Es zeigte sich, dass sie doch noch nicht zum Zulangen eingeladen worden waren, das war erst ein Probekosten des Gastgebers gewesen.
»Halt, halt, halt, halt — hm, hm, hm, hm — gut so, gut so — nun muss doch erst noch das Öl und das gibt doch erst die Kraft.«
Ach, richtig, da fehlte ja das Öl! Das war also dort in der Flasche.
Und der Alte nahm die Pulle her, öffnete den Rachen, dass man alle seine Zahnlücken sehen konnte, nahm den dicken Flaschenhals zwischen seine wulstigen Lippen, nahm einen tüchtigen Schluck, setzte die Flasche ab, beugte sich vor und...kschschschsch — — schrietzte er das Öl aus seinem Munde durch die Zahnlücken kunstgerecht über die Zwiebelsuppe, sodass diese alsbald die zur Fleischbrühe gehörenden Fettaugen bekommen hatte.
Und Axels Augen drohten die Höhlen zu verlassen.
»Hei—hei—heiliger Klabautermann, was war denn das?«
Lieber Leser! Wolle nicht glauben, dass dir hier ein unnatürliches Gericht aufgetischt wird. So geht es dort in den Koptenklöstern wirklich zu, so wird einem die Zwiebelsuppe wirklich serviert und angerichtet, noch heute.
Na und was ist denn schließlich weiter dabei? Unnatürlichkeit? Unsauberkeit? Scheußlichkeit? Das sind im Grunde genommen alles leere Worte, die wir Menschlein uns gemacht haben.
Und es gibt nichts auf der Welt, was nicht sein Eben- oder Gegenbild, sein Pendant hätte, gewöhnlich sind sie massenhaft vorhanden. Für diesen Fall seien nur zwei Gegenbeispiele angeführt.
Erstens trinken auch unsere Offiziere in Afrika manchmal aus Wasserpfützen, aus denen wir in Deutschland keinen Hund saufen lassen würden, wenigstens nicht den eigenen. Denn was da schon alles durchgewatet ist, und was da alles drin liegt!
Und da ist oftmals keine Zeit zum vorherigen Filtrieren und Abkochen, da wird auf die Knie niedergestürzt und geschlürft.
Zweitens wird auf Samoa dem Gaste im Hause des Eingeborenen ein Begrüßungstrank geboten, auch nach dem Essen — der Schreiber dieses weiß nicht mehr, wie das Zeug heißt, er hat es von einem dort gewesenen Regierungsassessor erzählt bekommen, es steht auch in allen sachlichen Büchern — dieser Trank wird immer frisch gebraut, und zuletzt noch kaut die Gattin oder Tochter des Hausherrn eine Wurzel, die erst die rechte Würze gibt, spuckt den Brei in den Becher, und so muss ihn der europäische Gast austrinken.
Er muss, er muss! Der Herr Regierungsassessor sowohl wie der Herr Staatssekretär. Da gibt es gar keine Widerrede. Und wehe, wenn da der Europäer auch nur den geringsten Ekel zeigen wollte! Das wäre viel schlimmer als bei uns eine Handverweigerung. Und mit solch einem samoanischen Häuptling ist nicht zu spaßen, der lässt sich nicht so einfach beleidigen. Das gibt Krieg, eine Rebellion, ein Massaker! Und wenn der Herr Regierungsassessor da nicht mitmachen will, da darf er eben nicht hingehen. Aber das bekommen diese Herren schon in der Heimat gesagt. Entweder — oder.

Aber das klingt ja alles schrecklicher, als es ist. Das Zeug soll, wenn man sich daran gewöhnt hat, wirklich gut schmecken, und zuletzt lässt man sich von den schönen Samoanerinnen recht oft in den Becher spucken, es ist zuletzt nicht anders als wie ein Kuss... den wieder der Chinese von uns nicht begreifen kann, wie wir solche Schw... begehen können. Ländlich, sittlich — es ist die alte Geschichte, und wer andere verurteilt, verurteilt sich zuletzt immer selbst. Wollen wir lieber nicht an alles das, was wir gebildeten Europäer für gute Sitte und Anstand und dergleichen erachten, das Seziermesser legen!
Übrigens gibt es diese Ölschrietzerei durch die Zähne auch in Paris, genau so, wie es der Koptenpriester macht. Da sind die billigen Bouillonküchen, in denen die Fleischbrühe aus allem gekocht wird, nur nicht aus Fleisch und Knochen. Oder Fett kommt aus letzteren sicher nicht mehr heraus, sonst wäre der Hauptmacher nicht nötig, der den Schlusseffekt arrangiert, wofür er ein horrendes Gehalt bekommen soll. Der nimmt den ganzen Mund voll Öl und sprudelt die Fettaugen so über den ganzen Waschkessel hin. Aber nun eben das Sprudeln, dieses Schrietzen — das soll gar nicht so einfach sein. Und das kann durch keine Gießkanne und keine Siebspritze so natürlich erzeugt werden. Das lässt sich auch glauben. Das ist genau so, wie bei der Ölmalerei. Die Menschenhand, die den Pinsel führt, kann doch auch nie durch Maschinerie ersetzt werden. So auch nicht der menschliche Mund durch Gießkanne oder irgendwelche Spritze. Nun kommt es aber auch wieder ganz darauf an, wem die Hand angehört, die den Pinsel oder die Feder führt.
Der Geist beseelt, und nicht der Text;
Der eine malt, der andre kleckst.
Und so ist es auch mit der Bouillonfettaugenschrietzerei. Dass nun nicht etwa jeder, der vorn die nötigen Zahnlücken hat, gleich nach Paris fährt und schrietzen will. Zu lernen ist das überhaupt gar nicht. Auch dazu gehört angeborenes Genie. Kunst ist eben Kunst. Und nun genug davon. — — —
Oibt Albidrak jedenfalls hatte prachtvoll geschrietzt. Die erst so magere Suppe sah plötzlich einfach lecker aus.
»Hei—hei—heiliger Klabautermann! Was war denn das?«
So hatte Axel zuerst geächzt. Aber dieser deutsche Fürstensohn war nicht der Mann, der sich lange verblüffen ließ, sonst hätte er niemals eine Depesche durch Feindesland gebracht.
Er sah, wie der Oibt zulangte, sah, wie der Graf mit unerschütterlichem, tiefernstem Gesicht wie immer, schon Miene machte, zuzulangen, und er kam mit einem schnell abgerissenen Fetzen essbaren Tischtuches noch zuvor, fischte eine große Zwiebel heraus.
»Wirklich delikat!«, sagte er mit kauendem Munde.
»Die Brühe, Freund, die Brühe«, munterte der Priester auf, »das ist die Hauptsache. Das ist Wasser aus den offenen Wunden des heiligen Suriani.«
»Ja, das schmecke ich wohl, es hat einen so würzigen Nebengeschmack...«
»Das machen die Zwiebeln.«
»Und das Öl. Ich finde aber, es könnte noch etwas mehr hinzu.«
»Ja, das dachte ich gleich, ich genierte mich nur, es zu sagen.«
Also der alte Priester griff wieder zur Pulle und füllte den Mund.
»Bitte, etwas mehr zu mir herüber«, bat Axel, und passte diesmal verständnisvoller auf, wie dieses Kunststück ausgeführt wird.
»Sie, Herr Graf«, sagte er dann zu diesem auf Deutsch, »wenn ich erst mal auf dem Färschtenthrone sitze, den Sie mir prophezeit haben — das mit der Ölspritzerei muss ich auch noch lernen — und wenn ich dann Hoftafel halte — die koptische Zwiebelsuppe wird serviert — mit auffressbarem Tischtuche — und ich nehme so aus einer Apothekerpulle einen tüchtigen Schluck Brennöl — und ich schrietze über den ganzen Tisch weg jedem Herrn und jeder Dame in den Teller die Fettaugen hinein — nu, ich sage Ihnen... da müssen Sie mich mal besuchen.«
Es war merkwürdig, wie ernst der Graf bleiben konnte. Seine Gedanken mussten mit etwas ganz anderem beschäftigt sein. Doch auch Axel selbst hatte sich so in der Gewalt. Aber wehe, wenn ein dritter Fremder dabei gewesen wäre!
»Was sagst du zu deinem Diener?«, fragte der Oibt.
»Ich sagte ihm, dass die Suppe gerade so schmecke, als ob ein Huhn darin gekocht wäre.«
»Kein Huhn. Wir dulden hier kein weibliches Geschöpf.«
»Na, dann ein Hahn.«
»Wir dürfen hier überhaupt keine Haustiere halten.«
Axel blickte erst an sich herab und dann sein Gegenüber an.
»Kein Haustier halten? Nicht? Na, was ist denn das da?«
Mit diesen Worten hatte er dem Priester etwas von der Kutte abgenommen, hielt es bedachtsam zwischen zwei Fingerspitzen vor sich.
»Und das ist ja sogar eine Dame — sogar eine verheiratete — die wird nächstens Nachkommen haben wie der Sand am Meere...«
Dass sich der arabische Kopte nicht wegen dieses von ihm abgelesenen Tierchens außer Fassung bringen ließ, das war selbstverständlich, aber er wusste auch gleich auszuweichen, ein anderes Thema anzuschlagen.
»Auch dieses Insekt hat Jehova geschaffen«, sagte er salbungsvoll, »und er hat es geschaffen, auf dass wir Menschen uns der Reinlichkeit befleißigen.«
»Na, deinetwegen hätte er es dann nicht zu schaffen brauchen«, lautete hingegen Axels sehr zweideutige Antwort, was aber wohl gar nicht verstanden wurde.
»Du bist noch unverheiratet, Chawaiki«, begann dann der Alte wieder, »und ich habe drei Töchter.«
»Zunächst würde ich's mal mit einer probieren.«
»Wie du willst.«
»Welche schlägst du mir da vor?«
»Die Fatme.«
»Der Name gefällt mir. Und das genügt mir. Wie alt, wie schön — das ist bei mir Nebensache.«
»Sie hat auch schon ein Kind.«
»Auch schon? Desto angenehmer. Ganz annehmbare Mitgift....«
»Ihr Mann ist vor einem Jahre gestorben.«
»Ach, sie ist Witwe. Eine Jungfrau mit Kind wäre mir eigentlich lieber gewesen. Never mind. Kann sie gut kochen?«
»Alles.«
»Auch so eine Zwiebelsuppe?«
»Sogar Schakalsuppe.«
»Wuuoas? Schakalsuppe?«
»Kennst du die nicht? Ah, so eine richtige gekochte Schakalsuppe!«
Und der alte Gourmand schnalzte verklärt mit Fingern und Zunge.
»Na, wie macht man denn solch eine Schakalsuppe?«
»Du nimmst einen Schakal«, begann der alte Wüsteneinsiedler, als hätte er ›auf Kochbuch‹ studiert, und es sei ausdrücklich betont, dass hier nicht etwa ein Witz gemacht werden soll. Diese Schakalsuppe wird tatsächlich in ganz Nordafrika gegessen, in Ägypten sowohl wie in Marokko, und ihre komplizierte Zubereitung ist tatsächlich so, wie es hier geschildert wird — mit Variationen, je nach Geschmack.
»Du nimmst einen Schakal, wirfst ihn in einen Kessel mit kaltem Wasser, hängst diesen übers Feuer...«
»Halt, halt, halt, halt, Verehrtester, nur immer eins nach dem anderen, nichts dabei vergessen.«
»Ich habe nichts vergessen.«
»Na, der Schakal muss doch erst abgezogen werden.«
»Nein, abgezogen darf er nicht werden.«
»Was? Der kommt mit Haut und Haaren in den Kochtopf?«
»Selbstverständlich, das gibt ja gerade die Kraft.«
»Aber ausgenommen muss er doch zuvor werden.«
»O nein, wo denkst du hin! Das gibt ja gerade die Kraft.«
»Der kommt gleich, wie er geht und steht, in den Kochtopf?!«
»Selbstverständlich.«
»Aber der Schakal ist ja ein Aasfresser, vergreift sich sogar an menschlichen Leichen.«
»Das gibt ja gerade die Kraft und den feinen Geschmack. Und dann kann man ihn auch gar nicht ausweiden.«
»Warum denn nicht?«
»Dabei würde er doch sterben.«
Axel reckte seinen Hals wie eine Schildkröte hervor.
»Ach ach ach ach achsoooo — der Schakal kommt lebendig in den Kochtopf hinein!«
»Selbstverständlich, das gibt ja gerade die Kraft.«
»Lässt er sich denn das Kochen gefallen?«
»Du musst ihn natürlich gut binden.«
»Achsooooo! Das gibt wohl die ganze Kraft und den feinen Geschmack?«
»Wie meinst du?«
»Na nun mal weiter, der Schakal könnte schon längst gar sein.«
»O nein, so schnell geht das nicht. Er muss drei Stunden lang kochen...«
»Aber dann ist er tot.«
»Sicher. Oder glaubst du, dass man einen Schakal in kochendem Wasser nicht tot bekommt? Das ist ein Aberglaube.«
»Nein, nein, ich weiß schon, den habe ich längst hinter mir. Jawohl, nachdem der Schakal drei Stunden lang gekocht hat, ist er mausetot. Und nun ist die Suppe fertig.«
»Ja, nun nimmst du den Schakal heraus, nimmst den Topf und gießt die Brühe aus...«
»Wo denn hin?«
»Irgendwohin. In den Sand.«
»In den Sand? Ich denke, diese Brühe soll man als Suppe essen!«
»O nein, wo denkst du hin! Davon würdest du doch sofort sterben.«
»Warum denn?«
»Diese Brühe ist doch viel zu stark. Was meinst du, was ein Schakal ist! Diese Suppe ist so stark wie zehn Mann, du würdest gleich daran sterben. Und außerdem, würdest du denn eine Suppe essen wollen, in dem ein Schakal mit allem, was er im Leibe gehabt hat, zu Tode gebrüht worden ist? Tut ihr das im Frankenland? Pfui! Da sind wir hier doch gesitteter.«
Axel fühlte sich geschlagen.
»Und wie wird nun die wirkliche Schakalsuppe fertig?«, fragte er kleinlaut, wenn das wohl auch etwas affektiert war, weil es nun einmal zum Ton gehörte.
»Jetzt füllst du den Kessel wieder mit kaltem Wasser, legst den Schakal hinein, hängst ihn über das Feuer und kochst ihn abermals drei Stunden.«
»Und nun ist er gar.«
»Der Schakal? Es handelt sich doch nur um die Suppe.«
»Na ja, jetzt ist die Suppe fertig, nun kann man sie getrost essen?«
»Jetzt schon? Ha, Franke, was meinst du, was ein Schakal zu bedeuten hat! Die Suppe ist immer noch so stark wie fünf Mann, das verträgst du nicht, du schlägst beim ersten Löffel noch immer tot hin!«
»Wie ist denn das Tothinschlagen nun zu vermeiden, dass man endlich zu seiner Schakalsuppe kommt?«
»Nur Geduld, nur Geduld, Jehova hat die Welt auch nicht an einem Tage erschaffen. Du nimmst den Schakal heraus, gießt die Brühe weg, füllst den Kessel wieder mit kaltem Wasser, tust den Schakal wieder hinein, hängst ihn über das Feuer und kochst ihn abermals drei Stunden...«
»Nun aber ist er auch wirklich tot — Äppelmus, wollte ich sagen.«
»Wie meinst du?«
»Ich meine, nun ist das Vieh endlich verschwunden.«
»Zerkocht, meinst du? Ha, Franke, was glaubst du wohl, was so ein Schakal zu bedeuten hat! Jetzt ist die Suppe so stark wie...«
»Zweiundeinhalb Mann.«
»Nein, wie drei Mann, und das verträgst du noch immer nicht. Also du gießt die Brühe fort, füllst den Kessel mit kaltem Wasser, hängst ihn über das Feuer, tust den Schakal hinein...«
»Immer noch denselben Schakal, der nun schon dreimal drei Stunden gekocht hat?«, vergewisserte sich Axel zur Vorsicht.
»Ja, welchen denn sonst? Diesmal aber kochst du ihn ununterbrochen fünf Stunden lang, dann sagst du freilich ha ha haaa haaaaaa hazzzieh!!! «
Dem alten Herrn war nämlich das Niesen angekommen, dabei beugte er sich rechtzeitig vor, gerade über die noch zur Hälfte mit Zwiebelsuppe gefüllte Schüssel, aus der auch noch immer gegessen wurde, und nieste gerade in die Schüssel hinein. Und nun wie der Kerl nieste! Und er hatte es schon längst sehr nötig gehabt. Und so etwas wie ein Taschentuch gibt es hier nicht, dazu wäre es überhaupt viel zu spät gewesen. Jetzt erst bekam die Zwiebelsuppe die richtige Würze.
Ehe sich der alte Herr ausgeniest hatte und sein Kochrezept vollenden konnte, hatte sich Axel schnell erhoben.
»Wünsche gesegnete Mahlzeit allerseits. Bitte um Entschuldigung, die Sonne geht unter, ich muss mein regelmäßiges Abendgebet verrichten.«
Sprach's, ging hinaus und verrichtete sein Abendgebet.
Das heißt, er warf sich in den Sand und lachte, lachte, lachte, und nachdem er genug auf dem Rücken gelegen hatte, drehte er sich herum und lachte auf dem Bauche weiter, und dann wälzte er sich wieder auf den Rücken und reckte lachend die Beine zum sternenbesäten Himmel empor.
Worüber lachte er denn?
Etwa über den Schakal?
Ja, haben wir überkultivierten Europäer nicht fast ganz genau dasselbe? Zum Beispiel mit dem Krebs? Werfen wir diesen notorischen Aasfresser — man soll nur einmal eine menschliche Leiche aus einem Flusse ziehen, der viele Krebse beherbergt — nicht ebenfalls lebendig mit allem Inhalte zum Kochen ins Wasser? Und die Araber verschmähen wenigstens den Kadaver, begnügen sich mit der drei- bis viermal verdünnten Fleischbrühe, wir aber fressen... pardon, essen gerade den Inhalt des Krebses! Das ist doch ein gewaltiger Unterschied zum Vorteil dieser Araber!
O, wollen wir doch nicht so spotten! Und auch gar kein Ekel ist angebracht. Wir schneiden uns ja immer nur ins eigene Fleisch. Das ist ja alles nur Prüderie, einfacher genannt Unwissenheit, Beschränktheit, Dummheit.
Was haben wir uns denn vor den faulen Eiern der Chinesen zu ekeln? Ekeln, gut, das lässt man sich noch gefallen — aber nur nicht sagen: pfui, solch eine Geschmacksverirrung, das ist ja unbegreiflich! Merkt man denn nur gar nicht, dass man mit dem ›unbegreiflich‹ sich selbst ein Armutszeugnis ausstellt? Nun wohl, so lerne eben begreifen, strenge dein Spatzengehirn an oder sprich nicht mit!
Übrigens versichern Europäer, die es gewagt haben, dass diese Eier, welche, in aromatische Kräuter gehüllt, sechs bis zwanzig Wochen in der Erde vergraben liegen, ganz ausgezeichnet schmecken. Ungefähr wie Hummer.
Doch die Hauptsache ist: Können wir es den Chinesen verargen, wenn die sich vor uns ekeln, weil wir in mehr oder weniger stinkende Fäulnis übergegangenen Quark, Käse genannt, essen? Das ist doch ganz genau dasselbe. Sogar mit dem Eiweiß stimmt's.
Nein, über den lebendig gekochten Schakal brauchte Axel nicht zu lachen. Das tat er auch nicht, dazu war dieser Mann zu klug... und zu gerecht.
Er hatte ja sonst auch genug anderen Grund dazu, um sich vor Lachen auf dem Bauche zu wälzen.
Die Zurückgebliebenen hörten nichts von diesem unbändigen Lachen. Die Mauern waren dick, Fenster gab es nicht, und Axel hatte sich genügend von der Tür entfernt.
»Ich danke, ich bin gesättigt«, sagte der Graf.
Noch einige Aufforderungen zum Zulangen, dann klatschte der Scheich, wie wir ihn auch nennen können, in die Hände, ein Mönch nahm Schüssel und den Rest des Tischtuches hinaus, ein anderer brachte drei winzige Schälchen Kaffee und drei Tschibuks, welche der Gastgeber freigebig mit dem geschenkten Tabak stopfte.
Kaffee und Tabak sind die einzigen Genüsse dieser Mönche. Aber während jeder Araber auf einen Tschibuk hält, der seinem Stande entspricht, wie wir auf die Kleidung, wobei fast jeder über seinen Stand hinausgeht, sodass er mehr scheinen will, als er wirklich ist, wie wir mit der Kleidung, während man sonst silberplattierte Pfeifen mit dem überhaupt ganz unvermeidlichen Bernsteinmundstück auch in den Händen des Arbeiters sieht, bestanden diese hier nur aus einem Schilfrohr mit einem roten Tonkopf, wie man sie in den orientalischen Städtchen und Dörfern bei jedem Trödler ausliegen sieht, das Stück zwei Pfennig, gekauft nur einmal zur Aushilfe, ständig gebraucht nur vom Bettler, vom Opischin oder Haschischin, dem heruntergekommenen orientalischen Schnapsbruder, und... vom Weißen. Dass aber auch die Mönche aus solchen verachteten Pfeifen rauchten, war ja schließlich ihrem Stande ganz entsprechend, sie hatten das Gelübde der Armut abgelegt, mochte auch die Schatzkammer des Klosters vielleicht von Gold strotzen.
Wolle der Leser verzeihen, dass wegen dieser Tschibuks noch solch ein langer, unförmlicher Satz gemacht wurde, Aber wenn ein Schriftsteller eine im Orient spielende Erzählung schreibt und er spricht bei einer neu auftretenden Person nicht auch von dessen Tabakspfeife, so darf man mit Sicherheit annehmen, dass er nicht selbst dort gewesen ist. Denn das Rauchinstrument gehört zum Orientalen wie die Toilette, das Kleid zur Dame, zur Europäerin, und es ist doch kaum möglich, im Roman eine weibliche Person neu auftreten zu lassen, ohne wenigstens ein Wort darüber zu verlieren, wie sie gekleidet ist. In manchen Romanen spielt die Beschreibung der Toilette die Hauptrolle... und in Theaterkritiken.
Zwischen Mahlzeit und diesem Nachtisch hatte wiederum das Waschwasser gefehlt. Diese koptischen Mönche schienen es wie die franziskanischen Kapuziner zu halten, die ihren Körper überhaupt nicht mit Wasser in Berührung bringen durften.
Der Oibt schlug mit Stahl und Stein Feuer, legte den glimmenden Zunder auf des Grafen Pfeife, und zum ersten Male sah man diesen Mann rauchen, er blies den Qualm durch die Nase, wie ein ausgelernter Türke.
»Wie lange währt das Gebet deines Herrn? Warum betest du nicht?«
»Oibt Albidrak, jetzt erlaube mir, dass ich einmal mit dir spreche.«
»Mit dir? Du?«, erklang es hochmütig zurück, der Graf wusste sofort, warum dieser Ton, hatte zwar die Einführung sehr gut verstanden, sonst aber seinem Gefährten keinen besonderen Dienst erwiesen.
Doch der Graf wusste sich sofort zu helfen.
»Bei uns beginnt der neue Tag oder doch unser neues Verhältnis mit dem Abendgebet. Jetzt bin ich der Herr, der andere ist mein Diener.«
»So ist es«, bestätigte der in diesem Augenblick eintretende Axel, machte auch gleich gegen den Grafen eine ehrfürchtige Verbeugung, ehe er sich niederließ und nach der Pfeife griff. Von den überstandenen Lachkrämpfen war ihm nichts mehr anzusehen.
»Ihr Franken habt merkwürdige Gewohnheiten. Was willst du, Chawaike?«
»Wir sind nicht hierher gekommen, um die Salzseen zu besichtigen.«
»Nicht?«
»Sondern um dich zu besuchen.«
»Ihr seid bei mir.«
»Wir haben in Kahira erst deinem Badrak unsere Aufwartung gemacht.«
»Habt ihr?«
»Er gab mir ein Schreiben an dich mit.«
Immer kürzer wurde der Prior, immer abweisender sein Gesicht.
Der Graf brachte unter seinem Burnus ein Pergament zum Vorschein, faltete es auseinander. Es zeigte arabische Schrift, das große Siegel war in der Mitte angebracht.
Der Oibt nahm das Pergament, las, tat wenigstens so.
Das Licht fiel durch die dünngeschabte Lederhaut, und wer arabische Schrift lesen konnte, musste etwas beobachten.
»Er kann gar nicht lesen, er hält es verkehrt,« sagte Axel denn auch gleich aus Deutsch.
»Leider habe auch ich es schon bemerkt.«
Der Oibt machte gegen das Pergament eine Verbeugung, ehe er es zurückgab, und zu dem einen großen Siegel waren noch zehn andere, kleinere gekommen — zehn fettige Fingerabdrücke.
Außerdem war ganz deutlich gewesen, wie er mit Absicht in seine Verbeugung Verachtung, Hohn zu legen versucht hatte.
»Es ist gut. Der Badrak schreibt mir. Und?«
»Er bittet dich, uns als seine Gastfreunde aufzunehmen.«
»Franke, was sprichst du da?!«, erklang es drohend. »Habe ich euch nicht reich bewirtet? Sind mein Kaffee und Tabak nicht köstlich?«
Es war eine schwere Situation. Und man hatte sie kommen sehen.
»Rrrin mit der Türe ins Haus«, sagte Axel, der, nachdem er vorhin genug geredet hatte, auch seinem Gefährten das Wort lassen wollte.
Der Graf hatte es bereits geschlossen gehabt.
»In diesem Kloster ist ein Mönch, der mit geschlossenen Augen in die Ferne sehen kann«, eröffnete der Graf also.
Furchtbar war es, wie die Augen in diesem alten Gesicht aufblitzen konnten. Doch sonst verstand sich dieser Asket zu beherrschen.
»Wer hat dir gesagt, dass in diesem Kloster ein Uschambi sei?«
»Der Badrak selbst.«
»Dann hat der Badrak gelogen — der Badrak ist überhaupt ein Narr.«
Oho!!! So wagt ein Prior von seinem höchsten Vorgesetzten zu sprechen?!
Aber schließlich kam es gar nicht so überraschend.
»Ich habe es geahnt«, flüsterte Axel.
»Ich auch.«
»Was hat der Badrak gesagt?«, ging der Oibt jetzt doch näher darauf ein.
»In diesem Kloster ist ein Mönch, der in die Ferne sehen kann, ein Hellseher, ein Uschambi, wie ihr ihn nennt.«
»Wie soll er heißen?«
»Arabit.«
Das schmutzige Gesicht blieb unbeweglich, die Kruste war überhaupt viel zu dick, um eine Bewegung zu gestatten, aber in den Augen lag das Unheilvolle, gemischt mit ungläubigem Staunen.
»Das hätte euch der Badrak gesagt?«
»Ja.«
»Wer seid ihr denn?«
»Wir sind in unserer Heimat gar mächtige Männer...«
»Und wenn ihr die Beherrscher des ganzen Abend- und Morgenlandes wäret... wie kommt ihr denn zu dem Badrak?«
»Der französische Konsul führte uns hin.«
»Konsul? Hm, ich weiß. Ihr wollt in der Zukunft lesen?«
»Nicht die Zukunft will ich wissen, sondern die Gegenwart. Ich möchte eine Person sehen, von der ich nicht weiß, wo sie sich befindet.«
»Du suchst einen Uschambi?«
»Wie ich sagte.«
»Und der Badrak behauptet, hier in Suriani wäre ein solcher?«
»Es muss doch so sein, wie kann er es denn sonst sagen.«
»Hast du gelesen, was mir der Badrak geschrieben hat?«
»Du möchtest uns als deine Gastfreunde aufnehmen.«
»Das habe ich getan.«
»Und unsere Wünsche erfüllen.«
»Was für Wünsche?«
»Die ich dir mündlich vorbringen werde.«
»Und was für Wünsche sind das?«
»Ich bitte dich, dass der Uschambi Arabit einmal für mich in die Ferne sieht.«
»Das hat also der Badrak nicht selbst hineingeschrieben.«
»Nein, nur noch, dass wir ihm geschworen haben, keinem Menschen etwas davon zu verraten, dass in diesem Kloster solch ein Uschambi ist.«
»Also das habt ihr geschworen, ja, das habe ich gelesen«, sagte der Oibt, der schließlich noch gar nicht verraten hatte, dass er nicht lesen konnte. »Aber die Sache ist nur die, dass hier überhaupt gar kein solcher Uschambi ist.«
»Aber wenn es der Badrak selbst...«
»Bah, der Badrak! Geh wieder hin zu ihm und sage ihm, dass er ein Narr, ein Affe, ein Hund ist! Wenn du es nicht tust, so werde ich es ihm selbst sagen. Was weiß denn dieser Badrak von uns, bah! Wenn du einen Uschambi brauchst, so suche ihn unter den verfluchten Heiden, unter den Derwischen und den abtrünnigen Christen. Wir Kopten aber, die wir die allein wahre Religion haben, befassen uns nicht mit solchen von Jehova verfluchten Zauberern. Dort legt euch schlafen!«
Der Oibt war aufgestanden, deutete in einen Winkel, band schnell die Lampe vom Strick und ging hinaus, nach hinten.

Man hörte noch, wie er schwere Riegel vorschob.
Die beiden saßen allein im Finstern.
»Verdammt«, murmelte Axel, »habe ich doch geahnt, was an diesem Patriarchen ist.«
»Ich auch.«
Wir haben uns nicht dabei ausgehalten, wie die beiden zu dem Patriarchen der Kopten gekommen waren. Es sei kurz nachgeholt.
Sie waren mit der Jacht nach Kairo gefahren, nicht wissend, wie sie die Bekanntschaft solch eines hellsehenden Derwisches machen sollten. Diese sind denn doch nicht so dick gesät. Oder jeder Bettler gibt sich für einen solchen aus, versteht den Fremden in wunderbarer Weise zu täuschen. So war es schon damals, so ist es noch heute.
Sie mussten erst mit einem Derwischorden bekannt werden, mit dessen Scheich. Aber das war ja genau dasselbe, nicht minder schwierig.
Da hörte Axel zufällig den Namen des französischen Konsuls.
»Wenn ich nicht irre, ist das ein alter Freund von mir.«
So war es denn auch. Ein Studienkollege. Oder sonst eine alte Bekanntschaft. Axel gab sich zu erkennen, und er wurde als Fürstensohn empfangen.
»Einen hellsehenden Derwisch, einen Uschambi? Die Derwischorden sind auch mir verschlossen, und von hundert solchen Derwischen, die sich auf andere Weise melden würden, sind neunundneunzig Gaukler und Betrüger, wenn nicht alle. Ich kenne das, habe selbst schon schlimme Erfahrungen gemacht, kümmere mich gar nicht mehr um dieses Gesindel. Aber ich kenne den Badrak, den Patriarchen der Kopten. Die Kopten dürfen sich zwar mit solcher Derwischgaukelei gar nicht abgeben, aber der Badrak weiß vielleicht Rat, und ich habe diesen Mann in der Tasche.«
»Wieso haben Sie ihn in der Tasche?«
»Das... bitte ich mein Geheimnis bleiben zu lassen.«
Sie gingen hin in die Residenz des Badraks — eine fast armselige Wohnung, die er mit zwölf Bischöfen teilte.
Ja, der Konsul musste von diesem Oberhaupte der wahren, allein seligmachenden Christenheit irgend etwas wissen. Zuerst sprach er mit ihm allein, aber sie bekamen abgerissene Sätze zu hören. Der Konsul kniete ihm offenbar aufs Leder, der Patriarch wand sich stöhnend wie ein Wurm.
»Das ist famos«, sagte der zurückkehrende Konsul, »die Kopten selbst haben unter sich einen Hellseher, der ganz Erstaunliches leisten soll. Es ist ein Mönch im Kloster Suriani. Aber davon darf die übrige Menschheit nichts erfahren, nicht einmal die Kopten selbst. Nur diejenigen, welche bezahlen können, dürfen einmal Fragen stellen. Sonst muss es das allertiefste Geheimnis bleiben. Der Badrak verriet sich, und dann ließ ich nicht locker, bis er mir alles gestanden hatte. Ich musste ihm bereits schwören, nichts zu verraten, und dasselbe verlangt er von Ihnen.«
Jetzt kamen die beiden vor den alten Patriarchen und beschworen ebenfalls, nichts von alledem zu verraten, was ihnen jetzt offenbart würde.
Es war eigentlich gar nichts Neues, was sie noch dazu erfuhren. Vielleicht nur noch den Namen. Dass dieser Kerl Arabit hieß.
»Nun gib den Herren eine Empfehlung mit, sonst kommen sie ja gar nicht in das Kloster hinein.«
Wieder wand sich der Patriarch wie ein Wurm, suchte tausenderlei Ausflüchte, ehe er die Empfehlung schrieb.
»Das genügt nicht, du musst hineinschreiben, dass dieser Uschambi diesen Herren zu Diensten ist. Du musst es dem Oibt Albidrak befehlen.«
»Das kann ich nicht, bei Jehova, das kann ich nicht!«, jammerte der alte Mann.
»Weshalb kannst du das nicht? Ich verstehe das nicht. Bist du nicht das allmächtige Oberhaupt aller Kopten?«
»Ja, das bin ich, aber es handelt sich um unser allertiefstes Geheimnis, wir dürfen keine solche Zauberei treiben!«
So jammerte der Patriarch weiter, bis er einen ausführlichen Empfehlungsbrief schrieb, mit dem der Konsul zufrieden war, wenn auch der Uschambi darin noch immer nicht direkt erwähnt war.
Der Konsul war stark beschäftigt, die beiden Freunde kauften sich Kamele, ritten allein ab.
»Dieser Patriarch scheint gar keine so große Macht über seine Untertanen zu haben.«
So hatten sie einmal geäußert, weiter nichts.
Jetzt hatten sie erfahren, was der Badrak in Wirklichkeit bedeutete.
»Er ist ganz einfach eine Puppe! Die ägyptische Regierung hat gefordert, dass der Patriarch in Kairo residieren soll, und da haben ihr die Kopten eine Puppe hingeliefert! So ein Klosterprior hat tausendmal mehr zu sagen als der Badrak.«
»Anders ist es nicht. Das hätte uns der Konsul auch sagen können.«
»Das hat der selbst nicht gewusst. Der wusste ja überhaupt sonst nichts von den Kopten, hatte von dem Patriarchen nur irgendein Geheimnis in der Hand und dadurch ihn selbst in der Tasche.«
»Ja, was nun?«
»Die Pest über diesen schmierigen Halunken!«, fluchte Axel.
»Schimpfen hilft nichts.«
»Bah, das brauchen Sie mir nicht erst zu sagen. Mit Donner und Blitz werde ich zwischen dieses ganze Gesindel fahren.«
»Es fragt sich sehr, ob wir mit Gewalt zum Ziele kommen.«
»Da haben Sie auch wieder recht. Wir wollen erst einmal zur Besinnung kommen, uns die Sache ruhig überlegen. Aber beschlafen? Nicht einmal ein Licht hat der Halunke zurückgelassen.«
Axel schlug noch einmal Feuer, auch er hatte eine kleine Laterne in der Tasche, freilich nicht mit elektrischer Zündung, und die des Grafen, die wir früher bei ihm beobachtet, trat nicht in Tätigkeit.
»Na, das sieht ja nett aus!«
In den Winkeln lagen ebenso schmutzige Binsenmatten, auf diesen also sollten die Gäste die Nacht verbringen.
»Warte, mein Freund, morgen sprechen wir uns wieder.«
Sie erhoben sich und traten hinaus. Eine milde, herrliche Wüstennacht. Soeben kam der Vollmond über den Horizont heraus.
»Ah, das ist entzückend! Sind Sie schläfrig, Graf?«
»Das fragen Sie mich? Sie haben mich vorhin essen und trinken sehen...«
»Und sogar rauchen, und das freut mich außerordentlich, dass Sie wenigstens ein richtiger Mensch sind, wenn es gilt, als solcher aufzutreten, um einen anderen Menschen zu beleidigen. Also was nun? Da auch ich mich nach dieser geölten Zwiebelsuppe riesenhaft gekräftigt fühle, schlage ich vor, gleich heute Nacht jenem Punkte einen Besuch abzustatten, der im Tale der Natronseen liegen soll.«
»Wenn er nicht gar so weit ist.«
»Was heißt weit. Wir haben Zeit. Ich schlafe morgen früh ein Stündchen im Schatten der Kamele.«
»Ja, Zeit«, seufzte der Graf.
»Armer Freund! Aber was ist es nur, dass Sie so über das Schicksal des schwarzen Schiffes bekümmert sind? Doch lassen Sie, ich will nichts wissen, wenn Sie ein Geheimnis haben und es mir nicht von selbst anvertrauen wollen. Hierher kehren wir auf alle Fälle zurück, und unterdessen überlegen wir, wie dieser Schuft von Prior doch noch zu fassen ist, dass er uns sein geistiges Fernrohr zur Verfügung stellen muss. Aber besser ist, Sie lassen mich dann immer sprechen. Bestimmen wir jetzt die Lage des Klosters, um erst zu erfahren, wie weit wir von jenem Punkte entfernt sind. Ich habe dazu extra den Mond aufgehen lassen.«
Der Graf hatte das Etui bei sich, das den Sextanten barg, ebenso den Taschenchronometer, Axel das für solche geografische Bestimmungen notwendige Handbuch, das auch die nötigen fünfstelligen Logarithmen enthielt, die der Graf aber meistenteils entbehren konnte.
Also eine geografische Ortsbestimmung nach dem Monde. Im Grunde genommen dieselbe wie nach der Sonne, aber doch wieder ganz anders. Durch Zuhilfenahme gewisser Sterne kann das Resultat gleich noch auf seine Richtigkeit kontrolliert werden, was am Tage nicht möglich ist; trotzdem ist die Bestimmung nach dem Monde schwieriger und langwieriger.
Die Quecksilberdose wurde in einiger Entfernung auf den Boden gestellt, der Graf richtete das Fernrohr des Instrumentes nach dem Mond und schraubte so lange, bis er auch den Quecksilberspiegel in das Rohr bekam.
»Stopp!!«
In demselben Moment stellte Axel, der den Chronometer bediente, den großen, um das ganze Zifferblatt laufenden Sekundenzeiger fest.
»Acht Uhr sieben Minuten achtzehn Sekunden.«
Die Berechnung wurde gemacht. Wohl rechnete der Graf mit Bleistift in seinem Notizbuch, machte aber alle die Nebenmultiplikationen im Kopfe, nur selten musste Axel einmal in den Logarithmentafeln nachschlagen.
Die Ortslage dieses Klosters war bestimmt. Aber die Bestimmung musste der Sicherheit halber wiederholt werden. Diesmal bediente Axel den Sextanten.
Es musste mit vollständig anderen Zahlen gerechnet werden, aber das Resultat war doch genau dasselbe.
»Dann sind wir ja keine zwei englische Meilen von jenem Punkte... hallo, Freund! Pardon, Halunke, wollte ich sagen.«
Aus dem Mondschatten der Klostermauer war die graue Kuttengestalt eines Mönchs ausgetaucht, und das scharfe Auge des Depeschenreiters hatte in ihr sofort den Oibt erkannt.
Die Begrüßung hatte er natürlich nicht auf arabisch gesagt, sondern auf Deutsch, dessen sich die beiden hier in Ägypten meist bedienten, wenn sie nicht von anderen verstanden sein wollten. Die italienische Sprache, die bisher diese Rolle gespielt, ist hier doch ziemlich weit verbreitet.
»Was macht ihr da?«
»Wir... machen uns beliebt«, entgegnete Axel.
»Ihr treibt Zauberei!«
»Jawohl, wir zaubern.«
»Ihr entweiht das heilige Kloster!«
»Oibt Albidrak, rücke mir nicht so nahe zu Leibe, sonst fliegst du dorthin zurück, wohin du gehörst — zwischen deine männlichen und weiblichen Haustiere, deren Gesellschaft wir uns entzogen haben.«
Die Drohung hatte allein im Tone gelegen.
Doch der Oibt ließ sich nicht einschüchtern, hatte selbst allerdings auch gar nicht drohend gesprochen, war nur, von sichtlicher Neugier getrieben, immer näher getreten.
»Was ist das?«, fragte er, auf den blitzenden Sextanten deutend.
»Ein Zauberinstrument.«
»Mit dem ihr alles finden könnt, was auf der Erde liegt, wenn ihr mit ihm nach der Sonne oder den Sternen blickt, nicht wahr?«
Jetzt wurde Axel stutzig, der Graf jedenfalls nicht minder. Der Mönch zitterte ja vor Aufregung. Und er hatte eine gewisse Kenntnis von dem verraten, was die beiden hier getrieben. Das war seltsam.
»Was weißt du davon?«
»In der endlosen Wüste steht ein einsamer Busch. Wohl weiß der Beduine ihn immer wieder zu finden. Aber wenn der Busch mit den Wurzeln herausgerissen wird, so weiß auch der Beduine nicht mehr, wo er einst gestanden hat. Du aber richtest dieses Zauberinstrument nach der Sonne, siehst oft in einem Buche nach, schreibst lange Zahlen auf, und dann kannst du diese Stelle immer wiederfinden, wo der Busch einst gestanden hat. Ist es nicht so?«
»Ja, so ist es. Also du hast schon jemand mit solch einem Instrument hantieren sehen?«
»Dieses Zauberinstrument heißt — heißt... Sextant.«
»Stimmt. Und ich glaube schon, dass hier europäische Reisende waren, die in deiner Gegenwart die Lage dieses Klosters berechneten.«
»Du sagst es. Kann das jeder lernen?«
»O ja, wenn er die nötigen Kenntnisse dazu hat.«
»So kann auch ich es lernen?«
»Das kommt darauf an. Weißt du, was ein Dreieck ist?«
Es konnte ja sein, dass dieser Mönch große mathematische Kenntnisse besaß, selbst wenn er nicht zu schreiben verstand. Wollen wir doch nicht vergessen, dass die Araber jahrhundertelang, als die ganze übrige Welt, auch Griechenland und Rom, in die tiefste Unwissenheit zurückgesunken war, so im sechsten und siebenten Jahrhundert, die einzigen Träger der Mathematik, Astronomie, Chemie und anderer Wissenschaften gewesen sind. Aber schon vorher. zu einer Zeit, da die Germanen in ihren Urwäldern noch so gut wie Wilde hausten, machten die Araber unter Malek Schah die erste Meridianmessung und berechneten die Länge des Sonnenjahres richtig bis auf zwei Sekunden.
Aber in diesem Koptenpriester hatte sich Axel nun freilich geirrt, wenn er bei dem mathematische Kenntnisse voraussetzte.
»Ein Dreieck? Das — das... ist ein dreieckiges Ding.«
»Jawohl, das ist ein Hut mit drei Ecken. Und wie viel Grad betragen zusammen die drei Winkel?«
»Winkel? Was für Winkel?«
»Höre, mein Freund, nun kann ich es dir sagen: Das lernst du nicht mehr, und wenn du auch noch hundert Jahre lebst. In so einen alten Kopf geht das nicht mehr. Da muss man jung anfangen.«
Der Oibt glaubte wohl dieser Behauptung, er ließ den Kopf hängen.
»Dasselbe hat mir auch schon damals der Franke gesagt, den ich...«, murmelte er gedrückt, die letzten Worte verschluckend.
Dann hob er wieder hoffnungsfreudig den Kopf, die alte Erregung blitzte in den Augen.
»Aber wenn nun ein anderer Franke solch eine Zahl schon gemacht hat...«
»Eine geografische Ortsbestimmung meinst du, nicht wahr?«
»Ja, ja — eine geografische Ortsbestimmung — so nannte diese Zauberei auch jener Franke — nach — nach... einer Zeit...«
»Nach Pariser Zeit?«
»Ja, ja, nach Pariser Zeit, das sagte auch er, ich entsinne mich. Kannst du dann diese Zahl auffinden?«
»Den Ort, meinst du.«
»Ja, den Ort, für den diese Zahl gilt.«
»Das kommt darauf an, wer diese Bestimmung gemacht hat, das muss ich erst wissen.«
Das war natürlich durchaus nicht nötig, aber der Graf gestand dann, dass sein Gefährte gleich an etwas dachte, woran der Graf nicht gedacht hätte.
»Das musst du wissen?«
»Unbedingt.«
»Es war ein Franke.«
»Wie hieß er?«
»Das... weiß ich nicht mehr.«
Zögernd hatte es der Oibt gesagt, doch Axel drängte jetzt nicht weiter, das konnte später geschehen.
»War er ein Franzesi?«
»Nein, ein Anglesi.«
Axel brach dieses Verhör ab. Er wollte zur Hauptsache kommen. Denn der Oibt hatte doch irgendeinen Wunsch.
»Du hast wohl so eine Zahl?«
»Ja.«
»Und ich soll den Ort suchen, auf den sie passt?«
»Kannst du das?«
»Natürlich. Wie heißt diese Zahl?«
«Ich habe sie geschrieben.«
»Zeige sie mir.«
»Niemals!«
»Warum denn nicht?«
»Weil — weil — das mein Geheimnis ist.«
»Ja, wie soll ich denn den Ort finden, wenn du mir die Zahl nicht sagst?«
Der Oibt rang mit einer gewissen oder sogar sehr starken Verlegenheit.
»Es ist dort etwas vergraben«, brachte er endlich heraus.
»Du selbst hast es vergraben?«
»Nein — ja — ja.«
»Oder der Anglesi hat es wohl dort vergraben?«
»Nein, aber der war dabei, als ich es vergrub, hat mit dem Zauberrohr nach der Sonne gesehen und dann gerechnet und mir eine Zahl gegeben.«
So sprach der Oibt sehr schnell mit sichtlicher Erleichterung, als habe er einen sehr guten Einfall abhabt.
Die beiden durchschauten ihn sofort, wenn sie natürlich auch noch nicht wussten, was hier nicht in Ordnung war.
»So weiß also auch jener Anglesi, wo du das vergraben hast?«
»Nein, das weiß er nicht.«
»Er ist wohl tot?«
»Tot?«, fuhr der Oibt empor. »Woher willst du das wissen?«
»Wenn er nichts mehr davon weiß...«
»Er reiste in seine Heimat zurück. Aber er sagte selbst, dass man sich doch solch eine lange Zahl nicht merken kann.«
»Er konnte sie doch noch einmal aufgeschrieben haben.«
»Nein, er musste mir gleich alles Papier geben, auf dem er gerechnet hatte.«
»Warum verstecktest du dein Geheimnis nicht anderswo, wo du es selbst leicht wiederfinden konntest?«
»Das geht in der Wüste schlecht, ich bin kein solcher Beduine.«
»Wie wolltest du aber den Ort wiederfinden? Das musstest du dir doch schon vorher überlegt haben.«
»Der Anglesi sagte, das könnten noch viele Franken, ich wollte warten, bis einmal einer hierher käme, oder — oder ich konnte deswegen ja auch einmal nach Kahira gehen und einen holen, den ich dafür bezahlte.«
»Und warum hast du das bisher noch nicht getan?«
»Weil — weil... erst einige Jahre darüber vergehen mussten.«
Es war ganz offenbar, wie sich der Oibt dies erst jetzt alles zusammenlog, und er war kein besonderer Held im Erfinden. Nun ging es aber schon besser.
»Warum müssen denn erst einige Jahre vergehen?«
»Weil es eine Medizin ist, die sich erst entwickeln muss, verstehst du?«
O ja, das war ein ganz triftiger Grund, sogar gar kein so abergläubischer.
»Ja, wenn du mir aber die Zahl nicht zeigst, kann ich den Ort doch auch nicht finden.«
»Dann gehst du hin und gräbst die Medizin selbst aus.«
»Bah, du hast doch hier die Macht. Wir bezeichnen dir den Ort, dann schickst du uns einfach wieder fort.«
Das leuchtete dem Oibt ein.
»Gut, ich hole dir die Zahl. Aber... wehe, wenn du mich betrügen willst.«
Mit dieser Drohung entfernte sich der Oibt, verschwand im Mauerschatten, kroch jedenfalls auf dem Bauche durch solch ein Mauseloch ins Innere.
»Mir kommt es vor, als sei hier etwas nicht in Ordnung«, sagte der Graf leise.
»Mir auch sehr stark.«
»Der hat gar keine Ahnung, wo der Ort ist und was da vergraben liegt.«
»Aber ein anderer hat dort etwas vergraben, der Betreffende hat eine geografische Ortsbestimmung gemacht, der Prior weiß, was das zu bedeuten hat und hat jenen kalt gemacht.«
»Getötet? Das ist doch gleich eine starke Annahme.«
»Na, na, ich habe... still!«
Schon kehrte der Scheich zurück. Nach langem Zögern und Hin- und Herreden, das wir nicht wiedergeben wollen, zeigte es sich, dass er in der geschlossenen Faust ein metallenes Büchschen hatte, und nach noch längerem Zögern entnahm er diesem einen Papierstreifen, aber immer noch den beiden das Geschriebene verbergend.
»Du musst wissen, wie der Mann hieß, der die geografische Bestimmung gemacht hat, sonst kannst du den Ort nicht auffinden?«
»Nein, so war das nicht gemeint, seinen Namen brauche ich nicht zu kennen«, lenkte Axel doch lieber ein, »ich muss nur wissen, welcher Nation jener Mann angehörte, denn jede Nation berechnet das auf eine andere Weise.«
»Es war ein Anglesi.«
»Eine englische Nachbestimmung kann ich machen. Zeige mir die Zahl.«
»Sie ist so lang, dass du sie nicht im Kopfe behalten kannst.«
»Natürlich nicht, deshalb kannst du sie uns ja ruhig zeigen, dann steht es noch immer bei dir, uns dein Geheimnis weiter anzuvertrauen oder nicht.«
»Du brauchst nur einen Blick darauf zu werfen?«
»Nur einen einzigen Blick.«
»Dann weißt du sicher, ob du die Bestimmung machen kannst?«
»Ja, ganz bestimmt. Es hängt von der Anordnung der Zahlen ab, von den Punkten und Strichen.«
»Ja, Punkte und Striche sind dabei.«
»Aber mein Freund hier muss die Zahl ebenfalls sehen, der versteht noch mehr davon als ich.«
Axel rechnete also mit des Grafen fabelhafter Gedächtniskraft, und es wäre gar nicht nötig gewesen, dass er diesem einen heimlichen Stoß in den Rücken gab.
Endlich war des Priors Zögern besiegt, er benahm sich aber noch immer wie ein Kind. Er hielt den beiden den Zettel schnell hin, zog ihn ebenso schnell wieder zurück.
Aber die beiden hatten schon genug gesehen! Auch Axel. Wenn es freilich nicht eine ganz besondere Bestimmung gewesen wäre, so hätte er bei der aus zehn bis vierzehn einzelnen Zahlen bestehenden Reihe, durch Buchstaben unterbrochen, nichts bemerkt, aber diese Zahlenfolge kannte er.
Es war dieselbe geografische Ortsbestimmung, die sich auf dieses Wüstental bezog, die aus jenem Zettel gestanden hatte, von Sir Dalton geschrieben!
Da freilich hatte ein einziger Blick genügt, um das zu erkennen!
Wenn das Axel erkannt hatte, so sicher auch der Graf.
Die beiden wussten ihr Staunen zu beherrschen, aber gleichzeitig berührten sich hinter ihrem Rücken ihre Hände, sie hatten sich, dicht zusammenstehend, ein heimliches Zeichen geben wollen, zur Vorsicht mahnend, gleichzeitig einer dem anderen.
Der Scheich hatte den Zettel also schnell zurückgezogen.
»Hast du gesehen?«
»Ja, und das genügt mir.«
»Wo liegt dieser Ort?«
»Das freilich kann ich noch nicht sagen. Die Zahlen verschwammen mir ja gleich vor den Augen. Deutlich habe ich nur gesehen, dass das solch eine geografische Ortsbestimmung ist, die wir nachzurechnen hier imstande sind. Nicht wahr, Graf?«
»Ja, das können wir«, bestätigte dieser.
»Aber der Anglesi blickte dabei nach der Sonne.«
»Das merke ich sofort an den Zahlen.«
»So müssen wir bis morgen warten, bis die Sonne scheint.«
»Sicher, bei Mondenschein geht das nicht«, entgegnete Axel schnell, ehe der Graf antworten konnte, und gab diesem auch wieder ein geheimes Zeichen. Denn für einen, der das versteht, ist es natürlich eine Kleinigkeit, die Sonnenaufnahme auch für den Mond umzurechnen. Axel hatte aber eben seinen Plan dabei.
»Und was verlangst du dafür?«
»Dass du uns den Uschambi einmal zur Verfügung stellst.«
Der Oibt schien zu erschrecken.
»Wir haben hier keinen Uschambi, dürfen keinen haben.«
»Lüge nicht, darf ich jetzt mit mehr Recht sagen, als du früher zu uns. Du hast dich bereits verraten.«
»Wie viele Piaster verlangt ihr?«
»Wir verlangen kein Geld, und wenn du uns alle Schätze Ägyptens bötest, wir nähmen sie nicht. Der Uschambi soll für uns in die Ferne schauen.«
Nur eine kleine Weile des Nachdenkens.
»Gut«, sagte der Oibt dann, »der Uschambi soll für euch in die Ferne blicken.«
Trotz der vorangegangenen Überlegung war das recht plötzlich gekommen, und vor allen Dingen war diesen beiden Menschenkennern nicht entgangen, wie tückisch es dabei in den Augen des alten Mannes aufgeblitzt hatte.
»Ihr müsst mir nach eurer Weise, die auch ich kenne, schwören, nicht zu verraten, dass wir hier solch einen Uschambi haben.«
»Wir werden schwören.«
»Also morgen früh.«
»Nein, jetzt sofort.«
»Weshalb sofort?«
»Wenn man eine so weite Reise gemacht hat, und wir kommen extra deswegen vom Frankenland, um solch einen Uschambi zu finden, so kannst du dir wohl denken, von was für einer Spannung man getrieben wird, endlich zum Ziele zu kommen.«
»Gut, ich verstehe, und ihr sollt euren Willen haben. Jetzt sofort. Was willst du von dem... doch du brauchst mir nichts zu sagen, sonst denkst du, du könntest betrogen werden, weil es so viel betrügerische Uschambis gibt. Von Arabit aber wirst du Wunder schauen. Doch wenn ihr mich dann morgen betrügen wollt...«
»Scheich, sprich doch keine Torheit. Du hast uns ja ganz in deiner Gewalt.«
»Wieso?«
»Das muss erst ich dir erklären? Führe uns doch in dein Kloster, du behältst uns darin, morgen begleiten wir dich, bei einem Fluchtversuch schießt du uns einfach nieder....«
»Ich verstehe, du hast recht«, kam ihm der edle Scheich verständig entgegen. »Wartet hier, ich komme gleich wieder.«
Diesmal nahm der Oibt seinen Weg durch die Eingangspforte.
»Sie sind doch mit allem einverstanden, wie ich gehandelt habe?«, flüsterte Axel, sich der deutschen Sprache bedienend.
»Besser konnten Sie alles nicht arrangieren, und ich danke Ihnen.«
»Wofür denn?«
»Weil Sie zuerst daran dachten, den Oibt für mich wegen des Hellsehers gefügig zu machen.«
»Bah, das ist doch selbstverständlich. Wäre ich nicht so schlau, hätte ich doch lieber Sie den Parlamentär spielen lassen. Aber haben Sie den bösen Blick bemerkt, als der Alte auf meine Forderung einging?«
»Ja, es war ein Blick der Hölle.«
»Der Kerl will uns natürlich kaltmachen, sobald wir ihm die Stelle bezeichnet haben.«
»Und ich denke, auch mit jenem Engländer hängt ein Verbrechen zusammen, das der Kopte auf dem Gewissen hat.«
»Anders ist es nicht, und was das ist, das müssen wir ausspionieren.«
»Und uns selbst schützen.«
»Das ist das Wenigste. Wenn wir nur die Möglichkeit hätten, noch diese Nacht unbemerkt von hier fortzukommen.«
»Um schon vorher jenen Ort bei Mondschein zu bestimmen und nachzugraben«, ergänzte der Graf.
»Das ist es.«
»Und unser Schwur?«
»Bah, in solchen Sachen habe ich ein weites Gewissen. Das wäre ja noch schöner, wenn man jeden Schwur halten sollte, den man einem Verbrecher leisten musste. Dann wäre ich schon oft meineidig geworden.«
»So denke auch ich, wenn ich auch noch nicht in eine solche Lage gekommen bin.«
»Ich glaube nur, der Oibt wird uns in ein festes Gewahrsam bringen, das sind dicke Mauern.«
»Hierfür wüsste vielleicht ich einen Rat.«
»Welchen?«
»Das muss die Gelegenheit bringen. Still, da kommt er wieder.«
»Folgt mir, meine Freunde«, sagte der zurückgekehrte Oibt mit kriechender Höflichkeit.
Sie folgten ihm in die Vorhalle, in der wieder die Lampe brannte.
»Das eigentliche Kloster darf von keinem Fremden betreten werden, aber Ausnahmen gibt es immer. Es muss dann nur wieder geweiht werden. Der Uschambi kann nur an einem bestimmten Orte hellsehend werden, an den er gewöhnt ist, eine fremde Umgebung stört ihn.«
»Wo ist dieser Ort?«
»Eben im Kloster. Nun legt eure Waffen ab.«
Das hatten die beiden als etwas Selbstverständliches erwartet, und auch wegen der Antwort hatten sie sich gar nicht erst zu besprechen brauchen.
»Unsere Waffen sollen wir hier lassen? Niemals!«
»Warum nicht?«
»In unserer Heimat gehört die Waffe zum Manne, er trennt sich niemals von ihr.«
»Auch nicht, wenn er auf Besuch in ein fremdes Haus kommt?«
»Auch dann nicht.«
»Ihr habt merkwürdige Sitten in eurer Heimat. Nun, es schadet nichts, das Kloster wird dadurch auch nicht besonders entweiht. Kommt!«
Also den Oibt irritierte es sehr wenig, dass die beiden sich nicht von ihren Waffen trennten, Axel nicht einmal von seiner langen Lanze. So ließen sie wie schon vorhin nur ihre Mantelsäcke zurück, und dass diese nichts enthielten, was sie bei einer Flucht vermissen würden, dafür hatten die beiden wohl schon vorher gesorgt.
Sie schritten durch die zweite Tür, durch einen langen, spärlich erleuchteten Gang, bis ihnen wieder das Mondlicht entgegenflutete.
Sie hatten die zu dem Turm führende Zugbrücke erreicht, und zwar war diese bereits niedergelassen.
»Im Turm befindet sich der Uschambi?«, fragte Axel.
»Ja, im Turm, nur dort wird sein Auge frei, er ist es so gewöhnt.«
Es war ja etwas merkwürdig, konnte Argwohn erregen, aber... warum sollte es schließlich nicht so sein. Sie folgten dem Oibt über das schmale Brett nach, befanden sich im Innern des Turmes, welches jetzt bei Mondschein gar keine künstliche Beleuchtung nötig hatte. Es waren ja vier große, offene Türen vorhanden, durch die sein Licht hereinfluten konnte.
Von dem Brunnen, dem Backofen, der Mühle und von den Vorräten an Lebensmitteln war nichts zu sehen. Einfach ein nackter, kreisrunder Raum von etwa fünf Meter Durchmesser, oben hing eine Glocke, an der jetzt auch kein Strick befestigt war. Wahrscheinlich wurde sie mit Hilfe einer Stange geläutet, die aber ebenfalls nicht zu sehen war.
Jedenfalls befand sich das, was hier untergebracht war, alles unter der Erde, wenn auch kein Zugang zu bemerken war. Doch ließ sich wohl eine der Steinplatten aufheben.
Die Hauptsache war, dass in der Mitte des nackten Raumes, vom Mondlicht übergossen. ein Mönch hockte, der Uschambi, der sie schon erwartete.
Wenn die beiden geglaubt hatten, in dem Hellseher einen ausgedörrten Asketen zu finden, so hatten sie sich getäuscht. Diesem noch gar nicht so alten Mönch musste die tägliche Zwiebelsuppe ausgezeichnet bekommen, er musste sie wohl recht tüchtig mit Öl bespritzen — wie so ein Hefekloß kauerte er da. Aber warum soll es nicht auch einen dicken Hellseher geben?
»Bruder Arabit«, stellte ihn der Oibt vor. »Es bedarf keiner Vorbereitungen. Du setzt dich neben ihn hin, nimmst seine Hand, denkst an das, was du sehen willst, fragst ihn, was er sieht, und er wird das Gewünschte im Geiste erblicken, und sei es auch an der Welt Ende. Nur nach Toten darfst du ihn nicht fragen. In den Himmel und in die Hölle kann er nicht blicken — oder er kann es wohl, aber er darf darüber nicht sprechen. Nur zu mir. Darf ich hier bleiben?«
»Wie du willst.«
»Ich werde euch zeigen, wie ich euch vertraue — ich gehe.«
Der Oibt überschritt die Zugbrücke, und alsbald ging diese in die Höhe. Es hatte nichts zu sagen.
Die beiden waren mit dem Fettkloß allein, der mit seinen hervorquellenden Augen stier vor sich hin blickte.
»Nun, Graf, jetzt nehmen Sie die Sache in die Hand, und... denken Sie an Gedankenübertragung!«
»Ich werde vorsichtig sein.«
Der Graf setzte sich neben dem Mönch an den Boden.
»Hörst du mich sprechen?«, fragte er, ohne schon die Hand genommen zu haben.
»Ja.«
»Schläfst du?«
»Nimm meine Hand in die deine, und ich werde einschlafen.«
Das war kurz und bündig. Der Graf nahm die fette, schmutzige Hand in die seine.
Der Mann schloss die Augen, stöhnte, begann sofort etwas zu schnarchen.
»Wenn das keine Verstellung ist, ist das sehr merkwürdig«, meinte Axel.
»Ruhig«, flüsterte der Graf, »es geht in der Tat eine Veränderung vor sich, die Hand wird plötzlich ganz kalt, der vorhin sehr stark schlagende Puls ist kaum fühlbar — jetzt steht er ganz still — Arabit, hörst du mich sprechen?«
Sofort hörte das Schnarchen auf.
»Eju — ja«, erklang es vernehmlich.
»Was siehst du?«
»Was du sehen willst.«
»Und was ist das?«
»Ich bin in einer weiten Halle — ich sehe einen Mann — er macht sich an seiner Lampe zu schaffen...«
»Wie sieht der Mann aus?«
»Er hat einen Bart...«
»Einen Schnurrbart?«
»Ja, und auch einen Backenbart, nicht sehr lang...«
»Einen Backenbart?!«
»Ja.«
»Bemerkst du sonst etwas Auffälliges an seinem Gesicht?«
»Nein. Es ist ein Franke.«
»Betrachte seine Ohren. Fällt dir nicht etwas an ihnen auf?«
»Nein — ja.«
»Was?«
»Er hat in jedem Ohrläppchen ein kleines Loch.«
Der Graf gab die Hand einmal frei.
»Eine Gedankenübertragung ist ausgeschlossen«, wandte er sich an Axel. »Ich habe an einen mir bekannten Mann gedacht, der, wie ich ihn kenne, niemals einen Vollbart trägt, wohl aber Ringe in den Ohren. So habe ich ihn mir jetzt lebhaft vorgestellt. Der Derwisch aber sieht ihn mit einem Backenbart, den er sich mag stehen gelassen haben, und anstatt der Ohrringe, die ich mir vorstellte, sieht er nur Löcher in den Ohrläppchen.«
»Dann ist das allerdings ein reelles Sehen«, bestätigte Axel.
Der Graf atmete tief auf, als er wieder die fette Hand ergriff.
»Was siehst du jetzt?«
»Ein Schiff — o, was für ein großes Schiff!«
»Welche Farbe?«
»Schwarz, ganz schwarz, alles schwarz!«
Wieder entrang sich der Brust des Grafen ein Stöhnen, aber es war ein unterdrücktes Jauchzen.
»Das schwarze Schiff, es ist nicht untergegangen, gelobt sei Gott!«
»Und der Teufel mag diese Halunken holen, die uns durch die Lappen gegangen sind«, setzte Axel murmelnd hinzu. »Ja, mit denen müssen wir noch einmal Abrechnung halten.«
»Was siehst du an Deck?«
»Schwarze Männer mit weißen Gesichtern.«
»Siehst du an Deck ein Häuschen mit einer Tür?«
»Ich sehe sie.«
»Geh durch diese Tür!«
»Ich gehe durch.«
»Was siehst du?«
»Vor mir ist eine Treppe.«
»Steige sie hinab!«
»Ich bin unten.«
»Geh durch den Korridor, zähle die Türen rechter Hand.«
»Eins — zwei — drei — vier...«
»Halt! Geh durch diese vierte Tür.«
»Ich bin durchgegangen.«
»Was erblickst du?«
»Ein sehr schönes Zimmer.«
»Sind Menschen drin?«
»Zwei Frauen und ein Kind.«
»Wie sehen die Frauen aus?«
»Die eine hat schwarzes, die andere rotgoldenes Haar...«
Er beschrieb Lady Isabel, Marietta und Pepita.
»Was tun sie?«
»Sie sprechen zusammen.«
»Kannst du auch hören, was sie sprechen?«
»Nein, das kann ich nicht.«
Der Hellseher musste sich wieder an Deck begeben und weitere Umschau halten. Jetzt handelte es sich darum, zu erfahren, wo sich das Schiff befand. Das wurde eine gar schwierige Sache, zumal der Mönch nicht lesen konnte, nicht einmal Zahlen. Die Offiziere hätten also eine geografische Ortsbestimmung machen können, der Hellseher konnte sie nicht mitlesen.
Da aber zeigte sich, dass das schwarze Schiff gar nicht segelte, sondern vor einer Küste verankert lag.
Axel musste staunen, wie der Graf zu fragen verstand. Palmen und Neger mit wolligen Schädeln sagten noch sehr wenig. Gewiss, eine afrikanische Küste war es, aber Afrika ist groß.
»Wie sind die Neger, die jetzt aus dem Boote an Deck steigen, im Gesicht tätowiert?«
Der Hellseher beschrieb, durch Fragen unterstützt, die Anordnung der blauen Punkte und Striche.
»Das scheint die Küste von Senegambien zu sein. Doch ich kann mich noch irren.«
Und er stellte weitere Fragen. Axel staunte immer mehr. Ja, es war auch wirklich staunenswert, wie der Graf zu fragen verstand. Wiedergeben lässt sich das gar nicht. Er musste ausgedehnte Kenntnisse über den Charakter jeder afrikanischen Landschaft besitzen. Aber in welchem Fache besaß dieser Mann keine staunenswerte Kenntnisse? Seine Kenntnisse waren einfach universelle.
Lieber Leser!
Gestatte dem Verfasser, dass er einmal persönlich zu dir spricht.
Mag ein Roman auch noch so unterhaltend und spannend sein — — für mich gilt der Grundsatz: Das Buch, welches nicht belehrt, ist des Schreibens auch nicht wert. So frage ich dich jetzt: Willst du dir eine Universalbildung aneignen? Nicht durch mühsames Studieren, sondern auf spielende Weise. Es ist eine Art von Sport, es macht dir das größte Vergnügen.
So gebe ich dir hierzu das ganz einfache Rezept: Nimm nichts in die Hand, wovon du nicht weißt, was es ist, woraus es besteht, wie es gemacht wird. Schäme dich fernerhin, etwas zu berühren, dich eines Gegenstandes zu bedienen, eine Speise zu essen, die du nicht von Grund auf kennst.
Ich war einmal in einer Gesellschaft von ungefähr zwanzig Herren und Damen, welche alle auf das Prädikat ›gebildet‹ Anspruch machten. Sogar sehr große Bildung. Es wurde Sagosuppe aufgetragen. Da fragte ich aus Scherz meine Tischnachbarin, was denn Sago sei. Sie wusste es nicht. Keine Ahnung.
Eine Mehlart. Die Frage ging weiter. Und da stellte es sich heraus, dass auch nicht ein einziger wusste, was er eigentlich aß. Nur ein einziger hatte schon von der Sagopalme gehört, glaubte aber, es sei das Mus der Frucht.
Das ist traurig. Für so etwas gibt es gar keine Entschuldigung. Was nützen mir Französisch und Englisch und die höhere Mathematik, was nützt es mir, wenn ich unter den Sternen wie zu Hause bin, und ich weiß nicht einmal, was das ist, was ich esse! Nein, dafür gibt es gar keine Entschuldigung.
In keiner Wohnung darf heutzutage noch ein Konversationslexikon fehlen, braucht es in keiner Schlafburschenstelle. Auch hierfür gibt es keine Entschuldigung. Ohne jede Anzahlung, gegen eine ganz geringe monatliche Abzahlung bekommt es jeder ehrliche Mensch sofort vollständig geliefert.
Fange mit irgend etwas an, mit Sago oder mit deinen Stiefeln oder mit der Zigarre, die du rauchst, mit dem Streichholz, mit dem du sie anbrennst.
Schlage den betreffenden Artikel auf, lies ihn, unterstreiche alle die Worte, Dinge betreffend, deren Wesen, Zweck und Entstehung du nicht kennst, dann orientierst du dich wieder über diese.
Auf diese Weise wirst du im Laufe der Jahre Erde und Himmel durchforschen. Es ist ganz merkwürdig. Es ist ganz gleichgültig, ob du mit der Sagopalme, oder ob du mit deiner Stiefelsohle, mit Leder anfängst. Du gehst trotzdem immer dieselben Kreise, kommst durch alle Erdteile bis in das Reich der Sterne, lernst dabei spielend die ganze Weltgeschichte.
Den Löffel, den du in die Hand nimmst, hältst du für Messing. Was ist Messing? Frage einmal einen Jüngling, der sein EinjährigFreiwilliges gemacht hat, oder so eine höhere Tochter, ob sie wissen, was Messing ist. Du schlägst nach — Kupfer und Zink. Hiermit dringst du schon in das Reich der Chemie. Beim Nachlesen über Legierungen wirst du Interessantes, sogar Staunenswertes genug finden. Vom Wood'schen Metall kommst du zur Dampfmaschine, weil diese Legierung schon in kochendem Wasser schmilzt und daher zu Sicherheitsventilen dienen kann, und vom Aluminium kommst du zu Napoleon dem Großen, weil dieser aus Aluminium Panzer fertigen wollte.
Und das muss ein Mensch, der ein wirklicher Mensch seiner Zeit sein will, alles kennen, sowohl den Lebensgang Napoleons mit allen seinen Schlachten wie das Wesen einer Dampfmaschine. Dabei braucht von speziellen oder spezifischen Kenntnissen gar keine Rede zu sein, kann es auch gar nicht. Nur auf den innersten Kern der Sache kommt es immer an. Es genügt schon, zu wissen, auf welche Weise der Kolben im Zylinder durch die Dampfkraft hin und her getrieben wird. Aber das wenigstens muss man wissen. Wer auf der elektrischen Straßenbahn fährt, und er weiß nicht, wie und warum die Elektrizität den Wagen in Bewegung setzt, hat auf den Titel ›Bildung‹ keinen Anspruch zu machen, und wenn er auch sonst ein dreifacher Professor und Studienrat ist.
Eine Universalbildung, wie im Anfange gesagt, ergibt das allerdings noch nicht, das stimmt. Aber was heißt das überhaupt, Universalbildung? Gibt es ja gar nicht. Tu nur, was du kannst, und das aus innerer Freudigkeit heraus, die sich bald von ganz allein einstellt. Was dir nicht gefällt, überspringst du. Das andere schreibst du dir durch Stichworte auf, wiederholst die Reihenfolge von Zeit zu Zeit wieder. Es wird dir das größte Vergnügen bereiten. Ja, du wirst vielleicht plötzlich die ganze Welt in einem ganz anderen Lichte ansehen. Bei jedem Spazier- und Geschäftsgange, bei jeder Arbeit, bei jedem Handgriffe tauchen dir immer neue Fragen auf, die du noch nicht beantworten kannst, und es wird dein Glück sein, die Antwort zu Hause zu finden. Und dein Glück wird es sein, schon so viele Fragen von selbst beantworten zu können. Die ganze Welt wird dir vertrauter, alles rückt dir näher, befreundet sich förmlich mit dir.
Und eines Tages wirst du entdecken, was für erstaunliche Kenntnisse du gesammelt hast. Es ist auch ein Geheimnis damit verbunden. Die Fragen beantworten sich zuletzt ganz von selbst. Dann aber, Freund, wenn du so weit bist, dann protze nicht damit! Sonst wirst du eines Tages schmählich blamiert!
Lass dir genügen, dass du es selbst weißt. Es ist deine eigene Freude, dein Glück. Ja, in dieser scheinbar so oberflächlichen Geistesausbildung, die ich eine Art von Sport, Sammelsport, nennen möchte, dürfte vielleicht sogar wahres Lebensglück zu finden sein, was in jeder Schicksalslage standhält.
Dann hierbei gleich noch eins. Den gebildetsten, ja, den gelehrtesten Mann, der mir je begegnet ist, habe ich einst in einem englischen Arbeiter gefunden. Er war einige Zeit mein Nachbar, in London. War in einer großen Maschinenfabrik Schraubenschneider, von Jugend an, war es noch damals als zweiundsechzigjähriger Mann. In der Woche 40 Schilling oder Mark Lohn, für englische Verhältnisse gar nicht so hoch, es war ja auch eine ganz mechanische Beschäftigung. Mehr Fabrikarbeiter als Handwerker, kam nicht höher, von acht bis sechs war er in der Fabrik, von sieben bis Mitternacht studierte er zu Hause in seinen Büchern. Und was für eine Bibliothek der nun hatte!! Seit 45 Jahren hatte der wöchentlich von seinen 40 Mark zehn Mark für Bücher ausgegeben, ohne Ausnahme. Also eine Bibliothek im Werte von dreiundzwanzigtausend Mark! Und dabei hatte dieser Mann mit einer braven Frau ein Dutzend Kinder großgezogen, und gut erzogen! — die waren alle wohl versorgt.
Also jeden Abend wurde fünf Stunden lang studiert. Das hatte er schon als fünfzehnjähriger Junge angefangen, vielleicht schon noch früher. Dann konnte er ja auch bei den mechanischen Beschäftigungen seinen Gedanken nachhängen.
Nun berechne man einmal nur diese fünf Abendstunden für 45 Jahre und vergleiche damit, was ein Student in seinen sechs bis zehn Semestern arbeitet! Im Grunde genommen aber hatte dieser Mann mehr als 45 Jahre ununterbrochen studiert, für alles andere ganz abgestorben.
Der Erfolg war denn auch danach. Wir haben uns manchmal unterhalten. Ich konnte damals diesen Geist nicht fassen, könnte es noch heute nicht, wenn ich wieder einmal mit ihm zusammenkäme. Es war nur so Neugierde von mir, ich wollte staunen, wenn ich ihn etwas fragte und aus dem Hundertsten ins Tausendste kam und der Greis im Arbeitskittel mir alles mit freundlichstem Lächeln beantwortete und erklärte. Aber als wir nun gar einmal eines Sonnabendnachmittags zusammen ins Britische Museum gingen und er den Mentor spielte! Und wir waren an diesem für den Engländer freien Nachmittag noch in anderen Museen. Himmel, diese Kenntnisse! Und nun alles aufs Gründlichste! Da konnte man wirklich von einer die ganze Welt umfassenden Universalbildung sprechen, soweit sie für einen Menschen erreichbar ist. Ich zweifle nicht, dass dieser Mann im Arbeitskittel den Professorenstuhl jeder Fakultät hätte einnehmen können.
Und nun dabei diese stille Bescheidenheit! Von seinen tausend Mitarbeitern wusste wohl kein einziger, was dieser Schraubenschneider in Wirklichkeit war.
Und diese Liebenswürdigkeit! Höchstens, wenn ich ihn einmal fragte, warum er denn sein fabelhaftes Wissen nicht zu verwenden, nicht Kapital daraus zu schlagen suche, konnte sich sein freundliches Lächeln in ein mitleidiges verwandeln. Nur da blieb er mir die Antwort schuldig.
Ach, ich Narr, der ich damals war! Damals hätte ich seine Antwort ja gar nicht verstanden. Heute weiß ich es von ganz allein. Dieser arme Arbeiter hatte das wahre Lebensglück gefunden und behütete es als köstliches Kleinod im stillen Kämmerlein, wie es ein Spinoza, ein Newton tat, denen ihre Manuskripte förmlich geraubt werden mussten, um sie zu veröffentlichen.
Und sollte denn dieser Mann, dessen Bekanntschaft ich ganz zufällig machte, der einzige seines Standes gewesen sein?
Nein, ich lasse mich nicht mehr täuschen. Seit jener Zeit bin ich vollständig von dem Wahne kuriert, einen Menschen nach seinem Äußeren, nach Titel und Rang beurteilen zu wollen.
Der Graf schien genug erfahren zu haben, er gab die Hand frei und stand auf.
»Kein Zweifel, es ist die Küste von Senegambien, an der das schwarze Schiff liegt, und zwar sind es Mandingos, mit denen die Mannschaft unterhandelt.«
Also der Graf hatte ganz erstaunliche Kenntnisse entwickelt, um dies durch Fragen konstatieren zu können.
»Ist Ihnen denn ganz Afrika so bekannt?!«, staunte Axel noch immer.
»Ganz Afrika ist gleich etwas viel«, lächelte der Graf, »aber die ganze Küste dieses Erdteils habe ich zweimal schon gründlich abgekleppert.«
»Wann denn?«
»Einmal mit einem phönizischen Schiffe, das ich selbst als Kapitän führte, gegen 600 vor Christi, und das zweite Mal erst vor 400 Jahren, als Schiffsarzt, unter Heinrich dem Seefahrer.«
Natürlich, anders hatte es ja gar nicht kommen können! Auch das ›erst vor 400 Jahren‹ hatte mit dazu gehört.
Aber Axel sagte diesmal nichts, er hatte eben Erstaunliches zu hören bekommen, und dann dachte er jetzt auch an etwas anders.
»Mehr wollen Sie den Fakir nicht über das schwarze Schiff fragen?«
»Es genügt mir, zu wissen, dass es noch auf der Oberfläche des Meeres schwimmt. Der Herr sei gepriesen! Ohne Zweifel befindet es sich schon auf dem Wege um Afrika herum nach dem Stillen Ozean.«
»Auch sonst haben Sie den Hellseher nichts mehr zu fragen?«
»Ich wüsste nichts, was meine Neugier noch reizen könnte.«
»Dann werde ich einmal eine Frage stellen.«
»Tun Sie es doch.«
Der dicke Mönch begann schon wieder zu schnarchen.
»Ob er erinnerungslos erwacht? Nichts davon weiß, was man ihn gefragt hat?«
»Das weiß ich nicht, darüber hat der Oibt gar nichts gesagt. Das wird sich erst später zeigen.«
»Oder wir könnten ihn gleich jetzt deswegen fragen.«
»Ja, das könnten wir eigentlich.«
Schon war Axel vor den Schnarchenden hingetreten, setzte sich noch nicht, nahm noch nicht seine Hand.
»Hörst du mich sprechen, Arabit?«
Keine Antwort, es wurde weitergeschnarcht. Jetzt setzte sich Axel neben ihn hin, nahm seine Hand.
»Hörst du mich sprechen, Arabit?«
»Ja.«
»Weißt du, wenn du erwacht bist, was wir dich im Schlafe gefragt haben?«
»Nein.«
»Vorsicht«, warnte der Graf in gehauchtem Tone, »auch in diesem Zustande kann er uns täuschen.«
»Bah, ich riskiere es. Arabit, du sollst das sehen, was ich sehen möchte.«
»Ich werde es sehen.«
»Was siehst du?«
»Ich sehe... einen Mann.«
»Einen Mann?«, wiederholte Axel verwundert.
»Ja, einen ganz, ganz kleinen Mann, er ist im Sand vergraben und sitzt...«
Plötzlich ward die fette Hand mit einem Ruck aus der von Axel gerissen, der Mönch gähnte, rieb sich die Augen und starrte dann seinen Nachbar grimmig an.
»Was hast du mich jetzt gefragt?«, knurrte er ebenso, wie sein Blick war.
»Ich fragte dich, was der Oibt jetzt im Kloster treibt, nur um deine Hellsehergabe einmal zu prüfen«, antwortete Axel mit schneller Geistesgegenwart.
»Alles, was du nicht zu wissen brauchst, werde ich nicht antworten.«
»Entschuldige.«
»Habt ihr erfahren, was ihr wissen wolltet?«
»Ja.«
»Stimmte es?«
»Es war wunderbar.«
»Dann ist es ja gut. Nun ist es aber auch genug.«
»Wir dürfen dich nicht mehr fragen?«
»Nein. heute Nacht nicht mehr. Morgen wieder.«
Axel erhob sich und trat zum Grafen, wieder deutsch sprechend.
»Er erinnert sich wohl nicht mehr«, sagte zunächst dieser, »was er gesagt hat, aber er empfindet auch in diesem Zustande, wenn er etwas gefragt wird, was er nicht beantworten darf, bringt sich selbst schnell zum Erwachen. Dasselbe findet ja auch oft genug in der Faszination statt, wenn man es nicht zu vermeiden weiß.«
»So ist es. Wissen Sie, was ich ihn fragen wollte?«
»Was dort an jenem Orte vergraben liegt.«
»Ja, darauf konzentrierte ich meine Gedanken. Haben Sie es gehört?«
»Ein ganz, ganz kleiner Mann, er sitzt... da brach er ab.«
»Offenbar eine Figur.«
»Das denke auch ich. Wir müssen vorsichtig sein. Der Oibt kommt.«
Er zeigte sich im Mondenschein neben der hochgezogenen Brücke, welche den Raum der Tür nicht ganz ausfüllte.
»Habt ihr Auskunft bekommen?«, rief er herüber.
»Ja. und wir sind befriedigt, sind erstaunt.«
»Jetzt lässt sich der Uschambi nicht mehr befragen.«
»Das hat er uns soeben selbst gesagt. Warum nicht mehr?«
»Er lässt sich immer nur einmal in Schlaf versetzen, dann muss eine lange Pause eintreten. Nehmt, was ich euch reiche.«
Hinter dem Oibt standen noch andere Mönche, sie dirigierten eine lange Stange herüber, an der vorn ein Krug befestigt war, nach der Biegung der Bambusstange ziemlich schwer.
»Was soll das?«
»Das ist Wasser, falls ihr in der Nacht Durst bekommt, dann noch Brot und Zukost, die Decken und Matten werfe ich euch hinüber.«
Die letzteren kamen schon geflogen, während jetzt an der Stange einige Brotfladen und ein Sack mit Zwiebeln hingen.
»Ja, sollen wir denn die Nacht hier verbringen?«
»Es ist nicht anders möglich, die Brücke darf nicht mehr herabgelassen werden.
»Weshalb nicht?«
»Ich habe von Jehova soeben den Befehl dazu bekommen.«
Gegen solch ein Argument war einfach nicht anzukämpfen.
»Ihr seid wohl so gut und gebt dem Bruder Arabit zu essen und zu trinken, wenn er es fordert, er hat euretwegen das Abendessen versäumt, und er kann nicht gehen, nicht einmal aufstehen, ist zu dick dazu. Denn nun muss auch er drüben bleiben, Jehovas Befehl ist zu plötzlich gekommen.«
»Und wie lange sollen wir hier bleiben?«
»Nur bis morgen früh. Bei Aufgang der Sonne darf die Brücke wieder herabgelassen werden. Und seid vorsichtig, ich bitte euch! In den Graben sind die von uns gefangenen heidnischen Geister gesperrt, die früher hier gehaust haben, und sie hauchen furchtbar giftige Dünste aus. Wer versehentlich dort hinunterfällt, ist sofort tot.«
»Wir werden uns hüten.«
»Sonst noch etwas? Wir müssen jetzt unseren religiösen Übungen obliegen.«
»Und morgen früh nehmen wir die Untersuchung jener Stelle auf?«
»Gewiss, bei Sonnenaufgang reisen wir ab.«
Der Oibt verschwand mit seinen Begleitern von der Türspalte.
»Solche Halunken!«, sagte Axel. »Das war natürlich schon alles vorher ausgemacht, dass wir die Nacht hier verbringen sollten.«
»Gewiss. Sie halten den Turm für das sicherste Gefängnis«
»Und diesen dicken Kerl haben sie uns noch als besonderen Wächter zurückgelassen.«
Der dicke Kerl nahm eine der Binsenmatten und rutschte, ohne auch nur die gekreuzten Beine auseinander zu nehmen, was er vielleicht gar nicht mehr konnte, von der Mitte des freien Raumes nach einer Wand, die im Mondschatten lag, rutschte auf die ausgebreitete Matte, lehnte sich gegen die Wand.
Axel trat in eine der offenen Türen dicht an den Graben, spähte hinab. Zu erblicken war dort unten aber nichts.
»Graf, es wäre doch ausgezeichnet, wenn wir schon in dieser Nacht jene Untersuchung auf eigene Faust anstellten.«
»Wie aber über den Graben kommen?«
»Können Sie nicht drüberspringen?«
»Sie könnten es?«, fragte der Graf staunend.
»Ja, ich glaube. Es mögen sechseinhalb Ellen sein. Doch auf Zahlenmaß darf man sich da gar nicht einlassen. So etwas täuscht, beeinflusst einen. Ich kenne das. Wenn in dieser Entfernung in den Sand zwei Striche gezogen wären, würden Sie solch einen Sprung gar nicht so riskant finden. Aber bei dieser Tiefe — das beeinflusst einen. Ich aber bin ein Freispringer, habe schon oft genug Gelegenheit gehabt, Klüfte abzuschätzen, wobei es nur ein Entweder—Oder gab. Und ich bin immer hinüber gekommen. Ja, ich würde auch über diesen Graben kommen.«
»Bei diesem kurzen Anlauf, der Ihnen hier zur Verfügung steht?«
»Er genügt mir. Sind Sie ein guter Springer? Sie haben doch einen athletischen Körperbau. Würden Sie es mir nicht nachmachen können? Denn gesprungen müsste werden, etwas anderes gibt es nicht.«
Auch der Graf war dicht herangetreten, prüfte lange.
»Hm. O ja, wenn Sie es mir vormachen, werde auch ich hinüberkommen. Ein guter Springer bin ich. Aber es kommt eben, wie Sie ganz richtig sagen, auf das vorherige Bewusstsein an, ob man es kann oder nicht kann.«
»Gut, so werde ich es Ihnen vormachen, und dann kann ich Sie noch immer an mein Lasso nehmen, dass Sie wenigstens nicht dort unten auf die Fußangeln stürzen.«
»Ja, aber — wir werden doch beobachtet. Schon von unserem Wächter hier.«
»Wir müssen eben fliehen und die Untersuchung jenes Punktes während der Flucht vornehmen.«
»Dann werden wir natürlich verfolgt.«
»Während wir ausgraben, müssen wir uns die Verfolger vom Leibe halten. Morgen, wenn wir den Punkt gefunden haben und die Ausgrabung hat das gewünschte Resultat ergeben, macht der Oibt uns ja doch kalt. Darüber besteht für mich gar kein Zweifel.«
»Auch für mich nicht. Ich habe es gleich in seinen Augen gelesen.«
»Gewiss, unser Tod ist bei ihm schon so fest beschlossen, dass er uns gar nicht erst fragt, wer wir eigentlich sind, ob wir in Kairo erwartet werden und dergleichen. Kurz und gut, wenn wir ihm geleistet haben, was er von uns verlangt, müssen wir sterben.«
»Und deshalb hat er uns auch gar nicht erst schwören lassen, nichts wegen des Uschambis zu verraten.«
»So ist's. Das hat er ganz vergessen und wird auch nicht wieder daran denken. Wir sind für ihn schon tote Männer.«
»Wir werden die Kamele benutzen?«
»Wenn sie noch zu haben sind.«
»Vorhin lagen sie noch angebunden und kauten wieder.«
»Aber sie können noch später anderswo hin gebracht werden.«
»Beobachten wir erst, das können wir uns alles noch überlegen. Jetzt ist der Plan doch noch nicht auszuführen.«
Der Graf der dies zuletzt gesprochen, ging zu dem Wasserkrug, fand in demselben einen Becher angehängt, schöpfte und trank.
»Seien Sie vorsichtig«, warnte Axel. »man könnte uns einen Schlaftrunk oder sonst etwas Ähnliches beibringen wollen.«
»Eben nur deswegen trinke ich. Nein, es ist reines Wasser.«
»Das können Sie schmecken?«
»Ja, da kann ich mich vollständig auf meine Zunge verlassen.«
»Sie könnten ein Gift herausschmecken?«
»Ja.«
»Es gibt aber auch ganz geschmacklose Gifte.«
»Nein, die gibt es nicht. Es gehört allerdings ein besonderes Studium dazu. Es war ebenfalls bei den alten Babyloniern, bei den Magiern, als ich in dieser Geschmacksprüfung einen ganzen Kursus durchgemacht habe.«
»Das lasse ich mir gefallen, solch einen sicheren Geschmack ziehe ich doch noch meinem Universalmittel vor.«
»Wasser — ich möchte trinken«, ließ sich der Mönch in diesem Augenblick vernehmen.
Der Graf füllte den Becher von Neuem, ging hin, wo der Mönch im Mondschatten kauerte, gab ihm den Becher, trat zurück.
»Hören Sie«, flüsterte Axel, dabei sich aber immer der deutschen Sprache bedienend, »wenn wir den Kerl einmal zu faszinieren suchten...«
»Ist bereits geschehen.«
»Was?!«
»Er schläft bereits. Wenn er nicht ein außergewöhnlicher Mensch ist oder... nein, da fängt er schon zu schnarchen an.«
So war es. Der Mönch hatte sich auch plötzlich schwer zurückgelehnt.
»Ja, haben Sie ihm denn etwas in den Becher hineingegeben?«
»Jawohl, jenes Mittel, welches ich auch in Pillenform bei mir führe.«
»Aber ich beobachtete Sie vorhin gerade, ich bemerkte nichts. Oder waren Sie schon darauf vorbereitet?«
»Das gerade nicht, aber Geschwindigkeit ist doch keine Hexerei.«
»Trotzdem, Sie sind ein Hexenmeister.«
Sie traten vor den Mann hin. Dieser saß so, dass er von der Klostertür nicht gesehen werden konnte. Der Graf begann sein Experiment, sein Examen.
Wir geben nur das Resultat wieder.
Vor zwei Jahren, etwa um dieselbe Jahreszeit, war hier ein Engländer gewesen, nur in Begleitung eines arabischen Dieners. Er hatte sich, mit einem Passe des Padischahs versehen, schon längere Zeit in diesem Tale aufgehalten, immer die Gastfreundschaft der vier Klöster in Anspruch nehmend.
Eines Tages war er wieder hierher gekommen, hatte den Oibt um einige Mönche gebeten, die für ihn mit Schaufeln und Hacken arbeiten sollten. Es hatte sich also um Ausgrabungen gehandelt. Der Fremde hatte in diesem Tale uralte Ruinen entdeckt, von dem auch die Kopten hier nichts wussten.
»Wo befinden sich diese Ruinen?«, fragte der Graf, der überhaupt immer fragen musste.
Nur drei Stunden von hier, in südlicher Richtung, mehr konnte der Hypnotisierte nicht angeben, auch nicht, wie der Engländer zu der Kenntnis dieser Ruinen gekommen, von denen übrigens gar nichts mehr zu sehen sei. Alles von Flugsand bedeckt. Die Mönche hatten sie dann auch später nicht wiederfinden können.
»Nun, und was geschah weiter?«
Nach tagelangem Graben wurde nichts weiter als eine steinerne Figur gefunden, einen Mann darstellend, auf einem massiven Stuhle sitzend, kaum einen halben Meter groß, aber so schwer, dass ein starker Mann die Figur nur mit größtem Kraftaufwand aufheben konnte.
Gegraben hatten die Mönche fleißig, sie wurden ja gut dafür bezahlt, aber nicht für alles Geld der Welt konnten sie dazu bewogen werden, diesen heidnischen Götzen anzufassen und davonzutragen. Und der arabische Diener, der wohl freier dachte, war einem giftigen Schlangenbisse erlegen.
So hob der Engländer, ein sehr kräftiger Mann, die Figur zuletzt selbst auf, um sie mühselig bis in das Kloster zu schleppen, sie dort einstweilen zu bergen. Er schleppte sie denn auch eine große Strecke, bis ihm der Oibt erklärte, er solle nicht etwa daran denken, den Götzen in das Kloster zu bringen.
Da vergrub der Engländer die Figur an der Stelle, bis an die er gekommen, im Sande, blickte durch sein Zauberrohr nach der Sonne und setzte seinen Weg fort, wollte zurück nach Kairo, um geeignete Arbeiter zu holen, die Figur weiter fort zu schaffen.
»Und ist er wiedergekommen?«
»Nein.«
»War er erst noch einmal hier im Kloster?«
»Nein.«
»Wer war bei ihm, als er die Figur vergrub?«
»Nur der Oibt.«
»Sonst niemand?«
»Nein.«
»Hat der Oibt den Anglesi ermordet?«
»Das weiß niemand.«
»Aber ihr glaubt es.«
»Ja, jedenfalls hat er ihn getötet — es war ja ein ungläubiger Hund.«
Mehr wusste der zur Offenheit gezwungene Mann über diese Angelegenheit nicht auszusagen, kannte nicht einmal den Namen des unglücklichen Engländers.
Aber zu befragen hatte ihn der Hypnotiseur doch noch.
»Du bist hier zurückgeblieben, um uns zu bewachen?«
»Ja.«
»Was für ein Zeichen sollst du geben, wenn wir entfliehen?«
»Fliehen? Entfliehen könnt ihr gar nicht.«
»Weswegen sollst du uns beobachten?«
»Wenn ich sonst etwas Verdächtiges an euch bemerke.«
»Und was sollst du dann tun?«
»Die Glocke läuten.«
»Wie machst du das?«
»Ich brauche nur hinter mich zu greifen und den Griff zu ziehen.«
Man musste an eine handgreifliche Untersuchung gehen, diese ergab eine sehr einfache Erklärung.
Der Mönch verdeckte mit seinem breiten Rücken eine Öffnung in der Wand, in der sich ein Handgriff befand. An ihn zu ziehen wagte man natürlich nicht. Er setzte durch einen Strick, der durch einen Hohlraum der Mauer lief, die oben hängende Glocke in Bewegung.
»Werden wir denn nicht noch von anderen Mönchen beobachtet?«
»Nein.«
»Warum denn nicht?«
»Heute ist doch Hammonda,«
»Hammonda? Was ist das?«
»Das heilige Nachtfest. Die ganze Nacht muss alles betend auf den Knien liegen.«
Die beiden Freunde sahen sich bedeutungsvoll an.
»Nur du darfst davon eine Ausnahme machen?«
»Ja, weil ich meine Knie nicht mehr beugen kann.«
»Ah so! Also die anderen Mönche liegen betend auf den Knien und lassen sich durch nichts stören.«
»Nein, durch nichts.«
»Wenn du an uns aber nun etwas Verdächtiges bemerkst und die Glocke läutest?«
»Das ist etwas anderes, eine Gefahr unterbricht die Andacht, dann muss die Hammondanacht wiederholt werden.«
»Das ist wohl gar keine bestimmte Nacht?«
»Nein, sie wird am Tage zuvor bestimmt. Sonst könnten doch Räuber sie sich zunutze machen.«
»Und wenn es uns gelänge, von hier fort zu kommen, niemand von den anderen Mönchen würde das bemerken?«
»Nein, keiner, sie sind in der Kapelle versammelt. Aber ich würde läuten, dann kämen sie angestürmt.«
Wieder blickten sich die beiden Freunde verständnisvoll an.
»Besser hätten wir es ja gar nicht treffen können!«, flüsterte Axel. »Mehr brauchen wir nicht zu wissen. Wie lange dauert die Andacht? Nur das noch.«
Bis zu Sonnenaufgang. Sie begann aber erst zwei Stunden nach Sonnenuntergang, war demnach jetzt schon im Gange.
Der Graf hatte aber immer noch einige Fragen zu stellen.
»Weißt du, was der Oibt mit uns vorhat?«
»Ja.«
»Nun?«
»Ihr sollt ihn morgen früh mit Hilfe des Zauberrohres an die Stelle führen, wo der Anglesi den Götzen und alles andere vergraben hat.«
»Was alles andere?«
»Sein Geld.«
Ah, auch Geld hatte er dort vergraben! Nun wurde die Sache anders! Wenn auch der Oibt vielleicht schon dem Götzen großen Wert beimaß, ihn vielleicht später verkaufen wollte, so kam es ihm doch hauptsächlich auf das bare Geld an!
»Weshalb hat denn der Anglesi dort sein Geld vergraben?«
»Ich... weiß nicht.«
»Doch, du weißt es! Ich höre es gleich deiner unsicheren Sprache an.«
»Es wird hier nur so gesagt.«
»Was wird hier gesagt?«
»Der Anglesi hatte viel Geld bei sich, Scheine und auch blankes, und er erkannte erst später, wie unsicher es hier ist, er fürchtete einen Raubanfall, und da hat er sein Geld lieber vergraben, um es später abzuholen, wenn er mit genügend vielen Dienern zurückkam.«
Nun war alles erklärt.
»Und wenn wir nun den Oibt hingeführt haben, was dann?«
»Dann tötet er euch«, erklang es ganz offen zurück.
»Dort an Ort und Stelle?«
»Ja.«
»Auf welche Weise?«
»Ihr werdet wahrscheinlich vergiftet — oder eben sonst wie getötet.«
»Das hat er allen Mönchen bereits gesagt?«
»Das ist alles schon abgemacht.«
Nun wusste man genug, es war nichts mehr zu fragen.
»Der Kerl bleibt selbstverständlich in diesem faszinierten Zustand«, meinte Axel.
»Natürlich, er muss weiterschlafen«, entgegnete der Graf und gab dem Hypnotisierten gleich entsprechende Suggestionen.
»Was nun?«
»Warten wir noch eine Stunde.«
Diese verging. Zu besprechen war kaum noch etwas. Alles andere musste die Gelegenheit ergeben. Die Zeit hatten sie sich dadurch vertrieben, dass sie nach dem Eingang zu den unterirdischen Räumen des Turmes suchten, hatten ihn gefunden, waren eingedrungen, hatten den Brunnen, den Backofen, die Vorratskammern und alles andere untersucht, aber kein Brett, kein Seil entdeckt, das ihnen zum Überwinden des Grabens hätte dienen können.
»Wir müssen springen«, sagte Axel. »Länger brauchen wir nicht zu warten. Hat sich Ihr Entschluss unterdessen nicht geändert?«
Nein, unterdessen war der Graf erst recht zu der Überzeugung gekommen, dass auch er diesen Sprung fertigbringen würde.
»Ich brauche nur ein Beispiel«, gestand er ganz offen.
Sonstiger Vorbereitungen bedurfte es nicht. Nur dass Axel noch seinen Hirschfänger und die beiden schweren Pistolen aus dem Gürtel nahm.
Dann trat er an das äußerste Ende des freien Raumes, den einen Fuß vorgesetzt, etwas visiert, den Oberkörper hin und her gewiegt, dann drei große Rennschritte, und er sprang vom Rande des Grabens ab, hatte auf der anderen Seite noch anderthalb Fuß festen Boden hinter sich.
Ja, es war ein Sprung gewesen!! Das erkannte der Beobachter, als der Springer mit hochgezogenen Knien und dann mit vorgeworfenen Füßen durch die Luft sauste! Es kann gleich gesagt werden, dass sich wohl mancher gewandte Turner und spezielle Springer, der es sonst auch mit sechs Metern aufnimmt, für ein Nachmachen dieses Sprunges bedankt hätte. Nach der Leine über feste Erde springen oder über eine tiefe Schlucht, deren Weite man nicht richtig kennt — es ist eben ein gewaltiger Unterschied! Es ist ja genau dasselbe mit dem Balancieren. Wenn jemand schwindelfrei ist, wäre es dem schließlich nicht ganz gleichgültig, ob er auf einem Seile, sogar auf einem breiten Brette geht, das auf dem Erdboden liegt oder himmelhoch über einen Abgrund führt? Nein, es ist eben nicht dasselbe! Und beim Springen gibt es ein dem Schwindel ganz entsprechendes Gefühl, für das wir aber noch gar keinen Ausdruck haben.
»Werden Sie es nachmachen können?«, flüsterte Axel zurück.
»Ja, ich kann es.«
»Soll ich Sie nicht lieber an das Lasso nehmen?«
»Nein, es ist nicht nötig, würde mich nur hindern.«
Jetzt setzte sich der Graf in Positur, zögerte aber gar nicht so lange wie sein Vorgänger, sprang und....
»Alle Wetter, nun veralbern Sie mich aber nicht mehr!«, stieß Axel in grenzenlosem Staunen hervor.
Der Graf hatte mindestens noch einen Meter festen Boden hinter sich bekommen, war überhaupt ganz anders gesprungen als sein Vorgänger, obgleich der doch auch die Schnelligkeit eines Steinbocks besaß — diese Leichtigkeit, mit der er abgeschnellt und drüben den Boden wieder erreicht hatte, diese Eleganz dabei!

»Ich habe selbst noch nicht gewusst, dass ich so weit springen kann, hatte noch keine Gelegenheit dazu, es zu erproben.«
Weitere Worte wurden deshalb nicht gewechselt, es wäre unangebracht gewesen. Nur schnell um das Kloster herum!
Da lagen ihre Kamele mit untergeschlagenen Beinen, nach der reichlichen Mahlzeit noch immer wiederkäuend. Ein besonderer Schlag auf den Nacken hätte genügt, sie wären aufgestanden, ihren Reiter schon auf dem Rücken.
»Soll ich jetzt auch noch unsere Mantelsäcke holen, wenn sie noch im Vorraum liegen?«, flüsterte Axel.
Der Graf riet ab. Die Säcke enthielten nichts weiter als einigen Proviant und Geschenke, welche Beduinen- und Koptenherzen erfreuen. Deshalb brauchte kein Alarm riskiert zu werden.
Aber schon hatte sich Axel entfernt. Nach zwei Minuten kehrte er mit den Säcken zurück, in denen nichts fehlte. Morgen früh hatte ja alles noch in Ordnung sein müssen, und entgehen konnte den Klosterräubern doch sowieso nichts, es fiel ihnen ja alles noch zur Beute.
Aufgesessen — fort ging es in die mondhelle Wüste hinein.
Zuerst hatte es sie gedünkt, als ob der Oibt selbst gar keine Ahnung habe, wo der betreffende Punkt liege. Nun ja, in diesem Wüstental. Sonst aber schien er nicht einmal die Entfernung zu kennen.
Der Uschambi hingegen hatte gesagt, der Oibt sei selbst an jener Stelle gewesen, wo der Engländer seinen Schatz vergraben hatte.
Doch das konnte wohl nicht stimmen. Der Uschambi hatte ja überhaupt von alledem sehr wenig zu erzählen gewusst. Richtiger war wohl die Annahme, dass der Oibt nur gewusst hatte, wie der Engländer in der Wüste den Götzen und sein Geld vergraben, der Oibt wusste schon von solchen geografischen Ortsbestimmungen und von ihrer Zuverlässigkeit, der Engländer mochte ihm auch den Zettel gezeigt haben — daraufhin war er ermordet worden.
Wenn diese letztere Annahme richtig war, so konnten die beiden schon nach zehn Minuten schnellen Reitens nicht mehr verfolgt werden, falls ihre heimliche Entfernung doch bemerkt wurde. Dann waren sie eben schon außer Gesichtsweite, zumal die Wüste dort hinten hügelig wurde. Und der Boden war hier felsig, glatt wie ein Tisch, der letzte starke Wind hatte etwaigen Flugsand weggeweht, und obgleich die Beduinen unter den Arabern doch wohl die schärfsten Sinne haben, sind sie doch ganz schlechte Fährtensucher. Und in dieser Gegend, ganz Nordafrika umfassend, setzt kurz vor Sonnenaufgang regelmäßig ein starker Wind ein, der auch im tiefen Sand jede Spur verwischt.
Es wäre sehr gut gewesen, wenn dies alles zutraf, sie nicht verfolgt würden, wenigstens nicht so bald.
Fürchten konnten sich die beiden nicht vor den achtzig Kuttenträgern, welche dieses Kloster wohl barg, brauchten es auch nicht, sie waren ja auf schnellen Tieren beritten, hatten ganz andere Waffen, ganz andere Erfahrungen, waren ganz andere Männer — und doch, ihr Ziel hätten sie bei einer baldigen Verfolgung vielleicht gar nicht erreicht. Denn sie mussten ja wiederholt Mondberechnungen machen, die letzte sogar bis auf Zehntelsekunden, wozu eine ganz knifflige Vorbereitung nötig war, dabei durfte sie niemand stören, da konnte ein einziger Störenfried die ganze Berechnung so vereiteln, wie es doch unmöglich ist, dass jemand eine gerade Linie zeichnet, wenn ein anderer am Tische wackelt.
So besprachen sich die beiden, während sie ihre Kamele zum schnellsten Laufe antrieben. Die Umrechnung der Sonnenaufnahme für den Mond hatte der Graf schon vorhin gemacht, gleich im Kopfe, und überdies kannten sie ja den geografischen Ort sowieso bereits, er lag keine zwei englische Meilen südlich von hier entfernt.
Nachdem sie zehn Minuten so schnell geritten waren, mussten sie unbedingt wissen, wo sie sich befanden, sonst schossen sie über das Ziel hinaus, verloren erst recht Zeit.
Sie ließen die Kamele niederknien und befestigten an ihren Füßen Schlingen, die sie am Aufstehen verhinderten.
Es war unterdessen eine echte Sandwüste geworden, sehr hügelig. Aber diese Sandhügel veränderten sich mit jedem Winde, ein Zeichen zum Wiederfinden boten sie niemals.
Die Orientierungsaufnahme nach dem hochstehenden Vollmonde wurde gemacht.
»Das nenne ich Glück!«, rief der Graf, nachdem er die Berechnung beendet. »Wenn kein Rechenfehler untergelaufen ist, so befinden wir uns gerade auf der gesuchten Sekundenbreite oder dicht daran.«
Die Berechnung wurde wiederholt — sie stimmte.
Danach also konnten sie ziemlich genau ein Terrain von dreißig Metern Länge und etwas kürzerer Breite abgrenzen, innerhalb dessen der gesuchte Punkt liegen musste.
Da nun der Zeiger des Chronometers auch noch auf halbe Sekunden arretiert werden konnte, vermochten sie dieses Quadrat um die Hälfte zu verkleinern. Dann aber hörte es auf, dann hätten sie auf diesem doch noch immer ziemlich großen Gebiet — etwa zweihundert Quadratmeter — planlos im Sande wühlen müssen, und da hätte ihnen ein großer Zufall zu Hilfe kommen müssen, wollten sie den gesuchten Gegenstand bald finden.
Außerdem fragte es sich, ob ihr Chronometer noch bis zur Sekunde richtig ging! Damals, auf den Ruinen Karthagos war das etwas anderes gewesen, da waren sie direkt von der Jacht gekommen, deren großer Schiffschronometer Zehntelsekunden anzeigte und sich nicht so leicht veränderte.
Jetzt also trat das Problem ein, welches nur ein wirklicher Astronom lösen kann und schon damals lösen konnte: die genaueste Ortszeit selbst ohne Uhr zu finden — ein Problem, von dem ja der Graf behauptete, dass es schon die chaldäischen Priester zu lösen verstanden hätten.
Es sei hierbei für den, den es interessiert, bemerkt, dass auf der Greenwicher Sternwarte — wohl aber auch auf anderen Sternwarten — die Ortszeit bis auf die Zweihundertstelsekunde bestimmt wird. So unglaublich das auch klingen mag, ist die Vorrichtung dazu doch ziemlich einfach, wenigstens dem Aussehen nach. Die Hauptsache ist ein zwei Meter langer Kreisbogen, der in zweihundert Kästchen geteilt ist, und über dem Bogen schlägt ein Pendel hin und her, zu jedem Schlag zwei Sekunden brauchend, an dessen Ende eine erbsengroße Stahlkugel durch Elektromagnetismus festgehalten wird. Die zweite Hauptsache ist das Meridianfernrohr, durch welches ein gewisser, sehr schneller Stern gehen muss. In dem Moment, da das Sternlicht eine lichtempfindliche Platte trifft, wird der elektrische Strom unterbrochen, die kleine Kugel fällt in ein Fach, und je nach der Lage desselben weiß man, um wie viele Hundertstelsekunden die Sternwartenuhr vor- oder nachgeht. Das innerste Wesen der Sache freilich bleibt dem Laien unverständlich.
Wie es der Graf machte, um wenigstens die Zehntelsekunde berechnen zu können, sei nur in Kürze wiedergegeben.
Aus zwei Ladestöcken wurde ein Galgen zusammengebunden, dieser in den Boden gesteckt. Von dem Galgenarm hing ein Faden herab, an dem eine Bleikugel befestigt war. Unter diese legte der Graf auf den geglätteten Sand ein dünnes Pergament von etwa einem Meter Durchmesser, auf das er an Bord der Jacht einen Kreis gezirkelt hatte, der wie bei einer Uhr in sechzig Teile geteilt war, und jedes dieser Felder war wieder zehnmal geteilt, was sich bei solch einem großen Kreise recht wohl machen lässt.
Das auf einer Seite aufgeschlitzte Pergament konnte um den senkrecht stehenden Ladestock geschoben werden, die Kugel musste genau über dem Zentrum des Kreises hängen, und nun warf der feine Seidenfaden doch einen Schattenstrich, der mit dem Monde wie bei einer Uhr der Zeiger fortrückte, natürlich in ganz anderer Weise.
Und nun begann der Graf zu beobachten und zu rechnen. Wie der durch den Mond erzeugte haarfeine Fadenschatten über die Strichelchen, deren also sechshundert vorhanden waren, fortrutschte. Dabei, immer mit dem Chronometer hantierend, von fünf zu fünf Sekunden den Sekundenzeiger arretierend, und bei solcher Länge gab es doch keine großen Ungenauigkeiten. Wohl aber rückte der Mond stark vorwärts.
Axel musste immer noch staunen. Der Graf hatte ihm an Bord der Jacht noch mehrere Lektionen darüber gegeben, er glaubte es begriffen zu haben — jetzt merkte er, dass er noch gar nichts wusste.
So verging eine Viertelstunde. Dann erhob sich der Graf, der immer gekniet hatte, blickte auf den Taschenkompass, machte sechs große Schritte und noch einen kleinen dazu und blieb stehen.
»Hier ist der Punkt. Jene Berechnung gilt für einen Kreis, der mit einem Radius von zwei Ellen Durchmesser um mich beschrieben wird. Wenn jene Berechnung richtig war — meine ist es.«
Zum ersten Male während dieser Viertelstunde öffnete auch Axel seinen Mund — zuerst zu einem Fluche, anders brachte es der Depeschenreiter noch immer nicht fertig.
»Bei Gottes Tod — Graf, jetzt glaube ich wirklich, dass Sie schon vor 3000 Jahren bei den babylonischen Magiern in die Lehre gegangen sind!«
»Wegen dieser Berechnung? O, das hätte ich auch in diesem Lebenslaufe lernen können.«
»Nee, nee, Graf — wie Sie da so auf dem Bauche herumrutschten und mit der Nasenspitze zirkelten — das bringt heutzutage kein Astronom mehr fertig — das konnte sicher nur so ein echter alter Babylonier oder vielmehr Chaldäer.«
»Graben wir nach!«
»Ja, paddeln wir.«
Eine Schaufel war dazu nicht nötig. Der feine Sand flog unter ihren Händen fort.
»Jetzt habe ich das sitzende Männchen entweder beim Kopf oder sonst wo gefasst«, sagte Axel nach einer kleinen Weile, in einer erst knietiefen Grube stehend.
»Wahrhaftig?«
»Ich fühle hier etwas Steinernes.«
»Vortrefflich! So eine Zehntelsekundenbestimmung ist doch sehr problematisch.«
»Na, dann hätte ich einfach kommandiert, und das Männchen wäre irgendwo anders aus der Erde gepustet worden«, spielte Axel auf jenen Zufall an, der in den Trümmern Karthagos den Schacht bloßgelegt hatte.
Der Sand musste ringsum beseitigt werden, ehe sie nur richtig anfassen konnten, dann hoben sie mit vereinten Kräften den Stein aus der Grube heraus.
Es war, wie schon der Hellseher beschrieben hatte, eine Figur, einen Mann darstellend, auf einem massiven Stuhle sitzend, das ganze etwa einen halben Meter hoch, wegen des Sitzes von ziemlichem Umfange. Der Götze hatte die Hände auf die Knie gelegt, um den Kopf eine Art Heiligenschein, das Gesicht machte besonders wegen der abgeschlagenen Nase einen recht dummen Eindruck — sonst war nichts Bemerkenswertes daran.
»Der tyrenische Baal«, sagte der Graf.
»Der alte Baal, aha, der manchmal dem Jehova Konkurrenz machte — weiß schon. Wurde der hier auch verehrt?«
»Gerade bei den Karthagern war er ein Hauptgott.«
»Ich denke, die hatten den Moloch oder Kronos?«
»Auch den Baal oder Bel. Es wurde zwischen diesen Hauptgöttern kein Unterschied gemacht, da herrschte überhaupt eine große Unklarheit. Geradeso wie bei uns zwischen Gott dem Vater und Gott dem Heiligen Geist, obgleich wir doch nur einen einzigen Gott haben sollen.«
Hierüber hatte sich schon Axel einmal sehr kräftig ausgesprochen, damals dem Lord Walter Moore gegenüber.
»Wurden dem Baal auch blutige Opfer dargebracht?«
»Ja, besonders junge Stiere. Und die rotgekleideten Priester ritzten sich, wenn sie um den Altar tanzten oder hinkten, wie es spöttisch in der Bibel heißt — 1. Könige, 18. Kapitel, Vers 26 bis 28 — bis das Blut reichlich floss.«
»Sie kennen wohl die ganze Bibel auswendig?«
»Gewiss.«
»Da muss ich doch einmal prüfen. Einen Vers kann ich nämlich auch. Wie lautet der 7. Vers im 4. Kapitel Maleachi?«
»Sie Schelm! Dieses Kapitel hat nur sechs Verse. Doch wollen Sie mich hier weiter katechisieren?«
»Sie haben recht. Suchen wir, was der arme Kerl sonst noch vergraben hat.«
»Das dürfte schon hier befestigt sein.«
Der Graf hatte sich gebückt, um die Figur näher zu untersuchen, und dabei entdeckt, dass an dem Nacken des Götzen, der noch umgestürzt lag, mit Kupferdraht eine Metallkapsel gebunden war.
Sie enthielt nichts weiter als einen mit Bleistift in französicher Sprache geschriebenen Brief, unterzeichnet am 6. September 1748 von Dr. Bruno Schumann aus Regensburg.
Er habe im Tale der Natronseen, in alten Ruinen, die er nicht näher bezeichnete, diese Baalsfigur gefunden, könne sie jetzt nicht weitertransportieren, er vergrabe sie hier, kehre zurück. Er behalte sich sein Eigentumsrecht an der Figur vor. Sonst solle der zufällige Finder an untenstehende Adresse schreiben, eine hohe Belohnung sei ihm zugesichert.
Nichts weiter.
Also war der Unglückliche kein Engländer, sondern ein Deutscher. Aber was wussten die Araber damals von Deutschland. Hingegen war Französisch damals die Weltsprache.
»Und das Geld?«
Man brauchte nicht erst danach im Sande zu suchen. Hätte der Reisende solches verborgen, so hätte er es wohl sicher ebenfalls in diese Büchse getan. Nein, da hatte er dem Oibt wohl nur etwas weisgemacht, oder es war sonst ein Irrtum gewesen.
»Nur wegen dieses verhutzelten Kerls ist ein wahrscheinlich braver Mann Raubmördern zum Opfer gefallen!«, sagte Axel grimmig, der Steinfigur einen Fußtritt gebend.
»Die äußerst wertvolle Baalsstatue soll wenigstens seinen Erben zugehen, dafür wollen wir sorgen.«
»Und Rache an dem schuftigen Mönch und seiner Sippschaft nehmen, das wollen wir auch!«, ergänzte Axel.
»Die Rache ist des Herrn«, sagte der Graf etwas salbungsvoller als nötig war.
»Ah bah! Jawohl, dann soll sie des Herrn Axel sein.«
Wir wollen es kurz machen. Noch als sie die Steinfigur, etwa einen Zentner schwer, auf einem der Kamele festbanden, gelang es dem Grafen, seinen Begleiter von dem Vorhaben abzulenken, überhaupt noch einmal nach dem Kloster zurückzukehren.
Zuerst begann er davon, wie schwer es sein würde, den Oibt zu einem Geständnis zu bringen, und der göttlichen Strafe entginge schließlich überhaupt kein Mensch — und so weiter — bis er endlich gestand, welch heiße Sehnsucht ihn triebe, so bald wie möglich das schwarze Schiff wieder zu erreichen.
Schon hatte Axel den Anfang gehört, und er sagte nichts, als sie das Kloster links liegen ließen. und in dieser Mondscheinnacht erfuhr Axel des Grafen ganzes abenteuerliches Verhältnis mit Marietta, der Graf verschwieg ihm nichts mehr, nicht einmal das mit dem ausgewechselten Kinde.
Und der im Grunde genommen doch so biedere Depeschenreiter war ganz bestürzt über das, was er da zu hören bekam, war ganz erschüttert.
»Mag Gott Ihnen ein gnädiger Richter sein«, sagte er dazu, als sich der Osten schon wieder zuröten begann, »ich möchte nicht über Sie zu Gericht sitzen. Ja, in der Stimmung, in die Sie mich jetzt versetzt haben, überlasse auch ich lieber diese Mörder dem himmlischen Richter.«
So endete dieser Abstecher ins Innere Ägyptens. der vor allen Dingen den Zweck gehabt hatte, einen hellsehenden Derwisch zu finden, und der Graf hatte sein Ziel erreicht, er war glücklich.
Es sei nur noch erwähnt, dass sie in Alexandrien die steinerne Figur mit einem erklärenden Begleitbriefe einem Schiffe zum Transport nach Deutschland, nach Regensburg, übergaben.
Mit dem verräterischen Koptenprior sollte der Graf von Saint-Germain aber noch nicht fertig sein, er sollte den Mörder doch noch einmal zur Rechenschaft ziehen.
Furchtbar tobte der Sturm, wütete das Meer in finsterer Nacht. Dabei war es ganz gleichgültig, ob es nur eine Jacht von wenigen Tonnen oder ein mächtiges Schiff von vielen tausend war — wie ein Spielball wurde das hölzerne Werk von Menschenhand umhergeschleudert.
Hinwiederum aber war die Jacht ebenso seetüchtig wie die größte Fregatte, seetüchtiger jedenfalls als die elenden Galleonen, mit denen einst Kolumbus als erster den Atlantischen Ozean durchquerte, und Kapitän und Mannschaft waren erprobt.
Wenn sie nur gewusst hätten, wenigstens ungefähr, wo sie sich befanden.
Auf der Straße von Gibraltar waren sie noch mit dem schönsten Wetter hinausgekommen, dann hatte der Weststurm eingesetzt, das war nun schon der sechste Tag, an dem er anhielt, und in diesen sechs Tagen hatte noch keine einzige geografische Bestimmung gemacht werden können.
Himmel und Wasser, nichts weiter, die ganze Atmosphäre ein Gemisch von beiden Elementen, höchst selten in nebliger Ferne ein anderes Fahrzeug, das sich in nicht minder großer Ungewissheit befinden musste.
Also Weststurm! Und im Osten lag die Küste! Und hielt man auch noch so gegen den Sturm an, das Vermeiden eines starken Abtreibens nach Osten war unmöglich, zudem man kaum die Sturmsegel stehen lassen durfte.
In dieser sechsten Nacht nun suchte der Sturm alles bisher Dagewesene zu überbieten. Die ganze Welt schien nur noch aus Wassergischt zu bestehen, und dazu ein heulender Ton, als ob die Posaunen schon für das jüngste Gericht probiert würden.
»Mut, Mut, das ist der letzte Akt, jetzt tobt er sich aus!«, suchte Kapitän Morphin das Brüllen der Elemente mit seiner Stimme zu überbieten.
Er selbst stand am Steuerrad, festgebunden, halbnackt, die reckenhafte Greisengestalt glich einem Wikinger, und dem alten Seebären schien es das größte Vergnügen zu machen, er musste immer wieder etwas johlen.
»Dass jeder das Messer bereit hält, um sich gleich loszuschneiden, falls alles aus den Fugen geht!!«
Das klang nun wenig tröstlich, aber sie gehorchten, nahmen die Scheidemesser zur Hand. Denn an Deck befanden sich alle, unten war es ja gar nicht auszuhalten, und einer hatte den anderen festgebunden. Aber jeder stand da, wo er noch ein Segel oder einen Mast bedienen konnte.
Wieder ein heulender Posaunenton.
»Das war das letzte Signal, jetzt flaut der Sturm ab...«
Da ein furchtbarer Ruck, wie keine Woge ihn erteilen kann, ein Scharren, Bersten und Splittern...
Weiter mag man auf solch eine Katastrophe nicht vorbereiten.
Wir bleiben bei Axel. Er war am vordersten Mast angebunden, hatte statt der Kappaxt, mit der jeder Mann bewaffnet war, seinen treuen Hirschfänger in der Hand, der ihm bei dem etwa nötigen Kappen eines gestürzten Mastes wohl nicht minder gute Dienste geleistet hätte als eine schwere Axt.
Da das Rucken, Bersten und Splittern. Zu sehen, was passierte, war absolut nichts, wohl aber recht deutlich zu fühlen — nämlich dass er plötzlich keine Planken mehr unter den Füßen hatte. Und da wusste Axel genug.
Die anderen mussten, wenn sie überhaupt noch Zeit dazu hatten, ihre Messer aus der Tasche ziehen oder doch aufklappen, wenn sie das nicht schon früher besorgt hatten, Axel säbelte gleich mit seinem Hirschfänger los, um sich frei von den Stricken zu machen.
Dann schwabbelte er im Atlantischen Ozean herum.
»Adjüs nun, Pferdeschwanz und Fürstenthron, der Graf hatte mir falsch prophezeit...«
Es war sein letzter Gedanke. Ein Schlag vor den Kopf, und vorbei war es.
Mit dem Menschen vorbei ist es aber schon, wenn er in das Reich jenes Unbewusstseins sinkt, das der Tod als Tribut täglich von uns fordert. Wie mag Adam erstaunt gewesen sein, als er nach dem ersten Schlafe wieder erwachte! Einmal tot gewesen — wenn er etwas vom Tode gewusst hätte — — und wenn er überhaupt gelebt hätte.
Auch unser Axel erwachte noch einmal auf dieser Erde, und zwar auf fester, sogar im Bett eines Gasthauses in der französischen Schweiz, der Wirt rüttelte ihn.
»Was willst du, Gasthaufen verdammter? Herrgott, muss ich gestern Abend besoffen gewesen sein, was brummt mein Schädel!«
»Axel, Axel, kommen Sie zu sich! Haben Sie den fürchterlichen Schlag überstanden?«
Da riss der Träumer weit die Augen aus, starrte in des Grafen Gesicht, starrte wieder um sich... da freilich merkte er, dass er in keinem Wirtsbett der französischen Schweiz lag, sondern auf einem flachen Strande, dort hinten standen Kokospalmen, sich leise im sonnigen Winde wiegend, weiter dahinter ein ganzer Urwald, und vor ihm brandete zwischen schwarzen Klippen furchtbar das Meer.
»Haben Sie etwas gebrochen?«
Axel sprang auf und dehnte die Glieder.
»Nein. Sie? Aber, Herrgott, mein Kopf!«
Er tastete an seiner Stirn, staunte.
»Ja, wer hat mir denn da den Pfannkuchen an den Schädel geklebt?!«
Es war eine mörderische Brausche, die er auf der Stirn hatte.
Aber jetzt sah er nun die beiden halbnackten Männer, der eine weiß, der andere schwarz, die dort unten am Strande dem wütenden Meere etwas abzuringen schienen.
»Morphium und Sam. Und die anderen?«
»Weg!«
Axel senkte das Haupt — und hob es wieder. Nur drei Sekunden hatte die Andacht gedauert.
»Amen. Was wissen Sie?«
Der Graf berichtete, was er konnte.
Wasser und Gischt, in der er umhergeschleudert wurde. Einmal fühlte er Boden unter seinen Füßen. verlor ihn aber gleich wieder. Dann fand er festen Halt. Eine Böschung, die er schnell erklomm, um sich aus dem Bereich der nachrollenden Wogen zu bringen.
»Es mag gegen vier Uhr gewesen sein, als unser Schiff barst, und ich schätzte die Zeit auf zwei Stunden, bis es Tag wurde. So freundlich wie jetzt. Der Sturm hatte sich wie mit einem Ruck gelegt. Wahrscheinlich ein heftiger Gegenwind. Dort drüben lag Sam, zuerst bewusstlos, Kapitän Morphin klemmte zwischen zwei Klippen, immer noch dem Ertrinken ausgesetzt. Ich habe ihn unter unsäglichen Schwierigkeiten befreit.«
»Alles heil?«
»Sam hat am linken Schenkel einen tüchtigen Fleischriss, der Kapitän einige kleine Quetschungen davongetragen. Nichts von Bedeutung. Sie hielt ich erst für tot, Ihren Kopf für geborsten.«
»Scheint noch zu halten. Grimmige Kopfschmerzen, weiter nichts. Wie lange liege ich schon?«
»Unterdessen mag wieder eine Stunde vergangen sein.«
»Und die anderen?«
»Keine Spur von ihnen zu entdecken.«
»Was machen die dort unten?«
»Suchen Kisten und Fässer zu retten. Scheint aber nichts vorhanden zu sein. Zwischen den Klippen ist alles zerschmettert.«
»Wie sind wir über diese furchtbaren Klippen gekommen?«
»Drüber weggetragen worden. Wie das? Fragen Sie, wohin die Wolke geht.«
»Wo sind wir?«
»Keine Ahnung.«
»Haben Sie noch keine Bestimmung gemacht?«
»Spotten Sie nicht.«
»Spotten? Mir ist gar nicht so spöttisch zumute.«
»Wir haben keinen Sextanten, und wenn ich eine geografische Ortsbestimmung auch ohne Instrument machen kann, so brauche ich doch ganz andere Vorbereitungen dazu. So einfach ist das denn doch nicht. Vorläufig habe ich mich immer mit Ihnen beschäftigt.«
»Aber doch an der Westküste Afrikas.«
»Oder auf einer Insel. Und auf welchem Breitengrade? Keine Ahnung.«
»Was glänzt da so in den Händen Sams?«
»Ihr Hirschfänger.«
»Ah, hatte ich den noch bei mir?!«
»Sie hatten den Griff fest umklammert, es fiel schwer, ihre Finger zu lösen.«
»Das freut mich, dass ich kein solcher Liedrian gewesen bin. Was macht der Schwarze mit meinem Hirschfänger?«
»Falls es einen Strick zu zerschneiden gibt. Und es war ein Glück, dass Sie ihre Waffe nicht fahren ließen. Es ist die einzige Waffe.«
»Haben die denn nicht einmal ein Messer?«
»Gar nichts. Ihre Messer hielten sie ja bereit, um sich abzuschneiden. Mir ging es nicht anders. Ein Feuerzeug hatte ich bei mir, das ist alles. Dort liegt der Zunder zum Trocknen.«
»Sind Sie schon dort oben in dem Wald gewesen?«
»Noch nicht.«
Die beiden anderen kamen herauf. Sie befanden sich in der Stimmung von Schiffbrüchigen, da wird kein guter Morgen gewünscht.
»Da ist nichts zu wollen. Selbst ein eisenbeschlagenes Wasserfass ist kurz und klein geschlagen.«
»Dann untersuchen wir den Wald, alle zusammen«, sagte der Graf. »Zuerst müssen wir Wasser finden, an dem kann es bei solch einem Walde ja nicht fehlen, wenn auch hier keine Quelle abfließt.
»Und auch an Wild nicht«, ergänzte Axel. »Zuerst machen wir uns Bogen und Pfeile.«
Sie sollten nicht weit kommen.
»Da steht ein Neger!«
»Dort noch einer.«
Es waren noch viel mehr, die sich teils vor den Feinden zu verbergen suchten, teils sich offen zeigten, große, starke, tiefschwarze Neger, Bogen, Lanzen und Keulen in den Händen.
Sie hielten sich am Waldrand, von dem die Schiffbrüchigen noch etwa hundert Meter entfernt waren.
»Sie treten gleich als Feinde auf. Da, der schüttelt schon einladend seine Keule. Wissen Sie, Graf, was für Neger das sind, um daraus vielleicht einen Schluss auf das Land zu ziehen?«
»Nein, keine Ahnung. Die Tätowierung, wenn sie überhaupt eine haben, kann ich noch nicht erkennen, und diese buschige Haartracht ist mir überhaupt ganz fremd.«
»Oder du, Sam?«
Nein, Sam war nur seiner schwarzen Haut nach noch ein Neger.
»Da, der leckt schon die Lippen«, sagte er nur, »der schon die Finger — das sind Menschfresser.«
»Wenn die mich fressen, möchte ich wenigstens selber ein gutes Stück von mir haben«, meinte Morphium, »ich habe einen mörderischen Hunger, und nicht einmal Muscheln gibt es an diesem verwilderten Strande.«
»Da, jetzt bringen sie schon Pfeile auf die Bogen!«
»Verdammt, das sind ja nette Aussichten«, knurrte Axel. »Ehe ich mich aber hier abschießen lasse, gehe ich mit Hurra zum Sturm über.«
»Halt«, warnte der Graf, »lassen Sie Ihre Waffe nicht sehen! Bleibt stehen, ich werde parlamentieren.«
Und schon schritt er vor.
»Sie werden einfach niedergeschossen!«
»Nein, jeder Feind lässt zuerst mit sich parlamentieren.«
Die Neger schrien, schwangen wieder Keulen und Lanzen. Doch ein Pfeil kam noch nicht geflogen. Der Graf machte auch nur wenig Schritte, dann blieb er wieder stehen. Er wollte nur zeigen, dass er derjenige sei, der hier zu sprechen habe.
»Spricht jemand Portugiesisch? Spanisch? Französisch? Englisch?«, rief er, immer in der betreffenden Sprache.
Die ganze Westküste Afrikas mit allen Inseln befand sich damals, wie ja zum Teil heute noch, in portugiesischen und spanischen Händen, wenigstens dem Namen nach.
»Wer seid ihr?«, erklang es da mit gurgelnder Stimme in gebrochenem Spanisch zurück.
Also konnte man sich wenigstens mit einem unterhalten. Auch Axel verstand Spanisch, desgleichen der Kapitän und Sam, ein Matrose, denn Spanisch war damals die internationale Seesprache wie heute Englisch.
»Ich bin ein Zauberer, der an dieser Küste Schiffbruch erlitten hat.«
Hallo! Axel glaubte doch im ersten Augenblick, nicht richtig gehört zu haben, und nicht anders mochte es den beiden anderen ergehen.
Aber hatte der Graf nicht gleich den richtigen Weg gewählt, wahrscheinlich den einzigen, der sie vor dem sicheren Tode bewahrte?
Es gibt kein wildes Volk — was hierbei unter ›wild‹ zu verstehen ist, weiß jeder — das nicht seine Zauberer hat, Priester, die mit irgendeiner Gottheit verkehren und daher mehr können als die anderen Menschen. Auch die nordamerikanischen Indianer, die doch auf einer ziemlich hohen Stufe stehen, nur dass sie sich der Zivilisation nicht fügen wollen, haben ihre Medizinmänner, jedes afrikanische Dorf seinen Zauberer.
Ist es nicht äußerst schlau, wenn sich ein Fremder, der mit solchen Wilden in unliebsame Berührung kommt, gleich für einen Zauberer ausgibt?
Ja, es liegt so nahe, aber eben gleich darauf kommen!
Und dann muss man natürlich beweisen können, dass man auch wirklich ein Zauberer ist.
Nun, das würde dieser Graf schon können. Das Überraschendste für seine Gefährten war im Augenblick nur, wie er sich sofort für einen Zauberer ausgab, ohne ihnen davon zuvor ein Wort gesagt zu haben. Das war so aus dem Stegreif, so ohne jede Vorbereitung gekommen.
Drüben ein Durcheinander von Stimmen unter lebhaften Gestikulationen, der Spanisch Sprechende musste seinen Genossen doch erst verdolmetschen, was er zu hören bekommen hatte.
Unterdessen hatte der Graf wieder einige Schritte vorwärts gemacht, blieb aber sofort stehen, als er angeredet wurde.
»Ein Zauberer willst du sein?«
»Ein großer, großer Zauberer«, nahm der Graf, der die Neger wohl wirklich schon kannte, den Mund gleich recht voll.
»Du lügst!«, musste er sich dafür zunächst den Vorwurf gefallen lassen. »Iklandoba hat dein Schiff scheitern lassen. damit wir dich und deine Begleiter aufessen können.«
Also richtig Menschenfresser! Wo aber waren diese damals an der Westküste Afrikas nicht zu finden! Und heute mag es nicht viel anders sein, nur dass die Eingeborenen in ihren Gelüsten oder religiösen Anschauungen vorsichtiger geworden sind.
»Nein, sondern Iklandoba hat mich hierher geführt, damit ich euch helfen soll.«
»Du kennst Iklandoba?«
»Seit drei Tagen ist er mir jede Nacht im Traume erschienen.«
»Wie hat er ausgesehen?«
»Mit den Füßen stand er auf der Erde, und mit dem Kopfe ragte er bis in den Himmel...«
»Was hatte er für einen Kopf?«
»Es war der ungeheure Kopf eines Fisches...«
»Siehst du, dass du lügst! Iklandoba ist ein Büffel!«
»Ganz richtig, alsbald verwandelte sich der Fischkopf in den eines Büffels, dabei aber blieb es nicht, es wurde ein Löwenkopf daraus, ein Elefantenkopf und noch viele andere Köpfe. In einem Augenblick sah ich alle, alle Tiere, und dennoch war es immer Iklandoba selbst. Er wollte mir damit kundtun, dass es falsch ist, wenn er nur als Büffel angebetet wird. Iklandoba ist das ganze Tierreich, so will er verehrt werden. So verwandelten sich auch alle seine anderen Gliedmaßen beständig, immer waren es Tiere, und als Nabel hatte er eine große Schlange.«
Drüben wieder eine große Bewegung.
Von den Schiffbrüchigen begriff nur Axel gleich, wie der Graf vorging.
»Donnerwetter, Donnerwetter!«, flüsterte er. »Graf, Sie müssen schwarzer Diplomat werden, oder noch besser alle vereinigten Negerreiche unter Ihr Zepter bringen, Sie haben das Zeug dazu!«
Jetzt kam auch der schwarze Sprecher etwas mehr aus dem Walde hervor, der Graf nachte ebenfalls wieder einige Schritte vorwärts, seine Begleiter folgten ihm.
»Was hat Iklandoba zu dir gesagt?«, wurde weiter examiniert.
»Geh hin, du weißer großer Zauberer, sagte er jede Nacht, zu meinen schwarzen Kindern, die ich am allermeisten liebe, und hilf ihnen, was ich dir noch befehlen werde.«
»Wo hat er das dir gesagt?«
»In meiner Heimat.«
»Wo ist die?«
»Wo die Sonne untergeht.«
»In Spaniola?«
»Noch viel, viel weiter dahinter.«
»Du bist kein Spaniola?«
»Nein.«
»Das ist gut, denn alle Spaniola sind große Lügner.«
»Also ich bin kein Lügner, sondern spreche die Wahrheit«, machte der Graf einen kühnen Schluss, aber einem Negergehirn ganz entsprechend.
»Und was hast du da getan, als Iklandoba das zu dir gesagt hatte?«
»Da habe ich sofort ein Schiff gekauft und bin nach Afrika gefahren.«
»Und da hat Iklandoba dein Schiff hier scheitern lassen?«, erklang es mit berechtigtem Zweifel zurück.
»Ja, weil ich ungehorsam gewesen bin.«
»Wie ungehorsam? Ich denke, du hast gleich gehorcht.«
»Ja, aber ich hatte dabei meinen eigenen Nutzen im Auge. Als mir Iklandoba erschien, konnte ich selbst niemals sprechen, brachte kein Wort heraus. Und Iklandoba nannte mir nicht euren Namen. Ich sollte nur so segeln wie er mich führen würde. Im Traume zeigte er mir auch euer Land, und das gefiel mir wenig. Ich bin schon früher einmal in Afrika gewesen, und ich kenne ein Land, noch weit von hier nach Mittag gelegen, wo es Gold und Silber und Elfenbein im Überfluss gibt. Dorthin wollte ich. Ich redete mir ein, dorthin schicke mich Iklandoba. Dreimal noch erschien er mir im Traume und sagte mir, dass ich hier landen sollte. Ich aber war trotzig und wollte nicht. Es waren bei mir noch fünf andere Männer, und die waren es besonders, welche mir rieten, nicht hier zu landen, sondern dorthin zu gehen, wo es viel Gold und Elfenbein gibt. Da hat Iklandoba heute Nacht mein Schiff scheitern lassen, er hat mich also gezwungen, hier zu landen, und die, welche mir falsch rieten, hat er dabei ertrinken lassen. Man muss eben dem großen Iklandoba gehorchen, ob man will oder nicht.«
Für das Negergehirn hatte diese Erklärung vollständig genügt.
Zunächst rief der Sprecher, sicher ein Häuptling, zurück in den Wald, verdolmetschte seinen Leuten das Gehörte.
»Du lügst!«, wurde dann trotz alledem immer wieder behauptet.
Wer selbst viel lügt, hält auch jeden anderen immer für einen Lügner.
»Ich lüge nicht.«
»Du musst beweisen, dass du ein großer Zauberer bist.«
»Ich werde es beweisen.«
»Kannst du Regen machen?«
»Ich kann es.«
»Jetzt nicht, es hat genug geregnet.«
»So verlange etwas anderes von mir.«
»Kannst du Krankheiten heilen?«
»Alle.«
»Kannst du auch dicke Beine wegnehmen?«
»Das ist mir ein leichtes.«
»Kannst du böse Geister austreiben?«
»Nichts leichter als das.«
»Du lügst.«
»Ich werde es dir beweisen.«
»Wenn du wirklich ein so großer Zauberer bist, dann mache ulambambombumbamba...«
Das Wort war noch viel länger. Ja, und nun sollte der Graf wissen, was das zu bedeuten hatte! Aber er ließ sich nicht beirren.
»Ich werde dir dann noch etwas ganz anderes vormachen.«
»Nein, jetzt sofort.«
»Gut, jetzt sofort. Ich werde das machen, was mir Iklandoba befohlen hat, um zu beweisen, dass er mich wirklich als Zauberer zu euch geschickt hat.«
»Ulambambombumbamba...«
»Ich verstehe noch nicht eure Sprache, die muss ich erst lernen.«
Ein Glück war es, dass diese Neger von ihren Zauberern nicht allzu viel verlangten. Sie müssen nur ein bisschen mehr können als ihre schwarzen Brüder, irgendeinen Hokuspokus, das genügt schon. Sonst ist man wegen der geforderten Kenntnisse, die zum Zauberer befähigen, sehr bescheiden, von einer Allwissenheit ist gar keine Rede.
»Wie sollst du uns beweisen, dass du wirklich ein Ukangara bist?«
Ukangara — das war also ein Zauberer. Doch viel schließen konnte man daraus nicht, was für ein Land das war. An der ganzen Westküste heißt der Zauberer oder Priester Ukangara.
Unterdessen war der Graf, immer gefolgt von seinen Begleitern, ganz nach und nach bis auf etwa 40 Meter an den Sprecher herangekommen. Der schien die Verkürzung der Entfernung gar nicht bemerkt zu haben. Auch so ein Trick des Grafen.
»Nimm deine Lanze und zeichne neben dir in den Boden einen kleinen Kreis.«
»Wozu?«
»Tu es. Oder fürchtest du dich?«
»Die Talalas fürchten sich vor nichts«, war die stolze Antwort.
Talalas? Ein ganz unbekannter Name.
»So tu es.«
Der Häuptling senkte seine Lanze und beschrieb mit der Spitze neben sich im Boden einen kleinen Kreis. Dass dort Sandboden war, konnte der Graf schon erkennen.
»Jetzt hebe ich hier einen Stein auf.«
Es war ein faustgroßer Stein, den der Graf aufgehoben hatte.
»Was soll der Stein?«
»Siehst du, dass es ein Stein ist?«
»Ich sehe es.«
»Nun pass auf...«
Der Graf schleuderte den Stein hoch in die Luft — und wie konnte er werfen!
Der doch ansehnliche Stein war kaum noch zu sehen, als er aus der Höhe wieder herabsauste, und erschrocken sprang der Häuptling davon, denn es sah nicht anders aus, als ob er von dem Stein getroffen werden würde.
»Alle Wetter!«, staunte auch Axel. »Graf, wo haben Sie denn das gelernt?«
Denn des Depeschenreiters scharfe Augen hatten schon erkannt, dass der Stein vom Himmel herab direkt in den vom Häuptling gezeichneten Kreis gefallen war. Der Sand hatte ihn am Weiterspringen gehindert.
Weit war der Häuptling nicht gekommen, er kehrte zurück, betrachtete mit ehrfürchtigem Staunen den Stein, schrie in den Wald hinein, jetzt kamen aus diesem noch andere Neger, bezeugten dem Zaubersteine ihre Ehrfurcht.
Denn dass jemand aus solcher Entfernung so geschickt werfen, dazu noch in solch großen. Bogen ein Ziel treffen könne, das konnten sie nicht glauben, das war für sie Zauberei, und so ganz unrecht hatten sie darin auch nicht.
Nun wolle sich der geneigte Leser erinnern, wie der Graf damals gestaunt hatte, als ihm der kleine Joseph das Kunststück mit dem zu einem Bumerang zusammengefalteten Stück Papier vorgemacht hatte. Er musste sich wohl in solchen Sachen unterdessen geübt haben.
»Haben Sie dieses Werfen durch Übung gelernt?«, fragte Axel nachmals.
»Nein, ich kann es nicht, verstanden?!«, wandte sich der Graf mit hochgezogenen Brauen an seine Begleiter, und diese hatten nun allerdings sofort begriffen, wo hinaus er wollte.
Unterdessen hatte der Graf die Entfernung wiederum bedeutend verkürzt, die beiden Parteien befanden sich noch kaum 20 Meter auseinander, die anderen Neger blieben jetzt auch bei ihrem Häuptling, immer mehr kamen hinzu. Die Unterhaltung war schon eine ganz vertrauliche geworden.
»Mach das noch einmal«, sagte der Häuptling.
»Das kann ich nicht.«
»Weshalb nicht?«
»Ich kann gar nicht so geschickt einen Stein werfen. Oder glaubst du überhaupt, dass das ein Mensch kann? Iklandoba sagte mir im Traume, ich sollte einen Stein nehmen und ihn zum Himmel schleudern, er würde ihn genau dorthin fallen lassen, wo du mit deiner Lanze einen kleinen Kreis in den Sand zeichnest. Dadurch sollte ich mich dir als einen von ihm geschickten Zauberer zu erkennen geben.«
Diese Worte fanden allgemeine Anerkennung, das sah man diesen wilden, kriegerischen Gestalten gleich an, als ihnen der Sinn verdolmetscht worden war.
»Hat er dir auch gesagt, dass ich der Häuptling Mgwambo bin?«
»Gewiss hat er mir das gesagt — der Häuptling der Talalas. Zu dem sollte ich gehen.«
»Habt ihr Waffen bei euch?«, wurde jetzt das Thema geändert.
»Nein.«
»Der Mann dort hatte vorhin ein langes Messer in der Hand.«
»Das ist mein Zaubermesser, mit dem ich böse Geister austreibe. Nur dieses Messer hat mir Iklandoba gelassen, weil ich ihn durch meinen Ungehorsam erzürnt hatte.«
»Ja, ich weiß. So komm mit in unser Dorf.«
Jetzt war das Zusammentreffen erfolgt. Im Nu waren die vier von den wilden Kriegergestalten umringt.
Noch einmal kam es Axel voll und ganz zum Bewusstsein, in welch furchtbarer Gefahr sie sich befanden — welche Gefahr sie aber auch hinter sich hatten.
Sie hatten sich auf einem ebenen Terrain befunden, welches absolut keine Deckung bot, und da der Wald sich keine hundert Meter vom Strande entfernt befand, hätten die Neger, deren Bogen ganz gewaltig waren, sie einfach mit ihren Pfeilen durchbohrt, auch ein flaches Hinlegen hätte da nicht viel genützt. Man hätte aus ihnen Stachelschweine gemacht. Und wie lange hätten sie denn das aushalten sollen! Sie hatten ja auch kein Wasser, und es war erst früher Morgen, und schon begann die Tropensonne fürchterlich zu brennen. Noch vor dem Abend wären sie verschmachtet gewesen.
Diese erste Gefahr hatte der Graf durch seine diplomatische Geschicklichkeit beseitigt. Nun allerdings hatte er sie erst recht direkt in die Höhle oder sogar in den Rachen des Löwen hineingeführt. Sie waren umringt, die Neger brauchten nur mit ihren Keulen zuzuschlagen, da wäre Axel mit seinem Hirschfänger gar nicht mehr groß zum Gegenangriff gekommen.
Aber der Graf hatte sich nicht geirrt. Dieses Umringen war kein feindliches. Die Neger hielten sich vor ihnen in respektvoller Entfernung, überhaupt die feindlichen Mienen fehlten.
Und der Graf war auch noch gar nicht fertig mit seiner Vorstellung.
»Noch ein anderes Zeichen soll ich dir geben, dass ich wirklich ein Ukangara der Weißen bin und von Iklandoba zu euch geschickt werde, um euch zu helfen.«
»Was für ein Zeichen?«
»Etwas, was kein Mensch kann. Nur durch Iklandobas Hilfe kann er es. Gib mir einen Stein oder irgendeinen kleinen Gegenstand von deinem Schmuck.«
Der Häuptling trug um den Hals eine Kette von Raubtierzähnen, Münzen und Spielereien, meist aus Messing oder Silber — Gold schien zu fehlen.
»Solch einen Zahn? Er gehörte einem Panther, den ich selbst getötet habe.«
»Wie du willst.«
Der Häuptling riss den Eckzahn einfach ab, wobei sich zeigte, dass daran noch eine kleine Silbermünze hing. Die Fassung war eine ziemlich kunstvolle.
»Soll ich das Silber abmachen?«
»Nein, es ist gerade recht so. Das ist ein Geldstück, nicht wahr?«
»Geld — ja, ich weiß.«
»Wirst du diesen Zahn und das Silberstück wiedererkennen?«
»Wiedererkennen?«, wiederholte der Neger verständnislos.
Der Graf hielt sich mit keiner Erklärung weiter auf, dieses schwarze Publikum brauchte nicht so behandelt, nicht so ›poussiert‹ zu werden wie ein weißes in einem Zaubertheater. Er streckte seine rechte Hand aus, streifte aber doch dabei den Ärmel weit in einer Weise zurück, als habe er sich schon auf Jahrmärkten produziert.
»Lege es in meine Hand.«
Der Häuptling tat es, der Graf schloss die Finger darüber, die Hand und jetzt die Faust sonst unbeweglich lassend.
»Ich habe den Schmuck doch jetzt in meiner Hand.«
»Ja.«
»Weißt du das ganz bestimmt?«
»Usungu, willst du mich verspotten?«, erklang es etwas drohend.
»Ich sage dir aber: Der Schmuck ist nicht mehr in meiner Hand!«
»Du lügst«, war die stereotype Antwort.
»Iklandoba hat den Schmuck aus meiner Hand verschwinden lassen.«
»Du lügst wie ein Spanier.«
Der Graf öffnete die weit ausgestreckte Hand — der Schmuck war daraus verschwunden.
Das genügte hier schon vollkommen. Die umstehenden Schwarzen waren einfach entsetzt. Es brauchte ihnen dazu gar nichts weiter gesagt zu werden.
»Wah! Wo ist der Zahn mit dem Silber hin?!«
»Iklandoba hat ihn unsichtbar gemacht und ihn in die Lüfte genommen. Dort oben am Himmel hängt er, seht ihr?«
Die rechte Hand immer ausgestreckt lassend, deutete der Graf mit der linken Hand seitlich in die Höhe, alle blickten nach der bezeichneten Richtung.
»Da kommt er wieder vom Himmel heruntergeflogen, direkt in meine Hand — seht ihr? — da da da da.... da ist er.«
Etwas Glitzerndes war herabgesaust gekommen, man hatte es verfolgen können, und mit ziemlicher Wucht fiel es in des Grafen rechte Hand, die er bewegungslos gehalten hatte, der Zahn mit der Silbermünze.
Axel hatte den Grafen scharf beobachtet. Es war vergebens gewesen. Keine Ahnung, wie er dieses Taschenspielerkunststückchen ausgeführt haben könnte. Keine Bewegung, auch nicht der linken Hand, wie er den Schmuck in die Höhe geschleudert habe.
»Ist es der Schmuck von deiner Halskette?«
Der Graf brauchte nichts weiter zu sagen. Kapitän Morphin und Sam machten vor Staunen die Mäuler auf, sagten etwas davon, dass dies Zauberei sei, was für einen Eindruck musste dies denn erst auf diese Kinder der Natur machen!
»Ja, du bist der größte Ukangara aller Msungus, und Iklandoba hat dich geschickt, um den Talalas zu helfen.«
So sprach der Häuptling, und ehe es sich die vier versahen, saß jeder von ihnen auf den Schultern von zwei Negern, so wurden sie durch den Urwald getragen, und die anderen Krieger tanzten in grotesken Sprüngen vor ihnen her, bis sie das nahe Hüttendorf erreichten, wo sie, wenn sie Appetit gehabt hätten, an dem Festschmaus hätten teilnehmen können, der aus drei Kriegern eines feindlichen Stammes bestand, die kürzlich während eines Jagdausfluges gefangen und erst etwas gemästet worden waren.

Zu retten waren sie nicht mehr, denn sie wurden bereits über Feuer am Spieße gedreht. Aber jedenfalls war es besser, andere steckten an den Spießen, als sie selbst, was ohne des Grafen Zauberdiplomatie ihr unvermeidliches Schicksal gewesen wäre.
Wir geben den Inhalt der nächsten fünf Tage nur in Kürze wieder. Das erste war, dass sich die Schiffbrüchigen zu orientieren suchten, wo sie sich eigentlich befanden. Das war außerordentlich schwer. Die Neger konnten ihnen weiter nichts mitteilen, als dass dies eine große Insel sei, die sie ebenso wie sich selbst Talala nannten, dass auf ihr noch zwei andere Negerstämme hausten, die der Insel wieder ihren eigenen Namen gaben, und dass in der Nachbarschaft, besonders nach Süden und Westen, noch andere Inseln lagen, aber so weit entfernt, dass ihre Küsten nur bei ganz klarer Luft zu erblicken waren.
Diese Neger wussten gar nichts von Afrika. Und doch, gehört hatten sie diesen Namen schon. Denn ab und zu, freilich höchst selten, manchmal jahrelang nicht, kam ein Schiff hierher, meist um Trinkwasser einzunehmen, wobei dann mit den Eingeborenen ein kleiner Tauschhandel getrieben wurde.
Viel war ihnen nicht abzuhandeln, Mais und Hirse zogen sie auf primitivste Weise nur für den notwendigsten Bedarf, etwas frisches Fleisch, das sich geschlachtet ja kaum einen Tag hielt, einer der gezähmten Büffel wurde lebendig mitgenommen, ein paar Dutzend Hühner, Felle und dergleichen Jagderzeugnisse, dafür erhielten die Eingeborenen Tabak und billigen Tand, eiserne Pfeilspitzen und Messer. Das Gewehr kannten sie, fürchteten sich gar nicht besonders davor, wie sie wenigstens versicherten, wollten aber nichts damit zu tun haben. Ihre Bogen und Pfeile und sonstigen Waffen waren ihnen lieber.
Vor etwa sechs Jahren war von solch einen Schiffe einmal ein strafwürdiger Matrose desertiert, hatte sich bei Abfahrt seines Schiffes im Walde versteckt. Der spanische Matrose entging nur dadurch dem Schicksal, aufgefressen zu werden, dass er eine Mundharmonika bei sich gehabt hatte. So war er Hofmusikant geworden. Nach einem Jahre war er am Fieber gestorben.
Der Häuptling, hier dieser schon, war unter seinen Stammesgenossen eine Art von Sprachenforscher, hatte eben ein gewisses Sprachentalent, hatte von diesem Matrosen ziemlich gut Spanisch gelernt. Bei dem Besuch der nächsten Schiffe konnte er seine Kenntnisse verwerten, einige spanische und portugiesische Brocken kannten sie alle.
So hatten sie auch gehört, dass die Usungus, wie alle die weißen Fremden hießen, in ihrer Sprache dieses Land Afrika nannten. Aber, dachten sie, damit meinten sie nur alle diese Inseln. Von einem afrikanischen Festlande wussten sie gar nichts. Wie sollte man denn das überhaupt solchen Inselbewohnern definieren?
Gleich am ersten Tage ging der Graf daran, eine geografische Ortsbestimmung zu machen, ohne Sextanten, ohne Uhr.
Wir wollen nicht schildern, wie er das machte, wie es gemacht wird. Äußerst umständlich, äußerst zeitraubend. Zuerst musste er sich, auch wieder durch Berechnung des fortschreitenden Sonnenschattens, ein möglichst genaues Millimetermaß anfertigen.
Als die Sonne sank, hatte er das Resultat gefunden.
»11 Grad nördliche Breite, 2 Längengrade östlich von Paris.«
»Und wissen Sie dann, was für eine Insel das sein könnte?«
»Kennen Sie die Gruppe der Bissagosinseln?«
»Nein. Noch nie etwas davon gehört.«
»Im Jahre 1724 von dem Portugiesen Halyas entdeckt.«
»Mir ganz unbekannt.«
»Ja, dann kann ich Ihnen schwer etwas darüber sagen. Es ist eine ganze Masse Inseln — wie viele, das weiß man noch nicht. Unter Heinrich dem Seefahrer haben wir sie nur in weiter Ferne gesehen, konnten uns mit ihrer Untersuchung wegen stürmischen Wetters nicht aufhalten. Die Portugiesen, die sie für sich in Anspruch nehmen, kennen selbst jetzt nur sieben von ihnen, denen sie Namen gegeben haben: Bissago, die größte Insel, Bulama, Cazegut, Gamona. Galinhas, so genannt wegen der dort vorkommenden zahllosen Hühner, Kanyabae und Orango.«
Axel musste wieder einmal höchlichst die geografischen Kenntnisse dieses Mannes bewundern.
Damals gab es noch kein Konversationslexikon, keine Enzyklopädie. Der erste Versuch dieser Art, alles Wissenswerte in einem Buche zu vereinen, wurde von dem Geistesheroen seiner Zeit, von dem Engländer Baco von Verulam, gemacht, dessen ›Organon scientiarum‹ im Jahre 1620 zu London erschien. Alles andere, was in den nächsten 150 Jahren in dieser Beziehung erschaffen wurde, war nur missglückte Nachahmung. Bis eine französische Gesellschaft von Gelehrten, die noch heute gleich die der Enzyklopädisten heißt, den Grund zu unserem heutigen Konversationslexikon legte, in den Jahren 1750 bis 1770. Wir Deutschen sind, wie gewöhnlich, damit hinterhergehinkt gekommen, haben dann aber auch, wie gewöhnlich, an Gründlichkeit alles übertroffen.
Der Graf von Saint-Germain wäre vielleicht der Mann gewesen, solch eine Enzyklopädie ganz allein zu schreiben.
»Wie weit befinden wir uns von der Küste Afrikas entfernt?«
»Zehn bis zwanzig geografische Meilen.«
»Und was für eine Küste ist das, Sie Allwissender?«
»Die Küste von Senegambien, und zwar befinden wir uns eben jener Gegend gegenüber, wo damals das schwarze Schiff gelegen hat. O, wenn ich allwissend wäre!«
Als der Graf dann auf ein großes Stück Leder diese Gegend Afrikas zeichnete, so weit ihre Grenzen damals bekannt waren, glaubte Axel doch fast wieder, dieser Mann müsse allwissend sein, besonders später kam er fast zu dieser Ansicht, als er die mitgenommene Zeichnung mit einer im Druck erschienenen Landkarte verglich. Es stimmte alles, so weit es nur für einen Menschen möglich war. Mit natürlichen Kenntnissen ließ sich das gar nicht erklären, Axel meinte noch oftmals, dass dieser Mann auch im wachen Zustande somnambule Fähigkeiten haben müsse. Denn es war nicht anders, als habe er solch eine Karte im Geiste gesehen und sie nur abgezeichnet.
»Dies waren erst die ganzen Grade. Zur Bestimmung der Minuten und gar der Sekunden muss ich nun freilich andere Vorrichtungen treffen und Berechnungen anstellen.«
Und es war gut, dass sich der Graf auf diese Weise zu beschäftigen wusste, wobei ihm seine Gefährten helfen mussten.
Denn eigentlich verlangten die Neger von dem Zauberer doch anderes, als dass er die geografische Ortslage ihrer Insel berechnete.
Auf dieser war, wie in so vielen Gegenden Afrikas, die Elephantiasis zu Hause, eine Art von Wassersucht, die sich besonders auf die Beine erstreckt, diese unförmig anschwellen lässt. Auch sonst war es ein ungesundes Land, das Sumpffieber dezimierte manchmal die Bevölkerung.
Da sollte nun natürlich der Zauberer helfen. Wozu hatte ihn denn sonst Iklandoba geschickt? Aber der größte Zauberer aller Blassgesichter gestand einmal ganz offen, wenigstens seinen weißen Gefährten, dass er dieser Elephantiasis gegenüber ohnmächtig sei. Einmal Wasser abzapfen, ja, das konnte er wohl — aber das verstanden auch diese Neger.
»Gegen die Malaria weiß ich wohl ein sicheres Mittel, aber das ist hier nicht zu haben.«
»Eine Pflanze?«
»Nein, eine anorganische Medizin. Die Substanzen sind hier nicht zu haben, ich brauche gar nicht erst danach zu suchen. Es ist... überhaupt etwas Besonderes dabei.«
Weiter wollte sich der Graf hierüber nicht äußern, wie er überhaupt auch Axel gegenüber noch mancherlei Geheimnisse bewahrte, manchmal nicht mit der Sprache heraus wollte. Dass er zum Beispiel seinen Hunger und Durst mit Arsenik bekämpfte, neutralisierte, das sollte Axel erst viel später einmal durch Zufall erfahren. Es ist eben nicht schön, sich als Arsenikesser zu legitimieren, es erinnert schon etwas an Morphiumsucht.
Kurz, mit dem Heilen von Krankheiten konnte der Graf nicht als Hexenmeister auftreten. Zunächst aber warteten die Neger auch geduldig, sie beobachteten mit geheimer Scheu, was für seltsame Manipulationen der Ukangara da mit seinen Gefährten trieb, wie er durch ein Bambusrohr immer nach der Sonne blickte, was für seltsame Figuren er in den Sand und auf Lederhäute malte, wie er immer Hieroglyphen schrieb, das waren doch sicher nur Vorbereitungen zu der nachfolgenden großen Zauberei, durch die er mit einem Schlage alle Kranken gesund machte.
So vergingen fünf Tage. Dann wurden die Neger doch endlich ungeduldig. Dazu kam noch, dass die Lieblingsfrau des Häuptlings am Fieber gestorben war und dass der Stamm schon seinen Ukangara hatte, der sich natürlich stark zurückgesetzt fühlte und den Tod der Lieblingsfrau benutzte, um gegen den fremden Rivalen zu hetzen.
Ja, was sollten die Schiffbrüchigen tun, wie überhaupt von hier wieder fortkommen? Das war natürlich die Hauptsache, worüber sie immer sprachen.
Die Aussicht, durch eigene Kraft von hier fortzukommen, war gering. Sie hatten deswegen Umschau gehalten. Die Eingeborenen besaßen nur deshalb einige ausgehöhlte Baumstämme als Boote, um, wenn einmal etwas ins Meer geweht war und forttrieb, dieses wieder aus dem Wasser holen zu können ohne schwimmen zu müssen, was wegen der Haifische sehr gefährlich gewesen wäre.
Auf diesen ausgehöhlten Baumstämmen auch nur die nächste Insel zu erreichen, das war selbst bei ruhigster See ganz ausgeschlossen, weil hier überall eine sehr starke Strömung herrschte.
Es musste unbedingt erst ein solideres Fahrzeug gebaut werden, dazu war eine List nötig, man musste den Negern irgend etwas anderes vormachen, vielleicht ein Haus, eine Hütte bauen, die in Wirklichkeit aber ein größeres Boot wurde, und um dies ausführen zu können, dazu musste man erst noch mehr spionieren, diese Neger näher kennen lernen usw.
Da am fünften Tage forderte der Häuptling, von dem einheimischen Zauberer aufgestachelt, von dem Weißen ganz energisch, er solle seine tote Lieblingsfrau wieder lebendig machen.
»Lebendig machen? Das kann ich nicht,«
»Du musst. Sonst schlachten wir einen deiner Gefährten nach dem anderen.«
Dieses Zwiegespräch ging noch weiter, und die Sache sah ganz gefährlich aus, der Häuptling wurde immer drohender.
Aber der Graf wusste alles noch einmal zu seinen Gunsten zu wenden.
»Ich will sehen, ob Iklandoba mir günstig gestimmt ist.«
Er ließ im Kreise der versammelten Krieger ein Feuer anmachen, weihte die Flammen unter besonderen Zeremonien, dann griff er in das Feuer hinein und holte mit der ungeschützten Hand eine faustgroße, hellglühende Holzkohle heraus, betrachtete sie einige Zeit tiefsinnig, ehe er sie zurückwarf.
»Ja, ich kann dein Weib wieder lebendig machen. Iklandoba hat es mir versichert, indem er meine Hand nicht vom Feuer verbrennen ließ. Aber ehe ich es kann, will er mir noch ein anderes Zeichen geben, so lange ist alle Mühe vergeblich.«
Dieses Experiment hatte wieder genügt. Die Neger staunten, hatten sich entsetzt vor dem Manne, dem eine glühende Holzkohle nichts anhaben konnte. Der schwarze Zauberer hatte dem Rivalen das Kunststück gleich nachmachen wollten und sich dabei die Hand dermaßen verbrannt, dass er seitdem keinem Feuer mehr zu nahe ging.
Nicht minder erstaunt war Axel, von Morphin und Sam gar nicht zu sprechen. Sie hatten dieses Experiment vom Grafen noch nicht gesehen, wussten wohl auch nicht, wie er damals bei seinem ersten Auftritt in der Öffentlichkeit die glühende Silbermünze mit den Fingern aus der Kohlenpfanne genommen hatte, oder dachten jetzt eben nicht mehr daran.
»Wie ist das möglich, dass Sie sich dabei nicht im Geringsten die Hand verbrennen?«, fragte Axel, als die vier dann unter sich waren.
»Es handelt sich nur um ein besonderes Anfassen der Kohle.«
»Ich verstehe nicht.«
»Erklären kann ich es Ihnen auch nicht. Es muss geübt werden, und ich glaube, dass es genug gibt, die es nie lernen werden. Aber ein anderes Beispiel kann ich Ihnen geben, wie das besondere Anfassen gemeint ist. Können Sie dieses Brett aufheben, ohne es seitlich zu ergreifen?«
Es war ein suppentellergroßes, sehr glattes Brett. Der Graf legte seine Hand darauf, ohne die Kanten zu berühren, hob den Handrücken etwas, dass nur noch die Fingerspitzen auf dem Brette lagen, und man merkte wohl, in welch eigentümlicher Weise er dabei die Finger spannte, und so hob er das ganze Brett scheinbar oder auch in Wirklichkeit nur mit den Fingerspitzen empor. Es war wie angeleimt.
Vergebens suchten Axel und die anderen beiden dieses Kunststückchen nachzumachen. Manchmal, als er schon lange probiert, kam es Axel vor, als wolle das Brett an seinen Fingerspitzen haften, es fiel aber doch immer gleich wieder ab.
Vielleicht ist dem Leser bekannt, dass man auf solch eine Weise auch einen Teller aufheben kann, nur mit den Fingerspitzen, die flach auf dem glatten Porzellan liegen. Die Fingerspitzen müssen dabei in eigentümlicher Weise zusammengeschoben werden, es ist überhaupt ein merkwürdiger Griff dabei. Mancher kann es gleich, ein anderer lernt es nie. Worauf es eigentlich ankommt, ist auch gar nicht zu erklären. Die indischen Gaukler bringen dasselbe auch mit den Füßen fertig. Sie stellen sich auf zwei polierte Bretter, plötzlich sitzen diese an den Fußsohlen fest, der Mann springt mit ihnen in die Höhe, tanzt, die Bretter verrücken sich nicht um eine Linie — dann aber kann er die Bretter doch wieder willkürlich von den Sohlen fallen lassen.
Dieses Kunststückchen wurde früher damit erklärt. dass der Gaukler versteht, durch Krümmung des Fußes unter der Sohle einen luftleeren Raum zu bilden, sodass die polierten Bretter durch den Luftdruck festgehalten werden. Europäer aber, welche auch das Geringste ernster nehmen als andere Menschen, die sich nicht mit dem Ausdruck ›Kunststückchen‹ zufrieden geben, haben bewiesen, dass dem nicht so sein kann. Sie haben die Bretter durchbohrt, und sie blieben dennoch an den Füßen des Gauklers festsitzen. Da kann also von einem Luftdruck nicht mehr die Rede sein.
Nein, diese Gaukler wissen ihre Füße und Zehen eben so zu gebrauchen wie solche Tausendkünstler bei uns ihre Hände und Finger, und für diesen Griff hört vorläufig die Erklärung auf.
Axel und seine Gefährten hatten auch diesen Tellergriff noch nicht gesehen, und so bestaunten sie das Wunder, wie der Graf das glatte Brett mit gespreizten Fingern aufheben konnte, fast nicht minder als das mit der glühenden Kohle.
»Es ist ein besonderes Anfassen dazu nötig, um sich von der Kohle nicht verbrennen zu lassen.«
»Ja, aber die ausstrahlende Hitze? Die muss doch die Hautgewebe zerstören.«
»Nein, eben nicht, wenn man sie auf diese besondere Weise anfasst, dadurch wird die Haut in besonderer Weise gespannt.«
Dass dieses Gleichnis gar nicht stimmte, liegt wohl klar genug auf der Hand. Aber der Graf blieb bei dieser seiner Behauptung, gab keine andere Erklärung.
Sein Biograf hat auch nie erfahren, wie er es machte, sich gegen Verbrennung zu schützen.. Ob er etwas bei sich hatte, mit dem er sich vorher einrieb, oder ob überall eine Pflanze oder sonst etwas zur Hand war — Axel hat es eben nie erfahren.
Übrigens war er sonst nicht etwa gegen Feuer gefeit. Wohl konnte er auch andere Stellen seines Körpers gegen Feuer unempfindlich machen, aber immer nur für einen Fall. So verbrannte er sich einmal mit einer glühenden Zigarre ganz tüchtig den Arm, nachdem er eben gezeigt hatte, wie er diesen minutenlang ins Feuer halten könne.
Wir werden später noch mehr von dieser scheinbaren oder auch wirklichen Unempfindlichkeit indischer Fakire gegen Feuer zu hören bekommen, durch Berichte verbürgt, deren Wahrhaftigkeit nicht anzuzweifeln ist. Wer freilich nun einmal nicht daran glauben will, einfach leugnet, was er nicht gleich begreifen kann, dem ist nicht zu helfen. Und vor dieser Feuerfestigkeit indischer Fakire, die sie aber auch anderen Personen zeitweilig wie auf Kommando mitteilen können, sollte auch der Graf von Saint-Germain vor einem ihm unlösbaren Rätsel stehen.
Jedenfalls hatte diese Feuerprobe genügt, um dem weißen Zauberer und seinen Gefährten noch einmal Frist zu geben.
Und noch an demselben Tage brachten Neger, die an dem etwa eine Stunde entfernten Strand gewesen waren, die Botschaft:
»Ein schwimmendes Haus kommt zu uns!«
Die größte Aufregung entstand in dem Negerdorf. Alles rüstete sich, das Schiff zu empfangen, das heißt, zum Tauschhandel. An einen feindlichen Empfang wurde nicht gedacht. Es war schon lange her, die ältesten Leute hatten es von ihren Großeltern erzählen hören, wie man einmal solch ein schwimmendes Haus hatte angreifen wollen. Die Neger hatten eine mörderische Lektion bekommen, und es war nur ein ganz kleines Schiff gewesen. Wie konnte es denn auch anders sein. Kanonen und Gewehre, und die ganze Insel, von der es kein Fortkommen gab, war kaum eine Quadratmeile groß. Eine Razzia von dem Schiffsvolk musste ja schrecklich ausfallen, der Urwald war nicht groß genug, um dauerndes Versteck zu bieten. Und damals hatten alle Schiffe, welche die afrikanische Küste abklepperten, noch Bluthunde an Bord, welche von den Negern mehr gefürchtet wurden als Kanonen und Löwen, ebenso wie in Amerika von den Sklaven.
Ehe noch die vier Schiffbrüchigen beraten konnten, auf welche Weise sie sich hier am besten verabschieden könnten, suchte ihnen der Häuptling jede diesbezügliche Hoffnung zu zerstören.
»Es kommt ein großes Schiff, es liegt schon in der Bucht. Kommt, geht hier in diese Hütte, und da bleibt ihr drin, bis das Schiff fort ist.«
»Ich muss mir aber erst von dem Schiffe Medizin holen«, versuchte der Graf einzuwenden.
»Nein, ihr dürft nicht eher wieder von anderen Weißen erblickt werden, als bis du meine schon begrabene Gattin wieder lebendig gemacht hast.«
So ungefähr sprach der Häuptling, nur etwas mehr in seiner Negerweise.
Was sollten die Schiffbrüchigen tun? Vorläufig mussten sie gute Miene zum bösen Spiel machen. Also, sie ließen sich in die unterirdische Hütte bringen.
Wir wollen es kurz machen. Halten ließen sie sich natürlich nicht. In das Dorf kamen die fremden Matrosen nicht, aber sie erlauschten von den geschwätzigen Negern genug, was sie wissen mussten. Die Hauptsache war, dass drei Boote des Schiffes am Strand lagen.
Es war bei Anbruch des Abends, als sie dies erfuhren. Die beiden inneren Wächter wurden ganz lautlos überwältigt, die draußen stehenden niedergeschlagen. Sonst befand sich kein einziger Mann im Dorfe. Den Weg durch den Wald nach jener Bucht kannten sie.
Als sie diese erreichten, wollte das letzte Boot soeben abstoßen, um nach dem in der Mitte der Bucht liegenden, sehr großen Dreimaster zurückzukehren.
Es war heller Mondschein, bis jetzt hatte der Tauschhandel gewährt, wobei die Neger, die vollzählig am Strande versammelt waren, keine Waffen mitbringen durften, während man dem Grafen oder seinem Leibdiener das ›Zaubermesser‹ gelassen hatte.
Es brauchte nicht benutzt zu werden, um sich Bahn zu hauen.
»Wir sind von den Negern gefangene Schiffbrüchige!«, schrie Axel und stürzte sich ins Meer, oder brauchte nur zu waten, ihm nach die anderen.
Ehe die Talalas nur wussten, dass das ihre Gefangenen waren, befanden sich diese schon im Boot, die Matrosen ruderten wieder an. Hinter ihnen tobte nur noch das ohnmächtige Wutgeschrei der Talalas.
Es waren weiße, braune und schwarze Matrosen, welche die Ruder handhabten. Die weißen sprachen unter sich Französisch, sahen meist auch wie Franzosen aus.
»Wer seid ihr denn?«, fragte der knebelbärtige Bootssteuerer.
»Wir haben vor fünf Tagen hier Schiffbruch erlitten und wurden von den Talalas gefangengehalten.«
»Ohne in dieser Zeit von ihnen aufgefressen zu werden?«
»Wir wussten sie hinzuhalten.«
»Da müsst ihr schlau gewesen sein, denn diese Talalas sind auf Menschenfleisch erpicht wie der Teufel auf jede Seele. Was für ein Schiff war denn das?«
»Eine Jacht des Grafen von Bellamare aus Venedig, der ich selbst bin«, entgegnete der Graf.
»So. Na, das geht mich jetzt nichts an. Das müsst ihr erst meinem Schiffsherrn erzählen.«
»Wer ist das? Wie heißt er?«
»Das wird er euch selbst sagen, wenn er es euch sagen will«, lautete die für einen Franzosen wenig höfliche Antwort. Als ob jeder Franzose solch ein höflicher Mensch wäre!
Das Schiff war erreicht, es ging an Deck. Es war ein sehr stattliches Fahrzeug, dem schwarzen Schiff wenig an Größe nachgebend, aber nur mit drei Masten, und schon wurden die Segel gesetzt, Vorbereitungen zum Ankerlichten getroffen.
Eine kleine Weile konnten die Geretteten sich an Deck umsehen. Auch hier lauter weiße Matrosen mit französischen Physiognomien, oder Araber, oder Neger, alle aber in europäischer Matrosentracht, freilich in dieser Tropengegend leicht genug.
Dann tauchte auch hin und wieder ein Inder auf, auch in indische Gewänder gehüllt. Offenbar Stewards und dergleichen dienstbare Geister.
Und dann kam über Deck ein Zug von einem Dutzend orientalischer, tiefverschleierter Weiber gegangen.
»Wir sind auf einem orientalischen Schiffe«, flüsterte Axel.
»Das ist noch nicht gesagt, es kann auch ein englisches oder wohl französisches sein, das in Indien nur beheimatet ist. Oder vielleicht auch nur eine Liebhaberei.«
Ein Mann trat auf sie zu, dem man gleich den Kapitän ansah, auch wenn er keine Abzeichen dieses Ranges trug.
»Bitte, Messieurs, Sie möchten die Güte haben, sich dem Schiffsherrn vorzustellen«, fing der jetzt in einem ganz anderen Französisch an.
Auf dem Wege nach einer Kajütentür wurde Axel noch einmal von ihm angehalten.
»Ah, Sie haben einen Degen! Bitte, Sie legen ihn wohl ab.«
»Meinen Hirschfänger? Von dem bin ich unzertrennlich...«
»Aber bitte, Monsieur, es ist hier so üblich, Sie können nicht mit Waffen vor den Herrn treten, wenigstens nicht mit sichtbaren.«
Solch einer Liebenswürdigkeit kann man ja gar nicht widerstehen. Axel schnallte sein Schlachtschwert ab.
»Wer ist denn der Schiffsherr?«
»Sie werden es sofort erfahren. O, ein ganz charmanter Herr.«
»Wie ist seine Anrede?«
»Oooooo... einfach Monsieur.«
Sie durchschritten unter Deck einige Gänge, eine Tür öffnete sich, sie traten in eine sehr große Kajüte, mehr Salon zu nennen, die durch zahlreiche Petroleum- oder wohl Öllampen erleuchtet wurde. Der betäubende Parfümgeruch schien von diesen Lampen auszugehen.
Alles orientalisch eingerichtet. Also fast nur Polster und Kissen und Teppiche. Nicht gerade prunkvoll, Gold und Edelsteine fehlten, aber die Kissen und Teppiche waren doch sehr kostbar, vielleicht gerade wegen ihres Alters.
Im Hintergrunde saß auf einer aus Kissen aufgebauten Erhöhung mit untergeschlagenen Beinen ein Inder — oder vielleicht auch ein Araber, das war schwer zu sagen. Er war in indische Seitengewänder gehüllt, beturbant, rauchte aus einer Wasserpfeife, strich sich den langen, schwarzen, aber schon graumelierten Vollbart. Eine schöne, stolze, ganz martialische Erscheinung, wenn auch ohne Narben. An seinen Fingern funkelten hier die einzigen Diamanten, Rubine und Smaragde.
Neben ihm stand wieder ein Franzose, ein schon älterer Herr, nach der neuesten Pariser Sommermode gekleidet.
Was den vier am unangenehmsten auffiel, das war, dass sie gleich von einer Schar Inder in Empfang genommen wurden, deren Gürtel mit Dolchen und Pistolen und Schwertern gespickt waren und die sie so nach hinten begleiteten, wie Verbrecher vor den Untersuchungsrichter geführt werden.
Die Stellung war eingenommen. Die bewaffneten Inder blieben die Polizisten, welche von den gefährlichen Untersuchungsgefangenen kein Auge verwenden.
Der vornehme Inder rauchte, strich seinen Bart und hörte zu, was ihm der Franzose zuflüsterte.
Dieser leise Meinungsaustausch war endlich beendet.
»Wer seid ihr?«, fragte der Inder mit tiefer Stimme auf französisch, während sich sein geckenhafter Nachbar ein Monokel ins Auge klemmte.
Der Graf machte den Sprecher. Er war und blieb der Graf Jocobo von Bellamare aus Venedig, der mit seiner Lustjacht wie schon oft eine weite Reise angetreten hatte, an dieser Insel vor fünf Tagen gescheitert war. Dies der Kapitän, dies ein Matrose, dies Signor Axel, ein Freund von ihm — die übrige Mannschaft hatte bei dem Schiffbruch ihr Leben verloren.
Der Graf hatte sich so kurz wie möglich gefasst, und über den Aufenthalt auf der Insel ward er gar nicht befragt.
»Ihr seid Christen?«
»Ja.«
Der Inder spuckte in einen neben seinem Thronkissen stehenden Napf.
»Aber der Schwarze nicht.«
»Auch er ist ein Christ, ist es schon als Kind geworden.«
»Hund!«
»Oho!«
»Ja, was nun mit euch anfangen? Warum habt ihr euch von den Talalas nicht braten und fressen lassen?«
Der Graf glaubte wohl, die Frage sei nur nicht richtig gestellt worden, der Inder wollte vielmehr wissen, auf welche Weise sie dem Tode entgangen feien.
»Es gelang mir, die Talalas...«
»Weil die Talalas Hundebraten verschmähen«, wurde er unterbrochen.
Axel verstand immer noch nicht, wie dieser Inder über sie dachte.
»Weil diese Talalas wenigstens selbst keine Christenhunde sind.«
Oho! Oho!! Jetzt ging freilich allen eine ziemlich deutliche Ahnung auf.
»Sie schmähen uns, weil wir Christen sind, Monsieur?«, fragte da auch gleich der Graf mit Nachdruck.
Also an den Iklandoba hatte er wohl einmal geglaubt, um sein und seiner Kameraden Leben zu retten, aber seine Religion schmähen ließ er sonst nicht.
Eine Antwort darauf wurde ihm nicht gegeben.
»Ihr hättet euch gleich auf der Insel aufhängen sollen. Soll ich euch hier über Bord werfen, mit euch Hunden die Haifische füttern? Nein, dazu seid ihr doch noch zu gut. Ihr werdet an Bord meines Schiffes als Sklaven die Arbeit verrichten, vor der sich jeder rechtgläubige Muselmann ekelt, die ich auch keinen ungläubigen Hindu machen lassen möchte.«
Erst ein ungläubiges Starren, dann aber brach Axel los:
»Bei Gottes Tod, was wagst du Schuft uns zu bieten...?«
Weiter kam er nicht. Es genügte, dass er dabei drohend die Faust erhoben hatte, vielleicht schon das hervorbrechende Blitzen seiner Augen — im Nu hatten sich die Wächter auf ihn geworfen.
Mit einem Griff hatte Axel dem ersten den langen Dolch aus dem Gürtel gerissen, er hätte zustoßen können, einmal, zweimal, mehrmals, es hätte mehrere Leichen gegeben, aber er tat es nicht, er ließ den Dolch eher wieder fallen, als er es nötig gehabt hätte. Er wäre auch niemals ein Depeschenreiter geworden, wenn er es getan hätte. Denn nur solange man lebt hat man Hoffnung, sein Leben auch noch fernerhin erhalten zu können. Es war schon eine Unklugheit von ihm gewesen, sich im ersten Augenblick hinreißen zu lassen, nur einen fremden Dolch aus dem Gürtel zu ziehen, nur zu drohen.
Ebenso vernünftig dachte sicher auch der Graf. Auch er wurde sofort überwältigt, und er rührte keine Hand. Der schwarze Sam freilich dachte weniger vernünftig, dachte natürlicher, wollte sich wehren, kam aber gar nicht dazu, wurde sofort niedergerissen und gefesselt.
Den bösesten Streich spielte Kapitän Morphium seinen Gefährten dadurch, dass er sich am männlichsten bewies, was hier aber eben nicht angebracht war. Ein einziges Mal konnte der alte Recke mit der Faust losschlagen, er traf einen der Inder zwischen die Augen, es klang, als ob ein irdener Topf berste — und der Getroffene stand denn auch nicht wieder auf.

Dann aber war auch Morphium ›zugedeckt‹, konnte nur noch fluchen.
Der ganze Kampf, wenn es ein solcher zu nennen gewesen, hatte kaum drei Sekunden gedauert. Der indische Schiffsherr saß noch ganz ruhig da, der Franzose stand neben ihm.
Der Tod des einen Inders wurde ihnen gemeldet.
»Hat der Kerl solch eine eiserne Faust? Bon, er soll uns noch andere Beweise davon geben. Sperrt die Hunde ein, lasst sie erst einmal zur Besinnung kommen, dann wollen wir weiter sehen, wie wir uns mit ihnen amüsieren können.«
Sie wurden hinausgestoßen, durch einen Gang, der immer dunkler wurde — plötzlich verlor Axel den Boden unter den Füßen, er stürzte etwa zwei Meter tief, drei andere Körper fielen auf ihn. Dann noch ein Geräusch, als ob ein eiserner Deckel zugeschlagen würde.
»Sind wir alle hübsch beisammen?«, war Axel wieder der erste, der das Wort ergriff.
Ja, das waren sie, und auch Schaden genommen hatte niemand.
»Das nennt man aus dem Regen in die Traufe kommen«, ließ sich dann der Graf in nicht minder phlegmatischem Tone vernehmen. »Signor Axel, das haben Sie übrigens verschuldet.«
»Ich weiß es, und ich bedauere. Dann hätte ich wenigstens auch noch ein paar abstechen sollen. Zu dem Hund von Inder wäre ich freilich nicht gekommen, da standen zu viele dazwischen. Es lässt sich nicht mehr ändern.«
Weiter entschuldigte sich Axel nicht, und Kapitän Morphin bekam wegen eines Totschlags gar keinen Vorwurf zu hören, den er überhaupt nicht verstanden hätte.
»Das ist ein mohammedanischer Inder, und meiner Ansicht nach ein geborener Perser«, sagte der Graf.
Diese Erklärung fand allgemeines Verständnis. Dass Ostindien zum größten Teil unter persischmohammedanischer Herrschaft stand, das war damals so bekannt, wie heute jedes Kind weiß, dass Ostindien den Engländern gehört.
Im Anfang des 16. Jahrhunderts hatte Rabur Schah, ein Urenkel des furchtbaren Welteroberers TimurLeng, mit seinen Truppen, die sich Perser nannten, aber mehr den heimatlosen Hunnen glichen, ganz Vorderindien unterworfen. Dieses sogenannte großmogulische Reich bestand noch zur Zeit unserer Erzählung. Die Großmoguls oder Schahs waren einander gefolgt, ohne aus demselben Geschlechte zu stammen, eine Dynastie war von der anderen verdrängt worden, sie waren im Kriege gefallen oder durch Gift und Dolch beseitigt worden, immer aber waren es mohammedanische Perser gewesen.
Gegenwärtig saß aus dem Großmogulthrone zu Delhi Achmed Schah, der aber gegen sich eine ganze Masse Kronprätendenten hatte, die alle nach seinem Leben trachteten, oder, wenn sie die Macht dazu gehabt, ihn offen bekriegt hätten.
Das indische Volk war schon damals zu sehr erschlafft, um diese persische Fremdherrschaft abzuschütteln. Übrigens wurde es ziemlich milde behandelt. Die Hunnen hatten sich mit den Hindus auch schon vollständig vermischt, nur dass die einen Mohammedaner, die anderen Buddhisten oder Brahmaisten waren. so wie es ja noch heute ist. Vor allen Dingen herrschte vollkommene Religionsfreiheit, alle indischen Heiligtümer wurden respektiert. Das Volk wurde von den indischen Herrschern auch nicht so ausgesaugt wie jetzt von den Engländern, oder es blieb doch wenigstens alles im Lande, verteilte sich durch die Äderchen des Verkehrs immer wieder auf alle Volksschichten.
Was die europäischen Interessen anbetrifft, so waren die Portugiesen die ersten, die in Ostindien Handelsniederlassungen gründeten — die erste unter dem Schutze der Schiffe Vasco da Gamas. Dann bekam die niederländische Kompanie die Oberhand. Fast gleichzeitig wurde eine dänischostindische Kompanie gegründet. Alle diese wurden von der französischostindischen Kompanie und der englischostindischen Kompanie verdrängt, welche zur Zeit unserer Erzählung noch als Rivalen um die Handelsherrschaft rangen.
Diese europäischen Handelsgesellschaften wurden von dem Großmogul geduldet, sie waren ihm sogar sehr angenehm, denn sie mussten ihm kolossale Abgaben entrichten. Sie hatten ununterbrochen Kämpfe oder sogar Kriege mit eingeborenen Fürsten zu führen, wozu sie ganze Armeen besoldeten, aus Eingeborenen wie aus mitgebrachten Soldaten und mehr noch aus aus aller Welt zusammengelaufenen Abenteurern bestehend, und hauptsächlich eben war es der Konkurrenzkampf zwischen Franzosen und Engländern, die sich gegenseitig durch Waffengewalt zu verdrängen suchten.
Der Großmogul in Delhi schaute diesen Kämpfen der Fremden auf eigene Faust ruhig zu, der hatte zu viel mit sich selbst zu tun, und außerdem war das nur zu seinem Vorteil, denn die Europäer bekämpften immer nur rebellische Fürsten, die auch ihm nicht gehorchen wollten.
Also, wohlverstanden, mit der französischen und englischen Regierung hatte das damals noch gar nichts zu tun. Das waren nur Handelsgesellschaften. Dass die Regierungen dahintersteckten, ist ja selbstverständlich. Aber die Annektierung Ostindiens durch England kam erst viel, viel später, wobei sich Frankreich definitiv in Hinterindien festsetzte.
Also auch die christlichen Europäer hatten in Indien Religionsfreiheit, wurden von den Mohammedanern nicht etwa verfolgt. Aber verachtet wurden sie, und auf das Gründlichste.
Wir haben schon früher einmal eine Andeutung gemacht, was für eine Umgangsform damals zwischen Mohammedanern und Christen herrschte. In Schlossers Weltgeschichte sind einige Briefe wiedergegeben, die zwischen den türkischen Sultanen und christlichen Kaisern gewechselt wurden.
»Du räudiger Hund, dessen stinkende Gedärme die Aasgeier verschmähen.«
Das ist die Einleitung eines Briefes Mohammed Alis an Kaiser Karl V., so geht es weiter, so antwortete der Kaiser auch, und so sind diese Briefe alle, und so titulierten sich mohammedanische und christliche Kaiser und Fürsten auch bei der persönlichen Zusammenkunft.
Nun darf man aber nicht glauben, dass dies immer so gemeint war. Die verschiedengläubigen Fürsten konnten die besten Freunde sein, voreinander die größte Hochachtung haben, und dennoch ging es per Hund und Vieh. Es war dies ein Mode gewordener Briefstil, eine Etikette der Umgangsformen, wofür wir heute gar kein Verständnis mehr haben. Aber in andern Dingen herrschte ja auch solch ein Widerspruch. Man denke nur daran, wie Katholiken und Protestanten gegeneinander gewütet haben, um sich gegenseitig die wahre Lehre des Meisters der Liebe aufzudrängen. Solche Gräueltaten, im Grunde genommen aus ehrlichster Überzeugung begangen, können wir ja heutzutage gar nicht mehr begreifen. Ja, aber auch betreffs Briefstils haben wir heute noch ein ganz ähnliches Beispiel, nur in umgekehrtem Sinne. Wenn jemand einem anderen einen Brief schreibt, von dem er weiß, dass er ein notorischer Lump ist, und er schreibt ihm dies womöglich noch gar, es ist ein Schmähbrief, so kann er doch nicht unterlassen, gewohnheitsmäßig ein ›Hochachtungsvoll‹ darunter zu setzen. Das ist ungefähr dasselbe, nur eben in umgekehrtem Sinne. — — — — —
»Dieser Mohammedaner hat das ›du Hund‹ und so weiter gar nicht so gemeint«, sagte der Graf.
Ja, das wussten die anderen nun auch, sie waren Kinder ihrer Zeit und Männer, die schon weit in der Welt herumgekommen waren.
»Teufel«, grollte aber Axel immer noch, »ich bin aber so etwas nicht gewohnt! Wenn ich erst einmal auf dem mir von Ihnen prophezeiten Fürstenthrone sitze, lasse ich mir solche Titulaturen vielleicht gefallen — vielleicht! — jetzt aber noch nicht, jetzt bin ich noch der freie Depeschenreiter Axel. Und wollte er uns nicht die dreckigsten Arbeiten verrichten lassen, die zu tun der schmutzigste Türke und Paria sich scheut?«
»Das waren alles nur solche übliche Redensarten. Zuletzt hätte er uns dennoch anständig als hilfsbedürftige Schiffsbrüchige aufgenommen und behandelt.«
»Können Sie dafür garantieren?«
»Das kann ich freilich nicht, aber...«
»Na, darüber zu debattieren hat nun gar keinen Zweck mehr. Jetzt sitzen wir drin im Loche, und verschuldet haben wir allerdings genug. Morphium, bist du nicht gefesselt worden?«
Ja, ebenso wie Sam, nur diese beiden, weil sie sich bis zuletzt gewehrt hatten.
»Mit Lederriemen, nicht mit Ketten? Komm her, ich will aufknüpfen.«
»Halt, das will überlegt sein, ob diese Befreiung vorteilhaft für uns ist«, warnte der vorsichtige Graf, auch bei dem sonst so trotzigen Axel behielt die ruhige Vernunft immer die Oberhand, er gab wenigstens zu, dass diese Selbstbefreiung erst überlegt sein wollte.
»Ich habe den einen totgeschlagen«, sagte Morphium zunächst sehr kleinlaut. »Was wird nun unser Los sein?«
»Das kommt ganz darauf an«, entgegnete der Graf, »wie wir uns...«
Er brach kurz ab, ohne dass die anderen einen Grund hierfür wussten. »Was haben Sie?« »Still! Hören Sie nichts?«
Alle lauschten. Das Kettenklirren des Ankerlichtens war schon längst vorüber, sie mussten sich ziemlich tief im Schiffe befinden — in dem stockfinsteren Raume herrschte Totenstille.
»Da da da da — wieder die Töne!«, flüsterte der Graf.
»Was denn für Töne?«
»Gelobt sei Gott, jetzt sind wir gerettet, das ist eine...«
Ehe der Graf aus sprechen konnte, knatterte es über ihnen, die eiserne Falltür ward geöffnet, ein Lichtschein fiel herein.
»Unter euch ist ein venezianischer Graf?«, wurde auf französisch gefragt.
»Ja, ich.«
»Der Graf von... wie war der Name?«
»Jacobo de Belamare.«
»Stimmt. Sie sollen noch einmal zum Schiffsherrn kommen. Nun seien Sie vernünftig, und ihr anderen auch! Hier, fassen Sie meine Hand, Sie werden wohl auch so aus dem Loche kommen.«
Der Graf erfasste die arbeitsharte Hand und schwang sich empor.
Im Scheine einer Laterne sah er einen weißen Matrosen, der ihm herausgeholfen, und einen indisch gekleideten Franzosen, der wohl gesprochen hatte.
Die Falltür ward wieder zugeklappt und ein starker Riegel vorgeschoben.
»Folgen Sie mir. Sie müssen erst etwas Toilette machen, ehe Sie wieder vor den Schiffsherrn treten.«
Etwas Toilette hatten die Schiffbrüchigen ja alle sehr nötig. Der Graf wusch sich in einer Kabine und erhielt ein einfaches indisches Kostüm.
»Sie sind wohl schon in Indien gewesen, weil Sie die Kleidungsstücke gleich so anzulegen wissen?«, fragte der zusehende Franzose.
»Ja, Indien ist mir sehr gut bekannt.«
»Wo sind Sie da... doch ich darf keine Fragen stellen.«
Das bedauerte der Graf sehr, denn dann durfte auch er nicht fragen, brauchte es gar nicht erst zu versuchen.
Fünf Minuten später stand er wieder in dem Salon vor dem vornehmen Inder, der noch immer seinen Bart strich, und lauschte, was ihm der geckenhafte Franzose zuflüsterte. Jetzt hielten sich nur zwei bewaffnete Wächter hinter dem Grafen.
»Du wirst vernünftig sein«, begann der Inder.
»Ich bedauere das Vorgefallene furchtbar.«
»Zu spät. Deine drei Begleiter, die sich gewehrt haben, sind des Todes.«
»Ich bitte für sie um Gnade.«
»Du hast gar nichts zu bitten...«
»Ich flehe einen edlen...«
»Still! Du Christenhund wagst mich zu unterbrechen?! Ich habe gehört, dass du dich bei den Talalas für einen Zauberer ausgegeben hast. Auf diese Weise rettetest du dein und deiner Gefährten Leben, sonst wäret ihr gefressen worden. Wie war das? Erzähle!«
Der Graf selbst hatte hiervon noch gar nichts gesagt, war bei seinem ersten Bericht gar nicht dazu gekommen. Es konnte nicht anders sein, als dass die Talalas noch vor Abfahrt des Schiffes ihren Ukangara reklamiert hatten, auf diese Weise hatte man hiervon noch etwas erfahren.
Der Graf erzählte. Der Inder und der Franzose hörten mit größten. Interesse zu.
»Sehr geschickt gemacht. Kannst du denn so gut werfen.'«
»Ich habe immer großes Talent dazu gehabt und mich darin geübt.«
»Wie weit kannst du einen Stein schleudern?«
»Das habe ich allerdings noch nicht abgeschätzt.«
»Und du verfehlst dein Ziel nie?«
»Wenigstens höchst selten.«
»Wenn die Talalas dich deshalb gleich für einen von ihrem Gott gesandten Ukangara hielten, so musst du darin Erstaunliches leisten können. Denn diese Neger verstehen sich doch selbst sehr gut darauf. Du wirst es mir vormachen.«
»Wie Sie befehlen, mein Herr.«
»Und dich unverbrennbar machen kannst du auch?«
»Wenigstens meine Hand und andere Teile meines Körpers.«
»Was kannst du sonst noch gaukeln?«
Es war doch ganz merkwürdig, dass der Inder gar nicht fragte, wie sich jener denn unverbrennbar machen könne. Doch nein, es war eben nicht merkwürdig. Diese Orientalen sind ja mit solchen Gaukeleien übersättigt, sie wollen gar nicht wissen, wie das scheinbar Übernatürliche gemacht wird. Eben auf irgendeine Weise. Das ist doch genau so wie bei uns im Zaubertheater. Wer zerbricht sich denn viel den Kopf, wie der Eskamoteur diesen und jenen Gegenstand verschwinden lässt, dies und das macht! Es ist genug, dass er uns eine Stunde amüsiert.
Diese Orientalen nun sind schon so weit, dass es ihnen ganz gleichgültig ist, ob so etwas auf natürliche oder übernatürliche Weise, durch magische Kräfte geschieht. Und der Europäer, der längere Zeit in Indien weilt, wird ebenso schnell gegen so etwas abgestumpft. Man sieht gar nicht mehr hin.
Aber das Steinwerfen, das war nun wieder etwas anderes, dafür interessierte sich der Inder.
Ja, es ist höchst ergötzlich, wie es der Schreiber dieses einmal gesehen hat, wenn solchen indischen Fakiren, die auf ihren Befehl auf der gepflasterten Straße mächtige Bäume wachsen lassen und anderen Teufelsspuk hervorzaubern, einmal von einem darin geschickten Menschen Kartenkunststückchen vorgemacht werden. Diese indischen Fakire staunten den weißen Hexenmeister an, sie entsetzten sich vor ihm. Das konnte ja gar nicht mit rechten Dingen zugehen, dass sie immer die schon vorher genannte Karte ziehen konnten, der musste unbedingt magische Kräfte besitzen — magische Fähigkeiten, die sie selbst nicht hatten, dem Berliner Wollonkel aber schrieben sie sie zu. Es ist wirklich merkwürdig!
»Was kannst du sonst noch gaukeln?«
»O, ich kann noch...«
»Kannst du dich mit Schwertern durchstechen, überhaupt die Schwertspielerei?«
»Ja, das kann ich, und...«
»Kannst du Verwandlungen ausführen?«
»Ja, wenn ich einige Vorbereitungen treffe...«
»Du wirst alles bekommen, was du brauchst. Wir haben keinen Gaukler an Bord, und unsere Frauen beginnen sich zu langweilen. Du wirst sie unterhalten. Geh!«
Aber der Graf ging noch nicht.
»Mein Herr!«
»Was willst du noch?«, erklang es ungeduldig zurück.
Hätte der Graf jetzt noch einmal von seinen Gefährten begonnen, etwa gar um Gnade für sie gebeten, so wäre er ein Narr gewesen. Der war der Graf von Saint-Germain aber eben nicht.
»Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen gleich jetzt etwas von meiner Kunst zeige.«
»Jetzt? Etwa wie du mit Steinen wirfst? Ja, glaubst du Christenhund denn etwa, ich sei ein ungeduldiges Kind?«
»Keine Gaukelei, sondern eine Kunst, die ich allein ausführen kann, ich als der einzige Mensch auf der Erde.«
»Was für eine Kunst?«
»Gestatten Sie mir, dass ich Sie überrasche, wie es jeder Gaukler tut.«
»Nun, dann los!«
»Ich bedarf dazu eines kleinen Apparates...«
»Was für eines Apparates?«
»Der sich hier an Bord befindet. Ich hörte vorhin die Töne einer Violine, einer Geige. Darf ich um das Instrument bitten?«
Der Inder hatte etwas zu hören bekommen, was ihm gefiel. Alle Orientalen lieben sehr Musik, ohne musikalisch zu sein, das heißt, ohne ein Instrument spielen zu können. Ausnahmen bestätigen nur die Regel, und der Lärm der arabischen Flöten, der Gongs und Becken und der anderen orientalischen Instrumente ist doch nicht etwa Musik zu nennen. Aber sie wissen bessere Musik zu würdigen, können durch sie in Verzückung versetzt werden.
»Sie können Violine spielen?«, fragte der Franzose.
»Ja.«
»Gut? Sehr gut? Wir sind darin nämlich etwas verwöhnt.«
»Ich möchte eine Probe geben, und wenn sie nicht zu Ihrer Zufriedenheit ausfällt, will ich meinen Kopf verwirkt haben.«
Schon vorher war ein entsprechender Befehl gegeben worden, einer der noch in den dunklen Ecken postierten indischen Diener war hinausgeeilt, kehrte schnell mit einer Violine und Bogen zurück, hatte auch das Kolophonium nicht vergessen.
Es war ein erbärmlich aussehendes Instrument, die Saiten geflickt und schlecht aufgespannt.
»Sie gehört einem Matrosen, der aber ein jämmerlicher Stümper ist«, erklärte der Franzose.
Ja, diese Violine hatte der Graf schon vorhin spielen hören, das waren die Töne gewesen, die auch des Depeschenreiters scharfen Ohren entgangen waren, und auf diese Violine hatte der Graf all seine Hoffnungen gesetzt, hatte gleich behauptet, dass sie jetzt alle gerettet seien.
Er verbesserte schnell etwas die Lage des Steges, nahm einige andere Korrekturen vor, stimmte und... spielte.
Musik kann man, wie schon einmal gesagt, nicht beschreiben. Man soll es wenigstens nicht tun. Es kommt dabei immer Unsinn heraus. So wollen wir nur sagen: Der elegante Franzose, der sich eine Zigarette angezündet, brannte mit dieser in seine neue Pariser Sommerhose ein großes Loch, ohne etwas davon zu merken. Mag das genügen, um zu erläutern, wie der Graf Violine spielte.
Er hatte geendet.
»Parole d'honneur!«, rief der Franzose, ganz außer sich, immer noch mit glimmender Hose. »So etwas von Violinspiel habe ich noch nicht gehört! Und ich verstehe etwas davon.«
Der Inder saß wie eine Statue da. Aber in den Augen lag es, was in ihm vorging.
»Mann, wer bist du?!«, erklang es dann aus dem bärtigen Munde mit grenzenlosem Staunen.
»Ein venezianischer Edelmann, der...«
»Spiele mehr, spiele mehr!«
»Darf ich erst eine Bitte stellen?«, durfte der Graf jetzt nach orientalischer Sitte fragen.
»Beim Barte des Propheten«, rief der Inder, die Hand an den eigenen Bart legend, »sie soll dir erfüllt werden — — — wenn ich die Erfüllung für gut finde.«
Dieser Nachsatz war fatal. Aber dieser Inder war eben ein vorsichtiger Mann, der sich nicht gleich alles, was er hatte, abgaunern ließ.
Doch der Graf musste es riskieren.
»Verzeihen Sie meinen Gefährten, schenken Sie ihnen das Leben.«
»Die Bitte sei dir gewährt, sie mögen leben«, erklang es sofort zurück.
Der Graf verneigte sich dankend, war aber noch nicht fertig.
»Und dass sie auch wie freie Männer behandelt werden.«
»Christenhund, wofür hältst du mich?! Spiele mehr!«
Der Graf hatte erreicht, was er wollte, verneigte sich nochmals dankend für den Christenhund und setzte wieder den Bogen an.
Vorhin hatte er eine ziemlich einfache, aber zum Herzen gehende Melodie gespielt. Da hatte er erst prüfen wollen, was für Geisteskinder er vor sich hatte. Sie hatten die Probe zu seiner Zufriedenheit bestanden. Jetzt zeigte er, was er an Fingerkapriolen leisten konnte, wenn er auch noch sein Bestes zurückbehielt, und dann dabei auch nicht das Klagen und Weinen und Jubeln vergessend, wie es eben nur die Geige hervorbringen kann.
Und er hatte das Richtige getroffen. Der würdevolle Inder vergaß sich so weit, dass er in die Hände klatschte, ganz verzückt.
»Mann, du bist mein Hofmusikant!«
Der Graf verneigte sich.
»Und weißt du, wer ich bin?«
»Nicht nur ein gewöhnlicher Schiffsherr.«
»Woher weißt du das?«
»Das sehe ich Eurer Hoheit gleich an.«
»Ich bin Alum Schah.«
Wieder eine Verneigung.
»Hast du schon von mir gehört?«
»Hätte ich es noch nicht, so werde ich noch genug von Alum Schah hören«, war des Grafen sehr, sehr kluge Antwort.
»Ich bin der Großenkel von Schah Aurengazeb.«
Diesen Namen hatte der Graf allerdings schon gehört, aber das Einfachste war, dass er wieder eine ehrfürchtige Verbeugung machte.
»Wenn ich als Großmogul auf dem Throne sitze, wirst du zu meinen Füßen sitzen und meinen Weibern und meinen Gästen, Fürsten, die aus aller Welt kommen, um mir ihre Ehrfurcht zu erweisen, etwas vorspielen. Christenhund, kannst du diese Ehre fassen?«
Wieder eine dankende Verbeugung.
»So spiele mir jetzt noch etwas vor, etwas recht, recht zu Herzen Gehendes. — — Und dann kannst du mir auch gleich etwas mit den Steinen vorwerfen.«
Eine halbe Stunde später fand der Graf seine drei Gefährten in einer Kabine versammelt, auf deren Tisch ein indischer Diener soeben eine große Schüssel mit Stockfischbrei setzte, dazu auch noch ein Schüsselchen mit geschmolzener Butter und frischbackenes Weißbrot.
»Ha, schon dieser Geruch labt!«, ries Axel. »Graf, diesen stinkigen Stockfisch haben wir nur Ihnen zu verdanken.«
»Seien Sie froh, dass Sie überhaupt noch Stockfisch essen können«, erwiderte der Graf, sich gleichfalls auf die Bank niederlassend.
»O, wir wissen schon, dass wir unser Leben nur Ihnen zu verdanken haben. Ja, Sie sind ein wirklicher Hexenmeister! Wie haben Sie das nun wieder fertig gebracht?«
Der Graf erzählte, sich der italienischen Sprache bedienend, die der aufwartende Diener wohl schwerlich verstand.
»Sie sind und bleiben ein wahrer Hexenmeister«, lobte Axel, als jener geschlossen, griff mit der Faust in den Stockfischbrei, tunkte in die geschmolzene Butter und stopfte sich den Kloß in den Mund. »Also Alum Schah heißt der Kerl. Doch nicht etwa gar der indische Großmogul?«
»Nein, der gegenwärtige heißt Achmed. Wenn er noch auf dem Throne sitzt. Das geht dort jetzt ja immer hin und her. Dieser hier glaubt jedenfalls auch Anrechte auf den Thron zu haben und fährt jetzt nach Indien, um ihn einzunehmen. So denkt er wenigstens.«
»Wo ist er jetzt gewesen?«
»In Konstantinopel. Inkognito. Hat da mit türkischen und englischen und französischen Diplomaten verhandelt. Es gilt wohl, für ihn in Indien einen Putsch vorzubereiten.«
»Hat er Ihnen das selbst alles erzählt?«
»O nein, so vertraut sind wir noch nicht. Aber mit seinem Oberkämmerer bin ich schon ziemlich gut Freund geworden. Von diesen Verhandlungen wusste der freilich auch nichts.«
»Und wo geht der Kasten hin?«
»Nach Indien.«
»Nach welchem Hafen?«
»Das konnte mir auch der Oberkämmerer nicht sagen. Das wird von der Hauptperson geheim gehalten, wie hier noch vieles mehr.«
»Na, da kommen wir doch wenigstens nach Indien, was ja sowieso unser Ziel ist.«
»Ja, und wie es sonst mit uns steht, darüber sind Sie doch nicht im Zweifel.«
»Wie meinen Sie das?«
»Nun, wir sind Sklaven.«
»Was, Sklaven?!«, fuhr Axel jäh empor.
Der Graf setzte es ihnen auseinander, so weit diese erfahrenen Männer nicht von selbst einsahen, wie es gar nicht anders sein konnte.
Die Sklaverei war ja damals in vollem Gange — wie auch heute noch.
Nun müsste man aber erst definieren, was das eigentlich heißt: Sklaverei. Wir wollen es nicht tun, es ist auch sehr schwer. Kurz: Dem Mächtigsten gehört die Welt, und zur Welt gehören auch die Menschen. Wir wollen lieber nicht untersuchen, inwieweit wir zivilisierten Europäer, die wir nicht zu den Mächtigen gehören, wirklich freie Menschen sind. Da darf man nicht viel aus seiner Stube herausgehen, und da muss man noch immer brav Steuern zahlen. Sonst hört die gemütliche Freiheit auf. Doch genug hiervon, wenigstens von uns. Sprechen wir von den Orientalen.
Für den mohammedanischen Orientalen gibt es zweierlei in der Welt: das eine, was ihm gehört, und das andere, was ihm nicht gehört. Und die Arbeiter, die er beschäftigt, gehören ihm, das sind seine Sklaven.
Nun ist das aber in Wirklichkeit gar nicht so schlimm, wie es sich erst anhört. Der Orientale hat überhaupt gar kein Wort für Sklaverei. Der Mohammedaner behandelt seinen lebendigen Besitz, Vieh wie Mensch, überhaupt anständig. Das schreibt ihm schon seine Religion vor, die ebenfalls eine höchst anständige ist. Die Negersklaven in Amerika sind von ihren christlichen Herren wohl oftmals barbarisch behandelt worden, aber von misshandelten Christensklaven unter mohammedanischer Herrschaft wird man sehr wenig gehört haben.
Ganz bemerkenswert ist auch, dass die Mohammedaner niemals Christen gezwungen haben, zu ihrer Religion überzutreten. Andersgläubige zu bekämpfen, mit Feuer und Schwert auszurotten — ja, das ist etwas anderes. Aber nicht zwingen, an den Propheten zu glauben. Die alten ›Heiden‹, wie die Römer, ließen die verfolgten Christen ihren Glauben abschwören, später mussten sie das Kruzifix anspeien. Karl der Große hat die besiegten Sachsen mit Gewalt zur Taufe schleppen lassen. Das tut der Mohammedaner nicht. Wer seine Religion annehmen will, muss freiwillig zu ihm kommen, als freier Mann oder als Sklave, und muss erst einen langen, langen Unterricht durchmachen. Im Übrigen verehrt ja auch der Mohammedaner Christus als Propheten, nur dass dieser nach Mohammed rangiert. — —
So und anders sprach der Graf, aber gar nicht viel mehr Worte machend. Und die Zuhörer verstanden ihn, billigten alles.
»Well, Graf, Sie haben wieder einmal recht. Spielen wir also zur Abwechslung einmal Sklaven. Die Hauptsache ist nur, dass ich nicht etwa gezwungen werden soll, ein Muselmann zu werden.«
»Wie gesagt — das ist ganz ausgeschlossen.«
»Und Christenhund und so möchte ich auch nicht gern geschimpft werden.«
»Das fällt weg, sobald Sie als Sklave, als lebendiges Eigentum anerkannt sind.«
»Na, dann man los. Womit sollen wir hier beschäftigt werden?«
»Das weiß ich nicht, und das dürfte wohl ganz von jedem Einzelnen abhängen.«
»Sie also sind bereits als Hofmusikant angestellt.«
»Wie ich erzählte.«
»Wie lange wollen wir da mitmachen, bis wir an unsere Befreiung denken?«
»Wie stellen Sie sich die vor?«
»Nun, wir hätten doch zum Beispiel schon Gelegenheit, zu entfliehen, wenn ein anderes Schiff ziemlich nahe an uns vorbeikommt. Wir jumpen über Bord. Oder eben im nächsten Hafen.«
»Machte Ihnen denn solch eine Flucht Spaß?«
»Wie meinen Sie das?«, fragte Axel, durch den Ton des Grafen gleich stutzig werdend.
»Dieser blickte nach der Tür, durch die der indische Diener soeben hinausgegangen war.
»Da wüsste ich doch eine bessere Weise, die Freiheit zu erlangen, als durch Flucht.«
»Welche?«
»Zu fliehen — das ist kein besonderes Kunststück. Aber als Sklave sich zum Gebieter seines Herrn aufzuwerfen, dass er jedem meiner Befehle gehorchen muss, obschon scheinbar immer noch Sklave zu bleiben — das ist ein Kunststück!«
Starr blickte Axel den Sprecher an. Für ihn hatten diese sonst etwas dunklen Worte vollständig genügt.
»Alle Wetter, Graf — — ja, Sie haben das Richtige erfasst — eröffnen mir da eine wunderbare Perspektive. Freilich ist das leichter gesagt als getan.«
»Nun, als Hofmusikant habe ich doch schon eine ziemliche Macht bekommen, und nicht etwa bloß dem Range nach, sondern schon über diesen Schah selbst. Das sehen Sie doch bereits daraus, dass ich sofort Ihr Todesurteil aufheben konnte.«
»Das stimmt. Aber wird diese Macht der Musik lange anhalten?«
»Sie haben recht. Ich musste ihm vorhin eine halbe Stunde lang ununterbrochen vorfiedeln, es kam gar nicht zum Steinwerfen, und wenn er nicht abberufen worden wäre, wahrscheinlich zum Nachtgebet, so fiedelte ich noch jetzt. Das wird eine Zeitlang noch so anhalten, ich werde ihm Tag und Nacht vorfiedeln müssen...«
»Bis der musikalische Herr des Fiedelns überdrüssig ist.«
»Anders ist es nicht.«
»Und was dann?«
»Dann mache ich ihm etwas anderes vor.«
»Dann schmeißen Sie mit Steinen.«
»Kann ich auch machen«, lächelte der Graf. »Nur dürfen Sie nicht glauben, dass mich der Schah, wenn ich ihn mit Geigenspiel gesättigt habe, deshalb als Hofmusikus absetzt und ins alte Eisen wirft.«
»Nicht?«
»O nein. Ich werde in denselben Ehren stehen, und das für immer, solange ich will. Das ist doch sehr einfach. Wenn der Schah einmal Gäste hat, dann will er mit mir als seinem Eigentum, das so wundervoll Violine spielen kann, doch... protzen, wollen wir gleich sagen.«
»Da haben Sie wieder recht. Und ich werde... hohohohoho!!!«
Dieser letzte Ausruf galt dem Kapitän Morphium, der eben seine knochige Tatze in den Stockfischbrei versenkt hatte, und Axel zog ihm die Schüssel weg.
»Nee, Morphium, du darfst nicht denken, weil es hier keinen Löffel gibt, du könntest nun gleich mit beiden Händen rausschöpfen, und überhaupt, ich weiß gar nicht, was du in der Stockfischschüssel zu suchen hast, du bist doch... Sie«, wandte sich Axel an den wieder eintretenden Diener, »haben Sie nicht vielleicht eine Portion Pferdeäpfel? Es brauchen keine frischen zu sein, getrocknete oder eingemachte... haaaa!!«
Dieser letzte Ruf hatte nun wieder einem zweiten indischen Diener gegolten, der soeben auf einer Platte ein gebratenes Huhn hereinbrachte, so groß, wie sie auf jener Insel herumgeflattert waren.
»So, das habe ich nicht gewusst, dass es noch einen zweiten Gang gibt. Wenn man schon den Strick um den Hals gefühlt hat, ist man nicht gewohnt, noch table d'hôte zu speisen. Dann, mein lieber Morphium, vergrabe du ruhig deine Pfoten in dem Stockfischbrei, du kannst dich auch gleich ganz in die Schüssel hineinsetzen — nur etwas Butter werde ich mir für dieses Brathuhn reservieren.«
»Ich glaube aber, dieses wird für mich bestimmt sein«, lächelte der Graf.
Axel lächelte nicht mit, machte sehr große Augen.
Denn so sah es auch ganz aus. Der Graf saß noch ziemlich weit abseits von den anderen dreien, und das Brathuhn wurde mit noch einigen anderen Sachen, zum Beispiel einem Schüsselchen Mixedpickles, direkt vor ihn hingesetzt.
»Ja, was soll denn das heißen? Wie kommen Sie zu diesem großen Brathuhn?«
»Weil ich Violine gespielt habe.«
»Nu, ich kann ooch Violine spielen. Aber — Scherz beiseite — was wollen Sie denn überhaupt mit dem Brathuhn anfangen? Sie haben den Mund aufzusperren und Luft einzusaugen, immer nur Luft.«
»Nicht durch den Mund, sondern durch die Nase, nur durch die Nase!«
»Na, wollen Sie dieses große Brathuhn etwa durch die Nasenlöcher aufsaugen? Geben Sie das dicke Ding her.«
Der Graf rückte denn auch näher, das Huhn wurde geteilt.
»Ich muss selbst mitessen«, entschuldigte er seine irdischen Gelüste, »es könnte dem Schah hinterbracht werden, der es sehr übel nehmen würde, wenn ich die vorgesetzte Speise ausschlagen wollte.«
»Würde es nicht einen größeren Eindruck auf den Herrn machen, wenn sein Hofmusikus einige Jahre hungert?«
»O, da käme ich zu spät, das ist dort nichts Neues, es gibt genug Fakire, die keiner Speise bedürfen. Aber wirklich, ich vergebe mir schon etwas, dass ich die mir vorgesetzte Speise mit Ihnen teile. Ich bin eben Hofmusikus.«
»Und da wird Ihnen hier am Sklaventisch serviert?«
»Gewiss, auch ich bin nichts weiter als ein Sklave.«
»Aber doch immer nicht so ein gemeiner wie wir, Sie sind eben Hofmusikus.«
»Nun, als der schon weltberühmte Händel, wie ich habe von einem Augenzeugen erzählen hören, in England am königlichen Hofe eingeladen war, wurde ihm, nachdem er vorgespielt hatte, als die Herrschaften zur Tafel gingen, ebenfalls im Dienerzimmer am Dienertisch serviert.«
»Jawohl, aber Händel machte nicht mit, er ging an die Hoftafel und setzte sich auf einen Stuhl — so, hier sitze ich, Ich, nun dürft auch ihr euch setzen. Und niemand wagte etwas zu sagen, die Lektion wurde angenommen.«
»So war es. Haben auch Sie davon gehört?«
»Aus erster Quelle.«
»Eine Ausnahme. Schulmeister und Musikanten gehören an die Dienertafel.«
Wir haben dem nichts mehr hinzuzusetzen. Das gilt für die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts. Jene Anekdote von Händel, am englischen Hofe erlebt, beruht auf Tatsache. Was für einen Dienst Georg Friedrich Händel, ein geborener Deutscher, den aber die Engländer als den ihrigen betrachten, auch nicht mit Unrecht, durch diese seine für damalige Zeiten beispiellose Kühnheit seinen Kollegen von der Kunst erwiesen hat, das wissen diese gar nicht mehr zu würdigen, sonst hörte man diese Anekdote öfter erzählen. Auch Mozart und Beethoven wurden ja an den Fürstenhöfen nicht viel besser behandelt als wie Bettelmusikanten. Erst Händel hat den Stein ins Rollen gebracht.
Der Graf von Saint-Germain aber konnte noch mit Recht sagen: »Schulmeister und Musikanten gehören an die Dienertafel.«
»Da werden Sie nur nicht viel Macht auf den Schah ausüben können, wenn Sie dann bloß immer unten am Thron zu seinen Füßen sitzen und seinen Weibern und Gästen zum Tanze aufspielen.«
»Nein, nicht zu seinen Füßen, sondern neben ihm auf dem Throne will ich sitzen, und damit will ich schon hier an Bord anfangen. Das Schiff fährt nach Indien, das ja sowieso unser Ziel ist. Freilich ein sehr umfangreiches Ziel. Dass mich dieses Schiff aber nun gerade dahin bringt, wohin ich will, das ist jetzt meine Aufgabe.«
»Sie meinen, dass es jene Inseln anläuft?«
»Ja, und jede sonstige Zwischenstation, die ich besuchen möchte.«
»A la bonheur, wenn Sie das fertigbringen — und ich glaube es von Ihnen — ja, dann hat es Zweck, einmal den Sklaven zu spielen, so ganz von unten anzufangen. Und dann, bitte ich Sie, dann verschaffen Sie mir die noch unbesetzte Stelle des Haremgauklers — ich will diesen Damen schon etwas vorgaukeln.«
Die Tage vergingen in südlicher Fahrt. Die drei dem Leben Wiedergeschenkten hätten herumbummeln können, wenn sie sich nicht selbst Arbeit gesucht. Zur Bedienung dieses Schiffes gehörten höchstens fünfundzwanzig Matrosen, und die doppelte Anzahl war vorhanden, und dann noch eine Unmasse von männlichen Scheuerfrauen, Stewards und anderen dienstbaren Geistern.
Axel kam zur Überzeugung, dass es hier keinen Menschen gab, der genau sagen konnte, wie viele Köpfe an Bord eigentlich waren. Es ging eben wie an einem indischen Fürstenhofe zu, schon wie in irgendeinem großen Hause eines reichen Inders. Jeder muss sehen, wo er bleibt, und der Topf ist groß genug, aus dem alles geht, und da kann jeder auch sein Taschengeld auf eigene Faust herausschlagen. Trotzdem kann sich kein Fremder hineindrängen. Es ist wie bei einer Hecke Vögel, die ihr eigenes Revier haben. Man weiß nicht, wie viele es sind, die Vögel wissen es selbst nicht, aber ein fremder Vogel derselben Art kann da nicht hinein. Er wird gleich totgehackt.
Setzt sich aber einmal vor die Haustür ein Bettler, und er stellt sich Tag für Tag dort ein, oder ein zufällig kommender Fremder nimmt einmal einem Diener eine Arbeit ab, schüttet für ihn den Ascheneimer aus, und er tut dies Tag für Tag, so sind nach einem Jahre stillschweigend zwei neue dienstbare Geister angestellt worden, der Bettler vor der Tür und der Ascheneimerausschütter, und für diese treten nun auch alle anderen Diener ein und der Herr selbst.
Sam hatte sich als Matrose nützlich gemacht und war stillschweigend zur Backbordwache übergetreten. Als der zweite Steuermann — oder irgendein andrer, es gab wohl fünf bis acht Steuerleute — bei der geografischen Berechnung keinen Partner gefunden, hatte Morphin ihm dabei geholfen.
»Das können Sie ja besser als ich — dann machen Sie's.«
Und der alte Morphium war unter die Steuerleute eingereiht worden.
Die Matrosen hatten nicht einmal ein Logis. Dies ist wirklich der Name des Raumes, in dem die Mannschaft schläft, aber ausgesprochen, wie es geschrieben wird, und das ist international. Jeder schlief, wo er wollte, suchte sich ein hübsches Winkelchen aus. Trotzdem aber funktionierte der ganze seemännische Betrieb ausgezeichnet. Wenn die Bootsmannspfeife rief, war alles zur Stelle. Es waren aber eben lauter tüchtige Seeleute, denen die Pflicht in Fleisch und Blut übergegangen war.
Axel hielt es mit dem freien Herumbummeln. Wie es hier zuging, das hatte er ja bald heraus. Und um sich ja nicht einmal unfreiwillig eine Arbeit aufzuhalsen, die er dann immer ausführen musste, hatte er vorsorglich immer beide Hände tief in den Hosentaschen vergraben.
Zur näheren Bekanntschaft hatte er sich den Bootsmann auserkoren und mit sicherem Blick auch den richtigsten Mann für seine Zwecke erkannt. Der schon alte Kerl war ein internationaler Seezigeuner, der nicht mehr wusste, welchem Volke er angehörte. Zu erzählen anfangen durfte er nicht, dann wäre er nie fertig geworden. Eigentlich hätte er schon einige Male begraben oder vielmehr tot sein müssen, gehenkt, erschossen, ersäuft, gevierteilt und so weiter. Sonst aber war er ein ganz gediegener Charakter. Sein Name war Kethog. Woher er den hatte, wusste er nicht. Es klang etwas irisch. Einen Vornamen gab's nicht.
Der ›Stern von Indien‹ hatte vor einem Jahre in Madras gemustert, unter französischer Flagge, welche die dort ansässige französischostindische Kompanie im Namen der Regierung erteilen konnte. Das Schiff war nach Konstantinopel gegangen, hatte dort drei Monate gelegen... mehr wusste der alte Bootsmann nicht zu sagen, auch nicht, wo das Schiff früher gewesen war.
»Wisst Ihr, wer der indische Schiffsherr ist?«
»Ja. Ali Alum, ein indischer Fürst, wenigstens will er es sein.«
»Wisst Ihr, was er vorhat?«
»Der will den Großmogul stürzen und sich auf den Thron von Delhi setzen. So denkt er es sich. Aber das ist ja alles Quatsch. So denken noch viele, viele andere. Darum kümmere ich mich gar nicht.«
»Aber er ist doch in Konstantinopel gewesen, hat mit europäischen Diplomaten verhandelt.«
»Machen andere auch. Wenn es so weit ist, suche ich mir den Herrn, der mich am besten bezahlt. So lange kümmere ich mich um so etwas gar nicht. Erst muss es richtig losgehen.«
»Werden denn die Leute hier richtig bezahlt?«
»Bezahlt? Hm. Ja und nein. Wir sind mehr — mehr...«
»Sklaven.«
»Sklaven? Wo denkt Ihr hin! Und doch. Ich weiß schon, was Ihr meint. Wisst, ich habe von den alten Landsknechten gehört, die sich als Soldaten mit Leib und Seele an einen kriegführenden Fürsten verkauften, für ein tüchtiges Handgeld, auch Lohn bekommen sollten, diesen aber gewöhnlich nicht erhielten.
Dafür durften sie sich durchs Plündern schadlos halten, oder schon durchs Fouragieren. Seht, wir sind Seeknechte. In Madras erhielt jeder ein paar Goldstücke als Handgeld, ich als Bootsmann hundert Rupien, das ist doch schon ein ganz gutes Stück Geld, um es in einer Nacht zu verjubeln. Aber von einer Heuer ist gar nicht gesprochen worden. Wir bekommen auch nichts.«
»Auch nicht in Konstantinopel?«
»Ja, da wollte ich vom Zahlmeister drei Pfund haben. Ich sei wohl verrückt, meinte er. Ein Pfund genügte doch. Well, da hatte er auch ganz recht. Und so hat jeder etwas bekommen. Ja, wir wissen recht wohl, dass wir uns hier sozusagen als Sklaven verkauft haben. Das ist eben indisch.«
»Waren denn aber alle, die sich bei der Musterung meldeten, mit solchen Bedingungen einverstanden?«
»Es wurden eben nur solche genommen, welche diese Verhältnisse kennen und damit einverstanden sind. Beim Aussuchen war der Franzose dabei, der Monsieur Belois, der immer beim Schiffsherrn ist, sein Vertreter, und der hat ein gar scharfes Auge, der kannte gleich seine Leute. Engländer, Deutsche und Skandinavier wurden nicht genommen. In Madras bummeln aber hauptsächlich auch nur französische Matrosen herum, und Monsieur Belois sah jedem gleich an, ob er diese Verhältnisse kenne oder nicht. Außerdem waren ja viele Zutreiber da.«
»Es findet auch keine Abmusterung mit nachträglicher Auszahlung statt?«
»Nee. Gibt's gar nicht. Wer die Geschichte satt hat, reißt bei irgendeiner Gelegenheit aus. Reklamieren kann uns der Schiffsherr oder Kapitän natürlich nicht. Und wer wieder erwischt wird, dem geht's wahrscheinlich traurig. Der kriegt die Peitsche. Aber daran denkt ja niemand. Das ist hier doch ein ganz fideles Luderleben. Habt Ihr Euch schon eine Frau ausgesucht? Könnt auch noch gleich Familie dazu kriegen, ein paar Kinder. Freilich müsst ihr vielleicht mit einem teilen. Aber Eifersucht gibt's hier nicht.«
Diese Unterredung fand gleich am ersten Tage statt, es war schlechtes Wetter, niemand ließ sich an Deck sehen, der nichts darauf zu suchen hatte. Trotzdem hatte Axel schon bemerkt, dass an Bord eine ganze Masse Weiber und auch Kinder sein müssten. Aber wie viele, das wusste auch der Bootsmann nicht zu sagen. Zwei bis drei Dutzend. Oder auch vier. Der Bootsmann wusste ja nicht einmal, wie stark die Mannschaft war. Die Matrosen konnte er wohl zählen, aber nicht die Stewards, die Köche, von den anderen dienstbaren Geistern gar nicht zu sprechen. Die Kerls liefen ja immer durcheinander.
»Ja, wurde denn die Mannschaft gar nicht in einer Musterrolle registriert?«
»Das wohl, aber die ist weg. Als ein Matrose bei der Hinfahrt über Bord ging, wollte man einmal nachsehen, wie der Kerl eigentlich geheißen hatte, aber der Zahlmeister konnte die Musterrolle nicht finden. Er meint, er habe mit dem großen Bogen Papier wohl einmal seinen Papageikäfig zugedeckt, und das Vieh habe ihn total zerfressen.«
Das klang gar nicht so ungeheuerlich für damalige Verhältnisse, zumal es sich um ein orientalisches Schiff handelte.
Da klingt es schon ungeheuerlicher, wenn man hört, dass noch heute spanische, italienische und selbst französische Dampfer keine Passagierlisten führen. Es ist Vorschrift, aber es wird ihr nicht nachgekommen. Geht einmal solch ein Auswandererdampfer unter, dann ist das Geschrei stets groß — keine Passagierlisten, das ist ja kaum glaubhaft! — und dann schläft die Sache wieder ein, die Bummelei geht weiter.
Mehr also konnte ihm der Bootsmann nicht berichten. Axel hielt weitere Umschau an Bord dieses merkwürdigen Schiffes. Durch jede Tür, die er unverschlossen fand, durfte er gehen. Manchmal ein weibliches Kreischen, das ihn zum diskreten Rückzug nötigte. Er hätte diesen vielleicht nicht einmal nötig gehabt. Oder aber: Vor der Tür, oftmals nur durch einen Vorhang verschlossen, standen ein oder einige indische Wächter, finstere Kriegergestalten, herkulische Sikhs aus dem Himalaja, bis an die Zähne bewaffnet, die dem Ankommenden schweigend das entblößte Flammenschwert entgegenhielten, und das sagte genug.
Die Tage vergingen in südlicher Fahrt. und Axel bekam den Grafen nicht wieder zu sehen, so wenig wie den Schah und diesen französischen Ratgeber. Axel fragte einmal den Bootsmann.
»Keine Ahnung, Sir.«
Dann durfte Axel von den anderen erst recht keine Auskunft erwarten. Was sich hinter jenen Türen befand, vor denen die indischen Engel Gabriels mit den Flammenschwertern Wache hielten, das war... tabu, heilig, unergründlich, vor jedem profanen Auge geschützt.
Eine Woche später, nach ununterbrochenem Kampfe mit widrigen Winden, tauchte vor dem ›Stern von Indien‹ eine felsige Insel auf, sich mit himmelhohen Bergkegeln einsam und jäh aus der endlosen Wasserwüste erhebend.
»Ascension«, sagten die Steuerleute, nachdem sie eine geografische Berechnung gemacht hatten.
»Was für eine Insel ist das?«, fragte Axel seinen ebenfalls Steuermannsdienste verrichtenden alten Freund.
»Nix«, entgegnete Morphium. »Nur dazu vorhanden, dass Schiffe mit Mann und Maus daran zerschellen.«
»Bewohnt?«
»Weiß nicht. Von dieser Felseninsel braucht kein ehrlicher Seemann etwas zu wissen.«
Axel ging ins Kartenhaus und schlug im Handbuch nach, das in englischer und spanischer Ausgabe vorhanden war.
Ascension, Himmelfahrtsinsel, am Himmelfahrtstage 1508 vom Portugiesen Tris
tan Azuna entdeckt, portugiesischer Besitz. Unbewohnt, wasserlos, völlig un
fruchtbar. Aber viele essbare Schildkröten. Bei ruhiger See in Booten da und dort
zu landen.
So war damals in den nautischen Handbüchern zu lesen, und das war auch noch 65 Jahre später über die Himmelfahrtsinsel in ihnen zu lesen.
Dann aber musste die neue Ausgabe redigiert werden.
Der Bericht über Ascension sollte sich gewaltig ändern.
An dieser Himmelfahrtsinsel haben die Engländer der Menschheit bewiesen, dass menschlicher Unternehmungsgeist, menschliche Energie und Ausdauer sogar den Himmel bezwingen. und das im buchstäblichsten Sinne des Wortes!
Am 15. Oktober des Jahres 1815 betrat der gestürzte französische Weltbezwinger als englischer Gefangener den Boden der englischen Insel St. Helena.
Da vernahmen die Engländer, ein Franzose habe eine Schar Abenteurer um sich versammelt, mit denen er den Exkaiser befreien wollte, und die Operation solle von Ascension ausgehen; auf dieser verlassenen Insel, 160 Meilen von Helena entfernt, wollten sie sich darauf vorbereiten.
Weiter hat man von dieser ganzen Geschichte nichts gehört, nicht einmal den Namen jenes kaisertreuen Franzosen. Vielleicht auch war alles nur ein Gerücht.
Jedenfalls aber kaufte die englische Regierung diese wüste Insel Portugal sofort um ein Butterbrot ab, schickte einige Kompanien Marinetruppen hin, die eine Kaserne erbauen und Befestigungen aufwerfen mussten. Sie wurden mit genügendem Proviant versehen, während der Regenzeit schnell angelegte Zisternen füllten sich mit Wasser.
Vierzehn Jahre hörte man nichts mehr von der weltverlassenen Himmelfahrtsinsel. Napoleon brauchte nicht mehr bewacht zu werden, der war schon längst tot. Aber die englischen Soldaten, 220 Mann, waren auf der wüsten Insel nicht untätig gewesen, erst hatten sie Gärtchen anzulegen versucht, sie freuten sich des Gelingens — und als im Jahre 1829 die englische Admiralität den Kapitän Bandreth nach Ascension schickte, um den Einsiedlern wieder Proviant zu bringen, da wurde dieser gar nicht mehr gebraucht. 44 Morgen Landes standen unter der höchsten Gartenkultur, Straßen waren gebaut, ein hundert Meter tiefer Brunnen spendete Wasser, und... das Allermerkwürdigste! — der Himmel selbst spendete ab und zu Regen!
Außerhalb der Regenzeit war früher hier ein Regenfall gar nicht vorgekommen. Jetzt umzog sich der Gipfel des 800 Meter hohen Green Mountain, der aber erst so getauft worden war, weil an seinen Anhängen die 44 Morgen Gärten angelegt worden, jede Nacht mit einer dichten Nebelwolke, die sich oft genug in Wasser auflöste.
Das Wunder war geschehen. Der arbeitende Mensch hatte den Himmel, hatte Gott besiegt. Heute ist die einstmals absolut wüste Felseninsel ein irdisches Paradies, an den Abhängen die herrlichsten Gemüse, Obst- und Weingärten, auf den üppigen Triften weiden Ziegen, Schafe und Rinder, die auf dem afrikanischen Festland erkrankten Engländer suchen und finden hier Gesundung, und der Himmel spendet immer mehr Segen, indem er von ganz allein durch seine Feuchtigkeit neue Strecken Lavaschlacke in fruchtbaren Humus verwandelt.
Es ist dies das erste Mal gewesen, dass solch eine Umwandlung hervorgebracht wurde, wenigstens so ersichtlich, im Laufe eines Menschenalters, so mit bewusster Absicht. Bisher wusste man nur, dass blühende Reiche, manchmal ungeheueren Umfanges, durch Versandung so zugrunde gehen können — wie zum Beispiel Persien und Ägypten — und der Mensch musste ohnmächtig zusehen.
Bei der Kultivierung von Ascension hat man ein neues Naturgesetz entdeckt. Es lag ja schon immer in der Luft, die Gelehrten kannten es schon längst. Aber was will alle Theorie sagen! Die Praxis, die Praxis!! Das handgreiflichste Resultat!
Besiegt den Boden, und ihr besiegt den Himmel. Schafft Grünes, so viel ihr könnt, und mit jedem Grashälmchen, das ihr dem störrischen Boden entlockt, schickt ihr etwas Feuchtigkeit zum Himmel empor, und kraft des Gesetzes, dass Gleiches Gleiches anzieht, muss der Himmel auch wieder Feuchtigkeit herabsenden. Und der Tautropfen wird zum Nebel und der Nebel zur Wolke und die Wolke zum Regen. Aber über eine Wüste können schwarze Wolken noch so tief herunter hängen, die lassen auf die verbrannte Fläche keinen Tropfen fallen. Nur dem, der da hat, wird gegeben.
Und so arbeiten die Engländer auch schon seit langen Jahren daran, das riesige Ägypten wieder zu dem zu machen, was es einst gewesen ist. Denn was es jetzt ist, der schmale fruchtbare Streifen am Nil, das ist doch gar nicht mehr der Rede wert. Die Engländer suchen jede einzelne Oase durch Anlegung von Kanälen immer mehr auszudehnen, Zoll für Zoll drängen sie die Wüste zurück, und die Wasserstauwerke am oberen Nil sind wohl die ungeheuersten Arbeiten der modernen Ingenieurbaukunst.
Kann man es den Engländern verdenken, wenn sie Ägypten schon jetzt als ihr Eigentum betrachten? Kann man es ihnen verdenken, wenn sie dereinst, sollte man ihnen ihr Eigentum streitig machen wollen, ihr gutes Recht mit Waffengewalt verteidigen werden? Denn sie haben Ägypten bereits erobert, aber nicht durch Waffengewalt, sondern durch Arbeit, durch Fleiß und Schweiß, und da darf man nicht viel vom Aussaugen fremder Arbeitskräfte sprechen! Der Schreiber dieses hat selbst in englischen Diensten in Ägypten gearbeitet, bei der Karawanenbrücke von Fum el Bagger, auch bei der Kanalisierung der Oase Fayum, und er hat diese englischen Ingenieure als Helden der Arbeit Tag und Nacht im Sattel sitzen sehen, im Sonnenbrande hin und her jagend, und in der eisigen Wüstennacht ein Dutzend Mal durch den Nil schwimmend, und alle wir anderen Arbeiter. Europäer und Araber und Kulis. sind von ihnen höchst, höchst anständig behandelt und bezahlt worden!
Ja, das klingt wohl etwas anders, als was jetzt unsere Zeitungen immer über die Engländer schreiben! Glücklicherweise aber — Gott sei Dank! — kümmert sich der erste deutsche Mann im deutschen Reiche nicht um dieses Zeitungsgewäsch, sondern er ist der bewundernde und bewunderte Freund diesem Engländer. Und so muss es sein, es darf nicht anders sein! Denn so, wie es keine Preußen und Sachsen und Bayern und GreizSchleizLobensteiner geben darf, sobald es sich um ein politisches Deutschland handelt, so darf es, wenn es sich um die kulturelle Eroberung der Welt handelt, auch keine Deutschen und Engländer geben, sondern nur noch Germanen, welche gemeinsam zu kämpfen haben gegen Romanen und Slawen und Mongolen, durch Arbeit, durch Geist und in letzter Instanz auch mit den Waffen! —
Dass der ›Stern von Indien‹ die wüste Felseninsel in Sicht bekam, war natürlich nur ein Zufall. Zu dieser Zeit waren auf ihr nicht einmal Schildkröten zu finden.
Das Schiff kreuzte gegen den widrigen Wind hin und her, man war zufällig in die Nähe dieser Insel gekommen. Übrigens noch sehr, sehr weit entfernt. Es war noch früher Morgen, am Abend hätte man sie noch nicht erreicht gehabt.
Zu bemerken ist noch, dass den zu steuernden Kurs allein der Kapitän angab. Das war ein älterer Franzose, sehr finster aussehend, trotzdem gegen seine Untergebenen sehr höflich, dabei ungemein wortkarg.
Er gab den Kurs an, machte auf kleine Mängel aufmerksam — und genug, sonst kein Wort weiter.
Zweimal hatte Axel bemerkt, wie ein indischer Diener, der aus dem bewachten Heiligtum kam, ihm einen Zettel überbracht hatte, und der Kapitän schrieb eine Antwort zurück. Es war ohne Belang gewesen, Axel hatte es nur zufällig beobachtet. Die eingeschlossenen Herrschaften wollten doch auch manchmal wissen, wo sie sich befanden.
Axel hatte das Kartenhaus wieder verlassen, stand an der Reling und betrachtete die fernen Felsenmassen, nicht an den Entdecker Tristan Acuna denkend, sondern an eine ganz reizende Inderin, die er selbst vorhin entdeckt hatte.
»Ob ich mich ranmache?«, murmelte er.
»Ganz sicher, Belionda ist doch ein reizendes Geschöpf, was schon in ihrem Namen liegt. «
Axel fuhr herum und starrte fassungslos in des Grafen lächelndes Gesicht.
»Alle Teufel.... wie können Sie meine Gedanken erraten?!«
»Sie haben ihre Gedanken ziemlich laut gedacht.«
»Ich wusste ja noch gar nicht, wie das Mädel heißt!«
»Aber ich sah vorhin, wie Sie ihr mit so eigentümlicher Miene nachblickten.«
»Haben Sie?«
»Ich nicht, sondern Sie.«
»Haben Sie das gesehen, meine ich? Ich habe Sie noch gar nicht wieder gesehen. Wo haben Sie unterdessen gesteckt?«
»Im Heiligtume, im Heiligsten und im Allerheiligsten.«
»Und was treiben Sie da?«
»Ich muss die Heiligkeiten unterhalten.«
»Mit Fiedeln?«
»Auch.«
»Allen Respekt vor Ihrem Violinspielen, aber... haben diese indischen Heiligkeiten die Fiedelei noch nicht satt?«
»Ja, teilweise schon.«
»Und dann haben Sie mit Steinen geschmissen?«
»Auch.«
»Und dann?«
»Dann habe ich ihnen etwas vorgegaukelt.«
»Dem Schah?«
»Mehr noch seinen Haremsdamen.«
»Sollten auch diese mit dergleichen Hokuspokus verwöhnten Damen sich so lange unterhalten lassen, dass Sie acht Tage lang keine Minute Zeit haben, um einmal Ihre Freunde aufzusuchen?«
»Es war eine ganz besondere Art von Gaukelei, die ich in dem Harem trieb.«
»Poussiererei!«
»Signor Axel!«
»Na, was für eine besondere Art von Gaukelei denn sonst?«
»Ich habe Bandwürmer hervorgegaukelt. Faktisch. Alle die Haremsdamen, gerade ein Dutzend, fühlten sich in letzter Zeit sämtlich recht elend, ohne richtig krank zu sein. Sie aßen viel mit bestem Appetit, sahen aber alle so schlecht aus. Da habe ich erkannt, dass sie sämtlich den Bandwurm haben — nicht nur einen einzigen alle zusammen, sondern jede einen, oder auch mehrere. Die Damen haben offenbar in Konstantinopel nicht gargekochtes, finniges Fleisch gegessen. Und ich verstehe mich auf den Bandwurm, weiß ein ganz einfaches, aber sicheres Mittel. Und da habe ich den Damen den Bandwurm abgetrieben.«
Axel blickte den Sprecher starr an, steckte den Finger in den Mund und blies.
»Graf, ich glaube nicht, dass Sie trivial sein wollen, Sie sprechen sachgemäß als Arzt...«
»Das tue ich auch.«
»Aber... bitte, verekeln Sie mir diese ganze holde weibliche Gesellschaft nicht!«
»Nur in den Harem des Schiffsherrn hat sich der Bandwurm eingeschlichen, ich musste schon alle anderen deswegen vornehmen... nein, die anderen sind frei davon, auch Ihre Belionda.«
»Na ja, schon gut, schon gut! Und diese Bandwurmgaukelei hat dem Schah imponiert?«
»Ganz mächtig. Ich bin jetzt nicht nur Hofmusikus, sondern auch Hofmedikus....«
»Hofbandwurmabtreiber.«
»Scherz beiseite, ich habe mir eine gar wichtige Position erobert. Diese Haremsdamen sind nur zum kleinsten Teil Inderinnen, meistens Mohammedanerinnen, und wissen Sie, was es bedeutet, Leibarzt von Mohammedanerinnen zu sein, die sonst keinem fremden Manne auch nur die Nase zeigen dürfen?«
»Jawohl, das weiß ich. Und bei der Bandwurmabtreiberei müssen sie wahrscheinlich noch etwas ganz anderes zeigen als nur die Nase. Und wenn die Damen keine Bandwürmer mehr haben, dann... sticht man dem Leibarzt vielleicht die Augen aus und hackt ihm die Hände ab, damit diese Organe nicht mehr wissen, was sie gesehen und gefühlt habend
»Im Grunde genommen haben Sie recht. Aber dieses Schicksal habe ich nicht zu befürchten. Die Sache ist folgende: Der Schah hat eine Heidenangst vor dem Bandwurm, nämlich im eigenen Leibe. Dieser Schah hat schon viel Pulver gerochen, ist schon gegen feuerspeiende Batterien gestürmt... hat nichts zu sagen gegen den Gedanken, solch eine bandähnliche Riesenschlange im Leibe zu haben. Ich muss ihn mehrmals untersuchen, bei den verschiedensten Gelegenheiten, ob er auch bandwurmfrei ist. Verstehen Sie?«
»Ich verstehe und gratuliere Ihnen, beneide Sie aber nicht um diese Untersuchungen.«
»Ich bin dem Schah tatsachlich schon unentbehrlich geworden, werde es auch immer bleiben.«
»Ja ja, ich verstehe schon, ich nehme die Sache mit all ihrer ernsten Wichtigkeit, wenn ich mich auch etwas humoristisch ausdrücke. Ich verstehe schon — die Angst ob solch einer Krankheit lässt nie nach, sie wächst nur immer, also werden Sie dem Schah auch immer unentbehrlicher, Sie bekommen ihn immer mehr in die Tasche, und das kommt auch uns anderen Sklaven zugute.«
»Dann haben Sie mich richtig verstanden. Wissen Sie, was für eine Insel das dort ist?«
»Ascension.«
»Was wissen Sie sonst von ihr?«
»Dass man nichts weiter von ihr zu wissen braucht. Nicht einmal Schildkröten sind jetzt drauf.«
»Richtig. Hören Sie: Dieses Schahs Ziel ist Indien, und er hat alle Ursache, schnellstens dorthin zu gelangen. Und wenn er jetzt dort auf jener Insel einen ungeheueren Klumpen Gold oder den Stein der Weisen wüsste, der ewige Jugend verleiht, er würde deshalb diese Insel nicht anlaufen. So eilig hat er es, Indien zu erreichen.«
»Ich glaube es schon. Aber warum sagen Sie mir das? Sie machen heute überhaupt recht merkwürdige Sprünge in Ihrer Konversation.«
»Lassen Sie mich sprechen. Und wenn der Schah wüsste, dass es dort auf der Insel ein Mittel gibt, durch dessen Verschlucken er niemals den Bandwurm bekommen könnte, er würde deshalb diese niemals anlaufen.«
»Dann lässt er's eben bleiben. Und?«
»Trotzdem aber wird er diese Insel anlaufen, obgleich darüber mindestens zwei Tage vergehen werden.«
»Weshalb wird er die Insel anlaufen?«
»Weil ich ihn darum gebeten habe.«
»Ist auf dieser Insel auch so ein geografischer Punkt von jenem Sir Dalton angegeben?«
»Ja, aber denken Sie nicht, dass sich der Schah durch irgendwelche Neugier auch nur um einen Strich von seinem Kurs abbringen ließe...«
»Herr Graf, halten Sie mich nicht für so schwer von Begriffen. Sie meinen, Ihr Wunsch, Ihre Bitte allein schon hat vermocht, den Schah vom Kurse abzuweichen, diese Insel anlaufen zu lassen.«
»So ist es. Schon ist meine Bitte zum Befehl geworden...«
»Ich verstehe, ich verstehe. Sie brauchten nur zu drohen, dass Sie nicht mehr die tägliche Riesenbandwurmuntersuchung an ihm vornehmen wollen...«
»Solch eine Drohung war gar nicht nötig.«
»Nein nein, ich verstehe schon, Sie haben diesen edlen Schah bereits in der Tasche. Großartig! Ja, ich weiß es zu würdigen. Sie sind und bleiben eben ein Hexenmeister. Also auch für Ascension haben die Hellseher Sir Daltons eine geografische Ortsbestimmung gegeben?«
»Ja, sogar zwei. Da wir nun einmal hier in der Nähe sind, will ich sie auch untersuchen. Ich habe wegen des schwarzen Schiffes jetzt Ruhe gefunden.«
»Sie haben dem Schah von dem Zettel mit seinen geografischen Angaben erzählt?«
»Nein, noch nicht, und deshalb eben wollte ich Sie sprechen. Wir sind hier ganz ungestört. Es könnte doch einmal sein, dass ich in Ungnade falle, dieses Inders Habgier könnte doch einmal gereizt werden, und dann könnte er auf eigene Faust weitersuchen. So habe ich jenen Zettel gleich vernichtet...«
»Aber Sie haben doch eine Abschrift davon gemacht!«
»Die könnte mich in dieselbe Gefahr bringen.«
»Ja, aber wenn Sie keine Abschrift haben...«
»Ich habe ja jede einzelne Angabe im Kopf.«
Axel sah den Graf mit etwas eigentümlichen Blicke an.
»Ja, Sie wohl, aber ich nicht.«
»Es genügt doch, wenn ich es im Kopfe habe, wir bleiben doch immer zusammen.«
»Meinen Sie? Hm. Na, gut denn, dann will ich nur immer gut auf Sie aufpassen, dass nicht etwa auch Sie mir einmal verloren gehen...«
»Ich kann Ihnen die Bestimmungen ja aufschreiben, sobald wir das sorglos tun dürfen.«
»Na, gut denn. Und also weiter?«
»Ich habe dem Schah einigen Hokuspokus vorgemacht, den auch dieser durch Gaukeleien aller Art verwöhnte Inder nicht begreifen kann, besonders durch Gedankenlesen. Er hält mich tatsächlich für mit magischen Fähigkeiten ausgestattet, und... etwas ist ja auch daran, obgleich ich Ihnen gegenüber nicht etwa...«
»Schon gut, schon gut — ich weiß bereits, was an Ihnen nicht ist«, unterbrach ihn Axel mit seiner gewöhnlichen Offenherzigkeit.
»So habe ich ihm erzählt«, fuhr der Graf unbeleidigt fort, »dass ich eine eigentümliche Gabe des Fernfühlens besitze. Oder richtiger, es ist ein Nachfühlen. Wenn ich mich einem Orte nähere, an dem etwas vergraben oder sonst wie verborgen liegt, dessen Finden für mich großes Interesse hätte, so... empfinde ich das eben sofort, und zwar entstehen da vor meinen geistigen Augen gleich Zahlen, welche nichts anderes ausdrücken als die geografische Lage dieses Ortes nach Pariser Zeit. Verstehen Sie?«
»O ja, ich verstehe, ganz schlau ausgedacht. Und das haben Sie dem Schah plausibel zu machen verstanden?«
»Ja. Auch dem Monsieur Belois, der seine rechte Hand ist und dereinst sein erster Minister sein soll. Leicht ist es mir allerdings nicht gefallen. Und nun wollen sie sich eben davon überzeugen. Doch von Neugier, ob ich diese Wundergabe auch wirklich besitze, werden sie eigentlich nicht getrieben...«
»Sondern Sie haben eben schon so viel Gewalt über den Schah bekommen, dass Ihr Wunsch für ihn Befehl ist.«
»So ist es tatsächlich. Ohne unbescheiden sein zu wollen.«
»Und von dem geckenhaften alten Franzosen gilt dasselbe?«
»Nicht so ganz. Aber der hat gar keine so große Macht über den Schah, und überdies bewundert er mich doch auch schon etwas.«
»Wann haben Sie denn in diesem Falle die Empfindung bekommen, dass dort auf der Insel etwas verborgen liegt?«
»Heute Nacht schon, als ich noch mit den beiden zusammen saß. Gesprochen hatte ich schon früher davon. Ich bat den Schah, den Kurs des Schiffes dorthin zu richten, wohin mich meine Empfindung trieb, und der Kapitän erhielt den Befehl dazu. Wo ich mich befand, wusste ich ja.«
Die Unterhaltung wurde dadurch unterbrochen, dass ein indischer Diener kam, welcher den Hofmusikus und Leibmedikus zu seinem Herrn befahl.
»Ich schildere Ihnen später noch ausführlich, wie ich das mache, vielleicht können Sie einmal dabei sein, jetzt instruieren Sie nur die beiden anderen, dass die nicht etwa etwas ausplaudern, was mich kompromittiert«, flüsterte der Graf seinem Freunde noch zu und folgte dem Diener.
Bei Sonnenuntergang befand sich der ›Stern von Indien‹ noch immer gegen sechs Seemeilen von der Felseninsel entfernt und würde sich ihr auch nicht so bald weiter nähern können, denn es war völlige Windstille eingetreten, welche nach menschlicher Berechnung längere Zeit anhalten würde.
Für die Mannschaft bestand ja nun kein Zweifel mehr, dass ihr Schiff es auf diese Insel abgesehen, dass man ihr einen Besuch abstatten wollte. Einer von den französischen Matrosen war früher schon einmal darauf gewesen, sein Schiff hatte sich mit Schildkröten verproviantiert, er schilderte seinen Kameraden diese eigentümliche Jagd und sprach weiter von der Trostlosigkeit der Himmelfahrtsinsel.
»Da wollen wir sicher auch Schildkröten holen, wie wir uns vor acht Tagen auf jener Insel mit lebenden Hühnern verproviantiert haben«, meinte einer.
»Nein, jetzt gibt's dort keine Schildkröten, nicht einmal Eier, die sind schon ausgekrochen.«
»Das musst du aber dem Kapitän sagen.«
»Denkst du, das weiß der Kapitän nicht? Kapitän Charmy weiß alles.«
»Ja, was wollen wir sonst auf der Insel suchen, von der nichts zu holen ist?«
»Was weiß ich, und was geht's dich an?«
Hiermit war die Sache erledigt, die Matrosen gingen während der windstillen Nacht, die keine Arbeit erforderte, ihrem Vergnügen nach, das sich ihnen unter Deck bot.
Axel hatte beizeiten Kapitän Morphium und Sam vorgenommen, dann schloss er sich den Matrosen an, nur mehr seine eigenen Wege gehend.
Als er gegen Mitternacht an Deck kam, traf er mit dem Grafen zusammen, der nach den Sternen spähte.
»Störe ich Sie?«
»Durchaus nicht.«
»Falls Sie astronomische Beobachtungen machen.«
»Nein, ich träume nur.«
»Na, dann können Sie mir gratulieren«, sagte Axel und hielt ihm gleich die Hand hin.
»Herzlich gern«, lächelte der Graf, die Hand ergreifend. »Wozu denn aber, wenn ich fragen darf?«
»Zu meiner Verlobung.«
»Aha, nun weiß ich genug! Ich gratuliere. Hier an Bord dieses Schiffes muss man doch aber erst fragen: zur Verlobung mit jener Belionda?«
»Ja, und Sie können mir auch gleich zu meiner Verheiratung gratulieren.«
»Das glaube ich schon, das glaube ich schon. Also, ich gratuliere Ihnen auch gleich zu Ihrer Verheiratung.«
»Na, dann können Sie mir auch gleich noch zum dritten Male gratulieren.«
»Wozu denn das?«
»Sie fragen noch? Wir sind schon wieder glücklich geschieden.«
»Was, schon wieder?!«, lachte der Graf. »Das ist aber doch etwas schnell gegangen.«
»Verliebt, verlobt, verheiratet und geschieden — alles innerhalb einer Stunde. Ja, sehen Sie, wer schnell lebt, der lebt lange. Wir sind während unserer Ehe zur Überzeugung gekommen, dass wir doch nicht recht zusammen passen.«
»Warum denn nicht?«, musste der Graf lachen, weil Axel das gar so trocken hervorbrachte.
»Weil — weil — die Jungfrau ist mir zu wohl genährt.«
»Zu wohl genährt? Die ist doch ganz schlank!«
»Da täuschen sich einmal Ihre sonst so scharfsichtigen Augen — wissen Sie, ich, ich... bin ein bisschen zu spät gekommen — in ein paar Wochen könnten Sie mir auch noch gleich als glücklichem Vater gratulieren — und das ist doch ein bisschen gar zu schnell gelebt...«
Der Graf machte, dass er fortkam.
Die Nacht verging. Das Schiff bewegte sich nicht von der Stelle.
Kaum tauchte der oberste Saum der Sonnenscheibe über den Horizont empor, im Nu die finstere Nacht mit dem hellen Tage verdrängend, als die Bootsmannspfeife schrillte, mit dem durch besonderes Trillern hervorgebrachten Befehl, die große Jolle klarzumachen.
Mochte es auch ein Zigeunerschiff sein, so war doch alles in seetüchtigem Zustande. In dem Boote befanden sich schon die vorschriftsmäßigen Wasserfässchen und fester Proviant, um Schiffbrüchige möglichst lange am Leben zu erhalten — jetzt freilich kam noch ganz anderer Proviant hinzu, Limonadenkrüge und dergleichen, über dem Heck ward schnell noch ein Baldachin aufgebaut.
»Sie kommen natürlich mit«, sagte der Graf zu Axel, »ebenso auch Kapitän Morphin und Sam. Wir gehören zusammen.«
»Müssen wir mit helfen, irgendwelchen Hokuspokus zu treiben?«
»Nein. Es war mein Wunsch, meine alten Gefährten mitzunehmen, und das genügte.«
»Wer kommt denn sonst mit?«
»Nur der Schah, Monsieur Bellois und zwei der Leibwächter.«
»Damit wir nicht etwa einen Putsch gegen ihn ausführen, indem wir den Spieß umdrehen und zur Abwechslung einmal den edlen Schah zu unserem Sklaven machen?«
»O nein, er hat nicht das geringste Misstrauen gegen mich. Zwei bewaffnete Leibwächter gehören aber nun einmal zu der Majestät, die dieser Schah tatsächlich schon ist, durch seine Geburt, wenn auch noch ungekrönt, wenn er es vielleicht auch niemals wird. Und Sie werden vernünftig sein, nicht wahr?«
»Wie immer!«
»Na! Einige der rudernden Matrosen werden uns dann als Diener begleiten, uns Wasser und anderes nachtragen. Erst muss ich ja bestimmen, wo der Punkt eigentlich ist. Er kann doch vielleicht direkt an der Küste sein.«
Der Schah erschien an Deck, im Stehen und Gehen erst recht einen äußerst stattlichen Eindruck machend, wirklich ein geborener Herrscher. Neben ihm der alte Franzose im geckenhaften Sportanzug, hinten den beiden zwei riesenhafte Sikhs, furchtbar bewaffnet.
Das schon herabgelassene Boot war vollbepackt, die Rudermannschaft darin. Sie bestand aus zwei Matrosen und vier indischen Kulis, den Steuerer spielte einer der Steuerleute. Kapitän Morphin und Sam gingen wie Axel nur als Passagiere mit.
Wie ein Pfeil schoss das Boot über die spiegelglatte Meeresfläche. In noch nicht einer dreiviertel Stunde hatte es die Küste erreicht, eine Bucht, von bizarren Felsblöcken umsäumt, lud direkt zum Landen ein. Gepeilt zu werden brauchte nicht, auf dem Grunde konnte man jedes Steinchen sehen, und er war für das Boot tief genug, sodass es anlegen konnte.
Während der doch ziemlich langen Fahrt hatte der Schah immer Axel angesehen, aber kein Wort gesagt, und Monsieur Belois schien sich recht ungemütlich zu fühlen, sich in dem kleinen Boot so weit von dem Schiffe entfernen zu müssen. Mochte das Meer auch noch so ruhig sein — es war doch immer das balkenlose Meer, diese wüste Felseninsel kam da gar nicht in Betracht.
Sie verließen das Boot. Es sah fürchterlich hier aus. Alles starrend von spitzen Basaltfelsen.
»Wo ist nun der Ort, wo du etwas liegen fühlst?«, fragte der Schah, zum ersten Male den Mund öffnend.
»Ich weiß nur, dass ich mich in seiner Nähe befinde, und dann kenne ich nur die Zahl, sie steht, sobald diese Empfindung kommt, immer vor meinen geistigen Augen.«
»Wie war die Zahl?«
Der Graf schloss die Augen und deklamierte nach einer kleinen Pause eine lange Zahl her, die wir nicht wiederzugeben brauchen.
In diesem Augenblicke kam es Axel zum Bewusstsein, wie schlau der Graf gehandelt, in welch gefährliches Spiel er sich aber auch eingelassen hatte.
Von seiner Gedächtniskraft schien er dem Schah noch nichts erzählt und vorgemacht zu haben, es war aber immerhin ziemlich schwer, einen doch wohl ziemlich aufgeklärten Mann in dem Glauben zu erhalten, solch eine geografische Ortsbestimmung träte nur ab und zu vor seine geistigen Augen, wenn eben auch das Gefühl hinzukäme, dass in der Nähe irgend etwas Besonderes verborgen läge.
»Wie weit hast du immer diese Empfindung?«
»Das ist ganz verschieden. Manchmal befinde ich mich, wenn sie mich befällt, nur noch wenige Schritte davon entfernt, manchmal aber auch viele, viele Meilen und selbst Tagemärsche, so wie ich diese Zahl ja auch schon in voriger Nacht erblickt habe, und sie wies, wie wir uns gleich überzeugten, hier auf diese Insel hin.«
Was der Graf dem Schah erzählt hatte, wie er schon früher solche Untersuchungen angestellt habe, davon hatte er gar nichts zu Axel gesagt, darüber ihn zu instruieren hatte er eben nicht für nötig gefunden, und dieser Mann wusste schon, was er tun und lassen durfte.
»Du brauchst aber doch nur hier eine geografische Ortsbestimmung zu machen«, fuhr der Schah fort, »dann weißt du, wie weit du von jenem Ort noch entfernt bist.«
»Gewiss, und ich bin schon dabei«, entgegnete der Graf, sich vom Steuermann aus dem Boot einen Sextanten mit dem nötigen Zubehör geben lassend.
Axel unterstützte ihn bei der Berechnung, bald war sie gemacht.
Danach befanden sie sich von dem Orte etwas über eine halbe geografische Meile entfernt, und zwar schien, soweit man das jetzt schon bestimmen konnte, dieser ungefähr in der Mitte der Insel zu liegen, die etwa zwei geografische Quadratmeilen umfasst, etwas länger als breit ist.
»Eine halbe geografische Meile, zwei englische?«, meinte der Schah, besorgt die spitzen Basaltblöcke musternd, die sich endlos vor ihm hinzogen, und der ganze Boden war wie mit Nägeln bedeckt, und Monsieur Belois machte noch ein ganz anderes Gesicht, schon mehr ein verzweifeltes.
»Wohl, machen wir uns auf den Weg, ich muss deine Gabe prüfen!«, entschied der Schah.
Auch die vier indischen Kulis verließen das Boot, bepackten sich mit allem, was mitgenommen worden war, der eine musste auch noch einen großen Sonnenschirm über seinen Herrn halten, so setzte sich die Karawane in Bewegung.
Das Boot blieb nur mit den zwei französischen Matrosen und dem Steuermann zurück.
Es war ein fürchterlicher Weg. Allerdings nicht für die indischen Diener, die waren barfuß und das Barfußlaufen gewöhnt, sie brauchten nur die spitzigsten Steine zu vermeiden. Bei den beschuhten Europäern aber waren schon nach wenigen Minuten die Stiefelsohlen zerschnitten oder gebrochen, und wie sie über diese spitzen Steine kommen sollten, wenn sie erst auf nackten Sohlen liefen, das war für Axel noch eine offene Frage, die er aber schon zu beantworten suchte.
Und dann, wenn die Sonne erst höher stieg, würden auch die Inder darankommen. Der schwarze Basaltstein musste die Sonnenhitze einsaugen, und der kann auch kein gewohnter Barfußgeher widerstehen.
Ebenso interessierte sich Axel schon jetzt, wie es mit dem Schah werden würde. Der war nicht barfuß, trug aber auch keine festen Stiefel, sondern nur ganz leichte Schuhe aus rotem, feinem Saffianleder.
Es ging nach dem Berge zu, der sich in der Mitte der Insel jäh erhob — bis in die Wolken, hätte man sagen können, und das mit Recht, wenn Wolken vorhanden gewesen wären.
»Wir werden doch nicht etwa diesen Berg erklimmen müssen?«, fragte Monsieur Belois schon jetzt in jammerndem Tone.
»Gewiss, wenn sich jener Ort auf dem Gipfel dieses Berges befinden sollte, so werden wir ihn bis zum Gipfel ersteigen«, entgegnete der Schah, und der Franzose schwieg.
Am Fuße des aus der Ebene kegelförmig aufsteigenden Berges ward wieder eine geografische Bestimmung gemacht, und sie ergab, dass sich der betreffende Ort recht wohl auf dem Gipfel dieses Berges befinden konnte.
Unterdessen war das Unvermeidliche schon eingetreten: Die beschuhten Männer hatten nur noch Lederfetzen an den Füßen, an den Sohlen so ziemlich gar nichts mehr, sie gingen seit geraumer Zeit schon wie auf Eiern, besonders dem Franzosen entschlüpfte mancher Wehlaut.
Nur des Schahs dünnes Schuhzeug, das für einen Teppich berechnet zu sein schien, war noch in tadellosem Zustande, und Axel beschloss, sich für zukünftige Bergpartien mit Lavagrund ebenfalls solche dünne Saffianbabuschen anzuschaffen, die freilich wohl mehr kosten würden als die besten Reit- oder Seestiefel. Zwischen Leder und Leder ist eben ein Unterschied, die Stärke macht es nicht aus.
Außerdem brannte die Sonne immer senkrechter herab, und der Abhang des schwarzen Berges sah erst recht fürchterlich aus. Zu erklimmen war er freilich leicht, überall ragten die spitzen Lavasäulen empor, man konnte sich mit den Händen fortgreifen aber das war es eben!
»Du irrst dich doch nicht?«, wandte sich der Schah mit gerunzelter Stirn an den Grafen. »Dort oben liegt der Ort wirklich?«
»Wo, das kann ich ja noch nicht sagen, aber hinauf müssen wir jedenfalls.«
»Und dort oben liegt wirklich etwas, was des Ansuchens wert ist?«
»Unbedingt.«
»Du fühlst gar nicht, was es sein könnte?«
»Gar nicht.«
»Du kannst nicht unterscheiden, ob es Gold oder überhaupt ein Metall oder ob es vielleicht... ein uralter Baum ist, der dort oben Nahrung gefunden hat?«
»Nein, einen Unterschied in der Empfindung habe ich nicht. Es können die verschiedensten Gegenstände sein, oder auch nicht einmal ein Gegenstand. Wie ich Ihnen erzählte, ergaben die letzten drei Untersuchungen, die ich in dieser Weise anstellte, wobei mich hier diese drei Männer unterstützten, in den Trümmern Karthagos einen mechanischen Elefanten, der wohl als Moloch angebetet worden war, in der ägyptischen Wüste fanden wir ebenfalls einen Götzen, und dazwischen entdeckten wir an der tunesischen Küste, aber doch ziemlich mitten im Meere, eine süße Quelle, die dem Meeresgrunde entsprang. Ist es nicht so, meine Freunde?«
Da konnten seine drei Begleiter leicht bejahen. Der Graf hatte eben das Klügste getan, was ein kluger Mann tun kann, er war bei der Wahrheit geblieben.
Freilich mochte er dem Schah noch von vielen anderen Funden erzählt haben, die er auf diese Weise gemacht hatte, er konnte diese wunderbare Gabe des Fernfühlens und geistigen Zahlensehens doch nicht so plötzlich bekommen haben, aber davon wussten eben seine drei Begleiter nichts, die waren damals noch nicht bei ihm gewesen.
Der Schah blickte einen der drei nach dem anderen kopfschüttelnd an.
»Im salzigen Meere eine Süßwasserquelle?«, richtete er zum ersten Male an diese das Wort.
Alle drei konnten es nur bestätigen, und der Schah schüttelte wieder den Kopf.
»Ich kann es nicht begreifen.«
»Aber ich habe Ihnen doch ganz genau demonstriert, wie das möglich ist«, sagte der »wie das Wasser durch einen unterirdischen Tunnel gedrückt wird...«
»Deine Erklärung und Zeichnung habe ich begriffen, und doch muss ich staunen, wie so etwas möglich ist. Machen wir eine kurze Rast, erfrischen wir uns etwas, dann ersteigen wir den Berg. Und sollte ich auch drei Tage daransetzen, und sollte ich auch erst Leitern anfertigen lassen müssen — ich will wissen, was sich dort oben befindet, wodurch du dich angezogen fühlst.«
Die Diener bereiteten eine Limonade, der Schah trank und überließ den Krug den anderen, zum Essen hatte niemand Appetit, so wenig es eine Erholung gewesen wäre, sich auf den schattenlosen, schon heiß werdenden Boden niederzulassen.
Der Aufstieg begann. Er war nicht gerade fürchterlich, es gibt noch ganz andere Kletterpartien, er war auch nicht gerade lebensgefährlich, aber es genügte. Vor allem der immer glühender werdende Lavaboden, der die nackt gewordenen Fußsohlen verbrannte, auch die der schon abgehärteten Inder.
Nur des Schahs dünne Saffianbabuschen trotzten allen Strapazen. Aber er sah, was die anderen litten, musste es ja besonders an dem Franzosen sehen, und er zeigte sich als gefühlvoller Mensch.
Zu der Ausrüstung, welche die vier indischen Matrosen auch noch zu schleppen hatten, gehörte ein kleines Zelt, nur für den Schah bestimmt, ein zweiter Mensch hätte kaum darunterkriechen können — und der Schah ließ die Leinwand zerschneiden, Stricke waren genug mitgenommen worden, und jeder umhüllte seine Füße.
Es zeigte sich, dass diese plumpen Fußhüllen für solch eine Klettertour viel praktischer waren, als es die Stiefel gewesen, sie gestatteten ein viel schnelleres Fortkommen, vorbei war alles Brennen, und die nachgiebige Leinwand zerschnitt auch nicht so leicht.
So vergingen ziemlich drei Stunden unter fortgesetztem Ansteigen, nur dass hin und wieder eine Sonnenaufnahme gemacht wurde. Ein Berg von 800 Meter Höhe will eben erstiegen sein, zumal, wenn man immer die Hände mit zu Hilfe nehmen muss.
Dann noch eine geografische Bestimmung, und sie hatten ihr Ziel erreicht. Wohl befanden sie sich auf der Höhe des Berges, aber ein ganz so regelmäßiger Kegel war dieser ja doch nicht, er bildete oben eher eine Plattform, die nach Süden von einer noch ziemlich großen Felsmasse begrenzt wurde, die nach dieser Seite mit ganz glatten Wänden abfiel, sodass ihnen nach Süden also die Aussicht versperrt wurde.
Doch dies alles hatte ja nichts zu sagen. Diese die Aussicht verhindernde Felswand muss nur erwähnt werden, weil sie der Expedition eine große Überraschung, die ihrer später wartete, verbarg.
Die ganze Himmelfahrtsinsel ist vulkanischen Ursprungs, die Feuerkräfte der Erde müssen hier einst furchtbar gehaust haben, aber seit Menschengedenken ist niemals mehr ein Ausbruch erfolgt.
Hier oben war der Herd der Eruptionen gewesen, wie ja nicht anders zu erwarten war. Die Krater waren nur sehr klein, aber dafür reihte sich einer an den anderen.
Es waren recht seltsame Krater. Wohl trichterförmig sich nach unten verjüngend, aber am Boden immer ganz rund, sodass jeder Krater ungefähr immer einem großen Waschkessel glich. Wie diese Bildung entstanden, das vermag ja kein Mensch zu erklären, oder es sind eben immer nur Hypothesen.
Als Zisterne konnten diese Kessel wohl schwerlich dienen, dass sie etwa während der Regenzeit Wasser auffingen und bis zur Verdunstung behielten, denn unten der runde Boden war immer kreuz und quer mit Rissen durchzogen, da sickerte sicher alles durch, in unbekannte Tiefen hinab.
Der Graf hatte die letzte Berechnung gemacht, noch einige Schritte, und er deutete in solch einen Steinkessel hinein, oben etwa von zehn Meter Durchmesser und keine sechs Meter tief.
»Hier ist der Ort!«
So, nun konnten sie hineinblicken. Ein ungeheuerer Wasch- oder Schlachtkessel mit ganz glatten Wänden, nur dass diese von schwarzem Stein waren und unten der Boden mit zahllosen Rissen durchzogen. Das war alles.

Die anderen waren sicher nicht minder enttäuscht. alles blickte fragend den Grafen an, der ebenfalls ein verlegenes Gesicht machte.
»Ja, wo ist denn nun das, was wir hier finden sollen?«, fragte der Schah.
»Ich... weiß es nicht.«
Da allerdings war es mit der edlen Selbstbeherrschung, auf die der Mohammedaner ebensoviel hält wie der Buddhist. endlich vorüber. Diese Enttäuschung überwog auch alle Bandwurmfurcht.
»Christenhund vermaledeiter!!«, donnerte er den Grafen an. »Du wagst mich zu foppen?! Ein Wink von mir, und diese beiden Krieger hauen dich zusammen!«
Axel fürchtete für seinen Freund das Schlimmste. Er hatte schon längst erkannt, dass dieser gewöhnliche Gleichmut des Schahs ganz erkünstelt, es war eigentlich eine äußerst jähzornige Natur, und jetzt hatte er schon die Hand erhoben, mehr noch aber lag die hervorbrechende Wut in seinen Augen, ebenso die Blutgier in denen der beiden wilden Krieger, sie hatten schon die Hand an den furchtbaren Schwertern, warteten nur noch auf den letzten Befehl, nur auf einen Fingerwink, um den verachteten Christenhund, der sie aus der Gunst ihres Herrn verdrängt hatte, zusammenzuhauen.
Der Graf hätte ja sagen können: Ja, dann hat eben hier etwas gelegen, ein anderer hat es schon fortgeholt, es ist sonst wie aus dem Kraterkessel verschwunden.
Das wäre natürlich eine sehr törichte Entschuldigung gewesen. Dann hätte er doch nicht mehr bis zuletzt solch eine vorgebliche magische Empfindung dafür haben dürfen. Dann wäre des Schahs Jähzorn sicher erst recht entflammt.
Axel aber fürchtete, dass der Graf in seiner ersten Verlegenheit, die auch diesen Mann einmal befallen konnte, dennoch zu dieser Entschuldigung greifen könne, und er machte sich schon bereit, den vorspringenden Indern die Beine wegzuziehen. Hoffentlich hatte er alle vier Beine recht hübsch beisammen. Was dann kommen würde, das wusste nur Gott.
»Ein Wink von mir, und ich lasse dich Hund von meinen Kriegern zusammenhauen!!«
Aber der Graf zuckte mit keiner Wimper, und sein Gesicht drückte auch keine Verlegenheit mehr aus, es war eisern geworden.
»Befiehl es ihnen, und du hast einen Unschuldigen töten lassen.«
Axel atmete auf. Er suchte wenigstens Zeit zu gewinnen — das war schon viel wert.
»Wo ist das, was hier drin liegen soll?!«
»Ich weiß es nicht.«
»Du willst doch nicht etwa sagen, dass es schon ein anderer geholt hat?!«, kam denn auch der Schah gleich auf diese übrigens am nächsten liegende Entschuldigung.
»O nein, dann hätte ich mich doch nicht angezogen gefühlt, hätte die Zahlen der geografischen Ortsbestimmung nicht immer vor Augen gesehen.«
»Ja, wo und was ist denn das aber, was wir hier oben finden sollen?«
»Gestattet mir, dass ich erst noch einmal die Augen schließe.«
Der Graf tat es, und als er sie wieder öffnete sagte er:
»Die Zahlen erscheinen mir immer noch, es sind immer noch dieselben, und die geografische Berechnung, die ich vorhin doppelt machte, stimmt ebenfalls, auch mein Gefühl sagt mir, dass wir hier am Ziele stehen — hier in diesem Kraterkessel befindet sich das gesuchte Geheimnis.«
Der Schah starrte wieder in den Kessel.
»Hund, du willst mich foppen!«, erklang es nochmals, aber doch schon ganz anders. »Da ist doch nichts drin!«
»Und warum nicht?«, gab der Graf mit unerschütterlichem Gleichmut zurück.
»Was?! Oder bin ich denn etwa blind?!«
»Konnte ich denn damals etwa erkennen, dass sich im Meerwasser eine süße Quelle befand? Auch ich glaubte schon, meine Empfindung und das magische Zahlensehen habe mich einmal genasführt, ich wollte schon weitersegeln — bis ganz zufällig das Wasser gekostet wurde. Da war das Rätsel gelöst, ich hatte mich nicht geirrt.«
Axel wusste noch immer nicht, wie sich der Graf weiter retten wollte — und der Schah wusste ebenfalls noch nichts.
»Wasser? Ja, in dem Kessel ist doch aber kein Wasser.«
»Erblicken Sie aber nicht an dem Boden die vielen Risse?«
»Ja, eben durch diese versickert alles Wasser.«
»Muss es denn gerade Wasser sein?«
»Du meinst, in diesen winzigen Rissen könnte etwas verborgen sein?«
»Ich weiß ja nicht, aber ich glaube das kaum. Doch könnte diesen Rissen nicht vielleicht ein Gas entströmen?«
»Ein Gas entströmen? Ich merke nichts davon.«
»Es braucht ja auch nicht immer zu entströmen. Gesetzt aber nun den Fall, diesem vulkanischen Boden entströmt manchmal ein Gas, welches sich an der Luft von selbst entzündet, wie es solche natürliche Gasflammen gibt — ist das nicht ein Naturwunder, wohl wert, dass es aufgesucht wird, sodass ich die Empfindung gehabt und die geografischen Ortszahlen gesehen habe?«
Der Schah wurde gleich nachdenklich.
»Hm, du magst nicht so unrecht haben — es gibt solche Gasflammen, die aus der Erde hervorbrechen, ich habe davon gehört — in Baku und noch in vielen anderen Gegenden der Erde, auch in Indien, obgleich ich solch ein Naturwunder noch nicht geschaut habe.«
»Bravo«, jubelte Axel innerlich, »dieser Fuchs von Graf hat sich wieder aus der Schlinge zu ziehen gewusst!«
Denn für Axel war es ziemlich klar, dass hier drin einmal etwas anderes gelegen hatte. Das war unterdessen nur schon abgeholt worden. Zu dieser Annahme hatte er zwar weiter gar keinen Grund, hinwiederum kam ihm die Gasgeschichte des Grafen erst recht bei den Haaren herbeigezogen vor.
Die Hauptsache aber war, dass der Schah sich mit dieser Gaserklärung anscheinend gleich zufrieden gab.
»Oder es braucht ja kein brennbares, sich selbst entzündendes Gas zu sein«, verbesserte der Graf seine Antwort noch mehr. »Vielleicht ist es ein der Gesundheit zuträgliches Gas, es heilt Krankheiten, wenn man sich darin badet oder wenn man es einatmet.«
Während Axel über seinen Freund ein ›Bravo‹ jubelte, blickte der Schah jetzt mit ganz anderen Augen in den Trichter hinein, man sah sogar, wie er durch die Nase die Luft intensiver einzog.
»So, meinst du? Ja, ich weiß, dass es Gase gibt, welche schwerer sind als die Luft, sie würden sich also am Grunde dieses Kessels aufhalten. Wir wollen hinabsteigen — vorsichtig.«
»Die Möglichkeit bleibt bestehen, dass diese Gase nur zeitweilig den Ritzen entströmen.«
»Ich gebe das zu — trotzdem, ich will hinabsteigen.«
Der Schah war so vorsichtig, an einem Seile erst einen der indischen Diener hinabzulassen. Da der am Leben blieb, keine Atembeschwerden fühlte, konnte es kein giftiges Gas sein.
Nur der Graf und Axel waren ihm gefolgt. Diese beiden waren Männer, die nicht so leicht einer Illusion unterlagen, ganz besonders deshalb nicht, weil sie selbst bei anderen Illusionen zu erzeugen verstanden. Wer hypnotisiert werden kann oder doch sehr leicht, der eignet sich sicher nicht zum Hypnotiseur.
Also der Graf und Axel sogen, sich auch einmal bückend oder auch ganz hinlegend, prüfend die Luft ein und waren überzeugt, dass der atmosphärischen Luft kein fremdes Gas beigemischt war.
Anders der Schah. Der wurde gleich ganz unruhig, als er in der Luft schnüffelte.
»Wahrhaftig — du hast recht — das riecht hier so nach nach nach... ganz merkwürdig — ich fühle auch, wie mich so eine fremde Atmosphäre umspült — das geht mir durch alle Glieder, das prickelt so erfrischend...«
Der Schah war als Opfer seiner Einbildung durchaus kein Narr.
Kohlensäure, welche den nackten Körper umspült, übt auf die Haut, auf das Nervensystem, einen fühlbar prickelnden Reiz aus. Das ist also Tatsache.
Nun geh in solch eine therapeutische Anstalt, oder wie sie sonst heißen mag, du willst ein Kohlensäurebad nehmen, der Arzt hat es dir verordnet, dir schon etwas von der Wirkung erzählt, du hast auch sonst schon vorher darüber Erkundigung eingezogen.
Du wirst nackt in einen Kasten gesteckt, siehst nur mit dem Kopfe heraus. Der Arzt will aber mit dir nur einmal ein Experiment machen, er erzählt dir nochmals, wie du das Prickeln der Kohlensäure am ganzen Körper fühlen wirst, dann dreht er den Hahn auf... lässt aber statt der Kohlensäure nur gewöhnliche atmosphärische Luft einströmen.
Trotzdem wirst du ganz deutlich das Prickeln der vermeintlichen Kohlensäure auf der Haut wahrnehmen, und nicht nur das, sondern auch alle Begleiterscheinungen werden eintreten, als wenn du in einem wirklichen Kohlensäurebad säßest, dein Puls- und Herzschlag werden beschleunigt, du musst viel schneller atmen, und die wohltätigen oder schädlichen Folgen dieses vermeintlichen Kohlensäurebades werden dich auch nach Hause begleiten.
Hierauf, auf eben derselben Kraft der Einbildung — lieber Leser, vernimm es!! — beruhen auch die ganze Homöopathie und der ganze Heilmagnetismus. Und trotzdem ist beides Tatsache! Und trotzdem beruhen die heilkräftigen Wirkungen der Homöopathie und des tierischen Magnetismus nur auf Einbildung! Und trotzdem haben diese beiden Verfahren tatsächlich die größte heilende Wirksamkeit! Wer Homöopathie und Heilmagnetismus einen Schwindel nennt, der spricht sich selbst das Urteil, und wer das öffentlich in die Welt hinausschreibt, der wird selbst dereinst verspottet werden.
Aber Homöopathie und Heilmagnetismus sind als wirksame Kräfte nur für den da, der auf einer genügend hohen geistigen Stufe steht, um sie als solche zu empfangen. Diese Höhe der geistigen Stufe ist ganz unabhängig von dem, was man gelernt hat. Ein Bauernknecht, der kaum lesen und schreiben kann, steht vielleicht — vielleicht! — auf einer viel, viel höheren geistigen Stufe als ein Professor aller Fakultäten. Der Bauernknecht, als Bauernkind geboren, hätte nur in eine andere Familie aufgenommen zu werden brauchen, wo er studieren konnte, und aus ihm wäre vielleicht noch etwas ganz anderes geworden als jener Professor aller Fakultäten. Und wenn dieser jetzige Professor als Kind ausgesetzt und von einer armen Tagelöhnerfamilie gefunden worden wäre, die sich seiner erbarmt, so wäre er ein Bauernknecht geworden, aber vielleicht kein geistig hochstehender, sondern ein tierähnlicher Mensch.
Allein die Kraft der Einbildung, allein die Phantasie entscheidet, auf welcher Stufe der Mensch steht. Die Gabe der Phantasie ist das wahrhaft Göttliche im Menschen. Dazu kommt der Glaube. Phantasie, oder richtiger Einbildungskraft, und Glaube ist überhaupt ein und dasselbe. (Wie das gemeint ist, kann hier nicht näher erklärt werden; wer fähig ist, das zu verstehen, weiß es überhaupt ganz von selbst.) Und kraft dieser Einbildungskraft vermag sich der, der sie besitzt — so paradox das auch klingen mag — jeder falschen Einbildung zu erwehren, indem er sich durch nichts mehr täuschen lässt.
Das ist der Grund, warum Tiere überhaupt nicht für Homöopathie und Heilmagnetismus empfänglich sind, sich gegen sie ganz indifferent verhalten.
Das ist der Grund, warum die auf einer sehr hohen geistigen Stufe stehenden Menschen gar nichts von Krankheit wissen.
Oder kannst du dir Jesus Christus, der nach allen seinen hinterlassenen Aussprüchen auf der höchsten geistigen und moralischen Stufe gestanden haben muss — und Unmoral ist nichts weiter als Unkenntnis, also die höchste Moral auch die höchste Weisheit — kannst du dir den vorstellen, wie er etwa von Zahnschmerzen geplagt wird?
Der Schreiber dieses kennt einige Menschen persönlich, von denen er sich nicht vorzustellen vermag, wie sie einmal krank sein können.
Doch muss man das nur richtig verstehen. Einmal krank werden können sie gewiss, es sind doch irdische Menschen. Aber sie wollen nicht krank sein, sie wollen nicht!!! Sie haben keine Zeit zu solcher lächerlichen Schlumperei! Sie haben wohl einmal Schmerzen, aber sie fühlen dieselben nicht, kraft ihres Willens, kraft ihrer Einbildungskraft! Sie versenken sich in eine Arbeit, und weg ist der Schmerz. Sie setzen sich mit den heftigsten Kopfschmerzen zur geistigen Arbeit hin, sie gehen mit hinkendem Fuß aufs Feld — und die sich anmeldende Krankheit gibt sich besiegt, zieht sich vor dem allmächtigen Willen des Menschen zurück!
Hunderte von Beispielen beweisen das als Tatsache. Aber im Grunde genommen ist es nicht der Wille — überhaupt ein ganz undefinierbares Ding sondern es ist die Kraft der Einbildung, die von einem felsenfesten Glauben unzertrennbar ist.
Als Schiller nach seinem Tode seziert wurde, standen die Ärzte staunend vor dem unfassbaren Rätsel, wie der mit dem letzten zusammengeschrumpften Reste eines einzigen Lungenflügels noch so lange hatte leben können.
Als Napoleon der Große nach seinem Tode entkleidet wurde, erkannte man mit grenzenlosem Staunen, dass sein ganzer Körper mit Narben bedeckt war, zum Teil mit fürchterlichen Narben. Wer hatte denn je gehört, dass Napoleon einmal ernstlich verwundet wurde? Die kolossale Begeisterung seiner Soldaten, wie eine solche fanatische Begeisterung für einen Heerführer die Weltgeschichte noch nie geschaut hatte und wohl auch nicht so bald wieder schauen wird, rührte ja nicht zum kleinsten Teile daher, dass sie ihren Kriegsgott für unverwundbar hielten. Er war eben ein Gott, kein Mensch. Und, ach, wie oft mag Napoleon schwer vermundet zu Pferde gesessen haben, und niemand seiner Umgebung ahnte etwas davon, und als die Schlacht geschlagen, stieg er wie gewöhnlich aus dem Sattel, schritt festen Ganges in sein Zelt, um sich dort in aller Heimlichkeit die schwere Schenkelwunde von seinem zur Verschwiegenheit verpflichteten Leibarzt verbinden zu lassen!
Und solche Willenskraft, richtiger Einbildungskraft, zieht auch noch weitere Kreise, da kann man wirklich schon von Zauberei sprechen.
In Belgrad liegen 150 000 christliche Streiter an Cholera, Ruhr und Gott weiß was für Seuchen todkrank danieder, dasselbe gilt von der französischen Armee in Ägypten, und da tritt dort der FranziskanerMönch Johannes Kapistranus und hier der Advokatensohn Napoleon Bonaparte an die Sterbebetten; jetzt ist Gelegenheit, den Feind zu schlagen, auf, auf, ihr seid nicht krank, das ist nur Larifari, nur Einbildung!... und die todkranken Armeen erheben sich wie ein Mann und schlagen den Feind — dann kann sich jeder gemütlich zum Sterben hinlegen — vorausgesetzt, dass er sich dann noch krank fühlt.
O, es ist herrlich, in der Weltgeschichte zu lesen, die schon mit der Bibel beginnt!
Da erkennt man, was für ein herrliches Geschöpf, der Mensch ist — das heißt, der wirkliche Mensch, der sich abgesondert hat von den mit Hemd und Hosen oder Kittel bekleideten Herdenschafen.
Und zu dieser Absonderung braucht er nicht auf Schlachtfelder zu gehen, das kann er auch im Fabriksaal oder in der stillen Stube besorgen, zwischen Büchern wie an der Schreibmaschine, die höchste Philosophie schreibend oder Adressen. Das ist im Getriebe des Weltalls alles eins, alles eins.
Die Abendländer (wenn sie überhaupt an eine Seele glauben) sagen: Der Mensch hat einen Körper mit einer Seele. Der buddhistische Morgenländer sagt: Der Mensch hat eine Seele mit einem Körper.
Das ist eigentlich das A und das O aller Selbsterkenntnis, die der Anfang aller Weisheit ist, und wer den Kern der Sache begreift, der hat sich bereits abgesondert.
»... Ich fühle, wie mich eine fremde Luft umspült — das geht mir durch alle Glieder, das prickelt so erfrischend...«
So und anders flüsterte der Schah mit den dazu nötigen Bewegungen, noch nicht richtig wissend, ob er diese ›fremde Luft‹ auch mit vollen Zügen atmen dürfe.
Dieser Graf von Saint-Germain sowohl wie dieser prinzliche Depeschenreiter waren befähigt, über andere Menschen zu herrschen, in gutem wie im bösen Sinne, sie aufzuklären oder sie zu täuschen — wobei die Täuschung noch gar nicht einem bösen Motiv zu entspringen braucht.
Und diese beiden Männer brauchten sich nur anzublicken, so hatten sie sich verstanden und wussten. was sie zu tun hatten.
»Nicht wahr?«, sagte der Graf zunächst nur.
»Ja, das geht mir bis in die Fingerspitzen«, bestätigte Axel, mit diesen Fingerspitzen zappelnd.
»Monsieur Belois, kommen Sie doch herab!«, tief der Schah.
»Ist das Gas aber auch wirklich nicht der Gesundheit schädlich?«, fragte der Franzose ängstlich zurück.
»Es gibt solche Gase, die einem erst ganz gut bekommen, man fängt zu lachen an, hinterher aber hat man den schrecklichsten Katzenjammer.«
»Nein, nein, Lachgas ist es nicht, das kenne ich«, versicherte der Graf.
»Es erpresst mir aber auch keine Tränen«, setzte Axel hinzu und bekam dafür von seinem Freunde einen heimlichen Tritt aufs Hühnerauge.
Endlich ließ sich Monsieur Belois bewegen, ebenfalls herabzukommen, und dieser geckenhafte Franzose musste nach dem Grundsatze, dass jede Eitelkeit stets ein Zeichen von geistiger Beschränkung ist, erst recht dieser Einbildung unterliegen — das heißt, einer fremden, ihm suggerierten Einbildung, während die, welche diese Kraft der Einbildung besaßen, selbst davon frei bleiben konnten, sobald sie es wollten.
»Wahrhaftig, wie das angenehm in der Nase kribbelt — ha ha ha hatzschiehhh!! — das ist ja großartig, ich fühle mich plötzlich wie neu geboren. Und sehen Sie nur, wie mein Schweiß plötzlich verschwunden ist.«
»Ob das Kohlensäure ist?«
»O nein, das ist ein ganz schädliches Gas.«
»Ja aber, was mag das sonst sein?«
»Ich halte es für gespaltenen Sauerstoff«, meinte der Graf.
Was konnte dieser Abenteurer schon von Ozon und Antozon wissen, welche Namen erst ums Jahr 1840 auftauchten, nachdem man durch Experimente erkannt hatte, dass der Sauerstoff der Luft durch den elektrischen Funken in positiv und negativ elektrischen Sauerstoff zerlegt wird, ohne welche Spaltung und spätere Wiedervereinigung die Atmosphäre der Erde bald in Fäulnis übergehen würde!
Die Namen Ozon und Antozon hatte er allerdings nicht gebraucht, aber hiermit hatte er verraten, dass er schon mit Elektrizität experimentierte, für die freilich die damalige Menschheit ebenfalls noch nicht einmal einen Namen hatte, wenn auch schon die alten Griechen wussten, dass Bernstein, von ihnen Elektron genannt, beim Reiben die Fähigkeit annimmt, kleine Körperteilchen anzuziehen. Wohl gab es schon damals Männer genug, die sich mit Erforschung der Elektrizität beschäftigten, die geheimnisvolle Naturkraft auch so nannten, aber die galten für damalige Zeiten als... etwa mit unseren Spiritisten vergleichbar.
»Was ist das, gespaltener Sauerstoff?«, fragte der Schah.
»Das ist... ein noch gar nicht entdecktes Gas, das höchst, höchst selten dem Erdboden entquillt.«
»Das habe ich mir doch gleich gedacht!«, entgegnete Axel, während die anderen beiden in ihrer Verzückung gar nichts von dem Unsinn merkten.
Auch die sechs indischen Diener mussten herabkommen, und entweder unterlagen auch sie der Suggestion, oder es waren tierähnliche Menschen, Hunde, welche aus knechtischem Gehorsam und Liebedienerei das bestätigten, was ihr Herr von ihnen hören wollte, und so wurde zuletzt doch noch eine Suggestion der Einbildungskraft daraus. Denn es waren eben zweibeinige, keine vierbeinigen Hunde.
So tanzte die ganze Gesellschaft in dem großen Wurstkessel herum, und ganz besonders der Schah ward immer verzückter, sein Zustand glich zuletzt wirklich einem Rausche.
»Köstlich, köstlich!! Führwahr, das lohnt diese beschwerliche Kletterpartie! Ja, für diese eine Stunde würde ich eine ganze Woche opfern, und wenn auch Thron und Krone auf dem Spiele ständen. Fürwahr, ich fühle mich plötzlich ganz verjüngt, wie neu geboren!«
»Und ich fühle mich schon wie ein Embryo«, setzte der herumtanzende Axel hinzu und bekam dafür von seinem Freunde wieder eins aufs Hühnerauge.
Ein Glück nur, dass sich Kapitän Morphium ausnahmsweise ganz vernünftig zeigte — das heißt, sich damit begnügte, seine Freude, sein Entzücken über diese köstliche Luft zu äußern, wie die verjüngend auf ihn wirkte, und das war ja ganz normal, und dass er dabei immer nur auf einem Beine herumtanzte, das hatte nichts zu sagen.
»Ob ich einmal meinen ganzen Harem hier heraufbringe?«, meinte der Schah. »Die Weiber haben gerade nach der Bandwurmkur eine solche Erfrischungskur sehr nötig.«
»Aber der Marsch, erst der furchtbare Marsch!«, klagte der Franzose, von der Erinnerung überwältigt.
»Sie werden getragen.«
»Wollen Sie hier nicht einen bequemen Weg anlegen lassen? Wollen Sie überhaupt diese Insel nicht in Ihren Besitz nehmen? Mit einer so heilkräftigen Gasquelle! Der Kessel hier muss dann natürlich überdacht, zu einem komfortablen Bade eingerichtet werden.«
»Hm. Etwas weit von meiner Residenz entfernt. Und dann... ich habe doch erst anderes zu tun, ehe ich an meine Vergnügungen oder auch nur an eine Erholung denken kann.«
Dieser Gedanke an eine offenbar sehr unangenehme Sache ernüchterte den tatsächlich trunken gewesenen — bekanntlich kann man schon durch Redensarten be... trunken gemacht werden — Schah wieder etwas, wenigstens begehrte er, den mit gespaltenem Sauerstoff gefüllten Wurstkessel wieder zu verlassen.
»Jedes Übermaß schadet, der Weise kostet auch kein Vergnügen bis zur Neige aus.«
Vorkehrungen waren vorher getroffen worden, dass man den Kessel auch wieder verlassen konnte, und wenn jetzt das um einen Felsblock geschlungene Seil riss, dann hätten sie hier in diesem Wurstkessel trotz seiner gesundheitsdienlichen Füllung verhungern und verschmachten können, und das wäre gar schnell gegangen. Oder sie hätten sich als Akrobaten produzieren müssen, die eine Pyramide von vier Mann hoch bilden können.
Aber der erste Inder war schon oben, und nun war diese Gefahr beseitigt.
Hier oben zeigte sich, dass der Schah durch den unangenehmen Gedanken doch nicht so ganz ernüchtert worden war, die freudige Stimmung ob dieser großartigen Entdeckung hielt noch nach.
Seinen stattlichen Bart in die Hand nehmend, wandte er sich an seinen Hofmusikus und Leibmedikus und sagte zu ihm mit einer Freundlichkeit, die man diesem martialischen Manne gar nicht zugetraut hätte:
»Christenhund! Du hast bewiesen, dass du kein Betrüger bist. Du hast bewiesen, dass du kein einfacher Gaukler bist. Du kannst mehr als alle anderen Menschen, und ich bin glücklich, dass du mein Sklave bist. Du hast mir etwas gezeigt, was ich noch nie gesehen habe. Christenhund, sprich eine Bitte aus — und beim Barte des Propheten, was für eine Bitte es auch sei, ich will sie dir erfüllen, Thron und Reich will ich mit dir teilen, so du darum bittest... wenn ich die Erfüllung deiner Bitte für gut befinde. Das schwöre ich dir beim Barte des Propheten zu! Nun bitte.«
Das ist ja ein ebenso kurioser wie schlauer Kauz mit seinem fatalen Nachsatz, dachte Axel. Der Graf aber hatte diesen Nachsatz ja schon einmal gehört, vielleicht schon mehrmals, und er machte eine dankbare Verbeugung.
»Ich bitte um nichts weiter, als dass mir der mächtige Alum Schah immer ein gnädiger Herr sein möge.«
»Diese Bitte sei dir erfüllt, beim Barte des Propheten... wenn du dich dieser meiner Gnade auch immer würdig zeigst. Gehen wir zum Schiffe zurück.«
»Gestatte noch einen Augenblick, edler Schah.«
»Was willst du noch, Christenhund?«, wurde der edle Schah schon jetzt ungnädig.
»Jedes Mal, sobald ich solch einen empfundenen Ort aufgesucht und das Betreffende, was er verbarg, gefunden habe, erlischt diese merkwürdige Empfindung, die ich nicht näher beschreiben kann.«
»Das glaube ich schon.«
»Dann sehe ich auch die Zahlen der geografischen Ortsbestimmung nicht mehr vor Augen.«
»Nicht?«, begann sich der Schah, der erst ungeduldig hatte werden wollen, jetzt doch dafür zu interessieren. »Aber das ist mir begreiflich, soweit man so etwas überhaupt begreifen kann.«
»Doch jetzt habe ich wieder eine andere Empfindung, hier in der Nähe muss noch etwas anderes sein, was des Aufsuchens wert ist.«
»Was du nicht sagst! Siehst du auch schon wieder Zahlen?«
»Ich habe sie bereits gesehen, vorhin, als ich zufällig einmal die Augen schloss. Gestatte mir, dass ich in deiner Gegenwart einmal die Augen schließe, um die Zahlen deutlicher zu lesen.«
Der Schah gestattete, dass sein medizinischer und magischer Sklave die Augen schloss, und der Graf tat es.
Als er sie nach einer Minute wieder öffnete, sagte er eine sehr lange Zahl, eine neue geografische Ortsbestimmung betreffend, die wir nicht wiederzugeben brauchen.
»Wo wäre das?«
Offenbar wieder eine gute halbe geografische Meile von hier entfernt, aber nach Westen, und das bedeutete also wiederum eine Klettertour von drei Stunden, denn bergab war durchaus kein bequemerer Weg als bergauf.
Der Schah schien gar nicht von Neugier gefoltert zu werden, was man an dieser zweiten Stelle finden würde.
»Den Berg hinab müssen wir doch sowieso«, munterte der Graf den Unschlüssigen auf, »aber diesmal steigen wir die Westseite ab, die sogar viel weniger zerrissener aussieht als hier die Nordseite, und dann haben wir meiner Berechnung nach nur höchstens noch eine Stunde zu marschieren.«
»Ja, dann aber sind wir an der Westküste und noch anderthalb Stunden vom Boote entfernt.«
»Dieses muss einfach um die Insel herumrudern, wir schicken deswegen schon vorher einen Diener hin.«
Der Schah musste einsehen, dass es ziemlich gleichgültig war, ob man auf der Westseite oder auf der Nordseite abstieg, erstere sah von hier oben auch wirklich viel manierlicher aus. Nur der Form wegen musste er zeigen, dass man den Willen eines Schahs und zukünftigen Großmoguls nicht so leicht über den Haufen wirft.
»Aber wehe dir, Christenhund, wenn wir dort nichts finden!«, sagte er ganz ungerechtfertigterweise in möglichst drohendem Tone.
»Wir werden etwas Interessantes finden, meine Empfindung ist so bestimmt wie die Zahlenreihe, die ich neu vor Augen habe.«
»Wieder eine Gasquelle?«
»Das allerdings weiß ich nicht.«
»Das musst du aber wissen, du ungläubiger Christenhund!«
»Herr, ich...«
»Schweig, Sklave!! Und ich sage dir: Wenn dort wieder eine solche Gasquelle ist, nichts anderes, dann wird dir sofort dein Kopf vor die Füße gelegt. Denn wegen einer nochmaligen solchen Gasquelle mag ich keinen Umweg machen. Du wirst sofort zusammengehauen — beim Barte des Propheten!«
So sprach der Schah, und diesmal wartete man vergebens darauf, dass er noch so etwas hinzusetzte wie ›wenn ich es anders nicht für gut befinde‹.
Hinwieder schien es dieser rechtgläubige Muselmann mit dem Barte des Propheten auch nicht gar so ernst zu nehmen, er war wohl schon ein bisschen Freigeist.
Es wurde Limonade getrunken — zu essen vermochte niemand etwas — zwei der erleichterten indischen Diener wurden nordwärts hinab nach dem Boote geschickt, das man von hier aus, wie natürlich auch das Schiff, liegen sehen konnte, die anderen begannen den Abstieg auf der Westseite.
Bei der ersten Gelegenheit sonderte sich Axel von der übrigen Gesellschaft möglichst weit ab, und der Graf verstand ihn auch sofort, wusste sich ihm unauffällig beizugesellen..
»Teufel, Graf, Sie riskieren viel!«
»Was soll ich denn dabei riskieren?«
»Wenn dort unten wieder nichts ist?«
»War denn dort oben etwas?«
»Ja, Graf, das haben Sie wirklich großartig gemacht! Ach, wenn ich mich doch wenigstens jetzt nachträglich einmal ordentlich auslachen könnte! Wie die in dem Wurstkessel herumhopsten, weil sie sich durch das vermeintliche Gas immer jünger fühlten! Graf, Sie sind wirklich ein Hexenmeister. Ja, in dem Wurstkessel war aber nichts drin.«
»Was drin gewesen ist, ist inzwischen eben von einem anderen Menschen schon herausgeholt worden.«
»Haben Sie davon eine Spur bemerkt?«
»Nein.«
»Ich auch nicht, obgleich ich aufs Aufmerksamste um mich geschaut habe. Auf diesem Lavaboden, der nicht die geringste Spur hinterlässt, ist schwer etwas zu entdecken. Wer mag uns da zuvorgekommen sein?«
»Was weiß ich.«
»Das schwarze Schiff?«
»Möglich.«
»Sie haben auch jede einzelne Zahl dieser Ortsbestimmungen im Kopfe?«
»Da ist ein Irrtum meinerseits ganz ausgeschlossen.«
»Und was werden wir an dem neuen Orte finden?«
»So fragen auch Sie mich? Ich habe doch keine Ahnung.«
»Er wird nahe der Westküste liegen.«
»Das schätze auch ich. Vielleicht sogar schon im Meere.«
»Und wenn wir dort wieder nichts finden?«
»Na, dann weiß ich schon wieder eine andere Ausrede. Diesen Schah habe ich ja nun schon erkannt, und das ist immer die Hauptsache Einen Kopf kürzer lasse ich mich so leicht nicht machen. Bin ich nun einmal hier, dann will ich auch wissen, was der zweite Punkt zu bedeuten hat, und finde ich nichts, so genügt mir schon, zu wissen, dass es bereits abgeholt worden ist. Vorsicht, der Schah blickt nach uns Er ist eine misstrauische Natur, und in etwas gereizter Stimmung befindet er sich auch.«
Es gelang ihnen, sich unauffällig wieder mit der Gruppe zu vereinigen.
Aber wenn der Schah sich schon in gereizter Stimmung befand, so wuchs diese immer mehr, und dazu hatte er auch allen Grund.
Die erste Stunde war der Abstieg sehr gut gewesen, dann zeigte sich, dass man zu schnell geschlossen hatte. Jetzt wurde der Weg wirklich fürchterlich, nicht zu vergleichen mit jenem auf der Nordseite, bei jedem Schritte konnte man den Hals brechen oder sich aufspießen.
»Verdammter Christenhund, du hast mich gefoppt!«
»Wodurch, edler Schah?«
»Du räudiger Hund wagst auch noch zu fragen?! Du hast behauptet, dieser Abstieg wäre besser als der auf jener Seite! Ich lasse dich stinkiges Aas auf der Stelle sengen und brennen...«
So weit kam es zwar nicht, der Graf wusste schon immer wieder zu beschwichtigen, um die Sengerei und Brennerei zu vermeiden, aber in Schimpfworten wusste der edle Schah immer Neues zu erfinden, und das waren hier nicht nur solche zeremonielle Titulaturen, die sich damals jeder christliche Fürst gefallen lassen musste. wenn er mit einem hochgeborenen Muselmann in Korrespondenz trat.
Als der Graf und Axel wieder einmal abseits der anderen zusammentrafen, sagte letzterer:
»Ich glaube schon, dass dieser mohammedanische Inder dies im Grunde genommen gar nicht so meint, aber... zu mir dürfte er derartige Worte nicht lange sagen, ich glaube, ich fiele bald aus der Rolle.«
»Sie würden aus der Rolle fallen — ganz recht. Dadurch würden Sie nichts weiter beweisen, als dass Sie ein schlechter Schauspieler sind. Denn betrachten Sie dies nicht nur als eine lustige Komödie? Und wenn ein Komödiant die Rolle eines Sklaven zu spielen hat, wird er etwa in Wirklichkeit dadurch beleidigt, dass ihm sein mohammedanischer Gebieter die gröbsten Titulaturen an den Kopf wirft, wie es der Schauspieldichter vorgeschrieben hat?«
»Sie haben recht«, stimmte Axel gleich besänftigt bei. »Gut, ich betrachte dies fernerhin nur als eine lustige Komödie, und wenn der Muselmann meine Mutter beschimpft, so gehört das eben zu seiner Rolle, und ich habe alles geduldig hinzunehmen, wie es der Dichter vorschreibt. Aber... ich werde mir erlauben, später einmal die Rolle umzukehren, dann bin ich der christliche Herr, und der da ist mein mohammedanischer Sklave — und da soll der etwas von mir zu hören bekommen — zu hören, sage ich Ihnen! — ich habe nämlich selber ein Schauspiel geschrieben — aber keine Komödie, sondern eine Tragödie — wenn auch darin viel gekitzelt wird — und ich will meinen mohammedanischen Sklaven kitzeln, — kitzeln, sage ich Ihnen...«
»Was habt ihr krätzigen Hunde da zu schwatzen?!«, donnerte der Schah herüber.
»Mein Freund fragte mich soeben«, entgegnete der Graf mit schneller Geistesgegenwart, »ob es schwierig ist, vom Christentum zum Mohammedanismus überzutreten.«
Der Schah gab sich mit dieser Antwort zufrieden, ließ sich aber auch nicht weiter darauf ein, was eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Denn für den rechtgläubigen Mohammedaner gibt es kein höheres Verdienst, als einen Andersgläubigen seiner allein seligmachenden Religion zuzuführen. Nur muss dass Gesuch, wie schon einmal erwähnt, ganz freiwillig kommen, und dann hat der Übergetretene auch absolut keinen Vorteil davon. Geld gibt's also nicht etwa dafür, keinen Piaster, und sollte der Betreffende als Christ aufgehangen werden, so kommt er auch noch als rechtgläubiger Mohammedaner an den Galgen — natürlich, jetzt erst recht, jetzt hat er ja auch noch den Vorteil, direkt ins Paradies zu kommen, das ihm vorher verschlossen war.
Aber der Schah hatte jetzt keine Lust zur Proselytenmacherei, er knurrte etwas und stolperte weiter.
Wenn er nur nicht einmal stürzte! Axel war noch immer bereit, den beiden Kriegern, wenn sie den Grafen niederhauen sollten, die Beine unterm Leibe wegzuziehen.
Es war aber auch ein furchtbarer Weg, und nun die brennende Mittagssonne, die den schwarzen Stein in glühende Eisenplatten verwandelte, und die Sonne drehte sich doch immer mehr nach Westen!
»Christenhund, warum liegt dieser Punkt nicht wenigstens nach Osten, dass wir die Schattenseite hinabklettern konnten?!«
Endlich hatte man die Ebene wieder erreicht, und der Schah wurde etwas versöhnlicher gestimmt, weil es hier viel manierlicher aussah, die Lavablöcke fehlten, es war eine ziemlich glatte Steinfläche, die sich bis zur Küste erstreckte.
Dort oben vom Berge aus hatte man die Boden- und speziell die Küstenbeschaffenheit der Inseln nach drei Seiten erkennen können. Die Nord- und Ostküste war mäßig felsig. An dieser Westseite verlief der Strand ganz flach im Meer. Die Südküste also hatte man von dort oben nicht erblicken können, da war noch eine Felsenwand davor gewesen, was nochmals bemerkt werden mag, und erst von hier aus erkannte man, dass sich das ganze Gebirge als Kamm bis nach dieser Südküste erstreckte, sodass von hier aus auch nicht das Meer zu erblicken war.
Als man sich der Küste näherte, sah man dort schon das Boot angerudert kommen, was des Schahs Laune wieder bedeutend verbesserte.
»Ja, wo ist denn nun aber der gesuchte Punkt, wir sind doch gleich am Meere?«
Der Graf hatte mit Axel mehrere Berechnungen gemacht, und beide waren zu der Ansicht gekommen, dass sich dieser Punkt im Meere selbst befinden müsse.
Es wurde ihnen zur Gewissheit, als sie die letzte Sonnenaufnahme direkt an der Küste machten.
Sie standen an einer weiten, halbkreisförmigen Bucht, von zwei Landzungen eingefasst, und ungefähr in der Mitte dieser Bucht musste der gesuchte Punkt liegen, etwa hundert Meter vom Lande entfernt.
»Vielleicht wieder eine süße Quelle, die dem Meeresboden entspringt?«
»Es wäre nicht unmöglich.«
»Dieses Wunder möchte ich wirklich einmal schauen. Christenhund, wenn dort im Meere keine süße Quelle ist, dann lege ich dir deinen Kopf zu Füßen.«
Aber beim Barte des Propheten schwor er diesmal nicht, hatte daher auch keinen vorsichtigen Nachsatz nötig.
Das Boot landete, alle stiegen ein, die Matrosen ruderten nach der Richtung, die der Graf bezeichnete.
Der Meeresboden senkte sich sofort tief hinab, das Wasser war durchsichtig wie Kristall, wie Glas, nein, durchsichtig wie ganz ruhiges, wie ganz reines Wasser, denn durch dickere Schichten auch des besten Kristall- oder Glases kann man gar nicht sehen — der feine, graufarbene Muschelgrund war deutlich erkennbar.
Der Graf und Axel maßen und rechneten unausgesetzt.
»Stopp!!«
»Und da liegt eine große Kugel!«
So war es. Dort unten auf dem grauen Grunde, aus lauter kleinen Muscheln bestehend, wie man es dicht am Ufer hatte beobachten können, lag eine etwas dunklere Kugel, etwa so groß wie ein Menschenkopf, soweit man das beurteilen konnte. Aber nun wie tief?
Das Wasser bricht das Licht in ganz anderer Weise, als die atmosphärische Luft es tut, es täuscht das menschliche Auge in doppelter Weise.
Es gibt Meeresstellen genug, besonders in tropischen Gewässern, auf denen bei ganz ruhigem Wasser ein nicht ganz schwindelfreier Mensch nicht über den Bootrand hinabblicken kann. Er wird angstvoll die Augen schließen und sich zurückwerfen. Jemand, der Tiefen taxieren zu können glaubt, aber die Verhältnisse nicht kennt, wird sie vielleicht auf 500 Meter schätzen. Die Peilung ergibt dann, dass es nur 100 Meter sind, und dennoch sind die herausgeholten Gegenstände, die man ganz deutlich gesehen hat, so klein, dass ein Unkundiger glauben möchte, die Lotleine habe getäuscht.
Das ist die doppelte Täuschung. Das Wasser zieht den Gegenstand heran, verlängert aber die Perspektive. Die Fische natürlich sehen in ihrem Elemente richtig, und auch der Taucher gewöhnt sich schnell daran.
Hier hätte ein Unkundiger die Tiefe auf 100 Meter geschätzt, wenn so etwas überhaupt zu schätzen ist. Eine Lotleine war verbanden, das Senkblei berührte dicht neben der Kugel den Boden, es hatte sich — wir wollen die übliche Fadeneinteilung vermeiden — dreiundzwanzig Meter abgewickelt.
Wie nun die Kugel heraufbringen? Das war gar nicht so einfach. Mit einem Haken war nichts zu machen. Es musste ein Netz sein, oder ein Leinwandbeutel, unten mit einem scharfen Eisen, das sich unter die Kugel schob, und das musste sofort gelingen, sonst trübte sich doch das Wasser, und dann konnte man nur noch im Trüben fischen. Solch ein Apparat war aber hier im Boote nicht herzustellen, es fehlte alles dazu, man musste erst an Bord zurück, was jetzt eine Fahrt von anderthalb Stunden bedeutete, und dann wieder hierher.
Der Schah wusste einen besseren Rat.
»Dreiundzwanzig Meter?«, lassen wir auch ihn sich dieses modernen Maßes bedienen. »Ibrahim, du hast bei Aripo Perlen getaucht?«
»Ja, Herr, aber...«
»Zieh dich aus, hinab mit dir!«
»Herr, das kann ich nicht!«, stieß der indische Matrose erschrocken hervor, und der Schah verlangte auch etwas Unmögliches von ihm.
Ein Kostümtaucher, dem Luft zugepumpt wird, kommt bis zu fünfundvierzig Meter hinab. Das ist aber die Höchstleistung. Das ist ein Virtuose in seinem Fache, dem die fünf Minuten tatsächlich mit Goldstücken bezahlt werden. Das ist eine Tiefe, von der wir uns gar keine Vorstellung machen können. Ein Apparattaucher, der nur bis dreißig Meter hinabgeht, ist schon sehr gesucht.
Wie tief kann der Mensch ohne alle Hilfsmittel tauchen?
Die höchsten Leistungen vollbringt der Mensch aus Gewinnsucht, eignet sich deshalb die dazu nötigen Fähigkeiten an. Allerdings auch aus Ruhm- oder Ehrsucht, die aber im Grunde genommen immer Gewinnsucht sind. Und die allerstärkste Triebfeder ist doch immer das Gold gewesen.
Wenn man bestimmt wüsste, dass sich am Nordpol ein großes Goldlager befindet, so wäre er von Menschen schon längst erreicht. Etwa durch eine elektrisch betriebene Röhrenbahn. Röhre wird an Röhre geschraubt, auf der schon vorhandenen Strecke wird alles nachgeschafft. Das ist alles ausführbar. Aber es gehört ein ungeheueres Kapital dazu. Und das wird natürlich nicht riskiert, solange man nicht weiß, dass es sich auch genügend verzinsen wird. So ist die Erreichung des Nordpols vorläufig nur abhängig vom Wissensdurst, der schon an Neugier grenzt, und von Ehrsucht, und solchen wissenschaftlichen Abenteurern wird doch kein unbegrenztes Kapital zur Verfügung gestellt.
So taucht der Mensch auch nicht tiefer, als es sich lohnt. Die bekanntesten Wassermenschen sind die griechischen Schwammtaucher und die indischen Perlentaucher bei Aripo auf Ceylon. Der Badeschwamm kommt bis zu einer Tiefe von achtzehn Metern vor, die Perlmuschel bis zu einer Tiefe von einundzwanzig Metern. Und tiefer geht man hier wie dort nicht. Der ungebildete griechische Schwammtaucher, der nichts von Ceylon weiß, hält es für ganz ausgeschlossen, dass ein Mensch tiefer gehen kann als achtzehn Meter. Käme der Schwamm noch in einer Tiefe von fünfundzwanzig Meter vor, so würde der Taucher wahrscheinlich auch diese Tiefe erreichen. Aber er kennt es eben nicht anders, deshalb kann er auch nicht tiefer als achtzehn Meter kommen, und das ist schon ein Virtuose. Hier kommt auch etwas wie die allmächtige Kraft der Einbildung in Anbetracht, wie es jetzt doch schon sonst ganz vernünftige Menschen gibt, welche direkt behaupten, dass wir nur deshalb sterben müssen, weil unsere Eltern und Großeltern gestorben sind, kennen es nicht anders, als dass wir sterben müssen, im Grunde genommen aber sei die ganze Sterberei nur eine Folge der Einbildung, sei eine Schwäche.
Die Zeitdauer des Tauchens wird von Erzählern, die nie dort gewesen sind, meist furchtbar übertrieben. Vierzig Sekunden sind hier wie dort ein guter Durchschnitt. Wer regelmäßig eine Minute aushalten kann, gilt schon als Meister. Es kommen viel längere Zeiten vor, der französische Gelehrte Lamiral hat einen griechischen Taucher beobachtet, der ziemlich drei Minuten unter Wasser blieb, aber das sind immer unfreiwillige Kunststücke, der Taucher hat sich unten verwickelt oder wird sonst wie festgehalten, und dann kommt eben von Hunderten nur einer wieder herauf.
Wolle man sich nicht dadurch beirren lassen, dass man bei uns Tauchkünstler sieht, die fünf Minuten und noch länger unter Wasser aushalten. Die legen sich dabei ruhig hin, halten sich fest oder schweben dabei ruhig hin und her. Diese griechischen und indischen Taucher aber haben unter Wasser zu arbeiten, und zwar ganz kräftig. Und beim Arbeiten wird Sauerstoff verbraucht, den sie erst in den Lungen mit hinabnehmen müssen. Das ist also etwas total anderes. Deshalb lassen sich die indischen Perlentaucher an einem zwei- bis dreizentnerschweren Stein hinab, auf dem sie aufrecht stehen, weil dieser Stein schneller untersinkt, als ein Mensch durch Schwimmbewegungen kopfüber hinabkommt, vor allen Dingen vergeuden sie dabei nicht unnötig Kraft, die Sauerstoff erfordert. Die griechischen Taucher allerdings gehen kopfüber hinab, ohne sich zu beschweren.
Was nun den in solchen Tiefen herrschenden Druck betrifft, so können wir den leicht berechnen, uns aber keine Vorstellung davon machen. Eine Wassersäule von einem Meter Höhe drückt auf den Quadratzentimeter mit hundert Gramm Gewicht, oder auf den Quadratdezimeter mit einem Kilo, das sind bei zwanzig Meter Tiefe zwanzig Kilo. Und dieses Gewicht lastet nicht etwa nur auf Kopf und Schultern, sondern der Druck kommt von allen Seiten, jeder Quadratdezimeter des menschlichen Körpers wird von ziemlich einem halben Zentner bedrückt.
Was das zu bedeuten hat, können wir nicht ermessen. Wenn bei uns ein sehr guter Schwimmer, der sich im Wasser wie ein Seehund zu Hause fühlt, mit einem Hechtsprung und etwas Nacharbeiten sechs bis acht Meter hinabkommt — — dann macht er aber schleunigst, dass er wieder hinaufkommt! Es ist schon in dieser Tiefe ein furchtbares Gefühl, die Augen werden einem eingedrückt, die Trommelfelle, der ganze Brustkasten.
Die indischen Perlentaucher, die bis zu einundzwanzig Meter hinabgehen, bluten beim Emporkommen regelmäßig aus Nase, Ohren und Augen. Trotzdem gehen sie nach zehn Minuten Erholung wieder hinab. Das sind eben ganz andere Menschen. Bis ihnen zuletzt das Blut aus allen Hautporen tritt. Das treiben sie so einige Saisons, in der Hoffnung, dann so viel zu haben, um als Krüppel ohne Arbeit leben zu können. Kostümtaucher können nicht gegen diese Freitaucher konkurrieren. Das rohe Menschenmaterial ist die billigste Arbeitskraft. Es gibt genug von diesem zweibeinigen Geschmeiße. Auch mag es gegen die Tradition gehen, dort wird viel zu viel Hokuspokus getrieben, Kostümtaucher mit Apparaten sind verboten. — — —
»Herr, das kann ich nicht!«, stieß also der indische Matrose, ein ehemaliger Perlentaucher, erschrocken hervor.
»Was wagst du Hund mir zu sagen?«
»Ich bin nie tiefer als höchstens zehn Faden getaucht, tiefer als zwölf Faden kam selbst Isorba nicht, das Wunder aller Perlentaucher, und das sind wenigstens fünfzehn Faden.«
Der Schah mochte doch etwas von der Taucherei verstehen, er gab gleich nach, forderte keine Unmöglichkeiten mehr.
»Dann müssen wir erst vom Schiff ein Netz holen.«
»Es ist nicht nötig, ich werde die Kugel heraufholen«, ließ sich da der Graf vernehmen.
Der Schah sah ihn groß an.
»Wie willst du das machen?«
»Ich selbst werde hinabtauchen, nur möchte ich doch...«
»Was? Du, ein Franke, willst diese Kugel durch Tauchen heraufholen?!«
»Es wird mir gelingen. Nur möchte ich mit einem schweren Stein hinabgehen, der Anker genügt noch nicht.«
»Mensch — dreiundzwanzig Meter Tiefe — weißt du, was das zu bedeuten hat?«
»Ich weiß es.«
»Hast du schon einmal Perlentaucher gesehen?«
»Ja, bei Aripo.«
»Du warst dort, als getaucht wurde?«
»Ja.«
»Hast du gesehen, wie den tiefsten Tauchern zuletzt das Blut aus allen Poren tritt?«
»Ich habe es gesehen.«
»Und dort ist die größte Tiefe nur einundzwanzig Meter! Und du willst noch zwei Meter tiefer hinabgehen? Christenhund, mach dich nicht lächerlich!«
»Ich bin aber schon in größere Tiefen gedrungen.«
»Was? Du selbst hast schon in solche Tiefen getaucht?«
»Wie ich sage.«
»Du hast es gelernt?«
»Ich konnte es immer und habe mich darin weiter ausgebildet.«
»Wo?«
»An der griechischen Küste bei Schwammfischern, Nur zum Vergnügen. Es war mein Stolz, dass ich die besten professionellen Taucher noch übertreffen konnte.«
»Hm, ich habe von griechischen Schwammtauchern schon gehört, auch sie sollen Außerordentliches leisten. Wohlan, du sollst hinabgehen, mit einem Steine, und was du sonst alles brauchst. Aber, Franke — wenn du geprahlt hast — wenn du die Kugel nicht mit heraufbringst oder nur den Grund nicht erreichst — beim Barte des Propheten! — dann brauchst du nicht erst wieder heraufzukommen — dann kannst du gleich unten bleiben — nimm dir ein Messer mit, um dir dort unten selbst die prahlerische Zunge abzuschneiden und es dir dann ins Herz zu stoßen — beim Barte des Propheten!«
Der Graf hatte diesen langatmigen Schwur ruhig angehört.
»Ich möchte mir am Ufer erst einen schweren Stein suchen, den ich...«
»Ich weiß, der Stein ist dir gewährt«, wurde der Schah wieder etwas gnädiger; er kannte das Tauchen ja schon.
Das Boot ruderte noch einmal an Land. Diese Küste war hier wohl eben, aber große Felsblöcke lagen doch genug herum. Der Graf wählte einen handlichen Stein von ungefähr einem Zentner Gewicht, ließ ihn von zwei Dienern ins Boot tragen.
»Graf«, sagte Axel bei dieser Gelegenheit, »ich habe zwar solches Tauchen noch nicht beobachtet, aber ich selbst bin ein ausgezeichneter Schwimmer und halte mich für einen guten Taucher — und wenn ich da in diese Tiefe blicke — muten Sie sich nicht zu viel zu...«
»Seien Sie ohne Sorge, ich weiß, was ich leisten kann.«
Während der Rückfahrt nach jenem Punkte schnitt er ein Stück Segeltuch zurecht, in welches der Stein wie in Netz gelegt wurde, sodass er oben noch einen bequemen Handgriff hatte.
»An diesem Steine willst du dich hinablassen?«, sagte der Schah, diese Vorkehrungen beobachtend. »Die Perlentaucher verwenden viel, viel schwerere Steine.«
»Aber die stellen sich darauf und halten sich an dem Seile fest, an dem der Stein dann wieder heraufgezogen wird.«
»Das willst du nicht tun?«
»Nein, ich gehe kopfüber hinab, lasse mich wohl ziehen, schwimme aber selbst mit. Dann hebe ich unten den Stein aus dem Sacke und lege dafür die Kugel hinein.«
»Tu das, wie du willst.«
Die Stelle war wieder erreicht, der Graf gab Instruktionen und entkleidete sich.
Alles staunte über die Muskulatur, die da zum Vorschein kam. Nicht gerade herkulisch, aber athletisch, trotz der strotzenden Muskeln von vollendetstem Ebenmaß. Herkules ist, wie er immer dargestellt wird, oder vielmehr wurde, eigentlich keine besonders schöne Figur, die Muskulatur ist viel zu sehr übertrieben worden, hauptsächlich beim farnesischen. Dann hört die harmonische Schönheit auf.
»Donnerwetter, Graf, solche Muskeln hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut, bei Ihren zarten Damenhändchen!«, sagte zunächst Axel.
»Franke, wie kommst du zu solcher Körperkraft?!«, sprach dann auch der Schah seine Bewunderung unverhohlen aus.
»Ich habe mich immer in ritterlichen Spielen geübt, glaube aber, dass mein Freund hier an Körperkraft mir noch bedeutend überlegen ist, obgleich man ihm das noch weniger ansieht.«
»Meinst du? Schade, dass ihr ungläubige Christenhunde seid!«
Es war alles bereit. Das lange Seil ward direkt über der Kugel ausgeworfen, beide Enden aber, an deren einem der Stein befestigt war, blieben natürlich im Boote.
Der Graf erbat sich von einem der Matrosen das lange Schiffsmesser.
Als der Schah dies bemerkte, strich er sich hastig den Bart.
»Franke, ich habe vorhin beim Barte des Propheten geschworen — du entsinnst dich wohl noch meiner Worte — dass du mich nicht missverstanden hast. Wenn du den Grund nicht erreichst, so brauchst du nicht erst wieder heraufzukommen — nein, das hast du nicht nötig, wenn es dir da unten besser gefällt, so erlaube ich dir, unten zu bleiben — du kannst, wenn es dir beliebt, dir dort unten die Zunge abschneiden und dir dann das Messer ins Herz stoßen. Beim Barte des Propheten, das erlaube ich dir!«
Der Graf machte wieder eine seiner dankenden Verbeugungen.
»Also, du brauchst kein Messer mitzunehmen.«
»Es ist nur, falls ich unten etwas zu schneiden habe, vielleicht ist auch die Kugel mit Muschelbärten verwachsen.«
»Das ist etwas anderes, dann nimm das Messer mit. Sonst darfst du wieder an das Tageslicht zurückkommen. Also kehre, sobald dir die Luft ausgeht, um.«
»Kehren Sie lieber etwas vorher um«, meinte Axel und war bereit, einen Faustschlag zu parieren, um sich nicht aufs Maul schlagen zu lassen, denn der Schah hatte so eine hastige Handbewegung gemacht. Aber er hatte nur eine Mücke verscheuchen wollen.
»Dein Freund ist ein weiser Mann — ja, kehre beizeiten um, wenn du noch genug Luft in der Lunge hast. Ich will deinen Tod jetzt noch nicht, du darfst erst sterben, wenn ich es bestimme.«
Es war alles bereit. Die Leine senkte sich doppelt fast bis zu der Kugel hinab, der Graf nahm den schweren Stein in beide Hände, setzte einen Fuß auf den Bootsrand und stürzte sich kopfüber ins Wasser.

Man sah ihn deutlich hinabschießen, äußerst schnell, den Stein voran, wie er auch noch mit den Beinen kräftige Schwimmbewegungen machte.
In etwa zehn Sekunden war er unten, stieß direkt auf die Kugel.
Jeder weiß wohl, was nur zehn Sekunden unter Wasser zu bedeuten haben. Man kann es schon in der Badewanne probieren. Auch beim bloßen Zusehen hat man schon dasselbe Gefühl. Wasser ist eben Wasser, und der Mensch ist kein Fisch, sondern ein Landsäugetier.
Hier lag aber noch etwas anderes vor. Besonders der ehemalige Perlentaucher wusste zu würdigen. was dieser Franke bereits jetzt geleistet hatte.
»Inschallah, er hat den Grund wirklich erreicht, inschallah!!«
Man sah noch, wie sich der Graf, die Füße noch oben, an der Kugel zu schaffen machte, dann stieg eine weiße Wolke empor, welche den Taucher schnell vollkommen einhüllte.
Der Schah hatte sofort, als der Graf mit einem Kopfsprung abgegangen war, eine goldene, diamantenbesetzte Uhr aus dem Gürtel gezogen. Axel hatte gleichfalls schon den Taschenchronometer zur Hand genommen, der von dem indischen Schiffe stammte.
Eine halbe Minute verstrich.
Eine Minute bedeutet bei so etwas, selbst für den Zuschauer, der einen Freitaucher beobachtet, schon eine kleine Ewigkeit, und auch diese verging.
Die weiße Wolke wuchs immer mehr an, aber doch ziemlich scharfe Konturen behaltend, und der von Luft und Sonne abhängige Mensch wollte noch immer nicht aus ihr emportauchen.
»Anderthalb Minuten!«, flüsterte der Schah.
»Ich halte meinen Freund für fähig, noch länger unten zu bleiben«, sagte Axel.
»Wie lange kann er tauchen, den Atem anhalten?«
»Ich weiß es nicht, ich habe ihn noch nie tauchen sehen, er hat mir nichts davon gesagt, dass er so etwas kann, aber er ist überhaupt ein außerordentlicher Mann.«
»Ja, das ist er. Zwei Minuten.«
Wir wollen uns nicht dabei aufhalten, was für Worte noch gewechselt wurden, wir machen es kurz.
Als noch weitere drei Minuten vergangen waren, gab auch Axel seinen Freund auf.
Was war da passiert? Nun, vielleicht ein Herzschlag. Musste der menschliche Körper nicht von selbst in die Höhe treiben?
Nein, nicht sobald, und er brauchte mit dem Finger nur ein klein wenig unter die Kugel gekommen zu sein, der Finger hatte sich dort festgeklemmt — das genügte schon, um den Körper für immer dort unten festzuhalten, mochte er sich auch ganz bedeutend mit Gasen füllen.
Zu sehen war nichts, die grauweiße Wolke blieb schweben.
Wir haben so einfach gesagt: Nach weiteren drei Minuten, also zusammen nach fünf, gab auch Axel seinen Freund auf. Nein, so einfach war das nicht, wenn sich deshalb auch nichts weiter ereignete.
Axel schrie nicht, stöhnte nicht, sagte nichts — er starrte und starrte auf die weiße Wolke hinab, bestimmt wissend, dass der Graf aus dieser nie wieder emportauchen würde, wenigstens nicht als lebender Mensch, und er wollte es doch nicht glauben.
Jetzt zeigte sich, dass auch der Schah das Leben seines Sklaven nicht so leichtsinnig betrachtete. Vielleicht dachte er an die zukünftige Gefahr eines Bandwurms — vielleicht dachte er auch als ein fühlender Mensch.
Erst war er sehr aufgeregt, dann betete er, murmelte Koransprüche.
»Acht Minuten — vorbei!«, stöhnte Axel zum ersten Male.
»Du sagst es. Oder... zieht den Stein herauf.«
Es geschah. Hatte der Schah etwa geglaubt, er würde an dem Stricke den Taucher lebendig heraufziehen? Auch der tote kam nicht.
»Wir wollen noch warten. Einmal muss sich die Wolke doch wieder senken. Armer Franke, ich hatte...«
»Da da da da da!!!«, schrien die Matrosen.
Da kam aus der weißen Wolke ein nackter Mann hervor, schoss mit schneller Schwimmbewegung nach oben, und der Graf legte beide Arme über den Bootsrand.
»Endlich habe ich die Kugel, eine Bombe, losgeschnitten, und dann zieht ihr mir den Stein mit dem Sack weg. Warum?«
Ganz ruhig hatte er es gesagt. Kein vorheriges Atemschöpfen, seine Brust ging nicht im Mindesten anders als sonst.
Axel starrte den Wiederaufgetauchten, der noch so sprechen konnte, nicht minder wie ein Gespenst an, die Mohammedaner streckten schnell die linke Hand gegen ihn aus, mehrmals die Finger zur Faust schließend und wieder öffnend — eine Art Kreuzschlagen der Mohammedaner — die linke Hand gehört dem Teufel, darf auch deshalb beim Essen nicht benutzt werden.
»Graf, Sie leben noch?!«
»Ja, warum denn nicht?«
»Inschallah, alschalla!!!«, schrie jetzt auch der Schah, und die anderen stimmten ihm bei. »O Allah, o Allah, wie bist du groß, dass du diesen Mann noch leben lässt!«
So ging es noch eine Weile weiter, bis der Graf ins Boot geklettert war. Dann mussten sie es wohl glauben.
»Franke, wer bist du, dass du länger als acht Minuten unter Wasser sein kannst, ohne zu ertrinken?«
»Ich kann es, ich habe schon eine Viertelstunde unter Wasser ausgehalten.«
»Du kannst unter Wasser atmen?«
»Nein, ich kann so lange den Atem anhalten. Oder es ist eigentlich kein Atemanhalten, es ist... noch etwas anderes dabei.«
Es war ein Inder, der dies zu hören bekam.
»Ja, ich habe Fakire gesehen, die zwei bis sechs Wochen viele Meter tief unter der Erde lagen, wo sie auch nicht atmen konnten. Aber sie mussten sich vorher präparieren, die Zunge zusammenrollen und anderes tun. Und dann unter Wasser? Das Wunder bleibt für mich bestehen. Du kannst mehr als alle Fakire meiner Heimat zusammen. Ich preise Allah, dass er dich mir zum Sklaven geschenkt hat und bedauere nur, dass du ein Christenhund bist.«
Hiermit war diese Angelegenheit für den edlen Schah erledigt.
»Es war eine Bombe?«
»Ich halte die eiserne Kugel für eine solche. Anscheinend besteht sie aus zwei Hälften, die zusammengeschraubt sind, das ist nicht ganz geschehen, die an sich so kleinen Muscheln haben sich mit ihren Bärten in die Ritze eingezwängt und hielten sie wie mit eisernen Zangen fest. Gerade als ich sie loshatte, wurde der Stein mit dem Sacke hochgezogen.«
»Willst du noch einmal hinabgehen?«
»Selbstverständlich.«
Diesmal aber traf der Graf zu seinem Tauchen Vorbereitungen, die man vorhin nicht an ihm bemerkt, die er auch sicher nicht gemacht hatte, und das an sich allein war schon wieder staunenswert.
Er nahm einen tiefen Atemzug — aber nun was für einen! — es war unglaublich, wie sich sein Brustkasten ausdehnen konnte, er nahm fast den doppelten Umfang an — — dann ergriff der Graf schnell den Stein und stieß hinab, verschwand in der Wolke.
Jetzt also hatte er unten nur den Stein aus dem Sacke zu nehmen und dafür die Kugel hinein zu legen, dann schoss er nach oben, die Kugel wurde an dem Seile nachgezogen.
So wenigstens war es doch selbstverständlich. Aber es sollte anders kommen.
Eine Minute verging, dann tauchte der Schwimmer wieder aus der Wolke aus, strebte trotz starker Fußbewegung nur langsam empor — denn er hatte die Kugel in den Händen.
Als er sie oben abgab, verstand man erst richtig, was für eine Leistung er da wieder vollbracht hatte. Die Bombe wog mindestens 30 Pfund, und wohl jeder kann sich denken, was das zu bedeuten hat, ein solches Eisengewicht schwimmend empor zu bringen, aus einer Tiefe von 23 Metern!
Deshalb also hatte sich der Graf vorher so voll Luft gepumpt, er hatte diese Überraschung, die am besten der Perlentaucher verstand, schon vorher geplant.
Die Hauptsache war aber nun doch diese Bombe. Sie bestand aus zwei Teilen, die zusammengeschraubt waren, die Kanten schlossen nicht ganz, wie der Graf schon beschrieben. Dort, wo früher der Zünder gesessen, war ein eiserner Stöpsel eingeschraubt.
Zuerst wurde sie etwas misstrauisch betrachtet. Eine Bombe ist immer eine Bombe.
»Ach, die hat ja schon lange im Wasser gelegen!«, meinte Axel, darangehend, sie aufzuschrauben.
»Woher weißt du das?«
»Weil sie so fest von den Muscheln bewachsen war. Und wenn wir wissen wollen, was drin ist, müssen wir sie doch öffnen, so oder so.«
Natürlich, und die Besorgnis schwand.
Aber was für Kraftanstrengungen auch gemacht wurden, das Gewinde gab nicht nach. Dass ein solches vorhanden, das war in der Ritze, die man gesäubert hatte, noch erkennbar.
Während dieser Versuche, die gleich hier im Boot vorgenommen wurden, erörterte man, wenn auch ganz zwecklos, was die Bombe wohl enthalten könnte, weshalb man sie wohl hier versenkt hatte, und der Schah hörte gern die Ansichten seiner ›Sklaven‹, zu denen auch der französische Steuermann gehörte.
Vor allen Dingen war der Schah nun schon der felsenfesten Überzeugung, dass dies keine gewöhnliche Bombe war, die durch irgendeinen Zufall hierher gekommen war, sondern dass ihr Hohlraum etwas ganz Besonderes enthalten müsse und dass sie deswegen mit Absicht hier versenkt worden war.
Dies war für unsere beiden Freunde insofern wichtig, als es zeigte, wie sehr er doch schon von der Unfehlbarkeit des Grafen überzeugt war.
Was die Bombe enthielt, konnte man natürlich nicht eher wissen, als bis man sie geöffnet hatte. Aber war es nicht etwas rätselhaft, sie hier im freien Wasser ganz nahe der Küste zu versenken, wo die runde Kugel, die so sehr von dem hellgrauen Meeresboden abstach, von jedem darüber hinwegfahrenden Boote erblickt werden musste?
Da aber konnte der französische Steuermann eine wichtige Auskunft geben. Man hatte nicht umsonst gerade diesen Mann als Bootssteuerer mitgenommen. Er war der einzige an Bord des ›Sterns von Indien‹, der schon mehrmals auf dieser Insel gewesen, indem er nämlich früher viele Jahre auf einem Schiffe gedient hatte, das einen schwunghaften Sklavenhandel zwischen der Luandaküste und Brasilien betrieben, und die Himmelfahrtsinsel war regelmäßig besucht worden, um sich mit Schildkröten zu verproviantieren, und da waren noch andere gewesen, welche diese Insel genau kannten, wenigstens die Küsten, und niemals habe man ein solches stilles Wasser gefunden, wie es heute war.
Diese Glätte der See, wie heute, war auch ganz, ganz merkwürdig, wirkte fast beunruhigend. Mag der Atlantische Ozean oft genug nach windstillen Tagen spiegelglatt sein, an den Küsten findet man das fast niemals, am wenigsten an solchen kleinen, weltverlassenen Inseln. Da ist doch noch immer eine Kraft vorhanden, auch im stillsten Wasser, die sich an jedem Widerstand bemerkbar macht. Das ist zum Beispiel recht deutlich im Hafen von Algier zu beobachten, an den weit hinaus gebauten Molen, die eigentümlich konstruiert sind, einmal ein Versuch, indem man die Steine mit Zwischenräumen übereinander gemauert hat. Mag das ganze Mittelländische Meer auch glatt wie ein Spiegel sein, ein auf das Wasser gefallener Öltropfen breitet sich ganz konzentrisch aus — zwischen diesen Molenmauern von Algier spritzt dennoch das Wasser in mächtigen Strahlen empor, es sieht aus, als wenn zahllose Walfische ihr Wesen trieben.
Und wenn sich die Oberfläche nur ein wenig kräuselt, dann kann man natürlich nicht mehr in die Tiefe hinabblicken, mag das Wasser sonst auch noch so klar sein. Damit hatten diejenigen gerechnet, welche die Bombe hier versenkt hatten. Oder diese war eben durch Zufall hier über Bord gefallen.
Jedenfalls also war der Schah felsenfest überzeugt, dass sie irgendein wichtiges Geheimnis barg, und der Graf wie Axel dachten nicht anders.
»Wir müssen sie an Bord des Schiffes öffnen, dort wird es schon gehen«, meinte der Schah.
Er hatte das letzte Wort noch nicht ganz ausgesprochen, als das Boot plötzlich von einem im Gegensatz zu der glühenden Atmosphäre fast eisig zu nennenden Windstoß getroffen wurde, so stark und heftig, dass sich das große Boot ganz auf die Seite legte.
Solche Phänomene kommen in tropischen Gegenden häufig genug vor. Mensch und Tier erschrecken jedes Mal, wenn so etwas Abnormales in der Witterung eintritt, dann bereitet sich in der Atmosphäre stets etwas Gefährliches vor.
Natürlich blickten alle sofort nach der Richtung, von wo dieser furchtbare Windstoß, der sich aber nicht wiederholte, gekommen war, nach Süden, dorthin, wo der eisige Südpol lag, und da sahen sie, dass sich inzwischen dort am Horizonte eine pechschwarze Wolkenwand mit schwefelgelbem Saume gebildet hatte.
»Das gibt einen furchtbaren Sturm!! Auf, auf, dass wir noch rechtzeitig zum Schiffe...«
Da brauste und sauste es abermals in der Luft, das Boot wurde abermals von einem gewaltigen Windstoß erfasst, der aber von der direkt entgegengesetzten Richtung kam und glühend heiß war, und als sie nach Norden blickten, sahen sie, dass dort ebenfalls solch eine schwarze Wolke mit schwefelgelbem Saume stand, die heraufgekommen war, während alle mit der Bombe beschäftigt gewesen waren.
»Böensturm! Wir können nicht mehr zurück!«
Eine der vielen Ursachen, aus denen völlige Windstille entstehen kann, ist die, dass zwei Winde aus entgegengesetzter Richtung um die Herrschaft kämpfen, sich gewissermaßen totdrücken, sich gegenseitig zum Stillstand bringen. Dann wird ein Hin- und Herrucken daraus, einmal siegt der Wind, einmal jener, bis einer die Oberherrschaft behält, den anderen völlig zurückdrängt.
Doch das sind alles nur Theorien, Hypothesen. Im Grunde genommen wissen wir absolut nicht, wie die Winde entstehen, woher sie kommen und wohin sie gehen. Wissen wir doch nicht einmal, wodurch das Donnern entsteht, welches dem Blitze nachfolgt. Mit dem Knattern, welches das Überspringen des elektrischen Funkens begleitet, dürfte es jedenfalls nichts zu tun haben, und dass es von der Erschütterung der Luft herkommen soll, das ist eine ganz haltlose Behauptung, die aber selbst von den gebildetsten Menschen gedankenlos als Überzeugung ausgesprochen wird, so wie einst von aller Welt gläubig nachgesprochen wurde, das Donnern entstehe dadurch, dass die Wolken zusammenstießen. Der Donnerschlag und das langanhaltende, polternde und rollende Donnern dürfte eine vollkommene andere Ursache haben als die Erschütterungen der Luft, worüber noch später gesprochen werden soll, von einem unserer genialsten Geister behauptet und begründet, noch jetzt gedruckt zu lesen ist, aber schon seinerzeit verachtet und ignoriert, jetzt vollständig vergessen.
Doch wie dem auch sei — das Entstehen und Verlaufen eines Gewitters können wir beobachten, wenigstens seine Begleiterscheinungen. Es setzt ganz plötzlich ein kalter Wind ein, der Courant ascendant der Meteorologen, er verdrängt die heiße, mit Feuchtigkeit geschwängerte Luft nach oben, sie geht in entgegengesetzter Richtung über den kalten Wind hinweg, durch die Reibung dieser beiden Winde wird in der Atmosphäre die elektrische Spannung erzeugt, die aus dem sich verdichtenden Wasserdampf bildenden Wolken spalten die neutrale Elektrizität in positive und negative, die sich durch den Blitz wieder zu vereinigen suchen — — und nun kann auch gleich noch jetzt gesagt werden: Durch diese elektrische Spannung zersetzt sich der Wasserdampf, wie es eigentlich auch gar nicht anders sein kann, in seine Urbestandteile, in Sauerstoff und Wasserstoff, es entsteht also Knallgas, aber so ziemlich jedes einzelne Molekül Knallgas ist in ein Wasserbläschen eingeschlossen, durch den elektrischen Funken erfolgt die chemische Wiedervereinigung, jedes Molekül Knallgas explodiert und wird wieder zu Wasser, das sind also zahllose Explosionen, welche die Wolke entlanglaufen, und daher die langanhaltende Detonation, die wir Donnern nennen, und das ist der Grund, weshalb nach jedem Blitze der Regen mit vermehrter Heftigkeit, in viel größerer Menge fällt! Die Wolke hat eben plötzlich viel mehr Wasser bekommen.
Diese Theorie, die einzige, die Hand und Fuß hat, ist von einem Manne, der mit solchen Sachen gar nichts zu tun hatte, dessen Geist aber das ganze Weltall umspannte — von dem deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer, der es erleben musste, dass seine Werke als Makulatur eingestampft wurden.
So muss es natürlich auch über dem Meere zugehen, nur dass hier, besonders in tropischen Gegenden, wegen anderer Temperaturverhältnisse die Winde nicht so übereinander hinweggehen können, sie kämpfen länger um die Herrschaft, diese über alles gefürchteten Windstöße aus verschiedenen Richtungen werden Böen genannt, dann streichen die dauernd gewordenen Winde nebeneinander hin, so entsteht der Hurrikan und Taifun, der alles vernichtende Wirbelsturm.
Die Folge solcher Böen lässt sich denken. Wo sie zusammentreffen, bäumt sich das Wasser, im Nu ist die stillste See ganz zerrissen.
So war es auch hier. Die Windstöße waren zu ertragen, sie unterbrachen die immer noch herrschende Windstille nur selten, aber mit einem Male glich das eben noch so spiegelglatte Meer einem wilden Chaos.
An ein Zurückrudern war jetzt gar nicht mehr zu denken. Die Seeleute wussten, dass es hier nur eins gab. Ehe das aufgewühlte Wasser in die noch ziemlich stille Bucht einbrach, musste das Boot an Land gezogen sein. So weit sollte es gar nicht kommen. Es war nur noch wenige Ruderschläge von dem Strand entfernt, der Kiel knirschte schon auf dem Grunde, eben wollten die Matrosen ins Wasser springen, um es aufs Trockene zu ziehen, als zu der Bucht eine vier Meter hohe Wassermauer herangerauscht kam, mit unheimlicher Schnelligkeit.
»Festgeklammert!!!«, brüllte der Steuermann, und da ward auch schon das große Boot in die Höhe gehoben, ganz sanft schwebte es dahin, nur dass es sich jetzt eben nicht eigentlich auf dem Meere, sondern auf dem festen Inselboden befand — dann ging die Flutwoge wieder zurück, aber das Boot nicht mitnehmend, sondern dieses stürzte aus ziemlicher Höhe herab und... fünfzehn Menschen lagen zwischen seinen Trümmern.
Verletzt war niemand. Nur, ein hohles Boot kann solch einen Sturz auf festen, felsigen Boden natürlich nicht aushalten. Es war hoffnungslos in alle seine einzelnen Klinkerplanken zerlegt worden. Die Flutwelle selbst hatte die Insassen mit keinem Tropfen benetzt, trotzdem waren sie alle durchnässt — — von der Limonade, die in indischen Tonkrügen mitgenommen worden war. Die hatten diesen Sturz erst recht nicht aushalten können. Ganz besonders war der schwarze Sam wie aus dem Wasser gezogen, denn an seinem wolligen, eisenharten Schädel hatte sich das Wasserfass in Stücke geschlagen.
Unwirsch krochen die auf diese Weise schiffbrüchig Gewordenen unter den Trümmern hervor. Ein von Süden kommender Windstoß, ein ganz anderer als die vorhergehenden, warf sie alle augenblicklich nieder, niemand hatte sich auf den Füßen halten können, Gegenstände, in denen sich der Wind fangen konnte, wurden weit weggeschleudert, ein Korb flog auf Nimmerwiedersehen davon, und trotzdem herrschte dann gleich wieder völlige Windstille. Es war nicht anders gewesen, als wenn eine riesenhafte pneumatische Kanone geschossen hätte.
An dieser Lage war jetzt nichts zu ändern. Aller Augen richteten sich nach dem Schiffe, das man von hier aus erkennen konnte.
Es wurde wie eine Nussschale hin und her geworfen. Ankergrund gab es dort nicht, wo es von der gestrigen Windstille überrascht worden, sonst wäre es doch gleich vor Anker gegangen.
Welcher Wind würde siegen, der nördliche oder der südliche? Davon hing jetzt alles ab. Wehe, wenn jetzt Südwind, Südsturm eintrat! Denn dann musste sich das Schiff, von dem doch allein Hilfe zu erwarten war, von der Insel entfernen. Das Folgende wagte man sich gar nicht auszudenken.
»Sie haben unseren Bootsbruch beobachtet, sie setzen die Kutter aus, um uns abzuholen!«
»Die sind wahnsinnig, wenn sie das riskieren!«
»Auf nach der Nordküste, die setzen dennoch die Kutter aus!«
Sie hätten gar nicht zu gehen brauchen, sie wären beinahe nach Norden geflogen. Hoch oben in der Luft ein Sausen und Brausen, das einen heulenden Ton annahm — es war das Siegesgeheul des Südwindes, der den Nordwind endlich zurückgeworfen hatte, und dort im Norden wich auch schon die Wolkenwand zurück, schwenkte nach Osten ab.
Ein ›Wind‹ war das freilich nicht mehr. Nicht einmal ein Sturm. Das war ein regelrechter Orkan, der alles niederwarf oder lieber vor sich hertrieb, was nicht fest in der Erde wurzelte.
Im Nu lagen die fünfzehn Menschen wieder platt am Boden, den Kopf dorthin gerichtet, nach der sie eine kurze Strecke geflogen waren, nach Norden zu. Und auch in dieser Lage konnten sie beobachten, wie ihr Schiff in voller Fahrt abging, wenn auch ohne ein Segel gesetzt zu haben. Es konnte ja auch nicht anders sein. Der Orkan blies das Schiff vor sich her wie ein Knabe eine im Waschbecken schwimmende Nussschale fortbläst, und noch ganz anders.
Dann krochen sie, auf dem Bauche rutschend, instinktmäßig dem Basalthügel zu, der sich in einiger Entfernung seitlich von ihnen erhob. Nur Deckung vor dem Orkan, nur Schutz suchen! Und eine andere Deckung war nicht vorhanden, auch die größeren Steine boten keine, und mit dem Boden verwachsene Felsblöcke waren eben auf dieser Seite nicht vorhanden.
Und selbst diese zentnerschweren Steine wurden lebendig, einer, von einem halben Meter Durchmesser, der etwas abgerundete Kanten hatte, rollte wie eine ungeheure Kegelkugel dahin, bis er sich in einer Spalte festklemmte. Das sagt genug, welche Kraft dieser Orkan besaß, und er schien noch immer zu wachsen. Der einzige, der daran gedacht hatte, etwas mitzunehmen, war der Graf, er hatte in einem Arm die Bombe, konnte sie kaum halten, sie sollte ihm von einer unwiderstehlichen Kraft aus dem Arm gerissen werden, und wäre das geschehen, so wäre sie auf Nimmerwiedersehen davongerollt, ins Meer hinein. Einer nach dem anderen erreichte den Hügel, kroch nach der Nordseite herum. Der kegelförmige Hügel war kaum fünf Meter hoch, bot aber doch schon genügend Deckung, dass man wenigstens einmal ruhig atmen konnte. Von furchtbaren Windstößen wurden sie ja sonst noch genug umspielt.
Axel war noch nicht zufrieden, hier etwas Schutz gefunden zu haben. Kaum konnte er wieder atmen, als auch schon wieder der Forschergeist in ihm erwachte. Er kroch den Hügel hinauf, immer der Gefahr ausgesetzt, herabgeblasen zu werden, was einen weiten Flug durch die Luft bedeutet hätte, der sicher nicht ohne einige gebrochene Glieder abgegangen wäre.
Oben angelangt, konnte er sich an einigen hervorstehenden Felsspitzen anklammern, und er winkte so eifrig zurück, dass ihm die anderen trotz aller Lebensgefahr folgten.
Es zeigte sich, dass damals, vor Jahrtausenden oder auch Jahrmillionen, auch dieser kleine Hügel hier als Quelle der feuerflüssigen Lava gedient hatte. Auch hier oben öffnete sich solch ein Waschkessel, etwa sechs Meter im Durchmesser und ebenso tief, und hier hatte das Regenwasser die Wände noch viel glatter geschliffen, sie glänzten sogar wie schwarzer Achat. Nur dass auch hier unten der Boden von zahllosen Rissen durchzogen war, haarfein, aber alles Regenwasser ablaufen lassend.
Jeder wusste sofort, dass man in diesem Kessel viel gesicherter war als hinter dem Hügel. Sie brauchten es nicht erst einander mitzuteilen, konnten es auch gar nicht. Man konnte schreien, wie man wollte, die menschliche Stimme war nicht zu vernehmen. Es sei denn, der Mund wurde dicht ans Ohr gelegt. Dabei war das Sausen in der Luft gar nicht mehr so bedeutend. Aber der Ton wurde von dem Luftzug sofort weggespült. Denn der Ton ist doch nichts weiter als Schwingungen der Luft, und ist der Luftzug ganz außerordentlich stark, dann hört das auf, es können sich keine schwingende Luftwellen mehr bilden. Natürlich muss das eben schon solch ein Orkan sein, der außer seinem eigenen Brausen keinen anderen Ton mehr aufkommen lässt, am wenigsten das Gepiepse einer menschlichen Stimme.
Der Schah war der erste, der die glatte Fläche hinabrutschte, und als Monsieur Belois sah, dass der unten glücklich angelangt war, folgte er eiligst nach, und so einer nach dem anderen, ohne sich gegenseitig besonders wehe zu tun, es war eine lustige, harmlose Rutschbahn. Der vorletzte war der Graf, immer die Bombe unter dem Arm, den Beschluss bildete Axel.
Ja, hier unten war es ganz anders. Dort oben tobte die entfesselte Hölle, wenn auch ohne Feuer — hier unten saßen sie wie in Abrahams Schoß. Kein Lüftchen fächelte ihre Stirn.
»So, da wären wir«, sagte Axel zum Grafen. »Und wissen Sie, was wir jetzt gemacht haben? Was unser hier unten wartet?«
Ein starrer Blick des Grafen, und er schlug sich vor die Stirn. Dieser Mann hatte sofort begriffen, diesmal freilich etwas zu spät, Axel war einmal weitsichtiger gewesen.
»Ach, wir haben ja kein... aber Sie haben doch immer Ihr Lasso bei sich.«
»Ja, das habe ich. Aber haben Sie an die Lederschnur gedacht, bevor Sie hier herabrutschten?«
»Nein«, gestand der Graf offen, »es fällt mir erst jetzt ein. Ich wäre rettungslos in diese Falle hineingegangen.«
Die Sache war nämlich die, dass sie ohne Leiter oder Seil aus diesem Kessel gar nicht wieder heraus konnten. Nicht einmal Akrobaten, die sich vier Mann hoch aufbauen können, wäre dies gelungen. Das war alles viel zu glatt, und der Boden ja ganz gewölbt — — nein, ohne Hilfsmittel konnte hier niemand wieder den oberen Rand erreichen, es mochten noch so viele Menschen zusammen sein.
»Und ein Glück, dass dort oben die spitzen Felsen sind, sonst nützte mein Lasso auch nichts«, setzte Axel noch hinzu.
Auch die Inder wurden jetzt unruhig, es war ihnen plötzlich zum Bewusstsein gekommen, in welche Lage sie sich hier begeben hatten. Einer teilte es dem anderen mit.
Axel hielt sich nicht mit Erklärungen auf, er wickelte unter seiner Weste das Lasso vom Leib, schleuderte die Schlinge nach der Windrichtung, zog sie im Augenblick, da sie über einen der spitzen Steine schwebte, zu, kletterte Hand über Hand hinauf, spähte einige Zeit mit dem Kopfe über den Rand nach Norden, hielt sich dann mit einer Hand oben fest, löste mit der anderen die Schlinge wieder von dem Steine ab und ließ sich zurückrutschen.
Die anderen hatten ihn beobachtet, wegen des Herauskommens waren sie beruhigt. Jetzt drängte sich eine andere besorgte Frage auf aller Lippen, der Schah sprach sie zuerst aus.
»Hast du mein Schiff gesehen?«
»Ja. Eben noch. Als kleinen Punkt in weiter Ferne.«
Es hatte gar keinen Zweck, weiter darüber zu sprechen, das sah jeder ein. Sie waren alle Seeleute oder doch mit dem Schiffswesen vertraut.
Da das Schiff alle Segel festgemacht hatte, konnte dieser Orkan ihm weiter nichts schaden. Es müsste denn in einen Wirbelsturm kommen, der sich aber hier wohl nicht bilden würde. In einem Wirbelsturm hört natürlich alles auf.
So wurde der ›Stern von Indien‹ durch diesen Orkan eben nach Norden geworfen, bis er so weit nachließ, dass das Schiff wieder gegen ihn an kreuzen konnte. Aber die Windrichtung konnte sich ja auch ändern, dann ging es noch schneller. Jedenfalls würde das Schiff sie so bald wie möglich von hier abholen. Wie lange das dauern würde, das freilich vermochte kein Mensch zu sagen. Inzwischen konnten sie vielleicht schon verschmachtet sein. Doch es hatte eben gar keinen Zweck, jetzt solche Erwägungen anzustellen. Jedenfalls war es gut, dass der Südsturm gesiegt hatte. Bei Nordsturm wäre das Schiff trotz aller Steuerung vielleicht gegen die Insel getrieben, wäre gestrandet, wäre im besten Falle erst bei einer besonders hohen Flut mit günstigem Winde wieder losgekommen. Es hätte aber auch zersplittern können.
»Wie Allah will!«, sagte der Schah, zog aus dem Gürtel eine kostbare Pfeife, ließ sie von einem Diener aus seinem ebenfalls am Gürtel hängenden Beutel stopfen, ließ Feuer schlagen, begann gemächlich zu rauchen.
Der Orkan währte fort. Schwarze Wolken überzogen den Himmel, aber sie entluden sich nicht, weder durch Feuer noch Wasser.
Die mohammedanischen oder buddhistischen Inder ergaben sich in das Kismet, kauerten und schmiegten sich wie die Hühner zusammen, wobei die mit Waffen geschmückten Krieger recht klägliche Figuren spielten, die vier Franzosen waren darin auch schon ganz Inder geworden, nur der Schah reservierte sich etwas und rauchte eine Pfeife nach der anderen.
Unsere vier Männer, die von dem verlorenen ›Pipin‹ stammten, beschäftigten sich während der letzten Tagesstunden immer mit der Bombe. Nur zum Zeitvertreib. Die Sikhs hatten zwei Pistolen hergeben müssen, mit den Kolben wurde immer auf der Bombe herumgehämmert, dem Gewinde nach. Und hastig — man glaubte wenigstens manchmal, die beiden Stücke ließen sich schon gegeneinander schieben.
Der Graf und Axel setzten sich noch einmal gegenüber, wie sie es schon öfters getan hatten, bisher immer mit negativem Erfolge, nahmen die Bombe zwischen die Hände, diese wieder zwischen die Knie, so versuchten sie zu drehen.
Und wahrhaftig, es gelang! Das Gewinde gab nach, die beiden Hälften ließen sich voneinander schrauben. Dies war fast ebenfalls ein Wunder zu nennen — wenn man den Erfolg menschlicher Kraft, Energie und Ausdauer ein Wunder nennen darf.
Die Höhlung war offen. In ihr ein Stück Wachstuch, zum Paket zusammengeschnürt, sodass es die Höhlung ganz ausfüllte, noch eine Wachstuchhülle, noch eine — und dann kam ein Stück gelbes, feingegerbtes Leder zum Vorschein, das in schwarzer Farbe mit Hieroglyphen bedeckt war, mit kleinen Kreisen, die Punkte enthielten oder von verschiedenen Strichen durchzogen waren, einzelne Striche in verschiedener Lage, Halbmonde und dergleichen.
»Das ist keine mit der Zeit entstandene Schriftsprache, sondern das ist eine willkürlich gemachte und zwar kindliche Geheimschrift«, erklärte der Graf sofort.
Er hatte recht. Wenn Kinder untereinander eine Geheimschrift erfinden, kommen sie zuerst immer auf solche Kreise und Kreuze und Striche. Das alles ist der Kriminalpolizei wohlbekannt.
Der Sturm, die ganze Lage war augenblicklich vergessen, das Interesse war geweckt worden.
»Ja, aber wie soll man die entziffern?«, meinte der Schah.
Der Graf erklärte, wie es keine Geheimschrift gibt, die man nicht entziffern kann. In jeder Sprache wiederholt sich jeder Buchstabe prozentual so und so oft. Das ist der Hauptschlüssel zu jeder Geheimschrift, der auch zuletzt jede aufschließt. Damit freilich ist auch schon gesagt, wie ungeheuer schwierig das zuletzt werden kann. Selbst die Sprachen können ja fortwährend gewechselt werden, und was kann man da nicht sonst alles ausmachen! Aber dem menschlichen Geiste ist schließlich alles möglich, wenn nur genug Buchstaben vorhanden sind.
Das ziemlich große Leder enthielt 268 Zeichen, das erachtete der Graf für genug, die Lösung herbeizuführen. Freilich nicht jetzt, und er sagte gleich, dass er allein das vielleicht nicht fertig brächte, dazu reichte seine Lebenszeit nicht mehr aus. Dann mussten eben die nachfolgenden Geschlechter diese Entzifferung fortsetzen. Einmal würde es schon gelingen, nicht durch Zufall, sondern logisch Schluss für Schluss.
So sprach der Graf ganz offen. Der Schah starrte ihn verständnislos an.
»Du kannst das nicht enträtseln? Du musst es können, du musst, du Christen...franke.«
Eben hatte es nämlich wieder ganz mächtig in der Luft geheult, es wurde immer dunkler, und wenn man nun so in einem Wurstkessel sitzt... der edle Schah hatte dem Christenhund doch lieber eine andere Endsilbe gegeben.
»Ich werde tun, was ich kann.«
»Tu es. Ich war ein Narr, dass ich mich von dir Christen....franken hierher locken ließ. Ich werde schlafen, Allah wird mir im Traum Weisheit schenken.«
Die Nacht brach an. Sie schliefen. Zu wachen brauchte niemand. Axel schlief wenigstens mit offenen Ohren, auch im Schlafe hörte er immer das Brausen des mit unverminderter Heftigkeit wehenden Orkans.
So vernahm er auch im Schlafe, wie der Sturm nach und nach an Heftigkeit abnahm, und als er immer schwächer wurde, brachte er sich durch seinen Willen zum Erwachen.
Da der Himmel noch ganz bedeckt war, herrschte die stockfinsterste Nacht. Axel sah die Hand dicht vor den Augen nicht.
Er betastete den neben ihm liegenden Grafen, mit der Absicht, ihm die Uhr zu nehmen und dann etwas Feuer zu schlagen, um nach der Zeit sehen zu können.
»Wünschen Sie etwas?«, flüstere da der Graf.
»O, habe ich Sie geweckt?«
»Ich habe gar nicht geschlafen.«
»Weshalb nicht?«
»Ich schlafe überhaupt nie.«
»Ach, machen Sie doch keine Geschichten! Na, meinetwegen! Ich wollte einmal nach der Uhr sehen.«
»Einen Augenblick — es ist drei Minuten vor fünf, in einer Stunde geht die Sonne auf.«
»Nanu! Woher wollen Sie denn das wissen?«
»Weil wir uns hier auf dem neunten Grade südlicher Breite befinden und...«
»Ich meine, woher wollen Sie denn wissen, dass es um fünf ist?«
»Na, weil ich den Chronometer hier in der Hand habe.«
»Ja, haben Sie denn das Deckelglas geöffnet, das Sie die Zeiger fühlen können?«
»Nein, ich kann im Finstern sehen.«
»Was? Sie können im Finstern sehen?«
»So gut wie am Tage. Allerdings nicht sehr weit. Wussten Sie das denn noch nicht?«
Nein, Axel bekam wirklich wieder etwas ganz Neues zu hören, so lange er mit dem Grafen auch zusammen war. Es war noch keine Gelegenheit dazu gewesen.
»Sie sind wahrhaftig ein Wundermann! Und das haben Sie mir als Ihrem Biografen noch gar nicht gesagt? Sie müssen mir einmal alles aufschreiben, was Sie eigentlich können — oder besser alles das, was Sie nicht können. Der Orkan hat bedeutend nachgelassen; was da oben bläst, ist kaum noch ein Sturm zu nennen.«
»Ja, es ist mir sehr lieb, dass Sie erwacht sind. Da werde ich mich gleich einmal nach dem Boote begeben, um zu sehen, ob nicht doch noch etwas Trinkbares der Vernichtung entgangen ist.«
»Haben Sie so großen Durst?«
»Ich? Nein. Aber ich kalkuliere, dass sich alle die anderen schon gestern Abend durstig niedergelegt haben. Ob wir noch etwas Trinkbares finden, davon hängt ab, wie lange wir — ich sage gleich wir — hier an Leben bleiben können.«
»Sie haben recht. Das kann überhaupt noch eine schöne Geschichte werden. Aber schon jetzt wollen Sie nach dem zertrümmerten Boote gehen? In dieser Stockfinsternis?«
»Ich sagte Ihnen schon, dass es eine solche Finsternis für mich nicht gibt. Vor meine Füße und noch einige Ellen weiter kann ich immer sehen. Ich brauche nur Ihr Lasso, und deshalb wecken wollte ich sie doch nicht.«
»Aber ich sehe ja gar keinen Stein, nach dem ich die Schlinge schleudern kann.«
»So lassen Sie mich einmal schleudern, ich sehe die Steine schon.«
So produzierte sich der Graf jetzt als Lassowerfer, in stockfinsterster Nacht. Gleich beim ersten Wurf hatte die Schlinge festen Halt bekommen.
Der Graf kletterte hinauf, Axel folgte ihm nach.
»Nein, da mache ich nicht mit. Ich müsste mich von Ihnen doch nur wie ein Blinder an der Hand führen lassen. Gehen Sie allein, bringen Sie mir Waschwasser und ein solennes Frühstück mit ein paar Pullen Wein mit, ich werde unterdessen noch ein kleines Nickerchen machen. Dass alles bereit ist, wenn ich erwache, Sie Nachteule.«
Axel sprach's, ließ sich zurückrutschen, suchte sich auf dem harten Stein die weichste Stelle und legte sich auf die andere Seite, schlief wieder ein.
Da er wusste, ganz sorglos schlafen zu dürfen, wachte er nicht eher auf, als bis er gerüttelt wurde.
Es war heller Morgen, auch die anderen waren wach, der Schah ließ sich soeben eine Morgenpfeife stopfen, wohl um den Magen über Hunger und Durst hinwegzutäuschen.
»Wo ist mein Arzt?«
»Der ist noch vor Tagesanbruch nach dem Boote gegangen, um...«
Axel brach ab, blickte nach der schwarzen Wand, überflog zählend die Köpfe.
»Wo ist mein Lasso?«
»Was?«
»Der Lederriemen, der hier herabhing?«
»Du sollst den Lederriemen so wie gestern werfen, dass wir hinauskommen können, denn es ist wieder fast ganz still geworden.«
»Zum Teufel, wo ist mein Lasso?! Wer ist hinaufgeklettert und hat den Lederriemen oben abgelöst?«
Keiner hatte es getan, das konnte am besten Sam versichern, der von den anderen zu allererst erwacht war.
»Und da hat der Lederriemen schon nicht mehr dort gehangen?«
»Nein.«
»Na, zum Teufel, träume ich denn nur — ich habe das Lasso doch oben hängen lassen, der Graf hat es auf keinen Fall mitgenommen, ich fühlte es doch noch zuletzt!«
Das mochte sein, aber die Tatsache blieb bestehen, dass das Lasso jetzt verschwunden war.
»Der Christenhund hat das Seil weggenommen, um uns hier dem Verschmachtungstode auszuliefern!«, rief der Schah.
»I, schwatzen Sie doch kein Blech!«, blieb Axel zunächst noch ganz gemütlich, bei dieser Gelegenheit nur in seinen gewöhnlichen Ton fallend, der vor niemand Respekt hatte, und die ganze Situation war danach, dass der Schah jetzt diesen Ton auch nicht als Beleidigung empfand.
»Wo ist die Geheimschrift?«
In der Bombe war sie nicht, in keiner Wachstuchumhüllung, niemand hatte sie.
»Die hat wohl der Graf in die Tasche gesteckt und mitgenommen«, erklärte Axel.
Da allerdings musste der Verdacht ja auch sehr nahe liegen, mit Ausnahme für Axel, der sich bei dieser Erklärung gar nichts gedacht hatte. Anders der Schah, der fuhr jetzt empor.
»Dann ist ja alles auch ganz klar! Der Hund hat sie schon entziffert, oder er weiß doch, dass sie ein wichtiges Geheimnis enthält, das ihm wahrscheinlich Schätze ausliefert — da hat der Christenhund das Seil weggenommen, um uns hier unten verschmachten zu lassen, um das Geheimnis allein zu besitzen, um nicht teilen zu müssen!«
Da aber fuhr auch Axel empor.
»Schuft!!«, donnerte er den Schah an. »Noch einmal wage es, meinen Freund solch einer Gemeinheit zu verdächtigen, und ich haue dir eine herunter, dass dir die Zähne sektionsweise aus dem Maule marschieren!«
Axel hatte diese guten, wenn auch nicht gerade hoffähigen deutschen Worte in regelrechtes Französisch übersetzt, und sollte dem Schah ihre Bedeutung vielleicht nicht ganz klar werden, so konnte er doch die dazugehörende Bewegung nicht missverstehen, denn Axel hatte dabei schon weit zur Ohrfeige ausgeholt.
Und der martialische Inder, der sicher sonst ein ganzer Mann war, saß regungslos wie eine Statue da — nicht fassungslos, er hatte die Worte recht wohl verstanden und wusste auch, was er von der ausholenden Hand zu erwarten hatte — aber die Augen waren es, diese blauen Augen, wie die ihn anblitzten! — die hielten ihn in Schach, machten ihn ganz wehrlos, dass er den Schlag ruhig hingenommen hätte.
Etwas anders benahmen sich die beiden indischen Krieger. Hatten sie die französischen Worte nicht verstanden, so konnten sie doch die ausholende Hand nicht missverstehen, es lag ja auch schon im Tone — und das waren ja schließlich nur zweibeinige Hunde, auf den Mann dressiert, jeden Augenblick bereit, sich auf den zu stürzen, der ihren Herrn nur mit dem kleinen Finger bedrohte, und die blitzenden Augen des Angreifers waren jetzt nicht auf sie gerichtet — und dann sahen sie auch, wie der alte weißhaarige Franke, Kapitän Morphium, schnellstens die Hemdsärmel über die knochigen Arme zurückstreifte, ebenso bereitete sich der schwarze Christ, Sam, schon zu einem Boxergefecht vor — und die Hände der beiden indischen Krieger fuhren an die im Gürtel steckenden Waffen.
Weiter sollten sie aber in dieser Bewegung auch nicht kommen.
»Hand weg von den Waffen!!«, donnerte Axel jetzt sie an, seine blitzenden Augen auf sie richtend. »Oder ich werde euch zeigen, wie ein deutscher Depeschenreiter mit euch Schokoladenpuppen Fangeball spielt!«
Wieder mochten es nur diese wie zweischneidige Schwerter blitzenden blauen Augen sein, welche allein die raubtierähnliche Wildheit sofort bändigten — oder es war überhaupt der ganze Mann, der diese Wirkung hervorbrachte. Trotzdem, es war eine höchst gefährliche Situation.
Die beiden Krieger rührten sich nicht, aber plötzlich füllte sich das Weiße in ihren Augen mit rotem Blut.
Die Gefahr sollte durch etwas anderes ausgelöst werden.
»Good morning, Gentlemen!«, erklang eine fremde Stimme von oben herab. Selbstverständlich blickte alles nach oben, und als man dort das bärtige, verwetterte Gesicht eines Fremden sah, der wohl auf dem Bauche lag, nur eben seinen Kopf zeigend, da freilich war alles andere vergessen. Die ganze Situation war eben danach beschaffen.

»Hallo!«, rief Axel als erster zurück. »Who are you? Parlez-vous Français?«
»Only English.«
»Verstehen Sie Englisch?«, fragte Axel zunächst den Schah.
Dieser bejahte.
»Lassen Sie mich den Sprecher machen — Wer sind Sie denn?«
»Käpten Smart vom ›Angel of Peace'. Feiner Name das, Friedensengel, was? Hähähähä.«
»Nach Ihrem ironischen Feixen muss das allerdings ein sehr nettes Schiff sein.«
»Noch nichts davon gehört, vom Friedensengel und vom Käpten Smart?«
»Hatte noch nicht die wahrscheinlich zweifelhafte Ehre.«
Dabei blickte Axel seinen weißhaarigen Freund an — dieser schüttelte den Kopf, und auch die französischen Seeleute kannten offenbar diese Namen nicht.
»Ebenholz, nur weibliches, nur allerfeinstes Ebenholz«, fuhr der grinsende Kopf fort. »Und was für Geschäftchen sich dann noch sonst so nebenbei machen lassen.«
»Also Sklavenhändler und Pirat.«
»Ahem«, bestätigte nickend der grinsende Kopf.
Sklavenhandel war ja damals erlaubt — aber dass sich dieser Mann auch gleich als Pirat legitimierte, das war äußerst fatal. Das war für die in dem Wurstkessel Sitzenden gewissermaßen ein Todesurteil.
»Na, und?«, fuhr Axel fort.
»Wart wohl in Amerika, he?«
»Woraus schließt Ihr das?«
»Feines Lasso, das Ihr da habt.«
»Also Ihr habt das Lasso weggenommen.«
»Yes.«
»Weshalb?«
»Liebe Lassos, hähähä.«
Axel hätte so gern einmal in das ewig feixende Gesicht schlagen mögen.
»Ihr wollt uns hier nicht wieder herauslassen?«
»Stimmt. Feines Rattenloch das, he?«
»Warum?«
»Möchte mit Euch gern ein bisschen plaudern. Liebe Plauderei, hähähä.«
»Nur zu!«
»Well, kommen wir zum Geschäft. Ich sehe da die Hälften einer Bombe liegen.«
»Seht Ihr?«
»Auch die Wachstuchstücke liegen dort. Wo ist nun das Leder mit den Klecksen?«
Hallo!!!
Gleichzeitig aber hätte Axel auch laut aufjubeln mögen.
Denn diese Frage war für ihn schon ein vollgültiger Beweis, dass der Graf noch nicht in die Hände der fremden Schiffsmannschaft gefallen war. Ob sie wussten, dass sich jemand überhaupt von hier entfernt hatte, das mussten die nächsten Fragen und Antworten entscheiden.
»Na, wo ist das beschriebene Leder?«
»Ja ja, das Leder. Was wisst denn Ihr davon?«
»Mehr als ihr alle zusammen. Wo ist es?«
»In meiner Tasche.«
»Her damit!«
»Fällt mir nicht ein.«
»Was?!«, erklang es jetzt in einem ganz anderen Tone.
»Das Leder gehört mir.«
»Mir gehört es.«
»Ich habe es gefunden.«
»Aber ich habe die Bombe mit dem Leder erst dort versenkt.«
»Wo denn?«
»Dort, wo ihr sie herausgefischt habt. Wer war denn das übrigens, der sie durch Tauchen herausgeholt hat? Es war ein weißer Mann, und wenn ich nur nun auch alle ansehe — das kannst doch nur du gewesen sein.«
Jetzt war es für Axel schon ziemlich klar, dass die Fremden überhaupt nicht wussten, dass sich einer aus dem Kessel entfernt hatte.
»Ja, das war ich.«
»Du kannst 23 Meter tief tauchen? Donnerwetter! Scheinst überhaupt ein ganzer Kerl zu sein. Musst einer der Unsrigen werden.«
Der Kapitän hatte es gar nicht so eilig mit dem Leder — freilich auch wieder gefährlich. Er hatte eben Zeit, fühlte sich seiner Sache ganz sicher, spielte wie die Katze mit der Maus.
»Sklavenhändler und Pirat?«
»Well, warum nicht? Feines Leben! Jeden zweiten Tag kann sich die Freiwache besaufen — immer nur feinster Whisky und Rum — und im Hafen Mädels die schwere Menge, hähähä.«
»Hm, das muss ich mir überlegen.«
»Na, mach keine Geschichten. Du bist noch nicht hartgesotten. Bist nur ein Fuchs. Aber ich liebe solche Burschen. Würde dich schon bald hartgesotten kriegen.«
»Da war Euer Schiff schon gestern hier?«
»Schon seit acht Tagen.«
»Wo liegt es denn?«
»Dort an der Südküste.«
Die Felswand, welche auch noch oben die Aussicht nach Süden versperrt hatte!
»Was macht ihr hier?«
»Geschäft! Nun aber lass mich mal fragen. Was habt ihr den hier auf dieser Insel zu suchen?«
»Wir wollten Schildkröten fangen.«
»Gibt's ja jetzt gar nicht.«
»Das wussten wir nicht.«
»Greenhorns. Wie kommt ihr dazu, die Bombe herauszufischen?«
»Nun, wir sahen sie eben in der Bucht liegen.«
»Wie kommt ihr denn nach der Bucht? Euer Boot lag doch erst an der Nordküste.«
»Wir waren etwas den Berg hinaufgestiegen, erkannten dort oben, dass der Weg zur Westküste viel bequemer war, und da ließen wir das Boot herumholen.«
»Hm, Ihr scheint nicht zu lügen. Sah den kaffeebraunen Kerl laufen. Und da saht ihr zufällig die Bombe auf dem Meeresgrunde liegen?«
»Ganz zufällig. Eine Kugel. Dass es eine Bombe war, wussten wir nicht, noch weniger, was sie enthielt.«
»Und die Kugel interessierte Euch so, dass Ihr Euer Leben riskiertet?«
»Leben riskieren? Ich weiß, was ich kann. Wir sprachen grade übers Tauchen, der Inder da wollte nicht glauben, was ich leisten könnte — so holte ich die Kugel herauf.«
»Und?«
»Es war eine recht merkwürdige Bombe. Solche mit zusammengeschraubten Hälften habe ich noch nie gesehen. Wir schraubten sie auf.«
»Ging denn das so leicht, wo die Bombe so viele Jahre... never mind. Die Bombe und ihr Inhalt ist mein Eigentum.«
»Was habt Ihr sie denn da nicht schon lange geholt, wenn Ihr schon acht Tage lang hier liegt?«
»Wir fischen dort immer an der Südküste nach der Bombe herum.«
»Also Ihr wusstet gar nicht, wo sie lag?«
»Nein.«
»Wie reimt sich denn das zusammen?«
»Die Bombe ist mir einfach einmal von ein paar meuterischen Matrosen gestohlen worden. Den einen erwischte ich, er gestand, dass sie die Bombe hier an der Küste versenkt hatten. Das heißt, der eine von ihnen, der wieder die anderen betrügen wollte. Er hatte die Bombe bei Nacht über Bord geworfen, um sie für sich später abzuholen. Der war tot, und der Matrose, den ich kitschte, konnte nicht einmal angeben, auf welcher Küstenseite sie sich damals befunden hatten.«
»Hm, dabei stimmt nur eins nicht.«
»Was denn nicht? Ich bin ein Mann, bei dem immer alles stimmen muss.«
»Woher wisst Ihr denn, dass das Wasser in jener Bucht 23 Meter tief ist?«
»Einfach weil wir schon alle Küsten abgefischt haben, daher wissen wir, wie tief überall das Wasser ist. Jetzt kam als letztes die Südküste daran, ich opferte wieder acht Tage, um die verdammte Teufelsbombe zu finden.«
»Und habt sie dort in der Bucht trotz allen Fischens nicht gefunden?«
»Ja, hat sich was! Ihr habt es verdammt gut getroffen. Solch ruhiges Wasser wie neulich kommt hier alle hundert Jahre mal vor.«
»Ihr hättet die ruhige See aber doch benutzen und schnell die ganze Insel umfahren müssen.«
»Die ganze Insel umfahren? Ihr seid verrückt. Da muss man doch direkt über dem Gegenstand liegen, um ihn vom Boote aus sehen zu können. Und wir glaubten eher an die Südküste, da machten wir gestern solche Sehversuche.«
Es hatte alles Hand und Fuß, was der Mann sagte. Hinwiederum glaubte er auch Axel, dass von ihnen die Bombe ganz zufällig erblickt worden sei.
»Was machtet ihr denn immer für geografische Berechnungen? Wolltet wohl die Küste aufnehmen, he?«
Wenn die Frage so gestellt wurde, brauchte Axel sie nur zu bejahen. Argwohn schöpfte der Mann also nicht hieraus. Wenn ein Schiff an eine ganz oder ziemlich unbekannte Küste kommt und es hat Zeit, so lässt es sich die Gelegenheit nicht entgehen, möglichst viele geografische Berechnungen zu machen. Solche Verbesserungen der Seekarten wurden schon damals von den nautischen Ämtern sehr gut bezahlt, es ist auch eine Ehre, es gehört mit zum Geschäft.
»Von wo aus habt Ihr denn das alles beobachtet?«
»Wir waren dort oben auf dem Bergkamm, um da mal Umschau zu halten. Nun aber, Freund... ich bin es, der hier zu fragen und zu kommandieren hat. Jetzt her mit dem beschriebenen Leder!«
»Hm. Und wenn Ihr es nun habt, was dann?«
»Dann dürft Ihr heraus aus dem Loche.«
»Und wenn ich es nicht gebe?«
»Dann bleibt ihr alle zusammen drin in dem Rattenloche.«
»Ihr wisst doch natürlich auch von unserem Schiffe.«
»Bah, ehe das wieder ansegeln kann! Da seid ihr schon längst verschmachtet. Und dann bin ich doch nicht umsonst der Käpten Smart vom Friedensengel.«
»Hm. Und dann gebt Ihr uns doch natürlich alles, was wir brauchen, um hier ruhig die Rückkehr unseres Schiffes abwarten zu können.«
»Nein, das werde ich nicht tun. Nicht so, wie Ihr es Euch denkt.«
»Was?!«
»Seht, Mann, ich will Euch beweisen, dass ich ein ehrlicher Kerl bin, ich könnte Euch sagen: Gebt mir das Leder, dann hole ich euch alle herauf, ihr seid frei. Es bleibt Euch doch gar nichts anderes übrig, als mir das Leder zu geben, sonst lasse ich euch alle zusammen verdursten und verhungern...«
»Dann vernichte ich zuvor das Leder, an dem Euch so viel gelegen ist.«
»Dann knalle ich euch alle einfach zusammen. Verstanden? Also das Leder bekomme ich doch sowieso, ich hätte gar nicht nötig, erst ein Lügner zu werden, und der bin ich überhaupt nicht. Ich habe ja aber auch sonst einen recht guten Fang gemacht. Für die Freigabe des Schahs Alum dort fordere ich ein Lösegeld von hunderttausend Rupien.«
»Was, du kennst mich?«, fuhr der Schah empor.
»Ja. Woher? Ich komme selber erst von Konstantinopel. Also, ihr alle zusammen seid einfach meine Gefangenen, kommt an Bord meines Schiffes. Die indischen Kulis sind in den hunderttausend Rupien mit inbegriffen, ebenso die Krieger, die sind ja auch nichts wert. Von den französischen Burschen mag ich ebenfalls nichts wissen. Euch aber, Mann, hoffe ich zu bewegen, dass Ihr freiwillig an Bord meines Schiffes bleibt, und der weißhaarige Kerl da ebenfalls, denn das ist doch sicher ein Seemann und hat noch gute Knochen im Leibe. Und nun her mit dem Leder! Dann werdet ihr anständig an Bord meines Schiffes geführt, auch anständig behandelt.«
»Und wenn ich das Leder nicht gebe?«
»Es bleibt Euch doch gar nichts anderes übrig. Ich lasse euch da unten zappeln, und ihr werdet schon bald genug anderen Sinnes werden.«
»Ich vernichte die Geheimschrift.«
»Na und was dann? Ihr habt dadurch doch nichts gewonnen, und ich nicht allzu viel verloren. Das Leder ist mir gar nicht so viel wert...«
»Und da fischt Ihr acht Tage lang hier an der Küste herum und tut das nicht zum ersten Male?«
»Ja, wert ist es mir schon etwas, aber keine hunderttausend Rupien. Und die sind mir doch sicher...«
»Nicht, wenn der Schah tot ist.«
»Doch. Ist dem Schah nicht bekannt, dass der eine Prämie von hunderttausend Rupien erhält, der ihn tot oder lebendig ausliefert?«
»Was sagst du da, Christen...mensch!«, fuhr der Schah wieder empor.
»Das weißt du nicht? Es wäre möglich. Ich bin eine Woche später als der ›Stern von Indien‹ abgesegelt, und es kam erst am vorletzten Tage heraus. Jawohl, wer dich tot oder lebendig ausliefert, erhält hunderttausend Rupien bar ausgezahlt.«
»Von wem? An wen soll ich ausgeliefert werden?«
»An den Emir Jussuf ben Famil. So war der öffentliche Aufruf, besonders an Seeleute gerichtet, unterzeichnet.«
Dieser Name übte auf den Schah eine furchtbare Wirkung aus. Er brach plötzlich ganz zusammen.
»Du sollst das Doppelte haben, nur liefere mich nicht diesem Hundesohn aus, nicht meinen Kopf, keinen Finger von mir, den dieser Teufelssohn noch zu schänden wüsste«, sagte er dann.
»Das Doppelte, zweihunderttausend Rupien? Well, angenommen! Ich hätte mich schon mit den hunderttausend zufrieden gegeben, und ob ich diese nun durch Lösegeld verdiene oder durch tote oder lebendige Auslieferung des Gefangenen, das ist mir doch ganz gleich. Ich hätte also nicht einmal ein höheres Lösegeld gefordert. Da seht ihr, was für ein ehrlicher Kerl ich bin. Aber wenn mir das Doppelte freiwillig geboten wird — well, dann nehme ich's natürlich.«
»Und wenn nun Emir Jussuf Euch noch dreihunderttaufend Rupien für meine lebendige oder tote Auslieferung bietet?«, fragte der Schah.
»Gibt's nicht mehr bei mir. Wort bleibt Wort! Und nun her mit dem Lappen!«
»Und wohin bringt Ihr mich?«, musste der Schah erst noch fragen.
»Wenn Ihr die Reisekosten für mein ganzes Schiff zum Marktpreis bezahlt — wohin Ihr wollt. Zum Teufel, nun aber zum letzten Male: jetzt her mit dem Leder!«
Was sollte Axel nun tun? Jetzt musste er gestehen, dass er das Leder gar nicht besaß, dass ein anderer schon...
Er brauchte nicht weiter darüber zu grübeln, was er in diesem schwierigen Falle tun solle, es kam alles anders.
In ziemlich weiter Entfernung ertönte ein gellender Pfiff.
»Ich werde an Bord gerufen, da ist irgend was los. Ihr scheint noch nicht mürbe genug zu sein, dass ihr noch so zögert — well, ich will euch noch ein paar Stunden Bedenkzeit lassen, die hochkommende Sonne wird euch schon mürbe machen. Und versucht nicht etwa, hier herauskommen zu wollen. Ich lasse hier drei meiner Burschen zurück. Jede Hand, die sich auf den Rand legt, wird abgehackt — jeder Kopf, der darüber erscheint, hat ein Loch in der Stirn. Und hiermit wird nicht gespaßt! Lasst euch die Zeit nicht lang werden.«
Der Kopf verschwand. Man hörte noch, wie der Kapitän einige Instruktionen gab, eben wegen des Hackens und Schießens — »Ay ay, Käpten«, sagten einige andere Stimmen — und es ward wieder still.
Ja, was nun tun?
Mit flüsternder Stimme wurde beraten.
Es war ein äußerst schwieriger Fall, noch ein ganz anderer als der des Esels zwischen zwei Heubündeln.
Durfte man auf die Hilfe des Grafen rechnen?
Es war so gar nicht abzusehen, wie der seine Kameraden noch rechtzeitig aus diesem Rattenloche erlösen könne.
Verriet man ihn aber, so kreuzte man vielleicht seine genialsten Pläne, und sie selbst hätten dadurch gar nichts gewonnen.
Die Beratung hatte schon eine Stunde gedauert, höher stieg die Sonne, brannte furchtbar in den schwarzen Trichter hinein, und alle hatten sich schon gestern Abend hungrig und noch mehr durstig schlafen gelegt.
»Nein, ich vertraue auf den Grafen«, sagte Axel zuletzt.
»Ich auch«, bestätigten Morphium und Sam gleichzeitig.
»Eure Hoffnung ist Torheit«, war der Schah anderer Meinung. »Ich will für ewig verstummen, wenn dieser Mann...«
Der Schah verstummte schon jetzt.
Während er gesprochen hatte, war in den Lüften der seltsam gellende Schrei des Kondors erklungen, eines Geiers, der sich aber viel über dem Meere aufhält, oder doch nahe der Küste, weil er am liebsten auf gestrandete Seesäugetiere pirscht. Er ist auch der Vogel, der von allen Vögeln am höchsten steigt. Eine Höhe von 15 000 Metern, nach Humboldts Schätzung, ist sein liebster Aufenthalt.
Wer diesen riesenhaften Vogel schreien hört, blickt natürlich sofort nach oben, gewöhnlich ohne ihn zu sehen, aber sein furchtbarer Schrei ist noch aus dieser enormen Höhe zu vernehmen, aus der er sich wie ein Stein in einer Minute herabfallen lassen kann.
Die Gefangenen in dem Trichter hatten anderes zu tun, als ihren Blick nach oben zu richten, ihr Gesichtsfeld war ja auch sehr beschränkt.
Also der Schah, der für ewig verstummen sollte, jedenfalls doch, wenn dieser sein Sklave ihnen wirklich helfen könne, verstummte schon jetzt nämlich dadurch, weil ihm mit Vehemenz etwas gegen den Mund klatschte, dass ihm aus der Nase gleich zwei Blutbächlein flossen und es einige Jahre dauern würde, bis die locker gewordenen Schneidezähne wieder festwuchsen.
Es war ein gelbes Leder, die Geheimschrift, darin eingewickelt ein faustgroßer Stein, dazu noch ein Stückchen Hemd — denn woher hätte der Graf sonst diese Leinwand nehmen sollen — und das Ganze war mit einem Streifen von eben demselben Hemd fest umschnürt gewesen.
Auf das Stückchen Leinewand waren mit grauer Schrift, wahrscheinlich mit einem etwas abfärbenden Lavastein, französische Worte geschrieben.
Gebt es ihm! Folgt ihm! Mich nicht verraten! Ich befreie euch!
Der Schah stillte, als er dies gelesen, seine blutende Nase, befühlte seine lockeren Vorderzähne und... war glücklich.
»Wie Allah will«, sagte er, und da Allah eben gewollt hatte, dass gerade seine Nase von dem Paket getroffen werden musste, so war diese Angelegenheit für ihn erledigt.
»Wie kann dein Freund das hierher geworfen haben?«
»Nun... immer durch die Luft.«
»Aber die Wächter? Ob die nichts davon gemerkt haben?«
»Sicher nicht. Hörtest du nicht den Kondorschrei?«
»Ich hörte ihn.«
»Das war doch natürlich der Graf, der ihn nachahmte, um die Augen unserer Wächter einige Zeit nach oben zu lenken, und er brauchte nur zehn Sekunden, da war die Sache schon gemacht. Der wird sich auch schon so postiert haben, dass alles klappte.«
»Woher weißt du alles so genau?«
»So etwas lernen bei uns schon die kleinen Kinder, und das nicht einmal in der Schule, sondern wenn sie Räuber und Gendarmen spielen.«
»Tun sie? Dennoch, du bist nicht nur ein ganzer Mann, sondern auch sehr scharfsinnig. Schade, dass du ein Christenhu...«
»Was?! Was wollten Sie sagen?«
»Schade, dass du einen Christenhut dem Turban eines rechtgläubigen Moslems vorziehst.«
Es war nichts weiter zu besprechen. Oder es hätte doch gar keinen Zweck gehabt.
Wusste der Graf schon, was hier alles verhandelt worden war? Woher? Man würde es später von ihm selbst erfahren.
Es hatte auch niemand Lust zum Sprechen. Die Zungen begannen zu vertrocknen.
Wieder verging eine Stunde in dem wirklichen Höllenkessel. Monsieur Belois sagte mit röchelnder Stimme, dass er es vor Durst nicht mehr aushalten könnte, und es war verzeihlich, er hatte nur den Anfang gemacht.
»He, hallo, Käpten Smart!«, schrie Axel.
»Was gibt's?«, erklang oben eine raue Stimme ohne dass ein Mensch sichtbar wurde.
»Wir verdursten!«
»Es ist eure eigene Schuld, ihr könntet jetzt schon längst behaglich in der Kajüte am vollen Tische sitzen.«
»Wir wollen die Geheimschrift ja geben.«
»Habt ihr euch besonnen? Jetzt aber müsst ihr warten, bis der Käpten zurückkommt.«
»Habt ihr denn dort oben nichts zu trinken?«
»Wenn wir was hätten, dürften wir's euch doch nicht geben, wenn es der Käpten nicht vorher erlaubt hätte. Aber wir haben nichts. Es ist eure eigene Schuld. Das haltet ihr nun auch schon noch aus. Hallo Fred?«
Ein neuer musste sich oben zugestellt haben. Zum ersten Male hörte man dort oben Worte wechseln.
»Ich bringe das Frühstück.«
»Ja, was denn sonst? Kalter Kaffee? Und nicht mehr? Habe einen Höllendurst. Verdammtes Felsennest hier! Und die da unten... na, das bisschen Kaffee kann die auch nicht retten...«
»Ja ja, gebt mir den Kaffee«, schrie oder wollte Monsieur Belois schreien, brachte aber keinen lauten Ton hervor, und dann war es schon zu spät.
»Leer war die Pulle! Uns so einen Fingerhut voll zu schicken. Was klettern die da zwischen den Felsen herum?«
»Hier nisten Kondors.«
»Ja, wir hörten vorhin einen schreien.«
»Und Dick und einige andere haben auch die Jungen schreien hören, jetzt ist alles, was abkommen kann, auf die Suche.«
Das war begreiflich. Mit dem Kondor ist nämlich noch heute aller möglicher Aberglaube verbunden. Wir wollen nur anführen, dass das Schiff, welches einen lebendigen Kondor an Bord hat, nach dem Glauben der Seeleute nicht untergehen kann. Wird ein Kondorhorst mit Jungen entdeckt, so setzen die Matrosen alles daran, sie zu bekommen, und dasselbe gilt von den südamerikanischen Eingeborenen und auch Weißen, die wieder ihren eigenen Aberglauben haben. Die Jungen lassen sich auch sehr leicht großziehen, werden dann ziemlich zahm. Weniger leicht ist freilich ihr Fang. Es ist der reinste Zufall, wenn ein Kondorhorst einmal für Menschen erreichbar ist, dann verteidigen die Alten wie Löwen ihre Brut, und schließlich sind die Jungen, noch ehe sie fliegen können, sehr flink auf den Beinen, wissen sich der Verfolgung geschickt zu entziehen.
Wenn man hier ein Kondornest mit Jungen entdeckt hatte, dann war es auch ganz selbstverständlich, dass sich alles, was vom Schiffe abkommen konnte, auf die Jagd gemacht hatte.
Axel aber dachte sofort an etwas anderes, und das Gleiche galt von Morphin, der jetzt so warnend den Finger erhob.
»Kondorjunge?«, flüsterte er. »Sollte das nicht der Graf sein, der die Mannschaft ins Gebirge lockt und sie zerstreut?«
Axel nickte nur und gebot durch eine Bewegung Stillschweigen.
»Da kommt ja schon der Kapitän mit vier Maaten.«
Eine Viertelstunde verging noch. Die Kommenden konnten eben schon aus großer Ferne erblickt werden.
Dann erschien wieder das verwitterte Gesicht des Kapitäns. Er war doch sehr vorsichtig, zeigte nie mehr als den Kopf.
»Na, habt ihr's euch unterdessen überlegt?«
»Ja, hier ist der Wisch.«
Axel warf den Lederlappen dem Kapitän gleich ins Gesicht.
»Ahhh, endlich! Dann werft zuerst eure Waffen herauf.«
Nur die Krieger und der Schah kamen in Betracht, sie entleerten ihre gespickten Gürtel, die Matrosen ließen noch ihre Schiffsmesser nachfolgen. Auch Axel hatte sich an Bord des indischen Schiffes nur ein Taschenmesser zu verschaffen gewusst, Schusswaffen waren nicht so leicht zu haben gewesen.
Es war alles hinaufgeworfen worden.
»Bei wem dann noch eine Waffe gefunden wird, irgendeine, der bekommt die neunschwänzige Katze. Da lasse ich nicht mit mir spaßen. Sonst sollt ihr durchaus anständig behandelt werden, ich bin gewohnt, mein Wort zu halten.«
Ein französischer Matrose ließ noch ein Taschenpistol nachfolgen.
»Sonst keine Waffe weiter?«
»Nein.«
»Dann kommt herauf. Jeder einzeln.«
Es war auch gar nicht anders möglich. An dem Seile, das herabgelassen wurde, war eine Schlinge, Monsieur Belois steckte zuerst seine Arme durch, ward hinaufgezogen und konnte aus einem der Krüge, welche die vier Matrosen, die den Kapitän begleitet, mitgebracht hatten, seinen Durst an kaltem Kaffee löschen.
Während er noch trank, wurden gleich Vorkehrungen getroffen, um ihm dann sofort die Hände auf dem Rücken zu fesseln. So ging es auch Axel, der einer der letzten war, welche dem Kessel entstiegen.
»Was, mich fesseln?!«, sagte er, als auch bei ihm während des Trinkens Vorbereitungen dazu getroffen wurden.
»Es ist nur wegen des Transportes. Wir sind nur acht und ihr euer vierzehn.«
»Hätte ich das gewusst — ich bin nicht gewöhnt, gefesselt zu werden — ich soll doch einer der Eurigen werden.«
Der Kapitän, bis auf sein häufiges Grinsen gar kein unsympathischer Mensch, blickte ihn lange an.
»Hm. Ihr gefallt mir immer besser. Wollt Ihr also einer der Unsrigen werden?«
»Nein, nein, so schnell geht das nicht, da muss ich erst mehr wissen, wer Ihr seid, und was Ihr treibt.«
»Gebt Ihr Euer Wort, nicht zu entfliehen, an keinen Wiederstand zu denken?«
»Nein, das gebe ich nicht.«
»Oho!«
»Wenn Ihr mich als Gefangenen behandelt, werde ich auch die erste Gelegenheit zur Flucht benutzen.«
Mit immer größerem Wohlgefallen betrachtete der Kapitän den vor ihm Stehenden, bei dem die Matrosen noch zögerten, die um die Hände gelegte Schlinge zuzuziehen, während dies auch jetzt schon bei dem Schah geschehen war.
»Kommt, Ihr sollt frei sein. Aber bei der ersten verdächtigen Bewegung wird euch natürlich eine Kugel an den Kopf geworfen.«
Der Gefangenentransport marschierte ab, begleitet von sieben Matrosen und dem Kapitän. Vier hatte dieser noch mitgebracht, drei waren als Wächter bei dem Kessel gewesen, nur dass der eine inzwischen das Frühstück geholt hatte.
Wenn nun die ganze Freiwache zur Kondorjagd im Gebirge war, so musste Axel daraus schließen, dass das Piratenschiff sehr stark bemannt war — oder aber es konnten nur einige Mann darauf zurückgeblieben sein.
Dieses letztere sollte sich dann auch bestätigen. Das am Felsenufer befestige Schiff brauchte ja hier nicht weiter bewacht zu werden.
»Wir sind keine solchen blutrünstigen Piraten, wie Ihr vielleicht denkt«, nahm der Kapitän unterwegs einmal das Wort. »Wir sind ganz ehrliche, staatlich konzessionierte Sklavenhändler, und was ein richtiger Sklavenhändler ist, der etwas verdienen will, der darf kein so roher Runks sein, der immer gleich drauflos peitscht. Das wird ja immer ganz falsch gehandhabt. Seht: ich behandele mein lebendiges Ebenholz immer aufs Anständigste — immer gutes Essen, lasse sie an Deck spazieren gehen, bei mir an Bord muss es Musik und Tanz geben, die kleinste Wunde wird sorgfältig verbunden — und deshalb bin ich auch der glücklichste Sklavenhändler. Aber es ist Dummheit, mich wegen meines Glückes zu beneiden. Es ist Verstand, nur mein Verstand. Und weil ich so verständig bin, bin ich befähigt, mich nur mit Mädchenhandel zu befassen. Versteht Ihr? Ich bringe immer nur die schönsten, gesündesten, lebensfrohesten schwarzen Mädel auf den Markt, dafür ist der Kapitän Smart vom Friedensengel bekannt in der ganzen Welt, wo es Ebenholz zu kaufen gibt.«
Und der Kapitän fuhr fort, seinen Verstand und seine Liebenswürdigkeit und seine daraus entspringenden Bombenerfolge im Sklaven- und speziell im schwarzen Mädchenhandel zu preisen.
Wolle man nun bedenken, dass damals der Handel mit gekauften und erbeuteten Negern eine erlaubte Sache war. Es gab Sklavenhändler genug, die sich für die ehrenwertesten Leute hielten, als solche galten und als Kinder ihrer Zeit es auch wirklich waren. So hielt sich auch dieser Kapitän Smart für einen tadellosen Ehrenmann — nur hätte er dies nicht immer so betonen sollen, das musste etwas stutzig machen.
»Wie kommt Ihr denn aber dann dazu, Euch einen Piraten zu nennen?«, fragte Axel.
»Na ja, so kleine Nebengeschäftchen werden ja dabei gemacht — seht, dass ich euch hier so gefangen nehme, das könnte ich doch auch nicht so ganz vor einem Seegericht verantworten, aber — Geschäft ist Geschäft — und da weiß sich Käpten Smart immer wieder herauszufitzen, dass er als ehrlicher Mann jeden Hafen anlaufen kann...«
So rechtfertigte er sich weiter nach dem Grundsatze: Stehlen ist erlaubt, selbst Morden, überhaupt alles, alles — man darf sich dabei nur nicht erwischen lassen.
Und die Sache war die, dass dieser Ehrenmann, ein Yankee, stolz darauf war, gesetzwidrige Taten, Verbrechen, zu begehen und dafür nicht bestraft zu werden, und dieser Stolz ging so weit, dass er sich gleich direkt einen Piraten nannte.
Es gibt solche Menschen, es laufen sogar genug herum, und es ist wirklich wert, noch ein anderes Beispiel heranzuziehen. Der Schreiber dieses kannte einen Mann, der es vom Hausknecht zum vielfachen Hausbesitzer, zu vielen Millionen gebracht hatte. Wenn er nun so im Scherze gefragt wurde: ›Wie kann denn nur ein Hausknecht Millionär werden?‹ — dann schrie er stolz, dass es möglichst viele hören konnten, schrie es womöglich über die ganze Straße weg: ›Immer nahe am Zuchthaus vorbei, immer nahe am Zuchthaus vorbei, das ist die wahre Kunst!!‹ Und richtig, mit sechzig Jahren kam der bisher unbescholtene, d. h. noch unbestrafte Mann ins Zuchthaus, hatte wegen eines Objektes von dreißig Mark einen Meineid geleistet.
Nach einer halben Stunde Marschierens über die Küstenebene drangen sie durch einen Einschnitt in das Kammgebirge, das sich also bis an die Südküste hinzog, hier steil ins Meer fallend, und da lag schon das Schiff, eine scharfgebaute Brigg, mit Heck und Bug an zwei isolierten Felsen vertaut. Hier hatte es dem Orkan widerstehen können, es hätte höchstens durch die Kraft des Sturmes an der Felswand zerdrückt werden können, aber das geht denn doch nicht so leicht.
Ohne ein Laufbrett benutzen zu müssen, konnte man gleich von dem Felsplateau an Deck treten.
»He, Steuermann, Bootsmann, Koch!! Wo sind denn die Kerls?«
Wenn der Kapitän sogar nach dem Koch rief, so musste Axel annehmen, dass sonst nicht einmal ein Matrose mehr zurückgeblieben war. Die Freiwache auf der Kondorjagd, die Matrosen von der Wache waren nach und nach von den Gefangenen in Anspruch genommen worden.
»Ja, wo sind denn nur die drei Kerls?!«
Die waren einfach nicht da. Es war in der elften Stunde; in der Kombüse, Küche, war auf dem Herd das Mittagessen angesetzt, aber das Feuer fast schon erloschen.
»Die sind mit ins Gebirge auf die Kondorjagd gegangen.«
Der Kapitän fluchte mörderisch. Es war ja auch fast unerhört, dass die letzten drei ihren Posten verlassen, um sich dem Vergnügen der Kondorjagd hinzugeben — aber es mochte eben hier eine sehr lockere Disziplin herrschen, wie gewöhnlich auf solchen Schiffen, die zu anderen Zeiten wieder die eisernste Manneszucht erfordern, die Begierde, ein paar der seltenen, glückbringenden Vögel zu erwischen, war gar zu groß gewesen.
»Na, kommt nur zurück, ihr Himmelhunde, dann könnt ihr etwas erleben, diesmal lasse ich das nicht wieder so hingehen!«
Die Gefangenen wurden von den Matrosen unter Deck geleitet, nach wenigen Schritten der freigelassene Axel vom Kapitän besonders davongeführt, nur noch von einem bewaffneten Matrosen begleitet.
Der Kapitän schob eine Schiebetür zurück, eine ganz hübsche Kabine zeigte sich.
»Hier geht einstweilen hinein. Das ist die Fremdenkabine, wenn ich einmal einen Gast habe, oder eine Gesellschafterin, hahähä. Na, anständiger kann ich Euch doch nicht behandeln. Zu essen bekommt Ihr gleich etwas.«
Die Tür ward geschlossen und draußen der Riegel vorgeschoben, dann kam offenbar noch ein Vorhängeschloss daran.
Axel war mit seinen Gedanken allein. Wir wollen diese nicht schildern.
Durfte er auf den Grafen noch hoffen? Ja, Axel bezweifelte es nicht.
»Ich kalkuliere, dieser Mann, ein wirklicher Wundermann, hat wieder eine Überraschung in petto.«
Mag das genügen.
Ein Matrose brachte ihm frisch gebackenes Brot, verschiedene kalte Fleischsachen und eine Flasche griechischen Rotwein, aus Konstantinopel stammend.
»Mit dem Mittagessen wird es heute etwas dauern.«
Axel aß, trank und promenierte auf und ab. Durch das Bullauge, das runde Schiffsfensterchen, war nur die sehr nahe Felswand zu sehen.
Über seinem Kopfe liefen Menschen hin und her, der Kapitän fluchte, andere Stimmen ertönten, aber auch von der lautesten war kein Wort zu verstehen.
Sehr viele laufende Schritte kündeten wohl das Kommen der Kondorjäger an, sie wurden von dem Kapitän noch brüllender empfangen.
So waren wohl zwei Stunden vergangen, als der Matrose, der von einem anderen, draußen bleibenden, begleitet war, das Mittagessen brachte:
Reis mit Curry, ein indisches, pfefferähnliches Gewürz, ohne welches der Inder überhaupt nichts isst und auch auf allen Schiffen sehr eingeführt, Pökelbraten, Kartoffeln und Eierkuchen, dazu wieder eine Flasche Rotwein — mehr konnte man auf einem Kauffahrteischiff ja gar nicht verlangen, nicht einmal am Sonntag, der heute nicht war.
Axel machte sich noch einmal mit bestem Appetit über die Mahlzeit her, vertilgte den Braten, die große Schüssel Kartoffeln und den Eierkuchen. Nur den Reis ließ er unberührt.
Er kannte das indische Gewürz schon, auch in Italien ist es sehr beliebt, aber sein Fall war es nicht. Ein ganz eigentümlicher Geschmack, man muss sich erst daran gewöhnen, dann isst es wohl jeder Mensch leidenschaftlich gern. Natürlich nicht der, der niemals einen Anfang macht. Es soll ein ausgezeichnetes, unschuldiges Mittel gegen Fieber sein. Das ist die gemahlene Wurzel dieser Pflanze, Curcuma, das daraus gewonnene Stärkemehl heißt ArrowRoot, gleichfalls in Indien ein beliebtes Nahrungsmittel, und bei uns dürfte es wenige geben, die als Kind nicht den gepulverten Samen in Sirup einbekommen haben — Zitwersamen.
Nach dem Essen ward es still an Deck. Die Mannschaft hielt Siesta. Auch Axel hatte sich in die Koje gelegt. »Was soll daraus werden? Was macht nun der Graf auf der wüsten Insel? Ob er denn nur wirklich ohne Speise und Trank...«
Axel konnte diesen fragenden Gedanken nicht fertig denken, er war eingeschlafen.
Ein Rasseln an der Tür, so leise dieses auch war, weckte ihn.
Er blickte nach der sich öffnenden Tür und... glaubte seinen Augen nicht trauen zu dürfen!
Es war der Graf, der eintrat, ganz gelassen. als wenn er hier zu Hause wäre.
Mit gleichen Füßen sprang Axel aus der Koje!
»Es — ist — doch — nicht — möglich!«, flüsterte er, sich die Augen reibend.
»Wieder einmal eine Unmöglichkeit?«, lächelte der Graf, seine Stimme durchaus nicht dämpfend.
»Sie können als Geist erscheinen — sind dem Lord Moore so erschienen, woran ich nicht zweifeln kann — ich bin fasziniert!«
»Nein, das sind Sie nicht, und ich bin Ihr Freund in Fleisch und Blut.«
»Ja, aber...«
»Wir sind die Herren dieses Schiffes.«
Der Graf deutete auf die Schüssel mit Reis.
»Sie haben den Reis nicht berührt, das ist die Erklärung, weshalb Sie allein noch bei wachen Sinnen sein können.«
Da freilich hatte der scharfsinnige Depeschenreiter schon genug gehört.
»Sie haben in den Reis ein Mittel getan, das die ganze Mannschaft betäubt hat?«
»So ist es.«
»Erzählen Sie!«
Der Graf setzte sich dazu ganz gemütlich hin.
»Ich hatte das zersplitterte Boot eben erreicht, als ich über die Ebene ein Licht schweben sah. Was konnte das sein? Nur ein Mensch, der eine Laterne trug. Das sagten mir schon die Bewegungen des Lichtes.
»Ich schlich mich hin, stieß auf ein Dutzend Männer, welche, mit Gewehren bewaffnet, in der Finsternis der vorausleuchtenden Laterne folgten.
Mich neben ihnen zu halten, ohne selbst bemerkt zu werden, war mir ein Leichtes. Sie unterhielten sich flüsternd, und ich vernahm, dass sie es auf die Schiffbrüchigen abgesehen, die sich gestern Nachmittag vor dem losbrechenden Orkan in den Hügelkrater geflüchtet hatten. Sie hofften nur, dass sich diese noch darin befanden, sodass sie alle gleich hübsch beisammen hatten.
Ja, ich vernahm auch einige hingeworfene Worte, dass es sich um die aus dem Wasser gefischte Bombe handelte, von der sie wussten, dass sie ein mit Geheimschrift bedecktes Leder enthält. ›Ob sie die Bombe wohl schon geöffnet haben?‹ — ›Wenn auch, diese Geheimschrift können sie niemals entziffern. Wenn wir selbst sie nur wiederhaben.‹
So und anders hörte ich sie zusammen flüstern. Sie mussten hier auf dieser Insel recht gut Bescheid wissen, sie fanden den isolierten Hügel fast im Finstern, zuletzt wurde auch die Laterne gelöscht. Ich hielt sie für professionelle Schildkrötenfänger, die dieser Insel öfter einen Besuch abstatten. Auch das hörte ich, dass sie schon seit acht Tagen mit ihrem Schiffe hier an der Südküste lagen.
Ja, sie wussten sogar, dass wir vom ›Stern von Indien‹ stammten, am wichtigsten aber war es für mich, zu hören, dass sie sich über unsere Anzahl nicht recht im Klaren waren. Sie hatten uns immer aus sehr weiter Ferne beobachtet, und wir waren ja viel durcheinandergelaufen, oben auf dem Berge hatte sich der Inder doch von uns getrennt, und so weiter. Kurz, sie wussten nicht genau, wie viele wir waren.
Sie schlichen an den Rand des Kessels, warteten den Anbruch des Tages ab. Dort oben gab es gar zu wenig Verstecke, ich selbst durfte dort nicht bleiben. So wandte ich mich schnell dem Gebirge zu, hatte ein sicheres Versteck gefunden, von dem aus ich den Krater im Auge behalten konnte.
So brach der Tag an. Meine Augen sind gar scharf, ich erkannte sogar, wie die fremden Matrosen Ihr Lasso betrachteten. Also, nun saßen Sie mit den anderen gefangen in dem Kessel.
Das Leder hatte ich zu mir gesteckt. Was würden Sie nun dem Kapitän über mich sagen? Das war für mich jetzt die große Frage, von der alles andere abhing. Eine Unterhaltung fand statt, ich sah den Kapitän auf dem Bauche liegen. Aber was nun wurde ihm berichtet?
Nach etwa einer halben Stunde trat der Kapitän den Rückweg an, begleitet von acht Matrosen, drei ließ er als Wächter zurück.
Ihr Weg führte dicht an meinem Versteck vorbei, und einem Manne fiel es ein, zwischen die Steine hineinzulaufen, er hatte wohl etwas glitzern sehen. Ich steckte in einer kleinen Höhle, auf diese hatte es der Mann gerade abgesehen, und es blieb mir nichts anderes übrig, als zuzugreifen, ihm die Gurgel zuzudrücken.
Der Kapitän war von einem anderen Matrosen geholt worden — Sie haben wohl auch den Pfiff gehört, mit dem er sich vorher angekündigt hatte — im Süden war nämlich ein großes Schiff erblickt worden, dessen Anwesenheit hier diesem Kapitän Smart höchst unangenehm zu sein schien. Ich erfuhr es dann, es war ein Rivale im Sklavenhandel, ein Todfeind, mit dem es wahrscheinlich einen Kampf auf Tod und Leben auszufechten galt.
Bei diesem Rückzug Hals über Kopf, um wieder an Bord zu kommen, fiel das Verschwinden des Mannes nicht auf. Oder man glaubte, er würde nachkommen. Dann später, als alles wieder geregelt war, fiel sein Verschwinden erst recht nicht auf, denn dann, als die Gefahr vorüber war, ging alles, was frei hatte, ins Gebirge.
So hatte ich den Matrosen in meinen Händen. Ich faszinierte ihn. Und da erfuhr ich alles, was der Kapitän von Ihnen gefordert, wie Sie behauptet hatten, das Leder mit der Geheimschrift zu besitzen... was wollen Sie?«
»Ihnen mein Kompliment machen — Graf, Sie sind doch ein Teufelskerl!«, musste Axel seinem Staunen einmal Luft machen, und doch sollte das Sensationellste erst noch kommen, das hier war ja nur eine Einleitung.
»Danke. Obgleich... dieser Sklavenhändler, der aber noch etwas ganz anderes ist, hält sich für einen Engel, und Sie halten ihn für einen Teufel — so ist es recht, so geht es zu in der Welt. Nun wusste ich, was ich zunächst zu tun hatte. Sie mussten benachrichtigt werden, dass Sie auf mich zählen konnten, und Sie mussten das Leder haben, um es dem Kapitän auszuliefern. Anders ging es doch nicht, nicht wahr?«
»Nein, wir standen vor einer Alternative, die nur einen Ausweg hatte.«
»So dachte auch ich. Von dem Gebirge aus zieht sich nach jenem Hügel eine Reihe von Felsblöcken hin. So konnte ich mich unbemerkt näher schleichen. Denn Ihnen schon von dort aus das Leder zuzuwerfen, dazu war die Entfernung denn doch zu groß, und das musste ja natürlich auch ganz unbemerkt geschehen.
Ich kam nahe genug heran, ahmte den Schrei des Kondors nach, den Ton hoch vom Himmel aus der anderen Richtung kommen lassend...«
»Was, das können Sie auch?!«
»Das ist gar nicht so besonders schwer, wenn man dabei die Hände zu Hilfe nimmt. wodurch man die Richtung des Tones ändern kann.«
»Sie sind Bauchredner?«
»Das hat mit Bauchreden gar nichts zu tun«, wich der Graf aus. »Also meine List gelang. Die beiden Matrosen — der eine hatte sich noch nachträglich entfernt — blickten nach der anderen Richtung in die Höhe, um den Kondor zu sehen — ich warf mein Paket...«
»Dem edlen Schah auf die Nase, es klatschte ihm direkt auf's Maul.«
»So? Tut mir leid. Geschah nicht mit Absicht. Na, geschadet scheint es ihm ja nichts zu haben. Ich kehrte zu meiner Höhle zurück, brachte meinen Mann, den ich in Faszination beließ, in ein noch sichereres Versteck, schlich mich nach der Südküste, besichtigte erst einmal die Brigg. Wissen Sie, was für Aberglauben die Seeleute mit dem Kondor verbinden?«
»Ich weiß es, und nicht nur die Seeleute tun das.«
»Darauf hatte ich meinen Plan gegründet. Auch in der Nähe des Schiffes ließ ich den Kondorschrei ertönen, gesellte das charakteristische Pfeifen des Weibchens hinzu. Das fremde Schiff — übrigens nicht ein feindliches, wie ich dann erfuhr — war inzwischen wieder verschwunden, alles blickte mit Interesse in die Höhe. Vielleicht wissen Sie auch, dass sich der Kondor mit Vorliebe in Regionen aufhält, in denen er für das menschliche Auge gar nicht sichtbar ist, und er stürzt so schnell herab, dass man dies ebenfalls kaum verfolgen kann.
So veränderte ich meinen Schrei, gab ihm einen anderen Klang, dass er mehr aus der Nähe zu kommen schien, die Matrosen sollten glauben, das Kondorpaar hause auf dieser Insel. Diese Vermutung lag ja überhaupt sehr nahe, sie sollten aber auch der Meinung werden, es sei gegenwärtig auf der Insel.
Und richtig, alles, was frei hatte, die Hälfte der Mannschaft, machte sich sofort auf die Suche nach dem vermeintlichen Horst, in der Hoffnung, darin Junge zu finden, und ich bestärkte sie in dieser Hoffnung. Der Kondor ist nämlich ein sehr dummes Tier; sobald er eine Gefahr merkt, dass sich ein Mensch seinem Horste nähert, schreit er, anstatt still zu sein, sodass man seinen kunstvoll versteckten Horst gar nicht finden würde, nur um so mehr.
»Also ich lockte, und lockte, und die Matrosen, neun Mann, folgten mir willig immer tiefer ins Gebirge hinein...«
»Ja, was hatten Sie denn nun eigentlich mit ihnen vor?«, unterbrach einmal Axel den Erzähler.
»Ich musste einfach alle neun Mann in meine Gewalt bringen.«
»Wie haben Sie denn das fertig gebracht?«
»Nein, ich brauchte es nicht zu tun, es kam alles ganz anders. Zunächst aber war mein Plan, einen dieser neun Männer nach dem anderen unschädlich zu machen, oder womöglich gleich alle zusammen, was freilich seine Schwierigkeit gehabt hätte. Einen nach dem anderen, das war einfacher. Wenn diese nicht zum Schiffe zurückkehrten, so wären doch andere nach ihnen geschickt worden, um sie zu suchen. Die hätte ich ebenfalls unschädlich gemacht. Und so wäre das immer weitergegangen, bis ich endlich das ganze Schiff entvölkert hätte. Mit den letzten wäre ich dann auch schon noch fertig geworden, zudem ich mich ja dann auch noch mit Ihnen in Verbindung gesetzt hätte.«
Starr blickte Axel den Erzähler an.
»Ja, aber ich verstehe gar nicht...«
»Was verstehen Sie nicht?«
»Wie wollten Sie denn nur die ersten neun Matrosen unschädlich machen?«
»Nun, ebenso wie den Mann, den ich doch schon hatte, ich hätte sie so nach und nach auseinander gelockt und einen nach dem anderen die Gurgel zugedrückt, hätte ihn mit seinem Gürtel gefesselt und ihn einstweilen in ein Versteck geschleppt, dass er nicht vorzeitig von seinen Kameraden gefunden wurde. So hätte ich einen nach dem anderen abgetan, ebenso dann auch die neu Hinzukommenden, welche ihre so lange ausbleibenden Kameraden suchten.«
»Mann, Mann, und das nennen Sie eine ganz einfache Sache?!«, brachte Axel staunend hervor. »Und das hätten Sie wirklich fertiggebracht?!«
»Bezweifeln Sie es? Allerdings konnte es mir ja auch missglücken...«
»Nein, nein, ich zweifle nicht im Geringsten, dass Sie Hexenmeister auch das fertiggebracht hätten. Erzählen Sie weiter!«
»Ich sollte nicht dazu kommen, diesen Plan auszuführen, keinen einzigen brauchte ich zu überwältigen. Ich sah, mich oben auf dem Kamme des Gebirges befindend, den Kapitän mit vier Begleitern das Schiff verlassen und wieder die Richtung nach dem Hügelkrater einschlagen. Der wollte seine Gefangenen jetzt also abholen, brauchte dazu einige Leute mehr als Sicherheitswächter.
Auch die in dem Gebirge herumstreifenden Matrosen sahen den Kapitän mit den vier Männern gehen, und da ich mich ihnen immer so dicht wie möglich nachschlich, hörte ich sie sagen, dass jetzt nur noch drei Mann an Bord wären: der erste Steuermann, der Bootsmann und der Koch.
Da änderte sich mein Plan. Die drei Männer zu überwältigen war doch viel einfacher, als alle die anderen. Nun muss ich noch nachträglich erwähnen, dass der Mann, den ich überwältigt hatte, mir etwas ähnlich sah, er hatte denselben Schnurrbart, vor allen Dingen ungefähr dieselbe Statur, und das war die Hauptsache. Wegen des Gesichtes hätte ich mir sonst schon zu helfen gewusst.
Also ich sofort hingeeilt nach jenem Versteck, seine Kleidung angezogen, mir etwas die Züge zurechtgezupft...«
»Was taten Sie?«, rief Axel. »Die Züge zurechtgezupft?! Na, lassen Sie nur, ich glaube Ihnen alles, alles.«
»Ich war zufrieden mit meinem Aussehen, das ich mir allerdings nur im Geiste vorstellen konnte. Und nun wieder nach dem Schiffe geeilt, dreist das Deck betreten. Die Gelegenheit war die günstigste. Der Steuermann und der Bootsmann standen gerade zusammen, in der Kombüse sah ich den Koch wirtschaften, der aber wieder jene beiden nicht sehen konnte.
Ich gleich auf die beiden zu. ›Was willst du, Dan?‹ Der Steuermann hatte kaum Zeit, den Namen des vermeintlichen Matrosen auszusprechen, da war er schon mitsamt dem Bootsmann überwältigt, und nun schnell nach der Kombüse und ebenso den Koch zu Boden geworfen...«
»Ja, aber erlauben Sie mal, Graf! Sie sprechen immer von Überwältigen. Davon verstehe ich doch auch etwas. Aber wie machen Sie denn das, dass das so fix geht? Doch nicht etwa... tot?«
»O nein, nur unschädlich gemacht.«
»Ja, aber wie denn nur?«
Der Graf kam manchmal in Verlegenheit, wenn man gar nicht wusste, was für einen Grund er eigentlich dazu hatte.
»Ich blies ihnen ein betäubendes Pulver ins Gesicht«, gestand er dann, in einem Tone, als habe er wirklich ein nicht ganz sauberes Geständnis gemacht, und... es war ja auch wirklich etwas daran. Jedenfalls hätte er einem anderen dies niemals erklärt, verpflichtete Axel dann später auch noch zum Stillschweigen.
»Ein betäubendes Pulver? Sie haben ein solches immer bei sich?«
»Immer. Wenigstens seit jener Zeit, da Lady Isabel unter dem Königstiger lag und mein bannender Blick, dem ich sonst unbedingt traute, versagte, als sich Ihr Taschenterzerol als zuverlässige Hilfe erwies. Seitdem führe ich dieses betäubende Pulver immer in größerer Menge bei mir.«
»Und es betäubt auf der Stelle?«
»Sobald man einen Atemzug macht, nur den geringsten, ist man sofort betäubt.«
»Selbst bei einem Königstiger ist das der Fall?«
»Weshalb nicht? Ich möchte es einmal bei einem Elefanten probieren. Bei einem Büffel habe ich es schon versucht. Er wankte sofort, ein dumpfes Brüllen, und er stürzte. Ein Mensch, selbst der kräftigste, hat keine Zeit mehr, auch nur einen Laut auszustoßen, keinen Seufzer mehr.
»Tausend noch einmal! — Was für ein wunderbares Pulver ist denn das?«
»Eine sehr einfache Substanz, fast überall zu haben. Hier allerdings nicht, auch in den Polargegenden nicht. Sonst aber wächst die Pflanze fast überall, und sie braucht, getrocknet und zerrieben, nur noch mit etwas behandelt zu werden, was wenigstens in jedem Kaufmannsladen zu haben ist, und das Pulver ist fertig.«
»Ja, was für eine Pflanze und was für ein käufliches Mittel sind das aber nun?«
»Signor Axel, es gibt Geheimnisse, Erkenntnisse, welche man lieber nicht aller Welt mitteilen soll, es kann zu großer...«
»Behalten Sie Ihr Geheimnis für sich.«
»Nein, nein, Sie sollen es erfahren.«
Und Axel erfuhr es. Er hat das Rezept in seinem Tagebuche nicht mitgeteilt, berichtet nur, dass das Pulver, als er es sich einmal selbst herstellen wollte, nicht wirkte.
Es gibt übrigens viele solche Mittel. Hat der Leser vielleicht einmal etwas von Kockelskörnern gehört? Man lese darüber dort nach, wo es zu suchen ist. Zum Glück sind diese höllischen Körner bei uns sehr schwer zu haben, sie dürfen nicht geführt werden, und wer in England, wohin sie durch den indischen Verkehr leichter kommen, mit diesen Körnern betroffen wird, kommt mindestens unter Polizeiaussicht, und in Indien ist der Eingeborene, in dessen Taschen oder Hütte sie gefunden werden, des Todes.
»Da werfen Sie das Pulver dem Betreffenden einfach ins Gesicht?«
»Ja.«
»Ich verstehe nicht recht — bei zweien mag es ja noch gehen...«
»Ich blase es.«
»Mit einem Blaserohr?«
»Nein, ich habe mir erst an Bord des schwarzen Schiffes dazu eine besondere Waffe gemacht.«
Es war ganz merklich, dass der Graf zu ungern hiervon sprach, es war ein gewisses Schamgefühl mit diesem Geständnis verbunden.
Zögernd griff er in die Westentasche, brachte dann mit einem Ruck eine kleine Pistole zum Vorschein, sehr klein, wie ein Kinderspielzeug aussehend, aber merkwürdig, ganz aus Stahl, auch der im Verhältnis zu dem ganz dünnen, kurzen Lauf sehr dicke Kolben.
»Es ist ein Windterzerol.«
Das kannte man nämlich schon damals. Als Otto von Guericke auf dem Reichstage zu Regensburg im Jahre 1681 seine öffentlichen Experimente mit den sogenannten Magdeburger Halbkugeln vorgeführt hatte — Guericke war in Magdeburg geboren und wurde Bürgermeister dieser Stadt, nur daher der Name — zwei große, eherne Halbkugeln, deren Innenraum luftleer gepumpt wurde, und die dann nur, obgleich lose zusammengepasst, durch dreißig Pferde erst auseinandergerissen werden konnten, beschäftigten sich alle damaligen Physiker mit dieser neuerkannten Erscheinung des Luftdrucks, und man dachte bald daran, ihn auch für eine Waffe zu benutzen, statt des Pulvers, setzte die größten Hoffnungen darauf. Sie erfüllten sich nicht. Im Anfange des neunzehnten Jahrhunderts ist einmal eine Abteilung irgendeines preußischen Dragonerregiments sogar mit Luftkarabinern ausgerüstet worden, welche an Durchschlagskraft den damaligen Feuerwaffen wenig nachgestanden haben sollen. Aber die Sache war zu gefährlich, die Kolben hielten den Druck nicht, sprangen, explodierten zu oft. So ist die Luftbüchse, damals in Deutschland allgemein Windgewehr genannt, heute nur noch eine kindliche Spielerei. Jedoch fangen die Amerikaner jetzt wieder an, ungeheuere Luftkanonen zu bauen, pneumatische Geschütze, die Dynamitbomben schleudern.
Jedenfalls hatte Axel auch schon von Luftpistolen gehört, wenn auch noch keine gesehen, am wenigsten solch ein zierliches Ding.
Der Graf erklärte ihm den Mechanismus, soweit er das gegen einen Laien konnte, zeigte, wie er durch mehrmaliges Auf- und Niederklappen des als Hebel wirkenden Laufes den Kolben immer mehr mit komprimierter Luft füllte.
»Nun tu ich hier hinten etwas von dem Pulver hinein, irgendeinen Pfropfen darauf — oder das ist auch nicht nötig, nur darf ich den Lauf nicht senken, und beim Abdrücken wird das Pulver herausgeschleudert. Nun sehen Sie aber doch hier hinten fünf kleine Kammern. Wenn jede mit dem Pulver gefüllt ist, kann ich fünf solche Pulverportionen herausschleudern, ohne erst immer wieder laden zu müssen.«
»Was? Fünfmal hintereinander?!«
»Ja, indem ich hier verstelle, dann entweicht immer nur ein Teil der komprimierten Luft. Nach dem fünften Schusse hat sich der Vorrat total erschöpft.«
»Wunderbar, wunderbar!«, staunte Axel. »Und wie weit können Sie damit schießen?«
»Allerdings nicht sehr weit. Mit den Teilschüssen wurde das Pulver nur zwei bis vier Meter weit geschleudert. Aber das genügte ja vollkommen für den Zweck, für den diese Waffe bestimmt war. Mit dem Einzelschuss, der alle komprimierte Luft mit einem Male entlud, ging es natürlich weiter, doch eine Bleikugel, mit diesem Terzerol abgefeuert, hatte keine Wirkung.«
»Ach, auf diese Weise wollten Sie wohl auch die neun Matrosen im Gebirge nacheinander unschädlich machen?«
»So ist es«, sagte der Graf leise, dabei wie beschämt den Kopf sinken lassend.
Axel sah ihn an. Und er verstand diesen Mann, verstand, was in ihm vorging. Auch der Leser wird ihn verstehen. Eben ein ganz eigentümlicher Mensch, immer zu den ungeheuersten Übertreibungen geneigt, und dabei von feinsten Empfindungen erfüllt, eine rätselhafte Doppelnatur, die sich überall selbst im Wege stand. Anders lässt es sich nicht ausdrücken, und es genügt wohl.
Erinnert sei nur daran, wie der Graf zuerst erzählt hatte, er habe dem ersten Manne mit seinen Händen die Gurgel zugedrückt, so habe er auch einen der neun Matrosen nach dem anderen überwältigen wollen.
Doch im Grunde genommen war das ja ganz gleichgültig, der Graf hob denn auch schnell genug mit freiem Blick wieder den Kopf.
»Nun verstehen Sie wohl auch, weshalb ich niemals in Gefangenschaft fallen darf?«
»Ja, ich verstehe.«
»Bin ich gefangen, visitiert man meine Taschen, meinen ganzen Körper, dann bin ich... ein ohnmächtiger Mensch.«
»Nein, da verstehe ich Sie nicht. Nein, Graf, da suchen Sie Ihren Stolz nun wieder darin, sich herabzusetzen. Nein, Graf, auch wenn Sie so sind, wie Gott Sie geschaffen hat, und wenn man Sie mit Fesseln wie mit einem Netz umwunden hat —Sie würden sich schnell genug zu helfen wissen, auch als gefesselter Sklave sind und bleiben Sie der Herr und Meister ihrer Feinde — Sie sind und bleiben ein... Engelskerl, wenn Sie sich nicht mit dem Teufel vergleichen lassen wollen.«
»In diesem Falle ist der Vergleich mit dem Teufel richtiger.«
»Ach, Larifari, nun hören Sie endlich auf mit Ihren Sentimentalitäten! Sie sind der kurioseste Kauz, der mir je vorgekommen. Wie wurde denn das nun weiter? Erzählen Sie!«
»Auf dem Herde stand schon das Mittagessen angesetzt. Den Reis hielt ich für die allgemeine Speise, die niemand verschmähen würde. Er kochte noch nicht. Ich tat genügend von dem farblosen, geschmacklosen Pulver hinein. Dann trug ich die drei Bewusstlosen unter Deck, sah mich nach einem besseren Versteck um, trug sie tiefer hinab ins Farbengatt, wo auch ich blieb, alles Weitere abwartend.
Es glückte alles aufs beste. Der Kapitän kam mit den Gefangenen zurück. Das Herdfeuer wurde wieder in Gang gebracht. Zur Essenszeit kamen auch die Matrosen von der fruchtlosen Kondorjagd zurück. Nur der erste Steuermann, der Bootsmann, der Koch und der Matrose, dessen Rolle ich gespielt hatte, fehlten noch. Derentwegen wurde nicht mit dem Essen gewartet. Die Pflichtvergessenen konnten sich dann auf etwas gefasst machen. Bald ward es still. Totenstill! Eine halbe Stunde wartete ich noch. Als ich neben dem Schiffe einen jungen Walfisch schnaufen hörte, ohne dass dem an Deck ein Schritt nachfolgte, war ich meiner Sache sicher.
»Ich begab mich hinauf. Ja, ich hatte mein Ziel erreicht. Alles lag in todesähnlichem Schlafe da. Mehr habe ich nicht zu berichten.«
Axel holte tief Atem, schüttelte den Kopf.
»Graf, Graf — Sie sind doch lieber ein Teufelskerl! Sind die Leute in diesem Zustande zu vernehmen? Durch Faszination?«
»Ohne Zweifel.«
»Sie haben es noch nicht getan?«
»Nein, ich habe zunächst Sie aufgesucht. Sie sind der einzige, der den Reis verschmäht hat. Denn auch unsere Kameraden sind natürlich bewusstlos geworden.«
»Gesundheitsschädlich ist das Betäubungsmittel nicht?«
»Gar nicht.«
Sie verließen die Kabine. Zunächst führte der Graf seinen Begleiter noch tiefer in den Raum hinab, öffnete eine schwere, eisenbeschlagene, mit vielen Riegeln und Vorhängeschlössern versehene Tür. Es war ein weiter Raum, fast durchs ganze Schiff gehend, überall waren in den Balken Ringe mit Ketten eingelassen, dazu bestimmt, die schwarzen Sklaven aufzunehmen. Statt dieser hingen jetzt in den Ketten Inder und einige Europäer. Nur der Schah fehlte.
Doch die Hände hatte man ihnen frei gelassen, diese Fußfesseln waren nicht zu sprengen oder die Schlösser zu öffnen. Sie hatten gegessen, und zwar die Schüsseln vollständig geleert, dann erst waren sie in bequemen Lagen eingeschlafen, und zwar war es ein ganz gesunder Schlaf, besonders Kapitän Morphium schnarchte wie ein Bär.
»Die haben den Reis erst aufgegessen?«, meinte Axel. »Ich denke, das Pulver wirkt so augenblicklich, und da kann doch zwischen Riechen und Schmecken kein so großer Unterschied sein.«
»Ich habe kein solches Pulver in den Reis getan.«
»Nicht? Sie sagten doch.«
»Sagte ich? Nein, in den Reis habe ich etwas anderes getan, eine Pille...«
Es war ganz offenbar, wie sich der Graf genierte, zu gestehen, dass er verschiedene solche Betäubungsmittel bei sich führte.
»Das Pulver hätte jeden sofort betäubt, beim ersten Kosten des Reises, und das durfte doch nicht sein. Nein, dieses Mittel wirkt ganz anders, erst nach einer Viertelstunde tritt eine ganz natürliche Müdigkeit ein.«
»Wo ist der Schah?«
»In einer besonderen Kabine, ungefesselt, schläft ebenfalls.«
Sie begaben sich an Deck hinauf. Alles schlief wie in Dornröschens verwunschenem Schlosse, auch ein Schwein, das man in einem Bambuskäfige mästete. Man hatte ihm gekochten Reis vorgeschüttet gehabt, und es schlief selig.
»Wie lange wirkt das Mittel?«
»Vor sechs Stunden wacht niemand auf, der auch nur einen Bissen genossen hat. Deshalb hielt ich eine sofortige Fesselung für unnötig, das kann noch geschehen.«
»Wo ist der Kapitän?«
»Im Kartenhaus, wohin er sich das Essen bringen ließ.«
Sie begaben sich hin. Der Kapitän lag schnarchend auf dem Bambussofa.

»Nun wollen wir ihn doch ausforschen, wenn das möglich ist, was für eine Bewandtnis es mit der Bombe und der Geheimschrift hat.«
Der Graf begann das Experiment sofort, machte seine magnetischen Striche.
»Hören Sie mich sprechen?«
»Ja.«
Wir geben das umständliche Frage- und Antwortspiel nicht wieder. Sie erfuhren alles, soweit der Kapitän selbst berichten konnte. Das war nämlich gar nicht so viel.
Vor vier Jahren hatte der Kapitän Smart die Besatzung eines kleinen, wrackgeschlagenen Schiffes aufgenommen. Auch ein Passagier hatte sich darauf befunden, oder eigentlich der Schiffsherr, indem er das Fahrzeug für eine Expedition gechartert, gemietet hatte.
Nach und nach vertraute sich Mr. Frank dem Sklavenhändler an, in dem er gar keinen so unrechten Mann vermutete. Er sei im Besitze eines Geheimnisses, das mindestens 50 000 Dollar wert sei. Er wisse einen Schatz, oder doch so eine Art von Schatz, den er heben wolle. Mehr verriet er nicht. An der afrikanischen Küste, gar nicht mehr so weit von hier. Erst müsse Kapitän Smart mit ihm einen schriftlichen Kontrakt machen, dann wolle er Näheres berichten. Die Bombe hatte er schon bei sich, zeigte dem Kapitän nur einmal flüchtig ihren Inhalt, das Leder mit der Geheimschrift, die er selbst geschrieben, falls er sein Geheimnis doch einmal in Sicherheit bringen müsse, und so leicht zu merken sei das nicht, es wären so viele Zahlen dabei. Also geografische Ortsbestimmungen. Ehe er sein Geheimnis anderen Menschen preisgebe, werfe er die Bombe lieber über Bord, dann habe er doch noch immer die Hoffnung, sie wieder aufzufinden.
Kapitän Smart war bereit, sein Schiff für die Fahrt herzugeben. Denn er sagte sich ganz richtig, dass, wenn der Mann für das Chartern des Schiffes schon 10 000 Dollar bar bezahlt hatte, das Geheimnis doch auch bedeutend mehr wert sein müsse. Und ein Narr war dieser Mr. Frank nicht, wollte sich seiner Sache durchaus sicher sein.
Es sollte nicht dazu kommen. Matrosen hatten diese Unterredung belauscht, sie stahlen die Bombe, hier an dieser Küste. In der Nacht hatten sich die Feuer eines anderen Schiffes gezeigt, das wollten sie im Boote erreichen.
Sie kamen nicht weit. Wind und Strömung schlugen sie nach der Insel zurück. Auch wurden sie unter sich uneinig. Der eine Matrose warf die Bombe über Bord, wo, wusste er selbst nicht. Alles so, wie der Kapitän freiwillig schon berichtet hatte.
Wenn er jetzt einmal in die Nähe dieser Insel kam, fischte er immer nach der Bombe.
Die Geheimschrift konnte auch er nicht übersetzen, hatte nicht den Schlüssel dazu bekommen. Aber, dachte er, das sei gar nicht so schwer, da würde er schon in einem Hafen einen Mann finden, der das konnte.
Das war alles.
»Da sind wir nun gerade so weit wie erst«, meinte Axel.
»Na, das finde ich nicht, wir wollen die Geheimschrift schon entziffern.
»Fragen Sie ihn doch, ob er vielleicht weiß, was für eine Bewandtnis es mit dem Krater dort oben hat, den wir leer fanden.«
Nein, der Kapitän wusste gar nichts davon.
»Da ist uns eben dort ein anderer schon zuvorgekommen.«
»Oder Sir Daltons Hellseher haben sich einmal getäuscht.«
»Das glaube ich weniger.«
»Na, ein Gas entquillt den Ritzen auch nicht.«
»Das nicht. Aber sollte es sich nicht lohnen, dort den Boden des Kraters einmal aufzuhacken, mit Pulver zu sprengen?«
»Hm, es könnte allerdings möglich sein, dass wir dann doch noch etwas fänden. Vielleicht eine Goldader, die von dort am leichtesten zu erreichen ist! Warum nicht? Nun, forschen Sie doch den Kapitän aus, was er sonst noch alles auf dem Gewissen hat.«
»Das... tu ich nicht gern«, entgegnete der Graf zögernd.
»Weshalb nicht?«
»Es... geht nicht gerade gegen mein Gewissen, aber...«
»Ich verstehe. Hier liegt immerhin ein besonderer Fall vor. Wir müssen wissen, ob der Mann Gnade verdient, dass wir ihn samt Schiff und Mannschaft wieder freigeben, oder ob wir nicht der Menschheit einen Dienst erweisen, wenn wir diese ganze Gesellschaft von der Erdoberfläche verschwinden lassen. Nur mit den Gerichten möchte ich nicht viel zu tun bekommen.«
»Sie könnten ihn dann töten?«
»Nun... fragen Sie nur erst! Wir können ja vielleicht ein Scheusal vor uns haben, das durchaus kein Mitleid verdient — selbst von uns Männern nicht, die wir doch wohl die Menschen von einem etwas anderen Standpunkt zu beurteilen wissen als die Welt es sonst tut.«
Der Graf gab nach. Er hatte ja auch die Diener, die er damals in Rom anstellen sollte, immer auf solche Gewissensfragen examiniert. Bemerkt sei aber, dass der Graf von Saint-Germain nie, niemals Gebrauch von dem machte, was er erfuhr, auch nicht im eigenen Interesse.
Nun, Mord und Totschlag hatte der Kapitän allerdings genug auf dem Gewissen. Dafür aber war er eben ein Sklavenhändler, und danach beurteilten ihn diese beiden Männer, die also alles etwas anders beurteilten als die übrige Welt.
Richtige Piraterie hatte er niemals getrieben, in keinem einzigen Falle, damit hatte er bloß geprahlt.
»Wenn Sie nun den Schatz oder was es sonst sein mochte, gefunden hätten — hätten Sie dann den Mister Frank getötet, um nicht mit ihm teilen zu müssen?«
»Nein. Geschäft ist Geschäft — ich habe auch meine Geschäftsehre.«
Der Graf trat zurück.
»Fast möchte ich sagen: Ich finde an dem Manne kein Fehl. Er ist ein Sklavenhändler, das entschuldigt alles andere — und dürfen wir über einen Sklavenhändler zu Gericht sitzen?«
»Natürlich nicht«, stimmte Axel bei, »wir lassen den Mann laufen. Wie wollen wir aber nun...«
»Der Stern von Indien«, sagte der Graf, die Hand ausstreckend.
Ja, dort stand das ihnen so wohlbekannte Schiff, das hinter dem Gebirge aufgetaucht war, zwei Seemeilen von der Küste entfernt, soeben mit herumgeschwenkten Rahen unter vollgesetzten Segeln über Stag gehend, gegen den Wind ankreuzend.
»Wir müssen uns beeilen«, sagte Axel. »Wie gehen wir an Bord?«
»Wir nehmen hier ein Boot, das wird wohl erlaubt sein. Wir können es ja dann treiben lassen.«
»Aber unsere schlafenden Kameraden? Die alle ins Boot schleppen?«
»Ich habe auch ein Gegenmittel bei mir, es bringt sie sofort zum Erwachen. Nur etwas taumlig wird ihnen im Kopfe sein, und diese Zeit benutzen wir, um an Bord zu kommen.«
»Bon, und die Bombe, die Geheimschrift?«
»Die liegt in des Kapitäns Kajüte.«
»Die nehmen wir doch natürlich mit, um die Geschichte weiter auszubeuten.«
»Sie gehört nicht uns.«
»Nanu!«
»Es ist nicht nötig, dass wir sie mitnehmen.«
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Ich habe die ganze Geheimschrift im Kopfe.«
»Was?«, musste Axel zunächst staunen. »Sie könnten das ganze Gekleckse Zeichen für Zeichen aus dem Kopfe gleich wieder so hinmalen?«
»Ja, das kann ich, und dann können wir mit gutem Gewissen behaupten, das Geheimnis nicht abgeschrieben zu haben.«
»O, Sie Fuchs, Sie schlauer Fuchs!«, lachte Axel jetzt aus vollem Halse. »Und was wird der Schah dazu sagen, wenn wir die Geheimschrift nicht einmal abgeschrieben haben?«
»Mit dem werde ich schon fertig, und der denkt auch an ganz anderes als an solche Kleinigkeiten.«
»Dann bringen Sie unsere Gefährten zum Bewusstsein, und die hier mögen sich ausschlafen. Ich möchte nur dabei sein, wenn sie erwachen.« — —
Die ganze Gesellschaft befand sich wieder an Bord des indischen Schiffes, dieses hatte schon die Inseln seit längeren Stunden hinter sich, die Nacht brach an.
Der Graf war immer beim Schah gewesen, würde schon alles berichten, was dieser erfahren durfte.
Ein Diener kam. Die drei Sklaven, Axel, Morphium und Sam, wurden zum Schiffsherrn befohlen.
»Jetzt«, sagte Axel, als er sich in Bewegung setzte, »legt er uns entweder den Kopf vor die Füße, oder er teilt mit uns Krone und Reich — beim Barte des Propheten!... wenn er es nicht anders für gut befindet.«
Es wartete ihrer doch eine große Überraschung, etwas, woran der spottende Axel nicht gedacht hätte.
In dem großen Salon saßen in einer langen Reihe anderthalb Dutzend Weiber, einen recht frischgewaschenen Eindruck machend, in die kostbarsten Seidengewänder gehüllt, mit Geschmeide überladen.
Neben dem Schah stand der Graf. Und der Schah strich sich den Bart und sagte in freundlichstem Tone:
»Christenhunde! Ihr seht hier meinen Harem. Und keine einzige fehlt. Auch mein Lieblingsweib ist darunter. Denn ich bin ein gerechter Mann. Beim Barte des Propheten — ihr sollt frei wählen können! Aber jeder nur eine.«
So sprach der edle, gerechte Schah und außer dem Nachsatz, dass jeder nur eine einzige erküren dürfe, machte er keinen anderen, dass er etwa die Wahl auch aufheben könne.
So, nun konnten sich die drei ihre Herzallerliebste erküren. Ganz frei. Aber jeder nur eine einzige!
Die Wahl war insofern etwas schwer, als man nur nach den äußeren Formen die Schönheit und Jugend messen konnte, und diese Körperformen waren auch noch reichlich mit Stoffen eingehüllt. Denn die Gesichter waren verschleiert, das konnte gar nicht anders sein. Muss doch auch der Mohammedaner, wenigstens der Türke und Araber, seine Braut verschleiert erküren, er bekommt ihr Gesicht nicht eher als in der Brautnacht zu sehen. Und hier schien es eben türkisch und arabisch herzugehen.
Wer die Wahl hat, hat die Qual.
Axel musterte die anderthalb Dutzend Figuren aufs Eingehendste, Sam gedachte seiner Urteilskraft wohl dadurch nachzuhelfen, dass er sich dabei mit der nackten großen Zehe des rechten Fußes sachte die linke Wade kratzte, nur Kapitän Morphium hatte Zeit, noch ein Wort zu finden.
»Nur nur nur — eine einzige?«
»Weißköpfiger Christenhund«, wurde der Schah etwas ungnädig, »dass du einen Bandwurm kriegen mögest, der von der Erde bis zum Mond reicht und dementsprechend dick ist! Ist für dich verrotteten Greis eine Frau nicht genügend?«
»Nu nu nu nu o ja, wenn's nicht anders sein darf.«
Dann war Kapitän Morphiums Wahl und Qual auch gleich beendet.
»Dann nehme ich die dicke da«, sagte er, mit dem Finger auf ein Monstrum von Körperfülle deutend. Wie das Weib mit untergeschlagenen Beinen da hockte, glich es ganz einem auseinandergelaufenen Hefekloß.
Und der Schah musste wiederum den raschen Wähler zurechtweisen.
»Halt! Erst hat der junge weiße Sklave seine Entscheidung zu treffen, der sich nach meinem Leibsklaven vor allen ausgezeichnet hat, und keine soll seiner Wahl entzogen werden — beim Barte des Propheten!«
Kapitän Morphium machte ein recht betrübtes Gesicht, wusste aber gleich Rat, wandte sich heimlich an Axel.
»Du, Axel«, flüsterte er«, lass mir die Dicke — was willst du dürrer Regenwurm denn überhaupt mit so einer anfangen — aber für mich ist das gerade was — du weißt doch — bitte, lass mir das fette Vieh.« — — — — — — — — — — — —
Wir wollen diese Sache nicht zu Ende führen, sondern nur erwähnen, dass der Graf verzichtete, bereits verzichtet hatte.
Dafür ward ihm dann auch noch eine ganz andere Ehre zuteil.
»Christenhund!«, sagte der Schah zu ihm, als die beiden wieder allein waren, und er strich seinen Bart. »Christenhund, höre — ich habe mit dem Pökelfleisch, das ich auf jenem Schiffe aß, offenbar einen Bandwurm bekommen — ich fühle ihn ganz deutlich — schaffe wir den Bandwurm zur Stelle, dass ich ihn erwürgen kann — oder — beim Barte des Propheten! — bringst du keinen Bandwurm zum Vorschein, dann lege ich dir den Kopf vor die Füße!!... wenn ich es nicht anders für gut befinde.«
Wochen waren vergangen. Schon längst hatte der ›Stern von Indien‹ das Kap der guten Hoffnung hinter sich, befand sich nur noch 200 Seemeilen von der Südspitze Ostindiens entfernt.
Noch kannte niemand das Ziel, wahrscheinlich auch der Kapitän nicht. Er bekam öfter aus der Kajüte Zettelchen, wonach er den Kurs änderte, ohne sich um den Wind zu kümmern, und dann wurde wieder planlos abgeschwenkt. Dort unten musste man selbst sehr unsicher über das Ziel sein.
Der Graf hatte sich noch nicht wieder an Deck blicken lassen. Dem Manne, der 15 Minuten unter Wasser aushalten konnte, schien auch die stickige Luft im Zwischendeck für immer zu genügen.
Auch sonst war Axel noch nicht wieder mit ihm zusammengetroffen.
Endlich, eines Abends, begegneten sich die beiden an Deck.
»Leben Sie noch?«
»Wie Sie sehen.«
»Ich dachte, Sie seien inzwischen wieder einmal tot gewesen.«
»Wenn Sie mich zu sprechen wünschen, brauchen Sie doch nur einen der indischen Diener zu schicken.«
»So groß war meine Sehnsucht nach Ihnen nicht. Ich bin unterdessen sehr fleißig gewesen, lerne Hindustanisch. Und was treiben Sie?«
»Ich vertreibe dem Schah und seinen Damen die Zeit.«
»Mit Steineschmeißen? Oder ziehen Sie noch immer Bandwürmer?«
»Nein, aber einen Backzahn habe ich dem Schah gezogen.«
»Na, das kann doch nicht sechs Wochen lang gedauert haben! Was ist nun eigentlich unser Ziel?«
»Der Schah weiß es selbst noch nicht. Er will irgendeinen indischen Hafen anlaufen. Welchen, das war bei ihm noch nie ausgemacht. Was er nun da erfahren hat, dass der Emir Jussuf ben Famil, ein persischer Rivale von ihm, eine Prämie auf seinen Kopf gesetzt hat, dass er das in Konstantinopel öffentlich wagen durfte, das hat ihn vollends aus dem Konzept gebracht. Er wartet jetzt nur noch auf ein aus einem indischen Hafen kommendes Schiff, das ihm berichtet, wie es jetzt in Indien aussieht. Das wird wegen des Zieles entscheiden. Kennen Sie die Malediven?«
»Malediven, Malediven? Ist das nicht so eine Art Apfelsinen wie die Pomeranzen und Orangen und und und...«
»Sie meinen wohl Mandarinen?«, lachte der Graf. »Nein, Malediven sind keine Apfelsinen, sondern eine Gruppe von Inseln.«
»Noch nie davon gehört. So bedeutend können die wohl nicht sein.«
»Na, so ungefähr zehn- bis zwanzigtausend Inseln, und zwar wirkliche Inseln, mögen sie auch noch so klein sein, bewachsen, bewohnt — nicht etwa nur sterile Felsklippen.«
»Zehn- bis zwanzigtausend? Na, nun hören Sie aber auf! Graf, Graf, Ihre Phantasie geht wieder mal mit Ihnen durch und verliert sich im Weltall.«
»Wieder einmal? Kommen Sie mit ins Kartenhaus!«
Da wurde Axel allerdings bald eines Besseren belehrt. Der Graf hatte nicht im Geringsten übertrieben, nach der einen Seite hin sogar unterschätzt.
Die Malediven bilden eine Inselgruppe, die gegen hundert geografische Meilen westsüdwestlich von Ceylon entfernt liegt.
In den deutschen nautischen Handbüchern ist zu lesen, dass sie aus 12- bis 15 000 Inseln besteht, die englischen berichten von 13- bis 20 000, und sie dürften recht haben. Denn der ›Sultan der 13 Atolle und 12 000 Inseln‹, wie sich das erste Oberhaupt nennt, erhält alljährlich von jedem einzelnen Inselhäuptling eine Kokosnuss, auf der der Name, die Anzahl der Untertanen, Berichte, Bittschriften und so weiter mit dem Messer eingraviert sind, und jedes Jahr werden auf Maleatoll, der Hauptinsel und Residenz des Sultans, mindestens 12 000 solcher Kokosnüsse abgeliefert. Der Sultan knackt diese Akten auf und verspeist mit seinem Hofstaat die süßen Kerne — für unsere Minister sehr zu empfehlen.
Und da kommen nicht etwa Felsklippen in Betracht, sondern jede einzelne Insel, mag sie auch noch so klein sein, ist bewohnt, hat Kokospalmen und Bananen, um wenigstens eine Familie selbstständig ernähren zu können. Dann gibt es aber auch noch ›leerstehende Wohnungen‹, Inselchen, die nur einige wenige Kokospalmen und nur einen einzigen Bananenbusch haben, die können natürlich auch nicht einen einzigen Menschen ernähren — aber die zählen eben bei dem Sultan auch nicht mit, wenn er sein Reich mustert, und so können also recht wohl noch drei- bis achttausend Eilande hinzukommen, welche dennoch den Namen von Inseln verdienen. Wenn wir an unserer Nord- und Ostseeküste nur recht viele solcher Inselchen mit Kokospalmen und Bananenbüschen hätten!
Und da soll es keine unentdeckten Inseln mehr geben! Da sieht man wieder einmal, was wir von der Erde wissen! Ja, mit den Kenntnissen, die wir von unserer Erde haben wollen, mit dem Darstellen der speziellen Verhältnisse, wird manchmal geradezu ein Unfug getrieben. Und das gilt noch für ganz, ganz andere Verhältnisse als nur für solches Inselwesen. Wahrhaftig, ein Jugendschriftsteller, der solche verachtete Indianerschmöker schreibt, Coopers Lederstrumpfgeschichten noch heute in scheinbarer Wirklichkeit spielen lässt, der urteilt ganz instinktiv, aus seiner Phantasie heraus, viel richtiger, als so ein aufgeklärter Mann, der steif und fest behauptet, waschechte Rothäute gäbe es ja heutzutage gar nicht mehr, und das tut er nicht nur aus dem ganz anerkennenswerten Grunde, damit die Jungen nicht durchbrennen, um Indianerhäuptling zu werden, sondern das behauptet er aus eigenster Überzeugung.
Ha, kommt mal hin! Im Staate New York skalpiert natürlich keine Rothaut mehr, auch überall da nicht, wo ihn die Kultur verdrängt hat. Aber zum Beispiel an der Grenze von Kanada und der Union! Weiß man denn, was es zu bedeuten hätte, wenn es diesseits und jenseits der Grenzlinie nicht noch genügend Indianer gäbe, die sich ständig in den Haaren liegen? Das Aussterben dieser Indianerstämme, ja nur ihr Zahmwerden, ihre Kultivierung würde eine gar nicht auszumalende Revolution im ganzen Welthandel bewirken. Denn dann wären alle Zollgesetze der nordamerikanischen Union unwirksam, es könnte ja nach Belieben eingepascht werden, diese Grenze von 600 geografischen Meilen kann doch nicht etwa von bezahlten Beamten bewacht werden. Oder Kanada müsste mit der Union ein Zollbündnis eingehen, und das bedeutete eine Trennung Kanadas von Mutter England.
Das ist der Grund, weshalb diese nördlichen, noch über 100 000 Köpfe zählenden Indianer nicht nach dem Reservat verpflanzt worden sind, weshalb ihnen die Regierungen alles liefern, wes sie bedürfen, nicht einmal umsonst, sondern gegen ihre Jagdbeute, weshalb sie aber gerade von diesen Indianern den Schnaps fernhalten und alles tun, dass sie nicht aussterben, sondern sich womöglich noch vermehren, und weshalb man dort gar nicht gern christliche Missionare sieht. — — —
Doch wir sind im Indischen Ozean, überhaupt auf dem Meere.
Es gäbe keine Insel mehr, auf der ein Robinson leben könnte? Ach, lieber Himmel! Von solchen Gruppen mit zum Teil winzigen Inselchen wollen wir gar nicht sprechen, das ist wieder etwas ganz anderes.
Das Meer bedeckt zwei Drittel der Erde, und denkt man etwa, wir haben diese ungeheueren Wasserwüsten schon Quadratmeile für Quadratmeile durchforscht?! Selbst im befahrensten, im Atlantischen Ozean, kann noch jeden Tag eine ziemlich umfangreiche Insel neu entdeckt werden. Zum Beispiel in der Nähe der Fucusbänke, die von den Schiffen gemieden werden. Und je mehr die Dampfer die Segelschiffe verdrängen, desto schwieriger wird das zufällige Finden solcher noch unbekannter Inseln, weil ein Dampfer hinter dem anderen herfährt, es sind immer bestimmte Kurse.
Nun aber erst im Stillen Ozean! England kann es sich leisten, dort immer einige Kriegsschiffe nur zu geografischen Vermessungen zu haben. Darüber kommen Berichte heraus, und die muss man lesen. Wie Romane. Fortwährend werden im Stillen Ozean neue Inseln entdeckt, und häufig genug sind sie mit weißen Robinsons besiedelt. Allerdings immer mit Familie. Sie haben sich mit Eingeborenen vermischt. Aber dennoch haben sie sich sehr oft separiert. Meist sind es Missionare, die in der Heimat schon längst als tot gelten, dann aber auch Seeleute und andere, die als Patriarchen mit königlicher Macht über ihre Untertanen herrschen. Und das Merkwürdige dabei ist, dass sie es nicht wie Robinson Crusoe machen, sondern den Schiffen immer abwinken. Das heißt, sie lassen sich wohl gern in einen Tauschhandel ein — dann aber wieder fort! Es sind auch schon genug einzelne Robinsons gefunden worden, die sich ebenso verhielten, keinen Rücktransport verlangten.
Es ist sehr großmütig von England, dass sie solche Kolonisten immer einmal aufsuchen lässt, um nach ihren Wünschen zu fragen, ohne davon einen Nutzen zu haben. Es gibt da Kapitäne, welche sich im Einverständnis mit der Regierung ganz dieser Sache gewidmet haben, richtig den Armenvater spielen.
Also, die Malediven werden auf 13- bis 20 000 Inseln geschätzt. Auf den lumpigen Unterschied von 7000 kommt es ja gar nicht an. Der ganze Archipel ist 20 deutsche Meilen breit und 120 lang, das sind 2400 Quadratmeilen, da geht schon etwas hinein.
Dieser Inselarchipel, der von 150- bis 200 000 Insulanern bewohnt wird, ist mit Monaco zu vergleichen, besser noch mit der Schweiz — dem einzigen europäischen Staat, der dank seiner vortrefflichen Verwaltung nicht nur keine Schulden, sondern auch noch bares Geld im Staatssäckel hat. Maledivia hat keine Produkte auszuführen, keine Fremden bringen Geld hinein, und dennoch ist es an barem Gelde ein unermesslich reiches Land, indem es nämlich das bare Geld, welches lacht, selber macht, oder indem die Kinder es einfach auf der Straße oder doch am Strande aufheben; Kauris, die Porzellanmuscheln, Cypraea moneta, die in einem großen Teile Asiens und vor allen Dingen in ganz Afrika als bares Geld zirkulieren.
Der Ursprung dieses Muschelgeldes ist nicht mehr zu ergründen. Schon Hanno der Karthager berichtet, dass er es überall an den Küsten Afrikas gefunden hat, Karawanen trugen es ins Innere. Also schon vor Jahrtausenden galten diese Muscheln als Münze. Und sie sind bis heute noch nicht verdrängt worden.
Freilich ist es ein gar gewichtiges Geld. Eine Tonne, 20 Zentner, repräsentieren heute einen Wert von etwa 1500 Mark. Und das sind ungefähr eine Million 200 000 Stück, die Muscheln anderthalb bis zwei Zentimeter lang.
Trotzdem, wer diese Porzellanmuscheln billiger herstellen, wer sie wachsen lassen könnte, was man mit Goldstücken und Banknoten leider nicht machen kann, der würde noch immer ein schönes Geschäft machen und würde auch nicht der Falschmünzerei angeklagt werden.
Aber diese Cypraea moneta, eine besondere Art der Porzellanmuschel — nicht jede gilt etwa als Geld — kommt nur an wenigen Stellen der Erde vor, am meisten zwischen den maledivischen Inseln, und England, das diesen Archipel als seinen Besitz bezeichnet, befasst sich gar nicht mit diesem Handel.
Von Maleatoll aus werden jedes Jahr zirka 30 Millionen Kauris in die muschelgeldbedürftige Welt verschickt, einem Werte von 43 000 Mark entsprechend. Diese Summe kann England natürlich nicht reizen, keinen englischen Spekulanten. Denn diese Muscheln wollen doch erst gesammelt und verfrachtet werden, da kommen also erst noch große Kosten darauf. Ja, europäische Schiffe sind nicht einmal fähig, die Kauris nach Colombo und von dort weiter nach Afrika zu bringen. Die Spesen kommen nicht heraus. Nach Colombo besorgen das die Maleatollen selbst, von dort aus nach Sansibar arabische Barken, die viel, viel billiger arbeiten.
Die Maleatollen bekommen auch kein bares Geld dafür, oder sie müssen dasselbe doch gleich wieder ausgeben, für alles das, was sie sonst brauchen und sich auf ihren Inselchen nicht selbst erzeugen können. Trotzdem sind sie sehr reich, jeder einzelne schwerreich — das heißt in den Augen der anderen Inder — weil das Geld ja bei ihnen wächst und weil sie davon mehr ernten, als sie ausgeben, weil sie sich ganz mit Muschelgeld behängen, ihre Hütten damit schmücken, ihre Kinder mit Kauris wie mit Steinen spielen. So gleichen sie richtig dem Geizhals, oder dem Manne, für den das Geld keinen Wert hat, der es nicht zu verwenden versteht, der damit nichts anderes anzufangen weiß, als mit Goldstücken und Banknoten seine Stube zu tapezieren. Trotzdem wird dieser Mann von der unverständigen Welt beneidet. Ebenso gut aber könnte man auch den Robinson beneiden, der einen Goldklumpen gefunden hat.
Der Archipel ist also englischer Besitz. Aber nur ganz dem Namen nach. Der Sultan der 12 000 Inseln schickt alljährlich an den Gouverneur von Ceylon einen Tribut von Kauris, Kokosnüssen, Bananen, Brotfrucht und Matten — in Wirklichkeit sind es Geschenke, die von dem Gouverneur noch reichlicher erwidert werden.
Denn es ist gar nicht möglich, diesen Inselbewohnern etwas anzuhaben. Malediven bedeutet nach Ansicht der Seeleute so viel wie vermaledeite Trift. Das ist aber nur ein zufälliger Gleichklang des maleatischen Namens mit einem halb italienischen, halb holländischen Worte. Und dennoch trifft die Übersetzung zu. Es sind Koralleninseln, die durch Korallenbänke zusammenhängen, von Korallenmauern umringt sind, da kann kein Schiff herein, nicht einmal das flachste Boot kann sich hindurchwinden, das versteht nur der eingeborene Lotse, und auch der nur immer von Insel zu Insel, sodass auch gar kein Verrat vorkommen kann.
England will nur nicht, dass sich eine andere Nation Herrin dieses Archipels nennen könnte. Rule Britannia! Deshalb gibt es Geschenke und würde jede andere Nation darin überbieten. Abschließen wollen sich die Maleatollen nicht. Sie nehmen Fremde gastfreundlich auf, freuen sich über den Besuch, aber da dieser immer auf demselben Inselchen bleiben muss, bekommt er nichts weiter zu sehen. So geht es den vornehmeren Besuchen, die in der Residenz des Sultans empfangen werden. Es ist nicht viel anders, als wenn bei uns ein Postbote eine Depesche ins kaiserliche Schloss zu bringen hat, der kann von diesem dann gerade so viel erzählen.
Man weiß noch absolut nicht, wie es in diesem Reiche der 12 000 Inseln eigentlich zugeht. Auswandern will kein Eingeborener. Ihre Zahl scheint hier nicht zuzunehmen, obgleich — das weiß man — hier nicht wie auf den Koralleninseln der Südsee die zu viel geborenen Kinder getötet werden. Es finden überhaupt wenige Geburten statt. — — — — —
Über das alles hatte sich der Graf schon aus Büchern orientiert, die in der Kajüte reichlicher vorhanden waren als im Kartenhause, die an Bord befindlichen Inder hatten ihm berichtet, so viel oder so wenig sie von dem sagenhaften Maledivia erzählen konnten, oder der Graf hatte schon früher davon gehört, und dies teilte er seinem Freunde nun mit.
»Und gerade für die Mitte dieser Inselgruppe haben jene Hellseher dem Sir Dalton eine geografische Bestimmung gemacht, wieder bis auf Zehntelsekunde.«
»Aha, deshalb also interessieren Sie sich so dafür. Sie werden es untersuchen?«
»Ja.«
»Wieder von dem Schah begleitet?«
»O nein, der hat jetzt anderes im Kopfe, und in dieses mysteriöse Inselreich einzudringen, dürfte auch längere Zeit in Anspruch nehmen.«
»Lässt er Sie denn da allein gehen?«
»Es gelang mir, uns Urlaub auszuwirken.«
»Uns?«
»Selbstverständlich kommen Sie mit, desgleichen auch Kapitän Morphin und Sam. Der Schah bot mir noch andere seiner ›Sklaven‹ an, aber ich meine, wir vier sind genug, und je weniger desto besser.«
»Urlaub auf wie lange?«
»Da konnte keine Zeit festgesetzt werden. Ich habe versprechen müssen, mich immer möglichst zu beeilen, bis ich am Ziele bin, und dann schnellstens zu ihm zurückzukehren.«
»Darauf haben Sie Ihr Ehrenwort gegeben?«
»Ich habe schwören müssen, muss auch für Sie und für die anderen haften, dass alle wieder zu ihrem Herrn zurückkehren, und so verlange ich auch von Ihnen wie von Morphin und Sam das Ehrenwort, dass mich dann alle wieder zu dem Schah zurückbegleiten.«
Axel schüttelte zunächst den Kopf.
»Der glaubt wirklich, dass wir seine Sklaven sind.«
»Im Grunde genommen sind wir es auch«
»Na ja, Sie haben recht, ich verstehe schon. Wenn ich einen Affen fange, so gehört er mir, ob er nun will oder nicht. Da er zuerst wohl nicht will, so wird er bei jeder Gelegenheit zu entfliehen suchen, was ich verhindern muss, und ist er entflohen, so werde ich ihn als mein Eigentum wieder einzufangen suchen, vorausgesetzt, dass der Affe es mir wert ist. Genau in derselben Lage sind wir.«
»Anders ist es nicht. Das Gleichnis ist ganz gut gewählt.«
»Mich wundert nur, dass der Schah Sie so einfach gehen lässt — von uns anderen gar nicht zu sprechen.«
»Er traut meinem Ehrenwort — meinem Schwure.«
»Trotzdem — es wundert mich.«
»Da sehen Sie, welche Macht ich eben schon über ihn ausübe, dass ich ihn zu solch einer Erlaubnis bewegen kann.«
»Haben Sie ihm da noch nicht schwören müssen, dass Sie ihm überhaupt nie entfliehen werden?«
»Nein, so etwas kommt einem Sklavenhalter gar nicht in den Sinn. Ich werde dereinst als freier Mann von ihm gehen.«
»So denke auch ich — wenigstens gesagt soll er von mir bekommen, dass ich niemals sein Sklave gewesen bin.«
»Aber daraufhin geben Sie mir doch Ihr Ehrenwort, dass Sie nach Erledigung dieses neuen Falles mit mir wieder zu dem Schah zurückkehren werden. Denn diese Garantie verlangte er von mir.«
»Sie haben es, und für Morphium und Sam ist das ganz selbstverständlich. Wenn Sie aber nun dabei etwa Ihren Tod fänden?«
»Dann sollen Sie frei sein. Ich sage nur: mit mir zurückkehren.«
»Bon, dann ist diese Sache erledigt. Wo werden Sie dann den Schah wiederfinden, wenn er noch nicht einmal sein eigenes Ziel kennt?«
»Wahrscheinlich wird er doch Ceylon als Operationsbasis auserwählen, wenn er auch erst heimlich an einer unbewohnten Küste landet. Aber auch sonst wird man immer erfahren können, wo sich der mächtige Schah Alum aufhält, und wo er auch sei, ich werde mich zunächst wieder hin zu ihm begeben, um mein Verhältnis zu ihm dann definitiv zu lösen.«
»Und wir werden Sie also begleiten. Ich habe ja nichts zu versäumen. Und von wo werden wir nun in diesen mysteriösen Inselarchipel eindringen?«
»Es wird wohl keine andere Möglichkeit geben, als dass wir erst um den ganzen Archipel herumsegeln und uns dann von Osten her nach Maleatoll, der Hauptinsel und Residenz des Sultans, begeben. Andere Durchfahrten durch die Koralleninsel sind gar nicht bekannt.«
Das sollte sich bestätigen, als sie den nordwestlichen Saum dieses Korallenarchipels erblickten und dann noch mehr als 24 Stunden, wobei sie mit dem günstigsten Winde in der Stunde acht Knoten segelten, an der östlichen Grenze hinauffuhren.
Das ganze ungeheuere Gebiet wurde von einer richtigen Korallenmauer umringt, aber nun von was für einer! Allzu hoch war sie nicht, bei der Flut erhob sie sich kaum zwei Fuß über den Meeresspiegel, bei Ebbe allerdings vier Meter, aber wie es nun, während hier das Meer spiegelglatt war, dort brandete und kochte und spritzte! Und wenn man den Mast erklomm, so erkannte man mit einem guten Fernrohr, dass diese Mauer mindestens eine geografische Meile breit war, ein furchtbares Bollwerk von haarscharfen Korallenspitzen, zwischen denen das Wasser doch immer noch tobte.
Kein Gedanke daran, dass hier ein Boot, ein Mensch darüber hinweg konnte. Es ist die furchtbarste Festung, die Gott erschaffen hat. Aber für den Menschen zwecklos, wenigstens für den modernen. Er kann durch die Einfahrt von der Ostküste auch nicht das flachstgehende Schiff hereinbringen, und gelänge es dennoch, so brauchte in der schmalen Einfahrt, die durch keine Kunst zu erweitern ist, nur ein Schiff versenkt zu werden, so wäre die ganze Flotte für immer eingesperrt.
Ob freilich diese Eingeborenen nicht dennoch Durchfahrten durch diese äußere Korallenmauer kennen, das ist eine andere Frage.
Nachträglich zu bemerken ist noch, dass die Maleatollen ein sehr reines Arabisch sprechen, nur vermischt mit einigen Worten des Sanskrits. Daraus kann man schließen, dass es jedenfalls echte Araber sind, wahrscheinlich von Maskat herübergekommen, die sich etwas mit Singhalesen vermischt haben, zu einer Zeit, als diese noch das jetzt völlig vergessene Sanskrit sprachen. Sonst ist der Ursprung nicht mehr zu verfolgen, muss schon Jahrtausende zurückliegen. Ihre Religion ist die mohammedanische, von Ostindien her eingedrungen, aber das ist auch nur eine Annahme. Man weiß von diesen von aller Welt abgeschlossenen Insulanern so gut wie gar nichts.
Am Nachmittage des folgenden Tages näherte sich der ›Stern von Indien‹ wieder mehr dem Korallenwall, dem man sich natürlich immer vorsichtig ferngehalten hatte, und das Bild änderte sich.
Gerade hier war die rote Korallenmauer sehr hoch, stieg zehn Meter und noch höher empor, und durch eine Öffnung, die aus der Ferne einem Bienenflugloche glich, gingen und kamen kleine Boote, die nur zum Teil von größeren Fahrzeugen aufgenommen wurden, die draußen vor Anker lagen, arabische Prauen, gar keine Schiffe zu nennen, viele der Boote setzten aber mit eigenen Segeln selbstständig die Fahrt bis nach Colombo oder einem anderen Hafen von Ceylon fort.
Von der Brahmrahe aus konnte man diese Korallenmauer überblicken, und hier auf dieser Seite nun sah man hinter ihr, wenigstens durch ein scharfes Fernrohr, zahllose Inselchen mit Palmen und auch sonst mit üppiger grüner Vegetation bedeckt — ein ganz reizendes Bild.
Ferner erblickte man eine größere Insel, die wie ein Hufeisen aussah, dessen Enden sich sehr nähern. Also ein schmaler, ringförmiger Landstreifen mit einer schmalen Einfahrt zu einer im Verhältnis zum festen Lande sehr, sehr großen Wasserfläche.
Diese Art von Inseln nennt man Atolle oder Laguneninseln im Gegensatz zu den anderen, isolierten Koralleninseln, die weiter keine Merkwürdigkeit bieten. Wie diese ringförmigen Atollen entstanden sind, das kann hier nicht erläutert werden. Darwin war der erste, der sie untersuchte und für ihre Entstehung, für das ringförmige Wachsen der Korallen, eine noch unübertroffene Erklärung gab. Bemerkt sei nur noch, dass der ringförmige schmale Landstreifen nicht immer zusammenzuhängen braucht, er kann auch aus vielen einzelnen Inselchen bestehen. Aber das Charakteristische ist eben immer die ringförmige Gruppierung um eine sehr große Wasserfläche, die auch nicht das kleinste Inselchen, keine Korallenklippe mehr duldet und dabei immer eine ziemlich breite Einfahrt hat. In dem Landstreifen oder zwischen der ringförmigen Inselgruppe ist immer eine Lücke vorhanden.
Es ist ein ganz, ganz wunderbares Naturspiel, das mit solcher Regelmäßigkeit immer wiederkehrt, aber man muss es wohl selbst gesehen haben, um darüber staunen zu können, und dann bewundert man wieder den Geist des Menschen, der dieses Rätsel zu lösen verstanden hat.
Solche Atolle befinden sich innerhalb der ungeheueren Korallenmauer, die 2400 geografische Quadratmeilen umschließt, dreizehn, diese hat man jedenfalls zählen können, und dann noch die zahllosen einfachen Koralleninseln, und daher der Titel des Beherrschers dieses seltsamen Reiches, Sultan der dreizehn Atolle und zwölftausend Inseln.
»Ist das Maleatoll, auf dem der Sultan residiert?«, fragte Axel, der neben dem Grafen auf dem Fußseil der Brahmrahe stand.
»Nein, das ist Fadatoll, die östliche Laguneninsel, der Sitz der Beamten, die alle Formalitäten zu erledigen haben, die Magazininsel. Über die kommt kein Fremder hinaus, der vom Sultan dazu nicht die Erlaubnis hat. Maleatoll liegt weiter der Mitte zu, nicht mehr zu erblicken. Das soll für eine Atolle eine außerordentlich große Insel sein, sogar meilenbreit.«
»Woher wissen Sie das eigentlich alles?«
»An Bord ist ein Maleatolle, aber kein so ganz echter, ein Fadatolle. So heißen diejenigen, welche nicht weiter als bis zu diesem Fadatolle kommen, nicht tiefer hinein, deren Aufgabe es ist, den Handelsverkehr nach Ceylon zu vermitteln. Es ist eine besondere Kaste, zu der auch schon die selbst höheren Beamten gehören, welche diesen Handel leiten. Diese wissen selbst nicht, wie es im Innern ihres Inselreiches eigentlich zugeht, während die richtigen Maleatollen wiederum niemals herauskommen dürfen.«
»Hören Sie, Graf — ich hab's Ihnen wohl schon gesagt — da komme ich mit! Das wird ja immer mysteriöser! Ob wir da auch hineinkommen werden?«
»Der Schah gibt uns ein Empfehlungsschreiben mit, das uns wenigstens bis nach Maleatoll zum Sultan führen wird. Alum Schah ist doch immer ein indischer Fürst. Weiteres schließt uns dieses Empfehlungsschreiben freilich nicht auf, dann müssen wir uns allein weiterhelfen.«
»Desto besser, ich gebe mehr auf meine eigene Empfehlung — und mit Ihnen zusammen ist das nun erst recht etwas anderes.«
»Kommen Sie, es ist schon alles so weit. Der Schah versieht mich mit reichen Geschenken, auch Waffen nehmen wir diesmal mit, nur, um standesgemäß auftreten zu können. Haben Sie Ihren Hirschfänger wieder?«
Ja, den hatte Axel bereits wiederbekommen.
Der ›Stern von Indien‹ war aus dem Wind gedreht, ein Kutter, der geopfert werden sollte, war schon vollbepackt und mit allem versehen, brauchte bloß herabgelassen zu werden.
Nur noch einige Minuten der Toilette, die sie aus den reichen Garderobekammern ergänzen konnten, und unsere vier Freunde stiegen ein, der Kutter berührte das Wasser und befand sich im nächsten Augenblick hinter dem wieder in Fahrt gebrachten Schiffe.
Also kein anderer Matrose war mitgekommen, der Graf hatte jede weitere Begleitung abgelehnt, sie war auch nicht nötig. Es musste eben gesegelt werden, und der jetzt herrschende Ostwind war der günstigste.
Die Segel wurden gesetzt, der Kutter strebte auf dem sich nur leicht kräuselnden Meere dem Westen zu, dorthin, wo die arabischen Boote in das Bienenloch hinein- und wieder herausschlüpften.
Je näher man kam, desto mehr zeigte sich freilich, dass es nicht nur so ein Schlupfloch war. Selbst eine Praue, die hundert Mann fasst, konnte mit hohen Masten durchfahren. Da aber musste sie sich zwischen den vorgelagerten Korallenriffen hindurchwinden, welche die Brandung abhielten, und hierzu war einer der eingeborenen Lotsen notwendig, die sich in kleinen Booten den Prauen näherten und sich hineinschwangen, sie beim Herausbringen auch so wieder verließen.
Außerdem gab es eine noch viel breitere Einfahrt, die Korallenmauer war auf einer Strecke von wenigstens dreißig Meter Breite unterbrochen, aber sie wurde von keinem einzigen Schiffe oder Boote benutzt.
»Weshalb nicht?«, fragte Axel. »Ist dort das Wasser zu flach?«
»Das wohl nicht, auch sie wird manchmal benutzt, aber es ist eben die geheiligte Einfahrt, wohl nur für den Sultan selbst oder seine Abgesandten bestimmt. Die Fahrzeuge, die alljährlich den Tribut oder vielmehr Geschenke nach Colombo bringen, nehmen immer diesen Weg. Die fremden Boote müssen sich in der Tunneleinfahrt eine Art von Zolluntersuchung gefallen lassen.«
»Na, wenn wir nur da so ohne Weiteres durchkommen.«
»Dieses erste Hindernis wird das Schreiben des Schahs sofort beseitigen.«
So war es auch. Noch vor den Riffen näherte sich ihnen ein kleines Boot mit drei Ruderern, von denen sich der eine in den Kutter schwang und ohne Weiteres das Kommando ergriff, sich ans Steuer setzte und durch Handbewegungen schon vorher die Richtung angab, die er steuern wollte, dass danach die Segel gesetzt würden, um sich durch die Riffe zu winden.
In den gehenden und kommenden Prauen und Booten war sonst kein einziger Europäer zu erblicken, aber die Ankunft der vier erregte doch gar kein besonderes Aufsehen, am wenigsten kümmerte sich der eingeborene Lotse darum.
Diese Lotsen zeichneten sich vor den anderen Schiffern, die meist Malaien, indische Kulis und zum Teil auch Chinesen waren, sehr zu ihrem Vorteil aus. Es waren kaffeebraune Gestalten, nackt bis auf den Binsenschurz, welche die Geschmeidigkeit des Arabers mit dem hohen, athletischen Wuchs des Singhalesen verbanden, das Haar war lang und glänzend schwarz, auch die Gesichtsbildung sehr edel.
Derselbe Typus herrschte auch bei denjenigen Maleatollen, welche nie hinter der Korallenmauer hervorkamen, die Kasteneinteilung bewirkte also keinen Unterschied in der Körperbildung. sondern nur in der Lebensweise.
Es ging hinein in den Tunnel, und es zeigte sich, dass dieser nur so kurz war, dass er keiner künstlichen Beleuchtung bedurfte. Er war eben so breit, dass sich zwei Prauen gerade ausweichen konnten, aber die Abfertigung ging sehr schnell, und der Andrang war auch gar nicht so groß.
Auf einem Vorsprung, an dem der Kutter, der natürlich die Segel festgemacht hatte, beilegen musste, stand ein in indische Gewänder gekleideter Beamter.
»Woher kommt ihr?«, fragte er auf Arabisch.
»Von dem ›Stern von Indien‹, einem Schiffe, welches...«
Der Beamte wollte gar nichts weiter hören.
»Wohin wollt ihr?«
»Den Sultan der dreizehn Atolle und zwölftausend Inseln sprechen.«
Gar keine Verwunderung darüber, dass die in einem einfachen Boote Kommenden gleich zu Seiner Majestät dem Kaiser wollten.
»Habt ihr eine Empfehlung mit?«
»Ja, von Alum Schah, dem...«
»Es ist gut«, wies der Beamte den versiegelten Brief zurück, den der Graf vorzeigen wollte.
Arbeiter schleppten den Kutter durch den Tunnel, sprangen zuletzt hinein und griffen zu den Riemen.
Aber sie hatten schon Befehl bekommen, wohin dieses Boot zu bringen sei. Das Ziel war ein Inselchen, nur eben so groß, dass darauf ein hübsches Häuschen Platz hatte, überschattet von einigen Kokospalmen. Kein anderes Frachtboot kam hierher, nur der Kutter wurde hierher dirigiert.
In der kleinen Bucht lagen einige primitive Fahrzeuge, daneben stand ein halbes Dutzend Krieger, mit gezackter Keule und Lanzen bewaffnet, dessen Spitze die Wehr des Sägefisches bildete — die Ehrenwache des hier wohnenden hohen Beamten.
Dieser, ein schon bejahrter Mann, saß zigarettenrauchend vor der Haustür. Er war von einem der Ruderer, der aber wohl ebenfalls einen höheren Rang einnahm, schon benachrichtigt worden, empfing die vier fremden Ankömmlinge ganz gleichgültig, und hätte er gewusst, dass einer von ihnen der Großmogul von Indien oder der König von England gewesen wäre, er wäre auch nicht aufgestanden.
Es ging in diesem Reiche ganz patriarchalisch zu, und hier an dieser vorgesetzten Stelle ward jeder Mensch erst recht als Mensch betrachtet und behandelt.
»Ihr wollt zum Sultan?«
»Ja.«
»Wozu?«, lächelte der Alte, als habe der Graf etwas ganz Naives gesagt.
»Wir bringen ihm Geschenke.«
»Von wem?«
»Von Ali Alum Schah, wenn du ihn kennst.«
»O, den kenne ich recht gut. Bringst du eine Empfehlung von ihm?«
»Hier ist ein Brief von ihm.«
Der Alte nahm das versiegelte Schreiben, aber der Graf griff hastig zu, als jener es ohne Weiteres erbrechen wollte.
»Was hast du?«
»Dieses Schreiben ist nur für den Sultan selbst bestimmt.«
»O, was das anbetrifft«, lächelte der Alte wieder, mit dem man sich auch englisch und französisch und vielleicht auch noch in anderen Sprachen unterhalten konnte, »so nimm nur an, dass ich der Sultan der 13 Atolle und 12 000 Inseln selber sei.«
»Wie, du wärst...«
»Nein, ich bin es nicht. Aber du könntest es annehmen. Jedenfalls darf ich diesen Brief erbrechen. Sieh, so ist die Sache gleich erledigt.«
Er zog einen ganz modernen Bleistift hervor und malte etwas auf das Kuvert, erbrach es vollends, und las den mit hindustanischen Zeichen geschriebenen ziemlich langen Brief.
Dann blickte er doch mit einiger Verwunderung zu dem Grafen empor.
»Dieser Comte de Bellamare bist doch nicht du selbst?«
»Ich bin es.«
»Du selbst bist dieser Wundermann?«
»Wenn mich der Schah einen solchen genannt hat, so muss ich es sein.«
»Du kannst... doch das geht mich nichts an. Ich kann dich nicht weiter befördern, als bis nach Fadatoll, der Beamteninsel, kann nur dafür sorgen, dass von dort aus dieser Brief möglichst rasch nach der Residenz des Sultans kommt, sodass ihr möglichst bald erfahrt, ob der Sultan euch empfangen will oder nicht. Wartet einen Augenblick.«
Der Alte ging ins Haus, und als er bald wieder herauskam, trug das Kuvert ein anderes, frisches Siegel und mit Tinte oder schwarzer Farbe einen längeren Vermerk, aber mit Hieroglyphen geschrieben, die dann auch der Graf nicht entziffern konnte.
»Jetzt wird dieser Brief nicht mehr geöffnet, nur noch vom Sultan oder seinem ersten Minister selbst. Habt ihr Hunger und Durst?«
»Nein, wir sind auch mit allem versehen.«
»Desto besser für euch, dann könnt ihr euer Ziel eher erreichen.«
»Wie weit ist es noch bis Fadatoll?«
»Noch eine Stunde Bootsfahrt.«
»Und von dort nach Maleatoll?«
»Einen halben Tag.«
»So lange?«
»Ja, und dann müsst ihr auch noch ein schnelles Eilboot benutzen. Und dann müsst ihr doch auch erst warten. Also, ein Tag vergeht mindestens. Bei Nacht wird nicht gefahren.«
»Auch nicht bei Mondenschein, der jetzt herrscht?«
»Auch nicht.«
»Weshalb nicht?«
»Die Nacht ist uns heilig, wie sie es jedem Menschen sein sollte. Nun haltet euch hier nicht weiter auf, ich gebe euch einen Krieger mit.«
Dieser kam aus dem Hause, das Boot wurde weitergerudert.
Es ging zwischen größeren und kleineren Koralleninseln hindurch, mit Kokospalmen und Bananenbüschen bestanden. So weit man das beurteilen konnte, führten die Insulaner ein Faulenzerleben. An den Küsten plätscherten überall Kinder im Wasser, man begegnete erwachsenen Männern und auch Frauen, die im Adamskostüm von Insel zu Insel schwammen, wie die Fische durchs Wasser schießend.
»Haifische gibt es hier nicht?«, wandte sich der Graf einmal an den stolz und stumm vor sich hinblickenden Krieger.
»Frage mich über nichts, Faringi!«, entgegnete dieser zum ersten und letzten Male.
Nach einer Stunde fuhren sie in die bis auf eine kleine Insel vollkommen geschlossene Bucht der ersten Laguneninsel ein, die sie also schon von draußen durch ein scharfes Fernrohr gesehen hatten.
Es war ein schon ziemlich großes Atoll, die ganze Länge des Landringes betrug mindestens eine halbe geografische Meile, und war dabei kaum dreißig Meter breit.
Auf diesem schmalen Ringe, der hier nicht unterbrochen wurde, standen sehr viele ziemlich umfangreiche Gebäude, aus Korallenkalk ausgeführt, und an Land wie in der fast ungeheuer zu nennenden Bucht herrschte ein reges Leben. Frachtboote wurden gelöscht und wieder mit Ballen, Kisten und Fässern beladen. Hier aber waren schon keine fremden Schiffer mehr, sondern nur noch Eingeborene zu sehen. Die fremden Boote oder doch ihre Besatzungen kamen nur bis an kleinere vorgelagerte Inseln, also auch das war bereits ein Heiligtum, und es war schon genug, dass die Fremden gleich bis hierher kamen.
Sie wurden von dem Krieger, der sicher ein Häuptling war, in das größte Haus geführt, nach einiger Zeit kam ein Beamter, der sie einem Verhör unterzog, aber wieder nur einem ganz kurzen.
Von dem ›Stern von Indien‹ und von Alum Schah wollte er gar nichts wissen, oder seiner Neugier waren Zügel angelegt.
Also diese vier Fremden hatten dem Sultan von dem Schah Alum Geschenke zu bringen, die Hauptsache war der Begleitbrief, der aber von diesem Beamten nicht mehr geöffnet wurde.
»Er geht sofort mit dem schnellsten Boote nach Maleatoll. Bis zur Ankunft der Antwort müsst ihr euch hier gedulden. Ihr seid meine Gäste, wohnt in diesem meinem Hause. Die ganze Insel steht euch frei, aber ihr dürft sie weder in einem Boote noch schwimmend verlassen. Dann muss sich hier jeder von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang in seiner Wohnung befinden, oder doch, sollte ihn die Nacht fern von seiner Wohnung überraschen, in irgendeinem Hause. Wer sich während der Nacht außerhalb eines Hauses oder einer Hütte befindet, der ist des Todes.«
Oho, das war ja ein recht böser Nachsatz, obgleich immer noch ganz freundlich hervorgebracht!
Jetzt ergriff einmal Axel das Wort, weil er sich mit dieser einfachen Drohung oder Warnung nicht zufrieden gab.
»Weswegen?«
»Allah duldet nicht, dass seine ihm geheiligte Nacht durch Menschen gestört und entweiht wird.«
»Das ist aber sonst nirgends der Fall, wo Allah herrscht.«
»Möglich, aber hier in Maledivia ist das so.«
»Da gehen Wächter umher, die jeden Menschen töten?«
»Wächter? Du meinst doch Menschen. Die würden dann doch ebenfalls getötet werden.«
»Ja, wer besorgt denn sonst diese Tötung?«
»Belawa.«
»Belawa? Wer ist denn das?«
»Das ist der König der Belas.«
»Ja, wer sind denn nun diese Belas? Geister, nicht wahr?«
»Geister? Weißt du nicht, was Belas sind? Hier ist einer.«
Er führte die Besucher in einen Nebenraum, in einem großen Drahtkäfig hing von einem entblätterten Baume herab ein großes, rotbraunes Tier, wie eine riesige Fledermaus anzusehen, aber doch auch wieder ganz anders. Regungslos hing es mit dem Kopf nach unten, sich mit den Hinterkrallen an einem Baumast festhaltend. Die Länge betrug etwa 60 Zentimeter.
»Ach, ein fliegender Fuchs«, sagte der Graf, »auch fliegender Affe oder fliegende Katze genannt, auf dem indischen Festlande und dem malaiischen Archipel Kaguang.«
»Richtig, ein Kaguang«, stimmte der Maleatolle bei. »Wir nennen ihn Bela. Er kommt hier sehr, sehr häufig vor, ist ein ganz harmloses Tier, frisst nur Früchte und macht sich durch Vertilgung von schädlichen Kerbtieren nützlich. Und was er uns an Früchten wegfrisst, das bringt er uns durch seinen feinen Pelz, welcher dem des Chinchillas nicht nachsteht, zehnfach wieder ein. Leider kann man ihn nicht künstlich vermehren, er pflanzt sich in der Gefangenschaft nicht fort.«
»Ihr jagt also den Bela?«
»Ja. Ausgenommen in der Schonzeit.«
»Dann kann er euch aber doch auch nicht so heilig sein.«
»Heilig? Der Bela ist uns nicht heilig. Wir essen auch sein Fleisch.«
»Wer ist denn nun aber der Belawa?«
»Das ist eben der König der Belas, und das ist nun freilich etwas ganz anderes, das ist ein furchtbares Ungeheuer, so groß wie ein Stier, auch mit Hörnern auf dem Kopfe, und der kann noch ganz anders fliegen als der Bela, und der nährt sich nur von Fleisch, besonders gern von Menschenfleisch. In der Nacht fliegt er von Insel zu Insel, ist im Augenblicke hier und im nächsten am anderen Ende des Inselreiches, und wenn er einen Menschen außerhalb der Wohnung findet, den frisst er auf oder saugt ihm doch das Blut aus. Allah hat ihn nur deshalb geschaffen, damit wir eben die heilige Nacht nicht entweihen sollen.«
Gegen diese Erklärung war nicht anzukämpfen. Nur Axel hatte noch etwas einzuwenden.
»Wenn Allah aber die Nacht heilig gehalten haben will, weshalb hat er diesen menschenfressenden Belawa nur für hier geschaffen?«
»Allah ist nie einseitig, er schafft überall etwas anderes. Anderen Ländern hat er wieder den Rum und das Opium gegeben, den man fast nur des Nachts trinkt und raucht, und wer auf diese Weise die Nacht entheiligt, der wird vielleicht fürchterlicher bestraft, als wenn er von einem Tiere gleich getötet würde.«
Das Gleichnis hinkte etwas — in anderer Hinsicht wieder war es ganz vortrefflich gewählt.
»Und«, fuhr der Beamte fort, »habt ihr in eurem Lande nicht auch solche Vögel, die doch keine Vögel sind, welche den Menschen bei Nacht das Blut aussaugen, sodass sie sterben müssen? Es kommen doch manchmal weiße Fremde hierher, sie erzählten uns davon, ich weiß nicht mehr den Namen...«
»Vielleicht Vampire?«
»Ja, Vampire. Saugen die nicht auch euch das Blut in der Nacht aus?«
Der Graf tat das Beste, wenn er diese Fabel bestätigte, ob er nun selbst daran glaubte oder nicht, und Axel behielt diesmal seine Meinung für sich.
»So seid ihr gewarnt. Hier in dem freien Maledivia darf keine Tür während der Nacht geschlossen werden, sonst würde ich euch wieder einschließen. Verlasst ihr das Haus nur mit einem einzigen Schritte — seid versichert, der Belawa ist im Augenblick da, wo er sich sonst auch zur Zeit befinden möge, tötet euch mit einem einzigen Schlage seiner furchtbaren Krallen und saugt euch mindestens das Blut aus.«
»Dann mag er mich auch noch ausfressen«, konnte jetzt Axel doch wieder nicht zurückhalten. »Wo wohnt denn dieser Belawa?«
»Wie ich sagte: Er ist in der Nacht überall und nirgends.«
»Und wo residiert er am Tage?«
»Das weiß ich nicht. Nirgendwo. Es ist ein Nachtgeist, der erst mit der Finsternis ins Dasein tritt und mit Anbruch des Tages wieder in nichts zerfließt.«
»Ist er schon gesehen worden?«, gab sich der wissbegierige Axel zufrieden.
»Ja, oft genug.«
»Wie sieht er aus?«
»Genau so wie ein Kaguang. Nur hundertmal so groß. Schrecklich. Nun kommt, das Essen ist für euch bereit.«
Der Brief an den Sultan war schon vorher zur Beförderung abgegeben worden. In einem anderen Zimmer wartete ihrer das Abendmahl, bestehend aus den verschiedensten Reisgerichten und aus Früchten, und nicht nur aus Kokosnuss und Bananen. Alle Früchte, die Indien erzeugt, waren vertreten. Diese wurden wohl in besonderen Gärten gezogen, nur für die Reichen und Vornehmen, denn sonst musste mit dem Lande ja sehr gegeizt werden. Als Zukost diente der gebackene Teig der Brotfrucht, den man auch gären lassen kann.
Noch eine Stunde war es hell. Nach beendeter Mahlzeit ergingen sich unsere vier Freunde noch etwas im Freien.
»Dass sich hier in der Nacht niemand außerhalb des Hauses aufhalten darf, dahinter muss doch etwas stecken«, fing Axel sehr bald an, und Kapitän Morphin und Sam stimmten ihm bei.
»Wieso?«, fragte der Graf.
»Sie finden gar nichts weiter dabei?«
»Nein. Weshalb feiern wir Christen denn den Sonntag? Weil Gott am siebenten Tage geruht hat. Wohl, und Allah liebt die Nachtruhe.«
»Davon wissen aber die anderen Mohammedaner nichts.«
»Doch, es gibt eine sehr große und weitverbreitete Sekte, die der Chaboiten, bei denen, sobald die Sonne gesunken ist, kein Handgriff mehr getan werden darf.«
»Nun gut — und dazu wird solch ein Ungeheuer in die Welt gesetzt, um die Nachtruhe zu sichern?«
»Ist es bei uns Christen viel anders? Wer den Feiertag nicht heiligt, begeht eine Sünde, hat wenig Aussicht auf den Himmel. Unsere Kirche droht also mit der Hölle und einer ganzen Legion von Teufeln — diese hier haben nur einen einzigen höllischen Geist dafür erfunden.«
»Na ja, schließlich haben Sie recht. Wenn aber nun einmal jemand hier das Gebot übertritt?«
»Na, der kommt eben noch einmal mit heiler Haut davon. Oder es ist ja auch möglich, dass von den Priestern eingeweihte freidenkende Wächter in der Nacht umherstreifen, die einmal ein Exempel statuieren müssen.«
Sie fanden sich beizeiten wieder in dem Hause des ersten Beamten dieser Magazininsel ein, zum Schlafen wurde ihnen ein Zimmer angewiesen, dessen Fenster wie alle anderen nach mohammedanischer Art nach dem innenliegenden Hofe gingen, der sehr hübsch als Garten eingerichtet war, nur dass der Springbrunnen fehlte.
Sonst war kein Mangel an Trinkwasser, fast jede größere Insel hatte ihren eigenen Brunnen, dessen Wasser freilich während der Flut ungenießbar wurde, dann verdrängte das hochsteigende Seewasser das süße — eine Erscheinung, die man auf allen Koralleninseln findet.
Der Beamte, der die Gäste hierher geleitet hatte, warnte noch einmal eindringlich vor dem Belawa.
»Die Tür darf ich nicht verschließen, es geht gegen die Sitte, sonst würde ich es tun. Ich lasse aber zur Vorsicht einen Wächter draußen stehen, dass ihr nicht doch einmal der Versuchung unterliegt, ins Freie gehen zu wollen.«
»Werden denn häufig Menschen von dem Belawa angefallen?«, fragte Axel.
»Maleatollen nicht, die hüten sich ja, in der Nacht das Haus zu verlassen.«
»Aber bei Fremden ist es schon passiert, bei Europäern?«
Der Beamte zögerte, bis er sagte:
»Das ist... hala.«
»Was ist es?«
»Darüber darf nicht gesprochen werden. Ihr seid gewarnt. Schlaft wohl.«
»Und es hat dennoch eine besondere Bewandtnis«, sagte Axel, als er sich auf die weiche Kokosmatte niederlegte, »dass man hier bei nächtlicher Weile das Haus nicht verlassen darf. Dass man nicht zum Fenster hinaussehen kann, dafür ist ja schon durch die arabische Bauart gesorgt. Da draußen wird in der Nacht, wenigstens zu gewissen Zeiten, irgend etwas getrieben, wovon nur die Eingeweihten wissen dürfen. Well, ich werde dieses Rätsel lösen.«
Am nächsten Tage spazierten die vier wieder auf der Insel herum, sahen zu, wie die Boote aus- und eingeladen wurden, beobachteten die Männer und Frauen, die hier unverhüllt gingen, noch viel mehr zeigten, als nur ihr Gesicht, bei ihren häuslichen Beschäftigungen, wie die Kinder am Strande Kauris sammelten und nach dem Muschelgeld auch in ziemliche Tiefen hinabtauchten. Aber nur leere Muschelgehäuse durften jetzt gesammelt werden, die vollen hatten sich losgerissen und wurden wieder nach den Bänken gebracht, die eben Schonzeit hatten.
Dies alles wurde von jedermann, den man befragte, willig und freundlich berichtet, und wenn dabei das Wort hala, das tabu der Neuseeländer, öfters vorkam, so wollte man dadurch doch keine Antwort umgehen. Es wurde einfach als ›heilig‹ gebraucht. So waren auch die Muschelbänke jetzt hala. Von Geheimnissen, über die nicht gesprochen werden dürfe, wussten diese einfachen Maleatollen selbst gar nichts.
Dass der Belawa in der Nacht herumflöge und jeden im Freien befindlichen Menschen töte und auffresse, das fanden sie ganz selbstverständlich, aber niemand konnte von solch einem schon geschehenen Falle berichten, es existierten auch keine Märchen darüber, und einer Lüge und Verstellung schienen diese Naturkinder ganz unfähig zu sein.
In der zweiten Stunde des Nachmittags kam die Antwort des Sultans zurück, und selbst der Beamte staunte, dass sie schon hier sein könne. Es war aber auch noch ein ganz anderes Eilboot, als das er selbst abgeschickt hatte, es war das schnellste der Schnellboote, welche der Sultan zur eigenen Verfügung hatte, durch die er die Befehle in seinem weiten Wasserreiche verteilte — ein Fahrzeug von 20 Meter Länge und kaum einem halben Meter Breite, kunstvoll aus Rohr zusammengeflochten, wasserdicht gemacht und so leicht, dass es von zwei Mann getragen werden konnte, und dabei von 20 Mann gerudert.
Der Comte Bellamare solle sofort zum Sultan kommen. Des Magazinbeamten Freundlichkeit verwandelte sich in tiefste Unterwürfigkeit vor dem Manne, der auf diese Weise geholt wurde.
Der Graf bezweifelte, dass dieses trotz seiner Länge spielzeugartige Fahrzeug noch einen Mann tragen könne, aber es nahm auch noch seine drei Begleiter auf. Viel Platz war dann freilich nicht mehr, man durfte sich auch nicht sehr bewegen, musste sogar vorsichtig niesen, hübsch nach der Mitte, nicht nach der Seite.
Die Geschenke konnten natürlich nicht mitgenommen werden, die sollte ein anderes Boot nachbringen.
Fort ging es. Die 20 Ruderschläge gaben dem gewichtlosen Rennboote die Schnelligkeit eines Pfeils. Mit diesem Boote würde man Maleatoll anstatt in sechs Stunden schon in vier erreichen, und das musste auch sein, wollte man die Nacht nicht untätig auf einer anderen Insel, in einem Hause verbringen. Auch das Hinboot hatte in der Nacht kampieren müssen — wegen des mordenden Belawas, der seine Beutezüge nach Menschen nicht nur auf das feste Land beschränkte.
Der führende Häuptling gehörte, wie alle diese Ruderer, schon zu jenen Maleatollen, welche nie aus ihrem Reiche herausgekommen waren, es nicht verlassen durften. Die Scheidegrenze dieser Gebiete bildete ja die Magazininsel. Die diesseits wohnenden Eingeborenen, kaum 2000, vermittelten den Verkehr mit der Außenwelt und durften nie in das eigentliche Inselreich hineinkommen, alle anderen kamen niemals heraus.
Aber dieser Häuptling, zur Leibwache des Sultans gehörend, hatte schon manchen europäischen Gast nach der Residenzinsel gebracht, stand den fremden Besuchern auch sonst zur Verfügung, und dabei hatte er sich eine Bildung angeeignet, die man ihm gar nicht zugetraut hätte.
Auch war er, obgleich er doch schon zu den Eingeweihten gehörte, noch viel mitteilsamer als die Magazinbeamten, die schon zum jenseitigen, halb ausgeschlossenen Bezirk gehörten.
So erfuhren unsere Freunde schon gar viel von dieser Hauptinsel Maleatoll, und es sei gleich hier wiedergegeben.
Diese größte der dreizehn Laguneninseln, vollständig zusammenhängend, hat an ihrer äußeren Peripherie einen Umfang von nicht weniger als 19 geografischen Meilen, der völlig ringförmige Landstreifen ist ziemlich genau eine geografische Meile breit, wonach sich schon aus der einfachen mathematischen Berechnung ergibt, dass die eingeschlossene Wasserfläche, also ebenfalls ein Kreis, einen Durchmesser von vier geografischen Meilen haben muss, was man wohl schon als ein kleines Meer für sich bezeichnen kann.
Nur der südlichste Teil dieses Landringes ist bebaut, hier auch mit Korn. Der ganze nördliche Teil ist mit undurchdringlichen Dschungeln bestanden, und es ist den Eingeborenen in jahrtausendlangen Anstrengungen nicht gelungen, diese Dschungel auszurotten. Der Mensch scheint eher die Wüste besiegen zu können als die Sumpfregion der Dschungel. Da gibt es kein Trockenlegen und kein Abbrennen und gar nichts.
Nur dass in diesen Schilfdschungeln hier sich keine wilden Tiere und Schlangen aufhalten, dass sie keine Fieberdünste aushauchen, dank der reinigenden Atmosphäre des Meeres.
Ferner unterscheidet sich die Hauptinsel von den anderen Atollen dadurch, dass die innere Lagune nicht als Hafen benutzt wird. Alle Gebäude liegen wie die Residenz des Sultans auf der Meeresseite, hier draußen legen die Boote an, die Lagune selbst darf von keinem Boote durchfurcht, das Wasser darf nicht einmal von einem Kiel berührt werden, die ganze Lagune ist hala, ihren Eingang, etwa zwei Kilometer breit, hat man sogar kunstvoll vermauert.
Aber das hat alles einen ganz besonderen Zweck, diese Lagune ist nicht nur so aus irgendeinem Aberglauben heilig gesprochen.
Die 200 000 Eingebornen könnten sich nicht allein von den Kokosnüssen und Bananen ernähren, welche die Inselchen hervorbringen, mögen diese auch noch so zahlreich sein. Es ist der Überfluss von Fischen, der die Existenz bedingt. Innerhalb der Korallenmauer wimmelt es von Fischen aller Art.
Aber auch hier muss der denkende Mensch dafür sorgen, dass diese natürliche Nahrungsquelle nicht einmal zu fließen aufhört. Zunächst durch Einhaltung einer Schonzeit, während welcher keine Fische gefangen werden dürfen, und dann hält man sich auch nicht an getrocknete Fische, die doch auch erst erbeutet worden sind. Dann nährt man sich nur von Kokosnüssen und anderen Früchten und von eingeführtem Reis, wie es gerade jetzt der Fall war — schließlich nur eine kurze Zeit, wenn die Fische laichen.
Dann aber vor allen Dingen ein geheiligtes Brutgebiet. Das ist die Lagune der Hauptinsel. Die Vermauerung des natürlichen Zuganges besteht aus porösen Korallenblöcken, welche nur ganz kleine, neu geborene Fischchen durchlassen, alle größeren in der Lagune zurückhalten. Alle kleinen, noch unentwickelten Fische, die innerhalb des Inselreiches sonst gefangen werden, müssen schleunigst nach der Hauptinsel gebracht werden und kommen in die Lagune, wo sie schon nicht wieder herauskönnen. Außerdem werden die 30 Millionen Porzellanmuscheln nur hier ihres lebendigen Inhalts beraubt, dieser wandert in die Lagune, sodass die eingesperrten Fische immer Überfluss an Nahrung haben.
Um nun, falls doch einmal eine Hungersnot ausbricht, diese letzte Fischquelle fließend zu erhalten, dass nicht auch sie ausgebeutet wird, ist diese ganze Lagune gleich heilig gesprochen, keine Angelschnur darf in ihr Wasser versenkt werden, kein Kiel es furchen, und das ist den Maleatollen in Fleisch und Blut übergegangen.
So hatte der Häuptling berichtet.
»Wahrhaftig, das ist ja das Ideal eines Musterstaates!«, rief der Graf in ehrlicher Überzeugung, und die anderen mussten ihm beistimmen, was den Häuptling und die anderen eingeborenen Ruderer mit nicht geringem Stolze erfüllte.
Jetzt waren sie erst recht zu weiteren Auskünften bereit. Wir greifen nur noch eine heraus.
Der Graf erfuhr auf Befragen, dass Sultan Abdallah und seine drei Minister sonst die einzigen Menschen waren, welche in dieser abgeschlossenen Region wohnten und doch schon einmal in die Welt hinausgekommen waren. Der Kronprinz musste sogar Reisen unternehmen, desgleichen die Söhne der Minister, die schon zu Ratgebern des Sultans bestimmt waren. Sultan Abdallah war sechs Jahre außerhalb des Inselreiches gewesen, wo, das wusste der Häuptling allerdings nicht.
Jedenfalls sprach er mit den ihn besuchenden Europäern Englisch und Französisch, er wurde auch sonst immer orientiert, wie es in der Welt zuging, und dies alles zu erfahren war für den Grafen doch sehr wichtig. So kam er doch nicht vor einen gänzlich weltfremden Menschen.
Die Sonne näherte sich dem Horizonte, als zwischen den zahllosen Inselchen ein langgestreckter Landstreifen auftauchte. Einige Häuser waren darauf zu bemerken, aber keine Gebäude, wie man sich solche bei einer Residenz vorstellt, selbst die auf der Magazininsel waren viel größer gewesen.
Trotzdem lag die Residenz direkt vor ihnen, aber sie war deshalb nicht zu erblicken, weil das Boot möglichst direkt auf sie zuhielt, und gerade davor lag eine größere Insel mit dichtem Baumbestand, der die Aussicht verdeckte.
Die zwanzig Mann ruderten, auch der Häuptling, dass sie ganz in Schweiß gebadet waren, und die im Wege liegenden Inseln wurden so umgangen, dass die Schaufelruder noch den Strand streiften, um nur ja nicht eine kleine Zickzacklinie zu viel zu machen.
»Höchstens noch zehn Minuten«, keuchte der Häuptling, »sind wir dann nicht im Palast, so müssen wir anderswo übernachten!«
»Auch wenn wir noch nur zehn Ruderschläge davon ab sind?«, fragte Axel.
»Dann gibt es keine Unterkunft mehr, dann sind wir verloren.«
»Wieso?«
»Dann tötet uns Belawa. Hast du davon gehört?«
»Ich habe. Wenn wir aber nun schon auf Maleatoll gelandet sind, konnten aber bei Sonnenuntergang nur schnell ein anderes Haus erreichen...«
»Dann müssen wir eben in diesem bleiben.«
»Wenn aber nun dieses dicht neben dem Palast ist, und der Sultan will uns durchaus sofort sprechen...«
»Er kann nicht, er muss bis zum Anbruche des Tages warten.«
»Wir dürften nicht die wenigen Schritte im Freien machen?«
»Du würdest sofort von Belawa getötet werden.«
»Auch der Sultan?«
»Gewiss, auch der Sultan ist doch nur ein Mensch.«
»Auch Fackellicht schützt nicht dagegen?«
»Gar nichts. Wer in der Nacht nur mit einem Schritte aus einem Hause kommt, ist sofort des Todes.«
Jetzt wurde auch der Graf stutzig. Das war ja wunderbar, was man diesem Belawa zuschrieb und wie das diesen Eingeborenen in Fleisch und Blut übergegangen war!
Nein, da musste doch irgend etwas dahinterstecken! Ob da nicht die Priester, die Derwische, ihre Hand im Spiele haben sollten?
Deswegen zu fragen war keine Zeit mehr.
Als das Boot hinter der großen, bewaldeten Insel hervorschoss, sahen sie vor sich ein mächtiges Haus liegen, aus rotem Korallenkalk ausgeführt, einen ganzen Komplex von solchen Gebäuden — aber ehe sie etwas näher unterscheiden konnten, schoss das Boot auch schon in eine Grotte hinein und lag mit einem Ruck der zwanzig Schaufelruder bewegungslos vor einer Galerie, gerade als draußen der letzte Saum der Sonne im Meere untertauchte, worauf augenblicklich die Nacht die Herrschaft übernahm.
In der Grotte brannten schon einige Lampen, aus hohlen Kokosnüssen hergestellt.
Das ankommende Boot wurde mit freudigen Rufen begrüßt, aus denen auch die Befreiung von einer großen Sorge sprach.
Es war schon gefürchtet worden, das Boot mit den Fremden könne vor Sonnenuntergang nicht mehr eintreffen, und der Sultan verginge vor Ungeduld, den ›Zauberer‹ zu sehen.
So und anders wurden die Ankommenden begrüßt, d. h. die Eingeborenen, die Empfangenden flüsterten wirklich etwas von einem Zauberer, dabei scheu nach dem Grafen blickend, der von den vier ja auch tatsächlich die imposanteste Erscheinung war.
Der kurze Tunnel führte in einen Raum, in dem außer einfachen Bambusmöbeln Kokosmatten und Kaguanpelze die Hauptrolle spielten — das Empfangszimmer für schon vornehmen Besuch — hier wurden sie von einem Palastbeamten erwartet.
»Comte de la Bellamare?«
»Das ist mein Name.«
»Bedürfen Sie einer Erfrischung?«, fuhr der Beamte jetzt in tadellosem Französisch fort.
Der Graf verneinte.
»Bitte, wollen Sie mir folgen, der Sultan möchte Sie sofort sehen.«
»Ich bitte, meine Gefährten mitnehmen zu dürfen.«
Der Beamte zögerte.
»Der Sultan wünscht nur Sie sofort zu sehen und zu sprechen.«
»Ich bitte, dass wenigstens mein spezieller Freund dabei ist.«
»Wohl, so mag er Sie begleiten, ich werde es verantworten können.«
Sie durchschritten mehrere Gänge, durch Kokoslampen mit wohlriechendem Öl erleuchtet. In einem nur kleinen Zimmer saß der Sultan, neben ihm standen drei Maleatollen, in lange indische Gewänder gekleidet. Nur diese waren kostbar, sonst war hier alles höchst einfach, und so ging es auch zu. Der Sultan saß auf einem ganz einfachen Bambusstuhle, alle Zeremonien fehlten.

Es war ein Mann von etwa 40 Jahren, einen sehr intelligenten und würdevollen Eindruck machend.
»Sprecht ihr Arabisch?«, nahm er selbst gleich das Wort.
»Wir tun es«, entgegnete der Graf.
»So werde ich mich unserer Sprache bedienen, es ist mir lieber. Bist du der Graf von Bellamare, für den dieser Empfehlungsbrief des Alum Schah gilt?«
»Ich bin es.«
»Und wer ist dieser Mann?«
»Signor Axel, der in dem Briefe als mein Freund erwähnt ist.«
»Du hast diesen Brief gelesen?«
»Der Schah gab ihn mir selbst zu lesen.«
»Ihr seid Sklaven des Schahs?«
»Ja.«
»Hier gibt es keine Sklaven. Aber ich verstehe. Wie seid ihr Sklaven des Schahs geworden?«
»Er fand uns schiffbrüchig auf einer Insel.«
»Ja, auch davon erwähnt er etwas. Du bist sein Leibarzt?«
»Ich hatte die Ehre, dazu ernannt zu werden.«
»Alum Schah, den ich recht gut kenne, wenn ich auch nie persönlich mit ihm zusammengekommen bin, schreibt mir nun, dass du wunderbare magische Fähigkeiten besäßest, dass du ein Zauberer seiest. Wenn das ein Alum Schah sagt, so hat es noch etwas ganz Besonderes zu bedeuten. Er schickt dich mir, dass du mir etwas Wunderbares offenbarst. Was ist das nun?«
Jetzt musste der Graf selbst erklären, und er erzählte von seiner vorgeblichen Eigenschaft, wie er manchmal ganz eigentümliche Empfindungen habe, als liege irgendwo etwas Wichtiges verborgen, wozu er auch vor seinen geistigen Augen Zahlen sehe, die eine geografische Ortsbestimmung ausdrückten.
Der Sultan hatte wie seine drei Minister aufmerksam zugehört.
»Hast du solche Ahnungen schon auf ihre Wahrheit geprüft?«
»Ja, und der Schah spricht doch selbst...«
»Nur in Andeutungen. Erzähle ausführlich!«
Der Graf tat es. Wir brauchen davon nichts wiederzugeben.
»Das ist allerdings wunderbar! Und wie war es nun mit der Geheimschrift?«
»Die habe ich bisher noch nicht entziffern können.«
»Und du hast eine Ahnung, ein Gefühl, dass auch hier in diesem meinem Inselreiche etwas verborgen liegt?«
»Ja. Sobald ich diese alles umschließende Korallenbank erblickte, von Westen her, hatte ich ganz deutlich wieder jene Empfindung, gleichzeitig stieg vor meinen geistigen Augen eine geografische Ortsbestimmung auf.«
»Wie war dieselbe?«
Der Graf nannte die lange Zahlenreihe.
Diese vier hochstehenden Eingeborenen wussten, was eine geografische Ortsbestimmung ist, konnten aber eine solche nicht machen, kannten nicht einmal die geografische Lage ihres Reiches, von dem ja auch durch europäische Schiffer höchstens die äußeren Grenzen berechnet sein konnten.
»Wo befindet sich nun dieser geografisch bestimmte Ort?«
Das konnte auch der Graf jetzt noch nicht sagen. Heute Vormittag hatten ja er und Axel geografische Bestimmungen auf der Magazininsel gemacht. Danach befand sich der bezeichnete Punkt, wieder bis auf Zehntelsekunden bestimmt, von der Magazininsel rund acht geografische Meilen in nordwestlicher Richtung entfernt. Weiter aber wusste der Graf vorläufig noch nichts anzugeben. Während der eiligen Bootsfahrt war keine Zeit zu solch einer Berechnung gewesen. Die Vermutung lag allerdings sehr nahe, dass für diesen Punkt hier die Hauptinsel in Betracht kam, ebenso gut konnte er auch auf einem anderen, vorgelagerten Inselchen liegen.
»Aber ich brauche ja jetzt nur eine Bestimmung zu machen, dann kann ich wohl schon genau angeben, wo sich der Punkt befindet.«
»Wie willst du solch eine Bestimmung jetzt in der Nacht machen?«
»Die Zahlen, die ich erblicke, gelten allerdings für eine Berechnung nach dem Sonnenstand, aber das lässt sich leicht für den Mond und andere Gestirne umrechnen...«
»Ich weiß, ich weiß. Aber wie willst du diese Berechnung anstellen? Hast du noch nichts von dem Belawa gehört?«
Da war wieder der Geisterkönig da, der nicht duldete, dass sich in diesem Inselreiche jemand des Nachts im Freien aufhielt. Also durfte man auch nicht aufs Dach gehen, nicht einmal in den eingeschlossenen Hof, der zur Berechnung eines über ihm stehenden Sternenbildes vielleicht auch schon genügt hätte. Das hätte wohl auch schon ein Fenster getan. Aber alle diese an sich schon sehr kleinen Fenster gingen nach dem Hofe, und da freilich genügte die Aussicht, die man von ihnen nach dem Himmel hatte, nicht mehr zu solch einer astronomischen Berechnung, und überdies mussten die Fenster bei Nacht auch noch mit Jalousien verschlossen sein, die eben nur noch die notwendigste Luft einließen.
Der Sultan und seine Räte waren so fest davon überzeugt, dass der König der fliegenden Hunde keinen Eingriff in sein heiligstes Recht duldete, dass sie deswegen gar kein Wort weiter verloren.
Die beiden wurden entlassen, fanden sich mit ihren Freunden zum Abendessen zusammen.
»Was für eine Bewandtnis mag es nur mit diesem Belawa haben?«, fragte Axel wiederum, als er sich zum Schlafen niederlegte, hier aber auf weiche, kostbare Decken.
»Ein Aberglaube, eine Religionslehre«, meinte der Graf.
»Sie denken dabei an nichts anderes?«
»Nein. An was sonst?«
»Dass hier in der Nacht von den Eingeweihten, wahrscheinlich von Priestern, etwas getrieben wird, was das andere Volk nicht zu wissen braucht?«
»Ich wüsste nicht, was hier getrieben werden sollte. Ob die Priester selbst an diesen Belawa glauben, das ist allerdings eine andere Frage.«
Mit Tagesanbruch wären die Gäste geweckt geworden, wenn sie nicht schon wach gewesen wären.
Der Sultan begehrte dringlichst des ›Zauberers‹ und des anderen Mannes, der ihn bei der geografischen Ortsbestimmung unterstützte. Die ganze Sache lag dem Sultan doch am Herzen.
Die Berechnung fand in dem außerhalb des Palastes liegenden Garten statt, der viele indische Bäume, Sträucher und Blumen enthielt, die auf diesem Inselarchipel sonst nicht vorkamen.
Bald war die Berechnung gemacht. Danach befand sich der gesuchte Punkt fünf geografische Meilen nördlich von hier.
»Dann müsste er ja mitten in der Lagune liegen«, sagten der Sultan und seine Räte sofort.
Sie besaßen auch noch eine Karte von dieser Hauptinsel, wie wohl noch von anderen, vielleicht vom ganzen Inselreiche, diese hier, welche sie mitgebracht, stellte nur Maleatoll dar, recht nach altertümlicher Art gezeichnet, also wie die Landkarten vor Hunderten von Jahren aussahen, nicht geografisch oder vielmehr astronomisch, sondern wohl nur mit der Messkette berechnet, anscheinend aber ziemlich genau, besonders waren die Himmelsgegenden scharf angegeben.
Danach befand sich dieser Palast auf dem südlichsten Inselreiche, ungefähr zwei Kilometer westlich von der künstlichen Korallenmauer, die den Lagunenzugang verschloss, und der gesuchte Punkt musste sich wirklich ziemlich mitten in der geheiligten Lagune befinden.
»O weh«, sagte denn auch der Sultan sofort, »dorthin, können wir nicht, dieses Wassergebiet ist uns verschlossen!«
»Und da gibt es keine Ausnahme?«, fragte Axel.
»Niemals — und wenn wir auch bestimmt wüssten, dass sich dort im Wasser ein Berg von gediegenem Golde erhebt, auf den Allah das Mittel zur ewigen Jugendkraft gelegt hat — dieses Wasser darf von keinem Boote berührt werden.«
»Darf dieses Boot auch nicht von uns geführt werden, die wir keine Maleatollen sind und auch einer anderen Religion angehören?«
»Du weißt nicht, was du sprichst, Fremdling!«, lautete die ungnädige, selbst etwas drohende Antwort. »Durch euch würde dieses heilige Wasser erst recht entweiht.«
Jeder weitere Einspruch wäre vergeblich gewesen, vorläufig wenigstens.
»Alum Schah hat dich umsonst hierher geschickt, es wäre besser gewesen, ich hätte nicht erst etwas erfahren, was mich nur beunruhigen kann.«
So sprach der Sultan und schritt, von seinen beiden Schirmträgern begleitet, sofort wieder dem Palaste zu.
Die drei Minister blieben noch zurück. zwei von ihnen sahen nachdenklich zu, wie der dritte die Pergamentzeichnung wieder zusammenrollte, auch so bedachtsam. Dann waren noch einige Diener da, zum unvermeidlichen Gefolge gehörend.
»Du weißt gar nicht, was dort in dem See liegen könnte?«, wandte sich dann nach langer Pause einer der Minister, die so sichtlich zögerten, an den Grafen.
»Nein, wenn wir das erfahren wollen, so müssen wir hin und...«
»Das ist ganz und gar ausgeschlossen.«
Der Minister hatte für die beiden anderen mit gesprochen, jetzt wandten sich alle ebenfalls dem Hause zu, ganz plötzlich, man hatte förmlich den Ruck gesehen, wie sie sich abgewendet.
Nur der Palastbeamte war zurückgeblieben, der wohl den Gästen zur Verfügung stand.
»Wollt ihr das Frühessen einnehmen?«, fragte dieser jetzt.
Der Graf und Axel wechselten einen schnellen Blick, und sie hatten sich verstanden. Darüber sprechen durften sie erst, wenn sie ganz unter sich waren.
Das war der Fall, als sie mit Morphin und Sam beim Frühstück saßen.
»Ob man nicht dennoch versuchen wird, jenem Punkte nachzuforschen?«, begann Axel mit der nötigen Vorsicht.
Der Graf stimmte gleich bei.
»Ja, es ging dem Sultan und seinen Räten äußerst nahe, dass sie über die Lagune nicht einmal sprechen durften, und wie sie sich so schnell abwandten — — ich glaube, die fangen noch einmal davon an, wenn niemand anderes dabei ist.«
»Eine Bootsfahrt in der Nacht.«
»Das denke auch ich. Die Höchsten hier werden doch wohl nicht an den Belawa glauben.«
»Wenn wir aber nun die Aufforderung bekommen, ein Schnellboot zu besteigen, vielleicht jetzt sofort, das uns wieder nach der Magazininsel zurückbringt und hinaus zum heiligen Reiche?«
»Ja, was dann?«
»Sollten wir uns diese Gelegenheit entgehen lassen, da wir nun einmal hier sind, zu erfahren, was für ein Geheimnis diese heilige Lagune birgt? Schon allein das Bewusstsein, der erste Mensch zu sein, der dieses jungfräuliche Wasser befährt, das ist doch auch etwas wert.«
»Wie wäre denn das zu ermöglichen?«
»Das muss ich Ihnen erst erklären Graf? Es wird sich doch auf der anderen Wasserseite ein Boot finden lassen...«
»Nein, eben nicht.«
»Dann an der Korallenmauer. Ich habe mir vorhin die Karte genau betrachtet, diese Mauer kann, wie sie eingezeichnet war, nur ganz schmal sein, da muss sich doch leicht ein Boot drüberheben lassen.«
»Und dann?«
»Na, dann rudern wir eben los. Verfolgen darf man uns ja nicht, Feuerwaffen scheint es hier nicht zu geben, oder wir müssen einfach zuerst recht fix rudern.«
»Und wie denken sie sich unsere Rückkehr.«
»Die bewerkstelligen wir einfach bei Nacht, wenn sich niemand als der Monsieur Belawa im Freien aufhalten darf.«
Während Kapitän Morphin und Sam für diesen wirklich tollkühnen Plan gleich Feuer und Flamme waren, schüttelte der Graf zweifelnd den Kopf.
»Das ist ein furchtbares Risiko, in das Sie sich da einlassen wollen. Wenn man uns nun doch erwischt? Wir werden massakriert.«
»Dass dies nicht geschieht, dafür haben Sie zu sorgen.«
»Ich?«
»Na, Sie haben doch schon ganz anderes fertig gebracht.«
»Nun gut — wenn wir aber schon in dieser Stunde wieder abreisen müssen?«
»Dann müssen wir die Abfahrt irgendwie verschieben. Einer von uns erkrankt schwer, oder Sie stellen sich tot, gaukeln den Leutchen sonst etwas vor.«
Der Graf hatte schon angedeutet, dass er zur Ausführung dieses tollkühnen Planes bereit war.
Diese ganze Unterredung wäre nicht nötig gewesen, es sollte alles ganz anders kommen — hinwiederum sollte gezeigt werden, wozu diese vier Männer entschlossen waren. Und vielleicht wäre es besser für sie gewesen, wenn sie den kühnen Plan wirklich ausgeführt hätten, dass man ihnen nicht erst hinterlistig entgegengekommen wäre.
Einer der Minister erschien bald wieder. Man hatte seinen Namen schon öfter aussprechen hören — Mallah.
Sich ganz sicher fühlend, begann er ohne Umschweife. Zunächst versuchte er auszuforschen, ob der ›Zauberer‹ denn so gar nicht wisse, was man an jenem Punkte mitten in der meilenweiten Lagune finden könne.
Nein, da konnte der Graf absolut keine Auskunft geben.
»Aber weißt du denn gar nicht, was für ein Geheimnis da in Betracht kommen könnte?«
Nein, da konnte wieder der Minister keine Auskunft geben.
»Geht da keine Sage unter euch?«
»Nein, gar nichts.«
»Weshalb ist denn da die Lagune eigentlich so heilig?«
»Sie ist eben seit uralten Zeiten ein unantastbares Heiligtum, das nur von Fischen bewohnt wird, von keinem Menschen entweiht werden darf.«
Diese Erklärung musste eigentlich schon genügen. die Ursache einer Heiligkeit ist ja überhaupt schwer zu definieren und zu ergründen.
»Noch niemals hat ein Mensch diese Lagune durchquert?«
»Noch niemals.
»Befindet sich in der Mitte vielleicht eine Insel?«
»Eine Insel? Wie soll da eine Insel hineinkommen?«
Der Mann hatte recht. Diese Atolle dulden innerhalb der Wasserfläche keine andere Ansiedlung von Korallen — weshalb nicht, das weiß nur Gott — und auch andere Inseln sind noch niemals innerhalb solcher Korallenlagunen gefunden worden.
Schließlich aber könnte da ja einmal eine Ausnahme stattfinden, von der der Mensch nur noch niemals etwas beobachtet hat.
Der Maleatolle freilich wollte von solch einer Ausnahme nichts wissen, deshalb brauchte man ihn auch gar nicht erst zu fragen, ob man schon einmal bei klarster Luft nur einen Schimmer von einem Eiland dort wahrgenommen habe, oder ein anderes Anzeichen, dass sich dort eine Insel befinden könne, hin und her fliegende Vögel und dergleichen.
»Und doch, es kann ja etwas sein — im Wasser versenkt, darinliegend — vielleicht ein Goldschatz, ein natürlicher.«
So sprach der Minister. Es ist eben immer die alte Geschichte: Am Golde hängt, nach Golde drängt doch alles, ach, wir Armen! Und das gilt auch für die Maleatollen, Gold war eben auch hier etwas anderes als Kaurimuscheln, auch an diesem Fürstenhofe schien der ewige Gelddalles zu herrschen, gegen den die Minister Rat schaffen sollen.
Eine Pause der gegenseitigen Erwartung trat ein. Jetzt wollte der Minister nicht mehr mit der Sprache herausrücken, und der Graf verlangte es doch von ihm.
»Ja, wie können wir uns dann davon überzeugen, was dort liegen mag?«, kam der Graf dem ihn sogar ängstlich Anblickenden doch wenigstens etwas entgegen.
»Es gäbe ja schließlich ein Mittel...«
»Welches?«
»Einfach hinfahren!«
»Ich denke...«
»Bei Nacht!«
»Aber der menschenfressende Belawa?«
»Ah bah!«
Und jetzt endlich rückte der Minister mit der Sprache heraus, bekannte, dass dies ja nur eine Fabel sei, allerdings eine religiöse, die aber zu diesem mohammedanischen Inselreiche so gut gehörte, um die Nacht heilig zu halten, wie zur Christenheit die Heilighaltung des Feiertages, und wie die Christenheit ihre Zeit gehabt hat, da kein Mensch an der persönlichen Existenz des Teufels zweifelte, so zweifelte hier niemand an der Existenz des menschenfressenden Belawas, der in der Nacht nach Opfern suchte.
Wie gewöhnlich mit Ausnahme der Priester, überhaupt der Leiter dieses Volkes. Sonst aber musste bei diesem patriarchalisch hinter einer chinesischen Mauer lebenden Volke dieser Aberglaube in Fleisch und Blut übergegangen sein.
Dieses Geständnis war geschehen.
»Ist denn schon einmal ein Fall vorgekommen, dass Belawa einen sich draußen herumtreibenden Menschen in der Nacht getötet hat?«, examinierte der Graf weiter.
»Wie meinst du das? Ich sagte dir doch so eben, dass es solch einen Belawa gar nicht gibt. Fliegende Füchse hört man in der Nacht genug schreien, aber das sind ganz harmlose Tiere.«
»Nun, da könntet ihr aber doch Wächter während der Nacht herumstreifen lassen.«
»Wozu denn?«
»Die jeden anderen töten müssen, sie können ja durch künstliche Wunden den Anschein erwecken, als habe ein blutsaugendes Ungeheuer sie hervorgebracht, diese Wächter sind eingeweiht...«
»Fremdling, wo willst du hin, was traust du uns zu!«, rief der Minister erschrocken. »Nein, es ist ganz einfach ein Märchen, das unbedingten Glauben findet.«
Er lügt, sagten sich aber der Graf sowohl wie Axel sofort, wir haben dennoch das Rechte getroffen.
Das hatten sie gleich an seinem Erschrecken erkannt, das einer ganz anderen Ursache entsprang, als dass er nur solch einen unbegründeten Verdacht zurückwiese. Er war eben darüber so erschrocken, dass die Fremden gleich das Rechte erkannt hatten.
Doch diese Angelegenheit war hiermit erledigt.
»Seid ihr bereit, in der Nacht hinzurudern?«, ging er jetzt der Sache näher.
»Wir sind es.«
»Denn Leute von uns können nicht als Ruderer mitkommen, das ist ganz ausgeschlossen, die Heiligkeit des Sees muss unbedingt gewahrt werden.«
»Wir vier Mann genügen ja auch vollkommen.«
»Nur ich selbst werde euch begleiten.«
Er schilderte weiter, wie der Plan hierzu entstanden war.
Der Sultan brannte vor Begier, zu erfahren, was für ein Geheimnis die Lagune in ihrer Mitte denn bergen könne.
Aber nur der Sultan und seine drei Minister waren Freidenker, die an den Belawa nicht glaubten und eventuell auch die Unverletzlichkeit der Lagune zu brechen bereit waren.
Die Fahrt nach jenem Ziele währte ja nur zwei Stunden, zwei Stunden wieder zurück, und wenn man noch eine Stunde nach und eine Stunde vor Sonnenuntergang hinzugab, so konnte man sich mit der Untersuchung jenes Ortes oder Punktes noch sechs Stunden beschäftigen, denn in dieser Gegend, nahe dem Äquator, währte die Nacht regelmäßig zu jeder Jahreszeit genau zwölf Stunden.
Aber das war eine menschliche Berechnung. Wer wusste denn, was dazwischenkommen konnte, was für Untersuchungen man dort an Ort und Stelle anzustellen hatte, was für Hindernisse sonst in den Weg kommen konnten.
Also, es war doch sehr die Frage, ob man noch in derselben Nacht hierher zurückkehren konnte. Und in der Nacht musste die Rückkunft unbedingt geschehen.
Alle drei Minister aber konnten doch nicht gleichzeitig krank sein, sodass sie sich am Tage nicht sehen zu lassen brauchten, und vom Sultan war da überhaupt gar keine Rede.
So konnte sich also, falls doch ein ganzer Tag dazwischenkam, nur ein einziger Minister dieser Expedition anschließen.
Darüber hatte sich der Sultan mit seinen Ministern, die ihn auch auf seinen Auslandsreisen begleitet hatten, soeben beraten, die Wahl war hier auf Mallah gefallen, dieser sollte die Fremden auf der nächtlichen Fahrt begleiten, eventuell einen Tag für krank gelten,
»Und wir vier? Sollen auch wir, falls wir einen Tag ausbleiben müssen, diesen ganzen Tag für krank gelten, dass wir das Zimmer nicht verlassen dürfen?«
»Nein, dass ihr krank seid, ohne von irgend jemand gesehen zu werden, das ist hier nicht gut angängig, das würde sofort Misstrauen erwecken.«
»Ja, wie denn sonst?«
»Ihr seid doch Christen. und wir wissen, dass die Christen viele Sekten haben, so wie ja auch wir Mohammedaner. So erzählt heute im Laufe des Tages, während ihr euch die Insel anseht, überall, dass ihr morgen einen Festtag habt, während dessen ihr euch laut religiöser Vorschrift zum gemeinsamen Gebet in eurem Zimmer eingeschlossen halten müsst, auch nichts genießen dürft. Versteht ihr?«
Ja, der Plan war ganz gut. Man hatte sogar schon damit gerechnet, dass es Maleatollen geben könne, welche wussten, dass die allgemeine Christenheit morgen sonst keinen solchen Festtag hatte. Aber das Wort ›Sekte‹ entschuldigte dann alles.
»Gut. Dann handelt es sich nur noch um das Boot.«
»Wir müssen eins von den Booten nehmen, welche jenseits der Korallenmauer liegen, die den Lagunenzugang verschließt, das Boot wird über die Mauer gehoben.«
Also genau so, wie es schon unsere vier Freunde geplant hatten.
»Wird dieses Boot nicht vermisst?«
»O, da liegen so viele Boote, sie sind herrenlos, gemeinsamer Besitz. Wer eins braucht, um nach einer anderen Insel zu fahren, nimmt es und lässt es liegen, wo er es verlässt. Nein, das fällt nicht auf. Nur in der nächsten Nacht müssen wir dann unbedingt zurückkommen.«
»Und Proviant?«
»Für den werde ich in aller Heimlichkeit sorgen, den tragen wir heute Nacht hin.«
Dann war vorläufig nichts weiter auszumachen, der Minister entfernte sich wieder.
Unsere vier Freunde besichtigten im Laufe des Tages die Insel. Ihre ganze Länge von neunzehn geografischen Meilen abzuschreiten, dazu hätten sie natürlich mehrerer Tage bedurft und hätten dabei doch immer nur auf einem Striche marschieren können.
In diesem einen Tage lernten sie sogar nur einen ganz kleinen Teil des Gebietes kennen, welches aus dieser Hauptinsel unter Kultur stand, und die nördliche Dschungelregion war viermal so groß.
Die Hauptsache war die Korallenmauer, die also nur zwei Kilometer von hier entfernt war, das heißt, ihr westlicher Anfang, sich ebenso weit nach Osten erstreckte, bei einer Breite von zwei Metern, sich kaum einen halben Meter über das Wasserniveau erhebend, und weil der ganze Inselarchipel durch einen zusammenhängenden Korallenwall von dem äußeren Meere abgeschlossen, war hier ein Unterschied zwischen Ebbe und Flut kaum bemerkbar.
Wie der Minister berichtet, lagen hier sehr viele Kähne, kleine und große, am ganzen äußersten Strand entlang und auch noch direkt an dieser kunstvoll aufgeführten Mauer aus behauenen Korallenblöcken, es ging auch sonst hier sehr lebendig her, während das jenseitige Wasser, die Lagune, die sie hier zum ersten Male erblickten, in Todesstille dalag. Höchstens dass ab und zu Fische hochsprangen, von denen es hier wimmelte.
Was die Freunde besprachen, mit Eingeborenen und unter sich, das wollen wir nicht wiedergeben.
Zum Mittag fanden sie sich wieder im Palaste ein, nach dem Essen gesellte sich nochmals der Minister Mallah zu ihnen zur geheimen Besprechung.
Ja, sie hatten alle Vorschriften befolgt, überall erzählt, dass sie als Christen morgen in aller Zurückgezogenheit einen Festtag begehen müssten, und der Minister konnte ihnen erklären, dass er den Proviant bereits in aller Heimlichkeit beschafft habe, die hohlen Kokosnüsse, die hier als Wasserfässchen dienten, brauchten nur noch gefüllt zu werden.
Denn die größte Heimlichkeit war nötig, das heißt, der Minister musste dies alles allein tun, durfte sich absolut keinem anderen Maleatollen anvertrauen. Es sei denn einem der anderen beiden Minister, die aber doch nicht wie die Handlanger arbeiten konnten.
Eine große Schwierigkeit bestand nur noch darin, dass hier nach uraltem, heiligem Landesgesetz keine Tür geschlossen werden durfte. Hinwiederum musste dem Befehl unbedingt nachgekommen werden, die christlichen Fremdlinge, die morgen im einsamen Zimmer ihren religiösen Übungen nachgingen, nicht zu stören. Dass jemand also etwa aus Neugier die Tür öffnete, das war ganz ausgeschlossen. Freilich durfte man deswegen vor ihrer Tür auch keine Wache aufstellen.
»Wenn aber nun in der Nacht hier einmal etwas passiert, was uns zwingen müsste, unser Zimmer zu verlassen?«, meinte Axel.
»Was sollte passieren?«
»Wenn etwa Feuer ausbräche.«
»Hier ist noch niemals Feuer ausgebrochen, der ganze Palast besteht aus Korallenkalk.«
»Es könnte aber doch einmal Feuer ausbrechen, gerade in unserem Zimmer, Brennbares gibt es ja genug darin.«
»Dann... sind wir eben verraten.«
»Was würde man dann glauben, wo wir uns befinden?«
»Dann würde man allerdings annehmen, dass ihr versucht habt, auf eigene Faust bei nächtlicher Weile die Lagune zu befahren.«
»Und wie würde man das auffassen?«
»Da ist gar nichts aufzufassen. Weit seid ihr natürlich nicht gekommen, nur wenige Schritte vor die Haustür. Dann hat euch selbstverständlich der Belawa überfallen.«
»So fest ist dieser Aberglaube eingewurzelt?«, fragte Axel noch einmal, ganz überflüssig.
»Daran besteht nicht der geringste Zweifel im Volke.«
»Dann müsste man aber doch unsere Leichen finden.«
»Das ist nicht nötig. Der Belawa hat euch mit Haut und Haaren aufgefressen.«
»Also nicht, dass man uns noch auf der Lagune vermutet?«
»Dass ihr in dieses Wasser auch nur ein Boot hinabgelassen hättet, das ist für das Volk ganz und gar undenkbar. Der Belawa ist ja eben der Schutzgeist dieses heiligen Wassers, wenn er auch sonst ein böser Geist ist.«
»Und wie würde man dein Verschwinden beurteilen?«
»Freund, zerbrich dir Allahs Kopf nicht!«, lautete die etwas spöttische Antwort. »Es geschieht alles, wie Allah will.«
Der Minister hatte ganz recht. Solche Erwägungen hatten gar keinen Zweck.
»Wir müssen nur sorgen«, setzte Mallah noch hinzu, »dass wir in der Nacht wieder zurückkehren, wenn nicht in dieser, dann doch spätestens in der nächsten, und dass wir dann hier im Palast auf keine Wächter stoßen, die irgendwelchen Verdacht schöpfen können, dafür werden wieder die anderen beiden Minister sorgen. Mehr können wir nicht tun. Auch uns sind hier die Hände sehr gebunden, hier geht alles ganz anders zu als in euren Ländern.«
Die Nacht war angebrochen.
Eine Viertelstunde später öffnete sich geräuschlos die Tür, Mallah trat in das Zimmer, das den vier Gästen zur Verfügung gestellt worden. Noch hatten sie die Öllampe brennen.
»Kommt, es ist alles...«
Er stutzte.
»Wozu wollt ihr die Waffen mitnehmen?«
Jeder hatte sich, als sie den ›Stern von Indien‹ verlassen, mit einem Gewehr und zwei Pistolen sowie der dazu nötigen Munition versehen, bei Axel kam noch sein treuer Hirschfänger hinzu, und mit diesen Waffen hatten sie sich auch jetzt behangen.
»Wir sind gewohnt, uns niemals von unseren Waffen zu trennen.«
»Wie ihr wollt«, fand dann Mallah gleich nichts weiter dabei. »Folgt mir ganz leise.«
Sie löschten die Lampe aus und traten hinaus. Es war ein geräumiges Haus, durch dessen Gänge sie auf Bastmatten lautlos schritten. Hin und wieder verbreitete eine Öllampe spärliches Licht, aber kein Mensch war zu sehen.
»Hier befinden wir uns schon in meiner Wohnung«, sagte Mallah, eine Tür öffnend.
Es war eine nur kleine Kammer, die sie betraten, ebenfalls von einer Lampe erhellt, in einem Winkel bauschte sich ein großes Stück Segeltuch; als der Minister es zurückschlug, zeigte sich, dass sich darunter alles das befand, was man mitnehmen wollte: zehn große Kokosnüsse, hohl, mit Pfropfen versehen, jede ungefähr zehn Liter Wasser fassend, und zwar waren sie schon gefüllt, je zwei durch ein Bastseil verbunden, sodass man sich die doch ziemliche Last bequem über die Schulter hängen konnte, und dann noch einige Bündelchen mit festem Proviant.
Alles war schon fix und fertig arrangiert, die ganze Last auf fünf Mann verteilt, sodass jeder das Seine nur umzuhängen brauchte, wonach jeder ungefähr fünfzig Pfund zu tragen bekam, was aber durch das bequeme Arrangement für einen kräftigen Mann nicht viel zu bedeuten hatte.
So behangen verließen sie die Kammer und durch das unbewachte und unverschlossene Haupttor den Palast.
Der Mond war noch nicht aufgegangen, doch die flimmernden Sterne genügten, um die ausgezeichnete Straße erkennen zu lassen, welche in schnurgerader Richtung nach der Korallenmauer führte.
Aber schon nach wenigen Schritten stockte wieder der Fuß der nächtlichen Wanderer, und sie alle schmiegten sich ängstlich zusammen oder einer suchte doch den anderen zu berühren.
Denn dicht neben ihnen erscholl plötzlich ein grässliches Gekreisch, wie das Hilfegeschrei eines kleinen Kindes vermischt mit dem Ächzen eines Schwerverunglückten, im Übrigen nicht wiederzugeben, jedenfalls grässlich, markzerschneidend, es kam wie aus der Luft über ihnen, und plötzlich erscholl allüberall dieses furchtbare Gekreisch, in der Nähe und aus weiter Ferne kommend, und da schwebte auch langsam über ihren Häuptern eine dunkle Masse dahin, verschwand in der Nacht....
Lange dauerte bei diesen Männern das Entsetzen freilich nicht.
»Der Kaguang, ich kenne dieses nächtliche Geschrei des fliegenden Fuchses, der eben wegen dieses Geschreis lieber fliegende Katze genannt werden sollte«, sagte zuerst der Graf.
Ja, da war die Erklärung gegeben, die verschlungenen Hände lösten sich wieder, aber...
»Verflucht«, flüsterte Kapitän Morphin mit zitternder Stimme, »ja, auch ich habe dieses verdammte Nachtvieh auf den Inseln des malaiischen Archipels oft genug miauen hören, Nacht für Nacht, aber ich konnte mich nicht daran gewöhnen, immer wieder sträubte sich mir im ersten Schreck das Haar vor Entsetzen, und so geht's mir altem Kerl noch jetzt.«
So berichten alle offenherzigen Reisenden, die aus dem malaiischen Archipel und aus Ceylon, wo der Kaguang besonders zu Hause ist, dieses Nachttier haben schreien hören; sie bekennen offen, von Gespensterfurcht befallen worden zu sein; kann man es da den Eingeborenen verdenken, wenn sie erst recht dem sonst so harmlosen Tiere geisterhafte Eigenschaften zuschreiben, wozu ja nun auch noch sein Fliegen kommt?
Ein richtiges Fliegen ist es allerdings nicht. Das fuchsgroße Tier bewegt sich mühselig an der Erde, kann aber mit Hilfe seiner scharfen Krallen mit Leichtigkeit die glattesten Baumstämme erklettern, um von Ast zu Ast seiner Fruchtnahrung nachzugehen. Um aber wieder herabzukommen, bedient es sich eines anderen Mittels. Zwischen seinen Vorder- und Hinterbeinen sind große Häute gespannt, ganz wie bei einer Fledermaus, oder richtiger, wie beim fliegenden Eichhorn, so springt es mit ausgebreiteten Beinen von der höchsten Höhe herab und schwebt wie ein Gleitdrachen in schiefer Richtung sacht zu Boden, kann auf diese Weise aus einer Höhe von zehn Metern die doppelte Strecke zurücklegen.
So kommt also auch noch in Betracht, wenn solch ein großes Tier bei Nacht durch die Luft schwebt, und der Mondschein, der seinen Schatten verdreifacht, lässt diesen nun erst recht ungeheuerlich erscheinen.
Aus diese Weise mochte wohl auch hier in diesem Inselarchipel die Sage von einem riesenhaften Kaguang entstanden sein, dem geisterhaften König all dieser fliegenden Füchse, infolge seiner Größe auch nicht so harmlos wie seine Untertanen. Ganz sicher hatten der Mondschein und sein Schatten diese Sage erst veranlasst, die zu einem förmlichen Religionskultus ausgewachsen war.
Und der Minister, zu den wenigen Eingeborenen gehörend, die nicht an den gesetzlich eingeführten Geisterkönig glaubten, unterlag dennoch wieder diesem Aberglauben. Während selbst der schwarze Sam schnell alle Gespensterfurcht abgeschüttelt hatte und ärgerlich über sich selbst lachte, weil er sich ins Bockshorn hatte jagen lassen, wurde Mallah erst jetzt von einem Zittern befallen, klammerte sich noch nachträglich krampfhaft an Axel an.
»Der Belawa, der Geisterkönig!«, stieß er in furchtbarer Angst hervor.
Also gerade der Mann, der die Existenz dieses Geistes ableugnete, fürchtete sich jetzt vor diesem.
Es ist und bleibt eben die alte Geschichte. Fast alle Menschen, von uns gesprochen, glauben nicht an Gespenster, so versichern sie wenigstens bei jeder Gelegenheit, und sind im Grunde genommen auch ganz davon überzeugt, dass es keine Gespenster gibt — — aber wenn es einmal darauf ankommt, dann rutscht plötzlich das mutige Herz in die Hosen, dann fürchten sie sich doch alle vor Gespenstern! Und so muss es auch sein, das Wort eines der Weisesten unserer Zeit bleibt bestehen: Nur der fürchtet sich nicht vor Gespenstern, der an die Existenz von Geistern glaubt — indem er dann nämlich auch weiß, dass sich diese Geister in unsere irdischen Verhältnisse gar nicht einzumischen haben, es nicht können.
Der Minister hatte die größte Lust, gleich wieder umzukehren. Innerhalb des Hauses, dessen Fenster alle nach dem inneren Hofe gingen, bekam man dieses nächtliche Gekreisch niemals zu hören, und nun überhaupt die Ungewohntheit, sich jemals in der Nacht im Freien aufzuhalten — die Furcht überwältigte ihn.
»Der Belawa geht um! Und wenn wir nun gar das heilige Wasser entweihen wollen! Wir sind verloren!«
Aber unsere vier Freunde erwischten ihn noch rechtzeitig, ehe er zurückfliehen konnte, und ihren vereinten Bemühungen gelang es, ihn weiter vorwärts zu bringen, zuerst mit Anwendung einiger Gewalt, bis er sich wieder etwas beruhigt hatte. Ganz wich die Gespensterfurcht aber niemals von ihm.
Der Weg wurde fortgesetzt, immer begleitet von dem grässlichen Geschrei der Kaguangs, und am entsetzlichsten klang es, wenn sich einer von ihnen in den überall gestellten Schlingen gefangen hatte. Das gab ja dann am Tage für den Fänger stets eine große Freude — nur bei Nacht wollte man von den Tieren nichts wissen, da standen sie unter dem Schutze ihres Königs aus dem Reiche der Hölle.
In einer halben Stunde hatte man den Anfang der Korallenmauer erreicht. Noch immer war der Mond unter dem Horizont, aber der Sternenschein genügte wieder, um das für diese Expedition geeignetste Boot auszuwählen.
Es wurde mit Leichtigkeit über die Mauer gehoben. Als es sich noch darauf befand, wollte der Minister wiederum Einspruch erheben.
»Sobald es das Wasser jenseits der Mauer berührt, wird Belawa uns...«
Aber das Boot lag schon auf der anderen Seite im Wasser, und Belawa wollte nicht erscheinen, nichts anderes passieren, und da ließ sich auch Mallah wieder beschwichtigen, half sogar die mitgebrachten Sachen verpacken.
Die fünf Schaufelruder wurden mächtig gehandhabt, wie ein Pfeil schoss das leichte, schlanke Boot über die spiegelglatte Wasserfläche dahin, dem Norden zu. Bei dieser Art des Ruderns, dorthin blickend, wohin es ging, war ein besonderer Steuermann nicht nötig.
Als sich der ziemlich volle Mond über den Horizont erhob, war die zurückgelassene Küste schon nicht mehr zu erblicken.
Also zwei geografische Meilen konnte man, dabei sich nach dem Kompass richtend, immer geradeaus rudern. Bei dieser Schnelligkeit aber durfte man nur mit einer Stunde rechnen.
Diese Stunde verging, nach des Grafen Chronometer berechnet.
»Stopp! Jetzt müssen wir erst einmal eine geografische Berechnung machen.«
»Sie ist nicht nötig!«, rief da Axel in größter Aufregung. »Dort — dort.«
Alle folgten mit den Augen der Richtung seiner ausgestreckten Hand, aber niemand wusste, was er denn wollte.
»Dort, dort — seht ihr denn nicht den Küstensaum?!«
Nein, niemand gewahrte eine Spur davon. Vor ihnen im Mondenschein erstreckte sich nichts als die spiegelglatte Wasserfläche, nur ab und zu durch einen aufspringenden Fisch bewegt.
Aber wir wissen, was für eigentümliche Augen dieser Depeschenreiter besaß, die er sozusagen, wenigstens in Anbetracht zur Sehweite, teleskopartig verschieben konnte, und seine drei Begleiter kannten auch schon diese Eigenschaft von ihm.
»Sie sehen wirklich eine Küste?«, fragte der Graf.
»Natürlich, ganz deutlich — dort hinten, das aufsteigende Land!«
»Und wahrhaftig«, rief da auch der Graf, die Luft durch die Nüstern ziehend, »das riecht nach — nach... Zimt und Nelkenblüten!«
Hiervon aber wollte nun Axel nichts bemerken, so wenig wie die anderen.
»Dann sind wir schon über die ganze Lagune hinweggefahren«, meinte der Minister.
»In der einen Stunde die vier geografischen Meilen, sodass dort schon der Anfang der nördlichen Dschungelregion sein sollte? O nein, so schnell sind wir nicht gefahren. Und wachsen denn dort Zimtbüsche und Nelkenbäume?«
»Nein, die kommen hier in ganz Maledivia nicht vor und nicht fort, dazu ist der Boden gar nicht geschaffen.«
»Ich rieche aber ganz deutlich indische Gewürzdüfte, vor allen Dingen Zimt und Nelken.«
»Und ich sehe dort ganz deutlich eine Küste«, ergänzte Axel.
»Dann vorwärts, dann muss sich ja das Rätsel gleich lösen.«
Und weiter ging es mit verdoppelter Ruderkraft, ohne dass man zuvor eine geografische Ortsbestimmung gemacht hätte.
Und schon zehn Minuten später, in denen das schnelle Boot fast vier Kilometer zurückgelegt hatte, sahen es auch alle anderen, wozu dann noch der Geruch kam.
Ja, dort erhob sich eine Küste, und nach den nächsten Ruderschlägen konnte man erkennen, dass sie dicht bewaldet war, und der Geruch nach Zimt und Nelken wurde immer intensiver.
Dabei herrschte vollständige Windstille. Wäre ihnen der Wind entgegengekommen, hätten sie den Geruch, der eine üppige Flora verriet, eher wahrgenommen, als diese Küste mit den Augen, wie der Seemann die Nähe der Molukken und anderer Gewürzinseln eher mit der Nase als mit den Augen erkennt.
»Inschallah, eine Insel!«, rief jetzt auch der Minister, die Hände über dem Kopfe erhebend. »Mitten in einer Lagune eine Insel — o Allah, wie bist du wunderbar!«
Ja, was der Mensch bisher noch nie auf der Erde gefunden hatte, war hier eben einmal der Fall: Inmitten einer Atollenlagune noch eine separate Insel. Unterdessen sind aber noch einige andere Atolle mit eigenen Inseln gefunden worden, die allerdings ihre Entstehung niemals Korallen zu verdanken haben, sie sind immer vulkanischen Ursprungs. So kann man ja schließlich auch ganz Haiti (1) als solch eine separierte Atolleninsel betrachten, nur dass hierbei der eingrenzende Korallenring gar nicht in Betracht kommt.
(1) Richtig muss es offenbar Tahiti heißen; Haiti ist der westliche Teil der Karibikinsel Hispaniola.
Dass auch diese Insel hier vulkanischen Ursprungs sein musste, das konnte man schon daraus schließen, dass sie eine besondere Flora hatte. Der verwitternde Korallenkalk bildet doch nur einen dürftigen Humus mit ganz einseitigen Nährstoffen für die Pflanzenwelt, es kommen nur wenige Gewächse darin fort, am besten die Kokospalme. Ganz anders ist es, wenn der Humus aus vulkanischem Gestein aller Art entstanden ist.
»Graf«, flüsterte Axel, während die Ruder noch untätig verharrten, und er befand sich in einer Aufregung, wie man sie bei dem eisernen Manne nur selten wahrnahm, »Graf, wissen Sie, was diese Insel für uns zu bedeuten hat?«
»Ich weiß es. Es ist ein jungfräuliches Eiland, das wir als die ersten Menschen betreten werden.«
»Nein, das genügt noch nicht. Solcher unentdeckten Eilande mag es noch zahllose geben, und es würde mich gar nicht so aufregen, ein solches zu finden und zu betreten. Aber hier, hier!! Innerhalb eines Inselgebietes, in dem auch das kleinste Inselchen dicht bevölkert ist — innerhalb einer Bevölkerung von zweimalhunderttausend Seelen, die wahrscheinlich schon seit Jahrtausenden jedes Fleckchen Erde nutzbar zu machen suchen, da liegt in einem stillen, leichtbefahrbaren Wasser, ein Binnensee zu nennen, eine große reichbewaldete Insel, von der die ganze Bevölkerung gar keine Ahnung hat!!«
»Ich verstehe Sie schon, stimmte der Graf nochmals bei, »ja, es ist eine ganz wunderbare Entdeckung die wir da machen, und es ist ein gar feierlicher Moment, den wir soeben erlebt haben.«
»Hier wohnt Belawa, der Geisterkönig!«, fing da der Minister schon wieder ganz ängstlich zu flüstern an.
»Ach geh und häng dich«, knurrte Kapitän Morphin. »Na, wollen wir hier liegen bleiben und die Insel nur von Weitem ansehen?«

Die Fahrt wurde fortgesetzt; vor den Augen der sich Nähernden teilte sich der undurchdringliche Urwald in einzelne Bäume, bis dicht an das ziemlich flache, aber felsige User stehend, und zwar waren es meist mächtige Teakbäume, welche die möglichste Nähe des Meeres lieben und das beste, eisenharte, unverwüstliche Schiffsbauholz liefern. Dazwischen schlangen sich Schlingpflanzen mit prächtigen Blüten von Baum zu Baum — eine vollständig tropischindische Landschaft, wie sie besonders Ceylon bietet.
Der eingeborene Minister geriet über alles dies nur deshalb nicht in grenzenloses Staunen, weil seine Furcht größer war. Denn hier erscholl erst recht überall das grässliche winselnde und ächzende Geschrei der Kaguangs.
Das Boot hatte unter einem Baume an einem Felsblock angelegt, ohne dass der Kiel den Grund berührte.
»Basalt und verwitterte Lava«, entschied der Graf nach kurzer Prüfung. »Also rein vulkanischen Ursprungs. Jetzt wollen wir...«
Er verstummte ebenso, wie plötzlich das misstönende Geschrei der Kaguangs, denn ein Mächtigerer hatte gesprochen — ein furchtbares Brüllen hatte alles zum Schweigen gebracht.
»Alle Wetter, ein Tiger — hier gibt es sogar Tiger!«
Da war es nicht geraten, sich so dicht am Ufer zu halten, wenigstens nicht bei Nacht, der Tiger mochte sich wenig daraus machen, ob er schon einen Menschen gesehen hatte oder noch nicht.
Aber noch etwas anderes sollte das Boot zum eiligen Rückzug ins freie Wasser veranlassen.
Dem ersten Tiger hatte ein zweiter geantwortet, die beiden hielten ein Duett, plötzlich aber, mitten in einem angesetzten Brüllen, verstummten auch sie, denn immer noch etwas ganz anderes erklang.
Was für ein Schreien das war, das wusste niemand. Ja, es war das miauende Geschrei des Kaguangs, aber in fast hundertfacher Verstärkung, einfach ohrenzerreißend, und nicht etwa, dass hundert Kaguangs gleichzeitig schrien, sondern es konnte nur ein einziges Tier sein, welches diese entsetzlichen Töne hervorstieß. Im Übrigen nicht zu beschreiben.
»Der Belawa, das ist der Belawa!«, heulte der Maleatolle auf, und er war nicht der einzige, der schleunigst nach dem Schaufelruder griff, sondern unsere vier Freunde unterstützten ihn dabei, schnell wieder einiges Wasser zwischen sich und den Urwald zu bekommen.
Das furchtbare Brüllen war verstummt, und keine andere Tierstimme wollte sich so bald wieder hören lassen.
Wir wollen nur sagen, dass auch Axel an allen Gliedern zitterte.
»Himmel und Hölle, was für ein Ungeheuer mag das gewesen sein?!«, stöhnte er.
»Ja, das war wirklich wie das Brüllen eines Höllenungeheuers, von dem die Erde nichts weiß«, bestätigte der Graf.
»Das klang gerade, als wenn so ein fliegender Fuchs in ein Sprachrohr hineingebrüllt hätte«, musste auch Kapitän Morphin seine Meinung aussprechen, und er drückte es vielleicht am besten aus, wenn man an einen riesenhaften Kaguang nicht glauben wollte, wonach man auch an den Belawa hätte glauben können.
»Bestimmen wir erst, wo wir uns hier befinden«, entschied dann der Graf.
Die geografische Ortsbestimmung nach dem Mond wurde gemacht, etwa hundert Meter von der gefährlichen Küste entfernt. Danach hatten sie den Mittelpunkt der Lagune noch nicht erreicht, diese Insel begann noch zwei Kilometer vorher.
Was nun? Diese Insel bei Nacht zu betreten, dazu hatte niemand Lust, es genügte schon, dass ab und zu noch das Brüllen eines Tigers erscholl, nicht wieder jenes schreckliche Geschrei.
»Zu der Untersuchung müssen wir den morgenden Tag verwenden«, sagte dann der Graf, »sodass wir erst in der folgenden Nacht zurückkehren. In dieser Nacht wollen wir die ganze Insel umfahren und möglichst ihre Küste bestimmen.«
Nur der Minister wollte davon nichts wissen, wollte sofort wieder zurückkehren, wurde aber überstimmt, musste sich fügen.
Wir geben die Einzelheiten nicht wieder. Innerhalb von drei Stunden umfuhren sie langsam die ganze Insel, ab und zu eine Ortsbestimmung machend.
Danach betrug die Breitseite der Insel, der sie sich von Süden her genähert hatten, ungefähr zweiundeinhalb Kilometer, ihre Länge aber von Süden nach Norden gegen vier Kilometer, sodass sie mit ihrem Flächeninhalt von zehn Quadratkilometern eine ganz beträchtliche Insel zu nennen war, zumal für solch eine Lagune, die also rings von einem Inselland eingeschlossen war.
Freilich wolle man bedenken, dass die Lagune selbst vier geografische Quadratmeilen umfasste, und erst fünfzig Quadratkilometer machen eine Quadratmeile aus.
Daran, dass diese genau in der Mitte liegende Insel von dem Landringe aus hätte erblickt werden können, war nicht zu denken, nicht mit dem besten Fernrohre, dazu war auf diese Entfernung hin schon die Krümmung der Erdoberfläche zu groß. Und es waren ja nur ganz flache Koralleninseln, diese selbst hier zeigte, soweit man das jetzt schon beurteilen konnte, nach der Mitte zu nur eine sehr mäßige Erhebung. Es hätte auch nichts genützt, hätte man eine der manchmal 20 Meter hohen Kokospalmen erklommen.
Desgleichen konnte auch der Duft nach fremden Gewürzen durch den Wind nicht so weit getragen werden; bei einer Entfernung von zwei Meilen hört das doch auf.
Anders war es, wenn man an die Stürme dachte, die hier ja oft genug mit furchtbarer Gewalt tobten. Diese mussten doch manchmal hier Bäume entwurzeln und ins Wasser werfen, die dann an den Küstenring getrieben wurden, und das waren Bäume, die auf den Koralleninseln sonst nicht vorkamen, noch dazu mit Schlingpflanzen bedeckt — kurz, das hätte die Eingeborenen doch stutzig machen müssen, daraus hätten sie doch schließen können, dass sich innerhalb der Insel noch eine Insel mit einer ganz anderen Vegetation befand.
Aber dieser Erkenntnis stand wiederum ein großes Hindernis im Wege. In dieser Gegend der Monsune herrscht fast immer Südwind, mindestens kommen alle Stürme und Taifune aus Süden. Also wurden die entwurzelten Bäume und alles andere, was von dieser Insel abtrieb, nach Norden geschwemmt. Im Norden aber befand sich auf dem Lagunenring die Dschungelregion, in die überhaupt gar nicht einzudringen war, ganz abgesehen davon, dass weitere Expeditionen gar nicht unternommen werden durften, wegen des Belawas, der in der Nacht keinen Menschen außerhalb eines soliden Hauses oder einer Hütte duldete. Also nicht etwa, dass einmal ein wissbegieriger Maleatolle solch eine Expedition nach jener Dschungelregion unternahm.
So kam es, dass, wenn dort auch fremdländische Pflanzen und Bäume angeschwemmt waren und wirklich festen Fuß gefasst hatten, der Bevölkerung hiervon gar nichts bekannt sein konnte.
Nachts gegen eins, als der Mond bald wieder unterging, hatte man die Umschiffung der ganzen Insel und die geografische Bestimmung der Küste, die keine bedeutenden Einbuchtungen zeigte, beendet.
Die Hauptsache war, dass man nun wusste, wo sich der Punkt befand, bis auf Zehntelsekunden bestimmt, dessentwegen man hierher gekommen war: ziemlich mitten auf der Insel, etwas mehr nach Norden.
Was konnte das sein, was die beiden sich ergänzenden Hellseher jenes Sir Dalton dort erblickt hatten?
Nun, der morgende Tag würde es lehren, jetzt war jede Erwägung deswegen zwecklos.
Die Kaguangs hatte man noch häufig genug winseln, Tiger und Panther und kleineres Raubzeug brüllen hören, manchmal auch den Todes- oder doch Angstschrei eines harmlosen Säugetieres, wahrscheinlich einer Antilope. Jedenfalls musste diese Insel ziemlich stark mit Tieren bevölkert sein, die sonst auf Koralleneilanden niemals vorkommen. Auch das Geschnatter aus dem Schlafe aufgescheuchter Affen glaubte man gehört zu haben. Eben eine ganze Welt für sich, so klein sie auch sein und Ähnlichkeit mit dem normalen Indien haben mochte, mit dem Festland sowohl wie mit Ceylon.
Nur jenes schreckliche Gebrüll, aller Beschreibung spottend, hatte sich nicht wieder vernehmen lassen, und die fünf Männer hätten sich gern eingeredet, diese entsetzlichen Töne vorhin nur geträumt zu haben, hätte es ihnen nicht noch immer in den Ohren geklungen, bis ins Gehirn und Rückenmark schneidend.
Um ein Uhr also hatte man die ganze Insel umrudert, war zur Südküste zurückgekehrt. Hier wollte man die letzten fünf Stunden der Nacht schlafend verbringen, in gehöriger Entfernung von der Küste, und natürlich musste einer immer wachen.
»Es ist nicht nötig, dass die Wache abgelöst wird, und zu beraten, wer hiermit beginnen soll«, meinte der Graf, als Axel hierüber etwas äußerte. »Ich übernehme die ganze Wache.«
»Wie? Auch hier in Indien bedürfen Sie keines Schlafes?«
»Ja, weshalb soll ich denn hier in Indien eine Ausnahme machen?«
Wirklich, Axel hatte den Grafen noch immer niemals schlafen sehen. Des Nachts hingelegt hatte sich der Graf ja immer, Axel hatte doch selbst geschlafen, wo er also nicht kontrollieren konnte — aber deshalb den Grafen Lügen strafen, direkt behaupten, er habe ihn schlafen sehen, das durfte er als gerechter Mann nicht.
»Nun, wie Sie wollen. Und wenn Sie den Belawa noch einmal brüllen — — —«
Axel hatte den Teufel an die Wand gemalt.
Da wiederum dieses entsetzliche Geschrei, ein Miauen, auch einige Ähnlichkeit mit dem hässlichen Kreischen eines Pfauhahnes habend, aber auch wieder mit dem Zetergeschrei eines Kindes, vermischt mit dem Ächzen und Wimmern eines tödlich Verunglückten, der sich in seinen Schmerzen windet — kurz, das charakteristische Geschrei des Kaguans, nur in hundertster Verstärkung.
Schnell war es wieder verklungen.
Aber wieder hatte sich allen das Haar vor Entsetzen gesträubt.
»Was für ein Tier kann das nur sein?«, wurde dann scheu geflüstert.
»Der Belawa, der Geisterkönig!«, stöhnte der Minister.
Man widersprach ihm gar nicht mehr.
»Morgen werden wir es erfahren«, sagte der Graf, »und es ist doch gut, dass wir unsere Waffen mitgenommen haben.«
»Fremdling, willst du gegen einen Dämon der Hölle mit irdischen Waffen ankämpfen?«
Es war das letzte Wort in dieser Sache, der Minister erhielt keine Antwort und verlangte keine. Mit Ausnahme des Grafen legten sie sich an den Boden des schwankenden Fahrzeuges zum Schlafen nieder, je zwei zusammen. Aber ob sie wirklich schliefen, das war sehr die Frage.
Kaum war der neue Tag angebrochen, als man sich wieder der Insel näherte. Jetzt erst, im hellen Sonnenlichte, erkannte man die überaus üppige Vegetation. Neben dem Teakbaum herrschte der nicht minder mächtige Affenbrotbaum vor, der seine kopfgroßen Früchte zu Tausenden noch über das Wasser hing, und ebenso strotzten andere Bäume und dazwischen wucherndes Buschholz mit Früchten aller Art, wie sie im tropischen Indien überall gedeihen, die wir aber kaum dem Namen nach kennen, da sie nicht ausgeführt werden, wegen ihrer leichten Verwesbarkeit nach dem Abpflücken nicht verschickt werden können. Nur die Banane ist in letzter Zeit auch bei uns bekannter geworden, während wir schon den Pisang gar nicht kennen, nicht einmal die Brotfrucht, die in Indien die ausschließliche Nahrung von Millionen bildet.
Diese ungeheure Fruchtbarkeit wird zum Beispiel durch die Mohnpflanze charakterisiert, die ja auch bei uns gedeiht, aber in Deutschland kaum eine Höhe von einem Meter erreicht, während sie in Bengalen bis zu zwölf Metern emporschießt, die brennendrote Blüte entfaltet sich wie eine Sonnenrose, und so war es auch hier. Noch über die Wipfel der Bäume hinaus trieb der Mohn; die kopfgroßen Kapseln, die in dieser Nacht ihre letzte Reifezeit durchgemacht, sprangen unter der Wärme der sie küssenden Morgensonne mit einem Knall auf, der einem Pistolenschuss wenig nachgab, und die Samenkörner, bei uns so winzig klein, regneten wie Steinchen herab. Das ist dann der Mohnsamen, aus dem man Opium und Morphium gewinnt, während das bei uns nicht etwa gelingt. Oder es ist nur ein chemisches Experiment.
Dann auch einige Palmenarten, nur nicht die Kokospalme. Die fehlte hier gänzlich. Die Kokospalme braucht unbedingt salzhaltigen Sandboden, der hier trotz der Nähe des Meeres nicht vorhanden war.
Schnatternd floh eine Herde Affen davon, einer kleinen, in Indien überall eingebürgerten Art angehörend, und weitere Arten sollte man auch nicht zu sehen bekommen.
Doch es war schon genug, hier überhaupt Affen zu finden, von denen sich die 200 000 Maleatollen nichts träumen ließen.
Sonst waren jetzt keine Tiere zu erblicken. Mit Ausnahme von Insekten, nur solcher Arten, wie sie auch aus den Koralleninseln vorkamen, vorkommen mussten, denn ohne Insekten keine Befruchtung der Pflanzen.
Auffallend war das gänzliche Fehlen von Vögeln. Auf den Koralleninseln gab es in diesem Archipel nur Möwen, denen die Eingeborenen als unnützen Fischessern eifrigst nachstellten. Hier hätten sie einen ungestörten Brutplatz gehabt, aber Seevögel lieben eben keine Gegenden mit dichter Vegetation.
Noch bevor man gelandet war, hatte man beschlossen, das Boot nicht allein zurückzulassen. Es war besonders mit den Affen zu rechnen.
Sofort erbot sich der Mallah, als Wächter zurückzubleiben, noch etwas abseits der Küste vor Anker zu gehen, wobei der Anker allerdings durch einen größeren Stein ersetzt werden musste.
Ebenso schnell aber dachten die anderen daran, dass das nicht viel anders gewesen wäre, als wenn man den Bock zum Gärtner einsetzt. Mallah wäre sowieso nicht zu bewegen gewesen, diese Teufelsinsel zu betreten, und eine Nacht wäre er sicher nicht allein noch hier geblieben, er hatte schon heute Nacht durchaus zurückkehren wollen, während unsere Freunde entschlossen waren, das hier obwaltende Geheimnis zu lösen, mochte darüber auch eine Woche vergehen. Der Eingeborene hätte sie ganz einfach im Stiche gelassen.
Die Frage war schnell gelöst, Sam erbot sich freiwillig, im Boote zurückzubleiben.
Bei einem Teakbaum wurde angelegt. Da zeigte sich, dass sich unter dessen hochstehenden Wurzeln hervor ein Bächlein ins Meer ergoss. So war schon jetzt die Wasserfrage gelöst.
Nur ihre Waffen wollten die drei mitnehmen. Gab es hier Wasser, dann würde man auch an anderer Stelle welches finden, man brauchte deshalb nicht den Bach zu verfolgen, und die vielen Tiere mussten sich doch auch tränken.
Kapitän Morphin wollte als erster an Land springen, hatte schon zu einer Taufrede ausgeholt.
»Morphia, sollst du heißen, du jungfräuliche Ins...«
Da wurde er mitten im Wort und Satz von Axel am Hosenbunde zurückgeholt.
»Halt! Diese Ehre gehört dem Grafen.«
»Mir?«
»Sie haben uns hierher geführt...«
»Ich verzichte«, entgegnete der Graf mit trübem Lächeln, wie oftmals bei solchen Gelegenheiten.
»Seien Sie der erste, geben Sie dieser Insel einen Namen.«
»Dann habe ich ein ebenso gutes Recht dazu«, versetzte Morphium, jetzt wieder den aussteigenden Axel am Hosenbunde haltend. »Eigentlich bin ich doch derjenige, der diese ganze Weltreise erst eingeleitet hat, und ihr seid mir überhaupt noch das Passagiergeld schuldig, von dem Verlust meines ganzen Pipins gar nicht zu sprechen.«
Axel erkannte diese Gleichberechtigung an, dann sollte die Sache ausgelost werden. Morphin schlug einen Boxgang vor, ganz unbegreiflicherweise, begnügte sich dann aber mit ›links oder rechts‹, welche Faust das Steinchen hielt.
Axel verbarg den Stein, Morphin riet — und hatte die Ehre verloren.
So betrat Axel als erster diese jungfräuliche Insel, unentdeckt in einem noch ganz besonderen Sinne, und man merkte es ihm an, wie ernst und feierlich es dem jungen Manne zumute war.
»Marianna sollst du heißen:« sagte er eben mit feierlichem Ernste, sonst nichts weiter.
War es der Name seiner Mutter, einer Schwester, wer hieß sonst so?
Man erfuhr es nicht. Aber es wirkte. Die Züge, die sonst immer eine trotzige Lebensfreudigkeit ausdrückten, dem ganzen Charakter dieses Mannes entsprechend, hatten sich einmal etwas mit Schwermut verdüstert.
Doch mochte es nur auf den Grafen wirken, nicht auf Kapitän Morphin.
»Marianna?«, meinte dieser, als er an Land nachstieg. »Das ist nix, ich hätte diese Insel doch lieber Morphia getauft, nicht etwa meines Namens wegen, sondern weil eben Morphium ein...«
»Du bist und bleibst ein Hansnarr!«, wurde er schroff unterbrochen, und diese Angelegenheit war erledigt.
Für den Leser aber sei noch bemerkt, wenn es auch nicht mit zu unserer Erzählung gehört, dass zehn Jahre später, als der australische Archipel der Ladroneninseln von Spanien annektiert wurde, dieser den Gesamtnamen ›Marianen‹ erhielt, zu Ehren der spanischen Königin, und diese war eine geborene deutsche Prinzessin. Und jetzt sind die Marianen oder Marianas, wie es die Spanier nun einmal geschrieben haben, bekanntlich deutscher Besitz.
Auch der Graf war an Land gestiegen, sie sahen noch, wie das Boot sich wieder von der Küste entfernte, und sie drangen in den Urwald ein.
Ein gar mühsamer Weg, die Schlingpflanzen oftmals nicht zu durchdringen. Da versagten auch die Schiffsmesser, mit Schneiden allein war nichts auszurichten. Sie hätten Äxte mitnehmen müssen, um sich einen Weg zu hauen. Aber wer hätte daran gedacht, hier solch eine Wildnis zu finden!
Ohne Axels Hirschfänger wären sie gar nicht weitergekommen, sie hätten sich erst Wildbahnen suchen müssen, die aber auch immer mehr fürs Kriechen eingerichtet sind. Doch des Depeschenreiters haarscharfer, schwertähnlicher Hirschfänger war vielleicht noch besser als eine Axt, mit Leichtigkeit zerhieb er das Gewirr von Schlingpflanzen und schlug selbst ziemlich dicke Buschäste glatt ab, ohne dass Axel Sorge um seinen geliebten Stahl hatte.
Nur hoch oben in den Zweigen fliehende Affen und summende Insekten, sonst nichts weiter. Dann einmal ein schlafender, kopfüberhängender Kaguang, den man ganz zufällig entdeckte. Sonst hatten sich diese ängstlichen Tiere, die mit ihren gewaltigen Krallen nichts anzufangen wissen, bessere Verstecke für den Tag ausgewählt, und andere Tagestiere zogen sich schon vorher rechtzeitig vor den fremden Eindringlingen zurück.
Jetzt war auch kein Tiger und kein anderes Raubtier zu fürchten, man hätte es auch bei Nacht nicht zu tun brauchen. Aber es hat doch etwas auf sich, wenn man solch ein Tier brüllen hört.
Und der Belawa oder wie das Ungetüm nun sonst hieß, das über solch eine grässliche Stimme verfügte? Von dem war ebenfalls nichts zu sehen. Jeder war wohl auf der Hut, aber man erging sich nicht lange in zwecklosen Erwägungen, hielt lieber das Pulver auf der Pfanne trocken.
Das schier undurchdringliche Unterholz trat etwas zurück, man konnte schneller vordringen, es ging etwas bergan, zwischen vielen Felsblöcken hindurch.
Dort wand sich auch wieder der Bach hervor, und an einer etwas sumpfigen Stelle sah man viele Spuren, von Hirschen und Antilopen stammend, auch die eines Wildschweines, dazwischen die von größeren Raubtieren, offenbar Tiger und Panther.
»Kann denn dieses Gebiet von zehn Quadratkilometern so viele Tiger ernähren?«, meinte Kapitän Morphin.
»Nun, da kommt es nur darauf an, dass es so viel Wild ernähren kann, um den Hunger der Raubtiere zu stillen, und zehn Quadratkilometer von solch üppiger Vegetation können schon stattliche Herden beherbergen. Außerdem braucht es von jeder Sorte nur eine einzige Raubtierfamilie zu geben, deren Spuren wir hier erblicken, sie sind nur hin und her gelaufen, so wie alle die zahlreichen Hasenfährten im Schnee, die man manchmal erblickt und nur von einem einzigen Hasen herrühren können.
»Aber diese Raubtierfamilien müssen sich doch vermehren.«
»Nicht mehr, als es die Natur, als es der Umfang dieses Gebietes gestattet. Sonst tritt Krankheit ein, große Sterblichkeit, oder es werden überhaupt keine mehr geboren.«
Kapitän Morphin musste sich mit dieser Erklärung des Grafen wohl oder übel zufrieden geben.
Nach einer halben Stunde der mühseligsten Wanderung mussten sie sich wieder durch eine wahre Mauer von Schlingpflanzen schneiden und hauen, und als sie durch die geschaffene Öffnung schlüpften, da... wussten sie sofort, dass sie vor sich das hatten, weswegen sie hierher gekommen.
Es war eine weite Blöße im Urwald, die wegen der besonderen Bodenbeschaffenheit keinen Baumstand und kein Unterholz duldete, nicht einmal hohes Gras, nur kurzes Farnkraut wucherte überall, und in der Mitte dieser niemals zuwachsenden Blöße standen in einiger Entfernung voneinander zwei kolossale Männergestalten, mindestens 15 Meter hoch, der eine ein dementsprechendes Schwert noch höher hebend, während das des anderen mit dem ganzen Arm wohl abgebrochen war.
Dass die drei Freunde bei diesem unvermuteten Anblick nicht gleich Worte der Erklärung fanden, sondern ganz verdutzt, wenn nicht erschrocken dastanden, ist begreiflich. Lange dauerte dieses stumme Starren freilich nicht.
»Altindische Statuen!«
»Und dahinter erhebt sich ein kleiner Tempel, dessen Eingang sie bewachen.«
»Aber lebendig sind die nicht«, setzte Kapitän Morphium ganz überflüssigerweise noch hinzu.
Sie begaben sich hin. Die Statuen waren nicht aus grünem Stein, wie sie erst vermutet, sondern der dunkle Basaltstein, aus dem sie gemeißelt, hatte sich mit Moos und kleinen Flechten überzogen. Schlingpflanzen konnten hier eben nicht aufkommen, sonst wären sie ganz überwuchert gewesen.
Ja, die beiden altindischen Krieger, von denen nur der eine Arm und Schwert verloren hatte, welche daneben lagen, bewachten den Zugang zu einem kleinen Tempel, nur acht Meter hoch, dessen Mauern etwas schräg nach oben gingen, sodass das Bauwerk einer unvollendeten Pyramide gleich — eine Bauform, die man ja auch bei ägyptischen und anderen Tempeln findet. Sie bietet jedenfalls den festesten Widerstand.
Sie traten ein. Es war ein nackter Raum von etwa zwölf Meter Länge und acht Meter Breite, der weiter nichts enthielt als in der Mitte einen großen, viereckigen, altarähnlichen Stein.
Licht drang nur durch die ziemlich kleine Tür ein, genügte aber vollkommen, verbreitete fast Tageshelligkeit. Sonst zeigten die kolossal dicken Mauern, hier innen nicht mehr abgeschrägt, so wenig eine Öffnung wie die Decke.
»Wir sind am Ziel«, sagte Axel.
»Woher wollen Sie denn das wissen?«
»Ja, was anderes sollten wir hier finden? Jener Sir Dalton scheint es nur auf solche altertümliche Bauwerke abgesehen zu haben.«
»Wenigstens meistenteils. Wir haben ja auch schon anderes gefunden. Erst wollen wir doch einmal eine geografische Ortsbestimmung machen, dann haben wir Gewissheit.«
Sie verließen den Raum wieder, machten draußen auf der Waldblöße eine geografische Ortsbestimmung.
Ja, von dem Punkte, wo sie jetzt standen, befand sich der bis zur geografischen Zehntelsekunde angegebene Punkt dreizehn Meter entfernt, und machten sie nach der betreffenden Kompassrichtung dreizehn große Meterschritte, so standen sie genau vor dem Altar, noch genauer hätten sie einen Fuß darauf setzen können.
»In oder unter diesem Steine befindet sich das Geheim...«
Da gellte wieder das entsetzliche Geschrei und Gekreisch, jetzt aber war wie ein heiseres Gelächter dabei, so wie es die Hyäne ausstößt, und als sie entsetzt nach dem Eingange blickten, sahen sie dort im hellen Lichte ein ungeheueres Etwas stehen... im nächsten Augenblick ein polternder Fall, und das Licht war mit der Erscheinung verschwunden, die drei befanden sich in der schwärzesten Finsternis.
Das alles war so schnell gegangen, dass auch der Schnellste von ihnen noch nicht zum Sprunge hatte ansetzen können.
Dann prallten der Graf und Axel dort zusammen, wo vorhin noch eine Öffnung gewesen war, nachträglich stießen noch Kapitän Morphins Fäuste wuchtig gegen beider Rücken.
»Verflucht, das Scheusal hat uns eingeschlossen!«, schrie Axel.
Ja, das war ja klar genug, und der erste Anlauf mit aller Kraftanstrengung nützte nichts, der Widerstand gab nicht nach.
Dafür aber erscholl draußen noch einmal das grässliche Gelächter, jetzt freilich nur noch ganz dumpf klingend.
»Ruhe«, ließ sich dann der Graf vernehmen, »keine unnützen Kraftanstrengungen verschwenden. Was für ein Geschöpf war das? Hat jemand etwas deutlich unterscheiden können?«
»Es war der Teufel«, sagte zunächst Kapitän Morphin.
»Mir kam es wie ein riesiger Affe vor — wie ein Mensch, der aber ganz mit dunklen Haaren bedeckt war«, erklärte Axel.
Dem musste auch Morphin beistimmen, während der Graf nur noch im letzten Verschwinden einen Schatten gesehen hatte.
»Aber ganz riesenhaft«, setzte Axel noch hinzu, »und ich sah noch in dem weit aufgerissenen Rachen, aus dem das entsetzliche Lachen kam, ein furchtbares Gebiss.«
»Und dann hatte er Hörner auf dem Kopfe«, ergänzte Morphin.
»Oder das kann auch buschiges Haar gewesen sein. Mir kam es so vor, als hätte das Scheusal eine richtige Haarmähne.«
»War es nackt?«
»Jedenfalls. Ich sah nur lauter Haare.«
»Ich kalkuliere, wir werden einen hier verwilderten Menschen vor uns haben.«
»Oder einen riesenhaften Affen, von einer Spezies, die sonst auf der Erde nicht verkommt, wenigstens nicht bekannt ist.«
Hierzu sei bemerkt, dass der Gorilla damals noch gar nicht entdeckt war.
Mit diesem afrikanischen Gorilla ist übrigens auch so eine eigentümliche Geschichte verbunden, welche beweist, dass hinter dem sogenannten ›Volksaberglauben‹ manchmal etwas viel Reelleres steckt als hinter der ganzen Wissenschaft.
Schon der Karthager Hanno, der als Erster Afrika umschiffte, ungefähr 1000 vor Christi, mit sechzig fünfzigrudrigen Galeeren, auf denen sich 30 000 Menschen befanden, die zum Teil als Kolonisten gelandet werden sollten, woraus dann aber nichts wurde — trotzdem, man bedenke, was für ein gewaltiges Unternehmen schon vor 3000 Jahren! Fürwahr, wir brauchen nicht besonders stolz zu sein — dieser Hanno also berichtet in seinem uns erhalten gebliebenen Werke »Periplus« (Umschiffung) von einem riesigen Menschenaffen, von dem ihm die Eingeborenen an der Westküste Afrikas erzählten, und den er selbst einmal gesehen hat, seine Erscheinung sehr gut beschreibend.
Natürlich Fabel. Und diese ›Fabel‹ — man höre und staune! — ist fast 3000 Jahre lang als solche bestehen geblieben! Im 19. Jahrhundert hatten Portugiesen, Spanier, Engländer und Franzosen dort, wo der Gorilla heute noch zahlreich vorkommt, schon recht ansehnliche Faktoreien, alle Eingeborenen berichteten von einem Affenmenschen, der in den Urwäldern sein Wesen treibt, sich auf Bäumen Nester zum Schlafen baut — nein, so etwas gibt es nicht, es musste eine Fabel sein!
Bis im Jahre 1847 der Missionar Godfrede Savage am Gabunflusse einen Gorilla schoss und Fell und Gerippe nach Frankreich brachte. Nur der Schädel war verloren gegangen. das Skelett auch auseinandergefallen, das Fell stark von Insekten zerfressen.
Und was erntete dieser Missionar für seine Entdeckung?
Die Akademie der Wissenschaft erklärte ihn für einen Schwindler, für einen Betrüger!
Er sollte dieses große Fell zusammengeflickt haben, das Skelett war aus anderen Knochen zusammengestellt.
Die Sache war nämlich die, dass man als den menschenähnlichsten Affen damals nur den OrangUtan kannte, und der hat wie der Mensch zwölf Rippen. Aber der Gorilla, dem Menschen im Körperbau noch viel ähnlicher, hat dreizehn Rippen. Dass dieses zusammengeworfene Skelett hier nun dreizehn Rippen haben sollte, das ging den Herren der Wissenschaft über ihr ›Verstehstemich‹. Demnach musste der Missionar ein Schwindler sein, hatte, um von sich reden zu machen, eine ungeheuerliche Lüge in die Welt gesetzt, auf der bis zum alten Hanno zurückreichenden Fabel der Eingeborenen basierend.
Dieser Skandal dauerte allerdings nicht lange. Jetzt wurde dem Waldmenschen energischer zu Leibe gerückt, andere Exemplare wurden geschossen, ein Gorilla kam sogar lebend nach Paris, im Jahre 1849.
Das Aufsehen, das dieser Menschenaffe hervorrief, war so groß — dann kam auch noch die Revolution hinzu — dass man ganz vergaß, die Ehre des verleumdeten Missionars wiederherzustellen. Erlebt hat er es zwar nicht mehr. — — — — —
Unsere drei Freunde hier dachten jetzt nicht an des Karthagers Hanno Berichte, obgleich schon erwogen wurde. ob es nicht doch vielleicht ein riesenhafter Affe sein könne, von dem die Welt nur noch nichts erfahren hatte.
»Nein, es wird ein verwilderter Mensch sein, der noch weiß, wie die Tür, die wir gar nicht sahen, zuzuschlagen ist, einen Affen halte ich zu so etwas nicht für fähig«, entschied dann der Graf. »Ging das Gelächter wirklich von ihm aus?«
»Gewiss, es kam aus seinem geöffneten Rachen.«
»Dann haben wir es erst recht mit einem Menschen zu tun.«
»Aber eigentlich war es doch ganz das Geschrei, wie wir es schon zweimal in der Nacht hörten, ganz ähnlich dem der Kaguangs, nur viel, viel lauter, und dass sich diesmal noch ein Lachen beimengte.«
»Dies bestätigt immer mehr meine Ansicht, dass wir es mit dem verwilderten Menschen zu tun haben, der in der Einsamkeit die Sprache verloren hat. Nun ist der gewöhnlichste Laut, den er hier hört, das klägliche Geschrei der Kaguangs, das versucht er nachzumachen, mit der heimlichen Freude des Bewusstseins, doch noch eine Stimme zu besitzen, in der Nachahmung dieses Geschreis hat er die größte Fertigkeit erreicht, nur hat er einen ganz anderen Brustkasten und eine andere Kehle als solch ein doch nur kleiner Kaguang, und dann ist ihm auch noch das Lachen geblieben.«
»Ganz meine Ansicht.« bestätigte der Graf. »Und könnte dieser verwilderte Mensch nicht vielleicht den Anlass zur Fabel vom Belawa gegeben haben?«
»Hm, aber diese Fabel ist wohl schon ganz uralt.«
»Nun, vielleicht haust hier eine ganze Familie solcher Affenmenschen, die den Kaguang nachahmen, hat schon immer hier gehaust.«
»Na, meine Herren«, ließ sich jetzt auch wieder einmal Kapitän Morphium vernehmen, »denken Sie etwa, dass solche philosophische Spekulationen uns diese Mausefalle wieder öffnen?«
Er hatte recht. Hinwiederum zeigte diese Unterhaltung, dass die beiden anderen die Situation durchaus nicht tragisch nahmen.
Sie versuchten, das Hindernis zu beseitigen. Offenbar war es eine massive Steinplatte von beträchtlicher Stärke. Aber da waren alle Kraftanstrengungen vergebens. Die Platte musste in Falzen stecken. sonst hätte sie sich doch umkippen lassen müssen.
»Oder der Belawa, wie wir den Kerl einmal nennen wollen, stemmt sich draußen davor.«
»Das kann er doch nicht immer machen.«
»Ja, und das letzte kreischende Lachen klang gerade, als ob er sich schon entferne. Er muss seiner Sache recht sicher sein, dass wir hier nicht wieder heraus können.«
»Benutzen wir unsere unfreiwillige Muße doch gleich, um den Altar zu untersuchen, weswegen wir ja nur hierher gekommen sind.«
»Ja, wenn es nur nicht so stockfinster wäre.«
»Nicht für mich. Ich kann recht gut sehen.«
»Ja, Sie. Na, dann gehen Sie an eine Untersuchung!«
Sie begaben sich nach dem Altar zurück. Der Graf mochte recht gut sehen, aber das hatte für ihn ebenso wenig Zweck. Der mächtige Steinblock wollte sich durch die vereinigte Kraft der drei Männer nicht von der Stelle bewegen, sich nicht einmal rütteln lassen. Entweder war er mit dem Steinboden verwachsen oder er war eben viel zu schwer.
Auch einen Mechanismus konnte der Graf nicht finden, das sollte aber von anderer Seite geschehen.
»Hier sind ein paar kleine Vertiefungen«, sagte Morphium.
Zuerst tastete der Graf so daran herum, ohne etwas zu erreichen. Plötzlich flammte es in seiner Hand auf, er hielt eine kleine Laterne, aus der ein Blendstrahl kam.
»Hei, was ist denn das?«
»Eine Taschenlampe, die ich immer bei mir führe.«
»Ja, wie haben sie denn die entzündet.'«
»Auf besondere Weise, die ich Ihnen nicht weiter erklären kann.«
Ja, wie sollte der Graf diesen Kindern ihrer Zeit auch eine magnetelektrische Zündung erklären, für die er selbst noch nicht einmal einen Namen hatte!
»Und da lassen Sie uns hier so lange im Finstern stehen?«
»Wir müssen das Licht für die nötigsten Fälle aufsparen, der Spiritus reicht nur für wenige Stunden. Ich hätte sie noch nicht angebrannt, hoffte ich nicht, dass es hier einen unterirdischen Gang gibt, der uns aus dieser Mausefalle auf anderem Wege wieder hinausbringt, und das ist für uns doch jetzt das Wichtigste.«
Unten an dem Stein befanden sich kleine Locher, und wirklich, der hineingesteckte Finger fand in einigen, nicht in allen, einen nachgebenden Widerstand, es war als ob eine Feder zurückwiche.
Wohl eine halbe Stunde probierte der Graf in allen möglichen Kombinationen, sicher aber ganz folgerichtig dabei vorgehend, wobei die beiden anderen an dem Steine immer rütteln mussten — bis dieser mit einem Male von ganz allein eine starke Drehung nach der Seite machte.
Eine Öffnung zeigte sich, in die eine kleine Steintreppe hinabführte. Ein sehr modriger Geruch schlug ihnen entgegen, aber atembar war die Luft dennoch, und als die an Axels Lasso hinabgelassene Lampe nicht verlöschte, stiegen sie hinunter.
Nur wenige Meter tief, dann befanden sie sich in einem engen, ausgemauerten Raume, in dem wiederum nichts weiter als ein Steinblock stand. Bald aber erkannte man schon durch die Leichtigkeit, mit der er sich verrücken ließ, dass er hohl sein musste. Oben lag nur eine eingefalzte Steinplatte darauf.
Sie konnte ohne Weiteres abgeschoben werden — in dem Hohlraum kauerte eine kleine Gestalt — ein mumifizierter Affe, einer von der hier gewöhnlichen Art.
Nichts weiter. Kein Lappen mehr, kein Staub, der verraten hätte, dass ein solcher zerfallen wäre.
»Es handelt sich hier jedenfalls«, nahm der Graf in etwas schulmeisterlichem Tone das Wort, während er das Blendlicht auf den Hautsack mit einem Gerippe fallen ließ, »um einen heilig gehaltenen Affen, wie ja auch die jetzigen Inder die Affen wenigstens noch als unantastbar betrachten. Damals aber wurde der Affe sogar für eine Gottheit gehalten, so war es sicher auch hier, ein Affe wurde als Gottheit selbst angebetet, er hatte hier seinen eigenen Tempel...«
»Zum Teufel noch einmal!«, fiel Morphium dem Erklärer ins Wort. »Sind wir denn wegen einer vertrockneten Affenleiche hierher gekommen?! Ist denn nicht wenigstens in dem Felle noch etwas Besonderes drin?«
Der Graf fasste die Mumie ohne Scheu an, dabei ging sofort die Naht auf — nichts weiter als zusammenfallende Knochen.
»Löschen Sie Ihr Licht aus, löschen Sie Ihr Licht aus!«, riet Morphium grimmig. »Geben Sie den Spiritus lieber mir zu saufen.«
»Ja, Graf«, sagte auch Axel, »da sind wir wieder einmal hereingefallen mit diesen seherischen Bestimmungen.«
»Wieder einmal? Haben wir nicht schon immer Interessantes gefunden? Mit Ausnahme der Krateröffnung, die offenbar schon ausgenommen war. Aber der Fund in Karthago, die Süßwasserquelle mitten im Meer, der Götze in der libyschen Wüste, dann die Bombe mit der Geheimschrift, die uns schon auch noch etwas höchst Interessantes finden lassen wird. Und ist das nicht ein gar wertvoller Fund, dieser Affe hier, der als Gott in einem eigenen Tempel angebetet wurde? Überhaupt schon diese ganze Insel hier! Ist das alles nicht wert, aufgesucht zu werden? Ja freilich, wenn Sie immer an Gold und Edelsteine denken!«
»Na ja, Sie mögen recht haben«, gab Axel zu, »aber... das ist mit solchen Altertümern Geschmackssache. Mir wäre lieber, wir hätten hier einen Ausgang aus diesem vermaledeiten Loche gefunden.«
Von einem solchen war hier unten nichts zu bemerken, als sie die nackten Wände auch ableuchteten.
Es konnte ja sein, dass auch hier eine geheime Tür vorhanden war, aber sicherer war doch die Sache, man versuchte oben die vorhandene Tür zu entfernen, als sich hier mit Tasten und Drücken aufzuhalten.
So begaben sie sich wieder nach oben, taten ihr Möglichstes, die Steinplatte zu beseitigen — alles vergebens.
Sie zeigte mit der Öffnung auch nicht die geringste Fuge, in die man hätte Schießpulver streuen können, um es mit einer Explosion zu versuchen.
Hierbei wäre aber auch zu überlegen gewesen, dass das Pulver nur den Sauerstoff des Innenraumes verzehrt hätte, auch noch andere schädliche Gase erzeugend. — — — —
Wir überspringen die nächsten 24 Stunden.
Sie hatten alles getan, was Menschen tun können, um sich aus solch einer Lage zu befreien.
Alles, alles war vergeblich gewesen. Keine körperliche Kraft und kein geistiger Scharfsinn hatten ein Resultat gezeitigt.
Das einzige Glück im Unglück war, dass die Luft atembar blieb. Der verbrauchte Sauerstoff musste sich durch außen wieder ersetzen, die ausgeatmete Kohlensäure entweichen können. Aber dazu genügt schon eine einigermaßen poröse Wand, mag sie sonst auch noch so dick sein, die kleinsten Risse genügen. Sonst müssten wir in unseren Zimmern ja auch sehr bald ersticken, während schließlich niemals ein Fenster geöffnet zu werden braucht.
Es mochte also auch hier solche Spalten geben — aber zur Befreiung der Gefangenen kamen sie nicht in Betracht.
Der Belawa hatte sich nicht wieder durch sein kreischendes Lachen oder Winseln bemerkbar gemacht.
»Wird uns Sam denn nicht zu Hilfe kommen?«
Draußen war schon die Nacht angebrochen, als Kapitän Morphin diese Frage stellte.
Er bekam die einzige richtige Erklärung.
Wann die drei zurück sein wollten, darüber hatten sie nichts ausgemacht.
Waren sie aber nun bis zum Anbruch der Nacht noch nicht beim Boote wieder eingetroffen, so konnte man von Sam auch nicht verlangen, dass er in der Nacht die Spur seiner Gefährten verfolgte, so deutlich diese hinterlassen worden. Dann ließ er sicher auch noch diese Nacht vergehen, um sich erst am Morgen über das Schicksal seiner Genossen zu vergewissern.
»Wir müssen mindestens bis morgen früh warten, vor halb sieben kann er nicht hier sein.«
»Wenn er aber nun selbst von dem Ungeheuer oder von einem anderen Raubtiere überfallen worden ist, oder wenn der feige Eingeborene...«
»Keine Erwägungen, keine Erwägungen! Zunächst müssen wir bis morgen früh warten, dann erst dürfen wir solche Erwägungen anstellen.«
Axel und Morphin legten sich zum Schlafen nieder — ob hungernd oder durstend oder nicht, darüber äußerten sie sich nicht.
Ehe sie einschliefen, hörten sie den Grafen noch lange herumtasten, er gab den Versuch noch nicht auf, er kämpfte, solange er kämpfen konnte, und hätten sie die ganze Nacht gewacht, so hätten sie den Grafen auch die ganze Nacht sich so herumbewegen hören können.
Er bewies einmal, dass er wenigstens für lange Zeit über jede Müdigkeit erhaben war.
Axel erwachte. Es herrschte Totenstille.
»Graf, schlafen Sie?«
»Nein«, erklang es dumpf zurück. »Ich bin unten in dem Raume, sehen Sie sich vor, dass Sie nicht hinabstürzen — wenn ich auch unsere drei Gewehre über die Öffnung gelegt habe.«
»Was machen Sie dort unten?«
»Nach einer geheimen Tür suchen.«
»Nichts gefunden?«
»Gar nichts.«
»Welche Zeit ist es?«
»Einen Augenblick... zehn Minuten nach fünf Uhr.«
Dann ging in einer Stunde die Sonne auf, in anderthalb Stunden, spätestens in zwei Stunden musste es sich entscheiden, ob Sam kommen würde oder nicht.
Die zwei Stunden verstrichen, eine dritte — da musste man die Hoffnung aufgeben, dass Sam noch kommen würde.
Wäre er fähig gewesen, hierher zu kommen, so wäre er unbedingt schon hier! Da gab es nun gar keinen Zweifel.
Drei Morgenstunden ließ er nicht noch vergehen, ohne seine Gefährten, welche die ganze Nacht ausgeblieben waren, aufzusuchen, und den durch den Wald gehauenen Weg konnte ja selbst ein Blinder verfolgen.
Weswegen kam er nicht? Hatte der feige Mallah gesiegt und war mit dem Boote abgegangen, auch Sam mitnehmend? An einen schnöden Verrat war natürlich gar nicht zu denken.
Waren sie Raubtieren zum Opfer gefallen? Dem Belawa?
Es hatte gar keinen Zweck, sich da in Vermutungen zu ergehen. Auf Sam durften sie jetzt nicht mehr rechnen, das war die Hauptsache.
»Wir müssen uns durch eigene Kraft befreien, wir müssen!!«
Ja, aber wie? Niemand konnte sagen, ob die Steinplatte von oben herabgefallen war oder sich von der Seite vorgeschoben hatte, das war viel zu schnell gegangen, und das war auch ganz gleichgültig.
Sie ließ sich nach keiner Richtung bewegen.
Ein meißelähnliches Werkzeug war nicht vorhanden, ein Meißel konnte durch nichts ersetzt werden. Als solchen ein Messer oder den Hirschfänger zu benutzen, daran war nicht zu denken.
Ja, wenn viele Tropfen zuletzt einen Stein aushöhlen, so musste man sich auch mit einem Messer hier durchkratzen können, aber es wäre ein fast kindisches Unternehmen gewesen. Ehe das Loch nur so tief war, um es als Sprengloch benutzen zu können, wären sie alle schon verhungert gewesen, und das Verdursten ging noch schneller. Sie hatten ja weder Proviant noch Wasser mitgenommen.
»Und doch, es bleibt uns nichts anderes übrig, als solch ein Sprengloch zu bohren, zu kratzen!«, sagte der Graf energisch.
»Ja, Sie freilich können das Resultat erleben«, meinte Axel mit grimmigem Spott. »Sie sind ja unabhängig von Speise und Trank, Sie brauchen nicht einmal frische Luft, halten einfach einige Jahre den Atem an.«
»Wohl — sollen wir etwa als feige Schwächlinge die Hände in den Schoß legen? Oder etwa gar jammern?«
»Sie haben recht, Graf. Es wird gegen das Schicksal angekämpft, solange es noch etwas zu kämpfen gibt. Frisch, Morphium, sei kein Waschlappen — das Messer genommen und losgekratzt — ich werde dich anleiten, wie du immer zu kratzen hast, und dir von Zeit zu Zeit in die Hände spucken!«
Seinen Humor hatte Axel also noch nicht verloren. Und es wurde auch Ernst daraus.
Man fing an zu meißeln. Als Hammer diente ein Gewehr, als großer Hammer, den der Graf schwang. Nur er war hierzu befähigt. Ein anderer musste ziemlich tief unten an der Steinplatte ein Messer ansetzen, der Graf holte aus und schlug mit dem Kolben oben auf den Griff. Das musste also im Dunkeln geschehen, und da war also nur der im Finstern sehen könnende Graf hierzu befähigt, ein anderer hätte doch niemals den Messergriff getroffen.
Aber obgleich der Graf gar nicht so stark zuschlug, nur desto schneller, war das Messer doch schon nach den ersten Schlägen abgebrochen.
»Mein Hirschfänger muss es sein, habe es mir gleich gedacht«, sagte Axel.
»Wird der lange Stahl nicht erst recht abbrechen?«
»Wenn er es tut, oder wenn er auch nur die kleinste Scharte bekommt, dann werde ich nicht eher rasten und ruhen — und ich hoffe noch die Gelegenheit dazu zu haben — als bis ich den arabischen Juden, der mir diese Toledoklinge verkaufte, aufgehangen habe.«
Ja, der Hirschfänger vertrug trotz seiner Länge die schwersten Kolbenschläge. Ob er keine Scharte bekommen hatte, das konnte erst später geprüft werden — und hoffentlich hatte man die Gelegenheit dazu. So sah es freilich vorläufig ganz und gar nicht aus.
Nach zwei Stunden war aus dem eisenharten Basalt so viel ausgehöhlt, dass man noch nicht ganz die Fingerkuppe in das Löchelchen legen konnte.
»Na, das fleckt ja«, sagte Axel ironisch, »da werden wir schon übers Jahr ein genügend tiefes Sprengloch ausgehöhlt haben. Los, Morphium, nun halte du mal den Meißel, mir tun die Pfoten weh.«
Aber Morphium wollte sich nicht rühren.
»Was, du fauler Schlingel willst nicht?!«
»Meine geehrten Herrschaften«, erklang es da mit heiserer, sogar etwas röchelnder Stimme aus der Finsternis. »Sie wissen doch, ich bin wahrhaftig kein Waschlappen — aber — ich bitte tausendmal um Entschuldigung — ich kann nicht mehr — in einer Viertelstunde können Sie meinen Leichnam als Rammwidder benutzen — und er wird starr wie ein Baumstamm sein — dermaßen ist er schon ausgetrocknet.«
So also erklang es aus der Finsternis mit röchelnder Stimme.
»Na«, konnte Axel noch immer lachen, »wenn du noch solch lange wohlgesetzte Reden halten kannst, dann wirst du wohl auch noch fähig sein, einmal den Meißel zu halten.«
»Nee, meine Herrschaften, nee — 's geht beim besten Willen nicht mehr — aber eine andere gute Idee ist mir eingefallen...«
»Eine rettende Idee?!«, horchten die beiden anderen auf, einmal die Arbeit ruhen lassend, was sonst nie geschah.
»Ja. Das ist das einzige Mittel, was uns noch retten kann. Graf, versuchen Sie's doch mal mit der Sympathie.«
»Was? Mit der Sympathie?«
»Ja — Sie können doch alles — Sie sind wirklich ein Hexenmeister — Sie haben doch der alten Hexe, der Fürstin Eudoxia, auch die Zähne wiedergegeben und die Runzeln weggezaubert — dann müssen Sie doch auch diese verdammte Tür wegzaubern können — hinauf oder hinunter oder zur Seite — probieren Sie's nur einmal mit der Sympathie — vielleicht ist die Tür doch empfänglich dafür — sprechen Sie beschwörend: Esau, öffne dich, Esau öffne dich...«
»Esau, öffne dich? Was für eine Beschwörungsformel soll denn das sein? Du meinst wohl den alten Samuel?«
»Nee, ich meine den alten Esau. So sagte doch auch immer der Räuber in dem Märchen aus Tausendundeiner Nacht — Esau, öffne dich, Esau öffne dich...«
»Ach so — Sesam, öffne dich! — aber doch nicht Esau.«
»Sesam oder Esau, das ist doch ganz egal — die Hauptsache ist, dass die vermaledeite Tür dadurch aufgeht — Sesam oder Esau, öffne dich! Sesam oder Esau, oder Samuel, öffne... hallooohhh.!!«
Da drang von unten plötzlich helles Licht ein, immer breiter ward der helle Spalt, die Türe ging zurück, nach oben, immer schneller, bis der ganze Eingang frei war.
Zuerst starrten die drei.
»Der Kerl hat mit seinem Geschwätze weiß Gott die Tür beschworen!«, flüsterte Axel, wirklich etwas scheu.
Denn Morphium hatte sich auch dazu so hingestellt gehabt, beschwörend die Hände ausgestreckt, ein dazugehörendes Gesicht aufgesetzt — und so stand er noch jetzt da, selbst seinen Augen nicht trauend.
Doch lange sollte dieses Starren und ungläubige Staunen nicht währen.
»Blut!«
»Ja, dort der grüne Pflanzenteppich, dicht vor dem Eingang, zeigte hier und da Blutflecke, und den ganzen Weg entlang, den die drei gekommen waren, führte eine Blutspur.
»Vorsicht, der Belawa!«
Doch mit diesem Rufe waren die drei auch schon hinausgesprungen, die Gewehre schussbereit, gleichzeitig von dem Gedanken beseelt, dass es jetzt die Hauptsache war, nicht etwa nochmals durch die sich herabsenkende Tür in der Mausefalle eingeschlossen zu werden.
Nichts zeigte sich.
»Still!«
Ja, das war ein Röcheln, über ihnen erklang es...
Und da, noch ehe sie den Blick nach oben richten konnten, kam es schon von dort herabgesaust — etwas Schwarzundweißes — eine menschliche Gestalt — und da lag er vor ihnen...

»Sam, um Gottes willen, Sam!!«
Ja, er war es, wie er bei der Bootsfahrt gekleidet gewesen, wie es der Neger in der Hitze liebte, nur mit einer weißen Hose, der Oberkörper nackt — aber dieser Oberkörper, der sonst wie schwarzer Samt glänzte, wie die weiße Hose ganz mit noch frischem Blut bedeckt.
Sie waren vor dem mit einem dumpfen Krachen Zusammengebrochenen niedergekniet, alle weitere Vorsicht außer Acht lassend, wenn sie auch die Gewehre schussbereit hielten, Axel seinen blitzenden Hirschfänger, dessen Spitze nicht die kleinste Scharte aufwies.
Die ganze Brust Sams war ein blutiger Fetzen, die Haut hing wirklich in langen Lappen herab, ohne sonst tiefere Wunden zu zeigen, wonach die Blutung auch nur eine geringe war, das Blut war zum Teil schon getrocknet, man erkannte Nägelmale, und dieselben zeigte auch der Hals, der in einer fürchterlichen Weise angeschwollen war.
Außerdem verriet die unnatürliche Lage seiner Beine, dass er beide gebrochen hatte — doch wohl erst durch den Sturz von dem mindestens zehn Meter hohen Dache, und zwar hatte er direkt über dem Eingange gestanden.
Leben war noch in ihm, aber die blutunterlaufnen Augen traten schrecklich weit aus den Höhlen hervor, mühsam rang, schnappte er nach Luft.
»Sam, Sam, wer hat dir denn das getan?«
Ein furchtbares Würgen, und dann endlich brachte er mühsam, röchelnd hervor, kaum vernehmlich:
»Der Belawa.«
Er hatte an einem Strick eine noch halbgefüllte Kokosnuss hängen, niemand der Halb- oder schon ganz Verschmachteten dachte daran, seinen Durst zu löschen, man verwendete das ganze Wasser, um dem Unglücklichen kühle Umschläge um den furchtbar geschwollenen Hals zu machen, schlucken konnte er gar nicht mehr, und dann war er imstande, seine Mitteilungen zu machen, mühsam genug, immer noch kaum verständlich.
Sam hatte richtig die Nacht noch abwarten wollen. Er hatte ja gar nicht anders handeln können.
Bei Sonnenaufgang hatte er sich auf den Weg gemacht, seine Gefährten, deren langes Ausbleiben er sich gar nicht erklären konnte, aufzusuchen. Dass diesen etwas zugestoßen war, das konnte er nicht glauben, wo dieser Wundermann von Graf dabei war, und vor dem Depeschenreiter hatte er eine nicht minder große Hochachtung als vor seinem Herrn. Diese drei Männer nahmen es mit der ganzen Welt auf!
Aber warum blieben sie so lange aus, ohne ihn erst noch davon zu benachrichtigen, dass dies der Fall sein müsse? Das war nun auch wieder ganz unerklärlich. Jedenfalls musste er ihnen jetzt doch nachgehen.
Aber so ohne Weiteres war Sam denn doch nicht gegangen, dazu war er zu schlau. Jawohl, dass der Herr Minister dann mit dem Boote abrückte!
Und da hatte der energische Schwarze gar keine weitere Einleitung zum Prozess gemacht, er hatte seinen schokoladenfarbenen Kollegen ganz einfach an Händen und Füßen gebunden.
Dann war er an Land gerudert, hatte sich dort einen größeren Stein gesucht, diesen an ein Seil gebunden, war wieder etwas hinausgerudert, hatte den Stein versenkt, so war das Boot verankert, und nun war Sam zurück ans Ufer geschwommen, oder er brauchte vielmehr nur zu waten, hatte sein Gewehr und für alle Fälle eine mit Wasser gefüllte Kokosnuss mitgenommen. Den ausgehauenen Weg hätte wirklich ein Blinder durch Tasten finden können. Da er selbst keine Schlingpflanzen mehr zu zerschneiden brauchte, hatte er den Weg in kaum einer Viertelstunde zurückgelegt.
Da, angesichts der zwei kolossalen Statuen, als er bei diesem Anblick etwas bestürzt vor der Waldblöße stand, war von dem letzten Baumriesen, unter dem er noch stand, plötzlich etwas Schweres auf ihn gefallen, er wurde von hinten umklammert, vor sich sah er zwei haarige, furchtbare Arme — — zwischen Sam und dem unsichtbaren Ungeheuer, das er ziemlich selbstverständlich für den Belawa hielt, entstand ein stummer Ringkampf.
Lange währte er nicht, vielleicht nur wenige Augenblicke — aber die hatten auch schon genügt, dass die mit schrecklichen Nägeln bewehrten menschlichen Tatzen ihm so furchtbar die nackte Brust zerkratzten, zerfleischten, und dann legten sich ihm diese Krallen um den Hals, um ihn zu ersticken...
Im letzten Augenblick hatte Sam sein Messer, das er hinten am Riemen in der Scheide gehabt, ziehen können, er hatte hinter sich einige Stiche gemacht... dann hatte ihn das Bewusstsein verlassen, er war zusammengebrochen.
Wie lange er so gelegen, wusste er nicht. Jetzt konnte es berechnet werden. Sechs Stunden lang.
Der furchtbare Schmerz an der zerfleischten Brust, mehr noch Atemnot hatte ihn zur Besinnung gebracht.
»Ich... fühlte... ich... musste... er... er... er... sticken...«
So erzählte er noch jetzt, zwischen jeder Silbe eine lange Pause machend, ringend, röchelnd, gurgelnd. Man suchte ihm so viel wie möglich zu Hilfe zu kommen, auch durch Worte.
Seine Gefährten noch erreichen, das war sein einziger Gedanke.
Neben ihm lag das behaarte Ungeheuer, mit aufgeschlitztem Leibe, tot. Dort hinten musste es liegen.
Sam betrachtete es nicht weiter, beschäftigte sich mehr mit sich selbst, kühlte die schmerzende Brust und den Hals mit Wasser, schleppte sich weiter, auf den Tempel zu, an dessen Tür von innen unausgesetzt ein Klopfen erscholl.
Das waren die meißelnden Gefangenen. Sam klopfte gegen die Steinplatte — seine Kraft war so geschwächt, dass er das innere Klopfen nicht übertönen konnte. Und er fühlte, dass es mit ihm bald vorbei war. Der Hals brauchte nur etwas mehr zu schwellen, dann musste er ersticken.
Was für eine Bewandtnis es mit dieser Steinplatte hatte, konnte man jetzt, da sie herabgelassen, von draußen sofort erkennen. Diese Angelegenheit sei in Kürze abgemacht.
Von dem Dache ging eine Art von Regenschutz aus, das heißt, überall ragte noch eine Steinplatte weit hervor. Das hatten die drei zuerst, als sie schnell in den Tempel eindrangen, ganz übersehen oder sich nichts weiter dabei gedacht. Es war eben eine besondere Bauart.
Nun war aber die Sache die, dass sich die mittlere Steinplatte, die sich direkt über dem Eingange befand, oben in steinernen Zapfen drehte. Sie war so gut ausbalanciert, dass sie sich mit Leichtigkeit nach unten und auch wieder nach oben drehen ließ. War sie aber einmal unten in einen Falz eingeschnappt, so konnte sie nicht wieder herausgebracht werden, wenigstens nicht von innen, auch nicht so einfach von außen, wenn man unten stand. Mit spielender Leichtigkeit aber konnte dies geschehen, wenn man oben auf dem Dache stand. Dann brauchte die steilstehende Platte nur umgekippt zu werden, ohne Kraftaufwand, dann senkte sie sich ganz von selbst nach hinten, und vorn ging sie in die Höhe.
Eine weitere Erklärung kann für so etwas nicht gegeben werden.
Jedenfalls hatte Sam, und jeder andere auch, sofort erkannt, dass sich das Beseitigen dieser Steinplatte nur von oben aus bewerkstelligen ließ. Er hatte sich um den Tempel herumgeschleppt, um nach einem auf das Dach führenden Aufstieg zu suchen, hatte richtig einen treppenförmigen Weg gefunden, war hinaufgekrochen.
Mit seiner letzten Kraft hatte er die Platte umgekippt. Gleich darauf befiel ihn ein Schwindel, eine Ohnmacht, er war vom Dache zu seinen Gefährten hinabgestürzt, dabei auch noch beide Beine brechend.
Dieses letzte Unglück hatte nichts mehr zu sagen. Seine Freunde sahen es kommen, und sie konnten es nicht aufhalten.
Kaum hatte der Unglückliche seinen Bericht beenden können.
»Ich glaubte — ihr — ihr wäret...«
Nur noch ein gurgelndes Röcheln entquoll dem zuckenden Munde, das ganze Gesicht verzerrte sich in der Atemnot, in der Sterbequal des Erstickens.
»Sam, Sam, du stirbst — und ohne dich wären wir verloren gewesen, du hast uns vom sicheren Tode gerettet!!«, rief Axel jammernd, des Sterbenden Hand ergreifend.
Da plötzlich verwandelten sich die eben noch verzerrten Gesichtszüge in ein glückliches Lächeln, noch ein starker Händedruck — und mit diesem glücklichen Lächeln entfloh dem schwarzen Körper eine unsterbliche Seele.
Axel war es auch, der ihm die Augen zudrückte.
»Wieder einer weniger von uns!«, murmelte der Graf.
»Ich rief den Samuel an — und er kam«, schluchzte der alte, weißhaarige Kapitän.
Mit finsterem Gesicht richtete sich Axel wieder auf, seine Finger prüften die blitzende Schneide des Hirschfängers.
»Der arabische Jude hat mich doch nicht mit der Toledoklinge betrogen — jetzt gilt es diesem Belawa — ach!«
Er entsann sich, dass Sam ihn ja schon getötet haben wollte — das hatte dieses ›ach‹ bedauert.
Sie brauchten nur wenige Schritte nach dem Baume zu gehen, dort sahen sie es selbst.
Ein riesenhafter, mehr als zwei Meter großer Mensch, herkulisch gebaut, ganz mit Haaren bedeckt — den Zügen nach, so vertiert diese auch waren, jedenfalls ein Maleatolle.
Sie sprachen nicht über ein vorliegendes Rätsel, ein solches war gar nicht vorhanden. Eben ein Maleatolle, der durch irgendeinen Zufall einmal hierher verschlagen worden, hier verwildert war, seinen Verstand verloren hatte.
Alles übrige hatte der Graf ja schon ausspekuliert, sicher ganz richtig.
»Begraben wir den Unglücklichen!«
Die weiche Erde war bald ausgeworfen, die Leiche hineingesenkt, der Graf war es, der auf den Hügel noch ein kleines Holzkreuz setzte.
»Sam?«
»Der soll ein Seemannsgrab in Salzwasser bekommen.«
Sie trugen ihn den Weg zurück nach der Küste.
Ja, dort lag das Boot, ein Mensch darin nicht zu sehen — weil dieser am Boden des Fahrzeuges lag.
Axel watete hin, holte es herbei. Der Minister war ganz teilnahmslos, auch als er entfesselt war, als er den Toten erblickte und sein Ende erfuhr.
»So oder so«, sagte er in seiner Sprache, nichts weiter, und man fragte ihn nicht, was er denn hiermit meine.
In dem Boote befanden sich einige Kokosfaserdecken, in eine solche wurde Sams Leiche mit einigen gewichtigen Steinen eingewickelt, das Paket festgeschnürt und weiter draußen an einer tieferen Stelle versenkt.
Die Mützen ab zum stummem Gebet, und auch diese Angelegenheit war erledigt.
»Wohin nun?«
»Die Nacht abwarten und nach Maleatoll zurück.«
»Lasst euch nicht auslachen«, ließ sich der Minister wieder einmal vernehmen. Er machte einen äußerst niedergeschlagenen Eindruck.
»Warum?«
»Zwei Nächte durften wir nicht ausbleiben.«
»Ja, was bleibt uns sonst übrig?«
»Wir werden vernommen — man weiß ganz sicher schon, dass wir das heilige Wasser entweiht haben. Ich habe es heute Nacht geträumt, dass wir alle zusammen gehenkt werden, und meine Träume gehen immer in Erfüllung.«
Auf diese Wahrträumerei wollte man sich gar nicht weiter einlassen.
»Dann müssen wir uns eben auf andere Weise durchschlagen.«
»Ja, das denke ich auch«, meinte der Maleatolle.
»Das meinst du auch?«
»Ja, ich mag nicht gehangen werden.«
»Du hältst es für möglich, durch die ganzen Inselchen durchzukommen?«
»Nicht den gewöhnlichen Weg, auch nicht bei Nacht. Denn wenn wir auch in einer einzigen Nacht die Ausfahrt erreichen könnten, so wird diese doch zu streng bewacht, auch in der Nacht.«
»Welchen Weg meinst du sonst?«
»Da wir das heilige Wasser nun einmal entweiht haben, kommt es ja auch nicht mehr darauf an. Jetzt fahren wir nach Norden hinauf, tragen das leichte Boot durch den Dschungel über den Landring hinweg, das ist höchstens zwei Stunden, das lange Messer des Faringis weiß ja überall Bahn zu hauen — dann sind wir im Freien, können von niemand mehr angehalten, nicht einmal gesehen werden.«
»Da ist aber doch erst noch die starke Korallenbarre, die diesen ganzen Archipel umringt.«
»Ja, aber gerade dort im Norden weiß ich einen geheimen Durchgang, nur uns Eingeweihten bekannt, da wir im Falle der höchsten Not einmal als Lotsen dienen müssen.«
Na, wenn es so war, dann hatte sich ja alles gleich zum Guten gewendet. Unsere drei Freunde ließen auf Maleatoll gar nichts zurück — nur hier auf dieser Insel, in diesem Wasser — etwas, was sie für immer verloren hatten.
»Und wohin gehst du?«
»Ich weiß schon, wo ich bleibe.«
»Aber wohin sollen wir dich mit dem Boote bringen?«
»Nach Ceylon.«
»Du wirst überhaupt nicht wieder nach Maleatoll zurückkehren?«
»Ich werde mich hüten.«
Es schien fast, als habe sich der Herr Minister überhaupt auf englisch verabschieden wollen. Vielleicht hatte er sowieso etwas auf dem Kerbholze, hatte seine Flucht sowieso schon geplant, benutzte nun gleich diese Gelegenheit.
Wenn es so war, dann brauchte man mit der Abfahrt nicht erst bis zur Nacht zu warten. Die drei hatten ja gar nicht gewusst, dass Maleatoll nach Norden den umringenden Korallenriffen so nahe lag. Oder eigentlich nach Osten, wie der Minister durch eine Zeichnung jetzt angeben konnte.
Aber zunächst musste man nach Norden halten, erst dann hatte man noch eine kleine Meile nach Osten zu fahren, bis man an die Korallenriffe kam, durch welche der in alle Geheimnisse auch praktisch eingeweihte Maleatolle einen Durchgang wusste.
»Und wie weit ist es dann noch nach Ceylon oder der Südspitze von Vorderindien?«
Allerdings noch ziemlich 500 Seemeilen, die sie in diesem Boote wohl schwerlich zurücklegen konnten. Aber jene Meerenge wird von außerordentlich vielen Schiffen befahren, da konnten sie sich aussuchen, brauchten sich nicht von dem ersten besten aufnehmen zu lassen.
Die drei hatten ihren Durst gelöscht und gegessen, noch einmal die Kokosnüsse an dem Bach gefüllt, und es ging über die spiegelglatte Wasserfläche dem Norden zu.
Wieder brauchten sie nur eine Stunde, um auf der anderen Seite den die Lagune bildenden Atollenlandring zu erreichen.
Ja, hier sah es allerdings ganz anders aus. Alles eine undurchdringliche Dschungelregion, nur auf bevorzugtem Boden ein Brotfruchtbaum gedeihend.
Nun ist aber der indische Dschungel nicht eigentlicher Sumpf. Sonst könnten diese Gebiete ja nicht die Tummelplätze aller Arten von Tieren, auch die der schweren Elefanten sein. Jeder Dschungel ist passierbar, wenn man sich einen Weg durchhaut, der freilich in einer Woche vollständig wieder zugewachsen ist, und dann ist die Hauptsache eben die, dass dieses Rohr, manchmal so stark wie ein Mannesschenkel, einfach unausrottbar ist.
Und der Kampf mit dem Dschungelrohr begann. Der Maleatolle gab ganz unnötigerweise die Richtung an, in der Axel mit seinem Hirschfänger den Weg zu hauen hatte — er musste doch ganz nach eigenem Ermessen die lichtesten Stellen und die dünnsten Rohre aussuchen — während der Graf und Morphin das leichte Boot nachtrugen.
Auch sonst zeigte sich, wie wenig der Maleatolle diese Dschungelregion kannte. Er hatte von nur zwei Stunden gesprochen, die man zur Durchquerung des Dschungels brauchen würde, und als nach vier Stunden Arbeit die Nacht anbrach, hatten sie sicher erst die Hälfte des Landrings überschritten.
Dafür aber hatten sie kurz vorher noch unter einem Brotfruchtbaum eine Quelle mit wohlschmeckendem Wasser gefunden, an den Ästen hingen außer leckeren Früchten noch schlafende Kaguangs, die einen ebenso leckeren Braten abgaben.
Mit Anbruch des neuen Tages wurde der mühsame Marsch fortgesetzt, jetzt genügten zwei Stunden, um wieder den freien Wasserspiegel zu erreichen.
Jetzt allerdings war der Minister der einzige, der die Richtung angeben konnte, und er gehörte zu den ganz wenigen Eingeborenen. welche dazu überhaupt imstande waren.
»Wir mussten in unserer Jugend oftmals diesen Weg machen, ringsherum um den ganzen Archipel, allerdings noch innerhalb der Korallenmauer, das gehört mit zur Ausbildung der höchsten Beamten, und sie müssen noch alljährlich diese Übung einmal machen.«
»Wenn ihr nun aber in dieser unkultivierten Gegend seid, wo übernachtet ihr dann wegen des Belawas?«
»Diese Übungsfahrten und andere, die Übernachtungen nötig machen, werden in einem Hausboot ausgeführt.«
Wenn der Mensch will, weiß er sich eben immer zu helfen.
Bald hatte man den Korallenring erreicht. Hier auf dieser Seite war das Wasser zwischen den roten Zacken noch ganz ruhig, aber in der Ferne sah man es schon spritzen.
Das Boot drang ein. Keiner von den dreien konnte weder jetzt noch später begreifen, wie der eingeborene Lotse den Weg fand, wonach er sich eigentlich orientierte.
Ja, der Passagen gab es sehr viele, sogar zahllose, und das war es eben — alle diese scheinbaren Passagen endeten blind!
Und nun unter diesen zahllosen Wasserlöchern und Passagen eben immer gerade die herauszufinden, welche eine Fortsetzung hatten!
Nun, dieser Minister war ein geborener Koralleninselbewohner und speziell eingeweiht. Er irrte sich nie, brauchte nie umzukehren.
Dann begann das Wasser unruhig zu werden. Aber auch wieder nur so scheinbar. Es spritzte wohl, immer mächtiger, aber das Wasser selbst war doch eigentlich ganz ruhig, dem Boote wenigstens drohte keine Gefahr.
Das blieb auch so, als sie sich mitten in der Brandung zu befinden schienen. Wehe freilich, wenn der kundige Lotse gefehlt hätte! Im Nu wäre das Boot zersplittert, von tausend Spitzen aufgeschlitzt gewesen, und dasselbe hätte von den Menschen gegolten.
Und dann hatten sie die offene, leichtgekräuselte See erreicht.
Wir machen den Schluss dieser ganzen Episode kurz.
Ein Schiff war noch nicht zu erblicken. So dick sind die Fahrzeuge denn doch auch hier nicht gesät.
Aber sie mussten sich beeilen, an Bord eines Schiffes zu kommen. Immer stärker blies der Südwind, immer höher wurde der Seegang.
Eine Stunde später gehörte alle Ruderkraft dazu, um das leichte Boot aufrecht zu halten.
»Das gibt Sturm!«
»Ein Segel!«
Sie sollten das rettende Schiff nicht erreichen, nicht in diesem Boot, nicht gemeinsam.
Dort kam von dem ersten Sturmstoß die erste hohe Woge mit schäumendem Kamme einhergerollt, sie ließ das Boot kieloben treiben.
Hiermit schließt die erste oder eigentlich schon die zweite Episode aus dem Leben des Grafen von Saint-Germain, soweit es der Öffentlichkeit angehörte, soweit man etwas von seinem Leben erfahren hat.
Zehn Jahre später!
Seit vier Jahren schon kämpfte das kleine Preußen unter seinem Heldenkönig Friedrich II. gegen fünf verbündete Mächte: gegen Österreich, Frankreich, Russland, Schweden — und die fünfte Macht bildete die sogenannte deutsche Reichsarmee, deren Kern aus Sachsen bestand.
Wir versetzen uns nach Genua, der Hauptstadt der damaligen Republik, an deren Spitze der Doge Giovanni Brignole stand, der sich von einem armen Fischerknechte zum Oberhaupte der mächtigen italienischen Republik emporgearbeitet hatte.
Eines Tages verlangte ein zerlumpter Reiter Einlass in den Dogenpalast. Bald darauf saß er an einer fürstlich gedeckten Tafel, obgleich er doch nichts weiter war als ein ganz gewöhnlicher Mann. Aber er brachte eine Depesche — von dem Preußenkönig.
Eine Senatorensitzung, und die Kuriere jagten nach Venedig, Rom, Genua und allen anderen selbstständigen Staaten Italiens, obgleich dieses damals noch immer nicht so schmählich zersplittert war wie Deutschland.
Und die Vertreter dieser Staaten kamen nach Genua, Edelleute und ganz einfache Männer aus dem Volke. Die Fürstenhöfe schickten Herzöge und Grafen, die Republiken mit Vorliebe Senatoren von der bürgerlichsten Abkunft.
Aber, ach, wie lange dauerte das, ehe die alle zusammengekommen waren! Und dann wusste immer noch niemand, was der Preußenkönig ihnen eigentlich mitzuteilen habe. Er bat die italienischen Mächte um eine Zusammenkunft in Genua, wohin er seinen Bevollmächtigten schicken würde. Mehr hatte in der Depesche nicht gestanden.
Ja, wie sollte man denn damals so etwas anders handhaben? Dem Kurier konnte doch nicht etwa eine wichtige schriftliche Mitteilung anvertraut werden!
Bis der preußische Bevollmächtigte kam, selbst ein preußischer Fürst, einer der wenigen, die mit ihrer Heeresmacht, mochte diese auch noch so klein sein, treu zu Preußen hielten, in der Erkenntnis, dass in diesem Bruderkriege nur Preußen siegen dürfe, sollte dereinst noch einmal ein einiges Deutschland entstehen.
Dann erfuhr man es. Der Preußenkönig suchte die italienischen Mächte zu bewegen, vereint Österreich in den Rücken und Frankreich in die Flanke zu fallen.
Und der Preußenkönig hatte zu dieser Mission den richtigen Diplomaten gewählt. Der in vollster Manneskraft stehende Fürst, wenn auch sein bis an den Gürtel reichender Bart schon etwas zu ergrauen begann, war eine germanische Heldengestalt, die man sich fast nur auf dem Schlachtfelde vorstellen konnte — aber hier im Parkettsalon bewies er sich als der gewandteste Diplomat, sprach mit einer Überzeugungskraft, eben durch seine schlichte Geradheit, dass die aalglatten Italiener völlig unterlagen.
Zwar sollte nichts daraus werden; die italienischen Mächte bekamen dann zu viel mit sich selbst zu tun, aber einen geeigneteren Mann für diese diplomatischen Verhandlungen hätte Friedrich dennoch nicht schicken können.
Noch ein günstiger Umstand sollte ihm zu Hilfe kommen.
Tag und Nacht war schon verhandelt worden, als ein russischer Kurier eintraf. Der konnte etwas mehr melden.
In Petersburg hatte sich eine Hofpartei gebildet, die mit Preußen gehen wollte. Ihr Vertreter war ebenfalls schon unterwegs, Graf Soltykow.
Dieser kam eher, als man es ahnen konnte. Er musste nicht geritten, sondern geflogen sein, um den vorausgerittenen Kurier so schnell einzuholen.
Von Petersburg nach Genua das sind genau 300 deutsche Meilen, bei den Russen mehr als 2000 Werst — in ganz direkter Luftlinie gerechnet — und wenn der sich Meldende wirklich Graf Soltykow war, so musste er Tag für Tag zwanzig Meilen geritten sein.
»Das ist nicht möglich, ich verstehe auch etwas von dieser Reiterei«, sagte der deutsche Fürst, der auch wirklich selbst einen Rekord auf seinem Ritt von Berlin nach Genua aufgestellt hatte.
Aber es war tatsächlich Graf Soltykow, er konnte Passworte und alle anderen geheimen Erkennungszeichen geben, die der Kurier zuvor gebraucht.
Denn man musste damals sehr, sehr vorsichtig mit so etwas sein. Das schnellste Pferd war eben auch das schnellste Beförderungsmittel, was für Gaunereien konnten da durch falsche Depeschen verübt werden!
Dabei war dieser tolle Reiter auch noch ein alter Herr. Wenigstens seinem weißen Haar und Schnurbart nach. Sonst freilich schwang er sich wie ein Jüngling aus dem Sattel, folgte den Palastbeamten mit elastischem Schritt die Treppe hinauf.
Das Verhör von Sachverständigen war also schon erfolgt, er hatte es bestanden — dann ein Bad, und der russische Gesandte verlangte vor das Konzil geführt zu werden.
Das war in früher Morgenstunde, trotzdem war alles versammelt, denn wieder hatte eine Beratung die ganze Nacht hindurch gewährt und war noch immer nicht beendet.
»Sie werden doch aber erst das Frühstück einnehmen, es ist bereits serviert.«
»Danke. Ich bedarf keiner Erfrischung. Nichts ist mir lieber, als zu hören, dass alle die Herren noch versammelt sind.«
Er beharrte dabei, keinen Bissen zu genießen, sondern sofort vorgeführt zu werden.
In kleidsamer Tracht, die ihm geliehen, betrat er den Beratungssaal.
Er konnte doch noch nicht so alt sein. Nur das weiße Haar täuschte. Eine ungemein kraftvolle Gestalt und dabei gewandt und graziös bis in die Fingerspitzen.
Die Vorstellung erfolgte. Als einer der letzten trat der deutsche Fürst vor, der sich bisher hinter dem erhöhten Sessel des genuesischen Dogen gehalten hatte, den russischen Gesandten scharf musternd, einem anderen Herrn, mit dem er sich während der letzten Tage befreundet, zuflüsternd, dass der Russe ihm einen ganz sympathischen Eindruck machte. Sonst war ein Graf Soltykow hier ganz unbekannt. Freilich — Petersburg und Genua — damals!
»Seine Durchlaucht, Fürst Alexander von...«
Der vorstellende Beamte kam wirklich nicht dazu, den Namen ganz auszusprechen.
Einen Blick auf den germanischen Hünen mit dem bis zum Gürtel reichenden Barte, und plötzlich befiel den russischen Grafen ein Zittern, es ging am ganzen Körper hinab, er neigte sich weit vornüber, die Knie versagten den Dienst, er wäre gestürzt, wenn er nicht aufgefangen worden wäre.
Doch nicht etwa, dass man glauben konnte, hier habe eine Erkennung stattgefunden, die einen solchen furchtbaren Eindruck auf den Grafen machte.
Nein, es war eben doch ein alter Herr, der sich zu viel zugetraut hatte, jetzt brach er plötzlich zusammen.
Er wurde hinausgeführt, in die ihm zur Verfügung gestellten Gemächer geleitet.
»Natürlich, der hat ja die ganze Nacht im Sattel gesessen.«
So hieß es, und die Versammlung wurde aufgelöst, und man war nur zu froh, dass es so gekommen war, denn sie alle waren total übermüdet, einige schliefen schon im Stehen ein.
Auch Fürst Alexander zog sich auf sein Zimmer zurück, um den versäumten Schlaf nachzuholen.
Er sollte nicht zum Auskleiden kommen.
Es klopfte, ein Diener trat ein.
»Graf Soltykow lässt Seine Durchlaucht zu sich bitten.«
»Der russische Graf? Was will denn der von mir?«
»Er lässt Seine Durchlaucht zu sich bitten«, konnte der Diener nur wiederholen.
»Ich bin hundemüde, habe schon seit vierzig Stunden nicht geschlafen. Na gut, ich komme.«
Drei Minuten später betrat der Fürst das Wohnzimmer des Grafen.
Dieser stand in der Mitte desselben, das von der Sonne gebräunte Gesicht war ganz grau geworden, er schien außer sich zu sein.
»Axel — Signor Axel — Sie leben noch!«, brachte er mühsam hervor, die, Hände abwehrend wie gegen ein Gespenst ausstreckend.
Jetzt war es Fürst Alexander, der seinen Kopf weit hervorstreckte, als glaube er nicht recht gehört zu haben.
»Was?«
»Axel — Sie sind es — und Sie leben noch?!«
»Was, Sie kennen mich?!«
»Der Depeschenreiter Axel...«
»Der ist schon lange tot.«
»Nein — nein — Sie sind es — und Sie leben wirklich noch!«
»Mann, wer sind aber Sie, dass Sie mich wiedererkennen?«, flüsterte jetzt der deutsche Fürst mit dem mächtigen, schon etwas ergrauten Vollbart.
»Sie kennen mich nicht?«
»Keine Ahnung.«
»Der Graf von... Bellamare...«
»Was?! Wer?!«
»Der Graf von... Saint-Germain.«
Es dauerte noch etwas länger.
Dann glaubte es der ehemalige Depeschenreiter Axel und der jetzige Fürst Alexander.
Aber sie fielen sich nicht in die Arme, und das Nachfolgende müssen wir doch ausführlich beschreiben.
»Sie leben noch, Sie leben noch!«, flüsterte der jetzige Graf Soltykow, und immer mehr klang es wie ein Jauchzen.
Es war etwas dabei, was den Fürsten abhielt, den ehemaligen Kameraden richtig zu begrüßen.
»Sie leben noch — o Gott, o gütiger Gott — Sie leben wirklich noch!!«, erklang es immer wieder mit diesem unterdrückten Jauchzen.
»Ja, ja, ich lebe noch. Ich bin damals gerettet worden. Und also auch Sie, Graf.«
»Sie leben noch, Sie leben noch — O Gott, o Gott, dann haben mich alle Fakire betrogen...«
»Was, Fakire betrogen?«
»Die mir sogar ihren Geist erscheinen ließen...«
»Was, meinen Geist erscheinen lassen?«
»O Gott, o Gott, dann habe ich ja noch Hoffnung, dass mich die Fakire auch wegen Marietta betrogen haben, dass auch meine Marietta noch lebt!«
Und der so alt gewordene Graf sank auf das Sofa, weinte und lachte zugleich vor Schmerz und vor Freude.
Jetzt hatte Axel, wie wir ihn noch nennen wollen, nun doch etwas herausgehört. Er ließ ihn sich beruhigen, dann saßen die beiden zusammen auf dem Sofa und erzählten sich gegenseitig, der Graf erst seine Schicksale, freilich gleich zur Hauptsache kommend.
Das Boot war also gekentert, die Insassen waren voneinander getrennt worden. Der Graf wenigstens wusste nichts von dem Schicksal der anderen, und wir bleiben nur bei ihm.
Nachdem er stundenlang mit den immer höher gehenden Wogen gerungen hatte, war er von einem Schiffe aufgenommen worden.
Er war nach Ceylon gekommen, hatte dort den Schah Alum wiedergetroffen, mit diesem nach Indien, Krieg und Mord und Totschlag — sieben Jahre lang hatte der Graf an indischen Fürstenhöfen die höchsten Rollen gespielt.
Mag das genügen, mehr erfuhr Axel jetzt auch nicht hierüber.
»In diesen Positionen war es mir leicht, mir die ersten hellsehenden Fakire Indiens dienstbar zu machen. Der erste war ein ausgezeichneter, in seinem Lande weit und breit berühmter Hellseher. Ich bin offen — Sie verzeihen wohl — ich gestehe, dass die erste Person, über deren Schicksal ich mich vergewissern wollte, meine Marietta war...«
»Ja, was soll ich denn da verzeihen?«, unterbrach Axel erst einmal.
»Mein erster Gedanke hätte doch Ihnen gelten müssen, aber...«
»I, machen Sie doch keine Geschichten! Weiter!«
»Der Fakir sah sie nicht. Auch nicht das Kind, nicht das schwarze Schiff, niemand von jener ganzen Gesellschaft. Demnach musste alles tot sein. Deshalb konnte der koptische Mönch ja immer richtig gesehen haben. Das schwarze Schiff war eben noch nachträglich mit Mann und Maus untergegangen.
Derselbe Fakir konnte sich auch noch in einen anderen Zustand versetzen, in dem er die Seelen Abgeschiedener zu beschwören vermochte, er tat es und... Mariettas Geist erschien mir, teilte mir mit, dass das schwarze Schiff in der Nähe des Kaps der guten Hoffnung untergegangen sei, wusste mir alles mit allen Einzelheiten zu schildern, soweit man das bei solchen Katastrophen kann.
So, nun wusste ich es. Dass mich der Fakir täuschen oder dass er sich selbst irren könne, das war ganz ausgeschlossen. Ich verstand selbst etwas davon, verstand, ihn oder den Geist den verschiedensten Prüfungen zu unterziehen. Nein, Marietta wusste mir zu beantworten, was nur sie wissen konnte — und ich.
Also tot, alles tot! Nun der Tod ist des Menschen Los. Dennoch bin ich im Laufe der sieben Jahre noch zu vielen, vielen anderen Fakiren gegangen, ließ sie zu nur kommen, ich hatte die Macht dazu, ließ mir immer wieder Mariettas Geist zitieren — und den Ihren.«
»Was, und den meinen?!«, rief Axel.
»Jawohl. Nachdem meine erste Begier gestillt war, etwas über Mariettas Schicksal zu erfahren, sagte ich mir mit etwas Scham, dass ich doch zuerst nach dem Schicksal meiner treuen Kameraden hätte fragen sollen. Gleich jener erste Fakir, Holokin hieß er, offenbarte es mir. Er konnte den, an den ich dachte, nicht sehen. Das sagte mir schon, dass Sie tot sein müssten. Dann sollte mir Holokin, sich in den zweiten Zustand versetzend, wenigstens die Seele des Betreffenden sichtbar machen — und richtig, die Nebelwolke wuchs aus dem Kopfe des schlafenden Fakirs heraus, verdichtete sich immer mehr, bis eine menschliche Gestalt entstand, bis ich sogar ganz deutlich Ihre Gesichtszüge erkannte. Dann konnte die Wolke auch sprechen — Ihre materialisierte Seele erzählte mir, wie Sie damals ertrunken seien. Auch alle die anderen Fakire ließ ich dasselbe Experiment wiederholen — im Laufe der sieben Jahre viele Dutzend Male — stets erfuhr ich von Ihrem Geiste dasselbe.«
»Diese materialisierte Seele sollte ich sein?«, rief der deutsche Fürst, in seinen alten Depeschenreiterton zurückfallend. »Na, das ist aber ein starkes Stückchen!«
»Und auch Kapitän Morphin soll tot sein.«
»Ja, der ist tot. Der hat sich totgelacht.«
»Was, totgelacht?«
»Faktisch, der hat sich totgelacht.«
»Damals, als er ertrank?«
»Sie meinen, der habe sich damals vor sieben Jahren im Wasser totgelacht? Nee, o nee, so einfach ist die Geschichte nicht.«
»Der ist einem Haifisch zum Opfer gefallen. Ein Hai biss ihm beide Beine ab.«
»Woher wollen Sie denn das wissen?«
»So berichtete er mir selbst.«
»Er selbst? Wann denn?«
»Nun, sein zitierter Geist, immer und immer wieder, so oft ich ihn auch beschwören ließ.«
»Hm, ein Fisch hat allerdings den Tod meines alten Freundes verschuldet...«
»Ein Haifisch?«
»Haifisch? Nee, in Berlin gibt's keene Haifische. Es war ein Karpfen. Karpfen blau. Mit Butter. Wir saßen ganz gemütlich an der Tafel, jemand hatte einen famosen Witz gemacht, Morphin lachte wie toll, lachte immer toller, dabei das ganze Maul voll, wurde immer röter im Gesicht — mit einem Male sagte er jiebs und weiter nichts. Tot war er. Der alte Sünder hatte sich ins Jenseits hinübergelacht. Als er dann untersucht wurde, fand man in seiner Luftröhre einen ganzen Karpfenkopf. Und das war nicht schon vor sieben Jahren, sondern erst voriges Jahr. So lange war mein Freund Morphium noch frisch und munter.«
»Und mir ist sein Geist schon vor sieben Jahren erschienen, er berichtete mir, wie ihn damals vor sieben Jahren ein Haifisch verschlungen habe! Immer und immer wieder dasselbe! O Lug und Trug dieser Fakire!«
Jetzt also glaubte sogar der Graf, dass diese Fakire Betrüger seien.
Und dennoch war er im Unrecht, konnte es wenigstens sein.
Es ist ganz unmöglich, hier darüber eine Erklärung zu geben, wie so etwas zustande kommen kann.
Der Spiritismus ist eine Tatsache, die als solche niemand leugnen kann, der sich einmal damit befasst hat, was freilich erst den Willen und dann Zeit und vor allen Dingen Geld kostet.
Aber der Spiritismus ist aus Lüge und Wahrheit zusammengesetzt, die wir heutzutage noch nicht unterscheiden können. Das mag einer späteren Generation vorbehalten sein — wir können es nicht.
Jedenfalls aber: Wer heutzutage die Phänomene des Spiritismus leugnet, der ist ein Unwissender, ein geistiger Faulpelz, oder er kann auch zum wissentlichen Lügner werden, Und wer hinwieder aus dem Spiritismus eine Religion macht, alles auf Treu und Glauben hinnimmt, was die ›lieben Geister‹ erzählen, der ist... ein Narr.
Nur so viel sei hier gesagt, dass dies auch mit der Einbildungskraft zusammenhängt, welche schon einmal als die größte Macht auf der Erde — und wohl auch im Himmel — erklärt wurde, die Einbildungskraft, die uns selbst zu schöpferischen Göttern macht.
Es gibt Medien, ob nun Fakire oder nicht, deren Phänomene und Aussagen einwandfrei sind, auf Tatsachen beruhen. Solange ihre psychische Kraft stärker ist als die desjenigen, der fragend zu ihnen kommt. Sobald aber der Frager eine stärkere Einbildungskraft besitzt, dann unterliegt das Medium dieser, macht und sagt alles, was jener will, bewusst oder unbewusst, und das Medium wird unbewusst zum Betrüger.
Das ist der Witz — und hiermit genug.
»Da sehen Sie, was sie von der ganzen Fakirerei zu halten haben«, sagte Axel, und hiermit war diese Angelegenheit für ihn erledigt.
Und für den Grafen kam jetzt nur eins in Betracht.
»Ja, wenn ich über Sie und Kapitän Morphin getäuscht worden bin, dann kann es doch auch betreffs Mariettas der Fall sein — vielleicht lebt sie doch noch.«
»Sehr leicht möglich. Haben Sie sonst nichts von dem Verbleib des schwarzen Schiffes vernommen?«
»Gar nichts.«
»Haben Sie nicht jene Inseln im Stillen Ozean besucht?«
»Doch, mit einem eigenen Schiff. Ein Jahr habe ich fast darauf verwendet, dadurch wurde mein sonst fortwährender Aufenthalt in Indien einmal unterbrochen.«
»Und was fanden Sie?«
»Seltsames genug, nur nicht den Heimathafen des geheimnisvollen schwarzen Schiffes, nicht die Werft, auf der es erbaut worden.«
Was er gefunden, darüber ließ sich der Graf jetzt nicht aus, ganz andere Gedanken erfüllten seinen Kopf.
Plötzlich sprang er auf, richtete die Augen und die Hände zur Decke empor, die hier auch noch im blauen Grunde goldene Sternlein zeigte.
»O Gott, o Gott!«, rief er. »Wenn meine Marietta doch noch am Leben sein könnte — oder gib mir wenigstens Gewissheit, allgütiger Gott, ich flehe dich an, nur Gewissheit!!«
So mit emporgestreckten Händen, den Kopf zurückgeneigt, blieb er noch längere Zeit stehen, wohl in stummes Gebet versunken.
Sein Gesicht konnte Axel, der sitzen geblieben war, nicht sehen, jener drehte ihm den Rücken zu.
Der betet recht lange, dachte Axel nach einigen Minuten.
Es vergingen immer noch einige Minuten, und der Graf veränderte seine Stellung nicht, rührte sich nicht.
Jetzt ward Axel stutzig. Diese Bewegungslosigkeit wurde ja fast unheimlich.
»He, Graf.«
Keine Antwort, keine Bewegung.
Da kam Axel eine Erkenntnis — eine Erkenntnis, an die er niemals geglaubt hatte, auch jetzt noch nicht glauben wollte.
Und doch — was war denn das?! Wie sollte man sich solch eine Bewegungslosigkeit erklären?
Axel stand auf, ging, schlich um den Grafen herum. Jetzt blickte er ihm ins Gesicht.
Und Axel erschrak.
Dieses Gesicht, wie das aussah!
Das gebräunte Gesicht war wachsgelb geworden. und nun vor allen Dingen diese weitgeöffneten Augen! — Es waren die eines Toten.
»Alle Wetter«, flüsterte der jetzige deutsche Fürst als ehemaliger Depeschenreiter, »der ist wieder einmal ein bisschen tot — oder doch in Starrkrampf gefallen, schickt seinen Geist auf Reisen, ohne Extrapost bezahlen zu brauchen — hat der sich das noch immer nicht abgewöhnt! Ja, ist denn nur wirklich etwas daran?
Denn Axel hatte den Grafen früher niemals in diesem Zustande gesehen.
Jetzt aber musste er daran glauben. Alle Glieder waren einfach starr und hart wie Glas, zum Beispiel auch das Ohrläppchen.
Doch Axel hütete sich, da umfassende Experimente vorzunehmen.
»In diesem Zustande soll man ihm leicht etwas abbrechen können — so hieß es damals immer, so sagte er selbst... nein, lieber nicht.«
Er versuchte ihn umzukippen — ja, umkippen ließ er sich ganz leicht, stand dann aber wieder ebenso fest auf den Füßen, deren Zehenlage er ja nicht einmal um eine Linie veränderte. Dasselbe Experiment kann man ja auch mit Hypnotisierten machen.
»Ich will ihn lieber nicht aufs Sofa legen, mag er so stehen bleiben — ich könnte ihn in der Mitte durchbrechen. Wenn er wieder zu sich kommt und er fällt dann um und bricht sich die Nase oder sonst was ab — dann ist's nicht meine Schuld.
Axel blickte nach der Uhr.
»Erst halb acht. Seine gewöhnliche Zeit ist es nicht. Früher opferte er nur mittags zwischen zwölf und eins dem Tode. Allerdings konnte er sich wohl auch zu jeder beliebigen Zeit in Starrkrampf versetzen. Diesmal scheint's ihn unwillkürlich befallen zuhaben. Ob's denn nur wirklich wahr ist? Oder will er mir immer wieder etwas vorgaukeln? Na, meinetwegen. Ich kann warten.«
Er setzte sich wieder aufs Sofa, beobachtete den Regungslosen. Alle Müdigkeit war ihm vergangen.
Fast eine halbe Stunde verstrich. Der Graf senkte auch nicht um eine Linie seine erhobenen Hände.
»Nein, das kann in natürlichem Zustande kein Mensch aushalten.«
Da plötzlich wandte sich der Graf, ohne vorher eine andere Bewegung gemacht zu haben, jäh um, erst bei diesem Umdrehen die Hände herunternehmend, und Axel sah ein vor Glück ganz verklärtes Gesicht.
»Sie lebt, sie lebt, ich war soeben bei ihr!«, erklang es jauchzend.
Was sollte Axel dazu sagen? Er stöhnte, wenn auch dabei etwas von seinem alten Humor durchklang.
»Graf, Graf, ich hatte mich in den letzten Jahren in einen so hübschen Seelenfrieden gewiegt — und jetzt fangen Sie wieder mit Ihrer Zauberei an. Na, meinetwegen, ich glaube alles, ohne mich deswegen irritieren zu lassen. Also Marietta lebt?«
»Ich war soeben bei ihr.«
»Das freut mich, ich gratuliere. Was haben Sie denn mit ihr gesprochen? Was sagte sie denn?«
»Ja, ich kann als Geist doch mit niemand sprechen!«
»Ach so! Pardon. Wo haben Sie sie denn gefunden?«
»Ja, was meinen Sie? Ich wollte es selbst erst nicht glauben. Sie wissen doch, ich muss mich da erst orientieren. Hier in Genua ist sie!«

Immer mehr jauchzte der Graf, wenn auch mit unterdrückter Stimme.
Axel schüttelte nur immer den Kopf. Nämlich auch deshalb, weil ihm der Graf immer jünger erschien, je länger er ihn anblickte, sogar jünger als früher, trotz des weiß gewordenen Haares und Bartes — wenn das natürlich war.
»Wo war sie denn da?«
»In der via della Milano!«
Der Graf schnallte seinen Degen um.
»Sie hat einen Fruchtstand, verkaufte soeben einem Engländer Apfelsinen.«
»Graf, Sie wollen wohl gleich hin...?«
»Ja, was denken denn Sie?!«
Und hinaus war er schon, der Mann, von dem man glaubte, er sei vorhin vor Erschöpfung zusammengebrochen.
Axel saß noch immer auf dem Sofa. Mit einem verblüfften Gesicht blickte er nach der Tür, durch die jener geeilt.
»Sie verkaufte soeben Apfelsieeeenen!«, machte er dann das letzte Jauchzen des Grafen nach. »Ei die Donnerwetter, jetzt fängt diese Zauberei schon wieder an! Ja, bin ich denn nur wirklich der sonst so ernst gewordene Fürst Alexander, der Vater von etlichen Prinzen und Prinzessinnen, oder bin ich noch immer der tolle Depeschenreiter Axel? Ich werde mir die Sache erst einmal beschlafen — heiliger Morphium, komm mir im Traume zu Hilfe.«
Am Nachmittage in der vierten Stunde wurde Fürst Alexander von seinem deutschen Diener geweckt, der ihn auch auf dem Schnellritt von Berlin bis hierher begleitet hatte.
Wenn nicht überhaupt ein vertrauliches Verhältnis zwischen Herrn und Kammerdiener herrschte, so hatte ein solches doch bei einer derartigen Reise, wobei alle Gefahren und das letzte Stück Brot geteilt worden waren, eingeleitet werden müssen.
Zuerst berichtete der Diener seinem Herrn, der Doge habe die nächste Sitzung für heute Abend sechs Uhr angeordnet — natürlich könne sie nur stattfinden, wenn alle Vertreter ihrer Länder zusammen seien. Hierfür mussten eben die Diener sorgen, auch dafür, dass jeder vorher etwas zu essen bekam.
»Das ist ja ein kurioser Kauz, dieser russische Graf«, wurde der Diener erst nach dieser Meldung vertraulich, »der hat noch nicht einmal...«
»Still, Hans!«, unterbrach ihn aber der Fürst sofort, »jetzt ist keine Zeit zu solcher Unterhaltung, jetzt habe ich an anderes zu denken!«
Und Axel brachte es fertig, kein Wort mehr über den Grafen zu verlieren, und auch dann in der Sitzung begegnete er ihm nur als dem Abgesandten der russischen, dem Preußenkönig freundlich gesinnten Hofpartei, und auch als die beiden einmal allein in einer Fensternische sprachen, wurde wegen Marietta kein Wort verloren.
Dieses Schweigen über diese Angelegenheit hatte wirklich etwas zu bedeuten — es waren eben zwei Diplomaten, zwei ganze Männer, die in dem, was sie vorhatten und was man ihnen anvertraut, ganz aufgingen.
Dann freilich, als gegen zehn Uhr die Sitzung aufgehoben wurde, waren sie wieder die alten Freunde.
»Ich komme auf Ihr Zimmer, hole Sie ab, wir gehen gleich zu Marietta«, hatte Soltykow dem Fürsten bei der zeremoniellen Verabschiedung zugeflüstert.
Er kam sofort, zum Ausgehen bereit.
»Sie kommen doch mit?«
»Wohin?«
»Ich habe die beiden gleich in einem Hotel untergebracht, wo auch ich wohnen werde.«
Daran war nichts Auffälliges. Einmal befand man sich im heißesten Sommermonat, in welchem die Nacht zum Tag gemacht wurde, und dann herrschten in Italien damals noch lockerere Verhältnisse als heute, und Genua ist die freieste Stadt Italiens, was man schon an der Sprache der Genueser und besonders auch der Genueserinnen erkennt. Man kann da in der besten Gesellschaft Dinge zur Sprache bringen oder sich auch allein mit einer sonst durchaus anständigen Dame über Sachen unterhalten, die selbst in Paris als frivol, als unmöglich gelten würden.
Merkwürdig aber dabei ist, dass die Genueserin und überhaupt die Italienerin auch beim schlüpfrigsten Gespräch niemals etwas an Würde, das Mädchen nicht einmal an Keuschheit einbüßt, die Italienerin wird niemals gemein, sie kann sprechen, was sie will — ein ganz wunderbarer Kontrast, dem schon Goethe bei der Schilderung der Römerin ein langes Kapitel widmet.
Und so wohnten auch die meisten der fremden Gäste, wenigstens wenn sie ein gewisses Alter noch nicht überschritten hatten, nur dem Namen nach im Dogenpalast, in Wirklichkeit wohnten und schliefen sie anderswo, ihre Freizeit sich durch weibliche Gesellschaft versüßen lassend, — obgleich das oftmals im Hause einer befreundeten Familie geschah, und niemand fand etwas Auffälliges dabei, vielmehr war das ganz der Sitte, sogar ganz der guten Sitte entsprechend.
So ist es ja noch heute in Italien. Das sind eben Verhältnisse, die wir gar nicht begreifen können, das bekannte Verhältnis des konzessionierten Cicisbeos, des Hausfreundes und erlaubten Liebhabers einer verheirateten Frau, die dadurch gar nichts an Achtung verliert, ist für uns Germanen ja erst recht ganz unfassbar.
»Beide?«, wiederholte Axel fragend.
»Auch Pepita ist ja dabei. Und was für ein herrliches Mädchen ist das geworden!«
Der Graf strahlte vor Seligkeit. Nein, diese weißen Haare konnten nicht natürlich sein. Er sah jünger denn vor zehn Jahren aus, dabei aber doch wieder so ganz anders.
Niemand hätte in ihm den Grafen von Saint-Germain wiedererkannt.
»Ja, wie ist es denn nun damals mit dem schwarzen Schiffe...«
»Kommen Sie, kommen Sie, ich erzähle Ihnen alles unterwegs!«
Axel warf nur einen leichten Mantel um, und die beiden verließen den Dogenpalast.
»Auch der koptische Mönch schon hatte mich betrogen«, begann der Graf auf der Straße. »wenngleich unwissentlich — er hatte mit den Augen meiner Einbildungskraft gesehen.«
Und er erzählte weiter, wie ihm Marietta berichtet hatte — wie das schwarze Schiff nämlich schon damals, als es vor der Höhle an der tunesischen Küste gelegen hatte, während sich die Jacht mit unseren Freunden in Rom befand, gescheitert war. Es hatte dem furchtbaren Nordsturme auch mit seiner Maschine nicht standhalten können, war an der felsigen Küste zerschellt.
So war die Planke, welche man dort aufgefischt, wirklich der letzte Rest des mächtigen Schiffes gewesen, alles übrige hatte das Meer verschlungen, war an der Küste zerrieben worden, oder was weiß man denn, wie solch eine gewaltige Brandung zu vernichten versteht.
Aber noch ehe es zur Katastrophe kam, war die ganze Mannschaft in die Boote gegangen, freilich Hals über Kopf, die Hälfte der Boote war sofort umgeschlagen, ihre Insassen ertrunken.
Doch Marietta hatte nur von sich selbst erzählen können, es war ja in der Sturmnacht gar nichts zu sehen gewesen.
Sie war mit Pepita in das Boot des Kapitäns gekommen, desgleichen Lady Isabel und einige der wertvollsten Fakire.
Zwei Tage lang war man auf offenem Meere getrieben, im fürchterlichsten Wogenschwall.
Dann endlich ein Schiff. Aber noch immer eine haushohe See. Ein Anbordgehen fast gar nicht menschenmöglich — und doch, es musste geschehen, was blieb denn anderes übrig?
Die schwarzen Matrosen wie die des deutschen Segelschiffes verrichteten Wunder der seemännischen Kunstfertigkeit. Als erste wurde Marietta mit ihrem Kinde hinaufgeholt. Weiter aber sollte nichts gelingen. Das Boot zerschmetterte am Schiffsrumpf, niemand konnte gerettet werden.
Der Graf war stehen geblieben, den Kopf gesenkt — dann streckte er dem ehemaligen Freunde die Hand entgegen.
»Verzeihen Sie mir!«
»Was soll ich Ihnen denn verzeihen?«
»Meinen schmählichen Verdacht, den ich gegen jenen Kapitän gehabt habe, er hätte mich, als einen Nebenbuhler hassend, im Stiche gelassen...«
»Ja, was habe aber denn ich Ihnen dann zu verzeihen?«
»Gleichgültig — ich muss irgendeinem Menschen Abbitte leisten.«
»In diesem Sinne gewähre ich Ihnen gern Verzeihung — im Namen jenes schwarzen Kapitäns.«
Sie hatten sich die Hand gedrückt.
»Und was nun weiter?«
Das Schiff ging nach Sardinien. Mit Hilfe von mitleidigen Menschen gelangte die ganz mittellose Marietta nach Rom.
Hier wusste man nichts, wo der Graf von Saint-Germain geblieben war.
Zwei Jahre blieb Marietta noch in Rom, sich kümmerlich ernährend.
Um dann dem fortwährenden Fragen ihrer Verwandten und anderer Menschen, was sie aber erst dadurch veranlasste, weil sie selbst jeden, besonders jeden Seemann fragte, ob sie etwas von dem Grafen von Saint-Germain gehört hätten, aus dem Wege zu gehen, begab sie sich nach Genua.
Mit ihren kleinen Ersparnissen fing sie einen Fruchthandel an, den sie nun seit acht Jahren betrieb, und an ihrer vierzehnjährigen Tochter hatte sie eine tüchtige Stütze.
Das Geschäft ernährte sie recht gut, Mutter und Tochter waren mit ihrem Schicksal ganz zufrieden. Der Graf von Saint-Germain war vergessen worden — oder vielmehr die Hoffnung aufgegeben, dass sein Sekretär, der ehemalige Skribent Antonio Roscalli, der Gatte und Vater, sich noch am Leben befinden könne.
Die Zeit heilt ja schließlich alle Wunden, auch solche des Herzens.
»Und wie gaben Sie sich nun heute früh zu erkennen?«
»Nur Pepita stand bei den Waren. Ach, ist das ein herziges Ding geworden! Sie werden sie sehen. Wie musste ich mich beherrschen, sie nicht gleich in meine Arme zu schließen. Die Mutter befände sich in der Wohnung, gleich nebenan. Es ist ein kleiner Durchgang, in dem sie ihren Stand haben. Und — dann stand ich vor ihr. O, Axel, Axel! Kaum, dass sie sich verändert hat. Fast spurlos sind die Jahre an ihr vorübergegangen. Nur einige weiße Haare. Sonst ganz noch meine Marietta.
Ich machte es kurz. Nur zur Vorsicht eine kleine Einleitung. Ob sie, da sie denselben Namen führe, verwandt sei mit dem Skribenten Antonio Roscalli... da erkannte sie mich schon...«
»Erkannte Sie?«, wiederholte Axel.
»Sofort.«
»Das hätte ich kaum für möglich gehalten. Oder gaben Sie sich das frühere Aussehen dieses Skribenten?«
»Nein. Aber ich nahm allerdings die alte Stimme an. Das genügte. Da lag sie mit einem Aufschrei an meiner Brust. Und dann eben die Liebe, die Augen der Liebe.«
»Was sagten Sie nun? Wie erklärten Sie Ihr langes Fernbleiben?«
»Viele Erklärungen brauchte ich da nicht zu geben Lange Irrfahrten mit dem Grafen Germain, Schiffbruch und dergleichen, sogar Sklaverei.«
»Und wie kamen Sie nun hierher?«
»Als russischer Gesandter. Oder doch erst als Kurier. Habe mich in Russland an einem Fürstenhofe emporgearbeitet, wurde sogar zum Grafen geadelt. Dass Sie da also niemals widersprechen. Übrigens ist das auch tatsächlich der Fall.«
»Aber als den Grafen von Saint-Germain gaben Sie sich noch immer nicht zu erkennen.«
»Gott bewahre. Sie darf oder braucht niemals zu erfahren, was für eine Doppelrolle ich damals gespielt habe, und jetzt ist der Graf von Saint-Germain überhaupt schon längst tot, verschollen. Ich bin und bleibe der russische Graf Soltykow. Nicht wahr?«
»Selbstverständlich. Und dann wurde Pepita geholt. Ach, dieser Jubel, als sie den Vater begrüßen konnte!«
Der Leser weiß: Der Graf hatte seinen Freund also zuletzt doch in alles eingeweiht, damals auf dem nächtlichen Ritte durch die Libysche Wüste.
Also Axel wusste alles ganz genau, wie der Graf das fremde Kind annektiert hatte, das Marietta noch immer für ihr eigenes hielt, welches durch die wunderbare Kunst des Zaubergrafen aus einem verkrüppelten Geschöpf in ein blühendes Wesen verwandelt worden war.
Auch von dem Tode seines eigenen, dem der Vater nicht hatte helfen können, wusste Axel natürlich. Der Graf hatte ihm überhaupt gar nichts verschwiegen, wenigstens nichts betreffs dieses Doppelverhältnisses und des Kindes und was sonst noch damit zusammenhing.
Sonst freilich hatte der Graf ja noch manches Geheimnis auch seinem besten Freunde gegenüber bewahrt.
Merkwürdig war nur, wie der Graf jetzt dieses fremde Kind so ganz als sein eigenes betrachtete, mit welchem Entzücken er von seiner Pepita sprach.
Eben ein ganz merkwürdiger Mensch! Oder es war wiederum die Kraft seiner Einbildung, die dieses fremde Kind für ihn ganz zu seinem eigenen machte. Die Macht der Gewohnheit konnte da nur als zweites, als Nebensache in Betracht kommen.
»Sie haben doch niemandem gesagt, dass ich der ehemalige Graf von Saint-Germain bin?«
»Werde ich! Dazu hätten Sie mir doch erst die Erlaubnis geben müssen.«
»Verzeihen Sie — natürlich, es war eine ganz unnötige Frage von mir. Ja, der Graf von Saint-Germain ist tot — schon seit zehn Jahren — desgleichen Graf von Bellamare.«
»Dann lebe der Graf Soltykow! Wie sind Sie eigentlich nach Russland gekommen?«
»Von Indien über Persien. Ich erzähle es Ihnen ein andermal ausführlich. Ich bin tatsächlich am russischen Hofe vom Zaren selbst zum Grafen ernannt worden — für einige Dienste, die ich ihm leistete. Doch jetzt nicht politisch werden!«
»Und was beabsichtigen Sie nun?«
»Sobald meine Mission hier beendet ist, gehe ich nach Russland zurück, nehme Marietta und mein Kind natürlich mit, um mich nie wieder von ihnen zu trennen.«
»An den russischen Hof nach Petersburg?«
»O nein, wo denken Sie hin! Ich habe in Russland ein idyllisches Plätzchen gefunden, dorthin werde ich mich in die Einsamkeit zurückziehen — ach, was für ein glückliches Leben werden wir führen...«
Und der Graf begann die geplante Zukunft auszumalen, und dieser Mann verstand ja nun auch zu malen.
»Hier sind wir am Ziel.«
Es war eins der besten Hotels Genuas.
Es ist dies kein Anachronismus. Hotels gab es schon damals in allen Städten, Gasthäuser waren schon im alten Athen und Sparta.
»Sie haben die beiden gleich hierher gebracht?«
»Sofort. Auch gleich alles eingekauft, was sie brauchten, womit ich sie erfreuen konnte. Was ist da weiter dabei. Ich bin der russische Graf Soltykow. Kommen Sie.«
»Aber ich störe doch, zumal jetzt in der ersten Nacht...«
»Wie können Sie nur so sprechen! Ach, könnten Sie doch mein ständiger Hausfreund werden!«
Der Graf war manchmal naiv wie ein Kind — oder eben wie ein Italiener in gewisser Hinsicht. Dazu kam nun noch das grenzenlose Glück. Und überhaupt stellte er sich dadurch, wie er dem alten Freunde entgegenkam, nur das schönste Zeugnis aus.
In der Portiersloge bekam er sofort den Zimmerschlüssel.
Was war weiter dabei? Der russische Graf, der als Gesandter hierher gekommen, eigentlich im Dogenpalast wohnte, hatte eben zufällig heute auf der Straße eine hübsche Obstfrau mit ihrer schönen Tochter gesehen, hatte gleich alle beide hier einquartiert, brachte auch gleich noch einen Freund zum Nachtbesuch mit. Italienisch! Der Portier zuckte mit keiner Wimper, die Kellner tauschten keinen zwinkernden Blick.
Der Graf klinkte an der betreffenden Tür, fand sie verschlossen, benutzte den Schlüssel.
»Sie schlafen schon, ich dachte es mir gleich. Sie sind gewohnt, um zehn Uhr schlafen zu gehen, da sie den ganzen Tag auf der Straße stehen müssen. Diese Verkäufer können keine Siesta machen. Ich konnte auch nicht bestimmt sagen, dass ich noch heute Nacht zurückkäme, wusste ja nicht, wie lange die Sitzung dauern würde.«
Er brannte ein Licht an, ging in das Nebenzimmer hinüber.
»Kommen Sie herüber!«, erklang es fast sofort. »Sehen Sie nur dieses Bild — ach!«
Axel gehorchte. Es war das Schlafzimmer der beiden. In dem einen Bett sah er den sehr hübschen Kopf einer Frau, welche noch immer das Prädikat ›jung‹ verdiente.
»Das ist meine Frau, die Marietta. Sie kannten sie wohl gar nicht?«
Nein, Axel hatte nicht die Ehre gehabt — auch damals nicht an Bord des schwarzen Schiffes, da hatte der Graf wieder seine versteckte Heimlichkeit gehabt.
»Ist sie nicht schön?«, fragte der Graf, ganz Seligkeit, in seiner naiven Weise, die dieser Mann manchmal zeigen konnte.
Was sollte Axel tun? Er bestätigte — auch aus ehrlicher Überzeugung. Eine sehr hübsche Frau war es auch wirklich, die da züchtig gebettet lag, ruhig schlafend.
»Nun aber erst meine Pepita — ach, das ist ein Engel geworden.«
Axel wurde vor das andere Bett geführt.
Alle Wetter, ja, diese Vorstellung konnte wirklich mit einem ›nun aber erst‹ eingeleitet werden.
Ein eben erst zur Jungfrau erblühtes Mädchen, und doch schon voll ausgereift — das fremde Kind, die Tochter des römischen Gürtlermeisters Feliciani, war erst vierzehn Jahre, aber man hatte mit südrömischer Rasse zu rechnen — und diese körperliche Reife konnte Axel umso besser beurteilen, als Pepita weniger ›züchtig‹ gebettet lag. Ihr junges, heißes Blut hatte die Decken nicht geduldet.
Der PseudoVater, der sich aber in seiner Einbildung ganz für den richtigen Vater hielt, dachte sich gewiss nichts dabei, als er auch noch wohlgefällig den Leuchter hin und her bewegte — Axel auch nicht.
Er war wirklich ganz Künstler geworden, er bewunderte nur. Sollte er aber mehr diese herrliche Gestalt bewundern oder dieses Antlitz?
Doch von einem ›Engel‹ durfte der Graf nicht sprechen. Es war nicht das durchgeistigte eines solchen, wie man sich einen Engel gewöhnlich vorstellt, sondern es war ein rundes Gesicht von Milch und Blut, strotzend von Jugendkraft, diesem schwellenden Busen und der ganzen Gliederpracht entsprechend.
Wer war der Glückliche, der diese herrliche Knospe einmal brechen durfte? Wem bot sich dieser kleine Mund mit den Korallenlippen dereinst zum Kusse dar?
Und doch... gerade dieser Mund gefiel Axel gar nicht.
Es lag etwas... etwas... gewiss, das war ein stark sinnlicher Zug, der um diesen Mund lag, obgleich es durchaus keine aufgeworfenen Lippen waren.
Aber der ehemalige Depeschenreiter, der ja kein gewöhnlicher gewesen, verstand sich auf so etwas.
Ganz sicher war es noch eine völlig unberührte Blume, sogar das glaubte Axel beurteilen zu können — und doch, der überaus starke sinnliche Zug um die Lippen war schon vorhanden.
Und noch etwas anderes sollte er beobachten, was diesen Mann, der als Depeschenreiter alles zu beobachten gelernt hatte, darüber sich seine Gedanken machend, unangenehm berührte.
Zunächst muss noch bemerkt werden, dass es auch in anderer Hinsicht ein wundervolles Bild war, würdig, von dem Pinsel eines gottbegnadeten Künstlers festgehalten zu werden.
Diana mit dem Goldregen! Auf der Bettdecke lag eine ganze Menge gleißenden Schmuckes verstreut, Ketten, Spangen, Ringe und anderes — gutes Gold, mit Perlen und Edelsteinen — wenn auch nicht gerade sehr kostbare Sachen.
»Ich habe es ihr vorhin gekauft, sie fragte mich — sie ist ja noch ein vollkommenes Kind — ob ich denn reich sei, weil ich so vornehm aussähe — na, da bin ich einmal schnell zum Juwelier hinübergesprungen und habe ihr einigen Tand gekauft, wie er jedes Mädchenherz erfreut.«
So lächelte der Graf.
Und mit diesem so unvermutet vom Himmel geregneten Schmuck beschäftigte sich das Kind, die Jungfrau auch im Traume, ihre kleine Hand wühlte in dem gleißenden Zeuge, aber sie lächelte nicht dabei, jetzt trat erst recht ein eigentümlicher Zug um den Mund hervor, wozu nur noch der Ausdruck des Auges fehlte, um ihn ganz deutlich zu machen, und jetzt öffnete sie die Lippen etwas, und während die Hand noch fester zugriff, um das kalte Gold zu fühlen, flüsterte sie:
»Mehr, mehr«
Axel hatte schon genug gesehen, diese Worte waren nur eine Ergänzung. Des Ausdrucks des Auges bedurfte er nicht mehr. Es wäre der der Habgier gewesen.
Aber der Graf, solch ein Menschenkenner er auch sonst sein mochte, dachte sich bei diesem ›mehr, mehr!‹ nichts. Er lächelte immer glücklicher.
»Sie ist noch die Unschuld selbst. Die Mutter hat sie noch mit keinem Blicke aus den Augen gelassen. Sie ist auch wirklich sonst noch das reine Kind. Und dass sie es bleibt, dafür werde ich sorgen. Nun kommen Sie herüber, das Nachtessen ist schon bestellt.«
Axel sagte nichts, fragte nicht, wie sich der Graf denn das mit der idyllischen Einsamkeit vorstelle — er folgte hinüber.
Das ausgesuchte Nachtessen kam mit Wein.
»Also Sie sind wieder ein anständiger Mensch geworden?«, fragte Axel.
»Bin ich das nicht immer gewesen?«
»Sie lassen es sich jetzt zu den regelmäßigen Zeiten schmecken?«
»Nein. Nur Ihnen zuliebe esse ich jetzt mit.«
»Was? Sie leben noch immer nur von Luft?«
»Ich kann es, wenn ich will, und ich tue es. Meine Theorie und Praxis, die ich früher lehrte, beruhen auf Tatsache. Doch lassen wir das, Sie sind doch nicht davon zu überzeugen — wohl Ihnen!«
»Apropos — eine Frage in dieser Hinsicht müssen Sie mir doch erlauben.«
»Bitte.«
»Sie bekamen doch heute früh wieder solch einen Anfall von Starrkrampf.«
»Ja, und den habe ich Ihnen zu verdanken. Alle meine magischen Fähigkeiten, die ich früher tatsächlich besessen, habe ich schon damals verloren, als mir jenes Experiment misslang — Sie wissen, als ich das schwarze Schiff sehen wollte. Ich war damals zu sehr erregt, und die größte Gemütsruhe ist zu so etwas die Hauptsache. Misslingt einem aber Derartiges nur ein einziges Mal, so hat man es gewöhnlich für immer verloren, weil das Selbstvertrauen fehlt. Ich habe seitdem nie wieder solch einen Anfall gehabt — ohne zu wissen, ob ich mich darüber freuen oder betrüben solle.
Da erkannte ich Sie wieder. Sie lebten noch! Alle Fakire hatten mich betrogen. Konnte dies dann nicht auch in Bezug auf Marietta geschehen sein? In dieser furchtbaren Gemütserregung trat nun wieder die Gegenreaktion ein, ich wurde eben in dieser sonst mir fremden Erregung wieder von meinem alten Starrkrampf befallen, wurde hellsehend.
Und dieses mein Hellsehen hat mich noch nie betrogen, und dass ich jetzt meine Marietta und mein Kind wiedergefunden habe, habe ich nur Ihnen zu verdanken. O, mein Freund, mein Engel, mein Gott!«
Axel konnte die stürmischen Dankbarkeitsbezeugungen kaum abwehren. Dieser Graf war im innersten Charakter eben ganz Italiener.
»Sie hätten Ihre Frau doch auch ohne mich hier in Genua wiedergefunden.»
»Nein, niemals. Der Stand befindet sich in einer Stadtgegend, in die ich niemals gekommen wäre. Nur Ihnen, Ihnen allein habe ich dieses selige Glück zu verdanken.«
»Na, dann prost — hoch lebe die Göttin Fortuna!«
So ging die Unterhaltung noch einige Zeit weiter.
Da öffnete sich leise die Nebentür, ein reizendes Köpfchen lugte hervor.
»Wer ist denn das, Papa?«
»Meine Pepita! Komm nur, komm nur herein, mein Kind, dass du meinen treuesten Freund kennen lernst, den besten Menschen, den es auf Gottes Erdboden gibt.«
Sie huschte herein, in einem leichten Nachtkostüm, vom Vater erst heute neu angeschafft, und bald stellte sich auch die ebenfalls erwachte Mutter ein.
Dieser nächtliche Zwischenakt war hier nichts Besonderes. Draußen auf der Straße begann erst richtig das Leben. Noch manch anderer mochte ebenfalls bis jetzt geschlafen haben, um dann gleich bis zur mehrstündigen Siesta des anderen Tages aushalten zu können.
Die Scheu vor dem fremden Fürsten war schnell überwunden, die allgemeine Unterhaltung, die bald im Gange war, brauchen wir nicht wiederzugeben, hingegen ist bemerkenswert, dass es gar nicht lange dauerte, bis Fürst Alexander das reizendste weibliche Wesen, das Gott in bester Laune je erschaffen, auf seinen Knien sitzen hatte.
Die Veranlassung zu dieser Vertraulichkeit gab des Fürsten Taschenuhr, die er einmal zog. Es war eine dicke, goldene, aber sonst unscheinbar und sehr abgegriffen aussehende Uhr, die er nach damaliger Sitte noch nicht an sichtbarer Kette trug.
Pepitas Interesse wurde sofort geweckt. Da saß sie aber noch zwischen Mutter und Vater aus dem Sofa, sie griff nur gleich über den Tisch hinüber nach der Uhr — damals nicht etwa eine Seltenheit, wohl aber eine Kostbarkeit, die sich nur reiche Leute leisten konnten. Ein gewöhnlicheres Metall als Silber wurde für Taschenuhren nicht verwandt, wie es damals überhaupt noch keine Schund- und Ramschwaren gab, auch noch keine Warenhäuser. Insofern kann man wohl von einer ›guten, alten Zeit‹ sprechen, während dieser Titel sonst für die Zeit, in der das Spießrutenlaufen noch florierte, durchaus nicht zutrifft.
»O, Papa, eine Uhr hast du mir noch zu schenken vergessen — wie konntest du das nur vergessen! — aber nicht so eine große und plumpe will ich haben, sondern eine kleine, eine richtige Damenuhr — und mit Brillanten, wie sie bei dem Uhrmacher auf dem Markt ausliegen — nicht wahr, mein liebstes, bestes Papachen, du schenkst mir so eine richtige Damenuhr mit recht, recht vielen Perlen und Diamanten darauf — ich bin jetzt doch eine vornehme Dame, eine richtige Komtesse, und du bist ja so reich, und da muss ich als deine Tochter doch auch stolz auftreten, dass du dich meiner nicht zu schämen brauchst — nicht wahr, mein einziges Papachen, du kaufst mir die teuerste und schönste Uhr, die der Juwelier am Markte hat?«
So plapperte das reizende, rote Mündchen mit wunderbarer Zungengeläufigkeit, sie wäre dem Papa gern auf den Schoß geklettert, wenn nicht der Tisch zu dicht vor dem Sofa gestanden hätte, so schlang sie nur die Arme, von denen die Ärmel weit zurück fielen, um den vor zwölf Stunden wiedergefundenen und sonst gänzlich fremden Papa und überhäufte ihn mit Liebkosungen, immer mehr Diamanten für ihre zukünftige Uhr wünschend, bis diese zuletzt ganz aus einem einzigen Diamanten hätte bestehen müssen.
Die Mutter sprach mit schüchternem Tadel etwas von Unbescheidenheit, der Vater aber lächelte glückselig über diese fremde Tochter, die unbedingt eine richtige Damenuhr mit recht, recht vielen Diamanten haben müsse, damit er sich ihrer nicht zu schämen brauche.
»Ja, ja, mein Kind, du sollst so eine Uhr haben...«
»Mit recht, recht vielen Brillanten!«
»Mit so vielen Brillanten, wie nur darauf Platz haben.«
»Und mit noch mehr!«
»Und mit immer noch mehr«, amüsierte sich der Papa köstlich über dieses jungfräuliche Kind, die Liebkosungen erwidernd.
»Und mit Perlen.«
»Natürlich, auch mit Perlen.«
»Du bist ja so reich!«
»Ja, Kind, jetzt bin ich es wirklich«, lächelte der Graf, der seinem alten Freunde gegenüber noch keine Angabe über seine neuen Vermögensverhältnisse gemacht hatte.
Er musste sich wohl als russischer Graf recht gut stehen, besser denn als ehemaliger italienischer oder französischer.
»Wie konntest du nur vergessen, mir so eine Uhr gleich heute früh zu kaufen, wo du so reich bist!«, fing sie jetzt etwas zu schmollen an.
»Entschuldige nur, mein Kind...«
»Geh, kauf mir jetzt gleich eine.«
»Aber der Uhrmacher hat jetzt doch zu.«
»Er sitzt im Café, du suchst ihn, er geht in seinen Laden.«
»Aber, Kind...«
»Du liebst mich nicht, Papa.«
»Doch, doch, Kind, aber...«
Wie der gute Papa mit seiner lieben Tochter fertig wurde, das war seine Sache. Es schien nur, als ob der Graf diesem Kinde gegenüber all seine diplomatische Gewandtheit plötzlich verloren habe.
Der deutsche Fürst betrachtete diese Szene mit sinnendem Blick, hatte seine eigenen Gedanken.
Mit der in einer weltabgeschiedenen Einsamkeit wohnen wollen — na, das konnte ja gut werden!
War der Graf denn nur plötzlich blind geworden? Oder gedachte er diesem begehrlichen Wesen durch Dressur eine andere Gesinnung beizubringen?
Wenn er aber das fertig brächte, das wäre wirklich Zauberei gewesen.
Doch nein, der Graf war in das reizende Kind einfach total vernarrt.
Und dabei war es doch gar nicht seine eigene Tochter. Wo hatte er diese blinde Liebe zu ihr denn so plötzlich gefasst? Er hatte doch gar keine Zeit dazu gehabt.
Oder lag hier vielleicht etwas anderes vor als Vaterliebe, die sich also überhaupt gar nicht motivieren ließ?
Mit solchen fragenden Gedanken beschäftigt, spielte Axel mit seiner Uhr, die er noch immer in der Hand hielt — diese Fragen und Antworten zwischen Tochter und Vater hatten ja noch nicht eine Minute in Anspruch genommen — als die Uhr mit leisem, aber silberhellem Schlag verkündete, dass es acht Minuten über elf war.
Das hatte nun gerade noch gefehlt.
»Santa Madonna, eine Repetieruhr!!«
Repetieruhren waren in Anbetracht zur ganzen Masse, prozentual genommen, damals häufiger als heute, eben weil nur gute und beste Uhren gefertigt wurden.
»Papa, es muss natürlich eine Repetieruhr sein!«
Mit diesem Wunsche war es aber noch nicht genug.
Vorhin, als sie nach Axels Uhr begehrlich gegriffen, hatte dieser sie geschickt, ohne seinen Widerstand direkt zu verraten, zurückzuziehen gewusst. Jetzt steckte er sie, nachdem er so leichtsinnig gewesen, sie versehentlich repetieren zu lassen, schnell in die Westentasche, aber das sollte ihm nichts nützen.
Der Papa war erlöst, jetzt wurde der mitgebrachte Gast in den Folterblock gespannt.
Schnell wand sich Pepita hinter dem Tisch hervor, im nächsten Augenblick hatte Axel das holdselige Wesen auf seinem Schoße. So war es also gekommen.
»Ach, bitte, bitte, zeigen Sie mir die Uhr, geben Sie sie mir, ich möchte sie selber einmal klingeln lassen!«
Was sollte der Gast tun?
»Aber Pepita, wie kannst du nur so aufdringlich sein!«, tadelte die Mutter.
»Geben Sie sie ihr doch!«, sagte der glückstrahlende Vater.
Das war nun wiederum etwas gewesen, was gerade noch gefehlt hatte.
»Sie wollen mir die Repetieruhr geben, mir schenken?!«, jubelte das schöne Mädchen mit seinem liebreizenden Mündchen, während die Uhr schon in ihren Händchen in einem fort klingeln musste. »O, Durchlaucht, wie soll ich Ihnen danken, Sie sind so freigebig...«
»Nein nein, diese Uhr kann ich nicht verschenken...«
»Aber Sie haben es doch schon gesagt!«
»Ich? Das war ein Missverständnis. Diese Uhr ist ein teures Andenken an meine selige Mutter...«
»Wie, Ihre Mutter trug solch eine dicke, plumpe Uhr?«
»Sie stammt schon von meinem Urgroßvater, es ist ein altes Familienheiligtum...«
»Ach, bitte, bitte, schenken Sie mir doch das alte Ding — Papa lässt mir Perlen und Diamanten dranmachen...«
Zu seinem Glücke wurde auch Fürst Alexander von diesem kleinen und in anderer Hinsicht wieder übergroßen Madamchen Unverschämt noch rechtzeitig erlöst. Denn solch ein trotz alledem reizendes Kind auf den Knien zu haben, diesen jungfräulichen Leib am eigenen Körper sich winden zu fühlen, die vollen Arme um den Hals, und trotz aller perfekten Ungezogenheit, um das mildeste Wort zu wählen, dieses kindliche Bitten — wer weiß, wie es noch gekommen wäre, der ehemalige Depeschenreiter war ja in gewisser Hinsicht sehr schwach, wenn es nicht zu seinem Glücke geklopft hätte.
Das brachte die quecksilberne Pepita gleich wieder auf andere Gedanken, während dieses einen Momentes des Lauschens ließ sie sich die gefährdete Uhr willig aus der Hand nehmen, und Axel steckte sie schnell mit dem felsenfesten Vorsatze in die Tasche zurück, sich lieber die Kleider vom Leibe reißen zu lassen, als das Kleinod noch einmal hervorzuziehen.
»Herein!«, rief er, das Mädchen wie eine Puppe von seinem Schoße auf den Boden stellend, denn Pepita wäre ruhig darauf sitzen geblieben. In diesem Sinne war sie doch noch ein unschuldiges Kind — aber eben eine ganz gefährliche Unschuld.
Der eintretende Zimmerkellner meldete den Besuch des Herzogs von Estrada an, oder fragte an, ob der Besuch angenehm sei.
Natürlich hochwillkommen — und der schon vor der Tür Stehende trat ein.
Der noch junge Herzog war der diplomatische Stellvertreter des Papstes oder Abgesandte des Kirchenstaates für die im Dogenpalast stattfindenden Verhandlungen, die ja kriegerischer Natur waren, und so hatte der Papst lieber einen Kriegsmann, einen General, als einen Prälaten gesandt.
Er war auch derjenige, mit dem der deutsche Fürst sich näher befreundet hatte.
»Pardon — ich störe doch nicht?«
Nein, durchaus nicht. Auch die keusche Marietta fühlte sich in ihrem ziemlich tiefen Negligé nicht geniert. Eben italienisch.
Nachträglich muss noch erwähnt werden, dass der ehemalige Graf von Saint-Germain mit den Wiedergefundenen ausgemacht hatte, dass er jetzt nur noch der russische Graf Soltykow sei, der er schon immer gewesen wäre. Also es brauche niemand zu erfahren, dass er früher in Rom der Skribent Antonio Roscalli gewesen war.
Marietta, wenn sie überhaupt einen eigenen Willen besessen hätte, war hiermit umso lieber einverstanden, als ihr Gatte, der vermeintliche Skribent, damals ja von der Polizei wegen eines Verbrechens verfolgt worden war, und wenn darüber auch schon längst Graf gewachsen — es war doch besser so.
Pepita hingegen wollte doch lieber die Tochter eines geborenen Grafen sein als die eines ehemaligen Lohnschreibers, der nur wegen seiner Verdienste in den Grafenstand erhoben worden.
Freilich konnten sich die beiden jetzt noch nicht für Gräfin und Komtesse ausgeben. Das musste erst in Russland geregelt werden. Jetzt waren sie noch die Obstfrau Roscalli und ihre Tochter, welche der russische Graf auf der Straße aufgelesen und einstweilen in diesem Hotel einquartiert hatte, was also hier überhaupt nicht als ehrenrührige Sache galt, obgleich es ganz ausgeschlossen war, dass Signora Roscalli sich oder ihre Tochter von einem anderen Manne hätte in einem Hotel einquartieren lassen — es sei denn, eine Heirat wäre nachgefolgt.
Über diese Verhältnisse und Zukunftspläne war auch Fürst Alexander vorhin bei der allgemeinen Unterhaltung orientiert worden.
Der junge Herzog verzog keine Miene, als er die beiden Diplomaten hier in einem fremden Hotel in solcher holden Gesellschaft sitzen sah, und bemerkt muss werden, dass er den beiden Weibern auch dann mit dem größten Respekt entgegengekommen wäre, wenn er gewusst, dass die zwei Edelleute sie mehr aus der Gosse denn von der Straße aufgelesen hätten. Durch die Freundschaft der Edelleute, mochte sie auch noch so vorübergehend sein, waren es jetzt für ihn ›Damen‹.
»Ich bitte die erlauchten und durchlauchtigsten Herren und Damen tausendmal um Entschuldigung — ich vernahm, dass Graf Soltykow hier abgestiegen sei — und ich hörte noch eine lebhafte Unterhaltung — zu meinem freudigen Erstaunen erkenne ich nun auch Seine Durchlaucht...«

Er wurde genötigt, Platz zu nehmen, und er trank das kredenzte Glas auf das Wohl der anwesenden allerdurchlauchtigsten Damen, da fing er gar nicht erst mit »erlauchten« an — so ungefähr, wie bekanntlich in Spanien jedes uneheliche Kind als Hidalgo gilt — gesetzlich — nämlich unter der vorsichtigen Annahme, dass sein unbekannter Vater ja doch vielleicht ein Hidalgo, ein Edelmann sein könne, damit dem Kinde also nicht etwa ein Unrecht geschieht.
»Sie waren nach Schluss der Sitzung so plötzlich verschwunden, mein Fürst, und auch Sie, mein Herr Graf.«
»Ja, wir hatten etwas verabredet...«
»Nun, vielleicht komme ich doch noch nicht zu spät — wenn es Ihnen angenehm ist — jedenfalls halte ich es für meine Pflicht, es Ihnen mitzuteilen. Die Sache ist folgende: Ich wurde, wie wir ja alle, heute gegen vier Uhr in meinem Nachmittagsschlaf geweckt — um sechs Uhr sollte wieder eine Sitzung beginnen. Ich schlief weiter, bis zur letzten Minute. Als es die höchste Zeit war, als ich mich hastig ankleidete, dabei schnell einige Bissen genießend, brachte mir ein fremder Diener ein Briefchen. Oder das Kuvert enthielt sogar einen ziemlich umfangreichen Brief. Unterschrift: Marquis Pellegrini. Wenn ich auch einen Marquis dieses Namens nicht kenne, so zwang mich dieser Titel doch zu einem etwas aufmerksameren Lesen des langen Briefes. So ist eben der Mensch. Außerdem wurde unsere Sitzung ja um eine Viertelstunde später angesetzt. Freilich bemächtigte sich meiner gleich eine große Enttäuschung. Dieser Marquis war so ungeschickt, sich gleich in der Einleitung als Adept zu bezeichnen...«
»Ahaaa!!«, erklang es sofort im Chore.
Und wir müssen, ehe wir den Herzog fortfahren lassen, noch eine Erklärung einschieben.
Die zehn Jahre hatten in dieser Hinsicht nichts geändert. Das Geschäft der Goldmacher, Geisterbeschwörer, Wunderdoktoren und anderer ingeniöser Köpfe, die sich summarisch ›Adepten‹ nannten, blühte noch immer ausgezeichnet. Es blüht ja heute noch. Man braucht dabei gar nicht an spiritistische Medien zu denken, deren gläubige Anhänger, die auf jedes Geisterwort, auf jedes Tischklopfen schwören, nach Millionen zählen — nicht an moderne Heilkünstler, die nicht einmal wissen, was tierischer Magnetismus ist, und die dank derer, die nicht alle werden, auf Gummirädern fahren.
Es ist ja noch gar nicht so lange her, im Jahre 1909 nach Christi Geburt war es, in Paris, da hat doch auch so ein Wundermann ein halbes Jahr lang behauptet, er könne Diamanten machen, ein halbes Jahr haben sich die Zeitungen ganz ernsthaft mit ihm beschäftigt, die Diamantenfirma Beit & Co. gab ihm zu kostspieligen Experimenten eine halbe Million Franc — und da war dieser Adept des 20. Jahrhunderts zufrieden, er verduftete mit dieser seiner Beute.
Na, kann man denn mehr verlangen? Nein, in gewisser Hinsicht, was den Charakter des Menschen anbetrifft, ändern sich die Zeiten überhaupt niemals.
Das Bestreben aller dieser Adepten und Magier war, sich durch Privatvorstellungen in höhere Kreise einzuführen, bis an die Fürstenhöfe. Gelang ihnen dies nicht, so blieben sie Zauberkünstler zweiten, dritten und vierten Ranges, waren auf Vorstellungen in Gasthöfen, in Volkskneipen und auf den öffentlichen Marktplatz und den Platz vor der Dorflinde beschränkt.
Es gibt Geschichtsforscher genug, welche dieses Schwarzkünstlerwesen seit seinem ersten bekannten Anfang bis zur Jetztzeit regelrecht studiert und in Büchern niedergelegt haben, als Beitrag zur Kulturgeschichte der Menschheit, solchen Quellen ist auch dies entlehnt, und der selbstdenkende Leser kann nur sagen, dass sich im Laufe von 3000 Jahren darin eigentlich gar nichts geändert hat. Es bleibt immer die alte Geschichte: Die Menschen wollen nun einmal betrogen sein! Nur der Name ändert sich, der Kern der Sache bleibt doch immer derselbe, wenigstens für den, der diesen Kern zu erkennen versteht. Wollen die Menschen nicht mehr dünn werden, dann müssen sie Pillen schlucken, die sie dick machen, und sind die Haar- und Bartwuchsmittel ›abgekloppt‹, dann wird ein Wasser auf den Markt gebracht, das einen vollen, festen Busen erzeugt. Geld machen, nur Geld machen! Und diejenigen, die auf den Schwindel hereinfallen, werden nicht nur nicht alle, sondern ihrer nur noch immer mehr.
Wer einmal zum Jahrmarktsgaukler degradiert war, der kam nicht mehr in höhere Kreise, wo er Gold statt Kupfermünzen erntete. Oder er musste unter anderem Namen von vorn anfangen, was damals allerdings leichter war, wo man nicht so viel reiste wie heute und die Zeitungen nicht eine solch weite und schnelle Verbreitung hatten. Immerhin war doch die Gefahr eines Erkanntwerdens vorhanden, und dann wurde der Erkannte zur Stadt hinausgepeitscht, wenn man ihn nicht im Kerker schmachten ließ.
Denn ein möglichst pompöser Name und Titel war für solche Adepten unerlässliche Bedingung. Kleider und Namen machen nun einmal Leute. Und damals konnte das Führen von falschen Namen und Titeln noch nicht so leicht nachgewiesen werden. Wurde aber solch ein Wundermann, der sich unter hochklingendem Namen und mit Hinweis aus Empfehlungsbriefe hochgeborener Persönlichkeiten in die besseren Kreise einzuführen suchte, als ehemaliger Jahrmarktsgaukler erkannt, so war er doch eo ipso ein Betrüger, und dann ging es ihm traurig. Das Mindeste war, dass man ihn zur Stadt hinauspeitschte.
Die Reklame, welche diese Adepten trieben, konnte schon zur Zeit des Beginns unserer Erzählung nicht mehr überboten werden. Der vornehme Repräsentant dieser Zunft versicherte in Briefen und bei der persönlichen Vorstellung, der zweiten Ranges in gedruckten Prospekten und der Jahrmarktsgaukler unter Trompetengeschmetter, alles zu können, was ein mit Geistern in Verbindung stehender Hexenmeister überhaupt nur fertig bringen kann. Wie sie dann ihre Versprechungen einlösten, das war ihre Sache, blieb ihrer Schlauheit überlassen.
Auch alle anderen Reklametricks waren erschöpft, zogen nicht mehr. Am allerwenigsten das Heilen von Krüppeln. Und wenn ein Lahmer sein ganzes Leben lang herumgekrochen war, und solch ein Wundermann kam und sagte: ›Stehe auf und wandle!‹ — und der seit dreißig Jahren völlig Gelähmte konnte plötzlich seine Glieder gebrauchen — es reichte nicht mehr hin, um an die Wunderkraft zu glauben.
Man war schon zu oft betrogen worden, hatte den Schwindel aufgedeckt. Es waren schon zu viele Lahme und Taubstumme und Blinde und sonstige Krüppel aller Art ›präpariert‹ worden. Und konnte das nicht sogar dreißig Jahre und noch länger vorher vorbereitet werden? Glückte der Trick, dann war der Betreffende, der dies arrangiert hatte, ja natürlich ein gemachter Mann.
Nein, es zog nichts mehr, gar nichts mehr. Ab und zu gelang es noch einem Adepten, durch eine ganz neue, sehr geschickte Täuschung Gold zu machen, der spielte dann einige Zeit eine Rolle, zuletzt aber wurde er doch entlarvt, und die Jahrmarktsgaukler dienten nur zur allgemeinen Belustigung.
Da war der Graf von Saint-Germain gekommen und hatte wieder einmal bewiesen, dass ein wirkliches Genie zu jeder Zeit alles über den Haufen werfen kann. Wie er sich als Scheintoter in dem vermauerten Keller hatte finden lassen, seine Behauptungen, die nicht zu widerlegen waren, dass er schon im alten Babylon chaldäischer Priester gewesen sei, mit Christus und den Aposteln verkehrt habe, das war — mit unseren sehenden Augen betrachtet — wieder ein ganz neuer, origineller Trick gewesen, das hatte wieder einmal gezündet!
Das erste öffentliche Auftreten des Grafen von Saint-Germain in Rom — das damalige Publikum konnte natürlich nicht von einem ›ersten‹ sprechen — war doch nur ein sehr kurzes gewesen, nur wenige Wochen. Dann plötzlich war er spurlos verschwunden, ohne irgendwie einmal eines Betrugs oder auch nur der kleinsten Täuschung überführt worden zu sein, er hatte vielmehr einen lebendigen Beweis für seine übernatürlichen Fähigkeiten hinterlassen — in der Fürstin Eudoxia, von der wir noch zu sprechen haben werden.
Es konnte ja nicht ausbleiben, dass dies bald Nachahmer fand. Bald nach dem Verschwinden des Grafen wurden aller Orten wohlerhaltene Leichname gefunden, zum Teil unter den grässlichsten Verhältnissen, die man unter den schauderhaftesten Manipulationen wieder zum Leben erwecken konnte, und dann berichteten sie, vor wie viel Jahrtausenden sie schon gelebt hatten, die phantasievollsten gingen noch bis vor Erschaffung der Erde zurück, hatten mit Adam auf du und du gestanden — wobei sie sich sehr hüten mussten, nicht mit der kirchlichen Schöpfungslehre in Konflikt zu kommen, was der Graf von Saint-Germain, wie öfters betont wurde, immer geschickt zu vermeiden gewusst hatte, während manche seiner Nachahmer vor das Inquisitionsgericht kamen, einige sogar noch auf dem Scheiterhaufen endeten.
Der französische Historiker Jules Brahet führt siebenundsechzig solcher Adepten namentlich an, die in den Jahren 1750—1768 allein in Italien und Frankreich den Grafen von Saint-Germain zu kopieren suchten.
Kein einziger hat sich lange behaupten können. Sie alle sind bald als Betrüger entlarvt worden. Die Hauptsache war schon, dass sich kein einziger als wohlerhaltener Leichnam direkt finden lassen konnte, sondern es wurden immer mehr Leute engagiert, die solch ein Märlein erzählen mussten. Und dann vor allen Dingen fehlten ihnen allen die eminenten historischen und sonstigen Kenntnisse jenes Grafen, so dass sie sich wegen ihres früheren Lebens bald in Widersprüche verwickelten.
Nur der Graf von Saint-Germain wusste sich siegreich zu behaupten.
Freilich bedeutet diese Anerkennung eine Verherrlichung des genialen Schwindels. Aber wir müssen den ganzen Fall doch mit den Augen seiner Zeitgenossen betrachten, und indem dies hiermit gesagt wird, ist der Vorwurf, als wollten wir den genialen Schwindel verherrlichen, auch schon hinfällig geworden — — —
So war die Sachlage, als der Herzog von Estrada berichtet hatte, ein Adept, der sich Marquis Pellegrini nannte, habe sich brieflich an ihn gewandt. Diesen Kindern ihrer Zeit war das alles ja wohlbekannt.
»Wie und wo ist er denn als Scheintoter gefunden worden?«, fügte Fürst Alexander seinem ersten ›aha!‹ gleich hinzu.
»Davon erwähnte er gar nichts in seinem Briefe.«
»Nicht? Das wundert mich sehr! Oder seit wie vielen Jahrtausenden wandelt er denn schon auf Erden?«
»Auch hiervon kein Wort.«
»Was?«, lachte Axel. »Das wird ja wirklich ganz mysteriös! Der originelle Trick dieses Adepten scheint darin zu bestehen, dass er sich der größten Bescheidenheit befleißigt.«
»Er stellt tatsächlich eine ganz neue Behauptung auf, die mit Bescheidenheit freilich nichts zu tun hat.«
»Und das wäre? Gibt es denn da wirklich noch etwas Neues?«
»Dieser Marquis Pellegrini will ein Schüler des Grafen von Saint-Germain gewesen sein.«
Es war ausgesprochen.
Man hatte für die beiden Weiber zu fürchten, dass diese jetzt etwas verraten könnten.
Aber bei Marietta genügte ein faszinierender Blick des Grafen, und sie war eine teilnahmslose Natur, und die kindliche Pepita zeigte sich als vollendete Schauspielerin.
»Ach, ein Schüler des Grafen von SainGermain, von dem ich schon so viel habe erzählen hören — wie interessant!«, rief sie, und in dieser Rolle der staunenden Neugier beharrte sie.
»Ich finde nicht, dass etwas so Sensationelles dabei ist«, nahm jetzt der Graf das Wort. »Ich hielt mich seinerzeit, als dieser Saint-Germain in Rom sein Wesen trieb, gerade dort auf, und da gab es doch genug, die sich seine Schüler und Schülerinnen nannten, er hatte dort einen Klub der Namenlosen gegründet, die geheime Zusammenkünfte hielten.«
»O nein, das war wieder etwas ganz anderes. Es ist mit der Zeit offenbar geworden, dass dieser Graf von Saint-Germain nur die hochedelsten Ziele im Auge gehabt hat...«
»Wie? Das ist noch erkannt worden?«, rief der Graf mit sich plötzlich entfärbendem Gesicht, und mehr noch hätten ihn seine Augen verraten können, aus denen es wie ein Leuchten triumphierenden Glückes hervorbrach.
Hiermit verriet er auch, wenigstens für uns, dass er sich seitdem noch gar nicht darum gekümmert hatte, wie später über ihn geurteilt worden war — stets das Zeichen eines wirklich großen Mannes, der über jede Kritik erhaben ist, weil es ihm genügt, von seinem Werte selbst überzeugt zu sein.
Dem Herzog war die Erregung des Grafen entgangen, und dieser hatte sich schnell genug wieder beherrscht.
»Ja, der Graf von SaintGerman — ich war damals ein dreizehnjähriger Knabe ohne eigenes Urteil, weilte auch in Frankreich, aber mein Vater hat mir gar viel von ihm erzählt, und zwar in Begeisterung — suchte die bevorzugtesten Repräsentanten der römischen Gesellschaft um sich zu versammeln, um sie zu einem besseren, edleren Leben zu erziehen, auf dass diese wieder Lehrer der Menschheit würden...«
»Inwiefern zu einem edleren Leben?«
»Indem er ihnen das höchste Mitgefühl für alle lebendigen Wesen einprägte, indem er sie lehrte, dass alles Lebendige ein und derselben Quelle entspringt, dass alles ein und dasselbe Fleisch und Blut ist, sodass man kein Tier töten, noch weniger sein Fleisch essen darf...«
»Was ist aus diesem Klub eigentlich geworden?«
»Hat sich nach dem Verschwinden des Grafen sehr bald aufgelöst, die Mitglieder sind zu ihrer früheren Lebensweise zurückgekehrt. Die waren ja gar nicht imstande, die idealen Lehren dieses Mannes zu verstehen. Dies hatte der Graf ja von vornherein erkannt, und eben deswegen gebrauchte er als Lockmittel den Mystizismus, versprach seinen Schülern die magischen Fähigkeiten, die dieser Mann unbedingt besessen haben muss — warum nicht? Es kann solche Männer geben. ich zweifle nicht daran, hat doch Christus selbst gesagt, dass nach ihm welche kommen werden, die noch größere Wunder verrichten würden, denn er — obgleich der Graf von Saint-Germain auf diesen Ausspruch Christi niemals Bezug genommen hat. Ganz im Gegenteil, dieser Mann war die Bescheidenheit selbst, hat niemals eine Bezahlung gefordert, nicht das kleinste Geschenk angenommen, und schon dies allein ist wiederum ein Beweis, dass dieser bescheidene Mann einer der größten gewesen ist, ein wahrhafter Adept, der wirklich übernatürliche Fähigkeiten besaß.
Aber als er erkannte, wie falsch er seine Wahl getroffen hat, dass sich alle diese Herren und Damen nur deshalb große Entsagungen auferlegten, um magische Kräfte zu gewinnen, mit diesen wieder Reichtümer, Gold machen zu können, um sich dann für die Entsagungen desto reichlicher zu entschädigen — da hat dieser Mann vorgezogen, wieder zu verschwinden. Nein, von allen Mitgliedern jenes Klubs kommt niemand als eigentlicher Schüler in Betracht.«
»Wer denn sonst?«
»Der Graf hatte doch auch ziemlich viele Diener, unter ganz eigentümlichen Bedingungen engagiert, worüber ich aber jetzt nicht sprechen kann. Als Diener hatten sich auch einige römische Edelleute einzuschmuggeln gewusst, teils aus Neugier, teils aus Wissbegierde, gedachten auf diese Weise dem Wundermanne seine Geheimnisse abzulauschen. Die kommen aber ebenfalls nicht in Betracht, konnten dann nicht mehr berichten, als die Mitglieder des Klubs. Es handelt sich um eine Person, so geringfügig, dass sie nach ihrem Verschwinden damals sofort vergessen war. Sie kannten die Verhältnisse damals nicht?«
»Ich habe nur wenig über diesen Wundermann gehört«, log der Graf.
»Aber ich hielt mich damals gerade in Rom auf — inkognito«, sagte hingegen Fürst Alexander der Wahrheit gemäß.
»Ach was! Das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Nun, da werden Sie ja gleich bezeugen können, ob mir dieser jetzige Marquis Pellegrini wirklich die Wahrheit berichtet hat. Hatte der Graf von Saint-Germain einen kleinen zwölfjährigen Leibpagen namens Joseph Balsamo?«
In des Grafen Hand zerbrach das Weinglas, das er zum Munde hatte führen wollen. Es fiel nicht auf, er war ungeschickt gewesen, sonst blieb er ganz ruhig, und dasselbe galt von dem deutschen Fürsten.
Die beiden Weiber hatten diesen Pagen gar nicht kennen gelernt, nichts von seiner Flucht gehört.
»In der Tat«, sagte Axel, wie wir ihn noch manchmal nennen werden, »ich entsinne mich.«
»Er entfloh — als Dieb.«
»Davon ist mir nichts bekannt«, entgegnete Axel, der dies natürlich alles erzählt bekommen hatte, ganz im Einverständnis mit dem ruhig zuhörenden Grafen. »Was hatte er denn gestohlen?«
»Ein höchst wertvolles Manuskript, die tiefsten Geheimnisse enthaltend.«
»Was für Geheimnisse?«
»Die tiefsten Geheimnisse eben des Grafen von Saint-Germain.«
»Von wem niedergeschrieben?«
»Eben vom Grafen selbst.«
»Woher wissen Sie das?«
»Das hat mir der frühere Joseph Balsamo und jetzige Marquis Pellegrini selbst in seinem Briefe mitgeteilt.«
Dann hatte dieser Joseph Balsamo in seinem Briefe gelogen. Auf dem Titelblatte des Pergamentbandes hatte klar und deutlich gestanden, dass dieses Buch, magische Geheimnisse enthaltend, von Agrippa von Nettesheim verfasst war. Wir haben darüber früher ausführlich berichtet.
Aber Axel durfte dem nicht widersprechen, noch weniger der Graf.
»Diesen Diebstahl hat er jetzt nach zehn Jahren ganz offen bekannt?«, durfte Axel nur fragen.
»Ganz offen.«
»Das ist eine... Dreistigkeit — noch ganz milde ausgedrückt.«
»Und dennoch spricht dieses Geständnis fast zugunsten dieses Mannes.«
»Er bereut den Diebstahl?«
»Das allerdings weniger. Er ist überhaupt ein offener Charakter. So teilt er mir auch gleich ganz offen mit, dass er sich den Namen und Titel eines Marquis von Pellegrini ganz ungerechtfertigter Weise zugelegt hat. Aber er sucht diese Täuschung zu entschuldigen. Heutzutage muss eben jeder Adept einen wohlklingenden Adelstitel führen, will er in besseren und den höchsten Kreisen verkehren. Es geht einfach nicht anders. Aber der Mann bittet mich, als einen Repräsentanten des italienischen Adels, deswegen gleich um Verzeihung und um Duldung dieser doch wirklich kleinen Täuschung. Faktisch — diese Offenheit gefällt mir an dem Manne.«
So sprach der junge Herzog, nicht wissend, dass er sich selbst dadurch unter die Herdenmenschen rangierte, die niemals einen eigenen selbstgedachten Gedanken haben.
Es gibt eine Art von Schurkerei, welche nur die genialsten Schurken auszuüben verstehen: nämlich ihre Schurkerei offen einzugestehen, darum um Entschuldigung zu bitten und dann ihre Schurkerei gewissermaßen mit der Konzession der ganzen Menschheit weiter betreiben zu dürfen.
Denn die meisten Menschen lassen sich diese Manipulation düpieren, ohne zu wissen, dass sie düpiert sind.
Dieser Herzog hatte sich düpieren lassen, war diesem raffinierten Schurkenstückchen bereits unterlegen.
Der deutsche Fürst und der italienische Abenteurer, der sich Graf von Saint-Germain nannte, ließen sich nicht täuschen, sie gehörten zu den seltenen Menschen, die sich von der Herde abgesondert haben — den ersteren, ein ehrenhafter Charakter, schützte seine theoretische Philosophie vor dieser Täuschung, der andere gehörte selber zu dieser Kategorie von Scheinheiligen, der kannte die ganze Geschichte aus eigener Praxis — ihre Ansicht über diesen Fall sagten sie alle beide nicht. Mochte doch der Herzog in seinem naiven Glauben bleiben.
»Ja, was hat er Ihnen denn sonst geschrieben?«
»Wunderbares genug. Ich muss den Brief in der Eile unter meine anderen Papiere verpackt haben, konnte ihn vorhin nicht finden, kann Ihnen aber alles sinngetreu berichten.
Der zwölfjährige Joseph war wegen schlechter Behandlung einer Klosterschule entlaufen, kam nach Rom, zur Zeit, als zuerst der Graf von Saint-Germain von sich reden machte.
Der Wundermann zog den aufgeweckten Knaben mächtig an. Der Graf suchte gerade Diener — es gelang Joseph, als Page anzukommen...«
»Auf welche Weise?«, schaltete sich Axel einmal ein.
»Darüber hat er nicht weiter berichtet. Ich habe ihn ja vorhin selbst gesprochen — er ist selbst ein wunderbarer Mann geworden, man unterliegt sofort dem Zauber seiner ganzen Persönlichkeit, wie Sie dann ja selbst empfinden werden.
So glaube ich gern, dass auch der Graf in dem zwölfjährigen Knaben gleich den zukünftigen Menschenbeherrschter erkannte — er machte ihn zu seinem Leibpagen, der Tag und Nacht bei ihm sein musste, wollte ihn zu seinem Nachfolger, zu seiner rechten Hand erziehen.
Der kleine Joseph vergalt die ihm erwiesenen Wohltaten mit schnödestem Undank. Der Graf hatte ihm gesagt, dass er ihn zum magischen Adepten ausbilden würde, und der Unterricht hatte auch schon begonnen und einige Wochen gewährt — aber dem jugendlichen Feuerkopfe ging es nicht schnell genug.
Eines Tages war Joseph verschwunden, und er hatte das Manuskript mitgenommen, in dem er seinen Meister so oft hatte studieren sehen — die eigene Handschrift des Grafen, in der er seine tiefsten Geheimnisse niedergelegt hatte.
Aber der Graf hatte sich dabei der lateinischen Sprache bedient. Und Joseph konnte kein Latein, oder hatte in der Klosterschule erst mit den Anfangsgründen begonnen.
Sollte er nun das unschätzbare Buch von einem anderen übersetzen lassen? Dann wäre auch dieser in den Besitz der magischen Rezepte und sonstigen Geheimnisse gekommen.
Nein, Joseph wollte mit keinem anderen teilen.
Und der zwölfjährige Junge zeigte eine ganz ungewöhnliche Energie. Er hatte sich in ein kleines Städtchen begeben, hier machte er sich in einem Mansardenstübchen mit Feuereifer daran, nach einem Leitfaden die lateinische Sprache zu studieren, Miete und die kärglichste Nahrung sich nebenbei durch Gelegenheitsarbeit verdienend.
Aber er sollte sein Ziel nicht erreichen, wenigstens nicht in der von ihm beschlossenen Weise. Er hatte nicht mit der magischen Kraft seines Herrn und Meisters gerechnet. Dieser setzte dem Flüchtling allerdings nicht nach, sondern er bezwang ihn in ganz anderer Weise, solch einem Magier ganz entsprechend.
Nachträglich bemerkt sei noch, dass sich der kleine Joseph umso sicherer fühlte, weil er die plötzliche Abreise des Grafen mit dem schwarzen Schiffe erfahren hatte.
Da aber mit einem Male wurde Joseph, als er nun so ganz ruhig in seiner Mansarde zu studieren gedachte, von einem ganz seltsamen, unwiderstehlichen Drange befallen, in die Welt zu wandern, dem Süden zu, und ob er nun wollte oder nicht, er musste diesem merkwürdigen, ihm ganz unerklärlichen Drange gehorchen.
So wanderte er fort, dem Süden zu. Wohin, warum — keine Ahnung. Das Buch hatte er mitgenommen, und das war auch wieder solch ein geheimnisvoller Befehl gewesen. Überdies hätte er es sowieso mitgenommen.
Das Gefühl, welches ihn auf seiner Wanderschaft bis nach Brindisi beherrscht hat, vermochte er weder schriftlich noch vorhin mir mündlich wiederzugeben. Er stand eben unter einem allgewaltigen fremden Banne, und das Merkwürdigste dabei war, dass er während der mehrwöchentlichen Wanderung weder Speise noch Trank noch Schlafes bedurfte. Wandern, wandern, nur immer wandern, und er brauchte an keinem Kreuzwege stehen zu bleiben, seine Schritte wurden von einer unsichtbaren Macht gelenkt, seine Füße förmlich vorwärtsgezogen, und dieselbe Macht gebot ihm auch, immer das ziemlich schwere Buch krampfhaft in den Armen zu halten.
So erreichte er Brindisi. Und wieder veranlasste ihn diese geheimnisvolle Macht, unbemerkt in ein im Hafen liegendes Schiff zu kriechen, sich im Kielraum zu verstecken — die rätselhafte Macht schob ihn immer im geeignetsten Moment vorwärts.
Das Schiff ging ab. Joseph hatte keine Ahnung, wohin. Als nach langer, stürmischer Fahrt die Anker fielen, kroch Joseph wieder unbemerkt hervor, begab sich an Land...«
»Erlauben Sie mal«, unterbrach Axel den Erzähler. »Er hat während dieser Wochen nichts gegessen und nichts getrunken?«
»Gar nichts. So hat er mir schriftlich berichtet und dasselbe vorhin mündlich bestätigt.«
»So, so. Nun, bitte, weiter.«
»Der Hafen war Alexandrien. Doch der Junge hatte nicht viel Zeit, sich umzuschauen. Die geheimnisvolle Macht trieb ihn immer weiter, dem Süden zu, den Nil entlang. So erreichte er Kairo. Aber davon weiß er gar nichts mehr. Jetzt will er erst recht von einer Art Taumel befallen worden sein. Nur das weiß er noch, dass er plötzlich gezwungen wurde, nach Westen zu marschieren. Bis er vor sich einige mächtige Steinbauten aus der Wüste auftauchen sah...«
»Die Pyramiden von Gizeh.«
»Ja, aber der kleine Joseph hatte noch gar nichts von Pyramiden gehört. Er marschierte auf die größte zu, musste es, seine Schritte wurden gelenkt, dabei immer das dicke Buch unter den Arm geklemmt. Plötzlich verlor er den Boden unter den Füßen, der Wüstensand hatte ihn verschlungen.
Als er aus tiefer Ohnmacht erwachte, befand er sich in einem unterirdischen Raume, und vor ihm stand... der Graf von Saint-Germain...«
»Der Graf von Saint-Germain!!«, echoten die beiden Weiber, welche der Erzählung mit atemloser Spannung gelauscht hatten, während die beiden Männer einen schnellen Blick wechselten.
»Der Graf hatte ihn durch seine magische Kraft herbeigezogen!«, setzte Marietta noch hinzu, und es war gut, dass sie keinen anderen Gedanken hatte.
»Selbstverständlich«, bestätigte der Herzog, »er hatte sein Buch wiederhaben wollen — und auch seinen Schüler, um dessen Ausbildung persönlich fortzusetzen.«
»Das hat Ihnen der jetzige Marquis Pellegrini alles so ausführlich geschrieben?«, fragte Axel.
»Nicht so ganz, ich habe etwas umständlicher erzählt und....«, der Herzog blickte nach seiner Uhr, »werde mich jetzt ganz kurz fassen, denn wir haben nur noch zwanzig Minuten Zeit.
Es war die Cheopspyramide. In ihr hat Joseph Balsamo neun Jahre verbracht, ohne wieder einmal das Licht der Sonne zu erblicken, Tag und Nacht unterrichtet werdend von dem Grafen, der ihn noch immer zu seinem Nachfolger bestimmt hatte.
Aber er hatte in den unterirdischen Kammern, die sich zahllos unter der Pyramide hin erstrecken, auch noch andere Lehrer.
Ich gebe wieder, was mir der Marquis vorhin mündlich berichtete. Seit uralten Zeiten, seit Erschaffung der Welt hat es eine geheime Verbrüderung von Magiern gegeben, die es nicht nötig haben, immer im fleischlichen Leibe zu wandeln. Es ist eine uniierte Freimaurerloge, die das ganze Weltall umfasst, jeder Planet hat seine Zweigloge, mancher Planet mehrere. So besitzt unsere Erde die Loge der Mahatmas, die ihren Sitz auf dem höchsten Gipfel des Himalajas hat — von dieser hat ja auch schon damals der Graf berichtet, aber nicht, dass es noch eine zweite gibt: die Loge der ägyptischen Ordensbrüder, die in der Cheopspyramide residiert. An diesen beiden Punkten kommen die Brüder auf geistigem Wege manchmal zusammen, von hier aus werden die Schicksale der Völker wie der einzelnen Menschen wie der ganzen Erde geleitet, jede der beiden Logen hat dabei ihre spezielle Aufgabe, beide korrespondieren ständig zusammen.
Bisher hatte der Magier, der sich in seinen beiden letzten Lebensläufen Graf von Saint-Germain nannte, der Loge der indischen Mahatmas angehört — wie der Graf ja selbst berichtet hatte. Er war von seinen Oberen geschickt worden, um der Welt zu verkünden, dass der richtig lebende Mensch nicht zu sterben braucht. Dieser Aufgabe ist der Graf nicht ordentlich nachgekommen; er soll sehr eigenmächtig gehandelt haben. So ist er zurückberufen worden, wurde zur Loge der ägyptischen Ordensbrüder versetzt, was allerdings nicht gerade einer Degradierung gleichkommt.
Aber öffentlich wirken darf er jetzt nicht mehr. Er selbst bedarf jetzt noch eines vielhundertjährigen Unterrichtes. Trotzdem soll das Werk, für das er selbst bestimmt gewesen, fortgesetzt werden, er selbst musste seinen Nachfolger bestimmen.
Seine Wahl blieb nach wie vor bei dem kleinen Joseph Balsamo. So wurde dieser durch magische Kraft nach der Cheopspyramide entführt. Nur dass das nicht so ganz geistig ging, man musste auch den Körper mitschleppen.
Also neun Jahre lang hat Joseph in der Pyramide Unterricht genossen, meistens vom Grafen, der ja schon am besten in die ganze Mission eingeweiht war, aber auch von anderen Ordensbrüdern, sogar vom Großkophta selbst, wie der Vorsteher dieser Geisterloge heißt.
Jetzt ist dieser so ausgebildete Schüler unter dem Namen eines Marquis Pellegrini in die Welt geschickt worden, um das Werk des Grafen von Saint-Germain fortzusetzen, oder es auch ganz von vorn wieder zu beginnen. Als erste Stadt hat sich der Marquis Genua ausgesucht, hier will er seine Tätigkeit eröffnen. Heute Mittag ist er hier eingetroffen, ist in diesem Hotel hier abgestiegen. Dass die maßgebendsten Persönlichkeiten ganz Italiens in Genua versammelt sind, passt wohl am besten für seine Zwecke. Das haben diese Logenbrüder natürlich vorausgesehen, deshalb wurde er gerade hierher geschickt. Sehr schmeichelhaft für mich ist, dass gerade ich ausersehen wurde, an den er den ausführlichen Brief schrieb.
In diesem erbietet er sich nun zum Schluss, eine Vorstellung zu geben, in der er beweist, dass er tatsächlich ein würdiger Nachfolger des in seiner Magierehre unantastbaren Grafen von Saint-Germain ist, sogar noch ganz andere magische Fähigkeiten besitzt als dieser. Die Zeit und den Ort der Vorstellung sollte ich bestimmen, ich möchte dazu doch möglichst viel Freunde und sonstige Herren aus meinen Kreisen mitbringen.
Wohl, ich habe darauf sofort reagiert, schickte gleich einen Diener: hier in seinem Hotel gegen Mitternacht. Denn länger als bis Mitternacht, sagte ich mir, würde unsere Sitzung doch nicht währen.
Nach Schluss der Sitzung, der schon gegen zehn Uhr erfolgte, habe ich die Einladung gleich an alle Versammelten ergehen lassen, denselben Bericht wie jetzt gegeben. Nur wenige waren am Mitgehen verhindert. Jetzt ist hier ein Dutzend Herren versammelt. Wir warten nur noch auf den Dogen von Genua, der sein Erscheinen bestimmt zugesagt hat, dann kann die Geschichte losgehen.
Und Sie, mein Fürst und mein Graf, waren nach Schluss der Sitzung plötzlich verschwunden. Da vernahm ich vorhin, dass Graf Soltykow hier abgestiegen sei, begleitet von einem Herrn mit einem mächtigen Vollbart. Sollte das nicht Fürst Alexander sein? Ich hörte hier lebhaft sprechen — richtig, ich kann Sie noch einladen, der Vorstellung beizuwohnen.«
»Ach, wenn wir da auch zusehen könnten!«, rief Pepita.
»Aber selbstverständlich, meine Damen....«
»Rasch, Mama, rasch anziehen — welch ein Glück, dass wir ganz neue Kleider haben!«
Sie riss die Mutter mit sich in das Nebenzimmer, ob diese wollte oder nicht.
»Sind auch Damen dabei?«, fragte Fürst Alexander, das Wort ›Damen‹ stark betonend.
»Nein, keine einzige, nur Herren«, lächelte der Herzog »und wenn es auch der Fall wäre — es hat jeder Zutritt, den ich einlade, und solch eine magische Sitzung ist doch etwas ganz anderes als eine Theatervorstellung, wobei man den Zuschauerraum kritischer beobachtet als die Bühne. Ja, meine Herren, was sagen Sie nun zu alledem, was uns dieser nun aufgetauchte Adept da wieder vormacht?«
Was sollte man dazu sagen? Diese beiden hier hatten noch ganz besonderen Grund, mit ihrer Meinung höchst vorsichtig zu sein.
»Wir wollen erst die Vorstellung abwarten«, meinte Axel.
»Das habe ich mir auch gleich gesagt«, stimmte der Herzog bei. »Taten sprechen besser als Worte, die er schriftlich und vorhin auch mündlich so zahlreich verschwendet hat, obgleich ich sagen muss, dass er durchaus nicht solch einen scharlatanhaften Eindruck machte wie alle anderen Adepten, die vor pomphafter Eitelkeit immer bald platzen möchten oder platzen zu müssen glauben, weil sie ein derartig anmaßendes Wesen für ihren Magierlauf nun einmal für unbedingt erforderlich halten. Er tritt sogar äußerst bescheiden auf — und dennoch, wie schon gesagt, der geborene Menschenbeherrscher, um nicht zu sagen Welteroberer. Eine ganz faszinierende Manneserscheinung, noch viel, viel imposanter wirkend als der Graf von Germain, so wie mir dieser wenigstens beschrieben wurde.«
Und dies alles musste nun der echte Graf von Germain ruhig mit anhören. Axel glaubte, mit ihm fühlen zu können.
»Der Graf von Saint-Germain hat sich von Rom sofort nach Ägvpten begeben?«, nahm dieser selbst wieder das Wort.
»Das hat mir der Marquis nicht näher berichtet, aber jedenfalls doch.«
»Und er hat die Pyramide nie wieder verlassen während der neun Jahre?«
»Wohl nicht, denn er hat seinen ehemaligen Pagen ununterbrochen unterrichtet. Und er darf die Pyramide auch für einige Jahrhunderte nicht verlassen, muss selbst noch strengen Unterricht haben, das sagte mir der Marquis noch.«
»Für einige Jahrhunderte, so so«, wiederholte der Graf recht schwermütig, was aber nicht weiter auffiel — wenigstens nicht dem Herzog.
»Apropos«, nahm der deutsche Fürst das Wort, wohl um seinem tiefsinnigen Freunde zu Hilfe zu kommen, »Tag und Nacht ist der Schüler unterrichtet worden?«
»Tag und Nacht im buchstäblichen Sinne des Wortes — so versicherte mir der Marquis.«
»Da bedarf auch er gar keines Schlafes?«
»Nicht während der neun Unterrichtsjahre, nicht in jener Pyramide, die man ja mit einem Geisterreiche vergleichen kann, brauchte er den irdischen Schlaf, so wenig wie Speise und Trank.«
»Und wie hält er es hier?«
»Hier unter den Menschen schläft, isst und trinkt er wie ein anderer Mensch, und er versicherte mir sogar mit bescheidenem Lächeln, dass er ein Freund einer recht guten Tafel sei.«
»So so. Und wie rechtfertigt er diese irdischen Gelüste, er als Schüler und Nachfolger des Grafen von Saint-Germain, der über solche Schwächen erhaben war?«
»O, das wusste er ganz vortrefflich zu rechtfertigen. Ja, hier kommt sogar die Hauptsache in Betracht. Der Graf hatte sich eben nicht so verhalten, wie ihm von seinen geistigen Oberen streng vorgeschrieben worden war, hatte eigenmächtig gehandelt, von einem falschen Ehrgeiz geleitet. Er hatte ganz als Mensch auftreten sollen. Hat etwa Christus keines Schlafes, keiner Nahrung bedurft?
Wohl hätte Gottes Sohn das alles entbehren können, aber er wollte ein Mensch unter Menschen sein, und deshalb hat er auch nicht die Legion Engel zur Hilfe gerufen, die ihm zur Verfügung standen, als er den Tod eines Schachers am Kreuze erlitt. Der Graf von Saint-Germain aber, von falschem Ehrgeiz getrieben, gebrauchte seine magischen Fähigkeiten auch dazu, sich des Schlafes und aller Nahrung zu enthalten, um vor den Leuten zu glänzen — ja, es war auch nichts anderes als falscher Ehrgeiz, dass er niemals Bezahlung forderte und Geschenke annahm. So berichtete mir der Marquis noch.«
»Aha, dieser sein Schüler und Nachfolger wird also für seine Gaukeleien Bezahlung fordern und annehmen!«, sagte Axel.
»Er sprach nicht direkt davon, aber die Andeutung war wohl schon deutlich genug. Jedenfalls hatte der Graf seine Vorschriften übertreten, dafür hat er nun eine vielhundertjährige Strafe abzuleisten. Denn um eine Strafe handelt es sich.«
»Nimmt er auch diese Vorstellung bezahlt?«
»Nein, durch diese will er sich ja erst einführen.«
»Natürlich, natürlich, erst einführen«, spottete Axel. »Und zu welchen hohen Zielen will nun der die Menschheit gegen Bezahlung führen?«
»Er lehrt ebenfalls die körperliche Unsterblichkeit, aber doch wieder ganz anders als der Graf von...«
Der Herzog brach ab und lauschte. Auf dem Korridor wurden Stimmen hörbar.
»Da scheint der Doge gekommen zu sein. Ich hole Sie ab, wenn es so weit ist, und sollten die Damen noch nicht fertig sein, so warten wir eben noch etwas.«
Der Herzog verließ das Zimmer.
Die beiden ehemaligen Freunde waren allein. Die ›Damen‹ hatten die Nebentür geschlossen.
Einige Minuten vergingen in drückendem Schweigen.
In sich zusammengesunken saß der Graf auf dem Sofa, den weißhaarigen Kopf tief auf der Brust.
Ach, sein alter Freund wusste ja nur zu gut, was in ihm jetzt vorging, was ihn so furchtbar bedrückte, und er wagte ihn nicht zu stören.
Endlich bewegten sich die farblos gewordenen Lippen.
»Aus falschem Ehrgeiz — ich —!«, erklang es murmelnd, nichts weiter.
Dem deutschen Fürsten aber hatte dies die Sprache wiedergegeben.
»Das ist ja die verwegenste Frechheit, die mir je vorgekommen! Der Kerl glaubt einfach, Sie sind tot — muss von dem Tode des Grafen von Saint- Germain felsenfest überzeugt worden sein. Anders ist es ja gar nicht möglich!«
Der Graf antwortete nicht.
»Na, den werden Sie doch tüchtig zur Rechenschaft ziehen!«
Der Graf antwortete nicht, verharrte regungslos in seiner tiefgedrückten Stellung.
»Sie wollen nicht? Freilich, dann müssen Sie sich auch zu erkennen geben. Denn von allein erkennt er Sie sicher nicht, sonst müssten das auch meine Augen tun, die noch nichts von ihrer Depeschenreiterschärfe eingebüsst haben. Na, da wird sich schon ein Ausweg finden lassen, und wenn Sie dann wieder in der Einsamkeit verschwinden wollen, so hat das ja auch nichts zu sagen. O, diesem Burschen muss fürchterlich klar gemacht werden, dass der Graf von Saint-Germain weder tot ist noch in der Cheopspyramide gefangengehalten wird. Oder er ist eben von dort entsprungen, auf geisterhafte Weise — das gibt sogar eine vortreffliche Komödie, die möchte ich arrangieren und dabei selbst mitspielen.«
Der Graf rührte sich nicht.
Plötzlich stutzte Axel, als er jenen immer aufmerksamer betrachtete.
»Graf!«
Noch immer keine Antwort.
»Hören Sie mich sprechen?«
»Was wünschen Sie?«, wurde zurückgeflüstert.
»Hat dieser... Schuft, der er doch offenbar ist — Sie etwa... in der Tasche? Weiß er etwas von Ihnen, womit er Sie... an den Pranger stellen könnte?«
Wieder keine Antwort, der Graf senkte nur den Kopf noch tiefer auf die Brust — und das war auch eine Antwort, eine bejahende.
Da fragte Axel nicht weiter — er konnte seinen alten Freund nur bedauern.
Hätte er freilich erfahren, inwiefern dieser ehemalige Leibpage den Grafen in der Tasche hatte, was er von ihm wusste, er hätte schon jetzt darüber gelacht, so wie er es später tat, als der Graf es ihm offenbarte. Denn es war wirklich nur eine Kleinigkeit. Aber der Graf nahm sie nun einmal für ein Kapitalverbrechen.
Auf diese Weise also hat sich der spätere Cagliostro als Adept in der Öffentlichkeit eingeführt, zuerst unter dem Namen eines Marquis Pellegrini.
Und wie er das nun getan, das war wieder einmal ein vollständig neuer, origineller Trick gewesen, der hatte seine Wirkung nicht versagt.
Denn im Laufe dieser zehn Jahre war noch kein anderer dieser Hokuspokusmacher auf den Gedanken gekommen, sich für den Schüler oder gar von ihm selbst bestimmten Nachfolger von Saint-Germain auszugeben.
Oder hatte einer einmal einen derartigen Gedanken gefasst, so hatte er doch auch gleich eingesehen, dass er nicht imstande war, ihn auszuführen.
Denn ein Schüler und Nachfolger dieses Grafen musste ihm doch auch ähnlich sein, musste doch wenigstens einen Bruchteil seiner eminenten Kenntnisse besitzen, und woher die nehmen? Und der Nachfolger dieses Wundermannes durfte doch auch nicht schlafen, nicht essen und nicht trinken, und wie das anfangen? Wenn man da zur Prüfung nun eingesperrt wurde? Jener Graf hatte auch niemals eine Bezahlung angenommen — und was sollte solch ein Adept, mochte er das Geld auch haufenweise machen können, ohne klingende Belohnung anfangen?
Nein, das war nichts.
Joseph Balsamo nun hat alle diese Schwierigkeiten in äußerst schlauer Weise zu umgehen gewusst. Wie er sich das Märlein mit dem Grafen ausgesonnen, der von dem, was er wusste, gar zu viel gezeigt hatte, für welchen frevelhaften Ehrgeiz er bestraft wurde — einen schlaueren Trick hätte dieser sein vorgeblicher Nachfolger ja gar nicht finden können.
Denn, was der Herzog noch gar nicht erwähnt, auch mit seinen Kenntnissen, mit seiner fabelhaften Gedächtniskraft soll der Graf von Saint-Germain viel zu sehr geprahlt haben, obgleich unter dem Deckmantel der Bescheidenheit — entgegen seiner Vorschrift.
Auf diese Weise brauchte sein Nachfolger gar keine besondere Gelehrsamkeit zu besitzen.
Trotzdem muss auch Cagliostro außerordentliche Kenntnisse besessen haben. Das bezeugt besonders Lavater, der damals als der größte Universalgelehrte Deutschlands galt und mit Cagliostro eine lange Unterredung hatte, ihn einem Examen unterwarf.
Doch wird Cagliostro wohl auch die Kunst verstanden haben, nur zu antworten, wenn er wollte und konnte, dem anderen nur die ihm bequemen Fragen in den Mund zu legen, und das hat dieser geniale Mann bei dem biederen, kindlichnaiven Lavater wohl sehr leicht fertig gebracht.
Lavater, also der damalige Großminister der gebildeten Welt, der Jupiter — er hat es gesagt! — hat auch auf Cagliostros magische Fähigkeiten geschworen.
Übrigens ist auch Cagliostro niemals als Betrüger gebrandmarkt worden.
Ja, als Betrüger entlarvt, das wurde er oft genug, aber nicht als Betrüger öffentlich gebrandmarkt. Das ist nämlich ein großer Unterschied.
Dieser mit allen Hunden gehetzte Scharlatan wusste, wenn er einmal bei einem betrügerischen Taschenspielerkniff ertappt wurde, dessen Resultat er für das Werk von Geisterhänden ausgeben wollte, die Sache immer so zu wenden, bis er wieder in völliger Unschuld dastand. Dann hatten ihn erst die Geister zu diesem Betruge verleitet, er selbst war der Betrogene — oder so ähnlich.
Was dem Cagliostro den Hals brach, das war seine unsinnige Verschwendungssucht, die ihn, obgleich er für andere das Geld klumpenweise machte, in fortwährender Geldverlegenheit hielt, dadurch wurde er zum direkten Betrüger, zum Hochstapler und Urkundenfälscher.
Von dieser seiner Verschwendungssucht war anfangs freilich nichts zu bemerken.
Wo sich Joseph Balsamo die zehn Jahre aufgehalten, hat man nicht in Erfahrung bringen können. Jedenfalls hat er da seine wirklich sehr großen Kenntnisse gesammelt, wobei ihn ein außerordentliches Gedächtnis unterstützte, wenn dieses auch nicht mit dem des Grafen von Saint-Germain zu vergleichen war.
Dann erschien er also zuerst in Genua als ein Marquis Pellegrini.
Den Namen wechselte er oft, trieb sich im Laufe einiger Jahre in Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Portugal als Marquis d'Anna, Graf Fennix, Melissa, Belmonte und Harnt umher.
Während dieser seiner ersten Periode befleißigte er sich immer eines bescheidenen, wenn auch vornehmen Auftretens, jedenfalls vermied er Prunk und Scharlatanerie und zeichnete sich schon hierdurch sehr vorteilhaft vor den anderen Adepten aus, auch das war eigentlich nur ein origineller Trick, der seine Wirkung nicht versagte.
In seinem Charakter lag diese Bescheidenheit nicht. Zuletzt in Lissabon als Graf Harnt des Führens eines falschen Namens angeklagt, ging er nach London, nahm hier den Geburtsnamen seiner Tante Vicente Cagliostro an, ihm freilich wieder den Titel eines Grafen vorsetzend — und von hier an begann seine wirklich glänzende Laufbahn.
Was für eine Rolle dieser Mann gespielt hat, können wir heute gar nicht mehr erfassen. Am besten wird es daraus ersichtlich, dass, wie schon einmal erwähnt, damals die Herren und Damen Fächer, Ringe, Souvenirs, Hüte, Knöpfe, Schuhe, Westen, Strümpfe usw. usw. à la Cagliostro trugen, und diese Mode verbreitete sich von London aus über die ganze zivilisierte Welt.
Damit legte Joseph Balsamo aber auch seine ihm widernatürliche Bescheidenheit ab, jetzt ernannte er sich selbst zum Großkophta der von ihm zusammenphantasierten ägyptischen Freimaurerloge und damit auch zum Herrn der ganzen Erde und sämtlicher Geisterreiche, huldigte dem pomphaftesten Prunk und ergab sich dem ausschweifendsten Lebenswandel.
Hierdurch geriet er trotz seiner Geldmacherkunst in Schulden über Schulden, die ihn zum betrügerischen Hochstapler und Urkundenfälscher machten, und zuletzt scheute er sich nicht mehr, mit den Reizen seiner Frau zu wuchern, sie an den Meistbietenden zu verkuppeln.
In dem Saale des großen Hotels war ein Dutzend Männer versammelt, welche zusammen die politische Macht Italiens repräsentierten, wozu noch der fürstliche Vertreter des Preußenkönigs und der gräfliche einer mächtigen Hofpartei Russlands kamen, welch letzterer zwei verschleierte Damen mitgebracht hatte, die unerkannt zu bleiben wünschten.
Der Marquis Pellegrini, der Nachfolger des Grafen von Saint-Germain, erschien.
Wenn man geglaubt, er würde sich als phantastisch herausgeputzter ägyptischer Oberpriester präsentieren, mit dem mit Hieroglyphen bedeckten Kaftan, auf dem Kopfe die chaldäische Mütze — und anders konnte man sich damals solch einen Adepten bei der Vorstellung gar nicht denken — so war man sehr enttäuscht.
Er trug einen Gesellschaftsanzug nach damaliger Mode, wohl vom feinsten Stoffe, aber sonst ganz schlicht, ohne jede Auffälligkeit.
Und doch — der Herzog von Estrado hatte es schon gesagt.
Dieser Mann hätte auch als Kellner, als Arbeiter eintreten können, und sofort wäre ebenfalls jedes Gespräch verstummt, wie es jetzt geschah.
Es muss nach den Berichten der Zeitgenossen eine Gestalt von wunderbar, von zauberhaft imponierender Erscheinung gewesen sein.
Aber die Beschreibung selbst macht fast das Zerrbild eines Menschen daraus.
Es hatte ja schon in dem zwölfjährigen Jungen gelegen.
Ein Mann unter Mittelgröße, dick, schon mit seinen 22 Jahren einen Schmerbauch habend — ein sogenannter keiner, dicker Stöpsel — ausgestattet mit einem Paar ungeheurer Schultern, die Oberarmgelenke wie Kanonenkugeln hervortretend — auf diesen Schultern ein mächtiger Stierkopf, mit einem plumpen Gesicht, Ohren und Nase und Mund und alles plump und massig — nun aber unter den buschigen Brauen ein großes Augenpaar von solch durchdringendem Feuer, dass ihm kein anderes menschliches Auge standhalten konnte.
So präsentierte sich der zukünftige Cagliostro.
Der Löwe war eingetreten, die Mäuslein duckten sich zusammen. Wäre es eine gewöhnliche Katze gewesen, so wären die Mäuslein davongehuscht. Der Löwe ließ sie gar nicht so weit kommen. Sie duckten sich zusammen, ergaben sich in ihr Schicksal.
Ist es denn möglich, schildern zu wollen, woher solch eine faszinierende Wirkung kommt?
»Cagliostro«, schreibt Jules Brahet, der diesen Mann wohl am besten gekannt hat, auch als Betrüger, »war der geborene Weltbezwinger, alles an ihm war unterjochend, schon sein mächtiger Schritt...«
Ja, dieser kleine, dicke Mann schritt mächtig wie ein Löwe einher — vergessen war die ganze sonstige Karikatur dieser Erscheinung, wie er zum Beispiel beim Gehen noch ganz besonders den Bauch hervorreckte, wie er sich dabei in den Hüften wiegte. (Es möchte hierbei erwähnt werden, dass man solche sehr kleine, dicke Gestalten mit Bauch, ungeheueren Schultern und Stiernacken, abgebrochene Riesen, die sich beim Gehen so wiegen, die der Beschreibung nach eigentlich Karikaturen sein müssten, aber in Wirklichkeit wunderbar imponierende Erscheinungen sind, alles Kraft und Kühnheit und Selbstbewusstsein, sehr häufig unter den Japanern findet.)
»Bona sera.«
Hätten die Mäuslein noch gepiepst, so wären sie jetzt verstummt.
Denn jetzt hatte der Löwe auch gesprochen.
Alle Zeitgenossen Cagliostros, die ihn persönlich gekannt haben, äußern sich darüber, was für eine Stimme dieser Mann besessen hat. Sie soll wie ein volles, ehernes Glockengeläute geklungen haben, gegen das jeder andere menschliche Laut verschwand, das lauteste Lärmen der größten Volksversammlung übertönend, es sofort zum Schweigen bringend.
So sah der Graf von Saint-Germain den Mann eintreten, der sich betrügerischerweise seinen Nachfolger nannte, so hatte er ihn sprechen hören, nur zwei Worte, aber es hatte genügt.
»Wehe«, flüsterte er seinem Freunde mit farblosem Gesicht zu, »dieser Mann ist mir hundertfach überlegen, und mir ist das Mittel genommen, ihn als einen Lügner und Betrüger zu entlarven!«
Der Graf nahm den Mund wohl etwas sehr voll, wenn er gleich von ›hundertfacher Überlegenheit‹ sprach, dass er es aber tat, nur auf den allerersten Eindruck hin, ohne von diesem Manne irgend etwas anderes gesehen zu haben, wonach er sein Können zu beurteilen vermochte, das sagt wohl am deutlichsten, was für einen Eindruck dieser Mann gleich beim ersten Blick machte.
Bisher hatte ihn nur der Herzog von Estrada gesehen und gesprochen, dieser übernahm jetzt die Vorstellung, und obgleich es also nur die ersten Männer Italiens waren, oder doch deren Stellvertreter, war es doch nicht anders, als wenn frischgeadelte Emporkömmlinge zum ersten Male Seiner Majestät, der sie ihre nunmehrige ›Erstklassigkeit‹ zu verdanken haben, vorgestellt werden.
Auch die beiden Damen kamen daran.
»Zwei Freundinnen des Grafen Soltykow, welche mit Ihrer gütigen Erlaubnis unerkannt zu bleiben wünschen.«
So hatte der Herzog mit lauter Stimme gesagt, dann setzte er noch einige ganz leise Worte hinzu, die Eigenschaft dieser beiden ›Damen‹ wohl etwas näher erklärend — ein gnädiges Kopfnicken Seiner Majestät, und sie hatte ihre gütige Erlaubnis erteilt.
Ob aber die dichten Schleier für diese in unbeschreiblichem Feuer lodernden Augen auch wirklich undurchdringlich waren?
Seinen ehemaligen Herrn aber hatte Joseph Balsamo in dem ihm vorgestellten Grafen Soltykow nicht erkannt, darauf hätte Axel gleich schwören können. Durch irgend etwas hätte er sich dann doch wohl verraten müssen.
In der Folge blieb der Marquis Pellegrini immer bei der allergrößten Höflichkeit, gepaart mit einer großen Bescheidenheit — die trotzdem vorhandene stolze Unnahbarkeit wurde ihm eigentlich mehr von der anderen Seite aus zugeschoben. In dieser Hinsicht war sein ganzes Auftreten wirklich außerordentlich verwandt mit dem des ehemaligen Grafen von Saint-Germain.
»Hatten Herr Herzog die Freundlichkeit, den Herren über mich zu berichten?«
»Ich tat es.«
»So habe ich dem nichts mehr hinzuzufügen, jetzt müssen Taten die Wahrheit meiner Angaben beweisen. Soll ich die Vorstellung hier in diesem Saale geben?«
»Wie Sie wünschen.«
»Ich betrete diesen Raum zum ersten Male, wenn Sie aber irgendein anderes Zimmer bestimmen wollen, falls Sie glauben, ich hätte Vorbereitungen treffen können...«
»O, Herr Marquis!«, erklang es im Chore, solch einen Verdacht energisch zurückweisend.
»Also hier in diesem Saale.«
»Jawohl — oder wie Sie sonst bestimmen.«
»Gut, bleiben wir hier! Bedienung habe ich nicht bei mir, brauche auch keine fremde Hilfe, wenigstens keine sichtbare irdische. Wollen die Herren mich jetzt am ganzen Körper visitieren, dass ich nicht etwa betrügerische Hilfsmittel...«
»O, Herr Marquis!«
»Die Herren wollen mich nicht visitieren?«
»Nein, auf keinen Fall!«
»Wie Sie bestimmen! Weitere Vorbereitungen brauche ich nicht, ich verschmähe prinzipiell auch allen einleitenden Hokuspokus, wie ihn sonst die sogenannten Adepten lieben, die ja alle nur Betrüger sind. Es gibt unter ihnen allerdings auch Ausnahmen, die rühmlichste davon war der Graf von Saint-Germain.
Ich fange nicht damit an, vor Ihren Augen unedles Metall in Gold zu verwandeln und ähnliche Kunststückchen zu machen. Das sind ja alles nur Kleinigkeiten. Als erstes werde ich Ihnen beweisen, dass mir ein Luftgeist zur Verfügung steht oder mehr der ägyptischen Freimaurerloge, der ich angehöre und die mich geschickt hat, worüber also der Herr Herzog Ihnen wohl schon berichtet hat... nicht wahr, Herr Herzog?«
»Gewiss. ich habe alles ganz ausführlich berichtet.«
»Dieser Freimaurerloge sind die sämtlichen Bewohner des Geisterreiches untergeordnet, sowohl der ägyptischen Loge wie der indischen, zwischen denen eigentlich auch kein Unterschied ist. Diese unsichtbaren Geister teilen sich, wie die Menschheit immer ganz richtig geahnt hat, oder wie sie von Wissenden belehrt wurde, in Feuergeister, Wassergeister, Erdgeister und Luftgeister. Mehr aber darf ich Ihnen über diese Bewohner des Geisterreiches nicht mitteilen, es ist mir von meinen Oberen, denen ich bedingungslos zu gehorchen habe, verboten worden.
Jedoch ist mir ebenso unbedingt geboten worden, den Menschen mitzuteilen, dass ich einen Luftgeist mitbekommen habe, mit dessen Hilfe ich die meisten meiner Experimente ausführe. Dies ist auch eine der Hauptsachen gewesen, wodurch sich der Graf von Saint-Germain so ungehorsam zeigte. Denn auch der Graf von Saint-Germain hatte von den indischen Mahatmas einen Luftgeist miterhalten, mit dessen Hilfe er die meisten seiner magischen Experimente zustande brachte. Aber anstatt der Wahrheit die Ehre zu geben, wie es ihm auch vorgeschrieben worden war, den Menschen von diesem seinen ihm dienstbaren Luftgeist zu erzählen, hat der Graf diese unsichtbare Hilfe verschwiegen, hat, von falscher Eitelkeit getrieben, die wunderbaren Resultate seinen eigenen magischen Fähigkeiten zugeschrieben, als hätte er sie also durch eigene Kraft zuwege gebracht. So erwähne ich als Beispiel nur, dass es nicht etwa der sogenannte Doppelgänger des Grafen war, der damals, wie Sie wohl alle gehört haben, dem englischen Gesandten Lord Walter Moore erschien...«
»Wie, das war nicht wirklich der Geist des Grafen?!«, erklang es sofort im Chor.
»Nein, sondern das war eben dieser Luftgeist, der nur die Gestalt des Grafen annahm. Es war auch nicht der eigene Geist des Grafen, den er in fremde Erdteile schickte, wenn er in Starrkrampf lag, sondern es war immer der ihm zur Verfügung stehende Luftgeist, der freilich in jedem Moment sein kann, wo er will oder vielmehr wo ihm sein Herr befiehlt, der ihm dann ales erzählte, was er gesehen und gehört hatte.
Insofern also schon hat sich der Graf von Saint-Germain einer großen Täuschung, um nicht zu sagen Betruges, schuldig gemacht. Er hatte deshalb mit dem Luftgeiste einen Pakt geschlossen, und mir selbst kommt es ganz ungeheuerlich vor, dass der Geist darauf eingegangen ist, sich hat betören lassen. Nur insofern hat sich der Geist noch zu reservieren gewusst, dass er darauf bestand, jedes Experiment, welches dann der Graf durch eigene Kraft fertiggebracht haben wollte, immer nur ein einziges Mal ausführen zu wollen...«
»Aha, also das war der Grund, weshalb der Graf von Saint-Germain jenes Experiment immer nur ein einziges Mal ausführen wollte!«, rief irgend jemand.
»Jawohl, anders war es nicht«, bestätigte der Marquis. »Hätte der Graf zugegeben, seine Resultate durch die Hilfe eines ihm dienstbaren Luftgeistes auszuführen, so wäre hierzu gar kein Grund vorhanden gewesen. Nun, der durch eine unglückselige Ehrsucht verblendete Graf hat seine Vermessenheit mit einer viele Jahrhundert langen Gefangenschaft abzubüßen, in der er vor allen Dingen zu einer höheren Moral, zur Wahrheitsliebe erzogen wird, und jener vielleicht noch bedauernswerte Luftgeist ist sogar zu vieltausendjährigen Höllenqualen verurteilt.«
So sprach der Marquis, der neuaufgetauchte Adept.
Und seine Zuhörer lauschten wie die Mäuschen, fühlten schon die Gottheit nahe, oder doch das Reich der Geister.
In dieser Totenstille erscholl ein Ächzen — aber nicht lauter, als dass es eben das Ohr des deutschen Fürsten erreichen konnte.
»Ja, dieser Halunke!«, raunte Axel ebenso unhörbar für jedes andere Ohr dem Grafen Soltykow zu, über dessen Lippen dieses Stöhnen gekommen war, während sonst sein Gesicht unbeweglich blieb. »Aber die Rache soll auch eine fürchterliche werden.«
»Also auch ich habe solch einen Luftgeist mitbekommen«, fuhr der Marquis fort, der vorhin gesagt hatte, weiter dürfe er über die Bewohner des Geisterreiches absolut nichts verraten, was er jetzt Lügen strafte, wie er sich überhaupt niemals um seine früheren Behauptungen kümmerte. »Sein Name ist Eziel. Nun dürfen Sie diese Geister aber nicht etwa für allwissend oder gar allmächtig halten. Allwissend und allmächtig ist nur Gott, dem ich diene. Ja, in gewisser Hinsicht haben die Geister nicht einmal so viel Macht wie der schwächste von uns schwachen Menschen. So zum Beispiel ist es diesen Geistern nicht einmal möglich, einen Ton von sich zu geben. Und doch, sie tun es, wie die Herrschaften gleich hören werden. Eziel, bist du hier? Dann verkünde deine Anwesenheit durch ein anhaltendes Klopfen.«
Bumberumbumbumbumbum, ging es sofort, dass alle erschrocken zusammenfuhren.
Das polternde Klopfen war wie aus den Wänden gekommen — wie aus allen, nicht nur wie aus einer, das heißt, man hätte die Stelle nicht bestimmen können, woher es erschollen war. Es hatte gewissermaßen das ganze Zimmer erfüllt.
»Haben Sie gehört?«
»Um Gottes willen, was war das?«, wurde ängstlich geflüstert.
»Dies«, erklärte der Marquis weiter, »widerspricht doch ganz meiner ersten Behauptung, dass die Geister keine Töne von sich geben könnten. Und doch ist es so. Das sind nämlich keine materiellen Töne, sondern nur astrale — eingebildete, möchte ich sagen. Das heißt, der Geist kann tatsächlich keinen einzigen Ton von sich geben, aber er bildet sich ein, es zu können, es zu tun, und durch seine astrale Kraft erzeugt er in unserem Gehirn, in unserem Nervensystem die Empfindung, als hätten wir die von ihm nur gedachten Töne in Wirklichkeit gehört. Eine andere Erklärung dieses Phänomens vermag ich Ihnen nicht zu geben.«
Diese Erklärung wurde denn auch wohl von keinem einzigen verstanden — vielleicht den russischen Grafen ausgenommen. Und dennoch hatte der Marquis die einzige begreifliche Erklärung für alle spiritistischen Phänomene gegeben, wie sie erst 100 Jahre später von kritischen Spiritisten aufgestellt wurde, welche weder alles auf gut Glauben hinnehmen, noch alles, was sie nicht gleich begreifen können, eo ipso leugnen.
Weiter können wir uns hierüber an dieser Stelle nicht auslassen. Jedenfalls aber hatte der spätere Cagliostro hiermit bewiesen, dass er auch auf dem theoretischen Gebiete des Übersinnlichen durchaus geschult war — freilich nicht für diese Zuhörer, die Kinder ihrer Zeit waren — immer wieder vielleicht nur mit Ausnahme des Grafen von Saint-Germain.
»Diese Poltertöne«, fuhr der Magier fort, der aber so bescheiden diese magischen Phänomene einem ihm zur Verfügung stehenden Geiste zuschrieb, »sind die einzigen Töne, die der Geist immer von sich geben kann — allerdings immer nur scheinbar, wenn wir sie auch wirklich hören. Woher gerade diese sogenannten Polter- oder Klopftöne bei den Geistern so beliebt sind, vermag ich Ihnen nicht weiter zu erklären. Es sind eben die allereinfachsten, kommen daher, wie Ihnen wohl bekannt, bei jedem Spuk vor. Die Geister vermögen sie bei jeder Gelegenheit unter allen Verhältnissen hervorzubringen, in und an festen Gegenständen, auf der Erde, im Wasser, im Feuer, in der Luft.
Anders wird es, wenn man von dem Geiste ein spezifisches Klopfen verlangt. Gesetzt den Fall, ich verlange, der Geist soll einen Ton erschallen lassen, als wenn er oder ich mit der Faust oder mit dem Fingerknöchel auf die hölzerne Platte eines Tisches klopfe. Ist ein Tisch vorhanden, so wird er es in seiner Einbildung tun, wir werden die entsprechenden Klopftöne vernehmen. Ist in hörbarer Nähe aber kein Tisch vorhanden, so wird der Geist in seiner Einbildung zwar ebenfalls gegen einen nur in seiner Einbildung vorhandenen Tisch klopfen, da aber für uns selbst die Wirklichkeit fehlt, weil also kein Tisch vorhanden ist, können wir diese Klopftöne auch nicht vernehmen. Verstehen die Herrschaften den Unterschied?«
O ja, es waren doch einige scharfsinnige Köpfe darunter, welche diese Erklärung verstanden, und tatsächlich war auch alles, von der gegebenen Voraussetzung ausgehend, ganz logisch. An die Voraussetzung musste man natürlich glauben. Aber es gibt doch selbst in der Mathematik Voraussetzungen, die man annehmen muss, ohne sie beweisen zu können.
»Hier ist ja ein Tisch«, hieß es.
Unter dem Kronleuchter, dessen zwölf Wachskerzen brannten, stand ein großer, runder Mahagonitisch ohne Decke.
»Jawohl, demonstrieren wir es gleich an diesem Tische. Bitte, wollen sich die Herrschaften darumstellen.«
Sie taten es, die meisten zitternd vor Erregung.
»Eziel, hörst du mich sprechen? Antworte bejahend mit einem zweimaligen Poltern.«
Bumberumbumbumbum erscholl es zweimal hintereinander, wie von überallher kommend, und zwar mit ganz mächtigem Tone, sodass wieder alles erschrocken zusammenfuhr.
»Nun, Eziel, lass einen Ton erschallen, als wenn ein Mensch mit der Faust auf den Tisch schlüge, und zwar auf die Mitte der Platte.«
Bum! erscholl es, und zwar hatte jeder ganz deutlich gehört, dass der Ton nur aus der Tischplatte kommen konnte, es war nicht anders gewesen, als ob jemand mit der Faust auf die Mitte derselben geschlagen hätte, was man doch recht wohl unterscheiden kann.
»Bemerken Sie wohl«, erläuterte der Zauberkünstler, »dass ich von dem Geiste verlangte, er solle einen Ton erschallen lassen, als wenn ein Mensch mit der Faust auf die Mitte der Tischplatte schlüge. Und anders wird es auch in Wirklichkeit nicht ausgeführt, der Geist ahmt diesen Ton nur in seiner Einbildung nach und lässt ihn so kraft seines astralen Willens hören, erregt gewissermaßen unsere Hörnerven so, dass wir diesen Ton hören müssen, ohne dass er in Wirklichkeit zum Ausdruck kommt. Doch kann ich auch sagen: Schlage selbst darauf! Dann bleibt es zwar beim alten, der Befehl ist nur ein kürzerer — Eziel, jetzt schlage mit der Faust dort auf den Rand des Tisches, wo die beiden Damen stehen! Halt, noch nicht! Wie oft, meine Gnädige, soll er auf den Tisch schlagen?«
»Dreimal«, flüsterte Pepita, während die Mutter der Sprache gar nicht fähig war.
»Hast du es gehört? Tu es!«
Bum, bum, bum, erklang es, und zum Tode erschrocken fuhren die beiden Weiber und auch die neben ihnen stehenden Herren zurück, denn auch mit geöffneten Augen in diesem hellen Lichte hätte jeder doch gleich schwören können, eine Faust hätte dort dreimal auf den Tischrand geschlagen, wo die beiden Damen standen.
»Nun aber, Eziel, klopfe mit dem Fingerknöchel mehrmals auf die Tischplatte.«
Poch, poch, poch, poch — erklang es jetzt wieder ganz anders.
»Wollen wir nun einmal prüfen, wie weit er diesen Klopfton richtig getroffen hat?«
Der Marquis neigte sich über den sehr großen Tisch und klopfte mit dem Fingerknöchel auf die Mitte der Tischplatte.
»Hören Sie den Unterschied?«
Nein — niemand wusste, was der Magier eigentlich meinte.
»Der wirkliche Ton ist etwas höher als der, den vorhin Eziel dem Tische entlockte. Die Sache ist nämlich die, dass der Geist nicht weiß und nicht wissen kann, welchen genauen Ton der Tisch bei einem Anklopfen von sich geben wird. Er formuliert den Ton nur so seiner Ansicht nach. Und dazu ist nötig, dass er überhaupt schon einmal gehört hat, wie es klingt, wenn ein Mensch auf solch einen Tisch klopft. Hat man einen Geist, der in den irdischen Verhältnissen auf der sichtbaren Ebene noch ganz unbewandert ist, so können bei solchen Experimenten die merkwürdigsten, sinnlosesten Irrtümer vorkommen. Denn Sie müssen bedenken, dass solch ein Geist nur auf seiner Astralebene, das heißt, in seinem für uns unsichtbaren Geisterreiche zu Hause ist, unsere irdische Ebene hingegen, in der wir leben, ist ihm so fremd wie uns sein Geisterreich. Würden uns einmal die Augen geöffnet, dass wir in dieses Astralreich sehen könnten, so würden wir lauter Unverständliches erblicken. Alles nämlich, was in der irdischen Ebene existiert, also einfach auf der Erde, existiert auch auf der Astralebene, jeder Stein und jeder Stuhl ist hier wie dort vorhanden, aber es kommt ganz darauf an, von welcher Ebene aus man den Stein und den Stuhl betrachtet, in jedem Falle sieht man etwas völlig anderes. Für uns Menschen ist der irdische Anblick des Steines und Stuhles der normale, wie wir ihn einfach nicht anders kennen, für den Geist ist der astrale Anblick der ganz natürliche, und mit dem von der irdischen Seite aus betrachteten Stein und Stuhl weiß ein Geist absolut nichts anzufangen. Verstehen mich die Herrschaften?«
Nein, absolut nicht. Und doch ahnten sie wohl sämtlich, dass alles, was der Marquis da sagte, Hand und Fuß hatte.
Überdies sagte er ja nichts Neues. Dies alles ist in den Schriften der alten und mittelalterlichen Mystiker zu lesen. Aber diese wurden damals noch nicht so studiert, wie es heute der Fall ist. Die noch am weitesten verbreiteten mystischen Werke waren die von Paracelsus. aber man konnte lange suchen, bis man einen alten Bücherwurm fand, der sie gelesen hatte und darüber mit eigenen Gedanken kritisieren konnte. Erst der neuesten Zeit war es vorbehalten, die wunderbare Übereinstimmung aller dieser Autoren zu konstatieren, wenigstens in den Hauptsachen, wobei man nämlich jetzt beweisen kann, dass alle diese Männer ganz unabhängig voneinander gedacht und geschrieben haben. Am vollgültigsten wird der Beweis dadurch, dass alle diese Gedanken schon in der uralten indischen Philosophie enthalten sind, aber das Sanskrit, in dem sie ausschließlich niedergeschrieben wurden, ist erst im vorigen Jahrhundert, im 18., der abendländischen Welt zugänglich gemacht worden.
Sonst mag hierüber jeder denken, was er will. Für den, der sich für so etwas interessiert, wenn auch nur aus historischer Ursache, sei noch erwähnt, dass Schopenhauer in dem Kapitel ›Versuch über das Geistersehen und was damit zusammenhängt‹ einen Vergleich anstellt, in dem er beweist, dass seit historischen Zeiten in allen Ländern und bei allen Völkern der Erde Geistererscheinungen immer auf ganz gleiche Weise berichtet werden. Zwischen einer germanischen oder äthiopischen oder chinesischen Geistererzählung, wo und warum ein Geist erschien oder gesehen sein sollte, ist absolut kein Unterschied.
Man muss freilich den Kern der ganzen Sache erfassen, um hierüber staunen zu können. Deshalb braucht man auch noch lange nicht an Gespenster zu glauben. Ob es Geister gibt oder nicht gibt, ist hierbei auch ganz gleichgültig. Es liegt hierbei etwas so Wunderbares vor, dass es jede etwaige Geistererscheinung ganz in den Schatten stellt.
»Solch ein Geist«, fuhr der Magier fort, »der von einem Menschen unterjocht ist, möchte seinem Herrn und Meister nun immer gern zu Willen sein, ohne manchmal die dazu nötigen Fähigkeiten zu besitzen. Dadurch also kommen manchmal die wunderlichsten Irrtümer vor. Überhaupt, meine Herrschaften, stellen Sie sich diese Geister ja nicht etwa als hochintelligente Wesen vor! Es gibt im Geisterreiche genau solche Dummköpfe wie auf unserer irdischen Ebene, und wenn sie sich auf unsere irdische Ebene begeben, so gleicht nun vollends auch der intelligenteste Geist nach unseren Verhältnissen einem unbeholfenen, unwissenden Kinde. Gesetzt also den Fall, solch ein Geist, den ich unterjocht habe, hat noch niemals gehört, wie es klingt, wenn ein Mensch auf einen irdischen Tisch schlägt, wohl aber hat er schon den Ton einer Klingel gehört, und ich verlange nun, er soll in seiner Einbildung auf den Tisch schlagen, so kann es sehr leicht geschehen, dass dann statt des Klopftones ein Klingeln aus dem Tische erschallt. Verstehen die Herrschaften?«
Ja, das war eher verständlich gewesen.
»Bei meinem Eziel kommen solche grobe Irrtümer nicht mehr vor. Dazu hat er auf unserer irdischen Ebene doch schon zu große Erfahrungen gesammelt, ist von Menschen, die wiederum im Astralreiche einigen Bescheid wissen, hierüber belehrt worden. Immerhin — gar zu viel darf ich auch von ihm nicht verlangen. Ich werde ihn dann einige Male mit Absicht sich irren lassen, darf das aber nicht zu häufig wiederholen, sonst könnte er seinen Astralkopf verlieren.«
Der Marquis hatte wohl einen Witz machen wollen, aber niemand lachte. Alle standen unter dem Banne des Gedankens, dass sich in diesem Raum ein unsichtbares Wesen aus dem Geisterreiche aufhielt.
»Wie Eziel«, suhr der Magier fort, »vorhin den Klopfton nicht ganz richtig getroffen hat, kann ich Ihnen jetzt nicht mehr erläutern. Denn nun hat er schon den richtigen Ton gehört, jetzt irrt er sich auch niemals mehr. Eziel, klopfe mit dem Fingerknöchel anhaltend auf die Tischplatte.«
Es geschah.
»Genug! Nun werde ich klopfen — sehen Sie, jetzt ist der Ton völlig gleichgestimmt, was vorhin nicht der Fall war.«
»So lassen Sie ihn doch einmal gegen etwas anderes klopfen, womit er noch nicht so viel Erfahrung hat wie mit einer Tischplatte«, äußerte zum ersten Male jemand einen selbstständigen Wunsch, und zwar war es der deutsche Fürst.
»Wie Sie wünschen. Da wollen wir aber doch gleich das zwingendste Experiment machen, mit einem Gegenstand, bei dem der Ton sehr oft verändert werden kann. Wird in dem Hotel nicht eine Violine oder eine Flöte aufzutreiben sein?«
Vor der Saaltür waren zwei Hoteldiener postiert. Sie erhielten die Order, eine Violine oder eine Flöte oder ein sonstiges musikalisches Instrument aufzutreiben.
»Inzwischen noch ein einfacheres Experiment«, sagte der Marquis. »Hat einer der Herren ein Papier bei sich, welches zusammengeknüllt werden darf?«
Ein belangloser Brief war sofort zur Stelle.
Der Marquis ließ ihn auf den Tisch legen.
»Eziel, zerreiße dieses Papier in kleine Stücke.«
Sofort erscholl ganz deutlich das Geräusch, als ob der Brief mehrmals zerrissen würde, und zwar ging das Geräusch wirklich von diesem Briefe aus, obgleich er dabei unbeweglich auf dem Tische lag.
Rufe des Staunens waren schon immer laut geworden, während sich der deutsche Fürst damit begnügt hatte, öfter den Kopf zu schütteln.
»Darf ich einmal das Ohr nahe daran bringen?«, fragte er jetzt.
»Bitte sehr — so nahe Sie wollen.«
Axel legte sich mit dem Oberkörper über den Tisch, bis sein Ohr den Bries fast berührte.
»Eziel, zerreiße den Brief noch einmal.«
Wieder erscholl das zerreißende Geräusch.
»Wunderbar, das ist wirklich wunderbar!«, murmelte Axel, als er das Ohr zurückzog.
Ein Herr nach dem anderen brachte das Ohr in die Nähe des Papiers, und die meisten zogen es schnell und ängstlich zurück, als das Geräusch des Zerreißens direkt aus dem Papiere kam, welches doch regungslos dalag.
»Jetzt, Eziel, knülle das Papier zusammen!«
Es war ziemlich steifes Papier, und sofort entstand das charakteristische raschelnde Geräusch.
»Jetzt werde ich den Briefbogen wirklich zusammenknüllen — hören Sie? Der Geist hat das spezifische Geräusch ziemlich richtig getroffen.«
»Kann man das Papier dabei nicht einmal in die Hand nehmen?«, fragte wiederum der deutsche Fürst, der wohl allein noch ganz selbstständig denken konnte.
Der Graf war dabei ein ganz teilnahmsloser Zuschauer.
»Bitte sehr, nehmen Sie es in die Hand. Eziel. knülle das Papier!«
Axel hätte geschworen, dass der in seiner ausgestreckten Hand liegende Papierballen von einer anderen Hand geknüllt wurde, ganz genau das charakteristische Geräusch, während der Ballen doch ganz bewegungslos dalag.
»Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich davon danken soll«, murmelte Axel.
»Täuschung, alles Täuschung, ich erkläre es Ihnen nachher«, wurde da in Axels Ohr geraunt, und zwar kamen diese Worte von des Grafen Lippen, der dicht neben Axel stand.
Dass dieser Mann sich so verständlich machen konnte, nur gerade für das Ohr, für das die Worte bestimmt waren, das war eigentlich auch eine Art von Wunder.
Doch daran dachte Axel jetzt nicht, er hatte nur die Worte gehört, wusste, dass diese von dem Grafen ausgegangen waren — einen Blick auf diesen, sonst hütete er sich, deswegen etwas zu sagen.
Während das Papier von Hand zu Hand ging, um so in fühlbarer Nähe das Rascheln zu hören, kam der abgesandte Diener mit der Meldung zurück, dass im Hotel keine Violine und keine Flöte vorhanden wäre, auch kein anderes musikalisches Instrument, ob es nicht vielleicht diese Tischglocke täte, die er gleich mitgebracht hatte.
»Jawohl, auch diese erfüllt schon den gewünschten Zweck. Es handelt sich also darum, zu beweisen, dass der Geist nicht etwa allwissend ist, dass er nicht einmal genau den Ton kennt, den irgendein Instrument oder ein sonstiger Gegenstand, mit dem man eben einen Ton erzeugen kann, hervorbringt. Den Klang, den solch eine Glocke hervorbringt, kennt er sonst natürlich schon. Aber ein sehr großer Zufall wäre es, wenn er genau denselben Ton träfe.«
Es war eine Tischglocke, die durch Drücken auf einen oben angebrachten Knopf zum Tönen gebracht wurde, der Klöppel schlug immer nur ein einziges Mal gegen die Glocke, und zwar von außen, die Bewegung war also zu beobachten.
Aber der Marquis tat dies noch nicht, setzte sie in die Mitte der Tischplatte.
»Eziel, schlage diese Glocke an!«
Ein heller Glockenton erscholl, ohne dass sich dabei der Klöppel bewegt hätte.
»Schlage sie mehrmals an!«
Es geschah.
»So, nun werde ich selbst die Glocke anschlagen — da hören Sie, der Geist hat sich in seiner Einbildung um wenigstens vier Töne zu hoch geirrt.«
So war es — in Wirklichkeit ein ganz anderer Ton, viel tiefer.
»Jetzt natürlich kennt er den Ton, jetzt irrt er sich nicht mehr, aber... Eziel, schlage nochmals die Glocke an.«
Der Marquis hatte schnell ein seidenes Tüchelchen aus der Tasche gezogen und dieses über die Glocke gedeckt. Als er nun verlangte, der Geist sollte klingeln, kam wieder der helle Glockenton, und zwar der ganz richtige — als aber nun hinterher der Marquis selbst auf die Glocke schlug, zeigte es sich, dass diese gar nicht mehr richtig läuten konnte, sie gab nur einen klirrenden Ton von sich, weil das Tuch die Metallwand an der Vibration hinderte. Dann freilich verstand der ›Geist‹ auch diesen Ton nachzuahmen, tat dies aber auch noch, als das Tuch wieder abgenommen war, die Glocke wieder frei schwingen konnte.
»Sie sehen daraus, meine Herrschaften, dass dieser Geist kein besonders intelligentes Wesen ist. Von physikalischen Gesetzen, die auf unserer irdischen Ebene herrschen, hat er überhaupt gar keine Ahnung, und es ist auch gar nicht möglich, ihm solche Kenntnisse beizubringen...«
Und so fuhr der Marquis noch einige Zeit fort, den ihn vom König aller Magier als Diener beigegebenen Luftgeist... einfach schlecht zu machen! Aber der Leser versteht wohl, was hierbei vorlag, was der neue Adept beabsichtigte. Es war wiederum eine ganz raffinierte List, ein ganz schlauer Trick, den er anwandte.

Unter Vermeidung von allem Hokuspokus gab er seinen Vorstellungen ein ganz wissenschaftliches Gepräge, erläuterte alles mit scheinbar unbestechlicher Kritik, wodurch er sich scheinbar selbst schädigte, sich viel von dem Nimbus eines Magiers raubte. Aber das war eben nur scheinbar. Es war vielmehr ein ganz schlauer Reklametrick, auf den wiederum noch kein anderer dieser Adepten gekommen war. Wohl nur dadurch hat Cagliostro seine Riesenerfolge erzielt, wohl nur deshalb haben sich die gelehrtesten und abgeklärtesten Männer seiner Zeit ganz ernsthaft mit ihm beschäftigt. Erst als er diese Methode nicht mehr nötig hatte, als seine Position als Magier gesichert war, zeigte er seinen eigentlichen Charakter, indem er bei seinen Vorstellungen den pomphaftesten Hokuspokus verwendete.
»Dies war der erste Teil des Experimentalvortrages. Im zweiten Teile nun werde ich den Luftgeist sich mehr manifestieren lassen. Aber wollen die Herrschaften nichts Unmögliches von ihm verlangen.
So ist es meinem Eziel schon nicht möglich, sich sichtbar zu machen. Der Luftgeist, der dem Grafen von Saint-Germain zur Verfügung gestellt worden war, vermochte dies, aber auch nur hin und wieder unter größtem Aufwand seiner Astralkraft, wodurch er dann stets auf lange Zeit geschwächt wurde. Dem Grafen von Saint-Germain war es streng verboten worden, das von seinem Luftgeiste zu verlangen, er hat es trotzdem einmal oder vielleicht sogar mehrmals getan — für diese Vermessenheit hat er nun eben zu büßen.
Ich habe zur Bedienung einen Geist von bedeutend schwächerer Astralkraft mitbekommen. Ich selbst soll ihn erst zu größeren Fähigkeiten erziehen. Auf diese Weise, wenn ich lerne, was es für solch einen Geist bedeutet, sich sichtbar zu machen, werde ich auch nie der Versuchung unterliegen, gar zu viel von ihm zu verlangen, wie es mein unglücklicher Vorgänger leider getan.
Was ich jetzt schon von meinem Eziel verlangen kann, ist der sogenannte Apport. Sie wissen wohl, was man hierunter versteht. Das Herbeibringen von Gegenständen, wohl auch das Wiederfortbringen. Aber auch hierbei sind meinem Eziel noch enge Grenzen gezogen. Wollen Sie nicht verlangen, dass er Ihnen aus fernen Ländern Sachen herbeibringt, etwa exotische Blumen und dergleichen. Es gibt Geister, die das können, gewiss. Aber mein Eziel ist hierzu nicht fähig — wenigstens vorläufig noch nicht. Wenn die Herrschaften vielleicht schon von anderen sogenannten Adepten derartige Apporte gesehen haben, wie also etwa aus fremden Ländern Blumen herbeigebracht wurden, so sind Sie sicher das Opfer eines Betrügers gewesen. Das wurde eben alles auf geschickte Weise vorbereitet — ein Taschenspielerkunststückchen, nichts weiter. Geister kamen da nie in Betracht.
Allerdings hat es immer von Gott erwählte Menschen gegeben, denen Geister zur Verfügung standen. Aber diese haben ihre Macht niemals zu schnöden Experimenten missbraucht, sonst hätten sie ja ihre Macht sofort wieder verloren. Das herrlichste Beispiel hiervon ist unser Heiland Jesus Christus gewesen. Trotzdem gebe ich zu bedenken, dass auch Christus seine magische Macht manchmal zu Wundern gebraucht hat, die nicht zum direkten Nutzen und Segen für andere Menschen dienten. So erinnere ich nur an das Wunder bei der Hochzeit, wo er Wasser in Wein verwandelte. Aber auch solche anscheinend zwecklose Wunder waren nötig, um der ungläubigen Menschheit entgegenzukommen.
Was nun die Jetztzeit anbetrifft, so versichere ich, dass es auf der ganzen Erde nur zwei Menschen gibt, welchen von denen, die über das Reich der Geister zu gebieten haben, die aber selbst nicht mehr im Fleische wandeln, Geister als Diener zur Verfügung gestellt worden sind. Der eine von diesen beiden ist oder war der Graf von Saint-Germain — der ist bereits abgetan — der zweite bin ich, sein Nachfolger. Ich bin gegenwärtig der einzige in Fleisch und Blut wandelnde Mensch auf der ganzen Erde, der einen Geist als Diener zur Verfügung hat.«
Mit einer leichten Verbeugung hatte der Marquis Pellegrini geschlossen.
Und die Zuhörer blickten auf ihn mit gläubiger Ehrfurcht, wie man eben auf einen Menschen blickt, der über einen Geist aus der vierten Dimension zu befehlen hat.
Ja, dieser Mann hatte eine wunderbare Gabe, zu sprechen. Diese seine Überzeugungskraft, die er in seine anscheinend so schlichten Worte legte, ist schriftlich freilich nicht wiederzugeben.
»Kommen wir nun zu den angekündigten Experimenten des geistigen Apportes«, fuhr der Marquis nach einer kleinen, wohlberechneten Pause fort — und was tat dieser Mann wohl nicht aus Berechnung! »Doch ich muss vorher immer noch etwas bemerken. Ich wiederhole: Verlangen Sie von meinem Eziel nicht allzu viel. Man sollte doch eigentlich meinen, dass es für einen Geist ganz gleichgültig ist, ob er leichte oder schwere Gegenstände von Ort zu Ort trägt, und das umso mehr, als er dabei ja nur geistige Kraft anwendet. Denn dieses Forttragen geschieht auf rein geistigem Wege, durch astrale Kraft. Aber gerade das Gegenteil ist der Fall. Sie müssen immer bedenken, dass der Geist alles nur in seiner Einbildung tut. Seine Gedanken werden nur durch die ihm innewohnende Kraft materialisiert. Anders vermag ich mich ihnen gegenüber nicht auszudrücken. Nun hält sich aber dieser Geist, der gar keine begrenzte Gestalt hat, uns irdischen Menschen gegenüber für ein äußerst schwaches Geschöpf. Er hat bereits beobachtet, dass kleine, schwache Menschen nur leichte Gegenstände aufheben können. Infolgedessen bildet sich auch mein Eziel ein, nur ganz leichte, kleine Gegenstände aufheben und tragen zu können. Diese falsche Vorstellung von sich selbst werde ich ihm noch austreiben können, vorläufig ist es aber nun nicht anders.
Zweitens kann der Geist den Apport nur bei vollständiger Dunkelheit zustande bringen. Wir müssen also die Lichter auslöschen. Ich sehe an den Mienen einiger der Herren, dass sie sofort Misstrauen schöpfen. Aber ich werde Ihnen dann eine Handhabe geben, mit der Sie alles aufs schärfste kontrollieren sollen. Es geht nicht anders. Geister scheuen eben die Helligkeit. Nicht umsonst finden alle Geistererscheinungen nur des Nachts oder nur in ganz finsteren Räumen statt, wie etwa in Kellern. Eine weitläufige Erklärung für dieses ihr Verhalten kann ich Ihnen hier nicht geben, es würde zu weit führen. Die Geister vermögen in der Helligkeit ihre astrale Kraft nicht zu konzentrieren, das gelingt ihnen nur in völliger Finsternis. Diese Erklärung muss Ihnen vorläufig genügen. Herren, die sich mehr dafür interessieren, stehe ich später mit einer wissenschaftlichen Erklärung zur Verfügung.
So wollen wir jetzt gleich mit den Experimenten beginnen. Ich bitte um einen einzelnen Leuchter mit einer Kerze.«
Einer der draußen postierten Kellner besorgte das Gewünschte.
Der Marquis setzte den Leuchter mit der neuen Wachskerze, noch unangebrannt, auf den Tisch, ließ diesen von einigen der Herren in die eine Ecke des Saales tragen, die Stühle darumsetzen.
»Es ist nicht nötig, dass Sie Platz nehmen. Wenn Sie es wollen, so können Sie es tun. Sonst aber bewegen Sie sich nur ganz zwanglos. Darf ich nun um irgendeinen kleinen Gegenstand bitten, der von dem Besitzer sofort wiedererkannt wird? Vielleicht einen Ring?«
Einer der Herren streifte einen Rubinring ab, der Marquis nahm ihn.
»Kennen Sie Ihren Ring an einem besonderen Zeichen?«
»Gewiss, er trägt innen eine Gravierung.«
»Gut. Diesen Ring werde ich von Eziel hin und her apportieren lassen, wie die Herrschasten bestimmen werden. Auf Unmöglichkeiten werde ich später aufmerksam machen, wenn es die Gelegenheit verlangt. Dann brauche ich für den Ring noch zwei Unterlagen, irgendwelcher Art. Vielleicht ein Taschentuch, welches ich in kleinere Teile zerreißen darf. Mein eigenes möchte ich dazu nicht verwenden, ich möchte allen Anschein vermeiden, als könnte ich mich irgendwie präpariert haben.«
Ein Taschentuch wurde ihm gereicht, er riss daraus zwei quadratische Flecke, jeder ungefähr von zehn Zentimeter Durchmesser.
»Diese Stückchen Zeug bilden immer die Unterlage für den Ring. Wir legen ihn auf das eine Stück, er wandert auf meinen Befehl auf das andere Stück Zeug...«
»Wozu denn diese Unterlagen?«, schaltete der deutsche Fürst wieder einmal ein, und zwar diesmal unter allgemeiner Beistimmung, nur dass kein anderer solch eine Frage zu stellen gewagt hatte.
»Das geht nicht anders«, lautete einmal die sehr kurze Antwort. »Eziel ist es nicht anders gewohnt, als dass der betreffende Gegenstand immer eine gewisse Unterlage hat. Aber es steht Ihnen ja frei, einen anderen Gegenstand und eine andere Unterlage zu wählen. Bitte, wählen Sie!«
»O nein, dann kann es dabei bewenden.«
»Wie Sie wollen. Sie müssen nur immer bedenken, dass es sich um ein Wesen aus einer ganz anderen Welt handelt, das sich in unseren irdischen Verhältnissen durchaus nicht zurechtfinden kann. Ihnen würde es auf der Astralebene genau so gehen. Diesen Geist habe ich gewissermaßen dressiert, vorläufig nur für einige Kunststücke, und für dieses hier ist solch eine Unterlage unbedingt notwendig, sie dient ihm wie einem blinden Menschen der Taststock. So, Durchlaucht, jetzt nehmen Sie das eine Stückchen Zeug und den Ring — bitte, legen Sie beides irgendwo hin, den Ring auf das Zeug.«
Axel nahm beides. Große Auswahl zum Hinlegen hatte er gar nicht. Dieses sehr große Hotelzimmer enthielt nichts weiter als den Tisch und ein Dutzend Stühle.
»Dorthin in die Ecke?«
»Ganz, wie Sie wünschen.«
Axel ging in die andere Ecke, legte das Stückchen Zeug an den Boden, der nach italienischer Sitte mit Steinchen mosaiert war, den Ring darauf.
»Haben Sie?«
»Da liegt der Ring.«
»Wollen wir uns alle noch einmal hinbegeben.«
Sie taten es, ohne noch richtig zu wissen, was der Marquis eigentlich wollte.
»Ist das auch wirklich Ihr Rubinring? Wollen Sie ihn zur Vorsicht noch einmal betrachten, Sie können ihn nochmals aufheben, so oft Sie wollen«, wandte sich der Marquis an den Besitzer des Ringes.
Dieser hob ihn noch einmal auf, während sich der Magier mit offenbarer Absicht mehr im Hintergrunde hielt. Er wollte dem Ringe nicht mehr zu nahe kommen.
»Gewiss, das ist mein Ring.«
»Bitte, legen Sie ihn wieder auf den Zeugfleck zurück.«
Es geschah.
»Nun wollen wir uns nach dem Tisch zurückbegeben. Wohin soll nun diese zweite Unterlage gelegt werden?«
Einer der Herren bestimmte die andere Ecke des Saales, von jener gegen zehn Meter entfernt, legte das Stückchen Zeug selbst hin.
»So, das war die einzige Vorbereitung. Treten wir nun etwas an den Tisch zurück, denn ich schicke voraus, dass Eziel wie alle Geister die persönliche Nähe des Menschen sehr fürchtet. Jetzt wird der Geist selbst die Lichter auslöschen, um die für dieses Experiment unbedingt nötige Dunkelheit zu schaffen.«
»Wie? Der Geist kann auch Lichter auslöschen?!«
»Gewiss, auch wieder anzünden — nur durch seine Astralkraft. O, mein Eziel kann noch ganz anderes. Aber ich möchte ganz fachgemäß vorgehen, Ihnen eins nach dem anderen erläutern. Wollen Sie mich zur Vorsicht, da es jetzt ganz finster wird, auch lieber anfassen. Bitte, Durchlaucht, und Sie, Herr Graf Soltykow, wollen Sie meine beiden Hände fassen, dass ich mich nicht etwa aus Ihrer Mitte entfernen kann. Auch alle anderen möchten lieber ihre Hände an mich legen.«
Da die beiden Genannten ungeniert gleich des Marquis Hände erfassten, legten auch die anderen ihre Hände an den Magier, berührten ihn wenigstens.
»Eziel, blase die Lichter des Kronleuchters aus, wie sie ein Mensch ausblasen würde!«
In demselben Augenblick verlöschte das erste der zwölf Lichter, dann das zweite, das dritte, und so ging es fort.
»Der Geist bildet sich dabei ein«, erläuterte der Marquis dazu, »ein Mensch zu sein, der ein Licht nach dem anderen ausbläst, so wie er es beobachtet hat, wie ich es ihm speziell mit Erklärungen sehr, sehr oft vorgemacht habe. Aber dieses Ausblasen bildet er sich eben nur ein. Trotzdem bringt er die Wachskerzen wirklich zum Verlöschen — nämlich durch seine Astralkraft, das heißt, durch seine magische Kraft — wenn Ihnen dieser Ausdruck geläufiger ist. Dass er sie nicht wirklich ausbläst, können Sie daraus ersehen, dass die Flamme vor dem Erlöschen nicht im Geringsten zur Seite geweht wird. Auch dies könnte der Geist allerdings zustande bringen, das erfordert aber wieder eine ganz besondere Kraft, deren Hervorbringen ihn unnützerweise außerordentlich anstrengen würde... da sehen Sie, wie langsam es schon geht.«
Wirklich, nach dem Verlöschen der sechsten Flamme wurden die Zwischenpausen immer größer.
»Sie sehen, seine Astralkraft erschöpft sich bereits, und da...«
Ein Stöhnen erscholl — ein so schauerliches, ächzendes Stöhnen, dass die Beobachter lieber sich selbst angefasst hätten als den Magier.
»Seien Sie ohne Sorge«, beruhigte dieser, »Eziel fühlt sich erschöpft und gibt mir dies dadurch kund, dass er einen menschlichen Laut nachahmt, von dem er weiß, dass ihn die Menschen ausstoßen, wenn sie sehr erschöpft sind. Die Geister haben überhaupt, wenn sie sich einmal etwas auf der irdischen Ebene bewegen können, einen sehr großen Nachahmungstrieb. Man möchte sie wirklich fast mit Affen und Papageien vergleichen. Freilich spricht das nicht sehr für die Intelligenz dieser geistigen Wesen. Aber dem höchstentwickelten Menschen würde es nicht anders gehen, wenn er plötzlich in die Astralebene versetzt würde. Und unsere ganze Entwicklung ist doch nichts weiter als lauter Nachahmung — Vorwärts, Eziel, lösche auch noch die drei letzten Lichter aus!«
Es geschah, in dem Saale herrschte Stockfinsternis. Die Fenster waren schon vorher verhangen gewesen.
»Jetzt, Eziel, trage den Rubinring, mit dem du uns vorhin beschäftigt sahst, von der einen Unterlage zur anderen. Möglichst schnell. Sobald dies geschehen ist, zeigst du dies durch ein Poltern an.«
Kaum eine halbe Minute verging in atemlosem Schweigen, als alle unter einem fast donnernden Poltern zusammenfuhren.
»Es ist geschehen. Jetzt, Eziel, zünde erst das auf diesem Tisch stehende Licht an.«
Sie alle standen, den Marquis umringend, ganz nahe dem Tische, und plötzlich erschien oberhalb dieses eine kleine Flamme — die Wachskerze brannte!
Das abergläubische Staunen ob dieses Wunders lässt sich denken. Dass der Marquis selbst oder ein Helfershelfer, den er unter diesen Herren gehabt, die Kerze angebrannt hätte, war ganz und gar ausgeschlossen.
Doch der Marquis ließ sich auf dieses Wunder nicht weiter ein.
»Bitte, nehmen Sie die Kerze, leuchten Sie nach der anderen Unterlage, ob nicht der Ring darauf liegt.«
Die Kerze wurde von dem Mutigsten genommen, alle begaben sich hin — ja, der Rubinring lag auf dem zweiten Stückchen Zeug, er war durch den ganzen Saal gewandert. Also noch nicht ganz eine halbe Minute hatte das Experiment erfordert.
Das Staunen war grenzenlos, bei vielen mischte sich ein gut Teil Entsetzen mit bei.
»Das geht nicht mit rechten Dingen zu! — Das ist wirkliche Hexerei.«
So und anders klang es durcheinander.
Dasselbe Experiment wurde in den verschiedensten Variationen wohl noch ein Dutzend Mal wiederholt.
Die beiden Unterlagen wurden immer wieder anders postiert, dann verlöschte Eziel zunächst das Licht, wobei die Zuschauer jetzt immer um den Tisch standen — die Kerze des einzelnen Leuchters verlöschte eben wie durch Zauberei — dann nach höchstens einer halben Minute kündigte der Geist durch ein Poltern an, dass der Apport geschehen war, gleichzeitig flammte die Kerze, ein gewöhnliches Wachslicht, wie man sich überzeugen konnte, wieder auf, und stets lag der Ring dort, wo man ihn durch Markierung der zweiten Unterlage hatte haben wollen.
Eine Täuschung war vollkommen ausgeschlossen; es konnte nicht anders sein, als dass der Ring von Unterlage zu Unterlage durch die Luft getragen wurde. Der Marquis stand immer in der Mitte der Zuschauer, von einer fremden Hilfe war gar nicht zu reden.
Nur einmal weigerte sich der Magier, einen besonderen Apport vorzunehmen — nämlich als der deutsche Fürst verlangte, der Ring solle aus seiner Hand fortgenommen und ihm in seine andere Hand getragen werden. Er könne ja, meinte er, beide Hände flach ausstrecken und darauf auch die Unterlagen legen.
»Nein, Durchlaucht, ich sagte doch schon, dass diese Luftgeister die Nähe der Menschen äußerst fürchten. Es ist schon genug, dass ich meinen Eziel so weit bekommen habe, dass er sich hier in einem geschlossenen Zimmer manifestiert, in dem sich so viele Menschen aufhalten.«
Und dabei beharrte der Magier, ließ aber den Apport dafür unter ganz erschwerten Umständen ausführen.
Die Zuschauer mussten sich eng geschlossen um den Tisch stellen, die eine Unterlage wurde auf die Mitte der Tischplatte gelegt.
»Es ist nicht etwa nötig, dass sie die andere Unterlage immer an den Boden legen. Legen Sie dieselbe doch einmal auf einen Arm des Kronleuchters, oder oben auf die Gardinenstange. Der Ring wird sowohl von dort geholt als auch dorthin wieder gebracht.«
Es wurde gemacht, und es glückte stets.
Nachdem das Licht selbstständig verlöscht war, wurde der Ring von dem Tisch geholt und dann oben auf dem Kronleuchter oder auf der Gardinenstange wiedergefunden, von dort wanderte er auch wieder auf den Tisch zurück.
Das Staunen der Herren wuchs nur immer mehr, obgleich man eine Steigerung dieses Staunens kaum noch hätte für möglich halten sollen.
Nachträglich zu bemerken ist noch, dass die beiden Damen, um besser sehen zu können, schon längst die Schleier vom Gesicht entfernt hatten.
Die Herren dachten jetzt nicht daran, die blendende Schönheit der jüngeren zu bewundern, ebenso wenig merkten sie da auch, mit welch lodernder Glut die Augen des Marquis so oft an den bezaubernden Zügen Pepitas hingen.
Als der Ring wieder einmal von der Gardinenstange in noch nicht einer halben Minute auf den Tisch zurückgewandert war und die Kerze sich von selbst wieder entzündet hatte, erscholl nochmals solch ein Stöhnen durch den Saal, noch grauenvoller anzuhören denn zuvor.
»Meine Herren — der Geist hat seine Astralkraft vollkommen erschöpft, dieses sein Stöhnen sagt es mir, und ich muss ihn schonen, auch er kann sich überanstrengen. Ich empfehle mich Ihrem Wohlwollen und stehe zu weiteren Privatvorstellungen, in denen ich noch ganz, ganz andere Experimente vorführen werde, gern zur Verfügung.«
So hatte der Marquis gesagt, eine elegante, vornehme Verbeugung, dabei das glühende Auge auf das junge Mädchen gerichtet, und er hatte den Saal schnell verlassen. — — — — —
Dies war des Marquis Pellegrini, des späteren Cagliostros erste öffentliche Vorstellung, welche noch lange Zeit in der ganzen zivilisierten Welt als das ›Wunder von Genua‹ besprochen wurde, das aber damals ein noch ganz anderes Aufsehen erregte als hundert Jahre später der bekannte Spuk von Resau.
Unsere beiden Freunde beteiligten sich nicht an der jetzt losbrechenden allgemeinen Diskussion, auch sie zogen sich schnell zurück, die beiden Damen mitnehmend.
Um deren Entfernung, um sich allein aussprechen zu können, brauchten sie sich nicht viel zu bemühen. Mutter und Tochter waren durch das Erlebte bis zur vollständigen Erschöpfung erregt worden, sodass diese Erregung also nicht noch länger anhalten konnte. Kaum hatten sie ihr Zimmer betreten, als sie vor Erschöpfung fast zusammenbrachen.
Schon fünf Minuten später konnte der Graf melden, dass beide in tiefem Schlafe lägen.
»Jetzt sind wir ungestört. Wir brauchen nur etwas leise zu sprechen. Nun, Durchlaucht — Signor Axel — was sagen Sie dazu, wie sich mein ehemaliger Leibpage entwickelt hat?«
Der Graf war während der Vorstellung ganz teilnahmslos gewesen, hatte sich gar nicht bemerkbar gemacht.
Axel hingegen war von allen Zuschauern der kaltblütigste gewesen, hatte als einziger seine Fragen immer mit größter Ruhe gestellt, alles mit prüfenden Augen beobachtet — jetzt hinterher erst brach bei ihm plötzlich die furchtbarste Erregung durch.
»Bei Gott, ich kann nicht mehr daran zweifeln, dass dieser Mann wirklich einen dienstbaren Geist besitzt, denn wie ist es denn sonst möglich, dass....«
Der Fürst, der aufgeregt im Zimmer hin und her ging, brach plötzlich ab, stutzte — er hatte den furchtbar spöttischen Blick aufgefangen, mit dem ihn der Graf betrachtete.
»Ja, wie ist mir denn — Sie flüsterten mir doch schon vorhin etwas von Täuschung zu!«
»Leise, leise«, ermahnte der Graf zunächst, aber mit immer grimmigerem Spott in den Zügen. »Wir sind hier weder in dem römischen Spukkloster noch in der Libyschen Wüste.«
»Das wäre alles nur Täuschung gewesen?«, flüsterte Axel jetzt.
»Gewiss, Betrug!«
»Sie können dafür eine nüchterne Erklärung geben?«
»Gewiss. Und Sie ahnen nicht, wie dieser Gaukler den Hokuspokus zustande gebracht hat?«
»Nicht die geringste Ahnung.«
»Zunächst die fremden Töne, das Poltern, Klopfen, Stöhnen, Klingeln und so weiter — Sie wissen nicht, wie man das zustande bringen kann?«
»So sprechen Sie doch nur!«
»Dieser neue Adept ist ganz einfach ein perfekter Bauchredner.«
Mit etwas geöffnetem Munde starrte Axel den so Sprechenden an.
Etwas für ihn Unverständliches hatte er ja nicht zu hören bekommen. Bauchredner oder Ventriloquisten hat es von jeher gegeben. Schon Jesaias im 20. Kapitel 4. Vers erwähnt einen. Im alten Griechenland hießen sie Eurykliden, indem ein Mann namens Eurykles eine besondere Fertigkeit in dieser Kunst erlangt hatte. Zur Zeit unserer Erzählung machten der Franzose Alexandre Olivier und der Engländer Fred James als Ventriloquisten viel von sich reden.
»Ein Bauchredner, meinen Sie?«, brachte Axel dann endlich hervor. »Graf, haben Sie denn einen Ventriloquisten jemals gesehen und gehört?«
»O ja.«
»Was meinen Sie denn aber wohl — ich habe den Olivier und den James gehört...«
»Ich auch.«
»Na, dann müssen Sie doch auch wissen, was für Grenzen die Bauchrednerei hat — ja, das ist ja ganz wunderhübsch, wie die ihre Puppen sich unterhalten lassen, wie die vor einem Fenster ein Gespräch erzeugen, die Stimmen sich entfernen lassen, Hunde bellen und Raben krächzen lassen und dergleichen — besonders Olivier bewegt dabei auch nicht im Geringsten seine Lippen — aber, wie gesagt, das hat doch alles seine Grenzen, und nun solche Poltertöne mit dem Zwerchfell hervorzubringen — und nun gar dieses Klingeln — da ist ja gar kein Gedanke daran...«
»Geehrter Herr, die enge Begrenzung ist ganz auf Ihrer Seite. Gewiss, Grenzen sind für alles gezogen — nur nicht für die Unendlichkeit des Raumes und der Zeit — das sind also schon zwei Ausnahmen — und dann kann jeder Mensch schon gezogene Grenzen doch noch immer weiter hinausschieben. Hatte ich Ihnen nicht schon erzählt, dass bereits mein zwölfjähriger Page ein fabelhafter Ventriloquist war?«
Hatte der Graf vergessen, dass er seinem Freunde damals so etwas nicht berichtet? Er hatte ihm von seinem Pagen nichts weiter erzählt, als dass er in den aufgeweckten Knaben die größte Hoffnung gesetzt hatte, ihn als Nachfolger zur Erreichung seiner hohen Ziele erziehen zu können, aber sonst nichts einmal davon, wie sich der Knabe bei ihm durch die erstaunliche Geschicklichkeit im Werfen einzuführen gewusst hatte.
»Ja, der Junge leistete schon damals im Bauchreden das Fabelhafteste. Er hatte, ohne je einen Ventriloquisten gehört zu haben, im Bauchreden das Wunderbarste, es war bei ihm eine angeborene Gabe, die er zufällig entdeckt und dann durch Übung weiter ausgebildet hatte, ohne einem Menschen davon zu sagen, seine Kunst höchstens zu Allotria benutzend, aber niemals eine Aufklärung gebend — und schon damals konnte er das Klopfen an der Tür und zum Beispiel sogar das Rollen einer Kanonenkugel auf hölzerner Diele ganz getreu nachahmen, und dann, als er meine schrillenden Klingeln gehört hatte, zum ersten Male, wusste er auch dies sofort ganz genau nachzuahmen, ließ sie ganz nah und weit entfernt schrillen, wie er wollte, ohne im Geringsten die Lippen zu bewegen. Er brachte überhaupt jeden Ton fertig, und in diesen zehn Jahren wird er sich darin wohl noch mehr ausgebildet haben.«
Axel hatte sich auf das Sofa fallen lassen, ganz fassungslos.
»Ja, wenn es so ist, dann freilich... Bauchrednerei... dann ist das ja alles Schwindel...«
»Haben Sie denn daran je gezweifelt, nachdem Sie wussten, dass es mein durchgebrannter Diener war?«
»Aber diese wissenschaftliche Erklärung, die er vorausschickte...«
»Alles einem Schwindler ganz entsprechend — ein neuer Trick in dieser Hokuspokusmacherei.«
Wieder sprang Axel auf, von Neuem ganz erregt.
»Ja, aber nun der Apport, das können Sie doch unmöglich auf natürliche Weise erklären!«
»Nichts einfacher als das.«
»Was, auch das könnten Sie auf natürliche Weise erklären?«
»Der Gaukler ahnte nicht, dass sich unter den Zuschauern ein Mann befand, der im Finstern fast ebenso gut sehen kann wie im Hellen.«
»Und was haben Sie da gesehen?!«, stieß Axel hervor.
»Ja, es wäre nicht einmal nötig gewesen, dass ich im Finstern sehen konnte — oder ich hätte diese Gabe unterdessen verlieren können — schon mein Leibpage hat mir dieses Kunststückchen vorgemacht, wie man einen Gegenstand hin und her wandern lassen kann.«
»Und wie machte er das — so sprechen Sie doch, Graf, sprechen Sie!«
»Als der Junge zu mir kam, hatte er bereits eine dressierte Maus in der Tasche — ich musste ihm ein Petschaft geben, er legte es hinter sich an den Boden, ich musste mich umdrehen, der Junge legte die Arme um meinen Leib — und im nächsten Augenblick hatte er das Petschaft in der Hand. Damals staunte ich nicht weniger als vorhin die Herren, wie Sie selbst — auch ich mochte fast an etwas Übernatürliches glauben — bis mir der kleine Joseph die Erklärung gab. Er hatte eine dressierte Maus bei sich.«
Wieder starrte Axel den Sprechenden ganz fassungslos an.
»Eine dressierte Maus?!«
»Nichts anderes.«
»Die Maus soll den Ring so hin und her tragen?«
»Jawohl, und auch vorhin war es eine Maus.«
»Wie kann man denn eine Maus so dressieren!«
»Na, warum denn nicht? Die Maus ist wohl gar kein so dummes Tier, und wenn man sich ein ganzes Jahr lang mit so einer Maus beschäftigt, da glaube ich schon, dass man ihr etwas beibringen kann. Und was ist es denn viel, was man von ihr verlangt, was sie da leisten muss? Sie schlüpft auf ein Zeichen ihres Herrn aus seiner Tasche und hat den kleinen Gegenstand hin und her zu tragen, von einer Unterlage zur anderen — deshalb eben die Geschichte mit der Unterlage — und ich sah recht wohl, wie der Marquis die beiden Tuchstückchen vorher gehörig zwischen seinen Händen rieb, um sie mit seiner Witterung zu versehen — und die Maus hat bekanntlich einen wunderbar feinen Geruch — und solch eine Maus huscht in einem Augenblick doch durch das ganze Zimmer — da hat sie sofort die beiden Unterlagen gefunden — die eine mit, die andere ohne Ring oder sonstigen Gegenstand — und was sie auf der einen findet, trägt sie eben nach der anderen —das ist die ganze Dressur, die man von ihr verlangt. Dann huscht sie in die Tasche zurück. Und das sollte man im Laufe der Zeit einer Maus nicht beibringen? Dann vielleicht nur noch, dass sie ängstlich zu vermeiden hat, mit einem anderen Menschen in Berührung zu kommen. Na, und da hat der Herr Marquis einfach gleich wieder eine Geistertheorie geschaffen.«
»Und wie kam der Ring auf den Kronleuchter?«
»Sie können noch fragen? Einfach die rautapezierte Wand hinauf. Dass sie diesmal den Gegenstand nicht am Boden zu suchen hatte, dafür genügte der klugen Maus doch schon ein kleines Zeichen, und sie suchte im Nu die Wände und die Decke ab, den Ring im Maule oder ihn von dort abholend. So legte sie ihn auch auf den Tisch, holte ihn von dort ab, kletterte dabei am Hosenbeine ihres Herrn hinauf.«
»Sie haben die Maus dabei beobachten können?«
»Gewiss, ganz deutlich. Es war ein allerliebstes schwarzes Mäuschen, mit etwas gestutztem Schwänzchen.«
Axel machte eine Bewegung, als wolle er die Hände über dem Kopfe zusammenschlagen. An das Verlöschen und Anzünden der Lichter dachte er gar nicht mehr, das war dann eben erst recht ein Taschenspielerkunststückchen.
»O, Betrug über Betrug — und dieser Schwindler schwatzt uns da immer etwas von den Eigenschaften der Geister auf der Astral- und auf der irdischen Ebene vor!«
»Natürlich, das hatte er äußerst geschickt gemacht.«
»Und Sie haben diesen vierbeinigen geschwänzten Astralgeist gesehen, wie er auf dem Tische herumlief, und haben ihn nicht gleich totgeschlagen?«
»Weshalb das?«
»Na, um diesen Magier des Betruges zu überführen!«
»O, ich wollte ihm oder vielmehr den Herren doch nicht das Vergnügen verderben. Man greift ja auch dem Taschenspieler nicht gleich in den Ärmel.«
»Sie haben recht — jetzt aber wollen wir diesen Magier doch einmal allein sprechen — auch schon wegen des entwendeten Buches, seiner sonstigen Schwindeleien, die er mit Ihrer Person treibt.«
Da plötzlich war es doch, als wenn der Graf zusammenbrechen wolle.
»Das... kann ich nicht!«, flüsterte er, und es hatte wie ein Ächzen geklungen.
Stutzend betrachtete Axel den Freund, der sich jetzt auf dem Sofa niedergelassen hatte, schon wieder den Kopf tief auf die Brust senkend.
»Ach sooo«, sagte Axel dann langsam, »er hat Sie ja in der Tasche, Sie haben es mir ja bereits gesagt.«
»Es ist so«, murmelte der Graf.
»Inwiefern? Kann ich es jetzt nicht erfahren?«
»Ich... möchte es lieber verschweigen.«
»Sind auch Sie vielleicht ein Bauchredner?«, begann Axel jetzt zu examinieren.
»Nein, ich habe gar keine Gabe dazu, habe mich darin nie auszubilden versucht.«
»Oder haben des Jungen Kunst zu derartigen Experimenten schon damals benutzt?«
»Nein, niemals. Joseph bot es mir an — ich wies derartiges entrüstet zurück — ich sei kein Betrüger, wolle es niemals werden.«
»Dann haben Sie auch niemals eine Maus oder ein sonstiges Vieh zu derartigen Kunststücken benutzt?«
»Niemals. Ich verbot dem Jungen derartige Betrügereien, redete ihm ernstlich ins Gewissen.«
»Ja, inwiefern soll der Junge Sie denn dann in die Tasche bekommen haben?«
Schwer rang der Graf nach Atem, noch immer nicht aufzublicken wagend.
»Weil — weil — er dennoch manches von mir erfahren hat.
»Dass Sie — dass Sie....«
»Dass auch ich ein Betrüger gewesen bin«, erklang es murmelnd.
»Inwiefern denn nur? Wollen Sie es mir nicht gestehen, damit ich das Mittel finde, wie wenigstens ich ihm aufs Leder knien kann?«
»Indem ich... indem er erfuhr, dass ich ja manchmal der Speise und des Trankes bedarf«, kam es endlich zögernd heraus.
Axel aber machte bei diesem Geständnis ein völlig verblüfftes Gesicht.
»Was? Das ist alles was er von Ihnen weiß?!«
»Unterschätzen Sie es nicht — gerade damals behauptete ich vor aller Welt, dass ich nur von der Luft leben könne — und Joseph wurde hin und wieder Zeuge, wie auch ich der irdischen Speise bedarf — wenigstens hin und wieder.«
»Na, Graf, nun machen Sie sich doch nicht lächerlich, möchte ich da wirklich fast sagen!«
»Nein, nein, Sie erfassen die Sache doch nicht richtig. Mein Leibpage musste auch wachen, wenn ich selbst schlief — ich, der ich fortwährend behauptete, keines Schlafes zu bedürfen.«
»Was weiß er denn sonst noch von Ihnen?«
»Nichts weiter.«
»Das ist also alles?«, sagte Axel in ehrlichem Staunen. »Weil Sie aßen und tranken und schliefen, weil Joseph das von Ihnen wusste, deshalb soll er Sie noch jetzt in der Tasche haben, sodass Sie nicht gegen ihn vorgehen dürfen?!«
Etwas freier hob der Graf den Kopf und das Auge.
»Nein, Durchlaucht — Signor Axel, mein treuer Freund — wenn Sie so sprechen, das so leicht nehmen, dann haben Sie eben die ganze Sachlage wirklich nicht begriffen. Ich selbst hatte den Weg des Betruges betreten — und wenn meinen Zielen auch das edelste Motiv zugrunde lag — ich war ein Betrüger — denn auch ich bedarf der Nahrung und des Schlafes, wenn auch nicht so häufig wie andere Menschen, denn ich besitze ein Mittel, um beides auf ein Minimum zu beschränken — aber dieser Mann hat insofern ganz recht, wenn er immer von einer falschen Eitelkeit spricht, die mich verleitet hätte — ja, ich wollte weit mehr scheinen, als ich in Wirklichkeit war — über alle irdischen Schwächen erhaben — und zu diesem Betruge brauchte ich einen Menschen, der mich dabei unterstützte, mich bewachte — und diesem Knaben glaubte ich mich anvertrauen zu dürfen — ich tat es — er musste mir Speisen verschaffen und für mich wachen, wenn ich schlief — so machte ich ihn zum Mitschuldigen dieses Betruges — und mochte dieser auch noch so harmlos sein... wie dürfte ich wagen, ihn wegen dieser seiner Betrügereien jetzt zur Rechenschaft zu ziehen? Ich habe einfach zu dulden — mir sind die Hände gebunden.«
So sprach der Graf. Es war nicht so ganz leicht zu verstehen, der furchtbare Grund, der ihn daran hinderte, gegen diesen Schwindler vorzugehen.
Aber dieser deutsche Fürst war eben der Mann, der ihn verstand. Ja, jetzt hatte der ihn verstanden.
In Gedanken versunken schritt Axel in dem Zimmer auf und ab.
»Ja, Sie haben recht, Sie haben leider nur zu recht. jetzt verstehe ich Sie«, war er es nun, der gedrückt zu murmeln begann.
Dann war er es auch, der mit einer energischen Bewegung den Kopf zurückwarf, als er vor dem Grafen wieder stehen blieb.
»Aber dass ich es bin, der diesen betrügerischen Magier zur Verantwortung zieht, dagegen werden Sie doch nichts einzuwenden haben.«
»Wie soll ich Sie daran hindern? Nur bitte ich Sie... lassen Sie mich dabei aus dem Spiele! Wenigstens dass ich nicht persönlich dabei eingreifen muss.«
»Das ist auch nicht nötig. Möchten Sie aber nicht wenigstens dabei sein?«
»Doch, aber... womöglichst noch immer ungesehen, heimlich.«
»Gut, machen wir es dann doch so...«
Es fand eine kurze Beratung statt, dessen erste Folge war, dass Axel die Klingelschnur zog. Der Zimmerkellner kam.
»Ich möchte diese Nacht hier im Hotel bleiben.«
Es waren noch genügend Zimmer frei, Axel hatte die Auswahl, der Graf begleitete ihn bei der Besichtigung.
»Hier, dieses werde ich nehmen, Apropos — ist der Marquis Pellegrini wohl noch zu sprechen?«
»Der Herr Marquis speist soeben.«
»Fragen Sie ihn doch... Sie wissen, wer ich bin?«
»Sehr wohl, allergnädigste Durchlaucht.«
»Fragen Sie den Herrn Marquis doch, ob ich ihn dann nicht noch einmal hier auf meinem Zimmer erwarten darf.«
Die beiden waren wieder allein.
»Alles wie geschaffen dazu.«
Axel meinte damit hauptsächlich den angrenzenden Garderoberaum, dessen Eingang nur durch eine dicht abschließende Portiere verhangen war. Hinter dieser sollte sich der Graf versteckt halten.
Dass für alle die, welche heute oder eigentlich schon gestern eine längere Siesta gehalten hatten, bereits wieder ein neuer Tag angebrochen war, ist schon gesagt worden. Trotzdem hatten die beiden kaum gehofft, dass die Auseinandersetzung schon so bald stattfinden würde.
Ob aber auch der Graf ›gehofft‹ hatte? Er musste noch immer mit einer scheuen Verlegenheit kämpfen, während sich auf des deutschen Fürsten männlichem Antlitz ein unheilverkündender Ernst ausdrückte.
Als der Kellner wieder erschien, war der Graf bereits hinter der Portiere verschwunden. Dass er sich hier befinden müsse, war durchaus nicht gesagt. Er konnte unterdessen längst wieder sein eigenes Zimmer aufgesucht haben.
»Der Herr Marquis lässt sich anmelden.«
»Ist er schon da?«
»Er ist mir gefolgt.«
»Bitte sehr.«
Der Erwartete trat unter einer Verbeugung ein.
»Eure Durchlaucht haben mich befohlen?«
Ganz devoter Gehorsam, in Worten wie in Gebärden — aber selbst ein weniger scharfer Beobachter hätte gleich das Empfinden gehabt, als sei es dieser so bescheidene Mann, der dem Fürsten befohlen habe, ihn hier zu empfangen. Es lag im ganzen Wesen dieses Mannes, was sich aber eben nicht definieren lässt.
Unser Axel freilich, mochte er auch diese Empfindung haben, ließ sich von derselben nicht unterjochen.
»O, bitte — Sie haben sich doch nicht etwa in ihrer Mahlzeit stören lassen?«
»Ich hatte sie soeben beendet,«
»Bitte wollen Sie Platz nehmen.«
»Danke sehr«, der Marquis zog im Niederlassen seine Taschenuhr, »... nur erlaube ich mir Eure Durchlaucht gleich darauf aufmerksam zu machen, dass jede Minute meiner Zeit fünf Lire kostet — also die Stunde 300 Lire — es ist jetzt genau acht Minuten nach eins.«
Der deutsche Fürst machte ein Gesicht, als dürfe er seinen Ohren nicht recht trauen. Das war ja die Grenze der Unverschämtheit!
Ja, aber warum dieses Urteil? Es lag eigentlich nur in dem wunderbaren Kontrast zu der sonstigen Bescheidenheit dieses Mannes, die er wenigstens zu besitzen vorgab.
Axel beherrschte sich.
»Ist denn Ihre Zeit gar so kostbar?«
»Ja und nein... ich habe von meinen Oberen strenge Vorschrift, diesen Preis von fünf Lire für jede Minute, die ich einem anderen zur Verfügung zu stehen habe, zu fordern. Eure Durchlaucht sind doch mit diesem Preise einverstanden?«
Der Fürst musste wohl oder übel bejahen, wollte er nicht gleich mit der Türe ins Haus fallen.
»Dann gestatten Sie aber wohl, dass ich mich so kurz wie möglich fasse.«
»Das ist mir sogar sehr angenehm. Denn ich selbst habe gar nichts davon.«
Axel fasste sich aber doch nicht so kurz wie möglich.
»Sie haben dieses Zeitgeld wohl an Ihre Oberen abzuliefern?«
»So ist es.«
»Dem Grafen von Saint-Germain.'«
»O nein, dieser kommt dabei gar nicht in Betracht.«
»Ach so, der ist ja jetzt selber ein Gefangener.«
»Zweifeln Euee Durchlaucht etwa an dieser meiner Behauptung?«
Axel musste sich bezwingen, nicht unruhig zu werden. Er fühlte schon heraus, das dieser Mann gewillt war, den Spieß umzukehren, und er wusste nicht, wie jener das anfangen wollte.
»Ja, ich zweifele Ihre Behauptung sehr stark an.«
»Da sind Eure Durchlaucht auch ganz im Recht.«
»Was?!«, stieß Axel vollständig verblüfft hervor.
»Was ich von der Gefangenschaft erzählte, beruht doch auf reiner Erfindung.«
»Was?!«, konnte Axel nur wiederholen.
»Sie wissen doch selbst am besten, dass sich der Graf von Saint-Germain nicht in der ägyptischen Cheopspyramide befinden kann.«
»Ich?«
Axel wurde immer fassungsloser, was bei diesem Manne doch viel zu bedeuten hatte — er ließ sich eben düpieren — während sich der Marquis immer bequemer in dem Lehnstuhl zurechtsetzte.
»Durchlaucht — ich bin für Sie ein Betrüger. Aber dasselbe sind Sie für mich.... bitte!!! Täuschung und Betrug ist doch eigentlich genau dasselbe. Wer im Pferdeverkauf betrügt, wird nur etwas vornehmer Rosstäuscher genannt. Sie wollen mir jetzt verheimlichen, dass Sie wissen, wie jener russische Graf Soltykow in Wirklichkeit der Graf von Saint-Germain ist. Wollen Sie mich also nicht täuschen? Und Täuschung ist Betrug. Wir sind quitt, haben einander nichts vorzuwerfen.«
Es war ausgesprochen. Ganz gemächlich.
Und wie vom Donner gerührt saß der deutsche Fürst da. Zunächst nur unter dem furchtbaren Bewusstsein stehend, dass er einem Schurken in die Hände gefallen war, der ihm in Anwendung der Waffen, mit denen er sofort kämpfte, hundertfach überlegen war.
Dies ›in die Hände gefallen‹ ist freilich nicht so wörtlich zu nehmen, das wusste auch Axel.
Immerhin, er saß einem Schurken gegenüber, der ihm bereits die Pistole auf die Brust gesetzt hatte, bereit, sie abzudrücken, und im Augenblick war Axel ganz wehrlos.
Einem Schurken? Inwiefern war denn dieser Mann ein so ausgemachter Schurke, der zu allem fähig gewesen wäre?
Ach, der Begriff ›Schurke‹ und ›Verbrecher‹ wird allzu eng umgrenzt.
Es laufen gar viele Schurken herum, die weit, weit gefährlicher sind als der gefährlichste Raubmörder, und es ist ihnen nichts anzuhaben.
Ist denn ein halsabschneidender Wucherer, der zahllose Familien ins Unglück, ins größte Elend ihren Ernährer zum Selbstmord treibt, nicht viel gefährlicher als ein Raubmörder? Diesen kann der Gendarm wenigstens mit einer Kugel niederstrecken, jeder darf ihn in der Notwehr töten, aber den Wucherer nicht. Aber solche Unterschiede oder vielmehr Gleichartigkeiten sehen wir blinden Menschlein ja nicht ein, wenigstens das Strafgesetzbuch macht da keinen Unterschied oder eben einen sehr großen Unterschied — weil eben dieses Strafgesetzbuch ein ganz und gar unvollkommenes Machwerk von Menschenhand und Menschengehirn ist.
Wenn es Axel nicht mit vollem Bewusstsein wusste, so fühlte er doch instinktiv sofort heraus, was für einem furchtbar gefährlichen Schurken er da gegenübersaß — und mit dieser Erkenntnis hatte er auch seine Kaltblütigkeit wieder, jetzt war er für jeden Kampf gewappnet.
Erst galt es für ihn, die Hauptsache zu erledigen.
»Sie wussten, dass dieser russische Graf Soltykow der Graf von Saint-Germain ist?«
»Als ich seinen Namen hörte, ohne ihn zu sehen — nein, da wusste ich es noch nicht.«
»Sie erkannten ihn?«
»Sofort.«
Das hatte Axel also nicht für möglich gehalten, selbst der Graf nicht. Es spricht für die Augen und sonstiges Beobachtungsvermögen dieses Cagliostro.
»Wie kommen Sie dazu, das Märchen von der Gesangenschaft des Grafen zu erfinden?«
»Weil ich es wagen zu dürfen glaubte.«
»Inwiefern?«
»Weil ich von dem Tode des Grafen fest überzeugt war.«
»Von wem haben Sie so etwas erfahren?«
»Das ist meine Sache«, wurde der Marquis jetzt weniger bescheiden. »Kurz, ich war fest überzeugt, dass mein ehemaliger Lehrmeister bald nach dem Verlassen Roms seinen Tod gefunden habe.«
»Und als Sie ihn nun in dem russischen Grafen erkannten?«
»Nun, was da?«
»War Ihr Schreck da nicht ein furchtbarer?«
»Ich bin über Schreck und Furcht und dergleichen Schwächen erhaben«, wurde der bisher so bescheidene Magier immer selbstherrlicher.
»Aber das Märchen von dem gefangenen Grafen hatten Sie doch schon vorher ausgesponnen.«
»Selbstverständlich.«
»Und auch als Sie den Grafen von Saint-Germain erkannt hatten, wagten Sie noch immer, Ihr Märchen als eine Tatsache hinzustellen?«
»Da war gar nichts dabei zu wagen.«
»Der Graf kann Sie doch sofort der Lüge überführen.«
»Fragen Sie ihn doch lieber, ob er dies würde.«
»Was wissen Sie denn von Ihrem ehemaligen Herrn, dass Sie seiner Verschwiegenheit oder vielmehr seiner Duldung so sicher sind?«, wollte Axel erst einmal aushorchen.
»Bah, nun machen Sie dieser Komödie doch endlich ein Ende!«, erklang es verächtlich zurück. »Oder lassen Sie den Grafen hier vor uns hintreten, er soll uns sein Ehrenwort geben, oder nein, er soll uns nur fest ins Auge blicken, und so soll er sagen, dass er nicht selbst ein Betrüger ist.«
»Inwiefern ein Betrüger?«, vermochte Axel noch ruhig zu bleiben.
»Ob er wirklich von dem französischen König zum Grafen von Saint-Germain geadelt worden ist, ob er überhaupt schon im vorigen Jahrhundert gelebt hat, von den Jahrtausenden gar nicht zu sprechen, ob er wirklich hundert Jahre lang in dem Keller der englischen Gesandtschaft zu Rom gelegen hat. Rufen Sie ihn, fragen Sie ihn, ob er uns antworten kann, ohne vor Scham die Augen niederzuschlagen. Nur möchte ich ihn selbst dabei fest anblicken.«
O, dieser Mann hatte recht, hatte furchtbar recht! Dagegen kam das, was der Graf vorhin angeführt hatte, wegen des Schlafens und so weiter, ja gar nicht in Betracht!
»Nun aber«, fuhr Axel fort, sich nicht aus der Fassung bringen lassend, was in ihm auch vorgehen mochte, »weiß ich auch, wie Sie vorhin den Hokuspokus fertiggebracht haben.«
»Das glaube ich schon.«
»Sie sind ein Bauchredner, den Apport lassen Sie durch eine dressierte Maus verrichten.«
»Ja, ja, das glaube ich schon, dass Sie das jetzt wissen — das alles hat Ihnen doch einfach der Graf berichtet. Außerdem wissen Sie ja sowieso, dass dies mit der Gefangenschaft des Grafen alles Schwindel sein muss.«
Ganz ruhig hatte es der Marquis gesagt, dabei gemütlich ein Bein übers andere legend.
»Nun also — nicht der Graf ist es, sondern jetzt bin ich es, der Sie vernichten wird.«
»Was heißt vernichten?«
»Ich werde Sie als Betrüger brandmarken, und das jetzt sofort!«
»Das werden Sie hübsch bleiben lassen.«
»Woraus schließen Sie, dass ich das bleiben lassen werde?«
»Weil Sie doch mit dem Grafen der dickste Freund sind.«
Schon zuckte der Fürst zusammen, und der Gaukler hatte wohl nicht umsonst einen recht vulgären Ausdruck gewählt.
»Woher wissen Sie, dass wir gute Freunde sind?«
»Um das sofort zu erkennen, dazu bin ich Menschenkenner genug — das erste Erfordernis eines Mannes, der als Adept die Welt, die betrogen sein will, wirklich mit Erfolg zu betrügen.«
Axel brauchte gar nichts weiter zu fragen — zum Beispiel, ob jener wisse, seit wann diese Freundschaft schon stamme.
Dieser Gaukler hatte erkannt, dass der deutsche Fürst den falschen Grafen nie bloßstellen würde — das genügte, der Gegner hatte so gut wie gesiegt, wenn es auch gar kein offenkundiger Sieg war.
Und als ob jeder Sieg im menschlichen Leben immer mit Posaunenschall verkündet würde! Nein, gerade die Siege, die in aller Stille errungen werden, — das sind immer die schwerwiegenden.
»Sie irren«, versuchte es Axel doch immer noch einmal, in der Hoffnung. jenen doch vielleicht noch ins Bockshorn jagen zu können, »dieser Graf Soltykow kümmert mich gar nicht mehr, ich werde Sie als Betrüger an den Pranger stellen.«
»Nein, ich irre mich überhaupt niemals — Sie werden den Grafen von Saint-Germain nicht bloßstellen.«
»Einen Grafen von Saint-Germain gibt es nicht mehr.«
»Dann, wenn Sie mich verraten — verrate natürlich auch ich, dass der Graf Soltykow und der einst so viel bewunderte Graf von Saint-Germain ein und dieselbe Person sind.«
»Auch der Graf Soltykow wird bald wieder spurlos von der Bildfläche verschwinden.«
»Aber das Andenken an den Grafen von Saint-Germain bleibt ewig, und zwar ist es ein sehr gutes, ehrenwertes Andenken — und dass es dieses bleibt, dass sein Name nicht noch jetzt gebrandmarkt wird, das liegt nur an Ihnen. Verraten Sie mich, so verrate ich Ihren Freund — man wird den Namen des Grafen von Saint-Germain noch nachträglich mit Schmach überhäufen.«
Da war der Fürst vollends geschlagen! Nur das hatte ihm noch gesagt werden müssen!
»Gehen Sie, wir sind miteinander fertig!«, konnte er mit letzter Kraft noch ruhig sagen.
»Dass Sie mir nichts anhaben können, weiß ich überhaupt, oder ich hätte mich einmal in einem Menschen geirrt. Eben weil Sie ein tadelloser Ehrenmann sind, dem die Freundschaft heilig ist, bin ich gefeit.«
Der Leser versteht! Gibt es wohl eine raffiniertere Schurkerei als die, welche mit solch einer Ehrenhaftigkeit spekuliert?
»Gehen Sie!«, wiederholte der Fürst nur.
»Wie Sie wünschen, Durchlaucht.«
Im Aufstehen zog der Marquis wieder seine Taschenuhr.
»Unsere Unterhaltung hat genau vierundzwanzig Minuten gewährt. Das macht einhundertundzwanzig Lire — wenn ich bitten darf.«
Schnell griff Axel in die Tasche und warf dem anderen eine schwere Geldbörse vor die Füße.
»Da!«
Gedachte Axel den Marquis auf diese Weise zu demütigen?
O nein, der spätere Cagliostro ließ sich nicht demütigen, der wusste immer und stets den Spieß herumzukehren.
Zunächst hob er die Börse ganz gelassen auf, öffnete sie.
»Erst muss ich mich wohl vergewissern, ob auch wirklich hundertundzwanzig Lire darin sind, schon Silber ist sehr schwer.«
Nur ein dunkles Rot ergoss sich über das Gesicht des Fürsten, er konnte auch noch seine Finger beherrschen, dass sie nicht schon zuckten.
»Ei, da sind ja eine ganze Menge Goldstücke darin, das ist viel zu viel...«
»Behalten Sie, behalten Sie!«
»Das ganze Geld? Auch die Börse? Dass ich Sie nicht etwa eines teueren Andenkens beraube. Nicht? Dann ist es dankend angenommen.«
Und kaltblütig versenkte der Herr Marquis die Börse in seine Beinkleidertasche.
»Übrigens«, setzte er noch hinzu, vor dem, der nun alles über ihn wusste, seinen Charakter nicht mit dem durchsichtigsten Schleier verhüllend, »habe ich mir dieses Mehr wohl auch redlich verdient, das war vorhin eine gar lange Sitzung, und die anderen Herren werde ich ebenfalls noch tüchtig schröpfen. Und dann, Durchlaucht, werden Sie wohl die Güte haben — und diese Zeit rechne ich Ihnen also nicht an — mir ein Attest zu geben, dass Sie mit meiner Vorstellung außerordentlich zufrieden waren, dass Sie nicht den geringsten Zweifel an meinen magischen Fähigkeiten hegen...«
»Unverschämter!!«, brauste da der Fürst auf, im Emporspringen den Stuhl umwerfend. »Ehrloser Lump — nun ist es aber endlich genug!!!«

Doch der andere zuckte mit keiner Wimper, war ganz von Eisen.
»Einen ehrlosen Lumpen nennen Sie mich? Und was ist denn der, der mit einem Betrüger freundschaftlich verkehrt, von dem er auch ganz bestimmt weiß. dass er wirklich ein Betrüger ist?«
Bleich wie der Tod taumelte der Fürst zurück.
Das hatte gesessen!
Das ganze Gleichnis traf ja durchaus nicht zu — aber wie war jetzt dem zu widersprechen?
»Mensch, Mensch, wie wagst du so etwas zu sagen«, stammelte der Fürst fassungslos, »das ist ja etwas ganz, ganz anderes!!«
»Ja, das sagen Sie — und Sie mögen ja auch ganz recht haben — aber machen Sie das einmal der anderen Welt plausibel!«
Wieder sprach dieser Schwindler eine furchtbare Wahrheit aus.
»Doch wohlan«, fuhr er dann fort, »ich nehme das ›ehrloser Lump‹ an. Also eine Beleidigung. Und selbstverständlich bin ich mit Ihnen ganz gleichgestellt, das heißt, ein ebensolch untadelhafter Ehrenmann wie Sie. Denn bezeugen Sie dies nicht der Öffentlichkeit gegenüber, so bin ich genötigt, auch von dem Grafen von Saint-Germain die Wahrheit zu erzählen, und diese Schande fällt doch nur wieder auf Sie zurück. Also gut, Sie haben mich furchtbar beleidigt — nehmen Sie, bitte, von mir einen Schlag ins Gesicht dafür entgegen. In Praxis ist er ja gar nicht nötig. Wir brauchen davon auch gar nichts in die Öffentlichkeit gelangen zu lassen, wir sind doch tadellose Edelleute. Aber selbstverständlich erwarte ich baldigst Ihre Sekundanten. Die Bestimmung der kavaliermäßigen Waffen ist also Ihnen überlassen.
Auf Wiedersehen!«
Eine stolzbescheidene Verbeugung, und der Marquis wiegte sich hinaus.
Nur noch einen einzigen starren Blick nach der Tür, die sich hinter dem abgebrochenen Riesen geschlossen, und der deutsche Fürst brach in ein schallendes Gelächter aus, das auch durchaus nichts Gezwungenes an sich hatte.
Dadurch überhörte er das Ächzen, welches das Hervortreten des Grafen hinter der Portiere begleitete.
»Graf, Graf, das ist ja die tollste Komödie, die ich je in meinem Dasein erlebt habe«, lachte Axel noch immer aus vollem Halse und Herzen, »das ist ja ein Bösewicht von Intrigant, wie er noch nie auf die schundigste Vorstadtbühne gekommen ist!«
Er brach ab, als er das Gesicht des Grafen sah.
»Na, Sie nehmen diese ganze Geschichte doch nicht etwa tragisch?«
Aber das tat der Graf wohl, so blickte er mit gerungenen Händen vor sich hin.
»Und wenn ich jetzt auch Selbstmord beginge«, murmelte er, »Ihre Ehre würde dadurch doch nicht wiederhergestellt werden!«
Da aber machte auch der Fürst plötzlich ein ganz anderes Gesicht.
»Halt!!! Was für Unsinn schwatzen Sie da? Noch ein solches Wort, und mit unserer Freundschaft ist es aus! Oder denken Sie wirklich, solch ein schmutziger Fatzke könne meine Ehre besudeln?«
Jetzt waren es die Augen des deutschen Fürsten, die in hellem Feuer aufloderten. Doch dieser Ausbruch war schnell wieder vorbei, er nahm gleich die Hand des Grafen, schüttelte sie.
»Nein, nein«, lachte er schon wieder, »das war wirklich nichts anderes als eine lustige Komödie. In der Tat, erst habe auch ich die Sache etwas tragisch genommen, ließ mich deshalb aufregen, aber jetzt habe ich plötzlich erkannt, dass das alles ja nur der bare Unsinn ist. Na, was ist denn nur eigentlich weiter dabei? Sie sind der russische Graf Soltykow. Sie erledigen hier schnell Ihre Angelegenheit, und dann verschwinden Sie, wie Sie sich vorgenommen, in Ihrer Einsamkeit. Und wenn ich Zeit habe, besuche ich Sie einmal, und dann werden wir noch oft über diesen köstlichen Witz lachen, den uns dieser Magier da bereitet hat. Und um mich kümmern Sie sich nur ja nicht. Wer es vielleicht erfährt, dem werde ich auch immer erzählen, dass der Graf von Saint-Germain mein bester Freund gewesen ist, und wenn dieser Marquis Pellegrini mir noch einmal über den Weg läuft, dann... kann er Bekanntschaft mit meiner Hundepeitsche machen. Zu einer Aufklärung derer, die durchaus betrogen sein wollen, sind wir ganz und gar nicht verpflichtet. So, nun habe ich Ihnen meine Meinung über diese Angelegenheit gesagt, und nun fangen Sie um Gottes willen nicht wieder davon an!«
Wie vorher verabredet, hatte die Sitzung der Diplomaten im Dogenpalast wieder früh um acht Uhr begonnen, und nur mit Unterbrechung einer zweistündigen Siesta währte sie wiederum den ganzen Tag und die halbe Nacht hindurch.
Kurz vor Mitternacht mussten die beiden fremden Gesandten, der deutsche und der russische, den Saal verlassen, jetzt gaben die Vertreter der italienischen Mächte ihre Stimmen zur endgültigen Beschlussfassung ab.
Der deutsche Fürst und der russische Graf hatten heute noch kein Wort wegen des Marquis Pellegrini gewechselt, sie hatten ganz, ganz andere Gedanken im Kopfe gehabt, und das war auch jetzt der Fall, als sie nach Verlassen des Saales schnell ein und denselben Weg einschlugen, dasselbe Ziel habend.
Es war das große Nebengebäude, in dem sonst das Gefolge vornehmer Gäste untergebracht wurde. Jetzt befanden sich darin ein halbes hundert Depeschenreiter, den italienischen Diplomaten Tag und Nacht mit immer gesattelten Pferden zur Verfügung stehend, und auch der deutsche Fürst hatte hier drei solcher internationaler Postreiter für sich liegen, der russische Fürst sogar ihrer vier, welche dann das Resultat dieser diplomatischen Sitzungen dorthin bringen sollten, wo man es mit der größten Spannung erwartete.
Jeder musste ja immer einige Depeschenreiter haben, von denen jeder die gleiche Botschaft, stets chiffriert, wenn überhaupt schriftlich, beförderte, ein einziger konnte doch verunglücken oder abgefangen werden oder sonst wie sein Ziel verfehlen — freilich konnte das auch bei einem halben Dutzend geschehen, ganz gleichgültig, ob sie alle zusammen oder in geewissen Zwischenpausen ein und denselben Weg ritten oder jeder einen anderen Weg nahm.
Die beiden gingen, um ihren Depeschenreitern zu sagen, dass sie noch einmal die Pferde fütterten, selbst noch die letzte Stärkung zu sich nahmen.
Wollten wir ausführlich schildern, wie es in dem gemeinsamen Saale zuging, den sie betraten, was für Gestalten und Charaktere sich hier zusammengefunden hatten, so würde daraus ein mehrbändiges Werk entstehen, nicht minder groß als das, welches wir dem Grafen von Saint-Germain gewidmet haben.
Denn jeder dieser mehr als fünfzig Männer war in Wirklichkeit ein Original, wie es die Menschheit wohl immer nur ein einziges Mal hervorbringt, halb Gott, halb Teufel, jedenfalls aber immer ein Held; die einen rohe, brutale Gestalten, zerlumpt und zerfetzt, auch im Gesicht, die anderen scheinbar die unschuldigsten Jünglinge, mit den glattesten Kindergesichtern oder ganz mit edlen Christusköpfen — und dazwischen nun alles, alles andere, was die Schöpfung an menschlicher Gestalt und Charakter nur hervorbringen kann, der behäbige Spießbürger, der Kavalier und der Pfaffe in der Kutte — und alles, alles doch nur Wölfe in Schafskleidern, sie sämtlich mit allen Hunden gehetzt, ihr Gesicht immer unter einer unsichtbaren Maske...
Doch wohin sollte das führen. wollte man zu schildern anfangen, was für eine Gesellschaft hier zusammengekommen war!
Fürwahr — und wie schon einmal gesagt — der historische Belletrist muss erst noch kommen, der seine Feder der Beschreibung dieser Depeschenreiterzeit weiht, welche Jahrtausende zurückreicht, bis zur Zeit der alten Phönizier und Karthager, als deren Kaufleute auf den Handelsstraßen durch ganz Europa, Afrika und Asien auch schon schnelle Boten mit geheimen Börsenberichten schickten, bis in die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts hinein, als zuletzt, nachdem sie noch lange dem Pfeifen der ersten Lokomotiven getrotzt hatten, das Gebimmel der Sekundärbahnen ihnen zum letzten Grabgeläute wurde — diesen deutschen Depeschenreitern, gegen deren abenteuerliche Romantik alles verblasst, was ein Fenimore Cooper und seine Nachahmer amerikanischen Rothäuten und Blassgesichtern nur je angedichtet haben.
Wenigstens in den letzten beiden Jahrhunderten waren es fast ausschließlich Deutsche, welche diesen Depeschenreiterdienst versahen, schon die ganze Erde umspannend, sowohl bis ins östlichste Asien wie nach dem westlichsten Amerika gehend. Weshalb es nur Deutsche waren, das ist schon früher einmal erklärt worden — deutsches Landsknechtsblut!
Sie sangen und johlten und brüllten und erzählten einander die haarsträubendsten Geschichten und spielten Würfel — und dies alles doch nur zu dem Zweck, um sich gegenseitig auszuhorchen — alles und alles Verstellung und Lug und Trug — der rote Wein, den sie maßlos aus großen Humpen soffen, war sicher nur rotgefärbtes Wasser — einer wusste es vom anderen, und doch wollte jeder seinen Nächsten glauben machen, er tränke wirklichen Wein, also auch hierin alles Tücke und Hinterlist — und dennoch jeder einzelne dem Herrn, dem er zurzeit diente, wenn auch für schnödes Geld, mit Leib und Seele in unbestechlicher Treue ergeben.
Wenn also auch fast alle nur oder doch zurzeit für Italien ritten, so war doch kein einziges italienisches Gesicht darunter, nur germanische, deutsche Züge — mit Ausnahme des einen, der eine offenbar mongolische Physiognomie zeigte. Jedenfalls ein tatarischer Kosak.
Dieser war es auch, der die beiden in der Tür Erscheinenden zuletzt erblickte, und obgleich er soeben noch einen schwerbetrunkenen Eindruck gemacht hatte, schritt er doch sofort elastischen Ganges auf seinen Herrn, den russischen Grafen, zu. Drei andere folgten ihm nach.
Auch dem deutschen Fürsten gesellten sich seine Leute bei, sie erhielten ihre Instruktionen.
Die beiden kehrten zurück, um, wenn es noch nicht so weit war, im Vorzimmer des Sitzungssaales auf den Bescheid zu harren.
»Es gibt nur eine Möglichkeit der Entscheidung«, sagte der eine, und es ist gleichgültig, welcher das war.
»Und sie lautet auf nein.«
Sie hatten es beide von jeher gewusst, es gleich von der ersten Stunde an erkannt, aber noch nie ein Wort deswegen gewechselt, so gute Freunde es auch sonst waren, nicht nur gewesene.
In Sachen ihrer Mission aber war ihnen eben der Mund versiegelt. Nur jetzt, wo die Entscheidung schon so gut wie gefallen war, durften sie das Siegel brechen.
»Was tun Sie dann?«, fragte hierauf der Graf.
»Ich habe meine Order«, wich der preußische Gesandte noch immer aus.
»Reiten Sie mit?«
»Nein, ich muss hier bleiben, bis ich von Berlin neue Order empfange. Und Sie?«
»Meine Mission ist beendet, ich bin ein freier Mann.«
Sie hatten das Vorzimmer erreicht, und eben wurde ihnen die Botschaft gebracht, dass sie den Sitzungssaal wieder betreten könnten.
Eine kurze Rede des Präsidenten, des Dogen von Genua — die Hilfe der vereinigten Mächte Italiens war dem Preußenkönig verweigert worden, und damit war auch die Mission des Gesandten der preußenfreundlichen russischen Hofpartei eine vergebliche gewesen.
Wer vielleicht dafür gestimmt hatte, das erfuhren sie jetzt nicht. Das herauszubekommen, das war ihre Sache, dann konnten sie ja auch noch Hoffnung haben. Aber der Plan Friedrichs, ganz Italien für sich zu gewinnen, war jedenfalls zu Wasser geworden. Sein Gesandter hatte es also schon kommen sehen — diese Absage ließ ihn ganz kalt.
Beide begaben sich sofort auf ihre Zimmer, wo sie das Resultat ihrer Mission und sonstiges, was sie ihren Auftraggebern mitzuteilen hatten, in drei, respektive vierfacher Kopie chiffriert niederschrieben, und wenige Minuten später jagten sieben Reiter aus den Toren Genuas — davon blieben vier, deren Ziel das ferne Petersburg war, immer zusammen, während von den drei anderen, die ihre Botschaft nach Berlin bringen sollten, der eine seinen Weg über Wien, zwei auf verschiedenen Pässen über die Alpen nahmen.
»Jetzt bin ich ein freier Mann«, wiederholte der russische Graf.
»Für mich gilt das wenigstens für vierzehn Tage«, sagte der deutsche Fürst. »Sie leisten mir doch hoffentlich für diese Zeit Gesellschaft, ehe Sie sich für immer in Ihre russische Einsamkeit zurückziehen?«
»O, mein Freund — es war mein fester Vorsatz, keine Minute länger unter Menschen zu weilen, als es unbedingt notwendig ist — am wenigsten in diesem Lande, das mir mit den unangenehmsten Erinnerungen verknüpft ist.«
»Ich will Sie nicht zurückhalten. Wann werden Sie da reisen?«
»Heute Nacht allerdings nicht mehr, es wäre von den beiden Frauen zu viel verlangt. Aber beim ersten Morgengrauen werde ich aufbrechen, mein Mantelsack ist schon gepackt, ich brauche ihn nur nach dem Hotel zu tragen, und einen Abschied hier habe ich ja nicht nötig. Wir verbringen diese letzte Nacht noch zusammen?«
Axel begleitete ihn ja schon auf dem Wege nach dem Hotel, in dem die beiden Frauen untergebracht waren.
Der Graf wusste den schwermütigen Ernst, der dieser Trennung sonst wohl vorausgegangen wäre, zu bannen.
»Als ich mich«, begann er zu plaudern, »heute während der Siestapause in das Hotel begab, hatte ich den Vorsatz, die beiden Frauen dort auszuquartieren, sie in ein anderes Hotel zu bringen.«
»Weshalb?«
»Es ist mir doch nicht angenehm, immer mit dem Manne unter einem Dache sein zu müssen, der mir mein ganzes Leben verbittert hat oder es doch verbittern könnte.«
»Richtig, ich wollte Ihnen diesen Vorschlag schon gestern Nacht machen, wusste aber wiederum nicht, welche Ursache ich hierzu hätte.«
»Es war gar nicht mehr nötig. Der Marquis Pellegrini hatte, als ich kam, das Hotel und Genua bereits verlassen.«
Axel blieb vor Überraschung stehen.
»Was Sie nicht sagen!«
»Er ist bereits heute Mittag abgereist — nach Mailand, wie er sagte. Nur in Begleitung eines noch gemieteten Dieners.«
»Was hat denn diese schnelle Abreise zu bedeuten?!«
»Inwiefern finden Sie daran etwas Auffälliges?«
»Ja, sollte der goldgierige Abenteurer die Gelegenheit denn nicht ausbeuten, die er sich nun einmal hier durch die einleitende Vorstellung geschaffen hatte?«
»Sie meinen, indem er weitere Vorstellungen gibt, die er sich mit Gold bezahlen lässt?«
»Gewiss doch!«
»Haben Sie nicht gehört, dass er gleich gestern Nacht noch jenen Herren eine zweite Vorstellung gab?«
»Kein Wort davon!«
»So war es. Die Herren, da sie nun einmal in dem Hotel waren, nahmen in demselben gleich das Nachtmahl ein. Das war überhaupt von dem Herzog Estrada schon bestellt gewesen, er hatte nur vergessen, uns schon vorher dazu einzuladen, dann zogen wir uns ja schnell zurück. Der Adept nahm ebenfalls daran nicht teil, hatte sich geweigert, wohl um neugierigen Fragen auszuweichen. Er will sich eben die Beantwortung solcher bezahlen lassen, was nicht gut angängig ist, wenn man ihn als Gast eingeladen hat.
Dann wurden die Herren irrtümlicherweise benachrichtigt, man hätte uns beide das Hotel wieder verlassen sehen, und so kam es, dass auch wir nicht noch nachträglich eine Einladung erhielten.
Während der Mahlzeit einigten sich die Herren, den Adepten doch gleich jetzt noch eine zweite Vorstellung geben zu lassen. Man konnte ihn ja wenigstens fragen. Der Tag war nun doch schon einmal angebrochen, und die Neugier war durch die Erklärung des Adepten, dass er in einer zweiten Vorstellung noch ganz andere Wunder ausführen würde, aufs Mächtigste angeregt worden.
Also man schickte nach dem Marquis. Jawohl, dieser war gern bereit, sofort noch eine zweite Vorstellung nachfolgen zu lassen. Aber jetzt unter ganz anderen Bedingungen. Nämlich nicht mehr umsonst. Für eine Stunde pro Zuschauer hundert Dukaten...«
»Was, pro Person hundert Dukaten? Ist der Kerl denn verrückt?!«
»Da sehen Sie eben, wie selbstbewusst mein ehemaliger Leibpage aufzutreten weiß. Und will er nun einmal einen bestimmten Weg einschlagen, so hat er ja auch ganz recht. Nur Stümperei wird immer billig bezahlt, und wofür man einen billigen Preis fordert, ist von vornherein als Stümperei gestempelt. Ja, der Adept hatte sogar die... Kühnheit, zu fordern, dass ihm diese Summe von dreizehnhundert Dukaten im Voraus bar auf den Tisch gezahlt würde, nämlich auch für den Fall, dass ihm dann bei der Vorstellung verschiedenes oder alles misslänge.«
»Und die Herren sind darauf eingegangen?«
»Warum nicht? Sie vergessen wohl, dass es so ziemlich die reichsten Männer Italiens waren, die da zusammen gewesen sind, auch wenn einige nur bürgerliche Namen führen. Und dann die grenzenlose Erwartung, die furchtbare Erregung, in der sich alle noch befanden.
Kurz, dem Verlangen wurde sofort nachgegeben, und was die Herren an barem Gelde nicht bei sich hatten, ließ der Doge aus seinem Palaste holen. Denn von einer Geldanweisung und dergleichen will dieser allerneueste Adept nichts wissen.
»So fand die Vorstellung sofort statt, die genau eine Stunde währte. Wir verließen das Hotel früh um sieben, nicht einmal zusammen, da waren die anderen Herren schon längst fort. Kurz vor der Sitzung sprach ich nur noch einmal den Herzog, der mir darüber berichtete, und er war außer sich — so stellte er sich, Sie wissen doch — dass wir noch immer in dem Hotel geweilt haben, und er hätte nichts davon gewusst.«
»Und was hat der Adept ihnen denn vorgemacht? Hat der Herzog darüber berichtet?«
»O ja! Der Herzog war noch immer außer sich, und diesmal in Wirklichkeit. Hokuspokus hat er ihnen vorgemacht. Zuerst ahmte er das Wunder der Hochzeit von Kanaan nach, verwandelte Wasser in die verschiedensten Weine, solche ähnliche Wunder mehr, bis er zuletzt auch die Geister Verstorbener erscheinen ließ.«
Es war nicht gerade etwas Neues, was Axel da zu hören bekam. Das Beschwören von Geistern gehörte damals unbedingt zum Handwerk des wirklichen Adepten. Nur der Graf von Saint-Germain hatte sich niemals mit so etwas befasst. Es geschah auf die verschiedene Weise, aber noch jeder Adept war dabei des Betruges überführt worden.
»Wie hat der denn die Erscheinungen zustande gebracht?«
»Ja, das kann ich Ihnen freilich nicht sagen, Ich kann ja nur berichten, wie es mir der Herzog erzählte, und der war eben noch ganz außer sich. Sogar den Geist Julius Cäsars ließ der Marquis erscheinen. Dann aber auch die materialisierten Seelen von verwandten Personen, die Aussagen über Dinge machten, von denen nur die betreffenden Herren wissen konnten.«
»Faszination?«
»Weiß ich nicht.«
»Haben Sie Ihren ehemaligen Pagen in diese Kunst nicht eingeweiht?«
»Mit keiner Andeutung.«
»Oder war in dem entwendeten Buche das Rezept dazu gegeben?«
»Auch nicht. Nein, da hat dieser neue Adept eben wieder seine eigene Methode, solche Geistererscheinungen zustande zu bringen, was ihm so lange glückt, bis auch er eines Tages als Betrüger entlarvt werden wird.«
»Hat er auch Gold gemacht?«
»Ebenfalls nicht. Er hatte es zwar versprochen, aber dazu kam es nicht, da war die Stunde schon vorbei, und wenn die Herren auch gern noch eine weitere bezahlt hätten, vielleicht sogar den doppelten Preis dafür, so erklärte sich der Magier jetzt doch zu erschöpft dazu.
»Doch die ausgeführten Kunststückchen sind ja dabei ganz Nebensache. Die Hauptsache ist, dass sich der Marquis dann gleich von jedem der anwesenden Herren einzeln eine Bescheinigung, ein Zeugnis ausstellen ließ, wonach er wirklich im Besitze übernatürlicher, magischer Fähigkeiten ist, einen Luftgeist zur Verfügung hat usw. usw. Darauf kam es ihm natürlich am meisten an. Denn hierdurch sind ihm die ersten Häuser und selbst die Fürstenhöfe der ganzen Welt geöffnet.«
»Ja, das glaube ich auch«, bestätigte Axel, »jetzt hat dieser Schwindler wirklich nicht mehr nötig, Gold zu machen. Aber trotzdem, diese schnelle Abreise — die will mir gar nicht in den Kopf.«
»Weshalb nicht? Er hat hier eben erreicht, was er hat erreichen wollen.«
»Na, ich wenigstens bedauere Sie sehr.«
»Warum?«
»Ich habe mir die Sache doch noch anders überlegt. Ich hätte ihm wirklich noch meine Sekundanten geschickt.«
»Wie? Sie wollten...«
»Ich glaube, wenn man solch einen Halunken kalt macht, erweist man der ganzen Welt nur einen guten Dienst.«
»Sie würden deshalb Ihr eigenes Leben in Gefahr setzen?«
»Na«, lachte Axel, »nun fangen Sie bloß nicht so an!«
»Indem er aber verlangte, dass Sie ihm Ihre Sekundanten schickten, musste er seiner Sache doch sehr sicher sein.«
»Sicher, wieso?«
»Dass er Ihnen in der Führung jeder Waffe weit überlegen ist.«
»Ist er etwa ein ebenso vorzüglicher Fechter wie Sie selbst? Denn ich hätte Degen oder vielmehr Säbel gewählt.«
Es war eigentlich merkwürdig, dass die beiden bei ihrem früheren langen Beisammensein niemals über die Fechtkunst gesprochen, niemals sich gegenseitig gemessen hatten. Denn von dem wunderbaren Fechten des Grafen, wenn er es auch nur einmal dem Lord Moore bewiesen hatte, musste der damalige Depeschenreiter doch unbedingt gehört haben, das war ja damals durch ganz Rom gegangen.
Besondere Proben von ihrer Kunst in der Führung der Waffen gegen Feinde hatten die beiden ja niemals gegeben, es war höchstens immer zu kleinen Handgemengen gekommen, wobei stets nur die Schnelligkeit des Hiebes und des Stoßes entschieden hatte, die Geistesgegenwart und Schnelligkeit der Ausführung — aber, wie gesagt, merkwürdig war es doch eigentlich, dass der Depeschenreiter niemals davon begonnen hatte. Das sollte er erst nach zehn Jahren als deutscher Fürst tun.
»Herr Graf, Sie sollen doch ein so ausgezeichneter Fechter sein.«
»Haben Sie davon gehört?«
»Wie Sie Lord Walter Moore eine Probe davon gaben, ihm und gleichzeitig seinem Leibdiener sofort beim Ausfall die Degen aus den Händen wanden, diese auch noch mit den Spitzen dort in der Wand stecken ließen, wo Sie es vorher bezeichnet hatten, und beide sollen doch die besten Fechter Englands gewesen sein.«
»So war es, und ich habe meinem Leibpagen in der kurzen Zeit, während welcher er bei mir war, täglich zwei Fechtstunden gegeben. Viel ausbilden konnte ich ihn in diesen wenigen Stunden natürlich nicht, aber ich versichere Ihnen, dass der Junge die erstaunlichsten Anlagen zur Fechtkunst besaß, und es ist doch anzunehmen, dass er sich in den zehn Jahren darin zur Meisterschaft ausgebildet hat. Sie würden also wohl einen ebenbürtigen Gegner finden.«
»Haben Sie mich schon einmal fechten sehen?«, lächelte der Fürst.
»Das allerdings nicht.«
»Nun, dann könnten Sie ganz beruhigt sein. Abgesehen davon, dass man doch nicht nur ein Duell annimmt oder eine Forderung ergehen lässt, wenn man bestimmt weiß, dem anderen überlegen zu sein. Das wäre ja noch mehr als unfair. Hier liegt allerdings ein besonderer Fall vor, hier würde es sich darum handeln, ein Raubtier unschädlich zu machen, wobei alles erlaubt ist. Und das ist es eben. Wir haben nicht Gelegenheit gehabt, uns miteinander zu messen. Und ich glaube ganz gern, dass Sie mir in der edlen Fechtkunst weit überlegen sind, es vielleicht auch dieser schwindelhafte Marquis ist. Aber zwischen Fechten und Fechten ist ein gewaltiger Unterschied. Mit dem stumpfen Florett oder Rapier bin ich ein Stümper. Ich habe niemals so nur zur Probe fechten können. Aber nun stellen Sie sich einmal dorthin, nehmen Sie einen Säbel und suchen Sie sich gegen mich zu wehren. Ich glaube, Graf — bei aller Bescheidenheit — Sie sollten sich nicht lange gegen mich wehren können. Wenigstens habe ich noch nicht den besten und stärksten Fechter gesehen, den ich nicht in Bälde zusammengehauen hätte. Meine Force ist eben das Zuhauen. Doch lassen wir das. Das mit dem Marquis ist jetzt für mich erledigt.
Denn nachlaufen tu ich diesem Halunken natürlich nicht. Führt mich der Zufall noch einmal mit ihm zusammen, so kann das ja noch immer geregelt werden — — wenn ich mich bis dahin nicht wieder entschlossen habe, ihn anstatt mit dem Säbel doch lieber mit der Hundepeitsche zu bearbeiten.«
Unter solchen Gesprächen hatten sie das Hotel erreicht.
Wieder forderte und erhielt der Graf seinen Zimmerschlüssel.
Die beiden Zimmer lagen in der ersten Etage.
»Ich nehme an, dass die beiden schon wieder schlafen gegangen sind«, sagte der Graf, als sie die Treppe hinaufstiegen. »Sie sind es nicht gewohnt, Siesta zu halten, sodass die Natur des Abends ihre Rechte fordert. Deshalb aber kann ich sie auch wecken. Denn diese letzte Nacht müssen wir doch noch gemeinsam verbringen.«
Er schloss sein Zimmer auf, öffnete die Tür. Lichtschein drang ihnen entgegen.
Auf dem Tische stand die brennende Lampe, zum Teil geleerte Schüsseln und Teller verrieten, dass Mutter und Tochter ihr Nachtmahl gehalten hatten, hinter dem Tische saß auf dem Sofa Marietta, zurückgelehnt, schlafend.
»Ach, die Gute, sie hat auf mich warten wollen, ist eingeschlafen!«
»Und Pepita?«
»Die hat sich natürlich zu Bett gelegt.«
Der Graf beugte sich über die Schlafende, küsste sie zärtlich, ohne sie dadurch zum Erwachen zu bringen, ging in das andere Zimmer hinüber. Er selbst brauchte ja kein Licht.
»Aber wecken Sie sie nicht«, flüsterte Axel ihm nach.
»Aber warum denn nicht, sie würde doch hinterher nur darüber...«
Die Stimme brach drüben ab. Axel konnte den Grafen in dem durch dieses Zimmer etwas erleuchteten Nebenraum noch im Halbdunkel stehen sehen.
»Wo bist du denn, Pepita?«
Keine Antwort.
»Ihr Bett ist unberührt, und...«
Der Graf verschwand hinter der Tür, kehrte aber gleich zurück, ein Stück Papier in der Hand, las... und ließ sich mit einem schmerzlichen Ächzen in den nächsten Stuhl fallen.
»Meine Tochter, meine Pepita — das konntest du mir antun — und deiner armen Mutter!«
Axel nahm ihm kurzerhand das Papier aus den zitternden Fingern.
Es war mit einer gekritzelten Schrift bedeckt, die sehr unorthografisch geschriebenen Zeilen lauteten:
Meine teuersten Eltern!
Es ist mir nicht möglich, die Zukunft mit Euch zu teilen, die Ihr Euch schon lebhaft ausgemalt habt. So eine Einsamkeit ist nichts für mich. Lieber in den Tod. Aber ich weiß etwas Besseres. So gestehe ich Dir erst jetzt, liebe Mutter, dass ich schon immer einen jungen Mann geliebt habe, und er mich. Aber aus gewissen Gründen hättest Du niemals Deine Einwilligung zu unserer Verheiratung gegeben, noch weniger der wiedergefundene Vater. So will ich auch gar nicht erst seinen Namen nennen. Nur seid versichert, dass ich an seiner Seite das glücklichste Wesen auf Gottes Erdboden sein werde, und er ist auch imstande, mich sehr gut zu ernähren, wenn er auch nur aus armem Stande ist.
Wir werden uns schon noch einmal wiedersehen. Jetzt aber muss ich fliehen, denn Ihr würdet in diese Verbindung doch niemals einwilligen. Der Mutter habe ich beim Abendessen einen ganz harmlosen Schlaftrunk beigebracht, den ich schon immer bei mir gehabt habe, weil ich wusste, dass es doch einmal so kommen würde. Bitte, meine lieben Eltern, verzeiht mir den großen Kummer, den ich Euch bereite, aber ich kann nicht anders, und werdet so glücklich wie Eure Euch innig liebende Tochter
Pepita.
Das ist ja eine nette Geschichte!«, murmelte Axel grimmig. »Aber ich hab's ihr gleich angesehen, was für ein herzloses Geschöpf das ist — herzlos und dumm zugleich wie dieser ganze Brief.«
»Meine Pepita hat mich böswillig verlassen können!«, jammerte der Graf nochmals.
»Ach, lassen Sie sie laufen!«, sagte Axel schroff, setzte dann aber etwas milder hinzu: »Das ist nun einmal der Lauf der Welt, dass die Tochter Vater und Mutter verlässt, um einem anderen anzuhängen. Jetzt wollen wir lieber dafür sorgen, dass die Mutter nicht etwa in die Ewigkeit hinüberschlummert.«
Das brachte den Grafen schnell wieder auf die Füße.
Zunächst konstatierte er, dass die beiden zum Abendessen Portwein getrunken hatten, und dass in dem noch halbgefüllten Glase, welches vor der Mutter stand, Opium enthalten war. Von allen Getränken verdeckt Portwein am meisten den typischen Geruch des Opiums, der Graf aber konnte es sofort herausriechen.
»Gegen Opium habe ich auch das beste Mittel bei mir«, sagte der ehemalige Depeschenreiter, von dem wir wissen, dass er sich gegen jeden Betäubungstrank zu schützen verstand, brachte ein Kristallfläschchen zum Vorschein, tröpfelte etwas in ein Glas mit Wasser, und während bei Marietta sonst alle Versuche, sie zum Erwachen zu bringen, erfolglos geblieben waren, kam sie bald wieder zu sich, nachdem sie zum Schlucken gezwungen worden war.
Scheinbar hatte das Opiat auch gar keine Folgen hinterlassen, und ihre Verzweiflung war grenzenlos, als sie das Geschehene erfuhr.
»Dann ist es auch kein anderer als Giuliano gewesen, der sie entführt hat!«, rief sie sofort.
Wer war Giuliano? Ein Korallenfischer, der jedes Frühjahr nach der algerischen Küste hinüberging, um nach Korallen zu tauchen.
Um die bildschöne Tochter der Obsthändlerin hatte ja schon mancher Freiersmann angehalten, wobei bemerkt werden muss, dass es in Italien für das Heiraten noch heute keine Altersgrenze oder vielmehr keinen Altersanfang gibt, so wenig wie in Spanien und den anderen südlichen Ländern. Wenn die Behörde überhaupt ein Zeugnis verlangt, so ist es nur das einer einwandfreien Matrone, dass das betreffende Mädchen den heiratsfähigen Zustand wirklich erreicht hat.
Alle Freiersleute waren von der Mutter abgewiesen worden, ob sie nun aus dem armen Volke waren oder aus besserem Stande, von denen, welche das schöne Mädchen einfach kaufen wollten, gar nicht zu sprechen.
Die Mutter hatte aus ihrer Tochter ja nicht etwa eine Nonne machen wollen, aber für sie war der richtige Freier eben noch nicht gekommen, und ihrer Meinung nach war Pepita auch noch viel zu jung, noch ein vollkommenes Kind, wenn auch nur dem Charakter nach.
Am hartnäckigsten als Freier war Giuliano gewesen, der in diesem Frühjahr gekommen war, vor etwa drei Monaten.
Also ein Korallenfischer. Von Genua aus gehen sehr viele Leute alljährlich nach der algerischen Küste, um den roten und weißen Tand für schmuckbedürftige Damen dem Meere zu entreißen.
Na, ein Korallenfischer, das war für die Mutter nun der allerletzte als Schwiegersohn! Den ganzen Sommer von zu Hause weg, und dann den ganzen Winter in der Kneipe liegen, und wenn sie auch oftmals Frauen und Kinder mitnehmen — das war doch erst recht nichts für die geliebte Tochter und ihre Mutter.
Giuliano hatte zwar geschworen, sein Handwerk aufzugeben und eine ruhige Arbeit an Land zu suchen, aber das kennt man ja. Auf den Korallenfischern liegt derselbe Fluch wie auf allen Seeleuten. Wer einmal Salzwasser gekostet hat, muss immer wieder hinaus, da wird zuletzt jeder Schwur gebrochen.
So war auch Giuliano abgewiesen worden, und Pepitas Herz sprach offenbar noch gar nicht mit, ein so hübscher Kerl er auch war.
Trotzdem hatte Giuliano Ernst gemacht, war im April nicht mit der Korallenflotte nach Afrika hinübergegangen, hatte sich Arbeit an Land gesucht, um nach Feierabend immer an dem Obststande herumschwänzeln zu können.
Aber hierbei war es auch geblieben, die Mutter hatte gar zu streng über die Tochter gewacht, und diese hatte auch tatsächlich nichts von dem armen Korallenfischer oder jetzigen Arbeiter wissen wollen. Denn wenn Pepita einmal von einer Heirat geplaudert, mit kindlichem Munde, so hatte sie immer gar hochfliegende Pläne gehabt. Das war einem Mädchen auch zu verzeihen gewesen. — —
So hatte Marietta in Kürze berichtet — nicht so ausführlich, wie hier dieses Verhältnis geschildert wurde.
»Ja, aber wenn Pepita von ihm hat gar nichts wissen wollen?«, meinte zunächst der Vater, der durch diese Erklärung nicht glücklicher wurde.
»Er hat ihr einen Liebestrank beigebracht«, jammerte die Mutter.
»Wie soll er denn das hier in diesem Hotel fertiggebracht haben?«, ließ sich Axel zweifelnd vernehmen.
»Vielleicht schon vor langer, langer Zeit, er fängt aber erst jetzt an zu wirken, zu einer ganz bestimmten Stunde, alle die Korallenfischer sind ja solche Zigeuner und Hexenkünstler.«
Dass es sich so verhielte, ließ sich die Mutter nicht ausreden, und auch der Graf schien da keine großen Zweifel zu hegen.
»Ja, wie ist sie denn da eigentlich von hier fortgekommen?«, blieb nur Axel lieber beim Reelleren.
Um zehn Uhr hatten Mutter und Tochter das Nachtessen auf das Zimmer kommen lassen, bald darauf war erstere, von Müdigkeit überwältigt, die ihr aber gar nicht so unnatürlich vorkam, eingeschlafen. Mehr wusste sie nicht zu berichten.
Die Fenster beider Zimmer waren geöffnet. Aber dass Pepita durch ein Fenster ihren Weg genommen hätte, das war durchaus nicht nötig. In dem Hotel wurde heute Nacht ein Fest abgehalten, und auch das wäre nicht einmal nötig gewesen — es gingen ständig so viele Personen ein und aus, eben weil das italienische Nachtleben zur Sommerzeit in Betracht kam, dass Pepita sehr leicht unerkannt durchschlüpfen konnte, zumal sie also schon gestern vom Vater mit neuer Garderobe versehen worden war, und die italienischen Frauen verhüllen ja ihr Gesicht mit Vorliebe durch ein Kopftuch.
Das Schlafzimmer war verschlossen, den Schlüssel hatte sie offenbar mitgenommen. Bei einer Flucht durch das Fenster hätte an diesem doch auch ein Seil oder etwas Ähnliches hängen müssen.
Was sie mitgenommen hatte, war noch nicht untersucht worden. Zunächst hatte sich Marietta, die sich im Negligé befunden, hastig angekleidet.
»Wo willst du hin, Marietta?«, fragte der ganz aus der Fassung geratene Graf, als sie jetzt ihr Kopftuch umwarf.
»Zu Giulianos Eltern!«
Ja, das war auch wirklich das Vernünftigste, was zunächst getan werden konnte. Weit war es nicht, sie brauchte keine Begleitung.
Nach ihrem Fortgehen war der Graf wieder aufs Sofa gesunken, saß mit gerungenen Händen da, ein Bild des fassungslosesten Jammers.
»Meine Pepita — dass sie mir das antun konnte — habe ich das um sie verdient?!«
Kopfschüttelnd betrachtete ihn Axel. Er erkannte seinen alten Freund wirklich gar nicht wieder.
Oder hatte Axels Kopfschütteln noch einen anderen Grund?
»Graf, mir will Verschiedenes nicht in den Kopf!«
»Was nicht?«, murmelte jener geistesabwesend.
»Woher hat sie denn zum Beispiel das Opiat?«
Das war von Axel eigentlich eine törichte Frage.
Genua trieb nächst Venedig damals noch den ausschließlichen Handel nach Indien, aus dem das Opium kommt — noch heute kann man sich in allen Hafenstädten sehr leicht Opium verschaffen, einfach von Matrosen, jeder alkoholische Aufguss liefert ein Betäubungsmittel — gerade damals, als das noch nicht so unter behördlicher Kontrolle stand, wurde mit dergleichen Mitteln viel Missbrauch getrieben, sie waren zu leicht zu beschaffen.
Axel sah wohl die Zwecklosigkeit seiner ersten Frage selbst gleich ein.
»Abgesehen davon«, fuhr er schnell fort, »aber an solch einen Liebestrank glaube ich nicht.«
»Und doch, es gibt solche Tränke«, murmelte der Graf.
»Na, und wenn schon — ist es denn aber nicht viel einfacher, dass Ihre Tochter schon immer mit diesem Giuliano, der ja ein so schöner Kerl sein soll, in Liebe korrespondiert hat?«
»Marietta behauptet ja, dass das nicht der Fall gewesen ist.«
»Na, wenn es sich um die Kinder handelt, ist oftmals auch die scharfsichtigste Mutter geradezu blind, und bekanntlich ist es leichter, ein Sieb voll Flöhe zu hüten, als ein verliebtes Mädchen.«
»Nein, nein, es muss ihr ein Liebestrank beigebracht worden sein — meine Pepita war noch das unschuldigste Kind.«
»Hm, hm«, brummte Axel, nach dem Grafen schielend, als habe er hierüber so ganz andere Ansichten, was er aber nicht bekannte. »Was hat sie denn eigentlich mitgenommen?«
Endlich raffte sich der Graf auf, um nachzusehen. Das Fehlende konnte er am besten bestimmen, einmal weil er selbst mit Ausnahme der Sachen, welche die beiden Weiber am Körper getragen, alles erst gekauft hatte, und dann, weil es eben der Graf von Saint-Germain war, der wohl etwas besondere Augen und bekanntlich auch ein sehr gutes Gedächtnis besaß.
Die Garderobe wurde gemustert. Es fehlte nichts weiter als das neugekaufte Straßenkleid, mit dem Pepita wahrscheinlich auch die Reise nach Russland angetreten hätte.
»Und den Schmuck, den Sie ihr gekauft hatten?«
Dazu hatte sie sich auch ein besonderes Schmuckkästchen schenken lassen — und dieses fehlte.
»So, so«, brummte Axel nach wie vor gedankenvoll. »Hatte sie auch Geld?«
Der Vater hatte ihr nach dem gestrigen Einkauf auch seine ganze Börse geschenkt — das heißt, die Tochter hatte sie ihm noch extra abgebettelt.
»Wie viel war denn darin?«
»Vielleicht dreißig Dukaten.«
»Mehr nicht? Haben Sie ihr heute nichts gegeben, als Sie während der Siesta hier waren?«
»Da hatte ich nicht mehr viel bei mir, ich hatte ihr eine Repetieruhr mitgebracht.«
»Aha! Aber was Sie bei sich hatten, hat sie Ihnen auch abgebettelt, nicht wahr?«
»Abgebettelt? Das arme Kind, es kennt ja noch gar nicht die Bedeutung des Geldes.«
»Na, na! Und nun will ich Ihnen einmal meine Meinung sagen...«
Aber Axel sollte vorläufig nicht dazu kommen, er wurde durch die Rückkunft Mariettas unterbrochen.
»Giuliano hat sie richtig entführt, er ist heute Nacht mit dem Proviantschiff abgegangen, da hat er sie mitgenommen — mein Kind, mein Kind bei solch stürmischem Wetter auf so einem gebrechlichen Schiffe auf der wilden See!!«
So jammerte die unglückliche Mutter, und es dauerte einige Zeit, bis man Näheres von ihr erfahren konnte.
Den Korallenfischern an der afrikanischen Küste ward alle Monate ein Proviantboot nachgeschickt, das ihnen alles brachte, was sie dort brauchten, nicht selbst ersetzen konnten.
Auch Frauen und Kinder kamen mit diesem Fahrzeug, halb Schiff, halb Boot, eine sogenannte Feluke, manchmal nach.
Heute Nacht halb zwölf, nämlich mit der einsetzenden Flut, war wieder ein solches in See gegangen — und auch Giuliano hatte sich dieser Expedition angeschlossen.
Das hatte Marietta ja am besten von seinen Eltern erfahren können.
»Und er hat meine Pepita mitgenommen!«, jammerte die Mutter.
»Haben Ihnen das seine Eltern erzählt?«, fragte Axel.
Nein, die hatten von dieser Entführung nichts gewusst.
»Von wem wissen Sie denn das sonst?«
Von gar niemand. Gesagt hatte es ihr niemand. Wohl waren einige Frauen wie Kinder auf dem Proviantschiff gewesen, hatten sich schon vorher an Bord begeben, von ihrer Pepita hatte ihr kein Zurückgebliebener etwas erzählen können... aber konnte es denn anders sein, als dass dieser verruchte Giuliano ihre Tochter mitgenommen hatte?
»Dort auf der Korallenstation ist ja auch ein Priester, die beiden lassen sich ganz einfach trauen! Ach, mein Kind, meine arme Pepita, solch einem schrecklichen, wüsten Leben ausgesetzt zu sein!«
So und anders jammerte die Mutter, und der Graf, der sich so bedeutend verwandelt hatte, stimmte ihr in allem bei.
Es konnte eben nicht anders sein.
»Nein, da bin ich ganz anderer Ansicht«, sagte hingegen Axel.
Die beiden Verzweifelten klammerten sich an jeden dargereichten Strohhalm.
»Was glauben Sie nicht?!«
»Dass dieser Giuliano Ihre Tochter entführt hat.«
»Ja, wer denn sonst?!«
»Lassen Sie erst einmal hören. Wie viel verdient denn eigentlich so ein Korallenfischer?«
Wenn die Korallenernte eine sehr gute gewesen war, bekam jeder Mann für seine halbjährliche Arbeit sechshundert Mark ausgezahlt, nach unserem Gelde gerechnet, für italienische Verhältnisse außerordentlich viel, aber auch durch eine lebensgefährliche, furchtbar schwere Arbeit verdient, die den Mann während des Winters wirklich unfähig zu jeder anderen Beschäftigung macht.
»Mehr nicht?«, fragte Axel.
»Ist denn das nicht genug?«, rief Marietta.
»Nein, Kinder«, schlug der deutsche Fürst jetzt einen anderen Ton an, »mit einem Manne, der nur solch einen Lumpenlohn verdient, brennt euere Tochter nicht durch, welche die teuerste Repetieruhr mit Perlen und Diamanten begehrt, und überhaupt... nun lasst mich bloß aus mit diesem Korallenfischer und mit Liebestränken und dergleichen — dieses Mädel ist mit einem ganz anderen durchgebrannt!«
Der Fürst hatte gesprochen, als habe er sich eine Last vom Herzen wälzen müssen, zuletzt war er sogar in einen etwas schimpfenden oder doch polternden Ton gefallen.
Starr sahen die beiden anderen den so Zürnenden an.
»Mit einem anderen?!«, rief die Mutter.
»Ganz sicher, ganz sicher.«
»Mit wem denn?«
»Ja, was weiß ich, das müssten doch eher... Graf, was ist denn mit Ihnen los?!«
Also auch der Graf, aus dem Sofa sitzend, hatte den Zürnenden starr angesehen, aber dieser starre Blick ward noch ein ganz anderer, die Augen verdrehten sich ganz nach oben, dass nur noch das Weiße zu sehen war, und dann nahm sein sonst gebräuntes, gesundes Gesicht eine derartige Farbe an, dass auch Marietta jetzt einen gellenden Schrei ausstieß.
»Santa Madonna, er stirbt — mein Mann stirbt!!«
Aber mit schnellem Griff hielt Axel sie zurück, ehe sie ihn noch erreicht hatte.
»Halt«, flüsterte er, »er ist wieder in Starrkrampf gefallen, in diesem Zustande werden wir vielleicht gleich etwas Näheres über den Verbleib des Mädchens erfahren.«
»In Starrkrampf gefallen?! Auch mein Mann fällt in Starrkrampf?!«
Augenblicklich war die Frau, welche natürlich an den Grafen von Saint-Germain dachte, so eingeschüchtert, dass sie sich scheu zurückzog und gar nicht weiter in Betracht kam.
Axel beobachtete den Grafen. Ja, es war wieder der Starrkrampf, in den er unabsichtlich gefallen war, wohl erzeugt durch die heftige Gemütsbewegung.
Dann aber kam es Axel vor, als wäre sein jetziges Aussehen doch ein ganz anderes als sonst — früher hatte er doch auch niemals die Augen so nach oben verdreht — und da öffnete er auch noch den Mund, ein Zeichen, dass der ganze Körper doch nicht so starr war wie sonst.
Nun aber geschah das gänzlich Außergewöhnliche, wenn nicht Grausige.
Immer weiter fiel die untere Kinnlade herab, bis der Mund unmäßig weit geöffnet war, und dann kam es aus ihm in hohlem Grabestone heraus:
»Ich — ich — sehe Pepita!«
Es lässt sich weiter nicht beschreiben, was es eigentlich war, weshalb auch Axel entsetzt, vom Grausen erfasst, zurückprallte.
Die Stimme war es, die hohl aus dem so weit geöffneten Munde herauskam, und es war deutlich erkennbar, dass die Zunge dabei völlig regungslos blieb.
Wie in aller Welt vermochte ein Mensch auf diese Weise deutliche Worte hervorzubringen?
Doch Axel warf jetzt nicht solche Fragen auf, er bezwang sein Grauen, trat vor den offenbar hellsehend gewordenen Grafen hin.
»Graf, hören Sie mich sprechen?«
»Ja — ja — befehlen Sie mir — befehlen Sie mir — ordentlich zu sprechen«, kam es immer wieder in jenem grausigen Grabestone aus dem weitgeöffneten Mund hervor.
Natürlich waren die Laute ja durchaus nicht, und dessen mochte sich der Hellseher selbst bewusst sein, er verlangte, dass man ihm durch hypnotischen Befehl helfen solle.
»Schließen Sie den Mund, sprechen Sie natürlich, ich befehle es Ihnen!«
Sofort klappte die untere Kinnlade langsam in die Höhe, fernerhin bewegte der Graf beim Sprechen auch die Lippen. Aber der Beweis war doch schon gegeben worden, dass es auch noch ein anderes Sprechen als mit Hilfe der Zunge und der Lippen geben muss — eine Tatsache, von der wohl jeder Hypnotiseur zu erzählen weiß.
»Was sehen Sie?«
»Ein Schiff — auf dem Meere — unter vollen Segeln...«
»Und Pepita?«
»Ja — ja... in einer Kabine — ein Mann — jetzt küsst er sie...«
»Giuliano?«
»Nein — nein...«
»Wer ist es sonst? Kennen Sie den Mann?«
Das erstarrte, aschgraue Gesicht des Grafen verzerrte sich wie unter einem furchtbaren Schmerze.
»Der Marquis Pellegrini — Joseph Balsamo.«
Da hob Axel Blick und Arme zur Decke empor.
»Der Marquis Pellegrini!«, flüsterte er. »Er hat sie entführt! O, meine Ahnung! Daher gestern Nacht diese glühenden Blicke auf das schöne Mädchen!!«
Also es kam dem Fürsten gar nicht so überraschend. Doch er raffte sich zusammen, jetzt hatte er anderes zu tun, als von seiner schon immer vorhandenen Ahnung zu sprechen.
»Was für ein Schiff ist es?«
»Befehlen Sie mir, dass ich mich wieder an Deck umsehe!«
»Begeben Sie sich an Deck, schauen Sie sich dort oben um!«
»Ich bin oben, ich sehe...«
»Was für ein Schiff ist es, auf dem sich Pepita und ihr Entführer befinden?«
»Eine sehr große Feluke.«
»Sehen Sie nicht irgendwo den Schiffsnamen?«
»Ja — ja — überall... die Vineta von Genua...«
Ein tiefer Seufzer, ein Ruck in allen Gliedern, den man zu hören meinte, und mit den herabrollenden Augen verließ den Grafen die Erstarrung, er war wieder zu sich gekommen.
»Was habe ich gesehen? Was habe ich gesagt?«, war seine erste Frage.
»Sie wissen es nicht?«
»Nein.«
»Sie haben Pepita gesehen, auf einem Schiffe, in einer Kabine, und bei ihr war ein Mann...«
»Giuliano.«
»Nein, der Adept, der Marquis Pellegrini.«
Der Graf schien abermals von einer Erstarrung befallen zu werden, aber so weit kam es nicht, es war nur der furchtbare Schreck gewesen.
»Der Marquis hat meine Tochter entführt!«, schrie er dann. »Auch das hat mir dieser Schurke noch angetan!!«
Es hätte gar nicht mehr darüber gesprochen zu werden brauchen, und so sagte auch Axel nichts mehr davon, dass er schon eine ganz ähnliche Ahnung gehabt, indem er gestern Nacht beobachtet hatte, mit welch glühenden Blicken der Magier manchmal das bildschöne Mädchen, nachdem es sich entschleiert, betrachtet hatte.
Wie sonst alles gekommen, war ja nur zu klar. Der falsche Marquis hatte eben von vornherein beschlossen gehabt, das schöne Mädchen zu entführen, und sei es auch nur deshalb, um seinem ehemaligen Meister den letzten, größten Streich zu spielen.
Zeit genug, um mit ihr zusammenzukommen, hatte er ja heute den ganzen Vormittag gehabt, ungesehen von der Mutter, das war in dem großen Hotel mit seinem lebhaften Verkehr ja sehr leicht gewesen, und ebenso leicht musste es diesem Manne geworden sein, dieses Mädchen gefügig zu machen, ob Pepita nun von den verschiedenen Begierden getrieben wurde oder nicht. Kurz, der schwächere Wille war dem hundertfach stärkeren sofort unterlegen, der Fluchtplan war entworfen worden.
Gegen Mittag war der Marquis vorgeblich nach Mailand abgereist, um in der Nacht zurückzukommen, um Pepita zu entführen. Sollte der Graf schon in das Hotel zurückgekommen sein, so wäre die Entführung eben etwas später ausgeführt worden, dieser mit allen Hunden gehetzte Gaukler hätte sich doch in jedem Falle zu helfen gewusst.
Aber die Entführung gelang gleich in der ersten Nachtzeit. Ob der Marquis das Mädchen durch das Fenster geholt hatte oder ob er mit ihr den regelrechten Weg gegangen war, ob sie sich in seiner Begleitung befunden oder ob er einen anderen geschickt hatte, das war ja dabei ganz gleichgültig.
Dann hatten sich die beiden sofort nach dem Hafen gewandt, und dass die ›Vineta‹ heute Nacht gegen elf Genua verlassen hatte, das konnte man ganz bestimmt auch hier in diesem Hotel erfahren, deshalb brauchte man nicht erst nach dem Hafen zu eilen.
Die Feluke, das konnte man ebenfalls hier feststellen, hatte Olivenöl für Rom geladen, also ging sie nach Fiumicino. Ein anderer Hafen kam gar nicht in Betracht, die Ladung war für dort bestimmt, war schon bezahlt, wurde dort erwartet.
Über alles dies brauchte gar nicht mehr debattiert zu werden. Wichtiger war die Frage, wie die Verfolger dorthin gelangen sollten, ob zu Wasser oder zu Lande. Das bedurfte einer reiflichen Erwägung.
Die Entfernung zwischen Genua und Rom beträgt vierundfünfzig geografische Meilen, in der Luftlinie gerechnet, und diese kam für das Schiff ja auch nur in Betracht, zumal bei diesem Winde.
Schon immer hatte Nordwestwind geherrscht, der denkbar günstigste für diese Fahrt, und dieser Wind wurde immer stärker, drohte in einen Sturm auszuarten.
»Wie viel Knoten macht die ›Vineta‹ bei solchem Winde?«, wurde der gefragt, der hier die beste Auskunft geben konnte und der sich zurzeit im Hotel aufhielt.
»Bis zu zwölf Knoten«, lautete dessen Antwort. »Einmal hat die ›Vineta‹ dieselbe Fahrt von Genua nach Fiumicino in siebzehn Stunden gemacht, und da ist der Nordwestwind noch nicht so stark und so direkt günstig gewesen wie heute.«
Dann freilich sah es schlimm für die Verfolger aus. Drei Meilen in der Stunde macht auf die Dauer kein Pferd, und kann man auch ständig die schnellsten Renner wechseln, so wollen vierundfünfzig Meilen in siebzehn Stunden doch von einem Menschen geritten sein, und dann laufen doch auch die Landstraßen nicht so schnurgerade.
Ach, was für Hindernisse kamen da alles in Betracht!
Hinwiederum hatte die Feluke nun schon fast drei Stunden Vorsprung, die waren auch durch den schnellsten Segler nicht wieder einzubringen. Diese Feluken sind ja selbst die ausgezeichnetsten Segler, eigens deswegen gebaut, um schnellen Seeräubern zu entgehen.
»Pferde, vorwärts, nur auf Pferde dürfen wir uns verlassen!«, schrie der Graf, seinen Degen umschnallend.
Da aber stieß er noch einmal bei seinem Freunde auf Widerstand.
»Halt«, sagte der Fürst. »Wissen Sie auch, was Sie tun wollen?«
Starr blickte der Gefragte den Sprecher an.
»Was meinen Sie? Was gibt es da noch zu überlegen?«
»Ihre Tochter ist freiwillig mit dem Marquis entflohen...«
»Er hat ihr einen Liebestrank beigebracht!«
»Ah bah, verschonen Sie mich doch mit diesen Liebestränken! Hat sie diesen Brief geschrieben oder nicht? Hat sie ihre Eltern zu täuschen versucht oder nicht? Und wenn Sie nun die Flüchtigen erreichen, und Pepita weigert sich, den Marquis zu verlassen, wieder mit Ihnen zu gehen, und wenn sie nun überhaupt schon von diesem offenbaren Schurken...«
»Dann will ich noch immer die Rache haben, nur die Rache!«
Da schnellte Axel empor.
»Wenn es so ist, dann bin ich mit bei der Partie!!«, rief er. »Auf nach Fiumicino, und Sie sollen einen Depeschenreiter vom alten Schrot und Korn als Führer kennen lernen!«
Dreizehn Stunden später, nachmittags drei Uhr, und nur noch fünfzehn Meilen von Rom entfernt. Aber wie waren sie auch geritten! In diesen dreizehn Stunden hatten sie mehr als vierzig geografische Meilen zurückgelegt, wobei sie freilich schon ein halbes Dutzend Pferde gebraucht hatten.
Ja, jetzt erst lernte der Graf in dem nunmehrigen deutschen Fürsten den Mann kennen. der seinerzeit als der beste Depeschenreiter Europas, wenn nicht der Welt, gegolten hatte.
Nicht nur, wie er auch in der stockfinsteren Nacht die Krümmungen der Landstraße abzuschneiden wusste, wie er sich sonst aus jeder Verlegenheit half, sondern besonders auch, wie er sich immer neue Pferde verschaffte, was vielleicht die Hauptsache war.
Mit was für Schwierigkeiten man da zu kämpfen hatte, das lässt sich gar nicht näher beschreiben, oder jeder einzelne Pferdewechsel müsste ausführlich geschildert werden.
Dass die beiden überreichlich mit Geld versehen waren, hatte dabei wenig zu sagen. Man bedenke nur: in der Nacht, alles schlafend, jedes Tor geschlossen, und dabei nur immer wenige Minuten dafür opfernd, um das Sattelzeug auf frische Pferde zu legen, welche doch auch als die besten ausgesucht sein wollten.
Nein, da half nicht allein das Geld, da durften auch weder Bitten noch Drohungen gespart werden, wunderbar war es, wie dieser ehemalige Depeschenreiter die Leute zu behandeln wusste, und wenn auch nicht direkt Pferde gestohlen wurden, so trat der deutsche Fürst doch oft genug als Räuber auf, der dem Unschlüssigen ganz direkt die Pistole auf die Brust setzte, dem Manne erst hinterher, wenn er schon das Zaumzeug dem erbeuteten Rosse überwarf, eine Anweisung auf die Mailänder Bank gab, selbst den Kaufpreis bestimmend — freilich immer zur späteren Zufriedenheit des unfreiwilligen Verkäufers.
Doch es lässt sich eben nicht schildern, wie er es trieb.
Freilich, was für Männer waren das auch, die diesen Ritt ausführten und aushielten! Hier hatten sich die beiden Ebenbürtigen eben zufällig einmal zusammengefunden. Vielleicht gab es in Italien keinen dritten, der sie auf diesem Ritte hätte begleiten können.
Wir müssen auch etwas über den Weg sprechen, den sie nahmen.
Sie hätten sich immer dicht an der Küste halten können, an der entlang die noch jetzt existierende ausgezeichnete Landstraße führte, bis nach Neapel und noch weiter. Sie wäre der direkteste Weg gewesen, der Luftlinie an Kürze wenig nachgebend.
Bis zum Anbruch des Tages waren sie denn auch dieser Straße gefolgt, bis Spezia vor ihnen auftauchte.
Dabei waren sie noch immer von dem peitschenden Nordwestwind vorwärtsgetrieben.
»Triumph, Triumph!!«, hatte da Axel gerufen, als es im Osten zu grauen begann. »In einer Stunde ist es vorbei mit diesem Winde — entweder haben wir dann Windstille, oder er dreht sich immer mehr nach Norden.«
Ja, etwas Günstigeres hätte der Graf nicht zu hören bekommen können, denn dann war es ja mit der günstigen Fahrt für die Feluke vorbei — er wusste nur nicht, woher das der Fürst bestimmen wolle. Er selbst, der Graf, verstand doch auch etwas von Wetterprophezeiung, wie er schon mehrmals bewiesen hatte, und er sah nicht das geringste Anzeichen, dass sich die Windrichtung ändern könne.
Axel gab auch keine Erklärung — die Hauptsache war, dass er recht behielt. Immer mehr flaute der Sturm ab, nach einer Stunde herrschte völlige Windstille, wenigstens hier unten, während oben am Firmament die schwarzen, zerrissenen Wolken schon nach Norden hinaufzogen.
»Das gibt einen tüchtigen Regen, und zwar einen endlosen, der einige Tage anhalten kann, und da müssen wir nach Osten abschwenken, müssen unseren Weg durch das Gebirge nehmen.«
Der Graf kannte doch sicher die topografische Gestalt Italiens, und er war bestürzt.
»Links über die Gebirge?! Aber warum denn diese ausgezeichnete Straße verlassen?!«
»Weil sich diese ausgezeichnete Straße innerhalb von zwei Stunden in einen Morast verwandelt haben wird, auf der wir nur halb so schnell vorwärts kommen wie auf den felsigen Gebirgspfaden.«
Noch bezweifelte es der Graf, aber er erhob keinen Widerspruch, folgte dem nach Osten abschwenkenden Führer.
Und wieder sollte dieser recht behalten. Bald begann es vom Himmel zu gießen, und als noch einmal die Küstenstraße gekreuzt werden musste, wäre auf dieser schon kaum noch ein Fortkommen für Rosshufe gewesen.
Die ausgezeichnete Beschaffenheit dieser Straße ist ein ganz trügerisches Gebilde. Es ist eine besondere Art von Sand, der bei Trockenheit fest wie Zement zusammenbindet, aber bei nur einiger Feuchtigkeit wird es grundloser Triebsandboden, von anhaltenden Regengüssen gar nicht zu sprechen.
»Und wären wir nicht schon dort abgeschwenkt«, erklärte Axel später noch, »so hätten wir dann gar keine Gelegenheit mehr dazu gehabt, denn nachher zieht sich links von der Küstenstraße ein endloser, unpassierbarer Sumpf hin.«
Die Richtigkeit dieser Behauptungen sollte der Graf später noch erkennen. Wäre es also nach seinem Willen gegangen, so hätte er Fiumicino nicht vor morgen Abend erreicht, das heißt wohl 24 Stunden später als auf diesem scheinbaren oder auch wirklichen Umwege.
Übrigens handelte es sich gar nicht um bedeutende Gebirge. Nur gerade jetzt kam das von Massa Carrara in Betracht. Das hatte man in drei Stunden auf ziemlich bequemen Pfaden passiert, dann kam wieder die toskanische Ebene, und mochte hier der Regen auch gießen, wie er wollte, hier blieben die felsenharten Wege ausgezeichnet.
So war es also drei Uhr nachmittags geworden. Noch hatten sie sich keine Minute wirkliche Rast gegönnt, waren nur immer beim Pferdewechsel einmal aus dem Sattel gekommen.
Bei dieser Gelegenheit verschlang Axel das, was man ihm auf sein Rufen an Speisen zureichte, trank schnell einmal aus dem Brunnen — der Graf war über Hunger und Durst erhaben, und Axel machte diesmal keine seiner gewöhnlichen Bemerkungen darüber. Er musste ja wohl nun auch glauben, dass sein Begleiter keiner Speise und keines Trankes bedurfte.
Schon seit langem lag vor ihnen ein hoher, ziemlich isolierter Berg.
»Der Monte Amiata«, erklärte Axel, »5200 Fuß hoch, zum toskanischen Gebirge gehörend, oder vielmehr zu dem von Grosetto.«
»Wir umgehen ihn natürlich.«
»Nein, eben nicht. Oder doch nicht so ganz. Der höchste Gebirgspass ist der beste, den nehmen wir.
»Das bedeutet aber durch die Steigung, die wir doch nur langsam nehmen können, wieder eine große Zeitversäumnis.«
»Was tut es? Was eilen wir jetzt überhaupt noch so?«
Ja, man hätte schon längst Schritt reiten können.
Bereits seit Mittag wehte nach längerer Stille ein leichter Ostwind, wie Axel vorausgesagt, und wenn die Feluke gegen diesen auch noch ganz gut aufkommen konnte, so konnte sie jetzt doch nur wie eine Schnecke kriechen.
»Das Schiff kann vor morgen früh nicht in Fiumicino sein, und selbst wenn wir immer nur noch Schritt ritten, hätten wir es schon um Mitternacht erreicht. Mindestens haben wir keinen Pferdewechsel mehr nötig, können unser Geld sparen, und ich dächte, wir hätten gerade jetzt ein paar ganz ausgezeichnete Klepper zwischen den Schenkeln.«
»Wenn aber nun die ›Vineta‹ einen Hafen anlaufen, der Marquis das Schiff verlassen sollte...«
»Bei diesem Ostwinde ja ganz unmöglich! Der ist wohl noch ganz günstig für die südliche Fahrt, aber die Feluke kann doch niemals mit ihm gegen die Westküste ansegeln.«
»Wenn der Marquis aber nun vielleicht mit einem Boote...«
»Lieber Freund — wenn der Himmel einfällt, dann sind alle Spatzen tot. Geben Sie sich doch nur keinen solchen Hirngespinsten hin, ich erkenne Sie überhaupt gar nicht wieder. Wenn der Mensch tut, was er kann, kann er nicht mehr tun — und damit basta.«
Der Graf schwieg, aber sein düsteres, melancholisches Gesicht klärte sich sogar gleich recht auf.
»Sie haben recht. Dann, denke ich, hielten wir im nächsten Dorfe etwas länger Rast.«
»Na, endlich!«, rief da Axel mit sogar ganz verklärtem Gesicht. »Graf, wissen Sie denn eigentlich, was wir schon geleistet haben?! Gottver... nein, mit der schönen Depeschenreiterzeit ist es vorbei, ich darf nicht mehr so aus Herzenslust fluchen — so schön und nutzbringend es auch war. Aber wahrhaftig — gestern um diese Zeit war meine Siesta beendet. Vierundzwanzig Stunden ohne Schlaf, und davon mehr als die Hälfte im Sattel und das immer in Karriere. Sie freilich, Graf — Sie sind ja der leibhaftige Teufel — aber ich bin noch ein ehrlicher oder doch irdischer Mensch — es ist eine Parforceleistung, wie ich sie selten in meiner besten Zeit vollbracht habe.«
»Sie bedürfen der Ruhe?«
»Na, nun sprechen Sie nicht. Ich zeige mich vor keinem Teufel schwach. Aber ein Dorf kommt erst wieder hinter dem Gebirgspass.«
»Das ist schade.«
»Nicht so ganz. Dafür kommt bald eine reizend gelegene Osteria, die werde ich mit meinem Wolfshunger beehren. Vor zwölf oder noch elf Jahren freilich hätte ich mich nicht so auf dieses Gasthaus gefreut.«
»Weshalb nicht?«
»Haben Sie nichts von dem gelben Ziringo und seiner Bande gehört, die bis vor elf Jahren diese Pässe unsicher machten?«
»Nein.«
»Graf, Sie scheinen im alten Babylon und Karthago nebst Umgegend besser zu Hause zu sein als in Italien, das Sie mit Ihrem letzten Lebenslaufe beehrten. Ein Zigeuner, wie schon der Name sagt — wenigstens in einigen Gegenden Italiens werden die Zigeuner Ziringi genannt — und wegen seiner ausgesprochen quittengelben Farbe hieß er noch speziell der gelbe Ziringo. Der Kerl war Zeit seines Lebens auch so eine Art Adept, aber mehr für die Dorfverhältnisse — eben ein Zigeuner, der mit Sympathie und Wunderkuren Menschen und krankes Vieh heilte, aus der Hand wahrsagte und anderen Hokuspokus trieb, nur dass dies Ziringos ausschließliche Beschäftigung war, mit der er alle Dörfer Italiens beglückte, wo er aber in dem Ruf eines allerersten Zauberkünstlers stand. Die Bauern erzählten die wunderbarsten Dinge von ihm, tun es noch heute. Seine persönliche Bekanntschaft zu machen, hatte ich nie die Ehre gehabt. So trieb er es also ein ganzes Menschenalter lang — er war schon damals ein alter Kerl — bis ihm einmal wegen eines kleinen Raubmordes der Prozess gemacht wurde. Vor vierzehn Jahren. Ziringo entsprang, wurde Räuber, sammelte eine Bande um sich, etablierte sich mit ihr hier am Monte Amiata.
Drei Jahre hat er hier seinen neuen Beruf ausgeübt. Es ist der beste und eigentlich sogar der einzige Weg zwischen Siena und Viterbo bis nach Rom, und er legte allen Verkehr vollständig lahm. Oder man musste ihm einen hohen Tribut entrichten, dann hielt der edle Zigeuner auch sein Wort. Er war einfach der König vom Monte Amiata, nannte sich auch so.
Ich habe während jener drei Jahre nur ein einziges Mal diesen Pass genommen. Ein Tributzahlen gab es bei mir ja nicht, ich kam auch glücklich durch, glaube aber, es war mehr Zufall. Die Bande war gerade anderswo beschäftigt.
Ja, da kommt also erst eine Osteria, ein idyllisch gelegenes Gasthaus. Ich kannte die Verhältnisse ja schon, d. h. vom Hörensagen, das hatte er überall erzählen lassen. Dass der Wirt dieser Osteria mit den Räubern unter einer Decke steckte, ihnen als Spion diente, das war ja in der weitesten Umgegend bekannt. Aber niemand wagte ihn zur Rechenschaft zu ziehen. So groß war die Macht Ziringos. Und der Wirt selbst sollte über den bösen Blick verfügen, was in Italien doch ebenfalls etwas zu sagen hat. Vor dem bösen Blick fürchtet sich jeder brave Karabiniere und Bersagliere mehr als vor einem Dutzend feuerspeienden Kanonen.
Sie wissen ja nun, wie ich es bei solchen Gelegenheiten hielt, hab's Ihnen oft genug erzählt. Wenn ich so einen Kerl hatte, der mir etwas von einer zukünftigen Gefahr erzählen konnte, der wurde von mir vorgenommen. Ich faszinierte ihn, machte ihn willenlos. Sie kennen's ja, wie ich das mache. Wenn ich mich da auch nicht mit Ihnen vergleichen kann, weil ich's auch nur mit den Augen mache — widerstanden hat mir da noch keiner.
Aber mit diesem Osteriawirt — Popplia hieß der Kerl, der dort ganz allein hauste — war ich mit meiner Kunst hereingefallen. Das wusste ich gleich, als ich ihn sah. Er hatte nämlich nur ein Auge, und mit diesem schielte er überallhin, nur nicht dahin, wohin er sehen wollte. Und ansehen muss mich der Betreffende, ich muss ihn scharf fixieren können, sonst ist es nichts.
Also es gelang mir nicht, den Kerl in Faszination zu bringen, wie wir diesen rätselhaften Zustand nun einmal genannt haben. So hübsch allein ich ihn auch vor mir hatte. Er wollte durchaus nicht einschlafen, um mir dann unfreiwillig zu erzählen.
»Na, ich hielt mich nicht lange dabei auf, ritt ab, und es ging auch so. Freilich, wiederhole ich, das Glück war mir eben günstig. Ich kam durch, ohne eine Spur von Räubern gemerkt zu haben. Ein zweites Mal hätte ich allerdings nicht auf solches Glück gepocht, täte es auch heute noch nicht, wenn der gelbe Ziringo hier noch sein Wesen triebe. Da würde ich noch etwas vorsichtiger sein.«
»Und was ist denn aus der Bande geworden?«, fragte der Graf.
»Endlich wurde die Sache doch zu toll. Der Großherzog von Toskana, ein gar energischer Herr, wollte sein Reich mit keinem anderen teilen, er wusste seinen braven Soldaten allen Aberglauben auszutreiben, unter Umständen mit der Peitsche, d. h. durch Androhung von entehrenden Strafen, wenn sie nicht gegen den maßlos gefürchteten Hexenräuberhauptmann vorgingen — na, das half, und einigen tüchtigen Kompanien Bersaglieri konnte die gelbe Bande natürlich nicht lange widerstehen. Sie wurde bald aufgerieben, auch der gelbe Ziringo fiel. Seitdem ist wieder Ruhe im Lande. Das ist, wie schon gesagt, elf Jahre her. Und dort ist die Osteria.«
Die Gegend war schon sehr hügelig geworden, auch waldig. An einem wilden Gebirgsbach lag unter schattigen Kastanien ein Häuschen, zwar sehr baufällig und verwahrlost aussehend, aber gerade dadurch einen höchst idyllischen Eindruck machend.
Noch ehe sie von den erst vor einer Stunde neu angeschafften, aber durch den langen Galoppritt schon sehr müden Tieren abstiegen, kam aus der Haustür ein junger Kerl hervor, ein echter Italiener, so zerlumpt und verwahrlost wie das Häuschen.
»Himmelherrgott, jetzt hat der Kerl ooch wieder nur een Ooge«, sagte der deutsche Fürst, sich noch immer bei passender Gelegenheit, wenn ihn niemand anders verstehen sollte, gegen seinen alten Freund des Deutschen bedienend, wobei er manchmal einen vulgären Dialekt sprach.
So war es. Und nicht nur, dass dieser Nachfolger des ehemaligen Räuberspions, dem natürlich ebenfalls der Garaus gemacht worden, nur ein einziges Auge besaß, das rechte, sondern mit diesem schielte er auch noch beharrlich nach links oder sonst wohin, nur nicht dahin, wohin er sehen wollte.
»Vielleicht ein Sohn oder Enkel jenes Popplia?«, flfsterte der Graf, während er sich aus dem Sattel schwang.
»Nein, gar keine Ähnlichkeit — bis auf das schielende Auge — wohl nur Zufall,« gab Axel zurück.
Der junge Kerl empfing die beiden Reiter, die trotz ihres derangierten Aussehens die Vornehmheit ja nicht ganz verleugnen konnten, mit kriechender Höflichkeit.
Was seine arme Osteria bieten könne, stände ihnen zur Verfügung, usw. usw.
»Seid Ihr der Besitzer?«
»Si si, Signore.«
»Haust doch nicht ganz allein hier?«
»Ganz, ganz allein, Signor — werde mich aber bald verheiraten, und meine Braut bringt mir gleich drei Kinder mit — aber alle von mir»« grinste der Bursche.
»Merkwürdig, auch wieder ganz allein in dieser Wildnis«, brummte Axel. »Na, da tragt mal auf, was Ihr habt!«
Sie selbst versorgten ihre Pferde. Dabei wollte der Graf einmal anfangen, ob hier nicht die größte Vorsicht geboten sei, ob das nicht doch ein Nachfolger des alten Räuberspions sein könne, nicht nur seinem einen Auge nach, aber Axel wollte davon nichts wissen.
»Nein, ein reiner Zufall. Der letzte Bauer, von dem ich diese Gäule erstand, war ein intelligenter Mann, und ein ehrlicher dazu, das konnte ich ihm sofort anmerken und darin irre ich mich nie — ich sagte ihm, dass wir den Amiatapass nehmen würden — und wenn nun hier irgend etwas nicht in Ordnung wäre, so hätte dieser Mann es doch am allerbesten wissen müssen, wo er kaum zwei Meilen von dieser Osteria und überhaupt vom Anfange dieses Passes wohnt, und dann hätte er uns doch gewarnt, etwas davon erzählt. Nein, diese Ähnlichkeit ist der reine Zufall, und sie besteht überhaupt nur in dem einen schielenden Auge.«
»Und darin, dass er ganz allein hier haust«, ergänzte der Graf.
»Na, warum soll er denn nicht! Er kann seinen spärlichen Dienst eben allein versehen, zu fürchten braucht er sich hier auch nicht, wird aber wohl auch keine freiwillige Gesellschaft finden, die er ja schließlich auch bezahlen müsste — bis seine Braut mit den drei Kindern zu ihm zieht.«
Die Sache war abgetan, wenigstens für Axel. Als sie die Pferde versorgt hatten, war in der Laube des verwilderten Gartens schon aufgetragen — hauptsächlich harter Backsteinkäse und Salamiwurst, von der aber der Italiener selbst nicht weiß, dass sie aus Eselsfleisch gemacht werden soll, die Stelle des Brotes vertrat Polenta, gekochtes und beim Erkalten wieder steif gewordenes Maismehl. Dazu kamen noch Kastanien und Feigen, welche in der Umgebung überall wuchsen.
Dann brachte der Bursche noch eine bauchige Flasche Rotwein, ließ sich aber, obgleich er kein Glas für sich selbst mitgebracht, nicht wieder abweisen, fragte in aufdringlich demütiger Weise nach dem Woher und Wohin der Fremden — kurz, suchte sie auszuhorchen.
Einen Verdacht brauchte man deshalb ja nicht zu schöpfen — wenn man nicht schon einen Verdacht geschöpft hatte, wie es wohl eben bei dem Grafen der Fall war.
Doch war es Axel, der als erster jenem auf den Zahn zu fühlen begann, wenn auch wahrscheinlich ohne jede besondere Absicht.
»Seid ihr mit dem alten Popplia verwandt, der früher diese Osteria bewirtschaftete?«, fragte er mit kauendem Munde.
Der Bursche erstarrte vor Schreck auf der Bank.
»Der damals mit dem gelben Ziringo hielt und dann gehangen wurde?«
»Jawohl, eben den meine ich.«
»Gott steh mir bei, wie kommt Ihr auf solch einen Verdacht! Das war doch ein Zigeuner, und sehe ich denn aus wie ein Zigeuner? Ich bin ein ehrlicher Christ, der jeden Sonntag zur Beichte geht — aber ich weiß schon, wie Ihr auf so etwas kommt, und ich kann doch nichts dafür, dass ich von Gott so gezeichnet bin...«
Der starke Bursche begann wie ein Kind zu flennen, und man hatte wenigstens das eine erreicht, dass er sich jetzt entfernte.
»Na, zum ersteren hat er keinen Grund, sich so beleidigt zu fühlen«, meinte Axel. »Jener Popplia war nämlich gar kein Zigeuner, sondern ebenfalls ein Italiener. Im Übrigen aber halte ich ihn für einen ganz harmlosen Burschen, wenn auch nicht gerade für einen ehrlichen — ein italienischer Osteriawirt wie alle anderen.«
»Und ich werde den Verdacht nicht los, dass er gegen uns irgend etwas im Schilde führt«, versetzte der Graf, sein Glas leerend, wie er sich auch die frugale Mahlzeit trefflich schmecken ließ.
»Weshalb nicht?«
»Haben Sie seinen Schreck beobachtet?«
»Der war ganz gerechtfertigt — aber das war nur Bestürzung ob meines Argwohnes, und dann war auch jede Bewegung und jeder Gesichtszug ganz natürlich.«
»Mir kam es nicht so natürlich vor.«
»Eben, weil Sie nun einmal einen Verdacht gegen den Burschen haben.«
»Mag sein, aber... ich möchte ihn doch lieber einmal faszinieren.«
»Tun Sie es doch. Ich kann es nicht. Gegen solch ein schielendes Auge vermag ich nichts auszurichten.«
Hier befand sich Axel offenbar in einem ganz ähnlichen Aberglauben, wie man ihn überhaupt dem sogenannten bösen Blicke zuschreibt. Ein schielender Einäugiger kann natürlich ebenso gut hypnotisiert werden wie jeder andere Mensch. Aber was wusste denn Axel von der auch uns heute noch immer ganz rätselhaften Hypnotik, und er war ein Kind seiner Zeit, und dann vor allen Dingen — die Hauptsache! — indem er sich in jenem Glauben oder Aberglauben befand, nämlich solch ein schielendes Auge nicht fixieren zu können, vermochte er es auch wirklich nicht. Denn unbedingtes Selbstvertrauen ist das allererste, wenn nicht das allereinzigste Erfordernis zur Hypnose, wie zu jedem anderen Erfolg.
»Haben Sie das Mittel bei sich?«
»Ja. Zwar wollte ich es nie wieder benutzen, aber... Ausnahmen gibt es immer.«
Ehe Marino, wie er hieß, gerufen zu werden brauchte, erschien er von selbst wieder, zwar nicht mehr flennend, aber gleich wieder davon beginnend, wie man ihn mit dem verruchten Popplia oder gar mit dem noch viel verruchteren Ziringo in Verbindung bringen könne — und dass er sich gleich wieder zu entschuldigen suchte, das war für solch einen Mann aus dem Volke wiederum ganz natürlich. Hätte er jetzt ganz darüber geschwiegen, dann allerdings hätte auch Axel Verdacht gegen ihn gefasst, wenigstens wegen der Verwandtschaft mit dem früheren Osteriawirt.
Er wurde beruhigt, sollte sich ein Glas holen, tat es, der Graf schenkte ihm ein.
Wenn der Wein jetzt schon das Mittel enthielt, als Marino mit einem ›salute, signori‹ das Glas an den Mund führte, so war es Axel wiederum entgangen, wie der Graf das Mittel in das Glas hineinpraktiziert hatte, denn der scharfsichtige Axel hatte gut dabei aufgepasst.
Doch richtig, nur zwei Schlucke, und der Mann war zu weiterem Trinken nicht fähig, mit dem Glase in der erhobenen Hand war er eingeschlafen.
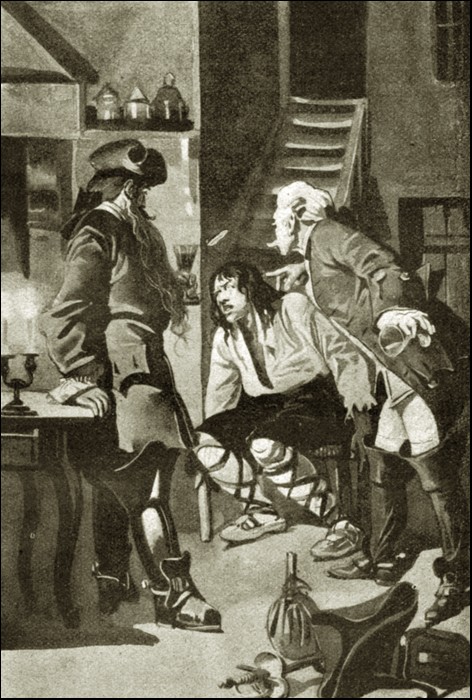
»Teufel, wie haben Sie das wieder fertig gebracht!«, staunte Axel.
Der Graf nahm schnell das Glas aus der erstarrten Hand, überzeugte sich, dass das eine Auge ganz nach oben verdreht war — der Mann lag wirklich im tiefsten Schlafe.
Er wurde vorgenommen. Ja, er hatte mehreres auf dem Gewissen. Aber nichts, was ihn vor den Staatsanwalt gebracht hätte. Und mit dem früheren Osteriawirt war er nicht einmal verwandt, hatte selbst in den vier Jahren noch keinen einzigen Reisenden, der bei ihm übernachtet oder eingekehrt, auch nur betrogen.
»Sie hatten recht«, gab der Graf jetzt zu, »mein Verdacht war gänzlich unbegründet, und ich habe es am meisten zu bereuen, denn wir haben dadurch nur kostbare Zeit vertrödelt.«
»Na, was das anbetrifft, lachte Axel, »so war mir Ihr Verdacht einmal ganz angenehm, denn ich sitze ganz gern einmal zur Abwechslung auf einer schattigen Bank beim Weine.«
Der Schläfer musste erinnerungslos erwachen, seine neuen Verteidigungsreden, dass er nichts mit jenem gehangenen Popplia zu tun habe, wurden durch die Bezahlung unterbrochen, und diese war eine so reichliche, dass dann der Bursche aus Freude seine alte Luntenflinte abschoss.
Die Pferde hatten sich erholt, die Reiter sich mindestens gestärkt. Der Regen hatte schon vor einigen Stunden aufgehört, jetzt kam auch noch die Nachmittagssonne zum Vorschein, es konnte noch immer ein heißer Tag werden.
Der Aufstieg begann. Der Weg war zwar steil, aber gut und auch noch für Pferde geeignet, nicht nur für Saumtiere.
»In einer Stunde sind wir oben auf der höchsten Höhe, die freilich nicht die des Monte Amiata zu bedeuten hat«, sagte Axel. »Auf der anderen Seite senkt sich der Weg so sanft bergab, dass wir ihn in gestrecktem Galopp bergab reiten können. Heute Abend um zehn Uhr sind wir in Rom, wenn nicht schon in Fiumicino, und können dort in Ruhe auf die Feluke warten.«
»Und wie gedenken Sie diesem Marquis gegenüberzutreten?«, fragte der Graf.
Es war während diesem Rittes das allererste Mal, dass über die zukünftige Begegnung gesprochen wurde. Eigentlich hätte diese erste Frage ja von Axel an den Grafen gerichtet werden müssen, aber Axel ignorierte diese Vertauschung der Rollen, und er lachte grimmig, als er an den Knauf seines Degens schlug, der noch viel eher den Namen eines Schlachtschwertes verdiente als früher sein nur kurzer Hirschfänger.
»Na, ich werde den Herrn Marquis daran erinnern, dass jemand auch seine Adresse hinterlassen muss, wenn man ihm seine Sekundanten schicken soll!«
»Sie werden ihn zum Zweikamps fordern?«
»Aber ganz sicher jetzt! Und, Gräfchen, Sie sollen Zeuge werden, wie so'n alter Depeschenreiter mit einem Meister der Fechtkunst fertig zu werden versteht!«
»Sie werden ihn töten?«
Finster zog sich des Fürsten hohnlachendes Gesicht zusammen.
»Ja«, erklang es dann kurz. »Es ist für die Menschheit das beste, wenn solch ein Charakter von der Bildfläche der Erde verschwindet. Ja, ich werde ihn töten.«
Und hiermit war dieses Thema beendet. Jetzt hätte auch Axel fragen können, wie der Graf sich das Wiedersehen mit seiner Tochter vorstellte, aber er tat es nicht, und der Graf selbst begann nicht davon.
Die erste Stunde des Aufstieges war vergangen. Nun wurde der Weg fast ganz eben, nahm aber eine ganz andere Gestalt an.
Bisher hatte man immer nach links und rechts freie Aussicht gehabt, jetzt wuchsen an den Seiten hohe Felswände empor, immer höher, und sie traten so eng zusammen, dass zwei Reiter nur noch mit knapper Not sich nebeneinander halten, ein einzelnes Pferd, das darauf nicht dressiert war, sich nicht mehr umwenden konnte.
Die steil aufsteigenden Porphyrwände waren sonst ganz glatt, zeigten aber viele Höhlen und noch mehr Löcher, wie Schießscharten in einer Festungsmauer anzusehen.
»Ja«, sagte der Graf, der zufällig als erster in diesen Engpass eingeritten war, nach einer kleinen Weile, »hier allerdings ist schon ein einziger Räuber imstande, ein ganzes...«
Er kam nicht weiter.
»Halt und Hände hoch!!!«, donnerte es auf italienisch mit vielstimmigem Echo.
Axel war der Klügere, als er sofort sein Pferd zurückriss und sich dabei den Zügel um den Arm schlang, sodass er beide Hände gen Himmel strecken konnte.

Denn der Mut, der jeder Gefahr trotzt, ist zwar eine schöne Sache, oftmals aber entspringt solcher blinder Mut auch nur der Torheit — und töricht war der Graf, dass er bei diesem Kommando sofort beide Pistolen aus den Halftern riss und sein Pferd anspornte.
Es sollte nicht weit kommen. Wohl war es nur ein einziger Schuss, aber zwischen diesen Felswänden klang es wie eine hundertfältige Gewehrsalve, und mitten im Sprunge stürzte des Grafen Ross zusammen, noch ein Wälzen, dann ein krampfartiger Ruck, und das durch das Auge geschossene Tier blieb regungslos liegen.
Der Graf hatte sich als Kunstreiter bewiesen, stand schon auf dem Leibe des etwas auf dem Rücken liegenden Pferdes, das die ganze Breite der Schlucht ausfüllte, die beiden Pistolen noch immer schussbereit.
»Hände hoch, zum letzten Male!!«, donnerte es abermals.
»Mensch, sind Sie denn toll!!«, zürnte jetzt auch Axel. »Jetzt haben Sie mit Ihrer Dummheit auch noch mir die Passage versperrt.«
Da kam der Graf zur Besinnung. Beschämt senkte er die schussbereiten Pistolen. Ja, so wie sein Pferd selber dalag, konnte das andere nicht einmal darübersetzen. Das ist nämlich gar nicht so leicht, das will dem Pferde mit großer Mühe beigebracht werden, ganz abgesehen davon, dass Pferde von Natur aus vor allem Toten zurückbeben, am meisten vor Leichen ihresgleichen.
»Hände hoch! Pistolen weg und Hände hoch, oder auch Sie sind des Todes!!!«, machte jetzt Axel auch noch mit den Wegelagerern gemeinsame Sache.
Der Graf ließ denn auch schleunigst die Pistolen fallen und hob die leeren Hände gen Himmel.
»Eine verdächtige Bewegung, und ihr seid tote Männer!«, erklang es wieder.
»Ja, ja, wissen's schon«, erwiderte Axel gemütlich, und leiser setzte er hinzu: »O weh, das war wieder eine andere Stimme als die vorige, also haben sich unsere Chancen schon um die Hälfte reduziert.«
»Der letzte herunter vom Sattel!«, donnerte es immer wieder, und niemand hätte bei diesem Widerhall beurteilen können, woher die Stimme eigentlich kam.
»Aber das gilt doch hoffentlich nicht als verdächtige Bewegung«, ließ sich Axel erst noch einmal vernehmen.
»Herunter vom Gaul!!«
Axel sagte nichts mehr, glitt aus dem Sattel, ohne dabei die Hände zu senken.
»So bleibt ihr regungslos stehen, bis ihr gebunden seid!«
»Wir gehorchen. Nur mal los, dass uns die Arme nicht müde werden.«
So rief Axel, der Brust des Grafen aber entstieg ein furchtbar qualvolles Ächzen.
»Heilige Madonna, erlöse mich bald, dass ich nicht doch noch zu spät komme!!«
»Ach was, hier nützt keine heilige...«
Axel vollendete seine unchristliche Rede nicht, auch in dieser Lage blieb er bei allem Spott und sonstiger Barschheit ein untadelhafter Gentleman, der jedem seinen Glauben lässt.
Und da wurde um Axels Arme, ohne dass er hinter sich einen Schritt gehört hätte, schon ein Strick geschlungen, dann, als man noch mit ihm beschäftigt war, drängten sich hinter ihm vier zerlumpte Gestalten hervor, welche auch des Grafen Arme wehrlos machten.
»Na, es sind wenigstens fünf«, sagte sich Axel, auch aus dieser bitteren Blume noch etwas Süßigkeit zu saugen wissend, »dann braucht man sich doch später nicht den Vorwurf gefallen zu lassen, man habe sich nur von zweien oder dreien so niederträchtig überrumpeln lassen. Das sind italienische Banditen und — hallo!! — auch zwei Zigeuner!!«
Ja, zwei von den vieren, die er vor sich beobachten konnte, waren offenbar Zigeuner, das erkannte dieser ehemalige Depeschenreiter, der immer auf der Landstraße gelegen, doch sofort, und eben deshalb wusste er auch gleich noch mehr.
»Dann ist das auch wieder eine ganze Zigeunerbande, die sich hier neu etabliert hat, die nur so aushilfsweise einmal Italiener und sonstige Fremde in ihre Dienste genommen.«
Er hatte recht. Ganz allein geht kein Zigeuner auf Raub, nicht einmal auf Diebstahl aus, und sammelt er andere um sich, so müssen das immer ebenfalls Zigeuner sein, und schließt er sich einer schon bestehenden Verbrechergesellschaft an, so erringt er entweder bald die Oberherrschaft, diejenigen, die nicht seines Volkes sind, nach und nach ausmerzend und sie durch Stammesgenossen ersetzend, oder er verlässt die Bande eben bald wieder. Darin gleicht der Zigeuner ganz dem Juden, obgleich dieser deshalb hier nicht schlecht gemacht werden soll. Es gibt auch genug ehrliche Juden — und auch genug ehrliche Zigeuner.
Hinter Axel tauchten noch immer fünf andere auf, die sich mit dem getöteten Pferde zu beschäftigen begannen, es sofort abhäutend und zerwirkend, und diese fünf waren lauter Zigeuner!
Sie unterhielten sich in ihrer Sprache, welche die ganze Welt beherrscht, welche unseren heutigen Gelehrten so manche Nuss zu knacken aufgibt, und Axel wäre doch kein ehemaliger Depeschenreiter gewesen, wenn er diese Sprache nicht perfekt beherrscht hätte.
Doch viel war es nicht, was er zu hören bekam. Sie äußerten ihre Freude darüber, dass ihnen ›Gott ein so gesundes Pferd geschlachtet‹ habe — ein echter Zigeunerausdruck, denn für den Zigeuner ist alles, was er nicht selbst tötet, von Gott geschlachtet, auch alles gefallene Vieh, was er deshalb nicht verschmäht — und dass es so nahe ihrem Lagerplatz gestürzt sei.
Mehr bekam Axel nicht zu hören — und da ward ihm auch schon eine Kapuze oder ein Sack über den Kopf gezogen.
Gewandte Hände visitierten seine Taschen, zuerst wohl nur nach verborgenen Waffen, dann ward er vorwärtsgeschoben, gar nicht unsanft, bald hatte er das Gefühl, als müsse er sich in einer Höhle befinden, wonach es noch durch einen Tunnel ging, dann hatte er wieder einen kleinen Schimmer durch die Sackleinwand, und diese ward ihm wieder abgenommen.
Kaum fünf Minuten hatte dieser Transport gedauert, und Axel sah sich in einem engen Kessel, in dem sich vierzehn Männer befanden, von denen nur drei Italiener, die anderen Zigeuner waren, und dann kam noch der Graf hinzu, der ebenfalls schon eingetroffen war.
Mehr als vierzehn Räuber wurden es auch nicht. Diese gingen hin und her, nach und nach das ganze Pferd in Stücken hereinbringend, wobei sie immer durch ein Loch krochen, wie solche Löcher noch mehrere in die Kesselschlucht mündeten.
Andere waren schon dabei, auf einer bereits vorhanden gewesenen Brandstelle ein neues Feuer anzuzünden, um darüber die saftigsten Pferdesteaks zu rösten, wozu an den schrägen Felswänden überall Buschholz genug wuchs.
Doch wir übereilen uns mit der Schilderung dieses Räuberlagers.
Jetzt vor allen Dingen wurde Axels Aufmerksamkeit von dem einen Zigeuner gefesselt, den er vorhin noch nicht gesehen hatte.
Es war ein schon sehr bejahrter Mann, das faltige Gesicht aber doch noch den echten Zigeuner erkennen lassend, dabei noch strotzend von Kraft und sonstiger Rüstigkeit, mit unruhigem, falkenhellem Blick — so ein Kapitän Morphium in zweiter Ausgabe, nur nicht mit solch einer ungeheueren Hakennase — die Hauptsache aber war, dass dieses faltige Gesicht, in dem sich Intelligenz mit der größten Verschlagenheit paarte, quittengelb war — ein so auffallendes Gelb, wie es sonst kein anderer Zigeuner zeigt, mag bei ihnen auch die gelbe Hautfarbe die vorherrschende sein.
»Sapristi!«, dachte Axel überrascht. »Wenn das nicht der alte Ziringo ist, der sich hier von Neuem etabliert hat, dann will ich doch gleich gehangen werden!!«
Auch der Graf hatte offenbar schon dieselbe Ansicht gefasst, mit solchem Interesse betrachtete er den quittengelben Greis, äußerte aber seine Meinung nicht gegen den Unglücksgefährten.
Der Capitano, der Hauptmann, der es doch auf alle Fälle war, stopfte sich den Tonkopf an dem ellenlangen Bambusrohr mit frischem Tabak, brannte die Pfeife an, dampfte mächtig, dabei mit seinen blitzenden Augen die nahe zusammenstehenden Gefangenen musternd.
»Wer seid ihr?«, begann er dann das Verhör.
»Ich bin«, übernahm Axel schnellstens die Antwort, ehe der Graf zu Worte hatte kommen können, »ein Deutscher, namens Schmidt, und das ist mein russischer Diener Paul.«
Der Graf wusste genug. Es war ja nicht das erste Mal, dass ihn sein Freund für einen Diener ausgab, das hatte er schon damals in dem koptischen Kloster getan, diesmal aber hatte es noch einen ganz besonderen Zweck.
Derartige Räuber haben es doch immer auf Erpressung von Lösegeld abgesehen. Nun aber wird man von einem Walter Schmidt und seinem Diener sicher weniger Lösegeld verlangen oder erwarten, als von einem deutschen Fürsten und einem russischen Grafen, und nur auf diese Weise hatte ersterer den gerechtfertigten Grund, auch den anderen gleich mit vorzustellen.
Ja, der mit allen Hunden gehetzte ehemalige Depeschenreiter hatte sogar vorhin vermieden. Seinen Freund wie gewöhnlich mit Graf anzureden, er hatte im Augenblicke des Überfalls den Anruf ›Mensch‹ gebraucht, was er sonst nie tat, also wohl sicher nicht aus Zufall.
Aber es sollte sich gleich zeigen, dass man auch in diesem Räuberkapitän einen Mann vor sich hatte, der trotz seiner dicken Lage Schmutz mit allen Wassern gewaschen war.
Zunächst spuckte er verächtlich aus.
»Bah. Du täuschst mich nicht.«
»Was soll ich dich täuschen?«
»Weißt du, wer ich bin?«
»Fast ahne ich es.«
»Nun?«
»Der gelbe Ziringo.«
»Ich bin es«, richtete sich der Alte stolz auf, »Und trotzdem — woher weißt du das?«
»Ich erkenne es aus der Hautfarbe.«
»Du hast von mir schon gehört?«
»Ja.«
»Von wem? Was?«
»Du hast schon vor elf bis vierzehn Jahren hier dein Wesen getrieben.«
»Wer erzählte dir das?«
»Das erzählt sich noch ganz Italien.«
»Fremder, versuche mir nicht zu schmeicheln, das nützt bei mir nichts, und ich verachte den Schmeichler!«
Dass der Zigeunerhauptmann so sprach, noch dazu in drohendem oder doch missbilligendem Tone, ließ schon auf einen tüchtigen Charakter schließen, der freilich auch mit einer echten Räubernatur harmonieren kann.
»Ich schmeichle nicht. Fast jedes Kind in ganz Italien kann von dem gelben Ziringo erzählen, es sind doch auch viele Bücher über dich geschrieben worden, du wirst im Bilde vorgeführt, und wenn diese Bilder dir auch gar nicht ähnlich sind, so ist das gelbe Gesicht doch immer die Hauptsache, und nun hier im Monte Amiata — wer sollst du Räuberhauptmann anders sein als der gelbe Ziringo?«
»Ein anderer, der sich diesem Namen anmaßt, sein Gesicht so gefärbt hat.«
»Ach so, das kann allerdings...«
»Nein nein, ich bin wirklich der gelbe Ziringo«, fiel der Hauptmann jetzt mit einiger Hast ein. »Und doch — bin ich nicht vor elf Jahren im Kampfe getötet worden, hat man mich nicht mit durchschossenem Kopfe in eine tiefe Schlucht stürzen sehen?«
»So genau weiß ich die Einzelheiten freilich nicht, und in den Büchern...«
»Bah, die erzählen nur Märchen von mir — Wunderdinge, die ich nie ausgeführt habe.«
Das sprach wieder sehr zum Vorteil dieses Mannes.
»Du bist nicht getötet worden?«
»Nein, ich stellte mich nur, als sei ich durch den Kopf geschossen worden, sprang mit Absicht in die Schlucht, wusste beizeiten einen Absatz zu finden.«
»Dann wundert mich nur eins.«
»Was?«
»Dass du innerhalb der elf Jahre gar nicht als Räuber von dir reden gemacht hast.«
Da veränderte sich das gelbe Gesicht, nahm einen furchtbar drohenden Ausdruck an.
»Was geht das dich an?!«, herrschte er Axel an. »Weißt du, weshalb ich zum Räuber geworden bin?!«
»Nein, das weiß ich nicht.«
»Das steht in allen diesen Büchern, und das ist auch so ziemlich die einzige Wahrheit.«
»Ich gestehe, dass ich diese Bücher niemals gelesen habe, weil sie von einer Art sind, die meinem Geschmacke nicht entspricht.«
Es war ein etwas kühnes Geständnis, wenn man einen intelligenteren Räuber vor sich hatte, aber das wilde Gesicht glättete sich gleich wieder, nahm sogar einen etwas traurigen Ausdruck an.
»Ich weiß, ich weiß. Ich war ein ehrlicher Mensch, sogar ein ehrlicher Zigeuner, ich wanderte von Dorf zu Dorf und heilte kranke Menschen und kranke Tiere... glaubst du, Fremder, dass es Menschen gibt, welche die Kraft der Heilung in ihrer Hand und in ihrem Blicke haben?«
»Ja, ich glaube an eine Macht der Sympathie.«
»Sympathie — du sagst es. Ja, ich hatte wirklich die Macht der Heilung. Die Fälle der Heilung überwogen weit die Fälle, da es mir nicht gelang. Ja, ich war ein ehrlicher Mensch, ein grundehrlicher Mensch. Da wurde auf der Landstraße ein Mann tot aufgefunden, ein reicher Viehhändler, ermordet, beraubt. Ich selbst war es, der ihn zuerst fand. Und wer anders sollte ihn ermordet haben, als ich, der verachtete Zigeuner? Alles, was ich vorbrachte, war vergeblich, ich wurde zum Tode verurteilt.«
Der Alte schöpfte tief Atem, ehe er fortfuhr.
»Ich entsprang dem Kerker in letzter Stunde. Ja, da wurde ich zum Räuber. Denn Rache wollte ich nehmen, Rache an der ganzen Menschheit, die sich von meiner so klar dargelegten Unschuld nicht hatte überzeugen lassen wollen. Nun, ich habe mir ja auch einen Namen als Räuber gemacht.
Bis ich dieses blutige Handwerk überdrüssig bekam. Schon immer wollte ich ihm entsagen. Die Bersaglieri kamen mir zuvor — wohl, so mochte ich als tot gelten.
Wo ich mich diese elf Jahre aufgehalten habe? Was geht's dich an? Und wenn ich dir sagte, der gelbe Ziringo hat in diesen elf Jahren als ehrlicher Mensch gelebt, würdest du es glauben?«
Mit seiner früheren Wildheit hatte der Zigeunerhauptmann diese Fragen gestellt, gerufen.
»Warum denn nicht?«, meinte Axel kaltblütig.
»Ja, du, du! Aber nicht die anderen. Und da hörte ich, dass der Mann noch lebte, der einzige, der felsenfest von meiner Unschuld überzeugt gewesen ist und der mich dennoch als Raubmörder verurteilt hat — der ehemalige Podesta von Florenz! Und da hörte ich in meiner Einsamkeit, dass er in den nächsten Tagen eine Reise nach Rom antreten, diesen Weg passieren würde! Und da regte sich in mir wieder das Zigeunerblut, welches nichts von Verzeihung weiß.
Zahn um Zahn und Blut und Blut! Und schnell hatte ich Genossen um mich versammelt, die ich zu meinem Plane brauche — morgen schon wird der Podesta von Florenz diesen Hohlweg passieren — morgen schon wird der gelbe Ziringo furchtbar über ihn zu Gericht sitzen!«
Mit einem furchtbaren Hass in Gesicht und Ton hatte der Alte die letzten Worte gerufen — und das sprach nun weniger zu seinen Gunsten. Doch es war eben ein Zigeuner, und wenn Rache überhaupt menschlich, so war das bei diesem doppelt zu verzeihen.
»So bist du gar kein eigentlicher Räuber mehr?«, fragte Axel.
»Nein, und ich werde es auch nie wieder werden. Nur noch einmal diese letzte Rache!«
»Ja, warum überfällst du uns harmlose Reisenden dann?«
»Weil ihr, wenn ihr nur noch um die nächste Ecke geritten wäret, sofort gemerkt hättet, dass hier Wegelagerer eine Vorkehrung treffen, um eine ansehnliche Karawane mit einem Schlage abzufangen.«
»Ich verstehe nicht.«
»Das ist sehr schlimm für dich, das spricht nicht eben für deine Geisteskraft.«
»Du baust eine Falle?«
»So ist es.«
»Und so auffällig ist diese, dass jeder sie sofort bemerkt?«
»Ja, jetzt noch, wo noch daran gebaut wird.«
»Ah so! Ja, aber ich verstehe noch immer nicht, weshalb du uns da überfällst und gefangen nimmst.«
»Nun, weil ihr doch sonst in der nächsten Stadt verkündet, was ihr geschaut habt und dann natürlich meinen Anschlag auf die Karawane vereitelt, auf die ich es abgesehen habe.«
»Ah so, nun verstehe ich allerdings! So nimmst du also jeden gefangen, der diesen Weg passiert?«
»Jeden. Damit er nicht plaudern kann.«
»Dann dürftest du aber viel Arbeit bekommen, musst viele Gefangene füttern.
»Das dürfte nicht schlimm werden. Vor einer Stunde ist erst die Arbeit begonnen worden, nach zwei Stunden wird sie beendet sein. Dann kann hier passieren, wer da will, das hat dann nichts mehr zu sagen.«
»Nur der, für den er bestimmt ist, fällt in den Hinterhalt.«
»So ist es.«
»Und wann kommt der Podesta?«
»Morgen.«
»Und so lange willst du uns hier gefangen halten?«
»Nur bis morgen, dann sollt ihr als freie Männer ziehen, kein Haar soll euch gekrümmt werden, und selbst das getötete Pferd soll euch ersetzt werden.«
Der Graf war zusammengezuckt. Doch er selbst brauchte nicht erst zu sprechen, Axel tat es schon für ihn.
»Lass uns ziehen, wir werden nichts verraten.«
»Bah!«, war die einzige Antwort.
»Du hast es nicht aus unser Geld abgesehen?«
»Wehe dem, der es wagt, euch auch nur eine Stecknadel zu entwenden.«
»Was für eine Sicherheit forderst du, dass wir dich und deine Pläne nicht verraten?«
»Dafür gibt es keine Sicherheit.«
»Wenn wir es dir zuschwören.«
»Sagte ich dir nicht schon, wer ich bin?«, fing der Gelbe wieder an, nicht recht verständlich.
»Ziringo, der ehemalige Räuberhauptmann.«
»Und weißt du nicht, wer dieser Ziringo war? Du sagtest doch erst, du wüsstest es. Und ich sagte dir doch schon, dass du mich täuschen willst. Aber es ist ganz vergeblich, den gelben Ziringo täuschen zu wollen.«
Ah so, auf dieses alte Thema wollte der Zigeuner auf solche Weise zurückkommen!
»Inwiefern soll ich denn zu täuschen versuchen?«
»Du nanntest dich Walther Schmidt.«
»Bin ich auch.«
Das konnte Axel umso kecker behaupten, weil er Pass und Legitimationspapiere auf diesen Namen bei sich führte.
»Was für ein Geschäft hast du?«
»Ich bin ein deutscher Bilder- und Raritätenhändler und komme öfter nach Italien, um solche Sachen einzukaufen. Prüfe doch meine Papiere, die ich in der Brusttasche habe.«
Denn auch das hätte Axel durch Papiere beweisen können.
»Wohl«, sagte Ziringo, und Axel konstatierte mit Vergnügen, dass er jetzt ein bedeutend gläubigeres Gesicht machte. »Und wer bist du?«, wandte er sich an den Grafen.
»Mein Name ist Paul Mankoff, ich bin der Diener dieses Herrn.«
»Wohl, dann lügst auch du, und daraus sehe ich, wie wenig man eurem Versprechen, nichts zu verraten, trauen könnte. Das da ist der deutsche Fürst Alexander von ***, und du bist der russische Graf Soltykow.«
Ganz ruhig hatte es der Zigeunerhauptmann gesagt.
Wie unseren beiden Freunden dabei zumute war, lässt sich denken.
»Woher willst du...«
»Schweigt! Ich habe euch in Genua gesehen, ihr wart die Hauptpersonen bei den Verhandlungen im Dogenpalast.«
O weh! Dann war alles Weitere vergeblich. Das freilich hatte man nicht ahnen können.
Der Graf hätte allerdings Grund gehabt, seinem Freunde zu zürnen, dass er nicht gleich die Wahrheit bekannt hatte, und daran dachte wohl auch gleich Axel, suchte die Sache noch gutzumachen.
»Ziringo, du bist doch ein Mann, der mit sich sprechen lässt. Kannst du uns verdenken, dass wir inkognito reisen und unser Inkognito zu wahren suchen...«
»Nein, das kann ich euch durchaus nicht verdenken«, wurde Axel von dem Zigeuner unterbrochen, immer ganz gemütlich. »Das hat auch für mich wenig zu sagen. Selbst wenn ihr gleich eure richtigen Namen genannt hättet, und wenn ich euch sonst auch noch so traute — kein Mensch darf diesen Hohlweg eher passieren, als bis sich der Podesta von Florenz in meiner Gewalt befindet. Basta!«
So war dennoch wieder einige Hoffnung vorhanden.
»Schweig! Ziringo hat gesprochen.«
»Ich bitte dich, mir noch einige Fragen zu erlauben.«
»Meinetwegen frage, aber Ziringos Willen änderst du nicht.«
»In zwei Stunden ist der Hinterhalt, den du anlegst, vollendet?«
»Ja, aber das hat schließlich mit eurer Gefangennahme gar nichts zu tun. Das sagte ich vorhin nur so, weil ich euch keine nähere Erklärung schuldig bin. Aber ihr sollt sie hören. Bevor sich der Podesta Riccardo nicht in meiner Gewalt befindet, darf kein anderer Mensch vor ihm den Monte Amiata überschreiten.«
»Ja, aber warum denn nicht?«
»Weil es so bestimmt ist. Es steht in den Sternen geschrieben.«
O weh! Wenn Aberglaube dabei im Spiele war, so stand es für die beiden am allerschlimmsten.
»Was steht in den Sternen geschrieben?«, wollte Axel doch noch ausforschen.
»Höre mich an. Wir haben ja Zeit. Glaubst du, der gelbe Ziringo hätte sich nicht an dem rächen können, der an seinem ganzen Unglück schuld ist, und den er daher über alles hasst? Wenn du so glaubst, dann kennst du den gelben Ziringo eben nicht. Der stolze Podesta wäre in seinem Palaste zu Florenz vor einer indischen Brillenschlange sicherer gewesen als vor meinem Dolche. Wenn das Schicksal es gewollt hätte! Aber in den Sternen stand es eben anders geschrieben. Zwar konnte ich schon damals in den Sternen lesen, aber ich glaubte ihnen noch nicht so. Ich musste erst überzeugt werden. Damals sagten mir die Sterne, die ich durch das Fensterchen meines Kerkers befragte, dass ich dem Strange entgehen würde, dass ich mich an dem Alkalden auch noch furchtbar rächen sollte, aber nicht eher als vierzehn Jahre später, und zwar hier auf dem Monte Amiata würde ich über meinen Todfeind zu Gericht sitzen.
Also ich glaubte den Sternen nicht, wollte eigenmächtig handeln. Ich entsprang, wurde zum Räuber. Doch das war für mich nur Nebensache. Ach, was habe ich nicht alles versucht, dem falschen Verräter meinen Dolch ins Herz zu stoßen, wie oft bin ich nicht durch die Straßen von Florenz geschlichen, bis in des Podestas Palast hinein. Stets wurde meine Absicht durch irgendeinen seltsamen Zufall vereitelt, und das Allermerkwürdigste dabei war, dass ich selbst nie gefasst wurde.
Alle meine Bemühungen waren immer nicht anders, als wenn man einen Becher Wasser ins Meer gießt. Kaum, dass einige kleine Kreise entstehen, sich sofort im Unermesslichen verlierend. Irgend jemand machte eine Bewegung, oder es geschah sonst eine Kleinigkeit — und unversehrt entschlüpfte der Gehasste meinem Dolche, um mich selbst kümmerte sich niemand.
Da erkannte ich, dass man den Sternen nicht trotzen kann. Ich musste die vierzehn Jahre warten. Nach drei Jahren gab ich also mein Räuberhandwerk auf. Der Alkalde kam ja doch nicht hier durch.
Wo ich die letzten elf Jahre mich aufgehalten, was ich da getrieben habe, geht dich nichts an. Die Sterne habe ich beobachtet, habe gewartet und... noch etwas anderes, was du nicht zu wissen brauchst.
Und da endlich las ich in den Sternen die Gewissheit. Wenn in diesem Jahre der Drache die Wasserhexe küsst, dann wird der Podesta ganz von selbst in meine Hände fallen. Kennst du den Drachen und die Wasserhexe?«
»Du meinst wohl Sternbilder?«
»Ja.«
»Ich habe nicht die Ehre, diesen Drachen und seine Wasserhexe zu kennen.«
»Morgen ist der Tag, an dem der Drache die Wasserhexe küssen wird.«
»Da wünsche ich guten Appetit«, war Axel nicht aus seinem Humor zu bringen. »Und so lange darf hier auch kein anderer Mensch passieren?«
»Kein einziger.«
»Das steht ebenfalls in den Sternen geschrieben?«
»Ja.«
»Dass du jeden Reisenden abfangen und festhalten musst?«
»Du sagst es.«
»Das alles kannst du in den Sternen lesen?«
»Alles und noch viel mehr.«
»Das sind ja merkwürdige Sterne!«
»Sie lügen nie.«
»Wenn du nur einen einzigen Reisenden, der diesen Pass benutzt, durchkommen lässt, dann wird auch der Podesta hier nicht passieren!«
»Doch, sein Schicksalsweg wird dadurch nicht geändert, aber dann entkommt er mir, das ist die Sache.«
»Hm, jetzt wird es auch etwas logischer. Wie viele Reisende hast du schon weggefangen?«
»Ihr beiden seid die ersten.«
»Seit wann liegst du hier schon im Hinterhalt?«
»Erst gestern Abend sind wir hier eingetroffen.«
»Also bis morgen Mitternacht willst du uns hier festhalten?«
»Keine Minute länger, dann sollt ihr wieder freie Männer sein.«
»Und wenn der Alkalde morgen nun nicht hier vorbeikommt?«
»Er kommt.«
»Weißt du, dass dies seine Absicht ist?«
»Nein, davon weiß ich nichts.«
»Dass er überhaupt eine Reise antritt?«
»Noch nicht einmal das weiß ich.«
Gegen eine solche Vertrauensseligkeit war einfach nichts zu machen.
»Nun lass noch einmal mit dir sprechen, Ziringo«, wollte es Axel doch noch einmal probieren. »Wir sind zwei...«
»Gib dir keine Mühe«, wurde er sofort unterbrochen.
»Auch wir haben eine Rache auszuüben...«
»Das geht mich nichts an.«
»Es ist eine heilige Rache...«
»Für mich gibt's nichts Heiliges mehr.«
»Ist nicht auch deine Rache dir heilig?«
»Nein, sie ist meine Pflicht.«
»Wohl, auch wir haben eine heilige Pflicht zu erfüllen...«
»Das geht mich nichts an, ich bin kein Christ, bin nie einer gewesen, und auch ihr haltet es ja trotz aller schönen Redensarten mit dem einzig richtigen Satze, dass jeder selbst sein Nächster ist.«
»Mann«, versuchte es Axel immer noch einmal, »diesem meinem Freunde hier ist das einzige Kind geraubt worden, er hat...«
»Und wenn er sich mir zu Füßen würfe und auch bei jeder anderen Gelegenheit mein Herz zu rühren verstände... nein, diesmal nicht, bis morgen Mitternacht seid ihr meine Gefangenen!!«
Der Zigeuner hatte dies in einer Weise gesagt, dass auch der Graf, der sich wohl noch viel eher an jeden Strohhalm der Hoffnung geklammert hätte, sofort einsah, dass hier alles vergebens war.
Dieser alte Zigeuner hatte trotz aller sonstigen Geschwätzigkeit etwas Eisernes an sich. Nein, hier brauchte man nicht mehr zu bitten oder sonstige Versuche zu machen.
Außerdem wurde die Unterhaltung abgebrochen.
Ein leiser Pfiff ertönte, welcher die vierzehn hier versammelten Männer auseinanderstieben ließ. Der Alte rief noch einige leise Worte in seiner Sprache, worauf er mit sieben der Räuber in einer der Felsspalten verschwand. Zwei von den sechs Zurückgebliebenen machten sich nach wie vor mit dem Feuer und den darüber schmorenden Pferdesteaks zu schaffen, die anderen vier wandten sich den Gefangenen zu.
»Bei dem geringsten Versuch, euch zu wehren, seid ihr des Todes!«
»Wir denken nicht daran.«
»Ihr sollt fessellos sein, aber sobald ihr den leisesten Verdacht erregt, dass ihr fliehen wollt, werdet ihr niedergestreckt!«
»Wir denken an keine Flucht.«
»Folgt mir!«
Sie mussten dem Stellvertreter des Hauptmannes in ein anderes Felsenloch nachkriechen, es war ein kurzer Tunnel, der bald in einem zweiten Kessel endete, der aber viel enger war als jener erste und von ganz steilen Felswänden umschlossen wurde. Auch führte von hier kein zweiter Tunnel ab, wohl aber war eine geräumige Höhle vorhanden.
Noch ein anderer Räuber war ihnen gefolgt, er löste ihnen die Fesseln.
»Ihr bleibt hier allein«, instruierte unterdessen der erste, »könnt euch frei bewegen, soweit es der Raum erlaubt, dort in der Höhle findet ihr Decken, Essen und Trinken wird euch gebracht werden. Kurz, ihr werdet aufs beste behandelt. Nur jenen Tunnel dürft ihr nicht betreten. Wer sich darin zeigt, hat sofort eine Kugel im Kopfe. Verstanden?«
»Wir haben verstanden.«
»So richtet euch danach.«
Beide verließen den Kessel wieder.
»Solch ein gelber Halunke«, machte Axel zunächst seinem Unmut Luft, freilich in besonderer Weise. »Was hat sich ein Zigeuner überhaupt mit Astronomie zu befassen? Ein Zigeuner hat nur aus der Hand zu wahrsagen, die Sterne gehen ihn gar nichts an! Aber ich sage es ja immer: die sogenannte Bildung ist nur ein Unglück für die Menschheit — ganz besonders auch die Pfaffen.«
Auch der Graf nahm diesen unfreiwilligen Aufenthalt viel weniger tragisch, als man hätte erwarten sollen.
Zunächst legte er sich ebenfalls in das weiche Gras, welches hier den Boden bedeckte, so, wie es Axel schon getan hatte.
»Sie meinen, vor morgen früh kann die Feluke nicht in Fiumicino sein?«
»Wenn der Wind so bleibt, sicher nicht.«
»Dann haben wir ja noch genügend Zeit.«
»Das denke ich auch. Obgleich hier die Aussichten einmal schlechter sind als die Einsichten. Haben Sie schon einen Plan, wie man hier auf anständige Weise wieder fortkommt, noch vor morgen Mitternacht?«
»Haben Sie schon einen?«
»Ich denke natürlich an eine Durchschleichen oder Durchhauen — List oder Gewalt — nur auf das Wie kommt es an. Die größte Hoffnung setze ich aber zunächst auf Sie.«
»Auf mich?«
»Sprechen Sie! Sie haben doch schon etwas auf dem Rohre.«
»Ich muss diesen Zigeunerkapitän erst noch einmal richtig vornehmen.«
»Um?«
»Um ihm etwas vorzumachen.«
»So Zauberkunststückchen, was? Ihn ins Bockshorn jagen. Ihn mit seinem eigenen Aberglauben schlagen.«
»So denke ich es mir.«
»Und dasselbe habe ich von Ihnen gedacht, eben deshalb meine Hoffnung auf Sie gesetzt, obgleich das eine Art Flucht ist, die nicht nach meinem Geschmack ist, weshalb ich vorhin von einer anständigen Weise sprach, wie wir von hier wieder fortkommen könnten. Doch das ist mir schließlich egal, da will ich gern einmal ein unanständiger Mensch werden. Was für Kunststückchen wollen Sie dem Kapitän vormachen?«
»Das muss die Gelegenheit bringen.«
»Also warten wir. Die Banditen scheinen jetzt gerade etwas vorzuhaben. Wenn wieder Reisende abgefangen werden, bekommen wir die hoffentlich nicht mit hier zur Gesellschaft.«
»Ja, es ist besser, wenn wir beide hier allein bleiben«, bestätigte der Graf.
Eine Viertelstunde verging. Axel untersuchte den Kessel und die Höhle. Einige Decken, nichts weiter. Dann entdeckte er noch, nachdem er sich an das in dieser ziemlich tiefen Höhle herrschende Dämmerlicht gewöhnt hatte, im Hintergrunde derselben ungefähr in Kopfhöhe eine Öffnung, welche weiterging, er konnte den ganzen Arm hineinstecken, aber da er das nicht einmal mit dem Kopfe zu tun vermochte, so kam dieses Loch nicht als Fluchtweg in Betracht.
In den Ausgangstunnel hineinzukriechen, davor hütete sich Axel natürlich. Da der Tunnel einen Bogen machte, konnte man auch nicht in jenen ersten Kessel blicken, und wenn es gelänge, diesen zu erreichen, so wusste man immer noch nicht, welchen der vielen von dort aus abzweigenden Tunnel man zu benutzen habe, sie waren ja mindestens fünf Minuten lang mit verbundenen Augen geführt worden, und zwar schnellen Schrittes, hatten dabei viele Windungen gemacht.
Nach alledem hatte man wenig Hoffnung, sich aus dieser Klemme mit List oder Gewalt zu befreien.
Die Viertelstunde war vergangen, ohne dass man einen Laut vernommen hätte. Ein neuer Überfall hatte wohl schwerlich stattgefunden, irgend etwas hätte man doch davon hören müssen. Allerdings lagen zwischen ihnen und dem Passweg gar dicke Felsmauern.
Dann kamen zwei Zigeuner aus dem Tunnel herausgekrochen, brachten auf einer Holzschüssel große gebratene Fleischstücke, einen Wasserkrug mit Holzbecher und eine Zweiliterflasche Rotwein.
»Hier sind auch eure Messer wieder. Und wenn ihr sonst etwas wünscht, so braucht ihr nur in den Tunnel hineinzurufen, wir hören es. Nur lasst euch nicht einfallen, ihn auch nur mit einem Schritte zu betreten. Es wird sofort geschossen, und wir verstehen zu wachen. Außerdem werdet ihr auch von oben beobachtet. Lasst es euch schmecken.«
Die beiden wollten sich wieder entfernen.
»Halt! Wir möchten den Kapitän sprechen«, sagte der Graf.
»Wozu?«
»Ich habe ihm eine äußerst wichtige Mitteilung zu machen.«
»Kannst du es mir nicht sagen?«
»Nein, nur dem Kapitän.«
»Er befindet sich auf einem Wachtposten, wo man ihn nicht stören darf, aber ich werde es ihm sagen.«
Die beiden Zigeuner verschwanden in dem Tunnel.
»Also Pferdesteak«, sagte Axel, sich vor dem dampfenden Fleischberg mit gekreuzten Beinen niederlassend und sein Messer schwingend. »Sie verschmähen doch nicht etwa Pferdefleisch?«
»Ich wüsste nicht, weshalb man, wenn man nun einmal Fleisch isst, das des vielleicht reinlichsten aller Tiere verschmähen sollte«, meinte der Graf, sich gleichfalls niederlassend.
»Na, solche Vorurteilslosigkeit findet man selten, ich hätte sie fast auch von Ihnen nicht erwartet. Ich freilich habe schon öfters meinen Gaul verzehrt, oder doch ein gutes Stück davon. Schade nur, dass man ihn dazu erst immer töten muss! Wenn man nur ein Pferd züchten könnte, aus dem man sich ab und zu ein Stück herausschneiden kann, was dann wieder nachwächst. Ihr Gaul ist übrigens ein sehr zartes Vieh gewesen.«
Eben so vortrefflich wurde der Wein gefunden, den nur der Graf mit Wasser mischte, wie im Süden überhaupt üblich. Der ehemalige Depeschenreiter bewies auch als ehrwürdiger Landesvater, dass ihm wohl jede Portion vorgesetzt werden konnte, die er nicht vertilgt hätte.
Einiger Zeit hatte das allerdings bedurft, und in dieser war der Hauptmann noch nicht gekommen, kein anderer der Räuber.
»Haben Sie Ihren Plan gemacht, wie Sie ihn empfangen werden?«
»Ja.«
»Faszinieren?«
»Ja, erst einmal, wenn es mir gelingt, ihn zum Trinken zu bewegen. Oder vermöchten Sie das durch den Blick Ihrer Augen?«
»Bei dem hätte das wohl seine Schwierigkeiten. Und wenn es auch mir nicht gelingt?«
»O, dann werde ich ihm schon etwas anderes vormachen.«
»Wir sollen auch von oben beobachtet werden.«
Beide hatten schon oft über sich gespäht, aber keine Spur von einem Menschen bemerken können, es war auch schwer zu erklären, wo sich hier jemand verbergen sollte. Die mindestens 100 Meter hohen Felswände waren glatt wie gemauert. Höchstens ganz oben konnte jemand liegen.
»Es schadete auch nichts, wenn wir beobachtet würden«, meinte der Graf. »Wenn der Kapitän nur käme.«
»Ich werde einmal nachfragen.«
Axel stand auf und rief in den Tunnel ein lautes ›halloh‹ hinein.
»Was gibt es?«, erklang es zurück.
»Wo ist der Capitano? Können wir ihn nicht sprechen?«
»Es ist ihm gesagt worden, aber er kann jetzt nicht kommen.«
»Wann sonst?«
»Später vielleicht.«
»Es ist eine höchst wichtige Mitteilung, die ich ihm zu machen habe«, rief jetzt der Graf in den Tunnel.
»Das ist dem Capitano auch gesagt worden. Habt ihr sonst einen Wunsch?«
»Das nicht, aber...«
»Dann seid still! Wenn der Capitano kommen kann, wird er kommen. Basta!«
Die beiden mussten sich wohl oder übel fügen.
Es begann zu dunkeln, hier in diesem Kessel besonders bald, und der Hauptmann kam nicht. Wurde deswegen in den Tunnel hineingerufen, so erklang nur dasselbe wie vorhin heraus.
»Habt ihr Hunger? Habt ihr noch Wasser und Wein? Braucht ihr sonst etwas? Nein? Dann legt euch schlafen. Der Capitano will nicht kommen.«
»Er will überhaupt nicht?«
»Er kann nicht, sagt er. Vielleicht morgen. Jetzt dürfen wir ihn nicht mehr stören.«
So war diese Hoffnung erschöpft. Jetzt musste man auf andere Weise versuchen, aus dieser Gefangenschaft zu entfliehen.
Aber wie? Wir wollen nicht wiedergeben, was für Pläne die beiden entwarfen. Denn ein jeder war bei reiflicher Überlegung einfach unausführbar.
Es gab nichts anderes, als durch jenen Tunnel hindurch, und das war nicht möglich. Man konnte wohl einen, zwei, drei und vielleicht noch mehr Räuber hier hereinlocken, sie überwältigen, aber sicher doch nicht alle.
»Es geht, wir werden schon noch herauskommen«, ermunterte Axel, »aber da müssen wir erst die Gelegenheit besser ausspionieren — und bis dahin freilich kann es morgen Mitternacht geworden sein, wo man uns sowieso entlassen will.«
Der Graf sagte nichts, schweigend blieb er im Freien, während sich sein Gefährte mit stoischem Gleichmute in der Höhle zum Schlafen niederlegte.
Ein neuer Tag brach an, und die Situation war noch dieselbe, wollte sich auch nicht ändern.
Zwei Banditen brachten das Frühstück, wieder aus gebratenem Pferdefleisch bestehend, wozu noch Polenta und Käse kam.
»Der Capitano kann nicht kommen, er verlässt seine Wache nicht«, sagte der eine und erhielt gar keine Antwort.
»Könnt ihr das Wichtige nicht einem anderen von uns mitteilen? Könnt ihr nicht schreiben?«
»Nein, jetzt ist es nicht mehr nötig«, wurde der Graf trotzig.
»Wie ihr wollt. Der gelbe Ziringo ist über jede Neugier erhaben, der brennt nicht etwa darauf.«
Die Banditen entfernten sich, nur noch eine neue Warnung gebend.
»Jetzt ist es sowieso zu spät«, meinte der Graf dann phlegmatisch.
»Ja, nun freilich wird sie schon in Fiumicino eingetroffen sein.«
»Und der Entführer meines Kindes soll mir doch nicht entgehen.«
»Na, wenn Sie so denken, dann ist es gut. Ich habe schon immer so gedacht«, entgegnete Axel.
Der ganze Tag verging, ein neuer Abend brach an, und nichts hatte sich geändert.
»Das ist das letzte Stück von eurem Pferde«, sagte der Bandit, als er den Gefangenen das Abendessen brachte.
»Ist denn der Podesta noch immer nicht gekommen?«
»Nein, aber er wird noch diese Nacht kommen, der Capitano weiß es.«
»Wohl dem, der solche Glaubensseligkeit besitzt.«
Wieder verstrich eine Stunde. Schon herrschte vollständige Dunkelheit. Es hatte heftig zu regnen begonnen, was auch den Grafen in die Höhle trieb.
Eine Beratung wegen einer Flucht fand zwischen den beiden nicht mehr statt, sie mussten eben warten, bis man ihnen die Freiheit gab.
»Guten Abend, die Herren«, erklang da dicht neben oder über ihnen eine volle Stimme!
Die beiden, die sich hingelegt hatten, fuhren empor.
»Wer hat da gesprochen?!«
»Ja, nun raten Sie einmal.«
O, wer diese Stimme einmal gehört hatte, der vergaß sie nicht so bald wieder.
»Joseph — der Marquis Pellegrini!«
»Ich bin es. Mich hatten die Herren wohl nicht hier erwartet?«
Ja, da waren auch diese beiden ganz aus Stein und Eisen zusammengesetzten Männer einmal ganz verblüfft! Sie hätten sich gern eingeredet, dass sie nur träumten.
Woher die Stimme kam, darüber waren sie sich allerdings nicht im Unklaren. Aus der Wandöffnung im Hintergrunde der Höhle.
Zuerst hatte sich Axel wieder gefasst.
»Sie sind es wirklich, Marquis?«
»Ich bin es. Muss ich Ihnen erst einige Beweise geben?«
»Es ist nicht nötig — ich erkenne Sie an der Stimme.«
»Sie sind wohl sehr überrascht, mir hier wieder zu begegnen?«
»Wie kommen Sie hierher?«
»Von Fiumicino. Ich hatte mit dem gelben Ziringo ein Geschäft abzuwickeln.«
»Also ein Bundesgenosse von Banditen sind Sie! Ja, das sieht Ihnen ähnlich.«
»Nicht so ganz, wie Sie denken. Der alte Ziringo, ein ganz tüchtiger Hexenmeister, der Ihnen Sachen vormachen kann, dass Sie Maul und Nase aufsperren würden, war während der zehn Jahre mein Lehrer. Mag Ihnen diese Erklärung genügen.«
Ja, das war allerdings eine Erklärung!
»Nun hatte ich mit meinem Lehrmeister nur noch eine kleine Auseinandersetzung, um mich von ihm für immer zu trennen, und da ich wusste, dass er sich im Monte Amiata aushielt, eilte ich sofort hierher. Es sind ja nur wenige Stunden.«
»Wo ist meine Tochter?«, fragte der Graf mit gepresster Stimme.
»Ja, Herr Graf von Saint-Germain, mit Ihnen habe ich hauptsächlich zu sprechen. Pepita ist freiwillig mit mir gegangen. Am Vormittage nach jener Nacht traf ich in dem Hotel mit dem jungen Mädchen zusammen, dessen blendende Schönheit — das gestehe ich ja ganz offen — mich gleich beim ersten Blick entflammt hatte. Aber dass es Ihre Tochter sei, davon hatte ich ja gar keine Ahnung, so wenig wie überhaupt, dass Sie verheiratet seien und schon damals in dem Keller des Spukklosters zu Rom Weib und Kind bei sich hatten. Weshalb Sie mir dies und aller Welt verschwiegen, dafür bedarf ich keiner Erklärung, das ist ja selbstverständlich genug...«
»Pepita sagte Ihnen, dass sie meine Tochter sei?«
»Natürlich erfuhr ich es nun schnell genug von ihr.«
»Dass sie die Tochter des Grafen von Saint-Germain sei?«
»Nein, sondern die Tochter des russischen Grafen Soltykow, der früher ein Skribent und dann der Sekretär des Grafen von Saint-Germain gewesen sei. Zuerst konnte ich mir diese Widersprüche gar nicht erklären. Aber das dauerte bei mir nicht lange, dann durchschaute ich alles. O, Herr Graf, Sie haben ja da ein raffiniertes Spiel getrieben!«
In der eintretenden Pause hörte man in der Finsternis nur die schweren, keuchenden Atemzuge des Grafen.
»Es war mir schließlich gleichgültig«, fuhr dann die Stimme aus der Felsöffnung fort. »Pepita gestand mir, dass sie in mich entflammt sei, nicht ohne mich leben könne. Was sollten wir tun? Etwa vor Sie hintreten und um Ihren Segen bitten? Lächerlich. Eine Flucht musste unter allen Umständen stattfinden. Mit meinem Wissen schrieb sie den Brief, und Sie müssen gestehen, dass im Grunde genommen alles ganz der Wahrheit entsprach. Höchstens, dass Pepita nicht schon längst diesen Mann liebte. Aber was hat bei der Liebe die Zeit zu bedeuten? Die Liebe entsteht in einem Augenblicke, und dann kann man annehmen, dass sie schon seit aller Ewigkeit bestanden hat.«
Ja, in diesem Sinne sprach der unsichtbare Mann eine große Wahrheit aus.
»Alles übrige können Sie sich wohl selbst erklären. Ich verließ das Hotel schon gegen Mittag, eine Reise nach Mailand vorgebend, kehrte in der Nacht zurück, holte Pepita ohne jede Schwierigkeit aus dem Hotel ab. Neu wird Ihnen nur sein, dass wir ein Schiff benutzten, welches in Genua segelfertig lag. Heute Nacht sind wir in Fiumicino eingetroffen.«
Der Marquis bekam nicht zu erfahren, wie der Graf die beiden in hellsehendem Zustande auf der Feluke erblickt hatte. Das war ja auch ganz Nebensache.
»Haben Sie ihr gesagt, dass ich der Graf von Saint-Germain bin?«
»Nein, vorläufig noch nicht, und also auch nicht, dass sie gar nicht Ihre Tochter ist.«
»Was?!«
»Herr Graf, machen Sie mir doch nichts vor. Mir ist doch alles ganz klar, wenn ich auch noch nicht die Einzelheiten weiß. Jener Skribent Antonio Roscalli hatte ein verkrüppeltes, blindes, taubstummes Kind. Der Graf von Saint-Germain nahm es in seine Behandlung, machte ein schönes, blühendes Kind daraus. Das soll also die jetzige Pepita gewesen und geworden sein. Na, Graf, wollen Sie diese Behauptung etwa auch mir gegenüber aufrecht erhalten?«
»Beweisen Sie mir das Gegenteil...«
»Sofort werde ich das. Zunächst fange ich damit an, zu beweisen, dass der Graf von Saint-Germain und jener Skribent Antonio ein und dieselbe Person gewesen sind... was haben Sie?«
Das Ächzen aus des Grafen Munde hatte wie ein Schmerzenslaut aus verwundeter Brust geklungen.
»Teufel!«
»Ich soll ein Teufel sein? Inwiefern denn? Weil ich die Wahrheit erkannt habe?«
»Fahren Sie fort!«
»Das habe ich wohl gar nicht mehr nötig. Gestehen Sie, dass Pepita gar nicht Ihr Kind ist?«
Was blieb dem Grafen denn anders übrig, als es zu gestehen?
»Wessen Kind ist Pepita sonst?«
»Das werden Sie niemals erfahren!«
»Nun, das brauche ich schließlich auch gar nicht zu wissen. Wenn Sie uns nur Ihren väterlichen Segen zu unserer ehelichen Verbindung geben.«
»Meinen Segen, hahaha!!!«, hohnlachte der Graf.
»Na, Sie werden wohl zugeben, dass es dann auch ohne Ihren Segen gehen wird«, klang es gleichmütig zurück.
Ach, dieser Mann hatte ja nur zu furchtbar recht!
»Es ist mir ja auch weniger um Ihren Segen zu tun«, fuhr er fort, »als vielmehr darum, dass Sie mir fernerhin keine Schwierigkeiten in den Weg legen.«
»Schwierigkeiten?«
»Sie wissen im Augenblick wohl gar nicht, wie Sie das tun könnten? Muss ich Sie darauf erst aufmerksam machen? Sie könnten zum Beispiel wieder als Graf von Saint-Germain auftreten, und dann ginge mein ganzes Märchen in die Brüche, wie Sie in der Cheopspyramide gefangenen gehalten werden...«
»Nie, nie — schwindeln Sie, was Sie wollen!«
»Doch, Sie könnten es tun. Bis jetzt haben Sie sich also noch nicht als der ehemalige Graf von Saint-Germain zu erkennen gegeben.«
»Nein, ich werde es auch niemals tun.«
»Dieser deutsche Fürst ist der einzige, der darum weiß?«
»Der einzige, er wird es bleiben und niemals etwas verraten.«
»Das ist mir eine große Beruhigung. Das heißt, dass er der einzige ist, der darum weiß. Denn jetzt gestehe ich es offen: Ich hatte deswegen doch eine große, große Sorge. Sie ist von mir genommen. Aber ich möchte mich noch mehr für die Zukunft sichern. Graf, ich will Ihnen einen Vorschlag machen.«
»Was für einen Vorschlag?«
»Wir wollen uns verbünden.«
»Wie verbünden?«
»Zusammen als Adepten arbeiten und...«
»Nimmermehr!«
»Hören Sie mich nur ruhig an. Die Finsternis ist gerade gut zu dieser Unterhaltung. Einmal wird es ja doch offenbar werden, dass der Graf von Saint-Germain noch unter den Lebenden als freier Mann wandelt... bitte, unterbrechen Sie mich nicht.
Ich habe auf alle Fälle mit dieser Möglichkeit zu rechnen, und solange mir diese Gefahr droht, könnte ich keine Ruhe finden. Ich war felsenfest überzeugt, dass Sie gleich nach der Abfahrt des schwarzen Schiffes Ihren Tod gefunden hätten. Woher, von wem, das gehört hier nicht mit zur Sache. Genug — ich durfte das Märchen von Ihrer Gefangenhaltung in der ägyptischen Pyramide erfinden. Ja, mein Schreck war furchtbar, als ich dann in dem russischen Gesandten meinen alten Lehrmeister wiedererkannte. Freilich bin ich nicht der Mann, der sich lange von solch einem Schreck beherrschen lässt. Mein Plan war sofort gefasst. Ich musste mich mit Ihnen verständigen, und dazu war wieder nötig, dass ich Sie irgendwie von mir abhängig machte. Denn auf gewöhnlichem Wege, im Guten, war solch eine Verständigung wohl ganz ausgeschlossen. Sie hatten zwei Damen bei sich — doch sicher zwei Geliebte — wenigstens eine davon war eine solche. Ja, jetzt gestehe ich, dass ich absichtlich die Bekanntschaft der einen suchte. Das war in dem Hotel sehr einfach. Es war die jüngere Dame, deren Schönheit es mir allerdings auch gleich angetan hatte. Die musste ich erst einmal über Sie ausholen, und das ward mir ja auch leicht genug. Da erfuhr ich denn auch, dass es Ihre Tochter sei, wenigstens hielt sie sich dafür. Über diese Verhältnisse brauche ich nicht mehr zu sprechen.
Ich hatte nicht viel nötig, Pepita zu überreden, mit mir zu entfliehen. Sie ging ganz freiwillig mit mir. Eine Flucht musste es natürlich sein. Auch hierüber habe ich ja schon gesprochen. Sie sollen Ihre vorgebliche Tochter sehen und fragen, ob sie nicht wirklich aus ehrlicher Liebe zu mir mit mir gegangen ist...«
»Sie haben ihr einen Liebestrank beigebracht«, unterbrach der Graf einmal.
»Einen Liebestrank? A bah, so etwas gibt es ja gar nicht«, sagte der Marquis genau so, wie es schon Axel mehrmals gesagt hatte. »Es brauchte nur der richtige Mann zu kommen, so war das junge Mädchen sofort in ihn entflammt, und dieser richtige Mann war eben ich. Allerdings wollte ich der auch sein.
Doch wir wollen hier nicht über die Rätsel der Liebe debattieren. Denn diese Liebe wird ewig ein ungelöstes Rätsel bleiben. Genug, ich hatte meinen Zweck erreicht. Ich habe Pepita nach Rom gebracht, sie befindet sich an einem Ort, wo Sie sie niemals finden werden.
Dann wollte ich nach Genua zurückkehren, mich mit Ihnen auseinandersetzen. Auf dem Wege wollte ich also auch gleich einmal mit meinem Lehrmeister sprechen, mit dem gelben Ziringo.
Da erfahre ich hier, dass dem schon die beiden in die Hände gefallen sind, mit denen ich mich auseinandersetzen will.
Na, besser hat es für mich ja gar nicht kommen können und nun ändert sich die Sache allerdings auch sehr. Jetzt kann ich doch ganz anders auftreten. Also, mein Herr Graf, mein ehemaliger Lehrherr, nun mache ich Ihnen folgenden Vorschlag:
Ich werde der Welt verkünden, dass Sie von den ägyptischen Magiern aus Ihrer Haft entlassen worden sind, deren Entschluss hat sich geändert, Sie sollen keine vielhundertjährige Belehrung empfangen, sondern Sie sind mir beigesellt worden, wir beide zusammen sollen die Menschheit mit magischen Geheimnissen beglücken...«
»Genug, genug!«, rief der Graf. »Niemals, niemals!!«
»Sie wollen nicht darauf eingehen?«
»Niemals, niemals!!«, konnte der Graf nur wiederholen.
»Es bleibt Ihnen ja gar nichts anderes übrig, als bedingungslos darauf einzugehen.«
»Was?!«, stimmte jetzt auch Axel in des Grafen Entrüstungsruf ein.
»Nein, es bleibt Ihnen nichts anderes übrig. Oder aber... ich lasse Sie von der Bildfläche verschwinden.«
»Was?!«
»Jawohl. Ich mag nicht immer die Gefahr vor Augen haben, dass Sie doch noch einmal gegen mich als Zeuge auftreten können, mich der Unwahrheit überführen. Und dasselbe gilt von Ihnen, Euer Durchlaucht.«
»Gilt auch von mir?!«, wiederholte Axel.
»Sicher. Sie sind ja in alles eingeweiht. Auch Sie sind mir viel zu gefährlich.«
»Ja, was beabsichtigen Sie eigentlich?«
»Das ist einfach genug. Sie, Durchlaucht, haben mir Ihr fürstliches Ehrenwort zu geben, dass Sie jetzt und immerdar darüber zu schweigen haben, was Sie jetzt und jemals über mein Verhältnis zu diesem sogenannten Grafen von Saint-Germain erfahren haben...«
»Niemals!«
»Sie wollen mir nicht Ihr Ehrenwort geben?«
»Niemals! Es ist ja auch gar nicht nötig. Ich habe Ihnen ja schon versichert, und Sie wissen es ja selbst, dass ich diesen meinen Freund niemals bloßstellen werde.«
»Das ist ja richtig genug. Jetzt aber ändert sich die Sache doch ganz. Der Graf wird sich mit mir als Adept verbinden, wir werden zusammen der Welt etwas vorgaukeln...«
»Niemals!!«, rief jetzt der Graf, und ebenfalls nicht zum ersten Male.
»Es bleibt Ihnen ja gar nichts anderes übrig, mein lieber Graf.«
»Oho! Zwingen Sie mich einmal dazu.«
»So direkt zwingen kann ich Sie allerdings nicht. Tun Sie es aber nicht, dann bleiben Sie ganz einfach hier Zeit ihres Lebens gefangen — wenn ich nicht vorziehe, Sie hier verhungern zu lassen — oder Ihnen noch schneller den Garaus zu machen — etwa mit einer mildtätigen Kugel... und dasselbe gilt von Ihrem Gefährten.«
Es war ausgesprochen. Die beiden hatten es vernommen. Und die nachfolgende Pause verriet, was sie dazu dachten. Es musste ja furchtbar auf sie wirken.
»Wir haben das Versprechen dieses Räuberhauptmannes«, begann zuerst Axel wieder, »dass wir heute Mitternacht wieder freie Männer sind, und wenn es auch ein Räuber ist...«
»Stimmt, er würde sein Wort halten — aber die Sache ist die, das der gelbe Ziringo nicht mehr in Betracht kommt, nichts mehr zu sagen hat.«
»Weshalb nicht?!«, riefen die beiden in unheilvoller Ahnung.
»Ziringo hat wahr in den Sternen gelesen — der Fall ist wirklich eingetreten, was ich selbst kaum erwartet hätte: Vor einer Stunde ist der Alkalde von Toskana durch diesen Pass gekommen, mit einem kleinen Gefolge, alle sind richtig in die Falle gegangen, es fiel nur ein einziger Schuss — dieser aber traf den Hauptmann... der gelbe Ziringo konnte noch seine Rache befriedigen, dann ist er in meinen Armen gestorben.«
Auch das machte auf die beiden einen furchtbaren Eindruck. Immer deutlicher ahnten sie, wie es nun mit ihnen stand.
»Was wird nun aus der ganzen Bande?«
»Die zerstreut sich wieder, das sind gar keine eigentlichen Räuber — bleibt sie aber zusammen, um das Räuberhandwerk weiter zu betreiben, so doch nicht hier in diesem Gebirge. Nur einige, die ich schon von früher her kenne und die mir treu ergeben sind, werden hier bleiben, um meine Gefangenen zu bewachen, solange ich es für gut befinde. Ihre Lage ist eine hoffnungslose. Sie befinden sich in meiner Gewalt. Also entweder geben Sie beide mir daraufhin, was ich von Ihnen fordere, Ihr Ehrenwort — denn diesem traue ich bei Ihnen vollkommen, obgleich ich mich deswegen auch noch zu sichern wissen werde — oder Sie sind für immer aus der Welt verschwunden — so oder so — tot oder lebendig.«
Wieder eine Pause.
Mit einem Male erscholl in der finsteren Höhle ein seltsames Geräusch.
Es war nicht anders gewesen, als wenn zwei Menschen mitten im Sprunge heftig zusammengeprallt wären.
Und etwas anderes war es auch nicht gewesen. Axel und der Graf waren beide gleichzeitig nach der Wand gesprungen, dorthin, wo sie beide das Loch wussten, hinter dem der Sprecher doch stehen musste, der Graf konnte ihn jedenfalls doch auch sehen, beide hatten schnell in das Loch greifen wollen, um den Bösewicht zu packen... Diese unverabredete Gleichzeitigkeit hatte ihren Plan vereitelt. Beide waren mitten im Sprunge zusammengeprallt.
»Verflucht!!«, stöhnte Axel, und wohl nicht nur deshalb, weil der Zusammenstoß für ihn etwas schmerzhaft gewesen war.
Aus der Finsternis erscholl ein höhnisches Lachen.
»Sie sind wohl zusammengestoßen, meine Herren? Ja, ja, viele Köche verderben den Brei. Aber es wäre Ihnen auch so nicht gelungen. und geben Sie sich fernerhin keine Mühe, mich überrumpeln zu wollen — ich weiß schon, was für Männer ich vor mir habe, und halte mich in dementsprechend vorsichtiger Entfernung. Es wäre auch keinem allein geglückt, mich mit der Hand nur zu berühren.«
»Niederträchtiger Halunke, dass dich die Pest befallen möge!«, musste der ehemalige Depeschenreiter noch einmal seinem Unmute Luft machen.
»Es steht Ihnen frei, zu schimpfen, das lässt mich kalt. Zunächst gebe ich Ihnen noch einige Zeit, sich zu besprechen. Im Übrigen bleibt alles beim Alten. Sie, Herr Graf von SaintGermam, haben sich mit mir als Adept zu verbinden, wir werden fernerhin die Welt gemeinsam betrügen, so wie sie betrogen sein will — und Sie, Durchlaucht. geben mir noch ganz besonders Ihr fürstliches Ehrenwort, dass Sie von alledem nichts verraten werden. Sollte Ihr Entschluss schon jetzt felsenfest sein, lieber zu sterben, als sich solchen Bedingungen zu unterwerfen, so können Sie auch gleich den Selbstmord auf die Weise wählen, dass Sie durch jenen Ausgangstunnel kriechen. Sobald sich nämlich in dem vorn erleuchteten Tunnel ein menschlicher Kopf zeigt, ist er auch schon von einer Kugel durchbohrt. So können Sie sich auf eine sehr einfache Art und Weise ins Jenseits befördern, ohne dass Sie direkt Hand an sich legen müssen. Ich gehe — in einer halben Stunde komme ich wieder.«
Einige Minuten lang herrschte die tiefste Stille, durch nichts unterbrochen.
»Kommen Sie, wir wollen draußen etwas auf und ab gehen«, sagte dann Axel, und seinem gleichgültigen Ton war nichts anzumerken.
»Wie denken Sie über das Ehrenwort, das man gezwungenerweise einem Räuber oder sonst einem Schurken gegeben hat?«, begann dann abermals Axel, mit möglichst leiser Stimme, dass sie eben nur das Ohr seines Nachbars traf.
»Das ist Sache jedes einzelnen.«
»So ist es — leider. Ja, wenn man allein ist! Ich gestehe, dass ich früher als Depeschenreiter in solchen Fällen gar manchmal mein Wort nicht gehalten habe. Aber so zu zweien — es ist eine verfluchte Geschichte — man dürfte sich dann später niemals wieder ins Auge sehen — dann ginge es wohl.«
»Und es ist auch damit zu rechnen, dass dieser Mann vorher noch andere Sicherheitsmaßregeln treffen wird.«
»Ja, das hat er ja selbst schon gesagt. Graf, wenn ich nun nicht wäre, würden Sie auf den Vorschlag eingehen?«
»Wahrscheinlich — ich komme langsam zu einer anderen Ansicht...«
»Ah bah, so sprechen Sie jetzt, um mich zu entlasten. Nicht wahr?«
Der Graf schwieg — und das war auch eine Antwort, eine Bestätigung. Und hätte er verneint, es wäre nicht anders gewesen. Die Sache lag gar zu klar auf der Hand.
»Und wenn ich nicht wäre«, fuhr der Graf dann fort, »würden Sie etwa Ihr Ehrenwort geben?«
»Dieser Fall kommt jetzt gar nicht in Betracht. Es handelt sich jetzt nur darum, ob... hallo. was machen Sie denn?!«
Bei dem bedeckten Himmel herrschte eine Stockfinsternis, ganz besonders noch hier unten in dem engen Kessel. Dem Fürsten war nur deshalb ein Hin- und Hergehen möglich, ohne anzustoßen, weil er dies schon den ganzen Tag lang geübt hatte.
Also sehen konnte er absolut nichts, auch nicht hören, das weiche Gras dämpfte den Schritt vollkommen — so war es ihm nur mehr dem Gefühl nach gewesen, als habe sein Gefährte sich mit einem plötzlichen Sprunge von ihm entfernt.
In demselben Augenblicke aber wusste Axel auch alles!
Dort seitwärts von ihm befand sich der Tunneleingang, nur in diesen hinein war der Graf gesprungen.
Wozu? Nun eben, um die erlösende Kugel zu erhalten, um dieser ganzen unangenehmen Geschichte mit einem einzigen Schlage ein Ende zu machen.
»Zurück, Graf, was für eine Dummheit wollen Sie machen!«
Und auch Axel war dorthin gesprungen, wo er, mit den Sinnen eines Indianers begabt, ganz genau den Tunneleingang wusste, erreichte ihn richtig, schon in geduckter Stellung, denn in aufrechter hätte er sich den Kopf zerschmettern können, drang, eine Hand die Wand entlang gleiten lassend, die andere ausgestreckt. in fliegender Eile vorwärts.
»Graf, um Gottes willen, zurück, zurück...!!«
Es gelang ihm nicht, ihn noch rechtzeitig zu erreichen. Da aber sah er vor sich einen hellen Schein, der hinter einer Ecke vorkam, hörte einen dumpfen Fall — und im nächsten Augenblick, als er selbst um diese Ecke bog, bekam er einen Hieb über den Kopf, der ihn niederwarf.
Als Axel wieder zu sich kam, war es heller Tag.
Er lag in demselben Kessel, der den beiden bisher als Gefängnis gedient hatte, jetzt aber befand er sich allein darin, und zwar an Händen und Füßen stark gebunden.
»Das ist ein Gummischlauch gewesen«, war sein nächster Gedanke, als er sich über seine Lage vergewissert hatte, auch darüber, dass man ihn ziemlich bequem hingelegt hatte, sodass es ihn nicht viel genierte, dass ihm die Hände auf dem Rücken gebunden waren. Das Gras war weich genug, und unter den Kopf hatte man ihm sogar ein Kissen oder eine zusammengewickelte Decke gegeben.
Dass ihn sein Kopf tüchtig schmerzte, jedenfalls eine große Beule hatte, darüber brauchte er sich nicht erst mit klarer Vernunft Rechenschaft zu geben. Alle weiteren Gedanken wurden dadurch abgeschnitten, dass er jetzt aus dem Tunneleingange, dem er das Gesicht zukehrte, den Marquis kommen sah, in einem Reitanzug, ein Schwert an der Seite, im Gürtel zwei Pistolen.

»Wie geht es Ihnen, Durchlaucht?«
»Sie sind ein niederträchtiger Kerl!«
»Na, das klang gar nicht so erzürnt«, suchte der Marquis einen scherzhaften Ton anzuschlagen.
»Bin ich auch tatsächlich nicht.«
»Sie fassen Ihre Lage nicht allzu tragisch auf?«
»Tue ich niemals.«
»Recht so. So erlaube ich mir, mich nochmals nach Ihrem Befinden zu erkundigen, und ich tue das in wirklicher Sorge, denn Sie haben mit einem Gummiknüppel einen außerordentlich heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Der tölpelhafte Kerl glaubte wohl, dem Grafen folge ein Ochse nach.«
»Ja, ich habe höllische Kopfschmerzen.«
»Sonst nichts weiter?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Nun, ich habe Sie auch eingehend untersucht, und ich verstehe etwas davon — zerschmettert ist Ihnen der Schädel nicht, am Leben bleiben werden Sie, ich fürchtete nur, Sie könnten niemals Ihre klare Besinnung wiedererhalten.«
»So schlimm scheint es nicht geworden zu sein, mein Schädel verträgt schon etwas. Aber wenn ich später noch einmal einen Tobsuchtsanfall oder etwas Ähnliches bekommen sollte, werde ich Sie gerichtlich belangen.«
»Mich freut, dass Sie bei gutem Humor sind.«
»O, mir ist eigentlich gar nicht so scherzhaft zumute. Wie lange habe ich besinnungslos gelegen?«
»Ziemlich zwölf Stunden.«
»Donnerwetter. Und wie ist es dem Grafen ergangen?«
»Der hat einen viel gelinderen Schlag abbekommen.«
»Also auch gefangen?«
»Nicht mehr.«
»Nicht mehr?«, wiederholte Axel stutzend.
»Wir sind handelseinig geworden.«
»Was, er will gemeinsam mit Ihnen das schwindehafte Handwerk eines Adepten betreiben?«
»Nicht so ganz. Wir haben eine gar lange Unterhaltung gehabt, ebenso ruhig und vernünftig geführt, wie ich mich jetzt mit Ihnen auseinandersetzen kann. Wir sind einander entgegengekommen. Der Graf hat nachgegeben, ich habe nachgegeben. Ich habe während einiger Stunden stillen Nachdenkens eingesehen, dass wir beide doch nicht so gut als Kompagnons zusammenpassen. Wir sind gar zu verschiedene Naturen. Auch der Graf wird fernerhin seine eigenen Wege gehen...«
»Als Adept?«
»Das kann er halten, wie er will. Die Hauptsache ist folgende: Ich habe nun einmal öffentlich verkündet, dass der Graf von Saint-Germain von jener ägyptischen oder indischen Geheimloge in die Welt geschickt worden sei, um der Menschheit durch magische Fähigkeiten das wahre Glück zu verkünden, dass er aus falschem Ehrgeiz seine Vorschriften übertreten habe, dass er deshalb zurückberufen und zu vielhundertjähriger Gefangenschaft verurteilt worden sei.
Dass ich nun diese Behauptung zurücknehme, das ist doch ganz ausgeschlossen. Sonst bin ich für immer blamiert. Denn ich kann meine sehr auffallende Gestalt nicht so leicht verändern, ein anderer Name hätte also dabei gar nichts zu sagen.
Um nun die Sache doch noch etwas zu arrangieren, werde ich jetzt weiter behaupten, dass der Graf von Saint-Germain seine Freiheit wiedererhalten hat, um weiter unter den Menschen als Adept zu wirken. Ob der Graf das wirklich tut, und dann unter welchem Namen, das ist mir gleichgültig. Tritt er aber wieder als der Graf von Saint-Germain auf oder wird er einmal als solcher erkannt, dann muss er auch unbedingt dieselben Aussagen machen wie ich. Verstehen Sie?«
»O ja, ich verstehe. Und darauf ist der Graf eingegangen?«
»Warum soll er nicht?«
»Sie haben ihm gedroht.«
»Freilich war er ja ganz in meiner Hand.«
»Nein, Sie haben ihm mit mir gedroht!«
»So ist es«, gestand der Marquis jetzt offen. »Ich drohte ihm mit Ihrer Gefangennahme und sogar mit Ihrem Tode. Da gab der Graf schnell genug nach.«
Der Gebundene knirschte mit den Zähnen und riss heimlich an seinen Fesseln.
»Geben Sie sich keine Mühe«, sagte der scharfsichtige Gaukler, »diese Riemen können von keinem Menschen zerrissen werden, und sei es Herkules selbst, und die Knoten sind von mir geschürzt.«
»Ich will den Grafen sprechen.«
»Bedaure. Der Graf ist bereits abgeritten — Sie werden ihn niemals wieder zu sehen bekommen.«
Da war es, als ob Axel, obgleich er schon langausgestreckt dalag, zusammenbreche.
Eines Kommentars bedurfte er nicht. Der Graf, wenn er auch ein edles Opfer gebracht hatte, schämte sich, ihm wieder vor die Augen zu kommen.
»Ohne Abschied davongegangen!«, flüsterte Axel.
»Es konnte nicht anders kommen. Nun aber zu Ihnen, Durchlaucht. Sie müssen mir noch Ihr Wort geben, über alles dies, was Sie hier vernommen haben, Stillschweigen zu beobachten.«
»Ich habe Ihnen doch schon früher gesagt...«
»Ich will Ihr Wort haben.«
»Sie haben es.«
»Dann ist diese Angelegenheit erledigt. Was werden Sie nun tun, wenn ich Ihnen jetzt die Bande zerschneide?«
»Sie sofort niederschlagen, Sie töten.«
»Na, das war wenigstens ein ehrliches Wort, das gefällt mir!«, lachte der Gaukler. »Natürlich habe ich das schon vorher gewusst, und Sie gestatten wohl, dass ich mich gegen eine solche Eventualität schütze.«
»O Sie Gauner!«
»Halten Sie mich wirklich für solch einen schlechten Menschen?«
»Hm, eigentlich nicht.«
»Dadurch beweisen Sie wiederum, dass auch ich Sie ganz richtig beurteilt habe. Wollen Sie fernerhin alle Feindschaft gegen mich unterlassen?«
»Sie sind mir noch einen Zweikampf schuldig.«
»Bestehen Sie wirklich darauf?«
»Nein, ich verzichte«, entgegnete Axel nach einigem Zögern.
»Und Sie entsagen auch sonst aller Feindschaft gegen mich?«
»Jeder tätlichen Feindschaft, ja.«
»Ich habe Ihr Wort, das genügt mir — und Ihnen blieb gar nichts anderes übrig, sonst hätte ich Sie hier ganz einfach für immer verschwinden lassen.«
Der Marquis zog einen Dolch und durchschnitt des Fürsten Bande.
Eine halbe Stunde später ritt dieser den sanften Abhang nach Rom hinab.
Joseph Balsamo, der spätere Cagliostro, hatte sowohl den Grafen von Saint-Germain wie unseren Axel besiegt.
Hiermit schließt das Tagebuch des deutschen Fürsten, das niemals veröffentlicht werden sollte, das noch heute im Geheimarchiv eines Schlosses liegt und nur durch irgendeine Indiskretion in einem englischen Auszuge in die Öffentlichkeit kam, aber zu den seltensten Kostbarkeiten einiger wenigen Bibliotheken des Auslandes gehört.
Dann existiert in einigen Exemplaren noch ein Nachtrag, in dem der Tagebuchführer noch kurz das Schicksal der Hauptpersonen anführt. Es ist traurig genug.
Die Herzogin von Borghesia war schon vorher in den dürftigsten Verhältnissen gestorben.
Die Fürstin de la Roche, die durch die mexikanische Revolution ihr ganzes Vermögen verloren hatte, tatsächlich eine gefeierte Schönheit, der sie freilich immer mehr durch künstliche Mittel nachhelfen musste, sank immer tiefer, bis sie als öffentliche Dirne an einer hässlichen Krankheit starb, die sie zuletzt vollständig entstellt hatte.
Lord Walter Moore beschloss sein noch immer junges Leben im Jahre 1764 als unbekannter, gebrochener Mann, mit seinem letzten Atemzuge den Grafen von Saint-Germain verfluchend, der ihn verführt habe.
Eine Marietta Roscalli kam bald darauf, nachdem der Graf Soltykow verschwunden war, in das Irrenhaus von Genua. Sie wickelte eine Decke zusammen, hielt das Bündel für ihr Kind, überhäufte es mit Zärtlichkeiten, bis der baldige Tod sie von ihrem Wahne erlöste.
Das sind nur die vier Hauptpersonen, über deren letztes Schicksal der Tagebuchführer berichtet.
Aber, sagt er, wollte man das Schicksal aller derer erforschen, die mit dem Grafen von Saint-Germain in Verbindung gekommen sind, freiwillig oder unfreiwillig, so würde man finden, dass sie alle ein gleiches, trauriges, Ende genommen haben — und er selbst sei davon nicht ausgeschlossen.
Was der deutsche Fürst hiermit meint, weiß man nicht, und wir wollen nicht nachforschen, wir haben ja auch niemals seinen richtigen Namen genannt.
Mit dem Grafen von Saint-Germain scheint er niemals wieder in Berührung gekommen zu sein.
Was dessen ferneres Leben anbetrifft, so kann man darüber in jedem Konversationslexikon nachlesen. Wie schon erwähnt, tauchte er dann, um das Jahr 1762, wieder als alchimistischer Lehrer des französischen Königs auf, mit der Behauptung, er habe die zehn oder elf unbekannten Jahre seines Lebens in Indien verbracht, wurde dann als französischer Gesandter nach London geschickt, widmete sich überhaupt ganz der Diplomatie, war in solchen Stellungen in Russland und in Berlin, bis er im Jahre 1780 zu Eckernförde eines friedlichen Todes starb.
Besonders hervorgetan als Diplomat, sodass die Weltgeschichte über ihn spräche, hat er sich niemals, ebenso wenig aber trat er noch als Magier auf.
Dies besorgte sein Nachfolger Cagliostro, der nie vergaß, sich einen Schüler des Grafen von Saint-Germain zu nennen, aber ohne weitere Erklärungen über diesen Unterricht zu geben, und bald machte sich Cagliostro ja selbst zum Großkophta aller ägyptischen und indischen Magierlogen, da hatte er den Grafen von Saint-Germain, den man auch schon längst zu vergessen anfing, nicht mehr nötig.
Das weitere Schicksal Cagliostros gehört nicht mehr hierher, seines gewaltsamen Todes im Kerker zu St. Leo ist schon erwähnt worden, und ebenso, wie er durch seine Verschwendungssucht zuletzt so tief sank, dass er mit den Reizen seiner schönen Gattin wucherte.
Wer dieser sogenannte Graf von Saint-Germain gewesen ist, hat man niemals erfahren. Es sind darüber vier Streitschriften geschrieben worden, wonach er ein Portugiese namens Betmar gewesen sein soll, oder ein elsässischer Jude Simon Wolf, oder ein spanischer Jesuit Aymar, oder der kolossal begabte und in früher Jugend von Zigeunern geraubte Sohn des Steuereinnehmers Rolando zu St. Germano in Savoyen.
Diese letzte Behauptung hat die größte Wahrscheinlichkeit für sich.
Doch schließlich ist das ganz gleichgültig.
In dieser Erzählung sollten nur die erste und die zweite Periode aus dem Leben dieses seltsamen Mannes geschildert werden, was hiermit geschehen ist, wie es außer in jenem seltenen englischen Exemplare sonst nirgends zu finden ist, und wer dieser rätselhafte Mann sonst war, was er erstrebte. und was er erreichte, darüber mag sich jeder Leser sein eigenes Urteil bilden.
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.