
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
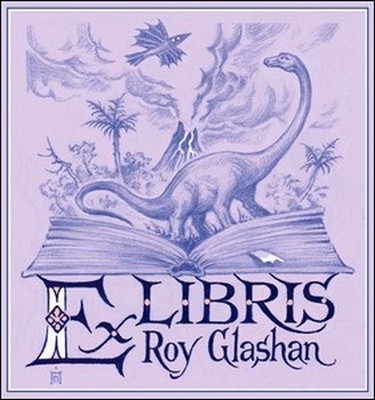
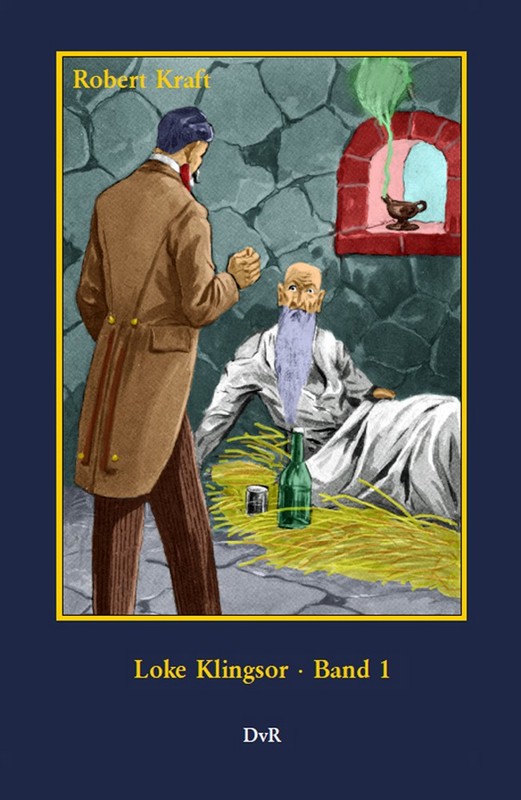
"Loke Klingsor," Band 1, Verlag Dieter von Reeken, 2024
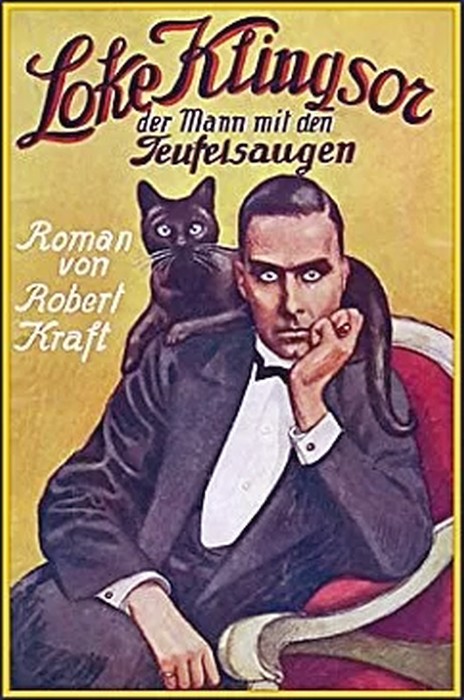
"Loke Klingsor," Coverbild, Lieferung 1
Die vorliegende Neuausgabe enthält in sechs Bänden den ungekürzten Text der ersten Auflage des von Robert Kraft (1869—1916) verfassten Kolportageromans
Loke Klingsor. Der Mann mit den Teufelsaugen. Lieferungs-Roman von Robert Kraft. Heidenau 1 bei Dresden: Verlagshaus Freya G.m.b.H. 1927, 60 Lieferungen mit je 64 fortlaufend nummerierten Seiten (Gesamtumfang 3840 Seiten), illustriert (60 Frontispize, 180 weitere Illustrationen) von Otto Peter (1864—1949).
Etwa ein Viertel des Romans wurde, teilweise nach Motiven aus Arthur Conan Doyles Roman The Lost World (1912, dt. Die verlorene Welt, 1926), von Johannes Jühling verfasst, der auch die Gesamtfassung bearbeitet hat.(1)
(1) Nach Mitteilung von Thomas Braatz sind folgende Kapitel von Jühling bearbeitet, ergänzt oder ausschließlich verfasst worden: Kapitel 9, 12 17 (teilweise Kraft), 19, 20 (teilweise Kraft), 21, 25—28, 29 (teilweise Kraft), 34—36, 38, 43, 44, 45 (teilweise Kraft), 50, 56—58, 63—68, 69 (?), 82—88, 92, 93 (teilweise Kraft), 94—97. Offenbar hat Jühling die Romanhandlung zum Ende hin (Kapitel 94—97) durch Ergänzung mit eigenem Text sehr in die Länge gezogen, um auf 60 Lieferungen zu kommen. Dies fällt besonders beim überaus langen und langatmigen, ja langweiligen Kapitel 95 auf. Die beiden kurzen Schlusskapitel vermögen den aufwändig aufgebauten Spannungsbogen der Handlung leider nicht in angemessener Weise zu vollenden.
Zu Robert Krafts Leben und Werk verweise ich auf die umfassende reich farbig illustrierte Bibliografie von Thomas Braatz(2), die ebenfalls farbig illustrierte Biografie von Walter Henle und Peter Richter(3), ein umfangreiches Buch von Arnulf Meifert(4) und auf die Tagungsbände(5—7) zu den Robert-Kraft-Symposien.
(2) Thomas Braatz: Robert Kraft — Farbig illustrierte Bibliographie zum 100. Todestag. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer, 3., erweiterte Aufl. 2016. — 1032 S. mit über 1000 farbigen Abb.
(3) Walter Henle, Peter Richter: Unter den Augen der Sphinx. Leben und Werk Robert Krafts zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2005. — Das Buch ist vergriffen; eine Neuausgabe ist für 2025 geplant.
(4) Arnulf Meifert: Robert Kraft. Avanturier und Selbstsucher. Eine Annäherung. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2018.
(5) Robert Kraft 1869—1916. 1. Robert-Kraft-Symposium. 15.—16.10.2016. Mit Beiträgen von Thomas Braatz, Arnulf Meifert, Achim Schnurrer sowie historischen Texten von Dr. S. Friedlaender und Robert Kraft. Leipzig: Thomas Braatz im Rahmen des Freundeskreises Science Fiction Leipzig 2016.
(6) Wenn ich König wäre! Robert Kraft zum 150. Geburtstag. 3. Robert-Kraft-Symposium. 12.—13.10.2018. Mit Beiträgen von Jakob Bleymehl, Gerhard W. Bleymehl, Thomas Braatz, Matthias Käther, Walter Mayrhofer, Arnulf Meifert, Karlheinz Steinmüller und Hans Wollschläger. A. a. O. 2019.
(7) 4. Robert-Kraft-Symposium. 16.04.2022. Serienheld Nobody. 100 Jahre Kraft-Film von Thomas Braatz, u. a. mit Beiträgen von Michael Bauer, Aurel Lupaþtean und Franziska Meifert. A. a. O. 2022.
Der im Original in Fraktur gesetzte Text ist in Antiqua (Garamond Standard) umgewandelt und an die seit 1996 geltenden neuen Rechtschreibregeln angepasst worden. Aus ›Neuyork‹ wurde also ›New York‹, aus ›Bureau‹ ›Büro‹, aus ›Telephon‹ ›Telefon‹ usw. Offensichtliche Rechtschreib-fehler und unübliche Schreibweisen sind stillschweigend berichtigt worden, z. B. ›Donna‹ in ›Doña‹, ›Sennor/Sennora/Sennorita‹ in (spanisch) ›Señor/ Señora/Señorita‹ bzw. (portugiesisch-brasilianisch) ›Senhor/Senhora/Senho-rita‹ und ›Vosco‹ in ›Bosco‹, soweit sie nicht (z. B. mundartlich bedingt) als beabsichtigt erscheinen.
Fußnoten mit Sternchen (*) stehen so auch im Originaltext, solche mit Zahlen (1) sind vom Herausgeber eingefügt worden.
Bei der Wiedergabe der Frontispize (Graustufenbilder) musste jeweils ein Kompromiss zwischen Bildschärfe und Bildglättung gefunden werden. An manchen Stellen war der sogenannte 6›Moiré-Effekt‹ (waagerechte oder dia-gonale Rasterung) daher im Interesse der Bildschärfe nicht zu vermeiden.
Für freundliche Unterstützung durch den Originaltext der Erstausgabe, für Bilder, Informationen und Hinweise bedanke ich mich bei Thomas Braatz, für das Korrekturlesen bei Ellen Radszat und Mike Neider.
»Mister O'Donnell?«
»Bin ich.«
»Nehmen Sie Platz. Sie sind Detektiv?«
»Gewesen.«
»Sie sind Afrikaforscher geworden?«
»Nur der Begleiter eines solchen«, lautete die bescheidene Antwort. »Ich habe den berühmten Afrikareisenden Percy Douglas auf seiner zweijährigen Durchquerung der Sahara von Norden nach Süden und von Westen nach Osten begleitet.«
»In welcher Eigenschaft? Sie müssen doch irgendeinen Posten dabei eingenommen haben.«
»Als Freund, als Gesellschafter, und allerdings auch als — persönliche Leibwache, will ich sagen.«
»Sie haben als Detektiv sehr große Erfolge gehabt. Die ganze Welt hat von Ihnen gesprochen. Sie haben hier in New York den mysteriösen Mord in der Bally Street aufgeklärt, haben durch außerordentlichen Scharfsinn den Täter in einem unbescholtenen Manne ermittelt, den niemand dessen fähig gehalten hätte. Sie haben das schreckliche Scheusal, den blutigen Timbill, diesen dutzendfachen Raubmörder, bis in die Urwälder und Prärien des Wilden Westens verfolgt und ihn endlich zur Strecke gebracht.
Sie haben die Verbrecherbande, die sich in einem Hause zu Omaha City wie in einer uneinnehmbaren Festung verschanzt hatte und alle Sturmangriffe der Polizei- und Militärtruppen zurückwies, dingfest gemacht, Sie ganz allein, indem Sie durch eine List in das Haus eindrangen und die mehr als zwanzig Mann starke Bande durch Gase betäubten.
Sie haben noch vieles andere fertiggebracht. Das sind jedoch Ihre schönsten Erfolge. Sie werden außer der Ehre auch klingenden Lohn geerntet haben. Weshalb sind Sie nicht Detektiv geblieben?«
»Weil mich dieser Beruf nie befriedigt hat. Die Gründe hierfür kann ich jetzt nicht anführen. Kurz, als vor zwei Jahren mein ehemaliger Schulfreund Percy Douglas, der ein berühmter Afrikareisender geworden war, mit dem Vorschlag an mich herantrat, ich solle ihn auf seiner Erforschung der Sahara begleiten, habe ich sein Angebot mit tausend Freuden angenommen und bin ihm gefolgt.«
»Mister Douglas fand seinen Tod.«
»Er wurde von Tuaregs ermordet.«
»Da haben Sie das Kommando über die Expedition übernommen, haben sie aus dem Herzen der Sahara westwärts bis nach Rio de Oro an die Küste geführt, trotz der heftigsten Einsprüche der anderen europäischen Mitglieder der Expedition.«
»Das tat ich, einmal, weil ich der festen Überzeugung war, dass es uns nie gelingen würde, die Nordküste zu erreichen, denn alle Tuaregs befanden sich in vollem Aufstande, und unsere Karawane war schon sehr geschwächt — und zweitens galt es, den letzten Willen des Toten zu erfüllen. Percy Douglas hätte niemals seine Route geändert. Wir aber standen in seinem Brot und Lohn. Daran durfte sein Tod nichts ändern.«
»Sie gingen in Ihrem Eigensinn so weit, dass Sie die anderen europäischen Mitglieder der Expedition gefangen nahmen, sie zwangsweise mitschleppten.«
»Ja, das habe ich allerdings getan. Aber nicht aus Eigensinn, sondern aus heiliger Überzeugung, dass die Herren in ihren Tod rannten, wenn ich sie nordwärts ziehen ließ. Und dann bestimmte mich immer wieder das Bewusstsein, den letzten Willen eines Toten, der unser Arbeitgeber gewesen, zu erfüllen.«
»Die Herren haben schließlich eingesehen, dass Sie recht gehabt haben?«
»Ja, zuletzt haben sie es eingesehen.«
»Ich habe das unterdessen erschienene Werk über diese Expedition gelesen. Es ist von einem Doktor Armand verfasst.«
»Er war der begleitende Arzt.«
»Dieser Franzose spricht anfangs sehr schlecht über Sie und macht Ihnen in seinem Tagebuche fortwährend die bittersten Vorwürfe.«
»Er hat mich gehasst, wie ein Mensch nur seinen Feind hassen kann.«
»Weswegen?«
»Weil ich mit der ärztlichen Behandlung des immer fieberkranken Mister Douglas nicht einverstanden war. Doktor Armand gab seine Verordnungen sicher nach bestem Gewissen, ich aber war ebenso fest überzeugt, dass eine Wasserbehandlung bei Mister Douglas nicht angebracht war. Deshalb lagen wir uns ständig in den Haaren.«
»Dann aber ist Doktor Armand voll Bewunderung für Sie und weiß während des furchtbaren Marsches nach der Westküste nicht genug Lobenswertes über Ihre Kühnheit und Umsicht zu berichten.«
»Das beweist eben, dass dieser Franzose ein lauterer Charakter ist, der ganz parteilos geurteilt hat.«
»Auch das sogenannte AtakarGebirge, mitten im Herzen der Sahara gelegen, ist erforscht worden, nicht wahr?«
»Es war meines Freundes letzte Arbeit; dort traf ihn der Dolch des fanatischen Tuaregs.«
»Wie sieht es dort aus?«
»Es ist ein furchtbar zerrissenes Wüstengebirge.«
»Wohnen dort Menschen?«
»Nein.«
»Wie groß ist das Gebirge?«
»Es mag eine Fläche von rund 40 000 Quadratkilometern bedecken.«
»Da können Sie doch nicht alles durchforscht haben.«
»Allerdings nicht. Aber dass dort Menschen existieren können in Ansiedlungen, davon ist keine Rede.«
»Haben Sie auch keine Ruinen gefunden?«
»Keine Spur davon.«
»Wie viel betrugen die Kosten dieser Expedition?«
»Genau 71 274 Dollar und 46 Cent von New York und wieder zurück. Mister Douglas hat ganz genau Buch geführt, ich habe dieses Rechnungswerk dann fortgesetzt und es abgeschlossen dem Testamentsvollstrecker übergeben.«
»War diese Expedition groß genug für den Zweck der Reise und genügend ausgerüstet, oder würden Sie ein andermal die Kosten höher veranschlagen?«
»Durchaus nicht. Ich würde es ein zweites Mal für die Hälfte dieser Summe machen.«
»Sie haben doch Arabisch gelernt und können geografische Ortsbestimmungen ausführen.«
»Ja, das habe ich perfekt gelernt.«
»Mister James O'Donnell, sind Sie bereit, auf meine Kosten noch einmal nach diesem AtakarGebirge zu gehen?«
Ein kurzes Besinnen, und dann erklang es umso rascher:
»Sofort, Mister Philipp!«
»Gut, ich engagiere Sie! Sprechen wir über die näheren Bedingungen! Fangen Sie an!«
»Was soll ich dort?«
»Da muss erst ich etwas fragen. Haben Sie schon einmal den Namen Loke Klingsor gehört?«
Dieses Gespräch, das wir mit der letzten Frage einmal unterbrechen, fand zu New York in einem armseligen Stübchen statt, das nichts weiter enthielt als einen alten, wurmstichigen Tisch, mit einigen Papieren und Karten bedeckt, und zwei ebenso dürftige Stühle. Die defekten Kalkwände waren ganz nackt und die Scheiben des Fensterchens ganz erblindet.
Auf dem einen Stuhl neben dem Tische saß ein noch junger Mann in elegantem Straßenanzuge, Mister James O'Donnell, eine hochgewachsene, breitschultrige Gestalt mit einem Kopfe, der zu einem Detektiv und Afrikaforscher passte, in dem bronzefarbenen Gesicht alles kalte Ruhe und eiserne Energie, die blauen Augen wie geschliffener Stahl blitzend, und auf dem anderen Stuhle vor dem Tische ein altes, ausgedörrtes Männchen in schäbigem, ganz zerlumptem Schlafrock.

Das war Mister Samuel Philipp, in dem man, besonders in dieser seiner Behausung, nun freilich nicht einen der reichsten Männer Amerikas vermutet hätte.
Bis vor vierzig Jahren hatte sein Vater den Pelzmarkt ganz Amerikas und der übrigen halben Erde beherrscht, bis auf den von Russland. Sein Sohn Samuel, das einzige Kind, hatte sich nicht dem Geschäft gewidmet, sondern hatte studiert, Staatswissenschaften. Er hatte wahrscheinlich Senator und vielleicht mehr noch werden wollen. Aber nach dem Tode des Vaters war er auf Reisen gegangen. Dreißig Jahre war er verschwunden gewesen. Doch nicht verschollen. Sein Jugendfreund, der Notar Salis, hatte die ihm anvertrauten hundertfachen Millionen immer hübsch zu verdoppeln gewusst; mit dem hatte er auch immer in Verbindung gestanden.
Und vor nunmehr zehn Jahren war Samuel Philipp zurückgekehrt von Sydney; der große Dampfer war fast ganz mit seinem eigenen Gepäck beladen gewesen.
Der einst so jugendkräftige Mann war im Laufe der Jahre ein ausgedörrter Greis geworden, sah aus, als wäre er in einer Kaffeetrommel geröstet worden. Er brachte ein halbes Dutzend Diener mit, teils von schwarzer, teils von brauner, teils von gelber Hautfarbe; mit diesen zog er in der Manley Street in ein großes, altes, baufälliges Haus, ebenso wanderten alle die zahllosen Kisten und Kästen, einige von riesigen Dimensionen, die der Dampfer auslud, hinein. Dabei ging doch einmal etwas in Trümmer, einmal kippte ein ganzer Wagen um, die meisten Kisten zerbrachen oder öffneten sich, und da sah man, dass ihr Inhalt ausschließlich aus ausgestopften Tieren, aus exotischen Vögeln, aus Krokodilen und Schlangen und anderem Gewürm bestand, oder aus alten Büchern, und wenn wieder einmal eine Kiste sich auf der Straße öffnete, da sah man immer wieder nichts weiter als solches ausgestopftes oder in Spiritus gesetztes Zeug und alte Schwarten und Papyrusrollen dazu.
Mit diesem Raritätenkabinett, schon mehr ein ganzes Museum, verschwand Mister Samuel Philipp in dem großen Hause und ward zehn Jahre lang, bis heute, nicht mehr gesehen.
Zwei der Diener kamen manchmal auf die Straße, um Nahrungsmittel einzukaufen, reichlich und gut, aber Mister Philipp selbst lebte nur von Hafergrütze und Milch. Das war alles, was man von diesen beiden Dienern zufällig erfuhr. Besucht wurde er nur von seinem Freunde, dem Notar Salis, durch den wohl auch die Post ging.
Und das war ebenfalls ein alter Sonderling, von dem nichts zu erfahren war. Sonst wurde kein Besuch und nicht einmal ein Brief bei Samuel Philipp angenommen.
Vor zwei Monaten war James O'Donnell aus Afrika zurückgekehrt; er wohnte in einem New Yorker Hotel, mit der Ausarbeitung seiner Reisebriefe beschäftigt, die unabhängig von jenem bereits veröffentlichen Werke des französischen Arztes erscheinen sollten.
Gestern Nachmittag hatte er nun von dem Notar Salis einen Brief empfangen, er möchte heute Vormittag bei Mister Samuel Philipp vorsprechen, und er hatte der Einladung Folge geleistet.
Wir haben vom ersten Worte an vernommen, was die beiden Männer verhandelt hatten.
»Haben Sie schon einmal den Namen Loke Klingsor gehört?«, war Mister Philipps letzte Frage gewesen.
»Loke Klingsor? Loke war ein Gott der nordischen Germanen, der Vertreter des bösen Prinzips, und Klingsor war ein ungarischer Minnesänger, ein Astrolog und Hexenmeister, den auch Richard Wagner in seiner Oper ›Der Sängerkrieg auf der Wartburg‹ eine Rolle spielen lässt.«
»Nicht diese beiden mythischen Figuren meine ich, sondern einen Mann, der noch heute lebt und diesen Namen führt. Haben Sie von dem schon gehört oder gelesen?«
»Nein.«
»Vor etwa dreißig Jahren machte ein Mann namens Sturle Klingsor viel von sich reden, als Taschenspieler und sogenannter Salonmagier, er war so bekannt oder sogar so berühmt, wie es einst der Italiener Bartolomeo Bosco gewesen und wie es der amerikanische Professor Hermann heute noch ist — wirklich ein Professor der Physik und Chemie, der aber als öffentlich auftretender Tausendkünstler ganz andere Einnahmen bezieht.«
»Ja, jener Klingsor, von dem Sie sprachen, soll ein Ungar gewesen sein. Das will aber gar nicht mit dem Namen zusammenpassen. Klingsor oder Klingsör ist ein Name, den man in Norwegen, Dänemark und besonders auf Island sehr häufig antrifft. Übrigens wird in diesem Klingsor, der wirklich gelebt hat, Astrolog am Hofe des Königs Andreas II. von Ungarn gewesen ist, ja auch der sonst unbekannte Dichter des Nibelungenliedes vermutet, woraus man doch auch schon auf seine nordgermanische Abstammung schließen muss. Er hat sich als Abenteurer nur bis nach Ungarn verirrt.
Dieser Sturle Klingsor den ich meine, war ein geborener Isländer, aber kein Däne, sondern ein Norweger, er behauptete, ein echter Nachkomme der alten Wikinger zu sein, die als erste Island besiedelten.
Irgendwie war er ein sehr geschickter Taschenspieler geworden und bereiste besonders Russland. Die Russen mögen sich besonders leicht verblüffen lassen und für so etwas viel bezahlen. Klingsor kam immer tiefer ins Innere, bis nach Sibirien hinein, wo er auch die Künste der Schamanen gelernt haben mag; dann wanderte er über Tibet, wo er die lamaistischen Klöster besuchte, in viele Geheimnisse gedrungen sein wird, nach Indien, heiratete dort die Tochter eines Brahmanen, des Oberpriesters der geheimnisvollen Kaste der MaasiFakire.
Dieser Ehe entsprang ein Sohn, dem der Vater den nordischen Götternamen Loke gab.
Loke wurde im heiligen Kloster der MaafiDerwische erzogen, und dann — Mister O'Donnell, begeben Sie sich ins Zentrum der Sahara nach dem AtakarGebirge und sehen Sie zu, ob Sie dort diesen Loke Klingsor fassen können.«
Diese plötzliche Wendung musste wohl einem jeden sehr überraschend kommen.
»Er hält sich dort auf?«, fragte O'Donnell.
»Ja. Er hat dort eine Wohnung. Was für eine das ist, wie er dort in dem wasserlosen Wüstengebirge existieren kann, weiß ich nicht. Nur das weiß ich bestimmt, dass er dort eine Wohnung besitzt. Ich kann Ihnen sogar genau den Eingang zu dieser Wohnung sagen. 22 Grad 34 Minuten 16 Sekunden nördliche Breite, 4 Grad 47 Minuten 8 Sekunden östliche Länge von Greenwich. Schreiben Sie sich diese Ortsbestimmung auf.«
Kaltblütig zog James O'Donnell sein Notizbuch, ließ sich die Zahlen wiederholen und schrieb sie auf.
»Das ist ungefähr in der Mitte dieses Gebirges«, sagte er dabei, »und nur zwei Gradminuten oder kaum vier Kilometer westlich von der Stelle entfernt, wo ich Mister Douglas begraben habe.«
»Wie sieht es dort aus«, fragte der alte Mann, indem er dabei O'Donnell aufmerksam anblickte.
»Eine trostlose, furchtbar zerrissene Gebirgsgegend, sicher vulkanischen Ursprungs, wenn auch jetzt von vulkanischer Tätigkeit nichts mehr zu merken ist. Aber gerade dort herum sind lauter kleine und größere Krater.«
Der Alte nickte sinnend vor sich hin.
»Ja, ja, Krater!«, sagte er leise wohl mehr für sich selbst. »Er nennt sich nicht umsonst den Fürsten des Feuers, dieser Mann mit den Teufelsaugen. Denn ganz sicher ist, dass er auch auf Island im Innern des furchtbaren Hekla eine seiner zahllosen unterirdischen Wohnungen hat, wie ferner auch in den noch schrecklicheren Feuergebieten Sumatras.«
»Er hat viele solche verborgene Schlupfwinkel?«, fragte O'Donnell.
Der alte Mann im Schlafrock erwachte aus seinem Sinnen und schrak empor.
»Was geht es Sie an? Für Sie kommt nur das AtakarGebirge in der Sahara in Betracht!«, erklang es herrisch.
»Wie groß ist das Rechteck, welches diese geografische Ortsbestimmung bis zur Sekunde angibt?«
»Nun, dreißig Meter lang und auf jenem Meridian ungefähr achtundzwanzig Meter breit.
In diesem Rechteck befindet sich der Zugang zu seiner unterirdischen Behausung, das weiß ich bestimmt, freilich nicht, ob er in einem Krater oder nur in einer Felsspalte besteht oder — ob er überhaupt sichtbar ist. Das herauszufinden, ist eben Ihre Sache, der zu unterziehen Sie sich mit Eifer und Energie bemühen müssten!«
»Gut, und wenn ich den Mister Loke Klingsor dort finde, was dann?«
»Wissen Sie, was Runen sind?«, lautete zunächst die Gegenfrage.
»Altnordische Buchstaben, immer nur aus geraden Strichen bestehend, die in verschiedener Weise zusammengefügt sind.«
»Richtig. Mehr brauchen Sie davon auch nicht zu wissen. Nun hören Sie, Mister O'Donnell! Dieser Loke Klingsor hat auf seinem Rücken sieben solcher Runen mit brennendroter Farbe eintätowiert. Fotografieren Sie diesen Rücken, oder zeichnen Sie diese sieben Runen ab, bringen Sie mir die Kopie — und Sie erhalten von mir eine Million Dollar ausgezahlt. Sind Sie damit zufrieden?«
»O ja, das wäre ich wohl. Und was werfen Sie für die Kosten der ganzen Expedition aus?«
»Die Zinsen dieser Million, die in normaler Weise hier 50 000 Dollar betragen. Diese können Sie jährlich ausgeben. Ich erwarte natürlich, dass Sie sich möglichst beeilen, zum Ziele zu gelangen.«
»Das werde ich tun.«
»Sie können ja sparen, wenn Sie wollen, aber Zweck hat es nicht. Sie sollen nichts weiter dabei verdienen als Ihre Prämie. Sobald Sie mir die sieben Runen bringen, erhalten Sie die Million Dollar. Haben Sie mich verstanden, Mister O'Donnell?«
»Sehr wohl, Mister Philipp.«
»Begeben Sie sich von mir sofort zum Notar Doktor Salis, dort wird alles schriftlich abgemacht. Dass ich Ihnen durchaus trauen kann, dass Sie sich auf diese Weise nicht etwa ein Vermögen ersparen wollen, indem Sie die Sache jahrelang hinausschieben, das weiß ich, ich wähle mir meine Leute aus.«
»Sie dürfen mir vertrauen, Mister Philipp. Ich kalkuliere nur, dass dieser Loke Klingsor nicht freiwillig. also nicht ohne energischen Widerstand, seinen entblößten Rücken fotografieren lassen wird.«
»Nein, das wird er allerdings nicht! Es ist sein größtes, sorgsam gehütetes Geheimnis, das er auf dem Rücken trägt, das er gegen alle Schätze der Welt nicht preisgibt. Sie haben den Mann zu überlisten, zu überwältigen, zu töten, um die Möglichkeit zu bekommen, die sieben Runen auf seinem Rücken zu sehen.«
»Zu töten?«, sagte der Detektiv verwundert. »Ist er ein Mann, der den Tod verdient hat, sodass man ihn wie einen tollen Hund über den Haufen schießt, sobald man ihn erblickt?«
Das faltige, ausgetrocknete, pergamentähnliche Gesicht des alten Mannes hatte einen furchtbar harten Ausdruck, als er sich jetzt das glattrasierte, hervorspringende Kinn rieb.
»Ich will Ihnen sagen, mit wem Sie es zu tun bekommen werden«, antwortete er.
Und dann sprach er wohl wieder mehr zu sich selbst — er blickte wenigstens dabei so starr und sinnend vor sich hin — als er fortfuhr:
»Sie sagten vorhin, Loke sei der Vertreter des bösen Prinzips gewesen.
Das stimmt nicht oder ist doch nur halb richtig.
Er hat — ein germanischer Prometheus — den Menschen erst das Feuer geschenkt.
Übrigens war Loke gar kein Gott, sondern nur ein Ase, nur ein Halbgott. Er hat das Feuer vom Himmel geraubt. Auch hierin stimmt die nordische Sage ganz mit der griechischen überein, ohne dass die beiden irgendeinen Zusammenhang haben konnten.
Loke aber wurde von den Göttern trotz dieses Raubes so bewundert, freilich ebenso auch gefürchtet, wegen seiner Schlauheit und all seiner Kunstfertigkeiten, dass sie ihn als ihresgleichen und als gleichberechtigt unter sich aufnahmen.
Loke war der Gott des Feuers und schenkte es den Menschen.
Aber das Feuer kann ebenso zum Segen wie zum Verderben gereichen.
Und das Gleiche gilt für alles das, wofür das Feuer als Symbol dient. Loke war auch der Gott der Künste und damaligen Wissenschaften, also hauptsächlich der Magie, er war der Repräsentant der Klugheit, des scharfsinnigen Witzes.
Alles dieses hat aber eben auch seine gefährliche Seite.
Mit dem ersten Messer, das der kunstfertige Loke die Menschen aus Eisen schmieden lehrte, wurde der erste Brudermord verübt, und seine Erfindung von Bogen und Pfeil brachte den ersten Krieg auf die Erde.
Trotzdem liebte Loke die Menschen. Und die Götter hasste er, weil diese die so tief unter ihnen stehenden Menschen nur als gelegentliches Spielzeug betrachteten. Er war es auch, der die Asen in der Götterdämmerung zum Kampfe anführte, nachdem er alle Geheimnisse der Götter ausspioniert hatte, und er zertrümmerte die ganze Götterwelt.
Nein, der Repräsentant des Bösen an sich war Loke durchaus nicht, er liebte die Menschen und gab sein Herzblut für sie hin.«
Der Alte erwachte aus seinem Selbstgespräch und wandte langsam den Kopf seinem Gegenüber zu.
»Haben Sie mich verstanden, Mister O'Donnell?«, fragte der Alte.
»Sie sprachen von dem nordischen Gott Loke.«
»Ich sprach von dem irdischen Menschen Loke Klingsor. Nein, ein böser Mensch ist er nicht. Ich muss die Wahrheit bekennen, obgleich ich ihn töten könnte, um in den Besitz seines Geheimnisses zu kommen. Ob Sie es tun oder nicht — ganz gleich, bringen Sie mir die sieben Runen, die er auf dem Rücken hat, und Sie erhalten eine Million Dollar.«
»Weiß er, dass Sie es auf dieses Geheimnis abgesehen haben?«
»Das weiß er allerdings, er kennt mich, wenn auch unter anderem Namen — aber dass ich jetzt jemand in die Sahara schicke, dass ich überhaupt so genau die Lage seines afrikanischen Schlupfwinkels kenne, davon hat er keine Ahnung.«
»Haust er denn allein dort?«
»Ich weiß es nicht. Natürlich müssen Sie die Sache ganz geheim halten. Sie sind eben der Forscher, der noch einmal in das Gebirge dort kommt. Sie schlagen an dem bezeichneten Punkte Ihr Lager auf, um umfassende Vermessungen anzustellen, und dabei beobachten Sie immer die ganze Gegend, ob sich Loke Klingsor zeigt. Dem haben Sie das Geheimnis vom Rücken zu nehmen. Wie Sie das machen, das ist ganz und gar Ihre Sache, da kann ich Ihnen absolut keine Anweisungen und keinen Ratschlag geben.«
»Habe ich Loke Klingsor denn als Feind zu betrachten, auch wenn er noch nichts von meinen Absichten weiß?«
»Loke Klingsor ist kein böser Mensch, Sie haben ihn unter keinen Umständen zu fürchten. Wohl wird er Sie unschädlich zu machen suchen, sobald er bemerken sollte, dass Sie ihm nachspüren, aber er wird Sie nicht töten, nicht misshandeln, Ihnen kein Haar krümmen. Mehr kann ich nicht sagen. Auf diese meine Versicherung dürfen Sie sich aber auch verlassen.«
»Hm, ein recht eigentümlicher Auftrag!«, brummte O'Donnell vor sich hin. »Da soll ich mich nun in die Wüste Sahara hinsetzen und vielleicht jahrelang darauf lauern, bis es diesem Manne beliebt, aus seinem Kraterloche hervorzukriechen.«
»Nein, Sie werden nicht jahrelang zu warten brauchen, nicht ein einziges Jahr, keinen Monat, vielleicht keine Woche — vielleicht können Sie gleich am ersten Tage Ihre Aufgabe lösen, denn ich werde Ihnen ein Lockmittel mitgeben, dem Loke Klingsor nicht widerstehen kann, das ihn sofort zum Erscheinen veranlassen wird.«
»Was für ein Lockmittel?«
Diese Frage blieb zunächst unbeantwortet.
»Sie treten die Wüstenreise wieder von Algier an?«, fragte vielmehr ganz unvermittelt Mister Philipp.
»Ja, das ist der beste Ausgangspunkt.«
»Wie lange brauchen Sie von dort bis zum Gebirge?«
»Mit meinen nunmehr gesammelten Erfahrungen glaube ich die Strecke in fünfzig Tagen zurücklegen zu können.«
»Glauben Sie, dass solch einen Wüstenritt auch eine Dame aushalten kann?«
»Eine Dame?! Was soll denn nur eine Dame dabei.«
»Antworten Sie erst!«, erklang es wieder einmal sehr herrisch.
»Das kommt ganz auf die Körperbeschaffenheit und Widerstandsfähigkeit dieser Dame an.«
»Eine junge, gesunde Dame, die viel Sport treibt, viel reitet und höchst energisch ist!«
»O ja, eine solche Dame kann einen Kamelritt schon aushalten, wenn man sonst für möglichste Bequemlichkeit sorgt.«
»Eine solche Dame wird Sie begleiten. Weshalb? Weil dieser Loke Klingsor ein großer Verehrer von Frauenschönheit ist. Er ist, mit einem Wort, ein Don Juan. Diesem Köder, den ich Ihnen mitgebe, hält er nicht stand.«
Mister O'Donnell machte ein missmutiges Gesicht.
»Ich kalkuliere, dass diese schöne Dame denselben Auftrag hat wie ich.«
»Das hat sie.«
»Und solch einer schönen Dame — hm — dürfte es gewiss leichter sein, diese sieben Runen auf seinem Rücken zu Gesicht zu bekommen, als mir.«
»Allerdings!«
»Und dann hat sie sich die Million Dollar verdient.«
»Seien Sie deshalb ganz ohne Sorge. Freilich hat auch diese Dame ihre Prämie ausgesetzt bekommen, aber das hat nichts mit der Ihren zu tun. Gelingt es der Dame oder irgendeiner anderen Person, sich in den Besitz des Geheimnisses jener Tätowierung zu bringen, es mir auszuliefern, so erhalten Sie trotzdem Ihre Million, auch wenn Sie gar nicht dabei tätig gewesen sind. Das wird nachher bei Doktor Salis alles schriftlich abgemacht.«
»Dann lasse ich mir solch eine Begleitung sehr wohl gefallen«, sagte O'Donnell jetzt in ganz anderem Tone. »Hoffentlich ist die schöne Dame auch sonst eine angenehme Person!«
»Sie kennen sie schon.«
»Ich kenne sie?«
»Sie ist eine Berühmtheit. Nicht nur für New York, das sie gegenwärtig bezaubert, nicht nur für Amerika. Sie ist eine internationale Berühmtheit. Es ist die Miss Anna Kutschbach, eine Deutschamerikanern, von der auch Sie sich schon haben bezaubern lassen, wie mir berichtet wurde.«
Der alte Yankee hätte sich bei dem Worte »Kutschbach« beinahe die Zunge abgebrochen. Und O'Donnell schüttelte sinnend den Kopf. Er wusste nicht, was er zu den Worten Philipps denken sollte.
»Ich kenne keine Miss Anna Kutschbach« — er konnte diesen Namen viel besser als jener aussprechen — »und so viel mir bewusst ist — und ich muss es doch wohl am bestem wissen — hat auf mich noch keine Frauenschönheit einen solchen Eindruck gemacht, dass ich sagen dürfte, ich wäre einfach bezaubert gewesen. Mein Ideal von Frauenschönheit ist nur gemalt. Das hängt in der Dresdner Bildergalerie. Leider kenne ich es nur nach mehr oder weniger guten Kopien. Wenn ich erst meine Million Dollar habe, reise ich einmal nach Europa, nur um mir in Dresden mein Ideal anzugucken. Es ist die Judith des Varotari mit dem Haupte des Holofernes.«
»Mister O'Donnell!«, hub jetzt der alte Yankee wieder an: »Ehe ich einem Manne mit solch einem Auftrage näher trat, musste ich erst einige Erkundigungen über ihn einziehen. Das können Sie mir doch nicht verübeln.«
»Durchaus nicht.«
»Ich habe Sie beobachten lassen. Sie waren vorgestern Abend in der Oper.«
»Ja, das stimmt. Ich selbst bin nicht gerade musikalisch, bin kein Kunstkenner, aber eine gute Oper höre ich immer gern an. In der Sahara war zu diesem Genuss wenig Gelegenheit. Geopert wurde zwar auch manchmal, aber in anderer Weise, sehr wenig melodiös.«
»Was wurde vorgestern Abend gegeben?«
»Der Barbier von Sevilla.«
»Wer sang die Rosine?«
»Die Olinda«, entgegnete der junge Mann, und schon begannen die stahlblauen Augen in seliger Erinnerung aufzuleuchten, die sonst eisenharten Züge des bronzefarbenen Gesichtes wurden plötzlich ganz weich. »Die unvergleichliche Olinda!«
»Die unvergleichliche Olinda!«, wiederholte der alte Philipp bedächtig. »Well, das ist nur der Künstlername der Miss Anna Kutschbach.«
Mister O'Donnell wollte sich wohl vom Stuhle erheben, er brachte es nicht ganz fertig, und dabei begann er mit freudigem Staunen ungläubig zu lächeln.
»Was, die — die — Olinda soll mich begleiten?!«
»Die Olinda wird Sie begleiten«, nickte der Alte bestätigend vor sich hin. »Als ich von einer Berühmtheit jener Dame sprach, meinte ich nicht ihre Schönheit. Wohl wird die Olinda ja auch als solche gefeiert, wohl ist Loke Klingsor ein Don Juan, aber dies alles kommt doch erst in zweiter Linie in Betracht. Auch dieses mit so großen Reizen ausgestattete Weib braucht ein Mittel, um den Loke Klingsor aus seinem Versteck hervorzulocken.
Es ist ihre eigene Stimme. Jener Klingsor ist ein begeisterter Freund des Gesanges, dort in dem wilden Wüstengebirge im Herzen der Sahara wird die Olinda singen. Vielleicht eben die Arie der Rosine aus dem Friseur von Dingsda! Ich mache mir nichts aus Opern. Diese Arie soll aber doch eine Glanznummer der Olinda sein. Sie sind doch auch ganz weg gewesen, wurde mir berichtet. Und wenn dann der Loke Klingsor nicht anbeißt, dann — ist er entweder tot oder zufällig einmal nicht da. In letzterem Falle muss eben etwas gewartet werden. Kommen wird er bestimmt. Und dann beißt er auch auf die Olinda an. Er erscheint sicher. Das ist ein Faktum.«
Mister O'Donnell hatte sich auf seinen Stuhl zurücksinken lassen, immer noch ganz verklärt.
»Die Olinda wird mich begleiten!«, konnte er immer nur wiederholen.
»Ja, und Sie haben dafür zu sorgen, dass sie auch in Ihrer Begleitung bleibt.«
»Wie das«, stutzte der andere bereits.
»Na, dass der Loke Klingsor Ihnen die schöne Dame nicht etwa vor der Nase wegschnappt, ohne dass Sie zum Ziele gelangt sind, also ohne die sieben Runen auf seinem Rücken gesehen und kopiert zu haben. Und dass er dann nicht die Olinda in seinem unterirdischen Reiche nach Belieben singen lässt. Die kann dann ja wohl die Tätowierung besichtigen, wenn's ihr Spaß macht, kann die Runen abmalen — aber sie kann mir die Zeichnung nicht bringen! Das ist die Sache.«
»Er soll es probieren!«, erklang die metallene Stimme O'Donnells.
»Recht so! Sie werden Ihre Sache schon machen. In Ihnen habe ich doch meinen Mann ausgesucht. Dafür setze ich bei Ihnen allein eine Million Dollar daran, was doch kein Pappenstiel ist. Zu Ihrer Beruhigung will ich Ihnen jetzt nur noch sagen, dass dieser Loke Klingsor niemals einen brutalen Raub, überhaupt niemals eine brutale Handlung begehen wird. Er ist ein Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle, und das auch inwendig. Das sagt alles. Er ist sogar der ChampionGentleman der Welt. Ein tadelloser Charakter.
Freilich — dass er Ihnen die Olinda wegzuschnappen sucht, damit müssen wir eben rechnen. Doch wir werden morgen weiter darüber sprechen, wenn auch die Olinda hier ist, was für Vorsichtsmaßregeln da zu treffen sind. Können Sie morgen früh um zehn Uhr hier sein?«
»Ich betrachte mich bereits als in Ihren Diensten stehend. Sie haben über mich und meine Zeit zu befehlen.«
»Gut. So kommen Sie morgen früh um zehn Uhr her. Da wird auch die Olinda hier sein. Ebenso Mister Snatcher, das ist der dritte im Bunde, der mitgeht; auch er ist also beauftragt, das Geheimnis auf Klingsors Rücken auszukundschaften. Aber seien Sie ohne Sorge, Ihre Prämie bleibt, wie gesagt, bestehen. Sie erhalten Ihre Million Dollar ausgezahlt, selbst wenn dieser Mister Snatcher mir die sieben Runen bringt. Morgen lernen sich die Herren kennen. Ein netter Mensch, dieser Mister Snatcher.
Für heute ist unsere Angelegenheit erledigt. Jetzt begeben Sie sich zu Doktor Salis, der das Geschäftliche regeln wird. Doch erst kommen Sie, nun will ich Ihnen den Loke Klingsor einmal zeigen, damit Sie wenigstens wissen, wie der Kerl aussieht.«
Mister Samuel Philipp erhob sich, schlug den zerlumpten Schlafrock um seine hageren Glieder und führte den jungen Mann in das Nebenzimmer.
Dieses war auch wieder so öde und leer wie das andere, bis auf einen alten Tisch, auf dem ein Apparat stand, sicher eine Laterna magica.
»Ich besitze nämlich von diesem Loke Klingsor eine Fotografie, ohne sein Wissen aufgenommen. Sie ist auf Glas übertragen und in natürlichen Farben koloriert worden. Ich werde sie Ihnen jetzt an der Wand vorführen.«
Das einzige Fenster besaß Läden, sie wurden geschlossen, kein Lichtstrahl drang durch eine Ritze; in dem Raum herrschte die schwärzeste Finsternis.
Nicht lange, so blitzte ein Flämmchen auf. Mister Philipp entzündete den Leuchtkörper des Projektionsapparates.
An der Wand erschien ein weißes Viereck, erst waren darin nur undeutliche Umrisse zu erkennen, dann war mit einem Ruck das ganze Bild plötzlich scharf eingestellt.
Ein ganz merkwürdiges Bild!
In einem bequemen Lehnstuhl saß in recht nachlässiger Haltung in natürlicher Lebensgröße ein Mann, das rechte Bein über das linke geschlagen, die Hände mit ausgestreckten Fingern vor dem Leibe gefaltet, die Ellbogen auf die Seitenlehnen gestützt.
Er war höchst elegant gekleidet, in schwarze Samtjacke, weiße Weste, dunkelgestreifte Beinkleider, diese noch mit tadellosen Bügelfalten; an den auffallend kleinen Füßen sehr feine Schnürstiefel von gelbem Leder.
Bemerkenswert aber war, dass man trotz dieser ausgesuchten Eleganz offenbar keinen eitlen Stutzer vor sich hatte.
Dann hätte er wohl schon überhaupt keine einfache weiße Weste und keinen einfachen schwarzen Schlips getragen. Und ein eitler Geck schmückt sich doch auch sonst gern.
Hier keine Spur davon. Statt einer Uhrkette lief über die weiße Weste eine dünne, schwarze Schnur, an den Fingern stak kein Ring. Dafür freilich waren das an sich schon wunderbar feine Hände!
Dies alles aber wäre noch keine Merkwürdigkeit gewesen. Doch nun dieses Gesicht!
Es kann nur ein schwacher Versuch sein, es schildern zu wollen.
An sich war es alles andere als schön zu nennen. Schon die Kopfform war eine ganz eigentümliche. Oval wie ein Ei, das Kinn klein und rund und dennoch spitz, oben aber ging der Kopf in die Breite. Im Gegensatz zu der unteren Gesichtspartie war die hohe, breite Stirn geradezu massig zu nennen, obgleich sie es in Wirklichkeit gar nicht war. Und in diesem Gesicht von wachsgelber Farbe ganz auffallend rote Lippen, wunderbar fein und zierlich geschwungen, eine scharfe und dennoch feine Nase und außerdem die zierlichsten Ohren.
Über der hohen, so stark gewölbten Stirn etwas lang gehaltenes Haar von wunderbar schwarzblauer Färbung, links ganz schlicht gescheitelt, man sah es sofort, dass dieser Mann gar nicht daran dachte, sein Haar viel zu pflegen, es war ihm ganz gleichgültig, wenn seine Frisur einmal in Unordnung kam, auch jetzt hing eine Haarsträhne etwas unordentlich herab. Aber dieses tiefschwarze Haar mit dem blauen Schimmer selbst war ein wunderbarer Schmuck, den ihm die Natur gegeben.
Nein, schön war dieses Gesicht eigentlich nicht zu nennen. Und dennoch wiederum war es von einer wahrhaft dämonischen Schönheit!
Dann aber vor allen Dingen die großen, schwarzen Augen!
Wir verzichten von vornherein, diese rätselhaften, unergründlichen Augen beschreiben zu wollen. wir lassen Mister O'Donnell sprechen.
»Himmel, was für faszinierende Augen!«, rief er schon in den ersten Sekunden, nachdem das Bild an der Wand erschienen war. »Das sind ja die wahren Teufelsaugen!«
»Ja, und deshalb wird er auch von denen, die mit ihm in nähere Berührung gekommen sind, ›der Mann mit den Teufelsaugen‹ genannt«, erklang es aus Mister Philipps Munde, und das alte Männchen schien recht erregt zu sein, denn die Stimme zitterte dabei merklich.
»Mit solchen Augen muss der Mann doch Menschen hypnotisieren können.«
»Halt!«, erklang es da in ganz anderem Tone. »Da kann ich Ihnen gleich eine Versicherung geben. Natürlich, dieser Mann, der Sohn eines Taschenspielers und einer indischen Priesterin, versteht zu hypnotisieren. Aber ich weiß auf das Bestimmteste, dass Loke Klingsor niemals hypnotisiert. Es ist ihm bei einem derartigen Experiment einmal etwas Böses passiert, und da hat er den Schwur abgelegt, niemals wieder von dieser seiner Kraft Gebrauch zu machen, und diesen Schwur hält er.«
»Nun, ich meinte auch nur so«, entgegnete O'Donnell leichthin, »ich selbst schließe mich dabei aus, als ich vorhin sagte, der Mann müsse wohl jeden Menschen hypnotisieren können. Den möchte ich einmal sehen, der das bei mir fertig bringt. Ja, das ist ein echtes, ganz indisches Gesicht, und zwar der Typus der höchsten und vornehmsten Kaste, wie ich ein solches einmal an einem Brahmanen studierte, der mir lange gegenübersaß. Und doch!
Es ist unverkennbar ein stark germanischer Zug darin, trotz der blauschwarzen Haare und nachtschwarzen Augen.«
»Ich habe Sie ja bereits über seine Abstammung aufgeklärt.«
»Ein ganz außergewöhnlicher, ein rätselhafter, ein ganz wunderbarer Kopf! Hinter dieser enormen Stirn — obgleich sie an sich gar nicht so kolossal ist — muss doch eine alles durchdringende Geisteskraft stecken. Ist dem nicht so?«
»Ich weiß nur, dass Loke Klingsor ein unvergleichlicher Schachspieler ist.«
»Merkwürdig, merkwürdig dieses Gesicht!«, gab O'Donnell seinen Physiognomiestudien immer wieder lauten Ausdruck. »Dieser tiefe Ernst, ja, man möchte von einem furchtbar finsteren Ausdruck sprechen — und dennoch ist auch wieder ein überaus gutmütiger Zug darin.«
»Das ist er auch, das ist er auch: ein überaus gutmütiger Mensch! Eine Seele von einem Menschen ist er. Der tritt auf kein Würmchen, wenn er es vermeiden kann, der zieht für jeden, der ihn darum bittet, sofort sein Hemd aus, ja er hat sogar schon...«
Mister Philipp brach ab. Er erinnerte sich, schon eine starke Andeutung gegeben zu haben, dass es ihm nicht darauf ankam, diesen Mann auch töten zu lassen, um in den Besitz seines Geheimnisses zu kommen, das er auf dem Rücken trug, und wenn er jetzt seinen edlen Charakter pries, so reimte sich das doch nicht recht zusammen.
O'Donnell achtete nicht darauf, dass jener den angefangenen Satz nicht beendet hatte, er war noch immer ganz in den Anblick des Bildes versunken, machte seine Bemerkungen.
»Was ist denn das für eine schwarze Katze, die er da auf seiner Schulter hat?«, fragte er.
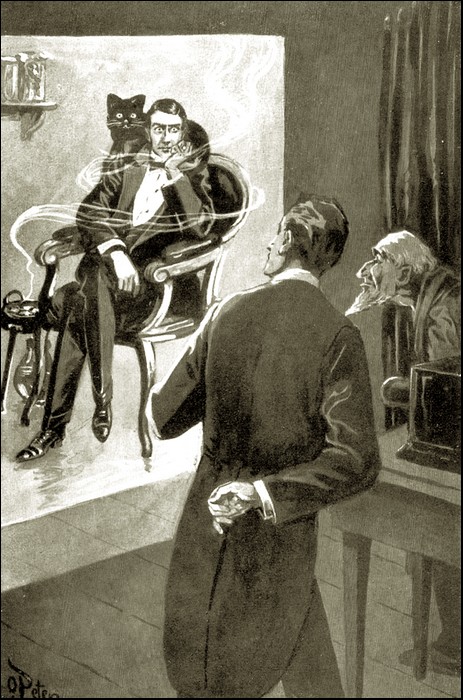
»Was ist den das für eine Katze, die Loke Klingsor
auf seiner Schulter trägt?«, fragte O'Donnell.
Denn das gehörte auch mit zu einer der Seltsamkeiten des ganzen Bildes. Auf der linken Schulter des Mannes kauerte eine ungeheure schwarze Katze. Wie sie mit untergeschlagenen Pfoten dasaß, drückte alles an ihr Behagen und Gemütlichkeit aus, man hörte sie förmlich schnurren, aber geradezu unheimlich war es, wie die großen, grünen Augen funkelten, während sie, von der Seite betrachtet, wieder rot leuchteten.
»Er — ist ein großer Katzenfreund«, lautete Mister Philipps Antwort.
Doch für O'Donnell genügte diese Auskunft; er beschäftigte sich wieder mit dem Mann selbst.
»Ist er eigentlich sehr groß?«
»Über mittelgroß.«
»Er ist doch sehr breitschultrig.«
»Ja, und dabei besitzt er eine Taille wie ein Frauenzimmer, wie eine Dame, die sich geschnürt hat. Eine höchst elegante Erscheinung.«
»Diese wunderbar feinen Hände, jeder Finger wie aus Elfenbein gedrechselt! Und dennoch sagen mir schon diese Hände, dass der Mann eine außerordentliche Körperkraft besitzen muss, ich verstehe mich auf so etwas. Ja, und was haben nun das Kohlenbecken und der Rauch und die merkwürdige Zimmerdekoration zu bedeuten?«
Denn das Bild stellte nicht nur den Mann dar, wie er im Lehnstuhl saß. Dieser stand in einem Zimmer, die Fotografie hatte auch den Hintergrund wiedergegeben.
Eine ganz seltsame Zimmerdekoration! An der Wand zogen sich Regale hin, auf denen lauter dicke Glasbüchsen in den verschiedensten Größen standen, die offenbar in Spiritus eingesetzte Tiere enthielten, von denen aber kein einziges eine normale Beschaffenheit zeigte. Eine Schlange war vorhanden mit zwei Köpfen, ein eben erst geborenes Ferkel mit sechs Beinen, eine menschliche Missgeburt nur aus Haut und Knochen bestehend, auf diesem winzigen Gerippe jedoch ein Kopf so groß wie ein Kürbis, und dergleichen mehr.
Außerdem nun, zwischen diesen Glasflaschen an der Wand befestigt, die verschiedensten Waffen und andere Gegenstände, deren Zweck man sich teils gleich, anderseits unmöglich erklären konnte. Das kundige Auge des Detektivs erkannte die hölzernen Wurfspeere und Keulen und Bumerangs der australischen Eingeborenen, den Assagai der Sudanesen, das Blasrohr des Botokuden, den Kris und das Flammenschwert des Malaien — ferner aber auch andere seltsame Gegenstände, für deren Zweck man, wie gesagt, vergebens eine Erklärung suchte.
Und links neben dem Stuhle stand am Boden ein merkwürdiger Apparat, etwa wie die Glasflasche einer Wasserpfeife aussehend, aber doch wieder ganz anders, oben ein großes Becken, in dem man glühende Kohlen liegen sah.
Von diesen stieg ein weißer Rauch auf, der sich als dicker Faden von scharf abgegrenzten Umrissen um den im Lehnstuhl sitzenden Mann einmal herumzog und sich dann weiter durch das Zimmer schlängelte, dabei die seltsamsten Figuren bildend.
»Die Momentfotografie ist aufgenommen worden, als Loke Klingsor in seinem Museum saß. Er ist nämlich nicht nur ein Freund von Wein, Weib und Gesang, sondern auch ein eifriger Liebhaber von Antiquitäten, Raritäten, Kuriositäten, Abnormitäten und dergleichen Dinge mehr.
Da ist er der leidenschaftlichste Sammler. Eine weitere Eigentümlichkeit von ihm aber ist, dass er so etwas niemals kauft, obgleich er es sich leisten kann. Durch Kauf würde es für ihn seinen Wert verlieren. Stehlen kann er es natürlich auch nicht. Es muss ihm freiwillig ausgehändigt werden gegen irgendeinen Dienst, den er dem Eigentümer der ersehnten Kostbarkeiten leistet. Das ist eine ganz, ganz merkwürdige Sache.«
»So, so«, sagte O'Donnell, ohne sich hierfür jetzt weiter zu interessieren. »Und die glühenden Kohlen? Der Rauch? Wie kann der dünne Rauchfaden so seltsame Figuren beschreiben?«
»Ich sagte Ihnen doch schon, welcher Abstammung dieser Loke Klingsor ist. Der Sohn eines Taschenspielers und Gauklers, dazu nun die indische Mutter, er selbst im Tempel der Wunder und Geheimnisse erzogen.
Schon der alte Sturle Klingsor experimentierte und gaukelte hauptsächlich mit Feuer herum. Er besaß eine Salbe, mit der er seinen ganzen Körper unverbrennbar machen konnte.
Dann wusste er Rauch zu blasen und zu formen, konnte ihn erstarren lassen und formte die wunderlichsten Gebilde und scheinbar lebende Gestalten daraus.
Das hat nun sein Sohn Loke von ihm gelernt, weshalb er sich denn auch den Fürsten des Feuers nennt oder von anderen so genannt wird. — Nun, Mister O'Donnell, haben Sie Ihren Mann genügend betrachtet? Werden Sie ihn wiedererkennen?«
»Wenn man dieses Gesicht einmal gesehen hat, dann vergisst man es nie wieder.«
»So wollen wir uns wieder hinüberbegeben.«
Sie gingen in das andere Zimmer zurück, ohne dass Mister Philipp die Fensterläden wieder geöffnet oder den Projektionsapparat abgestellt hätte.
»Also, Mister O'Donnell, jetzt gehen Sie zum Notar Doktor Salis, wo alles schriftlich geregelt wird, und morgen früh um zehn Uhr sind Sie wieder hier, worauf wir mit Miss Anna Kutschbach, der Olinda, alles Weitere besprechen werden. — Apropos, da fällt mir noch ein — es könnte sein, dass Sie die Dame schon jetzt beim Notar Salis treffen.
Reden Sie nicht mit ihr über die Sache, auch sie wird es nicht tun. Unterhalten Sie sich mit ihr über alles andere.
Nur auf das eine wollte ich Sie noch aufmerksam machen: Ich hatte vorhin gesagt, sie sei eine DeutschAmerikanerin.
Das ist die Olinda auch. Aber davon will sie nichts wissen, das mag sie nicht hören. Sie will eine echte Deutsche sein, die nur zufällig in Amerika geboren worden ist und sich mit dem ihr nun einmal aufgehängten Künstlernamen abfinden muss.
Sagen Sie ihr daher niemals, sie sei durch Geburt doch eine Amerikanerin. Das ist die einzige Stelle, an der sie empfindlich ist. Also morgen früh um zehn Uhr auf Wiedersehen.«
Mister O'Donnell war gegangen.
Der alte Yankee blickte nach der Tür, die sich hinter jenem geschlossen hatte, rieb sich das eckige Kinn und nickte vor sich hin.
»Ja, das ist der Mann, den ich für die Sahara brauche. Er kennt die Gegend und alle Verhältnisse, ist schon dort gewesen, weiß sich überall durchzuhelfen. Dabei treu wie Gold, absolut zuverlässig, unbestechlich. Nur in der einen Hinsicht muss ich vorsichtig sein. Ich hätte mich vorhin schon beinahe verplappert. Er wird nie einen Menschen töten, auch nicht, um sich eine Million Dollar zu verdienen. Na, das habe ich ja schon vorher gewusst, deshalb gebe ich ja auch den Snatcher mit.
Der hat ja da nun weniger ein sentimentales Gewissen, der macht schon für eine Flasche Whisky gleich ein Dutzend Menschen kalt, ohne erst nach dem Grund des Auftrags zu fragen. Diesmal freilich ist er nicht so billig.
So, das wäre also der letzte Fall gewesen, die Bearbeitung des AtakarGebirges in der Sahara. Die Posten auf der ganzen Erde sind verteilt. Nun will ich das ganze Register noch einmal prüfen und auch diese letzte Sache eintragen. Denn wenn man das nicht schriftlich macht, findet man sich zuletzt ja gar nicht mehr durch.«
Er setzte sich an den Tisch, zog die Schublade auf, nahm ein Büchlein heraus und las die Eintragungen halblaut vor sich hin, dazu auch noch einige Bemerkungen einschiebend.
»Erstens. Antonio Almeida aus Rio de Janeiro, der erfolgreichste Erforscher und beste Kenner des Amazonenstromes und dieses ganzen Flussgebietes. Der geht also den Rio Xingu hinauf, um den Loke Klingsor in seinem brasilianischen Schlupfwinkel aufzuspüren. Als Köder ist ihm beigegeben die Signorina Ravelli, die berühmte Geigenvirtuosin.
Zweitens. Walter Fürst. Wieder ein Deutscher. Er hat eine neue Flugmaschine erfunden, ich habe ihm die Möglichkeit gegeben, sie im Großen zu bauen. Der geht nach Island, etabliert sich auf dem Hekla, was aber ohne solche Flugmaschine gar nicht möglich ist. Wird begleitet von der Marie Warström, der sogenannten dänischen Nachtigall. Na, die kostet mich ja wieder ein Heidengeld. Außerdem sind das auch zwei solche sentimentale Naturen, die einen Bravo mitnehmen müssen, der mit Dolch oder Kugel oder Gift zu arbeiten weiß.
Drittens. William Atkinson. Bearbeitet das Feuerland, wo dieser Höllenfürst ebenfalls seinen Schlupfwinkel hat.
Was ich dem für einen weiblichen Köder mitgebe, weiß ich noch nicht, da habe ich noch einige Auswahl.
Viertens. Monsieur Charles Dubois, Australienforscher, geht also auch wieder ins Innere Australiens. Wird begleitet von der Miss Cobra, exzentrische Tänzerin und Sängerin.
Kein Bravo nötig. Dieses Weibsbild hat sich nicht umsonst den Namen der gefährlichsten Giftschlange beigelegt.
Fünftens. Professor Alois Flüeli aus — aus — aus — na, wie heißt doch das vertrackte Wort? Aus Graubünden.
Hat sich einen Namen gemacht durch die Erforschung des Himalajagebirges. Geht noch einmal hin, um den Gaurisankar zu besteigen, scheinbar im Auftrage der tollen Lady Fairhope, die Zeit ihres Lebens die Tiroler Alpen unsicher gemacht hat und nun auch einmal in Indien auf dem Himalaja herumkraxeln will. Nimmt ein halbes Dutzend Tiroler und Schweizer Bergführer mit. Singen oder sonst musizieren kann die zwar nicht, hat nichts weiter als ihre verteufelt hübsche Larve — na, die wird aber dort oben schon ihre Faxen machen, um den Loke Klingsor aus seinem Versteck in den Wolken hervorzulocken.
Sechstens. Dieser Fürst des Feuers scheint manchmal eine Abkühlung sehr nötig zu haben, dass er sich sogar auf dem Meeresboden eine Wohnung geschaffen hat. Mitten im Stillen Ozean. Dorthin begibt sich Richard Flint, der Sohn des deutschen ChampionTauchers Flint, welcher ein neues Unterseeboot und eine Taucherglocke konstruiert hat.
Ein ganz eigentümliches Ding, mehr eine Rüstung, in der er bis zu zweihundert Meter Tiefe tauchen können will.
Der braucht keinen weiblichen Köder. In dieser Krebspanzerung ist nichts von einer hübschen Larve und Körperreizen zu sehen, und unter Wasser singen ist auch nur eine halbe Sache.
Dafür oder trotzdem kostet mich dieser Kerl gleich drei Millionen Dollar, so viel forderte er, und ich musste sie ihm gewähren, anders war er nicht zu haben.
So, und nun kommen als Nummer sieben noch Mister James O'Donnell, die Olinda und der Snatcher hinzu, für das AtakarGebirge in der Sahara.«
Mister Philipp trug die betreffende Notiz ein.
Und was macht das nun alles zusammen?
Achtzehn Millionen Dollar. Er legte den Bleistift hin, lehnte sich zurück und blickte vor sich hin.
»Achtzehn Millionen Dollar!«, wiederholte er, und seine Stimme zitterte vor Erregung. »Ich habe sie darangesetzt, um sieben aus Strichen bestehende Buchstaben zu bekommen. Bin ich denn wahnsinnig? Nein, Samuel Philipp hat noch immer gewusst, was er tat. O, diese Runen, diese sieben Runen! Ich habe das Buch in der Hand, das mir alle Schätze der Erde ausliefert und mir die wunderbarsten Geheimnisse offenbart, das mich über Alter und Tod erhaben macht — aber der Schlüssel, der Schlüssel fehlt mir dazu! Dieser Loke Klingsor trägt ihn auf dem Rücken, kann ihn nicht benutzen, weil ihm wieder das Buch fehlt, und doch gibt er ihn nicht heraus, was ich auch schon alles versucht habe. Bisher im Guten. Wohl, so wird nun einmal zu anderen Mitteln gegriffen.
Ja, ich bin entschlossen, alle meine hundert Millionen zu opfern, um diese sieben Runen zu bekommen! Loke Klingsor, Du Mann mit den Teufelsaugen, höre meinen Schwur: Und wenn ich noch von tausend Verstecken höre, die Du auf der Erde besitzest, ich spüre Dir in allen tausend nach, und wenn Du eine Residenz auf einem fernen Planeten hast, ich werde auch Mittel und Wege finden, Dir dorthin zu folgen, und wenn Du eine Wohnung im Mittelpunkt der Erde hast, ich grabe Dir bis zum Mittelpunkt der Erde nach, bis in die Hölle hinein —«
Der Sprecher brach ab, zuckte zusammen, lauschte.
Was war denn das?
Dort drüben in jenem Zimmer, dessen Tür nur angelehnt war, erklang plötzlich eine Stimme. Ein prachtvoller und machtvoller Bariton sang den Anfang der berühmten Teufelsballade von John Burns:
Der auf dem Höllenthron ich sitze,
Der ich in Höllenflammen schwitze,
Der ich in Höllentiefen blitze,
Wo Laven glühn,
Mit Pech und Schwefel um mich spritze,
Euch zu verbrühn.
Der alte Yankee lauschte mit wahrhaft entsetztem Gesicht, den Mund halb geöffnet.
Also nicht etwa, dass es einer seiner Diener sein konnte, der dort drüben einmal seiner Sangeslust Luft machen wollte.
»Was — was — ist — denn — das?!«
Und langsam erhob er sich, schlich in gebückter Haltung nach der Tür.
Drüben fuhr die herrliche Baritonstimme fort:
Bald bin ich Löwe, Blut zu lecken,
Bald tu ich mich als Schlange strecken,
Bald riesig, Kirchen abzudecken,
Als wilder Föhn.
Doch auch in Herzen kann ich stecken,
Klein, ungesehn...
Samuel Philipp hatte die Tür erreicht.
Mit zitternder Hand öffnete er sie vollends, spähte scheu in das Zimmer.
Und dann stürzte er vorwärts.
»Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr! Das ist ein Trugbild der Hölle!«
So erklang es gellend im Tone des furchtbarsten Entsetzens.
Und dann dort drüben ein Lärmen, als fände ein wildes Handgemenge statt.
Darauf ein Fauchen und misstönendes Katzengeschrei.
Dann krachte ein Schuss, und schließlich war alles wieder still.
Die farbigen Diener waren in einer anderen Etage des großen Hauses beschäftigt gewesen.
Sie hatten nichts von dem Singen gehört, nicht einmal den Schuss.
Erst eine Viertelstunde später musste einer von ihnen das Schreibzimmer betreten, um dem Master eine Meldung zu bringen.
In dem Schreibzimmer war er nicht. Doch die Tür zum Nebenzimmer war halb geöffnet.
In dem finsteren Raume war noch immer das Lichtbild an der Wand. Noch immer saß der dämonische Mann mit den Teufelsaugen im Lehnstuhl, ein Bein über das andere geschlagen, auf der Schulter die schwarze Katze.
So blickten die Teufelsaugen herab auf den alten Mann, der neben dem Tisch am Boden lag, in der Hand einen Revolver, regungslos.

Er musste den Revolver abgeschossen haben; in dem Lichtbilde war dicht neben dem Kopfe des unheimlichen Mannes ein tiefes Loch in der Wand, dort war die Kugel hineingefahren.
Und Mister Samuel Philipp?
Er war nur bewusstlos, kam bald wieder zu sich; hatte nur eine tüchtige, blauaufgelaufene Brausche mitten an der Stirn.
Und außerdem über dem Gesicht lange, blutige Kratzwunden.
Woher hatte er die?
Er sagte es seinen Dienern nicht, ehe er sich verstört in sein Schlafgemach zurückzog.
Einige von ihnen hatten dieses Lichtbild schon mehrmals gesehen, ihren Herrn in Gedanken versunken und leise murmelnd davor stehen — aber es fiel ihnen nicht auf, dass der Mann mit den Teufelsaugen jetzt nicht mehr das rechte Bein über das linke, sondern das linke über das rechte geschlagen hatte.
Sie merkten auch nicht, dass der patagonische Wurfhammer jetzt anders an der Wand hing, als wie er früher gehangen hatte.
W, ir versetzen uns in einen Vorort Berlins, in eine Villenkolonie, bevorzugt von Gelehrten, die ganz still leben wollen, die es sich leisten können, dass ihnen auch die ganze Straße gehört, sodass kein Automobil und kein anderes Fuhrwerk sie in ihrer Ruhe stören darf.
Es war bald Mitternacht.
In dem großen Bibliothekszimmer einer Gartenvilla ging rastlos ein noch junger Mann auf und ab, die Arme über die Brust verschränkt.
Eine hohe, übermäßig schlanke Gestalt, die sich sehr schlecht hielt, schon mehr gebückt als nur gebeugt, das ideale Gesicht des blonden Lockenkopfes durch und durch vergeistigt, selbst die schlanken Hände förmlich durchsichtig.
Ein eingefleischter Bücherwurm, das war sofort erkenntlich, der sich das Rückgrat ganz krumm gesessen hatte, wodurch ihm auch die Brust eingedrückt worden war.
Gerade deshalb aber war etwas anderes sehr bemerkenswert. Seine Kleidung. Wir wollen gleich erwähnen, dass dieser junge Gelehrte heute schon den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen hatte, keinen Ausgang vorgehabt, keinen Besuch erwartet hatte. Er hatte arbeiten wollen. Und trotzdem trug er weder Schlafrock noch Filzpantoffeln, sondern einen tadellosen Gehrockanzug mit Kragen und Manschetten und an den Füßen feste Lederstiefel, so wie er sie immer zu Hause trug, und wenn er auch die ganze Nacht am Schreibtisch über Papier und Bücher gebeugt saß. Wirklich sehr bemerkenswert.
Professor Doktor Freiherr Karl von Edeling hatte des Lebens Sorgen nie kennen gelernt. Davon, dass er seine erste Jugend auf des Vaters Rittergut verbracht, von Hauslehrern erzogen worden, dass ihm jegliche Freiheit gestattet gewesen, hatte er freilich auch nie etwas gehabt. Freilich war er nie auf ein Pferd geklettert, nicht einmal auf einen Baum. Er hatte nie zu so etwas Zeit gehabt.
Er mochte drei Jahre alt gewesen sein, als die Gouvernante dem kleinen Baron einmal etwas von der Gudrun erzählt hatte, und da war sein Schicksal bereits entschieden. Er hatte schon seinen zukünftigen Beruf gewählt.
Er war Germanist geworden. Hauptsächlich auf die Kriegstaktik der altnordischen Völker hatte er sich geworfen. Er, der als langaufgeschossener Jüngling wegen allgemeiner Schwächlichkeit des Kaisers Rock nicht hatte tragen dürfen.
In dieser alten Kriegstaktik verfolgte er eine Spezialität — die Belagerungskunst. Er war eine Kapazität auf dem Gebiete der Ballisten, Katapulte, Onager und wie die Wurfmaschinen alle hießen, mit denen man vor der Erfindung des Schießpulvers die belagerten Städte bombardierte. Aber in dieser seiner Spezialität war er nicht so einseitig, sie nur auf das nordische Kriegswesen auszudehnen. Da umspannte sein Wissen, wie auch noch in anderer Hinsicht, die ganze Welt, alle Völker der Erde.
Ehe der berühmte Giovanni in Mailand an sein Kolossalgemälde ging — Die Belagerung von Salamis durch Demetrius Poliorketes, 306 vor Christi — reiste er erst nach Berlin, nur um Professor von Edeling wegen der Belagerungsmaschinen zu Rate zu ziehen.
Und Professor Edeling hatte das Modell solch einer historischen Wurfmaschine nach seinen Angaben und nach noch vorhandenen Plänen und Zeichnungen anfertigen lassen, die berühmte Helepolis, das ist so viel wie die Städtebezwingerin. Dort stand das Ding unter einer Glasglocke.
Diesem zierlichen Modell sah man freilich nicht an, dass die Belagerungsmaschine, ein ganzes Haus, mehr als sechzig Meter hoch gewesen war, bei einer Breite und Tiefe von dreißig Metern. Jedes der acht Räder fünf Meter im Durchmesser, jede Speiche — alles nur aus Holz — einen Meter dick. Dreitausend Mann gehörten dazu, um diese Hauskanone fortzubewegen. Die Maschine schleuderte Steine im Gewichte bis zu sechs Zentnern zwölfhundert Meter weit. Die treibende Kraft dabei war ein Tau, welches zusammengeknebelt wurde und beim plötzlichen Loslassen einen Balken vorschnellte, auf dem das Geschoss lag. Da nun das Menschenhaar die größte Dauerhaftigkeit und Tragfähigkeit besitzt, noch weit mehr als der Faden der Seidenraupe, so hatten für dieses Tau in Griechenland und Kleinasien mehr als zwanzigtausend Frauen und Mädchen ihr langes Haar lassen müssen.
Das sind Verhältnisse und Zahlen! Im Jahre 306 vor Christi Geburt! Alles historisch! Die Pläne und Berechnungen des Antichomenes, der diese Helepolis erbaut hat, liegen noch heute in der Bibliothek des Vatikans zu Rom, die staatliche Bibliothek in Berlin besitzt eine Kopie davon. —
Bis vor einem halben Jahre hatte Freiherr Doktor Karl von Edeling als ordentlicher Professor Vorlesungen über Germanistik gehalten. Seine letzte war durch einen Bluthusten unterbrochen worden. Er war wieder genesen. Scheinbar. Seit dieser Zeit lebte er noch zurückgezogener als zuvor in seiner stillen Gelehrtenklause, die er nur mit seinem alten Diener Valentin teilte, den er noch vom Vater übernommen, der ihm Köchin, Stubenmädchen und alles ersetzte.
Also Professor Edeling, wie wir ihn einfach nennen wollen, weil er selbst nur so genannt sein wollte, hatte heute den ganzen Tag über am Schreibtisch gesessen. Am späten Nachmittag hatte er dem alten Valentin, wie dieser gebeten, für die ganze Nacht Urlaub gegeben; der Mann wollte Schwiegertochter und Enkel besuchen. Morgen in aller Frühe war er wieder zurück, bis dahin konnte sich sein bedürfnisloser Herr allein behelfen.
Professor Edeling gab seine Wanderung durch das Zimmer auf und setzte sich wieder vor dem Schreibtisch nieder. Aber die Verschränkung der Arme löste er noch nicht.
Im Stuhle zurückgelehnt, blickte er auf einen Kupferstich, der ihm gegenüber an der Wand hing.
Ein bekanntes Bild.
In einer engen Klosterzelle sitzt ein Mönch, ein junger, schöner, kraftvoller Mann, dem die Kutte und die Tonsur ganz und gar nicht stehen will. Viele Bücher, an der Wand hängen Landkarten, neben dem Tisch steht ein riesiger Erdglobus. Also der junge Mönch treibt Geografie. Natürlich nur in der Klosterzelle. Das ist ungefähr so, als wenn ein freiwilliger oder unfreiwilliger Hungerkünstler in einem Kochbuche verschiedene Rezepte liest.
Jetzt studiert er nicht. Gedankenvoll blickt er vor sich hin.
Und da hat sich vor seinen geistigen Augen visionär die Klostermauer geöffnet.
Er blickt in einen schattigen Hain, sieht visionär ein Liebespaar wandeln, eng umschlungen, ein ritterlicher Jüngling und eine holdselige Maid.
Und der ritterliche Jüngling trägt dieselben Züge wie hier der Zellenbewohner.
Armes, armes Mönchlein! — — —
Auf dieses Bild waren des jungen Professors träumende Augen gerichtet.
Jetzt hob ein qualvoller Seufzer seine Brust.
Weh mir, dass ich das goldene Leben versäumt habe!
Eine energische Bewegung und die Schwäche war vorüber.
Er nahm das Schriftstück, an dem er den ganzen Tag geschrieben, brach es zusammen und schob es in ein Kuvert. Dann verklebte und versiegelte er es und schrieb mit kräftigen Zügen darauf:
»Mein letzter Wille.«
Hierauf erhob er sich etwas, um von einem Wandbrett ein Fläschchen zu nehmen.
War es ein Wunder, dass er dieselben Worte sprach wie Faust, ehe er sich das erlösende Tränklein bereitete?
»Ich grüße Dich, Du einzige Phiole.«
Den Inhalt des Fläschchens schüttete er hierauf in ein Glas, setzte sich recht bequem in den Lehnstuhl zurecht, schloss die Augen und führte das Glas an den Mund.
Keine Osterglocken konnten ihn wie den Faust abhalten, sich von allem Wissensdurst zu entladen. Es war Mitternacht, und es war nicht Ostern.
Aber ein anderer Glockenton sollte dasselbe erreichen.
Plötzlich, eben als er den ersten Schluck tun wollte, ertönte ein furchtbar schrilles Klingeln.
Doppelt furchtbar bei dieser unvermuteten Plötzlichkeit in dieser Stille angesichts des Todes.
Das Tischtelefon hatte geklingelt.
Da hätte auch jeder andere das Tränklein noch einmal abgesetzt, um sich erst einmal zu überzeugen, wer ihn angerufen habe.
Auch Professor Edeling tat es, und das umso mehr, weil er sich erst einmal überzeugen wollte, wie es überhaupt möglich war, dass er telefonisch angerufen werden konnte.
Das Tischtelefon war nämlich, wie er sich sofort überzeugte, überhaupt nicht gestöpselt, hatte gar keine Verbindung.
Professor Edeling war nicht sehr fürs Telefonieren eingenommen. Wenn ihn jemand telefonisch sprechen wollte, so musste ihm das vorher unter Angabe von Grund und Zeit schriftlich mitgeteilt werden.
Nein, das Telefon war nicht gestöpselt, hatte keine Verbindung. Und doch hatte es geklingelt?
Also Professor Edeling setzte den Giftbecher erst noch einmal hin und nahm den Hörer ans Ohr.
»Ist jemand dort?«
»Habe ich die Ehre, Herrn Professor Doktor Freiherr Karl von Edeling zu sprechen?«, erklang aus dem Schalltrichter eine sonore, prächtige Bruststimme, und zwar mit einer Deutlichkeit, die der Professor niemals an seinem Telefon gewohnt gewesen war.
»Jawohl, der ist hier, der bin ich.«
»Ich begrüße Sie, Herr Baron.«
»Ja, wer ist denn dort?«
»Loke Klingsor.«
»Loke Klingsor?«, wiederholte der Professor in steigender Verwunderung.
»Kennen Sie diesen Namen nicht?«
»Loke war der germanische Gott des Feuers«, musste wohl auch der befragte Professor erklären, »und Klingsor von Ungerland war —«
»Nein, nein«, wurde der Erklärer rasch unterbrochen, »ich bin ein selbstständiger Loke Klingsor, den es auf dieser Erde nicht zum zweiten Male gibt. Doch ich weiß schon, Sie kennen mich noch nicht. Nun, so machen wir unsere Bekanntschaft eben jetzt.«
»Ja, wo sind Sie denn eigentlich?«
»Auf dem Chimborasso!«
»Chimborasso?«, wiederholte der Professor verständnislos. »Wo ist denn das?«
»Na, Sie werden doch den Chimborasso kennen.«
»Sie meinen doch nicht etwa den höchsten Berg in Südamerika, in den Kordilleren, im Staate Ekuador?«
»Jawohl, eben den meine ich, auf dem befinde ich mich, 6243 Meter über dem Meeresspiegel. Ich würde gern noch höher steigen, aber es geht nicht, der Chimborasso ist oben alle.«
»Was machen Sie denn auf dem Chimborasso?«, fragte der Professor, dabei aber in Gedanken nur darüber grübelnd, wie durch das ungestöpselte Telefon überhaupt jemand sprechen könne.

»Ich heize ihn, damit dieser alte Vulkan, der schon seit Jahrhunderten geschlafen hat, endlich wieder einmal erwacht. Ich mache Feuer dahinter. Deshalb bin ich jetzt eben auch am Nordpol gewesen. Da habe ich aber nicht gefeuert, sondern die Erdachse geschmiert. Damit die Erde ein bisschen fixer rotiert. Sonst geht noch die ganze Atmosphäre in Fäulnis über, die ganze Menschheit schläft völlig ein.«
»Ja, ja, Herr Klingsor, Ihre Worte sind gar nicht so unrecht, aber... wie ist es Ihnen möglich, mit mir zu sprechen? Wie haben Sie sich mit mir verbinden lassen?«
»Das erfahren Sie nicht.«
»Weshalb nicht?«
»Weil Sie meine Erklärung ja doch nicht begreifen würden.«
»Ich verstehe nicht.«
»Na ja, das habe ich doch eben jetzt gesagt.«
»Herr, was wünschen Sie eigentlich?!«
»Sie.«
»Mich?«
»Jawohl, Sie.«
»Was wollen Sie von mir?«
»Dasselbe wie hier auf dem Chimborasso und wie am Nordpol. Ich will bei Ihnen ein paar Kohlen nachschaufeln und ein bisschen schmieren, damit auch bei Ihnen Feuer und Schwung dahinterkommt.«
Über das blasse, durchgeistigte Gesicht des jungen Professors huschte eine leichte Röte.
»Die Unterhaltung mit Ihnen ist sehr interessant, Herr Klingsor, aber — ich habe leider keine Zeit dazu.«
»Ich habe Zeit genug. Doch gut, so will ich Ihnen gleich klipp und klar eröffnen, was ich Ihnen zu sagen habe. Herr Professor Doktor Freiherr Karl von Edeling! Sie werden in meine Dienste treten! Sie werden mir von jetzt an bedingungslos gehorchen! Verstanden?«
»Oho, oho!«, lächelte der junge Gelehrte. »Na schön, ich will einmal darauf eingehen. Befehlen können Sie mir ja nach Belieben, ob ich auch gehorche, das ist freilich eine andere Sache. Was hätten Sie mir denn nun zu befehlen?«
»Wohlan, passen Sie gut auf! Sie werden sich dann noch alles aufschreiben, jetzt sollen Sie erst einmal alles im Zusammenhang hören.
Also Sie packen sofort Ihre Koffer!
Nur etwas Leibwäsche und dergleichen, was man für eine Reise von zehn Tagen braucht.
Gegen ein Uhr fahren Sie mit der Vorortsbahn nach Berlin, nehmen einen Wagen oder ein Auto und rutschen nach dem Lehrter Bahnhof, benutzen den ersten Schnellzug, der früh um drei Uhr nach Hamburg fährt.
In Hamburg angekommen, begeben Sie sich sofort ins Freihafengebiet, und zwar in den Hansahafen.
In diesem liegt der ›Prinz Friedrich‹. Führer ist Kapitän Schumann.
Es ist zwar nur ein Frachtdampfer, er nimmt aber auch einige Passagiere mit, ist dafür eingerichtet, und Kapitän Schumann ist ein sehr liebenswürdiger Mensch.
Der Dampfer geht nach Kapstadt, und Sie gehen mit, für sechshundert Mark, welche Sie doch zu Hause haben und also einstecken werden, auch noch etwas mehr.
Aber nicht etwa, dass Kapitän Schumann schon von Ihnen weiß oder noch von Ihrem Kommen benachrichtigt wird. Das mache ich jetzt alles nur mit Ihnen aus.
Morgen früh um zehn Uhr verlässt der ›Prinz Friedrich‹ den Hafen. Sie haben also gar nicht viel Zeit, bleiben gleich an Bord.
Der Dampfer läuft nur die Kanarischen Inseln an, und zwar trifft er am achtzehnten in Santa Cruz auf Teneriffa ein, früh acht Uhr dreiundzwanzig Minuten lässt er den Anker fallen.
Am anderen Tage geht es weiter nach Kapstadt. Aber so weit gehen Sie nicht mit.
Vier Tage später, also am dreiundzwanzigsten, stellen Sie gegen Abend Ihre Taschenuhr genau nach der Schiffsuhr. Oder Sie können sich überhaupt nach dieser richten.
Kurz vor elf Uhr gehen Sie an Deck nach hinten. Sie werden ganz allein sein, niemand wird Sie beobachten.
Und sobald die Schiffsglocke drei Doppelschläge glast, elf Uhr, springen Sie auf Backbordseite, also auf der linken, hinten über Bord, ins Meer.
Schwimmen können Sie ja. Das wenigstens ist Ihnen in der Jugend zwischen Ihren Gouvernanten und Schranzen beigebracht worden. Und schwimmen kann man nie wieder verlernen.
Springen Sie nur, so gut Sie können, machen Sie sich nichts daraus, wenn Sie tüchtig aufs Wasser klatschen. Haben Sie keine Angst vor der Schraube, Sie werden sofort davon frei kommen, und dann schwimmen Sie los.«
»Wohin?«
»Nun, natürlich dorthin, wo Sie in der stockfinsteren Nacht ein Lichtchen schimmern sehen.
Sie werden immer von einigen phosphoreszierenden Haifischen umgeben sein, aber daraus machen Sie sich nichts.
Das sind liebe Tierchen. Wenigstens in diesem Falle für Sie. Ihr Schicksal bestimmt nicht, dass Sie im Magen eines Haifisches enden sollen.
Wohin das Lichtchen Sie führen wird, das darf ich Ihnen jetzt noch nicht verraten.
Haben Sie mich verstanden. Herr Professor von Edeling?«
Ja, der Professor hatte jedes Wort verstanden.
Und nun wusste er, er hatte es hier mit einem Irrsinnigen zu tun, der irgendein Mittel kannte, um ein Telefon zu benutzen, auch wenn es nicht eingeschaltet war, wenn es nur noch an den Drähten hing. Irrsinnige sind oftmals sehr schlau, bis zur Genialität. Wahnsinn und Genie grenzen ja überhaupt dicht aneinander.
Und dieser Irrsinnige wollte sich jetzt als rätselhafter, die Zukunft beherrschender Prophet aufspielen, hatte sich als Opfer den Professor von Edeling auserkoren, von dessen Jugend und Lebensverhältnissen er etwas wusste.
Von Neuem ertönte die Stimme durchs Telefon.
»Also hören Sie, Herr Professor, nun will ich Ihnen alles noch einmal sagen, schreiben Sie es sich auf.«
»Das ist nicht nötig, Herr Klingsor, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis.«
»Können Sie wirklich alles im Kopfe behalten?«
»Sicher. Examinieren Sie mich doch.«
»Was sollen Sie tun?«
»Sofort meinen Koffer packen, mit einiger Wäsche und dergleichen für eine Reise von zehn Tagen. Gegen ein Uhr, also heute Nacht noch, nach Berlin fahren und nach dem Lehrter Bahnhof, den um drei nach Hamburg abgehenden Schnellzug benutzen.«
»Gut. Und weiter?«
»In Hamburg begebe ich mich sofort nach dem Hansahafen, dort liegt der Dampfer ›Prinz Friedrich‹, der nach Kapstadt geht. Kapitän Schumann nimmt mich für sechshundert Mark mit.
Unterwegs laufen wir nur Santa Cruz an. Dann geht es weiter nach Kapstadt!«
»Halt!«, wurde der Professor unterbrochen. »Wann trifft der Dampfer in Santa Cruz ein?«
»Am achtzehnten.«
»Wann lässt er dort im Hafen den Anker fallen?«
»Früh 8 Uhr 23 Minuten.«
»Gut, ich bin mit Ihrem Gedächtnis zufrieden. Fahren Sie fort.«
»Am anderen Tage geht es weiter nach Kapstadt.
Vier Tage nach der Abfahrt von Santa Cruz, also am dreiundzwanzigsten, gehe ich nachts vor elf Uhr auf Deck nach hinten, und sobald die Schiffsglocke mit drei Doppelschlägen die elfte Stunde schlägt, springe ich hinten auf der linken oder Backbordseite ins Meer, schwimme nach einem Lichtchen, das ich erblicke.«
»Richtig! Sie haben alles ganz gut behalten«, wurde wieder gelobt. »Dann nur noch eine Frage, Herr Professor, wobei Sie auch gleich so andeutungsweise erfahren, wozu ich Sie brauchen will: Sie haben doch das epochemachende Werk über die Belagerungsmaschinen des Altertums und Mittelalters geschrieben. Besonders ausführlich haben Sie darin die sogenannte Helepolis behandelt, dieses Ungeheuer von einer Wurfmaschine, mit der Demetrius Poliorketes die Stadt Salamis bombardierte. Wären Sie imstande, mir solch eine Helepolis im Großen zu bauen, wenn Sie die nötigen Leute und das nötige Material erhalten?«
»O ja, das könnte ich«, ging der Professor auch hierauf gleich ein.
»Ich will nämlich eine befestigte Stadt berennen. Schon seit zwei Jahren belagere ich sie vergebens. Dabei darf ich nur Ballisten und Katapulte und ähnliche Wurfmaschinen verwenden. Aber es gelingt mir nicht, die Feste zu nehmen, weder im Sturm noch durch Bombardement, obgleich ich in den zwei Jahren schon mehr als zehntausend meiner besten Krieger geopfert habe. Nun möchte ich es noch einmal mit so einer riesenhaften Schleudermaschine versuchen! Ob es mir da nicht gelingt, die Stadt in Trümmer zu legen oder doch in die Umfassungsmauer eine Bresche zu schlagen, dass sie sturmreif ist.«
»Gewiss, Herr Klingsor, gewiss, solch eine Helepolis könnte ich Ihnen bauen. Wo liegt denn diese Stadt, die Sie bestürmen, wenn ich fragen darf?«
»Im Innern Australiens.«
»Aha, aha!«
»Sie gehört der Königin von Thule und wird von ihr persönlich verteidigt, das heißt mit einer Besatzung von mehr als fünftausend auserlesenen Helden.«
»Aha, aha! Die Königin von Thule, jawohl, ich weiß schon. Na, Herr Klingsor, die wollen wir beide zusammen schon unterkriegen.«
»Na, na — von wegen — wir beide zusammen! Wissen Sie denn, wer ich bin? Freilich, Sie hatten das Recht, mich bisher immer nur Herr Klingsor anzureden, weil Sie es eben nicht anders wussten. Ich bin ein mächtiger Fürst! Und Sie haben für mich eine Helepolis zu bauen, nichts weiter.«
»Ich bitte demütig um Entschuldigung, Euer Durchlaucht, das habe ich nicht gewusst. Darf ich zu fragen wagen, Fürst von welchem Reiche?«
»Vom Reiche des Feuers.«
»Aha! Der Fürst des Feuers. Herrlich!«
»Jawohl, ich bin der Fürst des Feuers in meiner höchsten Stellung. Im gewöhnlichen Leben bin ich nur der Loke Klingsor. Dazwischen nehme ich noch eine Mittelstellung ein. Als Burggraf führe ich den Namen de Born. Sie kennen doch diesen Namen?«
Und ob Professor Edeling eine historische Persönlichkeit dieses Namens kannte!
Und wir müssen hierbei etwas verweilen, da diese ganze Erzählung hierauf aufgebaut ist.
Bertran de Born, Graf von Autafort, geboren um 1140 auf seinem Stammschlosse in Perigord, war ein Troubadour, also ein ritterlicher Sänger. Weniger ein Minnesänger. Wohl hat er auch Liebeslieder von wunderbarer Zartheit gedichtet, aber sein Element war doch der Kampf. In seinem »Sirventes« atmet alles Kampf!
Er hat sein ganzes Leben lang nichts weiter getan als gekämpft, Krieg geführt. Wenn er keine Kriegsdienste fand, dann zog er auf eigene Faust zur Fehde. Oder er wusste irgendwo wieder ein Feuerchen zu entfachen, manchmal auch eine riesenhafte Glut. So war der Bruderkrieg zwischen Heinrich und Richard, den Söhnen Heinrichs II. von England, hauptsächlich Bertran de Borns Mache gewesen. Als der Frieden im ganzen Lande geschlossen war, hielt er es nicht lange aus. Diesmal machte er es aber auch gleich ganz gründlich. Er stachelte nicht nur von Neuem den jungen Heinrich wider Bruder und Vater auf, brachte nicht nur ganze Provinzen zur Rebellion, sondern entführte auch gleich noch die Tochter des englischen Königs, obgleich diese schon mit dem Herzog von Lamartin verlobt war.
Diesmal jedoch erreichte ihn sein Schicksal. Der junge Prinz Heinrich fiel an seiner Seite, und der furchtbar ergrimmte König selbst zog mit Heeresmacht gegen Autafort, in das sich Bertran de Born geworfen hatte, erstürmte es und nahm den Rebellen gefangen, um ihn seinen Zorn fühlen zu lassen.
Nun aber geschah das Großartigste von der ganzen Sache.
Bertran de Born war nicht nur ein gewaltiger Kampfesheld, sondern er wird von seinen Zeitgenossen auch als ein äußerst scharfsinniger Geist gepriesen. Und er selbst rühmte sich öffentlich, immer in seiner herausfordernden Weise, dass er überhaupt stets nur der Hälfte seines Geistes bedürfe, um mit jeder Sache und Aufgabe fertig zu werden.
Und es ist historische Tatsache, dass König Heinrich II., als Bertran de Born gefangen vor ihn geführt wurde, ihn nach kurzem Wortwechsel an sein Herz drückte.
Ihn, der ihm Sohn und Tochter geraubt hatte, den er hatte zermalmen wollen. Ihn schloss er als Freund in seine Arme. Bertran de Born hatte ihn einfach bezaubert durch seinen Geist, als Dichter, als Troubadour.
Diesen Moment hat Ludwig Uhland in einer Ballade, betitelt »Bertran de Born«, festgehalten.
Selbstverständlich kannte Professor Edeling diese Ballade, er hatte sie im Kopf, sobald er den Namen »Bertran de Born« hörte.
»Ah so, Sie sind der Graf Bertran de Born!«
»Nun, nicht der, der vor achthundert Jahren gelebt hat, so alt bin ich noch nicht. Ich führe nur diesen Namen als Burggraf. Aber immerhin, ich habe eine ganz merkwürdige Ähnlichkeit mit jenem Ritter und Troubadour in der verschiedensten Hinsicht. Auch ich bin ein Sänger, und auch ich kenne nichts weiter als den Kampf. Aber nun vor allen Dingen für unseren Fall: Auch ich habe eine Geliebte, welche die Tochter eines Königs ist, und auch sie ist einem Herzog angelobt, wider ihren Willen. Ich beabsichtige, sie gleichfalls zu entführen. Ist das nicht ein merkwürdiges Zusammentreffen?«
»In der Tat, ganz erstaunlich!«
»Wissen Sie, Herr Professor, wie der Bote hieß, den Bertran de Born mit einem Liede hinschickte an den Königshof, auf dass seine Geliebte einstweilen einen Trost erhielt?«
»Nein, das weiß ich allerdings nicht.«
»Das war natürlich ebenfalls ein ritterlicher Troubadour.«
»Selbstverständlich.«
»Er hieß Magelon. Wollen Sie mein Magelon sein?«
»Ach, Sie meinen, ich soll an den Königshof gehen und Ihrer Geliebten ein Lied vorsingen?«
»Jawohl, das meine ich! Ein Lied von mir, das sie kennt, durch das Sie der gefangen gehaltenen Dame eine nur ihr verständliche Botschaft zugehen lassen, dass Rettung nahe ist.«
»Ei gewiss, Euer Durchlaucht, oder Herr Graf, das wird gemacht, wird gemacht!«
»Jetzt bin ich für Sie nur der Loke Klingsor.«
»Jawohl, Herr Klingsor, machen wir, machen wir! Also ich gehe nach England und —«
»Nach England? Was wollen Sie denn in England?«
»Na, ich denke, ich soll an den englischen Königshof, um der Tochter des Königs —«
»Na, erlauben Sie mal, Herr Professor? Was wollen Sie denn bei dem englischen König? Oder Sie sind wohl um achthundert Jahre zurück? Ich meine doch den König von Salamandrien. Seine Tochter ist meine Heimlichgeliebte, der sollen Sie etwas vorsingen.«
»Aaahhso, den König von Salamandrien meinen Sie! Ja, Herr Klingsor, das hätten Sie gleich sagen sollen! Aber — ich bitte um Verzeihung, ich bin etwas schwach in der Geografie — wo liegt doch gleich dieses Königreich Salamandrien?«
»Im See von Tegrinoor, auf dem Hochplateau von Tibet.«
»Ach, richtig, nun fällt's mir ein — das berühmte Salamandrien von Tengrinoor! Unten auf dem Boden des Sees, nicht wahr?«
»Jawohl, es liegt unter dem Wasser, daher der Name Salamandrien!«
»Gut, Herr Klingsor, da gehe ich hin als Ihr Magelon und singe Ihrer Geliebten etwas vor. Nur auf etwas möchte ich Sie rechtzeitig aufmerksam machen.«
»Worauf?«
»Ich habe noch keinen Ochsenfrosch brüllen hören, wenn er sein Lieblingslied anstimmt, aber — viel anders wird es bei mir auch nicht klingen. Ich bin ganz und gar unmusikalisch. Ich habe durchaus keine Stimme. Mir ist es eine Qual, mich selber singen zu hören. Es klingt schauerlich.«
»O, das wird sich bald ändern. Da brauche ich Sie nur ein paar Wochen in die Kur zu nehmen, dann können Sie singen wie der bestbezahlte Opernsänger. Auf so etwas verstehe ich mich.«
»Na, dann geht's ja. Da bin ich beruhigt!«
»Und inzwischen wird nach Ihren Anweisungen die Helepolis gebaut, wir bringen sie nach Australien und schießen die Hauptstadt der Königin von Thule zusammen.«
»Jawohl, Herr Klingsor, das machen wir!«
»Dann ist unser Gespräch jetzt beendet. Packen Sie Ihren Koffer und fahren Sie nach Berlin, es wird Zeit, deshalb Schluss!«
Das Telefon klingelte ab.
Schnell hatte sich der Professor überzeugt, dass er jetzt tatsächlich ohne jede Verbindung war.
Jetzt stöpselte er und rief das Amt an; dieses antwortete sofort.
»Wer hat soeben mit mir gesprochen?«
Auf dem Amt wusste man nichts von einer Verbindung seiner Nummer mit einer anderen.
Es war und blieb ein Rätsel, wie jemand mit ihm hatte sprechen können.
Und dann ging Professor Edeling daran, ein Köfferchen zu packen, um nach Berlin und weiter nach Hamburg zu fahren.
Er wollte in der Tat dem Wunsche jenes Loke Klingsor Folge leisten.
Nicht etwa, dass er alles das, was der seiner Meinung nach Irrsinnige ihm auf so geheimnisvolle Weise telefonisch mitgeteilt hatte, glaubte. Aber er war ja ein Todeskandidat, dem erst am Tage zuvor ein bedeutender Arzt versichert hatte, dass er im günstigsten Falle noch vier Wochen zu leben hätte, da er hochgradig schwindsüchtig sei.
Der Todeskandidat hatte deshalb soeben sein Testament gemacht, hatte seine sonstigen Angelegenheiten geordnet.
Professor Edeling hatte keine Lust, so lange zu warten, bis sein letztes Lungenbläschen geplatzt war, um dann noch tagelang im Todeskampfe zu liegen.
Um dem zu entgehen, hatte er sich hingesetzt und das erlösende Tränklein schlürfen wollen.
Da hatte das Telefon geklingelt, der Irrsinnige war dazwischengekommen und hatte ihm eine gute Idee gegeben.
Wer möchte sich nicht gern die schöne Welt besehen?
Auch Professor Edeling wäre gern gereist. Er hätte es sich leisten können. Aber er hatte nie Zeit dazu gehabt. Immer bis an den Hals in Arbeit steckend, war er noch niemals weit von Berlin fortgekommen.
Na, so wollte er wenigstens die letzten vier Wochen, die ihm vom Leben blieben, dazu benutzen, um noch ein Stück Welt zu sehen. So weit man in vier Wochen eben kommen kann.
Wenn er dann das Ende nahen fühlte, konnte er es ja noch immer abkürzen.
Also packte er sein Köfferchen, steckte Geld ein, drehte das elektrische Licht aus, schloss das Haus ab, begab sich auf den Bahnhof, fuhr nach Berlin und mit dem Schnellzug früh um drei dann weiter nach Hamburg.
I mmer mehr wird der geneigte Leser merken, dass diese Erzählung erhaben ist über Raum und Zeit. Wir können aus der Gegenwart gleich einmal tausend Jahre vorwärts oder auch bis ins graue Altertum zurückkommen. Die Sache mit den Ballisten und Katapulten war schon eine Andeutung davon.
Vorläufig bleiben wir noch in der Gegenwart, versetzen uns aber von Berlin nach Sydney.
Rechtsanwalt Maxim Iron, ein Witwer, hatte mit seiner einzigen Tochter Evelyn zu Abend gespeist.
Iron heißt Eisen, und dieser Mann wurde nur der Solicitor oder Rechtsanwalt Eisenkopf genannt, weil er eben einen eisenharten Schädel hatte. Aber nicht etwa in Kleinigkeiten, dass er immer Recht haben, überall mit dem Kopfe durch die Wand fahren wollte. Nein, kleinlich war er überhaupt nicht. Selbst dem impertinentesten Dienstmädchen gegenüber war er großzügig, nachgiebig. Aber in Rechtssachen war mit ihm nicht zu spaßen.
Er nahm selten einmal eine Verteidigung an. Doch wenn er sie annahm, dann ließ er auch nicht locker, dann setzte er Himmel und Hölle in Bewegung, bis er seinen Klienten freibekommen hatte, weil er dann eben auch von dessen Unschuld überzeugt war. Und dafür ließ er sich auch nicht bezahlen, nahm kein Geschenk und gar nichts an, da er selbst sehr vermögend war, welche Eigenheit wohl am besten für den Charakter dieses vortrefflichen Mannes spricht.
Also Rechtsanwalt Maxim Iron hatte mit seiner zwanzigjährigen Tochter zu Abend gespeist, dann zog er sich in sein Arbeitszimmer zurück, bis ihm nach etwa zwei Stunden die liebreizende Evelyn Gutenacht wünschen würde.
Doch schon nach kurzem wurde der in Zeitungen Vertiefte gestört. Ein Diener war eingetreten.
»Da ist ein kleiner Judenjunge — er spricht wohl Englisch, aber keiner von uns kann ihn verstehn.«
»Lass ihn hereinkommen!«
»Das — das — das — geht nicht«, lautete die verlegene Antwort.
»Weshalb denn nicht?!«, fragte Maxim Iron erstaunt.
Der Diener wusste, dass Offenheit bei seinem Herrn die erste Hauptbedingung war, sonst befand er sich morgen nicht mehr in dieser ausgezeichneten Stellung, und so sagte er denn jetzt ganz offen:
»Weil der Junge gar zu sehr verlaust ist.«
Nun, diesen Grund erkannte Maxim Eisenkopf an, und so ging er selbst hinaus, wo in dem Hausflur der »Besuch« stand.
Ein etwa zehnjähriger Judenbengel, in Lumpen gehüllt, starrend vor Schmutz, am ganzen Körper lebendig.
»Was wünschen Sie«, fragte der Hausherr korrekt.
Der Junge gab die Antwort in einem Englisch, das in der deutschen Übersetzung etwa lauten würde:
Drrrrrabbi Ebn Ezer will machen ä grrraußes Schtärm, de sollst komm fix ßu emm.«
Es schien Russisch mit dabei zu sein, aber die Hauptsache war, dass Rechtsanwalt Iron es doch gleich verstand.
»Der Rabbi Ebn Ezer liegt im Sterben?«
»Tjau, tjau, un wenn de nich wärscht machen fix, wärschte finden ä tauten Mann.«
»Wohnt er noch auf der Horse Street bei dem Lumpenhändler?«
»Tjau, tjau, beim Isaak Petrowitsch!«
»Laufe hin und sag, dass ich sofort käme«, erwiderte der Rechtsanwalt kurz entschlossen.
Die Tochter verständigt, Stiefel angezogen, und unterdessen wurde schon ein Cab geholt, ein Mietswagen. Zwar besaß der Rechtsanwalt selbst sowohl Equipage wie Automobil, aber er wollte nicht erst Pferde und Leute bemühen für diese kleine Fahrt.
Fort ging es. Unterwegs konnte Maxim Iron überlegen.
Ebn Ezer war einst Groß-Rabbi der orientalischen Synagoge gewesen, und zwar Wander-Rabbi, ein Wanderlehrer, im ganzen Orient reisend und überall in den Synagogen predigend, um die Verbindung der einzelnen jüdischen Gemeinden aufrecht zu erhalten, bis eines Tages Rabbi Ebn Ezer öffentlich erklärte, Kabbalist geworden zu sein.
Es kann an dieser Stelle nur eine kurze Andeutung gemacht werden; die jüdische Religion spaltet sich der Hauptsache nach in die beiden großen Sekten der Talmudisten und der Kabbalisten. Erstere sind die orthodoxen Juden, nur diese haben Synagogen und Rabbiner. Letztere haben wohl das Alte Testament, verwerfen aber den Talmud, hängen einer Art von Naturphilosophie an, deren Lehre in den Büchern Jezira und Sohar niedergelegt ist, die von den Talmudisten verdammt werden.
Da war es mit dem Amte des Rabbiners natürlich vorbei. Ebn Ezer wurde aus der orthodoxen Gemeinde ausgestoßen.
Er blieb jedoch beim Wandern, konnte wohl davon nicht mehr lassen. Aber jetzt betrieb er dabei einen Beruf.
Er wurde Händler und Hausierer. Aber ein ganz besonderer. Er wurde ein Tschaubulan. Das ist ein verdecktes malaiischchinesisches Wort und heißt so viel wie »Wundermann«. Obgleich ein solcher Mann gar keine Wunder zu verrichten braucht. Er handelt mit Amuletten und Talismanen, aber auch wieder mit solchen von ganz besonderer Art.
Bekanntlich verstehen die Chinesen, echte Perlen künstlich zu erzeugen. Also Perlmuscheln zu zwingen, Perlen zu erzeugen. Sie führen einen Fremdkörper zwischen die Weichteile der Muschel ein, diese umhüllt ihn mit der Zeit mit Kalkschichten, wodurch eine echte Perle entsteht, die mit den Jahren wächst, was noch keiner unserer Forscher und überhaupt noch kein anderer Mensch, der das Geheimnis nicht kennt, nachzumachen vermocht hat.
Übrigens wird das in China nicht etwa allgemein betrieben.
Nur einige wenige buddhistische Klöster haben das Rezept dazu. Und diese Mönche verbinden mit der Erzeugung künstlicher Perlen gleich noch einen anderen Zweck.
Sie führen als Reizkörper in die Muschel eine winzige Buddhafigur aus Zinn ein. Diese also bildet immer den Kern der Perlen, die dann als Amulett gegen Zauberei und als Allheilmittel für alle möglichen Krankheiten zu horrenden Preisen verkauft werden.
Da nun nicht jeder, der solch eine Wunderperle kaufen will, selbst nach einem derartigen Kloster zu reisen vermag, schickt dieses Händler aus, Tschaubulans.
Merkwürdig ist, dass diese Tschaubulans niemals Chinesen und niemals Buddhisten sind. Es sind immer indische oder arabische Mohammedaner oder Juden.
Merkwürdig ist auch, dass diese Tschaubulans immer in dürftigster Armut leben. Sie besitzen überhaupt nichts, sie leben als Bettler, müssen es wohl. Und man weiß auch nicht, wo sie das Geld lassen, das sie aus dem Verkauf ihrer Perlen lösen, manchmal enorme Summen. Man weiß auch nicht, woher sie die Perlen nehmen, die sie den Kauflustigen vorlegen. Es ist eine ganz rätselhafte Geschichte mit diesen Tschaubulans. Deshalb eben sind es »Wundermänner«, obgleich gerade sie sich sonst von jedem Hokuspokus fernhalten, still und bescheiden ihrer Wege ziehen.
Nach seiner Ausstoßung aus der orthodoxen Gemeinde war Ebn Ezer einige Jahre verschwunden gewesen, um endlich als Tschaubulan wieder aufzutauchen. Als solcher zog er jahrzehntelang kreuz und quer durch China und Indien und die Inseln des Malaiischen Archipels, auch bis nach Australien kommend, an gläubige Buddhisten seine Perlen verkaufend, Riesensummen einheimsend und dabei immer in dürftigster Armut lebend, bettelnd und zur Nahrung Brotrinden und Gurkenschalen aus den auf die Straßen geworfenen Abfällen zusammenlesend.
Da man ihn überall noch von seinen früheren Reisen her kannte, so blieb er der Rabbi, jetzt setzte man aber noch ein »Tschau« davor, nannte ihn also den Wunder-Rabbi.
Vor vier Jahren war er auch wieder einmal nach Sydney gekommen. Er hatte in einem armseligen Gasthause übernachtet, Zimmer und Lager im Voraus damit bezahlend, dass er den ganzen Nachmittag Kartoffeln geschält und Flaschen gespült hatte. Das Zimmer hatte er mit einem Inder geteilt, der mit Schleiern und anderen Geweben hausierte.
Am anderen Morgen war der Inder mit durchschnittener Kehle aufgefunden worden, vollständig beraubt, und der Wunder-Rabbi war verschwunden gewesen.
Er wurde einige Meilen von Sydney entfernt auf der Landstraße festgenommen.
Von dem Raube fand man zwar nichts bei ihm, wohl aber hatte er im Gesicht und an den Händen blutige Schrammen.
Natürlich leugnete der alte Jude. Er behauptete, er habe die ihm zugewiesene Schlafkammer überhaupt nicht betreten, jenen Inder gar nicht gesehen, er habe das Gasthaus schon am Abend zuvor verlassen. In der Nacht sei er in einen Stacheldraht gefallen, daher die blutigen Risse im Gesicht und an den Händen.
»Wo bist Du denn da die ganze Nacht gewesen?«
Das wollte der alte Jude nicht sagen, da verweigerte er hartnäckig die Auskunft.
Na, er war sowieso dem Strange verfallen. Aber einen Verteidiger musste er doch erst haben. Als solcher wurde Solicitor Maxim Iron bestimmt, ohne dass er es anzunehmen brauchte. Der englische Rechtsanwalt darf sich weigern, als vom Gericht vorgeschlagener Verteidiger zu fungieren.
Maxim Iron besuchte den alten Juden in seiner Zelle, hatte eine Unterredung mit ihm und nahm die Verteidigung an. Denn er kam zur festen Überzeugung. dass der alte Jude unschuldig an dem Morde war, ohne irgendeinen Beweis hierfür zu haben. Er hatte nur das Gefühl, es war seine innerste Überzeugung, und das genügte ihm.
Diese heilige Überzeugung des Verteidigers half natürlich vor den Geschworenen nichts. Ebn Ezer wurde zum Tode verurteilt. Da aber verwandelte sich Mister Maxim Iron in den Rechtsanwalt Eisenkopf. Er wies einen Rechtsfehler im Gange der Verhandlungen nach, legte Revision ein, der Prozess begann von Neuem. Er dauerte ein ganzes Jahr. Noch dreimal wurde der Wunder-Rabbi schuldig des Raubmordes befunden und zum Tode verurteilt, und noch dreimal warf Rechtsanwalt Eisenkopf den Richterspruch über den Haufen und verlangte Beweise für die Schuld des Angeklagten, bis dieser zuletzt wahrhaftig wegen mangelnder Beweise freigesprochen wurde!
Der Wunder-Rabbi verließ Sydney nicht mehr, der vorher noch sehr rüstige Mann war innerhalb des einen Jahres ein altersschwacher, ganz gebrochener Greis geworden. Ein russischer Trödeljude mit unaussprechlichem Namen gab ihm bei sich Unterkunft, nicht umsonst, sondern ein in Sydney lebender reicher Chinese hatte ihm eine Abfindungssumme von hundert Pfund Sterling gegeben.
Das war schon wieder drei Jahre her.
Der Wunder-Rabbi war verschollen, vergessen, auch Rechtsanwalt Iron hatte sich nie wieder um ihn gekümmert.
Jetzt war er an das Sterbelager seines einstigen Klienten gerufen worden, den er vom Galgen gerettet, er hatte dem Rufe sofort Folge geleistet.
»Verdammt, der wird doch jetzt nicht etwa gestehen, dass er damals den Inder ermordet hat«, murmelte er, als er auf den Polstern des rollenden Wagens saß. »Nein, nein«, setzte er beruhigt hinzu, »ich habe mich damals nicht geirrt, der sterbende Mann wird mir nur noch einmal danken wollen, was er damals vergessen hatte.«
Der Wagen bog in das alte Stadtviertel ein, in dem einst die freigelassenen Sträflinge hausten, deren elende Baracken heute noch stehen, soweit sie aus Stein gebaut worden sind, und hielt vor solch einer Baracke.
Mister Iron hieß den Kutscher warten, wurde von einer alten Hexe in Empfang genommen, die ihn auf unbeschreiblichen Wegen ins Innere des Trödlerhauses führte.
Zuletzt betrat er eine enge Kammer, erfüllt von einer verpesteten Atmosphäre, erleuchtet von einem dürftigen Ölflämmchen, und in dessen Scheine sah er auf einem von Lumpen hergerichteten Lager ein menschliches Gerippe liegen, mit gelbem Pergament überzogen, mit einem Totenschädel, in dem das einzige Lebendige die glühenden Augen waren.
»Der Wunder-Rabbi, lange macht er's nicht mehr, einen Arzt will er nicht«, sagte die alte Judenhexe in einem schwerverständlichen Dialekt und zog sich zurück.
Mister Iron sah gleich, dass er sich einem Sterbenden gegenüber befand, der im letzten Fieberdelirium lag.
Und jetzt streckte das Gerippe seinen Knochenarm mit den Krallenfingern gegen ihn aus, focht wild in der Luft herum.
»Fort, fort«, kam es ganz deutlich aus dem mit noch immer schönen Zähnen besetzten Munde hervor, »fort, Loke Klingsor — was habe ich mit Dir zu schaffen — ich war Dein Lehrer — Du hast mich besiegt — nun ist es gut — fort, Loke Klingsor — Du Mann mit den Teufelsaugen — ich hatte Dich lieb — aber ich konnte Dich nicht ertragen — Du bist der Fürst des Feuers geworden — fort, fort, Loke, Du verbrennst mich —«
So schwatzte das Gerippe unter lebhaften Gestikulationen abgerissen vor sich hin, mit furchtbar glühenden Augen.
Mister Iron sah eine halb gefüllte Flasche und ein Glas neben dem Lager stehen, es lagen noch Zitronenscheiben drin, furchtlos trat er näher, füllte das Glas, führte es dem Greise an die Lippen.
»Da, trinkt, das wird Euch gut tun.«
Gierig trank der Alte, leerte aber das Glas nicht ganz, die Glut in den Augen legte sich, diese veränderten sich überhaupt ganz und gar, ein Ausdruck des Erkennens, mit einem unsagbaren Dankesblick ergriffen die Krallenfinger die Hand des Rechtsanwaltes und zogen sie an die fieberheißen Lippen.
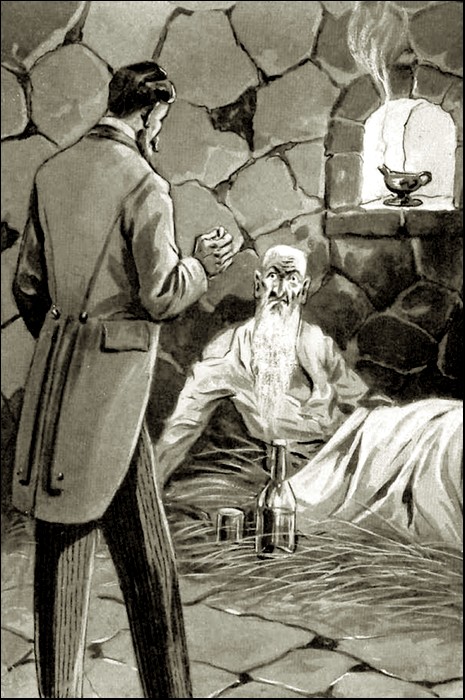
Mister Iron wurde Zeuge des Hinscheidens des Alten.
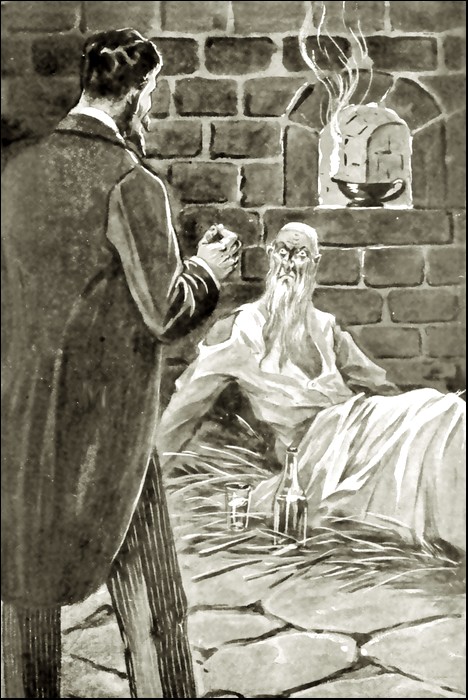
Variante obiger Frontispiz-Abbildung zu Lieferung 2.
»Edler Mann — edler Mann — Ihr habt mir das Leben gerettet — noch viel mehr habt Ihr gerettet — wie soll ich Euch danken — warum seid Ihr nicht einmal zu mir gekommen —«
»Hättet Ihr mich rufen lassen, ich wäre jederzeit zu Euch gekommen. Habt Ihr mir sonst etwas zu sagen?«
»Ja — ja — ich will Euch etwas geben — etwas schenken — ich will Euch danken — ich muss mich beeilen —«
Er wandte sich halb zur Seite, brachte eine Hand vor den Mund, eine würgende Bewegung des Schlundes, und er hatte in dieser Hand eine kleine, offenbar silberne Kapsel, ungefähr von der Größe einer Haselnuss, die etwas plattgedrückt war.
»Da nehmt — nehmt — es ist ein Golem — ich schenke ihn Euch — nehmt den Golem — so nehmt doch —«
Mister Iron hatte das kleine Ding genommen. Es schien darin etwas zu klappern.
»Er ist mein — mein rechtmäßiges Eigentum — ich schenke ihn Euch — den Golem —«
»Was ist denn das, ein Golem?«
»Ihr wisst nicht, was ein Golem ist? Hahahaha, Ihr wisst es nicht? Dann fragt den Loke Klingsor, was ein Golem ist, der weiß es noch besser als ich, der kann den Golem noch ganz anders gebrauchen — fragt nur den Loke Klingsor, den Mann mit den Teufelsaugen — aber hütet Euch, dass diese Augen Euch nicht verbrennen —«
»Ja, wer ist denn das nun wieder, der Loke Klingsor?«
»Ihr kennt den Loke Klingsor nicht?«, fing der im Fieberdelirium Liegende, der also gar nicht weit vom Wahnsinn entfernt war, nun wieder an. »Hahahaha, Ihr kennt den Loke Klingsor nicht? Den Fürsten des Feuers? Den Mann mit den Teufelsaugen?«
Dann nahmen seine Augen und sein ganzes Gesicht einen unsagbar geheimnisvollen Ausdruck an, und so begann er zu flüstern:
»Sssst — leise, leise — dass er es nicht hört! Fragt die Mönche von Senkinpen, wer Loke Klingsor ist, die wissen es besser als ich.
Wagt es, die höchsten Höhen des Himalaja zu erklimmen und in den Tempel der fürchterlichen Suarins einzudringen, die werden Euch erzählen, wer Loke Klingsor ist! Oder steigt hinab in die grässliche Tiefe des Makarbassa auf Borneo, auch dort werdet Ihr Menschen finden, und sie werden Euch von Loke Klingsor berichten, von dem Fürsten des Feuers, von dem Manne mit den Teufelsaugen.
Ja, und wenn Ihr den Mut habt, sogar in das Heiligtum der feurigen Schlangen zu dringen —«
»Rabbi Ebn Ezer, wollt Ihr mir nicht lieber gleich selber sagen, was dieses Medaillon enthält, wie man es öffnet, da ich ja sonst nicht weiß, was ich damit anfangen soll?«
»Ein Golem ist es«, fuhr der Alte ihn wild an, »ein Golem, der mich zum mächtigsten Manne der Erde gemacht hätte, wenn ich ihn hätte brauchen dürfen, aber ich durfte nicht — und nun gebe ich ihn Euch, und Ihr dürft ihn brauchen, jetzt habt Ihr alle Wundermacht der Erde —«
»Rabbi Ebn Ezer«, drängte der Rechtsanwalt, der ganz deutlich sah, wie es mit dem Alten jeden Augenblick zu Ende sein konnte, »so sprecht doch nur. Was ist denn das, ein Golem?«
»Hahahaha, weiß der nicht, was ein Golem ist, ein Golem, der alles Leben in sich —«
Der Alte fiel zurück, röchelte, streckte sich und war tot.
Nachdem Mister Iron hieran nicht mehr zweifeln konnte, wozu er sich auch einmal über den Körper gebeugt und ihn betastet hatte, was mancher Mensch nicht getan hätte, vor Ekel nicht, öffnete er die Tür, brauchte nicht lange zu rufen, die alte Hexe kam, ein jüngeres Weib, eine Unmasse von Kindern, ein allgemeines Lamentieren begann.
Mister Iron verstand nichts von den ihm jetzt ganz fremden Lauten, er hielt sich nicht länger auf, wurde nicht zurückgehalten — er wusste den Weg ins Freie auch ohne Führung zu finden und stand bald darauf draußen.
Aber den Wagen benutzte er nicht wieder, den er hatte warten lassen, er ging zu Fuß davon. Weshalb er den Wagen nicht benutzte, werden wir gleich erfahren, und das warf auch wieder ein schönes Licht auf den Charakter dieses Mannes.
Unterwegs beschäftigte er sich mehrmals mit der kleinen Kapsel, betrachtete sie im Scheine einer Laterne oder eines erleuchteten Schaufensters, versuchte sie zu öffnen, brachte sie aber nicht auf.
»Golem, Golem?«, murmelte er dabei wiederholt. »Mir ist, als ob ich dieses Wort schon einmal gehört hätte, ich komme aber nicht drauf. Na, ich werde mir die Sache bei besserem Licht besehen und in Ruhe überlegen, wenn ich nur erst einmal diese Pestatmosphäre los bin. Brrr, ich fühle förmlich den verwesenden Tod auf mir lasten!«
Sein Ziel war das Haus seines Freundes, des Doktor Lazare, der eine Privatklinik für Nervenkranke und Geistesgestörte leichterer Art, Gemütskranke, hatte. Es war eine sehr teure Klinik, auch wer an den höchsten Luxus gewöhnt war, konnte sich darin behaglich fühlen, aber Doktor Lazare, ein ganz vortrefflicher Mensch, hatte ein für alle Mal auch einige Freistellen für Unbemittelte eingerichtet, und da wurden ja nun manchmal geistesgestörte Individuen eingeliefert, in Spelunken oder auf der Landstraße oder an anderen xbeliebigen Orten aufgelesen.
In einer Viertelstunde hatte Maxim Iron das große Gartengrundstück mit angrenzendem Park erreicht, es war erst die neunte Stunde, also alles noch erleuchtet und lebendig.
Der dem Portier schon bekannte Rechtsanwalt wurde nach einem telefonisch eingeholten Bescheid in die Apotheke des Arztes geführt, die auch als Laboratorium eingerichtet war. Es roch intensiv nach Chlor und nach noch schärferen Höllenstoffen, atemversetzend. Doktor Lazare im weißen Arbeitskittel war eben dabei, einen Destillierapparat aufzubauen, ein jüngerer Mann rieb eifrig in einer großen Porzellanschale verschiedene Pulver zusammen.
»Verzeihen Sie, Herr Rechtsanwalt, wenn ich Sie gleich im Laboratorium empfange und mich in meiner Arbeit gar nicht stören lasse. Da hat mir vorhin die Polizei eine Dame gebracht, die sich für die Kleopatra hält, für das schönste Weib der Erde, mit Gold und Juwelen nur immer so um sich wirft, und dabei ist sie von Ungeziefer schon halb aufgefressen — eine Landstreicherin, die man dem Hungertode nahe aufgefunden hat. Für die muss ich jetzt ein ganz besonders kräftiges Desinfektionsbad herrichten.«
Der Assistent oder Laboratoriumsdiener hörte einmal auf zu reiben. Es war ein noch junger Mann mit einnehmenden, auffallend sanften Zügen und großen, schwärmerischen Augen, und diese schlug er jetzt empor zu der verräucherten Decke, und in ebenso schwärmerischem Tone erklang es:
»Die Kleopatra! Ach, meine Kleopatra, wenn ich Dich noch einmal — —«
Weiter kam er nicht, schnell fuhr Doktor Lazare gegen ihn herum.
»Was geht Sie die Kleopatra an!«, herrschte er den jungen Mann an. »Arbeiten Sie, arbeiten Sie! Wer sind Sie? Wie heißen Sie?«
Der junge Mensch knickte förmlich zusammen und rieb schnell weiter.
»Ich heiße Daniel Jobster und bin gelernter Drogist«, murmelte er demütig, aber man wurde dabei lebhaft an die eingelernten Worte eines Papageis erinnert.
»Arbeiten Sie und denken Sie an nichts anderes als an Ihre Beschäftigung. Nur für diese, für sonst nichts anderes werden Sie bezahlt!«
»Ich denke an nichts anderes«, wurde gehorsam wiederholt, und der junge Mann rührte mit verdoppeltem Eifer den Porzellanstempel.
»Also, Herr Rechtsanwalt«, wandte sich der Arzt nach dieser Unterbrechung an jenen, »was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches?«
Mister Iron hatte dieses Zwischenspiel ohne weitere Verwunderung beobachtet, er wusste ja, wo er sich hier befand.
»Ein desinfizierendes Bad richten Sie vor? Hören Sie, Doktor, da bereiten Sie auch gleich noch ein zweites für mich! Deshalb komme ich ja her. Und meinen Anzug und alle anderen Sachen sollen Sie auch gleich desinfizieren, oder ich muss alles in den Ofen stecken.«
»Was? Desinfizieren wollen Sie sich lassen, schon mehr ausbrennen?!«, lachte Doktor Lazare. »Wo sind Sie denn gewesen?«
»Sie erinnern sich doch noch an den Rabbi Ebn Ezer, an den Tschaubulan, den Talismanhändler, der vor vier Jahren den indischen Hausierer ermordet haben sollte, dessen Verteidigung vor Gericht ich damals übernahm —
Ich habe selbst gar nicht mehr an ihn gedacht. Heute ließ er mich rufen. Ich ging hin in die Horse Street, in das Haus eines Lumpenhändlers. Na, ich sage Ihnen, was ich da gesehen und noch mehr gerochen habe! So eine Bude! Dieser Gestank! Dieser Schmutz, dieses Elend! Und ich habe den Mann berührt, den lebendigen und dann den toten. Ich fühle förmlich die Pestbazillen und gewisse sechsbeinige Tierchen auf meinem Leibe herumlaufen. So nach Hause zu gehen, wage ich nicht, habe sogar einen schon auf mich wartenden Mietswagen nicht benutzt, um nicht etwa spätere Fahrgäste unglücklich zu machen.«
Das also war der Grund gewesen, weshalb der Rechtsanwalt den Weg zu Fuß gemacht hatte. Doch wirklich sehr rücksichtsvoll!
»So, so! Nun, da kann Ihnen geholfen werden. Aber eine Viertelstunde müssen Sie sich noch gedulden, das sage ich Ihnen gleich. Ich habe nur einen einzigen Desinfizierraum, in den muss jetzt erst die Königin Kleopatra hinein — arbeiten Sie, Daniel Jobster, die Kleopatra geht Sie gar nichts an! Sie wissen doch, dass ich etwas demokratisch veranlagt bin. Bleiben Sie gleich hier im Laboratorium, in dieser Atmosphäre können keine Bazillen und auch nicht gewisse sechsbeinige Tierchen, wie Sie sich so hübsch ausdrückten, gedeihen, während sie für die menschliche Lunge durchaus nicht schädlich ist.
Bitte, nehmen Sie Platz, dort steht ein Stuhl, bedienen Sie sich desselben!«
»Wie lange dauert denn die Geschichte?«, fragte Mister Iron, ehe er sich setzte.
»Na, in einer Stunde werden Sie wieder zu den Kulturmenschen gehören.«
»Dann kann ich auch wieder meine Kleidung anlegen?«
»Nein, das allerdings nicht! Wenn Sie nicht in einen ganz zermürbten Anzug schlüpfen wollen. Der muss doch erst gebügelt werden.«
»Da werde ich mir aus meiner Wohnung andere Sachen schicken lassen. Ich möchte überhaupt meiner Tochter einmal telefonieren.«
Auch in dieser Apotheke war ein Telefon, Mister Iron benutzte es, um seinen Auftrag zu geben und seiner Tochter zu sagen, wo er sei und wann er nach Hause käme.
Er habe nur einmal seinen Freund besucht. Nach seiner Rückkehr würde er etwas sehr Interessantes erzählen.
Er kehrte zurück und setzte sich. Doktor Lazare war zu jeder Unterhaltung bereit, ließ aber dabei seine Hände niemals ruhen.
»Gestatten Sie eine Frage, Herr Doktor, die wohl nicht gerade indiskret ist, am wenigsten für Sie«, eröffnete der Rechtsanwalt das neue Gespräch. »Nicht wahr, Sie sind Israelit? Ganz bestimmt weiß ich es nämlich wirklich nicht, so lange befreundet wir auch schon sind.«
»Jawohl, ich bin Jude. Na, wenn jemand Nathan Isaak Lazare heißt, das wird doch wohl auch ä echter Jied sein«, war die humoristische Antwort.
»Sie haben sich nicht nachträglich taufen lassen?«
»Nein, ich hatte keine Veranlassung dazu«, wurde diesmal ernsthafter gesagt.
»Können Sie Hebräisch?«
»Ich? Gar keine Ahnung davon.«
»Wissen Sie, was ein Golem ist?«
»Golem? Golem? Nein, habe dieses Wort noch nie gehört.«
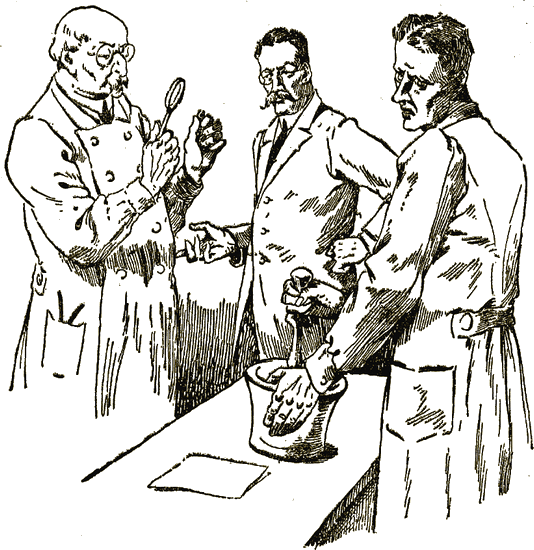
»Sind Sie eigentlich Talmudist oder Kabbalist?«
Mit allen Zeichen des Staunens wandte sich der Arzt dem Rechtsanwalt einmal zu.
»Ob ich Talmudist oder Kabbalist bin?! Herr Rechtsanwalt, mein lieber Freund. Wie in aller Welt kommen Sie denn auf diese Frage?! Ach, nun aber geht mir eine Ahnung auf! Sie denken wohl, von mir so ein altjüdisches Geheimnis erfahren zu können? Ach du lieber Gott! Nein, Herr Rechtsanwalt, da kommen Sie bei mir an den Unrechten. Ja, ich bin ein verschnittener Jude. Aber seit meiner Kinderzeit bin ich in keine Synagoge gekommen. Ich kenne gar nicht mehr die Zeremonien. Jeder ehrliche Mensch ist mein Glaubensgenosse. Ich ziehe eine gute Schweinskeule jedem anderen Braten vor. Nein, Herr Rechtsanwalt, über den Talmud und die Kabbala dürfen Sie mich nicht fragen, da bin ich gänzlich ahnungslos, kann Ihnen über diese Sachen keinerlei Auskunft geben!«
»Immerhin dürfte Sie interessieren, was ich zu erzählen habe.«
Und Maxim Iron erzählte. Er berichtete den ganzen Hergang an dem Sterbelager des Wunder-Rabbis. Und dieser Rechtsanwalt und Verteidiger verstand zu sprechen, hatte für so etwas ein Gedächtnis, konnte alles, was der Delirierende gesagt hatte, fast wortgetreu wiederholen, gab es in einer Weise wieder, dass man die ganze Szene deutlich vor sich sah.
»›Hahahaha‹, lachte das Gerippe, ›weiß der nicht, was ein Golem ist, ein Golem, der alles Leben in sich —‹ Da fiel der Alte zurück und war tot. Ich überließ ihn Leuten im Hause, machte mich davon, hatte genug von der Sache.«
»Hm, das ist ja allerdings sehr interessant«, meinte Doktor Lazare, der aufmerksam zugehört hatte, ohne seinen Destillierapparat aus den Augen zu lassen. »Und was ist's nun mit der silbernen Kapsel, in der etwas klapperte?«
»Hier ist sie. Es gelang mir noch nicht, sie zu öffnen.«
Der Arzt ließ ab von seinen Destillierkolben, nahm die gereichte Kapsel. Hier im hellen elektrischen Lichte sah man deutlich den Einschnitt zwischen den beiden Hälften, in die der Fingernagel zu setzen war, und so ließ sich die Kapsel jetzt auch ganz leicht öffnen.
Sie barg eine milchweiße Kugel von der Größe einer stattlichen Erbse.
»Donnerwetter, eine Perle. Und was für ein Exemplar! Na ja, der Wunder-Rabbi war ja auch ein Tschaubulan, so ein Perlenhändler, der hat Ihnen seine Dankbarkeit durch dieses Geschenk — das heißt, warten Sie mal. Ich habe schon manche echte Perle in der Hand gehabt, und wenn ich nun diese hier über die Handfläche laufen lasse — hm, diese runde Kugel macht mir gar nicht so den Eindruck einer echten Perle, die muss anders rollen, und vor allen Dingen muss sie ganz anders irisieren, schillern. Das kommt mir eher wie Glas vor, weißes EmailleGlas. Na, das werden wir ja gleich haben. Seien Sie ohne Sorge, dem Dinge geschieht nichts. Ich nehme nur eine mikrochemische Untersuchung vor, sie hinterlässt keine Spur, es kann also niemand nachweisen, dass irgend etwas mit dem Ding geschehen ist!«
Doktor Lazare nahm ein Fläschchen, tauchte ein Glasstäbchen von der Dünne einer Stricknadel hinein, klemmte ein Vergrößerungsglas ins Auge, betupfte die Perle mit der Flüssigkeit, dann auch noch den Inhalt eines zweiten Fläschchens gebrauchend.
»Nein, geehrter Herr Rechtsanwalt, da ist keine Spur von kohlensaurem Kalk drin, woraus jede Perle doch der Hauptsache nach besteht. Möglich, dass in dem Dinge eine heilige Buddhafigur eingeschlossen ist, aber sonst ist das nichts weiter als gewöhnliches Emailleglas, das kann ich schon jetzt nach der gemachten Probe beurteilen.«
Rechtsanwalt Iron zeigte sich durch diesen Bescheid nicht enttäuscht. Er betrachte die silberne Kapsel näher, besonders innen.
»Sind hier nicht Zeichen eingraviert? Ich bin etwas kurzsichtig.«
Doktor Lazare nahm auch das Innere der Kapsel unter die Lupe.
»Ja, da sind Zeichen eingeritzt, eine ganze Menge. Es scheinen Buchstaben zu sein. Aber hebräische sind das nicht, deren Charakter kennt man doch so ungefähr. Eher möchte ich an arabische denken.«
Weiter wussten die beiden jetzt mit der Kapsel und der Kugel nichts anzufangen.
»Das soll also ein Golem sein«, meinte dann der Arzt. »Haben Sie denn schon ein Konversationslexikon befragt? Ob es da vielleicht drin steht?«
»Ich habe mich ja direkt zu Ihnen begeben, unterwegs keinen Menschen gesprochen.«
»Na, da wollen wir doch einmal in Rees' Enzyklopädie nachsehen, vielleicht ist es angeführt.«
Doktor Lazare ging in ein kleines Nebenzimmer, das eine Bibliothek enthielt, hauptsächlich wissenschaftliche Nachschlagebücher, darunter auch die englische Enzyklopädie von Rees, das gewaltigste Konversationslexikon der Welt, 45 mächtige Bände. Übrigens haben an diesem Werke mehr deutsche Gelehrte gearbeitet als englische, französische, und solche aus anderen Ländern zusammengenommen.
Der Arzt kam mit dem 22. Bande zurück, schon unterwegs darin nachschlagend.
»Jawohl, hier steht's! Nicht viel, aber doch etwas. ›Golem, aus dem Hebräischen, eine ungeformte Masse, im jüdischen Volksglauben eine durch die angebliche Zauberkraft von Bibelsprüchen auf eine bestimmte Zeit belebte menschenähnliche Tonfigur, als Nachahmung der ersten Menschenschöpfung.‹*)«
*) Der freundliche Leser wolle eine kleine Unwahrheit verzeihen. Diese Erklärung ist nicht jener englischen Enzyklopädie entnommen, sondern Brockhaus' großem KonversationsLexikon, 14. Auflage, 1908: Eben zum Beweis, dass der ganzen Sache etwas Wahres zugrunde liegt, wenn auch nur ein Aberglaube.
Doktor Lazare legte das gewichtige Buch auf einen Nebentisch.
»So, nun wissen wir's. Mit Hilfe dieses Dinges können Sie also eine Tonfigur lebendig machen. Na, da machen Sie mal los, da bin ich gespannt.«
»Ja, wenn mir der Wunder-Rabbi nur auch gesagt hätte, wie ich das anfangen soll!«, entgegnete der Rechtsanwalt lachend.
»Na, er hat Ihnen doch auch gesagt, wen Sie da fragen sollen. Den — den den den — na, wie hieß der Kerl doch gleich?«
Nochmals sei betont, dass Rechtsanwalt Iron alle Reden des Sterbenden fast wortgetreu wiedergegeben hatte, und so konnte er auch jetzt wiederholen:
»Den Loke Klingsor, den Fürsten des Feuers, den Mann mit den Teufelsaugen, der immer eine schwarze Katze bei sich zu haben scheint.«
»Und wo sollen Sie diesen geheimnisvollen Mann suchen?«
»Oder doch fragen, wo er zu finden ist, oder wo man ihn ganz genau kennt: bei den Mönchen von Senkinpen oder auf den höchsten Höhen des Himalajas, bei den fürchterlichen Suarins, wenn ich nicht vorziehe, in die grässliche Tiefe des Makarbassa auf Borneo zu dringen.«
»Was für Schrecknisse sind denn eigentlich diese chinesischen Mönche, diese fürchterlichen Bewohner des Himalaja und dieser schauderhafte Abgrund auf Borneo?«
»Ich habe gar keine Ahnung.«
Mit allen Zeichen des Staunens wandte sich Doktor Lazare wieder von seiner Retorte gegen den Freund.
»Haben Sie die wirren Reden des Irrsinnigen nachgeschrieben?!«
»Kein Wort!«
»Ja, wie in aller Welt haben Sie denn da alle diese vertrackten orientalischen Namen im Kopfe behalten können?!«
»Weil ich ein gutes Gedächtnis besitze, und als Rechtsanwalt und Verteidiger muss man sich oftmals jeder Kleinigkeit erinnern.«
Doktor Lazare beruhigte sich wieder.
»Sie geben doch zu, dass Sie mit einem Irrsinnigen zu tun gehabt haben.«
»Wenigstens mit einem Sterbenden, der im Fieberdelirium redete. Ich gebe deshalb der Sache keine große Bedeutung. Wenn ich nur wüsste, wo ich das Wort Golem schon einmal gehört habe! Sehen Sie, Doktor, gar so vorzüglich ist mein Gedächtnis doch nicht. Für alles, was mich nicht interessiert, habe ich nämlich gar keinen Merksinn.«
»Nun, da fällt mir ein — ich habe da einen Pensionär, vielleicht kennen Sie ihn, den Mister Davidson, früher Bankier in Adelaide —«
»Nein, ich kenne ihn nicht, habe noch nie von einem Bankier dieses Namens gehört.«
»Er hat sein Geschäft auch schon längst aufgegeben, seine Verwandten brachten ihn vor zwei Jahren her, so lange ist er schon bei mir. Ein alter Herr, also ein Bankier, hat sich aber nebenbei in das Studium der Kabbala versenkt, um das Schicksal berechnen zu können. Sie wissen doch, kabbalistische Berechnungen sind ja immer nötig, um die Zukunft zu ergründen. Dabei ist er zuletzt übergeschnappt oder doch mindestens sehr nervenkrank geworden. Es hat sich bedeutend gebessert, er ist wieder ganz normal und fühlt sich wohl bei mir, wird Zeit seines Lebens bei mir bleiben. Man kann sich mit ihm über alles unterhalten. Nur von der Kabbala und dergleichen darf man nicht anfangen. Dann bekommt er gleich wieder seine Nervenanfälle. Den können wir ja einmal befragen, was ein Golem ist, der wird schon Näheres über diese geheimnisvolle Sache wissen —«
»Ja, wenn der alte Herr aber solche Fragen nicht vertragen kann?«
»Ohne Sorge, ich weiß schon, was ich tue. Ich werde doch meine Patienten nicht etwa aus Neugier peinigen. Der alte Herr muss vielmehr ab und zu auf diese Weise geprüft werden, daraus erkenne ich, wie weit seine Nerven wieder erstarkt sind. Solange er dergleichen nicht hören kann, ist er auch noch nicht ganz gesund.
So, der chemische Prozess geht jetzt seinen Gang. Ich werde erst einmal bei Mister Davidson nachsehen, ob er heute zu einer Unterhaltung fähig ist. Ist es der Fall, dann begeben wir uns nach Ihrem Bade zu ihm, der alte Herr bleibt nachts immer lange auf. Ich komme gleich wieder.«
Doktor Lazare entfernte sich.
Etwa zehn Minuten sah der Rechtsanwalt dem jungen Mann zu, der eifrig die Pulver mischte und durcharbeitete.
Der Arzt war wieder eingetreten.
»Ja, Mister Davidson ist zu sprechen. Der alte Herr ist heute bei recht guter Stimmung, und gerade da muss ich ihn solch einer Prüfung unterziehen. Und nun, mein lieber Freund, Ihr Bad ist fertig, Sie können gleich mitkommen.«
Mister Iron wurde in einen Baderaum geführt, bei dessen Anblick man nun freilich nicht an solch eine Prozedur des Desinfizierens dachte.
Ein prachtvoll getäfeltes Zimmer mit jeglichen Bequemlichkeiten, eine Marmorwanne mit wunderbarem Mosaik.
Doktor Lazare überließ seinen Freund dem Badediener, der noch einige Anweisungen gab; Mister Iron entkleidete sich und warf die Sachen in den Nebenraum, dann stieg er in das heiße Wasser, das aber durchaus nicht nach scharfen Chemikalien roch, vielmehr sehr gut duftete. Nur die Seife war etwas scharf und unangenehm.
»Wenn Sie etwas wünschen, dort hängt das Telefon«, sagte der Badediener, ehe er sich entfernte, auf die Dose deutend, die an zwei grünumsponnenen Drähten neben der Wanne an der Wand hing.
Eine halbe Stunde sollte Mister Iron in dem Bade sitzen bleiben.
Er hatte die Arbeit der Reinigung hinter sich, gab sich dem Genusse des Bades hin. Das Ende der halben Stunde nahte.
Da schnarrte es in dem Dosentelefon, das keine Klingel besaß.
Der Rechtsanwalt nahm die Dose vom Nagel, in die man sowohl sprach als aus ihr hörte, ohne sie dabei ans Ohr legen zu müssen. Die Worte kamen auch so noch ziemlich deutlich heraus.
»Ist jemand dort?«
»Herr Rechtsanwalt Maxim Iron?«, erklang es zurück, also sehr deutlich, noch ehe Iron die Dose ans Ohr gedrückt hatte, wenn auch die Stimme nicht den normalen menschlichen Ton hatte. Sie klang sehr weit entfernt und so kreischend, so unnatürlich hoch, und dazwischen kam auch immer noch ein Schnarren des Apparates zu Gehör.
»Ja, ich bin hier. Wer ist dort?«
»Loke Klingsor.«
Der Rechtsanwalt glaubte zuerst, nicht recht gehört zu haben.
»Wer ist dort?! Loke Klingsor?!«
»Ja, Loke Klingsor. Sie wissen doch — der Fürst des Feuers, der Mann mit den Teufelsaugen, der Mann mit der schwarzen Katze.«
Im ersten Augenblicke glaubte Iron, sein Freund, Doktor Lazare, erlaube sich mit ihm ein Späßchen, um ihn hier im Bade zu unterhalten, obgleich der jüdische Arzt sonst gar nicht dazu veranlagt war.
»Was wünschen Sie?«, fragte der Jurist darauf geschäftsmäßig.
»Herr Rechtsanwalt, Sie sind doch vor einer Stunde an dem Sterbelager des Ebn Ezer gewesen, des sogenannten Wunder-Rabbis.«
»Ja, war ich. Und?«
»Er hat Ihnen eine silberne Kapsel gegeben, die eine kleine weiße Kugel enthält.«
»Jawohl. Und?«
»Wollen Sie mir diese Kapsel mit der Kugel nicht überlassen?«
»Wozu?«
»Weil ich sie gern haben möchte. Ich kann sie gebrauchen. Ihnen aber, das kann ich gleich sagen, ist sie ganz und gar nutzlos.«
»Und wozu können Sie denn dieses Ding verwenden?«
»Das muss mein Geheimnis bleiben. Hat Ihnen Rabbi Ebn Ezer nicht gesagt, was diese Kapsel mit der Kugel ist?«
»Er sagte, es sei ein Golem.«
»Wissen Sie, was das bedeutet?«
»Nein. Oder wenigstens nicht mehr, als mir das soeben befragte Lexikon sagte.«
»Und was war das?«
»Ein Golem ist nach hebräischer Sage eine Tonfigur, der man durch Zaubersprüche zeitweiliges Leben einhaucht.«
»Ja. Wenigstens so halb und halb. Ein Golem ist eigentlich das Mittel, durch welches dieser Zauber bewirkt wird. Doch das bleibt sich gleich.«
»Glauben Sie etwa, dass so etwas möglich und ausführbar ist?«
»Diese Frage zu beantworten, ist jetzt nicht angängig. Ich sage Ihnen nur, dass dieser Golem des Ebn Ezer für Sie durchaus keinen Wert hat. Bitte, überlassen Sie ihn mir.«
»Was bieten Sie dafür?«, war des Rechtsanwalts nächste Frage, nur um erst einmal zu erfahren, welchen Wert das Ding für jenen hatte.
»Was fordern Sie dafür?«
»Zehntausend Pfund Sterling«, sagte Iron so aufs Geratewohl.
»Ich muss Ihnen mitteilen, dass ich den Golem überhaupt nicht gegen Geld kaufen kann.«
»Weshalb nicht?«
»Sonst wird er auch für mich unbrauchbar. Er verliert seine Kraft.«
»Hm. Das wird ja immer geheimnisvoller. Wollen Sie sonst etwas dagegen eintauschen?«
»Nichts Materielles darf es sein.«
»Sondern?«
»Nur mein Leben kann ich Ihnen für diesen Golem anbieten.«
»Ihr Leben? Wie das?«
»Woraus besteht jedes Leben, wenn man es als einen Zeitraum betrachtet?«
Dieser Rechtsanwalt verstand sofort.
»Nun — aus Jahren.«
»Richtig. Aber ein ganzes Jahr wäre mir zu viel. Auch schon ein Monat, eine ganze Woche. Doch handeln wir. Ich biete Ihnen zunächst drei Tage aus meinem Leben an.«
»Was soll ich mit diesen drei Tagen anfangen?«
»Was Sie wollen!«
»Ich verstehe nicht.«
»Während dieser dreier Tage haben Sie über mich zu befehlen, ich habe Ihnen bedingungslos zu gehorchen.«
»Hm!« Der kluge Rechtsanwalt ging auch auf diese Seltsamkeit ein. »Da müsste ich erst wissen, wer Sie sind und was Sie leisten können.«
»Sie sollen mich auch genau kennen lernen. Ich werde Sie persönlich aufsuchen. Nur müssen Sie sich etwas gedulden, ich habe eine weite Reise bis zu Ihnen zu machen!«
»Befinden Sie sich denn nicht in Sydney?«
»Nein.«
»Wo sonst?«
»Es ist mir unangenehm, dass ich dem, von dem ich den Golem erwerben will, die reine Wahrheit sagen muss, damit er seine Wirksamkeit behält. Ich befinde mich gegenwärtig in Umanak.«
»Wo liegt das?«
»Es ist die nördlichste Ansiedlung an der Westküste Grönlands.«
»Oho, oho!!! In Grönland wären Sie?! Auf der anderen Hälfte der Erdkugel, sogar in doppelter Hinsicht?!«
»Wie ich sage.«
»Und da können Sie mit mir hier in Sydney telefonisch sprechen? Ist denn Grönland überhaupt durch ein Kabel verbunden, nur mit dem Festland von Amerika?«
»Vielleicht habe ich solch eine Kabelverbindung gar nicht nötig.«
»Nicht? Aber wie können Sie denn da überhaupt telefonieren?«
»Herr Rechtsanwalt Maxim Iron! Ich wollte Sie jetzt nur bitten, dass Sie meine Ankunft abwarten, ehe Sie irgendwie über die Kapsel mit der Glaskugel verfügen. Bitte, geben Sie sie nicht aus den Händen, zeigen Sie sie niemand. Sie könnte Ihnen verloren gehen, und dann würde es mir schwer fallen, sie doch noch zu bekommen. Ich muss den Golem aus Ihren Händen erhalten. So will es das Schicksal oder er verliert auch für mich seine Kraft —«
»Aha, Sie treiben wohl auch kabbalistische Studien, Zukunftsberechnungen?«
»Und dann bitte ich Sie noch«, fuhr die schnarrende Stimme unbeirrt fort, »bewahren Sie die silberne Kapsel mit Inhalt an einem möglichst kühlen, schattigen Orte auf. In Ihrem eigenen Interesse bitte ich Sie darum, sonst könnte der Golem, besonders wenn er sich in der Sonne erhitzt, über Sie Unglück bringen. Mehr habe ich vorläufig nicht zu sagen. Ich werde mich Ihnen in Bälde persönlich vorstellen, dann sprechen wir weiter darüber, auch über den Kaufpreis. Ich hoffe, dass wir dann schon einig werden. Schluss!«
Ein besonderes Schnarren erklang in der Dose; das Telefon verstummte.
Mister Iron drückte sofort den Knopf der elektrischen Klingel, alsbald meldete sich der Badediener.
»Sie wünschen, Herr Rechtsanwalt?«
»Wer hat soeben mit mir gesprochen?«
»Telefonisch? Ich weiß nichts davon, dass jemand mit Ihnen gesprochen hat.«
»Wo ist Doktor Lazare?«
»In seinem Arbeitszimmer, er hat Besuch bekommen.«
»So, dann will ich ihn jetzt nicht mit solchen Albernheiten stören. Ist mein Anzug schon da?«
»Jawohl, alles liegt im Nebenzimmer bereit.«
»Dann heraus aus der Badewanne!«
Gleich darauf war Doktor Lazare für den Rechtsanwalt wieder zu sprechen.
Mister Iron berichtete das Telefongespräch.
»Na, mit Grönland sind Sie nicht verbunden gewesen!«, rief Doktor Lazare lachend. »Von außerhalb dieses Hauses kann niemand mit Ihnen gesprochen haben. Das ist nur ein Haustelefon. Ein Anschluss an die Stadtleitung ist gar nicht möglich.«
»Ja, wer hat denn da in Ihrem Hause mit mir gesprochen?«
»Das ist allerdings rätselhaft — ach —!!«
Doktor Lazare tippte sich plötzlich wie sich besinnend gegen die Stirn.
»Jetzt weiß ich's — das ist ganz einfach der Daniel Jobster gewesen! Das ist ein verpfuschter Apotheker, der es deshalb nur bis zum Drogistengehilfen gebracht hat, weil er zu viel ins Theater ging, nichts weiter als die Schauspielerei im Kopfe hatte, und er selber hat Theaterstücke geschrieben, bis er eines Abends überschnappte — im Theater — als gerade Julius Cäsar gegeben wurde. Seitdem hält er sich für diesen. Das heißt, manchmal ist er auch der König Lear, dann wieder der Hamlet. Er schnappt überhaupt alles auf und nimmt die betreffende Maske an. Die Sache ist also ganz einfach. Er hat vorhin Ihre Erzählung mitangehört, die geheimnisvolle Gestalt des Loke Klingsor imponierte ihm — da hat er sich hingeschlichen und Sie telefonisch angerufen, wobei er sich für diesen Klingsor ausgab. Er hat die Sache mit dem Golem gleich noch ein bisschen weiter ausgesponnen.«
»Aber kann er das so geschickt machen und auf die Idee verfallen, er sei in Umanak auf Grönland!«
»Er hat wahrscheinlich einmal etwas von Umanak auf Grönland gehört. Der Mensch hat überhaupt große Phantasie! Na, wir können ihn ja einmal herrufen und ihn zur Rede stellen.«
Der junge Mann wurde geholt, trat gleich recht schuldbewusst vor den Arzt hin, wie es freilich wohl immer der Fall war.
»Daniel Jobster, was haben Sie getan?«
»Ich — ich — weiß nicht!«, wurde ängstlich gestottert.
»Sie haben den Herrn Rechtsanwalt hier telefonisch angerufen, als er im Bade saß, nicht wahr?«
»Nein — ach nein —«
»Gestehen Sie, ich sehe es Ihnen ja gleich an!«
»Ja, ich habe ihn telefonisch angerufen«, erklang es nunmehr weinerlich.
»Als was haben Sie sich ausgegeben?«
»Ich — ich weiß nicht — als — als — Julius Cäsar.«
»Nein, als Loke Klingsor!«
»Ja — ja — als Loke Klingsor«, wurde gewinselt.
»Wie kommen Sie dazu, zu sagen, Sie befänden sich auf Grönland?«
»Weil ich — weil ich — als König Erik der Rote doch schon einmal auf Grönland gewesen bin —«
»Was? Wer sind Sie?«
Stramm richtete sich der schüchterne junge Mensch plötzlich auf.
»Ich heiße Daniel Jobster und bin Drogist,« schnarrte er geläufig herunter.
»Na, da sehen Sie, da haben wir die Erklärung«, wandte sich Doktor Lazare mit entsprechender Handbewegung an seinen Freund.
Es gereichte diesem sonst wirklich gediegenen Irrenarzte ja eigentlich nicht zur Ehre, dass er den Unglücklichen so behandelte, ihm so die Antworten in den Mund legte. Aber weil nun einmal nur jemand in diesem Hause telefoniert haben konnte und weil da nur dieser junge Mensch in Betracht kam, weil nur dieser jenes Gespräch mit angehört hatte, so war das Vorgehen schließlich entschuldbar. Auf eine andere Weise hätte Doktor Lazare ihn ja auch zu keinem Geständnis bringen können.
Daniel Jobster konnte somit keine weitere Erklärung abgeben und durfte sich wieder entfernen.
»Nun wollen wir zu Mister Davidson gehen. Sie sind schon angemeldet. Er freut sich, meinen Freund begrüßen zu können, entschuldigt sich nur, dass er Sie im Schlafrock empfängt. Also, ich werde ihm auf den Zahn fühlen, ob er als gründlicher Kabbalist etwas von einem Golem weiß. Da darf ich natürlich nicht gleich mit der Türe ins Haus fallen. Ich werde es so nach und nach einleiten. Lassen Sie mich nur machen und greifen Sie nicht in die Verhandlung mit ihm ein.«
Sie betraten das behagliche Wohnzimmer, in dem am Tisch hinter Zeitungen ein alter, würdiger Herr saß. Die semitische Abstammung war unverkennbar, und durch die langen, noch immer schwarzen Locken, die unter dem Käppi hervorquollen, und durch den kaftanähnlichen Schlafrock kam nun erst recht die Gestalt eines alten Rabbiners heraus.
Die Vorstellung erfolgte, der alte Bankier war die Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit selbst.
»Mein Freund hier hat eine Frage, die Sie vielleicht beantworten können«, eröffnete der Arzt nach einer kleinen Einleitung das Gespräch. »Sie sind doch viel im Orient gereist, Mister Davidson?«
»Jawohl, ich bin gereist viel im Orient, soll der Herr mich nur fragen«, schmunzelte der Alte.
»Können Sie Arabisch?«
»Werde ich doch können Arabisch, sprechen wie schreiben.«
»Hier ist ein kleines Medaillon, in dem Buchstaben eingeritzt sind. Sind das arabische?«
Doktor Lazare überreichte die Kapsel dem Alten, von dem er wusste, dass er noch recht scharfe Augen besaß.
Der alte Herr hatte aber auch schon die Lupe bei der Hand, nahm die noch geschlossene Kapsel, erspähte gleich den Schlitz für den Fingernagel — »darf ich sie öffnen?«, fragte er — und gleich darauf hatte er die beiden Hälften in der Hand.
Kaum aber hatte er darin die weiße Kugel erblickt und vielleicht auch noch dazu auf der anderen Innenseite der Kapsel die eingeritzten Buchstaben, als er mit allen Zeichen des Entsetzens aufsprang und sie von sich schleuderte, als wäre sie glühend heiß.
»Ein Golem, ein Golem!!«, begann er zu heulen. »Wollt Ihr mich machen unglücklich, dass Ihr mir gebt in die Hand einen verfluchten Golem, wollt Ihr mich schicken in das Tophet*), dass sich mein Heulen und Zähneklappern vermischt mit dem Wimmern der Verdammten? — — Wehe, wehe, ein Golem, ein fürchterlicher Golem —«
*) Die Hölle der Juden.
So heulte der Alte, und dann ward es noch schlimmer, er begann zu rasen, bekam einen förmlichen Tobsuchtsanfall.
Doch schon waren ein Assistenzarzt und ein Wärter zur Stelle, sie bändigten den Unglücklichen.
Doktor Lazare fasste den Fall gar nicht tragisch auf, er wartete das Resultat nicht erst ab, sondern verließ schon vorher das Zimmer, den tödlich erschrockenen Rechtsanwalt mit sich ziehend, dabei vergaß er aber nicht, Kapsel und Kugel vom Boden aufzuheben.
»Machen Sie sich keine Vorwürfe, Mister Iron«, sagte er. »Ich weiß schon, was ich getan habe, war auf so etwas vorbereitet. Solch ein Anfall ist ihm sogar ganz gesund. Er leidet an großer Schlaflosigkeit, aber nach jedem solchen Anfall schläft er dann die ganze Nacht sehr ruhig.
Doch was wir da erlebt haben, das ist wirklich ganz merkwürdig! Also auch dieser alte Kaufmann und Bankier, der sich nur nebenbei mit solcher althebräischen Geheimniskrämerei beschäftigt haben kann, erkennt auf den ersten Blick einen Golem und gerät außer sich vor Entsetzen.
Freilich wissen wir genau so wenig wie vorher, was ein Golem eigentlich ist, und um das zu erfahren, dazu, Mister Iron, müssen Sie sich nun allerdings selbst anderweitig bemühen. Den alten Herrn kann ich nicht noch einmal fragen, das darf ich jetzt nicht mehr riskieren!«
Rechtsanwalt Iron war nach Hause gefahren.
Evelyn hatte auf den Vater gewartet, er erzählte ihr alles.
»Merkwürdig!«, staunte das junge Mädchen. »Nicht nur diese ganze Sache, sondern dass ich gerade von einem Golem gelesen haben muss.«
Ach, nun plötzlich wusste Mister Iron, wann er schon einmal das Wort gehört hatte!
Erst vor einigen Tagen hatte die Tochter ihn gefragt, was ein Golem sei. Sie hatte ein Buch gehabt, welches diesen Titel führte: »Der Golem.« Der Vater war mit anderem beschäftigt gewesen, hatte gesagt, er wisse es nicht, die Tochter solle im Lexikon nachschlagen oder sich sonst wie darüber erkundigen, übrigens würde doch wohl das Buch selber eine Erklärung bringen.
Jetzt interessierte er sich nun freilich dafür, ließ sich von der Tochter kurz berichten und las selbst das Buch.
Es war eine phantastische Erzählung. Ein Rabbi — denn wenn es sich um jüdische Geheimnisse handelt, muss doch selbstverständlich ein solcher dabei sein — hat sich kabbalistischen Studien ergeben und findet in einer alten Handschrift das Rezept, wie man durch gewisse Zaubersprüche, dem Buche Sohar entnommen, tote Figuren lebendig machen kann, indem man einige Worte auf besonders präpariertes Papier schreibt und der betreffenden Figur einverleibt. Der Rabbi braut aus scheußlichen Sachen die höllische Mixtur für das Papier, er formt aus Ton und Holz und anderen Massen die verschiedensten Figuren, aber ob er den Zauberspruch nun hineinknetet oder in ein Loch hineinsteckt, die Figuren wollen nicht lebendig werden, sie sind und bleiben eben tote, gefühllose Gegenstände.
Da entdeckt er bei einem Trödler eine kleine hölzerne Figur von seltsamem Aussehen, einen Menschen darstellend, und der Trödler erzählt, sie stamme aus dem Nachlasse eines alten Juden, der im Rufe der Zauberei gestanden habe.
Das nun bereits geschärfte Auge des Rabbis erkennt gleich den »Golem«, dem nichts weiter fehlt als der Zauberspruch, der ihm in ein Löchelchen vorn auf die Brust gesteckt zu werden braucht, um ihm Leben einzuhauchen.
Er ersteht die Figur, nimmt sie mit nach Hause, macht seinen Hokuspokus, und richtig, das hölzerne Männlein wird lebendig! Nun hat der Rabbi seinen Hausgeist, seinen Kobold, der die wunderbarsten Sachen ausführt, seinem Herrn allerhand Vorteile verschafft, ihm am Ende aber immer Unglück bringt, und als einmal das Männlein durch einen Sturz zerschmettert wird, da bricht auch der Rabbi tot zusammen, seine Seele fährt zur Hölle —
Dass es so etwas nicht geben kann, braucht hier wohl nicht besonders betont zu werden. Die Sache ist nur dadurch von literarhistorischem Interesse, weil es sich dabei um eine jüdische Volkssage handelt.
Jenes Buch, welches nun auch der Rechtsanwalt gelesen hatte, besaß keinen wissenschaftlichen Wert. Nirgends war ein Hinweis auf eine Literatur, aus welcher der englische Verfasser geschöpft hatte. Ein Kenner musste sofort merken, dass der Mann das Buch Sohar niemals in der Hand gehabt haben konnte.
Es war eben eine phantastische, märchenhafte Erzählung, ein Produkt leichter Literatur, nichts weiter.
Am anderen Morgen saßen Vater und Tochter beim Frühstück.
Der Rechtsanwalt erledigte wie gewöhnlich gleich am Kaffeetisch die erste Morgenpost, ließ sich aber dabei gern von seiner Tochter Neuigkeiten aus den Zeitungen vorlesen oder kurz darüber berichten. Vorausgesetzt, dass es ihn interessierte, sonst unterbrach er sie beizeiten.
»Charles Dubois rüstet eine neue Expedition aus, um nochmals in das Innere Australiens zu dringen«, hatte Evelyn jetzt zu melden.
Aufmerksam hob der Vater den Kopf.
»Soooo? Charles Dubois? Das ist ein tüchtiger Kerl! Der hat der Wissenschaft schon manchen Dienst erwiesen. Subskribiert er wieder wie damals, um die Kosten zu decken? Dann würde ich nochmals tief in den Beutel greifen.«
»Davon steht hier nichts, es ist nur eine kurze Andeutung, dass er Leute anwirbt für eine neue Expedition ins Innere.«
Einige Zeit verging.
»Die Bella Cobra«, fing Evelyn dann wieder an, »tritt nicht mehr auf, sie ist kontraktbrüchig geworden, hat ihre Konventionalstrafe von tausend Pfund Sterling glatt bezahlt.«
»Die Bella Cobra, wer ist denn das?«
»Die exzentrische Tänzerin und Sängerin im OlympiaTheater —«
Weiter kam die Tochter nicht, der Vater machte eine Bewegung, als wolle er sich gleich die Ohren zuhalten.
»Ach, um Gottes willen, höre auf! Als ich neulich im Klub war, wurde von nichts weiter gesprochen, als von der Bella Cobra, bis ich davonlief. Ja, man sieht sich so etwas wohl einmal an, um für eine Stunde eine geistige Ablenkung zu haben. Aber dass ernste Männer sich über solch ein geschminktes Frauenzimmer lang und breit begeistert unterhalten können, das verstehe ich einfach nicht.«
Ehe Evelyn etwas erwidern konnte, meldete ein Diener, das Telefon habe geklingelt, der Herr Rechtsanwalt werde dort jedenfalls verlangt.
Mister Iron ging in sein Arbeitszimmer, erledigte das Gespräch, rief noch eine andere Person an und musste etwas warten.
Da — als er mit dem Hörtrichter am Ohre dastand — vernahm er andere Laute, wohl menschliche Stimmen, die ganz anders klangen als sonst, und er wusste sofort, was hier vorlag. Die Leitung hatte Nebenschluss, er hörte ein fremdes Gespräch mit an.
»Monsieur Dubois, sind Sie dort?«
»Jawohl, Miss Cobra, ich bin es.«
Ein merkwürdiger Zufall! Soeben hatte der Rechtsanwalt über diese beiden Personen gesprochen, ohne sie in irgendeinen Zusammenhang miteinander zu bringen, und jetzt unterhielten sich der Australienforscher und die Tänzerin hier durchs Telefon!
So gern nun auch Mister Iron gewusst hätte, was diese beiden Personen, die zusammenpassten wie Tag und Nacht, miteinander zu verhandeln hatten, war er doch viel zu anständig, um da zu lauschen.
Schon wollte er melden, dass dieses Gespräch einen versehentlichen Mithörer habe, als er noch etwas anderes vernahm, was ihn bewog, doch noch zu lauschen. Sein Interesse ward im höchsten Grade gefesselt, und er hörte sich das Gespräch mit an.
»Haben Sie schon nähere Nachrichten über unseren Loke Klingsor bekommen?«, fragte die dünne, aber durchdringende Frauenstimme.
»Aber um Gottes willen, Miss«, erklang wie erschrocken eine sonore Männerstimme, »wie können Sie hier durchs Telefon diesen Namen nennen!«
»Na also — den Fürsten des Feuers meine ich, den Mann mit den Teufelsaugen —«
»Ja doch, ja, ich weiß schon, wen Sie meinen! Jawohl, ich habe jetzt nähere —«
Da brach das Gespräch ab. Im Amt war die falsche Verbindung bemerkt und gelöst worden.
Und Rechtsanwalt Iron stand am Telefon und starrte und staunte und wusste nicht, ob in seinem sonst so klaren Kopfe auch wirklich alles noch in Ordnung war.
Loke Klingsor, der Fürst des Feuers, der Mann mit den Teufelsaugen!
Soeben hatte die Bella Cobra diese Worte auch dem Australienforscher Charles Dubois gegenüber gebraucht.
Das war doch zumindest ein seltsamer Zufall, dass er — Rechtsanwalt Iron — Zeuge dieser Unterredung wurde.
Mister Samuel Philipp? Angenehm. Womit kann ich Ihnen dienen?« Der diese Worte in seiner Wohnung zu Orange bei New York sprach, war ein gar berühmter Mann: Thomas Alva Edison.
Damals war er noch nicht taub wie heute, welche Stocktaubheit der große Erfinder nach seinen eigenen Worten als ein hohes Glück schätzt, weil er dadurch nicht mehr so in seiner Arbeit gestört wird, nicht mehr so viel Unsinn zu hören braucht.
Mister Samuel Philipp hatte den schwer zugänglichen Mann schriftlich um eine kurze Audienz gebeten und die Erlaubnis dazu erhalten, in sehr höflichen Worten, aber die Zeit war auch genau festgesetzt gewesen, nicht länger als eine halbe Stunde, bis zur Minute, und obgleich Mister Samuel nun wusste, wie streng das eingehalten werden würde, sobald dort der große Zeiger der elektrischen Uhr auf die zwölf sprang, würde Edison ihm den Rücken kehren, das Hinauskomplimentieren übernahm eine andere Person, so musste er sich doch erst mit einer kleinen Einleitung aufhalten, ehe er in die Tasche griff und die Hauptsache hervorzog.
»Haben Sie schon von dem Gerüchte gehört, das in New York zirkuliert und jetzt wahrscheinlich schon in allen amerikanischen, wenn nicht sogar in allen Zeitungen der Welt zu lesen ist, Mister Edison?«
»Was ist's?«, lautete die bei aller freundlichen Höflichkeit kurze, kühle Gegenfrage des Mannes, der ein Vermögen von mindestens hundert Millionen Dollar durch rastlosen Fleiß aus seinem eigenen Gehirn gemünzt hat.
»Ich lebe ganz einsam in einem Hause zusammen mit sechs Dienern, die niemals etwas ausplaudern werden, vorausgesetzt, dass in meinem Hause überhaupt Dinge passierten, welche die Neugier reizen könnten.
Die Sache ist nun die, dass zur Zeit, als sich die Geschichte abspielte, in meinem Hause gerade ein Gasschlosser beschäftigt war.
Dieser Mann hat nun unbemerkt ein Gespräch zwischen meinen Dienern belauscht, hat die ganze Sache falsch verstanden, hat das Gehörte verdreht und immer weiter verdreht, aus seiner Phantasie noch mehr hinzugefügt, und so ist das sinnlose Gerücht entstanden, das nun schon in den Zeitungen zu lesen ist.
Danach soll ich ein Lichtbild an die Wand projiziert haben. Also — ich bitte, wohl zu verstehen — ein einfaches Glasbild, nicht etwa einen kinematografischen Film, nur mit der Laterna magica.
Das Bild stellte einen Mann dar, auf einem Stuhle sitzend, auf seiner Schulter eine große schwarze Katze, im Hintergrunde hingen an der Wand verschiedene Waffen, Kriegskeulen und dergleichen Utensilien mehr.
Und da soll plötzlich dieses starre Lichtbild lebendig geworden sein, und nicht nur das, sondern es soll auch gesungen und gesprochen, der Mann soll sich plötzlich von der Wand abgelöst und als ein greifbares Wesen auf mich geworfen haben.
Wir sollen miteinander gerungen haben, und als ich auf den Mann mit dem Revolver schoss, soll er von der Wand eine Kriegskeule genommen und auf mich losgeschlagen haben.
Zum Überfluss sei auch noch die schwarze Katze auf mich losgesprungen und habe mir das ganze Gesicht in fürchterlichster Weise zerkratzt.
Zuletzt hat mich der Mann mit der Keule zu Boden geschlagen, sodass ich bewusstlos wurde, wie man mich dann gefunden hat.
Das lebendige Lichtbild war wieder in seiner ursprünglichen Stellung erstarrt.
Aber die Beule, die mir die Keule geschlagen, war mir auf der Stirn geblieben, und die Kratzwunde der Katze hatte ich auch noch im Gesicht, wie noch jetzt zu sehen ist.
Glauben Sie, Mister Edison, dass so etwas möglich ist?«
Der Gefragte blickte auf den ausgedörrten Greis, der an der Stirn noch immer eine tüchtige Brausche und im Gesicht lange Kratzwunden hatte.
»Dass ein Lichtbild sich von der Wand ablösen und als körperliches Wesen schlagen und kratzen kann? Nein, das halte ich nicht für möglich!«
»Danke. Wahr ist an der ganzen Sache nur, dass ich tatsächlich mit dem Revolver nach dem Lichtbild geschossen habe. Die Kugel fuhr in die Wand, traf einen Ziegelstein, prallte davon ab und mir gegen die Stirn. Daher die Brausche. Dieser Schlag mag mich auch betäubt haben. Möglich auch, dass ich beim Sturze oder schon vorher gegen den Tisch gerannt bin, daher das Geräusch eines vermeintlichen Handgemenges. Und schließlich bin ich gegen die Wand gefallen, eine raue Kalkwand, bin mit dem Gesicht an ihr herabgerutscht — daher die Kratzwunden.«
»Ja, das halte ich für möglich«, meinte Edison diesmal in demselben Tone wie vorher, »so etwas kann vorkommen.«
»Und doch ist etwas Wahres an der ganzen Sache.«
»Was?«
»Halten Sie es für möglich, Mister Edison, dass eine an sich starre Fotografie, auf Glas übertragen, durch eine Laterna magica als Lichtbild gegen die Wand projiziert, sich bewegen und sogar sprechen kann?«
»Das kommt ganz darauf an, Mister Philipp«, erwiderte der berühmte Erfinder.
Jetzt zog Mister Philipp die Hand hervor, die er schon längst in der Brusttasche gehabt hatte, brachte ein flaches Paketchen zum Vorschein, enthüllte es — es enthielt eine bunte Fotografie im Visitenkartenformat, offenbar auf einer Glastafel — das nun schon bekannte Bild von Loke Klingsor im Lehnstuhle, mit seiner schwarzen Katze auf der Schulter.
»Halten Sie es für möglich. Mister Edison, dass dieses kolorierte Glasbild in der Laterna magica an der Wand als Lichtbild vollkommen beweglich wird?«
Der Gefragte nahm die Tafel. Dabei war ihm nicht viel oder eigentlich gar nichts davon anzumerken, dass das doch wirklich seltsame Bild dieses Mannes mit den Teufelsaugen besonderen Eindruck auf ihn machte, er hielt es gleich gegen das Licht.
»Dieses Bild ist nicht einfach koloriert, sondern die Farben sind in das Glas zweifellos eingeschmolzen«, lautete sein sofortiges Urteil.
»Möglich. Aber Sie, Mister Edison — ich wiederhole meine Frage — halten Sie es für möglich, dass diese Fotografie als großes Lichtbild lebendig werden kann?«
»Wie soll ich das verstehen?«
»Dass es lebt, so, wie ein kinematografisches Bild bei abrollendem Filmstreifen.«
»Was für Bewegungen hat der Mann denn eigentlich ausgeführt?«
»Darüber möchte ich mich nicht weiter auslassen —«
»Wie Sie belieben. Ich meine nur, dass sich das Bild nicht etwa nur im flackernden Lichte zitternd bewegt hat.«
»Ausgeschlossen!«
»Weshalb ausgeschlossen?«
»Der Mann ist von seinem Stuhle aufgestanden, die Katze ist dann fauchend von seiner Schulter herabgesprungen —«
»Ah so, das ist etwas anderes! Und doch! Könnten Sie nicht etwa nur eine Halluzination gehabt haben, etwa im Augenblick Ihres Sturzes, bei dem Sie mit dem Kopfe heftig aufschlugen, wodurch ein Momenttraum entstand?«
»Ausgeschlossen!«, erklang es nach wie vor aufs Bestimmteste.
»Weshalb ausgeschlossen?«, wurde wiederum gefragt.
»Ich kann allerdings nicht sagen, wie lange sich das Bild bewegt hat. Ich wage nicht anzugeben, ob ich es nur eine viertel Minute oder eine viertel Stunde beobachtet habe, denn ich befand mich in einer furchtbaren Erregung, und da kann einem jedes Zeitmaß abhanden kommen —«
»Ich verstehe!«
»Aber Sie sehen, dass der Mann das linke Bein über das rechte geschlagen hat und ich weiß bestimmt, dass er ursprünglich das rechte Bein über das linke gelegt hatte. Dafür besitze ich einen bleibenden Beweis, nämlich eine Kopie des ursprünglichen Bildes. Außerdem hängt der patagonische Wurfhammer, den er wirklich schwang, wenn auch nicht gegen mich, jetzt anders als vordem an der Wand —«
»So, so! Das genügt mir. Also das Lichtbild hat sich wirklich selbstständig bewegt. Nun, Mister Philipp, Sie fragen mich, ob so etwas möglich ist. Ja, es gibt eine Möglichkeit. Um Ihnen aber diese auseinanderzusetzen, müsste ich Ihnen eine gar lange Gedankenkette abrollen, und es ist sehr die Frage, ob Sie mir folgen könnten. Deshalb will ich Ihnen in Kürze nur etwas erklären.
Worauf der von mir konstruierte Phonograph im Prinzip beruht, ist Ihnen bekannt.
Auf einem mechanischen Prinzip, indem die Schwingungen der Töne in eine nachgiebige Masse eingegraben und so wieder abgehoben und auf eine Membrane übertragen werden.
Was ich nun auf mechanischem Wege zustande gebracht habe, hat der geniale dänische Ingenieur Poulsen auf elektromagnetischem Wege erreicht — mit seinem sogenannten Telegrafon.
Bei diesem Sprechapparat läuft ein Stahlband oder auch nur ein ganz dünner Stahldraht an einem Mikrofon vorbei, die Schallwellen werden auf dem Draht durch positiven Elektromagnetismus fixiert.
Wird dann negativer Strom durch den Draht geschickt, so gibt er die Schallwellen wieder ab, die sich auf die Membrane übertragen.
So weit sind wir heute, und Poulsens Telegrafon übertrifft meinen Phonographen bei weitem.
Ferner ist aber auch bereits die Möglichkeit erkannt worden, dass man einen und denselben Draht immer wieder benutzen kann, um ein neues Gespräch aufzunehmen, ohne dass das vorige erst durch negativen Strom wieder ausgewischt werden muss.
Man braucht nur immer verschieden starken Strom einzuschalten und die bereits geschilderte Möglichkeit ergibt sich.
Man kann statt des Drahtes auch eine Stahlplatte verwenden, die sich nicht einmal an dem Mikrofon zu bewegen braucht, indem sich die Schallwellen ganz von selbst nebeneinander auf der magnetischen Stahlfläche ablagern und sich dann auch so in geordneter Reihenfolge wieder ablösen.
Ist man damit heute noch nicht so weit, so liegt das nur noch an einigen technischen Schwierigkeiten, die aber sicher noch überwunden werden. Also es wird die Zeit kommen, da man ein Stückchen Stahlblech bespricht, und zwar gleich stundenlang, man schickt es im Kuvert oder als Postkarte ab, und der Empfänger kann auf seinem Apparate stundenlange Briefe wörtlich vernehmen.
Dies dient als Einleitung zu meinen folgenden Ausführungen.
Unsere heutige Fotografie beruht auf chemischem Prinzip.
Aber es wird die Zeit kommen, da man dasselbe Resultat auf elektrischem oder magnetischem oder elektromagnetischem Wege erzielen wird, und zwar geschieht dies in absehbarer Zeit.
Eine Platte wird vorgerichtet, in die Kamera gesteckt, ein Strom durchgeschickt, ein Druck auf einen Knopf — schrumm!
Das Original ist elektromagnetisch auf der Platte unverwischbar fixiert.
Und nun kommt wieder das Gleichnis mit dem Telegrafon daran.
Es lässt sich denken, dass man dieses fixierte Bild durch einen anderen Strom wieder auslöschen kann. Das heißt, nur für unser Auge.
In Wirklichkeit bleibt es bestehen, es wird nur scheinbar unsichtbar.
Es lässt sich denken, dass diese selbe Platte dann sofort für eine neue Aufnahme bereit ist, die nun über die andere kommt.
Und so lassen sich Hunderte und Tausende und Millionen von Aufnahmen machen, immer übereinander auf einer und derselben Platte.
Wird nun der negative Strom eingeschaltet, so müssen sich ganz logischerweise die Bilder nacheinander wieder abrollen, von einer und derselben Platte, und es lässt sich weiter denken, dass man statt der Stahlplatte eine andere Masse nimmt, Glas oder eine sonstige durchsichtige Substanz, welche die gleiche Eigenschaft besitzt wie Stahl, um die elektromagnetischen Bilder festzuhalten.
Kommt nun solch eine Platte, die zahllose Momentfotografien enthält, in einen Projektionsapparat, dann erscheint eben an der Wand ein lebendes Lichtbild, ausgehend von einer einzigen Platte.
Haben Sie mir bzw. meinen Ausführungen folgen können, Mister Philipp?«
Aufmerksam, sich immer das spitze Kinn reibend, hatte der Alte gelauscht.
»O ja, so ungefähr habe ich Sie verstanden. Also Sie halten es für möglich, dass diese Glasfotografie lebendig werden kann?«
»Ich will in Ihrem Sinne antworten: Ja, die Möglichkeit ist vorhanden.«
»Und dass sie auch zu singen und zu sprechen vermag?«
»Das habe ich doch schon bei meiner ersten Beweisführung stark angedeutet.«
»Wie kann man denn dieses Bild wieder lebendig machen?«
Edison hob die breiten Schultern und zog ein etwas eigentümliches Gesicht. Der verstand ihn und all das, was er sagte, ja gar nicht.
»Geehrter Herr — wenn Sie's nicht wissen — ich weiß es nicht. Das Bild hat sich später nicht mehr bewegt?«
»Nie wieder.«
»Haben Sie es probiert?«
»Ach, was ich alles versucht habe!«
»Von wem haben Sie denn dieses Bild? Wer hat es denn hergestellt?«
»Das — das«, wurde der alte Mann wieder unsicher wie schon einmal, »das möchte ich mein Geheimnis blei...«
»Schon gut, schon gut! Nun, wir können ja einmal einige Experimente mit dem Bilde anstellen, jetzt allerdings nicht, jetzt habe ich keine Zeit, Sie müssten mich später einmal in meinem optischen Laboratorium besuchen —«
In dem Raume, in dem die beiden sich befanden, waren allerdings auch keine Experimente möglich. Der große Erfinder hatte seinen Besuch in einem ganz einfach ausgestatteten Zimmer empfangen, in dem es ganz und gar nicht »erfinderisch« aussah.

Das Bemerkenswerteste in diesem Zimmer war, dass am Boden überall Häufchen von Zigarrenasche herumlagen. Überhaupt Zigarrenasche allüberall, denn Edison ist ein Kettenraucher, er raucht sogar im Schlafe. Ehe er sich zum Schlafen hinlegt oder wohl häufiger in einem Stuhle zurechtsetzt, steckt er erst noch eine Zigarre in die Spitze, die er während des Schlafens automatisch verpafft.
Und zwar raucht der hundertfache Millionär heute noch dieselbe Sorte, die er sich einst als Zeitungsjunge manchmal geleistet hat. Also keine sehr besondere und feine Sorte.
Nur dass er heute jeden Tag das Viertelhundert voll macht.
Edison konnte seine Einladung nicht vollenden.
»Nein, nein, aus den Händen kann ich dieses Bild nicht lassen!«, rief Mister Philipp wie in tödlichem Schrecken, auch gleich die Hände nach dem Bilde ausstreckend.
»Wie Sie wünschen«, lautete wiederum die ebenso freundliche wie kühle Entgegnung. »Sonst noch etwas, Mister Philipp?«
»Können Sie mir denn nicht einen Ratschlag geben, wie ich dieses Bild noch einmal zum Leben bringe?«
Ja, für fünf Minuten war Edison noch bereit, Ratschläge zu erteilen, wozu er aber erst noch einige Fragen stellen musste.
»Was für einen Projektionsapparat benutzen Sie denn?«
»Eine ganz einfache Laterna magica.«
»Was für ein Licht?«
»Gasglühlicht.«
»Woher bekommen Sie das Gas? Ist es eigenes, in Ihrem Hause hergestellt?«
»Nein. Aus der New Yorker Gasanstalt.«
»So. Ich dachte an eine fremde Beimischung, aber dann allerdings — haben Sie vor das Okular farbige Gläser gesetzt?«
»Nie.«
»War das Zimmer verfinstert?«
»Ganz und gar.«
»Geschah das Wunder am hellen Tage oder in der Nacht?«
»Am Vormittage.«
»War draußen Sonnenschein?«
»Jawohl, ich entsinne mich.«
»Nach welcher Seite liegt jenes Zimmer?«
»Nach Südosten.«
»Also Sie hatten die Fenster verhangen?«
»Mit Läden verschlossen.«
»Sind denn diese auch ganz und gar lichtdicht? Kann nicht ein ganz dünner Strahl durchfallen oder sich sonst wie Licht bemerkbar machen?«
»Nein. Absolut lichtdicht. Ich benutzte dieses Zimmer und den Projektionsapparat öfters, um Schmetterlingsflügel und dergleichen — eine Liebhaberei von mir — zu vergrößern, und wenn man längere Zeit in so einem stockfinsteren Raume ist, merkt man doch bald, wenn sich irgendwo auch nur das geringste Löchelchen befindet, durch welches das Tageslicht dann schneeweiß eindringt.«
»Allerdings. Nun sagen Sie mal, Mister Philipp — wie ging denn eigentlich die Geschichte los? Wann wurde denn das Lichtbild lebendig?«
»Ich hatte es in dem finsteren Zimmer gegen die Wand projiziert, wie schon so häufig, ohne dass ich dabei jemals eine Bewegung bemerkt oder einen Ton gehört hätte.
Da wurde ich abgerufen, begab mich in das Nebenzimmer hinüber, das Licht in dem Apparat einstweilen brennen lassend, und plötzlich, nach einer kleinen Weile, höre ich da drüben von einer fremden Stimme ein Lied singen, und als ich die Tür öffne, da sehe ich — sehe ich — — ist der Mann hier eben lebendig geworden, seine Katze auch. Und wie lebendig sind beide geworden.«
»So! Hm! Also Sie begaben sich in das Nebenzimmer. Es liegt doch wohl auf derselben Südostseite wie jener Raum?«
»Jawohl.«
»Schien in dieses Nebenzimmer nicht die draußen scheinende Sonne?«
Schon begann der alte Samuel hoch aufzuhorchen, sein Gesicht nahm einen ganz anderen Ausdruck an, als es bisher gehabt hatte. Wie das der Katze, wenn aus dem Loche die Nasenspitze der Maus auftaucht. Denn dass er hier vor einem Manne stand, der mit unwiderstehlicher Geisteskraft einem rätselhaften Geheimnis Zoll für Zoll auf den Leib rückte, das ahnte er nun wenigstens schon, wenn er es auch noch nicht bestimmt wusste.
»Jawohl, ich entsinne mich — in dieses Zimmer schien die Sonne.«
»Hatten Sie die Tür zu dem Nebenzimmer hinter sich geschlossen?«
»Ich — ich — geschlossen? Nein, ich glaube nicht. Nur angelehnt. Jawohl, nur angelehnt war sie, jetzt weiß ich es bestimmt.«
»Eine kleine Spalte stand die Türe wohl noch auf?«
»Genau kann ich's nicht sagen, aber das ist sehr leicht möglich.«
»Ist Ihr Projektionsapparat hinten geschlossen?«
»Nein, er ist offen.«
»Gesetzt nun den Fall, aus dem hellen Zimmer drang ein Sonnenstrahl durch die Türspalte in das finstere Zimmer, stand der Projektionsapparat so, dass dieser Sonnenstrahl gerade das Glasbild in der Laterna magica traf?«
»Ja — o ja — wenn ich mir alles richtig vorstelle — das ist sehr wohl möglich. So hat der Apparat gestanden, so steht er immer.«
Jetzt rieb Edison sich das glattrasierte Kinn, während er, in Sinnen versunken, vor sich hinschaute, und erst sprach er nur leise für sich:
»Es ist das große Problem, ob sich die scheinbare Bewegung der Sonne nicht ausnutzen lässt — oder die wirkliche Bewegung der Erde — 30 700 Meter in der Sekunde — diese ungeheure Geschwindigkeit auf einen einzigen Punkt konzentriert, dessen Bewegung man in der Sekunde nicht kontrollieren kann — das ist das große Problem der Optik —«
Edison erwachte aus seinem Sinnen, warf einen Blick auf die Wanduhr und gab Mister Philipp das Glasbild zurück.
»Wissen Sie, Mister Philipp — machen Sie mal folgenden Versuch: An einem sonnigen Tage, so wie damals, stellen Sie Ihren Projektionsapparat so, dass von hinten Sonnenstrahlen auf das Glasbild fallen, entweder direkt oder indirekt, indem Sie sie mit einem Spiegel auffangen und lenken. In letzterem Falle können Sie dabei sogar das Zimmer verdunkelt haben. Schließlich auch in ersterem Falle. Denken Sie nur an die Türspalte, durch die sich wahrscheinlich ein Sonnenstrahl schlich. Erst arbeiten Sie mit dem Gasglühlicht im Apparat, dann ohne. Das müssen Sie ausprobieren. Verstehen Sie?«
»Jawohl, Mister Edison, ich habe Sie vollkommen verstanden.«
»Sie müssen selbst experimentieren. Ich kann Ihnen hier nur einen Wink geben. Haben Sie keinen Erfolg, dann schreiben Sie mir, ich werde Ihnen mitteilen, wann wir noch einmal darüber sprechen werden.«
»Bim«, machte die Uhr, deren großer Zeiger die Zwölf erreicht hatte.
Edison machte in demselben Augenblick eine kurze Verbeugung, wandte sich dann ganz plötzlich um und verließ schnellen Schrittes das Zimmer, statt seiner trat ein Herr ein, der den Besuch hinauskomplimentierte, was ebenfalls sehr fix ging. —
War es nicht merkwürdig gewesen, dass Edison für diese wunderbare Sache, die ihm da mitgeteilt worden war, die er sozusagen in der Hand gehabt, doch im Grunde genommen so wenig Interesse gezeigt hatte? Hätte dieser Erfinder sich nicht sofort darauf stürzen sollen, um die Angelegenheit über das Geheimnis zu verfolgen?
Nein. Edison hatte eben anderes zu tun. Und Edison gehört zu denjenigen klugen Leuten, welche nicht den Sperling aus der Hand lassen, um nach der Taube auf dem Dache zu greifen.
Aber es ist auch noch etwas anderes dabei.
Edison will sich für sich selber amüsieren, was ganz wörtlich zu nehmen ist. Er nimmt gar keine fremde Idee an.
Und wenn ihm jemand auch die genialste Erfindung unterbreitete, die erst noch perfekt zu machen ist, eine Zeituhr, mit der man die Weltgeschichte zurückdrehen könnte — Edison wird sich gar nicht darum kümmern. Er tüftelt für sich selber, das ist sein Vergnügen, sein Lebensglück. Und wer das weiß, der versteht den Blödsinn, den man einst in den Zeitungen lesen konnte: Weil Edison auf dem Steueramt seine hundertste Million angemeldet hatte, sollte er sich nun zur Ruhe setzen. Vielleicht im Großvaterstuhl mit der langen Pfeife?
Zu Hause angelangt, ging Samuel Philipp sofort daran, das ihm gegebene Rezept zu befolgen.
Ein schlitzäugiger Diener mit zitronengelber Haut war ihm behilflich, in dem Schreibzimmer, durch dessen geöffnetes Fenster die Sonne hereinflutete, einen gewöhnlichen Handspiegel so aufzubauen, dass er die Sonnenstrahlen durch die Tür in das verdunkelte Nebenzimmer lenkte, von hinten in den Projektionsapparat hinein, und falls das kein Resultat ergab, lag schon ein Rasierspiegel mit konkavem Glase zur Anwendung bereit.
Aber so weit sollten die beiden nicht kommen. Sie waren noch dabei, den Sonnenstrahl zu dirigieren, die Sache wollte nicht recht klappen, als ein pechschwarzer Neger hereingestürzt kam, mit allen Zeichen des Entsetzens.
»Massa, o, Massa!«, ächzte er und brachte vorläufig nichts weiter heraus.
»Was gibt's denn? Was ist denn los?«, musste sein Herr ihm erst zur Hilfe kommen, und dieses dürre Männchen schien sich nicht so leicht aus der Fassung bringen zu lassen, sein hageres Gesicht war eherner denn je.
»Das Telefon — das Telefon — es hat geklingelt!«
Es war ein Haustelefon, welches einige Zimmer in den verschiedenen Etagen mit der Dienerstube verband. Von einem anderen Telefon wollte Samuel Philipp, der nicht einmal Briefe annahm, nichts sehen und hören.
»Wo hat's denn geklingelt?«
»In unserer Stube«, keuchte der Schwarze nach wie vor atemlos.
»Wer soll denn geklingelt haben, wenn's nicht einer von Euch gewesen ist?«
»Loke Klingsor!«
Aber wie das nun herauskam!
Und welchen Eindruck dieser Name freilich auf das dürre Männlein machte!
»Das ist nicht wahr!«, kreischte es förmlich auf.
»Loke Klingsor — er ist es! Ich habe ihn auch gleich an der Stimme erkannt — Loke Klingsor — Massa, o, Massa — Loke Klingsor hat angerufen, Ihr sollt ans Telefon kommen, er will Euch unbedingt sprechen!«
Da war Samuel Philipp schon unterwegs. Er schoss wie ein Wiesel davon, bis er in ein geräumiges Zimmer stürzte, das nichts weiter enthielt als allüberall ausgestopfte Polarvögel. Hier erst mäßigte er seinen schnellen Lauf, dieser verwandelte sich sogar in ein Schleichen, und so näherte er sich geduckt dem an der Wand befindlichen Telefon.
»Ist jemand dort?«, fragte er leise, schüchtern.
Eine volle, sonore Bruststimme antwortete, und wenn sie auch eine ziemlich lange Rede hielt, so drückte sie sich doch kurz und bündig aus.
»Hier Loke Klingsor. Hören Sie mich an, Samuel Philipp, aber unterbrechen Sie mich mit keinem Wort. Wenn Sie auch nur einen einzigen Laut von sich geben, so schicke ich in Ihr zahnloses Lügenmaul einen Blitz, der Zeit Ihres Lebens, welches der Teufel recht bald abkürzen möge, als feuriger Bandwurm in Ihren Eingeweiden wühlen soll.
Wundern Sie sich nicht, dass ich so abfällig und drohend spreche, was Sie sonst nicht von mir gewohnt sind.
Sie wissen ja, was für ein höflicher, liebenswürdiger, ruhiger, feiner Mann ich bin. Aber als normal gebauter Mensch habe ich eine Galle, die auch einmal überlaufen kann. Sie haben sie mir endlich zum Überlaufen gebracht und nun hat meine Gemütlichkeit Ihnen gegenüber ein Ende.
Also, Samuel Philipp, hören Sie mich schweigend an.
Sie sind in den Besitz einer Glasfotografie von mir gekommen, die mir einst gestohlen worden ist. Diese Tatsache und dass ich sie vermisst, sie in allen Weltteilen und in allen Winkeln der Erde gesucht habe, das ist Ihnen ganz genau bekannt gewesen. Sie hatten auch immer die Möglichkeit, sich mit mir in Verbindung zu setzen — aber von Ihnen ist so etwas ja nicht zu erwarten.
Nun sind Sie zufällig auch noch dahinter gekommen, wie sich die Glasfotografie lebendig machen lässt. Aber Sie sollen nur ein einziges Mal Gelegenheit gehabt haben, mich in meiner intimen Häuslichkeit beobachten zu können, ein zweites Mal passiert das Ihnen sicherlich nicht mehr.
Ich befehle Ihnen hiermit: Sobald ich nachher ›Schluss‹ gesagt habe, gehen Sie hin und packen die Glasfotografie, ohne sie erst noch einmal zu betrachten, sofort irgendwie ein und legen das Paket oder die Schachtel einstweilen in die Schublade Ihres Schreibtisches, rühren sie diese aber im Laufe des Tages nicht wieder an.
Und sobald heute die Sonne untergegangen ist, aber noch in der Dämmerung, nehmen Sie die eingehüllte Fotografie, begeben sich in die dritte Etage Ihres Hauses, betreten das große, vierfenstrige Zimmer, das Sie sonst so selten betreten.
Auf der Frontseite sind nur drei Fenster, von diesen öffnen Sie das mittlere, legen die eingepackte Fotografie draußen auf den Sims, schließen das Fenster wieder und kümmern sich um nichts weiter.
Das ist alles, was Sie zu tun haben, Sie haben mich genau verstanden, und da brauchen Sie gar keine Erklärung weiter.
Ich will Ihnen auch nicht verbieten, zuzusehen, was aus der Fotografie wird.
Meinetwegen bleiben und warten und beobachten Sie nach Belieben, falls Sie es wirklich wagen, bei Nacht in diesem großen Zimmer zu weilen.
Sie dürfen auch andere Personen mitnehmen und Licht machen, so viel Sie wollen.
Auch die drei anderen Fenster können Sie öffnen. Nur jenes mittlere nicht. Das bleibt geschlossen.
Und nun, Samuel Philipp, wenn Sie diesen meinen Befehlen nicht nachkommen, dann sollen Sie etwas erleben. Dann spreche ich persönlich mit Ihnen.
Ich bin jetzt in Sydney, aber Sie wissen doch, wie schnell ich bei Ihnen in New York sein kann.
Dann sollen Sie den Loke Klingsor einmal von einer neuen Seite kennen lernen. Meine Rücksicht Ihnen gegenüber hat nun ein Ende.
Sie sind einst mein Freund gewesen, Sie gerissener Gauner haben mich sogar über Ihren Charakter zu täuschen verstanden.
Und als ich den erkannt hatte, habe ich Ihnen immer noch mehrmals aus der Klemme geholfen. Das letzte Mal in dem Lamakloster, Sie wissen doch, als Sie in der großen Trommel geröstet werden sollten, auch wieder wegen Ihrer Stänkerei, mit der Sie die Gastfreundschaft der Mönche vergolten hatten. Da habe ich Sie aus der schon geheizten Trommel herausgeholt und Sie in Sicherheit gebracht.
Nun aber könnte ich mich selbst einmal an Ihnen vergreifen.
Samuel Philipp, wenn Sie meinen Befehlen nicht nachkommen — bei Thor und Odin und bei Freyas heiligem Feuer — ich hänge Sie in den Krater des Hekla und lasse Sie räuchern, bis Sie schwarz sind, Sie vermaledeiter Lump Sie! Schluss!«
Lob sei Allah, dem Weltenherrn,
Dem Erbarmer, dem Barmherzigen,
Dem König am Tage des Gerichts!
Dir dienen wir und zu dir rufen um Hilfe wir.
Leite uns den rechten Pfad,
Den Pfad derer, denen du gnädig bist,
Nicht derer, denen du zürnst, und nicht der Irrenden.
So rief mit schallender Stimme der Vorbeter der aufgehenden Sonne entgegen, die erste Sure des Korans, die jeden neuen Tag einleitet, mehr als fünfzig in weiße oder braune Burnusse gehüllte Beduinen murmelten jeden Vers einzeln nach, und jedes Mal warfen sie sich mit rhythmischen Bewegungen auf den kleinen Teppich nieder, den jeder auf dem Wüstensande ausgebreitet hatte, erst auf die Knie, dann mit der Stirn den Boden berührend, um dann wieder aufzustehen und den vorgesprochenen Vers nachzubeten.
Dies alles geschah mit einer Taktmäßigkeit, wie wenn wohlgeschulte Turner ihre Freiübungen oder dergleichen vorführen.
Dort, wo die Kamele auf ihren zusammengekoppelten Füßen hockten, standen drei Personen, die sich nicht an dem Morgengebete beteiligten. Dass es keine Beduinen waren, das konnte man nicht erkennen.
Dieselben Kostüme, dieselben kaffeebraun gebrannten Gesichter, und solche Züge, die mehr germanisch als orientalisch sind, gibt es unter den Beduinen auch, und zwar gerade unter denen der nördlichen Sahara, in Algier und Marokko, wo sogar rothaarige und blauäugige Araber sehr häufig sind. Das kommt daher, dass in diesen Gegenden doch einmal die Vandalen und andere germanische Völkerstämme geherrscht haben, ist noch die Folge der Vermischung.
Nur das konnte man deutlich erkennen, dass die eine dieser drei Personen ein Weib war, und zwar ein junges und auffallend schönes dazu. Und das ist bei der ganzen Geschichte die Hauptsache.

»Heute ist der vierzigste Tag unserer Wüstenreise«, nahm dieses jetzt mit glockenreiner Stimme das Wort, »und ich glaube, ich sage es heute zum vierzigsten Male: Es ist doch etwas Grandioses, dieses Morgengebet in der Wüste! Immer wieder werde ich davon ganz überwältigt. Geht es Ihnen denn auch so, Mister O'Donnell?«
»Ja, es liegt etwas Erhabenes in dieser gemeinschaftlichen Anbetung, die auch äußerlich so wohlgeordnet ist«, entgegnete der Gefragte, den wir ja schon sehr gut kennen. »Nur muss man dies, was ich wohl auch schon mehrmals gesagt habe, nicht schon von großen Karawanen gesehen haben, deren Mitglieder nach Tausenden zählen, wie sie nach Timbuktu oder gar nach Mekka und Medina ziehen. Da wirkt dieses taktmäßige Beten und Niederwerfen und ruckweise Aufstehen geradezu sinnverwirrend. Schade, dass wir so weit von der Route der großen Timbuktu-Karawanen entfernt sind, sonst würde ich diese Linie einmal aufsuchen, nur damit Sie dies einmal mit ansehen könnten, Miss Kutschbach.«
»Und ich sage zum dritten und letzten Male, dass diese Plapperei und Gliederverrenkerei ein gottverfluchter Unsinn ist, über den ein vernünftiger Mensch nur lachen kann«, ließ sich der zweite Mann in dieser Gruppe vernehmen.
Roh wie seine Worte war seine Stimme, und dem entsprachen auch die brutalen Züge in dem von Blatternarben entstellten Gesicht.
Das war Ephraim Snatcher, den Mister Samuel Philipp der Karawane als dritte Hauptperson mitgegeben hatte.
Er spuckte den Tabaksaft aus und schlenderte alsdann davon.
»O dieser abscheuliche Mensch!«, flüsterte Miss Anna Kutschbach, oder die Olinda, wie sie mit ihrem Künstlernamen hieß, den sie aber gar nicht gern hörte.
Weiter sagte sie nichts. Diese beiden, die zusammen hielten, hatten während der ganzen Wüstenreise und schon vorher während der Seefahrt nach Algier so viel über diesen Menschen gesprochen, wenn sie einmal allein waren, hatten sich schon so viel über ihn geärgert, dass ihm wirklich zu viel Ehre angetan ward, wenn sie sich immer wieder mit ihm beschäftigten.
»Wenn er in seiner Unverschämtheit nur einmal so weit ginge, dass ich ihm eine Lektion zuteil werden lassen könnte!«, meinte Mister O'Donnell jetzt noch, als er jenem nachblickte.
»Hüten Sie sich! Ich glaube, der ist zu allem fähig!«
»Er sollte mich kennen lernen. Er würde es nicht zum zweiten Male wagen. Aber es zu provozieren, dass er es so weit treibt, dass ich ihn einfach prügeln muss, das geht auch wieder gegen meine ganze Charakterveranlagung.«
»Weshalb Mister Philipp uns den nur mitgegeben hat?«
»Ja, wenn ich das wüsste —«
Achselzuckend wandte sich James O'Donnell ab, und eine ganz ähnliche Bewegung machte auch die Olinda, als hätte sie schon zu viel gefragt und gesagt, als bedauere sie es.
Das war überhaupt eine merkwürdige Sache. Sobald einer von ihnen die Frage aufwarf, weshalb Mister Philipp ihnen diesen rohen Patron mitgegeben hatte, der nichts weiter konnte als reichlich essen und trinken und über alles schimpfen und fluchen und Tabak kauen, der sonst auch zu gar nichts nützlich war, ihnen als ganz gleichberechtigte Person mitgegeben — da brachen die beiden stets wie verlegen ab. Hier war zwischen ihnen, so befreundet sie auch geworden waren, irgendein wunder Punkt.
Die Gebetsübung war beendet und nun rüsteten sich alle Karawanenteilnehmer.
»Gemel kateeeeb! — Auf die Kamele!«, rief mit mächtiger Stimme der KarwanBaschi, der Karawanenführer, dem vor Antritt der Reise von allen Mitgliedern in feierlicher Zeremonie unbedingter Gehorsam zugeschworen wird, welcher Zeremonie auch Vertreter der Regierung beiwohnen, Gerichtsbeamte, in Algier also französische, indem dieser KarwanBaschi auch Macht hat über Leben und Tod.
Jeder der Männer rollte schnell seinen kleinen Teppich zusammen und eilte zu seinem Kamel. Losgekoppelt und aufgesessen, aufgesprungen, welche Kunst mancher Franke in seinem ganzen Leben nicht lernt. Denn in dem Augenblick, da das Kamel nur das erste Bein des Reiters im hölzernen Sattelgestell fühlt, richtet es sich mit drei unglaublich schnellen Rucken auf, eine Schwingung nach rückwärts, die zweite vorwärts, die dritte wieder rückwärts, und mancher Reiter kann es eben niemals vermeiden, beim dritten Ruck über den Kopf hinweg in den Sand geschleudert zu werden. Dann muss er an einer Leiter auf den Rücken des Kamels emporklettern.
Hier war kein solcher Ungeschickter vorhanden. Auch die Olinda saß mit gekreuzten Beinen fest im »Serdj«, im Reitsattel.
Pferde gab es nicht, aber auch keine Fußgänger, und mancher Reiter führte noch ein zweites Kamel am Halfter neben sich, hochbepackt, hauptsächlich mit Wasserschläuchen.
Edle Hedjins, Rennkamele, waren wenige dabei, aber auch die ganz schweren Packtiere fehlten — alles ein kräftiger Mittelschlag.
»Kedi Allah illahoooo! Mit Allahs Willen vorwärts!«, kommandierte der Führer, und die Karawane setzte sich in Bewegung.
Aufgebrochen wird regelmäßig nachts um zwei, wobei schon eine Stunde des Fütterns und sonstiger Vorbereitung vorausgegangen ist. Dann geht es bei forcierter Reise bis auf das Morgengebet bei Sonnenaufgang ununterbrochen bis zum zweiten Gebet, nachmittags vier Uhr. Nur die schwerbeladenen Handelskarawanen rasten auch noch vormittags von acht bis elf. Während der heißesten Mittagsstunden wird grundsätzlich nicht geruht, um Menschen und Tiere nicht zu verweichlichen für den Fall, dass einmal während dieser heißesten Zeit aus Not marschiert werden muss, was aber doch nur äußerst selten geschieht.
Die Reisenden befanden sich bereits seit dem Nachmittage des vorhergehenden Tages im AtakarGebirge. Jetzt befanden sie sich auf einem sandigen Hochplateau, das so ganz den Eindruck einer ebenen Wüste machte. Dieses Gebirge, soweit man es überhaupt kennt, bildet eben ein Quadrat von mindestens 200 Kilometer Seitenlänge, da können schon solche unübersehbare Wüstenstrecken ohne jede Erhebung vorkommen.
Ja, der vorausreitende KarwanBaschi war der Scheikh, der Herr der Karawane, auch der Bislawak, auf dessen Kosten die Expedition ging, hier unser James O'Donnell, hatte ihm gar nicht viele Vorschriften zu machen. Aber der den einzuschlagenden Weg angebende Führer war er nicht.
O'Donnell hatte in ganz Algier keinen einzigen Mann auftreiben können, der dieses Gebirge oder nur den Weg dorthin kannte, ihn schon einmal gemacht hätte. Alle nach Süden gehenden Karawanen, so verschieden ihr Ziel auch sein mag, nehmen ganz andere Wege, umgehen in weitem Bogen das Plateau von Ahaggar, das wasserloseste Gebiet der ganzen Sahara.
Percy Douglas, der dieses Gebirge als Erster erforscht hatte, soweit es in einigen Wochen möglich gewesen war, um dann darin den Tod zu finden, hatte es von Osten her erreicht, O'Donnell hatte die herrenlos gewordene Karawane dann also nach Westen an die Küste geführt.
Aber er hatte den Weg auch von Algier aus zu finden gewusst. Das machte der Sextant, den er in der Tasche hatte.
Die vierzigtägige Wüstenreise war ohne jeden ernstlichen Zwischenfall verlaufen. Die sonst immer beutelustigen Tuaregs hüteten sich, eine Karawane anzugreifen, die zwar aus nur 50 Mann bestand, aber ausgezeichnet bewaffnet war. Da hätten sie nicht unter zwanzigfacher Übermacht angegriffen, und außerdem wussten sie, dass dieser Karawane außer den Waffen und Kamelen ja gar nichts weiter abzunehmen war oder sonst ein Vorteil erreicht werden konnte.
Vor drei Tagen hatten sie die letzte Oase passiert, ein grünes Fleckchen, das eine aus 30 Köpfen bestehende Familie ernährte. Der erfahrene O'Donnell, unterstützt von seinem redlichen Soliman, dem alten KarwanBaschi, hatte mit dem TuaregScheikh ein Freundschaftsbündnis zu schließen verstanden, das durch nichts gebrochen werden konnte. Von dieser Oase aus würde man sich mit Wasser versehen, falls der Aufenthalt im AtakarGebirge so lange währte, dass der große mitgenommene Wasservorrat nicht reichte. Der Proviant kam dagegen gar nicht in Betracht, der langte für ein halbes Jahr, wenigstens für die Menschen. Freilich würde es immer sechs bis sieben Tage dauern, um das Wasser herbeizuschaffen, aber diese Zeit hat in der Wüste nicht viel zu bedeuten. Die Kamele konnten dabei jedes Mal getränkt werden und hielten dann wieder sehr lange aus, Futter war für sie in jener Oase genügend vorhanden, mindestens in der Umgebung dornige Sträucher, was für diese Tiere völlig genügt, wenn nur ab und zu etwas saftiges Gras hinzukommt. Der Scheikh der Oase bürgte für die Sicherheit.
So war die Existenz der Expedition für ihren längeren Aufenthalt in dem Gebirge vollständig gesichert — —
Schon tauchten vor ihnen wieder die Berge auf, welche dieses sandige Hochplateau umgrenzten, gegen Mittag waren sie erreicht.
O'Donnell hatte unterwegs mehrmals geografische Ortsbestimmungen gemacht, und so fand er richtig den Pass wieder, den er schon das letzte Mal benutzt hatte.
Sie drangen ein in das schauerlich zerrissene Felsengebiet von furchtbarer Wildheit. Aber jetzt brauchte O'Donnell nicht mehr den Sextanten zu benutzen, höchstens war einmal ein Blick auf seine damals gefertigte Karte nötig, sonst genügten seine Detektivaugen, um wieder an einem ihm bekannten Merkmal die Schlucht zu bestimmen, die ihm seinem Ziele immer näher brachte.
»Wir sind ganz dicht in der Nähe des Grabes, das wir meinem armen Freunde bereiten mussten«, sagte O'Donnell zu der neben ihm reitenden Olinda, »höchstens zehn Minuten noch, dort um die Ecke herum, da müssen wir den Steinhaufen unter dem Felsvorsprunge schon erblicken, und von dort nach der von Mister Philipp angegebenen Stelle sind es nur noch höchstens vier Kilometer.«
Die Olinda klatschte den Halfterstrick um den Hals ihres Kamels.
»Ich weiß gar nicht, mein Tier will gar nicht mehr gehen, es kann doch nicht schon —«
Da ein Kommando des KarwanBaschi, und alle Tiere standen mit einem Ruck und ließen sich nieder. Es war Punkt vier Uhr nach Ortszeit, Zeit zum Nachmittagsgebet und damit für heute Feierabend, und das wussten diese Kamele besser als der frömmste Muslim, kein Chronometer hätte richtiger gehen können als ihr Instinkt, und da waren sie vorläufig keinen Schritt mehr vorwärts zu bringen, oder es hätte statt des Betens fürchterlicher Flüche und Prügel bedurft.
»Ja, da müssen wir für heute Halt machen, das hilft nun alles nichts«, meinte O'Donnell. »Das Gebet muss eingehalten werden, und wenn wir auch in einer Stunde unser Ziel erreicht hätten, es liegt kein zwingender Grund zum Weitermarsch vor.«
Nur wenn die Stelle ganz und gar zur Gebetsübung ungeeignet gewesen wäre, wie in einem ganz schmalen Engpasse, wäre erst eine andere gesucht worden, aber hier befand man sich gerade in einer kesselartigen Erweiterung.
Also abgestiegen und die Kamele gekoppelt. Schon bestimmte der Vorbeter nach einem großen, wunderlich aussehenden Kompass, dem man die Heiligkeit gleich anroch, ganz genau die Richtung, in der Mekka und Medina, die durch Mohammed berühmten Städte, lagen.
Nach vollbrachter Zeremonie wurden die Zelte aufgeschlagen und Vorbereitungen zum Abendmahl getroffen, wobei auch ganz moderne Petroleum- und Spiritusöfen verwendet wurden, um den Reis zu kochen und Konserven zu wärmen, was es freilich nicht bei jeder Karawane gibt.
Doch so lange wartete O'Donnell gar nicht.
»Sind Sie müde und hungrig, Miss?«
»Ganz und gar nicht.«
»Wie wäre es, wenn wir uns gleich aufmachten, um das Grab aufzusuchen, oder womöglich auch schon jene bezeichnete Stelle zu besichtigen? Wir nehmen uns einigen Proviant mit, bei Sonnenuntergang sind wir zurück.«
»Denselben Vorschlag wollte ich Ihnen machen!«
Gewehre umgehängt, einen kleinen Wasserschlauch, einen Beutel mit Proviant.
»Aber schnell und heimlich, dass sich uns nicht wieder dieser Snatcher anschließt!«, flüsterte die Olinda.
»Wenn er es tut — diesmal würde ich ihn ganz energisch zurückweisen. Bisher lag nur immer kein Grund dazu vor. Hier aber handelt es sich um einen Spaziergang, dem er sich nicht anschließen darf.«
Nur dem KarwanBaschi war O'Donnell eine Abmeldung schuldig, auch als eigentlicher Herr der Karawane, das war seine unbedingte Pflicht, sonst hätte der auch einmal streiken können — die beiden entfernten sich, verschwanden um eine Ecke, und der schon vor einem dampfenden Topfe sitzende Snatcher schien nichts davon bemerkt zu haben.
Bald befanden sich die beiden in der Todeseinsamkeit einer wilden Schlucht.
»Mister O'Donnell — hier, wo wir nun schon so gut wie am Ziele sind, muss ich Sie endlich einmal offen sprechen«, brach die Olinda sehr bald das drückende Schweigen.
»Dasselbe wollte ich Ihnen sagen«, lautete die Entgegnung.
»Wir sind nun schon acht Wochen zusammen, wir hatten doch schon oft Gelegenheit, ganz offen miteinander zu sprechen, ohne dass dieser infame Snatcher dabei war, und ich denke, wir können gegeneinander offen sein, wir haben uns kennen gelernt, wir beide passen zusammen, aber trotz alledem — ich habe es immer noch nicht fertig gebracht.«
»Genau dasselbe gilt von mir.«
Ja, die beiden passten wirklich vortrefflich zusammen, der ernste, energische Mann und die junge Künstlerin, das denkbar sympathischste Weib — die beiden hatten in diesen acht Wochen eine innige Freundschaft geschlossen, ohne es einmal durch ein Wort auszudrücken.
»Und doch liegt etwas zwischen uns.«
»Das habe auch ich schon empfunden — eben das, was wir immer verschweigen.«
»Weshalb sind wir nur eigentlich hierher gekommen?«
»Das ist es!«, bestätigte O'Donnell aufs lebhafteste.
Eine merkwürdige Frage und Bestätigung! Und doch war es so. Eben eine ganz eigentümliche Sache.
»Wir sollen einen Mann aufsuchen«, fuhr die Olinda fort, »der hier in diesem weltverlassenen Gebirge im Herzen der Sahara haust, dem sieben Runen auf dem Rücken tätowiert sind, und diese Runen sollen wir abzeichnen. Wenn ich diese Kopie dem Mister Samuel Philipp bringe, dann zahlt er mir bar eine Million Dollar.«
»Denselben Auftrag habe ich, auch ich erhalte dieselbe Prämie.«
»Und wenn Sie mir zuvorkommen oder es jenem Snatcher gelingt, ganz gleich, trotzdem erhalte ich meine Million.«
»Gilt auch von mir.«
»Doch eine sehr eigentümliche Geschichte.«
»Eine ganz eigentümliche!«
»Klingt schon mehr märchenhaft.«
»Noch mehr als märchenhaft.«
»Wenn ich es mir jetzt richtig überlege, und Zeit genug habe ich ja nun dazu gehabt — — ich bin damals, als ich diesen Auftrag bekam, gar nicht richtig bei Besinnung gewesen.«
»Auch ich habe mich damals sozusagen überrumpeln lassen.«
»Aber die Sache war ja so klar, die schriftliche Abmachung bei dem Notar Salis.«
»Die Prämie von einer Million Dollar ist uns sicher, daran ist nicht zu zweifeln.«
»Vorausgesetzt, dass einer von uns die Kopie der Runen auch wirklich bringt und dadurch die Bedingungen Mister Philipps erfüllt!«
»Ja natürlich, sonst fallen uns nur die Jahreszinsen dieses Kapitals zu, und wir haben einmal umsonst eine Reise gehabt.«
»So ist es. Und das eben hat mich bewogen, auf diesen verrückten Vorschlag einzugehen. Einmal kostenlos eine Wüstenreise bis in die Mitte der Sahara zu machen, so sicher und bequem wie möglich, dazu noch eine Million Dollar in eventueller Aussicht — diese Gelegenheit wollte ich mir nicht entgehen lassen. Bei mir kam auch noch etwas anderes in Betracht. Ja, ich habe hohe Einkünfte gehabt, riesige Gagen. Ich bin durch meine Singerei schon einmal reich gewesen. Wissen Sie aber, dass ich vor einem Vierteljahr bankrott gemacht habe?«
»Das ist mir unbekannt. Ich habe nie etwas davon gehört.«
»Es kam nicht so an die Öffentlichkeit, weil ich alle meine Verpflichtungen gewissenhaft erfüllt habe, selbst wenn ich es gar nicht mehr brauchte. Als die ChicagoBank zusammenkrachte, habe auch ich mein ganzes Vermögen, das ich mir ersungen hatte, verloren und war große Verpflichtungen eingegangen. Ich hatte mich in Spekulationen eingelassen. Aber ich habe mich, wie gesagt, mit meinen Gläubigern zu einigen verstanden. Nur musste ich ganz von vorn anfangen, musste fleißig singen, habe auf meine letzten Sommerferien verzichtet. Da nahm ich das Angebot mit der auch mir fabelhaften Summe von einer Million Dollar erst recht gern an. Da wäre ich gleich heraus aus meinem Dilemma.«
»Ja, ich gestehe, dass auch mich die Million mächtig gezogen hat, sie ist nicht zu verachten«, stimmte O'Donnell bei.
»Ob denn nur wirklich etwas daran ist? Dass hier in diesem öden, wasserlosen Wüstengebirge, welches Sie doch schon zum Teil kennen, so ein geheimnisvoller Mensch haust?«
»Wir werden es ja morgen sehen, vielleicht finden wir gleich jetzt schon eine andeutende Spur dieses geheimnisvollen Loke Klingsor.«
»Mister Samuel Philipp scheint doch seiner Sache ganz sicher gewesen zu sein.«
»Das schien auch mir so.«
»Hm. Aber etwas wäre doch noch zu erwägen.«
»Und das wäre?«
»Dass dieser alte Mann nicht ganz bei klarem Verstande ist.«
Mister O'Donnell blieb bei diesem Ausspruch vor Überraschung stehen.
»Genau wieder derselbe Gedanke, den auch ich schon gehabt habe!«
»Der auch sehr nahe liegt. Sie kennen doch die Geschichte, die noch passierte, als wir in New York unsere Vorbereitungen trafen, oder da kam sie doch an die Öffentlichkeit, stand ja auch in den Zeitungen, ganz New York und wahrscheinlich ganz Amerika sprach damals davon — wie das Bild, das er uns beiden gezeigt hat, lebendig geworden sein soll, wie ihm die Katze ins Gesicht gesprungen ist, wie der Mann mit den Teufelsaugen, der Loke Klingsor, mit ihm gerungen und ihn zuletzt mit einem Wurfhammer zu Boden geschlagen hat.«
»Darüber haben wir ja bereits gesprochen.«
»Ja, als über etwas, was einfach unmöglich ist, aber nicht darüber, dass wir es vielleicht mit einem Irrsinnigen zu tun gehabt haben.«
»Allerdings nicht. So tun wir es jetzt. Halten Sie den Mister Philipp für irrsinnig?«
Die Sängerin hob die Schultern, deren schöne Rundung auch noch unter dem leicht übergeworfenen Burnus zu erkennen war.
»Eigentlich nicht. Ich wage mich da gar nicht richtig auszusprechen.«
»Er hat dieses Gerücht, das doch nur ein erfundenes Märchen sein kann, nicht dementiert.«
»Das sieht dem alten Sonderling ganz ähnlich. Er empfängt ja nicht einmal Briefe, da wird er wohl auch keine Zeitungen lesen.«
»Daraus wäre also nicht zu schließen, dass er irrsinnig ist.«
»Nein, daraus nicht. Der Argwohn, dass er nicht ganz normal ist, wurde in mir wachgerufen durch den Auftrag selbst, den er uns gegeben hat.«
»Das könnte eine fixe Idee sein.«
»Was also auch ein Zeichen von Geistesanormalität wäre.«
O'Donnell setzte seinen Weg fort.
»Na, wissen Sie was, Miss — sehen wir erst einmal, wie alles kommt! Nun sind wir ja am Ziele.«
»Ja, ich werde an der bezeichneten Stelle singen, mehr kann ich vorläufig nicht tun. Und doch, etwas anderes müssen wir noch besprechen, und ich glaube, das ist es, was bisher immer als Hindernis zwischen uns gelegen hat. So wiederhole ich meine Frage, mit der ich diese Unterhaltung eröffnete: Weshalb eigentlich hat uns Mister Philipp diesen Snatcher mitgegeben?«
»Ja, weshalb? Damit er ebenfalls versucht, die sieben Runen auf dem Rücken des geheimnisvollen Loke Klingsor zu kopieren.«
»Mister O'Donnell, Sie weichen mir aus! Dieser Mensch ist zu einer solchen Wüstenreise ja überhaupt nicht befähigt. Er kann nicht Arabisch, nicht einmal Französisch, kann sich mit unseren Leuten also nicht einmal verständigen. Zuerst konnte er die Strapazen nicht aushalten, er wurde auf dem Kamel seekrank, wir mussten seinetwegen einen Rasttag machen. Er hat einen Fotografenapparat bei sich. Ich habe ihn einige Male knipsen sehen. Ja, er versteht es, aber ganz dilettantenhaft, muss es eben erst gelernt haben. Warum ist nun gerade der uns mitgegeben worden? Mister O'Donnell, ich muss Ihnen einen Verdacht mitteilen, ich halte es für meine Pflicht. Als mir Mister Philipp den Auftrag näher erläuterte, machte er eine starke Andeutung, dass es ihm sehr recht wäre, wenn ich den Loke Klingsor, um seine Runen zu sehen, auch tötete. Er sagte es nicht direkt, aber — — ›die rot eintätowierten Runen verschwinden auch bei seinem Tode nicht.‹ Das sagte er mehrmals in einer Weise, dass es geradezu eine direkte Aufforderung zu einem Morde war. Nur dass ich mir damals nichts weiter dabei gedacht habe, es fiel mir erst später ein —«
»Und ich kann Ihnen sagen«, fiel O'Donnell der Sprecherin ins Wort, »dass mir Mister Philipp diesen Auftrag ganz direkt gegeben hat! ›Sie haben den Mann zu überlisten, zu überwältigen, zu töten, um die Möglichkeit zu bekommen, die sieben Runen auf seinem Rücken zu sehen.‹ — So hat er ganz wörtlich zu mir gesagt.«
»Und was erwiderten Sie ihm?«
»Als ich ihn fragte, ob dieser Loke Klingsor denn ein Mensch sei, den man ohne Weiteres wie einen tollen Hund über den Haufen schießen dürfe, lenkte er schnell ein, so sei das nicht gemeint gewesen, und fing sogar eine Lobeshymne auf den edlen Charakter dieses Loke Klingsor zu singen an.«
»Ganz genau wie bei mir! Ganz genau wie bei mir! Dieser biedere alte Yankee hat bei uns eben nur einmal auf den Busch geklopft, obgleich er doch gleich hätte wissen können, dass ich keines Meuchelmordes fähig bin, nicht einen einzigen Tropfen unschuldigen Blutes vergießen könnte, auch wenn mir alle Schätze der Erde zu Füßen gelegt würden. Das gilt natürlich ebenso von Ihnen, das brauchen Sie mir nicht erst zu versichern.
Also die Sache ist nun einfach die, dass Mister Philipp uns diesen Snatcher mit dem Verbrechergesicht mitgegeben hat, damit der einen Meuchelmord ausführt, falls ein solcher nötig wird.«
»Natürlich, so ist es, und nun ist endlich heraus, was auch ich schon immer auf dem Herzen hatte!«
»Und was gedenken Sie da zu tun?«
»Nun, ich werde dem Burschen gründlich auf die Finger sehen, vorläufig kann ich freilich noch nichts weiter sagen.«
Wiederum blieb O'Donnell stehen, dicht vor einer Felsenecke, um die sie mit den nächsten Schritten hätten biegen müssen.
»Verzeihung, Miss, wenn ich jetzt ein anderes Thema anschlage — hinter dieser Ecke werden wir sofort das Grab von Percy Douglas erblicken, und — — ich bin mehr Gefühlsmensch, als jemand in mir vermutet, der mich nicht näher kennt — ich bedarf wirklich einiger Sammlung, ehe ich diesen letzten Schritt tue —«
Der junge Mann zog unter seinem Burnus ein Taschentuch hervor, fuhr sich einmal übers Gesicht, mehr noch über die Augen.
»Armer Percy«, flüsterte er, »in der Schulzeit hat uns nur eine oberflächliche Freundschaft verbunden, aber während dieser zwei Jahre, während dieser Wüstenreisen, hatte sich bei uns das Herz zum Herzen gefunden!
Er wurde auf eine niederträchtige Weise ermordet. Der Dolch des Tuaregs war vergiftet, aber nur schwach, und gerade dadurch hatte mein armer Freund ein furchtbares qualvolles Sterben. Stundenlang wand er sich in höllischen Schmerzen, und wir konnten ihm nicht helfen, durch gar nichts, als höchstens durch — — das, was niemand von uns zu tun wagte, um sein Gewissen nicht zu belasten. Wir mussten warten, bis er ausgelitten hatte.
Dann haben wir ihm ein Grab bereitet. Auf derselben Stelle, wo ihn der Dolch getroffen hatte. Es war auch gerade die günstigste Stelle für ein Grab, unter einem vorspringenden Felsen, der Boden war sandig. Aber unsere Expedition hatte schon viel von ihrer Ausrüstung verloren, uns fehlte überhaupt alles, um ihm ein würdiges Begräbnis zu bereiten, wir hatten kein Brett — gar nichts. So haben wir ihn — — verscharrt. Dann suchten wir mühsam von weither große Steine, die wir über seiner letzten Ruhestätte aufhäuften; denn nach verschiedenen Anzeichen gibt es auch in diesem öden Gebiete immer noch Hyänen. Kein Holz, um ein Kreuz darauf zu setzen. Nur einen hölzernen Ladestock konnte ich zerbrechen und kreuzweise zusammenbinden, aber wie lange wird das halten —«
O'Donnell brach ab und tat schnell die letzten Schritte, die ihn um die trennende Ecke brachten.
Da sah ihn die Olinda plötzlich am Boden wie angewurzelt stehen bleiben, in einer Weise, dass sie sofort erkannte, er müsse etwas ganz Besonderes erblicken, dass sein Fuß plötzlich wie gelähmt war.
Und dann ein Ruf der grenzenlosesten Überraschung.
»Alle Himmel, was ist denn das?«
Im nächsten Augenblick war die Olinda an seiner Seite.
Professor Edeling, wie der freiherrliche Mann der Wissenschaft also nur genannt sein wollte, hatte trotz allem, was er erlebt hatte, während der ganzen Fahrt von Berlin nach Hamburg sanft geschlummert.
Was sollte er nun nach dem Aussteigen beginnen? Das Leben war schon längst erwacht, aber noch kein Büro offen, dazu war es doch noch zu früh, das wusste er, ohne jemand gefragt zu haben.
In ein Hotel gehen? Was sollte er denn dort? Er wollte sich erst einmal in aller Frühe Hamburg ein bisschen besehen.
Er gab sein Köfferchen zum Aufheben, verließ den Hauptbahnhof und schloss sich einem Menschenstrome an, der gerade vorbeikam, ohne zu wissen, wohin er ihn führte, ob nach dem Hafen oder nach der Alster, ob nach Ost oder nach West.
Hamburg!
Professor Edeling war noch nicht in Hamburg gewesen, hatte noch keine anderen Schiffe gesehen als Spreedampfer.
Doch Schiffe gab es auch hier noch nicht zu sehen. Anderes dafür genug, was es in Berlin nicht so leicht gibt.
Vor ihm begegneten sich zwei Arbeiter; sie hatten im Vorübergehen ein kleines Gespräch, ohne erst stehen zu bleiben.
»Moin, Hein.«
»Moin, Jochen.«
»Kommst mit, Hein?«
»Wohin geihst, Jochen?«
»Ik fohr nach'n Hansahovn.«
»Nee, ik hävv Nachtschicht hadd, ik mutt hüt zu Hus bi mien Olle bliem.«
»Na da adjüs, Hein.«
»Adjüs, Jochen. Sup nich tu väl.«
Etwas von diesem tiefsinnigen Gespräch hatte Professor Edeling doch verstanden, vor allen Dingen das Wort »Hansahovn«.
Ob dort wirklich ein Dampfer namens »Prinz Friedrich« lag, dessen Kapitän Schumann hieß, und der nach Kapstadt ging?
Des Professors Entschluss war schnell gefasst. Er wollte mal hin nach dem Hansahafen und sich überzeugen, ob oder ob nicht.
Also er folgte dem Jochen im Kielwasser. Unterwegs aber stiegen ihm mehrmals Bedenken auf.
Das wird doch auch wirklich der Jochen mit dem Hansahovn sein? Ich werde doch nicht etwa den Hein erwischt haben, der mich nun tu Hus tu siene Olle führt?
So dachte der Professor mehrmals mit Humor. Er fühlte überhaupt mehr und mehr eine humoristische Stimmung über sich kommen, obgleich er gar nicht wusste, was für einen Grund er hierzu hatte, der Todeskandidat mit den tuberkulösen Lungenbläschen. Er wurde immer fideler.
Ja, Hamburg! Da gibt es nicht viele Kopfhänger, das muss gleich in der Luft liegen.
Es ging die Bahnhofstraße entlang, gar nicht weit, da kam eine Brücke, die über den Zollkanal führte, und da lag an einer breiten Wassertreppe auch schon ein kleiner Fährdampfer, dem der Jochen zusteuerte.
Das Deck war dicht mit Herren besetzt, die wohl in die Werftbüros fuhren.
Professor Edeling bewunderte am meisten den ganz verteerten Schiffsjungen, einen Dreikäsehoch, wie der neben dem Poller stand, bereit, die Trosse abzuwerfen, breitbeinig, die Hände in den Hosentaschen, auf beiden Backen Tabak kauend, natürlich »swarten Krusen« — mit welch unsäglicher Verachtung der kleine, dicke Stöpsel auf die jämmerlichen Landratten herab- oder hinaufblickte, obgleich er doch gar nicht auf Salzwasser fuhr und wahrscheinlich auch niemals auf ein großes Seeschiff kommen würde.
Und doch, diese Hamburger Kanal- und Hafenschiffer, Jollenführer und dergleichen, das sind echte Wasserratten!
Die Glocke läutete, fort ging es, und Professor Edeling wusste noch immer nicht wohin.
Der Schiffsjunge kassierte ein, immer einen Groschen, und Professor Edeling gab ihm einen extra in die dreckige, teerige Pfote, die einem starken, ausgewachsenen Manne angehören konnte.
»Merci, Mussjö«, sagte der Dreikäsehoch, und es war wohl ein besonderes Zeichen der Dankbarkeit, dass er dabei so eigentümlich das eine Bein schlenkerte, und dann wurde seine Aufmerksamkeit von einem faulen Ei erregt, das noch vor dem Boote auf ruhigem Wasser schwamm, und er benutzte diese schöne Gelegenheit, um nach diesem Ei einen dicken Strahl braunen Tabakssaft zu schriezen; er traf es trotz der großen Entfernung mit unfehlbarer Sicherheit.
Ja, man kann viel sehen und bewundern in Hamburg.
Und dann kam die Elbe, schon ein Hafenbild bietend. Der Professor staunte die großen Schiffe an, obgleich die wirklich großen Dampfer ja gar nicht so weit herauf können.
Das Boot lief viele Landungsbrücken und Treppen an. Passagiere stiegen aus, neue kamen — aber Professor Edeling behielt seinen Jochen im Auge.
Ein Name wurde am Anlegeplatz niemals genannt, und der Professor fragte aus Prinzip nicht, er wollte sich treiben lassen.
Die großen Dampfer mehrten sich; jetzt kamen auch Segelschiffe, die der Professor sich eigentlich größer vorgestellt hatte.
Sie verschwanden eben gegen die großen Dampfer. Nur die himmelhohen Masten imponierten ihm.
Wieder legte das Boot an, und jetzt stieg auch der Jochen aus, der Professor ihm nach.
Es war der Segelschiffhafen, nach dem sich Jochen begeben hatte. Aber dieser ist vom Hansahafen nur durch einen Kai getrennt.
Der Arbeiter kürzte den Weg ab.
Doch davon wusste der Professor ja nichts, und er fragte prinzipiell noch immer nicht.
Seinen Lotsen hatte er aus den Augen verloren, und so machte er nun seine Fahrt auf eigene Faust.
Professor Edeling trat näher an solch einen Segelkasten heran. »Sankt Peter« war als Schiffsname am Heck zu lesen. Matrosen, aber nicht etwa in Uniform, die es auch auf keinem Frachtdampfer gibt, marschierten um das Gangspill herum, hievten etwas und sangen dazu im Takt ein Lied.
Da stand ein großer, starkgebauter, sehr dicker Mann mit einem herrlichen Jupiterkopf, das Haar schneeweiß, das Gesicht dafür kastanienbraun mit einem ziegelroten Untergrund, gekleidet in einen nagelneuen SchifferAnzug, dessen Stoff wie Seide glänzte, über den Bauch eine goldene Kette gespannt, an der man einen Ochsen hätte spazieren führen können, an der rechten, sehr großen, braunen, behaarten, aber sehr gut gepflegten Hand einen ganz schmalen Goldreif, an der linken einen herrlich funkelnden Brillanten von mehr als Erbsengröße, ein beträchtliches Vermögen darstellend.
Er kam dem Professor entgegen — der blickte gerade nach links, jener nach rechts — und so prallten die beiden zusammen.
»Gott verdamme mich ewig und mache mich blind — Verzeihung, Herr, es war meine Schuld.«
Dem Professor war gleich der Hut vom Kopfe gefallen, und der elegante Hüne, der sich nach dem ersten Fluche so höflich entschuldigt hatte, eilte sofort hin, balancierte wegen seines Bauches auf einem Beine herum, bis er den Hut glücklich erwischt hatte und überreichte ihn mit einem gutmütigen Lachen.
»Do, mien leiwer Fründ, sett dien Wolkenschieber all wedder up.«
Der Professor war plötzlich ganz gerührt von dieser Liebenswürdigkeit.
»Ach«, fing auch er jetzt zu lachen an, »da wir nun einmal so unsere Bekanntschaft gemacht haben — ist das hier der Hansahafen?«
»Nein, das ist der Segelschiffhafen, aber der Hansahafen ist gleich dort drüben, Sie brauchen nur über das Amerikakai nach dem Oswaldkai zu gehen«, erklang es jetzt im besten Hochdeutsch, wie ja auch schon die Entschuldigung gewesen war. »Sie sind wohl fremd hier?«
»Ja, ganz fremd —«
»Das habe ich mir gleich gedacht, weil Sie im Hansahafen Sailschipps vermuten. Was wollen Sie denn hier? Kann ich Ihnen behilflich sein? Ich habe Zeit.«
»Nur eine Frage — wissen Sie vielleicht, ob im Hansahafen ein Dampfer liegt, der ›Prinz Friedrich‹ heißt, Kapitän Schumann?«
»›Prinz Friedrich?‹ Käpten Schumann? Nee, das weiß ich nicht so ohne Weiteres. Wo soll er denn liegen? Am Oswaldkai? Oder am Bremer Ufer, Lübecker Ufer, Australienkai, Afrikakai? Mehr gibt's nicht.«
»Dann sicher am Afrikakai. Er soll heute noch nach Kapstadt gehen.«
»Na, das ist nicht gerade gesagt, dass er deswegen am Afrikakai liegen muss. He, junger Mann —«
Er rief einen vorübergehenden Zollbeamten mit Schleppsäbel an, der war übrigens gar nicht mehr so jung, und dem Professor fiel auf, mit welcher Ehrerbietung dieser Beamte dem Hünen, den er Käpten Meyer anredete, antwortete.
»Das ist sicher ein Kapitän, der so einen gewaltigen Riesensalonschnelldampfer über den Ozean lenkt, so ein König von einer Welt für sich«, dachte der Professor.
Was die beiden miteinander sprachen, konnte er absolut nicht verstehen, bis auf jene Namen. Der Beamte grüßte ehrerbietig und ging.
»Nee«, wandte sich Käpten Meyer wieder an den Professor, »der weet ook nix. Na, da wollen wir einmal zusammen hinübergehen.«
Sie gingen um das ganze Hafenbassin herum.
Bald hatten sie den Hansahafen erreicht. Kapitän Meyer fragte noch mehrmals — nein, hier lag kein Dampfer »Prinz Friedrich«, Kapitän Schumann.
»Schumann, Schumann?«, meinte Käpten Meyer. »Den Vornamen wissen Sie nicht? Schreibt er sich mit h oder ohne h? Auch nicht? Ich kenne drei — vier Käpten Schumann. Ist es vielleicht der Gurkenschumann?«
»Gurkenschumann?«
»Er hat so eine mächtige, blaue Gurke im Gesicht. Wissen Sie nicht? Na, warten Sie, wir wollen mal ins Speisehaus gehen, da ist sicher jemand, der hier Bescheid weiß.«
Es war eine große Halle, mehr für die Hafenarbeiter bestimmt, aber es saßen auch einige Herren darin, die frühstückten, unter ihnen auch ein Mann mit einer Aktenmappe, und der wusste wirklich alles, und wenn er es nicht im Kopfe hatte, so brauchte er nur in seinen Schiffsregistern nachzusehen.
Nein, gegenwärtig lag in ganz Hamburg, Altona und Cuxhaven und sonst wo auf der Elbe kein einziges Schiff, weder Dampfer noch Segler, der »Prinz Friedrich« hieß, und zufällig war auch kein einziger Kapitän Schumann registriert, weder mit noch ohne h.
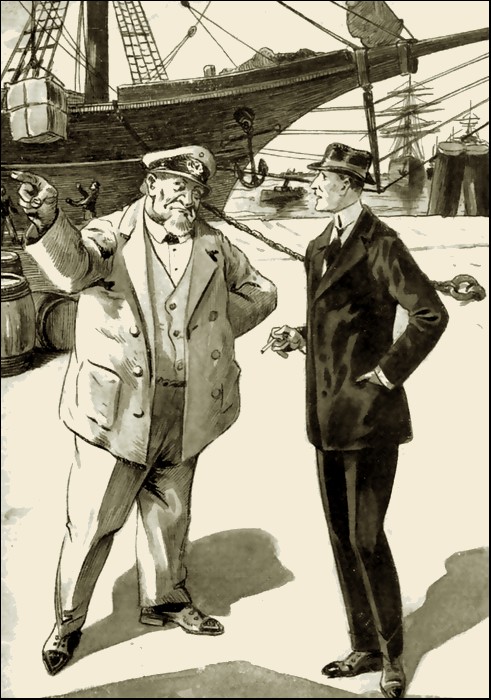
»Der Hansahafen liegt dort drüben. Sie sind wohl
fremd hier?«, fragte der Mann in Kapitänsuniform.
Also da war es nichts mit der Prophezeiung von heute Nacht gewesen.
Ein Irrsinniger hatte sich mit dem Professor telefonisch in Verbindung gesetzt und ihm etwas vorphantasiert.
Aber damit war die Sache noch längst nicht erledigt.
Immer mehr Männer drängten sich herbei, die eifrigst darüber debattierten, ob es überhaupt einen Dampfer »Prinz Friedrich« gäbe.
Der Professor wurde geradezu überwältigt von der Liebenswürdigkeit, mit der man ihm behilflich zu sein suchte, damit er wenigstens seinen Käpten Schumann fände.
Sonst brauchte er keine Auskunft weiter zu geben.
Ein neuer Gast kam eiligst herbei.
»Kinners, der ›Hans Sachs‹ ist nach Bremen verkauft worden!«
Allgemeiner Aufruhr.
»Und ist umgetauft, zum ›Prinz Friedrich‹! Der alte Name wird schon abgekratzt.«
Aller Blicke lenkten sich auf den fremden Herrn mit dem durchgeistigten Gesicht.
Aber er sollte nicht mit Fragen gepeinigt werden.
»Ob Kapitän Günther wohl bleiben wird?«
Diese Frage wurde wieder heiß umstritten und lenkte vorläufig die Aufmerksamkeit von dem Professor ab, der die Gelegenheit benutzte, um sich unbemerkt aus dem Staube zu machen.
»Wunderbar, wunderbar!«, flüsterte er. »Oder darf man da an einen Zufall denken?«
Der bisherige »Hans Sachs« lag hier im Hansahafen. Das hatte er schon erfahren, und er wusste sich hinzufragen.
Ein stattlicher Dampfer war es, Matrosen waren dabei, die Namen »Hans Sachs« und »Hamburg« abzukratzen.
Der Mann, der dort an Deck stand, konnte der Kapitän sein.
»Ist es erlaubt, so ein Schiff zu betreten?«, fragte der Professor erst einen auf dem Kai herumlungernden Arbeiter.
»Immer«, lautete die Antwort.
Ja, jeder Fremde darf immer jedes im Hafen liegende Handelsschiff betreten, über die Laufbrücke oder vom Boot aus, der Zutritt darf ihm nicht verweigert werden; denn das Schiff gilt als Wohnung der Mannschaft, die von jedem besucht werden darf. Natürlich alles mit Ausnahmen. Der Kapitän kann es auch einmal verbieten, muss aber dazu einen triftigen Grund haben, wozu ja schließlich auch schon dringende Arbeit ausreicht.
Ehe der Professor seinen Entschluss ausführte, sah er ungefähr drei Dutzend Männer anmarschiert kommen, auf den Schultern oder zwischen sich Kleiderkisten und Zeugsäcke tragend, mit großen Ankern bemalt, darunter der Name des Besitzers — ihnen voraus ging ein besser gekleideter Herr.
Das Ziel des ganzen Trupps war offenbar dieser Dampfer hier, und obgleich der Professor nicht gerade schon von einer Ahnung befallen wurde, wollte er das Weitere doch abwarten.
Der Trupp hielt; nur der erste Mann überschritt das Laufbrett, begrüßte den anderen, der als Kapitän eines einfachen Handelsschiffes aber nicht etwa durch goldene Streifen und dergleichen ausgezeichnet war. Er sah aus wie ein behäbiger Bürger.
»Herr Kapitän Günther? Kapitän Schumann! Ich übernehme das Kommando des Bremer Dampfers ›Prinz Friedrich‹.«
»Freut mich sehr, Herr Kollege!«, erklang es ganz herzlich unter einem Händeschütteln.
Der neue Kapitän brachte die neue Mannschaft gleich mit, für ein Bremer Schiff in Altona angemustert — alles herunter, alles an Bord!
Und am Kai stand der Professor und staunte und hatte ein Gefühl, als ob die Gottheit ihm nahe wäre.
Wunder über Wunder — Loke Klingsor, der du dich den Fürsten des Feuers nanntest — bist du auch der Herr des Schicksals, dass du ihm dienen kannst?!
Dann aber betrat er das Laufbrett.
Von einer Umwälzung war gar nichts zu merken, die vollzog sich zunächst unter Deck, im Mannschaftslogis.
Auch Kapitän Günther war verschwunden; jetzt bummelte der neue Kapitän dort ganz gleichgültig an Deck herum, die Hände in den Hosentaschen.
Der Professor trat auf ihn zu und zog den Hut.
»Habe ich die Ehre, Herrn Kapitän Schumann zu sprechen?«
Nur ein forschender Blick, dann ein Nicken.
»Bin ich.«
»Professor Edeling ist mein Name.«
Der Kapitän sah schon wieder anderswo hin.
»Dat hävv ik mi gliks docht, dat See Professor sünt. Und?«
Da überkam den Professor plötzlich ein eigentümlicher Reiz, er tat etwas, was er nur ganz selten tat:
»Professor Doktor Freiherr von Edeling.«
Aber der Kapitän blickte ihn nicht noch einmal an, er schwippte mit der Spitze seines Fußes ein an Deck liegendes Stück ausgekauten Primtabak weg.
»Olles Swien. Und?«
Über das blasse, durchgeistigte Gesicht des jungen Professors huschte eine flammende Röte, aber sonst hatte das für ihn nichts weiter zu sagen.
»Können Sie mich als Passagier mitnehmen, Herr Kapitän?«
»O ja. Der ›Hans Sachs‹ oder der nunmehrige ›Prinz Friedrich‹ ist auch für einige Passagiere eingerichtet. Erste Kajüte.«
»Was kostet das nach Kapstadt?«
Jetzt blickte der Kapitän den Frager verwundert an.
»Kapstadt? Ich gehe morgen Abend nach Petersburg.«
»Nach Petersburg?! Nicht nach Kapstadt?!«
»Wie kommen Sie denn nur auf Kapstadt? Denkt niemand dran. Ich bringe Kohlen nach Petersburg. Da sind Sie wohl an die falsche Adresse gekommen.«
Der Professor wusste nicht, was er denken sollte.
Fast in diesem selben Augenblick überschritt das Laufbrett ein uniformierter Telegrafenbote des Altonaer Seemannsamtes.
»Kapitän Schumann, Prinz Friedrich, Hamburg, Hansahafen. Segelorder!«
In der Seemannsprache segelt auch jeder Dampfer, selbst wenn er überhaupt keinem Mast hat.
Das Wort »segeln« hat mit der Segelleinewand gar nichts zu tun.
Das alte Wort »segeln« oder »seegeln« oder »saigeln« bedeutet ursprünglich »auf der See fahren«, und das hat sich im Seewesen noch bis auf heute erhalten.
Der Kapitän nahm die Hände aus den Hosentaschen, richtete sich stramm auf, Hacken zusammen und legte grüßend die Hand an die Kopfbedeckung, ehe er nach dem Telegramm griff und es erbrach.
Und dann wandte er sich in größtem Staunen zu dem fremden Herrn herum.
»Ja, woher wussten Sie denn — stehen Sie in Beziehungen zu meiner Reederei?!«
»Sie fahren nach Kapstadt?«
»Ja, ich habe Segelorder nach Kapstadt bekommen.«
»Wann fahren Sie ab?«
»Sofort, um die Flut noch zu erreichen. Nun heißt's aber hallo!!!«
Jetzt kam doch ein ganz anderes Leben in das Schiff, jetzt musste man sich beeilen, der Kapitän konnte sich nicht mehr um den fremden Herrn kümmern, ob der nun als Passagier mitkam oder nicht.
Und der Professor? Der wusste nun ganz bestimmt, dass der Dampfer Punkt zehn Uhr hier die Trossen loswerfen würde, bis dahin war es kaum noch anderthalb Stunden, und zum Glück dachte der Professor auch noch an seinen Koffer, den er herbesorgen lassen musste. Ja, es war ein Glück, dass er daran gedacht hatte, denn im Übrigen konnte er die auf ihn einstürmenden Gedanken gar nicht ordnen —
Ein Viertel nach zehn Uhr steuerte der »Prinz Friedrich« die Elbe hinab, und in der Kajüte füllte der einzige Passagier ein Formular mit seinen Personalien aus und zahlte die geforderten 600 Mark.
»Seien Sie mir herzlich willkommen, Herr Baron. Nun richten Sie sich ganz gemütlich ein, tun Sie, als wenn Sie zu Hause wären. Sie können, wenn Sie wollen, alle drei Kabinen benutzen. Vertrauen Sie sich nur immer dem Steward an, und wenn der Ihnen nicht raten kann, dann mir. Wenn Sie die Mahlzeiten mit mir einnehmen wollen, so soll es mir angenehm sein. Wollen Sie allein speisen, so tun Sie es, ohne sich erst zu entschuldigen. Auch ich kann einmal zu Tisch allein sein wollen, wenn ich den Kopf voll habe.
Die Kommandobrücke dürfen Sie jederzeit betreten, falls es Ihnen nicht ausdrücklich verboten wird, oder Sie werden ganz einfach heruntergewiesen, wozu ein triftiger Grund vorliegt. Nur immer ganz offen. Seien Sie mir herzlich willkommen, Herr Baron!«
So sprach der Kapitän und dasselbe hätte er jedem anderen Passagier gesagt, der ihm gefiel. Der freiherrliche Titel und ob jener zu seiner Reederei Beziehungen hatte oder nicht, das war ihm ganz gleichgültig. Er fragte jetzt und später auch nicht, woher sein Fahrgast gewusst habe, dass die Ladung Kohlen, die erst für Petersburg bestimmt gewesen war, nun nach Kapstadt gehen sollte.
»Laufen Sie unterwegs noch andere Häfen an?«
»Nein, keinen einzigen. Ich segle glatt nach Kapstadt.«
Der Professor wusste es besser; denn nun zweifelte er schon an nichts mehr. Und so sollte es denn auch geschehen.
Über die Reise ist nicht viel zu berichten. Der Professor machte von der angebotenen Rücksichtslosigkeit Gebrauch, indem er sich immer allein hielt. Er hatte den Kopf so voll. Ach, diese Gedanken! Aber als er am dritten Tage dieser Periode aus tiefem Schlafe erwachte, fühlte er sich als neugeborener Mensch, der gleich einen unverschämten Appetit mit auf die Welt brachte. So viel hatte der blasse Gelehrte noch nie in seinem Leben gegessen, wenn das überhaupt »essen« zu nennen war. Er genierte sich, merkte indessen bald, dass er das hier gar nicht nötig hatte. Nur manchmal bekam er noch moralische Anfälle.
Als ihm zum ersten Frühstück zehn weichgekochte Eier vorgesetzt wurden, wollte er anstandshalber wenigstens eins liegen lassen, unterlag jedoch der Versuchung. und dabei hatte er auch noch reichlich anderthalb Pfund Brot verschwinden lassen, und dann blickte er immer nach der Uhr, ob nicht bald das zweite Frühstück serviert würde.
Dieser fabelhafte Heißhunger wollte sich während der ganzen Reise nicht legen. Das hatte bald üble Folgen. Schon am fünften Tage brachte der Herr Professor vorn seine Hose nicht mehr zu, später auch nicht mehr die Weste. Er sah einen Matrosen an Deck schneidern, der wusste diese Kalamität zu beseitigen.
In der Nacht vom 16. zum 17. wurde er durch einen Ton geweckt, der als ein Surren das ganze Schiff durchzitterte, ganz anders als sonst das Zittern der Schiffsplanken. Erst glaubte man, die Schraubenwelle habe sich festgewürgt, aber es war die Schraube selbst, die nicht mehr mitmachte. Es musste ein Stahlseil sein, wahrscheinlich das einer abgetriebenen Boje, die sich um die Schraubenflügel gelegt hatte. Der Dampfer war so gut wie tot. Einen Taucher gab es nicht, alles sonstige Arbeiten war vergeblich.
Am anderen Morgen wurde ein Dampfer angerufen, der den leblosen Kasten ins Schlepptau nahm, und als wieder am anderen Morgen, also am 18., der »Prinz Friedrich« im Hafen von Santa Cruz den Anker fallen ließ, war es genau 23 Minuten nach acht Uhr.
Der Professor flüsterte nicht mehr »o Wunder über Wunder«, die Geschichte wurde ihm nun — nicht etwa langweilig, aber doch ganz selbstverständlich. Er ließ sich an Land setzen, um Santa Cruz kennen zu lernen, besonders auf die Kirchen freute er sich, aber es wurde nichts daraus, er kam in keine einzige, er begnügte sich, in den Restaurationen die spanischen und speziell kanarischen Nationalgerichte zu studieren. Kanarienvögel sah er nicht, brachte dagegen am Abend einen hübschen kleinen Affen mit an Bord, aufgefüttert mit kanarischem Sekt.
Wieder am andern Morgen verließ der durch Taucher befreite Dampfer den Hafen und setzte seine Fahrt nach Kapstadt fort.
Und vier Tage später betrat der Professor abends gegen zehn Uhr die Kommandobrücke.
»Wo befinden wir uns jetzt?«
Das war schwer zu sagen. Seit zwei Tagen schon hatte man weder Sonne noch einen Stern gesehen, immer war der Himmel bedeckt gewesen, also hatte man keine geografische Ortsbestimmung machen können, und die Schiffe, denen man begegnete, waren natürlich in derselben Lage gewesen.
Ja, ungefähr wusste man es, das automatische Log gab immer die Schnelligkeit des Dampfers an, und dann der Kompass: Ungefähr auf dem 15. Breiten- und 20. Längengrade. Dort drüben lag die Westküste von Afrika, mit der Sahara, dort drüben befanden sich die kapverdischen Inseln.
»Wie weit befinden wir uns von der afrikanischen Küste entfernt?«, fragte der Professor.
Das aber konnte ihm beim besten Willen nicht gesagt werden. Der Abstand zwischen jener Inselgruppe und der afrikanischen Küste beträgt rund 400 Seemeilen. Ob man sich aber nun hundert oder dreihundert Seemeilen von dieser oder jener Küste entfernt befand, das war unmöglich zu bestimmen.
Gerade hier kamen starke Strömungen in Betracht, die den Dampfer weit ab vom Kurs getrieben haben konnten, ohne dass dies irgendwie zu kontrollieren gewesen war.
Aber nicht etwa, dass man sich in einer gefährlichen Lage befunden hätte. Durchaus nicht. Nur zur Vorsicht war der Ausguck verdoppelt worden, auch sonst wurde nach Backbord wie nach Steuerbord nach Feuern ausgespäht, lauschte man auf eine Brandung.
Schon seit Tagen war Windstille gewesen, die See war glatt wie ein Spiegel.
Eine herrliche Nacht! Nur eben stockfinster. Gerade deshalb aber phosphoreszierte das von dem Dampfer durchpflügte Wasser in wundervoller Pracht.
Professor Edeling begab sich noch einmal unter Deck und kam kurz vor elf wieder herauf.
Er begab sich nach hinten, lehnte sich über die Bordwand, blickte hinab.
O, wie erst hier, wo die Schraube arbeitete, alles leuchtete und funkelte! Alles ein einziger Feuerregen!
Bimbim, machte die Schiffsglocke.
Der Professor zuckte zusammen und richtete sich auf.
Ob mich jemand sehen kann? Ich weiß, dass es nicht der Fall ist, ich brauche mich nicht erst umzuschauen.
Bimbim, bimbim, vollendete die Schiffsglocke ihre Schläge.
Sechs Glasen — elf Uhr.
»O, du rätselhafter Mann, der du dich Loke Klingsor oder Bertran de Born oder sonst wie nanntest — Herr, bringe mich nicht in Versuchung, dass ich ihn als einen Gott anbete und deiner vergesse.«
Er hatte es nicht gesagt, es war nur durch seinen Kopf gezuckt.
Und da war er schon drüben auf Backbordseite, trat auf einen Poller, von diesem auf die Reling hinauf, und nun machte er einen möglichst weiten Satz.
Plumps — da schlug schon das Wasser über ihm zusammen, warm wie Suppe.
Er tauchte wieder auf, rang mit einem kolossalen Wellenschlag.
Aber der nahm sehr schnell ab, und da sah der Professor das weiße Toplicht und das rote Backbordfeuer des Dampfers hingehen, schnell sich entfernend.
Er trat Wasser und blickte nach, bis nichts mehr zu sehen war, was außerordentlich schnell ging.
Nun konnte er das ersehnte Vergnügen genießen. Er ganz allein mitten drin im Weltmeer, um ihn herum die schwärzeste Finsternis und dennoch alles ein blitzendes Leuchten.
Jede seiner Bewegungen löste ein feuriges Fluten aus, mit jedem Spritzer konnte er ein brillantes Feuerwerk erzeugen.
Jetzt aber kam eine bleibende Lichterscheinung auf ihn zu. Es wäre zu viel behauptet, wollte man sagen, der Professor hätte die Umrisse eines Haifisches erkennen können. Aber ein Haifisch mit phosphoreszierendem Scheine war es selbstverständlich, und da nahte schon ein zweiter und ein dritter, um den Bissen erst einmal näher zu betrachten.
»Die prophezeiten Haifische sind da. Sie dürfen mir nichts tun, es steht nicht im Programm. Nun aber muss das Licht in der Nacht noch kommen.«
So sagte sich Professor Edeling mit aller Ruhe, während er kräftige Schwimmbewegungen ausführte. Vielleicht wusste er, dass der Haifisch dem Menschen gar nicht so sehr gefährlich ist. Solange ein Mensch schwimmt oder sonst tüchtig mit Armen und Beinen zappelt, wird der Hai überhaupt niemals zuschnappen, gerade nicht bei einem Menschen, der die Schwimmbewegungen eines Frosches macht, eher schon packt er einen schwimmenden Hund, aber auch wenn er die Wahl zwischen einer Bierflasche und einer daneben schwimmenden lebenden Ratte hat, verschlingt er doch lieber erst die Flasche.
»Wo ist nun das Licht, auf das ich zuschwimmen soll?«, fragte der Professor nochmals, sich nach allen Richtungen drehend, aber dabei niemals die heftigen Schwimmbewegungen vergessend.
Da war es schon!
Ein intensiv weißes Licht, das strahlte dort in weiter Entfernung in der finsteren Nacht.
Er schwamm darauf zu. Nach welcher Richtung? Das konnte er schon längst nicht mehr sagen.

Ob das nun gerade östlich war, wo sich die Küste der Sahara erstreckte, das war fraglich — er schwamm eben darauf zu.
Ja, schwimmen hatte er in seiner Kinderzeit gelernt, und es war der einzige Sport gewesen, den er auch noch in späteren Jahren betrieben. Das heißt, er war ab und zu so zehn Minuten im geschlossenen Bassin herumgeschwommen.
Es ging ganz vortrefflich. Seine Kleidung war sehr leicht, Segeltuchschuhe — er brauchte nichts abzustreifen.
Manchmal glaubte er, dass ihn eine mächtige Strömung vorwärts riss, er kam dann aber immer wieder zu der Überzeugung, dass er sich irren müsse.
Ein Sachkundiger kann in finsterer Nacht eben gar nicht beurteilen, ob ihn eine Strömung trägt oder nicht.
Er schwamm und schwamm. Wie lange? Da fehlte ihm jedes Zeitmaß.
Nach einer Viertelstunde wähnte er sich schon zwei Stunden im Wasser. Da vergeht die Zeit so unsäglich langsam. Aber weil er sich noch bei Kräften fühlte, sagte er sich dann wieder, dass es noch nicht so lange sein könne.
Die phosphoreszierenden Haifische umschwammen ihn getreulich, näherten sich ihm, schossen wieder davon.
Plötzlich tauchte vor ihm ein leuchtender Streifen auf, und im nächsten Augenblick befand er sich mitten in einem wahren Lavastrome. Es glühte alles um ihn herum.
Dabei aber berührten seine Hände eine grobbreiige Masse, er fühlte sie mit dem ganzen Körper. Erst empfand er einen jähen Schrecken ob dieser ihm ganz unerklärlichen Erscheinung — bis er gewahrte, dass es kleine Krebse waren, Garnelen genannt. Dazwischen auch größere und heller leuchtende Gestalten — Fische, die sich in diesem wandernden Garnelenzuge mästeten.
Angenehm war es dem Professor ja gerade nicht, in solch einer dicken Krebssuppe herumzupantschen; wenn er einmal den Mund öffnete, hatte er gleich so ein paar gepanzerter Tierchen drin, dann aber erkannte er doch den großen Vorteil dieser Begegnung.
Bald hatte er diesen Wanderzug hinter sich, der glühende Lavastrom war mit einem Male wieder verschwunden, und mit ihm die ihn begleitenden Haifische, die auch nicht wiederkommen sollten. Die wandernden Garnelen oder Krabben, wahrscheinlich auf der Hochzeitsreise begriffen, boten ihnen bequeme Gelegenheit, ihren unersättlichen Magen bis zum Platzen zu füllen, da brauchten sie sich nicht erst auf den Rücken zu wälzen und nicht so lange zu warten wie bei dem dummen Menschen dort, bis der sich mit seinen Beinen ausgezappelt hatte.
Der lungenschwindsüchtige Mann schwamm und schwamm, dem Lichte zu, das weißleuchtend unverrückbar in der Ferne stand. Dass er ihm näher kam, konnte er nicht bemerken.
Und noch weniger hätte er sagen können, wie lange er nun wieder schwamm.
Ja, wenn der Tag anbrach, hier in dieser Breite schon ohne vorausgehende Dämmerung, gegen sechs Uhr — da war er sieben Stunden im Wasser gewesen, das wusste er dann bestimmt. Jetzt aber ging ihm jedes Zeitmaß ab.
Was hatte der Kapitän gesagt? Es sei nicht zu bestimmen, ob man sich hundert oder dreihundert Seemeilen von der Küste des afrikanischen Festlandes oder von den kapverdischen Inseln entfernt befände? Ja, wie sollte denn ein Schwimmer auch nur die Hälfte dieser Strecke zurücklegen können?
Doch der Professor gab sich nicht mehr solchen Erwägungen hin.
Er schwamm und schwamm, wurde zum schwimmenden Automaten, ohne vorläufig zu merken, dass seine Kräfte nachließen.
Die Kunst, sich auf den Rücken zu legen und sich so auszuruhen, verstand er nicht, er hatte überhaupt nie viel vom Rückenschwimmen wissen wollen, und dann war er eben kein denkender Mensch mehr, sondern ein Automat.
Dann aber wurde er doch wieder ein Mensch, der spürte, dass es mit seinen Kräften zu Ende ging.
»Allmächtiger Gott, ich kann nicht mehr! O, Loke Klingsor —«
Mit diesem letzten Gedanken stellte Professor Edeling seine Schwimmerei ein, um sich sinken zu lassen, was nun freilich gar nicht so einfach ist. Zuerst sinken die Füße hinab, und dann kann man noch immer lange Wasser treten.
Es muss etwas Kurioses sein, wenn ein guter Schwimmer, ohne den Krampf zu bekommen, im ruhigen Wasser aus Kräftemangel ertrinkt.
Und da merkte der Professor, dass er die ganze Schwimmerei überhaupt nicht mehr nötig hatte, vielleicht schon längst nicht mehr.
Seine Füße fanden Grund, das Wasser ging ihm nur noch bis zur Hälfte der Brust!
Dem Tode entgangen! Er begann zu waten.
Es war bei dem feinen, weichen Sande mühselig anstrengend, bot ihm aber doch eine angenehme Abwechslung.
So watete und watete er, immer jenem weißen Lichte entgegen, das dort nach wie vor unverrückbar in der Nacht leuchtete, ohne sich zu vergrößern.
Endlich konnte er auch so nicht mehr weiter, die Kräfte verließen ihn, und zu Schwimmbewegungen war er überhaupt gar nicht mehr fähig, er brachte die Arme gar nicht mehr hoch. Da aber merkte er, dass die Wassertiefe jetzt sehr schnell abnahm, das ließ ihn wieder noch aushalten.
»Sobald ich mich setzen kann, setze ich mich und ruhe aus.«
Das Wasser sank bis an den Unterleib, bis an die Knie. Er wollte sich setzen. Das war aber schon nicht mehr so einfach, er kam ins Vorwärtstaumeln, er stürzte hin, und dann spürte er bloß noch, dass er gar nicht ins Wasser gefallen war, sondern nur noch auf feuchten Sand.
Mehr wusste er nicht. Vielleicht wälzte er sich noch auf den Rücken. Dann machte sich die furchtbare Erschöpfung geltend. Wenn er nicht in Ohnmacht fiel, dann doch sofort in einen todähnlichen Schlaf.
Das Hotel »Palmerston« in Sydney ist wegen der Pracht seiner Ausstattung und seiner vorzüglichen Küche berühmt, freilich auch wegen der Orgien, welche die Lebewelt Sydneys ab und zu darin feiert.
Ein Hotel vornehmster Art ist es daher nicht. Familien von Rang und Stand steigen darin nicht ab. Immerhin ist es das luxuriöseste und daher teuerste am Platze.
Es war in der fünften Nachmittagsstunde, als vor dem Portal dieses Hotels ein Cab vorfuhr, ein Mietswagen, der Groom öffnete den Schlag, ein älterer, behäbiger, schwarzgekleideter Herr stieg aus und betrat das Vestibül, das auch schon ein Wunder der Dekorationskunst bildete.
Der Mann in seiner Loge gehörte ausnahmsweise nicht zu jenen englischen Portiers, die sich als unnahbare Majestäten fühlen.

»Womit kann ich dienen?«, fragte er.
»Ist der Herr Direktor oder der Geschäftsführer zu sprechen?«
»Geschäftlich?«
»Ich möchte ein Zimmer bestellen und ein Nachtessen, aber erst Rücksprache mit dem Herrn Direktor nehmen.«
»Mister Backham wird sofort selbst kommen.«
Ein telefonischer Anruf, und alsbald erschien der Hotelier selbst, ein äußerst tüchtiger Wirt, der sich keinen Stellvertreter hielt, weil er sich nur auf sich selbst verließ.
»Sie wünschen?«
»Kann ich für heute Abend von acht bis zehn ein Speisezimmer im zweiten Stock bekommen, in dem ein Menü nach Bestellung für einen einzelnen Herrn serviert wird? Nicht für mich, für einen anderen, ich führe nur seinen Auftrag aus.«
»Sehr wohl, mein Herr. In der zweiten Etage? Wollen Sie das Zimmer besichtigen? Bitte folgen Sie mir.«
Sie fuhren mit dem Lift hinauf.
»Ohne Übernachtung?«
»Ohne Übernachtung und nur für zwei Stunden.«
»Dann vielleicht dieses hier?«
Ein kleines pompöses Speisezimmer tat sich auf, mit wunderbarer Aussicht auf den herrlichen Hafen von Sydney, dem schönsten der Welt.
»Ja, das ist gut. Und nun die Speisenfolge. Etwa sechs Gänge.«
Sie berieten sich sofort, berieten, wie zwei Diplomaten über Krieg oder Frieden.
Suppe und Vorspeisen waren erledigt; nun aber kam die Hauptsache daran, jetzt wurde die Geschichte erst verwickelt.
»Truthahn?«, fragte der Fremde.
»Getrüffelt?«
»Ja, der Truthahn getrüffelt, außerdem aber auch mit Oliven gefüllt.«
»Gelbe oder schwarze Oliven?«
»Gelbe, immer gelbe.«
»Gelbe Oliven«, notierte sich der Hotelier, ließ aber den Bleistift gleich wieder sinken. »Apropos, wie wäre es mit einem Truthahn à la PalmerstonHotel, meine Spezialität?«
»Was ist das?«
Die Erklärung war schnell genug gegeben.
Aus einem geschlachteten Truthahn werden sämtliche Knochen entfernt, aber so, dass der Vogel seine Form behält.
In diesen Truthahn kommt ein ebenso vorgerichtetes, also knochenloses Huhn gewöhnlicher Art, in seinen Leib eine ebensolche Taube, in diese eine Wachtel oder ein ähnlich kleiner Vogel, und in diesen zuletzt eine Olive. So wird das Ganze im Ofen gebraten.
So führte der Hotelier aus, aber dieser vierfach gefüllte Truthahn war gar keine Spezialität seiner Küche, sondern dieses Kochkunststückchen ist — zumal in Amerika, der Heimat des Truthahns — sehr beliebt, und nach Ansicht aller übergeschnappten Köche und Feinschmecker ziehen nun in diese einzige Olive alle die Kraft und der Wohlgeschmack der vierfach verschiedenen Fleischumhüllung hinein.
Also es kommt darauf an, wer das Mittelstück mit der Olive erhält. Deshalb wird für eine Schmauserei, bei der das Geld keine Rolle spielt, gleich für jeden Gast solch ein Truthahn mit einer Olive vorgerichtet. Oder will sich jemand an solchen Oliven einmal recht satt essen, gleich eine ganze Schüssel davon haben, so muss er eben für sich allein einige Dutzend oder gleich hundert solcher mit Hühnern, Tauben und Krammetsvögeln gefüllter Truthahne braten lassen. Und so etwas kommt denn auch in Nordamerika jeden Tag vor, bei den Geldaristokraten und zeitweiligen Verschwendern.
In China veranstalten manche reiche Leute Gastmähler, bei denen für ein einziges kleines Gericht viele Tausende von großen, feinsten Fischen geschlachtet werden, nur um dann die Zungen aufzutragen. Besonders aber in den Vereinigten Staaten ist diese an halben Wahnsinn grenzende Art von Leckerei oder Protzerei schon längst übertroffen worden. Da gibt es in Bezug auf Tafelfreuden überhaupt keine Grenzen mehr. Allerdings darf man von einer sinnlosen Vergeudung nicht eigentlich sprechen.
In China wie in den Vereinigten Staaten ist es allgemein Sitte, der Zwang der öffentlichen Meinung fordert es unbedingt, dass alles, was nicht bei diesen Gastmählern selbst Verwendung findet, den Armenhäusern und ähnlichen Anstalten überwiesen wird. Sonst lässt gerade der Amerikaner in diesem Falle sehr wenig mit sich spaßen.
Es ist noch gar nicht so lange her, dass so ein Goldsohn in St. Louis, der alle Kanarienvögel in der Stadt aufgekauft hatte, um sie seinen Freunden gebraten vorzusetzen, vom empörten Volke geteert und gefedert wurde —
Der Truthahn mit der Olive war erledigt, auch die weitere Folge der Gänge, sowie auch der Nachtisch. Das Getränk kam daran. Weißwein und Rotwein, diesem Essen entsprechend.
»Champagner?«
»Nein, keinen Champagner, auch keine Liköre, dagegen noch eine Tasse Kaffee. Nur eine einzige ist nötig. Ziemlich stark.«
»Mokka!«, notierte der Hotelier.
»Und dazu besonders eine größere Kanne Sahne, etwa ein halbes Pint.«
»Schlagsahne? Süß oder sauer?«
»Einfache Sahne, süße.«
»Ein halbes Pint süße Sahne«, schrieb der Hotelier. »Bringt der Herr eigene Bedienung mit?«
»Nein. Die soll durch ein und denselben Kellner geschehen — diskrete Bedienung — der Mann bringt jeden Gang und verlässt das Zimmer wieder, tritt aber stets ohne Meldung ein.«
»Sehr wohl. Wann darf der Herr erwartet werden?«
»Er fährt Punkt acht in einem Cab hier vor, wird in dieses Zimmer geleitet, und dann muss die Suppe sofort aufgetragen werden!«
»Sehr wohl. Darf ich um den Namen des Herrn bitten?«
»Er fährt Punkt acht Uhr in einem Cab hier vor«, wiederholte der Besteller statt der Antwort, »ist mit einem grauseidenen Staubmantel bekleidet, trägt einen gelben Koffer bei sich — oder mehr einen Lederkasten. Eine Verwechslung ist ausgeschlossen.«
»Sehr wohl.«
Es fiel dem Hotelier gar nicht ein, noch einmal nach dem Namen des Herrn zu fragen. Er machte sich durchaus keine Gedanken, weil jener die Frage danach umgangen hatte.
Diesem englischaustralischen Wirt war doch vollständig gleichgültig, ob da ein Fürst inkognito oder ein mit Millionen durchgebrannter Kassierer oder ein beutereicher Raubmörder zu ihm kam! Die Hauptsache war, dass er bezahlte.
»Nun ist wohl alles erledigt. Ich möchte gleich im Voraus bezahlen.«
Ja, das war die Hauptsache!
Der Hotelier rechnete zusammen.
Zweieinhalb Pfund das Zimmer, bis Mitternacht zu benutzen — sechzehn Pfund Speisen und Getränke.
Ja natürlich! In diesem Hotel kostete schon ein einfach gebratenes Täubchen fünf Shilling, obgleich man das Paar hier auf dem Markte schon für drei Pence bekommt, das sind 25 Pfennig. Da musste dieser raffinierte Truthahn wohl allein hundert Mark kosten. Was der Herr davon nicht aß, konnte er sich dann ja einpapieren und mitnehmen.
Der behäbige Herr zog bedächtig eine Brieftasche, zählte vier Fünfpfundnoten auf, die von dem Hotelier durch ein eigentümliches Anschnipsen als echt erkannt wurden.
»Der Rest von dreißig Shilling ist für die Bedienung.«
»Danke sehr!«
»Punkt acht Uhr fährt der Herr vor.«
»Es wird alles in Ordnung sein.«
Der Herr benutzte wieder den Wagen, den er hatte warten lassen —
Punkt acht Uhr — es war schon dunkel — fuhr das geschlossene Cab vor, dem der Herr im grauseidenen Staubmantel entstieg, den Kragen hochgeschlagen, den Schlapphut tief in die Stirn gezogen, in der behandschuhten Rechten einen nur kleinen, aber sehr dicken Kasten von gelbem Leder.
Die sich ausstreckende Hand des Pagen, der den Koffer abnehmen wollte, wurde durch ein leichtes Kopfschütteln zurückgewiesen.
Der Kutscher war schon entlohnt, er fuhr wieder davon.
Ein wie ein persischer General uniformierter Diener übernahm die Führung. Das kleine Speisezimmer strahlte in elektrischem Lichte. Der Fremde stellte den Koffer auf einen Diwan, zog die Handschuhe aus, warf den Hut ebenfalls auf den Diwan, den Mantel daneben — es war der Mann, den Samuel Philipp von dem Bilde auf die Wand projiziert hatte, nur dass er jetzt statt der schwarzen Samtjacke einen schwarzen Gehrock trug, offen stehend, sodass man die weiße Weste mit der schwarzen Schnur sehen konnte.
Dieses Ablegen hatte eine halbe Minute gedauert. Darauf ließ er sich an dem wunderbar gedeckten Tische nieder.
»Ein Fenster öffnen! Das rechte, bitte«, sagte er mit sonorer, voller Bruststimme.
Es war das Letzte, was der Diener noch zu tun hatte, dann konnte er gehen.
Statt seiner kam sofort der Kellner und servierte die Suppe.
Und wie das geschah.
Dabei musterte der Kellner natürlich auch einmal seinen Gast.
»Ein echtes Schauspielergesicht — die wahren Teufelsaugen — überhaupt der reine Mephistopheles — ja, den möchte ich einmal den Mephisto im ›Faust‹ spielen sehen.«
So sagte sich dieser Kellner, der natürlich über eine gewisse »Bildung« verfügte, vielleicht sogar über eine ganz beträchtliche, und der noch viel natürlicher ein Deutscher war.
Ehe der Gast zum Löffel griff, ließ er seine großen, nachtschwarzen, brennenden Augen über den Tisch schweifen, über all die herrlichen Aufbaue von Blumen und Früchten in kostbaren Schalen und Vasen.
»Wer hat das arrangiert?«
»Der Chef selbst, Mister Backham! Das lässt er sich nie nehmen, das ist sein Stolz.«
»Sehr schön! Zauberhaft schön!«
»Habe ich's nicht gleich gesagt«, dachte der Kellner, »dass das ein wirklicher Künstler ist, der für so etwas noch Sinn hat? Nicht nur so ein blasierter Fatzke, der Geld ausgeben kann.
Dieses Lob muss ich übrigens dem Chef melden, dann kann er auch erfahren, dass ich heute früh die Punschterrine zerschmissen habe.«
Der Kellner machte noch darauf aufmerksam, wie das über dem Tische hängende Telefon zu bedienen sei, um die Gänge nach Belieben zu bestellen, immer nur eine einzige Minute vorher, und er entfernte sich.
Nach einer dreiviertel Stunde, während welcher der Gast aus dem ganzen, aber schon in Scheiben zerschnittenen Truthahn auch die Olive glücklich herauszufischen gewusst hatte, wurden als letzter Nachtisch Torte und Eis gebracht.
Wieder fünf Minuten später griff der Gast nach dem Telefon.
»Kaffee, bitte!«
In einer Minute war er zur Stelle. Aber nun was für ein Kaffee!
Dieses Service, dieses Silber, dieses Porzellan! Allein schon dieses Löffelchen, mit Perlmutter und Elfenbein ausgelegt! Diese Decke, dieses Serviettchen vom feinsten Damast!
Dazu besonders eine silberne Kanne mit Sahne.
»Ich kann dieses Zimmer bis Mitternacht benutzen?«
»Jawohl, mein Herr, und da kommt es auch auf eine Stunde nicht an, oder Sie zahlen eben etwas nach.«
Der Herr zog an der schwarzen Schnur aus der weißen Weste eine sehr bescheidene silberne Uhr hervor, der Kellner bewunderte dabei nur die wunderbaren, wie aus Elfenbein gedrechselten Finger.
»Es ist gleich neun. Jetzt möchte ich für eine halbe Stunde allein sein. Dann gehe ich einmal fort, komme in spätestens einer Stunde wieder. Nachher habe ich noch eine halbstündige Besprechung mit einem Herrn hier auf diesem Zimmer. Ich werde schon bis um elf alles erledigt haben. Bitte mich jetzt nicht mehr zu stören.«
Der Kellner ging —
Draußen auf dem Korridor war trotz der späten Stunde ein Installateur noch damit beschäftigt, die elektrische Leitung nachzusehen.
Eben legte er seine Leiter hier vor diesem Zimmer an die Wand und stieg hinauf.
Dort oben nahe der Decke war ein großes Drahtgeflecht in die Wand eingelassen, eine Ventilationsöffnung.
Der Mann blickte unwillkürlich durch die weiten Maschen, aber was er nun da in dem Zimmer sah, das erweckte sein höchstes Interesse, bis er vor Staunen den Mund aufsperrte.
In dem Zimmer saß an dem gedeckten Tisch vor dem Kaffeeservice ein eleganter Herr mit ganz eigentümlichem Gesicht.
Soeben stand er auf, ging zu dem Diwan, nahm von dort den dicken Lederkasten, trug ihn zu dem Stuhle, stellte ihn daneben auf den Boden, setzte sich, bückte sich noch einmal — ein leises Knacken, der Kasten ging auf, und heraus sprang eine große schwarze Katze; ein solch mächtiges Vieh, wie der Mann noch nie gesehen hatte!
Dieses schwarze Ungeheuer war sofort mit einem Satze auf dem Schoße des Herrn, richtete sich an seiner Brust empor und schmiegte sich zärtlich an ihn.
Der Herr strich einige Male über den schwarzen Rücken, und der heimliche Beobachter glaubte deutlich die elektrischen Funken zu sehen und sogar Knistern zu hören, die dabei aus dem Fell sprangen. Dann zog er unter seiner weißen Weste eine goldglänzende Schale hervor und setzte sie auf den Tisch und füllte sie aus der Silberkanne mit Milch oder mit Sahne.
Die Katze fuhr sofort herum und schleckte, die Pfoten auf den Tisch gestemmt, die Milch mit der roten Zunge auf.
Inzwischen machte sich der Herr seinen Kaffee zurecht, die Katze putzte sich, nachdem sie die dritte Schale geleert hatte, eifrig mit den Pfoten die langbeschnurrbartete Schnauze.
Ihr Herr schob die Schale wieder unter die Weste, lehnte sich in den Stuhl zurück, trank Kaffee, gab sich dem Genusse der Zigarre hin — und jetzt war auch die Katze mit ihrer Putzerei fertig, sie sprang auf die rechte Schulter des Herrn, schlug die Pfoten unter — ein Bild des größten Behagens beiderseits, auch das schwarze Ungeheuer sah urgemütlich aus, trotz der unheimlich großen, grün und rot schillernden Augen, und der Mann draußen hörte sie auch ganz deutlich schnurren.
Er hätte gern beobachtet, was nun weiter werden würde.
Bis ihm einfiel, dass er nun wenigstens schon fünf Minuten hier zusah, vielleicht aber auch zehn.
Und wehe, wenn er hier bei seiner Spionierei erwischt wurde.
Der Installateur riss sich also von dem Anblick los, stieg herab und rückte seine Leiter weiter —
Etwa zwanzig Minuten vergingen. Da kam wieder der Kellner, der diesen Gast bedient hatte, und die beiden kannten sich gut.
Da konnte der Installateur wenigstens einem Menschen sein großes Geheimnis anvertrauen, sonst hätte es ihm doch das Herz abgequetscht.
»Du, Anton, was für ein Herr ist denn das da drin? Was für eine schwarze Katze hat denn der bei sich?«
»Eine schwarze Katze?«
So und so — der Installateur berichtete.
»Du hast geträumt, Ernst, oder Du willst mich veralbern!«
»Na, wenn ich Dir's sage!«
Kurz und gut, der Kellner zweifelte schließlich nicht mehr, nur wollte er sich noch überzeugen —
So wurde also nochmals die Leiter vor jenem Zimmer angelehnt, gut aufgepasst, dass niemand kam, und schnell hinaufgeklettert.
Richtig! Da saß noch der Herr auf dem Stuhle, auf seiner rechten Schulter das ungeheure Vieh von schwarzer Katze, beide ganz Behagen.
Jetzt aber legte der Herr die Zigarre weg, stand auf, die Katze sprang ihm sofort in die Arme oder gar in die Hände, er nahm sie her, steckte sie in den noch offenen Koffer, klappte diesen zu, trug ihn zu dem Diwan, den Mantel um und setzte den Hut auf.
Hallo! Jetzt rutschte der Kellner aber schnellstens von der Leiter herab und suchte das Weite, um nicht als Lauscher erwischt zu werden.
Er fand den Prinzipal, den er schon gesucht hatte, wusste das Lob anzubringen, das der Gast der Koch- und Arrangierkunst des Hoteliers gespendet hatte.
Mister Backham war für so etwas sehr empfänglich, da konnte auch ein Kellner ganz gemütlich mit ihm sprechen.
»Aber was für eine schwarze Katze der Herr bei sich hatte!«, fing dieser an, die Gelegenheit beim Schopfe fassend, um seinem Herzen Luft zu machen.
»Was für eine schwarze Katze?«
»Die er in dem Lederkasten mitgebracht hat.«
»Hat er? Woher wissen Sie denn das?«
Der Kellner gestand die Beobachterei, und der Hotelier war noch so vergnügter Laune oder fand selbst die Geschichte so interessant, dass er an den Vertrauensbruch nicht weiter dachte.
Die amerikanische Bar dieses Hotels war ein brillanter Raum, alles funkelnd im Widerschein von Spiegeln und Glasprismen, ausgestattet mit jeglichem Komfort.
Da war unter anderem — aber es wird nicht nur nebenbei erwähnt, es hat seinen guten Grund! — auch ein großer, mit goldenen Stangen und anderem Schmuck eingefasster Kamin, in dem ein tüchtiger Stapel Kohlen glühte.
Ein Kaminfeuer in Sydney, noch dazu zu dieser Jahreszeit?
Nun, es war gar kein echtes Feuer. Nur eine Vorspiegelung!
Die glühenden Kohlen waren rote, unregelmäßig geformte Gläser, in jedem brannte ein elektrisches Glühlämpchen.
Aber sonst war der Kamin echt, er mündete wirklich in einen Schornstein.
Die Hauptsache in dem Raume war natürlich die amerikanische Bar selbst.
Diese hat sich jetzt ja in fast allen großen Städten eingebürgert.
Der Amerikaner liebt »mixed drinks«, gemischte Getränke. Schon die Biere mischt er, noch mehr die Schnäpse und Liköre. Solch eine feurige Mischung heißt Cocktail, auf deutsch Hahnenschwanz, damit das Kind einen verrückten Namen hat. Der Cocktail ist das Ideal einer amerikanischen Bar. Mit einem Dutzend verschiedener Schnäpse lassen sich schon mehr als hundert verschiedene Mischungen herstellen, aber zu einer echten amerikanischen Bar gehören mehr als hundert verschiedener Schnapsflaschen. Die ganze Cocktailsache ist überhaupt eine Wissenschaft, die studiert sein will. Es gibt viele hundert verschiedene Mischungen, die von Cocktailkapazitäten, meist von ihren Erfindern, ein für alle Mal festgelegt sind. Jeder Cocktail hat seinen Namen, immer so einen verrückten: fette Henne, grüner Affe, toller Kakadu, fideler Floh — und dergleichen geistreiche Namen mehr.
Alle diese Namen sind international. Ob man nun in New York oder in Valparaíso oder in Sydney oder in Peking in einer amerikanischen Bar einen »geplatzten Frosch« bestellt, man bekommt immer dieselbe Mischung, aus zehn- bis zwanzigerlei Schnäpsen und Likören bestehend.
Die Schänkmamsells in diesen amerikanischen Bars werden sehr hoch bezahlt oder stehen sich entsprechend gut durch Trinkgelder, weil ihr Handwerk eben gar keine leichte Sache ist. Wohl gibt es Listen über alle die Cocktails, aber so eine Barmaid kann doch nicht immer erst nachsehen, sie muss alle die Hunderte von Namen und Vorschriften dazu im Kopfe haben. Und es gehört überhaupt eine Virtuosität dazu, die Gäste zu bedienen, wenn gleichzeitig ein Dutzend verschiedener Cocktails bestellt wird.
Mit unfehlbarer Sicherheit muss da in die Batterie der Flaschen gegriffen werden —
In dieser amerikanischen Bar hier saß eine Gesellschaft meist jüngerer Herren, die ausgemacht größten Tunichtgute von Sydney.
Söhne von schwerreichen Kaufleuten und Reedern, meist im Geschäft angestellt oder schon Teilhaber, deren Väter aber täglich den Himmel baten, die Herren Söhne möchten sich nur ja nicht in die Arbeit mischen.
Lieber wollten sie Schulden bezahlen und ihre tollsten Streiche durch Geld gut machen.
Der größte Goldsohn unter ihnen war ein Mister Griffin.
Er hatte nichts als Albernheiten um Kopfe, ging nur in die Kirche, um vor ihm sitzende Personen, am liebsten zwei alte Damen, mit den Kleidern hinten zusammen zu nähen. Das sagt wohl schon genug. Er hatte aber auch schon Streiche ausgeführt, die ihn bald ins Gefängnis geführt hätten, ganz regelrechte Einbrüche, wenn auch nur, um einem anderen einen Schabernack zu spielen.
Mister Griffin sen. hatte schon wiederholt tief in den Beutel greifen müssen, um den Sohn vor Schande zu retten. Der freilich machte sich aus alledem nichts. Die Ohrfeigen und die Prügel, die er schon bekommen hatte, konnte er gar nicht mehr zählen, aber die schüttelte er ab wie ein Pudel.
Auch andere Herren waren anwesend, die nicht zu dieser Clique gehörten.
Dasselbe galt natürlich von Rechtsanwalt Iron, der jetzt die Bar betrat. Er hatte eine Geschäftsreise gemacht und wollte noch einen Trunk nehmen, ehe er nach Hause ging.
Dann erschien der Wirt. Er sah die Gäste, alle ihm wohlbekannt, in recht gelangweilter Stimmung, und hielt es für seine Pflicht, sie zu unterhalten.
»Denken Sie, meine Herren — was für eigentümliche Menschen es doch gibt — was für Liebhabereien die manchmal haben! Da speist heute Abend ein Herr bei mir — oben in Nummer 27 — der hat in einem Koffer eine schwarze Katze bei sich —«
So fing er an, so erzählte er weiter, immer ausführlicher werdend.
Natürlich berichtete er nichts davon, dass der Installateur und der Kellner oben durch die Ventilationsanlage geblickt hatten. Er selbst hatte den Herrn gesehen, wie er mit der ungeheuren schwarzen Katze auf der Schulter am Tische gegessen hatte, seinen Kaffee trinkend und behaglich eine Zigarre rauchend. Dann war die Katze herabgesprungen, ihm auf den Schoß, und hatte die bestellte Sahne bekommen, aus einer goldenen Schale, die der Herr unter der Weste hervorgezogen hatte.
So erzählte der Hotelier, teils bei der Wahrheit bleibend, teils aus eigener Phantasie etwas dazu machend.
Von »Teufelsaugen« konnte er allerdings nichts erzählen, davon hatte der Kellner ihm nichts berichtet und er hatte seinen Gast wohl einmal gesehen, aber nur im Vorbeigehen, im Mantel, den Hut tief in die Stirn gezogen.
Nun, die Herren interessieren sich dafür. Es ist doch eine merkwürdige Sache, wenn jemand eine Katze immer mit sich herumschleppt.
»Wer ist es denn?«
»Ich weiß es nicht, habe keinen Namen erfahren.«
»Aus Sydney?«
»Schwerlich.«
»Ist er denn noch da?«
»Er ist gerade einmal fortgegangen, kommt aber in einer Stunde wieder und behält das Zimmer noch bis Mitternacht.«
»Und da hat er seine Katze mitgenommen?«
»Nein, die hat er dagelassen.«
»Wo denn?«
»Oben in Nummer 27. Die hat er einstweilen wieder in den Koffer gesperrt, und der steht auf dem Sofa.«
Das hörte also auch der Mister Griffin, und da entstand in seinem erfinderischen Kopfe eine geniale Idee.
Nun wusste er endlich, was zu machen sei, um in diese Langweile Leben zu bringen, und dann würde über seinen Streich morgen wieder die ganze Stadt reden.
Ohne etwas zu sagen, begab er sich hinaus. Die Aufmerksamkeit des Portiers wurde abgelenkt, und Mister Griffin eignete sich den Schlüssel von Nummer 27 an.
Dann fuhr er mit dem Lift hinauf und schloss die Türe auf. Das Zimmer war erleuchtet — dort auf dem Diwan stand richtig der Lederkasten.
Erst hatte Griffin den ganzen Kasten mitnehmen wollen, weil er geglaubt hatte, er müsse ihn erst erbrechen, was er schon fertig bringen wollte. Übrigens glaubte er das noch jetzt, es war ja auch ein Schloss vorhanden.
Doch als er dieses nun erst einmal untersuchte, um festzustellen, wie die Aufbrecherei wohl zu machen sei, drückte er auf einen Knopf und plötzlich sprang der Kasten auf.
Aber eine schwarze Katze kam nicht heraus, obgleich eine darin lag. In einer Stellung, dass Griffin gleich etwas ahnte.
Und richtig — er brauchte nur einmal vorsichtig zuzufassen, dann wusste er es bestimmt — das Tier war tot, jedenfalls erstickt. Der Koffer hatte ja auch gar keine Luftlöcher. Aber wie hatte sie denn früher da drin atmen können?
Doch der edle Jüngling zerbrach sich deswegen nicht den Kopf, jedenfalls war die Katze tot, schon erkaltet, und das änderte nun seine Pläne, jetzt nahm er nicht mehr den ganzen Kasten mit, um dem Tiere erst unten in der Bar die Freiheit zu geben und zum Gaudium seiner Freunde eine Hetz zu veranstalten, jetzt musste er sich mit dem toten Balg begnügen.
Also er packte das mächtige, ganz gewichtige Vieh, das die rote Zunge weit zum Maule heraushängen ließ, beim Genick, barg es unter seiner Jacke, so weit das möglich war, machte den Koffer wieder zu, verließ das Zimmer, zog gar nicht erst wieder den Schlüssel ab, sondern ließ ihn gleich stecken. Es war ihm ganz gleichgültig, was aus der Geschichte wurde. Sein Vater würde schon alles bezahlen. Wenn er seinen Freunden nur ein Gaudium machen konnte und sich selbst dadurch einen »berühmten« Namen —
Der Hotelier hatte gesagt, jener geheimnisvolle Herr sei »gerade einmal« fortgegangen, um in einer Stunde wiederzukommen.
Das entsprach nicht der Wahrheit. Vielmehr war schon bald eine Stunde vorüber, seitdem der Gast das Hotel verlassen hatte.
Der Wirt hatte unterdessen etwas anderes zu tun gehabt und sich dadurch so gewaltig in der Zeit geirrt.
Ein neuer Gast betrat den amerikanischen Barraum. In einen grauen Staubmantel gehüllt, den Schlapphut tief in die Stirn gezogen. Der Hotelier erkannte ihn gleich wieder.
»Das ist er, derjenige, welcher«, nickte und deutete er mit entsprechendem Gesicht mehr, als er es flüsterte, und er wurde von allen sofort verstanden.
Der Herr behielt seinen Mantel an, nahm nur den Hut ab.
Und das genügte. Was für ein merkwürdiges Gesicht man da zu sehen bekam! Das vergaß niemand wieder, der es einmal gesehen hatte. Und nun gar diese Augen!
»Die reinen Teufelsaugen«, dachte auch Rechtsanwalt Iron sofort, und erschrak, als er in Gedanken hinzusetzte:
»Himmel noch einmal, das wird doch nicht etwa der sein, der mich hier persönlich aufsuchen wollte, der Loke Klingsor, der Mann mit den Teufelsaugen?!«
Er musste sich gedulden und konnte unterdessen nur beobachten.
Der Herr war an die Bar getreten.
»Einen bunten Bären, bitte«, bestellte er, sich gleich als Sachkundiger erweisend, der nicht erst die lange Liste zu studieren brauchte, um seinen Geschmack zu bekommen.
Die Barmaid mischte mit Virtuosität zehn verschiedene Schnäpse, der Herr tat aus einer der Schalen gepulverten Kandiszucker dazu, verrührte ihn mit den Glasstempel, bezahlte, wie üblich oder sogar gesetzlich gleich im voraus, gab drei Shilling und wies den Rest von Sixpence zurück.
Als er das Glas ansetzte, um langsam die feurige Mischung zu trinken, schweiften seine Augen einmal über die anwesende Gesellschaft. Jeder bekam seinen lodernden Blick ab, und der Rechtsanwalt konstatierte, dass ihn selbst kein zweiter und kein längerer getroffen hatte als die Übrigen.
Da wurde die Tür aufgestoßen, Mister Griffin kam herein.
»Da habt Ihr das Vieh!«
Mit diesen Worten warf er lachend die tote Katze mitten auf den Tisch, an dem seine Freunde saßen. Die wollten, wenn ihnen auch schon eine Ahnung aufstieg, doch nicht an die Tatsache glauben.
»Was soll denn die tote Katze? Woher haben Sie die?«
»Das ist die von dem da oben. Ich habe sie aus seinem Koffer geholt, aber sie war schon erstickt.«
Und lachend — der alberne, an Gehirnschwund leidende Mensch lacht überhaupt immer — erzählte er seinen Streich, wie er vom Brett den Schlüssel entwendet hatte, und so weiter.
Eine unheimliche Stille folgte diesen Worten. Alles blickte nach dem Manne mit den Teufelsaugen.
Dass jetzt irgend etwas passieren musste, das war ja ganz klar, aber niemand konnte sich vorstellen, was das sein würde. Zuerst trat der Wirt heran, blass vor Erregung.
»Das ist ja unerhört!«, keuchte er. »Mister Griffin, wie soll ich Ihre Handlung nennen — in ein fremdes Zimmer eindringen — den Schlüssel stehlen — hier in meinem Hotel —«
Er wurde dadurch unterbrochen, dass jetzt auch der fremde Gast an den Tisch trat, und von dem hing doch alles ab, wie er den Fall auffasste.
Er packte die tote Katze am Genick, hob sie halb empor, dass ihre Zunge noch weiter zum Vorschein kam, und ließ sie gewichtig auf den Tisch zurückfallen.
»Armer Golem, dass Du ein so klägliches Ende finden musstest!«
Und während er dies sagte, suchten seine glühenden Augen den Rechtsanwalt.
Golem hieß diese Katze?
Ja, nun freilich wusste Rechtsanwalt Iron auch bestimmt, wen er vor sich hatte.
Aber dadurch war die Sache hier noch nicht abgemacht.
»Herr, Sie haben dieses Tier in Ihrem Koffer eingeschlossen und ersticken lassen!«, rief jetzt Mister Griffin.
Es war ein sehr schlaues Manöver von dem jungen Manne, was ihm gar niemand zugetraut hatte. Die Angst hatte ihm diese Schlauheit eingegeben; denn sein Lachen war schnell erstorben, sobald er den Mann mit den Teufelsaugen nähertreten sah, in dem er ahnungsvoll sofort den Besitzer der Katze erkannte. Diesmal würde er wohl nicht mit einer Backpfeife wegkommen, diesmal ging's vors Messer.
Da also — in seiner Todesangst — hatte er den schlauen Einfall, schnell den Spieß herumzudrehen und mit einer Anzeige wegen Tierquälerei zu drohen.
Und der Mann mit den Teufelsaugen schien auch gleich die Gefahr zu erkennen, er lenkte schnell ein. Zunächst hob er die Schultern, dann ließ er sein dunkelbrennendes Auge im Kreise schweifen.
»Ich bedauere. Gentlemen, was ist Ihr Drink?«
Australien hat dieselbe Entwicklungsgeschichte wie Nordamerika durchgemacht, das ja auch einmal eine englische Kolonie gewesen ist. Man kann noch heute in Amerika erleben, in der größten Stadt, dass in das feinste Lokal ein heruntergekommener Strolch tritt und an alle anwesenden Gäste die gemeinsame Frage richtet: »What's your drink?« — Was trinken Sie? — Und ein jeder wird etwas nach seinem Geschmack bestellen, keiner wird sich ausschließen. Der Strolch bezahlt alles, hebt sein Glas — »Good luck!« — »Good luck!«, tönt es überall zurück — jeder trinkt, der Strolch geht seiner Wege.
Es ist ausgeschlossen und man kann es sich gar nicht vorstellen, dass so etwas bei uns in Deutschland passiert.
Dass in ein feines Restaurant ein zerlumpter Strolch eintritt, an den Tisch geht, an dem etwa ein Legationsrat sitzt, und den nun fragt: »Trinken Sie ein Glas Bier mit mir?« Na, der Kerl würde doch gleich hinausgepfeffert werden, vielleicht auch würde man ihn noch auf seinen Geisteszustand untersuchen. In Amerika wie in Australien dagegen ist es ausgeschlossen, einfach undenkbar, dass da irgend jemand die Einladung zum »drink« abschlägt. Übrigens ist das gar keine Einladung, nicht erst eine Frage, ob man etwas trinken will, sondern es ist gleich ein direkter Befehl. Nur die Wahl des Getränkes steht noch frei, es sei denn, man hat eine Dame bei sich, sie befreit auch den Herrn von der Annahme. Sonst nichts. Sonst kann es passieren, dass der Strolch oder der wirkliche Gentleman einem den Revolver auf die Brust setzt, wegen der maßlosen Beleidigung, die in der Weigerung liegt. Aber sie ist ja gänzlich ausgeschlossen.
Wie gesagt, dies alles hängt mit der eigentümlichen Entwicklungsgeschichte zusammen, die Nordamerika wie Australien durchgemacht haben, die ihre Besiedelung und jetzige Höhe doch nur Hinterwäldlern, Jägern, Holzfällern, Goldgräbern und dergleichen rauen, aber offenen und ehrlichen Naturmenschen zu verdanken haben, und das hat sich bis heute noch nicht verwischen lassen, macht sich auch noch in den elegantesten Salons bemerkbar.
»Gentlemen, was ist Ihr Drink?«
In diesem Falle handelte es sich nicht nur um Befolgung einer allgemeinen Sitte, sondern jetzt war hierdurch in dieser peinlichen Situation auch das erlösende Wort gesprochen worden.
Alles erhob sich sofort, um nach der Bar zu gehen.
»Bestellen Sie!«
Wiederum ein Entgegenkommen, dass man die Wahl des Getränks dem Spender überließ.
»Danke. Doch wohl Cocktail. Wie viele sind wir? Elf — zwölf — dreizehn — vierzehn — Miss, vierzehn Cocktails, bitte! ›Schwarze Katze‹!«
Die Barmaid brauchte nicht erst im Register nachzusehen, sie wusste aus dem Kopfe, dass sich unter den 256 verschiedenen Mischungen, die hier zu haben waren, keine »schwarze Katze« befand.
»Schwarze Katze?«, lächelte die holde Maid. »Meinen der Herr vielleicht schwarzen Popanz? Oder schwarzen Schneemann?«
»Nein, schwarze Katze. Kennen Sie nicht? Mischen Sie. Dreizehn Schuss, den vierzehnten füge ich selbst zu.«
Alles trat erwartungsvoll näher, um ganz genau beobachten zu können.
Ein neuer Cocktail — o, welches Ereignis! Voraus gesetzt, dass sich der Erfinder nicht blamierte, indem es gar keine neue Mischung war.
Und es ging los, der Herr dirigierte:
»Pfefferminz — Angostura — Kirsch — Mandelmilch — Pommeranzen — Ingwer —«
Und so ging es weiter.
Die Barmaid jonglierte zwischen den Flaschen, gab aus jeder in jedes der vierzehn bereitstehenden Gläser einen kleinen Schwapp hinein. Wirklich geradezu fabelhaft, wie sie die Flaschen aus der Batterie ergriff, entkorkte und wieder in Reih und Glied stellte, wie sie einschenkte, diese Schnelligkeit und Sicherheit! Man wurde unwillkürlich an einen Klaviervirtuosen erinnert, der über die Tasten rast: oder an einen Croupier in Monte Carlo, der am grünen Tisch die Gewinne auszahlt.
»— Mastika. Halt! Den vierzehnten Schuss füge ich selbst hinzu.«
Genau dieselbe Flaschenbatterie war noch einmal vorhanden, handbereit für die Gäste aufgebaut, falls sich diese ihren zweiten Coktail selbst mischen wollten.
Der Mann mit den Teufelsaugen ergriff eine Flasche, harmlosen Irish Whisky, gab in jedes Glas noch einen kleinen Schwapp. Dann bezahlte er. Die Rechnung machte 35 Shilling, er gab zwei Guinees, wies die fünf Schilling, die er herauszubekommen gehabt hätte, zurück.
Unterdessen hatte sich jeder schon mit seinem Glase bewaffnet, bediente sich aus einer der Schalen mit gepulvertem Kandiszucker, der Glasstempel wurde gerührt. Auch der Spender hatte es getan, er hob sein Glas.
»Good luck, gentlemen.«
»Good luck!«
Nur wenige schluckten langsam, die meisten gossen das flüssige Feuer mit einem Ruck hinter.
Es war geschehen, die Gläser wurden zurückgesetzt.
Der Mann im Staubmantel ging wieder an den Tisch, auf dem die ungeheure schwarze Katze mit heraushängender Zunge als Leiche lag.
»Armer Golem, dass ich Dich so verlieren musste. Na, Du sollst wenigstens eine Deiner würdige Bestattung bekommen.«
Und er packte wiederum die tote Katze beim Genick, hob sie hoch, trat zum Kamin, legte das Tier auf die glühenden Kohlen, bis sie lang ausgestreckt darauf lag.
Alle sahen es. Und alle wussten, dass es nur ein imitiertes Feuer war, dass von den innen erleuchteten Glaskörpern kaum eine bemerkbare Wärme ausging.
Da aber kam die Überraschung. Der schwarze Katzenbalg blähte sich, wodurch er sich etwas bewegte, sich krümmte, die Haare schienen zu sengen, ein dicker Qualm stieg auf, der zum Schornstein hinauf und hinaus ging; dann schrumpfte der Kadaver zusammen, schwand mehr und mehr, zerfiel in Asche, bis schließlich auch diese Asche empor- und zum Schornstein hinauswirbelte.
Alle hatten es gesehen. Das Staunen lässt sich denken.
Das Verbrennen war allerdings unnatürlich schnell vor sich gegangen, gar so plötzlich konnten sich die Knochen doch nicht in Asche verwandeln — aber das Unnatürliche und daher Staunenswerteste und Unerklärlichste lag doch überhaupt schon darin, wie die Katze hatte verbrennen können.
Oder hatten die Glaskörper plötzlich eine ungeheure Glut ausgestrahlt?
Einige Herren streckten denn auch mit der nötigen Vorsicht die Hand aus, aber nur um sich zu überzeugen, dass von den imitierten Kohlen nicht mehr Wärme ausging als vorher.
»Sapristi!«
»God damned!«
»Wie ist das möglich?«
»Herr, wie haben Sie das gemacht?«
So und ähnlich und anders klang es durcheinander.
Der Tausendkünstler gab keine Erklärung. Sofort, nachdem die Asche verschwunden war, wandte er sich an Mister Griffin, der mit halb oder sogar ziemlich weit geöffnetem Munde dastand und ein ungeheuer geistloses Gesicht machte.
»Sir! Wenn ich Ihnen Verzeihung gewähre, so hat Ihnen der Hotelier keine Vorwürfe mehr zu machen. Nehmen wir beide zur Versöhnung einen Drink.«
Der junge Mensch machte den Mund zu und fing albern zu lachen an, weil er nichts zu sagen wusste. Aber selbstverständlich schlug er die Einladung nicht aus.
Schon hatte sich der Mann im Staubmantel gegen die Bar gewandt.
»Bitte, Miss, zwei Cocktails. ›Weiße Maus‹!«
Die Barmaid konnte jetzt nicht mehr lächeln.
»›Weiße Maus?‹«, fragte sie ängstlich. »Der Herr meinen wohl ›weißen Raben‹? Oder ›weißen Schornsteinfeger‹?«
»Nein, ›weiße Maus‹.«
Dieser Cocktail aber stand nicht im Register, den kannte die Barmaid nicht, sie musste wieder nach Vorschrift mischen, diesmal nur für zwei Glaser.
»Rosen — Wermut — Toddy — Kokos — Koriander — Aprikosen — halt! Den siebenten Schuss gebe ich selbst zu.«
Wieder war es die Flasche mit Irish Whisky, aus der er den letzten Schwapp dazu goss.
Beide bedienten sich mit Zucker und rührten.
Sie waren hiermit noch nicht fertig, als etwas anderes passierte.
»Miau, miiiaaauuu«, ging es — immer kläglicher und eindringlicher.
Das Katzenmiauen kam unverkennbar aus dem Kamine, aus dem Schornstein.
»Was ist denn das?«, wurde gestaunt, aber auch schon gelacht.
»Das ist mein Golem, meine Katze — jetzt natürlich nur noch ihre Seele, die da drin im Schornstein steckt«, erklärte der Mann im Staubmantel. »Bist Du das, Golem?«
»Miau, miiiaauu«, erklang es wiederum, jetzt in ganz anderem Tone als zuvor, man hörte die Bejahung förmlich heraus.
»Bauchrednerei! Nichts weiter als Bauchrednerei!«, musste einer der Herren seinen scharfen Geist gleich leuchten lassen.
»Famos gemacht — bravo!«, lachten die anderen.
»Wie geht es Dir, mein Golem?«, fragte der Herr im Staubmantel.
»Miau, miiaauu.«
»Gut? Du hast nur Hunger?«
»Miau, miiaauu«, wurde wieder bejaht.
»Hast Du denn keine Mäuse in deinem Schornstein?«
Alles lachte, weil das Miau, das jetzt erklungen war, gar zu drollig gelautet hatte, man hatte wiederum ganz deutlich die betrübte Verneinung herausgehört.
»Mein Golem frisst oder fraß nämlich nur Mäuse, nichts anderes als Mäuse, und zwar auch nur weiße Mäuse, ausgesucht schöne«, setzte der Mann im Staubmantel erklärend hinzu. »Golem, willst Du Mäuse haben?«
»Miau, miiaauu.«
»Soll ich Dir welche schicken?
»Miiiaaauuu, miiiaaauuu«, hörte man ganz deutlich das »bitte, bitte«.
»Weiße Mäuse?«
»Miiiiaaaaauuuuu«, wurde ganz energisch gedrängt.
Jetzt war der Herr im Staubmantel, der unterdessen immer den Zucker verrührt hatte, damit fertig, er hob sein Glas gegen Mister Griffin.
»Good luck, Sir.«
»Good luck.«
Beide tranken, leerten ihr Glas.
Plötzlich ein Fall und ein Splittern von Scherben. Mister Griffin hatte sein Glas zu Boden fallen lassen.
Und da sahen die Umstehenden auch schon, wie das sonst so gesunde, rote Gesicht des robusten jungen Menschen plötzlich käseweiß geworden war.
Er taumelte einige Schritte vor, bis ihm der Tisch Halt gebot, über diesen legte er sich mit halbem Oberkörper, griff sich mit beiden Händen an den Mund, zog aber die Hände schnell wieder zurück, um sich lieber festzuhalten, sie auf den Tisch zu stemmen, und —
Aus dem würgenden Munde schlüpfte etwas Weißes hervor, eine weiße Maus fiel auf den Tisch, lief über diesen hin, sprang auf den Boden und war mit einem Satze in dem Kamin verschwunden.
»Miau, miiaauu, miiaaauuu«, erklang jubelnd das Katzengeschrei.
Da aber kam aus dem würgenden Munde schon eine zweite weiße Maus mit roten Augen zum Vorschein, lief über den Tisch hin, sprang auf den Boden und in den Kamin, begrüßt vom Katzengeschrei.
Und noch eine dritte Maus würgte der junge Mensch hervor —

Alle die Herren sahen es.
Keiner lachte mehr.
Es sah doch zu fürchterlich aus.
Rechtsanwalt Iron war wohl der einzige, der daran dachte, auch einmal nach dem Herrn im Staubmantel zu blicken.
Der hielt sich im Hintergrund, hatte die Arme über der Brust gekreuzt, und ein allerdings ganz diabolisches Lächeln stand auf dem an sich schon so dämonischen Gesicht.
Und nun diese Augen! Diese großen, nachtschwarzen, unergründlichen, brennenden Augen! Was für eine wahre Feuersglut die über die ganze vor Schreck und Grauen erstarrte Gesellschaft gossen!
Rechtsanwalt Iron hatte jedoch nur durch einen einzigen Blick auf den Mann diese Feststellung machen können, dieser Blick wurde aufgefangen; in demselben Moment griff der Mann im Staubmantel nach seinem Hut und trat auf den Rechtsanwalt zu.
»Loke Klingsor. Ich bitte den Herrn Rechtsanwalt, mir auf mein Zimmer folgen zu wollen.«
Dieser ging sofort mit, mit einer Bereitwilligkeit, die eigentlich gar nicht seiner sonstigen Art entsprach und die er selbst später ganz unerklärlich fand.
Sobald die beiden hinaus waren, hörte der junge Mensch mit seiner Mäusespuckerei auf, er taumelte von dem Tisch nach einem Sofa, erreichte es noch glücklich, fiel darauf, immer noch ächzend und stöhnend und wimmernd, und wurde von den anderen Herren umdrängt.
Der Fahrstuhl hatte die beiden hinaufgebracht, die Türen konnten auch von der Portiersloge aus elektrisch geöffnet werden, der Mann mit den Teufelsaugen ließ den Rechtsanwalt eintreten.
Also das kleine Speisezimmer war noch erleuchtet, das rechte Fenster noch geöffnet.
Neben diesem stand ein Stuhl, auf diesen legte der Fremde Mantel und Hut.
»Bitte, Herr Rechtsanwalt, wollen Sie Platz nehmen.«
Mit schnellem Griff waren zwei Lehnstühle zurechtgerückt neben dem Tische, der schon wieder anders arrangiert worden war, eine einladende Handbewegung.
Ehe sich aber der Mann mit den Teufelsaugen selbst setzte, schien ihm noch etwas einzufallen — er begab sich nach dem Diwan, auf dem der dicke Koffer stand, den Mister Griffin also wieder geschlossen hatte, ergriff ihn, nahm in dem Lehnstuhl Platz und stellte gleichzeitig den Koffer daneben auf den Boden.
Darauf schlug er die Beine übereinander, dabei sich etwas zur Seite biegend und auf den Knopf des Kofferschlosses drückend.
»Ich bitte um Verzeihung — ich bin es gewohnt, es ist nun einmal meine Liebhaberei —«
Knacks, ging es, die beiden Kofferhälften teilten sich, heraus sprang eine ungeheure schwarze Katze, saß mit einem Satze auf dem Schoße ihres Herrn, richtete sich an seiner Brust empor und rieb sich mit allen Zeichen des größten Behagens daran.
»So, Herr Rechtsanwalt, nun können wir über den Golem sprechen.«
Für die Häusermasse, welche auf der Insel Manhattan liegt, war die Sonne bereits im Hudson untergetaucht, aber die Dämmerung würde noch lange währen.
Mister Samuel Philipp schlich in seinem Hause im Schlafrock auf Filzschuhen die Treppen hinauf, bis er in die dritte Etage kam. Ohne einen Schlüssel zu brauchen, öffnete er dort eine Tür.
Und da zeigte sich, dass Mister Samuel Philipp von seinen dreißig Jahre währenden Reisen im Auslande nicht nur ausgestopfte Vögel oder in Spiritus gesetzte Reptilien und sonstige Tiere mit heimgebracht hatte.
Das große Zimmer enthielt nur Mumien, nichts weiter als menschliche Mumien.
Der Hauptsache nach hatten sie, als ihnen noch der Odem durch die Nase wehte, in Indien gelebt.
Indien ist ja auch nun ein sehr weiter Begriff. Schon in Vorderindien gibt es total verschiedene Volksstämme, ein Gurkha aus Nepal ist von einem daneben hausenden Manrun so verschieden wie ein echter Norweger von einem echtem Hottentotten — oder auch wie von einem mongolischen Lappländer, der ja ebenfalls dicht neben dem germanischen Norweger lebt.
Besonders beachtenswert waren diese Mumien nicht. Es gibt Sammler, bei denen man ganz anderes findet.
Ja, Mister Samuel Philipp mochte eifrig gesammelt haben, und er mochte auch sein eigenes Mittel besitzen, um die toten Menschen vor Verwesung zu schützen, aber weit her war diese seine Kunst nicht.
Die präservierten Leichen nahmen möglichst charakteristische Stellungen ein. Da war zum Beispiel ein großes, starkes, schwarzes Weib von negerartigem Typus, das über einem Amboss einen Hammer schwang. Also zweifellos eine Mundari — ein Volksstamm, bei dem die Tätigkeit der Männer nur darin besteht, dass sie auf der Bärenhaut liegen und darüber nachgrübeln, aus was für Ingredienzen sie berauschende Getränke bereiten können, während den Frauen alle Arbeit überlassen bleibt.
Vor allen Dingen verstehen diese Frauen den Schmiedehammer zu schwingen, sie sind die reinen Zyklopinnen. Auch das Eisen gewinnen sie selbst, und ihre Schmiedearbeiten, Lanzenspitzen, Äxte und dergleichen, werden in ganz Indien gern gekauft.
Dieses Weib hier musste einst schwellende Muskeln besessen haben.
Die waren auch noch vorhanden, aber nicht mehr schwellend, sie hingen wie Windsäcke, denen die Luft ausgegangen war, von den Knochen herab, und nicht nur diese Mangelhaftigkeit der Präservierung, sondern auch das ganze Arrangement ließ viel zu wünschen übrig.
Der Schmiedehammer schwebte frei in der Luft, das heißt er war an der Wand befestigt, auch wieder recht ungeschickt, die Hand, die ihn schwingen sollte, war vom Stiele geglitten und schwabbelte an einem Stricke nun auch wieder frei über dem Kopfe der Inderin, die überhaupt dastand, als wolle sie ein Nickerchen machen, sich im nächsten Augenblick mit dem ganzen Leib über den Amboss werfen.
Und so war es mit allen diesen Mumien beschaffen. Der geschickte Konservator fehlte, der zugleich ein echter Künstler sein muss.
Auch eines fiel unangenehm auf: die Überfüllung des Zimmers.
Der große Raum war mit solchen Mumien geradezu vollgepfropft.
Dicht nebeneinander, nicht etwa nur an den Wänden entlang, überall waren sie einzeln oder in Gruppen aufgestellt, ganz liederlich, man konnte sich kaum durchquetschen und trat immer einmal solch einem verewigten Leichnam aufs Hühnerauge —
Mister Samuel Philipp hatte sich, ohne irgendwie Umschau zu halten, bis zur nächsten Tür durchgequetscht, die er öffnete.
Ein noch viel größerer Raum zeigte sich. Ein weiter Saal mit vier Fenstern. Und dieser weite Saal war völlig leer, es war absolut nichts darin vorhanden.
Warum baute Mister Philipp seine vielen Mumien denn nicht hier in diesem großen Saale auf, wo sie doch ganz anders zur Geltung kommen mussten? Warum zwängte er sie daneben in dem viel kleineren Zimmer zusammen?
Nun, diese Frage sei gleich beantwortet: Bis vor zwei Jahren hatten sich alle jene Mumien auch wirklich in dem großen Raum befunden, es war der Mumiensaal gewesen.
In jenem Zimmer daneben hatte man nur einige ausrangierte Präparate untergebracht.
Da — in einer Nacht — musste in diesem sonst so stillen Hause etwas Besonderes passiert sein. Es war ein unaufhörliches Schreien gewesen, wenn auch nicht hörbar für die Nachbarschaft.
Und am anderen Morgen hatten die Diener die sämtlichen Mumien mit oder ohne Glaskästen in das einzige leere Zimmer geräumt, das es in diesem Hause überhaupt noch gab, zwar eins der größten Zimmer, aber es hatte sie kaum fassen können.
Seitdem wurden die Mumien kaum noch gepflegt und gesäubert, und seitdem stand der große Mumiensaal, wie er trotz alledem noch immer genannt wurde, leer; selten, dass er einmal von jemand betreten wurde.
Die Diener waren überhaupt nicht mehr hineinzubringen, außer ihr Herr ging selbst mit. Aber das kam nur sehr selten vor.
Es hatte ja auch niemand etwas mehr in dem leeren Saale zu suchen.
Die Frage war bloß, weshalb er leer gelassen wurde, obwohl es ein zweites leeres Zimmer in diesem Hause nicht gab und jeder Platz sonst aufs äußerste ausgenutzt wurde.
Also Mister Philipp hatte von dem vollgepfropften Mumienzimmer aus den leeren Mumiensaal betreten.
Nicht gerade, dass ihm etwas von Angst oder auch nur Scheu anzumerken war, aber ganz sicher wanderten seine Augen doch auch nicht durch den weiten öden Raum.
Ungefähr in der Mitte blieb er stehen, sah sich noch gründlicher nach allen Seiten um und schüttelte wehmutig den Kopf.
»Ach, was war doch das für eine schöne Zeit, als ich hier zwischen meinen Mumien umherwanderte, manchmal vor einer stehen blieb, sie liebkoste und in meiner Erinnerung noch einmal durchmachte, auf welche Art der Mensch aus Fleisch und Blut einst mein Eigentum ward, wie ich ihn zur Mumie präparierte, was für furchtbare Strapazen und Gefahren ich deswegen durchmachte, nur um so einen interessanten Balg mit Haut und Fleisch und Knochen zu bekommen.
Ja, ich habe wirklich köstliche Stunden hier in diesem Mumiensaale verlebt.
Vorbei, ach, vorbei!
Ich könnte die Mumien ja anderswo unterbringen, müsste nur zwei Zimmer nebeneinander ausräumen lassen — dadurch aber würde mir dann wieder die andere Ordnung ganz gestört!
Nein, hier habe ich die Mumien vor zehn Jahren aus den Kisten gepackt, hier habe ich sie aufgestellt, hier hätten sie auch bleiben müssen, oder sie sind nichts mehr für mich. Ich bin nun einmal so.
Ach, dass dieser Hundsfott von Derwisch, als ich hier an ihm das hochinteressante Experiment mit dem Mumiengift vornehmen wollte, mir solch einen niederträchtigen Streich spielen musste!
Einen solch grässlichen Selbstmord zu begehen, ohne jede Rücksicht auf die Umstehenden, diese Gemeinheit!
Wie der dicke Kerl plötzlich auseinander platzte, uns mit seinem Geifer überschüttend, gerade so, wie wenn man auf eine Riesenspinne oder auf eine Kröte tritt, huh!«
Jetzt packte den ausgedörrten Yankee doch einmal das kalte Grausen, so schüttelte er sich.
Und dann, als seine umherirrenden Augen am Boden haften blieben, wo sich auf der hellen Diele ein großer dunkler Fleck zeigte, schien sein Grausen nur noch zuzunehmen.
»Was ist das?! Der Fleck ist schon wieder zum Vorschein gekommen? Wie ich auch habe mit Sand und Seife scheuern lassen, was für scharfe Chemikalien ich auch verwendete, der große Fleck kommt immer und immer wieder und nicht nur das, sondern immer deutlicher nimmt er die Umrisse des Derwischs an!
Jawohl, das ist der dicke Leib, dort der Kopf, dort die Nase, dort sind die Ohren, immer deutlicher sieht man, wie er die Arme hebt, um mit den Händen den würgenden Strick — —«
Mister Philipp schüttelte sich noch einmal, jetzt aber nicht mehr wie im Grausen, sondern um eine unangenehme Empfindung loszuwerden, und dann richtete er sich auf.
»Ach Unsinn, es ist ja nur Einbildung! Freilich, eine böse Sudelei hat der Derwisch bei seinem Platzen hinterlassen, aber dass der Fleck nicht wieder weggeht, das liegt daran, weil sein Blut eben schon mit dem Höllengift infiziert war. Es gibt kein Mittel, um das wegzubeizen, und dass der Fleck nach und nach die Gestalt des Derwischs annehmen soll, das ist einfach Einbildung. Man kann aus diesen Linien genau so gut einen Menschen wie ein Kamel machen.«
Er riss sich von dem Anblick los und schritt auf eins der vier Fenster zu.
Das Haus, ein sehr altes Gebäude, hatte eine ganz bevorzugte Lage — am Zentralpark. Niemand konnte von draußen durch die Fenster blicken, wenigstens nicht auf dieser Seite hier. Und das galt sogar auch noch von der anderen Seite, wo das Eckhaus wieder einem kleinen Platz zugewendet war.
Nach dieser Seite besaß das große Eckzimmer ein Fenster, nach jener ihrer drei, und zu dem mittelsten dieser drei Fenster war Mister Philipp gegangen.
Ehe er es öffnete, zog er aus der Tasche des Schlafrocks ein kleines Päckchen, und ehe er weiter das ausführte, was ihm bei fürchterlicher Drohung vorgeschrieben worden war, betrachtete er noch einmal sinnend dieses Päckchen; dabei huschte ein ebenso listiges wie etwas scheues Lächeln über die hageren Züge.
Jetzt freilich flüsterte und murmelte er nicht, er dachte es nur, und wir wollen seine Gedanken lesen können.
»Was wird er sagen, wenn er merkt, dass es gar nicht das echte Bild ist, sondern das falsche, die Kopie, die ich damals von dem Original habe fertigen lassen?
Gar nichts kann er sagen, wenigstens mir nicht, mir kann er keine Vorwürfe machen! Denn Loke Klingsor hat doch das Bild gemeint, das ich schon in dem Projektionsapparat hatte — das soll ich ihm aushändigen.
Und nun habe ich heute Mittag, als ich von Edison kam, tatsächlich versehentlich die Kopie, die ich ebenfalls bei mir hatte, in den Projektionsapparat gesteckt, weshalb die Geschichte mit den Sonnenstrahlen auch nicht gleich funktionieren wollte. Natürlich nicht, es war ja nur die gemalte Kopie, wie ich später schnell genug erkannte.
Nun soll aber Klingsor auch nur diese Kopie bekommen, ich führe nur aus, was er mir befohlen hat — immer ganz korrekt, hähähä.
Mit dem anderen Bilde, mit dem echten, konnte ich leider nicht weiter experimentieren, weil sich die Sonne hinter Wolken versteckte und nicht wieder zum Vorschein kam. Aber sobald wieder ein sonniger Tag ist, hoffentlich morgen schon, werde ich das Experiment ausführen, werde den Fürsten des Feuers doch noch einmal in seiner intimen Häuslichkeit beobachten, was für merkwürdige Sachen er da treibt.
Und wenn er es erfährt?
Bah, dann werde ich schon eine neue Ausrede haben. Ich kenne doch meinen Loke Klingsor.
Den kann ja ein Kind um den Finger wickeln. Man muss es nur verstehen.
Ja, der freut sich sogar, wenn es einmal jemandem gelingt, ihn übers Ohr zu hauen, den belohnt er noch obendrein. Dass er mich so bestrafen wird, wie er mir angedroht hat, mich in seinem Hekla räuchert, davon kann nun vollends gar keine Rede sein, hähähä.«
So kicherte der Alte in sich hinein, aber doch mit etwas verzagtem Gesicht, als er das Fenster öffnete und das Paketchen draußen auf den breiten Sims legte.
»Wie wird er das Bild nun abholen?
Na, da kommt selbstverständlich nur eine Möglichkeit in Betracht, und deshalb hat er ja auch gerade dieses Eckzimmer im dritten Stock bestimmt, damit er genügend Platz hat.
Aber ganz ungesehen kann das doch nicht abgehen. Und wie er oder sein Abgesandter das nun macht, das Paket von hier wegzuangeln, das muss ich unbedingt beobachten. Vielleicht habe ich dabei Gelegenheit, auch noch etwas anderes zu ergattern.
Also werde ich die Nacht über hierbleiben. Lange wird es ja nicht dauern, und ich darf ja auch Licht machen und Gesellschaft bei mir haben, so viel ich will, das hat er mir eigens erlaubt. Und wenn meine Burschen nicht mitmachen wollen — ich werde ihnen schon ihre Gespensterfurcht austreiben — oder sonst, wenn sie mir mit ihrem Wahnwitz etwa im Wege sind — na, dann bleibe ich eben allein hier. Ich fürchte mich doch nicht etwa vor so einem toten Derwisch oder vor sonstigen Gespenstern.«
Er schloss das Fenster wieder, begab sich zu einer der beiden Türen, die, wenn man die Lage des Hauses beurteilte, nach dem Korridor führen musste.
Als er sie öffnete, zeigte sich aber, dass hinter dieser Türe eine kleine, fensterlose Kammer war, nur ein ganz enger Winkel. Auf Regalen standen einige Bücher, ein einfaches an der Wand schräg angebrachtes Brett diente als Stehpult, darüber hing ein Haustelefon — — das Ganze war also die Telefonzelle, in der Mister Philipp wahrscheinlich auch seine Mumien katalogisiert hatte, und die nicht mit ausgeräumt worden war. Elektrisches Licht gab es in diesem Hause überhaupt nicht, Gas war hier in der dritten Etage auch nicht gelegt, an der Wand hing eine Petroleumlampe, sonst musste auch bei Tage die Tür offen bleiben, wollte man sehen.
Mister Philipp benutzte nun das Telefon, klingelte an.
»Wer ist dort?«, fragte er gleich, nachdem er das Gegenzeichen erhalten hatte
»Nursim.«
»Ja, Dich wollte ich eben haben. Komm gleich herauf in den Mumiensaal! Bringe zwei gefüllte Petroleumlampen mit, die man an die Wand hängen kann.«
»Wo seid Ihr, Sahib? Wohin soll ich die Lampen bringen?«, erklang es in recht kläglichem Tone.
»Im Mumiensaal! Hörst Du denn schwer?«
»O Sahib!«, ertönte es noch kläglicher als zuvor.
»Na, was gibt's?«
»Kann nicht ein anderer hinaufkommen? Ich habe wieder so das Gliederreißen —«
»So? Und vorhin erst habe ich Dich wie einen Affen die Treppe hinaufspringen sehen, ich warnte Dich noch und Du lachtest mich aus, Du würdest mit jedem Tage jünger —«
»Es ist ganz plötzlich wiedergekommen, mein altes Gliederreißen —«
»Du kommst sofort herauf!«, herrschte sein Gebieter ihn grimmig an. »Wenn Du in fünf Minuten nicht mit den zwei Lampen oben bist, sollst Du etwas erleben. Ich sperre Dich in den Sarkophag —«
»Nein, nein, Sahib, ich bin schon unterwegs!«
»Merkwürdig«, brummte Mister Philipp, während er unterdessen hin und her ging, »Nursim war sonst der einzige, der sich aus der ganzen Sache nichts machte, er verlachte die anderen, wenn die davon erzählten, wie der tote Derwisch hier oben in der Nacht poltere und spuke, sie sollten ihn doch einmal rufen, wenn sie hörten oder gar sehen — und nun scheint sich der Kerl plötzlich auch vor dem Mumiensaal zu fürchten.«
Die fünf Minuten waren noch nicht vergangen, als die zweite Tür auf dieser Seite, die aber nun wirklich auf den Korridor ging, vorsichtig geöffnet wurde, und noch vorsichtiger schob sich durch die Spalte ein beturbanter Kopf mit mächtigem Vollbarte, die Hautfarbe des Gesichts wohl ursprünglich braun, aber durch die zahllosen Tätowierungen, die jedoch nur aus Strichen und Punkten bestanden, ganz blau erscheinend.
Es war eigentlich ein martialisches Gesicht, sah jetzt aber ganz kläglich aus.
»Hier sind die beiden Lampen, Sahib«, erklang es in entsprechendem Tone, und die eine Lampe ward schon von der braunen Hand durch die Spalte geschoben.
»Herein mit Dir, Nursim!«
Es musste noch energischer befohlen werden, ehe der Mann gehorchte.
Es war ein riesenhafter Inder, jedenfalls ein Marathe, zu dem kriegerischen Stamme des Himalajas gehörend, ein »geborener König«, was das Wort Maratha bedeutet.
»Ich glaube gar, Nursim, Du fürchtest Dich! Dass die anderen Dummköpfe es tun, dass sie diesen ehemaligen Mumiensaal nicht betreten wollen, weil der Derwisch darin spuken soll, das weiß ich. Aber seit wann ist das auch bei Dir der Fall?«
Der riesenhafte und martialische Inder stand mit geknickten Knien da, scheu blickte er nach dem dunklen Fleck am Boden, er zitterte wirklich.
»O, Sahib, wenn Ihr mir glauben wolltet —«
»Sprich, Nursim! Wir waren vor acht Tagen hier oben, da hast Du die anderen noch ausgelacht mit ihren Ammenmärchen — — — warum fürchtest Du Dich jetzt?«
»Jetzt habe ich es selbst gehört und gesehen — — vor drei Tagen erst.«
»Was hast Du gehört und gesehen?«
»Was die anderen schon immer behauptet haben.«
»Was behaupten die?«
»Du weißt es doch, Sahib —«
»Ich will es aber noch einmal aus Deinem Munde hören!«
»Wie hier oben in jeder Neumondnacht die Schritte herumtapsen, der alte Derwisch auf seinen hölzernen Sandalen —«
»In jeder Neumondnacht? In jeder? Das wird hier nun schon seit vier Jahren geschwatzt. Ich selber bin wenigstens sechsmal hier oben gewesen, um mich zu überzeugen, ob etwas Wahres daran ist, immer war eine Neumondnacht, immer hatten die Diener die tapsenden Schritte gehört, sie mussten mich holen — ich aber habe niemals etwas gehört! Von etwas sehen erst gar nicht zu sprechen. Und die Kerls selber haben stets zugegeben, dass sie nichts hörten und nichts sahen.«
»Ja, wenn Sahib kamen, hörte der Spuk eben sofort auf!«
»Ach, papperlapapp! Einbildung, nichts als Einbildung! Erzeugt durch Gespensterfurcht oder Gespensterglauben. Du selbst hast noch niemals etwas gehört und gesehen.«
»Weil ich immer nur mit dem Sahib gegangen bin.«
»Na, und nun, wie war's vor drei Tagen?«
»Abdallah sagte, hier oben tapsten wieder die Schritte, der Derwisch ginge um, er wäre auch zu sehen.
Ich ging einmal mit, ohne Dich erst zu rufen. Du hattest ja streng befohlen, man solle Dir niemals wieder etwas von der dummen Sache erzählen.
Und, Sahib, da habe ich's selber gehört, habe ihn gesehen —!«
Der hünenhafte Inder mit dem martialischen Gesicht fing wiederum zu zittern an, am ganzen Leibe.
»Was hast Du gehört?«, forschte Mister Philipp nochmals.
»Die tapsenden Schritte, wie die hölzernen Sandalen des Derwischs sie hervorbrachten, den wir gastlich in unser Haus aufge...«
»Schweig!«, wurde der Sprecher plötzlich angeherrscht. »Und was hast Du gesehen?«
»Wie sich dort, wo der Derwisch damals gelegen hatte, der dunkle Fleck zu bewegen begann, er richtete sich auf — eine weiße Lichtgestalt — sonst aber der dicke Derwisch, wie er lebte und leibte — er schwebte hin und her —«
Der Mann konnte vor Erregung nicht weitersprechen.
Auf welche Weise er den Geist gesehen haben konnte, danach brauchte ihn sein Herr nicht erst zu fragen. In der alten Korridortür befanden sich Fugen genug, durch die man den ganzen weiten Saal überblicken konnte. Mister Philipp selbst hatte also mehrmals in der Nacht davorgestanden und durch solch eine Fuge gespäht.
»Was machte der Geist sonst noch?«
»Nichts weiter. Er schwebte nur hin und her.«
»Das ist sehr wenig, Geister müssen mehr können«, spottete der alte Yankee. »Wie lange ist er so hin und her geschwebt?«
»Ich weiß nicht — lange habe ich nicht zugesehen —«
»Natürlich, natürlich! Nur ein Blick, dann bist Du ausgerissen. Es war einfach der Mondschein, der in das Zimmer drang!«
»Es war ja eine mondlose Nacht —«
»Ach so! — Dann hat ein drüben über dem Park aufgestellter Scheinwerfer gespielt. Oder die Erscheinung hat sonst eine natürliche Lichtquelle gehabt. Wenn Du nicht alles aus Deinem Kopfe herausphantasiert hast.«
»Sahib, es war der Derwisch, den wir damals —«
»Schweig! Höre mich an, Nursim! Es mag Geister und Gespenster, Dämonen und Kobolde geben. Die Seelen der verstorbenen Menschen und vielleicht auch der Tiere mögen in einem Jenseits weiterexistieren. Ich will das gar nicht bestreiten. Aber das eine weiß ich ganz, ganz bestimmt: Auf dieser Erde hat noch nie, niemals ein Mensch einen Geist oder ein Gespenst oder einen Kobold oder die verkörperte Erscheinung eines Toten gesehen!
Glaubt er dennoch, einmal etwas Derartiges gesehen zu haben, so deutlich, dass er die Wahrheit mit bestem Gewissen beschwören kann, so ward die Erscheinung entweder durch seine Einbildungskraft erzeugt, oder es war ein verkappter Mensch oder etwas Ähnliches — oder aber es war der Hokuspokus irgendeines geschickten Schwarzkünstlers.
Was ich hierbei meine, Nursim, weißt Du doch wohl am besten. Es ist ja allerdings auch ganz wunderbar, was da einige solcher Geisterbeschwörer und Magier leisten können, aber dass zuletzt doch alles nur auf Täuschung und Illusion beruht, das, wie gesagt, weißt Du doch selbst am besten, Nursim, der Du mit mir so viel in indischen Klöstern und Adeptenhöhlen herumgekrochen bist. Hiermit ist die Sache wohl nun erledigt.«
Es war gar nicht unrecht, was der alte Yankee da gesagt hatte. Und so hatte dieser Inder früher auch gedacht — bis vor drei Tagen, da hatte sich sein Urteil eben geändert.
»Aber das Tapsen —«
»Das sind Ratten gewesen. Die Mumien müssen wieder mit Sublimat bepinselt werden, dass die Ratten sie nicht angehen, wir müssen überhaupt wieder einmal gegen diese Plage etwas tun. Nursim, Du wirst heute Nacht mit mir hier im Mumiensaal wachen.«
»Niemals, niemals! Herr, nur das nicht!«, schrie der Inder entsetzt.
»Na, dann nicht«, gab sein Herr überraschend schnell nach. »Dass ich Dich dazu zwingen könnte, weißt Du ja. Ich lasse Dich einfach binden, ein Knebel sollte Dir auch das Winseln und Stöhnen unmöglich machen.
Aber ich will mich nicht einmal über Deinen Anblick ärgern, Du elender Feigling. Jetzt besorge mir noch einen Hammer und einen Nagel, um dort an der Wand die eine Lampe aufzuhängen, und dann aus dem Insektarium den Lehnstuhl. Nun aber schnell, ehe es dunkel wird!«
In fünf Minuten war das Gewünschte da, Mister Philipp hatte schon die beiden Lampen angebrannt, die eine wurde an die hintere Wand gehängt, die andere auf das breite Brett des mittleren Fensters gestellt. Es war eine gewöhnliche Küchenlampe, aber noch neu, das hinten angebrachte spiegelnde Blech noch ganz glänzend; es warf einen ziemlich starken Blendstrahl, den Mister Philipp durch die Fensterscheiben auf das draußen liegende Paketchen richtete.
Vor dasselbe Fenster wurde der auf Rollen laufende Großvaterstuhl gestellt. Nursim durfte gehen, machte hinter sich die Türe zu.
Keine Vorbereitungen weiter wurden getroffen. Mister Samuel Philipp nahm einfach Platz in dem Lehnstuhl, das Gesicht dem Fenster zugekehrt, schlug den Schlafrock über den Beinen zusammen, faltete die Hände, und er war bereit, so die ganze Nacht sitzen zu bleiben, das Paketchen draußen vor dem Fenster immer im Auge behaltend.
Also Courage hatte der alte Yankee, das musste man ihm lassen, obgleich die Tatsache doch bestehen blieb, dass er nur höchst ungern diesen Mumiensaal betrat, sogar am hellen Tage, und dass ihn vorhin beim Betrachten des dunklen Fleckes am Boden ein richtiges Grauen überlaufen hatte. Frei von Gespensterfurcht war er jedenfalls.
Sonst sei hier noch bemerkt, dass der Großvaterstuhl unten einen Tritt hatte, auf dem die Füße des Sitzenden ruhten, noch etwas über dem Boden. Dass der Stuhl auf Rollen lief, wurde schon gesagt.
Jetzt wurde es schnell dunkel.
Das Haus lag an der Breitseite des Zentralparkes, und wie Mister Philipp saß, konnte er die jenseits liegenden Häuser sehen, das heißt jetzt deren erleuchtete Fenster.
Aber die Breite dieses Parkes beträgt fast einen Kilometer, deshalb waren diese erleuchteten Fenster also nur als Lichtpunkte zu sehen; größere und intensivere Lichtquellen fehlten.
Die Zeit verging, die nächste Turmuhr verkündete mit deutlichem Schlag die neunte Stunde.
Die Lichterchen dort drüben wurden immer verschwommener, die kleinsten waren bereits als glühende Punkte verschwunden.
»Es scheint neblig zu werden«, dachte Mister Philipp.
Das musste wohl sein, aber vor diesem Fenster selbst war noch nichts von Nebel zu bemerken, das Paketchen lag im Bereich des kleinen Blendstrahls mit so scharfen Umrissen wie zuvor.
Die Turmuhr schlug die zehnte Stunde.
Jetzt war dort drüben kein erleuchtetes Fenster mehr zu sehen, aber durchaus nicht aus dem Grunde, weil alle Zimmer verdunkelt worden wären. Mister Philipp hatte beobachtet, wie die Leuchtpunkte nach und nach vom Nebel verschlungen worden waren.
Nur hier vor dem Fenster hatte dieser Nebel noch immer keinen Einfluss.
Die Turmuhr schlug die elfte Stunde.
Mister Philipp verfügte über eine große Geduld. Regungslos saß er in seinem Stuhl, hatte nicht nötig, sich einmal Bewegung zu schaffen.
»Nebliger scheint's nun nicht mehr zu werden«, dachte er zufrieden. »Das Päckchen wird mir nicht aus den Augen kommen.«
Die Zeit ging weiter.
Baum, baum, baum — fing es jetzt wieder an, zum Schlage der Mitternachtsstunde aushebend.
Mitternacht! So, das war der letzte Schlag.
Der spukende Derwisch hat sich niemals an die Geisterstunde gebunden, aber wenn er nun einmal durchaus sich bemerkbar machen will, dann müsste er wenigstens jetzt —
Erschrocken fuhr Mister Philipp zusammen.
Taps, taps, taps — war es hinter ihm gegangen.
Und es tapste weiter
»Alle guten Geister! Das klingt gar nicht nach Ratten, das klingt nach hölzernen Sohlen — ist jemand da?!«
So hatte Mister Philipp leise gefragt, mit stillstehendem Herzen.
Denn das war nun freilich etwas gewesen, was ihm das Herz tief hinunter hatte rutschen lassen — und jedem anderen wäre es ebenso gegangen!
Das Tapsen hatte aufgehört.
Jetzt erst dachte Mister Philipp daran, hinter sich zu blicken.
Dazu musste er, wollte er nicht ganz aufstehen, sich etwas vorbeugen und dann den Oberkörper seitwärts legen, um hinter die Stuhllehne schauen zu können.
Er wollte es tun, aber konnte es nicht.
»Allmächtiger Gott, was ist das?! Habe ich denn den Starrkrampf?!«
Er konnte sich nicht bewegen, nicht den Rücken von der Lehne freibekommen, also sich nicht vorbeugen, konnte aber auch nicht die Arme heben und nicht die Füße.
»Ich habe wirklich den Starrkrampf!«, dachte er ganz entsetzt.
Dann aber dachte er gleich wieder etwas anderes.
Es war ihm, als ob alle seine Fleischteile an dem Stuhle klebten oder durch irgendeine geheimnisvolle Kraft daran festgehalten würden. Er konnte die Augen rollen, konnte die Knie hin und her bewegen, auch etwas den Kopf, diesen aber nicht von der Rückenlehne losreißen, so wenig wie seinen eigenen Rücken selbst, konnte sich nicht erheben, die Füße waren unten an dem Brett wie angenagelt, und dasselbe galt von den auf den Seitenlehnen liegenden Armen und Händen. Und doch hielt er seinen Zustand nicht für eigentlichen Starrkrampf. Er war nur angeklebt. Anders hätte er sich niemals ausdrücken können.

Mister Samuel Philipp nahm Platz in dem Lehn-
stuhl, das Gesicht dem Fenster zugewendet.
Nun freilich diese plötzliche Todesangst!
Und jetzt ging ein Ruck durch seinen Körper. Das kam daher, weil der Lehnstuhl auf seinen Rollen zurückgezogen wurde.
»Um Himmels willen, wer fährt mich da! Nursim, Abdallah, zu Hilfe, zu Hilfe!«
So brüllte der alte Mann in seinem furchtbaren Entsetzen.
Der Stuhl war bis in die Mitte des Zimmers gefahren worden, hier wurde er umgekehrt, sodass Mister Philipp jetzt nach der Tür des kleinen Mumienzimmers blickte. Rechts war die Lampe am Fenster, links die an der Wand hängende.
Jetzt erst bemerkte Mister Philipp — wenn er überhaupt noch zu solchen Beobachtungen fähig war — dass sich auch schon das ganze Zimmer mit Nebel gefüllt hatte.
Die beiden Lampen glichen nur noch feurigem Punkten, umgeben von einem roten Lichthofe, sie schienen sich auch immer weiter zu entfernen oder eben doch kleiner zu werden, bis sie ganz verlöscht waren.
Die schwärzeste Finsternis umgab den im Lehnstuhl sitzenden Mann, der sich noch immer nicht rühren konnte.
»Bin ich etwa eingeschlafen? Ist das nur ein Traum?«, dachte er. Aber was für ein Geruch ist das wieder?
Es roch nach Schwefel, immer stärker und stärker.
Und mit einem Male wurde Mister Philipp in die Höhe gehoben, aus seinem Großvaterstuhl heraus, und zwar war er hinten am Rücken gepackt worden, aber doch ziemlich tief unten, nicht von einer Faust, sondern da musste eben irgendeine Befestigung vorhanden sein. So wurde er hochgehoben, und ganz von selbst musste er sich umdrehen, mit seinem Körper eine horizontale Lage einnehmen, sodass ihm Arme und Beine nach unten hingen.
Und dies alles war von so handgreiflicher Deutlichkeit, dass er unmöglich mehr an einen bösen Traum denken konnte.
»Zu Hilfe, Hilfe! Nursim! Abdallah! Saladin!«, fing der so in der Schwebe hängende Mann wieder zu brüllen an. »Hilfe, Hilfe, ich ersticke!«
Denn das kam jetzt auch noch hinzu.
Der Schwefeldampf wurde schier unerträglich, war kaum noch atembar.
Und da tauchte unter ihm in dem Nebel oder Dampfe wieder eine Lampe auf.
Aber gleich darauf war das keine Lampe mehr, sondern eine feurige Kugel, die mit entsetzlicher Schnelligkeit an Größe zunahm oder aber heranraste, und schon zuckten aus dieser Kugel Feuerstrahlen empor, nach allen Seiten hin, bis sie ein ganzes Flammenmeer bildeten, in das der in der Schwebe hängende Mann direkt hineinblickte, und er fühlte schon die Glut dieser roten und blauen und gelben und grünen Flammen, die einen immer intensiveren Schwefeldampf aushauchten.
»Es ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Das ist nur ein schrecklicher Traum!«, zeterte der aufgehängte Mister Philipp und zappelte, obgleich er doch nur gar zu deutlich das Bewusstsein hatte, dass er wirklich wachte, dass er dies alles wirklich erlebte.
Immer furchtbarer wurde das farbige Feuermeer, immer furchtbarer der Schwefelqualm, und da donnerte ihm eine furchtbare Stimme ans Ohr:
»Schurke, Dich trifft die Dir angekündigte Strafe: Du hängst im Kraterkessel des Hekla!!«
Jawohl, es stimmte schon. Rechtsanwalt Maxim Iron hatte richtig gehört, als er infolge Nebenschlusses ein Gespräch zwischen der Bella Cobra und Charles Dubois belauschte —
Nur ein Bruchstück war es gewesen.
Wäre ihm möglich geworden, alles mit anzuhören, er hätte sicher recht große Augen gemacht.
Aber was er über die Bella Cobra dachte, das stimmte nicht ganz.
Er kannte sie eben zu wenig, nur so vom Hörensagen, um nicht gleich den richtigen Ausdruck zu gebrauchen: aus dem Stadtklatsch.
Denn den gab es in Sydney natürlich genau so gut wie in jeder anderen Stadt, in jedem — auch dem kleinsten — Orte, wo eben Menschen nebeneinander wohnen und sich gegenseitig beobachten.
Es ist die alte Geschichte von dem römischen »Culmaniare audacter« — verleumde nur feste drauflos, etwas bleibt doch immer hängen!
Das galt auch von der rassigen Tänzerin, die sich selber den mindestens auffallenden Namen der indischen Giftschlange beigelegt hatte.
Rassig war sie. Das musste ihr der Neid lassen; aber welcher Rasse sie angehörte, das — ja, das wussten auch die Neider nicht, nicht einmal ihre Freunde, und deren hatte die Bella Cobra eine ganze Menge, sicher schon ein Beweis, dass sie anzuziehen verstand — die Männer wenigstens — denn die Frauen behaupteten gerade das Gegenteil, sagten, sie zöge gar nicht an, wobei allerdings an das »Nicht« noch ein kleines »s« gesetzt werden musste.
Nein, viel hatte die schneidige Tänzerin nicht an, wenn sie sich im Lichte der unzähligen elektrischen Beleuchtungskörper auf der Bühne ihren Bewunderern zeigte.
Man konnte gleich sagen, es sei überhaupt nichts.
Aber das gehörte sich doch wiederum für eine solch schillernde Schlange, als die sie sich bezeichnete. Die hat doch von der Natur auch nichts weiter mitbekommen als das Schuppengewand — und ist schon darin, mag sie auch noch so giftig sein, deswegen noch so sehr vom Hasse der Menschen verfolgt werden.
Die Bella Cobra trat eben als Schlange auf, ahmte in ihren Tänzen die wirklich eleganten Bewegungen der indischen Kobra nach, die ja jedem Indienreisenden bekannt ist, meist aus den Vorführungen der Schlangenbeschwörer, der Fakire.
Rechtsanwalt Maxim Iron hätte sie nur einmal dabei sehen sollen, er hätte sicher Verständnis für diesen Tanz gehabt, für die große, sehr große Kunst, die darin lag, und — vielleicht wäre er — gleich unzähligen anderen — Abend für Abend wiedergekommen, hätte sich nicht satt sehen können an den Windungen dieses geschmeidigen Körpers —
Da war es schon verständlich, wenn die Direktion des OlympiaTheaters nichts davon wissen wollte, dass dieser vorzügliche Kassenmagnet seinen Kontrakt so mir nichts dir nichts brach —
Und das war geschehen.
Eben an dem Abend, an welchem Maxim Iron das Gespräch belauschte, hatte der Direktor die berühmte Tänzerin wieder einmal aufgesucht, hoffend, dass er sie doch noch umstimmen könnte, dass vielleicht nur eine Laune ins Spiel käme, wie das ja bei Künstlerinnen oft genug geschieht.
Mister Washington Irving war ein ganz gerissener Jude. Er war mit allen Hunden gehetzt und mit allen Wassern gewaschen —
»Ich werde sie schon rumkriegen!«, hatte er zu den anderen Herren im Theater gesagt. »Lasst mich nur machen!«
Und so hatte er sich bei der Bella Cobra melden lassen, hatte auch gleich Zutritt erhalten.
Es war das erste Mal, dass er zu ihr kommen durfte, sonst verhandelte die Tänzerin mit ihm nur in seinem Kontor; nur wenige Herren in der Stadt durften sich rühmen, bei ihr gewesen zu sein —
Deshalb war Mister Washington Irving einigermaßen verblüfft, als er in einem Raum geführt wurde, der sich in nichts, aber auch in gar nichts von einem ganz gewöhnlichen bürgerlichen Wohnzimmer unterschied.
Er wusste für den Anfang gleich gar nicht, was er denken und sagen sollte, hatte wahrscheinlich erwartet, die Bella Cobra umgäbe sich auch Daheim mit allem jenem mystischen Zauber Indiens, den sie bei ihrem Auftreten nötig hatte.
Nein, nichts davon war zu sehen, alles war sogar recht nüchtern.
Am nüchternsten aber erschien die berühmte Tänzerin selber.
Sie sah aus wie ein etwas großes und sehr entwickeltes Pensionsmädchen. So hatte sie sich gekleidet — ganz ohne Schmuck, das üppige, brennendste Haar zu einem dicken Knoten auf dem Hinterhaupte geschlungen —
Nein, die junge Dame, die dem Direktor hier entgegentrat, hatte nichts mit der Tänzerin gemein, die er kannte und so hoch schätzte, dass er sich ihretwegen diesen Weg gemacht hatte — sogar etwas beklommen —
Nur bewegen durfte sie sich nicht.
Als sie ihm jetzt ein kleines Stück entgegenkam, war das wirklich, als glitte eine Schlange über den Teppich.
Aber dieser Eindruck verschwand sofort wieder, als sie still stand.
Washington Irving stand ganz vertattert da, brachte mit Mühe einen Gruß heraus, und das erste, was er sagte, war nicht sehr geistreich, es bestand aus drei Worten.
»Na, so was!«
Da freilich veränderte sich das Gesicht der Bella Cobra. Ihre Augen flammten, die roten Lippen wichen von den Zähnen zurück — und was für Zähne waren das! — sie lächelte — recht spöttisch — so kam es wenigstens diesem allmächtigen Herrn Direktor vor, der doch seine Künstlerinnen nach dem üblichen Rezept als Sklavinnen behandelte, bloß bei solchen Größen eine Ausnahme machte.
Und ob dieses spöttischen Lächelns stieg ihm das Blut in den Kopf.
Er plusterte sich auf wie ein Truthahn. Bloß schade, dass er nicht mit einem Schwanze ein rauschendes Rad schlagen konnte!
Und nun wollte er den zürnenden Gott spielen, vor dessen Stirnrunzeln alles zittert und kuscht.
Er kam leider nicht dazu.
»Was verschafft mir die Ehre?«, fragte Bella Cobra und deutete auf den Stuhl, auf dem er Platz nehmen sollte.
Da war es aber mit der Zurückhaltung des Direktors vorbei.
»Na, erlauben Sie mal!«, stieß er kollernd hervor. »Das ist mindestens eine merkwürdige Frage von Ihrer Seite, Miss Cobra —«
»Ich hätte sie gewiss nicht gestellt wüsste ich, was Sie zu mir führt«, kam es recht kühl über die Lippen der Tänzerin.
Sie hatte die Lider gesenkt, schaute ihn nicht an.
»Miss Cobra, das wissen Sie nicht? Wirklich nicht? Wo ich Ihnen doch schon zweimal geschrieben habe, dass wir uns mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln gegen den Kontraktbruch von Ihrer Seite wehren werden —
Mit allen Mitteln!«, wiederholte er nachdrücklichst.
»Was besagen will, dass Sie von mir die Entschädigungssumme beanspruchen, die für diesen Fall ausgesetzt ist«, gab die Cobra darauf zurück. »Bitte sehr, Mister Irving! Der Scheck liegt schon bereit. Ich hätte ihn noch heute an Sie abgeschickt —«
»Der Scheck? Wer spricht denn von einem Scheck? Tanzen sollen Sie! Auftreten! Wir werden allesamt gesteinigt, gelyncht, wenn wir Sie nicht wiederbringen — die Leute brüllen und toben vor dem Theater —«
»Das kann ich mir wohl denken, aber ich sehe keine Möglichkeit, etwas daran zu ändern«, sagte die Tänzerin.
»Keine Möglichkeit? Ja, Sie brauchen doch bloß zu wollen! Aber Sie wollen eben nicht! Und deswegen bin ich da — ich selber bin gekommen — Was wünschen Sie eigentlich von uns, Miss Cobra? Ist Ihnen die Gage nicht hoch genug? Wir zahlen Ihnen das Doppelte! Hat irgend etwas sonst nicht Ihren Beifall? Wir werden es sofort ändern — sofort! Ich persönlich bürge Ihnen dafür —«
»Sehr freundlich von Ihnen —«

»Na, also! Was fordern Sie? Sie dürfen ganz ungescheut reden, ich bürge Ihnen dafür, dass alles eingehalten wird —«
»Tut mir leid, Mister Irving! Ich kann nicht mehr bei Ihnen auftreten, denn morgen schon werde ich Sydney verlassen«, sagte die Tänzerin.
Der Direktor starrte sie an, als verstände er sie nicht.
Endlich fand er die Sprache wieder.
Aber er brachte zunächst wieder nur ein Wort heraus, das er freilich sehr lang dehnte.
»Waaaaas?«
»Sie haben schon richtig gehört, Herr Direktor. Morgen — sehr früh schon — verlasse ich Sydney«, bestätigte die Bella Cobra.
»Na, erlauben Sie mal, da habe ich doch auch noch ein Wörtchen mitzureden!«, platzte Washington Irving nun heraus. »Sie haben Ihren Kontrakt —«
»Ich hatte ihn. Ich habe ihn gebrochen. Dafür zahle ich die vereinbarte Strafe. Dort liegt der Scheck. Sie brauchen ihn bloß an sich zu nehmen!«
Das sprach die Tänzerin ganz ruhig.
»Fünftausend Pfund?«, stotterte der Direktor.
»Genau so viel.«
Da verzerrte sich das Gesicht des Mannes zu einem hämischen Lächeln.
»Na, da haben Sie ja einen ganz Dummen gefunden, Miss Cobra!«, sagte er, und seine Stimme klang seinem Lächeln entsprechend.
Mit ein paar Schritten stand das junge Weib vor ihm.
Der Herr Direktor wollte zurückweichen, seine Knie knickten ein, seine Augen öffneten sich in jähem Schrecken weit —
Er hob auch noch abwehrend beide Hände —
Und er hatte allen Grund dazu.
Das war nicht mehr das Pensionsmädchen, das da vor ihm stand, das war die Bella Cobra, wie er sie kannte. Das waren die flammenden Augen, die allabendlich alle Zuschauer bannten — das war ein ganz anderes Gesicht —
Doch rasch hatte die Tänzerin sich wieder in der Gewalt.
Sie hob den rechten Arm, deutete nach der Tür.
Und Mister Washington Irving schritt rückwärts dorthin, immer noch die beiden Arme vorgestreckt, ein Bild höchster Furcht —
Aber als er sich in unmittelbarer Nähe des rettenden Ausganges wusste, kehrte der Mut ihm noch einmal zurück.
»Verehrtes Fräulein!«, hob er an. »Bitte legen Sie doch nicht gleich jedes Wort auf die Goldwaage! Ich —«
Die Bella Cobra aber hatte ihm den Rücken gewendet, kehrte sich nicht wieder um. Der hochmögende Herr Direktor war Luft für sie.
Trotzdem blieb er noch stehen.
Was sollte bloß werden, wenn sie nicht mehr auftrat?
Solch ein Weib fand er doch nirgends wieder — Er sah schon die Pleite voraus —
Und eben wollte er sich noch einmal aufs Bitten verlegen, da kam die Zofe herein.
»Mister Saunderson wünscht seine Aufwartung zu machen!«, sagte sie.
Sie war ein hübsches, zierliches Kammerkätzchen mit weißem Spitzenhäubchen auf dem blonden Haar und ebensolchem Schürzchen —
Der Herr Direktor aber hatte keinen Blick für sie. Der hatte gleich beide Ohren gespitzt.
Mister Saunderson! Das war doch der reichste Mann der Stadt, hatte seinerzeit die Goldfelder bei Valley Springs entdeckt und ausgebeutet — ein Rohling erster Klasse, aber ein Riese —
Man erzählte sich tolle Geschichten von ihm. Kein Weib war vor ihm sicher. Mit seinem Gelde brachte er die sprödeste Tugend zu Falle —
Washington Irving meinte jetzt zu wissen, woher der Scheck auf dem Tische dort stammte, ärgerte sich, dass er nicht nach der Unterschrift gesehen hatte —
Aber, was er versäumt hatte, das konnte er ja noch nachholen.
Er hörte den bärenhaften Schritt des Mister Saunderson schon hinter sich. Wenn er ein bisschen wartete, dann —
Und da kam auch der reichste Mann von Sydney schon herein.
Er war tatsächlich ein Riese, ein ungeschlachter Kerl, ein Steinetreiber in Frack und Lack — und die Gardinia im Knopfloch war so groß wie ein Suppenteller.
Ein Leuchten und Sprühen ging bei jeder Bewegung von ihm aus. Er hatte sich mit den kostbarsten Brillanten überladen, an jedem seiner Finger saßen ein paar Ringe. Nur schade, dass er in die Nase keinen hängen konnte! Aber im linken Ohre hatte er wenigstens noch einen starken Goldring —
Und dazu dieses Bulldoggengesicht! Der Stiernacken! Die hervorquellenden Stielaugen! Der breite Mund, aus dem wieder Gold blitzte —
Washington Irving hätte eigentlich der Bella Cobra einen besseren Geschmack zugetraut. Jetzt bedauerte er fast, dass er selber sich nicht rechtzeitig an sie gemacht hatte —
Freilich mit Saunderson konnte er nicht antreten — in keiner Hinsicht — der war leistungsfähiger als er.
Und da rannte dieses menschliche Trampeltier auch schon auf die Tänzerin zu.
»Miss Cobra!«, brüllte es — die Fenster klirrten, die Porzellanfiguren in der Vitrine zitterten —
Da aber erblickte Mister Saunderson den Herrn Direktor.
Und so dumm war er denn doch nicht, dass er nicht gleich geahnt hätte, was der hier wollte.
»Na, Sie alter Freund!«, fing er wieder zu brüllen an. »Sie wollen wohl der Bella Cobra an den Geldbeutel, he? Sie soll die Strafe für den Kontraktbruch zahlen, he? Wie viel ist es denn, he?«
Und er hatte schon aus der hinteren Hosentasche das Scheckbuch hervorgeholt, suchte nach der Füllfeder, und dabei lächelte er — es sollte wohl ein verschmitztes Lächeln sein, ward aber nur eine Grimasse, die zum Lachen gereizt hätte —
Wenn nicht eben ein solcher Riese, eine solche menschliche Bulldogge sie gemacht hätte!
Nee, mit dem war nicht zu spaßen, das sah Direktor Washington Irving gleich ein, hielt es für besser, nun doch zu retirieren, anstatt neugierig zu warten. Und übrigens — der Saunderson wollte erst bezahlen, hatte also den Scheck dort nicht geschrieben —
Na, das konnte ja eine schöne Geschichte geben!
»Meinen Segen habt ihr!«, dachte der Direktor.
Und dann wollte er hinausschlüpfen.
Er blieb jedoch — ganz unwillkürlich —
Die Bella Cobra hatte sich umgewendet, kam langsam zur Tür, an der die drei noch standen: das Zöfchen, der Direktor und Mister Saunderson.
Um die beiden Männer kümmerte sie sich jedoch vorläufig überhaupt nicht, und es war merkwürdig, dass sogar der Steinetreiber in Frack und Lack jetzt kein Wörtchen mehr sagte, sondern mucksmäuschenstill dastand.
Das braune schöne Gesicht der Bella Cobra war sehr blass.
Umso größer erschienen die dunklen Augen, und fast unnatürlich rot sahen die schwellenden Lippen aus.
Und diese Augen funkelten jetzt wie die der furchtbaren Schlange, nach welcher diese Tänzerin sich nannte.
Diese Augen schienen die gleiche magische Kraft zu besitzen wie alle Schlangenaugen, dass die Beute sich nicht nur nicht zu retten vermag, sondern sogar gezwungen ist, sich selbst in den weitgeöffneten Rachen zu stürzen.
Mister Saunderson kannte das, hatte es mehr als einmal während seines wilden Lebens in den Bergen gesehen — und jedes Mal hatte selbst ihm dann gegraut — er hatte das erkennen müssen, dass es etwas gab, was er nicht zu benennen wusste —
Und ein Grauen beschlich ihn, eiskalt rann es ihm den Rücken hinab, als er nun die Bella Cobra mit schlangengleichen Bewegungen herankommen sah, die regungslose Zofe —
Und dann hörte er sie sagen:
»Wie viel ist Dir dafür gezahlt worden?«
Die Zofe erbebte.
Sie wollte sprechen und konnte nicht, aber sie zog aus dem Ausschnitt ihres Kleides einen Geldschein hervor — eine Tausenddollarnote —
»Gib sie zurück!«, befahl ihre Herrin.
Und das Mädchen gehorchte.
Mit einer gleichsam maschinenmäßigen Bewegung hielt sie Mister Saunderson die Note hin.
Der sah darauf nieder, sah die zarte Hand — und nahm das Geld.
»Hoho!«, hob er zu lachen an. »So war das nicht gemeint — ich wollte Ihnen bloß zu Hilfe kommen — Sie nicht in den Händen dieser verdammten Juden lassen —«
»Mister Saunderson?!«, fuhr Washington Irving auf.
Die Bella Cobra aber richtete sich empor. Ihre flammenden Blicke trafen zuerst den Direktor.
Da stob der hinaus.
Dann richteten sie sich auf den Steinetreiber im Frack.
Und auch der knickte jetzt in den Knien ein.
Er wollte etwas sagen, hielt noch das Scheckbuch in der einen, den Füllfederhalter in der anderen Hand — so streckte er beide wie beschwörend vor.
Aber zu sagen vermochte er nichts.
Und auf einmal wendete er sich und ging hinaus, nein, er schlich davon wie ein nasser Pudel, den Kopf eingezogen — es sah unbeschreiblich lächerlich aus — dieser riesenstarke Mann und dieses schlanke Weib —
Die Portiere fiel vor.
Die Bella Cobra war mit ihrer Zofe allein.
»Geh jetzt, Lizzie!«, sagte sie, und ihre Stimme klang schon wieder ganz ruhig, fast freundlich.
Aber da war es vorbei mit dem Mädel.
Es sank auf die Knie, hob bittend die gefalteten Hände und begann zu schluchzen.
»Miss Cobra — —!«
»Geh!«, wiederholte diese.
Und gegen diesen Ton gab es keinen Widerspruch.
Die Zofe erhob sich, schluchzte auch nicht mehr — sie ging — aber sie ging wenigstens aufrecht —
Und in derselben Minute begann sie ihre paar Habseligkeiten zu packen. Dass sie nicht länger im Dienste der Tänzerin bleiben konnte, das sah sie selbst ein —
Aber sie konnte doch nicht gleich fort.
Als sie mit ihrem Köfferchen zur Tür hinaus wollte, da wurde an dieser geklingelt. Sie öffnete.
Ja, und nun war sie doch auf einmal wieder das Kammerkätzchen.
Alle Wetter, war das ein Mann!
Hatte der ein Paar Augen im Kopfe! Und wie er gewachsen war!
Lizzie war etwas poetisch veranlagt, hatte mancherlei gelesen, und da war es kein Wunder, wenn ihr alsbald ein Vergleich einfiel —
»Wie ein Edelhirsch!«, dachte sie, obwohl sie noch keinen gesehen hatte.
Sie hatte recht.
Schlank, edel und kraftvoll gewachsen war dieser Mann, der vielleicht die Mitte der Zwanzig erreicht hatte. Blond war sein volles, welliges Kopfhaar, blond auch das Bärtchen auf seiner Oberlippe. Und die Zofe dachte noch etwas.
»Schade, dass dieser Mensch nicht im Salonanzug steckt!«
Aber sie musste auch wieder gestehen, dass das Ledergewand ihm ganz trefflich stand, seine ebenmäßigen Glieder so recht zur Geltung brachte.
Nur nicht so abgeschabt hätte es zu sein brauchen.
Und so wollte der zu Bella Cobra?
»Melden Sie Ihrer Herrin meinen Namen — Charles Dubois —!«, sagte der Fremde, und die Stimme passte ganz zu seiner Erscheinung.
Die poetisch veranlagte Lizzie wusste auch da wieder einen Vergleich.
»Wie eine ferne Glocke!«, dachte sie.
»Der könnte mir gefallen«, fügte sie bei sich hinzu, zuckte aber trotzdem die hübschen runden Schultern und sagte, so recht bedauernd:
»Das tut mir leid, Miss Cobra empfängt nicht!«
»Es waren doch eben zwei Herren bei ihr. Ich bin ihnen auf der Treppe begegnet!«
»O je — die —«
Lizzie musste lachen. Sie machte auch mit der einen Hand und mit dem einen Füßchen eine entsprechende Bewegung.
Da lachte auch Charles Dubois.
Er lachte so ungeniert laut, dass im nächsten Augenblick die Tür aufgemacht wurde und in der Öffnung die Tänzerin erschien.
»Da ist sie ja!«, rief der schlanke junge Mann in seiner abgeschabten Lederkleidung, eilte auf die Bella Cobra zu und wollte ihr die rechte Hand entgegenstrecken.
Dann aber besann er sich, stutzte —
»Sie sind die Bella Cobra?«, rief er.
Ein Nicken war die einzige Antwort, aber Lizzie, die Zofe, sah, wie es dabei in den Augen ihrer bisherigen Herrin aufleuchtete — ganz anders als vorhin — und sie sah auch, wie eine Glutwelle in das Gesicht schoss —
»Wie eine verschämte Braut!«, phantasierte die poetische Zofe, aber sie hatte wieder einmal recht.
Die fast klösterlich schlichte Tracht mochte viel dazu beitragen, dass diese berühmte, wenn nicht berüchtigte Tänzerin jetzt mädchenhaft lieblich aussah, und so war auch das Lächeln, das ihre roten Lippen von den weißen Zähnen entfernte —
Charles Dubois aber zog seine Stirn in Falten, als sei er unmutig.
»Ich hoffte, Miss Cobra sprechen zu können, bin zu ihr bestellt«, sagte er. »Sie! O weh! Was hat denn da Mister Philipp gedacht?«, entfuhr es dem jungen Manne. »Sie sollen mit mir reisen? Sie?!«
Das war nun nicht gerade höflich, am allerwenigsten einer solch wirklich schönen Dame gegenüber, wenngleich sie so nonnenmäßig angezogen war, aber die Cobra lächelte.
»Wollen Sie nicht eintreten, Monsieur Dubois?«, fragte sie und machte Platz, dass er an ihr vorübergehen möchte.
Da musste Charles Dubois schon glauben, dass er wirklich die Tänzerin vor sich hatte, aber nur zögernd folgte er der Einladung.
»Einen Augenblick, Monsieur Dubois!«, rief sie ihm nach.
Sie wendete sich der Zofe zu.
»Wohin willst Du, Lizzie?«, fragte sie, aber nur ganz wenig verwundert.
»Fort — ich darf doch einmal nicht mehr bei Ihnen bleiben —«
Das Mädchen stieß es unter Schluchzen hervor.
Jetzt erst schien es zu erkennen, was für eine Dummheit es vorhin gemacht hatte, als es sich von dem Mister Saunderson hatte bestechen lassen. Und die größte Dummheit war doch, dass sie die tausend Dollar zurück gab.
»Ohne meine Erlaubnis?«, fragte die Cobra. »Bringe Deine Sachen in Deine Kammer zurück! Du gehst nur, wenn ich es Dir befehle, sonst nicht!«
Dann wendete sie sich wieder um, als dächte sie gar nicht an die Möglichkeit, dass ihrem Befehle nicht gehorcht werden könnte, und die Zofe gehorchte auch wirklich, brachte ihre Habe in die Kammer zurück und — schluchzte nun erst recht, nein, heulte zum Gotterbarmen.
Die Bella Cobra war zu Charles Dubois in das schlichtausgestattete Zimmer getreten und gewahrte noch, wie er sich verwundert umschaute.
Auch ihm erging es nicht besser, als es dem ehrenwerten Direktor Washington Irving ergangen war — er konnte das, was er sah, nicht zusammenreimen mit dem, was er gehört, was Mister Samuel Philipp ihm persönlich mitgeteilt hatte.
»Die Bella Cobra in Sydney ist das einzige Weib, das fähig ist, die Strapazen auszuhalten, die Ihrer warten, Monsieur Dubois«, hatte er gesagt. »Die reitet, wenn es sein muss, an einem Tage drei Pferde zuschanden und fürchtet sich selbst vor dem Teufel nicht — hähähä — weil sie den selber im Leibe hat — hähähä — na, Sie werden ja die Augen aufreißen, Dubois!«
Ja, so hatte das Männchen in New York gesprochen und Charles Dubois hatte doch schon allerhand von der Bella Cobra gehört, sie freilich noch nicht gesehen, noch gar keine Zeit dazu gehabt, sie im Theater zu bewundern — er war doch erst angekommen, hatte eben noch das telefonische Gespräch mit ihr führen können, das also Rechtsanwalt Maxim Iron zum Teile belauscht hatte, gerade an der verfänglichsten Stelle —
Und nun — diese Klosterschwester?
Allerdings, das sah er — gebaut war dieses Weib wie selten eins! Diese Fülle bei aller Schlankheit des Körpers —!
Und dann sah er sie auf sich zukommen.
Da mit einem Male wusste er, dass er doch die Bella Cobra vor sich hatte.
Das brauchte ihm nun nicht erst noch jemand zu versichern, denn er kannte die Kobras — so — genau so glitten sie über den Boden.
Und dann bekam er gleich noch einen ganz anderen Beweis.
Wie sie das angefangen hatte, das wusste er ja nicht zu sagen, hatte auch gar nicht darauf geachtet — er sah nur auf einmal den ganzen Raum in eine Fülle elektrischen Lichtes getaucht — überall blitzten die Glühbirnen, deren Schein durch hinter ihnen angebrachte Spiegel noch verstärkt ward — oder es war sonst etwas vorhanden, was sie so strahlend machte —
Und dann stand auf einmal vor dem überraschten Manne anstatt der Klosterschwester ein Weib —
Nein, vor ihm wand sich eine glitzernde Schlange aus dem Nonnenhabit heraus, das auf den Teppich gesunken war — und der schimmernde Leib ward umflutet von einer unbeschreiblichen Fülle leuchtendroten Haares — oder waren das Flammen, die aus diesem bleichen Haupte herausloderten?
Und das Gesicht — dieses braunhäutige schöne Gesicht war ganz blass — und schien nur aus den flammenden, großen, schwarzen Augen und dem leuchtend roten Munde zu bestehen —
Die nackten Arme waren selber wie gleitende Schlangen, die Hände wie Schlangenhäupter, die vorwärts zuckten und wieder zurück.
Kurz, Charles Dubois bekam hier in diesem schlicht ausgestatteten Zimmer das zu sehen, was im Olympiatheater allabendlich Tausende staunend bewundert hatten, nicht fassen könnend, wie so etwas möglich war, im Zweifel, ob sie da oben wirklich ein schönes Weib sahen oder nicht tatsächlich eine mächtige glitzernde Kobra —
Aber von den Tausenden Zuschauern hatte wohl keiner je diese unübertreffliche Tänzerin mit solchen Augen angeschaut, wie das jetzt Charles Dubois tat.
Sie hatten doch immer noch auf anderes geachtet, auf das schöne Weib, das dort auf der Bühne seinen Körper zur Schau stellte — anders nannten sie das nicht — und deshalb hatte so mancher gedacht, er könnte so etwas auch noch an anderer Stelle zu sehen bekommen, könnte sich diese wunderbare Cobra kaufen, sie für sich zähmen —
Für Geld —
Nein, so sah Charles Dubois dieses herrliche Weib wahrlich nicht an. Er war in diesem Augenblick nicht Mann dem Weibe gegenüber — er war Jäger, er sah eine giftige Natter, eine schimmernde Kobra — und wusste nur nicht, was er mehr bewundern sollte — diese Beobachtung, die dazu gehörte, diese Gabe der Nachahmung, diese unvergleichliche Geschmeidigkeit des schlanken Körpers —!
Atemlos stand er da, etwas vorgebeugt. Seine Blicke wichen nicht von ihr —
Ja, und als es zu Ende war, als die Bella Cobra sich wieder in ein Menschenweib verwandeln wollte, da — da drehte Charles Dubois sich um.
Er wollte ihr Zeit geben, wieder in das Nonnenkleid zu schlüpfen, denn so — so halbnackt — na, das war ja selbstverständlich für ihn, dass sie sich eben als Künstlerin so zeigen musste, aber doch nicht, wenn ein Mann ihr unmittelbar gegenüberstand wie jetzt er —
Und indem er sich also umwendete, sah er nicht, wie eine brennende Röte in das braune Gesicht der Tänzerin schoss, wie ihre Augen so fast ungläubig nach ihm blickten — wie es in ihnen aufleuchtete — seltsam warm — und er sah auch nicht, wie es um den vollen, roten Mund so merkwürdig zuckte — fast, als müsse dieses Rasseweib jetzt aufschluchzen —
Und er sah nicht, wie die Bella Cobra trotz allem eine Bewegung machte, als wolle sie auf ihn zueilen und sich ihm an den Hals werfen — so, wie sie noch war — mit so gut wie nichts auf dem herrlichen Leibe —
Nein, das alles gewahrte Charles Dubois nicht, er hörte nur, wie es hinter ihm leicht raschelte, und als er das nicht mehr vernehmen konnte, also annehmen durfte, dass die Rückverwandlung erfolgt sei, da drehte er sich um, und nun freilich streckte er dem schönen Weibe beide Hände entgegen.
»Verzeihen Sie mir, Miss Cobra!«, sagte er. »Und gestatten Sie, dass ich Ihnen danke! Noch nie in meinem Leben habe ich so etwas gesehen —«
Nun hätte sie ja fragen können, so recht kokett, ob es ihm wirklich gefallen hätte — sie hätte Schmeicheleien herausfordern können —
Die Bella Cobra dachte nicht daran. Sie sah nur in diese blauen, bewundernd auf sie gerichteten Augen und — ward abermals sehr rot.
»Ich musste doch Ihre Zweifel beseitigen«, sagte sie. »Nehmen Sie, bitte, nunmehr Platz, Monsieur Dubois!«
Ja, er setzte sich auf den Sessel, den sie ihm anwies, aber seine Blicke wichen nicht von ihr, waren noch immer so voller Bewunderung, und auch die Bella Cobra war doch nur eine Tochter Evas, und so spröde sie sonst sein mochte, sie musste gewahren, was für ein prächtiger, unverdorbener Bursche das hier war, ein Mann im vollsten Sinne des Wortes, arm vielleicht im Beutel, aber sonst ein Krösus, der noch Kräfte zu verschwenden hatte.
Da jedoch erklärte sich Charles Dubois schon.
»Nein, so etwas!«, sagte er. »Wo haben Sie bloß diese Tiere so genau beobachten können! Das haben Sie ihnen doch nicht in ein paar Wochen abgesehen! Oder — und jetzt kam er auf das Richtige — Sie haben eben lange in Indien gelebt, vielleicht am Hofe eines Fürsten, und dort die Tanzmädchen gesehen, die Nautschs —«
Die Bella Cobra lächelte, aber es war etwas wie Trauer und Enttäuschung darin. Vielleicht hatte sie andere Worte zu hören erwartet?
Konnte sie das von diesem berühmten Jäger erwarten, von dem Mister Philipp ihr doch geschrieben, über den sie dann in seinen und fremden Büchern gelesen hatte?
Vielleicht war es so, vielleicht sah sie in ihm zunächst erst einmal den Mann, den Vertreter jenes starken Geschlechts, das doch schönen Weibern gegenüber meist so schwach, so ganz erbärmlich schwach ist?
Sie ließ nichts merken.
»Verlangen Sie noch einen anderen Beweis, Monsieur Dubois?«, fragte sie.
Da kam er zu sich, strich sich fast verlegen das lockige Blondhaar aus der Stirn.
»Dass Sie die Bella Cobra sind, habe ich ja nun schon erkannt«, erwiderte er. »Freilich, mit Ihrem Tanze werden Sie draußen« — er machte eine unbestimmte Bewegung mit einer Hand, und sie verstand ihn vollkommen — »nein, da werden Sie gar nicht erst anzufangen brauchen —
Können Sie mit dem Schießeisen umgehen?«, fragte er dann ganz plötzlich. »Ich meine, auch treffen?«
Die Tänzerin stand auf.
Sie ging zu einem großen Kasten, der an der einen Längswand des Zimmers stand, hob ihn mit beiden Händen, trotzdem er ziemlich schwer war, über ihr Haupt empor, schleuderte ihn zu Boden, absichtlich eine Stelle wählend, wo dieser nicht mit dem dicken Teppich überdeckt war, hob ihn abermals und schleuderte ihn nun in eine Ecke.
Dabei schien der Deckel aufgegangen zu sein.
Charles Dubois war mit einem Satze auf den Füßen, hatte auch schon den langen Sechsschüsser in der Hand, ward ganz Stahl und Eisen, seine Augen blitzten —
»Alle Wetter!«, kam es über seine Lippen, wenn auch durchaus nicht furchtsam.
Und er hatte schon Grund zu diesem Rufe, denn aus dem nun offenen Kasten kam es herausgeglitten — Kobras — eine, zwei — drei —
Und sie glitten blitzschnell über den Boden, aufs höchste erregt, wütend durch die Behandlung, durch den Sturz —
Aber schneller als sie war die Tänzerin.
In ihrer Rechten funkelte ein Revolver, ein kleines Ding nur, und dann entfuhr dem Rohre ein Feuerstrahl, noch einer, ein dritter —
Und jeder Schuss zerschmetterte den Kopf einer Kobra.
Es war höchste Zeit gewesen, und das alles war so überraschend schnell gegangen, dass der junge Mann in der abgeschabten Lederkleidung nicht einzugreifen gebraucht hatte —
Jetzt zuckten die drei blutenden Schlangenkörper auf dem Teppich, machtlos, unschädlich —
Und die Bella Cobra lebte und schaute Charles Dubois an.
Diesmal wartete sie ganz bestimmt auf ein Lob aus seinem Munde, das war ihr anzusehen.
Doch es kam nicht.
Charles Dubois setzte sich wieder, schob den Sechsschüsser in das Futteral zurück und sagte:
»Machen Sie das auch auf der Bühne, Miss?«
Ganz bleich wurde der Tänzerin Gesicht.
»Was Sie nicht denken! Ich dürfte es ja gar nicht —«
»Na, dann sollten Sie es auch hier nicht machen«, sagte er trocken.
»Aber — Sie wollten doch wissen, ob ich schießen kann!«, entfuhr es ihr.
»Ach so! Deswegen! Na ja, flink waren Sie ja, aber wissen Sie, draußen — wieder die Handbewegung wie zuvor schon einmal — da geht es doch noch ein bisschen anders zu, da kann man nicht erst die Schlange wütend machen, da sind sie das von allein —
Und ja, da gibt es doch auch noch andere Tiere. Waren Sie schon einmal draußen?«, fragte er dann.
Die Bella Cobra hatte, wie gesagt, vollkommen verstanden, was mit diesem Worte »draußen« gemeint war, und da muss gesagt werden, dass sie selbst geborene Australierin war, dass sie von der Zeit ihrer Geburt und von ihrer ersten Kindheit gar merkwürdige Geschichten hätte erzählen können.
Vorläufig aber schwieg sie davon.
»Nein«, sagte sie.
»Dann begreife ich immer weniger, wie Mister Philipp Sie dazu bestimmen konnte, mit mir zu gehen!«, rief Charles Dubois.
Ob er gesehen hatte, dass das schöne Weib ihm gegenüber zusammenzuckte, war mindestens zweifelhaft, aber dieser Waldläufer war eben sehr zartfühlend, wie niemand es ihm zugetraut hätte.
Er besann sich plötzlich auf die beiden Männer, denen er auf der Treppe begegnet war, und nun erst sah er sie noch einmal vor sich — in der Erinnerung natürlich —
Der eine hatte ihn so gemein angefeixt — der kleine, dicke Kerl — und der andere, der Riese, hatte ihm einen Blick zugeworfen, als wollte er ihn am liebsten durch einen Fausthieb niederstrecken.
Charles Dubois kam nicht viel unter Menschen, aber er kannte sie recht gut, vielleicht besser, als wenn er immer mit ihnen zusammen gelebt hätte.
Vorhin hatte er ja nicht weiter auf die beiden geachtet, jetzt aber —
Und aus diesem schnellen Gedankengange heraus fragte er:
»Sie haben sich bei Mister Philipp gemeldet, weil Sie die Million brauchen können, nicht wahr?«
Einen Moment schien es, als wollte die Bella Cobra ihm ins Gesicht lachen.
Ihr Mund verzog sich schon, in ihren dunklen Augen blitzte es —
»Und wenn es so wäre?«, fragte sie.
Da strich sich Charles Dubois, wie es seine Gewohnheit zu sein schien, wenn er verlegen war, das lockige Haar aus der Stirn und wurde sehr rot — es tat ihm leid, dass er diese Frau — oder dieses Mädchen? — enttäuschen musste.
»Dann möchte ich Ihnen doch raten, lieber auch weiter als Tänzerin anzutreten«, sagte er. »Sie müssen doch ein schönes Geld verdienen. Ich habe so etwas gehört —«
»Fünfhundert Pfund allabendlich«, kam die Erwiderung. »Aber einer der Herren, denen Sie vorhin ja wohl noch begegnet sind — mein Theaterdirektor — bot mir das Doppelte.«
Darüber schien Charles Dubois nicht überrascht.
»Na also!«, sagte er. »Ist das nicht ein ganz hübsches Stück Geld?«
»Ich bin habsüchtig und geizig!«, erwiderte da die Tänzerin mit todernstem Gesicht.
Aber sie lachte mit, als Charles Dubois das tat.
Ja, er lachte sie einfach aus, legte sich gar keinen Zwang auf.
»Sagen Sie mir lieber den wahren Grund, weshalb Sie sich diese Million Dollar verdienen möchten, die Mister Philipp jedem von uns ausgesetzt hat, falls wir die Aufgabe lösen, die er uns stellte. Wenn Sie hier in Sydney bleiben, dann haben Sie doch diese Summe in spätestens einem Monat zusammen —«
»In vierzehn Tagen!«, unterbrach ihn die Bella Cobra, und nach kurzer Pause fügte sie, etwas leiser als zuvor, hinzu:
»Ich brauche nicht einmal aufzutreten, um diesen Betrag zu erlangen.«
Charles Dubois schaute sie an. Er verstand doch sofort, wie das gemeint war.
»So sehen Sie freilich nicht aus!«, sagte er, und dass er meinte, was er da aussprach, das konnte sie im Ausdruck seiner Augen lesen.
Jedenfalls errötete die Tänzerin zum dritten Male während dieses Gesprächs, und plötzlich streckte sie dem Manne in der abgeschabten Lederkleidung ihre rechte Hand entgegen.
»Das hat mir sehr wohlgetan, Monsieur Dubois!«, stieß sie dabei hervor.
Er aber achtete wohl gar nicht auf diese Worte, er umspannte mit seiner nervigen, braunen Hand das zierliche Patschhändchen und blickte bewundernd darauf nieder.
»O weh!«, sagte er gutmütig lächelnd. »Wie würde dieses Händchen aussehen lernen, wenn ich Sie mitnähme! Aber nein, das machen wir lieber nicht — ich weiß ja nicht, was werden soll, wenn Sie nicht mitgehen, doch ich muss dann eben erst noch einmal bei Mister Philipp anfragen —
Und da wäre wohl unsere Unterredung zu Ende.«
Er stand auf. Für ihn schien die Sache wirklich erledigt.
Diese Tänzerin konnte er doch unmöglich mit in die Wildnis nehmen. Gar nicht daran zu denken.
»Leben Sie wohl!«, sagte er und brauchte ihr ja nicht erst die Hand zum Abschied hinzustrecken, denn er hielt ja die ihre noch gefasst.
Und da geschah es, dass diese zarten Finger sich um die seinen schlossen — und dass er ganz verwundert darauf nieder blickte, auch gleich mit auf den Arm, der sich unter dem schwarzen Gewand in den unteren Muskelpartien zu bewegen begann —
Der Druck der so zart erscheinenden Fingerchen wurde immer stärker. Mancher andere Mann hätte sicher bereits schmerzhaft das Gesicht verzogen, aber Charles Dubois verriet nichts dergleichen — nur recht verwundert sah er aus — und plötzlich sagte er — wieder so recht naiv, wie eben nur ein solcher Waldmensch es sein konnte:
»Hören Sie mal, Miss Cobra, mit Ihnen möchte ich fast einmal ringen — es könnte doch sein —«
»Dass Sie sich in mir geirrt haben? Ja, das haben Sie, Monsieur Dubois! Das haben Sie!«
Die Bella Cobra schrie es fast.
»Jetzt will ich Ihnen nur sagen, dass dieses Geld mich überhaupt nicht lockt — ich weiß doch gar nicht, was ich damit anfangen soll — ach, dieses elende Geld! An dem der Fluch unzähliger Menschen hängt!
Aber hinaus in die Wildnis will ich! Gerade fort von diesen Menschen, die mit ihrem Gelde alles möglich machen wollen — ja, ich könnte Millionen verdienen — ich —
Was glauben Sie wohl, was der Riese, dem Sie ja auch begegnet sind, mir bezahlt hätte, hätte ich vor dem so getanzt — hier — wie vorhin vor Ihnen? Wenn ich ihm erlaubte, bloß einmal zuzusehen, wie ich — — Sie haben sich umgedreht vorhin, Charles Dubois — und deshalb — —
Nun, ich will Ihnen nur gleich gestehen, dass ich Sie hinausgeworfen hätte, wenn Sie sich nicht umgedreht hätten — nicht einen Schritt wäre ich mit Ihnen gegangen —
Aber jetzt, Charles Dubois, jetzt bitte ich Sie: Nehmen Sie mich mit! Lassen Sie mich Ihre Abenteuer, Ihre Gefahren, Ihre Strapazen teilen!
Sie denken, ich halte das nicht aus?
Kommen Sie! Ziehen Sie die Jacke aus! Jetzt mache ich Ihnen den Vorschlag, mit mir zu ringen — und wenn ich Sie besiege —«
Da hob er die Hand.
»Das wird Ihnen nicht glücken«, sagte er, aber ohne jede Prahlerei. » Sagen wir also lieber: Wenn ich zufrieden mit Ihnen bin, dann nehme ich Sie mit — dann wollen wir Kameraden werden — ist es Ihnen recht, Miss Cobra?«
Und da sie nickte, mit glänzenden Augen, so streifte er seine Jacke ab —
Er trug darunter ein Wollhemd — und es muss leider gesagt werden, dass er für diesen Besuch nicht erst für nötig erachtet hatte, die Wäsche zu wechseln — das Hemd hatte schon manches erlebt, wenn es auch noch sauber war —
Und dann streifte er die Ärmel noch etwas auf, denn über dem Ellbogengelenk saßen sie schon —
Und die Bella Cobra?
Sie hätte ja nun, um es leichter zu haben, ihr Pensionsmädelkleid auch ausziehen können, er hatte sie ja schon in dem »Kostüm« gesehen, das sie darunter trug, aber sie behielt es an —
Und Charles Dubois forderte sie nicht auf, es abzulegen. Er hob nur den runden Tisch zur Seite, stellte auch noch ein paar Stühle weg, schaute sich prüfend um, und dann trat er vor sie hin.
»Also los, Miss Cobra!«
Im nächsten Augenblick hatten sie einander schon gepackt.
Es hätte keinen Zweck diesen Ringkampf zwischen den beiden zu beschreiben. Gelingen würde es ja doch nicht. Niemand könnte so schnell schreiben, wie sich die Phasen dieses Kampfes abspielten, niemand auch so schnell lesen —
Aber gesagt soll wenigstens werden, dass Menschen, die etwas von der deutschen Literatur kannten, sofort an den Ringkampf zwischen Brunhild und Siegfried gedacht hätten.
Nur dass dort das Weib doch noch eine andere Figur besessen hatte als diese schlanke Tänzerin.
Nein, es war ganz anders, wie sie beide miteinander rangen.
Umsonst nannte sich die Tänzerin doch nicht die Bella Cobra.

Wie eine Schlange wand sie sich um den Mann, und dieser glich einem Edelhirsch, wie vorhin die poetische Lizzie gedacht hatte —
Nach nicht ganz zwei Minuten hatte Charles Dubois die Tänzerin niedergezwungen, hielt sie auf dem Teppich fest, dass ihre beiden Schultern ihn berührten. Er hatte die Bella Cobra besiegt. Da gab es nun keinen Zweifel mehr.
Und er stand auf.
Er drehte sich wieder einmal um.
Bei diesem Ringen hatte sich wirklich nicht vermeiden lassen, dass das schwarze Kleidchen nicht bloß aufgeplatzt, sondern auch gleich stellenweise in Fetzen gegangen war. Daran war sie freilich selber schuld gewesen durch ihre ungestümen Biegungen, und so hatte sie eben wieder einmal nicht viel mehr an als ihr Bühnenkostüm — und diesmal war das noch verfänglicher als während des Tanzes und nachher — sie atmete jetzt stürmisch —
Kurzum, Charles Dubois kehrte sich ab.
Die Bella Cobra aber blieb noch eine Sekunde regungslos liegen, die Blicke unverwandt auf den Mann gerichtet — und was für Blicke —
Dann aber erbleichte sie jäh, sprang auf und rannte hinaus, durch eine Tür, die sich hinter Charles Dubois befand.
Fast erschrocken wendete er sich bei diesem Geräusch um.
»Habe ich Ihnen wehgetan, Miss Cobra?«, fragte er.
Sie antwortete nicht, konnte es ja gar nicht, da die Tür sich zwischen ihm und ihr befand, sie hatte sicher seine Frage nicht mehr gehört.
Bestürzt stand der junge Mann da.
Da jedoch ward die Tür schon wieder geöffnet.
Die Bella Cobra kam wieder herein, jetzt vollständig angekleidet — in einen Lederanzug, wie er selber ihn trug — das reiche Rothaar aufgebunden und unter einem breiten Schlapphute versteckt — an den Füßen weiche Stiefel, deren Schäfte bis zur Mitte der Schenkel reichten, sich eng anschmiegend —
Und bewaffnet war sie auch schon.
Über der einen Schulter hatte sie ein Gewehr hängen. Von dem Ledergürtel herab baumelten zwei Revolverfutterale, und nach ihrer Größe zu schließen staken darin ganz andere Schießeisen als vorhin die kleine Browning — sogar das lange Scheidenmesser fehlte nicht.
Aber Charles Dubois sah mehr als das. Er gewahrte doch gleich, dass sowohl der Lederanzug als auch die Waffen nicht etwa erst vor Kurzem gekauft worden waren.
Das ist ja so etwas, was man, namentlich in Großstädten oft genug sehen kann. Da braucht man sich bloß mal auf einen Bahnhof zu stellen, wenn die Ferienzüge gehen.
Wie viele Damen sieht man da in Bergsteigerausrüstung fortfahren — oder im Winter im Schneeschuhdress — das ist doch immer die Hauptsache — die Abreise — und dann vielleicht auch noch die Fahrt und ein Spaziergang durch den erwählten Aufenthaltsort —
Bewundern wollen sie sich lassen, wie prall die Höschen sitzen, und was sie alles sonst noch zu zeigen haben —
Und in amerikanischen Bahnhöfen tauchen da auch solche Damen in Leder auf, oder in Cowgirlkleidung — das ist mal was anderes, das lockt mächtig —
Nein, davon, dass die Bella Cobra diesen Anzug und diese Waffen eben erst in einem der großen Basare, in einem Warenhaus, gekauft hatte, konnte gar keine Rede sein, das sah Charles Dubois sofort — aber sofort — und wusste auch, dass dieser Eindruck des Echten nicht etwa künstlich erzeugt worden war — denn auch so etwas gibt es —
Aber deswegen blieb ihm nicht vor Staunen der Mund offen stehen.
Er lachte nur, und zwar zufrieden —
»Wenn Sie mir gleich so gegenüber getreten wären, Miss Cobra«, sagte er —
»Aber wo haben Sie denn dieses Zeug schon getragen? Sie sagten doch vorhin, Sie wären noch nicht draußen gewesen?«
»Da habe ich Sie belogen«, erwiderte die Tänzerin und ward nicht rot, weil sie diese Lüge eingestehen musste.
Und indem sie ihn fest anschaute, fuhr sie fort:
»Fragen Sie jetzt, bitte, nicht weiter, Monsieur Dubois! Ich werde Ihnen alles erzählen, wenn die Zeit gekommen ist. Wir hätten ja auch gar keine Zeit dazu, denn es ist eine lange Geschichte, und unsere Minuten sind kostbar. Wollen wir gehen?«
»Sie können gleich mitkommen?«
»Sofort!«
»All right!«
Er schritt schon auf die Tür zu.
Aber die Tänzerin hatte noch etwas zu erledigen, eine Kleinigkeit nur, und Charles Dubois ward Zeuge davon.
Sie klingelte.
Das Kammerkätzchen kam herein — so muss gesagt werden, weil Lizzie sich eben schon wieder in ein solches verwandelt hatte — auch die rotgeweinten Augen hatte sie gekühlt —
»Lizzie«, hob die Bella Cobra an, »ich muss jetzt fort. Wann ich zurückkehre, weiß ich nicht. Du wirst während meiner Abwesenheit das Haus hüten. Ja, und diesen Scheck bringst Du morgen früh ins Theater, gibst ihn Mister Irving — und wenn ich nicht wiederkommen sollte — sagen wir nach einem Jahre — dann musst Du aus meinem Safe in der Bank den großen Brief nehmen und aufs Gericht tragen. Mein Testament ist drin — aber ich denke, es wird nicht nötig werden —«
Und die Zofe?
Eigentlich hätte sie doch furchtbar erschrecken müssen, zumindest neugierig fragen sollen, was da eigentlich los war.
Sie tat es nicht, sie blieb ganz ruhig, und das war wieder ein Beweis, dass Charles Dubois recht gesehen hatte, dass Miss Cobra öfter in diesem Lederanzug fortging.
»Sehr wohl, Miss!«, sagte Lizzie nur, knickste und ließ ihre Herrin an sich vorüber, ging hinter ihr die Treppe hinunter — ein letzter Gruß — dann ward die Tür hinter der Bella Cobra abgeschlossen.
Nun hatten Charles Dubois und die Bella Cobra aber auch die Brücken bereits abgebrochen, die nach der Alltagswelt hinüberführten.
In demselben Moment, als Professor Edeling die Augen aufschlug, konnte er sich mit klarem Bewusstsein an alles erinnern. Er wusste, weshalb er nach Hamburg gefahren war, weshalb er über Bord gesprungen, wie er nach dem Lichte in finsterer Nacht geschwommen war, wie er zuletzt den Strand erreicht hatte, vor Erschöpfung zusammenbrechend, wusste auch, dass er sich noch auf den Rücken gewälzt hatte, ehe er in einen todesähnlichen Schlaf gesunken war, der bis zu diesem Augenblicke gewährt hatte.
Und er wusste sogar, dass er sich hierüber nicht zu wundern brauche.
Der über Raum und Zeit erhabene Menschengeist, der sich in ein und demselben Moment ins graueste Altertum und auch auf einen fernen Planeten versetzen kann, ist hierzu und noch zu etwas ganz anderem fähig.
»Ich werde mich am Strande der Sahara befinden oder auf einer vorgelagerten Insel.«
Das war der Schluss seiner Gedankenkette — da hatte er seine Augen geöffnet.
Aber da nun freilich blieb die Weltgeschichte in seinem Gehirn einmal stehen, da konnte er nicht gleich weiter denken.
Heller Tag war es. Aber dass er nicht in den blauen Himmel hineinblickte, sondern gegen eine Decke, die mit Rosen und Vergissmeinnicht und anderen Blumen bemalt war, das passte eben nicht in seinen Kram.
Und ebenso wenig seine zweite Entdeckung, dass er nicht im nackten Wüstensande der Sahara lag, sondern in den weichen Pfühlen eines prächtigen Bettes, angetan mit einem feinen weißen Hemdchen, wie er es bei seiner Schwimmtour nicht etwa auf dem Leibe getragen hatte, zugedeckt mit einer seidenen Steppdecke.
»Nanu, jetzt bleibt mir aber der Verstand stehen!«, bekannte der Herr Professor gleich selbst.
Er hob den Kopf aus den Kissen, stützte sich auf den Ellbogen, und nun folgte eine Entdeckung der anderen.
Ein höchst luxuriös ausgestattetes Schlafzimmer. Weiter braucht die Ausstattung nicht beschrieben zu werden. Jedenfalls alles aufs gediegenste und kostbarste und behaglichste, jeglicher Komfort vorhanden.
Nur keine Fenster.
Das Licht wurde von einer an der Decke befindlichen Ampel verbreitet, und zwar derart hell, dass Professor Edeling es erst für Tageslicht gehalten hatte.
»Na, da wollen wir einmal«, sagte er jetzt, nachdem er mit dieser ersten Betrachtung fertig war, in aller Gemütsruhe aufstehend, schlug die seidene Decke zurück und kletterte aus dem Bett, seine Füße tief in dem prachtvollen Felle eines gewaltigen Eisbären vergrabend.
»Ich scheine bei Leuten zu sein, die nicht nur Moneten, sondern auch künstlerischen Geschmack haben.«
An einer goldenen Stellage, einem Wunder der Schmiedekunst, hing ein Mantel aus blauem Samt, und daneben auf einer Kommode, die nicht nur schön ausgelegt war, sondern auch die herrlichsten Intarsien enthielt, die Unterwäsche, wohl nicht aus Seide, sondern aus nur seideglänzender Leinwand — feinster Damast.
»Das ist natürlich für mich bestimmt.«
Professor Edeling bediente sich, zog sich an. Ehe er in den Mantel schlüpfte, ging er zu dem Waschtisch — aber nun was für ein Waschtisch mit zwei Becken! — drehte den Hahn auf, über dessen Griff der Vermerk »Kalt« stand — und zwar in deutscher Sprache!
»Gott sei Dank, parfümiert ist die Seife nicht! Ich dachte schon —«
Dann entdeckte er, und zwar gleich vor seinem Bett, die prachtvoll gestickten Halbschuhe, und nun legte er den blauen Samtmantel an.
»Nein, ein Schlafrock ist das nicht zu nennen«, sagte er befriedigt, als er sich in dem großen Spiegel betrachtete, »das ist schon mehr ein Rittermantel. Und wenn er mir von den Schultern gleitet — na, in solchem Damast kann man sich auch noch sehen lassen. Aber halt — hat man auch für ein Taschentuch gesorgt? Jawohl, gleich zwei stecken in den Taschen, und was für Prachtdinger, da geniert man sich förmlich, die Nase zu putzen.
Na, dann ist's ja gut. Ja, wo ist nun hier die Klingel, um den Kellner zu rufen, bei dem ich das Frühstück bestellen kann?«
So sagte sich Professor Edeling, obgleich er gar keinen Appetit verspürte. Aber er fühlte sich wie neugeboren.
Er hatte sich in der letzten Zeit, während der Seereise, nach Überstehung der Seekrankheit, immer außerordentlich wohl gefühlt, aber so wie jetzt doch noch nie.
Daher auch sein Humor, der fast bei jedem Worte zum Durchbruch kam.
Etwas zum Drücken oder zum Ziehen, um eine Klingel in Bewegung zu setzen, war nicht zu sehen. Aber da waren zwei Türen vorhanden, in dem etwas langgestreckten Zimmer sich gegenüber liegend, beide mit Portieren verhangen.

Der Professor schritt auf die ihm nächste zu, erfasste die Portiere. die in gefälligen Falten herabhing, wollte sie zurückschlagen und — — konnte es nicht!
Die vermeintliche Portiere bestand aus einer festen Masse, vielleicht aus Holz, es konnte aber ebenso gut auch Eisen oder Erz sein, und dennoch machte es so ganz und gar den Eindruck eines Gewebes, schien auch in Wirklichkeit mit einem solchen überzogen zu sein, er fühlte und sah auch die Fasern. Nur dass das Ganze eben starr war.
»Bin ich hier gefangen? In einem Raume, der nicht einmal Fenster hat? Will man mir sogar das Sonnenlicht entziehen?«
Doch ohne vorläufig Unbehagen zu empfinden, schritt der Professor durch das Zimmer nach der anderen Portiere, ohne viel Hoffnung, dieses Gewebe zurückschlagen zu können, das Zeug sah mit Muster doch genau aus wie jenes dort.
Aber siehe da — diese Portiere ließ sich bequem zurückschlagen, und dann war die Türöffnung auch gleich frei.
Ein pompöses und doch überaus behaglich eingerichtetes Wohnzimmer tat sich auf.
Wieder keine Fenster. An den Wänden sehr viele und sehr merkwürdige Bilder, von denen wir noch genug sprechen werden.
Jetzt vor allen Dingen sah der Professor nur die menschliche Wachsfigur, die dort auf dem Sofa lag.
Denn eine Wachsfigur war es, das hatte der scharfsichtige Professor, der noch keiner Brille bedurfte, in der ersten halben Minute heraus.
Mindestens wusste er bestimmt, dass Gesicht, Hände und Füße aus Wachs oder einer ganz ähnlichen Substanz modelliert waren.
Die Figur stellte in Lebensgröße eine junge Chinesin oder wahrscheinlicher eine Japanerin dar, bekleidet mit einem sehr buntfarbigen Kimono.
Ein ganz, ganz merkwürdiges Gesicht, das der Künstler da modelliert hatte! Zunächst schon auffallend durch seine ovale Form und dann auch noch durch vieles andere, was jedoch einzeln eben nicht zu beschreiben ist. Schön war es eigentlich nicht zu nennen. Aber interessant, originell — und schließlich dennoch von einem unendlichem Liebreiz.
Nur durfte man nicht klassische Frauenschönheit fordern. Dazu war schon diese Stirn zu hoch und zu gewölbt — eine Stirn, hinter der ganz sicher eine tüchtige Portion Geisteskraft aufgespeichert war — gewesen wäre. wenn diese Figur gelebt hätte.
Auch sonst war der modellierende Künstler seine eigenen Wege gegangen.
Ja, es war eine Japanerin! Solche große, mandelförmige Augen findet man häufig unter den Japanerinnen, niemals unter Chinesinnen.
Die vornehme Japanerin schminkt sich sehr, malt sich die Röte der Gesundheit an — weil sie weiß, dass es hübsch aussieht — oder weil es eben Sitte ist.
Die Lippen werden intensiv rot gefärbt, ebenso die Wangen.
Die schwarzen Augenbrauen werden durch Striche vergrößert und geschwungener gemacht, auch sonst die Augen mit viel Schwarz umgeben, was freilich sehr geschickt gemacht werden muss.
Korallenrote Lippen hatte auch diese Figur hier. Aber wirklich ganz auffallend war, dass der Künstler nun nicht auch die Wangen des etwas gelblichen, elfenbeinfarbenen Gesichtes rot gefärbt hatte. Denn ein Künstler, der die Japanerinnen studiert hatte, war das doch unbedingt gewesen.
Das erkannte man, wie er die straffgespannte, hochaufgebaute Frisur des blauschwarzen Haares arrangiert hatte, wie er in ganz eigentümlicher Weise den langen Pfeil durchgesteckt hatte — das erkannte man noch aus vielen solchen Kleinigkeiten.
Aber die Wangen hatte er eben nicht rot gefärbt.
Das ganze Gesicht zeigte denselben gelblichen Elfenbeinton.
Auch die Augen hatte er nicht schwarz umrändert. und das war für den, der etwas davon verstand, wirklich sehr auffallend.
Die rechte Hand lag unter dem Kopfe, die linke neben dem Leibe auf dem Diwan, lose einen Fächer haltend.
Und was für eine Hand hatte der Künstler da geschaffen!
Klein und zierlich, der ganzen Gestalt entsprechend, dabei aber dennoch geradezu strotzend von Muskeln und Sehnen, aber in einer Weise, dass trotzdem der Eindruck der wunderbar gepflegten Schönheit bestehen blieb. Eben ein Meisterstück, das der Modelleur allein in dieser Hand schon geschaffen hatte.
Dasselbe galt auch von dem rechten Arm, von dem nur die Hand unter dem Kopfe lag, sodass hier der Kimono noch mehr zurückgeglitten war. Wiederum ein so wunderbarer Arm.
So fein, so zierlich, wie für die zierlichste Puppe gedrechselt, und dennoch durch Muskeln und Sehnen und Adern eine gewaltige Kraft verratend.
Jedenfalls eine japanische Gauklerin, als Athletin und Akrobatin ausgebildet, und zwar eine, die durch ihre erstaunliche Kunst große Einnahmen hat.
So dachte der Professor.
Das letzte bezog sich auf den Schmuck, den er erblickte.
Allerdings war es nur ein ganz einseitiger Schmuck. Die ganz gefährlich spitze Haarnadel, schon mehr ein Dolch mit ganz dünner Klinge zu nennen, hatte als Griff eine rote, sich mehrmals spaltende Flamme. Ein herrliches Feuer ging von diesem roten Steine, oder was es nun sonst war, aus.
Man glaubte jeden Augenblick, die Feuerzungen müssten wirklich zu spielen beginnen.
Das war der einzige Schmuck im Haar und eigentlich überhaupt am Körper. Keine Armspangen, an dieser linken Hand keinen Ring, keine Halskette, keine Brosche und dergleichen, auch die zierlichen Ohren ohne Schmuck.
Dagegen zeigte solchen noch der nackte Fuß. Den einen hatte sie etwas angezogen, den anderen ausgestreckt, und von dem war das gestickte Pantöffelchen abgeglitten.
Man sieht selten einmal einen schönen Menschenfuß, sehr, sehr selten! Bei uns zivilisierten Europäern mit unseren ledernen Fußquetschen sogar gerade bei den Damen am allerwenigsten.
Das hier aber war ein entzückendes Füßchen! Es wäre nicht nötig gewesen, die Schönheit auch noch durch kostbare Zehenringe verstärken zu wollen, wie hier geschehen war.
Aber nun freilich eben Zehen, für welche solcher Schmuck wirklich passte.
Nach dieser ausführlichen Beschreibung ist nur noch zu sagen, dass die Wachsfigur nicht schlafend dargestellt worden war, sondern sie hatte die großen, mandelförmigen Augen weit geöffnet. Das war das einzige, was wirkliches Leben vortäuschen sollte; denn sonst hätte man ja auch an eine Leiche denken können, obgleich auch die mit offenen Augen daliegen kann. Aber hier fehlte der starre Blick des Todes, das hatte der Künstler in der Wahl der künstlichen Augen zu vermeiden gewusst.
Hingegen hatte er, eben ein echter Künstler, die dumme Mode nicht mitgemacht, die Wachsfigur durch einen inneren Mechanismus atmen oder gar mit dem Kopfe wackeln zu lassen. Das darf bei solch einem Kunstwerk niemals der Fall sein. Sonst hört es eben auf, ins Reich der wahren Kunst zu gehören, dann wird eine automatische Spielerei daraus, ein nachgeahmtes Zerrbild der Natur.
Der Professor riss sich vorläufig los von dem Anblick der Wachsfigur, betrachtete erst einmal das große Wandbild rechterhand.
Es stellte eine Bärenjagd dar in bunten Farben, fast in Lebensgröße ausgeführt. Aber keine moderne Bärenjagd.
In einem Walde mit mächtigen Eichen und einigen Felsformationen gingen alte Germanen, nur notdürftig mit Fellen bekleidet, das lange Flachshaar im Knoten zusammengebunden, einem gewaltigen Bärenpaare vor seiner Höhle zu Leibe, nur mit Keule und Steinaxt. Auffallenderweise benutzten sie dabei weder Spieß noch Lanze.
Des einen Bären Schicksal war bereits entschieden, auf dem trommelten ein halbes Dutzend urwüchsiger Germanen herum, aber der andere Bär hatte vorläufig noch die Oberhand, der hatte schon zwei der Jäger zur Strecke gebracht, der eine lag mit fürchterlich aufgerissenem Leibe da, den anderen bearbeitete der Bär noch mit seinen Pranken.
Doch dem Gefällten, wenn er nicht schon zu sehr verwundet war, konnte vielleicht noch Rettung kommen. Schon saß auf dem Rücken des zottigen Ungeheuers ein schlanker Jüngling, ein Knabe noch, der aber mit nervigen Armen die Waffe wohl zu gebrauchen wusste. Er holte mit der gewaltigen Steinaxt zum furchtbaren Schlage aus, der den Schädel des Bären spalten sollte —
Hallo! Was war denn das?!
Trug dieser germanische Heldenknabe nicht die Züge jener japanischen Wachsfigur dort?! Freilich ins Germanische übersetzt. Aber wenn man sich das flachsblonde, in einen Knoten geschürzte Haar schwarz und hochfrisiert vorstellte —
Ein Geräusch lenkte des Professors Aufmerksamkeit von dem Bilde ab und der zweiten Tür in diesem Wohnzimmer zu.
Schnell ging er hin, zunächst gleich wieder an eine eventuelle Gefangenschaft und an einen Ausweg denkend. Auch wieder so eine Portierentür — und das vermeintliche Teppichgewebe auch wieder so starr, unbeweglich. Also einfach eine verschlossene Tür.
Der Professor kehrte zurück, blieb aber nicht wieder vor jenem Bilde, sondern vor der Wachsfigur stehen.
Nochmals gab er sich längere Zeit der bewundernden Betrachtung hin.
»Ein herrliches Meisterwerk!«, sagte er halblaut vor sich hin.
»Ich bin ein einziges Mal in einem Wachsfigurenkabinett gewesen, das sogar großen Ruf genoss — ich habe genug davon gehabt! Diese angepinselten Puppenköpfe!
Selbst der blutigste Raubmörder, selbst die hässlichste Hexe hatte immer ein himmlisches Gesichtchen wie Milch und Blut. Ich hatte zwar schon gehört, dass von Wachsmodelleuren wirkliche Kunstwerke geschaffen worden sein sollen, haben doch auch Benvenuto Cellini und selbst ein Leonardo da Vinci in Wachs bossiert, sie sollen auch menschliche Figuren modelliert haben, welche das Entzücken der damaligen Kunstwelt erregten — ich habe es nie glauben können, weil ich es mir eben nicht vorstellen konnte, weil ich einmal so grässlich enttäuscht worden bin.
Hier aber muss ich mein Urteil ändern. Das ist echte Kunst!«
Noch einmal versank der Professor ganz in die Betrachtung der Figur, dieser Züge, um dann fortzufahren, mit recht eigentümlich vibrierender Stimme:
»Ein Bild zum Malen! Ach, du exotische Blume aus einer mir ganz unbekannten Welt — — ach, wenn ich dieser Gliederpracht Leben einhauchen könnte! Dann würde ich dich küssen und herzen —«
Ein energisches Kopfschütteln, und es war vorüber.
Das, was nun folgte, entstammte einer anderen Art von Interesse, das war die reine Wissbegier des forschenden Gelehrten.
Ob wohl noch mehr, als sichtbar ist, naturgetreu modelliert ist?
Erst berührte er mit dem Finger die Stirn, die Wange, die kräftige und doch so feine, zierliche Nase, mit der nötigen Vorsicht, um nichts zu verletzen, aber doch auch so, dass er sich überzeugen konnte, es sei wirklich hartes Wachs oder überhaupt eine harte Masse. Also etwas hatte er dabei doch mit der Fingerspitze drücken müssen.
Dann dehnte er die Untersuchung auf den wunderbar modellierten Hals aus und ging an diesem weiter hinab, betastete die Stelle, wo man unter dem bunten Gewebe einen jungfräulichen Busen vermuten konnte.
»Wahrhaftig! Alles ganz naturgetreu nachgeahmt! Das freut mich! Denn am meisten beirrt mich, wenn ich so eine schöne Wachsfigur sehe, immer die Vorstellung, dass alles andere, was durch das Kostüm verdeckt ist, doch nur aus einem Holzgerippe mit einem Paar Besenstielen besteht.«
Er setzte dann seine Untersuchung längs des Körpers fort.
Was er tastete, fühlte sich alles ganz naturgetreu an, nur etwas hart, was aber doch bei so einer Athletin und Akrobatin begreiflich ist.
Er kam zu den Füßen. Da hatte er ja nun die beste Gelegenheit, sich zu überzeugen, ob wächsernes Fleisch oder hölzerne Besenstiele.
Also er schlug den Kimono unten auseinander.
Nein, Besenstiele gab's nicht, oder diese waren doch mit roten, am Fußgelenk zugeschnürten Beinkleidern verhüllt, einer Art Pumphose.
Nun, der Professor konnte sich ja auch noch weiter überzeugen, er fühlte unter den Pumphöschen nach den Waden —
»Nun sagen Sie mal, Herr Baron — ist das eigentlich bei Ihnen zu Hause Sitte, dass ein Herr, wenn er eine ihm wildfremde Dame auf dem Sofa liegen sieht, sofort hingeht und ihr im Gesicht und sonst wo herumtapst und dann auch noch nachguckt, was sie unten drunter anhat? Ist das bei Ihnen zu Hause Sitte?«
So hatte die Wachsfigur mit kräftiger Altstimme im besten Deutsch gesagt und hatte sich dabei halb aufgerichtet.
Ach du großer, du allmächtiger Schreck!
Der noch so jugendliche Herr Professor war nicht fähig, sich nach einer Versenkung umzusehen, in der er spurlos verschwinden könne.
Die ganze Welt brach für ihn zusammen, schon hörte er die Posaunen des jüngsten Gerichtes.
»Ach, wenn mich doch jetzt der Schlag träfe!«, konnte er nur noch stöhnen.
»Wenn hier jemand zu schlagen hätte, so wäre das nur ich. Aber ich denke gar nicht daran. Ich wüsste nicht warum. Ich habe mir abgewöhnt, unausgesetzt atmen zu müssen, deshalb haben Sie mich für eine Wachsfigur gehalten. Also ich mache Ihnen keine Vorwürfe. Setzen Sie sich, Herr Baron — dorthin — zu meinen Füßen!«
Der Professor gehorchte, er sank zu ihren Füßen auf dem Diwan zusammen.
Nun muss aber gleich noch eines bemerkt werden.
Die lebendig gewordene Wachsfigur, die trotz ihres japanischen Aussehens ein so ausgezeichnetes Deutsch sprach, hatte eine ganz eigentümliche Weise zu reden.
Sie brachte das alles so leichthin, so gleichgültig hervor und doch auch wieder mit einer so herzgewinnenden Ehrlichkeit.
So hatte sie gleich anfangs gesprochen, immer tiefernst und doch so überaus gutmütig, und so sprach sie auch weiter, und das hörte der Professor sofort heraus und das machte, dass er sich bald Ruck für Ruck wieder aufrichtete und nun mit Andacht lauschte.
»Herr Baron Edeling, wie sie fernerhin genannt werden sollen, Sie sind Gelehrter, Sie sind trotz Ihrer jungen Jahre schon Professor, Sie haben bereits viele Beweise des größten Scharfsinns gegeben — — Sie werden alles ganz genau verstehen, worüber ich Ihnen hier nur kurze Andeutungen gebe.
Außer der einzigen Welt, in welcher die große Menschheit als Herde lebt, gibt es auf dieser Erde noch viele andere Welten.
Ein jeder Dichter, möge er auch nur in einem armseligen Dachkämmerchen hausen, lebt in seiner eigenen großartigen Welt, die er als Fürst regiert und die er auch nicht zu verlassen braucht, selbst wenn er sich einmal unter die anderen Menschen begibt — vorausgesetzt, dass er eben ein echter Dichter ist.
Dann gibt es Menschen, die sich in Gruppen, in Gesellschaften zusammentun, um für immer oder zeitweise in ihrer eigenen Welt, die sie sich aufbauen, zu leben.
Denken Sie an die Rosenkreuzer und Freimaurer, an die Klöster, an das ganze Sekten- und Ordenswesen — — — ja, ich bin so gerecht, nicht einmal die ganz harmlosen Vereine davon auszuschließen.
Aber es gibt noch eine andere Vereinigung, die das noch intensiver und praktischer durchgeführt hat, und dazu gehört auch, dass die andere, die große Welt hiervon überhaupt nichts weiß.
Es gibt eine Gesellschaft, deren Mitglieder sich die Skalden nennen.
Sie wissen, Herr Baron — — Skalden, das waren die ritterlichen Sänger Nordgermaniens, die Vorgänger der romanischen Troubadours.
Diese neuen Skalden nun haben sich an verschiedenen, sehr schwer zugänglichen Punkten der Erde angesiedelt.
Was sie dort treiben, werden Sie später ausführlich erfahren.
Über jede solche Ansiedelung herrscht ein selbstständiger König oder sonstiger Fürst.
Doch es gibt da auch Ausnahmen.
Das heißt, es gibt unter Skalden auch Fürsten ohne Land und Leute.
Ein solcher ist mein Bruder. In seinem bürgerlichen Leben heißt er Loke Klingsor, als Skalde führt er den Namen Bertran de Born, und als Fürst ist er der Fürst des Feuers, weil er dieses beherrscht. Inwiefern, das werden Sie schon später kennen lernen.
Also ein Fürstentum hat der nicht, wohl aber sonst Orte auf der Erde genug, wo er residiert. Auch über genügend Volk gebietet er, um jeden Kampf bestehen zu können.
Mein Bruder ist gewissermaßen der Zigeuner unter den Skaldenfürsten.
Ich, seine Schwester, bin die Prinzess Turandot. Aber ob Sie mich so anreden oder mich Fräulein Klingsor nennen, das ist mir ganz gleich.
Und nun zu Ihnen, Herr Baron.
Da will ich Ihnen sofort eine Frage beantworten, die Ihnen jetzt wohl am meisten auf dem Herzen brennt.
Ja, mein Bruder kann die Zukunft enthüllen. Er ist der einzige Skalde, der dies kann. Es ist seine Eigenart.
Aber denken Sie nun nicht gleich gar zu großartig von dieser Sache. Im Grunde genommen ist es herzlich wenig, was er vom befragten Schicksal erfährt.
Dieses antwortet auf seine Fragen mit Ja oder Nein, und über große Ereignisse, welche welterschütternd wirken, schweigt es ganz. Es sind immer nur Kleinigkeiten, die man erfahren kann. Sie, Herr Baron, können von ihm lernen, wie man das Schicksal befragt. Mein Bruder ist bereit, jeden, der sich dafür interessiert, in sein System einzuweihen.
Aber ich warne Sie! Ich habe es auch einmal lernen wollen.
Und ich bin nicht auf den Kopf gefallen und eine gar gute Rechnerin.
Doch ich sage Ihnen — nur eine einzige Stunde habe ich bei meinem Bruder gehabt, und hinterher ist mir tagelang ganz dämlich im Kopfe gewesen! So kompliziert ist die Rechnerei.
Doch immerhin, einigen praktischen Nutzen weiß mein Bruder schon aus seiner Rechenkunst zu ziehen. Die Sache ist folgende:
Mein Bruder liebt die Prinzess Imogen, die Tochter des Königs von Salamandrien, die aber vom Vater schon dem Herzog von Burgund versprochen ist. Prinzess Imogen hat bereits einen Fluchtversuch gewagt, seitdem wird sie in strengster Gefangenschaft gehalten, es sind Vorsichtsmaßregeln getroffen, die eine Befreiung ganz aussichtslos machen.
Da befragte mein Bruder die Zukunft, zog seine Kreise, denn um ein Ziehen von Kreisen handelt es sich dabei.
Erst ganz, ganz weite Kreise, die immer enger gezogen werden, bis zum Mittelpunkt, da ist die große Frage beantwortet. Wie das gemacht wird, kann auch ich Ihnen erklären, nur jetzt nicht, ein andermal, und die Rechnerei dabei kann Ihnen nur mein Bruder zeigen.
Die erste Frage durfte nicht etwa lauten: Wird die Prinzess Imogen noch einmal meine Frau werden? Auf solche naive Fragen, die nebst Antwort in jedem Punktierbuch stehen, antwortet das Schicksal gar nicht, oder aber — es narrt! Wovor man sich natürlich sehr hüten muss.
Die erste Frage, die mein Bruder stellte, war: Gibt es irgendein Mittel, um die Prinzess Imogen aus ihrer Gefangenschaft zu befreien?
Das Schicksal antwortete mit einem Ja.
Gut! Und nun wurde dem Schicksal weiter Zoll für Zoll auf den Leib gerückt, bis sich nach tagelangem Rechnen ergab, dass dieses Mittel ein Mensch war, ein Mann, der bei Berlin lebte und Professor Doktor Freiherr Karl von Edeling hieß.
Wer war dieser Professor Freiherr von Edeling?
Mein Bruder zog an Ort und Stelle persönlich Erkundigungen ein. Und da erfuhr er, dass Sie soeben bei Sanitätsrat Professor Hartung gewesen waren, und dass der Ihnen nur noch vier Wochen Lebensfrist gegeben hatte.
Wie die Sache aber jetzt liegt, ist gar nicht zu denken, dass Prinzess Imogen schon innerhalb von vier Wochen befreit werden kann.
Also nun befragte mein Bruder das Schicksal auch noch wegen Ihrer Lebenszeit und Ihres Todes. Die waren bereits so eng geworden, dass dies sehr schnell ging.
Und nun, Herr Baron, kann ich Ihnen eine sehr erfreuliche Mitteilung machen: Sie werden erst in Ihrem sechsundachtzigsten Jahre sterben, und zwar sozusagen bei vollster Gesundheit. Das heißt, der Tod wird Sie plötzlich in voller Rüstigkeit überraschen, und noch dazu ein Tod, wie kein Mann, kein echter Mann ihn herrlicher wünschen kann: der Tod auf dem Schlachtfelde. Nun, Herr Baron, ist es Ihnen nicht angenehm, dies zu hören?«
Der blickte zur Decke empor und schüttelte den Kopf.
»Es ist kaum glaublich, kaum glaublich!«
»Zweifeln Sie an der Wahrheit dieser Prophezeiung? Ist nicht alles in Erfüllung gegangen, was Ihnen mein Bruder damals sagte? Denn wie die Kreise nun einmal gezogen waren, konnte das Schicksal gleich noch um andere Kleinigkeiten befragt werden, besonders wegen Ihrer Reise hierher. Hieß der Dampfer, den sie benutzten, nicht ›Prinz Friedrich‹? Kapitän Schumann?
Von diesem Namen hatte mein Bruder noch gar nichts gewusst, das heißt, er hatte sich nicht etwa in Hamburg befragt, sondern das alles hat er erst dem Schicksal abgefragt. Lief der Dampfer nicht am 18. Santa Cruz an? Hat er nicht früh 8 Uhr 23 Minuten dort im Hafen den Anker fallen lassen? Sind Sie nicht von Haifischen umringt gewesen, die Sie aber sonst nicht weiter belästigten?
Wir haben nicht nachgeforscht, ob das alles auch wirklich zutraf, hatten hierzu kaum eine Möglichkeit, aber wir haben an der betreffenden Stelle am Wüstenstrande in der Nacht ein Licht leuchten lassen, weil wir Sie erwarteten, weil wir eben im Voraus ganz bestimmt wussten, dass Sie kommen und vor Erschöpfung zusammenbrechen würden.«
»O, es ist wunderbar, wunderbar!«
»Glauben Sie nun auch daran, dass Sie erst in Ihrem sechsundachtzigsten Jahre einen jähen Tod auf dem Schlachtfeld finden werden? Dass auch diese Prophezeiung in Erfüllung gehen wird?«
»Ich glaube daran!«, erklang es feierlich. »Ich zweifle nicht mehr!«
»Na, das ist schön von Ihnen, Herr Baron«, sagte die Prinzess in ihrem gewöhnlichen Tone, so leichthin, aber dabei immer tiefernst, graziös ihren Fächer spielen lassend.
»Aber nun wieder zu Ihnen, Herr Baron, zu Ihrer allernächsten Zukunft.
Also Sie werden sich nach dem Königreich Salamandrien begeben, das in Tibet liegt, und die Prinzess Imogen befreien.
Aber so schnell geht das nicht, da müssen Sie erst vorbereitet werden.
In den nächsten Tagen allerdings werden Sie sich noch ausruhen. Unsere Ärzte, die Sie bereits untersucht haben, sagen, Sie sollen möglichst viel schlafen, werden dazu ein ganz unschädliches Schlafmittel einbekommen.
Dann geht die Geschichte los. Und innerhalb eines Vierteljahres werde ich aus Ihnen einen Herkules gemacht haben, der mit Zentnergewichten Fangball spielt.
Weshalb sehen Sie mich so ungläubig an? Das halten Sie für unmöglich?
Herr Baron, an Ihnen ist ein Verbrechen begangen worden. Es war ja ganz schön und gut, dass man Sie schon als Kind Ihren gelehrten Neigungen folgen ließ, aber gar so weit hätte man das nicht treiben dürfen.
Jetzt sind Sie ein Skalde, und unter den Skalden gibt es keine Schwächlinge, darf es solche nicht geben. Die körperliche Ausbildung kommt noch vor der geistigen; denn die letztere lässt sich auch noch in späteren Jahren nachholen, die erstere aber nicht mehr.
Bei Ihnen ist es noch nicht zu spät, zumal Sie überhaupt zum Athleten geboren sind. Den geeigneten Körperbau mit allem, was dazu gehört, haben Sie.
Ich kann Ihnen gleich sagen, wie wir das machen. Eine höchst einfache Geschichte, wenn man das Rezept kennt.
Alle Viertelstunden ertönt ein Glockenzeichen. Da nehmen Sie eine Hantel von 25 Pfund und stemmen Sie zehnmal hoch, vom Boden bis über den Kopf. Das nimmt eine halbe Minute in Anspruch, bedeutet auch für Sie gar keine Anstrengung, und dann können Sie sich wieder vierzehn Minuten lang ausruhen.
Wenn Sie das nun täglich zehn Stunden machen, so stemmen Sie täglich hundert Zentner.
Ein Maurer, hat man berechnet, hebt täglich bei normaler Arbeitszeit vierzig bis fünfzig Zentner. Sie leisten also das Doppelte, und noch dazu in ganz anderer Weise, alle Muskeln viel besser durchbildend, ohne jede Überanstrengung.
Nun aber wird dieser Hantel täglich etwas an Gewicht zugefügt. Es ist ganz beträchtlich, und doch merken Sie gar nichts davon. Denn jede Überanstrengung muss absolut vermieden werden. Sie dürfen immer nur spielen.
Und ich versichere Ihnen, Herr Baron: Schon nach einem Monat stemmen Sie mit spielender Leichtigkeit zehnmal einen Zentner! Wir haben da unsere Erfahrung, und eine besondere Ernährung und anderes kommen auch noch dazu. Ferner treiben Sie Fechten, überhaupt ritterliche Übungen aller Art. Das übernehme ich selbst, mein Bruder hat mich dazu bestimmt.
Haben Sie nun sonst noch eine Frage, Herr Baron? Dann beeilen Sie sich. Ich gebe Ihnen nicht mehr lange Zeit. Sie sollen wieder ins Bettchen.«
»Ja, eine Frage liegt mir noch sehr am Herzen«, lächelte der Baron.
»Ihr Herr Bruder sagte mir damals, er belagere eine befestigte Stadt, die im Innern Australiens läge, der Königin von Thule gehörend, er dürfe dabei nur Balliste und Katapulte verwenden, ob ich ihm eine Helepolis bauen könne —«
»Ja, das ist eine ganz merkwürdige Geschichte!«, fiel dem Sprecher die Prinzessin mit außergewöhnlicher Lebhaftigkeit ins Wort. »Also, was Ihnen mein Bruder da sagte, das entspricht der Tatsache. Die Königin von Thule herrscht im Innern Australiens. Sie hat da unter anderem auch eine kolossale Festung gebaut, und vor zwei Jahren forderte sie übermütig den Fürsten des Feuers heraus, diese uneinnehmbare Festung doch zu stürmen, wenn er könnte.
Gut, mein Bruder nahm die Herausforderung natürlich sofort an. Aber hier scheint er seiner Kriegskunst doch einmal zu viel zugetraut zu haben. Seit zwei Jahren schon belagert und berennt er die Festung Thule, er verwendet zum Bombardement hundert der schwersten Wurfmaschinen, es gelingt ihm nicht, irgendwo eine sturmreife Bresche zu legen, und so hat er schon mehr als zehntausend seiner besten Krieger vergebens geopfert, fast die Hälfte des ganzen Belagerungsheeres, während Thule von der Königin Chlorinde nur mit fünftausend Kriegern verteidigt wird, die sogar fortwährend erfolgreiche Ausfälle machen, sodass oft genug mein Bruder sich verteidigen muss.
Also hier scheint die altbewährte, sieggewohnte Kriegskunst meines Bruders einmal kläglich Schiffbruch zu erleiden.
Nun könnten Sie einwenden: Warum befragt er denn nicht das Schicksal, ob es überhaupt möglich ist, die Festung Thule zu erobern?
Gewiss, das kann er.
Wenn das Schicksal aber nun mit einem Nein antwortet? Wenn es ihm niemals gelingen wird, Thule zu erstürmen? Dann soll er also lieber gleich die ganze Sache als hoffnungslos aufgeben?
Nein, mein Bruder wird sich schön hüten, deshalb die Zukunft zu befragen! Thule wird berannt, so lange der Fürst des Feuers noch einen einzigen Mann stellen kann, und als Letzter wird mein Bruder selbst vor den Toren Thules fallen — und damit basta! Oder es kommt eben irgend etwas Unvorhergesehenes dazwischen, was diesem mörderischen Ringen ein Ende macht.
Sonst wird nicht nachgegeben, von keiner Seite!
Denn die Königin Chlorinde ist genau aus demselben Holze geschnitzt oder vielmehr Erz gegossen wie mein Bruder.
Gesetzt aber nun den Fall, Loke hätte dennoch das Schicksal befragt, nach dem Ausgange dieses Kampfes, gleichgültig, wie die Antwort ausfallen würde, er würde die Eroberung doch fortsetzen. Und die Antwort hätte bejahend gelautet. Ja, du wirst Thule noch einnehmen.
Nun hätte natürlich die Frage sehr nahe gelegen: wann und durch was für ein Mittel?
Wie muss ich es machen, diese höllische Festung endlich zu bezwingen?
Nein, das gibt es bei meinem Bruder nun freilich nicht.
Lernen Sie ihn erst kennen, dann werden Sie begreifen, weshalb das bei ihm ganz ausgeschlossen ist.
Magische Künste anwenden, um einen ihm im offenen, ehrlichen Kampfe gegenübertretenden Gegner zu besiegen — das gibt es bei einem Loke Klingsor und einem Bertran de Born nicht!
Deshalb das Schicksal zu befragen, wie die gefangene Prinzessin befreit werden kann, das ist doch wieder etwas ganz anderes!
Da will mein Bruder jemandem helfen, der sich wirklich in Not befindet.
Und doch, das Schicksal sollte von ganz allein ihn auch darauf bringen, wie es möglich sei, die Festung Thule endlich zu erobern. Unbefragt gab das Schicksal eine Antwort — oder doch einen ganz deutlichen Fingerzeig.
Also Sie sollten es sein, der Professor Doktor Freiherr von Edeling, durch den mein Bruder die Geliebte befreien könne.
Mein Bruder zog Erkundigungen über Sie ein. Und da erfuhr er zu seinem grenzenlosen Staunen, dass Sie ein epochemachendes Buch über die Kriegskunst der Alten geschrieben haben, speziell über die Belagerungsmaschinen.
Ja, das war nun freilich ein ganz, ganz merkwürdiges Zusammentreffen!
Und die Sache kam immer noch erstaunlicher.
Ich kann eben nicht schildern, wie bei dieser Methode die Zukunft befragt wird. Kurz und gut, obgleich das Schicksal immer nur mit Ja oder Nein antwortet und obgleich mein Bruder deswegen gar nicht fragte, wurde doch immer deutlicher darauf hingewiesen, dass dieser Professor Baron Edeling auch derjenige sei, durch den die Festung Thule erobert werden würde. Durch eine von ihm konstruierte Wurfmaschine. So, nun wissen Sie es, Herr Baron.«
Der hatte immer wieder staunend den Kopf geschüttelt.
»Da muss ich erst noch einige andere Fragen stellen«, meinte er jetzt.
»Tun Sie es! Einige Zeit gebe ich Ihnen noch.«
»Zehntausend Mann hat Ihr Herr Bruder in diesem Kampfe schon geopfert?«
»Noch viel mehr. Nur die besten seiner Krieger sind da gezählt.«
»Im Innern von Australien?«
»Wie ich sage.«
»Das sind lauter Skalden?«
»Selbstverständlich.«
»Die gar nicht mehr der anderen Menschheit angehören?«
»Nein, die bilden eine geschlossene Welt für sich.«
»Wie viele solcher Skalden gibt es denn da?«
»Na, einige Millionen sind es.«
»Was, einige Millionen?!«, wiederholte der Baron staunend.
»O, lernen Sie erst mal unsere ganze Organisation kennen, da werden Sie noch ganz anders staunen.«
»Ja, aber immerhin — wenn solche mörderische Kämpfe stattfinden — räumen sie denn nicht furchtbar in den Reihen der Skalden auf?«
»Ja natürlich. Die Verluste werden einfach wieder ersetzt. Und nicht nur durch Geburt. Wir werben in der anderen Welt, zu der auch Sie bisher gehörten, immer neue Menschen an, Männer, Frauen und Kinder, natürlich nur solche, die sich für den Skaldenorden eignen. Schwächlinge können wir nicht brauchen. Wir unterhalten überall geheime Agenten, die uns ständig mit neuem geeignetem Menschenmaterial versorgen, alljährlich mit vielen Tausenden.«
»Was? Jährlich mit Tausenden von Menschen?«
»Jawohl.«
»Und das geschieht ganz geheim? Das ist ja gar nicht möglich, dass so etwas geheim gehalten werden kann!«
»Weshalb soll das nicht möglich sein? Oder haben Sie schon einmal etwas davon gehört, dass alljährlich viele tausend Menschen für eine geheime Gesellschaft angeworben werden und spurlos verschwinden?«
»Bitte, erklären Sie mir doch.«
»Das will ich tun. Wenn in einer Stadt von hunderttausend Einwohnern oder in einem Landkreis mit ebenso vielen Bewohnern, jährlich ein einziger Mensch, der weiter keinen Anhang hat, spurlos verschwindet, würde das besonders auffallen? Er macht eine Reise, er hinterlässt niemand, der ihm nachweint, auch keinen Gläubiger, und er kommt nicht wieder — wen kümmert das?«
»Allerdings niemand. Das kommt in jeder Stadt im Jahre sogar mehrmals vor, sie braucht gar keine hunderttausend Einwohner zu haben, und niemand zerbricht sich den Kopf über den Verbleib des Betreffenden.«
»Nun gut. Wie viele Menschen gibt es auf der ganzen Erde?«
»Man schätzt sie auf mindestens rund anderthalb Milliarde.«
»Was ist davon der hunderttausendste Teil?«
»Fünfzehntausend.«
»Na da haben Sie es! Wir können jährlich sogar fünfzehntausend Menschen verschwinden lassen, sie unserm Skaldenorden einverleiben, und ihr Verschwinden fällt gar nicht auf. Wenn wir die geeigneten Menschen aussuchen, denen nicht nachgeweint wird, die keine Verpflichtungen hinterlassen. Familienväter dürfen wir natürlich nicht entführen oder wir müssen auch ihre ganze Sippschaft mitnehmen.
Sie sehen also — — Menschenmaterial übergenug; denn dabei kommt für uns die ganze Erde in Betracht, alle Völkerrassen. Übrigens ergänzen wir uns doch aus unserer eigenen Mitte, und dann sind ja solche menschenmordende Kämpfe und Kriege auch nur Ausnahmen, sind eine Spezialität meines Bruders, wobei er nur wenige Konkurrenten hat, zu denen auch die Königin von Thule gehört.
Sonst geben sich die Skalden friedlichen Beschäftigungen hin, auch mein Bruder. Er sammelt Raritäten und geht auf harmlose Abenteuer aus; er narrt gern die Menschen — die Kriegsspielerei ist ihm nur eine Erholung so nebenbei.«
»Dann verstehe ich nur eins nicht.«
»Und das wäre?«
»Wenn die Skalden nun einmal den Krieg lieben, wobei es Ihnen auf Verluste von Tausenden nicht ankommt, und wenn sie so erfindungsreich sind — weshalb bedienen sie sich beim Bombardement von Festungen nur solcher Schleudermaschinen, wie man sie vor der Erfindung des Schießpulvers und vor Tausenden von Jahren anwandte? Warum benutzen sie nicht Kanonen und noch furchtbarere Geschütze, die sie erfinden?«
»Eben weil die Skalden schon gar so weit in technischen Erfindungen vorgeschritten sind, benutzen sie keine solche Geschütze.«
»Ich verstehe immer noch nicht, jetzt sprechen Sie erst recht in Rätseln.«
»Ich will Ihnen zur Erklärung etwas zeigen. Bitte geben Sie mir mal dort von dem Sims das kleine Schild her.«
Die Hand deutete, der Baron sah und holte es.
Es war ein kleines Schild von etwa zehn Zentimeter Höhe und einem Zentimeter Dicke, zeigte in vertiefter Gravierung eine Kampfesszene, konnte aufrecht hingestellt werden.
»Aus was für einer Masse besteht dieses Schild?«
»Ich halte es für Eisen.«
»Ja, es ist bestes Schmiedeeisen. Oder vielleicht sogar Stahl. Gleichgültig. Jedenfalls merken Sie doch, dass es nicht etwa aus Pappe besteht. Nun legen Sie das Ding auf das Sofa — so — und hier nehmen Sie meine Nadel —«
Sie zog diese aus ihrem Haar, reichte sie dem Baron.
»Sehen Sie sich vor! Das Ding ist sehr spitz. Denken Sie lieber, die Spitze sei vergiftet, obgleich es nicht der Fall ist. Nun setzen Sie diese Nadelspitze auf das Eisenschild, drücken Sie etwas —«
Da war es schon geschehen.
Eben hatte der Professor erst auf die aufgesetzte Nadel drücken wollen, als der dünne Stahl schon durch das Schild gefahren war und noch tief in das Sofapolster hinein.
»Wie ist das möglich?!«, staunte der Professor. »Ist das Schild gar nicht aus Eisen, sondern —«
»O ja, das ist aus hartem Schmiedeeisen, das müssen Sie mir glauben. Weshalb aber kann man mit einem Stück Holz in Butter stechen? Weil das Holz härter ist als die Butter. Und einen spitzen Nagel kann man auch in einen Stein treiben, der härter ist als Eisen. Herr Baron, haben Sie schon einmal die Spitze der feinsten Nähnadel sich unter dem Mikroskop betrachtet?«
»Ja, und ich weiß, was Sie meinen: Man sieht immer nur einen abgerundeten Kegel.«
»Haben Sie einmal unter dem Mikroskop den Stachel einer Wespe gesehen?«
»Ja, und da sieht man auch in der stärksten Vergrößerung immer eine ideale Spitze.«
»Ist es uns möglich, solch eine ideale Spitze zu fertigen?«
»Nein, es bleibt immer bei dem abgerundeten Kegel, das beweist eben die feinste Nähnadel.«
»Glauben Sie, dass es der Wespe möglich wäre, wenn sie einen genügend harten Stachel hätte, selbst in Eisen hineinzustechen?«
»Das wäre nicht nur möglich, sondern das müsste dann so sein.«
»Nun, unsere Schmiede verstehen die Kunst, solch eine ideale Spitze herzustellen, die auch in der stärksten Vergrößerung immer noch in endloser Verjüngung verläuft.
Und das geschieht bei einem Metall, das noch dreimal so hart ist wie der Diamant oder doch so gehärtet werden kann.
Sie haben hier gesehen, was nun mit solch einer Spitze zu machen ist. Die Nadel durchsticht die dicke Eisenplatte, als bestände sie aus Butter.
Unter dem Mikroskop gleicht die Schneide auch des besten und schärfsten Rasiermessers einer gezackten Säge.
Wir aber verstehen ein Messer anzufertigen, dessen Schneide auch in zehntausendfacher Vergrößerung nicht die geringste Lücke aufweist. Und zwar eben aus jenem ungeheuer harten Metall. Die Folge davon ist, dass wir mit solch einem Messer einen Eisen- oder selbst den bestgehärteten Stahlstab wie einen Bleistift schnipseln können.
Und solcher technischer und chemischer und physikalischer Erfindungen, von denen die Menschheit noch nicht einmal etwas ahnt, haben wir noch zahllose, wir sind eben der anderen Welt um viele Jahrhunderte vorausgeeilt.
Ja, wir können Feuergeschütze herstellen, gegen welche die heutigen die reinen Kinderspielzeuge sind.
Aber uns fällt es gar nicht ein, solche mörderische Kanonen und ähnliche Waffen zu benutzen, deshalb fabrizieren wir sie gar nicht erst.
Wir Skalden führen untereinander keine Kriege, die dem Sieger irgendeinen Vorteil, dem Besiegten einen Nachteil bringen.
Unsere Kriege und Schlachten sind nichts weiter als ritterliche Turniere, freilich im großartigsten Maßstabe.
Und allerdings auch blutig genug. Aber das waren die Turniere im Mittelalter doch auch.
Wie wir über den Tod denken, darüber ein andermal, jetzt würde es zu weit führen.
Jedenfalls also sind unsere Kriege und Kämpfe durchaus ritterlich.
Wir kämpfen mit keinem Gegner, der schon erschöpft ist.
Erst muss er sich wieder erholen und stärken, sonst wird seine neue Herausforderung nicht angenommen.
Wir hungern keine belagerte Stadt aus, schneiden ihr nicht das Wasser ab.
So benutzen wir auch keine Feuerwaffen, weder Geschütze noch Gewehre.
Denn, wie gesagt, da könnten wir Kriegsmaschinen liefern, von deren fürchterlicher Wirkung Sie sich gar keine Vorstellung machen können.
Also da ist ein Gesetz geschaffen worden: Alle durch Explosionskraft betriebenen Geschütze und Handwaffen sind ein für alle Mal verboten!
So dürfen wir uns nur der Wurf- und Schleudermaschinen bedienen, der Katapulte, Ballisten und so weiter.
Auch die pneumatischen Geschütze beruhen auf Explosionskraft.
Wir kennen nur Armbrust und Pfeil und Bogen.
Gegen diese durch Schnellkraft getriebenen Geschosse dürfen wir uns schützen.
Also wir tragen im Kampfe Panzer.
Wenn wir diese aber nun aus jenem Metall herstellen, das noch dazu überaus leicht ist? Was nützen dann Bolzen und Pfeile? Dann sind wir doch vollkommen unverwundbar.
Oder wenn wir nun anderseits diese Bolzen und Pfeile wie die Schwerter und Streitäxte auch wieder aus jenem unermesslich harten Metall herstellen, das sich zur idealsten Spitze und Schneide ausziehen lässt?
Sie merken wohl, Herr Baron: Das würde bei uns genau dasselbe Wettrüsten werden wie unter den Staaten in Ihrer Welt.
Es wäre ein ewiger Wettkampf wie zwischen Panzergranate und Panzerplatte.
Dies haben wir bei uns zu verhindern gewusst. In unseren Kriegen und Kämpfen dürfen wir derartige Erfindungen überhaupt nicht verwerten, keine einzige!
Wir dürfen für unsere Waffen und Schutzmittel kein anderes Eisen und keinen anderen Stahl und kein sonstiges Metall verwenden, als was man auch in Europa kennt und gegenwärtig herstellt.
Ich betone ausdrücklich: Europa und gegenwärtig! Denn man hat früher, besonders in Indien, Schuppenpanzer und dergleichen hergestellt, deren Härte der heutigen Welt gar nicht mehr begreiflich ist.
Und so hüten auch heute noch besonders die japanischen Waffenschmiede ein Geheimnis der Erzeugung eines Stahls, welcher noch den der alten Damaszenerklingen übertrifft, die heute ja auch schon nicht mehr nachgeahmt werden können. Das Rezept zu dieser Stahlbereitung ist wieder verloren gegangen.
Freilich kosten solche indischen Schuppenpanzer und solche japanische Schwerter auch ein immenses Geld, wenn sie überhaupt zu haben sind, weil sie sich meist in Händen von Fürsten oder von reichen Sammlern oder gar in heiligen Klöstern befinden.
Um aber nun bei uns Skalden jede Möglichkeit abzuschneiden, dass sich ein Anführer und Vorkämpfer besser schützen kann als ein gewöhnlicher Krieger oder dass er durch gefährlichere Hieb- und Stichwaffen einen Vorteil hat, sind auch solche alte Waffen verboten.
Es dürfen nur Schutz- und Trutzwaffen sein, die noch heute innerhalb Europas von jedem geschickten Waffenschmied gefertigt werden können, wenn wir dies auch selbst besorgen.
Der Skalde, der sich im Kampfe irgendeiner Waffe aus MansaMetall bedient, wie es nach seinem Erfinder benannt worden ist, wird sehr hart bestraft, sehr häufig sogar mit dem Tode.
Und aus demselben Grunde sind also nur Katapulte, Ballisten und andere Schleudermaschinen erlaubt. In Bezug auf Größe sind uns da keine Vorschriften gemacht, wir dürfen auch Verbesserungen anbringen, neue Erfindungen — nur kein Pulver und dergleichen, also auch keine komprimierte Luft verwenden. Das ist alles explosiv.
Und eine solche neuartige Schleudermaschine werden Sie uns liefern, die endlich ermöglichen wird, in die furchtbaren Mauern der Festung Thule Bresche zu legen, sodass sie gestürmt werden kann. So hat das Schicksal meinem Bruder offenbart. Sonst noch etwas, Herr Baron?«
Der hatte in letzter Zeit, mit so großem Interesse er dem allem auch gelauscht, immer ein an der Wand hängendes Bild betrachtet, dabei aber manchmal auch vergleichend nach der Prinzessin blickend.
Es war das bekannte Bild, der Mann mit den Teufelsaugen, im Lehnstuhl, auf der Schulter die schwarze Katze, im Hintergrunde die Abnormitäten, zur Seite das Rauchfass, genau dasselbe Bild, das sich im Besitze Mister Samuel Philipps befand, hier nur bedeutend größer, wohl einen Meter hoch und nur wenig schmaler.
»Verzeihen Sie — ist das dort vielleicht Ihr Herr Bruder?«
»Jawohl, das ist er.«
»Ich habe es gleich an der ganz auffallenden Ähnlichkeit mit Ihnen erkannt. Nur vermisse ich bei Ihrem Herrn Bruder den japanischen Typus, das ist mehr ein indischer —«
»Waas??!! Was haben Sie da gesagt?!«
So hatte die Prinzess gerufen, sich dabei aufrichtend, und dann fuhr sie mit unnachahmlichem Stolze fort:
»Wir beide, mein Bruder und ich, wir sind Isländer, aber keine dänischen, sondern norwegische, wir sind echte Germanen!«
Der Professor war höchlichst bestürzt über das, was er da angerichtet hatte, merkte aber sehr schnell, dass die Prinzessin die Sache gar nicht so tragisch nahm, sie markierte nur ihre Entrüstung und ihren Stolz.
Und sie winkte denn auch gleich wieder ab, wieder in einer Weise, dass man den Humor sofort merkte, und so fuhr sie fort:
»Ich verzeihe Ihnen, Herr Baron; denn Ihr Irrtum ist sehr begreiflich. Erstens heiße ich Turandot — Sie wissen doch, Shakespeares chinesische Prinzessin — zweitens trage ich gegenwärtig ein japanisches Kostüm und eine chinesische Haarfrisur, und drittens sehe ich eben wirklich mehr einer Japanerin oder Inderin als einer germanischen Norwegerin ähnlich.
Ich will Ihnen sagen, wie dies alles gekommen ist. Unser Vater, Sturle Klingsor, war tatsächlich ein norwegischer Isländer und das Bild eines germanischen Hünen, mehr als sieben Fuß hoch, ein blonder, mähnenumwallter Löwenkopf mit mächtigen, blauen Augen, überhaupt ein bildschöner Mann.
Aber er beging den Fehler, eine Inderin zu heiraten, die wahrscheinlich etwas japanisches Blut in ihren Adern hatte.
Die Zeit kam, da der junge Gatte die ersten Vaterfreuden genießen sollte.
Mein Bruder wurde geboren.
Au weh!
Die Sache war richtig schief gegangen.
Mein Vater hatte doch immer auf einen blondlockigen Germanensprössling von reichlich zehn Pfund gehofft, nun erschien da so ein kleiner schwarzer Popanz.
Na, die Sache war nicht mehr zu ändern, mein Vater machte gute Miene zum bösen Spiele, und wie er's sich nun einmal vorgenommen hatte, gab er dem kleinen schwarzen Popanz den germanischen Götternamen Loke, was schließlich insofern Berechtigung hatte, als die Geburt in einem Feuertempel stattfand, in dem geweiht wurde. So ist er denn tatsächlich ein Fürst, ein Beherrscher des Feuers geworden.
Die Jahre vergingen, dann kam für Frau Klingsor nochmals eine schwere Stunde.
Der Mann, der zum zweiten Male Vater werden sollte, verstand auch etwas von Zukunftsberechnung und so hatte er herausgefunden, dass es diesmal ein Mädel werden würde.
›Famos!‹, hatte er da gesagt. ›Dann wird es diesmal eine blondlockige Germanin; denn abermals solch ein schwarzer Balg, das ist doch ganz ausgeschlossen. Mädchen geraten überhaupt immer nach dem Vater, Jungen nach der Mutter. Wenigstens soll es so sein, wenn es nach dem ordentlichen Laufe der Natur geht, wie Arthur Schopenhauer sogar logisch bewiesen hat, und bei mir ist alles ganz ordentlich zugegangen. So wird der Name dieses Mädchens Freya sein, nach der Göttin des heiligen Herdfeuers.‹
Die Stunde kam.
Ich erblickte das Licht der Welt, und mein Vater mich.
Ach, dieser Schreck, diese grenzenlose Enttäuschung! ›Was?‹, hat er da geschrien. ›Die und eine germanische Freya?! Turandot soll das schwarze Ding heißen!‹
Sehen Sie, Herr Baron, so ist die Geschichte gewesen, so bin ich zu dem chinesischen Namen gekommen.«
Die Sprecherin schwieg. Und der Professor wandte sich schnell ab, um der Prinzess nicht ins Gesicht zu lachen.
Denn dies alles war gar zu drollig hervorgebracht worden, immer jedoch mit dem tiefsten Ernst erzählt.
Die Prinzess achtete nicht auf Edelings krampfhaftes Bemühen, seine Lachlust zu beherrschen, sie tat etwas, was dem Baron das Lachen gleich vergehen ließ.
Sie zog den Pfeil, den sie schon längst wieder ins Haar gesteckt hatte, nochmals heraus, griff mit der Hand in die nestartige Haarfrisur, brachte eine Zigarette zum Vorschein, nahm sie zwischen die korallenroten Lippen, näherte dem Ende die Flamme aus rotem Stein, die also den Griff der Nadel bildete, zog, und da ward dieser Stein eine wirkliche Flamme, die Zigarette brannte.
Das Staunen des Professors lässt sich denken, zumal er ganz deutlich gesehen zu haben glaubte, wie sich die rote Stein- oder Glasflamme, die sich wieder an dem blauschwarzen Haar befand, züngelnd bewegt hatte.
Und gleich darauf sah er etwas anderes, zwar nicht gerade Wunderbares, aber doch etwas, was seine Aufmerksamkeit auch noch weiter fesselte.
Die Prinzess hatte nach einigem leichten Paffen einen tiefen Zug getan, spitzte das Mündchen in besonderer Weise, und so blies sie einen großen, dicken Rauchring vor sich hin, der in ziemlich vollendeter Form in der Luft stehen blieb.
Gleich darauf schickte sie ihm einen zweiten, etwas kleineren Ring nach, der durch den ersten hindurchging und ebenfalls stehen blieb, und dann folgte ein dritter, wieder etwas kleinerer, der durch die beiden ersten Ringe ging.
Der Professor hatte zwar noch keinen professionellen Rauchkünstler gesehen, aber doch schon solche geschickte Ringeblaserei — der ernste Gelehrte hatte niemals für derartige Spielereien Interesse gehabt.
Jetzt amüsierte er sich nur über das reizende Karpfenschnutchen und stand im Übrigen noch unter dem Einfluss jener lebendig gewordenen Steinflamme.
Die Prinzess, zum weiteren Ringblasen bereit, schielte einmal nach ihm, und da zuckte es ganz eigentümlich in ihrem Gesicht, sie schickte keinen vierten Ring nach, sondern streckte die Hand aus und schien den ersten in der Luft schwebenden Ring zu ergreifen.
Aber bei dem »Schein« blieb es nicht. Sie fasste diesen Ring wirklich, aber da konnte das plötzlich nicht mehr ein luftiger Rauchring sein, sondern musste zweifellos aus einer festen Masse bestehen, das war sofort zu erkennen.
Diesen festen Ring näherte sie nun dem zweiten Rauchringe, in horizontaler Lage, zog ihn vorsichtig hindurch, und da fiel dieser zweite Rauchring klappernd in den ersten hinein, beide hingen zusammen.
Jetzt fasste sie diesen zweiten festen Ring, näherte ihn in derselben Weise dem dritten, fuhr hindurch, und auch dieser dritte fiel aus der Luft klappernd in den zweiten; drei feste Ringe hingen als eine Kette zusammen.
»Da haben Sie die Bescherung. Und ich will Ihnen gleich auf Ehrenwort versichern, dass diese Zigarette nicht etwa präpariert ist. Es ist eine ganz gewöhnliche, ich kann dasselbe mit jeder anderen Zigarette oder Zigarre machen.«
Indem sie das sagte, hatte sie dem Professor die Kette zugeworfen; er hatte sie genommen.
Die Ringe waren ziemlich vollkommen, bestanden aus einer zwar sehr leichten, aber durchaus nicht porösen Masse, die hart und fest zu sein schien, nicht mit dem Fingernagel zu ritzen.
»Ja, wie haben Sie denn das gemacht?«
Er erhielt sofort die Erklärung, wenn auch nicht die erhoffte.
»Ich bin Gauklerin, und zwar bin ich, abgesehen von der üblichen Akrobatik, hauptsächlich für Kunststücke mit Feuer und Rauch ausgebildet worden. Was ich da leisten kann, werde ich Ihnen später noch zeigen, wenn ich mich da auch nicht mit meinem Bruder vergleichen kann, der mit einem Atemzuge ganze Gruppen von Menschen und Tieren bläst und ihnen dann durch weitere Blaserei auch noch vollständiges Leben verleiht.
Dabei kommt außer Geschicklichkeit freilich auch noch anderes in Betracht. Diese Erstarrung des Rauches zu einer festen Masse beruht auf einem chemischphysikalischen Naturgesetz, das wir auszunutzen verstehen, während die andere Welt noch gar nichts davon weiß.
Es ist überhaupt eine ganz eigentümliche Sache dabei. Wir arbeiten nach Belieben auf verschiedenen Devanchans.
Aber wie soll ich Ihnen nun erklären, was wir hier herunter verstehen, was das ist.
Nun — es sind verschiedene Kraftfelder, die wir erzeugen können — aber nicht etwa auf magische Weise, sondern es ist alles rein physikalisch. Sie sehen schon, das ist wiederum keine genügende Erklärung für Sie. Hierüber werden Sie später einmal von anderer, berufener Seite einen erläuternden Vertrag zu hören bekommen.
Im Übrigen ist mir jetzt gar nicht erlaubt, Ihnen solche Gaukeleien vorzuführen, es ist mir sogar streng verboten worden. Ich habe mich nur einmal hinreißen lassen, weil Sie schon so ein erstauntes Gesicht machten, als ich mir vorhin die Zigarette anbrannte. Sie sollen jetzt noch einmal schlafen. Man flößt Ihnen dazu ein Tränklein ein, ein ganz harmloses, das aber nur wirkt, wenn Sie nicht aufgeregt sind, sonst könnten Sie Teufelszeug träumen oder Sie würden überhaupt nicht einschlafen. Man hat Ihnen auch künstlich den Appetit genommen, Sie sollen erst eine kleine Hungerkur durchmachen —«
Ein Glockenton erscholl.
»Ja, das war das erste Zeichen! Wir sollen unsere Unterhaltung abbrechen. Beim zweiten Glockenzeichen müssen Sie hinüber, dann werden Sie noch einmal von zwei Ärzten gründlich untersucht. Haben Sie erst noch eine Frage?«
»Ja. Wo befinde ich mich hier eigentlich?«
»Herr Baron, das ist eine Frage, die ich Ihnen noch nicht beantworten darf! Sie könnten nämlich, wenn Sie die Wahrheit erfahren, vor Staunen außer sich geraten, sodass Sie dann keinen Schlaf finden.
Jetzt bloß noch eins, Herr Baron, ehe ich Sie entlasse.
Sie sind jetzt schon ein Skalde, einer der Unsrigen. Ich kenne Ihr bisheriges Leben, und ich darf Ihnen versichern, dass Sie nun ein neues Dasein beginnen werden, wie Sie es sich herrlicher gar nicht denken können.
Sie kommen in eine Ihnen ganz fremde Welt der Wunder und Geheimnisse, die Sie nach und nach ergründen werden, teils allein, teils in meiner Gesellschaft, als mein Knappe und Ritter, und auch mein Bruder wird Sie wohl viel auf seine abenteuerlichen Fahrten mitnehmen, Sie werden wunderbare Erlebnisse —«
Der zweite Glockenton erscholl.
»Nun ist's vorbei. Jetzt marsch hinüber in Ihr Bettchen!«
Aber es sollte doch noch ein anderer Abschied stattfinden.
Plötzlich ging über diese sonst so ernsten, etwas herben Züge ein reizendes Lächeln, welches das ganze Gesicht verschönte.
So reichte sie ihm die Hand.
Und da erlebte der junge Gelehrte abermals ein Wunder.
Diese kleine, schöne und doch so von Muskeln und Sehnen starrende Hand, deren stählerne Härte man sozusagen mit den Augen fühlte, lag plötzlich ganz weich in der seinen.
So, Herr Rechtsanwalt, nun können wir über den Golem sprechen.« Die streichelnde Hand lockte knisternde Funken aus dem schwarzen Felle der Riesenkatze, und dann sprang diese auf die rechte Schulter ihres Herrn, um sich dort in ihrer gewöhnlichen Positur mit untergeschlagenen Pfoten niederzulassen, und er legte ein Bein übers andere, faltete im Schoße die Hände mit langgestreckten Fingern zusammen — und so war wieder das alte Bild fertig! Nur dass er statt der Samtjacke einen schwarzen Gehrock trug.
Es lässt sich denken, wie dem Rechtsanwalt zumute war. Er musste alle Energie aufbieten, um nicht in die Rolle des Schulknaben zu verfallen, der ob der Vorführungen eines Zauberkünstlers Maul und Nase aufsperrt.
Das aber gelang ihm, und da war er wieder der ganz nüchtern denkende Rechtsanwalt.
»Also diese Katze ist auch ein Golem«, eröffnete er jetzt seinerseits die Unterhaltung.
»Ja, mein Luzifer ist ebenfalls ein Golem«, bestätigte die volle Bruststimme.
»Luzifer heißt das Tier?«
»Luzifer!«
»Eine sehr eigentümliche Katze.«
»Ist sie.«
»Mister Klingsor, es ist nicht dieselbe Katze, die Sie vorhin verbrannt haben.«
»Sie dürfen das glauben oder nicht, ganz nach Belieben.
Es steht Ihnen frei, sich dies nach Gutdünken zu erklären, ich verweigere jede Auskunft. Herr Rechtsanwalt Iron: Ich wiederhole hiermit meine Frage: Was fordern Sie für die silberne Kapsel mit der Glaskugel, die Sie von dem sogenannten Wunder-Rabbi Ebn Ezer erhalten haben?«
Rechtsanwalt Iron war nicht geneigt, dieses Geschäft so schnell abzuschließen; er wurde sozusagen zum Untersuchungsrichter, der durch geschickte Fragen den Angeklagten oder einer strafbaren Tat Verdächtigen zu einer ungewolltem Aussage verlocken muss.
»Diese silberne Kapsel mit der Glaskugel ist ein Golem?«
»So hat Ihnen doch der Rabbi gesagt, und ich will seinen Worten nicht widersprechen.«
»Was ist ein Golem?«
»Hierüber verweigere ich Ihnen jede Auskunft. Holen Sie sich diese anderswo ein, wie Sie doch auch schon getan haben.«
»Ein Golem ist ein Zaubermittel, mittels dessen einer toten Figur scheinbares Leben verliehen werden kann, oder die Figur selbst wird Golem genannt.«
»Diese Definition stimmt.«
»Ich glaube nicht an so etwas.«
»Das steht in Ihrem Belieben.«
»Allerdings habe ich mit der silbernen Kapsel schon Seltsames erlebt, das muss ich bekennen.«
»Ich weiß es.«
»Was habe ich mit dem Golem erlebt?«
»Das wissen Sie doch besser als ich.«
Da der rätselhafte Mann, der übrigens bei aller seiner Kürze sehr höflich war, nicht aus seiner Reserve herausgehen wollte, so wollte der Rechtsanwalt es tun; er hielt es zunächst für das Beste, um jenen gesprächig zu machen.
»Ich hatte die Kapsel auf meinen Schreibtisch gelegt. Dort lag sie noch am anderen Morgen. Ich stand gerade am Telefon, da hörte ich hinter mir einen eigentümlichen Ton, wie den vollen Akkord einer Harfe.
Ich wandte mich um, konnte die Ursache des Tones nicht ergründen. Da wiederholte er sich, diesmal noch stärker. Gleich darauf erfolgte ein leiser Knacks, und da sah ich, wie die auf dem Schreibtisch liegende Kapsel aufsprang.
Ich hatte Ihren Rat, den sogenannten Golem nicht der Sonne oder Wärme auszusetzen, sondern ihn möglichst kühl aufzubewahren, nicht befolgt, hatte überhaupt gar nicht daran gedacht, dass die Kapsel auf dem Schreibtische am Morgen der Sonne ausgesetzt sein würde, wiederum hätte ich dies doch noch absichtlich getan, trotz Ihrer Warnung, dass der durch die Sonne erwärmte Golem Unglück über mich bringen würde.
Also auf den Schreibtisch schien die Sonne. Ihr erster Strahl hatte die Kapsel erreicht, vielleicht schon einige Zeit auf ihr geruht, und da sah ich sie, die doch auch zweifellos diese Harfenakkorde von sich gegeben hatte, aufspringen.
Eine runde, weiße Masse quoll hervor, eine Kugel, immer mehr anschwellend, bis zur Größe eines Kürbisses. Oder, genauer bestimmt, wie ich dann gewissenhaft nachgemessen habe, elf Zoll im Durchmesser haltend, was schon ein recht stattlicher Kürbis ist.
Die erbsengroße Kugel hatte unter dem Einfluss der erwärmenden Sonnenstrahlen diese Größe angenommen.
Im Schatten schrumpfte dann die große Kugel wieder bis zur Erbsengröße zusammen.
Ich habe dasselbe Experiment oft genug angestellt, und es war immer dasselbe.
Wenn die silberne Kapsel den Sonnenstrahlen ausgesetzt wird, so gibt sie nach einiger Zeit einen eigentümlichen Akkordton von sich, dem bald ein zweiter folgt, dann springt sie auf, die weiße Kugel quillt heraus.
Dasselbe findet statt, wenn die kleine Kugel von Anfang an direkt in die Sonne gelegt wird. Nur fallen dann die beiden Töne fort.
Diese entstehen jedenfalls dadurch, dass zuerst die eingeschlossene Kugel die innere Umhüllung der Kapsel berührt, und dann durch das Aufspringen. Dadurch mag die dünne Wandung der Kapsel in Schwingungen geraten, so entstehen diese Töne.
Sehr merkwürdig allerdings, aber es lässt sich doch alles auf natürliche Weise erklären.
Künstliche Wärme übt auf Kapsel und Kugel keine Wirkung aus.
Ich habe sie am Ofen erwärmt und über direktem Feuer erhitzt.
Die Kapsel springt nicht auf, die Kugel schwillt nicht an.
Und doch, eine Wirkung scheint diese künstliche Erwärmung zu haben, eine schädliche, sodass Sie ganz recht hatten, als Sie mich baten, den Golem möglichst kühl aufzubewahren.
Wenn ich die Kapsel künstlich erwärmt oder gar erhitzt habe, so dauerte es dann immer viel länger, ehe sie in den Sonnenstrahlen wieder aufsprang, der Akkord war nur schwach, die Kugel schwoll nur langsam an und erreichte nie die frühere Größe.
Aber das bessert sich mit der Zeit, wenn man Kapsel und Kugel wieder häufig den Sonnenstrahlen aussetzt.
Die Wärme der Sonne scheint dabei keine Rolle zu spielen. Es hängt wohl mehr von der Intensität der Strahlen, das heißt von der Reinheit der Atmosphäre ab.
An einem kühlen, aber wunderbar klaren Morgen erreichte die Kugel in der Sonnenbelichtung die größte Ausdehnung, die sie je angenommen hatte: fast eine ganze Elle im Durchmesser, obgleich ich sie kurz vorher der Feuerhitze ausgesetzt hatte; einige Zeit später brachte ich die Kugel in die glühende Mittagssonne, aber die Atmosphäre war schwül, diesig, voller Staub, und infolgedessen schwoll die Kugel nur wie eine Apfelsine an.
Das sind die Erfahrungen, die ich innerhalb drei Wochen mit diesem sogenannten Golem des Wunder-Rabbis gemacht habe.«
Der Mann mit den Teufelsaugen hatte aufmerksam zugehört und mehrmals genickt.
»Haben Sie die Kugel sonst wie untersucht oder untersuchen lassen?«
»Ja. Ich befragte einmal den Professor Ramsey, den berühmten Physiker, meinen Freund. Er hielt die Kugel erst für Glas, musste dann aber seinen Irrtum eingestehen. Es ist eine ganz besondere Masse, die eben unter dem Sonnenlichte außerordentlich ausdehnungsfähig ist.
Um sie zu analysieren, hätte er die Kugel zerstören müssen, das wollte ich nicht. So habe ich die Sache vorläufig auf sich beruhen lassen. Ich habe Ihre versprochene Ankunft erwartet.«
»Und jetzt bin ich hier. Herr Rechtsanwalt Maximus Iron! Ich habe Ihnen damals für diesen Golem drei Tage aus meinem Leben angeboten. Das muss ich natürlich aufrecht erhalten. Nehmen Sie dieses Angebot an?«
»Ja, Herr — wer sind Sie denn eigentlich? — soll ich denn nur mit Ihren drei Lebenstagen?«
»Ich frage Sie: Nehmen Sie mein Angebot an? Ja oder nein!«
»Nein!«
»Gut. Dann bin ich also davon entbunden und mache Ihnen ein neues. Erst aber gestatten Sie mir eine Frage: Sie haben Ihre Praxis aufgegeben, Herr Rechtsanwalt?«
»Ja, ich habe sie meinem Kompagnon abgetreten, mit dem zusammen ich die letzten Jahre gearbeitet habe. Ich will mich zur Ruhe setzen. Soeben bin ich von einer Reise zurückgekommen, auf der ich meine letzten Verpflichtungen gelöst habe.«
»So hören Sie mein neues Angebot: Treten Sie ganz in meine Dienste.«
Der Rechtsanwalt hielt es wiederum für das Beste, scheinbar auf alles einzugehen, um erst mal Weiteres zu hören.
»Als was denn?«
»Als mein Diener.«
»Und was hätte ich denn da zu tun?«
»Das, was ich Ihnen befehle.«
»Das ist etwas sehr undeutlich.«
»Mehr erfahren Sie nicht.«
»Und auf wie lange?«
»Zeit Ihres Lebens.«
»So, Zeit meines Lebens. Und dafür, dass ich Ihnen Zeit meines Lebens Dienste leiste, soll ich Ihnen auch noch den Golem ausliefern? Das verstehe ich wirklich nicht.«
»Und doch ist alles ganz logisch. Der Unterschied zwischen meinem früheren und meinem jetzigen Angebot ist nur der, dass ich nicht mehr drei Tage zu Ihnen, sondern dass Sie vorläufig drei Tage zu mir kommen. Gefällt es Ihnen während dieser Zeit so gut bei mir, dass sie für immer bleiben möchten, so haben Sie mir den Golem zu geben. Wenn nicht, nun, so können Sie eben gehen, ich muss auf den Golem verzichten. Aber ich werde schon dafür sorgen, dass es Ihnen bei mir gefällt. Fassen Sie auch nicht falsch auf, als ich vorhin sagte, Sie würden mein Diener sein. Ich bin ein Fürst. Ich würde Sie schon einen Ihren Fähigkeiten entsprechenden Rang bekleiden lassen.«
»Wo ist denn das Fürstentum, über welches Sie herrschen?«
»Das werden Sie schon sehen.«
»Wie kommen wir dorthin?«
»Das erfahren Sie alles, nachdem Sie mir den Golem ausgeliefert haben. Erst muss ich da Ihre bindende Zusage haben.«
»Ja, Herr, Sie verlangen wirklich viel von mir! Ich soll mich Ihnen blindlings anvertrauen, ohne die geringste Bürgschaft dafür zu haben, dass auch Sie Ihre Verpflichtungen erfüllen. Oder können Sie mir diese geben?«
»Nein. Sie müssen mir unbedingt vertrauen.«
»Wollen Sie mir nicht wenigstens sagen, was für eine Bewandtnis es mit diesem sogenannten Golem hat? Was Sie damit anfangen können?«
»Nein. Das bleibt mein Geheimnis.«
»Für mich ist der Golem vollständig nutzlos?«
»So ist es. Oder haben Sie schon irgendeinen Vorteil von ihm gehabt? Haben Sie irgend etwas damit erzielen können?«
»Das allerdings nicht. Aber das Unheil, das mich treffen sollte, falls ich die Kapsel nicht vor Sonne und Wärme schütze, ist auch noch nicht über mich gekommen.«
»Sprechen Sie nicht so! Vielleicht bereitet sich dieses Unheil schon vor!«
»Ich bin bereit, es zu erwarten. Wollen Sie mir nicht eine Probe davon geben, was mit diesem Golem in Ihrer Hand zu machen ist?«
»Nicht jetzt. Aber etwas anderes will ich Ihnen vormachen.«
»Bitte, tun Sie es.«
Zum ersten Male rührte sich der Mann mit den Teufelsaugen in seinem Lehnstuhl, löste den Beinüberschlag, faltete die Hände auseinander; sofort erhob sich die Katze und sprang ihm in den Arm, er nahm sie, steckte sie in den Koffer, schloss diesen, erhob sich, trug ihn zu dem offenen Fenster, stellte ihn auf das breite Brett, kehrte zurück zu dem Stuhl, setzte sich wieder, aber ohne diesmal seine beliebte Stellung einzunehmen.
»Wollen Sie einmal in diesen Spiegel blicken?«
Er griff in die Brusttasche, zog einen kreisrunden Spiegel hervor, ohne Handgriff, etwa zehn Zentimeter im Durchmesser, gleichzeitig ein seidenes Tüchlein, wischte einmal über das Glas, steckte das Tuch zurück und legte seine rechte Hand mit dem Spiegel vor sich auf seine Knie.
»Herr Rechtsanwalt Iron«, sagte die volle Bruststimme bedächtig und doch so bestimmt wie immer, »wollen Sie einmal in diesen Spiegel blicken.«
Mister Iron tat es, musste sich dazu etwas vor und herab beugen.
Es war ein recht merkwürdiger Spiegel! Also kreisrund, mit einer schwarzen Einfassung, die mit lauter kleinen menschlichen Augen besetzt war, etwa von Erbsengroße.
Diese Augen schienen aus weißen Steinen zu bestehen, die Iris war rot, und zwar aus kleinen roten Steinchen zusammengesetzt, die ein außerordentliches Feuer ausstrahlten, vielleicht Rubine, und die Pupille bestand wieder aus einem schwarzen Steinchen, das ungemein funkelte, sodass er an schwarze Diamanten denken musste.
Eine ganz eigentümliche Wirkung trat ein, wenn man so auf dieses sonst gewöhnliche Spiegelglas schaute. Es war dem Rechtsanwalt, als seien viele Dutzende von kleinen menschlichen Augen starr auf ihn gerichtet. Es sei jedoch gleich bemerkt, dass der Rechtsanwalt nicht etwa einem faszinierenden oder hypnotisierenden Einflusse erlag, wie er sofort konstatierte, eben weil auch er gleich hieran dachte.
Er konnte mit ganz klarer Besinnung in den Spiegel blicken, jetzt und immerdar.
»Was sehen Sie, Herr Rechtsanwalt?«
»Nun, ich sehe eben mein Gesicht.«
»Es ist ein gewöhnlicher ebener Spiegel?«
»Jawohl, mir fällt nichts weiter daran auf. Die Einrahmung ist zwar recht eigentümlich, aber — mich stören diese schillernden Augen nicht.«
Jetzt griff Loke Klingsor in seine linke Westentasche, brachte ein goldenes Fläschchen zum Vorschein, hielt es schräg über den Spiegel, brauchte es nicht zu entkorken, an der Schneppe erschien ein grünes Tröpfchen, das auf das Spiegelglas fiel.
Nun allerdings geschah etwas Seltsames. Das grüne Tröpfchen breitete sich mit überraschender Schnelligkeit über das ganze Glas, erzeugte darauf eine ganz dünne, in allen Farben des Regenbogens schillernde Haut.
»Was sehen Sie jetzt, Herr Rechtsanwalt?«
Während seines Fragens hatte Klingsor seine glühenden Augen nicht auf den Spiegel, sondern immer starr auf den Scheitel des Rechtsanwalts geheftet, der sich also ziemlich weit vorbeugen musste, um in den Spiegel blicken zu können.
»Ich sehe ein schillerndes Häutchen, das den ganzen Spiegel überzogen hat.«
»Nichts weiter?«
»Nein.«
»Nicht mehr Ihr Gesicht?«
»Nein, das Häutchen macht den Spiegel blind.«
»Nur wenige Augenblicke Geduld! Sehen Sie immer fest in den Spiegel.«
Einige Sekunden vergingen.
»Ah«, fing da der Rechtsanwalt von selbst an, »jetzt ändert sich die Sache.«
»Was sehen Sie?«
»Es ist schwer zu beschreiben. Das Schillern hat nachgelassen, das Glas färbt sich weiß, dabei ist aber eine ständige Bewegung zu bemerken, als ob — ja wie denn — ich denke an etwas, kann mich aber nicht gleich ausdrücken — ah, jetzt weiß ich! — Gerade wie ein Schneegestöber! Ja, es scheint ein Schneegestöber zu sein.«
»So! Ein Schneegestöber.« erklang es ruhig. »Und was sehen Sie weiter?«
Wieder vergingen nur wenige Sekunden.
»Jetzt hören die weißen Flocken auf«, fuhr der Rechtsanwalt fort, »der Spiegel klärt sich, ist zwar wieder verschleiert aber nicht so wie zuvor — ah, was ist das?
Jetzt sehe ich plötzlich eine verschneite Winterlandschaft — Nadelbäume, mächtige Tannen — jawohl, es sind Tannen, jetzt erkenne ich es ganz deutlich — dicht mit Schnee behangen — jetzt verschiebt sich die Szenerie, es ist eine Waldblöße — — — und jetzt kommen Schlitten angefahren — — was für eine Bespannung ist das? —
Hirsche — ah, es sind Rentiere, die Männer tragen Pelze und schwingen Peitschen, ja Herr, wie machen Sie das eigentlich nur?«
»Es ist ein magischer Spiegel.«
»Was heißt das? Hypnotisieren Sie mich etwa, dass ich dies alles nur in meiner Einbildung sehe?«
»Fühlen Sie sich hypnotisiert?«
Der Rechtsanwalt hatte nicht erst nötig, sich einmal an die Nasenspitze zu fassen und am Ohre zu zupfen.
»Ganz und gar nicht, ich bin bei so klarer Besinnung wie sonst. Ja aber wie bringen Sie das sonst zustande?«
»Ich werde Ihnen die Erklärung geben, wenn Sie erst bei mir sind, früher nicht. Blicken Sie nur wieder in den Spiegel.«
Der Rechtsanwalt gehorchte, sich jetzt wenig den Kopf darüber zerbrechend. Jetzt wollte er nur beobachten.
»Die Männer in Pelzen sind von den Schlitten gesprungen. Das sind wohl Eskimos? Nein, Ihre Pelzkostüme sind eigentlich anders, nicht so unförmlich, enger anliegend, mit Fransen verziert, dazu diese Gesichter, diese langen, straffen Haare — ich bin noch nicht in Amerika gewesen, aber ich muss sie doch gleich für Indianer halten — und da sind übrigens auch Zelte — ganz eigentümliche, bunt bemalt — Wigwams heißen wohl die Dinger —«
»Was für Malereien tragen die Wigwams?«
»Es sind meist Tiere, Vögel, vor allen Dingen ist darunter die Krähe vertreten —«
»Aha, es sind kanadische Krähenindianer. Das Richtige ist es allerdings noch nicht, was Sie sehen sollten. Oder — was tun die Indianer jetzt?«
»Sie laufen hin und her, in die Zelte hinein, kommen wieder heraus, schirren die Rentiere ab, führen sie fort, laden von den Schlitten — das scheint ein Bär zu sein —«
»Können Sie unter den Gestalten eine Frau erkennen?«
»Ich sehe keine, sie tragen alle die gleiche Kleidung.«
»Nun, lassen wir das noch, es ist eben noch nicht das Richtige. Blicken Sie immer fest auf den Spiegel, nicht auf mich! Was sehen Sie jetzt?«
»Nichts. Das ganze Bild ist verschwunden! Halt!
Jetzt plötzlich sehe ich einen einzelnen Mann, er steht frei da, ohne Hintergrund —«
»Wie sieht der Mann aus?«
»Ganz kurios. Er trägt ein phantastisches Kostüm, eine hohe, bunte, spitze Mütze, um ihn herum zappeln Bänder — nein, das sind wohl gar lebendige Schlangen? Jetzt kommt ein Tier, ein Hund — nein, es ist ein ungeheurer Wolf, er schmiegt sich an ihn —«
»Beschreiben Sie das Gesicht des Mannes!«
»Ein älterer Mann mit langem, weißem Vollbart, eine scharfe Hakennase, wie ein Geierschnabel —«
»Es ist der alte Czernebog.«
»Czernebog, Czernebog?«, wiederholte der Rechtsanwalt verwundert. »Diesen Namen muss ich doch schon einmal gehört haben.«
»Möglich. Czernebog war eine serbischwendische Gottheit. Dies hier aber ist ein Mensch, führt allerdings den Namen jenes serbischwendischen Gottes. Herr Rechtsanwalt, Sie sehen den größten Magier und Zauberer der Gegenwart vor sich — den alten Czernebog.«
»So, so, also zaubern kann der alte Herr«, sagte der Rechtsanwalt ganz gemütlich, nur mit einem leisen Anflug von Spott. »Daher auch die Schlangen, die er um den Leib und sonst wo — — jetzt ist er wieder verschwunden — — da erscheint aber schon etwas anderes. Herr, wie machen Sie das nur? Wie bringen Sie die Bilder zustande?«
»Was sehen Sie?«
»Donnerwetter, das ist ja ein prachtvolles Zimmer, dessen Einrichtung ich jetzt zu sehen bekomme! Sind diese gelbglänzenden Vasen und dergleichen Sachen gediegenes Gold, die Steine, mit denen sie besetzt sind, echt?«
»Sehen Sie nichts weiter?«
»Plötzlich steht in der Mitte des Zimmers eine Frau — oder eine Dame, will ich lieber sagen, weil sie höchst elegant angezogen ist. Sie trägt allerdings nur einen roten Mantel oder Morgenrock oder so etwas Ähnliches, aber er ist sicher von Samt und Seide oder Atlas, alles macht einen so aparten Eindruck. Und zaubern muss diese Dame ebenfalls können, weil sie so ganz plötzlich mitten im Zimmer steht —«
»Sehen Sie nicht ihr Gesicht?«
»Nein, vorläufig habe ich nur die Ehre, ihren Rücken bewundern zu dürfen. Lange, goldblonde Locken, gerade wie sie meine Tochter hat. Jetzt dreht sie sich um —«
Der immer spöttisch sprechende Rechtsanwalt verstummte jäh, um seine Augen weit aufzureißen. »Himmel, das ist ja meine Evelyn?!«
»Erkennen Sie wirklich Ihre Tochter?«
»Ja natürlich! Dieses Spiegelbild, so klein es auch sein mag, ist deutlich genug — — das ist Zug um Zug das Gesicht meiner Tochter! Selbst die Bewegung, wie sie jetzt den Arm hebt, um die vorfallenden Locken zurückzustreichen, ist die meiner Tochter — Ja, Herr, wie machen Sie das nur, dass ich hier in meiner Einbildung in dem Spiegel meine Tochter sehen muss? Und nun gar in einem Kostüm, das sie überhaupt nicht besitzt?«
»Beobachten Sie weiter! Was sehen Sie?«
»Jetzt wird eine Portiere zurückgeschlagen, ein Herr tritt ein. Ah, den alten Knasterbart kenne ich schon, auch wenn er jetzt nicht das bunte Harlekinkostüm trägt, sondern eine dunkle Mönchskutte, die übrigens von Seide zu sein scheint und auch sonst einen recht eleganten Eindruck macht. Also sprechen wir lieber von einem Talar —«
»Sie kennen ihn?«
»Nu natürlich, das ist doch wieder derselbe Geierschnabel im Gesicht — das ist doch wieder der alte Czernebog, der große Hexenmeister —«
»Was tut er?«
»Er geht auf meine Tochter zu — die gibt ihm die Hand — er neigt sich darüber — bohrt seinen Geierschnabel hinein — jetzt tätschelt er ihr den Kopf — ja zum Teufel, was hat dieser alte Zaubermeister meiner Tochter die Hand zu küssen und ihr den Kopf zu tätscheln?! Herr, wie können Sie mir solche Bilder vorgaukeln?«
Mit nur schlecht erkünstelter Entrüstung hatte es der Rechtsanwalt gerufen, der Spott klang gar zu deutlich durch.
»Sie halten dies nur für Sinnestäuschung?«, war die kalte Gegenfrage.
»Was ist es denn sonst? Wie Sie das machen, ist mir ja vorläufig unerklärlich, aber es ist doch keinesfalls ein Spiegelbild wirklicher Tatsachen!«
»Weshalb nicht?«
»Nun, weil eben alles ganz unmöglich ist. Wie kommt denn meine Tochter in dieses rote Kostüm, das sie gar nicht besitzt? Was hat sie denn mit dem alten Czernebog zu tun?«
»Ist es wirklich so ganz und gar ausgeschlossen, dass sich Ihr Fräulein Tochter gegenwärtig in einer fremden Umgebung befindet?«
»Jawohl, das ist ganz und gar ausgeschlossen.«
»Und weshalb?«
»Weil ich vor noch nicht einer Stunde mit ihr telefonisch gesprochen habe. Da arbeitete sie an einer Stickerei zum Geburtstag ihrer Freundin und dachte gar nicht daran, die Wohnung zu verlassen, wollte vielmehr gleich schlafen gehen, höchstens noch auf mich warten. Also mein bester Herr, gaukeln Sie mir getrost hier weitere Bilder vor, das interessiert mich sehr, aber sagen Sie ja nicht, dass diese Bilder Tatsachen entsprechen, dass sich meine Tochter in einem fabelhaften Zimmer beim alten Zaubermeister Czernebog befindet, der ihr die Hand küsst und so weiter. Zuletzt behaupten Sie gar noch, sie wäre schon in Kanada bei den Krähenindianern.«
»Gut! Wie Sie wünschen! Wollen Sie wieder in den Spiegel blicken?«
Der Rechtsanwalt beugte sich abermals vor.
»Was sehen Sie?«
»Schrumm! Ein anderes Bild! Jetzt sehe ich eine — eine Grotte — mit exotischen Pflanzen geschmückt — ich werde lebhaft an so eine Grotte im Zoologischen Garten erinnert, weil sich nämlich da ein großes Gitter befindet, das einen Raum abschließt — — Himmel, was ist denn das?«
»Was macht Sie so bestürzt?«
»Das ist doch der Gipfel!«, rief der Rechtsanwalt in aufrichtigem Staunen. »Jetzt taucht da hinter dem Gitter ein fabelhaftes Ungeheuer auf — — ein Drache, ein Lindwurm, wie er im Märchenbuche steht — — oben kommen zwei Männer, nach ihnen kann ich die Größen abschätzen — — das Vieh ist wenigstens vier Meter hoch und zwanzig Meter lang, die Augen sind wie Suppenteller, aus dem ungeheuren Rachen spielt eine gespaltene Zunge, über den ganzen Rücken bis zur Schwanzspitze läuft ein grüngefärbter Kamm — — sehen Sie, Mister Klingsor, da ist gleich der Beweis, dass sich meine Tochter unmöglich in der Gesellschaft des alten Czernebog befindet.«
»Inwiefern soll das ein Beweis sein?«
»Na, einfach, weil es solch einen Lindwurm doch gar nicht gibt! Also ist es nur eine Illusion, die Sie mir auf irgendeine Weise hier in diesem Spiegel vorgaukeln.
Also habe ich auch meine Tochter nur als eine Illusion in meiner Einbildung gesehen!«
»So, also Sie meinen, solch einen ungeheuren Lindwurm kann es niemals geben? Waren Sie noch nicht hier in Sydney im MansionHause, in der prähistorischen Abteilung?
Stehen da nicht die Gerippe von drachenähnlichen Ungeheuern, die einst die Erde belebten, deren Dimensionen die von Ihnen hier angegebenen noch bei Weitem übertreffen?«
»Ach was, wir leben jetzt nicht mehr in der vorsintflutlichen Zeit, diese Ungeheuer sind ausgestorben und damit basta!«, rief der Rechtsanwalt ärgerlich, aber dabei immer interessiert in den Spiegel blickend. »Und wie ist dieses Vieh hier lebendig! Jetzt reißt es den Rachen auf, es beginnt in dem weiten Käfig förmlich zu rasen — — aha, jetzt wird ein Schaf gebracht, ein ausgewachsener Hammel, er wird durch eine Sicherheitstür in den Käfig gesteckt — — hoppsa, der Lindwurm macht mit dem Schöps weniger Umstände als eine Katze mit einer Maus — — da ist der ganze Hammel schon verschlungen und verschluckt. Schade, dass solche Ungeheuer nicht in Wirklichkeit leben! Es müsste ergötzlich sein, sie beobachten zu können.«
»Herr Rechtsanwalt Iron«, nahm wieder Klingsor das Wort, »haben Sie solch einen Drachen oder Lindwurm wirklich noch nicht lebendig gesehen?«
»Ich? Einen lebendig gesehen? Sie sind wohl — Wie kommen Sie auf solch eine Frage?«
»Sollten Sie wirklich noch niemals unter dem Mikroskop einen Wassertropfen betrachtet haben? Einen Tropfen, der einem stehenden Gewässer, einem Sumpfe, entnommen worden ist?«
Rechtsanwalt Iron wurde etwas unwirsch. Es war noch gar nicht so lange her, da hatte er in einem wissenschaftlichen Vortrage solche mikroskopische Vorführungen gesehen, auch solch einen Wassertropfen, schon durch das Mikroskop tausendfach vergrößert — weiter geht die Vergrößerung vorläufig auch noch nicht — nun aber dieses mikroskopische Bild, durch Spiegel aufgefangen, in vieltausendfacher Vergrößerung gegen die Wand geworfen — ein einfacher Menschenfloh zum Beispiel hatte eine Länge von hundert Metern, konnte also nur stückweise gezeigt werden — und da hatte der Rechtsanwalt solche ungeheuere Drachen und Lindwürmer gesehen, sogar noch viel, viel schrecklicher gestaltet, und sie waren in vollem Leben gewesen, hatten sich gegenseitig bekämpft und andere kleine Tiere zerrissen und gefressen, in dieser Vergrößerung aber immer noch weit größer als jener Hammel —
Der Rechtsanwalt war nur unwirsch geworden, weil er nicht gleich daran gedacht hatte, weil diese Ähnlichkeit ihm erst jetzt einfiel. Sonst ließ er sich nicht etwa beeinflussen.
»Ach, das ist etwas ganz anderes! Das sind mikroskopische Infusorien —
Der Lindwurm hat seine Mahlzeit beendet. Jetzt kommt der alte Czernebog mit der roten Dame wieder. Jawohl, es ist immer noch meine Tochter Evelyn —
Mister Klingsor, ich will Ihnen etwas sagen!
Machen Sie mir noch weiter solche Gaukeleien vor! Das ist wunderhübsch, das interessiert mich — nur möchte ich Sie bitten, dabei meine Tochter aus dem Spiele zu lassen als eine der Wirklichkeit angehörende Person, die man eben nicht in solche Illusionen hineinziehen soll — —«
Klingsor zog den Spiegel plötzlich zurück und steckte ihn wieder in die Brusttasche.
Etwas betroffen blickte der Rechtsanwalt ihn an.
Und da öffnete jener den Mund zu längerer Rede, ganz ruhig, aber doch mit schneidender Stimme, jedes Wort betonend, so wie er damals zu Mister Samuel Philipp durchs Telefon gesprochen hatte.
»Herr Rechtsanwalt Maximus Iron! Hören Sie mich an, unterbrechen Sie mich nicht, blicken Sie mich an, rühren Sie sich nicht!
Ich befehle es Ihnen!
Ich habe damals gesagt, wenn Sie die silberne Kapsel nicht kühl und schattig aufbewahren, wenn Sie den Golem der Sonne oder der Wärme aussetzen, so würde er Unglück über Sie bringen.
Sie haben meine Warnung nicht befolgt, weil Sie nicht daran glaubten, und so ist dieses Unheil bereits über Ihr Haus gekommen, wenn Sie auch gegenwärtig noch gar nichts davon wissen.
Sie haben die Kapsel in der Sonne liegen lassen, sie sprang auf, die kleine Kugel schwoll an, und da haben Sie zur Ergründung des Rätsels noch weitere solche Experimente mit dem Golem angestellt.
Zwar haben Sie die Sache nicht in die Öffentlichkeit gebracht, nicht überall davon erzählt, das entspricht nicht Ihrem Charakter, auch nicht dem Ihrer Tochter, aber — es war doch nicht zu vermeiden, dass nicht Ihre Dienstboten davon erfuhren.
Sie haben von dem Wunder gesprochen, und so ist es außerhalb Ihres Hauses bekannt geworden.
So ist es geschehen, dass ein Mann davon erfahren hat, der dasselbe Interesse an diesem Golem des Wunder-Rabbis hat wie ich.
Es ist dies der alte Czernebog.
Ja, auch er möchte durchaus in den Besitz dieser silbernen Kapsel mit der weißen Kugel kommen.
Aber auch er darf den Golem weder kaufen noch rauben, sonst verliert er für ihn ebenfalls die Wunderkraft.
Dieser Czernebog jedoch wusste ein anderes Mittel, um sich in den Besitz des Golems zu bringen, um auf Sie, den Rechtsanwalt Iron, genannt Eisenkopf, einen Druck auszuüben, sodass Sie ihm den Golem doch so halb und halb freiwillig ausliefern, ein Mittel, das ich selbst nie benutzen würde; denn ich bin Gentleman — mehr noch: Ich bin ein offener, ehrlicher Mensch.
Wohl kann auch ich List und Gewalt anwenden, werde es aber niemals tun, um mich dadurch zu bereichern.
Ich bekämpfe nur alles Schlechte und Böse auf Erden; das rotte ich rücksichtslos aus; da ist mir jedes Mittel erlaubt, so, wie man einer giftigen Schlange den Kopf zertritt.
Aber jener alte Czernebog denkt darin anders.
Und so komme ich nun zur Sache.
Herr Rechtsanwalt Maximus Iron!
Ja, Sie haben vor einer Stunde mit Ihrer Tochter telefonisch gesprochen, sie war zu Hause und wollte auf den Vater warten.
Aber gleich darauf ist Ihre Tochter nochmals telefonisch angerufen worden, wiederum von Ihnen, Herr Rechtsanwalt, wenigstens hat sie Ihre Stimme erkannt, Sie haben ihr gesagt, Sie seien im Hause der Familie Hamstead, mit der Sie gut befreundet sind, Evelyn möchte doch einmal schnell hinkommen, es gäbe etwas Hochinteressantes zu sehen, ein Automobil sei schon unterwegs, sie abzuholen, sie solle nur gleich so kommen, wie sie sei, und Ihre Tochter konnte unmöglich einen Argwohn fassen, sie hat nur schnell einen Mantel umgehängt, da fuhr auch schon das Automobil vor —
Halt, Herr Rechtsanwalt! Unterbrechen Sie mich nicht! Sie können überhaupt nicht sprechen, sich nicht rühren, ich verbiete es Ihnen!
Der alte Czernebog hat Ihre Tochter entführt, geraubt!
Sie befindet sich, wie ich aus den magischen Bildern, welche nicht trügen, erkannt habe, bereits in seinem — doch das brauchen Sie nicht zu wissen.
Jedenfalls ist Ihre Tochter für Sie unerreichbar.
Czernebog hat es getan, um Ihre Tochter gegen den Golem des Wunder-Rabbis einzutauschen.
Aber bereits hat sich sein Entschluss geändert.
Czernebog ist beim Anblick Ihrer Tochter gleich entzückt gewesen; er hat beschlossen, wie ich bereits ganz bestimmt weiß, lieber auf den Golem ganz zu verzichten, um das schöne unschuldsvolle Mädchen für immer bei sich zu behalten.
Herr Rechtsanwalt Maximus Iron! Hören Sie meine Worte, und wehe Ihnen, wenn Sie daran zweifeln!
Ihre Tochter Evelyn ist Ihnen für immer verloren!
Es gibt kein Mittel, um sie aus der Gefangenschaft dieses Czernebog zu befreien!
Wohl aber gibt es einen Menschen, nur einen einzigen in dieser Welt, der Gewalt über diesen alten Zauberer hat.
Dieser einzige Mensch bin ich, Loke Klingsor, der Fürst des Feuers!
Freilich nicht als solcher habe ich Gewalt über den alten Zauberer, sondern durch einen Schwur, den er mir geleistet hat.
Wenn es mir einmal gelänge, ihn zu überlisten, dürfte ich von ihm fordern, was ich wolle, sein ganzes Reich und seine Macht und alles, alles — er würde es mir geben.
Und diesen Schwur muss und wird er halten, das weiß ich bestimmt.
Ich werde den alten Czernebog überlisten und werde Ihre Tochter Evelyn von ihm fordern!
Dann werden Sie mir wohl für ihre Befreiung den Golem ausliefern.
Aber Ihre Tochter darf nicht in die Welt zurück, weil sie in Czernebogs Reich schon zu viele Geheimnisse geschaut hat.
Also, Herr Rechtsanwalt, wollen Sie für immer mit Ihrer Tochter vereint sein, so bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als ebenfalls mit in unser Reich einzutreten, nicht in das Czernebogs, was ganz ausgeschlossen ist, sondern in das meine, wo es Ihnen auch bedeutend besser gefallen wird, als es bei jenem möglich wäre.
Das ist es, was ich Ihnen jetzt offenbaren wollte.
Herr Rechtsanwalt Maximus Iron!
Gehen Sie, sobald ich mich entfernt habe, sofort nach Hause und überzeugen Sie sich, dass meine Angaben stimmen, dass Ihre Tochter noch einmal mit ihrem Vater telefonisch gesprochen hat, Ihre Diener wissen, dass sie von einem Automobil abgeholt worden ist, dass sie sich aber nicht bei der Familie Hamstead befindet, dass sie spurlos verschwunden ist.
Dann treten Sie in Ihrem Arbeitszimmer an das Telefon, stellen keine Verbindung her, rufen einfach hinein: Loke Klingsor!
Ich werde sofort antworten, dann werden wir die weiteren Abmachungen treffen.
Hierzu gebe ich Ihnen bis morgen Mittag Zeit. So lange bin ich noch für Sie zu sprechen, später nicht mehr.
Haben Sie sich bis morgen Mittag mit mir nicht in Verbindung gesetzt, sind auf meine billigen Bedingungen nicht eingegangen, so ist Ihnen Ihre Tochter für immer verloren!
Ich habe gesprochen! Bis dahin gehaben Sie sich wohl.
Bleiben Sie sitzen, Sie können sich nicht rühren, so lange ich Sie anblicke!«

»Bleiben Sie sitzen, Herr Rechtsanwalt!«, sagte Loke Klingsor.

Variante der obigen Frontispiz-Abbildung zu Lieferung 5
So sprechend, erhob sich Klingsor und schritt nach dem offenen Fenster — aber rückwärts, die Augen auf den Rechtsanwalt gerichtet, und das waren jetzt wirklich wahre Teufelsaugen, mit so versengender Glut brannten sie.
So erreichte er das offene Fenster, drehte sich schnell um, ergriff mit der rechten Hand Mantel und Hut, mit der linken den Koffer, war dabei schon mit dem rechten Fuß auf den Stuhl getreten, im nächsten Augenblick stand er auf dem Fensterbrett und — trat in die finstere Nacht hinein und hinaus.
Anders lässt es sich nicht schildern.
Da schnellte der Rechtsanwalt empor!
Bisher war er dazu nicht fähig gewesen.
Von dem Moment an, da Loke Klingsor seine längere Rede begonnen, da er dem Rechtsanwalt befohlen hatte, ihm ruhig zuzuhören, sich nicht zu rühren, hatte dieser es auch nicht gekonnt.
Wohl hatte er sich immer bei klarem Bewusstsein befunden, kein Wort war ihm entgangen, aber unter dem Blick dieser glühenden Teufelsaugen war er immer auf seinem Stuhle wie festgebannt gewesen.
Nur einmal wäre es ihm fast gelungen, den geheimnisvollen Bann zu brechen.
Als ihm jener offenbart hatte, dass Evelyn entführt worden war, dass ein Fremder seine Stimme am Telefon nachgeahmt hatte.
Aber das hatte der Mann mit den Teufelsaugen sofort bemerkt, diese waren erst recht aufgeflammt, ein Befehl, und die Anstrengung war vergeblich gewesen, wieder hatte der Rechtsanwalt, dieser sonst so energische Mann, es wie einen Starrkrampf über sich kommen fühlen.
Doch in dem Momente, als sich Klingsor am Fenster herumgedreht hatte, war es mit dem Banne vorbei gewesen.
Mister Iron sprang auf, jenem nach, doch wohl um ihn zu packen, um weitere Rechenschaft von ihm zu fordern.
Da aber war der rätselhafte Mann schon aus dem Fenster verschwunden, in die finstere Nacht hinein.
Rechtsanwalt Iron beugte sich zum Fenster hinaus und spähte hinab.
So schnell war er gewesen, dass er, wenn der Mann hinabgesprungen wäre, ihn unbedingt noch durch die Luft hätte sausen sehen müssen.
Das Hotel lag an einem freien Platze, unten war im Scheine der Straßenlaternen das Trottoir zu erblicken — — aber kein Mensch, weder durch die Luft sausend, noch unten gehend, noch zerschmettert am Boden liegend.
Wo war der Mann mit den Teufelsaugen geblieben?
Der Rechtsanwalt blickte geradeaus.
Die Nacht war sehr finster, aber erhellt durch die Lichter des Hafens in der Ferne.
Diese Lichterchen leuchteten und blitzten und flackerten, die Dampfpfeifen heulten — — und hier in diesem Hotelzimmer antwortete ihnen ein qualvolles Stöhne.
Aus einer der unzähligen Wasserstraßen, die den Urwald in ebenso viele Inseln teilen, schoss, von der Strömung getragen, ein Kahn hervor, ein merkwürdiges, nicht gerade plumpes, aber immerhin recht ungefügig erscheinendes Fahrzeug.
Eine sogenannte Balandra.
Diese Kähne sind jenen Gegenden eigentümlich. Es sind Boote, auf denen eine Art Hütte errichtet ist, am ersten noch mit den Gondeln Venedigs zu vergleichen, natürlich sie an Eleganz nicht im Entferntesten erreichend.
Diese Balandras werden meist vom Vorderteile aus gesteuert.
Der zweite Mann am Hinterende hat nur nachzuhelfen, falls es nötig wird.
Manchmal aber stellt der Steuernde sich auf ein eigens zu diesem Zwecke auf oder über dem Hüttendache errichtetes Gestell.
Hier war auch noch ein Mast vorhanden, an dem ein Segel aufgezogen werden konnte, aber es lag jetzt am Fuß des Mastes auf dem Boden des Kahnes, eben nicht gebraucht, da die rasche Strömung die Mitarbeit nicht nur der Menschen, sondern auch des Windes überflüssig machte.
Rings breitete sich an beiden Ufern dichtester Urwald aus, schien auch zeitweise sich der Strömung quer vorzulagern, stand wie eine finstere, unheimliche Wand gegen den Himmel.
An diesem, der tiefdunkel war, erglänzten Milliarden Sterne in ruhigem Silberschimmer. Alles umher war in tiefe Stille getaucht.
Nur zuweilen erscholl aus dem Dickicht das katzenähnliche Geschrei des eine Beute suchenden Jaguars, und dann ward auch meist zur Antwort das misstönende Gekreisch aus dem Schlafe aufgeschreckter Affen laut.
Aufgeschreckt durch die Annäherung der Balandra fuhr bisweilen einer der großem Reiher aus dem dichten Laubdach der Urwaldriesen empor und strebte unter krächzendem Geschrei und klatschendem Flügelschlage eine kurze Strecke dahin, einem anderen Nachtquartiere zu.
Mit staunenswerter Schnelligkeit schoss die Balandra auf dem Wasser dahin, ein sicheres Zeichen, dass es bald in den Strom münden würde. Und dann wurde es mit einem Schlage hell.
Zu gleicher Zeit fast ertönte aus dem Dickicht das vielstimmige Gebrüll der Affen, nachdem ein altes Männchen mit tiefer Stimme das Zeichen dazu gegeben hatte. Papageien kreischten, das Tierleben der Wildnis erwachte mit einem Male.
Und aus der Hütte der Balandra trat ein Mann, schlank und sehnig —
Schwarzes Haar quoll unter dem breitrandigen Filzhute hervor, ein schwarzes Bärtchen verdeckte nur halb den Mund mit den etwas starken Lippen, schwarze Augen suchten die beiden Ufer ab —
Der junge Mann sah nach der Sonne, das heißt, nur nach der Richtung, in welcher sie hinter der grünen Mauer des Urwaldes am Himmel stehen musste.
Dann brachte er einen kleinen Taschensextanten hervor und machte eine Ortsaufnahme, was sehr rasch vonstatten ging.
Noch ein Blick in ein Büchlein, das er aus einer Tasche seines Lederanzuges hervorholte, dann gab der junge Mann ein Kommando.
Der Steuerer ließ die Balandra sich drehen, dass sie nun den Schnabel gegen die Strömung kehrte.
Rückwärts trieb sie dahin, bis sie mit dem Achterteil an irgendein Hindernis stieß und zum Stehen kam.
Nun zog der junge Mann noch ein anderes Büchlein hervor, entnahm ihm einen Taschenkalender, strich einen der letzten Tage durch und sagte.
»Der 14. Juli. Die Stelle stimmt. 13 Grad 57 Minuten und 2 Sekunden südliche Breite, 24 (1) Grad 24 Minuten 22 Sekunden westliche Länge von Greenwich.
(1) Hier liegt offenbar ein Drucksatzfehler vor: Bei 24 Grad westlicher Länge würde sich der Standpunkt mitten im südlichen Atlantik befinden. Da die genannten Bakairi Indianer im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso leben und weiter unten der Rio Xingu erwähnt wird, liegt der Standpunkt eher bei etwa 54 Grad westlicher Länge. mer wieder mit fast angstvollen Blicken in das Dickicht des Urwaldes spähten.
Hier müsste ich eigentlich warten, hier das indianische Kanu finden, hier nicht nur auf die ersten Bakairis stoßen, sondern auch mit Signorina Ravelli zusammentreffen, wenn anders dieser Amerikaner mich nicht zum Besten gehalten hat.
Das aber ist nicht anzunehmen, da der Vertrag unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften von Rechts wegen geschlossen worden ist und da ich ja auch die Mittel erhielt, welcher ich zu dieser Expedition bedarf.
Vorläufig also habe ich keinen Grund zu dem geringsten Zweifel.
Und nun will ich meinerseits halten, was ich versprochen habe.«
Er wendete sich zu dem Steuermann der Balandra.
»Capitão!«, sagte er.
Sofort eilte der Mann, nachdem er von dem Hüttendach herabgesprungen war, zu dem Rufenden, neigte sich demütig vor ihm und wartete schweigend, was nun befohlen werden würde.
Merkwürdig — das heißt, nur für einen guten Beobachter wäre es gewesen — dass dabei die Augen des braunen Eingeborenen seltsam scheu nach den beiden Ufern des Kanals irrten, dass auch die vier anderen Wilden im
Es sah aus, als fürchteten sie sich hier, als erwarteten sie, dass aus dem undurchdringlichen Gewirr irgend etwas hervorkommen und sie bedrohen würde.
Nur der braune junge Mann, der aber trotz dieser Hautfarbe eben zur weißen Rasse gehörte, schien sich nicht im Geringsten unbehaglich zu fühlen.
Er lächelte sogar, als er das scheue Wesen der Caboclos gewahrte.
»Du kannst jetzt umkehren«, sagte er gleichgültig.
»Laut unserem Vertrage gehört Dir von jetzt an diese Balandra, mit allem, was sich darauf befindet. Du hättest für die Treue, mit welcher Du mir gedient hast, eine besondere Belohnung verdient, aber Du wirst verstehen, dass ich sie Dir nicht geben kann.
Alles, was bis jetzt mein war, lasse ich auf der Balandra, nehme nur meine Waffen und diesen Ledersack mit mir, das Übrige geht in Deinen Besitz über.
Ich denke, Du wirst zufrieden sein und auch Deine Gefährten bei der Teilung gebührend berücksichtigen, dass sie nicht eine schlechte Erinnerung an mich behalten.«
Diese ziemlich lange Rede hielt er in der Sprache der Guaraunos, welchem Stamme also diese Wilden angehörten, und der Steuermann, den der junge Mann als Capitão anredete, das portugiesische Wort für Kapitän, neigte sich noch tiefer als bisher.
»Herr, Du bist sehr gut«, sagte er, und wieder war merkwürdig, dass er trotz aller Freude, die ihn ob dieses reichen Geschenks erfüllen musste, nur sehr leise sprach, wieder, als fürchtete er sich hier, als möchte er durch den Klang seiner Stimme nicht die Gefahr wecken, die auf ihn und seine Gefährten hier — irgendwo verborgen — lauerte.
»Du wirst sofort umkehren«, fuhr der junge Mann fort.
Der Capitão fuhr auf.
Seine Augen verloren den furchtsamen Ausdruck. Sie strahlten sogar.
Und dasselbe war bei den übrigen Guaraunos der Fall.
Sie hatten ja die laut gesprochenen Worte hören und verstehen müssen.
Doch auf einmal trat auf das Gesicht des Capitãos der Ausdruck neuer Besorgnis.
Er fragte:
»Und Du, Herr? Willst Du hier bleiben? Allein? Ganz allein? Wenn Du befiehlst, kehren wir noch nicht um —«
Das war ein Anerbieten, das sehr viel besagte.
Der junge Mann verstand es zu würdigen. Er lächelte und legte dem braunen Manne eine Hand auf die Schulter.
»Ich danke Dir, Capitão«, sagte er dabei. »Doch ich muss allein bleiben, darf Euch nicht bei mir behalten.
Und nun lass mich an das Ufer klettern!«
Einer der Indianer brachte ihm den bereits erwähnten Ledersack, ein anderer ein Gewehr, ein dritter das lange Haumesser, das fast einem Säbel glich — für den vierten blieb nichts übrig, denn mehr wollte der Senhor nicht mitnehmen.

Noch einmal schaute der junge Mann sich um.
Es war, als wollte er von dem Boote aus die Schönheiten dieses Urwaldes in sich aufnehmen, wie sie sich seinen Blicken boten.
Auf den über das Wasser hängenden Ästen hockten in ganzen Reihen unzählige schneeweiße Reiher und andere große Vögel, buntfarbig, schimmernd wie die Eisvögel der Alten Welt.
Einsam lauerten weiterhin die seltsamen Schlangenhalsvögel, und hoch in der Luft zogen im Zickzack braune Pelikane und rosenfarbene Ibisse, dazwischen wieder paarweise herrliche blaue Araras, und am Ufer selbst schwirrten, wie Bienen summend, winzige Kolibris gleich fliegenden Edelsteinen um die violetten Blütenbüschel der Vignonien.
Aber alles das sah der junge Mann nicht.
Er spähte nur nach einem auffallenden Baume hinüber, der aus dem Urwald hervorragte.
»Da steht die Moriche, von der in dem Briefe die Rede war«, sagte er zu sich selber, sich jetzt der portugiesischen Sprache bedienend.
In der Tat ragte dieser eine Baum so auffallend über die anderen hervor, war so merkwürdig, durch die Krone aus riesigen Fächerblättern, dass er gar nicht übersehen werden konnte.
Dicht neben ihm jedoch erhob sich noch eine schlanke Tripharis, die von den Landesbewohnern Santa Maria genannt wird, mit prachtvollen dunkelkarminroten Blütenrispen, die den ganzen Baum über und über bedeckten, sodass weder von den Blättern noch von dem Stamme etwas zu sehen war.
»Ja, es stimmt, und nun bin ich überzeugt, dass ich nicht vergebens hier warten werde«, sagte der braune junge Mann nochmals.
Er hing sich das Gewehr am Riemen auf den Rücken, befestigte die Machete in einer Vorrichtung am Gürtel, band sich dann auch noch den mit schmalen Tragbändern versehenen Ledersack auf den Rücken, erstieg das Dach der Hütte, nahm auf dem Brette, das dort angebracht war, einen Anlauf und — schnellte in mächtigem Sprunge mitten in das Gewirr hinein, das an dem einen Ufer aus hundert verschiedenen Schlingpflanzen gebildet wurde.
Zu durchdringen vermochte er es trotz der Wucht seines Anpralles nicht, aber er blieb daran hängen, und während er sich mit einer Hand anklammerte, zog die andere die lange Klinge des Haumessers —
Die Indios auf der Balandra sahen nicht mehr, wie nun der junge Mann die dichte lebende Wand durchhieb, wie er sich einen Eingang in den Urwald schuf.
Mit einer Hast, die wiederum auffällig war, wendeten sie das Fahrzeug, brachten es in die Strömung, kehrten es aber nicht wieder um, sondern lenkten es aus dem engen Kanal hinaus und wurden alsbald von der rasendschnellen Strömung draußen erfasst.
Ehe noch die Machete ein genügend großes Loch gehauen hatte, war die Balandra bereits hinter der grünen Urwaldmauer verschwunden.
Mutterseelenallein blieb der Abenteurer zurück, entfernt von allen menschlichen Siedlungen, von Menschen überhaupt.
Das aber schien ihn nicht im Geringsten zu kümmern.
Er schuf sich Bahn und arbeitete sich durch das Dickicht durch, und als er endlich auf festem Boden stand, da bückte er sich auch schon — aber nicht etwa, um nach gewissen Spuren zu suchen, sondern nur, um unter dem Gewirr der Lianen und anderen Pflanzen bis zum Ufer des Stromes zu kriechen.
Das war unbeschreiblich mühsam. Besser wäre jedenfalls gewesen, er hätte sich auch hier mit der Machete Bahn gehauen, aber wenn er das nicht tat, so musste er eben seine Gründe dazu haben, wie überhaupt zu allem, was er hier tat.
Und als er endlich wirklich den Wasserspiegel durch den grünen Vorhang der Pflanzen draußen erblickte, da stieß er einen Ruf der höchsten Überraschung aus.
Unmittelbar vor ihm lag auf dem vollkommen ruhigen Wasser ein indianisches Kanu, eine Curiara, ganz eigenartig gebaut, nur aus Rinde bestehend, deren einzelne Stücke mit Bast aneinander genäht waren, und doch vollkommen wasserdicht.
Freilich hätte das nicht viel genützt, wenn die Regenzeit gewesen wäre.
Da hätten die vom Himmel herabkommenden Wassergüsse dieses schwanke Fahrzeug alsbald füllen und versenken müssen. Doch daran war jetzt nicht zu denken — es lag da — ganz wohlerhalten —
Und unmittelbar hinter ihm erhob sich die Moriche, der Baum, nach dem sich der junge Mann bei seiner Landung einzig und allein gerichtet hatte.
Nun hatte er weiter nichts zu tun, als sich in das Kanu zu setzen und zu warten.

Dass die Zeit ihm nicht lang würde, zog er aus dem Ledersacke, den er gleich dem Gewehr vom Rücken genommen hatte, die Essvorräte hervor, die er mitgebracht hatte.
Was es war, kommt nicht weiter in Frage.
Darauf stopfte er sich ein Pfeifchen mit dem guten brasilianischen Tabak, brannte es sorgsam mit Hilfe eines Taschenfeuerzeuges an und streckte sich nun lang aus. Und da wunderte er sich auch schon.
Dass nicht die blutgierigen Moskitos in ganzen Schwärmen über ihn herfielen, was doch nur natürlich gewesen wäre!
Aber nicht ein einziges Mal erklang das schwirrende Singen an seinen Ohren, nicht eins dieser Insekten zeigte sich, wie auch keiner von den anderen Plagegeistern, an denen dieser Urwald sonst so überreich ist, denn da ist es eben nicht so, wie die meisten Jugendschriftsteller, die aber nie einen Urwald betreten, ihn nicht einmal gesehen haben, so munter erzählen, dass man einfach hineinspazierte und wartet, bis man einen Jaguar zu Gesicht bekommt, von den übrigen Tieren gar nicht zu sprechen.
Eine Wanderung in diesem Urwald — in jedem Urwald — ist eben nicht nur kein Vergnügen, sondern eine Marter, eine furchtbare Strapaze, und gerade hier, in diesem südamerikanischen Urwald, in den Wildnissen am Rio Xingu, wo es außer den Moskitos noch blutgierige Zecken gibt, die beim Durchkriechen durch die Büsche auf den Körper fallen, sich alsbald durch die Haut bohrend und Geschwüre erzeugend, wo sogar Blutegel auf den Bäumen leben —
Nun, wie gesagt, der einsame junge Mann spürte nichts davon, konnte so recht gemütlich sein Pfeifchen schmauchen und sich der Verdauung hingeben.
Aber das tat er nun doch nicht, sondern vergaß nicht eine Minute seine Pflicht, und die schien darin zu bestehen, dass er die Sonne beobachtete und von Zeit zu Zeit die Ohren spitzte —
»Ich bin ja neugierig«, hob er schließlich wieder ein Selbstgespräch an.
»Wenn alles andere so klappt, wie bisher, dann muss pünktlich zur Mittagsstunde gerade an dieser Stelle ein anderes Fahrzeug eintreffen — und ich kann doch fast nicht glauben, dass eine Dame darin sitzen wird —
Eine Dame, eine Geigenkünstlerin, im Urwalde am Rio Xingu! (sprich: Schingu).
Aber dieser Mister Samuel Philipp scheint zu wissen, was er will, und was er bisher versprochen hat, das ist ja eingetroffen, da muss ich ihm also auch ferner glauben — —
Und dort kommt das Boot auch schon.«
Über die Arbeit, die er hinter sich hatte, war die Zeit viel schneller vergangen, als er selber geglaubt hatte, und als er nun mit seinem scharfen Gehör das plätschernde Arbeiten von Rudern vernahm, da schaute er auch noch nach der Sonne und sah, dass sie wirklich in Mittagshöhe stand.
»Merkwürdig!«, sagte er.
Dann setzte er sich in dem Boote zurecht, erfasste das Schaufelruder, das darin lag, und spähte auch schon nach einer Öffnung, durch welche er ins Freie, auf den Strom hinaus gelangen könnte.
Er hatte sie bald entdeckt, darauf waren seine Augen geübt, und vorhanden sein musste sie ja, sonst wäre eben nicht die Curiara hier gewesen.
Das Kanu musste doch auf irgendeinem Wege in das Versteck gebracht worden sein.
In dem Augenblick aber, wo er das freie Fahrwasser erreichte, sah er auch schon ein anderes Boot vor sich —
Aber er sah noch etwas —
Auf dem Strome lag eine Motorbarkasse, ein ganz kleines Ding nur, anscheinend gerade für solche Urwaldfahrten gebaut.
Es soll hier nicht weiter geschildert werden, worin diese Eigenart bestand.
»Die hat es also bequemer gehabt als ich«, dachte der junge Mann, und dann richteten seine Blicke sich auf das Boot.
Jawohl, eine Dame saß drin und führte auch selbst die Ruder.
Nun hätte der einsame junge Mann ja wohl zunächst eben auf sie sehen müssen, auf ihr Gesicht, ihre Gestalt und so weiter —
Er tat es nicht, denn hinter dieser jungen Dame gewahrte er noch einen Mann, der eine für dieses Land ganz fremdartige Kleidung trug, einen weißen Kaftan und um das Haupt einen ebensolchen Turban.
Das musste wohl ein Inder sein, zumindest ein Orientale —
Dazu stimmte auch das gelbliche Gesicht, und der gekräuselte, blauschwarze Vollbart, der es umrahmte, passte erst recht zu einem Hindu.
»Nanu!«, flüsterte der junge Mann vor sich hin; weiter aber sollte er nicht Zeit zu langen Erwägungen finden, denn die kleine Barkasse wendete und fuhr davon, das Ruderboot mit seinen beiden Insassen aber kam gerade auf ihn zu.
Und nun sahen die drei Menschen, der junge Mann in seinem Kanu und die beiden in dem anderen Fahrzeuge gleichzeitig, wohin sie steuern mussten.
In den Strom hinein ragte ein gestürzter Baum, den das Wasser noch nicht vollständig hatte entwurzeln und mit sich forttragen können.
Es war ein ganz gewaltiger Kerl, ein Bombax, wie sie wegen ihrer Laubkrone genannt sind, und hinter diesem Baume zeigte sich eine Art Landzunge.
Das sah so aus, als bildete der gestürzte Riese eine Art Mole, um der Strömung Einhalt zu gebieten, und so konnten die beiden Fahrzeuge wirklich bequem dort landen.
Das heißt, der junge Mann ließ der Dame den Vortritt, hielt sich nur bereit, an Land zu springen, sobald es nötig würde.
Aber der Inder oder was es sonst sein mochte, der bei ihr war, war sehr aufmerksam, er glitt mit bewundernswerter Behändigkeit an ihr vorüber, stand auf dem festen Boden und hielt das Boot fest, dass die junge Dame ohne Mühe aussteigen konnte.
Im nächsten Augenblick landete auch das Kanu.
Und dann standen die drei Menschen einander gegenüber.
»Ich heiße Antonio Almeida«, sagte der junge Mann, seinen breitrandigen Hut ziehend.
Die Dame neigte den Kopf etwas.
»Ich bin die Ravelli«, sagte sie dann. »Und dieser hier ist Mohur Khan.«
Na da!

Diese beiden Worte hätte Antonio Almeida, der junge Mann, beinahe laut gesagt, das heißt nicht genau diese Worte, aber doch ähnliche, die ihnen im Portugiesischen entsprachen.
Er schaute nämlich jetzt ungescheut auf die junge Dame, auf diese Senhorita Ravelli, die er aber wohl besser als Signorina anzusprechen hatte, denn eine Italienerin war sie.
Das hatte er doch gleich gesehen, auch wenn er nicht schon vorher gewusst hätte, dass sie aus Castellamare stammte, also wirklich aus Italien.
Ja, Signorina Ravelli war die echte Italienerin, daran änderte auch das Haar nichts, denn das war eben nicht nachtschwarz, wie es hätte sein müssen, sondern rotgolden, fast leuchtend rot —
Und trotzdem war das eben eine Italienerin, wie sie im Buche stand, das konnte dieser Antonio Almeida recht gut beurteilen, denn in Brasilien wimmelt es eben von Italienern, und auch in seiner Vaterstadt Rio de Janeiro gab es eine Unmasse.
Warum er sie als Italienerin erkannte, besonders anzuführen, das erübrigt sich wohl, es würde zu viel Zeit erfordert und vielleicht langweilig werden.
Deshalb sei nur gesagt, dass Signorina Ravelli wie eine Juno gebaut war, ein majestätisches Weib, so recht eine olympische Göttin, dass sie sehr kleine Hände und entsprechend kleine Füße besaß und — dass sie recht berückend lächeln konnte, wie das der Fall war, als sie dem Brasilianer die rechte Patschhand hinstreckte.
»Buon giorno!«, sagte sie dabei auch gleich in ihrer Muttersprache.
Und dann setzte sie offen hinzu:
»Sie gefallen mir recht gut. Ich denke, wir werden miteinander auskommen.«
»Ich hoffe es ebenfalls, aber —«
Antonio Almeida schwieg, nur sein Blick sprach.
»O, ich habe ein anderes Kleid bei mir«, erwiderte denn auch gleich die Italienerin. »Ich brauchte es nur bisher nicht.«
»Vielleicht können Sie das, das Sie jetzt tragen, noch mit zurückschicken?«, sagte Almeida und schaute nach der Barkasse, die aber schon unsichtbar geworden war.
»Wozu das?«, erwiderte lachend die Dame. »Das werfen wir doch ins Wasser —«
»Wie Sie wünschen!«, konnte da Senhor Almeida nur sagen.
Und auf einmal lachte die Ravelli wieder hell auf.
Almeida verstand sie sogleich und stimmte deshalb in ihr Lachen ein.
»Jetzt haben die in der Eile vergessen, mein Gepäck auszuladen!«, sagte die rotblonde Juno.
»Auch Ihre Geige?«, ergänzte Antonio Almeida.
»Auch die.«
Der Brasilianer zog schon das indianische Kanu heran, schickte sich an, hineinzusteigen — hineinspringen durfte er nicht, denn da wäre er gleich durch den Boden hindurch ins Wasser gefahren.
»Ich werde der Barkasse nacheilen und Ihr Gepäck holen«, sagte er.
Da jedoch trat der Inder zwischen ihn und die Curiara.
»Bleiben Sie, Senhor!«, sprach er halblaut. »Sie werden sich nicht zu bemühen brauchen. Binnen wenigen Minuten wird das Gewünschte hier sein.«
»Das wäre ja allerdings das Beste«, gab Antonio Almeida zurück, »dass die Leute auf der Barkasse ihr Versehen merken und umkehren. Es würde mich Stunden harter Arbeit kosten, ehe ich zurückkehren könnte —«
Mohur Khan lächelte seltsam.
»Sie werden das Versehen nicht merken«, behauptete er.
»Und doch das Gepäck bringen? Ich verstehe Sie nicht ganz —«
»So warten Sie in Geduld!«
Und als Almeida sich nun fragend nach der Italienerin umschaute, da lächelte diese ihn an und sagte halblaut:
»Was Mohur Khan sagt, trifft stets ein. Mein Gepäck wird demnach in wenigen Minuten hier sein.«
»Ja, aber —«
Antonio Almeida sprach nicht weiter.
Ein fernes Geräusch drang an seine Ohren. Es war, als grolle dort unten irgendwo im Urwalde ein Gewitter.
Deutlich vernahm er ein Donnern, das jedoch mit auffallender Schnelligkeit näher kam.
Und da erklang auch schon wieder die Stimme des Inders.
»Zurück vom Ufer! Rasch!«
Das war nun freilich schneller gesagt als ausgeführt.
Der Urwald gab eben nur die schmale Landzunge frei, auf welcher die drei standen.
Hinter ihnen war undurchdringliches Dickicht —
Nein, das war eben nicht der Fall!
Als Mohur Khan sich einer bestimmten Stelle in diesem Dickicht näherte, da sahen die scharfen Augen Almeidas sofort, dass dort ein Gang vorhanden war, den vielleicht zur Tränke kommende Tiere getreten hatten.
Und obwohl er nicht wusste, warum sie so schnell diese Sandbank verlassen sollten, zögerte er doch nicht einen Augenblick, hob das leichte Kanu empor, in welchem seine Ausrüstung noch lag — Mohur Khan schritt voraus, die Italienerin folgte, und er machte den Beschluss.
Als sie in das Dunkel des Urwaldes untertauchten, da war das Donnern schon ganz nahe gekommen — war so laut geworden, dass es zwecklos gewesen wäre, noch etwas zu sagen.
Der Klang der menschlichen Stimme hätte dieses Dröhnen nicht zu übertönen vermocht, auch wenn man geschrien hätte, was nur die Lungen hergaben —
Noch eine andere Überraschung wartete Almeidas und der Ravelli.
Der schmale Pfad führte geradewegs zu einem Baume, wohl einer Palme — denn der schlanke Stamm ragte hoch empor, aber um ihn herum wand sich jene Schlingpflanze, welche von den Eingeborenen als »Affentreppe« bezeichnet wird — eine ganz merkwürdige Pflanze.
In Spiralwindungen schlingt sie sich um den Baum gleich einem festen Drahtseil, oft aus mehreren Einzelexemplaren zusammengesetzt, und wenn auch die Abstände zwischen den einzelnen Umwendungen zu eng sind, als dass ein größeres Tier als ein kleiner Affe sie wirklich als eine Art Wendeltreppe benutzen könnte, so vermag auch ein Mensch mit Hilfe dieser Pflanze eine Palme recht gut zu ersteigen. Und hier taten es die drei, nachdem der Inder den Anfang gemacht hatte.
Antonio Almeida war der zweite, die Ravelli machte den Beschluss, und so klommen sie ein Stück empor, vielleicht nur drei, vier Meter hoch — aber da tat der Inder auch schon einen Schritt seitwärts — und stand auf einem platten Felsen, auf den die anderen ihm folgten.
Und im gleichen Augenblick sahen sie von diesem erhabenen Standpunkte aus auf dem Flusse draußen eine haushohe Wassermasse herankommen.
Es sah aus wie eine Springflut — eine ganz merkwürdige Erscheinung —
Und das Merkwürdigste war, dass sie auf ihrem Rücken die Barkasse trug, die doch schon meilenweit flussabwärts gekommen sein musste.
Die drei auf dem Felsen sahen die Menschen in dem kleinen Fahrzeuge, gewahrten die verzweifelten Bewegungen —
Und während der Donner der Wassermassen zu betäubendem Brausen anschwoll, sanken diese urplötzlich in sich zusammen, platschten rechts und links in den Urwald, verliefen sich in den vielen Kanälen, die hier überall abbogen —
Und auf der Sandbank lag die Barkasse, als sei sie von einer Riesenhand dorthin gesetzt worden.
»Wunderbar!«, murmelte Antonio Almeida.
Dann jedoch kehrte er als Erster auf dem Wege, den er gekommen war, auf die Erde zurück, überzeugte sich, dass sein Kanu durch das Wasser nicht fortgespült worden war, sondern nur die Nase etwas in die grüne Pflanzenmauer eingebohrt hatte, und lief zu der Barkasse vor.
Die Männer darin waren noch bleich von dem ausgestandenen Schrecken.
Sie verstanden offenbar nicht, wie der Mann, der auf sie zukam, über das ganze Gesicht lachen konnte.
Antonio Almeida aber kümmerte sich nicht darum, sondern rief ihnen zu:
»Ihr habt vergessen, das Gepäck der Dame auszuladen. Gebt es her!«
»Jawohl, meine Geige! Meinen Ledersack!«, ergänzte die Ravelli, die nun auch herankam.
Niemand rührte sich, um diesem Befehl nachzukommen. Die Leute waren vielleicht noch gar nicht imstande dazu.
Doch da sprang die Ravelli in das Fahrzeug, das bewegungslos auf der Sandbank lag, fasste einen Ledersack, warf ihn hinaus und nahm ihren Geigenkasten in die Hand —
Nun fanden die Schiffer endlich Worte.
»Eine Pororoca!«, stöhnte einer von ihnen, und die anderen wiederholten dieses Wort.
Da wusste auch Antonio Almeida Bescheid.
Es war ja das erste Mal, dass er selbst Zeuge dieser seltsamen Naturerscheinung wurde, aber gehört hatte er davon, wusste auch, um was es sich dabei handelte.
Sie tritt nur in den südamerikanischen Flüssen auf, hauptsächlich in jenen, die ihr an sich enges Bett in der Mündung bedeutend erweitern.
Wenn dann im Meere die Flut eintritt, die in diesen Breiten sehr bedeutend ist, dann drängt manchmal eine ganz gewaltige Wassermenge mit ungeheurer Schnelligkeit stromaufwärts, ihr Nahen eben durch ein gewaltiges Donnern verkündend, die Menschen warnend, dass sie rechtzeitig flüchten.
Auf viel befahrenen Flussläufen sind wegen dieser Pororocas gleich Ausweichstellen eingerichtet worden, sogenannte Esperas; aber hier in dieser entlegenen Gegend war natürlich nicht daran zu denken, da hatte die kleine Sandbank als solche Espera dienen müssen.
Nicht darüber wunderte sich also Antonio Almeida jetzt mehr, sondern nur, weil die Pororoca bis zu dieser entlegenen Stelle vorgedrungen war, und noch mehr, weil der Inder, der doch in diesen Urwäldern überhaupt nicht Bescheid wissen konnte, die Flutwelle vorausgesagt und vorher gewusst hatte, dass die Barkasse noch einmal zu ihnen zurückkehren würde.
Er schaute nach dem ihm jetzt fast geheimnisvoll erscheinenden Manne hin und stellte doch nur fest, dass sein Gesicht unbewegt war wie immer. Mit über der Brust verschränkten Armen stand er da, den Blick seiner dunklen Augen in die Ferne gerichtet.
Inzwischen hatten die Bootsleute noch einen anderen Ledersack auf den Sand gelegt, daneben eine besonders schön gearbeitete Büchsflinte und ein krummes Messer in einer metallenen Scheide —
Dann sprangen die Männer selbst heraus, begannen an der Barkasse zu schieben und zu rucken und brachten sie auch in Bewegung, schoben sie so weit, dass die Strömung das Vorderteil erfasste und nun als ziehende Kraft wirkte —
Und kaum schwamm das Fahrzeug, als auch schon die Männer hineinsprangen, der Maschinist den Hebel an der Maschine herumwarf — und unmittelbar darauf schoss die Barkasse in eiligster Fahrt davon — entschwand abermals in überraschend kurzer Zeit den Blicken der Nachschauenden.
Die drei standen wieder allein auf der Sandbank, jetzt aber das Gepäck zu ihren Füßen, und die Ravelli lachte ihr heiterstes Lachen.
»Sie sind ein Zauberer, Mohur Khan!«, rief sie dann. »Ich habe es schon immer gewusst, nun aber gibt es für mich keinen Zweifel mehr —«
»Ja, wie war das möglich?«, entfuhr es auch Antonio Almeida. »Wie konnten Sie diese Pororoca voraussehen und wissen, dass sie uns die Barkasse zurückbringen, dass die Flutwelle gerade hier zusammenbrechen würde?«
Mohur Khan antwortete nicht gleich. Erst nach einer ganzen Weile sagte er mit seiner wohllautenden, tiefen Stimme:
»Es musste so sein!«
Darauf bückte er sich, nahm sein Eigentum auf, hing sein Gewehr um, schob den krummen Dolch in den Gürtel und setzte sich auf den Boden, stumm wartend, bis Antonio Almeida das Kanu in das Wasser schob und fahrbereit machte.
Durch eine Handbewegung lud er die Dame ein, Platz zu nehmen, der Inder stieg ebenfalls ein, und dann folgte Almeida nach.

Antonio Almeida half der Dame ins Boot.
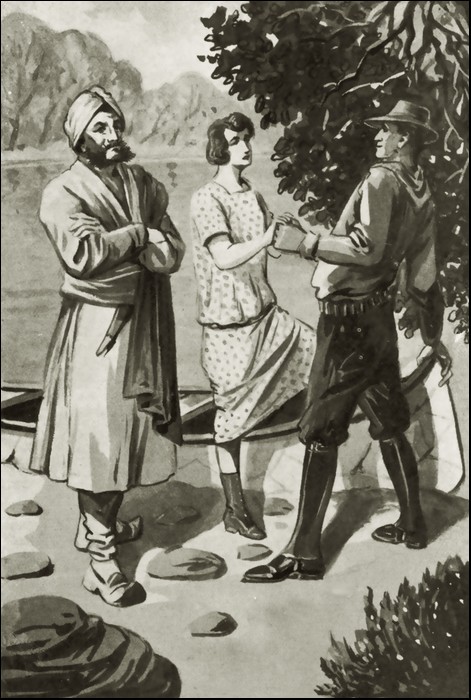
Variante der obigen Frontispiz-Abbildung zu Lieferung 6
»Den zweiten Kanal links!«, erklang da die Stimme Mohur Khans wieder.
Doch Antonio Almeida tauchte das Ruder nicht ein, hielt das Kanu noch hinter dem umgestürzten Baume außerhalb der Strömung.
Er wendete sich um, schaute den Inder an und fragte:
»Sie sind von Mister Samuel Philipp der Senhorita als Begleiter beigegeben worden? Sie kennen den Weg, welchen wir zu nehmen haben? Und Sie wollen als Führer auftreten? Wissen Sie, dann ziehe ich vor, Sie allein fahren zu lassen. Ich komme mir wenigstens sehr überflüssig vor.«
Und er machte Miene, auszusteigen, packte auch schon den Ledersack, der vor seinen Füßen lag.
Ein Lachen der Ravelli klang an seine Ohren und erhöhte seinen Unmut.
Fast hätte er vergessen, was er der Dame schuldete; seine schwarzen Augen flammten sie drohend an.
Desto mehr lachte sie.
»Senhor, Senhor!«, rief sie endlich.
»Was wünschen Sie noch, Senhorita?«, fragte er kurz, während der Inder sich überhaupt nicht um dieses Gespräch kümmerte.
»Sie brennen lichterloh, Senhor Almeida! Ohne jede Ursache! Oder wissen Sie, wohin Sie sich von hieraus wenden sollen? Sie schütteln den Kopf? Nun also — dann müssen Sie sich doch den Weisungen Mohur Khans fügen —«
»Ich lasse mir von niemand befehlen!«, klang es trotzig zurück.
»Und sind doch hier, weil Sie sich bereits etwas haben befehlen lassen — von eben diesem Mister Philipp!«, entgegnete die Italienerin.
»Das ist etwas anderes. Das war kein Befehl, das war eine Anfrage, ob ich Sie an einen bestimmten Platz bringen wollte, ob ich bereit sei, gemeinsam mit Ihnen eine Aufgabe zu lösen — — ich will davon nicht sprechen, es ist mir verboten worden —«
»So! Es ist Ihnen verboten worden! Ein Verbot ist wohl kein Befehl?«, fragte die Ravelli, und das Lächeln, mit dem sie diese Fragen begleitete, war nicht spöttisch, was den heißblütigen Brasilianer sicher erst recht in Zorn versetzt hätte.
Es war ein Lächeln, das ihn mit einem Male entwaffnete.
Er konnte sogar schon wieder lachen.
»Sie haben recht! Ich bin ein Narr!«, sagte er und setzte sich wieder.
Aber ehe er das Ruder ergriff und das Kanu in die Strömung hinaustrieb, fügte er hinzu:
»Vielleicht erklären Sie mir alles Nötige während der Fahrt?«
»Gerne, Senhor Almeida.«
Da schlug er das Ruder in das Wasser. Und während der nächsten Minuten hatte er keine Zeit zu etwas anderem, musste er alle Kraft aufbieten, um das Fahrzeug durch die Strömung in ruhigeres Wasser zu bringen.
Nach einer halben Stunde erst war es so weit, brauchte er nur hier und da einen Ruderschlag zu tun, denn auf dem Wasser unter den Bäumen glitt das Kanu wie von selbst dahin.
Und nun sagte er aus eigenem Antriebe:
»Warten Sie, bitte, mit den Erklärungen, bis ich den Eingang zu dem zweiten Kanal gefunden habe.«
So wurde die Fahrt vorläufig schweigend fortgesetzt.
Die Italienerin beobachtete das Leben im Flusse und im Walde, ohne etwas zu fragen, und Mohur Khan hatte ja überhaupt noch nichts wieder gesprochen, verhielt sich auch jetzt so schweigsam, als wäre er stumm.
Antonio Almeida aber beobachtete scharf das linke Ufer, bis er endlich den unter dichtem Pflanzenwuchs verborgenen Kanaleingang gefunden hatte, dem Kanu eine scharfe Wendung gab und in diese Wasserstraße einbog.
Fast im gleichen Augenblicke begann die Ravelli zu sprechen.
»Hören Sie, Senhor!« sagte sie. »Sie wünschen eine Aufklärung über die Gegenwart Mohur Khans. Mister Philipp schickte ihn zu mir mit einem Briefe.
Ich habe diesen Brief hier in der Hand, will Ihnen die betreffenden Stellen vorlesen. Da steht:
Ihre Aufgabe ist, den Hombre dorado zu suchen und zu finden. Man brachte
diese sagenhafte Gestalt in Verbindung mit verschiedenen Gegenden am Rio
Amazonas, hat sogar von einem Lande Eldorado gesprochen, es gesucht, seit dem
16. Jahrhundert.
Unzählige Menschen haben diesem Wahn ihr Leben oder wenigstens ihre Ge
sundheit geopfert — immer hat man vergebens gesucht, hat man jedoch feststellen
können, dass jener Hombre dorado, der vergoldete Mann, existiert hat, dass er
sogar an verschiedenen Stellen vorkam — immer hat es sich jedoch um nichts
weiter gehandelt als um eine religiöse Zeremonie: Ein Häuptling hatte die Pflicht
sich allmorgendlich am ganzen Körper mit Goldstaub pudern zu lassen, bis er
wie eine Bildsäule aus Gold aussah.
Dann wurde er auf einen See, auf eine Lagune oder auf den Fluss gefahren,
sprang aus dem Kanu ins Wasser und spülte so den Goldstaub von seinem Kör
per.
Oft wurden bei dieser Gelegenheit auch noch goldene Geräte, Schmucksachen,
kostbare Edelsteine versenkt.
Man fand eine solche Badestelle im See von Guatavita, der 3000 Meter über
dem Meere liegt, hat aus seiner Tiefe goldene Kostbarkeiten geborgen, ihn auch
abzulassen versucht, indem man das eine der felsigen Ufer durchstach.
Der Hombre dorado ist bloß an einer Stelle zu suchen und zu finden, und das
kann nur einer tun, der die Geheimnisse dieser längst vergessenen Religion kennt,
der Bescheid weiß über den Priesterkönig Idacanza, den Liebling des Lichtgottes
Bochica, dessen Residenz in Sogamaso war, jenes Priesterkönigs, dessen heiligen
Namen niemand, bei sofortiger Todesstrafe, aussprechen durfte, dessen Geheim
nis daher bis heute gewahrt geblieben ist —
Und dieser eine, der das Geheimnis kennt, ist Mohur Khan, den ich Ihnen mit
diesem Briefe schicke. Er soll Sie und Senhor Almeida bis zu jener Stelle bringen,
wo Sie selbst in Tätigkeit treten müssen Bis dahin fügen Sie sich seinen Weisun
gen, und dass er mehr kann als nur befehlen, das werden Sie ja selbst bald erle
ben.
So, das ist die Stelle, die für Sie in Betracht kommt, Senhor Almeida«, fügte die Italienerin dieser Vorlesung hinzu. »Ich hoffe, es wird genügen?«
»Ich muss mir daran genügen lassen," erwiderte der Brasilianer. »Aber ich muss gestehen, dass meine Aufgabe nichts von diesem sagenhaften Hombre dorado erwähnte, dass ich aufgefordert wurde, einen Loke Klingsor ausfindig zu machen, der sich Fürst des Feuers nennt, und der überdies noch den Beinamen ›der Mann mit den Teufelsaugen‹ führt. Auf seinem Rücken trägt er sieben rote Runen —«
»Die wir kopieren und wofür wir eine Million Dollar von Samuel Philipp erhalten sollen! Ganz recht!«, ergänzte die Ravelli. »Eben diesen Mann aber werden wir, wie Mister Philipp mir sagte, im Gebiete des geheimnisvollen Hombre dorado finden, in einer Gegend, die sich hoch über das übrige Land erhebt, infolge einer vulkanischen Katastrophe, die vor vielen tausend Jahren stattgefunden hat.
Und dieses hochliegende Land ist das Reich des Hombre dorado, ist das Gebiet, wo unser die Arbeit wartet, die wir leisten müssen —«
»Aber dieses Gebiet kann doch nicht hier liegen!«, wendete Antonio Almeida ein. »Hier werden wir auf Flachland stoßen, auf Steppen —«
Er kam nicht weiter.
Aus den Tiefen des Waldes, durch den sie fuhren, klangen auf einmal ganz eigenartige Laute.
»Trommeln!«, sagte Antonio Almeida.
Verwundert schaute die Ravelli ihn an.
»Zu unserer Begrüßung?«, fragte sie spöttisch.
»Ja. Zu unserer Begrüßung — aber mit Giftpfeilen —! Das sind Indianer, die sich durch Trommelsprache verständigen. Sie beobachten uns sicher schon, seit wir in diesem Kanal sind.«
»Ich habe noch keinen gesehen«, meinte die Italienerin, immer noch ganz sorglos.
Doch Antonio Almeida spähte, ohne auf sie zu achten, nach den Baumzweigen, die das an sich ganz schmale Fahrwasser überwölbten, ein grünes, ziemlich dichtes Dach bildend.
Dabei war überhaupt nicht zu erkennen, wie weit zu beiden Seiten die Wasserfläche reichte.
Luftwurzeln, die von den Ästen nach unten wuchsen, versperrten jede Aussicht, es war ein sogenannter Mangrovenwald.
Dabei durfte nicht damit gerechnet werden, dass diese Luftwurzeln etwa mit der Machete zerhauen werden könnten, dass es dadurch möglich würde, unter diese Bäume selbst zu kommen.
Jede der Luftwurzeln war gleichsam versteinert durch einen dichten Überzug von Muscheln und anderen Schaltieren —
Plötzlich wendete Antonio Almeida sich um.
Er war merkwürdig rot, als er nun die junonische Italienerin anschaute und leise sagte:
»Bitte, Senhorita, nehmen Sie Ihr Lederkleid aus dem Sacke — ich hoffe wenigstens, dass Sie eins bei sich führen —«
»Jetzt? Wegen der Wilden, die uns mit ihren Trommeln begrüßen?«, fragte sie verwundert.
»Ja, ich bitte darum. Jeden Augenblick kann ein Pfeilhagel aus dem Blattwerk dort oben auf uns herabprasseln.«
»Und davor soll ein Lederkleid mich schützen?«
»Wenigstens den Körper, die Stellen, die es eben verdeckt. Den Kopf und den Hals umwinden Sie mit einem Tuche oder wickeln das Kleid zusammen, das Sie anhaben — bitte, tun Sie es gleich — wir werden —«
Er blickte den Inder an, ob der ihn verstände, aber Mohur Khan schien ihn nicht zu sehen, hatte die starren Augen geradeaus gerichtet, saß ganz regungslos.
Die Ravelli merkte die Sorge, von der Antonio Almeida befallen war, sie bückte sich, öffnete den Ledersack und zog ein Kleid hervor, wollte es vielmehr tun —
Als sie sich vorneigte, trat ein, was Antonio Almeida befürchtet hatte.
Aus den Zweigen über ihnen schwirrte es wie ein Schwarm großer Insekten, und da schrie auch schon die Italienerin auf.
In ihrem Nacken, den das Kleid ganz freigab, stak ein dünnes Stäbchen, ein Stückchen Rohr, stand zitternd eine Sekunde aufrecht und fiel dann auf den Boden des Kanus.
Die anderen Geschosse schienen nicht getroffen zu haben, oder sie waren wirkungslos an der Lederkleidung Almeidas abgeprallt.
Mohur Khan war überhaupt nicht gefährdet gewesen, der Pfeilregen war nur nach dem Vorderteile des Kanus gegangen, hatte ihn gar nicht berührt.
Bei dem leisen Aufschrei der Ravelli aber erbleichte Antonio Almeida.
Einen Moment stand er noch zaudernd, dann jedoch sprang er neben die Italienerin, drückte mit seinen Händen ihre Schultern tief nach vorn — und presste seinen Mund auf die kleine Wunde, aus welcher kaum ein Tropfen Blut ausgetreten war.
Er saugte mit aller Kraft, dass die braune Haut in der Nähe sich ganz hell färbte, richtete sich auf, gab die Italienerin frei, spie aus, was er im Munde hatte, bückte sich, riss das Lederkleid ganz hervor und stülpte es ziemlich rücksichtslos über den Kopf der Ravelli.
»Rasch doch! Rasch!«, rief er drängend. »Ziehen Sie es vollends herab. Hoffentlich schließt es eng um den Hals —«
Er selber griff nach seinem Gewehr, feuerte schnell nacheinander mehrere Schüsse nach verschiedenen Richtungen in das Astgewirr über sich, hatte auch schon das Ruder in der Hand und jagte das leichte Fahrzeug so eilig wie möglich dahin —
Er wendete nicht mehr das Haupt zurück, die Zähne fest zusammenbeißend, und so sah er nicht, wie die Ravelli mühsam genug das Lederkleid weiter herabzog, in die Ärmel schlüpfen wollte, es aber nicht fertig brachte und nun kurz entschlossen erst das andere Gewand abstreifte, das sie trug, es nach unten gleiten lassend.
Nun erst konnte sie das andere überstreifen, es zurechtziehen und zunesteln.
Ja, es war ein ganz echtes, nettes Lederkleid, aber eben für eine Dame gefertigt, viel mehr als nötig und für diese Wildnis ratsam ausgeschnitten, wenn auch natürlich nicht etwa wie ein modernes Ballkleid, das oben nicht anfängt und unten nicht aufhört —
Jedenfalls blieb auch jetzt noch der schöne Nacken ungeschützt, ebenso der schlanke Hals und ein Teil der Brust —
Ja, und die Ärmel reichten gerade bis an das Ellbogengelenk, waren weit und überdies an der Seite geschlitzt, wenngleich da wieder durch eine rote Seidenschnur zusammengehalten.
Wie weit es unten reichte, war vorläufig nicht zu sehen, da sich dort noch das abgestreifte Kleid bauschte, unter dem die Ravelli sich mit beiden Händen zu schaffen machte.
Bis sie endlich die Füße herauszog.
Da zeigte sich, dass sie nun eine Art indianische Mokassins trug, die aber nicht nur den Fuß, sondern noch die Hälfte des Unterschenkels umschlossen und über welche außerdem noch enganliegende Gamaschen gezogen waren, die noch über die Knie empor reichten, bis zu denen das Kleid eben reichte.
Das Kleid war zu sehen, als sie nun aufstand, sich reckte und streckte, um das Lederkleid zum richtigen Sitz zu bringen.
Ob sie wusste, wie vorzüglich es ihre herrliche Gestalt zur Geltung brachte? Viel mehr als das andere Kleid es getan hatte.
Aber sie bückte sich noch einmal, hob dieses auf und schleuderte es lachend in das Wasser, wollte es tun, kam aber mit dem Schwung etwas zu weit —
Das Kleid blieb in dem Gewirr der Luftwurzeln hängen.
Und lachend schaute die Ravelli hinüber.
»Auf der Rückreise werde ich es vielleicht wieder mitnehmen können«, sagte sie, stülpte dabei schon den breitkrempigen Lederhut auf, den sie dem Sacke entnommen hatte, band den daran befestigten Riemen unter dem Kinn zu oder schob eine Schnalle vor oder wie sie das sonst machte.
»So, Senhor Almeida«, sagte sie. »Sind Sie nun mit mir zufrieden?«
Da wendete er sich ihr zu, sah sie vor sich stehen, errötete jäh und — löste von seinem Nacken ein Seidentuch, das er ihr hinhielt.
Er sprach kein Wort dabei, ruderte schon wieder.
Die Ravelli aber hatte das Tuch in der linken Hand und schaute es an, als sei es ein Gegenstand. den sie überhaupt noch nicht gesehen hatte.
Bis sie es hob, um den Nacken legte und vorn zusammenknotete, um sich dann langsam wieder auf den Boden des Kanus zu setzen.
Jetzt war sie rot geworden, und diese Röte wollte nicht wieder weichen.
Aus dem Dickicht ringsum aber scholl nun wieder das bald dumpfe, bald helle Rasseln der geheimnisvollen Trommeln, und immer rascher glitt das Kanu dahin, bis es ganz plötzlich einen wuchtigen Stoß erhielt, dass die drei Insassen nach vorn geschleudert wurden —
Und ehe sie sich noch wieder hatten aufraffen können, erklang ringsum ein misstönendes Geheul, wurden die Bäume gleichsam lebendig, schütteten Männer herab — kleine, schmutzigbraune Kerle — Wilde —
Und da surrten auch schon wieder Pfeile, aus langen Blasrohren geschossen, wieder solche kurze Rohrstängel.
Doch diesmal traf keiner. Die Angreifer hatten kaum zielen können —
Und da stand auch schon Antonio Almeida in dem Wasser neben dem aufgefahrenen Kanu und hieb mit der umgekehrten Büchse auf die Wilden ein.
Mohur Khan aber hatte sein krummes Messer gezogen —
So rasch, wie sie gekommen waren, verschwanden die Angreifer wieder in dem grünen Dickicht, suchten hastig ihre Gefährten mit sich zu ziehen, die von den beiden Männern niedergestreckt worden waren. Zwei nur ließen sie zurück, weil sie tot waren, und so sah nun erst die Ravelli diese tierischrohen Gesichter, im Todeskampfe noch so recht verzerrt — sah eigentlich nicht einmal diese Gesichter, sondern nur die scheußliche Malerei, aus Längs- und Querstrichen bestehend —
Sie wendete sich schaudernd ab.
Antonio Almeida aber kümmerte sich jetzt anscheinend nicht um sie, hatte sich nur durch einen raschen Blick überzeugt, dass sie nicht abermals verwundet worden war.
Er wendete sich zu dem Inder, der seinen Dolch in die Scheide schob.
»Wohin nun?«, fragte er kurz.
Zur Antwort hob Mohur Khan nur den rechten Arm, deutete gerade voraus.
Vor ihnen erhob sich eine Art Graswald, denn Schilf war es nicht, aber es sah so aus, und da nicht daran zu denken war, mit dem Kanu noch weiter vorzudringen, gleich gar nicht in diese grüne Wildnis hinein, so stiegen auch die Ravelli und der Inder noch aus.
Antonio Almeida hob sich seinen Ledersack auf den Rücken, packte auch den der Italienerin, hielt in der rechten das Gewehr und schritt, ohne noch etwas zu sagen, in dem seichten Wasser vorwärts, verschwand in dem rauschenden Grase, dessen Halme ihn überragten.
Lautlos folgten die beiden anderen und merkten alsbald, dass das Wasser ganz verschwand, dass sie erst noch auf weichem Boden liefen, dann aber auf festem, und nach einigen weiteren Schritten war das Gras zu Ende, machte einer schier endlos sich ausdehnenden Steppe Platz.
Antonio Almeida blieb stehen. Er wartete, bis auch die beiden anderen aus dem Graswalde herauskamen, und ehe er nun an Mohur Khan eine weitere Frage wegen des einzuschlagenden Weges richten konnte, deutete dieser mit der erhobenen Hand nach Süden.
Als Antonio Almeida dorthin schaute, entdeckten seine scharfen Augen ganz am Horizonte einen dunklen Strich.
Das konnte ein ferner Wald, aber auch ein Gebirge sein.
Nun trat er noch einmal zu der Ravelli.
»Sie müssen mir erlauben, die Wunde zu untersuchen«, sagte er.
»Und Sie mir, Ihnen für die rasche Hilfe zu danken«, erwiderte sie, löste das Seidentuch vom Nacken, beugte sich leicht vor und gab ihm dadurch einen Blick auf die Stelle frei, wo der Pfeil sie getroffen hatte.
Ehe er sich jedoch darüber beugen und die kaum sichtbare Wunde untersuchen konnte, vernahm er die Stimme des Inders, der sagte:
»Sie brauchen sich nicht zu bemühen, Senhor Almeida, Senhorita Ravelli wird nicht an Gift sterben.«
»Wenn Sie das so bestimmt wissen!«, erwiderte da der Brasilianer, trat zurück und — schritt im nächsten Augenblicke schon über das niedrige Gras der Steppe dahin, es den beiden anderen überlassend, ob sie ihm folgen wollten oder zurückbleiben.
Er war jedoch noch nicht weit gekommen, da hatte die Ravelli ihn eingeholt.(1)
(1) Hier folgt im Original der Satz »›Schlangen sind hier‹, stieß er leise, fast zischend hervor.«, der an dieser Stelle keinen Sinn ergibt und auf der folgenden Seite im richtigen Zusammenhang wiederholt wird.
Sie fasste nach der Hand, in welcher er ihren Ledersack hielt.
»Senhor Antonio!«, sagte sie bittend.
»Was wünschen Sie?«, fragte er kurz, ohne sie anzuschauen.
»Sie sollen nicht zürnen! Ich kann es nicht ertragen. Mohur Khan muss doch so handeln, er hat seinen Auftrag wie wir, und — dort drüben — an dem Ziel, das er uns angegeben hat, hört seine Führerrolle auf, dort muss er sich I h n e n fügen — Senhor — denken Sie daran, dass wir vielleicht viele Monate miteinander leben müssen, da dürfen Misshelligkeiten nicht aufkommen —
Oder — wenn Sie meine Bitte nicht erfüllen wollen, dann — — nun, dann helfen Sie mir, dass ich umkehren kann, dann will ich nichts mehr mit dieser Sache zu tun haben —«
Antonio Almeida antwortete nicht gleich.
Er kämpfte mit sich selbst, sie sah es, und sie wusste, was in ihm vorging, aber sie sprach keine neue Bitte aus, wartete immer neben ihm bleibend, bis er endlich hervorstieß:
»Es sei! Ich füge mich!«
Da spürte er einen leichten Druck an seiner Hand.
Die Ravelli blieb stehen, wartete, bis Mohur Khan neben ihr war und schritt mit diesem weiter.
Der Marsch über die Steppe war an sich gewiss nicht beschwerlich, wurde es nur durch die sengende Hitze, mit der die Sonne herabbrannte.
Den beiden Männern schadete sie nicht viel, aber der Künstlerin, die doch an solche Wanderungen unmöglich gewöhnt sein konnte, musste es wie eine schwere Strafe vorkommen.
Sie ließ sich nichts merken, hielt mit dem Inder Schritt, aber sie atmete schwerer und schwerer, Schweißperlen standen auf ihrer Stirn und rannen über ihre Wangen —
Und endlich musste sie stehen bleiben.
Ob das feine Ohr Antonio Almeidas das vernommen hatte oder ob er sich nur zufällig umwendete, war nicht festzustellen.
Jedenfalls tat er es, sah die Italienerin an — zögerte einen Augenblick, bückte sich, Gewehr und Ledersack fallen lassend, umschlang mit beiden Armen die Ravelli, hob sie empor und schritt weiter, dabei dem Inder befehlend:
»Heben Sie das auf, tragen Sie es!«
Und Mohur Khan weigerte sich nicht, gehorchte, nahm das Gewehr und den Ledersack und setzte sich gleich dem Brasilianer in eine Art Trab.
Die Ravelli wusste noch gar nicht, wie ihr geschah, sie wehrte sich nicht, suchte sich so leicht wie möglich zu machen — nur ihr Atem ging auf einmal wieder verdächtig rasch.
Und in ihren dunklen Augen war ein merkwürdiges Leuchten.
Antonio Almeida sah es nicht, er schien auch keine Ermüdung zu spüren.
Gleichmäßig schritt er in flinken Schritten aus, jagte gleichsam über die Steppe dahin, bis der dunkle Strich, der erst so fein geschienen hatte, näher und näher kam, sich als ein steil aufragender Felsenwall herausstellte, am Fuße durch dichten Pflanzenwuchs umsäumt —
»Bitte lassen Sie mich herunter, Senhor!«, sagte da die Ravelli.
Sofort blieb Antonio Almeida stehen, die Italienerin glitt zu Boden, und weiter wanderten die drei, bis der Brasilianer etwa hundert Meter vor dem grünen Dickicht stehen blieb.
»Bambus!«, sagte er. »Das sind wahrhaftig Bambus!«
Er hatte ein Recht, so verwundert zu sein. Bambuswälder trifft man in Südamerika kaum. Diese Grasart ist ein asiatisches Gewächs, eine Sumpfpflanze — und hier in dieser Steppe, am Fuße dieser wohl fünfzig Meter steil ansteigenden Felsenwand war kein für das Wachstum des Bambus günstiger Boden.
Trotzdem breitete sich das Dickicht ohne die geringste Unterbrechung nach beiden Seiten hin aus — und hinter ihm stand immer, gleich steil, gleich unersteiglich, die Felswand, aus einem merkwürdig dunklen Gestein bestehend.
Mohur Khan trat neben den noch immer Stutzenden.
»Bis zu dieser Stelle soll ich Sie führen«, sagte er.
»Bis zu dieser Stelle? Waren Sie denn schon hier? Kennen Sie diese Gegend?«
Mohur Khan schüttelte den Kopf.
»Ich habe Indien das erste Mal verlassen, als Mister Philipp mich zu sich rief«, erwiderte er dann. »Doch ich sah diesen ganzen Weg, und ich sah noch mehr. Ich will es Ihnen zeigen, damit ich meine Aufgabe ganz erfülle.«
Er schritt auf das Bambusdickicht zu, drang aber nicht ein, sondern hielt sich am Rande, immer nach dem Felsen hinüberschauend.
Die Bambusstauden ragten wenigstens zehn Meter hoch empor, und so verdeckten sie, was jenseits von ihnen lag.
Doch der Inder ließ sich nicht aufhalten.
Bis er plötzlich stehen blieb und den Flammendolch aus der Scheide zog.
»Schlangen sind hier«, stieß er leise, fast zischend hervor.
Die Ravelli, die es hörte, kreischte leicht auf, stellte sich gleich hinter Antonio Almeida —
»Schlangen!«, stöhnte sie. »Ich kann diese Tiere nicht ausstehen —«
Aber danach ging es ja nicht, da hätte sie sich eben nicht in diese Wildnis wagen dürfen —
Und schon kamen aus dem Dickicht die Reptilien hervor.
Es heißt, dass Schlangen nie einen Menschen angreifen, mit Ausnahme der Riesenschlangen — aber auch die tun es selten.
Das traf jedenfalls hier nicht zu, und der eingeborene Brasilianer wusste auch gleich, mit was für Schlangen er es zu tun hatte.
»Surucucus!«, sagte er.
Und auch er zog sein langes Haumesser, die einzige Waffe, die ihm hier nützen konnte, denn diese Surucucus gehen wirklich auf jeden los, der ihnen zu nahe kommt, begnügen sich nicht damit, ihn etwa in die Flucht getrieben zu haben, sondern verfolgen ihn in einer ganz eigentümlichen Weise, gleichsam springend —
Zählen konnte weder Antonio Almeida die Surucucus, die aus dem Bambusdickicht herauskamen, unter immerwährendem boshaftem Zischen, hoch emporgerichtet mit den Köpfen vorwärtsstoßend —
Er hob die Machete, und mit dieser furchtbaren Waffe hätte er sich schon der gefährlichen Angreifer erwehren können, denn an eine Flucht dachte er natürlich nicht, konnte es der Ravelli wegen gar nicht, die sich vor Grauen kaum noch auf den Füßen zu halten vermochte, sich aber glücklicherweise nicht an ihn klammerte, ihn dadurch in der freien Bewegung hemmend.
Doch Antonio Almeida sollte gar nicht dazu kommen, etwa ein halbes Dutzend Schlangenköpfe mit seinem furchtbaren Haumesser abzusicheln —
Mohur Khan stand dicht neben ihm, zwar den Flammendolch in der rechten Hand, aber doch regungslos —
Und was er sonst tat, wie er das anfing, das vermochte Antonio Almeida beim besten Willen nicht zu sagen, schon deswegen nicht, weil er doch nur auf die Surucucus blickte, die keine zwei Meter vor ihm waren.
Und die nun auf einmal zurückwichen, in sonderbarer Weise — zögernd, als wollten sie doch noch auf die Menschen losgehen —
Aber als erst mal eine sich umgewendet hatte, gab es für die andern kein Halten mehr, sie krochen ebenso eilig, wie sie gekommen waren, in das Dickicht zurück und waren verschwunden, ehe noch die beiden anderen wussten, wie es geschah.
Mohur Khan rührte sich noch nicht. Unbeweglich stand er da, bis auch das leiseste Rascheln in dem Bambusgewirr verklungen war.
Dann drang er genau an der Stelle, wo die Schlangen erschienen waren, in das Dickicht ein. Die beiden anderen folgten ihm, sogar die Ravelli, die nicht mehr zitterte —
Und da merkten sie, dass sie auf einem Pfade gingen, der freilich sehr schmal war, dessen Vorhandensein jedoch mindestens ein ebenso großes und ebenso unerklärliches Rätsel bildete, wie vorhin die Flucht der gefährlichen Schlangen.
Wenigstens war es ein Rätsel für Antonio Almeida und hätte eins sein müssen, für jeden, der mit der Natur des Bambus vertraut ist, der wusste, wie rasch diese Pflanze sich ausbreitet.
War heute ein Pfad durch einen Bambuswald gehauen, unter unsäglichen Schwierigkeiten, so ist er morgen vielleicht schon wieder verwachsen, sicher aber nach einigen Tagen.
Niemand vermag mehr zu sagen, wo die ausgehauene Stelle war.
Hier also war ein Pfad inmitten des Bambusdickichts vorhanden, anscheinend schon seit langem.
Warum hatten die Stauden ihn nicht wieder überwuchert?
Und vor allem, wer hatte ihn vor langer Zeit gehauen?
Denn das musste viele, viele Monate her sein, die seitwärts im Dickicht liegenden abgehauenen Stängel waren ganz und gar vertrocknet, prasseldürr —
Aber wer sollte diese Frage beantworten? Mohur Khan? Vielleicht hätte er es gekonnt, er tat es keinesfalls, schritt immer schweigend dahin, bis nach einer Stunde vielleicht die Felswand ihm Halt gebot.
Und da sahen die beiden anderen wieder etwas, was sie staunen ließ: An der Stelle, wo sie nun standen, war ein fast kreisrundes Loch in dem Gestein sichtbar, etwa in Mannshöhe über dem Boden, und unter ihm war ein langer, roter Pfeil angemalt, der gerade auf dieses Loch hinzeigte.

»Hier ist mein Führeramt zu Ende«, sagte Mohur Khan. »Durch diese Höhle dort werden wir in das Reich gelangen, das wir suchen. Auf dieser Hochebene, vor deren Fuß wir stehen, lebt der Hombre dorado —«
»Lebt?«, fragte Antonio Almeida rasch, ohne auf das andere zu achten.
Und der Inder nickte schweigend.
»Dieser Hombre dorado ist auch der Mann mit den Runen auf dem Rücken?«, fragte Almeida.
Wieder nickte Mohur Khan.
Diesmal aber setzte er hinzu:
»Du sagst es, Sahib!«
Durch dieses »Du«, das der Inder überhaupt sonst als Anrede ausschließlich benutzt, außer er spricht eben Englisch, das ja nur das »Sie« kennt, zeigte er ebenso wie durch das »Sahib«, was »Herr« bedeutet, dass er fortan Antonio Almeida als solchen anerkennen wollte, dass seine Führerrolle wirklich zu Ende war.
Ob der Brasilianer das sofort verstand, war zumindest zweifelhaft — er stand wie gebannt — die Blicke starr nach einer Stelle gerichtet, ganz bleich, so weit das bei seiner braunen Haut möglich war — und dann zeigte er auch noch vorwärts —
»Da! — Seht doch bloß —«, stieß er schweratmend hervor.
Und die Ravelli, die neben ihm stand, sah es auch —
Es war ein entsetzlicher, grauenhafter Anblick.
Auf dem Boden lag, lang ausgestreckt, ein menschliches Gerippe — das eines Mannes offenbar, ein vollkommen vom Rost zerfressenes Gewehr neben sich — von den Kleidern waren nur noch modrige Fetzen übrig, aber Stiefel und Hut waren fast ganz erhalten —
Und zwischen den Knochen dieses Skeletts ragten Bambusstauden empor — aber keine frischgrünen — nein, alte gebrochene, zersplitterte — und es ist ja wohl bekannt, dass diese Bambussplitter so scharf sind wie Messer, schärfer noch, dass sie gleich die Hand durch und durch bohren, wenn man sich etwa auf einen solchen abgebrochenen »Halm« stützen wollte —
Nein, diese Bambus waren unter der Last zersplittert, die von der Höhe des Steinwalles auf sie geschleudert worden war, waren gebrochen und hatten den Unglücklichen nicht nur etwa aufgespießt, sondern hatten ihn durchbohrt, hatten den zuckenden Körper zu Boden sinken lassen — und da standen sie nun noch so —
Und da sagte Mohur Khan:
»El Hombre dorado bringt Menschenopfer. Sie werden immer von der Höhe eines Felsens in einen Bambuswald geschleudert —«
»Aber das ist doch ein weißer Mann gewesen!«, schrie Antonio Almeida da auf und bückte sich —
Als er sich wieder aufrichtete, hatte er eine Brieftasche aus starkem Leder in der Hand.
Er öffnete sie durch einen Druck auf das silberne Schloss, und das erste, was er und die neben ihm stehende Ravelli sahen, war eine Fotografie — drei Menschen waren darauf abgebildet — ein junger schlanker Mann, vor ihm sitzend ein blondlockiges Mädchen auf dem Schoße einer jungen, schönen Frau.
Mit Tinte stand unten quergeschrieben:
»Zu Papsis Geburtstag, den 5. VIII. 1897.«
Also das Grab des Afrikaforschers, der hier seinen Tod gefunden hatte, sollte ein einfacher Steinhaufen sein, der sich unter einem vorspringenden Felsen erhob, vielleicht darauf noch ein aus einem zerbrochenen hölzernen Ladestocke zusammengebundenes Kreuz.
So hatte O'Donnell die letzte Ruhestätte seines Freundes beschrieben, mehr zu erblicken, durfte die Olinda nicht erwarten.
O'Donnell hatte zuerst die letzten Schritte getan, die ihn um die Felsenecke brachten.
Bestürzt hatte er dagestanden.
»Alle Himmel, was ist denn das?!!«
Im nächsten Augenblicke war die Olinda an seiner Seite, und nach dem, was sie übers Grab gehört hatte und sie es sich nun einmal vorstellte, konnte auch sie nur staunen.
Der überhängende Felsen und darunter der aus größeren und kleineren Steinen aufgehäufte Grabhügel waren vorhanden; aber aus diesem erhob sich statt der zusammengebundenen Bruchstücke eines Ladestockes ein richtiges schwarzes Kreuz, offenbar aus poliertem Holz, ziemlich groß, mit goldenen Linien verziert, sonst ganz schmucklos und dennoch einen sehr gediegenen, feierlichen Eindruck machend, und ferner war dieser Steinhaufen an einigen Stellen mit Erde bedeckt und schönen Blumen bepflanzt, nicht allzu reichlich, sodass noch die roh übereinander geschichteten Steine zu sehen waren, dafür aber war das ganze Grab mit einigen Dutzend manneshohen Zypressen und Lebensbäumen umstanden.
So machte es in seiner düsteren Schlichtheit einen überaus feierlichen Eindruck!
»Wer hat das getan?!«
Dies noch rufend oder flüsternd, näherte sich O'Donnell der Anlage vollends, aber mehr schleichend als gehend, so groß war dieses Rätsel für ihn.
Und es schwand nicht, war nicht nur eine Fata Morgana, er konnte die Bäumchen und Blumen mit Händen tasten, was er denn auch mehrmals tat.
»Das sind natürliche Bäume! Das sind natürliche Blumen!!«
»Ja, selbstverständlich!«, meinte die Olinda, die nicht in die gleiche Aufregung verfiel. »Glaubten Sie erst, es seien künstliche?«
»Ja. Wer aber hat diesen Grabschmuck angelegt, wer hat diese Erde hierher geschafft, und wer — vor allen Dingen — begießt die Pflanzen! Fühlen Sie, die Erde ist ganz feucht!«
Auch die Olinda überzeugte sich davon, und dann blickten die beiden einander an.
»Sollte jener Mann, der sich Loke Klingsor nennt...?«
»Es kann wohl schwerlich jemand anders in Frage kommen!«
»Er soll sein Versteck ja kaum vier Kilometer von hier entfernt haben.«
»Eben deswegen!«
»Wusste er denn von diesem Grabe hier —?«
»Er muss es wohl erfahren haben, hat vielleicht den Mord und das Begräbnis selbst beobachtet.«
»Was für einen Grund hat er, dieses Grab so zu schmücken?«
»Weil er eben weiß, wer hier ruht, und dass es Menschen gibt, die diesem Toten ein anderes Grab gönnten, weil er eben ein Mensch ist, der ein Herz besitzt und die Mittel hat, den einfachen Steinhaufen zu —«
»Da eine Fußspur!!«
Die Olinda hatte sie zuerst erblickt.
Von dem Grabe weg führte in dem feinen Sande die Spur eines nackten Männerfußes durch die Schlucht nach Osten.
O'Donnell war eben erst von dem Anblick dieses Grabes so überrascht gewesen, dass auch sein Detektivauge diese Spur nicht gleich gesehen hatte, die ja übrigens auf dieser Stelle mehrfach deutlich hervortrat.
»Der Mann, der diese Fährte zurückgelassen, ist zuletzt hier gewesen!«
»Um die Pflanzen zu begießen. Alles ist ja noch triefend nass!«
»Wollen wir der Spur folgen?«
»Gewiss werden wir das tun!«
»Sie könnte uns in das Versteck jenes geheimnisvollen Klingsor führen.«
»Das ist ja eben unser Ziel.«
»Tiefer hinein, als wir zu hoffen wagten.«
»Es könnte uns doch nur erwünscht sein, wenn wir gleich in seine intimsten Geheimnisse dringen.«
»Ob aber ihm das angenehm ist? Ob da Gefahr droht?«
»Miss — von diesem Manne, der das Grab eines Menschen so pflegt, haben wir nichts zu fürchten!«
»Sie haben recht. Also wollen wir?«
»Sofort! Hier haben wir nichts mehr zu suchen. Jetzt ist es zwanzig Minuten nach vier, und wenn uns diese Spur zu jener Stelle führt, die Mister Philipp uns angab, sind wir nur noch vier Kilometer davon entfernt. Bei Tageshelligkeit könnten wir dann allerdings nicht mehr ins Lager zurückkommen, aber wir haben ja unsere Taschenlampen bei uns, und überdies geht bald nach Sonnenuntergang der Vollmond auf. Also vorwärts!«
Sie folgten ohne Weiteres der Fußspur.
»Wenn wir annehmen, dass...«
»Verzeihung, Miss!«, unterbrach O'Donnell sofort die Sprecherin, dabei auch gleich stehen bleibend. »Ich mache ganz gleichförmige Maßschritte und zähle sie, beobachte auch den Kompass. Auf diese Weise ist es mir möglich, jene Stelle auch ohne geografische Ortsbestimmung, die doch immer sehr zeitraubend ist, ziemlich genau zu bestimmen, also den Punkt, zu dem diese Spur uns führen wird, zumal wenn ich ab und zu meinen kleinen Situationsplan befrage, den ich damals entworfen und bei mir habe.«
Sie schritten weiter, ohne noch ein Wort zu sprechen, O'Donnell die Schritte zählend und den Kompass beachtend, manchmal auch eine kleine Karte zu Rate ziehend.
Immer lief die Spur des nackten Männerfußes vor ihnen hin in dem feinen Sande, niemals kam felsiger Boden.
Wohl führte sie in dem Schluchtenlabyrinth hin und her, aber eine bestimmte Richtung wurde doch immer eingehalten.
So war fast eine Stunde vergangen als die Änderung eintrat.
Die Schlucht, durch die jetzt die beiden gingen, wurde von einer Seitenschlucht gekreuzt, in der die Felswände glatt wie gemauert bis zum Himmel emporstiegen, nur dass sie sehr viele Höhlen zeigten, und zwar direkt über dem Boden — eine Folge von Auswaschung durch Wasser, das einst, vor ungezählten Jahrtausenden, hier vorhanden gewesen war.
Die Spur führte in dieser Seitenschlucht nur noch eine kleine Strecke nach rechts, dann verschwand sie in solch einer Höhle.
Die beiden blieben stehen, O'Donnell aufmerksam sein Kärtchen betrachtend.
»Ja, es stimmt — wir stehen dicht vor der von Mister Philipp bezeichneten Stelle, bis auf die Ortssekunde angegeben, sodass also ein Rechteck von nur 30 Meter Länge und 28 Meter Breite in Betracht kommt.«
»Sind Sie hier schon damals gewesen?«
»Nein, gerade auf dieser Stelle noch nicht, wie ich Ihnen bereits gesagt habe, aber wohl in der weiteren Umgebung. Das ganze Gebirge zeigt hier deutlich seinen vulkanischen Ursprung, Krater sind vorhanden, obgleich wir bis jetzt noch keinen gesehen haben. Die Kraterbildung fängt erst weiter östlich an.«
»Die Spur führt in diese Höhle.«
»Und wir müssen nach. Also folgen Sie mir, Miss Olinda! Trennen wollen wir uns lieber nicht, und Mut brauche ich Ihnen wohl nicht erst einzusprechen, Sie haben schon Beweise genug für Ihre Unerschrockenheit erbracht. Nur wollen wir gleich unsere Lampen entzünden, die Höhle scheint sehr tief zu sein, dort hinten ist es schon ganz finster.«
Sie setzten ihre Taschenlampen in Brand und stellten den Scheinwerfer ein.
In der Höhle selbst war die Spur nicht mehr zu sehen, weil der Sand fehlte, der Boden war harter Felsen.
Sie mochten etwa zehn Meter tief eingedrungen sein, als sie gegen die hintere Wand stießen, was sich aber gleich als ein Irrtum erwies, der nur im Scheine der Lampen möglich gewesen war.
Die Höhle machte hier als Gang einen scharfen Bogen, eine Ecke, dahinter setzte sie sich als Spalte seitwärts fort, allerdings so eng, dass kaum zwei Menschen sich hätten ausweichen können.
Nur wenige Schritte, dann kam wieder eine Ecke, die Spalte verbreiterte sich wieder zum bequemen Gange, der auch seine anfängliche Richtung zurückgewann... und da schimmerte ihnen auch schon wieder das Tageslicht entgegen!
Mit wenigen Schritten standen sie im Freien, hatten eine ebenso wunderbare wie merkwürdige Szenerie vor sich.
Ein gewaltiger Trichterkessel, völlig kreisrund, mindestens hundert Meter im Durchmesser haltend, an den schrägen, himmelhohen Felswänden liefen Galerien herum, und genau in der Mitte des Kessels eine kreisrunde Barriere von, wie wir gleich angeben wollen, dreißig Meter im Durchmesser und etwa einen halben Meter hoch.
Der Boden war ganz ebener Felsen.
Besonders staunend betrachtete die Olinda diese Szenerie.
»Das ist ja ein regelrechtes Amphitheater!«, rief sie.
»Sie meinen, ein künstlich angelegter Zirkus mit Sitzplätzen ringsherum?«
»Nichts anderes!«
»Nein, das brauchen wir nicht anzunehmen, das kann ein ganz natürlicher Krater sein, an dem Menschenhände nicht das Geringste geändert haben.«
»Aber diese regelmäßigen Galerien — oder diese regelmäßigen Steinstufen als Sitzbänke!«
»Ganz so regelmäßig finde ich sie doch nicht. Sehen Sie, was für unregelmäßige Bogen die Stufen dort machen, einmal hoch, einmal niedrig?«
In der Tat, bei näherer Betrachtung erkannte auch die Olinda, dass jene Regelmäßigkeit doch fehlte, die auf menschliche Bautätigkeit hätte schließen lassen.
»Das ist ein ganz regelrechter Krater, allerdings einer von idealster Beschaffenheit, wo eben die Feuerkraft einmal ganz normal hat wirken können, nicht durch verschiedene Gesteinsarten mit verschiedenem Schmelzpunkt gestört wurde«, erläuterte O'Donnell näher. »Wir brauchen gar nicht nach der Mitte zu gehen, ich kann Ihnen schon jetzt versichern, dass sich dort im Boden auch wieder ein Trichterloch befindet, dessen Wände aber keine solche Absätze zeigen.
Das ist der innere Krater, den überhaupt jeder Vulkan hat, wenn eben auch nicht immer so ideal abgegrenzt.
Durch diesen ersten oder inneren Krater steigen die glühenden Lavamassen aus dem Innern der Erde
Dieser Vulkan aber ist zweifellos niemals übergeflossen, hat nie viel Asche geblasen. Auch der äußere Krater war immer nur mit glühender Lava gefüllt, wie diese bei so vielen Vulkanen auf dem Malaiischen Archipel vorkommt.
Nun hatte die Lava Zeit, zu erstarren, wobei sie sich an den Rändern des äußeren Kraters absetzte, und zwar nach Art ihrer verschiedenen Schwere und Schmelzbarkeit.
Auf diese Weise sind die Galerien und Steinstufen entstanden.
Es ist gewissermaßen eine Kristallisation in kolossalem Maßstabe, nur nicht aus dem wassergelösten, sondern aus dem feurigflüssigen Zustande heraus.
Wo nun die übrigen Lavamassen geblieben sind?
Die sind von dem kleinen, inneren Krater, als sie noch flüssig waren, wieder eingesaugt worden, und zwar umso eher, als durch die erste Explosion eine Entspannung der Gasdämpfe folgen musste, sodass der innere Krater eben wieder saugend wirkte.
Und dieses Aufsaugen ging so radikal vor sich, dass der ganz ebene Boden entstanden ist. Nur hatte damals, bei den ersten Ausbrüchen, der innere Krater noch nicht die Umfassungsmauer.
Nun musste aber der Entspannung wiederum ein innerer Druck folgen.
Die Lava ist dadurch nochmals emporgestiegen, jedoch nicht mehr explosionsartig, sie konnte nur wenig über den Rand des kleinen Kraters treten, und als sie wieder zurückgesaugt wurde, hinterließ sie den erstarrten Außenwall.
Das ist die ganz natürliche Erklärung, wie solch eine ideale Doppelkraterformation mit Galerien entstehen kann.«
So hatte O'Donnell erklärt, wozu er nicht gerade ein Geologe zu sein brauchte, und die Sängerin musste ihm wohl glauben.
»Also das ist der Platz, wo jener Loke Klingsor hausen soll?«, flüsterte sie.
»Ja, meiner Berechnung nach, und noch genauer muss diese Stelle gerade in der Mitte liegen. Gehen wir hin!«
Sie überschritten den wie asphaltierten Platz. Richtig, der niedrige Steinwall, auch wieder von ganz regelmäßigen Formen, umgab ebenfalls ein schwarzes Trichterloch, oben also etwa dreißig Meter im Durchmesser.
Hier aber waren die Wände völlig glatt. Das Ende des Trichters konnten die beiden natürlich nicht erblicken, verlor sich in schwarzer Finsternis, die Neigung der Wände war keine bedeutende.
Sie schickten die Blendstrahlen ihrer Laterne hinab. Es mochte nur eine optische Täuschung sein, dass sie das Ende noch immer nicht zu sehen meinten.
Der Trichter schien eben immer enger und enger zu werden. Wohl erblickten sie unten ein kleines Loch, das aber in endlose Ferne gerückt zu sein schien. Also glaubte man in eine grundlose Tiefe zu blicken.
»Schauerlich, ganz schauerlich!« Die Olinda wandte sich gruselnd ab. »Ich weiß sonst nichts von Schwindelgefühl, aber mir ist, als zöge mich eine unwiderstehliche Kraft über die niedrige Brüstung dort hinab.«
O'Donnell ließ seinen Blendstrahl noch länger hinein fallen.
»Dies also soll der Zugang zu dem unterirdischen Schlupfwinkel jenes Loke Klingsor sein«, meiste er gedankenvoll.
»Es ist schon wunderbar genug, dass wir genau auf der bezeichneten Stelle wirklich so etwas gefunden haben«, flüsterte die Olinda, sich immer noch scheu nach allen Seiten umblickend.
»Kein Stein ist zu sehen, den man hinabwerfen könnte. Haben Sie nicht etwas bei sich, was Sie entbehren könnten?«
»Herr, beschwören Sie die unterirdischen Geister lieber nicht!«
»Dazu sind wir aber hierher gekommen. Probieren wir es erst einmal so.«
Er riss einige Blätter von seinem Notizblock ab, ballte sie zusammen, tränkte sie aus seiner Lampe mit Petroleum, brannte sie an und ließ den Feuerball in den Trichter fallen.
Ja, man sah, wie dieser nach unten immer enger wurde, aber die Tiefe konnte so noch immer nicht ermittelt, nicht einmal irgendwie abgeschätzt werden. Es war eine ganz eigentümliche Sache dabei.
Schon nach wenigen Sekunden hatte sich der brennende Feuerball in eine glühende Kugel verwandelt, die immer kleiner ward, aber es war nicht zu sehen, ob sie noch immer fiel oder schon festlag und nach und nach verlöschte.
»So können wir die Tiefe nicht ergründen, dazu müssen wir ein Seil oder einen langem Draht haben.«
»Dann kommen wir morgen wieder«, meinte die Olinda, sich noch immer scheu umsehend.
»Wollen Sie nicht gleich einmal versuchen, den irdischen Geist durch den Zauber Ihres Gesanges hervorlocken?«
»Ach, mein lieber O'Donnell, mir ist jetzt gar nicht nach Singen zumute!«
»Und ich habe mich so darauf gefreut! Wie habe ich diese Stunde herbeigesehnt, da wir endlich an dieser Stelle stehen werden! Ist Ihnen während der ganzen Reise nichts aufgefallen? Oder Sie haben es doch nicht etwa als eine Unhöflichkeit aufgefasst?«
»Was denn?«
»Ich habe Sie nicht ein einziges Mal gebeten, Ihre herrliche Stimme erschallen zu lassen, uns auch nur das kleinste Liedchen vorzusingen.«
»Mister Snatcher hat mich dazu desto öfter aufgefordert, in ganz plumper, roher Weise, und ich sage Ihnen: Eben wegen dieses Kerls, der uns immer wie Pech anklebte, war mir die Kehle stets wie zugeschnürt. Sonst hätte ich schon einmal ohne Aufforderung gesungen.«
»Fast wusste ich diesen Grund Ihres Schweigens. Jetzt sind wir aber doch allein; morgen hingegen ist auch wieder Snatcher dabei, das wird sich nicht vermeiden lassen.«
»Und ich sage Ihnen, mein lieber O‹Donnell: Ich kann jetzt unmöglich singen. Mir ist die Kehle — wieder aus einem anderen Grunde — wie zugeschnürt. O, ist das schauerlich hier!«
»Aber da können Sie doch auch morgen nicht und niemals hier singen, zumal wenn Snatcher dabei ist.«
»O, das ist dann etwas anderes, dazu kommt der Zwang, das eiserne Muss. Das ist bei uns Künstlern eben so. Wir stehen manchmal auf der Bühne, das Herz todestraurig, und wir müssen jubilieren — bis es mit einem Male auch aus vollem Herzen kommt. Aber jetzt hier — so ganz freiwillig — ohne jeden Zwang — ich bring's beim besten Willen nicht fertig.«
»Schade, jammerschade! Da wollen wir wenigstens noch...«
O'Donnell brach ab, um zu lauschen, wie es auch die Olinda tat.
»Ist das nicht Wasser, was da plätschert?!«, flüsterte sie.
Da hörte dieses Wasser O'Donnell nicht nur, sondern fühlte es sogar schon!
Der Quell entsprang seinem eigenen Rücken und floss ihm an den Beinen hinab!
Sein auf dem Rücken hängender Wasserschlauch war geplatzt und entleerte sich schnell, was jedem plombierten und unter Staatsaufsicht längere Zeit kontrollierten Karawanenschlauche passieren kann.
Bekommt so ein Schlauch von Ziegenleder aber erst einmal den kleinsten Riss, dann gibt es kein Halten mehr, dann platzt er gleich der ganzen Länge nach auf.
Im Nu hatte sich der ganze Sack entleert.
»Sehen Sie, ganz eben ist dieser Boden doch nicht, das Wasser läuft nach der Mitte zu, wie einst auch die Lava, als sie von dem Innenkrater wieder aufgesaugt wurde«, konstatierte O'Donnell, und gleich darauf konnte er noch hinzusetzen: »Der Umfassungswall ist unten übrigens durchlöchert, das Wasser läuft hinein — da kommt es auf der unteren Seite schon wieder zum Vorschein, fließt in den Krater hinein!«
»Umso mehr Grund für uns, dass wir gleich den Heimweg antreten! Ich hatte Sie eben um einen Trunk Wasser bitten wollen«, sagte die Olinda.
»Sind Sie durstig?!«
»Na, gar so schlimm ist es nicht, aber die Kehle netzen müsste ich erst einmal, ehe ich singen könnte, und da dies nun nicht mehr möglich ist, kann ich nun auch nicht mehr singen.«
»So gehen wir.«
In dem Augenblick aber, da sich die beiden wandten, sollten sie erst noch eine kleine Überraschung erleben. Obgleich sie dasselbe eigentlich jeden Tag hatten.
In diesem Talkessel hatten ja schon immer die Abendschatten gelagert.
Plötzlich aber ward es stockfinster.
Die Sonne war eben untergegangen, die letzte Sphäre ihrer Scheibe unter dem Horizonte verschwunden.
Ja, diesen schnellen Übergang vom Tag zur Nacht waren sie schon gewohnt; es gibt in diesen äquatorialen Breiten eben keine Dämmerung, auch nicht bei Sonnenaufgang.
Aber ganz so plötzlich geht der Wechsel zwischen Helligkeit und Finsternis ja nun freilich nicht. Hier dagegen war es geschehen — weil eben dieser Kessel schon immer im Schatten gelegen hatte! Es war nicht anders gewesen, als wenn in einem schwacherleuchteten Saale plötzlich auch noch das letzte Licht ausgelöscht worden wäre.
Anstatt dass die Olinda nun auch dies noch als etwas Unheimliches empfunden hätte, begann sie mit einem Male heiter zu lachen.
»Ach, das war ja köstlich! Dreht uns hier der Herr Loke Klingsor einfach das Licht vor der Nase aus!«
»Miss, wir sollten nicht tun, als ob wir wüssten, wer hier haust, wir sollten keinen Namen nennen«, flüsterte O'Donnell.
»Aber, mein Bester, wenn ich nicht irre, haben Sie vorhin selbst ganz laut diesen Namen genannt!«
»Tat ich es? Möglich! Ja, wir haben uns wenig oder wohl gar nicht darüber unterhalten, wie wir hier eigentlich alles arrangieren wollen. Na, dann ist es eben für heute zu spät. Treten wir nun den Rückweg an! Morgen werden wir weiter sehen.«
Jetzt aber schien die Olinda Lust zu haben, gleich hierzubleiben, wenn sie auch nicht gerade davon sprach, dass sie singen wolle, doch bestand O'Donnell darauf, dass der Heimweg angetreten wurde, vielleicht, weil er glaubte, seine Begleiterin leide schon Durst.
Der Ausgang war nicht leicht wiederzufinden; es gab auf dieser Seite gar keine zweite Höhle; keine solche war zu erblicken.
»Das sieht auch wieder fast danach aus, als sei es ein künstlich angelegter Zugang zu diesem Kraterkessel«, meinte O'Donnell. »Dazu brauchte ja nur von der anderen Seite aus eine der Höhlen, eine recht tiefe, nach hinten durchbrochen zu werden.«
Während sie den Platz überschritten, hatten sie sich nun schon an die Stockfinsternis gewöhnt, die sie umgab, nun sahen sie die Sterne am Himmel funkeln.
»Jetzt ist schon der Mond aufgegangen, bald muss er über die Kraterwände kommen.«
»Da könnten wir gleich hierbleiben. Das muss herrlich sein, hier so eine Vollmondnacht — ohne den Snatcher!«, versuchte die Olinda noch einmal.
Aber jetzt bestand O'Donnell auf seiner Absicht, sofort ins Lager zurückzukehren, und seine Begleiterin fügte sich sofort, wie sie sich während der ganzen Reise seinem Willen gefügt hatte, was bei dieser Evastochter, zumal noch einer angebeteten Sängerin, gewiss sehr bemerkenswert war.
Sie erreichten den Höhleneingang, drangen ein.
»Wo mag denn nun eigentlich«, begann da die Olinda wieder, »unser Mann geblieben sein, dessen Spur wir gefolgt sind? Den haben wir ja bei alledem ganz vergessen?«
»Er wird vor uns einen bedeutenden Vorsprung gehabt haben, weiß überdies hier Bescheid und wird... alle Wetter, was ist denn das?!«
O'Donnell wusste bestimmt, dass hier die Ecke gewesen war, um die er jetzt hätte biegen müssen, um in die enge Spalte zu kommen.
Aber diese Ecke war nicht mehr vorhanden! Der Gang wurde von einer festen Felswand abgeschlossen!
»Da ist unterdessen eine Wand vorgeschoben worden!«
»Sehr interessant!«, meinte die Olinda gelassen, als auch sie den Felsen betrachtete.
»Wir sollen hier nicht wieder heraus können!«
»Dann bleiben wir eben hier.«
»Das ist das Werk dieses Klingsor!«
»Ohne Zweifel, und das hat er recht gemacht.«
»Ich lasse mich aber so nicht fangen!«
»So tun Sie etwas dagegen.«
»Es kann doch nur eine Schiebetür sein oder so etwas Ähnliches; sie muss sich doch auch wieder öffnen lassen!«
»Hören Sie, Mister O'Donnell, ich glaube, wenn dieser Loke Klingsor hier so etwas geschaffen hat, dann hat er auch dafür gesorgt, dass kein Unbefugter diese geheime Tür so leicht wieder öffnen kann.«
Vergebens hatte denn auch O'Donnell einige Zeit an dem Felsen herumgetastet, nach einem geheimen Mechanismus suchend.
»Eine nette Geschichte!«
»Ich finde sie ganz hübsch«, entgegnete die Olinda nach wie vor.
»Sie leiden Durst!«
»I ganz und gar nicht.«
»Aber was soll aus uns werden, wenn wir keinen anderen Ausgang finden?«
»Das werden wir schon sehen, was aus uns wird? Verschmachten werden wir keinesfalls.«
»Weshalb nicht?«
»Weil hier ein Mann haust, der jemand vier Kilometer weit mit der Gießkanne schickt, um die Pflanzen auf einem Grabe zu bewässern. Der wird wohl uns zwei nicht verschmachten lassen.«
»Hm, Sie mögen recht haben.«
»Gewiss habe ich recht! Ja, Mister O'Donnell, ist das überhaupt nicht ganz famos? Jetzt hat dieser Herr Loke Klingsor dem Herrn Snatcher den Weg verlegt, dass er uns nicht folgen kann, hat ihm die Tür vor der Nase zugemacht — jetzt werde ich auch singen, singen werde ich, singen...«
Mit diesen Worten, denen Laute beigemischt waren, wie ein Vögelchen sie jubelnd ausstößt, wenn es die Tür seines Käfigs offen findet und mit ausgebreiteten Schwingen ins Freie schlüpfen kann, war sie schon hinausgeeilt.
Überrascht blieb sie stehen.
Denn wiederum hatte sich die ganze Szenerie verändert.
Der Vollmond war über den Kraterwänden aufgegangen.
Er beleuchtete ja dasselbe Bild, aber in seinem magischen Lichte bekam dieser steinerne Galeriensaal, über dem sich der sternfunkelnde Himmel wölbte, eben ein ganz anderes, ein grandioses Aussehen.
»O, ist das herrlich, herrlich!«
Noch eine staunende Betrachtung, und sie wandelte nach dem Innenkrater zurück. Es war ein Wandeln gewesen. Hier noch ein kurzes Sinnen, noch einmal ein Umschauen in dem Felsensaale.
»Ja, ich werde singen. Was soll ich singen? Keine Koloratur, nichts Heiteres kann es sein. Hier diese nackten Felswände, kein grüner Halm zu sehen — Stein, alles Stein — er greift mir bis ans Herz, um hier eine namenlose Sehnsucht auszulösen — o, ich weiß, ich weiß, was ich singen werde — diese namenlose Sehnsucht nach einem Paradiese muss sich Luft machen...«
So hatte sie leise gesprochen, nur zu sich selbst, und sie begann.
Und nun erst noch eine kleine Bemerkung, um zu schildern, wie sie sang.
Die Anna Kutschbach, genannt Olinda, war keine Konzertsängerin. Sie war Opernsängerin. Also zugleich Schauspielerin.
Hierbei ist ein gewaltiger Unterschied.
Der Konzertsänger ist immer nur ein Künstler, mag er auch noch so gottbegnadet sein. Der Opernsänger muss, soll er echt sein, selbst ein produktiver Schöpfer sein.
Der Konzertsänger steht auf dem Podium und kann sich nur wenig bewegen. Er sieht das Publikum und singt für dieses.
Der Opernsänger, wenn er ein echter Künstler ist, sieht das Publikum gar nicht, er singt nur für sich selbst — oder eben für die Person, an die er seine Worte richtet, er geht völlig in der Person auf, die er darstellt, er verschmilzt mit ihr, und danach bewegt er sich auch.
Die Vorbereitung der Olinda bestand darin, dass sie sich sammelte.
Sie beugte den Kopf vor, legte eine Hand gegen die Stirn, dann vor die Augen.
Da war sie aber bereits nicht mehr die Anna Kutschbach, auch nicht die Olinda, sondern da war sie bereits eine andere Person, die, deren Lied sie jetzt erschallen lassen wollte.
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
Im goldnen Laub die Goldorangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?
Kennst du es wohl? Dahin, dahin
Möcht' ich mit dir, o, mein Geliebter, ziehn!
Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach,
Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach.
Und Marmorbilder stehn und sehn mich an:
Was hat man dir, du armes Kind, getan?
Kennst du es wohl? Dahin, dahin
Möcht' ich mit dir, o, mein Geliebter, ziehn!
Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg;
In Höhlen wohnt der Drachen Brut;
Es stürzt der Fels und über ihn die Flut.
Kennst du ihn wohl? Dahin, dahin
Geht unser Weg — dahin, o, mein Geliebter lass uns ziehn!

Das Lied war verklungen. Noch einmal die Arme, die nie geruht hatten, sehnsuchtsvoll ausgestreckt und wieder etwas in sich zusammensinkend, gegen den Busen gepresst.
Es soll nicht zu schildern versucht werden, wie sie es gesungen hatte.
Wie soll man überhaupt so etwas schildern können!
O'Donnell war überwältigt.
Er hatte nicht die Anna Kutschbach, nicht die Olinda singen hören — es war die arme kleine Mignon gewesen, mit einer Gauklerbande aus ihrem sonnigen Süden nach dem kalten Norden verschlagen, die er mit machtvoller und doch so unbeschreiblich süßer Stimme hatte sehnsuchtsvoll klagen hören.
Die Olinda hatte sich wieder verwandelt, sich in die Wirklichkeit zurückversetzt.
»Nun, wie hat es Ihnen gefallen?«, wandte sie sich in heiterem Tone an ihren Begleiter.
»Fragen Sie nicht, fragen Sie nicht!«, entgegnete der, und es klang fast schluchzend.
»Aber wie ist's denn nun mit dem da unten?«, fuhr die Olinda gleich fort, in den Trichter hinabspähend. »Das Lied war für ihn bestimmt. Ich soll ihn mit meiner Singerei aus seinem unterirdischen Schlupfwinkel hervorlocken. Also? He, Herr Loke Klingsor, Fürst des Feuers und der Hölle, Sie Mann mit den Teufelsaugen und der schwarzen Katze auf der Schulter — haben Sie mich gehört? Hat Ihnen das Lied gefallen?«
Mit schallender Stimme hatte es die Olinda, sich mit den Händen auf den Umfassungswall stützend, direkt in den Krater hineingerufen.
Es war das erste Mal, dass einer von ihnen so direkt mit erhobener Stimme hineinsprach oder gar rief.
Und da erscholl dort unten in dem finsteren Krater ein murmelndes Stimmengewirr.
Etwas betroffen fuhr die Olinda zurück, hatte sich aber schnell wieder gefasst, begann doch auch O'Donnell ob ihres Schreckens gleich zu lachen.
»Das war das Echo Ihrer Stimme.«
Jetzt tat aber die Olinda, nach diesem Schrecke nur noch übermütiger werdend, als ob sie das nicht glauben wolle.
»Echo meiner Stimme?«, wiederholte sie, sich erstaunt stellend. »Keine Spur davon! Das waren ganz selbstständige Worte. Haben Sie nicht gehört, was da ganz deutlich gemurmelt wurde?«
»Wenn ich diese Murmelei in Worte übersetzen soll, so war es mehr, mehr, mehr, mehr,...«, lachte O'Donnell. »Sie sollen noch mehr singen.«
»Sie wollen mehr hören, Herr Klingsor?«, rief sie wieder in den Trichter hinab.
Wieder ein murrendes Stimmengemurmel, das eben nur ein Echo sein konnte.
»Gut, dann will ich Ihnen auch noch etwas vorsingen, Herr Loke Klingsor. Aber ja nichts übel nehmen, das gibt's bei uns nicht!«
So hatte die übermütige Künstlerin in den finsteren Schlund hineingerufen.
Jetzt richtete sie sich auf und trat an den Wallrand, stützte sich mit den Händen darauf, und so sang sie diesmal direkt in den finsteren Schlund hinein, ohne dass diese etwas unbequeme Stellung ihrer Stimme und ihrer phänomenalen Kunst irgendwelchen Abbruch tat, aus Mozarts »Don Giovanni«:
Schmäle, tobe, lieber Junge!
Sieh, Zerline will mit Freuden
Wie ein Täubchen alles leiden,
Nur verzeihen sollst du ihr!
Nur nicht maulen, nur nicht grollen,
Nur nicht grämeln, nur nicht schmollen,
Alles sei sonst recht getan!
Her dein Händchen, her zu mir!
Schmäle, schmäle, lieber Junge,
Sieh, Zerlinchen will mit Freuden
Wie ein Täubchen alles leiden.
Nur verzeihen sollst du ihr!
Mit ihr schmollen, mit ihr grollen
Kannst du nicht, mein süßer Junge!
Das Lied war verklungen. Die Olinda war wieder zurückgetreten.
»So, gelockt habe ich, um Verzeihung gebeten auch, aber mir scheint gar nicht, als ob....«
Das Wort erstarb ihr vor Schreck auf den Lippen.
Durch die blauen Fluten des Stillen Ozeans, der diesen Namen einmal wirklich verdiente, steuerte ein kleiner, aber auffallend stark gebauter Dampfer, ein sogenannter »Norweger«.
Diese »Norweger« sehen aus wie gepanzert, haben aber nur eine doppelte Beplankung, dazwischen ist ein Hohlraum.
Sie werden da benutzt, wo es viel Eisgang gibt, auch zur Küstenschifffahrt, weil sie schon einmal ein »Anecken« vertragen können.
Immer wieder einmal stoppte der kleine Dampfer, der am Heck den Namen »Delphin« führte, es wurde auch etwas Gegendampf gegeben, bis er ganz still lag, und dann machten drei an Deck stehende Männer, jedenfalls Kapitän und Steuerleute, nach der hochstehenden Sonne geografische Ortsbestimmungen, eifrigst rechnend. Darauf hieß es wieder: halbe Kraft voraus — einen halben Strich Steuerbord — stopp! — halbe Kraft zurück — — stopp!
Und nun, wenn der Dampfer wieder still lag, neue Berechnungen, und dazu loteten zwei Matrosen unausgesetzt.
Also jedenfalls wurde hier mitten im Stillen Ozean eine Untiefe gesucht.
Ein vierter Mann beobachtete jene drei Rechner, manchmal an Deck hin und her gehend.
Es war kein so kleiner Mann, sondern, wenn er nicht mit anderen Menschen verglichen werden konnte, nur deshalb so klein aussehend, weil er fast ebenso breit wie hoch war.
Ein ganz kolossaler Körperbau, und auf den gewaltigen Schultern ein wahrer Stierkopf, zu dem auch wieder die finsteren, herrischen Züge passten, die etwas an die einer Bulldogge erinnerten.
Das war Richard Flint, ein professioneller Taucher, aber keiner von jenen, die im Dienste von Werften nach gefundenen Schiffen tauchen, um da eine Hebung vorzubereiten oder wohl auch gewisse Sachen heraufzubefördern, wenn sie nicht als Schlosser nur mit Reparaturen unter Wasser beschäftigt sind.
Richard Flint gehörte jenen Tauchern an, welche in der Welt wohl den abenteuerlichsten Beruf betreiben, dabei ganz geschäftsmäßig. Es sind die Lumpensammler des Meeres.
Wie die Statistik beweist, scheitern an jedem Tag einige Schiffe.
Geschieht dies direkt an der Küste, sodass das Wrack noch auf dem Strande liegt, so ist da nicht viel zu wollen.
Die Zeit des freien Strandgutes ist schon längst vorbei. Also nicht etwa, dass das Wrack samt Inhalt dem gehört der es findet, sodass er es nun durch von ihm bezahlte Arbeiter ausladen lässt. Es gibt nur noch einen Finder- und einen Bergelohn, und es ist herzlich wenig, was man da für schwere Arbeit bekommt.
Anders ist es, wenn das Wrack unter Wasser liegt, sodass auch bei Ebbe über den höchsten Punkt des Schiffsrumpfes — Takelage ausgeschlossen — noch mindestens zwei Meter Wasser steht.
Das ist dann nach internationalem Seerecht freies Gut, gehört dem Finder und dem, der es hebt, wenn er nicht durch Kontrakt verpflichtet ist, dies gegen Bezahlung im Dienst eines anderen zu tun.
Auch solche meist in der Nähe der Küste gesunkenen Schiffe gibt es ja massenhaft, deren Lage man ganz oder doch ziemlich genau kennt, da kommen auch Schiffbrüche in Betracht, die schon vor Jahrhunderten geschehen sind, und nun gibt es professionelle Taucherschiffe, die darauf ausgehen, solche gesunkene Wracks aufzusuchen und auszunehmen.
Einst schickte fast ausschließlich Spanien solche Taucherschiffe aus, dann führten sie alle die englische Flagge, heute sind sie fast alle in nordamerikanischem Besitz.
Deutschland hat wohl kein einziges Taucherschiff. Dazu ist es zu solid; denn eine äußerst riskante Spekulation ist die Geschichte.
Alle die Gesellschaften, welche solche Taucherschiffe ausschicken, machen über kurz oder lang bankrott.
Die Unkosten sind zu groß, der Gewinn ist gar zu unsicher. Da ist es schon besser, in der Lotterie zu spielen.
Die einzigen, die dabei immer gewinnen, hohen Verdienst haben, dass sind die im Dienste dieser Gesellschaft stehenden Taucher.
Sie erhalten festen Lohn wie die ganze Schiffsmannschaft und einen für ihre Taucherei fixierten Stundenlohn, für die Minute ausgerechnet.
Wie hoch der ist, das ist ja allerdings ganz verschieden, es richtet sich nach der Tiefe und nach der Gefahr und nach anderen Verhältnissen, immerhin sind es im Durchschnitt sechzig Mark, für die Minute eine Mark, und außerdem sind sie auch am Gewinn beteiligt.
Aber diesen Tauchern geht es zuletzt regelmäßig ebenso wie ihren Herren.
Wenn sie sich etwas erspart haben, so tun sie sich zusammen, mieten oder kaufen sich ein eigenes Schiff, betreiben das abenteuerliche Geschäft auf eigene Faust.
Sehr häufig mag dabei die Unehrlichkeit vorkommen, dass sie wohl das von ihrer Gesellschaft gesuchte Wrack auf dem Meeresboden finden, dies aber auf Verabredung verheimlichen, um es für sich auszunehmen.
Das rächt sich meist bitter. Oder überhaupt — — auch diese selbstständigen Taucher haben sich noch immer zuletzt ihrem Ruin gegenüber gesehen, wenn sie sich nicht nach einer guten Beute weislich vom Geschäft zurückzogen — —
Zu diesen Tauchern gehörte also auch Richard Flint. Dem war das Glück einmal hold gewesen. Vor einem Jahre hatte er sich mit einigen Kameraden selbstständig gemacht, sie hatten an der australischen Küste das Wrack des fast schon sagenhaft gewordenen »Hulligan« gefunden, der vor nun schon mehr als 150 Jahren mit sechs Tonnen Gold bei Kap Norton gesunken war.
Dieses hatten sie aus einer Tiefe von etwa 25 Metern herausgeholt, die fünf Mann hatten sich in den Schatz geteilt.
Jetzt hätte sich Richard Flint, wenn er klug war, als doppelter Millionär zur Ruhe setzen sollen.
Statt dessen kaufte er einen Norweger, hier den »Delphin«, um nun ganz allein seine abenteuerliche Schatzgräberei auf dem Meeresgrunde zu betreiben.
Wusste er ein reiches Wrack liegen, das er ausbeuten wollte, ohne mit jemandem zu teilen?
Da zirkulierte in der Taucherwelt das Gerücht, welches sich auch in die Zeitungen verirrte: Richard Flint habe einen neuen Apparat erfunden, mit dem er bis in 200 Meter Tiefe tauchen könne.
Wie tief kann ein Taucher eigentlich hinabgehen?
Man liest häufig, so auch im modernen KonversationsLexikon: bis zu 60 Meter.
Aber wer die Verhältnisse kennt, der lächelt über so etwas.
Ja, es sind von Tauchern solche Tiefen erreicht worden. Der spanische Taucher Almeida hat im Jahr 1898 mit seinen Füßen sogar eine Tiefe von 67 Metern erreicht.
Aber wenn man behaupten will, das sei eine von allen Tauchern zu erreichende Tiefe, so kann man ebenso gut behaupten, jeder Mensch könne ohne Apparat fünf Minuten unter Wasser bleiben oder überhaupt so lange den Atem anhalten, weil sich doch ab und zu einmal in einem Glasbassin ein Wasserkünstler produziert, der fünf Minuten den Atem anhalten kann.
Was für Wasserdruck in solchen Tiefen in Betracht kommt, kann hier nicht ausführlich berechnet werden.
Jeder Kubikzentimeter Wasser wiegt ein Gramm, bei zehn Meter Tiefe lastet also auf jedem Quadratzentimeter des Tauchers ein Kilogramm, aber nicht nur von oben, sondern dieses Gewicht drückt auch von unten und von allen Seiten, hat die Brust eines starkgebauten Menschen, als Quadrat von 32 Zentimeter Seitenlänge betrachtet, einen Inhalt von tausend Quadratzentimetern, so sind das schon zwanzig Zentner, und da kommen bei zunehmender Tiefe ganz phänomenale Zahlen heraus.
Als jener Almeida sein Experiment zum zweiten Male machen wollte, erreichte er mit den Füßen nur eine Tiefe von 58 Meter und wurde tot heraufgezogen, ganz plattgedrückt nur durch den Wasserdruck.
Kurz und gut: Ein Taucher, der ohne Besinnen bis auf 30 Meter hinabgeht und frisch und munter wieder zum Vorschein kommt, das ist schon ein Meister in seinem Fache!
Da ist er tiefer hinabgetaucht als die Höhe eines vierstöckigen Hauses beträgt, und was das unter Wasser zu bedeuten hat, davon kann man sich gar keine Vorstellung machen oder man muss selbst einmal das Kostüm angelegt haben, nur so zehn Meter tief hinabgestiegen sein.
Dieser ungeheure Druck! Dieses fürchterliche Sausen in den Ohren! Einmal und nicht wieder! Oder man ist eben zum Taucher geboren.
Taucher, die bis 40 Meter hinabgehen, sind gewaltige Ausnahmen in ihrem Fache, was darüber hinaus ist, gehört zur wagehalsigen Seiltänzerei unter Wasser.
Gibt es nun nicht ein Mittel, um sich von diesem Wasserdrucke unabhängig zu machen?
Ja, der Theorie nach ist es möglich, und erst muss immer Theorie kommen.
Der Taucheranzug aus Gummi oder einem ähnlichen wasserdichten Stoffe hat damit gar nichts zu tun.
Den trägt man eigentlich nur, um nicht mit dem Wasser in direkte Berührung zu kommen, und dann, um für den Helm den sichersten Abschluss zu haben.
Er und sein wasserdichter Abschluss sind der eigentliche Bestandteil des ganzen Taucherkostüms. Alles andere ist Nebensache.
Und dann natürlich der Schlauch! Durch diesen muss nicht nur so viel Luft zugepumpt werden, wie der Taucher zum Atmen bedarf, sondern der Atmosphärendruck muss auch ebenso stark sein wie der Wasserdruck.
Denn sonst würde der Schlauch ja in einer gewissen Tiefe zusammengequetscht werden.
Nun hat man sich zwar bereits von der Luftzufuhr von oben durch den Schlauch befreit. Durch den sogenannten Skaphander. Allerdings ein ganz falscher Ausdruck, der sich aber nun einmal in Taucherkreisen eingebürgert hat.
Der Skaphander ist ein auf den Rücken geschnallter, mit komprimierter Luft angefüllter Behälter, der automatisch arbeitet. Je tiefer der Taucher kommt, desto stärkeren Atmosphärendruck treibt der Apparat in den Helm hinein.
Denn das muss noch immer sein. Auch wenn es gar keine Schläuche mehr gibt, die zusammengequetscht werden können. Der ganze Körper des Tauchers wird doch zusammengequetscht, da muss wenigstens sein Kopf mit einem entsprechend starken Atmosphärendruck umgeben werden.
Oder — das Blut würde ihm schon in zehn Meter Tiefe aus Nase, Mund und Ohren hervorschießen, und was in größerer Tiefe werden würde, lässt sich gar nicht ausdenken.
Es handelt sich darum, den ganzen Körper des Tauchers gegen den äußeren Wasserdruck zu schützen, sodass er in einer normalen Atmosphärenumhüllung steckt.
Anscheinend ist dieses Problem ja ganz leicht zu lösen. Einfach ein eiserner Panzer, eine richtige Ritterrüstung, in der der ganze Mann steckt.
Natürlich müsste auch jeder Finger so gepanzert sein; denn sobald in den Adern der von außen zugepumpte Atmosphärendruck fehlt, würde die freie Hand von dem ungeheuren Wasserdruck einfach zerquetscht werden, dieser Wasserdruck würde auch den Kopf erreichen, dort das Gehirn auseinandersprengen.
Solche unterseeische Ritterrüstungen sind denn auch schon zur Genüge konstruiert worden, aber in der Praxis bewährt hat sich noch keine.
Das kann eben keine starre Eisen- oder Stahlumhüllung sein, der Taucher muss sich doch bewegen können, mindestens ausschreiten, die Arme heben und senken. Hierzu sind bewegliche Scharniere nötig, und es ist noch nicht gelungen, diese völlig wasserdicht herzustellen. Der furchtbare Druck treibt das Wasser hinein. Und dann ist der Taucher in einer noch viel schlimmeren Lage, als wenn einmal der Gummianzug einen Riss bekommt, was nämlich gar nicht so schlimm ist.
Er ist auch noch einmal auf der Brust ganz dicht abgeschlossen, ebenso am Halse.
Bei so einer Rüstung soll ja aber der Kopf von normaler Atmosphäre umspült sein oder die ganze Geschichte hätte ja gar keinen Zweck. Also sobald in die Rüstung Wasser eindringt, ist der Taucher überhaupt sogleich rettungslos verloren.
Nachdem man die Unmöglichkeit eines wasserdichten Scharnieres eingesehen hat, ist man von diesem Problem der festen Taucherrüstung ganz abgekommen —
Nun also war in der Taucherwelt das Gerücht entstanden, Richard Flint hätte solch eine starre Rüstung erfunden, in der er sogar bis 200 Meter hinabsteigen könne! Nicht aus Eisen oder Stahl oder einem Metall, sondern aus Hartgummi, das eine enorme Widerstandskraft besäße, alles fugenlos aus einem einzigen Gusse, oder doch nur aus einem oberen und unteren Teil, die zusammengeschraubt wurden, und nun vor allen Dingen an allen Gelenken völlig beweglich, jeder einzelne Finger!
Indem nämlich der sonst stahlharte Gummi an diesen Teilen weich und schmiegsam sei, ohne doch seine Widerstandskraft gegen den stärksten Wasserdruck zu verlieren.
Wie gesagt, auch Zeitungen hatten dieses Gerücht besprochen, womöglich gleich als Tatsache. Aber nur die naivsten. Fachleute und Wissenschaftler lächelten über so etwas.
Wo war Richard Flint, dass man ihn selbst darüber befragen konnte?
Der war mit seinem »Delphin« in See gegangen, niemand wusste wohin. Natürlich, bei einem Taucherschiff, das nach goldenen Schätzen sucht! Wenn es sich auch manchmal damit zufrieden gibt, ein gesunkenes Kohlenschiff auszuweiden, nur um auf die Kosten der Fahrt zu kommen.
Da tauchte Richard Flint in New York auf.
Aber der finstere Mann war nicht so leicht auszuhorchen, so wenig wie einer seiner Mannschaft, die er sorgsam zusammengesucht hatte.
Nur so viel war zu erfahren, dass er betreffs eines neuen Taucherkostüms oder sonstigen Apparates kein Patent angemeldet hatte.
Bald hatte er New York wieder verlassen — — —
»Einundzwanzig!«, meldeten die Offiziere das kurze Resultat einer langen Berechnung.
»Hundertundvierzig!«, riefen gleichzeitig die beiden auf verschiedenen Seiten lotenden Matrosen in singendem Tone, die Leine mit den Knoten wieder einholend.

Richard Flint, den seine Promenade nach dem Vorderdeck geführt hatte, kehrte um, kam zurück, ohne Eile, so schritt er immer: ein weitausholender Gang, dazu auch die Arme mit den geballten Händen hin und her werfend.
Man meinte, der trotz aller Kleinheit so kolossale Mann müsse bei jedem Schritt sich mit dem Fuße in das hölzerne Deck eingraben.
So schildern Attilas Zeitgenossen den furchtbaren Hunnenkönig, als einen zu kurz geratenen Herkules, fähig, die Erdkugel auf seine mächtigen Schultern zu nehmen, so schildern sie seinen wiegenden Gang.
»Ist eine Strömung vorhanden?«, fragte eine Bärenstimme.
Es wurde schon gesagt, wie schwer im freien Meere zu bestimmen ist, ob eine Strömung vorhanden ist oder nicht.
Dazu müsste das Schiff selbst ganz still liegen, vor Anker gehen. Bei 140 Meter Tiefe gibt es natürlich kein Ankern mehr, das hört meist schon bei 20 Meter auf. Aber da der Grund nun einmal mit der gewöhnlichen Lotleine zu erreichen war, konnte eine eventuelle Strömung doch leicht festgestellt werden.
Es wurde einfach eine andere entsprechend lange Leine über Bord gelassen und freigegeben, die an einem Ende eine Verankerung, am anderen eine kleine Boje trug.
Bald musste diese festliegen, das Schiff trieb nicht an ihr vorbei — also gab es keine Strömung.
»Was für Grund?«
Die Lote wurden am unteren Ende mit Talg eingefettet, sie brachten feinen Korallensand mit kleinen Muscheln herauf.
So wurden noch einige andere Untersuchungen angestellt, während der Dampfer langsam um die Boje herumfuhr.
»Meine Frau soll kommen! Warum ist sie überhaupt noch nicht da! Wo steckt die denn wieder?«, erklang es herrisch und barsch aus dem Munde der menschlichen Bulldogge mit den finsteren, sogar brutalen Zügen.
Bald trat die Gerufene aus dem Kajütenaufbau.
Seine Frau? Überhaupt eine Frau?
Sie war eher ein halbwüchsiges, unreifes Kind zu nennen.
Ein kleines, schmächtiges, schwächliches, blasses, nixiges Ding!
Das einzige Einnehmende an ihr waren die sanften, aber durchaus nicht etwa auch nur hübschen Züge und große, seelenvolle Augen, die aber auch wieder so unsäglich verschüchtert blickten.
Dazu nun ganz simpel gekleidet, fast ärmlich.
Das war die Frau dieses gewaltigen Kraftmenschen, ihm gegenüber einfach ganz verschwindend! Wie war er denn zu der gekommen? Aus Aberglauben!
Denn er wäre doch kein Taucher gewesen, hätte er nicht seinen Aberglauben gehabt. Was nun freilich auch sehr verzeihlich ist! Soll der Teufel diesen Beruf holen, bei dem man nicht nur immer mit einem Beine im Grabe steht, sondern gleich schon ganz und gar begraben ist!
Da kommt wohl ein Aberglaube geschlichen, dem man dann huldigt.
Richard Flint tauchte nur mit dem Skaphander, nahm also seine Luft auf dem Rücken selbst mit und verschmähte auch die Sicherheitsleine. Er empfand sie als hinderlich.
Nur bei starker Strömung konnte er sie natürlich nicht entbehren. Für gewöhnlich wollte er ganz frei sein.
Dagegen musste er mit der Oberwelt unbedingt telefonisch verbunden sein. Er musste sich unter Wasser jederzeit mit jemand unterhalten können, was nicht etwa gerade etwas Sachliches über seine Taucherarbeit zu sein brauchte.
Da war er ohne Sicherheitsleine schon 50 Meter hinabgegangen. Wenn er nur eine Menschenstimme an seinem Ohre hörte, über irgend etwas plaudern konnte.
Aber wenn das Telefon einmal nicht funktionierte, dann ging er keine drei Meter unter Wasser, war durch nichts dazu zu bewegen.
Das mochte eine Angewohnheit sein, war jedoch nicht eine Schwäche zu nennen.
Wenn der Telephondraht einmal riss, während er sich unter Wasser befand, so stieg er allerdings sofort empor, aber nicht etwa mit Zeichen des Entsetzens oder nur der Furcht.
Aber es wurde hieraus auch ein wirklicher Aberglaube.
Es musste eine ganz bestimmte Person sein, mit der er sich während des Tauchens unterhielt, und diese Person brauchte mit seinem Berufe absolut nichts zu tun zu haben, brauchte davon gar nichts zu verstehen.
Er ging in irgendeiner Stadt auf der Straße oder saß in einem Kaffeegarten.
Da sah er irgendeinen Menschen, alt oder jung, elegant oder dürftig.
Und plötzlich schoss es ihm durch den Kopf: »Das ist der, den Du brauchst, das ist Dein Talisman, mit dem musst Du sprechen, dann bist Du gesichert gegen jede Gefahr, dann bist Du selbst der Herr des Todes!«
Also einfach eine Eingabe von oben! Und nun versuchte er den Betreffenden zu engagieren, wobei es ja oft genug zu possierlichen Auseinandersetzungen kam. Wenn er einen wohlbestallten Rentier, der ohne seinen Frühschoppen am Stammtisch nicht leben konnte, veranlassen wollte, ihn nach Honolulu zu begleiten, damit er sich mit ihm dort unter Wasser telefonisch unterhalten konnte!
Meist aber traf seine Eingebung schon solche Personen, die sein Anerbieten nicht abschlugen, gewöhnlich junge Männer, die dürftig gekleidet waren und recht verkümmert aussahen, einen leidenden Zug im Gesicht, der aber nicht von Krankheit herstammte.
Einen solchen nahm er dann mit, bezahlte ihn hoch, bis — er ihn ins alte Eisen warf, ihn bei der nächsten Gelegenheit nach Hause schickte.
Denn Richard Flint brauchte unter Wasser nur den geringsten Unfall zu haben, sich nur den Finger ein ganz klein wenig zu quetschen — dann war es eben mit der Kraft des menschlichen Talismans dort oben, mit dem er sich telefonisch unterhielt, vorbei, dann wurde er entlassen.
Da sich das doch immer an Bord des Schiffes abspielte, so benutzte Flint inzwischen einen anderen Mann von der Besatzung zum Telefongespräch.
Kam er aber an Land, so war es sein Erstes, sich wieder nach einem regelrechten Talisman umzusehen, der ihm von einer höheren Eingabe bezeichnet wurde, wobei er sich also eigentlich gar nicht danach umsehen durfte.
Das hatte dieser Taucher, der jung angefangen hatte, nun seit bald zwanzig Jahren so getrieben. Immer waren es Männer gewesen, auf die seine plötzliche Wahl gefallen war.
Vor zwei Jahren aber hatte er an einem schönen Maimorgen in Bremen am Wall auf einer Bank gesessen, hatte an alles andere gedacht, als daran, sich nach einem neuen Talisman umzusehen, hatte gerade schwere Geschäftsberechnungen angestellt.
Da kam des Weges einher ein junges, recht bescheiden gekleidetes Mädchen, an der Hand ein herausgeputztes Kind führend, also offenbar ein bei einer Herrschaft im Dienst stehendes Kindermädchen.
Flint blickte einmal von seinem Notizbuch auf und — —
»Das ist sie, die musst Du als Deinen neuen Talisman engagieren, sonst erblickst Du bei deinem nächsten Tauchen nicht wieder das Licht der Sonne!«
Und der starke, eiserne Mann erschrak doch förmlich ob der inneren Stimme, die ihm dies so deutlich zugerufen hatte, er entsetzte sich wirklich.
Denn, wie gesagt, seine Wahl war bisher immer auf eine männliche Person gefallen, er hielt es überhaupt für ganz ausgeschlossen. dass es jemals eine weibliche sein könne.
Er war ja nicht gerade ein Weiberfeind, aber — diese raue Kraftnatur verachtete die ganze Weibergesellschaft.
»Ich habe mich geirrt, das ist ja gar nicht möglich —«
Aber es half ihm alles nichts, die innere Stimme, so eine Art Dämon, kommandierte weiter, und er musste unbedingt gehorchen, ob er wollte oder nicht, er musste aufstehen und auf sie zugehen.
»Entschuldigen Sie, Fräulein — Sie kommen mir recht bekannt vor — sind Sie nicht Fräulein Therese Schulze?«
So eröffnete er die Anknüpfung.
»Nein, die bin ich nicht«, war die schüchterne Antwort.
»Wirklich nicht? Ich dachte, Sie wären Fräulein Schulze, die ich — ich brauche nämlich ganz nötig eine Telefonistin.«
»Ich kann gar nicht telefonieren, ich bin Kindermädchen.«
»Na, deshalb kann man doch telefonieren, das ist ja gar keine Kunst!«, lachte die finstere, wirklich verbissene Bulldogge mit einer Gutmütigkeit, die man ihr nimmer zugetraut hätte, die sie bei solchem Lachen sofort jedes Herz gewinnen ließ, wie wir diese menschliche »Bulldogge« überhaupt noch von einer ganz anderen Seite kennen lernen werden.
So ging das noch einige Zeit hin und her unter der schönen Maiensonne und — —
»Würden Sie nicht bei mir als Telefonistin eintreten?«, war die letzte Frage, die zur Hauptsache führte.
Man merkt wohl schon, wie schwer es dieser Taucher hatte, um zu seinem Ziele zu kommen, aber gerade bei diesem schüchternen Mädchen ging es einmal überraschend leicht.
Martha Richter war nach kurzer Überlegung bereit, auf das Angebot einzugehen, freilich ohne es noch richtig zu begreifen.
In ihrer jetzigen Stellung war ihr schon gekündigt worden, die musste sie übermorgen verlassen, hatte auch keine andere Aussicht und musste von ihren paar Groschen einen gichtbrüchigen Vater unterstützen.
Da nahm sie an. Sie glaubte, an Bord eines großen Passagierdampfers als Telefonistin zu kommen, eine äußerste Vertrauensstellung; sie würde auf Verschwiegenheit vereidigt, daher auch die hohe Bezahlung. Die Hauptsache aber war, dass sie zu dem gewaltigen Manne trotz seines finsteren Bullenbeißergesichtes Zutrauen empfand — — etwas, was ihr selbst ganz unerklärlich vorkam.
Kurz, Richard Flint ging wegen weiterer Abmachungen noch an demselben Tage zu ihrem Vater, und der war nun zu seinem Glück ein alter Seemann, der für die ganze Sache Verständnis hatte, den Richard Flint für einen berühmten Taucher hielt, ihn als tatsächliche Berühmtheit schon kannte, auch seinen ehrenwerten Charakter — so wurde die Sache perfekt, Martha ging mit auf das Taucherschiff, auf dem Richard Flint damals noch in Diensten stand.
Und er hatte in dem schüchternen Mädchen auch wirklich den besten Talisman erwischt, den er jemals gehabt hatte.
Obgleich er ihn eigentlich gar nicht so sehr schützte.
Aber mit Richard Flint trat seitdem überhaupt eine große Umwandlung ein. Er verlor seinen Aberglauben oder dieser nahm doch eine andere, harmlosere Wendung.
Also das erhoffte Schutzmittel bot ihm dieser neue menschliche Talisman am Telefon eigentlich nicht.
Gleich bei seinem ersten Tauchen quetschte er sich nicht nur etwas den Finger, sondern schnitt ihn sich mit dem Messer fast halb ab.
Aber er jagte seinen Talisman nicht wie gewöhnlich gleich zum Teufel.
»Wer weiß, was mir passiert wäre, wenn ich mich nicht in den Finger geschnitten hätte! Dann wäre mir wahrscheinlich von einem Draht gleich der Kopf abgeschnitten worden«, sagte er sich diesmal.
Beim zweiten Male biss ihn ein gar nicht so großer Fisch heftig in die Hand.
»Gott sei Dank, dass es kein Haifisch gewesen ist, der hätte mich gleich mitgenommen, und davor hat mich nur das wackere Mädchen dort oben bewahrt.«
Und so ging das weiter.
Selten ein Tauchen ohne Unfall, aber es war immer nur ein geringfügiger — und außerdem hatte Richard Flint seitdem anderseits stets wirklich sehr großes Glück.
Das Taucherschiff nahm ein Wrack nach dem andern aus, immer machten die Kompagnons große Beute, und als sie einmal nichts weiter fanden als einen Geldschrank, der aber offen, also vor dem Verlassen ausgeräumt worden war, entdeckten sie doch noch eine Schatulle, die 200 000 spanische Pesetas in vollwertigem Papiergeld enthielt.
So war es auch Richard Flint gewesen, der an der australischen Küste das hundertfünfzigjährige Wrack mit den sechs Tonnen Gold gefunden hatte, weswegen ihm bei der Teilung auch der Löwenanteil zufiel.
Von seinem Anteil, mehr als zwei Millionen Mark, hatte sich Richard Flint also sein eigenes Taucherschiff gekauft, den norwegischen »Delphin«.
Selbstverständlich kam Fräulein Martha mit an Bord.
Aber Fräulein Martha wollte plötzlich nicht mehr mitmachen, wollte durchaus die Telefoniererei aufgeben.
Vergebens bot ihr Richard Flint fernerhin die Hälfte seines Gewinnes — sie wollte nicht, wollte nach Hause oder sonst wo hin, nur nicht an Bord seines Schiffes bleiben.
»Was ist denn nur mit dem verrückten Frauenzimmer los?«, dachte die Bulldogge grimmig. »Wenn ich sie auch oft genug angeschnauzt habe — die muss doch nun endlich wissen, dass das bei mir gar nicht böse gemeint ist! Und wie die sich nun bei mir steht.«
Ja, er wusste, weshalb sie nicht mehr mitmachen wollte. Die stach der Hafer. Er hatte sie zu sehr verwöhnt.
Das ehemalige Kindermädel besaß ein Diamantkollier, wie es nur eine Herzogin trägt, der es auf ein paar lumpige Millionen Schulden nicht ankommt, und er hatte sie noch anderweitig so beschenkt, und ihren gichtbrüchigen Vater hatte er in eine Heilanstalt mit erstklassiger Pension Zeit seines Lebens eingekauft.
Der finstere, mürrische, verbissene Mann hätte sich fast so weit gedemütigt, dass er vor dem ehemaligen Kindermädel auf die Knie fiel, wurde aber noch davor bewahrt.
Er hatte einen Freund, der sah die beiden einmal zusammen, und dann nahm er Richard allein vor.
»Es ist doch ganz klar, weshalb die nicht bei Dir bleiben will.«
»Weshalb denn nicht?«
»Na, einfach, weil die Dich liebt!«
Die menschliche Bulldogge klappte einmal ihren Rachen auf, zeigte fletschend die Zähne, und klappte ihn wieder zu.
»Ach geh, Du träumst, Heinz!«
»Nein, Du bist es, Richard, der träumt, und hast Du überhaupt jemals ein bisschen Menschenkenntnis gehabt, so hast Du sie auf dem Meeresgrunde liegen lassen, dass Du das nicht schon längst erkannt hast.«
»Die und mich lieben!«
»Natürlich ist es so; sie ist ja ganz verschossen in Dich, sie kann Dich ja gar nicht mehr ansehen, weil sie fürchtet, sie könnte sich verraten.«
»Ich mit meinem Bulldoggengesichte —«, meinte der Mann, der ganz genau wusste, wie er aussah, und der über jede Eitelkeit erhaben war.
»Hat bei einem Frauenzimmer gar nichts zu sagen. Und überhaupt, weshalb werden gerade für die hässlichsten Bulldoggen die höchsten Preise gezahlt? Weil es eben auch Liebhaber für solche Hässlichkeiten gibt. Und was macht sich denn überhaupt so ein Mädel aus einer hübschen Larve. Die Liebe ist blind, sie fällt, wie sie fällt, und wie sie fällt, so liegt sie. Und was Du da von einem schüchternen Mädel sagtest — ja, schüchtern mag sie sein, aber sonst hat die es doch ganz faustdick hinter den Ohren.«
»Ja, warum sagt sie mir nicht, dass sie mich liebt?«
»Ach, Du dummer, dummer Richard! Du bist ja gerade so dumm wie dick! Kurz und gut, die geht doch nur, weil sie Dich liebt. Und wenn Du sie behalten willst, dann musst Du sie heiraten. Anders lässt die Geschichte sich nicht machen.«
So lautete das Zwiegespräch zwischen den beiden Freunden — und da plötzlich fiel es dem Richard Flint wie Schuppen von den Augen: nämlich, dass er seine Telefonistin auch schon immer geliebt hatte!
Und eine halbe Stunde später nahm der gewaltige Mann einen noch gewaltigeren Anlauf — um dann kläglich zusammenzubrechen.
»Nichts für ungut, Fräulein — was ich gleich sagen wollte«, begann er stotternd seine Liebeswerbung, »wenn es Sie nicht weiter geniert — mir wärsch ja ganz egal — —«
Und so quetschte er sich weiter aus, bis er es glücklich ganz heraus hatte.
Das schüchterne Mädchen wollte Reißaus nehmen, war aber zu schwach, fing zu weinen an.
Und das gab dem zu kurz geratenen Herkules seine alte Kraft wieder.
»Albernes Mädel, lass doch nur Dein verfluchtes Grinsen — ich könnte Dich doch gleich ein paar in die — — na also, willste mich heiraten oder nicht, nun endlich heraus mit der Sprache!«
Es war eine ganz komplizierte Geschichte, dieser Heiratsantrag, diktiert von reinster Liebe — — aber die Hauptsache war, dass er von einem günstigen Resultat gekrönt wurde: Fräulein Martha Richter schluchzte und piepste ein vernehmliches »Ja«.
Sie heirateten sich.
Und es war eine geradezu ideale Ehe!
Die beiden passten nämlich zusammen wie die Faust aufs Auge, indem die Faust doch wirklich ganz ideal aufs Auge passt.
Allen Ernstes gesprochen: Es war eine überaus glückliche Ehe.
Freilich keine solche mit Mondschein, Limonade und Zuckerwasser, welche Dinge man doch sehr leicht überdrüssig bekommt.
Die Sache war, dass dieser gewaltige, brutale Kraftmeier mit dem bissigen Bulldoggengesicht im Grunde genommen ein überaus gutmütiger, sanfter Charakter war, eine Seele von einem Menschen, den jedes Kind um den Finger wickeln konnte, wie es ja auch bei der vierbeinigen Bulldogge der Fall ist. Jeder Kenner weiß, dass die echte Bulldogge unter allen Hunden das sanftmütigste Vieh ist. Sie lässt sich von jedem anderen Hunde und jedem Menschen, der sie nur irgendwie zu behandeln weiß, den schönsten Knochen aus dem Maule nehmen. Es kann gar nicht anders sein, als dass die weise Natur diesem Hunde nur deshalb seine finstere Hässlichkeit und das grimmige Aussehen und die hervorstehenden Zähne gegeben hat, um ihn eben durch dieses furchtbare Aussehen vor frecher Zudringlichkeit zu schützen.
Natürlich hat alles seine Grenzen, auch die Gemütlichkeit einer Bulldogge.
Wenn ihr mal der Geduldsfaden reißt oder sie ihren Herrn beschützen muss — na, dann hat man eben ihre Zähne wie Widerhaken in der Wade sitzen, bekommt sie gar nicht mehr heraus, und dann wirft sie auch einen weit größeren und stärkeren Hund nieder.
Und wenn es um die Ehre geht, dann rückt sie sogar einem Löwen zu Leibe.
Ganz genau so war es auch mit diesem gewaltigen Manne.
Und eben weil er wusste, dass er im Grunde genommen ein so sanfter Charakter war, dass ihm die Natur sein Bulldoggengesicht nur als Abwehr gegen zudringliche Menschen gegeben hatte, suchte er dieses Schutzmittel noch durch ein barsches Wesen zu verstärken.
Das war ihm nun freilich zur Gewohnheit geworden.
Er musste immer brummen und murren und schnauzen.
Und wenn es Frau Martha vielleicht auch nicht gerade faustdick hinter den Ohren hatte, so war sie doch jedenfalls trotz aller Schüchternheit ein sehr kluges Frauchen, das ihren Mann zu nehmen wusste.
Also eine wirklich ideale Ehe.
Der gewaltige Mann trug seine zarte Frau auf den Händen und schnauzte sie ab und zu an.
Und sie wickelte ihn um den Finger —
»Wo steckst Du denn nur?«, wurde sie jetzt grimmig angeherrscht.
»Ich habe geschlafen«, war die mit sanfter Stimme gegebene Antwort; dabei verbarg sie hinter der vorgehaltenen Hand ein Gähnen und wickelte sich fest in das einfache Umschlagetuch.
»Du bist doch nicht etwa krank, Martha?«, erklang es plötzlich in ganz, ganz anderem Tone, und sorgenvoll und zärtlich zugleich hafteten die grimmigen Augen auf der zierlichen, schmächtigen Gestalt, die eher einem Kinde angehörte als einer fünfundzwanzigjährigen Frau.
»Nicht im Geringsten, ich fühle mich ganz wohl.«
»Na, aber nun ein bisschen fix, ich will tauchen!«, fing es da gleich wieder zu bollern an.
»Ich bin fertig.«
»Meine Flasche!«
»Die ist schon längst fertig.«
»Der Saugeschlauch muss gereinigt werden!«
»Ich habe gleich einen neuen daran gemacht.«
»Oben an dem Telefondraht ist eine blanke Stelle!«
»Die habe ich schon längst wieder umwickelt.«
Herkules der Kleine kratzte sich unwirsch in den borstigen Haaren, weil er nun nichts mehr wusste, was er noch vorbringen könnte.
»Wenn Du Dir nur endlich angewöhnen wolltest, Martha, gleich zu sagen, dass alles in Ordnung ist, dann wäre meine ganze Fragerei nicht erst nötig!«, knarrte er verdrießlich.
Die Vorbereitungen zum Tauchen wurden getroffen. An Deck wurde ein Sarg gebracht, in dem jedenfalls eine zwei- bis dreizentrige Leiche mit stattlichem Schmerbauch die letzte Ruhe gefunden hatte oder der eben für solch einen gewichtigen und dicken Toten bestimmt war.
Unterdessen wurde von anderen Händen an Deck ein Häuschen aufgebaut, eine Kabine von dicken Korkwänden, auch noch mit einer besonderen Masse gepolstert — eine schallsichere Telefonzelle.
Es sei an dieser Stelle gleich noch etwas anderes ausgeführt, um den Gang der Handlung später nicht unterbrechen zu müssen.
Richard Flint war wirklich ein sehr wortkarger Mensch.
Einen geschwätzigen Taucher wird es wohl auch schwerlich geben.
Aber Richard Flint war trotz seines gutmütigen, nachgiebigen Charakters doch ein ganzer Mann.
Ja, seine kleine Frau konnte ihn um den Finger wickeln, aber nicht bei Geschäftsgeheimnissen, die solch ein »Lumpensammler des Meeres« hat. Das gab es bei diesem Manne nicht! Da erfuhr auch Frau Martha absolut nichts!
Der »Delphin« war in New York gewesen, innerhalb von zwei Monaten um Kap Horn herum und in die Südsee hinein, durch geografische Ortsbestimmung ein Ziel angegeben, das zwischen Hawaii und der ChristmasInsel lag, also dort, wo sich zwischen der NordÄquatorialStrömung und der SüdÄquatorialStrömung ein völlig und immer stromfreies Wassergebiet befindet, dann eine noch genauere Ortsbestimmung, hier war diese erreicht, wieder wurde gerechnet und gelotet — — plötzlich fand das 200 Meter lange Lot schon bei 140 Meter Grund, und diese Untiefe, die noch auf keiner Karte eingetragen war — sonst ist dort überall 3000 bis 4000 Meter Tiefe — ging noch weiter nach Westen — —
Wozu dies alles, was Richard Flint vorhatte? —
Keiner an Bord hatte eine Ahnung davon.
Und sie wusste genau, wie weit sie mit ihrer Fingerwickelei gehen durfte.
Über so etwas durfte sie ihn nicht fragen!
Sonst konnte die Bulldogge wirklich einmal bissig werden.
Aber dieser Mann litt an einer Schwäche, die all seine Vorsicht in solchen Geschäftssachen zuschanden machte.
Also wenn er unter Wasser ging, so musste er sich immer telefonisch mit der Oberwelt unterhalten, oder — — er ging eben gar nicht unter Wasser.
Und dann wurde der sonst so wortkarge Mann sogar geschwätzig.
Dann brauchte man ihn nur zu fragen, und er plauderte sogar seine heiligsten Geheimnisse aus.
Eine Charakterschwäche konnte hier natürlich nicht vorliegen.
Hier handelte es sich um eine physiologische Umwandlung, die sich auch psychisch äußerte.
Der zunehmende Druck mochte es sein, der diese seltsame Charakterumwandlung zustande brachte; denn dass, wenn das Blut so zusammengedrückt wird und ganz anders als sonst durch die Adern jagt, auch das Gehirn ganz anders arbeitet, das lässt sich wohl leicht begreifen.
Oder es mochte vielleicht auch etwas anderes daran schuld sein.
In größeren Tiefen wurde Richard Flint, wie wohl jeder Taucher, nach einer vorübergehenden Aufregung stets von starker Müdigkeit befallen.
In solchen ungeheuren Tiefen, die er mit seinem neuen Apparat aufsuchte, drohte er einfach einzuschlafen, konnte sich gar nicht wachhalten.
Das war kein Verlieren des Bewusstseins, also keine Ohnmacht, sondern eine unüberwindliche Schläfrigkeit wie beim Tode durch Erfrieren.
Doch auch hiergegen hatte er ein Mittel erfunden.
Wiederum sein Geheimnis.
Er nahm einen Trunk mit hinab, mittels dessen er, ab und zu einen Schluck nehmend, die Müdigkeit bannte.
Natürlich musste die Flasche entsprechend angebracht sein — im Helm selbst — mit einem festgestellten Gummischlauch.
Durch Drehung des Kopfes konnte er die Saugröhre mit dem Munde erreichen.
Möglich, dass es also auch dieser Trank war, der ihn unter Wasser in größeren Tiefen so gesprächig und offenherzig machte
Das war bei ihm schon so gewesen, als er, noch das gewöhnliche Taucherkostüm benutzend, nur in normale Tiefen gestiegen war.
Dieser seiner Schwäche sich bewusst, hatte er sich natürlich vor einem Aushorchen schützen müssen, wenn dieser ehrliche Charakter auch keine Schandtaten auf dem Kerbholz seines Gewissens hatte.
Es handelte sich eben um die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen.
Seinem Talisman hatte er da nie recht getraut.
Es hatte oben am Telefon immer sein Freund Heinz sein müssen.
Der hatte eben eingegriffen, wenn es jener Person etwa einfiel, verfängliche Fragen zu stellen.
Doch das war anders geworden, seit sich Flint Fräulein Martha Richter zugelegt hatte.
Der hatte er bald vollkommen vertraut, und nachdem sie seine Frau geworden war, natürlich erst recht.
Es war sehr gut gewesen, dass er sie rechtzeitig gefunden hatte, denn sein Freund Heinz, ebenfalls ein Taucher, war bald darauf in der liebevollen Umarmung eines Riesenpolypen erdrückt worden.
Und eine andere Vertrauensperson hätte er nicht so leicht gefunden.
Da konnte der sonst so ehrliche Mann sehr misstrauisch sein.
Doch nun also durfte seine Frau ganz allein am Telefon sitzen.
Aber in einer schallsicheren Zelle!
Durch eine zweite Telefonanlage war Frau Martha mit der Kommandobrücke verbunden, falls der Taucher dorthin einen Befehl zu geben hatte.
Dann konnte ihn seine Frau fragen, was sie wollte, er machte sich nichts daraus.
Dass er nicht vorher mit ihr über seine Geschäftsgeheimnisse sprach, das war wieder etwas ganz anderes, das war eben sein Charakter, da war er zu sehr »Mann«.
Aber ein Verbot, ihn nicht über dies und jenes zu befragen, nicht darauf zu hören, wenn er von selbst davon anfing, gab er ihr niemals
Im Übrigen hatte er, seitdem er New York verlassen hatte, noch nicht wieder getaucht, also war auch Frau Martha gänzlich ahnungslos betreffs dessen, was er hier im Stillen Ozean beabsichtigte — — —
Richard Flint öffnete mit einem Schlüssel das Sicherheitsschloss des stark mit Eisenbändern beschlagenen metallenen Sarges.
Darin lag ein schwarzgepanzerter Ritter von ganz unförmlichen Dimensionen.
Aber Fleisch und Knochen fehlten ihm.
Die wollte erst Richard Flint mit seiner eigenen Person hineinbringen.
Er legte die Ritterrüstung an, die gar nicht so sehr schwer war.
Alles nur Hartgummi, stahlhart, und dennoch konnte er auch jeden der ebenfalls gepanzerten Finger einzeln bewegen.
Dann wurde der gewöhnliche Taucherhelm, in dem schon die Flasche angebracht worden war, aufgeschraubt, auf den Rücken kam der Skaphander, vorn hin die elektrische Lampe — alles sonstige war geordnet.
Dieses An- und Zusammenschrauben besorgten zwei Männer mit kundigen Händen, immer wieder nachprüfend; aber die letzte Prüfung unternahm doch Frau Martha, manche Schraube noch nachziehend.
Schließlich wurde die Sicherheitsleine befestigt, mit welcher Flint diesmal, wie er schon vorher angeordnet hatte, unter Wasser gehen wollte.
So! Alles fertig! Mit seinen schweren Bleisohlen watschelte das schwarze Menschenungetüm über Deck, an einer Stelle war die Bordwand beseitigt, dort ging es die massive Leiter hinab, auch der Helm verschwand in den blauen, etwas milchigen Fluten, sodass das Wasser ganz undurchsichtig war.
In der vollständig geschlossenen und schalldichten Zelle, erleuchtet von einer elektrischen Glühlampe, saß Frau Martha bereits am Telefon, würde aber noch etwas zu warten haben, ehe ihr Gatte unter Wasser das Gespräch eröffnete; das ging immer so erst bei fünfzehn Meter Tiefe los, wenn das für diesen gewaltigen Taucher auch nur so viel bedeutete, als wenn unsereins sein Gesicht ins Waschbecken steckt.

In der vollständig geschlossenen, schall-
dichten Zelle saß Frau Martha am Telefon.
Das Untersinken des Tauchers muss sehr langsam geschehen, damit er sich nach und nach an den zunehmenden Wasserdruck gewöhnen kann.
Noch langsamer muss sein Wiederemporsteigen erfolgen.
Geht das gar zu schnell, wird er mit Gewalt hochgerissen, so kann es passieren, dass der Kerl oben wie eine explodierende Bombe auseinanderplatzt.
So wie es bei den Tiefseefischen der Fall ist.
Oder mindestens tritt dem Fische an der Oberfläche die aufgeschwollene Schwimmblase in entsetzlicher Weise zum Maule heraus.
Richard Flint war durch dieses auf einem ganz anderen Prinzip beruhenden Taucherkostüm über diese Gefahr erhaben.
Eigentlich hätte er so schnell sinken und steigen können, wie es ihm nur irgend möglich war.
Innerhalb der geschlossenen Rüstung blieb der Luftdruck ja immer derselbe.
Tat er es nicht, ließ er sich gerade im Anfang sehr langsam sinken, so mochte er hierfür Gründe haben.
Also Frau Martha hatte noch einige Zeit, ehe die Unterhaltung begann, die stets von dem Taucher eröffnet wurde.
Hier sei nachträglich noch etwas erwähnt.
Als Fräulein Martha Richter ihre erste, schicksalsschwere Begegnung mit dem Taucher hatte, war sie simples Kindermädchen gewesen.
Aber das hätte sie nicht zu sein brauchen.
Sie war zur Gouvernante ausgebildet worden, hätte als Gesellschafterin auch in die beste Familie gehen können, ihre ganze Erziehung war danach, ihr Vater hatte sein Letztes geopfert, um dem einzigem Kinde eine gute Existenz zu sichern.
Sie besaß sogar eine ausgezeichnete Bildung.
Aber das schwächliche, nixige Ding hatte keine entsprechende Stellung gefunden, war nicht repräsentationsfähig genug.
Da war sie, um der Not des kranken Vaters ein Ende zu machen, eben als Kindermädchen gegangen, wenigstens einstweilen.
Das soll ausdrücklich erwähnt werden, weil diese Frau Martha Flint in unserer Erzählung noch eine große Rolle spielen soll.
Um einen weiblichen Heldenmut zu schildern, der auch in solch einem schwächlichen Körper die größten Taten ausführen kann — —
»Hörst Du mich, Martha?«
»Ich höre, Richard.«
»Fünfzehn. Du bist doch nicht erkältet, Martha?«
»Ganz und gar nicht. Weshalb denn?«
»Achtzehn. Deine Stimme klingt etwas heiser.«
»Deine auch. Es muss im Telefon liegen.«
»Zweiundzwanzig. Die Leine soll schneller nachgegeben werden, vier Knoten bei jedem Schlag.«
Frau Martha setzte sich mit der Sicherheitsmannschaft in Verbindung, durch ein anderes Telefon, das sie aber erst stöpseln musste.
So war es nicht möglich, dass man dort etwa dieses Telefongespräch belauschen konnte.
Anderseits konnte sie jederzeit durch ein Klingelzeichen angerufen werden.
»Ist geschehen. Vier Knoten im Schlag.«
»Recht so! Einunddreißig. Siehst Du, nun geht es schon ganz anders. Jetzt überkommt mich aber auch schon die Müdigkeit.«
»Vergiss die Medizin nicht, Richard.«
»Jawohl, das werde ich nicht vergessen!«, lachte es heiter aus dem Telefon. »Jetzt nehme ich schon den zweiten Schluck! Vierzig. Nun sind es noch hundert Meter.«
»Hundertundvierzig Meter gehst Du hinab?«
»Das weiß ich noch nicht!«, erklang es recht barsch, während er dann gleich wieder ganz freundlich, zärtlich fortfuhr: »Martha, meine liebe Martha — möchtest Du wohl ein großes Rittergut haben, mit schönem Schlosse und herrlichem Parke, wo wir beide zusammen leben?«
Ach, dieses Gesicht, das hier oben am Telefon gleich gemacht wurde, diese selige Verklärung!
»Richard, Du willst doch nicht etwa sagen, Du wolltest Deinen Taucherberuf aufgeben?«
»Jawohl, das will ich — das hier ist mein letztes Tauchen.«
»Richard, o, Richard!«, erklang es in Jubel.
Denn was er einmal sagte, das galt, da brauchte sie nun nicht erst noch einmal zu fragen.
»Zweiundfünfzig. Leisten hätte ich es mir ja schon längst können, ich wollte nur erst noch einmal mit meiner neuen Erfindung ein großes Geschäft machen. Und das ist jetzt erreicht. Eine Million Dollar ist gesichert. Nun hänge ich die Taucherei an den Nagel. Und meine Erfindung wird mir wohl auch eine ganz beträchtliche Summe einbringen. Martha, eine Million Dollar, hier im Stillen Ozean auf dem Meeresgrunde, vielleicht sogar auch drei — hättest Du Dir das wohl gedacht?«
»Ein gesunkenes Wrack?«, fragte jetzt Frau Martha, ihr Rittergut vorläufig aufgebend.
»Nein, kein Wrack.«
»Ist es Gold?«
»Nein, es ist etwas ganz, ganz anderes, was Du nie erraten würdest. Achtundsechzig.«
»Da bin ich doch wirklich gespannt«, musste Frau Martha so weitersprechen, nur zur Unterhaltung. »Vergiss das Trinken nicht.«
»Ich trinke. Martha, kennst Du den Mister Samuel Philipp in New York?«
»Mister Samuel Philipp? Nein, diesen Namen habe ich noch nie gehört.«
»Ich dachte, es wäre doch möglich, dass Du diesen Milliardär dem Namen nach kenntest. Der schickt mich hier herab. Ob oder ob nicht. Schon dafür bekomme ich eine Million Dollar. Hahahahaha!«
Jetzt musste Frau Martha aufpassen. Er fing schon an zu lachen!
»Vergiss das Manometer nicht zu beobachten. Wie tief bist Du denn?«
»Sechsundsiebzig.«
In demselben Augenblicke fragte Frau Martha auch schon draußen die Bedienungsmannschaft, wie viel Leine nachgelassen sei.
Die Angabe hatte gestimmt.
»Jaaa«, fuhr das Telefon aus dem Wasser im heitersten Tone fort, »wenn es mir aber gelingt, den Loke Klingsor zu erwischen, die sieben Runen auf seinem Rücken abzuzeichnen, dann bekomme ich sogar drei Millionen Dollar!«
»Loke Klingsor? Wer ist denn das?«
»Der Mann mit den Teufelsaugen, der Fürst des Feuers, der immer die schwarze Katze auf der Schulter hat.«
Hallo! Jetzt begann er zweifellos zu phantasieren, zu träumen.
»Richard!«
»Meine liebe Martha?«
»Wie viel ist 17 mal 13?«
Das war das ausgemachte Mittel — ein sehr einfaches und dabei durchaus zuverlässiges — um unterscheiden zu können, ob jemand bei voller Besinnung ist oder nur träumt, wenn auch mit offenen Augen.
Man bringt ja im Traume mancherlei fertig; aber zweistellige Zahlen im Kopfe multiplizieren, das kann man im Traume nicht!
»10 mal 17. Ist 170 — 3 mal 17 ist 51 — macht zusammen 221. Stimmt es?«
Ja, es stimmte. Danach konnte sich der Taucher in keinem Traumzustande befinden, oder alle bisherigen Erfahrungen hatten sich als trügerisch erwiesen.
»Was sagtest Du da von sieben Runen, die er auf dem Rücken tragen soll?«
»Ja, die hat er. Eintätowiert. Du weißt doch, was Runen sind?«
»Das weiß ich. Altnordische Buchstaben.«
»Wenn ich dem Samuel Philipp diese sieben Runen bringe, zahlt er mir drei Millionen Dollar bar.«
»Und wer soll die Runen auf dem Rücken haben?«
»Loke Klingsor, der Fürst des Feuers.«
»Der befindet sich dort auf dem Meeresgrunde?«
»Jawohl.«
»Liegt dort als Leiche?«
»Nein, lebendig, hahaha, ganz lebendig, hahaha!«
Jetzt wurde die Sache bedenklich! Zumal, da er so lachte.
Ganz abgesehen davon, was er da schwatzte.
»Manometer!«
»Vierundneunzig.«
Die Angabe stimmte.
»Bist Du sehr müde, Richard?«
»Ich war es soeben, ein Schluck hat mich gleich wieder frisch gemacht.«
Dann hatte er soeben einmal etwas geträumt.
Anders konnte sich Frau Martha das nicht erklären.
»Du sagtest vorhin, Mister Samuel Philipp schickte Dich hier hinab — — ob oder ob nicht. Was meintest Du hiermit?«
»Ob sich hier auf dem Meeresgrunde wirklich das Gesuchte befände. Schon dafür erhalte ich eine Million Dollar. Nur für das einfache Nachsehen. Es brauchte gar nichts da zu sein. Ja natürlich — das kann mir auch niemand nachmachen. In so einer Tiefe. Hundertundacht.«
»Ja, was hoffst Du denn eigentlich zu finden oder zu sehen?«
»Hahaha — nein, meine liebe Martha — das wird vorläufig nicht verraten — hahaha —«
»Wie viel ist 14 mal 19?«
»190 — 4 mal 19 ist 76 — macht zusammen 266. Stimmt es?«
Die Rechnung stimmte allerdings.
»l26«, gab der Taucher jetzt wieder die Tiefe in Metern an.
»Wie heißt der Mann, der sich dort unten befinden soll?«
»Loke Klingsor, hahaha!«
»Den Fürsten des Feuers nanntest Du ihn?«
»Ja, und den Mann mit den Teufelsaugen, weil er eben solche Augen hat, hahaha —«
»Und was sagtest Du von einer schwarzen Katze?«
»Er hat auf seiner Schulter immer eine schwarze Katze sitzen, hahaha —«
Das Lachen klang recht eigentümlich, so schwach, woran aber im Telefon nicht die Wassertiefe schuld sein konnte.
»Bist Du müde, Richard?«
»Sehr, sehr«, erklang es mit dementsprechender Stimme.
»Trinke!«
»Ich trinke.«
»Wirst Du frischer?«
»Etwas.«
»Wie tief bist Du?«
»133. Ach, Martha, Du wirst mir dies alles nicht glauben, was ich Dir da erzählt habe, aber ich werde Dir noch etwas anderes offenbaren, etwas ganz, Wunderbares, was ich selbst erlebt — — Grund!«
Er hatte den Boden erreicht.
Und nun musste eine Krisis kommen, die er erst zu überwinden hatte.
Jedes Mal, wenn er den Grund erreicht hatte, es brauchte gar keine solche furchtbare Tiefe zu sein, geriet er eben zuerst in eine andere Verfassung, es war irgendein Nervenreiz.
»Richard!«
Aus dem Telefon kam nur ein dumpfes Murmeln.
»Was tust Du?«
Das Murmeln wurde noch schwächer.
»Lege Dich nicht etwa hin und schlafe!«
»Nnnnein«, erklang es schwach, aber schon deutlicher.
»Trinke!«
»Ich — trinke.«
»Tust Du es auch wirklich?«
»Ja, ich bin wieder ganz wach — o Martha, Martha, was soll das bedeuten, wie ist das möglich?«, erklang es jetzt in ganz anderem, lebendigem Tone.
»Was ist denn?«
»Um mich herum ist alles hell, ganz hell, und es wird immer heller —«
»Es ist der Schein Deiner Lampe.«
»Nein, ich befinde mich in einem Lichtkreis, der immer größer und größer wird, nur ist alles undurchsichtig — wie ein erleuchteter Nebel — jetzt aber beginnt sich alles aufzuhellen — o Martha, Martha, was meine Augen erblicken!«
»Nun, was erblicken sie?«
»Einen Garten! Einen herrlichen, wunderbaren, zauberhaft schönen Garten!«
Es war für Frau Martha nicht etwa etwas Merkwürdiges, was sie da zu hören bekam.
Er sah eben eine unterirdische Szenerie, bestehend aus Korallengebilden, Pflanzen, Schwämmen, Muscheln und dergleichen.
Die Sache war nur die, dass er bloß das Wenige erblickte, worauf der Blendstrahl seiner Lampe fiel, aber in seiner erhitzten Phantasie erweiterte sich das gleich zu einem ganzen Garten.
»O diese Früchte, diese herrlichen Früchte!«
Die konnte es dort unten auch geben — allerdings wohl nur ungenießbare.
»Dieser prachtvolle Baum! Reife Apfelsinen hängen daran! Martha, wie ist das nur möglich?«
»Kannst Du nicht eine Apfelsine abpflücken?«
»Ich habe eine abgepflückt.«
»Koste sie doch einmal.«
Diese Frage war eine Falle, eine Prüfung.
Wenn Richard jetzt sagte, er äße die Frucht, träumte er eben nur. Der Taucher konnte doch von außen nichts zum Munde führen.
Aber er bestand die Prüfung.
»Du träumst, Martha!«, behauptete sogar er jetzt. »Wie soll ich denn die Apfelsine essen können. O Martha, aber was ist das nun —?«
»Was siehst Du?«
»Ich habe mich umgedreht. Und jetzt plötzlich sehe ich da ein Haus — und was für ein schönes Haus — ein prächtiger Palast — o Wunder über Wunder! — es sind große Fensterscheiben darin — und dahinter sehe ich herrliche Zimmer — alles erleuchtet — da, da — da kommen zwei junge, schöne Mädchen — Seenixen — nein, es sind keine Nixen — wenn sie auch solche meergrüne Schleier tragen — aber es sind natürliche Menschen — und sie winken mir — winken mir — und jetzt — o Martha, Martha — was ich jetzt erblicke — jetzt kommen da —«
»Rrrrrr«, ging es in dem Telefon.
Diesen Ton kannte Frau Martha, wenn sie ihn auch noch nie gehört hatte, wenn sich ihr Gatte in solcher Tiefe befand.
Ein erschrockenes Stutzen, dann schnellte sie auf und eilte hinaus an Deck.
»Der Telefondraht ist gerissen!«
Sie wusste es so bestimmt, dass sie nicht erst noch einmal hinabgerufen hatte.
Jetzt geschah es — es kam keine Antwort, die telefonische Leitung war unterbrochen, wie nun auch noch durch das Galvanometer konstatiert wurde.
Der Taucher konnte von allein emporsteigen, indem er Luft aufspeicherte.
Aber das ging gerade bei diesem Kostüm sehr langsam, in dem mit normalem Luftdruck gearbeitet wurde.
Eine Gefahr lag nicht vor.
Es handelte sich nur um die merkwürdige Charaktereigenschaft Richard Flints, dass er durchaus nicht unter Wasser sein konnte, wenn er sich nicht immer mit der Oberwelt unterhielt.
Also die Leine wurde eingeholt, ziemlich schnell, Hand über Hand, was eben bei diesem Apparat ohne Schaden für den Taucher statthaft war.
Einhundertvierzig Meter wollen eingeholt sein.
Die Hälfte war herein.
»Das geht recht leicht«, meinte ein alter Matrose.
Die Arme arbeiteten noch emsiger.
»Natürlich, da hängt niemand mehr dran«, wurde geflüstert, mit scheuen Blicken nach dem jungen Weibe, das dort an der Bordwand stand, die plötzlich ganz seltsam starren Augen auf die Stelle geheftet, wo ihrer Berechnung nach der Taucherhelm zum Vorschein kommen musste.
Da erschien das Ende des Sicherheitsseiles — — leer, abgerissen, roh abgeschnitten, wie abgesägt, wahrscheinlich von Korallenklippen.
Ein gellender Schrei, und Frau Martha Flint musste aufgefangen werden, sonst wäre sie gestürzt.
Sie hatte gewusst, dass sie nicht mehr auf das selbstständige Aufsteigen des Tauchers zu warten brauchte, dass sie ihn nie wieder an der Oberfläche sehen würde.
Dich Schurken trifft die angekündigte Strafe! Du hängst im Kraterkessel des Hekla!« Diese Worte klangen an die Ohren des entsetzten Mister Philipp, machten sie gellen, hätten aber noch viel mehr in seinem Innern gellen, alles in Aufruhr setzen sollen.
Denn nun war ihm doch bestätigt, was er freilich bereits geahnt hatte.
Loke Klingsor ließ sich kein X für ein U vormachen. Der hatte doch gleich gewusst, was für einen alten »Jesuiter« er in Samuel Philipp vor sich hatte, dass der ihm ein anderes Bild unterschieben wollte, war deshalb auch nicht am Fenster erschienen, auf dessen Bord die Fotografie noch immer lag.
Deshalb hatte Samuel Philipp auch umsonst gespannt, ob vielleicht draußen ein Flieger auftauchte oder wie sonst Loke Klingsor sein gestohlenes Eigentum wieder an sich nehmen würde.
Diese Worte hatten also das bereits etwas erwachte Gewissen des alten Sünders wachrütteln sollen.
Aber gerade das Gegenteil war der Fall.
»Was? Ich hänge im Krater des Hekla? Das will der mir weismachen, und ich soll es glauben wegen der paar Schwefeldämpfe und wegen der Feuerkugel, die unter mir ist, wegen des bisschen Hitze?
Na, der müsste mich doch eigentlich nicht für so dumm halten, da müsste er doch wissen, dass der Samuel Philipp sich nicht so leicht übertölpeln lässt, dass der sich nicht so schnell fürchtet!«
Das dachte der alte Sünder, obwohl er sich in seinem Lehnstuhl noch nicht zu rühren vermochte, obwohl er immer durch die stechenden Schwefeldämpfe zum Husten gezwungen wurde.
Und anstatt nun etwa um Gnade zu winseln, verzog sich sein mageres Gesicht zu einem recht hässlichen Lächeln.
Er hütete sich allerdings, etwas zu sagen, denn das hätte doch nur Spott und Hohn sein können, und da wusste er wiederum ganz genau, wie weit er seinem ehemaligen Freunde gegenüber gehen durfte.
Außerdem — die Rechnung, die sie beide miteinander zu begleichen hatten, war doch im Laufe der Zeit eine ziemlich große geworden, und er war der Schuldner, Loke Klingsor der Gläubiger —
Nein, nein, sagen wollte Samuel Philipp lieber nichts, aber wenn der Fürst des Feuers, der mit den Teufelsaugen, der sogar als Fotografie lebendig werden und mit seiner Keule zuhauen konnte, wirklich Gedanken zu lesen vermochte, dann war es ja auch gar nicht erst nötig. dass Samuel Philipp lange Reden hielt, dann wusste er doch schon alles, was in dem vorging —
Und so hing dieser eben in der Luft, unter sich das Feuer, das angeblich der Krater des Hekla sein sollte, umwallt von den Schwefeldämpfen und — lächelte!
Und dabei spannte er schon wieder nach dem bewussten Fenster hinüber, suchte durch die gelben Dämpfe hindurch zu erspähen, was dort vor sich ginge — ob überhaupt etwas dort geschehen würde —
Furcht kannte der Mann eben nicht, wie schon mehrmals gesagt worden ist.
Sonst hätte er doch auch nicht gewagt, den größten Teil seines Vermögens für die vier Expeditionen auszusetzen, hätte nicht gewagt, dem gefürchteten Loke Klingsor das Geheimnis der Runen entreißen zu lassen.
Nein, Samuel Philipp übte jetzt eine Kunst, der er im Leben schon viel verdankte: Er schwieg, hielt den Mund zu, aber die Augen und die Ohren desto weiter offen.
Na, und da war es eben nicht besonders schwer für ihn, festzustellen, dass er wirklich nicht im Krater des Hekla hing, sondern ganz richtig in dem Mumiensaale, allerdings in keiner sonderlich angenehmen Lage, aber doch noch lange nicht von dem schrecklichen Schicksal bedroht, das ihm hier angekündigt worden war.
Dabei war er ehrlich genug, sich selbst nichts zu verhehlen.
»Der Loke kann doch wirklich noch ein bissel mehr als ich«, dachte er nämlich.
»Ich möchte wahrhaftig wissen, wie er das nun wieder fertig bringt, mich so an dem Stuhle festzuhalten und diesen in die Luft zu heben.
Das möchte ich auch können.
Vielleicht kann ich es ihm noch abgucken.«
Und da guckte er auch schon wirklich, sah aber eben nichts weiter als die gelben Schwefeldämpfe —
Und er beschloss, ganz geduldig zu warten, wie er ja schon längst nicht mehr um Hilfe gerufen hatte.
»Jetzt fehlt bloß noch, dass er wirklich den geplatzten Derwisch wieder lebendig macht!«, dachte er dann.
Und da erschrak er auch schon.
Hinter ihm klang es, wie schon einmal, wie wenn jemand in Schuhen mit Holzsohlen auf den Dielen umher tappste — immer so klipp klapp, klapp klipp —
»Jetzt muss er hinter mir stehen«, sagte er sich, als das Tappsen dicht hinter seinem »Schwebestuhle« war.
Und da kam es um den Stuhl herum.
Samuel Philipp hatte mit vollem Bewusstsein einmal die Augen zugemacht.
Das war aber nur geschehen, um sich selbst in Zucht zu halten, nicht den Verstand durch die Sinne verwirren zu lassen.
»Wenn ich also jetzt die Augen aufmache, dann müsste der Kerl unmittelbar vor mir stehen, oder wenigstens unter mir«, dachte er, »weil ich doch mit dem Gesicht nach unten in der Luft schwebe.«
Nun, wir wollen mal sehen, was daran wahr ist!
Und er machte die Augen auf, lächelte auch schon wieder, weil er fest überzeugt war, dass er eben nichts weiter sehen würde als den Nebeldampf —
Wenn nämlich da mit dem Brusttone der Überzeugung behauptet wird, dass es ganz bestimmt Geister gibt, wenn manche bereit sind, zu schwören, sie hätten schon einen gesehen, so brauchen sie deswegen noch gar nicht einmal zu lügen.
Sie sahen wirklich einen Geist, bloß, dass er nicht wirklich vorhanden war, sondern aus ihnen herauskam, nur von ihrer eigenen Phantasie erzeugt und nur für ihre — geistigen — Augen sichtbar.
Aus diesem Grunde hat eben auch noch jeder, der einen Geist gesehen haben will, behauptet, die Erscheinung sei wie Luft gewesen, habe sich in Luft aufgelöst, sei zerflossen, als er sich ihr näherte.
Gerade Amerika ist ja das Vaterland des Spiritismus.
Dort kamen zuerst die tanzenden Tische auf, dort hörte man zuerst das Geisterklopfen, dort gab es auch die ersten Geisterbotschaften und Geisterfotografien, und selbstverständlich hatte auch Samuel Philipp sich mit diesem Humbug beschäftigt, ohne ihm jedoch später noch irgendwelche Beachtung zu schenken.
Dieser mit allen Hunden gehetzte und mit allen Wassern gewaschene alte Fuchs ließ sich doch nicht über die Ohren hauen, lachte über den Hokuspokus, und doch wusste er auch ganz genau, wie leicht der Mensch imstande ist, sich selbst zu täuschen, wie er zu sehen und zu hören glaubt, was er eben sehen und hören will —
Einzig deshalb also hatte er die beiden Augen fest zugedrückt und sich noch obendrein gesagt: »Wenn Du sie wieder aufmachst, siehst du nichts weiter als die Schwefeldämpfe!«
Und als er sie auftat, da lief es ihm doch eiskalt über den krummen Rücken!
Da riss er die Augen, die von den Schwefeldämpfen bereits tränten und ganz rot aussahen, erst recht auf.
Und da hätte es ihm auch nichts geholfen, wenn er jetzt die Hände und die Arme hätte bewegen können, um sich die Augen zu reiben.
Er sah wirklich, was er nicht für möglich gehalten hatte.
Vor ihm stand der dicke Derwisch, den man im Hause bloß als den »geplatzten« bezeichnete und den die Diener allesamt schon als Geist gesehen haben wollten.

Das war das fette Gesicht mit den Hängebacken, das war die runde Gestalt mit dem kolossalen Bauche, und auch sonst stimmte eben alles — nicht eine Kleinigkeit an der Kleidung des Spuks war anders, als sie im Leben gewesen war.
Vor allem aber waren das die Augen, die Samuel Philipp ganz genau kannte — das einzige, was er damals beinahe gefürchtet hatte —
Und dieser Spuk hatte überdies das Instrument in der Hand, das ihm den Tod gebracht hatte!
Es ist schon gesagt und beschrieben worden, wie es in dem Nebenraume aussah, dass da eine Unmenge Mumien untergebracht worden waren, die einst in diesem Saale aufgestellt gewesen waren.
Es ist auch gesagt worden, dass diese Mumien allesamt sehr schadhaft geworden waren, namentlich bei dem indischen Weibe, das als Schmiedin dargestellt worden war.
Samuel Philipp hatte eben anscheinend den Geschmack an diesen Mumien verloren, hatte sich nicht um sie gekümmert, sie verlottern lassen, sich aber auch nicht entschließen können, sie zu beseitigen, indem er sie einem Museum schenkte oder wegwarf oder sich ihrer sonst wie entledigte, vielleicht, indem er sie verbrannte.
Alle diese vielen Gestalten sind als Mumien bezeichnet worden, und heute weiß wohl jeder halbwegs gebildete Mensch, was dieses Wort besagt, woher es stammt.
Es handelt sich da um eine vor vielen Jahrtausenden von ägyptischen Priestern geübte Kunst, menschliche Leichen nach dem Tode noch in ihrer Gestalt zu bewahren.
Dazu verwendeten die Priester, nachdem sie die Eingeweide entfernt hatten, bestimmte Salben und andere Ingredienzien.
In jedem großen Museum sind solche Mumien zu finden, wenigstens eine ist immer vorhanden, und da ist nicht viel zu sehen.
Es sind dürre Gerippe, mit Leinenbinden ganz und gar verwickelt.
Sie tragen an der Stelle des Gesichts meist eine mehr oder minder geschickt gemachte Maske, die oft aus kostbarstem Material besteht und sicher immer dem Leben nach geformt wurde.
Das ist aber auch das einzige Menschenähnliche, das heißt, was an einen lebenden Menschen erinnert. Sonst — eben wie gesagt, nichts weiter als ein von pergamentähnlicher Haut umspanntes Gerippe.
Weniger bekannt dürfte sein, dass man von diesen Mumien, die aus ihrem jahrhundertelangen Schlafe in den Totenkammern der Pyramiden und anderer Begräbnisstätten gerissen wurden, allerlei seltsame Dinge erzählt, und deshalb muss an einen Vorfall erinnert werden, der sich noch kurz vor dem Weltkriege ereignete, damals, als die ganze Kulturwelt ob des Unterganges der »Titanic« erschauerte.
Da wurde nämlich erst hinterher bekannt, dass sich an Bord dieses Schiffes eine Mumie befunden hatte, die Mumie einer vor vielen Jahrtausenden verstorbenen ägyptischen Prinzessin.
Sie war von einem Engländer geborgen worden. der aber starb, ehe er seine Beute heimbringen konnte.
Seine Familie erhielt mit dem anderen Nachlasse auch diese Mumie und verwahrte sie in irgendeinem Raume, ohne sich viel um sie zu bekümmern.
Desto mehr Interesse hatten natürlich die Fachgelehrten an ihr, und sie drangen in die Witwe, der Öffentlichkeit wenigstens ein Bild der Mumie zugänglich zu machen.
Die Dame willigte ein, wollte die Prinzessin fotografieren lassen, und da das in ihrem Hause aus irgendeinem Grunde nicht ging, so wurde die Mumie zu dem Fotografen gebracht.
Und da begann das Unheimliche, das eigentlich aber schon früher in Erscheinung getreten war, mit dem plötzlichen Tode des englischen Gelehrten nämlich.
Der Fotograf hatte die Mumie mehrmals »abgenommen« und entwickelte die Platten, hätte sie aber beinahe fallen lassen vor Schrecken.
Er sah doch deutlich, dass diese vor so vielen Jahrtausenden gestorbene Prinzessin die Augen auf hatte.
Und was für Augen!
So etwas von Bosheit, wie aus diesen hier leuchtete, hatte der Fotograf noch bei keinem menschlichen Wesen bemerkt!
Ihm grauste.
Er packte die Platten ein und rannte zu der Witwe — und da sah auch diese, sahen noch viele Leute dasselbe: Die tote Prinzessin hatte die Augen weit auf — wo doch gar keine mehr vorhanden waren! — und funkelte mit ihnen so boshaft, dass kein Beschauer diesen Blick ertragen konnte.
Nun, der Fotograf wurde zum Schweigen verpflichtet, schwieg auch vielleicht aus bloßer Angst vor der wieder lebendig gewordenen unheimlichen Mumie, und diese selbst wanderte ins Britische Museum, wo sie schon mehrere Gefährten vorfand, als Geschenk natürlich, das mit Freuden angenommen wurde!
Und seitdem weigerten sich die Museumsdiener, die Nachtwache in dem Saale zu halten, in dem diese Mumie stand!
Sie waren nicht zu bewegen, dass sie erzählten, was sie erlebt haben wollten, aber ebenso wenig, noch eine Nacht bei diesem unheimlichen Wesen Wache zu halten!
Und da half alles nichts — wenn die Museumsleitung nicht alle die erprobten Diener entlassen wollte, dann musste eben die Mumie beseitigt werden.
Sie wurde in einen Keller gebracht, wohin niemand kam — und der Spuk war zu Ende.
Bis ein Amerikaner, ein Ägyptologe, in London eintraf und dem Museum die Mumie abkaufte, um sie mit nach Amerika zu nehmen!
Man gab sie ihm gern.
Die alte Prinzessin, die aber vielleicht einst recht jung gestorben war, wurde verladen, kam auf die »Titanic«, und — was mit dieser geschah, braucht ja nicht erzählt zu werden.
Noch viel frischer in der Erinnerung aber dürfte das Schicksal jener Männer sein, die die Mumie des Tutanchamun aus ihrem kostbaren Grabe holten, und da das erst vor kurzem geschah, braucht erst recht nichts darüber erzählt zu werden.
Das aber waren Mumien nach ägyptischer Geheimkunst bereitet.
Und die Mumien des Mister Samuel Philipp hatten mit ihnen nichts gemein, gar nichts — als eben das Unheimliche, das ihnen anhaftete.
Die waren eben auch nicht nur mit pergamentähnlicher, eingeschrumpfter Haut überzogene Knochen, sondern waren genau, wie wenn sie noch lebten — sie waren das einmal gewesen, jetzt waren die — sagen wir einmal so — Bälge leer —
Aber niemand wusste, dass da ein viel größeres Geheimnis dabei war als etwa bei den ägyptischen Mumien.
Damals waren die Toten einbalsamiert worden.
Mister Samuel Philipp aber hatte seinen Mumiensaal, welcher Ausdruck beibehalten werden soll, trotzdem er also den Tatsachen nicht entspricht, mit Menschen bevölkert, die noch lebten —
Auch dieser Ausdruck trifft jedoch nicht das Richtige, denn selbstverständlich kann man einen lebendigen Menschen nicht mumifizieren, aber es dürfte ebenfalls bekannt genug sein, dass in manchen Grüften, in manchen Grabkellern, ja sogar auf manchen Friedhöfen die Leichen, die dorthin gebracht werden, überhaupt nicht verwesen, dass sie viele Jahre hindurch genau das Aussehen behalten, das sie bei der Beisetzung hatten.
Da wirken eben Umstände mit, die sich nicht leicht erklären lassen. Da sind Bleisärge vorhanden oder gewisse Mineralien im Boden, die keine Fäulniserscheinung aufkommen lassen.
Auch das traf aber bei den Mumien des Mister Philipp nicht zu, denn die Menschen, die er als Mumien bezeichnete, waren nie gestorben, die hatte er mittels eines Giftes, das er zu bereiten verstand, in einen Starrkrampf versetzt, der aber erst nach einiger Zeit eintrat, immer erst, nachdem er vollkommen Zeit gehabt hatte, ihnen die Stellung zu geben, in welcher er sie zu haben wünschte, wie die Schmiedin, den schweren Hammer schwingend —
Und dieses geheimnisvolle Gift wirkte eine bestimmte Zeit.
Dann trat eben der wirkliche Tod ein, die in Starrkrampf versetzten Unglücklichen starben tatsächlich, konnten jedoch auch da nicht mehr verwesen.
Das Fleisch schrumpfte unter der Haut zusammen, und dann sah es eben aus, als wären sie einmal mit Luft aufgeblasen oder ausgestopft gewesen.
So hätte es ganz im Belieben des Mister Samuel Philipp gestanden, seine »Mumien« lebendfrisch zu erhalten, so lange er wollte, er hätte eben nur die Einspritzungen nicht unterlassen dürfen, und das hatte er auch immer treulich besorgt, hatte seine Freude an den Dingern gehabt, ohne je die geringsten Gewissensbisse deshalb zu empfinden, dass er doch eigentlich der Mörder aller dieser Wesen war.
Er hatte sich ein völkerkundliches Museum geschaffen, um das alle Sammlungen der Welt ihn hätten beneiden müssen — alles war echt und lebenswahr vorhanden — und es ist auch schon gesagt worden, dass da selbst weiße Menschen nicht fehlten —
Da muss aber auch gleich wieder bemerkt werden, dass Samuel Philipp ein gutes Recht hatte, sie in diesen Starrkrampf zu versetzen, denn er hatte ihnen bei Lebzeiten das Recht dazu abgekauft, etwa so, wie ein Gelehrter sich den Körper eines abnorm gebauten Menschen kauft, um ihn nach dem Tode eingehend zu untersuchen.
Das kommt häufiger vor, als man glauben mag.
Leute, die nichts zu verlieren haben, zeitlebens in Armut und Elend lebten, wollen wenigstens einmal das Dasein genießen, schließen also mit einem derartigen Sonderling einen richtigen, gesetzlich gültigen Vertrag, verkaufen sich ihm selbst mit Haut und Haaren, leben lustig in den Tag hinein, bis das Geld alle ist — und — was dann mit ihnen wird, das ist ihnen eben vollständig gleichgültig.
Die weißen Mumien Samuel Philipps waren also sein rechtmäßiges Eigentum.
Die hatte er kraft seines Reichtums gekauft.
Anders stand es mit den Vertretern fremder Völker.
Da war er eben zum Menschenjäger und zum Mörder geworden, um seine Sammlung recht vollständig zu bekommen —
Und nun sind wir nach dieser Abschweifung, die aber unbedingt zur Klärung der Sache nötig war, wieder bei dem dicken Derwisch, der der »geplatzte« genannt wurde und jetzt als Spuk vor seinem Mörder stand.
Da war nämlich dem ehrenwerten Samuel Philipp mal ein Versehen unterlaufen, oder es war etwas an dem unheimlichen Gift nicht in Ordnung gewesen.
Er hatte den dicken Kerl unter irgendeinem Vorwand mit sich gelockt, ihn auch nach New York gebracht — und dort — in seinem abgelegenen Hause hatte er den Mann betäuben wollen, hatte sich schon darauf gefreut, wie er in einer recht possierlichen Stellung dastehen würde —
Und da hatte der Kerl die Bosheit gehabt, zu platzen — genau so, wie Samuel Philipp damals verdrießlich gesagt hatte — wie wenn man auf eine mit Blut gefüllte Schweinsblase haut — war einfach in die Luft gegangen —
Aber Samuel Philipp war eben kein Dummkopf, er hatte nur seinen Dienern gegenüber die Lüge gebraucht, dass da mal die Einspritzung zu stark gewesen sein könnte.
Er, als Kenner orientalischer Geheimnisse, hatte doch in Wahrheit gewusst, dass da etwas anderes vorlag, dass der dicke Derwisch mit voller Absicht geplatzt war, um sich nicht als Mumie aufstellen und auslachen zu lassen — er hätte vielleicht noch was ganz anderes fertiggebracht, hätte er rechtzeitig geahnt, was ihm bevorstand.
So aber war es zu spät gewesen, er hatte sich bloß noch dadurch rächen können, dass er eben platzte.
Und dass es seitdem in dem Hause spukte!
Dass er dem Samuel Philipp, seinem Mörder, gründlich und für alle Zeiten die Freude an den Mumien verleidete und ihn so weit brachte, dass er sich überhaupt nicht mehr um diese Sammlung kümmerte, sie verlottern ließ, dass der große Saal geräumt wurde — und dass keiner der Diener ihn mehr betrat —
Und nun stand der dicke Derwisch unmittelbar vor ihm — oder vielmehr unter ihm — und hatte in der einen Hand die Spritze, die Samuel Philipp nur zu genau kannte.
Das Grauen, das er empfand, war also nur zu erklärlich, erst recht, als er die Augen des Derwischs mit dem Ausdruck tückischer Rachsucht funkelnd auf sich gerichtet sah —
Wenn der Kerl jetzt die scharfe Spitze des Instrumentes ihm durch die Haut in eine der Adern bohrte und bloß ein wenig drückte, dann war es vorbei mit dem ehrenwerten Samuel Philipp, dann brauchte er nicht auf die Berichte von den verschiedenen Expeditionen zu warten, die er ausgeschickt hatte, dann konnte er sich von seinen Dienern nur gleich selber zu den anderen Mumien stellen lassen.
Trotz dieses Grauens aber, trotz seiner wahrhaften Todesfurcht musste das alte Männchen doch auch schon wieder seinen scharfen Geist arbeiten lassen, sagte sich, dass diese Erscheinung eben nur eine Ausgeburt seiner Sinne sein könnte, nichts weiter —
Und schon war er so weit, dass er fast wieder hatte lächeln können, so überlegen und spöttisch wie vorher, schon hatte er sich wieder so weit in der Gewalt, dass er entschlossen war, auch jetzt noch Loke Klingsor zu trotzen. Auf einmal zitterte er wirklich, so weit das in seinem gegenwärtigen Zustande möglich war.
Durch den gelben Nebel der Schwefeldämpfe, die ihm fast den Atem raubten, sah er Loke Klingsor selber genau so, wie er auf der bekannten Fotografie zu sehen war, das eine Bein über das andere geschlagen, auf der einen Schulter das riesengroße Katzenvieh, und neben sich dieser sonderbare Behälter, aus dem der Rauch sich um ihn wand.
Und dieses Bild war lebendig, das sah Samuel Philipp doch ganz deutlich, da hätte es gar nicht erst zu sprechen brauchen, wie es jetzt geschah.
»Du bist wirklich ein hartgesottener alter Sünder, Samuel Philipp«, sagte die tiefe wohllautende Bruststimme, die nur diesem Loke Klingsor eigen war, sonst keinem Menschen auf der Erde, und die das alte Männchen ja ganz, ganz genau kannte.
»Ich habe Dein Gewissen aufrütteln wollen, habe geglaubt, Hopfen und Malz seien auch bei Dir noch nicht ganz verloren — aber jetzt muss ich erkennen, dass ich mich doch getäuscht habe.
Samuel Philipp, Du hast mich bereits mehrmals auf unverantwortliche Weise herausgefordert, Dir ist der Kamm so sehr geschwollen, Dein Übermut hat sich so weit verstiegen, dass ich nun nicht länger zusehen kann.
Oder hast Du wirklich angenommen, ich würde mich durch Dich ein zweites Mal betrügen lassen und die wertlose Kopie anstatt des Originals holen?
Alter, Alter, diesmal hast Du Dich gewaltig verrechnet, hast meine Macht bedeutend unterschätzt, und nun sollst Du sie kennen lernen — kurz vor Deinem Tode, Du alter Gauner!
Denn dieser Derwisch vor Dir, den Du umgebracht hast, wird sich ein Vergnügen daraus machen, den Inhalt seiner Spritze in Deine Adern zu jagen, Dich für immer in Starrkrampf zu versetzen. Aber vorher muss ich noch einige Fragen an Dich stellen, die Du mir der Wahrheit gemäß beantworten wirst —«
»Ich? Dir?«, kam es da hämisch über die dünnen Lippen Samuel Philipps.
»Ja, Du mir!«, erwiderte Loke Klingsor.
»O, Du eingebildeter Narr, Du!«, brach nun aber das dürre Männchen los, das noch immer mitsamt dem Stuhle in der Luft schwebte. »Du willst mich wohl gar zwingen? Hähähä! Na, da versuche es doch! Da probiere doch mal Deine Macht! Hähähä! Du hörst ja, wie ich über Dich lache!
Oder denkst Du, ich sollte Dich um Gnade anbetteln! Ich Dich? Hähähä! Da bist Du aber ganz schiefgewickelt — ich denke nicht daran!
Meinetwegen kannst Du mich ja umbringen, ich gebe zu, dass ich in dieser Hinsicht wehrlos bin, aber wenn Du auch meinen Körper lähmen kannst, mit meinem Geiste, mit meinem Willen hast Du da kein Glück, über die besitzt Du keine Macht, und wenn Du das doch behauptest, so lache ich Dir ins Gesicht!«
Und er brach in ein lautes, meckerndes Lachen aus, aus dem seine ganze Bosheit offenbar wurde.
Nein, mit dem war nichts zu machen.
Der alte Samuel Philipp ließ sich aus Todesfurcht kein Geständnis erpressen, der starb lieber, als dass er seinem einstigen Freunde und jetzigen Feinde diesen Triumph gegönnt hätte.
Und nun setzte er auch gleich noch das Tüpfelchen auf das i.
»Du aufgeblasener Narr!«, hob er wieder an. »Denkst Du vielleicht, ich soll mich vor diesem Popanz hier fürchten, vor diesem dicken Vieh von einem Derwisch, hähähä?
Was tot ist, ist tot und kommt nicht wieder, wird nicht wieder lebendig, und der dicke Kerl ist sogar auseinandergeplatzt wie ein faules Ei — da wird es ein bisschen schwerhalten, ihn wieder zusammenzusuchen —
Nun natürlich, als Spuk kannst Du ihn auftreten lassen, das sehe ich ja, er ist mir ganz nahe, und ich muss zugeben, dass Du diese Sache recht gut verstehst, Loke Klingsor, aber es ist doch nicht viel anders als mit Deinem Hekla, in dessen Krater ich nun schon eine ganze Weile schwebe, wie Du vorhin sagtest —
Hekla! Denkst Du denn vielleicht, ich wüsste nicht, wie es in dem aussieht? Denkst Du vielleicht, ich hätte noch in keinen Krater geguckt? Nee, nee, da musst Du schon mit anderen Faxen kommen, mein Freund, ehe Du den alten Samuel Philipp ins Bockshorn jagen kannst! Und außerdem hättest Du doch von früher wissen müssen, dass ich mich überhaupt nicht fürchte —
Na, da winke doch mal dem fetten Kerl hier, dass er mir das Gift einspritzt! Na, da winke doch! Hähäha! Ich kann mich ja nicht wehren, er hat es so bequem — da winke doch, Loke Klingsor —«
Die Erscheinung des Mannes mit der Katze auf der Schulter war also doch so deutlich, dass selbst Samuel Philipp nicht im Geringsten daran zweifelte, dass Loke Klingsor, sein alter Freund, sich jetzt tatsächlich ihm gegenüber befand!
Nein, das nahm er als Tatsache an, da wusste er ja genau, was jenem möglich war —
Und da wurde eben der Neid in ihm erst recht lebendig!
Das hätte er doch für sein Leben gern ebenfalls gekonnt, hätte sein ganzes Vermögen dafür gegeben, wenn er die Kunst verstanden hätte, den Raum mit so spielender Leichtigkeit zu überwinden, wie Loke Klingst das vermochte.
Und dass er sein ganzes Vermögen dafür opfern wollte, um eben diese Kunst zu lernen, das hatte Samuel Philipp ja schon bewiesen.
Er hatte die vier Expeditionen ausgerüstet und ausgeschickt, hatte jedem Teilnehmer hohe Belohnungen versprochen — das wenigste war eine Million Dollar —
Und bloß deshalb, dass diese Wagehälse versuchten, die sieben Runen auf dem Rücken Loke Klingsors zu kopieren.
Diese Runen! Um sie handelte es sich eben bloß —
Wenn er die kannte, dann gab es für ihn auch keinerlei räumliche Beschränkung mehr, dann könnte er jetzt in seinem Hause sein und im nächsten Augenblick auf dem Chimborasso oder auf dem Gaurisankar —
Dann war eben jeder Wunsch. soweit er örtliche Veränderung betraf, schon erfüllt, kaum dass er entstand.
Und dort vor ihm saß dieser Loke Klingsor, so nahe, dass er ihn hätte mit der Hand erreichen können, wenn er diese nur zu gebrauchen vermocht hätte —
Und auf dem Rücken hatte er die Runen!
Die anderen suchten ihn in der Wüste Afrikas, in dem Urwald Südamerikas, in den Salzsteppen Australiens, sogar in der Tiefe des Stillen Ozeans, und vielleicht würden sie nie diesen Fürsten des Feuers zu sehen bekommen — oder wenn das geschah, dann würden sie es mit dem Leben bezahlen müssen —
Er aber hatte diesen Loke Klingsor unmittelbar vor sich!
Und trotzdem Samuel Philipp sich in der Gewalt seines jetzigen Feindes befand, trotzdem dieser ihm den Tod verkündet hatte, schmiedete er schon einen Plan, wie er ihn überlisten könnte.
»Ich muss ihn so weit bringen, dass er mir die Runen zeigt, dass er —«, dachte das alte Männchen und hatte auch schon seinen Plan —
Loke Klingsor jedoch hatte sich überhaupt noch nicht gerührt, nicht einmal seine Lippen hatten sich bewegt. Auch zu den Schmähungen hatte Loke Klingsor geschwiegen.
Auf seinem Gesicht war nicht zu merken gewesen, dass er sich ärgerte — es war ruhig wie zuvor, und seine dunklen Augen strahlten ebenfalls wie immer —
Bis sie jetzt auf einmal etwas lebendiger wurden, aufflammten und mit einem Strahl die Spukerscheinung des Derwischs trafen.
Da wurde dieser, der sich bisher unbeweglich verhalten hatte, auf einmal lebendig.
Diese Erscheinung, dieser Spuk, hob sogar zu sprechen an!
Genau so, wie der lebendige Derwisch gesprochen hatte, mit jenem Kreischen in der Stimme, das sich immer eingestellt hatte, wenn er wütend gewesen war, und selbstverständlich auch in seiner Sprache.
Da gab es also nichts von einer Sinnestäuschung, denn man kann zwar wähnen, eine Gestalt zu sehen, die nicht vorhanden ist, aber wenn man sie auch noch reden hört, dann kann von einer Täuschung nicht mehr die Rede sein, wenigstens hier war es so —
Der Derwisch öffnete den Mund und stieß aus diesem Schimpfworte und Drohungen hervor.
Entsetzt starrte jetzt das Männchen auf den Spuk, hörte dessen kreischendes Schimpfen und sah, wie der Kerl ihm näherrückte, die Spritze hob —
Und so sehr Samuel Philipp vorher geprahlt hatte, dass er sich aus dem Sterben nichts mache, dass Loke Klingsor ihn durch seine Todesdrohungen nicht zu schrecken vermöge, so wenig hielt er jetzt stand.
Hätte er sich bewegen können, so hätte er sicher beide Arme vorgestreckt, sich verzweifelt gewehrt.
Aber da er nicht konnte, so rührte er eben das, was allein an ihm noch beweglich war — außer dem heftig schlagenden Herzen — er schrie aus voller Kraft:
»Loke, ich bitte Dich, treibe den Spaß nicht weiter, ruf diesen Kerl ab — ich will nicht sterben — nein, ich will nicht — Loke — wir waren doch einmal ganz gute Freunde und könnten es auch jetzt noch sein — Du hast mich eben damals falsch verstanden oder bist gerade bei schlechter Laune gewesen — ich bin mir keiner Schuld Dir gegenüber bewusst —
Loke, dieser elende Kerl wird mich gleich mit seiner Spritze stechen — Loke!«
Das Gesicht Samuel Philipps ward durch höchste Angst entstellt — teils, weil er wirklich den Tod fürchtete, teils weil er doch überhaupt noch nicht sterben durfte —
Da klang ein sonores Lachen durch den unheimlichen Raum, das Lachen kam aus dem Munde des Mannes mit der Katze auf der einen Schulter —
»Jämmerlicher alter Schwächling!«, folgten dann auch Worte. »Vorhin prahltest Du, Du würdest mich niemals um Gnade anbetteln! Und jetzt?
Nein, nein, Samuel Philipp, Du hast mich umsonst bei unsrer ehemaligen Freundschaft beschworen. Gerade daran hättest Du mich nicht erinnern dürfen, denn der Mensch, der seinen Freund verrät, ist auch zu jeder anderen Schandtat fähig — Du musst sterben — ich kann höchstens Gnade üben, falls Du jetzt bereit bist, mir die Fragen zu beantworten, die ich vorhin an Dich richten wollte. Wie steht es damit?«
»Frage doch!«, ächzte Samuel Philipp ganz kläglich, aber unter den halb gesenkten Lidern funkelte es gar boshaft. Jetzt hatte er den dummen Kerl so weit, wie er ihn haben wollte —
Loke Klingsor lachte noch einmal, und dann sagte er, nun seinerseits mit unverhohlenem Spotte:
»Ich will Dich lieber nicht fragen, habe es gar nicht nötig, denn ich weiß selbst, dass Du kurz nacheinander vier Expeditionen ausgesandt hast. Jeder Teilnehmer hat die Aufgabe, Dir eine Kopie der Runen zu bringen, die ich auf dem Rücken trage, und jedem hast Du dafür eine hohe Belohnung ausgesetzt — bis zu drei Millionen —
Ja, Du hast ganz richtig spekuliert, indem Du jeder Expedition ein Weib beigabst — eine Künstlerin — die mich berücken — oder sagen wir doch gleich — die mich übertölpeln sollte — ich könnte Dir die Namen der Männer, der Künstlerinnen nennen, brauche also gar nicht auf Unterhandlungen mit Dir einzugehen.
Und nun«, hier hob sich der Klang seiner Stimme, dass sie wie schmetternder Trompetenton durch den Raum klang, »nun will ich Dir auch sagen, was Du soeben noch plantest: Du wolltest mich dahin bringen, dass ich Dir wenigstens einmal meinen Rücken zeigte, damit Du die Runen lesen könntest —
Und wenn es Dir möglich geworden wäre, dann hättest Du doch weiter nichts nötig gehabt, als Dich des Geheimnisses zu bedienen, das Du auf diese Weise erfahren hättest, Du hättest Dich im selben Augenblick an einen entlegenen Ort versetzt —
Ach, Du dummer, alter, Du jämmerlicher Samuel Philipp. Jetzt lache ich über Dich —
Und nun soll Dich die Strafe ereilen, die Du verdient hast!
Du hast vorhin darüber gespottet, dass ich sagte, Du befändest Dich im Krater des Hekla, hast gedacht, ich wollte Dich täuschen — ach, wie wenig kennst Du mich doch, trotzdem Du früher so manche Gelegenheit gehabt hattest, mich kennen zu lernen! Du müsstest wissen, dass ich niemals eine leere Drohung ausstoße, und nun gib acht! Du sollst selbst mit ansehen, was mit diesem Hause geschieht, mit Deiner Höhle, in der Du Deine verbrecherischen Pläne geschmiedet, die Ergebnisse Deiner zahllosen Verbrechen aufgespeichert hast —!«
Loke Klingsor erhob sich, immer noch die Katze auf der Schulter.
Er hob die rechte Hand.
Da war der spukende Derwisch verschwunden, die Schwefeldämpfe verzogen sich im Nu, die Feuererscheinungen versanken und der Stuhl, in welchem Samuel Philipp saß, kehrte in seine normale Stellung zurück, stand wieder auf dem Estrich, nur rühren konnte sich das alte Männchen noch nicht, merkte, dass es noch gleichsam an dieses Holz festgeklebt war.
Und obwohl er also eigentlich keinen Grund zur Furcht mehr gehabt hätte, stellte diese sich bei ihm jetzt erst wirklich ein —
Sein Gesicht verzerrte sich, die Haare auf seinem Nacken sträubten sich, die Augen quollen hervor. —
Er wollte reden, aber das vermochte er jetzt auch nicht mehr.
Sogar sein Herz schien nunmehr still zu stehen — vielleicht eben nur aus Furcht —
Und dann sah Samuel Philipp seinen Richter durch das Fenster hinausschweben, wieder auf dem Stuhle sitzend, in der bekannten Stellung, und er selber musste auf seinem Stuhle hinterher, auch durch die Luft —
Er wollte sich an den Lehnen festkrampfen, um nicht herauszufallen, aber das war ja gar nicht nötig, er saß ganz fest —
Und dabei dachte er wie in einem Fieberzustande, dass er das doch alles ganz bestimmt bloß träume, er jeden Augenblick erwachen müsste — so etwas gab es eben doch nicht —
Er sollte noch etwas ganz anderes erleben!
Loke Klingsor hatte haltgemacht, schwebte über dem Zentralpark in der Luft, und neben ihm befand sich auf seinem Stuhle Samuel Philipp, vor Schrecken halb tot —
Und sah, wie sein Haus wankte, sah, wie die Diener aus der hastig aufgerissenen Tür in voller Angst auf die Straße stürzten, wie sie schreiend dahinrannten — die Gegend war um diese Stunde menschenleer, aber die Polizei machte auch dort ihre Runde, und so stießen die Diener auf zwei Beamte, sie redeten auf sie ein —
Die Beamten eilten vorwärts und wurden so Zeugen des unheimlichen Ereignisses.
Es war, als befände sich im Keller des Gebäudes ein Vulkan, der nun plötzlich in Tätigkeit getreten war.
Eine mächtige Feuersäule erfüllte auf einmal alle Räume, schleuderte das Dach hoch in die Luft empor, ließ es aber nicht wieder zum Niederfallen kommen, sondern es ging dort oben in Flammen auf —
Es war fast so anzusehen, wie wenn man ein Blatt Papier schleudert und es anbrennt — es loderte auf und verbrannte bis auf den letzten Rest — obwohl es aus starkem Balkenwerk gefügt war —
Nur Ascheteile kamen aus der Luft herunter — —
Der eine Polizist hatte trotz seiner Verblüffung doch noch die Geistesgegenwart, aus seiner Pfeife das Signal zu geben, er rannte auch nach dem nächsten Telefonstande und alarmierte nicht nur die Wache, sondern auch die Feuerwehr, und die ist in New York gar schnell zur Stelle.
Aber so schnell war sie eben doch nicht, dass sie die Katastrophe hätte verhindern können, die sich hier abspielte.
Das ganze Haus brannte über und über, alles, was darin war, verloderte in glühendem Brande —
Und das war eben das Merkwürdige, das Unheimliche!
Dass nur das Innere brannte, dass die Flammen nicht aus den Rahmen(1), und diese selbst, die doch aus altem Holze waren, brannten nicht lichterloh —
(1) Hier fehlt offenbar ein Wort; sinngemäß könnte hier ›schlugen‹ oder ›loderten‹ stehen.
Dabei ging alles viel schneller, als es selbst dann hätte der Fall sein können, wenn es sich um eine Explosion chemischer Stoffe gehandelt hätte.
Da hätte man doch auch einen gewaltigen Knall hören müssen, Stichflammen wären hervorgeschossen —
Das alles war nicht der Fall.
Es war ganz unerklärlich —
Aber die Feuerwehrleute konnten und durften nicht bloß zuschauen, sie mussten ihre Pflicht tun, die Dampfspritzen traten in Tätigkeit und schleuderten gewaltige Wassermassen gegen das Haus — ohne dass diese Wassermassen es erreichten!
Es sah aus, als würden sie in der Luft durch irgendein unsichtbares Hindernis aufgehalten.
Man gewahrte ganz, ganz deutlich, wie sie gegen ein unsichtbares Etwas klatschten, das sich über und vor dem Hause befinden musste.
Sie wurden davon zurückgeworfen, fielen auf die Feuerwehrleute, dass diese im Nu ganz durchnässt wurden, dass die Schlauchführer die Mündungen der Schläuche gleich gar nicht mehr halten konnten, denn es war eben kein Spaß, unter diesen hernieder klatschenden Wassermassen zu stehen, die eine ganz gewaltige Wucht hatten —
Und zum ersten Mal ergriff die Feuerwehr von New York vor einem Brande die Flucht. Es blieb ihr und den Polizisten eben gar nichts weiter übrig, als sich in die nächsten Straßen zu flüchten.
Da war es nur ein Glück, dass eben die Flammen nicht aus dem Hause herausschlugen, dass kein Funkenregen die Nachbarschaft bedrohte, auch nicht die Bäume des Zentralparkes —
Gefahr für die Umwohnerschaft, die aber eben ziemlich weit entfernt war, gab es nicht.
Man durfte sich begnügen, das Ende der sonderbaren Katastrophe abzuwarten, konnte inzwischen die Diener verhören, die sich hatten retten können, und wenn das auch ein schweres Stück Arbeit war, einesteils, weil sie nur schlecht und wenig Englisch sprachen und verstanden, dann aber auch, weil sie vom Schrecken ganz außer sich waren — so viel erfuhr man doch, dass die Leute ganz plötzlich gemerkt hatten, wie das ganze Haus wankte und schwankte — sie hatten gleich an ein Erdbeben gedacht, das sie ja aus ihrer Heimat kannten —
Und dann war von unten her Feuer gekommen — nein, keine Flammen — ein Glutstrom — sie konnten es gar nicht schildern —
Und Mister Samuel Philipp?
Ja, von dem wussten die Leute nichts weiter, bloß, dass er eben im Mumiensaal geweilt hatte.
Sie sagten ferner einmütig aus, dass ihr Herr keinerlei feuergefährliche Stoffe im Keller verwahrt habe, die etwa hätten explodieren können —
Kurzum, man stand vor einem Rätsel und musste zunächst annehmen, dass der unglückliche Mister Philipp eben mit verbrannt sei —
Und die anderen Rätsel?
Dass das Wasser so von einem unsichtbaren Hindernis zurückgeklatscht war?
Man verschob ihre Lösung, bis man einen Gelehrten geholt hatte, der die verschiedensten Sprachen kannte. Vielleicht würde der etwas mehr aus den Dienern herausbringen.
Das alles hatte sich viel schneller abgespielt, als sich eigentlich erzählen lässt, und eben das war wieder nur ein neues Rätsel, denn ein solches Haus brennt doch nicht in ein paar Minuten aus, da stak doch allerhand drin, was den Flammen auf lange Nahrung gab, mochte ihre Hitze auch noch so stark sein, und außerdem — ein solches Feuer verlöscht nicht von selbst wieder.
Da wabert es manchmal noch tagelang unter den Trümmern, und immer wieder schießen da und dort die Flammen hervor —
Hier aber war es ganz anders, hier lag noch ein letztes Rätsel vor.
Der Brand erstarb mit einem Schlage, genau, wie er entstanden war!
Das Haus, das in seinem Innern eben noch ein ungeheures Glutmeer gebildet hatte, stand im nächsten Augenblick ganz schwarz da.
Auch die letzte Flamme schien erloschen,
Und während die Zuschauer ganz betroffen einander anschauten, sagte jemand mit lauter Stimme:
»Genau so sieht es aus, wenn aus einem Vulkan die feuerflüssige Lava hervorbricht und sich einen Weg in das Tal sucht. Was an diesem Wege steht, das flammt im Nu lichterloh auf, verbrennt wie ein Stück Papier — und dann ist alles vorbei. Da ist es ganz gleich, ob das ein grüner Busch ist oder ein ganzes Haus, und die Lava braucht nicht einmal in dieses Haus einzudringen, die ungeheure Hitze genügt, alles Brennbare darin sofort zur Entflammung zu bringen.
Nein, man kann gar nicht einmal sagen, dass die Gegenstände verbrennen, ich möchte sagen: Sie werden vergast — ich kann da nur an die Vorgänge in den Krematorien erinnern, wo die Leichen eingeäschert werden, und da handelt es sich um eine Hitze von fünfzehnhundert Grad vielleicht — so im Durchschnitt — die Vergasung tritt aber auch schon bei weniger ein —
Ja, wenn ich nicht wüsste, dass das hier ausgeschlossen wäre, möchte ich fast behaupten, dass es sich um einen Vulkanausbruch handelte —«
Lautlose Stille folgte diesen Worten, denn der so gesprochen hatte, war ein Fachmann, der sein Leben lang nichts weiter getan hatte als sich mit Vulkanausbrüchen zu beschäftigen, der schon vielmals dabei sein Leben aufs Spiel gesetzt hatte.
Und gerade, weil es nach den Worten dieses weltberühmten Gelehrten, den wohl nur ein Zufall an diesen Ort geführt hatte, so ganz still geworden war, kam den Feuerwehrleuten und den Polizisten erst zum Bewusstsein, dass noch etwas anderes Merkwürdiges bei diesem Brande gewesen war —
Jedes Feuer erzeugt doch allerhand Geräusche. Zeitungsberichterstatter und Schriftsteller, die solche Vorfälle schildern, berichten von dem Brausen der lodernden Flammen, von dem Krachen des einstürzenden Gebälks und so weiter —
Und hier?
Nein, da hatte niemand etwas vernommen. Die Zerstörung des Philipp'schen Hauses war fast geräuschlos erfolgt, und nun — nach erfolgter Aufklärung durch den Fachgelehrten — glaubten die Feuerwehrleute selber daran, dass alles, was sich in dem Gebäude befunden hatte, wirklich gleich »vergast« worden sei, wie der Herr das genannt hatte.
Natürlich auch der unglückliche Besitzer!
Und sein Geld?
Davon redete man ja vorläufig noch nicht, denn es ist nicht amerikanische Art, Bargeld im Hause zu bewahren. Auch Mister Philipp hatte sicher seine Reichtümer bei verschiedenen Banken deponiert.
Und weil das Feuer erloschen war, versuchte man nun doch, in das Innere des Hauses einzudringen.
Die Haustür, die durch die Diener aufgerissen worden war, stand noch offen, war also nicht verbrannt, war allerdings auf beiden Seiten mit dichten Metallplatten geschützt —
Aber als die Leute nun mit ihren Fackeln in die Finsternis leuchteten, die zwischen den ausgebrannten Mauern schon wieder herrschte, da war auch der Gelehrte mit in erster Reihe, und kaum hatte er einen Blick auf die Trümmer geworfen, da hob er beide Hände wie in fassungslosem Erstaunen und rief:
»Hier hat wirklich ein Vulkanausbruch stattgefunden! Das ist Lava — die echteste, reinste Lava!«
Nun, Herr Baron, wie haben Sie geschlafen? Und wie vor allen Dingen hat Ihnen das Essen geschmeckt?« Mit diesen Fragen wurde Professor Edeling empfangen, als er zum zweiten Male aus seinem Schlafzimmer den daneben befindlichen Wohnraum betrat.
Wiederum lag Prinzess Turandot in demselben japanischen Kostüm auf dem Diwan, aber nicht mehr als Wachspuppe, sondern sie richtete sich sofort auf.
Der Professor, auch wieder in seinem brillanten Rittermantel, lachte vergnügt.
»Von meinem Schlafe weiß ich nichts, und das ist wohl das beste Zeugnis, das ich ihm ausstellen kann — und was meine Leistung im Essen anbetrifft, da schweige ich. — Darüber zu sprechen geniere ich mich, und hoffentlich bin ich dabei auch nicht beobachtet worden.«
»Nein, eine heimliche Beobachtung gibt es bei uns nicht, wenigstens nicht die eines Gastfreundes, da können Sie beruhigt sein. Aber etwas über Ihre Mahlzeit möchte ich doch noch erfahren. Wie hat Ihnen zum Beispiel der Hasenbraten geschmeckt?«
»Ach, geehrte Prinzess, fragen Sie mich lieber nicht, was ich von dem großen Rückenstück übrig gelassen habe!«
»Na, hoffentlich noch die Knochen?«
»Ja, da erinnern Sie mich, da muss ich Sie jetzt etwas fragen. Dass aus allen Fleischstücken wie auch aus dem Geflügel alle Knochen herausgeschält werden können, das vermag ich zu begreifen. Aber wie ist es möglich, aus einem ganzen Fische, einem Karpfen, sämtliche Gräten zu entfernen, auch die kleinste, und es ist nichts von einem Schnitt zu bemerken, der Fisch behält völlig seine Gestalt, das Fleisch hängt innig zusammen?«
Die Prinzess erhob sich.
»Herr Baron, ich bin beauftragt, Ihnen einige Erklärungen zu geben, sodass Sie nach und nach in unsere Lebensweise eingeführt werden, über die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, sodass wir so ganz und gar unabhängig von der anderen Menschheit leben können, auch in den unwirtlichsten Gegenden. Meine Erklärungen sollen aber nur ganz schlicht und daher nur experimentell sein, die wissenschaftlichen Erläuterungen, zu denen ich überhaupt gar nicht fähig bin, erhalten Sie später von anderer Seite. Monostatos!«
Durch die andere Portierentür trat ein Mann ein, ein Neger, ein Mohr von schokoladenbrauner Hautfarbe, das Haar ganz wollig wie bei einem Schafe, unförmlich dicke Bratwurstlippen. die tatsächlich von einem Ohre bis zum anderen reichten — und was für Ohren das waren, eine Nase, so plattgedrückt, dass ihre Länge gegen die Breite gar nicht in Betracht kam — — kurz und gut, ein Monstrum von afrikanischer Hässlichkeit!
Dazu überaus auffallend und bunt gekleidet. Blaue Pumphosen, reich mit Gold und Silber gestickt, gleich dem roten Jäckchen; mit bunten Blumen gemusterte Kniestrümpfe, rote Schnürstiefel mit weißen Bändern und Schleifchen; ein grellbuntes Halstuch von riesigen Dimensionen; der ganze Anzug mit goldenen und schillernden Knöpfen bedeckt, auch sonst gleißender Schmuck allüberall, die kulbigen Finger mit Ringen förmlich gepanzert, und zwar nur immer so groß und glitzernd wie möglich — — diese Beschreibung genügt wohl.

Also ein Kerl, der vor Eitelkeit bald platzte. Und so trug er auch die Schüssel herein, ein Waschbecken von Porzellan, mit unnachahmlicher Gravität. Aus jedem Schritt, aus jeder Bewegung, aus der Art, wie er den Kopf zurückgeworfen hatte, sprach der bornierteste Hochmut, der immer zu verstehen gab: Ich habe es gar nicht nötig, euch zu bedienen, das tue ich nur aus Herablassung, weil ich gerade nichts anderes zu tun habe, um mich nicht zu langweilen; Herrgott, wer bin ich, und was kann alles aus mir noch werden. Ich bin Ich, und alle ihr anderen seid gar nichts gegen mich!
So hatte er auch die mit Wasser gefüllte Schüssel auf den Tisch gesetzt, daneben ein Kästchen, das silberne Kapseln von Haselnussgröße enthielt.
Dann trat er zurück, um herablassend noch andere Wünsche zu erwarten, die er vielleicht zu erfüllen geneigt war, den Baron aus ganz zusammengekniffenen Augen wiederum mit unendlichem Hochmut musternd.
Jetzt imitierte auch die Prinzess in komischer Weise eine ungemeine Gravität, als sie mit einer vorstellenden Handbewegung sagte:
»Monostatos, mein Faktotum, ohne das ich keine Minute meines Lebens auskommen könnte. Ich habe die Ehre.«
Aber gut dressiert war dieser braune Diener doch. Nicht etwa, dass er nun eine entsprechende Verbeugung machte. Steif stand er da, nur seine unverschämten Augen von einem zum anderen rollen lassend. Und dann wurde sein breites Maul noch etwas breiter, die schneeweißen Zähne kamen zum Vorschein, das einzig Schöne an dem hässlichen Kerl.
Nun wusste der Baron, woran er war. Er selbst war ja gar nicht vorgestellt worden. Einfach eine dienende Person, so tief stehend, dass sie sonst als eine Null übersehen wurde.
»Monostatos?«, wiederholte der Baron grübelnd.
»Mir ist doch, als hätte ich diesen Namen schon gehört —«
»So heißt der Mohr in Mozarts ›Zauberflöte‹«, kam ihm die Prinzess schnell zu Hilfe, »Sie wissen doch, der das Liedchen singt —«
Und die sonst so tiefe, kräftige Altstimme der Prinzess begann in ganz reizendem Tone zu trällern:
Alles fühlt der Liebe Freuden,
Schnäbelt, tändelt, herzt und küsst;
Und ich soll die Liebe meiden,
>Weil ein Schwarzer hässlich ist!
Ist mir denn kein Herz gegeben?
Ich bin auch den Mädchen gut!
Immer ohne Weibchen leben,
Wäre wahrlich Höllenglut...
»Dieses Liedchen zu singen hat unser Monostatos hier natürlich nötig«, fuhr sie dann wieder sprechend fort. »Sie sehen ja selbst, was für ein bezaubernd schöner Adonis er ist. Er braucht nur seine Finger auszustrecken, und an jedem hängt ein holdes Mägdlein, manchmal auch eine Witib oder gar eine Frau, die um dieses Schokoladenonkels willen ihren treuen Gatten verlässt. Tatsache! Es ist unglaublich, was für Unheil dieser Mann schon unter Frauenherzen angerichtet hat. Aber natürlich — seine blendende Schönheit, seine bezaubernde Grazie, der Adel in jeder seiner Bewegungen! Außerdem habe ich auch die Ehre, Ihnen hiermit den heldenhaftesten Mann vorzustellen, der je auf Erden gewandelt ist.
Er geht jederzeit durch Feuer und Wasser, nicht nur für mich, seinen Herrn, sondern er sucht überhaupt aus Prinzip fortwährend Gefahren auf, um den Brand seines Heldenmutes zu löschen. Einen entsprungenen Löwen wieder einzufangen, ihn nur mit seinem Händen niederzuzwingen, ist ihm eine Kleinigkeit, aber am liebsten nimmt er es mit Gespenstern auf, um durch seine einfache natürliche Kraft höhere Gewalten zu besiegen. Das ist unser Monostatos. Geh, Du süßes Schokoladenscheusal!«
Der Mohr grinste mit unsäglicher Eitelkeit, dabei seinen Kopf in unnachahmlicher Weise in der Halskrause hin und her drehend, wandte sich und ging, sich dabei wie ein kokettes Frauenzimmer in den Hüften wiegend.
Aber vor der Portiere blickte er noch einmal zurück und hatte die Frechheit, der Prinzess ein zärtliches Kusshändchen zuzuwerfen.
Allerdings befand er sich in dem Glauben, dass es nicht gesehen würde. Die Prinzess wandte ihm den Rücken zu, der Baron hatte es nur beobachtet.
Prinzess Turandot trat, ohne dem Schwarzen noch Beachtung zu schenken, an den Tisch, nahm eine der silbernen Kapseln, die nur aus dünnem Stanniol bestand, das sie abwickelte, wobei sie erläuterte:
»Sie wissen, Herr Baron, auch wenn Sie kein zünftiger Chemiker sind, dass alle Nahrungsmittel, welche unseren Körper aufbauen, wie alle organischen Verbindungen aus den Elementen Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff bestehen. Beim Eiweiß kommt noch der Stickstoff hinzu. Dann noch eine Kleinigkeit Schwefel, Phosphor und anderes, Salze, die für die Ernährung des Körpers von größter Wichtigkeit sind.
Jene vier Hauptelemente sind in der Natur massenhaft vorhanden, im Wasser und in der Luft, Kohle gibt es ja auch genug.
Es ist schon längst das Problem der Chemiker, diese Nahrungsmittel auf synthetischem Wege herzustellen, das heißt durch direkte Verbindung der uns so freigebig gebotenen Elemente, durch einen chemischen Prozess.
Beim Fette ist diese synthetische Darstellung auch schon tatsächlich gelungen. Nur ist die Herstellung noch viel zu kompliziert, daher viel zu teuer.
Uns Skalden ist schon längst eine künstliche Darstellung sämtlicher Nahrungsmittel gelungen, des Fettes sowohl wie des Eiweißes, wie der Kohlehydrate, also von Stärkemehl und Zucker, direkt aus den Elementen des Wassers und der Luft, unter Zusatz von Kohlenstoff. Aber unsere Herstellungsweise ist keine synthetische zu nennen, obgleich wir auch die fertig bringen. Sie ist auch uns zu teuer, erfordert zu viel Mühe und Zeit.
Wir wenden ein anderes Verfahren an, das wir Nascendieren nennen. Sie wissen, das heißt ›Wachsen‹ oder wohl auch ›Geboren werden‹.«
Wir ahmen dabei auf künstliche Weise den Bildungsprozess der Hefe nach.
Die Hefe — gleichgültig welcher Art — besteht, wie Sie wissen, aus winzigen Pilzen. Unter geeigneten Verhältnissen der Atmosphäre und bei genügender Feuchtigkeit spalten sich diese kleinen Pilze fortwährend, jeder Teil ergänzt sich zu einem selbstständigen Pilz, der sich wiederum spaltet, und so geht das immer weiter. Die Hefe wächst, sagt man, unter Umständen so schnell, dass man es mit den bloßen Augen verfolgen kann.
Das ist, was wir Nascendieren nennen.
So. Hier sehen Sie eine schwarze Kugel. Die Stanniolumhüllung dient nur zur Sauberkeit, sonst hat sie keinen Zweck, die Haltbarkeit der schwarzen Masse ist unbegrenzt. Wir nennen solch eine Kugel ein Nascendum. Sie besteht aus chemisch reinem Kohlenstoff, ist aber aus gewöhnlicher Steinkohle hergestellt, beigemischt sind ihr noch einige Phosphor, Schwefel, Kalium- und Natriumsalze sowie einige andere Ingredienzen, jede nur in verschwindender Menge.
Diese sogenannte Nascendumkugel oder Nascendumpille liefert also für das herzustellende Nahrungsmittel den Kohlenstoff, zugleich die Salze und den charakteristischen Geschmack, und sie leitet das Nascendieren ein, ist der Kernpunkt, um den sich die entstehende Masse anhäuft.
Die anderen nötigen Elemente liefert Wasser und, wenn wie bei Eiweiß Stickstoff nötig ist, die atmosphärische Luft.
Diese Schale hier enthält ein Liter Wasser — chemisch reines, destilliertes Wasser, ohne jeden anderen Bestandteil. Das müssen Sie mir glauben, jetzt will ich Ihnen noch nichts vorgaukeln, jetzt bin ich wissenschaftlich, wenn auch ganz dilettantenhaft.
Ich werfe die Kugel in das Wasser, der Entwickelungsprozess beginnt —«
Die Kohle musste sehr porös sein, sie schwamm auf dem Wasser. Sofort bildete sich um sie herum eine erst weiße Masse, die sich schnell rosarot färbte, immer mehr an Röte zunahm, da aber ging die weiße Masse ringförmig schon weiter hinaus, immer wieder sich rot nachfärbend, das ganze Wasser schien sich in eine breiige Masse zu verwandeln, die ständig konstanter, dicker wurde, gleichzeitig schmolz die schwarze Kugel immer mehr zusammen, bis der letzte schwarze Punkt verschwunden war, und da befand sich in dem Becken nur noch eine rote Masse, so dick, dass man, wie wir gleich sagen wollen, wohl den Finger hineindrücken konnte, ihn aber nicht eigentlich hineinstecken. Dazu war die Masse schon zu widerstandsfähig. Der ganze Vorgang hatte kaum eine Minute gedauert.
»Diese rote Masse ist ihrer chemischen Zusammensetzung nach Fleisch. Muskelfleisch, und zwar bestes Mastochsenfleisch, nur dass die Adern und Sehnen darin fehlen, was aber doch wohl nur für die Güte spricht. Ebenso fehlen natürlich die Knochen. Dagegen ist die übliche Blutflüssigkeit beigemischt, der Rest des verwandelten Wassers, das nicht verbraucht wurde.
Diese Masse, eben ganz richtiges Fleisch, etwas mehr als ein Kilogramm, enthält 20 Prozent Eiweiß. Jede Spur von Fett ist dabei mit Absicht vermieden. Wir können aber auch solches hinzufügen, das steht in unserem Belieben; denn mit diesen Nascendumpillen können wir jedes Nahrungsmittel herstellen.
Wir haben viele Hunderte verschiedener Pillen.
Auf diese Weise stellen wir Fette her, und zwar Fette der denkbar verschiedensten Art, sowohl tierische wie pflanzliche, Talg, die feinste Butter, das beste Olivenöl, und zwar immer mit dem charakteristischen Geschmack und in der natürlichen Farbe.
Auf dieselbe Weise erzeugen wir Zucker.
Wir haben auch Pillen, die süße Mehlspeisen liefern, vom gröbsten Brot an bis zur raffiniertesten Torte.
Aber bleiben wir nur beim Fleisch.
Wir haben Nascendumpillen für Kalbfleisch, Schweinefleisch, Hammelfleisch.
Wir machen auf diesem nascendierenden Wege sowohl Rindszungen als Kalbsgehirne als Schweinsknochen, wobei dann der Kochkünstler der zuerst formlosen Masse nur das nötige Aussehen geben muss.
Wir fertigen aus den Pillen Karpfen, Forelle, Hecht, Barsch und Aal, künstliche Austern, die in natürliche Schalen gelegt werden; man kann sie nicht von echten unterscheiden.
Mit dreißig Prozent Eiweiß erzeugen wir eine schwarze Masse, die nur noch gekörnt zu werden braucht, und auch der größte Feinschmecker kann das Zeug nicht vom besten, schwachgesalzenen Astrachaner Kaviar unterscheiden.
So ist uns in dieser Hinsicht überhaupt alles, alles möglich. Weitere Experimente sind wohl nicht nötig.«
Der Baron hatte mit größtem Staunen die Herstellung des Fleisches beobachtet und nicht minder den erklärenden Worten gelauscht.
Da musste ihm wohl ein sehr naheliegender Gedanke auftauchen.
»Und diese Erfindung enthalten Sie der anderen Menschheit vor?«, rief er.
»Ja, wie alle unsere Erfindungen«
»Aber, mein Gott, Prinzess, das ist doch der höchste Egoismus — bedenken Sie, zu welchem Segen das für die ganze Menschheit werden könnte, wenn man alle Nahrungsmittel so einfach aus ihren Elementen direkt zusammensetzen kann, welchen edlen Beschäftigungen sich da alle Menschen, befreit vom Kampfe um das tägliche Brot, zuwenden würden —«
Ein einziger Blick genügte, den Sprecher verstummen zu lassen, es war ein allgemein spöttischer Blick, und so erklang dann auch die Stimme, etwas schneidend.
»Welchen edlen Beschäftigungen sich die Menschen dann zuwenden würden? Wissen Sie, was geschehen würde, wenn die Menschen nicht mehr im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot bauen müssten? Um die tödliche Langeweile zu bannen, würde überall Revolution und Anarchismus ausbrechen, Krieg, überall Krieg nur zum Zeitvertreib, die brutale Macht des Stärkeren würde mehr herrschen denn jetzt — Genug! Ich sehe Ihnen an, dass Sie mich sofort verstanden haben. Nein, wir behalten unsere Erfindungen für uns. Die Menschheit ist noch nicht reif dafür. Wird sie das, so wird sie dies alles schon selbst erfinden.«
Ja, der Professor hatte sofort verstanden.
Die Prinzess schob die Schüssel mit dem Kunstfleische beiseite.
»So, Herr Baron, nun komme ich zum zweiten Teile meines Experimentalvortrages.
Sie haben gesehen, wie ich mir an dem flammenähnlichen Steine meiner Haarnadel eine Zigarette anbrannte, machten dabei ein sehr erstauntes Gesicht.
Noch viel mehr war das der Fall, als ich dann die Ringe blies und sie erstarren ließ.
Zu letzterem Kunststückchen ließ ich mich hinreißen, obgleich es mir streng verboten war, weil ich Ihnen noch nichts erklären durfte und Sie sich nicht aufregen sollten — meine Haarnadel benutzte ich ganz gewohnheitsgemäß als Feuerzeug.
Jetzt erhalten Sie die Erklärung, und zwar erst die der Feuererscheinung. Also kurz und bündig: An diesen Ring hier ist ein Feuergeist gebunden, der mir dienstbar ist.«
Der Baron hatte bereits gemerkt, dass Turandot an einem Finger der linken Hand einen Ring trug, den sie jetzt abzog und ihm reichte.
»Finden Sie an diesem Ringe irgend etwas Besonderes?«
Es war ein breiter, ziemlich dicker Goldreif mit einem flachen weißen Steine, der einige erhabene rote Pünktchen zeigte.
»Nein, ich finde nichts Besonderes daran.«
»Geben Sie mir den Ring zurück. Nun müssen Sie meiner Versicherung glauben, dass ich ihn nicht etwa gegen einen anderen vertausche. Ich behaupte, dass Sie ihn jetzt nicht mehr von diesem Tische wegnehmen können.«
Sie hatte den Ring auf den Tisch gelegt, auf die schöngemusterte Tischdecke.
»Weshalb soll ich ihn nicht wegnehmen können?«
»Probieren Sie es doch! Halt!«, rief sie aber in dem Moment, als der Baron die Hand ausstreckte, sodass er etwas erschrocken zurückfuhr. »Ich will Ihnen nicht wehe tun. Ich zeige Ihnen auf andere Weise, weshalb Sie den Ring nicht wegnehmen können. Er würde Ihnen nämlich zu schwer sein, viel, viel zu schwer.«
Die Prinzess hatte von einem Nebentischchen, auf dem noch verschiedenes andere lag und stand, bereits einige Bogen Papier genommen, jetzt nahm sie den Ring, ließ ihn auf das Papier fallen. Sofort entstand ein Qualm und ein brenzliger Gesuch, im nächsten Augenblick fiel der Ring durch das erzeugte Brandloch, ward von der Prinzess unten geschickt wieder aufgefangen.
»Der Ring ist heiß!«, rief der Baron. »Glühendheiß!«
»Glühendheiß? Nehmen Sie ihn! Nehmen Sie ihn nur! Ich werde Sie doch nicht verbrennen wollen.«

Der Baron nahm ihn — der Ring war ganz kalt.
»Ja, wie ist das möglich?«
»Nun, was meinen Sie?«
»Das Papier ist präpariert. Vielleicht wirkt eine Säure —«
»Nein, das Papier ist nicht präpariert, es wirkt keine Säure, es ist ein Brandloch. Geben Sie mir den Ring. Überzeugen Sie sich jetzt, dass Sie ihn nicht vom Tische nehmen können, jetzt sind Sie ja gewarnt. Nähern Sie Ihre Hand nur vorsichtig.«
Sie hatte den Ring wieder auf die Tischdecke gelegt, der Baron näherte ihm vorsichtig die Hand, die Fingerspitze — da fühlte er die intensive Hitze, die von dem Ringe ausströmte.
»Ja, wie ist das nur möglich?«
»Einfach Hexerei!«, erklärte Prinzess Turandot lächelnd. »Es steckt eben ein Feuergeist drin, dem ich zu befehlen habe, der aber nicht immer so hitzig zu sein braucht. Ariel, verwandele Dich aus einem glühnden Feuersalamander wieder in einen kaltem Frosch.«
Mit diesen Worten nahm sie den Ring und gab ihn dem Baron. Der Ring, der soeben noch die intensive Hitze ausgestrahlt hatte, war wieder ganz kalt.
»Ich begreife nicht«, murmelte Edeling kopfschüttelnd, »ich spürte doch die außerordentliche Hitze — ja, und warum verbrennt er denn die Tischdecke nicht, die doch aus einem zarten Gewebe besteht?«
»Hierin dürfen Sie nichts Wunderbares finden. Sie besteht aus einem Stoffe, der noch unverbrennlicher ist als Asbest. Sie sehen, wie ich Ihnen immer gleich die Wahrheit sage. Aber — was haben Sie denn?«
Plötzlich schleuderte der Baron den Ring von sich, auf den Tisch, schlenkerte die Finger.
Der Ring hatte sich in seiner Hand erwärmt, nach und nach, aber doch sehr schnell, bis der Baron ihn wegen der Hitze eben nicht mehr hatte halten können.
»Ach, der Ring ist Ihnen wohl zu schwer geworden?«, lachte die Prinzess. »Sehen Sie, ich hatte meinem Ariel befohlen, diesmal nur im Stillen, seinen Feuercharakter Ihnen zu demonstrieren, aber langsam, dass er Ihnen nicht wehe tut, und er hat getreulich gehorcht. Doch nun Spaß und Feuergeist beiseite. Haben Sie hierfür eine Erklärung?«
»Nein, ich stehe vor einem Rätsel.«
»Und wenn ich diese Experimente einer Versammlung von Gelehrten vorführte, wissenschaftlichen Physikern?«
»Auch die wüssten sich die Sache nicht zu erklären.«
»Ich will Ihnen die Erklärung geben, Sie werden mir schon folgen können.
Wir unterscheiden gute Wärmeleiter und schlechte Wärmeleiter, wobei das Wort ›Wärme‹ aber ein relativer Begriff ist. Es könnte ebenso gut Kälteleiter heißen. Also Temperaturleiter. Doch bleiben wir nur bei der üblichen Bezeichnung.
Holz ist ein schlechter Wärmeleiter, deshalb kann man ein Streichholz halten, während es abbrennt.
Wenn man dagegen das Ende einer Nähnadel im Feuer glühend macht, so kann man sie nicht lange zwischen den Fingern halten, sie wird zu heiß, weil Eisen und Stahl gute Wärmeleiter sind.
Nun werden doch, wenn man emsig danach forscht, immer bessere und auch immer schlechtere Wärmeleiter entdeckt. Kennen Sie, Herr Baron, die sogenannten Thermophorgefäße, in denen man Flüssigkeiten sehr heiß oder sehr kalt einen Tag lang und noch länger aufbewahren kann, ohne dass sich ihre Temperatur viel ändert?«
»Jawohl, die kenne ich«, bestätigte der Professor.
»Wenn man sich nun ein Gefäß vorstellt, das aus dem denkbar schlechtesten Wärmeleiter besteht, müsste da der Theorie nach nicht eine kochend heiße Flüssigkeit auch ewig kochend bleiben?«
»Der Theorie nach, ja.«
»Nun, wir sind diesem Ideal auch in der Praxis schon ziemlich nahe gekommen.
Wir stellen eine Masse her, eine Metalllegierung, welche die Wärme so schlecht leitet, dass sie auch die größte Hitze so gut wie gar nicht annimmt. die also auch im Knallgasgebläse sich kaum erhitzen lässt. Übrigens ist auch der gewöhnliche Kork so ein außerordentlich schlechter Wärmeleiter, wobei man nur dadurch irritiert wird, weil der Kork selbst verbrennt, sonst aber kann man eine dünne Scheibe Kork anbrennen und ohne Weiteres in den Mund stecken, die Flamme verlischt sofort und man merkt gar nichts von Hitze. Aus diesem ideal schlechtleitenden Metalle besteht dieser Ring. Sein Inneres ist hohl und dieser Hohlraum ist mit feurig flüssigem Eisen — das allerdings noch einen besonderen Zusatz hat — gefüllt.
Die Umhüllung leitet so schlecht, dass ihre äußere Wand immer kalt ist, infolgedessen bleibt innen das Eisen auch immer feurig flüssig. Denn ob man kochendes Wasser oder geschmolzenes Eisen verwendet, das bleibt sich dabei doch ganz gleich. Wie aber kann der Ring plötzlich auch außen so heiß werden?
Da kommt freilich etwas ganz Besonderes in Betracht. Unsere Forscher haben entdeckt, dass die Temperatur auf besonderen Ätherschwingungen beruht, und der Unterschied zwischen Hitze und Kälte darauf, ob diese Ätherschwingungen positiver oder negativer Natur sind. Und wir haben gelernt, diese verschiedenen Strömungen nach Willkür zu regeln.
Sie sehen hier auf dem weißen Steine einige rote Knöpfchen. Sie lassen sich verschieben, wozu man allerdings den Kniff kennen muss.
So, wie die Knöpfchen jetzt stehen, ist der Ring, das heißt die äußere Umwandung, der denkbar schlechteste Wärmeleiter, daher ist er außen kalt.
Verschiebe ich diesen Knopf hier, so wird die negative Strömung in positive umgewandelt, dadurch wird der schlechte Wärmeleiter zum denkbar besten, im Nu hat sich die Hitze des innen befindlichen flüssigen Eisens der äußeren Umwandung mitgeteilt, der Ring ist plötzlich glühend heiß geworden.
Jetzt verschiebe ich mit dem Fingernagel dieses Knöpfchen hier. Dadurch tritt eine Spaltung der verschiedenen Strömungen ein. Die innere Wandung der Umhüllung bleibt positiv, die äußere wird negativ. Die Folge davon ist, dass die äußere Umhüllung ihre ganze Hitze im Nu an die umgebende Atmosphäre abgibt, sie sofort erkaltet. Verschiebe ich jetzt dieses Knöpfchen, so schlägt die negative Strömung der äußeren Umhüllung zurück und treibt auch die Hitze der inneren Wandung noch mehr nach innen, wobei sie gleichzeitig ebenfalls negativ wird, sodass sie gegen die Hitze des flüssigen Eisens nun ganz unempfänglich wird.
Das ist das ganze Geheimnis dieses Feuerringes.
Sie haben wohl bemerkt — oder jetzt werden Sie sich daran erinnern — dass ich Ihnen den Ring stets abnahm, ehe ich seine Temperatur wechseln ließ. Ich musste erst die Knöpfchen verschieben — nur da war das nicht nötig — als ich den Ring Ihnen das letzte Mal gab, als er sich nach und nach in Ihrer Hand erhitzte, da hatte ich schon zuvor hier dieses Knöpfchen verschoben, wodurch das Erhitzen respektive Erkalten eben langsam vor sich geht.
Auf ganz demselben Prinzip beruht natürlich das Geheimnis meiner Haarnadel; nur dass da wirklich eine Flamme zutage tritt, weil sie eben ein Feuerzeug ist.
Je öfter man von dieser Erhitzung oder Feuererscheinung Gebrauch macht, desto mehr nimmt natürlich die innere Hitzequelle an Stärke ab. Das lässt sich nicht vermeiden. Da muss eben ab und zu nachgefüllt werden, ein neuer feurigflüssiger Kern hineinkommen.
So, Herr Baron, das wäre der zweite Teil unseres Experimentalvortrages gewesen. Jetzt kommt der dritte Teil daran.
Den wollen wir aber lieber unter Gottes schöner Sonne vornehmen; denn sonst könnten Sie glauben, ich hätte hier Apparate.
Die burschikose Sprecherin brach ihre Erklärung ab.
Auch der Baron hatte den Ton gehört, der durch das Zimmer geklungen war, wie ein voller Harfenakkord.
»Das ist mein Bruder! Er ruft an. Bist Du's, Loke?«
»Ich bin's. Hurra, Schwesterchen, ich habe den Golem des Wunder-Rabbis!«
So erklang eine sonore Bruststimme, die der Baron schon einmal gehört hatte, damals aus seinem Tischtelefon, nur dass sie da nicht so gejubelt hatte — erklang, als ob sie aus allen Wänden des Zimmers gleichzeitig hervorkäme.
Und so sprach Prinzess Turandot zurück, irgendwohin.
»Ich gratuliere. Ist alles gekommen, wie Du annahmst?«
»Alles, alles! Rechtsanwalt Iron ist bei mir und ich selbst bin bereits unterwegs, zu dem alten Czernebog.«
»Ach, der!«, rief die Prinzess belustigt. »Ich möchte dabei sein, wenn Du den überlistest!«
»Kannst Du leider nicht, Schwesterchen. Was macht mein Magelon, mein edler Troubadour?«
Das war also der Name des Sängers gewesen, den Bertran de Born ausgeschickt hatte, um mit einem Liede seine Geliebte dem königlichen Vater und dem herzoglichen Bräutigam zu entführen.
»Dem Baron geht's ganz ausgezeichnet, er hat zum zweiten Male ganz wunderbar geschlafen und zum ersten Male noch wunderbarer gegessen. Er ist jetzt hier bei mir, hört unser Gespräch mit an.«
»Na, das freut mich!
Aber, Turandot — fast scheint es, als ob mich meine Schicksalsberechnung einmal belogen hat, als ob der für mich gar keine riesenhafte Helepolis zu bauen brauchte, um mit ihr Thule zu bezwingen.«
»Ja, weshalb denn nur?«
»Denke Dir, Schwesterchen — die Königin Chlorinde hat mich zum Zweikampf auf Leben und Tod herausgefordert.«
»Was sagst Du da?«
Die Prinzess hatte es ziemlich ruhig gesagt, sogar mit etwas leiserer Stimme, aber gerade deshalb war dem Baron aufgefallen, wie furchtbar erschrocken sie dabei zusammengefahren war.
»Wie ich sagte. Sie hat mir eine Herausforderung zum persönlichen Zweikampf zugeschickt.«
»Ja, weshalb denn nur?«
»Weil sie des Belagerungskampfes endlich überdrüssig ist, weil sie während dieser zwei Jahre das gar nicht so komfortabel ausgestattete Thule nicht verlassen konnte und auch nicht eher verlassen kann, als bis die Festung entweder eingenommen oder die Belagerung als hoffnungslos aufgegeben worden ist, woran aber bei mir doch nicht zu denken ist.
Sie hat geschworen, die Festung nicht eher mit nur einem Schritte zu verlassen, als bis dieser Kampf entschieden ist, und diesen Schwur muss sie nun halten.
Ja, und nun hat die Königin von Thule kein anderes Mittel gewusst, ihre Freiheit wieder zu gewinnen, als dass sie mich zum Zweikampf auf Leben und Tod herausgefordert hat. Einer von uns beiden muss dran glauben.«
»Du hast die Herausforderung doch nicht etwa angenommen?«
»Na, Turandot, ich kann doch nicht eine entschuldigende Absage schreiben und ins Mauseloch kriechen?«
»Sieh Dich vor, Loke!«
»Da gibt's gar nichts, sich vorzusehen. Da heißt es immer nur recht fix und kräftig zuhauen. Wer am fixesten ist und am kräftigsten zuhaut, der darf hoffen, mit dem Leben davonzukommen.«
»Loke, diese Chlorinde ist die einzige, die sich mit Dir messen kann, und wenn Ihr gar auf Zweihänder fechten wollt, da ist Dir dieses furchtbare Weib sogar weit über —«
»Ja, allerdings, Schwesterchen — ich hatte als Geforderter die Waffen zu bestimmen, und ich habe das große zweihändige Schwert gewählt —«
»Du bist des Teufels, Loke!«, erklang es jetzt wirklich in grenzenlosem Schreck.
»Nein, nein, sei nur ganz ohne Sorge, Schwesterchen«, fuhr die so zärtlich sprechende Stimme fort. »Ich habe keine Lust, mich von diesem Höllenweibe zusammenhauen zu lassen, und weiß schon, wie ich mich auch diesmal aus der Schlinge ziehe.
Ja, ich habe als Waffe das schwere zweihändige Schwert bestimmt. Ich konnte doch nicht eine Waffe wählen, in der ich der Gegnerin weit überlegen bin. Aber ich durfte auch die Panzerung bestimmen, und zum Zweihänder gehört natürlich die schwerste Rüstung.
Es ist auch mit dem Zweihänder nicht so leicht, so einen starken Panzer zu durchschlagen, einem da eine tödliche Wunde beizubringen, etwa einem gleich den Kopf abzuhacken. Also bleibt nichts weiter als das Miserikordia übrig, um den Kampf endgültig zu entscheiden, und darauf lässt sich die Königin natürlich nicht ein.«
Das Miserikordia, Barmherzigkeit, hieß bei den Rittern des 13. und 14. Jahrhunderts, besonders bei den italienischen, der an der rechten Seite getragene lange, dreikantige, also stilettartige Dolch, mit dem beim Zweikampf auf Leben und Tod dem verwundeten, kampfunfähig gemachten Gegner vom Sieger der Gnadenstoß gegeben wurde, und zwar meist in die Kehle, nach Entfernung der Brünne, des Halsschutzes; die Schlagader wurde durchstochen.
Das nannte man: Das Miserikordia geben, und die dazu bestimmte Waffe selbst, mit der nichts anderes getan werden durfte, hieß selbst so.
»Weshalb soll sie sich nicht auf das Miserikordia einlassen?«, fragte die Schwester nach wie vor in höchster Unruhe.
»Na, Du weißt doch, Schwesterchen, wie ich mich mit der Chlorinde stehe.«
»Ich weiß nur, dass Dich die Königin von Thule glühend hasst.«
»Ja, eben als Königin von Thule, die ihr Reich und jetzt ihre Stadt gegen mich zu verteidigen hat. Aber als Weib denkt sie anders, das weißt Du doch am besten, Schwesterchen.
Ja, sie könnte mir im Kampfe den Kopf abschlagen, ihn mir mit der Streitaxt spalten, ihn mir mit dem Streitkolben zerschmettern, mit dem Schwerte im Kunstfechten mein Herz durchbohren, das brächte sie fertig, da würde sie alle Kraft und Kunst aufbieten — — aber mir, wenn ich hilflos am Boden liege, die Brünne lösen und mir kaltblütig die Gurgel abschneiden, das bringt sie nicht fertig!«
»Na«, erklang es zweifelnd, »dieses furchtbare Teufelsweib ist zu allem fähig!«
»Nein, Schwesterchen, ermorden wird sie mich nicht. Das bringt sie nicht fertig, und da sie das selbst weiß, aber bei einem Zweikampf auf Tod und Leben auf das Miserikordia unbedingt eingehen müsste, hat sie sich auch gleich auszureden versucht. Sie habe nicht einen Zweikampf auf Tod und Leben gemeint, sondern nur eine völlige Besiegung des Gegners.
Aber sie hatte mir eine Herausforderung schriftlich zugeschickt, und darin stand ›auf Tod und Leben‹, und darauf bestehe ich nun auch.
Wenn sie aber nun immer noch Ausflüchte sucht, dann bestehe ich darauf, dass die Belagerung von Thule noch so lange weiter geht, bis die neue Wurfmaschine fertig ist, und bleibt also doch alles beim Alten. Die Schicksalsprophezeiung wird sich demnach doch noch erfüllen, ich habe mich nicht verrechnet.
Und nun das Neueste, Schwesterchen: Der bunte Maulwurf hat sich bei mir im Mammutpark eingegraben!«
»Ach was!«, rief die Prinzess in höchster Überraschung. »Der bunte Maulwurf!«
»Ja, er hat dort wieder eine seiner Menschenfallen aufgebaut, will mir einige meiner Krähenindianer wegfangen. Ich war in Sydney, als ich es erfuhr, bereitete mich gerade zu der Besprechung mit Rechtsanwalt Iron vor, und mein Kopf war während dieser Besprechung noch so damit erfüllt, dass es mir passierte, dass ich den Rechtsanwalt, als er mir im Spiegel ein Zukunftsbild seiner Tochter zeigen sollte, ein falsches Bild sehen ließ. Er sah zuerst Krähenindianer, die in Rentierschlitten von der Bärenjagd zurückkehrten.
Dann freilich kamen Miss Evelyn und der alte Czernebog.
Ich staunte nicht schlecht, als zuerst plötzlich in einem verschneiten Walde Krähenindianer mit Rentierschlitten erschienen. So war mein Kopf noch mit dem buntem Maulwurf erfüllt, dass mir so etwas auch einmal passieren konnte. Na, den will ich ja bald wieder ausgegraben haben.«
»Ach, da möchte ich dabei sein!«
»Vielleicht ist es möglich, sonst schicke ich Dir sofort die fotografische Aufnahme von der ganzen Sache. Hast Du mir etwas mitzuteilen?«
»Ich wüsste nichts von Bedeutung.«
»Dann vorläufig Schluss. Ich habe noch viel vor. Grüße den Baron von mir, bis wir uns persönlich sehen.«
Wieder erklang durch das Zimmer ein Harfenakkord.
Also die Prinzess hatte immer nach einer beliebigen Richtung gesprochen; meist aber hatte ihr Blick auf einem der vielen Bilder geruht, welche die Wände des Zimmers schmückten.
Jetzt trat sie vor dieses Bild hin.
Es war fast einen Meter hoch und nur wenig schmaler, auch wieder in so leuchtenden Farben ausgeführt, dass man gleich an Glasmalerei denken musste, stellte ein Weib in schwarzer und doch prächtiger Rüstung dar, eine Jungfrau von Orléans, nur nicht so zart, nicht so madonnenhaft, wie diese doch gewöhnlich dargestellt wird, sondern ganz das Gegenteil, ein großes, starkes, junonisch gebautes Weib, wie sich auch noch unter der schweren Panzerung erkennen ließ, und die schwarzen Locken, die unter dem goldenen Helm mit phantastischem Drachenschmuck hervorquollen, rahmten einen Frauenkopf von dämonischer Schönheit ein.
So stand sie zwanglos da, sich mit beiden Händen auf ein gewaltiges Schwert stützend, das wohl auch mit zwei Händen geführt werden konnte. Im Hintergrunde sah man eine mittelalterliche Stadt oder Festung mit Türmen und Zinnen.
»Das ist sie, von der Sie uns soeben sprechen hörten«, flüsterte die Prinzess, die Worte an den Baron richtend, aber doch noch ganz in Gedanken versunken.
»Also die Königin von Thule!«, entgegnete der Baron. »Das habe ich mir gleich gedacht, als ich jetzt etwas mehr von ihr hörte, zumal Sie immer nach diesem Bilde blickten. In der Tat, die sieht ganz gefährlich aus.«
»Chlorinde heißt sie. Ist Ihnen dieser Name nicht aus einer berühmten Dichtung bekannt? Taucht Ihnen da nicht gleich die Erinnerung an eine poetisch verklärte Kriegsgöttin auf?«
»In der Tat, ich musste sofort an Tassos ›Befreites Jerusalem‹ denken, wie da die furchtbare Chlorinde geschildert wird, mit der sich alle die Helden vergeblich zu messen suchen.«
»So ist es, das ist sie —«
Und die Altstimme der Prinzess begann zu deklamieren, aus Torquato Tassos »Befreites Jerusalem«, jene Stelle, da die Chlorinde zuerst eingeführt wird:
Seit ihrer frühesten Jugendzeit verschmähte
Sie schon der Weiber Sitt' und Lebensart.
Arachnes Arbeit, Nadel, Spinngeräte
Ward nimmer mit der stolzen Hand gepaart.
Sie floh die Tracht und Weichlichkeit der Städte,
Denn Ehr und Zucht wird auch im Feld bewahrt.
Stolz waffnet ihr Gesicht, ihr Wohlgefallen
War strenger Ernst — doch ernst gefiel sie allen.
Als Kind schon lenkte sie mit kleiner Rechten
Das mutige Ross, hielt's auf und trieb es an.
Bald lernte sie mit Schwert und Lanze fechten
Und übt' und stärkte sich auf freiem Plan.
Dann folgte sie, auf Höhn, in Waldesnächten,
Dem Leu und Bären nach auf rauer Bahn.
Sie schien, im Forst und auf dem Schlachtgefilde
Ein reißend Tier dem Mann, ein Mann dem Wilde.
»Das ist die Königin von Thule«, fuhr die Prinzess im gewöhnlichen Tone fort. »Sie werden sie schon kennen lernen, und wozu sie hier auf dem Bilde steht, das können Sie sich dann einmal vormachen lassen, ich mag es gar nicht sehen. Aber etwas anderes will ich Ihnen vorführen. Es ist ein merkwürdiger Zufall, dass wir hier auch gleich Chlorindes Partnerin haben. Es wäre kein Zufall, wenn wir selbst dieser den Namen gegeben hätten. Aber der stammt von ganz anderer Seite, wo man vielleicht nicht einmal etwas von Torquato Tasso wusste.
Also Chlorinde ist im ›Befreiten Jerusalem‹ die furchtbarste Gegnerin des Christenheeres, die personifizierte Kriegsgöttin der Sarazenen. Wie heißt nun die zweite weibliche Hauptfigur in diesem Epos, welche die Christen nicht minder zu fürchten haben, wenn auch aus einem ganz anderen Grunde?«
»Armida!«, konnte der Professor der Literaturgeschichte sofort angeben, wenn er auch das ganze Epos nicht im Kopfe hatte.
»Ja, Armida, die blondgelockte Sarazenin, vom mächt'gen Zaubergreise Hydraot von Kindheit an in seine Künste eingeweiht, durch welche sie nun die christlichen Helden betören soll, dass sie Schwächlinge und Feiglinge werden. Hier ist unsere Armida.«
Die Prinzess war vor ein anderes Bild getreten, ebenso groß wie jenes, wiederum ein Weib darstellend, aber ein ganz anderes.
Es war ein junges Mädchen, nur in weiße Gazeschleier gehüllt, durch die man den zarten, herrlichen Körperbau in seinen Umrissen eben erkennen konnte, also durchaus dezent und keusch, gerade dadurch aber nur umso reizvoller wirkend, und nun dazu ein Mädchenkopf von entzückendem Liebreiz, umrahmt von goldblonden Locken, das schelmische Lächeln von unsagbarer Anmut.
Die Prinzess schien den ganzen Tasso im Kopfe zu haben, dass sie auch diese ziemlich lange Stelle zitieren konnte, wie diese sarazenische Hexe eingeführt wird, auf dem Wege ins Christenlager, wie alles schon allein von dieser holdseligen Schönheit bezaubert wird.
»Das ist unsere Armida; aber keine Hexe, sie versteht nichts von Zauberkünsten. Und doch — sie ist eine Zauberin — durch ihre Schönheit und Anmut, schließlich nicht minder durch ihre Kunst. Ich will Ihnen näheren Aufschluss über sie geben, über unser aller Liebling, über den vor allen Dingen mein Bruder alle Hände hält: Sie ist eine Deutsche, stammt aus Thüringen, die Tochter eines Bauern, eines Tagelöhners.
Da kam einmal fahrendes Volk, eine Künstlerbande, die kaufte den Eltern das etwa vierjährige Mädchen ab, um es für ihre Artistenzwecke zu erziehen. Dann fand das zarte und doch so kräftige Kind wieder einen anderen, kapitalkräftigeren Liebhaber, aber auch so ein Artist, ein Impresario, der aus dem Kinde einmal etwas ganz Besonderes machen wollte.
Die kleine Christine wurde zur speziellen Tänzerin ausgebildet, zur spanischen Tänzerin, und dazu musste sie auch einen entsprechenden Namen bekommen, sie wurde in Armida umgetauft, sollte mit schwarzgefärbten Haaren auftreten.
Ehe es aber so weit war, sah mein Bruder das damals vierzehnjährige Mädchen und kaufte es ihrem Besitzer ab, hat übrigens auch die Eltern noch reichlich entschädigt.
Nun hat mein Bruder die kleine Tänzerin noch weiter ausgebildet oder ausbilden lassen, bis zu ihrer jetzigen Vollendung, wie ich Ihnen gleich zeigen werde. Der Name Armida ist ihr geblieben, eben weil Tassos Beschreibung so wunderbar auf sie zutrifft, als Gegenstück zur Chlorinde, und deshalb dürfen ihre Haare natürlich nicht schwarz gefärbt werden.
Es sind so bewegliche Bilder, alle die Sie hier sehen, und wie sie lebendig gemacht werden, dazu bedürfen Sie gar keiner weiteren Erklärung, das macht man einfach so —«
Die sämtlichen Bilder, ob groß oder klein, waren schwarz eingerahmt, aber nun erst bemerkte der Baron, dass sich an jedem der schwarzen Rahmen auf der rechten Seite ein goldener Riegel in einer Spalte befand.
»Soll das Bild die ganze Szene von Anfang an geben, so muss der Riegel ganz oben eingestellt sein. Sobald Sie ihn etwas nach links rücken, dann fängt die Sache eben an, der Riegel schiebt sich langsam nach unten.
Drücken Sie ihn wieder nach rechts, dann bleibt das Bild wieder stehen. Hat der Riegel unten das Ende erreicht, so muss man ihn wieder nach oben schieben, mit beliebiger Schnelligkeit, dann schnarrt das ganze Bild nach rückwärts ab, man sieht nur die bunten Farben durcheinanderlaufen.
Auch nach unten kann der Riegel so schnell geschoben werden, falls man, ohne erst lange warten zu wollen, gleich eine bestimmte Szene erblicken will.«
So hatte die Prinzess doch noch erklärt, ehe sie den oben eingestellten Riegel etwas nach links drückte.
Sofort bekam das Bild Leben, die Mädchengestalt führte mit entzückender Anmut einen wogenden Schleiertanz auf.
Am meisten im Augenblick jedoch staunte der Baron die Vollkommenheit dieses künstlichen Lebens an.
»Ja, was für eine eigentümliche Kinematografie ist denn das?«
»Wie wir unsere kinematografischen Aufnahmen machen und auf eine glasähnliche Masse übertragen, wie unsere Künstler die Bilder kolorieren, worauf die ganze Lebendigkeit beruht, das müssen Sie sich von anderer, von berufener Seite erklären lassen, ich selbst kann das nicht. Doch ich wollte Ihnen etwas anderes zeigen.
Alle Bilder, die Sie hier sehen, können lebendig gemacht werden. Wir haben schon hier in unserem — halt, jetzt hätte ich mich beinahe verplappert! — schon hier, wo Sie sich gegenwärtig befinden, gibt es Hunderte von solchen Bildern, die Sie später allein lebendig bewundern können — vorausgesetzt, dass Sie in den nächsten Monaten so viel Zeit dazu haben — dann haben wir aber auch anderswo ein ganzes Museum, welches sogar viele Tausende solcher beweglichen Bilder enthält. Sie werden alles zu sehen bekommen.
Ach, was wir alles aufgenommen haben! Es ist eine Spezialität meines Bruders, der liebt so etwas zu arrangieren.
Das ist es gewesen, was ich Ihnen wegen dieser Bilder nur noch hatte sagen wollen.
Und nun wollen wir uns hinauf begeben in den Garten, damit Sie endlich erfahren können, wo eigentlich Sie sich befinden und wie es uns Skalden möglich ist, unser Wesen so ganz unbemerkt treiben zu können, wozu ich Ihnen aber als einleitende Erklärung erst eine Gauklervorstellung geben muss, und ich wiederhole, dass es Ihnen niemand verübeln wird, wenn Sie da wirklich an Zauberei glauben und mich als eine Gottheit anbeten.«
Jawohl, Papa, ich komme sofort, sobald das Automobil da ist. Schluss.« Miss Evelyn Iron trat von dem Telefon zurück, um sich schnell fertig zu machen, wozu sie aber nur einen Mantel anzuziehen brauchte.
Es war ein kräftiges, frisches, heiteres Mädchen von zwanzig Jahren. Ob schön oder hässlich — was hat's zu sagen.
Sie führte das Leben der Tochter eines reichen Mannes in geachteter Stellung
Sie hatte in Schule und Pension alles gelernt, was eine Dame wissen und können muss, vor allen Dingen Selbstständigkeit und viel Sport.
Auf die früh verstorbene Mutter konnte sie sich kaum besinnen, und sonst war ihr der Tod eines treuen Hundes, mit dem sie aufgewachsen, am nächsten getreten.
Das sagt ebenfalls genug, nämlich wie es mit ihrem Herzen beschaffen war — unberührt von allen Sorgen und Leiden des Lebens — wozu freilich gehörte, dass sie sich nicht selbst mit Sorgen und Hirngespinsten quälte — — —
In dem Arbeitszimmer des Rechtsanwaltes waren gerade ein Diener und eine Zofe mit einer Arbeit beschäftigt gewesen, sie hatten das Telefongespräch zwischen Vater und Tochter mit angehört.
Also nur den Mantel angezogen, und Evelyn war fertig.
Da fuhr auch schon ein Automobil vor und hielt vor dem Hause, Evelyn sah es durchs Fenster, und ehe es gemeldet wurde, ehe einer der Dienerschaft es so recht zu Gesicht bekam, war sie schon unten.
Ein sehr elegantes, grün angestrichenes Automobil. Der Chauffeur war abgesprungen und riss den Schlag des geschlossenen Wagens auf.
»Von wem ist denn das Auto?«
»Von der grünen Gesellschaft.«
Aha, die neugegründete Automobil-Gesellschaft, die grüne! Gesehen hatte Evelyn noch keins. Sydney ist groß.
»Wissen Sie, wohin Sie mich fahren sollen?«
»Allan Hamstead, Broaching Street 78.«
»Richtig.«
Eingestiegen; der Schlag fiel zu, die Hupe ertönte; fort ging es.

Evelyn schmiegte sich in die weichen Polster.
Doch gleich ward sie etwas unruhig.
»Merkwürdig, mir wird plötzlich so — — —«
Es war das Letzte gewesen, was sie hatte denken können.
Plötzlich verlor sie das Bewusstsein.
Als sie wieder zu sich kam, konnte sie sich sofort auf alles besinnen, sah sich nun aber nicht mehr in dem geschlossenen Automobil, sondern lag im prächtigen Bett eines hocheleganten Schlafzimmers.
»Ich bin betäubt und entführt worden!«
Sie war doch in der Großstadt aufgewachsen, las außer Romanen auch Zeitungen; gerade in letzter Zeit waren in Sydney mehrere Fälle vorgekommen, dass junge Mädchen verschleppt worden waren, und zwar, wie sich bald herausstellte, immer in indischmohammedanische Harems.
In Sydney ist ja das indische wie auch das chinesische Element sehr stark vertreten.
Nun hatte auch die ganze Ausstattung dieses Zimmers, trotz der meist europäischen Möbel, einen stark indischchinesischen Charakter; viele solche Kissen mit fremden Stickereien und Buchstaben und Nippsachen und dergleichen waren vorhanden, und was Evelyn dann gleich noch erlebte, sollte sie nur noch in ihrer Meinung bestärken, dass sie sich in solch einem indischen oder chinesischen Hause befand, also für einen Harem bestimmt war.
Kein Fenster war zu sehen, nicht einmal eine Tür, keine Portiere, hinter der man eine solche vermuten konnte, dafür aber neben dem Bett an der Wand ein Klingelknopf, auf den sie sofort drückte, um nur erst Gewissheit zu erhalten, mochte diese auch noch so schrecklich sein.
Richtig! Hinter dem chinesischen Wandschirm, der also doch vielleicht eine Tür verdeckte, trat sehr bald eine alte, sehr bunt gekleidete Frau hervor, offenbar eine Inderin.
Wenn nun auch in Sydney wie in allen australischen Hafenstädten farbige und besonders indische Dienstboten sehr häufig sind — der Rechtsanwalt hatte selbst zwei im Hause — so gingen sie doch niemals so bunt und so orientalisch gekleidet; das war nicht Sitte, das kannte man gar nicht — da dies aber hier der Fall war — eine alte Frau in gelben Pumphosen, über denen das blaue Röckchen nur bis an die Knie ging, rote Schnabelschuhe und was sonst zu so einem orientalischen Kostüm gehörte — musste also Evelyns schrecklicher Verdacht gleich bestätigt werden.
»Wo bin ich hier?!«
»Beim Meister Czernebog«, grinste die Alte vergnügt, dabei aber gleich einen Knicks machend.
»Meister Czernebog? Wer ist denn das?!«
»Meister Czernebog ist der größte Zauberer, der je auf Erden gelebt hat. Alle Geister gehorchen ihm.«
So grinste wiederum die alte Inderin, dabei aber ein ganz vortreffliches Englisch in wohlgesetzten Worten gebrauchend.
Was Evelyn nun da zu hören bekam, das musste für sie doch eigentlich vollkommen dunkel und rätselhaft sein — und doch, in diesem Augenblick wich der bange Schreck von ihr, erleichtert atmete sie auf, denn plötzlich glaubte sie ganz bestimmt zu wissen, wo sie sich befand und was dies alles zu bedeuten habe.
In der Gartenvilla des Mister Hamstead! Man trieb einen Maskenscherz mit ihr, ihr Vater selbst war unter denen, die sie heimlich beobachteten!
Mr. Allan Hamstead war ein sehr reicher Mann, der sich von den Geschäften zurückgezogen hatte, eine große Familie mit schon erwachsenen Kindern besaß, aber noch immer ein Sonderling war, der sich in allerhand Mätzchen gefiel.
Er machte gern Streiche, veralberte die Menschen, allerdings in ganz anderer Weise als etwa jener Griffin, der in der Kirche zwei alte Damen vor sich zusammennähte und in einer feierlichen Versammlung eine Rakete losließ.
Soweit trieb der alte Papa Hamstead es nicht, er war viel harmloser.
Da kam zum Beispiel, wenn er Gesellschaft hatte, auf den Tisch eine große Melone; obendrauf lag als Schmuck ein Blumenstrauß.
Nun forderte Mr. Hamstead seine Nachbarin auf, diesen Strauß zu nehmen, und wenn sie es tat, dann fuhr die vermeintliche Melone als Luftballon gegen die Decke.
Das war so etwas für den alten Herrn, da wollte er sich krank lachen.
Außer seiner Stadtwohnung hatte er in der Umgebung noch eine Gartenvilla, sein Tuskulum. Wenn es ihm einmal in seiner sehr großen Wohnung zu viel wurde, wenn die übermütigen Töchter und Enkel ihm gar zu sehr mitspielten, dann zog er sich für einige Tage dorthin zurück, um ganz allein zu sein, nur mit einigem Dienstpersonal.
In dieser Gartenvilla aber trieb er erst recht seine Späße, so etwa, dass er seinen Garten wunderlich dekorierte, an einen fremdländischen Baum lauter saure Gurken band, und wenn nun aus der Stadt die Ausflügler kamen und am Zaune stehen blieben, dann erzählte er ihnen von dem neuesten Wunder der amerikanischen Gartenbaukunst, vom Gurkenbaum, dessen Früchte genau wie saure Gurken schmeckten, und nachdem er das nun alles ganz ausführlich erzählt hatte, pflückte er die Essiggurken ab und schenkte jedem eine, und wenn das als Wahrheit aufgefasst wurde, wenn es gar als Tatsache in die Zeitungen kam, dann hatte er erst recht sein Ziel erreicht und wollte sich totlachen.
Und nun weiter: Es war doch gar nicht so lange her, da waren Rechtsanwalt Iron und Tochter bei der ihnen engbefreundeten Familie Hamstead zu Gaste gewesen. Der Hausherr war eben erst von einer Reise nach Melbourne zurückgekehrt und erzählte seine wunderbaren Erlebnisse, von denen man freilich kaum den vierten Teil glauben durfte; denn wenn der alte Herr erst einmal aufzuschneiden begann, dann flunkerte er das Blaue vom Himmel herunter.
Also, da wollte er auch in einer Gesellschaft gewesen sein, in der sich einer der Gäste als Zauberkünstler produziert hatte, als ein Zauberkünstler und Hexenmeister, wie es noch niemals einen gegeben hatte, dem einfach gar nichts unmöglich war.
Da war ein gebratenes Huhn auf den Tisch gekommen; der Herr hatte nur einmal schnell eine Schüssel darüber gedeckt, und da war das Brathuhn lebendig gewesen, und dann war ihm der volle Federschmuck gewachsen, und nicht nur das, sondern dann hatte das Huhn auch wie ein Papagei sprechen können, aber nun wie, hatte regelrecht Rede und Antwort gestanden — und so hatte Papa Hamstead immer weiter erzählt und war immer mehr ins Lügen hineingekommen.
»Ihr glaubt's nicht? Es ist so wahr wie ich hier sitze! Der Herr will nächstens nach Sydney kommen, da lade ich ihn ein, da muss er uns eine Vorstellung geben, und wenn's auch tausend Pfund kostet!«
Das war es, woran Evelyn jetzt im Moment dachte, und da also glaubte sie ganz bestimmt zu wissen, wo sie sich befand und was man mit ihr vorhatte.
Jener Taschenspieler, der ja vielleicht wirklich Verblüffendes leisten konnte, war nach Sydney gekommen, Papa Hamstead hatte ihn wirklich engagiert.
Ihr Vater war, von seiner Reise zurückgekehrt, noch einmal bei Hamstead gewesen oder die beiden Herren hatten sich sonst wo getroffen — »So und so, der Herr ist gekommen, ist bei mir, rufe doch einmal schnell deine Tochter.«
Es war zwar schon spät abends, in der zehnten Stunde, aber auch Rechtsanwalt Iron machte gern die Nacht zum Tage, er saß oft genug bis zum frühen Morgen am Schreibtisch, na, und wenn einmal etwas los war, dann musste auch Evelyn mitmachen.
Also Mr. Iron hatte die Tochter telefonisch in das Haus Hamsteads gerufen.
Nun aber hatte man dort unterdessen schon einen anderen Plan ausgeheckt. Oder das war schon früher geschehen.
Die ahnungslose Evelyn sollte nach der Gartenvilla gebracht werden, dort fand die Zaubervorstellung statt, scheinbar nur für sie selbst, sie wurde von den anderen dabei nur heimlich beobachtet.
So also hatte sich Evelyn die ganze Sache sofort zurechtgelegt.
Ein gütiges Geschick wollte, dass sie dies alles so glaubte und hierin immer mehr bestärkt wurde.
Und als sie die Wahrheit endlich doch erfuhr, da hatte sie sich an die fremden, wunderlichen Verhältnisse schon so gewöhnt, dass ihr kein neuer Schreck mehr durch die Glieder rieselte.
Als recht merkwürdig empfand sie höchstens, dass man sie betäubt hatte.
Aber wenn Mr. Hamstead oder sonst jemand ein Mittel wusste, das schnell wirkte und doch so harmlos war wie das bei ihr angewandte, na, dann hatte es ja nichts weiter zu sagen.
Denn Evelyn hatte einen ganz klaren Kopf, merkte nicht das Geringste von üblen Folgen, fühlte sich sogar wie neugeboren, als wäre sie aus einem langen, tiefen, gesunden Schlafe erwacht.
»So, also beim Meister Czernebog befinde ich mich.«
»Beim Meister Czernebog«, bestätigte knicksend die Alte.
»Wo denn da? Wo residiert denn dieser mächtige Zauberkünstler?«
»Weiß nicht, Missus«, erwiderte die Alte.
Das müssen Sie doch wissen«, meinte das Mädchen, nur um etwas zu scherzen.
»Meister Czernebog ist überall und nirgends.«
»Bin ich vielleicht auf dem Monde?«
»Ja, Missus, auf dem Monde«, bestätigte die Alte grinsend.
»Ich bin betäubt worden?«, fragte Evelyn, um jetzt doch Tatsachen zu erfahren.
»Weiß nicht, Missus«, erklang es abwehrend.
»Wie lange habe ich denn geschlafen oder ohnmächtig gelegen?«
»Weiß nicht, Missus.«
»Was soll ich nun tun?«
»Aufstehen, Missus, wenn es Ihnen angenehm ist. Meister Czernebog wartet schon lange.«
»Gut, ich werde aufstehen. Wo sind denn meine Kleider?«
»Dort liegt alles. Soll ich Missus behilflich sein?«
»Nein, danke, ich werde schon allein fertig Sie können sich entfernen.«
Die Alte verschwand hinter dem Wandschirm, Evelyn erhob sich.
Dass man sie sogar ausgekleidet und zu Bett gebracht, das hatte für sie nichts zu sagen. Das hatten natürlich diskrete Frauenhände besorgt.
Der alte Hamstead, so ein Ausbund er sonst auch sein mochte, war ein Ehrenmann — überhaupt, die Tochter seines besten Freundes! — und doch auch ihr Vater war hier, die ganze Familie Hamstead, um sie heimlich zu beobachten, um sich an ihrem Staunen zu ergötzen — natürlich erst, nachdem sie Toilette gemacht hatte.
Wenn sie geahnt hätte, wie bereits stundenlang an ihrem Bette ein fremder, alter, wenig Vertrauen erweckender Mann gesessen hatte, der sie zärtlich betrachtet und ihr wohl auch die Wangen gestreichelt hatte!
Aber sie ahnte nichts.
Also sie stand auf, sah anstatt ihrer Kleider andere daliegen. Auch das hatte für sie nichts zu sagen. Wenn schon, denn schon!
Sie legte die Sachen an, zuletzt den Morgenrock — ein ganz prächtiges Kostüm aus weißem Atlas, reich verziert.
Es war doch ein alter Sünder, dieser Papa Hamstead! Hatte der hier in seiner Villa solche pompöse Damenkostüme und alles, was dazu gehört!
Na, leisten konnte er sich das.
Erstens hatte er dazu Geld genug, zweitens eine sehr nachsichtige Gattin, und drittens war ihm eigentlich gar nichts Unrechtes nachzusagen.
Ihr Haar ließ sie gleich offen, und sie war fertig. Ihre Uhr suchte sie vergebens oder vielleicht hatte sie diese gar nicht bei sich gehabt, sie wusste es nicht mehr genau.
Auch von ihren anderen Sachen war nichts mehr vorhanden. Eine andere Uhr war nicht zu sehen, Fenster gab es in diesem Zimmer nicht, an der Decke strahlte elektrisches Licht, die Luft war ganz frisch.
Auch hinter dem chinesischen Wandschirm befand sich keine Tür.
So drückte Evelyn wieder einen elektrischen Knopf, aber einen anderen als den über dem Bett.
Die alte Inderin tauchte wieder hinter dem Wandschirm auf, der sehr solid war und sich nicht beiseite rücken ließ.
»Missus befehlen?«
»Ich bin fertig.«
»Wollen Missus etwas speisen?«
»Nein, ich habe gar keinen Appetit, ich hatte erst zu Abend gegessen — das heißt, welche Zeit ist es denn eigentlich?«
»Weiß nicht, Missus.«
»Sie werden doch wissen, wie spät es ist!«
»Nein, weiß nicht, Missus.«
»Na, dann meinetwegen! Also der Meister Czernebog — nicht wahr, so hieß er — erwartet mich schon? Ich bin bereit.«
»Wollen Missus mir folgen.«
Jetzt zeigte sich, dass sich hinter dem Wandschirm doch eine Tür befand, die sich nach oben oder unten verschieben lassen musste.
Evelyn betrat wieder ein höchst luxuriös, allerdings auch recht fremdartig eingerichtetes Gemach, was sie aber vorläufig nicht beachtete — denn da stand der merkwürdige Mann schon vor ihr.
Nun sei gleich noch eins bemerkt: Die Bilder, die der Mann mit den Teufelsaugen den Rechtsanwalt in dem magischen Spiegel hatte schauen lassen, haben mit den jetzt geschilderten Szenen nichts zu tun. Das konnten doch überhaupt nur Zukunftsbilder gewesen sein, denn zu der Zeit, da der Rechtsanwalt in den Spiegel geblickt, hatte seine Tochter ganz sicher noch in Betäubung gelegen.
Klingsor hatte jedenfalls nur erfahren wollen, wo sich das Mädchen überhaupt befand; auf Kleinigkeiten hatte er sich dabei gar nicht eingelassen. Oder wie er diese Sache nun sonst machte.
Also zwischen jenen Bildern im Spiegel und den jetzt geschilderten Szenen bestehen keinerlei Beziehungen. Daher trifft Verschiedenes auch nicht zu. So hatte der Rechtsanwalt seine Tochter in einem roten Kostüm gesehen, Evelyn trug aber jetzt ein weißes! Auch der alte Czernebog sah etwas anders aus, als der Rechtsanwalt ihn geschildert hatte, wenn auch die Beschreibung sonst stimmte, küsste dem Mädchen nicht gleich die Hand, streichelte ihr nicht das Haar — das waren jedenfalls Zukunftsbilder gewesen, die sich — erst später in Wirklichkeit abspielten und die jetzt nicht weiter in Betracht kommen.
In der Mitte des Zimmers stand ein alter Mann im schwarzen Talar, eine hohe, knochige Gestalt, nicht eben eine würdevolle Erscheinung, obgleich lange, weiße Haare das Gesicht einrahmten. Dazu hatte dieses bei aller Gutmütigkeit einen viel zu listigen, verschmitzten Ausdruck, und so pfiffig funkelten auch die kleinen Augen. Rechtsanwalt Iron hatte von einer ungeheuren Nase wie der Schnabel eines Geiers und von einem langen Vollbarte gesprochen.
Beides war vorhanden. Diese Nase war ein richtiger Geierschnabel, der fast bis zum Kinn reichte, aber der weiße Vollbart war ein ganz besonderer — sehr spitz gehalten, bog er sich unten ganz nach vorn, sodass man immer an den sehr großen Bart eines Ziegenbockes denken musste.
Etwas Ziegenbockähnliches hatte der ganze Mann überhaupt an sich.
Es lag auch schon im Gesicht, trotz des Geierschnabels. Und um nun das Ziegenbockhafte voll zu machen: Schließlich saßen auch noch zwei stattliche Hörner auf der Stirn, hüben und drüben eins, natürlich künstlich, sogar sehr künstlerische, von Gold und reich mit blitzenden Steinen geschmückt.
Vielleicht hat der Leser schon einmal Menschen mit Hörnern gesehen, das heißt auf Bildern, sie brauchten auch nicht gerade von irdischen Menschen getragen zu werden.
Das Horn war in alten Zeiten das Symbol der Kraft und der Macht, und das scheint es bei sehr vielen Völkern bedeutet zu haben.
Den römischen Jupiter sieht man häufig mit Hörnen abgebildet ebenso Moses; desgleichen trug der Donnergott Thor Hörner, obgleich die alten Germanen damals sicher noch nichts von den Römern gewusst haben, und auf alten Bildern ist auch Siegfried behörnt, nicht, weil, wie oft behauptet wird, man die Bezeichnung »der hörnene Siegfried« falsch verstanden hat, sondern weil früher das Horn eben tatsächlich als Symbol unbesiegbarer Kraft galt.
Selbst Buddha wird auf allen Bilden und Figuren mit wenigstens einem Knopfe zwischen den Augen dargestellt.
Also auch dieser Greis trug Hörner, und nun allerdings war bei diesem Ziegengesicht und diesem Ziegenbart der leibhaftige Ziegenbock fertig.
Nein, einen würdigen Eindruck machte er nicht. Der schwarze Talar war von feinster Seide und schien neu zu sein.
Aber vorn auf der Brust sah man Reste von allem, was der alte Herr in letzter Zeit gespeist hatte.
Da war eine ganze Rutschbahn von Fett und Suppe und Mayonnaise und anderen Gerichten, zum Teil schon eingetrocknet, zum Teil noch ganz frisch, und solche Überbleibsel von Mahlzeiten hatte er auch noch an anderem Stellen seines Talars.
Außerdem duftete der alte Herr sehr stark nach Schnaps, und zwar nach dem gemeinsten Fuselschnaps. Er trank gern einen, eben nur Fuselschnaps, obgleich er sich bessere Sorten hätte leisten können. Er liebte den Fuselgeschmack.
Jetzt stand das blühende Mädchen vor ihm, und sofort fing der Alte an, seine dürren Hände zu reiben, grinste, und begann als Ziegenbock auch noch zu meckern!

Jetzt stand das blühende Mädchen vor ihm, und so-
fort fing der Alte an, seine dürren Hände zu reiben.
»Hähahahähäha, ist sich mein Goldkindchen erwacht? Hähähähähähä, wird sich meinem Täubchen gefallen beim alten Czernebog. Ist sich doch gut aufgehoben beim alten ehrlichen Czernebog, hähähähahähä.«
Natürlich wusste Evelyn nicht recht, was sie hiervon denken sollte.
Nun, schließlich war ja die Sache einfach genug — entweder war jener Zauberkünstler wirklich so ein alter meckernder Ziegenbock, der sich nur so ausdrücken konnte, oder es war ihm solch eine Rolle zugeteilt oder er spielte sie von selbst, es war so gewissermaßen seine »Aufmachung«.
»Also, Sie sind der Meister Czernebog!«, sagte Evelyn, nur um etwas zu sagen, mit Ergötzen dieses Unikum betrachtend.
»Hähähähäha, ist sich der alte Czernebog — nur Czernebog, nur Czernebog — oder kann sich sagen Vater Czernebog — wird sich dem Goldkindchen etwas vorzaubern — — —«
Und er klatschte in die Hände.
Der Alte mit dem überaus pfiffigen Gesicht wusste schon, was er tat.
Er wollte Evelyn gar keine Zeit gönnen, Fragen zu stellen, sie nach dem Erwachen gar nicht richtig zur Besinnung kommen lassen, ihr immer Neues bieten, bis sie sich an ihn gewöhnt hatte.
Auf sein Händeklatschen traten sofort durch eine breite Tür, die hier vorhanden war, zwei Männer ein, Diener, unverkennbar Chinesen, mit kurzen, weißen Kitteln bekleidet, wenigstens mit ehemals weiß gewesenen, jetzt waren sie mehr grau, überhaupt recht schmutzig. Sie trugen zwischen sich ein breites Brett, so groß wie eine Tür, die man ausgehoben hatte.
Diese Tafel, wie wir das Ding nennen wollen, setzten sie grinsend — hier schien überhaupt alles zu grinsen und zu feixen — auf einen großen in der Mitte des Zimmers stehenden Tisch und entfernten sich grinsend wieder.
»Setz Dich, mein Goldkindchen, hähähähä, immer setz Dich, mein süßes Turteltäubchen — hier, Czernebog wird sich erst abwischen den Stuhl — nun pass auf, mein Töchterchen, wird sich der alte Czernebog Dir was vorzaubern, was sich gesehen hat noch kein Erdenmensch, hähähä.«
Evelyn setzte sich gehorsam auf den Stuhl, den der Alte mit einem Zipfel seines Talars schnell etwas abgewischt hatte, ihn dadurch aber vielleicht nur noch schmieriger machend, wie hier überhaupt alles trotz seiner Pracht recht unsauber aussah, nicht nur verstaubt. Von Staub war sogar gar nicht besonders viel zu sehen.
Aber überall sah man irgend etwas kleben, und wo nichts klebte, da fühlte es sich doch klebrig an — als hätten hier Kinder mit Sirupsfingern gehaust.
Also Evelyn saß vor dem Tisch und vor der Tafel, die etwa zwei Meter lang und anderthalb breit war. Da sah sie ja nun allerdings etwas ebenso Merkwürdiges, Reizendes.
Es war eine Miniaturlandschaft. Eine grüne, aber auch mit Blumen geschmückte Wiese, bestanden mit Bäumen, einzeln und in ganzen Gruppen, Büschen und Hecken, ein Teil etwas hügelig, dort auch eine kleine Felsformation, ein Miniaturgebirge.
Selbstverständlich waren die Bäume und das Gras und alle anderen Pflanzen nur nachgemacht. Darin ist man ja heute weit.
Die zartesten Gräser und die kleinsten Blümchen werden mit den kleinsten Staubfädchen so hergestellt, dass man sie von natürlichen kaum noch unterscheiden kann.
So war dies alles auch hier. Nur dass man eben Miniaturverhältnisse zu Grunde gelegt hatte.
Also nicht etwa, dass man junge Bäumchen nachgemacht hatte, sondern da gab es ganz mächtige Bäume von ehrwürdigem Alter und Aussehen, wenn sie auch nur einen Viertelmeter hoch waren, dafür aber der Stamm fast zehn Zentimeter dick, einige vom Alter ausgehöhlt.
So getreulich war alles der wirklichen Natur nachgeahmt worden, dass man auch nicht vergessen hatte, gefallenes Laub, frisches wie schon verwelktes und verdorrtes, desgleichen dürre Äste auf den Boden zu legen.
Das einzige, was nicht ganz gelungen war, war das Wasser.
Aus der Felsformation, die zum Teil mit Moos bedeckt war, entsprang in einiger Höhe eine Quelle, und zwar in Anbetracht der Verhältnisse eine recht beträchtliche, bildete gleich einen breiten Wasserfall, der dann als Bach die ganze Landschaft durchrieselte und in einer Grotte wieder verschwand.
Aber dieses Wasser war starr, bestand wahrscheinlich aus Glas.
Diesen glänzenden Wasserfall und Bach hätte man vermeiden sollen; sie wirkten direkt störend in dieser sonst getreuen Natürlichkeit des Ganzen.
Evelyn übersah dieses gläserne Wasser, sie bewunderte nur die ganze Landschaft im Allgemeinen, die Bäume und Büsche und Hecken, zum Teil Blüten oder kleine Früchte tragend, die wunderbar zierlichen Wiesenblumen.
»Ach, das ist ja entzückend!«, jubelte sie ein übers andere Mal.
»Wird sich meinem Zuckermäuschen bald noch besser gefallen«, schmunzelte der Alte.
Der Tisch besaß an den Seiten Klappen, etwa einen viertel Meter breit.
Czernebog schlug die, vor welcher Evelyn saß, herauf und befestigte sie mit einem Querriegel, sodass also der Tisch noch etwas verbreitert wurde, neben der Tafel noch ein freier Tischrand blieb.
Jetzt ging er hin, nahm von einem Wandregal einen größeren Kasten herab, stellte ihn auf diesen Tischrand.
Es war kein gewöhnlicher Holzkasten, mehr eine Truhe zu nennen, aus kostbarem Holze mit wunderbarer Äderung künstlerisch geschnitzt, schwarze Linien und Arabesken eingelegt, aus denen die Phantasie die wunderlichsten Figuren bilden konnte.
»Wollen sehen, was da drin ist, Goldkindchen«, schmunzelte der Alte. »Aber vorsichtig, Schätzchen, vorsichtig, ist sich sehr zerbrechlich! Wird sich der alte Vater Czernebog auspacken, mein Töchterchen wird sich alles aufbauen.«
Er öffnete den Deckel der Truhe.
Es war eine sogenannte Arche Noah, wie sie wohl jedem aus der Kinderzeit bekannt ist, eine Menagerie.
Jedes Tier war sorgfältig in Watte eingewickelt, Czernebog packte sie aus, gab die Figur immer dem Mädchen, das sie nun nach Belieben aufstellen konnte.
Wiederum war Evelyn ganz entzückt von diesen Figürchen.
So etwas von naturgetreuer Nachahmung hatte sie noch nie gesehen.
Auch der Fellbezug schien ganz echt zu sein; das heißt natürlich nicht, dass so ein Pferdchen mit Rosshaut überzogen gewesen wäre. Alles war wie von Samt, eben immer den Größenverhältnissen entsprechend.
Die Pferde und Kinder waren etwa zehn Zentimeter hoch und diesem Grundmaß entsprach alles andere, Rehe und Hirsche fünf bis sieben Zentimeter, die Schäfchen vier, die Hühner nur einen, ein Truthahn natürlich entsprechend höher, desgleichen die Gänse, Elefanten fünfzehn Zentimeter.
Diese Tierfiguren waren in ganz natürlichen Stellungen gehalten.
Evelyn war ja über das Alter hinaus, um mit solch einer Kindermenagerie zu spielen. Aber das hier war doch einmal etwas anderes.
Es machte ihr das größte Vergnügen, diese so vollendete Miniaturlandschaft mit den naturgetreuen Tierfigürchen zu beleben. Sie baute auf, die Punkte wählend, wohin jedes Tier ungefähr gehörte, der Elefant, der den Rüssel hob, musste natürlich unter einen Baum, von dem er sich Zweige abpflücken wollte, die Steinböcke und Gemsen mussten doch auf das Gebirge, und da gab es Rudel zu vereinigen und Wachen aufzustellen, und dann kamen auch noch immer neue Überraschungen hinzu.
»Ach, was für ein winziges Tierchen ist denn das?! Ein Eichkätzchen! Wahrhaftig, ein Eichkätzchen!!«
Das musste auch wieder untergebracht werden, in den Zweigen eines Baumes, während ein zweites am Stamme hinauflief, und so winzig das Tierchen auch war, kaum einen Zentimeter lang und entsprechend niedrig, besaß es doch ganz regelrechte, haarscharfe Krallen, sodass es an der Rinde gleich hängen blieb.
»Was ist sich denn aber nun das, mein Turteltäubchen?«, schmunzelte der Alte, dem Mädchen etwas reichend, was dieses kaum sah, nicht mit den Fingerspitzen zu fassen wagte.
Doch Evelyn besaß scharfe Augen, sonst hätte sie erst ein Vergrößerungsglas gebraucht, um erkennen zu können, dass es eine Maus war, kaum von Erbsengröße, oder wollen wir lieber sagen, wie eine kleine, längliche Bohne oder eine Perlgraupe, nur das noch ein längerer Schwanz hinzukam.
Und nun das Federvieh! Diese Farbenpracht der natürlichen Federn!
Auch diese Hühner und sonstigen Vögel, Störche und Kraniche und andere, mussten untergebracht werden, und das war manchmal gar nicht so einfach, da gab es Rätsel zu lösen.
Da war zum Beispiel ein Hahn, der mit gesträubtem Gefieder in Kampfstellung dastand. Der konnte doch nicht so einfach hingestellt werden, auch nicht einem anderen Hahn gegenüber, der mit gesenktem Kopfe nach Futter suchte.
Da fehlte offenbar ein zweiter Hahn als Gegner, und ein solcher ward in entsprechender Stellung denn auch gefunden, man musste eben unter dem vorhandenen Vorrat nur suchen, und infolgedessen also gestaltete sich die Sache gar nicht so einfach.
Oder der Hirsch, der mit gesenktem Geweih dastand, musste auch wieder seinen Gegner haben. Die Sache erforderte eben Geduld und künstlerischen Geschmack.
»Raubtiere gibt es nicht?«
»Wird sich in solch einem Paradiese doch kein Raubtier geben, ginge sich doch alles drunter und drüber!«
»Aber Noah musste in seiner Arche doch auch Raubtiere mitnehmen.«
»Ist sich keine Arche Noah, keine Menagerie. Hier aber ist sich ein Hund, hier eine Katze, sind ganz friedliche Tierchen, die auf keinem Hühnerhofe fehlen dürfen.«
Und dann schließlich kam, wie schon mehrmals, aus einem besonderen Schächtelchen auch noch ein Huhn, das in stolzer Mutterliebe sein Dutzend Küchelchen spazieren führte, wieder solche winzige Dingerchen wie die kleinen Erbsen, und doch von wunderbarer Naturtreue.
»Entzückend, entzückend!«, jubelte Evelyn immer wieder. »Ach, wenn ich doch ein Vergrößerungsglas hätte!«
Der Alte brauchte nur in die Tasche seines Talars zu greifen, und ihr Wunsch war befriedigt.
Zuerst staunte Evelyn etwas, weil sie durch dieses Glas die Küchelchen in voller Lebensgröße sah, und dann dachte sie daran, dass dies wohl ein ganz besonderes Vergrößerungsglas sein müsse, das nach eigenen optischen Gesetzen handelte, denn sie konnte es halten, wie sie wollte, es näher bringen oder zurückziehen, direkt vors Auge oder weit entfernt davon, die Küchelchen erschienen immer in derselben Größe, was es sonst bei solchen Vergrößerungsgläsern doch nicht gibt, und dasselbe galt nun von all den anderen Objekten, die sie mit dem Glase in Augenschein nahm.
Betrachtete sie also durch dieses Glas die ganze Landschaft, so glaubte sie die Bäume und alles andere in natürlicher Größe zu erblicken, und dasselbe galt auch von den Tieren.
Doch am meisten bewunderte Evelyn jetzt durch das Glas die Natürlichkeit auch dieser an sich doch so winzigen Küchelchen, wo jede Flaumfeder und jede Zehe von tadelloser Beschaffenheit war; darüber vergaß sie die sonstige Merkwürdigkeit dieses Vergrößerungsglases.
Der Inhalt der Truhe war erschöpft, Evelyn hatte alles aufgebaut, nur manchmal an den Stellungen noch etwas zu ändern.
Es war ein Tierpark, zu dem alle Erdteile hatten beitragen müssen, wenn auch nicht etwa jede einzelne Gattung vorhanden war.
Afrika war durch Elefant, Rhinozeros und Nilpferd vertreten, durch Antilopen aller Art, durch Zebra und Giraffe, aber auch durch einige richtige Affen, mit denen Evelyn meist die Bäume dekoriert hatte, und aus der Vogelwelt einige Strauße nicht zu vergessen, von denen einer sogar ein Nest mit Eiern bewachte, wenn sich hieran nicht die ganze Herde beteiligte.
Amerika hatte hauptsächlich verschiedene Hirscharten geliefert, aber auch Büffel waren vorhanden, wilde Mustangs.
Tapire, Gürteltiere und einige Affen, die mit ihren Wickelschwänzen von Evelyn an Ästen aufgehangen wurden, hatten ihre Heimat in Südamerika.
Australien hatte Kängurus und andere Beuteltiere geliefert, aus deren Brutsäcken die winzigen Köpfchen einiger Jungen hervorschauten.
So hatten auch Europa und Asien das ihrige mit beitragen müssen, um diesen Tierpark zu vervollständigen, nur dass eben alle Raubtiere fehlten.
»Ist sich mein Goldtöchterchen fertig? Nun wird Vater Czernebog zeigen, was er kann zaubern.«
Er setzte die leere Truhe unter den Tisch, schlug die horizontale Klappe hoch, ebenso die Klappe auf den anderen drei Seiten des Tisches, sodass um die ganze Tafel mit dem Miniaturpark eine Wand entstand, eine hölzerne Mauer, von etwa einem Viertelmeter Höhe.
»So, nun kann sich nichts mehr ausreißen, denn nun pass auf, mein Mäuseschwänzchen —«
Er bückte sich, schien unter den Tisch zu greifen, und mit einem Male — —
Evelyn glaubte ihren Augen nicht trauen zu dürfen, glaubte zu träumen, geriet vor Staunen außer sich.
Plötzlich, wie mit einem Schlage, wurden alle diese Tierfigürchen lebendig und blieben es!
Alles galoppierte und rannte und lief und flatterte durcheinander, auf den Felsen kletterten die Steinböcke und Gemsen herum, aus den Bäumen schwangen sich die Affen von Ast zu Ast und pflückten Früchte, um sie zu verzehren, und ebenso begannen auch die Pferde und Rinder, Elefanten, Zebras und Antilopen sich der Atzung hinzugeben, weideten am Boden das zarte Gras ab und rissen das Laub von den Bäumen, und die Hühner scharrten im Boden.
Und dazu nun ein Wiehern, Blöken, Bellen und Miaun, mit zarten Stimmchen, der Kleinheit dieser Tierwelt angepasst.
Und außerdem war auch das gläserne Wasser plötzlich lebendig geworden, der Wasserfall plätscherte hörbar herab und floss als wirklicher Bach durch die ganze Landschaft, bis er in der Grotte verschwand, und schon löschten viele der Tierchen an ihm ihren Durst, und dort, wo sich der Bach verbreiterte, hatte ein Nilpferd bereits sein eigentliches Element gefunden, in dem es untertauchte, und bald folgten auch andere Tiere seinem Beispiel, nahmen ein erfrischendes Bad, während sich ein Elefant vorläufig mit einer Dusche begnügte.
Evelyn war zu keiner Frage fähig, sie konnte nur starren und staunen.
Dabei aber fühlte sie sich in eine Versammlung versetzt, in der sie erst kürzlich mit ihrem Vater gewesen war, hörte nochmals einen Vortrag an, den ein Naturforscher gehalten hatte, allerdings einen ebenso phantastischen wie wissenschaftlichen.
Über die Umwandlung der natürlichen Schöpfungsprodukte durch die Kunst des Menschen, und was die Zukunft da noch alles bringen kann.
Schon viel hat ja der Mensch da geleistet, im Pflanzenreich sowohl wie in der Tierwelt.
Fast alles, was wir jetzt an Getreidearten, Früchten, Obst, Gemüsen und sonstigen Erzeugnissen des Pflanzenreiches genießen, ist erst ein Kulturprodukt des Menschen.
Alle unsere Zerealien, also Korngetreidearten, sind ursprünglich, meist in Asien, Unkraut gewesen.
Wohl haben sie schon immer Körner getragen, wie sie es in wildem Zustande dort auch jetzt noch tun, aber diese haben noch kein für den Menschen genießbares Mehl geliefert.
Die mehlreichen Körner haben sich erst in geeignetem Kulturland entwickelt, und wo diese fortwährende Kultur mit Bearbeitung des Bodens und Düngung unterlassen wird, da sinkt jedes Getreide bald wieder zum Unkraut mit mehllosem Samen herab.
Dasselbe gilt von der Kartoffel, ein Kulturerzeugnis der alten Mexikaner, von der Möhre und Rübe, die ursprünglich ungenießbare Wurzeln waren und auch wieder dazu herabsinken können, vom Apfel, von der Birne, von der Kirsche und Pflaume, von den meisten Obstsorten und noch von hundert pflanzlichen Nahrungsmitteln mehr.
In dieser künstlichen Umwandlung der Pflanzenwelt sind wir weiter und weiter gekommen, auch in Bezug auf die Größenverhältnisse.
Aus der kleinen Walderdbeere sind Früchte bis zur Faustgröße gezogen worden, an Zwergbäumen hängen pfundschwere Birnen.
Und was nun für das Pflanzenreich gilt, das gilt nicht minder für die Tierwelt.
Auch in dieser hat der Mensch doch schon wunderbare Umwandlungen hervorgebracht.
Es sei nur an das Pferd, an das Rind, an das Schwein und an den Hund erinnert.
Die verschiedenen Rassen haben jedenfalls nur einen einzigen Ursprung gehabt.
So hatte jener Gelehrte damals angeführt, und hieran dachte jetzt Evelyn, hörte den ganzen Vortrag noch einmal an, wozu der menschliche Geist ja nur weniger Augenblicke bedarf.
Hier in dieser Miniaturlandschaft bewegten sich die winzigen Tierchen durcheinander, fraßen, badeten sich, kletterten auf Felsen und Bäumen, jagten spielend durcheinander; dazu ließen sehr viele die ihnen von der Natur gegebenen Stimmen erschallen, mit einer ihrer Größe entsprechenden Feinheit. — Evelyn riss sich von dem Anblick einmal los, um staunend den alten Mann mit den Hörnern auf der Stirn anzublicken.
»Mann, wer sind Sie, dass Sie diese Figuren lebendig machen können?!«
Meckernd rieb sich der Alte die knöchernen, etwas schmutzigen Hände.
»Ist sich der alte Czernebog, was zaubern kann, hähähähä.«
»Sind denn das nur wirklich lebendige Tiere?!«
»Zweifelt sich mein Täubchen noch daran?«
»Sie sind von großen Tieren, die ihre natürliche Größe hatten, gleich so klein geboren worden?«
»So nach und nach, so nach und nach, hähähähä«, meckerte der Alte.
Evelyn gab sich hiermit vorläufig zufrieden, sie versenkte sich wieder in den entzückenden Anblick, dachte höchstens verwundert einmal daran, wie ihr Vater und die Familie Hamstead es über sich brächten, sich an ihrem Staunen zu ergötzen, anstatt selbst mit an diesem Tische Platz zu nehmen, um diese Wunder mit eigenen Augen zu schauen.
»Also auch die Bäume und alle die anderen Pflanzen sind natürliche«, begann sie dann wieder, »das begreife ich ja — meinetwegen auch diese winzigen Tierchen — aber sie waren doch zuerst ganz starr!«
»Waren im Starrkrampf, mein Goldtöchterchen, waren im Starrkrampf, hähähähä.«
»Sie hatten sie in künstlichen Starrkrampf versetzt.«
»So ist es, mein Zuckermäulchen, so ist es.«
»Wozu denn das?«
»Fressen da nicht so viel, werden auch älter, hähähä.«
Evelyn gab sich keine Mühe, diese Erklärung zu verstehen — sie beobachtete, wie gerade eine Katze eine Maus fing und verspeiste, und dann fiel ihr wieder etwas anderes ein.
»Ja, aber nun das Wasser, das Wasser! Wie ist denn dieses plötzlich lebendig geworden!«
»War sich immer richtiges Wasser, ist sich nur auch erstarrt gewesen, gefroren —«
»Gefroren? Zu Eis?«
»Nicht zu Eis. Oder ist sich anderes Eis. Ist sich nicht kalt. O, mein Turteltäubchen, was sich der alte Czernebog alles zaubern kann, hähähähä.«
Weiter sollte der Alte nicht zu erklären brauchen.
Einer der chinesischen Diener trat ein, machte eine Meldung, von der Evelyn, wenn sie überhaupt etwas hörte, nur die Worte »Tschigoreff« und »Barbarossa« verstand.
Eiligst war der Alte, der sich gesetzt hatte, aufgestanden.
»Kapitän Tschigoreff? Ist sich mein Freund Barbarossa schon gekommen?«, rief er freudestrahlend. »Nun bleib hier, mein Goldkind, amüsier Dich, kann nix passieren, nur schlage die Klappen nicht herunter, und wenn einmal ein Hühnchen herauffliegt, dann jage sich mein Täubchen das Hühnchen wieder herunter.«
Nach dieser Ermahnung verließ der Alte schnell das Zimmer, wenn auch mit etwas humpelndem Gange.
In einem anderen Zimmer, das nicht weiter beschrieben zu werden braucht, stand ein Mann in der Mitte, ging wohl auch manchmal etwas hin und her.
Es war eine untersetzte, breitschultrige, vierschrötige Gestalt, gekleidet in einen feinen blauen Anzug nach Seemannsschnitt, die Hosen unten trichterförmig sich erweiternd, wiegend war auch der Gang, aber sonst hatte der Mann nichts gerade Seemännisches an sich, vor allen Dingen fehlte die von Sonne und Wetter gebräunte Haut.
Das Gesicht war vielmehr auffallend blass; nur große rote Sommersprossen gaben ihm etwas Farbe; es war eingerahmt von einem brennend roten Backenbarte. Von gleicher Farbe war das kurzgehaltene Haupthaar, und dazu rohe, brutale Züge, kleine wässrigblaue Schweinsaugen, hinter den wulstigen Lippen schlechte Zähne mit großen Lücken — ein höchst unsympathisches Gesicht!
Ein viereckiges Stück Wand schob sich nach oben, durch die so entstandene Tür, die sich gleich wieder schloss, trat Czernebog ein.
»Kapitän Tschigoreff, mein bester Freund Barbarossa, so bald habe ich Dich noch gar nicht erwartet!«
So rief der Alte freudestrahlend, in einer Sprache, die sicher sonst nirgends auf der Erde gesprochen wurde.
»Hallo, Czernebog!«

Und zähnefletschend hielt ihm der Mann, der ganz mit Recht Barbarossa genannt wurde, jedenfalls ein Russe, die große, mit langen roten Haaren besetzte Pfote hin.
Denn eine normale Hand war das nicht, wenn sie auch gar nicht viel von Arbeit verriet.
Entsprechend groß waren auch seine Füße.
Ganz mächtige Quadranten von Stiefeln.
Sie setzten sich.
Schon brachte ein chinesischer Diener Flaschen und Gläser, sie schenkten sich ein, und gleich wurde das Zimmer von einem noch stärkeren Fuselgeruch durchzogen, als der Alte schon mit hereingebracht hatte.
Der Diener hatte sich gleich wieder entfernt.
»Mein bester Freund Barbarossa!«, meckerte der alte Czernebog, jenem nochmals gleich beide Hände schüttelnd. »Hast Du mich zu finden gewusst?«
»Natürlich, wir hatten doch Ort und Zeit genau ausgemacht. Was ist das?«
»Bester JamaikaRum, wie Du ihn liebst. Hier ist Zucker.«
Den verschmähte der Rote, ebenso das Wasser, stürzte das große Glas Rum gleich unvermischt hinter.
»Ach, wie freut es mich, dass ich wieder einmal mit Dir zusammen sein kann!«, fuhr der Alte fort, jenem mit einem nicht minder großen Glase, das aber den gemeinsten Fuselschnaps enthielt, Bescheid tuend. »Aaah, das schmeckt! In Gesellschaft ist das doch etwas ganz anderes. Wie lange bleibst Du?«
»Lange genug, dass Du Dir in meiner Gesellschaft die Gurgel vollsaufen kannst«, erwiderte der andere lachend, schon wieder sein Glas füllend.
Die innere Freundschaft schien in einer Saufkameradschaft begründet zu sein.
»Fährst Du noch den ›Seehund‹?«
»Natürlich, und werde wohl auch so bald kein anderes Fahrzeug bekommen.«
»Wo kommst Du her?«
»Von Sydney.«
»Ach was! Was hattest Du da zu tun?«
»Geheimnis! Aber weißt Du, wen ich da getroffen habe?«
»Na?«
»Den Loke Klingsor.«
»Aaaah, den Loke Klingsor. Dachte ich mir's doch fast, wollte es nur hören. Was machte er dort?«
»Weiß nicht. Der lässt sich doch am wenigsten in seine Karten blicken.«
»Ich komme nämlich auch von Sydney. Hat er nicht etwas von mir gesagt?«
Mit lauerndem Ausdruck in dem an sich schon so listigen, pfiffigen Gesicht hatte der Alte es gefragt.
»Er hat genug von Dir gesprochen.«
»Was denn?«
»Dies und das.«
»Von einem Golem?«
»Golem, was ist denn das?«
»Von dem Vermächtnis des Wunder-Rabbis an den Mister Maxim Iron, an den Rechtsanwalt Eisenkopf.«
»Habe alle diese Namen noch nie gehört.«
»Was hat der Klingsor sonst von mir gesagt?«
»Czernebog, hast Du mit ihm nicht einmal eine Wette abgeschlossen?«
»Hm. Habe ich.«
»Loke Klingsor kann doch sehr viel. Vielleicht mehr als wir Skalden alle zusammen. Unter anderem kann er sich auch das verschiedenste Aussehen geben. Wenn er sich für einen alten Chinesen ausgibt, so ist er eben ein alter Chinese, den jeder für einen solchen hält, und wenn er eine junge, hübsche Dame darstellt, dann wird sich jeder Mann in ihn verlieben. So etwas hat er doch schon oft genug gemacht. Du aber hast behauptet, wenn Dich Loke Klingsor ein einziges Mal täuschen könnte, würdest Du ihm alles geben, was er von Dir fordert.«
»Habe ich, habe ich«, schmunzelte der Alte, »wenn der Klingsor einmal in einer fremden Maske zu mir kommt und ich erkenne ihn nicht sofort, kann er verlangen von mir, was er will. Der alte Czernebog lässt sich aber nicht täuschen.«
»Dann würdest Du ihm Dein Reich und alles abtreten?«
»Würde ich tun, würde ich tun.«
»Du hast daraufhin Dein heiligstes Gelübde abgelegt?«
»Habe ich, habe ich. Wenn es dem Loke Klingsor einmal gelingt, mich zu täuschen, kann er von mir fordern, was er will, ich muss es ihm gewähren. Aber das wird ihm niemals gelingen, des alten Czernebogs Augen sind noch gar scharf.«
»Dann, Czernebog, gib die Tochter des Rechtsanwalts Iron heraus.«
Indem er das rief, griff der Russe an sein struppiges Kopfhaar, hob es ab, mit diesem aber auch noch alles andere, gewissermaßen das ganze Gesicht, oder so war es vielmehr wirklich — — plötzlich saß auf den breiten Schultern der charakteristische Kopf des Mannes mit den Teufelsaugen.
Klingsor hatte schnell das, was er abgezogen hatte, unter seiner Jacke verschwinden lassen, und so schnell war das vor sich gegangen, dass man gar nicht hatte sehen können, was es eigentlich gewesen war.
Bedächtiger zog er jetzt die rotbehaarte Haut von seinen Händen, oder vielmehr dicke Handschuhe, die er zwischen seinen feinen, schlanken, und doch so muskulösen Fingern zusammenballte und ebenfalls in die Taschen steckte.
Und schließlich, als müsse er sich dieses ungewohnten Zwanges so schnell wie möglich entledigen, streifte er mit den Fußspitzen auch noch sofort die quadratischen Schuhe ab, in denen seine Füße mit eigenen Stiefeln noch bequem Platz gefunden hatten.
Wie vom Donner gerührt saß der alte Czernebog da und starrte sein Gegenüber an.
»Das ist nicht möglich, das ist Zauberei!«, konnte er nur stöhnen, er, der selbst so ein großer Hexenmeister sein wollte.
Der ganze Vorgang war ja auch wirklich schier unbegreiflich.
Nicht nur, dass Loke Klingsor so einfach eine Maske, die auch den ganzen Kopf überdeckte, abgestreift haben konnte, da kam noch vieles andere ganz Unerklärliche hinzu.
Er hatte beim Sprechen doch den Mund, die Lippen bewegt, man hatte immer die schlechten Zähne mit den vielen Lücken gesehen — jetzt blitzten hinter den auffallend roten Lippen in dem elfenbeinfarbenen Gesicht des kleinen ovalen Kopfes die prächtigsten Zähne.
Dieser russische Barbarossa hatte kleine, blaue, wässerige Augen gehabt — jetzt brannten da die großen, nachtschwarzen Teufelsaugen.
»Das ist Zauberei!«
»Nein, das ist nur eine ganz neue Erfindung von mir, diese Art von Kopfmasken«, lachte Klingsor. »Aber nun vorwärts, Czernebog — Du hast mich lange genug für Deinen Freund Tschigoreff gehalten — — ich habe die Wette gewonnen — nun heraus mit Deinem Raube — mit der Tochter des Rechtsanwalts Iron!«
Die Olinda hatte die reizende Schmollarie der Zerline aus Mozarts »Don Giovanni« gesungen, wie eben nur die Olinda sie singen konnte.
Sie war von dem niedrigen Steinwall zurückgetreten, der den schwarzen Trichterschlund umgab.
»So, gelockt habe ich ihn, um Verzeihung gebeten auch, aber mir scheint gar nicht, als ob der Fürst des Feuers —«
Zum Tode erschrocken brach sie ab, wandte sich gleich halb zur Flucht, und nicht viel anderes tat ihr Begleiter.
Ein dumpfer Knall war erschollen. Aber was für einer! Wie ein Kanonenschuss! Und nur in dem Krater konnte er gelöst worden sein.
Oder beide dachten eben an eine unterirdische Explosion.
Und da stieg aus dem Krater auch schon eine mächtige Feuergarbe empor, im Nu eine Höhe von mindestens fünfzig Metern erreichend.
»Der Krater bricht aus, die Lava kommt!!«, schrie die Sängerin entsetzt und wollte nun erst recht fliehen.
Aber sofort sprang O'Donnell, der eben auch jetzt seine klare Beobachtung und schnelle Tatkraft behielt, hinzu und hielt sie zurück.
»Ohne Sorge«, lachte er, »das ist nichts weiter als Wasser, rot gefärbt oder erleuchtet. Fühlen Sie nicht den kühlen, feuchten Hauch?«
In der Tat, jetzt merkte auch die Olinda, wie die etwas schwüle Atmosphäre in diesem Talkessel plötzlich kühl und feucht wurde, und sofort war sie wieder beruhigt, schämte sich ihrer Furcht, wandte sich nun aber auch mit doppeltem Interesse dem gebotenen Schauspiel zu.
»Und dennoch, es ist der Fürst des Feuers, der sich auf diese Weise anmeldet!«, konnte sie gleich darauf sagen.
Ja, man mochte es eher für eine rote Feuersäule halten als für eine Fontäne glühender Lava, was da in Meterdicke bis zum nächtlichen Himmel emporspritzte.
Oben teilte sich der Strahl und fiel nach allen Seiten in feurigen Wassertropfen in den Krater zurück, nun freilich das bekannte Wasserplätschern erzeugend, was wieder zur Beruhigung diente — jedenfalls aber ein ganz grandioses Schauspiel.
So stand die rotglühende Säule einige Sekunden kerzengerade, dann sank sie langsam zurück.
Gleichzeitig erscholl unten in dem Trichter ein Rauschen und Brausen, und als die beiden nun sorglos wieder an den Rand traten, sahen sie das Wasser schon hochkommen, ebenfalls intensiv rot gefärbt, von leuchtender Pracht.
Wie glühende Lava stieg es höher und höher, und als von der Fontäne der letzte Strudel versiegt war, hatte das Wasser, oder was es nun sonst war, fast den Rand des Umfassungswalles erreicht.
Nun sahen die beiden auch ganz deutlich, dass es nicht mehr stieg, dass also kein Überlaufen zu befürchten war, sodass sie, wenn auch nicht vor glühender Lava, so doch vor dem Wasser hätten fliehen müssen.
Und jetzt begann die Flüssigkeit sich zu entfärben, wurde immer dunkler, bis sich über den ganzen Krater ein schwarzer Wasserspiegel ausbreitete, der sich ebenso schnell geglättet hatte.
»Das geht etwas unnatürlich schnell vor sich«, meinte der immer scharf beobachtende O'Donnell, »und wenn dieser Umfassungswall Löcher hat, durch welche vorhin das meinem geplatzten Schlauche entquellende Wasser in den Trichter hineinfloss, weshalb fließt dieses Wasser jetzt nicht durch dieselben Löcher zum Krater heraus?«
»Entweder weil es gar kein Wasser ist, oder weil diese Löcher jetzt geschlossen sind«, entgegnete die Olinda. »Wie aber können Sie jetzt solche Kleinigkeiten erwägen? Gewiss, es war der Fürst des Feuers, der sich auf diese grandiose Weise offenbart hat. Meine Liedchen haben ihm gefallen, er will sich — da, was ist das?«
In der Mitte des nunmehrigen Teiches, der also gegen dreißig Meter im Durchmesser hatte, war etwas Rotes aufgetaucht, kam sofort in Bewegung, trieb mit ziemlicher Geschwindigkeit dorthin, wo die beiden standen.
Ein großer Strauß prachtvoller roter Rosen war es! Das war nun schnell erkenntlich!
Gerade dorthin trieb er, wo die Olinda stand, bis an den Rand heran, und das war eine so deutliche Aufforderung, dass sich die Sängerin sofort bückte und in das Wasser griff und den Strauß heraushob.
Ein großes Bukett der herrlichsten roten Rosen, eine immer schöner als die andere, frisch gepflückt, einen köstlichen Duft aushauchend, unten ebenso einfach wie zierlich mit Golddraht umwunden und zusammengehalten.
»Aah, das nenne ich eine dankbare Aufmerksamkeit!«, stieß sie entzückt hervor »Eine solche Ehrung ist mir noch nie zuteil geworden. Mir ist ja schon manches Bukett überreicht worden, aber auf diese Weise doch noch nie, und noch nie habe ich herrlichere Rosen gesehen!«
Ihr Begleiter fasste die Sache von einer anderen Seite auf.
»Ja, sollen denn dort unter der Erde solche Blumen wachsen?!«
»Das wird wohl sein«, entgegnete die Olinda, immer wieder ihr Gesicht in die Rosen drückend.
»Aber die Blumen sind ja ganz trocken!«
»Nur etwas feucht, ganz naturfrisch.«
»Finden Sie das nicht seltsam?«
»Ich finde diesen Strauß herrlich und seine Überreichung himmlisch.«
Mister O'Donnell ließ die Verzückte stehen, ging hin an das Wasser, tauchte seine Hand hinein, plätscherte und spritzte.
Ja, Wasser schien es zu sein.
Offenbar jetzt ganz klares, farbloses Wasser.
Das dunkle Aussehen machte nur der schwarze Untergrund.
Aber dieses Wasser netzte nicht die Hand!
Kein einziger Tropfen blieb daran hängen, nichts von zurückbleibender Feuchtigkeit war zu bemerken!
So war es auch, als O'Donnell einen Zipfel seines Burnus hineintauchte.
Er brachte ihn vollkommen trocken wieder heraus.
Da verhielt sich diese Flüssigkeit also genau wie Quecksilber, obgleich es nicht etwa solches war, das ja zwanzigmal schwerer als Wasser ist.
In seinen hohlen Händen war es leicht und durchsichtig wie Wasser.
Auf seine verwunderte Äußerung hin trat die Olinda doch interessiert hinzu, um ebenfalls diese Merkwürdigkeit zu bewundern.
»Nun, nehmen wir an, es sei ein in einem besonderen Zustande befindliches Wasser, das eben nicht netzt«, meinte sie dann leichthin. »Schade nur, dass ich mich jetzt doch fürchte, davon zu trinken! Jetzt habe ich nämlich wirklich Durst, ich könnte jetzt nicht mehr singen —«
Da tauchte in der Mitte des Teiches schon wieder etwas auf.
Ein rundes, weißglänzendes Brett, auf dem zwei Flaschen und zwei Gläser standen, das war sofort zu erkennen, und als es schnell über die Wasserfläche auf die beiden zuschwamm, bemerkten sie auch noch ein drittes, kleineres Fläschchen, eine zierliche Karaffe.
Der Inhalt der einen Flasche war rot, der andere gelb gefärbt, der Patentverschluss, das ganze Aussehen dieser Flaschen —
»Himbeer- und Zitronenlimonade, natürlich moussierende, das lasse ich mir gefallen!«, sagte die Olinda, gleich nach der einen Flasche greifend.
»Und hier ist Brandy drin, scheint echter französischer Kognak zu sein«, setzte O'Donnell hinzu, schon den Glasstöpsel der kleinen Karaffe ziehend und hineinriechend.
Limonade mit Brandy oder Whisky — so eine englischamerikanische Liebhaberei.
Sie schenkten sich die feingeschliffenen Gläser voll, sie tranken, die Olinda ohne Alkohol.
»Aaah, das schmeckt ja köstlich! Die ist sogar eisgekühlt!«, rief sie nach dem Leeren ihres Glases tief aufatmend.
Ja, sie hatten für ihre Wüstenreise sich auch mit kohlensaurem Wasser und Limonaden versehen gehabt. Aber die letzte Flasche war schon vor langer Zeit — nicht ausgetrunken worden, sondern in der Sonnenhitze geplatzt.
»Ja, wie ist denn das nun wieder möglich?«
O'Donnell hatte, nachdem er seine Zitronenlimonade mit Kognak getrunken, die weißglänzende runde Platte aus dem Wasser genommen.
Er hätte doch annehmen müssen, sie sei von sehr dickem und sehr leichtem Holze, um das draufstehende Gewicht emporzutreiben und zu tragen, wenn man von allen anderen Rätseln absah, die hier vorlagen.
Statt dessen zeigte sich jetzt, dass es eine nur dünne Platte war, ihrem Gewichte nach jedenfalls von Silber.
O'Donnell legte sie zurück in das Wasser — sie schwamm.
Er tauchte sie unter — sie kam wieder empor.
»Wie ist denn das nur möglich?«
Er suchte unter dem Burnus in seiner Tasche, brachte einen Silberdollar zum Vorschein, legte ihn auf das Wasser — er sank sofort unter, verschwand.
»Miss Olinda, nun erklären Sie mir dieses Rätsel, das allen Naturgesetzen Hohn spricht!«
»Ich finde es ganz mit den Naturgesetzen übereinstimmend, dass Sie Ihren Dollar losgeworden sind!«, rief die Sängerin lachend. »Ach, zerbrechen wir uns doch jetzt nicht den Kopf, wie diese Wunder zustande kommen! Hoffen wir vielmehr, dass dieser Krater uns noch andere Wunder offenbaren wird. Dort unten haust eben der Loke Klingsor, der Mann mit den Teufelsaugen, der Fürst des Feuers, und Mister Philipp machte uns doch starke Andeutungen, dass der mehr als Brotessen kann, wenn der Alte auch nie recht mit der Sprache herauswollte, ihn immer wieder als einen ganz normalen, harmlosen Menschen hinstellte, der nur einige Geheimnisse besäße — Brotessen — jetzt bekomme ich auch Appetit, nun packen Sie mal Ihren Schnappsack aus.«
O'Donnell wollte den mitgenommenen Proviant auspacken, Hartbrot, Konservenfleisch und dergleichen, kam aber nicht dazu.
»Da taucht schon wieder etwas auf!«
In der Mitte des Teiches reckten sich vier hölzerne Beine zum Wasser heraus, schwammen heran — die beiden zogen einen eleganten Tisch aufs Trockene, der aber selbst gar nicht nass war.
»Das sieht vielversprechend aus. Ich ahne schon etwas — richtig, da kommt bereits die Fortsetzung geschwommen! Lassen Sie mal unser Hartbrot eingepackt.«
Ein viereckiges, etwas längliches Brett war aufgetaucht, wie immer in der Mitte des Teiches, aber so dick, dass man gleich mehr einen Kasten vermutete, man sah auch schon an den Seiten die Handhaben.
Es schwamm, immer wieder von einer unsichtbaren Kraft getrieben, heran und die beiden erkannten, dass auf der schwarzen Politur etwas mit Kreide geschrieben war, auf Englisch:
»Vorsichtig herausheben und waagrecht auf den Tisch setzen, den Deckel entfernen!!!«
So wurde der nicht allzu schwere Kasten denn herausgehoben und auf den Tisch gesetzt; wie der Deckel zu öffnen und zu entfernen war, das war sofort zu sehen.
Ein freudiges »Aaah!«, entschlüpfte den Lippen der beiden.
Der Kasten, in dem es schon etwas geklappert hatte, enthielt Schüsseln vom feinsten Porzellan; diese wieder Weißbrötchen, mit Butter bestrichen und mit dem ausgesuchtesten Aufschnitt belegt, kaltes Fleisch, Braten, Wurstscheiben und andere Delikatessen.
Es war so viel, dass die zwei es nicht gleich überblicken konnten.
»Frisches Weißbrot und Butter, frische Butter!«, jubelte zunächst die Olinda.
Ja, das hätten sie nicht zu erträumen gewagt, hier frischgebackenes Brot und frische Butter vorgesetzt zu bekommen, im Inneren der Sahara! Aber nur wer schon einmal solch eine Reise durchgemacht hat, nur der weiß zu würdigen, was frisches Brot und frische Butter bedeutet.
Die Expedition hatte mehr mit — doch das konnte man doch nicht regelrecht verpacken.
Sie hatte Butter mit — in Blechbüchsen — ein übelriechendes Öl.
Die beiden mussten ihrem freudigen Staunen noch weiteren Ausdruck geben.
»Kaviar!«, jauchzte selbst der so nüchterne, sich sonst aus nichts etwas machende O'Donnell förmlich auf.
»Und Wurst, richtige deutsche Wurst, wie man sie nicht einmal im deutschen Amerika kennt!«, frohlockte die Sängerin.
»Hier ist eine ganze Platte mit den verschiedensten Käsen!«
»Und hier Fleischsalat mit Mayonnaise!«
»Hier ein frisch gekochter Hummer, er ist sogar noch warm, noch heiß, er liegt in einem Thermophorgefäß!«
So wurden immer neue Entdeckungen gemacht, die gemeldet werden mussten.
Die belegten Brötchen bildeten trotz ihrer Massenhaftigkeit doch nur gewissermaßen die Garnitur zu den sonstigen Delikatessen, für die noch besonders Brot und Butter und Pasten vorhanden waren.
Es war ein ausgesuchtes kaltes Büfett, zu dem aber auch einige warme Sachen hinzukamen.
»Hier sind auch Gabeln und Messer.«
»Danke, habe ich gar nicht nötig«, entgegnete die Sängerin, schon kauend, und jetzt beeilte sich auch O'Donnell zuzugreifen.
»Da kommen zwei Enten geschwommen, die wir uns wohl erst braten sollen!«
Erst ganz in der Nähe entpuppten sich die beiden schneeweißen Enten, welche der Wassertrichter ausgespien hatte, als zwei kunstvoll zusammengelegte Servietten.
Diesen folgte ein Flaschenkorb nach, mit den verschiedensten Weinen, und als der Champagnerpfropfen knallte, kamen zwei Kissen angeschwommen.
Ehe das eine noch ganz den Rand erreicht hatte, tauchte O'Donnell seine Hand und den ganzen Arm tief in das Wasser und fuhr darunter hinweg.
Aber er fand nichts, was verraten hätte, wie es in Bewegung gesetzt wurde.
Die Kissen waren natürlich dazu bestimmt, auf die Umwallung gelegt zu werden.
Die beiden setzten sich, wenn sie nicht vorzogen, hin und her zu gehen, aßen, tranken und plauderten.
»Dieser Fürst des Feuers ist hier ja ausgezeichnet verproviantiert«, meinte O'Donnell.
»Verproviantiert? Ich denke, das meiste mag er wohl selbst erzeugen. Die Butter lässt sich auch in luftdichten Büchsen nicht weit verschicken und zum Gebrauch wieder so auffrischen. Der muss hier eine richtige Meierei haben. Und eine Gärtnerei natürlich erst recht!«
»Unter der Erde?«
»Na, das ist nicht gerade gesagt, das ist wohl kaum möglich. Aber es wird hier ein verstecktes Tal geben, in dem alles erzeugt wird.«
»So denke ich auch.«
»Und das kann ich Ihnen gleich sagen, Mister O'Donnell: Wenn sich dieser Loke Klingsor uns persönlich vorstellt — ich gestehe gleich ganz offen, weshalb wir hierher gekommen sind, wie wir dafür bezahlt werden sollen, dass wir ihm sein Geheimnis vom Rücken nehmen.«
»Darüber haben wir bereits gesprochen, und ich glaube sicher, unsere Unterhaltung ist belauscht worden.«
»Desto besser. Dann brauche ich ihm nicht erst ein langes Geständnis abzulegen. Besonders dieses Frischbrot und die Butter haben mich einfach überwältigt.«
»Wenn er uns nun für immer hier gefangen halten will?«
»Ich bin damit einverstanden«, erklärte die Olinda, in einen Hühnerschenkel beißend.
»Ist das Ihr Ernst?«
»Tatsächlich. Wenn ich irgendwo auf der Erde ein mir behagendes Asyl finde — mich zieht nichts in die zivilisierte Welt zurück. Und Sie, Mister O'Donnell?«
»Ich möchte da nicht so schnell mein letztes Urteil abgeben. Ich würde niemals schwören, keinen Fluchtversuch zu unternehmen —«
»Still, wir bekommen Gesellschaft!«, unterbrach die Olinda ihn flüsternd.
Also der ganze Kraterkessel hatte unten einen Durchmesser von rund hundert Metern, und da der kleine Innenkrater dreißig Meter hielt, so befanden sich die beiden auf ihrer Seite fünfunddreißig Meter von der untersten Stufe des natürlichen Amphitheaters oder Zirkus' entfernt.
Es waren schwarze Felswände, wahrscheinlich Basalt, und auf diesen Stufen sah man jetzt weißgekleidete Gestalten auftauchen, in allen Höhen gleichzeitig, und das rund herum, die beiden brauchten sich nur umzublicken.
Fünfunddreißig Meter sind ja eigentlich keine Entfernung, aber in diesem Mondlicht konnte man doch nichts weiter unterscheiden, als dass es menschliche Gestalten in langen, weißen Kostümen waren; die beiden mussten sie also für Beduinen halten, und ebenso wenig war zu erkennen, woher sie eigentlich kamen.
Es konnte wohl nichts anderes sein, als dass sich in den Felsentreppen Öffnungen befanden, Türen, die wegen der allgemeinen Schwärze nur nicht zu unterscheiden waren.
Diese Gestalten, die sowohl Frauen wie Männer sein konnten, brachten wohl Kissen mit, sie machten solche vorbereitende Bewegungen, ehe sie sich niederließen, und immer mehr kamen hinzu, bis man sie nach wenigen Minuten auf mehrere hundert schätzen musste, die sich aber meist getrennt voneinander hielten.
Dann hörte das weitere Zuströmen auf, und da die Stufen sicher viele tausend Zuschauer gefasst hätten, saßen die Menschen dort doch sehr vereinsamt.
»Das sieht ganz danach aus, als ob hier eine Vorstellung stattfinden sollte«, flüsterte O'Donnell, »das Publikum stellt sich nach und nach ein.«
»Vielleicht sind wir es, welche die Vorstellung geben müssen. Die wollen zusehen, wie es uns schmeckt.«
»Meinen Sie?«
»Nein, nein, ich scherzte nur. Hätten die uns so offen beobachten wollen, wie wir über das Büfett herfallen, dann hätte sich das Publikum eher einfinden müssen, die Hauptarbeit haben wir doch schon geleistet, die Glanznummer ist vorüber.«
»Oder das Publikum ist zu spät benachrichtigt worden.«
»Nein, nein — ich traue diesem Loke Klingsor, wie er sich uns nun einmal schon offenbart hat, nicht zu, dass er hier mit uns eine ›Fütterung der Raubtiere‹ vorführen will. Ich glaube auch nicht an eine regelrechte Vorstellung, sondern es wird sich nur um eine Probe handeln.«
»Woraus schließen Sie das?«
»Weil sich alle die Besucher so gesondert halten. Sind Sie noch nicht in einem Theater oder Zirkus gewesen, wenn geprobt wird? Da setzen sich die Zuschauer, die die Erlaubnis dazu erhalten, auch immer so einzeln, keiner möchte mit dem anderen etwas zu tun haben. Weshalb nicht? Weil sich eben erst jeder sein eigenes Urteil bilden will.«
»Das sind aber doch — wenigstens dreihundert Menschen. Auf so viele schätze ich sie.«
»Und dreitausend hätten Platz.«
»Dreitausend? Wie kommen Sie darauf?«
»Ich spreche nur so. Dieser Zirkus mag doch zehntausend Zuschauer fassen, und was wissen wir denn, wie viele Menschen hier unter der Erde oder wahrscheinlicher in versteckten, unzugänglichen Nebentälern leben.«
»Hm, Sie können recht haben, wenn ich es auch kaum zu fassen vermag, dass sich hier solch eine große Menschenansiedlung befindet. Ich habe mich damals wochenlang hier in dichter Nähe aufgehalten und nichts davon gemerkt.«
»Lassen wir uns nur gar nicht stören«, sagte die Olinda aufstehend, »wir sind hier in keinem gewöhnlichen Zirkus, sondern in einer antiken und auch wieder modern gewordenen Arena, auf einem großen Sportplatz, in einem Stadion oder meinetwegen auch auf einer Rennbahn, uns allein als geehrten Gäste ist der bevorzugte Sattelplatz angewiesen worden, man hat auch für ein Büfett gesorgt — aaah!!«
Die Olinda hatte von einem Stadion oder einer Rennbahn gesprochen.
Und da kam es auch schon!
Plötzlich erblickten die beiden vor sich, ohne gesehen zu haben, woher es gekommen war, an der Felswand, also an der untersten Stufe, ein Gefährt, einen jener antiken Rennwagen, deren Aussehen wir besonders von geprägten Münzen her, aber auch von in Häusern gefundenen Wandgemälden kennen, während sich keiner noch in Wirklichkeit hat finden lassen.

Also ein altgriechischer oder altrömischer Rennwagen, wie ihn aber auch schon die Babylonier und Assyrer und die sonstigen zum Teil prähistorischen Völker benutzt haben mögen.
Solch ein Wagen war auch dieser hier, von goldglänzender Bronze, wie man wohl annehmen musste, bespannt mit drei herrlichen, schneeweißen Rossen, und der aufrecht stehende Lenker, den dreifachen Zügel in der einen Faust, in der anderen eine mächtige Peitsche, trug, wie man jetzt unterscheiden konnte, kein weißes Beduinenkostüm, sondern eine kurze römische Toga.
Die Pferde gingen im Schritt, aber unfreiwillig, sie zeigten sich ungebärdig, man sah, wie sich die kolossale Muskulatur des nackten Männerarmes anspannte, um sie im Zügel zu halten, und neben dem Wagen oder Pferden hielten sich noch einige andere, ebenso römisch gekleidete Männer, immer bereit, den Tieren in die Zügel zu fallen, falls sie durchgehen sollten.
Staunend betrachteten die beiden dieses seltsame Schauspiel, lange Zeit keines Wortes fähig.
»Ja, es ist eine Probe, die Pferde werden erst eingefahren«, flüsterte die deutschamerikanische Sängerin, zuerst die Sprache wiederfindend.
»Merkwürdig, dass man fast gar kein Geräusch hört!«, meinte der ehemalige Detektiv. »Kein Hufgetrappel und nichts, obwohl es ganz harter Felsenboden ist.«
»Die Pferde sind unbeschlagen, vielleicht sind auch ihre Hufe noch umwickelt.«
»Ob der Wagen wirklich so schwer ist, wie er aussieht? Ganz aus massivem Erz? Dann müsste man doch ein Rollen hören.«
»Vielleicht haben die Räder einen Gummireifen, wenn dies auch nicht dem antiken Muster entspräche. Ja, Mister O'Donnell, was sagen Sie nun zu alle — horch, jetzt beginnt der Wagen doch zu rollen, sogar donnernd, die Pferde trappeln —«
Nein, von diesem Gefährt rührte das nicht her!
Diesmal sahen sie, wie aus einer noch dunkleren Öffnung, aus der schwarzen Steinwand, welche die unterste Stufe bildete, wohl mehr als vier Meter hoch, ein anderer solcher Wagen hervorkam, auch gleich unter Peitschenknallen.
Dieser Wagen aber war nicht goldglänzend, sondern von silberweißer Farbe, und bespannt war er mit Rappen von fleckenlosestem Schwarz, und zwar gleich mit fünf, erst drei in einer Reihe, wie bei jenem ersten Wagen, und dann davor noch zwei, die auch wieder so eine kurzgeschorene Mähne hatten, wie es die Alten bei ihren Rossen liebten, dagegen sehr lange Schweife.
Die erste Runde erfolgte in unregelmäßigem Trab, der in einen taktvollen Galopp überging, der wiederum in Karriere ausartete, und so rasten die fünf herrlichen und gewaltigen Rosse um die kreisrunde Arena herum, immer und immer wieder den langsam, nur im Schritt fahrenden Wagen überholend.
Die schweren Räder erzeugten ein wahres Donnern. Die Peitsche des Lenkers, der noch einen Begleiter neben sich stehen hatte, knallte wie Pistolenschüsse, und gerade am meisten knallte er, wenn er den anderen Wagen einholte und seitwärts dicht an ihm vorbeifuhr.
Dann wurden die weißen Rosse des goldenen Wagens stets furchtbar aufgeregt, wollten durchgehen, worauf die anderen Männer hinzusprangen und sie am Gebiss bändigten.
»Ja, es ist eine Probe oder sogar nur eine trainierende Übung«, flüsterte die Olinda, die vor Erregung ganz große Augen bekommen hatte, wieder. »Der weiße Wagen mag schon seine Schnelligkeit erproben, das dazu eingeladene Publikum erwägt schon die Aussichten für die späteren Wetten, der goldene Wagen aber führt sich erst ein, die Schimmel sind überhaupt noch gar keine solche Fahrt gewohnt, können das Peitschenknallen und das Vorbeifahren noch nicht vertragen — O, Mister O'Donnell — was sagen Sie nun hierzu?!«
»Ich fürchte, ich fürchte —«, murmelte der Gefragte, ohne seinen Satz zu vollenden, und die Sängerin fragte nicht, was er denn fürchte, immer mehr geriet sie in Aufregung.
»O, ist das herrlich! Ein Wagenrennen in antikem Stile, ganz echt gehalten! Es wird ja jetzt schon nachgeahmt — auf der Bühne — in dem Schauspiele ›Ben Hur‹ — auf der Bühne, na, was ist das — über das Podium rollen ständig zwei Bänder, auf dem Pferde und Wagen laufen, so kommen sie in Wirklichkeit gar nicht vorwärts, im Hintergrund ist ein gemalter Zirkus mit Publikum, der wird vorbeigezogen, so kommt die Täuschung für den Zuschauer zustande — sehr nett gemacht, wirklich großartig gemacht, ich habe es mir mehrmals angesehen — aber eben doch nur auf der Bühne, welche nur die Welt bedeutet — eben alles Täuschung — und doch, gerade dadurch kam ich auf den Gedanken, wie herrlich es sein müsse, so etwas einmal in voller Wirklichkeit zu sehen — und nun habe ich es hier — die Zeit spielt für mich keine Rolle — ich bin zurückversetzt ins klassische Altertum, ich bin in Olympia — und das ist nun erst eine Probe!!«
Die Olinda wurde immer begeisterter.
»Sind Sie denn gar so sehr für solche Sportspiele eingenommen?«, fragte ihr Begleiter.
»Ja, das bin ich! Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich als Kind nicht zur Sängerin, sondern zur Kunstreiterin ausgebildet worden. Freilich — gut, dass es so gekommen ist, dass ich jemandem parieren musste! Aber immerhin, ich schwärme noch heute für alles, was die ganze Kraft und Gewandtheit und Energie eines Menschen erfordert, wenn er darüber auch einmal sein Leben verliert. Ich liebe den Kampf!«
»Da würden Sie unter Umständen ganz hierbleiben mögen?«
»Ja, das möchte ich! Man brauchte mich nicht als Gefangene zu zwingen, wenn es hier immer so etwas zu schauen gäbe, wenn ich mich womöglich auch selbst daran beteiligen könnte. Oder ich wäre bereit, als Gegenleistung hier zu singen, ein Publikum hätte ich ja, es wird schon kunstverständig sein — Was ist denn das nun wieder?!«
Plötzlich rollte dort durch die Arena im Kreise herum eine weiße Kugel von wenigstens zwei Metern Durchmesser.
Sie musste gleich in voller Fahrt gewesen sein; schneller und schneller sauste sie dahin, bis sie auch noch das Fünfgespann überholte.
»Diese Kugel scheint sich ganz selbstständig zu bewegen«, meinte O'Donnell, »aber das ist nicht gut möglich, sie wird wohl von einem inneren Mechanismus getrieben.«
»Und wie wird sie da gelenkt?«
»Ja, das verstehe ich nicht.«
»Nun, der Mechanismus besteht einfach aus einem Menschen, der in der Kugel sitzt und die Pedale tritt, sein Sitz bleibt immer in derselben Lage, macht die Bewegungen nicht mit.«
»Gibt es denn schon so etwas, dass Sie davon als von etwas Selbstverständlichem sprechen?«
»Jawohl, so etwas gibt es schon. Sie sind eben zwei Jahre in Afrika gewesen. Vor etwa einem Jahre fuhr auf dem Hudson solch eine Kugel, wie ich sie beschrieben habe. Denn hauptsächlich ist ein derartiges Vehikel nur auf dem Wasser brauchbar, sie muss natürlich von Glas sein, will der Fahrer überall hinblicken können, denn auf festem Wege, er braucht gar nicht so schmutzig zu sein, würde die Durchsichtigkeit doch bald aufhören.
Oder die Kugel müsste zu Sportzwecken auf Asphalt- oder Holzbahnen fahren, so wie ja auch hier. Doch scheint sich das Fahrzeug nicht bewährt zu haben, man hat nichts wieder davon gehört, auf dem Wasser fehlte die nötige Reibung, es hatte wohl auch sonst viele Mängel, die hier beseitigt sein mögen.«
»Diese Kugel dort scheint aber nicht von Glas zu sein.«
»Weshalb nicht?«
»Man sieht den Fahrer drin doch nicht.«
»Er sieht aber wahrscheinlich uns. Oder er mag sonst seine Gucklöcher haben. Da eine zweite Kugel!«
Sie hatte dieselbe Größe, war aber von roter Farbe. Gleich als sie nebeneinander waren, begann der Wettlauf zwischen ihr und der weißen Kugel, was auch die Erregung verriet, die sich jetzt unter den Zuschauern bemerkbar machte, sie feuerten die Fahrer an, aber mit Zurufen, welche die beiden nicht verstanden.
Arabisch war es nicht, was doch O'Donnell beurteilen konnte.
Und jetzt das Brüllen von Raubtieren.
»O, sehen Sie, sehen Sie — ein Löwengespann!!«, jubelte die Olinda ganz außer sich.
Ein solches kam jetzt wieder aus einer in der Felsenwand neu entstandenen Tür heraus, ein jenen ähnlicher Wagen, aber bedeutend kleiner, bespannt mit vier mächtigen Löwen, je zwei und zwei zusammen.
Majestätisch schritten sie einher, nachdem sie nur beim Einzug gebrüllt hatten; ganz war ihnen wohl aber nicht zu trauen, das sagten die Männer, die in einiger Entfernung neben ihnen her schritten, große Fangnetze wurfbereit in den Händen.
»O, ist das großartig, und das scheint immer großartiger zu werden!«, jubelte die Olinda. »Was wir hier noch alles erleben werden!«
O'Donnell dagegen war wieder in tiefes Sinnen versunken.
»Ich fürchte nur, ich fürchte nur —«, murmelte er wie damals, wiederum ohne seinen Satz zu vollenden.
»Na, was fürchten Sie denn eigentlich immer!«, kam seine Gefährtin ihm diesmal zu Hilfe.
»Ich fürchte nur, wenn man uns hier so viele Geheimnisse und Sensationen schauen lässt, die dieser einsame Wüstenkrater birgt, dann wird man uns hier nicht mehr fortlassen. Denn einem fremden Menschen wird so leicht kein Schwur der Verschwiegenheit geglaubt.«
»Sind Sie sich darüber noch im Zweifel, dass wir Zeit unseres Lebens hier gefangen gehalten werden sollen?«, fragte die Olinda lachend.
»Und das sprechen Sie so sorglos aus?!«
»Ich wüsste nicht, was für Sorgen ich mir da machen sollte.«
»Sie würden für immer hierbleiben?«
»Gewiss, das habe ich doch schon vorhin ganz freiwillig gesagt.«
»Als Gefangene?«
»Na, wenn man immer so ein Büfett zu seiner Verfügung hat, dann hält man die Gefangenschaft schon aus, zumal hier auf dem bevorzugten Sattelplatz.«
»Zeit Ihres Lebens?«
»Zeit meines Lebens. So urteile ich wenigstens jetzt. Und wie denken Sie hierüber, Mister O'Donnell?«
Der junge Mann richtete sich auf.
»Dann gäbe es für mich nur eins.«
»Und das wäre?«
»Selbst wenn mir die Freiheit angeboten würde — ich würde Sie natürlich niemals hier allein lassen.«
Die Olinda blickte den Sprecher an. Jetzt schien der Zeitpunkt gekommen, da das Gespräch zwischen den beiden gefährlich werden konnte.
Aber es sollte nicht dazu kommen.
Zunächst traf jetzt der goldene Rennwagen mit dem Löwengespann zusammen, und die drei Schimmel gerieten außer sich, wollten bei Anblick und Witterung der Raubtiere durchaus das Weite suchen, konnten kaum noch gebändigt werden, obgleich sie doch sicher schon im geschlossenen Raume an die Raubtiere gewöhnt worden waren.
Es sah kritisch aus; auch die Löwen wurden unruhig, es schien zu einer Katastrophe kommen zu sollen.
Diese Szene fand jenseits des Wassertrichters statt, über diesen mussten sie also hinweg blicken, und da tauchte in der Mitte aus dem Wasser etwas Spitzes auf, das sich schnell zur vierkantigen Pyramide vergrößerte, und plötzlich stand dort in der Mitte des Teiches ein ganzer Pavillon, der eben die Aussicht nach jener Seite verdeckte.
Dieses Häuschen, das da aufgetaucht war, ließ die Olinda erst jene Szene vergessen, das musste doch irgendeine Bedeutung haben.
Wieder hatte sich mit überraschender Schnelligkeit der natürlich etwas aufgeregte Wasserspiegel beruhigt, da öffnete sich in dem Pavillon auch schon eine Tür, ein Mann mit einem Tituskopf und ebenfalls mit einer römischen Toga bekleidet trat heraus — trat einfach auf das Wasser und schritt herüber, brauchte den mit einer Sandale bekleideten Fuß nicht hoch zu heben, um auf die Umwallung zu treten.
Eine ehrerbietige Neigung, die aber kaum eine Verbeugung zu nennen war, und mit wohllautender Stimme erklang es:
»Miss Olinda, Mister O'Donnell — nachdem Sie bereits die Gastfreundschaft meines Herrn genossen haben, lässt Loke Klingsor, der Fürst des Feuers, Sie bitten, mir zu folgen.«
Die Überraschung war groß, aber schnell hatte sich die Olinda gefasst, griff gleich nach ihrem auf dem Büfett liegenden Rosenstrauß.
»Wir sind bereit.«
Der Römer trat etwas zur Seite und streckte die Hand aus, um ihr beim Ersteigen des Walles behilflich zu sein, doch schon stand sie mit einem leichten Sprunge oben, und er machte weiter eine einladende Handbewegung nach dem Pavillon.
Jetzt erst zögerte die Sängerin etwas, den Fuß auf das Wasser zu setzen, dessen Aussehen sich so gar nicht verändert hatte.
»Trägt denn dieses Wasser auch uns??!«
»Wie festes Eis.«
Da stand sie schon darauf.
»Sie kommen doch mit, Mister O'Donnell?«, fragte sie nur noch zurück.
»Ich werde Sie doch nicht verlassen«, entgegnete jener und stand neben ihr.
Der Führer schritt voran, ließ sie zuerst eintreten, schloss hinter sich die Tür, wozu nur ein Drehen der Klinke nötig war, und mehrere Hebel zogen die Tür fest an.
Es war ein schmuckloser Raum, nur dass sich an der runden Wand eine gepolsterte Bank hinzog, nunmehr vollständig geschlossen; an der Decke brannte eine Ampel.
Ein sanfter Ruck, bei dem man zuerst den Boden unter den Füßen zu verlieren schien, sagte ihnen, wohin es ging.
»Wir fahren in die Tiefe?«, fragte die Olinda dennoch.
»Ja, wir befinden uns in einer Taucherglocke. Es ist der kürzeste Weg, der uns nach der Alhambra bringt.«
»Wohin?!«, horchte die Sängerin hoch auf.
Über die ernsten, schönen Züge des jugendlichen Tituskopfes huschte ein Lächeln.
»Sie erreichen das Ziel Ihrer Sehnsucht, Miss Olinda. Sie kommen nach der Alhambra, und nicht nur, dass die unterirdische Residenz meines Herrn hier so heißt, sondern Sie werden tatsächlich die Alhambra betreten, eine genaue Wiedergabe des spanischen Originals, nur nicht so verfallen, an Pracht sogar jene in Granada noch weit übertreffend, und glauben Sie nicht, dort oben etwas zu versäumen, es handelt sich nur um eine Probe, der Sie eigentlich gar nicht beiwohnen sollten, denn hier unten wird Ihnen noch etwas ganz anderes geboten werden. So! Wir haben unser Ziel erreicht, die unterirdische Alhambra!«
Davon, dass die Bella Cobra und Charles Dubois nun etwa so, wie sie das Heim der Tänzerin verlassen hatten, gleich in das Innere des Landes einen kleinen Spaziergang machen konnten, war freilich keine Rede.
Da waren die Beschwerlichkeiten, die ihrer warteten. doch zu groß.
Die Bella Cobra wusste überhaupt noch nicht, wohin die Reise gehen sollte, sie war von Mister Philipp, wenn sie den gefragt hatte, immer an Charles Dubois verwiesen worden, und den hatte sie ja heute zum ersten Mal gesehen, hatte mit ihm vorher nur einmal telefonisch gesprochen.
Da wäre es sehr natürlich und entschuldbar gewesen, hätte sie ihn jetzt nach allen Richtungen hin ausgefragt.
Das tat sie nicht.
Die beiden brachten es sogar fertig, schweigend nebeneinander herzuschreiten, bis sie an den Hafen kamen, und erst, als Charles Dubois sich nun einem kleinen Boote näherte, das am Pier befestigt war, sprach die Bella Cobra eine Frage aus —
»Wir müssen eine Seefahrt antreten?«, sagte sie.
»Ja«, lautete die kurze Erwiderung.
Nun hätte die Tänzerin wieder fragen können, wohin diese Fahrt gehen solle, aber das tat sie eben nicht, stieg in das Boot, setzte sich auf eine der Duchten, der niedrigen Bänke, das Gewehr zwischen die Knie nehmend, und Charles Dubois griff schweigend nach den Rudern.
Er brachte das Boot nach kurzer Zeit zu einem jener kleinen Küstendampfer, wie man sie dort überall findet, plumpen, meist halb verrotteten Kästen, die keinem Sturme standhalten können, auf denen jede Reise eine Lebensgefahr bedeutet, die aber trotzdem lustig weitergondeln, weil die Regierung sich den Teufel darum kümmert, nicht daran denkt, diese »Seelenverkäufer« einmal durch die Hafenbehörden gründlich untersuchen zu lassen und die wenigstens, die ganz unbrauchbar sind, ins alte Eisen zu werfen.
Sie sagt sich einfach, dass doch kein Mensch gezwungen ist, sich einem solchen alten »Schlitten« anzuvertrauen.
Wer es tut, tut es eben auf eigene Gefahr.
Und da ist ja selbstverständlich, dass sich kein rechtschaffener Kapitän dazu hergeben würde, einen solchen alten Kahn immer an der Küste entlang zu steuern.
Die Führer dieser Dampfer sind das verworfenste Gesindel, das je die Deckplanken eines Schiffes betrat, haben ihr Führerzeugnis für große Fahrt verloren, meist nur deshalb, weil sie durch ewiges Saufen Unglücksfälle verschuldet, das Leben vieler Menschen auf dem Gewissen haben.
Und die Matrosen, die sich auf solche Dampfer verheuern, sind natürlich auch danach.
Mit denen wird sich kein ehrlicher Jan Maat einlassen, höchstens auf eine richtige Prügelei, bei der sie aber auch zu kurz kommen würden, denn diese Strolche stechen doch gleich mit dem Messer, feuern aus den längsten Revolvern, richtigen kleinen Kanonen, ohne Weiteres —
Menschenleben sind eben billig dort, und wer sich dorthin stellt, wo Kugeln fliegen, na, der muss eben gefasst sein, dass ihn eine trifft.
Ob die Bella Cobra das wusste oder nicht, war nicht zu beurteilen.
Keineswegs gab sie irgendein Zeichen des Erstaunens von sich, als gleich beim Anlegen des Bootes eine Flut von wüsten Schimpfworten auf sie beide vom Deck hernieder prasselte, rüde Flüche und Verwünschungen der schlimmsten Art, die mit der Aufforderung endeten, sofort das Weite zu suchen, falls sie nicht von Schüssen durchlöchert sein wollten.
Auch Charles Dubois kümmerte sich nicht darum, sondern befestigte das Boot sorgsam, fasste ein herabhängendes Tau, schwang sich mit wenigen Griffen empor, schob den betrunkenen, fluchenden Kapitän zur Seite, beugte sich hinab und wollte der Tänzerin emporhelfen.
Da stand sie schon neben ihm.
Und wieder wunderte er sich nicht darüber.
»Hölle und Verdammnis, wen bringt Ihr da an Bord?«, schrie der Kapitän mit branntweinheiserer Stimme. »Bless my eyes, wenn das nicht ein Unterrock ist! Kalkuliere, dass er schneller von Bord fliegen wird, als er heraufkam!«
Und da rückte er auch schon in Boxerstellung die Bella Cobra an.
Weit kam er nicht.
Ehe er noch den ersten Stoß hatte führen können, traf ihn selber einer, und der genügte vollkommen, um ihn ein Stück zurückzuschleudern, dass er der Länge nach auf die Deckplanken flog.

Die Bella Cobra hatte sich auf diese Weise des rohen Gesellen erwehrt, also auch dadurch wieder bewiesen, dass sie durchaus nicht so »grün« war, wie ihr Begleiter gedacht hatte.
Sie fasste jedenfalls den Zwischenfall gar nicht als etwas Besonderes auf, wendete sich vielmehr an Charles Dubois und fragte:
»Wohin wollen wir uns setzen, um unser Palaver zu halten? Denn etwas möchten wir nun doch wohl miteinander reden.«
»Allerdings, Miss Cobra«, erwiderte Charles Dubois.
Diesen Namen hatte der noch auf den Planken liegende Kapitän kaum gehört, als er aufsprang.
»Was? Das ist die Bella Cobra? Auf meinem ›Nuits‹? Hölle und Verdammnis, das muss doch begossen werden! He, Smutje, dalli, gib uns zu —«
Er hatte natürlich etwas zu trinken bestellen wollen, natürlich einen rohen Ausdruck dafür brauchen wollen, aber die beiden standen auf einmal in so drohender Haltung vor ihm, dass er verstummte, und nun sprach Charles Dubois ganz langsam und nur halblaut:
»Käpt'n Snyders, ich rate Ihnen, sich von diesem Augenblick an bis zu dem, wo wir das Schiff wieder verlassen, überhaupt nicht mehr um uns zu kümmern, vielmehr Ihre Leute anzuweisen, dass sie das ebenfalls beachten. Und nun scheren Sie sich in Ihre Koje, schlafen Sie Ihren Rausch aus!«
Kapitän Snyders starrte den kühnen Sprecher an, als hätte er nicht richtig gehört.
Er fand vor Wut gleich gar keine Antwort, und ehe er dazu kam, hatte Charles Dubois die Tänzerin nach dem Achterdeck gezogen, wo sie beide auf der ziemlich niedrigen Reling Platz nahmen.
»Nette Gesellschaft!«, sagte er noch, indem er schon aus einer Tasche die kurze Pfeife und den Plattentabak zog.
Da besann er sich, wollte beides wieder wegstecken, aber die Cobra legte ihm eine Hand auf den Arm.
»Rauchen Sie, bitte!«, sagte sie, weiter nichts.
Und Charles Dubois erging sich nicht erst in langen Redensarten, sondern schnitt sich von der Tabakplatte ein Stück ab, zerrieb es zwischen beiden Händen, füllte die Pfeife und brannte sie an.
»So!«, antwortete er. »Nun will ich beginnen. Zuerst eine Frage: Sie wissen also, um was es sich handelt, Miss Cobra?«
»Ja«, antwortete diese. »Wir sollen im Innern Australiens nach einem Manne suchen, der sich Loke Klingsor nennt und auf dem Rücken als Tätowierung sieben Zeichen trägt — Runen nannte Mister Philipp sie —«
»Und?«, fragte Charles Dubois weiter.
»Dafür soll ich, wenn es mir gelingt, diese Runen abzuzeichnen, eine Million Dollar erhalten«, ergänzte die Tänzerin ihre Aussage.
»Dieselbe Aufgabe ward mir gestellt«, bemerkte darauf der junge Mann. »Mir ward die gleiche Belohnung verheißen. Außerdem erhielt ich die Mittel, um die Expedition auszurüsten.
Nun weiter: Wohin sollen wir uns begeben, um diesen Loke Klingsor zu finden? Wo soll er sich aufhalten?«
»Das wurde mir nicht gesagt. Das würde ich von Ihnen erfahren, Monsieur Dubois.«
»Dann will ich es Ihnen sagen. Aber erst muss ich Sie noch etwas fragen. Sie haben mir schon gestanden, dass Sie bereits draußen waren. Wo war das?«
»In der VictoriaWüste.«
»Alle Wetter! Sie sind dort gewesen?«
»Ich habe fünf Jahre ununterbrochen in dieser Gegend gelebt, die ganze Zeit, bevor ich in Sydney als Tänzerin auftrat.«
»Allein?«
Ein kurzes Zögern, dann hob die Bella Cobra das Haupt, als wolle sie ihrem Gefährten frei und offen in die Augen schauen.
Das war nun freilich nicht möglich, dazu war es zu finster um sie her.
Nur am Hauptmast hing eine trübe brennende Laterne, deren Lichtschein nicht bis zu den beiden reichte, eben nur die Gestalt des Kapitäns beleuchtete, der einige Meter vor ihnen hin und her ging, anscheinend immer wieder im Begriff, zu ihnen zu treten, es aber doch nicht wagend.
Charles Dubois jedoch hatte es gar nicht nötig, in das Gesicht der Bella Cobra zu sehen.
Er wusste jetzt genau, dass sie ihm die reine Wahrheit sagen würde, aber freilich, das, was er nun zu hören bekam, das hatte er nicht erwartet, das ging selbst ihm über das Alltägliche.
»Ich bin sogar noch länger als nur jene fünf Jahre draußen gewesen«, sagte die Tänzerin leise. »Ich war noch ein kleines Mädchen, als meine Eltern nach Australien kamen, nach Adelaide, und damals war dort das Goldfieber wieder einmal ausgebrochen. Mein Vater wurde davon angesteckt, verwendete das ganze Geld, das er mitgebracht hatte, nicht zum Ankauf von Land und Vieh, sondern kaufte sich, was er als Digger brauchte, einen solchen zweispännigen Wagen — und dann brachen wir auf —
Monsieur Dubois, ich kann Ihnen nicht alles erzählen, was ich erlebte. Lassen Sie sich daran genügen, dass ich alles erduldet habe, was je ein Mensch in der Wildnis erduldet hat.
Wir sind mehr als ein Dutzend Mal dem Tode nahe gewesen, durch Durst, durch Hunger, durch wilde Tiere und wilde Menschen — Sie sehen, ich lebe noch — das eine sollen Sie wissen — mein Vater hatte Glück, er fand Gold, mehr, als er je hätte ausgeben können, er war ein schwerreicher Mann — und als er das geworden war, als er sich am Ziele seiner Wünsche sah, da — nun, da bin ich ihm davongelaufen, bin ihm entflohen und kam endlich nach Sydney. — Wie ich dort zur Bella Cobra wurde? Müssen Sie es wissen?«
Charles Dubois hob die rechte Hand.
»Nicht ein Wort davon, Miss Cobra!«
»Ich danke Ihnen, ich hatte es erwartet, jetzt kenne ich Sie ja schon zur Genüge«, entgegnete die Tänzerin, und dabei erfasste sie die erhobene Hand des jungen Jägers und drückte sie leicht herab.
»Es waren furchtbare Zeiten«, sagte sie dann leise. »Ich bin durch den tiefsten Schlamm gewatet, bis über die Knie — aber weiter hat er nicht kommen dürfen — und auch das, was dort unten haften geblieben war, habe ich abgespült —«
»Ich weiß es, Miss Cobra«, versetzte Charles Dubois.
Und da spürte er einen Druck ihrer Hände. Und die Sache war abgetan zwischen ihnen, für jetzt, für immer. Sie wussten, dass sie beide mit keinem Worte darauf zurückkommen würden.
»Wo war das?«, fragte Charles Dubois nach einer Pause. »Ich meine, wo Sie ausrückten.«
»Im Innern«, lautete die Antwort. »Ich kann die Gegend vielleicht wiederfinden, beschreiben kann ich es Ihnen nicht.«
»Ist auch nicht nötig. Ich weiß genug, weiß, dass Mister Philipp in Ihnen die richtige Gefährtin für mich fand. Hat er Ihnen auch gesagt, dass sich noch jemand zu uns gesellen wird, noch ein Mann?«
Die Bella Cobra schüttelte den Kopf.
»Dann werden Sie ihn noch kennen lernen — wie ich — ich habe ihn ebenfalls noch nicht gesehen, weiß nur seinen Namen, das heißt den, unter dem er sehr bekannt ist, sicher auch Ihnen — es ist der ›Hornfisch‹.«
Da allerdings war es, als liefe ein leichter Schauder durch die Gestalt der Bella Cobra.
Auch ihre Stimme klang nicht fest, als sie den Namen wiederholte.
»Der Hornfisch?«, sagte sie.
»Ja, der! Sie kennen ihn also?«
»Ich kenne ihn, genau sogar.«
»Desto besser, dann wissen Sie also, dass er uns als Führer dienen soll. Halten Sie ihn für geeignet dazu?«
»Sicher! Er kennt die Wüsten des Innern, könnte sicher der Regierung manchen wichtigen Aufschluss geben, aber er tut es nicht, er will nicht, dass jemand mit ihm geht — der Mann ist ein wandelndes Geheimnis, und wenn er reden wollte, würde niemand ihm glauben.«
»Inwiefern, Miss Cobra?«
»Er hat einmal gesprochen, mag damals betrunken gewesen sein, ganz ausnahmsweise, da er sonst nie einen Tropfen Branntwein oder ein sonstiges berauschendes Getränk über seine Lippen bringt — eben, weil er nicht reden will — und damals hat er etwas erzählt. Ach, es ist natürlich eine Phantasie von ihm gewesen, der alte Mann ist wohl nicht mehr ganz richtig hier oben —«
Die Tänzerin deutete nach ihrer Stirn.
»Trotzdem möchte ich es hören«, sagte Charles Dubois.
»Nun, ich kann es ja sagen — der Hornfisch behauptete, er hätte im Innern einer ungeheuren Wüste ein mächtiges Gebirge entdeckt, so einen Felsenwall, und der habe ein Land umschlossen, wo Menschen wohnten, wie es sonst nirgends wieder auf der Erde gäbe, viel größer als wir, wahre Riesen, und sie wohnten in einer einzigen großen Stadt, die er mit einer indischen verglich — hochentwickelte Geschöpfe —
Ach, und was er da alles gesehen haben wollte. Es lässt sich ja gar nicht wiedergeben! Vielleicht erzählt er selbst es Ihnen —«
Die Tänzerin schwieg.
Charles Dubois aber sagte:
»Und in diese Gegend müssen wir gelangen!«
»Wir? Aber das kann doch nur Phantasie gewesen sein! Der Alte hat geträumt, hat eine Sinnestäuschung für Wahrheit genommen! Man sieht ja in der Einsamkeit der Wüsten allerlei — Fata Morgana heißt man das wohl — kurzum, wir können doch nicht etwas suchen, was gar nicht vorhanden ist!
Monsieur Dubois!«
Beschwörend nannte sie seinen Namen.
»Es ist trotzdem wahr«, erwiderte er. »Mein Auftrag geht dahin, diese seltsame Stadt im tiefsten Innern dieses Kontinents zu betreten, diese Stadt, deren Dasein Sie für ein Hirngespinst halten, die noch nie jemand gesehen hat — außer diesem halbverrückten Alten — denn das ist der Hornfisch —
Aber sagen Sie mir nur noch eins«, lenkte er ab. »Wissen Sie, was dieser sonderbare Name bedeutet?«
»Nein«, bekannte die Tänzerin.
»Es ist der Name eines Tieres, das erst vor kurzem entdeckt wurde. Der zoologische Name ist Ceratodon, ein Lungenfisch, also ein Fisch, der kein Fisch ist, denn diese Tiere atmen doch durch Kiemen — von diesen hat der Ceratodon noch Reste, jedenfalls atmet er durch Lungen, wie die Tiere, die auf dem Lande leben, aber seinen Aufenthalt bildet das Wasser — Flusswasser —«
»Und wenn dieses verschwindet, wenn der Fluss austrocknet, atmet er als Landtier durch Lungen?«, ergänzte die Bella Cobra rasch.
»Vielleicht ist es so, ich weiß es selbst nicht, habe nie ein solches Tier gesehen. Ich will Ihnen aber gleich sagen, was über diesen Lungenfisch bis jetzt bekannt ist.
Den ersten sandte ein Farmer am Burnetflusse, ein gewisser William Forster, an den Kurator des Museums für Queensland, einen gewissen Gerard Krafft. Das Tier glich äußerlich einem fetten Karpfen, mit Kiemen, Flossen und Schuppen — aber die Flossen waren recht eigentümlich, sahen wie große Ruder aus, waren innen ganz seltsam gebaut, am besten mit einem Farnkrautblatte zu vergleichen, und anstatt der Schwanzflosse zog sich um den ganzen Hinterleib ein schmaler Flossensaum, mit einem besonderen Zipfel am oberen Ende.
Das Tier hatte knorpelige Knochen, wie man sie auch beim Hai findet. Das Merkwürdigste an ihm aber waren die vier Zähne, zwei im Unterkiefer, zwei im Gaumen, am Rande tief eingezackt, und man erkannte, dass diese Zähne eine zusammengeschmolzene Masse von vielen kleinen Zähnen darstellte. Es waren dieselben Zähne, die man bei versteinerten Tieren der fernsten Vorzeit entdeckt hatte, lange, ehe die Ichthyosaurier die Erde bevölkerten. — Ein berühmter Forscher nannte deswegen das Tier Hornzahn und daraus hat der Alte, der uns führen soll, Hornfisch gemacht —«
»Merkwürdig!«, sagte die Bella Cobra. »Dann hat er also diese Tiere selbst kennen gelernt!«
»Sicher!«, bestätigte Charles Dubois. »Und nun wieder zurück! Wir sollen also eine bestimmte Stelle im Innern aufsuchen, die mir in Graden, Minuten und Sekunden ganz genau angegeben ist, und ich habe schon festgestellt, allerdings nur ganz oberflächlich auf einer viel zu kleinen und ungenauen Karte, dass dieser Ort fast genau in der Mitte dieses Erdteils liegt, dass wir ihn nur von Adelaide aus erreichen können. Wir hätten ja auch gleich von hier aus den Marsch antreten können, durch die Blauen Berge, aber da hätten wir nur viele kostbare Zeit verloren, hätten uns unnütz anstrengen müssen, ehe die eigentliche Expedition begann, und so habe ich vorgezogen, mit diesem Dampfer nach Adelaide zu fahren.«
»Dort erwartet uns der Hornfisch?«
»Nein, nicht dort, sondern weiter nördlich, am Lake Eyre«, gab Charles Dubois Bescheid.
»Den kenne ich genau!«, rief die Bella Cobra. »Ich bin mehrmals dort gewesen, habe auch auf dem Mount Hopeless gestanden — ach, dort ist es fürchterlich! Ich kann mir gar keine schrecklichere Gegend denken als diese — nichts als Salzwüste, wohin auch das Auge blickt.
Und das Schrecklichste ist, dass man immer wieder blaue Wasserfluten zu sehen glaubt, große Seen, die doch nicht vorhanden sind —«
»Und im Norden erstreckt sich über viele, viele Kilometer ein Spinifexdickicht«, setzte der Jäger hinzu.
Die Bella Cobra nickte, sagte aber nichts mehr. Die Erinnerung an das, was sie damals am Lake Eyre gesehen und vielleicht erlebt hatte, war zu stark.
Charles Dubois aber fuhr fort:
»Ja, wenn ich ein Künstler wäre und durch ein Gemälde die Heimat des Todes darstellen sollte, dann verlegte ich sie dorthin. Aus dieser weißglitzernden Salzwüste müsste er hervorkommen — aber ich bin eben kein Künstler.«
In gewisser Beziehung mochte er ja da recht haben, er konnte kein solches Gemälde schaffen; ein Künstler war er trotzdem, eben, weil er so künstlerisch denken konnte, überhaupt auf diesen Einfall gekommen war.
»Sie haben den See nicht voll Wasser gesehen?«, fragte er.
»Nie! Nur kleine Tümpel waren mit Brackwasser gefüllt, und das war schrecklicher, als wenn auch sie ausgetrocknet gewesen wären. Wenn man so sehr dürstet und Wasser erblickt und es doch nicht trinken kann — Sie verstehen —«
Ja, Charles Dubois verstand.
»Wir werden nicht lange dort bleiben«, meinte er. »Ich fürchte jedoch, dass wir noch ganz andere Wüsten zu durchqueren haben werden als nur jene Salzwüste am Lake Eyre. Jedenfalls werden wir dort den Hornfisch treffen, am Mount Arden, südlich von Flinders Range wartet er auf uns.«
»Sie haben alles für die Expedition schon gerüstet, Monsieur Dubois?«, fragte darauf die Bella Cobra.
»Gar nichts!«, lautete die überraschende Antwort.
»Wir müssen uns also in Adelaide ausrüsten. Es gibt allerdings dort General Stores, wo wir alles Nötige bekommen können —«
Sie hatte recht, in solchen großen Warenhäusern, die nur in Englisch sprechenden Ländern zu finden sind, also schon in London, kann man alles kriegen, gegen schweres Geld natürlich, was man zu irgendeinem Zwecke braucht.
Wenn da ein feines Herrchen hineinkommt und dem Geschäftsführer sagt, so und so, »ich muss demnächst mal nach Abessinien, will dort ein paar Löwen schießen, machen Sie mir alles zurecht!«, da braucht er sich um nichts zu sorgen, da findet er zur gewünschten Zeit alles bis auf die kleinste Kleinigkeit bereit, und wenn er drüben in Afrika landet, dann ist auch schon die Karawane mit allen Trägern und einem erprobten Führer zusammengestellt.
Aber Charles Dubois sagte:
»Nein, wir haben nichts damit zu tun. Was nötig ist, das hat der Hornfisch alles schon besorgt, wenn wir ihn treffen —«
»Desto besser!«, erwiderte die Tänzerin. »Ich bin froh, dass wir nicht erst langte in Adelaide zu bleiben brauchen.«
Damit war auch dieser Punkt erledigt, aber Charles Dubois war doch nicht so ganz ohne jede Ausrüstung auf dem Dampfer, wie sich nunmehr zeigte, denn er brachte, nachdem er sich einige Schritte entfernt hatte, alles herbei, was er zum Aufbau eines Zeltes nötig hatte, allerdings nur eines solchen, wie man es im Inneren Australiens verwendet.
Das sind ganz leichte Dinger. Alles, was dazugehört, wiegt nur ein paar Pfund und lässt sich also bequem tragen. Es sind rechteckige Häuschen aus Tarpaulin, die ohne Zuhilfenahme von Stangen in ganz kurzer Zeit aufgestellt werden. Und so war auch hier das Zelt bald genug fertig, zumal nicht erst das wasserdichte Fly, das den leichten Bau gegen die Regenfluten schützen soll, darüber gespannt zu werden brauchte.
Charles Dubois verrichtete seine Arbeit schweigend, brachte dann noch einige Wolldecken herbei, die er im Innern des Zeltes ausbreitete, und als er die Bella Cobra einlud, sich in dieses zu begeben, folgte sie der Einladung, fragte nicht erst lange, wo er denn bleiben würde.
So, wie sie diesen Mann nun schon kannte, wusste sie, dass er sich vor dem Eingange des Zeltes auf den Schiffsplanken ausstrecken und dort mindestens ebenso gut schlafen würde, wie sie auf den Decken — und dass sie ruhig würde schlafen können. Charles Dubois behütete sie —
Es mochte ein eigenartiges Gefühl sein, das die Tänzerin beschlich, als sie sich auf den Decken ausstreckte. Schlafen konnte sie noch lange nicht, und was sie dachte, das sprach sie einmal halblaut aus.
»Herrlich, sich einem solchen Manne anvertrauen zu dürfen!«
Und das war ihre tiefste Überzeugung. Jetzt wusste sie, dass Charles Dubois sein Leben für sie lassen würde, ohne deshalb auch nur den geringsten Lohn für sich zu begehren, weder von ihr noch von sonst jemand —
Und sie hatte noch einen anderen Gedanken, der sie mächtig erregte, und der für sie ganz naheliegend war: Sie wunderte sich immer wieder, dass es einen Mann geben konnte wie diesen Charles Dubois, wie geschaffen, um von Frauen geliebt zu werden, und der doch die Liebe überhaupt noch nicht kannte, dem sie vielleicht noch lange fremd bleiben würde.
Da freilich klopfte auch ihr Herz einmal schneller.
»Gerade wie bei mir!«, sagte sie sich selbst. »Auch ich kenne ja die Liebe noch nicht —«
Und jetzt war sie stolz darauf, sehr stolz.
Ob sie daran dachte, dass sie dadurch vielleicht dieses jungen Jägers wert wurde?
Sie schlief aber doch endlich ein, und zwar fester, als sie in ihrer Wohnung je geschlafen hatte, und so hörte sie nicht, dass der getreue Ekkehard draußen einmal aufstand und einen Mann beim Kragen packte, der sich auf das Zelt hatte zuschleichen wollen —
Es war der Kapitän —
Zum zweiten Male kam er nicht wieder, verhielt sich auch während der Fahrt ganz vernünftig, die beim Morgengrauen begann, und so ist von dieser kurzen Reise nichts weiter zu berichten.
Charles Dubois und die Bella Cobra verließen in Adelaide den »Nuits«, durchwanderten nebeneinander die glanzvollen Straßen der Stadt, ohne in ihren Kostümen groß Aufsehen zu erregen, verließen sie aber auch gleich wieder, kauften sich zwei Pferde und begannen den Ritt nach Norden.
Das einzige, was sie außer den Reittieren noch gekauft hatten, war ein zweites solches Zelt. Sie brauchten es dringend, nicht der Bequemlichkeit halber, sondern weil sie beide wussten, dass es nicht ratsam war, sich ohne einen solchen Schutz gegen die furchtbaren Regengüsse in das Innere zu wagen. Wenn ein Weißer da durch Regen vollständig durchnässt wird, und das musste eben bei jedem Regen der Fall sein, dann kann er sicher darauf rechnen, dass bald das Fieber bei ihm zum Ausbruch kommt und dass er es nicht wieder los wird. Dann aber ist er den Strapazen nicht mehr gewachsen und muss damit rechnen, dass er nach längerer oder kürzerer Zeit am Wege zusammenbricht —
Und dann?
Ja, dann hat eben Australien ein Opfer mehr gefordert, eins mehr zu den vielen Tausenden, die schon gefallen sind, deren letzte Ruhestätte niemand kennt, nie jemand finden wird.
Der Ritt nach Norden war für die beiden, die schon ganz andere Reisen hinter sich hatten, gar keine Anstrengung, und ohne Zwischenfall erreichten sie den Ort, an welchem sie ihren dritten Gefährten treffen sollten.
Sie kamen in der Nacht dort an, sahen schon von Weitem durch die Dunkelheit einen Feuerschein und wussten nun, dass sie dort den Hornfisch treffen würden.
Schweigend ritten sie dahin, kamen aber nicht mehr weit.

Zwei mächtige Hunde sprangen ihnen plötzlich bellend entgegen.
Zwei mächtige Hunde sprangen ihnen plötzlich bellend entgegen und gebärdeten sich so toll, dass sowohl Charles Dubois wie die Tänzerin schon einen Revolver hervorgezogen hatten, um sich die Bestien vom Leibe zu halten. Ein gellender Pfiff rief die Tiere noch eben rechtzeitig zurück, sie gehorchten sofort, und dann ward der Feuerschein durch eine Gestalt verdunkelt —
Vor den beiden stand der Mann, der sich Hornfisch nannte und der unter diesem Namen in ganz Australien bekannt war.
Die beiden Ankömmlinge konnten anfangs nicht viel mehr sehen, als dass es sich um einen sehr kleinen Mann handelte, allerdings auch entsprechend breitschultrig. Er sah ganz zottig aus, als wäre er in Felle gehüllt, trug eine spitze, hohe Mütze auf dem Kopfe, ebenfalls aus Pelzwerk gemacht —
Und die Bella Cobra hatte gleich den bezeichnenden Vergleich gefunden.
»Der sieht ja aus wie Robinson!«, sagte sie halblaut.
Das stimmte — der Hornfisch hatte sich so gekleidet, wie gewöhnlich jener berühmte Einsiedler von Juan Fernández auf der Außenseite der Jugendbücher dargestellt wird, eben in raue Felle — bloß der Sonnenschirm fehlte und vielleicht noch das Lama —
»Na, da seid Ihr ja!«, klang eine knarrende Stimme durch die Nacht.
»Pünktlich genug, das muss ich sagen. Ihr könnt gleich mit essen, alles ist fertig!«
Darauf trat der Mann etwas zur Seite, der Lichtschein des Feuers bestrahlte ihn, und nun sahen die beiden, dass der Hornfisch einen mächtigen weißen Bart hatte, dessen Haar sich auf der Brust mit dem der Fellkleidung mischte, sie sahen ferner ein kugelrundes, rotes Gesicht mit Backen, die jeden Augenblick platzen zu wollen schienen, zwischen ihnen eine nach oben gereckte Stulpnase —
Nur die Augen sahen sie nicht, die waren entweder durch die fetten Backen verdeckt oder durch die struppigen weißen Brauen, die darüber hingen —
Und es war gut so, dass die Augen des Hornfisches nicht gleich sichtbar wurden, der Eindruck, den so der kleine dicke Mann auf die beiden machte, wäre ein ganz anderer gewesen.
So ergriff die Bella Cobra zuerst die dargebotene Rechte des Alten, dann tat es Charles Dubois, und eine Minute später saßen alle drei schon am Feuer, griffen zu und ließen sich's schmecken — es gab gebratenen Hammel —
Außerdem hatte der Alte schon Dampers gebacken, die heiß und frisch gegessen werden müssen. Kühles Wasser war auch da —
Und schließlich hatten die beiden Männer ihre Pfeifen in Brand gesetzt — nichts mehr fehlte zu ihrer Behaglichkeit. Jetzt konnte die Unterhaltung beginnen.
Es war merkwürdig, dass keiner den Anfang machen wollte, es schien, als wolle der Hornfisch nicht zuerst reden, aber auch Charles Dubois hatte wohl keine rechte Lust dazu.
Da löste die Bella Cobra den Bann.
Sie hatte sich der Länge nach auf dem Boden ausgestreckt, sich auf den rechten Arm stützend, und so schaute sie dem Hornfisch gerade ins Gesicht, als sie sagte:
»Ich hätte mir niemals träumen lassen, dass wir uns jemals wiedersehen würden — Jim Crawler —«
Das war ganz ruhig über die Lippen des jungen Weibes gekommen.
Umso überraschender war die Wirkung der Worte auf den Alten.
Mit einem Satze stand er auf den Füßen, hatte im gleichen Augenblick einen mächtigen Revolver in der Hand und schlug ihn auf die Bella Cobra an.
Aber auch die hatte den Revolver schon schussfertig.
»Warum seid Ihr so aufgebracht?«, fragte sie. Ihre Stimme klang immer noch ruhig, aber dem feinen Ohre Charles Dubois' entging nicht, dass ein Unterton darin war, ein seltsames Schwingen —
Unmerklich löste er den Verschluss des einen Revolverfutterals an seinem Gürtel, er wollte bereit sein, wenn es galt —
Doch es kam zu keinem Kampfe.
Der Alte brach plötzlich in ein lautes Lachen aus, das freilich unnatürlich und erzwungen genug klang, dann klatschte er sich mit der einen Hand auf den Bauch.
»Jetzt kenne ich Dich doch erst wieder!«, rief er dann. »Du bist es, Du kleine Krabbe! Ja, wer konnte denn denken, dass aus Dir die Bella Cobra geworden ist! Hahaha — damals warst Du so ein hüfriges Dingchen, dürr — ich dachte immer, der Wind würde Dich eines Tages mit in die Luft nehmen — Also, das bist Du —!«
»Ja, das bin ich, Jim Crawler«, erwiderte die Bella Cobra und steckte den Revolver wieder ein, wie auch der Hornfisch es getan hatte, der schon wieder am Feuer saß.
Aber in diesen Worten lag wiederum etwas ganz anderes, als sie an und für sich sagten — und noch mehr in denen, die sie hinzusetzte:
»Ihr habt wohl nicht vermutet, dass Ihr mich einmal wiedersehen würdet?«
Doch der Alte ließ sich nun nicht mehr verblüffen, stellte sich, als sei er wirklich nicht nur überrascht, sondern auch erfreut durch das Wiedersehen.
»Natürlich, natürlich!«, krächzte er. »Nein, wahrhaftig, das hätte ich nicht gedacht, dass ich Dich nochmals sehen würde — aber nun ist mir's recht, sehr sogar —«
»Das wollte ich nur wissen«, erwiderte die Bella Cobra gleichmütig, als sei diese Sache für sie abgetan. »Ich hatte ebenfalls keine Ahnung, dass unter dem Namen Hornfisch sich Jim Crawler verbarg.«
»Sonst wärest Du wohl nicht zu mir gekommen?«, fragte der Alte sogleich lauernd.
»Gerade erst recht!«, lautete die Antwort.
»Wie soll ich das verstehen?«
»Genau so, wie es gemeint ist! Oder solltet Ihr Euch nicht denken können, Jim Crawler, dass ich immerhin einigen Anlass habe, ein Wiedersehen mit Euch zu wünschen? Es gibt da so vielerlei, was ich von Euch wissen möchte, dass ich mir schon längst vorgenommen hatte, nach Euch zu forschen. Jetzt habe ich Euch unvermutet gefunden, aber leider kann ich nun die Fragen doch nicht an Euch stellen!«
»Nicht? Warum denn nicht?«
»Weil ich mich verpflichtet habe, mit diesem Manne hier — sie deutete auf Charles Dubois — und mit Euch zusammen eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Bevor dies nicht geschehen ist, kann ich meinen privaten Angelegenheiten nicht nachgehen, und deshalb werde ich Euch erst nach allem, was ich wissen möchte, fragen, sobald wir —«
»Sobald wir uns die Million Dollar verdient haben!«, unterbrach der Alte sie und hieb sich wieder mit der einen Hand auf den Bauch, wie es wohl seine Gewohnheit war. »Das nenne ich vernünftig gedacht, und sei sicher, dass ich Dir Rede und Antwort stehen werde, wenn es so weit ist.«
»Ich hoffe es«, bestätigte die Bella Cobra. »Bis dahin werdet Ihr für mich nur der Hornfisch sein, nicht mehr Jim Crawler, und Ihr werdet in mir die Bella Cobra sehen und nicht mehr jenes hüfrige, dürre Mädchen, die Tochter des Mannes, den Ihr Freund nanntet, und der in Euch einen Freund sah — aus diesem Grunde wünsche ich, dass Ihr mich fortan nicht mehr duzt.«
»Aber, Kindchen!«, wendete der Alte ein. »Wo ich Dich —«
Die Tänzerin hob die eine Hand und schaute ihn bloß an.
Da fügte er sich.
»Nun selbstverständlich! Wie Ihr wollt, Miss Cobra!«, sagte er. »Na, und jetzt darf ich wohl auch mit dem jungen Herrn da sprechen —«
Er wendete sich Charles Dubois zu.
»Wir kennen uns noch nicht«, sagte er, »aber ich habe mancherlei von Euch gehört, und ich denke, wir werden uns vertragen. Da ist meine Hand!«
Charles Dubois aber schien diese nicht zu sehen.
»Es wird ratsam sein«, sagte er mit scharfer Betonung und stopfte sich die Pfeife frisch.
Dadurch erschien auch erklärlich und entschuldbar, dass er dem Hornfisch nicht die Hand gereicht hatte, aber ob der nicht doch die Absicht gemerkt hatte, war mindestens zweifelhaft. Jedenfalls kam ihm jetzt, wie vorher bei dem Wortwechsel mit der Bella Cobra, trefflich zustatten, dass seine Augen nicht sichtbar waren, denn die hätte er schließlich doch nicht ganz beherrschen können.
Er spielte den harmlosen Biedermann weiter, wobei ihm sein Aussehen recht gut zustatten kam, und wer ihn so gesehen und beobachtet hätte, der würde nie geglaubt haben, dass dieser kleine, dicke, gemütliche Mann schon viele Male allein in die furchtbaren Wüsten im Innern Australiens eingedrungen und immer wieder heil und gesund zurückgekommen war, ohne abgemagert zu sein — stets der gleiche, höchstens, dass die Pausbacken eben etwas brauner gebrannt waren als vordem.
Dubois aber sagte, nachdem er die Pfeife in Brand gesteckt hatte:
»Da wir vermutlich bei Tagesanbruch den Marsch beginnen werden, muss ich Euch schon mal fragen, ob Ihr alles für die Expedition zurechtgemacht habt, Mister Hornfisch. Habt Ihr die Kamele irgendwo in der Nähe untergebracht?«
»Kamele?«, fragte der Alte etwas spöttisch zurück. »Nun, Mister Dubois, wenn Ihr mich als eins ansehen wollt, dann bin ich das einzige, das die Reise mitmachen wird. Nein, Kamele habe ich nicht beschafft.
Jaja«, fuhr er dann fort, »ich weiß schon, es ist jetzt allgemein üblich, dass man sich mit Kamelen versieht, ehe man eine Reise ins Innere antritt; das hat irgendeiner von den neunmal Gescheiten aufgebracht, aber sagt doch mal, mein Freund, habt Ihr selber schon einmal Kamele zu einer Wüstenfahrt gebraucht — hier in Australien natürlich?«
Charles Dubois schüttelte den Kopf, ohne etwas zu sagen.
»Na also, na also!«, rief der Hornfisch. »Aber Ihr wisst wahrscheinlich, dass auch die Herren, die sich mit Kamelen versorgten und dachten, sie könnten nun so recht bequem durch die Wüste reiten, nicht besser weggekommen sind als die andern, die keine mithatten?«
Diesmal nickte der junge Jäger.
Und der Alte sagte ihm auch gleich den Grund zu diesem Misserfolge.
»Kamele waren natürlich sehr gut«, meinte er, »wenn eben in den Wüsten hier die Nahrung wenigstens vorhanden wäre, die sie brauchen, denn ganz von der Luft können sie doch nicht leben — aber daran hapert's — und das einzige, was wir von Kamelen hätten, das wäre noch, dass wir sie essen könnten, wenn nichts anderes da ist —
Nee, nee, Kamele habe ich nicht, die brauche ich nicht, da komme ich ohne sie viel schneller vorwärts! Hahaha, der alte Hornfisch ist doch nicht umsonst so viele Male in der Wüste gewesen, und außerdem, Mister Dubois — haben Sie denn daran gedacht, dass wir etwas Verbotenes planen, dass wir gar nicht so nach unserem Belieben in das Innere aufbrechen dürfen?«
Daran allerdings hatte Charles Dubois schon gedacht. Ihm war recht gut bekannt, dass von der Regierung ein Verbot erlassen worden war, und mit vollem Rechte.
Es muss da etwas bemerkt werden, was manchem Leser unbekannt sein dürfte.
Australien ist besiedelt und erforscht, aber eben nur in den Küstenstrichen. Auch in das Innere sind zahlreiche Forscher eingedrungen, es musste ja sein, man wollte doch das Land wenigstens kennen lernen, erfahren, ob auch im Innern Siedlungen angelegt werden können, ob es da fruchtbares Land gab — und noch aus einem anderen Grunde wagten sich Menschen vor — aus Goldhunger!
Australien ist ein Goldland. Überall ist bereits das kostbare, so vielbegehrte glänzende Metall gefunden worden, oft durch Zufall — so zum Beispiel bei dem Bau der großen Telegrafenlinie, die mitten durch den Kontinent hindurch führt — so weit ist man eben doch gekommen — da fand einer der Arbeiter in der Grube, die er gehackt hatte, um einen der Masten darin aufzustellen, einen großen Goldklumpen —
Heidi, warf er die Hacke weg!
Um sie freilich gleich wieder aufzuheben und weiterzubuddeln — dass er noch mehr fände!«
Und da war es schon vorbei mit der Telegrafenlinie, da wollten alle die anderen Arbeiter auch Gold haben!
Ja, der Goldhunger hat der Menschheit zu mancher Entdeckung verholfen, hat zur Erforschung der ödesten Gegenden beigetragen — aber er hat auch unzählige Menschenleben als Tribut gefordert, nicht nur in Australien, überall, wo das lockende Metall gefunden wurde.
Und noch ein dritter Grund reizte zur Erforschung InnerAustraliens.
Dieser Kontinent, der kleinste unter allen, ist der einzige, der nie, wie die anderen zeitweise oder wenigstens teilweise, im Meer versunken ist. Er hat in der Vorzeit mit anderen Kontinenten zusammengehangen, Teil des sagenhaften Erdteils gebildet, der Gondwanaland genannt wird.
Später sind die Brücken, die nach Indien hinüberführen und nach den japanischen Inseln hinauf, zusammengebrochen, das Meer überflutete weite Landstrecken und trennte den neuen Kontinent für immer von seinen alten Verbindungen, hinderte aber auch, dass Tiere von drüben herüberkamen —
Was in Australien an Tieren heute noch lebt, das hat sich in direkter Linie aus jenen entwickelt, die schon im alten Gondwanalande lebten. Deshalb ist die Tierwelt Australiens so ganz anders als die aller übrigen Kontinente.
Man hat sogar lange genug behauptet, nur in Australien gäbe es Beuteltiere — bis man auch im äußersten Süden von Südamerika welche entdeckte, als Beweis, dass dieses einst doch mit Australien zusammengehangen haben muss.
In Australien allein gibt es das geheimnisvolle Schnabeltier, gibt es die Echniden, die eierlegenden Säugetiere, gibt es den Emu, den Kiwi, das Känguru, gibt es die Kragenechsen, die wie ihre Vorfahren vor Jahrmillionen aufrecht auf den Hinterbeinen gehen — in Australien gibt es einen Fasan, der in Wahrheit ein Kuckuck ist, aber nicht den charakteristischen Ruf ausstößt.
Das besorgt dort eine Eule — es ist ein wunderbares Land, wo die Säugetiere Eier legen, die Kuckucke Fasanen sind und die Eulen Kuckuck rufen —
Und da kommt noch etwas ganz anderes hinzu!
Die Eingeborenen, die doch auf der niedersten Stufe menschlicher Entwicklung stehen geblieben sind, die noch in der Steinzeit leben, erzählen von ungeheuren Tierriesen, die angeblich im tiefsten Innern des Landes leben, und da soll man nicht hochfahrend behaupten, das seien Lügen; denn diese armseligen Menschen, die kein bisschen Phantasie haben, vermöchten sich doch solche Märchen gar nicht auszudenken, und man hat ja bereits Überreste von solchen Tieren entdeckt, festgestellt, dass zum Beispiel auf Neuseeland noch in geschichtlicher Zeit ein Waran, eine Rieseneidechse von zehn Metern Länge gelebt hat, hat in den Blauen Bergen, also unmittelbar in der Nähe von Sydney, die Spuren eines mächtigen Säugetieres im Schnee der hohen Berge entdeckt, und kein Geringerer als Darwin hat behauptet, dass dort Entdeckungen zu machen seien, von denen die Menschheit sich nichts träumen lasse.
Da ist es doch kein Wunder, dass der Ehrgeiz so manches Forschers rege wurde, dass er solche Riesentiere finden wollte und ins Innere eindrang —
Ja, unzählig sind die Expeditionen, die aus einem der drei angeführten Gründe ausgerüstet wurden, aber die meisten sind jämmerlich zugrunde gegangen. Noch heute sucht man vergeblich nach ihren Überresten —
Da war es doch ganz recht, dass die Regierung verlangte, jeder, der eine solche Expedition unternehmen wolle, müsse nachweisen, dass er sich gebührend ausgerüstet habe, und wer das nicht nachweisen konnte, der musste eben daheim bleiben.
So war also die Frage des Hornfisches ganz berechtigt.
Hätte er Kamele gekauft, die in Australien zu haben sind, so wäre man doch sofort aufmerksam geworden, hätte gefragt, wozu er die Tiere brauchte, und dann hätte man ihn, auch wenn er eine triftige Ausrede gefunden hätte, fortgesetzt beobachtet und ihn schließlich doch abgefangen, ehe er in dem Innern hätte verschwinden können.
Gewiss, die Regierung hat ein großes Interesse daran, dass solche Expeditionen aufbrechen, aber sie will auch nicht die Verantwortung dafür tragen, dass immer wieder Menschenleben zugrunde gehen —
Das große, mordende Rätsel, wie das Innere dieses Kontinents genannt wird, lässt sich nicht so mir nichts dir nichts lösen, da nützen weder Mut noch Verwegenheit noch Todesverachtung — da nützt nur Geduld, immer wieder Geduld!
Ganz allmählich muss der Forscher vordringen, immer weiter müssen die Siedlungen sich vorschieben, um Stützpunkte für neue Forschungsreisen zu gewinnen und da will es gar nichts besagen, dass die Durchquerung des Kontinents schon mehrmals gelungen ist, dass auch, wie gesagt, eine Telegrafenlinie mitten durch die furchtbarsten Einöden führte.
Das große mordende Rätsel bleibt bestehen.
Und diese drei Menschen wollten wagen, es zu lösen, wollten in Gegenden eindringen, die nur ein weißer Mann bis dahin betreten hatte — dieser alte dicke Weißbart, der Hornfisch, den die Bella Cobra als Jim Crawler angesprochen hatte.
Da musste er doch wissen, was er zu einer solchen gefährlichen Reise nötig hatte, da war nicht anzunehmen, dass er sie leichtsinnig antrat!
Und selbst wenn er keine Rücksicht auf seine Gefährten nehmen würde, so musste er doch an sich denken, konnte keine Lust haben, auf dieser neuen Fahrt jämmerlich umzukommen.
Charles Dubois wusste also nichts auf die letzten Worte des Alten einzuwenden, und da erhob sich dieser.
»Na, da kommt nur mit!«, sagte er. »Ich will Euch zeigen, was meine ›Kamele‹ sind, und ich denke, Ihr werdet die Augen mächtig aufreißen! Jaja, der alte Hornfisch weiß, was er will!
Aber ehe ich Euch mein Geheimnis zeige, müsst Ihr mir beide schwören, dass Ihr es nicht verraten wollt! Unter keinen Umständen! Keinem Menschen! Wenn Ihr das nicht schwören könnt oder nicht schwören wollt, dann ist es ja noch Zeit, dann könnt Ihr wieder gehen, und der alte Herr in New York drüben mag sehen, woher er das kriegt, was er von uns haben will —
Übrigens noch eine Frage! Hat er etwas davon verlauten lassen, dass er — wenn etwa eins von uns unterwegs liegen bleibt — dass dann die Überlebenden die Belohnung, die ihm versprochen worden ist, miteinander teilen können?«
»Dass also der, der als einzig Überlebender zurückkäme, drei Millionen Dollar ausgezahlt erhält?«, fragte Charles Dubois sofort zurück, indem er mit festen Blicken den Alten anschaute.
»Nein, daran ist nicht zu denken, Hornfisch! Auch für den Fall, dass Ihr allein zurückkommt, müsst Ihr Euch mit einer Million begnügen!«
»Na ja, na ja, selbstverständlich! Ich fragte nur so! Und nun — wollt Ihr schwören?«
»Nein!«, erwiderte Charles Dubois mit fester Stimme.
Und auch die Bella Cobra stieß ein Nein hervor.
Zum ersten Male zeigte das runde Gesicht des Hornfisches einen anderen als den gewohnten Ausdruck. Die beiden sahen, wie verblüfft er war, und er gab sich nicht einmal Mühe, das zu verbergen.
Er stand mit offenem Munde da, als wollte er etwas sagen und brächte es nicht fertig —
Endlich aber war er doch so weit.
»Waaas?«, rief er. »Ihr wollt nicht schwören?«
»Nein!«, wiederholten die beiden.
»Ja, warum denn nicht?«
»Weil unser Schwur uns viel zu heilig ist, als dass wir ihn ohne Not abgeben«, antwortete Charles nun. »Wie können wir denn schwören, etwas als Geheimnis bewahren zu wollen, was vielleicht für uns gar keins mehr ist?
Lasst uns sehen, um was es sich handelt! Und ist es wirklich etwas, was wir noch nicht kennen, was noch kein Mensch außer uns gesehen hat, dann wollen wir Euch geloben, niemand etwas davon zu verraten.
Genügt Euch das nicht, dann lasst Euer Geheimnis Euer Geheimnis bleiben. Dann werden wir eben sehen, dass wir ohne Euch unser Ziel erreichen —«
Ein heiseres Hohngelächter des Alten unterbrach ihn.
Der Hornfisch schien jetzt wirklich die Maske ganz fallen zu lassen, die er bisher getragen hatte.
»Ihr?«, fragte er mit offenem Hohn. »Ihr beiden Grünschnäbel wollt das Rätsel lösen, an dem schon so viele gestorben sind? Ohne den alten Hornfisch? Ja, warum hat sich denn dieser Mister Philipp so viele Mühe gegeben, mich nur erst einmal ausfindig zu machen? Und mich als Euern Führer zu dingen? Denkt Ihr vielleicht, der wüsste nicht, um was es sich hier handelt, he? Na, da seid Ihr beide ja schief gewickelt, verdammt schief!«
»Mag sein, nach Eurer Meinung wenigstens, Hornfisch«, entgegnete Charles Dubois mit einer Ruhe, die in diesem Augenblick bewundernswert war.
Man muss sich nur in seine Lage und die der Bella Cobra versetzen!
Sie waren überzeugt gewesen, dass sie sofort die Reise antreten könnten, sobald sie diesen alten Abenteurer getroffen hatten — und nun sollte das alles umgestoßen werden?
Dubois aber war so vollkommen ruhig, dass er sich schon wieder an das Feuer gesetzt hatte, und die Bella Cobra folgte gelassen seinem Beispiel.
Der Hornfisch aber stand noch.
Seine Hände spielten an dem einen Revolverfutteral, sein Gesicht hatte wieder den früheren Ausdruck angenommen, seine Augen waren auch jetzt noch nicht zu sehen — er schwieg geraume Zeit —
Die beiden anderen störten ihn durchaus nicht, sprachen auch kein Wort miteinander, warteten ruhig ab, wie sich ihre Zukunft nun gestalten würde, und das war eben das große Wunder, dass dieser Charles Dubois nun nicht große Worte machte. obwohl er selber doch auch schon manche gefährliche Reise in diesem Lande hinter sich hatte, obwohl er doch von Mister Philipp ebenso mit gutem Grunde für diese neue Expedition gewonnen war wie die Bella Cobra und wie der Hornfisch selber.
Männer der Tat sind eben keine Großsprecher.
Es dauerte ziemlich lange, bis der Alte mit sich einig geworden war, was er nun zu tun hatte. Endlich sagte er, und es sollte wohl gutmütig spottend klingen, aber sein Ärger war doch deutlich genug herauszuhören:
»Ihr seid ein paar schöne Kerle! Wenn ich Euch nun wieder heimschicke? Was wollt Ihr dann anfangen?«
»Das wäre wohl dann allein unsere Sache«, erwiderte Charles Dubois.
»Na ja, na ja, da habt Ihr ja auch recht«, gab der Alte zu. »Aber ich habe mir einmal vorgenommen, die Million Dollar zu verdienen, die will ich mir doch nicht entgehen lassen — wolltet Ihr etwas sagen, Miss Cobra?«
Nein, die Tänzerin schwieg; sie hatte allerdings eine Bewegung gemacht, als wenn sie etwas bemerken wollte, schien sich indes eines andern besonnen zu haben.
»Ich dachte!«, fuhr der Alte also fort. »Na, und wenn Ihr eben nicht eher schwören wollt, als bis Ihr wisst, um was es sich handelt, dann will ich einmal einen Pflock zurückstecken und die Fünf gerade sein lassen — da kommt nur, und seht Euch die Geschichte erst mal an!«
Sofort erhoben sich die beiden und folgten ihm, von den beiden mächtigen Hunden umkreist, die sich bisher abseits von ihnen gehalten hatten.
»Es ist schon gut, Bill und Joe!«, sagte der Hornfisch zu ihnen. »Das sind gute Freunde, die tun eurem Herrchen nichts!«
Und zu seinen Begleitern gewendet, fuhr er fort:
»Die beiden verstehen nämlich keinen Spaß, wenn sich jemand an mir vergreifen will, die haben schon manchen von diesen schwarzen Schuften zerfetzt — hahaha — viel schneller, als ich ihm eins hätte abgeben können — hatten ihn schon an der Gurgel, ehe ich überhaupt etwas wusste — ja, die sind gut, die sind sehr gut — für einen einsamen alten Mann, der ich doch bin!«
Weder Charles Dubois noch die Bella Cobra erwiderten etwas darauf, und so schwieg auch der Hornfisch.
Der Mond am Himmel leuchtete genügend, sodass sie sehen konnten, wie der Alte sie an den Rand einer jener mächtigen Salzsteppen führte; die weißen Kristalle glänzten im Mondlicht wie Silber, wie tausend glitzernde Edelsteine.
Und am Rande dieser Salzwüste lag oder stand das, was der Hornfisch als sein großes Geheimnis bezeichnete.
Es war allerdings etwas, was man nicht in dieser Einöde vermutet haben würde.
Die Bella Cobra staunte wirklich, wusste gar nicht, was sie aus dem Ungetüm machen sollte.
Anders Charles Dubois.
»Das ist ein Segelschlitten!«, sagte er sofort.
Und dann fügte er noch hinzu:
»Auf einem solchen Segelschlitten habe ich die große Wüste am Salzsee in Utah durchquert.«
»Mensch, das ist — — nicht wahr!«, schrie da der Hornfisch heiser auf, sich aber doch noch rechtzeitig besinnend, denn er hatte sagen wollen: »Das ist eine Lüge!«, und dann freilich wäre die Beleidigung nicht wieder gutzumachen gewesen.
Vielleicht hätte er sie trotzdem aussprechen dürfen. Charles Dubois schien entschlossen, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen.
»So will ich Euch beweisen, dass ich diese Fahrzeuge genau kenne«, erwiderte er, trat zu dem seltsamen Gestell und wollte hineinsteigen.
Da aber wurde er von dem Alten zurückzogen.
»Na ja, na ja«, sagte er. »Ihr habt recht, das ist eine Art Segelschlitten, aber den habe ich mir gebaut, selbstständig, kein Mensch in Australien hat noch einen gesehen, und ich habe keine Ahnung gehabt, dass es drüben in Amerika solche Dinger schon gibt.«
»Da irrt Ihr, Hornfisch. Ich war der einzige, der sich eines solchen Schlittens bediente, und ich bin von selber auf den Einfall gekommen, ihn mir zu bauen, genau so wie Ihr hier — die Salzkristalle erinnern eben an Schnee, und da liegt es nahe, wenn man gleich daran denkt, ob man da nicht mit einem Schlitten drüberweg fahren könnte. Ich hatte auch einen Hund bei mir, so ein mächtig großes Vieh wie die hier — aber da war nicht daran zu denken, dass der etwa den Schlitten hätte ziehen können, der wäre doch bald mit ganz wunden Füßen zusammengebrochen, und noch schlimmer wäre es mit seinen Augen gewesen, das Salz musste doch aufwirbeln, wenn er rasch darüber hinlief — da habe ich einen Mast auf Schlittenkufen gesetzt und meinen Rock als Segel angebunden — und das ging ganz wunderbar —
So ist es Euch eben hier ergangen. Ihr habt Euch auch einen solchen Segelschlitten ausgedacht, und weil er sich bewährt hat, habt Ihr gleich ein richtiges Segel angebracht —
Nun, und wenn Ihr es jetzt noch wollt, so werde ich Euch versprechen, dieses Euer Geheimnis, Eure Erfindung niemand zu verraten. Das kann ich tun. Zu schwören brauche ich deswegen noch lange nicht, und Miss Cobra wird darin ebenso denken wie ich. Nicht wahr? —«
Die Tänzerin bejahte sofort. Sie hatte gleich verstanden, was für ein Kniff hier vorlag war deswegen gar nicht mehr neugierig.
Aber der Alte wollte jetzt nichts mehr von einem Schwur oder von einem Versprechen der beiden wissen.
»Ach, das ist ja gar nicht nötig, das war eben nur so ein Einfall von mir«, meinte er. »Seht Euch lieber an, was ich hier alles aufgestapelt habe! Da werdet Ihr Eure Freude dran haben!«
Er führte sie etwas abseits, wo unter einer Leinenplane, die zeltartig gestützt war, Stöße von Konservenbüchsen lagen.
»Da kommen wir schon aus«, fuhr er fort. »Die Hälfte brauchen wir auf der Hinfahrt, die andere auf der Rückfahrt — das heißt, nur bis zu einer gewissen Stelle. Von dort ab können wir uns alle Tage schießen, was wir brauchen. Da wird es Euch schon gefallen, na, und die paar Gefahren — Ihr seid ja daran gewöhnt, seid ja beide keine New Chumps mehr, keine Grünlinge —
Na, und was ich noch sagen wollte, wenn es Euch recht ist, bringen wir das Zeugs da gleich auf dem Schlitten unter und verstauen es darin — da können wir dann nach einer Stunde oder so abfahren —«
Die beiden waren einverstanden, packten von den Büchsen, was ihnen in die Hände kam, und trugen alles nach dem Schlitten.
Dieser war genau wie die Segelschlitten gebaut, die man ja schon auf deutschen Binnenseen im Winter oft genug sehen kann. Da werden doch sogar Wettfahrten abgehalten, da sind aber die Masten viel höher, und die Kufen sind auch anders gestellt. Eine Präzisionsarbeit hatte der alte Hornfisch nicht geleistet, ihm war es hauptsächlich darauf angekommen, dass das Ding fest wurde, auch mal einen Puff vertragen konnte, denn glatt wie das Eis eines Sees sind diese Salzsteppen doch nicht, da liegen oft genug große Steine, ganze Felsblöcke umher, da gibt es tiefe Spalten, Gräben, sogar ehemalige Flussbetten —
Und desto größer muss eben dann die Kunst des Mannes sein, der den Schlitten steuert, desto mehr Geistesgegenwart muss er besitzen, wenn er eine Katastrophe vermeiden will, von der Tod und Leben abhängt.
Nach etwas mehr als einer Stunde war die Arbeit getan, der Proviant war untergebracht Nur etwas vermisste die Bella Cobra noch.
»Wo sind denn die Wasserschläuche?«, fragte sie.
Eine Wüstenreise ohne Wasser war natürlich ein Unding, eine Unmöglichkeit.
Aber diesmal waren sie doch nicht nötig. Ehe noch der alte Hornfisch der Fragenden antworten konnte, sagte Charles Dubois bereits:
»Wir brauchen kein Wasser, Miss Cobra, denn mit diesem Schlitten werden wir eben die Salzwüste derart schnell durchkreuzen, dass wir schon wieder in fruchtbaren Gegenden anlangen, bevor wir den Durst nicht mehr ertragen könnten.«
»Und wenn doch einmal eine solche Wüste nicht so schnell durchquert werden könnte?«, fragte die Tänzerin noch.
»Dann haben wir in manchen Konservenbüchsen Flüssigkeit genug, um an keine Gefahr denken zu müssen.«
Da hatte auch die Bella Cobra nichts mehr einzuwenden.
Sie stieg in den sonderbaren Schlitten, setzte sich auf einen Platz, den der Hornfisch ihr anwies, Charles Dubois folgte und den Beschluss machten die beiden Hunde und ihr Herr.
Der Wind war günstig, das Segel, das nun gelöst wurde, füllte sich, und schon setzte sich der Schlitten in Fahrt, erst langsam, aber dann schneller und schneller, bis er mit der Geschwindigkeit eines Eilzuges über die Salzkristalle dahinsauste — hinein in diese schier endlos erscheinende Wüste, zu deren Durchquerung ein Trupp Kamelreiter viele Tage gebraucht hätte —
Nach Nordwesten ging die Fahrt — hinein in das unbekannte Innere des Kontinents, entgegen dem großen, mordenden Rätsel —
Die Bestürzung auf dem Taucherschiffe lässt sich nicht so leicht in Worten beschreiben, hauptsächlich deshalb, weil doch die Besatzung nur aus Männern bestand, die an manches schon gewöhnt waren, viele Abenteuer der verschiedensten Art hinter sich hatten.
Da war keiner unter ihnen, der nicht mit der Möglichkeit eines solchen Unglücks gerechnet hatte.
Allerdings gesprochen hatten sie nie davon, mochte ihnen das Mitteilungsbedürfnis auch fast das Herz abdrücken.
Nein, da hatten sie — jeder für sich — gewusst, was ein Wort bedeutete — und jeder hatte eben für sich behalten, was ihn nachts so oft geängstigt und gemartert hatte, wenn er in seiner Hängematte lag und, anstatt zu schlafen, vor sich in das Dunkel starrte.
Vielleicht kam auch der Aberglaube hinzu, von dem kein Seemann frei ist, unter dem aber diese Taucher noch mehr zu leiden hatten als die andern Jan Maats.
Was einmal ausgesprochen worden ist, das m u s s geschehen, m u s s sich erfüllen.
Das war die eine Seite dieses Aberglaubens.
Die andere aber war: Wenn etwas wirklich gelingen soll, dann darf es nie ausgesprochen werden.
Darin liegt natürlich ein Widerspruch. Einmal glaubten sie also, was gesprochen wurde, müsse geschehen, und dann wieder, dass etwas nicht gelingen könnte, sobald es einmal in Worte gekleidet worden war.
Der Widerspruch ist aber nur scheinbar, es lässt sich da schon eine Erklärung finden.
Die Erfüllung des ausgesprochenen Planes geschieht nämlich im gegenteiligen Sinne, die des unausgesprochenen im bejahenden.
Und da viel davon abhängt, dass dies richtig verstanden wird, sei es an einem recht gewöhnlichen Beispiele klargemacht.
Jemand spielt in der Lotterie und will natürlich gewinnen, sonst hätte er sich ja das Los überhaupt nicht gekauft. Da gibt es nun viele Menschen, die in einer Art Hochmut oder Prahlerei zu ihren Freunden sagen:
»Ach, geht mir doch mit der Lotterie! Wer da ein Los nimmt, der kann mir leid tun. So dumm möchte ich bloß fünf Minuten sein. Da spare ich mir doch lieber das Geld oder kaufe mir etwas dafür, anstatt dass ich andere reich machen helfe! Nee, nee, ich spiele nicht!«
Und dabei hat er, wie gesagt, sein Los in der Tasche und wünscht nichts sehnlicher, als dass es mit einem großen Gewinn gezogen wird, mit dem Hauptgewinn natürlich, dass er also das Große Los gezogen hat.
Ein anderer hat ein Los und sagt keine Silbe, aber sein Wille ist ständig darauf gerichtet: »Ich will gewinnen! Ich will gewinnen! Ich will ganz bestimmt gewinnen!«
Und das gewinnt er eben auch, während der andere in den Eimer guckt, wie das Volk so treffend sagt.
Vielleicht ist mit dieser Erklärung der Widerspruch von vorher gelöst?
Nun kommt noch hinzu, dass Seeleute an sich schweigsam sind, solange sie auf dem Meere schwimmen. Sie spinnen wohl in der Freiwache ein Garn, erzählen die tollsten Phantasien —
Gerade darin liegt eben der Witz.
Sie lügen mit Absicht, um nicht erzählen zu müssen, was sie wirklich erlebt haben. Davor scheuen sie alle zurück.
Und so war es auch auf dem Taucherschiffe des verschwundenen Richard Flint.
Die Leute hatten die Frau in ihre Kabine getragen, und da hatte sich auch gleich wieder einmal gezeigt, dass eine Frau nicht auf ein Schiff gehört, nicht unter das Seevolk.
Das bringt der Besatzung immer Unglück, und hier war es doch einmal offenbar geworden.
Dass Richard Flint nicht ewig würde nach Goldschiffen tauchen können, das hatte er selber gewusst, das hatten auch seine Leute sich nicht verhehlt.
Einmal musste auch bei diesem Kruge der Henkel abbrechen, das war nun einmal nicht anders.
Aber das schlimmste war, dass keiner etwas mit der Frau anzufangen wusste!
Sie hätten ihr gern geholfen, bloß dass keiner sich an sie wagte.
Sie war doch eben eine Frau, und außerdem auch die Frau vom Kapitän oder vom Herrn wenigstens.
Und eine weibliche Bedienung hatte sie nicht mitgebracht, hatte das gar nicht nötig gehabt, denn der Bullenbeißer von Mann, den sie gehabt hatte, der hatte doch für sie gesorgt, wie gar kein Mädel das fertiggebracht hätte, und das auch, wenn sie einmal unwohl gewesen war, was bei dieser zarten Frau gar nicht so selten vorkam.
Jetzt aber —
Ja, wie sollte denn einer dieser rauen Burschen Bescheid wissen, wie man eine bewusstlose Frau behandeln muss?
Das Kleid aufmachen, die Brust reiben, Atmungsbewegungen anstellen?
Ganz schön! Das hätten sie alle gekonnt, aber sie wagten sich eben nicht dran —
Und so standen die Männer schweigend beieinander und starrten über die Reling in die Tiefe hinab, welche ihren Führer verschlungen hatte und nicht wieder hergeben würde — niemals!
Da war auch nicht daran zu denken, dass etwa nun einer von ihnen hinunterging und nach Richard Flint forschte.
Leute, die tauchen konnten, waren ja da, sie hatten auch die nötigen Skaphander an Bord, alles sonst war vorhanden, aber eben keine zweite solche Ausrüstung, wie sie hier unbedingt erforderlich gewesen wäre.
Die hatte sich der Verschwundene nach seinen Angaben fertigen lassen, hatte das Geheimnis gewahrt — hatte es sich ja auch später patentieren lassen und teuer verkaufen wollen —
Nein, nein, es war ganz aussichtslos, dass da jemand versuchte, in die Tiefe zu gehen. Einen zweiten Richard Flint gab es eben nicht.
Da konnte man gar nichts weiter tun als warten, bis die Frau von allein wieder zu sich kam. Was die dann anordnete, das wurde eben besorgt.
Es war eben einer mehr von den Unzähligen, die auf dem Grunde des Weltmeeres der Auferstehung harrten.
Trübselig starrten also die Leute auf die Stelle, wo die letzten Anzeichen von Richard Flint sichtbar gewesen waren — die letzten Luftblasen —
»Lebe wohl, Richard!«, sagte einer und wusste gar nicht, wie töricht er da eben gesprochen hatte. Tote leben nicht mehr und gleich gar nicht mehr wohl, es war eben eine Gedankenlosigkeit gewesen, wie sie manchmal vorkommt, am meisten bei solchen plötzlichen Unglücksfällen, auf Kirchhöfen bei Beerdigungen —
Die anderen fanden jedenfalls nichts dabei, einer wollte sogar ausspucken, besann sich aber, dass in diesem Wasser ein guter Freund sein Ende gefunden hatte. Da ließ er es lieber.
Und in demselben Augenblick geschah das Unerwartete, das ganz und gar Rätselhafte!
Aus der Tiefe kam etwas empor.
Alle gewahrten es zu gleicher Zeit.
Die Augen dieser Leute waren doch daran gewöhnt, das Wasser in große Tiefen zu durchspähen — auch da tut die Übung viel —
Und so sahen sie, dass da noch etwas von dem Boden des Stillen Ozeans emporkam.
Was es war, konnten sie allerdings nicht gleich unterscheiden.
»Das ist eine Flasche!«, sagte Jochen Griepenkerl.
Und Heinz Termooden wusste es noch besser als sein Kamerad.
»Dat's dem Flint sin Buddel!«, sagte er.
Da sahen es auch die andern.
Es war wirklich die Flasche, die Richard Flint regelmäßig beim Tauchen mit sich nahm, in dem helmartigen Dinge, das er auf dem Kopfe trug, und das doch nicht wie andere Taucherhelme beschaffen war.
Martha, seine Frau, erinnerte ihn immer daran, besorgte die Füllung selber, fragte auch ihren Mann regelmäßig, wenn er in große Tiefen ging, ob er auch trinke, und das hatte ja Richard Flint stets getan — auch diesmal, wie aus dem Gespräch bekannt ist, das die beiden miteinander geführt hatten.
Er hatte also die Flasche bei sich gehabt, im Helm.
Dieser aber war natürlich luftdicht abgeschlossen. Da konnte nichts hinein, ebenso wenig jedoch auch etwas heraus.
Und wenn nun hier die Flasche emporkam, dann war der Schluss ganz leicht zu ziehen, da hätte sich auch der beschränkteste Mensch sagen können; dass da der Taucherhelm entzwei gegangen war, eben zerquetscht durch die Wucht des lastenden Wassers.
Daran wäre also gar nicht einmal etwas Wunderbares gewesen.
Das war nur, dass da nicht auch diese Flasche mit zerquetscht worden war!
Die war doch ganz gewiss nicht so fest wie ein solcher Taucherhelm — und gleich gar nicht wie der, den Richard Flint sich hatte fertigen lassen.
Wenn ein solches festes Ding dem Wasserdruck nicht mehr hatte widerstehen können, dann musste diese ganz gewöhnliche Glasflasche doch erst recht daran glauben.
Nun gibt es ja Glas, das auch einen hohen Druck auszuhalten vermag, Martha Flint hätte für ihren geliebten Richard eine Flasche aus solchem Glase anfertigen lassen können.
Wozu denn aber das?
Innerhalb des Taucherhelms hatte das Glas gar keinen hohen Druck auszuhalten gehabt, da war keine besondere Anfertigung nötig gewesen —
Und da hätte die Flasche eben mit dem Helme zugleich zerquetscht werden müssen!
Vor allem hätte sie gar nicht wieder zur Meeresoberfläche emporsteigen können!
Trotzdem tat sie das, kam jetzt durch das klare Wasser, das nur ganz leicht milchig aussah.
Und da war es sehr erklärlich, dass die Männer an der Reling vor Staunen gleich den Mund aufrissen, dass ein paar die Pfeife fallen ließen — was doch an dieser Stelle, die als Grab Richard Flints galt, ganz ungehörig war!
Mit offenem Munde standen sie alle da und starrten auf diese Flasche, und da war sie auch schon auf der Oberfläche angelangt und schwamm.
Sie bestand aus braunem Glase.
Für gewöhnlich — also immer, wenn Richard Flint sie mitgenommen hatte — war ein Stöpsel aus Gummi darauf gewesen, durchbohrt mit einer Glasröhre, an der wiederum ein Gummischlauch befestigt gewesen war — oben dran ein Mundstück. Man kann sich das am besten vorstellen, wenn man an die Saugflaschen für kleine Kinder denkt.
Jetzt war dieser Stöpsel nicht mehr darauf, ein anderer Gummiverschluss war eingesetzt. Das sahen die Leute aber nicht gleich. Sie gewahrten erst etwas ganz anderes —
»Dor is een Papeer drin!«, sagte Jochen Griepenkerl wieder.
Er sprach damit aus, was die anderen auch schon gewahrt hatten.
In der Flasche stak wirklich ein Streifen Papier.
»Dat's een' Flaschenpost!«, erklärte Griepenkerl auch noch.
Solche Flaschenposten sind ja jedem Seemann, jedem Küstenbewohner vertraut. Seeleute, die ihr Ende vor Augen sehen, schreiben ihre letzten Grüße an die Lieben daheim noch schnell auf einen Streifen Papier, stecken den in eine Flasche, die ja immer auf Schiffen vorhanden sind, schließen sie möglichst wasserdicht ab und werfen sie ins Meer.
Dass das Weltmeer Strömungen aufweist, ist schon gesagt worden und ohnedies wohl den meisten Menschen bekannt, man braucht da ja nur an die bekannteste zu denken, den Golfstrom.
Solche Strömungen aber gibt es sonst noch unzählige, und mit ihnen rechnet eben der schiffbrüchige Seemann, vertraut darauf, dass sie sich seines letzten Grußes annehmen und ihn früher oder später nach der Heimat tragen werden — oder wenn auch das nicht — dass ein Schiffer ihn findet und weiterbefördert —
Solche Flaschenposten sind oft jahrelang unterwegs, und immer haben sie wenigstens Aufschluss gebracht über eine jener furchtbaren Katastrophen, wie sie sich von Zeit zu Zeit inmitten der großen Wasserwüsten abspielen.
Jetzt sind solche Flaschenposten schon seltener geworden, als sie es früher waren. Das macht die drahtlose Telegrafie.
Auch kleine Schiffe haben jetzt einen Funkapparat an Bord aufgestellt. Das ist sozusagen ihre Unfallversicherung, und wenn ein Schiff in Not gerät, durch einen Orkan, durch Feuer an Bord oder durch sonst etwas, dann funkt es in die endlose Weite sein SOS, seinen Hilferuf — save our souls — rettet unsere Seelen — unser Leben!
Und welches Schiff diesen Hilferuf auffängt, das eilt sogleich den Bedrohten zum Beistand, da ist schon mancher wackere Seemann vor dem Tode bewahrt worden.
Flaschenposten also sind nicht mehr nötig, um eine letzte Kunde zu geben von sonst verschollenen Menschen, höchstens treiben Vergnügungsreisende einen schlechten Scherz damit, indem sie in die geleerte Champagnerbuddel einen Zettel stecken, mit ein paar Zeilen, die witzig sein sollen — es wäre ihnen recht heilsam, wenn sie die Flüche hören könnten, die der Entdecker einer solchen Flaschenpost ausstößt — vielleicht klingt ihm wenigstens das Ohr — dem witzigen Herrn —
Hier also war eine solche Flaschenpost eingetroffen, und gleich die erste in ihrer Art, das größte von allen Rätseln, die sich hier ereignet hatten.

Richard Flint verunglückte in der Tiefe, wurde wahrscheinlich zu Brei zerquetscht — und konnte noch seine »Luftflasche« benutzen, um seiner Frau und seinen Gefährten einen letzten Gruß zu schicken, hatte auch noch einen anderen Gummistöpsel aufsetzen können!
Na, die Gesichter!
Jedes Witzblatt hätte die Fotografie teuer bezahlt.
So was bringt doch kein Künstler fertig!
Aber das dauerte eben gar nicht lange.
Das spielte sich alles viel rascher ab, als hier erzählt werden kann, namentlich da doch auch einige Erklärungen unumgänglich nötig waren.
Als die Flasche emporkam, als sie dann auf der Oberfläche schwamm und als ihr Inhalt erkannt wurde, da hatte doch auch schon der Heinz Termooden einen Kescher in der Hand, so ein Netz, das an einer Stange befestigt ist —
Im nächsten Augenblick lag die Flasche auf Deck.
Ringsum standen die Männer und starrten sie an.
Aber keiner ergriff sie — die gehörte doch der Witwe des Toten.
Und die lag leblos in ihrer Koje, wohin zwei der Männer sie getragen hatten.
Also hinunter und mal sehen, wie weit sie inzwischen war.
Der Junge, den es auch auf diesem Norweger gab, der aber schon recht ausgewachsen war, schoss nach dem Kajüteneingang, schon aus voller Lungenkraft schreiend —
»Fru Kaptein! Fru Kaptein!«
Er hätte es gar nicht nötig gehabt.
Auf der obersten Stufe stand schon die junge Frau und schien wieder ganz bei sich zu sein.
Noch mehr!
Sie schien bereits zu wissen, dass eine letzte Botschaft von ihrem Richard angekommen war. schien sich nicht einmal darüber zu wundern —
Und so ging sie über die Planken, bis dorthin, wo in dem Kescher die Flasche lag, bückte sich und hob sie auf.
Sie guckte auch nicht erst lange durch die braune Glaswand hindurch, um zu sehen, ob sie so etwas von den Worten lesen könnte, die auf dem Papierstreifen geschrieben standen.
Sie hatte die Flasche in der linken Hand und streckte die rechte aus.
Sie nahm aber nur einen der vielen Pfropfenzieher, die ihr dargeboten wurden, bohrte ihn mühsam genug in den Gummistöpsel, klemmte die Flasche zwischen die Knie und riss ihn heraus.
Und dem Stöpsel folgte auch gleich der Papierstreifen, weil er an dem befestigt war.
Sie hielt ihn in der Hand und starrte auf die Schrift.
»Das hat Richard nicht geschrieben«, sagte sie.
Und da — es klingt vielleicht sonderbar — da atmeten die Seebären rings um sie auf, hörbar —
Es war ihnen eine wahre Erlösung, dass Richard Flint nicht mehr hatte schreiben können.
Erst dann dachten sie, dass es doch viel sonderbarer sei, falls ein anderer geschrieben haben sollte —
Es war doch geradezu lächerlich — ja, Wahnsinn — anzunehmen, dass der Taucher so tief unter der Meeresoberfläche einen anderen Menschen getroffen haben, dass dort überhaupt ein lebendes Wesen zu finden gewesen sein sollte!
Martha Flint aber dachte überhaupt nichts.
Sie hielt den Papierstreifen in der einen Hand — er hing immer noch an dem Gummistöpsel — in der anderen hatte sie die Flasche — und die ließ sie nun fallen —
Also bloß das kleine Stück von ihrer Hand bis zu den Deckplanken.
Und doch gab es gleich einen Krach, ein Klirren —
Die Flasche war in viele Scherben zersprungen, ein klarer Beweis, dass sie nicht doch etwa aus besonders hartem Glase bestand.
Darauf achtete auch gar niemand.
Alle guckten auf die junge Witwe, und alle sahen jetzt, dass auf dem Zettel Zahlen standen — eine Ortsangabe, wie sie ihnen, als Seeleuten, vertraut war.
Und Martha Flint las laut:
Siebenundzwanzig Grad neun Minuten südliche Breite. Hundertneun Grad zwanzig Minuten westliche Länge von Greenwich!
Sie selber verstand von der ganzen Seefahrt nicht die Bohne, war eben nur ihrem Richard zuliebe mit an Bord gekommen.
Es war sogar zweifelhaft, ob sie wusste, was diese Zahlen zu bedeuten hatten.
In der Schule hatte sie ja gelernt, was Breite und Länge bedeuten, sie hatte ja selber Erzieherin werden wollen — aber da ist doch die Praxis wieder was ganz anderes als die Theorie, die immer grau bleibt —
Sie wusste nicht, was diese Zahlen besagten.
Von den Jan Maats um sie her wusste es auch keiner.
Aber jeder verstand doch wenigstens so viel, dass nach dieser Angabe die Stelle zu finden sein musste.
Nein, einer wusste doch Bescheid, traute sich nur nicht gleich, seine Weisheit zum Besten zu geben, tat es erst, als die anderen ratlos standen.
»Das ist Rapanui«, sagte er.
»Rapanui?!«, wiederholte Frau Martha. »Wo liegt denn das? Was ist denn das? Eine Insel?«
»Die Osterinsel ist es!«, erklärte da Heinz Termooden, der einzige, der an Bord »Bildung gelernt hatte«, der sich aber bis dahin wohlweislich gehütet hatte, das merken zu lassen.
Denn das ist auch so eine Eigentümlichkeit des Jan Maat, die den Landratten wenig bekannt ist: dass er alles, was Bildung heißt, gründlich verachtet, unter Bildung natürlich nur geistiges Wissen verstehend, und wenn Matrosen miteinander streiten, dann trumpft wohl einer auf und wirft seinem Gegner als größte Beleidigung die Worte hin:
»Du hast wohl Bildung liert?«
Um Gottes willen! Nur das nicht! Nur nicht etwa verraten, dass man von der Schule weggelaufen ist! Das wäre ein großer Makel!
Heinz Termooden ließ es doch einmal darauf ankommen, und in der Erregung und bei der großen Neugier der anderen ging das Geständnis durch. Alle guckten ihn sogar erwartungsvoll an, wollten Genaueres wissen.
Heinz Termooden erzählte, was er wusste.
Rapanui, das heißt das große Rapa, ist bekannter als unter diesem Namen unter dem der Osterinsel, und diesen wieder verdankt sie dem Umstande, dass sie am Ostermontage durch den holländischen Seefahrer Roggeveen entdeckt wurde — im Jahre 1722. James Cook kam erst 1774.
Die dreieckige Insel besteht aus Lava und weist keine Bäume auf, dafür aber manches andere, was sie sehr, sehr merkwürdig macht, vor allem die kolossalen Steinfiguren.
Diese gehören zu jenen Rätseln, welche die Vorzeit uns Gegenwartsmenschen hinterlassen hat und die nie aufgeklärt werden können. Ebenso die mächtigen Steinhäuser, bis zu 110 m lang, aber nur 3 breit, die Terrassen aus Zyklopensteinen, 10—12 m lang, 4 breit, wie man sie sonst nur in Peru in den Ruinen von Pachacámac wiederfindet.
Jedenfalls enthält die Insel, die zweitausend Seemeilen von Südamerika entfernt ist — dieses ist das nächste Landgebiet — einen noch tätigen und viele bereits erloschene Krater.
Die Bewohner sind elende, verkommene Menschen, von denen noch zu reden sein wird.
Sie sind dem Aussterben geweiht, da die Todesfälle die Geburten um das Doppelte übertreffen, und weil nur etwa 600 Menschen auf diesem Eiland leben, so kann dieses Ende gar nicht mehr lange dauern, lässt sich also durch einfache Reihenrechnung feststellen.
Ebenso bekannt wie diese Osterinsel, vielleicht noch bekannter als sie, ist das noch viel kleinere Eiland Sala y Gómez, das Chamisso besungen hat, eine trostlose graue Felsmasse von etwa 38½ km Ausdehnung, die Brutstätte unzähliger Seevögel —
Heinz Termooden hätte vielleicht noch manches von dieser seltsamen Insel erzählen können, hütete sich jedoch wohlweislich, und was er sagte, das genügte ja auch —
Oder es genügte eben ganz und gar nicht!
Was sollte denn Frau Martha Flint auf dieser Insel?
Und vor allem: Wer schickte sie dorthin? Wer hatte diese Ortsangabe hier auf den Papierstreifen geschrieben und diesen mitsamt der nun zerbrochenen Flasche an sie gesandt?
Ja, wenn die junge Witwe hätte erzählen wollen, was sie noch zuletzt mit ihrem Manne gesprochen, was dieser ihr erzählt hatte — von dem herrlichen Hause, den schönen Mädchen, die aus ihm getreten waren — und so —
Aber das waren doch Ausgeburten eines kranken Hirns gewesen. Richard Flint hatte da schon nicht mehr seine Sinne beisammen gehabt —
Und Frau Martha wollte auf keinen Fall, dass die Männer hier etwas davon erfuhren. Da hätte sie sich für ihren nun toten Richard geschämt —
Es war doch auch noch etwas dabei: Jenes Geständnis, das er ihr von dem Grunde des Stillen Ozeans aus gemacht hatte, dass er dort etwas ganz Besonderes suchte, und dass er eine Million Dollar dafür bekommen würde, wenn er es fände, dass er dann seiner Frau ein Rittergut kaufen und mit ihr dort leben wollte —
Ach ja, sie hatte sich doch so gefreut über diese Aussicht, weil sie eben dieses Zigeunerleben auf dem Meere hasste, gar nicht dafür geschaffen war —
O, wenn doch ihr Richard zurückgekommen wäre!
Und nun stand sie und hatte den Papierstreifen in der Hand und grübelte vergebens, ganz vergebens über das ungeheuerliche Rätsel nach, das damit verbunden war — man mag sich nur an ihre Stelle versetzen —
Aber sie war eine liebende Frau, und das einfach genug, dass sie immer noch hoffte, ihr Richard könne irgendwo am Leben geblieben sein. Da ist eben die Liebe, so edel sie an sich sein mag, auch wieder sehr selbstsüchtig, sagt immer: Wenn nur mein Mann leben bleibt! Was aus den andern wird, das ist doch Nebensache.
Hier war jedoch wirklich so gut wie keine Hoffnung mehr.
Der berühmte Strohhalm, an den sie sich hätte klammern können, war ein dünner Streifen Papier, auf dem stand die Ortsbestimmung der Osterinsel, des Eilands Rapanui.
Schweigen herrschte ringsum.
Keiner der Männer wusste, nachdem Heinz Termooden seine »Bildung« verraten hatte, was er sagen sollte.
Da erklang die Stimme Frau Marthas.
»Wir fahren gleich einmal hin, wir müssen doch sehen, was das zu bedeuten hat!«
Und weil sie den kostbaren Papierstreifen nicht mehr aus der Hand geben wollte, las sie noch einmal die darauf verzeichneten Zahlen ab.
»Siebenundzwanzig, neun südlich — hundertneun, zwanzig westlich!«
Unwillkürlich wiederholte es Hinnerk Steffens, der Steuermann, und wenn er es auch vergaß, so war das nicht schlimm.
Rapanui stand doch auf den Seekarten verzeichnet, würde sich schon finden lassen.
Dann ging Martha Flint wieder in ihre Kajüte hinunter und war verschwunden, ehe einer sie hatte fragen können, ob der Schrecken ihr auch nichts geschadet hätte —
Die Männer machten sich weiter keine Gedanken darüber.
Der Steuermann nahm den Ort auf, »schoss« nach der Sonne, bestimmte den einzuschlagenden Kurs, und da kein Anker ausgeworfen war — bei der hier herrschenden Meerestiefe ein ganz unmögliches Beginnen — so wurde Segel gesetzt, die Hilfsmaschine wurde in Gang gebracht, und ehe eine halbe Stunde vergangen war, verließ der plumpe Norweger die Unglücksstelle, wo Richard Flint sein Grab gefunden hatte, und schlug den Weg durch die endlose Wasserwüste ein.
Kurs Rapanui — — die Osterinsel!
Über die Fahrt braucht nichts berichtet zu werden, denn sie verlief ohne den geringsten Zwischenfall, und als der Ausguck verkündete, dass die Insel in Sicht gekommen sei, erschien auch Martha Flint wieder, die sich bis dahin nicht hatte auf Deck sehen lassen.
Um sie zu kümmern hatte sich niemand brauchen, sie war doch eine Frau, die für sich sorgen konnte, und als sie nun wieder sichtbar wurde, war sie noch ganz genau, wie sie vor dem Unglück gewesen war, still, wortkarg, etwas blasser vielleicht.
Sie konnte ja keinem erzählen, was sie inzwischen durchgemacht, wie sie zwischen Hoffnung und Verzweiflung geschwebt hatte.
Das würde zeitlebens ihr Geheimnis bleiben, musste es auch, aber in ihren Augen war doch ein seltsames Leuchten, als sie die Umrisse des Eilandes erblickte und niemand hörte, was sie innerlich zu sich selbst sagte:
»Nun bin ich da, Richard, nun werde ich bald die Insel betreten, die Du mir als Ziel genannt hast. Nun musst Du mir aber auch weiterhelfen, dass ich Dich finde —«
Für sie unterlag es also gar keinem Zweifel, dass die geheimnisvolle Botschaft wirklich von ihrem Gatten stammte, trotzdem eine andere Hand die Zahlen niedergeschrieben hatte, und ebenso fest war sie überzeugt, dass sie auf diesem weltenfernen Inselchen noch mehr zu hören oder zu lesen bekommen würde —
Die Liebe glaubt alles, sie hofft alles, sie überwindet alles! Die Liebe einer echten Frau!
Und die war Martha Flint.
Wie üblich kamen die Bewohner der Insel sofort in ihren Kanus zu dem Schiffe gerudert, dessen Ankunft für sie ja ein großes Ereignis bedeutete.

Wer nichts dort zu suchen hat, der läuft doch Rapanui nicht an, es ist eben so ganz und gar nichts dort zu holen.
Die Männer brachten auch gleich ihre Frauen und ihre Töchter mit.
Das ist nun eben dort einmal nicht anders, dafür haben die Matrosen der wenigen Schiffe gesorgt, die dort angelegt haben — der Menschen- — oder besser gesagt — der Frauenhandel konnte beginnen, aber er hätte für die Leute von dem Taucherschiff nichts Lockendes gehabt.
Mit den armseligen Menschenkindern musste doch jeder Mitleid haben! Die waren von allerhand Krankheiten zerfressen und entstellt —
Schon eher willkommen waren die frischen Nahrungsmittel, die zum Tausche angeboten wurden. Die Bewohner der Insel verstehen wenigstens, dem Lavaboden das abzugewinnen, was sie zum Leben brauchen, und so entspann sich bald ein Handelsgeschäft.
Martha Flint achtete nicht darauf.
Sie stand etwas abseits von den Männern, nur Heinz Termooden neben sich, und ließ sich erklären, wie sie, zum Teil wenigstens, schon von Bord aus sah: eben die sonderbaren Terrassenbauten, die sich in der Nähe der Küste erheben, und die wohl am genauesten von dem deutschen Kapitänleutnant Geisler beschrieben worden sind, der im Jahre 1882 im Auftrage seiner Regierung mit dem Kanonenboot »Hyäne« die Insel besucht und durchforscht hat.
Das ist eben eine ganz sonderbare Geschichte, die sich, wie bereits erwähnt, wohl auch niemals aufklären lassen wird.
Auf dieser Insel haben einmal Geschöpfe gelebt — Menschen kann man sie nicht nennen, denn sie müssen wahre Riesen gewesen sein — und diese Riesen haben nicht nur verstanden, den ungeheuer harten rötlichen Lavastein zu brechen, sondern ihn auch so zu glätten, dass sich zwischen zwei solche aufeinandergelegte Blöcke nicht einmal die dünnste Messerklinge bohren lässt.
Das klingt vielleicht gar nicht so wunderbar, wie es tatsächlich ist.
Auch die Pyramiden sind ja aus solchen Steinblöcken zusammengesetzt, die von weit, weit her gebracht wurden.
Zehntausende von Menschen haben jahrzehntelang daran arbeiten müssen, und man hat lange angenommen, dass auch diese Blöcke, die gleichfalls ganz dicht aufeinander liegen, nur mit Steinwerkzeugen geglättet worden seien.
Bis man einmal zwischen zweien doch ein dünnes Stück Eisen entdeckte, das infolge eines Versehens der Bauleute dort liegen geblieben war.
Da wusste man auf einmal, dass die Pyramidenbaumeister das Eisen schon gekannt, eiserne Werkzeuge besessen hatten.
Die Bewohner von Rapanui, jene unbekannten Riesen, haben jedoch kein Eisen gekannt, ebenso wenig wie die Untertanen der Inkas in Peru, und doch haben sie ungeheure Steinblöcke, ganze Felsen so fein geglättet, dass sie wie geschliffen aussehen, dass unsere Ingenieure sich noch heute dieses Wunder nicht zu erklären vermögen, und noch viel weniger, wie diese Menschen und Riesen die ungeheuren Lasten heben, aufeinandertürmen konnten, wie sie sie bewegten!
Das bringt eben unsere Ingenieurkunst noch heutzutage nicht fertig.
Dazu müssen entsprechende Maschinen aufgestellt, vielleicht erst erdacht werden.
Und solche kolossale Bauwerke aus grauester Vorzeit gibt es auch sonst noch auf Erden, da braucht man nur die Steine von Carnac und Morbihan zu nennen, das Stonehenge, die Riesenstatuen von Bamian, die Felsentempel Indiens, ja, sogar die chinesische Mauer —
Und die armseligen Bewohner von Rapanui wissen selbst nicht, wer diese großen Steinhäuser auf ihrer Insel gebaut hat, wer die mächtigen Terrassen ausführte und die Bildsäulen schuf, die überall umherliegen und noch aufrecht stehen, allesamt das Gesicht nach Osten gekehrt — eigentlich nur mächtige Steinbalken, bis zu zehn Meter hoch, an den Schultern einen Meter breit — die Gesichter nicht etwa eins wie das andere, sondern ganz charakteristisch, jedes ein anderes Vorbild nachahmend, auf dem Kopfe große, zylinderähnliche Hüte — Ja, wer ist da einmal an der Arbeit gewesen?
Ist die Erde wirklich einmal von Halbgöttern bevölkert gewesen? Und sind diese den Riesen gefolgt, von denen ja auch die Bibel erzählt, die für viele noch jetzt maßgebend für das ist, was sie glauben sollen, was nicht?
Nun, die einfachen Matrosen auf dem Taucherschiffe zerbrachen sich darüber den Kopf nicht, sie guckten nach den Steinterrassen hinüber, aber aus einem ganz anderen Grunde als etwa ein Forschungsreisender.
Sie wollten nur wissen, was sie eigentlich hier sollten — weiter gar nichts!
Und am meisten bewegte diese Frage das Gemüt der jungen Witwe.
»Warum bin ich durch diese geheimnisvolle Botschaft hierher geschickt worden?«
Das fragte sie sich immer wieder und fand natürlich keine Antwort.
Sie guckte auf die braunen Naturmenschen, die das Deck bevölkerten, schnatternd, Tabak bettelnd —
Mit denen konnten sie sich nicht verständigen, wenn auch manche ein paar Brocken Englisch sprachen.
»Wir wollen hinüber!«, sagte sie endlich.
Hinnerk Steffens nickte, jagte erst einmal das Eingeborenengesindel von Deck, indem er einen Spritzenschlauch an den Kessel schraubte.
Das Wasser darin war nicht mehr heiß, aber noch recht hübsch warm, und wenn es mit dem nötigen Druck aus dem Rohre schoss, so genügte das schon —
Die Rapanuinesen flohen Hals über Kopf in ihre Kanus, ruderten dem Lande zu, das Taucherschiff ging so nahe wie möglich an dieses heran, es wurde gelotet, aber die Tiefe war viel zu groß, als dass man hätte ankern können. Man musste in einem der Boote eine starke Trosse an Land schaffen und sie um einen der feststehenden Felsblöcke schlingen. Da war man wenigstens etwas gegen das Abtreiben des Schiffes gesichert.
Darauf wurde das kleinste Boot ausgeworfen, in dem Frau Martha schon Platz genommen hatte. Sechs Matrosen ruderten.
Bald war der Strand erreicht, man stieg aus.
Und wohin nun?
Niemand wusste es, es war ein ganz seltsamer Fall, aber die sechs Matrosen brannten nicht weniger darauf, die Lösung des Rätsels zu erfahren als die junge Witwe, und da die junge Witwe allein zu bestimmen hatte, wohin es nun gehen sollte, schauten alle auf sie.
Aber Frau Martha Flint wusste selber nicht, was sie tun sollte.
Da kam ihr einer der Eingeborenen zu Hilfe.
Vielleicht war es der Häuptling, er nannte sich wenigstens King, also König, und da er wusste, was weiße Menschen, die auf seine Insel kamen, allemal zu sehen wünschten, so übernahm er die Führung, etwas von einem »stone pit« erzählend, was also Steinbruch bedeutete.
Und Frau Martha Flint nickte und folgte dem Manne, hinter sich die sechs Männer.
So kamen sie an eine Stelle, wo sie allerdings wieder staunen mussten.
Es war ein Berghang, der einst die Werkstätten dieser Steinmetzen und Bildhauer gebildet hatte.
Aus dem Felsen hatten sie hier die Figuren herausgemeißelt und wahrscheinlich an Seilen den Hang herabgelassen.
Noch jetzt war zu sehen, wie die Leute gearbeitet hatten.
Sie schienen mitten in ihrer Beschäftigung durch irgendwas gestört worden und fortgegangen zu sein, denn angefangene und halbfertige Bildsäulen hafteten noch an dem Gestein.
Da war es schon erklärlich, dass die Matrosen von dem King zu erfahren suchten, was das alles zu bedeuten hätte. Aber sie erhielten nur ungenügende Auskunft.
Der Mann wusste selber nichts, und was er vorbrachte, das hatte er sicher erst von Europäern gehört, hatte manches aufgeschnappt, das er nun als eigne Weisheit zum Besten gab.
Während die Männer und die junge Witwe noch so dastanden, hilflos und ratlos, geschah etwas, was sie gar nicht gleich bemerkten.
Auch hier erhob sich eins jener langen, aus Stein ausgeführten Häuser, wie sie sonst noch an verschiedenen Stellen zu erblicken waren, dieses aber ohne das Binsendach, das die Eingeborenen den übrigen aufgesetzt haben.
Und in der Eingangsöffnung dieses Hauses erschien jetzt ein Mann, ein über zwei Meter hoher, ungeschlachter Geselle, den mächtigen Oberkörper in einem schwarzen oder vielleicht auch dunkelblauen Hemde, dessen aufgestreifelte Ärmel die Muskeln riesenstarker Arme sichtbar werden ließen — um die Hüften einen breiten Ledergürtel, der nicht nur die einmal weiß gewesene Hose festhielt, sondern auch gleichzeitig als ein wahres Arsenal von Waffen diente — und in hohen, geschmeidigem Stiefeln, die bis zum halben Oberschenkel reichten.
Einen Hut trug der Mann nicht, schien ihn gar nicht zu brauchen, da sein brandrotes Haar dicht wie ein Fell war, und der lange Bart, der auf die Brust herabhing, war ebenfalls brandrot, aber schon von weißen Fäden durchzogen.
Selber ungesehen, beobachtete der Mann die Fremden, machte sich aber nicht bemerklich, sondern wartete, bis bei einer Wendung Jochen Griepenkerl ihn erblickte.
»Da schlag doch Gott den Teufel tot!«, stieß Jochen hervor.
Die anderen hörten es, wendeten sich gleichfalls um und erblickten nun den Mann.
Aber nur Frau Martha ahnte gleich, dass er der sein müsste, wegen dessen sie hierher geschickt worden war.
Und da muss an etwas erinnert werden, was bisher nicht erwähnt werden konnte, aus dem einfachen Grunde, weil weder jemand an Bord des Norwegers noch die eigene Frau von Richard Flint erfahren hatte, was er eigentlich dort in der Tiefe des Stillen Ozeans hatte suchen und finden wollen.
Nur die paar Andeutungen hatte er seiner Frau gegeben, während er in die schwarze Tiefe hinabging — dass er sich eine Million Dollar verdienen wollte —
Er war also von Mister Samuel Philipp verpflichtet worden, nach dem Loke Klingsor zu suchen und, falls er ihn fände, die Runen auf dessen Rücken abzuzeichnen.
Richard Flint hatte also die Expedition nach dem Stillen Ozean leiten sollen, hatte auch eine genaue Ortsbestimmung erhalten, wo er tauchen sollte, hatte das auch befolgt und war dabei verunglückt — wenigstens nicht wiedergekehrt.
Nun aber hatte doch Mister Samuel Philipp jeder dieser Expeditionen eine Frau mitgegeben, ein Weib, das nicht nur durch Körperschönheit bezaubern konnte, sondern auch noch eine Künstlerin sein musste — die Olinda war eine Sängerin, die Bella Cobra eine Tänzerin, die Signorina Ravelli meisterte die Geige.
Und außer diesem Weibe, das den Loke Klingsor aus seinem Versteck hervorlocken sollte, hatte Samuel Philipp dem Führer jeder Expedition auch noch einen anderen Mann zur Seite gegeben, ohne zu sagen, welche Aufgabe der hätte.
O'Donnell hatte sich die Begleitung durch Snatcher gefallen lassen müssen, Charles Dubois die des Hornfisches. Nur Antonio Almeida, der in Brasilien tätig war, hatte bisher noch keinen solchen Begleiter gehabt.
Und bei Richard Flint war nicht nur dieser nicht vorhanden gewesen, sondern er hatte auch kein solches berückendes weibliches Wesen, das zugleich irgendeine Kunst beherrschte, mitbekommen.
Sollte der verschlagene und gerissene alte Herr in New York das mit Absicht getan oder vielleicht die doch durchaus nicht schöne Martha Richter, verehelichte Flint, für geeignet erachtet haben, den Loke Klingsor zu einem Seitensprunge zu verleiten?
Daran war doch auf keinen Fall zu denken.
Und außerdem hatte er ihm also auch keinen Begleiter gegeben.
Das entsprach ganz und gar nicht dem misstrauischen Charakter dieses Menschen.
Und nun war diese Expedition ja auch schon gescheitert. Richard Flint hatte sich die Million Dollar nicht verdienen können, war dabei verunglückt und lag nun, zu einer formlosen Masse zerquetscht, auf dem Boden des Stillen Ozeans.
Ja, so musste jemand urteilen, der Samuel Philipp eben gar nicht kannte.
Aber der war doch viel gerissener, als jemand glaubte, der hatte seine Pläne auch nicht von gestern auf heute entworfen, sondern sie ganz sorgsam überlegt, jahrelang alle Einzelheiten erwogen —
Und wie er da gearbeitet hatte, das sollte sich eben wieder einmal zeigen, allerdings ohne dass Martha Flint etwas ahnte.
Als Jochen Griepenkerl den Fremden entdeckte und seinen Ausruf tat, sagte sich Martha Flint sogleich:
»Von diesem Manne wirst du erfahren, was du wissen willst und wissen musst. Seinetwegen hast du nach diesem Eiland fahren müssen!«
Und da war es eben ganz und gar nicht verwunderlich, dass sie gleich auf ihn zuging, ihm die eine Hand zum Gruße bot und einfach sagte:
»Guten Tag! Ich bin Martha Flint und wurde nach dieser Insel geschickt!«
Sie brachte auch schon den Papierstreifen hervor, den sie immer bei sich trug, und hielt ihn dem Manne vor die Augen.
Anfangs freilich schien es, als hätte der Fremde nicht das geringste Interesse — weder für Frau Martha verwitwete Flint noch für den Papierstreifen — so guckte er die sechs Männer der Reihe nach an und schüttelte endlich den rotmähnigen Kopf.
»Wo habt ihr ihn denn?«, fragte er dann.
Und Frau Martha wusste sofort, was er meinte.
»Richard Flint ist nicht mit uns gekommen«, erwiderte sie.
»So? Warum denn nicht? Wo steckt er denn?«
Da hätte nun die junge Witwe wahrheitsgemäß sagen müssen: Er liegt auf dem Grunde des Meeres, tot —
Sie dachte nicht daran, sondern antwortete ruhig:
»Er ist nicht mitgekommen, aber er hat uns hierher geschickt. Diesen Zettel sandte er mir —«

Da nahm der Fremde den Zettel, las die Zahlen aber gar nicht, sondern zuckte zusammen, gab das Stückchen Papier hastig zurück und murmelte nichts weiter als:
»Na da!«
Das kam der jungen Witwe etwas gar zu wenig vor, und schon wollte sie
den Mund öffnen, um eine neue Frage an den Fremden zu richten, da besann dieser sich anscheinend, guckte noch einmal die sechs Seeleute an, schüttelte den Kopf und sagte darauf:
»Ihr könnt gehen! Lasst mich allein mit dieser Frau!«
Selbstverständlich kümmerten sich die Seeleute nicht um den Befehl, sondern blieben stehen, wo sie standen, aber als Frau Martha ihnen nun ebenfalls zuwinkte, dass sie sich entfernen möchten, da gingen sie, kletterten über das Steingeröll und setzten sich in einiger Entfernung nieder, bereit, sofort aufzuspringen und zu Hilfe zu eilen, falls sich das als nötig erweisen würde.
Das ward vorläufig nicht nötig, sie konnten es wenigstens nicht beurteilen, denn der rothaarige, riesenhafte Fremde trat nunmehr, wie sie beobachteten, zur Seite, und an ihm vorüber ging die junge Witwe in das Innere des Steinhauses, wohin er ihr folgte.
»Na da!«, sagte Jochen Griepenkerl, und da er nichts zu tun wusste, zog er Pfeife und Tabak hervor, stopfte sich eine und brannte sie an, und seine Kameraden hielten das auch für das Vernünftigste, was sie tun konnten, und brannten sich auch eine an.
Und dann warteten sie — — —
»Na da!«, sagte Jochen Griepenkerl noch einmal.
Und hier sollte ich den Mann erwarten, der mich auf der weiteren Fahrt begleiten würde«, sagte Antonio Almeida zu Signorina Ravelli, die noch ganz entsetzt auf das Gerippe starrte, zwischen dessen Rippenknochen also nicht nur die abgebrochenen Bambusstauden hervorragten, sondern auch bereits neue gewachsen waren.
Die Künstlerin verstand allerdings nicht das Rätsel, das hier immer noch vorlag, sie wusste nicht, was schon angedeutet wurde, wie ungeheuer schnell dieses Gras sonst wächst, konnte sich also auch nicht darüber wundern, dass hier erst kleine Sprösslinge da waren.
»Hier?«, fragte sie nun. Und dann setzte sie gleich hinzu, was so nahe lag: »Vielleicht war es der Unglückliche, vor dessen Überresten wir hier stehen?«
Denselben Gedanken hatte auch Antonio Almeida schon gehabt, auch ihm war er ohne Weiteres gekommen, aber er hatte ihn alsbald wieder abgewiesen.
Den Grund sprach er jetzt aus.
»Dieses Gerippe liegt schon lange hier«, sagte er. »Es müsste, nach dem Zustande der Knochen zu urteilen, allerdings bereits längst wieder vom Bambus überwuchert sein. Ich kann nicht sagen, warum das nicht der Fall ist. Auf keinen Fall aber war dieser Mann, der hier ein entsetzliches Ende gefunden hat, der, den ich nach Mister Philipps Behauptung hier finden würde.«
»Und warum nicht?«, wollte die Ravelli wissen.
»Weil er schon tot war, ehe ich überhaupt von Mister Philipp meinen Auftrag empfing«, lautete die Antwort des jungen Mannes.
»Ja, aber hier ist doch niemand zu sehen! Und wer sollte denn hierher kommen, vielleicht sogar allein?«, fragte die Ravelli weiter.
»Ich weiß es auch nicht«, konnte ihr Begleiter nur antworten. »Vielleicht befindet sich der Betreffende schon hier oder er kommt noch — ob allein oder ebenfalls mit einer Karawane, das weiß ich auch nicht — wir müssen jedenfalls warten —«
Und als wollte er sich dieses Warten verkürzen, trat er dicht an das Gerippe, kniete schließlich sogar daneben nieder.
Signorina Ravelli stand dicht neben ihm und hörte so, was er murmelte, als spräche er zu sich selbst:
»Er ist von oben in weitem Bogen herabgeschleudert worden. Von einem Sturz infolge eines Fehltrittes kann keine Rede sein, da läge er dicht unter der Felswand.
Nein, nein, den hat man von dort oben herabgeschleudert, hat ihn an Händen und Füßen gehalten —«
»Mit der Absicht, dass er sich hier unten an dem Bambus aufspießte?«, rief die Künstlerin entsetzt.
»Ich kann es mir nicht anders denken«, gab Antonio Almeida zu.
»Dann müssten also Menschen dort auf dem Felsen leben?«
»Und zwar grausame, erbarmungslose Menschen!«
»Mit denen wir werden kämpfen müssen?«
Antonio Almeida lächelte leicht.
»Sie wohl schwerlich, Signorina. Das werden Sie schon mir überlassen müssen — und dem, auf den wir hier stoßen sollten —«
»Aber gegen eine Übermacht, gegen einen ganzen Stamm von Wilden können doch Sie nicht an — auch zu zweit nicht!«, rief die Italienerin.
Antonio Almeida zuckte die Achseln.
»Wilde fürchten uns Weiße wegen unserer überlegenen Waffen«, erklärte er dann beruhigend. »Da vermag ein weißer Mann wohl gegen eine ganze Horde nicht nur zu kämpfen, sondern auch zu siegen.
Jetzt aber wollen wir nicht an solche Möglichkeiten denken, die vielleicht nie eintreten werden, jetzt will ich einmal nachsehen, ob ich nicht etwas zu finden vermag, was über die Persönlichkeit dieses Unglücklichen Aufschluss geben könnte.«
Er suchte sorgsam den Boden ab, und die Ravelli sah zum ersten Mal, wie das von einem solchen erfahrenen Waldmenschen und Jäger gemacht wurde.
Sie konnte nur staunen!
Jeden Zollbreit des Bodens durchforschten die Augen und dann die Hände Antonio Almeidas. Wenn etwas vorhanden war, was diesem Unglücklichen gehört hatte, ihm bei dem Todessturze entfallend, dann musste es jetzt gefunden werden.
Aber es war eben nichts vorhanden, gar nichts!
»Man hat ihm alles abgenommen, ihn ausgeplündert, ehe man ihn umbrachte«, erklärte der junge Mann. Selbstverständlich hatte er auch keine Waffen mehr — aber zu einem erbitterten Kampfe scheint es auch nicht gekommen zu sein, sonst wäre vielleicht ein Knochen verletzt, ein Pfeil hätte in dem Körper gesteckt und müsste nun hier liegen —
Wir wollen ihn wenigstens begraben!«, setzte er hinzu, indem er sich aufrichtete.
Sie hatten kleine Grabscheite, ähnlich den Pionierspaten, bei sich, mittels deren sie schnell eine genügend tiefe Grube aushoben. Sie betteten die Überreste des Unbekannten hinein, warfen einen kleinen Hügel auf, und dann ging die Ravelli zu ihrem Gepäck, suchte einen Lederbeutel heraus, der ganz, ganz sorgsam verschlossen war, entnahm ihm einen schwarzen, polierten Kasten, zog aus ihrem Kleide über der Brust ein Ledertäschchen und entnahm ihm einen kleinen Schlüssel.
Mit diesem schloss sie den Kasten auf.
Eine Geige kam zum Vorschein, ein wunderbares Instrument — das sah auch Antonio Almeida — und regungslos wartete er, bis die Ravelli die Geige herausgenommen, rasch gestimmt und einige Passagen ganz leise zur Probe gespielt hatte.
Dann trat sie vor den frischaufgeworfenen Hügel, setzte das Instrument an und begann zu spielen.
Antonio Almeida war kein Kenner, hatte in seinem Leben nur selten genug Musik gehört, noch weniger Geigenspieler, aber er besaß die Gabe, Töne zu verstehen, und nun gleich diese Töne hier, die die begnadete Künstlerin inmitten der Wildnis ihrem Instrument entlockte.
Mit einer Totenklage begann sie, erschütternd, immer wieder von ganz tiefen Noten zu hohen überleitend —
Doch das kann ja gar nicht mit Worten geschildert werden. Das muss gehört werden —
Jedenfalls stand Antonio Almeida regungslos und schämte sich der Tränen nicht, die still aus seinen Augen rannen, bis die Ravelli mit ihrer Wundergeige auch nach der Klage den Trost fand, die Zuversicht auf ein Wiederfinden in einem besseren Jenseits, jubelnd, verheißungsvoll.
Der junge Jäger hätte sich vor ihr niederwerfen und sie anbeten können, wenn sie das verlangt hätte.
Wie eine Gottheit schien sie ihm und eine Gottheit war ja auch in ihr, befähigte sie zu dieser Musik.
Selbst die Indianer, die abseits hockten, waren gepackt, starrten auf die wunderschöne weiße Frau wie verzückt.
Die Ravelli ließ die Geige sinken, und da erst gewahrte Antonio Almeida, dass auch in ihren dunklen Augen Tränen standen.
»O, Sie!«, stieß er hervor, trat zu ihr, beugte sich, erfasste die schlaff niederhängende Hand, die den Bogen hielt, und presste seine Lippen auf die zarten Finger.
Jetzt verstand er, warum Samuel Philipp ihm diese Künstlerin mitgegeben hatte.
Mit ihrer Kunst musste sie ja die Teufel aus der Hölle locken, und sicher auch jenen geheimnisvollen Loke Klingsor aus seinem Versteck!
»O, wenn Sie auch an meinem Grabe so spielen würden!«, rief er.
Da lachte die Ravelli hell auf, und auch dieses Lachen aus ihrem Munde war Musik, aber eine ganz andere als die der Geige —
»Sterben! O, wer wird an den Tod denken!«, erwiderte sie und schien zu vergessen, dass sie an einem Grabe stand, das sich eben erst geschlossen hatte.
»Leben will ich — leben —!«
Sie breitete beide Arme aus, sie gegen den Himmel hebend.
Bald aber kehrte sie zur Wirklichkeit zurück, barg die kostbare Geige wieder in dem Kasten, verschloss ihn, tat den Schlüssel in das Ledertäschchen, den Kasten in den Beutel —
Und dann sagte sie, wiederum hell lachend:
»Nun wissen Sie, was Sie zu schützen haben, Senhor Antonio!«
»Ich weiß es«, erwiderte er ernst.
»Jetzt aber wollen wir versuchen, ob dieser Gang da nach der Höhe des Felsens hinausführt!«, fuhr die Künstlerin fort. »Wir müssen arbeiten, Freund, um unseren Auftrag zu erfüllen.«
»Sie? Auch Sie?«, stieß jedoch Antonio Almeida hervor. »Ich kann doch gar nicht glauben, dass Sie nötig haben, in diese Wildnis zu gehen, sich unbekannten Gefahren auszusetzen, um eine Million Dollar zu verdienen! Die können Sie doch viel bequemer und schneller zusammenhaben, wenn Sie Konzerte geben —«
»Sprechen wir nicht davon!«, unterbrach die Ravelli ihn, und ihr schönes Gesicht verfinsterte sich. »Sie sehen, dass ich gewählt habe. Ich bin hier, und das muss als Beweis genügen, dass ich mir die Million doch auf diese Weise verdienen möchte — verdienen muss! Jetzt genug davon!«
Sie näherte sich jenem Loche in der Steinwand, dem zur Seite also ein roter Pfeil angemalt war.
»Bitte, mein Herr!«, sagte sie dort, mit einer einladenden Bewegung.
Doch Antonio Almeida kroch nicht in das Loch.
»Es wird genügen, wenn ich es erst einmal erforsche«, sagte er. »Sie können hierbleiben und meine Waffen behüten. welche ich nicht mitnehmen kann.«
»Wie der hohe Herr befehlen!«
So kroch Antonio Almeida allein in den Gang, denn dass es sich hier nicht bloß um eine Höhle oder eine höhlenartige Vertiefung handelte. das hatte er nun schon erkannt, er wusste, dass dieser Gang nicht durch die Natur allein geschaffen worden war, sondern dass Menschenhände mitgeholfen hatten. Das sah er, als er sich darin befand noch deutlicher als vorher. Er konnte sogar die Meißelstriche unterscheiden und sah, dass der Mensch, der diesen Gang erweiterte, seinerzeit von oben nach unten gearbeitet haben musste.
Das ließ sich ja ganz leicht eben aus den Meißelstrichen beurteilen, da brauchte er noch lange kein Sherlock Holmes in zweiter Auflage zu sein.
Er stellte aber noch mehr fest.
Zuerst: dass seit geraumer Zeit niemand diesen Gang benutzt hatte.
Von der glatten und festen Decke hatte ja nichts abbröckeln können, ebenso wenig von den Wänden. Auf dem Boden lag also keinerlei Geröll — aber Staub, wie er vom Winde in diesen Hohlraum gefegt worden war.
Die Staubschicht war sogar ziemlich dick, er war bald an Knien, Unterschenkeln und Händen ganz schmutzig, kümmerte sich jedoch nicht weiter darum. Das ließ sich rasch wieder entfernen.
Er hatte viel mehr Interesse, zu sehen, dass der Gang nach oben führte, und zwar anfangs in leichter Steigung, bald jedoch fast senkrecht.
Dadurch kam er jedoch auch nicht in Verlegenheit.
Antonio Almeida hatte sich, wie so mancher seiner Landsleute, einen Sport daraus gemacht, die Regierung zu bestehlen — auf eine Weise allerdings, die der Durchschnittsmensch eben gar nicht als Diebstahl ansieht, ebenso wenig wie er das Schmuggeln für ein Verbrechen hält.
Antonio Almeida hatte Diamanten gestohlen!
Er hatte dabei sein Leben recht leichtsinnig aufs Spiel gesetzt, denn die Wächter, die solche Diebstähle verhüten sollen, haben rasch das Gewehr an der Schulter und schießen auch gar nicht schlecht, aber immer treffen sie doch nicht —
Es handelte sich darum, außerhalb der von der Regierung ausgebeuteten Fundorte, aber in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, nach Diamanten zu suchen.
Das ist streng verboten, und wer dabei betroffen wird, riskiert also, dass er erschossen oder, wenn er sich fangen lässt, dass er zu schwerer Freiheitsstrafe verurteilt wird.
Gerade deswegen wird es getan. Die Gefahr ist der einzige Reiz, der lockt!
Auch den Antonio Almeida!
Und so hatte dieser sich lange in den Bergen herumgetrieben, in der ödesten Wildnis, hatte oft um sein Leben klettern müssen.
Da konnte dieses bisschen Kletterei hier ihm durchaus nicht imponieren!
Er stemmte also die Knie vorn an, den gekrümmten Rücken hinten, und so kam er rasch genug empor.
Dabei wunderte er sich nur, dass noch immer von oben kein Licht einfiel, dass es vielmehr stockduster in dem Kamin war —
Und da rannte er auch schon heftig mit dem Kopfe gegen eine Decke, dass er fast den Halt verloren und zurückgestürzt wäre.
Zur rechten Zeit, während ihm noch das Feuer aus den Augen sprühte infolge des heftigen Anpralls, hielt er sich fest, tastete mit der einen Hand über sich und stieß einen Ruf der Überraschung aus.
Er wusste sofort, dass diese Decke über seinem Kopfe nicht gewachsenes Gestein war, sondern ein Felsblock, und dass dieser Felsblock in den Kamin geschleudert worden sein musste, um ihn zu versperren.
Deutlich tastete er die scharfen Kanten, die Zwischenräume zwischen ihnen und den Wänden des Kamins —
Und dann ließ er sich nach unten gleiten, kroch aus dem Loche heraus und stand wieder neben der Ravelli.
»Der Gang ist von oben aus versperrt worden«, sagte er, als sie ihn fragend anschaute. »Mit einem Felsblock, den wir höchstens durch eine Sprengung entfernen könnten.«
»Also sind doch Menschen dort oben? Und zwar solche, die nicht wünschen, dass man zu ihnen kommt!«, sagte die Italienerin.
Autonio Almeida nickte.
»Sie werden das nicht verhindern können«, bemerkte er dann. »Es muss noch irgendeine Möglichkeit geben, hinaufzukommen.«
»Fliegen!«, sagte die Ravelli lächelnd »Wir hätten ein Flugzeug mitnehmen müssen.«
»Und ich glaube nicht, dass wir eins brauchen«, erwiderte Antonio Almeida. »Wäre das der Fall, so hätte Mister Philipp es uns sicher mitgegeben.«
»Und wenn er nicht ahnt, dass dieser Zugang mittlerweile versperrt worden ist?«
Der junge Mann schüttelte den Kopf.
»Er hätte es sicher erfahren, das traue ich ihm zu.«
»Ich auch!«, bestätigte die Ravelli.
Dann kam ihr der Gedanke, der freilich auch nahe genug lag.
»Wenn wir nun von den Bewohnern dieses Plateaus beobachtet werden?«, fragte sie.
»Möglich wäre das, aber wahrscheinlich ist es nicht«, gab Antonio Almeida nach kurzem Besinnen zurück.
»Sie meinen, man würde uns gewahrt, vielleicht gar durch Schüsse vertrieben haben?
»Ja, das glaube ich.«
»Nun, vielleicht warten die Herrschaften erst einmal ab, wie weit wir kommen, wenn sie merken, dass wir uns durch nichts abhalten lassen wollen.«
»Auch das glaube ich nicht. Ich habe so eine Ahnung, dass sie diese Stelle für vollkommen gesichert halten. Sie haben den Gang versperrt und den letzten verwegenen Eindringling, der ihn benutzte, von der Höhe herabgeschleudert —
Hallo — da kommt er!«
Mitten in seinen Ausführungen hatte er den Reiter bemerkt, der quer über die freie Ebene gesprengt kam — gerade auf sie zu —
Und leise fügte er hinzu:
»Das muss der Mann sein, den wir hier treffen sollten — Manuel García —«
Da war der Reiter auch schon bei ihnen, parierte das Pferd mitten aus dem Galopp mit größter Meisterschaft, sprang aus dem spanischen Sattel, zog den breitkrempigen Filzhut, verneigte sich erst vor der Dame, dann vor dem Herrn und sagte mit einer recht wohllautenden Stimme:

Da war der Reiter auch schon bei ihnen und parierte das Pferd.
»Manuel García! Und ich habe die Ehre mit Signorina Ravelli und Senhor Antonio Almeida?«
Wie es ganz natürlich und erklärlich war, musterten Antonio Almeida und die Ravelli grüßend den Ankömmling, mit dem sie voraussichtlich auf lange gemeinsam leben sollten. Und ja nicht das allein. Von der Zuverlässigkeit dieses Menschen würde es doch manches liebe Mal abhängen, ob sie aus einer Gefahr mit heiler Haut entkamen oder ihr erlagen, ganz abgesehen davon, dass doch jeder Mensch lieber mit einem ihm sympathischen zusammen ist als mit einem, der ihn ständig abstößt.
Nun, was das Äußere Manuel Garcías anbetraf, so konnten die beiden gewiss nichts gegen ihn einwenden, denn er war das, was man einen schönen Mann nennt mit allen auszeichnenden Merkmalen seiner Rasse: schwarzen, leuchtenden Augen, die zu dem tiefschwarzen Kopf- und Barthaar gehörten, dazu die braune, wie alte Bronze schimmernde Haut —
Antonio Almeida dachte merkwürdig genug beim Anblick dieses Manuel García genau dasselbe wie Signorina Ravelli:
»Das ist doch der zweite Buffalo Bill!«
Und da hatten sie das Richtige getroffen, nicht einmal nur in körperlicher, sondern vielleicht noch mehr in seelischer und geistiger Hinsicht.
Dieser Buffalo Bill, auch Colonel Cody genannt, spielte ja lange Zeit eine große Rolle, auch in Europa, das er mit einer Wildwesttruppe bereiste, und er spielt diese Rolle noch jetzt in gar vielen sogenannten Jugendschriften, die geeignet sind, den Jungens die Köpfe zu verdrehen und ihnen einen recht, recht falschen Begriff von der Wirklichkeit beizubringen.
Dieser Buffalo Bill war unstreitig ein verwegener, entschlossener Mann. Das hat er durch seine Taten bewiesen, und das musste er auch sein, nachdem er von frühester Jugend an in der Wildnis gelebt hatte. Aber er war auch ein echter Amerikaner insofern, als er sein Licht nicht unter den Scheffel stellte, namentlich während seiner Reisen die Reklametrommel gewaltig zu rühren verstand, in den Zeitungen allerlei Abenteuer aus seinem Leben erzählte und vor allem durch seine Kleidung von sich reden machte.
Es braucht da wohl nichts weiter gesagt zu werden. Man wird sich dieses Mannes sicher noch genau erinnern. Also ein tapferer Kerl, aber etwas prahlerisch und vielleicht auch noch empfindlich, wenn sich ihm nicht alles beugte.
So war denn auch die Verbeugung, die dieser Manuel García vor der Italienerin machte, ganz vollendet. Kein Caballero hätte sie besser fertiggebracht, aber es war deshalb recht schade, dass die Ravelli es nicht zu dem beabsichtigten Handkusse kommen ließ.
Sie nahm die Hand, mit welcher er die ihre umfangen wollte, eben, um einen Kuss auf sie zu drücken, und umspannte sie mit allen Fingern, drückte vielleicht auch ein bisschen zu stark —
Kurzum, sie nötigte den Herrn, ihr die Hand zu schütteln, anstatt sie zu küssen, und selbstverständlich taten das auch die beiden Männer.
»Sie haben auf mich gewartet?«, fragte Antonio Almeida, was eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre.
Und da kam wieder eine Überraschung.
Manuel García nickte.
»Ja«, sagte er, »und da die Zeit mir etwas lang wurde, so habe ich inzwischen die Gegend etwas erkundet, hatte soeben eine Entdeckung gemacht, als Ihre Botschaft mich erreichte. Außerdem hörte ich selbst die von Ihnen abgefeuerten Schüsse —«
An den Gesichtern der beiden merkte er, dass da etwas nicht stimmte. Er konnte sich ja nicht denken, was sie so verblüffte, aber dass sie es waren, das sah er —
Und dann hörte er die Ravelli fragen:
»Eine Botschaft? Sie haben eine Botschaft von uns erhalten?«
»Wie ich sagte, Signorina —«
»Und wann war das?«
»Genau um die Mittagsstunde — ich habe ja keine Uhr bei mir, aber das weiß man doch —«
»Und Sie besitzen diese Botschaft noch?«
»Ich weiß wirklich nicht, ich glaube —«
Manuel García griff in die eine Tasche, griff in die andere — immer zog er die Hand leer zurück, bis er endlich aus seinem Tabakbeutel einen Streifen Papier zog.
»Jetzt besinne ich mich, dass ich mir eben eine Zigarillo fertigen wollte, als der Bote kam. Da habe ich das Papier gleich in den Beutel gesteckt — es wird also nach Tabak duften, aber sicher nicht unangenehm, ich rauche nur erste Marken —«
Und er bot mit einer Verbeugung der Künstlerin das Blatt oder vielmehr das Blättchen.
Die Ravelli aber nahm es noch nicht.
»Beschreiben Sie mir, bitte, den Boten, der es Ihnen brachte!«, bat sie.
Manuel García stutzte abermals.
Und dazu hatte er ja auch allen Grund.
Wenn diese Dame ihm eine Botschaft schickte, so musste sie doch auch wissen, wie der Bote aussah, der sie überbracht hatte. Aber er nahm an, dass vielleicht Antonio Almeida diesen ausgewählt habe.
»Es war ein Indio, so viel ich erkannte, ein Machipua«, antwortete er.
»Danke!«, stieß die Ravelli hervor und nahm das Papier aus der Hand Garcías.
Nun erst wendete sie sich Antonio Almeida zu, der also ihre Fragen nicht unterbrochen, noch kein Wort gesprochen hatte, außer der ersten Frage —
Sein Gesicht hatte den Ausdruck, den er sonst immer zeigte, verriet also nicht mehr die geringste Verblüffung, nicht einmal Staunen. Keinesfalls war auf ihm zu lesen, was er dachte.
Auch jetzt sagte er nichts, sondern griff nach dem Stück Papier in der rechten Hand der Ravelli und las, was in spanischer Sprache darauf geschrieben stand. Es waren nur wenige Worte.
Sie werden sofort erwartet an der Stelle, wo das Gerippe liegt.
Weiter stand nichts darauf. Die Schrift aber war genau die Antonio Almeidas. Zug um Zug! Sogar der kleine charakteristische Schnörkel fehlte nicht.
Nur etwas hatte der Fälscher dieser Botschaft nicht beachtet: dass der junge Jäger Portugiesisch sprach, obwohl er das Spanische verstand, dass er aber unter keinen Umständen in dieser Sprache eine Botschaft geschickt hatte.
Die Ravelli selbst sprach nur Portugiesisch, aber nur so viel, wie sie in einem halben Jahre hatte lernen können. Auch sie hätte nicht diese spanischen Worte schreiben können, und von ihr sollten sie ja auch gar nicht geschrieben sein, denn es war eben ganz klar die Handschrift Antonio Almeidas!
Da wäre es recht natürlich gewesen, wenn dieser jetzt gesagt hätte:
»Das habe ich gar nicht geschrieben!«
Es fiel ihm nicht ein. Er sagte nur:
»Und die Schüsse, die Sie hörten, Señor García?«
»Ja, eben — ich wunderte mich, da Sie doch schon den Boten geschickt hatten, dass Sie nun auch noch die Schüsse abfeuerten, ich nahm indessen an, Sie seien recht ungeduldig, und so sprang ich in den Sattel und jagte hierher. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich Sie habe warten lassen!«
Und wieder verbeugte er sich, aber nur vor der Italienerin, dieser dabei einen Glutblick aus seinen schwarzen Augen zuwerfend.
Und während der Sekunde, da sie nicht von Manuel García beobachtet wurden, tauschten die Ravelli und Antonio Almeida einen vielsagenden Blick, der sofort verstanden wurde. Da wäre gar nicht nötig gewesen, dass der junge Mann hinter dem Rücken des Spaniers noch eine Hand hob und den Zeigefinger auf die Lippen legte.
Sie wollten also dem Manuel García nicht verraten, dass diese geheimnisvolle Botschaft nicht von ihnen ausgegangen war, und sie verrieten auch nicht, dass nicht sie die Schüsse abgefeuert hatten.
In dieser Beziehung glaubten allerdings auch sie an die Wahrscheinlichkeit. Sie dachten an die Schüsse auf die Surucucus —
Aber waren diese Schüsse genau um die Mittagsstunde gefallen?
Sie hatten wirklich nicht darauf geachtet, und dass sie jetzt nicht weiter darüber nachdachten, das sollte ihnen später noch viel zu schaffen machen.
Vorläufig hatte nun Antonio Almeida eine Frage.
»Wo ist der Bote geblieben, der Ihnen diese Botschaft überbrachte?«
»Bei meinen Leuten«, erwiderte der Spanier. »Er wird wohl gleich mit ihnen hier eintreffen. Ich habe einige Guaranis mitgenommen.«
»Und Sie erwähnten, dass Sie gerade eine wichtige Entdeckung gemacht hatten, als der Bote kam?«
»So ist es, Senhor! Haben Sie sich die Gegend schon angesehen?«
Manuel García deutete nach dem Felsenplateau, das sich hinter ihnen erhob.
»Nein!«, erwiderte Antonio Almeida. »Ich habe nur versucht, durch den Gang dort nach oben zu kommen —«
»Und Sie fanden ihn versperrt! Hahaha, das ist mir nicht besser ergangen! Ich weiß aber noch mehr! Ich habe das ganze Plateau schon umritten, ohne irgendwo auch nur die geringste Möglichkeit eines Aufstieges zu finden, bis ich an jene Stelle kam, wo Ihr Bote mich traf —«
»Und Sie fanden?«
»Ich werde es Ihnen zeigen, falls Sie bereit sind, mir zu folgen!«
Wieder tauschte Antonio Almeida mit der Italienerin einen Blick. Dann nickte er und erwiderte:
»Wir werden gern mit Ihnen gehen, Señor. Doch zuvor noch eine Frage, die mich sehr interessiert.«
»Bitte sehr, Senhor!«
»Sie sind zu Pferde hier, das Tier sieht recht frisch aus. Wie brachten Sie es bis hierher?«
Jetzt war die Reihe, zu staunen, an Manuel García.
»Ich bin doch von meinem Wohnsitze an geritten«, sagte er.
»Sie kamen also von Süden?«
»Aber ja —«
»So! Ich danke Ihnen! Dann ist dieses Wunder ja erklärt, denn wir sind auf dem Flusse gekommen und konnten natürlich nicht daran denken, ein Pferd mitzunehmen.«
»Auf dem Flusse? Der liegt doch aber weit ab!«
»Und zuletzt natürlich über Land!«, erklärte Almeida.
»Dann allerdings! Sie haben viele Gefahren bestehen müssen?«
»Es ließ sich ertragen, jedenfalls sind wir unversehrt«, gab der junge Jäger zurück. »Und nun wollen wir aufbrechen, nachdem ich meine wenigen Begleiter belohnt und zurückgeschickt habe, denn nach der mir gewordenen Weisung des Mister Philipp dürfen nur wir drei allein unsere Entdeckungsfahrt fortsetzen.«
»Auf dem Plateau!«, ergänzte Manuel García schnell. »So wenigstens verstehe ich diese Weisungen, und deshalb möchte ich meine Leute nicht nach Hause schicken.«
»Sie haben einen triftigen Grund dazu?«
»Ja, und zwar den, die Verbindung mit der Außenwelt wenigstens nicht ganz zu unterbrechen. Man kann durch einen solchen Indio eine Botschaft befördern lassen, falls es nötig erscheinen sollte.«
»Nun, dann behalten Sie Ihre Indios. Sie werden auch für uns genügen! Einen Augenblick!«
Antonio Almeida erledigte, was er gesagt hatte, entlohnte die Indios und schickte sie heim.1
Dann kehrte er zu Manuel García zurück, der sich inzwischen mit der Italienerin unterhalten hatte, nun aber das vorhandene Gepäck der beiden seinem Pferde auflud.
Dann brachen sie auf, waren aber noch nicht weit gekommen, als sie einen kleinen Trupp Eingeborene vor sich erblickten.
1 Der im 12. Kapitel noch bis zuletzt als Führer fungierende Mohur Khan wird in diesem Kapitel aus nicht nachvollziehbaren Gründen überhaupt nicht mehr erwähnt.
»Da sind sie schon!«, rief Manuel García.
»Und der fremde Indianer ist dabei?«, fragte Antonio Almeida, wusste jedoch dabei schon, dass das nicht der Fall war, denn unter den Ankommenden sah er keinen Machipua.
In der Tat, der Mann war nicht mehr da, und als Manuel García die anderen Indios nach ihm fragte, schüttelten sie allesamt den Kopf. Keiner wusste, wo der Mensch geblieben war.
»So ein Halunke!«, stieß der Spanier hervor.
Jetzt aber sprach die Ravelli:
»Ich dachte es mir!«
Und dabei schaute sie Antonio Almeida an.
Manuel García schien durch diese Worte sehr zufriedengestellt.
»Dann brauche ich ihn also nicht suchen zu lassen?«, fragte er.
»Nein, nein, das mutet Ihnen niemand zu«, entgegnete die Italienerin.
Die Indios kehrten also mit den dreien wieder um. Manuel García aber führte immer noch selber das Pferd, und so kamen sie um eine Ecke des Hochplateaus herum, sahen schon von Weitem, dass unmittelbar dahinter ein Lager aufgeschlagen war, nur aus ganz leichten Zelten bestehend — sogar die Feuer brannten noch.
Daraus schlossen die beiden, dass Manuel García von Anfang an die Absicht gehabt hatte, sie hierher zu führen, aber nur Antonio Almeida erkannte gleich den Grund.
Hier ragte in einiger Entfernung von dem übrigen Steinmassiv ein Felsen senkrecht und steil in die Luft, genau so hoch, dass sein Gipfel in gleicher Höhe mit dem Plateau lag.
Er mochte also vor langer Zeit selber zu diesem gehört haben, durch irgendeine Katastrophe von ihm losgerissen worden sein, jedenfalls war es dasselbe vulkanische Gestein wie überall sonst.
Und auf dem Gipfel dieses Felsens erhob sich ein Baum.
An sich war das gewiss keine besondere Merkwürdigkeit. Vögel mochten dort oben nisten, einer hatte das Samenkorn mit hinaufgenommen, es hatte Erde genug gefunden, sich zu entwickeln, war zu einem Baume emporgewachsen —
Antonio Almeida schaute nur deshalb empor, weil er doch gleich aus der Höhe dieses Baumes auf die des Felsens schließen konnte.
Es handelte sich nämlich um einen Bombax Ceiba. Das war gleich an der ungeheuer entwickelten Laubkrone zu erkennen, und da diese Bäume meist eine Höhe von sechs bis acht Metern erreichen, so war durch ihn ein Maßstab für die Entfernung gegeben, in welcher sich die Felsennadel von dem Plateau befand.
Der geschärfte und geübte Blick des erfahrenen Jägers stellte sogleich fest, dass der Stamm dieses Bombax gerade ausreichen musste, eine Brücke über die tiefe Schlucht zu bilden.
Wenn er beim Fallen in die entsprechende Richtung gebracht werden konnte!
Noch aber verriet Antonio Almeida nichts von dieser seiner Entdeckung, er folgte dem Spanier, der das Pferd seinen Indios überlassen hatte, an den Fuß der Felsennadel und hörte schweigend zu, wie Manuel García nun sagte:
»Hier bietet sich die einzige Möglichkeit zur Ersteigung des Plateaus. Das ist die Entdeckung, die ich gemacht habe und über die ich mich sehr freute. Ich habe Seile mitgebracht und auch schon festgestellt, dass sie lang genug sind. Es wird sich also nur darum handeln, dass wir eins auf die Höhe bringen, es dort um den Stamm des Baumes schlingen, und dass wir dann an ihm emporklettern — Signorina Ravelli werden wir natürlich emporziehen —«
»Und dass der Baum fest genug steht, um sie zu tragen«, ergänzte Antonio Almeida.
»Na, das ist doch anzunehmen! Und wenn nicht, wird sich gewiss ein Vorsprung finden lassen, an dem das Seil befestigt werden kann. Es handelt sich nur noch um die eine Frage: Wie gelangt jemand auf die Höhe des Felsens?«
Ja, das war allerdings durchaus nicht zu sagen.
Antonio Almeida hatte schon festgestellt, dass die Felsnadel nicht nur senkrecht emporragte, wie das ja ganz natürlich war, sondern dass ihre Wände auch auf allen Seiten ganz glatt waren.
Keine Vorsprünge waren zu sehen, an denen Hände und Füße eines Kletterers hätten Halt finden können, keine Sprünge und Risse.
Es ist schon gesagt worden, dass Antonio Almeida ein geübter Bergsteiger und Kletterer war, aber auch er sah keine Möglichkeit, diese Höhe zu erklimmen.
Die Indios?
Ja, die steigen wohl an der höchsten Palme mit größter Leichtigkeit empor, indem sie sich ein Seil um den Leib schlingen, das sie auch um den Stamm legen, dann den Körper möglichst weit zurückbiegen und die Füße gegen den Baum stemmen.
Wenn man das zum ersten Male sieht, möchte man fast lachen, weil das so kinderleicht aussieht, aber wer es selber versucht, der merkt bald, wie schwierig es ist. Da muss man eben selber Eingeborener sein.
Auch in den Kulturländern kann man oft genug eine ähnliche Kletterei sehen, wenn nämlich Telegrafenarbeiter an den Leitungsmasten emporsteigen. Auch sie gürten sich an diese, aber sie benutzen Steigeisen, die der Wilde nicht kennt. Der benutzt nur seine Füße, deren Zehen er allerdings noch als Greifwerkzeuge brauchen kann, und diese Fertigkeit vermag kein Europäer je wiederzuerlangen, die besitzt er eben nur in frühester Kindheit, wenn er die Saugflasche nicht nur mit den Händen, sondern auch mit den Füßen hält, und da wundert sich niemand darüber, das ist eben so, kein Mensch denkt dabei daran, dass das ein Rückfall in uralte Gewohnheiten ist. Sobald der Fuß dann in Schuhe gepresst wird, vermag er nicht mehr zu greifen.
Dass er aber von der Natur dazu bestimmt war, das wird doch durch die armlos geborenen unglücklichen Menschenkinder bewiesen, denn sie behalten diese Fähigkeit des Säuglings ihr Leben lang, können mit den Zehen alles das ausführen, was andere Menschen mit den Händen und den Fingern tun — sogar berühmte Maler hat es unter ihnen gegeben — der bekannte Ducornet schuf kolossale Schlachtenbilder, wobei er nach dem Urteil von Zeitgenossen »wie eine Fliege an der Leinwand entlang kroch« —
Ja, also damit war es nichts. Die Indios konnten wohl Bäume mit Leichtigkeit ersteigen, aber nicht diese Felsnadel, denn die war eben zu dick für sie, da konnten sie kein Seil herumschlingen, und es ist auch etwas anderes, ob man die Füße gegen Baumrinde stemmt, oder gegen hartes Gestein.
Die Entdeckung, die Manuel García gemacht hatte und die so vielverheißend erschien, war also im Grunde vielleicht doch ganz wertlos. Die drei hätten ebenso gut auf das Plateau selbst kommen können wie auf den abgesonderten Felsen.
Wenn nicht Antonio Almeida gewesen wäre!
Dieser trat etwas zurück, betrachtete den Felsen von allen Seiten, stellte fest, dass auch an eine »Kaminkletterei« nicht zu denken war — acht Meter kann kein Mensch auf solche Weise überwinden —
Und dann bat er Manuel García, ihm die Seile zu zeigen.
Sie waren schon zurechtgelegt, und es waren feste Manilahanfseile, die jede Last aushalten würden, aber — sie waren natürlich viel zu schwer, als dass man etwa das eine Ende in diese Höhe hätte hinaufschleudern können. Kein Gedanke daran.
Gespannt beobachteten die Ravelli und der Spanier den jungen Mann, der nachdenklich auf die Seile schaute.
Dann hob er eins auf und besah sich die »Drähte«, also die einzelnen Strähnen, aus denen das Seil zusammengedreht war.
Er versuchte auch schon, sie zu lösen, und da das anging, so winkte er den Indios. Sie verstanden ihn sofort und machten sich auch gleich an die Arbeit, die ihnen gar flink von den Händen ging, wieder einmal ein Beweis dafür, dass diese verachteten Naturmenschen das, was ihnen liegt, viel besser verstehen als jene, von denen sie verachtet werden.
Eine der Strähnen war bald abgetrennt von den übrigen, aber damit war Antonio Almeida noch nicht zufrieden. Er ließ auch diesen »Draht« wieder in seine Einzelheiten zerlegen und bekam so eine ganz dünne Schnur, die natürlich genau so lang war wie das Seil, dem sie vorher angehört hatte.
Nun suchte Antonio Almeida nach einem Stein, da er aber keinen fand, nahm er eine Patrone — ein mächtiges Ding, das zu einem Elefantengewehre zu gehören schien, also ein Explosivgeschoss — band es an das eine Ende der Schnur, fasste diese ein Stück unterhalb, schwang sie einige Male um sein Haupt. Plötzlich ließ er sie fahren — Ja, er hatte die nötige Treffsicherheit und Geschicklichkeit noch nicht verloren —

Einer der Indios, der sich eben bei dem Gepäck zu tun machte, war das Ziel gewesen.
Im nächsten Augenblick lag er, wie von einer unsichtbaren Faust niedergerissen, auf der Erde, und Antonio Almeida musste schnell hinspringen und ihm die würgende Schnur vom Halse lösen, sonst wäre der Mann erstickt.
Manuel García klatschte Beifall. Die Ravelli schwieg. Nur ihre schönen Augen strahlten —
Auch die Indios verstanden sofort, um was es sich da handelte, sie lachten über den Schrecken ihres Gefährten, und als dieser wieder Luft hatte, lachte auch er mit — große Kinder —
Antonio Almeida aber hielt sich nicht lange auf, gab auch gar keine Erklärungen, sondern suchte schon nach einem geeigneten Standpunkt, um dieses Lasso nach dem Bombax auf der Höhe zu schleudern.
Er brannte vor Begier, dort hinauf zu kommen, die Menschen — oder was es sonst sein mochte — von Angesicht zu Angesicht zu sehen, die sich erlaubten, seinen Willen, sein Schicksal zu beeinflussen.
»Ich will und werde das Rätsel lösen, das diese geheimnisvolle Botschaft mir aufgibt!«, sagte er sich immer wieder, und deshalb konnte er es kaum erwarten, bis er den Fuß auf den Boden der Hochfläche setzen würde.
Die Aufgabe, die er sich dabei stellte, war viel schwerer, als sie eigentlich aussah. Vierzig Meter hoch kann ein kräftiger Mann schon einen Stein schleudern und auch noch treffen, wenngleich nicht mehr mit unbedingter Sicherheit — aber da muss er eben einen Stein haben, der genau seiner Kraft und der Kraft entspricht, welche in ihm selbst liegen muss — in der Kraft, den Luftwiderstand zu überwinden.
Die Patrone war dazu viel zu leicht. Ein Stein von ihrer Größe hätte genügt, war aber eben nicht vorhanden.
Da gewahrte Antonio Almeida bei einem der Indios eine jener Kalabassen, die meist aus Baumfrüchten gefertigt werden.
Sofort winkte er den Mann zu sich, nahm dem Überraschten das Ding ab, schüttelte es, wog es auch in der Hand — es dünkte ihm eben schwer genug.
Da zögerte er nicht länger.
Mit einem Stück Leder, das er mit Gras ausfüllte, stellte er einen wasserdichten Verschluss her, setzte den in die Öffnung der Kalabasse, schlang die Schnur darum und suchte nun abermals einen zum Wurfe am besten geeigneten Ort.
Nach einiger Zeit glaubte er ihn gefunden zu haben und stellte sich breitbeinig hin.
Signorina Ravelli wendete kein Auge von ihm, als er so dastand, in jedem Zoll die verkörperte Manneskraft —
Und dann hob er den rechten Arm, hielt mit der linken Hand die Schnur, die er rasch in kreisförmige Windungen auf dem Boden geordnet hatte, gab sich einen Schwung, reckte sich hoch auf und sandte, auf den Zehenspitzen stehend, das eigenartige Geschoss in die Höhe.
Manuel García hatte ihm ebenfalls anfangs zugesehen, dann jedoch seine Aufmerksamkeit ausschließlich der Italienerin gewidmet. und da konnte ihm die Bewunderung natürlich nicht entgehen, die aus ihren Augen strahlte — ganz unverhohlen —
Ein böses Lächeln umspielte den Mund des Spaniers.
Seine Hände schlossen sich und öffneten sich wieder —
Da ward er durch einen jubelnden Schrei aufgeschreckt.
Die Ravelli hatte ihn ausgestoßen —
Das Wagnis war geglückt — das Wurfgeschoss hatte den Baum erreicht, der Bindfaden hatte sich um den Stamm geschlungen und hielt —
Aber nun?
Sollte etwa jemand an dieser dünnem Schnur empor klettern?
Das war freilich ausgeschlossen.
Da nützte doch auch der glückliche Wurf nichts.
Dann aber hätte Antonio Almeida ihn auch gar nicht erst getan.
Nein, der wusste ganz genau, was er wollte.
Er machte sich schon daran, einen kleinen Mechanismus herzustellen, der ja bekannt ist und den man ebenfalls bei Telegrafenarbeitern sehen kann, er braucht hier nicht weiter beschrieben zu werden, besteht aus zwei Hebeln, die entgegengesetzt wirken, derart, dass der eine Hebelfuß auf die Schnur gesetzt wird und mit dem anderen Ende die an ihm befestigte Schnur emporhebt. Unmittelbar darauf tritt der andere in Tätigkeit, stemmt sich niedersenkend, sich ebenfalls gegen die Schnur, und hebt mit seinem freien Ende nun die Schnur wieder ein Stück.
Das geht natürlich viel schneller, als das beschrieben werden kann, immer so Zug um Zug, und die einzige Schwierigkeit war eben, diesen Hebel herzustellen.
Für Antonio Almeida, der gelernt hatte, sich in allen Lagen zu helfen, war es keine. Draht hatte er bei sich, den brauchte er oft, sogar ziemlich starken Messingdraht. An seinem mächtig langen Messer befand sich auch eine Schere, wenn auch nicht für diesen Draht berechnet, sie bekam ein paar Scharten, als sie ihn doch schneiden musste — kurz, es ging, und schon beförderte der Jäger eine zweite Schnur an der ersten in die Höhe, die hinter sich das dünnste Tau zog.
Nach einer Zeit von kaum zehn Minuten war sie oben, mit ihr das Tau, und nun kam das Schwierigste, wobei Manuel García sich wohl keinen Rat gewusst hätte.
Die Hebel hielten wohl die Schnur fest, an dieser hing das Tau, jetzt mit dem freien Ende in gleicher Höhe — aber die Hebel waren auch noch nicht fest genug, einen Menschen zu tragen, falls er sich an das Tau hing.
Antonio Almeida aber wusste schon, wie er da helfen musste.
Er nahm eine dritte Schnur, befestigte diesmal nur das Explosivgeschoss daran und schleuderte es mit bewundernswerter Geschicklichkeit gerade an die Stelle, wo die Hebel nicht mehr wirkten, also etwas unterhalb.
An dieser Stelle hingen Tau und Schnur ganz frei über der Tiefe, und so konnte die geschleuderte Schnur sich mehrmals darumschlingen —
Und kaum war das geschehen, da schnellte Antonio Almeida sich auch schon vom Boden ab und begann empor zu klimmen.
Auch das sah wieder aus, als wäre es gar nichts weiter, eben so, wie man es im Zirkus immer wieder anstaunt, wenn da ein Künstler sich am Seile bis zur höchsten Kuppel emporarbeitet. Das ging scheinbar spielend —
Aber die Indios und Manuel García wussten, was es zu bedeuten hatte, und jetzt prägte sich sogar auf dem Gesicht des Spaniers Staunen aus.
Da war Antonio Almeida oben, stand neben dem Baume, zögerte nicht, das Seil nun ganz emporzuziehen und es ganz sicher zu befestigen.
Das andere war wirklich Kinderspiel — das Emporbefördern des Gepäcks nämlich — und dann ebenso das der Signorina Ravelli, die sich ganz wacker hielt, als sie in der Seilschleife hing und emporgezogen wurde.
Manuel García sollte den Beschluss machen.
Ehe er jedoch emporklomm, bat Antonio Almeida ihn noch, eine scharfe Axt mitzubringen, die sich der Spanier denn auf den Rücken schnallte.
Den Indios gab er die nötigen Weisungen, dann trat er die Kletterfahrt an und stand bald neben den beiden anderen, sah nun, was sie schon gesehen hatten, aber von unten aus verborgen geblieben war.
Der Rand des Plateaus war etwas erhaben und in der Breite eines Meters etwa vollkommen ohne Pflanzenwuchs. Dahinter aber zeigte sich Grün — wahrscheinlich die Gipfel von Bäumen — das war noch nicht festzustellen —
Jedenfalls galt es nun, den Bombax nicht nur zu fällen, sondern ihn auch so zum Falle zu bringen, dass er als Brücke über den Abgrund diente.
Dazu musste er erst der üppigen Blattkrone beraubt werden, und das erledigte Antonio Almeida ebenfalls selbst, wie er dann auch die Axt gegen den Stamm führte —
An Seilen, die er an diesem befestigt hatte, hielten die Ravelli und Manuel García ihn fest. und als sich der Bombax knackend und ächzend neigte, kam er genau so zu Falle, wie Almeida es gewünscht hatte.
Die Brücke über den Abgrund war hergestellt, und ohne Zögern wurde durch die beiden Männer erst einmal das Gepäck hinüberbefördert, dann schritt der Spanier wieder hinüber, ein Seil wurde gespannt, an dem auch die Italienerin folgen konnte, und dann verließ Antonio Almeida als Letzter den Gipfel des Felsens, schritt rasch über den Stamm, kam drüben an — und stieß, ehe eins der anderen ihn daran hindern konnte, den Stamm mit dem Fuß von dem Rande des Plateaus ab —
»Mensch — sind Sie wahnsinnig geworden?!«, schrie Manuel García auf.
Da war es bereits geschehen
Krachend sauste der Stamm mitsamt den Seilen in die Tiefe. Der junge Jäger aber wendete sich um und sagte gelassen:
»Damit sind für uns die Brücken zwischen hier und der übrigen Welt abgebrochen.«
Auf auf, Georg, Du hast es wieder einmal verschlafen!« So rief Fritz Hammer und rüttelte energisch seinen im Bett liegenden Freund Georg Wedekind.
Die beiden jungen deutschen Kaufleute waren in Callao, dem Haupthafen Perus, bei einem Hamburger Exporthaus angestellt. Heute war Ostersonntag, und sie wollten die beiden Feiertage, vielleicht auch noch einen dritten und sogar vierten, zu einer Segelpartie benutzen im eigenen Boote, das ihnen gemeinschaftlich gehörte.
Fritz Hammer war eine mittelgroße Gestalt mit schwarzem Lockenkopf und blitzenden Augen, während sich sein Freund Georg Wedekind als ein blonder Hüne langsam aus den Decken schälte.
»Verdammt, da hat mich mein Boy nicht geweckt!«, sagte er, indem er die Blicke seiner großen, blauen Augen durch das halb exotisch, halb deutsch eingerichtete Balkonzimmer schweifen ließ.
»Geht denn Dein Wecker nicht?«, fragte Fritz, die auf dem Nachttisch stehende Uhr schüttelnd.
»Nee, den muss ich erst auskochen. Gestern früh ging er noch, aber gestern Abend entdeckte ich, dass sich wieder einmal Ameisen ihr Nest drin gebaut haben, und da ist er stehen geblieben. Welche Zeit ist es?«
»Zehn Minuten nach sechs.«
»Na, da ist ja die Sonne eben erst aufgegangen.«
»Ja, leider! Ich warte schon eine halbe Stunde am Hafen auf Dich, bis ich den Grund Deines Fernbleibens ahnte und schnell herauf lief. Wir wollten doch bei Sonnenaufgang schon auf hoher See sein. Nun aber schnell!«
»So schnell wie ich kann, zünde gleich dort den Spiritusapparat an!«
»Ach was, erst Kaffee! Auch kein Waschen gibt es! Wird alles im Boote gemacht. Zieh Deine Hosen an, und was sonst noch zum zivilisierten Menschen gehört, und dann fort!«
Georg gehorchte den Weisungen seines Freundes so schnell, wie sein riesenhafter Gliederbau es erlaubte.
»Wie ist das Wetter?«
»Famos! Die See ist glatt wie ein Spiegel, und dabei weht doch eine frische Brise aus Norden, die über Nacht eingesetzt hat; die Seezeichen stehen auf ›Beständig‹.«
Die flüchtige Toilette war beendet, und fort ging es, von der oberen Stadt zum Hafen hinab.
Es war ein schlankgebauter Kutter, den sie schnell auftakelten, nachdem sie ihn schon am Abend zuvor mit allem ausgerüstet hatten, um selbst sieben Tage auf See aushalten zu können, und dabei zeigte sich, dass der sonst so langsame Georg Wedekind mit der Hand doch sehr fix sein konnte, jeder Griff klappte, jeder Knoten war tadellos geschürzt.
Mit geschwelltem Groß- und Klüversegel ging es zum Hafen hinaus und weiter in die nur leicht gekräuselte See hinein, Georg am Steuer, Fritz das laufende Gut, das heißt die Leinen und Taue, bedienend, welche die Segel regierten.
Jetzt stand er in der Mitte des Bootes und blickte zurück; immer mehr leuchteten seine Augen auf.
Die Sonne war zwar schon längst aufgegangen, aber jetzt erst erhob sie sich für diese Gegend hinter den schneebedeckten Kämmen der Kordilleren, um das Meer und die Küste zu vergolden. Ein herrliches Bild!
»O, Georg, Georg!«, kam es da mit leisem Jubeln über die Lippen des jungen Mannes. »Ostersonntag! Gestern Nachmittag vor einem Jahre saß ich im Kontor der Magdeburger Seifenfabrik, kaute an meinem Federhalter und überlegte mir, wie ich die Osterfeiertage totschlagen sollte. Da fiel mein Blick auf den Annoncenteil einer Exportzeitung. Ich wusste ja, was drinstand, hatte alle die Gesuche gelesen, um seufzend das Blatt wieder wegzulegen. Mit einem Male aber stieg in meinem Herzen eine alte Sehnsucht mächtiger denn je empor, und gleichzeitig auch fühlte ich, wie mein Herz felsenhart wurde. Ich hörte einen räsonierenden Vater und sah eine weinende Mutter. Aber diesmal blieb mein Herz hart. Noch an demselben Abend schrieb ich an die Hamburger Firma, die einen seifenkundigen Mann suchte, zwei Tage später war ich in Hamburg und sechs Wochen später in Callao. O, dieser Ostersonntag hier, das hätte ich mir voriges Jahr nicht träumen lassen!«
So hatte der junge Mann gejubelt.
Georg Wedekind hatte von der Welt schon weit mehr gesehen als sein Freund. Er war der Sohn eines Bremer Tabaksgrossisten, der direkt hinausgeschickt worden war, um »das Geschäft« kennen zu lernen. Zwar war er eine ganz andere, viel nüchternere Natur als sein Freund, aber vom »Klub« ließ auch er sich nicht gefangen nehmen. Anderseits besuchte auch er wohl alle Volksfeste und selbst die Spelunken der ihm noch fremden Stadt, ohne jedoch zu verlumpen. Er machte lieber mit einem Freunde Ausflüge zu Lande und zu Wasser, mit Büchse und Angel.
Nur wenige Dampfer und große Segler kreuzten den Weg der beiden und waren in der Ferne zu sehen. Die vielen kleinen Segelboote, die sonst die See belebten, fehlten heute gänzlich. Es war Ostern; in Callao wurden Volksfeste abgehalten, darunter auch ein großes Stiergefecht.
Die beiden jungen Leute machten sich nichts daraus. Sie kannten anderes Vergnügen als solche Tier- und zum Teil auch Menschenschlächtereien oder die albernen Fandangos und Tangos der spanischen Bevölkerung.
Immer weiter entfernte sich die Küste. Sie segelten, kochten Kaffee, frühstückten und segelten, bis sie an einer der vorgelagerten, reizenden, stark bewaldeten, aber unbewohnten Inselchen landeten. Dort wurde an geschützter Stelle gebadet und geangelt und Robinson gespielt und dann auf einer Klippenregion nach Möweneiern gesucht.
»Hierher, Georg! Ich habe ein Nest gefunden!«
Eiligst kletterte der Gerufene über die Klippen, und dann kratzte er sich bedächtig hinter den Ohren.
Diese Eier musste der Osterhase gelegt haben, rote und blaue und grüne, und außerdem waren sie schon hart gekocht.
Na, Georg kannte ja schon seinen Freund.
So verging der ganze Tag und es ward nur immer schöner.
Freilich auf die Dauer wäre ein solches Leben auch nichts, da sehnt sich ein normal veranlagter Mensch nach geregelter Arbeit. Aber für einige Tage ist es doch herrlich.
Am Abend lagen sie wieder auf hoher See, außer Sichtweite der Küste. Nur im Nordosten war noch das kleine Eiland zu erblicken, auf dem sie zuletzt ihre Fische gekocht hatten.
Es herrschte Windstille und sie würde die ganze Nacht anhalten. In diesen Breiten sind die Witterungsverhältnisse ja äußerst regelmäßige; nur ganz langsam verschieben sie sich. So drei Stunden nach Mitternacht würde ein starker Nebel einsetzen, der sich bei Sonnenaufgang mit leichtem Nordwind wieder hob. Die beiden wussten bestimmt, dass ihnen gar keine Gefahr drohte.
Stürme waren zu dieser Jahreszeit ganz ausgeschlossen, auch jeder Ostwind, der sie von der Küste zu weit entfernt hätte, falls sie nicht dagegen aufkreuzen konnten!
Die Nacht brach an. Das vorschriftsmäßige Licht — anders kann es in der Seemannssprache nicht heißen — wurde aufgesteckt, Georg übernahm die erste Nachtwache, die nötig war. Um zehn Uhr weckte er seinen Freund, um sich für vier Stunden zur Ruhe niederzulegen, und gleich schnarchte er wie ein Bär. Um zwei wurde wieder er geweckt.
»Nun pass gut auf, Georg! Bald muss der Nebel kommen.«
Doch Fritz durfte beruhigt sein, er wusste es selbst, hatte es nur so gesagt. Eine Schlafmütze war sein hünenhafter Freund durchaus nicht.
So schnell ging es bei Fritz mit dem Einschlafen zwar nicht; endlich aber wurden auch ihm die Augen zugedrückt.
»Reise reiseeee!«, sang um sechs Uhr Georg den internationalen Weckruf aller Seeleute.
Sofort war Fritz munter.
Schon war es Tag, noch aber herrschte undurchdringlicher Nebel.
»Etwas passiert?«
»Gar nichts.«
»Ach, Georg, heute ist Ostermontag! Wie ich mich wieder auf diesen Tag freue!«
»Der Kaffee ist schon fertig. Wirf ihn nicht um, er steht gleich vor Dir auf der Ducht.«
So dicht war der Nebel, dass man das auf Armlänge nicht erkennen konnte.
»Ich glaube, wir könnten ruhig vier Tage ausbleiben, unser Prinzipal würde nichts sagen.«
»Die Brotschnitten habe ich auch schon geröstet. Was wollen wir dazu frühstücken?«
»Mensch, bist Du prosaisch mit Deiner ewigen Esserei! Da — jetzt kommt das erste Lüftchen, gleich wird sich der Nebel heben!«
Und er hob sich so plötzlich, wie man einen Vorhang aufrollt.
Und da erblickten sie die große Überraschung.
Kaum einen Kilometer südwärts von ihnen entfernt, was auf See doch gar nichts zu bedeuten hat, lag ein stattlicher Dampfer.
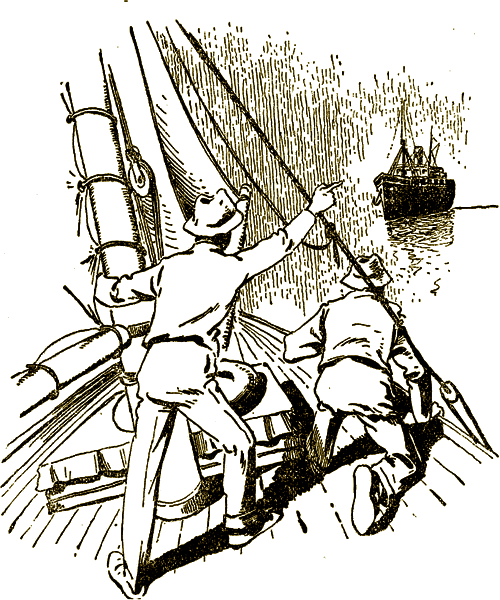
»Mensch, hast Du denn gar kein Signal gehört?!«, rief Fritz etwas erschrocken.
»Hast Du denn etwas gehört?«, lautete die Gegenfrage. »Du bist doch auch schon seit fünf Minuten wach.«
»Der Dampfer hat keine Warnungssignale gegeben?«
»Dann würde ich's Dir gesagt haben.«
»Er hätte uns überrennen können!«
»Er liegt ja still.«
»Immerhin, er hätte doch die Sirenen ertönen lassen müssen. Weshalb liegt er still?«
»Weil die Schraube nicht geht.«
»O, Du Kluger!«
»Vielleicht ist an der Maschine etwas defekt.«
»Oder doch einmal ein großes Schmieren nötig.«
»An Deck ist niemand zu sehen.«
»Soweit sich das beurteilen lässt. Die Bordwand kann, wie bei den Spaniern, sehr hoch sein.«
»Eine Flagge zeigt er nicht.«
»Gib mir mal das Glas her!«
»Wir wollen nur lieber gleich selber hin! Wir lassen uns an Bord ein Frühstück vorsetzen.«
Natürlich, das wurde gemacht. Wenn einmal ein Dampfer solch einen Halt macht, freiwillig oder unfreiwillig, dann sind ja Gäste stets willkommen. Wer weiß, wie lange der Dampfer schon unterwegs war, wohin er wollte, und da will die Besatzung doch die neuesten Nachrichten von Land hören.
Also die beiden setzten Segel und ließen sich von dem leichten Winde hintreiben. Sonst hätten sie rudern müssen, was bei dem ziemlich großen Kutter doch etwas auf sich hatte.
Da ihnen der Dampfer das Vorderteil zudrehte, war der Name am Heck nicht zu lesen, trotzdem hatte Fritz deswegen immer das Doppelglas vorm Auge.
»Jetzt — jetzt kann ich ihn an einem Rettungsringe lesen — etwas mehr Backbord, Georg, dass das Boot etwas ruhiger geht, wir holen es dann schon wieder auf — so, jetzt werden die Buchstaben deutlicher — —«
Und er begann zu buchstabieren:
»B—E—R—T—R—A—N — Bertran, nun weiß ich schon, was weiter kommt, nun kann ich mit einem Male auch ganz deutlich lesen: Bertran de Born — und als Heimathafen ist Ophir angegeben.«
»Bertran de Born aus Ophir?«, wiederholte Georg verwundert. »Was soll denn das sein?«
»Bertran de Born war ein Troubadour — —«
»Das weiß ich, so kann jedes Schiff heißen, aber was soll Ophir sein?«
»Aus Ophir holte der alte Salomo seine Goldschätze — —«
»Weiß ich ebenfalls, und auch, dass man dieses sagenhafte Ophir schon überall gesucht hat. In Arabien, in Indien, und nach der Entdeckung von Amerika, als Mexikos Goldreichtum bekannt wurde, wurde es sogar dorthin verlegt, und zwar nicht etwa vom Volksaberglauben, sondern vom damaligen Gelehrtenscharfsinn. Jetzt wollen Afrikaforscher dieses Ophir wieder an der Ostküste des schwarzen Erdteils gefunden haben. Aber wo gibt es denn heute einen Hafen, der Ophir heißt?«
»Na, warum soll es denn in Amerika nicht irgendwo ein Hafennest geben, das Ophir heißt? Wir haben nur noch nie etwas davon gehört!«
Der Sprecher hatte recht. Der Yankee wie der spanische Kreole liebt solche pompöse Namen, und die Welt ist groß. Ach, was für Heimathäfen liest man da manchmal am Bug von Schiffen, Namen, die man noch niemals gehört hat.
Darüber zerbrachen sich die beiden also nicht weiter den Kopf.
»Ein uns unbekanntes Hafennest mag es sein«, meinte Georg nur noch, »aber ein recht stattlicher Dampfer ist es doch, ich schätze ihn auf 5000 Tonnen.«
»Ich ihn auf noch mehr.«
»Ist denn an Deck noch kein Mensch zu sehen, der nach uns ausblickt?«
»Gar niemand.«
»Nicht auf der Kommandobrücke?«
»Die ist mit Segeltuch umkleidet.«
»Blickt denn kein Kopf darüber hinweg?«
»Ich bemerke nichts.«
»Seltsam! Na, wir werden ja sehen.«
Sie segelten heran, erreichten den regungslos daliegenden Dampfer. Noch niemand zeigte sich an der Bordwand.
»Die sind äußerst sorglos.«
»Die Leute, die nicht im Maschinenraum beschäftigt sind, werden beim Frühstück sitzen.«
»Ach was, wir müssen doch wenigstens schon von der Kommandobrücke aus gesehen worden sein!«
Umsegeln wollten sie den Dampfer nicht, sonst hätten sie doch noch zu den Rudern greifen müssen.
So legten sie bei, warfen einen Haken, an dem ein starkes Seil befestigt war, hinauf; es fand an der Reling festen Halt.
Fritz kletterte zuerst an dem Seil, das viele Knoten hatte, hinauf, Georg machte an demselben Seile nur noch das Boot fest, dann folgte er schnell nach.
Oben war nichts zu sehen, wenigstens kein Mensch. Alles war wie ausgestorben.
»Jetzt wird die Sache wirklich merkwürdig oder schon mehr unheimlich! Sollte die ganze Besatzung das Schiff verlassen haben?«
»Weshalb denn? Hier scheint ja alles in bester Ordnung zu sein, alles ist sauber gescheuert und geputzt. Außerdem sind auch alle Boote vorhanden. Gehen wir auf die Kommandobrücke!«
Sie erstiegen die Treppe, und da, als sie hinter den sogenannten Windschutz traten, hatten sie den Anblick!
Da lagen am Boden zwei Männer, nicht in Uniform, sondern in gewöhnlicher Tropenkleidung, aber doch gleich als Offiziere erkenntlich, der eine sicher der Kapitän.
Und neben dem Steuerrad war der Matrose zusammengebrochen.
Entsetzt blickten die beiden Freunde einander an.
»Tot!«, flüsterten sie und sahen wieder nach den Leichen, die so friedlich dalagen.
»Kein Blutfleck!«
»Nichts von einer Verletzung!«
»Die sind von selbst umgesunken!«
»Georg, hier ist etwas Furchtbares passiert — die ganze Besatzung ist vergiftet!«
Auf diesen Gedanken mussten sie wohl sofort kommen, da brauchten sie nicht schon von solch einem Falle gehört zu haben, wie eine ganze Schiffsbesatzung innerhalb weniger Minuten an Gift gestorben ist.
»Versehentlich? Oder sollte Giftmord vorliegen?«
»Ja, Georg, da fragst Du mich zu viel — das muss erst eine Untersuchung ergeben, wenn eine solche — der Mann dort hat sich bewegt!«
»Und der dort atmet!«
»Und der Matrose schnarcht ja!«
Ja, der am Steuerrad liegende Matrose fing jetzt ganz behaglich zu schnarchen an, hatte sich dabei auch etwas auf die Seite gewälzt, und so waren auch an den beiden anderen Männern Lebenszeichen bemerkt worden.
Das verscheuchte schnell den ersten Schreck der beiden. Besonders das kräftige, gesunde Schnarchen des Matrosen wirkte ungemein beruhigend, fast humoristisch; die beiden hätten fast hell aufgelacht.
»So mörderisch bezecht können sie sich doch nicht haben.«
»Nein, danach sieht es gar nicht aus; sie haben ihre Pflicht bis zuletzt getan — bis sie von einer plötzlich auftretenden Müdigkeit überwältigt wurden.«
»Da müssen sie also doch etwas Betäubendes getrunken haben.«
»Das ist wohl zweifellos.«
Sie beschäftigten sich mit den Schläfern. Aber da war jede Mühe vergebens.
Es gelang ihnen durch nichts, einen zu wecken, sie mochten rütteln, wie sie wollten, oder ihnen Wasser über den Kopf gießen.
Und doch reagierten die Schläfer auf solche Mittel — besonders der eine verzog, wenn er mit etwas scharfem Papier in den Nasenwinkeln gekitzelt wurde, in komischer Weise das Gesicht und machte mit der Hand abwehrende Bewegungen. Aber zu wecken war auch er nicht.
»Lassen wir sie liegen! Wir wollen uns erst weiter im Schiffe umsehen. Wir werden schon noch mehr Schläfer finden«, sagte Fritz.
»Wollen wir nicht ihre Taschen untersuchen nach Papieren?«
»Nein, Georg, wir gehen ganz korrekt vor, falls wir unser Erlebnis später eidlich zu Protokoll bringen müssen, dass man uns aus nichts einen Vorwurf machen kann. Die Männer hier schlafen nur, sind nicht Herr ihres Willens. Bei Toten wäre es etwas anderes. Jetzt wollen wir ihre Taschen noch nicht untersuchen, sondern uns erst weiter im Schiffe umsehen, wir werden schon offen liegende Papiere finden.«
Sie verließen die Kommandobrücke, unter welcher ein Eingang nach der unter Deck liegenden Kajüte führte, begaben sich aber erst nach vorn, wo sich immer, meist unter der Back, das Mannschaftslogis befindet.
Richtig! Da lag die ganze Besatzung in ebenso tiefem Schlafe; auf Steuerbordseite wurden vierzehn Matrosen gezählt, auf Backbord acht Heizer.
Sie hatten beim Essen gesessen, als sie von der plötzlichen Müdigkeit überwältigt worden waren, und nur einige wenige hatten noch die Kraft gehabt, sich nach ihren Kojen zu schleppen und sich hineinzulegen. Denn dass keiner schon vorher drin gelegen hatte, das war an allem erkenntlich. Besonders der eine lag noch so halb über dem Kojenrand, hatte nicht mehr die Kraft gehabt, vollends hineinzukriechen; der bleierne Schlaf hatte ihm die Augen zugedrückt, jetzt schnarchte er in dieser unbequemen Stellung mit voller Lungenkraft.
Die anderen saßen an der Back, an dem Tische, der sonst oben an der Decke befestigt ist; meist hatten sie die Arme auf den Tisch gelegt und den Kopf darauf; einige aber waren auch von der Bank herabgeglitten, lagen schlafend da, wie sie eben gefallen waren.
»Was für eine Mahlzeit ist das gewesen? Abendessen oder Frühstück?«
Auf der Back standen Kessel und die üblichen Trinkbecher aus Blech, zwei Buttertöpfe, ein Korb mit hartem und frischem Brot.
»Sie haben Kaffee getrunken.«
»Dann ist es das Frühstück gewesen«, meinte Fritz.
»Woraus willst Du das so bestimmt schließen?«
»So viel ich weiß, wird auf den Schiffen des Abends Tee und des Morgens Kaffee getrunken.«
»Ja, auf deutschen und englischen Schiffen ist es so, aber es gibt doch auch noch andere Schiffe. Auf Holländern zum Beispiel wird auch abends im Mannschaftslogis Kaffee getrunken, und ein paar Matrosen und auch Heizer machen mir einen recht holländischen Eindruck.«
Ja, die Schläfer — hier, wie auf der Kommandobrücke — waren Europäer, und zwar nordische, Südländer fehlten, ebenso Farbige. Wenn auch der eine oder der andere schwarze Haare hatte und sonnverbrannt alle waren, die Rasse kann man am ganzen Typus doch immer unterscheiden, und bei einigen musste man, wenn man einige Erfahrung besaß, gleich an Holländer denken.
»Außerdem könnte auch noch der Nachmittagskaffee in Betracht kommen«, setzte Georg hinzu.
Nun, sie wollten sich jetzt nicht weiter in Vermutungen darüber ergehen, wann der allgemeine Schlaf hier eingetreten war. Die Hauptsache war, dass sie alle doch zweifellos etwas genossen hatten, was diesen Schlaf verursacht hatte. War es der Kaffee gewesen? Die Vermutung lag sehr nahe. Natürlich hüteten sich die beiden, ihn zu kosten.
In einer besonderen Kabine unter der Back lagen schlafend zwei einzelne Männer, jedenfalls der Bootsmann und der Zimmermann, welche den Rang von Unteroffizieren bekleiden. Sie hatten vor derselben einfachen Mahlzeit gesessen, und daraus schloss Georg, der schon mehr als sein Freund auf Schiffen gefahren war, dass das Abendbrot nicht in Betracht kommen könne, denn da erhalten mindestens die Unteroffiziere warmes Essen.
Sie begaben sich nach der Kommandobrücke zurück, blickten aber erst einmal in die gleich dahinter liegende Kombüse, die Küche. Da lag auf der Bank der Koch mit weißer Schürze und Mütze und schnarchte.
Nun würden sie wahrscheinlich auch noch im Heiz- und Maschinenraum Personal finden, das nicht mit an der gemeinschaftlichen Mahlzeit hatte teilnehmen können.
Dorthin mussten sie sich erst einen Weg suchen. Auf den meisten Dampfern ist hinter der Kommandobrücke um den Schornstein herum ein Gitterwerk angebracht, durch dessen Luke die Heizer in ihr Reich steigen. Es fehlte hier.
Ehe die Freunde nun durch den großen Kajüteneingang hinabdrangen, hielten sie noch einmal Überblick über das Meer.
Im Südwesten war in weiter Ferne ein Segel zu sehen, sonst nichts.
»Es ist doch recht einsam hier, so nahe der Küste!«, meinte Fritz.
»War es gestern etwa belebter?«, entgegnete Georg.
»Es ist eben Feiertag, kein Fischer fährt heute aus, segelkundige Sportsfreunde gibt es in Callao herzlich wenig, und zudem befinden wir uns eben außerhalb der Dampferlinien.«
Sie stiegen die teppichbelegte und von blanken Geländern begleitete Treppe hinab. Unten, gleich daneben, war die Pantry, der Anrichteraum, wo ein Steward schlafend auf dem Stuhle saß.
Durch eine offene Tür blickten sie in die Offiziersmesse, in der zwei Männer schlafend am Tische saßen, ein dritter hatte sich am Boden ausgestreckt — jedenfalls ein Steuermann und zwei Maschinisten. Auch sie saßen vor Kaffee, Brot und Butter.
»Georg, o, Georg, das ist doch ganz wunderbar, was wir hier erleben!«, flüsterte Fritz noch einmal von der größten Erregung befallen.
»Ja, so einen Dampfer, auf dem alles eingeschlafen ist, den wird wohl selten jemand finden«, meinte sein phlegmatischer Freund.
»Ob wir wohl hier einen Bergelohn beanspruchen dürfen?«
»Darüber wollen wir jetzt noch nicht sprechen, sondern erst einmal weitere Umschau halten und festzustellen suchen, woher dieses Schiff kommt, was für ein Ophir das ist — wohin es geht — was es geladen hat.«
»Wenn nun noch einem anderen Fahrzeug dieser stillliegende Dampfer auffällt, wenn noch andere Menschen ihm einen Besuch abstatten?«
»Dann würden wir als erste schon unsere Finderrechte zu wahren wissen, wenn uns solche wirklich zustehen«, entgegnete Georg.
Auch hier untersuchten sie noch nicht die Taschen der Schläfer.
Der nächste Raum, den sie betraten, war unverkennbar die Kapitänskajüte. Niemand befand sich darin. Ein großer Panzerschrank war verschlossen; ebenso war es der Fall mit allen Schubladen des Schreibtisches. Auf diesem lagen wohl einige Bogen Papier, aber sämtlich unbeschrieben, sie führten nicht, wie üblich, am Kopf den Namen des Schiffes und den des Kapitäns.
»Merkwürdig, dass es hier gar nichts Geschriebenes und nicht einmal etwas Gedrucktes gibt, keine Zeitung und nichts sonst, woraus man schließen könnte, wo der Dampfer zuletzt gewesen ist!«, brummte Georg.
»Diese Nachweise werden sich in den Schubfächern befinden. Hier ist sehr ordentlich aufgeräumt. Der Kapitän wird die Schlüssel schon in der Tasche haben.«
»Wenn die Schläfer nicht bald erwachen, wird uns wohl das Recht zustehen, von diesen Schlüsseln Gebrauch zu machen, was aber schließlich auch erst noch überlegt sein will. Es ist eine heikle Geschichte. Man darf uns einmal nichts nachsagen können. Weiter! Eine Besichtigung des ganzen Schiffes ist wohl gestattet, das kann unmöglich als Hausfriedensbruch aufgefasst werden.«
Sie wanderten weiter, öffneten die Schiebetüren, die — bis jetzt wenigstens — alle unverschlossen waren, blickten in sehr viele Einzelkabinen mit Kojen und sonstigen Bequemlichkeiten ausgestattet, nicht gerade glänzend, aber doch schmuck und komfortabel.
»Es wird ein Frachtdampfer sein, der zur Mitnahme von mehreren Passagieren erster Klasse eingerichtet ist«, meinte Georg.
Dann folgte ein großer Saal, der wirklich geradezu glänzend ausgestattet war. An den Tischen mit bequemen, eleganten Stühlen hatten wenigstens hundert Personen Platz.
»Hallo, das gibt's auf einem Frachtdampfer nun freilich nicht! Das ist ein Passagierschiff, sogar ein Luxusdampfer!«, rief Georg.
»Da fehlen aber doch eigentlich die Stewards und die sonstigen dienstbaren Geister«, meinte Fritz.
»Die müssen wir erst noch finden, die halten sich abgesondert auf, oder der Dampfer ist einmal ohne Passagiere gegangen, hat also auch keine Bedienung angemustert.«
»Oder es ist überhaupt nur eine sehr große Luxusjacht, einem reichen Manne gehörend, der eben diesmal keine Gäste mitgenommen hat.«
»Auch möglich!«
Dieser Speise- oder Gesellschaftssaal, der auch einen Konzertflügel enthielt, befand sich schon im zweiten Deck, ging nach oben durch das erste hindurch. Die beiden Freunde standen vorläufig noch auf einer Galerie, von der ein Treppchen hinabführte.
Da sie dieses nun benutzten, befanden sie sich jetzt also im zweiten Deck, und in diesem setzten sie ihren Weg durch die Korridore fort.
Sie betraten kleinere Säle, Rauchsalons und dergleichen.
Ja, es war entweder eine sehr große Luxusjacht oder ein mittlerer, eleganter Passagierdampfer, der einmal keine Fahrgäste mitgenommen hatte.
Dann also durfte man auf Fracht gar nicht viel rechnen, in den übrigen Räumen war höchstens noch Proviant und dergleichen untergebracht, was sonst für die Passagiere bestimmt war. Und dann natürlich die nötigen Kohlen, Trinkwasser und so weiter.
Ein recht ansehnliches Bibliothekszimmer, oder ein Lesesalon, enthielt Literatur in allen modernen Sprachen, sodass auch hier wieder nicht zu erkennen war, welcher Nationalität der Dampfer angehörte, und merkwürdig war, dass auch hier wieder jede Zeitung fehlte.
Sogar ein Schwimmbad war vorhanden, das prächtige Marmorbassin, jetzt ungefüllt, zwölf mal acht Meter groß, mit Sprungbrettern und Rutschbahn und allem — daneben eine Halle mit Apparaten für schwedische Gymnastik und Turngeräten aller Art. Und wieder daneben ein Palmengarten!
»Ja, für gewöhnlich hat das Schiff eine andere Besatzung, der Dampfer ist nur einmal von der notwendigsten Mannschaft von einem Hafen zum anderen überführt worden«, lautete jetzt das einstimmige Urteil der beiden Entdecker.
Dann, wie sie wieder durch den Korridor schritten, bog der etwas vorausgehende Fritz abermals aufs Geratewohl eine der vielen Schiebetüren zurück.
Georg tat dasselbe unterdessen auf der anderen Seite, untersuchte einen Raum, der ganz mit Konservenbüchsen vollgepfropft war.
Jetzt begaben sie sich wieder an Deck.
»Ja, Georg, wir müssen so lange hier verweilen, bis die erwachen«, meinte Fritz, »das ist unbedingt unsere Pflicht.«
»Und wenn sie nun gar nicht wieder erwachen, in den Tod hinüberschlafen?«
»Dann müssen wir eben ihren Tod konstatieren. Ihnen zu helfen ist uns nicht möglich.«
»Wenn nun ein Schiff in die Nähe kommt, wollen wir es anrufen?«
»Ja, das müssen wir wohl. Schon deshalb, weil sich auf jenem Schiffe ein Arzt oder sonst ein Mensch befinden kann, der diesen anormalen Schlaf zu beurteilen versteht und vielleicht Hilfe bringen kann. Jetzt untersuchen wir die Taschen der Schläfer nach Papieren. Wir müssen doch irgend etwas finden, was verrät, was das eigentlich für ein Schiff ist!«
Sie begannen mit der Untersuchung der Taschen bei den beiden Offizieren, von denen der eine wahrscheinlich der Kapitän war.
Ja, Taschen hatten sie in Hose, Weste und Rock, auch Verschiedenes darin — Messer, Pfeife, Tabak, Feuerzeug, Revolver und dergleichen. Auch einiges Papier, auf dem sie Rechnungen ausgeführt hatten, jedenfalls geografische Ortsbestimmungen. Aber keinen Brief oder sonst ein Schriftstück, das auf ihre eigenen Personalien oder auf das Schiff irgendeinen Schluss gestattet hätte.
Noch fanden die beiden Freunde hierin nichts besonders merkwürdig, auch nicht darin, dass keiner der Offiziere einen Schlüssel einstecken hatte. Anders aber wurde diese Sache, als sie sich nach dem Matrosenlogis begaben und dort ihre Untersuchungen fortsetzten, die sämtlichen Matrosen und Heizer und Unteroffiziere hatten alles Mögliche in den Taschen, nur nichts Geschriebenes, und dasselbe galt von ihren Kleiderkisten, von denen die meisten offen waren.
»Das ist wirklich ganz auffallend!«, meinte Fritz.
»Ihre Seefahrtsbücher müssen die Leute wohl an den Kapitän abgeben, aber ihre sonstigen Ausweispapiere, Geburtsschein und dergleichen, behalten sie in eigener Verwahrung, und überhaupt, so ein europäischer Matrose oder Heizer, der sicher lesen und schreiben kann, muss doch irgendeinen Brief in seinem Kasten haben!«
»Ja eben, das ist es ja gerade, was mir so merkwürdig erscheint!«, bestätigte Fritz. »Das ist geradezu wie eine prinzipielle Abmachung, nichts bei sich zu haben, was über das Schiff oder über die Besatzung Aufschluss geben könnte!«
»Nicht einmal eine Fotografie, die man doch wohl in der Kleiderkiste jedes Seemanns findet!«
Es ließ sich nichts weiter machen, die beiden konnten sich nur wundern. Alles Raten hatte da gar keinen Zweck.
Allerdings gab es noch verschlossene Schränke und Koffer, auf deren gewaltsames Erbrechen sie aber doch lieber verzichteten. Dasselbe galt natürlich erst recht für die Kapitänskajüte.
Wo war nun der Zugang zum Maschinenraum?
So weit die beiden das Innere eines Schiffes beurteilen konnten — und besonders Georg vermochte das recht gut — musste er hinter dem Ende dieser Korridore liegen.
Richtig! Auf diesem Quergang befand sich eine große Tür. Sie musste nun unbedingt zum Maschinenraum führen. Aber sie war verschlossen, ließ sich nicht öffnen. Die beiden Freunde suchten noch einige Zeit nach einem anderen Zugang, in anderen Decks, und indem sie von hinten kommen wollten, fanden sie auch noch einige Türen, aber sämtlich verschlossen.
»Merkwürdig, dass man diese Türen sämtlich verschließt, die doch immer zur allgemeinen Benutzung für das Arbeiterpersonal offen stehen«, meinte Fritz.
»Oder wir verstehen sie nur nicht zu öffnen«, entgegnete Georg.
»Es sind doch einfache Klinken und Schlösser.«
»Aber sicher ist sonst noch ein Mechanismus vorhanden, dass man beim Öffnen keinen Schlüssel braucht. Nur muss man erst eingeweiht sein.«
Die Freunde gaben es vorläufig auf, einen Zugang zum Heiz- und Maschinenraum zu finden.
Sie fanden die Bottlerei, die Flaschenniederlage, und zwar mit gefüllten Flaschen aller Art, und gleich daneben war wieder eine Proviantkammer, besonders mit geräucherten Fleischwaren versehen. Es war ganz auffallend kühl darin, dazu nun die Schlangenrohre an den Wänden — man brauchte nur das Ventil in der Pfeilrichtung zu drehen, und schnell begannen sich die eisernen Wände des ganzen Raumes mit Reif zu bedecken.
Die beiden Freunde hatten in ihrem Segelboot recht guten Proviant, aber Schinken und Würste hatten sie nicht, die sind in Callao und dergleichen Breiten eben meist nicht für schweres Geld zu haben.
So wurde gleich hier in dieser Proviantkammer gefrühstückt, das war sicher erlaubt, für die viele Arbeit, die sie schon mit diesem verschlafenen Schiffe gehabt hatten.
Wieder ein Nebenraum enthielt Fässer und Blechkisten, zum Teil geöffnet, mit Hartbrot, die feinste Sorte, aus Weizenmehl, sowohl weiß wie braun gebacken, letztere ganz herzhaft schmeckend. So gut war das von ihnen Mitgenommene bei Weitem nicht.
Diese drei Räume besaßen wohl Bullaugen, die aber geschlossen gewesen waren, mit dem eisernen Deckel, und die beiden hatten nicht erst für nötig befunden, sie zu öffnen.
Sie ließen sich auf Kisten nieder, zogen ihre Messer und säbelten los, auch zweimal den Korkzieher arbeiten lassend.
Noch nicht lange hatten sie so gesessen und gegessen, als es einen Krach gab.
Aufgesprungen und aus der Räucherkammer hinüber in die Bottlerei geeilt, welche den mittelsten dieser drei Räume bildete, auch die einzige nach dem Korridor führende Tür besaß.
Diese Schiebetür, die sie natürlich offen gelassen hatten, war zugeschlagen.
Das war an sich nichts Merkwürdiges. Solche Schiebetüren laufen auf Rollen, und es gehört nur eine sehr leichte Schiffsbewegung dazu, die man manchmal gar nicht zu merken braucht, um solch eine Tür auf- oder zu rollen zu lassen. Um dies zu verhindern, ist immer eine Klammer oder sonstige Festhaltung vorhanden, die aber keiner der beiden benutzt hatte.
Georg wollte, noch mit kauendem Munde und in der Hand eine große Schinkenscheibe, die Tür an dem Griff wieder aufschieben.
Da merkte er, dass es nicht ging.
Und nach fünf Minuten währenden Versuchen mussten die beiden erkennen, dass es kein Mittel gab, die Schiebetür wieder zu öffnen. Wahrscheinlich war ein Schnappschloss daran, nur von draußen mit dem Schlüssel aufzuschließen.
»Das ist ja eine nette Geschichte!«
»Jetzt sind wir hier gefangen und müssen warten, bis die da oben ausgeschlafen haben!«
»Und wenn sie nun niemals wieder erwachen?«
»Na, es wird doch einmal ein anderes Schiff in die Nähe kommen!«
»Ja, öffnen wir die Fenster.«
Vergebens probierten die beiden alles Mögliche, um die Schrauben aufzudrehen, sie gaben keinen Schlag nach, und da ein Eisenband, etwa einer Kiste entnommen, derartig zu biegen, dass es als Schlüssel passte, das war leichter gesagt als getan, da ihnen jedes Werkzeug dazu mangelte.
Nach einer Viertelstunde gaben sie diese Bemühungen auf.
»Was nun, Georg?«
»Na, auf zehn Zentner Fleischwaren schätze ich den hier aufgestapelten Vorrat mindestens, vielleicht sind es auch zwanzig, drüben ist sicher ebenso viel Brot, da halten wir es schon zwei bis drei Jahre aus, so lange reicht auch der Wein als Getränk, und bis dahin kann sich vieles ändern«, meinte der Gefragte phlegmatisch.
»Und ich denke doch, bis dahin wird ein anderes Schiff sich — horch!«
Über ihnen gingen derbe Schritte!
»Da ist schon einer wieder erwacht!«
»Oder er hat überhaupt nicht geschlafen.«
Die Schritte waren verklungen. Bald aber kamen andere, rannten über Deck, manchmal mehrere zugleich.
»Da hilft es nichts, wir müssen uns bemerkbar machen. Fatale Geschichte!«
Sie klopften und donnerten gegen die Tür und gegen die Wände, sie schrien und machten anderen Spektakel — alles zwecklos.
Oben rannten die Schritte hin und her. Sie vernahmen auch Stimmen, ohne allerdings Worte verstehen zu können, aber sie wurden nicht aus ihrer Gefangenschaft befreit.
»Sie müssen doch unser Boot bemerken!«
»Natürlich, aber sie können sich nicht erklären, wie es hierher gekommen ist, keinem fällt ein, die Eigentümer zu suchen, oder sie finden uns nicht.«
»Seltsam, ganz seltsam!«
Gegen neun Uhr hatten die beiden sich hier zum Frühstück niedergelassen, und es war gleich Mittag, als oben das Lärmen verstummte, kein Schritt mehr hörbar war.
»Jetzt essen sie Mittag.«
Doch es wurde an Deck nicht wieder lebendig. Alles blieb totenstill.
»Sollten sie etwas an der Maschine zu reparieren gehabt haben? Warum aber — da, jetzt!«
Das Schiff stampfte und schlingerte etwas, allerdings nur wenig.
Aber in Fahrt war der Dampfer noch nicht. Da fehlte das Zittern der Planken.
Das Stampfen und Schlingern wurde ein wenig stärker.
Die beiden Freunde befanden sich wieder in der Räucherkammer, als es mehrmals hintereinander knallte, drüben in der Bottlerei.
Schnell hinübergesprungen.
Die Schiebetür rollte hin und her.
Befreit! Hinausgerannt, die nächste Treppe gesucht.
»Ich bin nur gespannt, wie jetzt die Auseinandersetzung werden wird«, sagte Fritz noch unterwegs.
Vom wolkenlosen Himmel herab brannte die Mittagssonne auf eine trotz der Windstille etwas gekräuselte See und auf das Deck, auf dem sich nichts geändert hatte; es sah noch genau so aus wie zuvor.
Und doch! Georg bemerkte es zuerst, das Fehlen des Seilhakens, an dem sie ihr Boot befestigt hatten. Er sprang hin, beugte sich über die Bordwand.
»Unser Boot ist weg!«
»Was soll das bedeuten? Wo ist die Mannschaft? Ist sie etwa schon wieder eingeschlafen?«
Sie eilten auf die Kommandobrücke, der sie am nächsten standen.
Verschwunden waren die beiden Offiziere, verschwunden der Matrose, der am Steuerrad gelegen hatte.
Das Steuerrad hatte eine Vorrichtung zum Feststellen und es war auch festgestellt worden — ob das schon etwa früher geschehen, darüber hatten sie sich vorher nicht vergewissert — sie begaben sich nach dem Mannschaftslogis.
Matrosen, Heizer, Unteroffiziere — alles fort!
Und Kleiderkisten und Zeugsäcke hatten sie mitgenommen!
Die beiden Freunde blickten einander mit großen Augen an.
»Nun schlägt's aber dreizehn!«, sagte Fritz.
»Ob die unter Deck — —«
»Ach, da brauchen wir gar nicht erst nachzusehen, da finden wir niemanden mehr.«
»Ja, wohin sind die denn?«
»Sie müssen doch wenigstens die Boote benutzt —«
»Die hängen ja sämtlich vorschriftsmäßig in den Davits.«
»So müssen sie in unserem Boote —«
»Na, glaubst Du denn etwa, Georg, die ganze Schiffsbesatzung hat das Schiff in unserem kleinen Kutter verlassen?«
»Ja, wie ist sie denn sonst fortgekommen?«
»Mensch, frage nicht, wenigstens nicht mich! In meinem Kopfe beginnt sich alles zu drehen. Die ganze Mannschaft ist eben samt ihren Kleiderkisten ins Wasser gehuppt!«
Fritz Hammer versuchte es mit dem Humor, um sich über dieses unlösbare Rätsel hinwegzusetzen.
Schließlich begaben sich die beiden doch unter Deck.
Richtig, in der Offiziersmesse war auch niemand mehr, man hatte die Tische und den ganzen Raum vor dem Verlassen so sauber aufgeräumt wie das ganze Mannschaftslogis, dasselbe galt von den Offizierskabinen, in die die beiden blickten. Die Koffer waren verschwunden, die jetzt offenen Schränke waren leer.
Ebenso war das in der Kapitänskajüte der Fall, so weit wenigstens in den Schränken Garderobe und andere Privatsachen hatten vermutet werden können. Der mächtige Panzerschrank war natürlich nicht mitgenommen worden, der Schreibtisch auch nicht — sie waren beide noch verschlossen.
»Fritz, nun äußere Dich einmal! Irgendeine Vermutung musst Du doch haben. Wo mag die ganze Mannschaft geblieben sein? Weshalb und wie hat sie den Dampfer hier auf hoher See verlassen?«
»Ich begreife nicht, dass Du Dich überhaupt noch über etwas wundern kannst! Verstehst Du denn nur gar nicht, was für ein unergründliches Rätsel vorliegt?«
»Na, an Hexerei glaube ich nun nicht. Ja, was nun? Ein Boot aussetzen und nach Callao zurücksegeln? Morgen müssten wir eigentlich wieder im Geschäft sein.«
»Weiter fehlte doch nichts! Unser Prinzipal würde uns schön auslachen, würde uns die größten Vorwürfe machen und jeder andere vernünftige Mensch würde dasselbe tun. Nein, unsere unbedingte Pflicht ist es, hier wenigstens so lange auszuhalten, bis ein anderes Schiff kommt oder andere Menschen uns als Wächter ablösen. Und bis dahin müssen wir immer weiter untersuchen, ob wir sonst noch etwas Auffallendes entdecken, das uns dieses Rätsel vielleicht lösen könnte.«
Sie begaben sich wieder in die Kapitänskajüte.
Dort wartete ihrer gleich eine große Überraschung. Wenigstens als sie, jetzt zum ersten Male, die an diese Kajüte grenzende Kabine betraten.
Es war ein größerer Raum, mit Schränken und Gestellen, die auch in mehrfachen Reihen durch die Mitte liefen, sodass Gänge gebildet wurden. Alle diese Schranktüren waren offen und die beiden Freunde sahen Garderobe aller Art, meist aber zu Sportzwecken dienend, die verschiedensten Jagdkostüme, die leichtesten Anzüge mit hohen Wasserstiefeln, wie Lederpanzer, wie dicke Pelzkostüme, alles war vorhanden, und zwar immer gleich für mehrere Körpergrößen, alles gebraucht, aber tadellos in Ordnung gehalten, und andere Schränke enthielten Jagdwaffen, von der leichtesten Vogelflinte an bis zur schwersten, Explosivkugeln schießenden Elefantenbüchse, Angelgerätschaften und Harpunen in jeder nur denkbaren Auswahl, ferner Reitzeug, und da war auch alles und jedes vorhanden, um dem nationalen Charakter des Reiters gerecht zu werden.
Es gab aber auch noch anderes in dem großen, langgestreckten Raume, was nicht in Schränken und Stellagen untergebracht werden konnte.
»Sieh hier, Georg! Ein ganzes Arsenal von Schlitten, Rennwölfe und Bobsleighs und wie die Dinger alle heißen, Ein- und Mehrsitzer!«
»Und hier grönländische Kajaks!«, rief Georg auf der anderen Seite des Raumes.
Und so machten sich die beiden Freunde gegenseitig immer wieder auf neue Entdeckungen aufmerksam. Dies alles war aber eigentlich nicht die große Überraschung, die ihrer hier wartete.
Die bestand in einer mächtigen Kiste, welche alles enthielt, was sie in ihrem Boote mitgenommen hatten! Ihre Waffen und Angelgerätschaften, ihren Proviant, Wäsche — alles war vorhanden.
Nur der Kutter selbst fehlte mit Takelage und Rudern, auch das Fass mit Trinkwasser war hier nicht abgeliefert worden.
»Da kommt ein Dampfer!«, rief Fritz da mit der ausgestreckten Hand durch eines der Bullaugen deutend.
In der Tat — es war ein Dampfer mit zwei Schornsteinen, der von Süden heraufkam, noch weit entfernt.
»Der muss so nahe hier vorbei, dass wir uns bemerkbar machen können. Sicher hat er das stillliegende Schiff schon gesehen und wird mit ihm wenigstens Grüße tauschen wollen«, sagte Fritz.
Der Dampfer kam wirklich heran, hielt direkt auf dieses Schiff zu.
Es war zweifellos ein Passagierdampfer. Schon hörten die Freunde eine Musikkapelle spielen. Es war ein Uhr, also Zeit für das zweite, große Frühstück, für den »Lunch«, warm serviert, jedenfalls an Deck unter Sonnensegeln eingenommen; die Kapelle spielte dazu lustige Weisen auf.
Die beiden hatten sich auf die Kommandobrücke begeben. Das sogenannte Kartenhaus, das dort steht, enthält auch nautische Instrumente, sie bewaffneten sich mit Fernrohren und konnten die ziemlich zahlreichen Passagiere an Deck des Dampfers erkennen.
Die meisten verließen gerade die Tische, traten an die Bordwand, gingen hin und her, einige übermütige Pärchen tanzten.
»Merkwürdig, dass sie unserem Dampfer weniger Beachtung schenken, als es doch eigentlich der Fall sein müsste«, meinte Fritz, »zumal hier in diesem so selten befahrenen Meere, wo wir weit und breit das einzige Schiff sind!«
»Ja, und dabei hält der Dampfer direkt auf uns zu. Da ist diese Teilnahmslosigkeit der Passagiere um so auffallender«, bestätigte Georg.
»Na, wir werden doch nicht etwa durch Winken und Rufen auf uns aufmerksam machen müssen?«, fragte Fritz lachend.
Das Lachen sollte ihm bald vergehen.
Näher und näher kam der große Dampfer mit der Geschwindigkeit eines Personenzuges. Jetzt war drüben alles mit bloßen Augen zu erkennen, aber das merkwürdige Verhalten der Passagiere wollte sich nicht ändern.
Einige standen wohl an der Reling, aber die meisten promenierten nach wie vor auf und ab oder standen plaudernd in Gruppen zusammen oder saßen noch an den Tafeln, dem fremden Dampfer vielfach den Rücken zukehrend, nicht den Kopf wendend.
»Georg, was sagst Du zu diesen stumpfsinnigen Menschen?«
»Mir völlig unbegreiflich!«
»Diese Menschen müssen doch geradezu blind sein!«
»Nicht einmal die Offiziere auf der Kommandobrücke blicken nach uns!«
»Ja, wollen die uns denn rammen?«
Fast sah es so aus, von Sekunde zu Sekunde wurde die Lage gefährlicher.
»Bertran de Born« lag so, als wolle er von Osten nach Westen fahren, und jener Dampfer, dessen Name noch nicht sichtbar war, wie er auch keine Flagge zeigte, kam also direkt von Süden her nach Norden, und es sah tatsächlich aus, als wolle er dem »Bertran de Born« in die Rippen fahren.
Und das wickelte sich, eben bei der Geschwindigkeit dieses großen Passagier- und wahrscheinlich Postdampfers, so schnell ab, dass es gar nicht zu beschreiben ist.
In der nächsten Minute oder schon Sekunde konnte die fürchterliche Katastrophe eintreten, die beiden merkten bereits, wie sich ihre Haare vor Entsetzen sträubten, waren kaum noch fähig zu winken und zu schreien, was nun freilich gar keinen Zweck mehr gehabt hätte.
Da rauschte und schoss der mächtige Dampfer schon an ihnen vorüber, mit der Steuerbordseite kaum noch zehn Meter entfernt.
Und dort drüben spielte die Musikkapelle, aßen und tranken und promenierten und plauderten und tanzten die etwa zweihundert Passagiere, und jetzt wandten sich einige von ihnen, die gerade in der Richtung nach dem »Bertran de Born« blickten, gelangweilt ab, oder auch interessiert, weil da ein Herr, der eben aus der Kajüte getreten war, ein Zeitungsblatt schwang.
»Gefunden, ich hab's gefunden! Nun werde ich den Damen und Herren beweisen, dass ich mit meiner Behauptung vorhin recht hatte! Hier steht's schwarz auf weiß, der Prinz von Wales hat bei dem letzten Hofball keinen Frack getragen, sondern einen Smoking mit Samtbesatz!«
So hörten die beiden Freunde dort drüben den Herrn ganz deutlich rufen. Und dann war der fremde Dampfer vorüber.
»Findest Du hierfür eine Erklärung, Fritz?«
»Nein, ich bin einfach paff!«
»Die dort drüben können doch nicht alle blind gewesen sein!«
»Aber gesehen haben sie uns nicht.«
»Gibt es denn dafür nur gar keine Erklärung?«
»Ja, die gibt es.«
»Und die wäre?«, fragte Georg hochaufhorchend.
»Dieses Schiff hier ist unsichtbar mit allem, was sich darauf befindet, also auch wir beide sind unsichtbar, einfach Luft.«
»Ach Unsinn, Fritz!«
»Na, dann gib mir eine andere Erklärung, Mensch, oder verschone mich mit Deinen Fragen!«, schrie der sanguinische Freund ganz wild.
Ja, es hatte gar keinen Zweck, hier nach einer Erklärung suchen zu wollen. Man musste sich mit der Tatsache abfinden. Die Menschen dort hatten einfach das ganze Schiff nicht gesehen. Und damit basta!
Jetzt hatte sich der Dampfer schon vielleicht dreihundert Meter entfernt, Georg starrte ihm nach, hob abermals sein Fernglas.
»Ein neues unerklärliches Rätsel!«, rief er.
»Und das wäre?«, meinte Fritz ruhig. »Aber etwas ganz Neues und Interessantes muss es wirklich sein, sonst lässt mich fernerhin alles kalt, und wenn auch Walfische durch die Luft zu fliegen beginnen.«
»Weißt Du, was für ein Dampfer das gewesen ist?«
»Ich? Nee. Ist mir auch ganz schnuppe.«
»Der ›Telemak‹ von Vancouver!«
»Ach nee!«, stellte sich Fritz erstaunt, immer nur, um irgendeine andere Empfindung zu heucheln als die, die ihn wirklich beherrschte — die des unheimlichen Staunens, des Entsetzens, mit dem Zwange, an etwas Übernatürliches glauben zu müssen.
»Derselbe Dampfer, auf dem ich damals von Sydney nach San Francisco fuhr, als mein Vater mich die Reise um die Erde machen ließ.«
»Auf diesem Dampfer bist Du selber gefahren?«
»Wie ich sage! Er gehört der CanadianAustralianLinie an, die ausschließlich zwischen Sydney und Vancouver fahren lässt, unterwegs nur Wellington auf Neuseeland und Hawaii anlaufend — und dann natürlich noch San Francisco mitnehmend.«
»Na, und?«
»Na, und?«, wiederholte Georg. »Nun stelle Dir einmal die Karte vor. Oder wenn Du sie nicht im Kopfe hast — drin im Kartenhaus wirst Du schon eine finden. Wir befinden uns hier doch nur einige Seemeilen von der Küste Perus entfernt, und dieser ›Telemak‹ fährt von Sydney nach Vancouver, stelle Dir diesen Unterschied in der Entfernung vor —«
»Was, Du willst doch nicht etwa sagen, wir wären hier mitten in der Südsee, so etwa achtzig Längengrade oder mehr als dreitausend Seemeilen von der peruanischen Küste entfernt?!«
»Ich sage nur, dass der ›Telemak‹ immer nur die angegebene Linie befährt, wie alle Dampfer dieser kanadischen Reederei.«
»Er macht eben einmal eine andere Tour, die südamerikanische Küste entlang.«
»Möglich! Ich wollte auch nur — hallo!«
Auch Fritz schnellte gleich von seinem Stuhle auf.
Durch die Schiffsplanken ging ein Zittern, und da brauchten die Freunde nicht erst über die Reling zu blicken, um festzustellen, wie unten am Schiffsrumpf das Wasser rauschte.
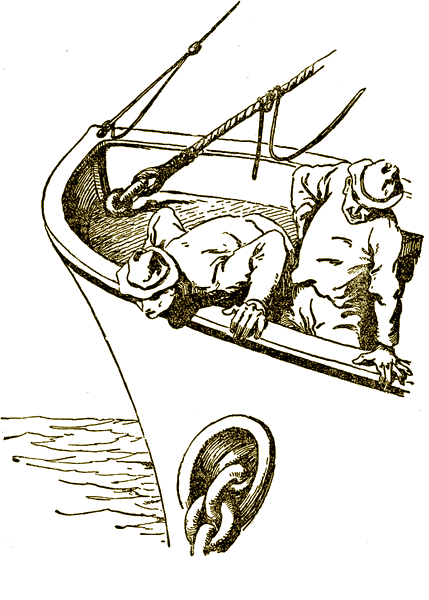
Der Dampfer hatte sich in Bewegung gesetzt, fuhr schneller und schneller.
Die beiden blickten verstört nach dem Steuerrad.
Ja, dieses war festgelegt gewesen, hatte sich nicht drehen lassen, als die beiden es vorhin probiert hatten.
Und jetzt drehte es sich selbstständig nach links, machte verschiedene ganze Umdrehungen, der Dampfer steuerte nach Backbord, beschrieb einen halben Bogen, bis er den Bug direkt nach Süden gerichtet hatte.
Hierauf hörte die lebhafte, einseitige Drehung des Speichenrades auf, es begann hin und her zu spielen, so wie der steuernde Matrose es ständig spielen lässt. Festgehalten wird das Rad niemals, denn ist die See auch noch so ruhig, nach einem Gesetz, das hier nicht erläutert werden kann, weicht das Schiff immer etwas nach links und rechts aus, das offenbart sich natürlich am Kompass, und das muss fortwährend ausgeglichen werden.
»Nun bleibt einem aber der Verstand stehen!«, ächzte Fritz wiederum, wozu er ja auch allen Grund hatte.
Georg fasste die Sache etwas ruhiger auf als sein Freund.
»Da sind im Maschinenraum eben doch noch Leute.«
»Und wer dreht das Steuerrad?!«
»Das geschieht durch irgendeine Übertragung.«
»Nein, das ist Zauberei!«
»Daran glaube ich nicht.«
Weiter sollten die beiden das rätselhafte Vorkommnis nicht zu erörtern brauchen.
Auf der Kommandobrücke vorn befand sich der Signalapparat, ein Gestell, auf dem eine Scheibe mit Hebel angebracht ist. Durch Drehen dieses Hebels werden auf elektrischem Wege die dem Maschinisten geltenden Kommandos gegeben.
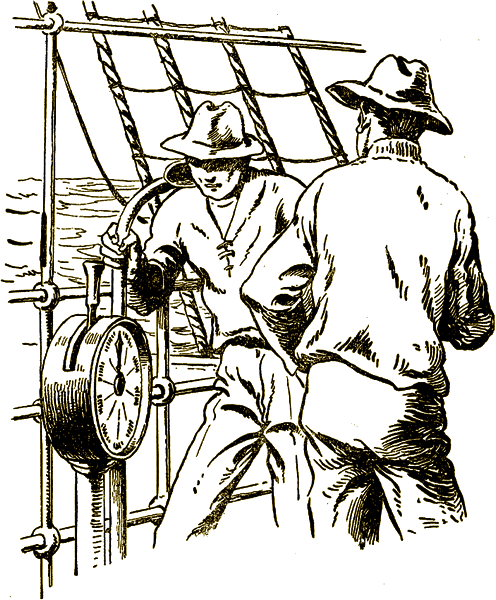
Um diesen auch einmal persönlich sprechen zu können, befand sich daneben früher immer das Sprachrohr — jetzt ist es auf Dampfern durch ein Telefon ersetzt.
Und dieses nun hatte schrill geklingelt.
Georg stand nahe dabei und trat nun ganz hin.
»Ist jemand dort?«
»Loke Klingsor, der Eigentümer dieses Schiffes, möchte die Herren persönlich kennen lernen und sprechen.«
So war es deutlich aus dem Schalltrichter herausgekommen, auch für den daneben stehenden Fritz noch verständlich.
»Loke Klingsor?«, wiederholte Georg, noch vollkommen überrascht.
»Ja.«
»Er befindet sich an Bord?«
»Nein.«
»Es sind aber doch Leute an Bord.«
»Nein.«
»Ich verstehe nicht, wie ist denn das möglich —«
»Wenn es Herrn Loke Klingsor beliebt, werden Sie Aufklärungen erhalten, sonst nicht«, wurde Georg etwas herrisch unterbrochen. »Wollen sich die Herren durch die Kajüte in das zweite Zwischendeck begeben. Sie gehen auf Backbordseite nach achtern, bis zum Quergang, der auf jeder Seite drei Türen hat, die mittlere, hinterste Tür öffnen Sie. Sie treten ein und warten das Weitere ab. Haben Sie mich verstanden?«
»Ich habe Sie verstanden.«
»Wiederholen Sie den beschriebenen Weg.«
Georg tat es.
»Befolgen Sie meine Anweisungen, bitte, halten Sie sich nicht weiter auf. Schluss!«
Das Telefon klingelte ab.
Die beiden Freunde blickten einander an.
»Ja, da wollen wir einmal!«, sagte dann Fritz. »Das ist das einfachste Mittel, um etwas zu erfahren.«
Sie nahmen den bezeichneten Weg, kamen in eine Region, in der sie schon gewesen waren, auf der Suche nach dem Maschinenraum, hatten ja auch schon diese Türen gesehen, sie aber eben nicht öffnen können.
Die mittlere der drei Türen war jetzt unverschlossen.
Ein ganz merkwürdiger Raum, den sie betraten.
Kreisrund und gewölbt, eine vollkommene Halbkugel bildend, unten etwa zehn Meter im Durchmesser und oben an der Decke eine große Öffnung, durch die man den blauen Himmel sah, aber erst musste man durch ein langes Rohr von mächtigem Durchmesser blicken.
»Das ist ja nichts anderes als der Feuerschacht, das dort oben ist der Schornstein!«, rief der im Schiffsbau erfahrene Georg sofort.
Ja, nichts anderes konnte es sein als in der Feuerungsanlage der Raum, der den eigentlichen Schornstein von den Feuerherden trennt, ein großer Rußfang.
Von Ruß war hier freilich nichts zu bemerken, überhaupt war das alles andere als solch eine schwarze Kammer.
Die runden Wände waren, wie auch der Boden, der aber hier keine Öffnung mehr zeigte, ein einziger Spiegel. Diesen Eindruck machte es wenigstens zuerst. Bei näherem Hinsehen aber erkannten die beiden, dass das Ganze aus zahllosen kleinen Spiegelchen zusammengesetzt war, jeder etwa drei Zentimeter im Durchmesser haltend.
In jedem einzelnen dieser Spiegelchen, die von tadelloser Beschaffenheit und Reinheit waren, wie frisch poliert aussahen, erblickten sich die beiden Freunde, ohne jede Verzerrung.

Das bekannte Bild Loke Klingsors!
Und außerdem befand sich in diesem rätselhaften Raume noch etwas anderes Merkwürdiges.
Von beiden Seiten der Schornsteinöffnung, also von der Decke, gingen rote Seile herab, wahrscheinlich starker Draht mit roter Seide übersponnen, und an diesen war eine schwarze, quadratische Platte von etwa drei Meter Seitenlänge befestigt, die also senkrecht herabhing, fast den Boden berührend, bei den geringen Schiffsschwankungen etwas über diesen hin und her pendelnd.
Die beiden brauchten sich nicht lange den Kopf zu zerbrechen, was dies alles zu bedeuten habe, so wie ihnen auch entgangen war, dass sich die Schiebetür, die sie offen gelassen, hinter ihnen von selbst geschlossen hatte.
Plötzlich erklang ein kurzes, surrendes Geräusch, das von der schwarzen Tafel auszugehen schien, und da begann deren Farbe auch schon zu erbleichen, sie wurde immer heller, bis sie ganz weiß war.
Und dann entstanden auf der weißen Fläche farbige Konturen, bis wie mit einem Ruck das ganze Bild fertig war.
Es stellte in Lebensgröße einen Mann vor, der mit übereinandergeschlagenen Beinen, die Hände in eigentümlicher Weise auf dem Schoße gefaltet, in einem Lehnstuhl saß, auf der rechten Schulter eine große schwarze Katze.
Das bekannte Bild Loke Klingsors! Nur das glühende Kohlenbecken mit der Rauchentwickelung und der seltsame Hintergrund mit den Flaschen und Glasbüchsen und sonstigen Sachen fehlte.
Noch betrachteten die beiden Freunde, natürlich staunend, diesen Mann mit dem so merkwürdigen Kopf und den unergründlichen Augen, die auf sie gerichtet waren, als einfaches Lichtbild, als dieses sich zu bewegen begann.
Zuerst erhob sich die Katze auf der Schulter, sprang in seinen Schoß herab, die verschlungenen Hände öffneten sich, um das Tier zu streicheln, und dann öffnete der Mann den Mund und begann mit ganz natürlicher Stimme zu sprechen.
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.