
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
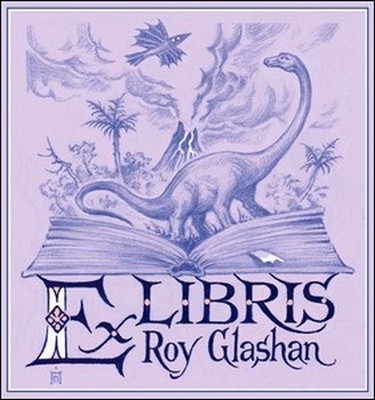
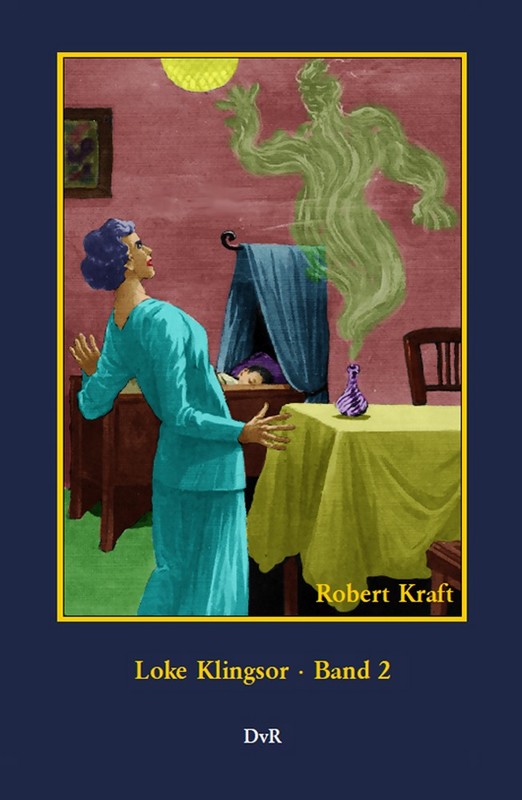
"Loke Klingsor," Band 2, Verlag Dieter von Reeken, 2024
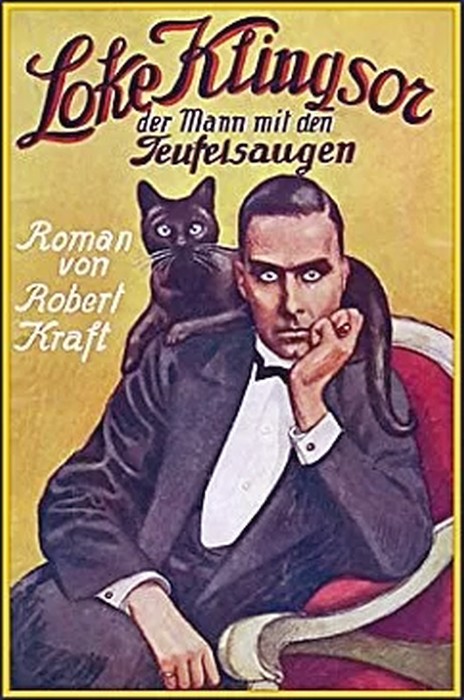
"Loke Klingsor," Coverbild, Lieferung 1
Prinzess Turandot und Professor Edeling begaben sich in das benachbarte Zimmer, und als der Baron gleich nach seinem Eintritt einen kleinen Ruck von unten her verspürte, wusste er schon, wozu es diente.
»Ein Fahrstuhl?«
»Nichts anderes.«
Sehr hoch konnten sie nicht gegangen sein, da öffnete Prinzess Turandot schon wieder die Seitentür.
Sie betraten einen Garten, Bäume und Büsche, deren Namen der Professor nur zum kleinsten Teil kannte, im üppigsten Grün prangend, die herrlichsten Früchte aber auch schon wieder neue Blüten und Knospen tragend. Zwischen blumengeschmückten Rasenflächen schlängelten sich mit gelbem Kiese bestreute Wege hin, reizende Brückchen führten über Teiche und Bäche, hier und da niedliche Pavillons und dergleichen mehr.
Dies sah der Baron wenigstens, wenn er nach links und nach rechts blickte. Er selbst stand, nachdem er aus der Tür getreten war, in einem Baumgange, der zwei große Gartenhälften miteinander verband, zu beiden Seiten mit Bäumen und Büschen bestanden, ihm gegenüber eine Felsformation mit einer Höhle, einer Grotte, die wohnlich eingerichtet zu sein schien, was sich aber wegen des darin herrschenden Dämmerlichtes nicht erkennen ließ.
»Nun, wie gefällt es Ihnen hier, Herr Baron?«
Der Gefragte blickte nach links und nach rechts den ziemlich langen Gang hinab, sah dort also den großen Garten, fühlte die warmen Strahlen der hochstehenden Sonne, musterte die herrlichen Blumen und Blüten und Früchte von allen Farben, Formen und Größen und atmete mit Entzücken die frische, köstlich duftende Luft ein.
»Herrlich!«, konnte er nur sagen.
»Wo, meinen Sie, befinden Sie sich hier?«
»An der Westküste der Sahara jedenfalls nicht mehr.«
»Weshalb nicht?«
»Na, da wird man solch einen Garten wohl vergebens suchen.«
»Weshalb denn nicht? Er kann doch künstlich angelegt sein.«
»Ein Garten von solcher Ausdehnung?«
»Sie haben recht. Sie werden die Erklärung später bekommen; ich muss erst noch einige Fragen stellen, denn ich habe zugleich den Auftrag, jetzt etwas Ihren Scharfsinn zu prüfen. Fällt Ihnen an diesem Garten nicht etwas auf?«
Noch einmal blickte sich der Baron aufmerksam um, jetzt mit prüfenden Augen, sah dabei auch zum ersten Male hinter sich.
Er gewahrte eine mit Weinlaub übersponnene Felswand, die dort, wo sie ins Freie getreten waren, von den Ranken frei gemacht worden war. Doch das war nicht von Bedeutung. Hinter dieser Tür befand sich eben das als Fahrstuhl benutzbare Zimmer.
»Können Sie aus der Vegetation schließen, wo Sie sich befinden?«, fragte die Prinzess, als er nicht gleich eine Antwort gab.
»Nein, das kann ich nicht, ich bin kein Botaniker und kein viel gereister Mann. Ich sehe Orangenbäume mit reifen Früchten, auch schon wieder Blüten treibend; dort sind Kirschen, ich erkenne Aprikosen und Feigen — aber dort die kindskopfgroßen Früchte sind mir schon ganz unbekannt. Fast möchte ich an ein Treibhaus glauben, in dem es wohl möglich ist, Pflanzen der verschiedensten Zonen zu unterhalten, an ihnen auch reife Früchte hervorzubringen, an ein und demselben Baume sogar gleich wieder neue Blüten. Da vermögen Menschenwitz und Gärtnerkunst ja heutzutage schon sehr viel. Aber, wie gesagt, ich bin in so etwas ganz unerfahren.«
»Sie glauben doch nicht etwa, das hier sei ein geschlossenes Treibhaus?«
Der Baron blickte zu dem azurblauen Himmel empor, der sich über ihnen wölbte.
»O nein.«
»Sondern?«
»Ich bin hier eben im Freien.«
»Und ich gebe Ihnen die Versicherung, dass Sie sich tatsächlich im Freien befinden.«
»Ja, ja, ich glaube es Ihnen schon«, sagte lächelnd der Baron.
»So muss ich meine Frage wiederholen. Fällt Ihnen hier sonst etwas auf?«
Der Baron blickte, während er die Antwort überlegte, auf das Marmorbassin, das sich in der Mitte des Baumganges befand, unverkennbar das eines Springbrunnens, jetzt nur nicht mit Wasser gefüllt.
»Die Luft ist hier trotz der hochstehenden Sonne und obgleich ich doch annehme, dass ich mich noch in Afrika befinde, recht angenehm kühl und auch feucht, als ob hier erst vor kurzem gesprengt worden wäre. An den Zweigen nehme ich freilich keine Wassertropfen wahr, auch der Boden ist ganz trocken.«
»Fällt Ihnen sonst noch etwas auf?«
»Dort in den weiten Gärten, die ich jenseits des Ganges sehe, sind die Wege mit gelbem Kies bestreut, hier ist der Boden wohl von Zement oder Asphalt.«
»Finden Sie sonst hier noch etwas Merkwürdiges? Ich muss wirklich erst Ihre Beobachtungsgabe prüfen, ich bin dazu beauftragt.«
Wenn dies so streng genommen wurde, dann musste sich der Baron genau umsehen und seinen Scharfsinn anstrengen, dann musste es hier doch auch etwas ganz Besonderes geben, was ihm aber noch nicht aufgefallen war.
»Halt, jetzt habe ich es!«, rief er und fuhr etwas in die Höhe. »In der Tat, das ist auffallend, wenn man es auch nicht gleich bemerken mag.«
»Und das ist?«
»Hier in dieser natürlichen Blütenpracht wie überhaupt in dem ganzen Garten fehlt etwas.«
»Sprechen Sie!«
»Das tierische Leben. Wo sind die singenden und zwitschernden Vögel? Wo sind die um die Blüten gaukelnden Schmetterlinge und die sonstigen Insekten?«
»Bravo, Herr Baron!«, zollte die Prinzess gleich Beifall. »Ich bin mit Ihrer Beobachtungsgabe und Ihrem Scharfsinn sehr zufrieden. Sie sind nämlich nicht der erste Schüler, der mir übergeben wird und dem ich in diesem Garten eine Gauklervorstellung vorführen muss, aber selten einmal hat einer sofort diese Beobachtung gemacht; es hat meist sehr lange gedauert.
Weshalb hier keine Vögel und Insekten leben können, das werden Sie später erklärt bekommen, und Ihr Staunen wird dann allerdings sehr groß sein.
Jetzt gebe ich Ihnen nur noch die Erklärung ab, dass alles, was ich Ihnen vorführen werde, auf ganz natürliche Weise vor sich geht.
Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass wir sogenannte Kraftfelder oder richtiger Krafträume erzeugen können, in denen wir Phänomene zustande bringen, welche scheinbar allen Naturgesetzen spotten.
Ich gebe Ihnen die Versicherung, dass ich keine solchen fremden Kräfte benutzen werde.
Hier sind keine Versenkungen vorhanden, keine Drähte gezogen und schließlich gebe ich Ihnen mein Ehrenwort, dass Sie auch nicht etwa hypnotisiert oder sonst wie fasziniert werden, sodass Sie alle die Wunder etwa nur in Ihrer Einbildung zu sehen wähnen.
Glauben Sie diesen meinen Versicherungen, Herr Baron? Oder soll ich noch einen furchtbaren Schwur ablegen?«
»Es ist nicht nötig, ich glaube Ihnen schon«, entgegnete Edeling lächelnd.
»Gut, so werde ich die Vorstellung beginnen.
Die Prinzess wandte sich von ihm ab.
»Monostatos!«
Aus der etwas dunklen Grotte kam der Mohr, ein Tischchen tragend, das er in einiger Entfernung von dem Springbrunnen hinsetzte.
»Monostatos wird mir bei meiner Zauberei als Diener behilflich sein«, erläuterte die Prinzess, nachdem der Mohr schon wieder in der Grotte verschwunden war.
»Also er ist schon eingeweiht, weiß, was er zu tun hat, um was es sich hier handelt, und nun wollen Sie an das denken, was ich Ihnen vorhin über ihn sagte. Er behauptet, an nichts zu glauben, was er nicht greifen kann, dabei aber fürchtet er sich entsetzlich vor Gespenstern.
Wenn er also nicht ganz genau wüsste, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht, wäre dieser abergläubische Feigling der letzte, der mir auch nur die geringste Handreichung täte.«
Gravitätisch wie immer, als hätte er das gar nicht nötig, kam der Mohr wieder aus der Grotte heraus, ein ziemlich großes Goldfischglas von gewöhnlicher Form tragend, mit Wasser gefüllt, in dem drei kleine Goldfische schwammen.
»So, das wäre alles, was wir zur ersten Nummer des Programms brauchen. Herr Baron, wollen Sie sich überzeugen, dass es lebendige Goldfische sind, die sich in ihrem natürlichen Elemente befinden?«
Was gab es da viel sich zu überzeugen? Aus Gefälligkeit heuchelte der Professor eine genauere Untersuchung, fragte, ob er das Glas anfassen dürfe, gewiss — er hob es einmal in die Höhe, klopfte mit dem Knöchel daran, tauchte seine Hand in das Wasser, die Fischchen schnellten erschrocken vor einer Berührung zurück.
»Sind Sie überzeugt, dass es ganz natürliche Fische sind?«
»Gewiss doch!«
»Dass es Wasser ist, in dem sie schwimmen?«
»Auch das!«
»Dass es sich bei diesem Glasbassin nicht um einen Zauberapparat handelt, der etwa einen doppelten Boden hat?«
»Ich bin völlig überzeugt, dass es ein einfaches Glas mit richtigem Wasser und mit lebenden Goldfischen ist«, antwortete der Baron, ob dieser Umständlichkeit lächelnd.
»So lasse ich mir von Monostatos noch bringen, was ich sonst noch zu diesem ersten Zauberkunststück brauche.«
Der Mohr war wieder aus der Grotte gekommen, überreichte seiner Herrin einen Pappzylinder, oben geschlossen, von dem man gleich annehmen konnte, dass er über das Goldfischglas gestülpt werden sollte, und einen schwarzen Stab, mit goldenen Hieroglyphen bedeckt, von der Größe eines Dirigententaktstockes.
»Wollen Sie sich überzeugen, dass diese Hülse aus einfacher Pappe besteht, keine doppelten Fächer und dergleichen hat.«
Nach einer kleinen Untersuchung musste der Professor es glauben.
»Und dies ist mein Zauberstab, mittels dessen ich über die mir dienstbaren Geister des Feuers, des Wassers, der Erde und der Luft herrsche. Jetzt kann ich ihn noch in Ihre profane Hand geben, ohne dass er entweiht wird, seine Kraft verliert. Bitte, untersuchen Sie ihn. Zerbrechen und anschneiden dürfen Sie ihn allerdings nicht.«
Der Professor nahm den Stock und drehte ihn hin und her.
»Na, gnädigste Prinzess, nun legen Sie mal los mit Ihrem Zauberkunststückchen.«
»Gut, ich werde mich nicht weiter mit einer Vorrede aufhalten. So decke ich jetzt die Papphülse über das Goldfischglas, schwinge vorschriftsmäßig meinen Zauberstock, klopfe an den Kasten, spreche die geheimnisvolle Zauberformel, der die sämtlichen Geister gehorchen: erex, bibrex, pontifex — so, nun muss es schon geschehen sein, ich klopfe nur zur Vorsicht noch einmal an die Pappröhre, hebe sie ab und — na, was sehen und sagen Sie nun?!«
Die drei Goldfische waren aus dem Glase verschwunden.
Und der Professor wusste wirklich nicht, was er hierzu sagen und denken sollte.
Auch er hatte ja als Kind Taschenspieler und Hexenmeister gesehen, auch als reifer Mann noch.
Gewiss, man sieht da manche Sachen, die man sich nicht erklären kann, über die man staunt.
Aber wer gerät heutzutage über so etwas noch außer sich? Wer grübelt hinterher darüber nach, um das Rätsel zu ergründen, oder wer glaubt da gar an ein Wunder, an wirkliche Zauberei?
Nicht einmal ein Kind tut das. Man staunt, man freut sich, amüsiert sich, lacht — und damit genug! Wie das gemacht worden ist, das ist einem hinterher doch ganz gleichgültig.
»Na, Herr Baron, was sagen Sie nun?«, wiederholte Turandot ihre Frage.
Der Professor wollte kein Spielverderber sein.
»Ja, um Gottes willen, wie haben Sie denn das gemacht? Wo sind denn die drei Goldfische geblieben?«, rief er, sich grenzenlos erstaunt stellend.
»Nicht wahr, da staunen Sie!«, frohlockte das naive Kind, das dieses junge Weib doch noch war. »Wissen Sie eine Erklärung hierfür?«
»Nein, es ist mir ganz und gar rätselhaft.«
»Also nehmen Sie an, dass Zauberei dabei ist?«
»Ja, ich möchte fast an Zauberei glauben!«
»Nun, da will ich weiter zaubern. Ich decke die Papphülse wieder über das Glas, klopfe mit meinem Stocke nur daran. Jetzt ist der Zauberspruch gar mehr nötig, hebe die Hülse wieder und —«
Die drei Goldfische waren wieder in dem Glase.
»Fabelhaft, fabelhaft!«, heuchelte der Professor wieder »Wie machen Sie das nur?!«
»Das sind eben Luft- und Wassergeister, die ich jetzt arbeiten lasse. Nicht wahr, Monostatos?«
»Jawohl ja, Missus«, grinste der Mohr, die Zähne fletschend.
»Nun will ich Ihnen aber zeigen, dass ich die Papphülse gar nicht brauche, um die Goldfische verschwinden zu lassen. Das mache ich ganz frei und offen.«
Immer dazu erklärende Worte gebrauchend, die freilich gar nicht nötig waren, tauchte Turandot ihren »Zauberstock« in das Wasser, rührte darin herum, und das Wasser färbte sich, ohne sich erst zu trüben, tiefschwarz, wurde ganz undurchsichtig.
»Haben Sie gesehen, Herr Baron?«
»Gewiss.«
»Die Goldfische sind nicht mehr zu erblicken, ich habe sie verschwinden lassen.«
»Freilich, wenn Sie es so meinen!«, lachte der Professor.
»Wie habe ich denn das Wasser plötzlich so schwarz färben können?«
Gar zu dumm wollte der Professor sich doch nicht stellen.
»Na, Sie haben einfach aus Ihrem Zauberstock, der hohl ist, etwas hineinfließen lassen, das das Wasser sofort schwarz färbt und undurchsichtig macht.«
»So! Aha! Also der Stock ist hohl. Und Sie meinen, die Goldfische sind noch in dem Wasser, nur wegen dessen schwarzer Färbung nicht mehr zu sehen?«
»Das muss ich allerdings annehmen.«
»Gut! Ich rühre wiederum mit dem Stabe in dem Wasser und —«
Unter ihrem Rühren und Plätschern hatte sich das Wasser wieder entfärbt, war wieder ganz klar geworden — die drei Goldfische aber blieben verschwunden.
»Sie glauben also, ich habe etwas in dem Stocke, was das Wasser schwärzt und wieder entfärbt. Wo sind aber nun die Fische?«
Dafür freilich wusste der Professor keine Erklärung.
»Etwa in den Stock gekrochen?«
Nein, das war unmöglich, dazu war dieser viel zu dünn.
»Also ich kann zaubern?«
»Sie können zaubern«, bestätigte der Baron immer noch mit einigem Humor, wenn er auch schon etwas kopfscheu wurde.
»Aber dass die Hauptsache mein Zauberstab tut, glauben Sie noch immer?«
»Allerdings!«
»Gut. Ich werde Ihnen zeigen, dass ich das Wasser gar nicht zu berühren brauche. Oder denken Sie, der Tisch hier hat etwas damit zu tun? Nehmen Sie selbst das Glas in die Hand.«
Der Professor musste das Goldfischglas nehmen und mit ausgestreckten Armen vor sich hinhalten.
Die Prinzess trat zwei Schritte zurück und schwang ihr Stöckchen.
»Eins, zwei, drei —«
Das Wasser in dem Glas, das der Professor also hielt, begann aufzuwallen und färbte sich im Nu tiefschwarz, wurde undurchsichtig.
»Eins, zwei, drei —«
Wieder wallte das Wasser auf, klärte sich sofort, wurde ganz rein und darin schwammen wieder die drei Goldfische.
»So, Herr Baron! Glauben Sie noch immer, dass ich etwas in meinem Zauberstocke habe?«

Edeling machte jetzt ein Gesicht, dessen Verblüffung durchaus nicht erkünstelt war.
An Zauberei glaubte er freilich noch lange nicht, aber — —
Noch weiter zurücktretend, schwang die Japanerin abermals ihr Stöckchen.
»Eins, zwei, drei — —«
Abermals wallte das Wasser auf, diesmal aber färbte es sich nicht schwarz, und so konnte der Professor deutlich sehen, wie einer der drei Goldfische nach dem anderen daraus verschwand.
»Wo sind die Fische nun geblieben?«
»Mir ganz rätselhaft!«, murmelte jener, auf das Glas in seinen Händen starrend.
»Wenn ich nun jetzt befehle, dass auch das Wasser aus dem Glase verschwinden soll — glauben Sie, es wird geschehen?«
»Hm — ich wüsste nicht, wie das möglich sein sollte. Wenn Sie freilich das Glas umkippen, und das Wasser fließt heraus — ist es denn da nicht aus dem Gefäß verschwunden?«
»Wenn aber das Wasser nun vor Ihren Augen spurlos in der Luft verschwindet?«
»Das ist nicht möglich.«
»Und wenn es nun doch geschieht, wollen Sie mich dann als eine Gottheit anbeten?«
»Wenn nicht gleich als Gottheit, so doch als eine echte Zauberin, die also mit übernatürlichen Kräften begabt ist«, versicherte der Professor wiederum lächelnd, dabei immer auf das Glas in seinen Händen blickend.
»Kippen Sie das Glas um!«
Edeling tat es, das Wasser floss heraus und — verschwand spurlos in der Luft!
Ehe der Wasserstrahl den Boden erreichte — war er plötzlich fort, einfach verschwunden, und kein Tropfen hatte den Boden genetzt.
»Ja, wie ist denn das nur möglich?!«, murmelte Professor Edeling ganz verwirrt.
»Sind Sie überzeugt, dass das ganz natürliches Wasser ist?«
Alles war ja nicht herausgeflossen, ein Drittel befand sich noch darin — der Professor tauchte seine Hand hinein, prüfte sogar am Finger leckend die Feuchtigkeit, und die Taschenspielerin hätte das schon nicht zugelassen, falls es gefährlich gewesen wäre.
»Ich muss das für reines Wasser halten.«
»Ist es auch.«
»Ja, wie machen Sie das nur?«
»Also Sie finden keine Erklärung?«
»Nein. Hier hört für mich jeder Taschenspielerkniff auf.«
»Geben Sie das Glas her!«
Die Prinzess nahm es ihm aus der Hand, setzte es auf den Tisch, und als sie sich wieder nach ihm umdrehte, hatte ihr wie aus Elfenbein geschnitztes Gesicht doch einen recht besonderen Ausdruck angenommen, so blickte sie ihn an, und entsprechend klang jetzt auch ihre Stimme, höchst eindrucksvoll, jedes Wort betonend:
»Herr Baron!
Herr Professor Edeling!
Ich will Ihnen etwas sagen!
Als ich Ihnen vorhin die ersten Kunststückchen vormachte, als ich erst die Papphülse über das Glas deckte, da haben Sie mich für eine recht dumme Gans gehalten.
›Die macht ja nichts weiter, als was man bei mir zu Hause in jeder Zauberbude auf dem Jahrmarkt zu sehen bekommt, aber von diesen unseren Zauberbuden weiß die gar nichts, und die denkt nun wunder, wie ich über das staunen werde, was sie mir da vormacht.‹
Habe ich nicht recht, Herr Baron? Haben Sie das vorhin nicht gedacht?«
Ja, sie hatte sich hiermit auch als Gedankenleserin erwiesen, wozu freilich, wie die Sache einmal lag, nicht viel gehörte.
So sagte sich auch der Professor, staunte also hierüber nicht weiter, wurde deshalb auch nur ein klein wenig verlegen.
»Ja, so habe ich vorhin tatsächlich gedacht«, gestand er offen ein.
»So einfach ist die Sache aber nicht«, fuhr Turandot fort.
»Ihre Zauberkünstler bringen so etwas nur mit Hilfe besonders konstruierter Apparate zustande, wozu meist auch nötig ist, im gegebenen Augenblick die Aufmerksamkeit des Publikums von der Hauptsache abzulenken, und natürlich die nötige Geschicklichkeit der Hand.
Dass ich hier nicht mit solchen Apparaten operieren kann, um das Wasser in der Luft plötzlich verschwinden zu lassen, liegt wohl klar zutage. Ich wüsste wenigstens bei aller meiner Erfahrung als Taschenspielerin nicht, was für einen Apparat man da anwenden sollte.
Der morgenländische Gaukler, der sich Magier nennt, bewirkt dasselbe durch Massenhypnose. Er hypnotisiert das zusehende Publikum. Allerdings gebraucht er dazu eine ganz besondere Art von Hypnose, und vor allen Dingen hypnotisiert er sich erst selbst, etwas, wovon das Abendland überhaupt noch gar nichts weiß.
Nun versichere ich Ihnen aber nochmals, Herr Baron, dass ich hierbei keine Hypnose irgendwelcher Art anwende... was haben Sie?«
Plötzlich war der Professor nämlich in die Höhe gefahren.
»Halt, jetzt habe ich es gefunden!«
»Was haben Sie gefunden?«
»Also diese Art von Gaukelei wird auf Grund eines besonderen physikalischen Naturgesetzes ausgeführt, von welcher die andere Welt, die große Menschheit nur noch nichts weiß?«
»So ist es!«
»Darf ich noch einmal beobachten, wie das Wasser verschwindet?«
»Bitte sehr. Hier haben Sie...«
»Nein, wollen Sie einmal das Wasser ausgießen, ich möchte es aus einiger Entfernung beobachten.«
»Wie Sie wollen!«
Die Prinzessin nahm das Glas, das also noch reichlich bis zum Drittel mit Wasser gefüllt war, wartete, bis der Baron bis zur gewünschten Entfernung zurückgetreten war, und kippte dann das Glas langsam um.
Wieder floss das Wasser als Strahl heraus und verschwand, ehe es den Boden berührte, spurlos in der Luft.
»Jawohl, ich habe die Lösung des Rätsel gefunden!«, rief der Professor triumphierend.
»Und?«
»Es klingt ja etwas unglaublich, aber da Sie nun einmal ein besonderes Naturgesetz kennen und es zu handhaben und auszubeuten verstehen, kann es gar nicht anders sein!
Sie sprachen schon von Kraftfeldern oder Krafträumen, die Sie erzeugen können.
Ich will lieber von Kraftzonen sprechen.
Sie erzeugen solch eine Kraftzone in der Luft, in gewissem Abstande über dem Boden, und sobald nun das Wasser in diese Kraftzone kommt, verwandelt es sich in Dampf oder geht vielleicht auch in einen anderen Aggregatzustand über, von dem wir anderen Menschen ja noch nichts zu wissen brauchen — das Wasser verschwindet unseren Blicken.«
So hatte der Professor jubelnd gerufen.
Gelassen setzte die Prinzessin das leere Glas auf den Tisch zurück.
»Nein, Herr Baron, Sie haben falsch geraten, falsch geurteilt«, sagte sie, als sie sich ihm wieder zuwandte. »Wo sind denn da die Goldfische geblieben? Können Sie das auch mit Ihrer Kraftzone erklären?«
Schon wurde der Professor etwas verwirrt, suchte sich aber an seinem Glauben noch einmal aufzurichten.
»Die sind auch zu — zu... etwas Wesenlosem aufgelöst worden.«
»Sie sind aber doch immer wiedergekommen.«
»Das waren dann andere.«
»Ich versichere Ihnen aber, dass es immer dieselben drei Goldfische waren. Glauben Sie mir nur vorläufig! Später will ich Ihnen beweisen, dass es tatsächlich so ist.«
Der Professor sank wieder in sich zusammen.
»Ja freilich, wenn es so ist...«, murmelte er gedrückt.
»Es ist so. Ihre Theorie mit der Kraftzone ist falsch. Ich habe Ihnen doch überhaupt gesagt, dass ich solche Kraftfelder oder Kraftzonen, wie Sie ganz richtig sagen und von denen Sie auch schon etwas ahnen mögen, nicht anwenden würde. Sie haben falsch geraten, Herr Baron. Denn etwas anderes als ein Raten ist es nicht gewesen, das muss ich Ihnen offen sagen. In diesen wenigen Minuten können Sie aus dem, was ich Ihnen da vorgemacht habe, noch keinen sicheren Schluss ziehen.
Und nun, Herr Baron, will ich Ihnen gleich noch etwas anderes offenbaren. Ich bin dazu beauftragt, wie mir überhaupt der ganze Gang dieser Vorstellung, die ich Ihnen hier gebe, sehr streng vorgeschrieben ist. Es ist eben doch nicht nur so eine einfache Gauklervorstellung, deren Programm ich aus dem Stegreif entwerfe.
Sie sind bereits als Mitglied des Skaldenordens aufgenommen worden, wenn auch ohne jede Zeremonie. die erst später stattfindet.
Der Skaldenorden hat viele Grade, die jeder natürlich, um höher zu gelangen, nacheinander durchlaufen muss.
Es gibt da ritterliche und geistige Grade, welche eben durch die entsprechenden Fähigkeiten erworben werden, durch Ablegung eines Examens.
Der Neueintretende ist je nach der Richtung die er einschlägt, ritterlich oder geistig, zuerst entweder Page oder Lehrling Er wird, wenn er entsprechende Leistungen zeitigt, zum Knappen respektive Gesellen befördert; der nächst höhere Grad ist der des Ritters respektive Meisters.
Diese beiden Richtungen, die ritterliche und die geistige, kann man auch gleichzeitig verfolgen.
Es gibt aber auch noch höhere Grade, die man sich erwerben muss.
Ich bin eine Fürstin, und zwar eine Prinzessin, nicht, weil ich als solche geboren wurde oder weil mein Bruder der Fürst des Feuers ist, sondern ich habe mir den Titel durch ritterliche Fähigkeiten erworben.
Auf geistigem Gebiet bin ich Meisterin.
Mein Bruder ist Obermeister.
Der höchste Rang, den man erreichen kann, ist der des Großmeisters.
Es gibt nur einen Großmeister, der von den Obermeistern gewählt wird, immer auf sieben Jahre.
Dieser Großmeister steht auch über sämtlichen Fürsten, welche über sich kein ritterliches Oberhaupt mehr haben, die alle gleichberechtigt sind.
Dem Großmeister aber haben auch sämtliche Fürsten, gleichgültig ob Herzog oder König, bedingungslos zu gehorchen.
Also im Skaldenorden werden die geistigen Fähigkeiten über die körperlichen gestellt.
Natürlich ist es nicht so einfach, diese Stufen zu erreichen, besonders die geistigen.
Durch eine kühne Tat, welche dem ganzen Skaldenorden zum Nutzen gereicht, ihn vor Schaden bewahrt, oder auch in unseren Wettkämpfen, die alljährlich stattfinden, kann ein Ritter oder selbst ein Knappe plötzlich zum Baron oder sogar zum Fürsten ernannt werden.
Die Mitglieder der geistigen Richtung aber müssen mühsam Stufe nach Stufe erklimmen, was eben in der Natur der ganzen Sache liegt, müssen sich die geistigen Fähigkeiten nach und nach mühsam aneignen. Selbst die genialsten Erfinder sind da nicht ausgeschlossen.
Hier aber, Herr Baron, ist einmal eine Gelegenheit, dass sich selbst ein Lehrling, eben erst aufgenommen, sofort bis zum Meister emporschwingt.
Die Gauklervorstellung, die ich Ihnen hier gebe, gehört mit zum vorschriftsmäßigen Programm des Skaldenordens. Der Lehrling bekommt dabei alles doch sehr viel zu sehen, was wir Skalden leisten können, in amüsanter Weise vorgetragen.
Hinterher wird alles erklärt. So wird er nach und nach in alle unsere Geheimnisse eingeweiht.
Der Lehrling kann dabei versuchen, aus eigenem Scharfsinn eine Erklärung zu finden.
Zweimal darf er sich äußern.
Hat er auch zum zweiten Male falsch geraten oder bei allem Scharfsinn falsch geurteilt, so hat er sein Vorrecht verscherzt.
Dieses besteht darin, dass, wenn er das Geheimnis erkennt, worauf alle diese Gaukeleien beruhen, sofort zum Meister ernannt wird, während er sonst gar keine Aussicht hat, unter zehn Jahren diesen Rang zu erreichen, und da mag er sonst geistige Erfolge erringen, so viel er will.
Erkennt er aber hier bei dieser ersten Vorstellung die Geheimnisse, die drei Naturgesetze, durch deren Verbindung wir alle diese scheinbaren Wunder erzeugen, so wird er sofort zum Meister ernannt, und Obermeister zu werden ist dann viel leichter! Da braucht er nur noch eine gute Erfindung zu machen.
So, Herr Baron, nun wissen Sie es.
Einmal haben Sie schon Ihre Meinung zum Besten gegeben, und sie ist falsch gewesen.
So können Sie jetzt nur noch einmal raten.
Irren Sie auch da, was ich Ihnen sofort sagen kann, so haben Sie sich Ihr Recht als neuer Lehrling verscherzt.
Zwar können Sie dann noch raten und urteilen so viel Sie wollen, aber selbst wenn Sie beim dritten Male das Richtige treffen, so hat das auf Ihre Beförderung keinen Einfluss mehr. Sofort Meister werden Sie dann nicht mehr, nicht einmal sofort Geselle. Ihre Ausbildung nimmt dann ihren gewöhnlichen Gang.
Das ist eigentlich sehr ungerecht, aber dieser Beschluss ist im Skaldenorden nun einmal gefasst worden, ich kann daran nichts ändern.
Also, Herr Baron, seien Sie vorsichtig, ich bitte Sie dringend!
Kommt Ihnen im weiteren Laufe der Vorstellung die Erkenntnis, glauben Sie das Richtige gefunden zu haben, so rufen Sie meinetwegen: ›Jetzt weiß ich es!‹ — Aber mehr sagen Sie nicht.
Ich will Ihr Urteil nicht hören. Denn es könnte doch wieder ein falsches sein.
Beobachten Sie ruhig immer weiter, bis zum Schlusse, prüfen Sie sorgsam, ob auch alles Weitere für die Richtigkeit Ihrer Annahme spricht, aber halten Sie Ihre Zunge im Zaume, was auch mit zur Meisterschaft im Skaldenorden gehört, worin Ihnen später auch die knifflichsten und schwersten Prüfungen auferlegt werden. Schweigen zu können, jedes Geheimnis bewahren, das ist es, was später den Obermeister ausmacht. Sie werden davon mehr hören, wenn Ihnen erst die dem Schweigen innewohnende Kraft offenbart werden wird.
Übrigens könnte ich selbst da gar keine Entscheidung treffen, es kommt noch anderes in Betracht. Sie haben nämlich nach Schluss der Vorstellung Ihre Ansicht, wenn Sie eine solche gefasst haben, schriftlich niederzulegen.
Man gibt Ihnen dazu eine halbe Stunde Zeit, keine Minute länger, und Ihr Aufsatz wird von einer Kommission von Altmeistern sofort geprüft, was allerdings einige Zeit in Anspruch nimmt, keineswegs aber dauern Prüfung und Beratung länger als eine Stunde.
Fällt der einstimmige Beschluss der Kommission zu Ihren Gunsten aus, so werden Sie in der nächsten Minute schon telefonisch vom Großmeister zum Meister ernannt. Und zwar nicht zum dienenden. sondern zum freien Meister!
Was für ein gewaltiger Unterschied dabei ist, das werden Sie später kennen lernen. Nur so viel kann ich Ihnen schon jetzt sagen: Als freier Meister sind Sie ein wahrer Fürst im geistigen Reiche des Skaldenordens. Dann aber sind Sie auch gar nicht an diesen, nicht an die Skaldenwelt gebunden.
Während der gewöhnliche, der dienende Meister alle seine Kenntnisse in unsere Dienste zu stellen, für uns zu arbeiten hat, darf der freie Meister ganz nach Belieben über sich selbst verfügen.
Ein freier Meister ist in dieser Hinsicht noch viel mehr als ein dienender Obermeister. Auch ich bin ein dienender Obermeister.
Ein freier Meister kann, wenn er noch die Prüfung des Schweigens bestanden hat, auch in die andere Welt zurückkehren, unter die Erdenbürger, wie mein Bruder, was mir verboten ist.
Also, Herr Baron, nochmals: Seien Sie vorsichtig! Halten Sie Ihre Zunge im Zaum!
Leicht ist es natürlich nicht, die Erkenntnis der Wahrheit zu fassen.
Im Laufe der ungefähr zwanzig Jahre, seitdem wir diese Art von ausnahmsweiser Prüfung in unsere Statuten aufgenommen haben, sind viele Tausende von Lehrlingen so geprüft worden, und bisher hat nur ein einziger bestanden, ist auf Grund seiner schriftlichen Arbeit, binnen einer halben Stunde verfasst, sofort zum freien Meister ernannt worden.
Er gehört natürlich unserem Orden noch an, ist aber zu den Erdenmenschen zurückgekehrt, dort als... doch über das, was er da treibt, darf ich nicht sprechen.
So, Herr Baron, nun können wir unsere Vorstellung fortsetzen. Also bitte, seien Sie vorsichtig!«
Aufmerksam hatte der Professor gelauscht, und immer mehr hatten sich seine Mienen dabei verändert. Man hätte gar nicht geglaubt, dass diese eigentlich so sanften Züge so eisern hätten werden können.
Jetzt kreuzte er die Arme über der Brust.
»Ich möchte gleich jetzt eine Frage stellen.«
»Nun? Vielleicht darf ich sie beantworten.«
»Sie sprachen von drei Naturgesetzen, durch deren Verbindung Sie diese scheinbaren Wunder zustande brächten.«
»Ja, es sind ihrer drei. Aber darüber machen Sie sich keine Kopfschmerzen. Erkennen Sie das erste physikalische Gesetz, von dem die andere Welt noch nichts weiß, noch gar nichts ahnt, das wir Skalden als etwas ganz Selbstverständliches beherrschen, so werden Ihnen die beiden anderen Gesetze ganz von selbst sofort klar. Sonst noch eine Frage?«
»Nein!«
»Ich kann also meine Vorstellung fortsetzen?«
»Bitte!«
Die Prinzessin lächelte, streifte die weiten Ärmel ihres Kimonos bis an die Ellbogengelenke zurück und rieb sich die Händchen mit den wie aus Elfenbein gedrechselten Fingern, so wunderbar fein und doch starrend von Muskeln und Sehnen.
»Sie haben schon Taschenspieler auftreten sehen?«
»Gewiss, mehrfach.«
»Was ist immer das erste Kunststückchen, womit er das Publikum mehr oder weniger verblüfft? Regelmäßig das erste?«
»Er zieht, wenn er im schwarzen Frack auftritt, zuerst seine weißen Handschuhe aus, ballt sie zusammen, reibt sie zwischen den Händen und lässt sie spurlos verschwinden.«
»Richtig! Genau das wollte ich von Ihnen hören. Wohin lässt er die Handschuhe wohl verschwinden? Das darf ich Sie fragen, das dürfen Sie mir beantworten. In Ihrer Kraftzone?«
»Nein, in seinen Ärmeln.«
»Ich habe keine Handschuhe an, aber das kann ich ja noch nachholen, ich mache überhaupt alles anders, ich bin immer originell....«
Mit einem Male, als sie noch ihre Hände und Unterarme rieb, hatten sich diese tiefschwarz gefärbt.
»Was ist das?«
Sie hielt ihm die Hände hin.
Wenn Professor Edeling staunte, so war ihm doch nicht das Geringste mehr davon anzumerken.
Denn grenzenlos erstaunt musste er wohl sein, als er erkannte, dass sie plötzlich schwarze, halblange Glacéhandschuhe anhatte, jeder mit drei Knöpfen geschlossen, und zwar mit richtigen Knöpfen und Knopflöchern, was die Sache doch nur noch viel komplizierter machte.
»Das sind schwarze Glacéhandschuhe.«
»Können Sie sich erklären, wie die Glacés plötzlich an meine Hände kommen? Solche Fragen sind erlaubt, da dürfen Sie antworten.«
»Nein, das ist mir unerklärlich.«
»Mit Ihrer Kraftzone können Sie es sich nicht zusammenreimen?«
»Nein, diese Theorie hält da nicht stand.«
»Bitte, ziehen Sie selbst mir die Handschuhe aus, damit Sie nicht glauben, es sei nur eine Sinnestäuschung.«
Der Professor tat es, hatte schon einige Mühe, die wohl ganz neuen Handschuhe aufzuknöpfen. Dann streifte er sie von den Händen.
»So, Sie dürfen sie behalten. Ich werde etwas anderes verschwinden lassen, was man nicht so leicht in den Ärmel rutschen lassen kann. Dieser lange Kittel ist mir überhaupt hinderlich.«
Sie heftelte den japanischen Kimono auf, ließ ihn fallen und trat heraus.
Dass sie heute doch etwas anders kostümiert war als tags zuvor, hatte der Professor bereits bemerkt.
Gestern, da er die vermeintliche Wachsfigur so gründlich untersuchte, hatte sie lange rote Pumphosen getragen, kurz über den nackten Füßen zugeschnürt.
Heute waren diese mit leichten, zierlichen Schuhen bekleidet. Außerdem fehlte heute in der chinesischen Haarfrisur die Flammennadel.
Nun zeigte es sich, dass sie keine langen, roten Pumphöschen trug, sondern kürzere von blauer Farbe, die nur bis ans Knie reichten; blau waren auch die Strümpfe, aber durchbrochen und außerdem ein goldenes Blumenmuster zeigend, und blau war auch das Trikot, das den Oberkörper bedeckte, aber auf Brust und Rücken tief ausgeschnitten, die Arme bis an die Achseln freilassend.
»Nicht wahr, in den Ärmeln kann ich nichts verschwinden lassen?«, sagte sie lächelnd, als sie sich bückte, um den abgestreiften Kimono aufzuheben.
Der Professor blieb die Antwort schuldig. Mit staunender Bewunderung betrachtete er, was sich da seinen Blicken bot.
So etwas von harmonischem Gliederbau hatte er noch nicht gesehen!
Sie hatte sich wieder aufgerichtet; das Lächeln war verschwunden, mit ihrem gewöhnlichen Ernst blickten die großen, schwarzen Augen ihn an.
»Nicht wahr, in meinen Ärmeln kann ich nichts verschwinden lassen?«, wiederholte sie ihre Frage.
»Nein.«
Sie ballte den Kimono zwischen ihren Händen zusammen.
Das lange Gewand war nicht von dünner Seide, sondern von seidenartig glänzender gar nicht dünner Baumwolle, und sie hatte einen ziemlich umfangreichen Ballen in den Händen, ihn hin und her drehend.
Und mit einem Male — der Professor hätte unmöglich schildern können, wie es eigentlich vor sich ging — verschwand der Ballen zwischen ihren Händen.
Nicht in einem Nu, sondern es war, als ob sich das bunte Knäuel in Nebel auslöse, sehr schnell, aber doch mit den Augen zu verfolgen.
Sie nahm vom Tisch wieder das jetzt leere Goldfischglas.
»Es ist also dasselbe wie vorhin, ich werde Ihnen nun einmal zeigen, wie... ooooh, ich Ungeschick!!«
Sie hatte das Glasbassin einige Male wirbelnd herumgeworfen, es immer wieder auffangend, aber beim dritten oder vierten Male war ihr das missglückt, das Glas war auf dem Zementboden in tausend Stücke zerschmettert.
»Monostatos, wegkehren!«
Der Mohr eilte aus der Grotte, bewaffnet mit Kehrichtschaufel und Handbesen, hatte zur Vorsicht auch gleich ein Wischtuch mitgebracht, das über seiner Schulter hing.
»Halt, warte mal erst, was hast Du da?«, sagte die Prinzess, ehe er niederkniete und zu kehren anfing, ihm das Tuch von der Schulter nehmend.
Es war ein brauner, grober Scheuerlappen, auseinandergefaltet etwa einen Meter im Quadrat.
»Warte, Schokoladenmolch, fege noch nicht zusammen — der Herr Baron soll erst diesen Lappen hier untersuchen.«
Der Professor nahm ihn — da war nicht viel zu untersuchen.
Dabei aber ließ er auch niemals die Glastrümmer zu seinen Füßen aus den Augen!
»Finden Sie etwas Besonderes an dem Lappen?«
»Gar nichts.«
»Behalten Sie ihn einstweilen. Jetzt, Monostatos, fege zusammen!«
Der Mohr tat es, kehrte die Glassplitter auf die Schaufel, musste, da diese doch umhergeflogen waren, ziemlich weit herumkriechen.
»Bist Du endlich fertig?«
»Gleich, Missus.«
Er richtete sich auf.
»Hast Du sie alle auf der Schaufel?«
»Alle.«
»Dann, Herr Baron, wollten Sie das Tuch auseinanderbreiten und so halten, dass Monostatos die Glasscherben hineinschütten kann!«
Es geschah.
»Nun fassen Sie das Tuch an den Zipfeln, drehen es einmal herum, halten Sie es so.«
Der Professor tat, wie er angewiesen wurde.
Also aus dem Tuche war eine Art Sack hergestellt worden, der die Glasscherben enthielt.
»Nun geben Sie die Glasscherben her... oder halt, schütteln Sie erst! Sie dürfen auch noch einmal hinblicken.«
Der Professor tat es, sah die Glasscherben in dem zusammengesackten Tuche.
»Nun geben Sie es mir. So! Ich fasse den Scheuerlappen an den Zipfeln, schüttele ihn noch einmal, Sie hören die Scherben klirren. Ich drehe den Sack herum, fasse ihn oben, dass die Ränder herabhängen, Sie werden sich schon wundern, dass keine Scherben herausfallen; aber nicht genug damit, jetzt greife ich unter das Tuch und sage hokus pokus philiax...«
Die Prinzess hatte immer die angesagten Bewegungen ausgeführt, jetzt griff sie, mit dem rechten Arm weit ausholend, unter das Tuch, das sie als Ballen in der linken Hand hielt, oben gefasst, zog es schnell fort und hatte in der rechten Hand das unversehrte Goldfischglas mit Wasser gefüllt, und darin schwammen wieder drei Goldfische.
»Hübsch, nicht wahr?«, fragte sie wie vorhin. »Sie werden ja Ähnliches schon in Zauberbuden gesehen haben. Dass etwa ein Glasgefäß zerbrochen wird, man deckt etwas darüber, und dann plötzlich ist es wieder ganz und heil. Aber so, wie ich das hier gemacht habe, kann das niemals ausgeführt werden. Niemals! Wir benutzen dabei besondere physikalische Gesetze, von denen die andere Welt noch gar nichts ahnt.«
Der Professor hatte das Ganze beobachtet, ohne eine Miene zu verziehen; jetzt kreuzte er wieder die Arme über der Brust.
»Ja, sehr hübsch gemacht war das — es mögen ja auch besondere Naturgesetze dabei in Betracht kommen, die ich nicht kenne — — aber das zerbrochene Goldfischglas ist dies nicht.«
»Nicht?! Weshalb nicht?«
»Das ist ein anderes.«
»Wie wollen Sie denn das behaupten? Sie haben doch gesehen, wie das Glas am Boden zerbrach, wie die Scherben zusammengefegt wurden, in das Tuch kamen, usw. usw. Sie sollen mir keine Erklärung geben, sondern ich will nur wissen, wie Sie zu der Behauptung kommen, es müsse unbedingt ein anderes Glas sein...«
»Weil dieses Goldfischglas tadellos unversehrt ist und weil dort noch ein Glassplitter liegt, den Ihr Diener vorhin übersehen hat; wenn ich nicht irre, stammt er von dem Rande her.«
Professor Edeling sprach, tat zwei Schritte und hob unter einem Busche einen fingerlangen Glassplitter auf.
»Gewiss, der stammt oben vom Rande her, und dort müsste er jetzt fehlen, wenn es wirklich dasselbe Glas wäre. Ihr Diener hat nicht sorgfältig genug ausgekehrt.«
»Aaah, bravo, bravo!!«, lachte und lobte die schon etwas entlarvte Zauberkünstlerin, dem Professor auf die Schulter klopfend. »Beobachten Sie so weiter, dann geht Ihnen vielleicht doch ein Licht auf und Sie bestehen die Meisterprüfung!«
Weiter ließ sie sich auf diesen Fall nicht ein.
»Nun wollen wir sehen, was wir in diesem wieder gefüllten Goldfischglase noch machen können.«
Sie begab sich zu dem am Boden eingelassenen Wasserbassin, das also leer und gereinigt war, hatte dazu nur wenige Schritte nötig, der Professor konnte alles sehen, sie verdeckte nichts. Dort hob sie das Goldfischglas, kippte es halb um.
Das Wasser floss heraus, plätscherte in das Bassin hinein, einer der Goldfische wurde von dem Strome ergriffen und ging mit hinab, dann der zweite, dann ereilte auch den dritten dasselbe Schicksal.
Das war begreiflich. Jetzt aber folgte auch ein vierter und fünfter Goldfisch nach, immer mehr fielen mit dem Wasserstrahle in das Bassin hinab, dutzendweise, und nun musste Edeling merken, dass sich das Glasbassin gar nicht leerte! Es war eine unerschöpfliche Wasserquelle geworden, welche die Goldfische gleich dutzendweise ausspie, die dann unten in dem zementierten Bassin lustig herumschwammen.
»Na, Herr Baron und Professor, sagt Ihnen Ihre Wissenschaft nichts?«
Nein, die sagte nichts. Es war ihm aber auch keine Spur von Staunen oder dergleichen anzumerken, er hatte die Augen nur starr auf das Goldfischglas geheftet.
»Da tut einem ja der Arm weh, und das wird wohl noch etwas dauern, bis das große Bassin vollgelaufen ist.«
So sprach die Prinzess und zog ihre Hand zurück.
Jetzt schwebte das Glasgefäß frei in der Luft, immer den Wasserstrom mit Goldfischen ausgießend.
»Darf ich einmal näher treten?«, fragte der Professor.
»Bitte sehr, tun Sie, was Ihnen beliebt.«
Er ging hin, strich mit der Hand über und unter dem Glase hinweg — von Drähten oder dergleichen war nichts zu bemerken.
»Darf ich es auch angreifen?«
Er nahm es und hatte eben das Goldfischglas in der Hand. Als er es gerade hielt, floss natürlich kein Wasser mehr heraus. Fünf Goldfische schwammen darin.
»Die Schwerkraft ist wieder hergestellt.«
»Schwerkraft?«
»Ich... drückte mich nur so aus.«
»Halten Sie das Glas wieder über das Bassin, aber ohne es zu kippen.«
Er tat es, und jetzt begann das Wasser auch so zu fließen, es mehrte sich und quoll über den Rand, und zwar in einer Menge, dass es auch die Goldfische mit über den Rand riss. Dabei aber kamen immer wieder neue zum Vorschein, tauchten plötzlich in dem Wasser auf!
»Nun, Herr Baron?«
Diesmal hatte dieser doch wenigstens ein leichtes Kopfschütteln. Aber auch nichts weiter.
»Wenn Sie das Glas jetzt loslassen, fällt es natürlich zu Boden.«
»Ja, natürlich«, wiederholte der Professor murmelnd, die Augen immer auf das wunderbare Glas mit der unerschöpflichen Wasserquelle richtend.
»Nein, es ist eben nicht so natürlich! Lassen Sie das Glas los — immer zu! Geben Sie es ruhig frei! Öffnen Sie die Finger und ziehen Sie die Hand zurück.«
Die Prinzess musste diese Aufforderung noch mehrmals wiederholen, ehe der Professor ihr nachkam.
Denn so wenig eigentlich auch verlangt wurde, wohl jeder hätte sich gehütet, das Glas einfach loszulassen, vorausgesetzt, dass er es nicht fallen lassen wollte.
Endlich tat es der Professor doch, löste die Fingerumklammerung, zog die Hand zurück — — das Glas schwebte wieder frei in der Luft, immer übersprudelnd.
»Nun, Herr Baron, immer noch nichts?«
Der guckte und guckte.
»Hahahahahaha!!!«, erklang es da.
Der Mohr hatte schallend gelacht.
»Was hast Du Schokoladenkröte so zu lachen?!«
»Ach, das ist doch so einfach, so kindereinfach!!«, antwortete der Mohr noch immer lachend.
»Haben Sie es gehört, Herr Baron?«
»Einfach, kindereinfach?«, murmelte der.
»Ja, in gewisser Hinsicht hat der Kerl ja auch ganz recht. Es ist so einfach wie damals die Geschichte mit dem Ei, das Kolumbus auf dem Tische stehen ließ. Aber ich will Ihnen sagen, wie dies alles gemacht wird: Unsichtbare Geister bedienen mich auf meinen Befehl.«
Der Professor brauchte sie nur anzublicken, und er musste wissen, dass sie nur scherzte. So mutwillig zuckte es um ihre Mundwinkel.
»Herr Baron, Sie glauben nicht, dass mir Geister zur Verfügung stehen?«
»Nein.«
»Sie glauben wohl überhaupt nicht an Geister?«
»Nein.«
»Soll ich Ihnen hier unter Gottes strahlender Sonne einen ganz echten Geist erscheinen lassen?«
Der Professor blieb die Antwort schuldig.
Wer zu beobachten verstand, musste erkennen, dass in ihm jetzt irgendeine große Umwälzung vor sich ging.
Sinnend blickte er vor sich hin, sich dabei das Kinn reibend.
Mit einem Male ging es über seine Züge, die zuletzt so starr geworden waren, wie ein sonniges Lächeln, und dann richtete er sich mit einem Ruck auf, um die Prinzess anzublicken.
»Gestatten Sie mir, ehe Sie Ihre Gaukeleien fortsetzen, einige Fragen?«
»Bitte!«
»Vielleicht können wir die Vorstellungen sehr abkürzen. Also Sie können mir hier einen richtigen Geist erscheinen lassen?«
»Jawohl«, bestätigte die Prinzess, schien sich aber über diese Frage sehr zu wundern.
»Ihn aus dem Nichts entstehen lassend?«
»Er wird sich materialisieren.«
»So, dass ich ihn sehen kann?«
»Sie können ihn sehen.«
»Ihn auch betasten?«
»Auch das.«
»Wenn ich jetzt die Hand ausstrecke und befehle, dass jenes Goldfischglas auf mich zuschwebt, wird es auch mir gehorchen?«
»Es wird gehorchen, weil ich es befehle.«
»Auch der auf dem Tisch liegende Zauberstab wird gehorchen?«
»Er wird gehorchen.«
»Wohl auch der ganze Tisch?«
»Auch der.«
»Dürfte ich vielleicht um ein Glas Wein bitten?«
Wiederum schien die Prinzess ob dieser unvermuteten Frage höchst überrascht zu sein, hatte sich aber schnell gefasst.
»Sie fühlen sich doch nicht unwohl?!«
»Nur etwas angegriffen. Kann ich ein Glas Wein bekommen?«
»Gewiss. Monostatos....«
»Halt! Es ist doch gar nicht nötig, dass Sie erst Ihren Diener aus Fleisch und Blut bemühen. Befehlen Sie doch einfach einem Ihrer Geister, er soll mir ein Glas Wein bringen, es soll plötzlich frei aus der Luft in meine Hand hineinschweben!«
Und während der junge Gelehrte dies sagte, die Hand ausstreckend, huschte wiederum ein so heiteres und zugleich listiges Lächeln über sein Gesicht.
»O ja, das geht...«
»Ich kann ja etwas warten.«
»Obgleich eine Zauberin, die Geister zur Verfügung hat, das eigentlich im Moment besorgen können müsste. Aber lassen Sie nur, ich brauche gar keinen Wein. Dagegen, gnädigste Prinzess, würden Sie einmal die Güte haben, sich selbst in die Luft zu erheben und dort schweben zu bleiben?«
Ganz starr blickte die Prinzess den noch immer lächelnden Sprecher an.
»Ich glaube, Herr Baron, Sie haben eine Ahnung von der Wahrheit...«
»Sogar eine sehr große, und sie ist mir gar nicht so plötzlich gekommen, ich habe mich vorhin nur ein bisschen verstellt, um desto schärfer beobachten und nachdenken zu können. Sagen Sie mal, gnädigste Prinzess... in welcher Höhe befinden wir uns hier eigentlich?«
»In welcher Höhe?!«, wiederholte sie in immer größerem Staunen.
»Wie hoch über dem Erdboden, meine ich.«
»Über dem Erdboden?«
»Na, ich befinde mich hier doch in oder auf einem Luftschiffe.«
»Mensch, wie kommen Sie auf diese Idee!«, fuhr die Prinzess empor, immer mehr betroffen.
»Gar kein Zweifel, ich befinde mich hier auf dem Oberteil eines Luftschiffes, als Garten eingerichtet. Das ist wohl möglich, nicht aber gut das Vorhandensein von Vögeln, Insekten und dergleichen. Nicht wahr, gnädigste Prinzess?«
»Blicken Sie doch nach den Seiten! Sie sehen links wie rechts den Garten sich unermesslich weit fortsetzen.«
»Alles nur Täuschung«, sagte lächelnd der junge Gelehrte, der sich plötzlich so ganz und gar verändert hatte.
»Es ist das Deck eines Luftschiffes, das vielleicht nur zwanzig Meter breit ist, oder nur so breit wie dieser Gang hier. Jene Gärten werden nur durch Spiegelung hervorgebracht oder vielleicht auch durch Kinematografie. Gestatten Sie, dass ich den Gang entlang gehe und diese Wände betaste?«
»Es ist nicht nötig, Sie haben es erraten«, murmelte die Prinzess.
»Nein, ich habe es nicht erraten, sondern durch Beobachtung erkannt.«
»Was für Beobachtungen?«
»Durch Beobachtung des Schattens. Hier rückt er vorschriftsmäßig weiter, dort in jenen weiten Gängen nicht.«
»Sie haben richtig beobachtet. Aber wodurch wird das Luftschiff getragen?«
»Darf ich es denn aussprechen?«
»Sprechen Sie!«
»Sie beherrschen die Ätherschwingungen, welche, wie unsere Gelehrten schon erkannt haben, auch die Schwerkraft oder Anziehungskraft der Erde bedingen. Sie können diese Ätherschwingungen aufheben und damit die Schwerkraft.«
»Und das, was ich Ihnen vorgegaukelt habe...«
»Beruht ebenfalls auf Aufhebung der Ätherschwingungen. Sie können alles lichtdurchlässig, mit anderen Worten unsichtbar machen...«
Mit einem Ruck richtete sich die Prinzess empor.
»Herr Baron, sind Sie sicher, dies alles schriftlich niederlegen zu können?«
»Ich wollte mich eben zu dem Examen melden, und ich werde mich so kurz fassen, dass ich keine halbe Stunde dazu nötig habe; auf zwei Quartseiten will ich alles klipp und klar ausführen.«
»Dann kommen Sie, Sie wunderbarer Mann, der einzige unter vielen Tausenden, dessen Scharfsinn so schnell die Wahrheit erkannt hat!«
Der rätselhafte Mann, dessen geheimnisvolles Treiben sich an so weit voneinander entfernten Orten der Erde und so vielgestaltig auswirkte, befand sich in einem Raum, der kein Zimmer zu nennen ist, nur eine Kammer, sogar eine sehr enge, kaum bewohnbar.
Sie hat eine quadratische Basis von noch nicht drei Metern und ist so niedrig, dass ein Mann von sechs Fuß Höhe darin nicht aufrecht stehen kann. Und wie diese Kammer nun auch noch vollgepfropft ist. und wie es sonst darin aussieht!
Die vier Wände sind dicht mit Klinken, Riegeln, Schiebern, Hebeln, Rädern und anderen Handgriffen bedeckt, alle von ganz verschiedenen Farben und außerdem immer mit einem Buchstaben und einer Zahl versehen.
Dazwischen aber sind noch viele andere Instrumente und Apparate vorhanden, die sonst wohl nirgends im Gebrauch stehen, deren Zweck dem Uneingeweihten ganz unerklärlich ist, sodass ihr Aussehen nicht erst beschrieben werden soll.
Da hängt zum Beispiel an der Wand eine gewöhnliche Uhr. An ihr ist gar nichts besonders Bemerkenswertes.
Sie zeigt jetzt auf zehn Minuten vor acht. Wer aber diese Uhr beobachtet, der sieht, wie der große Zeiger, nachdem er noch zwei Minuten zurückgelegt hat, plötzlich rückwärts geht, und zwar in vorschriftsmäßiger Zeit sechs Minuten; dann besinnt er sich, geht wieder vorwärts, und nun zwar mit einer Schnelligkeit, als wolle er das Versäumte wieder einholen — bis er abermals stehen bleibt und wieder zurückgeht.
Oder ist es ein Manometer, das irgendeinen wechselnden Atmosphärendruck anzeigt?
Nein, es ist wirklich eine Uhr, welche die Zeit messen soll. Freilich eben eine ganz besondere, der Messer für eine ganz besondere Zeit, wie sich später erweisen wird.
Ein anderer uhrähnlicher Apparat ist eine wirkliche Uhr. Der große Zeiger dreht sich innerhalb einer Stunde einmal herum, der kleine Zeiger braucht dazu allerdings nicht nur zwölf, sondern vierundzwanzig Stunden. Das Zifferblatt hat nur die Zahlen von eins bis zehn, und jedes Feld ist wieder in zehn Grade geteilt, sodass hier also die ganze Stunde hundert Sekunden hat.
Außerdem sind auch wirkliche Manometer vorhanden, sogar geradezu massenhaft; aber kein Sachverständiger würde ihren Zweck erkennen, ihre Zeiger machen gar zu seltsame Sprünge, oder sie verändern plötzlich ihre Farbe, oder in irgendeinem besonderen Felde springen geheimnisvolle Zeichen heraus oder sie treiben andere Kapriolen.
Ebenso wie diese vier Wände ist auch die Decke mit solchen Schiebern, Hebeln und Rädern bedeckt, auch mit Uhren und Manometern! Hier kommen aber auch noch viele Spiegel hinzu. Jedoch sind es niemals einfache Spiegel, immer sind sie entweder konvex oder konkav, oder sie sind aus Tausenden von winzigen Spiegelchen zusammengesetzt, oder ihre Scheibe ist durchlöchert, mit einem einzigen Loche oder siebartig mit Hunderten von winzigen Löchelchen.
Der dunkle Boden dieser Kammer ist... leer.
Aber etwas enthält er dennoch. Er ist durch weiße Striche in Felder eingeteilt, von ganz verschiedener Größe, und jedes Feld ist wiederum mit einem Buchstaben und einer Zahl bezeichnet.
Viel Platz ist dazu übrigens nicht vorhanden. In der Mitte steht ein Tisch, so groß, dass er den engen Raum fast ganz ausfüllt, dass nur ringsherum ein schmaler Gang frei bleibt.
Es ist ein flacher Schreibtisch ohne Aufsatz. Unten ist er voll, das heißt die Platte ruht links und rechts auf breiten Schubläden, nur in der Mitte ist eine kleine Höhlung, in die man gerade, wenn man daran sitzt, seine Beine stecken kann.
So groß diese Schreibtischplatte nun auch ist, hat man darauf doch wenig Platz zum Schreiben, kann sich mit seinen Papieren nicht gerade sehr weit ausbreiten.
Denn auch dieser Schreibtisch ist, bis eben auf den Platz für eine Schreibtischmappe, über und über mit solchen Schiebern und Hebeln und Rädern bedeckt, dazu kommen hier hauptsächlich auch noch Holztafeln, die ganze Batterien von weißen Druckknöpfen enthalten, jeder mit Buchstabe und Zahl versehen, Schaltvorrichtungen, die wohl mehrere tausend verschiedene Stöpselungen zulassen, und schließlich auch wieder eine ganze Menge der denkbar verschiedensten Apparate, die jedoch alle nicht sehr groß sind, dem die Aussicht nicht versperren, der an diesem Tische sitzt.
Dass dieser Raum weder Tür noch Fenster enthält, ist schon gesagt worden.
Trotzdem herrschte darin helles Tageslicht. Woher dieses kam, war nicht zu erkennen.
Vor dem Schreibtische saß in einem bequemen Lehnstuhle, den er aber nicht viel rücken durfte, da er sonst überall anstieß, der Mann mit den Teufelsaugen, Loke Klingsor, gekleidet, wie gewöhnlich, nur dass er jetzt auf der Schulter nicht die schwarze Katze sitzen hatte.
Er schrieb emsig. Es waren wohl stenografische Zeichen, mit denen er einen Papierbogen nach dem anderen bedeckte, sicher aber seine eigene Stenografie, kein bekanntes System.
Dazu bediente er sich eines Füllfederhalters, der aber auch wieder ganz besonders konstruiert schien. Die in die Feder fließende Tinte war schwarz, aber nicht immer. Manchmal entstanden, mitten in der Zeile auch andersfarbige Buchstaben oder Zeichen, rote, grüne, gelbe und noch andere.
Das war allerdings ein merkwürdiger Füllfederhalter, aber noch viel merkwürdiger, überhaupt ganz undenkbar, wäre noch vor dreißig Jahren eine Schreibmaschine gewesen, noch dazu eine mehrfarbig schreibende. Wer von so einem Instrument phantasiert hätte, der wäre ja nicht schlecht ausgelacht worden.
Dieses Schreiben oder Stenografieren schien Loke ungemeinen Spaß zu bereiten. Das sonst so ernste Gesicht, das tatsächlich sonst etwas von dämonischer Finsternis an sich hatte, strahlte jetzt geradezu vor Vergnügen, und oft genug zeigte es sogar ein heiteres Lächeln.
Wenn er einmal von dem Papier aufblickte, so ruhten seine Augen stets auf einem Apparat, der vor ihm stand und der etwas näher beschrieben werden muss.
Doch ein »Apparat« war es kaum zu nennen — Nichts weiter als eine viereckige weiße Scheibe, etwa zehn Zentimeter hoch und fünfzehn breit, die in einer Art von Fotografieständer befestigt war.
Durch diese weiße Platte ging ungefähr in der Mitte von oben nach unten ein dünner roter Strich, und vielleicht drei Zentimeter links von ihm entfernt befand sich ein kleiner roter Punkt.
Das war alles — scheinbar doch kaum erwähnenswert — und doch war diese weiße Platte mit dem roten Strich und dem roten Punkte die Hauptsache in diesem Raume.
Von dieser einfachen Linie und dem winzigen Punkte hing das Wohl oder Wehe des Mannes ab, der hier wie eine Spinne in ihrem Netze saß, sein Tod oder sein Leben!
Jetzt sei nur noch verraten, dass die Entfernung der roten Linie von dem roten Punkte nicht immer die gleiche blieb.
Die senkrechte Linie war unbeweglich, der winzige Punkt aber näherte sich ihr immer mehr.
Allerdings sehr, sehr langsam! Er musste wohl, wenn man keinen Zirkel zur Hilfe nahm oder sich sonstige Merkmale machte, mindestens eine Stunde lang genau kontrolliert werden, ehe ein Näherrücken bemerkbar ward.
Also auf diese Platte blickte der Schreibende, wenn er einmal seine brennenden Teufelsaugen hob.
Aber er tat es ohne jedes Zeichen von Besorgnis, schien nur ganz gewohnheitsmäßig immer einmal hinzublicken.
Jetzt legte er die Feder weg, machte sich an einigen Hebeln und Rädern auf dem Schreibtisch zu schaffen, ohne erst viel überlegen und suchen zu müssen.
Das erste war, dass es in der Todesstille einen leisen Knacks gab. An der gegenüber befindlichen Wand entstand oben an der Decke ein ganz schmaler Spalt, aus dem etwas Weißes hervorkam.
Es war eine weiße Leinwand, ein Vorhang, der herabrollte, die ganze Wand mit all ihren Griffen und Apparaten bedeckend, also in einer Größe von zweimal drei Metern.
Durch die Drehung eines zweiten Hebels ward diese Leinwand ganz straff gespannt.
Darauf bewegte Klingsor ein Rädchen, und auf der weißen Wand erschien eine mächtige Spitzkugel von schwarzer Farbe.
Diese »Spitzkugel« muss näher beschrieben werden.
Man stelle sich eine völlige Kugel vor von einem Meter Durchmesser. Auf diese wird ein hohler Kegel gesetzt, der an seiner Basis achtzig Zentimeter Durchmesser hat und ebenso hoch ist.
Dann liegen die Seitenlinien des Kegels an dieser Kugel als Tangenten, als »Berührungslinie«.
Klingsor drehte weiter an seinem Rädchen, und die riesige Spitzkugel, die ja fast die ganze Wand bedeckte, schrumpfte immer mehr zusammen, bis der Durchmesser ihrer Rundung kaum noch zwei Zentimeter betrug.
Dafür erschienen an der Wand jetzt andere Linien und farbige Felder, und als das Lichtbild, um das es sich doch zweifellos handelte, schärfer eingestellt war, erkannte man, dass es eine Weltkarte in Mercatorprojektion war, also die ganze Erde auf einer Ebene darstellend.
Infolge der Drehung eines anderen Rädchens wurde die farbige Erdkarte von einem Netze schwarzer senkrechter und waagerechter Linien durchzogen, die also Breiten- und Längengraden entsprachen.
Auch dieses Netz wurde sorgfältig eingestellt.
Die Drehung wieder eines anderen Rädchens bewirkte, dass sich mitten durch das in gelber Farbe gehaltene Arabien von oben nach unten eine brennend rote Linie legte.
Die schwarze Spitzkugel, jetzt also nur noch zwei Zentimeter groß, war geblieben. Sie lag auf dem Indischen oder Arabischen Meere, so genannt, weil es sich eben zwischen Arabien und Vorderindien erstreckt. Wie alles Wasser auf dieser Karte war es mit blauer Farbe angegeben. Die Kugel lag ungefähr in der Mitte dieses Meeres und hatte ihre Spitze nach Nordwesten gerichtet, also direkt auf Arabien zu.
Einige Zeit betrachtete Klingsor dieses geografische Lichtbild.
Schon nach wenigen Minuten musste jeder, der mit seinen Augen beobachtete, erkennen, dass die Spitzkugel auf dem blauen Meere nicht still lag, sondern sich bewegte, auf Arabien zu.
Eine Hebeldrehung, und die Landkarte war von der weißen Wand verschwunden.
Jetzt packte Klingsor die beschriebenen Papierbogen zusammen, barg sie in einer Schublade des Schreibtisches, zog eine andere auf, entnahm ihr eine feine Porzellantasse, die er unter ein Röhrchen hielt, das sich auf der Tischplatte zwischen all den anderen Schaltvorrichtungen und Apparaten emporreckte, mit umgebogenem Endstück. Ein Druck auf einen Knopf, und aus dem Röhrchen floss in die Tasse ein dampfender, schwarzbrauner Strahl, ein Duft von köstlichem Kaffee erfüllte den engen Raum.
Also er wollte sich beim Genusse einer Tasse Mokka erfrischen. Dazu ward auch noch eine lange, schwarze Zigarre angebrannt, das helle Licht bis zur Dämmerung verdüstert, der Lehnstuhl zurückgeschoben, so weit es möglich war, um die Beine übereinanderschlagen zu können — Loke Klingsor hatte seine liebste Stellung im Lehnstuhl eingenommen, um den köstlichen Kaffee mit einer ebensolchen Zigarre sich zu Gemüte zu führen.
Aber noch fehlte ihm etwas zum vollständigen Behagen.
»Luzifer!«
Wieder ein Druck auf einen Knopf! Am Boden sprang eins der durch weiße Linien markierten Felder auf und heraus die mächtige schwarze Katze, war mit einem Satze auf dem Schoße des Mannes, der sie erst etwas liebkoste, was ebenso zärtlich beantwortet wurde, und dann saß sie auf seiner rechten Schulter, die Pfoten untergeschlagen und vor Behagen laut schnurrend.
Doch lange währte diese behagliche Untätigkeit nicht.
Nachdem Loke zum ersten Male die allerdings sehr lang gewordene Asche von der Zigarre abgestrichen hatte, in eine kleine Öffnung der Schreibtischplatte hinein, stellte er wieder das helle Licht an, rückte den Stuhl näher, griff, die Zigarre zwischen den Fingern der rechten Hand, mit der linken nach einem Bleistift, machte sich auf einer kleinen Tafel von weißem Stein oder einer sonstigen Masse einige stenografische Notizen.
Also er konnte mit der linken Hand ebenso gut schreiben wie mit der rechten.
»So, Luzifer, nun musst du wieder in deiner Unterwelt verschwinden.«
Die Katze schien jedes Wort zu verstehen, erhob sich auf seiner Schulter, was sie freilich wohl nicht gern tat, und verschwand wieder in der Bodenklappe, die sich über ihr schloss.
Jetzt drehte Klingsor ein trichterähnliches Instrument mehr nach sich herum, drückte einen Knopf.
»Hekla!«, sagte er mit gedämpfter Stimme.
»Hier Hekla!«, erklang es sofort und deutlich aus dem Trichter heraus.
»Ist Doktor Sala zu sprechen?«
»Einen Augenblick! Ich rufe ihn sofort an.«
»Nur, wenn er Zeit hat, ich will ihn nicht von seinen Verpflichtungen abhalten, ich kann warten.«
»Hier Doktor Sala«, erklang gleich darauf eine andere Stimme.
»Wie geht es Herrn Reinhard?«
»Die Augenentzündung und alles verläuft ganz normal.«
»Hat er noch heftige Schmerzen?«
»Vor einer Viertelstunde erst sagte er mir, dass jetzt das Stechen in den Augen nachgelassen habe; gegenwärtig ist er ganz schmerzfrei, die Krisis ist überstanden.«
»Gott sei Dank! Es ist also tatsächlich die ägyptische Augenentzündung?«
»Die ganz echte ägyptische Augenentzündung, alle Symptome dafür sind vorhanden.«
»Ist es denn schon einmal vorgekommen, dass die ägyptische Augenkrankheit auch in Brasilien auftritt?«
»Gewiss, das kann einmal passieren, wie überall in der Welt, sogar in den kältesten Zonen, ohne dass eine Infizierung vorliegen muss.«
»In meinem Ophir ist es doch der erste Fall.«
»Und wird sich wohl nicht so bald wiederholen. Von einer Epidemie ist keinesfalls die Rede.«
»Weshalb eigentlich haben Sie den Erkrankten gleich nach dem Hekla überführt?«
»Weil ich reine Gebirgsluft für das Beste halte, zumal in höheren Breiten.«
»Sie kennen doch meinen Mammutpark.«
»Wenigstens dem Hörensagen nach.«
»Er liegt am nördlichen Fuße des Himalajas in fast 3000 Metern Höhe. Könnte Reinhard nicht dort untergebracht werden? Das Felsenhaus bietet jegliche Bequemlichkeit, Sie würden ihn begleiten und weiter behandeln.«
»Herr Klingsor... Sie haben mir Herrn Ingenieur Reinhard auf die Seele gebunden, ich habe fast geschworen, ihn innerhalb vierzehn Tagen wieder herzustellen... aber das ist nur möglich, wenn er bleibt, wo er nun einmal ist. Jede Klimaveränderung würde einen schädlichen Einfluss ausüben, einen Rückschlag bewirken, selbst in ganz gleichem Klima. Das liegt schon allein in der Luftveränderung.«
»Dann bleibt Reinhard natürlich dort. Machen Sie ihn nur so bald wie möglich wieder gesund. Kann ich ihn einmal sprechen?«
»Gewiss, Herr Klingsor.«
»Dass er nicht schläft!«
»Er hat vorhin erst zwei Stunden gut und schmerzlos geschlafen.«
»Wird ihm eine Unterhaltung angenehm sein?«
»Sogar sehr.«
»Dass er nicht etwa nervös ist, meine Unterhaltung nur duldet!«
»Keine Spur von Nervosität!«
»In der Camera obscura kann er wohl nichts beobachten?«
»O, nein! Er liegt im finsteren Zimmer, hat auch noch eine dichte Binde vor den Augen.«
»Wollen Sie mich melden, Herr Doktor!«
Nur eine Minute, und ein leises Klingeln ertönte.
»Sind Sie es, Herr Ingenieur?«
»Ach, Herr Klingsor, das ist aber schön, dass Sie mich einmal aufsuchen!«, erklang es erfreut mit etwas schwacher Stimme.
»Na, von wegen besuchen!«, erwiderte Klingsor heiter lachend. »Wenn Sie wüssten, wie weit ich von Ihnen entfernt bin!«
»Bei uns spielt die Entfernung ja gar keine Rolle, bei uns gibt es keinen Raum und, in gewissem Sinne, nicht einmal eine Zeit.«
»Da haben Sie allerdings recht. Nun, wie geht es Ihnen denn, mein lieber Reinhard?«
»Besser, ganz bedeutend besser! Jetzt befinde ich mich sogar ganz wohl, habe gar keine Schmerzen mehr in den Augen.«
»Das zu hören freut mich. Doktor Sala versichert, dass Sie in vierzehn Tagen wieder völlig hergestellt sind und wie ein Luchs werden sehen können.«
»Ich glaube es ihm, und das Letztere hoffe ich. Ein vorzüglicher Arzt, dieser Doktor Sala.«
»Wie wohl alle, die ich um mich versammelt habe.«
»Weil Sie, Herr Klingsor, selbst der denkbar vorzüglichste, beste Mensch...«
»Ssssst, ich will so etwas nicht hören!«, wurde der in einen begeisterten Ton fallende Sprecher schnell unterbrochen. »Mit der Vermessung von Ophir sind Sie also fertig?«
»Ja, das war wie abgepasst. Gerade hatte ich den letzten Namen in die fertige Karte eingetragen, als ich die ersten Anzeichen der Augenkrankheit verspürte.«
»Ich habe Ihre topografische Karte bereits eingesehen; sie kann an Korrektheit ja gar nicht übertroffen werden. Wenn Sie erst wiederhergestellt sind, sollen Sie Ihre Belohnung dafür empfangen, jetzt dürfte die freudige Kunde Sie noch zu sehr aufregen.«
»Und womit werden Sie mich dann beschäftigen? Darauf bin ich jetzt am gespanntesten, das enthalten Sie mir doch nicht vor.«
»Würden Sie wieder eine Vermessung übernehmen?«
»Es ist mir das Liebste, ich bin, wenn auch ursprünglich mehr Maschineningenieur, nun einmal aus Liebhaberei Geometer geworden.«
»Aber wohl nicht wieder in den Tropen?«
»Wie Sie bestimmen! Ganz gleichgültig wo! Wenn ich nur in der frischen Luft tätig sein kann!«
»Haben Sie schon von meinem Mammutpark gehört?«
»Nein.«
»Es ist eine meiner größten Besitzungen.«
»Ach, Herr Klingsor, wo auf der Erde haben Sie keine Besitzungen!«
»Na na, so zahlreich sind sie nicht; an den zehn Fingern herzählen lassen sie sich schon...«
»Aber diese Schlupfwinkel und Verstecke, die Sie sonst überall angelegt haben! In einige haben Sie mich damals auf meiner Ferienreise ja selbst eingeführt, und ich bin aus dem Staunen gar nicht herausgekommen. Immer neue Wunder habe ich geschaut, mir so lange unfassbar, bis Sie mir alles erklärten...«
»Das ist wieder etwas anderes, das sind meist unterirdisch angelegte Verstecke, oftmals auf einem Gebiet, das gar nicht mein Eigentum ist. Bei dem Mammutpark aber handelt es sich um ein ganzes Land, das auf der Oberfläche der Erde liegt und mein rechtmäßiger Besitz ist. Was haben Sie nun von diesem sogenannten Mammutparke schon gehört?«
»Nicht viel mehr, als dass er im Himalajagebirge liegt.«
»Weshalb führt er den seltsamen Namen?«
»Das weiß ich nicht. Der Skalde, mit dem ich darüber einmal ins Gespräch kam, erklärte, mir nichts weiter sagen zu dürfen, und ich habe niemals wieder eine diesbezügliche Frage stellen können.«
»Sie hätten es ruhig tun dürfen. Doch nun lassen Sie sich von mir selbst über dieses Gebiet berichten, über dieses Wunderland, in das Sie demnächst Ihre Tätigkeit als Vermessungsingenieur verlegen werden, und ich kann Ihnen versichern, dass Sie Staunenswertes sehen und erleben werden.
Der sogenannte Mammutpark liegt am nördlichen Fuße des Mount Everest oder Gaurisankars, mit seinen 8840 Metern der höchste Berg der Erde.
Da er dicht an der Grenze von Tibet liegt, liegt also auch mein Gebiet schon in Tibet, aber vollständig isoliert.
Das ganze Gebiet bildet ein ziemlich regelmäßiges Rechteck von etwa sieben geografischen Meilen Länge und vier Meilen Breite, also ein recht beträchtliches Gebiet, das man wohl kaum einen Park nennen kann. Aber dieser Name ist ihm nun einmal gegeben worden, nach einer bestimmten Gegend.
Es ist ein im Großen und Ganzen ebenes Plateau von im Durchschnitt 3000 Meter Höhe über dem Meeresspiegel, da es aber im Himalaja liegt, und zwar in dessen höchstem Teile, dicht am Gaurisankar, so ist es dennoch ein Tal, indem es auf allen Seiten von himmelhohen Bergwänden eingeschlossen wird.
Soweit bisher konstatiert werden konnte, sind diese Bergwände auf allen vier Seiten unübersteigbar. Oder vielmehr unüberwindbar. Im Norden schließt sich daran ja das Hochplateau von Tibet, das auch ziemlich dicht bis an die Grenze meines Gebietes bewohnt, dort sogar ausnahmsweise dicht bevölkert ist.
Aber dieses Plateau ist eben 4500 Meter hoch. Dann also kommt nach Süden ein Absturz von 1500 Metern, mit Wänden so glatt wie die Mauern, und das ist eine Höhe oder Tiefe, welche kein Mensch überwinden kann.
Von einem Herablassen mit Seilen ist gar keine Rede, höchstens könnte jemand hinabstürzen, was aber auch nicht so einfach ist, denn die Bezeichnung ›glatt wie die Mauern‹ ist doch nicht wörtlich zu nehmen.
Außerdem sind oben auf dem tibetanischen Hochplateau dicht am Rande des furchtbaren Abgrundes immer noch verschiedene unüberwindliche Hindernisse vorhanden.
Kurz und gut — es gibt für die Menschen der anderen Welt heute noch kein Mittel, um von oben in dieses Tal, in meinen Mammutpark, hinabzugelangen. Von den anderen Seiten aus noch viel weniger als von Tibet her. Mit Ausnahme von Süden her. Hier gibt es allerdings einen Abstieg.
Aber um zu diesem zu gelangen, müsste man den Gaurisankar bis zu einer Höhe von mindestens 8000 Metern ersteigen, und das soll mir erst einmal ein Mensch, der nicht unsere Hilfsmittel besitzt, vormachen, und dann muss er auch den betreffenden Pass erst finden, und dann den Abstieg, und so weiter und so weiter.
Schließlich müsste der betreffende Mensch an meinem astronomischen und meteorologischen Observatorium vorüber, das ich, wie Ihnen doch wohl bekannt ist, auf dem höchsten Gipfel des Gaurisankars angelegt habe, und da wird er eben nicht vorüber gelassen, dieser Passweg wird immer bewacht. Es ist ganz ausgeschlossen, dass jemand in dieses isolierte Tal von achtundzwanzig geografischen Quadratmeilen Ausdehnung dringen kann.
Menschen leben nicht darin, mit Ausnahme derjenigen, die ich erst hingebracht habe.
Aber das ist früher einmal anders gewesen. Dort hat schon früher einmal ein Volk gehaust, das aber ausgestorben ist. Wir haben die Überreste einer einst hochentwickelten Kultur gefunden, kolossale Ruinen, gewaltige Anlagen von Gräbern, ganze Totenstädte von riesenhafter Ausdehnung und dergleichen mehr, wovon Sie später mehr erfahren werden, soweit Sie nicht selbst neue Entdeckungen machen, welche dort kein Ende zu haben scheinen. Sie sollen eben erst alles richtig erforschen, so, wie ja auch Sie erst über mein brasilianisches Ophir Licht verbreitet haben, eben durch Ihre Vermessungsarbeiten. Jetzt will ich nur im Allgemeinen über das Mammutland sprechen, um Sie vorzubereiten.
Die Flora ist im Großen und Ganzen die einer solchen Höhe in Indien entsprechende, also etwa eine mitteleuropäische mit vielen Eichen, Buchen und Birken. Auch alle mitteleuropäischen Obstarten gedeihen. Die Sommer sind sehr heiß, die Winter sehr kalt.
Aber da kommen gewaltige Ausnahmen vor, die sich an engbegrenzte Distrikte knüpfen.
Dass es in der Nähe des Gaurisankars, wo er seine Gletscher herabschickt, ganz anders aussieht als im Norden, dass es dort eine Region des ewigen Eises gibt, können Sie sich wohl selbst denken. Im Norden aber gibt es zahllose heiße Quellen und dampfende Geiser, dort ist überall unterirdisches Feuer, da gedeiht die bunte Pflanzenpracht des südlichsten Indiens noch in dieser Höhe.
Und ebenso ist es mit der Tierwelt beschaffen.
Ich habe dieses abgeschlossene, menschenleere Tal vor vier Jahren zufällig entdeckt und in Besitz genommen, und ich fand an Tieren darin alles vor, was wiederum diesem Klima und der ganzen Eigentümlichkeit entspricht, aber nur, soweit die indische und überhaupt südasiatische Fauna in Betracht kommt.
Also Axishirsche waren bereits vorhanden, ebenso Paradiesvögel und andere Tiere mehr, die man sonst nur im heißesten Indien findet, die aber auch in den heißen Regionen des Nordens gedeihen können.
Am Abhange des Gaurisankars fanden sich Yaks und andere Bewohner einer kälteren Zone vor und in der gemäßigten Mitte schließlich Hirsche aller Art, Bären und sonstiges Viehzeug, was diesem Klima entspricht.
Nun aber eine große Merkwürdigkeit. Dass es in diesem Gebiet Elefanten gibt, ist an sich ja nicht wunderbar.
Aber diese sind erstens von außerordentlicher Größe, zweitens sind ihre mächtigen Zähne nach unten gebogen, fast geringelt, und drittens sind sie mit einem langhaarigen Pelze bedeckt, der auch im Sommer nur wenig an Dichte verliert. Also es sind Mammuts, welche sich von den heutigen Elefanten ja überhaupt nur durch jene genannten drei Eigenschaften unterschieden haben.
Nun ist aber — das Merkwürdigste dabei — mit Sicherheit konstatiert worden, dass diese jetzigen Mammuts sich nicht etwa aus der sogenannten vorsintflutlichen oder Tertiärzeit dort bis heute erhalten haben, sondern dass sie dereinst ganz richtige Elefanten gewesen sind, wie sie heute noch in Indien herumlaufen.
Das ist klar aus den Zeichnungen des ausgestorbenen Urvolks erkenntlich, welches einst dort gehaust hat.
Alle die Wandmalereien und Tempelfiguren zeigen nur Elefanten von gewöhnlichem Aussehen, niemals ist ein bepelztes Mammut mit nach unten gebogenen Zähnen nachgebildet worden, was doch sicher geschehen wäre, wenn dieses Urvolk solche Tiere gekannt hätte.
Also die ehemaligen Elefanten haben sich im Laufe der Zeit in Mammuts zurückverwandelt.
Wodurch nun ist diese Umwandlung geschehen?
Unsere Geologen haben dieses Rätsel bereits gelöst.
Quer durch das ganze Tal zieht sich ein Zwischengebirge, welches wohl von Bären und Hirschen zu übersteigen ist, nicht aber von Elefanten.
Dieses Scheidetal ist ganz sicher sehr plötzlich durch vulkanische Kraft in die Höhe gehoben worden, da ist einmal eine Katastrophe eingetreten, und zwar im heißen Sommer.
Elefanten haben sich auch noch in der südlichen, also kälteren Region befunden; durch die Erhebung des Gebirges ist ihnen im Herbst der Rückweg nach der nördlichen, durch seine heißen Quellen und überhaupt vulkanischen Boden auch im Winter noch sehr warmen Region abgeschnitten worden.
Diese abgeschnittenen Elefanten haben sich auch in dem kalten Teile zu akklimatisieren vermocht. Es ist ihnen ein Pelz gewachsen. Die Krümmung der Zähne nach unten ward durch die veränderte Nahrung bewirkt. Denn diese Mammuts ernähren sich jetzt, hauptsächlich im Winter, von Nadelzweigen. Wie es ja auch die sibirischen Mammuts gehalten haben. Deren Magensäcke, wie man sie wohlerhalten noch im Eise findet, sind ja auch immer nur mit den Nadeln und Zweigen von Tannen und Fichten gefüllt — weil sie eben Gras und Laub dort gar nicht vorfanden. Inwiefern sich nun durch diese geänderte Nahrung die Zähne nach unten gebogen haben, das kann ich Ihnen hier nicht erläutern, das würde zu weit führen. Übrigens handelt es sich dabei nicht um die Nahrung, sondern um die Art, auf welche sich die Mammuts diese verschaffen müssen.
Also diese Mammuts haben jenem Tale den Namen gegeben, und in Anbetracht seiner parkähnlichen Eigenschaften ist daraus der Mammutpark geworden.
Ich habe daraus noch vollends einen Tierpark gemacht, habe Tiere aus allen anderen Weltteilen hineingesetzt, Eisbären und Rentiere sowohl wie Kängurus.
Die ursprünglich vorhanden gewesenen Raubtiere, welche da erst dafür sorgten, dass sich das pflanzenfressende Wild nicht ins Zahllose vermehrte, habe ich nach und nach ausrotten lassen.
Dafür musste ich nun menschliche Wildhüter besorgen.
Vor vier Jahren, gerade damals, als ich diese menschenleere Gegend im Himalaja entdeckte, sollten in Amerika die letzten Absarokas, das heißt so viel wie Rote Raben, welche zu den Crows oder Krähenindianern gehören, diese wieder zum Stamme der Sioux, ihr ihnen angewiesenes Reservat räumen, weil darin große Kohlenlager entdeckt worden waren, die man abbauen wollte.
Natürlich bekamen sie ein anderes Reservat angewiesen, sie wurden sogar reichlich entschädigt, aber im Grunde genommen war es doch wieder eine Vergewaltigung, die sich die Herren Yankees da erlaubten.
Gern gingen die Roten Raben nicht aus ihrer neuen und ihnen doch wieder so lieb gewordenen Heimat, aber zu einem Verzweiflungskampfe wäre es nicht gekommen, sie hätten sich gefügt. Der ganze Stamm bestand aus kaum noch hundert Köpfen, nur zur Hälfte waffenfähige Krieger.
Ich erfuhr von der Sache und nahm mich der Ausgestoßenen an, die nämlich ein ganz elendes Gebiet zugewiesen bekommen hätten, aus dem von einer Ernährung durch Jagd keine Rede mehr sein konnte, und diese Absarokas sind geborene echte Jäger, die sich niemals zum Ackerbau herabgewürdigt hätten.
So echte Jäger sind sie, dass sie Feuerwaffen, obgleich sie solche besitzen und ausgezeichnet damit umzugehen wissen, auf der Jagd verschmähen, das Wild nur mit Bogen und Pfeilen erlegen, und außerdem gehören sie auch nicht zu jenen Indianern, wie sonst die übrigen Sioux, die nur aus wahrer Blutgier jagen, gleich einmal eine ganze Büffelherde niedermetzeln, nur die Höcker oder gar nur die Zungen mitnehmend, das andere Fleisch verwesen lassend.
Diese Absarokas waren also als Wildhüter für meine Zwecke wie geschaffen. Ich überredete sie nicht erst lange, sondern packte sie einfach zusammen und brachte sie nach dem Mammutpark. Dann erst kam die Auseinandersetzung.
Nun, die Roten Raben haben sich eingerichtet und könnten gar nicht glücklicher sein. Sie dürfen nach Herzenslust jagen, wilde Mustangs einfangen und zureiten und im Winter sogar, wie in ihrer alten Heimat, wieder im Rentierschlitten fahren.
Sie haben die Raubtiere im Laufe der Zeit gänzlich ausgerottet, bis auf jene, die geschont werden durften, weil sie unter dem Wilde nicht gar zu sehr hausen, wie die Bären, und habe ich Raubtiere am Leben gelassen oder gar solche aus fremden Erdteilen eingeführt, darunter auch Löwen, so sind diese auf gewisse Gebiete beschränkt, ohne dass sie aus diesen entweichen können, obwohl man keine Mauern oder gar Gitter sieht.
Sonst ist dort auch noch für eine komfortable Wohngelegenheit gesorgt, das sogenannte Felsenhaus, in dem die höheren Skalden untergebracht sind, wo auch ich manchmal Quartier nehme. Die Indianer leben in ihren Wigwams.
So, nun habe ich Ihnen das Gebiet Ihrer zukünftigen Tätigkeit ziemlich ausführlich beschrieben. Was es aber sonst noch alles dort zu sehen gibt, kann ich Ihnen hier unmöglich aufzählen. Dort hat eben einst ein hochentwickeltes Kulturvolk gehaust, dessen Ruinenstädte noch vorhanden sind, die aber erst in der Wildnis entdeckt werden müssen, und nun außerdem ein Naturwunder am anderen.
Ich sage Ihnen, Herr Ingenieur: und wenn Sie hundert Jahre dort verbringen und Sie tun nichts anderes, als immer herumkriechen, so werden Sie doch jeden Tag ein neues Wunder entdecken. Man braucht bloß eine neue Höhle zu finden, sie enthält sicher ein neues Phänomen, von der Natur oder von Menschenhänden geschaffen, und dort ist alles von Höhlen zerklüftet.
Die indianischen Wildhüter gehen nicht auf solche Entdeckungen aus, sie haben vor allem, was von jenem ausgestorbenen Volke herstammt, aus gewissen Gründen eine heilige Scheu, und ich habe auch sonst keinen anderen Skalden, den ich da ständig herumkriechen lassen kann.
Nun, Herr Ingenieur, wäre das etwas für Sie?«
»Ach, wie ich mich darauf freue!!«, erklang es jubelnd aus dem Schalltrichter.
»So machen Sie nur, dass Sie baldigst gesund werden, und die Sache kann gleich losgehen.
Nun etwas anderes.
Es gibt noch einen zweiten Grund, dass ich Sie in meinem Mammutpark beschäftigen möchte.
Kennen Sie den Bunten Maulwurf?«
»Den Bunten Maulwurf?«, wurde verwundert wiederholt. »Nein«.
»Sie haben diesen Namen noch nie gehört?«
»Noch nie.«
»Wer ist der Erfinder des sogenannten Elektrodenmessers?«
»Ein gewisser Meister Kafka.«
»Den kennen Sie auch nicht weiter?«
»Nein, nur dem Namen nach.«
»Sie haben sonst nichts von ihm gehört?«
»Gar nichts.«
»Wissen nicht einmal, dass er ein Malandrino ist, ein Ausgestoßener und Verfemter?«
»Das ist mir neu!«
»So lassen Sie sich berichten.«
Klingsor machte eine kleine Pause und begann:
»Stephan Kafka ist ein Ungar.
Sein Vater war Gutsbesitzer in der Nähe von Budapest.
Stephan wurde schon verkrüppelt geboren, und es ist gerade, als ob die Natur in einer bizarren Laune einen menschlichen Maulwurf habe schaffen wollen.
Sein Kopf ist ganz normal menschlich, der Oberkörper schon etwas zu kurz geraten, die Oberschenkel fehlen gänzlich, ja überhaupt die Beine, und doch sind menschliche Füße vorhanden, die aber fast direkt am Leibe sitzen. Ebenso fehlen die Unterarme, die Hände sind gleich aus den Ellenbogen herausgewachsen, zwar menschlich geformte Hände, aber die Finger sind schaufelartig zusammengewachsen, nur der Daumen ist isoliert.
Infolge der fehlenden Beine hat Kafka nie richtig gehen können. Wohl kann er sich aufrichten und auf den Stummeln watscheln, aber sonst läuft er auf den Händen, das heißt, er reckt nicht die Füße in die Höhe, sondern er kriecht auf allen Vieren, dabei aber die Füße nur nachziehend; die eigentliche Bewegung besorgen die Hände, und so huscht er schnell wie ein Wiesel über den Boden hin.
Aber die Natur hat ihn nicht zum Wiesel, sondern zum Maulwurf bestimmt, und dazu hat sie ihm auch die Charakterveranlagung gegeben.
Schon als Kind kannte Stephan Kafka kein größeres Vergnügen, als mit den Händen in der Erde zu schaufeln, Löcher zu graben — oder aber auf dem Heuboden des heimatlichen Gutes sich in das Heu einzuwühlen, lange Gänge und große Höhlen darin zu schaffen, und man muss die Leute gehört haben, die ihn damals beobachteten, um zu erfahren, was für Labyrinthe das Kind da angelegt hat.
Aber noch lieber als im Heu schaufelte der kleine Krüppel in der Erde — weil er da bunte und glitzernde Steinchen fand, die er sammelte und aufhob.
Und das war nicht nur eine kindliche Spielerei, sondern hierbei offenbarte sich schon der zukünftige Mineraloge und Geologe, der er geworden ist. Wenn er nach Budapest kam, ließ er sich auch regelmäßig in das NationalMuseum fahren, nur um die geologischen Sammlungen zu besichtigen.
Nun muss ich aber noch eine andere Charaktereigenschaft dieses verkrüppelten Kindes, das geistig sonst normal war, erwähnen. Dass ich keinem Menschen etwas Übles nachsage, wenn ich es irgendwie vermeiden kann, das wissen Sie doch von mir, Herr Ingenieur. Hier ist es einmal nötig, ich muss etwas aufdecken, um den Knaben und den jetzigen Mann zu charakterisieren.
Stephan war schon als Kind diebisch veranlagt. Er stahl alles, was ihm gefiel, was bunt war und glänzte. Da war er mehr eine Elster als ein Maulwurf. Die Gänge und Höhlen in den Heuschobern schien er nur deshalb anzulegen, um dort das Gefundene und mehr noch Gestohlene zusammenzutragen, aufzuhäufen und zu verbergen, und ganz wunderbar soll es gewesen sein, was für Irrwege er da anlegte, um den Nachsucher zu täuschen. Oder, wenn er seinen Fund oder Raub in der Erde verscharrte, wie er jede Spur zu verwischen verstand.
Die Umgebung achtete nicht weiter auf diese kindische Manier. Denn zu wirklichen Wertsachen gelangte der kleine Stephan nicht oder fand sie nur zufällig. Er trug nur bunte Steinchen und Glasstückchen zusammen und dergleichen, für Gold und Silber hatte er gar kein Interesse, und Juwelen gab es eben auf dem Gutshofe nicht.
Anders wurde die Sache, als man in solch einem Versteck eine ganze mineralogische Sammlung von zum Teil höchst wertvollen Gesteinen und selbst Edelsteinen wie Diamanten, Rubinen, Smaragden und dergleichen fand. Da war der Schreck groß, und da kam die Erkenntnis. Die Zeitungen hatten nämlich schon immer berichtet, dass in dem mineralogischen Museum zu Budapest schon seit langer Zeit ein Dieb sein Wesen treibe. Die Polizei setzte vergebens alle Hebel in Bewegung, um ihn zu fassen; vergebens waren Detektive ausgestellt worden. Ein Stück nach dem anderen verschwand aus der Sammlung, auch aus den verschlossenen Glaskästen heraus. Die wertvollsten und auffallendsten Stücke waren beschrieben worden. Hier, in dem Versteck auf dem Gutshofe, fand man sie alle im gemütlichen Beisammensein wieder. Der kleine Stephan, der also so gern das Museum der Stadt besuchte, besonders die mineralogische Abteilung, war der Dieb gewesen. Und bei dieser Gelegenheit offenbarte sich auch, dass das Kind selbst das komplizierteste Schloss mit einem gewöhnlichen krummen Nagel öffnen konnte, von welcher Kunstfertigkeit des Jungen ich aber später noch mehr zu melden haben werde.
Die Sache wurde geregelt. Es war ein siebenjähriges Kind gewesen, ein verkrüppeltes dazu, eine Missgeburt, das man auch geistig nicht für normal halten konnte.
Der Vater machte bankrott, kam ganz herunter, starb — das missgestaltete Kind, der menschliche Maulwurf, der verschiedene Kunstfertigkeiten verstand, wurde von einem Schausteller erworben, der an ihm Geld verdienen wollte.
Aber daraus wurde nichts. Mein Vater war, eben durch jenen Diebesfall, auf das merkwürdige Kind aufmerksam geworden; er nahm es zu sich.
Das verkrüppelte Kind war, wie schon erwähnt, wohl für geistig zurückgeblieben gehalten worden, war aber alles andere als ein Idiot, hatte vielmehr einen ungemein scharfen Verstand.
Stephan Kafka ist unter der Erziehung der Skalden Geologe geworden, hat sich praktisch hauptsächlich in unseren mexikanischen Bergwerken, wo wir besonders das rätselhafte Ximunit gewinnen, betätigt.
Es ist fabelhaft, wie dieser Mensch von der Natur zum Geologen, zur Erforschung der Erdrinde, geradezu prädestiniert ist. Dabei will ich nicht von seinen phänomenalen wissenschaftlichen Kenntnissen sprechen, sowohl in der speziellen Gesteinskunde, wie in der Chemie und Physik. Stephan Kafka besitzt in dieser Hinsicht Gaben, die man übernatürliche nennen möchte. Er scheint einen sechsten Sinn zu haben, und doch bedient er sich nur ganz natürlicher Hilfsmittel, also nicht etwa einer Wünschelrute und dergleichen trügerischer Mittel. Er klopft zum Beispiel den Erdboden mit einem gewöhnlichen Holzhammer ab, lauscht, das Ohr auf den Boden pressend, und so findet er mit absoluter Sicherheit jede Höhlung unter der Erde, bis zu einer Tiefe von fünfzig Metern und mehr, kann ungefähr ihre Größe angeben, und so verfolgt er auch jeden unterirdischen Gang meilenweit — nur durch Abklopfen mit dem Holzhammer. Also es ist nichts Übernatürliches oder Übersinnliches dabei. Er verlässt sich dabei lediglich auf sein Gehör. Aber zu begreifen ist das nicht.
Dann noch eine andere Merkwürdigkeit dieses unglücklichen Menschenwesens.
Wie er schon als Kind jedes Schloss mit einem Nagel öffnen konnte, sagte ich bereits.
Die Merkwürdigkeit liegt auch schon darin, dass das Kind das konnte und ausübte, ohne dass jemand davon eine Ahnung gehabt hat.
Und das geht nun noch viel weiter.
Der unter der Erde hausende Gott Vulkanus oder Hephaistos der Alten war als Hüter des Feuers zugleich der Erfinder der Schmiedekunst, übte diese praktisch in seinen unterirdischen Werkstätten aus.
Dieser Stephan Kafka nun, der sich nur unter der Erde wohl fühlt, besitzt eine wunderbare Geschicklichkeit im Schmieden — oder überhaupt eine fabelhafte Handfertigkeit. Er, der gar keine Finger hat, nur schaufelförmige Tatzen, mit einem Daumen daran, dass er eben gerade einen Hammer halten kann! Aber so hält er auch die feinsten Instrumente, so machte er auch die feinsten, knifflichsten Arbeiten, und dies noch dazu, ohne dass er den kurzen Arm im Ellenbogengelenk bewegen kann.
Diese seine Geschicklichkeit hat er immer ausgeübt, wenn auch mehr aus Liebhaberei in seiner Freizeit. Er hat viele mechanische Spielereien, Automaten und dergleichen angefertigt und da ist es übrigens auch wieder so eine Merkwürdigkeit, dass sich so viele Bergleute, wie Ihnen doch wohl bekannt ist, so gern mit dem Anfertigen derartiger mechanischer Spielereien beschäftigen. Der Sage von dem kunstfertigen Gotte Vulkan scheint eine tiefe Bedeutung zugrunde zu liegen, ich habe oft darüber nachgedacht, will mich aber jetzt nicht weiter darüber auslassen.
Ich komme nun zur Hauptsache für den vorliegenden Fall.
Jene besondere Elektrizität, die wir Elektrodik nennen, ist eine gemeinsame Entdeckung unserer Physiker, an der gar viele Skalden gearbeitet.
Das sogenannte Elektrodikmesser, mit dem es erst möglich wurde, die Eigenschaft dieser Elektrizität beim Bergbau und in anderer Weise auszunutzen, ist eine persönliche Erfindung Stephan Kafkas. Sie brachte ihm den Titel eines Meisters ein, jedenfalls zu seinem Unheil.
Von den diebischen Neigungen des ehemaligen Kindes war niemals wieder etwas zu merken gewesen, solange Kafka sich im Bergwerk praktisch betätigt hatte; nun kam er als Meister ins Laboratorium, wo er nur noch theoretisch zu arbeiten hatte, immer unter Aufsicht und Anleitung anderer, und das hat er offenbar nicht vertragen können.
Er beging eine strafbare Tat.
Was für eine das gewesen ist, darüber will ich schweigen. Nur das eine kann ich sagen: Nicht als Skaldenfürst, sondern als Obermeister hatte auch ich über ihn zu Gericht sitzen müssen, aber ich lehnte ab. Das sagt wohl genug. Ja, auch ich hätte ihn verurteilen müssen, aus kalter Überlegung heraus, Recht und Unrecht erwägend — aber mein Herz musste ihn freisprechen. Man hätte ihn gleich zum freien Meister, nicht zum dienenden ernennen sollen, was freilich als Lohn für diese Erfindung nicht gut möglich war. Oder man hätte ihn dann aus seiner praktischen Tätigkeit im Bergwerk herausnehmen und ins Laboratorium stecken sollen. Das hatte ich gewusst, und ich hatte es nicht so offen ausgesprochen — so fühlte ich mich selbst etwas schuldig.
Bei diesem gerichtlichen Verfahren, und besonders, als man bei ihm eine Haussuchung vornahm, kamen übrigens auch noch andere strafbare Taten zum Vorschein, die Kafka schon früher begangen hatte.
Das hängt wieder mit der merkwürdigen Charaktereigenschaft zusammen, die er schon als Kind gezeigt oder auch nicht gezeigt, aber doch schon immer besessen hatte.
Er war von jeher ein Tüftelbruder gewesen, dazu nun seine fabelhafte Geschicklichkeit — er hatte schon immer Erfindungen gemacht, wenn auch nur auf mechanischem Gebiete, wenn auch nur Spielereien und dergleichen, die er aber doch dem gelehrten Skaldenbunde zu melden verpflichtet gewesen wäre, sodass sie ein Gemeingut des Skaldenordens wurden. Er hatte es nicht getan, obwohl er gar keinen Vorteil davon hatte. Er hat seine Erfindungen eben verschwiegen.
Verschärfen konnten diese weiteren Vergehen seine Strafe nicht, und todeswürdig war überhaupt nichts.
Meister Kafka wurde degradiert.
Was das bei uns Skalden bedeutet, wissen Sie.
Stephan Kafka wurde ein Malandrino. Er wurde...«
»Verzeihen Sie, dass ich Sie einmal unterbreche«, erklang es aus dem Trichter. »Was heißt das eigentlich, Malandrino? Die Bedeutung dieses Wortes kenne ich wohl, aber über seinen Ursprung habe ich schon mehrfach vergebens gefragt.«
»Diese Erklärung kann ich Ihnen geben. Es ist ein italienisches Wort, das freilich in keinem Wörterbuche steht, eine vulgäre Verkleinerungsform, und heißt so viel wie ›schlechtes Kerlchen‹, ein Schimpfname, den man unter den italienischen Lazaronis oft genug zu hören bekommt — sonst freilich schwerlich. Wie dieses Wort in unsere Geheimsprache gekommen ist, kann ich nicht sagen.«
»Ah so, nun weiß ich! Besten Dank!«
»Also Stephan Kafka wurde ein Malandrino, ein Verfemter, ein Geächteter. Nicht einmal seinen Namen durfte er mehr führen. Er ist nur noch der Bunte Maulwurf, wie man ihn freilich scherzeshalber schon früher genannt hatte.
Bei einer Sprengung in Granitfelsen war ihm einmal die Ladung ins Gesicht geflogen, hatte ihn nicht erheblich verletzt, aber winzige Splitterchen des Granits müssen in die Haut gedrungen sein, sind da eingeheilt, ohne Störungen hervorzurufen — nur dass er seitdem eben ein sozusagen marmoriertes Gesicht hat. — Daher dieser Name.
Also der Bunte Maulwurf führt nun seit einigen Jahren ein menschenscheues Dasein, natürlich, seinem Charakter entsprechend, immer unter der Erde, und nun ist sein alter Seelendefekt mit voller Kraft wieder zum Durchbruch gekommen. Er dringt mit Vorliebe in fremde Häuser ein, immer von unten, immer als Maulwurf wühlend, und... maust.
Das kann er natürlich nur auf dem Gebiete von Skalden tun. Mit den anderen Menschen, mit den Erdenbürgern, darf er nicht zusammenkommen. Wehe ihm, wenn er es einmal täte, irgendwie eine Annäherung suchte, sie brauchte gar keine verbrecherische zu sein! Es wäre sein Tod! Das wissen Sie ja selbst, Sie kennen die betreffenden Gesetze.
Nun aber lassen sich doch auch die Skalden nicht derartige Einbrüche und Diebstähle gefallen. Der Bunte Maulwurf würde, wenn man ihn wegen solcher Einbrüche nach unseren Gesetzen auch nicht zum Tode verurteilen kann, doch auf andere Weise für immer kaltgestellt werden.
Das weiß der schlaue Kauz aber zu vermeiden. Er sucht sich als Opfer für seine Diebesgelüste solche Skaldenmitglieder aus, von denen er schon weiß, dass sie ihn aus angeborener Gutmütigkeit nicht gleich anzeigen, dass sie ihm nichts weiter tun, ihn, wenn sie ihn einmal erwischen, nach einer Verwarnung oder höchstens nach einer kleinen Züchtigung, die ihm aber nicht weiter wehtut, immer wieder laufen lassen.
Zu diesen gutmütigen Geistern gehöre auch ich. Aber es gibt im Skaldenorden noch andere solche Naturen, die sich alles gefallen lassen, wenn es sich nur nicht gerade um eine niederträchtige Gemeinheit handelt.
Mich hat er schon einmal heimgesucht. Damals ist er mir mit seiner Beute, übrigens nur aus Nascendumpillen bestehend, die er eben zu seiner Ernährung braucht, entwischt. Das war in seiner patagonischen Besitzung.
Seitdem hat er mich verschont. In letzter Zeit bohrte er immer in Thule herum. Denn die Königin Chlorinde ist ja auch viel zu gutmütig, trotz ihrer Grimmigkeit, als dass sie den armen, verkrüppelten Kerl ausliefern oder ihm sonst wie das Handwerk für immer legen würde. Und wenn er in Thule einmal erwischt wird, was freilich gar nicht so einfach ist, und er wird nach der anderen Hälfte der Erdkugel transportiert — er kehrt immer wieder nach Thule zurück, um dort sein unterirdisches Diebswesen zu treiben.
Zu meinem Bedauern! Ich möchte, dass er mir wieder die Ehre seines Besuches schenkt. Ich habe ihm damals, obgleich ich ihn nicht fassen konnte, er mir noch unter den Händen entschlüpfte, doch etwas hart zugesetzt. Vergebens habe ich ihn seitdem mehrmals eingeladen, seine Diebeskünste nochmals in einem meiner Gebiete vorzuführen. In letzter Zeit ist er telefonisch überhaupt nicht mehr erreichbar. Entweder besitzt er gar kein freies Telefon mehr, oder er antwortet einfach nicht.
Und ich möchte doch so gern einmal mit ihm zusammenkommen. Er soll sich mir anvertrauen. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Ich habe ihn ja früher persönlich kennengelernt, als er noch der ehrenwerte Meister Kafka war, und ich hatte dieses Original wirklich lieb gewonnen. Außerdem imponiert mir, wie er seine unterirdischen Einbrüche in Szene setzt, wie er seine Baue anlegt, was für Kuriositäten er da aufhäuft. Denn er schleppt vielerlei mit sich, errichtet dort, wo er sich einmal häuslich niederlässt, seine unterirdische Werkstatt, arbeitet dort seine mechanischen Spielereien aus.
Damals habe ich von alledem nichts zu sehen bekommen, weil er, als ich in sein unterirdisches Reich eindrang, schon hinter sich alles zerstört respektive beiseite und in Sicherheit gebracht hatte. Aber ich habe viel davon erzählen hören. Auch Graf Tankred, mein Nachbar in Ophir, mit dem ich in ewigem Kampfe liege und mit dem ich doch so freundschaftlich verkehre, hat ihn einmal ausgegraben, hat in seinem unterirdischen Reiche Umschau halten können. Es soll so sonderbar und rätselhaft sein, dass man es gar nicht schildern kann, wie der sich immer unter der Erde einrichtet. Man muss es selbst sehen.
Er hat auch immer einige Gesellschafter bei sich, Gehilfen, lauter lichtscheues Gesindel, natürlich nur Skalden, die ebenfalls in die Acht erklärt worden sind, also sogenannte Malandrini. Die hat er um sich versammelt und als Maulwürfe ausgebildet, er ist ihr Häuptling, der König einer unterirdischen Diebesbande. Darunter soll auch ein echter Zyklop sein. Sie wissen doch, Herr Ingenieur, was man darunter versteht?«
»Gewiss«, lautete die Antwort, und der akademisch gebildete Ingenieur musste dabei wahrscheinlich lächeln, »die Zyklopen waren nach Homer Riesen, welche unter der Erde hausten und hauptsächlich die Schmiedekunst betrieben...«
»Allerdings, das stimmt schon«, wurde er unterbrochen, »und das hängt ja auch mit dem zusammen, was ich meine, aber eigentlich dachte ich an etwas anderes. Diese Zyklopen waren doch einäugig, hatten ihr einziges Auge mitten auf der Stirn.«
»Ja, so meldet die Sage.«
»Die Sage? Nun, die riesenhaften Zyklopen sind allerdings nur Sagengestalten. Aber wissen Sie, dass die sogenannte Zyklopie wirklich vorkommt? Dass es Menschen gibt, die nur ein einziges Auge haben, mitten auf der Stirn?«
»Was? So etwas soll es wirklich geben?!«, erklang es mit ungläubigem Staunen aus dem Trichter.
Was Klingsor hierüber erklärte, soll hier nicht wiedergegeben werden, sondern nur, was ein modernes Konversationslexikon, der große Brockhaus, darüber sagt zum Beweise, dass hieran wirklich etwas Wahres ist.
Zyklopie, Zyklopenauge, eine bisweilen bei Menschen und Tieren vorkommende Missbildung, bei der nur ein einziges, in der Mitte der Stirn sitzendes Auge vor handen ist. Gleichzeitig bestehen immer wesentliche Gehirndefekte, und es sterben die lebend geborenen zyklopischen Kinder immer bald nach der Geburt.
So meldet, um der Wahrheit die Ehre zu geben, das Konversationslexikon neuester Auflage.
Also die zyklopischen Kinder sollen immer gleich nach der Geburt sterben. Nun wird wohl niemand die Möglichkeit leugnen, dass auch einmal ein zyklopisches Wesen geboren werden kann, das nicht gleich wieder stirbt, sondern am Leben bleibt, sich weiterentwickelt und keinen geistigen Defekt zeigt.
So ungefähr hatte auch Klingsor erklärt.
»Ein solcher Zyklop«, fuhr er fort, »ist auch unter jener Bande, und ich habe schon so Seltsames über ihn gehört, dass ich ihn einmal persönlich kennen lernen möchte.
Nun scheint mein Wunsch in Erfüllung gehen zu wollen.
Vor einiger Zeit erfuhr ich auf Umwegen, dass der Bunte Maulwurf beabsichtigt, mir einen Besuch abzustatten, und zwar eben in meinem Mammutparke.
Ich stellte einige Beobachter an, freilich nicht Indianer, die hiervon gar nichts erfahren dürfen. Sonst würden diese abergläubischen Wildlinge, wenn dort nun auch noch ein unterirdischer Geist sein Wesen treibt, vollends kopfscheu werden.
Das geht überhaupt nur durch die Camera obscura zu machen.
Der ganze Mammutpark mit seinen achtundzwanzig geografischen Quadratmeilen ist unter den Spiegel genommen worden und wird ständig beobachtet, sowohl dort im Felsenhaus wie auch noch von anderen Stellen aus.
So einfach ist es nun freilich nicht, die Tätigkeit dieses menschlichen Maulwurfs zu entdecken.
Wenn sich ein wirklicher Maulwurf irgendwo eingräbt, so verrät er die betreffende Stelle durch einen aufgeworfenen Erdhaufen.
Bei diesem menschlichen Bunten Maulwurfe fällt das weg. Er sucht sich stets felsigen Boden aus, unter dem er eine große Höhle konstatiert hat, schneidet sich mit dem Elektrodenmesser in den Steinboden ein und füllt den entstandenen Gang hinter sich wieder aus und macht das in so geschickter Weise, dass von seinem Eindringen keine Spur zu bemerken ist.
Die unterirdische Höhlung, die er auf diese Weise anlegt, ist der Ausgangspunkt für seinen weiteren Tunnelbau, in sie schafft er das ausgebuddelte Material, Steine und Erde, sodass niemals etwas davon an die Oberfläche kommt.
Das ist schon der eine Grund, weshalb seine Anwesenheit nicht so leicht kontrolliert werden kann.
Der zweite Grund ist, dass er, wenn er an der Erdoberfläche beginnen muss, immer nur in der Nacht arbeitet. Denn dieser menschliche Maulwurf teilt, was ich vorhin zu erwähnen vergessen habe, mit seinen vierbeinigen Kollegen auch die Eigenschaft, dass er im Finstern sehen kann, besitzt aber auch noch den Vorteil, dass er durch das Tageslicht nicht geblendet, nicht blind wird. Da er sich also nur bei Nacht an der Erdoberfläche aufhält, und zwar nur in sehr finsteren Nächten, ohne Mondschein und Sternenschimmer... nun, Herr Ingenieur, beweisen Sie einmal Ihren Scharfsinn.«
»Da braucht man wohl nicht viel Scharfsinn zu haben«, erklang es lachend zurück, »in der finsteren Nacht kann er eben in keiner Camera obscura beobachtet werden.«
Über das sonst so ernste Gesicht des Mannes mit den Teufelsaugen ging es wie ein spöttisches, sogar höhnisches Lächeln, doch gleich war es wieder unbeweglich.
»Richtig! Mit einer derartigen Beobachtung ist da also nichts anzufangen. Man kann nur...«
»Verzeihen Sie, wenn ich Sie einmal unterbreche. Mir fällt da etwas ein.«
»Bitte?«
»Es ging doch einmal das Gerücht, ein Obermeister hätte eine neue Art von Lichtstrahlen entdeckt, mit denen es möglich sei, die Camera obscura auch in finsterer Nacht zu benutzen. Er ging von dem zunächst theoretischen Grundsatze aus, dass es so etwas wie Finsternis oder Lichtlosigkeit überhaupt nicht gibt, es sind immer Lichtstrahlen vorhanden, die für das menschliche Auge und für das der meisten Tiere nur nicht sichtbar sind, so, wie ja auch die ultravioletten Strahlen für unser Auge einfach nicht existieren, während manche Tiere sie wahrnehmen.«
Wieder huschte über die dämonischen Züge des Mannes, der hier am Schreibtisch saß, ein ganz eigentümliches Lächeln.
»Was für ein Obermeister soll das gewesen sein?«
»Seinen Namen konnte ich nicht erfahren. Die Sache wurde überhaupt recht geheim gehalten.«
»Es war nur ein Gerücht, wie Sie schon sagten. Ja, ein Obermeister glaubte einmal der Erfindung auf der Spur zu sein, wie man auch in der finsteren Nacht jede Gegend durch die Camera beobachten könne, was unser ganzes Camerawesen ja vollständig umgewälzt hätte. Er musste aber bald erkennen, dass er sich nur in einem schönen Wahne befand. Nein, im Finstern versagt unsere Camera obscura.«
»Verzeihen Sie, dass ich Sie unterbrochen habe. Bitte, wollen Sie in Ihrer hochinteressanten Erzählung fortfahren.«
»Nun, ich bin gleich fertig.
Also mit einer Beobachtung des Bunten Maulwurfes ist es nichts.
Man könnte den Ort, wo er seine Wühlerei beginnt, nur durch einen Zufall entdecken, oder man müsste bei irgendwelchen Erdarbeiten gerade einmal auf einen seiner Gänge stoßen.
Am sichersten erfährt man seine Anwesenheit immer dadurch, dass in einem Wohnhause oder in einem Magazin etwas verschwindet, immer gerade das, was dieser menschliche Maulwurf allem anderen vorzieht.
In meinem Felsenhause des Mammutparkes wird vorläufig noch nichts vermisst, aber das wird schon noch kommen. Ich weiß aus ganz zuverlässiger Quelle, dass sich der Bunte Maulwurf vor zwei Tagen nächtlicher Weile im Mammutparke mit seiner Gesellschaft eingegraben hat.
Die Entfernung von dem Hause, auf das er es abgesehen hat, spielt dabei gar keine Rolle. Unterirdische Gänge gibt es überall, es handelt sich immer nur um die Tiefe, und er weiß sie stets zu finden. Stößt er an eine hindernde Wand, so gräbt er sich eben mit zauberhafter Schnelligkeit durch.
Außerdem habe ich noch ein besonderes Mittel, um ihn aufzufinden, das ich aber jetzt nicht näher erörtern möchte. Ich habe auch meinen Grund, ihn erst einige Zeit in Ruhe zu lassen. Er soll sich nur mal häuslich bei mir einrichten, vor allen Dingen auch seine Werkstatt, da will ich ihn erst heimlich beobachten, ehe ich ihn fasse.
Und hierbei sollen Sie, Herr Ingenieur, mir behilflich sein.«
»Ich Ihnen?«
»Sie wissen doch, dass ich mich gern mit Schicksalsberechnungen beschäftige, mein eigenes System habe, auch ab und zu recht gute Erfolge erziele...«
»O, Herr Klingsor, wie können Sie so bescheiden von dieser Ihrer wunderbaren Kunst sprechen! Sie haben auch mir schon einmal bewiesen, dass...«
»Schon gut! Also ich habe einmal in einer müßigen Stunde das Schicksal befragt, ob es mir diesmal gelingen wird, den Bunten Maulwurf zu fangen.
Die Antwort lautete: Nein, es wird mir nicht gelingen.
›Ein andermal?‹
›Nein.‹
›Also niemals?‹
›Doch!‹
Da musste ich wohl anders fragen, ich schien einen Fehler begangen zu haben.
›Wird der Bunte Maulwurf gefasst?‹
›Ja.‹
›In meinem Mammutpark?‹
›Ja.‹
›Diesmal?‹
›Ja.‹
›Aber nicht durch mich?‹
›Nein.‹
›Durch einen anderen Menschen?‹
›Ja.‹
›Den ich kenne?‹
›Ja.‹
›Der in meinen Diensten steht?‹
›Ja.‹
So zog ich die Berechnungen weiter, in einer Weise, wie ich es Ihnen einmal offenbart habe, was Sie freilich nicht ganz verstanden haben wollen, und so erfuhr ich, dass dieser Mann sich zurzeit im Hekla befindet, dass Sie dieser Mann sind.
Sie sollten es sein, der des Bunten Maulwurfes habhaft wird.
Das konnte aber gar nicht stimmen, meine Methode musste mich doch wieder einmal betrogen haben. Denn Sie befanden sich ja gar nicht auf Island, sondern in Brasilien.
Da, als ich noch zweifelnd die geometrischen Felder teilte und nachrechnete, um einen etwaigen Fehler zu finden, wurde mir die Kunde, dass Sie in Ophir erkrankt und von Doktor Sala bereits nach meiner isländischen Residenz überführt worden seien.
Nun musste mir wohl jeder Zweifel schwinden. Jetzt bin ich überzeugt, dass es Ihnen gelingen wird, den Bunten Maulwurf festzunehmen.«
»Wunderbar, wunderbar!«, erklang es in aufrichtigem Staunen. »Obgleich Sie mich ja schon überzeugt haben, dass Ihre Schicksalsbestimmungen eintreffen, ist es doch immer von Neuem wunderbar.«
»Also mir selbst wird es nicht gelingen. Trotzdem werde auch ich versuchen, des Bunten Maulwurfs habhaft zu werden nur aus Trotz gegen das Schicksal. Oder ich bin eben gespannt, wie er mir immer wieder entschlüpfen wird, unter den Händen, wie die Bestimmung sagte, wenn auch nur auf meine Fragen hin durch kurzes Ja oder Nein.«
»Herr Klingsor... Doktor Sala ist hier und möchte Sie sprechen.«
»Herr Doktor.«
»Es ist jetzt die festgesetzte Zeit«, sagte wieder die erstere Stimme aus dem Schalltrichter. »dass ich Herrn Reinhard die Binde abnehme, um seine Augen zu untersuchen, und ich möchte diese bestimmten Zeiten gern genau einhalten.«
»Selbstverständlich! Ich war überhaupt fertig.
Herr Ingenieur, befolgen Sie die Anweisungen des Doktors, damit Sie bald wieder hergestellt sind und nach dem Mammutpark gehen können. Auf Wiedersehen dort, wenn ich Sie auch vielleicht schon vorher noch mehrmals spreche! Schluss.«
Klingsor entnahm einer Schublade neue Papierbogen und begann wieder zu schreiben, dabei wie zuvor ab und zu einen Blick auf die kleine weiße Tafel werfend, auf welcher der rote Punkt der roten Linie merklich näher rückte.
Doch bald erscholl erst ein leises Klingeln und dann ein noch leiseres Ticken, dem er lauschte.
Dieses Geräusch wurde von einem Rädchen verursacht, das auf einen Papierstreifen schlug, der sich in Bewegung gesetzt hatte, auf ihm schwarze Zeichen hervorbringend.
Also offenbar ein telegrafischer Schreibapparat. Nur dass das Rädchen nicht wie bei den Morseapparaten nur Punkte und Striche auf dem Papierstreifen entstehen ließ, sondern die verschiedensten Zeichen, welche mit denen jener stenografischen Schrift die größte Ähnlichkeit hatten.
Der Papierstreifen lief eine gute Strecke über den Tisch hin, bis er in einer Spalte verschwand, wie er auch aus einer solchen hervorkam.
Klingsor las die telegrafische Mitteilung, und wenn das Schreibrädchen nach einem bestimmten Zeichen einmal aussetzte, wobei auch der Papierstreifen stehen blieb, so spielte er seinerseits mit den Fingern auf einer Tastatur von Knöpfen, welche mit ebensolchem Zeichen markiert waren. Also es war eine telegrafische Schreibmaschine. Merkwürdig war nur, dass dabei auch Worte mündlich gewechselt wurden.
»Wo befinden Sie sich eigentlich, Herr Klingsor?«, fragte es einmal aus jenem Trichter heraus, während das Rädchen noch schrieb.
»In meiner Camera obscura«, entgegnete Klingsor, dabei schon wieder auf der Tastatur geläufig tippend.
»Im Hekla?«
»Nein, in der Zentralcamera, in meinem Geheimkabinett.«
Also Klingsor nannte diesen engen Raum eine Camera obscura.
Was man hierunter versteht, weiß wohl ein jeder, und anders waren die geografischen Lichtbilder, die wir bisher gesehen, doch auch nicht zustande gekommen.
Dieses physikalische Gesetz, wonach Lichtstrahlen, die durch ein Löchelchen in einen Raum dringen, draußen befindliche Gegenstände an einer Wand erscheinen lassen, wegen der Kreuzung der Strahlen in verkehrter Stellung, was durch Spiegelung aber auch beseitigt werden kann, ist, soweit es sich in der Literatur verfolgen lässt, zum ersten Male im Jahre 1321 von dem jüdischarabischspanischen Astronomen Levi ben Gerson zur Beobachtung von Sonnen- und Mondfinsternissen benutzt worden.
Heute ist diese Vorrichtung ja fast nur noch eine Spielerei, obwohl unsere ganze Fotografie noch auf demselben physikalischen Prinzipe beruht.
Levi ben Gerson nannte schon damals seinen Apparat eine Camera obscura.
Wenn man dieses Wort verdeutschen will. so wird es immer mit Dunkelkammer übersetzt.
Das ist einerseits ja auch ganz richtig, anderseits aber falsch.
Um Lichtbilder durch eine sogenannte Camera obscura erscheinen zu lassen, braucht der Raum nicht finster, nicht einmal etwas verdunkelt zu sein, er kann bei geschickter Anordnung sogar tagshell erleuchtet bleiben.
Man sagt: »Das ist eine dunkle Geschichte«, und meint damit eine geheimnisvolle, welche der Aufklärung bedarf.
In diesem Sinne ist das Wort »obscur« aufzufassen.
Also »Camera obscura« wäre richtiger mit »Geheimkammer« zu übersetzen — eine Kammer, die geheimgehalten, in der etwas Geheimnisvolles getrieben wird.
Klingsor hatte es so aufgefasst, indem er sagt: »Ich befinde mich in meinem Geheimkabinett.«
Dass er dieses auch als lichtbilderzeugende echte Camera obscura benutzen konnte, das war eigentlich nur Nebensache. In diesem Geheimkabinett konnte er noch ganz anderes vornehmen, wie später gezeigt werden soll.
Die telegrafische und mündliche Unterhaltung war beendet.
Klingsor hatte sich schon seit einiger Zeit wieder seinem Schreiben gewidmet, als ein Glockenton erscholl, und diesmal warf er mit auffallender Hast den Federhalter hin.
»Endlich — — Angela ist zurückgekommen!«
So flüsterte er, und dabei ging über das dämonische Antlitz ein Lächeln von wahrhaft seligem Glück, als er jetzt schnell nach einem der Drehräder auf der Tischplatte griff.
Die nächtliche Fahrt in dem Segelschlitten nahm fürs Erste die Gemüter der beiden, die als Gäste des Hornfisches daran beteiligt waren, vollständig in Bann.
Das war durchaus nicht zu verwundern, es war eben eine Fahrt, wie sie beide noch nicht erlebt hatten, und der zauberhafte Lichtschein, den die Mondstrahlen auf diesem weiten Salzmeere hervorbrachten, musste auch einen sonst stumpfsinnigen Menschen poetisch stimmen.
Aber die Gedanken, die den Kopf Charles Dubois' erfüllten, waren ganz andere, als die, von denen seine Gefährtin heimgesucht wurde, die Bella Cobra. Jedenfalls achtete keines der beiden mehr auf den Mann, der im Hinterteil des sonderbaren Fahrzeuges saß und es mit wirklich staunenswerter Geschicklichkeit lenkte.
Jedem Steinblock, der sich ihm in den Weg stellte, wich er mit ans Wunderbare grenzender Geschicklichkeit aus. Seine Augen schienen die des doch gewiss scharfäugigen Jägers bei Weitem zu übertreffen, er schien jedes Hindernis auf die weiteste Entfernung nicht nur zu sehen, sondern sozusagen zu ahnen — zu wittern, wie das etwa bei dem Fluge der Fledermaus der Fall ist, die ja darin das Erstaunlichste leistet, was man sich nur denken — oder eben — nicht denken kann. Wenn man ein solches Tier in einem Raume fliegen lässt, in welchem kreuz und quer, wirr durcheinander, kaum sichtbare Fäden gezogen sind, dann kann man das ja beobachten, kann sehen, wie sie unbeirrt durch die Fäden lautlos umherfliegt, nirgends anstoßend.
Und die Fledermaus ist ein Nachttier, wie der Hornfisch es auch zu sein schien. Er musste mindestens noch einen Sinn mehr haben als andere Menschen, dass er sich so in dieser Einöde zurechtfand.
Das vermochte Charles Dubois ebenso gut zu beurteilen wie die Tänzerin, die ja bekannt hatte, dass sie bereits draußen gewesen war, das Innere dieses rätselhaften Kontinents genau kannte.
Beide hätten sich die Fahrt im Schlitten nicht getraut.
Längst war alles verschwunden, was irgend als Wegweiser benutzt werden konnte. Sie schienen sich wirklich nicht mehr auf einer Salzwüste zu befinden, sondern eben auf einem weiten Meer, nur mit dem Unterschied, dass die Wellen hier durch leichte Erhebungen des Bodens ersetzt wurden, dass kein Wasserstaub ihnen entgegensprühte, sondern feinste Salzkristalle.
Das war allerdings eine unangenehme Zugabe, denn diese Salzkristalle erzeugten, indem sie fast ununterbrochen gegen die Haut des Gesichts prallten, einen heftigen Schmerz, den man sich am besten vorstellen kann, wenn man daran denkt, wie einem im Winter der Sturm feine Schneekristalle ins Gesicht peitscht.
Und selbstverständlich hätten diese Salzkristalle auch großes Unheil anrichten können, wenn sie in die Augen geraten wären.
Dagegen aber waren alle drei Teilnehmer der Fahrt geschützt. Sie hatten Schutzbrillen aufgesetzt, ganz eigenartige Dinger, die der Hornfisch sich selbst hergestellt hatte, auf Grund langjähriger Erfahrungen vermutlich, denn sie hatten wohl wie alle Brillen Gläser, die aber hier ganz eigenartig gekrümmt waren, derart, dass sie die Augenhöhle vollkommen abschlossen, also dicht an dem Stirnbein, an dem Wangenbein und an der Nase anlagen.
Außerdem waren sie jedoch mit einem ganz dünnen Netze noch besonders geschützt, so fein, dass keins der feinen Salzkristallchen bis zu dem Glase vordringen konnte, und es war bloß ein Wunder, dass sie sich nun nicht an diesen Drahtmaschen festsetzten und diese mit einem undurchsichtigen Überzug bedeckten.
Das war eben nicht der Fall. Die umherstiebenden Stäubchen wurden von dem Netze aufgefangen und glitten seitwärts an ihm herab, immer als feiner Regen über die Wangen rinnend.
Gesprochen wurde zwischen den dreien nicht ein Wort mehr.
Auch das hatte durchaus nichts Auffälliges an sich, denn die drei waren eben Leute, die schon in der Wildnis gelebt hatten, und da verlernt der Mensch das unnütze Reden.
Ein solches zweck- und inhaltloses Schwatzen ist eben fast immer ein Zeichen sogenannter Kulturmenschheit, denn je mehr da geredet wird, wo ein paar solche Menschen zusammenkommen oder eine ganze Herde, desto inhaltloser wird das alles. Man spricht ja da auch nicht, um angehört zu werden, sondern nur, um mitzureden und dadurch sein Dasein zu bekunden.
Der Jäger, ein Landmann — alle Leute, die sich in der freien Natur aufhalten — sie sind schweigsam, verlernen das Reden angesichts der großen Gottesschöpfung, der gegenüber sie sich so verschwindend klein vorkommen.
Die einzige Unterbrechung der eintönig wirkenden Fahrt, dieses Dahingleitens über die glitzernde Salzfläche, ward durch die Bauart des Segelschlittens bedingt.
Die Bella Cobra, die noch keinen gesehen hatte, auch keinen Segelschlitten, wie er auf Eisbahnen benutzt wird, konnte ja darüber nicht urteilen, desto besser aber Charles Dubois, der ja, nach seinen Worten, bereits in einem solchen Fahrzeuge die große Salzwüste in Utah durchquert haben wollte.
Er fand bald heraus, dass dieser Segelschlitten des Hornfisches doch anders gebaut war als jener, den er damals benutzt hatte.
Jetzt verstand er erst, warum seitwärts noch eine dritte Kufe angebracht war; die hatte er anfangs gar nicht weiter beachtet, sie nur für eine Vorrichtung gehalten, welche die Segelbedienung erleichtern sollte.
Bald jedoch sollte er erkennen, wozu diese Kufe da war.
Der Segelschlitten war wohl anfangs schnurgerade dahingesaust, da war die Strecke frei und übersichtlich gewesen, aber auf die Dauer war das doch nicht möglich, da hatte der Hornfisch das Segel wenden müssen, und schließlich waren auch Stellen gekommen, wo sich ein Kreuzen nötig gemacht hatte — genau wie bei einem Segelboote.
Die Kunst des Segelns an sich ist gering. Es handelt sich eben nur darum, dass die treibende Kraft des Windes ausgenutzt wird, dass man ihn voll im Segel fängt.
Freilich ist dazu nötig, dass man ihn im Rücken hat und dass der zurückzulegende Weg eben geradlinig verläuft. Er kann auch noch leichte Biegungen nach den Seiten hin machen. Da stellt man eben das Segel danach ein.
Wie aber wird es, wenn einem der Wind gerade entgegenkommt oder nur rechtwinklig von einer Seite?
Da muss eben der Segelnde zeigen, dass er die physikalischen Gesetze beherrscht, dass er das Parallelogramm der Kräfte kennt und auszunutzen versteht, dass er den Wind auch noch dann sich dienstbar machen kann, und ein geschickter, geübter Segler kommt ja auch mit dem Gegenwind noch ganz flott vorwärts, nur muss er dann eben jene Bewegungen ausführen, die man Kreuzen nennt — er muss von links nach rechts und von rechts nach links fahren, sodass der Wind ihm wenigstens seitlich in das Segel kommt.
Wer dieses Kreuzen einmal bei einer großen Segeljacht beobachtet hat, der wird wissen, dass es ganz lebensgefährlich aussieht, dass es scheint — namentlich beim Wenden — als müsse das Fahrzeug kentern. Dann legt sich die eine Bordwand so dicht auf das Wasser, dass dieses jeden Augenblick in das Boot eindringen kann. Dann müssen die Insassen sich rasch auf die gegenüberliegende Bordwand setzen und so das Gleichgewicht wiederherstellen.
Nach denselben Gesetzen musste also auch der Hornfisch mit seinem Segelschlitten handeln, nur dass er für den Fall eines Kenterns kein Wasser schöpfen konnte, sondern nur Salzkristalle —
Jedenfalls aber hätte ein solches Umwerfen die übelsten Folgen für die Insassen des Segelschlittens und für diesen selbst haben können. Es musste unter allen Umständen vermieden werden.
Und da zeigte sich erst, wie praktisch dieses Fahrzeug konstruiert war.
Nachdem es den »Strand« verlassen hatte, hier also die öde Gegend südlich des mächtigen Sees, war es nicht mehr auf beiden Kufen dahingeglitten, sondern hatte sich aus einem Schlitten in einen Schlittschuh verwandelt, nur auf einer der Kufen dahingleitend, und infolge der verminderten Reibung hatte sich die Schnelligkeit beträchtlich gesteigert.
Dann kam die erste Wendung.
Der Hornfisch stieß einen leisen Warnruf aus.
Die Bella Cobra und Charles Dubois, die ja gesegelt waren, verstanden sogleich, was gemeint war, machten sich fertig, ihren Platz zu wechseln, duckten sich zunächst, dass der schwere Segelbaum über sie hinweg gleiten konnte, ohne ihnen gegen den Kopf zu schmettern, und dann voltigierten sie nach der anderen Seite des Segelschlittens hinüber, stellten dadurch das verschobene Gleichgewicht wieder her.
Und da sah Charles Dubois, dass das Fahrzeug nun wieder bloß auf einer Kufe dahinglitt, auf jener, die er zuvor als eine Erleichterung für die Segelführung angesehen hatte!
Der Schlitten besaß also in Wahrheit nicht zwei, sondern drei Kufen, und die eine war, wenn er fuhr, immer ziemlich einen Meter hoch über dem Boden, kam nur in Betracht, wenn gewendet wurde. Dann ragte wieder die auf der anderen Seite in die Luft.
Nur die mittelste ward nie frei, sie blieb immer auf dem Boden, und wahrscheinlich war sie so gebaut, dass sie zugleich den Kiel eines Segelbootes darstellte und ersetzte.
Das waren die Feststellungen, die Charles Dubois gleich in der ersten Zeit der Fahrt gemacht hatte. Da hatte er eben nur auf das Fahrzeug geachtet, aufgepasst, wie der Hornfisch es lenkte —
Und als er damit Bescheid wusste, nichts Neues hätte mehr lernen können, da wendete er seine Aufmerksamkeit der Gegend zu.
Die Fahrt ging also über eine Salzsteppe, die mit einem Meere verglichen wurde, und dieser Vergleich war auch ganz treffend. Eine Steppe kann doch nur mit Salzkörpern bedeckt sein, ihr Boden braucht nicht ebenfalls aus Salz zu bestehen, etwa so, wie doch eine Wüste nicht aus Sand besteht, sondern dieser auf einer festen Unterlage ruht, meist auf Gestein.
Hier aber war die Sache anders, hier musste die Salzschicht, die ganz und gar nicht lose auf einer Unterschicht auflag, tief, tief, hinabreichen; sie bildet eine feste Masse, dass sie eben wirklich mit einem gefrorenen Meere oder wenigstens einem großen See verglichen werden konnte.
Auch dafür hatte der im Beobachten und Erklären von Naturerscheinungen und anderen Vorkommnissen geübte Jäger gleich einen Grund gefunden, und er durfte da annehmen, dass er sich nicht irrte.
Im Innern Australiens regnet es wohl nur selten — dieses »wohl« muss hinzugesetzt werden, weil eben niemand die volle Tatsache behaupten kann — aber einmal fällt doch ein ergiebiger Regenguss, und wenn da feste Erde sich in einen Brei verwandelt, so muss das noch viel mehr der Fall sein, wenn der Boden aus Salz besteht. Es löst sich doch im Wasser sogleich auf, zerfließt zu einem zähen Morast und kann doch nicht ganz gelöst werden, weil da ganze Ströme Wasser nötig wären.
Charles Dubois kannte das, hatte mit dieser Möglichkeit gerechnet, als er die große Salzwüste durchquerte, hatte aber keine Gelegenheit gefunden, die Richtigkeit seiner Vermutung bestätigt zu sehen; es war damals kein Regen gefallen, die Salzkruste war nicht aufgeweicht worden, hatte sich nicht in einen Morast verwandelt.
Sonst hätte eben der kühne junge Jäger nicht heute an dieser nächtlichen Fahrt teilnehmen können, da bleichten jetzt seine Gebeine drüben über dem Meere inmitten der unendlichen Salzwüste.
Durch einen solchen Salzbrei hätte er mit seinem Segelschlitten nicht dringen können, höchstens ein Umfahren wäre möglich gewesen, und um dieses rechtzeitig ausführen zu können, hätte er eben wissen müssen, dass da und da nicht mehr fester Boden war, sondern eben ein Sumpf.
Wäre der Segelschlitten in einen solchen geraten, so hätte dieser Salzsumpf ihn verschlungen, wie jeder andere Sumpf das mit den Unglücklichen tut, die sich in ihn wagen.
Also auch daran dachte Charles Dubois und sah, allerdings mit einem nicht ganz zu unterdrückenden Gruseln, dass diese Salzwüste, über welche er jetzt so leicht dahinglitt, sich wiederholt nicht nur in einen Salzsumpf verwandelt haben musste, sondern gleich in eine dicke Salzbrühe — den Ausdruck Salzsee darf man da ja gar nicht anwenden —
Das stellte er durch seine Beobachtungen fest.
Die Fläche, über welche der Schlitten dahinglitt, war viel zu glatt!
Man schütte zum Beispiel pulverförmigen Schwefel in ein flaches Gefäß und beobachte dann diese scheinbar so vollkommen ebene Fläche. Man wird staunen wie viele Ungleichheiten sie aufweist.
Dann aber schmelze man diesen Schwefel und lasse ihn langsam wieder fest werden! Beobachtet man nun die Oberfläche, dann wird sie fast vollkommen eben sein — ganz ja immer noch nicht, weil es eben nicht wirklich Vollkommenes auf Erden geben kann.
So war es auch hier.
Diese Salzkruste musste einst geschmolzen sein, war dann wieder erstarrt und glich nun tatsächlich der Oberfläche eines gefrorenen Sees.
Da lag der Gedanke nahe, dass sie auch wie Eis durchsichtig sein musste!
Und noch ein anderer Gedanke stieg blitzähnlich in Charles Dubois auf: Wenn dieses Salz einst flüssig gewesen war, dann musste es beim Erstarren alles in sich eingeschlossen haben, was in dieser Salzflut oder Salzbrühe sich befunden hatte.
Und da Salz sehr stark alle Feuchtigkeit anzieht, für sich verbraucht, so wirkt es eben konservierend. Deshalb salzt man ja das Fleisch ein, um es lange essbar zu erhalten.
Also musste auch jedes Lebewesen, das in diesen Salzsumpf geraten und darin natürlich umgekommen war, vollkommen erhalten, sozusagen eingepökelt sein!
Das war ein merkwürdiger Gedanke, der gar keine praktische Bedeutung zu haben schien, denn es war eben so gut wie ausgeschlossen, dass sich Tiere oder gar Menschen in diese Salzwüste gewagt haben sollten.
Er hätte höchstens dann einige Bedeutung haben können, wenn diese weite Salzwüste wirklich einmal ein See gewesen war, mit Süßwasser gefüllt, in welchem doch allerhand Tiere gelebt hatten.
Wenn dann später das Süßwasser sich allmählich in salziges verwandelt hatte, so konnten die in ihm lebenden Geschöpfe sich dieser Änderung wohl anfangs noch anpassen, konnten sich aus Süßwassertieren in Salzwassertiere verwandeln — aber sobald auch das letzte Restchen Wasser schwand, mussten sie doch zugrunde gehen und wurden dann eben eingepökelt, mussten sich bis zum heutigen Tage vollständig erhalten haben.
So kam es, dass Charles Dubois immer und immer wieder sich über den Rand des Schlittens beugte und nach der Fläche spähte, über welche dieser dahinsauste, aber jedes Mal war sein Bemühen vergeblich, die Schnelligkeit war viel zu groß, als dass er gründliche Beobachtungen hätte anstellen können, und außerdem genügte das Mondlicht, so hell es an sich war, doch nicht.
Da war aber auch tagsüber nichts zu machen, da sogar erst recht nichts, denn Charles Dubois wusste, dass da die Lichtbrechung durch die Salzkristalle geradezu blind machend, nicht nur blendend, wirken musste.
Wenn die Sonne mit aller Kraft auf diese Salzwüste strahlte, dann gab es keine Möglichkeit mehr, die Augen zu öffnen, auch unter der Schutzbrille nicht, wenigstens nicht auf die Dauer.
Deshalb fuhren sie ja auch nachts.
Und als Charles Dubois das noch dachte — freilich auch noch Verschiedenes andere dazu — erlebte er ein neues Wunder.
Er spürte plötzlich einen Ruck.
Die gleichmäßige, gleitende Bewegung, die also immer an das Fahren in einem Segelboote erinnert hatte, hörte auf, und als Charles Dubois hinausblickte, gewahrte er natürlich sofort, dass die weiße Fläche unter ihm verschwunden war, der Boden war schwarz, schien wenigstens so —
Und da rief auch schon die Bella Cobra in heller Verblüffung:
»Wir fahren ja! Wir fahren auf einem Segelwagen!«
Ja, das war es!
Der Segelschlitten hatte sich in einen Segelwagen verwandelt, also in ein Fahrzeug, das viel bekannter und öfter verwendet ist, als jener. Man kennt ja sicher die chinesischen Segelkarren, und wenn das nicht der Fall ist, dann hat man sich doch als Kind auf seinen Handwagen gestellt, wenn der Wind so recht blies, hat die Jacke geöffnet und ausgebreitet festgehalten — und hat dadurch den langweiligen Handwagen in einen Segelwagen verwandelt.
Hier war ja aber ein wirkliches Segel vorhanden, und die Räder hatte der Hornfisch durch einen Hebeldruck rechtzeitig in Tätigkeit treten lassen, nachdem er erkannt hatte, dass die Kufen nicht mehr brauchbar sein würden.
Charles Dubois staunte nicht schlecht.
An das Anbringen von Rädern hatte er bei seinem Segelschlitten ja nicht gedacht, erkannte aber jetzt nachträglich, wie praktisch das gewesen wäre. Und er war viel zu ehrlich, um seiner Bewunderung über diese Einrichtung nicht sofort Ausdruck zu geben.
»Alle Wetter!«, rief er. »Das habt Ihr fein ausgedacht, Hornfisch!«
Der Alte brummte wohl eine Erwiderung, die aber nicht verstanden wurde, und der junge Jäger nahm ihm das auch gar nicht übel, denn er sah doch, dass jetzt das Steuern des Wagens alle Aufmerksamkeit des Lenkers in Anspruch nahm.
Und er staunte immer mehr, als er gewahrte, dass das seltsame Fahrzeug nun über hartes Gestein hinglitt, das sich in sanfter Steigung hob — dass vor ihnen Klippen auftauchten — ziemlich hohe Felsen.
Da aber hielt das Fahrzeug mit einem Ruck, dass Charles Dubois gegen die Bella Cobra geschleudert wurde.
Er wollte sich eben bei ihr entschuldigen, er hatte sie tüchtig genug angerannt, da aber spürte er plötzlich, wie sie mit beiden Händen seinen Kopf umfasste —
Unwillkürlich schaute er zu ihr empor — das musste er tun, denn er lag fast quer über ihren Beinen, mit dem Haupte in ihrem Schoße —
Und da gewahrte er den seltsamen Blick ihrer Augen, sah, wie sie sich zu ihm neigte, als wolle sie ihm helfen — und hörte an seinem linken Ohre ein kaum vernehmbares Tuscheln —
»Vorsicht!«
Nur dieses eine Wort sprach die Tänzerin, und Charles Dubois wunderte sich, dass sie das auf so geheimnisvolle Weise tat, denn es war doch wirklich nichts dabei, wenn sie ihn zur Vorsicht mahnte, namentlich jetzt, wo er eben bewiesen hatte, dass er auch einmal unachtsam sein konnte.
Aber der Blick, der ihn getroffen hatte!
Und die Bella Cobra tat doch nichts ohne Grund. Das wusste er nun schon, so weit hatte er sie bereits kennengelernt.
Er wollte fragen — aber er kam nicht dazu —
»Bitte aussteigen, meine Herrschaften!«, rief der Hornfisch. »Das erste Wirtshaus ist erreicht —!«
Der Schlitten, der sich also zuletzt in einen Wagen verwandelt hatte, stand schon geraume Zeit, der Alte war auch bereits ausgestiegen — aber die beiden Gäste schienen sich nicht so schnell herauszufinden —
Charles Dubois hatte nun doch noch Gelegenheit gehabt, die rechte Hand der Tänzerin zu ergreifen. Er umspannte die schlanken Finger mit festem Drucke, und es ist ja unglaublich, was sich zwei Menschen durch einen solchen Händedruck alles sagen können — Gutes und Böses —
Sie verstanden einander, das wussten sie, und nun verließen auch sie das Fahrzeug.
Der Hornfisch schaute ihnen schmunzelnd entgegen, soweit man auf seinem Gesicht ein Schmunzeln überhaupt entdecken konnte.
»Na, was sagen Sie nun dazu, meine Herrschaften?«, fragte er, offenbar in der Erwartung, sein Lob zu hören.
Deshalb stutzte er, als Charles Dubois, anstatt zu antworten, zu dem Felsen trat, neben dem er gerade stand.
»Das ist Granit«, sagte er, verbesserte sich aber gleich, nachdem er sich das Gestein mehr aus der Nähe betrachtet hatte. »Nein, das ist Kordieritgneis.«
»Hähähähä!«, meckerte da der Hornfisch. »Kordieritgneis! Hähahä! Steine sind's, hart genug, dass auch der härteste Schädel sich daran einrennen kann —«
»Und sie bilden den Gipfel einer Insel, die einst — vielleicht vor undenklicher Zeit — aus einem mächtigen See emporgeragt hat«, setzte Charles Dubois hinzu, ohne sich durch die Worte des Alten beirren zu lassen.
»Das hatte ich freilich nicht in dieser Wüste erwartet«, fuhr er fort, ehe der Hornfisch etwas zu sagen vermochte.
»Das ist ja eine geradezu wunderbare Entdeckung!«
Die Bella Cobra, die dicht neben ihn getreten war, staunte über dieses Entzücken des Mannes, verstand es nicht, kam aber auch nicht dazu, eine Frage an ihn zu richten, denn nun wurden sie beide erst an etwas erinnert, was sie über den letzten Ereignissen vergessen hatten.
An die beiden mächtigen Hunde, die doch die Fahrt mitgemacht hatten, an Bill und Joe.
Ob die Tiere herausgesprungen waren, noch ehe diese Steininsel in dem Salzmeer erreicht worden war, konnte nicht einmal Charles Dubois sagen, er hatte eben gar nicht mehr auf die Hunde geachtet.
Jetzt aber tauchten sie plötzlich wieder auf, kamen mit heiserem Gebell herangesprungen und — trieben vor sich einen Menschen her, einen Schwarzen — einen Eingeborenen.

Sie taten dem Manne nichts zuleide, umsprangen ihn nur, stießen ihn höchstes einmal mit der Schnauze. Trotzdem aber zitterte der arme Kerl am ganzen Leibe und warf sich nun gleich platt aus den Boden — vor dem Hornfisch.
»Na, da bist Du ja, Wumbo!«, sagte der, und seine Stimme hatte dabei einen so eigenartig hämischen Klang, dass Charles Dubois sofort näher trat.
»Steh nur auf, Du schwarze Kröte!«, fuhr er dann fort. »Du siehst ja, dass ich nicht allein bin, sondern Besuch mitgebracht habe. Ich hoffe, Du hast alles Dir Anvertraute gut in Ordnung gehalten, sonst —«
Der Schwarze rührte sich nicht, er blieb auf dem Boden liegen.
Er war ein echter Australneger, das sah man doch gleich an den wadenlosen Unterschenkeln, die für diese Rasse charakteristisch sind, auch an dem eigenartigen Haar, das mit dem der anderen schwarzen Rasse, den afrikanischen Negern, nichts gemeinsam hat als die Farbe —
Charles Dubois aber sah noch mehr, und auch die Bella Cobra gewahrte es.
Der Rücken dieses bis auf einen Gürtelschurz vollkommen unbekleideten Wilden war mit tiefen Narben wie übersät, auch an der Rückseite der Oberschenkel saßen sie, waren aber dort anderen Ursprungs als die oben, da sahen die beiden noch deutlich, dass sie von Bissen herrührten —
Und sie wussten nun auch gleich, dass die auf dem Rücken die Spuren von Peitschenhieben waren!
Die kein anderer als der Hornfisch diesem armen Menschen versetzt haben konnte!
Sie schwiegen jedoch vorläufig, wenngleich die Abneigung, die sie beide von Anfang an gegen diesen Mann gehabt hatten, beträchtlich stieg, bis zum direkten Widerwillen —
Der Hornfisch selber erschien fast erstaunt zu sein, weil Wumbo, wie er den Australier genannt hatte, sich nicht gleich auf sein Geheiß erhob.
Dann aber wurde er zornig.
Mit einem Fuße stieß er nach dem Liegenden, und zwar tüchtig genug.
»Aufstehen sollst Du, schwarzes Schwein!«, herrschte er ihn nunmehr an.
Da aber begann Wumbo, der immer noch an allen Gliedern bebte, zu winseln. Er stieß Worte hervor — anscheinend in verderbtem Englisch —
Weder Charles Dubois noch die Bella Cobra jedoch verstanden auch nur eins davon. Nur der Hornfisch brachte das fertig, und was er da zu hören bekam, das schien ihn nun zur größten Wut zu reizen.
»Was sagst Du da? Was willst Du mir weismachen, Du elender Nigger? Die Blandini hätten Dich überfallen und dir alle Vorräte geraubt? Die Blandini? Was weißt Du, Kerl, denn von den Blandini? Hähähä! Ich will Dir sagen, wer die gewesen sind — Dein Maul, Deine Zähne, Dein Schlund, Dein Magen! Gefressen hast Du alles, jawohl, gefressen — und nun willst Du uns hier hungern lassen? Wie? Und meine Gäste? Was sollen sie denn bloß von mir denken?
Aber warte! Dir will ich die Gefräßigkeit austreiben und das Lügen dazu! Ich will Dich karbatschen, dass Du noch nicht wieder heil bist, wenn ich das nächste Mal hierher komme!«
Er griff nach dem Gürtel, dem mächtigen Dinge, das bereits geschildert worden ist, und hatte auch schon eine Peitsche in der rechten Hand — an einem kurzen Stiel ein langer Riemen.
Die schwang er nun in der Luft, wollte den Riemen auf den bloßen Leib des Schwarzen niedersausen lassen.
Er kam nicht dazu.
Charles Dubois sprang vor, packte den erhobenen Arm des Alten, entriss der zusammengekrampften Hand die Peitsche und wollte sie weit hinwegschleudern.

Charles Dubois sprang vor, packte den erhobenen Arm des Alten.
Er sollte sie aber alsbald selber nötig genug brauchen.
Kaum hatten die beiden ungeheuer großen Rüden gesehen, dass er ihren Herrn anfasste, da sprangen sie gleichzeitig unter wütendem Bellen gegen ihn.
Es war ein ganz gefährlicher Augenblick, denn diese Tiere waren in diesem Augenblick mindestens so schlimm wie zwei Wölfe, und mit der Peitsche allein hätte sich ihrer auch ein Charles Dubois nicht erwehren können. Nun hatte er ja die Revolver am Gürtel hängen, aber sie staken in geschlossenen Futteralen, und ehe er diese öffnete, die Waffen entsicherte, hatten die beiden Bestien ihn gepackt und niedergerissen —
Er schien verloren —
Doch schon kam ihm Hilfe, die er nicht erwartet hatte.
Ein Schuss krachte.
Bill, der eine der Hunde, sank heulend zu Boden, sein Gefährte Joe lag im nächsten Augenblick neben ihm.
Charles Dubois hatte ihm mit dem Fuße einen so derben Tritt in den Leib gegeben, dass es dem Tiere ging wie einem Menschen unter gleichen Umständen — es bekam keine Luft mehr, schnappte ächzend und röchelnd, aber immer noch mit dem furchtbaren Gebiss —
Das alles spielte sich so schnell ab, dass der Hornfisch selbst noch wie erstarrt dastand, keiner Bewegung fähig, nur auf die Hand starrend, die er wieder gesenkt und in welcher er eben noch die Peitsche gehalten hatte.
Dann sah er auch die beiden Hunde —
Er öffnete den Mund, wahrscheinlich um einen seiner ellenlangen gottlosen Flüche auszustoßen —
Aber ehe er dazu kam, erstarb ihm schon wieder das Wort im Munde.
Wumbo der Schwarze sprang mit einem Male auf, stand einen Moment noch da, als wage er doch nicht das Ungeheure, was er plante — dann aber schoss er pfeilschnell davon — ein anderer Ausdruck lässt sich gar nicht anwenden — es sah wirklich aus, als sei da ein großer Pfeil von einem entsprechend mächtigen Bogen abgeschossen worden —
Der Mensch schnellte im Sprunge ein ganzes Stück dahin, ehe seine Füße den Boden wieder berührten — und dann rannte er so schnell, dass er den Nachschauenden aus den Augen war, ehe diese noch so recht zur Besinnung gekommen waren.
Bill, der eine der Hunde, den die Kugel aus dem noch rauchenden Revolver der Tänzerin getroffen hatte, machte eine Bewegung, als wolle er sich erheben und dem Flüchtling nachsetzen, aber das vermochte er eben nicht mehr — und mit einem letzten Röcheln, mit einem letzten wilden Blick aus seinen blutunterlaufenen Augen sank er tot zurück.
Kaum aber war der Hornfisch sich klar geworden, dass das Tier verendet war, da griff er schon zum zweiten Male nach seinem Gürtel, brachte daraus ein mächtig langes Schießeisen hervor und legte es auf die Bella Cobra an.
»Verfluchtes Weib —«, hob er an.
Sein Gesicht war furchterweckend; jetzt sahen die beiden auch zum ersten Male die sonst unter den dichten Brauen vollkommen verborgenen Augen und mussten unwillkürlich an die des nun toten Hundes denken —
Doch wieder konnte der Hornfisch seine Drohung nicht ausführen, die er ja nicht einmal ausgesprochen hatte, die aber aus seiner ganzen Haltung, aus der erhobenen Waffe zu erraten war.
»Die Hand nieder!«, donnerte Charles Dubois ihn an. »Sofort! Ohne die geringste Widerrede!«
Und dabei hatte er ebenfalls einen Revolver auf den Hornfisch gerichtet.
Dieser hätte es ja nun auf einen Kampf ankommen lassen, eben einen Zweikampf zwischen gleich ausgerüsteten Gegnern, und dass er zu treffen verstand, daran war wohl nicht zu zweifeln.
Da hätte auch nichts ausgemacht, dass die Bella Cobra jetzt ebenfalls ihre Waffe auf ihn richtete, dass er also zwei Feinde sich gegenüber hatte —
Es schien jedoch eine ganz plötzliche Wandlung in ihm vorzugehen.
Ganz gemächlich senkte er den Arm und somit auch die Waffe, steckte sie gleich wieder in das Futteral, schloss dieses noch und — begann dann zu lachen — in seiner hämischen, abstoßenden Weise.
Er konnte sich anscheinend gar nicht wieder beruhigen. Immer wieder ließ er das »Hähähähä« erklingen. Die Sache schien ihn sehr zu belustigen.
»Der Mensch muss verrückt sein, kann seine Geisteskräfte nicht mehr ordentlich beisammen haben«, dachte Charles Dubois schon.
Da sollte er sogleich erkennen, wie sehr er sich in dieser Annahme geirrt hatte.
Der Alte verstummte; wenigstens das hässliche Lachen hörte auf; aber indem er nun so recht gemütlich die Arme über der Brust kreuzte, sagte er:
»Na ja, da wäre also diese Kompagnie auch schon wieder zum Teufel! Da kann dieser Mister Samuel Philipp in New York sehen, woher er kriegt, was er von uns haben wollte! Denn mit solchem Gesindel, das mir die Hunde totschießt und meinem Sklaven zur Flucht verhilft, will ich natürlich nichts mehr zu tun haben, das nehme ich nicht einen Meter weit mehr mit —
Und deshalb darf ich die Herrschaften wohl ersuchen, ihr Eigentum sogleich aus dem Schlitten zu nehmen — aber sogleich — denn ich fahre ab, ehe Ihr bis zehn zählen könnt, Ihr —«
Nun wollte er doch anfangen zu fluchen.
Er ließ es wiederum.
Charles Dubois war dicht vor ihn getreten und blitzte ihn aus seinen blauen Augen an.
»Hier wird nicht geflucht!«, sagte er dabei ganz ruhig. Ein hämisches Grinsen war die einzige Antwort. Charles Dubois kümmerte sich nicht darum.
»Kommen Sie, Miss Cobra, wir wollen unser Gepäck an uns nehmen.«
Die Tänzerin war schon dabei, hatte bereits das meiste ausgeladen und es auf den Steinboden geworfen. Charles Dubois brauchte nur noch Weniges zu helfen.
Und kaum waren sie damit fertig, da schob der Hornfisch den Segelschlitten auch schon wieder von dem Gestein herunter, bis er die weiße Salzfläche erreicht hatte, stellte das Segel, sprang auf den Hintersitz — und sauste davon, diesmal den Wind ankreuzend, wie es vorhin beschrieben wurde.
Die beiden Zurückbleibenden schauten ihm nach, ohne noch etwas Besonderes dabei zu denken — es war fast, als beobachteten sie interessiert vom Meeresstrande aus das geschickte Manövrieren eines Seglers.
Sie sahen, wie der Segelschlitten wendete, wie er fast dieselbe Strecke zurücksauste, die er eben erst gekommen war, und nun erst erkannten sie so recht, was für eine Schnelligkeit dieses Fahrzeug zu entwickeln vermochte. Das ging viel schneller, als es mit einem Boote in unbewegtem Wasser möglich gewesen wäre —
Dreimal wendete der Hornfisch, ehe er aus den Augen der Nachblickenden verschwand, und das Letzte, was diese von ihm sahen, war seine emporgereckte Gestalt, das Letzte, was sie von ihm hörten, war sein höhnisches Lachen.
Da war gar nicht nötig, dass sie auch noch gewahrten, wie er drohend die Faust nach ihnen streckte, wie er ihnen Drohungen zurief.
Die beiden erwachten sogleich zur Wirklichkeit.
Und das Erste, was Charles Dubois nun tat, war, dass er dem noch lebenden Hunde den Gnadenschuss gab.
Er ließ den Kadaver vorläufig neben dem anderen liegen und wendete sich seiner Gefährtin zu.
Und er lächelte, als diese ihm freimütig ihre rechte Hand entgegenstreckte. Da wäre gar nicht nötig gewesen, dass er sah, wie ihre Brust sich unter einem Seufzer der Erleichterung hob, und noch weniger, dass sie ein lautes »Gott sei Dank!« hervorstieß.
»Sie freuen sich, dass wir den Gesellen auf diese Weise losgeworden sind?«, fragte er.
»Ja«, gab sie zu. »Ich habe schon während der Fahrt immer daran denken müssen, ob es nicht besser gewesen wäre, ich wäre umgekehrt, ehe ich mich ihm anvertraute. Dieser Mensch —«
»Es war wirklich Jim Crawler, wie Sie ihn nannten, Miss Cobra?«
Die Tänzerin nickte.
Und dann sagte sie mit schwerer Betonung:
»Der mutmaßliche Mörder meines armen Vaters! Was —«
Sie konnte nicht weitersprechen, aber nicht vor Trauer. Ihre Hände ballten sich, ihre Augen funkelten —
»Sie erzählen mir das später, wie Sie mir ja schon versprochen haben«, erwiderte da Charles Dubois. »Jetzt müssen wir erst einmal sehen, wo wir uns hier befinden. Der Hornfisch fragte den Schwarzen nach Vorräten. Er scheint also hier eine Station angelegt zu haben, die der Eingeborene — sein Sklave, wie er ihn ja auch gleich nannte — bewachen sollte — nun aber behauptete dieser Wumbo, dass die Blandini ihn überfallen hätten — oder vielmehr der Hornfisch sagte das — können Sie sich denken, was darunter zu verstehen ist, Miss Cobra?«
Und als diese den Kopf schüttelte, fuhr der junge Jäger fort:
»Der Name deutet an, dass es sich um Weiße handelt, ich habe mal Latein gelernt, weiß aber nicht mehr genau, ob ›blandinus‹ wirklich so viel wie ›weiß‹ bedeutet. Nehmen wir es einmal an! Dann müssten also weiße Menschen den Wächter überfallen und ihm Vorräte geraubt haben.
Welcher Art diese Weißen sind, kann ich natürlich nicht sagen, um Europäer handelt sich's keinesfalls, denn diese dringen nicht in diese Salzwüste ein, sind gar nicht imstande dazu. Und andere Weiße gibt es doch hier auch nicht! Es ist also vorderhand noch ein Rätsel, was wir lösen müssen.
Jetzt wollen wir erst einmal sehen, wo die Vorräte aufbewahrt gewesen sind. Ich nehme an, die geheimnisvollen Blandini haben nicht alles mitgenommen, denn sonst hätte der arme Wumbo doch Hungers sterben müssen —«
»Da — da ist er ja wieder!«, unterbrach ihn die Bella Cobra.
Sie deutete mit ausgestrecktem Arme nach der Ecke des Felsens, an dem sie immer noch standen.
Es wäre nicht nötig gewesen. Charles Dubois hatte zugleich mit ihr den Schwarzen entdeckt, der also nicht weit geflohen sein konnte und von irgendeiner Stelle aus beobachtet haben musste, dass der Hornfisch sich entfernte.
Als die Cobra ihm winkte, kam er sofort näher, wollte sich wieder zu Boden werfen, blieb aber stehen, als Charles Dubois ihm das andeutete.
Jetzt zitterte der arme Mensch nicht mehr an allen Gliedern; er begann auch gleich zu sprechen, seine Worte immer durch Gesten unterstützend, was sehr nötig war, da die beiden ihn sonst kaum verstanden hätten.
Er bediente sich eines Mischmaschs von Englisch und seiner eigenen Sprache und es war wirklich ein Glück, dass sowohl Charles Dubois als auch die Tänzerin wenigstens etwas von dieser verstanden.
Zwei Worte verstanden sie vor allen anderen: »djao« und »gunda« — und sie wussten, was diese bedeuteten.
Das erste ist der Ausdruck, den der Australier sowohl für essen wie für trinken braucht. Das zweite bedeutet Zelt, Hütte, Höhle — jeden Unterschlupf, nur muss dabei nicht vergessen werden, dass der australische Eingeborene eben gar kein Zelt kennt, noch viel weniger also eine Hütte — er hat keinen festen Wohnsitz, und wenn er irgendwo die Nacht verbringt, so bedarf er keines Schutzes. Wenn es regnet oder der Wind gar zu kalt pfeift, errichtet er sich höchstens einen Schutzschirm aus rasch ineinandergeflochtenen Zweigen, vorausgesetzt, dass er solche bekommen kann! Und das ist in diesem Lande ja höchst selten der Fall, wenn man auch nicht annehmen darf, dass die Eingeborenen sich immerzu in unwirtlichen Einöden und Wüsten aufhalten.
Hier also hatte der Ausdruck »gunda« sicher eine Höhle zu bedeuten. Das lag ja sehr nahe, und da Wumbo nun noch mehrmals das Wort »mjeringa« hervorstieß, das »gehen« bedeutet oder überhaupt Fortbewegung, also bei einem Vogel fliegen, bei einem Fische schwimmen, so wussten die beiden, dass er sie nach einer Höhle führen wollte, wo sie essen oder wenigstens trinken könnten, und dass sie ihm folgen sollten.
Sie hatten zwar noch keinen Hunger, aber desto mehr Durst, durch den feinen Salzstaub erzeugt, den sie eingeatmet hatten, und als sie daran dachten, besannen sie sich auch darauf, dass sie ja noch die Brille auf der Nase hatten. Die hatte der Hornfisch zurückzufordern vergessen, würde sie nun wohl auch nicht wieder holen.
Sie setzten sie ab, steckten sie in die Tasche und schritten hinter dem Schwarzen her, der sich immer wieder nach ihnen umdrehte, als wollte er sich überzeugen. dass sie ihm auch wirklich folgten.
Der Weg war nicht weit, konnte es ja auch gar nicht sein, da dieses schwarze Gestein eben nur eine Insel im Salzmeer bildete oder vielmehr die höchste Erhebung einer einstigen Insel gebildet hatte.
Charles Dubois, der nun einmal alles gleich beobachten musste, sah ohne Weiteres, dass das Gestein insgesamt einen Umfang von vielleicht hundert Metern hatte, davon kamen auf die Seiten links und rechts, wie sie sie jetzt sahen, vielleicht dreißig Meter, sodass für die anderen je zwanzig blieben.
Eine solche Strecke lässt sich natürlich leicht übersehen, nur war hier der Überblick durch die Felsen behindert.
Jedenfalls dachten die beiden jetzt nicht an eine Durchforschung des Gebiets, sondern betraten hinter dem Schwarzen eine Höhle, die aber nicht in dem Gestein ausgehöhlt war, sondern durch zwei dicht nebeneinander stehende Blöcke gebildet wurde.
Das nahm Charles Dubois wenigstens an, staunte daher nicht wenig, als er unter diesen Blöcken dann wirklich eine in die Tiefe gehende Höhle fand, und als sie sich viel weiter ins Innere der Erde erstreckte, als er je angenommen und für möglich gehalten hätte.
Zuletzt mussten die beiden sogar einige Stufen hinabsteigen, kamen dann in einen weiten Raum, wie sie sofort merkten, obwohl Dunkelheit sie umgab.
Den Schwarzen hatten sie zuletzt überhaupt nicht mehr gesehen, erblickten ihn nun zum ersten Male wieder, nachdem er irgendeinen Stein oder einen Deckel oder sonst was entfernt hatte und dadurch dem Mondlicht Zutritt in die Höhle gestattete.
Es reichte nicht aus, um diese ganz zu erhellen, aber doch, um festzustellen, dass sie ringsum aus ganz glatten Wänden bestand, wie auch der Boden ganz eben war, sicherlich eine Folge langwieriger Arbeit.
Das interessierte sie aber viel weniger als das andere, was sie gleich noch erblickten: eine ganze Anzahl großer und kleiner Kisten, die jetzt freilich alle erbrochen und ihres Inhaltes beraubt schienen.
Woraus dieser bestanden hatte, war leicht zu sehen; auf dem Boden lagen die Spuren überall herum — es waren hauptsächlich Hülsenfrüchte gewesen, dann wohl Zucker, Mehl — auch Konserven waren vorhanden gewesen, viele leere Büchsen lagen herum, und es war zu sehen, dass sie gar nicht lange erst geöffnet worden waren.
»Das sieht allerdings ganz aus, als hätte hier ein Überfall durch Räuber stattgefunden«, sagte Charles Dubois. »Hoffentlich haben sie uns zu trinken übrig gelassen, und zwar keinen Whisky —«
Da gewahrte er, dass der Schwarze sich bemühte, eine Steinplatte im Hintergrunde der Höhle zu heben, eilte hin, half ihm und wusste auch schon, was er unter ihr entdecken würde.
Es war ein Brunnen!
Und schon der feuchte Hauch, der daraus emporstieg, verriet, dass es sich um Süßwasser handelte!
Da bückte sich Charles Dubois, hatte sein »Pannikin«, das in ganz Australien übliche Trinkgefäß, in der Hand, schöpfte es voll und bot es seiner Begleiterin.
Die Bella Cobra nahm es ohne Zieren, setzte es an den Mund und leerte es.
Dann gab sie es dem Gefährten zurück, und auch er löschte den brennenden Durst.
Und gab auch Wumbo einen Becher voll!
Die Augen der Bella Cobra leuchteten, als sie das sah, aber sie sagte nichts. Jedenfalls hatte der Schwarze auch Durst gelitten, hatte den schweren Stein nicht heben können und schon deshalb war er nicht in die Salzwüste geflohen —
Er trank wenigstens mit großer Gier, und seine verlangend nach dem Brunnen gerichteten Blicke verrieten, dass er noch nicht satt war.
Doch ehe Charles Dubois ihm einen zweiten Becher voll reichte, bückte er sich über das Loch.
Schon dadurch verriet er, dass er sehr wohl wusste, in welcher Lage er sich mit seiner Begleiterin befand. Er wollte sich überzeugen, dass der Brunnen Wasser genug — mindestens für mehrere Tage — enthielt — ob ein Zufluss vorhanden war —
Die beiden befanden sich eben mitsamt dem Schwarzen mitten in einer Salzwüste, deren Ausdehnung sie nicht kannten, hatten keinen Segelschlitten mehr, um sie in fliegender Eile durchqueren und überwinden zu können, mussten vielmehr damit rechnen, dass sie dieses ungeheure Wagnis zu Fuß auf sich nehmen müssten — und ohne genügend Wasser war das ausgeschlossen. Freilich, auch Wasser allein tat es nicht. Das sollte sich bald zeigen.
Jedenfalls verstand die Bella Cobra sogleich, warum der junge Mann zögerte, doch sie sagte wiederum nichts, lächelte aber, als er dem Schwarzen nun einen zweiten Becher voll reichte.
Darauf schloss er den Brunnen sorgsam wieder durch Auflegen der schweren Steinplatte und wendete sich seiner Gefährtin zu.
»Vor dem Tode durch Verdursten sind wir geschützt«, sagte er. »Dieser Brunnen scheint unversieglich zu sein. Jetzt wollen wir sehen, was die Blandini an Essvorräten für uns übrig gelassen haben.«
Er machte sich an eine Untersuchung der Behälter.
Das war bei der unzureichenden Beleuchtung eine schwierige Sache. Immer wieder musste er sich über die Kisten beugen und mit dem Arme tief hineingreifen — bis Wumbo neben ihn trat, ihn leicht berührte und durch eine Bewegung andeutete, dass er mitkommen solle.
Sofort folgte Charles Dubois dem Schwarzen.
Dieser führte ihn nach einer Stelle in der Höhle, wo der junge Mann in der Steinwand eine schwarze Vertiefung gewahrte.
»Taddo!«, sagte er dabei, »gujom«, und machte mit beiden Händen eine so deutliche Bewegung, dass Charles Dubois sogleich verstand.
Er griff in die Nische und holte aus ihr lange dünne Holzspäne. Das war also taddo — Holz!
Und nun sollte er mit diesen Spänen »gujom« schaffen, Feuer — oder vielmehr Licht.
Ein Feuerzeug hatte er bei sich, das einzige, was in der Wildnis brauchbar ist: Stahl, Stein und Zunder — der hier aber durch eine lange besonders präparierte Wollschnur ersetzt war.
So schlug er Funken, setzte den Zunder — welcher Ausdruck nun einmal für diese Art Feuerzeug gang und gäbe ist — in Brand, brachte ihn also zunächst zum Glimmen und durch Anhauchen zur hellen Glut — hielt einen der Späne daran und hatte nun einen Leuchter und ein Licht zugleich, konnte die begonnene Untersuchung fortsetzen. Die Bella Cobra, die sich zu ihm gesellte, schüttelte alsbald den Kopf.
Die Kisten waren allesamt leer bis auf die geringfügigen Reste, die eben immer bleiben, bis auf einen Bodensatz, wenn dieser Ausdruck hier angewendet werden darf.
Ja, wenn sie alles sorgsam zusammenkratzten, ergab es noch so viel, dass sie einige Tage davon leben konnten. Wasser und Feuer hatten sie — aber es wäre ihnen schon lieber gewesen, sie hätten mehr gefunden. Sie dachten doch beide gleich, dass sie für die fernere Fahrt Nahrungsmittel brauchten, und wussten genau, dass sie sich diese durch die Jagd nicht würden verschaffen können —
Welches jagdbare Tier sollte sich denn in diese unendliche Salzwüste verirren — außer vielleicht einer Eidechse!
Aber auch die würde fehlen, da es ja keine Insekten gab!
Nachdem sämtliche Fässer und Kisten untersucht worden waren, schauten die beiden einander an.
Die Bella Cobra lächelte.
»Wir sind immer noch besser daran als es mancher vor uns gewesen ist«, sagte sie. »Einige Zeit werden wir es aushalten können —«
»Und inzwischen besinnt sich vielleicht der Hornfisch und kehrt zu uns zurück«, setzte Charles Dubois hinzu.
Betroffen schaute die Tänzerin ihn an.
Da lächelte auch er.
»Sie können wirklich glauben, dass ich noch irgendwelche Hilfe von diesem Menschen annehmen, mir seine Gesellschaft auch nur für Minuten gefallen lassen würde?«, fragte er.
»Lieber tot!«, erwiderte die Bella Cobra.
»Und wir haben ja den Schwarzen«, setzte er hinzu.
Sie nickte eifrig. Sie kannte diese Eingeborenen ebenfalls, wusste, was für ausgezeichnete Pfadfinder sie sind, wie sie Spuren zu lesen verstehen, auch dort noch, wo der beste Jagdhund versagen würde.
»Und das ist etwas, was so vielen Forschern schon zu denken gegeben hat, die diesen Erdteil bereisten: diese Fähigkeit der Eingeborenen, Spuren zu folgen, die für jedes andere Wesen unauffindbar wären.
Man erzählt in Jugendschriften so viel von den nordamerikanischen Indianern, was sie in dieser Hinsicht leisten, aber jede solche Rothaut könnte doch bei einem australischen Eingeborenen noch in die Lehre gehen, und wenn so ein Indianer und ein Australneger einen Wettkampf im Spurensuchen ausfechten sollten, dann würde der Neger immer Sieger bleiben — mit Leichtigkeit!
Das ist eben eine Gabe, die beweist, dass diese so verachteten, weil so tiefstehenden Wilden, doch Fähigkeiten besitzen, die anderen Rassen abgehen, und da muss auch gleich erwähnt werden, dass sie ja auch zwei Waffen führen, die allen anderen Völkern fehlen: den Bumerang und das Wurfbrett!
Ersterer, das bekannte, halbmondförmig gekrümmte Wurfholz, das von den Australiern mit unfehlbarer Sicherheit geschleudert wird, das aber doch nach einem Fehlwurfe in die Hand des Schützen zurückkehrt, ist so sorgsam in seiner Wirkung errechnet, dass man es bis jetzt eben nur anstaunen kann.
Gelehrte haben auf ägyptischen Bildwerken ein ähnliches Wurfinstrument feststellen wollen, um zu beweisen, dass die Australier es nicht selbst erfunden, sondern von irgendeiner anderen Seite her bekommen haben müssten — aber ein genauer Vergleich hat gelehrt, dass beide Waffen doch ganz verschieden sind.
Anders ist es schon mit dem Wurfholz, mit dem der australische Eingeborene seinen Speer schleudert, und das hier nicht weiter beschrieben werden soll. In jedem ethnologischen Museum kann man es sehen — aber auch in Sammlungen, die sich mit der Vorgeschichte der Menschheit beschäftigen — denn — und das ist eben das Merkwürdige — die Menschen der Steinzeit besaßen dieses Wurfholz auch schon — in Europa hat man es verschiedentlich entdeckt — nur die Australier führen es heute noch —
Genug davon! Es wurde nur erwähnt, um zu zeigen, dass diese beiden Menschen, die sich allein inmitten einer unermesslichen Salzwüste befanden, genau wussten, welchen Wert dieser eine Eingeborene für sie hatte, wie viel er ihnen nützen konnte.
Jedenfalls durchsuchten sie nun die Höhle noch, solange der Span brannte, aber als er verlosch und Charles Dubois den glimmenden Rest von sich geschleudert hatte, brannte er keinen zweiten mehr an.
»Kommen Sie, Miss Cobra!«, sagte er. »Wenn Sie nicht zu müde sind, so möchte ich gern draußen doch eine Untersuchung vornehmen.«
»Ich bin durchaus nicht müde«, erwiderte die Tänzerin und folgte dem Vorausschreitenden, der Wumbo winkte, sie zu begleiten.
Bald standen sie abermals im Freien.
»Blandini?«, sagte Charles Dubois mit einer entsprechenden Handbewegung.
Der Schwarze verstand ihn sofort.
Schattengleich huschte er über das Gestein dahin, nach der entgegengesetzten Seite, von ihrem »Landeplatz« aus gerechnet.
Der Felsboden ging dort wieder in die Salzwüste über. Im hellen Mondenschein sahen die beiden eine endlose weiß schimmernde Fläche vor sich —
Aber nicht darauf achteten sie jetzt, sondern sie beobachteten lediglich den Schwarzen, der mit dem rechten Arme in die Ferne deutete und sich dann auf den Boden niederwarf, dem jungen Jäger eifrig winkend, sich neben ihn zu legen.
Aber nicht Charles Dubois allein gehorchte diesem Winke, sondern auch die Bella Cobra ließ sich neben ihm nieder.
Beider Augen schauten auf die Stelle, welche der Schwarze andeutete.
Und da sahen sie es —
Am Rande dieser Insel im erstarrten Salzmeere waren die Kristalle nicht so fest aufeinandergepresst wie anderwärts, waren mehr körnig, und in dieser Masse mussten sich natürlich Spuren deutlich abprägen können.
Und Spuren waren hier vorhanden, ganz deutlich!
Spuren von Füßen —
Sie waren tief eingedrückt, besonders der vordere Teil.
Da wussten die beiden gleich Bescheid.
Charles Dubois deutete in die Luft empor, machte eine Bewegung, als käme aus ihr etwas auf den Boden gesprungen, und Wumbo schüttelte sogleich lebhaft den Kopf, was bei ihm aber keine Verneinung, sondern eben eine Bejahung bedeutete.
Also aus der Luft waren diese Wesen gekommen, waren auf den Boden gesprungen, und dabei hatten sie diesen natürlich mit den Zehen zuerst erreicht, wie jeder Springer das tut, um die federnde Wirkung zu erzielen.
Damit aber war nicht erklärt, wie die Blandini durch die Luft hatten kommen können, und noch weniger wurde etwas anderes erklärt, etwas viel Sonderbareres!
Diese Fußabdrücke, deren insgesamt mindestens ein Dutzend vorhanden waren, übertrafen an Größe weit die eines menschlichen Fußes — auch des größten, den sich diese beiden Menschen hätten vorstellen können.
Charles Dubois erhob sich und setzte, um diese Größe recht deutlich zu machen, seinen linken Fuß in eine der Spuren, trat kräftig auf —
Da war es fast genau so, wie wenn ein Kind in die Fußspuren seines Vaters getreten wäre!
So also war das Verhältnis der beiden Füße zueinander.
Und da ließ sich ja sofort ein Schluss auf den Unterschied in der Körpergröße ziehen.
»Was für Riesen müssen das gewesen sein!«, stieß der junge Mann denn auch hervor.
»Mein Fuß misst dreißig Zentimeter, ich selber bin sechsmal so lang, also einhundertachtzig Zentimeter, und das ist doch immer das Durchschnittsverhältnis zwischen Fuß und Körperlänge. Ausnahmen bestätigen auch hier nur die Regel, dass also manchmal ein Mensch auf einem sehr großen Fuße lebt und doch klein ist und umgekehrt —
Wenn wir also mit diesen Maßverhältnissen rechnen, so müssen die Blandini Riesen von dreieinhalb bis vier Meter Höhe sein —«
Er wendete sich an Wumbo, der doch die Blandini gesehen hatte.
Zuerst auf die Spur deutend, die er erzeugt hatte, dann auf sich, machte er dem Menschen verständlich, was er wissen wollte. Dann deutete er auf den Abdruck des Riesenfußes und reckte beide Arme hoch in die Luft.
Sogleich schüttelte Wumbo zum Zeichen der Bejahung wieder den Kopf, reckte ebenfalls die Arme in die Höhe so weit, wie er nur konnte.
Es stimmte also.
Und da war es kein Wunder, wenn Charles Dubois seine Gefährtin vielsagend anschaute.
»Riesen!«, sagte er dabei. »Sollte sich also doch bewahrheiten, was verschiedentlich schon behauptet worden ist — dass im Innern dieses Kontinents noch menschenähnliche Geschöpfe leben, die als Riesen bezeichnet werden müssen?
Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass solche hier gewesen sind, dass sie uns Menschen gleichen — der Fuß ist rein menschlich — und sie haben ihn bekleidet, denn sonst müssten wir die Abdrücke der einzelnen Zehen sehen — es sind also Wesen, die geistig höher stehen als die Eingeborenen, und sie müssen eine hohe Kultur besitzen —«
»Sonst könnten sie nicht aus der Luft gekommen sein, sich also eines Flugapparates bedient haben!«, vollendete die Bella Cobra.
»So ist es!«, bestätigte ihr Gefährte. »Ich habe noch nie ein solches Wesen gesehen, so oft ich auch das Innere des Erdteils durchstreifte, noch nie eine Spur dieser Art erblickt —«
»Auch wir haben es nicht«, versetzte die Tänzerin, und sie kannte ja das Innere Australiens.
Um aber genau zu gehen, deutete Charles Dubois nun auf eine der Spuren, den Schwarzen dabei anschauend, und hob dann beide Arme hoch, wie man eben etwas recht Großes andeutet.
Wumbo schüttelte wieder den Kopf. Es stimmte also. Diese Blandini waren wirklich Riesen. Aber er wusste auch gleich das Maß dieser Riesen besser zu veranschaulichen, als der Jäger es getan hatte.
Wumbo lief an den Rand der Wüste, an eine Stelle, wo — vielleicht vom Winde — die Salzkristalle dicht zusammengefegt waren, dass sie lockerem Sande glichen.
Dort legte er sich auf den Boden, die beiden sahen, wie er seinen Körper fest in die lockeren Massen eindrückte, sodass ein genauer Abdruck entstand.
Doch nicht das wollte Wumbo.
Er erhob sich alsbald wieder, schritt neben dem Abdruck nach vorn, bis seine Füße das Kopfende erreicht hatten, und nun streckte er sich ein zweites Mal aus, wiederum den Leib fest in das Salz drückend.
Dann sprang er auf, deutete aus die so entstandene merkwürdige Figur und sagte dabei:
»Blandini!«
Die beiden verstanden sofort, was er meinte.
Diese beiden Abdrücke seines Körpers sollten veranschaulichen, wie groß die unbekannten Räuber waren, und wenn er nicht übertrieben hatte, dann freilich handelte es sich um Riesen.
Wumbo maß vielleicht etwas über 160 Zentimeter. das ließ sich nicht so schnell feststellen — immerhin genügte es — dann waren die Riesen also über drei Meter hoch —
Und da stimmte wieder, was Charles Dubois von Anfang an aus dem Fußabdruck errechnet hatte.
Charles Dubois schaute seine Begleiterin an, die noch ganz erstaunt war.
»Wer hätte das gedacht!«, sagte er. »Manches Seltsame habe ich erlebt, wenn ich im Innern dieses Erdteiles Abenteuern nachging, ich habe Tiere erblickt, deren Maße alles übertrafen, was sonst bekannt ist — es waren freilich niemals Raubtiere — aber ich habe auch Spuren von solchen gefunden, die noch in keinem Buche beschrieben worden sind — Spuren, die nicht etwa aus den ferneren Tagen der Vorzeit herrührten, sondern noch ganz frisch waren — nur solche riesenhafte Menschen habe ich nirgends zu Gesicht bekommen.
Hier haben wir den Beweis, dass sie leben, und zugleich den weiteren, dass sie auf irgendeine Weise die Luft beherrschen.
Das wäre an sich nichts Wunderbares, wenn sie mit der übrigen Menschheit in Verbindung ständen, wenn sie also die Flugzeuge und Luftschiffe kennengelernt hätten.
Wir müssen also annehmen, dass sie in der Abgeschiedenheit ihres Landes ähnliche Erfindungen gemacht haben, wie sie den Menschen erst in den letzten beiden Jahrzehnten gelungen sind, und wir müssen weiter annehmen, dass sie alle Hilfsmittel besitzen, um Flugzeuge oder sonst etwas herzustellen — mit einem Worte, dass sie ein hochentwickeltes Kulturvolk sind, von dessen Existenz die Menschheit noch keine Ahnung hat.
Lockt es Sie nicht, diese Blandini kennen zu lernen, Miss Cobra?«
Die Tänzerin lächelte.
»Ich müsste kein Weib sein«, erwiderte sie. »Wissen möchte ich allerdings, wie wir zu diesen Riesen gelangen sollen, es sei denn, sie holten uns freundlichst hier ab —«
»Oder wir fänden doch noch eine Möglichkeit, diese Salzwüste ohne den Segelschlitten des Hornfisches zu durchqueren —«
Wohl ganz unwillkürlich blickte er, indem er so sprach, in die Ferne, stutzte, beugte sich etwas vor, spähte noch schärfer aus als zuvor —
Und da die Tänzerin ihn beobachtete, so schaute auch sie in die gleiche Richtung, sah auch sie, dass weit da draußen der Segelschlitten in großem Bogen dahinglitt —
»Also doch!«, stieß Charles Dubois hervor.
»Das bedeutet?«, fragte die Bella Cobra.
»Dass dieser Mensch uns nicht aus den Augen lassen wird!«, erwiderte der Jäger. »Die Habgier zwingt ihn dazu, er will uns überwachen, will sich, wenn wir doch von hier fortkommen, verfolgen und beobachten, ob wir die uns gestellte Aufgabe lösen, ob wir den Loke Klingsor finden —«
»Und seinen Anteil einstreichen?«
»Genau so!«
»Aber ich denke, ich werde ihm einen Strich durch die Rechnung machen!«, sagte Charles Dubois, ohne zu erklären, was er meinte, denn in diesem Augenblick flammte es hinter den beiden im Osten auf.
Die Sonne schickte ihre ersten Strahlen über die unermessliche Wüste, und schon nach wenigen Minuten übergoss sie diese mit leuchtendem Glanze, dass ihr Licht sich in den unzähligen Salzkristallen blendend brach —
»Die Brille! Setzen Sie rasch die Brille auf, Miss Cobra!«, rief Charles Dubois. »Jetzt bin ich froh, dass wir sie durch einen Zufall behalten haben. Diese Gläser schützen vor dem grellen Funkeln! Überzeugen Sie sich nur selbst! Nun haben wir schon viel gewonnen!«
Die Bella Cobra setzte die Brille auf.
Es stimmte. Die grauen Gläser wehrten dem blendenden Lichte, sie konnte ohne Gefahr auf die Wüste hinausschauen.
»Und nun wollen wir gleich noch eine kleine Entdeckungsfahrt machen, ehe die Hitze uns in die Höhle treibt!«, rief Charles Dubois. »Kommen Sie, Miss Cobra! Ich denke, ich werde finden, was ich suche!«
Die Tänzerin erhob keinen Widerspruch, hatte keine Frage. Sie schritt neben dem Gefährten in die Wüste hinaus, wunderte sich nur, dass er die Blicke immer auf den Boden gerichtet hatte, tat es nun ebenfalls —
Und da erkannte sie, was Charles Dubois suchte! Seine Annahme während der schnellen Fahrt im Segelschlitten traf zu.
Diese unermessliche Wüste war nicht mit jenen Salzsteppen im Innern Asiens zu vergleichen, wo das Salz gleichsam aus dem Boden ausschwitzt und an der Oberfläche verhärtet — nein, diese ganze Fläche hatte einst einen See gebildet, und zwar, wie er ebenfalls ganz richtig vermutet hatte, einen Süßwassersee, dessen Wasser aber nach und nach immer salziger geworden war, bis es endlich einer übersättigten Salzlauge geglichen hatte, die naturgemäß mehr und mehr erstarren musste.
Nachdem die beiden sich vielleicht einige hundert Meter in die Wüste gewagt hatten, hörten die Salzkörner fast vollständig auf. Sie schritten auf einer fast ebenen spiegelglatten Fläche dahin, und hätten sie nicht gewusst, wo sie sich befanden, dann hätten sie annehmen können, sie schritten auf der Eisfläche eines Sees dahin.
Die Salzschicht war so durchsichtig wie das reinste Kristalleis. Die beiden konnten bis auf den einstigen Boden des Sees hinabblicken.
Und da freilich gewahrten sie, dass die Tiere, die einst darin gelebt, auch in ihm ihr Grab gefunden hatten.
Wie es in jedem Teiche geht, der gänzlich gefriert, wie da die Frösche und Fische in das Eis eingeschlossen werden, so lagen sie hier in dem Salze eingebettet, und da kam nicht weiter in Betracht, dass diese Geschöpfe sich vor ihrem traurigen Ende noch dem immer salziger werdenden Wasser angepasst hatten, dass sie sich aus Süßwassertieren in Salzwassertiere verwandelt hatten.
Aber die Tänzerin staunte doch etwas, als Charles Dubois nun sein Weidmesser zog, es in die Salzkruste bohrte und über einem meterlangen Fische, der in Salz eingebettet war, ein Quadrat beschrieb oder vielmehr ein Rechteck.
Als er dann das Messer senkrecht einbohrte, sprang die ganze Schicht bis weit hinein und nach kurzer Zeit konnte er einen ziemlich großen Block emporheben, in welchen der Fisch eingeschlossen war.
Mit wenigen Schlägen hatte er ihn vollständig freigelegt —
Er hielt das Tier, das vor wer weiß wie langen Jahren verendet war, in den Händen und rief lachend:
»Nun haben wir das Letzte, was wir noch brauchten. Nun hätten diese Blandini in der Höhle dort noch gründlicher plündern können, als sie es ohnehin schon getan haben —«

»Wir sollen diesen Fisch essen?«, fragte die Bella Cobra ungläubig.
»Natürlich! Und er wird uns ausgezeichnet schmecken! Er ist doch vollkommen frisch! Eben nur gepökelt!«
Um das zu beweisen schnitt er den Fisch der Länge nach auf. Das Fleisch war nicht so weich wie bei frischgefangenen Fischen, aber es ließ sich doch ganz leicht schneiden, und wenn es auch rot aussah, etwa wie das eines Lachses, so sah es doch sehr appetitlich aus —
Da freilich klatschte die Bella Cobra in die Hände, und in ihrer Freude war sie nicht mehr die raffinierte Tänzerin, sondern ein frisches, unschuldsvolles Mädchen —
»Wasser haben wir genug, dass wir den Fisch entsalzen können!«, rief sie. »Das ist ja herrlich — — herrlich!«
Charles Dubois lächelte zwar, aber so freudig erregt war er nicht. Doch er wollte nicht sagen, was er dachte. Sie trugen den erbeuteten Fisch nach der Felseninsel zurück, und nachdem sie ihn tüchtig gewaschen hatten, brieten sie ihn rasch über einigen der Späne, von denen ziemliche Vorräte vorhanden waren.
Dazu bereitete die Bella Cobra noch einige Dampers, flache Teigkuchen(1), aus dem vorgefundenen Mehl —
(1) Im Original steht ›falsche Teichkuchen‹; es dürften aber wohl ›flache Teigkuchen‹, in Asche gebacken, gemeint sein.
Sie wurden alle drei satt, wenngleich der Schwarze eine viel größere Portion hätte vertragen können.
Dann aber sagte Charles Dubois:
»Nun werden Sie sich etwas niederlegen und schlafen, Miss Cobra. Wenn es Zeit ist, werde ich Sie wecken, damit Sie die Wacht übernehmen können.«
Ohne Umstände breitete die Tänzerin die mitgebrachte Decke auf dem harten Steinboden aus, legte sich darauf, lächelte ihren Gefährten noch einmal an, und schlief fast sofort ein.
Charles Dubois aber setzte sich an den Eingang der Höhle, derart, dass er weder von der Wüste aus noch von der Luft her gesehen werden konnte, und überließ sich seinen Gedanken.
Immer wieder irrten seine Blicke in die Ferne, über die unermessliche Salzwüste, und dann verdüsterten sich seine Mienen.
Wie sollten sie von hier fortkommen?
Ja, wenn sie Schläuche gehabt hätten, um sie mit Wasser zu füllen, dann hätte er wohl den furchtbarem Marsch gewagt, aber der Hornfisch hatte ihnen ja gesagt, dass sie nichts derart brauchten, dass sie die Wüste rasch durchquert haben würden — und da hatte er ihnen sogar noch verschwiegen, dass er unterwegs Vorratsstationen angelegt hatte.
Jetzt saßen sie hier, zwar vor dem Verhungern geschützt und noch besser vor dem Verdursten — aber sie waren Gefangene der Wüste! Es gab keine Möglichkeit für sie, von dieser Felseninsel nach dem jenseitigen Rande der Wüste zu gelangen.
Charles Dubois war gewiss nicht der Mann, der so schnell den Mut verlor, aber er gab sich auch keinen Hoffnungen hin, die sich schließlich doch nicht erfüllen würden.
Und indem er noch einmal die Blicke nach allen Richtungen gleiten ließ, murmelte er vor sich hin:
»Wenn nicht ein Wunder geschieht, dann sind wir rettungslos verloren!«
Und dann dachte er weiter, ohne diese Gedanken in Worte zu kleiden:
»Schade, dass dieses herrliche Weib ein so trauriges Ende finden soll! Und das darf nicht sein — nein, es darf nicht! Ich will es verhüten, und müsste ich —«
Da brach er seinen Gedankengang jäh ab.
Das, was er plante, war das Letzte, und deshalb musste es bis zuletzt bleiben.
Aber seine Hände ballten sich, seine Augen loderten und seine Lippen pressten sich fest aufeinander.
Als die Sonne am höchsten stand, weckte er die Bella Cobra durch eine leichte Berührung an der Schulter.
Sie sprang sofort auf, war gleich vollständig munter und rief:
»Ich habe ausgezeichnet geschlafen, Monsieur Dubois!«
»Das freut mich sehr«, erwiderte er höflich wie immer. »Ich denke, auch ich werde so fest schlafen, dass mein rechtes Auge das linke nicht sieht, und vielleicht werde ich träumen, wie wir von dieser Insel fortkommen können —«
Er streckte sich auf seiner Decke aus und schien auch wirklich gleich einzuschlafen, aber er stellte sich nur so — er blieb wach — die Sorgen ließen ihn keinen Schlummer finden, die Sorgen um das Schicksal des schönen jungen Weibes, das allen Luxus der Großstadt mit den Entbehrungen der Wüste vertauscht und auf einer Wolldecke so herrlich geschlafen hatte, auf hartem Steinboden!
»Rettungslos verloren! Rettungslos verloren!«, hämmerten seine Pulse wieder und wieder, und so sehr er sich mühte, diesen Gedanken zu verscheuchen, er kam wieder gleich einer zudringlichen Mücke —
Rettungslos verloren!
»Nein! nein! Noch sind wir es nicht!«, dachte Charles Dubois.
Nun hausten die beiden schon zwei Wochen auf dem elenden Stück Felsen und sie wussten immer noch nicht, wie sie fortkommen könnten!
Auch die Bella Cobra hatte nun erkannt, dass sie rettungslos verloren waren, dass sie hier ihr Ende finden würden, wenn kein Wunder geschah.
Zu verhungern und zu verdursten brauchten sie freilich nicht.
Der Brunnen gab noch immer Wasser, das gleich kühl und frisch blieb. Die Wüste spendete eingepökelte Fische, deren Fleisch ganz vorzüglich schmeckte, aber die Höhle verlassen konnten sie nicht.
Es wäre nicht nur Wahnsinn, sondern geradezu Selbstmord gewesen, hätten sie sich ohne Wasserschläuche in diese Wüste wagen wollen.
Ja, sie konnten nachts marschieren, wenn die Sonne nicht so unbarmherzig hernieder brannte.
Aber wo sollten sie die Tage verbringen?
Durften sie hoffen, wieder eine solche Insel zu finden? Wieder eine Höhle?
Sie ließen es nicht darauf ankommen, sie blieben, wo sie waren und warteten auf das Wunder und suchten sich gegenseitig zu täuschen, indem sie gute Laune heuchelten. Nur Wumbo, der Schwarze, schien restlos zufrieden, seit er sich nicht mehr vor seinem grausamen Herrn zu fürchten und zu essen hatte, so viel er nur essen wollte.
Er wagte sich weit in die Wüste hinaus, grub sich dort aus, was er an Fischen fand, verzehrte sie gleich roh und trank sich dann am Brunnen satt, immer aber dabei das Blechgefäß benutzend, nachdem Charles Dubois ihn einmal heftig angeschrien hatte, als er direkt aus dem Brunnen hatte trinken wollen.
Und immer, wenn ein neuer Tag anbrach, schauten die beiden sehnsüchtig über die flimmernde Wüste, starrten empor in die Luft —
Wenn nur wenigstens die riesenhaften Blandini noch einmal hätten kommen wollen!
Viel besser als dieses Harren wäre ein Kampf mit ihnen gewesen —
Aber die Riesen kamen nicht — und die Herzen der beiden hämmerten immer wieder eintönig das alte »Rettungslos verloren! Rettungslos verloren!«
Snatcher hatte gar wohl gesehen, dass seine beiden Begleiter sich entfernten, obwohl er sich stellte, als merke er nichts. Sie wiederum — O'Donnell und die Olinda — hätten nur einmal zurückzublicken brauchen, um zu gewahren, in wie teuflischem Hohn sich das Gesicht des Mannes verzerrte, der ihnen nach dem Willen Mister Samuel Philipps beigegeben worden war.
Und Mister Philipp hatte es ja nicht ausgesprochen, aber doch sehr klar angedeutet, was dieser Snatcher sollte, warum er die Fahrt nach der afrikanischen Wüste mitmachen sollte: als eine Art Henker — der das zu vollbringen hatte, wovor die anderen zurückschreckten — der im Notfalle den Loke Klingsor kaltblütig ermorden würde, um sich das Geheimnis der Runen auf seinem Rücken anzueignen!
Die beiden hatten von Anfang an eine große Abneigung gegen Snatcher gehabt, hatten sich immer von ihm entfernt gehalten und keinerlei Gemeinschaft mit ihm haben wollen, aber das hatte sich eben nicht so streng innehalten lassen, das ging nicht bei einer solchen Expedition, deren Mitglieder immer in ihrer Bewegungsfreiheit sehr beschränkt sind, die innerhalb des gemeinsamen Lagers bleiben müssen.
Nun, weder O'Donnell noch die Olinda hatte sich umgedreht. Keins von beiden hatte also das hämische und tückische Grinsen gewahrt, das sein an sich schon widerliches Gesicht entstellte.
Noch weniger konnten sie natürlich die Worte hören, die er ja nicht einmal laut aussprach, sondern nur dachte, aber in jener Weise, wie Menschen das tun, die viel mit sich allein sind: Sie sprechen mit sich, hören die Worte auch, trotzdem geschieht dieses Sprechen nur innerlich.
Snatcher also lächelte und sagte zu sich selber:
»Da gehen sie, die Narren, und denken, ich merkte nicht, was sie vorhaben. Ich könnte ihnen ja nachschleichen, und ich weiß, dass sie mich nicht entdecken würden, nicht einmal dieser Detektiv, der sich so viel auf seine Spürnase einbildet.
Hahaha, wenn sie ahnten, dass sie mir gar keinen größeren Gefallen hätten tun können, als dass sie mich allein lassen! So kann ich wenigstens das kleine Privatgeschäft erledigen, wegen dessen ich hauptsächlich hierher gekommen bin.
Ach, ihr Narren, ihr aufgeblasenen! Wenn ihr doch wüsstet, dass ihr nur Puppen in meiner Hand seid! Dass ich euch vernichten könnte, wenn ich wollte —

Und die ersten wäret ihr ja nicht!«, setzte er dann noch hinzu.
Er wartete jedenfalls, bis die beiden sich weit genug entfernt hatten, ehe er überhaupt eine sichtbare Bewegung machte.
Diese aber bestand nur darin, dass er den Kopf hob und etwas nach Osten drehte.
Da blickte er gerade nach einer Felsenspitze, die sich in ganz eigentümlicher Weise von der Umgebung abhob.
Diese Felsenspitze sah gar nicht natürlich aus, was sich ja immerhin leicht genug unterscheiden lässt. Ihre Wände waren viel zu glatt, zu regelmäßig, und wenngleich das auch sonst vorkommen mag, so war eben doch ein Unterschied. Man sah, dass dort oben Menschenhände der Natur nachgeholfen hatten.
Worin das bestand, wird sich noch zeigen, sodass es vorläufig hier nicht beschrieben zu werden braucht.
Dorthin also schaute Snatcher, ohne sich irgendwie auffällig zu machen.
Die Araber achteten aber sowieso nicht auf ihn, waren mit ihrer Mahlzeit beschäftigt, hatten auch mit den Tieren noch allerlei zu tun.
Keiner von ihnen sah, dass dort oben an der Felsenspitze plötzlich ein Lappen sichtbar ward — anders kann es nicht genannt werden — es sah aus, als hätten dort wandernde Wüstenbewohner eine Opfergabe zurückgelassen, wie dies ihre Gewohnheit ist — und die der meisten Naturvölker.
Diese Gewohnheit ist so wenig bekannt, dass schon ein paar Worte darüber gesagt werden müssen. Der nordamerikanische Indianer ist ja bekannt — oder war es — als vorsichtiger Mensch, immer auf der Hut vor Feinden. Er verwischte regelmäßig die Spuren, auch wenn das Kriegsbeil einmal begraben war, richtete die zertretenen Grashalme wieder auf, schob die verbogenen Zweige zurecht — und doch beging er regelmäßig eine grobe Unvorsichtigkeit, wenn er seinen Durst stillte, es sei an einem Bache oder an einem Brunnen. Dort musste er nach dem heiligen Glauben seines Volkes eine Opfergabe niederlegen und tat das auch ganz unweigerlich, und wenn es auch nur eine Glasperle war, eine Feder, die als Verzierung seiner Kleidung diente, die buntgefärbte Borste eines Stachelschweines oder so etwas.
Genau dasselbe tun aber auch die Araber, die Beduinen und alle Wüstenbewohner überhaupt.
Sie legen an dem Brunnen, an dem sie sich und ihre Tiere tränken, mindestens ein Trinkgefäß nieder, meist aber auch gleich noch ein Seil, mittels dessen der nächste Ankömmling dieses Gefäß in die Tiefe lassen und Wasser schöpfen kann.
Noch auffälliger wird dieser fromme Brauch dort, wo einer ihrer Heiligen begraben ist, also ein Marabut.
Über seinem Leichnam wird eine Steinpyramide errichtet, und jeder vorüberkommende Gläubige muss wenigstens einen neuen Stein hinzufügen, was oft gar nicht so einfach ist, er muss diesen Stein oft von weither holen oder ihn, falls er weiß, dass sein Weg ihn an einem solchen Grabe vorbeiführt, schon lange vorher aufheben und mit sich nehmen.
Kann er aber doch keinen Stein opfern, weil er keinen gefunden hat, so muss er etwas anderes zurücklassen, und das ist dann meistens ein Fetzen Tuch, den er aus seinem Kleide reißt oder aus seinem Turban —
Und ein solcher Fetzen wehte von der Felsenspitze dort oben, nach welcher die Blicke Snatchers gerichtet waren, kennzeichnete diese Spitze als das, was sie war, die Steinpyramide über dem Grabe eines mohammedanischen Heiligen.
Hier aber schien der flatternde Lappen noch eine andere Bedeutung zu haben, denn der Amerikaner zog nunmehr ein Taschentuch hervor, das allerdings längst nicht mehr sauber genannt werden konnte, führte es an sein Gesicht, als wollte er sich seiner zu dem Zwecke bedienen, zu dem eben Taschentücher da sind — und da konnte es ja ganz natürlich zugehen, dass das Tuch dabei etwas flatterte.
Jedenfalls steckte er es sogleich wieder ein, brannte sich dann eine Zigarre an, von denen er eine ganze Menge bei sich führte, erhob sich und schlenderte langsam davon, wie einer, der noch einen kleinen Verdauungsspaziergang machen will.
Keiner der Araber achtete auf ihn, keiner kam auch nur im Entferntesten auf den Gedanken, ihm nachzuschleichen. Hier konnte und mochte jeder tun, was er wollte.
Snatcher seinerseits beobachtete die Zurückbleibenden immer wieder unauffällig, bückte sich einmal und schaute sich um oder tat sonst etwas — und dann stand er im Schatten der Felswand, gerade, als die Sonne diese nicht mehr erreichte.
Nacht war es deswegen noch nicht, aber die tiefen blauen Schatten reichten vollkommen hin, den einzelnen Mann unsichtbar zu machen.
Nun begann Snatcher auch wieder mit sich zu sprechen, wie es eben seine Gewohnheit geworden war, immer freilich so leise, dass kein Lauscher die Worte hätte verstehen können.
»Abd el Hamid ist pünktlich«, murmelte er. »Das gefällt mir. So werden wir schnell genug einig werden, vorausgesetzt, dass er schon vorgearbeitet hat! Wollen sehen!«
Die Felswand, in deren Schatten Harry Snatcher stand, wies zahlreiche höhlenartige Löcher auf, wie dies in der Wüste eben auch fast überall der Fall ist. Man kann annehmen, dass da der Sand seine Arbeit getan hat, der vom Wüstenwind gegen das Gestein getrieben wurde und allmählich die weichen Stellen aushöhlte.
Dieser Wüstensand, der tagsüber von der glühenden Sonne unglaublich erhitzt wird, muss doch, wenn er von dem ebenfalls heißen Wind mit großer Gewalt weitergefegt wird, wie ein Sandgebläse wirken, also wie eine jener Maschinen, mit denen zum Beispiel die Schrift auf Grabsteinen erzeugt wird.
Hier hatte er Höhlen geschaffen und Höhlungen, und es gehörte schon eine eingehende Untersuchung dazu, um festzustellen, womit man es zu tun hatte — mit einer wirklichen Höhle oder nur einer oberflächlichen Vertiefung.
Snatcher aber wusste Bescheid.
Die Vertiefung, in welcher er nunmehr untertauchte, war eine wirkliche Höhle, noch dazu eine, bei welcher Menschenhände vollendet hatten, was die Natur nur anbahnte.
Als Snatcher nunmehr den Leuchtkegel seiner elektrischen Taschenlampe aufblitzen ließ, bestrahlte er die Steinwände der Höhle, und da hätte nun jemand, der irgend etwas von Steinmetzarbeit verstand, sofort erkennen müssen, dass hier Meißel gearbeitet und das Gestein geglättet hatten.
Snatcher selber schien an dieser Tatsache, die für die abgelegene Gegend mindestens recht merkwürdig war, nichts Besonderes zu finden oder hatte sie eben schon wahrgenommen.
Er schritt, allerdings ganz leise auftretend, weiter, immer wieder die Lampe abstellend, und er schien so genau hier in dieser Unterwelt Bescheid zu wissen, dass er sie nur aufleuchten ließ, wenn eine Biegung vorhanden war oder wenn — wie dies mehrmals der Fall war — Stufen empor führten.
So kam er endlich auf die Höhe des Felsens, die ein vollkommen nacktes Plateau darstellte, auf dem sich in einiger Entfernung die Felsspitze erhob, eben jener Steinhügel, der das Grab eines Marabuts bezeichnete.
Harry Snatcher aber betrat diese Hochfläche nicht sogleich, schob seinen Kopf nur so weit aus der Höhle, dass er hinausblicken konnte — aber dabei hatte er wieder das Taschentuch gezogen und wedelte damit.
Der Lappen, den er von unten aus bemerkt hatte, war auf dieser Seite nicht zu sehen gewesen, aber nun kam er um den Steinhaufen herum, ein Zeichen, dass er von Menschenhand bewegt wurde.
Zugleich ertönte ein zischender Laut — nicht mehr hörbar als etwa das Zischen, das eine gereizte Sandnatter ausstößt, die in diesen Gegenden sehr häufig sind. Niemand, der es hörte, konnte einen Verdacht schöpfen — es sei denn, er hätte wirklich die Lebensweise dieser Tiere genau gekannt und gewusst, dass sie um diese Zeit längst zusammengerollt liegen und sich nicht mehr bewegen.
Jedenfalls erwiderte Snatcher diesen Ton sogleich in derselben Weise, und da löste sich aus dem Schatten der Steinpyramide auch schon eine Gestalt los, ein Araber anscheinend, dem weißen, weiten Gewand nach zu urteilen.
Auch Snatcher tauchte nun aus der Höhle ganz auf, trat auf die Hochfläche hinaus, richtete sich auch zu seiner ganzen Größe auf, hielt sich aber doch weit genug von dem Absturz des Felsens entfernt, sodass er von unten nicht gesehen werden konnte.
In der Mitte der Entfernung zwischen Höhlenausgang und Steinhügel trafen die beiden zusammen.
Der weißgekleidete Araber hob die rechte Hand zum Selam, zum Gruße, und dabei sprach er auch die vorgeschriebenen Worte in arabischer Sprache.

Der weißgekleidete Araber hob die rechte Hand zum Selam.
Snatcher hob zwar ebenfalls die rechte Hand, aber nur, um eine wegwerfende, geringschätzige Bewegung zu machen.
»Lasst doch den Kram!«, knurrte er dabei wie unwillig. »Solchen Hokuspokus macht denen vor, die Euch nicht kennen, Monsieur du Couret, nicht mir! Freue mich jedenfalls, dass Ihr die Pünktlichkeit noch nicht verlernt habt, die Euch früher auszeichnete —
Da — meine Hand! Guten Abend, alter Freund!«
Das Merkwürdigste war, dass er sich bei dieser Anrede weder des Arabischen noch seiner Muttersprache, des Englischen, bedient hatte. Er hatte vielmehr Französisch gesprochen — und wenn ein Engländer oder ein Amerikaner die Sprache redet, so kann einem Hörer schlecht dabei werden — auch wenn keine Verstöße gegen Grammatik und Satzbau und so weiter dabei vorkommen —
Die englisch sprechenden Völker können nun einmal keine fremde Sprache so reden, wie andere Völker das tun, passen alles ihrer Aussprache an — es ist zum Davonlaufen!
Der Araber indessen verstand dieses jämmerliche Französisch anscheinend. Er antwortete wenigstens in derselben Sprache, aber das klang nun ganz anders, eben genau so, wie wenn ein Pariser spricht — es war ein ausgezeichnetes, klangreines Französisch.
»Bon soir, Monsieur Snatcher!«, erwiderte er. »Und besten Dank für das Kompliment wegen meiner Pünktlichkeit. Ich verdiene es nicht. Sie selbst wissen, dass bei Geschäften, wie wir sie miteinander führen, Pünktlichkeit die unerlässlichste Bedingung für das Gelingen ist, gleich gar in dieser Wüste —
Und nun noch eine Frage: Sie haben immer noch nicht Arabisch gelernt?«
Snatcher lachte in seiner hämischen Art auf.
»Allahu akbar, allah il allah!«, stieß er dann hervor, sich auch mit komischer Feierlichkeit verneigend. »Das ist alles, was ich von dieser Sprache kann.
Nee, Monsieur du Couret, da ist bei mir nichts zu machen, das Kauderwelsch lerne ich in meinem Leben nicht, es hat mich Mühe genug gekostet, Französisch zu lernen!«
»So werden Sie sich selbst zuzuschreiben haben, wenn Sie die Verhandlungen mit unserem neuen Freunde in dieser Ihnen unverständlichen Sprache führen, nicht verstehen und wahrscheinlich, wie ich Sie kenne, alle fünf Minuten mit einer misstrauischen Frage kommen werden, wissen wollen, was wir gesprochen haben — das ist peinlich, denn es wird meine Arbeit sehr schwierig machen.«
»Dann mag doch dieser —«
Er wollte anscheinend einen Namen nennen, den Namen dessen, von dem der französisch sprechende Araber eben geredet hatte, da hob dieser die eine Hand, und — der Name blieb unausgesprochen.
Aber Snatcher fuhr trotzdem fort und sagte:
»Er mag doch Englisch lernen, was die einzige vernünftige Sprache auf der Erde ist und selbst von den dümmsten Wilden verstanden wird!«
»Vielleicht kann er es!«, sagte da eine tiefe, aber sehr wohllautende Stimme hinter ihm.
Die Dunkelheit, die sich auf die Erde und auch auf dieses Plateau gesenkt hatte, ohne die beiden in ihrer Unterhaltung zu stören, hatte bewirkt, dass — wenigstens Snatcher — die Annäherung des neuen Ankömmlings vollkommen überhört hatte.
Umso erschrockener prallte er herum, denn die Worte waren wirklich englisch gewesen, mit dem echt englischen Tonfall gesprochen worden, und doch stand anscheinend eben nur ein zweiter Araber da.
»Sie?«, rief denn auch Snatcher, fast verblüffend.
Der andere verneigte sich.
»Abd el Dschelil!«, sagte er dabei.
Und wäre es nicht so finster gewesen, so hätte er sehen müssen, wie dieser amerikanische Rohling ihn fast ehrerbietig anblickte. So gewahrte er wenigstens, dass er den Hut zog —
Aber er achtete nicht darauf.
»Folgen Sie mir, meine Herren!«, sagte er, wandte sich und schritt direkt nach der Steinpyramide hinüber.
Die beiden folgten ihm und traten hinter ihm in die Öffnung, welche der ungefähr drei Meter hohe Haufen hier aufwies.
Schweigend ging es einige Stufen hinunter, tastend und tappend vonseiten Snatchers, ganz sicher vonseiten der beiden Araber oder was sie sonst sein mochten.
Dann folgte ein ebener Gang, und plötzlich flutete durch eine Tür, die der Vorausschreitende geöffnet haben musste, ein so blendender Lichtschein, dass — namentlich Snatcher — überhaupt nichts mehr sah, sondern gleich stehen blieb, bis seine geblendeten Augen sich an die Helle gewöhnt hatten.
Dann freilich betrat er ohne Zögern das Gemach, das sich vor ihm auftat, schien sich nicht einmal darüber zu wundern, dass es überhaupt vorhanden war — schaute sich auch nicht weiter um, trotzdem sich das recht wohl gelohnt hätte, sondern setzte sich, dem Beispiel des Franzosen folgend, auf ein Lager von Teppichen, das sich an der einen Längswand erhob.
Die Tür schloss sich von selbst wieder.
Die drei Männer befanden sich in einem Raume, der jetzt aus vier glatten Steinwänden zu bestehen schien, in denen nicht die kleinste Fuge oder gar eine Öffnung sichtbar war.
Zum Teil waren sie allerdings wiederum mit kostbaren Teppichen behangen, wie auch der Boden mit ihnen überbreitet war — und sonst war die Ausstattung eben rein orientalisch.
Snatcher achtete, wie schon gesagt, auch gar nicht darauf, wendete seine Blicke vielmehr auf den Mann, der sich selbst als Abd el Dschelil vorgestellt hatte.
Und da muss allerdings gesagt werden, dass dieser Name in ganz Afrika so bekannt war wie vielleicht kein anderer.
Dieser Abd el Dschelil hat eine große Rolle in diesem Erdteil gespielt. Mancher wird ihn auch bereits kennen, aus Reisewerken, das heißt, nicht aus phantastischen Reisebeschreibungen, sondern aus den Werken ernster Forscher.
Es gab eben eine Zeit lang für solche Forschungsexpeditionen nur einen Führer, gleichviel ob es nach Abessinien gehen sollte oder nach Bornu oder sonst wohin.
Immer wurde dieser Abd el Dschelil angeworben, und immer wieder staunten die fremden, gelehrten Herren, dass er dieses geheimnisvolle Land durch und durch kannte, wohin er auch kam — als hätte er es schon durchwandert oder als besäße er mindestens eine genaue Karte, etwa so eine vom Großem Generalstab herausgegebene, auf der man jede Kleinigkeit angegeben findet.
Das war ja freilich ganz ausgeschlossen. Solche Karten sollten eben erst durch die Forscher geschaffen werden, und die wussten doch am besten, wie mühsam so etwas ist, wie sie immer wieder von dem Hauptwege abbiegen mussten, um auch die nächste Umgebung zu erforschen, wie sie sich trotzdem oft genug irrten, eine weiße Wolkenwand für ein Schneegebirge ansahen, durch eine Luftspiegelung, die dort ja so häufig sind, noch mehr genarrt wurden.
Nein, dieser Abd el Dschelil brauchte keine Karte, der kannte den schwarzen Erdteil durch und durch.
Noch mehr aber als über diese Kenntnis haben sich alle Herren, die von ihm geführt wurden, darüber gewundert, dass dieser Mann, wohin er auch kam, eine an heilige Scheu grenzende Verehrung genoss, dass auch die wildesten schwarzen Stämme des tiefsten Innern seinen Namen nur flüsternd auszusprechen wagten und ihm auf den leisesten Wink widerstandslos gehorchten.
Es kam ja vor, dass auch Karawanen oder Expeditionen, die dieser geheimnisvolle Mann führte, unterwegs angegriffen wurden, aber dann brauchte er sich den Angreifern nur zu zeigen, und sofort ließen sie die Waffen sinken, stellten nicht nur jede Feindseligkeit ein, sondern wurden für die durch ihr Gebiet führende Strecke die treuesten, zuverlässigsten Begleiter.
Woher das kam?
Niemand hat es erfahren.
Dazu hätten die Herren Forscher eben mindestens Rechtgläubige sein müssen, Verehrer Allahs, aber auch dann hätten sie nicht viel Zuverlässiges über ihn erfahren, höchstens, dass er ein sehr hochgeborener Herr war, der einstige Herrscher über ganz Fessan, dessen Schwestern an Fürsten des Innern verheiratet waren — eine war die Hauptgattin des Kaisers von Marokko — eine andere war an den Herrscher von Bornu verheiratet — eine dritte herrschte über Tibbu — und so hätten sich noch viele solche Verwandtschaften aufzählen lassen.
Wir Weißen lächeln ja meist etwas hochmütig, wenn die Rede auf solche innerafrikanische Herrscher kommt. Wir denken gar nicht daran, wie sehr wir uns da blamieren, weil uns da gleich so ein Duodezfürstchen vorschwebt, so einer, dessen ganzes Heer noch aus keinem Dutzend Soldaten besteht — und wie soll denn ein solcher afrikanischer Negerhäuptling, der in einem Lehmpalast wohnt, irgend etwas vorstellen?
Dabei sind das aber ganz echte Fürsten, nicht nur, dass sie ihren Stammbaum vielleicht weiter zurückführen können als manche ihrer europäischen Kollegen, sondern auch ihre Macht ist größer, sie können nicht nur Tausende von Kriegern auf die Beine bringen, sondern Hunderttausende. Das haben die Engländer und die Franzosen oft genug erfahren müssen, jene, als sie gegen die Ketschewayo, den König der Zulukaffern, kämpften, diese, als sie Dahomey eroberten.
Abd el Dschelil war also nicht nur ein mächtiger Fürst gewesen, sondern nannte auch solche mächtige Fürsten Schwäger.
Und wenn da so ein Negerlein in Ehrfurcht vor ihm erstarb, so war das doch schon aus dem Grunde recht erklärlich, weil dieser Herrscher ihm durch einen Wink den Kopf vor die Füße legen lassen konnte.
Dieser Abd el Dschelil also ist keine Romanfigur, ebenso wenig wie es der andere Araber war, den Snatcher als Monsieur du Couret angeredet hatte.
Er war ein Franzose, das stimmt schon, aber er war zum Islam übergetreten, hatte den Namen Abd el Hamid erhalten und war Bei, also schon eine Standesperson —
Und die Hauptsache war, dass er der intimste Freund Abd el Dschelils war!
Wer sich dessen Dienste sichern wollte — Dienste! — der musste sich an den zum Mohammedaner gewordenen Franzosen wenden. Ohne dessen Vermittlung war der Schwager des Kaisers von Marokko, des Kaisers von Bornu und so weiter überhaupt nicht auffindbar.
So also war es recht erklärlich, dass Harry Snatcher diesen Mann mit forschenden Blicken betrachtete.
Allerdings, was er sah, war eigentlich gar nichts Besonderes. Er hatte ihn sich doch ganz anders vorgestellt.
So sah er einen Araber vor sich, wie er sie schon hundertweise kannte: ein braunes Gesicht, von schwarzem Vollbart umrahmt, mit etwas aufgeworfenen Lippen, die eine Beimischung von Negerblut verrieten, und das Gesicht gar nicht einmal besonders edel geschnitten, wie man das so oft bei Arabern trifft, namentlich bei Wüstenarabern, die ja echte Freiherrn sind, sich niemals einer Fremdherrschaft beugen.
Nur etwas fiel Snatcher auf.
Das waren die Augen des berühmten Mannes.
Sie waren ja tiefschwarz wie die aller seiner Landsleute, aber sie hatten einen seltsamen Ausdruck, so sanft, fast weibisch!
Ja, diese Augen waren das Merkwürdigste an dem Manne, und nur, wer ihn fortgesetzt und aufs schärfste beobachtete, konnte gewahren, dass der Ausdruck dieser Augen auch ein ganz anderer sein konnte, je nachdem, gebietend, drohend, grausam!
Das Gewand Abd el Dschelils aber wich von dem ab, das sonst von Arabern getragen wird. Es war eine Art römische Toga — oder noch besser — eine Tunika.
Sie umhüllte den ganzen Körper, verdeckte die Arme und natürlich somit auch die Hände —
Ob er darunter noch ein anderes Gewand trug, war nicht zu sehen.
Harry Snatcher wunderte sich über diese eigenartige Tracht nicht weiter, er dachte, das wäre eben Geschmackssache —
Er irrte sich gewaltig.
Diese mit farbigen Streifen geschmückte Tunika hätte ihm eine ganze Geschichte erzählen und ihm manchen wertvollen Aufschluss über ihren Träger geben können, hätte er sich eben je mit der Geschichte dieser Wüstenbewohner beschäftigt.
Das war die Tracht der Ibaditen, einer Sekte, der an Mitgliederzahl keine andere auf Erden gleichkommt.
Diese Ibaditen sind dasselbe, was die Quäker für Amerika sind, und gerade jetzt weiß ja jedes Kind, was für großmütige Menschen sich in dieser Sekte vereinen, wie sie die reinste Nächstenliebe nicht nur im Munde führen, sondern ganz selbstlos betätigen.
Man kann also gar keinen besseren Vergleich gebrauchen. Diese Ibaditen sind die Quäker Afrikas, Puritaner, aber — und da liegt der Unterschied — sie treten nicht selbst an die Öffentlichkeit. Ihre Tätigkeit vollzieht sich ganz im Stillen, viel umfangreicher als die ihrer amerikanischen Gesinnungsgenossen, und dabei ist noch gar nicht erwiesen, ob sie nicht auch besondere, nur ihnen bekannte Zwecke damit verbinden — etwa politische —
Das Haupt dieser nach Millionen zählenden Sekte saß jetzt vor Harry Snatcher, gleichmütig lächelnd, als er nun freundlich sagte:
»Welcome, Mister Snatcher!«
Doch der ließ sich eben nicht verblüffen, behauptete es wenigstens immer, und so erwiderte er frech:
»By Jove! Sie sind der erste vernünftige Araber, der mir je vor die Augen gekommen ist!«
Das freundliche Lächeln verschwand nicht aus dem Gesicht Abd el Dschelils, aber ein rascher Blick traf den Franzosen, und da sagte dieser:
»Die Anrede ist das ›Du‹, Mister Snatcher.«
»Na, meinetwegen! Sagen wir also Du zueinander«, fuhr dieser fort. »Also was meinst Du, Dschelil, was soll nun geschehen?«
»Ich möchte hören, was Du mir zu sagen hast«, entgegnete nunmehr der Hohepriester der Ibaditen. »Doch zuvor will ich einige Erfrischungen kommen lassen. Ihr werdet vielleicht auch rauchen wollen.«
Er klatschte in die Hände.
Sofort hob sich einer der an der Wand hängenden Teppiche und ein Weib kam herein, noch ganz jung, ein halbes Kind noch, nur bekleidet mit den im Orient üblichen weiten Beinkleidern und einer Art ärmellosen Jäckchens, das die Brust umschloss.
Da musste sich natürlich ohne Weiteres zeigen, wie gazellenschlank dieser schöne Leib war, und das Gesicht, das nicht durch den üblichen Schleier verhüllt wurde, entsprach dem.
Dieses Mädchen glich dem, was der Mohammedaner sich unter einer Houri vorstellt, die bekanntlich im Paradies die abgeschiedenen Gläubigen erwarten.
Snatcher staunte nicht schlecht.
»All thousand devils!«, stieß er hervor und leckte sich gleich beide Lippen, wobei er einen schnalzenden Ton hervorstieß.
Da aber traf ihn ein furchtbarer Blick aus den schwarzen Augen Abd el Dschelils — und es war merkwürdig, dass Snatcher diesen Blick auch gleich gewahren musste, dass dieser ihn in seinen Bann zwang.
Zur gleichen Zeit stieß der neben ihm sitzende du Couret ihn an und raunte ihm zu:
»Kein Fluch! Schweig, wenn Dir das Leben lieb ist! Und keinen Blick auf dieses Weib!«
Snatcher hätte ja am liebsten eine freche Antwort gegeben, es leuchtete in seinen Augen schon so tückisch auf, aber der Blick des Ibaditen zwang ihn doch mit magischer Gewalt.
Er schwieg und guckte nicht mehr auf die schöne Houri, so dicht diese auch an ihn herankam, als sie die kostbare Wasserflasche des Nargilehs vor ihn stellte, daneben ein maurisches Tischchen, und darauf wieder eins jener winzigen Tässchen, aus denen der Orientale den Kaffee trinkt —
Snatcher verhielt sich ganz artig, so sehr er innerlich auch knurren mochte, wagte auch nicht, nach einem Whisky zu fragen, den er dem Mokka bei Weitem vorgezogen hätte —
Und dann rauchten die beiden Gäste des Abd el Dschelil erst schweigend eine ganze Weile, sodass der Raum sich mit den duftenden blauen Wolken anfüllte.
Nur das leise Gurgeln war zu hören, mit dem der Rauch durch das Wasser in der Flasche ging.
Abd el Dschelil selber rauchte nicht, hatte auch keinen Mokka erhalten, er saß bewegungslos und hatte jetzt auch die Lider gesenkt, wie in tiefem Nachsinnen.
Dann hob er mit anmutiger Bewegung eine Hand.
»Du richtetest eine Frage an mich, Bruder Snatcher«, sagte er, wieder in einwandfreiem Englisch.
»Ja, das tat ich, Dschelil«, gab der Amerikaner zu.
»Du wolltest wissen, was geschehen soll?«
»Ja«, erwiderte Snatcher.
Es hatte den Anschein, als wollte Snatcher auffahren und rufen: »Ist das ein dummes Gefrage! Du weißt doch ganz genau, was ich meine!« — aber er beherrschte sich auch jetzt noch und fügte hinzu:
»Es handelt sich natürlich um meine beiden Begleiter.«
»Du weißt, wo sie sind?«, fragte der Ibadite.
»Denken kann ich mir's. Sie sind sicher zu dem Grabe gegangen.«
»Das haben sie getan. Und weißt Du, mein Bruder, was sie dort gefunden haben?«
»Wie soll ich das wissen, da ich ihnen nicht gefolgt bin?«
»Sie haben eine große Überraschung erlebt, sie haben dieses Wüstengrab mit Blumen geschmückt gefunden«, sagte Dschelil.

Da lachte Snatcher nun doch laut auf.
»Blumen? Vielleicht hat man ein paar abgehackte Hyänenschwänze draufgesteckt, hahaha! Woher sollen denn hier in der Shebkha Blumen kommen, und noch dazu frische?!«
»Der, den Du suchst, hat sie pflanzen und pflegen lassen!«
»Der Loke Klingsor? Gott verdamm — ach so — entschuldige, Freund — wir Amerikaner sind eben nun einmal so, uns fährt leicht ein Fluch aus dem Gehege der Zähne —«
»Du wirst es künftig vermeiden, mein Bruder. Wenn Du zum dritten Male fluchst, muss ich Dich verlassen«, sagte der Ibadite sanft.
»Und ich will Dich weiter fragen: Weißt Du, wo Deine beiden Begleiter jetzt sind?«
»Keine Ahnung!«, knurrte Snatcher.
»Sie sind auf dem Wege zu dem, dessen Namen Du soeben nanntest.«
Da freilich musste der Amerikaner gewaltig an sich halten, dass er nicht doch wieder einen Fluch ausstieß. Da er das aber nicht durfte, so lachte er wenigstens, fragte jedoch gleich:
»Oder darf ich auch nicht lachen? Das würde mir schwer fallen! Denn Du musst doch nicht glauben, dass ich ein Dummkopf bin, Dschelil, wenn ich vielleicht auch so aussehe — o, nee — auf den Leim huppe ich nicht — denn der Loke Klingsor soll doch das Gras wachsen hören, der weiß sicher schon, dass wir hinter ihm her sind — — hahaha — und da soll er die beiden —?
Nee, nee, Freund Dschelil, wie gesagt, auf den Leim huppe ich nicht!«
Es war nicht zu erkennen, welche Wirkung diese Worte auf den Häuptling der Ibaditen hatten, auf seinem Gesicht zeigte sich kein anderer Ausdruck als vorher, es blieb freundlich, auch die Augen blitzten nicht wieder.
Er klatschte nur in die Hände.
Darauf erklang von irgendwoher eine Stimme, die eines Mannes.
Was sie sagte, verstand Snatcher nicht, hätte es auch nicht verstehen können, wenn er Arabisch gekonnt hätte — es war die Geheimsprache dieser Sekte —
Dschelil gab einen Befehl, ohne sich zu rühren, und da erlosch auf einmal das helle Licht, dessen Quelle gar nicht sichtbar gewesen, das anscheinend durch die Decke gedrungen war —
Tiefe Dunkelheit erfüllte das Gemach.
Und dann ward es wieder hell, aber in ganz merkwürdiger Weise.
Das weiche Licht schien von überall her zu kommen, aber es hatte eine ganz besondere Eigenschaft, es entfärbte sozusagen die bunten Teppiche an den Wänden, auf dem Boden — verwandelte die ganze Farbenpracht in ein seltsames Grau, und nun sagte Dschelil:
»Mein Bruder mag die Augen schließen und wird doch sehen!«
»Na, da bin ich ja neugierig!«, dachte Snatcher, gehorchte aber, machte beide Augen zu —
Und riss sie gleich wieder auf.
Ganz verstört guckte er sich um.
»Nanu!«, rief er halblaut. »Mir war eben ganz sonderbar — als stände ich dicht neben O'Donnell — und neben dieser Olinda —«
»Schließe die Augen wieder und sprich nicht!«, mahnte der Ibadite.
»Und dann sehe ich das wieder, was ich eben sah?«, fragte Snatcher.
Er erhielt keine Antwort, sah nur, dass auch Abd el Dschelil die Lider gesenkt hatte —
Da machte er es ebenso, hielt auch gleich noch beide Hände vor, als wolle er sich durch nichts stören lassen.
Was er nun als eine Art Vision zu sehen bekam, war allerdings sehr wunderbar — für ihn wenigstens, der die Geheimkünste des Orients noch nicht kannte.
Er sah wirklich O'Donnell und die Olinda, als stände er neben den beiden — und so sah er mit an, was sie selbst erlebten, die Mahlzeit, die sie hielten — die Zirkusvorstellung —
Es war das Wunderbarste, dass er nun nicht doch die Augen weit aufriss, aber dazu war er eben viel zu verblüfft.
»Und jetzt —!«, murmelte er endlich, als die Bilder vor seinen Augen erloschen, ganz plötzlich.
»Und jetzt vermag ich Dir nichts weiter zu zeigen«, sagte Abd el Dschelil. »In das Reich jenes Mannes vermag ich nicht einzudringen.«
»In das Reich Klingsors?«
»Du nennst ihn.«
»Und der haust wirklich hier, in diesem Kraterkessel?«
»Nicht in dem Kraterkessel, der ist nur ein Eingang zu seinem Reiche.«
»Und die beiden sind zu ihm gegangen, von dem Manne, den ich sah, zu Klingsor geführt worden?«
»Es wird wohl so sein, wenn Du es gesehen hast.«
»Dann begehen sie ja einen schnöden Verrat!«, stieß er nur hervor.
»Wieso?«
»Nun, sie sollen doch diesen Klingsor aus seinem Versteck hervorlocken, die Olinda soll singen —«
»Das hat sie getan, Du hast dieser Szene nur nicht mehr beiwohnen können.«
»Und nun sind sie bei ihm und denken nicht daran, die Runen —«
Da hob der Ibadite die rechte Hand.
»Still! Kein Mensch soll aussprechen, was er nicht weiß! Sie sind in das Reich des Mächtigen gedrungen, sind dahin eingeladen worden, aber Du darfst nicht behaupten, dass sie einen Verrat begehen wollen. Oder woraus schließt Du das?«
»Und ich? Sie sollen doch nicht ohne mich handeln! Sie müssen mich mitnehmen!«, schrie Snatcher.
»Und wenn sie das nicht konnten? Komm! Ich will Dich überzeugen!«
Abd el Dschelil erhob sich. Die beiden andern folgten seinem Beispiel. Durch die Türöffnung, die in der einen Wand entstand, gingen sie hinaus.
Es ging nur abwärts, immer tiefer, und da dieser Gang beleuchtet war, ohne dass Snatcher eine Fackel oder eine andere Lichtquelle zu entdecken vermochte, so sah er, dass von dem Hauptgange sich viele andere abzweigten, dieser ganze Felsen von Gängen durchzogen war, ohne dass er zu beurteilen vermochte, ob sie weiterführten oder irgendwo blind endeten.
Jedenfalls standen die drei Männer nach einiger Zeit vor einer Felswand, die jedes Weitergehen unmöglich machte.
»Hier beginnt das Reich dessen, den Du suchst!«, sagte Dschelil. »Ich kann und darf Dich nicht weiterführen, aber ich darf Dir den Weg zeigen, den Deine Freunde gekommen sind, ehe sich hinter ihnen diese Felswand geschlossen und sie von der Außenwelt für immer abgesperrt hat.«
Er wendete sich, wollte weitergehen, da aber vertrat Snatcher ihm den Weg.
»Halt!«, sagte er auch noch und reckte den einen Arm vor. »Das verstehe ich nicht ganz. Du sagtest, dass dieser Felsen sich hinter den beiden geschlossen hätte. Das ist doch ausgeschlossen, das ist ja gewachsenes Gestein, keine Tür!«
»So sieht es aus«, gab Dschelil zu.
»Aber?«
»Der Herr dieses Reiches kann Felsen bewegen, sie wie Türen sich drehen lassen.«
»Na da! Wer das glaubt, der muss — aber meinetwegen. Du sagtest weiter, dass sie für immer von der Außenwelt abgeschlossen seien.«
»Das sagte ich.«
»Das heißt also, dass ich sie nicht wiedersehen werde?«
»Da fragst Du mich zuviel, ich kann Dir nicht antworten. Aber meinst Du, dass der Herr dieser Unterwelt denen, die sein Reich sahen, gestatten wird, zu den Menschen zurückzukehren?«
Snatcher schüttelte den Kopf.
»Er wäre zumindest sehr dumm!«, sagte er dann.
Da lächelte Dschelil, aber Snatcher fuhr fort:
»Nun, dann wünsche ich ihnen viel Vergnügen und werde nun sehen, wie ich allein zu meinem Ziele komme. Die beiden können mir den Buckel langrutschen. Bloß dem Mister Philipp werde ich ein Lichtchen aufstecken, was er da getan hat, dass er sein Geld umsonst hinausgeschmissen hat —
Na ja, und der Loke Klingsor wird den Snatcher schon noch kennen lernen! Mich hätte er ja nicht so übertölpeln können.«
»Hast Du noch etwas zu fragen? Nicht? Dann gib den Weg frei!«, sagte der Araber, und als Snatcher zur Seite wich, da schritt er weiter, führte die beiden genau den Weg, den O'Donnell und die Olinda zurückgelegt hatten, bis sie an dem Grabe standen.
Und da staunte ja Snatcher nicht schlecht, als er wirklich die frischen Blumen auf dem Hügel sah, gleich auch erkannte, dass sie begossen worden waren —
Er konnte das feststellen, denn da es hier im Freien finster war, so hatte er seine Taschenlampe in Tätigkeit gesetzt, und keiner seiner beiden Begleiter hatte ihn daran gehindert.
»Das ist doch nicht zu glauben!«, rief er fast stöhnend. »Ich habe immer gemeint, ich könnte mir alles erklären, was ich sehe, aber hier — nein, da hört alles auf, da steht mir der Verstand still —
Und Du hast das gewusst und die beiden nicht aufgehalten?«
Diese Frage richtete er an Dschelil, der sie gar nicht übel nahm, sondern sofort erwiderte:
»Die Gäste jenes Mannes sind unverletzlich für mich. Auch wenn ich es wollte, könnte ich ihnen nicht schaden.«
»Soso!«, machte Snatcher nur, verschwieg aber, was er sich dachte, denn das war nicht gerade ein Kompliment für diesen allmächtigen Oberpriester der Ibaditen, dessen Macht er ja aber nicht einmal ahnte.
Der sich auch nicht weiter um diese Gedanken kümmerte, sondern nun gelassen sagte.
»Mein Bruder wird seine Leute entlassen müssen.«
»Das fehlte noch! Gibt's nicht!«
»Sie werden doch gehen, dann gegen Deinen Willen!«
»Wenn Du das fertig bringst!«
»Gib acht!«, entgegnen Abd el Dschelil nur.
Sie standen so, dass sie das Lagerfeuer der Araber sehen konnten, selbst aber durch die Nacht verdeckt blieben.
Und nun hob Abd el Dschelil den linken Arm, beschrieb mit der ausgebreiteten Hand einen flachen Bogen am Himmel —
Noch ehe er die Hand wieder schloss und den Arm wieder senkte, sprangen drüben die braunen Gesellen mit allen Zeichen des Entsetzens auf, rannten zu den angepflockten Kamelen, lösten die Halfter, setzten sich auf und — ritten davon, so schnell die Tiere nur laufen wollten.
Ganz starr vor Verblüffung und Staunen stand Snatcher da.
Ja, was hatten denn nur die Leute, dass sie auf einmal in so wildem Schrecken flohen?
»Das sieht doch aus, als wäre der Teufel hinter ihnen her und wollte sie allesamt holen!«, knurrte er.
»Sage: der Scheitan!«, bemerkte Dschelil.
»Scheitan? Das ist doch eben der Teufel in Deiner Sprache!«
»Das denkst Du, aber der Teufel der Christen und der Scheitan der Söhne Mohammeds sind noch nicht dasselbe.«
»Und Du hast ihnen den Scheitan erscheinen lassen?«
Keine Antwort erfolgte.
Erst nach einer geraumen Weile sagte Dschelil:
»Nun wollen wir messen. Du, Abd el Hamid, wirst uns sagen, ob die Stelle die richtige ist, die ich so lange schon vergeblich gesucht habe.«
Da ergriff du Couret zum ersten Male wieder das Wort, nachdem er sich während all dieser Vorgänge ganz schweigsam verhalten hatte, als gingen sie ihn überhaupt nichts an.
»Die Nutationsberechnung stimmt. Der Platz ist gefunden.«
»So muss ich Dich loben«, bemerkte Dschelil und ging nun vorwärts, bis er fast an derselben Stelle stand, an welcher Snatcher vor Kurzem noch gesessen hatte.
»Nun zeige Deine Kunst, Hamid!«, sagte er.
»Nicht nötig, Dschelil! Das dritte Loch über dem untersten ist der Eingang.«
»Wozu denn nur?«, fragte Snatcher. »Ich komme mir vor, wie vor den Kopf geschlagen, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich denken soll! Da versprecht Ihr mir Hilfe und seid auch an der Stelle, wo ich Euch treffen sollte, aber was nun hier vorgeht, was Ihr eigentlich wollt —«
»Du wirst es sogleich erfahren«, entgegnete Dschelil. Du verstehst die Kunst des Lassowerfens?«
»Das will ich meinen.«
»So gib ihm das Seil, Hamid!«
Du Couret öffnete seinen Burnus, und nun zeigte sich, dass er ein ziemlich langes Seil um den Leib gewickelt trug, der übrigens in dünnes Leder gehüllt war.
Er löste dieses Seil, an dessen einem Ende ein schwerer Eisenhaken befestigt war, und reichte es Snatcher.
Doch dieser griff nicht zu.
»Was soll ich denn mit dem Dinge?«
»Als Lasso werfen!«
»Das da? Ich glaube, Du bist — — na, ich will nicht schimpfen, aber das musst Du Dir doch selber sagen, dass ich den Eisenhaken allein zwar in die Höhe schleudern könnte, doch nicht mit dem Seil daran — das reißt ihn doch gleich wieder zu Boden, ist viel zu schwer —«

»Dann kannst Du auch nicht Lasso werfen«, sagte da Dschelil, nahm den Haken in die rechte Hand, hob den vorderen Teil des Seiles mit der linken und schritt näher zu dem Felsen, in dem also viele Löcher sichtbar waren.
Dann hob er die rechte Hand, bog den Arm weit zurück und im nächsten Augenblick flog der schwere Eisenhaken durch die Luft und zog hinter sich das Seil her —
Es war also nicht zu schwer für die Kraft dieses Mannes, und noch mehr musste nun Snatcher wider seinen Willen die Treffsicherheit bewundern, sowie die Kunst, den Haken gerade so zu schleudern, dass er dort Halt gewann —
In das Gestein konnte er nicht eingedrungen sein, das war dazu viel zu hart. Da musste er schon irgendwie anders sich verfangen haben, und das würde sich ja auch gleich herausstellen, denn Abd el Dschelil hatte schon mit beiden Händen das Seil gepackt, hing sich einmal probeweise mit der ganzen Schwere seines Körpers daran und kletterte dann daran empor, immer so Hand über Hand greifend, sich nur ganz selten mit den Füßen gegen den Felsen stemmend —
Dieser war insgesamt hier vielleicht etliche vierzig Meter hoch. Die Öffnung, aus welcher nun das Seil herabhing, befand sich sechs bis sieben Meter unter dem oberen Rande, also immer noch gegen dreißig Meter über dem Boden, und eine solche Höhe zu erklettern, das will schon gemacht und gelernt sein, dazu gehört ebenso viel Kraft wie Gewandtheit —
Deshalb war erklärlich, warum Snatcher so staunte. Das war etwas, was ihm imponierte, wogegen vorhin die Zauberei oder was nun sonst es gewesen war, ihm gar keine Hochachtung abgenötigt hatte —
»Bitte!«, sagte da auch schon du Couret und machte eine entsprechende Bewegung, als Abd el Dschelil eben in dem Loche oben verschwand.
Und Snatcher folgte ihm sogleich, vielleicht nicht so gewandt klimmend, aber dafür mit desto zuverlässigerer Kraft.
Auch er kam oben an, und nun machte der Franzose den Beschluss.
Die Höhlung, in der sie alle drei nebeneinander Platz hatten, trotzdem sie von unten gar nicht so geräumig ausgesehen hatte, führte in das Innere des Felsens, und das Oberhaupt der Ibaditensekte schritt nunmehr in die gähnende Finsternis hinein.
Die Nacht ist keines Menschen Freund, sagt das Sprichwort und damit eigentlich eine Unwahrheit, denn eben die Nacht ist doch des Menschen größter Freund, weil sie ihm Ruhe bringt, Erholung — weil sie ihm ein zweites Leben beschert, das Traumleben, und da ist es ja noch recht fraglich, welches Leben eigentlich ein Traum ist, das, das der Mensch tagsüber führt oder jenes, das ihn nachts erwartet.
Wenn also die Nacht des Menschen Feind genannt wird, so kann sich das bloß auf die Finsternis beziehen, und die ist ja allerdings des Menschen Feind, weil diese eben Lichtwesen sind, des Lichtes bedürfen, um nicht nur leben zu können, sondern sich auch erst wohl zu fühlen. Aus diesem Grunde sind ja auch so viele Völker zur Sonnenverehrung gelangt, sind alle guten Götter auch lichte Götter, wogegen die bösen immer schwarz aussehen.
Diese Abneigung gegen die Dunkelheit ist also im innersten Wesen des Menschen begründet, und deshalb strebt er seit jeher danach, die Dunkelheit zu erleuchten oder ihre Dauer abzukürzen, er macht einen Teil der Nacht zum Tage —
Es gibt ja auch nichts Schrecklicheres, als im Dunkeln tappen müssen — in einer ganz unbekannten Gegend — nicht wissen, wohin man endlich kommen wird, ob Hindernisse vorhanden sind, Gefahren — und wenn es nur ein paar Stufen sind, man kann da doch schon den Hals brechen —
So erging es hier in dieser stockdunklen Höhle dem Harry Snatcher.
Er war in dieser Finsternis geradezu hilflos, gehörte zu jenen Menschen, die man nachtblind nennt. Er sah überhaupt nichts, konnte nur immer tasten, bald mit den Händen, bald mit den Füßen, und trotzdem rannte er bald hier, bald da an —
Er hätte am liebsten laut geflucht, aber er wagte es doch nicht, er hatte recht wohl erkannt, dass mit diesem Araber nicht zu spaßen war, so freundlich er auch ständig lächelte. Nein, mit dem mochte er nicht aneinander geraten —
Und außerdem — was hätte werden sollen, wenn er sich die Hilfe dieser beiden Männer verscherzte, wenn O'Donnell und die Olinda nicht wiederkamen?
Und als Harry Snatcher das dachte, da kam ihm — wie allen Menschen, die selber schlecht sind — auch gleich das Misstrauen.
Hatte etwa dieser Dschelil die Leute der Karawane in die Flucht gescheucht, damit er vollkommen wehrlos in die Hand der beiden gegeben sei?
Ja, Snatcher kannte die Wüste, hatte sich in ihr zurechtgefunden, auch noch in dieser Shebkha, wie die Araber dieses Gebiet hier nannten, aber alles Zurechtfinden wäre doch nutzlos gewesen. Ohne Kamele und ohne Wasser kam er nicht durch —
Und da musste Snatcher wenigstens innerlich fluchen. Er rasselte alle seine Paradeflüche herunter, und das verschaffte ihm eine große Erleichterung, gab ihm auch die Frechheit zurück, die ihn schier verlassen hatte.
Auf einmal blieb er stehen.
»Nee, so mache ich nicht mehr mit!«, sagte er. »Ich bin kein blinder Maulwurf, dass ich hier in dieser stockfinstern Unterwelt mich wohl fühle. Wenn ich meine Laterne nicht gebrauchen darf, dann kehre ich um!«
Und da wunderte er sich auch schon.
Die beiden vorausgehenden Männer blieben nicht nur nicht stehen, sondern schienen sich auch um seine Worte gar nicht zu kümmern. Sie antworteten nicht, gingen in gleichmäßigen Schritten weiter.
Und da hörte Snatcher auch etwas, was ihm vorher ganz entgangen war.
Die beiden schritten so ruhig und gleichmäßig dahin, als sähen sie ihren Weg deutlich vor sich. Sie tappten nicht und tasteten nicht —
»Merkwürdig!«, dachte Snatcher, aber er ärgerte sich auch, dass sie sich nicht um ihn kümmerten.
»Hört Ihr denn nicht?«, fragte er. »Darf ich Licht machen? Oder soll ich umkehren?«
Wieder kam keine Antwort. Die beiden waren unentwegt weitergegangen, der Klang ihrer Schritte wurde undeutlicher und undeutlicher, sie mussten schon ein ganzes Stück vor ihm sein — Snatcher wusste nicht, was er tun sollte.
Nachlaufen?
Das ging gegen seinen Trotz.
Umkehren?
Was gewann er dadurch? Nichts!
Wenn er an den Ausgang der Höhle zurückkam, war er allein, und wer bürgte ihm denn dafür, dass die beiden dann noch einmal zu ihm zurückkamen?
Die Araber der Karawane aber waren fort, die kamen nicht wieder. Snatcher kannte dieses abergläubische Gesindel genau genug —
»Himmel und Hölle!«, fluchte er innerlich. Dann riss er seine Taschenlampe heraus, stellte sie an —
Aber sie leuchtete nicht!
Sekundenlang stand Snatcher regungslos.
Er wusste ganz genau, dass das Ding in Ordnung war, die Batterie war noch wenig gebraucht und neu, und es war eine Sorte, die eigens für solche Wüstenfahrten gefertigt war, die nicht so leicht austrocknete.
Desgleichen war die Glühlampe von der besten Art, konnte nicht durchbrennen, höchstens unbrauchbar werden, wenn er die ganze Lampe fallen ließ, und das war doch nicht der Fall gewesen —
Ja, zum Teufel, was war denn nur los mit dem Dinge?
Harry Snatcher schraubte die Birne heraus, setzte eine andere ein, die er in einer Blechschachtel bei sich führte, drückte wieder —
Nichts! Die Lampe brannte nicht mehr.
Jetzt hielt sich der wütende Mann nicht mehr, er begann laut zu fluchen, tat sich gar keinen Zwang mehr an, die anderen hörten ihn ja doch nicht mehr, ebenso wenig, wie er sie hörte —
Und schon nahm er die Batterie heraus, brachte die beiden Pole mit seiner Zunge in Berührung, hatte sofort den salzigen Geschmack, der ihm anzeigte, dass der Strom noch vorhanden war —
Er schob sie wieder zurück in die Hülse, schloss diese, drückte —
Am liebsten hätte er das Ding an die Steinwand geschmettert!
So klug war er aber doch noch, es lieber nicht zu tun. Ganz hilflos wollte er nicht bleiben, und er hoffte immer noch, dass das Ding wieder arbeiten würde.
Nun aber lauschte er erst einmal.
Nichts war mehr zu hören.
Die beiden hatten sich also nicht um ihn gekümmert, keinerlei Rücksicht auf ihn genommen, waren weitergegangen und hatten ihn hier stehen lassen.
Auf einmal erschrak er derart, dass er gleich an allen Gliedern zu zittern begann!
Harry Snatcher war durchaus kein Feigling, stand in jedem Kampfe seinen Mann, aber hier war er — — — hilflos!
Seine Hände, die bisher noch die Steinwand gespürt hatten, griffen auf einmal ins Leere —
Ein Gang zweigte also hier ab.
Er wusste nicht, wohin die beiden gegangen waren; jetzt wusste er nicht, ob er geradeaus gehen musste oder hier rechts ab —
Und wenn er den falschen Weg einschlug?
Wenn immer neue Gänge abzweigten?
Nun, wer jemals ohne Licht in einem solchen Irrgange geweilt hat, der wird verstehen, dass auch diesem sonst so unerschrockenen Mann ein eisiger Schauder den Rücken hinablief.
Um Gottes willen nicht in dieser Unterwelt verirren, etwa hier unten verhungern und verdursten müssen!
Harry Snatcher war so erschrocken, dass er sogar das Fluchen vergaß.
»Nee, nee!«, stieß er hervor. »Nur nicht verlaufen und nicht wieder zurechtfinden! Entweder muss ich jetzt hier stehen bleiben, bis die beiden mich vermissen und zurückkommen, oder ich muss eben umkehren!«
Und für das Letztere entschied er sich.
Vorsichtig genug drehte er sich um, er wusste, dass alles davon abhing, denn wenn er sich jetzt täuschte, nur eine dreiviertel Drehung machte, anstatt eine ganze, wenn er dann zufällig wieder in einen Seitengang geriet, dann war er eben doch noch verloren.
Und Harry Snatcher wusste — als Mann, der viel in der Wildnis gelebt hatte — wie leicht sich ein Mensch verirren kann, er verstand nichts von den Gesetzen der Asymmetrie des menschlichen Körpers, aber er wusste, dass im Dunkeln der Mensch fast mit tödlicher Sicherheit im Kreise zu laufen pflegt, immer wieder an seinen Ausgangspunkt zurückkehrt.
Einmal schon hatte er einen solchen Fall erlebt, nicht in einer Höhle, sondern in einer vollkommen ebenen, freien Gegend.
Da hatte er mit zwei Kameraden drei Tage hindurch versucht, den verlorenen Weg wiederzufinden, sie waren gewandert und gewandert — und immer wieder hatten sie zu ihrem Entsetzen erkennen müssen, dass sie sich schließlich wieder an der Stelle befanden, wo sie gelagert hatten.
Es war entsetzlich gewesen. Nur das plötzliche Nachlassen des Nebels hatte sie gerettet.
Also brauchte Harry Snatcher alle Vorsicht.
Bisher hatte er sich immer an der rechten Steinwand entlanggetastet, jetzt setzte er also die linke Hand neben die rechte, die er noch an dem Felsen hatte.
So! Nun brauchte er sich bloß ganz umzudrehen und mit der linken Hand zu tasten, dann kann er sicher wieder ins Freie.
Er atmete aus, tat vorsichtig ein paar Schritte, versuchte auch wieder die Taschenlampe, die aber immer noch nicht brennen wollte, tappte weiter und — rannte mit dem Körper gegen ein Hindernis.
Verblüfft stand er still.
Mit der rechten vorgestreckten Hand tastete er nach vorn.
Das war Stein — — Stein — so weit er auch griff!
»Aha, da war eben eine scharfe Biegung!«, dachte er.
Die hatte er vorher gar nicht wahrgenommen.
Also an diesem Steine weitergetastet — Und da kam die Erkenntnis, die furchtbare Erkenntnis!
Das war keine Biegung des Ganges — —
Nein, das war eine Felswand, die diesen vollkommen abschloss.
Er hatte sich also doch verlaufen?
Himmel und Hölle —
Fluchend wendete sich Snatcher um, tappte wieder dahin, rannte abermals an — und dann —
Ja, da sank er doch gleich auf den harten Steinboden nieder und begann um Hilfe zu schreien, so sehr er nur konnte —
Er brüllte aus Leibeskraft — immer wieder und wieder — er schrie die Namen seiner beiden Begleiter —
Und lauschte!
Und hörte nichts! Gar nichts!
Nicht einmal das Tropfen fallenden Wassers, was sonst in Höhlen immer erklingt!
Hier gab es kein Wasser! Hier nicht!
Und er hatte keins bei sich, gar nichts — nicht einen Tropfen, nicht einen Bissen Brot — er musste elend sterben, wenn die beiden nicht umkehrten —
»Abd el Dschelil! Abd el Hamid!«, schrie er, dass die Steinwände dröhnten.
Aber keine Antwort klang zurück.
Schweigen und Finsternis waren um Harry Snatcher.
Da überkam ihn die Wut.
»Ihr verfluchten Hunde!«, schrie er und knirschte die Zähne aufeinander, ballte die Hände —
Bis er endlich daran dachte, einen Schuss abzufeuern.
Er griff nach dem Gürtel, fand keine Revolvertasche —
Auch das noch!
Harry Snatcher brach zusammen — —
Martha Richter, die Gattin oder vielmehr Witwe des Tauchers Flint, stand in der mächtigen Steinhalle dem Manne gegenüber, der sie aufgefordert hatte, hier einzutreten.
Das Dach des zehn Meter langen Gebäudes bestand, wie schon gesagt wurde, nur aus Binsen, die ganz roh zusammengeflochten worden waren, überall also Licht und Luft durchließen.
So konnte sie sich in aller Muße den Mann ansehen, der noch kein Wort gesprochen hatte, jetzt die Arme über der Brust verschränkte und ganz ruhig dastand, als wolle er ihr Gelegenheit geben, ihn zu mustern.
Was Martha Richter da sah, sagte ihr aber noch gar nicht viel.
Der Fremde war das, was wir Menschen einen Riesen nennen, obwohl es gar nicht zutrifft. Ein Riese ist eben schon jeder, der die gewöhnliche Körperhöhe überschreitet und dabei auch noch besonders stark gebaut ist, mächtige Hände hat —
Riesen sind schon oft gezeigt worden, werden auf fast allen Jahrmärkten zur Schau gestellt, aber immer sieht der Verständige gleich, dass diese Geschöpfe nur zu bedauern sind. Es sind eben arme Kranke, ebenso wie ihr Gegenstück, die Zwerge.
Das hängt mit einem Organ zusammen, welches den wenigsten Menschen bekannt ist, mit der sogenannten Hypophyse, einem sehr kleinen Anhang des Hirns, der sich zwischen der inneren Nase und der Stirnwölbung des Menschen befindet, im sogenannten Türkensattel, diesen ausfüllend, und von der Kreuzungsstelle der beiden Sehnerven überdeckt ist.
Das ist ein ganz eigentümliches Ding. Es hat fast den Anschein, als wäre da von dem flüssigen Gehirn ein Tropfen abgesondert worden und erstarrt. Dieser Tropfen hängt auch noch mittels eines dünnen Stieles fest am Hirn, und die neuesten Forschungen haben festgestellt, dass diese Hypophyse die wichtigste Wohlfahrtszentrale des Menschenkörpers darstellt, dass nur durch sie der menschliche Körper seine Gestalt erhält, dass, wenn dieser winzige Tropfen, der aber fest ist, zu wuchern beginnt, der ganze Leib sich ändert, dass eben Riesen entstehen.
Das sind solche Riesen, die als Kranke bezeichnet werden müssen. Das ist gleich daran zu erkennen, dass namentlich die Weichteile ihres Körpers sich übermäßig entwickeln, die Nase, die Lippen, die Lider, dann aber auch die Hände, die Füße, die Zunge sogar — man merkt deutlich, wie das Unterhautbindegewebe da krankhaft wuchert.
Und umgekehrt führt jede Verkümmerung dieses feinen Hirnanhanges unbedingt zu zwerghaftem Wuchse.
Das ist durch Versuche an Tieren unweigerlich und unzweifelhaft festgestellt worden.
Man kann also bei Tieren Riesenwuchs und Zwergwuchs schon künstlich erzeugen.
Davon wusste Martha Richter, da sie in der Stadt, wo sie ihre Bildung genossen hatte, auch Gelegenheit gehabt hatte, anatomische und andere medizinische Vorlesungen zu hören, und so ist erklärt, warum sie also diesen riesenhaften, rothaarigen Menschen so genau betrachtete — sie nahm eben an, es läge hier eine krankhafte Missbildung vor, und da immer in einem kranken Körper auch eine kranke Seele wohnt, so hätte sie also, wenn das der Fall gewesen wäre, diesem Manne mit Misstrauen begegnen müssen.
Das hatte sie nun freilich nicht nötig.
Der Unbekannte war trotz seiner Größe vollkommen normal gebaut, hatte weder übermäßig lange Hände noch ebensolche Füße, sein Gesicht war ganz regelmäßig, wies nicht die vorstehenden Backenknochen auf, die ebenfalls ein Merkmal krankhaften Riesentums sind —
Und da bot sie ihm auch schon die rechte Hand zum Gruße und sagte etwas, was ja etwas wunderbar klang — oder nicht nur etwas — sondern sehr wunderbar.
Sie sagte.
»Sie bringen mir eine Nachricht von meinem Mann, von Richard Flint?«
Und darauf geschah das noch Merkwürdigere.
Dass dieser Mann sich durchaus nicht über diese doch ganz unerwartete Frage wunderte, sondern ganz schlicht mit einem »Ja« antwortete.
Man muss sich das nur erst vorstellen, um das Wunderbare daran zu verstehen.
Richard Flint war mitten im Stillen Ozean auf den Meeresboden hinabgetaucht, hatte noch aus der Tiefe mit seiner Frau gesprochen, hatte allerlei konfuses Zeug geredet, und dann war es auf einmal aus gewesen. Er war also tot, verunglückt.
Darauf hatte diese Frau, nunmehr eine Witwe, eine geheimnisvolle Botschaft aus eben dieser Meerestiefe erhalten, hatte auch gleich die erhaltene Weisung befolgt, war nach dem einsamen Rapanui gefahren, hatte dort eine der Terrassen aus grauester Vorzeit bestiegen, hatte in einem dieser sicher früher heilig gewesenen Häuser den rothaarigen Mann stehen sehen — er hatte ihr gewinkt — sie war zu ihm gegangen, hatte ihn sich angeschaut und ihn dann gleich gefragt, ob er ihr eine Nachricht von ihrem Manne brächte!
Was auch alles über die Liebe schon geschrieben worden ist, namentlich über die Liebe einer Frau zu ihrem Manne, es ist immer noch lange nicht erschöpfend, weil die Liebe eben alle Tage neue Wunder schafft — aus sich selbst heraus.
Oder war es etwa kein Wunder — kein heiliges Wunder — wenn diese Frau hier trotz allem, was sie erlebt hatte, fest überzeugt war, dass ihr Mann noch am Leben sei, sich mit ihr in Verbindung setzen könne?
Ja, es war ein heiliges Wunder, und deshalb stellte der rothaarige Riese auch gar keine Zwischenfrage, horchte sie nicht aus, sondern sagte eben nur »ja!«
»Ich wusste es!«, jubelte da die kleine Frau auf. »Ja, o ja, ich wusste es! Mein Richard hätte mich nicht so schnöde im Stiche lassen können!«
Und vor dieser Liebe neigte der Mann abermals in Ehrfurcht sein Haupt, und es war keine Gotteslästerung, wenn er jetzt die Worte des Heilands brauchte und sagte:
»Weib, Dein Glaube hat Dir geholfen!«
Martha Richter fand nichts dabei, es war ihr alles so ganz selbstverständlich —
»Was also haben Sie mir zu sagen?«, fragte sie und fasste jetzt gleich mit ihren beiden schmalen Händen die mächtigen Pranken des Mannes, so ganz vertrauend, so ganz überzeugt, dass er ihr würde helfen können.
Er führte sie zu einem Platze an der Längswand des Gebäudes.
Dort lagen die Trümmer einer mächtigen Steinplatte, und es war deutlich erkennbar, dass diese einst als Dach dieses Gebäudes gedient hatte, aber nicht so ganz offensichtlich war, wie die Urbewohner der Insel diese doch zehn Meter lange und drei Meter breite Steinplatte hatten herstellen können, und noch weniger, wie es ihnen ohne Hilfe von Maschinen gelungen war, sie als Dach auf das Gebäude zu bringen.
Die Platte war später zerbrochen oder zertrümmert worden, ihre Stücke lagen umher, und der Rothaarige hatte aus ihnen eine Art Bank errichtet, auf welcher sie beide nun Platz nahmen.
»Ihr Gatte, Richard Flint, hat Ihnen von mir schon erzählt?«, fragte der Fremde nunmehr.
»Gar nichts«, lautete die Antwort.
»Er hat Ihnen aber mitgeteilt, warum er nach dem Stillen Ozean fuhr?«
»Auch nicht! Oder doch — zuletzt — als er schon bald den Meeresboden erreicht haben musste oder schon auf ihm stand —«
»Und was sagte er da?«
Martha Richter schaute den Frager prüfend an, aber keineswegs misstrauisch.
»Wenn Sie Bescheid in der Sache wissen, dann brauchen Sie diese Frage nicht an mich zu richten, sonst könnte und dürfte ich Ihnen auch nicht antworten.«
Und wieder leuchteten die Augen des Rothaarigen auf.
»Ich weiß Bescheid«, sagte er. »Ich will es Ihnen beweisen. Ihr Gatte sprach von geheimen Zeichen, die auf dem Rücken eines Menschen eintätowiert wären. Er nannte auch den Namen — Loke Klingsor —«
»Ja, das stimmt!«, gab Martha Flint sogleich zu.
»Da Sie also sehen, dass ich Sie nicht aushorchen will, werden Sie sich wohl nun nicht mehr weigern, mir zu erzählen, was er Ihnen zuletzt noch sagte?«
Die junge Frau nickte und berichtete ohne Zögern, fügte auch keine Bemerkungen bei, etwa, dass sie sich gewundert hätte, sondern behauptete am Schlusse nur:
»Als Richard mir das anvertraute, war er bei voller Geistesklarheit.«
»Davon sind Sie fest überzeugt, trotzdem es doch auf dem Meeresgrunde weder ein Schloss noch schöne Mädchen geben kann? Es sei denn, Sie glaubten noch an Märchen —«
Frau Flint schaute den Sprecher groß an.
»Jedes Märchen enthält eine Wahrheit, eine uralte sogar«, erwiderte sie ruhig. »Auch das Märchen von Nixen und Seejungfern, von Glaspalästen auf dem Meeresgrunde.«
»Es handelt sich hier aber um kein Märchen, sondern um eine Tatsache.«
»Desto besser!«
»Dieser Palast auf dem Meeresgrunde ist da, und in ihm wohnen schöne Frauen —«
»Die unter Wasser leben können?«
»Unter Wasser ja, aber natürlich nicht im Wasser, also nicht ohne Luft. Doch davon brauchen wir nicht zu sprechen. Sie werden es mit eigenen Augen sehen, wenn auch auf andere Weise als Ihr Gatte.«
»Ich darf zu ihm?«, fragte die junge Frau gleich wieder jubelnd. »O, Richard, Richard! Wenn ich Dich wiederhabe, darfst Du aber nicht wieder tauchen — nie mehr!«
Sie gewahrte das leichte Lächeln, das den bärtigen Mund des Riesen umspielte, und sie verstand es auch gleich.
»Nicht aus Eifersucht!«, verteidigte sie sich. »Und wenn tausend der schönsten Frauen dort wären, mein Richard liebt doch nur mich. Das weiß ich, da habe ich kein Misstrauen — nein, deswegen sagte ich das nicht, ich will bloß meinen Mann nicht mehr in solchen Gefahren wissen, wir können doch auch so schön leben, und selbst wenn wir arm wären, wäre es doch viel schöner, wir könnten arbeiten — in Gottes Luft und Gottes Sonne —«
Da hob der Fremde die rechte Hand.
»Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Frau Flint!«, sagte er, und seine Stimme bebte leise dabei.
Da erst errötete sie, ward sich bewusst, dass sie einem Fremden Einblick in ihr Herz gestattet hatte, aber sie schämte sich dessen doch nicht, wartete nun aber schweigend, was weiter kommen würde.
»Ihr Mann sprach auch von dem, der ihn nach dem Stillen Ozean geschickt hätte?«, fragte der Rothaarige.
»Er redete von einem Herrn in New York.«
»Der Name?«
»Ich weiß nicht —«
»Nun, ich will Ihnen alles sagen.«
Der Fremde begann zu erzählen, und er wusste auch wirklich alles von den vier Expeditionen, die Mister Samuel Philipp ausgerüstet hatte, er nannte nur nicht die Namen der Teilnehmer.
»Die vierte Expedition, die Ihr Gatte führen sollte, war also hierher nach dem Pazifik bestimmt. Der ausgesetzte Preis betrug eine Million Dollar für jeden — es kann aber auch sein, dass dem berühmten Taucher mehr versprochen wurde. Deshalb tauchte er also, und Mister Samuel Philipp hat sich nicht geirrt, die Sandbank ist wirklich dort vorhanden, deshalb konnte Richard Flint dort einen Tauchversuch wagen, und er hat ja auch sein Ziel erreicht —«
»Er hat also diesen Loke Klingsor entdeckt?«
»Sicher! Indes zu spät! Als er selbst schon in der Gewalt dieses Mannes war, also seinen Auftrag nicht mehr ausführen, zu Ende bringen konnte.«
»Sie meinen, er sei gefangen?«
»Ja, das meine ich.«
»Und wer schickte mir da die Botschaft, die mich hierher führte?«
»Wer könnte das wohl getan haben?«, fragte der Rothaarige dagegen.
»Doch wohl dieser Loke Klingsor«, gab Frau Flint sofort zurück.
»Und zu welchem Zwecke sandte er diese Botschaft?«
Nur kurze Zeit überlegte die junge Frau, dann rief sie:
»Weil er will, dass ich zu meinem Manne kommen soll!«
»Aber dieser ist doch gefangen, er kann doch gar nicht mehr sein Vorhaben ausführen«, wendete der Rothaarige ein.
Da freilich blitzten die Augen der Frau ihn ganz eigenartig an.
»Wenn Richard Flint etwas verspricht, dann hält er es auch, unter allen Umständen!«
»Auch dann noch, wenn er gefangen ist?«
»Ach, den vermag doch niemand zu halten! Er ist ja nicht so groß wie Sie, aber sicher ebenso stark.«
Der Rothaarige nickte.
»Das stimmt«, sagte er auch noch. »Wir beide sind gleich stark, und eben deswegen sind wir ja zusammen gerade hierher geschickt worden, denn hier können nur starke Menschen zu dem Ziele kommen, das Mister Philipp erreicht zu sehen wünscht.
Bloß Sie selbst sind freilich keine Riesin!«, setzte er lächelnd hinzu.
»Ich? Nein, die bin ich nicht, dem Körper nach nicht, aber an Willensstärke übertrifft mich keine.«
»Und nicht an Liebe und Treue!«, setzte der Rothaarige innerlich hinzu.
»Deshalb sind Sie ja auch als unsere Gefährtin ausersehen worden. Ich sagte Ihnen schon, dass immer zwei Männer und eine Frau zusammengehören, und jede dieser Frauen soll den Loke Klingsor an sich locken, ihn betören, dass er die Vorsicht vergisst, dass sie ihm das Geheimnis vom Rücken stehlen können!«
Da freilich öffnete Martha Flint die Augen weit und entsetzt.
»Ich soll —«
Der Mann hob die Hand.
»Machen Sie sich keine Gedanken. Die Zeit wird lehren, was von Ihnen verlangt wird, jedenfalls möchte ich Ihnen noch etwas Bescheid über diesen Loke Klingsor geben —«
Er wurde unterbrochen.
»Ist er ein Bösewicht?«, fragte Martha Flint.
Und sie beantwortete sich diese Frage auch gleich selbst.
»Nein, das ist er nicht, sonst hätte er mich nicht benachrichtigt, mir nicht die Botschaft gesandt — und da mag ich auch gar nichts weiter von ihm wissen. Erzählen Sie mir also nichts, Herr —«
Jetzt erst besann sie sich, dass sie seinen Namen noch gar nicht wusste.
»Ich heiße Berndt Fehrmann, bin ein Schleswiger und von Beruf NavigationsSchullehrer.«
Indem er das bekannte, gab er auch gleich etwas anderes zu: dass er ein befahrener Seemann war, denn als Lehrer einer solchen Schule wird — nach bestandenen Prüfungen — nur immer einer angestellt, der eine entsprechende Seefahrtszeit nachweist, er muss als Matrose vor dem Mast gefahren sein, auf Segelschiffen, mindestens vier Jahre —
Davon verstand Frau Martha etwas, das hatte sie von ihrem Manne erfahren, und obwohl sie das Seeleben selbst nicht liebte, erschienen ihr doch alle Seeleute liebenswert, weil sie eben da den Maßstab anlegte, mit dem ihr Richard gemessen werden musste, und da wusste sie ja auch weiter, dass diese Seeleute unter einer rauen Schale meistens einen recht edlen Kern bergen.
»Ja, also Herr Fehrmann, da erzählen Sie mir lieber nichts weiter von diesem Loke Klingsor, sondern sagen Sie mir, wie ich zu ihm und zu Richard kommen kann!«
»Finden Sie nicht merkwürdig, dass er Sie wissen ließ, Sie würden mich hier finden?«, fragte Fehrmann.
»Ja, jetzt allerdings —«
»Und dass ich wusste, Sie würden kommen?«
»Er hat es Ihnen eben auch gemeldet!«
»So ist es und ich will Ihnen zeigen, wo das geschah. Jedenfalls wissen Sie nun, trotzdem Sie nicht fragen wollen, dass dieser Loke Klingsor von dem Abgange und dem Zwecke unserer Fahrt vollständig unterrichtet ist, dass er weiß, was wir von ihm wollen, dass er sich dagegen gewehrt hat, indem er Richard Flint gefangen nahm, und dass er auch uns als Feinde empfangen, sich unser bemächtigen wird, sobald er es vermag.
Sind Sie da noch bereit, mit mir zu gehen?«
Frau Martha schaute ihn groß an.
»Ich muss doch zu meinem Manne«, sagte sie dann.
Da stand Berndt Fehrmann auf, ohne noch ein Wort zu sagen, trat zur Tür, ließ Frau Flint an sich vorüber ins Freie treten und folgte ihr selbst nach.
Die Matrosen des Taucherschiffes, die schon recht ungeduldig geworden waren, sahen die beiden herauskommen und liefen gleich hin, umringten sie — aber keiner hatte eine neugierige Frage.
Da wendete sich Berndt Fehrmann an sie und sagte:
»Ich habe mit Frau Flint noch einige Zeit hier zu tun, und zwar etwas, was nur wir allein tun können. Ihr müsst Euch also wieder auf das Schiff begeben und auf unsere Rückkehr warten.
Seht Ihr dort drüben den einzelnen Felsen aus dem Meere ragen?«
Ja, den sahen sie natürlich alle.
»Gut, wenn Ihr uns abholen sollt, dann werdet Ihr aus der Höhe dieses Felsens eine Rauchsäule hervorsteigen sehen.«
»Und wir sollen immer hier im Hafen liegen bleiben?«, fragte Griepenkerl. »Das wird doch sicher eine langweilige Geschichte. Oder dauert es nicht lange?«
»Das kann ich nicht sagen, aber Ihr braucht nicht hier zu liegen. Frau Flint erlaubt Euch, dass Ihr eine kleine Entdeckungsfahrt macht, dass Ihr diese oder jene Insel anlauft und landet — amüsiert Euch nur, Jungens, — Ihr wisst doch, wo Ihr seid —«
»Und wenn wir zu weit wegfahren?«
»Ihr werdet trotzdem erfahren, wenn wir Euch brauchen.«
Da bisher nur der Fremde gesprochen hatte, so schauten die Leute nun auf die Frau ihres Kapitäns, und sie nickte.
»Fahrt nur!«, sagte sie. »Um mich braucht Ihr Euch nicht zu sorgen. Ich will nur den Richard wieder holen.«
Da hatten die Matrosen nichts mehr einzuwenden, die Entdeckungsfahrt lockte — die Männer trollten sich, schritten dem Strande zu, bestiegen die Boote und setzten nach dem Dampfer hinüber.
Währenddessen aber stiegen die beiden nun schon einen steinigen Hang hinan, kamen an manchem Zeugnis früherer Kultur vorüber, an Bildwerken, die in den Fels gemeißelt waren, an Hieroglyphen und ähnlichen Beweisen uralter Kunst, achteten aber nicht darauf.
Auf der Höhe des Felsens, die etwa dreihundert Meter betragen mochte, blieben sie stehen und schauten nach dem Schiffe zurück.
Es hatte bereits die Anker eingenommen und schwamm lustig auf der glatten Flut.
Was Frau Martha bei diesem Anblick dachte, verriet sie nicht. Ihre Augen waren allerdings etwas feucht; es war doch ihre Heimat, die dort hinging, auf dem plumpen Kasten hatte sie mit ihrem Richard so manche schöne Stunde verlebt — und wie zärtlich diese menschliche Bulldogge hatte sein können, das wusste doch sie allein. —
Diese Regung aber war schnell bezwungen.
Berndt Fehrmann hatte ein Messer gezogen, eine solche lange dolchähnliche Klinge, wie sie vielfach von Seeleuten geführt werden, als dalekarlische Messer bekannt.
Mit dieser Messerklinge stach er bald hier, bald da in das Gestein, wollte es vielmehr — immer glitt natürlich die Spitze ab.
Frau Martha sah es, wunderte sich auch darüber, sagte aber nichts, bis es ihr doch zu dumm wurde.
»Warum ruinieren Sie denn das Messer?«, fragte sie. »Das ist doch harte Lava. Da gibt es nichts zu stechen oder zu schneiden!«
»Ja, Lava ist es«, gab Berndt Fehrmann zu, »aber was bedeutet denn dieser Name, Frau Flint? Doch nur, dass es sich um Gestein handelt, das als feuerflüssige Masse von einem Vulkan ausgespien wurde, und da ist Basalt ebenso gut Lava wie Diorit oder Gneis — nicht wahr?«
Ja, das musste sie zugeben.
»Hm«, machte Berndt Fehrmann darauf. »Sie haben doch unten die kolossalen Steinfiguren gesehen, nicht wahr? Aus was bestanden die denn?«
»Aus Lava, so viel ich sehen konnte.«
»Und die rote Krone, die sie alle auf dem Kopfe haben, oder diesen zylinderförmigen Hut? Der ist doch bei allen rot.«
»Den haben sie eben aus einem anderen Gestein gemeißelt.«
»Nun, wir werden sehen, aber es müssen wunderbare Künstler gewesen sein, die so etwas fertiggebracht hätten, und vor allem bewundernswert müssen die Werkzeuge gewesen sein, mit denen sie solche Arbeiten vollbringen konnten. An dieser harten Lava splittert doch der beste Stahl, und trotzdem sieht man an keiner der Bildsäulen auch nur den leisesten Messerstich.«
So schritten sie auf der Höhe hin, bis sich vor ihnen ein weiter Trichter auftat, einer jener unzähligen Krater, welche den eine Quadratmeile umfassenden Boden der Osterinsel bedecken, längst erloschen, nicht einmal eine Rauchwolke mehr aussendend, also ganz ohne Gefahr zu betreten.
Auch hier bestanden die Wände aus Terrassen, die gleichsam ein großes Amphitheater bildeten, stellenweise ganz glatt, wie von Menschenhand gearbeitet.
Und in diesen Krater kletterte Berndt Fehrmann nun hinab, dabei seine Begleiterin sorgsam stützend.
Bald standen sie auf der dritten Terrasse, und nun setzte Fehrmann auch sein Messer wieder in Tätigkeit.
Diesmal aber mit besserem Erfolge als vorher.
Die Gesteinsdecke sprang, ließ sich leicht entfernen, und nun sah Martha Flint, wie die Klinge tief in die Wand eindrang, wie der rothaarige Riese einen ganzen Klumpen herausschnitt. ihn in die Hand nahm und drückte —
Es sah aus wie ein roter Lehm, aber auch wieder anders.
Und auf einmal schnitt Beredt Fehrmann mit seinem Messer aus dieser weißen Masse eine kleine Gestalt, einen Mann —
Und da ging der jungen Frau ein Licht auf.
Aus dieser weichen Masse hatten die Urbewohner der Insel ihre mächtigen Steinfiguren geformt, sie einfach aus dem Felsen, der unter der Oberschicht ganz weich war, herausgeschnitten, sie erhärten lassen und dannunten aufgestellt!
So musste es wohl gewesen sein, und sie sah auch, wie diese Erde, die erst so weich war, recht bald erhärtete, erst außen, dann aber durch und durch — sich in einen harten Stein verwandelte —
»Was für merkwürdiges Zeug ist denn das nur?«, fragte sie, denn davon hatte sie auf der Schule nichts gelernt, auch nicht in den Hörsälen.
»Das nennt man Seifenstein«, erklärte ihr Begleiter, »ein Mineral, das an verschiedenen Stellen der Erde vorkommt, hier in einer ganz besonderen Art. Sie können es auch in Europa finden, sogar in Deutschland, aber da ist es immerhin selten, ist sein Vorkommen auf einzelne Orte beschränkt, hier finden Sie es vielfach, auch drüben auf dem Festlande von Australien. Man ist, weil es so häufig vorkommt, sogar auf den Gedanken gekommen, es auszuführen, man wusste eben nur nicht, wie man es weich und geschmeidig erhalten sollte, und das weiß man heute noch nicht, deshalb hat es auch gar keinen Wert, findet keinerlei Beachtung mehr. Wir aber können dieses Vorhandensein des Seifensteins recht gut ausnutzen, wie Sie gleich sehen werden.
Noch einmal aber muss ich Sie fragen: Fürchten Sie sich?« Frau Martha schüttelte den Kopf.
»Sie haben vorhin den Felsen gesehen, den ich den Matrosen zeigte, Sie sehen ihn noch«, fuhr Berndt Fehrmann fort. »Sie hörten, wie ich sagte, dass die Leute die Beendigung unserer Arbeit hier durch ein Rauchsignal auf der Höhe dieses Felsens angezeigt erhalten sollten.«
»Ja, das habe ich gehört«, gab die junge Frau zu. »Und haben sich nicht darüber gewundert, sich nicht gefragt, wie ich auf diesen doch unersteiglichen Felsen hinaufkommen wollte?«
»Nein. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht.« Berndt Fehrmann verstand sie.
Er hatte es eben mit einer Frau zu tun, und Frauen denken mit dem Herzen, nicht mit dem Kopfe — das heißt die echten Frauen — unter den anderen gibt es leider gar zu viele, die den Verstand allein herrschen lassen.
Frau Martha Flint kannte nur noch eine Aufgabe: ihren Richard wiederzukriegen, und da war ihr alles recht, da war sie bereit, alles zu dulden, da fragte sie aber auch nicht nach den Möglichkeiten, denn — wieder als echte Frau — schenkte sie diesem Manne ihr Vertrauen ganz — ein Zwischending gab es da nicht, wie dies überhaupt nicht sein kann, wenn Vertrauen in Frage kommt — und so überließ sie es ihm vollkommen, wie er sie an das Ziel bringen wollte.
Berndt Fehrmann lächelte, als er weiterfragte: »Wie denken Sie sich die Ersteigung dieses Felsens, Frau Flint? Bin ich nicht etwas leichtsinnig gewesen, als ich den Leuten das Rauchsignal von der Höhe dort versprach?«
Vielleicht hatte er auf die erste Frage gar keine Antwort erwartet, auf die letzte aber ein »Nein«.
Die junge Frau schaute nach dem Felsen. Sie dachte nach.
»Der sieht fast aus wie ein mächtiger Schornstein«, sagte sie endlich, »und weil Sie versprochen haben, dort oben ein Rauchsignal erscheinen zu lassen, so werden Sie auch eine Möglichkeit haben, hinaufzukommen. Ich denke mir, der Felsen ist hohl, man kann ihn von innen ersteigen.«
Da hatte er es!
Niemals hatte Berndt Fehrmann vermutet, dass diese Frau auf eine solche Vermutung kommen könnte, und nun hatte sie gleich das Richtige getroffen. Deshalb nickte er nur und gab ohne Zögern die weiteren Erklärungen.
»Der Zugang führt durch diesen Krater«, sagte er. »Wir müssen ein Stück in seine Tiefe dringen, dann stoßen wir auf einen Gang, den wir verfolgen müssen, und das Weitere werden Sie ja selbst sehen.«
»Wir müssen in diesen Krater?«, fragte Frau Martha, jetzt doch etwas verdutzt. »Das wird aber sehr schwer sein.«
»Gar nicht! Ich habe alles schon vorbereitet. Sehen Sie nur her!«
Hinter einem Steinblock, der hier einen ganz fremdartigen Anblick bot, da er gar nicht herzugehören schien, holte er mehrere Seile hervor, aus bestem Manilahanf gefertigt, wie die junge Frau sie vom Schiffe her kannte, aber auch kleine Eisenstäbe, mit einer scharfen Spitze am einen Ende. dabei diese Spitze gezackt, wie man es bei Dübeln findet, die in eine Mauer eingelassen werden sollen.
Frau Martha Flint verstand sogleich.
Berndt Fehrmann fand Erklärungen nicht mehr für nötig, entfernte mittels des Messers die Steindecke von einer neuen Schicht Seifenstein dicht am Kratertrichter, stieß einen der Stäbe mit aller Kraft in die weiche Masse und befestigte das eine Seilende mit einem Seemannsknoten daran.
Noch während dieser Arbeit war die Oberfläche des Seifensteins wieder erstarrt. Diese Erstarrung pflanzte sich nach innen fort, und nach einer ganz kurzen Zeit musste das Eisen so fest in der Wand stecken, als bilde es von jeher einen Teil von ihr.
So war es in der Tat.
Der Eisenstab saß so fest, dass er noch eine ganz andere Last hätte tragen können als nur den Körper dieses riesenhaften Mannes, und nachdem dieser nun die einzelnen Seile miteinander verknüpft hatte, gaben sie insgesamt eine Länge von etwa dreißig Metern.
»So, Frau Flint, nun kann der Abstieg beginnen, und da Damen allemal den Vortritt haben, bitte —«
Frau Martha guckte nur eine Sekunde lang in die schwarze Öffnung. Dann aber bewies sie, dass sie wirklich großen Mut besaß.
Sie kniete nieder, fasste das Seil oben und glitt an ihm in den Schlund hinein.

Noch eine Weile war ihr Kopf sichtbar, ihr aufwärts gerichtetes Gesicht schaute auf Berndt Fehrmann, der ihr freundlich zunickte.
Dann verschwand sie in dem ziemlich engen Loche, aus welchem also vor Urzeiten glühende Gesteinsmassen und feuerflüssige Lava hervorgeschleudert worden waren.
Berndt Fehrmann verharrte lautlos und regungslos, bis aus der Tiefe wie durch ein Sprachrohr ein Ruf erscholl.
»Ich stehe auf ebenem Boden!«, meldete Frau Flint. »Ein Gang zweigt ab.«
»Ich komme sofort!«, antwortete er, schaute sich noch einmal um und glitt dann ebenfalls in den Schlund des Kraters hinein.
Bald stand er neben Frau Flint.
»Lassen Sie mich nun wieder vorangehen!«, bat er. »Sie fassen mich am besten am Rocke, dann brauchen Sie sich nicht an der Wand entlang zu tasten und können die Augen schließen, denn sonst könnten Sie, wenn Ihnen plötzlich wieder Licht entgegendringt, geblendet sein.«
Und Frau Martha gehorchte ohne Weiteres.
Sie fasste einen Zipfel des Rockes von Berndt Fehrmann, schloss die Augen, wie er es ihr geraten hatte, und schritt tapfer vorwärts, hinein in die finstere Nacht, ohne dass ihr das Herz nur irgend schneller klopfte als zuvor.
Dieses Marschieren dauerte übrigens nicht lange.
Schon nach etwa hundert Schritten, von denen jeder etwa einem Dreiviertelmeter entsprochen hatte, sagte Berndt Fehrmann.
»Jetzt können Sie die Augen langsam wieder öffnen.«
Frau Flint tat es, schloss sie jedoch gleich wieder.
Die Warnung ihres Gefährten war berechtigt gewesen, denn ihr strahlte eine schier übernatürliche Helle entgegen, und als sie die Lider wieder zu heben wagte, erkannte sie auch die Ursache.
Sie stand in einem geräumigen Felsenkessel, den sie hier gar nicht hatte vermuten können, und seine Wände wurden durch ganz glatte Felsen gebildet, so glatt, als seien sie poliert oder ganz aus Glas gegossen.
Das gleißende Licht der südlichem Sonne wurde in den grellsten Strahlen von ihnen zurückgeworfen, dass die Augen schmerzten.
Da war es erklärlich, dass sie gleich fragte, was für ein merkwürdiges Gestein das wäre.
»Glasflüsse, durch die Ausbrüche dieses Vesuvs hervorgerufen«, erklärte Berndt Fehrmann.
»Nun folgen Sie mir weiter«, fuhr er fort. »Sie sehen hier überall Gänge, die nach allen Richtungen hin abzweigen. Ich will Sie nicht erst fragen, ob Sie sich denken können, wie sie entstanden sind, will es Ihnen nur gleich sagen, wenigstens, was ich darüber denke.
Sie haben unten die kolossalen Steinbilder gesehen und nun auch schon erfahren, wie sie geschaffen worden sind. Wer die Bildhauer waren, weiß ich nicht, das weiß niemand. Man hat einmal angenommen, dass dasselbe Volk, das die Kolossalbauten in Peru schuf, das dort ganze Tempel aus einem einzigen Felsen meißelte, auch hierher verschlagen worden sei. Von dieser Anschauung ist man längst wieder abgekommen. Die Entfernung zwischen hier und dem südamerikanischen Kontinent ist viel zu groß.
Eine andere Erklärung fand man aber auch nicht, nimmt vielmehr an, dass hier einst ein geheimnisvolles Urvolk gelebt hat, das diese Bilder schuf, dann aber auswanderte — irgendwohin — später kamen dann Malaien auf diese Insel, deren Nachkommen die jetzigen Bewohner sind —
Ich habe mir darüber meine eigenen Gedanken gebildet. Ich denke, vor alters haben hier einmal Chinesen gehaust, die bekanntlich überall auf der Erde zu treffen sind, früher aber noch viel häufiger zu treffen waren als jetzt. Man nimmt sogar an, dass sie die ersten Entdecker Amerikas gewesen sind, weil man dort allerhand Spuren gefunden hat, die darauf schließen lassen. Die Chinesen aber sind nie Künstler gewesen, werden es nie werden, und was sie an Bildwerken geschaffen haben, das ist geradezu jämmerlich. So jämmerlich wie diese Statuen unten, die doch aussehen, als hätte ein Kind sie geformt, deshalb haben sie auch keine Arme, keine Beine, keine Füße. Dazu hat die Kunst der Hersteller nicht gereicht. Da ist es ihnen ergangen wie Kindern, die aus Ton Männchen bilden, aber die Arme fallen immer wieder ab, wollen nicht halten, und da machen sie eben die Männchen ohne Arme —
Jedenfalls haben diese Urbewohner von Rapanui die ganze Insel durchwühlt, was ja sehr leicht war, da sie überall auf den weichen Seifenstein stießen. Die Gänge, die Sie hier sehen, stammen aus jener Zeit, sind seit vielen Jahrhunderten nicht mehr betreten worden, der Zugang durch den Schlund des Kraters bewirkte, dass sie sogar den vielen Forschungsreisenden unbekannt blieben, die doch diese Insel sorgsam durchsucht haben.
Und nun kommen Sie und sehen Sie, was ich da gefunden habe!«
Martha Flint hatte zwar mit großem Interesse diesen Erklärungen gelauscht; sie bewunderte diesen Mann immer mehr, aber sie war doch froh, dass sie aus diesem glitzernden Tale mit den Glaswänden heraus durfte, folgte ihm gern in den dunklen Gang, und da er ihr nicht geraten hatte, ihn wieder am Rocke zu packen, so tat sie es nicht.
Sie hatte es gar nicht nötig, der Gang war kurz, und dass er ihr so dunkel erschienen war, das rührte davon her, dass er eine scharfe Ecke beschrieb.
Nachdem diese umgangen war, strahlte ihr wieder helles Licht entgegen.
Abermals betraten die beiden einen Felsenkessel, aber er war nicht nur viel geräumiger als der vorige, sondern bestand auch aus dem gewöhnlichen vulkanischen Gestein, die Wände sahen also schwarz aus.
Dafür aber wies er eine andere Merkwürdigkeit auf.
An der einen der Wände, die fast alle, bis auf geringe Unterschiede, gleich lang waren, standen acht Steinfiguren, ebenfalls riesengroß, durchschnittlich acht bis neun Meter hoch.
Aber diese Steinbilder waren ganz anders als jene, die im Tale unten auf den Terrassen noch standen oder bereits umgefallen waren. Sie waren nicht von der Hand eines noch kindischen Volkes geschaffen worden, sondern von Meistern der Bildhauerkunst.
Jede von ihnen stellte einen Mann dar, mit Armen, Beinen und so weiter — das heißt, von den Beinen sah man eben nur die Füße, da der ganze Körper in ein weites, faltenreiches Gewand gehüllt war, aber da war alles bis aufs feinste ausgearbeitet. Der Künstler hatte sogar verstanden, dem Stein Ähnlichkeit mit gewirktem Stoffe zu geben. Man meinte, die einzelnen Fasern erkennen zu können.
Ebenso sorgsam waren die Gesichter ausgearbeitet, jeder Zug charakteristisch, nie der gleiche Ausdruck wiederholt.
Bemerkenswert war vor allem, dass der Künstler jedem dieser Steinmänner eine scharfgeschnittene gerade Nase gegeben hatte, aber sonst war der Ausdruck, wie schon gesagt, sehr verschieden.
Das eine Gesicht drückte Freude aus, das andere Schmerz, ein drittes Trauer, ein viertes Zorn, wieder eins war zu einer gräulichen Grimasse verzerrt —
Und immer passte der Ausdruck der Augen genau zu diesem Charakter des Gesichts.
Schon daraus ging hervor, dass ein Künstler hier tätig gewesen war, denn es ist eben höchste Kunst, einem solchen starren Stein durch das Auge den Ausdruck vollkommenen Lebens zu verleihen.
Kurzum, es war sehr erklärlich, dass Frau Martha Flint sogleich einen Ruf bewundernden Staunens ausstieß, als sie dann hinzusetzte:
»Das sind aber keine Chinesen gewesen, Herr Fehrmann!«
»Nein, das ist die Arbeit anderer Menschen, und da diese Bildsäulen noch bearbeitet worden sind, nachdem der weiche Seifenstein bereits erstarrt war, wie aus verschiedenen Anzeichen zu erkennen ist, so kann ich nur sagen, dass diese Künstler entweder Riesen gewesen sein müssen oder verstanden haben, sich Gerüste zu bauen, auf denen stehend sie arbeiten konnten.
Wir aber haben hier etwas ganz anderes zu tun als diese Kunstwerke zu bewundern, wir müssen hier nach dem geheimen Eingang suchen, der uns unter dem Meere zu jenem Felsen hinüberbringt, von welchem ich das Rauchsignal aufsteigen lassen möchte —«
»Sie kennen den Weg noch nicht?«, fragte Martha Flint.
»Ja und nein! Gegangen bin ich ihn nicht, aber man hat mir mitgeteilt, dass er da ist. Ich soll ihn nur suchen.«
»Loke Klingsor?«
Berndt Fehrmann nickte.
»Er spricht also manchmal zu Ihnen?«
Wieder ein Nicken.
Es ist merkwürdig, dass der Mann, der doch sonst so schnell alle nötigen Erklärungen gab, sich jetzt jedes Wort abkaufen ließ.
»Wie geschieht das denn nur?«
»Ich höre plötzlich seine Stimme.«
»Gleichviel, wo Sie sich befinden?«
»Ja. Ich stehe da vor einem wunderbaren Rätsel, kann mir nicht erklären, wie dieser Mann mich überall zu beobachten vermag, immer weiß, wo ich bin, was ich tue —
Ach, Frau Flint, vorhin habe ich Sie gefragt, ob Sie sich fürchten. Und nun muss ich Ihnen ganz offen gestehen, dass mir selbst manchmal etwas wie Furcht, sogar wie Grauen, vor diesem Manne aufsteigen will.
Was für Kräfte muss er kennen und beherrschen, dass Raum und Zeit nicht für ihn existieren, dass er sogar durch die Steinwände sehen kann! Vermögen Sie das zu fassen?«
»Nein, oder er ist eben kein Mensch — er ist ein Gott«, erwiderte Frau Martha ohne Zögern.
»Ja, ein Gott! Das habe ich schon manchmal denken müssen! Nur ein Gott kann das, was er kann —«
»Und was er kann, das bewirkt er durch die Zauberrunen«, ergänzte Frau Flint.
Berndt Fehrmann schaute sie an, betroffen, fast verdutzt.
»Ich kann es nicht fassen!«, erwiderte er dann mit einem leisen Stöhnen, welches seine Ohnmacht deutlicher erkennen ließ als alle Worte es vermocht hätten.
»Und er missbraucht diese seine göttergleiche Macht niemals?«, fragte Martha Flint, dadurch beweisend, dass sie doch auch recht logisch denken konnte.
»Ich habe noch nie etwas Derartiges gehört! Ich weiß ja überhaupt nichts von ihm, als was dieser Mister Samuel Philipp in New York mir mitzuteilen für gut befand.«
»Sie haben ihn noch nie gesehen?«
»Doch! Auf einem Bilde, das Philipp auf die Wand warf.«
Und nun schilderte Berndt Fehrmann dieses Bild.
Frau Flint schüttelte den Kopf.
»Ich möchte ihn wohl kennen lernen«, sagte sie halblaut.
»Gegen seinen Willen wird uns das nie gelingen«, erwiderte der Mann. »Das habe ich nun schon erkannt. Ich müsste sogar diese meine Erkenntnis meinem Auftraggeber mitteilen, ihm melden, dass ich mich außerstande fühle, seinen Befehl auszuführen — aber das kann ich auch nicht. Jetzt hat es mich doch gepackt, jetzt kann ich gar nicht mehr zurück, jetzt muss ich suchen, das Geheimnis dieses Mannes zu ergründen, ihn zu sehen —
Aber ihn bestehlen — nein, das kann ich nicht mehr! Ich müsste doch, wenn es mir vergönnt ist, ihn zu schauen, anbetend vor ihm niedersinken, könnte ihn nur mit flehend erhobenen Händen bitten, mich einige der Wunder schauen zu lassen, die er zu vollbringen vermag —
Und nun, Frau Flint, haben Sie das Recht, jede fernere Gemeinschaft mit mir abzulehnen, denn ich habe doch eben ganz offen bekannt, dass ich nicht das tun will, was mir jener Mister Philipp zugemutet hat. Ich werde nicht versuchen, das Geheimnis der Runen auf dem Rücken Klingsors zu erkennen, ich werde Ihnen nicht helfen, wenn Sie oder Ihr Mann das tun wollen —
Sie werden sagen, ich hätte Ihnen das gleich bei unserem ersten Zusammentreffen erklären müssen, hätte Sie nicht erst in allerlei Hoffnungen wiegen und gleich gar nicht hierher schleppen dürfen —
Wenn Sie das sagten, würden Sie mir unrecht tun —«
»Weil mir an den Runen auf dem Rücken Loke Klingsors überhaupt nichts liegt, sondern bloß daran, meinen Mann wiederzubekommen, meinen Richard!«, unterbrach hier Frau Martha den Sprecher.
»Ja, was Sie da eben sagten, das ist mir sogar aus dem Herzen gesprochen« — sie sagte also nicht: aus der Seele — war eben auch jetzt ganz Weib — »ich verstehe Sie, und außerdem — ich wüsste nicht, inwiefern Sie mich hintergangen hätten. Sie haben versprochen, mich zu Loke Klingsor zu bringen. Sie selbst suchen ihn. Da gehe ich eben mit!
Und dass Sie ihn finden werden, daran zweifle ich nicht —«
»Sie zweifeln nicht?«, fragte Berndt Fehrmann überrascht.
Und wieder einmal bewies diese schlichte Frau, dass sie sehr scharf denken konnte. Sie antwortete, jetzt sogar lächelnd:
»Nun, Sie haben mir vorhin gesagt, dass Loke Klingsor Sie immerfort sehen und hören kann. Da hat er doch auch vernommen, was Sie jetzt gesprochen haben, na, und da wird er doch Ihren innigsten Wunsch nicht unerfüllt lassen — da wird er Ihnen schon den Weg zeigen, wie Sie zu ihm kommen können — und ich mit Ihnen!«
»Frau Flint!«
Berndt Fehrmann rief es und streckte der blassen Frau beide Hände hin.
Sie wurden ergriffen. Ein neuer Bund ward geschlossen.
Berndt Fehrmann schaute sich um.
»Ich habe noch etwas in Erfahrung gebracht, was ich bisher verschwieg«, hob er an. »Ich sagte vorhin, dass das Geheimnis dieser Insel bis jetzt noch nicht hat erforscht werden können, dass niemand ahnt, wer einst hier gelebt und gearbeitet hat. Das stimmt auch jetzt noch, aber unlösbar ist dieses Rätsel doch nicht so ganz, denn jene merkwürdigen Geschöpfe haben schriftliche Aufzeichnungen hinterlassen, und in diesen haben sie alles niedergelegt, was sie betrifft.«
»Und Sie besitzen diese Aufzeichnungen?«
Berndt Fehrmann brachte aus seinem Lederrocke ein Päckchen zum Vorschein.
Schon aus der Art, wie er es so sorgsam umhüllt hatte, war zu schließen, dass es etwas überaus Kostbares enthalten musste, und als er nun die Hüllen löste, da kam ein Stück Pergament zum Vorschein, über und über mit farbigen Malereien bedeckt.
Eine Bilderschrift!
Neugierig, aber auch bewundernd betrachtete Frau Martha diese zierliche Malerei, denn die bunten Bildchen waren nicht viel größer als etwa die gemalten Buchstaben in alten Handschriften aus der ersten Zeit der Schreibkunst. Dabei waren sie so klar gezeichnet, dass sich auch hier die Künstlerhand verriet.
»Sie haben diese Hieroglyphen entziffert?«, fragte Frau Martha.
Ein Leuchten kam in die blauen Augen Berndt Fehrmanns.
»Ja!«, rief er fast jauchzend.
»Und deswegen stehe ich hier, denn hier soll ich den zweiten Schritt zur Erkenntnis tun —«
»Und dieser ist?«
»Eine dieser Bildsäulen birgt in ihrem Kopfe ein anderes Pergament.«
»Dann werden wir es bald gefunden haben.«
»Meinen Sie?«
Berndt Fehrmann schaute empor zu den Köpfen der Bildsäulen.
Da freilich erkannte Frau Martha Flint, was er meinte.
Ohne Gerüst waren sie nicht zu erklettern. Ausgeschlossen!
Wie aber sollten sie hier ein solches Gerüst herstellen?
Auf der Osterinsel, also auf Rapanui, gedeihen keine Bäume, nicht einmal das Allerweltskind, die Kokospalme, kommt dort vor, trotzdem der Boden ihr ohne Weiteres zusagen würde. Die Bewohner bauen allerhand Gemüse, aber Holz haben sie nur dann, wenn das Meer welches anspült, Schiffstrümmer oder entwurzelte Bäume, und sie wissen damit nicht einmal viel anzufangen, da ihnen die nötigen Werkzeuge fehlen.
Trotzdem sind sie ganz versessen auf dieses Treibholz, denn mindestens alle drei Jahre läuft ein englisches Kriegsschiff die Insel an. Da überzeugen sich die Herren, wie es steht, ob die Eingeborenen noch nicht ganz ausgestorben sind, und da spenden sie ihnen gnädigst allerhand — auch Werkzeuge — da können also die Rapanui wieder einmal das angeschwemmte und gesammelte Holz verarbeiten.
Aber an Fremde geben sie es nicht ab, obwohl ihnen sonst alles feil ist, wie schon gesagt, am ersten ihre Weiber und Töchter —
Da darf man sie auch gar nicht unsittlich nennen, auch kultivierte Völker boten dem Gaste solche Vergünstigungen, und auf dieser Insel steht doch das Weib sehr, sehr tief, da ist es gar nichts Auffälliges, wenn ein Sohn die Mutter heiratet und nachher auch noch die Töchter, die sie ihm geboren hat.
Aber Holz geben die Rapanui nicht her.
Da musste es eben gestohlen werden, und das wäre nicht schwer gewesen.
Die Eingeborenen sind zwar heimtückisch und machen ganz gern mal einem Europäer den Garaus, wenn sie sich an ihn wagen dürfen, aber sonst sind sie feig, und einen mit Schusswaffen versehenen Mann greifen sie niemals an.
Sie hätten sich also einem Holzdiebstahl nicht zu widersetzen gewagt, und Berndt Fehrmann hatte auch daran gedacht, aber doch seine Absicht wieder verworfen.
Er hätte das nötige Holz gar nicht hierher schleppen können. Da hätte er viel zu lange Zeit dazu gebraucht, ganz abgesehen davon, dass auch seine Riesenkraft da sicher manchmal versagt hätte.
Er hatte einen anderen Plan entworfen.
Frau Martha erfuhr ihn aus seinem Munde.
»Da ich diese Bildsäulen nicht ersteigen kann«, sagte er, »so habe ich mir, trotzdem es mir leid tut, vorgenommen, sie umzustürzen. Zertrümmern müsste ich die Köpfe ja einmal —«
»Und ich habe da einen ganz anderen Gedanken!«, rief Frau Martha.
Sie schaute ihren Gefährten an.
»Ja, es geht aber doch nicht«, fuhr sie fort, ehe er sie hatte fragen können. »Sie haben kein Gewehr bei sich.«
»Bei mir nicht, aber hier versteckt!«, erwiderte Fehrmann und brachte aus einer Höhlung schon eine ganz moderne SnydersBüchse heraus.
»Nun, dann versuchen Sie doch einmal, ob Sie die Köpfe nicht zerschießen können!«, riet nunmehr Frau Martha.
»Zerschießen?«, wiederholte er. »Wahrhaftig! Das ist ein Gedanke — das Gestein springt leicht —«
Und schon hob er das Gewehr, zielte nach dem Kopfe der einen Figur und drückte los.
Inmitten des Felsenkessels krachte der Schuss ganz gewaltig, aber da die Patrone rauchloses Pulver enthalten hatte, so verdeckte keine Qualmwolke die Bildsäule.
Deutlich sahen die beiden, wie die Kugel gegen die Stirn schlug, dicht unterhalb des Aufputzes, der darüber saß...
Aber sie zerschmetterte das Gestein nicht —
Und prallte auch nicht zurück.
Sie war in den Kopf eingedrungen!
Staunend sahen die beiden einander an.
Berndt Fehrmann wich unwillkürlich erst einige Schritte zurück, dann aber sprang er vorwärts, schien auf die Bildsäule zueilen zu wollen.
»Um Gottes willen, zurück — — zurück!«, schrie Frau Martha auf und packte ihren Gefährten eben noch.
Dann geschah das Unglaubliche.
Die Figur, welche den Schuss in die Stirn erhalten hatte, schwankte, neigte sich erst etwas zurück, dann nach vorn, drehte sich langsam um sich selbst — ganz herum und stürzte endlich mit dröhnendem Schmettern auf den Boden, gleich in tausend Stücke zerschellend.
Entsetzt, vor Schrecken starr und bleich, standen die beiden da.
Das hatte genau so ausgesehen, wie wenn ein in den Kopf geschossener Mensch zusammenbricht. Den dreht es auch so herum, ehe er stürzt — nur, dass er vielleicht noch die Arme in die Luft wirft, und dass natürlich sein Gesichtsausdruck sich verändert —
Aber sonst war alles wie bei einem lebenden, zu Tode getroffenen Menschen.
Es war ein neues, unerklärliches Wunder.
Das aber die beiden mutigen Menschen nicht lange in Bann zu halten vermochte, denn sie sahen doch, dass bei dem Sturze auch der Kopf zersplittert war, und — dass er nichts enthielt — er war hohl gewesen — die ganze andere Gestalt aber massiv. Und schon hob Berndt Fehrmann zum zweiten Male das Gewehr.
Diesmal wählte er sich die Bildsäule, die den Zorn darstellte, ein so recht wildes Gesicht hatte.
»Den habe ich nie leiden mögen«, sagte er dabei scherzend. »Und da wir doch alle diese Figuren zerstören müssen, es sei denn, wir fänden bald das Pergament, so soll er der nächste sein!«
Krachend entlud sich der Schuss. Wie Donner hallte der Lärm von den Wänden des Felsenkessels wider.
Gespannt schauten die beiden auf die Figur.
Drang auch ihr die Kugel widerstandslos in die Stirn?
Kam auch diese Riesenbildsäule zum Stürzen wie ein tödlich getroffener Mensch? Die beiden hielten schon den Atem an — in Erwartung der Katastrophe —
Da aber schrien sie auch schon laut auf — beide — der furchtlose Mann und die nicht minder mutige Frau —
Die getroffene Bildsäule neigte sich zwar auch etwas nach vorn, aber sie richtete sich alsbald wieder auf, stand ganz ruhig — und dann — dann hob sie den linken Fuß —
Es gab gar keinen Zweifel, die beiden sahen es doch zu gleicher Zeit, beide konnten nicht derselben Sinnestäuschung unterliegen —
Der Fuß hob sich, das Bein schritt aus — dieses kolossale Bein — und das Gewand, welches das Bein verdeckte, wallte —
Stampfend fiel der Fuß wieder auf den Steinboden.
Die beiden hörten es ganz genau, ganz, ganz genau, sahen auch schon den anderen Fuß sich heben, das Bein —
Und da eben schrien sie auf.
Diese Steinfigur, die Jahrhunderte hindurch unbeweglich gestanden hatte, vielleicht Jahrtausende lang — sie war durch den Schuss in die Stirn lebendig geworden, sie bewegte sich — schwerfällig zwar, aber sicher —
Und Fuß um Fuß vorwärts setzend, kam sie auf die beiden verwegenen Menschenkinder zu.
Das an sich schon abscheuliche Gesicht, das also in wildem Zorn entstellt war, verzerrte sich noch mehr, die Augen schienen Leben zu gewinnen, zu funkeln vor Wut —
Nur die Arme bewegten sich noch nicht, hingen in der früheren Steife an dem Leibe herab —
Nein, jetzt regten auch sie sich, hoben sich —
Und da flohen die beiden in haltlosem Entsetzen in den engen Gang zurück, aus welchem sie eben herausgekommen waren, tauchten in der kurzen Finsternis unter, kamen drüben wieder heraus —
Und hörten nun ein furchtbares Gebrüll, das ihnen das Blut in den Adern erstarren machte....
Die rasche Tat, die Antonio Almeida begangen hatte, schien allerdings ganz unbegreiflich. Wie durfte er seine beiden Begleiter und sich der Möglichkeit berauben, dieses Felsenplateau wieder zu verlassen?
Auch Signorina Ravelli verstand ihn nicht, aber sie sprang dazwischen, als Manuel García tätlich werden wollte.
»Was haben Sie getan, Senhor!«, raunte sie ihm dabei zu.
Doch Antonio Almeida wiederholte seine Worte von vorhin teilweise.
»Ich habe die Brücken abgebrochen, die uns mit der anderen Welt noch verbanden, vielmehr die einzige Brücke. Nun sind wir ganz auf uns gestellt, nun müssen wir durchführen, was wir uns vorgenommen haben, was uns aufgetragen worden ist, oder — wir müssen eben zugrunde gehen!«
Manuel García lachte bissig auf.
»Sie verfügen etwas sehr eigenmächtig über das Leben Ihrer Gefährten, Senhor Almeida!«, rief er.
»Ich muss es tun«, verteidigte sich der junge Mann.
»Müssen?«, fragte die Ravelli. »Das verstehe ich doch nicht so ganz.«
»Und ich noch weniger«, fügte García hinzu.
Antonio Almeida aber schüttelte den Kopf, strich sich über die Stirn und murmelte verwirrt:
»Ich selber weiß es doch nicht, ich kann nur sagen, dass ich so handeln musste, dass es plötzlich über mich kam —«
Dann aber richtete er sich jäh auf, ehe die anderen beiden etwas hatten erwidern können.
»Und wenn ich leichtsinnig gehandelt hätte, so lässt sich das jetzt nicht mehr ändern. Der Baumstamm ist in die Tiefe gestürzt, wir können ihn nicht wieder emporziehen, vermöchten es nicht, auch wenn wir Seile hätten — so heißt es eben, sich in die neue Lage fügen.
Und«, fügte er hinzu, »ist diese Lage nicht beneidenswert?«
Abermals lachte Manuel García bissig auf, wie er denn überhaupt nicht anders lachen zu können schien.
»Ich sehe nichts Beneidenswertes!«, stieß er hervor.
Die Ravelli aber dachte anders.
»O, ich verstehe Sie, Senhor Almeida!«, rief sie. »Sie denken daran, dass wir auf diesem Hochlande hier ein RobinsonDasein führen werden, dass wir auf Entdeckungsreisen ausgehen können!
Ja, das ist herrlich! So ein Leben habe ich mir schon immer gewünscht. Ich habe als Kind alle die Bücher gelesen, verschlungen, die von solchen Abenteuern handelten, und ganz zuletzt habe ich noch einen Film gesehen, der ein ähnliches Schicksal zweier Menschen behandelte. Ein junger Mann und eine junge Dame werden bei einem Schiffbruch auf ein einsames Eiland verschlagen!
Ach, was die beiden da erlebten! Es war unbeschreiblich schön!
Und wir sind hier auf einem solchen Eiland, wenn es auch nicht vom Weltmeer umbrandet wird! Wir sind wirklich abgeschlossen von aller Welt. Niemand kann uns helfen, niemand — und da müssen wir eben selbst uns helfen — da müssen wir sehen, wie wir uns das Leben hier recht hübsch einrichten können.
Wir haben ja Waffen bei uns, genügend Munition — und wir werden nicht verhungern, nicht verdursten, es muss hier zu essen und zu trinken geben, der Boden ist fruchtbar —«
»Sie scheinen die Wildnis nicht zu kennen, Signorina«, unterbrach Manuel García die Künstlerin, die ganz begeistert gesprochen hatte, deren dunkle Augen leuchteten. »Oder denken Sie nicht an die zahllosen Gefahren, die uns hier drohen können?«
»Ich? Nein! Tun Sie es vielleicht? Sie als Mann?«
Manuel García lachte, diesmal spöttisch.
»Samuel Philipp hätte mich schwerlich zur Ausführung seines Planes ausersehen, wäre ich ein Feigling«, erwiderte er.
»Das habe ich auch nicht sagen wollen«, entschuldigte die Ravelli sich sogleich.
Manuel García hob die rechte Hand.
»Sie haben das nicht nötig«, sagte er. »Eine Dame sollte sich niemals entschuldigen. Und wenn ich von Gefahren sprach, so geschah es doch hauptsächlich Ihretwegen.«
»O, sorgen Sie sich nicht um mich! Ich kenne keine Furcht und hänge gar nicht so sehr am Leben — das heißt, ich verachte es nicht, ich liebe es — aber ich könnte es auch opfern, wenn es einer großen Sache gilt —
Und jetzt wollen wir Antonio Almeida hören, der uns ja in diese Lage gebracht hat!«, fuhr sie fort. »Was schlagen Sie vor, Senhor?«
Antonio Almeida hatte die Künstlerin unverwandt angesehen, während sie so zu Manuel García gesprochen hatte. Nun, als sie sich an ihn wendete, senkte er die Lider, errötete sogar und schien etwas verwirrt, aber alsbald hatte er sich wieder in der Gewalt.
Er lächelte sogar, als er antwortete:
»Ich schlage vor, dass wir uns zunächst einen Platz suchen, wo wir die erste Nacht verbringen werden, die nicht auf sich warten lassen wird.«
»Und wir sind einverstanden! Nicht wahr, Señor García?«
Dieser nickte schweigend.
Nun erst schauten die drei sich um, was sie bisher noch gar nicht getan hatten.
Sie sahen zunächst noch nicht viel mehr, als sie gleich anfangs gewahrt hatten, aber sie sahen es jetzt mit anderen Augen als vorher.
Die Hochfläche, die sie erklommen hatten, bestand also zunächst aus einem Steinwall, der nach der Ebene unten fast lotrecht abfiel, manchmal sogar überhängend, nach dem Innern zu aber nur in sanfter Neigung.
Dabei war er auch nach dieser Seite ganz glatt, und wer sich auf den inneren Hang wagte, der musste unbedingt von den beiden anderen gehalten werden, da er sonst abglitt, in die unbekannte Tiefe hinabfuhr, aus welcher Bäume emporragten — mächtige Kerle, den breiten Kronen nach zu schließen.
Am besten ließ sich dieses sonderbare Stück Erde vielleicht mit einer mächtigen Schüssel vergleichen, auf deren Außenrand die drei jetzt standen, in deren Innenraum sie aber noch nicht einmal blicken konnten.
Dafür aber konnten sie nunmehr diese ganze Hochfläche übersehen und feststellen, dass der erhabene Rand sich rings um sie hinzog, dass es also möglich sein musste, auf ihm entlang zu wandern und erst einmal das Gelände zu erkunden.
»Wie schätzen Sie die Ausdehnung dieses Gebietes?«, fragte Antonio Almeida.
Der Spanier(1) dachte kurze Zeit nach, ehe er erwiderte:
(1) Im Original wird García an dieser und an späteren Stellen als Brasilianer bezeichnet. Im Kapitel 21 (S. 374, 376 ff.) wurde er aber ausdrücklich als Spanier eingeführt, weshalb er hier auch (spanisch) als ›Señor‹ bezeichnet wird, im Gegensatz zu Almeida, auf den die portugiesischbrasilianische Anrede Senhor‹ zutrifft; die Aussprache ist übrigens bei bei den Anreden gleich. Für die Italienerin Ravelli gilt die italienische Anrede ›Signorina‹. dann bei Tagesanbruch das neue Land, das wir entdeckt haben, umwandern.«
»Das lässt sich schwer sagen. Wenn ich den Durchmesser auf zwei Kilometer schätze —«
»So schätze ich ihn auch!«, gab Almeida zu.
»So lässt sich der Umfang ja leicht mit der Kreisformel berechnen, wir können ihn aber ohne Weiteres auf etwa sechs bis sieben Kilometer annehmen, und da er nur stellenweise mit Bäumen bestanden ist, so wird er sich leicht umwandern lassen. Ich fürchte allerdings, dass wir nirgends eine Möglichkeit entdecken werden, in das eigentliche Innere zu gelangen. Sie werden wahrscheinlich doch zugeben müssen, Senhor, dass wir die Seile wenigstens recht gut brauchen könnten.«
»Ich werde Ersatz für sie schaffen«, gab Antonio Almeida darauf zurück. »Habe ich Sie in diese Verlegenheit gebracht, so werde ich Ihnen auch wieder daraus helfen. Jetzt aber wollen wir den Marsch antreten. Dort links erhebt sich eine Gruppe Buschwerk, überragt von einigen Bäumen. Dort werden wir die Nacht verbringen können, und von dort aus wollen wir
»Sieht das nicht aus, als sei das ein ungeheurer Krater?«, fragte da die Italienerin. »Ich meine nicht, wie ein Krater der üblichen Art, sondern denke an jene mächtigen Vertiefungen, wie man sie auf Mondfotografien gewahrt. Da würde sich auch diese eigenartige Umrahmung erklären lassen.«
»Und diese Annahme wird dadurch bestätigt, dass das Gestein entschieden vulkanischen Ursprungs ist«, gab Manuel García zu.
»Noch viel mehr aber dadurch, dass wir hier jenen geheimnisvollen Menschen suchen sollen, der sich den Fürsten des Feuers nennt und seine Verstecke, wie Samuel Philipp ebenfalls behauptet, mit besonderer Vorliebe in solchen noch tätigen oder erloschenen Kratern besitzt«, ergänzte Antonio Almeida.
»Übrigens stimmt auch die Ortsangabe, die wir erhalten haben. Für mich unterliegt es keinem Zweifel, dass wir am rechten Platze sind, und so wollen wir mit dem neuen Tage die Jagd beginnen, wollen versuchen, diesen Loke Klingsor zu entdecken, und wenn nicht ihn selber, so doch wenigstens eins seiner Verstecke zu finden. Dann haben wir vielleicht auch den Zugang zu den anderen gefunden —«
»Und verdienen uns die Million Dollar!«, rief Manuel García.
»Ach, dieses Geld!«, sagte die Italienerin verächtlich. »Mir wäre viel lieber, es wäre kein Preis ausgesetzt —«
»Nun, wenn Sie die Million nicht brauchen, so treten Sie mir sie ab, ich weiß schon, was ich damit anfangen werde!«, lachte García.
»Brauchen? O, brauchen kann ich das Geld schon«, erwiderte die Ravelli. »Ich meine nur — ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll — es ist so etwas wie Verrat dabei — mir wäre lieber, wir wüssten nichts von dieser Belohnung, wären nur aus reiner Abenteuerlust auf dieses Anerbieten eingegangen —
Und«, setzte sie lächelnd hinzu, »ich weiß ja wirklich noch nicht, ob ich mich je dazu hergeben werde, durch mein Geigenspiel diesen Loke Klingsor zu betören. Vielleicht achtet er auch gar nicht darauf.
Jedenfalls wollen wir jetzt weiter. Senhor Almeida wird schon ungeduldig!«
In der Tat hatte der junge Jäger sich bereits mit dem Gepäck der Künstlerin beladen, und nun schritt er ohne weiteres Zögern dahin. Die anderen folgten ihm, schweigend, und alle drei schauten immer wieder in die Tiefe zu ihrer Seite, ohne aber auch jetzt mehr zu sehen als den dichten Wald von Baumgipfeln, der einem grünen See glich.
Der Marsch an sich bereitete nicht die geringste Schwierigkeit, denn der Boden war vollkommen glatt, der Rand aber auch breit genug, dass man nicht in Gefahr geriet, abzustürzen, und so kamen sie nach halbstündiger Wanderung an jene Stelle, die sie von Weitem schon als Lagerplatz erkoren hatten.
Es war höchste Zeit gewesen. Die Sonne stand tief am Horizont, und alle drei wussten, dass es sofort Nacht werden würde, wenn sie unter diesen hinabglitt.
So war es ihnen ganz lieb, dass sie an Ort und Stelle waren, und nachdem Antonio Almeida sich des Gepäcks entledigt hatte, nahm er sein langes Haumesser, um sich einen Zugang zu den Bäumen zu bahnen, die inmitten des dichten Buschwerkes emporragten.
Manuel García folgte seinem Beispiel, erfasste ebenfalls seine Machete, und nun führten die beiden Männer die ersten Hiebe.
Unter der Wucht der mit aller Kraft geführten Klingen sanken die Äste und Zweige rauschend nieder, wurden zur Seite geschleudert, ein Weg tat sich auf — aber das Vordringen bis zu den Bäumen musste doch immer einige Zeit in Anspruch nehmen.
Signorina Ravelli achtete zunächst nicht auf die Tätigkeit der beiden Männer, sie war dicht an den Rand des Felsenwalles getreten und schaute über die Ebene hinaus, die sich unter ihr schier unermesslich ausbreitete. Sie suchte mit den Blicken die Stelle, wo sie aus dem Urwalde herausgekommen waren —
Ach, es war doch herrlich, so fern von allen Menschen zu sein, von diesem Geschmeiß, wie sie es nannte, fern von Heuchelei und Gleisnerei —!
Unwillkürlich hob die Künstlerin beide Arme und breitete sie aus, ihre Brust hob sich in einer Empfindung berauschenden Glückes, und plötzlich lief sie zurück, holte ihre Geige aus dem Behälter, setzte sie an und begann zu spielen.
Ihre Seele jubelte sich aus in Tönen, alles, was sie empfand, gab sie in ihnen wieder — sie vergaß, wo sie war — sie sandte ein Grüßen hinab in die Tiefe, ein Grüßen an die urewige, heilige Natur, deren Geheimnisse sie nun mit erforschen wollte —
Die beiden Männer hatten sofort die Haumesser sinken lassen, als die Italienerin zu spielen anhob.
Sie waren beide Südländer. Auf sie übten diese berückenden, weichen und doch so jubelnden Klänge eine ganz besondere Wirkung aus. Sie vergaßen ebenfalls alles um sich her.
Und die Ravelli spielte und spielte, entzückt und berückt von ihrer eigenen Kunst, die Blicke nach der sinkenden Sonne gerichtet —
Keins der drei achtete mehr auf die Umgebung bis die Italienerin den Bogen sinken ließ und die Geige —
In diesem Augenblick schrak Antonio Almeida zusammen.
Ein Geräusch war an sein feines Gehör gedrungen, ein Geräusch, das von unten her kam, von dort, wo die Baumwipfel emporragten.
Rasch wendete er sich um, spähte in die Tiefe, sah einige Zweige sich bewegen, da — und dort —
Und plötzlich fasste er den linken Arm Manuel Garcías.
»Haben Sie es gesehen?«, stieß er flüsternd, aber doch in höchster Erregung hervor.
»Dort — da ist es wieder — — diese Augen —!«
Manuel García war zusammengefahren, als der junge Mann ihn berührte.
Er war mit seinen Gedanken weit, weit fort gewesen, und seine Blicke lösten sich nur widerwillig von der schlanken und doch so formvollendeten Gestalt der Italienerin.
»Was wollen Sie?«, fragte er fast barsch.
Da jedoch gewahrte auch er die Bewegung in den obersten Zweigen der Bäume.
»Affen!«, sagte er indessen geringschätzig. »Was soll es weiter sein?«
Doch Antonio Almeida schüttelte den Kopf.
»Affen? Ja, das dachte ich auch anfangs, aber jetzt — nein, das waren keine Affen, das waren — — ich weiß nicht, was es war, ich habe nur zweimal diese Augen aufglühen sehen. Nein, einen solchen Ausdruck habe ich noch nie in den Augen eines Affen bemerkt, auch nicht in denen eines Menschenaffen —«
»Augen? Sie haben in Augen gesehen?«, fragte da die Ravelli, die zu den beiden getreten war.
Und in diesem Moment, als sie dicht an dem Rand des Felsens stand, war es, als hätten die Wesen dort unten sie erblickt.
In den Ästen rührte es sich, hier und dort, überall — ein Rauschen war vernehmbar, als huschten dort unten wirklich viele, viele Affen unsichtbar von Ast zu Ast —
Aber plötzlich schob sich das Blattwerk zur Seite — es wurde zur Seite geschoben — etwas wie eine Hand ward sichtbar, undeutlich nur —
Und da schrie die Künstlerin auch schon gellend auf, streckte beide Hände vor und wich so entsetzt zurück, dass sie beinahe rückwärts über den Rand des Felsens gestürzt wäre, hätte nicht Antonio Almeida sie eben noch gepackt und gehalten.
Er selbst hatte nichts gesehen als die Bewegung der Zweige, auch Manuel García nicht, aber sie sahen doch nun, wie totenblass die Italienerin war, welcher Ausdruck des höchsten Entsetzens ihr Gesicht entstellte; sie spürten, wie sie zitterte —
»Mein Gott, was haben Sie gesehen, Signorina?«, fragte Antonio Almeida.
»O, diese Augen! Diese furchtbaren Augen!«, stöhnte die Ravelli auf, ihre eigenen mit beiden Händen bedeckend, als wolle sie das Bild aus ihnen verwischen.
»Auch Sie haben diese Augen gesehen?«, rief der junge Jäger. »So habe ich mich nicht getäuscht —«
»Und ich bleibe dabei, es sind nur Affen gewesen!«, sagte Manuel García.
»Ich werde Ihnen gleich den Beweis liefern — welche Tiere sonst sollten sich in diesen Bäumen aufhalten —?«
Und ehe die beiden anderen ihn hindern konnten, hatte er sein Gewehr angelegt und feuerte in das Laubwerk des nächsten Baumes.
Dessen Krone befand sich vielleicht noch sechs Meter tief unter ihm, es war also gar keine Entfernung, und wenn wirklich in diesem grünen Dickicht Affen staken, dann musste der Schuss einen von ihnen treffen — oder ein Zufall wenigstens konnte die Kugel lenken —
Aber nichts rührte sich in der grünen Wirrnis.
Wären Affen dort verborgen gewesen, so hätten sie doch alsbald ein lautes Kreischen und Schreien ertönen lassen, ein ungeheures Durcheinander wäre erstanden haarige Gesichter wären überall aufgetaucht —
Doch alles blieb totenstill.
Manuel García hatte das Gewehr sinken lassen. Er war merkwürdig blass geworden.
»Es scheinen doch keine Affen zu sein«, murmelte er.
Die anderen beiden antworteten nicht. Die Ravelli, die noch immer sehr bleich war, erbebte sichtlich und schaute wie sehnsüchtig hinab nach jener Stelle, wo ein Feuer loderte.
Dort saßen die Indianer und bereiteten sich ihre Mahlzeit.
In diesem Augenblick der Schwäche wünschte sich die Ravelli zu ihnen, und — hätte Antonio Almeida den Baumstamm nicht in die Tiefe gestürzt, hätte die Möglichkeit einer Rückkehr in die Welt dort unten bestanden, die Ravelli wäre nicht länger als unbedingt nötig hier oben geblieben, hätte diese Hochfläche nie wieder betreten und tausendmal lieber die Million Dollar fahren lassen als noch einmal in die furchtbaren, glühenden Augen geschaut —
Aber es gab keinen Rückweg mehr.
Die Brücke nach der Welt dort unten war abgebrochen!
Und wenn die Indianer fortgeschickt wurden, dass sie andere Seile brächten?
Als sie das dachte, begegneten die Blicke der Künstlerin denen Antonio Almeidas —
Da schoss eine Blutwelle ihr ins Gesicht.
Einen Moment noch lehnte sie sich fest gegen die kraftvolle Gestalt des jungen Mannes, dann aber richtete sie sich auf, löste sich aus seinen Armen und brachte es fertig, lustig aufzulachen.
»Was müssen Sie von mir denken, Senhor!«, sagte sie dann.
»Nichts, was Ihnen zum Tadel gereichen könnte!«, erwiderte er sogleich. »Auch ich habe diese furchtbaren Augen gesehen, sogar zweimal — und ich schäme mich nicht, offen zu gestehen, dass ein Grauen mich packte, dass mir der Herzschlag stockte —
Jetzt, Signorina Ravelli, bereue ich, dass ich den Baumstamm in die Tiefe stieß, und gäbe viel darum, ich hätte es nicht getan.«
Ein Händedruck dankte ihm.
Manuel García gewahrte ihn nicht, er hörte nur die Antwort der Italienerin.
»Und gerade das war das einzig Richtige, Senhor Almeida!«, sagte sie. »Jetzt müssen wir den unbekannten Gefahren ins Gesicht schauen und sie bestehen, und ich denke, das wollen wir auch tun. Oder nicht?«
»Für mich gibt es kein Zurück«, erwiderte der junge Mann. »Ich wäre vielleicht noch einmal mit Ihnen hinabgestiegen, hätte den Rückweg mit Ihnen angetreten, bis ich Sie in Sicherheit gewusst hätte, aber dann — wäre ich doch wieder hierher gekommen.
Ich habe mein Wort verpfändet, habe es noch immer eingelöst und will es auch diesmal tun.«
»Und ich will nicht hinter Ihnen zurückstehen!«, rief die Künstlerin.
»Also nun weiter! Bahnen Sie uns den Weg zu jenen Bäumen, Senhores! Dort wollen wir erst einmal schlafen und unsere aufgeregten Nerven beruhigen. Wenn der neue Tag anbricht, werden wir einen Plan entwerfen, und dann wollen wir uns nicht wieder erschrecken lassen!«
Darauf erwiderte Antonio Almeida nichts, schaute die Künstlerin auch nicht mehr an, die nun erst ihre Geige wieder einhüllte.
Manuel García freilich griff noch nicht wieder zur Machete. Er stand noch an seinem vorigen Platze und spähte mit vorgebeugtem Oberkörper in die Tiefe, als hoffe er, dort nun ebenfalls die Augen zu entdecken.
Das Gewehr hielt er schussbereit in den Händen.
Der nächste Schuss hätte sicher sein Ziel getroffen.
Aber nichts mehr rührte sich in dem Blattgewirr. Die Wesen, die sich dort aufgehalten hatten, schienen geflohen zu sein.
Manuel García fand sogar eine Erklärung dafür, dass sie auf den Schuss hin nicht zu brüllen und zu kreischen angehoben hatten. Sie hatten eben noch nie einen solchen Krach vernommen, hatten vielleicht noch gar keinen Menschen gesehen, geschweige denn ein Gewehr kennen gelernt — da war schon erklärlich, dass sie vor gewaltigem Schrecken gleich ganz stumm wurden —
Und nachdem Manuel García diese Erklärung gegeben hatte, lächelte er über sich selbst, schwang von Neuem die Machete und arbeitete so wacker, dass nach Kurzem schon die Stämme der mächtigen Bäume sichtbar wurden.
Mit einigen Schlägen schufen die beiden Männer noch einen freien Raum um sie her, entfernten daraus die abgeschlagenen Äste, nachdem sie von einigen die Blätter abgestreift hatten, um aus ihnen eine Lagerstätte zu schaffen, ergriffen das Gepäck und brachten es an diese für ein Nachtlager sehr geeignete Stätte.
Sie hatten gerade die Künstlerin herbeigeholt, als die Dunkelheit hereinbrach, mit jener fast unheimlichen Schnelligkeit, die sie aber alle drei bereits zur Genüge kannten.
Da sie auch dürres Holz genügend gefunden hatten, so war es nicht schwer, ein hellloderndes Feuer anzubrennen, und der Lichtschein, den es verbreitete, ließ sie alles andere vergessen.
»Nehmen Sie hier Platz, Signorina!«, sagte Antonio Almeida, auf die Stelle deutend, wo er das abgestreifte Laub aufgehäuft hatte. »Hier können Sie den Rücken gegen den breiten Stamm lehnen und es sich bequem machen.«
Die Ravelli nickte und setzte sich.
Manuel García brachte allerlei Proviant zum Vorschein, Antonio Almeida trieb zwei Hölzer in den Boden, der hier eine ziemlich dicke Erdenschicht aufwies, legte in die Gabelenden ein drittes starkes Stück Holz, das er zuvor durch den Henkel des kleinen Kessels geschoben hatte, füllte diesen aus der Trinkflasche und bereitete alles vor, um die Gefährten und sich mit jenem eigenartigen Tee zu versorgen, der in diesen Landen mit Vorliebe getrunken wird, mit Mate —
Er selbst hatte keinen Hunger, brannte sich lieber eine Pfeife an, nachdem er die Italienerin um Erlaubnis gebeten hatte. Diese selbst aß wacker, schon dadurch zeigend, dass ihre Nerven sich vollkommen beruhigt hatten.
Es war wirklich ganz traulich unter dem Laubdache des mächtigen Baumes.
Das knisternde Feuer verbreitete Licht und Wärme, die recht gut zu brauchen war, da ja die Nächte ständig recht kühl sind in diesen Breiten, und eben wollte Antonio Almeida eins der Trinkgefäße mit Tee füllen, da hielt er mitten in seinen Bewegungen inne.
»War das der Wind?«, fragte er halblaut.
»Wind?«, erwiderte Manuel García. »Sie träumen, Senhor. Die Luft ist vollkommen unbewegt.«
»Ja, es regt sich kein Lüftchen, das Feuer brennt ruhig«, bestätigte die Italienerin.
»Und doch rauschte es soeben über mir in den Zweigen des Baumes«, versetzte der junge Mann.
Er schaute empor, aber er sah nichts als das dunkel erscheinende Laub, einige Äste dazwischen —
»Ich habe mich vielleicht doch getäuscht«, dachte er, wollte nun das Gefäß füllen, streckte die Hand wieder vor —
Und da geschah es —
Wie ein Blitz kam es aus der Höhe herab.
Ehe noch einer der drei wusste, was es eigentlich war, sahen sie dicht vor sich etwas wie ein starkes buntes Seil — sahen einen dreieckigen Kopf, einen weitgeöffneten Rachen, aus dem eine gegabelte Zunge hervorschoss —
»Eine Riesenschlange!«, durchzuckte es Antonio Almeida.
Die anderen beiden aber schienen überhaupt nichts denken zu können — aus weit aufgerissenen Augen schauten sie in die funkelnden, grünlich schimmerndem Augen der ungeheuren Schlange —
Schon aber wich die Lähmung von Antonio Almeida.
Die Riesenschlange hielt ihren Kopf seitwärts von den emporlodernden Flammen. Sie wollte sich wahrscheinlich nicht der Glut aussetzen, aber gerade dadurch, dass sie seitlich abbog, gewann es den Anschein, als wollte sie sich im nächsten Augenblick auf die Italienerin stürzen —
Und das gab dem jungen Manne die Geistesgegenwart zurück.
Die blanke Machete lag noch neben ihm.
Im Nu hatte er sie gepackt, schwang sie und führte einen mächtigen Hieb.

Im Nu hatte Almeida die Machete gepackt,
schwang sie und führte einen mächtigen Hieb.
Im nächsten Augenblick stürzte der Kopf der Schlange zischend in die Flammen, aus dem in entsetzlichen Windungen sich krümmenden Leibe schoss das Blut in einem starken Strahle hervor, fast die Glut des Feuers löschend.
Aber nun sprangen auch die drei auf, starrten entsetzt aus das verendende Ungetüm, sprachlos, schwer atmend —
Bis Antonio Almeida vorwärts sprang, den noch immer zuckenden glatten Leib des Ungetüms ergriff, an ihm zerrend, ihn aus dem Laubversteck vollends hervorreißend, wo er sich fest angeklammert hatte —
Das schwere Werk gelang, der Körper glitt herab — und was für ein Körper!
Schon manches dieser Ungetiere hatte der junge Jäger erlegt, Riesen waren darunter gewesen, bis zu sechs Meter Länge, aber dieses hier übertraf sie alle — mindestens auf zehn Meter schätzte er es —
Und dabei war der Leib viel stärker, als er jemals einen gesehen hatte.
Die stärkste Stelle war fast so dick wie der Leib eines Mannes!
Ohne die Hilfe Manuel Garcías hätte Antonio Almeida das Untier gar nicht fortschleppen können. Die beiden Männer mussten alle ihre Kräfte aufbieten, um es bis an den Rand des Felsens zu schleifen und über diesen in die Tiefe zu stürzen, sie mussten den noch immer zuckenden Körper fest umklammern und den ganzen Weg entlang ziehen, den sie eben erst gehauen hatten —
Als sie an das Lagerfeuer zurückkehrten, sahen sie die Ravelli regungslos dasitzen, die Blicke starr auf die Reste des Schlangenhauptes gerichtet, das in der Glut fast ganz verkohlt war. Wie gebannt schaute sie darauf —
Und unmittelbar neben ihr stand das Blut des erlegten Ungeheuers in einer großen Lache —
»Signorina!«, rief Antonio Almeida.
Da fuhr sie zusammen.
»Das war fürchterlich!«, murmelte sie. »Noch immer sehe ich diesen weitaufgerissenen Rachen mit den scharfen großen Zähnen — diese gespaltene Zunge — und dieser Gestank, dieser entsetzliche Gestank —
O, wir wollen fort von hier, sogleich! Nicht eine Minute mag ich mehr hier bleiben —«
»Das ist auch ganz ausgeschlossen«, gab Antonio Atmeida zu. »Der Gestank, der von diesen Tieren ausgeht, ist nicht zu vertreiben, wir müssen uns einen anderen Lagerplatz suchen —«
»Oder umkehren, auf dem Felsen draußen übernachten«, ergänzte Manuel García.
»Sie meinen, es könnte noch eine solche Schlange sich hier versteckt halten?«, fragte die Ravelli mit bebender Stimme.
»Ich weiß es nicht«, antwortete der Brasilianer achselzuckend.
»Aber ich weiß, dass diese Schlangen nie in Gemeinschaft mit ihresgleichen leben«, rief da Antonio Almeida. »Nie habe ich ihrer zwei auf einer Stelle erlegt. Das ist ja auch ganz ausgeschlossen, schon wegen der Nahung, die diese Tiere brauchen. Sie beherrschen jede für sich ein weites Revier, und deshalb dürfen Sie ganz ruhig sein, Signorina, hier ist keine zweite Riesenschlange mehr verborgen.
Trotzdem rate ich Ihnen, sich vorläufig auf den Felsen hinaus zurückzuziehen. Señor García kann auch dort ein Feuer anbrennen, kann von diesem hier einige brennende Äste mitnehmen —«
»Und Sie?«, fragte die Italienerin.
»Ich werde erst einmal die nächste Umgebung sorgsam durchforschen«, erwiderte der junge Mann.
»Nein, nein, das dürfen Sie nicht! Sie sollen bei uns bleiben!«
Antonio Almeida lächelte.
»Sie brauchen sich nicht meinetwegen zu sorgen, Signorina«, erwiderte er. »Ich habe nicht das erste Mal eine solche nächtliche Entdeckungsfahrt unternommen. Und ich verspreche ihnen, ganz vorsichtig zu sein —«
»Und wenn Ihnen trotzdem etwas zustößt?«
»Dann stehen Sie unter dem Schutze Señor Garcías«, gab der junge Mann zurück.
Die Künstlerin machte eine Bewegung, als wollte sie sich dem Brasilianer zuwenden, sie öffnete auch schon den Mund zu einer Erwiderung, aber sie unterdrückte die Bemerkung, die eine Beleidigung für Manuel García hätte sein müssen
»So gehen Sie!«, sagte sie unwillig.
Da aber trat Antonio Almeida neben sie, fasste eine ihrer Hände und schaute ihr bittend in die Augen.
»Es muss sein!«, sagte er halblaut.
Dann wendete er sich ab, bückte sich, nahm aus dem Feuer einen ziemlich langen, hell brennenden Ast, schob sich zwei andere, die noch nicht brannten, in den Gürtel nahm in die andere Hand seine Machete und wartete, bis seine Gefährten durch das Buschwerk nach dem freien Felsen zurückgekehrt waren.
Von seinem Standorte aus konnte er sehen, wie Manuel García ein neues Feuer anbrannte, wie die Italienerin sich niedersetzte. Er wartete, dass die beiden miteinander sprechen sollten, aber das war nicht der Fall. Sie blieben stumm und regungslos, nur dass der Spanier manchmal einen dürren Ast in die Glut warf.
Da lächelte Antonio Almeida wehmütig.
»So hast Du dir diese Fahrt in die Wildnis doch nicht vorgestellt, armes, schönes Kind!«, sagte er leise. »Ich fürchte, Du wirst bald noch mehr als bereuen, dass Du Dich durch die hohe Belohnung hast verlocken lassen —
Und wenn ich Dir helfen kann, dann sollst Du bald zurückkehren, sollst Dein kostbares Leben nicht länger aufs Spiel setzen. Du — nein, Du darfst nicht sterben wie wir anderen, Dein Dasein gehört der Kunst —«
Er strich sich über die Augen, dann wendete er sich ab, starrte minutenlang in die Finsternis, die unter den Bäumen war, er wollte seine Augen an sie gewöhnen, und das gelang ihm tatsächlich —
Als er nun in das Dickicht eindrang, sich mit dem Haumesser Bahn schaffend, da sah er die Äste und Zweige, die er abhieb, und sein scharfes Gehör hätte ihm jetzt unbedingt verraten, falls ein Tier vor ihm floh.
Aber alles blieb still und regungslos. Nur die abgehauenen Zweige rauschten im Niederfallen.
Da schleuderte Antonio Almeida den brennenden Ast von sich, der auch schon fast zu Ende war. Jetzt brauchte er ihn nicht mehr. Er hatte das kleine Dickicht durchquert, stand wieder auf dem freien Felsen.
Die Sterne, die am Himmel aufgegangen waren, verbreiteten Licht genug, dass er ein ganzes Stück vor sich hinsehen konnte, aber er hätte dieses Lichtes nicht einmal bedurft, er war oft genug in finsterer Nacht auf unbekannten Pfaden gegangen, und so wanderte er langsam weiter und weiter, bis er ein neues Buschwerk vor sich auftauchen sah.
Wieder ragten mächtige Bäume daraus hervor.
Antonio Almeida blieb stehen.
Es hatte nicht viel Zweck, dass er weiterging. Die Erforschung dieser Hochfläche hatte Zeit bis zum nächsten Morgen. Im Tageslicht war das auch viel bequemer als jetzt —
Und doch war es, als triebe eine geheime, innere Gewalt den jungen Mann vorwärts.
Unentschlossen stand er da. Seine Blicke glitten rückwärts, dorthin, wo das Feuer noch brannte und weiterhin das andere, an dem die beiden saßen oder vielleicht jetzt schlafend lagen.
Er gewahrte kaum mehr als einen matten Schein.
»Schlaf sanft!«, murmelte er. »Um Deinetwillen will ich meinen Weg fortsetzen. Diese Nacht und diese Wildnis haben ja keine Schrecken für mich — ich fürchte mich nicht, weiß nicht, was das ist — und morgen soll jedes Hindernis auf Deinen Wegen geräumt sein —«
Er hob die Machete hiebbereit und näherte sich dem Dickicht, das jetzt tiefschwarz wie eine Mauer vor ihm stand —
Da kam ihm ganz plötzlich eine Erinnerung.
Er dachte an das Skelett, das sie am Fuße dieser Felswand gefunden hatten, an die Erklärung, die er selber abgegeben hatte.
Dieser Unglückliche hatte sich ebenfalls hier herauf gewagt.
Und dann —?
Was war dann mit ihm geschehen?
Er war unzweifelhaft gepackt und in die Tiefe geschleudert worden, hatte sich an den Bambusstauden aufspießen und sterben müssen.
Wer weiß, wie qualvoll sein Ende gewesen war!
Aber wer hatte ihn gepackt? Wer hatte ihn an dieser Stelle hinabgeschleudert?
Tiere?
Hätten diese gerade jene Stelle gewählt, wo die Bambusse wuchsen?
Konnte ein Tier, und mochte es noch so hoch stehen, so viel Überlegung aufbringen, dass es sich sagte: Dort unten muss dieser Mensch sich aufspießen, muss sterben?
Niemals!
Dann aber blieb nur eine einzige Erklärung: Dann musste es hier oben Geschöpfe geben, die folgerichtig denken konnten — Menschen! Wenn auch Wilde!
Und da schrak Antonio Almeida trotz seines Mutes zusammen.
Wenn nun diese Wilden das Feuer gewahrten? Wenn sie sich hinschlichen und die beiden Schläfer überfielen?
Warum hatte er nicht Manuel García zur Pflicht gemacht, zu wachen?
Warum hatte er ihn nicht gewarnt, ihn an diese geheimnisvollen Geschöpfe erinnert?
Antonio Almeida ließ die erhobene Hand wieder sinken. Er wendete sich abermals um —
Er sah jetzt auch nicht den leisesten Feuerschein mehr.
Nur weit, weit da draußen und da unten glühte ein feuriges Pünktchen, dort saßen die Indianer —
Und da schaute Antonio Almeida in die Tiefe zu seiner Linken, die ausgefüllt war von dem Durcheinander der Baumkronen, jetzt wirklich einem unergründlich tiefen See von ungeheurer Ausdehnung gleichend.
Welche Geheimnisse bargen sich dort unten?
Staken in dieser grünen Wildnis die grausamen Wesen, die jenen Unglücklichen einem so furchtbaren Tode überliefert hatten?
Warum hatten sie es getan?
Um die Geheimnisse zu wahren, die sie hüteten?
Hingen diese Geheimnisse mit jenem Loke Klingsor zusammen, den sie zu dritt suchen sollten — sie an dieser Stelle — andere Expeditionen an anderer —?
Mit marternder Wucht drangen diese Gedanken wieder und wieder auf Antonio Almeida ein, so sehr er sich auch bemühte, sie abzuschütteln. Und er stand und zauderte, wusste nicht, was er tun sollte — vorwärtsgehen oder zurückkehren —
»Nein!«, stieß er plötzlich hervor und stampfte auch gleich mit einem Fuße dabei auf, zum Zeichen, dass seine Zweifel endgültig behoben waren.
»Ich kehre um! Ich selber will Signorina Ravelli schützen und diesen ihren Schutz keinem anderen anvertrauen.«
Darauf wendete er sich um, betrachtete noch einmal das schwarze Dickicht unmittelbar vor sich, lauschte, sog sogar die Luft prüfend ein — und hätte sich hier eine andere Riesenschlange verborgen, so hätte er das ganz bestimmt gerochen, und begriff ja jetzt überhaupt nicht, wie ihm dieser Gestank vorhin hatte entgehen können — es musste wohl gewesen sein, weil Manuel García so rasch das Feuer angebrannt hatte —
»Jetzt zurück!«, sagte er und ging schon vorwärts — erst mit seinem gewöhnlichen, allerdings sehr förderndem Schritt, aber diesen immer mehr beschleunigend, bis er zuletzt schneller und schneller lief.
Die Unruhe in seiner Brust, das immer stärker werdende beklemmende Empfinden trieben ihn vorwärts.
Er atmete auf, als er das Dickicht wieder erreichte, in dem sie hatten lagern wollen — er lauschte — vielleicht plauderten die beiden doch miteinander —
Er hörte nichts, auch nicht das Prasseln, mit welchem das Feuer die dürren Äste verzehren musste.
Er stutzte.
Hatten sie es ausgehen lassen?
War Manuel García wirklich so leichtsinnig und unvorsichtig gewesen, sich ebenfalls schlafen zu legen? Wo er doch unbedingt hätte wachen müssen?
Fast hätte Antonio Almeida laut aufgeschrien, schon öffnete er den Mund.
Da besann er sich, dass er sicher die Italienerin erschrecken würde durch seinen Ruf. Er schwieg.
Nun drang er in das Dickicht ein.
Das Haumesser hatte er in die Scheide zurückgesteckt, er brauchte es ja doch nicht mehr, hier hatte er ja den Weg gebahnt.
Wirklich?
Warum stellten sich ihm da dicke Zweige hindernd in den Weg?
War er auf der falschen Stelle angelangt und hatte die verpasst, wo der Weg frei war?
Aber das war doch ausgeschlossen! Das hätte möglich sein können, wenn das Dickicht eine große Ausdehnung gehabt hätte. Aber so — es war doch insgesamt keine drei Meter breit — vielleicht auch vier — es war nur deshalb ein Hemmnis gewesen, weil es eben den Weitermarsch hinderte, weil sie es nicht hatten umgehen können —
Antonio Almeida griff vor sich hin, er musste sich überzeugen, dass er wirklich einen Irrtum begangen hatte, und er überzeugte sich auch, dass es so war.
Niemals hatte hier eine Machete Bahn gehauen, dieses Astgewirr war noch von keinem Menschen durchdrungen worden —
Antonio Almeida zögerte also nicht, sich wieder aus der grünen Wirrnis herauszuwinden, um nach der richtigen Stelle zu suchen —
Er kam ins Freie, beugte sich vor, strengte seine Augen aufs äußerste an —
Aber er suchte vergebens nach dem Wege.
Es war keiner mehr vorhanden.
Sollte das Dickicht so rasch nachgewachsen sein?
Beinahe hätte der junge Waldmensch laut aufgelacht. Das war doch Unsinn, grandioser Unsinn, so etwas überhaupt zu denken!
Aber wie war denn das nur möglich, dass er den Pfad nicht fand, den er selbst vor Kurzem gehauen hatte?
Er stand ganz verwirrt da, ging hierhin und dorthin, immer mit beiden Händen in das Dickicht tastend —
Nirgends war ein Eingang —
Das war doch fast wie Zauberei!
Aber er fand den Weg nicht, und da blieb nur eins — er musste García rufen, dass dieser von drüben mit einem Feuerbrand käme.
Noch einmal zögerte er, doch er sah keine andere Möglichkeit, und die Unruhe in ihm wurde geradezu jetzt marternd, sein Herz schlug so rasch wie noch nie —
Eben wollte Antonio Almeida rufen, da klang durch die vollkommene Stille, die ihn umgab, ein schriller Angstschrei — Und er erkannte sofort diese Stimme.
Das war die Ravelli gewesen. Sie hatte geschrien — in wildem Entsetzen —
Sie waren überfallen worden, die beiden —
Noch einmal gellte der Schrei durch die finstere Nacht, verzweifelter, angstvoller als vorher —
»Haltet aus! Ich komme!«, stieß Antonio Almeida hervor, so laut er nur konnte.
Nun suchte er nicht mehr nach dem Wege, der doch nicht zu finden war.
Das Haumesser riss er heraus, hieb auf die Äste los, dass es krachte — und so arbeitete er sich mit rasender Gewalt vorwärts, immer wieder rufend:
»Haltet aus! Ich komme — Antonio Almeida —«
Nichts mehr antwortete, kein neuer Angstschrei erscholl.
Auch kein Schuss krachte.
Kein Kampf schien sich jenseits des Dickichts abzuspielen —
Endlich war er durch, sah vor sich den freien Weg, stürmte aber trotzdem nicht auf ihm dahin, blieb vielmehr stehen, nun erst recht von jähem Schrecken gepackt.
Das Feuer war niedergebrannt?
Antonio Almeida entdeckte dank seiner scharfen Augen, dass noch glimmende Holzstücke umherlagen, aber gerade die Art, wie das der Fall war, war verdächtig.
Es sah aus, als wäre das Feuer gewaltsam auseinandergerissen worden!
Keinesfalls sah er dort drüben mehr die beiden Gestalten der Italienerin und des Spaniers.
Signorina Luzia Ravelli und Manuel García waren verschwunden!
Waren sie geflohen?
Vor wem? Und wohin?
Antonio Almeida erging sich nicht mehr in langem Erwägungen. Nur sekundenlang hatte sein Zögern gewährt.
Seine Blicke durchdrangen die Finsternis, er hätte einen Menschen auf ziemliche Entfernung gewahren müssen —
Wenn einer vorhanden gewesen wäre!
Aber es war keiner da — niemand mehr!
Ein Schauder überrann ihn. Er dachte wiederum an das Skelett in der Tiefe unten.
Wenn Signorina Ravelli — —
Er wagte nicht den Gedanken auszudenken, bückte sich vielmehr und untersuchte den Platz, an dem er stand, mit jener bewundernswerten, unnachahmlichen Sorgfalt, die dem echten Waldmenschen eigen wird.
Eins der noch glimmenden Holzstücke brachte er durch Anblasen wieder zum hellen Brennen. So gewann er eine Fackel, konnte seine Untersuchung mit mehr Hoffnung auf Erfolg fortsetzen als vorher.
Er fand nichts.
Er hatte es auch gar nicht erwartet. Dieser Boden nahm doch keinen Fußabdruck an. Er hätte die Nase eines Spürhundes besitzen müssen, um feststellen zu können, wo die beiden Verschwundenen geblieben waren.
In seiner Heimat gab es allerdings Menschen, die Spuren »riechen« konnten, er hatte sich auch bemüht, ihre Kunst zu erkunden und zu erlernen, hatte jedoch einsehen müssen, dass es sich dabei um eine natürliche Gabe handelte, dass es eben Menschen waren, die Tieren näher standen —
Antonio Almeida richtete sich auf. Sein Herz schlug etwas schneller als gewöhnlich. Das aber war auch das einzige, was seine Erregung hätte verraten können — — doch diesen raschen Herzschlag hörte nur er selbst, und er allein wusste, warum es da drin in seiner Brust so hämmerte und pochte.
»Luzia Ravelli«, pochte das närrische Ding taktmäßig. Immer wieder diesen so wohlklingenden Name —
Ganz ruhig aber schritt Antonio Almeida nun auf dem Felsenpfad dahin, zu dessen beiden Seiten die Tiefe lag und auf der einen das unbekannte Land.
Wie hatte Mister Samuel Philipp es genannt? Antonio Almeida musste eine ganze Weile nachdenken, ehe er sich des Namens zu entsinnen vermochte.
Endlich hatte er ihn wieder: Ophir!
So hieß das sagenhafte Goldland, dessen Namen die meisten gebildeten Menschen kennen, aber wo es liegt, das hat noch keiner sagen können.
In Südafrika suchten es die einen, in Indien die andern, die dritten in Südamerika — keiner noch hatte es bisher gefunden und betreten — Aber er stand an der Grenze!
Auf einmal wusste Antonio Almeida mit vollkommener Sicherheit, dass das Land unter ihm, von dem er nur die mächtigen Baumkronen sah, Ophir war, das geheimnisvolle Goldland!
Und er ließ sich nicht beirren durch die Erinnerung, die ihm sagte, dass doch Salomo aus diesem Lande seine Goldschätze hatte holen lassen. Was wusste er davon, ob früher schon ein Ozean zwischen den beiden Erdteilen seine Wassermassen ausgebreitet hatte, ob er erst später entstanden war?
Und nun schritt er aufrecht dahin — nicht weit —
Ein Gedanke kam ihm plötzlich, zwang ihn zu sofortiger Umkehr.
Das Gepäck! Die Geige der Ravelli!
Alles war verschwunden!
Und da wusste Antonio Almeida, dass der Überfall auf die beiden nicht durch Tiere geschehen war.
Durch Menschen also?
Dann konnten es nur Indianer sein, Indios bravos! Vielleicht einem ganz unbekannten Stamme angehörend —
Und denen wollte er die beiden Gefangenen schon entreißen. Vor allem die Künstlerin, die Ravelli!
Er stutzte.
Schon einmal hatte er ein Stöhnen zu hören geglaubt, jetzt vernahm er es deutlich, wusste auch gleich, woher es kam, wer es ausstieß.
»Señor García?«
Er legte sich der Länge nach auf den Boden, schob den Oberkörper über den Rand des Felsens, nach der inneren Seite des Felsenringes.
Und zugleich mit dem »Ja«, das aus der Tiefe zu ihn klang, sah er den Mann.
Er lag oben auf einem Baume, anscheinend durch die starren Äste vor dem endgültigen Sturze in die Tiefe bewahrt.
»Hilfe!«, stöhnte es von unten.
»Sofort! Paciência! Geduld!«
Nicht einen Augenblick zögerte Antonio Almeida mehr, streifte seinen Jagdrock aus schmiegsamem Hirschleder ab, das er selber gegerbt hatte, schnitt mit der Machete vom unteren Rande feine Streifen ab, dünne Riemen — gar nicht so viele — er hatte ja schon erkannt, dass die Tiefe, in welcher Manuel García lag, gar nicht bedeutend war.
»Sind Sie verwundet?«, fragte er, indem er sich wieder über den Rand beugte.
»Nur durch den Sturz — ich weiß es selbst nicht — Schmerzen habe ich —«
»Aber Sie können die Arme gebrauchen, die Hände?«
Nach kurzer Pause kam die Bejahung.
»Ich lasse Ihnen einen Riemen hinunter, fassen Sie ihn! Wenn Sie nicht klettern können, werde ich Sie emporziehen! Jetzt!«
Manuel García hatte das Ende des Riemens gefangen, schürzte es zu einer Schlinge und versuchte den Aufstieg —
Antonio Almeida half, auf dem Felsen liegend. So gelang das schwere Werk. Nach kaum zwei Minuten lag der Gerettete neben dem Retter.
»Gracias!«, hauchte er erschöpft.
»Wo ist die Signorina? Auch abgestürzt?«, hastete Antonio Almeida hervor.
»Sicher! Ich weiß nichts — sie fielen über uns her —«
»Wer fiel über Sie her?«
Manuel García zuckte beide Schultern.
»Quién sabe? Wer kann es sagen? Indios waren es nicht, oder sie hatten sich gegen deren Gewohnheit in raue Felle gehüllt — — aber sie waren auch viel zu klein — und dabei zu breit gebaut — — die Arme ungeheuerlich lang — Hände — — Da — sehen Sie — —!«
Er hielt dem anderen einen Gewehrlauf hin, den Lauf seines Gewehres. Der Kolben fehlte —
»Ich hatte es unten gepackt, als Keule — Sie verstehen — — da kriegte es einer der Feinde mit beiden Händen zu fassen — ein Ruck, ein Krach — der Kolben war ab — — die Bestie biss in das Holz, in das harte Holz — es splitterte nur so — —
Und dann erhielt ich den Stoß, stürzte, fiel, schlug auf und verlor die Besinnung, bin eben erst erwacht — —
Gott sei Dank, dass Sie mir helfen konnten!
Aber nun lassen Sie uns fliehen — rasch — ehe sie wiederkommen — — ah, ich sage Ihnen, mir graut noch jetzt — —«
Er umklammerte mit beiden Händen den einen Arm Almeidas, wollte ihn fortzerren. Aus seiner Stimme klang die entsetzliche Angst.
Und doch war Manuel García kein Feigling. Seine Taten, die im ganzen Erdteil bekannt waren, zeugten von seiner Tapferkeit und seiner Unerschrockenheit.
Antonio Almeida schüttelte ihn nicht von sich. Nur eine Frage stellte er zum zweiten Male:
»Wo ist Signorina Ravelli?«
Wieder zuckte Manuel García die Schultern.
Da aber fiel der rote, zuckende, ungewisse Lichtschein des brennenden Holzes auf ihn. Antonio Almeida stutzte, er griff nach dem Gewehrlauf, nahm ihn und betrachtete das Ende, wo der Kolben gesessen hatte.
»Sehen Sie diese Haare hier, García?«
Der Spanier nickte.
Doch als er sich vorbeugte und die Haare aus nächster Nahe betrachtete, fuhr er gleich wieder zurück.
»Affenhaare!«, sagte er, und da stand auch gleich fest, dass dieses Urteil richtig war. Dieser Mann kannte das Haar jedes Wildes in seiner Heimat.
»Ja, es sind Affenhaare«, bestätigte Antonio Almeida. »Aber von welcher Art?«
»Mir unbekannt — rotbraun —«
»Sie sind von Menschenaffen überfallen worden!«, sagte Antonio Almeida da mit schwerer Betonung.
»Menschenaffen? Hier? Noch nie hat man einen hier entdeckt!«
»Das sagt nicht, dass es keine gibt. Oder vielleicht — waren es — Affenmenschen — —?«
Manuel García zuckte zusammen.
»Himmel, wenn Sie recht hätten! Aber es stimmt doch! So sahen sie aus — wie man sich diese Geschöpfe vorstellt — — ich habe Bilder gesehen, Phantasie natürlich —
Warten Sie! Sie waren so hoch — —«
Er deutete mit der Hand seine Schulterhöhe an.
»Und fast ebenso breit über der Brust — die Arme hingen weit herab — ich habe sie ja nur wie eine Erscheinung gesehen — ich kann nichts sagen — aber man erzählt doch, dass Gorillas den Jägern die Flinte entreißen, den Kolben abbrechen, den Lauf mit den Händen verbiegen — —«
»Und in den Händen dieser Bestien ist die Signorina!«, stieß Antonio Almeida hervor.
Er schaute sich um, er wollte García wegen des Gepäcks fragen, sah jedoch ein, dass das gar keinen Zweck hatte.
»Lassen Sie erst mal sehen, ob Sie verletzt sind!«, sagte er.
»Nein, das hat Zeit! Ich weiß, was wir tun müssen — kommen Sie nur, Senhor Almeida — — die Signorina — ah, jetzt verstehe ich doch alles — sie ist entführt worden, ich aber — —«
Er deutete erschauernd nach der Stelle, wo das Skelett im Bambusdickicht lag.
Ja, nur durch seinen Sturz nach dem Innern des Felsenkessels war er dem furchtbaren Tode entgangen, der den Unbekannten ereilt hatte. Auch er wäre in die Tiefe geschleudert worden wie jener, hätte sich an den brechenden Stauden aufspießen müssen — —
Da war sein Grauen erklärlich, aber auch seine Wut!
Er umklammerte mit beiden Fäusten den Gewehrlauf, die einzige Waffe, die er noch besaß.
»Kommen Sie!«, wiederholte er.
Antonio Almeida ging mit ihm. Sie brauchten sich nicht zu verständigen, es gab ja nur einen Weg, den sie beschreiten konnten, nur eine Möglichkeit, in die Tiefe zu gelangen, aus der die Feinde unvermerkt heraufgekommen waren — diese Menschenaffen — oder Affenmenschen —?
Sie eilten zu dem Dickicht.
Dort nur konnten sie den Riemen anbinden, an einen der Baumstämme, von dort aus konnten sie in die Tiefe klettern, sonst hatten sie keinen Halt für den Riemen. Rasch war dieser befestigt. Es kam nicht darauf an, ob er reichte. An den Rückweg dachten sie beide nicht, nur an den Abstieg —
Antonio Almeida kletterte zuerst hinab.

Manuel García sah ihm zu, sich über den Rand beugend.
Viel war nicht zu erkennen, nur die schwarze Masse der Baumkronen.
Doch schon erklang der Ruf des jungen Mannes:
»Ich lasse los. Folgen Sie!«
Als Manuel García das Rauschen unten hörte, hatte er selbst schon den Riemen gepackt, kletterte an ihm abwärts, erreichte das Ende, wusste nicht, wie hoch er noch über den Bäumen schwebte — über dem Baume, in dessen Krone er seinen Gefährten wiedersehen musste —
Er ließ fahren und sprang.
Rauschend schlugen Laubmassen über ihm zusammen.
Er griff zu, packte einen Ast, hielt sich fest, wurde gleichzeitig gehalten und hörte Antonio Almeida flüstern:
»Still! Ganz still! Nun müssen wir warten, ob wir entdeckt wurden!«
Mit angehaltenem Atem lauschten sie. Nichts rührte sich.
Da zog Antonio Almeida den Gefährten dicht zu sich heran.
»Wir bleiben hier — bis Tagesanbruch — in der Finsternis, die unter den Bäumen herrscht, wären wir hilflos —«
»Es ist das Beste«, gab Manuel García zurück.
Dann sprachen die beiden nichts mehr, sie dachten aber auch nicht an Schlaf, sie lauschten unter Anspannung aller Sinne, aber kein Laut erscholl, nicht ein einziges Nachttier ließ seine Stimme erschallen.
Und so kam der Morgen.
Die Sonne grüßte schon den Felsenrand oben, als es im Innern des kraterähnlichen Kessels noch ganz finster war, aber sie stieg rasch am Himmel empor, und dann ward es mit einem Schlage hell —
Und da sahen beide zu gleicher Zeit, was ihnen in der nächtlichen Dunkelheit entgangen war, hatte entgehen müssen:
An der Felswand lehnte ein Baumstamm, dessen Äste bis auf kurze Stümpfe abgebrochen waren, die aus einem der Bäume hervorragten.
Und die beiden begriffen sogleich, dass dieser Stamm den unbekannten Feinden als Leiter gedient hatte — aber sie wussten auch, dass in der Nacht nicht nur diese eine Leiter angelegt worden war. Da hätten die Angreifer nicht in Masse erscheinen können. Die andern waren abgestürzt, entfernt worden.
Stumm schauten die beiden einander an.
»Affen tun das nicht! Sie bauen keine Leitern, bedürfen ihrer nicht — aber —«
»Aber Menschen brechen die Äste nicht ab, könnten es gar nicht, ihre Kraft würde nicht ausreichen«, ergänzte Antonio Almeida.
»Also sind es wirklich Affenmenschen gewesen!«
Nur flüsternd sagte es der Spanier.
Sein Gefährte aber lächelte.
Es war ein furchtbar drohendes Lächeln.
»Sie sollen uns kennen lernen!«, sagte er dabei.
Dann kletterte er vorsichtig an dem Stamme hinab, die vielen Äste als bequeme Treppe benutzend, und Manuel García folgte ihm.
Fritz Hammer und Georg Wedekind lauschten nicht schlecht, aber von Bangigkeit oder gar von Furcht regte sich nichts in ihnen. Dazu klang diese Stimme aus dem Unbekannten doch viel zu wohllautend.
Und selbst wenn ihnen wenigstens ein leichter Schauder über den Rücken gelaufen wäre, so hätte sich das bald geben müssen. Das Staunen, das sie befiel, überwand jedes andere Empfinden.
Das Erste, was sie hörten, war eine Frage:
»Wie heißt das Schiff, auf dem Sie sich befinden, meine Herren?«
Da war natürlich die Antwort nicht schwer, und wenn die beiden sie trotzdem nur zögernd gaben, so lag das eben nur daran, dass sie nicht wussten, ob sie laut reden müssten, vielleicht gar schreien — oder wenigstens nach einer bestimmten Richtung hin —
Georg Wedekind überwand sich zuerst.
»Bertran de Born«, sagte er.
»Ganz recht! Und Sie wissen, was dieser Name bedeutet?«
Das war nun wieder ganz selbstverständlich für diese beiden deutschen Jünglinge, und so begann Fritz Hammer gleich zu deklamieren:
»Droben aus dem schroffen Steine raucht in Trümmern Autafort, und der Burgherr steht gefesselt —«
Er wurde unterbrochen.
»Schon gut! Ich wusste es im Voraus. Dieser Bertran de Born spricht zu Ihnen —«
Ob der ferne Sprecher die Gesichter der beiden sehen konnte?
Sie hörten ihn jedenfalls belustigt lachen.
»Selbstverständlich bin ich nicht jener Bertran selbst, ich nenne mich nach ihm, sonst aber ist mein Name Loke Klingsor. Ich fragte auch nur so nebenbei und weil ich mich Ihnen eben vorstellen musste.
Sie befinden sich also auf dem mir gehörigen Schiffe, ›Bertran de Born‹, als meine lieben Gäste —«
»Kommen die immer auf die gleiche Weise zu Ihnen?«, fragte der kecke Georg.
Wieder erscholl ein Lachen.
»Je nachdem! Manchmal wende ich auch andere Methoden an, schlage andere Wege ein. Niemals aber wissen die Betreffenden, was ihnen bevorsteht, und Neugier ist ja auch nicht Ihre Untugend, daran ändert selbst der Umstand nichts, dass Sie das ganze Schiff gründlich durchsucht haben. Das war sogar Ihre Pflicht, und ich hatte meinem Spaß an Ihrer steigenden Verwunderung —«
»Sie können uns immer sehen?«, fragte Fritz jetzt fast verblüfft.
»Immer!«, kam die Antwort, ohne dass die beiden wussten, woher.
»Ja, Herr Klingsor, wie ist das bloß möglich? Und wie können wir mit Ihnen sprechen, obwohl Sie doch sicher weit von uns entfernt sind? Wie können Sie uns —«
»Und so weiter!«, wurde er unterbrochen. »Diese Fragen werden Ihnen alle noch beantwortet werden, vorausgesetzt, dass Sie bereit sind, sich auf ein kleines Abenteuer einzulassen, das jedoch so recht Ihren Neigungen entspricht, wie ich bestimmt weiß —
Und da gleich noch eins! Ehe Sie sich entscheiden, muss ich Ihnen offenbaren, dass Sie — wenigstens für die nächsten Jahre — nicht zu den übrigen Menschen zurückkehren werden, falls Sie sich bereit erklären, die Aufgabe zu lösen, die ich Ihnen stelle.
Wären Sie dazu bereit?«
»Da müssen wir erst die Aufgabe kennen und wissen, mit wem wir es zu tun haben, das heißt, den Namen wissen wir ja schon, aber sonst gar nichts«, entgegnete diesmal Georg Wedekind.
»Tut mir leid! Mehr, als Sie eben erfahren haben, kann und darf ich Ihnen nicht offenbaren — jetzt nicht — aber ich will Ihnen erst etwas zeigen —«
In demselben Augenblicke ging von der schwarzen Platte ein seltsames Leuchten aus, eine Strahlung, die aber doch keine Helligkeit im Raume verbreitete, sondern nur wie eine Lichthülle sich über die ganze Platte verbreitete, und ehe die beiden jungen Männer noch darüber nachdenken konnten, was für ein neues Wunder das war, wurde ihre Aufmerksamkeit schon wieder abgelenkt.
Auf der Platte erschien ein Bild.
»Ein Film!«, sagten die beiden gleichzeitig halblaut.
Wenn sie aber auf eine Bestätigung dieser Vermutung warteten, so sahen sie sich enttäuscht. Die Stimme des Geheimnisvollen ließ sich nicht wieder vernehmen, und sie erkannten auch gleich, dass das doch etwas ganz anderes war, als solche Lichtbilder, wie sie jetzt auch in dem kleinsten Neste auf der »zappelnden Leinwand« gezeigt werden.
Der Unterschied lag schon darin, dass diese Bilder hier farbig waren, nicht etwa nur getönt, wie das der Film in der »Virage« bereits ebenfalls kennt, auch nicht ein sogenannter farbiger Film, wie die beiden einmal gesehen hatten.
Was es war, wussten sie ja nicht, aber sie sahen doch, dass sich hier vor ihren Augen ein wirklicher Vorgang ganz natürlich abspielte, natürlich selbst im zartesten Farbton, dass das Leben dieser Bilder auch natürlich war, das heißt, dass keine bezahlten Kräfte da etwas gemimt hatten. Es war eben eine Naturaufnahme in vollendetster Form, genau, als ständen sie an einem Fenster und sähen alles wirklich vor sich.
Und sie sahen zunächst etwas, was ihnen gut genug bekannt war: ein Stück Urwald mit Bäumen, Schlingpflanzen, Tieren — kurz, mit allem, was dazu gehört.
Fritz Hammer und sein Freund kannten den »Urwaldzauber«, fuhren tausendmal lieber im Boote aufs weite Meer, als dass sie sich in diese modrige Wildnis wagten.
Aber sie kannten alles, was sie sahen, dachten es wenigstens, bis beide zugleich merkten, dass sie sich doch recht beträchtlich geirrt hatten.
Und dann plötzlich beugten sich doch beide in höchster Erregung vor.
Das Bild war weitergeglitten, ein schmales freies Fleckchen, eine Art Oase in der Baumwildnis tauchte auf und auf ihr, aus dem dichten Blattwerk hervorkommend, ein mächtiger Affe, den ganzen Körper mit rotbraunem, grobem Stichelhaar bedeckt —
»Ein Orang Utan!«, murmelte Fritz.
»Ein Gorilla!«, flüsterte Georg.
Und dann erkannten sie wieder, dass sie sich beide geirrt hatten.
Sie kannten jeder den Menschenaffen, den sie genannt hatten, hatten ihn in irgendeinem Zoo gesehen und natürlich nicht nur einmal — solche Seltenheiten besucht man doch öfter —
Sie wussten, dass Menschenaffen aufrecht stehen und gehen können, aber nur mit Hilfe einer Stütze, und auch dann ist es danach.
Dieser Affe hier, der vom Filmoperateur belauscht worden war, ging ohne jede Stütze aufrecht, etwas schwankend, doch aber ganz menschenähnlich.
Und das Gesicht!
Es lag nicht in dem Schnitt allein, es war vielmehr der Ausdruck der gelbgrünen Augen, die unter gewaltigen Stirnwülsten boshaft genug hervorschauten — nein — die beiden konnten nicht sagen, was der Unterschied war, aber Georg Wedekind sprach genau das aus, was sein Freund dachte, als er, nun doch erschauernd, flüsterte:
»Ein Affenmensch! Fritz — Fritz! Dass es so etwas gibt! Nie hätte ich mir das träumen lassen! Kann denn das wahr sein — Natur?«
Und da kam ihm die Antwort durch die so seltsam wohllautende Stimme:
»Sie sehen nur Wirkliches vor sich, nicht aufgenommen durch den Fotografenapparat, sondern eben jetzt sich ereignend. Dieses Geschöpf tritt in dieser Minute aus dem Dickicht auf den freien Platz. Ebenso geschieht alles andere eben erst, wird noch geschehen — nein, das ist kein Film — das ist — eben mein Geheimnis!«
Die Stimme schwieg. Die beiden Freunde hatten nichts zu erwidern, konnten es gar nicht.
Dazu war ihr Staunen, nein, ihre Verblüffung viel zu groß.
Der Menschenaffe oder Affenmensch sicherte, ehe er den freien Platz betrat, winkte dann ganz menschenähnlich mit der einen Hand, und da kam aus demselben Dickicht, das er eben verlassen hatte, ein junges Weib hervor, offenbar eine Italienerin —
»Ist die aber schön!«, flüsterte Fritz entzückt.
Dann aber musste er lachen.
»Dieser Herr Klingsor hat uns zum Besten«, fuhr er fort. »Wie soll denn diese schöne Italienerin in den Urwald kommen! Und in Gesellschaft dieses Affen! Die würde doch schön ausreißen, wenn sie ein solches Vieh sähe!«
»Und jetzt! Sieh doch nur, Fritz!«, fügte Georg hinzu, als die junge Dame, die allerdings für die Wildnis passend gekleidet war, einen Ledersack öffnete und ihm eine Geige entnahm, sie stimmte, ansetzte und zu spielen begann —

Die beiden hörten die Töne nicht, sahen aber gleich, dass das Weib unbedingt eine Künstlerin sein musste, eine Virtuosin auf ihrem Instrument, kamen indessen gar nicht dazu, weiter darüber nachzudenken, denn auf einmal ward es ringsum in dem Urwald lebendig —
»Es ist nicht möglich!«
Fast stöhnend kamen die Worte aus Georgs Mund, und Fritz klammerte sich an den Freund.
Die Künstlerin ward umringt von mindestens zwanzig solchen Riesenaffen, die ihr aber nichts zuleide taten, sondern sich auf den Boden hockten und verzückt den Tönen lauschten, die sie der Geige entlockte.
Da sich die grässlichen Geschöpfe regungslos verhielten, konnten sie von den beiden Freunden in aller Muße beobachtet werden, und nun stand es bei beiden fest, dass sie nicht Menschenaffen vor sich hatten, sondern Affenmenschen, wenngleich sie an deren Existenz nicht zu glauben vermochten.
Es waren auch Weibchen dabei, eins hatte ein Junges bei sich, und auch das lief schon aufrecht, ohne sich einen Ast als Stütze brechen zu müssen. Auch der Bau der Füße war doch ganz anders, wenngleich der abstehende Daumen des Greiffußes noch vorhanden war —
Und da entschwand das Bild!
Das Licht wurde scheinbar von der schwarzen Platte eingesaugt.
Die Freunde aber standen noch und starrten regungslos und beklommen auf die Platte, kaum zu atmen wagend.
Es war beiden wie eine Erlösung, als nun die tiefe, klingende Stimme wieder erscholl.
»Die junge Dame, die Sie eben sahen, ist eine Signorina Ravelli, eine der ersten Geigenkünstlerinnen der Welt. Sie war auf dem Wege zu mir« — den beiden Hörern entging bei ihrer Aufregung der leise Spott in den Worten — »als sie von diesen Geschöpfen entführt wurde, die ihr nichts zuleide tun, aber sie strengstens bewachen und nicht entfliehen lassen —«
»Kann sie denn nicht befreit werden? Wo spielt sich das alles ab?«, fragte Georg Wedekind in höchster Erregung.
Auch Fritz Hammers Augen funkelten, seine Hände zuckten, öffneten sich und schlossen sich —
Und schon kam die Antwort.
»In Ophir.«
Da wussten die beiden allerdings gerade so viel wie erst.
Was der Name bedeutete, war ihnen ja bekannt, jedoch ebenso, dass noch kein Mensch dieses geheimnisvolle Land betreten hatte, keiner es je betreten würde —
»Es gehört mir, und Sie beide sollen es betreten, wenn Sie bereit sind, Signorina Ravelli aus der Gewalt der Affenmenschen zu befreien«, fuhr Loke Klingsor fort.
Da freilich musste Georg Wedekind trotz aller anerzogener und angeborener Höflichkeit doch einmal lachen.
»Sie machen sich einen Spaß mit uns, mein Herr!«, sagte er dann. »Unsere Dummheit und Leichtgläubigkeit scheinen Ihnen große Freude zu machen —«
»Sie irren vollkommen!«, wurde er unterbrochen. »Aber ich nehme Ihnen das gar nicht übel, obwohl Sie doch schon Beweise genug erhalten haben dafür, dass ich über Kräfte verfüge und über Geheimnisse, die der Menschheit noch vollkommen unbekannt sind. Ich will Ihnen noch einen solchen Beweis geben. Jetzt ist es Mittag. Was tut Ihr Herr Chef da regelmäßig? Nein, antworten Sie mir nicht! Ich will es Ihnen zeigen, und wenn nicht alles bis aufs Kleinste stimmt, bis auf die Tintenkleckse auf dem Boden, wo Sie immer Ihre Feder ausspritzen, Freund Hammer, dann brauchen Sie mir nicht zu glauben, dann werde ich dafür sorgen, dass Sie wohlbehalten in Ihre Wohnungen und zu Ihrer Tätigkeit zurückkehren — Bitte!«
Die Tafel erleuchtete sich wieder, umgab sich abermals mit einer Art Gloriole, und ehe noch Fritz Hammer sich von seiner Überraschung erholt hatte, weil der Fremde seinen Namen kannte, seine Gewohnheit, wie er immer die Feder ausspritzte, sahen sie schon den Kontorraum vor sich, in dem sie so oft gesessen hatten — und es braucht nicht erst gesagt zu werden, dass wirklich alles stimmte. Fritz konnte sogar auf seinem Pulte das Monogramm sehen, das er einmal aus Langeweile hineingeschnitzelt hatte —
Ebenso aber stimmte, was sie ihren Chef, den ehrenwerten Señor Paolo Alvarez, tun sahen. Das tat er wirklich immer um diese Zeit, und von einer heimlichen Filmaufnahme war da keine Rede. Das hätte sich der Herr sehr, sehr stark verbeten —
»Wir glauben!«, rief denn auch Georg Wedekind, zugleich im Namen seines Freundes, der eifrig nickte, und da sprach die Stimme aus der unbekannten Ferne:
»Das freut mich, und ich wiederhole also, dass Signorina Ravelli in dem mir gehörigen Ophir gefangen gehalten wird. Sie hatte zwei Begleiter, die eifrig nach ihr suchen, denen ich ebenfalls helfe, die ich aber nicht zum ersehnten Ziele gelangen lassen werde.
Sie beide habe ich zu dem Befreiungswerk ausersehen. Sind Sie bereit?«
»Ja, ja!«, riefen die beiden gleichzeitig.
Jetzt fiel es ihnen nicht mehr ein, zu fragen, wo dieses Ophir läge, sie konnten es doch kaum erwarten, dass sie fort durften —
Und da sprach Loke Klingsor:
»Ich habe mich also nicht in Ihnen getäuscht, habe Sie auch schon lange genug beobachtet, um jede Täuschung unmöglich zu machen.
Gut! Unser Handel gilt! Sie werden in eine Welt der Wunder kommen, Sie werden staunen und nicht eine Minute lang Reue empfinden.
Jetzt begeben Sie sich in den untersten Raum! Dort werden Sie ein Fahrzeug finden, in welches Sie sogleich zu steigen haben. Das Weitere werden Sie selbst sehen.«
Etwas wie ein ferner Glockenton schien aus der schwarzen Platte zu kommen. Die beiden achteten aber nicht darauf, sondern machten, dass sie in den untersten Raum kamen, den sie noch nicht betreten hatten.
Es war sehr finster dort unten, aber als sie eintraten, flammte von selbst das Licht der vielen kleinen Glühbirnen auf, die überall an der Decke und an den Wänden angebracht waren, und da sahen sie auch, was sie hier hatten finden sollen.
Auf einem ganz niedrigen Gerüst lag ein silberglänzender, fischähnlicher Körper, anscheinend aus Aluminium bestehend, aber es konnte natürlich auch ein ganz anderes Metall sein, und da nichts weiter vorhanden war, was irgendwelche Ähnlichkeit mit dem Boote gehabt hätte, so konnten die beiden Freunde eben nicht zweifeln, dass dies das Fahrzeug sein sollte, dem sie sich anvertrauen mussten.
Sie traten hinzu und betrachteten es mit wachsendem Erstaunen.
Das Ding war knapp hoch genug, dass in seinem Innern ein erwachsener Mensch aufrecht stehen konnte, und ungefähr dreimal so lang, also etwa fünf Meter, glich in der Form ganz dem Körper eines Delfins und hatte auch an den betreffenden Stellen eine Art Flossen, aus Metallplatten bestehend.
Eine Tür war nirgends zu sehen. Wenn das Ganze nicht aus einem einzigen Stücke bestand, so waren die Teile doch so aneinandergepasst, dass keinerlei Naht und Fuge mehr zu sehen waren.
»Ein seltsames Boot!«, sagte Georg Wedekind. »Aber praktisch der Form nach.«
»Und da im Kopfe sind Augen eingesetzt, genau in der Farbe der Delfinaugen!«, rief Fritz Hammer, der eben diese Entdeckung gemacht hatte.
Ohne dass er eine Absicht dabei hatte, berührte er eins dieser Augen, vielleicht um festzustellen, ob sie aus Glas seien, und in demselben Moment prallte er — tüchtig erschrocken — zurück.
Da hatte dieser silbern glänzende, gewaltige Fisch doch gleich den Rachen aufgetan, als wollte er den jungen Mann mit Haut und Haaren verschlingen.
»Da haben wir ja den gesuchten Eingang!«, versetzte Georg, der erst über den Schrecken seines Freundes gelacht hatte.
Und schon spazierte er in den offenen Rachen hinein, stieg das Treppchen hinab, das darin angebracht war, und stand in einer überaus wohnlich eingerichteten, freilich sehr niedlichen Kajüte.
Fritz war ihm gefolgt, und noch schauten die beiden sich bewundernd um, als der Delfin schon wieder seinen Rachen zuklappte, gleichzeitig in zwei Ampeln ein sanftes Licht aufglühte, das aber nicht elektrisch sein konnte, und — das Ganze sich in Bewegung setzte.
Und da setzten sich auch die beiden Freunde! Vor Staunen natürlich! Gleich auf den Boden!
Sollten sie auch nicht!
Wohin wollte denn das Vieh mit ihnen hier in dem tiefsten Bauche des Schiffes? Wollte es sich den Schädel an den dicken Bohlen einrennen?
Die beiden sprangen alsbald wieder auf, suchten aus dem Kerl herauszukommen, fanden aber keine Türöffnung mehr und drückten vergebens an den Augen, die auch von hier innen zu sehen waren.
Dabei merkten sie recht gut, dass der ganze metallene Fisch noch immer in gleichmäßiger Bewegung vorwärtsglitt, ohne bisher noch anzurennen —
Und dann — sie merkten es doch beide gleich — waren sie auf einmal im Wasser.
»Das ist ein Unterseeboot, ein Tauchboot!«, rief Fritz, außer sich vor Entzücken, denn er hatte sich immer gewünscht, mal eine Fahrt in einem solchen machen zu können.
»Und was für eins!«, fügte Georg hinzu, auf die Wände deutend.
Da gewahrte auch sein Freund das neue Wunder.
Die scheinbar aus härtestem Metall bestehenden Platten waren vollkommen durchsichtig, aber das hätten die Eingeschlossenen doch gar nicht beurteilen können, denn unter Wasser fehlte es eben an Licht, wenn dieses nicht auf geheimnisvolle Weise von dem Delfin ausgegangen wäre, in solcher Stärke, dass das Wasser auf eine weite Strecke durchleuchtet wurde.
Die beiden Freunde brauchten eine ganze Weile, ehe sie ihr Staunen bezwungen hatten. Sie sahen nun auch, dass sogar die vermeintlichen Glasaugen wie große Laternen oder vielmehr wie Scheinwerfer wirkten, und da freilich klatschten sie gleich vor Freude in die Hände.
»Jetzt fahre ich endlich mal in einem Tauchboot!«, rief Fritz Hammer. »Das hätte ich mir ganz anders vorgestellt —«
»Eben!«, gab Georg Wedekind zu.
Er guckte sich immer wieder um, sah aber nichts von den komplizierten Apparaten, die doch in einem solchen Tauchboote vorhanden sein müssen. Der Raum war nichts weiter als eine wohnlich eingerichtete Kajüte oder — wenn man nicht mehr daran dachte, dass man sich in einem Boote befand — ein recht hübsches Zimmerchen, das auch auf dem festen Lande in irgendeinem Hause hätte gelegen sein können.
Da merkte Fritz, was sein Freund suchte.
Auch fiel ihm jetzt etwas auf.
»Ja, wie wird denn hier die atembare Luft erzeugt, Georg?«, fragte er. »Ich atme genau so gut, als stände ich im Freien, habe keinerlei Beschwerde, keinen Druck auf der Brust, mein Herz schlägt normal —«
Er fühlte auch gleich seinen Puls.
»Merkwürdig!«, konnte Georg nur murmeln. »Das Boot enthält anscheinend gar keine Maschine und bewegt sich trotzdem. Es erzeugt ein wunderbar strahlendes Licht, die Luft wird nicht schlechter — was liegt denn eigentlich hier vor?«
Ja, sie wussten es nicht, fanden auch nichts, was zur Erklärung dieses seltsamen Rätsels hätte dienen können. Sie konnten eben nur staunen.
Der Delfin, wie sie das Fahrzeug nach seiner Gestalt nannten, schoss unaufhaltsam dahin, immer in tiefstem Wasser. Die beiden konnten seine Schnelligkeit nicht beurteilen, denn das ist in einem unter Wasser fahrenden Boote ebenso wie in einem über den Wolken fahrenden Luftschiff nur durch Apparate möglich. Aber in der Tiefe der See ist da jede Beobachtung erst recht schwer, weil jeder feste Punkt fehlt, nach dem man urteilen könnte. Immerhin kann man doch das Empfinden haben, ob man schnell oder langsam vorwärtskommt, und die beiden hier nahmen eben an, sie führen sehr, sehr schnell.
Sie guckten auch einmal hinaus in das Wasser, das der Delfin so schnell durchschnitt, ohne irgendwelche Bewegung hervorzurufen. Er glich eben auch darin ganz dem Fische, nach dessen Vorbild er gebaut war.
»Woher kommt nur das Licht, das von dem Boote ausgeht?«, rief Fritz Hammer aufs Höchste verwundert.
»Und wie ist es möglich, dass wir durch die festen Metallplatten das Wasser sehen können?«
Ja, da hätte er noch ganz andere Fragen stellen können, ohne eine Antwort darauf zu erhalten. Die beiden hatten keine andere Kenntnis von modernen Maschinen als jeder andere gebildete Mensch, und da fährt man doch täglich mit der elektrischen Straßenbahn, mit einem Auto oder mit einem Zuge, man sitzt drin, und wenn man gefragt würde, wie es kommt, dass das Ding fährt, so antwortet man wohl: durch die Kraft der Elektrizität, des Gases, des Dampfes, aber wie das eigentlich zugeht, das weiß selten einer, und noch weniger könnte einer das auch den Mitfahrenden gleich ganz deutlich machen.
Das ist nun einmal so. Der erste von einer Lokomotive gezogene Zug, die erste Elektrische, das erste Auto sind angestaunt und vielfach belacht worden. Kurze Zeit später aber hatte man sich so an ihren Anblick gewöhnt, dass niemand mehr hinsah —
Nein, die beiden wussten durchaus nicht, wie sie dieses technische Wunder erklären sollten, und weil sie diese Unmöglichkeit immer mehr erkannten, taten sie das Vernünftigste, was in diesem Falle getan werden konnte: Sie kümmerten sich nicht weiter darum.
Nur die letzte Frage seines Freundes beantwortete Georg Wedekind noch, indem er sagte.
»Wie es zugeht, dass diese Metallplatten durchsichtig geworden sind, weiß ich nicht, aber ich weiß auch nicht, warum aus Quarz und den übrigen Bestandteilen, die alle undurchsichtig sind, das durchsichtige Glas entsteht.
Ich weiß nicht, warum ich mit Röntgenstrahlen einen Körper durchleuchten kann, dass ich alle Knochen darin deutlich sehe. Das sind eben Naturgeheimnisse, die wir Menschen zufällig gefunden haben, die wir aber nicht erklären können, sondern als Tatsache hinnehmen müssen.
Vielleicht gibt uns Herr Klingsor später eine Erklärung — auch für die Rätsel an Bord des ›schlafenden Schiffes‹. Ich bin wissbegierig, aber nicht neugierig, und außerdem habe ich jetzt großen Durst. Es ist schade, dass wir nichts zu trinken mitgenommen haben —«
Ja, da fiel ihnen erst ein, dass sie doch recht leichtsinnig gewesen waren. Sie hatten gar nicht daran gedacht, sich auf die Reise Vorräte mitzunehmen, von denen es doch auf dem ›Bertran de Born‹ gerade genug gegeben hatte.
Doch Fritz Hammer rief:
»Mich sollte sehr wundern, wenn dieses Tauchboot nicht auch in dieser Hinsicht mit allem versehen wäre, was wir brauchen. Wir wollen nur einmal nachsehen.
Nun, viel nachzusehen war da freilich nicht.
Die Kabine enthielt keine Möbel außer dem in der Mitte stehenden Tische und der an der Wand umlaufenden Bank. Ein Schrank oder nur ein Wandkasten war nicht zu sehen. Sie brauchten also eigentlich gar nicht zu suchen, aber sie taten es doch, veranlasst durch eine Bemerkung, die sie erst jetzt machten.
Der Delfin war also durchsichtig, sie konnten durch die Wände in das Wasser hinaussehen, aber nicht an allen Stellen.
Im hinteren Teile war ein ganzes Stück dunkel gefärbt, und als die beiden Freunde dorthin traten und die Wand untersuchten, fanden sie bald genug an ihr einen nur ganz wenig hervorstehenden Knopf.
Georg drückte darauf.
Sofort sprang eine Platte auf, schlug ganz herum, und die beiden sahen nun vor sich, was sie gesucht hatten. Sie blickten in eine kleine Speisenkammer, in welcher wirklich alles vorhanden war, was sie nur wünschen konnten, freilich nicht in frischem Zustande, sondern in Büchsen, also präserviert, und auf dem Boden war ein Gestell angebracht, in dem allerlei Flaschen standen, seesicher verstaut, dass sie nicht herausgeschleudert werden und zerbrechen konnten, was bei der ruhigen Bewegung des Delfins ganz unnötig gewesen wäre, und in der Tiefe des Meeres gibt es ja auch keinen Wellenschlag.
Jedenfalls versorgten sich die beiden mit dem, wonach ihr Sinn stand, bedauerten keineswegs, dass die Flaschen bloß alkoholfreie Getränke enthielten, sondern brachten alles, was sie sich gewählt hatten, zu dem Tisch, stellten es hübsch zurecht, wie sie es sich auf ihren einsamen Fahrten angewöhnt hatten, suchten nach dem Tischkasten, in dem sie Bestecke vermuteten, fanden sie, sahen nun auch auf einem kleinen Wandbord Gläser — und hatten alles, was sie brauchten.
Mit dem leichten Sinn der Jugend aßen und tranken sie, räumten darauf alles wieder weg, säuberten auch den Tisch, und nun suchte Georg Wedekind nach seiner Tabakspfeife.
Ja, die hatte er in seiner Tasche, aber der Tabak? Der war wohl in dem Kutter geblieben, er hatte nicht daran gedacht, ihn zu sich zu stecken, als er an Bord des treibenden Dampfers kletterte.
»Schade!«, murmelte er. »Jetzt kann ich nicht rauchen, und das wird mir wohl fehlen, wenn ich auch nicht gerade unglücklich deswegen bin.«
»Vielleicht ist Tabak vorhanden!«, meinte Fritz Hammer und suchte schon auf der dem Speisenschrank gegenüberliegenden Seite nach einem Druckknopf, denn auch dort war das Metall undurchsichtig.
Und er hatte richtig vermutet.
In dem Fache, das sich auftat, fanden sie nicht nur losen Tabak verschiedener Schnittart, sondern auch Zigaretten und Zigarren sowie Pfeifen unterschiedlicher Größe. Auch andere Sachen lagen darin.
»Hier ist ein Schachbrett!«, rief Fritz, der das ›königliche‹ Spiel sehr liebte. »Das ist famos, Georg! Da spielen wir nachher eine Partie, wenn die Fahrt uns langweilig wird —«
Aber Georg achtete nicht auf den Freund.
Er hatte in einem Kästchen Papiere entdeckt, eins davon entfaltet und betrachtete es nun verwundert.
Fritz, der es bemerkte, schaute ebenfalls auf das Blatt.
»Das ist wahrscheinlich eine Tafel für Kriegsspiele!«, sagte er, und er hatte ein Recht, so zu sprechen, denn das Blatt war mit geraden Linien in verschiedenen Farben bedruckt oder bemalt — er konnte das nicht ohne Weiteres feststellen — und wo zwei oder drei oder mehr solche Linien einander kreuzten, war immer ein Kreis gezeichnet, ein großer oder ein kleiner. Eine bestimmte Regel schien es nicht zu geben, aber nach Fritz Hammers Ansicht stellten diese Kreise eben Ortschaften dar, und die Kreise, um die noch ein Stern gezeichnet war, sollten dann wohl Festungen markieren.
Jedenfalls sah das Ganze etwa aus wie eine Karte von Bahnlinien, nur dass diese eben in verschiedenen Farben gehalten waren. Aber auch solche EisenbahnOrientierungskarten gibt es ja.
Georg Wedekind indessen schüttelte den Kopf.
Er deutete auf eine Schriftzeile ganz unten auf dem Blatte, und da freilich stutzte Fritz doch wieder. Er las:
»Übersichtskarte der südamerikanischen Verbindungen.«
»Nanu!«, rief er. »Das habe ich auch noch nicht gewusst, dass Südamerika ein so ausgedehntes Eisenbahnnetz hat?«
»Eisenbahnnetz?«, wiederholte Georg spöttisch. »Im Innern dieses Erdteiles Eisenbahnen? Du träumst wohl, Fritz! Sieh doch bloß mal her! Hier — das Gebiet, das ich mit dem Finger berühre, das ist das Gran Chaco, ein Landstrich, der fast noch gar nicht durchforscht worden ist, den noch nie der Fuß eines weißen Mannes betreten hat.
Und da soll eine Bahnlinie verlaufen? Unsinn!«
Er hatte recht. Die um die Linien gezeichnete Karte stellte Südamerika vor. Das sahen die beiden, wenn es auch nicht dabeistand, und da wussten sie doch, dass es wohl allerhand Bahnstrecken gab, aber doch keine einzige, die das Land durchquerte, während hier die Linien das taten. Sie liefen sogar über die Kordillieren hinweg.
»Nein, diese Linien haben etwas ganz anderes zu bedeuten als Bahnstrecken, und ein Kriegsspiel ist das erst recht nicht«, sagte Georg Wedekind. »Ich will doch mal sehen, ob auch von den anderen Erdteilen noch Karten vorhanden sind.«
Er nahm ein anderes Papier aus dem Kästchen, entfaltete es und sah darauf Australien, auch nur im Umriss gezeichnet, aber doch gleich erkennbar, und auch da waren wieder die Linien und Kreise vorhanden, sogar welche mit dem Stern darum.
Das nächste Blatt stellte Afrika dar, aber nur den nördlichen Teil.
Es war dasselbe. Wieder die Linien und Kreise.
Die beiden wussten mit den Blättern nichts anzufangen, und deswegen packten sie sie wieder ein, Georg nahm sich Tabak, Fritz Zigaretten, und eben wollte ersterer seine Pfeife anbrennen, da blies er das bereits angestrichene Zündholz wieder aus.
»Wir wollen es lieber lassen, Fritz!«, sagte er. »Wir wissen doch nicht, wie lange wir in diesem Tauchboot zubringen müssen, und wenn wir rauchen, verderben wir nur die Luft.«
»Unnötige Besorgnis! Die Luft wird ständig erneuert!«
Ganz deutlich hatten die beiden diese Worte vernommen, und ihre Gesichter waren ja nicht schlecht verdutzt.
Sie guckten sich um. Sie dachten ja nicht anders, als dieser geheimnisvolle Loke Klingsor, dessen Stimme sie nun bereits kannten und die sie eben gehört hatten, hätte sich irgendwo in dem Delfin versteckt gehalten und sei nun hervorgekommen.
Aber sie waren allein. Sie sahen keinen anderen Menschen.
»Mein Himmel, jetzt kann der zu uns sprechen, trotzdem wir sicher tief unter Wasser sind!«, stieß Fritz Hammer hervor, ganz blass werdend.
Das ging doch über alles menschliche Können hinaus! Das grenzte an Zauberei!
Georg Wedekind jedoch hatte sich schnell von dem Schrecken erholt, der auch ihn befallen hatte.
»Herr Klingsor!«, rief er, lauter, als die Stimme erklungen war.
Vergebens wartete er auf eine Antwort. Alles blieb stumm.
Da aber sprang er auf, die gestopfte Pfeife auf den Tisch werfend.
»Wir benehmen uns wirklich unverantwortlich!«, rief er dabei. »Wir denken an Essen und Trinken und an Rauchen, und dabei achten wir gar nicht darauf, wohin wir eigentlich fahren, was draußen vorgeht — ich weiß wirklich nicht, was uns so umgewandelt hat! Wir waren doch sonst ganz anders, hielten immer unsere Augen offen, wenn es etwas Wunderbares oder wenigstens Neues zu sehen gab, und hier setzen wir uns an den Tisch —«
Er trat an die eine Wand des Unterseebootes. Fritz gesellte sich beschämt zu ihm. Sie guckten beide hinaus, ganz angestrengt, als wollten sie nun durch doppelte Aufmerksamkeit das Versäumnis von vorher wieder ausgleichen.
Sie hätten es nicht nötig gehabt.
Sie sahen wirklich weiter nichts als Wasser, Wasser, Wasser!
Nicht einmal einen Fisch entdeckten sie, an dem der Delfin vorbeikam, auch kein anderes Tier, und es musste doch gewiss viele noch unbekannte Geschöpfe in dieser Tiefe geben.
Schon wollten sie an den Tisch zurückkehren, da blieben sie aber doch in höchster Überraschung stehen.
Bisher hatten sie also nichts sehen können als Wasser. Den Boden des Meeres hatten sie nicht gewahrt.
Nun aber sahen sie auf einmal, dass sie zwischen Felsen dahinfuhren, mächtigen Gebilden, die sicher hoch empor ragten, deren Gipfel sie aber nicht erblicken konnten.
Und an diesen Felsen gewahrten sie nun auch die ersten Seetiere, festsitzende Polypen, Seeanemonen und anderes —
Aber nicht darüber wunderten sie sich, sondern bloß, weil der Delfin allen diesen Hindernissen auswich, als sei er lebendig.
Das Boot betrug sich, wie ein wirklicher Delfin sich betragen hätte, fuhr gewandt zwischen den Felsen hindurch — schwamm vielmehr —
Und da sahen die beiden auch den Meeresboden, der durch das von dem Fahrzeug ausgehende Licht klar beleuchtet wurde und auf dem sich allerhand seltsames Getier regte.
In eine Welt der Wunder hatten sie geführt werden sollen, wie Klingsor ihnen versprochen hatte.
Jetzt waren sie mitten drin, und da freilich vergaßen sie alles andere. Einer machte den anderen auf das oder jenes seltsame Geschöpf aufmerksam, auch schraken sie manchmal beide zurück, wenn ein solches mächtiges Ungetüm mit weitgeöffnetem, von Zähnen starrendem Rachen gerade auf sie zu geschwommen kam, als könne es sie von draußen erblicken.
Mehrmals hörten sie auch einen Anprall, sahen, dass Tiere gegen die Wand stießen —
Sie lachten endlich darüber.
»Schade, dass wir keinen fotografischen Apparat bei uns haben!«, sagte Georg Wedekind eben, da prallte er doch gleich bis zur Mitte des kleinen Raumes zurück.
Er hatte gerade von vorn geschaut und so gewahrt, dass der Delfin auf eine mächtige Steinwand zu schwamm.
»Fritz!«, schrie er auf. »Wir rennen an — — es gibt ein Unglück!«
Auch Hammer gewahrte die Nähe der Katastrophe, auch er prallte zurück, erwartete schon den gewaltigen Krach, mit dem der Zusammenstoß erfolgen musste —
Sie waren beide ganz blass geworden. Aber da atmeten sie auch schon wieder erleichtert auf. Der Anprall fand nicht statt.
Der Delfin rannte also nicht mit dem Schädel gegen das Gestein, sondern hob sich unmittelbar vor ihm mit Leichtigkeit, stieg und stieg —
Und dann fassten die beiden Freunde einander, als wollten sie im letzten Augenblicke ihres Lebens möglichst nahe beieinander sein, zusammen durch die Pforte des Todes gehen.
Sie sahen, wie sich vor dem Delfin eine mächtige Höhle öffnete, wie er hineinfuhr — in diesem Augenblick hatten sie erst das ganze Empfinden der großen Schnelligkeit, das ihnen nicht einmal da gekommen war, als sie an den Felsen vorübergeschwommen waren.
Sie sausten hinein. Anders konnten sie es gar nicht bezeichnen, und Georg Wedekind hatte trotz seiner Bestürzung. trotz der Beklemmung, die ihm den Atem versetzte, auch gleich eine Erklärung.
»Wir sind in eine unterseeische Strömung geraten!«, murmelte er. »Hier wird das Wasser in eine Höhle gezogen — da — wir sind schon drin — Gott sei uns gnädig!«
In der Tat! Sie fuhren nicht mehr im freien Wasser, aber auch nicht in einer weiten Höhle, was sie ja gar nicht so ohne Weiteres hätten beurteilen können, sondern diese musste sich unmittelbar hinter dem breiten Eingang sehr verengt haben, denn sie bemerkten rechts und links Felswände — auch über sich, als sie nun durch den Rücken des Delfins emporschauten —
Da mag einer noch so unerschrocken sein, bei einer solchen Entdeckung kann er doch erbeben!

Diesen beiden jungen Männern aber war das gewaltige Erschrecken gleich gar nicht übel zu nehmen. Sie befanden sich zum ersten Male in einem Unterseeboote, konnten nicht das Geringste tun, um es zu lenken, wussten nicht, wo sie sich befanden — da soll einer nicht erschrecken, wenn das Ding plötzlich in eine solche Höhle einbiegt oder vielmehr in eine Röhre —
Denn diese hier war doch eben kaum weit genug, um den Delfin durchzulassen. Das konnten sie ohne jede Mühe durch einen Blick hinaus feststellen. Die grauen Steinwände waren dicht neben und über ihnen, sodass sie sich unwillkürlich duckten —
Aber diese Bangigkeit dauerte nicht lange, nur Sekunden.
Fritz Hammer fand das befreiende Wort, indem er sagte:
»Georg, sind wir nicht recht töricht, dass wir uns so sorgen? Wir dürfen doch ganz gewiss diesem Loke Klingsor vertrauen, der uns nicht in einen so schrecklichen Tod geschickt hätte! Wenn er das wollte, dann hätte er uns auf ganz andere Weise ins Jenseits befördern können —
Nein, Georg, ich vertraue auf ihn, und Du —«
»Ich auch!«
Die beiden schauten einander an, mit noch etwas verstörten Augen, aber auf einmal lachten sie alle beide.
»Na, weißt Du«, sagte Georg, »wenn unser unsichtbarer Freund uns jetzt hat beobachten können, da wird er keinen hohen Begriff von unserem Mute erhalten haben. Ich wenigstens habe mich jämmerlich benommen. Aber das soll das letzte Mal gewesen sein, und er wird schon verstehen, wie es kommen konnte. Meinst Du nicht, Fritz?«
Dieser ward einer Antwort enthoben, denn auf einmal erklang wieder die herrliche Stimme Loke Klingsors selbst.
»So ist es, mein Freund!«, sagte er. »Wir wollen auch gar nicht weiter davon sprechen. Ich will nur daran erinnern, dass wir Menschen eben Lichtgeschöpfe sind, Sonne brauchen und Luft. Deshalb habe ich ja schon dafür gesorgt, dass das Tauchboot eigenes Licht verbreitet und die ewige Nacht der Tiefsee erhellt.
Genug davon! Sie fahren jetzt in einem der unzähligen Kanäle, von denen nicht nur Südamerika, sondern überhaupt alles Festland der Erde vollkommen durchzogen wird. Die Karten, die Sie vorhin fanden, sind Aufzeichnungen solcher Kanäle, enthalten freilich noch lange nicht alle. Ich habe noch nicht Zeit gehabt, diese Forschungen zu vollenden. Jedenfalls aber werden Sie bei einiger Aufmerksamkeit bald erkennen, dass sich sehr oft Seitenkanäle abzweigen. Das sind solche, die für Sie nicht in Betracht kommen.
Vor allem fürchten Sie nichts mehr. Sie sind in vollkommener Sicherheit, aber Sie werden das Boot auch verlassen können, wenn Sie einmal Lust dazu verspüren. Ich will es vorläufig einmal bei Treppe achthundertzwei halten lassen —«
»Verzeihen Sie, Herr Klingsor«, wagte Georg Wedekind da den unsichtbaren Sprecher zu unterbrechen. »Sie lenken das Boot?«
»Ja.«
»Aber wie ist denn das nur möglich? So tief unter dem Wasser! Mit solcher unfehlbarer Sicherheit?«
»Eine Kleinigkeit für mich, die eben nur etwas Aufmerksamkeit erfordert«, erklang die Antwort. »Sie besinnen sich an die Versuche, ein auf dem Wasser fahrendes Boot vom Lande aus zu lenken?«
Ja, die beiden besannen sich, hatten seinerzeit mit Interesse in den Zeitungen gelesen, wie ein bayrischer Lehrer solche Experimente gemacht und das Problem auch gelöst hatte. Sie hatten allerdings nichts von einer praktischen Verwendung der Erfindung gehört.
»Sie bedienen sich der Elektrizität?«, fragte Georg Wedekind also gleich.
»Nein, ich verfüge über eine andere, viel stärkere Kraft, aber ich kann Ihnen jetzt darüber keinen weiteren Aufschluss geben. Später, wenn Sie alles kennen, werden Sie einsehen, wie wenig Mühe mir dieses Lenken Ihres Bootes macht, ebenso wenig wie, dass ich mit Ihnen spreche und Sie selbst fortgesetzt sehe.«
»Herr, Sie sind doch kein allwissender, allgegenwärtiger Gott!«, rief Georg außer sich.
»Vor solchem Hochmut möge mich der behüten, dessen Namen Sie aussprachen! Nein, ein Gott zu sein, dünke ich mich nicht. Lassen wir das! Sie werden ja bald sehen, dass auch ich ein Menschenkind bin — wenn ich auch etwas mehr als meinesgleichen in der Erkenntnis gewisser Kräfte vorgeschritten bin.
Also, Sie dürfen das Boot verlassen. Es wird an der Treppe halten. Diese führt einen Schacht empor, der mit Wasser gefüllt ist. Wohin Sie durch ihn gelangen werden, das will ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich würde Ihnen nur die Überraschung verderben. Damit Sie aber das Boot verlassen können, das Sie mit dem richtigen Namen ›Delfin‹ genannt haben, müssen Sie sich der Taucheranzüge bedienen, die sie in einem anderen Wandfache finden. Suchen Sie es nur. Und nach der kleinen Extratour kehren Sie in das Boot zurück, um an Ihr Ziel zu gelangen. Halten Sie sich auch nicht zu lange auf. Sie wissen, was auf dem Spiele steht!«
»Die Befreiung der Künstlerin!«, riefen die beiden gleichzeitig, und Fritz Hammer setzte hinzu:
»Da wollen wir doch lieber gar nicht erst aussteigen!«
»Sie dürfen es schon. Die Affenmenschen, welchen Namen ich diesen Geschöpfen einmal geben will, obwohl er nicht treffend ist, tun ja der jungen Dame nichts zuleide, und Furcht kennt sie nicht — also seien Sie auch da ohne Sorge!
Haben Sie sonst eine Frage?«
»Wie steht es mit Waffen, Herr Klingsor?«, fragte Georg Wedekind.
»Alles vorhanden. Suchen Sie nur nach! Sie werden schon finden, was Sie brauchen. Es sind sogar Waffen da, die Ihnen unbekannt sind, mit Elektrizität zu laden, aber lassen Sie die lieber noch liegen. Ich zeige Ihnen noch, wie sie anzuwenden sind.
Sonst noch was?«
Nein, die beiden wussten nichts mehr, waren ja nun auch vollkommen beruhigt.
»Nun, wenn Ihnen etwas einfällt, dann sprechen Sie es nur aus! Ich höre Sie immer, und sollte ich meinen Posten doch einmal verlassen müssen, dann werde ich für einen Stellvertreter sorgen.
Also vorwärts! Und viel Vergnügen!«
Die beiden schauten abermals einander an. Vergnügen wünschte er Ihnen?
Na ja, man konnte die Fahrt schon vergnüglich nennen, wenn man keine Sorge mehr zu haben brauchte, aber wahrscheinlich hatte dieser Loke Klingsor da eben nur die übliche Redensart angewendet, sich auch nichts dabei gedacht, wie das immer ist, wenn zwei Menschen sich treffen, solche Redensarten miteinander tauschen.
»Wir wollen gleich mal nachsehen, wo die Taucheranzüge liegen!«, schlug Fritz vor, denn das hatte er sich auch schon lange gewünscht, dass er einmal so auf dem Meeresboden herumspazieren könnte. Er wusste freilich, dass das gar nicht so vergnüglich war, aber versuchen wollte er es doch gar zu gern.
Nun, die beiden fanden nicht nur die Anzüge, sondern auch die Waffen und noch manches andere, hatten eben noch Zeit die Gebrauchsanweisung zu studieren, die bei den Skaphandern lag, und diese mal probeweise anzuziehen, da merkten sie, dass der Delfin haltmachte.
Rasch liefen sie an die eine Wand, sahen aber dort bloß den grauen Felsen, auch an der anderen — bis sie über sich blickten und da eine Öffnung gewahrten.
Von einer »Treppe« sahen sie freilich noch nichts, aber sie kletterten doch gleich auf den Tisch, mussten ganz gebückt stehen, während sie nun an dem »Rücken« des Delfins herumsuchten, um eine Tür zu finden.
Bis Georg Wedekind plötzlich lachend wieder heruntersprang.
»Mensch, sind wir dumm!«, rief er.
»Wieso denn?«, fragte Fritz.
»Nun, wenn wir auch eine Tür dort oben entdecken, aufmachen können wir sie doch nicht! Bedenke doch den Wasserdruck! Wie sollen wir den überwinden!«
»Ja, wirklich, Du hast recht, Georg!«, gab Fritz zu. »Aber wie sollen wir da hinauskommen?«
Georg brauchte diese Frage nicht zu beantworten. Der Delfin rückte etwas, als sei es ihm schwer, an sein Ziel zu kommen, schob sich wieder vorwärts, kam in einen ganz engen Kanal, den er ganz ausfüllte, fuhr darin ein Stück und lag wieder still.
»So ist es recht!«, rief Georg, nachdem er kaum hinaus geblickt hatte.
Das seltsame Tauchboot lag in einer kleinen Höhle, die aber nur im unteren Teile mit Wasser gefüllt war.
Rechts zog sich eine ziemlich breite Steinplatte hin, und über ihr musste sich also ein Luftraum befinden.
Wie hoch diese Höhle war, konnten die beiden nicht sehen, aber sie kümmerten sich auch nicht darum, da eben der Delfin seinen Rachen auftat, sodass sie aussteigen konnten.
Sie wollten es wenigstens, merkten erst, als sie die Füße nicht vorwärts brachten, dass die schweren Bleisohlen an diesen Schuld daran waren, lösten sie also und kletterten nun hinaus.
Ja, sie standen in einer Höhle, die recht hübsch geräumig und hoch war.
Wie die Luft darin beschaffen war, konnten sie nicht beurteilen, da sie zu schnell die Tauchhelme aufgesetzt hatten, die sie sich nun gegenseitig festschraubten, wobei sie aber plötzlich innehielten.
Fritz griff auch gleich mit beiden Händen nach denen Georgs, und dieser hatte im gleichen Augenblick denselben Gedanken.
Sie nahmen nun doch die Helme noch einmal ab.
»Beinahe hätten wir eine große Dummheit gemacht, Georg«, sagte Fritz. »Wir müssen uns doch vorher verständigen, ehe wir die Dinger festschrauben. Wenn wir sie einmal aufhaben, können wir nicht mehr miteinander reden, uns höchstens durch Zeichen verständigen.
Also zunächst: Wir müssen wahrscheinlich in dem engen Kanal zurück bis zu dem Schachte. Meinst Du nicht?«
»Ganz recht!«, gab Georg zu.
»Hm! Und wenn wir —«
»Zweifelst Du schon wieder?«, fuhr Georg ihn vorwurfsvoll an.
Fritz wurde rot.
»Nein, das will ich nicht. Also setzen wir die Dinger wieder auf!«
Er machte den Anfang, Georg tat es ihm nach, sie zogen die Schrauben an, sie waren fertig —
Und ohne Weiteres stiegen sie in das Wasser, sich vorläufig noch an dem Rande der Felsplatte haltend, und da merkten sie schon, dass das Wasser ihnen nur bis an die Brust reichte, wie denn auch der Delfin über die Hälfte daraus hervorragte, konnten sich aber nicht darüber verständigen und kamen alsbald an die Öffnung des engen Kanals.
Georg kroch als Erster hinein, Fritz folgte, und dadurch bewiesen die beiden nun allerdings, dass sie nicht nur keine Furcht kannten, sondern ihrem geheimnisvollen Beschützer vollkommen vertrauten.
Es war doch ein sehr, sehr großes Wagnis, in diesen Kanal zu kriechen, dessen Länge sie nicht kannten, und sie wussten auch nicht, wie sie an seinem Ende in den senkrechten Schacht kommen sollten.
Wenn sie nun versanken?
Nun, dieser Gedanke mochte beiden gekommen sein, aber sie hatten ihn beide sogleich wieder verworfen.
Langsam ging es vorwärts, auf dem Bauche liegend, aber schon streckte Georg die Arme in freies Wasser, und als er noch suchend umhertastete, gewahrte er, wie die dichte Finsternis um ihn her durch einen grellen Lichtschein erhellt wurde, griff auch gleich etwas wie eine Stange, stutzte, schaute hin und fand, dass es eine metallene Sprosse war, zu einer Leiter gehörig, die also von Klingsor als Treppe bezeichnet worden war.
Aus was für Metall sie bestand, ahnte er nicht, sie leuchtete so silbern wie die Platten, aus denen der Delfin bestand, jedenfalls kümmerte er sich nicht weiter darum, sondern zog sich ganz zu der Sprosse heran, griff nach der nächsten und stieg so empor.
Der Schacht, in den er auf diese Weise gelangte, war sehr eng, er konnte sich kaum darin bewegen, hätte sich nicht umzudrehen vermocht, und noch weniger konnte er nach unten blicken, um sich zu überzeugen, ob Freund Fritz ihm folge.
Da aber erhielt er auf andere Weise diese Gewissheit.
Von unten her wurde an seine Füße gestoßen, und nun setzte er beruhigt den Aufstieg fort, die Sprossen zählend, bis er bei der achtundvierzigsten zu seiner Erleichterung merkte, dass der Schacht zu Ende war und er mit dem Kopf bereits in einer Höhle war.
Halbdunkel umgab ihn, sodass er zunächst nichts weiter erkennen konnte. Er stieg also vollends heraus, half seinem Freunde, der unmittelbar hinter ihm auftauchte, und nachdem beide nun wieder auf festem Boden standen, hielten sie es doch für richtig, den Tauchhelm abzuschrauben, schon, damit sie sich miteinander besprechen könnten, wenn das nötig werden sollte.
Bald war der Helm entfernt, beide atmeten erst einmal tief, obwohl sie auch in dem engen Behälter keine Luftnot gehabt hatten — es war eben doch was anderes — Luft und Licht braucht der Mensch, aber an letzterem fehlte es hier, und die Kunst Loke Klingsors schien nicht fertigzubringen, dass es auch hier hell wurde. Es blieb dunkel.
»Nun, dann müssen wir eben so festzustellen suchen, was wir hier sollen«, sagte Georg Wedekind. »Ohne Grund hat Herr Klingsor uns nicht hierher geschickt. Wir wollen aber erst einmal nach der Wand suchen, dass wir uns an ihr entlangtasten können. An das Halbdunkel werden wir uns bald gewöhnen. sodass wir auch hier ganz gut werden sehen können.«
Fritz hatte nichts einzuwenden, er tappte hinter seinem Freunde her, aber sie hatten einen ziemlich weiten Weg bis zu der Wand der Höhle. Diese war also geräumiger als sie erwartet hatten. Endlich erreichten sie sie doch, und Georg tastete mit der Hand, die von diesem Taucheranzug freigelassen wurde, aber durch einen besonderen Handschuh geschützt werden konnte, an ihr hin.
Er berührte kaltes Gestein, das jedoch von Menschenhand bearbeitet worden zu sein schien, da es recht glatt war. Oder das Wasser war hier tätig gewesen, das ja auch den härtesten Stein ganz glatt zu schleifen vermag —
Langsam schritt er dahin, dicht hinter sich den Freund.
Da griff seine Hand ins Leere.
Die Gesteinswand war zu Ende.
»Hier zweigt ein Gang ab, Fritz«, sagte er. »Das ist eine recht üble Geschichte, und hätte man uns darauf vorher aufmerksam gemacht, dann wäre ich nicht hierher gekommen, denn verirren möchte ich mich in dieser Unterwelt nicht. Wir hatten mindestens ein Licht mitnehmen sollen. Im Delfin hätten wir ganz sicher auch Unterwasserlaternen gefunden.«
»Ja, mir behagt das Umhertappen im Dunkeln auch nicht«, gestand Fritz Hammer. »Und wenn wir hier etwas finden, so können wir es ja nicht einmal richtig sehen. Kehren wir also lieber um. Besser, wir haben den Weg umsonst gemacht, als dass wir nicht wieder aus diesem Loche herauskommen.«
Er wendete sich schon um, da aber geschah das Wunderbare.
Georg Wedekind hatte sich gebückt, um erst einmal am Boden entlang zu tasten und zu sehen, ob hier wirklich ein Gang sich auftat oder nicht.
Das aber konnte nicht der Fall sein, denn er stellte fest, dass eine Steinleiste von vielleicht Handhöhe den Gang unten abschloss —
Er tastete weiter, merkte bald, dass die Öffnung zu Ende war, das Gestein in der Wand weiterging, bückte sich noch einmal, schob an der Steinleiste — und da geschah es —
Es war, als sei in dieser Höhle plötzlich die Sonne aufgegangen, so hell ward es, und wie das Sonnenlicht vom Himmel, so kam auch dieses hier aus der Höhe herab. Die ganze Decke der Höhle strahlte einen solchen Glanz aus, dass die beiden gar nicht hineinsehen und auch nicht sagen konnten, wodurch dieses herrliche Licht erzeugt wurde.
Aber sie hatten auch gar kein Verlangen danach, denn ihren Augen bot sich ein Anblick, der sie erst recht in Staunen setzte, dem allerdings ein gewisses, wenn auch nur leichtes Grauen beigemischt war.
Jetzt erkannten sie, dass der vermeintliche Gang nichts weiter war als eine Nische, die etwa einen Meter tief in das Gestein gehauen war.
Rings um die ganze Höhle zogen sich solche Nischen hin, fast in einem Kreis, und in seinem Mittelpunkt gewahrten sie die Schachtöffnung, der sie entstiegen waren.
In diesen Nischen aber saßen auf Sesseln, die in dem strahlenden Lichte nur so gleißten und funkelten —
Ja, was war denn das nun eigentlich?
Sie konnten es für den Augenblick gar nicht sagen.
Auf den glänzenden Stühlen saßen Männer, aber ob das nun von Menschen geschaffene Kunstwerke waren oder eine Art Mumien in voller Lebensfrische erhalten, also nicht so vertrocknet wie die in den ägyptischen Gräbern — das war nicht zu erkennen, nur so viel, dass dann diese Mumien mit Gold überzogen oder gleich überdeckt, damit gepanzert waren.
»Georg!«, murmelte Fritz. »Wohin sind wir hier geraten? Das blitzt doch alles von purem Golde!«
Ja, wo waren sie?
Und welche Bewandtnis hatte es mit diesen Figuren dort?
Nun, die beiden schüttelten die Scheu ab, die sie überkommen hatte, näherten sich der Gestalt in der ersten Nische und betrachteten sie aus nächster Nähe.
»Das ist ein Indianer!«, sagte Georg Wedekind, »ein Toter, aber wunderbar erhalten und ganz mit Gold überzogen — ah, ich verstehe! Es ist Goldstaub, der in dicker Lage auf der Haut haftet, die vermutlich mit irgendeinem Klebstoff eingerieben worden ist, bis auf die des Gesichts —«
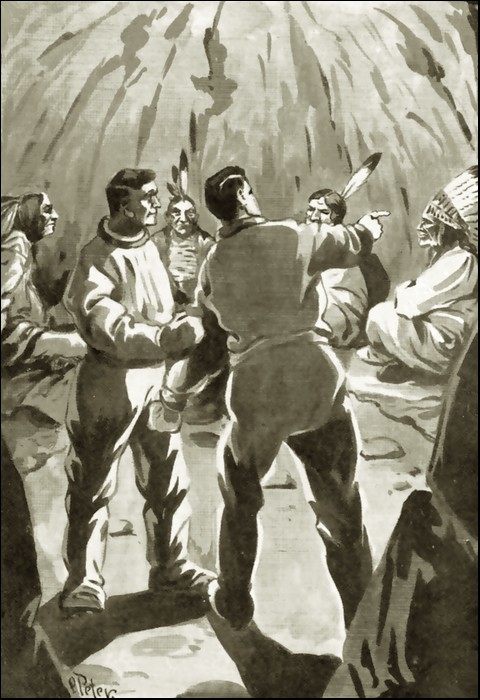
»Das ist ein Indianer«, sagte Georg Wedekind, »ein Toter.«
Und so war es.
Der Körper des Toten war vergoldet, das Gesicht jedoch nicht, und als die beiden es betrachteten, wussten sie auch gleich, womit sie es hier zu tun hatten.
»Das sind Inkas!«, flüsterte Fritz Hammer. »Diesen Gesichtsschnitt hat kein anderes Volk der Erde gehabt, höchstens noch die Tolteken in Mexiko —«
»So ist es, und wir stehen in der heiligen Grabhöhle, die so lange vergebens gesucht worden ist!«, ergänzte Georg Wedekind. »Hier befinden sich alle die Mumien der verstorbenen Inkaner, die vor der Habgier spanischer —«
Er unterbrach sich.
»Nein, Fritz, das kann nicht sein. Die Inkaner balsamierten zwar die Körper der verstorbenen Fürsten und Vornehmen auch ein, aber sie nahmen ihnen doch vorher die Eingeweide, und diese Mumien sind immer in Hockerstellung — das sind keine Inkas, von denen man allerdings auch ganz goldene Bildsäulen schuf, aber die wurden nicht gemeinsam beigesetzt, jede bekam einen eigenen Palast und behielt auch nach dem Tode noch einen Hofstaat —
Fritz, ich weiß, was für Mumien das sind — — o, was dürfen wir hier schauen! Noch kein Mensch hat das gesehen außer vielleicht dieser Loke Klingsor, und dass er diese Mumien unberührt ließ, dass er das Gold nicht fortbrachte, das zeigt ihn in einem neuen Lichte — welch ein Mann muss das sein!«
Fritz nickte, aber dann fragte er:
»Woran denkst Du denn eigentlich, Georg? Was für Mumien sind das nach Deiner Meinung?«
»Hast Du noch niemals von dem Hombre dorado gehört, Fritz? Man nennt ihn ja meist nur El Dorado, was dasselbe ist —«
Da freilich wusste Fritz Hammer Bescheid. Auch er hatte von diesem südamerikanischen Goldland gelesen, von dem heiligsten See von Guatavita, wusste alles, was schon früher darüber gesagt worden ist.
»Und Du denkst, man hat die Häuptlinge nach ihrem Tode hier beigesetzt, sie zum letzten Male mit Gold überzogen?«, fragte er.
»Es kann nicht anders sein, obwohl ich ja nicht weiß, ob wir uns unterirdisch unter jener Gegend befinden«, erwiderte Georg. »Wenn wir unseren Schützer fragen, wird er uns sicher Bescheid geben. Jetzt aber lass uns dieses uralte Heiligtum betrachten!«
Doch Fritz Hammer hatte noch etwas auf dem Herzen.
»Georg«, sagte er, »wenn diese Mumien von den Indianern hierhergebracht worden sind, dann muss diese Höhle doch auch noch einen anderen Ausgang oder vielmehr einen Eingang haben. Wenn wir ihn finden, können wir schnell mal hinaussehen —«
»Das stimmt!«, gab der andere zu. »Aber wir wollen uns lieber nicht mit dem Suchen aufhalten. Du weißt ja, dass wir eine wichtige Aufgabe zu lösen haben, und Loke Klingsor riet uns, nicht zu lange zu bleiben. Vielleicht dürfen wir später noch einmal hierher.«
Da fügte sich Fritz Hammer, und nun wanderten die beiden jungen Männer in immer steigendem Staunen rings an den Nischen hin, sahen in manchen von diesen vor der betreffenden Mumie noch Opfergaben liegen, alles aus Gold gefertigt, Früchte, Tiere, Kanus, ganze Flotten davon, durch Goldstäbe miteinander verbunden, immer in indianischer Manier gehalten.
»Das ist ein geradezu unermesslich wertvoller Goldschatz!«, murmelte Georg. »Es ist ein wahres Glück, dass die Menschen diese Höhle nicht kennen. Sie wäre bald geplündert!«
Sie waren wieder an der ersten Nische angekommen, es gab nichts mehr zu sehen, und Georg versuchte nun bloß noch durch Rücken an der Steinleiste das flammende Licht abzustellen.
Das ging ganz leicht, er brauchte die nach hinten gedrückte Leiste nur wieder vorwärts zu ziehen, und alsbald waren sie wieder in das Halbdunkel von früher gehüllt, das ihnen jetzt aber nach der strahlenden Helle wie finsterste Nacht erscheinen wollte.
Sie mussten eine ganze Weile stehen bleiben, ehe sie imstande waren, wieder etwas zu sehen, ehe sie sich nach dem Mundloche des Schachtes begeben konnten.
Dort befestigten sie die Tauchhelme wieder. Dann stieg Fritz als erster in den Schacht hinein, und Georg folgte ihm.
Sie hatten diesmal etwas mit dem Wasserdruck zu kämpfen, aber sie kamen doch wohlbehalten unten an, und da es noch hell dort war, so fanden sie auch den engen Kanal, aus dem sie gekommen waren, krochen ihn wieder zurück, kamen in die kleine Höhle, sahen den Delfin vor sich, mit noch geöffnetem Rachen, stiegen hinein, und alsbald setzte sich das wunderbare Fahrzeug wieder in Bewegung, glitt rückwärts durch den Kanal, kam wieder in den weiten und fuhr darin vorwärts, wahrend die beiden sich der Skaphander entledigten, dabei immer wieder ihrer Bewunderung in begeisterten Worten Ausdruck gebend.
»Ich komme mir vor, als träume ich ein Märchen, wie ich es als Kind gelesen habe!«, sagte Fritz Hammer. »Ach, ist das schön! Georg, so eine Osterpartie haben wir beide doch noch nicht miteinander gemacht!«
Georg stimmte zu, erinnerte auch nicht daran, dass Ostern ja nun längst vorüber sei.
Sie guckten von Zeit zu Zeit ins Freie, sahen immer noch die grauen Wände, bald nahe an dem Delfin, bald weiter ab, bis sie auf einmal wieder in freies Wasser kamen, das von mächtigen Fischen wimmelte, aber von ganz anderen als sie vorher gesehen hatten —
»Das sind doch Süßwasserfische, Fritz!«, rief Georg Wedekind alsbald.
»Jaja, das stimmt!«, gab Fritz zu, und da merkten sie auch schon, dass sie stiegen, das erkannten sie ganz leicht an den Fischschwärmen, die sie unter sich ließen.
Höher und höher kamen sie empor, das von dem Delfin ausstrahlende Licht erlosch, aber es ward nicht finster, Sonnenlicht drang zu ihnen in die Tiefe, und auf einmal schwammen sie auf der Oberfläche eines Gewässers.
»Merkwürdig!«, murmelte Fritz. »Was für ein Metall mag das nur sein, das selber eben noch Licht ausstrahlte, nun aber das Sonnenlicht zu uns eindringen lässt! Doch wir werden wohl alles noch erfahren!«
»Und sicher bald, Fritz«, gab Georg zurück. »Trügt mich nicht alles, so schwimmt der Delfin dem Ufer zu —«
Er hatte noch nicht ausgesprochen, da gab es einen leichten Stoß. Der Rachen des Delfins tat sich auf, und staunend blickten die beiden Freunde in einen wunderbaren Tropenwald. Sie waren angelangt am Ziele.
Auf der weißen Leinwand der Camera obscura war wieder ein Bild erschienen, das in wenigen Sekunden aufs Schärfste eingestellt wurde. Es zeigte die Einrichtung eines Zimmers, das sowohl als Küche wie als Schlaf- und Wohnraum benutzt wurde.
Neben dem breiten Doppelbett stand noch eine Kinderbettstelle.
Dabei aber war von Ärmlichkeit keine Spur zu bemerken. Für einen, der in der Welt etwas Bescheid wusste, auch einmal in England gewesen war und auch Fühlung mit den untersten Volksschichten genommen hatte, war sofort zu erkennen, dass das Zimmer sich nur in London befinden konnte. Es war das Universalfamilienzimmer eines sogenannten »Building«.
Denn anderswo gibt es keine solchen BuildingZimmer, nirgends in der Welt, auch in England nur in London.
In dieser Riesenstadt sind die Wohnungen teuer und werden immer teurer, je näher sie der City oder überhaupt dem Mittelpunkte liegen.
Da hat man sogenannte »Buildings« errichtet. Das heißt nichts weiter als »Gebäude«. Es sind große, meist mächtige Mietskasernen mit Einrichtungen, die man sonst nirgends in der Welt kennt.
Diese Buildings sind stets in Vierecken gebaut. In der Mitte befindet sich ein großer Hof mit Anlagen und Spielplätzen für Kinder und Erwachsene.
Im Kellergeschoss liegen die großartigen Baderäume, in neuester Zeit auch immer ein eigenes Schwimmbassin. Ein Lesesaal mit auserwählter Bibliothek und allen möglichen Zeitungen, ein Gesellschaftszimmer, ein Billardzimmer und dergleichen mehr sind vorhanden, alles den Mietern kostenlos zur Verfügung stehend.
Die Benutzung der gemeinschaftlichen Küche, in der man Feuerung und alles Mögliche umsonst hat, ist kein Zwang. Jede Familie kann auch für sich in der Wohnung kochen. Nur das Geschirr darf nicht in den Zimmern ausgewaschen werden. Zu seiner Beförderung in die allgemeine Aufwaschküche, der sogenannten »scullery«, sind aber wieder besondere Fahrstühle vorhanden.
Und was nun sonst noch der Hausfrau für Vorteile geboten werden! Sie hat ein großes Stück Fleisch gekauft, nach Schluss des Fleischmarktes ganz billig auf der Auktion, kann es nicht gleich verwerten, will es nicht anbraten.
Sie geht in die große Küche, hängt es in den Räucherschrank, nach gewisser Zeit wird es ihr tadellos geräuchert wieder zugestellt. Oder die Hausfrau hat große Mengen von Gemüsen und Früchten billig erwerben können. Auch eine Abteilung zum Einmachen von Konserven ist vorhanden, mit den neuesten Einrichtungen, die man sonst nur in großen Fabrikbetrieben findet. Sie kann das Trocknen oder Einkochen und Einmachen selbst besorgen oder Angestellte tun es kostenlos, die dazu nötigen Flaschen und Gläser und Büchsen bekommt sie unentgeltlich geliehen.
Man muss wirklich staunen, wenn man solche moderne Buildings oder Mietskasernen in London besichtigt. Was solchen kleinen Leuten alles geboten wird!
In den Wohnungen gibt es eingemauerte Wandschränke und allen möglichen Komfort, heißes Wasser und Elektrizität überall. Eigene Möbel braucht man kaum noch mitzubringen. Die Wände sind hohl und spenden alles. In jedem Schlafzimmer hängt über dem Bett entweder eine elektrisch betriebene Uhr oder doch eine Scheibe mit einem Zeiger, der auf eine gewisse Zeit eingestellt werden kann, ein elektrischer Wecker, der so lange klingelt, bis er abgestellt wird. Weil es eben meist Arbeiter sind, die früh aufstehen müssen. Und so ist an alles gedacht worden.
Die größten Wohnungen bestehen aus zwei Zimmern und einer Kammer. Nun wird aber auch mit solchen Familien gerechnet, die sich nur eine einzige Stube leisten können, in der sie sowohl wohnt als schläft, unter Umständen auch kocht. Das darf man sich übrigens nicht allzu schlimm vorstellen. Hierbei kommt eine englische Eigentümlichkeit in Betracht. Selbst der gutsituierte Engländer der Mittelklasse liebt es, in seiner »kitchen«, in der Küche, zu wohnen. Diese ist daher auch ganz anders eingerichtet als bei uns, eben wohnlich, enthält Möbel und Bilder und dergleichen. Der Engländer will am Abend in der Küche auf dem Sofa sitzen, seine Pfeife rauchen und dem Singen des Teetopfes über dem offenen Kaminfeuer lauschen. Das ist auch der Grund, weshalb selbst in der kleinsten Hütte neben der Küche die »scullery« ist, der kleine besondere Aufwaschraum für das Geschirr.
Also es war das Einzelfamilienzimmer in einem Londoner Building, das hier das Lichtbild auf der weißen Leinwand zeigte.
Nun kann es in solch einer Familienstube ja auch noch sehr liederlich und schmutzig aussehen, trotz aller komfortablen Einrichtungen und trotz aller sanitären Kontrolle.
Dies war hier aber nicht der Fall. Alles blitzte vor Sauberkeit, alles war behaglich eingerichtet, sogar künstlerischen Geschmack verratend. Der große Tisch war mit einer kunstvoll gestickten Decke belegt, gehäkelte Deckchen und gestickte Kissen lagen auch auf den Stühlen, das Bett war schneeweiß überzogen, und so machte eben alles einen freundlichen, sauberen, behaglichen und sogar gediegenen Eindruck.
Eine Nähmaschine und ein daneben auf einem Stuhle aufgehäufter Stapel von halbfertiger Wäsche verriet, dass hier Weißnäherei betrieben wurde.
Vor dem zweiten, ebenfalls mit Blumentöpfen besetzten Fenster stand eine Staffelei mit einem angefangenen Ölgemälde, auf einem Tischchen daneben lagen die Malgeräte.
Also hier hauste ein Kunstmaler, der es nicht über solch ein einziges Zimmer für seine ganze Familie hinaus brachte. Wohl ihm, wenn er immer die Miete bezahlen konnte, vielleicht fünf Shilling die Woche, und seine Frau konnte durch Nähen für Kleidung und Essen sorgen. Oder es konnte ja auch ein Arbeiter sein, ein Nagelschmied oder ein Straßenreiniger oder etwas Ähnliches, der nur in seinen Mußestunden aus Liebhaberei die Ölmalerei betrieb.
Das angefangene Bild sollte seine Frau mit einem Kinde auf den Armen darstellen, so viel war aus den Umrissen der Kohlenstriche und den ersten Farben schon zu erkennen.
Übrigens zeigten die anderen Bilder an den Wänden was es werden sollte. Alle stellten die Madonna mit dem Christuskinde dar. Es war immer derselbe Kopf mit denselben Zügen, und diese waren durchaus originelle.
Wenn eine Ähnlichkeit vorhanden, so war es die mit der Sixtinischen Madonna von Raphael.
Diese Madonna hier hatte ganz andere Züge als die Sixtinische. Es war eine blonde, germanische Schönheit.
Auch der Knabe, meist unbekleidet, war durchaus Original, kein tiefsinniges Christuskind mit Lockenhaar, sondern ein ganz gewöhnlicher Knabe mit recht verschmitztem Gesicht — und doch auch wieder schon die zukünftige ideale Mannesschönheit verratend.
Auch noch ein anderes Ölgemälde schmückte die Wand, welches einmal nicht die Madonna darstellte: das Brustbild eines Mannes in Lebensgröße mit auffallend semmelblondem Haar und ausgesprochenem Mopsgesicht. Alles andere als ein schöner Mann. Auch so sehr jung konnte er nicht mehr sein. Die Vierzig hatte er sicher schon hinter sich. Aus den blauen, etwas wässerigen Augen sprach simple Gutmütigkeit. Simpel sah er überhaupt aus.
Sonst sei nur noch ein anderer, eigentümlicher Zimmerschmuck erwähnt.
Mitten an der Decke hing an einem kurzen Drahte eine große Glaskugel. Wenn man die wirklichen Verhältnisse berechnete, was doch nach der Höhe von Tisch und Stühlen möglich war, so mochte sie etwa einen Viertelmeter im Durchmesser haben.
Die Kugel hatte keine ebene Fläche, sondern war in Hunderte oder gar Tausend von kleinen Flächen geschliffen — wenn sie nicht aus lauter kleinen, ebenmäßigen Glassplitterchen zusammengesetzt war. Infolgedessen konnte sie selbst, wenn es mit Quecksilber belegtes Spiegelglas war, gar nicht spiegeln.
Was hatte diese Glaskugel dort oben an der Decke zu bedeuten?
Nun, es war eben eine Spielerei, ein Schmuckstück ohne jeden Zweck. Da hatte einmal ein »Bastelbruder« aus Langeweile eine große Glaskugel in lauter Facetten geschliffen oder sie aus Glassplitterchen zusammengesetzt, so, wie ein anderer, der nichts weiter zu tun hat, aus alten Briefmarken ein Landschaftsbild zusammenklebt.
Als Loke Klingsor das Lichtbild eingestellt hatte, befand sich schon jemand im Zimmer, kann aber soeben erst eingetreten sein, machte noch die Türe zu.
Offenbar hatte Klingsor auch hauptsächlich das Eintreten dieser Person beobachten wollen, deshalb hatte er es, sobald der Glockenton erschollen, so eilig gehabt.
Es war eine Frau, eine junge Frau — dieselbe, welche überall als Madonna porträtiert worden war, dasselbe so schöne, holdselige, liebreizende Antlitz. Und zu diesem Kopfe gehörte auch die mittelgroße, ziemlich volle, wenn auch nicht korpulente Gestalt.
Sie trug ein dunkles, schlichtes Straßenkleid mit entsprechendem Hut. Die beiden Goldreifen an der linken Hand waren der Trauring und der Verlobungsring, letzterer in besonderer Weise ziseliert, nach englischer Sitte stets an der linken Hand getragen, beide an ein und demselben Finger.
An dem vollen Arme hatte sie einen Tragkorb hängen, unter dessen Deckel einiges Gemüse und der Fuß eines Huhnes hervor sah.
Und der Mann mit den Teufelsaugen begann zu schmunzeln.
»Aaaah, Huhn mit Stangenspargel! Hat der Fuß nicht einen Sporn? Jawohl. Also Hähnchen. Es ist der Fuß eines noch ganz jungen Tieres. Aaaah, das soll ja heute Abend ein Göttermahl werden!«
Sie war etwas außer Atem und hatte es auch jetzt noch eilig. Schnell setzte sie den Korb in einen Wandschrank.
Dabei warf sie einen Blick nach dem semmelblonden Mopse dort oben.
»Um zehn Uhr kommt er, mein Charly! Ach, wie ich mich freue!«
So hatte das Lichtbild, hatte die junge Frau gesprochen, so deutlich, als ob sie selbst in diesem Raume gewesen wäre. Kein Ton der glücklichen Zärtlichkeit war verlorengegangen.
Und wieder lächelte der Mann mit den Teufelsaugen, aber das war kein Schmunzeln mehr, sondern ein geradezu grimmiges Lächeln.
»Jawohl, Angela, um zehn Uhr bin ich dort.«
So hatte er ziemlich laut gesprochen.
Aber nur er hörte sie sprechen, sie nicht ihn. Sonst hätte sie sich wohl anders verhalten, hätte sie plötzlich eine Stimme vernommen.
»Nun aber erst mein kleiner Loke! Er wird doch nicht...«
Sie wollte nach der Tür.
Da erscholl wieder ein Glockenton in der Camera obscura, und schon wurde die Tür geöffnet.
Eine ältere Frau trat ein, hatte einen schlafenden Jungen von etwa einem Jahre auf dem Arme. Natürlich in einem Kleidchen, aber in einem kurzen. Steckbettchen und Tragkleider kennt man in England nicht, und wen es interessiert, dem sei noch verraten, dass in England die Säuglinge auch nicht »gewickelt« werden. Und da es sehr viele Menschen gibt, die nicht einmal einen Jungen von einem Mädel unterscheiden können, solange beide im Kleidchen stecken, so tragen in England die Jungen blaue Ärmelschleifen, die Mädels rote. Auch die zerlumpteste Whiskymutter in Whitechapel heftet ihrem Säugling dieses Unterschiedsmerkmal an.
»Ach, Missis Dorington, ich wollte eben zu Ihnen!«
»Ich hörte Sie kommen, Missis Steen, und da bin ich gleich herüber.«
»Sie sind zu liebenswürdig, Missis Dorington. War er denn immer artig?«
»Ach, Missis Steen, wie kann denn ihr Loke andes sein! Erst hat er mit Papierschnitzeln gespielt, dann hat er mit meiner Scheuerbürste sich die Haare gekämmt, dann hat er im Bilderbuche den Tieren die Augen ausgestochen...«
Und die alte, freundliche Frau zählte weiter auf, was der ihr anvertraute Engel innerhalb der Stunde alles getan hatte, wobei sie von der Mutter des Kindes immer durch Fragen unterstützt wurde, abgesehen von allen anderen Zwischenbemerkungen.
»Doch nicht etwa mit einer Nadel?!«, erklang es ängstlich.
»O, Missis Steen, wo denken Sie hin!«, wehrte Missis Dorington diesen Verdacht vorwurfsvoll von sich ab. »Ich werde dem Kinde doch keine Nadel in die Hand geben! Nur einen Bleistift, den er nicht verschlucken kann, der auch gar nicht so spitz war... und dann hat er die Teekanne vom Tische geschmissen, und dann ist er eingeschlafen«, schloss Missis Dorington ihren Bericht über den Engel.
»Oooh, die Teekanne vom Tisch geworfen!«, rief die Mutter erschrocken.
»Es war nichts mehr drin, ich hatte mir gerade die letzte Tasse eingeschenkt.«
»Aber die Teekanne...«
»Die ist von Blech und geht nicht kaputt.«
»Was hat Loke denn hier Weißes am Ohr kleben?«
»Das wird noch etwas kondensierte Milch sein. Er war einmal über die Milchdose gekommen und hatte sich das ganze Gesicht vollgekleistert. Ich habe mächtig mit Bürste und Seife rumpeln müssen, ehe ich das Zeug wieder abbekam, und der Engel hat dabei kein Sterbenswörtchen gesagt, hat immer gelacht und dabei aus meinem Kamme, den ich ihm einstweilen gegeben hatte, alle Zinken ausgebrochen. Er ist eben ein Engel.«
»Oooh, Missis Dorington, was für Umstände ich Ihnen mache!«
»Ach lassen Sie nur, an dem Kamme waren ja nur noch drei Zinken.«
»Wie soll ich das aber nur wieder gut machen!«
»Das werde ich besorgen«, mischte sich der Mann mit den Teufelsaugen ein, der halb schmunzelnd, halb grimmig lächelnd dem Berichte über die Taten des Engels aufmerksam und andachtsvoll gelauscht hatte. »Ich werde ihr heute Abend einen... na, was werde ich ihr denn mitbringen?... ein Diamantenkollier natürlich nicht... ein Pfund Tee und ein Pfund Zucker wird's auch tun. Übrigens wirklich eine ganz vortreffliche Frau, diese Mrs. Dorington, die führe ich vielleicht doch noch in den Skaldenorden ein und schlage sie zur Herzogin vor. Mehr als manche andere Fürstin verdient die's jedenfalls.«
Diese Bemerkung hatte die Unterhaltung natürlich nicht gestört. Die Wechselreden waren schon weitergegangen. Unterdessen waren auch höchstens drei Minuten verstrichen. In drei Minuten können sich ja zwei Frauen auch viel erzählen. Besonders wenn sie immer gleichzeitig sprechen. Was hier zwar nicht der Fall war, aber lange Pausen machten sie auch nicht.
Unterdessen hatte Mrs. Steen ihren Hut abgelegt, wozu drei Minuten nun wieder nicht zu kurz bemessen waren, zumal das Entfernen der Hutnadel mit Sicherheitshülse eine sehr komplizierte Geschichte war, und nun streckte sie die Arme aus, um den Knaben in Empfang zu nehmen.
Bei dieser Bewegung trat das Mutterglück begreiflicherweise wieder mit aller Macht zu Tage.
»Das ist eine entzückende Stellung«, murmelte der Beobachter, »so muss ich sie einmal malen — wie sie ihr Kind nach einer Trennung in Empfang nimmt — dieses verklärte Lächeln kann ich freilich bei keiner Sitzung verlangen, das kann nicht erzwungen werden — und da nützt auch keine schnelle Fotografie, die gibt keine Seele wieder, das muss ich im Kopfe behalten — — — ja und doch...«
Ein schneller Griff nach einem größeren Knopfe auf dem Schreibtisch, und hinter ihm gab es einen kleinen Knacks.
»So, die ganze Szene ist festgehalten.«
Das Kind war auf den Mutterarm gewandert, und dabei hatte es einmal die Äuglein aufgeschlagen.
Für einen scharfen Beobachter hatte dieser einmalige Augenaufschlag genügt, um eine Entdeckung zu machen.
Jetzt sei nur so viel bemerkt, dass der Knabe blonde, schlichte, etwas lange Haare hatte. Nichts Merkwürdiges bei einem einjährigen Kinde.
Weiter als bis zu dem Augenaufschlag hatte der kleine Loke es nicht gebracht. Noch ein abwehrendes Strecken der Ärmchen, ein schiefes Mäulchen, dann legten sich die erst abwehrenden Ärmchen nur umso zärtlicher um der Mutter Hals, und es wurde weitergeschlafen.
Die Mutter entkleidete das Kind auf dem Tische und legte es in das Kinderbettchen.
Dabei unterhielten sich die beiden Frauen weiter, und sie hätten ihre Stimme noch so vorsichtig dämpfen können, in der Camera obscura wurde jedes Wort verstanden.
»Ihr Mann kommt heute?«
»Ja, um zehn Uhr ist er hier«, erklang es wie ein unterdrücktes Jauchzen.
»Missis Sherman sagte es mir, der Sie es schon unterwegs erzählt haben. Kommt er auch bestimmt?«
»Ganz, ganz bestimmt!«
»Jawohl, ganz, ganz bestimmt«, bestätigte der Mann mit den Teufelsaugen.
»Weil er damals doch auch geschrieben hatte, er wollte kommen, und er kam nicht.«
»Ja, das tut mir leid, das letzte Mal musste Mr. Hendrick Steen in Südafrika unbedingt einen Zuluhäuptling sprechen, durch den er etwas länger aufgehalten wurde«, entschuldigte der Mann den Nichtgekommenen, wieder einmal mit einem grimmigen, mit einem wirklich teuflischen Lächeln.
»Diesmal aber hat er telegrafiert, von Liverpool aus, er war schon auf dem Wege nach dem Bahnhofe.«
Die alte Frau warf einen schwärmerischen Blick, soweit ihre Augen eine Schwärmerei erlaubten, nach dem semmelblonden Mopsgesicht hinauf.
»Ach, Mrs. Steen, sind Sie glücklich, solch einen herrlichen Mann zu haben!«, seufzte sie.
Klingsor rückte etwas auf seinem Stuhle, räusperte und reckte sich selbstgefällig, offenbar in einem Anfluge von Humor, woran dieser Mann mit den Teufelsaugen überhaupt keinen Mangel zu haben schien.
Der schwärmerische Blick der Alten wurde von dem der jungem, schönen Frau zu dem semmelblonden Mopsgesicht hinauf noch weit übertroffen.
»Ja, mein Hendrick ist eine Seele von einem Menschen!«, erklang es wieder mit unendlicher Zärtlichkeit.
»Wenn ich da an meinen seligen Mann zurückdenke! Meine glückliche Zeit fing erst an, als er sich unter die Erde gesoffen hatte. Ach, hat der mich gedroschen!«
Die junge Frau zuckte zusammen, blickte schnell nach dem Kinderbettchen, und aus dem schönen, sonst so freundlichen, sanften Antlitze wollte etwas wie kalte Zurückweisung hervortreten. Ihr Gedankengang war wohl klar genug.
Sie war sicher nicht solche Worte und Redensarten gewohnt, und sie dachte sofort an ihr Kind. Jetzt ging es ja noch, das Kind verstand noch nichts. Aber wie sollte das später werden? Denn sehr fein geht es in solch einem Building und draußen auf den Spielplätzen natürlich nicht zu.
»Wenn er nur nicht gar so viel auf Reisen wäre!«, kam es dann mit einem leisen Seufzer und einem etwas schmerzlichen Blicke nach dem semmelblonden Mopse von den Lippen der schönen Madonna.
Da hob die Alte Augenbrauen und Zeigefinger.
»Hören Sie, meine liebe Mrs. Steen — — das sagen Sie ja nicht, da seien Sie sehr zufrieden!!«
»Dass er so viel auf Reisen ist und so selten nach Hause kommt?«, fragte die junge Frau, die ob dieser warnenden Geste und Stimme lächeln musste.
»Sehen Sie, meine liebe Frau Steen, je seltener der Mann zu Hause ist, desto glücklicher ist die Ehe. Wenn der Mann den ganzen Tag auf Arbeit ist und er kommt jeden Abend nach Hause,... na, das ist ja auch ganz hübsch, aber es wird schließlich auch langweilig. Ich bleibe dabei, und glauben Sie nur mir alten, erfahrenen Frau: Je seltener ein Mann nach Hause kommt, desto glücklicher ist eine Ehe. Deshalb sind die Ehen von Seeleuten immer die glücklichsten. Ach, dieser Jubel, wenn so ein Mann wieder da ist!«
Die alte Nachbarin ging.
Die junge Frau trat an das Bettchen, beugte sich über den kleinen Schläfer und küsste ihn vorsichtig.
»Heute Nacht kommt der Vater und bleibt morgen den ganzen Tag bei uns — — Ach, Loke, soll das ein schöner Tag werden! Da spielt er mit Dir, mit Bleisoldaten Festungskrieg und mit der Menagerie, da kannst Du auf ihm reiten, und dann sitzt er dort bei mir im Lehnstuhl — — und dann essen wir zusammen — — und dann sitzen wir dort auf dem Sofa — — Du auf seinen Knien und ich an seine Seite geschmiegt — — den ganzen Tag, den ganzen Tag! — — und abends gehe ich mit ihm vielleicht ins Theater oder ins Konzert! — — Ach, wenn es doch nur erst Abend wäre, um zehn — — jetzt ist es um vier — — noch sechs lange Stunden...«
Der kleine Schläfer schien den Kuss trotz aller Vorsicht doch verspürt zu haben, er bewegte sich unruhig, wenn er auch nicht erwachte.
»Wauwau — wauwau — wauwauwauwau...«, lallte er im Schlafe.
»Ja, der Papa bringt Dir einen Wauwau mit, er hat es Dir versprochen, er wird es nicht vergessen.«
»Nein, der Papa hätte es nicht vergessen«, bestätigte Klingsor.
»Einen schneeweißen Wauwau, wie ihn drüben Deine kleine Freundin hat, mit einer Gummischnur, und wenn man auf den Ball drückt, kann er springen und tanzen und bellen.«
»Der Wauwau, den der Papa mitbringt, soll noch etwas anderes können auch ohne ›Gummiball‹«, sagte der Mann mit den Teufelsaugen wieder mit einem grimmigen Lächeln, dem sich doch so viel Glück beimischte. »Ach, das wird ja eine Überraschung, wenn ich ein lebendiges Hündchen auspacke — — das heißt, das merken die erst gar nicht — er muss sich tot stellen — auch er hat so einen Schlauch mit Luftdruckvorrichtung — und wenn ich nun drücke und kommandiere, führt das vermeintliche Spielzeug gehorsam alles aus! Der alte Brazas, mein bester Dresseur, wird seine Sache schon gemacht haben, der weiße Zwergpudel, den ich aussuchte und ihm übergab, war ein äußerst gelehriges Tier. Na, dieser Jubel dann!«
Der kleine Loke schlief weiter, ohne noch Selbstgespräche zu führen.
Die junge Mutter holte aus einem Wandschrank ein Hauskostüm hervor, heftelte ihre Taille auf, begann sich zu entkleiden.
Da ein furchtbar schrilles Klingeln, wie hier drin noch nicht ertönt war, Mark und Bein durchdringend, nervenzermalmend — — und Klingsor machte einen blitzschnellen Griff nach einem sehr großen Knopfe oder schlug vielmehr gleich mit der Faust darauf.
Ein Blick nach jener kleinen weißen Tafel — der rote Punkt hatte die rote Linie erreicht, hatte sich mit ihr verschmolzen.
»Nun habe ich den Punkt stundenlang beobachtet, und gerade wo's drauf ankommt, muss ich es verpassen! Zu sagen hat es ja nichts, aber... eine große Schwäche ist es doch. Tja, die Weiber! Da wird auch ein Loke Klingsor zum Narren, sogar zum doppelten! Obwohl's seine Frau ist.«
Während dieses Selbstgesprächs hatte er einige Handgriffe ausgeführt, weitere folgten.
Das Buildingzimmer war von der weißen Leinwand verschwunden.
Die Erdkarte in Mercatorprojektion mit der kleinen Spitzkugel erschien wieder.
Diese lag jetzt aber nicht mehr auf dem Indischen Ozean, sondern ziemlich in der Mitte von Arabien, gerade auf der roten Linie, die hier ebenfalls gezogen war.
Auch die Weltkarte verschwand — oder vielmehr die Konturen verschoben sich.
Nachdem sie sich wieder geordnet hatten, zeigte die weiße Wand in ihrer ganzen Größe nur noch die ganze Halbinsel von Arabien.
Aber das war jetzt keine gewöhnliche Landkarte mehr, sondern man glaubte Arabien aus der Vogelperspektive zu sehen, schon konnte man die Gebirge in plastischer Erhebung erkennen.
Die rote Linie und die schwarze Spitzkugel waren verschwunden.
Weitere Handgriffe folgten, und wieder ziemlich in der Mitte Arabiens, zwischen den Gebirgen el Chardsch und Yebrin auf jeder größeren Karte zu finden — erschien auf der gelben Fläche, welche die zwischen diesen beiden Gebirgen liegende Wüste kennzeichnete, ein leuchtend roter Punkt, nicht von brennend roter Farbe, sondern von innen heraus erglühend, was man jetzt sogar bei Tageslicht beurteilen konnte.
Plötzlich war diese plastische Karte von Arabien kreuz und quer mit den schwarzen Linien durchzogen, eine dicht neben der anderen, also kleine Vierecke bildend, an Enden mit Zeichen und Zahlen versehen.
Diese waren noch etwas undeutlich, sie wurden schärfer eingestellt, wodurch auch der rote Punkt in dem gelben Felde noch mehr erglühte.
Und dann war dies alles wieder verschwunden.
Dafür tauchte auf der weißen Leinwand jetzt wieder die schwarze Spitzkugel in Riesengröße auf, mit noch mehr als einem Meter Durchmesser.
Sie lag noch immer mit der Spitze von rechts unten nach links oben, richtete sich aber, und zwar sehr schnell, auf, reckte die Spitze nach oben.
Die Riesenkugel verschwand wieder, dafür erschien ein anderes Bild.
Abermals eine Landkarte?
Nein, das war ein vollkommenes Landschaftsbild.
Eine ebene, gelbe Wüste, nur im fernen Hintergrund himmelhohe Berge.
Wieder tauchte der rotleuchtende Punkt auf, wieder wurde das Ganze von einem Karree schwarzer Linien überzogen und dann erschien wieder die Spitzkugel, jetzt etwa zehn Zentimeter im Durchmesser, allem Anscheine nach in ungeheurer Höhe über dieser Wüste schwebend, die Spitze nach oben gereckt.
Jetzt aber drehte sie sich herum, die Spitze nach unten, und setzte sich in Bewegung, allerdings sehr, sehr langsam, aber nach einiger Beobachtung an den kleinen Karrees, die sie kreuzte, bemerkbar.
Auf den rotleuchtenden Punkt, den sie schon etwas überholt hatte, von dem sie sich überhaupt nordwärts befand, bewegte sie sich zu, ging also wieder zurück.
Klingsor drehte an einem der größten Räder, das sich auf dem Schreibtisch befand, und die Richtung nach dem leuchtenden Punkte ward noch direkter.
Und in dem Augenblicke, da die nach unten gekehrte Spitze den roten Punkt berührte, erscholl ein schrilles Klingeln, wenn auch nicht so furchtbar wie vorhin — ein schneller Druck auf einen Knopf, und die Kugel blieb stehen, wenigstens war schon nach einer halben Minute erkenntlich, dass sich die Kugel nicht mehr weiterbewegte, mit der nach unten gekehrten Spitze auf dem roten Punkte verharrte.
Eine Hebeldrehung und die Kugel wendete sich herum, reckte die Spitze wieder nach oben.
»So, das Ziel ist erreicht!«
Ein Blick nach einer der Uhren.
»Eine Stunde habe ich noch Zeit.«
Ein Griff, die arabische Wüstenlandschaft verschwand, statt ihrer erschien wieder das Zimmer im Londoner Building.
Die Madonna hatte ihre Haustoilette beendet, saß bereits an der Maschine und nähte.
Klingsor beobachtete sie ruhig, ganz in den doch eigentlich sehr nüchternen Anblick versunken, der aber wieder einen wahrhaft seligen Ausdruck auf seinen dämonischen Zügen hervorzauberte.
»Loke«, kam es flüsternd über seine Lippen, weißt Du eigentlich, was für ein glücklicher Mensch Du bist? Sie heißt Angela, und sie ist ein wirklicher Engel...«
Das Schreibrädchen begann wieder zu ticken. Der Mann mit den Teufelsaugen warf einen Blick auf den laufenden Papierstreifen.
»Pauli, sind Sie es?«
»Jawohl, Herr Klingsor«, erscholl es aus dem Schalltrichter.
»Sind Sie allein im Meldezimmer?«
»Ganz allein.«
»Sorgen Sie dafür, dass Sie allein bleiben!«
»Ist geschehen.«
»Dann brauchen Sie nicht zu schreiben, ersparen Sie sich die Mühe, sprechen Sie nur, es geht doch schneller. Was ist im nordamerikanischen Felsengebirge?«
»Ein Grizzlypaar mit vier Jungen ist gesichtet worden.«
»Aaah!«, rief Klingsor mit freudiger Überraschung.
Es folgte eine lange Reihe von Zahlen, die sich Klingsor notierte, offenbar eine geografische Ortsbestimmung, und zwar eine solche bis zur Zehntelsekunde, die nur regelrechte Astronomen mit den feinsten Instrumenten und mit fünfzehnstelligen Logarithmen ausführen können.
»Was sollen denn die Zehntelsekunden bedeuten, die doch nur einen Raum von wenigen Quadratmetern bestimmen?«
»Dort befindet sich die Höhle der Bären.«
»Ah so! Vortrefflich! Ist das nicht im MontanaTerritorium? Ich will nicht erst die Karte befragen, so ungefähr habe ich's ja im Kopfe.«
»Jawohl, dicht an der kanadischen Grenze.«
»Wie sieht es dort aus?«
»Es ist eine waldige Felsenwildnis.«
»Bewohnt?«
»Wir haben einen Raum von neun Quadratmeilen wenigstens eine Stunde lang in der Camera gehabt, weil wir einen eine Spur verfolgenden Bären im Auge behielten, um seinen Schlupfwinkel zu finden, was uns also auch gelang. Es war das Männchen, und wir haben alles aufs sorgfältigste abgesucht, um auch die Bärin zu entdecken. Wir haben keine Hütte, keinen Wigwam, keine Feuerstelle und keine menschliche Fußspur bemerken können.«
»Vortrefflich! Haben Sie die Jungen selbst gesehen oder nur die Spuren?«
»Sie selbst. Sie spielten mit der Mutter vor der Höhle. Vier Stück.«
»Wie alt?«
»Höchstens vier Wochen.«
»Das wird immer besser. Sie gehören mir!«
Klingsor lehnte sich im Stuhle zurück und kreuzte die Arme über der Brust, und jetzt sprach er wohl mehr zu sich selbst, obgleich der andere es sicher auch hören durfte.
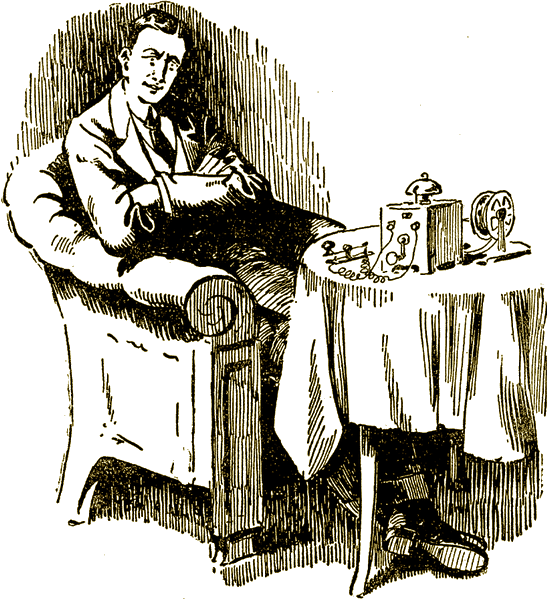
»Hm. Heute Nachmittag habe ich noch in Arabien zu tun. Um oder schon halb zehn muss ich in London sein und bleibe morgen den ganzen Tag dort, das bin ich meiner Angela schuldig, nicht minder meinem Loke, und am Abend muss ich mit ihr auch einmal ins Theater oder sonst wohin gehen, die Arme kommt ja sonst nirgends hin — Aber so nachts gegen zwei muss ich wieder abreisen, denn übermorgen am Vormittag muss ich unbedingt in Tibet sein... ja, dann kann ich übermorgen Nachmittag im Felsengebirge der Bärenjagd obliegen.«
So hatte Klingsor vor sich hin gesprochen.
War dieser Mann mit den Teufelsaugen wahnsinnig geworden?
Jetzt am Nachmittage in Arabien, am Abend in London, übermorgen früh von dort abfahren, an demselben Morgen auch schon wieder in Tibet sein und am Nachmittage im amerikanischen Felsengebirge Bären jagen?!
Eine Erklärung wäre möglich gewesen.
Diese Skalden hatten die Tageszeit anders eingeteilt. Das Wort »Tag« ist doch nur eine Bezeichnung für irgendein Zeitmaß, dessen Länge man beliebig festsetzen kann. Gott hat die Erde auch in sieben »Tagen« geschaffen, das heißt, in sieben »Tagewerken«. Da hat jeder Tag eben einige hunderttausend Jahre umfasst.
Das wäre eine Erklärung für dieses Rätsel gewesen.
Ja, aber hatte die Madonna nicht gesagt, in sechs Stunden würde ihr Mann bei ihr in London sein?
Denn dass sie den Loke Klingsor erwartete, darüber braucht wohl nichts mehr gesagt zu werden.
Und hatte Klingsor nicht behauptet, er befände sich jetzt in Arabien?
Das Rätsel blieb bestehen.
»Herr Klingsor, ich muss Sie auf etwas aufmerksam machen«, fing da der Trichter wieder zu sprechen an, aber die Stimme klang mit einem Male ganz auffallend schüchtern und sogar ängstlich.
»Na? Was gibt's denn? Was haben Sie denn, Pauli? Sie sprechen ja plötzlich so seltsam!«
»Sie können sich nicht sofort hinbegeben?«
»Nein. Unmöglich. Was veranlasst Sie überhaupt zu dieser Frage?«
»Weil Ihnen dann die Bärenfamilie entgehen wird.«
»Weshalb denn?!«
»Ach, Herr Klingsor, ich muss Ihnen etwas gestehen«, erklang es immer kläglicher.
»Na, nun mal los!«
»Hauser ist an allem schuld.«
»Woran ist Hauser schuld?«
»Er sollte Ihnen vorhin diese Meldung übermitteln, und er hat sich falsch verbunden.«
»Mit wem denn?!«
»Mit der Fürstin von Salamba.«
»Ach du großer Schreck!«, rief Klingsor erschrocken. »Und Hauser hat seinen Irrtum nicht gleich bemerkt?!«
»Nein.«
»Er hat der Fürstin von den Bären gesagt!«
»Ja.«
»O je!!«, rief Klingsor immer enttäuschter. »Da habt ihr also gar nicht so unrecht, wenn ihr ihn immer den Kaspar Hauser nennt. Das ist ja ein richtiger Kasper! Konnte er sich denn nicht wenigstens eine andere falsche Verbindung aussuchen als gerade die mit der Fürstin Salamba? Nun fahrt wohl ihr schönen Träume von Bärenjagd und Bärenschinken!«
Seine Enttäuschung schien grenzenlos zu sein.
»Verbinden Sie mich mit der Fürstin Salamba.«
»Sie wollen sie fragen, ob sie die Sache schon weitergegeben hat?«
»Jawohl. Nun mal fix!«
»Das ist nicht nötig. Ich habe deswegen schon selbst angefragt.«
»Und?«
»Sie gesteht ein, dass sie davon bereits die Königin von Thule, den Grafen Tankred und Meister Czernebog benachrichtigt hat. Sonst niemand weiter.«
»Na das reicht ja auch gerade!«, lachte Klingsor wiederum grimmig auf. »Andere Skaldenhäupter kommen für eine Bärenjagd überhaupt nicht in Betracht.«
»Königin Chlorinde darf Thule nicht verlassen.«
»Ja, das stimmt, und mit dem alten Ziegenbock werde ich auch fertig, dem verbiete ich es einfach, was ich gleich besorgen werde. Aber gegen Graf Tankred kann ich nichts machen.«
»Herr Klingsor, können Sie denn nicht schnell hineilen? Oder wenigstens im Laufe des morgenden Tages? Wenn Graf Tankred auch mit seinem Luftschiffe vierhundert Kilometer in der Stunde macht, so braucht er doch immer noch zwanzig Stunden, um von Ophir nach Montana zu gelangen! Ich habe es bereits ausgemessen. Sie dagegen können in kürzerer Zeit dort sein, von London aus in sieben Stunden.«
Einige Zeit lang hatte Klingsor sinnend vor sich hingesehen.
»Nein, es ist unmöglich«, entgegnete er dann auf jenen Vorschlag, »ich habe heute unbedingt etwas in Arabien zu erledigen und muss noch unbedingter morgen den ganzen Tag in London verbringen. Ich müsste die Bärenfamilie mindestens dem Tankred überlassen. Aber...«
Mit einem Male entstand auf dem ernsten Gesicht ein überaus listiges Lächeln.
»... aber vielleicht gibt es doch noch ein Mittel, um die Grizzlys meinem Busenfreunde aus den Zähnen zu rücken! Verbinden Sie mich erst mal mit Czernebog, dass der erledigt wird, denn der könnte unserem gemeinsamen Ziele näher sein als Tankred.«
»Einen Augenblick!«
Es dauerte nicht länger als eine Viertelminute, da war die Verbindung hergestellt.
»Hier ist sich Czernebog, hähähäha«, meckerte es aus dem Trichter.
»Hier Klingsor. Was hast Du, alter Ziegenbock, schon wieder zu meckern?«
»Weil sich der alte Czernebog immer freut, wenn er sprechen kann mit dem Fürsten des Feuers, hähähähä.«
»Na warte, Dir wird gleich das Feixen vergehen! Du hast durch die Fürstin Salamba von den Grizzlys in Montana erfahren?«
»Czernebog hat sich erfahren«, erklang es jetzt in ganz anderem Tone, sehr kühl.
»Du rechnest auf die Bären?«
»Freilich wird sich Czernebog die sechs Bären haschen.«
»Du willst sie mit Pfeilen oder Kugeln betäuben?«
»Freilich! Tot kann sich der alte Czernebog sie nicht gebrauchen.«
»Kann man da nicht einmal zusehen, wie Du das machst?«
»Will sich der Fürst des Feuers zusehen?!«, erklang es wiederum in ganz anderem Tone, jetzt mit geschmeicheltem Stolze. »Wird sich Meister Czernebog sehr freuen, zu zeigen dem edlen Fürsten des Feuers, wie er Bären hascht.«
»Wann soll ich dort sein?«
»In acht Stunden.«
»Eher ist es Dir nicht möglich?«
»Nein, ist sich zu weit ab.«
Wieder trat auf dem dämonischen Gesicht das listige und spöttische Lächeln hervor.
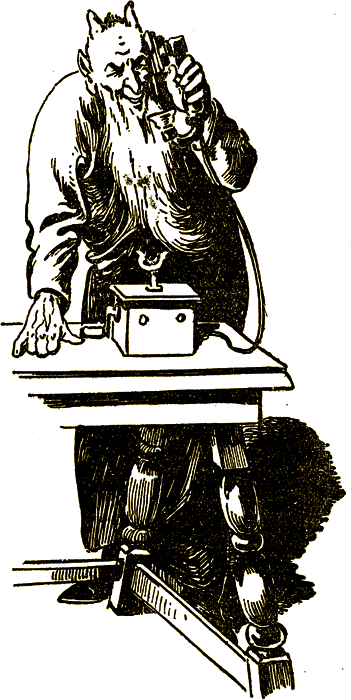
»So, ich danke Dir, mein lieber Ziegenbock. Ich wollte nur einmal von Dir selbst hören, wie weit Du von Montana entfernt bist. Denn Du selbst hättest es mir ja sonst niemals gesagt, hättest mich vielmehr angelogen, dass mir die Augen übergegangen wären, um mir einen Strich durch die Rechnung zu machen, vorausgesetzt eben, dass Du um meine Absicht gewusst hättest. Jetzt aber bist Du in die Falle gegangen, die ich Dir mit Deiner eigenen Eitelkeit gestellt habe.
Also, Meister Czernebog: Ich beanspruche diese sechs Bären in Montana für mich! Ich selbst werde sie erlegen oder fangen. Du wirst Deine Finger davon lassen! Ich verbiete Dir, Dich innerhalb der nächsten vier Tage nach Montana zu begeben!«
»Was hat denn Loke Klingsor mir so etwas zu verbieten?«, erklang es jetzt erstaunt. »Etwa weil er der Fürst des Feuers oder Obermeister ist?«
»Nein, nur als Loke Klingsor verbiete ich Dir, Dich dieser Bären zu bemächtigen!«
»Du hast mir in dieser Hinsicht gar nichts zu befehlen oder zu verbieten, ich bin ein freier Meister!«, rief der Alte jetzt trotzig.
»Nicht? Nein, so wie Du meinst, allerdings nicht. Aber ich werde ein anderes Register ziehen. Czernebog, Du bist ein Schuft!«
Es war ein starkes Wort gewesen, das aber seine Wirkung nicht verfehlte.
»Was soll sich denn der alte ehrliche Czernebog schon wieder verbrochen haben?«, erklang es mit einem Male wieder ganz ängstlich.
»Dein böses Gewissen verrät Dir schon, was ich von Dir ersehen habe.«
»Der alte ehrliche Czernebog weiß sich nichts...«
»Czernebog, Du hast Deine Züchtungsversuche, Deine schauderhaften Experimente nicht nur auf Tiere, sondern auch auf Menschen erstreckt, und Du weißt, was für Gesetze wir Skalden da haben. Das kostet Dich den Kopf...«
»Das ist sich nicht wahr. das ist sich nicht wahr!!«, kreischte es jetzt förmlich in dem Trichter auf. »Das ist sich erstunken und erlogen!«
»Ich werde Dich anklagen und Beweise bringen, dass es doch so ist.«
»Gar nichts kannst Du beweisen! Du hast nichts gesehen! Man soll bei mir Haussuchungen halten...«
»Jawohl, damit Du Unhold alle die kleinen Menschlein vorher tötest und beiseite bringst.«
»Du bist nicht allwissend, Du hast es Dir nur zusammenphantasiert, und ich werde beweisen, dass Deine Berechnungen und Deine Bilder in dem magischen Spiegel auch trügen können...«
»Wohl, das mag sein, aber ich werde reelle Beweise bringen.«
»Was für Beweise sollen das sein?«
»Die Du selbst angefertigt hast! Als ich Dich das vorletzten Mal besuchte, damals auf den FalklandInseln, als Du mir die neuesten Errungenschaften in Deiner Menagerie zeigtest, da habe ich ein langzusammengefaltetes Papier gefunden, an der einen Ecke angebrannt, offenbar als Fidibus benutzt, es war nichts als weißes Papier, aber dort, wo es gebrannt hatte, war doch etwas Blaues zum Vorschein gekommen, was mir auffiel, ich steckte es ein, habe alle möglichen Versuche damit angestellt. Erst wollte es mir nicht gelingen, eine Erhitzung brachte nichts weiter zum Vorschein, Hunderte der verschiedensten Chemikalien nicht, zuletzt aber wandte ich auch einfaches Schwefelstoffgas an, und da plötzlich kamen ein Bild zum Vorschein sowie eine Schrift, Deine eigene, in der Du erklärtest, dass dies eine von Dir selbst an dem und dem Datum aufgenommene Fotografie sei...«
»Höre auf, höre auf!! Czernebog will sich nichts weiter wissen!«, kreischte es jetzt wieder in dem Trichter auf, um dann in bettelndem Tone fortzufahren. »Der edle Fürst des Feuers wird den armen, alten Czernebog, der immer so das Zipperlein hat, doch nicht anklagen?«
»Hm. Also in acht Stunden wirst Du im amerikanischen Felsengebirge der Bärenjagd obliegen, Czernebog?«
»Ach, ich denke ja gar nicht daran, ich hatte vielmehr gleich vor, die Bären Dir abzutreten, ich wollte Dir nur eine freudige Überraschung bereiten, mein liebster, bester Fürst, den ich in meinem Herzen...«
»Schon gut, schon gut! Ich danke Dir, mein lieber Czernebog. Die Sache hat sich erledigt, und dass Dein Geheimnis bei mir gut aufgehoben ist, weißt Du ja, da kennst Du mich, und wenn ich Dich das nächste Mal besuche, zeigst Du mir Deine Männlein. Schluss!«
Schmunzelnd drehte Klingsor wieder einen Hebel herum, den er vorhin abgestellt hatte.
Aus dem vergnügten Schmunzeln wurde wieder ein grimmiges Lächeln.
»Na, wenn der wüsste, was alles auch ich schon auf dem Kerbholze habe, was alles auch ich schon gegen die Skaldengesetze gesündigt habe — nur ein einziges meiner Geheimnisse, die ich den anderen vorenthalte — der würde mir ja nicht schlecht auf dem Leder knien! — — So, nun kommt mein Freund Tankred dran, für den habe ich auch einen hübschen Köder auf Lager, da wird er schon anbeißen. — — — Pauli!!!«
»Herr Klingsor?«
»Verbinden Sie mich mit dem Grafen Tankred!«
In noch kürzerer Zeit als vorhin war es geschehen, Klingsor isolierte sich wieder.
»Hier Graf Tankred!«, rief oder donnerte vielmehr eine dröhnende Bassstimme. »Der Graf Bertran de Born will mich haben?«
»Der ist schon hier.«
»Guten Abend, Loke!«
»Guten Morgen, Tankred!«
Die beiden befanden sich also auf den entgegengesetzten Hemisphären. Für den einen ging die Sonne auf, für den anderen unter.
Aus der Art, wie die beiden sich nun unterhielten, war nichts von der Todfeindschaft zu merken, von der Klingsor schon mehrmals gesprochen hatte. Sie schienen die besten Freunde zu sein, wenn sie auch nicht gerade einander zur Liebe lebten, jeder seinen Kopf für sich hatte und seinen eigenem Vorteil wahrte.
»Was willst Du, Loke?«
»Mensch, brülle doch nur nicht so! Du zersprengst mir ja den Apparat!«
»Ich bin etwas heiser, habe eine belegte Stimme.«
»Ich merke nichts davon, und da solltest Du Deine Stimme gerade schonen. Dir ist gemeldet worden, dass in Montana im Felsengebirge eine Familie Grizzlybären gesehen wurde?«
»Ich bin schon unterwegs, um sie abzunicken, hohohohoho!!«, lachte es dröhnend.
»Was gibt es denn da zu lachen?«
»Weil ich weiß, dass Du noch vier Stunden in Australien gewesen bist, also kannst Du unmöglich früher dort sein als ich, hohohohoho!!«
Dann also wusste auch dieser Skaldengraf nicht, dass sein Freund und Gegner eine Erfindung besaß, durch die er weit schneller die weiteste Strecke durchmessen konnte als jeder andere Skalde, dass er auch von Australien aus weit eher am gemeinsamen Ziele hätte sein können.
»Überlass mir diese Bären, Tankred!«, legte sich der Mann mit den Teufelsaugen aufs Bitten, und er wusste in seine so überaus angenehme Stimme noch einen ganz eigentümlichen Schmelz zu legen, dem wohl nur wenige widerstanden hätten.
Aber bei seinem brasilianischen Nachbar schlug das nicht an.
»Nee. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.«
»Wir wollen uns in die Bären teilen.«
»Nee. Ich bin nicht fürs Teilen.«
»Was willst Du dafür haben?«
»Nischt.«
»Ich biete Dir dafür mein Durandarte.«
So hieß Rolands Schwert, das der Held, als er im Tale Roncevalles überfallen wurde und seinen Tod kommen sah, vergebens an den Felsen zu zerschmettern suchte; er spaltete mit dem Stahle nur die Steine.
»Dein Schwert bekomme ich sowieso.«
»Wann denn?«
»Sobald ich Deine Burg Autafort genommen habe.«
»Da kannst Du ja lange warten!«, lachte Klingsor.
»Sollst mal sehen, wie schnell es geht! Ich habe einen neuen Plan.«
»Ich biete Dir meinen Bukephalus dafür.«
So hieß Alexander des Großen Pferd, das er als Jüngling gebändigt hatte und das er allein reiten konnte. Keinen anderen Mann duldete es auf seinem Rücken.
»Nee. Behalte nur Deine alte Schindmähre für Dich allein.«
»Schindmähre? Du warst doch neulich noch ganz begeistert für mein Streitross, wolltest ewigen Burgfrieden mit mir schließen, wenn ich es Dir abträte.«
»Ja, neulich... da war ich wieder einmal verrückt. Ich will Dir etwas sagen, Loke. Du bist ein alter Fuchs. Du versprichst einem immer alles, und hinterher...«
»Was?! Habe ich jemals mein Versprechen und mein Wort nicht gehalten?!«
»Jawohl, recht hast Du! Niemand kann Dir etwas nachsagen. Du bist ein tadelloser Ritter. Aber ebenso ein ganz gerissener Fuchs, und dabei bleibt es. Du versprichst mir jetzt Dein Schwert und Dein Ross, und Du würdest sie mir auch geben. Aber hinterher machst Du einen mit Redensarten besoffen oder weißt es sonst in so vertrackter Weise zu drechseln, dass man Dir alles zurückgibt. Du willst es nicht annehmen; aber man bettelt so lange, bis Du es doch annimmst, und dann ist man von Deiner Großmut auch noch ganz gerührt. Da verstehst Du so eine besondere Art von Hexerei. Aber ich will mich nicht von Dir behexen lassen. Nee, Loke, es gibt nischt! Ich bin in zwanzig Stunden in Montana, Du brauchst wenigstens doppelt so lange, bis Du dort sein kannst — — das ist mir die sicherste Garantie. Die Grizzlys, die immer rarer werden, gehören mir, und damit basta!«
Der Mann mit den Teufelsaugen hatte gegen diesen Vorwurf solcher Art Hexerei keine Einwendung zu machen.
»Wir wollen doch die Bären zusammen jagen«, versuchte er es noch einmal. »In die vier Jungen teilen wir uns.«
»Nee. Gehört alles mir.«
»Es gibt eine herrliche Jagdpartie.«
»Ich jage lieber allein.«
»Aber, Tankred, Du bist doch mein Freund!«
»Na, ich danke für solche Freundschaft! Mir brummt von Deinem letzten Keulenschlag heute noch der Schädel.«
»Ich bringe eine Kruke von dem babylonischen Wein mit, der dreitausend Jahre in der Pyramide gelegen hat!«
»Sauf' das Zeug alleine!«
»Auch Chlorinde kommt mit.«
Mit einem ganz eigentümlichen Gesicht hatte Klingsor dieses letzte gesagt.
Und da entstand eine längere Pause.
»Wer?«, fragte die sonst so donnernde Stimme ganz leise.
»Die Chlorinde!«
»Du meinst doch nicht etwa... die Königin von Thule?!«
»Jawohl, eben die meine ich. Wir laden sie ein zu der Bärenjagd im Felsengebirge. Sie macht ganz sicher mit.«
Wiederum entstand eine längere Pause.
»Mensch! Loke! Teufelskerl!«, erklang es dann abermals so leise. »Was hast Du vor? Wie willst Du mich wieder einmal übertölpeln?«
»Habe ich Dich denn schon einmal übertölpelt?«
»Hm. Eigentlich nicht. Oder aber... man weiß es ja niemals, wenn Du einen übers Ohr gehauen hast. Das ist ja eben das verflixte bei Dir. Ich muss mich noch einmal überzeugen, ehe ich glauben kann, richtig gehört zu haben: Du willst die Königin von Thule einladen, dass sie mit uns zusammen Grizzlys im amerikanischen Felsengebirge jagt?«
»Jawohl.«
»Hohohohohoho!!!«, fing es in dem Schalltrichter wieder donnernd zu brüllen an.
»Bei allen Göttern — willst Du mir denn die Membrane zersprengen und mein Trommelfell dazu?!«
»Chlorinde hat geschworen, ihr Thule mit keinem Schritte eher zu verlassen, als bis Du es im Sturme genommen hast.«
»Wenn ich Thule nun in allernächster Zeit nehme?«
»Dann geht die besiegte Chlorinde ganz sicher nicht sofort mit Dir auf die Bärenjagd.«
»Da hast Du allerdings recht. Und doch, Chlorinde wird meiner Einladung Folge leisten.«
»Niemals! Die bricht ihren Schwur nicht.«
»Sie hat gar keinen Schwur abgelegt, nur ein Gelübde.«
»Das ist doch genau dasselbe!«
»Nein.«
»Was für ein Unterschied ist denn da dabei?«
»Es können Verhältnisse eintreten, dass man ein Gelübde einmal ausschalten muss. Einen Schwur kann man nur brechen, nicht unterbrechen.«
»Du bist ein Wortklauber, Loke.«
»Kurz und gut: Ich weiß ein Mittel, um Königin Chlorinde aus Thule hervorzulocken, dass sie sich nach Montana ins amerikanische Felsengebirge begibt.«
»Was für ein Mittel?«
»Das wirst Du selbst sehen, wenn es so weit ist, eher verrate ich es nicht.«
»Dass sie an unserer Bärenjagd teilnimmt?«
»Auch das!«
»Auch sie ist von der Anwesenheit der Bären benachrichtigt worden.«
»Weiß ich!«
»Sie weiß, dass auch ich es erfahren habe!«
»Ist mir bekannt!«
»Nun nimmt sie als ganz selbstverständlich an, dass ich sofort hineile!«
»Das tut sie.«
»Willst Du ihr vorflunkern, ich wäre nicht dort?«
»Ich flunkere nie«
»Na ich danke!«
»Beweise mir...«
»Schon gut, schon gut! Dir kann man niemals etwas beweisen. Loke, Du willst mich mit Chlorinde zusammenbringen?«
Mit vor Erregung zitternder Stimme, der auch etwas wie Schmerz beigemischt war, war es gesagt worden.
»Es wird möglich sein, ich glaube es ganz bestimmt.«
»Loke, sei ehrlich!«, begann jetzt diese Bärenstimme förmlich zu schmeicheln. »Du willst mich doch nicht zum Besten haben?«
»Bei Thor und Odin und beim heiligen Feuer der Freya«, erklang es feierlich, »ich habe einen Hintergedanken bei meinem Vorschlage, Dich mit der Königin von Thule zusammenzubringen.«
»Ach, sie einmal sehen, sie nur einmal wiedersehen...!«
Immer mehr zitterte die plötzlich so weich gewordene Bärenstimme — wie sich die Unterhaltung überhaupt recht geändert hatte, die ganze Stimmung zwischen den beiden.
»Armer Kerl!«, murmelte Klingsor mit recht melancholischem Gesicht.
»Loke, wenn Du das fertig bringst... fordere von mir, was Du willst...«
Der plötzlich wieder ganz begeistert Sprechende schien vergessen zu haben, dass er ja bloß auf die Bären verzichten sollte. Und der Mann mit den Teufelsaugen war wiederum nicht derjenige, der sich das entgehen ließ.
»Was bietest Du mir?«
»Meine Burg, meine ganze Grafschaft...«
»Das alles bekomme ich sowieso, ganz Ophir muss mir gehören, ich will es mit niemand teilen...«
»Meine Freundschaft...«
»Will ich nicht haben! Als Feind bist Du mir lieber und ich verlange die sechs Bären. Du siehst nur zu, wie ich sie erlege und fange.«
»Selbstverständlich. Wenn ich Chlorinde wieder einmal sehen kann, denke ich an keine Bärenjagd mehr — — Ach, sie nur einmal wiedersehen, sie sehen...!«
»Ich will Dir doch eine lebende Fotografie von ihr schicken, Du hängst sie über Deinem Bett an die Wand...«
»Ach fahre mit Deinen zappelnden Bildern zur Hölle! Wann nun wird die Begegnung stattfinden?«
»Morgen und übermorgen natürlich noch nicht.«
»Natürlich nicht! Sie ist ja in Australien Die Reise erfordert einige Tage.«
»Am... 9. Hyparion wollen wir sagen.«
»Gut!«
»Am 9. Hyparion um drei Uhr nach Skaldenzeit treffe ich mit Chlorinde dort in Montana ein.«
»Kannst Du das so genau bestimmen?«
»Ich glaube. Den Ort, wo wir uns treffen, machen wir noch aus. Nun aber muss ich erst Chlorinde sprechen. Sonst noch etwas?«
»Nichts! Nur melde mir dann das Resultat!«
»Schluss!«
Klingsor drehte wieder den Hebel und wollte sich mit dem vergnügtesten und listigsten Lächeln die Hände reiben, tat es aber nicht, wurde gleich wieder ernst.
»Halt! Noch bin ich meiner Sache doch nicht so ganz sicher. Erst muss alles geglückt sein, dann darf ich mich freuen. Dann kann ich einmal von dem halben Geiste sprechen, den Bertran de Born nur nötig hat, um jeden Knoten zu lösen, der nicht mit dem scharfen Schwerte zu zerhauen ist.
Aber auch sonst stimmt mich diese Sache sehr ernst.
Mein armer Tankred!
Er ist bis über die Ohren verliebt in die Chlorinde, war es vom ersten Augenblick an, wo er sie gesehen hat, hatte alle Hoffnung, erhört zu werden — — da musste der ungehobelte Brummbär eine Äußerung tun, die sie als maßlose Beleidigung auffasste, die sie ihm nie verzeihen kann.
Geliebt hat sie ihn überhaupt nie, wenn er ihr auch nie ganz gleichgültig gewesen sein mag.
Da lernte sie mich kennen. und nun hatte sie nur noch mich im Sinne.
Dieses Teufelsweib ist ganz vernarrt in mich, liebt mich zum Fressen, was ganz wörtlich zu nehmen ist; denn sie will mich lieber tot wissen als in den Armen einer anderen.
Ha, wenn die wüsste!
Und sie könnte es eigentlich wissen. Wenn sie eben in dieser Hinsicht vor Liebe nicht ganz blind und taub wäre!
Mir ist sie gleichgültig.
Ja, als Freundin ist sie mir angenehm, aber sonst... ich habe mir die Finger schon einmal bös verbrannt, trotz meiner Höllensalben. Die schützen nur gegen natürliches Feuer, aber gegen das der Liebe habe ich noch keine Salbe und kein anderes Mittel erfinden können.
Wie mache ich es nun, dass ich ihren Hass oder doch ihre ehrliche Abneigung gegen den armen Tankred in Liebe verwandle?
Wenn ich das fertig bringe, dann habe ich mein Meisterstückchen gemacht.
Nun, erst muss ich sie einmal zusammenbringen, und auch das will arrangiert sein. — — — Pauli!!«
»Herr Klingsor?«
»Verbinden Sie mich mit der Königin von Thule.«
»Ist geschehen.«
»Wer ruft mich?«, erklang alsbald eine tiefe, aber wohllautende Frauenstimme.
»Hier Klingsor.«
»Was willst Du, Loke?«
Die Skaldenhäupter schienen sich alle zu duzen und so untereinander zu verkehren. Anders war es wohl zwischen den Meistern.
»Ich habe mich Dir, Chlorinde, bis zum 12. Hyparion zum Zweikampf zu stellen.«
»Hast Du schon wieder eine Absage?«
»Ich habe Deine Herausforderung angenommen und noch nie an eine Absage gedacht. Vielmehr liegt es nur an Dir, o Königin, ob Du mit mir den Zweikampf auf Tod oder Leben bestehst.«
»Auf das Miserikordia lasse ich mich nicht ein. Ich kann keinen anderen Menschen, wenn er schon besiegt und hilflos am Boden liegt, wie ein Metzger dem Lamme mit dem Messer den Todesstoß geben.«
»Wenn ich aber nun darauf bestehe?«
»So bezichtige ich Dich, Graf Bertran de Born, der Feigheit. Dein Miserikordia ist nur ein Ausweg, um diesen Zweikampf zu verhindern, weil Du meinen Charakter kennst.«
»So kommen wir nicht weiter, Chlorinde.«
»Lass also Deine Bedingung fallen, und die Sache ist erledigt.«
»Ich gehe darauf ein.«
»Aaaah!«, erklang es mit freudigem Staunen. »Also ungepanzert?«
»Wie Du wünschest.«
»Ohne jeden Schutz?«
»Ohne jeden Schutz!«
»Dann aber kann der Kampf auch nicht auf Zweihänder ausgefochten werden.«
»Weshalb denn nicht?«
»Weil — weil... ich will es Dir offen sagen, Loke: weil ich Dir im zweihändigen Schwerte gar zu sehr überlegen bin.«
»So? Das sollst Du eben erst beweisen.«
»Ich lasse mich auf das zweihändige Schwert ohne Panzerung nicht ein.«
»Siehst Du, Königin, Du bist es ja, die immer neue Hindernisse erfindet!«
»Meinetwegen bezichtige mich der Feigheit, glauben wird Dir ja doch niemand.«
»Nun gut, ich will Dir wiederum entgegenkommen — bestimme Du eine andere Waffe.«
»Das hast Du zu tun.«
»So wähle ich den leichten Säbel.«
»Angenommen!«, erklang es schnell.
»Du weißt doch, dass ich in der Führung dieser Waffe Meister bin?«
»Rühme Dich gegen andere, nicht gegen mich!«
»Du wünschst also den Tod durch meine Hand zu erleiden?«
»Wer von uns fällt, wird sich ja finden.«
»Ist es Dir denn nur gar so angenehm, von meiner Hand zu sterben?«, ging der Mann mit den Teufelsaugen immer mehr zum offenen Hohne über.
»Prahle doch nicht, Loke!«
»Dass Du nicht mehr leben magst, weil ich Dir nicht angehören kann? Weil ich Deine Liebe nicht erwidere? Dass Du da wenigstens den süßen Tod von meiner Hand sterben willst?«
Es war wohl so ziemlich das Stärkste, was ein Mann einem Weibe sagen kann, um es zu beleidigen.
Deshalb war auch die längere Pause begreiflich. Chlorinde mochte jetzt ganz erstarrt sein.
»Mensch, was wagst Du mir da zu sagen!!«, brauste sie dann furchtbar auf.
»Wohl, also auf leichte Säbel ohne jeden Schutz«, fuhr Klingsor gemächlich fort, als ginge ihn das vorher Gesagte gar nichts mehr an. »Da Du es aber nun doch eigentlich gewesen bist, welche die Waffe bestimmt hat — denn anders ist es nicht, nachdem ich Dir auch schon das Miserikordia erlassen habe — wirst Du mir nun auch zugestehen, dass ich die anderen Bedingungen stelle.«
Sie brauchte noch einige Zeit, um sich wieder zu beruhigen.
»Was für Bedingungen gibt es sonst noch?«, konnte sie wieder ziemlich gelassen fragen.
»Erstens die Zeit.«
»Die kannst Du überhaupt bestimmen. Bis zum 12. Hyparion, wie schon ausgemacht. Ich stehe Dir zu jeder Stunde und Minute Tag und Nacht zur Verfügung.«
»So bestimme ich die dritte Stunde am 9. Hyparion.«
»Angenommen!«
»Nun handelt es sich nur noch um den Ort, wo wir den Strauß ausfechten.«
»Den kannst Du ebenfalls bestimmen.«
»Wirklich?«
»Ja, selbstverständlich! Auch die Himmelsrichtung. Ob Dir die Sonne entgegen sein soll oder mir oder wie Du sonst willst.«
»Sonne? Um drei Uhr nach Skaldenzeit ist in Thule wie in ganz Australien ja noch finstere Nacht, am 9. Hyparion haben wir auch noch gerade Neumond.«
»Loke, was für Schliche hast Du wieder vor?!«, erklang es mit misstrauischem Stutzen.
»Du denkst wohl, der Zweikampf muss unbedingt vor den Toren von Thule stattfinden?«
»Ja, wo denn sonst?!«
»Na, wie wär's denn, wenn er auf dem Monde stattfände? Also, Chlorinde, ich erwarte Dich am 9. Hyparion punkt drei Uhr auf dem Monde!«
»O, Du Ungeheuer, Du Ausgeburt von allen teuflischen Listen, Du Feigling, Du elende Memme! —«
»Halte ein, Chlorinde, erschöpfe nicht Deinen ganzem Vorrat an Scheltworten! — — Nein, ich will Dir durchaus nicht ausweichen — aber den Kampfplatz habe nun einmal ich zu bestimmen — — und ich will, dass er nicht vor den Toren Thules und nicht in Deinem ganzen Königreiche liegen soll.«
»Ha, jetzt durchschaue ich Deine List!«, lachte sie grimmig. »Du willst mir dennoch ausweichen, um nicht das Leben zu verlieren! Weil ich das Gelübde abgelegt habe, keinen Schritt aus Thule zu tun, bevor Du nicht Deine Ohnmacht eingestanden hast, meine Festung im Sturme zu nehmen! Aber Deine Schlauheit soll zu Schanden werden, Du befindest Dich in einem Irrtum! Diesen Schwur habe ich nur mir selbst geleistet, ich kann ihn brechen, so bald und so oft ich will; und wenn ich dereinst dafür in der Hölle büßen muss, so ist das meine Sache. Um Dich endlich zu vernichten, breche ich meinen Schwur! Bestimme den Ort, und wenn er auf dieser Erde liegt, ich komme hin, und wenn Du der leibhaftige Fürst der Hölle wärest, bestelle mich in Deinen Flammenpfuhl, ich suche Dich auf!«
»Wohl, ich habe Dein Wort! Aber einen gar so gefährlichen oder auch nur versteckten Platz habe ich nicht auserwählt. Er liegt im amerikanischen Felsengebirge, im MontanaTerritorium, noch auf Seite der Vereinigten Staaten, aber ganz nahe der kanadischen Grenze. Den ganz bestimmten Punkt, wo wir am 9. Hyparion um drei Uhr nach Skaldenzeit uns treffen, werde ich Dich in Bälde noch wissen lassen.«
Wieder eine kleine Pause.
»In Montana im Felsengebirge?«, wurde dann zögernd gefragt.
»Jawohl.«
»Bist Du nicht vor kurzem davon benachrichtigt worden, dass dort Grizzlybären gesichtet worden sind?«
»Gewiss.«
»Und — und... andere sind hiervon wohl auch noch benachrichtigt worden?«
»Jawohl, Graf Tankred ebenfalls. Auch er wird an der Bärenjagd teilnehmen, wenn auch nur als Zuschauer; er wird zusehen, wie ich die Bären erlege, respektive fange, natürlich nur die Jungen, bei den großen werde ich mich hüten, die schieße ich mit vergifteten Pfeilen oder sprenge sie mit Dynamitkugeln auseinander. Vorsicht ist die Mutter der Weisheit... also nicht wahr, Chlorinde, dort findest Du Dich zur bestimmtem Stunde ein?«
Wieder ein höhnisches Lachen.
»Loke, Du bist doch immer derselbe! Ganz zusammengesetzt aus Spott und Hohn und Teufelslisten! Du musst wirklich in der Hölle studiert haben! Du meinst, weil jener Mensch dort ist, dessen Namen ich nicht mehr in meinen Mund nehme, werde ich nicht hinkommen? Und so suchst Du wiederum den Zweikampf mit mir zu vermeiden! Aber wiederum irrst Du! Jener existiert einfach nicht für mich, er wird auch dort Luft für mich sein. Mag er mich mit seinen Glotzaugen auch noch so anstieren, ich sehe ihn nicht. Also Deine feige List hat Dir nichts genützt, Loke. Ich werde zur festgesetzten Zeit nach dem Felsengebirge kommen und mit Dir kämpfen, lass mich nur den Punkt genau wissen, wo wir uns treffen.«
»Dann ist es ja gut«, sagte Klingsor mit seiner gewöhnlichen Gelassenheit. »Aber sage, Chlorinde: Hältst Du mich denn wirklich für eine Memme?«
»Nnnein«, erklang es zögernd. »Ich habe schon zu viele Beweise bekommen, dass Du es eigentlich nicht bist.«
»Weshalb schmähst Du mich dann immer so?«
»Weil... haben wir sonst noch etwas vorher auszumachen?«
»Aus demselben Grunde, weswegen Du mich töten willst, schmähst Du mich auch. Weil Du mich liebst, was Du Dir aber selbst nicht gestehen...«
»Schluss, Schluss, Schluss!!! O, wenn Du wüsstest, wie ich Dich hasse, hasse, hasse!!!«
Klingsor musste an einem Zeichen erkennen, dass die Verbindung unterbrochen worden war.
Er lehnte sich in den Stuhl zurück und lachte.
»Sie kann die Evastochter doch nicht verleugnen, trotz all ihrer furchtbaren Grimmigkeit! Macht einen dreifachen Schluss, kann sich aber nicht versagen, doch noch etwas hinzuzusetzen, mit dreifacher Wiederholung — und zwar etwas, was sie selbst nicht glaubt, hahaha!«
Sein lautes Lachen verwandelte sich in ein vergnügtes Schmunzeln, und jetzt rieb er sich wirklich die Hände.
»So, es wäre alles arrangiert. Das nennt man doch wohl drei Fliegen mit einem Schlag klappen. Der alte Czernebog kalt gestellt — dem Tankred die mir schon so gut wie verlorenen Bären doch noch aus den Zähnen gerückt — und auch noch die Königin von Thule aus ihrer Festung und dorthin gelockt, wo ich sie haben will! Wenn alles gut geht, dann komme ich ihr auch noch auf der Rückreise zuvor oder weiß sie im Felsengebirge festzuhalten und statte als Spion ihrer Festung einen Besuch ab, was ich während ihrer Anwesenheit nie wagen dürfte.
Ja, das Großartigste ist, dass ich fertiggebracht habe, die Chlorinde zu bewegen, dass sie ihr Gelübde bricht, ihr belagertes Thule einmal verlässt. Loke, auf diesen Erfolg darfst Du wirklich stolz sein!«
Das Schmunzeln erstarb, seine Züge und Augen nahmen wieder den ernsten, gedankenvollen Ausdruck an, der ihnen eigen war.
»Wenn ich nur auch noch wüsste, wie ich Chlorindes Abneigung gegen den armen Kerl besiegen, wie ich die beiden für immer vereinen könnte.
Oder wenn ich nur wenigstens wüsste, ob es überhaupt einen Zweck hat, sich da erst zu bemühen — dass das Schicksal nicht von vornherein ganz anders beschlossen hat.
Scheinbar ist die Sache ja ganz einfach.
Ich mache einfach meine Horoskopberechnungen und lasse, um die Details zu erfahren, jemand in den magischen Spiegel blicken.
Jawohl, wenn die Sache nur so einfach wäre!
Solch eine Berechnung nimmt immer mindestens drei Tage und drei Nächte in Anspruch, die ich schlaflos verbringen muss, unausgesetzt arbeitend.
Denn schlafe ich dazwischen einmal, so besitze ich nicht die Fähigkeit, den in den magischen Spiegel Blickenden zu faszinieren.
Zwar habe ich ein Mittel, um den Schlaf auf jede Zeitdauer unnötig zu machen, aber das darf ich hierbei nicht anwenden, ich muss das Schlafbedürfnis durch freie Willenskraft besiegen, es handelt sich dabei eben um eine asketische Übung, welche den Geist vom Körper befreit.
Wenn das solche Anstrengungen kostet, befragt man das Schicksal nicht wegen jeder Kleinigkeit. Mir graut immer davor.
Wegen Thules Eroberung habe ich es getan, weil ich nun endlich wissen wollte, ob es noch einen Zweck habe, so viele Menschen zu opfern, dadurch kam ich auf den Professor Edeling — — das letzte Mal tat ich es wegen des Golems.
Da hatte die Rechnerei immer einen besonderen Zweck. Aber nun wegen der Liebelei meines Nachbarn mich wieder drei Tage und drei Nächte hinsetzen — — nein, so weit geht unsere Freundschaft nicht, so leid es mir auch tut.
Denn nun das Allerschönste dabei — — schon der Ansatz erfordert mindestens zwei Tage und zwei Nächte, und wenn die Sache losgehen soll, dann antwortet mir das Schicksal mit einem Nein! Es verweigert mir das Endresultat! Alle vorhergehende Rechnerei war umsonst!
Es ist ja überhaupt ganz wunderbar, welche verschlungenen Wege das Schicksal immer geht.
Nur mein eigenes Schicksal ist mir verschlossen, und das aller derer, mit denen ich durch Liebe aufs Engste verknüpft bin.
›Dein Fleisch und Blut.‹ So hat der rätselhafte Seher gesagt, der mich diese Schicksalsberechnung lehrte, der mir wenigstens den Schlüssel zur letzten Pforte gab, welche noch das große Geheimnis verschloss, bis zu welcher ich durch eigene Anstrengungen gedrungen war.
Erst später erkannte ich, dass er mit ›Blut‹ die Seele gemeint hatte, wie er sich überhaupt stets in dunklen Orakelsprüchen bewegte, und so erkenne ich auch plötzlich die Möglichkeit, dass ich dennoch mein eigenes Schicksal befragen kann.
Wie Schuppen ist es mir plötzlich von den Augen gefallen.
Dass diese Möglichkeit besteht, das Schicksal auch über meine eigene Person zu befragen, hatte der Seher ja schon stark angedeutet, und dann sollte dies sogar ohne Anstrengung geschehen können, ohne vorherige Horoskopberechnungen.
›Wenn Du nur mit einem einzigen Auge in diesen Spiegel blickst, dann siehst Du Dein eigen Fleisch und Blut und brauchst nicht mehr das Horoskop zu berechnen, dann ist der Bann gebrochen, das Glas ist rein.‹
So sagte er mir, als er mir den Spiegel gab. Es waren seine letzten Worte. Er verschwand. Ich habe den rätselhaften, von wunderbaren Geheimnissen und Kräften umgebenen Mann nie wiedergesehen, nicht seinen Namen erfahren. Er musste einer anderen Welt angehören.
Ach, was könnte ich erzählen, von den Tagen, die ich in seiner Gesellschaft verlebt habe!
Doch ich will in meinem Gedankengange bei der Sache bleiben.
Nur mit einem einzigen Auge sollte ich in den Spiegel blicken, um meine eigene Zukunft zu enthüllen?
Ach, was habe ich daraufhin alles probiert!
Natürlich kniff ich abwechselnd erst ein Auge zu. Ich sah nichts.
Ich ließ andere ein Auge zudrücken.
Ich konnte nur konstatieren, dass sie mit einem Auge in dem Spiegel überhaupt nichts sahen.
Sie mussten mit beiden Augen starr auf das Glas blicken, wenn ich sie faszinieren können wollte.
Ich habe zahllose Experimente mit Einäugigen gemacht, links erblindet, rechts erblindet, auf einem Auge blind geboren, durch ein Unglück das eine Auge verloren, sich selbst verstümmelt, usw. usw. Ich kam nicht in den Spiegel hinein.
Ja, in einer exaltierten Stunde hatte ich einmal die Absicht, mir selbst ein Auge zu rauben, um dieses Geheimnis endlich zu lüften.
Ich schäme mich, wenn ich daran zurückdenke.
So vergingen Jahre und ich dachte gar nicht mehr an den letzten Spruch des Sehers, hatte mich gezwungen, es zu vergessen.
Und doch, es soll sich noch bewahrheiten!
Oder alles trügt!
O Wunder über Wunder!
Da bin ich neulich in Deutschland, um persönlich Erkundigungen über den Professor Edeling einzuziehen, oder mehr noch, um mich zu amüsieren, gehe auf Abenteuer aus, komme in ein Städtchen, in dem Vogelschießen ist.
Ich bummele auf der Festwiese zwischen den Buden herum.
Da, ehe ich es noch sehe, höre ich eine bierheisere Stimme brüllen:
›Immer rein, immer rrein, immer rrrein, meine Herrschaften, hier ist zu sehen, was noch niemand gesehen hat, das größte Wunder der Welt: Ein sogenannter Zyklop, der nur ein einziges Auge mitten auf der Stirn hat...‹
Wie ein unheimliches Schauern ging es über mich.
Ich drehe mich um — da sehe ich den heruntergekommenen Kerl im schäbigen Frackanzug mit Brille, den Gelehrten markierend, auf dem Podium einer Bude stehen, wie er mit einem Rohrstock immer gegen ein großes Leinwandbild klopft.
Es stellt eine antike Landschaft dar, den einäugigen Zyklopen aus Homers Odyssee, wie er die Menschlein verschlingt, und daneben ein anderes Bild, ein modern gekleideter Junge, der ebenfalls nur ein Auge auf der Stirn hat.
Ja, wie eine heilige Ahnung überkam es mich. Ich dachte an meinen Spiegel.
Gleich darauf lachte ich höhnisch über mich selbst.
Und doch — ich trat ein.
Natürlich war es der plumpeste Schwindel.
Es ist eine Wachspuppe, die da gezeigt wird, mit einem Auge auf der Stirn.

Der Schausteller konnte gut behaupten, dass diese Figur nach einem Säugling modelliert, der wirklich geboren worden sei, um gleich wieder zu sterben.
Ich fragte einen in der Bude befindlichen Schutzmann, ob solch ein Schwindel denn erlaubt sei.
Der Mann lachte.
›Wer so dumm ist‹, meinte er, ›um glauben zu können, das es so etwas gäbe, Menschen mit nur einem Auge mitten auf der Stirn, dem schadete es nichts, wenn ihm ein Groschen abgenommen würde, der würde sein Geld sowieso los.‹
So sprach der Hüter der Ordnung — und ich schämte mich ob meines geheimen Schauerns und meiner heiligen Ahnungen, die mich überkommen hatten, wovon ich sonst glücklicherweise verschont bleibe.
Aber ich begann mich doch zu interessieren.
Es gab in der Bude auch noch anderes zu sehen — kleine Gruppen, sehr schön aus Wachs modelliert, Szenen aus der Odyssee darstellend.
Der Schausteller hatte sich von der einäugigen Säuglingspuppe schnell abgewandt, erklärte dafür jene Figuren und Szenen.
Und es war wirklich außerordentlich, wie der Mann zu erzählen und zu deklamieren verstand. Er musste die ganze Odyssee im Kopfe haben und wusste unverständliche Stellen dem Publikum vortrefflich zu erklären.
Dabei erkannte ich an Ausdrücken, dass es ein akademisch gebildeter Mann sein musste, so nahm ich ihn mir dann einmal vor.
Jawohl, er war ein heruntergekommener Arzt, der auch klassische Studien getrieben hatte.
›Wie kommen Sie denn dazu, so eine künstliche Missgeburt zu zeigen, wie es eine solche noch nie gegeben hat?‹, fragte ich.
›Noch nie gegeben hat? Die Figur ist wirklich nach einem Original modelliert.‹
›Das glauben Sie wohl selbst nicht!‹
›Sie bezweifeln, dass Menschen und Säugetiere mit nur einem Auge auf der Stirn geboren werden? Haben Sie noch nichts von der Zyklopie gehört?‹
Und der rotnasige Kerl hielt mir einen Vortrag über etwas, wovon ich noch nie etwas gehört hatte.
Und da ich noch immer zweifelte, im Glauben, der schon am Säuferwahnsinn leidende Mann schöpfe dies alles nur aus seiner Phantasie, holte er eine schmierige Scharteke herbei, ein wissenschaftliches Buch.
Da las ich es.
Und eine Viertelstunde später suchte ich in einem Konversationslexikon. Diesmal schämte ich mich nicht, als mich wiederum Schauer und Ahnungen überkamen.
Und dann saß ich in meinem magischen Tuskulum, rechnete und zog Kreise.
›Gibt es einen Menschen, der als Zyklop nur ein einziges Auge mitten auf der Stirn hat?‹
›Ja.‹
Klipp und klar war die Antwort gekommen. Ich hatte dieses Ja erwartet, und doch erschrak ich furchtbar.
›Gibt es ihrer mehrere?‹
›Nein.‹
›Nur diesen einzigen?‹
›Ja.‹
Die zyklopischen Kinder sollen ja immer gleich nach der Geburt sterben. Aber warum denn immer? Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ich fragte weiter:
›Ist das dieser Mensch, durch dessen zyklopisches Auge ich mich selbst im magischen Spiegel sehen und so meine Zukunft enthüllen kann?‹
›Ja.‹
Ich erschrak nicht mehr, und mein Fragestellen erforderte die größte Kaltblütigkeit.
Ich begann meine Kreise zu ziehen, um seinen Aufenthaltsort zu erfahren, und wenn man da nicht ganz genau vorgeht, aufs pedantischste, so gewöhnt man sich die Oberflächlichkeit an und vergisst Kreise, begeht die schwersten Fehler. Ich hab's erlebt, was für Umstände man dann hat, um wieder auf die rechte Spur zu kommen.
So lautete meine nächste Frage:
›Lebt der Zyklop auf dieser Erde?‹
›Nein.‹
›Was, nein?! Nicht auf dieser Erde?! Ja, wo denn sonst?! Lebt er in Europa?‹
›Nein.‹
Ich nannte die anderen vier Erdteile, und immer wurde verneint.
Jetzt wurde ich kopfscheu.
›Lebt der Mann wirklich?!‹
›Ja.‹
›Und er lebt nicht auf dieser Erde?‹
›Nein.‹
›Ich werde ihn dennoch später in meinen Spiegel blicken lassen?‹
›Ja.‹
›Ich werde ihn sehen?‹
›Ja.‹
›Ihn persönlich sprechen?‹
›Ja.‹
›Und er lebt gar nicht auf der Erde?‹
›Nein.‹
Nun begannen sich meine Gedanken zu verwirren. Aber ich verstand sie wieder zu ordnen.
Ich sage immer, dass meine Methode trügerisch sei. Ich könne mich in den Zukunftsberechnungen auch irren. Aber das sage ich nur, um Neugierige abzuhalten. In Wirklichkeit haben mich meine Berechnungen noch nie, noch nie getäuscht! Noch weniger haben sie mich je verhöhnt, geäfft.
Wenn ich es manchmal glaubte, so war es, wie ich schließlich stets erkennen musste, immer meine eigene Schuld, ich hatte falsche Fragen gestellt.
Wo lag hier nun gleich am Anfange der Fehler? Welchen größeren Kreis hatte ich zu ziehen vergessen, bevor ich den kleinen konstruierte?
Der Fehler musste unbedingt in der Frage liegen: Lebt er auf dieser Erde?
Aber wie sollte ich da anders fragen?
Ich wollte noch einmal jedes einzelne dieser fünf Worte erwägen und dabei immer noch größere Kreise ziehen.
›Lebt — — — ist das richtig?‹
›Ja.‹
›Er — — — richtig?‹
›Ja.‹
›Auf — — — richtig?‹
›Nein.‹
Hallo! Was für ein anderes Wort war denn da zu wählen?!
›In?‹
›Ja.‹
›Er lebt in dieser Erde?‹
›Ja.‹
›Unter der Erde?‹
›Ja.‹
Nun hatte ich es: Der Zyklop lebe unter der Erde! Es mag pedantisch klingen, aber das Schicksal oder eben meine Methode ist nun einmal so, und eben dadurch ist sie untrüglich.
Nun hätte ich ja eigentlich gleich eine Ahnung haben können, aber ich bin eben nicht sehr für Ahnungen. Glücklicherweise nicht, und ich musste unwillkürlich immer an einen mythischen Zyklopen denken, an ein riesenhaftes Ungeheuer. So kam ich eben nicht von selbst darauf.
Übrigens ging es dann schnell genug.
›Lebt er unter der Erde in Europa?‹
›Nein.‹
So machte ich die anderen Erdteile durch, bis mein Kreis Asien einschloss. Ich verengte die Kreise und kam nach Vorderindien, immer nördlicher hinauf, ins Himalajagebirge, rutschte zu weit hinauf nach Tibet, rutschte wieder herab, und — — — kam in meinen Mammutpark!
›Der Zyklop wohnt in meinem Mammutpark unter der Erde?!‹
›Ja.‹
›Immer?‹
›Nein.‹
›Gegenwärtig?‹
›Ja.‹
Nun freilich überkam mich die Gewissheit, nicht nur eine Ahnung.
›Gehört er zur Gesellschaft des Bunten Maulwurfs?‹
›Ja.‹
›Der Bunte Maulwurf hat sich bei mir im Mammutpark eingegraben?‹
›Ja.‹
So, nun wusste ich es.
Als ich aber nun, was doch am nächsten lag, Näheres über diesen Zyklopen erfahren wollte, wer seine Eltern seien, wann und wo er geboren war, da erlebte ich wieder einmal, dass mir das Schicksal die Auskunft verweigerte.
›Ich soll nichts weiter über ihn erfahren?‹, musste daher meine nächste Frage lauten.
›Ja nein‹, rechnete ich heraus, wie es manchmal geschieht, wenn meine Frage nicht ganz richtig gestellt war.
›Jetzt nicht?‹
›Nein.‹
›Später werde ich es erfahren?‹
›Ja.‹
Also ich werde es später erfahren?
Nur das hatte ich noch herausbekommen, schon vorher, dass der Bunte Maulwurf den Zyklopen vor zwei Jahren in einer unterirdischen Höhle gefunden hatte und ihn seitdem bei seinen Wühlereien beschäftigte. Als ich wegen seines Namens gefragt hatte, was durch Hersagen des Alphabets ja ganz einfach ist, war Polyphem herausgekommen. So hieß jener riesenhafte Zyklop, der sechs Gefährten des Odysseus verschlang, bis dieser ihm einen glühenden Pfahl ins Auge stieß.
Jedenfalls hat Kafka ihn erst so getauft. Ich vermute, dass seine Eltern dienende Skalden waren, welche das zyklopisch geborene Kind nicht anmeldeten, sich vor der Missgeburt entsetzten und ihrer schämten, dass sie das Kind versteckten, aber dafür sorgten, dass es am Leben blieb, es also nicht verhungern ließen. So wurde der Zyklop dann von Kafka gefunden.
›Ich werde den Zyklopen finden?‹
›Nein.‹
Diese Verneinung konnte mich nicht mehr bestürzt machen.
›Ich werde mich seiner nicht bemächtigen?‹
›Nein.‹
›Ein anderer?‹
›Nein.‹
›Ich werde dennoch den Zyklopen sehen?‹
›Ja.‹
›Mit ihm sprechen?‹
›Nein.‹
Was hätte wohl ein anderer zu alledem gesagt? Er hätte sich nichts zusammenreimen können, wäre ganz kopfscheu geworden.
Ich sollte ihn sehen, aber nicht mit ihm sprechen.
Nun, ich kenne meine Methode, die ich doch selbst erst erfunden habe.
›Ist der Zyklop stumm?‹
›Ja.‹
Aber auch ein anderer Widerspruch war erst noch zu ergründen.
›Ich selbst werde ihn nicht finden?‹
›Nein.‹
›Ein anderer?‹
›Nein.‹
›Stellt er sich mir freiwillig?‹
›Nein.‹
Ruft ihn ein anderer, dem er gehorchte?‹
›Ja.‹
Ich hätte raten können, es lag eigentlich auch ziemlich nahe, wer dieser andere sei, aber ich hätte doch falsch raten können, ich zog lieber meine Kreise und nach vieler Mühe kam ich zu dem Ergebnis:
Ich selbst würde mich des Zyklopen, der doch natürlich vor mir floh, nicht bemächtigen können, sondern sein Herr und Meister würde ihn herbeirufen.
Ich würde des Bunten Maulwurfs in meinem Mammutparke nicht habhaft. Es sollte ein Skalde sein, der sich im Hekla befand.
Hätte ich jetzt nicht geschickt genug gesagt, oder gar etwa geraten, so wäre ich nimmermehr auf den Betreffenden gekommen. Denn ich hatte keine Ahnung, dass Ingenieur Reinhard in Ophir erkrankt sei und sich bereits auf Island befand. Ich ging auch nicht etwa mit dem Gedanken um, ihn den Mammutpark vermessen zu lassen, denn ich glaubte, er sei mit seinen Arbeiten in Ophir noch längst nicht fertig, und wenn das geschehen war, wofür ich mindestens noch ein Vierteljahr ansetzte, so war es meine Absicht, ihn nach Südafrika zu schicken. Aber ich zog meine Kreise groß genug, und so rechnete ich trotz aller Umwege schnell genug den Ingenieur Reinhard heraus.
Durch eine telefonische Anfrage erfuhr ich nun zu meinem Staunen, dass Reinhard erkrankt sei und sich tatsächlich schon in dem Hekla befände!
Also mir selbst wird es nicht gelingen, des Bunten Maulwurfs habhaft zu werden. Ingenieur Reinhard wird ihn festnehmen.
Wann dies geschehen soll, darüber wurde mir die Auskunft verweigert. Jedenfalls aber geschieht es noch in diesem Monat, das konnte ich noch herausbringen. Dann wird Kafka den Zyklopen herbeirufen.
Polyphem ist taubstumm.
Hierbei ist schon wieder ein Widerspruch, wenn auch wohl nicht für jeden gleich erkenntlich.
Es ist eben ungeheuer verwickelt, wie das Schicksal befragt werden muss, um seine dunklen Wege zu ergründen, oder man wird fortwährend irregeführt.
›Kafka wird ihn rufen?‹
›Ja.‹
›Ich denke, Polyphem ist taub? Und der Bunte Maulwurf ruft ihn dennoch?‹
›Ja.‹
›Kann denn der Zyklop hören, wenn man mit ihm spricht? Und der Bunte Maulwurf ruft ihn wirklich?‹
›Ja.‹
›Mit seinem Namen?‹
›Nein.‹
›Mit Worten?‹
›Nein.‹
›Durch andere Töne?‹
›Ja.‹
Es genügte mir. Kafka kann sich mit dem taubstummen Zyklopen unterhalten, aber nicht durch eine Gebärdensprache. Näheres konnte ich nicht erfahren, obgleich das Schicksal zu antworten gewillt war. Ich konnte nur nicht geschickt genug fragen. Mir scheint, dass dieser einäugige Zyklop ein ganz besonderes Wahrnehmungsvermögen, einen besonderen Sinn besitzt. Ich denke mir, dass dabei Vibrationsschwingungen in Betracht kommen. Jedenfalls kann sich Kafka mit dem Taubstummen irgendwie verständigen.
Und jedenfalls, ohne allen Zweifel, werde ich durch dieses eine Auge des Zyklopen nun meine eigene Zukunft in dem magischen Spiegel schauen können, was mir bisher versagt wurde.
Zwar wurde es mir auf eine Anfrage nicht bestätigt, das Schicksal verweigerte die Antwort, aber ich zweifle nicht daran, jener Seher hat mich nie belogen.
Dann also wird mein ganzes Leben in eine neue Phase treten.«
Klingsor hatte sein Selbstgespräch beendet. Während dieser ganzen Zeit hatte er unausgesetzt auf das Lichtbild an der Wand geblickt. Eine Veränderung war dort nicht eingetreten.
Die Madonna saß an der Maschine und nähte, säumte eines der Wäschestücke nach dem anderen, das Kind schlief ruhig in seinem Bettchen.
Jetzt wieder ein Hebelgriff.
»Pauli!«
»Herr Klingsor?«
»Ich bin also heute Abend halb zehn nach Greenwicher Zeit auf meiner Londoner Station. Dass dort alles bereit ist!«
»Es wird alles bereit sein.«
»In meine Handtasche kommen noch zwei Pfund Tee zu anderthalb Schilling, ein Pfund Zucker und eine Halbpfunddose kondensierte Milch.«
»Sehr wohl! Es ist notiert. Das Pfund Tee zu neun Pence oder zu anderthalb Schilling?«
»Das Pfund zu anderthalb Schilling.«
»Es ist notiert.«
»Bester Würfelzucker. Die Sorte der Milch ist gleichgültig.«
»Sehr wohl.«
»Und dass Whiteboy nicht vergessen wird!«
»O nein!«
»Ich möchte ihn in einen besonderen kleinen Koffer verpackt haben, der Luftlöcher besitzt.«
»Es wird geschehen.«
»Also nicht etwa solch ein Patentkäfig, wie wir besitzen. Die Luftlöcher sollen zu sehen sein.«
»Ich verstehe schon.«
»Oder überhaupt kein Koffer, und nicht etwa aus Leder. Am besten ist ein einfacher Holzkasten, mit mehreren kleinen Löchern, bequem an einem Riemen zu tragen. Dass ja nichts auffällt!«
»Ich weiß schon, Herr Klingsor, worum es sich handelt, und ich werde alles besorgen.«
»Dann ist es gut. Ich weiß, Pauli, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Als Marat noch Ihre Stellung einnahm, hatte der mir einmal für solch einen Besuch ein elektrisches Toilettenecessaire eingepackt, durch das ich in die bösesten Verlegenheiten hätte kommen können. Ich wusste es noch zu vermeiden. So etwas kann bei Ihnen nicht vorkommen. Haben Sie eigentlich schon gesehen, wie Brazas den Whiteboy dressiert hat?«
»Jawohl, schon mehrmals. Ach, das ist ja köstlich!«, erklang es lachend aus dem Trichter. »Ich glaube übrigens, Brazas ist gerade dabei, ihn noch einmal vorzunehmen. Wollen Sie ihn nicht einmal sehen?«
»Ja, das können wir machen, zumal ich bei meiner Ankunft in London nicht mehr viel Zeit haben werde, mich mit dem Tiere zu beschäftigen, Brazas kann mich gleich etwas einweihen. Dass Whiteboy seine Kunststückchen auch auf Kommando eines jeden anderen macht, dafür wird er wohl gesorgt haben.«
»Brazas wird gleich in die Camera gehen.«
»Gut, stellen Sie an, wenn es so weit ist.«
Auf eine Hebeldrehung verschwand das Buildingzimmer von der Wand.
Auf der Leinwand erschien etwas anderes, erst mit undeutlichen Umrissen, Klingsor stellte schärfer ein, ein Zimmer zeigte sich, ein Tisch, daneben ein alter, sehr verwahrlost aussehender Kerl, offenbar ein Zigeuner, auf dem Tische ein Kasten, nicht viel größer als eine Zigarrenkiste.
»Ich sehe und höre Sie, Brazas, fangen Sie mal an!«

»Ich sehe und höre Sie, Brazas, fangen Sie mal an!«
Der Alte schien einmal Schausteller oder so etwas Ähnliches gewesen zu sein, war vor einem Publikum aufgetreten, danach benahm er sich, fand sich gleich in seine Rolle.
»Nun sieh einmal, mein Kind, was ich dir hier Schönes von der Reise mitgebracht habe.«
So sprechend öffnete der Mann den Deckel des Kastens, griff hinein und brachte einen kleinen, schneeweißen Pudel zum Vorschein, ein äußerst kleines Tier, etwa, wollen wir sagen, von der Größe eines mäßigen Kaninchens.
Diese abnorme Kleinheit selbst für einen Zwergpudel konnte nicht weiter auffallen, da es sich nur um ein lebloses Spielzeug handelte. Auf einem Brett, das dann meistenteils Rollen hat, war es nicht befestigt. Das Pudelchen, hübsch geschoren, hatte die Hinterbeine angezogen und die Vorderpfötchen, an denen sogenannte Manschetten stehen gelassen worden waren, in jener Haltung, als wolle es »bitte bitte« machen.
Es trug ein rotes Halsband, an diesem war die Leine befestigt, der man gleich ansehen konnte, dass es ein dünner Gummischlauch war, der in einem Gummiball endete.
Der Zigeuner hatte das Pudelchen nicht aufrecht hingesetzt, sondern es einfach auf den Tisch gelegt, und da blieb es eben so liegen, auf der Seite.
»Gefällt Dir das Pudelchen?«, fuhr der Zigeuner fort, zu einer imaginären Person, also zu einem Kinde, sprechend. »Es heißt Whiteboy. Nun wollen wir einmal sehen, was Whiteboy alles kann.«
Er nahm das Spielzeug wieder her, drehte es in seiner Hand mehrmals herum und setzte es schließlich in aufrechter Stellung hin.
»Sieh, mein liebes Kind, jetzt macht Whiteboy schön. Ob er wohl auch springen kann? Na da springe mal, Whiteboy — — eins, zwei, eins zwei...«
Bei jeder Zahl erfolgte ein sichtbarer Druck auf den Gummiball, und das Pudelchen begann in bekannter Weise zu hüpfen, die mit Gelenken versehenen Hinterbeine, innen hohl, wurden durch den Luftdruck in Bewegung gesetzt, sodass ein Springen oder Hüpfen herauskam, wie mit solchen pneumatisch betriebenen Figuren die deutsche Spielwarenindustrie heute alle Welt versorgt, bis ins innere Afrika hinein für die kleinen und großen schwarzen Kinder.
»Kannst du sonst noch etwas, Whiteboy? Kannst du auch tanzen?«
Ein stärkerer Druck auf den Gummiball, und das Pudelchen richtete sich höher auf den Hinterbeinen empor, begann im Kreise zu tanzen.
»Kannst du auch sprechen? Wie spricht Whiteboy?«
»Hau hau hau«, machte das Pudelchen, bei jedem Drucke auf den Gummiball sein Mäulchen öffnend und die rote Zunge zeigend.
Und so ging es weiter. Das Pudelchen sprang auch über den Stock und durch den Reifen, konnte auf den Vorderpfoten stehen und Salti mortales schlagen und machte noch viele andere Kunststückchen auf das Kommando seines Herrn.
Es war eben ein wirklicher, lebender Pudel, der abgerichtet war, eine tote Figur zu markieren, als Automat gewisse Bewegungen auszuführen.
Aber wirklich großartig war es, wie das Tierchen dies alles machte! Nicht nur ein Kind, auch jeder Erwachsene mit dem schärfsten Blick wäre getäuscht worden. Jeder hätte geschworen, es sei eine tote Puppe, die durch einen inneren Mechanismus, durch Luftdruck getrieben, so regiert wurde.
Das starre Auge, die ruckweisen Bewegungen, wie es plötzlich einmal umfiel und starr liegen blieb, in derselben Stellung, die es zuletzt eingenommen hatte — — — es konnte eben nur ein kunstvoller Automat sein.
Dazu kam nun noch, dass der Zigeuner seine Sache, dabei immer sprechend, ganz ausgezeichnet machte.
Für den, der das Geheimnis nun schon kannte, musste das nun freilich ganz anders wirken.
Klingsor musste manchmal aus vollem Halse lachen.
»Großartig, großartig!«, rief er ein übers andere Mal. »Brazas, das habt Ihr wirklich meisterhaft gemacht! Da würde auch ich drauf hereinfallen. Ja, gehorcht der Hund nun auch einem anderen, auch mir?«
Dem Pudel war seine automatische Starrheit erlassen worden, jetzt sprang er lustig, sich seiner Freiheit erfreuend, auf dem Tische herum.
»Ei freilich, er gehorcht jedem! Dafür habe ich natürlich gesorgt.«
»Worauf kommt es nun an? Wird er durch die Schnur oder gar wirklich durch Luftdruck regiert?«
Auch zum Teil mit. Die Hauptsache aber waren Stichworte, die der Pudel hören musste. Dies führte der Zigeuner des Weiteren aus, Klingsor notierte sich die Stichworte, begann sie schon auswendig zu lernen.
»Heute Abend gebe ich unter Eurer Leitung erst einmal eine Probevorstellung; so viel Zeit muss ich haben.«
In dem Lichtbilde tauchte neben dem Tische noch ein zweiter Mann auf, ein Herr mittleren Alters im schwarzen Gehrockanzug.
»Soll ich den Pudel noch einmal vornehmen, Herr Klingsor?«
»Es wäre wirklich nicht nötig, mein lieber Pauli. Ich glaube schon, dass er auch jedem anderen gehorcht.«
»Da fällt mir aber etwas anderes ein, Herr Klingsor. Gestatten Sie, dass ich Sie zur Vorsicht darauf aufmerksam mache.«
»Und das wäre? Sprechen Sie unverzagt.«
»Dieser Pudel ist doch ein sehr wertvolles Objekt. Wird es in dem Building der Nachbarschaft nicht auffallen, wenn der Mr. Steen, der sich sonst so einschränkt, seinem Kinde ein so teures Spielzeug mitbringt.«
»O, mein lieber Pauli. daran habe ich auch schon gedacht!«, entgegnete Klingsor lachend.
»Nein, nein, da seien Sie ohne Sorge, da weiß, ich schon eine plausible Ausrede. Erstens ist dieser Mr. Steen ein Mann, der ganz freiwillig solch ein bis an die Armut grenzendes Leben führt, zwar mit voller Absicht, aber doch ohne jeden Zwang, und am allerwenigsten aus Geiz, das weiß dort die ganze Nachbarschaft, und ebenso, dass er es sich sonst sehr wohl leisten kann, einmal einige Pfund auszugeben, um seiner Frau und seinem Kinde eine Freude zu machen — und zweitens kann man so etwas auch einmal ganz billig bekommen; der bisherige Besitzer hat den Wert des dressierten Zwergpudels nicht gekannt, oder ich kann ihn ja auch...«
Da wieder jener Glockenton; ohne Weiteres brach Klingsor die Unterhaltung ab und ließ das Lichtbild verschwinden; das Buildingzimmer erschien wieder an der Wand.
Erwartungsvoll blickte die Näherin, die jedenfalls ein »come in!« gerufen hatte, nach der Tür, die sich schon geöffnet hatte.
Eine alte Frau war eingetreten, die eine »Dame« vorstellen wollte, ohne es zu sein. Eine dürre Gestalt, elegant aufgedonnert, aber alles alt und schlumpig; dazu nun das Raubvogelgesicht mit den stechenden Augen, die in einem Nu das ganze Zimmer gemustert hatten — — eine höchst unsympathische Erscheinung. Wehe, wer die zur Nachbarin hatte! Ihren spähenden Geierblicken entging nichts, und ihre mit Neid und Scheelsucht vergiftete Zunge ruhte nimmer.
Die Madonna war von ihrer Nähmaschine aufgestanden.
»Sie wünschen?«, erklang es, sanft wie immer, aber doch auch kühl.
Die alte Dame hatte schon die Hände mit den an allen Fingern aufgeplatzten Glacés ausgestreckt, hatte die junge Frau wohl gar in die knöchernen Arme schließen wollen, und schien nun ob dieser kühlen Frage sehr erstaunt zu sein, wenn nicht gar beleidigt.
»Ja, Ange, kennst Du mich denn nicht mehr?! Oder Du bist wohl zu stolz geworden?«
»Ich kann mich wirklich nicht gleich erinnern...«
»Deine Tante, Deine Pate, die Dir zur Taufe das goldene Kreuz für acht Schilling six Pence schenkte...«
Da ging über das edle(1) Antlitz der Madonna ein Strahl der reinsten Freude. Wie es einem jeden beim Anblick auch der sonst unsympathischsten Person passieren kann, wenn sie nur irgendwie die Erinnerung an eine glückliche Zeit hervorruft, besonders, wenn es sich um die erste Jugend, um die Kinderzeit handelt, aus der man nur Angenehmes im Gedächtnis behält.
(1) Im Original heißt es völlig unpassend ›alte‹ statt ›edle‹. Es liegt offenbar ein Übertragungsfehler vor, der hier berichtigt worden ist.
»Ach, Mrs. Plumber — — die Tante Mary! — — Meine liebe Tante, wie mich das freut, Dich wiederzusehen!«
Und sie lagen einander in den Armen und küssten einander zahllose Male.
Darauf aber begann die Mrs. Plumber loszulegen, mit einem endlosen Wortschwall, aus dem man gleich erfuhr, dass Angela Wodford das einzige Kind eines Dorfschullehrers im Norden Englands gewesen war, nach dem Tode des Vaters, dem der der Mutter vorausgegangen war, sich kümmerlich durch Näherei hatte ernähren müssen, ein ganzes Jahr lang, nachdem die gute Tante, deren Verwandtschaft aber nur von den Urgroßeltern her stammte, sich schon mehr als zehn Jahre gar nicht um ihr Patchen gekümmert hatte. Natürlich ohne jede eigene Schuld. Ach, wo Mrs. Plumber vom Schicksal unterdessen überall herumgetrieben worden war! Und die zur Jungfrau erblühte Angela — oder Ange — war vor zwei Jahren durch eine »reiche Heirat« von ihrem traurigen Lose befreit worden.
Dies alles hatte man sich zusammenreimen können, wenn man dem furchtbaren Wortschwalle, bei dem es immer vom Hundertsten ins Tausendste ging, zu folgen verstand, und während dieses Redens stand die Mrs. Plumber vor dem Wandspiegel und nahm den pompösen Hut mit den ganz zerknickten Federn ab, ein sicheres Zeichen, dass sie sich für längere Zeit hier häuslich niederzulassen gedachte — wobei man außer zahllosen anderen wichtigen Sachen auch gleich erfuhr, dass dieser elegante, zerzauste Hut, der noch wie neu aussehen sollte, in einem Trödlerladen für zwei Schilling neun Pence erstanden worden war, wie Dame Plumber überhaupt alles zweiterhand kaufte, weil ihr Gatte, den sie glücklicherweise immer nur mit totgeborenen Kinderchen beschenkt hatte, alles ver — — trank. Unterdessen bereitete die Madonna den unvermeidlichen Tee in einem kleinen Gasofen, der sich über dem niedrigen Kamin in der Wand eingelassen befand, besetzte den Tisch mit Tassen, Brot, Butter und Marmelade sowie mit der in der wärmeren Jahreszeit ebenfalls unvermeidlichen Wasserkresse.
Mrs. Steen hatte nur selten einmal eine Frage zu stellen oder eine Einwendung zu machen.
»Wo wohnst Du denn jetzt, Tante?«
»Das weißt Du gar nicht?! In Richmond wohne ich. Seit drei Wochen. Mein Mann hat dort eine sehr schöne Stelle im Kaufhaus von Gardener als Portier bekommen. Ach, meine einzige Ange, wenn Du wüsstest, wie ich Dich während der ganzen zwölf Jahre gesucht habe! Wie eine Stecknadel! Wie ich immer an Dich dachte! Warum hast Du mir denn nur gar nicht geantwortet?«
»Du hast mir doch niemals geschrieben?!«
»Ich nicht?!! Fast jeden Tag einen Brief, manchmal gleich zweie!«
»Ich habe keinen einzigen bekommen.«
»Ja, so geht es! Die Post, die liederliche Post! Da erfahre ich gestern von der Mrs. Ulrik, dass Du in London wohnst! Und ich in Richmond! Ach, meine einzige Ange, das wird ja herrlich! Es sind ja nur ein paar Minuten Fahrt. Ich bin jeden Tag in London. Von früh bis abends. Mein Mann bekommt sein Essen im Geschäft. Und da lasse ich mich überhaupt nicht binden, ich gehöre zum Verein der aufgeklärten Frauen. Da besuche ich Dich jeden Tag. Und unserem Vereine trittst Du auch bei. Unser Lokal ist ›Der letzte Penny‹. Da verkehre ich überhaupt immer. Ein ausgezeichnetes Ale und Porter, immer frisch, schon früh um Acht. Ja, meine Ange, ich komme jeden Tag zu Dir, hole Dich ab, wir bummeln herum...«
»Dass Dich die Pest!!«, knurrte der Mann mit den glühenden Teufelsaugen auf seinem Beobachtungsposten. »Na warte, Dir will ich Deine Besuche bald verleiden!«
»Ach, Ange, mache Dir doch nicht so viele Umstände —«
»Du wirst doch etwas bei mir bleiben.«
»Ja, aber nicht länger als bis um elf — — —«
»Weiter fehlte doch nichts!«, knurrte es höhnisch wieder hier in der Camera obscura, im Geheimkabinett. »Na warte, Dich will ich ja bald hinausgeekelt haben, wenn ich auch tausend Meilen von Dir entfernt bin.«
»Um zehn kommt mein Mann«, warf die junge Frau ob solcher Aussicht etwas ängstlich ein.
»Ach, Dein Mann! Ich habe ja noch gar nicht nach ihm gefragt. Und Du hast ja auch ein Kind. Ich weiß alles. Ach, der herzige Junge, ganz Dein Ebenbild, und doch auch wieder der ganze Vater — — —«
Ihre rastlos umherwandernden Augen hatten ja schon längst das Kinderbettchen gesehen, sie hatte schon immer hingewollt, aber noch mit ihrem Hute und ihren Handschuhen zu tun gehabt.
Übrigens konnte sie das schlafende Kind gar nicht sehen. Die Mutter hatte über den Kopf des Knaben aus irgendeinem Grunde ein Gazegewebe gedeckt, wohl dünn und luftig und durchsichtig, aber doch das Gesicht verhüllend.
Ihren letzten Worten wollte sie die Tat folgen lassen. Aber daraus wurde nichts. Schnell vertrat die junge Mutter ihr den Weg.
»Bitte — Loke muss schlafen!«, sagte sie freundlich und doch ganz energisch.
»Ich will ihn mir nur einmal ansehen.«
»Er muss zugedeckt bleiben.«
»Warum denn?«
»Weil er sonst aufwacht.«
»Warum hast Du ihn denn zugedeckt?«
»Weil er sonst bei Tage nicht schläft — oder nur unruhig — er ist es so gewohnt.«
Immer gehässiger und boshafter begannen die Augen des Weibes zu funkeln.
»Ach, Dein Kind ist wohl verkrüppelt und hässlich?«, fragte sie.
Diese Niederträchtigkeit verfehlte bei der jungen Mutter ganz die Wirkung; sogar ein freudiges, glückliches Lächeln ging über die schönen Züge.
»Nein, es ist ganz wohlgebildet«, erklang es sanft und heiter.
Die Tante sah ihren niederträchtigen Angriff abgeschlagen und ließ sich am Teetisch nieder.
»Du sollst ja sehr, sehr glücklich sein in Deiner Ehe, meine liebe Ange.«
»Ja, ich bin sehr, sehr glücklich!«, erklang es schwärmerisch mit einem entsprechenden Augenaufschlage nach jenem männlichen Brustbilde.
»Wer ist denn dieser hässliche Mops dort oben?«
»Das ist mein Charly«, erklang es zärtlich.
»Was? Dein Mann?! O, hast Du einen schönen Mann!«
»Schön ist er gerade nicht«, wendete die junge Frau lächelnd ein.
»Der ist doch viel jünger als Du.«
»O nein, zwanzig Jahre älter.«
»Dein Mann ist wohl Maler?«
»Er malt nur zu seinem Vergnügen.«
»Alle die Bilder, die da an der Wand hängen, sind von ihm? O, kann der schön malen! Wer ist denn das Weibsbild, das er da immer gemalt hat?«
»Erkennst Du denn das nicht, liebe Tante?«, wurde heiter gefragt.
»Nein. Die sieht recht ordinär aus. Solche Bekanntschaften habe ich nicht.«
»Das bin ich doch immer selbst.«
»Was, das sollst Du selbst sein? Ach natürlich, natürlich, das ist doch meine schöne, holdselige Ange, die Madonna, wie Du schon als Kind immer genannt wurdest! Das ist doch die sprechendste Ähnlichkeit! Aber was für einen struppigen, hässlichen Bengel hast Du denn da immer bei Dir? Der hat ja schon das reine Verbrechergesicht!«
»Das ist mein Kind, mein kleiner Loke.«
»Ach, was Du nicht sagst! Nein, dieses reizende Kindchen! Diese holde Unschuld! — Übrigens Loke heißt Dein Kind? Was für ein heidnischer Name ist denn das?«
»Ein nordischer. Mein Mann ist Däne.«
»Er ist Versicherungsbeamter?«
»Ja, Inspektor bei einer Lebensversicherung.«
»Er soll doch ein so großes Gehalt haben — 500 Pfund im Jahre.«
»Das hat er.«
»Und da sperrt er Dich hier in so einem Building ein? Ihr habt noch dazu nur ein einziges Zimmer? Und Du trinkst solchen miserablen Tee, das Pfund zu einem Schilling oder gar nur zu neun Pence? Ach, geh doch, Ange — das mit den 500 Pfund machst Du einer anderen weis, mir nicht!«
Jetzt wurde das Madonnenantlitz doch wieder sehr reserviert.
»Wenn Du schon so viel weißt, hast Du vielleicht auch gehört, weshalb wir uns so einschränken.«
»Ja, ich habe etwas munkeln hören, aber glauben kann ich es nicht.«
»Der Vater meines Mannes starb mit Hinterlassung von sehr vielen Schulden — unglückliche Geschäftsspekulationen — mein Mann befriedigt diese Gläubiger.«
»Ach geh, Ange, das glaubt Dir doch kein Mensch!«, wurde höhnisch gelacht.
»Andere Menschen, die uns kennen, zweifeln nicht daran.«
»Und da wohnt ihr hier in solch einer Höhle, hungert und trinkt solchen Tee?!«
»Das ist keine Höhle, sondern ein Zimmer, in dem ich mich sehr behaglich fühle; wir hungern auch nicht, sondern leben recht gut, wie mein Pfund Wirtschaftsgeld auch gestattet.«
»Aber ein Pfund Wirtschaftsgeld bei 500 Pfund Einkommen!! Nein, nein — da steckt etwas dahinter, das lasse ich mir nicht ausreden.«
»Was soll dahinter stecken?«
»Wo der sein vieles Geld lässt.«
»Das zahlt er an den Gläubiger seines Vaters nach Kopenhagen ein.«
»Das glaubt doch kein Mensch! Der wird sich auf seinen Reisen schon zu amüsieren wissen. Das wird er Dir aber freilich nicht auf die Nase binden.«
Nun endlich schien es doch genug zu sein.
Das sanfte Madonnenantlitz erstarrte plötzlich.
Aber es sollte doch nicht zur Katastrophe kommen, die, wie man hoffte, mit einem Hinauswerfen geendet hätte.
Die schönen blauen Augen, die plötzlich so starr geworden, waren wiederum zu dem Männerbilde empor gewandert, und da wich die Starrheit, das Madonnenantlitz ward nur erst recht von heiterer Seligkeit verklärt.
»Nein, liebe Tante«, erklang es freundlicher denn je zuvor, »Du irrst — mein Charly ist mir treu und kann mich nie betrügen — oder es gibt überhaupt keine Treue und Ehrlichkeit mehr in dieser Welt.«
In dem engen Raume der Camera obscura erklang ein eigentümlicher Laut, fast wie ein Schluchzen.
»Habe Dank, Angela!«, wurde leise geflüstert.
Dann aber in einem ganz anderen Tone, fast stöhnend:
»O, Klingsor, was für ein Satan bist Du doch!!«
Dort drüben im tausend Meilen weit entfernten Londoner Building hatte der schwärmerische Gefühlsausbruch der jungen Frau bei der alten Tante keine Wirkung erzielt.
»Kannst Du Deinen Mann nicht einmal heimlich beobachten lassen?«
»Wie soll ich denn das anfangen?«, wurde ruhig gefragt.
»Nun, da gibt es doch solche Detektivinstitute, die das besorgen.«
»Du weißt wohl nicht, Tante, dass mein Mann hauptsächlich den europäischen Kontinent bereist, um zu kontrollieren, Frankreich und Deutschland und sogar bis tief nach Russland kommt er hinein.«
»Ja, siehst Du, das ist's ja gerade, weshalb er seine Heimlichkeiten so gut verbergen kann!«, erklang es triumphierend. »Bei welcher Lebensversicherung ist er denn angestellt?«
Es wurde eine der größten Englands genannt, die mit ihrem Betriebe eben die ganze Welt umspannt.
»So, die! Da werde ich mich einmal über Deinen Mann erkundigen. Du erlaubst es doch, meine liebe Ange? Ich bin so besorgt um mein liebes Patchen.«
»Immer zu!«, wurde wieder ganz heiter gelächelt. »Es dürfte Dir nur schwer fallen, da etwas über einen Charles oder richtiger Karl Steen zu erfahren.«
»Weshalb denn das?!«
»Diese Gesellschaft hat doch viele Tausende von Angestellten — —«
»O, die stehen doch alle in Listen.«
»Ja, aber den Namen meines Mannes wirst Du in keiner finden, weil er eben ein geheimer Inspektor ist, weil er hauptsächlich die anderen auswärtig beschäftigten Beamten inspiziert, deshalb führt er einen anderen Namen. Natürlich steht der auch in einer Liste, aber das ist ein Geheimbuch, nur den Direktoren zugänglich. Sonst hat mein Mann gar keinen Vorgesetzten. Er bekleidet einen Vertrauensposten. Nein, meine liebe Tante. da gib Dir keine Mühe, in dieses Geheimbuch bekommt Dein Freund keinen Einblick, und nach einem Charles oder Karl Steen wirst Du dort vergeblich fragen, diesem Namen kennt man gar nicht.«
»Was für einen anderen Namen hat er denn da?«
»Wie soll ich denn das wissen?«
»Das muss er Dir doch gesagt haben — seiner Frau!«
»Nein, liebe Tante, bei solchen Geschäftsgeheimnissen, die anderer Eigentum sind, hört die Vertraulichkeit auch zwischen Ehegatten auf. Er würde es mir nie sagen, und ich würde ihn auch nie fragen.«
»Siehst Du, siehst Du!!«, triumphte jetzt die gute Tante auf. »Da hat er es so leicht, Dich zu hintergehen! Aber lass mich nur machen, ich werde doch schon seinen Inspektornamen erfahren, und da wirst Du schon sehen, was da alles ans Tageslicht kommt, wenn er heimlich beobachtet wird, wo er sein vieles Geld lässt.«
»Ja, bitte, liebe Tante, bemühe Dich einmal«, wurde freundlich genickt, »ich bin selbst gespannt, was da herauskommen wird.«
Aber diese freundliche Zustimmung war das Letzte, was dieses Weib vertragen konnte!
Wieder irrten die grünen Augen umher, um ein neues Angriffsobjekt zu finden, das mit ihrem Gift bespritzt werden konnte. Sie erblickte die facettierte Glaskugel an der Decke.
»Was für ein Ding ist denn das dort oben?«
»Eine geschliffene Glaskugel.«
»Was soll die denn?«
»Ein hübscher Schmuck an der Decke, nichts weiter.«
»Woher hast Du denn die?«
»Mein Mann brachte sie schon aus seiner Junggesellenwohnung mit; er hat sie wohl einmal von einem Freunde geschenkt bekommen.«
Die Alte starrte immer zu der blitzenden Kugel empor, und mit einem Male nahm ihr hageres Raubvogelgesicht einen ganz anderen Ausdruck an, und so legte sie auch den dürren, schmutzigen Finger an die Nase.
»Herrgott, wie wird mir plötzlich... wo habe ich solch eine Glaskugel nur schon einmal gesehen? Erst neulich, gleich eine ganze Masse — in jedem Zimmer hing eine an der Decke — ach richtig — dass mir das aber erst jetzt einfällt! — Ich werde schon gedankenschwach... In Richmond — mein Cottage grenzt mit dem Hintergarten an den Park einer Villa, in der Mister Glane wohnt, ein Steuermann — der hat in jedem Zimmer so eine Glaskugel hängen...«
Der Lauscher mit den Teufelsaugen war zusammengezuckt.
»Himmel und Hölle!«, knirschte er. »Muss diese vermaledeite Schachtel mit dem Steuermann Glane benachbart sein und von der Einrichtung seiner Villa mehr wissen, als nötig ist!«
»So? Da hängen auch solche geschliffene Glaskugeln an der Decke?«, fragte die junge Frau mit aufrichtigem Interesse, vielleicht auch froh darüber, dass nun endlich das Gespräch auf ein anderes Thema kam.
»Ja, in jedem einzelnen Zimmer eine, und die Villa hat wenigstens acht Zimmer und noch einige Kammern dazu. Ich bin drin gewesen; ich machte die Bekanntschaft des Kindermädchens; sie nahm mich einmal mit hinein, als niemand zu Hause war; hinten im Garten lässt sich einer der Gitterstäbe verschieben, da bin ich durchgekrochen, ich habe die ganze Villa besichtigt...«
»Warte, Du ungetreue Bessy, diesen Vertrauensbruch sollst Du büßen!«, knirschte es in der Camera.
»Es sind genau solche Glaskugeln?«, fragte die Madonna interessiert.
»Ganz genau solche.«
»Da scheint das ein Zimmerschmuck zu sein, der ganz allgemein ist, wovon wir sonst nur nichts wissen. Oder er ist erst seit kurzer Zeit in Mode gekommen.«
»Soooo, meinst Du?«, erklang es in unendlichem Hohne. »Ahnst Du denn noch nichts, meine arme Ange?«
»Was soll ich denn nur schon ahnen, Tante?«
»Warte mal, Ange... lass mich nachdenken damit ich meiner Sache ganz, ganz sicher bin... und ja niemand Unrecht zufüge... ihn auch nur in einen falschen Verdacht bringe... das ist das Allerletzte, was ich tue, da kennst Du mich doch. Also, sage mal, Ange... wie oft kommt denn Dein Mann nach Hause? Wie lange ist er denn immer fort?«
Die junge Frau verbannte ihre aufsteigende Ängstlichkeit, raffte sich zusammen, um mit kühler Ruhe Rede und Antwort zu stehen.
»Das ist ganz verschieden. Manchmal vergehen nur wenige Tage, manchmal auch vierzehn. Ein einziges Mal in den zwei Jahren ist er sechs Wochen ausgeblieben. Da war er in Russland gewesen.«
»Genau wie Mister Glane!«, wurde triumphiert. »Und wie lange bleibt er denn da immer zu Hause?«
»Einen Tag oder zwei Tage, selten länger, dann muss er wieder fort. Manchmal kann er auch nur für wenige Stunden bei mir weilen.«
»Genau wie Mister Glane!!«, erklang es in immer größerem Triumphe.
»Ja, solche Berufe mag es viele geben«, meinte Mrs. Steen. »Er ist doch ein Seemann, sagtest Du, nicht wahr?«
»Ein Steuermann, fährt als erster Offizier, und zwar nur als wilder... weißt Du, was das ist, ein wilder Kapitän oder Offizier?«
»Nein.«
»Ja, siehst Du, das ist es eben, Du Unschuld, deshalb geht Dir auch noch keine Ahnung auf, wie das hier alles zusammentrifft.
Die Schiffsbesatzung muss doch für jede Fahrt regelrecht auf dem Seemannsamt angemustert werden, und das wird sehr streng genommen. Nun kommt es doch aber häufig vor, dass kurz vor der Abfahrt Leute fehlen, sie sind mit dem Vorschuss ausgekniffen, oder sie sind plötzlich krank geworden. Na, bei den Matrosen und Heizern kommt das gar nicht so genau darauf an, da finden sich immer genug andere, und können sie nicht mehr angemustert werden, so gehen sie eben einstweilen als Arbeiter mit.
Anders aber steht es bei den Kapitänen und Offizieren. Die sind für alles verantwortlich. Die müssen unbedingt auf dem Seemannsamt in die Schiffsliste eingetragen werden, sonst dürfen sie kein Schiff führen.
Nun kann aber doch einmal im letzten Augenblick so ein Offizier krank werden — oder gar der Kapitän. Da ist also doch wieder eine Ausnahme zulässig; da gibt es nun besondere Patente für Offiziere und Kapitäne. Das sind die sogenannten Wilden. Die brauchen nicht unbedingt angemustert zu werden. Die springen im letzten Augenblick ein. Dafür werden sie natürlich viel höher bezahlt als die übrigen. Und da haben sie auch eine ganz andere Lebensweise. Die laufen nicht auf den Reedereien umher, um sich eine neue Stelle zu suchen, sondern bleiben ruhig zu Hause und warten, bis sie geholt werden. Oder sie haben ihre Telegrammadresse.
Verstehst Du nun die Ähnlichkeit zwischen Deinem Mann und dem Mister Glane?«
»Nein, ganz und gar nicht«, erwiderte die junge Frau mit aufrichtiger Verwunderung den Kopf schüttelnd.
»Aber, Kind, das ist doch so einfach! Dein Mann, der Mister Steen, ist ein geheimer Versicherungsinspektor, der immer in der Welt herumreist, und niemand weiß, wo er sich befindet. Er meldet sich nicht an und nicht ab, oder er tut es unter einem falschen Namen — er kann nicht kontrolliert werden, man kann ihm nicht schreiben, nicht telegrafieren — gar nichts. Und genau so ist es auch bei dem Mister Glane. Der erhielt plötzlich ein Telegramm, er soll da und da hin kommen, und da wird niemals ein Schiffsname genannt, das ist dabei so üblich. Er geht mit seinen Koffern ab und sofort an Bord — wenn er die Aushilfsstelle annimmt, wozu er nicht verpflichtet ist. Jedenfalls aber erfährt seine Frau niemals, wohin er eigentlich reist, weil er auf dem Seemannsamte nicht angemustert wird! Sie kann ihm auch nicht schreiben, und dann kann er ja seiner Frau vorschwatzen, was er will, sie wird es ihm glauben. Weitere Fahrten als bis nach Nordamerika nimmt er nicht an, da ist er auch spätestens in sechs Wochen immer wieder zurück. Meist aber fährt er nur nach europäischen Häfen; sehr oft nach Petersburg. Na, Ange, geht Dir nun endlich ein Licht auf?«
»Ich weiß nicht, was Du eigentlich willst, was Du mit diesem Mister Glane hast«, lautete die Entgegnung.
»Dann muss ich deutlicher werden. Kann Dein Mann zaubern?«
»Ob er was kann?«, fragte die junge Frau mit wachsendem Staunen.
»Ob er zaubern kann? Ob er Zauberei treibt?«
»Was verstehst Du denn unter Zauberei?«
»Nun... Hexenkünste aller Art, dass er ein Ding in ein anderes verwandelt, aus einem Korbe alles nur Denkbare hervorholt, was gar nicht hineingeht, dass er sich selber in andere Gestalten verwandelt, Geister erscheinen lassen kann...«
»Wie man es manchmal in Theatern zu sehen bekommt?«
»Nein, ganz echte Hexerei, wie bei einem, der sich dem Teufel verschrieben hat, so dass er übernatürliche Kräfte besitzt.«
»Ja, Tante, glaubst Du denn, dass es so etwas wirklich gibt?!«
»Du etwa nicht?«
»Nein, niemals!«
»Dann weißt Du es besser als Moses«, erklang es spitz.
»Als Moses?«
»Lies nur einmal das sechste und siebente Buch Moses, ich habe es zu Hause, kann es Dir borgen...«
»Ach, um Gottes willen nicht!«, rief die junge Frau, die nun wusste, was gemeint war, erschrocken, ging dann aber doch noch näher darauf ein. »Also Du hast dieses Zauberbuch, das manchmal in den Zeitungen annonciert wird?«
»Jawohl, das habe ich.«
»Und da steht drin, wie man zaubern kann?«
»Alles ganz genau beschrieben.«
»Ja, Tante, dann musst Du doch auch zaubern können!«, fing die junge Frau jetzt amüsant zu lachen an.
»Nein, ich kann es nicht.«
»Warum denn nicht?«
»Da muss man erst den Schlüssel haben.«
»Wie bekommt man den?«
»Man muss sich dem Teufel verschreiben.«
»Wie macht man das?«
»Das steht auch in dem Buche ganz genau beschrieben.«
»Hast Du denn das nicht getan?«
»Der Herr behüte mich, dass ich meine Seele dem Teufel verschreibe und meine ewige Seligkeit verliere!«, rief die Alte, ihre Hand auf den Busen legend.
Selbstverständlich hätte sie gern ihre Seligkeit geopfert, um zaubern zu können; wer weiß, wie oft sie es probiert hatte, aber der Teufel war eben nicht gekommen, und da nützten auch alle die anderen Rezepte nichts.
»Also Du meinst, jener Mister Glane kann zaubern?«, forschte Mrs. Steen nun interessiert weiter.
»Jawohl, der kann es, sogar Geister beschwören.«
»Woher weißt Du denn das? Hast Du es selbst gesehen?«
»Ich nicht, aber die Bessy, das Kindermädchen, die hat es einmal gesehen.«
»Was denn? Erzähle doch!«
»Wie der Mister Glane einmal mit seiner Frau zusammen gewesen ist, haben die beiden von indischer Zauberei gesprochen, und da hat der Steuermann gesagt, er wäre früher lange in Indien gewesen und hätte Unterricht bei so einem Zauberkünstler genommen, wofür er schrecklich viel hätte bezahlen und natürlich auch seine Seele dem Teufel verschreiben müssen, den er aber dann betrogen hätte, sodass seine Seligkeit nun wieder gerettet sei.
Aber solche Zauberkunststückchen verstände er noch immer, und das nächste Mal, wenn er wiederkäme, wollte er einmal etwas mitbringen.
Das hatte die Bessy hinter der Tür gehört, und wie nun ihr Herr in vierzehn Tagen wiederkam, hatte sie zuvor oben in die Tür ein kleines Löchlein gebohrt, durch das sie das ganze Zimmer überschauen konnte. Denn mit dem Schlüsselloch ist es immer eine halbe Sache. Wenn da die Klappe herunter ist oder der Schlüssel gerade schlecht steckt, kann man doch niemals etwas sehen.
Richtig, Mister Glane zeigte seiner Frau ein ganz eigentümliches Fläschchen und sagte, dass darin ein Geist oder gar der Teufel eingeschlossen sei, dem er zu befehlen habe.
Das Zimmer, das Mister Glane schon vorher zu der Vorstellung bestimmt hatte, denn sonst hätte Bessy ja nicht gewusst, welche Tür sie anbohren sollte, wurde ganz verfinstert, auch kein Licht angesteckt; plötzlich aber begann die große Glaskugel an der Decke ganz wunderbar zu glühen, ein grünes, geradezu höllisches Licht verbreitend.
Und nun begann der Hexenmeister seine Vorstellung. Bessy hat es mir ganz ausführlich beschrieben, ich aber will hier nichts weiter erwähnen, als dass er die Flasche entkorkte, und da spritzte ein Feuerregen heraus, dem eine weiße Rauchwolke folgte, und diese nahm die Gestalt eines riesenhaften Geistes an, der sich vor dem Steuermann verbeugte, dieser befahl ihm, sich in einen richtigen Menschen zu verwandeln, und das geschah. Die nebelhafte Gestalt verwandelte sich in einen beturbanten Türken, der eine große, schwarze Katze auf dem Arm hatte.
Mehr sah Bessy nicht. Sie war vor Schreck in Ohnmacht gefallen. Als sie wieder zu sich kam, war alles vorüber, Mister Glane zog gerade wieder die Fenstergardinen auf.
Siehst Du, das hat die Bessy selber gesehen, sie hat es mir beschworen. Mister Glane steht mit dem Teufel im Bunde.«
»Oho, oho!«, wurde in der Camera obscura belustigt aber doch auch etwas ärgerlich gelacht. »Diese Mistress Plumber und ebenso das Kindermädchen besitzen ja eine ganz außerordentlich lebhafte Phantasie! Etwas Wahres ist ja daran, das stimmt allerdings, also ist es auch Tatsache, dass das Kindermädchen heimlich gelauscht hat. Mister Glane erzählte seiner Frau, dass er früher lange Zeit in Indien gewesen sei und sich viel mit den Gaukeleien der Fakire beschäftigt habe, dass er selbst eine sogenannte Matavaflasche besitze, die wolle er das nächste Mal mitbringen und ihr Kunststückchen vorführen. Das hat er getan, und Margot ist die Frau, die so etwas versteht, sich nicht gleich ins Bockshorn jagen lässt. Aber was nun diese Mrs. Plumber daraus macht, das ist alles reine Phantasie. Die Rauchwolken haben sich zu keinem Türken und überhaupt zu keinem menschenähnlichen Wesen verdichtet. Es war nichts weiter als ein besonderer, gewissermaßen fester Rauch, den man durch Blasen und auch durch Berühren lenken kann. Aber wie kommt sie auf die schwarze Katze? Nun, das ist eben auch wieder ein Gebilde ihrer Phantasie, weil dieses Tier nun einmal das Attribut des Teufels ist. Wie aber wird nun Angela dieses Märlein auffassen, sie, die gebildete Lehrerstochter, von deren aufgeklärtem Geiste ich schon wiederholt Beweise bekommen habe?«
Die junge, madonnenhafte Frau in dem Lichtbilde lachte ebenfalls herzlich.
»Tante, das glaubst Du wohl selber nicht, was Du da erzählt hast!«
»Was? Glaubst Du, ich lüge?!«, fuhr die alte Dame wild auf.
»Nein, Du nicht — aber das Kindermädchen hat Dir etwas vorgelogen.«
»Bessy lügt nie, niemals!! Das weiß ich ganz bestimmt!«
»Ich will Dir sagen, weshalb dies alles ganz unmöglich ist.«
»Nun?«
»Wenn das Kindermädchen wirklich so etwas gesehen hätte, dann würde sie es doch nicht nur Dir erzählen, sondern noch vielen anderen, dann wüsste es auch die ganze Nachbarschaft.«
»Nein, das Mädchen ist sonst verschwiegen wie das Grab; nur mir hat sie sich anvertraut, mir allein!«
Dem wollte die junge Frau lieber nicht widersprechen, sie wusste indes noch einen anderen Grund anzuführen.
»Wenn das Kindermädchen wirklich so etwas erlebt hätte, so würde es doch nicht mehr in diesem Hause bleiben.«
»Das wollte sie auch nicht; sie wollte gleich fort. Da aber lernte sie mich kennen, vertraute sich mir an, und ich habe ihr geraten, noch zu bleiben und weiter zu beobachten, und das tat sie nun auch.«
»Ja, Tante, weshalb erzählst Du mir das nun eigentlich alles? Was wolltest Du denn nur vorhin immer mit der Ähnlichkeit zwischen diesem Mr. Glane und meinem Manne?«
Die Alte setzte wieder ihre triumphierendhöhnische Miene auf.
»Also Du ahnst wirklich noch gar nichts?«
»Nein.«
»Erinnere Dich, dass auch Mr. Glane in jedem Zimmer seines Hauses solch eine große Glaskugel mit tausend Kanten an der Decke hängen hat, wie die Glaskugel im Finstern plötzlich zu leuchten begann.«
»Das tut diese hier niemals.«
»Weil Dir Dein Mann noch nichts vorgezaubert hat. Weil er Dir überhaupt verheimlicht, dass er sich dem Teufel verschrieben hat.«
»Dann wird er es mir wohl stets verheimlichen.«
»Ach, Du Unglückliche, dass Du noch so sorglos sprechen kannst! Und ich sage Dir: Alle diese Männer, die sich dem Teufel verschrieben haben, um zaubern zu können, dürfen niemals nur eine einzige Frau haben, sondern sie müssen viele Wohnungen haben, in jeder eine Frau und Kinder. So besuchen sie immer eine Familie nach der anderen, und jede Frau glaubt, sie sei seine einzige. So täuscht er sie alle, alle. Das ist das Opfer, welches er dem Teufel täglich schuldet. So betet er ihn an, und um das fertig bringen zu können, mehrere Frauen in verschiedenen Wohnungen zu haben, ohne dass es auffällt, müssen sie einen Beruf haben, bei dem sie immer auf Reisen sind, ohne dass sie dabei kontrolliert werden können. Na, Ange, steigt Dir nun endlich eine Ahnung auf, was für eine Bewandtnis es mit Deinem Manne haben dürfte?«
Jetzt glaubte die Alte, ihren letzten Trumpf ausgespielt zu haben, und jetzt waren die Züge der schönen, jungen Frau auch plötzlich wieder erstarrt.
»Du meinst doch nicht etwa, dass mein Mann in Doppelehe leben könnte?«
»Jawohl, das meine ich, und wenn man alles richtig bedenkt...«
Da kam es zur Katastrophe. Aber sicher in anderer Weise, als die Tante und vielleicht auch der Lauscher es vermutet hätten.
Die junge Frau hatte sich erhoben.
»Verlassen Sie das Zimmer!«, erklang es kalt in schneidendem Tone.
Die Alte stutzte. Das hatte sie eben nicht erwartet.
»Ange, ich will Dir doch nicht...«
»Verlassen Sie meine Wohnung! Hinaus mit Ihnen oder ich rufe die Polizei!!!«
Da sah die alte Dame, dass mit der Nichte nicht zu spaßen war, und diesem Befehle musste sie unbedingt sofort nachkommen. In England ist Hausfriedensbruch eins der schwersten Verbrechen.
»Hinaus mit Ihnen!!«, erklang es noch einmal in demselben Tone, und da hatte Mrs. Steen schon die Tür geöffnet und deutete mit der Hand auf den Korridor.

Mrs. Plumber griff nach ihrem Hute und gehorchte, allerdings nicht stillschweigend, sondern unter einer Flut von Schimpfworten
Das Lichtbild zeigte wieder das geschlossene Zimmer, die Madonna befand sich allein.
Von einer Erregung war ihr nichts anzumerken. Aber ihr holdseliges Antlitz strahlte in ganz besonderer Weise, sie kniete vor dem Männerantlitz nieder, das ihren Gatten darstellte, hob zu ihm die gefalteten Hände empor.
»Mein Charly, Vater meines Kindes — Du guter, edler, reiner Mann, den mir der Himmel als Engel gesandt hat — wie könntest Du....«
Mit einem auffallend hastigen Griffe hatte Klingsor einen Hebel gedreht, und das sprechende Lichtbild war von der Wand verschwunden.
»Nur das nicht — dass sie mich gar als einen himmlischen Engel anbetet! Das kann ich nicht vertragen!«
Er kreuzte die Arme über der Brust und blickte längere Zeit sinnend vor sich hin, ehe er in seinem Selbstgespräch fortfuhr.
»Hm. Diese vermaledeite Schachtel ist durch einen Zufall auf eine Spur gekommen. Zum ersten Male passiert mir so etwas, dass meine Geheimnisse in Gefahr geraten, entdeckt zu werden.
Aber die Sache ist gar nicht so schlimm.
Der unglückliche Zufall besteht nur darin, dass sie gerade die Nachbarin des Steuermanns Glane sein muss und durch den Treubruch der pflichtvergessenen Bessy in sein Haus gelangt ist, dass sie da solche Facettenkugeln an der Decke hat hängen sehen.
Dadurch fand sie einen Anhalt, um ihr geiferndes Gift gegen die junge Frau zu verspritzen, wozu noch kommt, dass ihr Kopf mit solch lächerlichem Aberglauben angefüllt ist.
Erst glaubte ich schon, sie wolle auch damit anfangen, dass der Steuermann Glane und der Versicherungsinspektor ein und dieselbe Person wären, was freilich nur auf ungeheuerlicher Phantasie hätte beruhen können, denn zwischen dem blonden Steen und dem schwarzbärtigen Glane ist ja auch nicht die geringste Ähnlichkeit vorhanden.
Dies hat sie allerdings nicht ausgesprochen.
Sie hätte auch von einer Ähnlichkeit zwischen den beiden Kindern sprechen können, hat es aber nicht getan.
Eine solche Vermutung, die der Tatsache nahe käme, ist ihr also gar nicht aufgetaucht.
Sie hat eben nur irgendeinen Verdacht erregen wollen, um ihr Gift verspritzen zu können, nichts weiter.
Also die Sache steht durchaus nicht schlimm.
Und selbst wenn sie viel schlimmer stünde, wenn sie die Wahrheit erraten und Angela veranlassen sollte, Nachforschungen deswegen anzustellen — wohl, so entständen daraus Schwierigkeiten, die mir nur höchst willkommen wären, denn was gibt es angenehmeres im Leben, als die verwickeltesten Hindernisse zu überwinden.
Aber dafür, dass diese Mrs. Plumber nicht nochmals in das Nachbarhaus dringen und die Bessy nicht noch einmal solch einen Vertrauensbruch begehen kann, werde ich doch lieber sofort sorgen.«
Während dieser letzten Worte spielten seine Finger schon wieder auf der Tastatur, und wenn sie einmal innehielten, tickte das Rädchen und schrieb Zeichen auf den laufenden Papierstreifen.
Nach kurzer Zeit war dieses schriftliche Gespräch, das diesmal durch kein mündliches unterbrochen worden war, beendet.
»So! Mein Besuch heute Abend in London wird doch stattfinden, und ich werde gegen alle Möglichkeiten gewappnet sein.«
Er blickte nach einer der Uhren.
»Jetzt ist die Zeit gekommen.«
Er bewegte Hebelgriffe, und an der weißen Leinwand erschien wieder die plastische Wüstenlandschaft mit der patronenartigen Kugel, die Spitze nach oben gekehrt.
Obgleich sie gar nicht sehr hoch über dem Boden in der Luft zu schweben schien, war es doch noch immer unmöglich, ihre Größe zu bestimmen, weil in dieser Wüste alles fehlte, was man zu einem Vergleiche hätte heranziehen können.
Und nun spielten sich unter den Hebelgriffen und Räderdrehungen, welche der Mann hier in der Camera obscura ausführte, die seltsamsten Vorgänge ab.
Das erste war, dass an der runden Kugel unten plötzlich eine ebene Fläche entstand. Es war nicht anders, als wenn sie ein Gummiball wäre, der sich eindrücken ließ oder als hätte man diesen Gummiball kräftig auf eine Tischplatte gesetzt.
So ließ sich die jetzt unten flach gewordene Kugel herab, gerade dorthin, wo in dem gelben Sande der rote Punkt noch immer glühte, setzte sich mit der Fläche gerade auf diesen drauf.
Obgleich es sich nur um eine flüchtige Berührung handelte, sah man doch deutlich, wie sich die abgeflachte Kugel tief in den Sand eindrückte. Im nächsten Augenblick hob sie sich schon wieder, und da zeigte sich, dass dort in dem Sande eine viereckige Vertiefung entstanden war, einfach dadurch, weil eine beträchtliche Menge Sand jetzt unten an der Abplattung der Kugel hing.
Mit dieser Sandlast ging die Kugel, sich nicht sehr hoch über den Boden erhebend, etwas seitwärts, blieb stehen, und da fiel der Sand von der Fläche herab, am Boden einen kleinen Haufen bildend.
Nun ging die Kugel wieder zurück, senkte sich, drückte sich abermals dort in den Boden ein, wo der rote Punkt noch immer glühte, jetzt aber schon in einer Vertiefung, ging wiederum mit einer bedeutenden Sandlast in die Höhe, um diese seitwärts fallen zu lassen.
Und so wiederholte ich dieses Spiel noch einige Male.
Also die Kugel arbeitete als Sandbagger, schaufelte selbsttätig ein Loch aus, dabei sicher als Magnet wirkend, den Sand durch magnetische Kraft anziehend und festhaltend, um ihn seitwärts wieder fallen zu lassen.
An diesem Vorgange war im Grunde genommen gar nichts so sehr Überraschendes, mindestens nichts Unerklärliches.
In allen größeren Eisenwerken und Hafenstädten sind jetzt solche magnetische Kräne vorhanden.
Man wendet sie an, wenn große Eisenmassen, die aus vielen kleinen Eisenstücken bestehen, unsortiert ein- und ausgeladen werden sollen, also etwa Alteisen, das wieder eingeschmolzen werden soll.
Wozu da sich erst die Mühe machen, alle diese einzelnen Eisenstücke mit den Händen anzufassen und in die Wagen zu werfen oder sie gar erst in Kisten einzuladen, um sie dann in den Wagen oder ins Schiff zu transportieren, respektive so auszuladen? Das ist doch äußerst zeitraubend und anstrengend.
Da benutzt man heute die Kraft des Elektromagnetismus. An dem Kran hängt ein starker Magnet — oder vielmehr ein »Anker«, ein Stück Eisen von geeigneter Form, das an sich kein Magnet ist, sondern erst durch Elektrizität zeitweilig dazu gemacht wird.
Dieser Anker zieht von dem eisernen Gerümpel so viel an, wie er tragen kann, der Kran wird herumgeschwenkt, negativer Strom wird eingeschaltet, und der Magnet lässt das alte Eisen dort hineinfallen, wohin es kommen soll.
Genau so arbeitete hier diese Kugel, nur dass sie als Magnet nicht erst an einem Krane hing, sondern frei in der Luft hin und her fuhr, und dass sie nicht Eisen, sondern Sand anzog, festhielt und wieder fallen ließ.
Sand? Kann denn ein Magnet auch Sand anziehen?
Gewiss, das ist recht wohl möglich.
Man darf dabei nur nicht immer an einen eisernen Hufeisenmagneten denken, der nur Eisen und Stahl anzieht.
Was übrigens auch wieder nicht stimmt.
Der Eisenmagnet zieht nämlich auch reines Nickel, Kobalt, Chrom und noch viele andere Metalle an, deren Zahl sich nach Forschung noch ständig vermehrt.
Da sieht man also schon, dass der einst aufgestellte Lehrsatz »Gleiches kann nur Gleiches anziehen« schon längst hinfällig geworden ist.
Und wenn man eine Siegellackstange oder einen Gummifederhalter mit einem seidenen Lappen reibt, werden da nicht auch Holzspänchen und Papierschnitzelchen angezogen?
Oder man erzeuge eine Seifenblase, und sie wird gehorsam dem geriebenen Stabe aus Siegellack, Gummi oder Glas nachschweben. Setzt man der Seifenlösung etwas Leim zu, so kann man auch eine bleibende Seifenblase schaffen, man kann sie sogar bronzieren, und die goldene Kugel rollt auf dem Tische dem Stäbchen nach.
Wir sind noch nicht so weit, aber ganz sicher wird noch ein Universalmagnet erfunden, der überhaupt jede Substanz anzieht, und wird das mit Elektromagnetismus betrieben, so dürfte die Fähigkeit, einmal diese, einmal jene Substanz anzuziehen, auch nach Willkür geregelt werden können — — —
Wieder hatte die Kugel eine Sandlast beiseite geschafft, wohl zum sechsten Male, kehrte jetzt nicht mehr nach der immer tiefer gewordenen Grube zurück, die sie geschaffen, sondern ließ sich neben dem von ihr aufgehäuften Hügel, dessen Größe man auf diesem Lichtbilde ebenfalls nicht bestimmen konnte, am Boden nieder, und zwar ohne sich jetzt tiefer einzudrücken.
Man musste annehmen, dass dies alles in dieser Camera obscura durch Hebelgriffe und Räderdrehungen dirigiert worden war.
Jetzt zog Klingsor aus der Westentasche die an der schwarzen Schnur befindliche silberne Uhr hervor, von deren Schlichtheit schon einmal gesprochen worden ist.
Es war eben eine ganz einfache, silberne, mittelstarke Uhr, ohne besonderen Deckel, um das Glas zu schützen, nicht einmal mit Sekundenzeiger versehen.
Aber gleich zeigte sich, dass es doch nicht nur eine so einfache Uhr war.
Ein Druck oben auf den Knopf, mit dem man sie durch Drehen auch aufziehen konnte, und der hintere Deckel sprang auf.
Er hatte noch nicht das Werk verhüllt, sondern über diesem war, wie ja überhaupt gewöhnlich, noch immer ein Deckel.
Auf dieser Schutzhülle nun, zwar von weißer Farbe, aber sehr fraglich, ob von Silber — eher musste man an einen weißen Papierüberzug denken — war mit bunten Farben eine Erdkarte gezeichnet. Groß konnte diese natürlich nicht sein, und da sie mit einer kreisrunden Umgrenzung versehen war, überhaupt von ganz besonderen, verzerrten Dimensionen. Jedenfalls aber waren bei aller Kleinheit die beiden Hemisphären mit allen Ländern und Meeren vom Nordpol bis zum Südpol darauf vertreten.
Wieder ein Druck oben auf den Knopf, und auch dieser Landkartendeckel sprang auf, und noch immer wollte das Uhrwerk nicht zum Vorschein kommen.
Dieser neue Untergrund war von roter Farbe, darauf eine silberne, geometrische Figur, bestehend aus ineinanderlaufenden Ringen und Dreiecken.
Klingsor betrachtete die Figur nicht lange, so wenig wie die Erdkarte, sondern drückte zum vierten Male oben auf den Knopf — der vierte Deckel sprang auf, und jetzt zeigte sich ein weißes Feld, das mit stenografischen Schriftzeichen in schwarzer Farbe bedeckt war, allerdings von besonderer Kleinheit, aber doch noch deutlich mit bloßen Augen erkennbar.
Und immer noch nicht genug! Auch dies war nur ein Verschlussdeckel gewesen, der noch aufspringen konnte.
Dabei war ja die Uhr eher flach als dick zu nennen.
So mussten alle diese Deckel natürlich von ungemeiner Dünne sein, nur wie von Papier, und dennoch schienen sie sich durchaus nicht zu biegen.
Der sechste Untergrund zeigte sich ganz weiß.
Klingsor selbst schien etwas ungeduldig geworden zu sein, so schnell er auch die Deckel hintereinander hatte aufspringen lassen.
»Na endlich!«, murmelte er. »So vollkommen diese Uhr, die wohl mit Recht den Namen einer Universaluhr verdient, auch ist, ein Wunder der Feinmechanik, so hat sie doch immer noch den großen Nachteil, dass man erst nachsehen muss, bis man unter den zehn Deckeln den richtigen gefunden hat, den man gerade gebrauchen will, um ihn zur Benutzung nach oben zu verstellen.
Zwar versichert mir Cyrill, dass er auch noch bewerkstelligen kann, dass der gewünschte Deckel sofort oben unter die Schutzhülle zu liegen kommt, aber da müsste ich ihm die Uhr wenigstens vier Wochen lang anvertrauen, und so lange kann ich sie nicht entbehren.
Der arme Cyrill! Ich kann ihn nicht zum Meister vorschlagen, weil dadurch mein Geheimnis allgemeines Skaldeneigentum würde, und da würde es mit dem außerordentlichen Vorteil, den ich allein schon durch diese Uhr habe, natürlich vorbei sein.
Nun, ich weiß diesen genialen Armenier ja in anderer Weise zu entschädigen. Ja, mit seiner fabelhaften Kunstfertigkeit kann der Bunte Maulwurf freilich nicht wetteifern.«
Während dieses Selbstgespräches hatte Klingsor einen nach dem anderen Deckel wieder zugeklappt; nun ein neuer Druck oben auf den Knopf, der äußerste, silberne Deckel, der auch viel stärker war als die andern, also der wirkliche Schutzdeckel, sprang auf, jetzt aber befand sich darunter nicht mehr die farbige Landkarte, sondern die weiße Scheibe.
Klingsor zog oben den Knopf noch etwas heraus und begann in ganz anderer Weise als vorher darauf zu drücken, schnell hintereinander. in längeren und kürzeren Pausen.
Also er bediente sich offenbar der telegrafischen Morseschrift, die aus Punkten und Strichen besteht, wobei man ja noch immer eine Geheimsprache vereinbart haben kann.
Schließlich machte er eine Pause, und gleich darauf kamen auf dem weißen Felde schwarze Zeichen zum Vorschein, nicht nur Punkte und Striche, sondern wieder solche stenografische Zeichen, von links nach rechts schreibend, ein Viereck entstehen lassend.
Als dieses fertig war, aber der Schreiber noch nicht, drückte Klingsor etwas oben auf den Knopf, und die oberen Zeichen verschwanden, es konnte oben weiter geschrieben werden, und nach Bedarf wurde dann auch weiterer Platz geschaffen.
Dazwischen telegrafierte aber Klingsor auch selbst, wobei das Schreiben einstweilen aussetzte; also fand ein Wechselgespräch statt.
Und wiederum wurde ein solches unabhängig von diesem Schreiben auch mündlich gehalten.
,Bist Du es selbst, Zingo?«
»Jawohl, Herr Klingsor«, erklang es mit deutlicher Stimme aus der Uhr heraus.
»Hast Du die Granate in der Camera?«
»Ja.«
»Hast Du alles beobachtet?«
»Ja.«
»Die Grube wird hinter mir sofort wieder zugeschaufelt, der Sand geebnet.«
»Aufgenommen!«, erklang es zur Antwort. Wahrscheinlich wurde jeder solcher Befehle sofort notiert, und auch das musste gemeldet werden.
»Dann legt sich die Granate wieder daneben und bleibt einstweilen liegen.«
»Aufgenommen!«
»Ob sie dann die Falltür wieder freimachen muss oder ob sie anderswo hin dirigiert werden soll, um mich abzuholen, weiß ich jetzt noch nicht.
Ich gebe darüber näheren Befehl.
Ist dieser aber bis heute um sieben Uhr Skaldenzeit noch nicht eingelaufen, so wird die Granate nach der Station Hekla dirigiert.«
»Aufgenommen!«
»Sonst etwas Neues zu melden, Zingo?«
»Nichts, Herr Klingsor.«
»Dann Schluss.«
Das mündliche Gespräch war beendet. Dazwischen aber hatte Klingsor auch immer telegrafiert und die entstehende Schrift gelesen.
Doch jetzt war auch dies beendet, Klingsor klappte den Hauptdeckel zu, ließ ihn jedoch sofort wieder aufspringen, und da zeigte sich darunter wiederum etwas anderes. Nicht die Erdkarte, keine von den anderen Scheiben, sondern der neue Uhrdeckel, der jetzt unter dem Schutzmantel zu oberst lag, war von schwarzer Farbe und enthielt ein großes Viereck von goldenen Punkten, in sieben Reihen zu je sieben Stück geordnet, und dieses goldene Viereck war wieder von weißen Punkten umgeben.
Wenn man jedoch genauer zuschaute, so erkannte man auch schon mit bloßen Augen, dass dies keine einfachen Punkte waren, sondern kleine, geheimnisvolle Zeichen, aber doch wieder andere als jene der stenografischen Schrift.
Also irgendeine aus Hieroglyphen bestehende symbolische Tafel.
Klingsor hielt sich mit ihrer Betrachtung nicht auf, er »blätterte« weiter, wie man dieses Umwenden der Deckel recht gut nennen konnte.
Außer den schon gesehenen Deckeln kamen nun noch andere zum Vorschein, wie Klingsor ja auch bereits von zehn gesprochen hatte, und jeder bot ein immer seltsameres Bild als der andere.
Als er den zehnten Deckel aufspringen ließ, wobei der Verschlussdeckel nicht mitgerechnet ist, wurde er etwas ungeduldig.
»Natürlich wieder der letzte!«, brummte er ärgerlich. »Was man sucht, findet man immer ganz hinten, und ist man so schlau, von hinten anzufangen, ist es natürlich vorn, und vor diesem Missgeschick, das ein eisernes Gesetz zu sein scheint, vermag auch ich mich mit all meinen Künsten nicht zu schützen. Ich muss die Uhr noch einmal dem Cyrill zur Umänderung geben; da hilft nun alles nichts.«
Der zehnte und letzte Deckel zeigte das farbige Arabeskenmuster, das vorhin zu zweitoberst gelegen hatte.
Klingsor klappte die sämtlichen Deckel mit einem einzigen Drucke zu, ließ die Schutzhülle wieder aufspringen, und jetzt befand sich das Arabeskenmuster zu oberst.
Der Knopf wurde weiter herausgeschoben, ein Drehen daran, und die farbigen Kreise und Dreiecke liefen durcheinander, langsam oder blitzschnell, je nachdem gedreht wurde, bis sie völlig stehen blieben, jetzt ein ganz anderes Muster als vorhin bildend.
Nur noch eine kleine Korrektur, und Klingsor hatte nichts mehr daran zu ändern.
»So, der Schlüssel ist eingestellt, der Weg ist offen.«
Er klappte die Uhr völlig zu und steckte sie in die Westentasche zurück, ließ das Lichtbild mit der Spitzkugel, die er gar nicht so mit Unrecht Granate nannte, von der Wand verschwinden; die ganze Leinwand rollte in die Höhe und verschwand wieder in der Deckenspalte; diese selbst schloss sich.
Hier schien überhaupt alles hermetisch verschlossen zu sein.
Jetzt stand er auf, wollte einen Schritt seitwärts tun, zögerte, blickte erst einmal an sich hinab.
»Ich werde dieses Hauskostüm gleich anbehalten. Brauche ich ein anderes, so habe ich dort unten genug Auswahl.«
Er trat auf eins der mit weißen Strichen und mit Zahl und Buchstaben gezeichneten Karrees, welche den Fußboden bedeckten, und fuhr ohne Weiteres, ohne erst einen Mechanismus gelöst zu haben, hinab in die Tiefe.
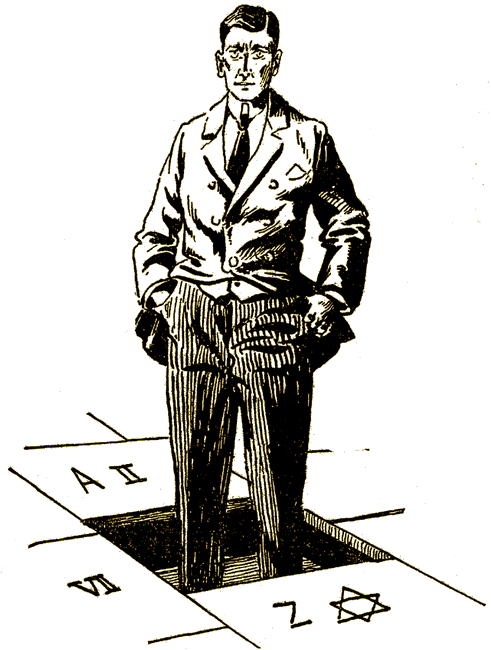
Doch sehr tief ging es nicht hinab, dann hielt der Fahrstuhl wieder.
Klingsor befand sich in einem sehr engen Schacht von etwa vier Meter Höhe, zwischen dessen nackten Wänden sich ein korpulenter Mann kaum hätte umdrehen können, in den er überhaupt gar nicht hineingegangen wäre. Wiederum herrschte volles Licht, ohne dass eine Lichtquelle zu sehen gewesen wäre.
Ein Druck mit der Hand gegen die Wand, ein niedriges Türchen sprang auf, Klingsor trat gebückt hindurch — — befand sich mit dem ersten Schritte in einer Wüste.
Eine nackte, gelbe Sandwüste, auf welche die ziemlich hoch stehende Sonne mit furchtbarer Glut herabbrannte — — nichts weiter. Aber etwas kam doch noch hinzu. Etwa zwanzig Schritte seitwärts von Klingsor in der sonst völligen Ebene erhob sich ein ziemlich beträchtlicher Sandhügel, und in derselben Entfernung vor ihm eine Vertiefung, eine Grube, in welche, wie leicht taxiert werden konnte, jener Sandhügel gerade hineingegangen wäre.
Wo waren die von Wänden eingeschlossenen Räume geblieben, die Camera obscura und der Schacht, aus dem Klingsor getreten war?
Er machte einige Schritte vorwärts, drehte sich um.
Da war nichts zu sehen. Wüste, nichts als Wüste. Ein dunkler Streifen am Horizont konnte ebenso gut eine Wolkenwand wie ein Gebirgskamm sein.
Klingsor griff in die linke obere Westentasche, setzte einen Klemmer auf die Nase, nickte zufrieden.
Sah er durch diesen Klemmer etwas Besonderes?
Er blieb noch etwas so stehen, wie in Betrachtung versunken, hatte die Hände in die Seitentaschen seiner Samtjacke gesteckt.
»Es wird wohl nichts schaden, wenn ich einmal — —«
Und da lag dort vor ihm plötzlich eine ungeheuere schwarze Kugel, von mindestens vierzehn Meter Durchmesser, oben mit einer Kegelspitze!
Höchstens fünf Sekunden währte die Erscheinung, dann war sie wieder verschwunden, und auch nicht die leiseste Spur im Sande verriet, wo solch eine ungeheuere Kugel liegen könnte. Wie kann auch ein Phantom eine Spur erzeugen? So wenig wie einen Schatten.
Klingsor nahm den Klemmer ab, steckte ihn ein, drehte sich wieder um und begab sich zu der Vertiefung.
Sie war etwa drei Meter tief, ebenso breit im Quadrat war unten die Steinfläche, die zu Tage trat, aber da der feinkörnige Sand nur ein sehr geringes Gefälle hatte, musste die Grube oben fast zehn Meter im Durchmesser haben, um diese Steinfläche auch wirklich frei zu halten, sodass also kein Sand nachrutschte.
Die Riesenkugel oder die »Granate«, wie Klingsor sie nannte, hatte ihre Arbeit als magnetischer Sandbagger ganz ausgezeichnet getan. Dort unten auf dem ganz flachen Felsenboden lag auch nicht ein einziges Sandkörnchen mehr! Ja, man hätte mit einem Tuche wischen können, es wäre durch keinen Staub beschmutzt worden. So gründlich hatte die magnetische Kugel die feinsten Partikelchen aufgesaugt, durch magnetische Anziehungskraft mitgenommen.
Klingsor stieg hinab, bei der flachen Neigung nur wenig losen Sand mit sich reißend, und zuletzt machte er einen Sprung.
Also ein nackter, ganz ebener Felsboden, ein Quadrat von drei Meter Seitenfläche bildend, nichts weiter. Auch keine Spur von einem Risse.
Der Mann mit den Teufelsaugen griff in die Hosentasche. zog ein gewöhnliches Taschenmesser hervor, mit zwei Klingen und einem Korkzieher in brauner Holzschale, ein sehr billiges Taschenmesser, bückte sich und berührte ungefähr in der Mitte des Quadrats den Stein mit diesem Messer.
Da plötzlich entstand wiederum ein Quadrat, aber kaum von einem Meter Seitenlänge, gekennzeichnet durch klaffende Fugen.
Es war eben nicht anders gewesen, als habe sich dort der Steinboden zusammengezogen, sodass die Fuge entstehen konnte — so etwa, wie Humusboden Risse bekommt, wenn er vollständig austrocknet, nur, dass es sich hier um einen Felsen handelte und dass die vier ganz geradlinigen Risse ein Quadrat bildeten.
Gleichzeitig blieb der so umzeichnete graue Steinboden an dem Messer hängen. Klingsor hob eine quadratische Platte von der angegebenen Größe ab, die zwar fast zehn Zentimeter dick war, aber doch ungemein leicht zu sein schien, also nicht aus Stein bestehen konnte. Oder hier war sonst irgend etwas Rätselhaftes geschehen.
Eine viereckige Öffnung zeigte sich, ein Schacht, an Weite dem Deckel entsprechend, etwa zwei Meter tief. Sonst war nichts weiter zu sehen. Den Boden bildete wieder grauer Stein.
Wenn nun andere Menschen hier gegraben und diesen Schacht entdeckt hätten?
Nun, sie hätten ihn eben für einen gemeißelten Brunnenschacht gehalten, den sie aber bald wieder aufgegeben hätten, weil doch kein Wasser gefunden worden wäre — oder vielleicht ein Grab, wie es die Assyrier anlegten — der Tote wurde stehend bestattet — und die Assyrier sind wiederholt erobernd durch Arabien gezogen, bis nach Ägypten.
Aber es war überhaupt sehr die Frage, ob jemand diesen Schacht entdecken, ob er die ja erst unsichtbare Platte hätte heben können.
Klingsor hatte den Deckel seitwärts gelegt, das Messer, das er gleichsam hatte abstreichen müssen, wieder eingesteckt, beugte sich, legte die Hände auf den Rand und sprang hinab, über sich den Deckel wieder auflegend.
Jetzt hätte es hier stockfinster sein müssen. Aber es war taghell, aber nicht etwa, weil jener Deckel durchsichtig war.
»Zingo ist zwar durchaus zuverlässig, aber doch noch etwas unerfahren in dieser Sache, ich werde ihn einmal kontrollieren.«
Mit diesen Worten zog Klingsor wieder seine Uhr und drückte oben auf den Knopf. Diesmal sprang kein Deckel auf.
»Zingo!«, sprach er mit gewöhnlicher Stimme gegen den hinteren Silberdeckel.
»Herr Klingsor?«, erklang es sofort.
»Hast Du beobachtet?«
»Alles.«
»Was tust Du jetzt?«
»Ich lasse die Granate bereits arbeiten.«
»Recht so. Hast Du vorhin nicht etwas Besonderes bemerkt?«
»Meinen Sie, weil Sie die Granate einmal sichtbar machten?«
»Gut, das wollte ich von Dir nur hören. Achtest Du scharf darauf, dass niemand in der Nähe ist, der die Sandschaufelei beobachten könnte?«
»Herr, meilenweit, so weit die aufs Schärfste eingestellte Camera reicht, ist kein Mensch zu sehen, und auch keine Sandspinne würde mir entgehen!«
»Dann Schluss.«
Klingsor steckte die Uhr zurück.
Er verspürte einen kleinen Ruck, hatte das Empfinden, als ob ihn plötzlich der Boden unter den Füßen wiche. Und bei genauer Beobachtung der Wände, an denen er doch hier und da wenigstens einen Punkt wahrnahm oder eine Äderung, konnte er erkennen, dass diese Wände nach oben rutschten — oder der Boden nach unten.
Es war also ein in die Tiefe gehender Fahrstuhl, ohne Schienen und dergleichen, die ja auch bei den modernen Fahrstühlen nicht zu sehen sind. Man sitzt in einem behaglichen Zimmer. Hier war es ein nackter Felsenschacht.
Die Fahrt ging sehr schnell und, nach der Länge der Zeit, auch ziemlich tief, wenn es da auch gar keine Möglichkeit einer Schätzung gab.
Wieder erfolgte ein schwacher Ruck.
»Dieses Rucken müsste aufhören; aber ich will nicht erst eine Änderung vornehmen, das Ding tut schon seine Pflicht.«
Ein Druck gegen die Wand; diese öffnete sich.
Klingsor, die entstandene Tür hinter sich wieder schließend, trat in einen Raum, der etwas größer und höher war als der Fahrstuhl, aber immer noch eng genug, mit eben solchen nackten Steinwänden und auch wieder taghell erleuchtet ohne sichtbare Lichtquelle, was immer erwähnt werden muss, da sich dies auch einmal ändern konnte.
Die hier herrschende Helligkeit schien ihm nicht zu gefallen.
»Ich muss aus dem Finstern in das trauliche, nur spärlich erleuchtete Studierzimmer treten, sonst geht der ganze Effekt verloren.«
So murmelte er, und alsbald ward es finster, dass man die Hand nicht vor den Augen sehen konnte.
Doch da öffnete sich schon wieder eine Tür, aus der Licht strahlte, aber ein ganz anderes.
Klingsor trat in ein Zimmer, das näher beschrieben werden muss.
Es hatte die wohl normale Höhe von vier Metern, war etwa sechs Meter lang und fünf breit.
In der Mitte stand ein flacher Schreibtisch, ohne Aufbau, die Platte grün bezogen, dem auch sonst nichts weiter anzusehen war, nur mit Schreibgerätschaften und einigen Papieren bedeckt, ein gewöhnlicher Schreibtisch, davor der bequeme Lehnstuhl.
Dann noch ein anderer einfacher Stuhl und an der einen Randseite ein breites Sofa, mit gelbem Leder zogen, davor am Boden ein großes Eisbärenfell.
Das waren die einzigen Möbel, die hier zur Bequemlichkeit dienten, aber sonst gab es ja nun freilich viel zu sehen.
Die Wände waren von oben bis unten mit Regalen bedeckt, auf denen alte, ehrwürdige Bücher standen, meist in Schweinsleder gebunden. Ein solcher Foliant lag aufgeschlagen auch auf dem Schreibtisch, und die Pergamentseiten zeigten eine krause, verschnörkelte. lateinische, aber doch sorgsam ausgeführte Handschrift. Jeder mit etwas Einbildungskraft Begabte sah gleich den Mönch, der einst in seiner Zelle diese Buchstaben, dabei verschiedene Farben benutzend, sorgsam gemalt hatte. Also auch die anderen Folianten enthielten wohl Handschriften, das war ihnen gleich anzusehen, wenn auch gedruckte Bücher darunter sein mochten — sicher aber aus dem vorigen Jahrhundert stammend.
Zwischen den Regalen war an den Wänden hin und wieder doch noch Platz gelassen, und da gab es die seltsamsten Sachen.
In einem Glaskasten kauerte eine menschliche Mumie, eingehüllt in ein gar kostbares, goldbesticktes Gewand. Dann ohne weitere Schutzhülle ein menschliches Gerippe, stehend, aber den Oberkörper so weit zurückbiegend, dass es den Kopf zwischen den Beinen hatte, die Knochenarme um die Beine schlingend, und an diesen Knochen erkannte der Kundige das Weib — eine Schlangendame, die ihre Glieder verrenkte und deren Skelett so aufgestellt worden war, um studieren zu können, wie sich eine Wirbelsäule so unnatürlich zu verbiegen vermag.
Dann in einer großen Glasflasche ein riesiger Frosch, aber mit einem Kopfe, der ganz wie der eines Menschen gestaltet war — oder eben eine menschliche Missgeburt, ein Kind mit einem ganz regelrechten Froschleib.
Dann folgte ein ausgestopfter Uhu, dessen Kralle aber Tigerpranken glichen.
An der Decke hing ein vier Meter langes Krokodil, dessen Schwanz jedoch in einer Schlange endete, wie sich auch die aus dem Rachen hervorsehende Zunge sehr dünn und gespalten zeigte.
Und so noch war eine ganze Masse von Missgeburten und tierischen Abnormitäten vorhanden, als Skelette oder ausgestopft oder in Glasbüchsen, in Spiritus gesetzt oder in anderer Weise konserviert.
Außerdem gab es noch viele andere Merkwürdigkeiten zum Teil wunderlichster Art: die schrecklichsten Tanz- und Totenmasken der verschiedensten wilden Völker, Waffen aller Art, große und kleine Holzkästen und Büchsen und Truhen, teils von künstlerischer Arbeit mit kostbarsten Intarsien, teils ganz einfach.
Und so noch vieles mehr. Das ganze Zimmer war damit angefüllt, so weit die Bücherregale es nur irgendwie erlaubten.
Aber es waren nicht jene Raritäten und Kuriositäten, welches jenes bekannte Bild zeigte, Klingsor mit der Katze im Lehnstuhl sitzend, das Samuel Philipp hatte ausliefern sollen.
Die Beleuchtung des Zimmers schließlich bestand aus einem halben Dutzend oder noch mehr Lichtern, langen, dicken Wachskerzen, welche überall verteilt waren. Auch auf dem Schreibtisch standen zwei in wunderlichen Kandelabern.
Waren es wirklich Wachskerzen, die hier ständig brannten? Wohl schwerlich. Das kann ja auch sehr leicht imitiert werden, wie es meist in den Kirchen geschieht, wo man solche Wachskerzen nötig zu haben glaubt. Es ist einfach Gaslicht. Dem Rohre hat man nur das Aussehen von Wachskerzen gegeben. Jedenfalls aber war das hier gar nicht zu unterscheiden; auch die ganze Atmosphäre war von einem angenehmen Duft nach Wachs erfüllt.
Klingsor war an der Tür stehen geblieben, die sich ebenfalls von selbst hinter ihm wieder geschlossen hatte, ohne eine Spur zu hinterlassen, ein ganzes Bücherregal hatte sich mit gedreht, und so stand er einige Zeit da, die Arme über der Brust verschränkt und seine dämonischen Augen glühten immer mehr, als sie dies alles wie mit einem Blicke verschlingen wollten, und dabei trat auf seinem charakteristischen Mephistogesicht immer mehr der Ausdruck von Behagen, Zufriedenheit und Glück hervor.
»Siebzig Meter unter der Erde!«, murmelte er in abgerissenen Sätzen.
Mitten im Herzen des wüstesten Arabiens!
Wer würde hier wohl solch ein trauliches Studierzimmer vermuten? Mit solchen kostbaren, unbezahlbaren Raritäten?
»Ich habe ja noch an gar vielen Punkten der Erde solche geheime Schlupfwinkel, angefüllt mit den kostbarsten Seltenheiten, aber das hier in der Wüste Arabiens ist doch mein liebster Aufenthalt.
Das sage ich freilich bei den anderen versteckten Nestern auch stets, sobald ich sie betrete, dieses oder jenes, doch — — das ist es ja eben, was den undefinierbaren Reiz ausmacht — den Reiz der Neuheit, um nicht zu sagen, den der Abwechslung.
Loke, weißt Du denn eigentlich, was für ein glücklicher Mensch Du bist?«
Und immer stärker trat der Zug glücklicher Zufriedenheit in dem eigentümlichen Gesicht hervor.
»Mich hat zwar ein unaufschiebbares Geschäft hierher geführt, aber etwas muss ich mich diesem Behagen doch erst hingeben.«
Er ging an die Wand, nahm von dort ein kleines Beil mit sehr langem Griff herab, mit bunten Federn und einigen zusammengeflochtenen Haarsträhnen geschmückt, jedenfalls einen indianischen Tomahawk. Gegenüber dem Beile aus Stahl war noch eine kleine Erhöhung angebracht, wohl aus rotem Stein oder Ton.
Zärtlich betrachtete er die Waffe, streichelte sie liebkosend wirklich mit der Hand.
»Der Tomahawk des würgenden Panthers!«, flüsterte er ganz glückselig.
Klingsor ging nach dem Sofa, strich erst einmal zärtlich über das gelbe Leder, ehe er sich darauf ausstreckte.
»Die Haut des Schimmels«, erklang es ebenso zärtlich, »den Napoleon in der Schlacht bei Waterloo geritten hat — — nur etwas nachgedunkelt.«
Er blickte auf das Eisbärenfell, das ihm den zähnefletschenden Kopf zukehrte.
»Ja, ja, ich weiß schon«, sagte er freundlich.
»Kein anderer Mensch in der Welt weiß, wo Sir John Franklin geblieben ist; vergebens hat seine Gattin zwei Expeditionen ausgerüstet, um den Verschollenen in den arktischen Eiswüsten zu suchen — — nur ich weiß, dass Du ihn aufgefressen hast, am 13. August 1849, auf dem 78. Breitengrade. Ach, ist das köstlich!«
Noch viele andere Sachen weckten solche Erinnerungen.
»Dort die Handschrift des Lysander, über deren Verlust alle Bibliophilen der Welt weinen — — und wenn gar dort die Bücher des Hermes Trismegistos, des dreimal größten, den alle heutigen Gelehrten in das Reich der Fabel verweisen, und doch hat er existiert; seine geheimnisvollen Bücher, von ihm mit eigener Hand geschrieben, gehören mir, mir allein, und niemand ahnt etwas davon — — ach, ist das herrlich!!«
Dann nickte er der Schlangendame zu, die den Kopf durch die Beine steckte, und die, was erst jetzt erwähnt werden mag, auf dem schönfrisierten Flachshaare des Totenschädels eine kleine, goldene Krone trug.
»Und Du, biegsames Skelett — — wer Dich für nur so eine gewöhnliche Schlangendame hält, die gegen schnödes Geld öffentlich ihre Künste zeigt, der irrt sich gewaltig — — ich kenne Dich besser — — Du trugst diese Krone vor mehr als vier Jahrhunderten nicht nur als gewöhnlichen Schmuck — — Deine irdischen Überreste, Isabella von Kastilien, wird man vergebens in dem Katafalk des Domes zu Madrid suchen, ich habe mir erlaubt, sie mir anzueignen.«
Der Mann mit den Teufelsaugen hielt Gespräche mit noch vielen anderen Dingen, die sich in diesem Raume befanden, geriet immer mehr in eine Art von Verzückung.
»Ach, ist das herrlich, herrlich, von solch unbezahlten Raritäten und Geheimnissen umgeben zu sein, ohne dass die Welt davon auch nur etwas ahnt! Hier mitten im Innern Arabiens, siebzig Meter unter der Erde!
Und nun schon wenige Stunden später wieder in London, an der Seite meiner Angela — —«
Obgleich er sich also doch auf diesen Wechsel freute, erstarb plötzlich der glückliche Gesichtsausdruck, machte wenigstens einem sinnenden Zuge Platz.
»Hm, ich weiß noch nicht recht, was ich da anfange.
Diese Mrs. Plumber hat die Sache nun einmal aufs Tapet gebracht.
Ja, es war eine köstliche Zeit, wie ich wilder, rastloser Abenteurer und ausgesprochener Teufel mich der holden Unschuld als simpler Versicherungsbeamter näherte und sie mir so errang, wie ich die Madonna, wenn ich mich von meinen Fahrten in aller Welt einmal ausruhen wollte, immer besuchte, das herzige Kind auf meinen Knien, aber — — die Sache wird mir nun nach und nach langweilig.
Ich hätte mich dieser Madonna überhaupt lieber gleich als höllischer Mephistopheles vorstellen und sie als solcher besiegen sollen, der Effekt wäre doch jedenfalls viel größer gewesen.
Das habe ich ja allerdings auch schon oft genug bei sanften Mägdeleins getan, und noch keins hat es zu bereuen gehabt, aber so eine holde Unschuld, so ein tugendhaftes Weib wie diese Lehrerstochter habe ich doch noch nie kennen gelernt.
Nun, schließlich könnte ich dies ja noch nachholen.
Ich könnte mich ihr als der von jener vermaledeiten Schachtel geahnte Hexenmeister, der sich dem Teufel verschrieben hat, offenbaren.
Soll ich es tun?
Heute Abend noch?
Das will reiflich überlegt sein.
Besonders, ob ich da auch die Mrs. Margot Glane mit dazwischen bringe.
Was bei dieser Madonna nun freilich ein äußerst gewagtes Stückchen wäre.
Da müsste ich einmal meine ganze Schlauheit aufbieten, nicht nur den halben Geist, um auch aus dieser Situation als Sieger hervorzugehen, und das ist ja gerade etwas für mich. Ohne Kampf kein Leben.
Nun, ich habe ja noch einige Stunden Zeit, um mir das reiflich überlegen zu können. Hin muss ich jedenfalls, ich habe es ihr versprochen, und den Spaß mit dem Pudel lasse ich mir auch nicht entgehen.
Jetzt aber will ich mich daran machen, das zu erledigen, weshalb ich hauptsächlich hierher gekommen bin, eines meiner größten Geheimnisse, das aber erst durch den Golem des WunderRabbis, den ich dem Rechtsanwalt Iron abgeluchst habe, Wert bekommen hat.«
Klingsor erhob sich, drückte eins der Bücherregale zurück, aber wieder ein anderes als jenes, welches die Tür verdeckt hatte, durch die er eingetreten war.
Eine neue Tür entstand also, durch die er in einen Korridor mit nackten Wänden trat, immer wieder wie durch Tageslicht erleuchtet, das keinen Schatten warf.
»Eine famose Erfindung, dieses ZoelestrialLicht«, murmelte er, »aber mein Fall ist es eigentlich nicht, es ist mir etwas gar zu hell, wenn, wie hier, nicht dafür gesorgt ist, dass man es abdämpfen kann.«
ZoelestrialLicht — — so viel wie Himmelslicht!
Nur wenige Schritte, und der Gang mündete an einer abwärts führenden Steintreppe.
Klingsor stieg sie hinab, ziemlich tief, mindestens die vier Etagen eines normalen Hauses.
Die Treppe mündete wieder in einen horizontalen Gang, ebenfalls taghell erleuchtet, in dem aber ein schwarzer Wasserstrom, den ziemlich breiten Gang oder Tunnel ganz ausfüllend, träge floss.
Und an den letzten, bis ins Wasser hinein führenden Stufen lag ein Boot, jedenfalls aus Eisen oder Stahl, und wenn auch darin alles das fehlte, was zu einem Motorboot gehört, so erkannte das kundige Auge doch gleich, dass es einst ein solches gewesen war, aus dem man nur den Motor und die dazu nötige Steuerung genommen hatte. Nur vor der mittelsten der drei Duchten oder Bänke befand sich ein ganz kleiner Kasten, aus dem ein einfacher, in vier Schlitzen gehender Hebel hervorsah, nichts weiter.
Er stieg in das Boot, setzte sich vor dem unscheinbaren Kasten nieder, ein Hebelgriff, und das Boot löste sich sofort von der Steintreppe ab, an der es trotz der Strömung auch ohne Kette festgelegen hatte, es strich sich wie von einem Magneten ab, setzte sich in Bewegung.
Schneller und schneller fuhr es stromaufwärts durch das dunkle Wasser.
Der unterirdische Stromlauf machte verschiedene Bogen, aber ein ernstliches Hindernis trat nirgends entgegen, und immer war alles taghell erleuchtet.
Die erst dunklen Wände wurden weiß, es schien Marmor zu sein; dicke Goldadern zogen sich durch ihn.
»Gold genug, um alle Kostbarkeiten der Erde, so weit sie von Menschenhänden gefertigt sind, kaufen zu können. Und ich darf kein Körnchen davon verwenden. auch nur die billigste Rarität dafür kaufen. Ein Skaldengesetz verbietet aufs Strengste, Gold und Geldeswert für etwas zu bezahlen, was keinen festen Marktpreis hat — um eben zu verhindern, dass wir unsere unermesslichen Schätze unter die Menschen bringen. Und solche Raritäten, wie ich sie sammle, haben doch natürlich keinen festen Preis. Andererseits ist dieses Verbot ja ganz vortrefflich, gerade für mich. Wenn ich sie kaufen könnte, so hätten solche Raritäten gar keinen Reiz mehr für mich, und andere Skalden dürfen es eben nicht, jeder muss sein Gehirn anstrengen, um durch irgendeine List in den Besitz solcher Sammlerware zu gelangen, und da Loke Klingsor doch wohl der schlaueste unter den Skalden ist, so fällt das heißumstrittene Objekt eben immer mir zu, so wie es auch wieder mit dem Golem gewesen ist. Ha, dieser Golem des WunderRabbis!«
Das Boot wurde noch mehr angetrieben, es schoss an den goldgeäderten Wänden vorüber.
Nach einer Viertelstunde etwa erfolgte ein schnelles Bremsen, das Boot legte wieder an einer Steintreppe bei.
Klingsor stieg aus, blickte in eine kleine Nische hinein.

»Der Fahrstuhl würde mich schnell zum ersehnten Ziele führen, aber etwas Bewegung ist mir sehr angenehm.«
Federnden Fußes, immer gleich zwei Stufen auf einmal nehmend, sprang er die Treppe empor, die ihn noch höher hinauf führte, als er vorhin hinabgestiegen war.
Durch einen kleinen Vorraum trat er in eine weite prächtige Halle, die Wände mit bunten, herrlichen Mosaiken ausgelegt, die ebenso geschmückte Decke trotz ihrer Wölbung noch durch viele Säulen gestützt.
Ein kundiges Auge erkannte gleich den maurischen Stil.
Da aber nun besonders die Säulen Bildhauerarbeiten zeigten, welche Menschen darstellten, meistenteils gepanzerte Krieger, so musste dieser Saal noch vor Mohammeds Zeiten geschaffen worden sein, also noch vor dem 6. oder doch 7. Jahrhundert. Denn der Prophet hat streng verboten, den Menschen irgendwie figürlich oder bildlich nachzubilden, jedenfalls, um eine neue Gelegenheit zum Götzendienst, dem Araber und Osmanen doch bis zu Mohammeds Zeiten huldigten, zu verhindern.
Im Übrigen diente dieser mächtige Saal als physikalisches Laboratorium, wenigstens waren überall Apparate und Instrumente aufgestellt, wenn sie auch meist ein recht fremdartiges Aussehen hatten, außerdem von ungewöhnlich riesenhafter Größe waren.
Der erste war eine Sanduhr von ungeheuren Dimensionen.
Jeder der beiden birnenförmigen Glasbehälter, in einem massiven Gestell von Eisenstangen aufgebaut, hatte in der Mitte einen Durchmesser von wenigstens drei bei einer Höhe von fünf Metern. Als ablaufendes Material diente ein goldglänzender Staub. Ob es nun gerade Goldstaub war, das war ja fraglich. Es konnte ja auch ganz feiner Sand sein, der natürlich oder künstlich so gefärbt war.
Die beiden riesigen Glasbirnen waren ungefähr gleichmäßig bis zur Hälfte gefüllt. Die Durchgangsöffnung war für diese Dimensionen sehr eng gehalten, kaum konnte man mit bloßen Augen den dünnen Strahl sehen, der hindurchfloss. Nur wenn man sich richtig stellte, sodass man durch eins der Eisenbänder einen dunklen Hintergrund bekam, sah man deutlicher den ablaufenden Strahl wie einen dünnen goldenen Faden in der Luft stehen.
Und wenn man dann längere Zeit beobachtete, sah man auch, wie in dem goldenen Kegel in der unteren Glasbirne, dort, wo der Goldfaden endete, eine kleine Vertiefung war, eben durch den auffallenden Staub gebildet, diese vertiefte Kegelspitze musste doch nach und nach in die Höhe wachsen, bis dann so ungefähr alle fünf Minuten in den ganzen Kegel ein kleines Rutschen kam — alles, wie man es bei jeder Sanduhr beobachten kann, die man zum Kochen von weichen Eiern benutzt. Und wenn die Sanduhr abgelaufen ist, dann sind die Eier regelmäßig hart.
Über dieser kolossalen Sanduhr hier war an der Wand eine richtige Uhr angebracht, jedenfalls elektrisch betrieben, der große Zeiger sprang alle Minuten ruckweise vor, und zwar dauerte es wirklich immer genau eine Minute; das Zifferblatt war in zwölf Stunden geteilt, also handelte es sich hier nicht um »Skaldenzeit«, die den ganzen Tag von 24 Stunden nur in 10 teilte, sondern eben um eine von unseren Uhren.
Daneben noch eine Tafel mit vier Feldern. Das linke Feld zeigte die Zahl 3, das nächste die Zahl 123, das dritte die Zahl 16, das vierte eine 60, die aber soeben verschwand, um einer Eins Platz zu machen, und zwar in dem Augenblick, als der Minutenzeiger vorwärts sprang.
Also die rechte äußerste Zahl zeigte die abgelaufenen Minuten an, und dann ging man wohl nicht fehl, wenn man annahm, dass die anderen Zahlen die ganzen Stunden, Tage und Jahre angaben. Denn dass diese kolossale Menge Sand oder Staub zum Durchlaufen einiger Jahre bedurfte, das konnte sich jeder berechnen, der hiervon nur einigermaßen etwas verstand.
Und Klingsor sprach das auch gleich aus, nachdem er eine halbe Minute die Sanduhr und den Zahlenapparat betrachtet hatte.
»Drei Jahre und 123 Tage sind verflossen. Noch drei Jahre und 233 Tage; dann ist die heilige Zahl Sieben erreicht, und dann wird sich ja zeigen, ob Hermes Trismegistos mit seiner ungeheuerlichen Behauptung recht gehabt hat oder nicht.«
Er setzte seinen Weg fort, kam an noch manch anderem Apparat vorbei, immer so wunderlich konstruiert, und blieb vor einem Apparate stehen, der folgendes Aussehen hatte:
Auf einem vierbeinigen Gestell ruhte ein Kasten von etwa einem Meter im Quadrat und ziemlich ebenso hoch, oben offen. In diesem Kasten war eine silberglänzende Kugel von etwa 15 Zentimeter Durchmesser in ständiger Bewegung Sie rollte und sprang hin und her, bis zur Hälfte der Wände empor, manchmal langsam, manchmal außerordentlich schnell, alles ganz unregelmäßig, aber keinen Augenblick in Ruhe liegend.
Man musste gleich auf den Gedanken kommen, dass hier negativer Magnetismus vorlag, der die Kugel immer wieder abstieß.
Auf einem Tische lag ein Ring von Eisenband, also eine kreisrunde Schiene ohne Ende, über ihr lief mit sehr großer Geschwindigkeit ein kurzes Stück Eisen, etwas gebogen, dabei aber immer etwa zehn Zentimeter über der Schiene frei in der Luft schwebend, diese niemals berührend.
Einem physikalisch gebildeten Fachmanne wäre das gar keine so große Merkwürdigkeit gewesen.
Es handelte sich um ein Problem, welches wohl auch wir bald in der Praxis ausgenutzt sehen werden: Ein Eisenbahnzug, der in der Richtung einer Schiene läuft, ohne diese zu berühren, also in gewisser Höhe frei in der Luft schwebt.
Das ist die Erfindung eines englischen Ingenieurs; das tadellos arbeitende Modell war bereits im Londoner KensingtonMuseum ausgestellt.
Es wird hierbei eine schon längst bekannte Erscheinung praktisch ausgenutzt. Die ganze Maschine setzt sich aus lauter kleinen, einzelnen Magneten zusammen, die abwechselnd positiv und negativ wirken. Der darüber schwebende »Anker«, der also auch ein ganzer Eisenbahnzug sein kann, wird wohl von dem positiven Magnetismus angezogen, aber wenn er einmal in eine Bewegung von gewisser Schnelligkeit gesetzt worden ist, hat er nicht mehr Zeit, der Anziehungskraft Folge zu leisten, schon ist er über diese Stelle hinweggeglitten, wird von dem nächsten negativen Pole wieder abgestoßen, von dem nächsten positiven Pole wieder angezogen — — und so geht das immer weiter, dadurch bleibt der Zug immer in Bewegung und immer in der Schwebe.
Gerade die gelehrten Fachleute behaupten zwar, dass sich diese Eisenbahn im Großen nicht ausführen lässt, aber immerhin, in einem Modell ist dieses Problem tatsächlich schon gelöst worden.
Auch hier befand sich an der Wand ein uhrenähnlicher Apparat, mit nur einem Zeiger, wohl nur ein Manometer oder sonstiger Messer.
Der Zeiger hatte eine rote Marke schon weit hinter sich.
Diesen Apparat betrachtete Klingsor hauptsächlich prüfend, bis er auch Worte fand.
»Nein, Meister Gordes, mit Deinem Perpetuum mobile ist es nichts! Das elektrische Kraftquantum, mit dem Du es zuerst in Bewegung gesetzt hast, hat sich schon ganz bedeutend verringert. Dein Modell damals war nur zu klein, und eine Woche Beobachtung reichte auch nicht hin, um den Verlust zu konstatieren. Ich habe dieses Modell hier in ganz anderen Dimensionen ausführen lassen, es läuft schon zwei Jahre, da ist der Kraftverlust ersichtlich. Nein, da habe ich das Problem des Perpetuum mobile in anderer Weise zu lösen gewusst. Es verbraucht nicht nur keine Kraft, sondern entwickelt auch noch solche, und zwar ist dies theoretisch einfach unbegrenzt.«
Der vierte und letzte Apparat, vor dem er stehen blieb, war wieder seltsam genug.
Zwischen zwei Schienen, fast bis zur hohen Decke reichend, einen halben Meter auseinander stehend, bewegte sich ein in Schwalbenschwänzen eingepasster Block auf und ab.
Dicht daneben war noch einmal solch ein Schienepaar mit solch einem hin und her gehenden Block.
Die beiden wechselten immer ihre Farbe. Der abwärtsgehende war immer schwarz, der aufwärtsgehende immer weiß.
Wenn der aufwärtsgehende, weiße Block oben an ein kleines Stiftchen stieß, das etwas aus der einen Schiene hervorsah, nahm er im Nu eine tiefschwarze Färbung an, ging als schwarzer Block hinab, um sich unten, wieder an solch ein Stiftchen stoßend, im Moment wieder weiß zu färben.
So sausten die beiden Blöcke abwechselnd mit diesem Farbenspiel immer auf und ab, in der Mitte sich begegnend. Dieses Wechselspiel der vertikalen Bewegung wurde durch eine ganz einfache Vorrichtung auf ein Rad übertragen, das also rotierte.
Der Zweck dieser Vorrichtung soll später beschrieben werden.
Klingsor hatte seinen Weg fortgesetzt.
Vor zwei Steinfiguren machte er wieder Halt.
Es waren zwei ungeheure Sphinxe, in ihrer liegenden Stellung mindestens drei Meter hoch und sieben lang, welche in geringer Entfernung voneinander an der Wand lagen, mit den Köpfen in den Saal hineinschauend.
Tigerleiber mit schönen Frauenköpfen, auch die Brust noch menschlich, aber die Vorderarme, auf die sie sich stützten, schon wieder in Raubtierpranken auslaufend.
Die Frauenköpfe von idealer Schönheit. Nur die großen roten Augen, wohl aus lauter kleinen Rubinen zusammengesetzt, glühten ganz unheimlich, selbst in diesem äußerst hellen Lichte, den eigentlich sanften oder doch teilnahmslosen Zügen dadurch dennoch den Ausdruck einer schrecklichen Wildheit gebend.
Die beiden Tigersphinxe schienen den Eingang bewachen zu wollen, der sich zwischen ihnen in der Wand befand, mit einem Teppich verhangen, der mit kleinen, ganz wunderlichen Figuren bedeckt war, zweifellos ägyptische Hieroglyphen.
Hier also war Klingsor stehen geblieben. Sinnend betrachtete er die beiden Tigerweiber sowie den gestickten Teppich.
Dann begab er sich nach der nächsten Säule, drehte einen kaum sichtbaren Hebelgriff. und plötzlich herrschte die schwärzeste Finsternis in dem weiten Saale.
Sie wurde nur durchbrochen von den rotglühenden Strahlen, welche den Augenpaaren der Sphinxe entstrahlten. Und außerdem tauchte noch ein zweites, schwächeres Lichtfeld auf.
Es konnte doch kein dicker Teppich sein, der vor jener ziemlich großen, hohen Tür hing, wie es erst den Eindruck gemacht hatte, sondern nur ein dünnes Gewebe. Hinter ihm lag eine vielleicht noch größere Halle, aber eben nur sehr schwach erleuchtet, und in dieser stand in einem Nebelschleier eine riesenhafte weibliche Figur, welche die eine Hand erhob.
Diese Umrisse waren wohl ziemlich scharf, aber im Allgemeinen alles doch so nebelhaft, dass unmöglich etwas deutlich zu unterscheiden war. Nicht einmal die Entfernung war zu taxieren, in welcher diese ungeheure Figur stand. Nur dass es ein Weib von kolossalen Dimensionen mit erhobenem Arme war, das durfte man sicher behaupten.
Und dann plötzlich geschah wieder etwas ganz Rätselhaftes oder doch Unheimliches.
Klingsor war abermals vor die beiden Sphinxe hingetreten, und da richteten sich die roten Lichtstrahlen, die aus den Rubinaugen brachen, direkt auf ihn.
Das konnte ja leicht arrangiert werden, die Lichtstrahlen wurden eben gelenkt — aber furchtbar unheimlich war es, wie dieser Mann mit den Teufelsaugen in seiner schwarzen Samtjacke nun so rotglühend da stand, die Arme über der Brust gekreuzt, mit diesem rätselhaften Gesicht, wie diese Augen selbst jetzt so erglühten!
»Das allerheiligste der ägyptischen Heiligtümer«, kam es flüsternd über seine Lippen, »nur den eingeweihtesten Priestern zugänglich — das Standbild der Isis — es gehört mir — das verschleierte Bild zu Sais — —
Es ist nicht nur eine Sage gewesen, die der unvergleichliche Schiller da verwendet hat. Das verschleierte Bild der Wahrheit in der Gestalt der Isis hat existiert.
Ich habe es aus dem Trümmerhaufen, der sich neben dem jetzigen Dorfe Saelhager bei Rosette erhebt, ausgegraben, um es mit allem, was dazugehört, hierher zu versetzen.
Und was alles gehört noch dazu!
Was für mechanische und andere Kunstfertigkeiten haben die alten Ägypter oder doch diese Priester damals schon verstanden! Mit was für schauerlichem Hokuspokus haben sie dieses Götterbild zu umgeben gewusst!
Was habe ich damals Furchtbares erlebt!
Zwar weihte mich kein Hierophant erst ein, aber eine schreckliche Warnung erhielt ich doch, auch ich spottete ihrer, denn auch ich war damals ein wissensdurstiger Jüngling.
Ha, was habe ich erlebt!
Es war eine Vollmondnacht, als ich in den unterirdischen, noch wohlerhaltenen Tempel eindrang, ich kam in eine Rotunde, durch deren obere Öffnung des Mondes bleicher, silberblauer Schein hereinfiel, mein Schritt hallte mit schrecklicher Unheimlichkeit in den geheimen Grüften wider, vor mir erglänzte schrecklich die Gestalt in langem Schleier, und da ging es mir bald heiß, bald eisigkalt durch das Gebein.
Doch ich zögerte nicht.
Ich kannte das Geheimnis, wie man den sonst starren Schleier lüften konnte
Und ich tat es.
Aber das Lüften dieses Schleiers setzte auch den ganzen übrigen Mechanismus in Bewegung — —«
Wie ein Zittern ging es durch die nervige Gestalt des ganzen Mannes, der sonst sicher nichts von solchen Schwächen wusste.
Bis er sich mit einem Ruck wieder beherrscht hatte.
»Ach, was habe ich erlebt!
Ich war gewarnt, ich wusste, was geschehen würde — aber der Teufelsspuk, der da losbrach, war auch für meine Nerven zu viel.
Auch ich wurde am anderen Morgen bleich und besinnungslos am Fuße des Standbildes hingestreckt gefunden — von meinen Gefährten.«
Der Schwächeanfall war vollständig vorüber.
»Nun«, fuhr er fort, »mich hat kein tiefer Gram ins frühe Grab getrieben, auch meines Lebens Heiterkeit ist dadurch nicht im Mindesten getrübt worden. Ich spürte den Mechanismus auf, untersuchte alle Einzelheiten bei Tageslicht, und die Sache war all right.
Ich grub die ganze Maschinerie aus, nahm sie mit, baute sie hier in meinem arabischen Tuskulum wieder auf, und alles funktioniert noch vortrefflich, bis auf die glühenden Sphinxaugen, die den Eintretenden verfolgen, so lange er hier weilt.
Jederzeit kann ich mir den ganzen Teufelsspuk wieder vormachen lassen.«
Klingsor schritt auf den durchsichtigen Vorhang zu, der die Tür verhüllte.
Die roten Lichtstrahlen, die aus den Sphinxaugen hervorbrachen, folgten ihm, ihn immer mit einem glühenden Lichte übergießend, bis dieses fast in einem rechten Winkel hervorkam.
Dann plötzlich erloschen sie vollkommen, in der weiten Halle herrschte wieder die schwärzeste Finsternis.
Nur durch das dünne Teppichgewebe, hinter dem also die riesenhafte Frauenfigur sichtbar war, brach noch einiges schwaches Licht hervor, und in diesem stand jetzt Klingsor, schon die Hand ausgestreckt, um den Teppich zurückzuschlagen.
Aber er tat es nicht, ließ nach einigem Besinnen die Hand sinken.
»Hm. Es wäre das zweite Mal, dass ich diesen Höllenraum allein betrete, und... ich weiß nicht... ich habe gar keine rechte Lust heute, es hält sehr auf, ich habe noch vieles andere vor...
Oder, Klingsor, mach dir lieber keine Flausen vor, sei immer ehrlich, wenn es dir auch schwer fällt.
Du fürchtest dich ganz einfach, diesen Höllenspuk ganz allein über dich ergehen zu lassen!
Du hast noch die Nase voll von damals mit deinem ersten Experiment!
So, das ist die Wahrheit, und nachdem ich dies gestanden habe, kann ich ruhig zurücktreten und mir den nächsten Eintritt bis dahin vorbehalten, wenn ich hier den Baron Edeling einführe, um mich an seinem Gruseln zu weiden, wie ich es mir überhaupt vorgenommen habe.«
Klingsor kehrte um, ging nach jener Säule zurück, schaltete das helle Tageslicht wieder ein und setzte seinen Weg fort, ohne noch einmal stehen zu bleiben, bis er vor eine sonst nackte Wand kam.
Ein Tasten mit verschiedenen Fingergriffen, und in ihr wich eine geheime Steintür zurück, die sich hinter ihm wieder schloss.
Durch einen kurzen Gang betrat er einen unverschlossenen Raum.
Ein Druck auf einen kleinen Wandknopf, eine Klingel schrillte anderswo.
Hier waren noch andere Menschen, Schritte kamen gelaufen, nicht nur von einer einzigen Person herrührend.
»Der Meister ist gekommen!«, wurde auf arabisch leise und erschrocken gesagt, mit von verschiedenen Stimmen wiederholter Betätigung.
Aber nur ein einziger betrat durch eine andere Tür dieses Zimmer, ein älterer Araber im sauberen Arbeiterkittel, so eine Art römischer Tunika, wie wir sie schon bei anderer Gelegenheit einmal gesehen haben, in dem Kraterkessel der Sahara.
Der Diener oder vielleicht Sklave kam nicht erst zu einer Begrüßung seines Herrn, wozu er mit über der Brust gekreuzten Armen ausgeholt hatte.

Aufmerksam betrachtete ihn Klingsor.
»Fehlt Dir etwas, Sardan?«, erklang dann die schöne Baritonstimme ungemein weich.
»Nichts, Herr.«
»Bist Du krank?«
»Nein, Effendi, ganz gesund.«
»Gefällt es Dir nicht mehr zwischen diesen Felswänden?«
»Ich bedarf der Sonne nicht, Herr, ich hasse sie!«, erklang es grimmig.
»Willst Du anderswohin versetzt sein?«
»Nein, Herr, es gefällt mir hier sehr gut.«
»Aber Du bist nicht mehr derselbe wie früher. Hast Du etwas auf dem Herzen?«
»Nein, Effendi.«
»Wie geht es Deiner Familie?«
Jetzt wurde das sonst teilnahmslose Gesicht des Alten doch sehr bekümmert.
»Ach, Herr, meiner jüngsten Tochter geht es recht schlecht.«
»Wie? Der Suleima? Was fehlt ihr?«
»Gleich, als Du das letzte Mal fort warst, klagte sie über Schmerzen in der Brust, seitdem ist sie nicht wieder gesund worden; das Kind siecht immer mehr hin.«
»Siehst Du, ich wusste doch gleich, dass Du Sorgen hast! Aber was fehlt dem Kind? Was sagt Hakim Okla dazu?«
»Sie hat die... Auszehrung. Was es eigentlich ist, weiß ich selbst noch nicht.«
»Wenn Hakim Okla es nicht anerkennen kann, dann hat es keinen Zweck, dass ich Deine Tochter untersuche; er versteht mehr als ich. Was schreibt er vor?«
»Sonne, viel Sonne!«
»Ihr habt doch auch hier eine Sonnenkammer.«
»Aber es soll Morgensonne sein, echte Morgensonne, nicht nur durch Spiegelung hereingebracht.«
»Ja, dann muss eben Deine Tochter fort von hier, auf eine freie Sonnenstation! Ich werde sofort meinen besten Arzt rufen, er wird selbst herkommen und alles Weitere veranlassen.«
»O, Effendi, bist Du ein guter, edler Mann!«, frohlockte jetzt der Alte und suchte die feine Hand zu erhaschen, um sie zu küssen, was ihm verwehrt wurde.
»Weshalb habt Ihr denn das nicht sogleich gemeldet?«
»Wir wollten Dich nicht wegen solcher Kleinigkeit belästigen...«
»Ihr seid Narren, dass Ihr mich so verkennt. In drei bis vier Stunden wird ein Herr hier sein, um sich mit Hakim Okla über Deine Tochter zu beraten.«
Darauf wandte sich Klingsor ab, tickte im Weitergehen auf den Knopf seiner Taschenuhr.
So betrat er den nächsten Raum.
Es war eine Werkstatt, und zwar die eines Künstlers, eines Bildhauers oder Holzschnitzers, eines Modelleurs.
Überall standen, lagen und hingen menschliche und tierische Figuren herum, von den verschiedensten Größen, sowohl riesenhaft wie zwerghaft, indem ein Elefant einmal die Kleinigkeit einer Maus hatte, dann wieder eine Maus meterhoch war.
Diese sämtlichen Figuren waren aus einer weißen Masse modelliert, deren Beschaffenheit nicht so ohne Weiteres zu beurteilen war.
An dem Werktisch saß ein junger Mann mit derbem Kopfe in arabischer Tracht, aber mit nordeuropäischen, germanischen Gesichtszügen, hatte in eine Art Schraubstock einen kleinen Block von jener weißen Masse gespannt, bearbeitete ihn mit Stemmeisen, Messer und Feile, und da ließ sich erkennen, dass sich das Zeug ungefähr wie weicher Speckstein bearbeiten ließ.
Es sollte wohl ein Pferdchen werden, was unter seinen Händen hervorging, die ersten Umrisse ließen sich schon unterscheiden.
»Guten Tag, Martin. Wie geht's? Was macht die Kunst?«
Der so auf deutsch Angeredete blickte nur flüchtig auf.
»Danke, Herr Klingsor. Mir geht es ausgezeichnet, aber mit meiner Kunst bin ich nie zufrieden.«
»Weil Sie eben ein unzufriedener Charakter sind, und das kommt wieder daher, weil Sie eben ein echter Künstler sind. Ihre künstlerischen Leistungen sind doch...«
»Bitte, lassen Sie das, Herr Klingsor«, erklang es etwas verdrießlich. »Sie kommen mir übrigens wie gerufen; ich muss noch einmal Ihre Stirn messen.«
Der Modelleur stand auf und ergriff einen langen Zirkel mit gebogenen Schenkeln, einen sogenannten Taster.
»Ging es denn nicht mit dem Abklatsch, den Sie das letzte Mal von meiner Physiognomie nahmen?«, fragte Klingsor lachend.
»Nein, das ist nicht das Richtige. Der danach gegossenen Maske fehlt die Seele. Denn für mich hat der Kopf selbst, auch die Stirn, eine Seele. Das Lebendige fehlt.«
»Sie haben aber doch schon so manchen Kopf von mir gefertigt, bei dem ich selbst Ihnen gesessen habe.«
»Das ist schon lange her, und unterdessen haben Sie sich doch recht verändert.«
»Meinen Sie? Ich kann wirklich nichts davon merken.«
»Aber ich. Deswegen bin ich mit meinen Leistungen immer unzufrieden.«
Martin hatte schon mit dem Taster an Klingsors Kopf herum gemessen, doch war dies wohl nur Nebensache, am meisten kam es ihm auf den Blick an, wobei er öfters zurücktrat und den Kopf kritisch betrachtete.
Hierbei verglich er einen lebensgroßen Kopf, aus jener weißen Masse gefertigt, der schon Klingsors Züge trug, feilte und raspelte bereits etwas nach.
»Ja, nun hab ich's.«
»Also fertig?«
»Es ist erledigt. Danke. Nun passen Sie auf, wie die nächste Maske ausfallen wird. Ganz anders als die früheren.«
»Ich will dem nicht widersprechen, indem ich wiederhole, dass ich kaum glaube, Sie könnten Ihre Kunst noch übertreffen. Haben Sie jetzt Zeit?«
»Wenn Sie befehlen habe ich immer Zeit.«
»Ich befehle Ihnen niemals etwas.«
»Ich habe Zeit.«
»Da möchte ich Sie für eine halbe Stunde oder vielleicht noch länger in Anspruch nehmen. Ich will Ihnen im Spiegellaboratorium etwas ganz Neues vormachen.«
»Da bin ich gespannt. Wenn ein Loke Klingsor mir wieder etwas ganz Neues vormachen will, das muss wohl etwas ganz Sensationelles sein.«
»Kommen Sie mit, gleich so wie Sie sind, die Vorbereitungen, die ich nötig habe, sind schnell getroffen.«
Wieder einmal saßen Charles Dubois und die Bella Cobra auf dem höchsten Punkte ihrer winzig kleinen Insel inmitten des unermesslichen Salzmeeres.
Es war Vollmond. Ein wundersamer Lichtschein lag über allem, ließ sogar diese trostlose Einöde zu einem Zauberreiche werden.
Schweigend schauten die beiden in die endlose Ferne. Es hatte doch keinen Zweck, immer wieder über die Möglichkeit — oder vielmehr Unmöglichkeit — zu sprechen, von hier fortzukommen. Sie hatten alles erwogen, hatten sogar schon einmal versucht, nachts zu entfliehen, waren aber glücklicherweise rechtzeitig umgekehrt, dass sie wieder auf ihrem Felseneilande waren, ehe die Sonne mit unerbittlicher Glut auf diese Salzwüste hernieder zu brennen begann. Sie wären lebend nicht davongekommen.
Vergeblich hatten sie auch versucht, den Schwarzen auszufragen. Der Mann verstand sie nicht oder wusste nichts, konnte nicht einmal sagen, wie er hierher gekommen war. Das einzige, was ihn beherrschte, aber auch ganz und gar, war die Furcht vor seinem Herrn, dem Hornfisch, und das war erklärlich, angesichts der furchtbaren Striemen und Narben, die seinen Körper bedeckten. Er musste aufs Unmenschlichste gezüchtigt worden sein.
Nahrungsmangel litten die beiden an sich nicht.
Unter der Salzdecke des ehemaligen Sees fanden sie immer noch genügend viele Fische und andere Tiere, und jedes Mal wieder, wenn sie eins hervorholten, stellten sie fest, dass es Süßwassergeschöpfe waren, die hier in dem immer salziger werdenden Wasser jämmerlich zugrunde gegangen waren, aber doch nicht hatten verwesen können. Das Salz hatte sie ganz vortrefflich konserviert, viel besser als zum Beispiel jene Mammutleichen, die im sibirischen Eise gefunden und von den Eingeborenen gegessen werden — Fleisch, das Jahrtausende alt ist!
Jetzt beobachteten die beiden den Schwarzen, der in der Salzwüste umherhuschte, bald hier, bald da nachgrub, also wieder Nahrung sammelte. Er schien nichts zu entbehren, sich nicht fort von hier zu sehnen, seit er wusste, dass er nicht zu hungern brauchte.
»So werden wir die von uns übernommene Aufgabe doch nicht lösen können, Miss Cobra«, sagte Charles Dubois. »Mr. Philipp in New York wird vergebens auf eine Nachricht von uns warten, die Welt wird nie erfahren, wo wir geblieben sind. Mir wird sie ja nicht nachtrauern, mich kennt kaum jemand — aber Sie — Miss Cobra, dass Sie hier so elend zugrunde gehen sollen, das will mir nicht in den Kopf. Ich kann, ich will es auch noch nicht glauben. Es muss eine Möglichkeit geben, dieses Gefängnis zu verlassen!«
Die Tänzerin lächelte wehmütig
»Als wenn mein Tanz — mögen Sie ihn auch mit Recht als Kunst bezeichnen — so wertvoll für die Menschheit wäre!«, entgegnete sie. »Nein, Monsieur Dubois, mich wird man ebenfalls bald vergessen haben. Niemand wird nach mir fragen. Man wird anderen Künstlerinnen zujubeln, und wir wollen uns doch überhaupt nicht darum streiten, wer von uns beiden mehr wert ist als der andere — wenn wir sterben, geht die Erde ihre Bahn weiter wie vorher. Aber etwas fragen möchte ich Sie.«
»Bitte, Miss Cobra!«
»Weswegen sind Sie auf das Angebot des Mr. Samuel Philipp eingegangen? Ich will voraus bemerken, dass ich nicht annehme, das Geld habe Sie gelockt. Bekämen Sie es, Sie wüssten doch nichts damit anzufangen, würden es wahrscheinlich gleich wieder verschenken — an die Armen —«
»Allerdings, das war mein Vorsatz, und weil es so viele gibt, denen ich gern helfen möchte, so —«
Er sprach nicht weiter.
Die Bella Cobra schaute ihn aus ihren großen Augen prüfend an.
»Das habe ich gewusst«, sagte sie leise. »Und welchen Beweggrund mag nach Ihrer Meinung ich gehabt haben?«
Charles Dubois schüttelte den Kopf.
»Darüber steht mir kein Urteil zu.«
»Und wenn ich es doch zu hören wünsche?«
»Ist das Ihr Ernst?«, fragte er.
»Ja, mein voller Ernst. Mir liegt daran, Ihr Urteil zu hören, weil es zugleich ein Urteil über mich sein wird.«
»Nun, dann will ich antworten! Auch Sie haben sich nicht durch die verheißende Belohnung locken lassen, hatten es gar nicht nötig, Sie verdienten ja durch Ihre Kunst genügend — Sie haben den Auftrag angenommen, weil Ihnen dadurch Gelegenheit geboten wurde, einen privaten Zweck zu erreichen.«
»Und dieser wäre?«
»Sie suchen Ihren Vater, obwohl Sie ihm entflohen sind!«
Da lachte die Bella Cobra laut auf. Es war ein seltsam misstönendes Lachen. Es tat dem jungen Mann neben ihr weh, und hastig hob er die eine Hand, als wolle er sie ihr auf den Mund legen, dieses Lachen verstummen machen —
Er ließ die Hand wieder sinken vor dem Blick, der ihn aus ihren Augen traf.
»Monsieur Dubois!«, sagte sie. »Ich habe bisher gedacht, dass jedes Ihrer Worte die reine Wahrheit sei.«
»Und jetzt habe ich gelogen?«, fragte er, und im Schimmer des Mondes sah sie, dass sein braunes Gesicht sich dunkel färbte von aufsteigendem Blute.
Da legte sie ihm eine ihrer Hände auf den Arm.
»Nein! Lüge ist Ihnen fremd. Aber Sie unterdrücken eben die Wahrheit.«
»Weil ich sie nicht als solche anerkennen will! Wenn Sie aber doch hören wollen, was ich noch dachte, nun denn — Sie haben gerade diesen Jim Crawler zu finden gehofft, den Hornfisch, weil Sie mit ihm noch eine alte Rechnung zu begleichen haben.«
»Und sie begleichen werde!«, rief die Tänzerin. »Ich habe Ihnen gesagt«, fuhr sie fort, die Stimme dämpfend, als dürfe niemand außer dem jungen Jäger hören, was sie ihm jetzt offenbarte, »dass ich in der Wildnis Australiens aufgewachsen bin, ich will dem jetzt hinzufügen, dass ich erst als heranwachsende Jungfrau andere Menschen zu Gesicht bekommen habe, als jene, die man im Innern dieses Erdteiles treffen kann — Eingeborene und — Schufte! Entlaufene Verbrecher, habgierige Gesellen, die ihr Leben für nichts erachten, nur nach Gold trachten —
Und mein Vater gehörte zu ihnen. Ich begehe keine Sünde wider das göttliche Gebot, wenn ich ihn einen vollendeten Schuft nenne. Er war es, ist es noch, und das wird Ihnen verständlich werden, wenn Sie hören, dass er meine Mutter an sich lockte, sie Eltern und Verwandten durch teuflische List entfremdete, bis sie nichts anderes kannte als seinen Willen, bis sie ihm entfloh — und ich brauche nur noch hinzuzufügen, dass ihre Eltern sehr, sehr reich waren — nein, sie sind es noch, sie leben und trauern noch jetzt um die verlorene Tochter — aber sie haben sich doch nicht von dem Schurken erpressen lassen, auch dann nicht, als er versprach, ihnen die Tochter wiederzugeben. Aus seiner Hand wollten sie ihr Kind nicht zurückhaben. Sie nahmen an, es sei verdorben. Lieber beklagten sie es als tot —«
Plötzlich stützte die Bella Cobra ihren Kopf auf beide Hände, das Gesicht mit ihnen verhüllend, und Charles Dubois sah, dass ein wehes Schluchzen ihren geschmeidigen Körper erschütterte.
Er schwieg, sprach kein Wort des Trostes, weil er wusste, es war zwecklos. Er wartete nur, bis sie die Hände sinken ließ.
»Aber meine Mutter erkannte den Schurken, durchschaute ihn — zu spät — sie trug mich bereits unter dem Herzen, und da gab es für sie natürlich kein Zurück mehr, sie wusste, dass sie Strafe verdient hatte, und als solche nahm sie die Gemeinschaft mit diesem Manne hin, blieb bei ihm, nicht mehr als seine Frau, und er — hat sie nicht wieder anzurühren gewagt, hätte vielleicht gern gesehen, wenn sie ihn verließ — sie blieb. Zu den Menschen konnte sie nicht zurück. Sie erzog mich —
Welch ein Leben hat sie geführt! Was sind alle Höllenstrafen gegenüber der entsetzlichen Buße, die sie freiwillig auf sich nahm!
Umgeben von dem Auswurf des Menschengeschlechts zog sie rastlos mit ihrem Mann durch die Steppen, die Berge des Innern, nur einen Wunsch noch hegend: dass ich — ihr geliebtes Kind — einst in die Welt zurückkehren könnte! Und immer wusste sie die Strolche von sich abzuwehren, die sie belästigten, wie nur eine einsame Frau belästigt werden kann. Sie erfuhr, dass eines Nachts die Männer um sie gespielt hatten. Jim Crawler hatte sie gewonnen, wollte seine Rechte geltend machen. Aber sie hatte ein Messer bei sich. Mit dem stieß sie ihn nieder, als er — mit Vorwissen meines Vaters — über sie herfiel — und da — hat er ihr Rache geschworen — eines Tages fand ich sie tot im Scrub — ermordet, erwürgt, grausam entstellt — und Jim Crawler war der Mörder.
Mein Vater züchtigte ihn nicht, freute sich nur, dass ein anderer vollbracht hatte, was er nicht selbst zu tun gewagt hatte. Ich habe meiner Mutter das einsame Grab bereitet, habe sie hineingebettet und habe seitdem auf die Stunde der Rache gewartet.
Kurze Zeit darauf glückte meinem — Vater ein reicher Fund. Er entdeckte Gold in einsamen Bergen, seine Habgier überwucherte alle seine anderen niedrigen Triebe — sie waren ihrer acht damals — als ich entfloh waren noch zwei am Leben, die anderen —«
Wieder verbarg die Tänzerin auf kurze Zeit ihr Gesicht in den Händen, dann aber stieß sie hervor:
»Sie sind von den anderen beiden vergiftet worden, damit sie keinen Anteil hätten an dem Golde, und auch die Überlebenden trachteten danach, sich gegenseitig aus dem Wege zu räumen, aber sie waren beide zu misstrauisch, sie hätten sich geradezu im Zweikampfe messen müssen, und dazu waren sie zu feig. Und da schlug Jim Crawler seinem Gefährten, seinem Mordgenossen, einen Handel vor — sie wollten spielen. Gewann Jim Crawler, so sollte er den dritten Teil des bereits erbeuteten Goldes erhalten und — mich! Aber er musste dann das Lager sogleich verlassen, durfte nie mehr zurückkehren —
Und ich erlauschte das.
In derselben Nacht floh ich. Was ich damals ausgestanden habe, wird nie ein Mensch erfahren, nicht, was mir später geschah. Aus Indien kam ich wieder nach Australien, als die Bella Cobra, die ich noch bin, und Ihnen, Monsieur Dubois, brauche ich nicht zu sagen, warum ich diesen Namen wählte. Ich will ihm Ehre machen, habe ihm Ehre gemacht — aber Sie werden nun wissen, warum ich auf das Angebot Mr. Samuel Philipps einging, warum ich mich Ihnen anschloss —«
Sie schwieg.
Auch Charles Dubois sprach nicht, aber seine Hände ballten sich, und dann schaute er nach der Gegend, in welcher der Segelschlitten des Hornfisches verschwunden war.
Er hob nicht drohend die Faust, sprach keinen Schwur aus, wenigstens nicht vernehmbar, aber furchtbar finster war sein Gesicht, und seine blauen Augen blitzten.
Er stand auf, reckte sich.
Und da zuckte er auch schon zusammen, fasste mit seiner rechten Hand den einen Arm der Tänzerin, dass diese unter dem harten Griff sicher Schmerzen empfand, und mit der anderen Hand deutete er hinaus in die Salzwüste.
»Dort kommt er!«, murmelte er zwischen den aufeinandergebissenen Zähnen, sich auch schon duckend gleich einem Raubtier, das zum Sprunge ansetzt — und dann zog er die Bella Cobra neben sich nieder.
Sie lagen auf dem Steinboden, nur den Kopf so weit hebend, dass sie in die Ferne spähen konnten, wo die scharfen Augen des Jägers ein sich bewegendes Etwas entdeckt hatten, das sich mit großer Schnelligkeit bewegte, näher und näher kam, aber nicht auf geradem Wege, sondern das in weiten Bogen die kleine Insel in der Salzwüste umkreiste —
Die beiden wussten sofort, was es war.
Der Segelschlitten Jim Crawlers.
Dieser kam, um sich die Gewissheit zu holen, dass die beiden tot seien!
Und noch etwas beobachteten diese beiden.
Sie sahen, dass auch Wumbo, der Schwarze, den Schlitten erspäht hatte, sahen ihn noch einen Moment wie gelähmt aufrecht stehen, dann aber niedersinken und mit größter Hast nach den Felsen kriechen.
»Wir müssen ihn festhalten«, flüsterte Charles Dubois der Tänzerin zu. »Er fürchtet den Schurken dort draußen —«
Er konnte nicht vollenden, was er hatte sagen wollen.
Aus der Gegend, wo der Segelschlitten sichtbar war, jetzt vielleicht noch zweihundert Meter von den Felsen entfernt, stieg eine rote Rakete.
Wumbo, der schon ganz nahe an die Zufluchtsstätte gekommen war, blieb regungslos liegen.
Auch er hatte die Feuerbahn der Rakete gewahrt. Jetzt schien er zu warten.
Da stieg die zweite Rakete.
Jäh sprang der Schwarze auf.
Er wollte fort, wollte in hündischem Gehorsam hinausrennen zu seinem Peiniger, der ihn durch die Raketen zu sich gerufen hatte.
Zu welchem anderen Zwecke, als ihn auszufragen?
Und wenn Wumbo sagte, dass die beiden noch lebten?
Er sollte nicht dazu kommen.
Charles Dubois hatte sogleich erkannt, was die Raketen bedeuteten, und ehe die zweite noch aufgestiegen war, war er auf dem Felsen lautlos bis dicht hinter den Schwarzen gekrochen, gefolgt von der Bella Cobra —
Wumbo sprang auf, schickte sich an, zu laufen.
Da traf ihn ein schwerer Hieb auf den Schädel.
Sofort brach er zusammen, keineswegs aber betäubt — nur durch den Schreck gefällt — entsetzt starrte er auf Charles Dubois, der ihn bereits band.
Sein beschränkter Verstand vermochte nicht zu fassen, dass dieser Mann, der immer so gütig gegen ihn gewesen war, ihn nun so furchtbar drohend anblicken konnte.
Charles Dubois aber kümmerte sich den Teufel um diese Gedanken des Schwarzen, band ihn, dass er sich nicht rühren konnte, und hielt ihm dann das blitzende Messer vor die Augen.
»Du stirbst, sobald Du einen Laut von Dir gibst!«, raunte er ihm zu.
Wumbo erbebte, erwiderte nichts; verstanden hatte er, wusste auch, was es heißen sollte, als Charles Dubois nun das Messer an die Bella Cobra gab und diese sich neben ihn duckte, die Spitze der Klinge ihm auf die Brust setzend.
»Jetzt können wir ihn heranlocken«, flüsterte Charles Dubois seiner Gefährtin zu. »Wenn der Schwarze nicht zu ihm kommt, so weiß er nicht, woran er ist, muss annehmen, dass wir alle drei verhungert sind, und dann wird er sich hierher wagen — Ducken Sie sich noch mehr. So!«
Sie lagen wieder nebeneinander, in die Wüste hinausspähend, in der sie jetzt deutlich das eigenartige Fahrzeug gewahrten.
Ihre Herzen klopften laut, aber das konnte der dort draußen nicht hören. Er konnte sie auch nicht sehen, ihre Körper hoben sich nicht im Geringsten von dem Gestein ab, und sie lagen regungslos wie dieses.
Jim Crawler, der Hornfisch, wie er sich nannte, wartete noch.
Vielleicht nahm er an, dass der Schwarze schlief.
Oder hatte er doch die einsame Gestalt schon erblickt gehabt?
Jedenfalls blieb er, wo er war.
»Wie er jetzt fluchen mag!«, zischte Charles Dubois seiner Nachbarin zu.
Da krachte ein Schuss.
Die beiden sahen den Feuerstrahl aus dem Rohre fahren.
Und wieder wartete der Hornfisch auf das Erscheinen seines Sklaven.
»Jetzt muss sich's entscheiden!«, murmelte Charles Dubois.
Und es entschied sich!
Aber anders, als er vermutet hatte.
Von dem Segelschlitten löste sich etwas ab — ein Tier —
»Er hat einen Hund mitgebracht!«, stieß der junge Mann hervor. »Den schickt er jetzt ab, dass er den Schwarzen zu ihm bringt. Die Bestie ist sicher darauf abgerichtet —«
»Und wir?«, fragte die Tänzerin.
»Noch weiß ich es nicht«, gab Charles Dubois zurück. »Nur das eine weiß ich, dass er mir nicht entgehen wird!«
Dann schwiegen sie wieder, sahen den Hund über die Salzfläche auf die Felseninsel zukommen, erkannten immer mehr, dass es ein mächtiges Vieh war, größer als jene beiden, die Jim Crawler anfangs bei sich gehabt hatte.
Bald hörten sie das Hecheln seines Atems, auch der Schwarze vernahm es, sie erkannten es an dem Zittern seines Leibes, brauchten ihm gar nicht in das angstverzerrte Gesicht zu schauen.
Die Entscheidung nahte.
Beide wussten genau, wenn jetzt der Hund nicht zu Jim Crawler zurückkehrte, dann war dieser doch gewarnt, dann wendete er den Schlitten und entfloh, kam nie wieder oder erst nach langer Zeit, wenn er sich vollkommen sicher wähnen durfte —
Was war da zu tun?
Wer sollte da einen Entschluss fassen?
Charles Dubois streckte seine rechte Hand seitwärts.
Die Bella Cobra verstand ihn sofort, legte das Heft des Messers hinein —
Und dann stand das gewaltige Hundevieh vor den beiden, starrte sie aus glühenden Augen an, anscheinend überrascht — der Wind hatte ihm keine Witterung bringen können, da er hinter ihm gewesen war —
Und ehe das Tier sich besinnen und springen konnte, war es schon erledigt.
In Todeszuckungen lag es auf dem Boden, dicht vor den beiden —
Und da sah die Bella Cobra auch schon ihren Gefährten emporspringen und davonrennen —

Und da sah die Bella Cobra auch schon ihren
Gefährten emporspringen und davonrennen.
Nein, das war kein Rennen mehr. Die Redensart sagt, er flog wie ein Pfeil. So war es hier. Noch nie hatte die Bella Cobra einen Menschen so laufen sehen.
Sie selber sprang auf. Ein Verbergen hatte keinen Zweck mehr, seit Charles Dubois dort über die Salzwüste rannte. Der Hornfisch musste ihn doch gleich gewahrt haben — da durfte er wissen, dass auch sie noch lebte —
Und so sah die Bella Cobra, wie der Segelschlitten sich auf einmal wieder in Fahrt setzte.
Das ging nicht schnell im Anfang, er musste erst wenden —
Aber dann wollte er voller Schnelligkeit davonsausen. Jim Crawler wusste doch, was ihm bevorstand, wenn Charles Dubois ihn einholte —
Aber er fühlte sich vollkommen sicher.
Die Bella Cobra hörte sein höhnisches Lachen durch die stille Nacht, sie sah ihn davonsausen —
Aber sie sah auch Charles Dubois hinter ihm, und laut jubelte sie auf, als sie gewahrte, dass er nicht zurückblieb, dass die Entfernung zwischen ihm und dem Schlitten sich nicht vergrößerte —
»Wenn er ihn doch packen könnte!«, stieß sie hervor.
Aber sie wusste auch schon, dass die Lungen dieses jungen Mannes, mochten sie auch noch so gut sein, auf die Dauer nicht mit der Schnelligkeit des Schlittens sich messen konnten, dessen Lunge das Segel war, von dem üblichen Nachtwind voll aufgebläht —
Und Jim Crawler hätte seinem Verfolger entkommen müssen, hätte er nicht jetzt das Gewehr gehoben und einen Schuss auf ihn abgefeuert.
Nur einen Augenblick hatte er das Steuer losgelassen, aber dieser eine Augenblick genügte —
Der Schlitten beschrieb einen Bogen, legte sich nach der einen Seite über, stieß gegen irgendein Hindernis, kam einen Moment zum Stehen —
Zwar hatte Jim Crawler nun schon wieder das Steuer in der Hand, aber es war doch zu spät.
Ohne sich um den auf ihn abgefeuerten Schuss zu kümmern, stürmte Charles Dubois weiter, erreichte den Schlitten —
Und dann hatte er den Insassen gepackt.
Der Hornfisch war gewiss kein Schwächling. Feigheit hätte ihm auch niemand nachsagen können, aber diesmal erbebte doch selbst sein schurkisches Herz, als er den jungen Mann im Sprunge durch die Luft schnellen sah —
Und dann war es zu jeder Gegenwehr für ihn zu spät, nicht einmal den Schlitten konnte er mehr unbrauchbar machen, indem er ihn gegen einen Felsen rennen ließ.
Von der rechten Faust des Jägers getroffen, brach er bewusstlos zusammen, einen seiner gottlosen Flüche auf den Lippen —
Charles Dubois aber griff nach der Segelleine, löste sie von dem Pflock, das Segel schlug in den Wind, der Schlitten fuhr noch ein kurzes Stück, kam zum Stehen —
Inzwischen war der Hornfisch bereits gefesselt, dass er sich nicht zu rühren vermochte, und als er wieder zu sich kam, musste er merken, dass der Segelschlitten wieder in voller Fahrt dahinsauste, sah, sich mühsam etwas aufrichtend, am Steuer Charles Dubois sitzen —
Da freilich brüllte er laut auf vor Wut, riss an seinen Fesseln und überschüttete, als er sie nicht zu sprengen vermochte, seinen Überwinder mit einer Flut von Verwünschungen und Flüchen.
Charles Dubois achtete nicht auf ihn.
Er hatte, wie er der Bella Cobra erzählte, schon einmal einen ähnlichen Segelschlitten besessen, wusste mit dem Segel umzugehen, erkannte aber auch, dass er bei dem gegenwärtig herrschenden Winde nur durch Kreuzen an die Insel herankommen könnte.
Das würde eine langwierige Geschichte werden, und er wollte doch die Bella Cobra nicht unnütz warten lassen.
Da befolgte er die Taktik, die auch der Hornfisch angewendet hatte; er fuhr in Kreisen, die sich ständig beträchtlich verengerten, kam seinem Ziele schneller als durch Kreuzen näher und gewahrte auch, wie die Tänzerin ihm zuwinkte, hörte ihre jubelnden Rufe —
Da aber vernahm er noch etwas —
»Mr. Dubois!«, rief der Hornfisch, und als er keine Antwort erhielt, wiederholte er den Ruf, um nun hinzuzusetzen: »Sie haben mich überlistet und überwunden, ich gebe es zu, aber zum Teufel, warum können wir uns denn nicht wieder vertragen? Ich habe Ihnen einen schlimmen Streich gespielt, aber doch nur, weil Sie meine Hunde töteten und sich in Dinge mischten, die Sie nichts angingen — nun wollen wir meinetwegen quitt sein — oder ich biete Ihnen noch ein Lösegeld — ich kenne Goldadern hier in der Nähe — unerschöpflich, sage ich Ihnen —«
Charles Dubois hatte nicht einmal ein Lächeln bitterster Verachtung für diesen Schuft, achtete lediglich auf den Schlitten, fuhr den vorletzten Kreis, den letzten — und dann hielt das Fahrzeug vor der Felseninsel.
Die Bella Cobra stand vor ihm, streckte ihm beide Hände entgegen und schaute ihn an. Da brauchte sie kein einziges Wort zu sagen, da wusste er, was in ihrem Herzen für ihn lebte, und so erwiderte er den Druck ihrer Hände.
Dann hob er seinen Gefangenen heraus, legte ihn aus den harten Boden, nicht gerade sanft. und dann löste er erst einmal die Fesseln Wumbos.
Er hatte vorausgesehen, dass dieser nun einen Fluchtversuch machen würde, hielt ihn noch zur rechten Zeit fest und führte ihn zu dem Hornfisch, dass er sich überzeuge, wie unschädlich dieser geworden war.
Doch Wumbo zitterte immer noch an allen Gliedern, als er vor seinem Peiniger stand, und da Charles Dubois den armseligen Menschen nicht weiter quälen wollte, gab er ihn frei, lächelte, als er sich in der Höhle verkroch.
»Ach, da ist ja auch Miss Cobra!«, hob jetzt Jim Crawler wieder an, so recht freundlich, dass es die beiden Hörer anwiderte. »Wie mich das freut, dass Sie nicht nur noch leben, sondern auch wohlauf sind. Jaja, ich bin immer noch hitzig, kleine —«
Er verstummte jäh.
Die Bella Cobra stand unmittelbar vor ihm. Ihre Augen funkelten ihn an.
»Sobald Du meinen Namen aussprichst, ist es Dein letztes Wort gewesen!«, raunte sie ihm zu. »Wehe Dir, Jim Crawler, wenn Du —«
Sie richtete sich auf. Jetzt erst erkannte sie, dass sie eine große Torheit begangen hatte, sie las es in dem hämischen Gesicht des Gebundenen. Jetzt hatte sie ihm eine Waffe wider sich in die Hand gegeben.
War es denn wirklich so schlimm, wenn Charles Dubois erfuhr, wie sie hieß?
Mit dem Vornamen nur, den die Mutter ihr gegeben hatte! Den Familiennamen ihrer Mutter kannte auch er nicht und würde ihn nie erfahren.
»Nur unbesorgt, ich verrate ihm nichts, wenn Du es nicht willst!«, zischelte da auch der Hornfisch schon wieder. »Ich habe ja gar nichts gegen Dich, war nur wütend, weil ihr beide mir Vorschriften machen wolltet, und ich wusste doch auch, dass ihr nicht verhungert wart. Wenn ich nicht gleich mit dem Schlitten herankam, so wirst Du das doch verstehen, das gebot die einfachste Vorsicht, Du hast doch gehört, dass es hier Feinde gibt, die auch ich fürchten muss — also sei vernünftig und löse mir die Fesseln oder bewirkte, dass er mir sie löst — ohne mich könnt Ihr ja doch nichts hier anfangen, wisst nicht, wohin ihr Euch wenden sollt — nein, nein, Ihr braucht mich, und ich will Euch ja gern helfen, habe doch auch ein Interesse daran, weil ich mir die Million Dollar verdienen will.
Und ich weiß, wo wir diesen Loke Klingsor finden!«, setzte er in ganz geheimnisvollem Flüstertone hinzu.
Die Bella Cobra aber antwortete ihm nicht ein Wort, sondern schaute zu, wie ihr Gefährte den Schlitten untersuchte und allerhand heraushob, was er darin gefunden hatte. Jim Crawler hatte eine Menge Nahrungsmittel sowie einige Wasserfässchen darin verstaut gehabt, die letzteren also erst nachträglich, denn sie waren bei der ersten Fahrt nicht vorhanden gewesen.
Was aber suchte Charles Dubois sonst noch in dem Fahrzeug, weil er immer noch darin umherkramte?
Die Bella Cobra hätte ihn fragen können, aber sie wollte nicht neugierig erscheinen, sondern warten, bis er ihr Aufschluss gab, deswegen blieb sie, wo sie war, und so musste sie anhören, was Jim Crawler ihr zuraunte.
»Hast Du gehört?«, fragte er eben. »Ich weiß, wo wir den Loke Klingsor finden und überrumpeln können. Ihr beide würdet ihn niemals entdecken, aber ich führe Euch hin, natürlich nur als freier Mann.
Und dann — ich weiß auch, wo Dein Vater jetzt ist!«
Da er die Tänzerin aufs Schärfste beobachtete, so sah er, wie sie bei den letzten Worten zusammenzuckte, und wieder lächelte er hämisch.
»Das hast Du wohl nicht erwartet?«, fuhr er fort. »Aber ich lüge nicht! Und ich will Dir auch noch etwas verraten. Damals, als Du in der Nacht flohst, hast Du doch nicht Zeit gefunden, das mitzunehmen, was Du gern haben wolltest, die Papiere Deiner Mutter, ihren Trauschein, ihr Gebetbuch, dessen freie Blätter sie als Tagebuch benutzt hatte. Dein Vater hatte ihr alles entwendet, weil er wusste, nicht eher würde sie ihn verlassen, als bis sie diese Papiere wieder an sich gebracht hätte, und sie hat auch oft genug danach gesucht, aber nie etwas gefunden.
Hahaha, der Mann war viel zu gerissen für sie, er hatte die Papiere an einen sicheren Ort gebracht, wo niemand sie so leicht finden kann, und dort liegen sie noch.
Ich aber kenne diesen Platz und kann Dich hinführen.
Natürlich nur unter der Bedingung, dass Ihr mich freigebt, sonst verrate ich nichts, und Du wirst nie erfahren, wer Deine Großeltern sind —«
»Schweig!«, herrschte sie ihn da drohend an. »Jedes Deiner Worte ist eine Lüge! Und wenn Du nicht still bist, so werde ich Dich zum Schweigen bringen, Dich einfach knebeln!«
»Na ja, das kannst Du ja tun«, höhnte er, »aber die Worte, die ich Dir eben gesagt habe, werden Dir doch keine Ruhe lassen, werden Dir immer im Kopfe rumgehen, und wenn es eines Tages zu spät sein wird, dann wirst Du bitter bereuen, dass Du nicht auf meinen Vorschlag eingegangen bist —
Und bedenke doch, was Du da eintauschen kannst! Deine Großeltern würden Dich mit offenen Armen aufnehmen —«
Da stand die Bella Cobra auf, nahm ihr Taschentuch, das ja freilich nicht mehr weiß war, und setzte sich dicht neben den Gebundenen.
»Was sagtest Du eben?«, fragte sie, scheinbar nunmehr auf seine Vorschläge eingehend.
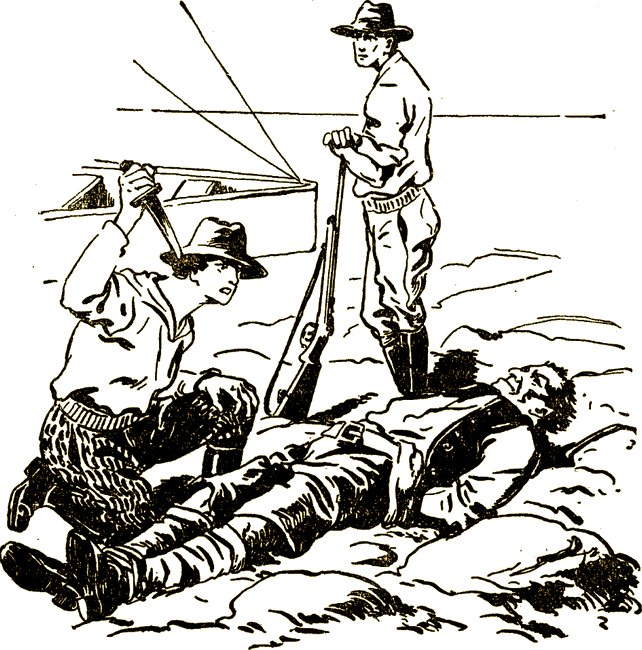
Doch kaum öffnete er den Mund, da fuhr ihm auch schon ihre Hand hinein, verstopfte ihn mit dem Taschentuch — und es nützte ihm gar nichts, dass er sie noch tückisch zu beißen suchte —
So war er stumm gemacht. Die Bella Cobra kümmerte sich gar nicht mehr um ihn, ging nun zu dem Schlitten, in dem Charles Dubois immer noch hantierte, und berührte ihn leicht mit einer Hand.
»Was suchen Sie noch?«, fragte sie ihn.
Er wendete sich ihr zu.
»Nichts, Miss Cobra. Ich muss nur alles ausräumen, um festzustellen, ob nicht etwas gebrochen ist. Sie haben ja wohl bemerkt, wie der Schlitten draußen gegen einen Felsen prallte. Da kann leicht etwas gebrochen sein, und bevor wir das nicht ausgebessert haben, können wir nicht fort.«
»Sie haben aber bisher nichts gefunden?«
Er schüttelte den Kopf.
»Dann suchen Sie nicht länger! Ist etwas entzwei, so können Sie es doch nicht ausbessern, Sie haben weder Werkzeuge noch Holz, und mich treibt es mit aller Gewalt fort von hier! Ich gestehe es ganz offen.«
»Wie mich!«, gab er zu. »Ich möchte nur die Verantwortung nicht tragen.«
»Und wenn ich Sie von ihr losspreche?«
Er lächelte wehmütig.
»Das würde uns nicht vor einem entsetzlichen Tode in der Wüste schützen«, erwiderte er. »Wir haben doch keine Ahnung, wie weit diese sich noch vor uns erstreckt, welche Gefahren sie birgt —«
»Dann müssen wir hierbleiben!«
Da verstand er sie sogleich, nahm die Büchsen, die er herausgeräumt hatte, legte sie wieder an ihren früheren Platz, räumte auch die Wasserfässchen wieder hinein und sagte dann:
»Nun wollen wir unser Eigentum holen und dann losfahren!«
»Und was wird aus dem Hornfisch?«
Eine Minute zauderte Charles Dubois mit der Antwort, dann sagte er:
»Ursprünglich wollte ich ihn hier zurücklassen, aber ich habe mich anders entschlossen. Wenn Sie nichts dagegen haben, nehme ich ihn mit.«
»Ich habe nichts dagegen«, versetzte die Tänzerin, und nun war diese Sache zwischen ihnen erledigt.
Sie holten ihre Habseligkeiten, hoben den Gefesselten in den Schlitten und legten ihn dort nieder, dann suchten sie den Schwarzen, fanden ihn aber nicht, konnten sich auch nicht seinetwegen noch groß bemühen und überließen ihn also sich selbst. Zu leben hatte er ja.
So bestiegen sie den Schlitten. Charles Dubois brauchte nur einen Blick nach dem Monde zu tun, da wusste er, wohin er den Kurs nehmen musste, und eine Minute später sauste das seltsame Fahrzeug in voller Fahrt davon, in die Wüste hinein —
Keins der beiden sprach ein Wort, auch dann nicht, als die Nacht dem Tage wich, als die Sonne am Himmel emporstieg.
Jedes wusste von dem andern, dass sie auch jetzt noch dem Tode nahe waren, dem entsetzlichsten Tode, den ein Mensch sich nur auszumalen vermag, aber es lohnte sich doch gar nicht, darüber zu reden. Sie mussten eben sehen, ob Gott sie schützen würde, und so fuhren sie schweigend dahin.
Jetzt konnte Charles Dubois zeigen, dass er den Segelschlitten ebenso meisterhaft zu lenken wusste, wie der Hornfisch es getan hatte. Auch er vermied trotz der rasenden Schnelligkeit der Fahrt alle Hindernisse, die vor ihm auftauchten, und die Brillen mit den abgetönten Gläsern schützten beide vor dem furchtbar grellen Lichte, das von den Salzkristallen widerstrahlte.
Im Übrigen blieb die Wüste dieselbe, die sie vom ersten Tage kannten. Sie stellten auch hier fest, dass die dicke Salzschicht fast vollkommen durchsichtig war, sodass sie alle die eingeschlossenen Tiere erkennen konnten, flüchtig allerdings nur, da sie eben zu schnell vorübersausten —
Und so verging der Tag, währenddessen sie nur einmal gegessen, ebenso auch nur einmal den ausgedörrten Gaumen durch einen Schluck Wasser angefeuchtet hatten.
Jim Crawler aber ließen sie dursten.
Ob er litt oder nicht, war ihm nicht anzusehen. Er hatte die ganze Zeit dagelegen, als schliefe er, aber sowohl die Bella Cobra als auch Charles Dubois wussten, dass er schon öfters Durst ertragen hatte, noch länger als jetzt. Sie durften kein Erbarmen mit diesem Elenden haben.
Von dem, was sie beide durch die schier unerträgliche Sonnenglut auszustehen hatten, sprachen sie selbstverständlich nicht, ebenso wenig von der Pein, die das fortgesetzte Spähen in die Ferne ihnen verursachte. Ihre Augen brannten trotz der Schutzbrille. Auch sie fühlten sich verlockt, die Lider wenigstens minutenlang zu schließen, aber sie wagten es nicht, sie wussten, dass Tod und Leben davon abhing.
So viel wird erzählt von der furchtbaren Not, der Schiffbrüchige auf dem Meere ausgesetzt sind, wie sie tagelang, wochenlang im Boote treiben, immer wieder hoffend, dass endlich ein Segel, eine Rauchfahne auftauchen würde, ihnen die nahe Rettung verkündend, wie sie immer wieder vergebens auslugen, stets von Neuem enttäuscht, wie ihre Verzweiflung wilder und wilder wird —
Es ist auch genugsam geschildert worden, was Reisende in Sandwüsten auszustehen hatten, aber nur einer hat so recht anschaulich berichtet, wie es ihm in einer Salzsteppe ergangen ist: Sven Hedin.
Aber wer das gelesen hat und einige Phantasie besitzt, der wird diese Bilder des Schreckens nicht mehr los, nie wieder, kann viele Nächte davon träumen.
Charles Dubois und die Bella Cobra kannten vielleicht dieses Buch, hatten es auch gelesen, sie kannten ebenso schon diese Salzwüsten Inneraustraliens und wussten, dass noch kaum je ein Mensch aus ihnen zurückgekommen war, aber noch nie hatten sie für möglich gehalten, dass es welche von so ungeheurer Ausdehnung geben könnte.
Wenn ihr Segelschlitten wenig zurücklegte, so waren es doch durchschnittlich zehn bis fünfzehn Kilometer in der Stunde, und sie waren mit dem Hornfisch schon eine ganze Nacht hindurch gefahren, ehe sie an jene Felseninsel gekommen waren. Sie selber waren seit Tagesanbruch unterwegs, und wenn sie die Fahrtdauer auf vierzehn Stunden schätzten, so ergab das doch eine zurückgelegte Strecke von wenigstens zweihundert Kilometern!
Zweihundert Kilometer Salzwüste in gerader Linie!
Eine Ungeheuerlichkeit, die niemand sich vorstellen kann!
Und als der Abend ihnen Halt gebot, sahen sie noch kein Ende!
Nicht einmal, dass am Horizonte aufgetürmte Wolkenmassen ihnen ein fernes, rettendes Gebirge vortäuschten!
Nichts, nichts, nichts sahen sie als diese endlose Ebene, viel entsetzlicher als die schlimmste Sandwüste, denn da gibt es doch wenigstens Dünen, die den Ausblick hemmen, die endlosen Weiten nicht so trostlos erscheinen lassen.
Aber hier, dieser Boden eines früheren ungeheuren Süßwassermeeres mochte an sich noch so uneben gewesen sein, mochte neben gewaltigen Abgründen auch wieder Untiefen ausgewiesen haben — zu sehen war nichts mehr davon — das durch den übermäßigen Salzgehalt erstarrende Wasser hatte alles überdeckt, hatte im Erstarren eine vollkommene Ebene gebildet, aus der nur noch hier und da die höchsten Spitzen von einigen Klippen hervorragten, als niedrige Felsblöcke!
Als der Segelschlitten in der Nähe eines solchen Felsblockes hielt, sprang Charles Dubois als Erster heraus, erklomm den Stein und hielt Umschau.
Er sprang alsbald wieder herab, und als die Bella Cobra ihn anschaute, da brauchte sie ihn nicht erst zu fragen, da wusste sie, dass er noch kein Ende erschaut hatte.
Aber sie hatten Wasser, sie hatten zu essen.
Was sollten sie da verzagen?
Vor allem sicherte Charles Dubois den Segelschlitten, indem er den Eisenbolzen herauszog, um den das Steuer sich drehte, und ihn zu sich steckte.
Nun konnte niemand mehr den Schlitten benutzen, ihn wenigstens nicht steuern.
Dann setzten sie sich, öffneten eins der Wasserfässchen, füllten sich jedes einen der kleinen Zinnbecher, die kleinen Zinnbecher, die sie bei sich führten, und leerten ihn in langsamen Zügen, immer wieder absetzend, mit dem Hochgenuss, mit welchem der Kenner einen edlen Wein genießt.
»Wasser!«, sagte Charles Dubois leise. »Nie habe ich so klar wie eben jetzt erfasst, dass alles Leben auf Erden aus ihm hervorgeht. Ich las einmal vor Jahren eine Geschichte, in ein orientalisches Gewand gekleidet. Ein Kalif war von einem Kriegszuge heimgekehrt, hatte seinen Nebenbuhler besiegt, der gefesselt mit anderen Gefangenen im Saale lag, und versprach dem das eroberte Reich, der ein Rätsel lösen würde.
»Was ist das?«, sprach er. »Es ist in euch, es ist um euch, und ihr seht es nicht, aber wenn es euch ganz umgibt, dann müsst ihr sterben.
Ihr seht heute hinaus, und es ist nicht da, und morgen erschauet ihr nicht sein Ende.
Es ist weich wie ein Zephir und hart wie der härteste Stein.
Heute achtet ihr es gleich einem Nichts, und morgen gäbet ihr euer Leben darum, wenn ihr es hättet.
Es gebiert tausend Leben, es zerstört tausend Leben und wandelt tausend Leben in ein Nichts. Nun sagt mir des Rätsels Sinn!«
Und die Helden ringsum wussten es nicht, aber der gefangene Kalif stöhnte: »Wasser!« und hatte sein Reich zurückgewonnen, ohne dass er es ahnte.
Charles Dubois schwieg, nahm eine der Konservenbüchsen, öffnete sie mit dem Messer, schüttete den Inhalt in einen Zinknapf und bot ihn seiner Gefährtin.
Sie sprachen nicht mehr von dem seltsamen Rätsel, aber ihre Gedanken arbeiteten weiter, sannen nach, wo all dieses Wasser, das einst hier Wellen geschlagen hatte, geblieben war, welche Katastrophe sein Verschwinden bedingt hatte, sie konnten es nicht enträtseln.
Schweigend aßen sie und tranken noch einmal.
Dann ging Charles Dubois zu seinem Gefangenen.
Die Bella Cobra folgte ihm, ohne zu wissen, warum.
Und als sie beide vor Jim Crawler standen, da sahen sie, dass er die Augen offen hatte, und sie erschraken vor dem Blicke, der sie aus diesen Augen traf.
Eine solche boshafte Tücke hatten sie noch aus keinem Menschenauge funkeln sehen. Einem Satan schien dieses ledergelbe Gesicht zu gehören.
Trotzdem bückte sich Charles Dubois und nahm dem Hornfisch den Knebel.
Einen Becher voll Wasser hielt er in der Hand und setzte ihn nun an die Lippen des Mannes.
Entsetzlich mussten die Durstesqualen Jim Crawlers sein. Er hatte sich tagsüber nicht vor der sengenden Sonnenglut schützen können, hatte den Knebel im Munde gehabt —
Aber er trank nicht.
Fest presste er die Lippen aufeinander.
Charles Dubois hätte das Wasser verschüttet, hätte er es ihm einflößen wollen, ohne ihm vorher den Mund gewaltsam zu öffnen.
Da zog er den Becher zurück.
»Wie Ihr wollt, Jim Crawler!«, sagte er ganz ruhig.
Da aber tat dieser doch wieder den Mund auf, nicht, um nun doch um einen Trunk zu betteln, sondern er lachte heiser, es klang wie das Krächzen eines Raben.
Und während er die beiden abermals mit satanischer Bosheit betrachtete, stieß er hervor:
»Ihr Narren alle beide! Hängt Euch! Schießt Euch eine Kugel ins Hirn! Hahaha! Ihr wollt die Erbarmenden spielen und mich kränken? Weil Ihr denkt, das Wasser reicht ja doch?
Hahaha! Ich kenne das Geheimnis, wie man ohne zu trinken durch diese Salzwüste kommt! Ihr kennt es nicht! Und Euer Wasser wird Euch nicht retten! Verdursten werdet Ihr, elend verkommen.
Auf den Knien werdet Ihr vor mir liegen, mir die Fesseln lösen und mich winselnd anflehen, dass ich Euch netten soll!
Ich Euch! Nicht Ihr mich!
Aber ich werde Euch verdursten lassen! Umkommen sollt Ihr in tausend —«
Da schob Charles Dubois dem heiser Brüllenden ganz gelassen den Knebel wieder in den Mund, dass er verstummen musste, stand auf und ging zu der Stelle am Felsen zurück, wo sie eben gesessen hatten.
Dort setzte er sich, als hätte er nicht eben diese furchtbaren Drohungen gehört, zog sein Pfeifchen, stopfte es, wollte es anbrennen, besann sich, schaute die Tänzerin fragend an und setzte erst dann das Feuerzeug in Tätigkeit.
Alsbald stiegen die blauen Rauchwölkchen des wohlriechendem Tabaks empor.
»Wenn Sie schlafen wollen, Miss Cobra, so rate ich Ihnen, sich im Schlitten niederzulegen«, sagte er dann.
»Weil das Holz dort doch etwas weicher ist als der Boden hier?«, entgegnete sie und lachte dabei ganz heiter. »Nein, Monsieur Dubois, ich bleibe bei Ihnen.«
Und schon streckte sie sich auf dem Boden aus, bettete das Haupt auf einen Arm, schloss die Augen und schien sofort einzuschlafen, hob jedoch noch einmal den Kopf und sagte.
»Schlafen Sie wohl, Monsieur Dubois!«
»Danke, ebenfalls!«, klang es zurück.
Dann wurde es wieder still umher.
Ganz hoch über den beiden leuchteten die ewigen Sterne in funkelnder Schöne. Der Mond stieg am Horizonte auf, und mit ihm kam ein kühler Wind, der dem einsamen Träumer wohl tat —
Bewegungslos saß er da, bewegungslos lagen auch die Bella Cobra und etwas zurück Jim Crawler.
Ob er schlief?
Charles Dubois kümmerte sich nicht darum. Er wusste, dass er wachen musste, für sich — für sie —
Und er ließ die Gedanken wandern, wohin sie wollten, sie flogen durch unermessliche Weiten, kehrten aber immer wieder zu der einen Stelle zurück —
Niemand sah, wie die Blicke des einsamen Mannes immer wieder zu der Gestalt der Tänzerin hinüberwanderten, wie es in seinen Augen stets aufleuchtete, wenn er sie betrachtete.
Die Pfeife war ausgebrannt, er klopfte sie leer, steckte sie ein und streckte sich ebenfalls aus, aber immer wieder stand er auf, machte einen kurzen Rundgang, erstieg auch von Zeit zu Zeit den Steinblock und spähte umher —
Niemals gewahrte er etwas anderes als was er im Tageslichte gesehen hatte.
In drohendem Schweigen lag die Wüste vor ihm.
Aber als er das letzte Mal den Block erstiegen hatte und in die Ferne spähte, nach Westen hinüber, da legte er doch plötzlich eine Hand über die Augen.
»Welcher Stern geht so spät noch auf?«, murmelte er.
Ganz weit dahinten sah er ein ruhiges, rötliches Licht, nicht größer als ein Stern —
Lange schaute er hinüber, er konnte seine Blicke nicht lösen von diesem leuchtenden Pünktchen, und als er herabstieg, murmelte er.
»Dich will ich mir als Wegleiter nehmen!«
Er berührte die Bella Cobra leicht. Sie sprang sogleich empor.
»Guten Morgen!«, rief sie lachend. »Der Schlaf hat mir sehr gut getan!«
Ihr strahlendes Aussehen bezeugte anscheinend die Wahrheit ihrer Versicherung und doch hatte sie nicht eine Minute geschlafen, hatte immer wieder ihren treuen Gefährten beobachtet, wenn er sich erhob — und alle ihre Gedanken hatten ihm gegolten, wie die seinen ihr —
»Nun wollen wir frühstücken und die Fahrt antreten«, sagte Charles Dubois. »Heute aber werden wir, falls wir noch nicht das Ende der Wüste erreichen, das letzte Mal tagsüber fahren. Solange der Mond noch am Himmel erscheint, mag er uns künftig leuchten, und — ewig kann ja die Fahrt nicht mehr dauern. Einmal muss auch diese Wüste ihr Ende erreichen.«
Da schaute sie ihn an, fasste auch gleich seine beiden Hände.
»Was wollen Sie noch wissen, Miss Cobra?«
Sie zögerte einen Augenblick.
»Zunächst möchte ich Sie bitten, nennen Sie mich nicht mehr so. Meine Mutter nannte mich Grace —«
»Grace« bedeutet im Englischen so viel wie Gnade, Gunst, Huld. »Our gracious queen« hieß die Königin, »unsere huldvolle Königin«, aber da war immer der Nebengedanke an unser — allerdings auch nicht deutsches — Wort »graziös«.
Und daran musste Charles Dubois jetzt zuerst denken, als Franzose erst recht!
Wie dieser Name stimmte und zu ihr passte!
Aus der wilden Tänzerin war eine andere geworden, nicht etwa ein schüchternes Mädchen, aber doch eine schlichte, jungfräuliche Maid, von einem wunderbaren Zauber umwoben —
»Grace!«, murmelte der junge Jäger.
Und als seine Blicke den ihren begegneten, da errötete er, was ihm sehr gut stand.
»Hahahaha!«
Das misstönende Lachen des Hornfisches schreckte die beiden auseinander.
Überrascht sah Charles Dubois zu ihm hin, auch etwas verärgert.
Wie konnte der Mann lachen, da er doch den Knebel im Munde hatte?
Ja, wie konnte er lachen?
Das Taschentuch der Bella Cobra, das als Knebel gedient hatte, lag neben ihm auf dem Boden. Der Hornfisch musste auf irgendeine Weise fertiggebracht haben, es herauszustoßen.
Charles Dubois trat nicht zu seinem Gefangenen.
»Vielleicht wäre es das Beste, wir ließen ihn hier, nachdem ich ihm die Fesseln gelöst habe«, murmelte er. »Da könnte er gleich einmal beweisen, dass er Durst ertragen kann —«
»Ohne Waffen wollen Sie ihn zurücklassen?«, fragte die Bella Cobra.
Da war es entschieden.
Charles Dubois näherte sich Jim Crawler, bückte sich, ihn aufzuheben.
Da aber lachte der Mensch wiederum so tückisch und boshaft auf.
»Müht Euch nicht, Dubois! Lasst mich nur getrost liegen! Nicht einmal die Riemen braucht Ihr mir abzunehmen! Ich verrecke nicht! Den Gefallen sollte ich Euch beiden tun? Ich denke nicht daran! Wir wollen doch noch abrechnen miteinander —
Fahrt nur! Geht zum Teufel!
Und denkt an mich! Hahaha! Vergesst nicht den Hornfisch!
Oder habt Ihr beiden gar keine Gedanken mehr? Habt Ihr Euch denn noch nicht gefragt, warum ich mich gerade Hornfisch nenne, he?
Ich will es Euch sagen: weil ich, wie dieses Tier, noch leben kann, wenn alle anderen Geschöpfe zugrunde gehen, elend verschmachten!«
Da schob Charles Dubois ihm nicht wieder den Knebel in den Mund.
»Wir werden Euren Wunsch erfüllen und Euch liegen lassen«, sagte er.
»Recht so! Und auf Wiedersehen! Auf baldiges, fröhliches Wiedersehen!«, grölte der Mann.
Charles Dubois war es, als ränne ein kalter Schauer über seinen Rücken, er wusste nicht, woher das kam —
»Kommen Sie, Miss Grace«, sagte er sich aufrichtend und schritt bereits zu dem Schlitten, das Wenige an sich nehmend, was sie aus diesem herausgenommen hatten.
Die Tänzerin erhob keinen Einwand mehr, folgte ihm, setzte sich auf den nun schon gewohnten Platz, Charles Dubois sah nach dem Wind, gab die Segelleine frei, der Wind füllte die Leinwand, der Schlitten warf sich auf die Seite und sauste davon — wieder hinein in die endlos erscheinende Salzwüste, und hinter den beiden erscholl zum letzten Male das hämisch klingende Lachen des Hornfisches.
Sie achteten nicht darauf, sprachen auch kein Wort deswegen miteinander, vergaßen alles andere bei der sausenden Fahrt, und so verging der Vormittag.
Charles Dubois aber hielt diesmal einen anderen Kurs als tags zuvor.
Ihm war, als sähe er auch jetzt noch bei leuchtendem, grellem Sonnenschein das geheimnisvolle Licht, das er in der Nacht wahrzunehmen geglaubt hatte.
Und als die Sonne am heißesten hernieder brannte, so gegen zwei Uhr, da geschah es.
Die Salzwüste war in der letzten Zeit ebener geworden als vorher, das heißt, eben nur, dass nun auch die aus ihr hervorragenden Steine fehlten.
Nicht die geringste Erhebung war mehr sichtbar gewesen, kein Felsen erhob sich aus ihr —
Aber in der Ferne war immer ein Gleißen und Blinken gewesen, dass die beiden trotz der Schutzbrille nur ungern dorthin geblickt hatten. Die Augen schmerzten von diesem grellen Glast —
Und nun erkannten sie, was das zu bedeuten gehabt hatte.
Die mit Stahlbändern beschlagenen Schlittenkufen glitten auf einmal nicht mehr flink über die Salzfläche hin.
Sie schnitten in diese ein!
Immer tiefer!
Und als Charles Dubois sich hinausbeugte, da sah er es. Nicht von einer starren Salzkruste mehr war hier die Rede, sie waren bereits in einen Salzsumpf geraten.
Gewaltig erschrak der junge Mann.
Nach sekundenlangem Zögern riss er das Steuer herum, das er bisher einfach festgebunden hatte, da es eben keinem Hindernis mehr auszuweichen gegeben hatte.
Jetzt aber —
»Wir haben den Eisenbolzen verloren!«, stieß er hervor.
Und so war es.
Er hatte den langen, nagelförmigen Bolzen an der letzten Raststätte herausgezogen, ihn aber vor der Abfahrt wieder eingeschoben. Vielleicht hatte er das etwas nachlässig getan —
Aber wenn auch! Der Bolzen trug am oberen Ende einen dicken Kopf. Er konnte gar nicht nach unten durchrutschen, musste also bei einer schnellen Bewegung herausgeschleudert worden sein —
Charles Dubois ließ das Segel fahren.
Noch eine kurze Strecke schlidderte das Fahrzeug in dem Salzbrei dahin, dann kam es zum Stehen.
»Warten Sie im Schlitten, bis ich zurückkomme!«, sagte Charles Dubois zu seiner Gefährtin.
»Sie wollen den Bolzen suchen? Wissen Sie denn wenigstens ungefähr, wo Sie ihn verloren haben können?«, fragte die Bella Cobra, ohne das geringste Zeichen von Erregung oder gar Furcht.
»Keine Ahnung!«, erwiderte er. »Aber ich muss ihn finden —«
Er sprang hinaus.
Bis über die Knie sank er in den dicken Brei, und als er den einen Fuß herausziehen wollte, merkte er, wie schwer ihm das ward!
Hätte er sich nicht am Schlitten halten und so emporziehen können, er wäre stecken geblieben!
Von einem Zurücklaufen war keine Rede.
Nicht einen Meter weit wäre er gekommen.
Ratlos schaute er um sich.
»Ich bin sehr unachtsam gewesen«, murmelte er.
»Wir müssen versuchen, sofort zu wenden, ehe der Schlitten tiefer und tiefer einsinkt«, rief die Bella Cobra.
»Ohne den Bolzen?«
»Dann schnitzen wir einen! Nur rasch! — Hier ist ein Stück hartes Holz!«
Sie hatte es liegen sehen, reichte es ihm, und er zog auch sein Messer und begann zu schnitzen — hastig genug —
Er erkannte alsbald, dass er nicht mit der Arbeit zustande kommen würde, bevor es nicht schon zu spät war.
Als er hinausschaute, sah er, dass die Kufen des Segelschlittens schon bis über die Hälfte versunken waren.
Er griff nach dem Steuer, versuchte es zu drehen —
Es stak ebenfalls schon unlösbar in dem zähen Brei, ließ sich nicht mehr bewegen.
Da stellte er das Segel ein, gab seiner Gefährtin die Leine.
»Ich will sehen, dass ich das Steuer lösen kann!«
Das Segel füllte sich allerdings sofort, die Gewalt des Windes reichte sogar aus, den Schlitten noch ein Stück vorwärts zu treiben, ihn also aus dem Salzsumpfe zu reißen, auch das Steuer kam frei, blieb aber immer noch zur Hälfte in dem Hemmnis stecken —
Und so sehr sich Charles Dubois einstemmte, er vermochte nicht, dem Schlitten eine andere Richtung zu geben.
»Lassen Sie los!«, rief er.
Das Segel flappte wieder zur Seite.
Und der Schlitten sank tiefer und tiefer.
Sie brauchten nur hinauszusehen, da gewahrten sie es.
Das kurze Stück, das sie noch weitergeglitten waren, hatte genügt, sie noch tiefer in den Sumpf zu bringen, noch gieriger schluckte dieser jetzt die Beute.
»Wie Treibsand!«, murmelte Charles Dubois.
Er schaute um sich, nach allen Richtungen.
Was er sah, war trostlos. Sie staken schon zu weit im Sumpfe, als dass sie hätten hoffen dürfen, watend bis an sein Ende zu gelangen.
Und was hätten sie erreicht, wenn ihnen das geglückt wäre?
Wie sollten sie zu Fuße die ungeheuren Strecken wieder zurücklegen, die sie in dem Fahrzeug so leicht überwunden hatten?
Noch dazu bepackt mit den Wasserfässchen, mit dem Proviant?
Es war aussichtslos.
»Soll Jim Crawler recht behalten mit seiner Verwünschung?«, fragte die Bella Cobra leise. »Er hat gewusst, wohin wir geraten würden —«
Da reckte Charles Dubois sich auf.
»Niemals soll dieser Schuft triumphieren!«, stieß er hervor.
Eine Axt lag im Schlitten. Die packte er und hieb auf die Stelle los, wo die dritte Kufe, die in die Luft ragte, mit dem übrigen Gestell verbunden war.
Die Bella Cobra schaute verwundert zu, begriff nicht, warum ihr Gefährte das Fahrzeug nun erst recht unbrauchbar machte. Aber sie schwieg.
Und dann wusste sie, was Charles Dubois plante.
Die Kufe war getrennt. Ehe sie in den Sumpf fallen konnte, winkte Charles Dubois der Tänzerin, sie zu packen. Sie zogen sie in den Schlitten.
»Jetzt brauchen wir nur noch zwei Staken jedes, um uns vorwärts zu stemmen«, sagte er, riss schon die Segelstange heraus und zerteilte sie mit wuchtigen Hieben in vier Stücke.
Die Bella Cobra begriff.
Diese Bohle war zwar schwer, aber auch breit genug, um sie vor dem Einsinken zu schützen, wenn sie sich daraufstellten. Dann konnten sie sich mit den Stöcken vorwärtsschieben —
Es war ein verzweifeltes Beginnen, aber gewagt musste es werden.
Sie stiegen aber noch nicht aus.
Charles Dubois überlegte, was er mitnehmen sollte.
Wasser vor allem. Dann die Waffen.
Ob die Last da nicht zu groß wurde?
Und er brauchte auch noch Seile — die Segelleine mindestens!
Er löste sie ab, wickelte sie sich erst um den Leib, band sie aber wieder.
Ein Gedanke kam ihm, der ihm verheißungsvoll erschien.
»Bleiben Sie noch im Schlitten, Miss Grace! Ich will versuchen, den festen Boden wieder zu erreichen und den Schlitten rückwärts zu ziehen!«
Sie wendete nichts ein.
Charles Dubois ließ die Bohle draußen nieder, stellte sich darauf, band das Ende der Segelleine an dem Schlitten fest, ergriff zwei Stöcke und stieß sich vorwärts.
Es ging, mühselig zwar, aber es ging — er kam langsam weiter.
Und dabei wickelte er die Segelleine ab, immer weiter —
Ja, er stand endlich auf festem Boden, die Leine reichte zum Glück bis dorthin, und nun begann er zu ziehen, aus Leibeskraft, und er war stark —
Vergebens! Der Schlitten rührte sich nicht!
»Noch einige Minuten und die Kufen sind ganz verschwunden!«, rief die Bella Cobra.
Noch keine Handbreite hatte Charles Dubois die Leine einholen können. Er sah ein, dass seine Anstrengung zwecklos war.
»Ich komme zurück!«, antwortete er, und wieder glitt er auf der Bohle über den Sumpf.
Er brauchte lange, ehe er den Schlitten wieder erreicht hatte, und da sah er, dass die Kufen schon vollständig verschwunden waren. Über ihnen hatte der zähe Brei sich wieder geschlossen.
Vielleicht bot der Schlitten selbst genügend Widerstand, dass er nicht versinken konnte?
Was hätte das genützt?
Es hätte nur die Qual des Sterbens verlängert!
Des Sterbens?
Die beiden hatten dem Tode nicht nur einmal bereits ins Auge geschaut, sie fürchteten ihn nicht, und — sie wussten, dass er nur die nimmt, die ihm zu entfliehen suchen.
Sterben? Jetzt?
Alles in Charles Dubois bäumte sich auf. Er warf einen raschen Blick auf seine Gefährtin.
Dort drüben, das Gleißende, musste Wasser sein. Wenn sie hinkamen und schwimmen könnten, jenseits festen Boden fanden?
Wenn dort vielleicht auch die Salzwüste zu Ende war?
Sehen konnte er es nicht, die glitzernde Fläche blendete zu heftig.
»Kommen Sie, Miss Grace!«, sagte er. »Geben Sie mir eins der Wasserfässchen! Reicht es nicht, bis wir auf festem Boden sind, nun, dann —«
Sie verstand ihn.
Er schnürte sich das Fässchen auf den Rücken, schob in seine Taschen einige Konservenbüchsen.
Fertig!
Der Tod nimmt auch Menschen mit leeren Magen.
»Und der Hornfisch soll doch nicht frohlocken dürfen!«
Das war der letzte Gedanke Charles Dubois', als er der Tänzerin auf die Bohle half.
Sie stellten sich beide an das hintere Ende, ein kurzes Stück voneinander entfernt — da hob sich das vordere, schwachbelastete, glitt leichter als sonst über den Salzbrei.
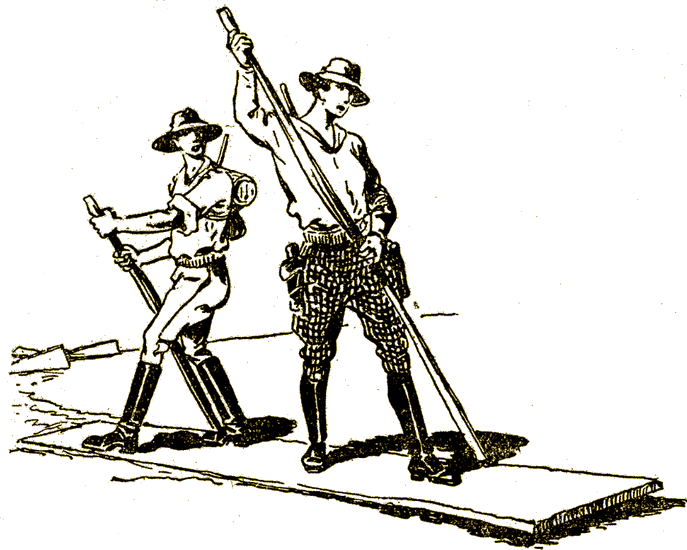
Nur eine Furcht war in dem jungen Manne.
Wenn die Stöcke keinen Grund mehr fanden und sie sich nicht mehr weiterstoßen konnten?
Nun, dann war eben doch das Ende da, versüßt nur durch die Gewissheit, dass sie mit ihm ging — sie — die Bella Cobra —
Sie stakten dahin. Es ging besser, als sie gedacht hatten.
Näher und näher kamen sie der glitzernden Fläche.
Es war wirklich Wasser!
Ein See inmitten der Salzwüste, der Rest des einstigen Meeres?
Und die schwere Bohle glitt hinein, erst in seichtes Wasser, das sie nicht trug, das über ihr zusammenschlug — aber sie sanken doch nicht —
Und dann schwamm die Bohle!
»Bleiben Sie oben, Miss Grace!«, rief Charles Dubois, als er schon in das Wasser glitt. »Ich schiebe schwimmend, das Wasser ist tief genug!«
Und so tat er.
Die Bella Cobra streckte sich lang aus, so die Last verteilend, ihr Gefährte schob sie schwimmend vorwärts — zuerst nur daran denkend, möglichst weit von dem Sumpf fortzukommen —
Wassertretend löste er das Fässchen vom Rücken.
Dabei schaute er einmal in das Wasser.
Er traute seinen Augen nicht.
Fische? Waren das wirklich Fische?
Er täuschte sich nicht.
Im nächsten Augenblick schöpfte er mit der hohlem Hand von dem Wasser.
Er trank.
»O, Wunder über Wunder!«, jubelte er. »Miss Grace, wir schwimmen in Süßwasser! Schöpfen Sie! Trinken Sie!«
Die Bella Cobra sprang auf, ihre dunklen Augen glänzten.
Wahrhaftig, das waren Süßwasserfische! Ganz bekannte Arten.
Und in dem Wasser sah sie es außerdem noch grün schimmern — auch Pflanzenwuchs gab es drin, der freilich dem Meerwasser ebenfalls nicht fehlt, im Ozean wachsen ja sogar die größten Pflanzen, die die Erde überhaupt hervorbringt, die Riesentange, die viele hundert Meter lang werden —
Die Bella Cobra schöpfte aber nicht mit der Hand, in ihrer Freude sprang sie doch lieber gleich kopfüber hinein in die Flut, tauchte auch einmal —
Charles Dubois wollte es ihr eben nachtun, ihn packte der Übermut der Freude, er verwandelte sich in einen Jungen, der mal der strengen Aufsicht entronnen ist. Da aber kam die Tänzerin schon wieder empor, und erschrak.
Das schöne, von Sonne und Luft gebräunte Gesicht war ganz aschfahl, die Augen schauten verstört —
Sofort war er bei ihr.
»Was haben Sie, Miss Grace? Hat eine plötzliche Schwäche —«
Sie aber packte ihn mit beiden Händen an den Schultern, selber wassertretend, und dann näherte sie ihren Mund seinem Ohre — so dicht, dass es ihn durchschauerte — ihre heftig atmende Brust wogte gegen seinen Arm, er spürte es —
»Miss Grace!«, rief er.
»Still! Sprechen Sie nicht! Ich habe ihn gesehen —«
Verständnislos schaute er sie an.
»Ihn? Wen denn?«
Da berührte der Mund der Bella Cobra sein Ohr.
»Den wir suchen!«, lispelte sie, dass es nur wie ein Hauch war.
Er starrte sie an.
Seine Lippen formten den Namen, ohne ihn auszusprechen.
»Loke Klingsor?«
Sie nickte.
Da fasste er sie, zog die nicht Widerstrebende mit sich nach der Bohle, die ein Stück vor ihnen auf dem Wasser trieb. Beide schwangen sich hinauf.
»Nun sprechen Sie, Miss Grace!«, bat er, und aus dem Klange seiner Stimme hörte sie, wie er sich ängstigte.
Da musste sie lachen, leise nur, aber es war ihr Lachen, das er so liebte.
Er atmete auf.
»Gott sei Dank!«, sagte er auch noch.
»Sie glaubten, mein Verstand sei verwirrt?«, fragte sie.
Er nickte nur. Bei der Sonnenglut, die auf sie herabgebrannt hatte, wäre das kein Wunder gewesen.
Sie lachte abermals, wurde jedoch gleich ernst.
»Ich hätte allerdings gleich wahnsinnig werden können bei dem Anblick, den ich hatte —«
»Sie sahen etwas, als sie tauchten?«
»Ja — — ich war ziemlich tief, drei, vier Meter, hatte die Augen offen, wollte eben nach einem vorüberschießenden Fische greifen, da stand vor mir plötzlich das Bild —«
»Ein Bild?«, rief Charles Dubois und schaute sie wieder misstrauisch an.
»Ich kann es nicht anders nennen. Ich sah einen Mann auf einem Stuhle sitzen —«
»Unter Wasser?«
»Auf seiner Schulter eine mächtige schwarze Katze —«, fuhr die Bella Cobra fort. »Nein, unterbrechen Sie mich nicht mehr — ich sah die beiden so deutlich, wie ich Sie vor mir sehe, und wenn ich sagte, es sei ein Bild gewesen, so war das nicht der richtige Ausdruck — die beiden schauten mich an, der Mann und die Katze, und die dunklen Augen des Mannes flammten, während ein Lächeln diesen drohenden Blick wieder milderte —
Ach, Monsieur Dubois! Was für ein Gesicht das war! Ich kann es ja gar nicht beschreiben.
Haben Sie einmal den ›Faust‹ gesehen?«
Der junge Mann nickte.
»Da kennen Sie doch den Teufel, der sich ihm zugesellt, den Mephisto?«
Charles Dubois nickte.
»Genau so sah der Mann aus — wie ein Teufel, der sich über mich lustig machte — ich kann es ja nicht beschreiben.«
Und ehe ihr Gefährte etwas bemerken konnte, fuhr sie fort:
»Er lächelte mich an, mit furchtbar drohenden Augen, und die der ungeheuren schwarzen Katze glühten, und beide waren lebendig, bewegten sich, die Katze zuerst — sie stand auf der einen Schulter des Mannes, nun aber setzte sie sich, genau wie Katzen das machen, zog die Vorderpfoten unter sich — und der Mann winkte mir, streckte die Hand nach mir aus —
Ich könnte ihn malen — eine schwarze Samtjacke, eine weiße Weste, eine dünne schwarze Schnur darauf nach der der Westentasche —«
Noch ganz entsetzt schaute sie wieder in das Wasser, und Charles Dubois auch. Es war doch vollkommen klar, sonst hätten sie nicht die Fische darin hin und her schießen sehen. Nur bis auf den Grund konnten sie nicht blicken, es war eben zu tief, und die Bella Cobra hatte ja selbst gesagt, dass sie drei bis vier Meter getaucht war, da muss der Mensch schon ziemlich hoch stehen, wenn er bis auf den Boden eines solchen Gewässers schauen will.
Sie wunderten sich also nicht, dass sie nichts sahen, am wenigsten Charles Dubois, der immer noch glaubte, seine Gefährtin sei das Opfer einer Sinnestäuschung gewesen.
Plötzlich stand er auf, hob schon die Arme über den Kopf, um, diesen voran, in die Flut zu springen, da wendete er sich noch einmal seiner Gefährtin zu.
»Wie kommen Sie auf den Gedanken, dass dieser Mann Loke Klingsor ist?«, fragte er.
»Hat Mr. Philipp Ihnen denn nicht sein Bild gezeigt?«, lautete die Gegenfrage.
»Nein, er versprach es mir nur, hat aber sein Wort bisher noch nicht eingelöst —«
»Nun, ich habe sein Bild zu sehen bekommen. Mr. Philipp warf es durch einen Projektionsapparat an die Wand, aber es blieb auch da ein Bild, nur genau so, ich ich es eben sah — lebend —«
Da musste Charles Dubois lachen.
»Wenn Sie das gleich gesagt hätten, Miss Grace!«, rief er.
»Sie meinen immer noch, ich hätte nur eine Sinnestäuschung gehabt?«
Er nickte, noch lachend.
»Nein, nein, nein! Das war Leben, Monsieur Dubois! Er winkte mir —«
»Und doch haben Sie geträumt, mit offenen Augen meinetwegen — unsere Seele lässt sich da nichts befehlen, sie arbeitet, wie es ihr gefällt —«
Er konnte nicht weitersprechen.
Entsetzt starrte er auf einmal in das Wasser.
Aus diesem kam es herauf, langsam, aber ganz deutlich —
Auch er sah das Bild, den Mann mit der Katze, den furchtbar drohenden Blick der großen dunklen Augen, das spöttische Lächeln, die glühenden Katzenaugen.
Er wäre fast rückwärts von der Bohle getaumelt —
Mit beiden Händen strich er sich über die Stirn, in das Wasser starrend.
Und da klang aus diesem heraus eine Stimme, wie er sie noch nie vernommen hatte, tief, schwingend, wie Glockenton —
»Ich bin der, den Ihr beide sucht, Loke Klingsor! Ihre Augen täuschen Sie nicht, Mr. Dubois, wie die der Bella Cobra sich nicht täuschten. Greifen Sie doch zu! Sie suchen mich ja, wollen hinter mein Geheimnis kommen — hier bin ich!«
Und noch drohender als vorher flammten die Augen in dem Mephistogesicht, noch spöttischer, hohnvoller wurde das Lächeln.
Dann aber fuhr die prachtvolle Stimme fort:
»Glaubt Ihr beiden armseligen Menschenkinder wirklich, dass Ihr einen Loke Klingsor überrumpeln könntet? Seit Ihr mein Reich betreten habt, habe ich Euch beobachtet, ich habe Euch in den Salzsumpf geführt, und nun hierher, und wenn ich Euch verderben will, so werdet Ihr mir nicht entrinnen!
Aber Ihr seid keine Schurken, ich weiß, dass die verheißene Belohnung Euch nicht lockte, jedes Eurer Gespräche habe ich belauscht, jeden Eurer Gedanken kenne ich —
Und nun hört zu, hört meinen Befehl!
Ihr bleibt auf diesem See, schwimmt nicht nach dem Ufer, wartet, bis Ihr geholt werdet, fügt Euch ohne den geringsten Widerstand in das, was Euch geschieht! Vergesst nicht, dass ich Euch immerfort beobachte, und wenn Ihr in Not geratet, so verzagt nicht, ich bin bei Euch, ich helfe Euch, aber haltet die Augen offen, prägt Euch genau ein, was Ihr seht! Ich werde Euch prüfen, ganz eingehend, und besteht Ihr diese Prüfung nicht, dann —
Nun, das werdet Ihr ja dann sehen! Seid Ihr bereit?«
Die beiden standen lauschend, fassungslos, sahen das »Bild« im Wasser, hörten die Stimme — sie wussten nicht. was sie denken sollten —
Charles Dubois aber raffte sich nun doch zusammen.
»Eine Frage noch!«, sagte er.
Es war eine Probe, die er machen wollte. Er glaubte doch, jetzt hätte auch er nur eine Sinnestäuschung, sein Gesicht, sein Gehör äfften ihn, und wenn er sich nun zu einer Frage aufraffte und keine Antwort bekam, dann war eben klar, dass er nur träumte.
»Wir waren nicht allein«, sagte er.
»Nein, Sie hatten diesen hier bei sich!«, klang es aus der Tiefe des Sees, und wiederum prallte der junge Mann ganz erschrocken zurück, als er nun fast unmittelbar vor sich den Hornfisch sah, Jim Crawler, genau so, wie sie ihn zuletzt gesehen hatten, hämisch grinsend — hasserfüllt —
Und trotzdem ließ Charles Dubois sich nicht verblüffen.
»Was tut dieser Mann jetzt?«, fragte er.
Und wieder tauchte ein Bild auf.
Jim Crawler lag auf dem Boden, gebunden, dass er sich nicht befreien konnte, einem furchtbaren Tode preisgegeben, den er selbst herausgefordert hatte, und doch schien er durchaus nicht verzweifelt, er schien auf einen Befreier zu warten, der sicher kommen musste —
Plötzlich aber verzerrte sich sein Gesicht auf unbeschreibliche Weise.
Ganz deutlich sah Charles Dubois, sah auch die Bella Cobra, wie die Mienen des Mannes angstvoll wurden, wie seine Augen nach oben schauten, ja, sie merkten sogar, dass er zu lauschen schien — —
Und dann gab er sich alle erdenkliche Mühe, sich seitwärts zu rollen!
Sie gewahrten, wie er sich mit den gefesselten Händen vom Boden abstieß —
Und dann sahen sie ihn auf einmal emporschweben, es war keine Täuschung, das war doch auch gar nicht möglich, es lässt sich genau unterscheiden, wenn so ein gebundener Mensch, der nichts weiter ist als ein hilfloser Packen, in der Mitte seines Körpers gepackt und gehoben wird — wie da die Beine nach unten hängen, der Kopf, der Oberleib, und nur die Mitte des Körpers sich emporreckt —
Ja, der Hornfisch wurde durch eine unsichtbare Gewalt gehoben, und immer mehr von furchtbarster Angst entstellt ward sein hässliches Gesicht —
Bis er auf einmal mitten in der Luft verschwand!
Von einer Täuschung konnte gar keine Rede sein.
Die beiden, hier auf der Bohle stehend, mitten in dem See, sahen ganz, ganz deutlich, bis auf die kleinste Einzelheit, die Stelle, wo sie den Gefangenen zurückgelassen hatten. Dort lagen auch die Konservenbüchsen, die sie geleert und natürlich liegen gelassen hatten —
Und sowohl Charles Dubois als auch die Bella Cobra hatten zu lange in der Wildnis gelebt, dass sie gelernt hatten, jede Stelle, die sie einmal gesehen hatten, ihrem Gedächtnis einzuprägen. Da hängt doch manchmal das Leben davon ab —
Nein, das war der Platz, wo der Hornfisch zurückgeblieben und nun in der Luft verschwunden war! Da gab es nicht den geringsten Zweifel.
Trotzdem ließ der junge Jäger sich noch nicht überzeugen.
»Was haben Sie soeben gesehen, Miss Grace?«, fragte er.
»Etwas ganz Wunderbares!«
»Wer sind Sie? Ein Zauberer?«, stöhnte Charles Dubois auf.
»Loke Klingsor!«, lautete die Antwort. »Aber genug jetzt! Auch Sie werden alsbald in die Luft entführt werden, Sie werden den Hornfisch wiedersehen —«
»Ausgeschlossen!«, rief Charles Dubois, während die Bella Cobra sich still verhielt.
»Man wird Sie in ein Land bringen, das noch kein Mensch betreten hat, kein Mensch nach Ihnen wieder betreten wird. Ich will Sie nicht auf die Folter spannen.
Haben Sie schon einmal gehört, dass Australien früher mit dem asiatischen Kontinent zusammengehangen hat, dass diese Landbrücke durch eine furchtbare Katastrophe zerstört wurde?«
»Ja, das weiß ich.«
»Und wie hieß dieses verschwundene Land?«
»Lemurien.«
»Recht! Und die Bewohner dieses verschwundenen Erdteiles werden Sie alsbald kennen lernen, die Reste — denn nicht alle sind damals zugrunde gegangen, eine ganze Anzahl konnte sich retten, hierher — ins tiefste, unbekannteste Innere Australiens.
Genug davon! Binnen weniger Minuten werden Sie solche Lemuren sehen — und was Sie bei diesen erleben, das will ich von Ihnen erfahren —«
Die Stimme verklang, das Bild zerrann.
Charles Dubois und die Bella Cobra starrten in reines, klares Wasser, in dem sich munter die zahlreichen Fische tummelten —
Und dann schauten sie einander an, fassungslos, beide ganz bleich.
Aber ehe sie ein Wort sprechen konnten, spürten sie beide, dass sich ihnen etwas nahte — am Luftdruck — sie sahen, dass sich etwas auf dem Wasserspiegel niederließ — es war, als würde von oben her etwas daraufgesetzt.
Bis auf einmal vor ihnen ein Luftschiff auftauchte, eine Art Wasserflugzeug — der Körper fischförmig —
Und aus diesem Körper kamen durch eine Tür Menschen —
Ach, nein, Menschen waren das nicht, wenngleich sie wie Menschen aussahen — schöne, ernste Gesichter mit strahlenden, blauen Augen — lange blonde Haare bis auf die breiten Schultern hängend — aber riesengroß —
Die beiden mussten zu ihnen emporschauen und waren doch selbst über das Durchschnittsmaß gewachsen —
Und wie ein silbernes Schimmern ging es von diesen Gestalten aus, von ihren Kleidern —
Nein, das waren auch keine Kleider! Das war etwas, was wie eine Haut sich dicht an ihren Leib schmiegte —
Lemuren?
Gab es wirklich auf der Erde noch solche Wesen aus einer längst, längst versunkenen Zeit?
Charles Dubois und die Bella Cobra standen regungslos, sie staunten und staunten, sahen diese Menschen über das Wasser auf sich zukommen, ohne einzusinken —
Und da streckten sich Hände nach ihnen aus, fassten sie, führten sie — und die beiden schritten ebenfalls über das Wasser, ohne zu sinken — gingen in das Flugzeug hinein und — sahen als Erstes darin — den Hornfisch —!
O'Donnell und die Olinda schritten hinter ihrem Führer her gleich Kindern, die zur Weihnachtsbescherung geholt werden. Die Sängerin erbebte innerlich vor Freude.
Die Alhambra sollte sie sehen? Das Ziel ihrer Sehnsucht?
Sie zweifelte nicht daran nach dem, was sie hier schon hatte schauen dürfen, hatte eigentlich schon ganz vergessen, weswegen sie eigentlich hierher gekommen war. Es stand jedenfalls bei ihr fest, dass sie nichts Feindliches gegen diesen liebenswürdigen Mann unternehmen würde, gegen diesen Loke Klingsor —
Anders sah es noch in O'Donnell aus, der als Mann ja anders dachte als seine Begleiterin. Er hatte sein Wort verpfändet —
Sie sollten beide noch eine ganz andere Überraschung erleben, als sie erwartet hatten.
Ihr Führer blieb plötzlich stehen.
Immer war ihr Weg von dem magischen Lichtscheine erleuchtet gewesen, und der Raum nun, in dem sie eben weilten, machte ganz den Eindruck eines kleinen Saales, die Steinwände waren nach orientalischer Sitte mit bunten, recht kostbar scheinenden Teppichen verhangen. Teppiche verhüllten auch den Boden. Sogar die Decke war unter Geweben verborgen. Eine farbige Ampel hing herab, und sie konnten nicht unterscheiden, ob ein Licht darin brannte.
Hier also blieb der Führer stehen, wendete sich zu den beiden um und sagte:
»Ich muss um Entschuldigung bitten. Soeben erhalte ich einen Befehl, den ich erst entgegennehmen muss.«
Einen Befehl?
Die beiden schauten ihn erstaunt und verwundert an. Wie sollten sie das verstehen?
Der junge Mann machte zwar ein Gesicht, als lausche er der Stimme eines Unsichtbaren, aber weder O'Donnell noch die Olinda vernahmen das Geringste.
»Sie sollen — Verzeihung! — Ich soll Sie bitten, mit in einen Raum zu gehen, der nicht auf dem ursprünglich vorgeschriebenen Wege liegt. Sind Sie bereit dazu?«
Die beiden wussten nicht, was sie darauf antworten sollten. Sie wussten ja überhaupt nicht, was man mit ihnen vor hatte, es war ihnen nur gesagt worden, sie sollten nach der Alhambra kommen.
Ihr Führer merkte ihre Unentschlossenheit. Er lächelte.
»Ich darf Ihnen leider keinen Aufschluss geben, aber wenn Ihnen mein Rat angenehm ist, dann —«
»Selbstverständlich gehen wir mit!«, rief da die Olinda. »Ich vertraue Ihnen und Ihrem Herrn vollkommen!«
Der junge Mann verbeugte sich, ohne sich noch mit Worten zu bedanken, und da die Olinda sich entschieden hatte, blieb ihrem Gefährten nichts anderes übrig, als sich ihrem Entschlusse zu fügen.
»Führen Sie uns!«, sagte er.
»Wir gehen am besten gleich hier hinaus!«, sagte der junge Mann, bei Seite tretend, hob den einen Wandteppich, und nun sahen die beiden, dass eine feste Steinwand dahinter war, sahen aber auch schon, wie in dieser eine Tür sich auftat:
»Bitte!«
O'Donnell und die Olinda schritten durch den Spalt in einen kurzen Gang, sahen vor sich einen anderen hellen Raum, gingen hinein und wollten sich gleich nach ihrem Führer umwenden. Sie wagten sich allein gar nicht weiter.
Aber ihr Führer war nicht mehr bei ihnen, hatte sie allein gelassen.
Und da freilich erwachte ein Misstrauen in dem jungem Manne, er griff wenigstens nach dem Messer an seinem Gürtel, um auf alles gerüstet zu sein —
Da aber hörten sie eine Stimme, die ihnen bereits bekannt vorkam, eine überaus wohllautende Männerstimme:
»Bitte, treten Sie nur ein! Sie haben hier unten nicht die kleinste Hinterlist zu fürchten, vor allem keinerlei Falle! Sie sind meine lieben Gäste!«
Das war er! Sie wussten es sofort, und wenn es nicht der Fall gewesen wäre, so hätten sie es alsbald erfahren, denn die Stimme des Unsichtbaren fuhr fort:
»Setzen Sie sich zunächst einmal. Ich möchte Ihnen einige erklärende Worte sagen, ohne die Sie sich hier unten vielleicht bedrückt fühlen würden — angesichts der vielen Wunder, die Sie zu sehen bekommen werden! Bitte, nehmen Sie irgendwo Platz!«
Sessel standen mehrfach umher, allerdings nur Hocker, ohne Lehnen, und das hatte seinen guten Grund, wie sich bald zeigen sollte. Sonst enthielt der Raum eine Menge ganz eigenartiger Apparate, und die eine Wand bestand aus einer jener roten Platten, wie auch Georg Wedekind und Fritz Hammer sie auf dem »Bertran de Born« zu sehen bekommen hatten.
Die beiden setzten sich also, dicht nebeneinander, und wieder erklang die Stimme, jetzt mit etwas spöttischem Unterton:
»Ich heiße Sie zunächst willkommen, trotzdem Sie ja als meine Feinde hier sind! Verteidigen Sie sich, bitte, nicht erst. Ich kenne den Auftrag, den Sie übernommen haben, war Zeuge, wie Mr. Samuel Philipp Sie über alles instruierte, weiß auch, welche Belohnung Ihnen verheißen worden ist, und habe ja vorhin gehört, dass Sie, Miss Olinda, wirklich eine Meisterin in der Sangeskunst sind. Wenn es jemand glücken könnte, mich zu betören, dass ich alle Vorsicht vergäße, dann —
Doch schweigen wir davon, ich will Sie nicht beschämen, lasse Ihnen auch vollkommen freie Hand. Sie dürfen sich ganz nach Ihrem Belieben für oder wider mich entscheiden, und damit Ihnen das leicht fällt, will ich Sie etwas sehen und hören lassen, was Ihnen ein klares Urteil ermöglicht. Nur so viel noch:
Sie wissen, dass außer Ihnen noch andere Expeditionen gegen mich ausgeschickt worden sind?«
»Ja, das wissen wir«, erwiderte O'Donnell ohne Weiteres.
»Aber nicht, dass dies alles mir bekannt ist! Und ich will Ihnen auch gleich sagen, dass ich die Teilnehmer dieser Expeditionen ebenso ständig beobachten kann, wie ich Sie von Anfang an beobachtet habe.
Wie mir das möglich ist, werden Sie gleich selbst sehen!
Mr. Samuel Philipp war einmal mein Freund, verstand, mich zu täuschen, dass ich ihm traute. Erst später durchschaute ich ihn, sorgte dafür, dass er nicht das letzte Geheimnis erfuhr, und nun sucht er es mir auf andere Weise zu entreißen, scheut sogar vor Gewalt nicht zurück — auch das werde ich Ihnen gleich beweisen.
Davon also will ich nicht erst lange zu Ihnen sprechen, sondern Ihnen nur eine Erklärung geben, wie es mir möglich ist, hier unter der Erde solche Räume zu schaffen, Ihnen alle die Überraschungen zu bereiten, über die Sie schon genug gestaunt haben.
Ich bin Mitwisser eines uralten Geheimnisses, von dem die Menschheit in ihrer großen Gesamtheit nichts weiß, von dem sie sich nichts träumen lässt.
Haben Sie einmal etwas von dem Königreich Agharti gehört, wenn auch nur als eine Sage?«
O'Donnell schüttelte den Kopf, auch die Olinda tat es.
Der Unsichtbare musste es gesehen haben, trotzdem sie selbst ihn nicht erblicken konnten. Er fuhr schon fort.
»Ich nahm es an. Wie sollten Sie auch etwas davon erfahren haben! Nun, ich will Ihnen nur ganz kurz sagen, dass es ein solches Königreich Agharti gibt, seit dreihundertdreißigtausend Jahren!«
»Das ist sehr lange«, musste da O'Donnell etwas spöttisch sagen. »Da müsste man doch einmal etwas von diesem Königreiche erfahren haben!«
»Man? Meinen Sie damit sich oder die gesamte Menschheit?«, fragte der Unsichtbare sogleich, der also kein anderer sein konnte als Loke Klingsor. »Die Menschheit weiß so manches nicht, was sie wissen könnte!«, fuhr er fort. »Bedenken Sie doch, wie lange sie gebraucht hat, um bloß die Elektrizität zu entdecken, die es von Anbeginn der Welt an gegeben hat und die einzelnen besonders begnadeten Menschen schon lange bekannt war — jenen Menschen, die freilich eben wegen dieser Kenntnis als Zauberer angestaunt oder als Betrüger verfolgt oder als Hexenmeister verbrannt wurden.
Wenn Sie daran denken, dass zum Beispiel ein Graf Saint Germain, ein Cagliostro und andere die Elektrizität anzuwenden verstanden, dann werden die Wundertaten dieser Männer Ihnen in einem ganz anderen Lichte erscheinen, als es bisher der Fall war, dann verstehen Sie doch ohne Weiteres, wie sie eine Kupfermünze ohne Mühe in Silber, in Gold verwandeln konnten? Das machten sie eben auf galvanischem Wege — sehr einfach, nicht? Und die Lichterscheinungen, die sie hervorzauberten! Die Schläge, die sie Zweiflern versetzten?
Nun also!
Vor der Menschheit an sich habe ich keine besondere Achtung. Die Menschen sind Herdenvieh, keiner denkt selbstständig, jeder redet nach, was ein anderer ihm vorredet!
Und ob Sie mir deswegen zürnen oder nicht, ich muss aussprechen, dass auch Sie noch nicht selbstständig denken gelernt haben —
Ich will Sie nicht kränken! Lassen Sie mich das sagen, was ich Ihnen über das Königreich Agharti sagen darf.
Gegründet wurde es also vor dreihundertdreißigtausend Jahren, also vor einer Zeit, mit der die Menschen überhaupt nicht rechnen, die sie nicht fassen können. Der Gründer war ein Goro, der aber als König Brahytma heißt.
Er verschwand mit einem ganzen Volke von der Erdoberfläche, zog sich in die Unterwelt zurück. Dieser Brahytma kann alles, seinem Willen sind keine Schranken gesetzt, er beherrscht alle Kräfte der Erde, der Hölle, des Himmels, das Dasein der Menschen, könnte, wenn er wollte, die ganze Erde in die Luft sprengen, kann Meere trocken legen, Kontinente in Meere verwandeln, Berge in Wüstensand, er macht Greise zu Jünglingen und Tote wieder lebendig. Sie fassen das nicht, es ist unmöglich für Sie — jetzt noch! Vielleicht werden Sie es verstehen lernen, wie ich es verstehe. Kurzum, dieses unterirdische Königreich umfasst alles, was sich unter der Erdoberfläche befindet, auf den Straßen, die den Menschen unbekannt sind, sausen die Bewohner von Agharti in Wagen dahin, die kein Erdbewohner sich vorstellen kann — in Luftschiffen durchkreuzen sie das Luftmeer, und nichts geht auf Erden vor, was sie nicht wüssten. Mahytma, der eine Gehilfe Brahytmas, kennt alle zukünftigen Ereignisse, Mahynga, der andere, ihre Ursache.
Ihr Herr aber, Brahytma, kann trotzdem nicht verhüten, dass Böses geschieht, denn von allem, was es auf Erden gibt, ist nichts beständig außer dem Bösen. Alles andere wandelt sich, befindet sich im Werden. Nur das Böse bleibt, und sogar die Menschen haben eine Ahnung davon, haben es in der Person des Teufels verkörpert!
Aber nicht etwa, dass nun Brahytma, der Herr von Agharti, Gott genannt werden müsste! Er ist ein Mensch geblieben, aber freilich einer, dem niemand gleichkommt.
Genug davon! Sie sind bestimmt worden, dieses Königreich Agharti zu betreten. Ob Sie es ganz kennen lernen dürfen, weiß ich nicht, glaube es auch nicht, denn auch ich kenne es noch erst ganz wenig, aber was ich schon vermag, das wird Sie in höchstes Staunen setzen.
Und nun sollen Sie nicht mehr durch solche langatmige Erklärung behelligt werden, sondern sehen, hören —
Und dann urteilen! Vergessen Sie das nicht!
Richten Sie Ihre Blicke auf die rote Tafel! Verhalten Sie sich ganz ruhig, sprechen Sie nicht, auch nicht flüsternd! Ich warne Sie ausdrücklich! Furcht kennen Sie ja nicht, das weiß ich. Sie wäre auch nicht nötig!«
Die Stimme verhallte. Zu gleicher Zeit verdunkelte sich der Raum, aber nur sekundenlang. Dann schien es, als strahle von der roten Platte, die also die eine Wand des Raumes bildete, jenes magische Licht aus, das O'Donnell und die Olinda nun schon zur Genüge kannten.
Das erste Wunder vollzog sich.
Die eben noch rote Platte färbte sich immer dunkler, bis sie ganz schwarz aussah, und da auf einmal sahen die beiden in einen dunklen Felsengang.
Es war ganz, ganz merkwürdig, dass sie also diese Finsternis sahen, trotzdem sie selber von Licht umstrahlt waren.
Wie das möglich war?
Sie zerbrachen sich nicht den Kopf, kamen auch gar nicht dazu, jetzt nicht und später nicht! Des Wunderbaren war so viel, dass sie gar nicht zur klaren Besinnung kamen.
Und das größte Wunder von allen war doch, wie gleich bemerkt werden muss, dass die beiden, so groß auch die Lockung war, nicht ein Wort miteinander sprachen, keine Frage tauschten, nicht einmal einen Ruf des Staunens ausstießen!
Sie sahen also einen stockdunklen Felsengang und vermochten trotzdem darin einen Menschen zu erkennen, wussten auch gleich, wer es war, sprachen seinen Namen innerlich aus, was ja ganz gut möglich ist. Man kann sich doch inmitten anderer Menschen stundenlang mit sich selbst unterhalten, ohne dass die Herumstehenden das Geringste davon hören. Wie könnte man sonst manchmal die Langeweile ertragen!
»Snatcher! Das ist doch Snatcher, unser Gefährte!«, dachten die beiden.
Und dann hatten sie auch gleich eine Erklärung, wenn sie auch falsch war, wie sie bald merken sollten. Sie dachten:
»Der ist uns also nachgeschlichen. Er hat irgendwie auch einen Eingang in die Unterwelt gefunden und sich nun verirrt!«
Dann sahen sie, wie Harry Snatcher zusammenbrach und — hörten seine grässlichen, gottlosen Flüche!
Ganz deutlich, als ständen sie unmittelbar neben ihm!
Sie sahen, wie er die Hände ballte! Und da verschwand dieses Bild von der Platte, um einem anderen Platz zu machen.
Zwei Männer erschienen: Abdel Dschelil und Abdel Hamid!
Sie saßen einander gegenüber in einem prunkvoll nach orientalischer Weise ausgestatteten Raume, jeder auf einem solchen Deckenlager, rauchten gemeinsam aus einer Wasserpfeife durch lange Schläuche und sprachen miteinander.
Und wieder hörten O'Donnell und die Olinda jedes Wort, das die beiden miteinander sprachen.
Sie bedienten sich des Arabischen.
O'Donnell kannte diese Sprache, aber doch bei Weitem nicht genug, um zwei Eingeborene verstehen zu können, für welche er die beiden ja halten musste.
Die Olinda dagegen verstand nur einige Brocken Arabisch — was sie so zum Verkehr mit den Leuten der Karawane gebraucht hatte — mehr nicht!
Und doch verstanden beide das Gespräch der beiden Araber Wort für Wort!
Sie staunten nicht über dieses neue Wunder, weil es ihnen eben gar nicht zum Bewusstsein kam.
An ihnen vollzog sich also etwas Ähnliches wie bei jener Ausgießung des Heiligen Geistes, bei dem großen Pfingstwunder, als auf einmal die Apostel »in Zungen redeten«, was doch nur so verstanden werden kann, dass sie sich ihres Hebräischen bedienten, dass dieses aber von den Hörern verstanden wurde, weil jeder es als seine Muttersprache hörte!
Anders ist das doch gar nicht zu erklären, nicht etwa, dass die ganz ungelehrten Männer nun auf einmal soundso viele Sprachen beherrscht hätten!
So hörten also auch O'Donnell und die Olinda das Arabisch des Abdel Dschelil und des Abdel Hamid.
»Wir müssen diesen Snatcher erst ganz zähmen«, sagte der erstere eben. »Was hältst Du von ihm, Hamid?«
»Er ist ein Schurke durch und durch, dem auch wir nicht trauen dürfen«, lautete die Antwort.
»Desto besser eignet er sich für uns«, versetzte darauf Abdel Dschelil. »Er mag nur erst unsere Macht kennen lernen.
Nun zu den beiden, die er zu sich führen lässt! Was ist Deine Meinung über sie, Hamid?«
Der Gefragte stieß mehrmals den blauen Rauch aus, ehe er erwiderte:
»Sie kommen für uns nicht in Frage.«
»Ganz meine Meinung! Aber warum, Hamid?«
»Weil sie ehrenwerte Menschen sind, die sich durch nichts von dem abbringen lassen, was sie als recht erkannt haben!«
»Auch durch keinen Zauber, den wir ihnen vormachen könnten?«
»Was Klingsor doch ebenfalls versteht! Und sie staunten zwar, aber sie betrachteten das als das, was es ist — als Hokuspokus! Nein, die beiden kommen für uns nicht in Frage.«
»Du sprichst ganz meine Ansicht aus, Hamid. Klingsor wird sie für sich gewinnen. Schade, dass wir sie nicht beobachten können —«
»Das ist gerade gut, denn könnten wir es, Dschelil, dann sähen auch sie uns! Und das wäre Dir wohl nicht lieb, wie?«
Er lächelte bei dieser Frage.
O'Donnell und die Olinda aber stutzten.
Sollten sie auch nicht, da sie so etwas hörten!
Aber sie verhielten sich ganz still.
Und Abdel Dschelil lächelte ebenfalls, als er entgegnete:
»Ja, auch die Macht eines Loke Klingsor hat eben ihre Grenzen. Es käme ihm trefflich zustatten, könnte er uns beobachten, uns hören! Aber weil dies eben nicht der Fall ist, wollen wir ohne Scheu weiterverhandeln. Die Zeit drängt.
Also, er steht im Begriff, nach dem Montanagebirge zu fahren, sich dort mit der Chlorinde und mit dem Tankred zu treffen, angeblich, um dort einen Zweikampf mit der Königin von Thule auszufechten —
Angeblich! Ich durchschaute ihn ja vollkommen. Er wird sich hüten! Aber das kümmert uns nichts. Wen schicken wir hin?«
Abdel Hamid zögerte nicht einen Augenblick mit der Antwort.
»Da kommen doch nur die beiden in Frage, die dort bekannt sind.«
»Nenne sie!«
»Der Gelbe Marder und der Steinfuchs!«
Da freilich zuckte O'Donnell einmal zusammen, ballte auch gleich beide Hände, aber was er zu sich sagte, das hörte eben niemand außer ihm, ein Lob war es nicht.
»Diese beiden!«, dachte er. »Das sind Schufte, die sich mit dem Snatcher messen können! Sie sind mir bekannt — aber ich will lieber zuhören!«
Die Olinda hatte die Namen noch nie gehört, wusste auch nicht, was sie daraus machen sollte, erfuhr es jedoch alsbald.
»Du hast wieder recht, Hamid«, sagte der andere Araber. »Rufe sie!«
Abdel Hamid stand nicht auf, griff nur unter seinen Burnus, fingerte an irgend etwas herum.
Ein leiser Ton erscholl, den die beiden hier in der Felsenkammer deutlich hörten.
»Der Steinfuchs!«, sagte dann Abdel Hamid.
Und erklärend setzte er leise hinzu, was die beiden aber trotzdem hörten:
»Ich muss sie einzeln rufen. Sie sind einander feind.«
Da geschah etwas, was O'Donnell und die Olinda schon selber erlebt hatten:
Der Teppich an einer Wand wich zur Seite, ein Spalt tat sich auf.
Und aus der Öffnung kam ein echter nordamerikanischer Jäger, ein Trapper, also ein Fallensteller, in der üblichen Lederkleidung.
Ein widerlicher Kerl! Trotz des weißen Haares, das nun sichtbar wurde, als er an der schmutzigen Ledermütze rückte, was einen Gruß bedeuten sollte —
Gleich das Gesicht des Mannes verriet, dass er ein hartgesottener Schurke war!
Und dabei sicher schon gegen siebzig Jahre alt!
Jetzt stellte er ein Gewehr, das er bei sich führte, an die Wand, und O'Donnell betrachtete sich diese Waffe etwas verwundert, konnte aber nicht dabei verweilen, weil er anderweit beobachten musste.
Der Alte verneigte sich plump und offenbar widerwillig, schaute dabei unter halb gesenkten Lidern auf die beiden, bis seine unsteten Blicke an Abdel Dschelil hängen blieben.
»Du hast mich rufen lassen?«
»Nimm Platz!«, sagte der Scheich der Ibaditen.
Der Trapper guckte sich um, sein Gesicht war köstlich, halb Grimm, halb Unterwürfigkeit, und so klang auch seine Stimme:
»Leicht gesagt!«, knurrte er. »Auf dem Boden? Das kann ich immer noch nicht, so mit untergeschlagenen Beinen hocken! Und sonst — hol mich der und jener, wenn ich etwas sehe, worauf ich mich setzen könnte!«
»Dann bleib stehen!«, erklang es kühl. »Du bist der Steinfuchs?«
»Jawohl, der bin ich!«
»Du kennst das Montanagebirge?«
Die bereits wieder zugekniffenen Augen des Trappers blitzten auf.
»Jawohl, das kenne ich.«
»Genau?«
»Jeden Stein!«
»Wie lange hast Du dort gelebt?«
Da ballte der Steinfuchs gleich beide Hände.
»Wie lange? Immer! Bis dieser blutig gottver... — ja so — bis der Gelbe Marder, den der Satan holen möge —«
Ein furchtbarer Blick aus den Augen Abdel Dschelils ließ ihn verstummen.
»Hüte Dich!«, wurde er auch noch gewarnt. »Du weißt, dass Du hier nicht fluchen darfst!«
»Ich weiß es«, antwortete der Trapper, schon wieder ganz demütig, aber eben erheuchelte Demut.
»Wann warst Du zuletzt dort?«
Wieder wollte der Trapper grimmig auffahren, besann sich jedoch rechtzeitig, nur seine Augen funkelten einmal.
»Bis ich mit dem Gelben Marder zusammengeriet war ich dort — zwei Jahre ist es her —«
»Das genügt. Und Du möchtest wieder hin?«
»Wenn ich das Stinkvieh — ja so — wenn ich ihn nicht mehr dort treffe!«
»Du wirst ihn treffen!«
»Dann —!«
Zischend klang die Stimme des Alten.
Ein Blick Abdel Dschelils bändigte ihn.
»Du wirst ihn treffen und Dich mit ihm aussöhnen!«
Da freilich fuhr der Steinfuchs auf.
»Eher will ich auf der Stelle verenden!«
Und da sahen die beiden ihn auch schon wie von einem Blitzstrahl getroffen zusammenbrechen.
Die Schmerzen, unter denen er sich wand, mussten entsetzlich sein. Seine Zuckungen sahen danach aus, auch sein Gesicht war ganz entstellt, aber kein Schrei kam über seine Lippen, er ächzte nicht einmal, was die beiden doch hätten hören müssen.
Die Olinda empfand heißes Erbarmen mit dem alten Manne, den sie ja noch nicht verachtete, weil sie ihn nicht als Schurken kannte.
O'Donnell aber wunderte sich nicht, dass der Steinfuchs die Marter so standhaft aushielt. Der hatte doch nicht umsonst im Wilden Westen gelebt, war dort siebzig Jahre alt geworden, und wenngleich es jetzt keine wilden Indianer mehr dort gab, die einen Gefangenen an den Marterpfahl stellten, so war das doch noch der Fall gewesen, als der Steinfuchs hingekommen war — als junger Mann — und an seinem Leibe hätte einer, der danach suchte, wohl die Narben finden können, die von ganz anderen Martern zurückgeblieben waren, welche er ebenso standhaft ertragen hatte wie diese hier.
Also einen Schmerzensschrei entlockten ihm die beiden nicht, das wussten sie anscheinend selber, sie endeten deshalb die Qualen des Mannes.
Mühsam richtete dieser sich auf. Sein Atem ging schwer, aber seine Augen hielt er wohlweislich geschlossen.
»Du wirst Dich mit dem Gelben Marder treffen und Dich mit ihm aussöhnen!«, sagte nunmehr Abdel Dschelil wieder, als habe der Zwischenfall sich überhaupt nicht ereignet.
»Ja, das werde ich tun«, erwiderte der Steinfuchs.
»Genaue Anweisungen werdet Ihr beide erst an Ort und Stelle erhalten. Jetzt nur so viel: Ihr werdet wahrscheinlich ständig von der Camera aus gesehen werden, und Du, als Skalde. weißt ja ganz genau, was Du da zu tun hast.
Kannst Du Dir zuverlässige Helfer beschaffen?«
»So viele, wie ich haben will.«
»An wen denkst Du da?«
»An Cowboys. Vielleicht auch einige Jäger.«
»Wie viele?«
»Das habt Ihr doch hier zu bestimmen!«
»Nein, wir stellen es Dir frei. Nimm, so viele Du willst! Als Lohn erhält jeder tausend Dollar.«
»Auch wenn sie nichts erreichen?«
»Auch dann.«
Und dann merkten O'Donnell und die Olinda genau, dass der Steinfuchs nun eine Frage auf der Zunge hatte; das war auch nicht schwer zu erraten; er wollte wissen, wie viel er erhalten würde.
Abdel Dschelil sah es ebenfalls, ging aber nicht darauf ein.
»Du kannst gehen!«, sagte er sehr hochmütig.
Der Steinfuchs schaute ihn zum ersten Male wieder an, dann jedoch verbeugte er sich in seiner ungeschickten Art und verschwand durch den Spalt, durch den er gekommen war.
Merkwürdig war nur, dass dieser alte Trapper. der sich doch sonst nie von seiner Waffe trennte, sein Gewehr an der Wand stehen ließ.
Abdel Dschelil und Abdel Hamid waren wieder allein. Sie schwiegen geraume Zeit, bis ersterer von Neuem anhob und sagte:
»Der Gelbe Marder ist nicht hier. Wir werden ihm die nötigen Weisungen durch die Platte geben. Er mag sich ebenfalls Helfer suchen.«
»Und Du glaubst, dass es auf diese Weise gelingen wird, Loke Klingsor in unsere Hände zu bekommen?«, fragte Abdel Hamid.
Der andere schaute ihn an, ein unbeschreibliches, spöttisches Lächeln auf dem Gesicht.
»Für so töricht hältst Du mich, Freund?«, fragte er. Und sogleich setzte er hinzu:
»Du weißt, was ich bezwecke, Du wolltest es nur noch einmal von mir hören, aber ich werde es nicht aussprechen. Ich will Dir eine andere Antwort geben.«
Er klatschte in die Hände, die im ganzen Orient übliche Art, einen Diener zu rufen.
Und auch hier wirkte das. Durch die Wand kam ein alter Mann, hager und gebückt, für einen Kenner sofort als Singhalese kenntlich, an dem sanften Gesicht, dessen weibischer Ausdruck noch dadurch verstärkt wurde, dass das lange weiße Haar am Hinterkopfe durch einen hineingesteckten Kamm gehalten wurde. Das einzige Kleidungsstück war ein mit bunten Streifen gemustertes Tuch, in das er sich derart gewickelt hatte, dass nur die rechte Schulter und der rechte Arm frei blieben.
Tief neigte sich dieser Greis vor den beiden, im Gegensatz zu dem alten Trapper ganz von Ehrfurcht erfüllt.
Abdel Dschelil erwiderte den Gruß durch eine freundliche Handbewegung, forderte den Greis ebenfalls zum Niedersitzen auf, und sogleich hockte dieser sich auf den Boden nieder.
»Was hast Du uns zu melden, Tagmandu?«
Wieder neigte sich der Greis.
»Deine Befehle sind ohne Zögern vollführt worden, o Herr!«
»Erzähle! Ich will Dir nicht alles abfragen!«
»Die Ramsawedda hat das heilige Schloss gekauft, die heilige Insel ist ihr freigegeben worden, nichts hindert sie, in die Geheimnisse der Unterwelt einzudringen«, berichtete Tagmandu.
Aber als er dann schwieg, war deutlich zu merken, dass er noch etwas auf dem Herzen hatte, es nur nicht ohne direkte Aufforderung aussprechen wollte.
Abdel Dschelil und sein Freund schauten einander an. Dann redeten sie in einer Sprache miteinander, die Tagmandu offenbar nicht verstand, wohl aber die beiden Hörer in der Höhle hier.
»Dieses Weib wird uns unschätzbare Dienste leisten«, sagte Dschelil. »Ich glaube, ich habe einen guten Griff getan, als ich sie für uns gewann.«
»Was nicht schwer war«, erwiderte Hamid. »Sie war doch schon in die Geheimnisse eingedrungen, kannte die Zauberkunst der Schamanen, ist selbst eine Schamanin.«
»Trotzdem! Und sie ist berückend schön, ganz das, was Loke liebt! Ein satanisches Weib!«
»Das aber nicht uns, sondern nur seinen eignen Zwecken dienen wird!«, wendete Abdel Hamid ein.
»Wie meinst Du das?«
Zum ersten Male schien Abdel Dschelil erregt. Durch eine Bewegung des Hauptes deutete sein Gefährte zu dem Singhalesen hin.
»Du hast uns noch etwas zu melden, Tagmandu?«, fragte Dschelil sofort.
»Ja, Herr! Die Ramsawedda liebt den, den sie vernichten soll«, lautete die demütig gegebene Antwort.
Da freilich fuhr der Scheich der Ibaditen auf. Wilder Zorn funkelte aus seinen Augen.
»Wenn sie es wagt!«, stieß er hervor.
Schon aber hatte er sich wieder bezwungen.
»Wie kommst Du auf diese Vermutung?«, fragte er den Greis.
»Herr, Du weißt, dass ich in die Seelen der Menschen blicken kann.«
»Und Du irrst Dich nicht?«
»Nein, Herr, ich weiß, dass sie ihn liebt, ich weiß aber auch, dass diese Liebe sich in glühenden Hass verwandeln wird, denn sie wird keine Gegenliebe finden.«
»Und so wird sie uns doch dienen!«, stieß Dschelil hervor.
»Du irrst, Herr! Sie plant anderes — eher bringt sie ihn um, ehe sie ihn Dir ausliefert.«
Ein verächtliches Lachen war die Antwort.
»Wir werden sehen! Geh jetzt auf Deinen Posten! Oder hast Du noch etwas zu melden?«
»Herr, das Geheimnis, mit dem die Ramsawedda sich umgibt, lockt andere, es zu lüften. Zwei Faringhi stellen ihr nach, und er wird sich ihrer bedienen, da ihm selbst verboten ist, die heilige Insel zu betreten«, erwiderte Tagmandu.
»Zwei Faringhi? Ah, sie mögen es versuchen! Die Insel ist genügend geschützt. Fallen Sie nicht den Haien zum Opfer, so werden die Wölfe der Gräfin sie zerfleischen!«
Abdel Dschelil hob die rechte Hand.
Sofort stand der Greis auf, neigte sich ehrerbietig und ging.
Die beiden waren wieder allein, schwiegen abermals, länger als das erste Mal, und so hatten die beiden Beobachter Zeit, ihren Gedanken über das eben Gehörte nachzuhängen. Die Olinda allerdings wusste nicht viel mit dem anzufangen, was sie eben vernommen hatte; anders O'Donnell.
Zunächst hatte er sofort erkannt, dass der Greis ein Singhalese gewesen war, also ein Bewohner jener Wunderinsel Ceylon, und dann — er hatte auch den zweimal gebrauchten Ausdruck Ramsawedda verstanden, wusste, um was es sich handelte.
Die Zeitungen hatten ja schon genug von dem Weibe berichtet, das diesen Namen erhalten hatte, auch, dass sie von dem Maharadscha jenes Gebietes dessen prächtiges altes Schloss gekauft hatte — viel wusste ja auch O'Donnell nicht von ihr, hatte kein Interesse weiter an jenen Berichten gehabt, aber nun — auch dieses Weib sollte versuchen, Loke Klingsor zu fangen — und es liebte ihn!
O'Donnell aber wusste, dass die schlimmsten Feinde des Mannes Frauen sind, deren Liebe er zurückgewiesen hat!
Doch weiter konnte er nicht nachdenken, keine Lösung des Rätsels finden, denn nun sah er auf der geheimnisvollen Platte wieder den finsteren Gang, in welchem Harry Snatcher niedergebrochen war, sah, wie dieser Gang auf einmal hell wurde, sah den Schurken auffahren, aufstehen — und da war auf einmal die Felswand verschwunden, die ihn eingeschlossen hatte, er konnte weiter, stürmte, trotzdem er eben völlig erschöpft geschienen hatte, weiter, riss einen Teppich zurück und — stand vor den beiden Männern, vor Abdel Dschelil und Abdel Hamid.
Einen Moment stutzte er, schaute sich um, dann aber sprang er vorwärts, streckte beide Fäuste vor, auf dem hässlichen Gesicht sinnlose Wut.
»Ihr Schufte!«, hörten die beiden ihn schreien.
Und dann sahen sie ihn regungslos werden! Wie in Stein verwandelt stand er da. Nur sein Geist schien lebendig geblieben zu sein; auch die Augen lebten noch, verrieten den gewaltigen Schrecken, der ihn jetzt durchzuckte.
Abdel Dschelil aber klatschte wiederum in die Hände, anderer Weise als vorher.
Wieder kam der Teppich an der einen Wand in Bewegung, wich zurück, ein Spalt in der Wand tat sich auf.
Diesmal traten zwei Neger herein, nackt bis auf einen Fellschurz, mächtige Gestalten, von Muskeln strotzend.
Ein Wink Abdel Dschelils und sie packten Snatcher, trugen ihn hinaus.

Die beiden Freunde folgten ihnen, und die beiden Beobachter gingen mit, durch einen ziemlich weiten Gang, von einem geheimnisvollen Lichtschein erleuchtet.
Ein ehernes Tor, das ihn verschloss, sprang vor den Schwarzen auf; sie traten hindurch, gefolgt von ihren Herren, in einen weiten, weiten Saal —
Und die Olinda staunte nicht weniger als O'Donnell.
Dieser Saal war ein mächtiges Amphitheater, eine Art Zirkus mit übereinander aufsteigenden Bankreihen, alle besetzt von einer dichtgedrängten Menge, und es dauerte eine ganze Weile, ehe sie da unterscheiden konnten, dass diese Menge aus Männern und Frauen bestand, dass immer einzelne Gruppen durch hohe Zwischenwände voneinander geschieden waren, derart, dass sie wohl in die Arena schauen konnten, aber nicht einander zu sehen vermochten.
Das war vielleicht sehr nötig, denn die Zuschauermenge setzte sich aus recht verschiedenen Elementen zusammen.
Die eine Abteilung enthielt nur Eingeborene, also Araber, und O'Donnell, der ja schon in Nordafrika geweilt hatte, erkannte sie sogleich als Mzabiten, Bewohner der innersten Wüste, kaum noch von Europäern gekannt, echte Wüstensöhne, die Männer mit den braunen, von schwarzen Vollbärten umrahmten Gesichtern, echte Wüstenblumen die Weiber, die keine Schleier vor dem Antlitz trugen, deren schwarze Augen gleich glühenden Kohlen funkelten.
Die nächste Abteilung dagegen wies nur Europäer aus, wieder Herren und Damen, alle aber in großer Toilette, die Herren also in schwarzem Frack, die Damen in tief ausgeschnittenen Kleidern.
Sie gehörten allesamt den ersten Gesellschaftskreisen an. Das war nicht nur an der vornehmen Kleidung zu sehen, sondern bei den Damen auch an dem funkelnden Schmuck, und es war manche sehr schöne Erscheinung darunter.
Die nächste Gruppe bestand nur aus Negern und Negerinnen, aber nicht aus solchen, die bereits mit »Europens übertünchter Höflichkeit« Bekanntschaft gemacht hatten. Das waren echte Neger, wie sie nur noch im Innersten Afrikas gefunden werden und nur in ganz wenigen Küstenstrichen. Männer und Frauen verschmähten die Kleidung, wenngleich sie nicht ganz hüllenlos erschienen waren. Sie trugen aber nur das Notwendigste, die Männer also den Schurz und manche noch ein Fell über der Schulter, die Frauen höchstens eine Art Latz, der unter der Brust begann und über den Knien endete. Da konnte den beiden Beobachtern also nicht verborgen bleiben, was für kraftvolle Gestalten das waren, die Weiber fast noch muskulöser gebaut als die Männer.
Und wieder wusste O'Donnell sogleich, dass er hier Eingeborene aus Dahomey vor sich hatte, aus jenem Lande also, das von den Franzosen nach furchtbar blutigen Kämpfen unterworfen wurde — freilich nur scheinbar — der König konnte nicht mehr Tausende und Abertausende von Menschen seinen Ahnen opfern, durfte nicht mehr seine Amazonengarde halten — und tat es doch!
Und dann kam die nächste Abteilung mit lauter Indern und Inderinnen, alles den verschiedensten Stämmen angehörend, jeder dieser Stämme aber vom andern streng geschieden, und da fehlte an der Stirn weder das Abzeichen der vornehmsten Brahmanenkaste noch das der verachtetsten Sudza.
Da saß der Verehrer der blutigen KaliDurag neben dem harmlosen Tamilen, nur durch eine Bretterwand geschieden.
Die nächste Gruppe waren andere Asiaten, aus Hinterindien stammend, Siamesen, Burmesen, und wie alle heißen, wieder in ihrer Landestracht, die schönen Weiber mit Blumen geschmückt, und zwar mit solchen, die in ihrer Heimat wachsen —
Darauf wieder folgten Tungusen, Burjäten, Kirgisen und andere innerasiatische Völker.
O'Donnell, der doch da Bescheid wusste, sah fast alle Völker der Erde in diesem Amphitheater versammelt, er staunte nicht schlecht. Auch die Olinda tat dies, aber ganz anders als er. Am liebsten hätte sie jubelnd in die Hände geklatscht. Sie beherrschte sich nur mühsam.
Wie kamen alle die Tausende von Menschen in diese Unterwelt?
Sie fand keine Antwort, und ihre Aufmerksamkeit wurde auch gleich von anderem in Anspruch genommen.
Beim Eintritt der beiden weißgekleideten Araber erhoben sich alle Anwesenden, jubelten ihnen stürmisch zu, winkten mit den Händen, die Weiber schleuderten Blumen hinab —
Und die beiden hörten diesen Jubel ganz deutlich, als wären sie mitten darin, als ständen sie mit in der weiten Arena.
Da hob Abdel Dschelil nur leicht eine Hand.
Sofort ward es totenstill.
»Ich grüße Euch, Brüder und Schwestern!«, sagte er.
Wieder brach der allgemeine Jubel aus, wieder verstummte er.
Und Abdel Dschelil fuhr fort:
»Heute sollt Ihr das große Fest feiern, das wir alljährlich begehen. Die Wonnen des Paradieses erwarten Euch, aber ehe Ihr sie genießen dürft, müsst Ihr durch die Dschehenna gehen! Nach grässlichen Qualen unbeschreibliche Freuden! Ihr kennt es.
Und an diesem hier will ich Euch ein Beispiel geben lassen!«
Er deutete auf Harry Snatcher, den die Neger wieder auf seine Füße gestellt hatten und der genau in der Haltung verharrte, die er zuletzt eingenommen hatte, also den Oberkörper vorgeneigt, die Hände geballt und vorgestreckt, halb zum Sprunge geduckt —
Ohne auf ihn zu achten, schritten Abdel Dschelil und Abdel Hamid quer durch die Arena zu einer Stelle der Umwallung, die sich vor ihnen öffnete.
Eine breite teppichbelegte Treppe zeigte sich.
Sie stiegen sie empor und betraten eine Loge.
Und nachdem sie sich auf den schwellenden Sitzen niedergelassen hatten, waren sie für alle Anwesenden genau so unsichtbar geworden, wie diese für sie.
Lautlose Stille herrschte ringsum, und gleichzeitig mit den in dem Amphitheater Versammelten empfanden auch die Olinda und O'Donnell dieses Schweigen als etwas entsetzlich Marterndes. Auch sie ahnten, dass sich nun etwas ganz Furchtbares hier ereignen würde, aber was es sein würde, das hätten sie sich auch in ihren verwegensten Träumen nicht einbilden können.
Harry Snatcher stand also allein inmitten der weiten Arena, noch immer gelähmt durch eine Zaubermacht. der er nicht zu entrinnen vermochte, noch immer imstande, seinen Geist arbeiten zu lassen, noch immer durch den Ausdruck der Augen verratend, was in ihm vorging.
Und ein neuer Zauber war, dass anscheinend alle Zuschauer diesen Ausdruck seiner Augen gewahren konnten, auch die, denen er den Rücken zukehrte — wie auch die Olinda und O'Donnell ihn fortgesetzt so beobachten konnten.
Und da verdunkelte sich die Arena für Sekunden, verwandelte sich in eine amerikanische Prärie, durch welche Auswanderer zogen, acht jener plumpen Wagen, wie sie damals üblich gewesen waren, als die ersten kühnen Wagehälse nach dem Fernen Westen vordrangen.
Neben den abgematteten Pferden schritten Männer in roten und blauen Flanellhemden, jeder das Gewehr schussbereit im Arme, jeder außerdem noch ein langes Messer am Ledergürtel tragend, auf dem Kopfe den breitrandigen Hut.
Es waren meist hochgewachsene Gestalten, die sonnengebräunten Gesichter umrahmt von struppigen Bärten, Riesenkerle, denen man ansah, dass sie sich vor nichts fürchteten.
Weiber und Kinder schauten unter den Leinenplanen einzelner Wagen vor, andere schliefen wohl, und nichts deutete darauf hin, dass diesem Zuge irgendwelche Gefahr drohte.
Er hatte ja auch einen Führer, der für schweres Geld geworben worden war, einen noch nicht alten, aber doch schon sehr berühmten Trapper, der an der Spitze der ganzen Gesellschaft schritt, ebenfalls hochgewachsen —
Und alle kannten ihn sofort.
Sogar die Olinda wusste, dass das Snatcher war, wie er einst ausgesehen haben mochte.
Der Zug bewegte sich auf eine Felsengruppe zu, die nicht mehr fern war, und als sie erreicht war, wurden die Wagen zusammengefahren, dass sie rings um die Feuer, die nun angebrannt wurden, einen sicheren Wall bildeten.
Frauen und Kinder kletterten von den Wagen, ein buntes Leben entwickelte sich, die Mahlzeit ward bereitet, alle aßen, plauderten darauf, die Männer rauchten, die Kinder spielten, und als es spät genug war, teilte Harry Snatcher die Wachen ein. Wen das Los nicht traf, der streckte sich sorglos am Feuer nieder, Frauen und Kinder verschwanden wieder in den Wagen —
Und das ganze Bild verschwand, machte einem anderen Platz.
Man sah Harry Snatcher allein durch die Nacht schleichen, sah ihn, trotzdem es finster war, und der Mann musste besondere Augen haben, dass er sich so zurechtfand.
Nun stieß er den Schrei der Erdeule aus, der sofort beantwortet ward, worauf neben ihm, wie aus dem Boden hervorkommend, ein anderer Mann auftauchte.
Ein Indianer!
Für einen solchen mussten die meisten Zuschauer ihn halten, weil er das Gesicht grell bemalt hatte, wie eine Rothaut gekleidet war, auch die Skalplocke fehlte nicht.
Nur O'Donnell ließ sich nicht täuschen, er erkannte in dieser Maske den Weißen, und die anderen merkten es, als sie nun das flüsternd geführte Gespräch der beiden vernahmen, immer wieder allen verständlich, in welcher Sprache jeder auch sonst denken mochte.
Die Unterhaltung war kurz.
»Seid ihr bereit?«, fragte Snatcher.
»Wir warten schon lange.«
»Dann merkt auf das Zeichen! Und dass keiner lebend entkommt!«
Der Indianer lachte, was also für eine echte Rothaut ganz ausgeschlossen gewesen wäre.
»Ich weiß schon«, erwiderte er. »Nur die eine bleibt am Leben!«
»Dann ist es gut! Ich gebe sofort das Zeichen!«
Und da ließ Snatcher auch schon eine bereitgehaltene Rakete zum Nachthimmel emporsteigen.
Das Bild verschwand abermals, das neue, das auftauchte, war wildbelebt: Das Lager, die Wagenburg der Auswanderer, wurde von Rothäuten überfallen, die von den beiden freien Seiten auf Pferden heranstürmten, unter gellendem Geschrei, und zwar war dieses so echt, das richtige Sassakwi der Indianer, dass die Hörer bis ins Innerste davor erschauerten, vor diesem quiekenden Jiiiiiii, dem kein Tier standhält, selbst nicht der Bär —
Aber die Auswanderer kamen nur kurze Zeit in Verwirrung, dann feuerten sie bereits unter die Feinde, und mancher Sattel ward leer, die Männer hatten schießen gelernt —
Der Angriff wurde abgeschlagen, es wurde nichts aus dem allgemeinen Abschlachten, auch die Frauen beteiligten sich mit an dem Kampfe —
Und abermals machte dieses Bild einem anderen Platz.
Die Auswanderer hatten einen Kreis geschlossen, in dessen Mitte Harry Snatcher stand, schwer gefesselt, dass er sich nicht rühren konnte.
Er war überführt worden des Verrates, und nun wurde ihm das Urteil gesprochen.
Die Sache war schnell genug erledigt.
Man setzte ihn auf ein Pferd, auf seins, führte dieses unter einen verkrüppelten Baum, der aus einer Felswand hervorwuchs, einer der Männer befestigte einen langen Riemen an ihm, an dem unten eine Schlinge war, warf diese um den Hals des Verurteilten — und damit war die Sache erledigt.
Die Wagen wurden angeschirrt, setzten sich in gewohnter Ordnung in Bewegung, verließen den Felsenkessel.
Nur Harry Snatcher blieb zurück, auf dem Pferde sitzend, hilflos, die Schlinge um den Hals.
Es war ein furchtbarer Anblick, denn alle wussten, dass das Pferd doch bald Hunger spüren und zu grasen beginnen würde. Dann lief es unter dem Reiter fort, und dieser henkte sich selbst —

Ach, und noch entsetzlicher war der Ausdruck der Todesangst auf diesem hässlichen Gesicht Harry Snatchers! Man sah mit angehaltenem Atem, wie er das Pferd zu halten suchte — wie es immer wieder fortstrebte, wie der Strick sich schon straffte —
Und die gleiche Todesangst gewahrten alle noch einmal in dem Gesicht des alten Snatcher, der also das ebenfalls mit ansehen musste, es noch einmal erlebte!
Die Olinda erbebte vor Grauen. O'Donnell merkte es, denn sie schmiegte sich eng an ihn, aber er fasste ihre Hände und hielt sie fest, und ein Strom der Beruhigung ging von ihm zu ihr über —
Sie schrak zusammen.
Ein Schuss krachte.
Das Pferd tat einen Satz.
Jetzt musste der Verurteilte am Riemen in der Luft schweben!
Nein, er stürzte schwer auf den Boden, blieb regungslos liegen. und neben ihm tauchten wieder jene falschen Indianer auf —
Er war im letzten Augenblick durch seine Kumpane befreit, gerettet worden!
Flutende Helle durchstrahlte die Arena.
In ihrer Mitte stand Harry Snatcher, noch regungslos — aber diese Augen!
Es war entsetzlich!
Und schon kam wieder die Finsternis herangekrochen, hüllte alles in ihre Schleier.
Ein Waldfluss ward sichtbar, Urwaldbäume an den Ufern, durch die dichte Laubdecke brachen flimmernd vereinzelte Sonnenstrahlen.
Aus einem Dickicht kam ein junges Weib hervor, eine Indianerin, vielleicht noch ein Kind den Jahren nach, aber sonst schon ein Weib, nur einen kurzen Rock aus schmiegsamem Hirschleder tragend, dazu ein ebensolches Jäckchen, das blauschwarze Haar wallte gelöst über den Rücken, war mit leuchtenden Hibiskusblüten geschmückt.
Und nun schickte sich dieses holde Kind an, in dem Flusse ein Bad zu nehmen, wie sie es sicher schon oft getan hatte.
Da ward es gepackt — von einem weißen Jäger —
Und wieder war es Harry Snatcher.
Ein wilder Kampf entspann sich, das junge Weib hatte ein Messer bei sich, mit dem sie ihrem Angreifer die eine Wange aufschlitzte —
Aber desto größer nur wurde seine Wut.
Er überwältigte sie, nachdem er ihr die Waffe entrissen hatte, hob sie empor, schleppte sie fort, zu einer Stelle, wo er ein Kanu versteckt hatte.
Die junge Indianerin schien verloren, er hatte sie schon gebunden, stieg in das Fahrzeug, stieß ab —
Da kam Hilfe.
Rote Krieger tauchten auf, sahen den Entführer, schossen ihre Pfeile nach ihm — und da riss Harry Snatcher hohnlachend die Gefesselte empor, hielt sie als Schild vor sich —
Ehe die Brüder der Entführten es hindern konnten, hatte ein Pfeil deren Brust durchbohrt — ein furchtbar gellendes Geschrei erhob sich —
Da aber schleuderte Snatcher die Sterbende von sich, in den Fluss, sprang selbst auf der anderen Seite ins Wasser, tauchte und — kam nicht wieder zum Vorschein—
Aufs äußerste empört, wollte die Olinda aufspringen.
Mit Mühe hielt ihr Gefährte sie nieder, aber er konnte nicht mehr hindern, dass sie stöhnend aufschrie:
»Dieser Schurke —!«
O'Donnell presste ihr zwar sofort eine Hand auf den Mund, aber es war schon zu spät —
Er sah noch, wie Abdel Dschelil und Abdel Hamid in ihrer Loge aufsprangen, wie ein furchtbarer Aufruhr in dem Amphitheater entstand, hörte auch einen schmetternden Ton wie von vielen Trompeten —
Da ward die schwarze Wand vor ihnen rot, und schon legte sich eine Hand auf die Schulter des jungen Mannes.
»Rasch! Sie müssen sogleich fliehen! Die Ibaditen sind auf dem Wege hierher!«
Und nachdem noch einmal das strahlende geheimnisvolle Licht aufgeflammt war, in welchem die beiden ihren Führer von vorhin vor sich stehen sahen, wurden sie von diesem mit fortgezogen —
Durch einen ihnen endlos erscheinenden Gang ging es, eine Pforte tat sich auf, es war den beiden, als kämen sie in das Kämmerchen eines Aufzuges. Sie spürten, wie dieser sich in Bewegung setzte, es ging abwärts — ein kaum wahrnehmbares Aufstoßen — die Tür sprang auf.
Aber weder die Olinda noch O'Donnell traten hinaus.
»Ja, träume ich denn immer noch? Oder ist das Wahrheit?«, stammelte die Sängerin.
Auch O'Donnell strich sich mehrmals über die Augen, denen er nicht zu trauen schien. Er stand unentschlossen da.
»Spazieren Sie getrost heraus und hinein in dieses Paradies!«, sagte da die so ungemein wohlklingende Stimme Loke Klingsors. »Sie träumen nicht, wie Sie sich sofort werden überzeugen können. Das ist keine verzauberte Landschaft, kein Erinnerungsbild und keine Vision, das ist El Daya, die reizendste aller Oasen, nur mir bekannt und meinen Freunden!
Aber wenn Sie erwarten, dass ich mich Ihnen nun endlich zeigen werde, so muss ich Sie nochmals enttäuschen. Ich muss sogleich nach London und von dort aus nach Nordamerika. Um zehn muss ich in London sein, morgen früh wieder um zehn im Montanagebirge Aber vielleicht hole ich Sie dorthin nach. Ich kann es noch nicht versprechen. Keinesfalls werden Sie sich während meiner Abwesenheit langweilen. Scheuen Sie sich nicht! Alles, was Sie sehen, gehört jetzt Ihnen, und wenn es da auch einige Verbote gibt, so werden Sie das gar nicht merken — Auf Wiedersehen! Und vergessen Sie nicht den Auftrag, den Mr. Philipp Ihnen gab!«
Regungslos standen die beiden, Berndt Fehrmann, der rothaarige Riese, und Martha Flint, das schmächtige Frauchen. Unbeschreiblich furchtbar war das heisere Brüllen, das an ihre Ohren klang, aber noch viel furchtbarer dünkte sie das, was sie eben gesehen hatten:
Diese riesenhafte steinerne Gestalt, die auf einmal lebendig geworden und auf sie zugekommen war, die jetzt jenseits des kurzen Ganges stand und doch nicht durch diesen hindurchkommen konnte.
Nein, davor wenigstens waren sie geschützt.
Dieser Steinriese konnte sich nicht bücken, besaß keine Gelenke in Beinen und Armen, dass er vielleicht mit ihnen hätte nach den beiden greifen können —
»Was war das?«, stammelte Martha Flint, die noch ganz blass war infolge des ausgestandenen Schreckens.
»Ja, was war das? Wer diese Frage beantworten könnte!«, erwiderte ihr Begleiter tonlos. »Ich vermag es nicht. Schon dass die eine Figur so zusammenbrach, sich um sich selbst drehte, ehe sie stürzte — es sah ganz aus wie bei einem Menschen.«
»Und sie war doch nur aus Stein!«, ächzte die junge Frau.
Plötzlich packte sie den einen Arm Berndt Fehrmanns.
»Lassen Sie uns fliehen!«, raunte sie ihm zu. »Ich weiß nicht, mir ist, als müsste dieses Ungeheuer doch noch zu uns gelangen können —
Ah, wie schrecklich er brüllt in seiner Wut!«
Sie wollte ihren Gefährten mit sich ziehen, aber dieser wehrte ihr.
»Wohin wollen Sie denn fliehen?«, fragte er. »Sie können doch gar nicht aus diesem Felsenkessel heraus!«
Da erst sah sie es.
Auch hier war eine geheime Kraft wirksam gewesen. Sie staken in einem von glatten, unersteiglichen Felswänden umgebenen Kessel, aus dem es keinen Ausgang gab, es sei denn, sie hätten plötzlich fliegen gelernt.
»Mein Gott, gibt es wirklich auf Erden solche geheimnisvolle Mächte?«, stöhnte die junge Frau auf. »Ich kann es doch gar nicht fassen! Und ich muss fort, muss zu Richard —!«
Fehrmann nickte schweigend.
Ja, diese Frau musste zu ihrem Gatten. Das wusste auch er. Sie würde nicht ruhen, bevor sie ihn nicht gefunden hatte —
»Wir müssen uns den Weg nach drüben erkämpfen!«, murmelte er und griff nach dem Gewehr, das er an eine der Felswände gelehnt hatte.
»Warten Sie hier auf mich, Frau Martha!«
Sie guckte ihn an, hoffnungsvoll und doch zweifelnd.
»Was wollen Sie tun?«, fragte sie.
Er deutete nach dem Gang.
Er näherte sich dem dunklen Loche, schritt hinein, kam bis an die scharfe Biegung, spähte vorwärts —
Jetzt musste er den Unterkörper des lebendig gewordenen Steinriesen sehen können.
Aber er sah ihn nicht, seine Blicke streiften durch die jenseitige Öffnung ins Freie, sahen das Sonnenlicht draußen —
Da hätte er nun wohl aufjubeln und gleich Martha Flint zu sich rufen müssen, um ihr die Freudennachricht zu verkünden, aber er dachte nicht daran.
Das wilde Gebrüll draußen war ja verstummt, alles war wieder so totenstill, wie es vorher gewesen war, und dieser Ausdruck sagt an sich ja viel — totenstill!
Die vollkommenste Stille ist das, wie sie eben nur im Reiche des Todes herrschen kann!
Und wie grauenvoll ist diese Stille für den Lebenden!
Auch im Walde ist es zu Zeiten ganz still, kein Lufthauch regt die Blätter, kein Vogel singt, selbst die Insekten scheinen zu ruhen — aber das ist keine Totenstille, man weiß, das Leben schlummert nur, kann jeden Augenblick wieder erwachen —
Hier also war es totenstill.
Berndt Fehrmann empfand das. Er fürchtete sich nicht, aber hindern konnte er doch nicht, dass ihm ein Eisesschauer über den Rücken rann, und das war eben auch nur natürlich. Sein ganzes Denken lehnte sich auf gegen das, was er eben erlebt hatte.
Steinfiguren, die sterben, wie Menschen! Steinfiguren, die lebendig werden, wandeln, vor Wut brüllen!
Noch fasste er es nicht, aber er verwandelte sich wieder ganz in den Jäger, der seine Feinde kennt, er schlich geduckt bis an den Anfang des kurzen Tunnels, legte sich ganz langsam nieder, immer das Gewehr schussbereit, mit allen Sinnen spähend, lauschend —
Nichts regte sich. Er spähte hinaus und er erbebte von Neuem.
Dort an der Felswand stand wieder die riesenhafte Steinfigur, wieder als solche leblos, unbeweglich, das plump gemeißelte Gesicht starr wie es vordem gewesen war!
Aber vor dieser Gestalt standen zwei Männer!
Fast hätte Berndt Fehrmann aufgeschrien vor Überraschung, er musste sich selbst eine Hand auf den Mund pressen, dass er es nicht tat.
Und er blieb nicht etwa liegen, beobachtete diese beiden Männer, sondern kroch zurück, sprang auf, stand neben Martha Flint —
Sie starrte ihn an, weil sie doch gleich sah, dass er etwas ganz, ganz Außergewöhnliches zu berichten hatte.
Aber sie fragte nicht mit Worten. Nur ihre Augen bettelten.
»Da draußen sind zwei Männer!«, raunte er ihr zu.
»Zwei Männer? Zwei solche —«
»Nein, Männer, gewöhnliche Menschen —«
Er hatte den einen sofort erkannt, er hätte es ihr sagen können, aber er schwieg, zog sie nur mit sich.
»Ganz, ganz leise!«, warnte er noch.
Dann schlichen sie geduckt in den Gang, um die Ecke, bis an das Ende, etwa einen Meter davor stehen bleibend.
Nun drückte Berndt Fehrmann seine Gefährtin sanft nieder.
Er selbst tat ebenso.
Sie knieten nebeneinander und spähten hinaus und sahen die beiden Männer.
Doch vergebens hielt Berndt Fehrmann die eine Hand bereit, um sie sofort auf den Mund Martha Flints drücken zu können, falls diese einen Ruf ausstieß, einen Namen nannte.
Sie blieb stumm.
Und sie hatte schon so viel gelernt, dass sie erst ein ganzes Stück zurückkroch, ehe sie etwas sagte.
»Woher kommen diese beiden? Sie hätten doch an uns vorüber gemusst! Und wir haben sie nicht gesehen!«
Sie hatte vollkommen recht. Zu dem Felsenkessel jenseits führte nur der eine Weg — der, den sie gekommen waren. Drüben hatten sie keinen Ausgang bemerkt, der also den beiden als Zugang hätte dienen können.
Wie waren sie da hineingekommen?
Berndt Fehrmann antwortete nicht auf diese Frage.
»Sie kennen die beiden nicht? Wenigstens den einen?«, fragte er.
Martha Flint schüttelte den Kopf.
»Ich habe sie noch nicht gesehen.«
Da guckte er sie an, wollte den Mund öffnen, um etwas zu sagen, schloss ihn aber wieder. Nur der Ausdruck ungläubiger Verwunderung blieb auf seinem Gesicht noch eine Weile stehen.
Da wendete sich die junge Frau an ihn.
»Kennen Sie denn diese Männer?«
Und Berndt Fehrmann schüttelte den Kopf.
Eine Lüge wollte er nicht aussprechen. So konnte dieses Kopfschütteln anstatt einer Verneinung nur eine Ungewissheit ausdrücken, wie er sich selber beruhigte.
»Dann wollen wir wieder hin und sehen, was sie tun!«, schlug sie vor.
Er hatte nichts einzuwenden.
Wieder, wie schon einmal, schlichen sie in dem Gange bis fast zu dem Ende, so weit, dass sie die beiden sehen konnten — und sie belauschen! Denn jetzt sprachen sie miteinander!
Der eine, auf dem die Blicke der Frau immer wieder haften blieben, weil sein edelschönes Gesicht so ganz anders war, als das aller Männer, die sie je gesehen hatte — wie aus altem Elfenbein geschnitten — und nun diese lodernden Augen, die wie Sonnen brannten!
Und diese Stimme!
Martha Flint war fromm erzogen, hatte jeden Sonntag dem Rufe der Kirchenglocken Folge geleistet, war regelmäßig zum Gottesdienst gegangen und hatte sich innerlich, wenn auch schweigend. danach gesehnt, ihren ehernen Klang noch einmal hören zu können.
Jetzt hörte sie ihn!
Die Stimme dieses seltsamen Mannes dort drüben klang wie das Schwingen von Erz, wie Glockenton!
Schon deshalb hätte sie ihm gleich vertrauen können, wenn sie auch noch eine geheime Scheu vor ihm empfand.
Und er sprach zu seinem Begleiter, der gar nichts Auffälliges an sich hatte, mit flammenden Augen.
»Sind Sie nun überzeugt von der Wunderkraft, die diesem Golem des Wunderrabbis innewohnt?«
»Ich muss es wohl«, lautete die Antwort. »Aber ich hätte nun und nimmer für möglich gehalten, dass es noch so etwas auf Erden geben kann.«
Ein fast spöttisches Lächeln zeigte sich auf dem schönen Gesicht des andern.
»Sie werden noch vieles für unmöglich halten, was doch möglich ist. Sie zweifeln aber nicht mehr, dass ich mit Hilfe dieses Zaubermittels die toten Figuren zum Leben erwecken kann?«
»Nein, daran zweifle ich nun nicht mehr!«
»Und dass dieses Leben von mir zwar in gewissem Maße beherrscht wird, aber doch ebenso auch bis zu einem bestimmten Grade selbstständig ist?«
»Ich habe gesehen, wie der Riese sich nach dem Tunnel dort bewegte, ich habe in seinem verzerrten Gesicht den Ausdruck höchster Wut gewahrt, ich habe ihn brüllen hören — nein, Mr. Klingsor, ich zweifle nicht mehr, und doch! Wenn Sie jetzt von mir verlangten, ich solle vor Ihnen niederknien und Sie anbeten — Sie als Satan, ich aber noch lange nicht als Menschenerlöser — ich würde es nicht tun —
Mir graut nicht einmal vor Ihnen, höchstens um Ihretwillen. Was Sie mir soeben gezeigt haben, das war das, was die Menschen schwarze Magie nennen —«
»Und wer diese treibt, der ist verflucht! Sprechen Sie es doch aus, ganz getrost, Herr Rechtsanwalt!«, kam es in furchtbarem Hohne über die schöngeschwungenen Lippen des anderen, und so funkelten auch die dunklen Augen.
Ob die beiden Lauscher in dem Felsentunnel diese letzten Worte hörten, war zumindest zweifelhaft.
Martha Flint rang mit Berndt Fehrmann — wie ein schwaches Weib mit einem starken Manne ringen kann — hoffnungslos — strebte vor allem danach, die Hand wegzuzerren, die ihr den Mund verschloss.
»Klingsor!«
Als sie diesen Namen hörte, war ihr gewesen, als fiele ihr eine Binde von den Augen.
Sie besann sich auf die letzten Worte, die sie von ihrem Richard gehört hatte.
Der hatte doch von einem Manne gesprochen, den er suchen sollte, und er sollte eine Million Dollar dafür erhalten — oder noch mehr — hatte ihr versprochen, dann die Taucherei aufzugeben —
Und da hatte er diesen Namen genannt.
Loke Klingsor!
Und sie hatte eben gehört, dass der ein Hexenmeister war!
Sie hatte selber gesehen, dass er tote Steinfiguren lebendig machen konnte!
Da glaubte sie auch, dass er ihren Richard verhext hatte! Dass er ihn in den unterseeischen Palast zu den schönen Nixen hatte locken können.
Eifersüchtig war sie nicht, war es nie gewesen und brauchte es auch nicht zu sein, sie wusste ja, wie furchtbar unbeholfen ihr Richard gegenüber allem war, was einen Unterrock und lange Haare hatte, wie dieser sonst so willensstarke Mann sich von ihr um den Finger wickeln ließ —
Nein, eifersüchtig auf die Nixen war sie nicht. Aber dort draußen stand der, der ihren Mann gefangen hielt.
Und da sollte sie nicht vorspringen und ihn packen und ihn zwingen, dass er ihr den geliebten Mann zurückgab?
Ja, das hatte sie tun wollen.
Da hatte Berndt Fehrmann sie gepackt und gehalten, hatte ihr eine Hand auf den Mund gepresst, dass sie nicht schreien konnte!

Und verzweifelt rang sie mit ihm. Die schwächliche Frau verwandelte sich in eine Furie, biss, kratzte, wand sich — aber sie kam nicht auf gegen die überlegene Kraft des riesenstarken Mannes.
Berndt Fehrmann zwang sie aus dem Tunnel hinaus, schleppte sie wieder nach jenem Felsenkessel, in dem sie vorhin gestanden hatten.
Martha Flint konnte sich nicht mehr wehren, gab jeden Versuch auf, sich zu befreien, aber ihre Augen blickten ihn in bitterem Vorwurf an.
Da nahm er seine Hand von ihrem Munde.
»Ich weiß, dass Sie keinen Laut von sich geben werden, durch den Sie uns verraten können, denn — merken Sie sich, Martha Flint — wenn Sie schreien, dann sehen Sie Ihren Richard nie wieder!«
Das war eine Zauberformel, durch die er alles über sie vermocht hätte.
Sie nickte nur, hätte auch — vor innerer Erregung — noch gar nicht sprechen können.
Berndt Fehrmann lächelte.
»Jetzt wissen Sie seinen Namen«, fuhr er fort. »Ich dachte, Sie würden auffahren als Sie ihn sahen, ich setzte voraus, dass Sie ihn schon gesehen hätten —«
»Wen?«, fragte Martha Flint.
»Nun, eben diesen Loke Klingsor!«
»Nein, ich habe ihn heute zum ersten Male erblickt.«
»Und Ihr Mann hat Ihnen nichts von ihm erzählt?«
»Nicht ein Wort!«
Fehrmann schüttelte den Kopf, er wusste sich das nicht zu erklären.
»Ja, hat er Ihnen denn nicht erzählt, warum er nach dem Stillen Ozean fuhr? Dort eine ganz bestimmte Stelle suchte?«
Der Blick aus den Augen der Frau, der ihn traf, war auch eine Antwort.
Martha Flint gehörte eben nicht zu jenen Frauen, die immer wissen müssen, was ihr Mann tut, wohin er geht, was er dort will — das sind jene Frauen, die sich verhasst machen. Jeder Mann will wenigstens den Schein der Selbstständigkeit wahren, wenn er auch längst eingesehen hat, dass er sich seiner Frau unterordnen muss, und wenn da diese immer alles wissen will, was er tut und treibt und vorhat, da vernichtet sie eben diesen Schein, da macht sie einen dummen Jungen aus ihrem Manne, der keinen eigenen Willen mehr hat — und dann — nun, da fängt er eben an, Heimlichkeiten vor ihr zu haben. was er sonst nie getan haben würde, belügt sie, bloß um einmal das Bewusstsein zu haben: Jetzt weiß sie doch nicht, was du tust, wo du bist!
Nein, Martha Flint hatte ihren Mann nie nach dem Warum und Wohin gefragt, trotzdem sie doch alles von ihm hätte erfahren können. Und so war sie eben auch, trotz ihrer Abneigung gegen diese Fahrerei, mit nach der Südsee gegangen und hatte dort, wie immer, seine gute Fee gespielt, damit er wohlbehalten wieder aus der furchtbaren Tiefe emporkäme.
Aber er war nicht wiedergekommen, hatte ihr im letzten Augenblick noch etwas verraten, was sie bis dahin gar nicht geahnt hatte: dass es sich diesmal zwar auch um eine Schatzhebung handelte, aber nicht aus einem untergegangenen Schiffe, sondern —
Also sie wusste jetzt, dass er Loke Klingsor gesucht hatte und dass dieser nur ein kurzes Stück von ihr entfernt war.
»Merkwürdig!«, brummte Berndt Fehrmann. »Wir hatten uns doch verabredet, ich wartete hier auf Richard, wir wollten zusammen diesen Loke Klingsor fangen oder doch wenigstens belauschen — und das hat er Ihnen nicht gesagt?«
»Kein Wort! Bis zuletzt einige Andeutungen.«
»Er hat auch nicht den Namen Samuel Philipp genannt?«
»Auch nicht. Wer ist denn das wieder?«
Da sah Berndt Fehrmann ein, dass er die Frau aufklären musste, und tat es.
Auch er war also zu Samuel Philipp bestellt worden, hatte dort das Bild Loke Klingsors zu sehen bekommen und seinen Auftrag erhalten. Es war ihm gesagt worden, dass er in Gemeinschaft mit Richard Flint arbeiten würde, dass er diesen auf Rapanui erwarten müsse und dass auch eine Frau dabei sein würde, die eine Hauptrolle spielen sollte, nämlich deshalb, weil Loke Klingsor gegenüber Frauen besonders schwach sei.
Da hatte Berndt Fehrmann natürlich gleich an ein solches schönes, verführerisches Weib denken müssen, das allen Männern den Verstand verdreht —
Und es hatte ihm nicht in den Kopf gewollt, dass dieses schmächtige Weibchen diese Frau sein sollte!
Aber deswegen hatte er sich doch keine Gedanken gemacht. Der Mr. Samuel Philipp würde ja nicht ohne Grund gerade diese Frau für seinen Zweck gewählt und ihr auch eine so hohe Belohnung ausgesetzt haben.
Das alles erzählte er der jungen Frau, und diese hörte ihm schweigend zu. Keine Miene ihres jetzt so blassen Gesichts veränderte sich, und die Augen konnten nichts verraten, denn die hatte sie geschlossen.
Berndt Fehrmann war zu Ende, wartete nun auf allerhand Fragen, die doch ganz selbstverständlich waren.
Und nach einer kleinen Weile tiefsten Schweigens fragte Frau Martha in der Tat.
»Mein Mann sollte diesen Loke Klingsor überlisten und ihm das Geheimnis zu entreißen suchen, das er auf dem Rücken trägt?«, stieß sie leise hervor.
»Ja, das sollte er.«
»Und da sollte er diesen Klingsor in der Tiefe der See finden?«
»An der genau bestimmten Stelle! Ganz recht!«
»Und dafür eine Million Dollar erhalten? Unter Umstanden sogar drei Millionen?«
»Ein hübscher Betrag, nicht?«, rief Berndt Fehrmann und lachte.
Da aber richtete Martha Flint sich auf.
»Das ist nicht wahr! Das ist eine freche, unerhörte Lüge!«, schrie sie, so laut, dass er sich ganz erschrocken umschaute.
»Um Gottes willen!«, mahnte er auch gleich. »Wenn er uns hört!«
Und dann fragte er:
»Was soll denn da nicht wahr sein?«
Abermals traf ihn ein Blick aus den Augen der Frau. Ganz verdutzt schaute er sie an. Das war doch eine ganz andere, als er eben noch vor sich gesehen hatte, und so richtete sie sich auch auf, stand stolz und aufrecht vor ihm.
»Das fragen Sie noch?«, stieß sie hervor. »Sie glauben wohl wirklich, dass mein Mann für eine Million Dollar — oder für drei — seine Ehre hätte verkaufen können?«
»Aber, Frau Flint, ist er denn nicht mit seinem Schiffe nach der Südsee gefahren?«
»Jawohl, das hat er getan!«
»Und hat er nicht an der bestimmten Stelle getaucht?«
»Jawohl, auch das stimmt!«
»Na, sehen Sie! Und warum sonst hat er das denn getan, als dass er sich eben die verheißene Belohnung verdienen wollte?«
»Niemals! Niemals!«, rief die junge Frau. »So ein Schuft sollte mein Richard gewesen sein? Mein Richard? Ha, Berndt Fehrmann, da kennen Sie aber den Richard Flint schlecht! Der verkauft seine Ehre nicht! Auch nicht um drei Millionen Dollar!«
Vollkommen verständnislos schaute er sie an.
»Ich verstehe Sie nicht«, bekannte er. »Er hat Ihnen doch gesagt —«
»Und wenn er es gesagt, dann hat er eben einen Grund dazu gehabt! Ja, mein Richard ist in die Südsee gefahren, er hat getaucht. er hat auch dort unten diesen Mann gesucht, aber wenn er ihn gefunden hätte — ha, was denken Sie wohl, was er dann getan hätte?«
»Sein Versprechen hätte er gehalten, das er dem Mr. Philipp gegeben hat!«
»Jawohl, jawohl, das sagen Sie! Ich weiß es besser, und ich will es Ihnen sagen! Er hätte diesem Manne alles offenbart, hätte ihm gesagt: ›So und so! Sie sollen ein Geheimnis besitzen, das ein anderer haben möchte, und damit er es kriegt, hat er mich hierher geschickt, ich soll Sie überlisten — und nun wissen Sie Bescheid nun richten Sie sich danach, dass Ihnen das Geheimnis nicht doch gestohlen wird! So, das habe ich Ihnen sagen wollen! Und nun leben Sie wohl!‹
Ja, so hätte mein Richard gehandelt! Nicht anders! Und da hätte er sich nicht um die drei Millionen gekümmert!
Was glauben Sie wohl, was für Schätze der vom Meeresgrunde holen könnte, wenn er nur wollte! Der könnte sich die ganze Welt kaufen und sie mir zu Füßen legen — aber da würde ich ihn nur auslachen —
Was brauchen wir denn Geld? Wenn ich meinen Richard habe, dann kann es so viel Geld geben, wie es will — der Bettel!
Ach, nein, Berndt Fehrmann, da haben Sie meinen Richard eben nicht gekannt, und da haben Sie hier ganz vergebens auf ihn gewartet. Der hätte Ihnen nicht bei einer solchen Schmutzerei geholfen, der nicht!
Aber ich weiß schon, Sie sind auch gar nicht so, Sie haben mich nur auf die Probe stellen, mich aushorchen wollen, na, und nun wollen wir die Sache abgetan sein lassen. Jetzt brauchen wir uns nicht mehr zu balgen.
Kommen Sie! Wir wollen hinaus und vor diesen Loke Klingsor treten, und Sie werden aus seinem Munde hören, dass ich ganz recht geraten habe, er wird Ihnen bestätigen, dass mein Richard ihn gewarnt hat!
Oder denken Sie vielleicht, der wüsste nicht, dass er mich hier finden würde? Und Sie dazu?
Hahaha, wenn einer so viel kann, wie der! Und Sie haben doch gehört, dass er die schwarze Magie versteht!
Na? Kommen Sie mit?«
Das Gesicht Berndt Fehrmanns hatte während dieser langen Rede der jungen Frau ständig den Ausdruck gewechselt. Jetzt sah es nicht gerade geistreich aus. Er starrte sie aus weit aufgerissenen Augen an, hatte auch den Mund halb auf, weil er sie immer hatte unterbrechen wollen, aber gar nicht dazu gekommen war — und jetzt auf einmal hatte er eine wahre Offenbarung.
Jetzt sah er, dass dieses schwächliche Weiblein wirklich schön war!
Ja, das war sie, wie sie so dastand mit den flammenden Augen, dem geröteten Gesicht! Die verkörperte Frauenliebe, die den Geliebten fleckenlos sieht, ihn mit ihrem letzten Tropfen Herzblut gegen jeden niedrigen Verdacht verteidigt!
»Sie wollen wirklich vor diesen Mann draußen treten?«, fragte er nun endlich.
Und da kam ihm ein Gedanke, den er auch gleich aussprach.
»Nun ja, Sie mögen recht haben«, fügte er hinzu. »Ich kenne ja Ihren Mann noch gar nicht, mir ist nur von dem Mr. Philipp sein Name genannt und gesagt worden, dass er mit mir zusammen arbeiten, dass ich ihn hier treffen würde.
Na, und wenn Sie von mir denken, dass ich ein Schuft wäre, da irren Sie sich. Ich will ja genau dasselbe wie Sie —
Aber warum sollen wir denn nicht erst einmal beobachten, was für ein Mann dieser Loke Klingsor eigentlich ist? Kann es denn nicht möglich sein, dass e r ein Schuft ist? Dass deswegen der Mr. Philipp die hohe Belohnung dem versprochen hat, der ihm diesen Mann ausliefert, ihm das Geheimnis entreißt?
Und Frau Flint, Sie haben doch selber gehört, dass er die schwarze Magie versteht. Sie sind eine fromme Frau, das habe ich nun schon gemerkt, eine rechtschaffene Frau. Da wissen Sie doch, dass Gott alle Zauberer verflucht und sie zu den härtesten Strafen verdammt!
Und der dort draußen ist ein solcher von Gott Verfluchter! Der kann zaubern! Sollen wir ihm da so ohne Weiteres trauen? Kann es da nicht auch so sein, dass er Ihren Richard gefangen hält, ihn vielleicht martert, ihn umbringen will? Und das erst recht und umso schneller, wenn er merkt, dass wir den Richard befreien wollen?
Frau Flint, nur nicht so voreilig sein! Um Himmels willen nicht! Da könnten wir uns eine schöne Suppe einbrocken! Und Ihren Richard bekämen Sie vielleicht nie wieder zu sehen!«
So dumm, wie er zuletzt ausgesehen hatte, war also Berndt Fehrmann durchaus nicht. Jetzt bewies er sogar, dass er ein sehr guter Menschenkenner war, er hatte die Worte gefunden, durch die allein er diese Frau von einer Torheit zurückhalten konnte.
Und dass er dabei log, das hatte ja in seinen Augen nicht das Geringste zu sagen, da machte der sich keine Gewissensbisse.
Nun aber war er auch klug genug, zu schweigen, die Wirkung seiner Worte abzuwarten.
Er schloss die Augen halb, um so die junge Frau erst recht scharf beobachten zu können, und — den Ausdruck teuflischer Freude zu verbergen, der in ihnen aufleuchtete, als er gewahrte, dass er seinen Zweck erreicht hatte.
Frau Martha hatte sich einwickeln lassen, wie man das treffend nennt. Zumindest war ihre vorher so feste Überzeugung wankend geworden, und dazu hatte am meisten beigetragen, was Berndt Fehrmann von der schwarzen Magie gesagt hatte.
Ja, die Zauberer waren von Gott verflucht.
Loke Klingsor war ein Zauberer, hatte das eben erst bewiesen, auch der andere Herr, der bei ihm war, hatte es ihm ins Gesicht gesagt.
Und nun sah Frau Martha auf einmal das furchtbar spöttische Gesicht dieses Zauberers vor sich, hörte ihn so höhnischverächtlich sprechen:
»Und wer diese treibt, der ist verflucht! Sprechen Sie es doch aus, ganz getrost, Herr Rechtsanwalt!«
Ja, das hatte sie noch gehört, trotzdem sie da schon mit Fehrmann gerungen hatte.
Es gab keinen Zweifel. Loke Klingsor war ein von Gott verfluchter Zauberer, hatte auch ihren Richard verhext!
»Was sollen wir denn da tun?«, fragte sie schüchtern.
»Nichts weiter, als ihn beobachten!«, lautete die Antwort. »Wir schleichen uns wieder hin und sehen, was weiter geschieht.«
Er hütete sich, hinzuzusetzen, was nahe genug lag: dass er dann mit Hilfe Frau Marthas doch noch die Belohnung verdienen wollte!
Eine bessere Gelegenheit konnte sich ihm gar nicht bieten.
Und er hatte auch schon Helfershelfer in Bereitschaft, wie sich gleich zeigen sollte!
Noch eine Minute zögerte Frau Martha Flint, dann fügte sie sich.
Aber sie kam sich vor wie eine Verbrecherin, als sie nun mit Berndt Fehrmann wieder durch den Tunnel schlich, bis sie abermals ins Freie spähen konnten.
Loke Klingsor stand noch mit dem Rechtsanwalt draußen.
Jetzt sahen sie nur, wie die beiden Herren weitergingen, also von den Steinfiguren weg, und sie schritten gerade auf einen Felsen zu, der keinerlei Höhlung aufwies.
»Wir könnten wieder in das Luftschiff steigen, das uns hergebracht hat«, hörten die Lauscher den »Zauberer« sagen, »aber ich möchte Ihnen erst noch einen Einblick in ein Reich gewähren, das Ihnen bis jetzt verschlossen gewesen ist.
Sagen Sie mir doch, Herr Rechtsanwalt Maxim Iron, wird Ihre Tochter Sie nicht vermissen, wenn Sie so gegen Ihre Gewohnheit nicht nach Hause kommen?«
Verwundert schaute der Gentleman ihn an.
»Wie kommen Sie plötzlich darauf?«
»Beantworten Sie, bitte, erst meine Frage!«
»Nein, sie wird sich nicht sorgen.«
»Sie sind jedoch überzeugt, dass Ihre Tochter daheim ist?«
»Daheim? Es kann sein. Sie kann jedoch auch eben einen Spaziergang unternommen, eine Freundin besucht haben —«
»Jedenfalls ist sie weit von hier entfernt, so weit, wie eben diese Insel von Sydney?«
»Natürlich!«, erwiderte Maxim Iron lächelnd.
»Sie würden es also für ausgeschlossen halten, dass Ihre Tochter hier auf Rapanui weilt?«
»Ganz und gar!«
»So, das wollte ich nur hören! Und nun —
Loke Klingsor brachte seine Uhr zum Vorschein, die schon beschrieben worden ist, ließ mehrere Deckel nacheinander aufspringen, ohne sich weiter um den Rechtsanwalt zu kümmern, fingerte daran herum —
Und plötzlich tat sich der Felsen auf, gleich ganz weit, dass Mr. Iron in einen weiten Raum blicken konnte.
Und schon taumelte er mit einem Rufe des höchsten, ungläubigen Staunens zurück.
»Edith!«, kam es über seine Lippen —
Und da wendete die junge Dame, die in dem Raume an einem Tische stand, ihm den Rücken zukehrend, sich um, lächelnd — kam mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu.
»Vater! Wie nett, dass Du Dich nun zeigst! Nein, diese Überraschung war herrlich —«
Da gewahrte sie den fremden Herrn, sah auch den Felsenkessel, die mächtigen Steinfiguren —
Sie ließ die vorgestreckten Arme nicht sinken, aber nun drückte deren Haltung nicht mehr Freude aus, sondern Schrecken — Abwehr — und ihr schönes Gesicht entsprach dem, ihre Augen öffneten sich weit —
»Vater —!«
»Kind! Edith! Wie kommst Du hierher? Und in diesem Kleide?«
»Ja, wo bin ich denn? Ich war doch bei Mr. Hamstead! Und da hat der alte Scherzbold mir —«
»Bei Mr. Hamstead warst Du? Jetzt? Noch eben?«
Die Arme Miss Ediths sanken nun doch herab.
Und Loke Klingsor wusste den Grund. Er trat vor, nannte seinen Namen.
»Miss Iron«, sagte er dann, »Sie müssen mir zürnen, dass ich mir einen Scherz mit Ihnen erlaubte, ich hoffe auf Vergebung —«
Da aber fuhr Maxim Iron auf.
»Was? Sie haben Ihre Scherze auch auf meine Tochter auszudehnen gewagt? Herr, wer sind Sie, dass Sie sich so etwas erlauben dürfen?«
»Loke Klingsor! Der Mann mit den Teufelsaugen! Der Mann mit der schwarzen Katze!«, erwiderte der »Zauberer«, ohne dass das Lächeln von seinem Gesicht wich.
Aber als der Rechtsanwalt nun schweigend zu seiner Tochter trat, die noch ganz fassungslos war, als er ihre rechte Hand fasste, als wollte er sie davonführen, da trat Loke Klingsor zwischen die beiden.
»Halt, Mr. Maxim Iron! Bleiben Sie!«
»Soll ich mir von Ihnen befehlen lassen?«
»Befehlen? Nein, aber ich darf Ihre Erinnerung wachrufen! Sind Sie nicht wegen des Golems von mir gewarnt worden? Nun, auch ein anderer wusste, dass Sie ihn besaßen, und dieser Mann versuchte nicht erst, in Verhandlungen wegen Kaufes mit Ihnen einzutreten, der nahm den Golem, und er nahm Ihre Tochter dazu. Unter dem Namen des Mr. Hamstead lockte er sie zu sich, wollte sie zunächst wohl nur als Geisel benutzen, aber als er sah, wie schön sie war, da änderten sich seine Pläne —
Und, Mr. Iron, Sie können wahrhaftig Gott danken, dass ich bereits mit Ihnen in Verbindung getreten war, dass ich merkte, wie jener andere —
Genug davon! Ich habe Ihre Tochter vor einer furchtbaren Gefahr geschützt, habe sie der Gewalt eines Schurken entrissen, konnte es glücklicherweise — und nicht ich habe sie hierher gebracht! Das tat eben jener andere! Aber ich führte S i e hierher, weil ich Sie mit Ihrer Tochter wieder vereinigen wollte.
Und das ist jetzt geschehen! Nun werde ich Sie in meinem Luftschiffe nach Hause bringen lassen, Herr Rechtsanwalt, und dort mögen Sie sich von Miss Edith erzählen lassen, was sie erlebte.
Sie sind nicht bei Hamsteads gewesen, bei Ihren guten Freunden, Miss Edith! Der lustige, alte Herr hat Ihnen nicht durch einen Taschenspieler etwas vormachen lassen. Der Zauberer — nun, sagen Sie Ihrem Herrn Vater selbst seinen Namen! Wie nannte er sich?«
»Czernebog!«, erwiderte Miss Edith.
»Ja, der alte Czernebog hatte sich Ihrer Tochter bemächtigt, wollte sie für immer bei sich zurückhalten, sie zu seiner Frau machen — und da hätte es nichts genützt, dass sie sich weigerte, dass sie ein Grauen vor diesem schmierigen Säufer hatte, er hätte sie gezwungen — —
Jawohl, Mr. Iron! Ihre Tochter wäre Ihnen auf immer verloren gewesen ohne mein Dazwischentreten, und nun wenden Sie sich noch hochmütig ab von mir! Bitte, gehen Sie!«
»Aber das ist doch unmöglich! Ganz unmöglich!«, stammelte der Rechtsanwalt.
»Sie glauben mir nicht? Nun, ich habe zwar sonst nicht die Gewohnheit, meine Wahrheitsliebe Zweiflern gegenüber noch zu beweisen, hier will ich eine Ausnahme machen. Nehmen Sie an, ich täte es, weil mir an Ihrer Achtung liegt, Mr. Iron!«
Er trat an den Eingang des hohlen Felsens.
»Czernebog!«, rief er.
Und da sahen die anderen wirklich den Greis vor sich, genau so, wie Edith ihn immer gesehen hatte. Mr. Iron bekam gleich eine ganze Wolke von Fuselgestank in die Nase —
Klingsor kümmerte sich nicht um seine Verwirrung.
»Czernebog, gestehe jetzt, dass Du diese junge Dame durch eine Lüge an Dich gelockt hast!«
»Was ist sich weiter dabei? Kann sich Czernebog schon zugeben!«, meckerte der alte Gauner.
»Und zu welchem Zwecke tatest Du das?«
»Wollte Czernebog doch den Golem haben und würde sich nicht gekriegt haben, weil er ihn nicht hätte kaufen dürfen für Geld, musste sich Czernebog etwas anderes beschaffen, was er sich geben konnte dem Herrn Rechtsanwalt.«
»Und als Du Miss Edith sahst, beschlossest Du, sie zu heiraten?«
»Natürlich! Ist sich Czernebog doch noch ledig und gar nicht alt, möchte sich gern schöne junge Frau haben, hihihihi!«
»Entferne Dich!«
Czernebog verschwand auf ebenso unerklärliche Weise wieder, wie er plötzlich aufgetaucht war.
»So, Mr. Maxim Iron! Vielleicht zweifeln Sie auch jetzt noch —«
»Nein, nein! Ich danke Ihnen, ich sehe ein, dass ich Ihnen unrecht getan habe! Aber, Edith, wie konntest Du —«
»Vater, wenn ich telefonisch von Deinem besten Freunde angerufen werde!«
Ja, sie hatte gar nichts anderes tun können. Er durfte ihr da keinen Vorwurf machen.
Und dazu war ja auch hier nicht der Platz. Er hatte so vieles andere zu denken, was er gar nicht fassen konnte.
»Wo sind wir hier denn eigentlich?«, fragte Miss Edith. »Diese Steinfiguren habe ich doch schon gesehen!«
»In einem Werke, das sich mit der Osterinsel beschäftigte«, erklärte Loke Klingsor. »Sie befinden sich auf diesem weltenfernen Eiland. Hier hat der alte Czernebog seinen Sitz. Deshalb hat er Sie hierher bringen lassen.«
»Davon habe ich doch aber gar nichts gemerkt!«, rief die junge Dame, nun erst erschreckend.
»Sie haben geschlafen?«, fragte Loke Klingsor.
»Allerdings! Ich erwachte auf einem Lager.«
»Und während Sie bewusstlos waren, wurden Sie in einem Luftfahrzeuge hierher gebracht.«
»Genau wie ich, Edith! Auch ich bin in ganz kurzer Zeit hierher gekommen! Ich kann Dir ja gar nicht alles schildern, was ich erlebt habe. Dieser Herr hier ist wahrhaft ein Zauberer, vor dem man sich fürchten möchte!«, rief der Rechtsanwalt.
Loke Klingsor lächelte nicht etwa selbstgefällig. Seine Blicke glitten verstohlen einmal nach dem Tunnelausgang hin, in welchem also Frau Martha Flint neben dem Berndt Fehrmann lag, alles dies sehend und jedes Wort hörend. Es blitzte dabei seltsam in seinen Augen auf.
Dann wendete er sich den beiden wieder zu, Vater und Tochter.
»Herr Rechtsanwalt, da wir uns über den Handel einig waren und ich Ihnen bewiesen habe, dass dieser Golem wirklich Steine lebendig machen kann, darf ich Sie nicht länger zurückhalten. Ich bitte Sie nur noch, zu bestimmen, wann ich mich Ihnen zur Verfügung stellen, Ihre Wünsche entgegennehmen soll —«
»Aber davon kann doch gar keine Rede sein, Mr. Klingsor. Gleich gar nicht nach dem großen Dienste, den Sie mir eben geleistet haben!«
»Dann muss ich Ihnen den Golem zurückgeben. Sie kennen die Bedingung unter der allein ich ihn erwerben darf!«
»Nun, dann bin ich einverstanden, herzlich gern! Und meine Wünsche? Ach, Edith, wollen wir uns mal von diesem Herrn in ein Wunderreich führen lassen, in dem er Herrscher ist?«
»Wie dieser Czernebog? Ach, Vater, wenn Du das niedliche Spielzeug gesehen hättest! Nein, war das entzückend, wie die Tierchen alle auf einmal lebendig wurden! Aber Du hast es ja nicht gesehen — es stand eben noch dort drin auf dem Tisch —«
Sie hatten der Felsenhöhle den Rücken gekehrt gehabt, jetzt wendete sich die junge Dame wieder um —
Aber nun sah sie nur noch eine starre Felswand, keine Spur mehr von einer Öffnung, und gleich gar nichts mehr von einer Höhle —
Ja, wie war denn nur das möglich?
Ihr Vater sah ihre Verwunderung.
»Frage nicht, Kind!«, sagte er. »Wunder muss man hinnehmen, nicht aber versuchen, sie zu erklären!«
Jetzt lächelte Loke Klingsor.
»Bitte, folgen Sie mir!«
Er ging gerade auf den engen Tunnel zu, in dem die beiden lagen.
Erst glaubten diese gar nicht, dass er wirklich hinein wollte, aber als sie nicht länger daran zweifeln konnten, da sprangen sie doch in aller Hast auf, rannten jenseits hinaus —
Und während des Dahinjagens wurden sie sich klar, dass sie gar nicht weiter konnten, nicht aus dem Felsenkessel heraus, dass Loke Klingsor sie also doch ertappen würde.
Nein, jetzt waren die Felsen wieder weg, der Ausgang stand offen, sie konnten über die Terrassen emporklettern —
Sie hätten es gekonnt!
Aber sie blieben unten, Frau Martha gleich wieder schreckensstarr.
Dort oben wimmelte es von wildaussehenden braunen Gestalten; Lanzen blitzten.
Und schon kamen diese Männer herabgesprungen, gellend schreiend —
»Meine Freunde! Meine Helfer gegen unseren gemeinsamen Feind!«, raunte Berndt Fehrmann der zitternden jungen Frau zu. »Jetzt werden wir diesen Zauberer fangen und zwingen, Ihren Richard freizulassen!
Ha, wie er staunen wird —!«
Und da trat auch schon Loke Klingsor aus dem Tunnel ins Freie.
Fehrmann hatte Martha Flint seitwärts gerissen. Sie standen neben dem Tunnelende, dass sie nicht gleich gesehen werden konnten.
Erst als Loke Klingsor ganz im Freien war, sprang er zwischen ihn und den ihm folgenden Rechtsanwalt.
Martha Flint blieb stehen, wo sie stand.
Da stürmten die braunen Krieger heran, immer noch so wild schreiend. Keulen und Speere wurden geschwungen, und nun rief auch noch Berndt Fehrmann, das Gewehr an der Hüfte haltend, die Mündung auf den »Zauberer« gerichtet:
»Ergeben Sie sich, Mr. Klingsor! Sie sind waffenlos! Und diese Krieger werden Sie nicht schonen, wie ich selber bei dem geringsten Zeichen von Widerstand auf Sie schießen werde!
Und dass Sie auch gegen Gewehrkugeln gefeit sind, das werden Sie wohl nicht behaupten wollen, so viele andere Künste Sie auch verstehen mögen!«
»Viele Worte um ein Nichts!«, erwiderte da der Überfallene, sich gelassen umwendend, und nun flammten nicht etwa seine sonst so machtvollen Augen den Frevler an. Nein, sie waren mit merkwürdig ruhigem Ausdruck auf diesen gerichtet, nicht einmal Spott und Verachtung standen in ihrem Blick.
Dabei aber bedeutete es doch schon die höchste Lebensgefahr für diesen Mann, dass er sich überhaupt umwendete, den Kriegern den Rücken kehrte und ihnen dadurch Gelegenheit gab, hinterrücks über ihn herzufallen.
Sie taten es nicht, warteten vielleicht auf einen Befehl ihres Verbündeten.
Berndt Fehrmann aber lachte.
»Viele Worte oder wenige, der Erfolg ist gleich. Ergeben Sie sich, Loke Klingsor!«
,Ihnen?«
»Mir! Und ich verspreche Ihnen heilig, dass Ihnen nichts geschehen wird!«
»Außer, dass Sie den Auftrag Mr. Samuel Philipps ausführen, nicht wahr?«
Ganz gelassen kam die Frage über die schön geschwungenen Lippen.
»Wenn Sie es denn bereits wissen!«
»Schade!«
»Was ist schade?«
»Schade, dass Sie sich die Belohnung nicht mehr verdienen können!«
»Warum nicht? Weil ich Sie nicht festzuhalten vermöchte? Ah, da will ich Sie gleich eines anderen belehren!«
Berndt Fehrmann wollte den Kriegern winken. Doch Loke Klingsor hob eine Hand.
»Noch einen Augenblick, Berndt Fehrmann —!«
»Sie kennen meinen Namen?«, stieß der rothaarig Riese betroffen hervor.
»Und Sie selbst! Lassen wir das! Nein, die Belohnung können Sie sich leider nicht mehr verdienen, auch wenn Sie mich gefangen nehmen, denn Mr. Philipp ist kein freier Mann mehr, sondern mein Gefangener!«
Da lachte Berndt Fehrmann dem Sprecher ins Gesicht.
»Sie müssen uns für sehr dumm halten, Mr. Klingsor.«
»Das tue ich auch!«, kam gleich die Antwort.
»Herr!«
»Bitte sehr, die Wahrheit darf niemand verletzen, Sie sind wirklich recht, recht töricht, wenn Sie glauben, dass diese armseligen Menschen hier einen Loke Klingsor fangen könnten!«
»Bitte, ich will es Ihnen beweisen!«
Und wieder ganz gelassen wendete er sich um.
Jetzt schien es ihn gar nicht zu stören, dass er den starken Mann in seinem Rücken wusste. Er kümmerte sich nicht um ihn.
Ruhig kehrte er sich den so furchtbar wild aussehenden Kriegern zu.
Und plötzlich öffnete er den Mund.
Martha Flint, die noch immer regungslos dastand, schrak furchtbar zusammen.
Aus dem Munde dieses »Zauberers« schossen plötzlich lodernde Flammen hervor, meterlang —
Und dann musste sie doch wieder lachen!
Wie entsetzt nämlich die Rapanuier ausrissen vor diesen sprühenden Flammen, vor diesem unheimlichen Zauberer!
Es sah auch zu komisch aus, wie sie die Terrassen hinaufsprangen! Wie Affen!
Sie warfen gleich alles von sich, was sie an Waffen bei sich hatten!
Und Loke Klingsor würdigte sie keines Blickes.
Langsam wendete er sich abermals um.
»Ich denke, Sie versperren jetzt dem Herrn da nicht länger den Weg, Berndt Fehrmann!«, sagte er ganz ruhig.
Der rote Riese war noch ganz verblüfft, fasste sich aber nun, hatte ja schon andere Beweise von der Macht dieses Mannes erhalten.
»Sobald wir unseren Handel abgeschlossen haben, Mr. Klingsor!«, sagte er.
»Welchen Handel?«
»Sie entblößen hier Ihren Rücken —«
»In Gegenwart von Damen?«
»Und lassen mich die Runen abzeichnen, die darauf stehen!«, vollendete Berndt Fehrmann.
Darauf erhielt er keine Antwort.
»Bitte, Mr. Iron, kommen Sie!«, sagte Loke Klingsor zu dem Rechtsanwalt, der also noch in dem Tunnel stak, die Szene aber ohne jede Furcht und Besorgnis mit angesehen hatte.
Jetzt wollte er heraustreten und hinter ihm seine Tochter.
Da hob Berndt Fehrmann das Gewehr noch etwas.
»Ich zähle bis drei, Loke Klingsor! Glauben Sie nicht, dass Sie mich auch so in die Flucht schlagen können wie diese elenden Wilden! Ich lasse mich nicht bluffen! Also jetzt!
Eins — — zwei — — bei drei schieße ich — —«

»Eins — zwei — bei drei schieße ich — —«
Loke Klingsor stand unbewegt, schaute ihn ruhig an.
Da musste Berndt Fehrmann schon zeigen, dass er keinen Spaß verstand. Natürlich, umbringen wollte er den Mann nicht, aber ihm einen Denkzettel geben.
Als er drei rief, schoss er.
Und Loke Klingsor stand wie zuvor unbeweglich da!
»Hölle und Teufel!«, schrie der Rothaarige. »Sind Sie wirklich schussfest? Das soll Ihnen nichts helfen!«
Schon holte er mit dem Kolben zum Schlage aus, und da freilich hätte die Sache schlimm für Loke Klingsor ablaufen können.
Doch der Schlag fiel nicht.
Das Gewehr blieb in der Luft schweben.
Der erhobene Arm konnte sich auf einmal nicht mehr bewegen.
Berndt Fehrmann merkte es mit heimlichem Grauen —
»Bitte, Mr. Iron! Bitte, Miss Edith!«, sagte Loke Klingsor, ohne sich noch um seinen Feind zu kümmern.
Die beiden kamen heraus.
»Da ist ja auch noch eine Frau!«, rief die junge Dame verwundert und auch etwas entrüstet, denn sie hatte doch gehört, um was es sich hier handelte — um einen ganz gemeinen Überfall durch Wegelagerer!
Deshalb war sie so entrüstet, dass da auch eine von ihrem Geschlecht mit dabei war.
Und da sank Martha Flint auf die Knie, verhüllte ihr Gesicht mit beiden Händen, unter denen Tränen hervorquollen.
Sie sprach kein Wort, regungslos kniete sie da.
Und Loke Klingsor trat zu ihr.
War es ein Frevel, eine Gotteslästerung, dass er jetzt zu ihr Heilandsworte sprach? Er tat es, indem er sagte:
»Stehe auf, Weib! Dein Glaube hat Dir geholfen!«
Und so legte er ihr auch eine seiner wunderbar schönen Hände auf die eine Schulter.
Und Martha Flint?
Jauchzend sprang sie auf, noch Tränen in den nun schon leuchtenden Augen.
»Sie wollen mir meinen Mann wiedergeben, meinen Richard? Er lebt?«
»Ja, Martha Flint, Ihr Mann lebt und wartet auf Sie!«
Da brach die junge Frau abermals zusammen, reckte beide Hände gefaltet hoch und rief:
»Dank, Dank, tausend Dank! Und was Sie auch sein mögen — ob ein von Gott Verfluchter oder selber ein Gott — ich frage nicht danach — segnen will ich Sie noch in meiner letzten Stunde!
Richard! Ich soll Dich wiedersehen! O, mein lieber, lieber Mann!«
»Charly, mein Charly!« Nicht laut jubelnd, aber mit innigster Zärtlichkeit hatte die junge Frau es gerufen, und so warf sie sich dem Eintretenden an die Brust.
Mr. Charles Steen hatte schnell seinen Koffer und das Holzkistchen niedergesetzt, um sie in seine Arme schließen zu können.
»Endlich wieder einmal zu Hause! Bin ich nicht pünktlich?«
»Pünktlich wie immer! Aber ich bin es auch — brauche das Essen nur auf den Tisch zu setzen...«
»Und was macht mein kleiner Loke?«
Das Kind saß angekleidet auf dem kleinen Sofa, es hatte den Vater schon erkannt, streckte ihm lallend und vor Freude kreischend die Ärmchen entgegen, die Mutter reichte ihm den Knaben, und noch einmal fand eine Szene der überquellenden Wiedersehensfreude statt.
»Hund — Hund«, stammelte das Kind auf des Vaters Arm.
»O, Du glaubst wohl, das hätte ich vergessen?«, lachte der. »Nein, so ein Versicherungsinspektor darf niemals etwas vergessen.«
»Du hast ihm so ein Spielzeug mitgebracht?«, fragte Angela, die schon dabei war, aus der Ofenröhre das Brathähnchen und den Stangenspargel zu nehmen und auf dem gedeckten Tisch zu servieren.
»Das ist doch sicher, und das muss erst erledigt werden, ehe ich essen kann. Nun sieh, mein Loke, was der Vater Dir mitgebracht hat.«
Auf dem Sofa wurde das mit einigen Löchern versehene Holzkistchen geöffnet, jenes weiße Pudelchen kam zum Vorschein, in einer Stellung, als wenn es aufrecht säße, an dem roten Halsbande statt der Schnur einen dünnen Gummischlauch, der in einem Gummiball endete.
Kreischend vor Entzücken presste das Kind das Spielzeug an sich.
»Genau so einer wie der von Nachbars Fred«, bestätigte die Mutter, »oder auch nicht genau so — noch viel, viel schöner, und springen kann er doch auch...«
»O, was mein Pudel alles kann!«, lachte der Vater.
Das Spielzeug wurde dem Kind wieder abgenommen und auf den Boden gesetzt, Mr. Steen kauerte sich hin und nahm den Gummiball zur Hand.
»Das Pudelchen heißt Whiteboy. Nun wollen wir einmal sehen, was Whiteboy alles kann.«
Ein Druck auf den Gummiball und das Pudelchen begann in bekannter Weise auf den zusammengeknickten Hinterbeinen zu hüpfen.
Das war dem Kinde ja nichts Neues mehr, das machte seines Spielgefährten Pudel ja ebenfalls; aber das hier war ein etwas größerer und viel schönerer Pudel, hatte ganz natürliche, wenn auch immer noch starre Augen, und der Vater hatte ihn mitgebracht, es war jetzt sein Eigentum — das wusste der kleine Loke nun doch schon, dazu reichte sein einjähriger Verstand aus, und deshalb jauchzte er ob dieser Hüpferei mit verstärktem Entzücken.
»Kann denn Whiteboy auch tanzen?«, fragte jetzt Mr. Steen.
Das Stichwort war gegeben, das stärkere Drücken auf den Gummiball wäre wohl gar nicht nötig gewesen — die »Figur« richtete sich höher auf den Hinterbeinen empor und begann im Kreise herumzuhüpfen und sich zu drehen.
»Das ist ja wieder etwas ganz Neues!«, fing auch die Mutter, die ebenfalls niedergekauert war, jetzt zu staunen an. »Was die Spielzeugindustrie doch alles fertigbringt! Aber dieses Spielzeug hat gewiss sehr viel gekostet?«
»O, für meinen kleinen Loke ist mir nichts zu teuer!«, lachte der gute Vater und Gatte, der seine schöne, junge Frau zum Beitrag für Miete und Lebensunterhalt von früh bis spät abends an der Nähmaschine arbeiten ließ. »Nun wollen wir weiter sehen, ob Whiteboy auch noch mehr kann. Wie spricht der Hund?«
Erst ließ sich der Pudel auf die Vorderpfoten nieder, was des Nachbars Spielzeug überhaupt nicht konnte, und dann bellte er sogar, etwas dünn, aber doch ganz wie ein richtiger Hund, eben dieser Zwerghaftigkeit entsprechend.
Und so ging es weiter. Der vermeintliche Hundebalg, der innen einen ganz komplizierten, durch Pneumatik betriebenen Mechanismus haben musste, sprang auf Kommando über den Stock und durch den Reifen, hüpfte und tanzte auch kopfunten auf den Vorderfüßen, wälzte sich und richtete sich wieder auf, nahm alle möglichen Stellungen ein, schlug sogar Salto mortales, gab Pfötchen und machte »bitte, bitte« und noch einige Dutzend andere Kunststückchen.
»Das ist ja richtige Zauberei!«, rief Mrs. Steen zuletzt.
Die junge Frau wurde aus den wasserblauen Augen des semmelblonden, so simpel aussehenden Mannes, der wohl zwanzig Jahre älter sein mochte, von einem gar scharfen Seitenblicke getroffen.
Allein das mit der »Zauberei« war nur so eine Redensart gewesen, das sah man ihr gleich an, sie war wohl vom höchsten Staunen ergriffen, aber von Furcht oder gar Entsetzen keine Spur, sie glaubte nicht etwa an etwas Übernatürliches, wie sie denn auch gleich fortfuhr:
»Wie ist denn das nur möglich?«
»Nun, wie wird das wohl ermöglicht?«, forschte der Gatte vorsichtig.
»Der Hund hat inwendig einen Mechanismus, der durch Luftdruck reguliert wird.«
»Natürlich.«
»Aber das muss doch ein ganz komplizierter Mechanismus sein.«
»Untersucht habe ich ihn noch nicht, aber er soll gar nicht so kompliziert sein, wie mir gesagt wurde. Es ist eben eine ganz neue Erfindung, es handelt sich dabei nur um die Stärke des Luftdrucks, den man durch den Gummiball gibt.«
»Großartig, großartig!«
»Wenigstens ganz reizend, das stimmt. O, mit diesem Luftdruck kann man auch noch etwas ganz anderes erzielen. Hast Du etwas Zucker, Ange? Danke. Willst Du ein Zuckerchen, Whiteboy?«
Ein Druck auf den Gummiball, der Pudel nieste zur Bejahung, wie viele Hunde es ganz von selbst tun, machte schön und bitte. Dies alles aber, immer mit ganz automatischen, ruckweisen Bewegungen. Also an einen lebenden Pudel konnte man bei längerer Beobachtung doch nicht glauben.
Das Stück Zucker wurde ihm gezeigt und auf die Nase gelegt.
»Dass du es aber nicht etwa gleich wegschnappst, Whiteboy!!«
O nein, der Automat blieb ganz starr sitzen, wartete erst auf den Luftdruck des Gummiballs.
»Nicht, bevor ich bis drei gezählt habe! Dann gehört der Zucker dir, dann darfst du ihn wegschnappen.«
»Er verdreht die Augen, wie er nach dem Zucker auf seiner Nase schielt!!«, jubelte jetzt auch die junge Frau, wie sie schon öfters gejubelt hatte, besonders im Anfange, bis sie eben vom Staunen ob des Unbegreiflichen überwältigt worden war.
»Natürlich, natürlich, das gehört doch alles mit zu dem Mechanismus, auch schielen muss er!«, rief lachend der Gatte. »Nun pass auf, Whiteboy! Eins — zwei — drei!!«
Bei »drei« warf der Pudel das Zuckerstück durch einen Ruck des Kopfes hoch und fing es mit dem schnell einmal geöffneten Maule auf, ließ es darin verschwinden.
Das kann schließlich auch ein Automat fertigbringen, er muss nur vom richtigen Tüftelbruder oder Künstler erdacht und gefertigt worden sein.
Als aber jetzt der kleine Hund das große Zuckerstück auch zu verzehren begann, was bei diesen Verhältnissen eben nicht so einfach war, das große Stück konnte in dem Mäulchen nicht nur so verschluckt werden, die Zähnchen mussten den Bissen erst zerkleinern, wobei man diese Zähnchen und das rote Züngelchen auch wirklich sah, wie sie arbeiteten, und nun diese Bewegungen des Kopfes dabei — jetzt erstarrte die junge Frau plötzlich zur Statue, und jetzt nahmen die Augen, welche das beobachteten, doch einen Ausdruck des Entsetzens oder doch wenigstens der Scheu an.
»Das ist ja gar keine tote Figur, das ist ja ein lebendiges Tier!!«
Ein schneller Griff von Mr. Steen, und in seiner Hand erstarrte der Pudel wieder, so reichte er ihn der Gattin hin.
»Ist das ein lebender Pudel oder nur ein ausgestopfter Hundebalg?«, lächelte er.
Die Furcht wurde überwunden, die feinen Hände der jungen Frau griffen zu; sie musste sich überzeugen, dass es wirklich nur eine tote, starre Figur war, deren Glieder sich auch bei Anwendung von ziemlicher Gewalt nicht biegen ließen.
»Wie ist das nur möglich?«, murmelte sie, jetzt aber mehr gedankenvoll als scheu. »Wie kann der Pudel sogar fressen?«
»Der heutigen Technik ist eben gar nichts mehr unmöglich, auch nicht in Bezug auf automatische Figuren«, belehrte der Gatte sie. »Also Du bist überzeugt, dass es nur eine tote Figur ist, die Du da in den Händen hältst?«
»Ich muss es wohl sein.«
»Witheboy, so werde lebendig!«
Das Stichwort war gegeben.
Die junge Frau stieß einen Schreckensschrei aus und ließ die Figur fallen.
Denn die war in ihren Händen plötzlich ganz außerordentlich lebendig geworden, hatte aus Leibeskräften gezappelt und gestrampelt, und sobald das Pudelchen den Boden berührte, tanzte es um die beiden herum, um mehr Zucker zu bekommen, oder überhaupt froh, sich nun frei nach Willkür bewegen zu können, und da war von automatisch erscheinenden Bewegungen nun freilich keine Rede mehr, wie Mr. Steen ja überhaupt den Gummiball losgelassen hatte, der an der Schnur am Boden nachschleifte.
Er gab seiner Gattin eine Erklärung, wie es mit der Dressur beschaffen sei, und vor allen Dingen, wie er dieses Unikum von einem Pudel von einem Freunde geschenkt bekommen habe, der, ein Junggeselle, das Tier auf eine lange Reise nicht mitnehmen konnte und es lieber in die besten Hände verschenken als es an Unbekannte verkaufen wollte. Denn sonst war dieses wunderbar dressierte Tier ja mindestens seine zwanzig Pfund Sterling wert.
Bei dieser Erklärung beruhigte sich die erschrockene Mrs. Steen wieder, jetzt konnte sie wieder lachen und sich erst richtig freuen, und noch mehr galt das von dem kleinen Loke, der den Automaten ja gar nicht richtig verstanden hatte, dem das lebende Pudelchen doch viel, viel lieber war als die wunderbarste Mechanik. Jetzt fing das Kreischen und Liebkosen erst richtig an, zumal sich Whiteboy von dem Kinde alles gefallen ließ.
»Nun aber will ich mir das Hähnchen und den Spargel nicht mehr entgehen lassen!«, rief der Gatte. »O, Angela, wie hast Du für mich gesorgt! Gerade an mein Leibessen hast Du gedacht!«
Alles dampfte noch. Viel Zeit hatte diese Spielerei ja nicht in Anspruch genommen. Sie setzten sich. Auch die junge Frau aß mit, wenn auch nur zur Gesellschaft, die vorgelegten Stückchen kaum berührend.
»Morgen früh machen wir einen Ausflug nach Buckhorsthill«, sagte er nach dem ersten Bissen.
»Ach, in den Wald!«, jubelte gleich die junge Frau.
»Ja, da machen wir ein Picknick...«
»Wenn nur schönes Wetter ist!«
»Es wird ganz bestimmt schön sein, darauf verstehe ich mich. Auf dem Rückweg holen wir im Vorverkauf Billets für die Große Oper.«
»Ach, in die Oper gehen wir!«, erklang es mit noch größerem Jubel als zuvor. »Was wird denn gegeben?«
»Wagners ›Lohengrin‹.«
»Wagners ›Lohengrin‹! Den ich immer so gern einmal hören wollte!«
»Habe ich alles extra für Dich eingerichtet«, lachte scherzhaft der aufmerksame Gatte, der sich das Hähnchen und den Stangenspargel schmecken ließ. »Und bis dahin, bis zum Abend, werde ich den ganzen Nachmittag malen. Ich werde ein neues Bild anfangen, zwar wieder Dich mit dem kleinen Loke auf den Arm, aber doch wieder in ganz anderer Weise, es wird etwas ganz Besonderes. Du wirst schon sehen.«
»Ach, wird das ein herrlicher Nachmittag wenn Du an der Staffelei sitzt!«, wurde immer wieder in unsäglichem Glücke gejubelt.
»Was hat sich denn hier unterdessen alles ereignet?«
Absolut nichts Neues. Und doch hatte die junge Frau so unendlich viel und Wichtiges zu berichten. Als Mutter! Über ihr Kind, über seine Entwicklung! Da wurde keine Kleinigkeit vergessen.
Aufmerksam hörte der Vater zu, hatte immer neue Fragen zu stellen, ebenfalls ganz verklärt vom häuslichen Familienglück, und dabei vergaß er nicht der Mahlzeit zuzusprechen.
»Bist Du nicht einmal fort gewesen?«
»Nur meine gewöhnlichen täglichen Einkäufe habe ich gemacht.«
»Keinen Besuch bekommen?«
»Heute.«
»Wen denn?«
»Eine alte Tante. Oder ich weiß gar nicht recht, in welchen verwandtschaftlichen Beziehungen ich zu ihr stehe. Eine gewisse Misses Plumber, die im Hause meiner Eltern ein- und ausging und von uns Kindern ›Tante‹ genannt wurde.«
»Was wollte sie?«
»Gar nichts weiter. Sie hatte gehört, nachdem wir uns seit bald zehn Jahren nicht mehr gesehen haben, dass ich verheiratet sei, dass ich hier wohne, und da wollte sie mich eben einmal besuchen.«
»Was sagte sie?«
»Nichts von Bedeutung. Wir sprachen über dies und das.«
Mr. Steen klopfte vergebens auf den Busch. Diese junge Frau mit dem Madonnenantlitz hatte einen viel zu edlen Charakter, als dass sie über jenes Weib auch nur ein schlechtes Wort sagte.
»Ist diese Misses Plumber eine sympathische Person?«
»Ich habe nichts an ihr auszusetzen, wenn ich auch nicht die ehemalige Bekanntschaft erneuern möchte.«
»Weshalb nicht?«
»Damals war ich ein Kind und sie galt als meine Tante — jetzt habe ich meine Familie. Du weißt doch, dass ich mit keinem einzigen Menschen verkehre.«
Mr. Steen gab seine Bemühungen in dieser Sache auf. Die Mahlzeit war beendet; auch den nachfolgenden Pudding hatte er verspeist. Er brannte sich eine Zigarre an.
»Nun muss ich Dir eine Mitteilung machen, die Dich wohl etwas betrüben wird. Ich tue es erst jetzt; ich wollte das Wiedersehen nicht stören, mir selbst das Essen nicht verderben.«
»Was ist es?«, erklang es besorgt.
Mr. Steen zog seine Taschenuhr. Er trug sie an einer schwarzen Schnur, und wir wollen gleich sagen, dass sie ganz genau so aussah wie jene Uhr, welche Loke Klingsor immer in der Westentasche hatte.
Also besaß sie auch zwei Deckel. Als aber Mr. Steen jetzt den oberen Deckel aufspringen ließ, da war nichts von rätselhaften Scheiben zu sehen, sondern das Zifferblatt einer normalen Uhr zeigte sich.
»Es ist gleich um elf. Ich habe noch einen Weg zu machen, von dem ich erst gegen halb zwei zurück sein kann.«
»O weh! Noch so spät in der Nacht hast Du eine Besorgung zu machen?«
»Ja. Ich muss in eine Gesellschaft, in einen Klub; ich habe mein Wort gegeben. Ich muss noch einmal den Steuermann Glane sprechen.«
Hoch horchte die junge Frau bei diesem Namen auf. Vielleicht war sie auch etwas zusammengezuckt. Das war aber auch alles. Sonst wurde sie vergebens so scharf von den Augen ihres Mannes beobachtet.
»Steuermann Glane?«
»Kennst Du ihn?«
»Mir ist, als ob ich diesen Namen schon einmal gehört hätte...«
»Von wem? Bei welcher Gelegenheit?«
»Ach richtig! Misses Plumber erzählte mir von ihm. Sie wohnt in Richmond; ein Steuermann Glane ist ihr Nachbar...«
»Das ist möglich, er wohnt tatsächlich in Richmond«, wurde die Sprecherin unterbrochen.
Nun hätte doch sehr nahe gelegen, dass der Mann, der seine Frau aushorchen wollte, fragte, was sie denn sonst über diesen Steuermann Glane erfahren habe.
Das tat aber Mr. Steen, der ja überhaupt recht eigentümliche Wege ging, nun gerade nicht. Seine Gründe dazu mochte er freilich haben; eine Vergesslichkeit lag sicher nicht vor.
»Ja, mit diesem Steuermann Glane, der mein spezieller Freund ist, wenn ich Dir auch noch nie von ihm erzählt habe, will ich mich heute in einem Klub treffen. Dass wir die Zeit so spät in der Nacht ausgemacht haben, fällt Dir wohl nicht weiter auf?«
»O nein, ich weiß schon, dass die Klubs doch immer bis tief in die Nacht zusammen sind, und nun überhaupt London; die Herren müssen doch am Tage ihren Beschäftigungen nachgehen.«
»Du kennst die Klubs von London wohl nicht?«
»Woher soll ich sie kennen?«
»Den Namen nach.«
»Auch nicht! Wenn es sich nicht um die ganz bekannten, um die berühmten, handelt, wie etwa den ›NavyKlub‹ und dergleichen.«
»Es ist ein sehr merkwürdiger Klub, in den mich Glane heute Nacht einführen will.«
»Merkwürdig inwiefern?«
»Der ›Klub der Teufelsbrüder‹ nennt er sich.«
»Teufelsbrüder?!«
»Unter uns im Vertrauen gesagt: Ich darf eigentlich gar nicht darüber sprechen. Bei Dir ist das ja aber etwas anderes. Du weißt, dass ich vor Dir keine Geheimnisse habe. Es ist auch gar kein konzessionierter Klub, sondern eine geheime Vereinigung.«
»Und was treiben denn die Mitglieder?«
»Nun, sie beten eben den Teufel an und treiben schwarze Künste. Glaubst Du an so etwas, Angela?«
Lachend hatte es Mr. Steen gefragt. Die junge Frau faltete die Hände, machte aber sonst kein ängstliches Gesicht.
»Nein, ich glaube nicht, dass der liebe Gott so etwas zulässt«, sagte sie ergebungsvoll.
»Meinst Du?«, erklang es gleichmütig zurück. »Wenn es aber nun doch anders wäre?«
»Wie das?«
»Hast Du schon einmal etwas von schwarzer Magie gehört?«
»Ja.«
»Nun, was ist das?«
»Geheime Künste treiben, durch die man Übernatürliches erzeugen will, besonders solches, wodurch man andere Menschen schädigt.«
»Das wäre nicht unbedingt nötig. Man könnte ja auch Gutes beabsichtigen.«
»Das wäre dann sogenannte weiße Magie. Du sprachst von der schwarzen.«
»Du scheinst sogar mehr davon zu verstehen, als ich annahm. Und wenn es nun doch so etwas gäbe? Dass man sich deswegen dem Teufel verschreibt?«
»Ich glaube an ein böses Prinzip, das in der Welt herrscht, aber nicht an einen persönlichen Teufel, und überhaupt nicht, dass es so etwas gibt«, entgegnete die junge Frau sogar mit einer gewissen Heiterkeit.
»Dieser Steuermann Glane soll ein ganz besonderer Teufelskünstler sein.«
»Er will Dich heute Nacht in der Geisterstunde einweihen?«, scherzte sie.
»Und wenn ich nun schon selbst solch ein Teufelsbündler wäre, heute Nacht in dieser geheimen Verbrüderung nur die letzte Weihe erhalten sollte?«
Sie schlang die vollen Arme um seinen Nacken und küsste ihn zärtlich.
»Ach, Du guter Mann! Du versuchst vergeblich, in mir den Glauben zu erwecken, als gingest Du auf geheimen Wegen, die zur Hölle führen! Ich kenne Dich schon, Du scherzest gern. Also gehe nur ruhig in den Klub! Ich bin wegen Deines Seelenheiles ohne Sorge.«
Lachend griff Mr. Steen nach seinem Hute.
»Mit Dir ist nichts anzufangen, Ange, Du bist von der Vortrefflichkeit meiner Wenigkeit gar zu felsenfest überzeugt. Also halb zwei bin ich zurück, so lange wartest Du wohl auf mich?«
»Bis zu Deiner Rückkehr, und sollte es auch noch viel länger währen.«
»Du kannst Dich ja einstweilen schlafen legen...«
»Nein, nein, ich warte. Höchstens lege ich mich etwas aufs Sofa. Loke wird auch noch lange wach bleiben, er hat heute den ganzen Nachmittag geschlafen.«
»Dann ist es gut.«
Noch ein zärtlicher Kuss, noch einmal den Jungen auf den Arm genommen, und Mr. Steen war fertig zum Gehen.
»Dass ich es nicht vergesse... unsere Nachbarin, die Misses Dorington, ist doch immer so gefällig, wie Du auch vorhin mir wieder so viel von ihrer Freundlichkeit erzählt hast — ich habe ihr etwas mitgebracht, etwas Tee und Zucker und dergleichen — es ist in meinem Koffer, packe es inzwischen aus.«
»Ach, Du lieber Mann, wie Du doch an alles denkst, immer jedem eine Freude bereitest!«
Er hatte das Zimmer verlassen, befand sich auf dem die ganze Nacht hindurch erleuchteten Korridor.
»Alles ist eingeleitet, jetzt kommt die Entscheidung«, murmelte er, als er die Treppe hinabstieg.
»Es ist viel, was ich dieser armen, unschuldigen Frau bieten werde, etwas ganz Ungeheuerliches — aber es geht nicht anders, ich muss sie endlich einweihen, um sie ganz in meine Sphäre zu bringen, und da lässt es sich nicht anders machen. Sie ist von meiner frommen Ehrbarkeit, die kein Wässerchen trüben kann, gar zu fest überzeugt. Da heißt es: biegen oder brechen! Doch ich werde ja schützend bei ihr weilen, um das Schlimmste von ihr abzuwenden, falls es doch über ihre Nervenkraft gehen sollte. Dass der Junge bald einschläft, dafür habe ich ja mit meinem letzten Kusse gesorgt.«
Er trat auf die Straße, ging hinüber nach der anderen Seite und blickte zu den beiden erleuchteten Fenstern in der zweiten Etage empor.
Die junge Frau saß auf dem Sofa, die Hände gefaltet, und schaute dem Kinde zu, das mit dem immer ausgelassener werdenden Hündchen spielte.
Doch ob ihre Augen auch wirklich sahen? Ihr Gesichtsausdruck war sorgenvoll und bekümmert.
»Sollte an alledem, was mir die Tante erzählte, doch etwas sein?«, flüsterte sie.
So verging wohl eine halbe Stunde, sie regte sich nicht.
Mit einem Male, mitten im Spiele, neigte das am Boden sitzende Kind das Köpfchen, fiel gleich mit dem ganzen Körper um.
Es war für die Mutter nichts Besorgniserregendes. Sie kannte dieses schnelle, plötzliche Einschlafen ihres Kindes, nur ein Zeichen der Gesundheit.
Das brachte sie nun auch auf andere Gedanken. Sie erhob sich, nahm den Knaben auf, entkleidete ihn und brachte ihn zu Bett.
Dann räumte sie den Tisch ab, wusch das Geschirr gleich auf, ordnete alles wieder; dann nahm sie den Schlüssel und schloss den Koffer auf, wozu sie ihn auf den Tisch gehoben hatte, wo er die Hälfte der Platte einnahm.
Unter den Wäsche- und Kleidungsstücken hatte sie schnell gefunden, was sie suchte, und sie packte es aus: vier Päckchen Tee, jedes zu einem halben Pfund, ein Pfund Zucker, eine Dose kondensierte Milch und eine Glasbüchse feinste Orangenmarmelade, wie das Etikett verriet.
Das brachte sie nun vollends auf andere Gedanken, ihr holdes Madonnenantlitz wurde wieder ganz von stillem Glück verklärt.
»Der gute Mann! Wie er doch an alles denkt! Wie er sich damit geschleppt hat! Ach, wird sich Misses Dorington freuen! Und der will nun mit Teufelsbrüdern...«
Sie brach ab. Ihr Blick war auf etwas anderes gefallen, was sich da zwischen den Paketchen und Wäschestücken befand.
Es war eine Flasche in Karaffenform, unten sehr bauchig mit langem Halse, von buntem Glase, rot und blau und gold, ein sogenanntes venezianisches Fläschchen. Die goldenen Linien bildeten auf dem andersfarbigen Grunde wunderliche Schnörkel, aus denen die Phantasie ebenso gut geheimnisvolle Buchstaben wie Teufelsfratzen machen konnte.
Mit starrem Blicke betrachtete Angela das Fläschchen, bis sie es auch nahm, freilich mit sehr scheuen Händen.
»Hat Mistress Plumber nicht erzählt, Steuermann Glane hätte seiner Frau solch ein Fläschchen mitgebracht und mit ihm wunderbare...«
In diesem Augenblicke holte der Regulator an der Wand zum Schlage aus, verkündete die Mitternachtsstunde.
Und in demselben Augenblicke verlosch das Licht des von der Decke herabkommenden Gasarmes, der nicht ganz in der Mitte des Zimmers angebracht war.
Stockfinsternis herrschte plötzlich. Zwar waren in der lauen Frühlingsnacht beide Fenster geöffnet, aber auch draußen war es sehr finster, und das diesem Building gegenüberliegende Haus war zu weit entfernt, als dass dort drüben die erleuchteten Fenster hier noch Helligkeit hätten erzeugen können.
Und in dieser Finsternis nun fing das Hündchen plötzlich kläglich zu heulen an.
»Was ist das? Weshalb geht das Gas aus?!«
Es war in den bald zwei Jahren, seitdem sie hier wohnten, zum ersten Male, dass so etwas geschah.
»Weshalb winselt der Hund so? Mitternachtsstunde! Jetzt ist er im Klub der Teufelsbrüder, jetzt beginnt dort das geheimnisvolle Treiben...«
Da stieß Angela einen Schreckensschrei aus, schnell setzte sie das Fläschchen auf den Tisch hin oder ließ es gar fallen, so hatte es geklirrt.
War es ihr doch gerade gewesen, als ob das Glas in ihrer Hand plötzlich lebendig geworden wäre.
Sie war gleich zurückgeprallt, bis das Sofa ihr Halt gebot, auf dem sie nun niedersank.
Dann wollte sie wieder auf, um mit einem Streichholz Licht zu machen, das Gas wieder anzubrennen.
Aber sie konnte sich vor Schreck und vor bangem Entsetzen nicht erheben.
Denn plötzlich ward es in dem Zimmer von selbst hell.
Aber nicht, dass das Gaslicht vielleicht auch nur ganz klein geworden, von selbst wieder aufgeflammt wäre, sondern es war ein ganz anderes, gelbes, magisches Licht, welches das Zimmer mit schwachem Scheine erfüllte.
Und dieses merkwürdige, unheimliche Licht ging von der facettierten Glaskugel aus, die dort oben an der Decke hing.
»Die Glaskugel, wie auch Steuermann Glane überall eine solche in seiner Wohnung hängen hat, in jedem Zimmer eine! Was ist das nur?«
So flüsterte die junge Frau mit bleichen Lippen, während das Hündchen, das sich irgendwo verkrochen hatte, nur immer kläglicher winselte.
»Was hat der Hund? Sieht er mehr als ich? Was soll dies nur alles bedeuten?«
Sie wollte auf, um nach der Tür zu eilen und diese aufzustoßen — draußen musste ja helle Gasbeleuchtung sein — aber sie konnte nicht.
Ihr Blick war auf das Fläschchen gefallen.
Dieses stand merkwürdigerweise aufrecht auf dem Tisch, obgleich sie es doch hingeworfen hatte.
Jetzt begann es sich zu bewegen, wackelte hin und her, bis es mit einem Ruck wieder stehen blieb.
Und nun entquoll dem schlanken Halse dieser Flasche ein weißer Rauch, der zu einer Säule emporstieg.
Angela wollte einen Schrei ausstoßen, aber auch das vermochte sie nicht mehr, die Kehle war ihr wie zugeschnürt, wie auch ihre sämtlichen Glieder gelähmt waren.
Mit vor Entsetzen starren Augen beobachtete sie die weiteren Vorgänge.

Mit vor Entsetzen starren Augen beobachtete sie die weiteren Vorgänge.
Die dem Flaschenhalse entquollene weiße Rauchsäule war bis zur Hälfte der Zimmerdecke emporgestiegen, so blieb sie stehen, verdickte sich aber immer mehr.
Und dann begannen aus dieser Rauchsäule Vorsprünge hervorzukommen, erst wie Bänder, sie bildeten Arme, oben entstand eine Einschnürung, so bildete sich ein Kopf, und wie die Arme immer deutlicher wurden, bis man die Hände mit jedem Finger erkennen konnte, so nahm auch der Kopf Gesichtszüge an.
Die geisterhaften Umrisse eines Mannes entstanden, dem man das Diabolische gleich ansah, nicht nur an diesen bartlosen Gesichtszügen, es waren, wie wir gleich verraten wollen, die charakteristischen Züge Klingsors, welche die Nebelgestalt zeigte, nur dass an dem Kopfe auch die Teufelshörner nicht fehlten.
Also der Teufel selbst in vollendeter Ausgabe! Jetzt entstand hinten sogar ein Schwanz, der rechte Fuß bildete sich zu einem Klumpen — nur dass bei der an sich farblosen Wolkengestalt ein Kostüm nicht richtig zu erkennen war.
So löste sich das Gespenst, wie man es wohl bezeichnen konnte, von dem Flaschenhalse ab, senkte sich mit den Füßen auf die Tischplatte, glitt über diese, senkte sich weiter auf den Boden herab.
Die gespensterhafte Erscheinung aus der Hölle schien sich der jungen Frau nähern zu wollen.
Mit einem Male aber vollzog sich wiederum eine Verwandlung.
Durch die Nebelgestalt ging ein Wallen, sie umgab sich wie mit einer Kleidung, deutlich war zu sehen, wie jetzt ein Rockanzug entstand, wie Mr. Steen einen getragen hatte, und da nahm auch der Kopf dessen Gesicht an, und so wandte sich die nunmehrige neue Gestalt von der jungen Frau ab und dem Kinderbett zu, jetzt aber nicht mehr schwebend, sondern richtig gehend, wenn auch unhörbar und dabei hinkend, was ja Mr. Steen nicht tat — so hinkte sie auf das kleine Bett zu, beugte sich darüber, hob die unruhig zitternden Hände und streckte sie nach dem kleinen Schläfer aus...
Es war zu viel für die junge Frau.
Und sie war keineswegs durch irgendein Mittel in einen Starrkrampf versetzt worden, von dem sie sich durch eigene Kraft nicht wieder hätte befreien können.
Mit einem gellenden Angstschrei sprang sie auf, rannte hin, griff gleich durch die Nebelgestalt hindurch, riss das Kind aus dem Bettchen, drückte es an ihre Brust, stürzte nach der Tür, stieß sie auf und eilte hinaus.
Die Tür ging wie immer hinter ihr ganz von selbst wieder zu.
In dem Zimmer herrschte noch das magische Licht. aus der Facettenkugel kommend.
Es verschwand, wieder herrschte Stockfinsternis.
Mit einem Male flammte wieder das Gaslicht auf.
Die Nebelgestalt an dem Bettchen war verschwunden.
Statt ihrer stand dort ein wirklicher Mensch aus Fleisch und Blut.
Aber nicht Mr. Charles Steen, sondern Loke Klingsor war es, in seinem gewöhnlichen Kostüm, das er mit Vorliebe trug, mit der schwarzen Samtjacke.
Wie jene Nebelgestalt, so hatte auch er noch die feinen, schlanken, und doch so ungemein kräftigen Hände nach dem Bettchen ausgestreckt, als wolle er das Kind fassen.
Jetzt aber zog er diese Hände zurück, kreuzte die Arme über der Brust.
So blickte er nach der Tür, durch die das junge Weib verschwunden war, und immer mehr umspielte ein diabolisches Lächeln die merkwürdigen, charakteristischen Züge.
»Schade!
Ich wollte ihr noch etwas ganz anderes vormachen, aber sie hat nicht einmal den Anfang vertragen können.
Sie glaubte, die gespensterhafte Erscheinung hätte mit dem Kinde etwas vor, und das war zu viel für ihre Mutterliebe.
Sie ist geflohen — geflohen vor ihrem Gatten, auch wenn sie den in dem Gespenst nicht so ganz erkennen konnte.
Wohl, so musste es kommen.
Nun sind ihr die Augen geöffnet worden, und ich weiß, was ich nun zu tun habe.
Immer fliehe vor Deinem Gatten — als Loke Klingsor wirst Du ihn wiederfinden, er weiß auf Deinen Spuren zu bleiben, ihm kannst Du Dich nicht entziehen.
Und diese neue Verwicklung und Schwierigkeit, die sich mir hierdurch bietet, zu überwinden, alles zu besiegen, das ist ja meine Lust.«
Eine furchtbar zerrissene Felsenschlucht. Von einer der Wände stieg langsam und vorsichtig ein Mann herab, der in einen abgeschabten ledernen Jagdanzug gehüllt war, über der Schulter die Doppelbüchse hängen hatte.
Das war alles, was man bei diesem Abstieg vorläufig beobachten konnte.
Seine große Vorsicht war begreiflich. Eine außerordentliche Gewandtheit gehörte dazu, diesen gefährlichen Abstieg bewerkstelligen zu können. Aus einiger Entfernung waren die Vorsprünge an der sonst glatten Wand kaum zu erkennen, welche die mit Mokassins bekleideten Füße bei jedem neuen Schritte nach abwärts erst tastend suchen mussten, und noch schwieriger war es für die Hände, einen Halt zu finden, an den sie sich klammern konnten.
Wenn er nicht aus einer Spalte gekommen wäre, welche die Wand hier und da durchzogen, musste der Mann wenigstens schon aus 200 Meter Höhe abgestiegen sein. Jetzt trennten ihn kaum noch zehn Meter von dem ziemlich ebenen Boden der Schlucht.
Auch diese geringe Tiefe wurde von ihm noch glücklich überwunden.
Ehe er aber den Boden erreichte, löste sich unter seinen Füßen ein ziemlich großer Stein und polterte hinab.
»Verdammt, dass mir das auch noch passieren muss!«, knurrte er verdrießlich, sogar erschrocken.
Nun schien er aber auch zu wissen, wo er sich befand, denn unter sich konnte er, das Gesicht immer dicht gegen den Felsen gepresst, ja wohl schwerlich blicken, und mit einem letzten Satze sprang er vollends hinab, was ihm freilich nicht so leicht jemand nachgemacht hätte, denn eine Höhe von drei Metern war es immer noch gewesen.
Er knickte etwas zusammen, stand aber unbeschädigt gleich wieder aufrecht.
Und da zeigte sich, dass dieser Kletterer und Springer, der solche elastische Knochen besaß, ein alter Mann war, der wenigstens schon siebzig Jahre zählen mochte. Sonst war das nicht zu erkennen gewesen; hatte er weiße Haare, so verschwanden diese ganz unter der Ledermütze — dieses hohe Alter verriet sich durch das faltige, verwitterte Gesicht, wenn auch aus den Augen noch jugendliches Feuer strahlte, wie ja überhaupt solch ein halsbrecherischer Abstieg außerordentliche Rüstigkeit und Geschmeidigkeit erforderte.
Im Übrigen waren es durchaus keine vertrauenerweckenden Augen, sie hatten einen stechenden Blick, und ihnen entsprach der Ausdruck des ganzen Gesichts, das besonders auch durch die stachligen Borsten unter der Nase an das eines alten, schlauen, mit allen Hunden gehetzten Fuchses erinnerte.
Tief aufatmend blickte er sich mit den stechenden Augen um, und etwas wie Freude war darin zu lesen.
»Mein altes Felsengebirge, in dem der Steinfuchs sein halbes Leben verbrachte — endlich erblicke ich dich wieder, endlich kann ich mich wieder einmal in dir...«
Er brach ab; die noch immer so nervöse Faust fuhr nach dem Revolver, der neben dem Scheidenmesser am Gürtel hing.
Aus einer der Höhlen, welche die Wand besonders am Boden aufwies, war ein anderer Mann getreten, jenem recht ähnlich gekleidet und bewaffnet, aber weit jünger, wenn auch er die vierzig schon weit überschritten haben mochte.
»Der Gelbe Marder!«
»Der Steinfuchs!«
»Vermaledeiter Hund!«
»Schakal, verdammter!«
So hatten die beiden sich mit giftigen Blicken angezischt, jeder die Hand am Revolver.
Was hier vorlag, war ja ganz klar.
Zwei Jäger waren sich begegnet, die sich ein Revier streitig machten, da musste es zu einem blutigen Zusammenstoß kommen.
Musste es unbedingt?
Es sollte gleich anders werden.
»Na, was soll's?«, knurrte zuerst der Jüngere, seine Hand von dem Revolverkolben zurückziehend. »Was uns zu Feinden machte, ist schon lange her, die Zeiten haben sich geändert, und wir treffen uns doch hier nicht unvermutet.«
»Dass Dich die Pest!«, zischte der andere trotzdem.
»Wusstest Du nicht, dass Du mich hier treffen würdest?«
»Ich wusste es.«
»Was war Dir befohlen? Was sollen wir zuerst tun?«
»Was geht's Dich an?«
»Uns die Hände schütteln.«
»Weiß es. Na, denn mal los, wenn's unbedingt sein muss!«
Und der Alte ließ schon etwas freundlicher, wenn auch noch grimmig genug, den Revolver los, um jenem die Hand hinzuhalten.

Sie wurde genommen und sogar ziemlich herzlich geschüttelt.
»Ich denke, Steinfuchs, wir sind eigentlich niemals so richtige Feinde gewesen.«
»Meine es auch.«
»Haben uns auf dem gemeinsamen Jagdgebiete immer ganz gut vertragen.«
»So ziemlich.«
»Nur treffen durften wir uns nicht.«
»So wie damals.«
»Als wir uns katzbalgten.«
»Du mir den kleinen Finger abbissest«, sagte der Alte, seine linke Hand betrachtend, an der der kleine Finger fehlte.
»Und Du mir drei Zoll kaltes Eisen in den Leib ranntest, dass ich's jetzt noch manchmal fühle.«
»Schlimm?«
»Nur wenn's Wetter umschlagen will, dann fühle ich in den Eingeweiden noch so ein leises Brennen — nicht von Bedeutung.«
»Feines Wetterglas das, höhö!!«, lachte der andere vergnügt.
»Und seitdem ist mein altes Magenleiden verschwunden, der Gelbe Marder kann wieder schlingen wie ein Wolf«, lachte der andere noch vergnügter.
»Na, lassen wir das, kommen wir zur Sache, weswegen wir uns hier treffen mussten! Setzen wir uns!«
Und die beiden Rivalen, die in Wirklichkeit also niemals gar so schlimme Feinde gewesen waren, sahen sich nach einer Sitzgelegenheit um; fanden eine solche auf zwei sich gegenüberliegenden Felsblöcken.
Aber so schnell, wie sie vorhatten, sollten sie die Hauptsache nicht erledigen.
»Na?«, fing der Steinfuchs an, sein Gewehr auf den Knien balancierend.
»Was sollst Du hier?«
»Dich treffen.«
»Und?«
»Mich mit Dir verabreden.«
Der Gelbe Marder, wohl wegen seiner etwas krankhaft gelben Hautfarbe so genannt, zog zunächst aus seinem Gürtel eine lange, stark gebrauchte Tabakspfeife, deren Kopf aus einem Marderschädel bestand, was wiederum Veranlassung zu seinem Namen gegeben haben mochte, und gleichzeitig zog er aus der Tasche einen gefüllten Tabaksbeutel.
Aber ehe er die Pfeife stopfen konnte, fiel ihm der Alte in den Arm.
»Bist Du des Teufels?!«, zischte er erschrocken. »Du willst hier doch nicht etwa rauchen?«
»Nee, denke gar nicht daran«, knurrte der Jüngere unwirsch, die Pfeife in den Gürtel zurückschiebend.
»Du wolltest doch.«
»Nur eine alte Gewohnheit, dass ich auch die Pfeife hervorholen muss, wenn ich den Tabaksbeutel ziehe, wollte nur einen Mund voll nehmen.«
Und er pfropfte sich den ganzen Mund voll mit dem losen Tabak!
Dann blickte er sich um und schüttelte den Kopf.
»Merkwürdig, ganz merkwürdig!«
»Was ist merkwürdig?«
»Das wir nicht gesehen werden können, wo wir uns doch so ganz deutlich sehen.«
»Jeder andere Mensch und jedes Vieh sieht uns — da, die Eidechse auch, die vor uns schnell Reißaus nimmt.«
»Aber in dem Dinge sieht man uns nicht. Wie heißt das Ding?«
»Du meinst wohl die Camera obscura?«
»Richtig! Camera obscura!«
»Nee, da sieht man uns nicht.«
»Aber wenn ich hier rauche, da könnten die Wölkchen gesehen werden.«
»Das ist ein Faktum.«
»Und wenn ich jetzt einmal ausspucke, das könnten sie auch sehen.«
»Könnten sie.«
»Und wüssten nicht, woher der Klatsch käme.«
»Wüssten es sich aber wohl zu erklären. Wenn es nicht gerade vom Himmel gießt.«
»Aus dem Munde eines tabakkauenden Menschen.«
»Vorausgesetzt, dass sie diese Gegend gerade in der Camera haben, an der Wand oder auf dem Tische.«
»Das werden sie wohl jetzt haben.«
»Wir selbst aber sind unsichtbar.«
»Ja, in der Camera.«
»Wie sie's nur machen! Wo wir uns doch selbst und gegenseitig sehen.«
»Hast Du nicht so einen kleinen Apparat auf der nackten Brust?«
»So eine Platte, eine elektrische, sagen sie wohl? Habe ich.«
»Na, daher kommt's.«
»Ja, aber wie, wie?«
»Weiß ich nicht. Da musst Du die Gelehrten fragen, die das erfunden haben.«
»Aber die Skalden können doch sich und uns und alles andere ganz und gar unsichtbar machen, dass man überhaupt nichts mehr davon sieht.«
»Können sie.«
»Warum machen sie uns da nicht auch gleich ganz unsichtbar?«
Der Alte musterte den jüngeren Frager mit einem misstrauischen Seitenblick.
»Willst Du etwa spionieren?«
»Was spionieren?«, wurde verwundert zurückgefragt. »Bist Du beauftragt, mich auszuhorchen?«
»Ich? Nee!«
»Ich kenne Deine Galgenphysiognomie, und die hat sich, seitdem wir uns nicht gesehen, nicht verändert — wenn Du was ausspionieren willst, siehst Du ganz anders aus. Dann bist Du einfach ein Narr, wenn Du so fragst. Warum wir nicht gleich ganz und gar unsichtbar gemacht werden? Erstens, weil wir uns da gegenseitig selbst nicht sehen würden...«
»Dafür gibt es doch wieder besondere Gläser.«
»... und zweitens, weil wir auf einem sogenannten neutralen Gebiete sind, das heißt auf einem solchen, das eben auch allen anderen Menschen gehört, und da dürfen sich die Skalden nicht unsichtbar machen.«
Der andere kratzte sich verlegen hinter dem Ohre.
»Ach so, ja — da hast Du recht — das hätte ich auch gleich wissen können. Aber warum dürfen die Skalden sich außerhalb ihrer eigenen Gebiete eigentlich nicht unsichtbar machen?«
»Weiß ich nicht. Das ist eben strenges Skaldengesetz, das sie so in ihren Versammlungen aufstellen, wobei die Mehrheit der Stimmen entscheidet. So wie auf solchen neutralen oder richtiger allgemeinen Gebieten ja auch alle die anderen Erfindungen nicht benutzt werden dürfen, keine einzige.«
»Ja, ja, jetzt weiß ich schon. Deshalb durften wir ja auch nur die gewöhnlichen Waffen mitnehmen.«
»Gott sei Dank, dass ich wieder einmal meine alte Knarre schleppen kann!«, schmunzelte der Alte, zärtlich seine Doppelbüchse streichelnd, die wohl auch auf ein sehr hohes Alter zurückblicken konnte. »Wenn ich schieße, muss es krachen, sonst macht es mir keinen Spaß — wie bei den dummen elektrischen Gewehren.«
»Ja, aber ich verstehe immer noch nicht recht«, fing der Gelbe Marder wieder an.
»Was denn nicht?«
»Warum dürfen wir denn da nicht in der Camera gesehen werden?«
»Dummkopf Du!«, lachte der andere. »Weil uns dann doch auch die, auf die wir es abgesehen haben, hier sehen würden. Oder die, welche diese Gegend in ihrer eigenen Camera beobachten — also gewissermaßen unsere Feinde.«
»Ach so, richtig, richtig!«
»Na, nun hast Du's wohl endlich kapiert.« Eine kleine Pause trat ein. Der eine streichelte seine Büchse, der andere kaute eifrig Tabak und schluckte den Saft hinter, obgleich er ihn wohl gerne ausgespuckt hätte!
»Ja, weshalb sollen wir uns nun hier treffen?«, fing der Gelbe Marder dann wieder an.
»Wir sollen ausmachen, was auszumachen ist.«
»Und was ist auszumachen?«
»Einen Kriegsplan entwerfen.«
»Gegen wen befinden wir uns auf dem Kriegspfade?«
»Das weißt Du ganz genau.«
»Na, nun einmal heraus mit der Sprache!«
»Heute, am 9. Hyparion um drei Uhr nach Skaldenzeit treffen hier Loke Klingsor und die Königin von Thule zusammen.«
»Richtig. Was wollen die hier?«
»Das weißt Du genau so gut wie ich.«
»Höre, Steinfuchs — ich bin beauftragt, Dich zu fragen, und Du sollst mir immer antworten!«
»Dasselbe ist mir gesagt worden, das gilt also auch von Dir.«
»Und wir haben zu gehorchen.«
»Leider, ja.«
»Also antworte mir! Oder frage Du und ich will antworten.«
»Die beiden wollen hier einen Zweikampf ausfechten.«
»Mit leichten Säbeln?«
»Auf Leben und Tod. Einer von ihnen muss bleiben, eher wird nicht aufgehört.«
»So ist's.«
»Wo findet der Zweikampf statt?«
»In der Bärenschlucht.«
»Stimmt!«
»Und diesen Zweikampf sollen wir beide verhindern?«
»Das heißt, wir sollen uns der beiden bemächtigen, solange sie noch lebend sind.«
»Ich mich des Loke Klingsors.«
»Und ich mich der Chlorinde, der Königin von Thule.«
»Kennst Du die?«
»Habe wenigstens genug von ihr erzählt bekommen.«
»Soll ein ganz rabiates Weib sein.«
»Eben deswegen hat man mich so genau instruiert.«
»Und kennst Du den Klingsor?«
»Nur dem Namen nach. Auch ein Skaldenfürst.«
»Was weißt Du sonst noch von ihm?«
»Dass er immer Gaukeleien treibt und alle anderem Menschen gern zu Narren hält. Sogar den Skalden hat er schon manchen Possen gespielt.«
»Ich glaube, Steinfuchs, da ist mir der schwerere Teil unserer gemeinsamen Arbeit zugefallen.«
Es war der Gelbe Marder, der dies sagte. Dem fiel also Loke Klingsor zu, der Ältere, der Steinfuchs, sollte sich der Königin von Thule bemächtigen.
»Wir sollen aber ganz zusammenarbeiten.«
»Natürlich müssen wir, da die beiden hier zusammentreffen.«
»Ja, eben deshalb müssen wir einen gemeinsamen Kriegsplan entwerfen.«
»Wir könnten sie auch wegfangen, wenn sie sich einzeln an Ort und Stelle begeben.«
»Einzeln?«
»Nun, jeder kommt doch mit seinem eigenen Luftschiffe.«
»Aber wo legen diese an?«
»Wissen wir nicht.«
»Nein, das wusste auch der nicht, der mir diesem Auftrag gegeben und mich instruiert hat.«
»Auch meiner nicht, sonst hätte er es mir schon gesagt.«
»Die Luftschiffe, die sie benutzen, sind natürlich unsichtbar.«
»Selbstverständlich. Ebenso wie die, die uns hierher gebracht haben.«
»Und die werden schon an einer versteckten Stelle anlegen, wo man sie beim Aussteigen nicht beobachten kann.«
»Das ist gewiss.«
»Also können wir sie nur an dem Treffpunkte überraschen, das ist in der Bärenschlucht.«
»Oder auf dem Wege dorthin.«
»Na ja, auch auf dem Wege dorthin. Aber bleiben wir nur bei der Bärenschlucht selber!«
»Gut!«
»Wo befindet sich die?«
»Höhö, das wirst Du wohl gerade so gut wissen wie ich!«, lachte der Gefragte. »Oder willst Du mich nicht auch fragen, wo wir uns hier befinden?«
»Im Indianersturz.«
»Ja — so genannt, weil hier einmal gleichzeitig ein ganzes Dutzend Indianer abgestürzt ist.«
»Das ist nun bald zwanzig Jahre her, und damals schon machten wir uns hier das Jagdrevier streitig. Da werden wir diese Gegend wohl kennen.«
»Aber wer nach der Bärenschlucht will, kann nicht hier durchkommen, oder er muss die Gegend so gut kennen wie wir beide.«
»Das muss er.«
»Deshalb eben schlug ich hier den Indianersturz als unseren Treffpunkt vor.«
»Ich desgleichen.«
»Der Höhlengang, durch den man auf dem Bauche rutschen muss, wird wohl noch existieren.«
»Er kann nicht verschüttet werden, alles Granit.«
»Und ein Bär wird ihn nicht bezogen haben, der liebt solche enge Nebengänge nicht.«
»Und wenn ein Bärenpaar mit Jungen darin hauste, dann...«
Der Sprecher vollendete den Satz nicht, schlug aber vielsagend an seinen Büchsenschaft, die andere Hand an den Griff des Bowiemessers legend, und seine Augen funkelten in Jägerleidenschaft.
»Wo liegst Du mit Deinem Luftschiffe, Marder?«
»In der Wolfsschlucht. Und wo liegst Du?«
»Dort oben!« Der Alte deutete dort hinauf, von wo er gekommen war.
»Wie viele Leute hast Du?«
»Genau fünfundvierzig. Alles ausgesuchte Männer. Lauter Cowboys. Und wie viele folgen Dir?«
»Achtunddreißig Mann.«
»Was für welche?«
»Alles Rothäute.«
»Sind es Crowreds?«
»I wo! Gar nicht aus dem Norden. Gilarives heißen sie, haben weit unten im Süden gesessen, in Arizona. Ich kenne auch nicht ihre Sprache. Und dann sind sogar einige Rothäute aus Südamerika dabei, die sich Penchuenchen nennen.«
»Wie verständigst Du Dich mit ihnen?«
»Sie können alle Englisch.«
»Tüchtige Burschen?«
»Mit denen man Pferde stehlen und auch die bestbewachte Farm getrost überfallen kann. Zwei davon waren auch schon ganz moderne Posträuber, trotz ihrer kupferroten Haut.«
»Also sind wir zusammen dreiundachtzig Mann.«
»Wozu noch wir beide kommen.«
»Und wie viele haben wir gegen uns?«
»Ja, wenn ich das wüsste!«
»Hat Dir Dein Auftraggeber nichts davon gesagt?«
»Hätte er es gekonnt, hätte er es getan.«
»Jedenfalls kommt jeder von den dreien mit seinem eigenen Luftschiffe an.«
»Sicher.«
»Also haben wir es mit den Besatzungen von drei Luftschiffen zu tun.«
»Die Rechnung stimmt.«
»Da können wir mit einigen hundert Gegnern rechnen — oder auch nur mit sechsen.«
»Was? Nur mit sechs Gegnern?!«
»Es könnte sich doch auch nur um kleine Luftboote handeln, wenn wir nicht annehmen wollen, dass jeder allein ein Flugzeug steuert.«
»Allerdings. Aber, Freund, das hat gar keinen Zweck, uns in solchen Erwägungen zu ergehen. Wir sind hier zusammengekommen, um uns die Gegend zu beschauen, die wir schon von früher genau kennen. Wenn nun alles noch stimmt, dass uns die Erinnerung nicht betrogen hat, sollen mir beraten, wie wir am besten die drei Hauptpersonen und ihre vielleicht vorhandenen Begleiter überwältigen können, wenn sie sich auf ihrem ausgemachten, uns genau bekannten Treffpunkte zusammenkommen oder wenn sie sich von ihrem Fahrzeuge aus nach dorthin begeben. Also entweder gleich alle zusammen oder jede Person einzeln. Und bei der Überwältigung darf absolut kein Blut fließen. Also es handelt sich darum, jenen eine Falle zu legen, was wir doch verstehen. Haben wir diesen Plan beraten, so sollen wir ihn unseren Vorgesetzten vorlegen, von denen er entweder gutgeheißen wird oder nicht. Ist es nicht so?«
»Ganz genau dasselbe wurde mir gesagt.«
»So wollen wir nun ernstlich an diesen unseren Kriegsplan gehen. Zu übereilen brauchen wir uns dabei nicht, wir haben noch Zeit genug.«
Und sie taten es, sie berieten sich, ohne zunächst diese Schlucht verlassen zu müssen.
Der Alte hatte sein Bowiemesser gezogen und zeichnete zur Erklärung mit der Spitze auf dem nackten Steinboden, auf dem kein Stäubchen lag.
»Hier ist die einsame Fichte, an welcher sich die drei treffen wollen. Dass sie immer noch in der Bärenschlucht an der alten Stelle steht, davon habe ich mich schon vom Luftschiffe aus überzeugt. Hier ist der geheime Gang. Nun schlage ich vor, Du führst Deine Leute hier herum, während ich von der anderen Seite mit meinen Cowboys...«
»Weißt Du, Steinfuchs«, wurde der Sprecher unterbrochen, »ich kann Dir da bei Deiner Malerei nicht richtig folgen. Gehen wir doch dort hinüber, da liegt feiner Sand, in dem kannst Du viel deutlicher malen, da sieht man wirklich, was Du gezeichnet hast.«
Jäh fuhr der Alte empor.
»Bist Du des Teufels, Marder?!«, zischte er, wie schon einmal. »Ist Dir denn nicht gesagt worden, dass wir absolut keine Spuren erzeugen dürfen? Verstehst Du denn nun gar nicht, um was es sich handelt? Später müssen wir uns wohl sichtbar machen, aber jetzt müssen wir doch unsichtbar bleiben, dürfen auch nicht die geringste Spur von uns geben!«
Wieder kratzte sich der andere verlegen hinter dem Ohre.
»Ach so, ach so! Ja, freilich! Ich denke nun immer an die Spuren meiner Füße, nicht so an jede Kleinigkeit, weil doch...«
Er brach ab und fuhr wie erschrocken zusammen. »Was hast Du?«, fragte der Alte verwundert.
»Mein Apparat auf der Brust tickt, ich werde vom Luftschiff angerufen!«, flüsterte der Gelbe Marder.
»Was wird Dir gemeldet?«
»Ein fremdes Luftschiff kommt und...«
Da zuckte auch der Alte empor.
»Wahrhaftig, auch ich werde angerufen! Schnellstens zurück an Bord! Sie kommen, sie kommen schon!«
Beide sprangen auf und eilten einer Höhle zu, in der sie verschwanden.
Gar nicht weit ab von der Stelle, wo die beiden Jäger gesessen hatten, befand sich in dem Gebirge eine Art Kessel, freilich geräumig genug, wohl fünfzig Meter im Durchmesser habend, in den sternförmig von allen Seiten her zahlreiche Schluchten oder doch Felsenspalten einführten.
Dieses Revier nannten die beiden Jäger »Bärenschlucht« — vielleicht, weil hier früher einmal Bären gehaust hatten oder sie ein besonderes Abenteuer mit solchen bestanden hatten.
Der Kessel, von steilen Felswänden gebildet, zeigte gar nicht den geringsten Pflanzenwuchs, kaum dass hier und da auf dem nackten Felsenboden ein Grashälmchen gedieh.
Nur an der Felsenwand an der Nordseite stand eine gewaltige araukanische Fichte, wohl vierzig Meter hoch, mit einem Stamme von anderthalb Meter Durchmesser — einer jener Riesenbäume, die besonders in Kalifornien vorkommen, wo es Exemplare von mehr als hundert Metern Höhe gibt, in deren hohlem Stamme bequem eine vielköpfige Familie wohnen könnte.
Dieser Baum hier hatte sich nur einseitig entwickeln können. Er stand dort gar zu dicht an der Felsenwand.
Nur nach drei Seiten reckte er seine Äste, die vom Stamme aus bis an den Boden hinab hingen. Auf der Nordseite schmiegte sich der Stamm eben ganz dicht an das Gestein, sodass er selbst sich nicht einmal richtig hatte entwickeln können, mit dem Felsen sogar wie verwachsen schien.
Sonst sei nochmals bemerkt, dass die Äste also bis dicht auf den Boden herabhingen, nicht herabhängend, sondern horizontal aus dem Stamme herauswachsend. Die untersten drei, die an sich schon starke Bäume gebildet hätten, befanden sich kaum einen Meter über dem Boden, und dann ging es in Abständen von immer etwa einem Meter so weiter nach oben. Diese Fichtenart wächst so. Nur trugen die unteren Äste nicht mehr die mächtigen, aber sehr weichen Nadeln, sondern waren ganz nackt, obgleich sie nicht abgestorben zu sein schienen. Die äußeren, dünneren Zweige und Seitentriebe hatten sie verloren. Erst in einer Höhe von etwa fünfzehn Metern fing die dunkelgrüne Benadlung an. Auf diese Weise ließ sich der Baum erst recht leicht besteigen, wenn auch einige turnerische Übung dazu gehörte — —
Aus einer der Seitenschluchten kam ein Mann hervor.
Ein riesenhafter Mann!
Die Gestalt eines Germanen, der einem Hünengrabe entstiegen sein konnte.
Sieben Fuß betrug seine Höhe sicherlich, und auf den mächtigen Schultern saß ein wahrer Büffel- oder richtiger Löwenkopf, denn er war umwallt von goldblonden, etwas lang gehaltenen Haaren, und wenn er auch nur einen Schnurrbart trug, so hatte der doch eine solche Fülle, dass er einem anderen, normalen Menschen einen stattlichen Vollbart gegeben hätte.
Die Hautfarbe dieses germanischen Hünen mit den rotblonden Haaren und den blauen, mächtigen Augen musste unbedingt sehr weiß gewesen sein. Sonne und Wetter aber hatten das Gesicht bronzefarben gemacht, ein Männerantlitz von klassischer Schönheit! Alles darin ein stolzer Adel, dabei aber auch, was jeden Stolz sofort vergessen ließ, ein Ausdruck von unendlicher Gutmütigkeit.
Er war ganz in Leder gekleidet. Aber ein Jagdkostüm war das nicht gut zu nennen. Es war mehr eine Panzerung von Leder. Man wurde lebhaft an die mittelalterlichen Reiter erinnert, so aus der Reformationszeit, welche die sogenannten Lederkoller trugen. Solch ein Lederpanzer von wenigstens einem Zentimeter Stärke umhüllte auch die kolossale Brust und den Rücken, alles aus einem Stück, höchstens genäht, also nicht aus einzelnen Teilen bestehend, die zusammengeschnallt hätten werden müssen. Wie denn auch dieser Lederkoller trotz seiner Stärke ganz geschmeidig sein musste, denn er besaß ja auch Ärmel.
Dazu kamen noch Stiefel, deren Schäfte bis an den Leib reichten, lange Stulphandschuhe und auf dem mähnenumwallten Löwenkopfe ein breitrandiger Sombrero, gleichfalls von dunkelbraunem Leder.
Bewaffnet war er mit einer Doppelbüchse von mächtigem Kaliber, ein richtiger Bärentöter, aber auch auf der Elefantenjagd zu gebrauchen, ein »Knochenschmetterer«. Das war die einzige Schusswaffe, die er zeigte, sonst erinnerte alles wieder an eine mittelalterliche Ausrüstung. Denn über der Schulter trug er eine Lanze von wenigstens sechs Meter Länge und am Gürtel außer einem kürzeren Jagdmesser einen Hirschfänger, der eine ganz altertümliche Form aufwies, wenn auch ohne weiteren Schmuck, von einer Länge und Stärke, dass er eher an ein mit zwei Händen zu führendes Schwert gemahnte. Die Größe passte zu der ganzen Gestalt des Mannes.
So kam der Hüne mit weitausgreifenden, gewaltigen Schritten aus der Felsenspalte heraus, die sein Leib fast ganz ausgefüllt haben musste, während sich zwei andere, normale Menschen darin hätten ausweichen können, obgleich er nicht etwa »dick« zu nennen war. Nur die Schultern waren so ungeheuer breit!
Ein kurzes Zögern, ein schnelles Umsehen.
»Gewiss, das ist die Kesselschlucht mit der einsamen Araukana. Es sieht aber in der Camera doch alles ganz anders aus als in Wirklichkeit, mag man es auch mit noch so handgreiflicher Deutlichkeit vor sich haben.«
So hatte er mit tiefer Stimme gebrummt, die auch bei dieser Dämpfung noch immer etwas von dem Grollen des fernen Donners an sich hatte, und er setzte seinen Weg fort, die Richtung nach der Fichte zu nehmend.
»Ich bin der Erste. Natürlich, ich bin gut eine halbe Stunde zu früh gekommen. Na, da warten wir, machen wir es uns einstweilen gemütlich.«
Er lehnte die Lanze an einen der niedrigen Äste, ließ sich im Schatten der Zweige nieder, den Rücken gegen den Stamm.
Über das edle und doch so unendlich gutmütige, treuherzige Antlitz war etwas wie Sorge gebreitet.
»Wer wird zuerst kommen? Hoffentlich ist es Klingsor. Denn wenn es Chlorinde wäre — verdammt, ich wüsste nicht, was ich zu ihr sagen sollte. Ach, Chlorinde...!«
Der Ausdruck von Sorge und sogar Angst wurde einmal von Wehmut verdrängt, der sich aber doch etwas wie seliges Glück beimischte; ganz verklärt schauten die großen, blauen Kinderaugen drein — es hätten nur noch schmerzliche Tränen darin gefehlt.
Freilich mussten diese großen Kinderaugen bei Gelegenheit auch schrecklich blitzen können, das war dem Manne gleich anzusehen.
Noch nicht lange hatte er dagesessen, als sich ein leiser Schritt näherte, was seinen Ohren nicht entging.
»Gott sei Dank! Klingsor! Das ist sein schneller, federnder Gang!«
Aber er hatte sich geirrt.
Eine andere Person kam aus einer zweiten Felsenspalte hervor.
Ein junges, hochgebautes Weib von vollen und dennoch schlanken Formen, eine Walkürengestalt, nur dass statt der goldenen oder flachsblonden Locken, die nun einmal zur Walküre gehören, solche von schwarzer Farbe auf die Schultern herabfielen.
Es war Chlorinde, die Königin von Thule.
Sie trug eine schwarze Taille, die wohl züchtig bis zum Halse die üppigen Reize verhüllte, sich aber doch recht verräterisch an sie schmiegte, dazu einen kurzen, noch nicht ganz bis an die Knöchel reichenden Rock, unter dem man die gelben, zierlichen, mit roten Schnüren durchflochtenen Stiefelchen sah, sodass man sich verwundert fragte, wie diese an sich doch so ungemein kräftige Frauenfigur solch kleine Füße haben konnte.
Die schlanken Hüften wurden von einem silbernen Schuppengürtel umschlossen, an dem ein Täschchen hing, aber keine Waffe, wie sie auch sonst keine solche bei sich zu haben schien.

Ihr Haar flatterte ohne Kopfbedeckung frei herab.
Das Täschchen zugleich in der linken Hand tragend, schritt sie schnell, ohne sich erst einmal umgesehen zu haben, sofort auf den Baum zu.
Doch da stockte ihr Fuß plötzlich.
Sie hatte erst etwas vorgehen müssen, ehe sie den an dem Baumstamm Liegenden erblicken konnte.
»Graf Tankred!«
Mit tiefer, wohllautender Stimme hatte sie es hervorgestoßen, und noch mehr Bestürzung als Überraschung hatte darin gelegen.
»Allbarmherziger Gott, es ist wahrhaftig die Chlorinde, die der Teufel herbeiführen muss!!«
So hatte der Riese leise gerufen im höchsten Schreck.
Doch nicht gerade eine galante Begrüßung, einer gegenüber, die man noch dazu von ganzem Herzen verehrt. Graf Tankred wollte sich schnell erheben, aber er konnte es vor Schreck nicht — oder vor Schüchternheit, die ihn plötzlich überfiel.
Er konnte sich nur halb herumwälzen, sodass er auf Hände und Knie zu liegen kam, und so blieb er, den Stierkopf weit vorgereckt, die Kommende mit seinen mächtigen Augen anglotzend, dabei auch sonst durchaus kein geistreiches Gesicht machend.
Es war ein Bild von unsäglicher Komik, das der hünenhafte und sonst so schöne, herrliche Mann bot, wozu auch noch kam, dass ihm plötzlich, obgleich es gar nicht so heiß war, die dicken Schweißtropfen über das ziegelrote Gesicht liefen. Und schließlich nun auch noch jene Begrüßungsworte!
»Ach — ach — Chlorinde — edle Königin — das ist ja reizend, dass Du — dass Sie, wollte ich sagen — dass Sie — ja, was wollte ich denn nur gleich sagen? — Wie ist Ihr Befinden? — Haben Sie — Sie — auch so einen Wolfshunger wie ich?«
So fing er jetzt in dieser merkwürdigen Stellung auch noch zu stottern an!
Er brauchte sich nicht weiter zu bemühen, seiner schrecklichen Verlegenheit Herr zu werden.
Ohne ein Wort an ihn gerichtet zu haben, presste sie die fein geschwungenen Lippen zusammen und wandte sich von ihm ab, betrachtete angelegentlich die Riesenfichte und die Umgebung.
Jetzt vermochte der Graf vollends aufzustehen, sammelte sich etwas, trat einen Schritt näher.
»Chlorinde!«, erklang es bittend, in einem weichen, so schmelzenden Tone, wie man ihn diesem Hünen gar nicht zugetraut hätte.
Sie betrachtete eingehend die Felsenwände.
»Chlorinde! Kannst Du mir denn nicht endlich verzeihen, dass ich damals...«
Sie wandte sich ihm zu.
Aber wenn er deswegen ein so hoffnungsfreudiges Gesicht machte, weil er glaubte, sie würde ihn wenigstens ansprechen, so hatte er sich geirrt.
Sie hatte nur den Kopf gedreht und sich selbst halb herum, um nun auch die andere Felswand zu mustern.
Sie sah dabei wohl nach seiner Richtung, aber sonst an ihm vorbei. Er war einfach für sie Luft. Es war ihr ganz deutlich anzumerken, wie sie das noch extra auszudrücken suchte. Er existierte nicht für sie.
Da stieg in dem bronzefarbenen, sonst so gutmütigen Gesicht jetzt doch etwas wie energischer Trotz auf.
»Na, da eben nicht!«
Mit diesen Worten wandte auch er sich ab. Dann ein kleines Besinnen, dem nach einiger Niedergeschlagenheit ein vergnügtes Schmunzeln folgte.
»Also da wollen wir einmal frühstücken!«
Und er begann seine Taschen auszupacken, die der Hose und die des Lederkollers, griff auch einmal unter diesen.
Herrgott, was diese Taschen alles fassen konnten! Ohne dass man vorher etwas von besonderem Aufbauschen bemerkt hätte!
Ein Stück Schinken von wenigstens zwei Pfund, eine Blutwurst von einem Viertelmeter Länge und ein halbes Vierpfundbrot, alles in grobes Packpapier eingewickelt, und außerdem noch eine ganze Literflasche Rotwein.
Das alles brachte er aus seinen Taschen zum Vorschein. Es waren eben ganz besondere Taschen, bei dieser kolossalen Mannesgestalt, da ging schon etwas hinein, ohne dass es besonders auffiel.
Er setzte sich wieder an seine alte Stelle, diesmal aber mit gespreizten Beinen, zwischen die er alles hinlegte und aufbaute, zog sein kurzes Jagdmesser, für normale Menschen aber ein sehr großes Schlachtermesser, hieb zunächst der Pulle einfach den Kopf ab, und dann fing er an zu speisen, zu säbeln und zu kauen.
Zu speisen? Himmel, was dieser Mensch schlingen konnte! Auch von Kauen durfte man nicht viel sprechen. Immer einen Bissen zurechtgeschnitten von der Größe einer Kinderfaust, ihn in den weitgeöffneten Mund oder richtiger Rachen gesteckt, ein Druck — und weg war er!
Unterdessen spazierte die Dame hin und her, hatte immer etwas zu betrachten.
Nur den einzigen Menschen sah sie nicht, den es außer ihr hier in dieser Öde gab.
Und doch, manchmal streifte ein rascher Seitenblick den »Speisenden«, und dann malte sich immer etwas wie Staunen in ihren schönen Zügen wieder, dem sie aber den Ausdruck von Abscheu und Ekel geben wollte, danach verzog sie den Mund, was ihr nur nie recht gelingen wollte. Es war eben immer mehr bewunderndes Staunen ob solchen Appetites.
Graf Tankred ließ sich nicht stören, auch er kümmerte sich nicht um seine Gesellschafterin, für die er Luft war, gab sich ganz dem Behagen des Schluckens hin.
Bis er sich jener doch in Höflichkeit erinnerte. Er wendete halb den Kopf.
»Chlorinde — ehem — was ich sagen wollte, Königin — wenn Sie vielleicht Appetit haben, es reicht für zwei...«
Als er aber diese freundliche Einladung ergehen ließ, da hatte er freilich von dem halben Vierpfundbrote nur noch ein Eckchen übrig, von der Wurst noch einen Zipfel, sonst nicht einmal mehr die Schale, die hatte er mitgegessen. Also er kam mit seiner Einladung reichlich spät. Immerhin, er hatte noch einmal eine Annäherung versucht, an ihm lag's nicht.
Aber er wurde wiederum keiner Antwort und keines Blickes gewürdigt.
»Na, da eben nicht!«, meinte er ebenfalls wiederum, nur dass ihm diesmal nicht wieder das Blut ins Gesicht schoss, und er schob auch noch den letzten Bissen in den Mund und lehrte vollends die Flasche.
Noch keine zwanzig Minuten hatte er gebraucht, um diesen Proviant von wenigstens fünf Pfund Gewicht zu vertilgen und einen ganzen Liter Rotspon daraufzusetzen!
Schon wiederholt hatte Chlorinde ihr Täschchen geöffnet und darin nach etwas geblickt.
»Jetzt ist es drei Uhr!«, rief sie, als sie dies das letzte Mal tat.
Dann musste sie aber eine andere als die wirkliche Zeit meinen. Hier wurde eben nach Skaldenzeit gerechnet. Nach dem Stande der Sonne mochte jetzt ungefähr die zehnte Morgenstunde sein.
»Schon etwas darüber, und er ist noch nicht da! Graf Bertran de Born scheint wieder einmal sein Wort zu brechen!«
Der Riese, der gerade bedächtig das Papier zusammenwickelte und in die Taschen steckte, dann sich sehr langsam erhebend, warf mit einem plötzlichen Ruck den Kopf zurück, und wie ein Feuerstrom brach es aus den großen Kinderaugen.
»Schon wieder einmal? Was willst Du damit sagen, o Königin? Wann hat Loke Klingsor schon jemals sein Wort gebrochen?!«
Ganz energisch hatte er es gerufen.
Die Skaldenfürstin schien eine Entgegnung haben zu wollen, wohl eine Entschuldigung, denn plötzlich schoss ihr vor Verlegenheit das Blut in das Gesicht, aber schnell besann sie sich, dass jener ja gar nicht für sie existiere.
Und dem Hünen schien seine scharfe Bemerkung leid zu tun, er machte wieder sein treuherzigstes Gesicht.
»Na ja, ich weiß schon, das war nicht so gemeint — wie die Frauenzimmer nun einmal sind — die Damen, wollte ich natürlich sagen«, verbesserte er sich erschrocken, und dann, um dieses Versehen vergessen zu machen, fuhr er fort. »Sie sind doch eigentlich gar nicht wie zur Bärenjagd angezogen, Königin? Wo haben Sie denn Ihre Waffen? So ganz allein mit den Händen können Sie die Bären doch nicht greifen. Und es war ausgemacht, dass wir drei hier ganz allein zusammenkommen wollten. Da können Sie sich doch nichts nachbringen lassen. Oder darf ich es Ihnen holen?«
Als er auch jetzt keiner Antwort und keines Blickes gewürdigt wurde, musste er endlich einsehen, dass alle Bemühungen vergeblich waren.
Nochmals blickte die Fürstin, immer ungeduldiger werdend, in ihr Täschchen nach der Uhr.
»Aber die Tatsache bleibt bestehen, dass es schon fünf Minuten nach drei ist, und Klingsor ist noch immer nicht...«
Da plötzlich ein Schwirren in den Lüften, nicht eigentlich ein Ton, die Luft wurde nur erschüttert, kam in starke Vibration, und plötzlich stürzte da ein silberweißer Schwan von Riesengröße — denn für etwas anderes konnte man es zuerst nicht halten — von oben herab in den Felsenkessel hinein, hielt im nächsten Moment mit den ungeheuren Schwingen von vier Metern Spannweite über den Häuptern der beiden, senkte sich seitwärts weiter herab und lag — wieder im nächsten Moment — regungslos am Boden.
Da freilich konnte man erkennen, dass es sich nicht um einen sagenhaften Riesenvogel handelte.
Es war ein Aeroplan von blitzendem Stahlgefüge, und als solcher musste er nun wieder jedem Sachkenner durch seine außerordentliche Kleinheit auffallen. Denn eine Flugmaschine, deren Tragfläche nur vier Meter Spannweite besitzt, gibt es heute noch nicht.
Herrlich aber sah es aus, wie das silberweiße Gefüge von Stangen und Drähten in der Sonne blitzte, und dazu ein Bau, der doch wieder ganz an einen Vogel erinnerte, zumal die Maschine vorn, wohl nur als Schmuck, tatsächlich in den Kopf eines Schwanes auslief.
Zwei Männer saßen darin, die sich sehr voneinander unterschieden: ein schwarzgekleideter mit weißer Haut und ein weißgekleideter mit schwarzer Haut — ein Neger.
Im Übrigen konnte dieser Unterschied nicht groß beobachtet werden, es ging außerordentlich schnell.
Kaum hatte der Riesenschwan den Boden berührt, als der schwarzgekleidete Mann auch schon von seinem Sitze auf- und heraussprang; im nächsten Augenblick erhob sich das Flugzeug schon wieder, stieg kerzengerade empor und war, noch ehe es die Höhe der Fichte erreicht hatte, plötzlich spurlos verschwunden, als hätte es sich plötzlich in der Luft aufgelöst.
Der Herausgesprungene war Loke Klingsor — vollständig salonfähig — im schwarzen Frackanzug mit glänzendem Zylinder, mit weißer Weste, weißem Schlips und weißen Glacéhandschuhen.
Von Anfang an dicht vor Chlorinde stehend, zog er den Zylinder.
»Heil Dir, o Königin! Ich begrüße Dich als meine fürstliche Schwester! Möge Dir dieser sonnige Tag Glück und Segen bringen. Aber Deinen Vorwurf muss ich ablehnen. Ich hörte Deine letzten Worte. Loke Klingsor ist niemals unpünktlich, weder als Graf de Born noch als Fürst des Feuers, und er würde der edlen Königin von Thule nie wieder vor die Augen zu treten wagen, wenn er auch nur eine einzige Sekunde später käme, als sie ihn bestellt hat. Deine Uhr geht eben falsch, mindestens fünf Minuten vor. Geht aber die meine auch nur eine Zehntelsekunde vor oder nach, so will ich Dir Zeit meines Lebens als Sklave dienen.«
So hatte die sonore, prächtige Stimme gesagt, und dabei zog er, den Zylinder noch in der anderen Hand, an der schwarzen Schnur die Uhr aus der Westentasche und ließ vor Chlorindes Augen den Deckel aufspringen.
Ja, auch jetzt war dieser rätselhafte Apparat wohl eine Zeituhr, aber wiederum eine andere.
Jetzt sah man auf der Scheibe drei kleine, viereckige Felder.
Das mittelste zeigte eine größere Zwei, das linke eine Neunundneunzig, und dieselbe Zahl war auf dem rechten Felde vorhanden.
So war es wenigstens in dem Augenblick, als die Uhr der Dame vor Augen gehalten wurde.
Im nächsten Moment sprang auf dem linken wie auf dem rechten Felde eine Doppelnull hervor, in dem mittelsten statt der Zwei eine Drei.
Klingsor setzte den Zylinder wieder auf und steckte die Uhr, deren Deckel von allein zuzuklappen schien, in die Westentasche zurück.
»Bist Du überzeugt, dass meine Uhr richtig geht?«
Die Königin blieb zuerst die Antwort schuldig.
Es war, wie gesagt, alles ganz außerordentlich schnell vor sich gegangen. Das Erscheinen des Riesenschwanes und das Auftreten dieses befrackten Salonmenschen hatten wie eine Art von Zauberei gewirkt — kurz, Chlorinde schien ganz bestürzt zu sein, obgleich dieses Weib sonst sicherlich über so etwas wie Schreck erhaben war.
»Möglich, dass meine Uhr falsch geht!«, murmelte sie dann.
Anders Graf Tankred. Der hatte bei dem plötzlichen Erscheinen und Wiederverschwinden des Riesenvogels, der einen schwarzbefrackten Geist ausgespieen hatte, nur einmal seinen Mund aufgeklappt.
»Höhöhö!!«, lachte er jetzt dröhnend. »Loke, Du willst wohl die Bären mit dem Zylinder totschlagen?! Mensch, was fällt Dir ein, so ins Felsengebirge zu kommen?!«
»Ich musste diese Toilette wählen, weil ich dann gleich zu einer Hochzeit will und nicht mehr Zeit genug habe, um mich umzukleiden«, entgegnete lächelnd der Verspottete, der überhaupt in ganz ausgezeichneter Laune zu sein schien.
Chlorinde hatte sich aus ihrer Bestürzung aufgerafft; sie fühlte sich verpflichtet, etwas zu sagen, und es fiel ihr nichts anderes als eine bissige Bemerkung ein.
»Vorausgesetzt, dass Sie fähig dazu sind, mein Fürst! Wenn aus Ihrer Hochzeitsfestlichkeit nur nicht eine Trauerfeierlichkeit wird, bei der Sie selbst als Toter die Hauptrolle spielen.«
Klingsor verbeugte sich lächelnd.
»Daran habe ich selbst schon gedacht, o Königin. In diesem Falle wird die Hochzeitsgesellschaft leidtragend meinem Begräbnis beiwohnen.«
Tankred hatte auf diese Wechselreden nicht geachtet, er musste Klarheit über eine Sache haben, die ihm nicht in den Kopf wollte.
»Ja, Loke, auch Du kommst ja ganz ohne Waffen? Oder hast Du sie etwa in der Westentasche? Es sind in diesem neutralen Reviere doch nur Waffen erlaubt, mit denen man wie jeder andere Mensch schießen und stechen und hauen kann. Und was willst Du denn hier nur mit Deinen Lackschuhchen? Wir werden die Bären doch erst aufstöbern müssen, und da sind die Dingerchen in diesem Felsengebirge doch in der ersten Minute in Fetzen gegangen.«
»O, Tankred, das lass nur meine Sorge sein — meine Lackschuhe halten schon etwas aus, wenn sie auch nicht aus unserem Nihilitstahle hergestellt sind, sondern aus ganz gewöhnlichem Leder, und was die Waffen anbetrifft, die habe ich natürlich, o Königin, mitgebracht, wie wir verabredet haben.«
Er machte eine Bewegung hinter sich.
Und da sah man, dass der Aeroplan außer dem Passagier auch noch etwas anderes zurückgelassen hatte.
Zehn Schritte zurück stand auf dem Boden ein langer, schmaler, niedriger Kasten, von der Größe und auch ganz von dem Aussehen eines Violinkastens. Er war besonders deshalb nicht gleich bemerkt worden, weil er von derselben grauschwarzen Farbe wie der Felsboden war.
»Was, Loke? Hohohoho, Du willst die Bären wohl mit der Fiedel bezaubern, dass Du sie gleich tanzend abführen kannst?«, lachte Tankred wieder mit seiner dröhnenden Stimme.
»Allerdings!«, war die lächelnde Antwort. »Nur dass der Kasten bloß zwei Violinbögen enthält. Nicht wahr, Chlorinde?«
»Ich hoffe, dass Du die richtigen mitgebracht hast«, entgegnete diese finster.
»Ganz nach Deiner Vorschrift!«
»Ich hatte da keine Vorschrift zu machen!«
»Ganz nach Reglement, wollte ich sagen, und die Auswahl hast natürlich Du.«
»Natürlich? Du hast dasselbe Recht, zu wählen.«
»Einer ist genau wie der andere.«
»So werden wir losen.«
»Wenn Du willst, werden wir losen.«
Tankred verstand von alledem nichts, er dachte nur immer an die Bärenjagd, wusste ja noch gar nichts anderes.
»Fiedelbögen?«, wiederholte er. »Ja, Loke, was willst Du denn nur hier mit Fiedelbögen?«
»Es sind Fiedelbögen besonderer Art — solche, die manchmal sehr unangenehm kitzeln und dann auch ganz besondere Töne hervorlocken aus dem Instrument, das sie bestreichen. Nicht wahr, o Königin?«
»Wenn Du so schwächlich bist, dass Du einem Schmerz Ausdruck verleihen musst — ich werde es sicher nicht tun.«
Klingsor hatte sich dorthin begeben, wo der Kasten lag, die beiden waren ihm gefolgt.
Ein Schlüsselchen ward aus der Westentasche geholt und aufgeschlossen.
Der vermeintliche Violinkasten enthielt zwei blitzende Säbel, in schwarzem Samt gebettet, ohne weiteren Schmuck, aber sicher die besten Klingen, die es gab.
Chlorinde nahm eine, musterte sie und führte einige Hiebe durch die Luft.
»Recht so, o Königin?«
»Gewöhnlicher Stahl?«
»Sicher! Etwas anderes ist doch hier nicht erlaubt, am wenigsten in unserem Falle. Freilich ein japanischer Stahl, wie ihn nicht besser selbst der Mikado an seinem Schlachtschwerte führt.
Chlorinde legte den Säbel vorläufig in das Futteral zurück.
»Ja, habt Ihr denn ausgemacht, den Bären gerade mit Säbeln zu Leibe zu rücken?«, fing Graf Tankred immer wieder an.
Jetzt hielt es Klingsor für das beste, seinem Freunde endlich reinen Wein einzuschenken.
»Ja, Tankred, eine Bärenjagd kann hier allerdings stattfinden, und Du sollst auch einen Gesellschafter dabei haben, aber nur einen — entweder Königin Chlorinde oder mich.«
»Was soll das heißen?!«, rief jener stutzend. »Mir geht überhaupt schon eine Ahnung auf. So schwach von Begriffen bin ich doch nicht... Ihr wollt doch hier nicht etwa auf Säbel losgehen?«
»Erraten! Zwischen mir und der Königin von Thule findet ein Säbelduell statt. Auf Leben und Tod! Eins von uns wird am Platze bleiben.«
Das bronzefarbene Gesicht des Hünen entfärbte sich etwas vor Schreck.
»Ein Säbelduell?! Auf Leben und Tod?! Ach, Du scherzt nur!«
»Es ist eine blutige Tatsache, wie Du sehr bald erkennen wirst. Du kannst beiwohnen, wenn auch gerade als Sekundant, den wir nicht nötig haben.«
»Was in Teufels Namen habt Ihr beide denn miteinander gehabt?!«
»Etwas, was solch eine Auseinandersetzung unbedingt nötig macht; nur eins von uns kann noch von der Sonne beschienen werden, und hiermit genug!«, sagte Chlorinde.
In einem Tone hatte sie es gesprochen, der keinen Einwand mehr zuließ.
Graf Tankred kannte die beiden und wusste, dass hier jedes weitere Wort seinerseits vergeblich war; er war auch nicht der Mann danach, sie zu hindern.
»Ihr seid beide wahnsinnig geworden!«, sagte er nur noch.
Aber nun wollte er auch nichts mehr damit zu tun haben, wenigstens nicht direkt.
Er wandte sich, ging nach dem Baume, nahm dort seine Lanze, schlenderte weiter die Felswand entlang, besann sich, lehnte die Lanze an den Felsen, das Gewehr daneben, schnallte den Gürtel ab, streckte sich wieder im schmalen Schatten der Felswand aus, jenen den Rücken zukehrend.
Klingsor hatte ihm nachgesehen, recht interessiert, und jetzt, nachdem Tankred sich niedergelegt hatte, nickte er wie zufrieden.
»Nun, Fürst, wo wählen wir unseren Kampfplatz?«, nahm Chlorinde wieder das Wort.
»Wohl außerhalb der Sonne.«
»Dort ist Schatten genug.«
»Unter dem Baume? Seine Äste sind hinderlich.«
»Auch an der Felswand ist noch Schatten genug.«
»Er ist sehr schmal, und wo er noch am breitesten ist, hat schon Freund Tankred seinen langen Leichnam ausgestreckt.«
»Ha, suchst Du etwa wieder den Zweikampf hinauszuschieben?!«
»Tue ich das etwa? Ich bin sofort bereit, mache Dich nur auf die Unannehmlichkeit aufmerksam, dass wir sehr wenig Schatten haben.«
»Er ist überall breit genug; wir brauchen ja nur so viel zu haben, dass der Kopf und vielleicht noch der Oberleib beschattet ist, und das ist überall der Fall.«
»Da magst Du recht haben. Gut, suche den Platz aus! Unterdessen möchte ich noch eine Kleinigkeit schreiben, eine Art Testament. Das gestattest Du mir wohl noch?«
Klingsor wartete die Antwort nicht ab, sondern schritt dem Baume zu, zog ein Notizbuch und ein winziges Federmesserchen, spitzte einen Bleistift und begann zu schreiben, einen der niedrigen Äste als Unterlage benutzend.
Chlorinde hob den Kasten auf, dessen Deckel Klingsor vorhin mit der Fußspitze zugeworfen, wobei es geschnappt hatte, und ging nach der Felswand.
Es war ungefähr die Mitte zwischen dem Baume und Tankreds Lagerstelle, wo die Felswand etwas überhing, welche Stelle sie schnell als die geeignetste herausgefunden hatte. Hier setzte sie den Kasten wieder auf den Boden.
Die Entfernung von dem Baume betrug etwa fünfzehn Schritte, ebenso weit lag wieder Tankred entfernt. Gleich hinter ihm wurde die Felsenwand von einer breiten Spalte unterbrochen, von da an bis zu der Fichte kam keine solche Spalte oder Schlucht mehr vor.
»Bitte, Chlorinde, noch auf ein einziges Wort!«, erklang es von dem Baume her.
Sie folgte dem Rufe.
»Vorausgesetzt, dass Du nicht wieder versuchst, dem Zweikampfe auszuweichen.«
»Nein, das werde ich nicht mehr tun«, entgegnete Klingsor mit der größten Bestimmtheit, »denn ich habe nun eingesehen, dass dies bei Dir doch keinen Zweck hat. Einer von uns muss heute sein Leben lassen.«
»Gut, dass Du es eingesehen hast! Dann möchte auch ich noch eine Frage stellen, die Du mir hoffentlich offen beantwortest.«
»Bitte.«
»Bist Du es gewesen, der den Grafen Tankred hierher bestellt hat?«
»Nein, das habe ich nicht getan.«
»Lüge nicht!«, fuhr sie auf.
»Ich will nicht sagen, dass ich niemals die Unwahrheit spreche. Es gibt wohl keinen Menschen, der dies täte, und man wäre oftmals ein Narr, wenn man immer die Wahrheit sagte«, erwiderte er, ohne jeden Zynismus, und hiermit sprach er nur eine Wahrheit aus. »Aber ich habe Tankred nicht herbestellt. Auch er hat einfach von den Bären hier erfahren, durch die Fürstin Salamba, die wieder einmal den Mund nicht halten konnte. Er wäre also ganz von selbst hierher gekommen.«
»Aber dass er gerade um diese Stunde hier eintrifft, dass ich ihm hier begegnen muss, das ist doch Dein Werk, das hast Du so eingerichtet. Gestehe es!«
»Gut, ich gestehe es. Ja, das habe ich so arrangiert.«
»Siehst Du!«, fuhr sie wieder empor. »Und weshalb hast Du das so eingerichtet?«
»In der Hoffnung, Euch beide einander näher zu bringen.«
»Ungeheuer!!«
»Na, na, ich weiß nicht, wieso ich deswegen ein Ungeheuer sein soll.«
»Was ist Dir daran gelegen, mich mit diesem Grafen zusammenzubringen?«
Ein spöttisches Lächeln zeigte sich auf dem diabolischen Gesicht, als er die Arme über die Brust kreuzte.
»Damit Du mich endlich vergisst, damit Du aufhörst, o Königin, mich mit Deiner Liebe zu verfolgen.«
Es war wieder eine jener Beleidigungen gewesen, die kein Weib verzeihen kann, solange es noch ein Weib ist.
Das an sich schon sehr weiße Gesicht verlor vollends alle Farbe, die nervige Hand fuhr nach dem Gürtel, an dem aber nur das Täschchen hing, und das auch noch an der anderen Seite. Sie hatte vergessen, dass sie keine Waffe bei sich hatte.
»Du Teufel aus der Hölle!!«
»Schmähe nicht immer, ergehe Dich nicht in Schimpfnamen, es steht Dir nicht, entstellt Dich nur«, spottete er.
»Dass dies Dein letztes Wort gewesen wäre!«
»Das liegt nur an Dir, Du kannst mir dann ja den Garaus machen, und an meiner Leiche werdet Ihr Euch schon versöhnen und für immer zusammenfinden. Deshalb habe ich gleich den Frack angezogen. Das ist die Hochzeit, der ich beiwohnen will.«
»Was beleidigst Du mich nur immer?«
»Ich will Dich nicht beleidigen. Aber sage, was hast Du an dem Grafen Tankred eigentlich auszusetzen?«
Sie ging darauf ein, wohl nur, um auf andere Gedanken zu kommen.
»Dieser Tölpel!«
»Wenn Du damals gesehen hättest, wie er den Löwen bändigte, würdest Du anders sprechen, und dass er Meister in allen ritterlichen Künsten ist, das weißt Du überhaupt selbst.«
»Er trinkt.«
»Warum nicht, wenn er Durst hat? Ich habe ihn noch nie betrunken gesehen.«
»Dieser Vielfraß!«
»Wohl ihm, wenn's ihm schmeckt.«
»Hättest Du ihn nur vorhin essen sehen!«
»Das habe ich oft genug gesehen. Ich bekomme immer Appetit, wenn ich ihm zuschaue. Hast Du sonst noch etwas an dieser Seele von einem Menschen auszusetzen? Dort kommt er selbst, Du kannst es ihm gleich selbst sagen, da legt er vielleicht alle diese Gewohnheiten ab, die Du nicht leiden kannst, entwickelt sich zum Hungerkünstler.«
Ja, er kam selbst. Graf Tankred schien sich eines anderen besonnen zu haben, wollte die beiden doch noch einmal sprechen, hatte sich erhoben und kam jetzt herbeigeschlendert, die Hände in den Stiefelschäften, die auch noch die Hosentaschen verdeckten. Seine Waffen und den Gürtel hatte er liegen gelassen.
Als Chlorinde sich umdrehte, nickte Klingsor wieder einmal recht zufrieden.
Der Riese war bereits unterwegs gewesen, nur wenige Schritte trennten ihn noch von den beiden.
»Hört, Kinder, ich will Euch etwas sagen«, fing er an. »Ihr werdet beide vom Wahnsinn geplagt. Aber ich will Euch einen Vorschlag machen. Wenn Ihr Euch nun durchaus duellieren wollt, so nehmt doch einfach...«
Weiter kam der Sprecher nicht. Plötzlich erklang ein furchtbares Brüllen, und da kam in plumpen und doch so kolossalen Sätzen ein graues, zottiges, furchtbares Ungeheuer angestürmt.
Ein Grizzlybär!
Wer kann sich rühmen, schon einmal in einem zoologischen Garten oder sonst wo einen gefangenen grauen Bären gesehen zu haben? Schon dies allein gibt zu denken.
Der Grizzlybär ist sicher das furchtbarste Raubtier der Erde — schon durch seine Größe! Man hat Exemplare erlegt von anderthalb Meter Höhe, zweieinhalb Meter Länge und neun Zentnern Gewicht! Man messe sich diese Maße einmal aus! Und wer das nicht glaubt, der lese in »Brehms Tierleben« nach. Seine Klauen, das heißt die Nägel von weißlicher Farbe, sind bis zu dreizehn Zentimeter lang.
Und nun seine Furchtbarkeit als Räuber! Es ist ja bekannt genug — denn wer hat nicht schon davon gelesen — dass der indianische Krieger, der die Klauen eines selbsterlegten Bären trägt, in seiner Heimat als unvergleichlicher Held gefeiert wird, nicht nur unter seinen Stammesbrüdern, sondern allüberall in Amerika, wo man den Bären und seine Gefährlichkeit kennt, und der Besitzer dieser Trophäe darf ruhig in das Lager des feindlichen Stammes gehen, er wird als Gastfreund aufgenommen, denn seine Gegenwart verherrlicht alles. Wer eine Bärenklaue zu Unrecht trägt, der wird lebendig geschunden.
Davon liest man ja also genug, nicht nur in Indianerschmökern. Aber es wird immer vergessen, dass hiermit die Klauen des braunen Bären gemeint sind. Auch der braune amerikanische Bär ist so ein gefährliches Raubtier, seine Erlegung erfordert so viel Kühnheit, dass auch sein Besieger schon solche Ehren genießt.
Wer aber nun einen grauen Bären erlegt hat, einen Grizzly, wer dessen Klauen als Trophäe tragen kann, der wird in Amerika einfach als Gott angebetet, und zwar sowohl im indianischen Wigwam wie im New Yorker Salon.
Dem asiatischen Wisent geht der Königstiger, dem Kaffernbüffel der Löwe sorgsam aus dem Wege. Der Grizzly aber greift den doch nicht minder gewaltigen Bison ohne Weiteres an. Übrigens hat man bei Kampfspielen, wie man sie sich in Amerika noch häufig leistet, wenn auch nur in »geschlossenen Gesellschaften«, schon oft genug gesehen, wie auch der amerikanische Büffel gegen jeden Tiger und Löwen Sieger bleibt. Der Grizzly aber, dessen kolossales Gewicht von den Hörnern des Bison nicht hochgeschleudert werden kann, nimmt ihn einfach her und drückt ihm mit einem einzigen Druck alle Rippen im Leibe zusammen.
Jedes Raubtier geht dem Menschen aus dem Wege. Wenn Kinder von Wölfen geraubt, auf dem Felde arbeitende Frauen oder auch Männer von Tigern oder Panthern angegriffen werden, so sind das doch immer nur Ausnahmen, wie es selbstverständlich ist, dass die Bestie sich gegen ihren Angreifer verteidigt oder ihre Jungen zu schützen sucht. Im Allgemeinen aber gilt es doch, dass kein Raubtier ungezwungen, nur weil es von Hunger geplagt wird, einem Menschen zu Leibe geht.
Der Grizzlybär aber betrachtet den Menschen als Jagdwild.
Und nun diese Ausdauer, mit der er die erspähte Beute verfolgt!
Es klingt schier unglaublich, dass ihm kein Reiter entgeht, dass er auch das schnellste Pferd einholt, und doch ist es so.
Ein galoppierendes Pferd ist freilich schneller als dieses plumpe Ungeheuer. Aber Stunde für Stunde trabt er seinem Opfer nach, den ganzen Tag und die ganze Nacht, bis er das vor Hunger und Durst und endlich vor Angst zusammenbrechende Tier doch schließlich erreicht hat. Freilich muss man da eben an die amerikanischen Wälder und Prärien denken.
Schier märchenhaft klingt es auch, was man von seiner Lebenszähigkeit erzählen hört. Und doch entspricht es den Tatsachen. Schon mancher Grizzly hat eine schwere Kugel durchs Auge direkt ins Gehirn bekommen, und er hat den hundert Schritt entfernten Jäger doch noch erreicht, hat ihn sogar noch verfolgt und ihn zermalmt. Dass sein Herz noch längere Zeit weiterarbeitet, auch wenn es von einer Kugel durchbohrt oder sogar zerrissen ist, das hat man auch auf dem wissenschaftlichen Seziertisch beobachtet.
»Bruder Jonathan«, sagt der Amerikaner, wie er den Grizzly mit scherzhaftem Respekt nennt, »hat nur eine einzige Tugend: Er klettert nicht auf Bäume.«
Das sagt genug.
Nein, auf Bäume klettert er nicht. Obwohl er sonst ganz ausgezeichnet klettern kann. Er ist ja ein Kind der Felsenwildnis. Wo ein Mensch klettern kann, und sei es auch der gewandteste Steinbockjäger, da folgt ihm auch der Grizzly und ruht wiederum nicht eher, bevor er ihn hat.
Aber auf Bäume steigt er nicht — so wenig wie der Löwe und Königstiger. Es ist ja schwer zu erklären, weshalb alle diese großen Katzenarten keine Bäume erklettern, befähigt sind sie dazu. Sind sie einmal dazu gezwungen, wie bei Wassersnot, so kommt der Löwe wie der Tiger gar schnell bis in die höchsten Äste hinauf. Dann aber verwandelt das Raubtier vollkommen seinen Charakter. Es verhungert lieber, ehe es ein anderes Tier, das vor dem Wasser auf demselben Baume Schutz gesucht hat, schlägt. Wie es übrigens auch bei unserem Fuchse ist. Bei der Überschwemmung sitzt der Fuchs auf dem Aste ganz gemütlich neben dem Hasen. er ist vor Hunger schon abgezehrt, aber er tut dem Hasen nichts. Das ist ein großes Rätsel.
Der Grizzly wird deshalb keine Bäume ersteigen, weil er sein ungeheures Gewicht kennt, und da braucht er selbst nicht schon üble Erfahrungen gemacht zu haben, das ist bei ihm Instinkt. Er steigt auch auf keinen niedrigen Ast, mag der auch noch so stark sein, er scheut sich davor. Das Ding könnte unter seiner Last doch brechen.
Also wer von einem Grizzly verfolgt wird und erreicht einen Baum, den er ersteigen kann, der ist gerettet. Wenigstens vorläufig! Sonst ist diese »Rettung« sehr problematisch. Der graue Bär belagert ihn und zeigt dabei dieselbe Ausdauer wie bei der Verfolgung, legt sich einfach hin und wartet, bis das Menschlein vor Erschöpfung herabfällt, wartet einige Tage und Nächte, zehrt unterdessen von seinem eigenen Fett, braucht kein Wasser. Er lässt von dem einmal erspähten Opfer prinzipiell nicht ab. Ausgenommen, es ist ein Weibchen, das Junge zu säugen hat. Das kehrt nach einiger Zeit zu seinem Lager zurück.
Solch ein Grizzlybär war es, der da unter furchtbarem Gebrüll angestürmt kam, und zwar ein ausgesucht großes Exemplar seiner Rasse, ein Männchen.
Unsere drei Helden konnten diese Bezeichnung mit vollem Rechte verdienen, und sie brauchten noch keine persönlichen Erfahrungen mit Bruder Jonathan — oder auch Onkel Ephraim genannt — gemacht zu haben, brauchten alle seine Untugenden und seine einzige Tugend nicht zu kennen, um doch sofort zu wissen, was allein hier zu tun war.
Soweit ersichtlich, hatte keiner von ihnen noch eine Waffe bei sich, und an die, die Graf Tankred abgelegt hatte, brauchten sie nicht erst zu denken, so wenig wie an die beiden haarscharfen »Fiedelbögen« in dem Violinkasten, das alles hatte der aus jener Seitenspalte hervorstürmende Bär bereits hinter sich, also zwischen sich und jenen drei Menschlein, deren Anblick bereits seine Wut erregte — und nun überhaupt, wie dieses zottige Ungeheuer angaloppiert kam, wie aus dem Rachen die rote, triefende Zunge heraushing, wie er ihn jetzt erst recht weit aufriss, um ein Brüllen auszustoßen, das an das von einem Dutzend Ochsen erinnerte, vermischt mit Elefantentrompetengeschmetter...
»Rette sich, wer kann!!«
Klingsor hatte das gerufen, und er war auch der erste, der sich auf den untersten Ast der Fichte schwang. Da sich dieser mit seiner unteren Seite ungefähr einen Meter über dem Boden befand und einen halben Meter stark war, war er, aufrecht stehend, nur anderthalb Meter vom Erdboden entfernt, und das genügte natürlich nicht, um vor diesem Ungeheuer Schutz zu gewähren, der riesenhafte Bär brauchte sich noch nicht einmal auf den Hinterfüßen empor zu richten, um dem dort oben stehenden Menschlein in die Waden zu beißen, brauche nur den Kopf etwas höher zu recken.
Das musste Klingsor doch wissen, er hätte sich mindestens eine Etage höher schwingen müssen.
Aber er war so galant, auch an seine Gefährten zu denken und bot zunächst der Dame hilfreich die Hand.
Doch da kam er zu spät. Dazu hatte er sich natürlich erst umdrehen müssen, und als er das tat, da stand diese Dame bereits neben ihm auf seinem Aste und stieg auch schon höher, war im nächsten Augenblick über ihm in der zweiten Etage.
Nun wollte Klingsor wenigstens noch seinem Freund helfen, bei dessen Körpergröße und Umfang man ja allerdings daran zweifeln konnte, dass er so schnell, wie es jetzt nötig war, hinaufkam.
Doch er brauchte sich keine Sorge zu machen, auch bei dem kam er mit seiner hilfreichen Hand zu spät — oder sie wurde doch nicht angenommen.
Mit affenartiger Behändigkeit schwang sich Graf Tankred auf den untersten Ast hinauf, und den nächsthöheren benutzte er gewissermaßen nur als Sprungbrett, um gleich in die dritte Etage hinaufzukommen!
Übrigens hätte jemand einen ansehnlichen Bauch haben können und durchaus nichts von der edlen Turnerei zu verstehen brauchen, der Anblick dieses zottigen Ungetüms hätte ihn schon gelenkig gemacht. Aber dieser Graf Tankred sollte ja ein Meister in allen ritterlichen Künsten sein, also würde er wohl trotz seiner Schwere auch gut turnen können. Immerhin, es war ganz erstaunlich gewesen, mit welcher blitzartigen Schnelligkeit er hinaufgekommen war.
Nun befand sich nur noch Klingsor auf seinem untersten Aste in Gefahr, er war eben gar zu uneigennützig gewesen, hatte den richtigen Anschluss verpasst.
Und die Gefahr war auch wirklich außerordentlich groß.
Schon hatte der Bär den Baum erreicht, hielt sich nicht erst mit einer Vorrede auf, das heißt, richtete sich nicht erst in Fechterstellung empor, sondern führte mit der Pranke sofort einen furchtbaren Schlag nach dem Aste, dorthin, wo auf diesem Klingsors linker Fuß noch stand.

Was aus diesem samt Lackschuh geworden wäre, wenn er getroffen worden wäre, das konnte man sich nicht so leicht ausmalen. Jedenfalls wäre von dem Lackschuh samt Inhalt nicht mehr viel übrig geblieben. Ein Schlag mit der Pranke, dass die fünf Zoll langen Nägel, jeder reichlich drei Zentimeter breit, dabei nur wenig spitz zulaufend, dafür aber messerscharf, von dem Aste gleich ein förmliches Brett abhobelten, nicht nur die Rinde abrissen, obgleich die auch schon stark genug war.
Aber Klingsor war so vorsichtig gewesen, diesen bedrohten Lackschuh vorher rechtzeitig wegzunehmen, er balancierte nur noch auf einem Beine, und als der Bär wieder ausholte, um auch den rechten Menschenfuß in Angriff zu nehmen, saß Klingsor bereits in der zweiten Etage und baumelte mit den Beinen.
Dies alles war ja weit, weit schneller vor sich gegangen, als sich hier erzählen ließ.
Eins, zwei, drei — die drei Menschen waren hinauf voltigiert, Klingsor einmal als erster, das andere Mal als letzter.
Jetzt hatte sich unten der Bär aufgerichtet und blökte mit weit aufgerissenem Rachen hinauf.
Oben in den dritten Etage stand Graf Tankred und starrte hinab, mit Augen, die jetzt mehr an die eines Riesenfrosches als an die eines Riesenkindes erinnerten.
Eine Etage tiefer stand Chlorinde, die eine Hand am Stamme, und blickte auch mit sehr starren, weit aufgerissenen Augen hinab. Und neben ihr saß Klingsor im tadellosen Frackanzuge, nur den Zylinder etwas schief auf dem Kopfe, wie er es liebte, die Hände im Schoße gefaltet, und baumelte vergnügt mit den Beinen.
So war die Situation, im ersten Augenblick, nachdem sich das ganze Tohuwabohu geklärt hatte, alles wieder zur Ruhe gekommen war.
Der Bär brüllte jetzt nicht mehr, friedlichste Stille herrschte wieder.
»Also, meine Herrschaften«, erklang da Klingsors bezaubernde Stimme, und jetzt fing er auch noch mit den Daumen zu leiern an, »wir wollen ja im Grunde genommen auf die Bärenjagd gehen. So war doch ursprünglich geplant. Das Säbelduell wäre dazwischen doch nur eine angenehme Abwechslung gewesen. Der Bär ist vorhanden. Meine Herrschaften, die Jagd kann beginnen.«
So hatte Klingsor gesprochen, mit den Beinen baumelnd und die Daumen drehend.
Und es wurde verstanden, es zündete.
Chlorinde brach in ein Lachen aus, so hell und silbern, wie man es der sonst so tiefen Altstimme gar nicht zugetraut hätte, wahrend Graf Tankred seinem furchtbaren Basse keine höhere Lage gab; er lachte, dass es dröhnte, auch brauchte er sich dabei nicht festzuhalten, er hatte sich breitbeinig genug aufgepflanzt, während Chlorinde sich lieber an den nächsten Zweigen festklammerte, sie lachte, dass ihre schwarzen Locken flogen.
»Was gibt es denn da zu lachen?«, fragte Klingsor nach wie vor in tiefstem Ernste, sogar eins seiner melancholischen Gesichter machend. »Ist denn eine Bärenjagd ein so lächerliches Vergnügen? Eine Bärenjagd, vor welcher auch jede Rothaut erst zum Rechtsanwalt und Notar geht, um ihr Testament zu machen? Na, wollen wir nun nicht mit der Jagd beginnen?«
Die Lacher beruhigten sich, sie besprachen die Lage, dabei aber immer noch humoristische Bemerkungen genug machend. Wer es war, der gerade das Wort hatte, braucht dabei nicht immer gesagt werden.
»Vorläufig sind wir es, die von dem Bären gejagt werden.«
»Himmel, was für ein Ungeheuer!!«
»Es ist das Männchen.«
»In der Camera sah es gar nicht so mächtig aus.«
»Ach, die Camera!«, erklang es verächtlich.
»Ja, was nun tun?«
»Hat jemand eine Waffe bei sich?«, fragte Klingsor.
»Ich nicht«, entgegnete Chlorinde. »Und Du?«
»Ich auch nicht.«
»Gar keine?«
»Ja, wenn Du hier mein Federmesserchen als Schwert betrachten willst und den Bleistift als Lanze?«
»Wie kommt es denn nur, dass Du nicht einmal einen Revolver einstecken hast?«
»Warum hast Du denn keinen bei Dir?«
»Weil ich... mich zu einem Duell vorbereitete, da hat man keine Waffen bei sich.«
»Und von mir gilt dasselbe. Ich wollte, falls ich mit dem Leben davonkam, sogar zu einer Hochzeit. Und Du, Tankred?«
Der wühlte bereits in seinen verschiedenen Taschen und brachte zunächst das fettige Frühstückspapier zum Vorschein.
»Was ist denn das?«
»Wurstpapier!«
»Mit Wurstpapier kann man keinen Grizzlybären jagen«, meinte Klingsor, und Chlorinde lachte.
»Sonst nichts weiter?«, richtete sie dann zum ersten Male an den gehassten Mann das Wort.
Der wusste diese Ehre gleich zu würdigen und machte ein ganz glückliches Gesicht, während er in den Hosentaschen weiterwühlte, aus denen er denn auch wirklich, freilich mit ungemeiner Bedächtigkeit, einen sehr großen Nickfänger zum Vorschein brachte, immer seiner eigenen Größe entsprechend, auch schon mehr so eine Art Schlachtschwert.
»Na, das ist ja schon etwas!!«, jubelte Chlorinde, gleich danach greifend. »Ja, was ist denn das?«
»Das ist mein Nickfänger, die Klinge steht fest«, lautete die Erklärung.
»Ja, da ist aber doch gar keine Klinge dran?«
»Nee, die ist abgebrochen, neulich, als ich einen Hasen ausweidete«, erläuterte der Riese kleinlaut.
»Aber die Klinge stand fest, als sie noch dran war«, versicherte der Mann mit den Teufelsaugen, immer mit den Beinen baumelnd.
»Auf der anderen Seite ist ein Korkzieher«, setzte Tankred noch hinzu.
»Gut, gehen wir dem Bären mit dem Korkzieher zu Leibe! Bohren wir ihm so nach und nach beide Augen aus«, sagte Klingsor.
Chlorinde hatte den Korkzieher bereits aufgeklappt, der für das große Messer nun wieder sehr klein war, und sie lachte.
»Sonst haben Sie nichts weiter bei sich?«
»O ja...«
»Was denn?«
»Ich glaube — glaube — eine Zigarre!«
Und der Riese in der dritten Etage präsentierte die mühsam unter dem Lederkoller hervorgezogene Zigarre.
»Die kannst Du mir geben!«, rief Klingsor sofort hinauf.
»Weiter fehlte nichts, es ist die einzige, die ich...«
Da fiel dem Grafen, wie es manchmal so geht, braucht deshalb gar nicht ungeschickt zu sein, diese einzige Zigarre aus den Fingern.
Sie fiel nicht so direkt auf Klingsor zu, er musste sich dazu erst ein wenig vor und seitwärts biegen, das tat er aber auch sehr schnell, und ganz merkwürdig war es, mit welcher Sicherheit er die Zigarre auffing. Er griff sie förmlich aus der Luft heraus, nur mit Daumen und Zeigefinger.
»Danke, mein lieber Tankred!«, sagte er, schnitt mit seinem Federmesserchen die Spitze ab, nahm sie zwischen die Lippen, zog aus der Westentasche ein Büchschen, es enthielt gewöhnliche Schwefelhölzer, brannte eins an und entzündete die Zigarre.
»Gar kein so schlechtes Kraut!«, pustete er behaglich. »Riechst Du es da oben, mein lieber Tankred?«
»Loke, Du bist ein gemeiner Kerl!«, fing der jetzt zu schimpfen an.
»Wir rauchen die Zigarre zusammen«, wurde er getröstet, »ich ziehe hier unten, Du dort oben kannst das Aroma riechen.«
»Ja, meine Herren«, wollte Chlorinde jetzt zur Sache kommen, wenn sie auch lachte, »wie helfen wir uns nun aus dieser Lage?«
»Dort liegen ja Tankreds Waffen, er mag sie nur holen.«
»Dein Fiedelkasten mit den Säbeln ist aber näher«, wehrte der Hüne bescheiden ab, also auch zeigend, dass er Humor besaß.
»Gut, dann hole den Kasten! Oder Du brauchst ihn ja nicht erst herzuschleppen, kannst die beiden Säbel herausnehmen — hier hast Du den Schlüssel.«
Doch sie besprachen auch ernsthaft die Möglichkeit, zu jenen Waffen zu gelangen, um dann eine richtige Bärenjagd zu eröffnen.
Nein, keine solche Möglichkeit bestand! Jeder von den dreien kannte den Grizzly aus eigenen Erfahrungen schon zur Genüge. Wer hier von dem Baume herabsprang und dorthin rannte, hinter dem war sofort der Bär her. Wohl konnte es ihm gelingen, die Waffen des Grafen, die also etwa dreißig Schritt entfernt lagen, zu erreichen, aber er hatte sicher nicht mehr Zeit, die Lanze herumzudrehen oder den Hirschfänger aus der Scheide zu ziehen, da hätte der Bär ihn schon von hinten zu Boden geschlagen oder in seine zermalmende Umklammerung genommen. Das Gewehr kam erst recht nicht in Betracht, weil es erst entsichert werden musste, was, wie der Graf erklärte, etwas umständlich war; den näher liegenden Säbelkasten musste man gar erst aufschließen.
»Hast Du denn sonst gar nichts bei Dir, Loke?«, fragte Chlorinde wiederum, in dieser Situation die alte Feindschaft bereits etwas vergessend, und geduzt hatten sie sich ja überhaupt fast immer.
»Was soll ich denn sonst bei mir haben?«
»Du verstehst doch so allerhand Hokuspokus.«
»Was für Hokuspokus?«, stellte sich Klingsor verwundert.
»Um den Bären zu verscheuchen.«
»Ich verstehe Dich nicht.«
»Man erzählt doch von Dir allerhand. Du bist zum Beispiel in Czernebogs Menagerie von einem Drachen angefallen worden, schienst rettungslos verloren zu sein — aber da verwandeltest Du Dich plötzlich in ein feuerspeiendes Ungetüm, hauchtest die geflügelte Riesenschlange, wohl aus einer geflügelten Eidechse gezüchtet, nur an, ein Feuerstrom brach aus Deinem Munde, und das konnte dieser Drache Dir nicht nachmachen und es nicht vertragen — Du warst gerettet. Kannst Du hier diesem Bären nicht mit so etwas aufwarten?«
»Na, Chlorinde, Du wirst doch nicht von mir verlangen, dass ich jederzeit Feuer speien kann?«
»Du hast so ein Mittel, das Du in den Mund nimmst, eine Patrone oder dergleichen.«
»Ja, das besitze ich.«
»Hast Du es nicht bei Dir?«
»Nein. Wir sind hier auf neutralem Gebiet, wo kein Skalde etwas benutzen darf, was nicht Gemeingut der ganzen Menschheit ist. Das ist ein ehernes Gesetz.«
»Du bist gerade der Rechte, der sich um solch ein Gesetz kümmert!«, wurde gespottet.
»Chlorinde«, erklang es ernst zurück, »erhebe keine Anklage gegen mich, deren Wahrheit Du, wenn ich es verlange, beweisen müsstest! Nein, ich habe nichts Derartiges bei mir. Nicht einmal eins unserer Feuerzeuge. Du hast gesehen, wie ich mir vorhin die Zigarre anbrannte — — mit einem ganz ordinären Schwefelhölzchen.«
»Dann wende Deine hypnotischen Künste an!«
»Was für hypnotische Künste?«
»Du verstehst sie. Verstelle Dich doch nicht immer. Du hast es allein im Auge. Du gehst, wie Du es schon mehrmals gemacht hast, in einen Käfig voll der wildesten Bestien, die halb wahnsinnig vor Hunger sind, und Du hast keine weiteren Manipulationen nötig, Du lässt nur Deine Teufelsaugen im Kreise herumwandern, und sie alle kriechen zu Deinen Füßen.«
»Ja, ich kann es, aber Du weißt auch, dass mir bei einem hypnotischen Experimente einmal etwas misslungen ist, es hatte schreckliche Folgen, und seitdem hypnotisiere ich nicht mehr.«
»Das ist doch gar kein richtiges Hypnotisieren, es liegt nur in Deinem Blick.«
»Nein, ich tue es nicht mehr. Täte ich es noch, so würden wir beide heute keinen Zweikampf auf Leben und Tod verabredet haben, keine Königin von Thule würde mich mit ihrem Hasse verfolgen.«
»Wie meinst Du das?!«, zuckte die Fürstin bereits empor.
»Nun, ich brauchte Dich nur anzusehen und Dir im Stillen zu befehlen: ›Lass ab von mir, Chlorinde!‹ — und Du würdest sofort...«
»Ha, probiere es einmal, mich zu hypnotisieren!!«, hohnlachte sie.
»Ich tue es nicht mehr, weder bei einem Menschen noch bei diesem Bären, noch bei irgendeinem anderen lebenden Geschöpfe.«
So sprach Klingsor mit größter Entschiedenheit.
Chlorinde gab denn auch ihre Bemühungen in dieser Hinsicht sehr bald auf, sie erwog andere Möglichkeiten.
»Ist einer der Herren mit seinem Luftschiffe telefonisch verbunden?«
»Ich bin's nicht«, entgegnete zuerst Graf Tankred.
»Du, Loke?«
»Ich bin ja mit einem Aeroplan gekommen.«
»Deshalb kannst Du doch mit dem Führer in Verbindung stehen, auch mit einem anderen Luftschiffe, mit einer Station.«
»Wir dürfen doch keins unserer Telefone hier bei uns haben.«
»Hm, dasselbe ist ja bei mir der Fall, aber ich dachte, dass gerade Du Dich um so etwas nicht... na, lassen wir das! Also können wir keine Hilfe herbeirufen. Wirst Du wenigstens von irgendwo aus beobachtet?«
»Im Gegenteil, ich habe strengen Befehl gegeben, keine Camera auf diese Gegend einzustellen.«
»Habe ich auch getan!«, fügte der Graf hinzu.
»Und ich desgleichen!«, sagte Chlorinde. »So haben wir also keine Hilfe von anderer Seite zu erwarten. Was machen wir da?«
»Das ist sehr einfach«, meinte Graf Tankred.
»Nun.«
»Ich nehme es mit dem Bruder Jonathan auch ohne Waffen auf, es wird ein kleiner Ringkampf...«
»Hallo!«, rief Klingsor sofort, während Chlorinde dem Sprecher einen langen Blick zuwarf. »Davon kann keine Rede sein! Was meinst Du wohl, was...«
»Graf Tankred hat einen Löwen in voller Freiheit bezwungen, einen ausgewachsenen, starken Löwen in der Wildnis, es soll sogar ein riesiges und ganz unbändiges Exemplar gewesen sein«, sagte Chlorinde, nicht etwa Tankred selbst.
»Ach, das ist hier gar kein Vergleich!«, rief Klingsor. »Da war Tankred doch natürlich durch eine Lederpanzerung geschützt...«
»Das bin ich auch jetzt«, unterbrach ihn der Graf.
»Auch Dein Gesicht, der ganze Kopf musste es natürlich sein...«
»Solch ein Kopfschutz ließe sich wohl leicht noch fertigen.«
»Rede nicht! Das Leder war doch präpariert, dass es trotz seiner Geschmeidigkeit dennoch die Härte unseres besten Panzerstahls besaß. Oder besteht etwa dieser Jagdanzug aus solchem Leder?«
»Nein, das allerdings nicht...«
»Dann hättest Du auch gegen unsere Gesetze verstoßen, hier auf neutralem Menschengebiete so etwas zu benutzen.«
»Aber da musste ich mich doch nur gegen die Zähne und Klauen des Löwen schützen, der Bär dagegen beißt und kratzt gar nicht...«
»So, tut er das nicht? Hast Du nicht gesehen, wie vorhin die Fetzen flogen?«
»Ehe er zuschlagen kann, bin ich schon dicht bei ihm, drücke ihn an mich...«
»Das ist es ja, worauf Bruder Jonathan nur wartet. Er nimmt Dich in seine Umarmung und zerquetscht Dich zu Apfelmus.«
»Wenn ich nicht schneller zudrücke...«
»Na, Tankred, nun höre endlich auf! Alle Hochachtung vor Deinem Wagemut, und dass Du eine Riesenkraft besitzest, weiß ich. Aber ein Mensch ist denn doch kein Bär. Mit einem Grizzly kann sich kein Mensch im Ringkampf messen. Und wenn's Herkules selber wäre. Daran glaube ich nicht. So etwas gibt's nicht. Und damit basta! Also versuche nicht mehr, Dich für uns aufopfern zu wollen. Ich nehme das Opfer nicht an, und probierst Du es noch einmal, dann ist es mit unserer Freundschaft aus!«
Klingsor hatte mit einer Entschiedenheit gesprochen, dass der Riese gleich betrübt den Kopf hängen ließ. Auch Chlorinde sprach längere Zeit kein Wort mehr.
Unten lag der Bär, ganz ruhig, hatte ganz gemütlich den Kopf auf die Vordertatzen gelegt und schielte mit den auffallend kleinen, aber tückischen, rot glühenden Augen nach den drei Menschlein dort oben hinauf.
»Wie lange wird der Bär uns belagern?«, nahm Chlorinde wieder das Wort.
»Das weißt Du doch wohl selbst recht gut«, entgegnete Klingsor. »Bis er uns hat! Bis wir vor Hunger und Durst so erschöpft sind, dass wir vom Aste fallen! Und dieser Fettwanst hält unter allen Umständen länger aus als jeder menschliche Hungerkünstler, ganz abgesehen vom Trinken.«
»Als Du Dich einmal in Gefangenschaft des Herzogs von Salamandrien befandest, hast Du bewiesen, dass Du vier Wochen lang ohne Speise und Trank aushalten kannst, ohne ein Quäntchen an Gewicht zu verlieren.«
»Da hatte ich besondere Pillen bei mir, die ich benutzte: Ohne die bringe ich das nicht fertig, sonst halte auch ich es keine drei Tage aus.«
»Solche Pillen hast Du jetzt nicht bei Dir?«
»Wie kannst Du noch fragen, o Königin! Natürlich nicht. Schon deshalb nicht, weil auch diese Pillen wieder zu den Dingen gehören, die wir hier nicht benutzen, nicht einmal bei uns tragen dürfen.«
»Diese Pillen sind Deine Erfindung, die Du dem Skaldenbunde anmelden müsstest; Du hast es bisher nicht getan. Auch hierin verstößt Du ja gegen die Skaldengesetze.«
»Das ist wieder ein ganz anderer Fall und ganz und gar meine eigene Sache«, entgegnete Klingsor. »Ich habe ein für alle Mal öffentlich erklärt, dass ich solche Geheimnisse dem Skaldenbunde nicht preisgebe.«
»Ob diese Deine Erklärung als gültig angenommen wird, darüber ist noch nicht entschieden.«
»Dieser Entscheidungsprozess schwebt nun schon und ich denke, er wird ewig schweben bleiben.«
»Der Bär hat Junge«, begann Chlorinde wieder von der Hauptsache.
»Es ist das Männchen.«
»Auch der männliche Bär sorgt für seine Jungen.«
»Aber nicht, dass er deswegen von der einmal erkorenen Beute ablässt. So weit geht seine Vaterliebe nicht. Das tut nur die Bärenmutter.«
»Nun, wir können doch nicht hier oben sitzen bleiben, bis wir vor Schwäche herabfallen.«
»Nein, das können wir nicht.«
»Dort liegen Waffen genug.«
»Ja, dort liegen sie.«
»Weißt Du ein Mittel, um in ihren Besitz zu kommen?«
»Nein.«
»Ich weiß eins.«
»Nun?«
»Es springt ganz einfach jemand vom Baume herab und rennt davon. Das dies möglich ist, ohne dass der Bär ihn sofort im Rachen oder in den Armen hat, wirst Du wohl zugeben...«
»Das gebe ich zu.«
»Der Bär jagt ihm natürlich sofort nach. Inzwischen rennt ein anderer nach den Waffen, die beiden anderen tun es, der Bär wird mit der Lanze erledigt oder auch erschossen.«
»Und was tut unterdessen der andere?«
»Nun, der lenkt eben den Bären auf sich.«
»Ja, das tut er allerdings.«
»Rennt im Zickzack hier in dem Felsenkessel herum. Oder auch geradeaus.«
»So? Im Zickzack oder immer geradeaus«, wiederholte Klingsor spottend.
»Na, ein Bär kann mich doch nimmermehr einholen, wenn ich freie Bahn habe.«
»Bist Du schon einmal von einem Bären verfolgt worden, von einem Grizzly?«
»Nein, das freilich nicht.«
»Und ich sage Dir, o Königin: Der Bär hat Dich in der ersten Minute gefasst!«
»Das bezweifle ich. Solch ein plumper Gesell kann nicht schneller sein als ein schnellfüßiger Mensch.«
»In einer Hinsicht hast Du recht. Auf freier Rennbahn würde er Dich nicht einholen, und ich weiß ja, was Du im Laufen leisten kannst, Du könntest es mit einem Achilles aufnehmen, und hier in diesem Kessel ist der Steinboden ja auch glatt wie ein Tisch. Aber hast Du Dir die einmündenden Schluchten und Spalten betrachtet?«
»In der Camera.«
»Ganz genau?«
»So ganz genau nicht.«
»Ich habe es getan. Überall ist der Boden mit Geröll bedeckt, mit Steinen und Felsblöcken verbarrikadiert. Das Geröll genügt schon, um jedes schnelle Laufen unmöglich zu machen, für den Menschen, mag er noch so gut beschuht sein. Für den Fuß des Bären aber ist das kein Hindernis, der Grizzly ist ein Sohn der Felsenwildnis. Er holt den Flüchtenden sofort ein, verlass Dich darauf, Chlorinde.«
»So jage ich hier in diesem Talkessel im Kreise herum, im Zickzack, schlage immer Haken.«
»Nein, Chlorinde! Auf solche Finten lässt sich der Grizzly nicht ein, ich kenne ihn. Er treibt Dich immer mehr in die Enge, bis er Dich hat. Ja, wenn es einen zweiten Baum gäbe, auf den sich der Betreffende flüchten könnte, oder wenigstens einen erhöhten Felsvorsprung, von dem man annehmen dürfte, dass der Bär ihn nicht zu ersteigen vermöchte.«
Kein solcher war zu erblicken, so weit das Auge reichte. Die Felswände waren in diesem Kessel wohl von Spalten unterbrochen, sonst aber ganz glatt, wie gemauert, und auch Höhlen fehlten ganz.
»Na, was sollen wir denn nur sonst anfangen!«, rief Chlorinde ärgerlich. »Auf, Fürst des Feuers, streng Deinen Scharfsinn an, uns aus dieser Klemme zu helfen — — auf, Loke, der Du den Namen des germanischen Gottes führst, dem die Menschheit alle Erfindungen verdankt und der so reich an Listen und Schlichen und Kniffen sein soll!«
»In der Tat, ich will nicht umsonst den Namen dieses Gottes führen, der eben wegen seiner Erfindungsgabe auch der Gott des Feuers war«, lächelte Klingsor.
»Wie? Du weißt ein Mittel, wie wir uns aus dieser Klemme helfen?«
»Ich weiß eins.«
»Wie wir dort jene Waffen bekommen?«
»Nein.«
»Sondern?«
»Wir töten den Bären durch eigene Kraft.«
»Ich denke, das hältst Du nicht für möglich?«
»Durch eine Waffe, die wir uns erst selbst fertigen.«
»Was für eine Waffe?«
»Durch einen Spieß, eine Lanze. Dazu geeignete Äste haben wir hier ja genug.«
Chlorinde blickte in die Zweige der Fichte empor und lächelte spöttisch.
»Willst Du mit Deinem Federmesserchen etwa eine Lanze zurechtschnipseln?«
Behaglich blies Klingsor den Rauch seiner Zigarre von sich.
»Nein. Aber mit Feuer. Mit Feuer gehen wir unserem zottigen Gegner zu Leibe. Streichhölzchen habe ich. Dürres Holz gibt es genug. Wir werden auch einen geeigneten Ast finden, weiter oben, den wir abbrechen können, um ihn als Lanze zu benutzen. Oder vielmehr als Brander. Dass die Lanze besonders spitz ist, ist gar nicht nötig. Vorn wird noch trocknes Holz befestigt, das werden wir schon fertig bringen, dort oben sehe ich auch ausgeschwitztes Harz massenhaft kleben, das wird angezündet, und so rücken wir dem Grizzly mit Feuer auf den Pelz. Er wird schwerlich standhalten. Mindestens werden wir auf diese Weise dort zu unseren Waffen gelangen.«
»Wahrhaftig, das ist eine Idee!«, rief Chlorinde jubelnd. »Loke, Fürst des Feuers, Du machst diesem Deinem Namen und Titel alle Ehre!«
Es wurde sofort nach geeignetem Material Umschau gehalten. Zuerst musste eine Lanze geschaffen werden.
Hier unten waren die Äste ja viel zu stark, sie mussten weiter oben suchen. Zu sehen war von hier aus nicht viel, die dicht benadelten Seitentriebe verdeckten die Aussicht.
Tankred, der sich noch immer in der dritten Etage befand, war der erste, der auch gleich höher stieg. Die beiden anderen folgten, da das Gezweig aber immer dichter wurde, sahen sie ihn in demselben verschwinden.
Sie mochten sich schon in der Hälfte der Höhe des Baumes befinden, die Seitenäste waren für ihre Zwecke immer noch zu stark, als sie über sich des Grafen Stimme vernahmen.
»Hier ist eine Höhle!«
Eine Minute später sahen die beiden Nachfolgenden diese selbst. Also der riesige Stamm schmiegte und drückte sich ganz dicht an die glatte Felswand, und an dieser sah man linkerhand in geringer Entfernung vom Stamm in dieser Felswand ein ziemlich kreisrundes Loch von fast einem Meter Durchmesser, nur mit etwas unregelmäßigen Rändern.
Unter dieser Öffnung lief, immer noch dicht an der Wand, ein vom Hauptstamme ganz horizontal ausgehender Ast hin, immer noch von Schenkelstärke, so konnte man ganz bequem hin gelangen, und der Graf musste wohl schon in die Höhle eingedrungen sein, denn er war nicht mehr zu erblicken.
»Wo bist Du, Tankred?«, rief Klingsor.
»Hier drinnen!«, erscholl es denn richtig etwas gedämpft aus dem Loche zurück.
Er war schon so weit vorgedrungen, dass man ihn in dem einfallenden Tageslichte, das ja besonders in dem dunklen Schatten dieser dichten Fichtenzweige spärlich genug war, schon nicht mehr erblicken konnte. Außerdem schien der Gang bald eine Biegung zu machen.
»Was ist da drinnen los?«
»Die erst so enge Höhle wird gleich ganz geräumig, setzt sich immer weiter fort.«
»Kannst Du denn sehen?«
»Ich habe doch meine Taschenlampe bei mir, wenn auch eine ganz gewöhnliche, mit Benzin.«
Dann musste er sich also tatsächlich schon hinter einer Biegung befinnen, dass man von diesem Lichtscheine nichts bemerkte.
»Sapristi!!«, erklang es jetzt im Tone des höchsten Staunens.
»Was ist denn?«
»Hier sind Stufen, die hinabführen, ganz regelrechte Stufen!«
Unterdessen waren die beiden schon auf dem Aste hinbalanciert, Chlorinde voran, und so war sie auch die nächste, welche in die Höhle eindrang.
Dies musste bei Meterhöhe natürlich in sehr gebückter Stellung geschehen, besser noch gleich auf Händen und Knien, wie Chlorinde es auch tat.
Dadurch, dass sie hinter sich ein gutes Teil der Öffnung verdeckte, sah sie ja von vornherein nicht viel, aber erkannte doch, dass sie sich schon nach einer ganz kurzen Strecke wieder aufrichten konnte, weil sich der Gang eben nach oben ganz bedeutend erweiterte, höher wurde.
Also sie richtete sich auf. Die Lampe ihres Vorgängers war noch nicht zu sehen. Erst einmal zurückblickend, bemerkte Chlorinde. dass die Erhöhung des Ganges ganz plötzlich vor sich ging, hinter ihr hing ein Felsblock über.
Ohne hierbei etwas zu finden, ohne an eine Gefahr zu denken, setzte Chlorinde ihren Weg fort.
Nach wenigen Schritten schon kam eine ganz scharfe Biegung, und da sah sie in geringer Entfernung vor sich im schwachen Scheine eines Lämpchens den Grafen stehen.
In demselben Augenblicke, als Chlorinde diese Wahrnehmung machte, erscholl ein Krachen, dem ein Donnergepolter folgte. Dann trat wieder Todesstille ein.
»Um Himmels willen, was war das?!«
In einem Zimmer, dessen Wände ganz mit Aktenregalen bedeckt waren, schritt ein älterer Herr mit glattrasiertem Gesicht auf und ab. Mr. Huxly war Direktor der Filiale, die eine englische PrivatDetektivGesellschaft, welche mit ihren Fäden die ganze Welt umspannt, auch in Colombo unterhielt, und zwar nicht etwa in irgendeinem Winkel der Altstadt, sondern das Büro, in dem ständig einige Dutzend Schreiber beschäftigt waren, nahm die erste Etage in einem am Hafen bevorzugt gelegenen Geschäftspalaste ein.
Der alte Herr mit den schlauen und doch so eisernen Gesichtszügen schien auf etwas zu warten.
Bald blieb er an dem Schreibtisch stehen, blätterte in einem Bündel zusammengehefteter Briefe und noch mehr Telegrammen, bald griff er nach einem dicken Aktenstück, bald trat er an das Fenster, das Aussicht auf die herrliche Hafenszenerie bot, um dann seinen Spaziergang im Zimmer wieder aufzunehmen, manchmal ungeduldig nach der Uhr sehend.
Da ein leises Klingeln, und fast gleichzeitig öffnete sich die Tür.
Ein jüngerer Herr trat ein, in weißem, elegantem Tropenkostüm mit roter Schärpe. Es mochte ein europäischer Südländer sein, doch ein Kenner musste gleich auf etwas malaiisches Blut in seinen Adern schließen, besonders deshalb, weil in dem hübschen Gesicht von runder Form unter der kleinen, etwas gebogenen Nase der dünne, eigentümlich geschwungene Schnurrbart so fest auf der Haut lag, als wäre jedes Haar angeklebt oder der ganze Schnurrbart überhaupt nur angemalt. Daran erkennt man immer gleich den Malaien oder dessen Abkömmling.
»Sie haben recht lange auf sich warten lassen, Mr. Rouen!«, wurde er etwas ungnädig empfangen.
»Setzen Sie sich!«
Mr. Huxly nahm Platz vor dem Schreibtisch, der andere auf einem Stuhle seitwärts davon.

»Setzen Sie sich!«, sagte Mister Huxly,
der selbst schon Platz genommen hatte.
Noch einmal blätterte der alte Herr in dem Briefbündel und dem dicken Aktenheft, dann lehnte er sich zurück.
»Kennen Sie den Lord Hektor Clifford?«, eröffnete er die Unterhaltung.
»Ja, wenigstens dem Namen nach«, beeilte sich Mr. Rouen zu sagen, »und einen zweiten dieses Namens dürfte es in Großbritannien wohl nicht geben.«
»Was wissen Sie von ihm?«
»Er ist der einzige Sohn und Erbe des verstorbenen Lord Artur Clifford, Peer von England, einer von den zweiundvierzig Lords, denen ganz Großbritannien gehört, und zwar einer der reichsten von ihnen, der die Miete von halb London einzieht, der selber nicht genau weiß, wie viel er eigentlich hat und was für Einkünfte er bezieht. Unermesslich reich! Da kann noch kein amerikanischer Milliardär mit.«
»Stimmt. Sonst wissen Sie nichts weiter von ihm?«
»Nein.«
»Von seiner Krankheit?«
»Ist er krank?«
»Von seiner Lebensweise? Wie er immer auf Reisen ist?«
»Nein. Davon ist mir allerdings nichts bekannt. Nur das, was ich soeben von ihm sagte.«
»So lassen Sie sich über ihn berichten.
Über seine Vermögensverhältnisse sind Sie gut orientiert. Ich habe noch hinzuzufügen, dass das uralte Adelsgeschlecht der Cliffords eng verwandt ist mit dem der englischen Königsfamilie, und sollte dieses einmal aussterben, so hätte Lord Hektor Clifford als einziger männlicher Spross dieser Linie die nächste Anwartschaft auf den englischen Königsthron, wozu ja nun freilich keine Aussicht vorhanden ist.
In doppelter Hinsicht nicht.
Gegenwärtig ist Lord Hektor 24 Jahre alt, ein ungemein kräftiger, athletisch gebauter Mensch, vor Gesundheit strotzend, aber... geistig nicht ganz normal.
In seiner ersten Jugend und auch als Jüngling hat er keine Sonderlichkeiten gezeigt.
Vor ungefähr fünf Jahren hat es mit ihm begonnen.
Er besuchte die Universität Oxford, ein lebenslustiger Jüngling von nicht zu trübender Heiterkeit, viel Sport treibend, geistig hoch veranlagt.
Mit einem Male brach er allen Verkehr ab, zog sich immer mehr in die Einsamkeit zurück, versäumte die Vorlesungen, wollte keinen Menschen mehr sehen, schloss sich tagelang in seinem Zimmer ein, wäre verhungert, wenn man nicht mit Gewalt bei ihm eingedrungen wäre.
Der junge Lord war schwer an Melancholie erkrankt.
Melancholie ist ein Gemütszustand, an dem gar viele Menschen, die nichts weiter zu tun haben, zu leiden glauben, ohne zu wissen, was das in Wirklichkeit ist.
Melancholisch sein — na, was ist denn das weiter? Eine moderne Modekrankheit, die gewissermaßen zum guten Tone gehört — so vom blassen Pessimismus angehaucht zu sein, am ganzen Leben zu verzweifeln.
In Wirklichkeit soll Melancholie eine echte Geisteskrankheit mit ganz fürchterlichen Symptomen sein.
Lord Hektor war im höchsten Grade an Melancholie erkrankt. Möglich, dass sich das schon längst vorbereitet hatte, aber ausgebrochen war es ganz plötzlich.
Möglich, dass ein tragischer Vorfall da die Veranlassung gegeben hatte. Lord Hektor hatte eine Liebelei mit einer Portiertochter seines Hauses unterhalten, das bildhübsche Mädchen war beim Fensterputzen heruntergestürzt und tödlich verunglückt. Aber das ist nur eine Annahme. Der junge Mann war damals alles andere als ein Weiberfeind, ohne jedoch, was wiederum betont werden muss, etwa ein Wüstling zu sein. Eben so ein liebenswürdiger Schwerenöter. Und das Mädchen ist nicht etwa in seinen Armen gestorben, er hat das Unglück nicht selbst gesehen; er erfuhr es hinterher; es machte natürlich auf ihn den stärksten Eindruck, aber noch nicht so, dass er nun gleich überschnappte.
Man nimmt nur an, dass dies der letzte Anstoß zu dem Ausbruch der Gemütskrankheit war, die sich im Stillen schon längst vorbereitet hatte.
Also Lord Hektor Clifford war von Melancholie stärksten Grades befallen worden.
Von einer ›Unheilbarkeit‹ wollten die Ärzte nicht sprechen. Dann hätte sich ihnen doch eine reichlich fließende Goldquelle verstopft.
Ich will nicht schildern, was diese Ärzte alles mit dem jungen Manne aufstellten. Es war alles vergeblich. Der Zustand wurde nur immer schlimmer, bis die noch jetzt lebende Lady Clifford, seine Mutter, den Vorschlag machte, das Beste sei wohl, ihn zur Zerstreuung auf Reisen zu schicken.
Das hatte ja eigentlich von vornherein sehr nahe gelegen, das Heer von Ärzten, die den Patienten behandelten, immer über neue Maßnahmen beratend, hatte, ein festes Konsortium bildend, das keinen anderen hereinließ, hiervon nur noch nichts wissen wollen, weil ihnen dadurch das kostbare Objekt aus den Fängen gerückt worden wäre. Nun aber war die Sache mit dem Reisen einmal angeschnitten und ließ sich nicht mehr rückgängig machen.
Lord Hektor war mit diesem Vorschlage sogleich einverstanden, als etwas ganz Selbstverständlichen voraussetzend, dass er dabei seine eigene Jacht benutzte, bei Landreisen mit der Bahn sein eigenes Coupé, wenn nicht gleich seinen eigenen Zug.
Aber die Mutter dachte hierüber anders.
Oder die ganze Sache ging wohl von einem deutschen Arzte aus, einem Doktor Worm, der sich bei der Lady Clifford einzuschleichen gewusst hatte, zum Leidwesen der anderen Ärzte.
So zu reisen, wie es sich der junge Mann gedacht, hätte ja gar keinen Zweck gehabt. Dann hätte er sich auf seinem eigenen Schiffe oder in seinem Eisenbahnwagen doch immer wieder von der anderen Welt ganz abschließen können.
Die Mutter nahm ihm deshalb das feste Versprechen ab, dass er nur so reisen dürfe, wie es die meisten anderen Sterblichen tun: mit Benutzung der gewöhnlichen Fahrgelegenheiten. Auch muss er immer der allgemeinen Tafel beiwohnen, an Bord wie im Hotel, darf sich keiner Gesellschaft entziehen usw. usw.
Also seit vier Jahren schon reist er ständig in der Welt herum, nur begleitet von Doktor Worm, an dem er sehr zu hängen scheint, und einem alten Kammerdiener.
Doch obgleich sich nun Lord Hektor ganz den Vorschriften fügt, sich auf den Dampfern und in den Hotels den gemeinsamen Tafeln anschließt, alle Sehenswürdigkeiten besichtigt, Gesellschaften und Jagdausflüge u. dgl. mitmacht, hat sich in seinem Verhalten noch nichts geändert.
Er ist und bleibt der melancholische Mann, der immer in Gedanken versunken dasitzt, aus ihnen erst geweckt werden muss, ehe er eine Antwort gibt, der überhaupt nicht hört und sieht, was um ihn herum vorgeht, für gar nichts Interesse hat. Dabei körperlich rüstig, und auch von Schwachsinn ist ihm nichts anzumerken.
Doch etwas anderes ist es, worüber ich Sie, Mr. Rouen, sprechen wollte.
Die ganze Reise, und alles, was darauf Bezug hat, wird immer noch von London aus arrangiert, und zwar persönlich von Lady Clifford, und zwar wird von ihr jeder Dampfer und jeder Eisenbahnzug bestimmt, den Lord Hektor benutzen soll, sie bestellt auch die Hotelzimmer, natürlich telegrafisch.
Die Sache ist nämlich die: Doktor Worm, ein alter Herr, soll selbst ein großer Sonderling sein, vor allen Dingen ganz und gar unpraktisch. Wenn es von dem abhinge, würde die Reisegesellschaft niemals das nächste Ziel erreichen, jeden Anschluss versäumen. Und der alte Kammerdiener ist ein einfacher Mann, der auch nicht als Mentor zu gebrauchen ist. Von einer anderen Begleitung aber wollte der junge Lord nichts wissen.
Nun ist aber die Möglichkeit dieser Reiseführung doch immerhin beschränkt.
So wird für diesen Ort, der als Zentralpunkt dienen soll, immer von London aus ein Mentor und Leiter bestellt, natürlich ein Einheimischer. Und für Colombo, wie überhaupt zum Besuche von ganz Ceylon, ist diesmal unsere Detektivgesellschaft von der Lady Clifford hiermit beauftragt worden.
Ich wiederum übergebe diese ganze Sache nun Ihnen, Rouen. Sie sind hier geboren, kennen die Verhältnisse von Ceylon ausgezeichnet. Sie werden also dem jungen Lord als ständiger Führer zur Verfügung gestellt.«
Der Sprecher machte eine Pause: Monsieur Rouen verneigte sich dankend und mit strahlendem Gesicht; er sah schon etwas Tüchtiges für sich herausspringen.
»Das in mich gesetzte Vertrauen ehrt mich sehr: Ich werde es rechtfertigen.«
»Das weiß ich, Mr. Rouen, ich war mit Ihnen ja bisher sehr, sehr zufrieden. Sie haben bereits zahlreiche Proben Ihrer außerordentlichen Gewandtheit, Ihres bewundernswerten Scharfsinnes und Ihrer sonstigen Tüchtigkeit gegeben.«
Der junge Mann warf dem alten Herrn einen etwas misstrauischen Blick zu. Er kannte doch seinen Prinzipal, und wenn Direktor Huxly so sprach, dann hatte er immer irgendeinen kniffligen Hintergedanken dabei, wollte jemand ködern.
»Wo befindet sich Lord Clifford denn gegenwärtig?«
»Er hält sich zurzeit, nachdem er von Kalkutta aus ganz Vorderindien durchquert hat, alle sehenswerten Städte mitnehmend, noch in Bombay auf. Von dort geht es direkt hierher.«
»Und wann wird er hier eintreffen?«
»Das ist noch nicht bestimmt, ich werde jedenfalls rechtzeitig benachrichtigt.«
»Welcher Art sind nun da meine Obliegenheiten? Werde ich da noch nähere Weisungen bekommen?«
»Zunächst haben Sie das Hotel zu wählen und auch sonst für den Empfang alles vorzubereiten. Darüber spreche ich Sie noch einmal. Inzwischen arbeiten Sie den Plan aus, nach welchem Sie dem Lord die Sehenswürdigkeiten von Colombo zeigen und was für interessante Reisen Sie dann weiter mit ihm durch die ganze Insel unternehmen werden.«
»Auch Jagden?«
»Gewiss, auch Jagden. Arrangieren Sie eine Elefantenjagd im Distrikt Balabad wie damals für den Herzog von Cambois, darin haben Sie schon Routine. Wenn sich Lord Clifford auch ganz und gar nicht für Jagd interessiert, den Schießprügel nur gedankenlos mit sich herumschleppt, so ist es doch der Wunsch seiner Mutter, dass für ihn solche Jagdausflüge arrangiert werden, und er nimmt willig daran teil.«
»Hm. Und wie ist es nun mit den anderen Gelegenheiten, wobei man sich gerade hier in Colombo ganz ausgezeichnet amüsieren kann?«
Auf diese vorsichtig gestellte Frage hin zog der alte Herr die Stirn kraus.
»Ja, nun kommen wir zur Hauptsache. Dass der junge Lord in früheren Jahren durchaus kein Weiberfeind gewesen ist, sagte ich Ihnen bereits. Seitdem er jedoch menschenscheu geworden ist, erstreckt sich das besonders auf das weibliche Geschlecht. Er geht jeder Frauensperson aus dem Wege, blickt sie nicht an, antwortet womöglich keiner Dame. Er ist direkt weiberscheu geworden.«
Wieder blätterte Mr. Huxly sinnend in den Briefen und Akten.
»Und trotzdem... hm... Lady Clifford ist gerade der Überzeugung, dass er sofort von seiner Gemütskrankheit geheilt sein würde, wenn es gelänge, seine Neigung für ein Weib zu erwecken.«
»Das ist recht wohl möglich«, stimmte Mr. Rouen bei.
»Dass der Zufall dazu hilft, ist bei dem jetzigen Charakter des Lords wohl ausgeschlossen. Doktor Worm denkt an so etwas gar nicht, oder der alte Herr, ein schrullenhafter Gelehrter, wie er im Buche steht, ist dazu viel zu unpraktisch und weltfremd. Der alte Kammerdiener kommt ebenfalls nicht in Betracht. Lady Clifford aber hält diese Sache für so wichtig, dass sie dem betreffenden Mentor, den sie auserwählt, immer direkt diesbezügliche Weisungen gibt. Kein Mittel soll unversucht bleiben, den jungen Lord in die Fesseln der Liebe zu schlagen.«
»Aha! Das ist allerdings etwas für mich«, begann der junge Mann mit dem französischen Namen bereits zu schmunzeln.
»Ich weiß es. Dabei braucht auf den gesellschaftlichen Rang der betreffenden Dame keinerlei Rücksicht genommen zu werden. Lady Clifford hat sich nun einmal in den Kopf gesetzt, dass, sobald ihr Sohn Interesse an irgendeinem Weibe findet, er auch wieder vollständig gesund wird. Da ihr nun die Gesundheit des einzigen Kindes über alles geht, so wäre es ihr auch ganz gleichgültig, wenn die Liebschaft ernstere Folgen hätte und sie das ordinärste Frauenzimmer als Schwiegertochter begrüßen müsste. Ich glaube, ich habe mich wohl ganz deutlich ausgedrückt.«
»Deutlich genug!« Das Lächeln des jungen Franzosen mit dem malaiischen Blute wurde immer zynischer. »O, wenn es so ist, da will ich wohl etwas in die Wege leiten!«
»Mr. Rouen, frohlocken Sie nicht zu früh!«, erklang es aber warnend aus des Prinzipals Munde. »Sie können sich denken, was da schon alles versucht worden ist, um den jungen Lord ins Garn zu bekommen. In Madras zum Beispiel hat man mehr als tausend Bajaderen vor ihm tanzen lassen...«
»O, das ist doch nichts — solche öffentliche Massenveranstaltungen!«, rief der Franzose verächtlich. »Da muss man ganz andere, pikante Situationen unter vier Augen herbeiführen...«
»Ja, glauben Sie denn, dass Ihre Vorgänger nicht auch auf diesen Gedanken gekommen sind? Ach, was hat man mit dem jungen Lord nicht alles versucht, in was für gewagte Situationen hat man ihn nicht schon gebracht! Ich bin darüber sehr gut unterrichtet worden, habe aber einen Grund, keinem anderen einen Einblick in das betreffende Aktenstück zu gestatten, es ist ein streng vertraulicher Bericht. Jedenfalls aber... ach, was hat man da nicht schon alles angestellt! An Bord, in den Kabinen, in den Hotels, in Spelunken, und was für routinierte und raffinierte Weiber, mit allen Reizen und Verführungskünsten ausgestattet, die deswegen sozusagen Weltberühmtheit genossen, hat man dazu herangezogen... alles vergebens, alles vergebens! Das Herz dieses Jünglings ist ein Eisklumpen, der durch nichts zu schmelzen ist. Oder er ist ganz einfach ein Stockfisch.«
»Da muss man es mit einer holden Unschuld versuchen...«
»Na, glauben Sie etwa, das ist nicht auch schon probiert worden?«, spottete der Prinzipal. »Alles, alles! Die denkbar raffiniertesten Sachen, auf die man sonst gar nicht so leicht kommt.«
»Aber da gibt es doch gewisse Mittel...«
Der Franzose machte eine Pause und blickte seinen Chef dabei lauernd an.
»Was für Mittel?«
»Nun, solche, die das dicke Blut dünnflüssig und feurig machen.«
»Das weiß ich. Nein, mit solchen Mitteln dürfen Sie nicht arbeiten. Lady Clifford verbietet es aufs Strengste — in der ganz richtigen Ansicht, dass ein solch künstlich erzeugter Liebesrausch nur eine um so heftigere Gegenwirkung auch auf das Gemüt des jungen Mannes erzeugen würde.
Gewissenlose Frauen haben es trotzdem versucht, aber sie sind zu keinem Ziele gekommen. Doktor Worm, dieser sonst so unpraktische, weltfremde Gelehrte, hat ein Mittel erfunden, das alle diese aufreizenden Liebesmittel vollkommen wirkungslos macht, der Betreffende, der sie einnimmt, wird dagegen ganz immun...
Nein, mit solchen Zaubermitteln und Teufelspräparaten lassen Sie sich also ja nicht ein, dieser Doktor Worm könnte etwas merken, und dann hätten wir den jungen Lord verloren.«
»Wie wäre es da, wenn man ermöglicht, dass der Lord ein junges, schönes Mädchen aus einer höchst gefährlichen Lage befreit — oder das Mädchen ihn, aus Todesnot...«
»Ach, hören Sie auf, hören Sie auf!!«, unterbrach sein Prinzipal unwillig den Sprecher. »Das ist ja alles wohl schon ein Dutzend Mal versucht worden! So schlau wie Sie sind andere auch. Lernen Sie den Lord Hektor nur erst kennen, dann werden Sie schon merken, wie zwecklos das alles ist. Ja, er wird das Mädchen befreien... und sich dann kalt von ihm abwenden. Und wenn er selbst schon auf dem Folterbock sitzt und solch eine schöne Unschuld taucht auf, um ihn zu befreien? Der erduldet ja mit größtem Vergnügen den schauderhaftesten Martertod, um endlich aus diesem jämmerlichen Leben zu scheiden, von seiner Seelenpein erlöst zu werden! Selbstmord begeht er nur seiner Mutter wegen nicht, um ihr keinen Kummer zu bereiten. Aber sonst... Also verschonen Sie mich mit solchen Vorschlägen. Das ist alles, alles schon zahllose Male probiert worden.«
Der junge Franzose saß etwas kleinlaut da, während Mr. Huxly wieder in dem Aktenheft blätterte, bis er sich abermals zurücklehnte.
»Ja, aber ein Mittel könnte es doch geben«, nahm er dann wieder das Wort, »um den kalten Jüngling an ein Weib zu fesseln, ein ganz neues Mittel, welches, wie ich bestimmt weiß, noch niemand probiert hat. Dass Sie darauf kommen, Mr. Rouen, kann ich nicht verlangen. Hm, das müsste versucht werden. das könnte zum Ziele führen.«
Mr. Huxly versank ganz in Gedanken.
»Und was für ein Mittel ist das, wenn ich fragen darf?«, brach der Franzofe endlich das lange Schweigen.
Der alte Herr erwachte aus seinem Brüten.
»Ja, lassen Sie es sich offenbaren. Also es war vor zwei Jahren.
Doktor Worm hielt sich mit seinem Schützling in Buenos Aires auf. Der Arzt hatte einmal das Hotel verlassen, auch der Kammerdiener war nicht anwesend. Als Doktor Worm zurückkommt, findet er den jungen Lord in größter Aufregung vor, was an sich ja schon etwas ganz Außerordentliches ist.
›Wer ist der Herr gewesen?‹
›Was für ein Herr?‹
›Mit dem ich soeben hier gesprochen habe?‹
›Es ist jemand hier bei Ihnen gewesen?‹
›Eine Viertelstunde lang. Er hatte eine schwarze Katze bei sich.‹
›Was, eine schwarze Katze?!‹
›Eine ungeheure schwarze Katze. Sie sprang aus einem kleinen Koffer, den er mitgebracht hatte, setzte sich ihm auf die rechte Schulter, und da blieb sie, während er dort auf dem Stuhle saß und mit mir sprach.‹
›Mylord. Sie haben wohl geschlafen und geträumt!‹
Aber der Lord behauptet, weder geschlafen noch geträumt zu haben. Er beschreibt den Mann genauer. Eine ganz, ganz auffallende Persönlichkeit sei es gewesen. Ein halb nordeuropäisches, also germanisches, halb indisches Gesicht — oder vielleicht auch etwas japanisch. Dieses Gesicht gelb wie Wachs, wie aus Elfenbein geschnitzt, auch die wunderbar geformten Hände.
In diesem eigentümlichen, bartlosen Gesicht mit den fein geschwungenen Lippen von purpurroter Farbe zwei große brennende Augen, wahre Teufelsaugen.
Er sei in einen langen, grauen Staubmantel gehüllt gewesen, aber als er in dem Lehnstuhle saß, habe sich dieser geöffnet, und da habe der Lord gesehen, dass der Fremde dunkelgestreifte Beinkleider, eine weiße Weste und ein schwarzes Samtjackett getragen habe. Auch wieder ganz auffallend.
So habe der Mann eine Viertelstunde lang dort in dem Lehnstuhl gesessen, ein Bein übers andere geschlagen, die Hände im Schoße gefaltet, neben sich den gelben Koffer, auf seiner Schulter die ungeheure schwarze Katze, so hätten die beiden eine Viertelstunde lang zusammen gesprochen.
›Worüber haben Sie denn mit ihm gesprochen?‹, fragte natürlich der Arzt.
Hierüber aber wollte Lord Hektor keine Auskunft geben, keinesfalls.
›Ich soll ihn nur suchen, dann werde ich ihn auch finden.‹
Das war das einzige, was man noch aus ihm herausbrachte, sonst absolut nichts weiter.
›Wenn Sie ihn finden, dann sind Sie wohl wieder gesund? Dann kehrt Ihr Lebensfrohsinn zurück?‹
Auch hierüber keine Auskunft.
›Ich soll den Mann mit den Teufelsaugen und mit der schwarzen Katze nur suchen, dann würde ich ihn auch finden.‹
Nichts weiter als immer nur diese Wiederholung.
Doktor Worm zog Erkundungen ein.
Ja, in dem Hotel hatte allerdings ein Herr logiert, der einen kleinen Koffer, in den eine große Katze hineinging, bei sich gehabt und einen Staubmantel getragen hatte. Er hatte erst vor wenigen Minuten seine Tagesrechnung bezahlt und das Hotel verlassen.
Wohin er sich gewendet hat und wer er gewesen sei, das wusste niemand — irgendein Geschäftfreisender.
Aber dieser kastenähnliche Koffer war nicht von gelber, sondern von schwarzer Farbe gewesen, der lange Staubmantel nicht grau, sondern dunkelgrün, und darunter hatte er einen schwarz und weiß karierten Straßenanzug getragen. Auch sonst passte die Beschreibung, die der Lord gegeben hatte, durchaus nicht auf jenen Herrn.
Keine Spur von einem gelben, wie aus Elfenbein geschnitzten Gesicht mit geschwungenen roten Lippen, es war das ganz alltägliche Gesicht eines behäbigen, schon älteren Mannes gewesen; in dem Koffer hatte ein Kellner Leibwäsche gesehen.
Eine andere Persönlichkeit aber konnte, wenn es sich um einen langen Staubmantel und einen kastenähnlichen Koffer handelte, gar nicht in Frage kommen.
Kurz und gut, der Lord hatte diesen Mann mit dem Staubmantel und dem Koffer einmal erblickt, durch das Fenster auf der Straße oder vielleicht auf dem Korridor, war auf sein Zimmer gegangen, war eingeschlafen und hatte dies alles nur geträumt: Der Traumgott hatte den nur flüchtig gesehenen Mantel und Koffer wie den ganzen Mann anders gefärbt und gestaltet, und so war daraus eben eine ganze Episode entstanden.
Lord Hektor wollte freilich von alledem nichts wissen.
Nein, einen anderen Mann mit einem anderen dunkelgrünen Mantel und schwarzen Koffer und kariertem Anzuge hatte er nicht gesehen, sondern eben den rätselhaften Mann, der eine Viertelstunde vor ihm im Lehnstuhle gesessen, der ihm solch wunderbare Offenbarungen gemacht habe.
›Was für Offenbarungen?‹
Da aber schwieg sich der Lord nach wie vor beharrlich aus.
›Ich soll ihn nur suchen, den Mann mit den Teufelsaugen und der schwarzen Katze, dann würde ich ihn schon finden.‹
Weiter war aus ihm nichts herauszubringen. Oder höchstens nur noch belanglose Kleinigkeiten. ›Wo werden Sie ihn finden, Mylord?‹
›Wenn ich das wüsste, brauchte ich ihn doch nicht erst zu suchen!‹
›Hier in Amerika?‹
›Irgendwo in der Welt.‹
›Die ist groß.‹
›Nicht groß genug, dass ich diesen Mann nicht finden würde.‹
›Und wenn Sie ihn gefunden haben?‹
›Dann wird er mir weitere Offenbarungen machen.‹
›Was für Offenbarungen?‹
›Das wird niemand erfahren.‹«
Der Erzähler machte eine Pause und legte die Hand auf das dicke Aktenheft.
»So ist mir diese ganze Sache mit diesem Gespräch hier ganz ausführlich mitgeteilt worden. Freilich nicht von Doktor Worm aus. Der hat es nach London an Lady Clifford berichtet; von dieser habe ich es, was Doktor Worm freilich nicht zu erfahren braucht.
Er schenkte dem Falle weiter keine Bedeutung. Der junge Lord hatte eben einen Traum gehabt, eine Vision. Wer wusste denn, was er mit der Traumfigur Wunderliches gesprochen haben mochte. Er beruhigte sich denn auch bald wieder.
Seitdem aber trat die Geisteskrankheit des Lords, die doch zweifellos vorliegt, wenn er auch nicht gerade irrsinnig zu nennen ist, in ein neues Stadium.
Seit zwei Jahren verfolgt er mit seiner Weltreise einen bestimmten Zweck. Er sucht den Mann mit den Teufelsaugen und der schwarzen Katze. Anders bezeichnet er ihn nicht, will auch den Namen nicht erfahren haben.
Überall fragt er bei jeder Gelegenheit, ob nicht ein Mann gesehen worden sei, wie er ihn genau beschreibt, also mit dem gelben Elfenbeingesicht und dann vor allen Dingen mit den glühenden Teufelsaugen und der ungeheuren schwarzen Katze.
Sogar die weiße Weste mit einer einfachen Uhrenschnur statt Kette und die schwarze Samtjacke muss unbedingt dabei sein, anders tut er es nicht. Als ob sich der Unbekannte, wenn er wirklich existierte, niemals anders kleiden könnte.
›Hat er denn gesagt, dass er sich immer so kleide?‹, lautete eine Frage, die der Arzt noch stellte.
›Nein, das hat er nicht gesagt.‹
›Warum muss er denn da gerade die schwarze Samtjacke tragen, wenn Sie ihn finden?‹
Da ward der Lord unwirsch.
›Ich weiß, was ich weiß‹, entgegnete er schroff und ließ sich nicht weiter darauf ein.
Es ist also eine fixe Idee, die ihn beherrscht.
So, Mr. Rouen, hiermit habe ich Sie eingeweiht. Jetzt erwarte ich von Ihnen einige Fragen, aus denen ich erkenne, ob Sie die Sache gleich so auffassen, wie ich sie aufgefasst haben will.«
»Hm«, brummte der junge Franzose gedankenvoll, »das ist doch eigentlich etwas, womit sich etwas machen ließe.«
»Was ließe sich damit machen?«, fragte Mr. Huxly mit gespanntem Lauern.
»Wenn man diese fixe Idee des Lords benutzte — — man instruierte ein passendes Frauenzimmer, es müsse solch einen Mann mit Teufelsaugen und einer schwarzen Katze kennen — — sie lässt sich aber erst nur in geheimnisvolle Andeutungen ein, um nicht gleich überführt werden zu können — — unterdessen wird der Lord in geschickter Weise sondiert — — und das Weib gibt immer deutlicher zu verstehen, sie weiß noch viel mehr, wird aber erst sprechen, wenn der Lord der ihre ist — — sie fordert seine Liebe von ihm — — und nun so ein recht raffiniertes, mit allen Reizen geschmücktes Weibsbild, wie es hier in Colombo doch genug gibt — — oder wir lassen eine anderswoher kommen, da haben wir doch die Auswahl — — da ist jetzt zum Beispiel eine Kokotte aus Monte Carlo hier, die bringt alles fertig...«
Der Sprecher wurde dadurch unterbrochen, dass ihm sein Prinzipal kräftig auf die Schulter schlug.
»Das ist es, was ich von Ihnen hören wollte!«, rief er erfreut. »Mr. Rouen, ich habe mich in Ihnen nicht getäuscht, Sie sind der richtige Mann, den ich brauche! Jawohl, Mr. Rouen, so machen wir die Geschichte!!«
Zunächst machte der junge Mann ein Gesicht, als bereue er bitter, seinen Plan gleich enthüllt zu haben, von welcher Enttäuschung der andere aber nichts zu merken schien.
»Jawohl, so wird es gemacht! Was für eine Kokotte ist das, von der Sie sprachen?«
»Sie heißt Madame Phöbe, macht in Begleitung eines reichen Amerikaners, den sie so nach und nach ruiniert, den sie in Monte Carlo aufgegabelt hat, eine Weltreise, streut das Gold mit vollen Händen aus. Mehr weiß ich vorläufig noch nicht von ihr. Vielleicht finden wir auch eine andere. Ich dachte nur gleich an sie.«
»Ja, arbeiten Sie den Plan aus! Machen Sie es ganz, wie Sie wollen, aber ich will erst die schriftliche Ausarbeitung haben, ob ich den Plan auch billige. Also worum es sich handelt, wissen Sie doch nun genau.«
»Gewiss.«
»Irgendein Weib gewinnen, das den verrückten Lord dadurch zu fesseln weiß, dass es auf seine fixe Idee eingeht, indem es vorgibt, es kenne solch einen Mann mit den Teufelsaugen und einer schwarzen Katze. Sie lässt sich aber nicht eher näher darüber aus, als bis sich der junge Lord ihr ergeben hat.«
»Das wird mir schon glücken. Und wenn es nun gelungen ist?«
»Dann haben wir eben das Ziel erreicht.«
»Was für eine Prämie erhalte ich?«
»Prämie?«, erklang es etwas abweisend.
»Sollte Lady Clifford für dieses Ziel ihrer Sehnsucht keine Prämie ausgesetzt haben?«
»Herr, was geht das Sie an?!«, erklang es immer schroffer.
Monsieur Rouen wollte lieber keine schärferen Saiten aufziehen.
»Sie können mir doch nicht verübeln, dass ich einen besonderen Lohn erhoffe, der mich anspornt, meine ganzen Kräfte für diese Sache einzusetzen«, sagte er demütig.
»Sie erhalten Ihre Spesen ersetzt, über deren Höhe Sie ja zur Genüge orientiert sind, ich will auch für diesen Fall noch fünf Rupien pro Tag hinzufügen.«
»Und wirklich gar keine Prämie?«
»Mr. Rouen, Sie wissen, unser Institut ist eine Aktiengesellschaft, und ich muss Dividenden ausbringen, die immer knapper und knapper werden. Die Unkosten, die ich mit Euch Detektiven habe, sind ja ganz enorm. Na, hundert Pfund Sterling sollen Sie erhalten, wenn Sie diese Sache glücklich zustande bringen.«
»Hundert Pfund Sterling? Ich danke verbindlichst, Mr. Huxly.«
Der Franzose verneigte sich wohl hauptsächlich deshalb so tief, um den bösen Blick dabei in seinem Auge nicht sehen zu lassen.
»Bitte. Es ist das Höchste, was ich dafür aussetzen kann. Die Geschäfte gehen schlecht, und Sie wissen, wie die Aktionäre auf uns Direktoren knien. Und überhaupt — man muss Euch Herren Detektive scharf im Zügel halten, sonst werdet Ihr gleich übermütig und maßlos in Euren Ansprüchen. Aber, mein lieber Rouen, wir müssen abbrechen, besprechen das Nähere ein andermal, arbeiten Sie nur Ihren Plan aus, wir haben ja noch Zeit, und ich muss jetzt unbedingt gehen, ein unaufschiebbarer Geschäftsweg...«
Der Direktor war aufgestanden.
In Diesem Augenblick trat ein Boy ein, ein farbiger Diener, brachte eine Visitenkarte.
»Ach, der Mr. Farman!«, erklang es nach der ersten Neugier enttäuscht. »Ich kann ihn nicht empfangen, kann mich nicht mehr aufhalten. Diesen Schwätzer wird man ja nie wieder los. Mr. Rouen, den könnten Sie abfertigen. Haben Sie nicht in seiner Sache gearbeitet?«
»Jawohl, korrespondiere deshalb mit unserer Filiale in Kalkutta.«
»Na, dann empfangen Sie den Farman in meinem Namen. Schmieren Sie ihm Honig um den Mund, wie alles aufs Beste stände. Ich muss fort.«
Nebenan war das eigentliche Büro des Direktors, das die beiden nun betraten.
Mr. Huxly verschloss hinter sich die Tür der geheimen Aktenkammer, überzeugte sich, dass die Rolljalousie des Schreibtisches und der Geldschrank verschlossen waren und entfernte sich durch eine Seitentür, den Detektiv in seinem Privatbüro zurücklassend.
Ein unsagbar höhnischer und böser Blick folgte ihm.
»Hundert Pfund Sterling!«, erklang es flüsternd. »Und was für eine Prämie hat die unermesslich reiche Lady Clifford in Wirklichkeit ausgesetzt, wenn es gelingt, ihren Sohn gesund zu machen oder ihm auch nur irgendein Frauenzimmer aufzuhalsen, wie?«
Und wer wird denn das meiste davon einstecken?
Wohl Sie, edler Mr. Huxly?
Denn wie Du die Gesellschaft betrügst, das ist mir doch nur zu gut bekannt!
Sobald die Sache reif ist, denunziere ich Dich und breche Dir das Genick.
Mir nur hundert Pfund anzubieten!
Aber jetzt endlich scheint einmal die Gelegenheit zu kommen — und wenn die Geschichte so klappt, wie ich es mir denke, dann haue ich Euch alle zusammen übers Ohr, dass Euch die Augen übergehen sollen!
Der Gemeldete war eingetreten. Ein geckenhafter, ungemein nervöser Herr — auch in seinem Gedankengang — keinen Satz konnte er vollenden, sprang immer auf etwas anderes über.
»Ist Mr. Huxly nicht selbst zu sprechen? Ich muss ihn unbedingt selbst sprechen, unbedingt... das heißt, wenn Sie... Sie sind in alles eingeweiht? Na, dann ist es ja gut. Also der Herr Direktor ist wirklich nicht da?«
Endlich kam die Sache ins Gleis.
Eine schrecklich schmutzige Geschichte wurde ausgepackt, auch den gemeinen Charakter dieses Detektivinstituts offenbarend.
Der junge Mann hatte in Haiderabad ein großes Exportgeschäft, vom Vater geerbt, das unter seiner faseligen Leitung natürlich schnell zurückging; er hatte eine reiche Heirat gemacht, ein schönes, tugendhaftes Mädchen, und nun, nachdem er einige Wochen im Eheglück geschwebt, war er der Gattin schon überdrüssig, nur nicht ihres Geldes, hatte eine Geschäftsreise nach Colombo vorgegeben, um von hier aus die Ehescheidung vorzubereiten, einen Grund dafür zu suchen. ließ seine Frau beobachten, und da sie ihm treu war und blieb, wurde ein Verführer mit den teuflischsten Mitteln auf sie gehetzt.
Innerhalb von zehn Minuten offenbarte sich die ganze Niederträchtigkeit, deren ein Ebenbild Gottes fähig ist, ohne von irdischen Richtern deshalb belangt werden zu können.
Die Sache war erledigt. Der französische Detektiv hatte dem Herrn nicht nur Honig um den Mund zu schmieren gewusst, sondern ihm auch sonst die größten Hoffnungen gemacht.
»Und wenn es sein muss, dann gehe ich noch selbst nach Haiderabad und bringe Ihre Gattin zu Fall«, sagte zuletzt der junge Franzose, unternehmend seinen wie angeklebten Schnurrbart streichend und mit seinem Spiegelbilde liebäugelnd.
»Na, dann ist ja alles gut! Tun Sie nur Ihr Möglichstes. Hier etwas für Ihre Bemühungen im Voraus.«
Monsieur Rouen glaubte vor freudigem Schreck seinen Augen nicht trauen zu dürfen, als er eine Zehnpfundnote in die Hand gedrückt bekam. Dass dieser nervöse Lebemann sehr verschwenderisch war, wusste er ja, aber für so verrückt hätte er ihn doch nicht gehalten.
»Mr. Farman, Sie können sich darauf verlassen, ich werde...«
»Ja, ich weiß schon — — da fällt mir gerade ein — — sagen Sie mal, mein Lieber — — wer ist denn eigentlich die Dame, die ich vorhin in der Hauptstraße gesehen habe?«
Ja, nun sollte der Detektiv wissen, was für eine Dame der vorhin gesehen hatte!
»Ein ganz seltsamer Zug bewegte sich durch die Hauptstraße — — voran eine Dame auf einem herrlichen Rosse — — mit feuerrotem Haare — — dann eine ganze Masse kleiner Männer, die wie Kosaken aussahen — — mit großen Hunden, die ich aber eher für Wölfe halten möchte — — und ein Tiger oder Panther wurde an einer Kette geführt — — und das Weib ganz phantastisch gekleidet...«
»Ach so! Das ist keine andere als die ›Maladetta‹ gewesen — die ›Wolfsgräfin‹, wie sie auch genannt wird — von den Singhalesen die ›Ramsawedda‹, was fast genau dasselbe heißt wie das italienische ›Maladetta‹, die von Gott Verfluchte...«
Und Mr. Rouen, dazu aufgefordert, berichtet ausführlicher.
Olga, welchen Namen sie einzig und allein immer beibehalten hatte, war von früher Jugend an Kunstreiterin gewesen — oder überhaupt Artistin, die alles können musste, auf dem Seile tanzen wie am Trapez turnen, zum fahrenden Volke alleruntersten Ranges gehörend — in Russland geboren, aber wo, das wusste sie selbst nicht — hatte weder Vater noch Mutter kennen gelernt.
Als Artistin hatte sie nicht von sich reden gemacht, war niemals aus dem elenden Wanderzelt heraus gekommen. Bis das bildschöne Mädchen, wenn auch immer noch ein Kind, an einen reichen Bojaren verkauft worden war.
Fast zehn Jahre vergingen, ohne dass man wieder etwas von ihr vernahm. Doch sie erzählte ja selbst ihre Schicksale, tat es sogar sehr gern.
Sie war eben die Geliebte des reichen Tatarenhäuptlings gewesen, der sie aber auch auf seine wilden Ritte mitgenommen, der sie weiter in ihren akrobatischen Künsten hatte ausbilden lassen.
Nach dem Tode dieses Mannes war eine Zeit gekommen, über die sie nicht sprach, und dann war sie wieder aufgetaucht, abermals als Kunstreiterin, hatte als solche den ganzen europäischen Kontinent bereist, jetzt aber immer in den glänzendsten Engagements.
Bis es herausgekommen war, dass sich unter der gefeierten Schönheit, die in fleischfarbenen Trikots auf dem Pferde tanzte und die waghalsigsten Sprünge ausführte, eine Spionin im Dienste des russischen Kriegsministeriums verbarg! Daher wählte sie in allen Hauptstädten Europas ihre Verehrer auch ausschließlich unter Offizieren und politisch Eingeweihten aus.
In Berlin hätte beinahe das Schicksal sie erreicht. Es gelang ihr noch rechtzeitig, zu entfliehen, sonst hätte sie schwer büßen müssen.
Dann vergingen einige Jahre, bis sie in Bombay auftauchte. Während dieser Zeit, behauptete sie, habe sie Forschungsreisen im Himalaja gemacht, wäre tief in die Geheimnisse der tibetanischen Lamaklöster gedrungen und sei auch in die geheimnisvolle Gemeinschaft der Mahatmas aufgenommen worden.
Einige Zeit abenteuerte sie in Indien umher, verkehrte viel mit Fakiren und Brahmanen, umgab sich mit einem mysteriösen Nimbus, wollte Gold machen können und dergleichen mehr — — einträglicher aber als diese Künste war ihre Heirat mit dem steinreichen Grafen Koschinsky, der im Uralgebirge Platinbergwerke besaß.
Der alte Russe starb bald, und Gräfin Olga Koschinsky siedelte nach Ceylon über, machte sich hier ansässig.
Siebzig Kilometer südlich von Colombo liegt an der Westküste die kleine Hafenstadt Kalutotta, mit dem täglich zweimal gehenden Schnellzug in einer Stunde zu erreichen. Und wieder acht Kilometer südlich davon bildet die Küste die kleine Bucht von Caltura, wo das die ganze Insel durchziehende Adamsgebirge endet.
An dieser Bucht liegt hoch oben auf einem isolierten Felsen, der jäh ins Meer hinabfällt, ein mächtiges Schloss, eines von jenen ungeheuren Bauwerken, mit denen ganz Ceylon bedeckt ist, ohne dass man ihre Erbauer kennt, jedenfalls schon aus vorbuddhistischer Zeit stammend.
Dieses uralte Schloss am Meere, von einem verschwundenen Volke erzählend, hatte, zumal da es meist in den Felsen hineingehauen war, den Jahrtausenden getrotzt, war noch vollständig erhalten.
Es war Eigentum des Maharadschas von Kandi, des eingeborenen Beherrschers von ganz Ceylon, natürlich unter englischer Aufsicht. Er hatte es glänzend eingerichtet, bewohnte es aber niemals, kümmerte sich gar nicht darum.
Trotzdem wunderte man sich sehr, dass der Fürst dieses herrlich und einzig gelegene Lalakawana, das Schloss am Meere, wie es auch von den Eingeborenen genannt wurde, an die russische Gräfin verkauft hatte.
Die anderthalb Million Rupien — das sind ebensoviel Mark — die er dafür eingesteckt, hatte für diesen unermesslich reichen Maharadscha ja gar nichts zu bedeuten. Die Gräfin hatte überhaupt einen äußerst billigen Kauf gemacht. Schon die fabelhaft prächtige Einrichtung war so viel wert, wenn auch vorher die speziellen Kostbarkeiten daraus entfernt worden waren.
Das war vor einem Vierteljahre gewesen. Die Gräfin Koschinsky war in das Schloss eingezogen, mit ihrem Gefolge, bestehend aus einigen Dutzend Kosaken, ausgesucht kleinen Männern, während die farbige Dienerschaft meist aus riesengroßen Afghanen bestand, und mit einer ganzen Menagerie.
Nun hauste sie dort in dem Schloss am Meer. Niemand wusste, was sie darin trieb. Sie mied jeden gesellschaftlichen Umgang, empfing keine Besuche. Wohl aber kam sie manchmal nach Colombo, um persönlich Einkäufe zu machen. Dazu benutzte sie niemals die Eisenbahn, sondern immer nur ihre eigene Dampfjacht, auf der auch die Pferde mitgenommen wurden. Denn stets erschien sie samt ihrem ganzen Gefolge hoch zu Ross, in einem pompösen, phantastischen Aufzug, umgeben von Löwen, Tigern, Panthern und Wölfen. Auch wenn sie nur nach der Hauptstadt kam, um sich eine einzige Zeitung zu kaufen, dann gleich wieder zurückfahrend. Wenn sie es nicht vorzog, ganz allein nach ihrer Residenz zurückzureiten, die 80 Kilometer innerhalb eines Tages, was sie schon mehrmals fertiggebracht hatte, während ihr Gefolge stets wieder die Dampfjacht benutzte.
So hatte der französische Detektiv berichtet, noch viel kürzer, als es hier geschehen ist.
Der hysterische Engländer hatte schon immer durch Fragen unterbrochen, und nun wollte er noch viel, viel mehr wissen, wobei es ihm auf die Reihenfolge gar nicht ankam, in welcher seine Wissbegierde befriedigt wurde.
Der Franzose hatte dabei selten von der Gräfin Koschinsky gesprochen, sondern meist von der »roten Gräfin« oder von der »Wolfsgräfin« oder von der »Ramsawedda« oder von der »Maladetta«.
»Weshalb nennen Sie sie denn immer die »Rote Gräfin?«
»Nun, sie wird so genannt, weil sie so fuchsfeuerrote Haare hat.«
»Ach so — ja natürlich, natürlich! — und weshalb heißt sie die Wolfsgräfin?«
»Weil sie so viele Wölfe bei sich hat.«
»Ach ja natürlich — das ist doch leicht begreiflich... gibt es denn hier auf Ceylon auch Wölfe?«
»Nein, so wenig wie Löwen. Die Wölfe hat sie wie ihre ganze Menagerie mitgebracht. Es sind echt sibirische Wölfe.«
»Und Maladetta heißt sie auch?«
»Jawohl, das ist sogar ihr Hauptname, und genau dasselbe bedeutet das singhalesische ›Ramsawedda‹.«
»Was heißt das?«
»Ganz wörtlich übersetzt: die Schlechtgesagte. Und im Besonderen so viel wie ›die von Gott Verfluchte, die Verdammte‹.«
»Wie kommt sie denn zu dem italienischen Namen?«
»Den hat sie sogar erst hier bekommen. An der Bucht von Kalutotta hausen italienische Fischer. Die Italiener können sich ja überall in der Welt gut ernähren, nur in ihrer Heimat nicht. Da muss das arme Volk, das nur auf seiner Hände Arbeit angewiesen ist, bei allem Fleiße fast verhungern. Deshalb spuckt man fast überall in der Welt, wo man hinspuckt, auf Italiener. Die Bucht von Kalutotta ist gar nicht so fischreich, sogar wegen ihrer Fischarmut berüchtigt, das machen wahrscheinlich die zahllosen Quallen und Polypen, die dort vorkommen. Kalutotta heißt übrigens so viel wie ›Höllenbestie‹, und das ist in der indischen Götterlehre der Name eines fabelhaften Ungeheuers, eines riesigen Polypen — Sie wissen, die Kali, die Göttin der Vernichtung, die wird doch mit solchen Schlangenarmen, richtiger aber Polypenarmen, abgebildet, der Wasserpolyp ist ihr Attribut, und das Wort Kalutotta hängt eben mit der Göttin Kali zusammen — also diese Bucht ist so fischarm, dass andere, eingeborene Fischer gar nicht daran denken, sich dort niederzulassen, und so schön die Gegend dort auch ist, gibt es auf Ceylon doch noch fruchtbarere Küstenstriche, die noch unbebaut sind — — diese Italiener aber wissen sich dort ganz vortrefflich zu ernähren.
Ja, diese Italiener möchte die Wolfsgräfin zu gern weghaben, sie hat alles aufgeboten. um ihre Absicht zu erreichen, um alleinige Besitzerin der ganzen Umgegend zu sein, um von ihrem Schlosse aus keinen anderen Menschen sehen zu müssen — — aber das italienische Völkchen nimmt auch das höchste Geldangebot nicht an, und da erreicht die Maladetta auch nichts bei dem indischen Maharadscha und nichts bei dem englischen Gouverneur, so sehr sie bei dem sonst lieb Kind ist.«
»Lieb Kind ist sie bei dem? Bei dem Gouverneur von Ceylon?«
»Jawohl. Er ist auch der einzige, dem sie ihre Aufwartung macht, wenn sie nach Colombo kommt. In den Regierungspalast geht sie jedes Mal, wenn der Gouverneur anwesend ist, wenn auch nur für eine Viertelstunde, und wird immer mit den höchsten Ehren empfangen.«
»Ach was! Ist sie etwa mit dem Gouverneur verwandt?«
»Die verwandt mit dem?«, erklang es verächtlich. »Diese Kunstreiterin unbekannter Geburt!«
»Also eine Liebschaft.«
»Nein, auch nicht, das weiß man ganz bestimmt. Der alte Gouverneur ist überhaupt gar nicht für Liebschaften.«
»Ja, woher sonst diese Bevorzugung?«
Der junge Franzose hob Schultern und Brauen und machte überhaupt ein sehr geheimnisvolles Gesicht.
»Ja, wissen Sie... die Gräfin war doch eine russische Spionin... ist tatsächlich in die politischen Pläne Russlands tief eingeweiht gewesen... und wie England und Russland jetzt zusammen stehen... was die zusammen vorhaben... aber darüber darf man nicht sprechen, gerade wenn man etwas Näheres weiß...«
»Also die Gräfin will die Italiener von dort forthaben?«
»So ist es. Ach, was die deswegen schon alles probiert hat! Aber da ist ihre Macht zu Ende; da kann der Gouverneur nicht wagen, etwa die Italiener an der Bucht einfach zu enteignen, obwohl er sonst schon ganz anderes fertiggebracht hat.«
»Weshalb geht das nicht?«
»Vor etwa zehn Jahren ist dort ein Passagierdampfer gescheitert, alle Menschen wären rettungslos verloren gewesen, wenn die italienischen Fischer sie nicht unter tatsächlich heldenhafter Kühnheit geborgen hätten. Unter den Passagieren befand sich auch ein Mitglied des englischen Königshauses und ferner die Lieblingsfrau des Maharadschas von Kandi mit ihren beiden Töchtern. Da haben die Italiener, eine andere Belohnung ausschlagend, jene Küstengegend als erbliches Eigentum für ewige Zeiten bekommen, und daran lässt sich nun nichts mehr ändern. Obschon, wie Sie doch wohl selbst wissen, es sonst fast ganz ausgeschlossen ist, dass englisches Küstengebiet, ob nun in England selbst oder in den Kolonien, Privatbesitz wird. Wegen der Landesverteidigung! Aber dem Wunsche dieser Italiener, die Fürstenleben gerettet hatten, musste ausnahmsweise doch einmal nachgegeben werden. Die haben also Brief und Siegel, da ist nun nichts mehr zu machen, da sind alle Anstrengungen und Bitten der Maladetta vergeblich. Freilich bemühen sich die Italiener ebenso vergeblich, die Gräfin wieder von dort fortzubringen, wie auch die ganze eingeborene Bevölkerung von vornherein darüber entrüstet gewesen ist, dass der Maharadscha das für heilig geltende Schloss der von den Göttern Verfluchten und überhaupt einer Fremden, noch dazu einer Nichtbuddhistin, überlassen hat.«
»Weshalb sind sie so entrüstet? Weshalb soll sie denn von Gott verflucht sein?«
»Weil die Gräfin im Rufe einer schrecklichen Zauberin steht. Unter anderem kann sie sich auch in eine Wölfin verwandeln, als solche schweift sie des Nachts in der Umgegend des Schlosses umher, scharrt Leichen aus und raubt auch kleine Kinder, um sie lebendig zu fressen.«
Der Engländer lachte in einer Weise auf, die zwar höhnisch sein sollte, die aber nur zu deutlich verriet, dass er an so etwas glaubte und davon gern noch mehr hörte.
»Also ein Werwolf! Ach, so etwas gibt es doch gar nicht, das ist doch der helle Blödsinn! Oder glauben Sie etwa an solche Ammenmärchen?«
»Nein, ausgeschlossen!«, lautete die kühle Entgegnung. »Aber es wird nun einmal unter den dort wohnenden Italienern und auch Eingeborenen behauptet, abgesehen von anderen schrecklichen Sachen, welche die Gräfin in dem einsamen Schlosse treiben soll. Tatsache ist, dass die Gräfin unter ihren Wölfen auch ein riesenhaftes weibliches Exemplar von feuerroter Farbe hat, eine sehr seltene Spielart des sibirischen Wolfes.
Und Tatsache ist weiter, dass diese rote Wölfin innerhalb des Vierteljahres schon zweimal ausgebrochen ist und in der Umgegend des Schlosses bei nächtlicher Weile Schreckenstaten ausgeführt hat.
Das erste Mal hat sie auf dem italienischen Friedhof ein frisches Grab aufgescharrt und mit ungeheurer Gier die Leiche eines Mannes halb aufgefressen; trotzdem hat sie gleich darauf noch einen Singhalesen angefallen, der schlafend im Freien lag, hat ihn erwürgt, aber nicht angefressen, dazu war sie eben schon zu satt, hat ihm aber die Schlagader durchbissen und reichlich Blut getrunken.
Und das zweite Mal, vor kaum drei Wochen, ist die Wölfin in der Nacht abermals ausgebrochen und hat aus einer Hütte ein italienisches Kind von wenigen Monaten geraubt, hat es lebendig ins Schloss getragen und erst dort in einem Versteck bis auf die Knochen aufgefressen.«
»Ach was, das ist ja entsetzlich!!«, staunte Mr. Farman und schüttelte sich vor Grauen und Hochgenuss.
»Also das Blut saugt der Wolf den Menschen aus?! Dann ist die Gräfin ja auch ein Vampir!«
»Ich weiß, was Sie meinen... ich spreche aber von der Wölfin, nicht von der Gräfin. Ja, Blut hat die Wölfin allerdings gesaugt, nur deshalb überfiel sie den Schlafenden. Dem Blutdurste konnte sie nicht widerstehen.«
»Ja, musste die Gräfin sich denn da nicht gerichtlich verantworten?«
»Freilich, belangt wurde sie. Aber da sie reichlich Entschädigung zahlte, sodass keine weitere Anklage erfolgte, ist die Sache im Sande verlaufen. Sie hat nur noch versichern müssen, die gefährliche Wölfin wirklich getötet zu haben. Sie zeigte auch ein rotes Wolfsfell, das einen ziemlich frischen Eindruck machte. Aber dass sie ihre Astarte, wie sie die Wölfin nannte, wirklich getötet hat, das glaubt ihr hier kein Mensch. Dazu hatte sie das Teufelsvieh viel zu lieb. Es soll immer vor ihrem Bett geschlafen haben, wenn nicht gar darin. Und das abergläubische Volk behauptet ja nun gar, dass die Gräfin sich selbst nachts in die Wölfin verwandle.«
»Natürlich, natürlich, da kann sie sich doch nicht selbst töten«, stimmte Mr. Farman bei, obgleich der aufgeklärtere Franzose das ja gar nicht so gemeint hatte.
»Also auch als blutsaugender Vampir betätigt sich die Gräfin! Das interessiert mich eigentlich noch mehr, als dass sie sich in einen Wolf verwandeln kann. Man hätte nur Haussuchung halten sollen, da wären schöne Dinge zum Vorschein gekommen.«
»Inwiefern?«, fragte der Detektiv zerstreut, weil er gerade durch das Fenster draußen im Hafen etwas beobachtete, und dieser Schwätzer wurde ihm überhaupt langweilig.«
»Na, was für unheimliche Zaubermittel die da verborgen haben mag!«
»Ach, das ist doch alles nur dummes Geschwätz!«
»Ja, natürlich, natürlich, ich glaube an so etwas doch auch nicht, so etwas gibt's ja gar nicht, hahaha, aber... die Sache interessiert mich doch sehr — aus einem gewissen Grunde — den ich Ihnen vielleicht einmal später offenbaren werde...«
»Weiter fehlte nichts«, dachte Monsieur Rouen offenbar. »Wie werde ich den Kerl jetzt nur wieder los?«
»Ob man die Gräfin nicht einmal besuchen kann?«
»Ausgeschlossen.«
»Weshalb nicht?«
»Weil sie eben keinen Besuch annimmt.«
»O, wenn man sich einzuführen weiß...«
»So probieren Sie es doch! Ja«, fuhr der Franzose dann sinnend fort, wohl mehr zu sich selbst sprechend, »die Erregung in dem italienischen Dorfe über diese Vorfälle ist ganz ungeheuer, und mehr noch unter der buddhistischen Bevölkerung, sogar von ganz Ceylon.«
»Das lässt sich denken.«
»Nicht nur, weil auch die Buddhisten an etwas ganz Ähnliches glauben. Nämlich, dass es Menschen gibt, die sich durch Zauberei in wilde Tiere verwandeln können und dann deren Gelüsten frönen müssen. Es ist noch ein anderer Grund dazu vorhanden, dass die ganze buddhistische Bevölkerung Ceylons gegen die Wolfsgräfin empört ist, noch mehr freilich gegen den Maharadscha von Kandi, was aber nicht zum Ausdruck kommen darf.«
»Was für ein anderer Grund.«
»Alle diese alten Bauten sind den Buddhisten Heiligtümer, auch wenn sie gar nicht von ihnen stammen. Dass der Maharadscha sein Schloss an die Gräfin verkauft hat, das könnte schließlich noch verziehen werden, denn das Gebäude ist nun einmal schon immer von Mohammedanern bewohnt gewesen. Dass aber der Maharadscha der christlichen Fremden auch die heilige Insel abgetreten hat, dass sie die so entweiht, das macht das denkbar böseste Blut.«
»Was für eine heilige Insel?«, forschte Mr. Farman weiter.
»In der Bucht von Kalutotta liegt eine Insel, einige Quadratkilometer groß. Sie ist ganz mit alten Tempeln und sonstigen kolossalen Bauten bedeckt, und da kann auch nichts in Ruinen liegen, weil alles aus dem Felsen herausgehauen ist — oder vielmehr in den Felsen hinein. Die ganze Insel ist nichts weiter als ein einziger ungeheurer Felsblock.
Sie war von jeher den Singhalesen und den Tamilen das größte Heiligtum. Die Scheu geht so weit, dass niemand sie zu betreten wagt. Denn auf ihr hausen die Geister der Lemuren, wie jenes sonst unbekannte, verschwundene Volk genannt wird. Es ist die Geisterinsel.
Bisher hatte der Maharadscha diesem allgemeinen Volksaberglauben auch Rechnung getragen. Er selbst ist ja kein Buddhist oder Brahmist, sondern ein Mohammedaner, für welchen Religionsunterschied zwischen Volk und Herrscher die englische Regierung aus schlau erwogenen politischen Gründen immer sorgt.
Schon oft haben europäische Forscher um die Erlaubnis nachgesucht, diese geheimnisvolle Geisterinsel besuchen zu dürfen; sie erhoffen dort die wichtigsten Funde, die endlich Licht in das Dunkel dieses ausgestorbenen Volkes bringen. Der Maharadscha hatte die Bitte stets verweigert, und so besorgt war er, das heilige Empfinden des Volkes zu schonen, auch als Mohammedaner, dass er um die Geisterinsel ständig einige Wachtboote fahren ließ, damit nicht etwa allzu Wissbegierige sie heimlich betreten. Er selbst hat das natürlich erst recht nicht getan, dazu ist dieser Maharadscha ein viel zu strenggläubiger Mohammedaner, dem alles, was auf Zauberei hindeutet, ein Gräuel ist.
Und nun kommt da vor einem Vierteljahre diese rothaarige Abenteurerin, die überhaupt schon im Rufe der Zauberei steht, spricht mit dem Maharadscha, und der tritt ihr für eine lächerliche Summe nicht nur sein Schloss, sondern auch die Geisterinsel ab, stellt sie ihr zur freien Verfügung.
Merkwürdig! Wirklich ganz merkwürdig! Was für einen Einfluss die rote Gräfin auf diesen Fürsten nur ausüben mag!«
Kopfschüttelnd hatte der Franzose es gesagt, noch immer ganz in Gedanken versunken.
»Und die Gräfin betritt die Geisterinsel?«, fragte der Engländer.
»Jawohl, das tut sie. Sie lässt sich oftmals hinüberfahren, bleibt tagelang darauf. Auch während der Nacht hat man schon Lichterchen darauf herumwandeln sehen. Und man muss nur wissen, was das bei diesen abergläubischen Singhalesen zu bedeuten hat, diese verhexte Insel, auf der die Geister der alten Lemuren ihr Wesen treiben, sogar bei Nacht zu betreten. Dass sie immer lebendig wieder zurückkommt, ohne das Gesicht im Genick zu haben, das ist ja erst recht ein Beweis, dass sie mit dem Teufel im Bunde ist.«
»Lemuren heißen diese bösen Geister?«
Mr. Farman sollte diese Frage nicht mehr beantwortet bekommen.
Der indische Bote trat wieder ein, diesmal in ganz anderer Weise, ganz verstört, an allen Gliedern zitternd.

»Sahib, sie kommt — sie ist schon da!«, brachte er vor Angst kaum heraus.
»Wer kommt? Wer ist schon da?«, fragte Monsieur Rouen mehr erstaunt als besorgt.
»Die von allen guten Göttern Verfluchte, die Ramsawedda...«
»Was? Die Gräfin Koschinsky?!«, rief der Franzose jetzt in ganz anderem Tone, ganz aufgeregt.
»Sie will Sahib Huxly sprechen, aber der ist ja nicht da...«
»Ich vertrete den Direktor. Führe sie herein! Ich empfange sie!«, rief Monsieur Rouen jetzt ganz begeistert.
Der Diener entfernte sich.
»Ah, die geheimnisvolle Gräfin, das wird ja höchst interessant!«, meinte Mr. Farman, zappelnd vor Aufregung.
Der junge Franzose hatte sich schnell einmal im Spiegel gemustert und wandte sich ihm jetzt zu.
»Ja, mein Herr, ich muss die Gräfin natürlich allein empfangen!«
»Aber Sie können doch...«
»Bitte, wollen Sie sich einstweilen hier hinüber bemühen, dann stehe ich wieder zu Ihrer Verfügung.«
Rouen hatte schon eine Tür geöffnet, die in ein größeres Büro führte, in dem einige Schreiber arbeiteten, und da Mr. Farman noch immer nach einem Grund suchte, um bleiben zu können, schob der Detektiv ihn kurzerhand hinaus, schloss und verriegelte die Tür, die eine schallsichere Polsterung hatte.
Und da trat sie auch schon ein.
Wirklich eine ganz auffallende Erscheinung, die nicht nur wegen ihres seltsamen, phantastischen Aufputzes in eine andere Welt, in eine Märchenwelt gehörte.
Eine für ein Weib ungemein große, eine riesenhafte Gestalt, eine Heroine, wie sie im Buche steht, voll und dabei dennoch schlank gebaut.
Dazu ein klassisch schönes Gesicht von den edelsten Zügen, stolz und herrisch, aber von einer kalten Ruhe, und dieses Gesicht von blütenweißer Farbe, der keine indische Sonne etwas anzuhaben vermochte, nur gekrönt von einer Wucht brennendroten Haares, das auch im Schatten förmlich Funken zu sprühen schien.
Dann dieses Kostüm, dieser Aufputz!
Sie trug einen sogenannten Kirgisenmantel von blauem Samt, der von den Unterkleidern nichts weiter sehen ließ, der aber selbst ziemlich tief ausgeschnitten war, so die herrliche Büste zeigend, und trotz dieser sommerlichen oder eben für die Tropen berechneten Toilette war der Mantel an den Säumen mit weißem Hermelinpelz eingefasst, außerdem reich mit silbernen und goldenen Stickereien bedeckt, zwischen denen auch farbige Edelsteine blitzten.
Zusammengehalten wurde er an der für die große, doch eigentlich volle Gestalt auffallend schmalen Taille durch einen Schuppengürtel, an dem Goldschmiede und Juweliere ihre ganze Kunst und Phantasie verschwendet hatten, und dasselbe galt für den darin steckenden Dolch und die beiden seltsam geformten altertümlichen Pistolen wie für das daran hängende Täschchen.
Unter dem nicht allzu langen Kirgisenmantel sah man gelbe Reiterstiefel mit gewaltigen Rädersporen, die langen Schäfte aber durchbrochen und zierlich mit silbernen Bändern durchflochten, und wenn sich der geteilte Mantel einmal öffnete, erblickte man darunter rotseidene Pluderbeinkleider.
Ein weißer Turban auf dem roten Haar mit prachtvoller Reiherfeder, von einer juwelenfunkelnden Agraffe festgehalten, vollendete den seltsamen Aufputz.
Sie kam nicht allein, brachte einen Teil ihres üblichen Gefolges mit.
Hinter ihr war ein riesenhafter Mann eingetreten, zweifellos ein Inder. Der Kundige erkannte gleich den Afghanen, der das überirdisch große Weib noch immer fast um Kopfeslänge überragte, auch wieder in einem bunten, ganz auffallenden, phantastischen Kostüm, an der Seite das ungeheuer lange, krumme Schwert seiner Heimat, den Gürtel mit Dolchen und Pistolen gespickt, obgleich doch jedes Waffentragen hier eigentlich verboten war, und dann folgte noch ein fast zwerghaft kleiner Mann nach, unverkennbar ein sibirischer Kosak, der im Gegensatz einen recht schäbigen, schmierigen Pelz trug, und der führte an einem Riemen einen ungeheuren Wolf von tiefschwarzer Farbe.

Das erste war, dass dieses Ungetüm knurrend und zähnefletschend auf den Detektiv los wollte, und obgleich sein Führer bei aller Kleinheit durchaus keinen schwächlichen Eindruck machte, konnte er die Bestie doch nicht halten, wurde mit fortgerissen. Aber den Gelüsten des Tieres, seine Zähne in das Fleisch des jungen Franzosen zu schlagen, wurde schnell ein Ende gemacht.
»Zerberus, du Höllenhund, willst du gleich artig sein!«
So rief das schöne, rote und doch so blütenweiße Weib mit glockenreiner, freilich auch metallharter Stimme. Die schwere Peitsche, die sie in der Hand trug, an sich schon eine furchtbare Waffe, sauste pfeifend durch die Luft, der Wolf bekam zwar nur einen kleinen Schmitz ab, aber das genügte, dass er sofort heulend umkehrte und sich hinter seinem kleinen Herrn verkroch, und fernerhin war Zerberus der Höllenhund denn auch ganz artig.
So hatte sich die Situation geklärt, die Tür war geschlossen, die Unterhandlung konnte beginnen.
»Mr. Huxly?«
»Rouen ist mein Name«, brachte der Franzose nur mühsam hervor.
Die Attacke des Höllenhundes hatte ihm doch einen gewaltigen Schreck in die Glieder gejagt, und zudem war ihm die Peitschenschmitze so dicht am Ohre vorbeigepfiffen, dass er förmlich ein schmerzhaftes Brennen fühlte, wenn es nur auch Einbildung war.
»Sie sind nicht der Direktor dieses DetektivInstituts?«
»Sein Stellvertreter, gnädigste Gräfin.«
»Ist Mr. Huxly nicht da?«
»Er ist abwesend.«
»Wann kommt er zurück?«
»Das ist unbestimmt, so bald aber keinesfalls.«
»Sind Sie sein bevollmächtigter Stellvertreter?«
»Jawohl, gnädigste Gräfin.«
»Gut, dann kann ich mich auch an Sie wenden.«
Die Gräfin öffnete die Tasche, zog gemächlich ein zusammengefaltetes Zeitungsblatt heraus.
»Heute ist die amerikanische Post von San Francisco gekommen.«
»Sehr wohl, Madame.«
»Das ist Ihnen wirklich bekannt?«
»Gewiss. Die neuen Zeitungen haben für uns doch immer eine große Bedeutung.«
»Haben Sie sie schon gelesen?«
»Eine — den New Yorker ›Herald‹ — das wichtigste Blatt.«
»Ist Ihnen etwas Besonderes aufgefallen?«
»Hm — das kommt darauf an — für uns ist da Verschiedenes von Wichtigkeit — Politik oder...«
»Es steht unter dem Vermischten — ein Stadtgespräch, das jetzt in New York zirkuliert.«
»Ich weiß augenblicklich nicht, was gnädigste Gräfin meinen.«
»Haben Sie das gelesen?«
Die Gräfin hatte das Blatt endlich auseinander gefaltet, reichte es dem Detektiv; dieser las den mit Blaustift eingerahmten Artikel.
Es war die Beschreibung des geheimnisvollen Vorganges im Hause des Mr. Samuel Philipp zu New York.
Er sollte ein farbiges Glasbild an die Wand projiziert haben, einen Mann darstellend, der in einem Lehnstuhle saß, und dieses Lichtbild, obgleich nicht etwa ein kinematografischer Film, war lebendig geworden, so lebendig, dass der Mann sogar aus der Wand heraus getreten war, hatte mit Mr. Philipp gerungen, der hatte mit einem Revolver geschossen, und die lebend gewordene Lichtgestalt hatte von der Wand eine Keule genommen und den Gegner niedergeschlagen.
So war der alte Mann von seinen Dienern gefunden worden, betäubt am Boden liegend, mit einer tüchtigen Brausche an der Stirn und Kratzwunden im Gesicht.
Der Mann hatte »natürlich« wie zuvor wieder als Lichtbild an der Wand in seinem Lehnstuhle gesessen.
Das war der Inhalt des sehr kurz und spöttisch gehaltenen Berichtes, und zuletzt war — recht überflüssig — noch betont worden, dass es sich selbstverständlich nur um ein Ammenmärchen handele. Merkwürdig sei nur, wie so etwas entstehen könne und wie es noch immer Menschen gebe, die solchen Blödsinn für bare Münze nehmen.
Ziemlich verständnislos hatte Monsieur Rouen den Artikel gelesen. Er wusste nicht, was er damit anfangen sollte.
Es fehlte darin eben noch etwas; sonst wäre der Detektiv sofort stutzig oder sogar grenzenlos überrascht gewesen.
»Ja«, sagte er, »merkwürdig, wie solche Gespenstergeschichten entstehen!«
»Sie glauben nicht, dass so etwas möglich ist?«
»O nein, Madame, so etwas gibt's nicht! Es wäre ja möglich, dass es sich um eine lebende Fotografie gehandelt hat...«
»Es war ein starres Glasbild.«
»Na, dann ist die ganze Sache erst recht Unsinn. Dass eine Lichtfigur aus der Wand heraustreten kann, das ist auch noch nicht bei der Kinematografie erfunden worden und wird niemals erfunden werden.«
»Kennen Sie diesen Mr. Samuel Philipp?«
»Hier steht, dass es der Sohn des sogenannten Pelzkönigs gewesen ist, und von dem habe ich allerdings schon gehört.«
»Stimmt! Kann ich Sie oder dieses Institut beauftragen, nähere Erkundigungen einzuziehen, was an dieser Sache ist?«
Monsieur Rouen unterdrückte ein Lächeln.
»Gewiss, Madame!«
»Sie haben doch auch in New York Verbindungen?«
»O, sicher! Eine eigene Filiale in der Wall Street.«
»So fragen Sie telegrafisch an, was an dieser Sache ist, ob es vielleicht Tatsache sein könnte! Ziehen Sie Erkundigungen ein.«
»Wird geschehen, Madame.«
»In allen amerikanischen Zeitungen, die heute hier eingetroffen sind, wird dasselbe berichtet. Deshalb braucht es ja nicht wahr zu sein. Eine Zeitung druckt doch immer nur von der anderen ab. Die anderen Blätter schildern es noch ausführlicher, der ›Herald‹ tut es am kürzesten, deshalb habe ich nur den mitgebracht. Sie orientieren sich in den anderen Zeitungen wohl selbst weiter?«
»Sehr wohl, Madame, ich werde es tun.«
»Nur ein Blatt habe ich noch mitgebracht, das auch eine Illustration dazu bringt, jenes Lichtbild wiedergebend.«
Sie zog aus dem Täschchen ein zweites Zeitungsblatt hervor und faltete es auseinander.
Es war der »New York Reporter«, ein Sensationsblättchen, das seine Berichte mit schreiend bunten Bildern illustriert.
Und da begann Monsieur Rouen zu starren!
Gleich die erste Seite enthielt die Wiedergabe jenes uns nun schon zur Genüge bekannten Glasbildes. Der Zeichner musste es gesehen haben; es war ganz ausgezeichnet wiedergegeben worden, auch der Ausdruck der brennenden Augen.
»Was für eine schwarze — Katze ist denn das...?!«
Der Gräfin schien die Aufregung, in die der Detektiv beim Anblick dieses Bildes versetzt wurde, ganz zu entgehen, wenigstens forschte sie nicht nach dem Grunde, sie blieb kalt und sachgemäß.
»Ja, in den anderen Zeitungsberichten spielt diese schwarze Katze ebenfalls eine Hauptrolle, nur der ›Herald‹ hat sie gar nicht erwähnt.
Also der Mann auf dem Glasbilde hatte auf seiner rechten Schulter eine schwarze Katze sitzen.
Diese ist, als die Hexerei begann, ebenfalls lebendig geworden, aus der Wand herausgesprungen und dem Mr. Philipp ins Gesicht, hat ihm die Kratzwunden beigebracht.«
Sehr gleichgültig hatte die Gräfin es gesagt, und hiermit schien diese Sache für sie erledigt zu sein.
Für den französischen Detektiv war es das natürlich noch nicht, sein Hirn arbeitete plötzlich fieberhaft.
»Dieser Mann hat ja die reinen Teufelsaugen!«, stieß er hervor.
»Ja, die hat er allerdings, und ich kann Ihnen versichern, dass diese Illustration sogar eine ganz ausgezeichnete Wiedergabe seiner Person ist.«
»So existiert dieser Mann also wirklich?«
»Der existiert wirklich.«
»Und Sie kennen ihn?«
Da plötzlich überzog sich das schneeweiße Gesicht der schönen Frau mit einer Röte, die immer dunkler wurde, und die sonst so kalten Augen begannen zu sprühen.
»Ob ich ihn kenne, diesen Mann!«, kam es flüsternd von den roten Lippen, und die Nüstern der feinen, stolzen Nase bebten.
Dem Detektiv war dieser plötzliche Gefühlsausbruch nicht entgangen, und nun beherrschte gerade er sich schnell wieder, in der Hoffnung, durch geschicktes Fragen zu erfahren, was man ihm sonst vielleicht verschweigen würde. Er wollte diesen Gefühlsausdruck des Weibes ausnutzen.
»Also ich soll Erkundigungen einziehen, wo sich dieser Mann aufhält?«, fragte er, wieder in einen geschäftsmäßigen Ton fallend.
Aber diese Frage musste doch wohl keine sehr geschickte Einleitung gewesen sein.
Plötzlich brach das Weib in ein höhnisches Lachen aus.
»Wo sich dieser Mann aufhält!«, echote es. »Sie wären gerade der Rechte, auszukundschaften, wo sich ein Loke Klingsor aufhält! Durchsuchen Sie die tiefsten Tiefen der Erde und des Meeres, ersteigen Sie die höchsten Höhen des...«
Sie brach jäh ab, ärgerlich, als hätte sie schon viel zu viel gesagt, grub die weißen Zähne in die rote Unterlippe.
»Sie sollen Erkundigungen einziehen«, erklang es dann wieder ganz kalt, »ob sich dieser rätselhafte Vorgang zu New York im Hause des Mr. Samuel Philipp wirklich abgespielt hat, ob überhaupt etwas Wahres daran oder ob die ganze Sache rein erfunden ist. Verstanden?«
»Sehr wohl, gnädigste Gräfin!«, Der Detektiv verneigte sich mit schneller Selbstbeherrschung demütig.
»Auf telegrafischem Wege. Ich könnte es selbst tun, aber mir ist diese Geschichte zu umständlich. Sparen Sie keine Telegrammgebühren. Dann machen Sie Ihre Rechnung, und falls diese etwa gar zu ungebührlich hoch ist, so werde ich reklamieren. Verstanden?«
»Gnädigste Gräfin werden mit uns zufrieden sein, wir haben feste Tarife...«
»Das weiß ich. Ich habe mich auch erst über dieses DetektivInstitut erkundigt, ehe ich den Entschluss fasste, Ihnen diese Sache zu übertragen. Sie sind mir empfohlen worden. Und Sie kennen mich doch?«
»O, wer in der Welt kennt die Gräfin Koschinsky nicht...«
»Na na, so weltberühmt bin ich nicht, hoffe es doch nicht. Hier natürlich haben Sie schon viel über mich gehört, wie?«
In die kalten Augen trat ein lauernder Seitenblick; er entging dem Detektiv nicht, und sofort beschloss er, auf alle noch etwa kommenden Fragen ganz offen zu antworten, mochten sie auch noch so delikater Natur sein.
Und diese Fragen blieben denn auch nicht aus.
»Ich werde hier selten die Gräfin Koschinsky genannt, nicht wahr?«
»Allerdings.«
»Wie nennt man mich sonst?«
»Die Wolfsgräfin.«
»Weil ich eine besondere Vorliebe für Wölfe habe. Gibt man mir nicht noch andere Namen?«
»Auch.«
»Nun?«
»Zum Beispiel... verzeihen gnädigste Gräfin, aber wenn Sie...«
»Heraus damit!«, erklang es herrisch, und sogar die schwere Peitsche ließ sie in ihrer Hand spielen. »Wie nennt man mich sonst noch?«
»Die Maladetta.«
»Weshalb soll ich verdammt sein?«
»Es sind einige Sachen passiert...«
»Was für Sachen?«
»Ein Wolf von Ihnen hat zwei lebende Menschen zerrissen und eine Leiche ausgegraben...«
»Na, und? Die Wahrheit will ich hören!«
Der Detektiv gab vollends jede Zurückhaltung auf.
»Sie selbst sollen dieser Wolf gewesen sein. Sie sollen sich in eine rote Wölfin verwandeln können.«
»Und auch Vampirismus treiben, nicht wahr?«
»Jawohl.«
»Ich stehe im Rufe der Zauberei?«
»Allerdings.«
»Glauben Sie denn, dass es so etwas wirklich gibt?«
»O nein, das ist doch nur leeres Geschwätz.«
»So urteilen auch die anderen?«
»Da, gnädigste Gräfin, ist natürlich ein Unterschied zu machen zwischen den Eingeborenen und den Europäern, und bei den letzteren wieder zwischen den Gebildeten und den Ungebildeten...«
»Es ist gut«, wurde der Sprecher unterbrochen. »Also machen Sie Ihre Sache, möglichst schnell, darauf kommt es bei mir an, und wenn Sie einen Bericht haben, so schicken Sie einen Boten nach Caltura, nach Lalakawana, meinem Schlosse. Das geht doch noch schneller als Postbrief, der erst ausgetragen werden muss, auch wenn es ein gleich zu bestellender Eilbrief ist. Telegrafisch oder telefonisch bin ich nicht verbunden, und dass ich sonst für niemanden zu sprechen bin, wissen Sie wohl. Ihr Bote wird sofort empfangen. Oder kommen Sie selbst. Und wenn ich mit Ihnen zufrieden bin, werden Sie meine Freigebigkeit kennen lernen.«
So sprach die Gräfin, wandte sich ohne Abschiedsgruß um und verließ sporenklirrend das Zimmer, ihr nach ihre zwei- und vierbeinigen Begleiter.
Der französische Detektiv stand in der Mitte des Zimmers und betrachtete das bunte Bild in seiner Hand.
»Der Mann mit den Teufelsaugen und mit der schwarzen Katze!«, flüsterte er. »Das ist er! Gar kein Zweifel! Der Wahn des Irrsinnigen wird zur Wirklichkeit! Lord Clifford, nun kannst Du kommen, jetzt weiß ich, wie ich Dich hier festhalten kann, wo Du nähere Auskunft über Dein Idol erhältst. Aber das muss arrangiert werden. Ich werde mein Eisen schmieden, solange es heiß ist.«
Der Schnellzug raste auf dem Uferdamme dem Süden zu, rechts das blaue Meer, links die tropische Inselszenerie. Welche dichte Zusammengruppierung von schlanken, säulenförmigen Stämmen, welche dunklen Schatten zwischen den siebzig bis hundert Fuß hohen Säulen tief unter den rauschenden Wedeln! Welche dem Urwald gleichende Wildnis von Palmen! Welche Verwirrung von in allen Richtungen durcheinander geworfenen, senkrechten, überhängenden und ganz niedergeworfen Stämmen! Unübersehbare Waldungen von Kokospalmen bedecken das Tiefland und die Küsten auf Strecken, die sich oft tagereisenweit ausdehnen. Weder Sumatra noch Java hat solch ungeheure Palmenmassen. An diesen Palmen klimmen der schwarze und der Betelpfeffer empor, Kaffee, Zimt, Vanille und eine Menge anderer blühender und duftender Sträucher erfüllen die Zwischenräume, und die Menge des reizendsten Laubwaldes ist untereinandergemischt, wie keine Phantasie es sich ausmalen kann. Ceylon ist das Schmuckkästchen aller Inseln, ist der wertvollste Besitz aller englischen Kolonien.
Dieser Schilderung durch den Geografen L. Junghuhn ist nichts mehr hinzuzufügen. Oder nur noch eins. Ceylon ist auch sehr reich an Edelsteinen. Besonders in der Provinz Anaradhnapura werden sie in außerordentlicher Menge und von hervorragender Schönheit gefunden — allerdings keine Diamanten, sondern Edelsteine anderer Art, hauptsächlich Rubine, Amethiste, Topase, Saphire, Granaten, Turmaline, Kannelsteine, die seltenen Katzenaugen, Chalcedon, Hyazinthe und Berylle.
Aber man darf den Wert der Ausbeute nicht überschätzen. Die Gesellschaft, welche dort diesen ergiebigsten Distrikt im Adamsgebirge ausbeutet, arbeitet mit einem Kapital von fünfundzwanzig Millionen Mark und verteilt jährlich im Durchschnitt nur 200 000 Mark Gewinn, verzinst das Anlagekapital also kaum mit einem Prozent. Die Edelsteine liegen in einem Sumpfe, der nicht trocken gelegt werden kann, ihre Gewinnung ist ungeheuer schwierig. Die Aktiengesellschaft hätte sich längst gern aufgelöst, müsste sie dann nicht eben die kolossalen Baggerwerke und sonstigen Einrichtungen aufgeben; das ganze Anlagekapital ginge verloren. So muss weiter gewürgt werden — —
In einem Coupé erster Klasse saßen zwei Herren. Der eine vergrub sich hinter Zeitungen, hatte keinem Blick für die herrlichen Landschaften, die ihm etwas Alltägliches sein mochten.
Der zweite Fahrgast war ein noch junger Mann, den idealen Zügen und dem ganzen Aussehen nach gleich als Künstler erkennbar, auch wenn er die blonden Haare nicht lang getragen hätte. Die neben ihm liegende Skizzenmappe sagte, dass er ein Maler war, und dieser führt heute, um stimmungsvolle Momente festzuhalten, auch immer einen Fotografenapparat bei sich.
Diesen hatte der junge Künstler seit der halbstündigen Fahrt von Colombo noch nicht benutzt. Noch immer ließ er seine strahlenden Augen wie trunken über die Szenerien schweifen, die sich ihm links und rechts durch die offenen Fenster boten.
Wenn er so gekleidet blieb, wie er es jetzt war, musste er sich wohl auch damit begnügen, diese landschaftlichen Herrlichkeiten nur von Weitem zu betrachten. Näher durfte er ihnen da nicht zu Leibe rücken, denn auch auf dem paradiesischen Ceylon haben die Rosen Dornen, und was für welche! Da wäre sein nagelneuer, hocheleganter Flanellanzug bald in Fetzen gegangen; das schneeweiße Oberhemd hätte auch nicht lange mitgemacht, und wenn er nicht größeres Gepäck aufgegeben hatte — in dem kleinen, dünnen Köfferchen dort oben fand ein anderes Kostüm, welches den Strapazen gewachsen war, gar nicht Platz.
Überhaupt sah der junge Mann gar nicht danach aus, als ob er sich für solche sehr eigne. Dagegen sprach schon dieses ideale, durchgeistigte Gesicht, wenn es auch natürlich von der Tropensonne ziemlich gebräunt war. Fast ebenso durchgeistigt hätte man die etwas langen, auffallend schmalen, äußerst sorgsam gepflegten Hände mit den polierten Fingernägeln nennen können. Für solche Naturen ist aber selbst das paradiesische Ceylon nichts, wenigstens nicht, wenn sie der Schönheit näher auf den Grund gehen wollen. Ohne dornenfestes Lederkostüm kommt man nicht aus.
»Ragmana! Aussteigen! Aussteigen!«
Und fix musste das gehen. Der Schnellzug hielt kaum eine Viertelminute.
Die Coupétür wurde aufgerissen, ein Mann sprang herein — da ging es schon weiter.
Es war ein großer, herkulisch gebauter Mann im Jagdstrapazieranzug, wenn auch nicht gerade von Leder, jedenfalls aber allen Anforderungen gewachsen, hatte eine gewaltige Doppelbüchse umgehängt mit allem, was dazu gehört.
»Uff!«, stöhnte er, sich den Schweiß aus dem knallroten Gesicht wischend.

Der Leser blickte von seinen Zeitungen auf.
»Ah, Mr. Pot! Wohin fahren Sie denn?«
»Nun, nach Hause. Die Bürozeit ist aus.«
»Wo sind Sie denn zu Hause?«
»Ich wohne in Kalutotta.«
»Ach so! Da fahren Sie jeden Tag hin und her?«
»Was ist da weiter dabei? Eine Stunde! Als wir früher zusammen in Southend wohnten, hatten wir doch täglich zwei mal zwei Stunden ins Geschäft zu fahren. Wohin gehen Sie?«
Der Herkules hatte sich gesetzt, immer noch schwitzend und pustend.
»Kennen Sie die Plantage von Mr. Oly?«
»Ei gewiss. Da müssen Sie von Kalutotta aus noch anderthalb Stunden die Zweigbahn benutzen.«
»Ich weiß. Dort in den Dschungeln hat sich ein schwarzer Panther gezeigt, Mr. Oly hat mich telegrafisch zur Jagd eingeladen.«
»Ein schwarzer? Die sind auf Ceylon selten geworden, und nun gar hier so nahe der Küste!«
»Eben deswegen muss ich mich beeilen, dass kein anderer das kostbare Tier erlegt.«
»Na, dafür wird schon Mr. Oly sorgen, wenn er Sie einmal eingeladen hat.«
»Na, wenn mir nur nicht ein anderer zuvorkommt.«
»Wer denn?«
»Ich bin jemand begegnet, dem ich jede Nichtswürdigkeit zutraue.«
»Wem denn?«
»Hören Sie, was ich erlebt habe!
Wie ich heute Mittag in meinem Hotel sitze — also noch in Colombo, ich habe hier in Ragmana nur den Anschluss erwartet — da sehe ich einen Kerl beim Frühstück — es geht mir doch gleich durch und durch!
Sie wissen doch, dass ich in Amerika gewesen bin, in den Vereinigten Staaten, dort viel gejagt habe?«
»Na, ich dächte doch, Sie hätten mir gerade genug von Ihren Jagdabenteuern erzählt«, lachte der andere.
»Auch von den beiden unzertrennlichen Deutschen? Der eine ist ein Professor, der andere ein Doktor.«
»Ich kann mich nicht gleich besinnen. Ich wüsste nicht.«
»Es war vor zwei Jahren in Arkansas, in der Nähe von ManhaCity. Da lernte ich die beiden zuerst kennen.
Aber nicht etwa als deutsche Gelehrte, als Forschungsreisende, die wissenschaftliche Bücher schreiben, sondern es waren zwei Hinterwäldler, Trapper, Tramps, Stromer, die ebenso gern betteln und stehlen wie sich von der Jagd nähren. Nur noch in Lumpen gehüllt, Lederfetzen um die Füße gewickelt, starrend vor Schmutz und vor Dreck.
Als sie zum ersten Mal nach ManhaCity kamen, legten sie sich gleich mitten auf dem Marktplatz am helllichten Tage unter die Pumpe, pumpten sich gegenseitig den Schlamm ab.
Und da soll man nun wissen, dass der eine von ihnen ein Professor der Archäologie ist, ein hochberühmter Literat, der andere ein Doktor, sogar ein doppelter, Doktor der Philosophie und Doktor der schönen Wissenschaften!«
»Na, und weshalb sind Sie denn nun so empört über die beiden oder doch über den einen, dass Sie ihm jede Schlechtigkeit zutrauen?«, fragte Mr. Pot lachend.
»Ja, wissen Sie... bei ManhaCity gibt es nämlich noch gelbe Füchse, Honigfüchse, vielleicht die einzigen noch in ganz Amerika. Honigfüchse, für deren Pelz jeder Kürschner mit Kusshand tausend Dollar zahlt, da kann er schon etwas geschunden sein, und für ein lebendes Exemplar jeder Tierhändler dreitausend Dollar zahlt.
Aber Sie glauben gar nicht, wie schwer diese Tiere zu erlegen sind, von einem Fangen in der Falle oder Ausgraben gar nicht erst zu sprechen. Diese Schlauheit und Vorsicht! Unsere Füchse sind dagegen die reinen Waisenknaben. Als ob sie wüssten, dass sie die letzten ihres Stammes sind!
Nur die allerleiseste Witterung, nur das denkbar geringste Geräusch auf hundert Schritt Entfernung, und verschwunden sind die gelben Burschen, ohne eine Fährte zu hinterlassen. Sie müssen geradezu durch die Luft fliegen!
Ich war nur wegen dieser Honigfüchse nach ManhaCity gekommen.
Dort lebt ein alter Indianer, das ist der einzige, der diese Honigfüchse noch aufzuspüren versteht, ihre Schlupfwinkel findet, einen Jäger heranführen und zum Schusse bringen kann, ein Kerl, der das Gras wachsen sieht und die Flöhe niesen hört. Dafür lässt er sich aber auch bezahlen. Dieses Führen von fremden Jägern bringt ihm noch mehr ein, als wenn er die Füchse selbst erlegt oder fängt. Er ist ein schwerreicher Mann, wenn er auch noch immer wie eine echte Rothaut lebt.
Den hatte ich mir also engagiert. Für jeden Fuchs, den ich schoss, musste ich ihm 500 Dollar garantieren, das Fell wurde von einem Pelzhändler taxiert, und ich hatte dem Indianer, wenn ich es behalten wollte, die Hälfte dafür zu bezahlen.
Aber nichts war es!
Wir haben nicht einmal einen einzigen Fuchs zu sehen bekommen.
Gerade zu jener Zeit waren die beiden Landstreicher dort aufgetaucht. Für Jäger hielt man sie gar nicht, der eine hatte nur einen alten, ganz verrosteten Vorderlader, der andere gar bloß eine vorsintflutliche Pistole bei sich.
Sie sollten bald beweisen, was es für Jäger waren!
Der Indianer hatte ein frisches Fuchsloch aufgespürt, wir marschierten am frühen Morgen hin — da kamen die beiden uns schon entgegen, als Beute zwei erlegte Honigfüchse tragend.
Und so ging das weiter. Stets und stets kamen uns die beiden zuvor.
Und dann brachten sie es auch noch fertig, eine ganze Familie mit vier Jungen auszugraben und lebendig zu fangen!
Da wurde mein indianischer Führer ganz kopfscheu.
Wenn ihn nicht ein Vorgang schon früher gemütskrank gemacht hatte!
Es war dort ein Hirsch aufgetaucht, ein Zwanzigender, aber schon acht Tage vor meiner Ankunft.
Man kannte wohl die Stelle, wo er gewechselt hatte, aber das war eben schon vor acht Tagen gewesen, und inzwischen hatte es mehrmals geregnet.
Da überraschten wir die beiden Stromer, wie sie auf diesem Wechsel eine Spur ausarbeiteten — die alte Fährte jenes Hirsches.
Mein Indianer lachte sie aus, und ich wiederhole Ihnen, dass er ein roter Jäger ist, der das Gras wachsen sieht, für den alles, was sich am Boden befindet, wie ein offenes Buch spricht.
Auf dieser Fährte war also nichts mehr zu machen, überhaupt gar keine Spur mehr vorhanden. Wir hatten zwei Hunde mit ausgezeichneten Nasen bei uns. Sie kümmerten sich gar nicht mehr darum.
Aber was soll ich Ihnen sagen?
Die beiden Stromer arbeiteten die acht Tage alte, ausgewaschene Fährte doch noch aus, verfolgten sie mehrere Stunden weit und brachten den Zwanzigender wahrhaftig noch zur Strecke!
Sie sind kein Jäger, Mr. Pot, so wissen Sie nicht, was das zu bedeuten hat. Ich vermag es Ihnen auch nicht zu erklären. Ich kann Ihnen nur sagen: Dieser Indianer glaubte einfach an Zauberei und wollte mit den Honigfüchsen nichts mehr zu tun haben, mir nicht mehr als Führer dienen.
Als die beiden Stromer gingen, nahmen sie sieben Pelze mit und fünf lebendige Honigfüchse, die jetzt in Stellingen bei Hamburg sein sollen, eine der größten Seltenheiten der Welt.
Diese bloody damned Germans!«
Der dicke Herkules schwieg ganz erschöpft, die Erinnerung daran musste ihm noch jetzt ganz mächtig an die Nieren gehen.
»Die beiden Gelehrten hatten sich also ganz auf die Jagd gelegt?«, fragte der andere.
»O, nein! Das machten sie nur nebenbei zu ihrem Vergnügen. Oder ihre Jägerei diente ihnen nur so zum Vorwand. In Wirklichkeit waren sie immer noch die Archäologen, die ihren Forschungen nachgingen. In der Nähe von ManhaCity gibt es sehr viele Mounds. So heißen in Amerika die Bauten, welche noch von den Ureinwohnern stammen, die noch vor den Indianern dort hausten, von denen sie erst kurz vor der Ankunft der Europäer ausgerottet oder vertrieben worden sind, welcher Vernichtungskampf freilich jahrhundertelang gedauert hat. Die letzten Überreste dieses Volkes sind die heutigen Eskimos, die bis in den höchsten Norden verdrängt worden sind.
Die Mounds bestehen aus Erdwällen mit soliderem Kern, sind symmetrisch angelegt, dienten zu Verteidigungszwecken oder umschlossen Altäre, Grabstätten und dergleichen.
Die eigentlichen Räume sind immer unterirdisch, da findet man noch alle möglichen Waffen und Hausgerätschaften.
Die meisten dieser Mounds sind ja vollkommen erforscht, aber es gibt doch immer noch welche, bei denen dies nicht der Fall ist.
So liegen auch bei ManhaCity einige, und zwar solche von außerordentlicher Schönheit der Formen, man kann gleich bestimmt vermuten, dass sie etwas ganz Besonderes verbergen. Das muss einmal ein ganz besonderes Heiligtum gewesen sein.
Aber diese Mounds liegen eng zusammen auf einem Gebiet, das Privateigentum eines Mr. Jefferson ist, und dieser alte Herr ist ein Sonderling, der eine Mauer darum gezogen hat, sie eifersüchtig bewachen lässt und niemand den Zutritt gestattet. Er selbst hat noch gar keine Ausgrabung veranstaltet. Es ist ihm eben ein Vergnügen, solch ein Geheimnis zu besitzen, ohne es selbst richtig zu kennen, und das hält er nun natürlich erst recht aller anderen Welt vor. Vergebens haben ihn schon massenhaft Forscher zu animieren gesucht, ihm große Summen geboten, die Regierung selbst unterstützte die Gesuche — Mr. Jefferson ist niemals darauf eingegangen. Er ließ seine unterirdischen Raritäten nur umso sorgfältiger bewachen.
Da, vor anderthalb Jahren, ein halbes Jahr nach meinem Besuche dort, erscheint in Deutschland ein Buch, das bald in alle Kultursprachen übersetzt wird: Die Mounds von ManhaCity, beschrieben von Professor Kurt Becker und Doktor Walter Frank.
Und dieses Buch enthält nicht nur die Beschreibung, sondern auch zahlreiche Illustrationen der ganzen Anlage und darin vorgefundener Sachen nach Zeichnungen und Fotografien.
Hiervon erfährt natürlich auch Mr. Jefferson, jetzt lässt er die unterirdische Gräberstadt doch öffnen, und da findet er alles den Tatsachen entsprechend! Die Beschreibungen stimmen, die Illustrationen sind getreue Wiedergaben.
Ja, wie war denn das möglich?
Nun, die Erklärung ließ nicht lange auf sich warten.
Man brauchte nur zu suchen, so fand man auch den unterirdischen Tunnel, der von einem alten Fuchsbau aus unter der Mauer hinweg in das Heiligtum angelegt worden war, eine kolossal und genial ausgeführte Erdarbeit, ein ganz verzwickter Gang von wenigstens hundert Metern Länge — wenn dabei auch ein schon früher vorhandener alter Gang benutzt worden war.
Und nun stellte sich auch das Weitere bald heraus.
Jene beiden Vagabunden waren die Täter gewesen. Sie erzählten es in der Einleitung selbst, gaben auch ihre Konterfeis wieder.
Der große, starke Mann war der Professor Kurt Becker, der andere, klein und schmächtig, war der Doktor Walter Frank.
Die Verfasser erzählten ganz offen, wie sie sich nur deshalb dort bei ManhaCity als Trapper und Vagabunden aufgehalten hatten, um eben die Aufmerksamkeit von ihrem Hauptzwecke abzulenken, um in die verschlossenen Mounds zu dringen.
Und als man sich näher orientierte, erfuhr man auch weiter, was für ganz gefährliche Individuen das sind.
Sie hatten so etwas nicht zum ersten Male gemacht, sind zwei in ihren Kreisen weltberühmte Archäologen, die es hauptsächlich auf solche Altertümer abgesehen haben, welche aus irgendeinem Grund der forschenden Welt verschlossen sind.
So haben sie auch schon die Altertumsschätze eines peruanischen Klosters beschrieben, die von den Mönchen eifersüchtig bewahrt wurden. Da sind die beiden selbst Mönche geworden, und zwar haben sie sich als eingeborene Lamatreiber einzuführen gewusst.
Nun bedenken Sie, was hierzu gehört, wie die beiden die Sprache und Sitten der peruanischen Eingeborenen beherrscht haben müssen!
Und in der Zwischenzeit ist von diesen beiden unzertrennlichen Gelehrten auch wieder solch ein Streich bekannt geworden, wobei man sieht, dass sie sich nicht etwa nur auf Amerika beschränken, dass ihr Gebiet, das sie beherrschen, die ganze Welt ist.
Um die Schatzkammer des Schahs von Persien in Teheran hat sich doch schon immer ein Sagenkreis gesponnen. Aber noch kein Europäer, noch kein Uneingeweihter ist da hineingedrungen.
Es ist noch kein Jahr her, da hatte der Schah einmal Handwerker nötig, Goldschmiede, die in seiner Schatzkammer eine Arbeit vornehmen sollten, und so knifflig war diese, dass er sich die Künstler direkt aus Armenien kommen ließ.
Da haben es diese beiden deutschen Gelehrten fertiggebracht, sich als solche auszugeben, haben die armenischen Goldschmiede, die schon unterwegs waren, überwältigt oder sich mit ihnen geeinigt — kurz, sie sind an ihre Stelle getreten, so sind sie nach Teheran gekommen und in die kaiserliche Schatzkammer hinein, haben ihre Arbeit zur größten Zufriedenheit verrichtet. Dann allerdings sollten sie geköpft werden, aber daraus wurde nichts; die beiden wussten unter tausend Gefahren zu fliehen und haben die erste Beschreibung dieser sagenhaften Schatzkammer der Welt überliefert, wieder mit vielen Illustrationen.
Da sehen Sie, was für gefährliche Burschen das sind! Diese bloody damned Germans!
Und nun habe ich den Professor Kurt Becker heute Mittag an der Frühstückstafel meines Hotels sitzen sehen. Jeder Irrtum ist ausgeschlossen. Ich erkannte den Riesen, fast noch größer als ich, sofort wieder, wenn er sich jetzt auch als tadelloser Gentleman präsentierte und den langen Vollbart, den er damals trug, abgenommen hatte. Mir ging es doch gleich durch und durch!
Wo ich gerade auf dem Wege bin, hier in der Nähe von Colombo einen schwarzen Panther zu erlegen, der sonst nur noch auf den SundaInseln vorkommt, dort auch schon selten geworden ist!
Da bin ich Hals über Kopf abgefahren, musste aber doch in Ragmana den Zug unterbrechen und auf Anschluss warten, sonst würde ich in Kalutotta noch viel später eintreffen.
Diese bloody damned Germans!«
Und mit dieser nochmaligen Verwünschung wischte sich der dicke Erzähler wieder den Schweiß ab, der ihm immer noch von der Stirn perlte.
»I beg your pardon — ich bitte um Verzeihung, ich möchte eine Aufnahme machen«, sagte da der dritte Passagier, nach dem Fotografenapparate greifend und aufstehend.
Er hatte still in der anderen Ecke des Abteils gesessen, immer hüben und drüben durch die Fenster die Gegend musternd, die beiden anderen hatten sich gar nicht um ihn gekümmert.
Also er wollte eine Aufnahme machen, durch das Fenster, an welchem die beiden saßen.
Die warfen ihm nur einen Blick zu, lehnten sich dann etwas zurück, um die Aussicht freizugeben oder nicht mit auf die Platte zu kommen.
Der junge Mann, dem man den Künstler so offenkundig ansah, trat nun weiter näher, visierte durch den Sucher, es knipste.
»Danke sehr!«
Er zog aus der Tasche ein Fläschchen, tröpfelte etwas durch ein Trichterchen hinten in den Kasten hinein. Also es war ein ganz moderner Apparat mit den neuesten Errungenschaften der fotografischen Technik, die eingetröpfelte Flüssigkeit verdunstete und fixierte das Negativ sofort.
Es war geschehen, der junge Mann setzte sich wieder. Übrigens konnte man auch gleich seinen Namen und seine Heimat wissen. An dem Köfferchen oben in dem Regal war in einer dazu angebrachten Spalte seine Visitenkarte befestigt: W. R. Duncan, London.
»Seinen Begleiter, den Doktor, hat er diesmal nicht bei sich?«, fragte der andere, der interessiert zugehört hatte.
»Nein. Ich habe mich über ihn erkundigt. Er wohnte auch in meinem Hotel, freilich unter einem anderen Namen. Er nannte sich... na, ich weiß nicht, wie der vertrackte Name war. Aber er wohnt seit einigen Tagen allein hier. Den anderen, den Doktor, würde ich auch sofort wieder erkennen, mag er sein Aussehen noch so verändern!«
»Und Sie meinen, der Professor hat ebenfalls von dem schwarzen Panther gehört und wird sich nun gleich nach Mr. Olys Plantage begeben, um ihn Ihnen wegzuschnappen?«
»Na — das gerade nicht — aber ich bin vorsichtig. Ich traue dem alles zu. Jedenfalls habe ich mich beeilt.«
»Was will der deutsche Professor nun hier?«
»Das weiß ich nicht.«
»Hat er Sie erkannt?«
»Schwerlich. Mindestens hat er mich keines Blickes gewürdigt.«
»Ob er hier auch wieder archäologische Forschungen veranstalten will?«
»Wahrscheinlich. Weiter hat der ja nichts im Kopfe, alles andere ist ihm nur Nebenzweck. Und hier auf Ceylon soll es ja noch genug auszugraben geben.«
»Da hat er es am Ende gar auf die Geisterinsel abgesehen.«
»Was für eine Geisterinsel?«
»Da liegt sie ja.«
Die Bahn hatte eine Biegung gemacht. In die bisher langgestreckte Küste schnitt sich eine tiefe Bucht ein, und in ihr sahen die beiden allerdings in ziemlicher Entfernung, sodass nichts weiter zu unterscheiden war, eine Insel.
»Ach, das ist wohl die heilige Insel, die von dem Maharadscha der Gräfin Koschinsky zugesprochen worden ist?«
»Jawohl, das ist sie.«
»Von dieser russischen Gräfin habe ich in der Woche, seitdem ich hier bin, schon genug gehört, von der Maladetta oder wie sie sonst noch genannt wird, habe sie auch einmal in ihrem phantastischen Aufzuge durch die Stadt reiten sehen. Wo ist denn nun ihr märchenhaftes Schloss, das doch dicht am Meere liegen soll?«
»Dort oben, wo der vorspringende Felsen jäh ins Meer fällt, liegt es.«
»Ich sehe nichts.«
»Es ist auch kaum erkenntlich, weil alles in den Felsen hineingehauen ist.«
»So, so. Von dieser Wolfsgräfin bekommt man ja Schalkhaftes zu hören.«
»Ach, das ist doch alles heller Blödsinn.«
»Na ja, selbstverständlich. Aber dass der Maharadscha ihr auch die heilige Insel abgetreten hat, das war auch dem sehr aufgeklärten Herrn, der mir die Geschichte erzählte, ganz unerklärlich.«
»Ja, das ist wirklich sehr rätselhaft. Diese russische Gräfin muss auf den Maharadscha wie auf den Gouverneur einen ganz außerordentlichen Einfluss ausüben, das ist das einzig Rätselhafte an der ganzen Sache. Sonst zerbricht sich doch kein vernünftiger Mensch über alles andere, was die Gräfin da Schauerliches treiben soll, den Kopf. Oder er ist eben gerade so hirnverbrannt wie diese buddhistischen Singhalesen und christlichen Italiener, die natürlich auch mit Aberglauben ganz vollgepfropft sind.«
»In das Schloss kommt niemand hinein?«
»Niemand! Ganz ausgeschlossen! Die Gräfin verkehrt ja mit niemand.«
»Und die Insel ist auch unzugänglich?«
»Vielleicht noch mehr als früher.«
»Inwiefern?«
»Früher ließ der Maharadscha das heiligste Heiligtum der Buddhisten, obgleich es eigentlich mit ihrer Religion gar nichts zu tun hat, durch einige kleine Dampfboote bewachen, die Tag und Nacht um das Eiland herumfuhren, um zu verhindern, dass neugierige oder wissbegierige Europäer landen konnten, die sich nicht um die ruhelosen Seelen der alten Lemuren kümmern... Was es mit diesen Lemuren für eine Bewandtnis hat, wissen Sie doch wohl?«
»Das weiß ich. Jener Herr weihte mich sehr gründlich ein, erzählte mir von diesem sagenhaften Menschen- oder schon mehr Göttergeschlecht, die alle die alten Bauten mit den zyklopischen Mauern ausgeführt haben sollen, noch weit vor Buddhas Zeiten, schon vor ungezählten Jahrtausenden unserer Zeitrechnung, und wie diese Lemuren nun immer noch als Geister zwischen ihren Ruinen hausen, von den jetzigen Eingeborenen weniger geehrt als schrecklich gefürchtet.
Nun, wie wird denn jetzt der Besuch von dieser Insel abgehalten? Wie macht die Gräfin als neue Besitzerin das? Wir sind von unserem ersten Thema ganz abgekommen.«
»Wachtboote lässt sie nicht mehr fahren, sondern hat auf der Insel ihre ganze Menagerie untergebracht, nicht nur ihre Wölfe, sondern auch Panther und Tiger und sogar Löwen.«
»Die laufen dort frei herum?«
»Natürlich. Wenn sie eingesperrt wären, könnten sie die Insel doch nicht bewachen. Nun soll aber einmal ein Fremder wagen, die Küste zu betreten. Die Bestien warten nur auf seinen Besuch, um ihn zu zerreißen.«
»Womit werden sie denn sonst gefüttert?«
»O, da gibt es ja dort Fische und mehr noch Tintenfische und sonstige Polypen, zum Teil von ganz unheimlicher Größe, daher hat ja auch diese Bucht ihren Namen.«
»Die Caltura-Bucht?«
»Nein. Das ist nur die geografische Bezeichnung. Der Volksmund spricht nur von der KalutottaBucht.«
»Ach richtig... Kalutotta soll so viel wie Höllenbestie heißen.«
»So ist es.«
»Es hängt mit der Göttin Kali zusammen, die Polypen mit vielen Armen um den Hals trägt.«
»Jawohl.«
»Und nun heißt es, in der Mitte dieser Insel läge ein großes Wasserbecken, wunderbar mit Gold und Edelsteinen ausgelegt, und darin säße der Kalutotta selbst, ein ungeheurer Polyp, an Umfang wie ein ganzes Haus, mit Saugarmen, die ausgestreckt bis an die Küste reichen, also wohl tausend Meter weit. Und dieser oder diese Kalutotta ist die Mutter, welche alle die Tintenfische gebiert, von denen es in jener Bucht wimmeln soll.«
»Das ist schon richtig, so geht die Volkssage.«
Mr. Pot liebäugelte mit seiner weggelegten Zeitung. Die Unterhaltung begann ihn zu langweilen. Er sollte auch davon gleich erlöst werden.
»Kalutotta!!«
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.