
RGL e-Book Cover 2017©

RGL e-Book Cover 2017©
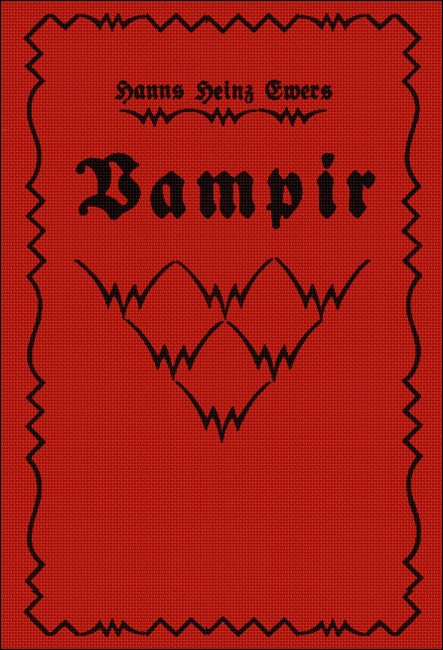
"Vampir," Georg Müller Verlag, Munich, 1921
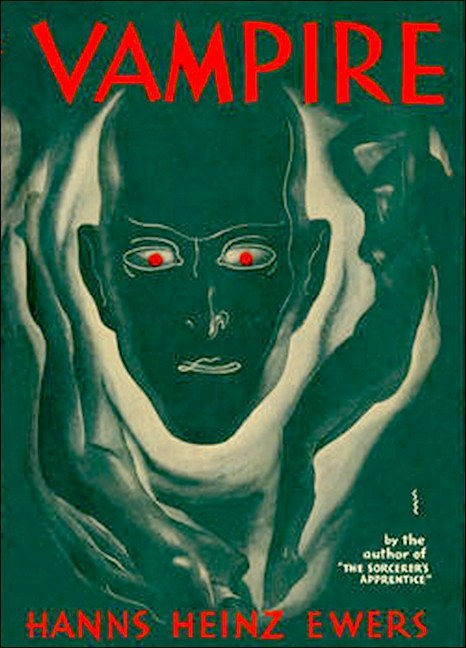
Englische Ausgabe von "Vampir,"
The John Day Company, New York, 1934
I fought with all; more then with all — with you,
I suffered much; so, I suppose, did you.
And out of cruel wounds and bleeding years
Grew forth this book, brimfull of love and pain.
It is your book — take it with gracious hands!
H.H.E.
Habent Sua Fata Libelli —
manchmal schon, wie dies hier, ehe sie noch gedruckt sind. Das Manuskript ward beendet Dezember 1916 in Sevilla; H.H.E. sandte es von dort mit einem norwegischen Schiff nach Deutschland. Der Kapitän, in Brest von den Franzosen angehalten, vernichtete das Manuskript. Eine Kopie, stark durchgearbeitet, sandte H.H.E. dann im Frühjahr 1917 von Neuyork; ein Herr R. aus Wien, der durch Jahre die Geheimpost nach Deutschland besorgte, übernahm es. Sein Agent fuhr als Steward auf einem schwedischen Dampfer; er wurde, schon lange im Verdacht, Geheimpost herüberzuschaffen, von den Engländern in Kirkwall festgenommen. Aber seine Post fand man nicht; die hatte er wohl versteckt. Nach fünf Monaten fruchtloser Untersuchung ließen die britischen Behörden den gefährlichen Menschen los, brachten ihn auf dasselbe Schiff zurück, das wieder auf einer Fahrt nach Amerika war. Wohlbehalten fand er alle seine Sachen in dem alten Versteck und lieferte sie, da an weitere Versuche für ihn nicht mehr zu denken war, getreulich seinem Auftraggeber wieder ab. Kurz darauf wurde dieser, Herr R., von den amerikanischen Behörden in Haft genommen und alle seine Sachen beschlagnahmt — darunter auch dies Manuskript. Er wurde zwar wieder freigelassen, die Untersuchung ging aber bis spät in den Sommer 1918 weiter. Als er sich endlich glücklich herausgelogen hatte, gelang es ihm durch einen günstigen Zufall, einige seiner Sachen zurückzuerlangen — auch das Romanpaket kam wieder in seinen Besitz. Er vergrub es mit anderen Dokumenten in einer Kassette in seinem Garten im Bronx.
Eine letzte Abschrift hatte H.H.E., nachdem er sie bei einem halben Dutzend Haussuchungen glücklich gerettet hatte, seiner amerikanischen Sekretärin, Frl. J.I., zur Aufbewahrung übergeben. Als die Behörden auch in ihrer Wohnung wiederholt haussuchten, übergab sie die Abschrift einer befreundeten irischen Dame — die nun ebenfalls mit dem Besuche der Geheimagenten beglückt, das Manuskript noch rechtzeitig in den hinteren Räumen verbrennen konnte, während vorne die Spürhunde des Justizministeriums darnach suchten.
Inzwischen war H.H.E. in Haft genommen worden. Bei allen seinen Verhören war immer einer der Hauptpunkte die Frage nach dem Manuskript »Vampir«. Ein paar Kapitel waren in spanischen Blättern veröffentlicht worden; der ausgezeichnete englische Geheimdienst, der H.H.E. seit 1914 schon auf das gründlichste beobachten ließ und jede [dritte!] seiner Bewegungen kannte, wußte natürlich davon und hatte längst die amerikanischen Behörden verständigt. Während er oft stundenlang über das Manuskript, unter dem sich die amerikanischen Vaterlandsretter gottweißwas Gefährliches vorstellten, inquiriert wurde, lag dies ganz gemütlich im selben Büro, hübsch in braunes Packpapier gewickelt, bei den Akten »R.«! H.H.E. glaubte das Manuskript übrigens längst in Deutschland und konnte den Herren Inquisitoren nur immer versichern, daß es nicht in seinem Besitze sei. So grundverderblich jedoch erschien es den Behörden, daß sie es als erstes Buch auf den damals für die Ver. Staaten angelegten »Index« setzten, der sofort in allen Blättern veröffentlicht wurde; man muß gestehen, es dürfte schwer gewesen sein, gegen dies Verbot zu verstoßen!
Wieder ein Jahr später, im Sommer 1919, als H.H.E. nach höchst unsympathischen Aufenthalten in Gefängnissen, Zuchthäusern und Gefangenenlagern sich in Neuyork wieder einer etwas beschränkten Freiheit erfreute, tauchte plötzlich Herr R. bei ihm auf. Er hatte mittlerweile seinen Schatz ausgegraben und brachte das Manuskript zurück. Doch auch jetzt war das Manuskript nur ebenso »beschränkt frei« wie er selbst. »Paroliert« war er nur unter der Bedingung, nichts zu veröffentlichen, »weder in den Ver. Staaten noch in irgendeinem anderen Lande, weder in englischer noch in irgendeiner anderen Sprache, weder privat noch öffentlich, weder direkt noch indirekt« usw. usw. — Man sieht: die amerikanischen Behörden sind tüchtig, wenn es sich um Unterdrückung von irgend etwas Geistigen handelt! H. H. E. ist in Berlin und Wien, in St. Petersburg, Rom und Paris »zensuriert« worden, aber nie so fabelhaft gründlich wie in den Staaten. Dazu bekam er, selbstverständlich, auch keine »Erlaubnis zur Abreise«, wurde vielmehr, nach wie vor, gründlich überwacht.
Nun ist er endlich doch wieder in Europa, darf sich einer gewissen persönlichen Freiheit erfreuen — wenigstens soweit davon in modern regierten Ländern die Rede sein kann. Franzosen, Engländer, Amerikaner haben ihr Bestes getan, dies Buch zu vernichten — und den, der es schrieb. Daß es doch nicht gelang, war — Schicksal Und vielleicht half dazu ein Karneol, in den ein Skorpion eingeschnitten war. Wie ein Beryll ihm half durch manche Fährnisse in diesen Jahren, ihm gute Kraft gab und noch geben mag.
Beide gab ihm eine schöne Frau —
Neapel, 7. Juli 1920
»My muse by no means deals in fiction,
she gathers a repertory of facts.
And that's one cause, she meets with
contradiction, for too much truth, at
first sight, never attracts.«
Byron
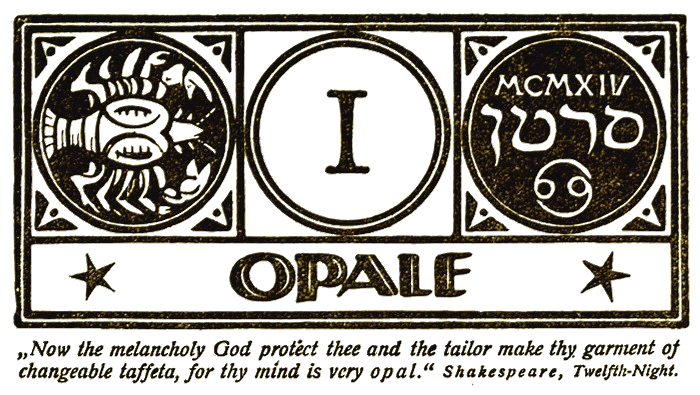
In dem Jahre, in dem die ganze Welt wahnsinnig wurde, war er hinausgezogen — zum andern Mal. Er sagte immer: zum andern Mal; er zählte nicht, ob es das siebente Mal war, oder das zehnte, das zwölfte. Drei Jahre war er nun schon zu Hause geblieben, über drei Jahre schon in seiner alten Heimat: Europa.
Er wußte wohl, daß er krank war; Europa machte ihn krank, die Heimat, die er liebte. Nach einem Jahre wußte er es selbst; nach zwei Jahren sahen es seine Freunde; nach drei Jahren merkten es alle, die mit ihm sprachen. Die Nerven vielleicht —
Aber er wußte auch, was ihn heilen mochte. Oder eigentlich: nicht heilen. Wohl aber: ihm neue Kraft geben für neue Jahre in der Heimat. Wenn er die Gluten der Tropen trank, wenn er die Einsamkeiten der Wüsten atmete, wenn seine Sehnsucht sich badete in den Unendlichkeiten aller Meere.
Und gesund — oder doch fast gesund — war er schon an dem Tage in Antofagasta. Irgendein Kleines nur war zurückgeblieben, ein Leichtes, Seltsames, Weiches und Verwildertes. Frank Braun lachte darüber, breitete die Arme aus, dehnte sich, reckte sich, fühlte seine alte Kraft, wie er jeden Muskel am Körper spielen ließ. Am liebsten wäre er hineingesprungen ins Wasser, zwischen die Seelöwen, wäre wettgeschwommen mit ihnen hinter den Heringsschwärmen im Hafen von Antofagasta. Das war an dem Tage, als das Wetterleuchten zuckte am Himmel der Heimat, an dem Tage, als der Schrei rings um die Welt jagte, durch alle Drähte in Meeren und Landen, durch alle Lüfte in funkenden Wellen: der wilde Schrei von Sarajewos Mordtat.
In Hamburg war er an Bord gegangen — auf den Dampfer, der gerade hinausfuhr in die Welt. Es war ihm, als ob ihn der Ozean trage und nicht das Schiff. Das war nur die Wiege, die ihn hielt — sie aber schaukelte leicht die allmächtige Mutter. Die sang, sang für ihn; wenn er die Augen schloß, konnte er's wohl verstehen, Weise und Worte. — Dann, bei St. Pauls Riff, mitten im Meer, bat er den Kapitän um ein paar Stunden, Haifische zu fangen. Der wollte nicht, aber er ließ nicht nach, gab ihm die schönsten Worte, steckte sich hinter den Ingenieur, der erklärte, er wolle die Zeit schon aufholen bis Montevideo. So hielten sie, machten die Haken zurecht, warfen sie aus; fingen fünf mächtige Bursche. Schnitten ihnen die Leiber auf, wie jeder Seemann tut, fanden nichts: da ist kein Überfluß an Menschenfleisch, mitten im Atlantik, bei St. Pauls Riff.
Unten traf er, in Punta Arenas, einen schmutzigen Kasten der La-Plata-Regierung, der herumfuhr zwischen den Inseln, selbst nicht ahnte, weshalb. Der Kapitän war ein Baske aus den Bergen, er sollte wohl Vermessungen machen und wußte nicht recht, was das war. Der Kosmosagent im Südhafen schrieb ihm ein paar Ziffern ab aus einem deutschen Buche, die zahlte er mit Fellen und schickte sie, mit vielen Siegeln, nach Buenos Aires. Kein Mensch las sie dort.
Sie kreuzten in der Magelhaensstraße. Zum Feuerland, auch hinüber nach Patagonien. Da schossen sie Guanakos und drüben Ottern und große Füchse. Sie besuchten die armseligen Goldgräber, die immer noch suchten, froren, fluchten und tranken; sie streiften herum mit den Bootsindianern, nackt in all der Kälte, schmutzig und verhungert, erbärmliche Tiere, die ihr Leben verkauften um einen Mundvoll Schnaps.
Oder er lag an Deck, fest eingehüllt, irgendwo in einer Bucht. Blickte auf die blauen Gletscher, die tief hinabglitten ins Meer, suchte im Wasser nach einer Robbe oder einem Pinguin, warf Speckstücke hinunter und kleine Fische für die Kaptauben und Boobies und Albatrosse, die wie plumpe Riesenenten sich schaukelten. Lag auch an den langen Abenden unten in seiner Kabine, auf Fellen, zwischen Fellen, rauchte, spielte Schach mit dem schwedischen Steuermann.
Nahm dann wohl seine alten Bücher, träumte mit ihnen. Es waren wenig genug, sechs oder sieben: Jacomino von Verona, Bruder Pacifius, St. Bonaventura, Jacopone von Todi. Der Schwede sah sie verächtlich an, und ein wenig scheu. »Die waren nie herum um Kap Horn!« Frank Braun sagte: »Nie? Vielleicht kannte Magelhaens den Todaner.«
Er kaufte ein paar Pferde irgendwo, ritt hinauf mit zwei Indianern durch Patagonien, kletterte über die Anden und hinunter nach Coronel. Stieg auf einen kleinen Walfischfänger der norwegischen Station, fuhr hinunter, half beim Harpunieren, ließ sich ein paar Zähne ausbrechen vom größten Tiere. Und zurück schneckenlangsam auf der Nußschale, die zwei große Potwale schleppte, an Backbord einen und einen an Steuerbord. — Dann durch das deutsche Chile; nordwärts, mit der Bahn, durch das spanische. Wieder über die Anden nach Bolivien; er sang und trank mit den deutschen Offizieren, die dort Soldaten machten aus barfüßigen Affen.
Nun wollte er zurück. Der Hapagdampfer wartete im Hafen von Antofagasta. Stark war er und gesund — bis auf ein Kleines.
Das grüne Wasser war so klar, man sah hinunter, viele Meter tief. Dann wieder, dicht am Boot, eine Wolke, die sich wälzte und schob, leuchtend und gleißend wie patiniertes Silber — Heringsschwärme, Hunderte, Tausende, Hunderttausende von Heringen. Die Seelöwen jagten sie, trieben sie tiefer hinein in den Hafen, ringsherum im großen Halbkreis vom Meere her, wie geübte Treiber. Einer hob sich und noch einer, schüttelte den starken Kopf mit dem mächtigen Schnauzbarte, tappte mit der Flosse breit auf das aushängende Ruder. O, der alte Kerl weiß genau, daß er frei ist, daß er großen Schutz hat und ihm kein Mensch was tun darf an der Westküste. Neugierig schaut er ins Boot, wer will da wieder hinaus? Wer ist dumm genug, von hier fortzufahren — von diesen glückseligen Jagdgründen der unzähligen Heringe? Narren, dachte er, Narren! Und, im starken Schwunge, schob er den gewaltigen Leib halb hinaus aus dem Wasser, hinein wieder, kopfüber in die Hatz auf die reiche Beute.
Hinten dehnte sich die Salpeterwüste. Diese öde, trostlose, riesige Strecke, die sich hinaufzog über fast dreißig Grade zwischen dem Ozean und den Bergen. Braun und weiß und gelb und rot. Kein Baum, kein Strauch, kein kleiner Grashalm. Nichts. Und die Stadt, Antofagasta, ausgedörrt in der Sonnenglut, wie Arica, wie Mollendo, wie Iquique und alle die andern. Deutsche und Engländer, Chilenen, Kroaten, Syrier — und sie alle rissen aus dem unfruchtbaren Boden den Stoff, der da drüben, im alten Lande, höchste Fruchtbarkeit gab. Bleich und ausgedörrt all die Menschen, wie die Wüste ringsum; wie ein großes Seufzen zitterte es hinauf an der langen Westküste: Wasser! Und da war genug, freilich, dicht vor ihnen, ein ganzes gewaltiges Weltmeer voll! — Der Seelöwe begreift es nicht.
Weiße Vogelschwärme überall auf den Klippen. Und die Jagd im Wasser, die große Treibjagd. Die Weibchen und jungen Tiere nehmen die Mitte; an beiden Flanken aber halten die Alten, die mächtigen, bärtigen, vier Meter lang. Immer enger schließt sich der Kreis, immer niedriger wird das Wasser, immer geschlossener die Heringsschwärme an der Mole. Kein Mensch fischt — heut ist Feiertag. Müde und verschlafen starren ein paar gelbe Bengel herab von der Darse. Die Seelöwen fassen zu, greifen, schlingen, jagen in die Silberwolken. Werfen sich hoch, schießen hinein ins Wasser, zehn, zwanzig zugleich. Zwischen ihnen kleine, kluge Köpfe, so menschlich wie sie. Vögel, die Fische wurden, wie sie: Pinguine. Die sind neidisch, können immer nur einen Fisch fassen, wenn die Robben viele Dutzende schlingen. Ein riesiger Bulle, uralt, schwer und wuchtig, hebt sich auf die Uferplanken, daß sie laut krachen. Schnauft, prustet, wiegt den Kopf, blinzelt durch die Sonne ins Boot hinüber. Der weiß es, der Alte, weiß es gut, kennt das Geheimnis des Lebens. Fisch werden, denkt er, das ist es! Wie wir es machten! Wie es die frechen Vögel da machten, die Pinguine! Fisch werden, o Mensch, Fisch werden! Ins Meer zurück! — Das ist gewiß, daß er lacht. Sieht lachend dem plumpen Pelikan zu, der ins Wasser klatscht. Platsch, wie ein dicker Ball! Der stößt den Kopf hinunter, bringt ihn wieder heraus, hat seinen Hering im Klappschnabel. Wirft ihn hoch, fängt ihn im Kropf, flattert mühsam auf, von den Wellen zurück auf die Klippe. Wie ungeschickt, denkt der Alte, wie täppisch und plump! Und wie um zu zeigen, was er kann, springt er hinab von den Planken mit einem gewaltigen Satze, taucht wieder auf im Augenblick, die Beute zwischen den Zähnen. Keinen Hering diesmal, einen andern Fisch, drei Schuh lang. Er hat den zappelnden quer im Maule, wirft ihn hoch wie der Pelikan, fängt ihn auf. Noch einmal und wieder, wie ein Jongleur! Möwen kommen, fünf, sechs, schreiend und kreischend. Fliegen ihm um den Kopf, hacken in den Fisch, wollen auch ihr Teil. Da beißt er zu, schlingt die eine Hälfte, läßt die andere den Vögeln, großmütig, mitleidig fast.
Und wieder hinein in die Hatz —
Die schwanke Treppe hinauf auf den Hapagdampfer. Ein Offizier, groß, blond, blauäugig, kam ihm entgegen, preßte ihm kräftig die Hand. Frank Braun erkannte ihn gleich; in der Südsee war er vor Jahren mit ihm gefahren. »Wie geht's?« fragte er. — »Wenn Sie kommen — gut!« rief der Hamburger. »Sind wieder mal Eiermann!«
Frank Braun lachte. Eiermann — das war er oft gewesen — einziger Kajütspassagier! Der ist stets beliebt in der Offiziersmesse — er bedeutet: bessere Kost, Passagierkost — und besonders die Eier zum Frühstück! »Das ist recht,« sagte er. Er wandte sich um, sah ein paar Männer und Frauen an der Reeling stehen. »Und die da? — Keine Passagiere?«
Der zweite Offizier nickte. »Doch! — Aber alles Zwischendeck: Einen ganzen Zirkus haben wir! Rauf nach Guayaquil.«
Dann kam der Kapitän, mit ihm der Agent; der las ihnen das Telegramm von der Ermordung des Thronfolgers vor. »Es wird Konflikte geben drüben!« sagte er. »Das wird Wien nie ruhig einstecken, das nicht!«
Der Zweite schlug sich auf die Schenkel. »Es hat sich vielzuviel gefallen lassen von der Lausebande. Soll endlich dreinhauen.« Und er pfiff: »Prinz Eugen, der edle Ritter« —
Die Zirkusleute machten es sich bequem auf Deck. Sie schlugen kleine Zelte auf neben den Käfigen. Drei Löwen waren da und ein schöner Tiger, dann ein räudiger alter Wolf, ein syrischer Tanzbär und ein paar Hyänen. Hundsaffen und Meerkatzen; ein Angorakater, ein Pudel und eine Dogge; dazu Kakadus und Papageien. Und Pferde natürlich — achtzehn Pferde; auch ein kleiner Esel war dabei. Dann die Menschen; die Frau Direktorin, dick, sehr überfettet und schwammig, aus Toulouse. Zwei Brüder aus Maestricht, Tierbändiger der eine und der andere Degenschlucker. Zwei Reiterinnen, zwei Tänzerinnen — und die eine war hübsch. Mehrere Clowns, dann die Bedienungsleute. Und endlich Louison, ein blondes Ding von elf Jahren, der Direktorin Pflegekind — das tanzte auf dem Drahtseil. Sie war überall herum an Bord, kletterte in den Masten, stieg mit dem Ingenieur hinunter in die Maschine. Oben auf der Brücke spielte sie mit dem Kapitän und den Offizieren, in der Küche mit dem Koch, im Heck mit dem Zimmermann. Jeden Matrosen, jeden Heizer kannte sie, und ein jeder hatte etwas für sie. Was immer die Mama brauchte, erschmeichelte Louisen — und man braucht sehr viel an Bord, wenn man mit einem Zirkus reist, mit über zwanzig Menschen und zweiundfünfzig Tieren.
Am Sonntag lag man in Arica; da gingen die Clowns an Land, die Tänzerinnen und der Degenschlucker, gaben eine kleine Vorstellung auf der Plaza. Aber am Abend war Vorstellung an Bord; dazu hatte der Kapitän die Honoratioren geladen. Der Bär tanzte, die Clowns prügelten sich und die Äffchen spielten Soldaten. Die fette Direktorin führte die Papageien vor, die Tanzmädchen hupften und der Degenschlucker fraß zehn Säbel. Einigen von der Schiffsmannschaft gefiel er besser, und den andern die hübsche Tänzerin; darin waren aber alle einig: daß die höchste Kunst die kleine Louison gab. Man hatte ihr ein Seil gespannt, längs über das Schiff, von einem Mastkorb zum andern. Oben brannten bengalische Fackeln, eine grüne vorn und eine rote achtern. Es gefiel dem Kapitän nicht, daß man Steuerbord und Backbord so ihr uraltes Recht nahm — aber er ließ es gehn, um Louisons Willen. Sein Herz lachte, wie sie die Spieren hinaufsprang. »Da schaut zu, Jungs!« rief er den Matrosen zu. »Da könnt ihr was lernen!«
Louison war in rosarotem Trikot, sie lachte, und die blonden Haare flatterten in der Nachtbrise. Der Mann im Korb gab ihr ihren Stab, an beiden Enden mit großen Lampions geschmückt, einen roten wieder und einen grünen. Sie faßte ihn fest in der Mitte, schob den linken Fuß vor, scharrte ein wenig auf dem Drahtseil, wie ein Pony im Sand. Dann schritt sie dahin —
Atemlos starrten die Seeleute, keiner sprach ein Wort. Doch plötzlich, mit raschem Auflachen, rief der Kochsmaat: »Joh! Se hatt de greune Lamp an Backbord und de rote an Stürbord!«
Keiner lachte — der Kapitän warf ihm einen bösen Blick zu. Die, die neben dem Koch standen, zischten ihn an. Aber die kleine Louison hatte ihn wohl verstanden — sie blieb schaukelnd stehn, zog die Lippen hoch. Und vorsichtig, rechts hebend, links senkend, wandte sie den schweren Bambusstab, Zoll um Zoll, führte die rote Lampe hin und die grüne her. Nickte dann, leicht, graziös zu der Brücke hin, zum Kapitän. Der blinzelte ihr zu mit klugen kleinen Augen; aus seinem braunen Barte brummte es: »Lütte Deern! Brave lütte Deern!« — Aber die dicken Schweißtropfen perlten von seiner Stirn.
Keiner rief ein Wort, keiner klatschte. Sie starrten hinauf mit emporgereckten Hälsen, mit verhaltenem Atem, auf den rosaroten Bub, der am Sternenhimmel tanzte, unter dem Kreuz des Südens. Langsam, Schritt für Schritt, von der grünen Fackel zur roten, leicht schwankend, mitten durch die Luft.
Als sie am Fockmast war, fing ein Matrose sie auf, nahm ihr die Stange aus den Händen. Und die kleine Louison grüßte, warf Kußhändchen hinunter, dankte für das wilde Klatschen der schwieligen Fäuste, für den heiseren Schrei aus hundert Seemannskehlen. Sie schickte sich an, wieder zurückzugehn, aber der Kapitän gab es nicht zu. »Nee!« sagte er, »da geh ich lieber selber — dann hab ich weniger Angst!«
Louison ging herum mit dem Teller, sammelte ein. Und sie gaben alle — auch die Schiffsjungen hatten noch einen versteckten Groschen. Aber der Kapitän nahm die Kleine in seine Kabine, suchte herum im Schubfach, gab ihr ein Band mit des Schiffes Namen »Thuringia«. Und einen silbernen Serviettenreifen mit dem Hapagzeichen. Da küßte ihn die kleine Louison.
Sie liefen Ilo an und Mollendo. Es war Mittwoch früh, als Frank Braun auf die Brücke kam zur Wache des Zweiten.
»Wann sind wir in Callao?« fragte er. »Ich muß gleich rauf nach Lima.« — Der Hamburger lachte hart auf. »Callao? — Das werden Sie in zwei Stunden sehn! Aber auf Lima müssen Sie heute verzichten, Doktor!«
Das war ihm unerwartet. »Wieso?« fragte er. »Fahren wir so bald wieder ab? Ich will nur ein paar Bekannten die Hand schütteln.«
Der Zweite pfiff ein paar schrille Töne. Dann, mürrisch: »O — wir haben viel Zeit jetzt. Bleiben wochenlang liegen vor Callao. Oder: gehn überhaupt nicht hin.« Er reckte den Arm, zeigte hinauf auf den Mast. »Da! Schauen Sie!« Frank Braun blickte nach oben — da flatterte ein kleiner gelber Wimpel.
»Was ist geschehn?« fragte er. »Wer ist krank?«
Der Offizier trat näher zu ihm: »Der Kapitän wird's Ihnen ja doch sagen, wenn er heraufkommt — es ist kein Geheimnis. Wer jetzt krank ist, weiß es nicht — aber einer ist tot. Wir haben ihn ins Meer gesenkt, achtern, vor drei Stunden.«
»Wen?«
»Den großen Clown!«
»Was war es?«
Der Hamburger zuckte die Achseln: »Gelbes Fieber.«
In Callao nahm man sie nicht, und nicht in Salaverry noch in Manta. In Guayaquil nicht und nicht in Buenaventura. Bei Kap Blanco starben zwei der Pferdeknechte, einen Tag später senkten sie die Schulreiterin ins Meer. Kein Arzt war an Bord — und die Ärzte der Hafenbehörden hüteten sich wohl, an Bord zu gehn. Man schickte sie weg von einem Hafen zum andern, mitleidslos, grausam, ohne Erbarmen.
»Die Schweine!« schimpfte der Zweite.
Aber der Kapitän sagte: »Sie haben ganz recht! Einrichtungen haben sie nicht — sollen sie sich die ganze Stadt von uns verseuchen lassen?«
Sie krochen hinauf, nordwärts, mit vier Meilen Fahrt.
Ihre Hoffnung war Panama — da saßen die Yankees. Aber man schickte sie fort, auch hier. Die Quarantänestation war überfüllt. Wenn man draußen liegen wollte — sechs Wochen lang? Doch es sei wohl besser, hinaufzudampfen nach Kalifornien. Der amerikanische Doktor rief: »Ihr seid sicher genug! Kein Engländer verbrennt sich die Finger an euch.«
Kein Engländer? Da erfuhren sie, daß Krieg sei — Krieg mit Frankreich, Krieg mit Rußland, Krieg mit England —
Der Kapitän lachte: »Sonst niemand?«
»O ja!« rief der Hafenkapitän. »Belgien, Serbien, Montenegro, Portugal! Und die Japsen kommen bald! Dann die Italiener, die Rumänen, die Griechen« —
Sie wollten es nicht glauben — aber man gab ihnen Zeitungen, hohnlachend; ganze Bündel voll zogen sie hinauf. »Lest nur! Mit Deutschland ist's aus! Bis ihr zu Friscos Goldenem Tor kommt, ist längst Friede — und dann gibt's kein Deutschland mehr auf der Landkarte.«
Die Amerikaner fragten, was man haben wolle; aber der Kapitän lehnte alles ab. Nur frisches Wasser nahm er an und einen Kasten mit Arzneien. Dann dampfte er weiter.
Oben, in seiner Kabine, entfalteten sie die Blätter: N. Y. Herald, N. Y. Times, World, Tribune, Sun und ein paar Lokalblätter aus der Kanalzone.
Sie starrten auf die riesigen Überschriften.
»180 000 Deutsche fallen im Sturm auf die Lütticher Forts — — »Der Kronprinz beging Selbstmord« — — »Die Serben besiegen die Österreicher, nehmen 80 000 Gefangene, töten 150 000« — — »Sieg der Russen in Galizien, österreichische Verluste über 400 000« — — »Seeschlacht in der Nordsee! Neunzehn deutsche Schlachtschiffe von den Engländern in den Grund gebohrt.«
Der Kapitän legte die Blätter aus der Hand, gab sie dem Ingenieur hinüber. Aber der schob sie zurück: »Nein, ich mag auch nicht mehr lesen.«
»Was meinen Sie, Doktor?« fragte der Kapitän.
»Übertrieben natürlich,« sagte Frank Braun.
Da hob sich der Kapitän. »Übertrieben? Ich will Ihnen was sagen: es sind alles ganz gemeine infame Lügen! Niederträchtiger amerikanischer Schwindel!«
Der Zweite stand zwischen der Tür: »Darf ich die Zeitungen haben auf einen Augenblick?«
Der Kapitän gab ihm den ganzen Stoß. »Da, nehmen Sie! Nur weg damit — so rasch wie möglich!« Er stieg, mit starken festen Schritten, auf die Brücke.
Frank Braun ging in seine Kabine, legte sich hin.
Was war nur? Was war anders geworden in dieser Viertelstunde? Was ging denn vor? War der Kapitän ein andrer — und der Ingenieur? Und — — er selbst?
Es schien ihm, als ob er trunken sei. Er wollte nachdenken — und es ging nicht.
Er griff nach einem Buche — aufs Geratewohl; nahm Jacopone da Todi, schlug ihn auf.
Und er sang halblaut:
Stabat mater speciosa
Jeuxta foenum gaudiosa,
Dum jacebat parvulus.
Cujus animam gaudentem,
Lactabundam ad ferventem
Pertransivit jubilus.
O quam lacta et beata,
Fuit ill' immaculata
Mater unigeniti!
Quae gaudebat et ridebat,
Exultabat cum videbat
Nati partum inclyti!
Quis est is, qui non gauderet —
Er stockte. Das war schön, ganz gewiß war es schön! Woher nahm er die Farben nur, diese schillernden, jubelnden Regenbogenfarben — der arme Narr von Todi?
Aber dann — nein! Weshalb sang er jetzt die »Speciosa«? Jetzt? — Er sollte die »Dolorosa« singen!
Singen nicht Millionen Menschen die »Dolorosa« jeden langen Tag — während die »Speciosa« nicht hundert lasen in sechs Jahrhunderten? Die »Dolorosa« ist das Lied der Menschen!
Er begann:
Stabat mater dolorosa
Juxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius —
Er sprang auf. Was ging ihn der Todaner an, der ein Heiliger war und ein Wahnsinniger und ein Dichter: alles zugleich! Was die Jungfrau — heute? Speciosa — Dolorosa — so oder so — wie sie gerade ein Dichter sah!
Dichter? Ah: es gab keine Kunst mehr — heute!
Gab nur noch: Fäuste, Kugeln, Granaten, Torpedos!
Er lief durch die Gänge, eine Treppe hinab, über Deck, eine andere hinauf — vorne zum Bug. Lehnte über die Reeling, starrte in blaue Wogen, die sich teilten an der Schneide des alten Schiffs.
Und der weiße Schaum da unten ward ihm zur Taube — und die Taube sang, wie sie oft ihm gesungen. Aber kein Liebeslied, so wie einst, kein Lied von seinem blutenden Herzen. Auch kein freches Lied, das durch den Wind pfiff, wie ein Schlag von Peitschen. Nun schluchzten, wie ein Harfenspiel, die weißen Wogen, als ihm die Taube sang:
— Eia Mater, fons amoris,
Me sentire vim adoris,
Fac ut tecum sentiam!
Omnes stabulum amantes
Et pastores vigilantes,
Pernoctantes sociant. Per virtutem Nati tui
Ora, ut electi tui
Ad patriam veniant!
Und seine Lippen sprachen: »Ora, o piissima, o dulcissima, ora! Bitte, du süßeste Jungfrau, seligste Jungfrau, für deine Auserwählten, daß sie heimkehren mögen in ihr Vaterland! Bin ich nicht deiner Auserwählten einer, süße Jungfrau Maria? Wer, in diesen Tagen, liebte dich, so wie ich es tat? Wer sang dir Lieder, wer schrieb dir Märchen? Liebe Frau, süße, geliebte Frau, schöne göttliche Frau, führe mich heim ins Vater — ins Va — ins — —«
Er sprach es nicht aus. Das Land, das jetzt vor seinen Augen lag — das war Umbrien. War das Land der Heiligen — und der Zauberer auch. Er sah Narni und Terni, Spoleto, Trevi und Perugia, sah des heiligen Franziskus Stadt und die des seligen Jakob. Und die süßen Ufer des Trasumener Sees —
War das sein Vaterland? Lagen nicht irgendwo vor Wien schon die Leute von Assisi und die von Todi? Waren sie nicht stets Guelfen gewesen, die die Ghibellinen haßten und zum König von Frankreich schworen? Hieß nicht der Heilige — Franz — gerade zu Frankreichs Ehren! Predigte er nicht lieber und besser in der Sprache des Pariser Hofes als in der Virgils oder der Dantes?
Er liebte den heiligen Franz, der mit den Vögeln sprach und der das große Lied sang an seine Schwester, die Sonne! Aber er liebte den andern nicht weniger, den Staufenkaiser, den jener zur Hölle warf. Ihn, Friedrich II., Enzios Vater und Manfreds, der mit deutscher Faust griff an die Angel aller Welten. Der hinüberflog über Jahrhunderte, der den Kreuzfahrern in Palermo das freche Buch schrieb: »De tribus impostoribus«. — Drei Schwindler: Moses, Jesus, Mahomet!
Frank Braun dachte: ›Gleich alle drei! Nur ein Schwabenkaiser konnte so zugreifen!‹ Was war sein Vaterland?
Seine Heimat, das war gewiß, war Europa. In Wien war er zu Hause, in Berlin, in München und am Rhein. Aber nicht weniger in der Bretagne, in der Provence, in Paris. Und in Italien — o überall! In Andalusien auch und in der Stadt, die den Prado barg. Und in Stockholm, in Pest, in Zürich und Antwerpen. In — —
Was war sein Vaterland?
War er ein Deutscher — er? Weil er geboren war, irgendwo am Rhein? Kannte er nicht so viele Sprachen und sprach sie öfter als deutsch?
International? — Nein? So hatte er nie empfunden. Aber es gab über allen Völkern ein anderes Volk, höher, edler und größer. Die Kulturnation hatte er es genannt — ihr gehörte alles an, was hinausflog über die Massen. Und er kannte sie gut, fand ihre Bürger überall in der Welt. Es war da, dieses Volk, ganz gewiß, ohne jeden Zweifel.
So nah war es, so mit Händen zu greifen — gestern noch.
Und heute? Weg, fort — als ob es nie existiert hätte! Es gab nur noch Deutsche, Russen, Franzosen, Engländer. Und die schlugen sich tot, gegenseitig!
Warum denn nur?
Um ihrer Vaterländer willen?!
Er lachte bitter auf. So hatte es der Mann aus Todi nicht gemeint, als er die Mutter Gottes anrief! Das Vaterland, das er meinte, das war sein Todi nicht, das gerade 40 000 Mann zu Fuß und zu Roß gegen die Nachbarstadt Perugia ins Feld schickte. Das war Umbrien nicht, dessen Grafen und Städte sich gegenseitig befehdeten — für Welf und für Waibling! Und Italien ganz gewiß nicht — in dem Papst und Kaiser und König und Städte und Fürsten einander auffraßen. Italien — das war überhaupt kein Land, war nur ein geographischer Begriff, war ein mörderischer Ozean, in dem immer der größere Fisch den kleineren verschlang. — Des armen Narren Jakob Vaterland war der stille Frieden in der heiligen Jungfrau gebenedeitem Schoß.
Und der andere, der Staufe Friedrich — hatte der ein Vaterland? Dieser Christ, der den christlichen Propheten nicht weniger höhnte wie den jüdischen und den arabischen! Dieser Deutsche, der in Palermo Hof hielt, dessen Kanzler ein Dichter aus Pisa, dessen bester Freund ein Jude aus Jaffa und dessen weise Berater Sarazenen waren! Nein, der Kaiser lachte genau so hell über den Schwindel der Vaterländer wie über den der Religionen!
Vaterland? Hier das Schiff war sein Vaterland nun. Deutsche Offiziere und Ingenieure — aber Chinesen als Heizer in der Maschine. Und die Passagiere, die Zirkusleute — Franzosen, Flamen, Spanier, Basken und Bretonen. Fest zusammengeschmiedet alle, ein ausgestoßenes Volk von Unreinen, zitternd, heulend unter der schweren Peitsche des gelben Dämons!
Vorgestern nacht starb der Stallmeister und der kleine bucklige Pferdeknecht. Letzte Nacht, dicht vor Panama, der Degenschlucker. Wen fraß heute das Meer?
Er wandte sich um. Da lag, vor seinem Löwenkäfig, der mächtige Tierbändiger, nicht weit von ihm die schwammige Direktorin. Die blonde Louison bockte auf den Treppenstufen, sie spielte nicht, lachte nicht, zupfte nervös an den Silberperlen ihres Rosenkranzes.
Die nicht, die kleine Louison nicht! Liebe Mutter Jungfrau, die kleine Louison nicht!
Er ging zurück in seine Kabine. Hörte Lärm unten, Schreien und erregte Stimmen. Er stieg hinab, riß die Türe auf zur Offiziersmesse. Da lärmten die jungen Burschen, Schiffsoffiziere und Ingenieure, lachten und tranken.
»Prost, Doktor!« rief der Dritte, reichte ihm ein Glas Bier. »Es lebe der Kluck!«
»Was ist denn los, beim Teufel?« fragte Frank Braun.
Einer der Ingenieure lag lang über den Tisch gelehnt, studierte eifrig in den Blättern.
»Brüssel!« schrie er. »Hier wieder! — Sie haben Brüssel! Jetzt wird's auf Antwerpen gehn!«
»Die Deutschen siegen, Doktor,« jauchzte der Zweite. »Sie halten Lüttich, haben Namur und Lille! Sie belagern Maubeuge, schlugen die gottverdammten Engländer bei Mons!«
»Auf Paris marschieren sie, auf Paris!« Er riß ein paar Zeitungen auf, hielt sie ihm unter die Nase. »Da, lesen Sie doch! Es steht alles drin — nur versteckt irgendwo auf der sechsten oder siebenten Seite. Vorne lügen sie ihren Lesern die Hucke voll, diese sauamerikanischen Preßlümmel! Die Engländer bezahlen sie!«
Frank Braun griff nach den Blättern. »Und die Siege der Serben und Russen? Und die Seeschlacht, in der neunzehn deutsche Schlachtschiffe untergingen? Und —«
Der kleine Zahlmeisterassistent hieb mit der Faust auf den Tisch. »Erlogen! Alles erlogen und erstunken! Die Deutschen siegen! Herrgott, wer doch dabei wäre!«
Der Dritte hielt noch immer das Glas. »Trinken Sie, Doktor, trinken Sie! Es lebe Deutschland, es lebe der Kaiser!«
Frank Braun nahm das Glas, tat ihnen Bescheid. »Es lebe unser Vaterland!« sagte er.
Und sie brüllten und jauchzten: »Das Vaterland, unser deutsches Vaterland!«
»Schneidet die Telegramme aus,« sagte Frank Braun, »bringt sie dem Kapitän.«
Dann ging er.
Seltsam. Er, Frank Braun, hatte auf Deutschland getrunken und auf den deutschen Kaiser! Auf — das Vaterland! Es war ihm gewiß nicht ernst darum — er tat es den prächtigen Burschen zuliebe.
Wie ihre Augen leuchteten! Wie ihre Herzen jubelten und jauchzten! Wie sie alles vergaßen ringsum, das gelbe Fieber, den heimtückischen Tod, der die Krallen ausstreckte nach ihnen und sie hinausjagte, wie Aussätzige, auf das erbarmungslose Meer! Wie sie alle nur eines dachten, nur eines fühlten: »Die Deutschen siegen!«
Das war wohl wahr — auch ihn freuten diese Nachrichten. Aber es war nur ein leichter Kitzel, irgendein angenehmes Kritzekratze auf der juckenden Seele. Es griff ihn nicht, packte ihn nicht.
Erregt? Er? O je! Nur, freilich, daß dieser helle Jubel, diese wilde Begeisterung aus den andern brach, plötzlich, gemeinsam, vulkanisch — das schien ihm schön. Das allein —
Und er dachte: es wäre wohl gut, drüben zu sein. Zu sehn, zu fühlen, zu erleben im gewaltigen Meere der deutschen Massen, was er hier im Wasserglase sah. Die ungeheure gewaltige Suggestion von hundert Millionen — dieser rasende Glaube —
O ja — das mochte Berge versetzen!
Und dann war es groß! Dann — schön!
An diesem Tage starb keiner von den Zirkusleuten. Wohl aber drei Kulis und ein deutscher Seemann.
Sie liefen Corinto an und wurden weggeschickt. Sie kamen nach La Libertad, und man jagte sie fort. Wie von Salvador und von San José de Guatemala —
Es starben wieder drei Leute von der Mannschaft. Es starben zwei Chinesen und zwei spanische Pferdeknechte. Es starb der rothaarige Clown und die alte Tänzerin. Es starb auch der dritte Offizier, dieser große blonde Junge aus Rostock.
Die Chinesen weigerten sich, die Leichen einzunähen. Der Bootsmann tat es mit dem Kochsmaat. Drei Tage darauf waren sie tot.
Auf der Höhe von Tehuantepec starb Moses, der Schiffsjunge, zwei Stunden später die Direktorin, Sie hatte vorher schon ein Testament gemacht — zu Louisons Gunsten — hatte es dem Kapitän gegeben. Wenn auch die Kleine starb, sollten alles die bekommen, die übrigblieben von ihrer Truppe. Alles: die Tiere, das Zirkuszelt, die Garderobe, die Kasten und Kisten. Und das bißchen Geld.
Sie starb schwer. Schrie und tobte. Kämpfte so lange. Verlangte immer wieder nach einem Priester —
An dem Tage holte sie ein englischer Kreuzer auf, schloß zwei blinde Schüsse ab, befahl ihnen, beizudrehen und das Fallreep herabzulassen. Als sie lagen, kam die Barkasse längsseits ein Offizier sprang die Treppe hinauf.
»Wo ist der Kapitän?« fragte er.
Der stand dicht vor ihm. »Hier!« sagte er.
»Was wollen Sie?«
»Sie sind mein Gefangener!« sagte der Engländer. »Sie kommen hinüber an Bord der ›Glasgow‹. Das Kommando Ihres Schiffes übernehme ich. Lassen Sie die deutsche Flagge da herunterholen!«.
»Sonst nichts?« fragte der Kapitän. »Hängt euch auf.«
»Was?« fuhr ihn der Offizier an. »Was? Sie weigern sich, meinen Befehlen nachzukommen?«
»Ich weigere mich,« sagte der Deutsche.
Der Engländer pfiff. Im Nu sprangen sechs Mann das Fallreep hinauf. »Faßt ihn!« befahl er.
»Rührt mich nicht an!« sagte der Kapitän. »Es ist besser für euch —« Er sprach so still und ruhig, so sicher und überzeugend, daß die Leute stutzten. »Wir haben gelbes Fieber an Bord,« fügte er hinzu. »Achtzehn Tote bisher an Mannschaft und Passagieren. Zwei Leichen noch an Bord —« Er wies mit der Hand nach dem gelben Wimpel da oben, winkte dann seinem ersten Offizier: »Zeigen Sie dem Herrn das Schiffsjournal!«
»Es ist alles Schwindel!« rief der Engländer. Aber er schickte doch an Bord seines Kreuzers, den Arzt zu holen.
Der Erste hielt ihm das Buch hin, aber der Brite wies ihn verächtlich ab. »Ich kann nicht Deutsch lesen,« sagte er. »Und dann — da mögen Sie viel hineinschreiben.«
Der Arzt kam, man zeigte ihm die Säcke, in die die Leichen genäht waren.
»Schneiden Sie auf!« befahl er.
»Schneiden Sie selbst auf!« gab ihm der Kapitän zurück. Da grinste der Zweite. Der Arzt winkte den englischen Matrosen. Die machten es kunstgerecht genug, schnitten die Nähte durch, zogen mit den Messern die Leinwand auseinander. Und der Arzt beugte sich über die gräßliche Masse, die einmal eine Zirkusdirektorin war.
Dann ging er zurück, sprach leise mit seinem Offizier.
»Wollen Sie meine Kranken sehn?« fragte der Kapitän. »Ich habe noch neun oder mehr — vielleicht ist der eine oder der andere davon schon tot inzwischen.«
Der Arzt antwortete nicht. Der Offizier zuckte mit den Achseln, wandte sich dann an den Kapitän: »Ich werde die Befehle meines Kommandanten einholen. Inzwischen bleiben Sie hier ruhig liegen; ich lasse die sechs Mann als Wache da.« Er grüßte leicht, wandte sich zum Fallreep.
Aber der Hapagschiffer vertrat ihm den Weg. »Einen Augenblick, Herr! Nehmen Sie lieber Ihre sechs Mann mit. Sonst lasse ich sie zusammen mit meinen Leichen einnähen und über Bord werfen. Und sagen Sie Ihrem Kapitän, daß ich nicht daran denke, mir von ihm Befehle geben zu lassen. Ich werde, wenn Sie zurück sind an Bord, genau zehn Minuten warten, hören Sie! Das gibt Ihnen Zeit, mit dem Kommandanten zu sprechen, ihm Bericht zu erstatten. Dann werde ich Dampf geben lassen.«
Der Engländer verschluckte einen Fluch. Er spie über die Reeling, räusperte sich; sagte, so ruhig es gehn mochte: »Nehmen Sie doch Vernunft an, Mann! Unsere Kanonen werden Ihren Kahn hinuntersacken, sobald nur ein Mundvoll Rauch aus Ihrem Schornstein kommt!«
Aber der Hamburger wich keinen Schritt zurück. »Erzählen Sie das Ihrer Großmutter, Mann!« antwortete er. »Ich habe Passagiere an Bord: Spanier, Belgier, Holländer, Franzosen. Schießen Sie ruhig, wenn Sie das für eine Heldentat halten!«
Der Offizier antwortete nicht mehr. Er winkte seinen Leuten, stieg hinab in die Barkasse. Man sah den Matrosen an, daß sie froh waren fortzukommen von dem Fieberschiff.
Die »Thuringia« wartete ab, wie der Kapitän es befohlen; dann setzte sie Dampf auf. Der Kapitän stand oben auf der Brücke, neben dem Steuermaat; er ließ einen schönen Bogen fahren, so nahe heran an den Kreuzer, als es nur eben ging. Dann hielt er auf Norden.
Die »Glasgow« feuerte einmal, blind. Und noch einmal. Dann gab sie einen scharfen Schuß ab, der hoch über die Masten schlug, weit ins Meer klatschte —
Die »Thuringia« antwortete — mit ihrer Flagge. Dreimal, höhnisch genug, grüßte das deutsche Tuch den Union Jack. Nicht eine Sekunde stoppte sie, fuhr langsam, nordwärts, ihre Schneckenfahrt. Und der Kapitän blickte, lange, voller Liebe, auf seine schwarzweißrote Flagge, die das Eiserne Kreuz zierte.
Der englische Kreuzer bog ab, fuhr nach Süden hin. Sein Kommandant hatte schon recht: das ist ein Teufelsbissen — ein Fieberschiff.
Jeden Tag starben sie und jede Nacht. Die Panneaureiterin starb, drei Stallknechte und auch der letzte der Clowns. Dann der zweite Ingenieur, ein Steward, ein Chinese und noch zwei Leute der Mannschaft. Und immer neue erkrankten —
Sie liefen vier mexikanische Häfen an — überall jagte man sie fort.
Eines Morgens schickte der Löwenbändiger nach dem Kapitän. Er sagte, daß er wohl sterben würde, und bat ihn, für seine Tiere zu sorgen.
»Lassen Sie sie nicht verhungern!« flehte er. »Lassen Sie ihnen ihr Fressen geben. Und wenn keiner mehr da ist, der für sie sorgen will — oder kann — dann schießen Sie sie tot.«
Der Kapitän versprach es fest, aber der mächtige Flame war noch nicht zufrieden. »Schwören Sie, Kapitän,« drängte er, »schwören Sie es mir!«
»Ist es nicht genug, wenn ich Ihnen mein Ehrenwort gebe?« sagte der Kapitän. »Als Offizier der deutschen Marine?«
»Doch, doch!« winselte der andere. »Doch! Ja! Gewiß! — Aber bitte, Kapitän, bitte, schwören Sie es — trotzdem!«
Der Kapitän hob die rechte Hand. »Wobei soll ich schwören?«
»Bei — bei Gott!« flüsterte der Kranke.
Der Kapitän sprach. »Bei Gott schwöre ich dir, daß ich für deine Löwen sorgen werde.«
»Und für den Tiger!« rief der Flame.
»Gewiß,« bestätigte der Kapitän. »Für den Tiger und alle Tiere an Bord. Ich schwöre es dir! — Sind Sie zufrieden?«
Der Löwenbändiger schluchzte. Griff die Rechte des Kapitäns, küßte sie heiß. Der zuckte — dann ließ er ihm die Hand.
Er ging zurück zur Treppe — blickte nachdenklich auf seine Finger. »Mach mein Bad zurecht!« rief er dem Steward hinauf. »Und schmeiß den antiseptischen Dreck hinein.« Er nahm ein paar Stufen — dann drehte er um. »Nun ist's ein Aufwaschen!« murmelte er.
Er trat in das Zelt; da hockte auf dem Boden die hübsche Tänzerin. Sie schlang beide Arme um das blonde Kind, das in ihrem Schoße schlief, bleich, jämmerlich mager, zuckend im Fieber. »Wie geht's?« fragte er. »Ein wenig besser seit heute morgen?«
Die spanische Tänzerin schüttelte den Kopf.
»So geht's nicht weiter, Mamsell!« sagte der Kapitän. »Noch sind Sie gesund — Sie müssen an sich selbst denken. Ich werde Ihnen eine Kabine geben lassen — heute abend noch.«
Das Mädchen sah ihn groß an. »Ja, Kapitän,« sagte sie langsam, »ja — wenn ich die Kleine mitnehmen darf.«
Der Kapitän brummte. Er versuchte, einen recht harten Klang in seine Stimme zu legen — und es gelang ihm nicht. »Die Kleine ist krank! Sie sind gesund. Sie müssen sich trennen. Sie werden selbst krank, wenn Sie sie stets im Arm halten. Sie müssen sich um sich selbst kümmern.«
Da lachte die Tänzerin. »Kümmern Sie sich um sich selbst, Kapitän? Oder kommen Sie herunter zu uns, der einzige von allen?«
Der Kapitän schnauzte: »Seien Sie nicht blöd, Mamsell! Das ist etwas ganz anders. Ich habe Pflichten! Stehn Sie auf und kommen Sie mit.«
Aber das Mädchen rührte sich nicht. »Sie sind verheiratet, Kapitän. Eine Frau haben Sie drüben und fünf Kinder — ich hörte es, als Sie Louison davon erzählten. Vier Jungen und ein blondes Mädchen, so alt, so schlank, so blauäugig, wie Louison ist. Ich aber — habe niemand in der Welt. Und ich habe auch eine Pflicht.«
»Dummes Zeug,« schimpfte der Kapitän. »Albernes dummes Zeug! Sie —« aber er sprach nicht weiter. Louison erwachte, sie erkannte ihn und streckte beide Ärmchen nach ihm aus. »Kapitän,« lallte sie, »lieber Kapitän —«
Der Kapitän beugte sich hinab, nahm die Kleine auf den Arm. Er fühlte ihren Puls, klopfte sie leicht auf die Wangen. »Lütte Deern!« Er trat an den Ausgang des Zeltes, riß den Vorhang auf. »Steward«, rief er, »Steward!«
Und als sein Steward oben erschien, fuhr er fort: »Die Mamsell wird hinaufkommen. Der Obersteward soll ihr eine Kabine geben, gleich hier vorne, Zwölf oder Vierzehn. Und vorher führen Sie sie rauf zu mir: sie soll mein Bad nehmen — verstanden?«
»Jawohl, Herr Kapitän!« rief der Steward.
Der Kapitän schlug den Vorhang zurück, bettete die Kleine auf die Matratze, kniete vor ihr. Er wandte sich, ein Glas zu nehmen, sah die Tänzerin stehn. »Was wollen Sie denn noch da?« fauchte er. »Sie sehn doch, daß ich dableibe!«
»O, Kapitän,« sagte sie, »Sie sind so gu —«
»Dummes Zeug!« brüllte der Schiffer. »Machen Sie, daß Sie fortkommen, Mamsell!«
Da nahm sie ihr Tuch und ging.
Am Abend traf sie Frank Braun. Sie stand vor ihrer Kabine, blickte hinüber zu ihrem Zelt. Er dachte: ›Saphiraugen hat sie.‹
Sie sprach ihn an: »Doktor! Bitte, gehn Sie hin, schauen Sie hinein. Der Kapitän ist drinnen bei Louison. Sagen Sie mir, wie es geht.«
Er nickte, ging auf Zwischendeck. Bei den Käfigen hörte er eine Stimme, trat näher heran. Er sah den Flamen bei seinen Löwen stehn, die ihre Mähnen an das Gitter rieben. Große Fleischstücke hatte er ihnen hineingeschoben, streichelte nun zärtlich die mächtigen Köpfe.
Und leise, ganz still, klangen die Flüsterworte: »Leb wohl, Allah! Leb wohl, Mahmud! Der Kapitän wird für euch sorgen. Er hat's versprochen, er hat's geschworen. Leb wohl, Abdullah!«
Wie ein Singsang, immer wieder und wieder — Frank Braun trat zum Zelt, schob das Ohr an die Öffnung des Vorhangs, lauschte. Aber er hörte nichts. Da zog er schnell den Vorhang zurück und trat ein.
Die kleine Louison lag, leise atmend, auf ihren Decken, ihre schmalen Händchen krampften sich fest um die großen Finger des Kapitäns. Der saß auf dem Boden, ruhig, ohne sich zu rühren; kühlte mit der rechten Hand die fieberheiße Stirne des Kindes. Er blickte sich um, sah den Eindringling.
Er wollte aufbrausen, aber Frank Braun kam ihm zuvor: »Schon gut, Herr Kapitän,« sagte er, »schon gut.«
Er ging hinaus und zurück zur Tänzerin. »Noch lebt Louison,« sagte er.
— Aber am Morgen war sie tot.
Der Löwenbändiger starb erst zwei Tage später, zusammen mit dem letzten der Stallknechte. Dann ruhte der Tod für eine Weile, aber er wachte hell auf, als sie nach Frisco kamen. Auch dort nahm man sie nicht an, brachte sie nicht zu der Quarantäneinsel. Man wies ihnen einen Platz an, zweieinhalb Meilen heraus; dort hieß man sie vor Anker gehn. Drei Wochen sollten sie dort liegen — drei Wochen nach dem letzten Todesfall.
Aber man schickte Ärzte jeden Tag, versorgte sie mit allem, was nötig war.
Und es war, als ob gerade darum das gelbe Tier noch einmal zeigen wollte, was es könnte: gleich in der ersten Nacht griff es vier Chinesen und drei deutsche Matrosen. Zwei von ihnen waren die, welche die letzten Leichen eingenäht hatten, und der dritte schlief mit ihnen Seite an Seite — da packte die Mannschaft zum erstenmal die große Angst. Sie steckten die Köpfe zusammen und tuschelten.
Der Zimmermann sprach für sie. Die Mannschaft weigerte sich nicht, o nein. Sie wollten sich selbst und dem Kapitän zeigen, daß sie mit ihm durchhielten bis zum letzten — gerade in dieser Zeit.
Aber sie verlangten, daß man losen sollte: wen es traf, der sollte die Leichen einnähen.
Der Kapitän schüttelte den Kopf. »Der wird die Leichen einnähen, dem ich's befehle!« erklärte er. »Ich bin Kommandant an Bord; ich allein bestimme und nicht das Los!« Das war der Bescheid, den er dem Zimmermann gab.
»Warum tun Sie den Leuten nicht ihren Willen?« fragte Frank Braun. »Nun werden sie sich weigern, nun erst recht. Und dann wollen Sie Ihren harten Schädel durchsetzen — ein hübscher Krach! Rebellion an Bord — das einzige, was uns noch fehlt!«
Da lachte der Kapitän: »Meinen Sie? Ich werde Ihnen zeigen, wie man die Jungens behandelt von der Waterkant.«
Er schickte den Steward nach seinen Offizieren und dem Oberingenieur; mit ihnen zusammen ging er hinunter. Und die vier Männer trugen, eine nach der andern, die Leichen auf Deck. Dann ließ er Segeltuch holen, Eisenstücke, große Nadeln und starkes Garn. Er hockte zusammen mit dem zweiten Offizier bei einer der Leichen, wie ein Schneider, mit untergeschlagenen Beinen. An die nächste machte sich der Ingenieur und der Erste. Sie rollten die Leinwand um die Kadaver, gaben ein Eisenstück hinein. Und sie nähten sachkundig, Stich um Stich, ohne ein Wort.
Einer um den andern kamen die Matrosen heran, drückten sich herum, schauten zu, drehten verlegen die Mützen. Frank Braun stand mitten unter ihnen.
Ohne es recht zu wollen, ging er vor. Setzte sich hin, neben den Kapitän vor die widerliche Leiche eines Chinesen. Griff eine Nadel auf —
›Das ist saublöd, was ich da tue,‹ dachte er. ›Warum mache ich's nur? — Und es wird eine schöne Stümperarbeit werden.‹
Im Augenblick saß der Zimmermann bei ihm, faßte das Tuch an, drehte mit drei schnellen Griffen die Leiche hinein.
»Weg da!« rief der Kapitän. »Keiner rührt die Leiche an ohne Befehl! Wir vier hier nähen — niemand sonst!«
Der Zimmermann stand auf, schlich zur Seite. Aber Frank Braun sagte: »Befehlen Sie Ihren Leuten, Kapitän, aber nicht mir. Ich tue, was ich für richtig halte.«
Und er dachte: ›Es ist gar nicht richtig! Es ist unglaublich dumm!‹
Warum sagte er es nur? So gut hätte er sich jetzt mit Anstand herausziehen können!
»Meinetwegen,« nickte der Kapitän. »Nähen Sie nur, Doktor. Aber ziehen Sie die Schnüre fest zu.« — Wie ein Urteil klang es ihm.
Aber er nähte doch, mühsam, ungeschickt, widerwillig. Er nahm sein Taschentuch, klemmte es zwischen die Zähne, um die Nase zu bedecken. Sein Chinese stank.
Die andern waren viel schneller fertig als er; dann half ihm der Zweite. Sie trugen die Leichen in das große Boot, schwenkten die Davits aus und ließen es ins Meer. Sie ruderten ein paar hundert Meter vom Schiffe fort, dort versenkten sie ihre Toten. Sie nahmen die Mützen ab; der Kapitän murmelte etwas, das wohl ein Gebet sein sollte.
Es war nicht sehr feierlich; man war es schon so gewohnt.
Früh am andern Morgen klopfte der Zweite an Frank Brauns Tür. »Kommen Sie, Doktor,« rief er, »ich will Ihnen was zeigen!«
Sie gingen auf Deck; der Offizier wies aufs Wasser.
»Sehen Sie dorthin!« lachte er. »Da schwimmt Ihrer!«
»Wer schwimmt?« fragte Frank Braun.
»Ihr Chinese!« rief der andere.
»Meiner?« Frank Braun spie aus. »Warum soll es gerade meiner sein?« Aber der Offizier überzeugte ihn rasch: »Es ist ganz sicher Ihrer. Das Eisenstück, das Sie ihm mitgaben zur Reise, war viel zu klein. Ich vergaß, es Ihnen zu sagen. So kam er wieder herauf und schwimmt nun herum.«
»Was wollen Sie tun?« fragte Frank Braun. »Ihn wieder herausfischen? Besser beschweren?«
»Nee!« sagte der Hamburger. »Ich nicht! Wenn Sie Lust haben? — Der wird schon allein Abschied nehmen von der Sonne und sich zu seinen Fischen zurückziehn.« Dann wurde er plötzlich ernst. »Der Zahlmeister ist krank.«
»Sonst noch jemand?« fragte Frank Braun.
»Nein« sagte, der Zweite, »sonst niemand.«
Frank Braun dachte: der Zahlmeister?! Der hatte nicht mit eingenäht, der nicht. Der hatte es von allen am meisten vermieden, mit den Toten und Kranken in Berührung zu kommen. Und gerade den nun krallte das gelbe Tier.
An diesem Tage und durch die ganze Nacht litt es ihn nicht bei seinen Büchern. Eine seltsame Unruhe faßte ihn; immer wieder lief er auf Deck. Stand an der Reeling, sprang die Brücke hinauf und wieder hinunter. Starrte ins Wasser, vom Bug oder achtern —
Und immer trieb der Chinese vorbei. In der glühenden Sonne erst und dann in der Mondnacht.
›Er will mich holen,‹ dachte Frank Braun. ›Der Fieberteufel ist in die gelbe Leiche gekrochen. Er will mich hineinhaben in sein Segeltuch.‹
Und gegen seinen Willen sprachen seine Lippen:
»Stabat mater dolorosa« —
»Speciosa! Speciosa!« verbesserte er. Aber es klang doch: dolorosa!
Es war die Kreuzigung, deren Bild ihn festhielt, mitleidlos, ohne Entrinnen.
Die von Kolmar —
Wie oft hatte er da gestanden, vor dem furchtbaren Gekreuzigten des Matthias Grünewald. Er wollte nie — aber es zog ihn. Wenn er in Freiburg war, in Straßburg — immer wieder mußte er den Zug nehmen nach Kolmar hin.
Einmal war er dort mit einer schönen Frau. Damals sagte er: »Es ist das Gewaltigste, das je Kunst schuf; du mußt es sehn!«
Die schöne Frau sah es. Sie wurde bleich, weiß, grün — wie das verwesende Fleisch des Messias. Sie fiel zurück, schrie dann, erbrach sich —
»Es ist entsetzlich,« flüsterte sie, »es ist entsetzlich.«
Er brachte sie hinaus in den Klosterhof, setzte sie nieder auf die Steinbank unter die Linden.
Und ging zurück, starrte, starrte auf den Toten am Kreuze.
Tod, Fäulnis, Verwesung. Und doch Leben! Und doch der Sieg aus allem Ekel der Vernichtung!
So war es — jetzt, jetzt auch! — Und doch anders!
Die Wellen trugen das Segeltuch, warfen es leicht auf und nieder. War es nicht, als ob sich die Nähte lösten? So stümperhaft war seine Arbeit —
Das war gewiß: er sah ihn. Durch das Tuch — ohne das Tuch — etwas sah er. Es schwärte und gärte, es faulte und stank — die Wasser spien sie aus, so ekel war diese Leiche. Und — diese Fäulnis, diese jämmerliche Vernichtung, dieser verwesende Kadaver — hatte doch Leben, hatte Leben, wie der gewaltige Christus von Kolmar.
Nur — was war es denn? Was nur?
Es grinste im Mondschein —
Kein Sieg war es, keine Befreiung aus allem Ekel. Kein letztes Fortwerfen verrotteter Fleischhüllen, kein Herausdrängen des großen Aufsteigens durch Eiter und Fäulnis —
Kein Prophet, kein Messias —
War eines, das sich wohl fühlte in all dieser Vernichtung, das sich sielte und aalte in dem Schleim der Verwesung.
Und das — trotzdem — die Finger ausstreckte.
»Heilige Jungfrau,« stammelte er, »süße Gottesmutter« —
Sechs Tage lagen sie vor dem Goldenen Tor, als der Zahlmeister starb.
Der zweite Offizier hatte ein großes Blatt in seiner Kabine aufgepickt, mit einundzwanzig Strichen — einen für jeden Tag der drei Wochen. Und jeden Abend um zwölf Uhr strich er einen aus. Sechs waren ausgestrichen — nun mußte er sechs neue hinzumachen. Er war ganz verzweifelt an diesem Tage.
Und wieder zwei Tage später, als der Küchenjunge starb.
»Wir werden nie herunterkommen!« seufzte er. »Noch sind vier Kranke da — und wer weiß, wie viele noch krank werden.«
In seiner Freiwache saß er zusammen mit dem kleinen Assistenten. Sie hatten ihren Plan: sie wollten gleich, sowie nur das Schiff abgenommen war vom Hafenarzt, auf die Bahn. Durch das Land fahren nach Neuyork. Und hinüber von dort mit einem Holländer oder Schweden. In sechs Wochen konnten sie in Kiel sein.
Nur dabei sein, nur mit dabei —
Noch fünf Tage — und wieder starb einer. Und wieder fingen die drei Quarantänewochen von vorne an.
Der Zweite saß in seiner Kabine; wie ein kleines Mädchen heulte er. »Wir werden nie fortkommen, nie!«
Aber der Assistent war pfiffiger. Er sagte nichts; aber er schlich herum, redete vor sich hin, jedesmal, ehe das Boot des Hafenarztes kam. Er hatte nun die Pflichten des Zahlmeisters, mußte hinunter die Gangway und mit den Leuten reden.
Tief in der Nacht klopfte es leise an Frank Brauns Tür. Er öffnete — der Zweite stand da, und mit ihm der kleine Assistent.
»Pst,« machte er, »leise!«
Wie zwei Verschwörer kamen sie herein, schlossen hinter sich ab.
»Wir können fort!« flüsterte der Kleine. »Ich habe einen von den Bootsleuten bestochen — fünf Pfund hat's gekostet. Er kommt morgen nacht mit einem Boot.«
»Famos!« sagte Frank Braun.
»Es ist nur —« fiel der Zweite ein, »Sie müssen uns helfen. Wir wollen uns nicht — wegstehlen — desertieren. Sie müssen mit dem Kapitän sprechen: dann erlaubt er's.«
Frank Braun zweifelte: »Glauben Sie? Er wird Unannehmlichkeiten haben, wenn die Behörden es merken.«
»Sie werden es nicht merken,« warf der Assistent ein, »sie können es gar nicht merken. Sie haben noch keine Listen gefordert, wissen nicht, was an Bord ist und was nicht. Reden Sie nur mit dem Kapitän — Ihnen kann er's nicht abschlagen! Und wenn er es Ihnen gestattet, muß er's uns auch erlauben.«
»Gut, gut,« sagte Frank Braun, »ich will's versuchen.«
Er sprach mit dem Kapitän, tat so, als ob der ganze Anschlag von ihm ausgehe, als ob die beiden sich nur ihm angeschlossen hätten. Der Kapitän war nicht sehr einverstanden. Ob er denn wirklich solche Eile habe? Er käme noch früh genug hinüber, es wäre höchst gleichgültig, ob man im Oktober sich totschießen lasse oder im Dezember.
Er wußte nicht, was er antworten sollte. Wollte er denn überhaupt hinüber?
Einerlei — das wollte er gewiß: fort vom Schiff!
Wenn er nur ein wenig Begeisterung gehabt hätte, ein wenig — Vaterlandsliebe! Nur ein kleines bißchen von dem Empfinden der beiden da!
Aber nichts war da, gar nichts. Er dachte nur: der Kapitän hat ganz recht. Es ist immer noch früh genug, sich totschießen zu lassen.
Endlich fand er etwas. »Kapitän,« sagte er, »wenn Sie die Möglichkeit hätten, heute nach Deutschland zu fahren — würden Sie bis morgen warten?«
Der Kapitän sah ihn fest an: »Nein, Herr, ich nicht! Ich würde nicht warten!«
»Also,« sagte Frank Braun.
Der Kapitän zuckte die Achseln; aber er gab die Erlaubnis.
Das Boot fuhr ab, gleich als der Mond herunter war. Frech, mitten durch den Hafen fuhr es, und niemand hielt es auf. Eine Kutsche nahm sie auf, brachte sie zum Bahnhof — da mußten sie ein paar Stunden warten.
Als der Zug herausrollte aus San Franzisko, rief der Zweite: »Nun sind wir frei!«
Und der kleine Assistent jauchzte: »Nach Deutschland! Es lebe der Kaiser!«
Frank Braun schwieg —
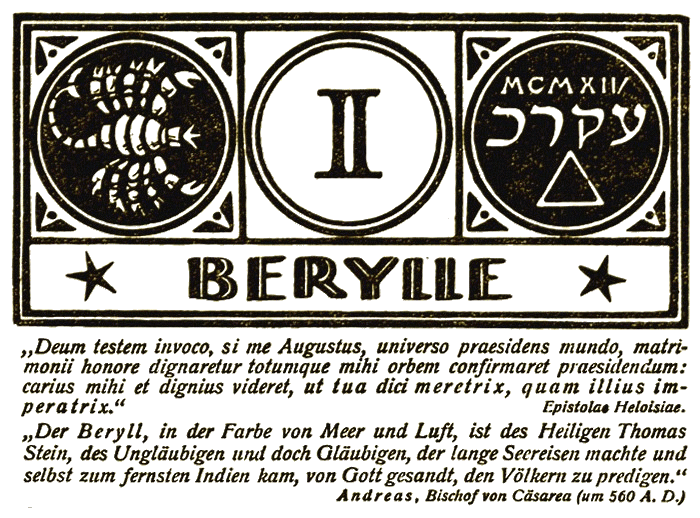
Immerhin, in diesen Tagen, während sie den Kontinent durchquerten, wuchs in ihm der Entschluß, mit hinüberzufahren mit den beiden. Langsam und allmählich, aber ganz sicher und fest: es war schließlich das beste, was er tun mochte.
Freilich, seine Gründe waren ganz andere als die der beiden. Für die gab es nur eins: Deutschland! Ihr Vaterland, angegriffen von zehnfach überlegener Zahl, dem sicheren Verbluten nahe, wenn es nicht mit letzter Kraft die Feinde niederwerfen konnte. Und zu dieser Kraft gehörten auch sie, die beiden! Sie empfanden das nicht als eine Pflicht, die sie erfüllten mußten — es war Selbsterhaltungstrieb: sie waren nichts als ein kleinstes Teilchen des gewaltigen Deutschlands — und dies Deutschland kämpfte und wehrte sich bis zum letzten Blutstropfen. Es mußte sterben — oder aber es mußte siegen: und das mußten auch sie tun, die beiden. Es schien ihnen, als ob es gar nicht anders denkbar sei, als daß ein jeder Deutscher so fühlte wie sie: sie hegten nicht den leisesten Zweifel, daß auch er, Frank Braun, mit jedem Atemzuge, jedem Pulsschlage nur eines empfände: Vaterland, Deutschland, Mutter. — So wie sie —
Er fühlte nichts dergleichen. Das sah er wohl, wie in solcher Zeit jeder einzelne zurücktrat, wie er verschwand und sich auflöste, aufging in der Masse, zusammenschmolz mit Millionen andern. Und wie plötzlich, über Nacht, ein Wesen erwuchs, jung, gewaltig, titanenhaft: das Volk.
Er aber gehörte nicht dazu. Alles, was er war, war er ja geworden in stetem Kampf gegen die andern, war er ja nur als er selbst, nur als Individuum. Die andern? Nun, Menschen, überall. Und Deutsche zumeist. Massen, Volk, Herde.
Mit dabei sein, auch mit dabei sein — das war frisches Leben für Millionen Menschen. Sie waren nichts — und die große Stunde erst schuf sie. Schuf sie, zwar als ein kleinstes Teilchen nur in dem Riesenleibe des Volkes, aber doch als ein Stück, das mitatmete, mitlebte, mitkämpfte.
Ihm aber würde es alles rauben. Würde ihn — wie die andern alle — zu einem Stäubchen machen, zu einem jämmerlichen Fleischfetzchen im blutenden Leibe des Volkes.
Tod war für ihn — was für die andern Leben war.
Zurücktreten, untertauchen, verschwinden und sich auflösen — nein!
Das, was sie Vaterland nannten, rief die Seelen. Und die Seelen jauchzten laut — sie gaben dem Leibe hohen Mut, Ausdauer und Kraft, gaben ihm den Willen zum Siege. Seine Seele hörte die Botschaft wohl, laut und hell, sah auch, wie die andern kamen — alle! Aber er blieb kühl und kalt — berauschte sich nicht — folgte nicht dem schallenden Rufe.
Sein Leib, ja, der mochte mitgehn. Beine und Arme, Bauch und Hirn. Zwei Schenkel, die einen Gaul wohl fassen konnten, ein Auge, scharf genug, um das Ziel zu treffen, eine Faust, die oft genug den blanken Säbel geschwungen. Am Ende mochte es herzlich gleichgültig sein, weshalb er mitging — wenn er nur kam!
Gebrauchen würden sie ihn schon können. Krieg war ihm ja nichts Neues, er hatte vier mitgemacht oder fünf. Und wenn es auch nur Affenkriege waren, Revolutionen in Mexiko, in Haiti, Venezuela und Peru, so war das doch gleich für den einzelnen Mann. Dort wie drüben schoß man mit warmen Kugeln, stach und schlug man mit langen Messern. Freilich, barbarisch noch, kindlich fast, ganz und gar nicht kunstgerecht. In Europa heute betrieb man nun wissenschaftlich das große Morden.
O ja! Auch er wollte mit dabei sein! Aus Patriotismus nicht — rein aus Lust am Abenteuer. Er war in der Südsee, träumte in Samoa, als die Welschen Tripolis raubten, hörte in Kaschmir von den großen Balkanschlachten erst, als alles vorüber war. Zwei Gelegenheiten hatte er schon verpaßt — diesmal mußte er dabei sein.
Aber es war nicht anders, als ob er zu einem Kriege reiste, den wildfremde, ihm völlig gleichgültige Völker miteinander führten. War, wie damals in El Paso, als er mit dem texanischen Kuhreiter den Silberdollar hochwarf: Kopf oder Schwanz? Für Villa oder Huerta? Nur daß er diesmal keine Wahl hatte, zu welcher Seite er reiten sollte.
Und er dachte, daß das wohl das einzige sei: dieses bestimmte, sichere Gefühl, daß er für Deutschland und nicht gegen Deutschland kämpfen würde. Aber es war kaum mehr als ein Reinlichkeitsgefühl, etwas Anererbtes, Anerzogenes, das ihn leitete. So wie er kein fremdes Hemd anziehen würde, solange sein eignes noch hielt in den Nähten.
Es war, als sie aus Saltlake-City hinausfuhren. Da saß der Mann ein wenig vor ihnen, drei Sessel entfernt, oder vier. Er saß da und spuckte, spuckte regelmäßig alle zwei Minuten in den großen messingenen Spucknapf. Nicht in den, der vor ihm stand; er spuckte im Bogen in den andern, weg über zwei Sessel, gerade auf sie zu. Nicht einmal fehlte er sein Ziel, traf stets, genau in die Mitte.
»Ein ausgezeichneter Spucker!« lobte der Zweite.
Der Assistent krähte: »Der Kerl sollte ein Unterseeboot sein! Und seine Spucke ein Torpedo. Und der Spucknapf ein englischer Kreuzer.«
Frank Braun starrte den Fremden an. Der hatte früher nicht dagesessen, er mußte wohl erst eingestiegen sein, eben im Bahnhof. Oder aber — er war herübergekommen aus einem andern Wagen.
Frank Braun starrte ihn an. Er glich seinem Onkel, dem alten Sanitätsrat ten Brinken — auf ein Haar glich er ihm. Es war ein kleiner Mann und häßlich genug. Glattrasiert; dicke Tränensäcke hingen unter den Augen. Wulstig die Lippen, fleischig die große Nase. Tief hing deckend das Lid über dem linken Auge, aber das rechte stand weit offen, schielte lauernd heraus.
Nur: sein Onkel spuckte nicht, das tat er nicht. Er säberte wohl, hie und da — genau so wie dieser Mann.
Der Sanitätsrat war es nicht, gewiß nicht. Auch war der ja tot, ganz und gar tot. Hatte sich aufgehangen; vor drei Jahren nun, gottseidank.
Der Zweite stand auf. »Ich gehe in den Speisewagen!« erklärte er. »Ich hab in meinem Leben schon viele gute Dagos spucken sehn — aber so schwarz wie den da noch keinen, verdammt noch mal! Das stört mich weiter nicht, aber die Regelmäßigkeit macht mich kribbelig. Bis hundertundfünfzehn kann ich zählen — klatsch springt's in den Napf! Er rührt sich nicht — und ich zähle von neuem.«
»Zählen ist wohl deine besondere Freude!« lachte der Assistent. »Willst du nicht wieder eine Liste aufmachen wie in den Quarantänetagen?«
»Zähl du allein weiter!« gab ihm der Zweite zurück.
Der Onkel saß da, still und stumm und starr. Er las nicht, er rauchte nicht, er rührte sich nicht. Er spuckte.
Frank Braun zählte nun die Pausen ab, er brachte es auf hundertunddreiundzwanzig. Dann waren es zwei mehr und wieder vier weniger. Es werden genau zwei Minuten sein, dachte er. Und er zählte wieder.
Zählte fünfmal, zehnmal, vierzehnmal —
Nun stand der Mann auf. Blickte hinüber, rasch, ganz flüchtig nur; ein schleimiges verfaultes Lachen troff von den Hängelippen.
Und in diesem einen Augenblick glaubte Frank Braun, daß es — o ganz bestimmt! — der Ohm Jakob wäre und kein anderer.
Dann aber — und zu gleicher Zeit — glich er auch wieder dem toten Chinesen, der herumschwamm um das Fieberschiff.
Oder aber: der war ja eben sein Onkel, war der Geheime Sanitätsrat ten Brinken. Er faßte sich an den Kopf —
Der Assistent rief: »Gottlob, das Schwein ist weg!«
Frank Braun sah auf, ja, der Mann war fort; soeben ging er durch die Türe in den nächsten Wagen.
»Komisch,« sagte er, »der Mann glich sehr meinem Onkel.«
»Na, dann ist Ihr Herr Onkel auch keine große Schönheit,« meinte der Assistent. Frank Braun sagte: »Nein, das war er wohl nicht. — Ich will ihm nachgehn.«
»Wem?« fragte der andere.
»Dem Mann. Dem Spucker.« Frank Braun stand auf, langsam und schwerfällig. Seine Stimme klang eingetrocknet. »Er sah genau aus wie der Chinese!«
Der Assistent horchte auf: »Wie wer — sah er aus?«
»Wie der Chinese,« antwortete Frank Braun. »Wie der Chinese, wissen Sie, der am Fieber starb und den ich einnähte. Der wieder hochkam am andern Tage und herumschwamm ums Schiff.«
»Sagen Sie mal, Doktor,« unterbrach ihn der kleine Assistent, »es ist Ihnen wohl ein bißchen zu warm hier, was? Jetzt gleicht der Kerl dem Chinesen und eben Ihrem Onkel!!? Oder war der tote Chinese etwa Ihr Onkel? Dann gratulier ich! — Immerhin, gehn Sie einen Highball trinken — aber recht kalt bitte, es wird Ihnen gut tun.«
Frank Braun sah ihn groß an. »Er glich beiden,« stotterte er. »Ich muß ihm nachgehn.«
»Von mir aus!« lachte der Assistent. »Dann gestatten Sie wohl, daß ich Ihren Platz nehme, bis Sie zurück sind — hier scheint die Sonne mir gerade ins Gesicht. Und grüßen Sie mir den chinesischen Spuckonkel.«
Frank Braun hörte kaum hin. Er dachte: es ist heller Tag — es ist ein Uhr mittags, und heißer sommerheller Tag. Wir sind mitten in den Staaten — in einem Pullmanwagen der Union-Pacific. Zwischen Saltlake-City und Denver. Es ist ganz heller Tag.
Er sah den Mann im nächsten Wagen stehn; fast schien es, als ob er auf ihn gewartet hätte. Er blickte sich um, grinste, ging weiter. Frank Braun folgte ihm. Durch sieben, acht Wagen durch, bis hin zum ersten.
Der war leer, kein einziger Reisender saß dort. Der Mann ging gerade hindurch, zum vordersten Sessel, drehte ihn herum, setzte sich. Dann spie er aus — mitten in den großen Messingnapf vor ihm. Frank Braun nahm einen andern Sessel, ein wenig entfernt, starrte hinüber. Er zählte —
Hundertundneunzehn — hundertundzwanzig — hundertund — Der Napf schien nicht mit Wasser gefüllt; es klatschte nicht, wenn er spuckte. Es gab einen leisen, ganz leichten metallischen Ton, fast wie ein Zirpen, wie ein Pfeifen oder Piepsen. Ganz schwarz flog es durch die Luft, schlug in den blank gescheuerten Napf — ping — ping — Frank Braun starrte auf den Napf — lauschte.
Es kratzte da herum, schob und rieb am Metall. Es war, als ob irgend etwas da herumliefe, ganz geschwind, rings im Napf herum.
Hundertundachtzehn — neunzehn — zwanzig. Da schoben sich die dicken Lippen zusammen, da sprang es durch die Luft. Schwarz, ganz schwarz. Mitten in das runde Loch des Metalls, auf das die Sonne hell lachte. Wie blankes Gold leuchtete es.
Pang — ping — es kratzte gleich. Lief gleich. O, es hatte Leben, was der Mann da spuckte.
Frank Braun beugte sich vor, starrte hinüber. Und er sah genau: ein schwarzes Köpfchen hob sich aus dem runden Loch, spitze Öhrchen reckten sich hoch, kleine, grüne Augen lugten zu ihm her. Es hob sich an den Rand, fiel zurück, sprang dann hinauf. Saß einen kleinen Augenblick auf dem hellen Gold in der Sonne. Sprang hinab, huschte unter die Sessel.
Er atmete auf, wie befreit. Also das war es: ein armes Mäuslein saß versteckt in dem Napf. In Todesangst vor dem scheußlichen Hagel des fremden Mannes. Das war es nur! Es hat sich gerettet, das kleine Ding, dachte er, gottseidank!
Aber es zirpte wieder, kritzte und kratzte. Er dachte: es sind noch mehr da drinnen, ein ganzes Nest voll vielleicht. Und es kam heraus, groß und klein, eins um das andere, saß auf dem Sonnengold, lugte in die Welt, sprang hinab.
Noch eins und wieder eins. Immer mehr —
Viele, viele — —
Wieder spitzte der häßliche Kerl die Lippen. Nein, er spitzte sie nicht, er ballte sie plump wie einen unförmigen Bleitrichter. Schwarz spie er — und dieses Schwarze bewegte sich in der Luft — ehe es noch in den Napf sprang, piepste es. Frank Braun hörte es gut. Und dann wieder nach zwei Minuten und abermals nach zwei Minuten.
Der Mann spuckte schwarze Mäuse.
Seltsam — das erschien ihm gar nicht unnatürlich. Er erinnerte sich des Menschen, den er einmal im Zirkus Busch gesehn hatte, in Berlin, und später in Madrid im Teatro Romeo. Der nahm eine große Kuppel, voll von Wasser, darin schwammen Fische, Molche und Frösche. Setzte sie an und trank sie aus, mitsamt ihrem Inhalt. Bog sich weit zurück, blähte die Backen auf und blies: da sprang ein schöner Springbrunnen aus seinem Mund. Und durch die Luft sprühten die Fischlein, goldene, silberne, grüne, die Salamander und Frösche und Kaulquabben — auch ein paar dicke Blutegel waren dabei. Sie zappelten bunt durcheinander auf dem Boden, und der Diener sammelte sie eilends auf, setzte sie in ein frisches Aquarium. Da schwammen sie alle wieder vergnügt herum — jedenfalls war es besser da als in dem dunklen Bauche des Wundermannes.
Vielleicht war es auch so mit dem Kerl da vor ihm. Vielleicht hatte der Mann eine Mausefalle in der Tasche, wohlgefüllt, oder gar eine Zigarrenkiste voll. Stopfte rasch ein Tierchen ins Maul, wenn niemand hinschaute, spie es dann aus. Oder auch, er hatte schon vorher ein paar Dutzend verschlungen, die er nun wieder zum besten gab, tief aus dem Magen heraus.
Ein Bluff war es, ein frecher Bluff!
Wie er grinste, wie er höhnisch grinste! Nun stand er auf, langsam und behäbig. Trichterte die schleimigen Lippen, blähte den Bauch und die Backen. Und wie Sprühraketen stob es aus dem Maul, Mäuse, Mäuse, hundert schwarze Mäuse. Sprang auf die Sessel, pfiff, schrie, lief herum, überall hin. Verschwand dann irgendwo.
Wie der Kerl grinste! — Und wie er dem alten Sanitätsrat glich!
Frank Braun öffnete die Lippen. »Ohm Jakob!« flüsterte er.
Er fiel vornüber, irgend etwas riß ihn hinab auf die Knie. Er hielt sich am Sessel mit der Linken, stützte die Rechte auf den Boden. Einen dumpfen Krach hörte er, dann das schrille Heulen der Dampfpfeife.
Der Zug stand, etwas war geschehn. Er sprang auf, lief in den nächsten Wagen. Er sah die Leute in heller Aufregung; einige rissen die Fenster auf, blickten hinaus, manche drängten weiter nach hinten.
»Was gibt's denn?« rief er.
Keiner wußte es. Er schob sich weiter durch den Wagen mit den Leuten. Nichts im nächsten und im übernächsten nichts.
Dann aber sahen sie, was geschehn war. O, nichts Besonderes. An einem Übergang hatte der Wächter geschlafen, die Schranke nicht heruntergelassen. Und — dummer Zufall! — vor einem Landwagen waren die Gäule gescheut und waren losgerannt, mitten hinein in den Zug. Die zwei Pferde lagen da mit dem Gefährt, elend zerfetzt. Eins war schon tot, dem andern gab ein mitleidiger Passagier mit dem Revolver den Gnadenschuß. Aber der Kutscher war mit dem Schreck davongekommen, war im hohen Bogen über den Zug geflogen und auf der andern Seite angelangt. Er rieb sich die Arme und die Beine, fühlte herum: heil war alles. Kaum eine Schramme hatte er.
Auch der Zug war heil. Ein paar Kratzer am Lack des Wagens. Nur eine Scheibe zertrümmert, da war die Deichsel durchgegangen.
Nur die eine Scheibe war zerschlagen — und freilich, noch etwas, das hinter der Scheibe war.
Der blonde Schädel eines Reisenden, der nun rot war von Blut.
Das war der kleine Assistent, der auf Frank Brauns Platze saß. Der war tot.
Man brachte die Leiche fort, bettete sie vorne im Gepäckwagen.
Kaum zehn Minuten dauerte der Aufenthalt. Dann pfiff die Pfeife. Aber der Zug wartete noch eine kleine Weile, um einen andern vorbeizulassen, der ihm entgegenbrauste. Frank Braun blickte hinüber —
Da saß, breit am Fenster, der häßliche Mann, der wie sein Onkel Jakob aussah. Er spie hinaus — eine kleine schwarze Maus lief über die Schienen.
Still, geräuschlos, eine riesige Schildkröte mit hochgewölbtem Panzer, kroch die Fähre über den Hudson. Frank Braun saß oben, blickte zurück auf die Zinken und Zacken Manhattans, das matt leuchtete in der Novembersonne.
Neben ihm saß der Zweite. »Sie wollen also durchaus fahren?« fragte er ihn. Der nickte nur. Sah ihn an, ein wenig verächtlich. »Ich fahre,« sagte er.
Frank Braun zog eine Zeitung aus der Tasche. »Lesen Sie! Die ›Bergensfjord‹ ist eingeschleppt nach Kirkwall, fünfhundertundsechzig deutsche Gefangene. Das ist der letzte Fang.«
Der Zweite zuckte die Achseln. »Ich fahre doch.«
»Hören Sie,« fuhr Frank Braun fort, »die ›Potsdam‹ lieferte den Engländern über dreitausend, die ›Hellig Olav‹ achthundert, die ›Nieuw Amsterdam‹ brachte fast zweitausend den Franzosen nach Brest, ›Frederik VIII.‹ brachte —«
Der Seemann unterbrach ihn. »Und ›König Haakon‹ fast tausend nach Dover, die ›United States‹ doppelt soviel nach Falmouth. Ich weiß. Kenne auch die Ziffern, die die Italiener nach Gibraltar brachten. Alles zusammen zwanzigtausend und mehr. Ich fahre doch.« Er schwieg einen Augenblick, blickte träumerisch in die Fluten. »Vielleicht hab ich Glück. Die ›Noordam‹ soll durchgekommen sein.«
»Sie soll!« Frank Braun schnalzte mit der Zunge. »Sie soll!« Und morgen meldet die ›World‹ freudejauchzend, daß sie in Hull ist oder in Cherbourg!«
Der andere antwortete nicht. Schweigend kreuzten sie den gewaltigen Strom, über den all die Dampfer, Schlepper und Fährboote wie riesige Wasserkäfer hin und her liefen. Drüben in Hoboken wurde der Seemann wieder gesprächiger. »Hier ist mir immer, als ob ich beinahe schon zu Hause wäre. Nur Deutsche überall, alles spricht Deutsch.«
Sie gingen vorbei an den weiten Piers des Bremer Lloyd und der Hapag. Da lagen die mächtigen Schiffe der Deutschen, die größten der Welt, still, untätig, regungslos. Hoch reckte sich über die Häuser hinweg die »Vaterland«. Der Zweite blieb stehn, hob den Arm. »Da schaun Sie,« rief er, »unsere Schiffe!«
Und Frank Braun sagte: »Warten Sie, bis die fahren!«
Aber der Seemann schüttelte den Kopf: »Versuchen Sie's bei andern, Doktor! Es werden genug Deutsche an Bord der ›Ryndam‹ sein. Halten Sie denen eine Rede!«
»Das werde ich tun,« nickte Frank Braun und biß die Lippen. »Das werde ich tun — verlassen Sie sich drauf! Ich werde ihnen eine Rede halten.«
Sie kamen zum Pier der Hollandlinie. Dicht gedrängt standen die Menschen in der großen Halle, viele blonde Männer, Frauen und Kinder. Die weinten, aber die Männer lachten, sangen auch. Die zwei schoben sich durch zur Holzbrücke, die auf Deck führte. Da stand der Zahlmeister des Schiffes; Frank Braun erkannte ihn an der Mütze.
»Wieviel Passagiere?« fragte er.
»Weiß nicht genau,« brummte der Holländer. »Zweieinhalbtausend oder mehr. Übervoll wieder — Kajüten und Zwischendeck.«
»Deutsche?«
Der Holländer lachte: »Was denn sonst? Österreicher noch und Ungarn! Kein halbes Dutzend Neutrale. Fahren Sie auch mit?«
Frank Braun verneinte. »Glauben Sie, daß Sie alles gut hinüberbringen?« fragte er.
Da nickte der Holländer. »Alles kommt hinüber, nur keine Angst! Dafür garantieren wir. Genau bis Falmouth! Die Engländer werden sich freuen. Gute Fleischware bringen wir, und ganz umsonst.«
Frank Braun stieg auf die Treppe, nicht einen Augenblick besann er sich. Er klatschte in die Hände, so laut er konnte, schrie dazu: »Achtung! Achtung! Aufpassen!« Er schwenkte seine Zeitung hoch in der Luft herum.
Die Menschen wurden aufmerksam: »Ruhe!« schrie einer. Und ein anderer: »Zuhören! Er hat eine neue Ausgabe! Laßt ihn lesen!!« Und sie wiederholten: »Ruhe! Zuhören! Lest das Telegramm!« Sie sammelten sich um die Treppe, enggedrängt, unten in der Halle und oben auf Deck an der Reeling.
Rasch begann er. Stotternd erst, unsicher. »Lauter!« schrien ein paar dahinten. »Ich verstehe kein Wort!« rief ein Dicker von Bord her.
»Ihr sollt nicht abfahren, Leute!« schrie Frank Braun. »Ihr sollt nicht abfahren mit diesem gottverdammten Holländer! Keiner von euch kommt nach Deutschland, kein einziger! Sie liefern euch ab wie Heringe, zwölf Stück aufs Dutzend, hundert Dutzend auf die Tonne! Gefangene seid ihr schon, sowie ihr hinauskommt von Sandy Hook — und ihr zahlt noch obendrein euer gutes Geld dafür! So lange geht's noch — wie ihr auf dem Meere seid — drüben aber kommt ihr in die Konzentrationskamps! Wißt ihr, was das ist — Konzentrationskamps?«
Dicht vor ihm lachte einer, ein breiter bärtiger Seemann. »Mags sein, was es will!« rief er. »Jedenfalls besser, als hier herumzulungern, ohne Arbeit, ohne Brot! Sie, Herr, könnens vielleicht abwarten hier — aber ich? Und so viele? Ein Bettler wird man hier im besten Falle, ein Verbrecher sonst und Dieb. Da bin ich lieber ein ehrlicher Kerl und Kriegsgefangener im englischen Lager.«
»Sie wissen nicht, was Sie reden, Mann!« fuhr ihn Frank Braun an. »Hier hat ein jeder doch eine Möglichkeit — drüben keine. Hier kann jeder wenigstens versuchen zu arbeiten — für sich und das Vaterland. In England muß er arbeiten — für England! Sie wissen nicht, wie es zugeht in den Gefangenenlagern — Sie nicht und keiner von Ihnen. Ich weiß es. Ich kenne sie gut — vom Burenkrieg her. Männer, Frauen, Kinder steckten sie zusammen wie Fliegen, das verseucht und verpestet sich gegenseitig. Rein kommen viele — aber gesund heraus nur sehr wenige. — Geht nicht an Bord, Leute, bleibt, wo ihr seid!«
Da reckte sich über die Reeling ein Großer, Schnauzbärtiger. »Kameraden,« schrie er, »Kameraden! Das mag alles wahr sein, was der Herr da redet. Aber ich bin Offizier und manch anderer noch — und Reservisten, Angehörige unseres herrlichen Heeres — sind wir alle. Drüben kämpfen unsere Brüder und unsere Väter und Freunde um Tod und Leben, verspritzen ihr Blut für Kind und Weib und für des Vaterlandes Ehre! Wollt ihr da feige zurückbleiben? Heute morgen erst war ich beim Generalkonsul, sprach mit ihm gerade über das, was der Herr da euch erzählt, fragte ihn, was zu tun sei? Und der Generalkonsul, der Vertreter unseres Volkes, sagte mir, daß es eines jeden Deutschen Pflicht sei, auf dem schnellsten und besten Wege heimzukehren, um seine Dienste dem Vaterlande zu weihen. Das wißt ihr ja auch alle — wie vielen von euch sind nicht die Mittel zu dieser Fahrt eben vom Konsul gegeben worden. ›Werden wir durchkommen?‹ fragte ich den Konsul. Und er antwortete: ›Das steht in Gottes Hand! Handeln Sie nach Ihrem Gewissen und tun Sie Ihre Pflicht!‹ — Kameraden! Daß wir alle das tun wollen, beweist, daß wir alle hierherkamen! Was auch immer geschehn möge — wir haben unsere Pflicht getan — unsere stolze Pflicht als deutsche Männer!«
Da schrien sie, da jauchzten sie und johlten. »Es lebe Deutschland! Es lebe der Kaiser!«
Frank Braun trommelte mit den Fingern auf dem Geländer der Brücke. Er wartete ungeduldig, nervös, bis die Menge ein wenig ruhiger wurde. Dann begann er von neuem. »Leute,« schrie er, »Leute, Leute —«
Er drang nicht durch. Aber der Offizier über ihm verschaffte ihm Ruhe. »Kameraden! Laßt ihn ruhig reden! Er meint es gut — ganz gewiß. Nur weiß er nicht, daß es etwas gibt, das noch höher steht als persönliche Freiheit und selbst das Leben: Vaterlandsliebe und Ehre!! Laßt ihn ruhig reden, Kameraden!«
Sie schrien wieder in heller Begeisterung. Dann aber, wie auf Kommando, schwiegen sie. Und Frank Braun rief, zitternd vor Aufregung: »Leute, der Generalkonsul ist ein Hanswurst! Er ist ein Phrasendrescher, ein Narr, der nicht weiß, wo Gott wohnt! Schlimmer noch, er ist ein bürokratischer Verbrecher —«
»Genug,« schrien sie, »genug! — Halts Maul!« brüllten sie. »Reißt ihn da runter, den Kerl!«
Aber er gab nicht nach. Seine Stimme wurde hoch, kreischend, drang hell durch den Lärm. Überschlug sich, galoppierte weiter, sprang klirrend über Gräben und Hürden.
»Ein Verbrecher ist der Konsul! Ein Schuft aus Dummheit! Er allein liefert den Briten und Franzosen mehr Gefangene ans Messer als die Joffre und French zusammen! Um euch einmal auszutauschen — die von euch, die dann noch leben — müssen unsere Brüder ebensoviel Engländer fangen — und das kostet Ströme deutschen Blutes. Denn die Alliierten sind nicht so dumm, nach Hamburg zu fahren und nach Bremen auf neutralen Schiffen. Kein Kalb, kein Schaf ist so dumm, daß es selbst zum Metzger läuft: ›Da bin ich, bitte schlacht mich!‹ — Leute, fahrt nicht! Folgt nicht eurem blöden Leithammel, dem Generalkonsul! Bleibt, wo ihr —«
»Kameraden! Kameraden!« Und die Kommandostimme dröhnte wie Marschmusik durch die weite Halle: »Kameraden, denkt ihr nicht, daß es nun genug sei! Einen Hammel nennt der Herr den Vertreter des deutschen Kaisers, einen Hanswurst, Schuft und Verbrecher! Kälber nennt er euch und dumme Schafe. Ich selbst habe ihm Ruhe verschafft — aber einmal hat auch unsere deutsche Langmut eine Grenze! Wenn Gott es will, so kommen wir alle durch, Kameraden, und darum werde ich — für meine Person — fahren!«
»Ich auch!« schrien sie. »Ich auch! Wir fahren alle!« Einer stimmte an: »Deutschland, Deutschland über alles«. Und sie sangen es, tausendstimmig.
Frank Braun nagte die Lippen. Langsam ging er die Planken hinab. Der holländische Zahlmeister faßte seinen Arm, führte ihn ein paar Schritte weit unter die Brücke. »Hier ists besser,« sagte er, dick lachend, »sicherer.« Da stand er schweigend, neben dem Niederländer und dem zweiten Offizier.
Sie sangen: »Heil dir im Siegerkranz« und »Gott erhalte!« Und sie sangen weiter, als die Glocke das letzte Signal zum Einsteigen gab, jauchzten in heller Begeisterung die »Wacht am Rhein«.
In langen Scharen zogen sie über die Brücke, winkten zurück den Frauen und Kindern.
»Waren Sie einmal in Chicago?« fragte der Holländer. »Bei Armours?«
Frank Braun nickte.
»Genau so drängen die Hammel über die Brücke, die zum Schlachtmesser führt,« fuhr der andere fort. »Und die Ochsen und die Schweine. Genau so! Ich sage Ihnen, Herr, von allen den Menschen, da hat jeder einzelne, als er seinen Fahrschein nahm, in unserem Büro gefragt: ›Bringen Sie uns sicher nach Rotterdam?‹ Und jedem einzelnen hat der rothaarige dünne Levinne geantwortet: ›Bin ich ä Prophet?‹ — Aber sie zahlten doch und sie kamen doch. Genau so wie das letzte Mal, da brachten wir fast dreitausend den Engländern nach Falmouth.«
Der Zweite sah ihn an, brach dann sein Schweigen: »Sie haben recht, Sie haben vollkommen recht. Aber — Sie sind ein Holländer — werden nie verstehn, was heute vorgeht in einer deutschen Brust.« Er wandte sich halb, streckte die Rechte aus. »Leben Sie wohl, Doktor, ich will an Bord.«
Frank Braun drückte ihm die Hand, ohne ein Wort. Über ihm, auf der Brücke, schrie einer: »Da steht er! Versteckt hat sich der Kerl!«
Er blickte nach oben; im selben Augenblick fiel ein wuchtiger Stockhieb ihm über den Kopf. »Nimm das!« schrie es. »Zum Andenken! Und das da!«
Aber der Zweite griff den Stock, entriß ihn dem Schläger, zerbrach ihn im Augenblick. Und oben auf der Brücke schrien sie: »Schäm dich doch! — Du bist betrunken! — Bringt ihn an Bord!«
So schnell ging das alles; Frank Braun hatte nicht einmal gesehn, wer ihn eigentlich schlug. Der Holländer nahm ihm den Hut ab, strich ihm durch die Haare. »Macht nichts!« lachte er. »Eine kleine Beule! Fürs Vaterland!«
Frank Braun ging vor, stellte sich dicht neben die Brücke. Recht breit und groß — mochte doch jeder ihn sehn! Mochte doch noch einer kommen mit gehobenem Stocke. Fast herausfordernd blickte er auf die Menschen.
Aber keiner kam, keiner achtete auf ihn. Nun sank die Dämmerung durch die Halle, schon warfen ihr spärliches Licht die wenigen Bogenlampen.
Und immer mehr kamen, immer mehr. Er starrte in die Massen, sah einen an um den andern, hörte ihre letzten Worte. Er vergaß den Hieb; wäre am liebsten wieder hingetreten zu jedem einzelnen: »Fahr nicht! Ich bitte dich, fahr nicht!« Unaufhörlich flüsterten es seine Lippen. Aber keiner blieb zurück, nicht ein einziger.
Einer, ein großer, nahm das schlafende Kind aus den Armen seiner Frau, küßte es leise. »Ich bring es dir mit,« sagte er. »Ich schwör dirs, Junge, ich bring dir das Eiserne Kreuz mit! Ich habe zwei geerbt — vom Vater eins und eins vom Großvater. Du sollst drei haben, Junge!«
Aber die Frau schluchzte: »Kehr du nur wieder!«
Einer, ein junger, schlanker, küßte sein New Yorker Mädel. »Leb wohl, Fay,« lachte er. »Bleib mir treu, wenn du kannst. Und sonst, versprich mir's, nimm wenigstens keinen Engländer!«
»Farewell kid, dear kid,« weinte sie.
Einer, ein starker stiernackiger, wankte trunken über die Brücke, ganz allein. Krampfte sich fest ans Geländer, lallte: »Zwei Brüder — zwei Brüder — haben sie mir totgeschossen — zwei Brüder schon. Vier sind noch da im Krieg — ich bin der Siebente — Wartet nur, Franzosen! Zwei Brüder« —
Keiner hörte auf ihn.
Einer —
Und wieder einer und noch einer — —
In strammem Schritt zogen zehn Männer herauf, die Stöcke geschultert wie Gewehre. Und ihre Sangesbrüder standen unten, sangen das Abschiedslied: »In der Heimat, in der Heimat, da gibts ein Wiedersehn —«
Ein dicker Graubart drängte sich vorbei, stieß ihn mit dem Ellenbogen, bat um Entschuldigung. Frank Braun erkannte ihn, es war ein deutscher Professor der Kolumbia-Universität. Ein schwarzrotgoldenes Burschenband leuchtete über dem mächtigen Bauch.
»Sie wollen auch mit?« fragte er ihn.
»Nein,« sagte der Alte. »Wollte Gott, es ginge noch! Aber mit dreiundsechzig werden sie mich kaum als Rekruten gebrauchen können! Da — meine zwei Jungens schick ich — und meine Tochter auch — die geht zum Roten Kreuz.«
»Professor,« drängte er, »Professor, hören Sie —«
Aber der Alte hörte nicht. Er schloß seine Söhne in die Arme, küßte seine Tochter. »Kinder,« sagte er, »ihr haltet für den Vater das Treuversprechen, das ich schwur, als man das Band da mir gab. Ich bin stolz auf euch in diesem Augenblick: macht, daß ich es bleibe, daß ich stolzer werde auf euch mit jedem Tage! — Gott schütze euch!«
Man verstand ihn kaum. Überall ein Rufen und Lärmen, ein Weinen und Schluchzen, dazwischen das schrille Schreien der Dampfpfeife. Und über alles hin die Klänge des Liedes, das sie nicht mehr losgaben, das sie anstimmten eins ums andere Mal, Strophe um Strophe, immer von neuem:
»Lieb Vaterland — magst ruhig sein —«
Die Taue fielen, und die Ankerkette krächzte hinauf. Sie schoben die Brücke zurück, schlossen die Reeling. Langsam bewegte sich die ›Ryndam‹.
Er stand allein im Augenblick. Alle die Zurückgebliebenen eilten weg, nach vorne auf die Spitze des Piers. Da fuhr der Dampfer vorbei, da konnten sie noch einen letzten Blick erhaschen. Konnten die Tücher schwenken, singen, auf Wiedersehn schreien. Schon spielte, wie stets, die Schiffskapelle das Abschiedslied: »Muß i denn, muß i denn zum Städtle hinaus — Städtle hinaus —«
Er blickte den Hudson hinab, sah der ›Ryndam‹ nach. Seine Lippen murmelten: ›Da schwimmt sie — da schwimmt sie‹. Und er schämte sich dennoch, daß nicht auch er an Bord war.
Dann, plötzlich, fiel ihm der alte Sang ein, vom Bewerland:
»In einem Pißpott kam er geschwommen
Hochzeitlich geputzt hinab den Rhein —
Und als er nach Rotterdam gekommen,
Da sprach er: ›Juffräuken, willst du mich frein?‹«
Er lachte bitter. Weiß Gott, so war es doch! Hochzeitlich geputzt waren sie alle, genau wie des Liedes Mauseheld. Und sie alle fuhren zu ihrer geliebten Braut, die Vaterland hieß! Nach Rotterdam wollten sie, wie der Mäuserich. Nur — der hatte Glück: er kam zu der Stadt, trotz seines seltsamen Fahrzeuges. Sie aber, die zweitausend Ratzen da, die würden nie hinkommen: ihr Pott, ihr verdammter holländischer Pott, war ja schon eine riesige Ratzenfalle!
Er schrak auf. Eine Hand legte sich leicht auf seine Schulter. Es war der lange Tewes, ein Redakteur des »Deutschen Herold«.
»Doktor,« krähte er, »das war sozusagen ein Reinfall!«
Frank Braun nickte nur, antwortete nicht.
»Ich hätte es Ihnen vorher sagen können,« fuhr der andere fort. »Ich war jedesmal da, habe siebzehn Schiffe abfahren sehn seit August. Immer dasselbe, da hilft nichts!«
Er wartete eine Weile, sprach dann weiter, als keine Antwort kam. »Dennoch, Sie sprechen gut! Sie haben das Zeug dazu. Und den Namen obendrein. Sie müssen uns helfen — für die deutsche Sache!«
»Was gehts mich an?« flüsterte Frank Braun.
»Komm, komm!« Der Journalist streichelte ihm begütigend den Rockärmel. »Wir brauchen Sie, Doktor, brauchen Sie. Sie stellen was vor — und Sie können reden — die kleinen Pfiffe haben sie bald weg. Phrasen, schöne dicke Phrasen, so wie sie der Major vorhin hinknallte — das will die Masse. Worte, die jeder kennt, die jedes Kind auswendig kann. Das kann jeder Vereinsredner bei uns. Sie sollen mal sehn, wie das flutscht! Dann aber, was die nicht können und was der Major auch nicht kann: so hie und da einen klugen Gedanken dazwischen — irgend was Neues — für die paar besseren Menschen. Denn die sind uns so wichtig wie die Massen auch, glauben Sie mir! Und die müssen auch was haben, damit sie sich nicht erbrechen, bei dem ewigen Einerlei von Schwarzweißrot und Volkesnot, von deutscher Treue, Kaiser und Reich, vom Erbe Bismarcks und solchen schönen Sachen.«
Er faßte ihn unter dem Arm, ging auf und nieder mit ihm, redete auf ihn ein, unausgesetzt. Er müsse helfen; es sei seine Pflicht. Er dürfe sich nicht drücken in diesen Tagen. Er wisse ja, wie tagtäglich das Deutschtum hier im Lande beschimpft und bespien werde, man müsse sich zusammenschließen, zur Wehr setzen. Das Komitee der deutschen Arbeit sei nun fest gegründet — da müsse er mitmachen!
Frank Braun hörte alles, aber so weither nur. Und es schien ihm, als ob der Lange da gar nicht zu ihm spräche — sondern zu irgendeinem dritten — irgendwo —
»Ja, ja —« sagte er leichthin.
Der Journalist ereiferte sich: »Mir kommen Sie nicht aus,« pfiff er, »mir nicht! Wenigstens den Versuch müssen Sie machen. Schlägts fehl — nun so schadets nichts. Und gehts gut, hetzen wir Sie herum im ganzen Lande. Es ist kein Vergnügen — ich sags Ihnen im voraus. Aber Sie müssen — Sie müssen!«
Er unterbrach sich, blieb stehn, faßte ihn am Rockknopf.
»Sagen Sie mir, Doktor,« rief er, »würden Sie rüberfahren, wenn Sie eine halbwegs sichere Möglichkeit hätten, nach Deutschland zu kommen?«
Frank Braun dachte: ›Wie ich den Kapitän frug — genau so!‹
Der Redakteur ließ ihn nicht antworten. »Da haben Sies! — Und nun sehn Sie: hier können Sie mehr leisten für Deutschland, zehnmal mehr, zehntausendmal mehr, als wenn Sie drüben im Schützengraben lägen. Also nicht wahr, Sie werdens versuchen, Doktor? Am Sonntag zum Deutschen Tag in Baltimore!«
Er nickte: »Ja, ja —«
Der Journalist zog ein Notizbuch hervor. »Ihre Adresse, bitte? Und die Telephonnummer?« Er klappte das Buch wieder zu, schob es in die Tasche. Und es klang sehr befriedigt, als er sagte: »So, das wäre erledigt — Sie werden von mir hören, Doktor, ich werde Ihnen alles Nähere mitteilen. Morgen rufe ich Sie an.« Er wandte sich zum Gehn — drehte rasch wieder um, begann von neuem: »Fast hätte ichs vergessen — da wartet eine Dame, die Sie sprechen will. Eine alte Bekannte.«
»Wie heißt sie?« fragte er.
»Frau van Neß ist es,« sagte der Lange. »Kommen Sie, kommen Sie!« Er griff seinen Arm.
Frank Braun widerstrebte. »Ich kenne sie wirklich nicht,« sagte er, »habe nie den Namen gehört.«
»Aber sie kennt Sie, Doktor, verlassen Sie sich darauf!« beharrte der Redakteur. »Sie hat mir erst den Gedanken eingegeben, Sie zu angeln für unsere Sache. Kommen Sie, kommen Sie, ich habs eilig. Zur Redaktion muß ich.«
Er zog ihn mit. Da stand die Dame, schlank, mittelgroß, im tiefen Schwarz. Ein langer Trauerschleier fiel über ihr Gesicht.
»Da ist er,« sagte der lange Tewes. Und er stellte vor: »Frau van Neß.« Dann wandte er sich schnell: »Und nun verzeihn Sie — habe wirklich keine Zeit mehr.«
Mit mächtigen Schritten sprang er durch die leere Halle.
Die Dame schlug ihren Schleier zurück, rotblondes Haar leuchtete über den grünen Augen. Nein, nein, dachte er, nicht schwarz! Sie sollte nicht schwarz tragen!
Dann erkannte er sie: Lotte Lewi war es, vom Tiergarten.
Er sagte: »Sie sind es, Lotte —«
Sie lächelte: »Sie? Immer wieder: Sie?«
»Also du, Lotte,« verbesserte er. »Du — wenn du das lieber magst. Wo sahn wir uns zuletzt?«
»In Venedig,« sagte sie, »sechs Jahre sind es her. Auf dem Markusplatz traf ich dich wieder, und du sprachst: ›Lotte Lewi, die Phönizische! Rote Haare, grüne Augen und dünne schwarze Streifen darüber. So schlank wie Baaltis — und die Nägel gefärbt mit Hennah. Mädchensehnsucht, die jede Sünde kennt. Und verlangt nach neuen. Tiergarten — bestes Halbblut — muß Belladonna in ihren Haaren tragen‹.«
»Weißt du so genau, was ich sprach?« fragte er.
Sie nickte leicht: »Ganz genau. Was du sprachst und was ich sprach. Und was geschah — Einen Tag hatte ich dich und eine Nacht.«
Er fragte rasch: »Du bist in Trauer?«
Sie lachte. Sie merkte wohl, wie er wegwollte über die Erinnerung. Ruhig sprach sie: »Warum? Glaubst du, daß ich jetzt dich losließe?«
Da hob sich seine Lippe, wie befreit klang sein Lachen. »Du auch? Eben erst hat mich der Redakteur mit Beschlag belegt. Glaubst du, daß jeder mich nehmen kann, wie und wanns ihm beliebt?«
Sie wurde ernst: »Ja, das glaube ich,« sagte sie still. »Jeder kann dich nehmen — jeder, der eben will und mag. Manchmal denke ich, daß du gar kein Mensch bist, nur ein Saiteninstrument, das so aussieht wie etwas Lebendiges, seltsam genug. Alles, was nur mag, nimmt dich und spielt auf dir — Menschen, Dinge, Gedanken! Du, Frank Braun, du bist nur immer die Puppe — in all deinen Tragikomödien!«
Er spottete: »Und nun willst du wieder einmal die Drähte ziehn, Lotte? Du mußt doch wissen, daß ich wenigstens einen Willen habe —«
»Welchen?« fragte sie.
»Den — fortzulaufen,« gab er zurück.
Da nickte sie: »O ja. Und das ist vielleicht das beste an dir. Für dich — und wohl auch für die andern. So bleibst du jung.«
»Wie du, Lotte,« warf er hin.
Sie seufzte: »Meinst du? Ich bin dreißig nun. Immerhin, ich weiß gut, daß ich niemals besser aussah. Als ich fünfzehn war, als du mich verführ — oder nein: als ich dich zwang, mich zu verführen — war ich nicht so schön. Und nicht, als ich dich wiedernahm mit neunzehn, und auch nicht das letzte Mal in Venedig. Ich weiß es wohl: ich bin schön heute. Darum —«
Er unterbrach sie: »Unsere Liebschaft ist alt, Lotte.«
Sie sah ihn ruhig an. »Unsere Freundschaft meinst du. Alt genug — sechzehn Jahre nun. Aber unsere Liebschaft? Laß mich zählen. Einen Nachmittag in Berlin — später einmal unsere Osterfahrt: fünf Tage. Und wieder in Venedig einen Tag und eine Nacht. Acht Tage also, wenn mans nach oben abrundet.«
Sie ließ ihren Blick nicht von ihm, aber er erwiderte ihn nicht, sein Auge schweifte durch die weite Halle. Sie seufzte leicht auf, sagte: »Wir sind die letzten. Laß uns gehn.«
Ein paar Schritte gingen sie schweigend nebeneinander. Dann begann sie wieder: »Fragst du nicht, warum ich in Trauer bin?«
»Ja,« sagte er, »ist dein Vater gestorben? Oder deine Mutter?«
»Der Vater starb vor drei Jahren schon,« erwiderte sie. »Schlagfluß. Und ein schönes Begräbnis hatte der Geheime Kommerzienrat Lewi, sehr prunkvoll und sehr christlich, ganz nach dem Herzen der Mutter. Sie zog dann fort von Berlin, lebt nun auf dem thüringischen Rittergut mit ihrem Vater, dem alten Baron Kühbeck.«
»Vor drei Jahren schon?« fragte er. »Und immer noch trägst du Trauer?«
Sie sagte: »Nicht um des Vaters willen. Ich heiratete kurz vor seinem Tode einen Amerikaner — in Baumwolle — einen Geschäftsfreund des Vaters, der noch viel reicher war als er selbst. Er starb — vor sechs Wochen nun.«
»Mein — mein Bei —,« versuchte er. Aber er brachte es nicht heraus.
»Schon gut, mein Freund!« nickte sie. Und wieder gingen sie schweigend ein paar Schritte.
»Damals,« begann er, »sagtest du, du seist verlobt mit irgendeinem Grafen. Damals, in Venedig. Nicht wahr?«
Eine kleine Freude flog über ihr Gesicht. »O, du erinnerst es! Ja, es war so, die Mutter wollte es durchaus. Aber der Vater war so dagegen — ich glaube, ihm wärs am Ende noch sympathischer gewesen, ich hätte dich geheiratet!«
»Und dir?« fragte er.
»Mir?« Sie lachte. »Mir? Mir wohl auch — das weißt du ja. Aber du warst fort — den nächsten Tag. Und damals war ich noch ein wenig stolz — oder dumm, wie dus nehmen willst. Statt dich zu suchen — heulte ich, wie ichs schon früher getan. Dann kam der Yankee — und der Vater drängte mich, genau so wie die Mutter mit ihrem hübschen Grafen. Der oder der: mir wars ganz gleich. Ich habs an den Knöpfen von Papas Weste abgezählt: so wurde ich Frau van Neß.«
Sie traten aus der Halle heraus; sie hob den Schirm, winkte ihrem Chauffeur. Das Auto fuhr vor, er öffnete den Schlag.
»Auf Wiedersehn,« sprach er.
Da lachte sie hell auf. »Nein,« rief sie, »nein! Diesmal nicht! Steig ein!« Er zögerte. Da hob sich ihre Stimme. »Steig ein!« befahl sie.
»Lotte,« sagte er, und sehr weich klang es, »Lotte — haben wir zwei nicht oft genug die Waffen gemessen?«
Sie antwortete: »Und warst du nicht jedesmal der Sieger? Sags doch! Aber heute kenne ich dich, Frank Braun, kenne dich besser, als du mich kennst, besser, als du dich selbst kennst.«
»Und du meinst: heute wirst du siegen, Lotte?« fragte er.
»Heute — ja!« sagte sie fest. »Jetzt in dieser Stunde. Sieh, was möchte es dir nutzen, wenn du fortgingest? Ich würde morgen in deiner Wohnung sein. Und am nächsten Tage — und wieder — du würdest schon nachgeben — einmal — du weißt, daß du es tun würdest.« —
Er biß seine Lippen. »Gibs doch zu!« rief sie.
»Vielleicht,« schluckte er.
»Sicher,« sagte sie. »Und weil du das fühlst — darum bin ich stärker als du — jetzt. Steig ein!«
Er stieg in das Auto, und sie folgte ihm. Sie setzte sich neben ihn und warf den Schlag zu. Dann ließ sie den Schleier fallen.
»Nach Hause,« befahl sie.

Und doch war es kein Sieg für Lotte Lewi. Nicht, daß er den Joseph spielte in dieser Zeit, o nein! Er tat stets, was sie wollte, war gehorsam und gefügig wie ein artiges Kind. »Küß mich,« sagte sie, und er küßte sie.
Nur — so müde war er.
Er saß zu Tisch mit ihr und vergaß zu essen. »Iß!« sprach sie — dann nahm er ein paar Bissen. »Trink doch!« sprach sie — dann leerte er sein Glas.
Er saß auf dem Diwan neben ihr, und sie nahm seine Hand. »Sprich,« sagt sie, »erzähle.« Nun erzählte er. Aufgezogen wie ein Uhrwerk, ruhig und still. Aber plötzlich schwieg er. »Was ist?« fragte sie. Aber er wußte es nicht, hatte längst vergessen, was er noch eben gesagt hatte.
Sie sah ihn an, lange, aufmerksam.
»Etwas —« murmelte sie. »Denk nach.«
Er gehorchte gleich, sann nach, angestrengt. Aber er fand nichts.
Sagte: »Ich weiß nicht, liebe —«
Er stockte — wie hieß sie denn nur?
Sie merkte es gut. »Weißt du nicht, wer ich bin?« drängte sie.
Da fiel es ihm ein. »Doch, doch!« rief er, »Lotte Lewi!«
Sie schüttelte nachdenklich den Kopf. Sehr ernst sah sie aus.
Da lachte er. »Es ist gewiß nichts Sonderliches. Nur ein wenig müde bin ich — so hie und da — in der letzten Zeit.«
»Hast du Schlaf?« fragte sie.
Nein, nein — Schlaf hatte er nicht. Jetzt nicht — und auch sonst nicht, wenn er sich müde fühlte. Ja — das war wohl seltsam — schläfrig machte ihn diese Müdigkeit nicht. Oft war es gerade umgekehrt: eben wenn er geschlafen hatte, lange, tief und fest — nachts oder auch tagsüber — gerade dann fühlte er sich so matt und abgespannt.
Was war es denn? Er sprang auf, machte ein paar Schritte durchs Zimmer, setzte die Beine, hob langsam die Arme. Er fühlte all seine Muskeln — stark war er und kräftig wie stets. Er trat vor den Spiegel, lachte. Und dann gleich — taumelte er. Wie ein leichter Schwindel war es, der dennoch sein Hirn völlig freiließ, nur den Körper griff.
Er hielt sich fest an dem Sessel. Er blickte in den Spiegel, studierte sich, sah jeden seiner Züge. Er fand nichts, nichts. Das alles war ihm bekannt, seit vielen Jahren nun. Genau so und nicht anders.
Und doch war da irgendein Fremdes. — Was denn nur?
Er ging zurück zum Diwan. Da sprach sie: »Du bist krank.«
Er zuckte die Achseln: »Dummes Zeug, Lotte.« »Laß nur!« sagte sie. Sie seufzte leicht. »Du — heute Nacht bin ich nicht deine Geliebte. Heute nicht. Morgen nicht — und wer weiß, wann? Du bist krank, Frank Braun: so werde ich deine Mutter sein.«
Er fühlte: nun mußte ein stechender Witz kommen. Eine höhnische Frechheit, ein häßlicher Peitschenhieb, der ihre Liebe traf. So sollte es sein.
Aber weich klang seine Stimme und nicht schneidend. Er sprach — und ein Schluchzen wurde daraus —: »Lotte, du — du — Etwas fehlt mir. Etwas — etwas brauche ich. Ah — wie ich mich darnach sehne!«
»Wonach?« fragte sie.
Tonlos — verzweifelt fast klang es: »Ich weiß es nicht.«
Da sprach die Frau: »Ich werde es finden, lieber Junge.«
In Baltimore saß er im Hotelzimmer, vor ihm stand der Heroldredakteur. Der hielt sein Manuskript, verbesserte darin.
»Nein, nein, das geht nicht,« sagte er. »Da, an dieser Stelle müssen Sie knapp werden. Kurz, kräftig, nur ein Schlagwort. Sagen Sie: ›Deutsche Treue auf immerdar!‹ Das knallt!«
Frank Braun meinte: »Wir haben die ›deutsche Treue‹ schon dreimal.«
»Um so besser!« rief der Journalist. »Dann begreifen sie's.«
Unten auf der Straße wehten die Fahnen. Sterne und Streifen überall, von allen Fenstern und allen Balkonen. Und quer über die Straßen gespannt riesige Flaggentücher. Dicht gedrängt die Massen.
»Warum keine schwarzweißrote Fahnen zum Deutschen Tage?« fragte er.
»Deutscher Tag?!« Der lange Tewes lachte. »Baltimore feiert das Fest des Liedes vom ›Star Spangled Banner‹ — Hundert Jahre ists heute alt — und die schlechten Phrasen sind gewiß nicht schöner geworden in der Zeit. Aber hier ists höchste Poesie. Eine ganze Woche lang dauert das Fahnenfest — da ist der Deutsche Tag nur eine kleine Einlage.«
Der Festzug kam, hundert aufgeputzte Wagen und wieder hunderte. Frauen in römischen Schlachtwagen, als Amazonen ausstaffiert, Wagen mit riesigen Bierfässern, mit Häusern, Pappdrachen, Klavieren und allem möglichen Zeug. Wie im Kölner Karneval war es, nur viel geschmackloser, kleinlich, plump, unsäglich albern.
›Was soll ich hier?‹ dachte er.
Der Redakteur klopfte ihm auf die Schulter, gab ihm das Manuskript zurück. »Da, so wirds gut sein. Lesen Sie's noch ein paarmal durch. Und nun kommen Sie, es wird Zeit.«
Sie stiegen ins Auto, fuhren durch die Stadt; dann hinaus dem Meere zu. Ein mächtiger Vergnügungspark war da, Ringelspiele, Schaukeln, Schaubuden, Biergärten; da stiegen sie aus.
»Ein Rummelplatz!« sagte Frank Braun. »Hier soll ich reden?«
Der Redakteur nickte. »Freilich!«
Er führte ihn durch die Menschen, hinauf auf die große Musikestrade. Da saß das Komitee — zwei Dutzend schwere Männer im Bratenrock. Und im Hintergrund stand der Gesangverein: noch ein paar hundert Festtagleute. Der Redakteur stellte ihn vor, zweien oder dreien. »Sie kommen gerade recht!« sagte einer. »Gleich gehts los.« Sie mußten sich setzen, vorne, dicht an der Rampe.
Frank Braun blickte hinab. Da standen die Menschen — Männer, Kinder, Frauen — dicht an dicht. Menschen, Menschen den weiten Platz durch — unabsehbar fast.
»Wieviel sind es?« fragte er. »Sechstausend wohl!«
Der Journalist lachte: »Sechstausend? Was denken Sie! Gut vierzigtausend drängen sich da.«
Hier sollte er sprechen? Hier? Vor ein paar hundert Menschen, ja, vor tausend, vor zweitausend vielleicht — aber vor dieser gewaltigen Masse? Und im Freien — nur hinaus auf den Platz! Er griff nach seinem Manuskript — nicht eine Silbe wußte er mehr. Dann lächelte er: es gilt gleich — wird ja doch niemand eine Silbe verstehn.
Da fiel dreimal ein riesiger Hammer auf den eisernen Amboß. Der Pastor Hufner schwang ihn, der Vorsitzende des Deutschen Tages.
Sonor und voll schallte diese gewaltige Männerstimme über den riesigen Garten; wie tiefe Glocken klang sie. Nur ein paar Worte sprach er, und dann, zugleich mit den Tausenden, das Vaterunser.
›Man versteht ihn!‹ dachte Frank Braun. ›Ihn versteht man!‹
Der Pastor stellte den ersten Sprecher vor, ein Parlamentsmitglied aus Missouri.
»Passen Sie gut auf,« flüsterte der Journalist, »das ist ein rechter Volksredner — der weiß, wie mans macht. Lauschen Sie ihm die Technik ab.«
Der Amerikaner begann. Demagogengeschwätz, Schmeichelkram für das Volk, um das deutsche Stimmvieh zu fangen. Dann Witze, dicke plumpe schallende Witze, uralt — da lachte die Menge und kreischte. Er schwenkte die langen Arme in der Luft, schritt hin und her an der Rampe mit großen Schritten. Einen Satz spie er hinaus — laut, dröhnend. Nicht wie die Glockentöne des Pastors klang es — mehr wie eines Hammers rasche Hiebe. Dann eine Pause, breit gedehnt, länger noch wie sein Satz.
Und wieder aus vollen Lungen zehn, zwölf heulende Worte. Und die Pause wieder.
So also gehts, dachte Frank Braun. Er versuchte, sein Manuskript zu lesen, aber kein Wort sah er. Er sah nur — schwarz und wieder schwarz — diese Massen von Menschen, diese erdrückenden endlosen Menschenmassen. Die Bäume dahinten, hohe kahle Bäume — und das Riesenrad der russischen Schaukel.
»Ich kann es nicht,« flüsterte er. Er sah sich um — konnte er nicht aufstehn, still verschwinden — sich verstecken hinter die Sangesbrüder?
Aber der Redakteur hielt seinen Rock.
Wieder dröhnte die Hammerstimme, wieder — und noch einmal. Schlug ein Klatschen und Lachen mit mächtigen Hieben aus der schwarzen Menschenerde. Schwieg dann — hob sich wieder — dröhnte nieder.
Noch ein Witzwort — breit, fett — älter als alle. Alle kannten es — so lachten sie alle.
Der Amerikaner wischte den Schweiß von der Stirne, schwenkte dann sein Tuch, dankte für den lauten Beifall der Menge.
»Nun sind Sie dran,« rief der Journalist.
Er zitterte. »Nein, nein,« flüsterte er, »sagen Sie dem —«
Da fiel der Hammer, der aus Eisen. Und weithin über den Platz klangen die vollen Glocken des Pastors. Was sagte er? Ein Gast — ein Deutscher aus Deutschland — ein gefeierter — ein sehr berühmter — ein Halbgott — ein —
Von wem sprach er denn? Von ihm, Frank Braun? So mochte man Bismarck vorstellen — Goethe — Beethoven —
»Bravo!« sagte der Journalist. »Das nennt man vorstellen!«
Frank Braun zischte: »Unsinn schwatzt er. Keiner da kennt auch nur meinen Namen, keiner!«
»Natürlich nicht!« lachte der Journalist. »Ihren nicht — und überhaupt keinen! Wozu auch? — Aber gerade darum nimmt ers Maul so voll. Und prachtvoll macht ers.«
Der Pastor trat hin zu ihm, griff seine Hand, zog ihn hoch.
»Und hier ist er, meine deutschen Brüder, hier ist er selbst.«
Da stand er vor der klatschenden Masse, er allein vor vierzigtausend. Er zitterte vor Erregung, glühte hochrot in verletzter Scham. Biß in die Lippen, schluckte und würgte —
Pang, pang, fiel der Eisenhammer — da schwieg die Menge. Still, atemlos — vierzigtausend.
Alle Farbe verließ ihn. Blaß wurde er, bleich und weiß. Stand da, angewurzelt, starr und regungslos. Unfähig, ein Glied nur zu rühren.
»Reden Sie doch!« flüsterte der Redakteur.
Er begriff nicht. Reden sollte er? Er? Was denn?
»Lesen Sie!« scholl es wieder. »Nehmen Sie doch Ihr Manuskript!«
Ja, das war in seiner Hand. Er fühlte es, fest umklammerten es die Finger. Da hob er die Hand, entfaltete es, blickte hinein. Aber instinktiv nur, ohne Bewußtsein fast.
Von der schrecklichen Zeit — stand da etwas. Von der Heimat — von der Kriegsnot. Von Helden — von Tod und Sterben. Und davon — daß man geben solle — geben — geben — für die Brüder da drüben — geben.
Nichts begriff er, nichts. Ein Wort nur bannte sein Auge, ließ es nicht los mehr —
Weinen — stand da — Weinen —
»Fangen Sie an, zum Kuckuck!« flüsterte es.
Er riß den Arm herab, schloß die Augen. Zerknüllte sein Papier — warf es fort, sog die Lungen tief voll von Luft.
Und dann plötzlich schrie er hinaus:
»Reden? — Zu euch reden — die ihr lacht in diesen Tagen? — Weinen solltet ihr, Männer und Frauen, weinen und weinen!«
Etwas trug ihn, etwas hob ihn hoch in die Luft. Etwas riß ihn hinauf auf die Schneeberge, ließ ihn laut hinaussingen in die schwarzen Tale. Von Deutschland sang er und von seinem gewaltigen Ringen, sang von Siegesjubel und von Heldentod. Sang, sang von großem Sterben und der Heimat Not. sang, sang von dem einen gewaltigen Willen, von dem Willen, der Tat ward und reißendes Feuer.
Sang — —
Er fühlte nichts — er sah nichts — wußte nicht einmal, daß er war.
Nur eine Stimme hörte er. Er — er war die Stimme. Nur eine Stimme war er — und nichts sonst.
Dann war es still.
Nichts. Kein Wort. Kein leises Geräusch.
Das wunderte ihn. Eben noch sprach doch jemand. Sprach — er! Er?
Er zuckte. Heiß war ihm, sehr heiß. Auf Erden war er, stand da auf Brettern. Und gesprochen hatte er — eben noch — irgend etwas.
Das war ganz gewiß.
Dann — von unten her — ein Schluchzen. Und ein Weinen hinten. Was war denn nur?
Sie weinten, weinten. Vierzigtausend weinten. Warum nur?
Er stand wieder, regungslos, unbeweglich, Nur heiß war ihm, zum Sieden heiß.
Nun aber schrien sie. Klatschten. Brüllten.
»Verbeugen!« rief der Redakteur.
Da nickte er ungeschickt. Stand hilflos in all dem Jubel.
Aber die Herren kamen heran, preßten ihm die Hand. Die rechte hielt der Pastor und der Redakteur seine linke.
Der sagte: »Wie Raketen war es — wie himmelhohe Raketen!«
Und der Pastor sprach: »Das war sehr schön, was Sie sagten, von den Tränen, die sie weinen sollten! Die zu Perlen würden — zu Perlen und Schmuck und Gold und Geld! Und die sie geben sollten — heute noch — für der Heimat Not.«
Er murmelte: »Sagte ich das?«
Der Pastor schwang seinen Hammer. Nun verstand er gut, was der sagte. Alle sollten vorbeimarschieren an dem Musiktempel. Sollten ihre Gabe bringen für Deutschland — was immer es sei.
Dann gab ihm einer einen Mantel.
»Ziehen Sie ihn an,« rief der Herr, »Sie sind ganz naß.«
Er befühlte sich — o, naß war er. Nicht Hemd nur und Unterzeug — auch Weste, Jacke und Hose.
»Zum Auswringen!« lachte der Journalist. »Besser als ein Dampfbad! Vier Pfund wenigstens!«
Er zog den Mantel an, dankte.
Einer brachte ein mächtiges Tischtuch; vier Herren nahmen je einen Zipfel davon. Sie stiegen die Estrade hinunter, stellten sich auf — vorne der Pastor und Frank Braun neben ihm.
Die Musik setzte ein, und der Männerchor sang. Hundertundzwanzig Männerstimmen.
Dann kamen sie heran — die Tausende.
»Darf ich gehn?« fragte er.
»Nein, nein!« rief der Redakteur. »Sie sind sehr notwendig hier: jetzt kommt die Hauptsache.«
Die Menschen warfen Geld in das Tuch — und viele Scheine. Ringe und Broschen und Uhren. Volle Börsen gaben manche — zogen Nadeln aus den Krawatten, nahmen die Ohrringe ab. Er sah ein kleines Mädchen, das seinen Ball hineinwarf — sah ein Dienstmädchen, das eine goldne Schnalle vom Kleide trennte —
Und ihm, ihm gaben sie die Hand. Zehn, hundert — tausend —
Erst gab er den Händedruck zurück, preßte wieder. Aber die Hand begann zu schmerzen.
»Nicht drücken,« riet ihm der Journalist. »Nur die Finger hinhalten.«
Das Tuch war voll — man brachte ein neues. Wieder fielen Geldstücke — und Uhren — und Ringe —
Und wieder drückte er Hände. Schwarze Fäuste und rote, schwielige und sehr schmutzige. Auch — selten einmal — eine reine und weiche —
Die Hand schwoll ihm auf — aber er hielt sie hin.
Er dachte: ›Hättest du sonst je einem von allen die Hand gereicht? Einem nur?‹
Dann zwang er sich. Da drüben liegen sie im Schützengraben. — Du — du — brauchst nur die Hand zu geben.
Deine Hand — deutschen Händen. Deutsch — wie deine Hand.
Aber es half nichts. Es ekelte ihn — dennoch!
Warum tust du es denn? dachte er. Was gehts dich an?
Kling, kling — fiel es in das Tuch — und wieder: kling!
»Das ist Ihr Geld,« lachte der Pastor. »Sie allein machten es! Es werden wohl hunderttausend Taler werden — nur das Bargeld gerechnet!«
Er freute sich. O ja! Aber er dachte doch: ›Was gehts mich an?‹
Nun gab er die linke Hand — bis sie schmerzte. Aufschwoll wie die rechte. Wechselte dann — rechts — links —
Und immer mehr kamen — immer noch mehr.
Da schloß er die Augen.
Was sie nur wollte, tat er, willenlos. Er wohnte nicht bei Frau van Neß — aber er war doch immer da. Selten nur — einmal am Tage kaum — ging er nach Hause, sich umzuziehn oder etwas zu holen. Tagsüber lag er herum auf ihren Diwans und Sesseln, las ein wenig, plauderte mit ihr. Oder saß still versunken da — blickte vor sich hin. Aber er träumte nicht.
Ihr Kind war er — tagsüber. Sie pflegte ihn, dokterte so herum.
Nachts war er ihr Geliebter. Lag bei ihr — ließ sich küssen und küßte sie. Gesund sah er aus, stark und blühend. Er lachte, wenn er neben ihr stand vor dem großen Spiegel. Sie — weiß, weiß und kaum ein paar Flecken darin: oben das Rothaar — dann die roten Knospen ihrer Kinderbrüste. Und die aufgelegten Stellen: Hennah auf den Nägeln — und ein klein wenig Rot auf den Lippen — an den Nüstern und Ohrläppchen. Und er — tiefbraun der ganze Leib — noch hielt die Schminke der Tropensonne.
Er hob sie auf — zum Zerbrechen war sie. Er — war stark.
Und doch fühlte er: unter der braunen Haut bist du bleicher als sie. Viel, viel bleicher.
Und: sie ist stärker als du — sie.
Und dann, zuweilen: du bist die Frau. Sie — sie ist dein Mann. Sie.
Sie beobachtete ihn, unausgesetzt, tagsüber und nachts. Selbst in ihren Umarmungen fühlte er, daß ihn etwas umlauerte.
»Kannst du nicht vergessen?« sprach er. »Jetzt?«
Sie fragte: »Was?«
»Was?« gab er zurück. »Dich. Mich. Alles!«
Sie sah ihn voll an, küßte ihn. »O ja,« antwortete sie. »Wenn du wieder gesund bist, Frank Braun.«
Sie ließ Ärzte kommen, einen um den andern. Ließ ihn untersuchen, viermal, fünfmal. Herz und Lunge — und Nieren — und alles.
Die sagten, daß er gesund sei. Stark, gesund, kräftig. Nichts fehle ihm, gar nichts. Diese Müdigkeit — diese Apathie — eine kleine Nervenschwäche nur —
Tüchtig essen solle er. Und nicht so viele Zigaretten rauchen.
Aber Lotte van Neß schüttelte den Kopf.
»Ich werde es finden,« bestand sie.
In dieser Nacht lief er durch die Straßen.
Er war aufgewacht, in dem breiten Bette, neben ihr. Aber anders als sonst, nicht müde — frisch, o so frisch! Nur — eine Angst hatte er — eine große Angst. Und er wußte es gleich: es war eine Furcht vor der Frau da.
Er saß auf dem Bettrand, einen Augenblick nur. Griff nach Strümpfen und Hemd, suchte die Hosen. Kleidete sich an. Das war gewiß, daß er fortmußte.
Die Lippen klebten ihm — er wischte sie ab am Hemdärmel — da sah er ein wenig Blut. Aus der Kehle — aus der Lunge? So war er doch krank?
Aber so jung fühlte er sich, gerade jetzt.
Er trat vor den Spiegel, zog Weste an und Jacke. Hinten vom Bett her kam ein Weinen, ein Schluchzen fast. Aber so leise, so sehr leise. Sie schlief gewiß, weinte im Schlaf.
Er ging nicht zurück, küßte sie nicht. Eilte aus dem Zimmer, fuhr hinab im Aufzug, öffnete die Haustüre.
Er atmete, atmete. Er wußte nichts, aber er empfand: er war krank gewesen. Und war nun — ganz plötzlich — gesund. Und er fühlte: das alles hängt zusammen mit dieser Frau — mit Lotte van Neß.
Sie hielt ihn fest, nur sie. Und schlimmer ward es und schlimmer, seit er mit ihr war. Wie ein Verwelken war es.
Ihre Puppe war er, ihr Spielzeug.
Dann fiel ihm was ein. Lotte Lewi, ein Kind damals, das doch mit fünfzehn Jahren die suchenden Nerven hatte und die wilden Sehnsüchte nach allen verschleierten Sünden, wie nur eine kluge, schöne — o so erfahrene Frau der Welt. Und dennoch ein Kind war — unschuldig und blank. Und sie nun, Lotte van Neß — dreißig Jahre — so wie einst sehnsüchtig und verlangend in allen Nerventräumen — und dennoch: Kinderbrüste und Kinderseele.
Sie fraß ihn auf, sie saugte ihn aus — ja, das tat sie. Aber sie tat es, wie ein liebes kleines Mädchen, das froh war und glücklich, wenn es sein Zuckerl lutscht.
Er war das Zuckerl.
Das gefiel ihm, er lachte. Ein Zuckerl war er schon, freilich, süß und ein wenig sauer und bitter zugleich. Langweilig nicht, fad nicht — war so ein rechtes Fressen für eine verwöhnte Kinderzunge. Aber er war mehr noch, war ein Wunderzuckerl, so ein großes, dickes, wie er es sich immer gewünscht hatte als kleiner Junge. Man lutscht und schleckt, bis es kleiner wird und ganz klein — und dann, plötzlich, ists wieder groß und dick wie zuvor. So eins war er — fast aus wars mit ihm, fast vergangen war er in den Küssen dieser Frau. Und war nun doch wieder dick und groß und war hinausgesprungen aus Lottekinds Mäulchen. Atmete alle fröhliche Freiheit. Lief durch die Nacht über Broadway.
Schmutz, viel Schmutz. Überall Papierfetzen, die im Winde tanzten. Er ging über den Fahrweg — da stieß sein Fuß an einen toten Hund. O ja, er war in New York, und in keiner Stadt der Welt liegt das Aas so lange auf den Straßen. Oben waren Sterne vielleicht — wer sollte es wissen? Denn so hoch reckt man den Kopf nicht, um nach oben zu sehn, hinüber über die zwanzig, vierzig, sechzig Stockwerke an beiden Seiten. Steinmauern, häßlich und schmutzig — da krabbelt man unten hin. Über den Boden — den sie Pflaster nennen in dieser Stadt. Steine, Asphalt — Holz, viel Holz. Eisen und Glas. Alles durcheinander, sinnlos, zwecklos, wie es gerade der Augenblick verlangt. Nichts glatt, mächtige Beulen überall, Zementbeulen über irgendein Zerbrochenes, wie Eitergeschwüre. Und Risse dazu und Löcher — wie die eines Leprakranken ist die Haut New Yorks.
Leer die Schmutzgassen. Nur ein Betrunkener, schwankend, hier und da — und dann, pfeifend, ein irischer Schutzmann. Oder, an den Ecken, ein Bettler. Keiner von Beruf, wie in Andalusien, keiner, der davon lebt und glücklich ist. Bettler nur, die nichts zu sagen brauchen. Frierend, bleich, mit blauen Lippen und verglasten Augen. Die schreien: ›Ich suche Arbeit seit Monden. Ich finde nichts. Ich hungre.‹ O ja, zehntausend verhungern auf der zerfressenen Leprahaut dieser Stadt. Oder erfrieren auch — da ists gleich, wie das Totenzeugnis lautet. Beides ist richtig — so oder so — und tot ist er.
Er war kein Bettler. Er gab, gab, sein ganzes Leben hindurch. Gab allen, die kamen, allen und immer — sein bißchen Geld — und sein Herzblut und seine Seele. Aber ihm, freilich, wer gab ihm?
Was tats — blieb er nicht reich? Mochten sie nehmen, mochten sie doch. Fressen und saugen! Heute fühlte ers gut: ein Zauberzuckerl war er und nicht kleinzuschlecken!
Früh genug stand er auf. Badete, zog den Kimono an. Schellte um seinen Tee.
Dann griff er den Fernsprecher, klingelte die Frau an »Ich bin gesund, Lotte,« rief er, »ich bin gesund.«
Sie antwortete: »Ich weiß es.«
Das ärgerte ihn. Was konnte sie davon wissen! »Du!? Ach wie klug du doch bist. So sag doch, was du weißt!«
Er hörte: »Diese Nacht —«
Aber nichts mehr. Da rief er: »Diese Nacht? Ich lief fort — ja! Dir — fort! Daraus schließt du —?«
Langsam kam es, zögernd: »Nein. Daraus nicht. Ich wußte es — vorher schon. — Ach nein!«
Da drängte er: »Geh, Lotte, sags!«
»Nein!« gab sie zurück. »Nein! Was gehts dich an? Verzeih — das lernte ich von dir.«
Und er wieder: »Gut, gut! Aber du mußt es doch sagen. Komm her, Lotte, hol mich ab in deinem Auto. Wir fahren den Strom hinauf, hinaus aufs Land.«
Da schluchzte es. »Ich kann nicht. Ich — ich bin krank. Ich will auch nicht, daß du zu mir kommst — heute — diese Woche. — Wart, bis ich rufe.«
»Lotte,« rief er, »Lotte —«
Keine Antwort kam.
Der alte Diener brachte den Tee und die Morgenblätter. Stumm, gefühllos, idiotisch.
›Frag doch, wo ich war?‹ dachte Frank Braun, ›Frag doch, ob ich nun wieder hier schlafe?‹ Aber der alte Diener fragte nichts. Er ging schweigend durch die weiten Zimmer, nahm sein Staubtuch auf.
»Mach, daß du raus kommst,« fuhr ihn Frank Braun an. Da schlich er fort.
Eine Pampelmuse. Tee und Brot. Die Zeitungen und die erste Zigarette.
Dann klopfte es. Der Diener meldete den Redakteur.
»Laß ihn eintreten,« befahl er. Er war froh, daß jemand kam; nun konnte er sprechen.
»Doktor,« sagte der Tewes, »nun ist alles in Ordnung. Hier ist der Reiseplan — in drei Tagen sollen Sie fahren. Wir fangen oben an, in Neu-England — Boston zuerst. Dann den Mittelwesten, Cincinnati, Cleveland, Detroit, Chicago. Achtundzwanzig Städte im ganzen — das ist genug für die erste Rundfahrt. Ich fahre voraus, heute noch. Ich glaube, daß alles gut vorbereitet ist — wir hatten schon Angst, daß Sie uns dennoch im Stiche ließen.«
»Im Stiche ließen?« lachte er. »Habe ich denn irgendwas versprochen?«
Der Redakteur sagte: »Sie nicht, Doktor!«
»Wer denn?« fragte er.
Ganz geschäftsmäßig klang es: »Frau van Neß.«
Da fuhr er auf: »Frau van Neß? Sie hat Ihrem Ausschuß versprochen, daß ich fahren würde? Vermutlich hat sie Ihnen dann auch angedeutet, daß ich nicht so ganz zuverlässig wäre — und daß ich Sie vielleicht doch aufsitzen ließe?«
»Ja,« nickte Tewes. »Wir hörten, daß Sie krank seien?«
»Von wem, bitte?« fragte er.
»Von Frau van Neß,« antwortete der Journalist.
Frank Braun trommelte mit dem Finger auf dem Tisch. »Frau van Neß!« brummte er. »Und die Dame hat Ihnen vermutlich auch gesagt, daß ich nun wieder gesund sei?«
Der Tewes machte ihm nach. »Ja. Die Dame hat uns das gesagt. Die Frau — Frau van Neß — hat mich soeben angerufen — hat mir gesagt, daß alles in Ordnung sei. Daß Sie fahren würden.«
Er stand auf, trat dicht vor dem Redakteur. »Bitte!« rief er. »Ob ich für Ihren Arbeitsausschuß Reden halte — ob ich fahre oder nicht — was geht das Frau van Neß an? Und wieder: wenn ich und die Dame — ja was zum Kuckuck geht das Sie an und Ihr Komitee?«
Der Redakteur lachte. »Gehn Sie, Doktor, seien Sie kein Kindskopf! Seit Kriegsausbruch haben wir hier wohl dreißig Arbeitsausschüsse — für alle möglichen patriotischen Zwecke — und wenn er ein Jahr dauert, werdens dreihundert sein. Und die Alliierten — glauben Sie mir — haben zehnmal soviel. Bilden Sie sich ein, daß alle die Komitees umsonst arbeiten könnten? Ein Rückgrat brauchts — backing nennt mans hier: Geld! Unser Rückgrat — oder gut dreiviertel davon — ist Frau van Neß. Und wenn unser Interesse an Ihrer Redetätigkeit im Lande sich zufällig mit dem Interesse, das die Dame persönlich an Ihnen nimmt, deckt — so kanns uns nur recht sein: um so runder sind ihre Schecks. Begreifen Sie nun?«
Begreifen? Gewiß — die Herren des Ausschusses verstand er gut. Er wußte, was Agitation, was Propaganda kosteten in diesem Lande, wußte sehr wohl, daß alle die Vereine und Komitees immer herumliefen mit dem Klingelbeutel: Geld — Geld! Manche Tausende mußte man schon hinauswerfen, um die Millionen einzunehmen — die Traummillionen für die Heimat drüben.
Aber sie? Lotte Lewi? Was sollte sie dabei? Ein bißchen Geld geben, Schecks schreiben — in Gottesnamen ja! Sehr reich war sie ja. Und wenn sie Tausende gab, wie er Centstücke — so war es doch noch kaum der Rede wert.
Dies aber war ein anderes. Sie hatte ihn den Herren vorgeschlagen, sie hatte den Redakteur zu ihm geschickt. Und das Komitee — aber noch mehr, sie — hatte ihn nach Baltimore gesandt.
Um ihn — auszuprobieren. Ja, das war es.
Und — mit ihrem Gelde — schickte ihn nun der Ausschuß auf die Redereise. Oder auch: sie schickte ihn — durch den Ausschuß. Nicht daß man ihn zahlte — o nein — aber man schuf ihm doch die Möglichkeit zu sprechen und — zwang ihn dazu!
Warum denn nur? Was hatte sie davon — Lotte Lewi?
Nichts begriff er. Er strich die Haare zurück, zog die Lippen hoch.
»Ich fahre — doch!« sagte er.
Der Tewes pfiff. »Doch!? Was: doch? — Natürlich fahren Sie!«
Er sprach in Boston, sprach in Buffalo, Rochester und Albany. Er sprach in Columbus, in Milwaukee. Jeden Tag redete er und manchmal zweimal am Tage. Redete in Sälen, in Theatern, in Feuerwehrhallen — zweimal auch herab von der Kanzel. Das Publikum drängte sich, nicht weil es eine Ahnung hatte, wer er war — sondern weil die Vorreklame gut war, die der Redakteur machte.
Viele Hände schüttelte er und empfing Reporter, jeden Tag neue. Erzählte immer wieder dieselben Sachen — morgens den Reportern, abends dem großen Publikum und hernach den einzelnen Leuten. Stieg in den Zug, zog sich aus, schlief: kam in stets das gleiche Hotelzimmer überall, badete in immer derselben Badewanne, fand auf jedem Nachttisch die gleiche schwarze Bibel. Jeden Morgen brachte man ihm Zeitungen — stets war sein Bild darin, immer dieselben Phrasen schwatzten von ihm. Wie eine Maschine ging das alles.
Dann aber, irgendwo, setzte ein Rädchen aus. Er fühlte es kaum, aber der Redakteur merkte es, der ihm nicht von der Seite wich. Er führte ihn gleich weg von der Bühne, sowie nur der Applaus zu Ende war, ließ ihn nicht mehr sprechen mit den Leuten. Er empfing nun auch die Zeitungsleute selber, ließ ihm Sekt bringen jeden Abend vor dem Auftreten.
»Was ist denn?« fragte Frank Braun.
»Sie müssen sich schonen,« sagte Tewes. »Sie sind wieder müde. Sie sind krank. Ich habe die Verantwortung.«
»Vor wem?« lachte er. »Vor Ihrem Ausschuß? Der fragt den Kuckuck darnach, ob ich ein wenig müde bin.«
Da sagte der Journalist: »Sicher nicht! Aber ich habe einen Extrajob. Zwanzig Dollar auf den Tag.«
»Einen Extrajob?« fragte er. »Sie? Von wem denn — und was?«
»Es ist durchaus in Ordnung,« sagte Tewes. »Ich soll auf Sie aufpassen — und Frau van Neß zahlt es.«
Wieder?! Er wollte auffahren, aber der Redakteur kam ihm zuvor. »Verschieben Sie es!« sagte er ruhig. »Eben hats geklopft — der Arzt ist da!«
Er schrie: »Schmeißen Sie ihn hinaus! Ich will keinen Arzt sehn, verstehn Sie!«
Der andere zuckte die Achseln. »Schon gut, ich werde ihn fortschicken. Ich habe meine Pflicht getan.«
An diesem Abend sprach er schlecht. Er sagte genau dasselbe, wie an allen Tagen, hob seine Stimme, senkte sie, machte eine Pause, genau wie immer. Aber irgend etwas fehlte, das, was die Menschen gefangen nahm. Es war ihm, als ob eine weite Wüste liege zwischen ihm und den Leuten da, als ob die Rampe zur starken Mauer würde, die sich vor ihn dränge. Er kam nicht hinüber heute. Er stand da, sprach, einsam, gleichgültig — und so müde.
»Kein Blut mehr!« sagte der Redakteur. Noch in der Nacht telegraphierte er, sagte die zwei, drei übrigen Abende ab. »Aber morgen, morgen muß es noch einmal gehn. Reißen Sie sich zusammen, Doktor.«
Er brachte ihn zum Zuge, bereitete ihm das Bett. »Schlafen Sie sich aus, recht fest!«
Frank Braun schlief, fest genug und ohne sich zu regen in den hellen Tag hinein; wachte erst auf dicht vor Philadelphia. Müder als je, dennoch.
Diesmal war es eine Debatte, in dem mächtigen Theater der Musikakademie. Das Haus war voll zum letzten Platze, weit auf der Straße standen die Menschen. Tewes führte ihn den Bühnenaufgang hinauf, geleitete ihn in seine Garderobe. Er drückte ihm einen Zettel in die Hand. »Da, lesen Sie! Damit Sie wissen, was heute los ist! Sie scheinen es ganz vergessen zu haben!«
Frank Braun las. Er wußte genau, was da stand, erinnerte sich gut, das alles im Manuskript gelesen zu haben, und dann wieder in Korrekturbogen. Sein Bild war da und sein Name, dazu das übliche Geschrei über seine angebliche Berühmtheit. Dann auf der andern Seite das Bild einer schönen Frau: Miß Maud Livingstone stand darunter. Und daß sie die berühmteste Schauspielerin der Welt sei, die intime Freundin und beste Interpretin G. Bernard Shaws, daß sie —
O ja, er wußte es. Sie würde für England sprechen. Er für Deutschland. Sie zuerst — dann er — und noch einmal sie. Ein Turnier war es, ein Hahnenkampf —
Der Journalist nahm eine Sektflasche aus dem Kübel, schenkte ihm ein. »Trinken Sie, trinken Sie! Überwinden Sie Ihre Apathie! Nur heute noch.«
Er goß den Sekt herunter wie Wasser, aber er blieb müde und kalt, blickte völlig gleichgültig auf den zappelnden Mann, der da vor ihm stand. Er hörte jedes Wort, das der Journalist sagte, aber es war ihm, als ob er gar nicht zu ihm spräche.
»Fünftausend sind da! Die beste Gesellschaft der Quäkerstadt! Pro-englisch dreiviertel! — Trinken Sie doch! — Und dann: Ihr Gegner heute ist eine Frau — eine Dame — bedenken Sie! Das ist nicht wie gegen Chesterton in Cleveland oder den Hillis in Cincinnati! Eine Frau steht gegen Sie — in Amerika! Sie dürfen mich nicht blamieren heute. — Jedermann hat mir abgeraten, die Herausforderung anzunehmen für Sie — und ich habs doch getan. — Trinken Sie! — So fest habe ich auf Sie vertraut. Sie müssen siegen heute — Doktor — hören Sie? Selbst über eine Frau! Noch ein Glas! Neun Chancen von zehn sind gegen Sie — es muß doch gehn, verdammt noch mal!«
Frank Braun nickte, gelangweilt stand er auf, zupfte seine Krawatte zurecht. Dann sagte er ruhig: »Vielleicht gehts — vielleicht nicht. Wahrscheinlich nicht.«
»Um Gottes willen —« begann der Redakteur.
Aber er unterbrach ihn: »Lassen Sie nur. Ich weiß es jetzt gut: etwas in mir spricht — nicht ich. Und wenn das nicht mag —«
»Was nicht mag?« rief der andere. »Was? Was spricht in Ihnen?«
Da lachte er: »Was —? Ja, das weiß ich so wenig wie Sie, lieber Herr.«
Er ging hinaus, hinter die Kulissen. Da stand mit einem älteren Herrn eine Dame im Abendkleide, sehr groß, sehr stark, mit mächtig ausladenden Hüften und Brüsten.
»Ist das die Livingstone?« fragte er.
Der Redakteur schüttelte den Kopf. »Die — nein! — Aber das ist ja die Farstin! Kennen Sie sie nicht?«
O ja, er kannte sie, Emaldine Farstin, die beste Sängerin zweier Welten. Kannte sie von der Dresdener Oper, von Berlin, von Neuyork.
Tewes stellte ihn vor, die Diva reichte ihm die Hand.
»Ich habe morgen ein Konzert hier,« sagte sie, »aber ich bin einen Tag früher gekommen, um Ihre Debatte zu hören. Sie haben Mut, Doktor, — gegen eine Dame zu sprechen in diesem Lande.«
Sie sah ihn an mit großen schwarzen Augen. ›Warum brennen sie nicht?‹ dachte er.
»Hals- und Beinbruch!« wünschte ihm die starke Frau. »Ich halte Ihnen die Daumen.«
Die Glocke klang schrill und durchdringend. »Kommen Sie,« drängte der Redakteur. »Auf die Bühne! Gehn Sie nicht mit, Gnädigste?«
Sie lachte: »Kein Platz mehr — so voll ists kaum, wenn ich singe! Wir sind froh, ein paar Stühle zu haben, hier in der Kulisse.«
Der Journalist zog ihn mit auf die riesige Bühne; noch war der Vorhang nicht herauf. Im Halbkreise saßen hinten zwölf Reihen Menschen; vorne, dicht an der Rampe, standen drei Tischchen und drei Stühle.
»Der Herr da ist der Unparteiische,« sagte Tewes, »die beste Karte der Stadt. Ein Schotte, Oberrichter — kost' uns hundert Dollars!«
Er stellte ihn vor. Dann, von der andern Seite, kam die Schauspielerin mit ihrem Impresario — man begrüßte sich und gab sich die Hände.
Der Schotte nahm den Zettel, las laut:
»Also: ›Wird der Sieg der Zentralmächte oder der der Alliierten — der Welt — und ganz besonders Amerika — Fortschritt bringen?‹«
Die Engländerin lachte: »Das ist sicher: nichts auf Erden wird je diesem Affenlande Fortschritte bringen!«
Frank Braun blickte auf. Sie ist gescheit, dachte er. Er schaute sie an, suchend, prüfend, so wie ihr kritischer Blick ihn maß.
Sehr elegant war sie in ihrem lavendelfarbenen Kleid. Graue Augen, scharf und klug. Und ebenmäßig, edel das Gesicht. Ungeschminkt. Und keine Perücke. Welliges Blondhaar, einfach zurückgekämmt und ein wenig ergraut an den Schläfen. Keine Komödiantin — eine große Frau.
»Raffiniert ist sie!« flüsterte Tewes. »Die versteht ihr Publikum!«
Noch ein Zeichen; dann hob sich der Vorhang.
Der schottische Richter stellte sie dem Publikum vor; und mit gutem Witz. Nichts wußte er von den beiden, als was er eben auf dem Zettel gelesen hatte — aber wußte das Publikum mehr? Er log und schwatzte — und die Leute klatschten und amüsierten sich. Sprach von dem mörderischen Europa, wo man sich gegenseitig totschlug, und von diesem herrlich zivilisierten Lande, wo die Kämpfer mit Geisteswaffen einander gegenüberständen. Erzählte einen langen Roman von der Berühmtheit der beiden Kämpen — und von der seinen — schloß natürlich mit dem ›Star-Spangled-Banner‹: da war die Stimmung da.
Und gab das Wort der Frau.
Bescheiden sprach sie und klug. Gleich im Anfang ein paar volltönende Sätze über dies Wunderland Amerika, dann schnell einen raschen Witz. Sie zeigte ihre prächtigen Zähne, betonte jedes ihrer Worte, redete einfach und gewinnend.
Frank Braun fühlte: sie kennt die Menge. Kennt sie und fängt sie und hält sie. Fest, sehr fest — in dieser kleinen nervösen Hand.
Er würde die Masse heute nicht halten — er nicht. Er schaute hinab: atemlos lauschten sie; jedes Auge hing an dieser geschmeidigen Frau. Keiner blickte hin zu ihm.
Da stand er auf, ganz ruhig und leise. War mit zwei Schritten in der ersten Kulisse. Er lächelte — so gewiß war er, daß kaum einer es bemerkt hatte.
Einer doch — Tewes.
Der kam ihm nach im Augenblick. »Wo wollen Sie hin?« fragte er. »Weg? Fort? Das ist —«
Frank Braun sagte: »Feige. Ja. Meinetwegen.«
Der andere faßte ihn am Rock, redete auf ihn ein. Bitten und Schelten — wie Hagelschlag fiel es. Feigheit — Verrat — schlimmer als Desertion — sich schämen solle er! Erbärmliche Flucht —
Er hörte zu, geduldig genug. Antwortete nichts.
Immer aufgeregter wurde der Redakteur. Ließ ihn doch los am Ende, als er sah, daß das alles vergebens war.
Sagte: »Gehn Sie nur, wenn Sie wollen! Und für mich ists schließlich auch besser!«
Frank Braun fragte: »Warum für Sie?«
Da zog Tewes ein Telegramm aus der Tasche, gab es ihm:
»Da, lesen Sie! Das ist die Antwort auf meinen Bericht von heute morgen.« — Er las: »Auch heute absagen. Ihn sofort zurückbringen. Van Neß.«
Der Journalist sagte: »Ich habe doch nicht abgesagt — um der Sache willen. Das hätte mich meinen Job gekostet — und ich kann die Groschen wahrhaftig gebrauchen. Darum ists besser für mich, wenn Sie nicht reden.«
Frank Braun zerknüllte das Papier. »Sie soll ihren Willen nicht haben!« zischte er. »Ich rede.« Dann zu Tewes: »Gehn Sie nur — ich komme auf die Bühne zur rechten Zeit.«
Er drehte ihm den Rücken, ging mit langen Schritten um die Kulissen herum. Trat in seine Garderobe, trank den Rest der Sektflasche aus, ging wieder auf die Bühne. Lief auf und ab.
Er quälte sich und zerquälte sich. Er krampfte die Finger und biß die Zunge. Strich mit beiden Händen über das Gesicht. »Es muß — es muß —« flüsterte er.
Aber er zwang es nicht. Leer blieb er, leer.
Wie ein Samum war es — und nirgend ein grünes Hälmchen.
Dann fieberte er, zitterte, fühlte die Tränen in seinen Augen, fühlte, wie die Knie ihm brechen wollten —
Taumelte, hielt sich an der Kulisse fest.
Ein Lärm schreckte ihn auf — drinnen klatschten sie und jubelten. Verzweifelt, hoffnungslos starrte er vor sich hin — wie einer, der gehängt werden soll.
Etwas zog ihn — da schwankte er vorwärts einen Schritt. Blickte auf — traf das dunkle Auge der Diva.
»Was ist Ihnen?« fragte sie.
Er winselte: »Ich weiß nicht.« Dann aber — plötzlich, ohne Übergang: »Darf ich Sie küssen?«
Er wartete nicht auf ihre Antwort. Er griff sie, zog sie an sich, wild, tierisch. Er riß ihre Arme herab, preßte seine Brust an ihre mächtigen Brüste. Faßte ihren Kopf, küßte sie.
Er fühlte wohl, wie sich ihre Lippen öffneten. Er schloß die Augen, trank, trank diesen rasenden Kuß —
Lärmen hinten und Klatschen und Schreien —
Da riß er sich los; lief wieder herum um die Bühne, am Hintergrund vorbei. Er hörte die Schelle des Unparteiischen, fühlte das plötzliche Schweigen der Menge, hörte dann des Richters Sätze, der ihm das Wort gab. Nun war er vorne, nun trat er auf die Bühne, dicht an seinen Tisch.
Aber die Leute wollten ihn nicht. Ein paar begannen — und alles fiel ein. Klatschte von neuem, und immer wieder, der Frau zu.
Er stand da, bebend, nervös, lächelnd, strich sich das Haar zurück, wartete —
Wieder erhob sich der Unparteiische, bat um Stille. Wieder schwieg die Menge, aber sie zischte und schrie, so wie er den Mund öffnete. Klatschte von neuem für die Frau.
Er begriff es gut: sie wollten ihn nicht zu Worte kommen lassen. Aber er lachte.
Dann winkte die Schauspielerin mit der Hand, da schwiegen sie. Und sie bat — für ihn. Das sei nicht gerecht — man solle fair sein — in diesem Lande der Freiheit und Gerechtigkeit — solle auch ihn reden lassen.
Da klatschten sie wieder.
Wie gescheit sie ist, dachte er. Und wie sicher ihres Sieges. Sicher wie der Major auf der ›Ryndam‹!
Nun schwiegen sie. Nun konnte er beginnen. Er sprach leicht, leichter als je. Er machte keinen guten Witz und sagte kein schönes Wort über dies herrliche Amerika. Er sprach gewandt und flüssig, vollbewußt jeden Wortes und jeder Wirkung. Sprach so gut wie die Dame auch —
Und sicherer noch —
Denn er fühlte, daß es kommen mußte. Jetzt vielleicht — oder im nächsten Satze — oder im übernächsten. Einmal mußte es kommen —
Das, was sie nicht hatte. Das, was er verloren hatte heute und nun wiederfand in dem Kuß der großen Frau. Das, was die vielköpfige Bestie da unten zahm machte und artig, wie ein Kätzchen, das hübsch aus der Hand frißt und die Peitsche leckt —
Das, was ihm die Macht gab, seine Gedanken einzuhämmern in des Tieres Hirn und seines Augenblicks Glauben in des Tieres zottige Brust.
Und nun griff er ein Wort, zwei oder drei — einen Satz. Geschmeidig, geschliffen und spitz — schlug ihn hinab wie einen Reitgertenhieb. Noch einmal und wieder — da flogen weit auf die eisernen Tore vor dem schwanken Schlage seiner Zaubergerte.
Und das Tier der fünftausend Köpfe hatte doch eine große Seele nur. Und die Seele war gewaltig und weit wie ein Dom — da trat er hinein durch das Eisentor. Berauscht von seiner Reitgerte Pfiff — berauscht von der Brandfackel, die seine Linke trug. Die warf er hinein in die Tiefen des Domes: da flammte es auf. Nun sah er nichts mehr: Rot nur trank sein Auge. Blut, dachte er. Blut. Durch das Flammenmeer schritt er — laut schreiend. Lachend. Wie ein Prophet —
Das blieb ihm, das nur. Seine Worte hörte er nicht, und nicht den Sturm der Menge, als er schwieg. Hörte nicht die Sätze des Richters, noch das ängstliche Schlußwort der englischen Frau. Noch das Toben und Klatschen und Schreien am Ende — das ihm nur galt — ihm und seiner Sache. Sah die Flammen nur und all das Blut —
In der vierten Kulisse stand er mit der starken Diva. »Wohnen Sie auch im ›Ritz‹?« fragte sie. Er nickte.
»So speisen Sie zu Nacht mit mir,« fuhr sie fort. »Und —«
Er nahm ihre Hand, küßte sie. »Ja,« sagte er, »das will ich tun.« Er hielt ihren Blick — und jetzt brannte der warm und gut. Weich auch und heimlich zugleich, wie ein Kaminfeuer.
Er begehrte sie rasch, wie er fühlte, daß sie ihn wollte — und das sprach sein Auge. Das ihre antwortete: heute nacht.
Sie nahm seinen Arm, preßte ihn.
Dann lachte sie: »Ich trinke ein Glas Bordeaux vor jedem Auftreten. Mancher muß Chartreuse haben, mancher Bier oder sonst was. Aber Sie —?! Dann wünsche ich Ihnen nur, daß Sie immer ein so gutmütiges Schaf finden wie mich!«
Der alte Herr lachte, und der Redakteur und die andern, die herumstanden. Tewes scherzte: »Sekt hat er bekommen — eine ganze Flasche voll! Das wirkt nicht mehr bei ihm.«
Er verbeugte sich: »Schöne Frau — ist Ihr Kuß nicht besser als Champagnerwein?«
Sie zog die Lippen hoch. »Lassen Sie das doch — das steht Ihnen nicht.« Sie zog ihn herein in die Kulisse, sagte leise: »Meinst du, ich weiß nicht, was du wolltest? Da!« Sie hielt ihm ihr Taschentuch hin — das war rot von Blutflecken.
Er starrte auf das Tuch. Das — das hatte er gewollt?
Sie flüsterte: »Meine Lippe hast du zerbissen! Ich werde dirs heimzahlen — heute nacht!«
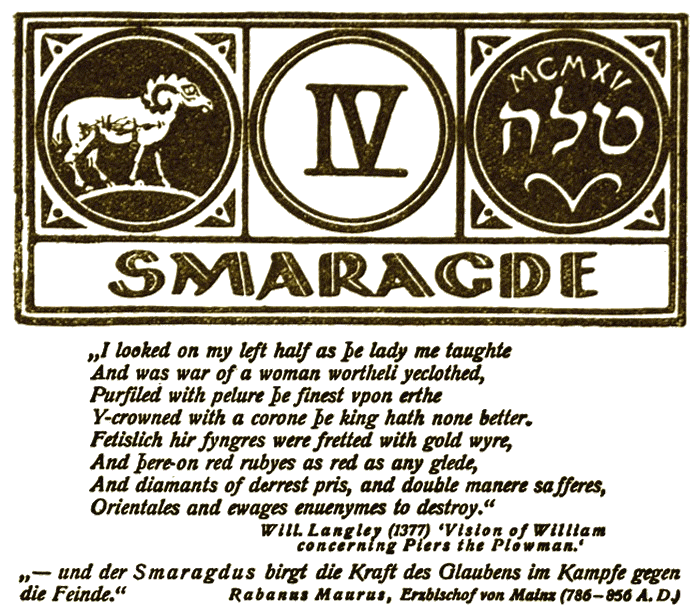
Sie hatten ihn gut und fest in Newyork — er war mitten drin in der deutschen Arbeit. Morgens, früh genug, brachte sein Sekretär die Post, las sie ihm vor. Er diktierte Briefe, dann Aufsätze für Zeitungen und Zeitschriften. Und Besucher, einer um den anderen, den langen Tag über. Abends Reden — in der Stadt, im Lande, wie es nötig war.
Man sandte ihm zu, was die anderen nicht mochten, alles, was etwas heikel war und schwierig. Alles auch, das ein wenig gefährlich war, das irgendwie anstoßen mochte, oben oder unten, an die rauhen Kanten des Gesetzes. Washington, kriechend in liebedienerischer Ehrfurcht vor England, voll neidischen Hasses gegen alles, was deutsch schien, wob aus seinen Millionen Paragraphen absurder Gesetze ein engmaschiges Netz, legte Fallstricke überall, stets bereit, ein paar armselige Deutsche zu fangen, die es wagten, für ihr Land zu arbeiten. Hielt man einen, — welch ein Geschrei, welch ein Jubel in allen Blättern. Wieder ein deutscher Verbrecher, ein Verschwörer, Hochverräter, Bombenwerfer und Mörder! Freilich, das Verbrechen wurde klein genug, wenn es endlich vor den Geschworenen stand. Irgendein winziges, kindisches, längst vergessenes Paragraphchen war verletzt worden. Aber immerhin: man hielt den Gesetzesbrecher, strafte ihn gut, schickte ihn auf lange Jahre ins Zuchthaus.
Hier war ein Platz, den er ausfüllen mochte, das war sicher. Er hatte kein Geschäft, war kein Kaufmann, kein Fabrikant: er war unabhängig, frei, und kannte keine Rücksichten. Es war gefährlich, gewiß, aber war es weniger gefährlich da drüben an der Front? Und dann: gerade für ihn war es nicht so schlimm. Er war nicht Deutschamerikaner wie die meisten andern, er brauchte nur eine Pflicht zu kennen, nur eine Loyalität: die für Deutschland. Und er hatte gute Bekannte, Freunde — auch auf der anderen Seite: die mochten helfen, wenn es nottat.
»Ihnen passiert nichts,« lachte der lange Tewes. »Ihnen nicht! Man läßt Sie nicht fallen.«
»So gut wie jeden andern,« erwiderte Frank Braun. »Wer soll mir helfen?«
Der Redakteur rief: »Wer? Der junge Hunston und Ralph Oakman und die Chutnams und Poates! Sie alle und der ganze Neuport-Set! Und Marion de Fox und die Marlborough und Susan Pierpont! — Alle die Leute kennen Sie persönlich, die aus Paris und aus Yokohama die andern. Freilich wissen sie kaum was Bestimmtes von Ihnen — nur, daß Sie jemand sind, und daß Sie irgendeinen Namen haben. Aber das genügt. Das ganze Pack würde hineinschwatzen in Ihren Prozeß — kaum zwei Jahre würde man Ihnen aufbrummen, wo ich vierzig bekäme. Und die zwei Jahre würden Sie auch nicht abbrummen! Eine Mordsreklame wäre es für Sie — das steht mal fest.«
Langsam war es gekommen, eins ums andere so, und ganz allmählich. Ohne daß er — oder irgendwer — recht wollte und wußte, was oder wie. Aber dann war es so, und so blieb es. Und schließlich: ihm gefiel es. Vor seiner Türe lungerten, nachtsüber und tagsüber, ein paar Detektive. Jämmerliche Aufpasser einer Privatgesellschaft, die nun für englische Rechnung arbeitete, arme verhungerte Teufel, die froh waren, einen Job zu haben und ein paar Dollar zu verdienen. Er machte bald genug Bekanntschaft mit ihnen, kaufte ihnen Zigarren, lud sie zum Whisky ein, einen erst und dann den andern. Und bald genug hatte er sie, wie er sie wollte. Sie folgten ihm nicht mehr überallhin, waren sehr zufrieden, wenn er ihnen täglich aufschrieb, wohin er ging und fuhr. So sparten sie das Fahrgeld, das sie der Gesellschaft hübsch anrechneten, Tram, Untergrund, Omnibus und manches Taxi — das war ein schöner Verdienst. Und ihr Bericht war in bester Ordnung stets, alles stimmte genau — nur, wenn er einmal etwas zu tun hatte, das sie nicht zu wissen brauchten, dann stand es nicht drin. Aber das war selten genug. Auch über seine Besucher konnten sie manches berichten, alles, was ganz harmlos war, erfuhren sie sicherlich. So wurden sie seine Freunde und Helfer, die stets bereit waren, zu tun, was er nur verlangte, die ihn bewachten, wie es ihr Auftrag war, wie treue Hunde vor seiner Haustür lagen und ihn vor jeder Gefahr sicher warnen würden.
Drinnen klang es: Pässe, Pässe und wieder Pässe. Man war klüger geworden, man schickte nicht mehr die Reservisten zu Tausenden in englische und französische Gefangenschaft. Nur einzeln noch sandte man sie hinüber, Offiziere zumeist, Leute, die in ihrer Person allein schon da drüben wertvoll sein konnten. Gut ausgerüstet mit Papieren aller Art, die sie wohl schützen mochten, wenn sie sonst ein wenig Glück hatten. Amerikanische Papiere, das war das Billigste und Schlechteste zugleich. Man konnte sie leicht kaufen überall in den Vorstädten, echt und gefälscht, wie mans haben wollte, da war kein Mangel. Aber er nahm sie ungern und selten genug, zu leicht durchschauten die Engländer den Schwindel. Und dann: nur mit ihren eigenen Papieren konnten sich die Yankeebehörden beschäftigen, erhoben ein großes Geschrei ob solcher Mißachtung des Gesetzes. Zeigten, daß sie die Macht hatten im Lande, schwatzten von Verletzung heiliger Rechte und bestraften die armen Kerle, die sie griffen, schlimmer als Mörder und Räuber. Aber russische Papiere — die waren gut. Wer nur ein paar Worte slawisch konnte, reiste mit russischem Paß, mit serbischem oder montenegrinischem. Schweizerische, holländische, skandinavische Pässe hatte man, auch spanische, italienische und — immer zwölf aufs Dutzend — solche der südamerikanischen Staaten. Wie es gerade paßte, suchte er aus, nach Alter und Aussehn und Beruf. Studierte die Leute ein, ließ sie die Nationalhymne ihres Paßvaterlandes lernen, machte regelrechte kleine Vorexamen mit ihnen für den Besuch der englischen Schiffsoffiziere. Manche wurden dennoch erwischt — aber Hunderte kamen hinüber, tropfenweise, einer um den andern.
Auch die Fanatiker sandte man ihm, die Streiks inszenieren wollten in den Waffenfabriken, auf den Werften und Schiffen, die die todbringende Fracht übers Meer brachten, — Flinten, Kanonen, Munition.
Schickte ihm alle die Leute hin, mit denen man nichts anzufangen wußte, Erfinder, Phantasten, Menschen, die krause Ideen hatten, wilde, wahnsinnige Gedanken, Verrückte mit großem Herzen und kleinem Kopfe, und wieder Schwindler und Betrüger und Lockspitzel. Alles schob man ihm zu. Er war der Unverantwortliche.
Ein Alter kam, der ein Pulver erfunden hatte, das nur brannte, wenn es naß war. Er lief ins Badezimmer, ließ die Wanne vollaufen und streute sein Zeug hinein. »Versuchen Sie doch zu löschen!« rief er triumphierend. »Versuchen Sies doch!«
Nein, löschen konnte Frank Braun nichts. Er rettete, was er konnte, und ließ brennen, was wollte, Bademantel und Tücher. »Telephonieren Sie!« meckerte der Alte. »Rufen Sie die Feuerwehr! Hih! Die kann auch nicht löschen.«
Frank Braun war nicht sehr begierig, die Feuerwehr dazuhaben. »Löschen Sie doch selber!« sagte er. Aber das war es ja: selbst der Erfinder konnte nicht löschen.
»Das über London!« gickste er. »Zehntausend Tonnen von meinem Pulver über das nebelfeuchte London — herab aus den Zeppelinen! Ich muß dabei sein!«
Frank Braun ging zum Fernsprecher, rief seinen chemischen Sachverständigen auf. Da hörte er, daß man das Pulver lange kenne und daß es sehr leicht zu löschen sei, nur freilich mit Wasser nicht, aber mit Paraffinöl oder Kerosin.
»Schade um den Bademantel,« sagte er.
Aber der Alte spie: »Was geht mich Ihr Bademantel an? London will ich, London!«
Unterseeboote brachten sie, die auf ihren Papieren in einer Woche durch den Atlantik fuhren und wieder zurück. Und Torpedos, seltsame, wunderbare, mit immer neuen Zaubereigenschaften. Spottwohlfeil, alles aus Liebe zum alten Vaterland: nur ein kleiner Vorschuß von ein paar Millionen. Maschinengewehre, die ganze Regimenter umwarfen, gigantische Geschütze, die jedes Fort umbliesen im Handumdrehn. Gewaltige Äroplane auch, die —
»Wie soll ich sie nur hinüber schaffen?« fragte Frank Braun.
Je nun, das sei seine Sache. Sie waren Erfinder und nicht Verschiffer. Wo ein Wille sei, da sei — natürlich, das sei doch ganz gewiß! Aber er wolle nur eben nicht —
Einer, mit rotem Haar und stechenden kleinen Augen, brachte den großen Kreisel. Zwei oder drei ungeheure, urgewaltige Motore, die man nur einzubauen brauchte in deutsche Bergwerke. Der Mann ging langsam vor, Schritt um Schritt, klug und bedächtig. Die Hochbahn, ja — dort hinten an der Ecke, nicht? — nur zehn Häuser weit — und hier bebten die Wände! Das sei es. Und seine Riesenkreisel würden ein Beben machen, das ganze Städte umwerfe — ein herrliches Erdbeben, wann und wo es ihm beliebe. Von jedem seiner Erdmotore gingen die gewaltigen Wellen aus, harmlos, ziemlich harmlos, so lang sie für sich allein blieben. Wo aber die Wellen sich trafen und kreuzten, da müsse es losbrechen — da! Auf das Papier zeichnete er die Linien, eine, noch eine und wieder eine: da sank Paris in Trümmer.
Der Rothaarige war ängstlich und nicht sehr sicher. »Vielleicht ist doch ein Haken dabei,« meinte er. »Aber ich habe es durchgearbeitet, immer wieder, durch dreißig Nächte. Ich kann den Fehler nicht finden.«
Er sah ihn fragend an.
»Ich weiß nicht,« antwortete Frank Braun.
Der andere nahm seine Papiere, blickte über die Zeichnungen, durch alle die Berechnungen, viele Seiten wilder Zahlen. Scheu hob er den Kopf.
»Herr Doktor,« flüsterte er, »glauben Sie daran?«
Frank Braun sagte: »Ja. Ich wohl. Das ist so groß — und so schön — darum glaube ich es. Mit Haken — oder ohne — ich glaube es.«
Der Rothaarige faltete seine Zeichnungen zusammen. »Entsetzlich ist es. Schrecklich. Vielleicht habe ich mich doch verrechnet. Dann geht es nicht.«
»Lassen Sie mir die Papiere da,« sagte Frank Braun. »Ich werde alles durchprüfen lassen.«
Aber der andre wollte nicht. Er bot ihm Geld — vergebens.
»Nein,« sagte er, »es ist nicht ums Geld. Ich habe mein Auskommen — zwölf Dollar in der Woche. Wenn meine Rechnung stimmt, soll sie das Vaterland haben — so — ohne Geld. Aber — ich will sie erst noch einmal durcharbeiten — vielleicht ist sie dennoch falsch.«
»Und wenn sie richtig ist?« fragte Frank Braun.
Der andere sagte: »So bring ich sie wieder her. Oder — oder — ich — häng mich auf.«
Dann ging er. Er gab seinen Namen nicht und keine Adresse. Er kam nie wieder.
Und die andern kamen, die sehr Wilden. Die, die rot sahen, die, die Kanada erobern wollten, mit zwölf Säbeln und sechs Gewehren. Die Bomben legen wollten unter Gebäude und Brücken, die mit Flugzeugen über die Munitionsfabriken fliegen wollten, sie mit Granaten in die Luft zu sprengen. Ehrlich manche, mit warmblutendem Herzen, die bereit waren, alles zu tun und den letzten Tropfen Bluts zu geben für Deutschlands Sache. Und wieder feige Abenteurer und Agenten, bezahlt und nicht bezahlt, die eine Lockspeise hinwarfen, ihn zu ködern. Plump oder fein — wie sie's eben konnten.
Einer kam, der nichts wollte als reden. Ein Wiener war er, ein armer Teufel, der die Fiedel spielte. Er faltete Pakete auseinander — Zeitungsausschnitte, viele hundert. Lügen alles, infame Verleumdungen gegen Deutschland und Österreich und Ungarn, gegen Wien und Berlin und die zwei Kaiser.
»Was soll ich damit?« fragte Frank Braun.
»Hier — hier,« rief der Musiker. »Hören Sie nur —«
Er las.
»Ich kenne alles,« unterbrach ihn Frank Braun. »Dreiundzwanzig Blätter muß ich lesen am Tag! Sagen Sie mir, was ich für Sie tun kann?«
Dann kam es. Der arme Kaiser Franzl war so krank und so alt. Seine Frau hatten sie ihm gemordet und seinen einzigen Sohn. Und den Thronerben nun und —
Da saß er allein in seinem Schloß, ganz allein, und weinte. Die Russen brannten die Dörfer im Buchenlande und in Galizien, die Serben drangen über Sau und Drina und Donau. Überall, überall floh vor der Übermacht der Doppeladler. So stands in den Blättern.
Und der arme Kaiser Franzl war so krank und so alt, saß im Schönbrunner Schloß, ganz allein und weinte. Weinte — durch alle die Tage, durch die Wochen und Monde —
Wenn man ihm nur etwas schicken könnte, das ihm Freude mache! Daß der liebe, alte Herr doch nur einmal wieder lachen könne!
Ob er denn nichts wisse? Etwas ganz Besonderes — etwas, das gar kein anderer habe?
Nein, Frank Braun wußte auch nichts.
Aber, wenn man nun etwas fände — ob ers dann hinüber schicken könne? Ganz sicher, ohne daß es die Engländer stehlen würden?
Ein Geschenk für den Kaiser? O ja, das konnte man schon. Das versprach er.
»Ich finde es!« sagte der Geiger. Dann ging er.
Frank Braun sah ihn wieder, eine Woche später, auf der Polizeistation: man hatte ihn verhaftet wegen versuchten Diebstahls. Er war verhört worden, scharf genug — da hatte er auch seinen Namen als Zeugen angegeben.
Der Polizeihauptmann fuhr ihn an: »Nur heraus, was wissen Sie davon? Wir haben Sie schon lange im Verdacht. Sie sind mitten drin in allen deutschen Komplotten. Sie haben auch hier geholfen bei dem Blödsinn: Sie wollten das Biest rüberschicken!«
Er lachte, ein gutes irisches Lachen.
»Was für ein Biest?« fragte Frank Braun. Er war froh, daß er es mit einem Irländer zu tun hatte, da konnte es nicht so gefährlich werden.
»Das Nilpferd!« rief der Hauptmann. »Natürlich kams Ihnen nur auf das Leder an — das ist ja rar im Vaterland. Denn das glaubt doch keiner, daß der verdammte Kaisernarr in Wien sich von Nilspanferkelbraten nährt.«
Er schrie und lachte, und der Geiger weinte und schluchzte. Es war nicht ganz leicht, die Geschichte herauszubringen.
So war sie:
Der arme Musiker war zum Zentralpark gegangen, in die Menagerie — frühmorgens in der Dämmerung. War hinübergeklettert über das Eisengitter zu den Nilpferden. Vater — Mutter — und Kind — drei Monate alt oder vier. Das war so komisch, so drollig — war so ganz unmöglich: jeder Mensch mußte lachen, der es sah. Das wollte er stehlen, das Hippopotamusbaby, das wollte er einpacken und lebendig seinem Kaiser schicken. Dann mußte auch der lachen, der liebe, alte Herr!
Aber die Flußpferde im Zentralpark von New York haben eine sehr dicke Haut und haben gar kein Gefühl für das goldene Wienerherz. O nein, sentimental sind sie nicht. Gutmütig vielleicht — aber wenn man ihr Prinzchen rauben will, so werden sie böse. Sie grunzten und fauchten und rissen das Maul weit auf, daß dem armen Kunz Kauffungen recht angst und bange wurde. Da schrie er und jammerte laut — gottseidank! Denn die Wärter kamen und befreiten ihn — sonst wäre er nun — für seinen Kaiser — zerquetscht, zerbissen, zertrampelt worden von den zwei Behemoths. So kam er nur zur Polizei.
Der Polizeichef glaubte nichts von der Geschichte. Aber er ließ es gehn, daß man ein paar Ärzte rief, die den Geiger für geistesgestört erklärten. Ließ es gehn, daß man »für weitere gute Führung gutsagte«, daß man ihn freiließ und mitnahm.
Er war ein Ire und liebte die Deutschen. Bewunderte sie.
Er sagte: »Nur eins können sie nicht. Ganz und gar nicht — das sollten sie wirklich von uns lernen! Als Verschwörer sind sie der größte Mißerfolg, der je da war! Nur Blödsinn machen sie, nur gottverdammten Blödsinn.«
Die Farstin traf er nicht wieder. Er schellte sie an, doch sie war nicht zu Hause; da gab er der Zofe seinen Namen und die Rufnummer. Er wartete, aber die Diva rief ihn nicht an. Nur in der Oper sah er sie, auf der Bühne. Sandte ihr Blumen in die Garderobe, große Orchideen. Und seine Karte mit ein paar Worten. Der Logenschließer kam zurück, grinste.
»Antwort?« fragte Braun.
Der Kerl sagte: »Sie hat gemeint, es wäre keine nötig. Und sie hat die Blumen in die Ecke geworfen.«
Launen, dachte er. Bühnenärger. Aber es kränkte ihn doch. Was denn? Hatte er sie verletzt? — Und womit nur?
Er fand es nicht.
Aber Lotte kam eines Tages. Sie legte nicht einmal den Pelz ab, faßte seine Hand, nahm ihn gleich mit in ihren Wagen. Sie legte ihm die Hand auf die Lippen, als er sprechen wollte — feines weiches Rehleder, das nach Jicky duftete.
»Frag nicht weiter!« sagte sie. »Ich hab mirs ausgedacht: ich will dich — wie ich dich wollte — auch so.«
Er wiederholte: »Auch so!? Was soll das? Bist du eifersüchtig, Lotte? Und wer hat dir erzählt — von der Diva?«
O nein, sie wußte gar nichts. Aber nun mußte er berichten, alles und ganz genau. Sie lauschte still, leise atmend.
»Wie bist du weg von ihr?« fragte sie. Sie sah ihn an, scharf, lauernd, wie ein kluger Arzt. »Hast du sie geküßt — zum Abschied?«
Er lachte. »Weggelaufen bin ich, Lotte! Ich wachte auf — als sie schlief — da lief ich fort. Wie bei dir, Lotte!«
»Sahst du sie wieder?« fragte sie.
Er schüttelte den Kopf. Sagte, daß er angerufen habe, auch Blumen geschickt. »Das ist gewiß: sie wollte mich in jener Nacht. Aber es scheint, daß sie nun nichts mehr von mir wissen will.«
Frau van Neß ließ den Kopf zurücksinken in die Polster. Sie seufzte auf, ein wenig spöttisch und doch mitleidig. Sie sagte: »Das kann ich mir denken!«
Er begriff nichts. »Was nur?« fragte er.
Da schaute sie ihn an, warm und mit großer Liebe. Sie zog ihren Handschuh aus und schob ihre kleine Hand in seine Hände.
Sie sprach; »Du brauchst keine andre Frau. Keine, hörst du? Ich bleibe dir — trotzdem!«
Er griff fest ihre Hand. Er verstand sie nicht, wollte lachen und fand den Ton nicht.
»Was ist denn nur?« rief er.
Da fragte sie: »Du weißt es nicht?«
Er wurde ärgerlich. »Aber nichts, gar nichts. Wenn du endlich die Güte haben wolltest, mir zu erklären —«
Ihre Fingerspitzen pulsten, er fühlte wohl, wie ihr Blut schlug, so leicht und warm an seiner Haut. In Wellen, kleinen schnellen Wellen.
»Du weißt es nicht?!« wiederholte sie. »Gut — gut!« Und plötzlich: »Bist du noch müde — in dieser letzten Zeit?«
Ihr Puls hielt ihn fest — durchströmte ihn in weicher Wohllust. Sie merkte es gut, preßte stärker seine Hand.
»Müde!« antwortete er. »O nein — jetzt nicht, wenn dein Blut heiß an mein Fleisch klopft.« Er flüsterte: »Als ob es hinein wollte.«
Sie bestand: »Aber sonst — bist du sonst müde? Sprich, mein Freund.«
Er schloß die Augen, fühlte nur, fühlte. Murmelte: »Sonst? Ach ja — manchmal — bisweilen.«
Und Lotte Lewi sagte: »Ich will dich heilen, weißt du? Heute. Und — immer von neuem. Ich bin dein Wein — trink!«
Auf ihrem Kissen lag sie im tiefroten Kimono. Seiner war violett, und er saß vor ihr mit untergeschlagenen Beinen. Rauchte, kleine japanische Pfeifchen, viele Dutzende. Ein Zug, einer nur — dann das helle Klopfen am Bronzerand der Aschenschale. Und wieder — klick! — wieder.
Aller Schmuck lag vor ihr — soviel Schmuck. Ringe und Ketten, Broschen, Armreifen und Ohrgehänge. Diademe auch, Spangen und Nadeln. Goldene Dosen und emailgefaßte, lose Steine, Perlen und Gemmen. Damit spielten sie.
»Komm, mein Freund,« sagte sie, »ich will dich schmücken. Morgen sprichst du im Cort-Theater, da mag es dir Glück bringen. Gib deine Hand.«
Sie suchte herum in ihren Ringen, nahm einen indischen, der einen großen Aquamarin trug. Aber sie legte ihn zögernd fort.
»Den?« sagte sie zweifelnd. »Nein, den nicht. Hellgrün — aber er sticht nicht, wie deine Augen tun. Wenn ein gelber Schein darin wäre, statt des blauen.« Sie griff einen andern Ring, aus dem ein Beryll leuchtete. »Den nimm. Er ist so gut dein Stein wie der da.«
»Nein,« sagte er. »Topas ist es, ich bin ein Novemberkind.«
Sie lachte. »Du irrst! Der Stein folgt dem Sternbild, und erst von der dritten Woche deines Mondes an herrscht der Schütz mit dem Topas. Du, aus der ersten Woche, folgst dem Skorpion. Du stichst.« Sie erschrak plötzlich, wurde fast ernst, als sie den Ring auf seinen Finger schob. »Immer trifft es zu,« flüsterte sie, »und überall — seltsam.«
»Was trifft zu?« fragte er.
Sie lenkte ab. »O nichts, nichts! Dein Sterntier sticht — wie du.«
Er blickte sie erstaunt an. »Ich steche?«
Sie streichelte seine Finger. »Ja, ja! Das tust du, mußt es wohl tun, weils in den Sternen steht.« Sie suchte in ihren Kameen, wählte eine kleine, in die ein Skorpion geschnitzt war. »Gibs in die Tasche. Verlier es nicht. Es macht dich stark.«
Sie hielt ihm den Stein hin, da stand ein kleines »J« unter dem Sternbild. »Was bedeutet es?« fragte er.
»Joseph,« sagte sie. »Das bist du.« Sein Auge fragte und sie antwortete. »Ja, Joseph, der Stärkste der zwölf Brüder. Der, der seinem Volk hilft — im fremden Lande. Hier — in Amerika — du — deinem deutschen Volke. Nimm!«
Da lachte er. »Joseph — ich?! Widerstand ich so gut deinen Reizen?«
Aber sie lachte nicht mit. Sie starrte geradeaus, schwieg lange genug. Sagte langsam: »Wieder stimmt es, und immer wieder. Stets von neuem, in allem, was dich angeht.« Sie führte die Kamee zu den Lippen, küßte sie. »Als ich sie schneiden ließ, dachte ich an dich mit keinem kleinsten Gedanken. Shoham heißt der Stein des Stammes Joseph — und es ist der Beryll. Das aber ist der Novemberstein, der Stein des Skorpion — so gab ich deinem Sternbild Josephs Zeichen.« Sie reichte ihm die Kamee hin und er nahm sie. »Wahr sie gut,« fuhr sie fort, »wahr sie gut! Damals ließ ich sie schneiden — sie und die andern elf — in Venedig. Als du mir fortliefst zum dritten Male.«
Er versuchte zu spotten. »War ich sehr keusch? Ließ ich dir meinen Mantel?«
Sie starrte ihn an. »Deinen Mantel nicht — aber deinen Gürtel vergaßest du. Willst du ihn sehn? — Und keusch? Ach ich weiß nicht, ob du nicht keusch bist — auch in deinen wildesten Sünden.« Sie griff in das Gold und die Steine — nahm Smaragde heraus, strahlende Smaragde in Reifen und Ringen. Und sie fuhr fort. »Keusch — das ist: unbewußt! Du bist unbewußt.«
»Sehr bewußt bin ich,« sagte er.
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Was du tust, weißt du nicht. Deine Nerven tun — und dein Hirn weiß nichts davon. Und du entfliehst dir selbst, wenn dein Hirn kaum noch ahnt, was geschieht. So ist es — das hält dich jung.« Sie lachte leicht, das klang wie ein Läuten von Akazienblüten. »Du bist kein Zeugender, kein Befruchtender, du nicht! Du bist Boden, bist Weib und Mutterschoß. Alles nimmst du, alles befruchtet dich, liebend und gewaltsam, mit deinem Willen und gegen ihn. Wie die Erde bist du.«
Er sprach: »Die Erde ist eine alte Metze.«
Sie nickte. »O ja. Wie du. Und sie ist doch keusch an jedem jungen Tag. Wie du!«
»So bist du die Sonne,« sagte er, und es klang feierlich und lächerlich zugleich. »Strahle,« sagte er, »wärme, befruchte!«
Sie hielt Smaragde in beiden Händen, wog sie auf und nieder. »Die Sonne,« begann sie, »die Sonne? Nein. — Der Mond vielleicht. Der schafft Ebbe und Flut; der treibt der Erde Blut. Und das ist es, was du brauchst, du Kind der Erde.«
Sie hielt ihm die grünen Steine bin. »Da, schau, wie sie blitzen! Ich kaufte sie in Colombo, bei Mohammed Bachir, von dem du mir erzähltest. Herr Sidney van Neß zahlte sie, mein Gatte: dafür schlief ich bei ihm in jener Nacht.« Sie lauerte aus halbgeschlossenen Augen, sah wohl das leichte Zucken seiner Nasenflügel. »Tut es dir weh?« Und sie drängte: »Ja? — Ja? Schmerzt es dich? Ich verkaufte mich ihm — einmal und wieder — oft genug! O, er war ein guter Bürger — glaubte seine Gattin zu küssen, ahnte nicht, daß eine Dirne in seinen Armen lag. Aber du sollst es wissen — du! Deine Geliebte war ich — deine Frau — seit Anbeginn. Und ich schlief bei ihm — eine Hure. Reich und groß — und doch eine Hure — immer wieder — um Steine und Gold! Du machtest mich so — du! Du wolltest es —? O nein! Du willst nichts, du läßt es so gehn. Es quält dich wohl, schmerzt dich, reißt dir blutrünstige Striemen — und doch, doch — es reizt dich, kitzelt dich — wie Peitschenhiebe von Frauenhänden. Ist es nicht so? Vielleicht wird dir einmal ein Gedicht daraus — vielleicht wird Witz nur — irgendein paradoxer Gedanke. Das genügt dir schon, das allein. Und darum gehst du — und merkst es kaum — durch alle Qualen, trittst mit leichtem Fuß über jämmerlich Sterbende. O du — sehr Keuscher!«
Sie warf die Steine zurück, riß mit beiden Händen den Kimono herab. Saß da auf den Kissen, hoch aufgerichtet, im dünnen Hemdchen, spitzenüberdeckt.
»Schmücke mich,« lachte sie, »nimm die Smaragde. Nur die Smaragde und nichts sonst. Meine Steine. Schmücke mich.«
Er streifte die Ringe an ihre Finger, zog die grünen Bänder auf die nackten Arme. Große Gehänge gab er in ihre Ohrläppchen. Legte die schmale Kette eng um ihren Hals und zwei längere, breitere dazu, die hinabfielen über Nacken und Brüste. Schob ihr die strahlende Smaragdkrone ins rote Haar.
»Gib die Zehenringe,« befahl sie, »und die Knöchelreifen.« Er zog die Schuhe ihr ab und die Strümpfe. Er streifte ihr die grünen Reifen über die Füße, legte die Ringe an, einen um jeden Zeh.
»Bring die Karaffe,« sagte sie, »die große, geschliffene Crême de Menthe.«
Er holte sie und füllte die Gläser. »Trink aus!« lachte sie. »Das ist grün — grün wie nasse Wiesen am Junimorgen. Mein Mond — wenn der Krebs im Zodiak herrscht. Grün — füll noch einmal und trink! — grün wie meines Monats Stein: der Smaragd. Das ist der Bareketh, der erste der zweiten Reihe in meiner Platte. Und zugleich meines alten Stammes Stein; ist aller Priester Stein, der Stein Lewis.«
Sie setzte ihr Glas hin, griff eine große Dose aus getriebenem Golde, mit Sternsaphiren besetzt, öffnete sie, nahm eine seltsame Platte heraus. Viereckig war sie, eine Spanne hoch und eine breit. Die Platte war aus altem Gold, stark mit Silber legiert und mehr noch mit Kupfer. Ein goldener Ring war an jeder Ecke des Schildes und aus den beiden oberen Ringen fielen kleine goldene Kettchen. Eins schien alt, aber das zweite war ersichtlich nachgemacht vor wenigen Jahren erst. Und neu waren auch die schmalen, blaugrünen Seidenbänder; zwei davon setzten die Goldketten fort, die beiden andern liefen durch die untern Ringe der Platte, die mit zwölf bunten Steinen besetzt war.
Vier Reihen, und drei Steine in der Reihe, jeder Stein aber trug in hebräischen Lettern die Namen der Kinder Jakobs. »Das ist der Onyx, der Yahalom,« erklärte sie, »der Julistein des Löwen: Sebulon führt ihn. Und Ruben hat den Odem, den wir Karneol nennen, ihn schützt die Jungfrau. Benjamin bekam Yaschpheh, den Jaspis und den Widder, Gad die Zwillinge und Shebo, den Agat. Simeon hält die Wage, ihn schmückt der Chrysolith — Pitdah heißt er. — Ach, mein Vater hat mirs oft genug gezeigt — am Eiref manchen Festtages. Das war seine Art zu feiern.«
Er schaute auf: »Dein Vater? Ich wußte nicht, daß der sich um irgend etwas kümmerte, das jüdisch war.«
Sie lachte. »Das tat er auch nicht — gewiß nicht. Erst ich tus — weil du es mich lehrtest — und weil der Krebs mein Sterntier ist, das zurückläuft in alle Vergangenheiten. Mein Vater — hier die Platte war das einzige, das ihn interessierte am Judentum — und nur um der Steine, nicht um Jerusalems willen. Denn dies, siehst du, ist ein Heiligtum.«
Sie hob die Platte auf, legte sie mitten auf ihre Brust unter die Smaragdketten, hieß ihn die Bänder zuschnüren über Schultern und Rücken. Sie zog das Hemdchen hinab: neugierig wie zwei weiße Kätzchen lugten ihre Brüstchen über die bunten Steine.
»Ein Heiligtum,« lachte sie hell, »wenn — es echt ist! Und vielleicht ist es echt, wer weiß das? Viele hundert Jahre war es in Papas Familie, wanderte mit ihr durch ganz Europa. — Was möchte die Ostseite sagen, wenn sie wüßte, daß das da nun am Hudson ist: Choschen Hammischpath! Denk nur: zwei Millionen Juden leben hier und nicht einer weiß etwas davon.«
»Was ist es denn eigentlich?« fragte Frank Braun.
Sie trommelte mit den rosaroten Nägeln auf der Platte. »Ein Heiligtum,« wiederholte sie, »ein großes Heiligtum. Es ist die Brustplatte des Hohenpriesters! — Wie steht sie mir?«
Er meinte: »Es scheint dich nicht sehr heilig zu stimmen — dein großes Heiligtum.«
»Nein,« lachte sie, »das tut es nicht. Ich bin vom Priesterstamm und du weißt ja: Pfaffen untereinander! Aber vielleicht,« — sie wurde plötzlich ernst und der helle Stimmklang wurde tiefer — »vielleicht, weißt du, ist das Ding da mehr noch. Ich habe durchstudiert, was ich finden konnte über des Hohenpriesters Brustplatte — und keine Beschreibung stimmt überein mit meiner da. Der Midrasch Bensidbar Rabba erzählt von ihr und Flavius Josephus. Meine Platte ist anders.« Sie nahm seine Hand, zog ihn heran zu sich und ihre Stimme sank in ein leises Flüstern. »Schau, schau — sie ist kleiner, viel unscheinbarer. Nicht so kostbar, o lange nicht! Mein Stein, der Bereketh, ist nur ein armer Feldspat, wie ihn die Ägypter kennen als Uat — aber er ist grün, wie der Smaragd. Und Judas Stein, der Nophek, ist kein Rubin, sieh nur, der da: ein billiger Granat ists. Da ist ein brauner Agat, statt Isaschars Saphir, und hier ein Malachit an Stelle des Berylls. Und das bedeutet, mein Freund: meine Platte ist nicht die des zweiten Tempels. Nicht die des Hohenpriesters: es ist die alte, uralte selbst, die, von der die Bibel erzählt, die meines Stammvaters: Aaron!«
Ein Zwang lag in ihren Flüsterlauten, ein seltsamer Zwang, der ihn drückte. Er hatte ein Empfinden, als ob er sich freimachen müßte. »Und dann,« fragte er rasch, »was dann? Die oder jene — was macht es aus?«
Sie nahm seinen Kopf in beide Hände, zog ihn hin zu sich, eng heran, daß ihre Smaragdaugen in seine glühten. »Was es ausmacht? O viel, viel! Dann, weißt du, dann birgt meine Platte — und sie allein nur — Urim und Thummim.«
Da lachte er auf. »Ah — das ist es. Und du, du weißt, was das ist? Seit dem heiligen Augustin zerbrachen sich tausend Doktores den Kopf darüber — aber keiner fand es.«
»Schweig!« rief sie. »Schweig! Ich weiß es nicht — so wenig wie einer. Aber ist es darum weniger da? Wer löst des Johannis Offenbarung? Und doch ist sie da in vielen tausend Sprachen! Ob ichs weiß, ob ichs nicht weiß — gleichviel — hier ruht der Zauber auf meiner Brust — hier, hier in Aarons Platte.«
Er zuckte die Achseln, spottete: »Wenn — sie echt ist.«
Sie lachte mit ihm, warf sich zurück auf die bunten Kissen, hob das linke Knie und gab das rechte Bein hinüber. Wippte mit dem kleinen Fuß auf und nieder, daß die Reifen leise klangen und die Smaragdringe funkelten auf ihren Zehen.
»Wenn sie echt ist — o ja! Aber gerade, daß ich das nicht weiß, und daß es keiner wissen kann — das ist es, was sie mir lieb macht. So glaube ich — o manchmal nur, wenns meine Laune ist! — daß es Aarons Wunderplatte sei — und dann — dann ist sie mir echt. Willst du ihre Geschichte wissen? In meinem Kopfe steht sie geschrieben und nirgend sonst. Im ersten Tempel lag sie seit Aarons Tode, tat Wunder, gab Orakel, bis zu der Zeit, als Baal stärker ward als Jehovah. Nach Babylon zogen die Kinder Israel als gefangene Sklaven und mit ihnen alle Schätze des zerstörten Tempels — nur diese kleine Platte blieb zurück, weggestohlen den Feinden, vergraben unter den Ruinen des Tempels von der frommen Hand eines meiner Ahnen. Israel kam zurück, baute den zweiten Tempel, schuf eine neue Brustplatte, größer, leuchtender, kostbarer, als diese da. Aber später fand man die alte unter dem Schutt, gab ein großes Dankfest und verwahrte sie gut durch manches Jahrhundert im heiligsten Schreine des Heiligtums. Bis Titus Jerusalem in Trümmer riß, bis er des Tempels Schätze nach Rom schleppte. Da lag sie — das erzählt Josephus — in der Konkordia Tempel, den Vespasian errichtete. Genserich, der Vandalenkönig, nahm Rom und all die Schätze, schleppte sie hinüber nach Afrika. Als das Räuberreich des rothaarigen Helden zusammenbrach, zog Belisar mit der großen Beute nach Byzanz, und Kaiser Justinian stellte die jüdischen Schätze auf in einer Sakristei der Hagia Sophia. Dann aber sandte er sie zurück nach Jerusalem, und man hütete sie in der heiligen Grabeskirche. Das alles las ich im Prokopius, der über den Vandalenkrieg schrieb.«
»Noch ein weiter Weg von da bis Manhattan,« sagte er.
Sie nickte. »Weit genug — und hin und zurück — wie der der Juden. Khusru, der Zweite, der Perserkönig, nahm Jerusalem, er schleppte alles, was der Tempel hielt, nach Ktesiphon, der schätzereichsten Stadt, die je die Welt sah. Aber nicht lange blieb dort meine Platte. Omar, der Araber, schlug das Sassanidenreich in Stücke, nahm die Hauptstadt und die gewaltige Beute. Weißt du, daß man seinen Raub an dem einen Tage auf über tausend Millionen schätzt? Aber meine armen alten Steine trugen nicht viel dazu bei. Das ist das Letzte, das ich finden konnte in der Geschichte. Doch ist es seltsam genug, denke ich. Anbeter des großen Baal nahmen des Aaron Platte, dann Römer, Wotanskinder, Arianer und wieder Anastasianer. Feueranbeter Zarathustras raubten sie und endlich Mohamets wilde Wüstenvölker. Und immer wieder kehrte sie zurück zum Judenvolk. Nun höre — Omars Söhne teilten das Reich und die Schätze. Heilig war diese kleine Platte dem Moslem, wie sie dem Juden war — so mag einer, irgendein Fürst oder Feldherr, sie mitgenommen haben ins Ägypterland, wo sie herkam, und wieder dann ein anderer auf dem Zuge durch Afrika. Und mit Tarik kam sie nach Spanien, lag versteckt in Cordoba oder Granada in den Schatzkammern der Omajaden und Nasseriden. Die katholischen Majestäten aber, Isabella und Ferdinand, nahmen sie, als die Alhambra fiel — sie legten ganz gewiß keinen Wert auf die armseligen Steine, selbst wenn sie wußten, was sie bedeuteten. So mag die Platte ein Hidalgo bekommen haben und dem oder seinen Kindern handelte sie ein jüdischer Leibarzt ab. Ein Sepharde, einer, der große Kunst kannte und manch christliches Leben rettete. Zum Dank dafür brauchte er dann bei keinem Autodafé als Fackel mitzuwirken, wurde sehr gnädig nur ausgeraubt und bettelarm aus dem Lande gejagt. Aber Aarons Platte nahm er mit, nach Amsterdam oder Hamburg vielleicht. — Und irgendwie bekam sie später einer meiner Urgroßväter, ein deutscher Jude, denn meines Vaters Leute sind Ashkenasim. Und so kam sie endlich, zum ersten Male, in das Yankeeland, mit einer halben Deutschen. Hier mag sie helfen, wenn sie das kann — dir und mir — allem, was jüdisch ist, und allem, was deutsch ist, auch! Und sie wird es tun — verlaß dich drauf.«
Ihre Stimme hob sich, klang sicher und hell. Sie richtete sich auf, knieend hob sie die Platte mit beiden Händen, führte sie zu den Lippen, küßte sie — inbrünstig fast.
Er spottete: »Wie ein Prophet! Aber vergiß nicht, das waren Männer und du —«
Da rief sie: »Und Deborah? Deborah? Ein Weib, wie ich! Ihre Hände troffen von Blut und ihr Herz war voll von Haß gegen ihres Volkes Feinde. Wie meines!«
Ein klein wenig zog sich seine Lippe. »Du!« sagte er. »Du? Mischblut — Lotte Lewi!«
»Und gerade darum!« gab sie ihm zurück. »So kann ich doppelt fühlen. Mit meines Vaters Volk, das sie jämmerlich zu Tode martern in Polen und Rußland — und mit dem meiner Mutter, das um sein letztes Leben kämpft gegen die ganze Welt.«
Er empfand gut, wie ernst es ihr war — das reizte ihn. So klang es verächtlich genug, als er sagte: »Sentimentalitäten — anerzogen und anererbt!«
»Nein,« rief sie, »nein! Nichts war jüdisch an meinem Vater, der längst getauft war, ehe ich zur Welt kam. Nichts, außer Namen und Nase. Nicht Liebe — Verachtung für alles, was jüdisch ist — das hätte ich von ihm geerbt. Und anerzogen? Im Tiergarten zu Berlin? Du weißt es am besten, du, wer allein mir sagte, daß ich Jüdin sei! Du, der alles Jüdische wachrief in mir — und mich erst machte zur Jüdin!«
Er höhnte: »Hab ich vielleicht dich auch zur Deutschen gemacht?«
Aber sie blieb ruhig und sicher genug. »Nein, das tat der Krieg. Ich bin, was ich bin: Halbblut. Aber ich habe mein Vaterland, habe mein Volk — zwei Völker, wenn du willst.«
Er goß die Gläser voll. »Trink, Lotte, trink! Auf dein Vaterland!«
Sie tat ihm Bescheid. »Und auf deines!«
»Ich habe keines, glaub ich,« sagte er achselzuckend. »Was ich auch rede und tue — es ist doch ein Spiel nur, Lotte. Arbeit — Bewegung — Lust am Abenteuer. Aber Glauben — und Liebe zu meinem Lande? Nein — nein!«
»Du hast es verloren,« sprach sie, »nie gehabt vielleicht. Ich werde dich hinführen.«
Er lachte auf. »Der Weg ist weit, Lotte, wie der deiner Steine.«
Aber sie bestand. »Und doch sollst du ihn gehn. Mit mir.« Und wieder klang aus ihrer Stimme dieser drückende Zwang.
Er füllte seine kleine Pfeife, brannte sie an. Tat einen raschen Zug, klopfte sie aus an der Bronzeschale. Dann begann er. »Ich werde ihn nicht gehn, nie. Du hast recht, ich habe das, was man Vaterland nennt, nie und nimmer gekannt. Aber ich habe es gesucht, sehr heiß gesucht, in diesem Jahre. Gesucht mit Hirn und mit Herz, wie jeder, der deutsch ist, irgendwo in der Welt. Und ich weiß nun: ich kann nie etwas finden, das es nicht gibt. Viele suchten es, durch alle Zeiten, kluge Leute — und keiner fand es. Nur Narren träumten ein Nebelland.«
»Wer suchte es, wer?« fragte sie. »Wer suchte es heiß und fand es nicht?«
Er antwortete: »Soviel Namen du willst, will ich dir nennen, und jeder hat einen guten Klang! Was war Friedrich dem Großen das Vaterland? Ein lächerlicher Scherz! Er, der kaum deutsch konnte, französisch sprach und schrieb, er, der nicht Lessing zum Bibliothekar nahm, sondern einen unwissenden französischen Mönch. Dieser kluge Hohenzoller, der den blutigen Witz machte, er habe die ›Nation Prussienne‹ erschaffen. Und Lessing sagte, der deutsche Lessing: ›Ich habe von der Liebe zum Vaterlande keinen Begriff, sie scheint mir höchstens eine heroische Schwachheit zu sein.‹ Das paßt gut zu dem, was sein Freund Nicolai schreibt, der gewiß kein Talent hatte, wohl aber scharfen Verstand: ›Deutscher Nationalgeist ist ein politisches Unding!‹ Willst du stolzere Namen? Goethe? Er, der Napoleon bewunderte, schrieb in den Xenien: ›Zur Nation euch zu bilden, ihr hofft es, Deutsche, vergeblich!‹ — Und noch viel schärfer und stärker schrieb euer Schiller an Jacobi: ›Es ist das Vorrecht und die Pflicht des Philosophen und Dichters, zu keinem Volke zu gehören!‹ Das, das, Lotte, sagte der deutscheste unserer deutschen Dichter — o, und du glaubst nicht, wie sehr deutsch das ist.«
Sie wiegte leise den Kopf hin und her. »Es ist echt deutsch. Wie es echt jüdisch war, als sich mein Vater — taufen ließ.« Überlegen klang es, herausfordernd fast. Er stutzte, begriff im Augenblick nicht, wo sie hinaus wollte — das nahm ihm die Sicherheit.
»Was soll das?« fragte er ungewiß.
»O nichts?« lachte sie. »Sag mir doch — seit wann glaubst du an Autoritäten? Du — Frank Braun?« Und da er schwieg, fuhr sie fort: »Lessing, Schiller, Goethe, Friedrich der Große! — Sag mir doch, kommen die Namen nicht auch in deinen Volksreden vor? Sollte ich mich irren, mein Freund — ich meine, so etwas gehört zu haben!? Und da sagen sie ganz etwas anders, nicht wahr? Antworte doch!«
Er biß sich die Lippen, suchte nach einer Antwort. »Für die Masse,« stotterte er, »für die Plebs —«
»Ja doch, ja, mein Herr und Gebieter! Ja doch! Und meinst du, daß ich so sehr zur Masse gehöre, daß du auch mir solche Weisheiten auftischen willst? Mir — die ich deine Schülerin bin — denken und fühlen lernte — nur durch dich? Mir?« Weit offen standen ihre Augen — leuchteten grün und herausfordernd wie ihre Steine. »Wach auf, Meister,« rief sie. »Wach auf!«
Er griff sich an die Stirne, strich hart darüber; es war, als ob er einen Schwindel fortwischen wollte. »Du hast recht,« sprach er. »Ich werf mich fort. Dumm macht mich das alles und kindisch. Es muß ein Ende haben.«
»Was?« fragte sie.
Er sagte: »Meine Arbeit, meine sogenannte deutsche Arbeit.«
Sie nahm seine Hand, aller Triumph schwand aus dem Klang ihrer Stimme. Still sprach sie und ernst. »Nein, nein, Freund, du wirst sie weiter tun — und mehr noch als bisher. Einem Gedanken dienst du und einem Glauben — der dich gebraucht. Du bist ein Werkzeug: du mußt arbeiten.«
Er seufzte leicht: »Es wird mich zugrunde richten.«
Aber sie sagte: »Dich — nie! Mich vielleicht.« Sie wartete seine Frage nicht ab. »O, du wirst es verstehn, später einmal. Nicht mein Geld — o nein. Ich gebe mehr, und viel Kostbareres — um dich stark zu machen zu deiner — Arbeit.« Wieder schnitt sie seine Frage ab. »Ich werde es nicht sagen, nein. — Aber warum ich es tue, das will ich dir sagen.«
Sie strich mit der Hand durch seine blonden Haare, streichelte leicht seine feuchte Stirn. »Höre, mein lieber Junge, hör zu. Ich bin deine Braut und deine Mutter, bin deine Geliebte und deine Schwester in dieser Zeit. Und ich bin deine Prophetin auch. Dich will ich stark machen und groß — und das kann ich, wenn ich dich deutsch mache. Denn ich weiß es gut: das wird dich heben — weit, weit über dich selbst hinaus.«
Er trotzte. »Versuch es doch, wenn du magst und kannst.«
Aber ihr Vertrauen blieb sicher genug. »Ich kann es, ich allein. Ich kann dich deutsch machen.« Ihre Hand zitterte, sie ließ seinen Kopf, griff an die Steine ihrer Platte. Und es klang seltsam, visionär fast, als sie sprach: » Ich hab ein Zeichen.«
Sein Auge fragte: »Du?«
Und sie nickte. »Ja — ich! O, es ist nichts Geheimes, kein Mysterium. Was ich weiß, ist vielen bekannt, Millionen vielleicht, seit dreitausend Jahren und mehr. Aber keinem fiel es auf, und keiner verstand den Sinn — kein Jude und kein Deutscher. Ich fand ihn, ich allein.«
Wieder hob sie ihre Brustplatte, strich mit liebkosenden Fingern darüber hin. »Die zwölf Stämme lagerten in der Wüste, ein jeder für sich und doch alle für einen im Kampfe gegen die übermächtigen Feinde ringsum. Wie die Deutschen heute — die Bayern und Sachsen und Preußen und Österreicher. Und wie den Haufen ihres Stammes Fahne voranleuchtet, Schwarzweiß und Grünweiß, Schwarzgelb und Blauweiß — so führte ein jeder Stamm der Kinder Israel seine eigene Flagge. Rot wehte über den Zelten von Rubens Kinder, Himmelblau über denen Judas. Weiß war Sebulons Farbe, Schwarz die Isaschars. Einfarbig war das Tuch all ihrer Fahnen — und nur ein Stamm, ein einziger nur, hatte eine bunte Flagge.«
»Welcher?« fragte er.
»Warte,« sagte sie, »warte! Als das verheißene Land erobert war, als man es aufteilte unter die Stämme, in zwölf gleiche Teile, da bekam der Stamm Josephs, des größten der Brüder, zwei Teile. Einen für jeden seiner beiden Söhne, für Ephraim und Manasse. So mußte ein anderer Stamm leer ausgehn, das war mein Stamm: Lewi. Er ward der Priesterstamm, ward gesetzt über alle andern, ward der bindende Kitt in Israel. Und dieser Stamm war es, der Stamm Lewis, der in der Wüste schon das dreifarbene Tuch führte. Kennst du die Farben? Schwarz — Weiß — Rot!«
»Das ist nicht wahr!« rief er.
»Das ist wahr,« antwortete sie. »Ich will es dir zeigen im Sepher Midrash Rabba, ah, in Dutzenden uralten Schriften. Schwarz, Weiß und Rot ist Lewis stolze Flagge — dreimal meine — und deine dazu! Viele wußten es, lasen es durch Jahrtausende. Aber keiner, keiner sah die Deutung: ich fand sie zuerst und ganz allein — weil mein Herz an Aarons Platte schlägt, die Urim hält und Thummin.«
Sie hielt ihm ihr Glas hin und er füllte es mit flüssigem Smaragd. Sie sprang auf, streckte den nackten Arm weit aus. »Schwarzweißrot wehte hoch in der Wüste über allen anderen Fahnen Israels! Was möchte Bismarck gesagt haben, wenn er das gewußt hätte, er, der bei des neuen Reiches Gründung diese Farben wählte, und nicht schwarzrotgold. Und was Lord Beaconsfield, sein großer Zeitgenosse, der Jude Disraeli! Er, der zuerst von allen Menschen es aussprach, daß nur zwei Völkern die Welt gehöre, beiden zusammen, eng vereint, dem germanischen und dem jüdischen. — Durch meine Adern fließt, gut vermischt, beider Blut, ich bin Deutsche und Jüdin zugleich. Und ich, ich fand die Deutung von der Sendung meines Stammes für diese Zeit — lange lebe mein deutsches — lange lebe mein jüdisches Volk! Lewis stolze Fahne führe sie — beide vereint — durch alle Wüsten — in das verheißene Land — das ist: die Herrschaft der Welt! Dafür — dafür — gebe ich dich — und mein Leben!«
Sie leerte ihr Glas in einem Zuge — warf es weithin durch den Raum. Und sie stand, hocherhaben, mit aufgereckten Armen — wild, halbnackt, ekstatisch, unbeweglich.
»Deborah,« flüsterte er, »Deborah!«
Dann zitterte sie, ihre Knie schwankten. Sie ließ die Arme fallen, sank zurück in die Kissen. Sie schloß die Augen, lag da, heftig atmend, ein starkes Zucken schüttelte ihren Leib.
Und über Aarons uralte Steine hin schluchzten ihre süßen Brüste.
In der Dämmerung ging er über Madison Square — da, wo Broadway und Fünfte Avenue, ein paar Block weit, eins werden. Hinten hob sich, die beiden Riesenstraßen trennend mit Messerschneide, das mächtige Bügeleisenhaus, das einzige Gebäude der gewaltigen Stadt, das einen eigenen, starken Gedanken hatte. Durch den eisigen Schneesturm kroch er entlang an den Häuserwänden, Schritt um Schritt sich weiterarbeitend, tief tappend in die weiße Fläche. Drüben, an der Nordseite, sah er, rings von Säulen umfaßt, den starken Backsteinbau des Madison-Square-Gartens, der den Alkazar von Sevilla nachahmte und die Giralda noch dazu gab. Da, fiel ihm ein, da hatte er vor Jahren gesessen und getrunken, oben auf dem Dachgarten, durch eine wilde Nacht, mit Stanford White, dem Erbauer, und mit der schlanken Evelyn Nesbit Thaw, der kallipygischen. Mit White, dem berühmten Baumeister, dem Stolze Neuyorks, den am nächsten Tage — und auf demselben Stuhle — die todbringende Kugel Harry Thaws traf, ihres Gatten. Wer wußte seinen Namen heute noch — wer sprach von ihm? Kaum noch, wenn wieder einmal, in einem anderen Staate, sein millionenreicher Mörder, der den Wahnsinnigen spielte, von einem Gericht freigelassen wurde. Oder wenn Evelyn Nesbit im Vaudeville ihre schalen Lieder abkrächzte —
Und, unweit des Alkazarbaus, der griechische Tempel des Obergerichts und der andere der Presbyterianerkirche, vier hochstrebende mächtige Marmorsäulen. Aber beide Gebäude, erdrückt, totgequetscht von den himmelhohen Massen des Metropolitanbaus, abgeschmackt, billig und nachempfunden, nur hoch, nur groß und riesenhaft, überragt von dem vierkantigen Babelturm, dessen Spitze in einer rotflammenden Fackel auslief, diesem ungeschlachten Baukastenturm, dessen protzig strahlende Riesenuhr alles zusammenschlug, was am Platz nur Stil, Form und Farbe hatte.
Da, an der Ecke der Dreiundzwanzigsten Straße, schrie, eingeduckt in sein Haustor, ein jüdischer Zeitungsjunge Blätter hinaus in den Schneesturm. Seine jüdischen Blätter »Wahrheit«, »Zukunft«, »Vorwärts«, mächtige Zeitungen der Ostseite in jüdischer Sprache und hebräischen Lettern, die in Auflagen von Hunderttausenden erschienen. Er kaufte ein paar der Blätter, las die frohlockenden Überschriften: »Hindenburg gibt Fonjes ihre tägliche Portion!« — »Daitsche geben Großfürst Pätsch!«
›Fonjes‹ — das waren die Moskowiter und ›Pätsch‹ bekamen sie, gründliche Keile. Da jubelten die Millionen des Neuyorker Ghetto!
Das wußte er wohl, daß es nur ihr Haß war, ihr rasender Haß gegen das mörderische Rußland, das ihre Brüder und Väter und Mütter und Schwestern hinschlachtete wie Hammel im Schlachthaus, nein, mit Knüppeln totschlug, wie räudige Hunde in der Abdeckerei. Und dennoch: sie standen Seite an Seite mit seinem Volke — da war keine Nummer dieser Blätter, die nicht offen kämpfte für Deutschlands Sache — o, entschiedener noch, wilder und rücksichtsloser, als selbst die deutschen Zeitungen im Lande.
Er kämpfte sich mühsam durch den Sturm, quer über den Platz. Eine Melodie summte er vor sich hin, einen alten Gassenhauer, der ihm durch den Kopf fuhr. Er suchte die Worte — — es mußte irgendwas sein, das mit dem zu tun hatte, das ihn eben beschäftigte — mit Juden und mit Deutschen. Dann fiel es ihm ein, langsam, Zeile um Zeile — mit dem Rhythmus erst fand er auch die Worte, die seiner Zunge schwer genug fielen:
»Ti kolinšti židí
krestány vrazdejí!
holku podrezali
krv jé vycedili
do vody hodili!«
Das — ja doch — das hatte er singen hören, wieder und immer wieder, im Böhmerland. So, wie in diesem Jahre auf allen Straßen und in allen Lokalen, von Drehorgeln und Grammophonen, von Klavieren und Geigen, von Musikbanden und allen Menschenkehlen, gesungen, gepfiffen und gespielt, überall, nachts- und tagsüber das Schlachtlied der Alliierten diese Stadt erfüllte: »Tipperary« und wieder »Tipperary«!
Tipperary — das Schlachtlied der Alliierten, und — natürlich! — das aller Yankees gegen Deutschland. Sie sangen es, weil es Mode war — aber auch um ihrer Liebe zu England, Rußland und Frankreich, ihrem Haß gegen Deutschland lauten Ausdruck zu geben. Genau wie das böhmische Volk sein Haß- und Hetzliedchen sang gegen die Juden.
»Von Kolin die Juden,
die schlachten die Christen.
Sie schnitten den Hals ab dem Mägdelein,
sie zapften das Blut in ein Eimerlein,
sie warfen es tief in den Brunnen hinein.«
So empfand das Volk, so und nicht anders. Und es glaubte felsenfest an alle Geschichten vom Ritualmord — schlagt ihn tot, den Jud!
Was — was wollte da Lotte Lewi — mit ihrem großen Bund, ihrem stolzen Traum von Liebe und Verbrüderung? Eine Narretei war es, eine kindische Albernheit!
Aber nein, nein! Nicht dem Christen — dem Deutschen allein wollte sie Israel verbinden. Die aber, die dies Liedchen sangen, waren nicht Deutsche, waren Tschechen, Slawen, wie die Progrombanden des Zaren. Hatten nicht gleich zu Beginn des Krieges tschechische Regimenter gemeutert — waren mit fliegendem Banner übergelaufen zum Feinde? Sie haßten die Deutschen nicht weniger als die Juden.
Er überlegte, dachte zurück an seine Prager Zeit. Krawalle Tag um Tag, Schlägereien mit den buntbemützten deutschen Studenten, deren unbekümmerte Grabenbummel den Mob aufreizte. Steine und Stöcke — manchmal auch Messer und Kugeln. Und immer: ein deutscher Student gegen ein Dutzend Tschechen. Wer waren diese deutschen Knaben, die sich nicht fürchteten, die hellachend ihr rotes Blut — und vielleicht ihr Leben — aufs Spiel setzten um den deutschen Ruf der ältesten deutschen Universität? Diese hochgewachsenen Landsmannschafter und Korpsstudenten, Turner und Burschenschafter in Stürmern und Mützen, deren schleppende Schläger hell über das Pflaster klirrten? Wer waren diese Prager Deutschen, die für ihre Sprache und Sitte kämpften, jahraus und jahrein, mitten im Slawenlande? Juden waren es, rassenreinste Juden zu neun Zehnteilen. Ihnen gab der Tscheche die süßen Namen »nemecky psi prašivci, všiváci, roštáci«: lausige, räudige, im Dreck sich sielende deutsche Hunde! Sie empfand er als Deutsche — ach, all der slawische Deutschenhaß war nur Antisemitismus im letzten Grunde. Und Juden, die sich Deutsche fühlten, fochten an heißester Stelle für des Deutschtums Sache: Lewis Kinder für Schwarzweißrot! Juden und Deutsche gegen das Slawentum — war das nicht der tägliche Schrei der jüdischen Zeitungen — der heiße Wunsch der Millionen des Neuyorker Ghettos? Juden als Deutsche — als ein gleichberechtigter Stamm im Deutschtum, wie der Schwabe und Franke, wie der Steirer und Pommer und Tiroler — war das nicht Lotte Lewis prophetischer Traum? Hier war er erfüllt an der ältesten Stätte deutscher Wissenschaft — Jahre vor dem Kriege! Unbeachtet — unbemerkt kaum von hüben und drüben: und dennoch klar und offen, mit Händen zu greifen.
Und wieder: war es nicht, als ob ein uraltes Wort zum zweiten Male wahr werden sollte — größer, stärker als das erstemal? Damals, im kleinen Palästina, bekam Lewis Stamm keinen Teil am Lande, er ward verschmolzen in alle Stämme, bildete ihren guten Kitt. Lewis Stamm, dessen Flagge in deutschen Farben wehte. Konnte es wieder so werden in naher Zukunft? Israel, ein deutscher Stamm, vermischt durch alle, sie fester und enger zusammenschmiedend!?
Ein fremdes Element?! Ein Stück asiatischer Rasse?! O, das schreckte ihn nicht. Diese Kindereien von Rassefragen hatte man sich an den Schuhsohlen abgelaufen vor dreißig Jahren schon. Das war geschehn in den Jahrhunderten, mehr als einmal — und was geschah, konnte wieder geschehn. Im neunten Jahrhundert trat in der Krim das mächtige ugrische Volk der Chasaren zum Judentum über: heute gab es nicht bessere Juden als diese blonden, blauäugigen Karaim aus Südrußland. Ah — möglich war es, das stand ganz gewiß fest.
Und dann — dann?
Deutschland war Israels Zion — und das verheißene Land — war die Welt.
Um die Ecke bog er, zum Gramercy-Park. Einer ging vor ihm. Im schwarzen Guinmiraglan, der den Schnee abwarf. Den weichen Filzhut tief in die Stirn. Schlürfend, watschelnd, hinkend, fallend fast. Nicht trunken, stolpernd nur, mühsam aufrecht in dem eisigen Schneesturm. Frank Braun schritt ihm nach, halb zu ihm hingewandt, ob er ihm helfen könne. Da lachte der Schwarze — nein, ein Gröhlen war es, ein schleimiges, sabberndes Grunzen. Das klang ihm in den Ohren, wie des Fischermessers Reißen beim Ausweiden häßlicher Rochen — glatt und grau und doch knirschend und schiebend. Sehr ekel — und bekannt ihm genug. So lachte sein Onkel — so der Mann im Pullmanwagen. Er sah sich um — sprangen nicht schwarze Mäuse durch den Schnee?
Nichts — nichts. Frank Braun blieb stehn, wartete, ließ ihn herankommen. Aber nein, der Mann spuckte nicht. Er schnalzte vorbei, grunzte wieder. Nun sah er im Flackerlicht sein Gesicht. Ein Chinese war es, wohlgemästet und überfett. Er hielt sich fest an dem Gitter, hing da, schwappend, wie an der Reeling eines schwankenden Schiffes. Bog dann ab, segelte hinüber, quer durch die Straße, der Zweiten Avenue zu, hinunter nach Chinatown.
Frank Braun sah ihm nach. Aber kein Spucken, nein — blank blieb der weiße Teppich. Nur, weiter nun, und noch weiter, schlug ihm das ekele Grunzen um die Ohren, zerfetzt, in Stücke zerrissen vom jagenden Schneewind.
Keine Autos mehr, keine Wagen, Omnibusse und Straßenbahnen. Leer, leer alles, und immer stärker das eisige Heulen, das nichts dulden wollte in allen Gassen neben sich selbst. Das peitschte die Flocken, das spie von allen Seiten, jagte die Steinwände hinab und hinauf, riß an Laternen, Gittern, Bänken und Bäumen. Formte auch, für Minuten nur, phantastische Figuren rings durch den Parkplatz, riß sie wieder zusammen, schaffend und zerstörend zugleich.
Eines hob sich, ein gewaltiges Tier, hinter dem schneeverklebten Gitter, in entlaubtem Busch. Wie ein Bär, wie der ewige Eisbär, den er täglich sah in den Zeichnungen der Tagesblätter als Rußlands reißendes Symbol. Und da, an die Laterne gelehnt, stand einer im Schneemantel, wie ein vergessener Posten in der Winternacht. Etwas lugte heraus unter dem Mantel her, schwarz und spitz, wie ein Bajonett. — Dann, von der Westseite her, ein neuer Stoß. Da sprang es auf, dünne Gestalten aus Schnee — stürmte hinüber, brach zusammen an dem klirrenden Eisengitter. Aber neue jagten heran, mehr, mehr wuchsen aus dem Boden, blendend weiß. Rasten herüber, an ihn, gegen ihn, durch ihn hindurch. Neue Schneescharen, neue und neue. Das faßte ihn, warf ihn zu Boden, riß ihn herum, wie einen plumpen Balken, klebte ihn fest an den weißen Boden. Mühsam kniete er, kroch vorwärts, rutschend, kriechend. Noch einmal und wieder, über ihn weg, Tausende, Hunderttausende weißer Reiter. Das raste, das heulte und schrie —
Da brach hinter ihm das Eisengitter —
Nur hinüber — dreißig Schritte nur — über die Straße. Da war sein Klub — da konnte er warm werden. Grog trinken. Poker spielen.
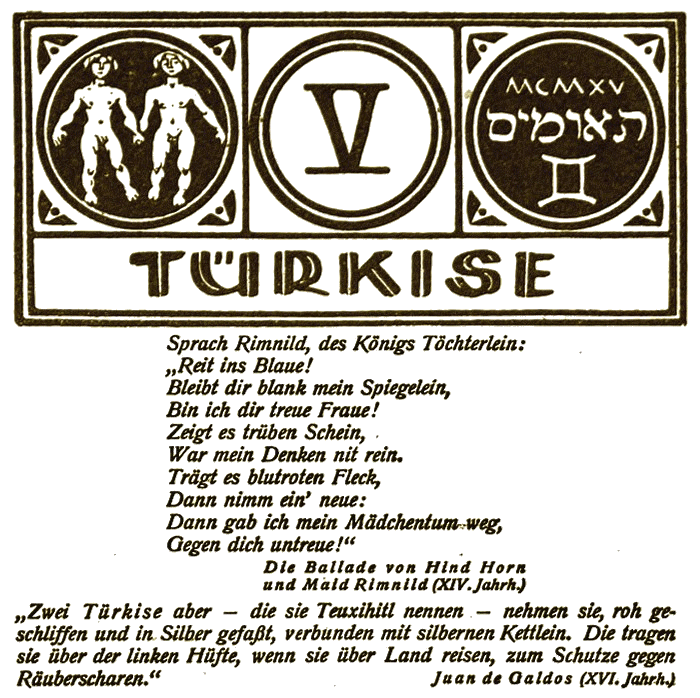
Sein Sekretär gab den Revolver in die Ledertasche.
»Nein,« sagte Frank Braun, »legen Sie ihn weg. Er ist nicht nötig.« Dann schwankte er, hielt die Waffe unschlüssig in der Hand. »Oder — ich könnte ihn als Geschenk geben, er wird willkommen genug sein.« Aber wieder zögerte er einen Augenblick. »Nein — den nicht. Es ist ein deutscher Armeerevolver — man soll nicht sagen, daß wir Waffen einführen über den Rio Grande. Alles, was die Mexikaner bekommen, liefern ihnen ja die Yankees selbst — so mögen sie auch von mir amerikanische Ware bekommen. Da — unten in der Schublade — liegen Smith und Wessons genug, nehmen Sie gleich ein halbes Dutzend. Und vergessen Sie die Patronen nicht, fünf Schachteln mit jeder Waffe.«
Sie packten die Revolver ein, schwer genug ward die Handtasche.
»Soll ich Ihre lieben Freunde rufen?« fragte der Sekretär. »Sie müssen Abschied nehmen.«
Er nickte. »Ja, holen Sie sie! Sind sie herbestellt?«
»Alle drei!« lachte der andere. »Es wird rührend genug werden.« Ging ans Fenster, schlug die Vorhänge zurück, winkte mit raschen Gesten. Es war ein junger Bursch, schlank und blankäugig, kaum dreiundzwanzig. Ein Steiermärker, gescheit genug, fähig und geschickt zu allem, was nötig war. Ein wenig zerfahren manchmal und oberflächlich, wenn ihm die Mädchen im Kopf spukten. Aber er riß sich zusammen, wenn es drauf ankam, fand sich zurecht in heikelster Lage — das war, was man brauchte an dieser Stelle. Ernst Rossius hieß er, war weggelaufen vom Gymnasium, hatte sich herumgetrieben in drei Erdteilen als Journalist und Dolmetscher, als Steward und Trimmer und Stauer — als Landstreicher auch, wies gerade traf. War nun gestrandet in den Staaten, wie so viele Tausende. Er kam zu ihm eines Tages, bot sich ihm an.
»Empfehlungen?« fragte Frank Braun gewohnheitsmäßig. Das war seine erste Frage bei jedem Besucher; er nahm dann die Briefe, las sie nie, aber blickte so hinein, ließ den andern sprechen. Das gab ihm Zeit, sich ein Bild zu machen.
»Hier!« sagte der junge Mann rasch. Er griff in die Tasche, nahm einen Stoß Papiere heraus, reichte sie ihm. Es waren lyrische Gedichte. Der Namenszug stand unter jedem und irgendein Datum.
Frank Braun brummte: »Nette Empfehlungen — pfui Teufel!« Aber er las doch. Die Gedichte waren schlecht, unreif und nachempfunden. Und doch — hier und dort — war ein Klang, ein kurzer Satz — irgendein Wort nur, das diesen Bengel da gab, den Ernst Rossius und sonst keinen. Irgendein: ›Vielleicht‹ rief aus diesen Versen.
»Was können Sie?« fragte er.
Der Junge sagte: »Alles. Oder auch: nichts — wie mans nimmt. Ich kann alles — und nichts ordentlich.«
Das gefiel ihm wieder, er lachte. »Meinetwegen bleiben Sie, wenn Sie Lust haben.«
So blieb er.
Die Detektive kamen herein; sie waren sehr erschreckt über die offenen Koffer. Wenn er sonst wegfuhr, zwei oder drei Tage nur, nahm er nur die große Ledertasche mit. Ein paarmal, im Anfang, hatte ihn einer der Leute begleitet; später hatte er nur gesagt, wohin er fahre und wo er sprechen würde. Da waren sie brav in New York geblieben, hatten seinen Bericht genommen und alle die hübschen Reisespesen in die Tasche gesteckt.
Aber dies sah anders aus. »Wie lange wollen Sie fortbleiben?« fragte der Hagere mißtrauisch.
»Einen Monat. Sechs Wochen vielleicht,« antwortete er.
O, so lange? Warum denn nur? Und wohin er denn reise?
Ruhe müsse er haben, das sei alles. Allein müsse er sein, still arbeiten für sich. Aufs Land wolle er, an die See.
Aber sie glaubten ihm keinen Buchstaben. O, sie wüßten Bescheid — mehr als er denke! Nach Kanada wolle er, das sei gewiß. Den Wellandkanal in die Luft sprengen, oder eine Eisenbahnbrücke. Die Zeitungen seien ja voll davon. Ein paarmal sei es mißlungen — aber man kenne die Deutschen — sie versuchten es wieder und noch einmal, bis —
Der Kleine, Dicke hob die Ledertasche auf — schwer, schwer. »Dynamit?« fragte er scheu.
Dann baten sie, beschworen ihn, flehten fast. Er solle sich schonen, um Himmelswillen. Der Kaiser würde auch ohne ihn fertig. Das sei Leichtsinn, sei verbrecherische Tollkühnheit, so sein Leben aufs Spiel zu setzen. Wenn ihn die verdammten Kannucken fingen — totschössen — als Spion —! Sie würden es sich nie vergeben können, daß sie ihn nicht besser beschützt hätten. Sie liebten ihn so —
»Und euren guten Job!« lachte er.
Es klopfte, der alte Diener meldete den Briefträger. »Führen Sie ihn ins Vorderzimmer,« befahl er. Er wandte sich an seinen Sekretär. »Werden Sie mit den Leuten fertig?« fragte er auf deutsch.
»Ich denke schon,« antwortete der Junge.
Er ging hinüber, schloß die Türe hinter sich. Er nahm seine Post in Empfang, quittierte die eingeschriebenen Briefe. Er sagte dem Mann, daß er ein paar Wochen ins Seebad ginge, ließ ihm Vollmacht für seinen Sekretär. Das war nicht ganz in der Ordnung, aber ein paar Dollarnoten brachten es rasch ins reine.
Dann kam ein Laufbursche, brachte einen großen Busch roter Rosen und ein Briefchen dazu. Von Ivy Jefferson kam es, der kleinen blonden Ivy Jefferson, der er den Hof machte seit ein paar Monaten schon. Er kannte ihren Vater und ihre Mutter — die spielte in der Fünften Avenue eine Rolle und er in Wallstreet.
Er nahm das Papier von den Rosen — das duftete jung und gut, wie das frische Fleisch von Ivys achtzehnjährigem Nacken. Er lächelte — die Rosen waren ein gutes Zeichen. Er hielt sie gut, die blonde Ivy, und mit ihr Vater und Mutter — die schon tun mußten, was sie wollte, dies verwöhnte, eigenwillige, einzige Kind. Mit ihnen aber — zwanzig Familien, mehr noch — das war eine gute Rückversicherung, wenn ihm doch etwas passieren sollte da unten. Er hielt sie alle — gegen ihr Gefühl — nur mit der einen Karte: Ivy.
Ihr Empfangstag war es, im Februar, der Tag, an dem sie eingeführt wurde in die Welt, an dem alles da war, was nur in New York zur ersten Gesellschaft gehörte — o, zur allerersten. Vor ein paar Jahren schon hatte ihn in London der alte Jefferson dazu eingeladen — so leichthin nur, so im Plaudern: dazu müssen Sie hinüberkommen! Und er hatte — ebenso — geantwortet: gewiß, dazu komme ich.
Nun war er da, war in New York. Der lange Tewes brachte ihm eines Morgens die Zeitungen, die alle der blonden Ivy riesiges Bild gaben. Ivy Jefferson wird eingeführt in die Gesellschaft — ach, das war wichtiger als alle Schlachten in Polen und Frankreich.
»Sagten Sie nicht einmal, daß Sie die Jeffersons kennen?« fragte der Journalist. »Haben Sie schon Besuch gemacht?« Er verneinte. »Dann müssen Sie hin — heute noch!« Und er gab nicht nach, packte ihn auf, nahm ihn mit hinunter nach Wallstreet zu des Alten Büro in der Jeffersonbank. »Dahinein, Doktor!« rief er.
Er wartete draußen, lief auf und ab mit langen Schritten, bis Frank Braun herauskam. »Nun — was ist?« fragte er. »Hat er Sie eingeladen?«
»Ja, das hat er,« antwortete er. »Ungern genug.«
Der Journalist krähte: »Kann ich mir denken. Nur Alliierte sind da — Munitionsmenschen und Anleihefritzen! Sie sind der einzige Deutsche — ganz gewiß.« Er rieb sich die Finger vor Vergnügen. »Ach, ich kann mir das Gesicht denken, das der alte Jefferson gemacht hat! Süß und sauer und gekränkt — und wieder liebenswürdig — und sehr ergeben. Er wußte gleich: wie er's machen würde, wars falsch. Lud er Sie nicht ein — würde seine teure Gattin ihn mächtig ausgezankt haben, ob seiner Taktlosigkeit und Feigheit — und nun, da er Sie einlud, wird sie ihn schelten eben deshalb.« Er brannte eine große Zigarre an, stieß den Rauch weg in dicken Wolken. »Aber nun kommt die Hauptsache, Doktor: Sie müssen dem Jeffersongirl den Hof machen auf Teufelkommraus. Müssen alle andern bei ihr ausstechen. Denn das Frätzchen hält viele Fäden — oder wird sie halten, wenn sie's heute auch selbst noch nicht einmal weiß. Ihr ists — heute noch — vermutlich ganz gleichgültig: britisch oder deutsch. Sie müssen sie gewinnen! Die Kleine kann uns — oder Ihnen — einmal sehr nützlich sein. Sehn Sie —«
Und er redete, redete. Erklärte ihm, stoßweise in raschen Sätzen, zwischen hinausgepufften Rauchwolken, wie die Jefferson-Bank arbeitete, vor und hinter den Kulissen. Und wie der alte Börsenbär — und seine Frau nicht weniger — alles tun möchten um ein Lächeln ihres blonden Töchterleins.
»Woher wissen Sie das alles?« fragte Frank Braun.
Tewes blieb stehn, schwenkte den langen Arm in der Luft. »Wozu bin ich politischer Pressemensch in New York seit nun dreiundzwanzig Jahren? Drüben muß man Behörden kennen — hier Familien!«
Frank Braun bekam seine Einladung. Er ging hin um des Tewes willen und mehr noch, weil ihn Lotte van Neß so drängte. »Er hat dreimal recht,« sagte sie. »Mach ihr den Hof, zeig, was du kannst. Nimm sie — gib ihr die ersten Küsse.«
»Küsse — ohne Empfindung!« warf er ein.
»Pah!« machte sie. »Was tut das? Küsse sind Küsse — ob sie gemeint sind oder nicht.«
Das war nicht schwer, da den Hahn zu spielen. Ein paar französische Bankleute und Diplomaten, aber alt; amüsant genug, aber völlig unfähig, so wie man englisch sprach. Italienische Künstler, Maler und Sänger, zweiter Klasse alle, überlaut und bedientenhaft zugleich. Dann manche Engländer, mit sehr guten Formen, ruhig und kalt. Unterhaltend, aber ohne Witz, sehr höflich und zuvorkommend, aber stets mit der beleidigenden Geste: »Wie gut von mir, hinüber zu kommen zu euch — Pack!«
Und Amerikaner natürlich, viele Amerikaner.
Junge Burschen, gutgewachsen, gesund, groß und kräftig, diese Söhne der ersten Häuser — welch ein Gegensatz zu dem hohlwangigen, engbrüstigen und plattfüßigen Volk, dessen Millionen tagein und aus die Untergrundbahn aus der Erde heraus ans Licht spie! Studenten von Harvard, Yale und Princeton, die rudern konnten und reiten, boxen und motorfahren, die Baseball spielten und Fußball und gleich gewandt waren im Hockey wie im Tennis. Und die — ohne Frage — ihren Frack so leicht trugen wir ihr Polohemd.
Juden waren nicht da — keiner und keine. Der Kaiser mochte sich Herrn Ballin zum Frühstück bitten, und der König von England Sir Ernest Cassel! Dies aber war ein amerikanisches Haus — eines der allerersten: eher hätte der Russenzar den Baron Günzburg zum Tee geladen und mit Herrn Mandelbaum Bridge gespielt, ehe auch der reichste Jude über diese Schwelle gekommen wäre. Hier galt er schon fast als aussätzig — er, der Deutsche.
Ivy Jefferson stand da, neben ihren Eltern, einen Riesenbusch weißer Orchideen im Arm. Sie empfing, schüttelte über vierhundert Hände, sagte jedem eine rasche Phrase. Er kam spät genug, machte seine Verbeugung, nahm ihre Hand. Er wußte, von Europa her, daß sie Deutsch verstand — so sprach er zu ihr in seiner Sprache. Ihr Vater hörte es gleich, machte ein langes Gesicht — warf einen mißtrauischen Blick seiner Frau zu — dann ihm einen sehr vorwurfsvollen. Und begrüßte ihn, sichtlich kühl, auf englisch. Er antwortete, höflich und kurz, wandte sich wieder dem Mädchen zu. Sagte lachend und laut genug: »Soll ich Englisch sprechen? Ihr Vater stirbt vor Angst, daß einer Deutsch spricht in seinem Hause.« Da sprach die kleine Ivy — auf Deutsch — holpernd und ungelenk, aber doch auf Deutsch: »Es ist mein Tag heute: sprechen Sie Deutsch!« Er sagte:
»Danke!«, wandte sich zum Gehn. Aber sie hielt ihn fest. Absichtlich und offen. O, sie war erwachsen nun, war »in der Gesellschaft« seit dieser Stunde, war unabhängig allen gegenüber und ihren Eltern erst recht. Das mußte sie zeigen — und hier war die erste Gelegenheit.
Und — nur um noch etwas zu reden — sprach sie: »Jeder sagt mir ein paar Artigkeiten über mein Aussehn — Sie kein Wort. Wie gefalle ich Ihnen?«
Er maß sie, im Zehntel der Sekunde. »Gut,« sagte er langsam. »Sehr gut. Nur — Ihre Zofe ist eine Gans.«
»Weshalb?« fragte sie.
Er zog die Lippen herab. »Sie haben ein Wimmerl — da auf der Schulter — ein kleines nur. Wozu gibt es Muschen?«
Sie wurde rot — unter Schminke und Puder — das sah er wohl. Ihr Blick traf ihn, beleidigt und gekränkt — flog hinüber zur Schulter. Sie biß die Zähne zusammen —
»O!« flüsterte sie.
Dann wandte sie sich scharf ab — ließ ihn stehn. Streckte die schlanke Hand einem andern entgegen.
Er ging, verlor sich in den Menschen. Er überlegte — einen Augenblick zweifelte er — nickte dann befriedigt. Er dachte: »Es war doch gut. Zweihundert Männer gaben ihr die Hand — sagten alle dasselbe. Mich wird sie merken.«
Er saß, irgendwo an einem Tische, hinten in dem gotischen Speisesaal. Aß ein wenig, trank, sprach mit höchst gleichgültigen Menschen. Ging hinüber mit ihnen in den Wintergarten, in den Ballsaal dann, stand an einer Seite ganz allein, sah zu.
Ja, tanzen konnten sie, diese amerikanischen Jungen. Gleichmäßig hinüber und herüber, immer dasselbe. Seelenlos, ohne jede Empfindung, unendlich langweilig — aber geschmeidig, unermüdlich, stundenlang.
Er stand und wartete.
Er sah sie vorbeischreiten, zweimal, fünfmal, viele Mal. Sie blickte wohl hinüber zu ihm, aber sie nickte ihm nicht zu. Manchmal, wenn sie sich setzte auf ein paar Minuten, schien es ihm, als ob ihr Auge hinüberirre — auffordernd erst, dann entrüstet und wieder herausfordernd. Warum kam er nicht, sie zum Tanz zu bitten? Aber er stand nur, still, unbeweglich, schaute zu, wartete.
Hochmütig, ein wenig gelangweilt.
O nein, es war nicht Absicht bei ihm. Er ließ es gehn, wie es ging. Er wartete. Er dachte: sie wird kommen.
Wieder tanzte sie vorbei — da brach die Musik ab. Sie kam zurück mit ihrem Partner, streifte ihn dicht, blieb stehn, wandte sich zu ihm.
»Da, schauen Sie!« sagte sie.
Es klebte eine kleine schwarze Musche auf ihrer Schulter.
»Das ist lieb!« nickte er.
Sie stellte ihren Partner vor, einen großen Studenten. Sie gaben sich die Hände, boten sich Zigaretten an. Dann nahm sie seinen Arm, verabschiedete den andern.
»Tanzen Sie nicht?« fragte sie.
»Nein,« sagte Frank Braun.
Wieder begann sie: »Ich bin etwas müde — ich möchte Eis haben. Kommen Sie!«
Jetzt war die Gelegenheit da, jetzt. Aber nichts fiel ihm ein, und er sagte nichts. Er dachte: ›Wenn mich der Tewes sähe! — Esel! würde er machen, Dummkopf!‹
Aber sie gab nicht nach. »Wollen wir Englisch sprechen — wenn wir allein sind? Mir fällts soviel leichter.«
Er nickte leicht: »Wie Sie wollen.«
Wieder eine Pause. Er holte ihr Eis, sie setzten sich an einen kleinen Tisch, ganz in der Ecke. Und wieder begann sie: »So habe ich Sie mir gedacht — sehr verschlossen. Manchmal so — und manchmal anders.«
»Gedacht?« fragte er. »Wann gedacht?«
»Gestern!« lachte sie. »Über eine Stunde haben sie sich gezankt, Papa und Mama, Ihretwegen. — Sie sind gefährlich. Sie sind ein Verschwörer.«
»Ach,« sagte er, »ich bin harmlos genug.«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein,« rief sie, »das sind Sie nicht. Unsere Hausdame ist aus Wien — die weiß von Ihnen. Mama hat sie ausgefragt. Sie hat mich dann gewarnt vor Ihnen.«
Er blickte auf. »Und?« fragte er.
Sie lachte: »Darum sitze ich hier.«
Er antwortete nicht. Er sah sie an, lange und still. Sie sprach, sprach, aber er hörte nicht hin. Sie war dunkelblond, ihr Haar war nach hinten gekämmt in großen Wellen. Die Brauen schienen ein wenig zu stark — aber das Auge selbst war grau und schön und die Nase schmal und wohlgebildet. Und ein nervöses Zucken in den Flügeln. Klein der Mund, gutgeschweift die Oberlippe. Ein bißchen zu lang der Hals, zu fallend die Schultern und nicht voll genug. Flach der Busen noch, allzu flach. Und doch war sie hübsch — so jung — so erste Blüte noch.
»Was starren Sie mich an?« rief sie. »Sprechen Sie doch.«
Er hielt ihr Auge nun. Schwieg, wie sie schwieg.
»Was wollen Sie?« fragte sie.
Er ließ sie nicht. Sagte: »Ich kam her — Ihretwegen.«
Sie setzte ein Lachen an, das brach in der Mitte.
»Ihretwegen —« wiederholte er.
Einer kam, bat sie zum Tanz. Da sagte er — aber wie eine Frage klang es: »Ich werde nun gehn.«
Sie stand auf, reichte ihm die Hand. Und sie sagte: »Kommen Sie zum Tee — am — am — — Übermorgen!«
Wieder hob er die roten Rosen — jeder Stiel ein Meter lang — American Beauties.
Sog ihren Duft ein — legte sie vor sich auf den Tisch. Griff ihr Briefchen, riß es auf. — Er war zum Tee gegangen zu Ivy Jefferson. Er war allein mit ihr — nur einmal kam die Mutter herein, auf wenige Minuten nur. Nein, er hatte ihr nicht den Hof gemacht, ganz und gar nicht. Er war nicht nett zu ihr, nicht liebenswürdig.
Aber sein grünes Auge konnte verwirren — manchmal, wenn es gerade sein Tag war — und der Tag war sein guter Tag. Er hatte mit leichten Fingern ihre Hand gestreichelt und den Arm.
Er wurde ein guter Freund in diesem Hause. Er ging zweimal hin in jeder Woche oder dreimal. Er ging mit ihr zur Oper, ritt aus mit ihr. Viel zu oft, dachte er. Sie nimmt meine Zeit weg. Aber sie sagte: »Viel zu wenig! Sie sind mein ›Beau‹ — und Sie müßten jeden Tag kommen.«
Sie mußte ihren erklärten ›Beau‹ haben — wie jede Dame der New Yorker Gesellschaft — das war ausgemacht. Doch sie, Ivy Jefferson, nahm einen Deutschen — in dieser Zeit. Ihr Vater war entrüstet darüber, noch mehr die Mutter. Aber dann, erstaunlich rasch, gewöhnten sie sich daran. Und Frau Alice Jefferson — ihr ›Beau‹ war der englische Generalkonsul — erklärte jedem, der es hören mochte — daß sie es sehr stilvoll fände, was ihre Tochter tue, und sehr mutig. Wirklich, sehr mutig.
Mehr noch, sie wurden herzlich zu ihm und gut. Sie taten nicht nur so — sie mochten ihn wirklich leiden, gewöhnten sich an ihn — das machte der kleinen Ivy Wille. Einmal nur versuchte die Mutter, ihr ernste Vorstellungen zu machen.
»Muß es gerade ein Deutscher sein?« rief sie.
»Soll ich einen Italiener nehmen?« gab die Tochter zurück. »Mich lächerlich machen?«
Nein, nein, einen ›Dago‹ nicht. Aber es waren so viele Engländer da, Kanadier, dann Franzosen und Belgier, auch ein paar Russen. Denn, daß es kein Amerikaner sein konnte, stand fest. Das hatte die kleine Ivy von ihr, diese instinktive mißtrauische Nichtachtung für alle Männer ihres Landes, die sie teilte mit so mancher Dame der großen Gesellschaft.
O ja, im Beruf — da waren sie gut. Geld schaffen, so oder so, auf tausend Wegen, das konnten sie. Aber als Männer? — Keine von all diesen Damen sprach es je aus — und doch hing es überall in der Luft. Sie waren anders mit Amerikanern — anders mit den Fremden. Da zitterten ihre Nüstern, da kam ein Glanz in ihre Augen.
Etwas fehlte diesen amerikanischen Männern von Klasse — allen fast. Sie waren aus gutem Holz — manche aus Erz oder festem Stein. Sie waren gut gekleidet und gut gewachsen, hatten Muskeln und Sehnen. Und doch —
Sein Freund, der Attaché der spanischen Gesandtschaft, faßte es gut. »No tienen cojones!« lachte er.
Das war es, ganz gewiß, das allein. Und die Frauen merkten es, fühlten es — bewußt und unbewußt. Asexuell waren sie — oder auch Masturbanten von Jugend auf — keine Empfindung, keine Erregung, kein rotes Blut.
Noch weniger: Sinne —
Und dann: so ungebildet waren sie, so ohne Kultur und unwissend.
Die Dame der Gesellschaft stand viel höher. Sie mußte hinabsehen auf den amerikanischen Mann — aber der Europäer war ihr sehr gleichberechtigt — stand höher zumeist.
Und dann — und das war viel mehr — er gab ihr: »Thrill« —
»Thrill« — eine Erregung, groß oder klein, ein Kitzel im Blut und in den Nerven — etwas, das aufpeitschte.
Das tat kein Amerikaner.
— Er las Ivys Brief — drei Seiten — in großer steiler Schrift. Sehr häßlich sei es von ihm, daß er weggehe, sehr gemein! Warum er nicht mit ihnen käme nach Neuport? Und daß er nur nicht sich einbilden solle, daß sie nicht rausfände, was er vorhabe! Sie werde es herausbekommen — und wenn es ihr fünfzigtausend Taler kosten solle! Und sie schicke ihm keinen Kuß — nein, das tue sie nicht.
Er stutzte; setzte sich hin, schrieb ihr. Wenn sie nur einen Schritt tue, ihm nachzuforschen, würde sie ihn nie wiedersehn. Er habe Gründe — und wenn sie klug sei — würde sie es begreifen. Er danke für die Rosen — die würde er mitnehmen. Er sei zurück, bald genug — und er schicke ihr ja Küsse. Sieben — und noch einen dazu.
Er gab den Bogen in den Umschlag, schrieb die Adresse. Dann rief er seinen Sekretär. Der kam mit den Detektiven — die grüßten und freuten sich.
»Da sehen Sie!« rief Ernst Rossius, »Rosen und ein kleines Briefchen.«
Der Kleine, Dicke trat auf ihn zu: »Recht viel Vergnügen, Doktor! Und bitte — eine Rose zum Gedenken — ich will sie meiner Frau mitbringen.«
Frank Braun nahm die Rosen, teilte sie in drei gleiche Teile — gab jedem der drei Halunken.
»Haben Sie auch eine Frau?« fragte er den Hagern.
»Nein,« sagte der, »aber ich kenne ein Mädchen.« Der Sekretär schob ihm schnell einen Scheck zu. »Unterschreiben Sie,« sagte er. »Dreihundert Dollar für die Leute.« Er setzte seinen Namen hin, gab einem das Papier. Schüttelte drei Hände, sagte dreimal: »So long —«
»Das war billig genug!« rief er, als sie draußen waren. »Wie haben Sie's angestellt?«
Rossius lachte. »Schade, daß Sie alle Rosen weggaben. Sie hätten mir auch ein paar lassen können für mein Fräulein Braut.«
»Noch dieselbe?« fragte er.
Der Junge verneinte. »Eine andere — seit letzter Woche. — Da — die Rosen — das war es! Ich habe den Kerls eine Geschichte vorgelogen: Sie hätten eine Liebschaft — sehr geheim natürlich. Und sie gingen mit der Dame auf eine kleine Hochzeitsreise. Das leuchtete ihnen ein — und die Rosen stärkten ihren Glauben. Dann die hundert Dollar für jeden —«
Frank Braun blieb in Torreon, im Staate Chihuahua. In Monterey hatte er sich von seinem Begleiter getrennt. Der fuhr südwärts nach Veracruz zu General Carranza. Sie waren übereingekommen, daß sie sich trennen wollten, daß jeder arbeiten sollte auf eigene Faust. Wenn sie zusammen blieben, gemeinsam von Villa zu Carranza fuhren, oder umgekehrt — immer würde der andre sie mißtrauisch genug aufgenommen haben.
Er wäre gern vorher noch hinunter gefahren zu dem dritten der drei Condottieri, dem kleinen glutäugigen Emiliano Zapata, der Guerrero hielt und Michoacan und Morales — aber es würde ihm zuviel Zeit nehmen, das stand fest. Und dann, der würde nie nach Norden ziehn, der nicht. Der war ein Stutzer im Räubergewerbe, einer, der sich und sein Pferdchen mit Silber schmückte, der Mädchen küßte und Jarape tanzte, viel Pulque trank und sein schwarzes Schnauzbärtchen keck in die Höhe drehte. Der war nie weiterzuschieben — und das wußten die Japsen sicher so gut, wie er selbst. Besser wie dort unten, konnte er das, was er wissen wollte, hier im Nordwesten erfahren: wenn irgendwo, so waren hier Nippons Agenten am Werke.
Er wartete. Pancho Villa mußte kommen, morgen, übermorgen — von Durango her. Nächste Woche vielleicht oder übernächste — aber kommen würde er. Er hatte seine Leute hierher bestellt, aus allen Teilen des Landes, wo immer sein Name galt: wie eine Heerschau sollte es werden. Und sie trafen ein, Hauptleute und Generäle, mit kleinen Trupps und mit großen. Lagerten in der Stadt und draußen, in Gomez Palacio und Lerdo.
Frank Braun ritt herum durch das Lager, schloß Freundschaften, schwatzte den lieben, langen Tag. Aus New York hatte er sich allerhand Kinkerlitzchen mitgebracht, Zigarren, die Feuerwerk machten, Streichhölzchen, die nicht anbrannten, und solch geistreiche Scherze. Die verschenkte er den Herrn Offizieren. O, er kannte seine Mexikaner! Wie die Kinder freuten sie sich, lachten wie Schulbuben, sie, deren schmutzige Finger dick klebten von Menschenblut.
Er horchte sie aus — das war leicht genug. Sie waren alle für Villa; o gewiß, er sei der starke Mann. Keiner aber hatte eine sichere Meinung, was werden sollte. Anarchie in diesen Köpfen, wie überall im Lande.
Und nur in einem, einem einzigen Punkte stimmten sie alle überein. Jeder Soldat, vom General bis zum letzten Maultiertreiber, jeder kleinste Obsthändler und Stiefelputzer, jeder Advokat und Politiker. Jede Frau auch, von der Señora bis zur Bordelldirne —
Das war der Haß, der tief eingefleischte Haß gegen den Yankee.
Kaum einer konnte sich ein Bild davon machen, wie das alles so recht gekommen war. Aber das wußten sie gut: alles, alles hatte der Amerikaner gemacht, vom ersten Tage an. Von ihm kam das Geld und die Waffen, die den mächtigen Diaz stürzten, durch ihn fiel Madero und Gutierrez und Huerta. Und die Carranzaleute, die gegen sie kämpften, hatten wieder amerikanisches Geld, schossen mit Yankeekugeln.
Und sie, die Villistas? Nun — sie auch, freilich! Das war es ja eben! Man fraß sich auf im ganzen Lande, man brannte, mordete, raubte und stahl. Allen zum Schaden — und zum Nutzen nur einem, dem Gringo, dem Amerikaner. Und es sollte keine Ruhe kommen, kein Frieden mehr, sie sollten weiterkämpfen und sich totschlagen gegenseitig. So paßte es Wallstreet und Washington — und darum geschah es.
Davon war jeder fest überzeugt. Wenn nur einer kommen wollte und sie führen: ah, im Augenblicke würden sie alle eins werden, Villisten und Zapatisten, Carranzisten und Diazleute, alle, alle, von Sonora bis Yukatan. Das war die einzige, die letzte Rettung für das verblutende, jämmerlich zerfetzte Land, der Kampf nach außen, der Krieg gegen den elenden, gewissenlosen Gringo, der ihr schönes, reiches, blühendes Land zu dem elendesten der Erde gemacht hatte.
Warum denn? Weshalb? Welche Gründe hatte ihr Feind, der Yankee? Auch das wußten sie, wurden nie müde, darüber zu sprechen. Er wollte ihr Land, wollte Sonora, Coahila, Chihuahua und das reiche Tamaulipas mit den Ölfeldern. Wollte sie berauben und bestehlen, wie er einst Kalifornien stahl, Neumexiko, Texas und Arizona. Aber er war viel zu feige, es einfach zu nehmen. Er machte es hinten herum, hetzte sie gegeneinander, ließ sie totschießen einer den andern, durch lange Jahre hindurch. Dann, wenn im ganzen Lande kaum mehr ein Mann da war, der eine Flinte tragen konnte, dann erst würde der tapfere Yankee kommen. Würde dann: Ruhe stiften. Würde nehmen, was ihm beliebte! So war Gringopolitik!
Sie gossen den Agavenschnaps hinunter in großen Gläsern, sie schlugen mit den Fäusten auf den Tisch, spien und schrien und lärmten. Und dann — einer und noch einer — schluchzte auf, weinte. O, es wäre schon besser, wenn die Gringos endlich kämen! Bald sei ja doch alles zu Ende — bald genug. Wie ein Stier stöhnten sie auf, wie einer, dem die Kreuzklinge des Espada hoch zwischen den Hörnern steht. Der in den Knien liegt, sehnsüchtig wartet auf den raschen Gnadenstoß des Puntillero.
Und da schrien die New Yorker Blätter: »Deutsche hetzen Mexiko gegen die Staaten auf.« Deutsche?! O je! Hier hetzte nur einer, einer — und das war der Yankee.
Am nächsten Sonntag ritt Villa ein. Man hatte die Stadt geschmückt, zerrissene Teppiche hingen aus den Fenstern und bunte Bettlaken. Auch ein paar Fahnen flatterten herum.
Die Leute blieben in den Häusern, aber manche Dirnen drängten sich an den Fenstern und in den Türen. Erwiderten lachend die saftigen Späße der einziehenden Männer. Die ritten und liefen durch die Gassen, ohne viel Ordnung, wie es jedem gerade behagte. Zerlumpt und zerrissen, bunt bewaffnet, alle in ihren mächtigen, spitzen Hüten.
Er stand auf dem kleinen Balkon, blickte hinab — noch war der Generalissimus nicht vorbei. Da klopfte es. »Herein!« rief er, wandte sich zurück.
Ein Offizier kam durch die Tür, hochgewachsen, mit mächtiger Adlernase. Und es fiel ihm auf, daß der wenigstens glatt rasiert war.
»Bitte die Störung zu verzeihn,« sagte er höflich genug. »Ich muß Sie verhaften.«
Er fragte: »Wer sind Sie?«
»Ich bin des Generals Adjutant.« rief der andere. »Es tut mir sehr leid — aber ich muß Sie abführen.«
»Wer gab den Befehl?« verlangte er.
Der Adjutant sagte: »Ich selbst. Sie sind ein Fremder, kommen aus den Staaten. Sie haben keinerlei Papiere. Wir müssen den Fall untersuchen. Bitte, folgen Sie mir.«
Frank Braun betrachtete den andern genau. Er trug hohe, neue Ledergamaschen — hatte im Gürtel drei Revolver stecken; in der Hand wippte eine kleine elegante Reitgerte. Kein Rock, keine Weste; das blaue Hemd war verstaubt und verschwitzt. Es stand halb offen, da sah er ein Stück weißer Wolle mit blauen Querstreifen.
»Arbekampfes?« fragte Frank Braun.
Der Fremde stutzte. »Das hat mich noch keiner gefragt in Mexiko!« Er trat an das Fenster, wandte sich zum Zimmer hin, daß er ihn gut sehn konnte, in vollem Licht. »Sind Sie auch —?« fuhr er fort. »Nein, nein — Sie sind ein Deutscher!«
Frank Braun nickte. »Das bin ich. Und Ihre Untersuchung können Sie gleich hier anstellen, wenn es Ihnen recht ist. Bitte, wollen Sie Platz nehmen?«
Sie setzten sich beide, sprachen zusammen, verstanden sich schnell. Er kenne Villa, erzählte Frank Braun, sei mit ihm in Sonora geritten, vor vier Jahren nun, als es gegen den Maitorena ging. Was er nun wolle? Je nun, sehn, wie die Stimmung sei, hier im Lande. — Welche Stimmung? Für Villa, oder Carranza — oder wen sonst? Nein, das sei ihm ganz gleichgültig — ihn interessiere nur eine Stimmung: die zu Washington — für oder gegen —?
»Sie hassen die Yankees?« fragte der Adjutant.
»Soll ich sie lieben?« gab er zurück. »Dafür, daß ihre Kugeln zu Tausenden meine Landsleute niederstrecken?«
Zögernd kam es: »Ich bin aus Neuyork —«
»Aus Hesterstreet?« fragte Frank Braun.
Da lachte der andere auf. »Sie wissen Bescheid! Aus Hesterstreet nicht grade — aber nicht sehr weit davon.« Er wurde nachdenklich. »Ich bin amerikanischer Bürger — heute noch. Und ich war es mit Leib und Seele — als Kind und Knabe und Jüngling. Glaubte felsenfest an Gleichheit und Freiheit und Gerechtigkeit — an das große Symbol im Neuyorker Hafen — kannte nichts, was nicht Sterne und Streifen war. Bis —«
Er stockte. Und Frank Braun wiederholte: »Bis?«
Der Adjutant sagte: »Bis ich sah, daß das alles freches Gelüge ist und hundsgemeiner Schwindel! Sehn Sie, Herr, ich bin zum Soldaten geboren — habe nie was anders geträumt. Mein Vater war entsetzt darüber, aber meine Mutter freute sich — sagte, daß ich Makkabäerblut habe. Zuschneiden lernte ich, aber endlich, als ich zwanzig Jahre alt war, setzte meine Mutter es durch, daß ich mich melden durfte beim einundsiebzigsten Regiment. Das ist keine reguläre Truppe, nur ein Freiwilligenregiment, Nationalgarde, die ein paar Abende im Monat drillt. Aber es gab doch Uniformen und Flinten und Säbel. Roch nach Soldat. — Überall hingen die Plakate herum, an allen Ecken verteilte man lockende Zettel der Werbebüros. Es sei die Pflicht jedes patriotischen Bürgers —! Patriotisch war ich bis in die Knochen hinein. Meine Pflicht war es: da meldete ich mich.«
Er lachte auf, schwippte mit der Reitgerte hell durch die Luft. »Sie untersuchten mich — und der Doktor sagte, ich sei ein prachtvoller Kerl, auf den das ganze Regiment noch einmal stolz sein würde. Dann aber — nach zwei Tagen schon — kam der Bescheid — daß ich untauglich sei, körperlich untauglich. Ich heulte die ganze Nacht hindurch — lief gleich am Morgen zu unserem alten Arzte, ließ mich noch einmal untersuchen. Kein Mensch in Neuyork sei so gesund wie ich, erklärte der. Ich sparte meinen Wochenlohn, ich ging zu den ersten Ärzten der Stadt, ließ mich begreifen und betasten, stundenlang. Eine schöne Sammlung prachtvoller Zeugnisse bekam ich — die schickte ich zum Regiment. Aber wieder kam der Bescheid: untauglich. Sie wollten mich nicht, wiesen mich zurück — weil ich Jude war. Nicht einmal als gemeinen Soldaten wollten sie den Juden!«
Er sprang auf, streckte ihm seinen Arm unter die Nase. »Fühlen Sie doch!« rief er. Frank Braun griff zu, wie Stahl waren diese Muskeln. Dann hob der Jude das rechte Bein. »Fassen Sie an — festere Schenkel haben nie einen Gaul umspannt.« Wieder tat er ihm den Gefallen, griff ihm ins Bein, versuchte das Fleisch zu kneifen. Aber es war unmöglich — das war aus Stein gemeißelt.
»Jeder krumme, plattfüßige Ladenjunge hinkt mit der braunen Uniform durch Neuyorks Straßen,« schrie er. »Aber mich wollten sie nicht — weil ich beschnitten bin! Ich war — untauglich!«
Er ließ sich schwer in den Stuhl zurückfallen, pfiff laut ein paar Takte vom Sternenbannerlied. »Sie lehrten mich in der Schule, daß das Yankeeland das herrlichste und das freieste der ganzen Welt sei. Dachten vermutlich, daß jeder Jude glückselig sein müsse und dankbar in alle Ewigkeit, wenn ihn ein Ozean trennt von des Zaren Knutenhieben. Aber meines Vaters Kille stand nicht in Rußland, aus Galizien stammen wir her. Sein Bruder war Rebbe — der machte ein bißchen Geld mit Petroleumland bei Drohobytsch. Zog nach Wien dann — und alle seine Jungen gingen aufs Gymnasium. Bekamen eine weit bessere Schulbildung, als ich sie hatte. Einer ist Ingenieur, einer Student auf der Universität und zwei, zwei sind — Leutnants! Heute stehn sie alle vier im Felde, kämpfen gegen die Mörder unseres Volkes. Das ist besser, als im Neuyorker Ghetto — wo man nur das Maul aufreißen kann!«
Seine Reitgerte schlug scharfe Hiebe durch die Luft. »Ich lese die Neuyorker Zeitungen. Jeden Tag predigen sie — wie einst in der Schule — Amerika ist das freieste Land der Welt! Deutschland und Österreich sind versklavte, reaktionäre Länder, die letzten und schlechtesten der Erde. Aber dort sind meine Vettern Offiziere — und hier war ich ihnen zu schlecht als gemeiner Soldat!«
Er bog seine Gerte, als ob er sie zerbrechen wollte. Er biß die Zähne übereinander, schluckte, würgte, atmete dann tief. Sprang rasch auf, bot ihm die Hand.
»Sie kennen meinen Chef?« rief er. »Gut! — Ich werde Sie heute nachmittag abholen und zu ihm bringen. Und wir können uns dann weiter unterhalten — wenn Sie Lust haben.«
Frank Braun erwiderte den starken Druck. »Ihren Namen?« bat er.
Der Jude lachte. »De Piedraperla — wie gefällt Ihnen das? Pearlstone heißen meine Eltern in Neuyork — Perlstein meine Vettern drüben. Aber sagen Sie Perlstein — mir klingts besser.« Er öffnete die Tür, wandte sich noch einmal zurück.
»Über alldem habe ich ganz vergessen, Sie zu fragen, was Sie eigentlich hier wollen,« rief er. »Aber wenn Ihre Mission die ist, gegen die Yankees zu hetzen — so sind Sie vollkommen überflüssig. Hier träumt keiner, Tag und Nacht, von etwas anderm, als von dem Haß gegen die Gringos, die das Land ruinieren.«
Frank Braun blieb zum Abend in seiner Wirtschaft, wartete. Aber der Adjutant kam nicht. Da ließ er sein Pferd satteln, ritt hinaus in das Lager, fragte nach Villas Quartier Das fand er bald; in einer Hazienda hauste der General, vor der Stadt. Der verwilderte Garten wimmelte von Soldaten. Die standen, saßen, lagen herum, sogen an ihren Zigarettenstummeln.
Nach Villas Adjutanten fragte er, dem Obersten Piedraperla. Aber keiner kannte den Namen, niemand konnte ihm Auskunft geben. Neugierig, hilfsbereit kamen sie heran, umstanden in großem Kreise seinen Gaul.
Wie der Mann denn aussähe?
Schlank, groß, glatt rasiert, elegant, braungebrannt, schwarze Augen und Haare —
Sie rieten hin und her — und fanden es nicht.
»Solch eine Nase hat er,« rief er und zeichnete mit dem Finger einen mächtigen Bogen in die Luft.
Nun lachten sie los, sprangen vergnügt herum wie Schulkinder. Den kannten sie gut, o ja, den mit der großen Nase! Don Benjamino sei es — natürlich! Und sie riefen, schrien, alle durcheinander: »Don Benjamino!«
Also Benjamin heißt er — Benjamin Perlstein, dachte Frank Braun.
Da flog eine Fuchsstute durch die Büsche, schweißüberdeckt. Der Reiter parierte sie, sprang ab, warf einem der Soldaten die Zügel zu. »Ach, da sind Sie!« rief er. »Ich komme gerade von Ihrer Fonda, dachte mir schon, daß Ihnen die Zeit zu lang geworden sei. Sie müssen entschuldigen, wir hatten alle Hände voll zu tun, diesen Nachmittag.«
Er nahm seinen Arm, führte ihn dem Hause zu.
»Der General ist sehr mißmutig heute,« sagte er, »schlechter Laune und wild. Die Tänzerin liegt ihm im Magen!« Er lachte, gab einen guten Fußtritt einem Soldaten, der schlafend auf der Treppe lag. »Ja, eine spanische Tänzerin — verdammte Bestie! Sie hat uns den Kopf verdreht, Pancho Villa und mir und allen andern. Keinem schenkt sie ihre Gunst — ist kalt wie das Eiswasser, das sie einem in Neuyork auf alle Tische stellen.«
Frank Braun blickte auf. »Na, offen gestanden — von euch sieht keiner so aus, als ob er ein Weibsbild lange bitten würde.«
»Ist auch nicht die Mode bei uns,« antwortete der Oberst, »ganz und gar nicht. Aber die zwingts — der Teufel mag wissen: wie! Jeder ist eifersüchtig auf den andern, so ist jeder ihr Beschützer. Schade, wenn Sie acht Tage früher gekommen wären, hätten Sie noch einen guten Striemen auf meiner Backe sehen können — den hat mir die blanke Dolores hingehauen, die sich ›Goyita‹ nennt. Ich griff sie um den Leib — da riß sie mir die eigene Peitsche weg. Villa und Perez Domingo und alle die andern wälzten sich vor Lachen. Aber ich kann mich trösten: sie hat mehr Hiebe hier im Lager ausgeteilt. La Pegona, die Hauerin, nennen sie die Soldaten — die laufen durch alle Feuer für sie.«
Sie waren im Hause, gingen durch einen großen Patio, in dem verdurstete Blattpflanzen auf dem Marmor standen. Gelbe Vorhänge hingen vor einer hohen Türöffnung, daneben salutierten Soldaten. Don Benjamino schlug die Vorhänge zurück, rief ein paar Worte in das völlig dunkle Zimmer.
Von hinten her scholl ein halbes Fluchen, ein tiefes, fast unverständliches, abgerissenes Grunzen.
Der Jude ließ die Vorhänge fallen. »Kommen Sie,« sagte er, »es ist besser, daß Sie ihn allein lassen heute. Er ladet Sie ein zu morgen, zum Jaripeo in der Arena und hernach zum Nachtmahl hierher. Da wird er bei Laune sein, da werden Sie besser fertig werden mit ihm.«
Oberst Perlstein pfiff nach den Pferden. »Wollen wir ein bißchen herumreiten, ehe die Sonne fällt?« schlug er vor.
Sie sprangen auf ihre Tiere, ritten in langsamem Schritt durch den Garten. Am Tore hielten sie; der Adjutant ließ einige Offiziere kommen, gab Befehle.
Da faßte ein seltsamer Schwindel Frank Braun. Er hörte die Stimme des Obersten, jedes Wort und jede Silbe. Aber es war, als ob der in einer fremden Sprache redete, die er nicht verstand. Und dabei verließ ihn — überall zugleich — alles Gefühl. Seine Schenkel faßten nicht mehr den mexikanischen Holzsattel — sie hingen ins Blaue. Seine Hände hielten den Zügel nicht mehr, der fiel schlaff auf des Tieres Hals. Es schien ihm, als ob er nicht einen Tropfen Blutes mehr im Leibe habe, langsam sank er vornüber.
Ein Offizier sprang hinzu, griff ihn fest, richtete ihn auf. Und — so wie er nur diese menschliche Berührung fühlte, dieses Zufassen einer starken Faust um sein Handgelenk — war es vorbei. Er konnte die Zügel greifen — setzte sich zurecht im Sattel.
»Was ist Ihnen?« rief der Adjutant. »Mann — wie ein Bettlaken schaun Sie aus.«
Er schüttelte den Kopf — ein leichter Schwindel nur — es sei schon alles wieder gut.
Aber der Jude war nicht zufrieden. »Wir wollen nach Hause reiten — das ist besser. Sagen Sie doch — was haben Sie gegessen heute?«
Nein, nein, sein Magen sei in schönster Ordnung — heute und immer.
»Wenn Sie — nichts Giftiges gegessen haben. Dann hilft der beste Magen nichts! Und bei uns hier ist manches möglich — in dieser Zeit.«
Frank Braun schüttelte lächelnd den Kopf. Er möge sich beruhigen — eine leichte Nervenschwäche sei es, an der er leide, seit Monaten schon.
»Mag sein,« sagte der Oberst, »mag nicht sein. Jetzt stehn Sie unter meinem Schutz — und da lassen Sie mich sorgen.«
Er half ihm vom Pferde, führte ihn die Steintreppe hinauf in die Fonda, brachte ihn in sein Zimmer. »Legen Sie sich aufs Bett,« rief er, »ruhn Sie ein paar Stunden aus. Ich komme später nach Ihnen zu sehn.«
Er ging; Frank Braun hörte durch die offene Türe, wie er unten laut nach dem Wirt schrie, dann einen Soldaten hereinrief von der Straße her. Er sprach Spanisch mit dem, mischte ein paar indianische Brocken hinein. ›Es ist ein Yaqui‹, dachte Frank Braun.
»Du,« befahl der Adjutant, »du bleibst hier. Stehst in der Küche, jedesmal, wenn etwas gekocht wird für den Herrn da. Den Fremden, weißt du, den großen! Kennst du ihn?«
»Ja,« rief der Indianer, »den Blonden.«
»Eben der!« fuhr der Oberst fort. »Du paßt auf, verstehst du, daß nichts hineinkommt ins Essen, was nicht reingehört. Du läßt doppelte Portionen kochen — und kostest selbst alles, ißt von jedem die Hälfte.«
»Ja, mein Oberst!« rief der Yaqui. Er war sehr zufrieden mit dem guten Auftrag.
Dann wandte sich Perlstein an den Wirt. »Sie haben gehört — was ich dem Soldaten befahl? Wir haben Verdacht. Und Sie sind mir verantwortlich — Sie! Wenn etwas passiert — an die Wand mit Ihnen. Also hüten Sie sich!« Er wartete keine Antwort ab, ging rasch auf die Straße, sprang auf seine Stute.
Dann aufgeregtes Geschwätz vom Patio herauf. Frank Braun stand auf, schloß die Tür.
Er war nicht müde, nein. Nur leer, leer — o so leer. Dasselbe Gefühl, das er hatte, als er in Philadelphia gegen die Livingstone sprechen sollte. Damals, als er die Farstin küßte —
Damals — und dann wieder, als er mit Lotte von der Oper kam — Und wieder, als er —
Oft nun, oft. Stärker und schwächer — doch nie so stark wie heute.
Aber er tröstete sich. War er nicht auf lange Wochen hinaus wieder ganz gesund? So gesund, daß er sich gar nicht vorstellen konnte, wie das eigentlich war mit dieser müden Leere!?
Dann fiel ihm ein, daß ihm Lotte van Neß ein Kuvert gegeben hatte — als er Abschied nahm. Es seien ein paar Pulver, hatte sie gesagt, falls er einen starken Anfall habe. Ein wenig Strychnin — und er solle nur dann eins nehmen, wenn es durchaus nötig sei —
Wo hatte ers nur hingesteckt? Er suchte in den Taschen, fand das Kuvert in der Brieftasche. Riß es auf, nahm eins der Papierchen, schüttelte das weiße Pulver auf die Zunge, spülte es herunter mit einem Schluck Wasser.
Nun ruhn ein wenig —
Das Kuvert schien ihm schwer, er schüttelte den Inhalt aus. Vier Pulverchen in Papier, dann ein Briefbogen und, in Watte gehüllt und in feinstem Lederetui, ein ganz kleines Taschenmesser. Er nahm den Brief, las ihn. Da stand in Lottes raschen, wilden Zügen: »Ich bitte dich, nimm das Messerchen. Trag es, mir zuliebe, in der linken Brusttasche deines Hemdes. Es ist ganz neu und sehr rein — und die Klinge ist blank und ohne jeden Fleck. Wenn du nicht mußt, gebrauch es nicht. Bring es mir zurück — wie es ist. Dir wird es nichts sagen, mir: alles.«
Er nahm das Messer heraus, öffnete die einzige Klinge. Es war aus Platin, die eine Seite zeigte das Bild eines Skorpions, die andere die eines Taschenkrebses. Die prächtige kleine Stahlklinge blitzte in den letzten Strahlen der Abendsonne, sie war so blank, daß er deutlich sein Bild sehn konnte, wie in einem Spiegel. Sehr spitz war die Klinge und scharf wie ein Rasiermesser.
Was will sie nur damit? dachte er. Aber er gab es doch — vorsichtig in Watte gehüllt und in dem weichen Lederetui — in die kleine Brusttasche seines Hemdes. Auf der linken Seite, über dem Herzen.

Das war des obersten Generals Namensfest, des Heiligen Franz von Carracioli Tag. Und an diesem Montage war das Heer sein Gast und die ganze Stadt dazu. Wer wollte, mochte hinauskommen zum Stierkampfplatz; es gab ein großes Volksspiel heute. Nicht das nationale Jaripeo nur, erweitert war es, aufgeputzt durch die Regiekünste der Spanierin, der Goyita.
Die große Arena hatte wenig gelitten in all den Kämpfen, nur die Sonnenseite war zusammengeschossen. Aber man hatte tüchtig gearbeitet in den letzten Wochen, hatte große Tribünen gebaut für neue Tausende. Unversehrt war die Schattenseite. Hier schmückten die Logen riesige Tücher in Grün, Weiß und Rot, Mexikos Farben.
Noch war des Diktators Loge leer; in der daneben saß Frank Braun mit ein paar Generalen, Und rings um den mächtigen kreisrunden Sand, aufsteigend in fünfzig Reihen und mehr, saß und stand die wartende Menge. Auf der ganzen Sonnenseite Soldaten, mit all ihren Waffen, wild und verwegen, zerfetzt und zerlumpt. Aber manche trugen auch, trotz der Glutsonne, ihren buntfarbigen Zarape, dieses große schwere Tuch mit dem Kopfschlitz genau in der Mitte, das nach allen Seiten lang herunterfällt. Fast nur reine Indianer, aus dreißig Stämmen, kaum einige Tröpfchen weißen Blutes dabei. Riesige Spitzhüte überall, braunrote Gesichter darunter mit den schwarzen Flecken der Augen und dem breiten Strich der blitzenden Zahnreihen. An beiden Seiten die Tausende der Buhlweiber, in grellen, schreienden Tüchern, losgelassen auf Stunden und mitten am Tag: Fleisch, Fleisch für die gierigen Augen der Soldateska. Dann, im Schatten, in den Logen und den Reihen darunter, die Offiziere; zwischen ihnen ein paar Bürgerfamilien mit ihren Frauen — was so als besser galt in Torreon. Die warfen ihre großen, langgefransten Seidentücher über die Brüstungen.
Kein Schreien, kein Toben und Johlen. Es war still, alles starrte, lauschte in gespannter Erwartung. Große Spiele in dem alten Zirkus, zum erstenmal wieder seit so vielen Jahren!
Die Leibwache zog auf, zwanzig sehnige Burschen. Yaquiindianer, bestes Holz zum Krieger. Flinten, Pistolen, Säbel und Macheten, Patronengürtel rings um den Leib und andere über die Brust in Kreuzform — Mordwaffen überall, wo man sie nur hinstecken konnte.
Dann blies einer ein Trompetensignal, scheußlich falsch, aber hinschmetternd durch das weite Amphitheater — da kam er, der Generalissimus, der Diktator, der Herrscher: Francisco Villa.
Er, den sie zärtlich Paco nannten und Pancho, Frasco und Curro. Auch Paquito, Frasquito, Panchito und Currito, schmeichelnde Kosenamen für das steifklingende Franz. Er, von dem sie alle wußten, daß er mit vier Jahren zu stehlen anfing, mit acht seinen ersten Brand anlegte und mit zwölf als Räuber debutierte. Daß er mit vierzehn zum ersten Male wegen Notzucht ins Zuchthaus kam und, ausgebrochen, mit fünfzehn schon ein Mörder ward. Er, Villa, der weder schreiben konnte noch lesen und nur sehr schlecht den vorgezeichneten Namen nachmalen, und der dennoch der Große wurde und der sehr Mächtige. Mit einem Maisschober fing er an — heute legte er ganze Städte in Asche. Ein lahmer Schweinehirt, der wider ihn gezeugt, war sein erstes Opfer — heute aber schlachtete er oft Hunderte an einem Tage. Und man erzählte sich — mit Schauder und doch mit großer Bewunderung — daß er in Durango hundertunddreiundzwanzig gefangene Huertaoffiziere habe aufstellen lassen in einer langen Reihe, die Hände auf den Rücken gebunden. Daß er die Front abgeschritten sei, daß er einem nach dem andern den Revolver an die Schläfe gesetzt habe und ihn niedergeknallt. Einhundertunddreiundzwanzig — er allein — und kaum eine halbe Minute brauchte er für jeden.
Wer brachte das fertig im ganzen Lande — wer, wer in der ganzen Welt?
Er, er nur, Pancho Villa —
Sie klatschten ihm nicht zu. Erhoben sich nicht, schrien nicht. Sie sahen nur hin zu ihm, in festem Bann, starrten ihn an, still und schweigend, staunend, bewundernd, hingerissen und geblendet, in unverhohlener Anbetung solch wilder Größe. Frank Braun dachte: ›Sie haben recht. Er ist ein tausendfacher Mörder, grausam und roh, ein Menschenmetzger und Henker. Ist ein Räuber und Dieb und Notzüchtiger und Brandstifter und wilder Trunkenbold. O ja — das ist er und macht kein Hehl daraus. Aber groß ist er, in jedem, was er tut, weit hinausragend über alles rings umher. Er ist gewaltig, er ist groß — für dieses Landes Kinder.‹
Vorne an die Brüstung setzte sich der Diktator. Er gab keinem die Hand, grüßte keinen. Nicht verächtlich — aber sehr gleichgültig fiel sein Blick auf die bunten Massen.
Wieder ein zerbrochener Trompetenstoß — da öffnete sich das kleine Tor auf der Sonnenseite. Der Alguacil, in altspanischer Tracht, den schwarzen Velasquezhut auf dem Kopf und den Schmuckdegen an der Seite, ritt auf schwarzem Klepper über den Sand. Hielt vor des Generals Loge, zog den Hut, bat mit steifer Geste um die Erlaubnis, das Spiel zu beginnen.
Don Benjamino stand hinter dem Diktator, der reichte ihm den unförmigen, alten Schlüssel. Pancho Villa wandte sich um — da sah er, neben dem Obersten, einen Soldaten stehn, mit einem kleinen Körbchen. Er faßte sich an das struppige Kinn — dann gab er den Schlüssel zurück, winkte dem Mann, setzte sich breit zurück in seinen Sessel.
Der Soldat kam nach vorne, packte sein Körbchen aus. Nahm eine Serviette heraus, leidlich rein, die legte er dem General über die Schulter, nahm sein Messingbecken, mit dem halbrunden Einschnitt für den Hals, goß Wasser hinein aus einer kleinen Kanne, gab Seife dazu und begann Schaum zu schlagen.
Ah — der Herr Generalissimus ließ sich rasieren.
Oberst Perlstein kam an den Logenrand, reichte Frank Braun die Hand hinüber. »Gewöhnlich läßt er sich jeden Samstag rasieren,« sagte er halblaut, »aber gestern war er so schlecht gelaunt, daß er den Mann mit Fußtritten hinauswarf. Da hab ich ihn heute mitgenommen. — Sie sollen mal sehn, der General wird gleich menschlicher, wenn er frisch geschabt ist.«
Der Soldat legte seinen Helm des Mambrin an des Diktators Hals, begann ihn einzuseifen: ohne Übereilung, gründlich, mit gutem Schwung. Der hielt still — aber plötzlich richtete er sich auf — geschickt zog der Soldat sein Becken zurück.
»Durst,« sagte Pancho Villa.
Sie füllten ein sehr großes Glas mit schmutziggelbem Agavenschnaps, reichten es ihm. Er nahm einen starken Schluck, spülte sich den Mund aus, spie das Zeug achtlos über die Brüstung. Dann nahm er einen zweiten Schluck, lehnte sich zurück, schloß halb die Augen. Aber wie der Barbier herankam mit seinem Becher, sich über ihn beugte, richtete er sich schnell hoch, spitzte die dicken Lippen, spritzte ihm den Pulque mitten ins Gesicht. Lachte brüllend auf, klatschte in die Hände, freute sich wie ein kleiner Junge über den wohlgelungenen Scherz. Der Soldat wischte das Gesicht ab, grinste mit ihm — und alle lachten, ringsum. Aber nicht devot, nicht kriechend und unterwürfig — nein offen, fröhlich und herzlich: es war ein sehr guter Scherz, wirklich, das mußte man sagen.
Dann erst trank der General — drei große Gläser schmutzigen Pulque. Lehnte sich zurück in seinen Sessel, schloß die Augen. Und der Soldat schwang seinen Pinsel, seifte, seifte, seifte, als gälte es, ein ganzes Regiment abzukratzen. Nahm dann sein Messer.
Unten hielt auf seinem Gaul der schwarze Stadtschreiber, den Hut in der Hand. Hinten, unter den Sonnensitzen, warteten die Stiere und Pferde und Reiter und Kämpfer — ringsum in dem mächtigen Zirkus lauschten still die gewaltigen Massen. Kein Laut rings — nur Schauen und Schweigen und Warten.
Pancho Villa ließ sich rasieren.
Nun war er fertig. Noch ein wenig spritzen, abtrocknen, reiben — Puder, blauweißer Puder in großen Mengen. Und zwei Gläser Agavenschnaps. Dann warf er den Schlüssel in den Sand.
Mühsam kroch der schwarzsamtene, dürrbeinige Alguacil von seinem Tier, nahm den Schlüssel auf, kletterte wieder in den Sattel, rutschte herunter an der andern Seite. Die Masse lachte — das war ein uralter Witz, daß der Stadtschreiber so tun mußte, als ob er nicht reiten könne.
Der Adjutant winkte Frank Braun heran, stellte ihn dem General vor. Aber der erinnerte sich gleich: er war doch der Deutsche, der dabei war, als sie von Hermosillo flohen nach Ures!? Der, der ihm das schöne Zigarettenetui gegeben hatte!? Das sei nun weg, jemand habe es ihm gestohlen. Wenn er den Kerl nur kriegen könnte!
Frank Braun dachte: wie blöd, daß ich daran nicht dachte! Warum brachte ich nicht andere mit aus Neuyork? Es war ein silbernes, schauderhaft geschmackloses Etui, das ihm ein paar Nächte vorher ein Amerikaner gegeben hatte, um seine Pokerschuld zu zahlen. Aber allen Mexikanern stach es sehr in die Augen, weil — in schlechtem Email — zwei nackte Weiber drauf waren.
Wieder öffnete sich hinten das Tor — feierlich schritt die Prozession der Schausteller durch den Sand; zugleich setzte, hinter den Logen, eine kleine Musikkapelle ein, machte einen verwischten Lärm auf einer Anzahl von Instrumenten.
Oberst Perlstein sagte: »Sonst spielen sie nur die Marseillaise, des Generals Leiblied — das da ist Ihnen zu Ehren.«
Frank Braun gab sich gute Mühe, eine Melodie herauszuhören. »Das da?« erwiderte er. »Aber das ist doch der spanische Königsmarsch!«
Der Adjutant rief: »Freilich! Aber es ist das einzige deutsche Stück, das die Kapelle spielen kann.« Er sah ihn erwartend an, und Frank Braun fragte: »Wieso deutsch?«
Da lachte der Oberst vergnügt und recht zufrieden mit sich. »Wissen Sie nicht, wer das komponierte? Ich weiß es. Ein Preußenkönig wars: Friedrich der Große.«
Er sah ihn erstaunt an, aber Don Benjamino nickte bekräftigend. »Es ist wirklich so — erkundigen Sie sich nur, wenn Sie zurück sind in Europa. Und — glauben Sie mir — der König wird bald in Villas Kopfe den Platz einnehmen, den bisher die Marat und Robespierre hatten!«
Durch den kreisrunden Ring kam die bunte Schar. Voran ritt der schwarzsamtene Stadtschreiber, hinter ihm, plump und schwer, mit langen Lanzen und runden Filzhüten, die wie das Messingbecken des Barbiers aussahen, ein paar Picadores. Zu Fuß die übrigen, voran, ganz in Weiß, der, der den Don Tancredo spielte. Zwei Espadas und ein halbes Dutzend Banderilleros. Sie alle in spanischen Torerokostüm, blau, rosa, grün und violett, mit sehr viel Gold und Silber — das bunte Tuch über dem linken Arm. Nur einer dunkel dabei, der den Gnadenstoß gab, der Puntillero. Und nun, auf prächtigen Tieren, vier Reiter — mexikanisch. Riesenhut, lange lederne Fransenhosen und ungeheuer große Radsporen. Silberstücke und Silberplatten überall — auf dem Geschirr der Pferde, wie auf den Kleidern der Männer. Ihnen folgte ein fünfter, noch reicher, noch prunkender gekleidet, sein Hut war noch größer, die silbernen Räder seiner Sporen noch gewaltiger als bei den andern. Der ritt ein schneeweißes arabisches Vollblut aus Andalusien — o ein herrliches Tier.
»Das ist Vasquez Cabrera,« rief ihm der Adjutant zu. »Sie werden sehn, was er kann.«
Hinter ihm zogen die Chulos, eine Schar lausiger Kerle in roten Jacken und Mützen, die letzten mit der Quadriga der vier Maultiere, bunt, aufgeschirrt in Rotgrünweiß, bestimmt, die Äser der Pferde und Stiere aus der Arena zu schleppen.
Aber noch war der Aufmarsch nicht zu Ende. Hinter all den Männern schritt, ganz allein, eine schlanke Frau.
»Das ist die Goyita,« rief Don Benjamino, »Dolores Echevarria, la Pegona!«
Sie trug die Tracht eines texanischen Kuhjungen, echt genug, nur einen kurzen Lederrock statt der Schaffellhosen. Und, über das Gesicht, eng gebunden, einen sehr dichten, braunen Schleier.
»Warum die Maske?« fragte Frank Braun.
Oberst Perlstein lachte: »Sie ist weißer als der Schnee und will sich in der Sonne den Teint nicht verderben. Das ist das ganze Geheimnis — jeder hier findet das sehr begreiflich.«
Durch die Mitte zog der lange Zug, hielt vor des Diktators Loge. Steif zogen sie ihre Hüte, der General winkte ihnen mit der Hand. Aber als die Spanierin kam, da klatschte er mit starken Fäusten.
Sie bogen ab, schritten und ritten ringsum an den Tribünen vorbei, langsam und feierlich. Und die Weiber und Männer begrüßten klatschend und schreiend den Aufzug. Noch einmal zurück durch die Mitte, zur Sonne hin — ab durch ihr Tor.
Die Chulos rollten eine runde, weißgestrichene Waschbütte in den Sand, stellten sie genau in der Mitte auf, den Boden nach oben. Und, mit gravitätischen Schritten kam Don Tancredo heran, stieg hinauf. Altspanisch, wie des Alguacil, war seine Tracht, aber weiß, ganz weiß, vom Hut bis zu den Schuhen. Weiße Handschuhe trug er, und von weißem Mehlpuder klebte sein Gesicht. Er verschränkte die Arme über die Brust — eine unbewegliche Gipssäule.
Dann ließ man den ersten Stier auf den Platz. Der rannte heran, geradeaus, in einem wilden Ansturm, die Hörner tief gesenkt. Doch blieb er, wie stets, dicht stehn vor der weißen Bütte, berührte sie nicht. Hob den Kopf, schnüffelte herum — nein, das war nichts Lebendes. Er drehte sich um, blickte rings um sich, schlug mit dem Schwanz, scharrte mit den Vorderhufen im Sande.
So war es Vorschrift, so begann jeder Stierkampf in Mexiko. Nun aber geschah ein Besonderes zu des Diktators Ehre und zur großen Freude seines Volkes. Don Tancredo trat vor um einen Schritt — faßte das Tier am Schwanz, gab ihm einen guten Fußtritt. Der Stier sah sich um, sehr erstaunt — nein, so benahm sich keine Statue — da war Leben darin. Ein paar Schritte ging er zurück, senkte tief den mächtigen Kopf. Don Tancredo benutzte rasch den guten Augenblick — sprang herunter von seinem Postament — das eine Sekunde später des Stieres Hörner hoch in die Luft warfen. Wieder blieb er stehn — ah, da lief seine Statue! Und der Stier brach hinterher, in rasendem Lauf. Don Tancredo schlug einen Haken, wie ein rasches Häslein, gewann von neuem einen kleinen Vorsprung, kam an die Brüstung, faßte die Planken, schwang sich hoch. Oben saß er, als das starke Tier mit den scharfen Hörnern unter ihm gegen das krachende Holz prallte.
»Caramba!« lachte Pancho Villa. »Beinahe hätte er ihn erwischt.«
Und die Massen johlten.
Zwei Stierkämpfe folgten. Ein paar Picadores wurden von ihren Gäulen geworfen, einem halben Dutzend Pferde die Bäuche aufgeschlitzt und die Eingeweide herausgerissen. Dann das Spiel der Banderilleros, die, wieder zu Ehren des Generals, nur mit Feuerwerkstäben arbeiteten, kurzen Banderillas, die sich entzündeten, so wie die Haken das Fleisch faßten, die brannten und knatterten und die schwarzen Stiere noch wilder machten. Und die Espadas endlich, die ihre Sache gut und tapfer genug machten, streng im Stil und mit kaltem, sicherm Stoße.
»Alles Dilettanten!« erklärte ihm der Oberst.
»Soldaten?« fragte er. »Indianer?«
»Nein, kein einziger!« antwortete der Oberst. »Nicht ein reiner Indianer ist dabei — das liegt ihnen nicht — spanisches Blut gehört dazu. Aber warten Sie nur, gleich kommen unsere Indianer dran — Stil haben die freilich nicht, aber Sehnen und Nerven.«
Er schwenkte sein Taschentuch, da bellte die heisere Trompete.
Das Jaripeo begann.
Die Mexikaner ritten in den Sand. Vasquez hielt auf seinem Andalusier dicht am Tore, die andern vier sprengten herein. Einen braunen Mustang ließ man in den Kreis, den hetzten die Vaqueros rund herum. Nun setzte sich Vasquez zurecht im Sattel, galoppierte vor, warf sein Lasso auf fünfzig Meter dem wilden Gaul um die Vorderbeine, daß er zusammenbrach im Augenblick. Sie banden ihn, ließen ihn liegen im Sand. Noch ein paar Wildlinge trieb man auf den Platz, frisch von den Llanos, den weiten Steppen Durangos. Für jeden der fünf eines — die jagten herum, brachen dann zu Boden unter dem scharfen Riß des langen Lassos. Und die Reiter stiegen ab, gingen heran an die Mustangs, lösten vorsichtig die Schlingen. Griffen die Mähnen, schwangen sich auf den nackten Rücken, als die Tiere sich aufrichteten. Saßen oben und blieben oben, die Linke fest in der Mähne, in der Rechten auffliegend und schwer niederklatschend die kurze, silberknöpfige Peitsche. Das bäumte hoch, stand auf den Vorderbeinen, das krümmte den Rücken wie ein Kater, sprang mit allen vieren hoch in die Luft. Das warf sich zu Boden, rollte sich um, wie ein junger Hund — aber der Reiter saß fest auf dem Rücken, wenn es wieder aufsprang. Das jagte herum, biß nach hinten, prallte gegen die Planken, das trat aus, drehte sich um sich selbst, stand auf den Hinterbeinen, warf sich vornüber, wie der Schwimmer beim Kopfsprung. Aber die Reiter blieben oben, und unbarmherzig, in jeder Sekunde, sauste die schwere Peitsche herab über Schenkel und Leib und Hals und Nüstern. Die silberbeschlagenen Lederbeine preßten die runden Leiber wie Schraubstöcke, die großen Radsporen schlugen grausam gegen die weichen Flanken. Weißer Schaum brach den Mustangs aus dem Maule, Blut tropfte aus ihren Seiten, naß vor Schweiß glänzte die braune Haut in der Sonne. Da wurden die Portos still, ruhig und zahm — erkannten den Herrn. Gingen wie brave Lämmchen im Schritt, machten Trab und Galopp, wie er's befahl — artig und sanft — nach zehn Minuten schon.
»Das kann ich auch!« rief Don Benjamino.
Die Mexikaner trieben die todmüden Mustangs ab, saßen wieder auf ihren Rassepferden, jagten einen neuen Wildling im Kreise herum. Dann blieben die andern zurück — allein folgte die arabische Stute des Vasquez. Wie er sie ritt! Nie berührte diese Flanke sein Sporn, dicht drückte er die Fußspitze nach innen und die Hacken heraus. Die Zügel hingen lose am Sattelknopf, er schnalzte nur mit der Zunge, rief irgendein seltsames Wort. Und die weiße Stute streckte sich, flog an den Mustang heran, lag ihm zur Seite, eng genug. Da bog sich Vasquez hinüber, griff die braune Mähne; schwang sich auf, saß plötzlich auf dem Rücken des wilden Pferdes. Ritt es ohne Zügel, ohne Sattel, ohne Peitsche, nur mit den eisernen Schenkeln. Ließ es daher galoppieren, wie die Andalusierin führte. Ringsherum immer dicht an den rotgestrichenen Planken. Wechselte, kroch zurück in seinen Sattel und wieder hinüber auf den nassen Schweißrücken des Mustangs. Her — hin — und immer in rasendem Galopp. Und herum, ringsherum in wildem Jagen, wie die kleinen Bleipferdchen im Spielsaal. Dann pfiff er — da brach die Schimmelstute zur Seite ab. Nun ritt er zur Mitte auf dem Wildling — und der gehorchte. Tat alles, was er befahl, zitternd vor Angst, abgejagt, todmüde, sehr gehorsam unter dem Druck dieser eisernen Beinzangen.
Vasquez sprang ab; es johlte die Menge. Er zog seinen Hut, schritt plump durch den Sand mit den schweren, metallbeschlagenen Lederhosen, vornübergebeugt, in x-beinigem Schritt auf diesen mächtigen O-Beinen. Die Fußspitzen scharf nach innen, die Fersen nach außen gebogen, daß sich die Fransenhosen nicht verhedderten in den ungeschlachten Rittersporen.
»Zu Fuß ist er kein Genuß!« lachte der Oberst. »Auf den Gaul gehört er.«
Aber die Andalusierin trabte zu dem Mustang, der bebend dastand, schwer atmend, mit fliegenden Flanken. Wieherte, als ob sie ihm zureden wollte, führte ihn ab, ganz allein zum Tore hin. Trabte zurück zu ihrem Herrn, schmeichelte, schnupperte an seinen Taschen, bis sie den guten Lohn fand: dicke Stücke leckern Zuckerrohrs.
Dann kam des Vasquez großes Stück, das ihm heute niemand nachmachen konnte in ganz Mexiko. Man ließ einen Stier in die Arena, ein gewaltiges, starkes Tier, schmutzigweiß und mit gelben Flecken. Es stürmte gleich heran, wild auf die Reiter — die wichen ihm geschickt aus. Es war, als ob die Pferde selbst mitspielten, furchtlos vor dem todbringenden Gegner, sicher vertrauend auf ihre rasche Gewandtheit. Sie standen ruhig da, scharrten im Sande, ließen den Stier heran, sprangen fort im letzten Augenblick. Manchmal auch setzten die Reiter in hohem Bogen weg über das anstürmende Tier. Nicht einmal berührten die Hörner eines Pferdes Leib.
Dann, auf einen Wink des Vasquez, ritten die Reiter zusammen zur Mitte, rings im Kreise auf den Stier zu. Der griff rechts an und links, brüllte auf, nahm einen neuen Anlauf, stieß in die Luft, wühlte den Sand in ohnmächtiger Wut gegen diese Feinde, die er nie fassen konnte. Nun aber schrien die Reiter, und mit ihnen johlten die Tausende. Verwundert hob der Stier seinen Kopf, blickte umher. Jetzt ritt einer nahe heran, schlug ihm die lange Peitsche quer über den Leib. Das Tier stürzte vor, stieß, bohrte die scharfen Hörner in den Sand. Da sausten rings die Peitschen in der Luft: das schnitt und pfiff und kreischte und klatschte.
Nun brach — ganz plötzlich — des starken Tieres Mut — nun floh es, rannte durch den Sand. Und hinter ihm hetzte das Peitschengewitter, klirrend, sausend, die Luft zerreißend. Bald war es dieselbe Jagd, ringsherum an den Planken, wie vorher mit den Pferden — hoy! hoy! und corre! corre!
Und wieder blieben die vier zurück, und wieder jagte die arabische Stute allein heran. Von hinten her nahm sie ihren Lauf — auf ein paar hundert Meter weit flog sie heran, den Kopf lang vorgestreckt: eine gerade Linie von den Nüstern zur letzten Spitze des prachtvollen Schwanzes. Lang, lang streckten sich die Beine, es sah aus, als berührten die fliegenden Flanken den aufwirbelnden Sand. Und der Reiter oben — die Beine lang herunter, aber Kopf und Rumpf weit vorgebeugt.
Näher kam die Stute und näher. Schon schlug um ihre Nüstern des Stieres Schweif, nun lag ihr Hals an seinen Schenkeln — nun ihr Leib dicht an dem seinen. Da, mit einem Ruck hob sich der Vaquero hoch, wandte den Rumpf im Sattel herum, beugte sich nach hinten — griff zu mit beiden Händen.
Jetzt schoß die Stute vor — als ihr Herr zufaßte. Den Schwanz des Tieres — den griff er, den hielt er — nur einen Augenblick lang. Aber lang genug, um das mächtige Tier herumzureißen mitten im rasenden Lauf, hinzuwerfen, hinauszuschleudern weit in die Arena hinein.
Da fiel es, überschlug sich, rollte, dieses gewaltige Tier, über eintausend Kilogramm schwer. Niedergerissen, am Schwanze niedergerissen von zwei Menschenhänden.
Das war des Vasquez Cabrera großes Schaustück.
Aber noch war er nicht zu Ende. Der Stier stand wieder auf, wieder hetzten ihn die Reiter, lassierten ihn dann, warfen ihn zu Boden, festgeschnürt an allen vier Beinen. Stiegen ab, banden dem hilflosen Tier einen dünnen Strick quer um den Leib, am Nacken, dicht hinter den Vorderbeinen. Und Vasquez stieg von seiner Stute, tappte durch den Sand, ungefüg und plump. Bog sich herab, gab das rechte Bein über des Stieres Leib, faßte den Strick mit beiden Händen. Wartete, bis die andern die Schlingen der Lassos lösten.
Der Stier war frei, richtete sich auf im Augenblick. Aber auf seinem Rücken saß ein Reiter.
Unerträglich war das — wer in der Welt ritt je einen Stier? Das Tier stutzte, stand still minutenlang, schien zu überlegen. Ließ ein starkes Zucken durch die Haut laufen, das allein einen Mann abgeworfen hätte. Aber Vasquez rührte sich nicht.
Dann begann es. Das stolze Tier tat wie die Mustangs taten, sprang hoch auf allen vieren. Hob sich, ließ sich fallen, wälzte sich herum. Aber wenn es aufstand, saß sein Herr wieder oben. Es bäumte sich auf den Hinterbeinen, blieb stehn, drehte — aber dieser Reiter rutschte nicht herunter, seine Finger hielten fest den strammen Strick. Dann, rasch, sprang der Stier nach vorne, schlug die Hinterbeine in die Luft, bohrte die Hörner in den Sand — ah es sah aus, als ob er auf dem Kopf stehe. Aber Vasquez blieb oben, die Arme ausgestreckt, die Füße aufgestützt an des Tieres Ohren, lang liegend auf dem mächtigen Rücken.
Das war der letzte Versuch. Ruhig blieb der Stier stehn, scharrte, brüllte auf, stöhnend, melancholisch, schritt dann aus, folgte dem Schenkeldruck seines Meisters. Durch den weiten Sand, auf und ab, wie ein liebes Pony.
So ritt Vasquez Cabrera.
»Ist der ein Yaqui?« fragte Frank Braun durch das Beifallsgeschrei.
Der Adjutant antwortete: »Nein, die Yaquis können das nicht, die sind ein Bergvolk. Vasquez ist ein Maya aus Yukatan. Er gehört nicht zu uns, ist nur hergekommen vom Süden zu diesem Tag. Vor drei Wochen hat er mit seinen Leuten in Jalapa gearbeitet, vor Carranza. Er macht es selten genug, nur ein paarmal im Jahr — und zu sehr hohen Preisen. Aber er arbeitet überall — bei Freund und bei Feind — wer immer ihn zahlt: er ist der einzig Unverletzliche im Lande Mexiko.«
Wieder winkte sein Taschentuch, da setzte der Königsmarsch ein zum zweiten Male. Und mit diesen Klängen trat die Goyita in den Kreis.
Das, was sie machte, hatte er oft gesehn, auf Farmen und Ranchos in Texas und Coahila. Und dann wieder, raffinierter, ausgearbeiteter und doch farbloser und verkitschter auf allen möglichen Varietés: das Lassowerfen der Cowboys und Vaqueros. Aber hier wirkte es so gut in diesem farbenfrohen Riesenzirkus, obwohl ihr befranster Lederrock nach Vaudeville roch, und obgleich der häßliche, braune Schleier ihren Kopf wie ein großes Holzei erscheinen ließ. Sie machte die ganze Schule durch, warf Kreise, Ovale und Spiralen, zeichnete rasche Figuren in die Luft und den Sand. Ließ den Arm über den Kopf sausen, hüllte sich in das schwirrende Seil wie in einen weiten Mantel.
Ließ einen der Mexikaner reiten, warf ihr Lasso auf fünfzig Meter, riß ihn herunter. Stellte einen andern hin, warf ihm die Schlinge um die Beine, um das rechte Handgelenk, das linke dann, um Arme und Brust, um den Hals endlich. Band ihn, kunstgerecht, aus weiter Entfernung mit dem einen Seil.
Und sie nahm, endlich, die Bola — das war neu hier oben. Drei kleine Stricke, zusammengebunden an einem Ende, während die freien Enden schwere Bleikugeln trugen — dies Wurflasso der argentinischen Gauchos. Sie ließ Mustangs durch die Arena treiben und ein paar Stiere, warf die Bola — dreimal so weit wie die Vaqueros ihr Lasso. Und das Ding spritzte durch die Luft wie eine wilde Rakete, sauste nieder, schlug dem laufenden Tiere über Hals und Beine, riß es zu Boden. Die Vaqueros ritten heran, lösten die Bola, fühlten herum an dem entsetzten Tiere, ob nicht die Bleikugeln irgendeinen Knochen zerschlagen hatten. Nein, nein, da war alles heil — das war ja die Kunst. Aber sie schüttelten doch den Kopf: ihr Lasso schien ihnen sicherer. Weiter flog die Bola, o gewiß — aber wozu hatten sie ihre guten Pferde?
Noch eine Nummer zeigte sie. Ein grauer Wolf sprang über die Planken, gleich hin zu ihr in langen Sätzen — den ließ sie durch Reifen springen. Es war ein sehr großes und schönes Tier, schlank und gewandt, mit wohlgepflegten Fell. Wo hat sie ihn nur her? dachte Frank Braun, überall in Amerika sind sie viel kleiner. Dann ließ sie sich ein Pferd bringen, ungesattelt, rieb ihre Stiefelsohlen vorsichtig ein. Sprang hinauf, setzte den Gaul in leichten Galopp, ritt herum, gefolgt von ihrem Wolf. Erhob sich geschickt, stand auf dem Rücken des Pferdes, ließ sich offene und verklebte Reifen hinhalten, durch die sie sprang, während der Wolf dem Pferde in Serpentinen zwischen die Beine lief. Sprang auch Seilchen da oben.
Die gewöhnliche Arbeit einer Panneaureiterin. Aber dann nahm sie selbst einen Reifen, hielt ihn hoch, pfiff ihrem Tier. Und der Wolf setzte an, sprang in einem Satze über das Pferd, über die Tänzerin, mitten durch den Reifen. Ein schöner Sprung.
Noch einmal und wieder — endlich sprang er zu ihr auf das Pferd; so ritt sie hinaus, überschüttet mit Beifall wie alle andern.
»Tanzt sie nicht?« fragte Frank Braun.
»Hier im Sande?« gab Perlstein zurück. »Sie wird heute abend tanzen in des Generals Quartier. Aber jetzt kommt die Hauptnummer: Villas Geschenk an sein Heer.«
Alle ritten hinaus, der Sand war leer. Nur die Chulos gossen Wasser, walzten und harkten. Dann ein Trompetenstoß — da kam die Quadriga der Maultiere. Sie zogen einen schweren Käfig, der auf kleinen Holzrädern lief; rings war er umkleidet mit Segeltuch. Den stellten sie genau in die Mitte; einer der rotblusigen Kerle griff unter das Tuch — man sah, daß er einen Riegel zurückschob. Nun sprangen sie weg, liefen mit ihren Maultieren Hals über Kopf zur Sonnenseite.
Still das große Amphitheater, atemlos in glühender Spannung. Was stak in dem Käfig? Gefährlich mußte es schon sein — er sah, wie alle zehn Schritt ringsherum hinter den roten Planken ein Soldat sein Gewehr über die Brüstung schob.
Nichts, nichts, minutenlang nichts.
Dann, quälend langsam, bewegte sich das Segeltuch. Das war nicht der Wind — das schob sich, drängte sich vor. Eine gelbe Pratze kam heraus und ein runder, schnurrbärtiger Kopf — ah, ein Tiger, ein Tiger!
Langsam kroch er hervor, vorsichtig, sehr bedächtig, lauernd, Schritt um Schritt —
Welch ein Tier! Wer von all den Tausenden da hatte je so eins gesehn?
Aber sie schrien nicht; nicht einmal die Weiber kreischten. Sperrten nur Augen auf und Nasen und Mäuler, starrten geblendet, andächtig fast auf die wilde Bestie.
Ein Trompetenschrei — da brauste ein schwarzer Stier herein. Gradaus zur Mitte, gleich zu auf den schweren Käfig — den stieß er um, mit einem raschen Stoß seiner starken Waffen. Der Tiger sprang zur Seite — einen Satz nur, kauerte sich nieder, bereit zum Sprung.
Nun sah ihn der Stier, senkte von neuem die Hörner. Es sah aus, als ob er sich auf ihn stürzen wollte im Augenblick. Aber er zögerte, blieb stehn, hob langsam den Kopf, warf mit den Vorderhufen in hastigem Scharren den Sand nach hinten.
Und die Tiere starrten sich an.
Angriffstiere beide, im Sprunge das eine und das andere im Stoß. Aber der Stier war das Tier, das die Menge kannte, er war das Symbol der Stärke und wilden Tapferkeit — er mußte anfangen.
Es war, als ob ein jedes des andern Stärke messen wollte — still, kauernd und lauernd die Katze — ungeduldig, nervös fast der Stier. Jedes Aufstampfen des Stieres, jedes Heben und Senken des Kopfes beantwortete der Tiger mit einem verhaltenen, warnenden Knurren — tief und rollend.
So standen sie — Auge in Auge — ungewiß.
»Feiger Stier!« zischte der Diktator. Aber keiner schrie rings im Zirkus — überall diese atemlose Stille, drückend, beklemmend fast.
Dann, ganz allmählich, wandte der Schwarze den Kopf. Ging zur Seite, vorsichtig und langsam, einen Schritt um den andern — immer schielend auf die Bestie im Sand. Hob die Hörner hoch — schritt schneller hinweg, den Planken zu.
Ein Schrei war es, ein wilder Schrei der Zehntausende: »Feiger Stier!«
Da flog des Adjutanten Taschentuch auf. Des Zwingers Tor öffnete sich — zwei weißgelbe Kühe kamen heraus, helläutend mit großen Glocken. Die blickten kaum hin auf das Tigertier, schritten die Seiten entlang, ruhig und gemächlich zu dem Stiere hin. Nahmen ihn in die Mitte, leiteten ihn sehr friedlich, sehr sanft, führten ihn still zurück zum Stalle.
Vor Lachen schüttelten sich die Indianer. All ihr Zorn gegen den feigen Stier war verrauscht im Augenblick, sie sahen nur das seltsam komische Bild. »Las mujeres!« kreischten sie. »Er liebt die Weiber! Und die Unterröcke!« Und hinüber zu den Reihen, wo die Dirnen saßen, flogen saftige Scherze, plump, eindeutig, roh und brutal, alle begrüßt von dem kreischenden Jauchzen der Frauen. Die bogen sich, wanden sich vor Lachen, stolz und gebläht über die Rolle, die sie nun spielten: dicke Kühe, die den starken Stier zum Stalle brachten. Dort —
Längst lag der Schatten über der ganzen Arena, schnell und schneller sank nun die Sonne. Und in der Dämmerung, mitten im Sand, lag der mächtige Tiger, auf den keiner mehr achtete. Langsam stand er auf, drehte sich im Kreise, legte sich dann ruhig nieder.
Wieder zog Oberst Perlstein sein Taschentuch heraus. »Ich habs mir gedacht!« rief er lustig. »Den haben mir die Kuhhirten gut ausgesucht — es war der friedlichste Stier von allen; blind dazu auf dem linken Auge, träge und feig. Ausgezeichnet hat er seine Rolle gespielt — über Erwarten gut.« Er schwenkte sein Tuch hoch in der Luft — da bellte die Trompete.
»Aber nun geben Sie acht!« fuhr er fort. »Nun kommt ein anderer Stier.« Er beugte sich vor, schob seinen Kopf heran, flüsterte: »Wir haben Sekt bekommen gestern abend, hundert Kisten voll. Und mit dem ersten Glase der ersten Flasche hab ich ihn getauft.«
»Sie haben ihn getauft?« fragte Frank Braun erstaunt.
»Ja,« nickte der Jude. »Das hab ich! Man tauft doch Dampfer, Äroplane, Luftschiffe, nicht wahr, und auch mit Champagner — warum keine Stiere? Und für solche Taufen bin ich auch zu haben. Es hat mir Spaß gemacht — und für Sie ists ein kleines Kompliment.«
»Wie heißt er denn,« fragte er.
»Warten Sie,« rief Don Benjamino. »Erst müssen Sie ihn sehn — dann werden Sies schon raten.«
Er wandte sich ungeduldig nach hinten, befahl dem Soldaten: »Blas noch einmal — blas!«
Im selben Augenblick, als die Trompete schrie, flog das Tor auf. Und heraus trat ein ungeheurer Stier. Er kam mit ruhigem, festem Schritt — blieb stehn, hob den Kopf, atmete tief, gewöhnte das Auge an das helle Licht.
»Wie gefällt Ihnen der?« fragte Perlstein. »Nun raten Sie: wie heißt er?«
Frank Braun betrachtete ihn genau. Es war ein herrliches Tier mit wundervollen Waffen, die sich bogen und scharf nach vorne liefen, in die Höhe und nicht nach den Seiten. Den Kopf warf er auf, leicht und gelenk; sein Nacken war stark, stämmig die Beine, die Brust weit ausladend. Er war schwarz und weiß gefleckt, dazwischen glänzten kleine, rostrote Tupfen.
»Nun wie heißt er?« drängte der Oberst. »Finden Sie es nicht? Die Farben? Die Farben! ›Aleman‹ hab ich ihn getauft.«
Da fiel dort, wo die Weiber saßen, ein buntes Tuch über die Brüstung, hinunter in den Sand. Ein Soldat sprang hinüber, es aufzunehmen. Kaum sah es der Stier — so brüllte er auf — es war, als ob er sagen wollte: dieser Platz gehört mir! Und er sprang an, rannte zu auf den Eindringling, der rasch mit seinem Tuche zurückkletterte. Aber dieser Stier krachte nicht plump gegen die Bretter, er hob die Hörner, mitten im Laufe, setzte an, sprang mit einem gewaltigen Satze über die mannshohen Planken, lief herum in dem engen Laufgang, jagte sie alle vor sich her — Soldaten, Stierkämpfer, Kuhhirten, hetzte sie herum in dem Bretterschlauch, im Halbkreis an den Tribünen vorbei. Dann, unter der Präsidentenloge, schlug einer der Toreros die schräge Klapptüre hinter sich zu: da war der Gang versperrt und zugleich ein neues Tor zur Arena geschaffen. Da hinaus sauste der Stier, stand von neuem auf dem Sande, den er beanspruchte als sein Eigentum.
Und nun — mitten in dem riesigen Kreise — sah er das Tigertier. Er lief nicht, rannte nicht, flog nicht heran, wie ein wilder Sturmwind. Er ging ruhig vor, Schritt um Schritt, mit halbgesenktem Kopfe, den Blick nach vorne, die scharfen Hörner voraus. Zehn Schritte vor der großen Katze blieb er stehn.
Wieder kauerte sich der gelbe Tiger zum Sprung — wieder beobachteten sich die beiden Tiere, mißtrauisch genug. Nun faßte der Stier sein Ziel, ging erst ein paar Schritte zurück, sprang dann an, rannte los. Es war, als ob der Tiger das vorausgesehn habe — einen Schritt sprang er zur Seite, kauerte nieder — schnellte ab. Und er saß — im nächsten Moment — auf des Stieres Rücken; man sah, wie die gewaltigen Pranken die Haut faßten. Aber nur einen Augenblick — der nächste schon trennte die Tiere. Zu stark war die Kraft von beiden Seiten, um ein wenig zu weit auch hatte die Katze die Entfernung geschätzt. So konnten selbst ihre mächtigen Krallen sich nicht halten auf des Stieres Rücken, dem sie doch das Fleisch zu Fetzen rissen, daß das rote Blut in Strömen herunterlief. Und jetzt — jetzt, als das Blut ihn taufte, besser als der Champagner — jetzt leuchtete er wirklich in der Abendsonne in Deutschlands Dreifarben.
Frank Braun warf einen raschen Blick auf den Oberst Perlstein. ›Die Farben Lewis!‹ dachte er.
Der Stier stand, drehte sich gleich, wandte sich von neuem dem Gegner zu. Hob den Kopf, schwenkte ihn hin und her, brüllte laut auf vor Schmerzen. Dann, mit raschem Entschluß, stürzte er sich wieder auf den Tiger, der kaum diesen neuen blitzschnellen Angriff erwartete. Er sprang fort, entwischte mit knapper Mühe dem Stoß der Hörner, deren linkes ihn noch streifte am Hinterschenkel. Nicht mit der Spitze — mit der Seite nur — aber doch kräftig genug, um das starke Tier in den Sand zu rollen. Der Stier stand fest mit einem Ruck, wandte sich im Zehntel der Sekunde, griff von neuem an. Aber nun faßte auch der Tiger den Augenblick, setzte kurz an, sprang — hing an dem Kopf des Stieres — schlug die mächtigen Pranken tief in den Nacken ein. Der Stier schwenkte den Kopf, schleuderte die Katze ab, mit zwei, drei schnellen Bewegungen. Sprang vor, ohne Besinnen, traf mit den Hörnern den Tiger, wie er kaum den Boden berührte, faßte ihn, warf ihn hoch, wie einen leichten Ball. Hob die Hörner, blickte auf, brach wieder vor, griff ihn, ehe er noch in den Sand fiel, jagte ihm die spitzen Waffen tief in die Flanke, schleuderte ihn noch einmal in die Luft.
Und nun war es, als ob er Tennis spielte mit der riesigen Katze. Wohin sie fiel, da faßten sie von neuem die entsetzlichen Hörner, warfen sie hoch, weiter und weiter durch den Sand. Ein paarmal versuchte der Tiger, sich aufzurichten, fortzukriechen — und oft genug traf er mit einem Tatzenhiebe den blutbefleckten Stier. Aber es war, als ob all dies Blut den stolzen Bullen noch stärker, noch wilder machte, immer tiefer rannte er seine Dolche in der Katze Leib, rollte sie, hob sie, warf und trieb sie zu den roten Planken hin. Und da — seitlich, wo die Weiber saßen — machte der Stier seinen letzten Angriff: spießte mit beiden Hörnern den verendenden Tiger an das Holz.
Riß sich dann los, trabte langsam genug, zur Mitte hin.
Dort in den letzten Strahlen der Abendsonne, stand das gewaltige Tier, ausschnaufend, triumphierend brüllend, gehüllt in den roten Mantel von Blut.
Da klatschten sie, da schrieen und jauchzten sie, halb närrisch in wilder Begeisterung. Warfen dem Stier zu Ehren, ihre Hüte in den Sand, Jacken und Tücher und Schleier. Standen auf den Bänken, schwenkten die Arme in der Luft: »Bravo toro!« heulten sie, »Bravo toro!«
Einer, mit durchdringend heller Kastratenstimme, kreischte:
»Viva el toro!«
Das nahmen sie auf, das schmetterten sie aus zehntausend Kehlen: »Viva el toro! Viva el toro!«
Pancho Villa war aufgesprungen, schrie mit allen andern. Dann plötzlich stockte er, rief dazwischen in heller Begeisterung: »Viva la Goyita!«
Frank Braun fragte: »Warum läßt er die Tänzerin hochleben?«
Der Adjutant begann: »Weil die es ist, die —« Er brach ab. Der General winkte ihn heran, nahm eine mächtige Ledertasche, die er links am Gürtel trug, neben dem Säbelknauf, öffnete sie, griff hinein, nahm eine starke Handvoll großer Goldstücke heraus. Frank Braun sah, daß es lauter neue blitzblanke amerikanische Zwanzigdollarstücke waren.
»Nehmen Sie, Oberst,« rief der Diktator, »zählen Sie hundert ab. Schicken Sie die der Goyita.«
Der Oberst zählte, band das Gold in sein Taschentuch — schickte drei der Soldaten damit ab.
— Noch ein letztes Mal öffnete sich das Zwingertor der Sonnenseite. Kühe kamen, rote, weiße und falbe, buntgefleckte, alle mit helläutenden Glocken am Halse, geschmückt mit Bändern und Blumenkränzen; hinter ihnen jagte die Quadriga der Maultiere in den Sand. Einen raschen Blick nur warf der Stier auf die vier buntgeschirrten, schellenläutenden Maultiere und ihre rotblusigen Treiber, wandte sich dann verächtlich ab, blieb ruhig stehn — nein, das war keine Arbeit für ihn. Die Chulos banden des Tigers Schwanz an die Zugstricke, trieben ihre Tiere an, springend und schreiend. Die Maultiere schleiften in raschem Galopp die tote Bestie rings herum durch die Arena.
Inzwischen umringten den blutigen Sieger die Kühe, kamen nahe heran, drängten sich, schoben sich an ihn. Und eine, eine strahlend weiße, legte ihre rosa Schnauze an seinen Hals, begann, zärtlich fast, das rote Blut zu lecken. Da hob er seinen Kopf, bog ihn über den der weißen Kuh, leckte sie, einmal nur, scheu und rasch, zwischen den Augen über die Stirn. Ließ sich führen, schritt ruhig ab mit den Kühen, langsam genug. Und zum dritten Male spielte die Musik — zu Ehren des stolzen Siegers jetzt — den Marsch des alten Preußenkönigs.
Diesmal machte die Menge keine frechen Witze über Weiber und Kühe und Unterröcke. Diesmal sah sie ruhig zu, still, stumm und bewundernd.
Das war das letzte Bild in den großen Spielen zu Ehren des Generals Villa zu Torreon. Nur ein wilder, gewaltiger Schrei noch, als der Stier mit seinen Frauen verschwunden war, ein rasender Schrei:
»Viva Villa!«
Gegen zehn Uhr an diesem Abend schlug Oberst Perlstein mit dem Silberknopf seiner Reitgerte an Frank Brauns Tür.
»Kommen Sie, Doktor,« drängte er, »jetzt ists Zeit.«
Die Pferde standen gesattelt vor der Fonda; sie stiegen in die Sättel. »Das Fest lacht in den Gärten Villas!« rief der Jude. »Gegessen haben sie, Pulque getrunken, daß ihre Wänste zum Platzen voll sind. Nun krachen die Champagnerkorken, im Patio sauft Villa mit seinen Generälen: sie warten auf die Goyita.«
Sie ritten durch die Gassen der Vorstadt. Lichter überall, Soldatenlärmen und Weiberjohlen aus jedem Hause. »Die Leute bekamen heute ihr Geld — Sold für drei Monate. Das Geld ist eben fertig geworden, gestern frisch angekommen — mit dem Champagner.«
»Amerikanisches Geld?« fragte er.
»Nein, diesmal nicht!« lachte der Oberst. »Unser eigenes. Hier nehmen Sie.«
Er zog ein Paket von Bankscheinen aus der Tasche, reichte es ihm: es waren fünfhundert Noten, zu hundert Dollar eine jede. Frank Braun betrachtete es — denkbar einfachstes Papier, jämmerlicher Druck — darunter der kindliche Namenzug: Francisco Villa. Er reichte das Päckchen zurück, aber der Oberst lehnte es ab.
»Nein, nein, behalten Sie nur!« rief er. »Von morgen ab hat es Zwangskurs — da können Sie nichts anders mehr ausgeben hier. Und sonst ists vollkommen wertlos — Papierfetzen, die wir halt drucken — soviel wir wollen: Villa-Geld!«
»Und die Leute nehmens?« fragte Frank Braun.
»Sie müssens nehmen, was bleibt ihnen anders übrig?« erwiderte der Adjutant. »Hat man die Assignaten nicht genommen? Daher hat Villa das Rezept — aus seinem Buch über die Französische Revolution. Die kopieren wir in allem Drum und Dran — das hat Madero angefangen — und nach ihm Carranza und alle andern — Villa am meisten. Nur der Zapata, glaube ich, kümmert sich nicht darum, der wirtschaftet nach eigenem Gusto, weiß wohl kaum, daß es je sowas gab wie eine französische Revolution.«
In den Gärten lagen die Soldaten herum, viele Dirnen zwischen ihnen. Das trank und spielte, rauchte und sang, zotete laut, kroch in die Büsche, umarmte sich kreischend, schamlos und brutal. Da und dort krächzte eine sehr verstimmte Arpa, dazu sprangen sie in täppischem Schaukeln den nationalen Jarape oder auch — die Weiber allein — den Kriegertanz, den Mitote. Hier spielten sie eine Metze aus — die lachend dabeistand — warfen die schmutzigen Karten: Siete y media. Daneben würfelten sie um ein Weib auf einer alten Trommel, dort wieder losten sie eine andre in der Lotterie aus. Ah — es war ein Fest — Villas großes Fest!
Sie stiegen von den Gäulen, traten in das Haus, gingen durch zum Patio, dem großen, offenen, viereckigen Hof in der Mitte, den ein naiver Geschmack zum Festsaal umgeschaffen hatte. In den Säulengängen ringsum lagen überall Matratzen, eingenäht in buntfarbige Tücher, dazwischen standen einige Rohrsessel und Schaukelstühle. Zwischen den Säulen hingen Laubgirlanden mit roten, gelben und blauen Papierblumen. Azetylenlampen, die man hoch an die Mauern geschlagen hatte, warfen sehr helles Licht, unter den Galerien baumelten ein paar armselige Lampions.
Hier becherte Villa mit seinen Generälen und Obersten — und mit geschminkten, halbentkleideten Weibern. Es war genau dasselbe Bild wie draußen im Garten — auch hier standen und saßen und hockten und lagen die Männer herum, rauchten, tranken, sangen, zoteten, griffen den Frauen nach Schenkeln und Brüsten. Die Uniformen waren weniger zerfetzt, das war wahr, dazu trugen sie alle nagelneue Ledergamaschen amerikanischer Mache. Auch waren sie noch nicht trunken genug, sich einfach auf den Boden zu werfen mit den Dirnen — nur zuweilen klatschte einer oder der andere einer Dirne auf den Leib, dann folgte sie ihm lachend ins Haus. Vielleicht waren auch die Mädchen um ein weniges jüngere und bessere Ware als das Fleisch, das man den Soldaten hinwarf. Aber die Hauptsache: hier trank man Champagner — Goulet, Roederer, Montebello — auf Eis gekühlt, wie es sich gehörte. Daran erkannte man die bessern Menschen.
»Haben Sie nicht irgend etwas, das Sie dem General zum Geburtstag schenken können?« fragte der Oberst halblaut. »Es würde ihm schmeicheln.«
Frank Braun griff an seine Taschen — nichts war da. Im Hemd das kleine Messerchen — aber was in aller Welt sollte Villa damit, dem jedes Messer die gute Länge einer Machete haben mußte! Verdammt, warum hatte er daran nicht gedacht?
Dann fielen ihm die Revolver ein, die ihm sein Sekretär eingepackt hatte. »Ich will zurückreiten,« sagte er.
»Lassen Sie nur,« sprach der Oberst, »ich werde einen meiner Yaquis schicken. Keine Angst, auf den können Sie sich verlassen — nicht eine Stecknadel würde er anrühren. Geben Sie Ihren Zimmerschlüssel — was soll er holen?«
Frank Braun überlegte — es war schon besser, wenn er die ganze Tasche herschaffen ließ. Er beschrieb dem Adjutanten, wo die stand — auf einem zerbrochenen Stuhl, am Fußende des Bettes.
Der Oberst nickte, winkte einem der Soldaten, gab ihm den Schlüssel.
»Kommen Sie!« sagte er dann. »Wir wollen derweil ein Glas Wein in meinem Zimmer trinken.«
Sie wandten sich zum Gehn, Frank Braun warf noch einen raschen Blick zurück, ob der General sie noch nicht bemerkt hätte. Aber der saß auf seinem Sessel, ein Glas in der Hand. Vor ihm hockte ein Händler, der ihm aus einem großen Holzkasten Schmuckstücke verkaufte — Halsketten, Ohrringe, Armbänder — aber auch dicke, goldene Ringe für Männerfäuste, mit protzenden bunten Steinen.
Es klopfte, der Yaquisoldat trat ein mit der großen Ledertasche. Frank Braun suchte nach dem Schlüssel, öffnete dann. Ganz unten lagen die Waffen, er mußte abräumen, was darüber lag. Da sah er einen großen, schwarzen Lederkasten, mit Silber beschlagen — was war es nur? Er nahm ihn in die Hand, betrachtete ihn.
Dann erinnerte er sich: es war ein sehr schöner Toilettenkasten. Aus getriebenem Silber alles, ein Geschenk, das ihm nach einem Vortrage in Cleveland ein paar Herren überreicht hatten. Er hatte damals kaum einen Blick hineingeworfen — ihm genügte sein kleiner Rasierapparat.
Das Ding also hatte sein Sekretär eingepackt? Nun, das war gut, ein besseres Geschenk konnte er nicht finden für den General. Da ließ er die Revolver liegen — steckte noch alle Taschen voll mit seinen albernen Scherzartikeln aus dem Fünfcentladen.
Er ging zum Hof hinab mit dem Oberst, seinen Kasten im Arm. Der Händler hatte sein Geschäft mit Villa abgeschlossen, saß nun in der Ecke, ordnete seinen Kram. Aber der Diktator spielte mit den Goldkettchen, betrachtete wohlgefällig seine dicken Finger, an denen drei breite Ringe glänzten, alle mit schlechten Brillanten.
Frank Braun ging auf ihn zu, gab ihm die Hand, gratulierte zum Festtage, überreichte sein Geschenk. Villa dankte nicht, antwortete nicht, viel zu neugierig auf den Inhalt des schwarzen Kastens. Er öffnete ihn behutsam genug, nahm einen Gegenstand um den anderen heraus. Drei Rasiermesser, Solinger Stahl und Elfenbeingriffe, Seifenbecken, ein paar Pinsel — alles zum Auseinandernehmen und Zusammensetzen — das gefiel ihm. Zwei Spiegel — einer für die Hand, einer zum Aufstellen — da blickte er lange hinein. Aber die Hauptsache: alle die Dingerchen zur Nagelpflege; Feilen und Messerchen, Scheren, kleine Stäbchen, geschweift und gebogen — Puderbüchschen, Löffelchen — immer was Neues, als ob es kein Ende nehmen wollte. Die Offiziere umdrängten ihn, staunten wie er die seltsamen Sachen an.
»Weiber!« rief der General. Da drängten sich die Mädchen herzu. »Wer weiß Bescheid von euch?«
Mit den Augen verschlangen sie all die Herrlichkeiten, zitterten vor Begier, sie anfassen zu dürfen. Aber eine drängte sich heran, stolz und gebläht: »Ich weiß alles!«
»Du, Concha?« fragte der General. »Woher weißt du es?«
Die Dirne sagte: »Ich war oben in Washington. Mich hat Oberst Benitez mitgenommen, den General Madero sandte.« Da ließ er sie neben sich knien.
O ja, sie war Kennerin, hatte gute Studien gemacht im Yankeelande. Jedes Stückchen nahm sie heraus, erklärte es ihm genau. Er legte alles vorsichtig wieder an seinen Platz, versuchte nichts. Nur einmal konnte er der Versuchung nicht widerstehen — als sie ihm das Ohrlöffelchen erklärte. Das nahm er vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger, benutzte es gleich, rechts und dann links. Lachte, war sehr zufrieden mit dem Erfolg. Reinigte es gründlich an Conchas Haar, legte es zurück in den Kasten.
»Kannst du alles anwenden?« fragte er die Dirne, die eifrig nickte. »Gut, dann sollst du morgen kommen, mir die Hände schön zu machen.« Er lachte laut, streckte ihr die schmierigen Hände ins Gesicht, zeigte ihr die tiefschwarzen Nägel.
Die Dirne stand auf, strahlend, lächelnd. Welch ein Glück — des Generals Maniküre!
Der Adjutant beugte sich über ihn. »Die Goyita ist da, General.«
»Laß sie kommen,« rief Pancho Villa. Dann wandte er sich zu Frank Braun, gab ihm eine Zigarette. »Danke, Cabarello,« sprach er, »danke Ihnen! Gebt Wein, ich will mit ihm trinken!« Er reichte ihm das volle Glas. »Trink, Deutscher, trink! Wenn du Frauen willst, such dir aus. Wenn du ein Pferd willst, sag es, Don Benjamino soll dir das beste geben.«
Er winkte einem Soldaten, ließ ein Körbchen bringen und braunes Papier. Er zeigte noch einmal sein Geschenk den Offizieren, erklärte nun alles selbst, großartig und stolz, als tiefer Kenner. Wickelte den Kasten ein, legte ihn in das Körbchen, gab das dem Soldaten. Er schwankte, ob er es in sein Zimmer bringen lassen solle, befahl dann dem Indianer, neben ihm niederzuhocken, das Körbchen zwischen den Beinen. Vielleicht bekam er Lust, sich noch einmal alles anzusehen.
Man machte den Innenraum frei, reinigte die Marmorfliesen. Alles drängte sich unter die Säulengänge, vorn die Offiziere — die lagen, hockten und saßen. Ganz hinten, an die Wand gedrängt, standen die Weiber.
Ein Orgeldreher schob sein Instrument auf kreischenden Rädern durch den Patio, stellte sich in einer Ecke auf, zwischen zwei Säulen, begann sofort zu spielen. Ihm folgte dicht die Goyita.
Die schritt zur Mitte. Grüßte nicht, verbeugte sich nicht. Ein spanisches Kostüm trug sie, hohe Frisur mit dem mächtigen Schildpattkamm, von dem die Mantilla herunterhing, schwarze Spitzen, die ihr über die Schultern fielen. Einen großen Busch von roten Hibiskusblüten trug sie im tiefschwarzen Haar über dem linken Ohr, einen gleichen mitten auf der Brust.
Aber sehr blau leuchteten die großen Augen.
»Nun, wie gefällt sie Ihnen?« fragte Oberst Perlstein.
Frank Braun blickte hinüber. Die kannte er doch — o sicher! Wo hatte er sie nur gesehn?
Dann fiel es ihm ein — das war — ja, das war die Tänzerin von der »Thuringia«, die die kleine Louison gepflegt hatte! Nun wußte er auch, woher Francisco Villa den Tiger hatte — dafür also hatte ihn der Kapitän durchgefüttert auf dem Fieberschiff!
Er nickte leicht hinüber, fing ihren Blick. Sie erkannte ihn gleich, aber sie antwortete nicht. Grüßte ihn so wenig wie einen der andern. Sie wartete auf den Takt der Drehorgel, dann begann sie.
Eine Madrileña tanzte sie, mit ihrem kleinen Fächer spielend. Würdevoll, vornehm, ein wenig steif und langweilig. Es wirkte lächerlich — hier eine Madrileña!
Aber diesem Publikum gefiel es grade; sie überschütteten die Goyita mit Beifallsklatschen.
Dann nahm sie die Kastagnetten, tanzte eine reiche Petenera; aber wieder zahm genug, graziös und zierlich, wie die artigen Fräulein in Toledo und Saragossa.
Sie legte die Mantilla ab, zog den Kamm heraus. Gab beides auf einen Stuhl neben ihrem Begleiter, dem Orgeldreher. Da lagen Tücher, Schuhe — all ihr Handwerkszeug. Er sah, daß auch eine Reitpeitsche dabei war.
›La Pegona,‹ dachte er.
Sie setzte einen Hut auf, einen grauen Filzhut mit steifem Rand, einen kecken Cordobahut, wie ihn die Männer in Andalusien tragen. Und sie wählte einen großen Manton, ein langfransiges Seidentuch in Grün und Gelb mit riesigen, roten Blumen. Ging zur Mitte zurück.
Einen Tango tanzte sie jetzt. Aber nicht wild aufreizend und gemein, wie die frechen Weiber vor ihren Lehmhütten, in den Vorstädten von Buenos-Aires. Auch keinen Zigeunertango, wie ihn, auf dem rollenden Hintern das lange Schleppkleid raffend, die andalusischen Dirnen in ihren Cuadros tanzen. Nein, sehr gemäßigt, stolz und zurückhaltend, sittsam fast — ad usum Delphini!
Sie warf den Hut weg, nahm einen weißen Manton. Tanzte die Seguidilla, dann den Soleares. Endlich mit einem sehr schönen alten Tuche in tiefstem Violett eine Malagueña. Und immer die klappernden Kastagnetten.
»Familientänze,« dachte er. Genau so tanzten die höheren Töchter in Granada, in Jaen und Sevilla. Die, die im Kloster erzogen sind, die französisch parlieren können und scheußlich Klavier spielen, die nie allein auf die Straße dürfen und abends ihren Liebsten an der »Reja« empfangen — an dem gräßlichen, engmaschigen Fenstergitter, das durch lange Jahre alle Liebenden trennt, bis der Priester in der Kirche den nötigen Segen spricht. Artig tanzte sie, sehr tugendhaft und wohlerzogen.
Sie trat zurück, setzte sich auf ihren Stuhl. Sofort umringten sie die Offiziere, hielten ihr die Gläser hin. Aber sie schüttelte den Kopf, nahm nicht einen Tropfen.
»Die Rumba!« rief Pancho Villa. »Tanz die Rumba!« Und die andern nahmen es auf, alle schrien, daß sie die Rumba tanzen solle.
»Nein,« sprach die Goyita. Und kein Wort mehr.
Sie zog die hohen Stöckelschuhe aus, legte Spargatten an, Bauernschuhe aus Segeltuch mit geflochtenen Hanfsohlen. Spargatten nahm sie und nichts sonst. Keinen Hut und keine Mantilla, weder Kamm noch Tuch noch Kastagnetten.
So tanzte sie die rasche aragonesische Jota. O ja, nun war Blut darin — nun zeigte sie in raschem Ländler die schlanken Beine.
Aber die Offiziere konnten nicht genug bekommen, wollten mehr und immer mehr. Und immer wieder verlangten sie nach der Rumba.
Doch diese Frau blieb fest. Sie zog ihre Hackenschuhe wieder an, tanzte die Faruca, geschmeidig wie eine Zigeunerin, die Hüften weit herausdrehend — ah, nun war es nicht mehr gute Gesellschaft. Den Garrotin mit den Füßen trommelnd und stampfend, die Bewegungen der Toreros nachahmend. Und, die Röcke hebend und fallen lassend, die kecke Buleria.
»Die Rumba!« schrien die Offiziere, aufgereizt und erregt. »Die Rumba!«
»Nein!« sagte sie wieder.
Sie tanzte im langen Schlepprock die Flamencos der gaditanischen Dirnen, den Lapateao und Por Alegrias. Wirbelnd und frech. Sie gab ihnen auch die gemeine Mariana, die den Steiß rollte und warf, die den Bauch schob und drehte, deren Handbewegungen einluden und aufforderten, mit schamlosester Deutlichkeit.
Da rief Villa hinüber: »Tanz sie für mich, die Rumba!« Er konnte es nicht ertragen, daß alle Offiziere sie rings umstanden, während er allein da saß. Er kämpfte mit sich, am liebsten wäre er aufgesprungen, hätte sich zu ihnen gesellt. Aber er wollte zeigen, daß er ein andrer war — nicht seinen Generalen, o ein — nur der Tänzerin.
»Tanz für mich die Rumba,« rief er, »für mich allein!«
Mit einem Ruck stand die Goyta auf, ging vor ein paar Schritte — da machten die Offiziere Platz, drängten sich an den Seiten. Sie tat noch einen Zug aus ihrer Zigarette, schleuderte sie dann weg. Faßte mit beiden Händen den Manton, warf den Kopf hoch in den Nacken. »Nein!« rief sie ihm zu. »Für Sie nicht und keinen! Ihr seid betrunken heute nacht — alle!«
Sie schritt quer durch den Patio, wie eine Fürstin, und keiner wagte es, sie zurückzuhalten.
Pancho Villa fauchte vor Zorn — und doch lachte er, freute sich, daß er wenigstens zurückgeblieben war, nicht sich an sie geworfen hatte, wie die andern.
»Wie ein Haufen geiler Straßenköter seid ihr,« brüllte er, »die sich um eine heiße Hündin drängen!«
Sie lachten alle, herzhaft genug. Und nur ein Alter antwortete ihm, der krumme, häßliche Alvaro Gomucio, der auf dem linken Beine lahmte. Der rief: »Hast nur halb recht, Pancho Villa! — Heiß ist die Goyita nicht!«
Da gröhlten sie wieder, schenkten die Gläser voll, spülten die heisern Kehlen mit Champagnerwein.
Ein Offizier kam in den Hof, stand vor Villa, legte die Hand an den Hut.
»Gonzalez ist draußen,« meldete er. »Er bringt die Gefangenen von Bonanza.«
»Führ sie herein!« befahl der General.
Don Benjamino brummte: »O je! Denen wirds schlecht ergehen.«
Ein paar Offiziere kamen, auch Soldaten, von Staub und Schmutz gelbbraun von oben bis unten; man sah ihnen an, daß sie von einem scharfen Ritt kamen. Sie stießen ihre Gefangenen vor sich her, die sich kaum halten konnten auf den zitternden Beinen, nachdrücklich geschoben mit Flintenkolben und Säbelscheiden.
Neun waren es, sechs Männer und drei Weiber.
»Geistlichkeit!« raunte der Oberst Frank Braun zu. »Sehn Sie — die Tracht der Frauen war einmal ein Nonnenkleid, ehe sie so zerfetzt und. zerrissen und verdreckt war von Schmutz und Blut. Und die Kerls — erkennen Sie die Tonsuren? Nun geben Sie acht: Jetzt spielen wir französische Revolution.«
»Wieso?« fragte der Deutsche.
»In Unserem Buche —« fuhr der Adjutant fort, »in dem Buche über die große Revolution, das sich der General wohl ein dutzendmal hat vorlesen lassen, steht drin, daß die Jakobiner die Pfaffen haßten. Daß sie die Klöster stürmten und die Nonnen schändeten. Und daß sie alles, was männlich war von der Geistlichkeit, an die Laternen knüpften. Laternen haben wir nicht — aber aufknüpfen können wir so gut wie die Franzosen.«
Er erzählte ihm, daß der General vor einigen Tagen den Befehl gegeben hätte, das Kloster der Schwestern zum Guten Hirten bei Bonanza aufzuheben; man hatte Wind bekommen, daß sich dorthin ein paar Geistliche gerettet hätten, die die Nonnen versteckten.
»Die Priester sehe ich,« sagte Frank Braun. »Aber wo sind die Nonnen?«
Wieder lachte Oberst Perlstein: »Ach, es war eine nur kleine Niederlassung — kaum ein Dutzend Schwestern werden dort gewesen sein. Wieviel sind hier? Drei? Nun, dann sind die anderen neun heute Soldatendirnen! Das geht schnell bei uns. Sehn Sie, jede Truppe bekommt Befehl, alles aufzuheben und mitzuschleppen, was nicht bewaffneten Widerstand leistet. Nur dann, wenn man zu fliehn versucht — wird geschossen. Aber es ist eigentümlich: immer die Schwestern, die noch einigermaßen appetitlich sind, immer die versuchen zu fliehn, immer die leisten ›bewaffneten Widerstand‹. Wir kriegen immer nur die steinalten ins Hauptquartier — zur Probe gewissermaßen.«
»Und der General ist nicht eifersüchtig?« fragte Frank Braun. »Nicht wütend, daß ihm seine Kerle nur das alte Fleisch bringen und das zarte selber fressen?«
»Nein,« sagte der Oberst, »durchaus nicht. Denn er weiß, daß die jungen Nonnen alle längst durch zwanzig Hände gegangen wären, ehe sie ihm abgeliefert würden — da ists kein Unterschied mehr mit unsern Weibern. Und dann, sehn Sie, es ist ein eigen Ding mit den Nonnen. Früher hat der General manche Klöster selber aufgehoben — und weiß gut Bescheid. Er hat längst den Geschmack daran verloren — das paßt nicht fürs Bett. Ich glaube, er gäbe alle Schwestern der Welt für einen einzigen Kuß der Goyita.«
Der Hauptmann Gonzalez machte seinen Bericht. Da seien die Priester; der siebente, ein alter, achtzigjähriger, sei halbtot auf dem Wege zusammengebrochen: man habe ihn liegen lassen. Von den Nonnen hätten vier Widerstand geleistet, fünf hätten zu fliehen versucht: man habe sie niedergeschossen.
»Hoffentlich habt ihr ins Zentrum getroffen!« gröhlte Villa. Er lachte laut, wie alle andern, über seinen gloriosen Witz.
Er fuhr die Geistlichen an. »Ihr habt spioniert, ihr Hunde, für General Carranza!«
Einer versuchte zu sprechen, ein paar abgerissene Worte rangen sich stammelnd aus den zitternden Lippen.
Aber Pancho Villa unterbrach ihn: »Fusilar a esos carajos!«
Er winkte mit der Hand, griff dann sein Glas, ließ es füllen.
Schrie die Nonnen an, rief: »Könnt ihr Rumba tanzen?« Die alten Schwestern starrten ihn an — was fragt er da? Aber er blickte sie kaum an, zischte ein verächtliches: »Ab!«
›So also hält man hier Kriegsgericht!‹ dachte Frank Braun. ›Ein einziges: Füsiliert die Hunde! Das genügt — da stellt man sie an die Wand. Fixer konnten die Jakobiner auch nicht arbeiten! Wozu Verhör, wozu Richter und Zeugen und Verteidiger? Sie haben Tonsuren, sind Priester — schlagt sie tot!‹
Er ging zu dem Adjutanten. »Haltet die Leute zurück, nur einen Augenblick!« bat er.
»Was wollen Sie?« fragte der Oberst.
Er wiederholte: »Nur einen Augenblick!«
›Wie die Yankeepresse,‹ dachte er, ›genau so! — Das schreit: Deutsche! Darum Barbaren, Hunnen, Verräter, Bombenwerfer, Räuber und Kindermörder! Schlagt sie tot! Wie die Zarenbande, genau so! Juden, kreischt sie, Juden, die den Herrn kreuzigten, die Christenkindern Blut abzapfen — schlagt sie tot! — Fusilar a esos carajos!‹
Aussätzig war er, der Deutsche, wie die andern — wie die Juden, wie die katholischen Priester: so schmiedet sie das Schicksal zusammen.
Er überlegte, blickte hinüber auf den General. Über die Maßen häßlich war er, mit herausstehenden Backenknochen und mächtigen Ohren. Behaart vom Hals herunter und auf den langen Armen, mit wilden, flackernden Augen, die sich selbst mißtrauten. Eingedrückt die kurze Nase, das riesige Maul darunter voll großer schneeweißer Zähne, die hell leuchteten aus den viel zu kurzen Lippen. Und er fletschte sie, rieb sie knirschend übereinander. Wie ein Tiger war er —
Aber nun schlug der General dem Soldaten, der neben ihm hockte, leicht über den Kopf. Ließ sich den Lederkasten geben, öffnete ihn, spielte plump mit den Spiegeln und Löffelchen —
Er dachte: ›Nein — der ist kein Tiger! Ist ein Gorilla, der den Tiger spielt.‹
Er trat dicht zu ihm hin. »Mein General,« sagte er, »Sie haben mir ein Pferd versprochen. Ich hab ein gutes — kann ein zweites jetzt nicht gebrauchen. Wollen Sie mir eine andere Gunst erweisen?«
»Was wollen Sie?« fragte der Diktator.
»Geben Sie mir die Priester frei,« forderte er. Der General runzelte die Stirn; da fuhr er fort: »Nicht umsonst, mein General! Ich gebe Ihnen für jeden einen Revolver!« Er wandte sich um, bat den Adjutanten, seine Tasche herbringen zu lassen.
Pancho Villa lachte. »Einen Revolver für einen Pfaffen?« überlegte er.
»Und ich gebe fünf Schachteln Patronen mit jeder Waffe — zweihundertfünfzig Schuß!«
»Sie machen ein sehr schlechtes Geschäft,« rief der General. »Nicht einen Schuß sind sie alle zusammen wert.«
Man brachte ihm die Handtasche, und er öffnete sie, griff eine Schachtel mit Streichhölzern heraus, die nicht angingen, gab sie dem General. Dann eine Zigarrentasche mit Feuerwerkszigarren, ein paar Stehaufmännchen, hübsche Springteufelchen. Leerte alle seine Taschen, gab ihm, was er nur hatte von dem billigen Spielzeug.
Eine ganze Weihnachtsbescherung für artige Kinder!
Pancho Villa vergaß im Augenblick alles ringsum. Er ließ sich die Kinderscherze zeigen, schickte derweil die Offiziere hinüber zur andern Seite, damit sie nicht zuschauen sollten. Dann probierte er das Spielzeug selbst, eins um das andere, rief die Generale zurück, winkte die Weiber heran, gab ihnen die Herrlichkeiten — schlug sich auf die Knie vor Vergnügen, wenn sie darauf hineinfielen.
Und wieder forderte Frank Braun: »Bekomme ich die Priester, mein General?«
»Wo sind die Waffen?« gab Pancho Villa zurück.
Er nahm sie heraus, Stück für Stück, legte sie auf den Boden, dazu die Patronenschachteln. Der General nahm einen Revolver, betrachtete ihn sehr sachverständig, füllte ihn. »Ruft die hohe Geistlichkeit!« befahl er.
Man brachte die Priester zurück und mit ihnen die Nonnen; der General ließ sie aufstellen. »Ich hätte große Lust, die Revolver zu versuchen,« lachte er. Er hob den Revolver, zielte einen Augenblick nach dem Kopfe des ersten, riß plötzlich die Waffe hoch, schoß in die Luft.
Die alten Nonnen schrien auf, fielen auf die Knie, beteten laut. Ihrem Beispiel folgten die Priester.
»Halts Maul, Pack,« fuhr sie der General an. »Ihr seid nicht wert, daß man euch niederknallt! Steht auf, Pfaffen — der Mann da hat euch losgekauft! Ihr seid frei!«
Er wandte sich zu seinem Adjutanten. »Don Benjamino, seht zu, daß ihnen nichts passiert. Schreibt ihnen Pässe zur Reise nach den Staaten.«
Aber noch hatte er nicht genug. Er rief einen der Priester heran, gab ihm eine Zigarre. Der nahm sie, drehte sie in zitternden Fingern.
»Rauch!« befahl der Diktator. Einer reichte ihm Feuer, da brannte der Priester seine Zigarre an, tat ein paar vorsichtige Züge.
»Rauch kräftig 1« rief Pancho Villa. »Zieh ein und paff aus!« Der Priester gehorchte — sog, so stark er konnte, mit eingezogenen Backen.
Fünf, sechs Züge — da knatterte und knallte das Feuerwerk. Entsetzt ließ er die Zigarre fallen, zitterte am ganzen Körper, drohte zusammenzusinken auf den schlotternden Beinen.
Pancho Villa krümmte sich vor Lachen. »Geh, geh, Schwarzrock! Und wenn du nach Spanien kommst, erzähl deinen Brüdern: solche Zigarren raucht man bei General Villa.«
Oberst Perlstein ließ sie abführen. Aber noch waren sie nicht zur Türe hinaus, als der Diktator von neuem auffuhr. »Die Nonnen nicht,« brüllte er, »die nicht! Er hat die Pfaffen gekauft, einen Revolver für jeden. Die alten Weiber hat er nicht gekauft — die hängt auf!«
Frank Braun rief: »Ich kaufe sie auch, mein General.«
»Haben Sie noch mehr Revolver?« schrie Villa. »Und genug Patronen?«
Er suchte in seiner Handtasche — die war leer. Nur sechs Waffen waren eingepackt — auch alle die Scherzartikel hatte er nun weggeschenkt. Nur unten lagen noch ein paar Bücher.
»Hier meine Ledertasche —« versuchte er.
»Nein!« rief der General. »Die gib dem Hauptmann Gonzalez, der dir deine Pfaffen sicher besorgt nach Yankeeland. Für die Nonnen will ich Revolver wie für die Priester! Und wenn Du keine mehr hast — müssen sie baumeln.«
Da drängte sich die Goyita heran. Er hatte sie nicht bemerkt die ganze Zeit über — nun war sie plötzlich da.
Sie schob ein paar Offiziere zur Seite, stand dicht vor dem Diktator, hoch aufgerichtet.
Sprach: »Ich kaufe sie frei.«
Pancho Villa schrie sie an: »Du? Und wenn du mir die gemästeten Schweine mit Gold aufwiegst, sollst du sie doch nicht bekommen.«
Die Goyita sagte: »Ich tanze die Rumba.«
Der General sprang auf. »Die Rumba?! — Die Nonnen sind frei! Hauptmann Gonzalez — Ihr bürgt mir, daß sie sicher durchkommen und ungefährdet.«
Die Tänzerin trat zu den Nonnen, küßte sie, gab jeder ein paar Goldstücke — kam rasch zurück zu dem Diktator.
»Gebt mir ein Glas Wein, General,« sagte sie.
Pancho Villa ließ ihr Champagner reichen — sie leerte das Glas in drei raschen Zügen.
»Noch eins!« bat sie.
Frank Braun gab ihr sein volles Glas — sie dankte mit einem kleinen Blick, trank den Wein.
»Laßt Platz schaffen,« sagte sie. »Ich will mich anziehn.«
Sie nahm ihre Tücher, Schuhe, Kastagnetten, all ihre Sachen über den Arm, ging in eines der Zimmer, die auf den Patio liefen.
Die Offiziere räumten von neuem den Plate in der Mitte, ließen ihn auskehren von Flaschen, Schmutz und Papier. Alle füllten ihre Gläser zum Rande, warteten.
Einer, ein Schlanker, Schnauzbärtiger, stand neben Frank Braun, sah ihn an, als ob er etwas wolle, das er doch nicht zu sagen wage.
»Was wünschen Sie?« fragte der Deutsche.
Der Mexikaner zeigte auf die Ledertasche mit gierigen Augen. »Darf ich sie haben?« bat er. »Der General —«
»Sind Sie der Hauptmann Gonzalez?« unterbrach ihn Frank Braun.
Der andere nickte. Der Deutsche griff hinein, nahm die Bücher hinaus, gab ihm die Tasche, ging mit ihm zur Tür.
»Versprechen Sie mir —« begann er.
Der Hauptmann ließ ihn nicht zu Worte kommen. »Ich laß ihnen zu essen und zu trinken geben, so viel sie wollen — heute abend noch! Ich bring sie sicher zur Grenze — verlassen Sie sich drauf!«
Er streichelte zärtlich die schöne Ledertasche.
»Kommt mit!« rief er den Priestern und Nonnen zu.
Frank Braun trat zu ihnen, gab ihnen Villa-Geld und amerikanische Dollarnoten. Dann fielen ihm die Bücher ein, die er in der Hand hielt.
Vielleicht — Reiselektüre —
Er öffnete sie — nein, das war es nicht! — Jacopone da Todi — war das eine. Und das andere, ganz dünne, hielt die Lieder des heiligen Franciscus und solche seiner Schüler.
»Wer kann Lateinisch lesen?« fragte er. Einer konnte es, der, der die Zigarre rauchen mußte. Dem gab er die Verse des Heiligen von Assisi. »Ist einer von euch ein Italiener?«
Nein, sie waren alle Spanier. Aber die alte Oberin war lange in Rom gewesen, verstand Lateinisch und Italienisch dazu. Ihr gab er des Todaners süße Lieder.
»Vergessen Sie nicht, Mutter,« sagte er, »vergessen Sie nicht: das ist der fromme Dichter, der die Mater Dolorosa schuf und die Mater Speciosa auch. Dolorosa — war die Mutter Gottes — um euch alle heute nacht — sehr schmerzreich! Und dann war sie doch — die Speciosa! Und denken sie daran: Dolores hieß die Frau, die euch freimachte, Dolores Echevarria.«
Von drinnen riefen die Leierkastenklänge. »Reist mit Gott!« rief er. »Betet für die katholischen Priester in diesem Lande. Und — für die Juden in Rußland — denen gehts dort wie euch hier! — Und, und — für die Deutschen — überall in der Welt!«
Er eilte fort — nahm wieder seinen Platz ein, nahe bei Villa. Aber noch war die Tänzerin nicht zurück — nur die Drehorgel sang die wilden Rhythmen der Rumba.
»Ich gratuliere!« raunte ihm der Oberst zu. »Das haben Sie gut gemacht! Aber ich sage Ihnen, Doktor — noch vor einem halben Jahre hätte Villa die Priester und Nonnen nicht freigegeben. Nicht für den Toilettenkasten und nicht für die Revolver, weder für Ihre Feuerwerkzigarren noch für den andern Tineff aus dem Neuyorker Fünfcentladen. Nicht einmal für die Rumba der Goyita.«
Er reichte ihm ein volles Glas. »Trinken Sie noch nicht — warten Sie, bis die Tänzerin kommt,« fuhr er fort. »Die Französische Revolution kommt außer Mode bei uns — das ist es. Der General zweifelt manchmal, ob es wirklich so durchaus nötig sei, alles totzuschlagen, was ein geistliches Kleid trägt. Haben Sie eine saftige Gotteslästerung von ihm gehört, einen wilden Fluch? Nichts — keine Silbe! Aber vor einem halben Jahr spuckte er es bei jedem Satze heraus: ›Me cago en Dios!‹ — ›Jodo en la Virgen!‹ — Unflätiger Schmutz, wie ihn keine andere Sprache der Welt kennt! Das ist anders geworden, seit wir den Preußenkönig studieren. Ich habe, leider Gottes, wenig genug gelernt und weiß nicht, ob das alles so stimmt, was unser spanisches Buch über Friedrich den Großen erzählt. Danach war er ein wilder Atheist — der an gar nichts glaubte — und das imponierte Villa. Aber dann steht da, daß er trotzdem alle Religionen ruhig gewähren ließ, daß er sagte, ein jeder möge nach seiner Art selig werden. Das hat der General gar nicht begriffen im Anfang — aber es scheint, daß es ihm einleuchtet allmählich. Denn, wissen Sie, wenn wir ein Buch haben, lesen wirs gleich ein dutzendmal hintereinander! Nachmachen muß er, der General — und ich glaube, daß der Tag nicht mehr fern ist, wo auch in seinen Gebieten jeder selig werden kann, wie er will.«
Er unterbrach sich — die Goyita trat in den Hof.
Sie kam in einem halblangen, weißen Musselinrock und einer ebensolchen, vorne etwas ausgeschnittenen Hemdbluse. Um die Hüften trug sie, glatt anliegend, ein blaues Seidentuch, ein gleiches um den Hals. Ein drittes blaues Tüchlein wand sich über die Stirn, deckte die Haare, schlang sich zum Knoten und fiel hinten über den Nacken. Das Kostüm war das eines Bauernmädchens, eines von der Varietérampe natürlich. Die Tänzerin hielt ein Körbchen in der Hand; sie machte ein paar eingelernte Bewegungen, die andeuten mochten, daß sie von der Arbeit auf dem Felde komme und daß es sehr heiß sei. Wieso sie gerade darum nun so große Lust zum Tanzen bekommen sollte, war wenig ersichtlich — ohne plausiblen Übergang entschloß sie sich eben dazu. Sie warf ihr Körbchen weg, zog das Halstuch aus, fächelte sich ein paarmal damit, tat, als ob sie den Schweiß abwischen wolle, schleuderte es dann dem Körbchen nach. Ohne Interesse und steif genug machte die Goyita dieses kleine Vorspiel, aber immerhin verstand man den Sinn: es ist heiß — darum ist sie sehr leicht angezogen, nur mit Rock und Hemdbluse. Und: sie will tanzen.
Nun trat sie in die Mitte, warf einen Blick auf ihren Orgelmann, wartete auf den Takt.
Aber plötzlich, auf einen Wink des Generals, erhoben sich mit ihm alle Offiziere.
»Viva la Goyita!« riefen sie. Leerten ihre Gläser, hielten sie hoch in der Hand.
Oberst Perlstein ging zu ihr hin, reichte ihr ein volles Glas. Sie nahm es, trank es aus zur Neige. »Viva Villa!« antwortet sie.
Sie gab das Glas zurück, warf einen schnellen Blick ringsumher. Stampfte auf mit dem Fuß, rief laut: »Schickt die Weiber hinaus, General!«
Das verstand er gut. Nein, vor denen tanzte sie die Rumba nicht, vor den Dirnen!
So mußten die Frauen abtreten, hinaus in den Garten — mußten draußen warten.
Dann erst begann sie.
Langsam, Schritt um Schritt. Sich reckend und räkelnd, aber geschmeidig und schmiegsam. Schneller allmählich in allen Bewegungen, wischend und windend. Wellenlinien durch beide Arme und herunter den ganzen Leib, vom Hals bis zu den Fußspitzen, als ob Schlangen rasch hinunterglitten. Und — in hellem Gegensatz dazu, die Bewegungen der Schultern, kurz, rasch, seltsam eckig. Das war kein Tanz der Hüften oder des Bauchs. Keiner, der die Beine warf, der die Arme schwenkte oder mit Kopf und Händen kecke Gesten machte. Obwohl auch das alles mitspielte, obwohl sie den Bauch herauswand und zurücknahm, die Hüften drehte — die Arme und Beine hob in den Gesten der ermüdenden Hitze, die Kühlung sucht. Aber nur auf die Schultern zog sie den Blick. Auf die Schultern und auf die Brust.
Schneller tanzte sie nun, wilder, wirbelnder, die Hände fest in die Hüften gestemmt! Ihre Schultern zuckten, flogen hin und zurück, sprangen heraus, bogen sich zurück — eine — die andere — und wieder beide. Dann öffnete sich — auf einen schnellen Augenblick nur — die ungeschlossene Bluse, zeigte einen schmalen Streifen weißleuchtenden Fleisches, tief hinab.
Nun arbeitete nicht die Schulter nur, nun war es die ganze Brust. Aus dem Recken wurde ein Schnellen, aus dem Räkeln ein Heben und Senken — es war, als ob sie mit den Lungen tanzte. Immer zuckender, immer wilder und rasender —
Da sprang — heraus aus dem Hemde bei einer raschen Drehung der linken Schulter nach hinten — die eine ihrer jungen Brüste. War da, lugte hervor, auf eine Sekunde — weißer, strahlender als das weiße Hemd — verschwand wieder, schnell, wie sie gekommen —
»Ah!« machten die Offiziere. »Ah! Oh!«
Sie tanzte weiter. Immer wieder dieses Zucken der Schultern, dieses Zittern der Brust — und hinunter den Leib. Immer wieder dieses Recken, das zum raschen Reißen ward — dies wilde Schnellen — das in ein sanftes, wollüstiges Räkeln sich auflöste.
Keinen Blick ließen sie von ihr, warteten, gierig und hungrig, auf den raschen Augenblick, wo sie eine der weißen Brüste erspähen mochten.
»Die andere,« riefen sie heiser. »Sácalá!«
Das war das Spiel, daß es stets so aussah, als ob eine der Brüste herausspringen wollte aus dem schützenden Hemd — das sie doch deckte, wieder und wieder.
»Sácalá!« schrien sie.
Und fast zu gleicher Zeit, wie auf das Kommando — flog die rechte Brust aus dem Hemde heraus. Lachte, strahlte — wie Marmor kühl — barg sich hinter das dünne Tuch.
Pancho Villa sprang auf von seinem Stuhle, beugte sich weit vor. Seine dicken Augen quollen aus den Höhlen, der Speichel troff ihm aus dem offenen Maul.
»Las dos!« brüllte er. »Alle beide!«
Und seine Leute schrien ihm nach: »Las dos! Las dos!«
Alle brünstige Geilheit zog nebeldick durch den weiten Raum. Kroch in ihre Nasen und Mäuler, krallte sich fest in ihre armen Hirne. Diese rohen Krieger, deren lachendem Wort Tausende von frechen Dirnen bereit lagen, diese Räuber und Banditen, die der Mutter das halbwüchsige Kind wegrissen und Nonnen aus ihren Betstühlen schleppten, denen Weiberfleisch so billig und gemein war wie ihr schmutziger Pulqueschnaps — sie zitterten in anbetender Erregung vor diesen zwei Brüsten. Ihre plumpen, heißen Hände zuckten nach diesen Schneeballen, ihre dunkeln Augen lechzten nach dem weißen Wild, das heraussprang und rasch sich verbarg, ihre Zungen, heraushängend, wie die von Stieren, dürsteten nach dem süßen Trank dieser weißen Knospen. Ihre Nüstern schlürften den Duft der Kirschenblüten, ihre häßlichen Ohren tranken die tanzende Musik der versteckspielenden weißen Kätzchen —
Eines — schnell, schnell — und noch eines — schnell, schnell—
Frank Braun sah, wie der lahme General Alvaro Gumucio eine Säule umschlang mit beiden Armen, sich fest anklammerte, als fürchtete er umzusinken. Er sah, wie Pancho Villa sein Knie auf die Schulter des Soldaten stemmte, der neben ihm hockte, ihn niederdrückte mit der ganzen Schwere seines Gewichtes, als wollte er ihn zerquetschen.
»Las dos!« flüsterte der Diktator. »Las dos!«
Oberst Perlstein, der neben ihm stand, wahrte sein Gesicht. Da hing noch sein Lächeln, kritisch und ein wenig spöttisch, aber es schien eingefroren, zu festem Stein geworden. Und seine Fäuste krampften sich um der Reitpeitsche Knauf, bogen sie, preßten — als ob er sie zerbrechen wollte.
Und es riß auch ihn hinein in den roten Nebel. Es war, als ob er heiße Lavaluft einatme, als ob er ersticken müsse in dieser Glut aller Sinne. Und fern nur — fern — in den Wolken irgendwo hinter der ewigen Wüste lockte die weiße Kühle —
Weiß, weiß — irgendwo weiß in unendlicher Ferne — Schatten und Schnee — Unschuld und alle Reinheit. Und — hinter Marmor und Schwänen und todkalten Grabtüchern — war Labung von all der glühenden Qual. Da war — irgendwie in den blanken Mondwolken — eingehüllt in das strahlende Geheimnis weißglühenden Leuchtens — das große Gesunden —
Dann sah er — vorüberfliegend wie eine Sternschnuppe in der Novembernacht — einen kleinen roten Streif mitten auf ihrer Brust. Eine kleine Wunde, kaum einen halben Zoll lang — und ein einziger Bluttropfen quoll daraus —
Etwas peitschte ihn auf — etwas riß ihn nach vorn —
Aber er zwang es, klammerte sich mit beiden Händen an des Sessels Lehne. Hielt sich fest.
Eine — husch — husch — und noch eine — husch —
Pancho Villa verkrampfte die Finger. »Las dos!« betete er. »Las dos!«
Sie stand plötzlich, auf einen Ruck, als die Musik schwieg. Hoch aufgerichtet — das stolze Haupt weit im Nacken — den tiefblauen, triumphierenden Blick über ihre Sklaven. Sie stand, warf die Arme zurück, schleuderte mit einem wilden Zucken die Schultern zurück: da sprangen sie heraus, beide zugleich — ihre jungen Brüste.
— — Keiner lachte, keiner sagte ein Wort. Tiefe, atemlose Stille.
Weinten sie nicht? Lagen sie nicht auf den Knien? — Alle?
Die Goyita trat ab, warf ein Tuch über den Hals, setzte sich auf ihren Stuhl neben den Leierkastenmann.
Keiner klatschte, kaum wagte einer eine Bewegung zu machen. Es schien, als ob sie erstarrt seien, wie sie da saßen und standen, gebannt, hypnotisiert auf Minuten hinaus.
Frank Braun dachte: ›Die hat gelernt von dem Tierbändiger! Und sie hat ihren Meister übertroffen. Die versteht es, die Bestie zahm zu kriegen.‹
Die Tänzerin stand auf, schritt langsam durch den Hof. Oberst Perlstein schob ihr einen Schaukelstuhl hin, und sie setzte sich. Sie sagte ruhig: »Gebt mir zu trinken. Ich bin durstig.« Der Oberst füllte ein Glas, und sie trank. »Es ist Euer Festtag heute, General — auf Euer Wohl!«
Da wachte Pancho Villa auf. Er griff in das Körbchen, das der Soldat zwischen seinen Knien hielt, nahm den schwarzen Lederkasten heraus, reichte ihn ihr, ohne ein Wort. Sie nahm ihn, öffnete ihn, sagte dann lächelnd: »Soll ich mich rasieren?«
Er war verwirrt, wie ein Schulbub. Er nahm den Kasten zurück, griff die Uhren, Reifen, Ohrgehänge, die er dem Händler abgekauft hatte, schleuderte sie ihr in den Schoß. Zog auch die dicken Brillantringe von seinen Fingern und warf sie dazu. Perlstein nahm seine Ketten und Broschen aus der Tasche, reichte ihr noch ein paar dicke Päckchen neuer Villa-Scheine. Und alle kamen heran, füllten ihr den Schoß mit Schmuck und Gold. Aber der General griff wieder in seine Gürteltasche, nahm beide Hände hoch voll von Goldstücken, ließ sie klirrend hineinfallen. Er lachte, freute sich, wie das Gold so hübsch klang auf dem Gold.
Sie rief den Orgelmann, der brachte ihre Tasche. Sie gab alles hinein, achtlos, ohne hinzublicken.
»Danke euch!« Einmal nur und für alle.
Aber es schien, als ob die Offiziere dankbar sein müßten dafür, daß die Tänzerin ihre Geschenke nahm. Sie drängten sich heran, saßen, standen herum, artig, wie liebe Kinder im Kreise.
›Das sind Räuber?‹ dachte Frank Braun. ›Mörder und Brandstifter? — Süße Lämmchen sind es!‹
Und die schöne Schäferin hielt sie alle an ihrer Augen veilchenblauem Seidenband.
»Trinkt« lachte sie. »Trinkt! Seid lustig, es ist des Generals Namensfest!«
Da tranken sie. Niemand dachte daran, die Weiber zurückzurufen — o nein — die Goyita war ja da, die ihnen die Rumba tanzte. Sie saß bei ihnen, sie trank mit ihnen, rauchte mit ihnen, sie, die Goyita —
Frank Braun stieß an mit ihr. »Wer ist übriggeblieben vom Zirkus?« fragte er.
Sie erwiderte seinen Blick. »Der da!« antwortete sie, zeigte auf den Orgelmann. »Der da — und sonst keiner. Er war einer der Pferdeknechte. Er ist fast blind nun.«
»Blind?« fragte er. »Vom Fieber?«
Sie sagte: »Ich weiß nicht. Er lag noch lange im Hospital in San Francisco — als er herauskam, war es so. Nun zieht er herum mit mir.« Sie sah ihn lange an mit diesem Saphirblick — es schien ihm, als ob ein kühles, blaues Wasser ihn bade, allen heißen Schmutz von ihm abwasche. »Sie haben meinen Priestern geholfen,« fuhr sie fort, »Sie sind gut, wie der Kapitän war. Wie alle andern Deutschen auf dem schrecklichen Schiff.«
»Was wurde aus den Tieren?« unterbrach er sie.
Sie erzählte: »Der Kapitän half mir, sie zu verkaufen in San Francisco. Auch die Zelte, auch die Käfige — alles. Ich bekam viel Geld — mehr als wir glaubten. Ich habe Messen dafür lesen lassen für die Seele der Direktorin. Und die Louisons — und für die aller andern. Nur den Tiger wollten sie nicht und den Wolf nicht; die waren krank beide. Ich habe sie gesund gepflegt — da hatte ich mehr Glück als bei der armen kleinen Louison.« Sie sprach ruhig und still, ganz gleichmäßig und gleichmütig, als ob sie von längst vergangenen Zeiten erzählte. »Der Tiger war böse und häßlich, schlug nach mir, war hinterlistig und schlecht. Darum habe ich ihn dem General verkauft — es ist gut, daß der Stier ihn besiegte. Aber der Wolf ist dankbar und gut — er ist mein treues Tier.« Sie erzählte ihm von dem Kapitän der »Thuringia«, von den Offizieren und der Mannschaft. Berichtete von ihrem Auftreten in Kalifornien und Texas, Sonora und Chihuahua. Und wie sie endlich zu General Villa kam —
Keiner unterbrach sie, alle hörten schweigend zu. Frank Braun ließ keinen Blick von ihr, aber es war nicht ihr blaues Auge, das er suchte. Wie ein Zwang war es: er mußte auf ihren Hals starren, lauern, warten, ob sich ihr Tuch nicht verschieben möchte. Denn darunter war die kleine Wunde mit dem Blutstropfen: die mußte er sehn —
Endlich stand sie auf. »Ihr habt Festtag heute, General Villa, ich will noch einmal für Euch tanzen.«
Sie rief ihren Orgelmann — aber der war eingeschlafen auf seinem Stuhl.
»Laßt ihn,« sagte sie, »weckt ihn nicht! Wer will den Leierkasten drehen?«
Alle sprangen hinüber, aber der lange Dominguez faßte zuerst den Schwengel.
Sie zog die leichte Bluse aus, ganz ruhig, vor all den Männern. So gewiß, so gebieterisch sicher war sie ihrer Herrschaft.
Frank Braun schärfte den Blick — wo war nur die kleine Wunde?
Aber dieser Hals und dieser Busen waren weiß, blendend weiß. Nirgend ein kleinster roter Riß.
Geträumt hatte er —
Sie band einen gelben Manton fest um den Leib, über Hüfte, Brust und Schulter. Sie trat an, tanzte einen kurzen, einfachen Ole.
Sie nahm ihre Blumen aus dem Haar, verteilte sie, gab allen. Aber die größten und schönsten bekam Pancho Villa. Sie trat wieder zur Mitte, sagte: »Eine Sevillana noch — und dann ist es aus. Die, die sie in Chipiona tanzen — vor ihrer Madonna.«
Sie tanzte, leichtfüßig und heiter, leise sich beugend und wiegend. Und sie sang dazu, einfach und naiv, die kleine Copla:
»Morena, Morena eres,
Bendita tu, Morenura!
Que me tienes en la cama
Sin frio ni calentura!«
»Wer ist die Morena,« fragte der General, »die Braune, von der du da singst?«
»Wer?« rief sie. »Die Mutter Gottes ist es, die braune Mutter Gottes von Chipiona!«
Noch einmal hoben sie die Gläser, tranken noch einmal auf der Tänzerin Wohl.
General Villa rief: »Ich mag den Wein nicht mehr. Bringt Mescalschnaps!«
Frank Braun faßte des Obersten Arm. »Habt ihr Mescal?« fragte er. »Ich frage jeden Menschen danach in der ganzen Stadt. Und keiner kann mir auch nur einen einzigen Knopf verschaffen.«
Der Oberst lachte: »Wir noch weniger. Der General ist verrückt nach Mescal — wie jeder bei uns. Es ist strenger Befehl, daß alles abgeliefert werden soll, was nur gefunden wird — aber niemand findet etwas, und nichts wird abgeliefert. Was wir Mescalschnaps nennen, hat von Mescal nicht viel mehr als den Namen — eine Frucht auf hundert Liter starken Alkohols.«
Die Tänzerin berührte leicht seinen Arm. »Was wollen Sie haben?« fragte sie.
»Mescalknöpfe!« erwiderte er. »Kleine Früchte sind es, von einer Kaktusart. Die Indianer nennen es Peyote —«
Sie sagte: »Ich werde sie Ihnen besorgen.«
Er sah sie erstaunt an. »Sie? Woher?«
»Ich weiß nicht,« antwortete sie. »Aber ich werde es finden.«
Dann ging sie. Sie nickte leicht, grüßte lächelnd ringsherum. Die Hand gab sie keinem.
Hinter ihr schob sich der Orgelmann.
Langsam stahlen sich die Weiber in den Hof, eine um die andere. Lauter wurde es wieder, wilder und lärmender.
Dann Würfel, Kartenspielen, Schreien und Singen —
Fort war die Heilige — da wurde wieder zum Hurenhause die stille Kirche.
Große Flaschen brachten sie, dickbauchig und schwer, gossen eine scharfriechende Flüssigkeit in die Gläser, mischten sie mit Wein. Nicht Stöpsel staken in den Flaschenhälsen — braune vertrocknete Dinger, wie kleine Wurzeln.
Oberst Perlstein reichte ihm eins. »Was ist das?« fragte er.
Aber er riet es nicht.
»Finger!« lachte der Adjutant. »Vertrocknete Finger von Yankees, die wir niederknallten bei Naco.«
Er fragte: »Ist das des Generals Witz?«
»Nein,« rief Perlstein, »Oberst Gumucio hat es erfunden; er behauptet, der Schnaps schmecke besser so.« Er schob den Arm unter den seinen. »Kommen Sie, Doktor, wir wollen gehn. Was jetzt hier folgt — ist nicht sehr erfreulich.«
Sie ritten langsam zur Stadt. »Was wollten Sie eigentlich mit dem Mescal?« fragte der Jude. Er antwortete: »Es flog mir neulich durch den Kopf. Ich habe lange keinen gehabt — wohl zehn Jahre und mehr. Und ich dachte, vielleicht wirds helfen, wenn ich diese verdammten Schwindelanfälle bekomme.«
Oberst Perlstein zuckte die Achseln: »Ich glaube nicht an das Zeug. Aber es ist wahr: alle Indianer schwören darauf.«
Er zeigte mit der Reitpeitsche auf ein paar elende, völlig zerstörte und herabgebrannte Mauern. »Da stand einmal ein großes Haus,« sagte er. »Das war das amerikanische Konsulat. Sie haben es heruntergerissen bis auf den Boden.«
»Und der Konsul?« fragte er.
»Der hatte Glück. Jemand versteckte ihn, half ihm zur Flucht — sie hätten ihn totgeschlagen, wenn sie ihn erwischt hätten — so ließen sie ihre Wut an den Steinen aus. Ich denke, die Yankees lassen sich mächtig viel gefallen von uns.«
»Alles!« nickte Frank Braun. »Und wenn ihr jeden einzelnen Amerikaner im Lande totschlagt und die Konsuln zuerst — so steckt Präsident Wilson es dennoch ein.«
»Warum nur?« fragte der Oberst.
Frank Braun sagte: »Pah, Ihr wißt es ja selbst! Weil die Mexikaner sich selbst auffressen sollen. Mehr noch, weil England es so will — und, sehn Sie, Oberst, der Präsident und die gesamte Regierung — und die ganze herrschende und reiche Klasse in den Staaten — sie machen viel, viel Geld, wenn sie tun, was London befiehlt. Was ihr bekommt an Waffen und Munition, ist grade genug, um euch einer dem andern gefährlich zu machen. An der Lieferung verdient der Yankee nichts — im Gegenteil — aber er verdient eine blutige Million nach der andern an den Kriegslieferungen, die er nach Europa sendet — gegen Deutschland und Österreich und für Rußland und seine Freunde. Längst wäre drüben der Krieg zu Ende, wenn nicht täglich Amerika soviel den Alliierten schicken würde, wie ihr in Jahren erhaltet. Das ist des Yankeelandes großes Geschäft — und solange das blüht, muß Frieden sein mit euch. Denn, verstehn Sie, Oberst, wenn Amerika kämpfen würde gegen euch, brauchte es selbst seine Waffen und seine Munition: mit einem Schlage würden dann die Lieferungen ins Ausland verboten werden. Das aber hieße: Deutschland siegt. Später erst, wenn ihr ganz schwach seid, wird der Amerikaner euch von hinten den Gnadenstoß geben — das nennt er dann: Ordnung schaffen. Aber solange der Krieg in Europa tobt — solange habt ihr schönste Ruhe, könnt Konsulate plündern und Amerikaner totschlagen nach Herzenslust. Den Krieg, den ihr braucht, um euer Land zu einigen, den Krieg nach außen — den Krieg kann euch nur eines schaffen!«
»Was?« fragte der Adjutant
»Nur eines —« wiederholte Frank Braun. »Wenn mexikanische Truppen in Texas einfallen oder Kalifornien.«
Oberst Perlstein antwortete nicht, schwieg lange, wurde sehr still und nachdenklich. Ohne ein Wort ritten sie durch die Gassen. Sie kamen an die Fonda, Frank Braun stieg ab, ließ sein Pferd in den Stall bringen, reichte dem Adjutanten die Rechte.
»Gute Nacht,« sagte er.
Der Oberst hielt seine Hand, drückte sie. Pfiff vor sich hin, streichelte mit der Reitpeitsche seiner Stute Hals.
Langsam sprach er: »Ich bin Amerikaner, bin in Neuyork geboren. Ich wäre mit ihnen, ritte heute hinter dem Sternenbanner, wenn sie mich genommen hätten. Sie haben mich nicht gewollt — haben mich ausgestoßen wie einen Leprakranken —«
Er gab seinem Tier einen raschen Hieb, daß es erschreckt hoch sprang zur Seite hin. Er parierte es schnell, wandte es, ritt fort im Schritt.
Hielt dann plötzlich, wandte sich im Sattel, rief hell durch die Nacht:
»Ich werde Pancho Villa über die Grenze bringen!«

Ernst Rossius holte ihn am Bahnhof ab.
»Wie gehts unsern Detektiven?« fragte er ihn. »Danke,« sagte der Sekretär, »sie werden sehr froh sein, Sie zurück zu haben, Doktor — tot oder lebendig.« Er trat einen Schritt zurück, starrte ihn an. »Wirklich — mehr tot als lebendig! Sie sehn aus —«
»Nun?« forschte er.
»Wie Sauerbier und Spucke!« platzte der andere heraus.
Frank Braun dachte: ›Wenn es weiter nichts ist!‹ — Er war drei Tage liegen geblieben unterwegs, in einem Hotel in St. Louis, fest im Bett. Aber es hatte kein bißchen geholfen, er fühlte sich genau wie zuvor, müde, zerschlagen, leer.
Lotte van Neß war nicht halb so erschreckt. Er dachte: ›Sie tut nur so, um mich nicht aufzuregen. Das ist dumm, wozu gibts Spiegel? Und — es regt mich gar nicht auf.‹
Er war zu ihr gefahren, am selben Abend noch. Sie saß auf dem Diwan; er lag bei ihr, den Kopf in ihrem Schoß. Sie hielt seine Hände, streichelte leicht seine Stirn. Er erzählte ihr, von Mexiko und von Pancho Villa —
Sie fragte: »Du sagst, daß der Oberst Perlstein heiße?«
Er nickte lächelnd. O ja, das war ihre fixe Idee: die Juden würden es tun — sie würden Deutschland helfen. Und dieser da, Perlstein, würde die Mexikaner nach Texas hetzen — das war der Krieg. Und die Engländer und Italiener, die Russen und Franzosen bekamen keine Lieferungen mehr: da mußte Deutschland siegen —
Er dachte: ›Und wenn Villa zehn Yankeestädte verbrennt, so wird dennoch der englische Lakai, der auf dem Stuhle George Washingtons sitzt, nicht zufassen. Nie, nie!‹
Aber er sprach es nicht aus, er ließ sie träumen.
Er fühlte sich klarer, ruhiger, stärker, wenn ihre schmalen Hände ihn berührten; leise küßte er ihre Fingerspitzen.
»Wo ist das Messerchen?« fragte sie. Er gab es ihr; sie zögerte einen Moment, öffnete es rasch.
»Es ist ganz blank!« rief sie fröhlich. Aber dann — im selben Atemzuge noch — seufzte sie: »Armer Junge!«
Er fragte: »Was soll das Ding eigentlich? Ist es ein Wunderspiegel? Bekommt es Flecke, wenn ich dir untreu werde?«
Sie nickte. »Ja — Flecken bekommt es — häßliche, große Flecke. Aber ein Wunderspiegel ist es nicht — seine Flecke sind sehr natürlich. Jedes Messerchen der Welt würde mir dieselben Dienste leisten.« Sie steckte es wieder in seine Tasche. »Bewahr es gut: eines Tages wird es blutig sein.«
Sie erhob sich rasch, küßte ihm die Frage vom Munde weg. »Steh auf, mein Freund, das Nachtmahl wartet.«
Sie aßen schweigend und tranken. Er faßte ihre Hand über den Tisch, es schien ihm, als ob er zu Hause sei — still — bei der Mutter.
Und zugleich, als ob er nie eine andere Frau in den Armen gehalten habe.
Nur diese — nur sie — Lotte Lewi —
Sie hatte sich geschmückt für ihn — jetzt erst sah er das. Sie sah strahlend aus, sehr verführerisch — nie war sie so schön.
Einmal fragte sie: »Bist du froh, daß du zurück bist?«
Er nickte nur.
Sie warf Rosinen in die Sektkelche, die zogen Luftperlen an. Schwammen hoch, wie kleine, dicke Fischlein, huschten silbern über den goldenen Wein. Und sie fischten sie, mit raschen Zungen, hielten sie in gespitzten Lippen — aßen sie — eins aus des andern Mund.
»Komm!« sprach sie.
Er rieb sich die halbwachen Augen — setzte sich auf in dem großen Bett. Die Sonne brach warm durch die gelben Vorhänge — wie spät war es nur?
Dann schloß er die Lider — versuchte nachzudenken, suchte ein Verlorenes aus dieser Nacht. Aber es war immer nur sein Traum, den er fand.
Von der Tänzerin, der Goyita — Dolores Echevarria. Von der, die die Rumba tanzte. Von ihrem Hals, ihren Brüsten, von der kleinen, roten Wunde und dem einzigen Blutstropfen —
Oder — nein — sie sah er nicht. Ihr Auge nicht — ihr Bild nicht — ihren Tanz nicht —
Das phantasierte er jetzt hinzu — jetzt im Wachen.
Aber geträumt hatte er nur von ihrer blanken Brust und dem kleinen blutroten Streifen —
Er öffnete die Augen weit, lachte auf.
»Der nicht einmal da war!«
Er blickte um sich — da war ein dunkelroter Fleck auf dem weißen Kissen, ein wenig verwischt, wie ein Streif.
Hatte er das gesehn im Halbschlaf — daraus seinen Traum geschöpft?
Er sprang aus dem Bett — wo war denn Lotte? Ihre Kleider lagen herum — hier und dort, über dem Diwan, auf Stühlen und auf den Teppichen — Schuhe, Mieder, Strümpfe.
Er stieg ins Bad — zog sich an — ging ins Eßzimmer. Die Zofe, die ihm den Tee brachte, bestellte, daß er warten möge, die gnädige Frau mache Toilette. So frühstückte er allein und es schmeckte ihm gut, wie seit Wochen nicht.
Er war krank gewesen und müde? Er — und gestern noch? Er konnte es sich kaum vorstellen, wie er sich da gefühlt — so frisch war er nun und gesund.
Er ging hinüber in ihre Bibliothek, schritt herum, griff nach den Büchern, die sie liegen hatte auf ihrem Schreibtisch, las die Titel.
— ›Sancti Petri Epiphanii Episcopi Cypri Ad Diodorum Tyri Episcopum, De XII Gemmis, quae erant in veste Aaronis‹ — Ah, das handelte von ihrer Brustplatte. ›Sie nimmt sie ernst genug,‹ dachte er. Er fand des Franciscus Rueus seltsame Steinkunde und des Bischofs Marbod von Reimes Buch über Edelsteine, den ›Hortus Sanitatis‹ des Johann von Cuba, Jean de Mandevilles ›Grand Lapidaire‹ auch, des Camillus Leonardus berühmtes ›Speculum Lapidum‹. Cardano lag auf einem Sessel und dicht dabei Konrad von Megenberg. Und in den Fächern standen, dicht beieinander, Josephus Gonellus, De Boot, Volmar, Finot, Kunz, Morales — viele, viele noch, wer immer träumte von edlen Steinen.
Dann, auf der andern Seite, lange Reihen von Bänden, die sich mit Prophezeiungen beschäftigten, mit geheimen Enthüllungen der Zukunft, Horoskopen, Weissagungen. Albertus Magnus natürlich, Ragiels Zauberbuch, Plotinus, Jamblichos, Dionysios der Areopagite, Paracelsus, Eliphas Levi. Erstaunlich viele Gnostiker, dazu Indisches, Babylonisches, Talmud — jüdisches, Alexandrinisches, Christlich-mystisches. Und überall Lesezeichen, Eselsohren, Bleistiftstriche am Rande —
»Was sucht sie nur?« dachte er.
An diesem Tage wartete er nicht auf Lotte van Neß. Sein Sekretär schellte ihn an, bat ihn, nach Hause zu kommen, da ein paar Herren ihn dringend erwarteten. Er fuhr zur Dreiundzwanzigsten Straße, begrüßte, vor der Türe, seine lieben Späher, die ihm freudig die Hand drückten. Er verhandelte mit den Herrn des Ausschusses, erstattete raschen Bericht. Am Abend traf er Ivy Jefferson und ihre Mutter im Claremont, oben am Hudson; auch ihr Beau war dabei, der englische Generalkonsul.
»Sie sehn ausgezeichnet aus!« sagte Frau Alice. »Sprühend, wie Sekt.«
Er lachte. So hatte er sich verändert in vierundzwanzig Stunden? Gestern wie Sauerbier —
»Danke!« sagte er. »Und Ihnen ist —«
Aber sie ließ ihn nicht zu Worte kommen. »Es muß wundervoll sein an der Westküste! Es ist eine Schande, daß wir nie da waren. Haben Sie gut arbeiten können in Kalifornien?«
Er dehnte: »Kalifor—«
Da fühlte er Ivys Fuß auf dem seinen. »Sicher haben Sie da arbeiten können! So hübsche Karten haben Sie uns geschickt — aus Los Angeles und San Diego.«
Er erwiderte ihres Fußes leichten Druck. Sagte: »Ganz ausgezeichnet — wie von selber ging alles. Es ist ein herrliches Land: Kalifornien!«
Als sie hinausgingen, sah er die Farstin aus ihrem Auto steigen, begleitet von zwei Damen. Sie warf ihm einen raschen Blick zu, den er nicht verstand, ging an ihm vorbei. Aber dann besann sie sich, wandte sich halb um, maß Ivy Jefferson vom Kopf zu den Füßen. Sah ihn an, grüßte, leicht und spöttisch.
»Kennst du sie?« fragte Ivy. Er nickte.
Das Auto fuhr vor, er half Frau Jefferson einsteigen, reichte dann Ivy die Hand.
»Nein,« sagte sie, »Mama fährt mit ihrem Beau. Ich habe mein neues Auto herbestellt, das wollte ich dir zeigen.«
Ein großer Packardwagen, schwer genug. Sie sprang auf den Lenksitz, nahm das Steuer, lud ihn ein, neben ihr Platz zu nehmen. Drehte an, folgte dem andern Wagen.
»Du warst in Mexiko —« sagte sie.
Er fuhr sie an: »Du hast doch spioniert?!«
»Nein,« sagte sie, »ganz und gar nicht. Das auszufinden, war das leichteste von der Welt.«
»Wie?« fragte er.
Sie lachte: »Hast du nicht die paar Briefe an mich deinem Sekretär geschickt? Mit dem netten Kopf: ›Irgendwo‹?! Der gab dein Kuvert in ein anderes, schickte mir die Briefe zu, genau wie du es bestimmt hattest. Da rief ich ihn auf, von Neuport aus; bat ihn, mir jedesmal zu telephonieren, so wie Nachricht für mich gekommen sei. Und gleich das nächste Mal —«
»Sagtest du, daß du in der Stadt zu tun habest!« unterbrach er sie. »Ludest ihn zum Luncheon ein — nun wohin?«
Sie lachte. »Zu Delmonicos natürlich — dorthin sollte er mir den Brief mitbringen. Das tat er — und drei Minuten später wußte ich, wo du stecktest.«
»Und sonst?« fragte er.
»Sonst nichts!« antwortete sie. »Leider! Es war nichts aus ihm herauszubringen — und ich habe doch so hübsch mit ihm geflirtet mit deiner gütigen Erlaubnis. Er vergaloppierte sich — gleich im Anfang — aber nachher war er eine bittere Enttäuschung. Übrigens — ich habe allen erzählt, daß du in Kalifornien warst.«
Er pfiff. »Sag nur jedem, daß ich in Mexiko war — es ist kein Geheimnis. Ich wollte wieder mal einen Stierkampf sehn — das war alles.«
»Und dazu hast du fast zehn Wochen gebraucht?« drängte Ivy.
»Gewiß,« sagte er ruhig. »Ich mußte eben warten, bis es einen gab.«
Sie bog sich hinüber zu ihm. »Du lügst!«
»Dir?« fragte er. Tat verletzt, versuchte einen recht gekränkten Zug. Aber sie lachte ihn aus. »Mir erst recht! Du warst als Agent da unten für dein Land. Jeden Tag erzählen ja die Zeitungen, wie die Deutschen dort gegen uns hetzen.«
»Kind,« sagte er — und diesmal klang es ernst — »jeden Tag lügen eure Zeitungen. Die Deutschen in Mexiko sind froh, daß sie das nackte Leben haben: sie wurden längst zu Bettlern durch die Revolution, die Wallstreet schürte. Nur einer hat unten gehetzt und hetzt noch — der Yankee.«
Sehr überlegen klang es: »Gegen sich selbst?«
Er nickte: »Darauf kommt es heraus am letzten Ende.«
Er schwieg; er fühlte gut, daß er sie doch nicht überzeugen würde.
»Ich war bei Evangeline Adams,« sagte sie nach einer Weile. »Ich habe mir mein Horoskop stellen lassen. Und deins.«
›Du auch?‹ dachte er. Fragte: »Und bei wem warst du sonst noch?«
Sie sagte: »Bei Frau Cochrane und bei Doktor Deed und der Otis. Sie sagen alle was anders.«
»Und du gehst doch wieder hin?! rief er.
»Natürlich,« lachte sie. »Morgen will ich zu der Sullivan fahren.«
Das — und sicher das nur — hatte Lotte van Neß in Amerika gelernt. Ihre Bibliothek, ihr Arbeiten und Studieren, ihr rastloses Kämpfen und Eindringen in all diese verwilderten Bände — das war europäisch: deutsch und jüdisch. Aber sie fuhr herum, jeden Tag fast, zu einem oder andern der vielen Schwindler, die für gutes Geld kindische Phrasen verkauften. Das gehörte dazu — das war guter Ton in der vornehmen Gesellschaft Neuyorks.
Nirgends, in keinem Lande und in keiner Stadt der Welt machte sich dieser Pöbelschwindel so breit wie hier. Schamlos gemein und mit naiver Frechheit trieb dies Gesindel sein Handwerk — alte Weiber zumeist — hie und da auch ein Mann. Manche Zehntausende in allen Vierteln der Riesenstadt: Horoskopsteller, Orakeldeuter, Zukunftleser, geheime Ratgeber, Okkultisten, Psychologen, Chiromanten, Spiritisten, Propheten, Theosophen — und kein Ende. Herauf von den schmutzigen, zerlumpten Weibern, die auf den Straßen die Leute ansprachen, um für ein paar Nickel ihnen ihr Schicksal aus der Hand zu lesen, bis zu dem hochberühmten Professor Reese, den sie das Hirn der Welt nannten. Und sie verdienten ihr gutes Geld alle, von Quarterstücken bis hinauf zu Zehntausenddollarschecks.
— Sie bekam Dutzende von Horoskopen — eins immer dümmer, immer kindischer als das andere. Sie überflog sie rasch, zerriß sie dann. Es war geradezu erstaunlich, auf welch tiefer Stufe das alles stand.
Und doch fuhr sie immer zu andern, bestellte immer neue —
Einmal sagte ihr Frank Braun: »Es gibt einen, einen einzigen Menschen in Neuyork, der wirklich ein Horoskop stellen kann. Ich traf ihn gestern auf der Straße — es ist ein Bekannter von mir aus Europa her. Er ist der einzige, der kein Schwindler ist und wirklich etwas davon versteht. Aber er wird dir im voraus sagen, daß das alles Unfug ist.«
»Führ mich hin,« verlangte sie.
Lotte van Neß holte ihn ab am andern Morgen. »Nun, wie heißt dein Zauberer?« Er erwiderte: »Freiherr Otto von Kachele, Universitätsprofessor, Doktor med. et phil.« »Universitätsprofessor?« fragte sie.
Er nickte. »In Süddeutschland — in Heidelberg, glaube ich, oder in Freiburg — das war vor meiner Zeit. Als ich ihn kennen lernte, war er Badearzt in Thüringen.«
Er erzählte ihr die Geschichte des Mannes, während sie durch die Straßen fuhren. Und es fiel ihm ein, daß er viele hundert solcher Geschichten erzählen könnte — alle verschieden in der Mitte, aber alle gleich im Beginn und am Ende. Der Anfang: ein sonniger Aufstieg in der Heimat — gute Familie, goldene Jugend, Arbeit und Lust. Und irgendwann das Gewitter, der Sturm, der hinüberblies nach Amerika. Und der Schluß: ein elendes Verkommen in dieser Riesenstadt, ein jämmerliches, qualvolles Zugrundegehen durch die langen Jahre. Tiefer und noch tiefer —
Dieser hier war ein Gelehrter, Magister und Doktor. Schrieb als Student schon für viele gelehrte Zeitschriften, habilitierte sich, wurde Privatdozent und Professor. War vermögend genug, heiratete ein blondes, junges Ding, das ihn anbetete und für ihn sorgte. So leicht und eben schien dieser Lebensweg.
Dann plötzlich verlor er seinen Lehrstuhl, mußte fort aus der Stadt, über Nacht. Etwas war passiert — und man munkelte — aber niemand sprach laut darüber. Man wollte ihn halten, jede weitere Möglichkeit ihm geben. Er ließ sich in einem Bade nieder, trieb seine Studien weiter, bekam einen Weltruf als Ägyptologe und Assyriologe. Er gab sein Geld aus für Ankäufe seltener Altertümer; aber er bekam als Arzt in kürzester Zeit eine sehr große Praxis, die ihm jeden Genuß ermöglichen konnte. Nur: er kannte keinen. Er trank nicht, rauchte nicht, spielte nicht, reiste nicht — sah nie eine Frau an, nicht einmal seine eigene. Nichts hatte ein kleinstes Interesse für diesen Mann, nur seine Keilschriften und Hieroglyphen. Da freilich sparte er weder Zeit noch Geld, da gab er aus mit vollen Händen, da arbeitete er die Nächte hindurch.
Dann — wurde er verhaftet, vor Gericht gestellt, verurteilt — er hatte sich an einer Patientin in der Praxis vergangen. Er versuchte anfangs zu leugnen — gab dann alles zu, verteidigte sich nicht mehr hinter den geschlossenen Türen. Im Gefängnis verschaffte man ihm jede Erleichterung, brachte ihm alle Bücher, die er haben wollte, ließ ihn arbeiten nach Herzenslust — da schrieb er ein großes Werk über assyrische Horoskope. Ja, man ging so weit, ihm die Aufnahme der Praxis wieder zu gestatten — er begann an einem andern Orte, hatte in kürzester Frist von neuem eine glänzende Praxis.
Zwei Jahre hielt es — dann bekam der Staatsanwalt eine neue Anzeige. Es war genau dasselbe: er hatte sich wieder vergriffen an einer Frau, die in der Narkose lag. Jung, schön? O nein — sie war über sechzig Jahre alt und abscheulich häßlich — an Nasenkrebs litt sie.
Der Staatsanwalt kannte ihn gut — wie gern hätte er ihn gerettet! Er zögerte einen Augenblick, dann ließ er den Haftbefehl ausstellen — zum nächsten Morgen. Aber am Abende ging er in seine Kneipe, sprach davon.
Und die andern saßen herum: Amtsrichter, Oberförster, Ärzte —
Was sollte nun folgen? Langjähriges Zuchthaus? Oder Irrenhaus auf Lebenszeit?
Einer ging zu ihm in der Nacht noch — sprach mit ihm. Der Professor war durchaus vernünftig und gar kein bißchen verrückt. Nur wenn die Rede auf das kam, was er angestellt hatte, schüttelte er langsam den Kopf. »Ich weiß nicht.«
In derselben Nacht noch brachte man ihn weg, nach zwei Tagen schwamm er auf dem Ozean.
Nun war er in Neuyork seit manchen Jahren. Das Geld, das seine Frau nachbrachte, war längst verbraucht, was er besaß an Altertümern längst unter dem Preise verkauft. Seine Seitensprünge drüben standen ihm nicht im Wege — kein Mensch wußte hier etwas davon. Aber eine Praxis konnte er nicht eröffnen — dazu hätte er alle Examen noch einmal machen müssen. Das hatten Tausende deutscher Ärzte getan und es wäre ihm — wie ihnen allen — eine Spielerei gewesen. Aber: er sprach kein Englisch. Er las völlig flüssig alle Keilschriften, Runen und Hieroglyphen, verstand Phönizisch, Äthiopisch und Koptisch — doch sein Englisch blieb ganz abscheulich. Dazu kam, daß er vielleicht sich fürchtete vor sich selbst: konnte das, was ihm passiert war nun dreimal schon, nicht wieder geschehn an jedem einzelnen Tage? Er hatte Angst vor der Praxis — vor dem häßlichen Tier, das irgendwo in ihm schlummerte.
So wurstelte er herum. Schrieb nach wie vor sehr gescheite Untersuchungen, für alle möglichen wissenschaftlichen Zeitschriften, war nach wie vor korrespondierendes Mitglied aller möglichen gelehrten Gesellschaften. Um zu leben aber, tat er alles, was ihm die Stunde zutrug. Er erfand eine neue Goldmischung für Zahnfüllungen und verkaufte sie an einen Zahnarzt, der sie patentieren ließ und zwanzigtausend Dollar damit verdiente — er selbst bekam fünfzig Dollar davon ab. Ein Schwindeldoktor, der an der Kolumbia-Universität einen Lehrstuhl für Orthopädie erstrebte, gab ihm den Auftrag, eine Geschichte dieser Heilkunst zu schreiben und versprach ihm hundert Dollar dafür. Der war sehr unzufrieden mit ihm, denn er hoffte, daß das Manuskript in spätestens drei Wochen fertig sein würde — und der deutsche Professor brauchte fast ein Jahr dazu. Er arbeitete die Nächte hindurch, fand verblüffende Aufschlüsse über Fußleiden aus babylonischen und assyrischen Zeiten, schöpfte die Materie mit einer Gründlichkeit aus, als handle es sich um ein Verfahren, das die Welt von der Schwindsucht befreien sollte. Als er seine Bogen endlich ablieferte, war der Amerikaner außer sich vor Entrüstung: das Buch war viel zu lang und hatte dazu eine Menge Illustrationen — das würde die Drucklegung erheblich verteuern. Er zog ihm dafür fünfzig Dollar ab und weitere dreißig, weil doch eine englische Übersetzung angefertigt werden mußte. Es ist wahr, daß er auch aus eigenem hinzugab: sein Bild mit der Unterschrift.
— Das Werk wurde gedruckt — mit des Bestellers Namen als Verfasser natürlich; es wurde preisgekrönt in Harvard und der orthopädische Lehrstuhl wurde für ihn in Kolumbia geschaffen. Und jetzt zeigte sich der Yankee als Gentleman
— er schickte dem Professor ein Exemplar zu, das trug auf der ersten Seite eine sehr ehrenvolle Widmung: »Meinem lieben Freunde.« Und dabei lag eine Zehndollarnote.
Aber solches Verdienst war ein besonderes Glück. Sein Leben machte der gelehrte Baron mit Urinuntersuchungen. Tagaus und tagein — für alle möglichen Doktoren und Quacksalber — einen Dollar bekam er für die Untersuchung. — Sie stiegen die Treppe hinunter, gleich von der Straße aus, siebzehn Stufen. Unten in den Kellerräumen war das Laboratorium; zwischen seinen Gläsern, Retorten, Tiegeln und Phiolen, die ein unwahrscheinliches ultraviolettes Licht wie ein vergifteter Mondschein beschien, saß der armselige Professor auf einem Stuhle ohne Lehne, die Hände auf den Knien, vornübergebeugt, wie im Halbschlafe. Sehr eingefallen waren diese häßlichen Züge, die ein grauer, ungepflegter Bart und schmutziges, zerzaustes Kopfhaar umrahmten. Über die Stahlbrille lugten kurzsichtige, hellgelbe Augen.
»Doktor,« rief ihn Frank Braun an, »was machen Sie?«
Der kleine Professor sprang auf, reichte ihm beide Hände. »Das ist lieb, daß Sie zu mir kommen, das ist lieb. Ich habe herausgefunden, wonach Sie mich neulich fragten, ich habe Ihnen alles aufgeschrieben.« Er lief nach hinten, nahm von einem Tisch ein Manuskript, wohl dreißig Seiten stark.
»Da,« rief er, »hier haben Sie die Sache! Ihre Vaudouxpriesterin, die Mamaloi, kann gar nichts anders sein, als eine menschliche Personifikation der koptischen Berzelia — und die — viel weiter zurück — ist die Gattin Molochs, die die Griechen Basileia nannten. Ich versichere Sie, wir haben eine gerade Linie — nein nicht gerade, sie ist vielmehr sehr gerollt und verbogen — von der babylonischen Göttin Labartu bis hin zu den Kinderopfern im Vaudoux Haitis! Und die merkwürdige Umkehrung, daß die blutfordernde Astarte selbst ihr Blut gibt, wenn —«
Frank Braun unterbrach ihn: »Danke, Professor, Sie werden mir das später einmal auseinandersetzen. Heute wollte ich was anders von Ihnen. Diese Dame hier —«
Er stellte Frau van Neß vor. Kachele wandte sich um, jetzt erst bemerkte er, daß eine Frau in seinem Keller war. Er reichte ihr wohl die Hand hin, aber er begrüßte sie nicht — bitter enttäuscht, daß man seinen Vortrag unterbrach.
»Kommen Sie,« beschwichtigte er ihn, »seien Sie nicht böse, Professor! Ich habe Frau van Neß erzählt, daß Sie der einzige Mensch seien, der heutzutage ein Horoskop stellen könne — streng wissenschaftlich und ohne Schwindel.«
»Was?!« rief der kleine Mann. »Wissenschaftlich und ohne Schwindel? Alte Horoskope untersuchen, das ist Wissenschaft, aber neue stellen ist immer Schwindel! Gibt es in Neuyork nicht dumme Esel genug, die ihren noch eselhafteren Klienten das Geld für Horoskope abnehmen? Was kommen Sie zu mir? Sie haben sich verlaufen, gleich nebenan wohnt so ein Zauberkünstler — ich sehe jede Stunde am Tage elegante Autos vorfahren. Ich kann Ihnen eine Zahnpasta mischen, wenn Sie wollen, oder Ihnen ein Mittel gegen Wimmerl verschreiben — ich will Ihnen den Urin untersuchen — im Abonnement billiger. Das ist ehrliche Arbeit! Aber —«
Frank Braun rief: »Regen Sie sich nicht auf, Baron, es steht nicht drum. Wenn Sie nicht wollen, lassen Sies eben bleiben.«
»Nein, ich will nicht.« schrie der Professor.
»Also gut, gut!« beruhigte er ihn. Sagte dann rasch: »Ein großes Laboratorium — schade, daß Sie kein Tageslicht haben. Wohnen Sie auch hier, Professor?«
»Nein,« knurrte er, »ich habe noch ein Zimmer in der vierzigsten Straße.«
Frank Braun hielt ihn fest. »Ein Zimmer — für Sie und Ihre Frau? Wie geht es ihr?«
»Schlecht,« zischte der Professor.
»Ist sie krank?« fragte er.
Dr. von Kachele zuckte die Achseln. »Ist das ein Wunder, bei dem Leben, das wir führen?«
Nun hatte er ihn, wo er wollte. Trat dicht auf ihn zu, sagte langsam und betonend: »Ihre Frau ist krank — unterernährt vermutlich — wie Sie selbst! Und Sie haben den Mut, aus Fakultätsstolz heraus einen Auftrag abzulehnen, der Ihnen viel Geld einbringen würde?«
Der kleine Professor zog den Kopf ein in seinen Rockkragen, schnellte ihn dann wieder heraus, wie eine Schildkröte. »Viel Geld, sagen Sie? Wieviel Geld?« forschte er.
»Wie lange Zeit würde es in Anspruch nehmen?« fragte Frank Braun zurück.
Der Professor sann einen Augenblick nach. »Wenn ich es wirklich ernsthaft machen soll — alle Tafeln nachsehen —« Er nahm sein Taschentuch, putzte seine Brille, wischte sich dann den Schweiß von der Stirne. »Drei Monate wird es wenigstens kosten,« schloß er, »vielleicht vier, wenn ich gründlich arbeiten darf.«
»Ich zahle Ihnen zehn Dollar für den Tag — für vier Monate!« sagte Frau van Neß.
Er rechnete. »Das — das wären ja — über zwölfhundert Dollar —« stotterte er.
Sie nickte: »Nehmen Sie an?«
»Ja!« schrie er laut. »Ich —« Aber er unterbrach sich plötzlich. »Doktor,« begann er dann zögernd und tappend, »ich kenne Sie seit zehn Jahren nun — Aber wir hatten nie irgendwie etwas Geschäftliches miteinander —« Er räusperte sich, versuchte Mut zu fassen, begann von neuem. »Sehn Sie, ich bin so oft hier im Lande um meine Arbeit betrogen worden —« seine Stimme schlug um, wurde heiser und sehr bitter — »immer — immer!«
Lotte van Neß zog ihr Scheckbuch heraus, schrieb, reichte ihm das Papier hinüber. »Hier, Herr Professor. Und bitte, fangen Sie nicht eher an, ehe Sie das Geld abgehoben haben. So gehn Sie sicher.«
Er nickte, mechanisch, fast verständnislos. Faltete den Scheck zusammen, gab ihn sorgfältig in seine Brieftasche. Nahm einen Bleistift vom Tisch, ging an die gekalkte Wand. Zeichnete einen großen, unbeholfenen Kreis und hinein die zwölf Häuser.
»Weiß die Dame, was ein Horoskop ist?« fragte er.
Frank Braun lachte. »Ich hoffe wohl. Sie hat schon hundert bekommen — von der Konkurrenz.«
Der Professor wiegte den Kopf hin und her. »Die sind im Grunde genau so gut, wie das, was ich Ihnen machen soll — aus den Sternen. Ob ich mich hinsetze und Ihnen in fünf Minuten etwas zusammenphantasiere — oder ob ich in langer Arbeit nach allen alten assyrischen Regeln das herausfinde, was die Sterne in ihrer Zeugungsstunde verkündeten — das ist völlig gleichgültig im letzten Grunde. Es kommt nur auf Sie an, gnädige Frau! Machen Sie es, wie es Alexander der Große machte — oder wie Jesus von Nazareth — dann stimmt das Horoskop. Meines oder das der kleinsten Wahrsagerin von Coney-Island —«
Er hatte sein Gleichgewicht völlig wiedergefunden. »Wollen Sie zuhören?« fragte er. »Eine Viertelstunde nur? Ich muß Ihnen doch sagen, was Sie bekommen werden für Ihr Geld. Setzen Sie sich, bitte, setzen Sie sich!«
Er rückte ein paar Stühle zurecht, von denen der eine noch durchaus tauglich war. Seine gelben Augen wurden blank, zitterten vor Freude, daß er reden konnte. Reden, Vortrag halten, über etwas, das ihn interessierte. Dieser einzige Genuß des Wissens, das sich mitteilen will —
Er erklärte das Horoskop genau, gab die uralten Gesetze der assyrischen Astrologen, schlang hinein die Weiterbildung der Babylonier, Phönizier, Ägypter und Äthiopier. Der Araber, Griechen, Aramäer und Perser — und die seltsam sophistischen Glossen der alexandrinischen Schule. Erklärte, weitschweifig oft und schwatzhaft, aber doch klar und sachlich, warum in der alten Welt die Horoskope sich erfüllen mußten.
»Damals, ja, da glaubte alles an die ewigen Gesetze der Sterne. Die Regeln? Nomadenträume aus der Wüste! Wann — wo — das weiß man nicht. Aber sie waren einmal da — wurden fest und heilig durch die Jahrhunderte, sichere Konvention, wie das Zahlensystem, wie die Buchstaben. So fest glaubte die alte Welt daran, daß ihre Historiker — Herodot an der Spitze — darnach ihre Geschichte schrieben. Der sagt, mehr als einmal: ›Die Überlieferung bei jenem Volke behauptet zwar, daß — Aber das ist grundfalsch; in den Sternen steht es anders.‹ Und dann erzählt er des Volkes Geschichte, wie sie in den Sternen steht — und nicht, wie er sie hörte auf seinen Reisen.
»Nun aber lernte man — vor Jahrtausenden schon — den Sternenlauf berechnen, für die Vergangenheit sowohl wie für die Zukunft. Nicht der Augenblick interessierte — vielmehr das, was war, und noch mehr das, was sein würde. In den Sternen stand die Geschichte Jesu Christi — o, mit allen kleinsten Einzelheiten — und man konnte sie heute so gut dort lesen, wie man das Tausende von Jahren vor seiner Geburt konnte. War sie nicht aufgemeißelt in klarster Keilschrift auf dem großen Stein im Berliner Museum? Man brauchte nur auszurechnen: wie sah der Sternenhimmel aus in jenem Jahre oder in diesem?
»Dann aber — ein paarmal in einem Jahrhundert — kam eine ganz seltsame Konstellation — und solch eine war es, die die Welt umwarf im vierten Jahrhundert vor Christi. Einer wird kommen von Westen her: ein junger Held auf weißem Roß. Der wird die Reiche zerschmettern — dem werden die Städte sich öffnen und die Heere werden vor ihm zerstieben wie Spreu. Und er kam auch, der Mazedonier Alexander, und erfüllte alles, wie es die ewige Weisheit der Sterne lehrte. Ein Russe, Murajeff, hat es nachgerechnet, und es stimmt alles, haarklein, Tag um Tag. Warum? Weil der ganze Orient die Prophezeiung kannte und fest an sie glaubte, weil man den Eroberer erwartete seit langen Jahren schon. Darum schlossen die Städte ihre Tore auf, darum flohen vor der Handvoll Griechen die riesigen Heere des Perserkönigs. König Alexander spielte seine Rolle als Sternengesandter gut genug, erfüllte — wo es nur eben ging — alles das, was prophezeit war von den Astrologen, deren Weissagung er so gut kannte, wie alle andern. Darum bemühte er sich um den gordischen Knoten, darum pilgerte er in den Ammontempel! Nur freilich fiel es ihm etwas spät ein, daß er berufen wäre, der versprochene Held zu sein: wir wissen heute, daß er beinahe ein Fünfziger war und durchaus kein Jüngling mehr, als er nach Persien zog. Vielleicht nahm er Schminke zu Hilfe und Mehlpuder — aber, was er auch tun mochte, um sein Alter zu verbergen — es gelang ihm gut. Heute noch ist er in den Schulbüchern der ganzen Welt der junge, lachende, strahlende Held!
»Weil es so in den Sternen steht — und die haben recht — nicht die Wirklichkeit.
»Die andere gewaltige Prophezeiung war die des Messias. Fieberhaft und aufgeregt war in jenen Jahren das Judenvolk — die Zeit der Sterne war gekommen — nun war er da, der Gottgesandte, war mitten unter ihnen. Er tauchte auf — nicht allein — gleich in mehreren Exemplaren. Ging nicht Johannes in die Wüste, taufte er nicht mit Wasser — wie Jesus auch? Führte nicht Josephus, der sogenannte Judenchristus, der ein wenig später auftrat, genau dasselbe Leben, wie der Nazarener?
»Warum nur? Weil — es geschrieben stand.
»Wieder und immer wieder sagt uns das Testament, daß der Gekreuzigte dies oder jenes tat — auf daß erfüllet werde, was da geschrieben steht. Wo denn geschrieben? — In den Sternen.
»Und so felsenfest war dieser Glaube an die ewigen Sterne, daß die alexandrinische Schule es genau so machte, wie Herodot: sie korrigierte — nach den Sternen — die Geschichte der Apostel. So kam — ein paar Jahrhunderte später — die merkwürdige Geschichte von der Darstellung des zwölfjährigen Jesus im Tempel in das Evangelium des Lukas, so die von der Flucht nach Ägypten in das des Matthäus.
In den Sternen steht diese Geschichte — jeden Tag kann man das nachprüfen. Der Evangelist hat sie nicht notiert? Nun wohl, er wird sie vergessen haben — da mußte man die Lücke ausfüllen.«
Wärmer wurde der kleine Professor und immer wärmer. Seine kurzen Arme zuckten in der Luft herum, auf seinem zerbrochenen Stuhle wippte er hin und her. Er sprach von den Prophezeiungen der Azteken und denen der Inkas, die sich Cortez zunutze machte und Pizarro; er trug ein Beispiel heran nach dem andern aus der spätrömischen Geschichte und aus dem Mittelalter, um zu zeigen, wie prächtig sich alle Horoskope erfüllen, wenn man eben nur tut — was da geschrieben steht. Er schwieg nicht einen Augenblick, nutzte die gute Gelegenheit voll aus, plätscherte wie ein fröhlicher Wasserfall.
Frank Braun stand auf, legte ihm die Hand auf die Schultern. »Ich muß Sie unterbrechen, Professor,« sagte er, »ich habe eine Verabredung —«
»Aber die ›Labartu‹?« bat der andere. »Ich muß Ihnen doch sagen, wieso die phönizische Astarte —«
»Ein andermal,« sagte er, »ein andermal! Heute habe ich wirklich keine Zeit.«
Lotte van Neß schob ihren Hut zurecht. Wollen Sie mit mir zum Luncheon kommen, Doktor?« sprach sie. »Sie können mir das alles erzählen.«
»Ihnen?« fragte er. »Interessiert Sie das?«
Sie lächelte: »Ich glaube — ja. Ich werde ihm alles berichten.«
Professor von Kachele suchte seinen Hut, fand ihn endlich in einem Papierkorb.
Sie gingen die Treppe hinauf, stiegen in das Auto. Lotte van Neß ließ bei Tiffanys halten, stieg aus, kam gleich darauf wieder mit einem kleinen Kästchen in der Hand. Sie öffnete es, nahm ein schmales, goldnes Halskettchen heraus, das einen kleinen unscheinbaren Kristall hielt. Sie zeigte es dem Professor, fragte: »Das hab ich mir machen lassen — wissen Sie, was es soll?«
Dr. von Kachele betrachtete den Stein: »Sie haben einen Greifen hineinschneiden lassen,« sagte er langsam. »Einen Greifen — haben Sie ein Baby?«
Frank Braun lachte. »Ein Baby? Nein, das hat sie nicht. Warum denn?«
Dozierend wieder, den Finger an der Nase, erklärte der Professor: »Das ist ein venetianischer Aberglaube aus dem Trecento, den vermutlich die Kreuzfahrer aus Syrien brachten — Das Ding da — soll Frauen reichlich Milch verschaffen!«
Lotte Lewi nickte, nahm das Kettchen, legte es um den Hals. »Sie haben recht,« sagte sie.
Frank Braun starrte sie an: »Du, Lotte — du brauchst Milch?«
»Ja,« sagte sie ruhig. »Milch. — Für mein Kind. Viel Milch — rote Milch.«
›Dummes Zeug,‹ dachte Frank Braun. ›Narreteien!‹
Aber es ließ ihn nicht. Immer wieder zog der Beryll, den sie ihm gab, an diesem Tage seinen Blick auf die Hand. Und er dachte an die alten Steine ihrer Brustplatte —
Schon am nächsten Tage stieg er wieder in die Höhle des Kachele.
»Sagen Sie mir, Professor,« rief er, »ist es denkbar, daß Edelsteine wirklich die seltenen Eigenschaften besitzen, die ihnen aller Völker Aberglauben zu allen Zeiten zuschrieb? Ich meine — da und dort in irgendeinem Falle! ist es möglich?«
Der kleine Professor hustete. »Warum nicht? Jedes Kind weiß, welch merkwürdige Eigenschaften die Mineralien besitzen — jedes hat einmal mit einem Magneten gespielt und Stahlnägel damit aufgehoben. Hat Natrium und Kalium ins Waschbecken geworfen, um zu sehn, wie hübsch das im Wasser brennt. Hat mit Quecksilber gespielt, das stets in flüssigem Aggregatzustande ist, oder Magnesium angezündet, das heller leuchtet wie Tageslicht. Sind das nicht höchst wunderbare Eigenschaften? — Ach, fast jedes Mineral hat sein kleines Wunder — und nur wenige davon kennen wir genau. Alle Metalle oxydieren, aber Gold nicht, weil es mit Sauerstoff keine Verbindung eingeht. Denken Sie an die unerhörten Emanationen des Radiums, oder an Iridium, das sich in keiner Säure löst, nicht einmal in Königswasser. An den Doppelspat, der die einzige Eigenschaft hat, das Licht doppelt zu brechen — an den Turmalin, der durch Erhitzen, und den Topas, der durch Reiben elektrisch wird. An die Unverbrennbarkeit der Hornblende, an die Wassergierigkeit des Meerschaums, der aufgelöst zur Gallerte wird. Wunder, wohin Sie greifen.«
»Auch heilwirkend?« fragte Frank Braun.
Der Professor lachte. »Aber Doktor, das wissen Sie doch so gut wie ich. Haben Sie nie Glaubersalz genommen, das viel durchschlagender wirkt wie Rizinus? Nie mit Karbol zu tun gehabt und seine desinfizierende Wirkung kennen gelernt? Überlegen Sie doch — was wäre die ganze Medizin ohne die Mineralien? Ätzkali, Ätznatron, Höllenstein wirken kaustisch, mit Quecksilber schmieren Millionen Menschen, Eisen fressen noch mehr. Als heilwirkend für tausend Sachen gelten Karlsbad, Vichy und alle Mineralwasser. Und es gibt heute noch Ärzte — Autoritäten dazu — die fest überzeugt sind, daß man mit den beiden — Jod und Arsen — alle Krankheiten der Welt heilen könne.«
»Dann,« begann Frank Braun zögernd, »dann ist es durchaus möglich, daß —«
»Daß die eine oder andere seltsame Eigenschaft zutrifft, die die Alten den edlen Steinen zuschrieben?« unterbrach ihn der Professor. »Ohne jede Frage. Manches ist bare Phantasie, sicherlich; und oft kindisch genug. Aber manches, manches mag richtig sein. Und dann, wissen Sie, kindisch genug ist auch oft unsere sogenannte exakte Wissenschaft: recht hat sie nur, solange sie grade lebt.«
Der junge Rossius trat an sein Bett. »Es ist zwölf Uhr, Doktor,« rief er. »Möchten Sie nicht aufstehn? Der Diener ist da mit dem Tee.«
Er nickte schlaftrunken. Sie brachten ihm das Frühstück ans Bett; er aß und trank schweigend, dachte nach. Das war nun schon so seit einiger Zeit, daß er sich des Morgens nie mehr zurechtfand, immer angestrengt sich besinnen mußte über das, was geschehn war am vergangenen Abend.
»Der Vortrag ist fertig getippt,« sagte der Sekretär. »Ich wachte schon früh auf, nahm mein Bad und ging zur Schreibmaschine. Ich habe mir auch Tee machen lassen — mit Ihrer Erlaubnis.«
Frank Braun fragte zögernd: »Haben Sie hier gebadet?«
»Wo denn sonst,« gab der Sekretär zurück. »Ich hab doch hier geschlafen heute nacht — auf dem Sofa im Mittelzimmer.«
Ja — nun fiel es ihm ein. Er war spät genug nach Hause gekommen in der Nacht — da saß der junge Rossius, wartete auf ihn. Der Vortrag, den er heute halten sollte — über — worüber war es denn nur?
Einerlei — es würde ihm schon einfallen. Deshalb hatte er den Sekretär in der Nacht bestellt. War herumgelaufen im Zimmer, hatte noch anderthalb Stunden diktiert. Ja — und er hatte dem jungen Mann gesagt, daß er dableiben möge, um gleich am andern Morgen das Stenogramm abzutippen. So war es — nun hatte er alles, gottseidank.
»Sie haben mich schön erschreckt, Doktor — heute nacht,« lachte der Sekretär.
»Ich?« fragte er. »Wieso?«
»Sie sind ein Schlafwandler!« antwortete Rossius.
Er sprang aus dem Bett. »Dummes Zeug!« rief er.
Aber der andere sagte: »Gar kein dummes Zeug. Sie kamen herüber, machten sich an dem Tisch zu schaffen. Irgend etwas fiel herunter — davon erwachte ich, drehte das Licht an. Das störte Sie weiter nicht. Sie standen da im Pyjamas mit weit offenen Augen — kramten herum auf Ihrem Toilettentisch.«
»Was tat ich?« fragte er.
»Nichts Besonderes,« gab der andere zurück. »Sie nahmen ein paar Sachen auf, Scheren — Kämme — dann zogen Sie etwas aus der Tasche Ihres Schlafanzuges, steckten es wieder hinein. Auch Ihren Rasierapparat schraubten Sie auf und wieder zu.«
»Das war alles?« forschte Frank Braun. »Und wer sagt Ihnen denn, daß ich nicht sehr wach war?«
»Nein, Sie waren nicht wach,« beharrte Rossius. »Ich rief Sie an — und Sie hörten mich nicht. Ich stand auf, trat dicht vor Sie hin — und Sie sahen mich nicht — trotz der offenen Augen. Dann nahm ich Ihren Arm und führte Sie zurück. Sie waren sehr sanft und ließen sich ruhig zu Bett bringen. Nach zwei Minuten schon schlossen sich Ihre Augen und Sie schliefen fest —«
»Was jedenfalls gescheiter war,« brummte er. Er nahm seinen Kimono, ging ins Badezimmer.
Nach einer Weile kam er nach vorne, immer noch müde genug, kein bißchen ausgeschlafen.
»Viel zu tun heute?« fragte er. Aber er wartete die Antwort nicht ab. »Kommen Sie, Rossius, wir wollen eine Partie Schach spielen.«
Er lag lang auf dem Diwan, den Oberkörper aufgestützt auf ein halbes Dutzend Kissen. Er flog die Zeitungen durch, dazwischen warf er einen raschen Blick auf das Brett, schob eine Figur.
Dann ließ er sich den Vortrag vorlesen, verbesserte hier und da. Allmählich hörte er nicht mehr zu, träumte vor sich hin.
Unterbrach ihn plötzlich. »Geben Sie doch mal die blaue Mappe,« sagte er, »die, wissen Sie, in der wir die anonymen Wische aufbewahrt haben, die Drohbriefe und derlei Zeug.
»Nicht mehr da!« sagte der Sekretär. »Sie sagten neulich mal, ich solle den Kram vernichten. Da habe ich die Mappe im Kamin verbrannt mit allem, was drin war — gestern, als ich auf Sie wartete und die Zeit benutzte, ein wenig Ordnung zu schaffen.«
»Habe ich das gesagt?« rief Frank Braun. »Es war sehr dumm — sehr dumm!« Er nahm ein Kissen, warf es hoch, fing es wieder auf. »Erinnern Sie sich an den Brief, den wir bekamen, einige Tage, nachdem ich aus Mexiko zurück war? Den, wissen Sie, der sehr geheimnisvoll tat und vor einem sichern Anschlag warnen wollte!«
Rossius nickte. »O ja, Doktor. Sie meinten, der komme von einem närrischen Frauenzimmer — es sei heller Blödsinn. Es stand etwas drin, daß — wenn auch die Männer in diesem Lande schliefen, doch die Frauen weit wach wären — daß sie schon Mittel finden würden — und gefunden hätten — um Ihnen und Ihresgleichen das Handwerk zu legen.«
»Den Brief meine ich,« sagte er langsam. »Vielleicht war es nur kindisches Gefasel einer alten Jungfer, die von der englischen Lügenpresse verrückt gemacht wurde, wie so viele Millionen andere. Und die nun in jedem Deutschen einen verruchten Mörder sieht! Vielleicht! Vielleicht auch mag etwas daran sein. So oder so, mein Junge, ich glaube fast: ich habe Angst.«
Rossius lachte auf: »Sie — Doktor? Sie haben Angst? Na, immerhin hab ich noch nichts davon gemerkt.«
»Ich auch nicht —« sprach er achselzuckend. »Jedenfalls nicht, wenn ich wach bin. Aber — ich glaube — ich habe Angst — wenn ich schlafe.«
Er schwieg eine Weile, fuhr dann fort, langsam, überlegend und nachsinnend: »Ich träume, — das habe ich sonst nur getan, wenn ich wach war — und es war mehr ein Grübeln, ein Phantasieren und Spinnen. Jetzt ist es richtiges, kindisches Träumen — im tiefsten Schlafe — und es ist immer dasselbe. Von einer Wunde auf der Brust — und von rotem, tropfendem Blut. Ich mag das Geträume nicht.«
Er sprang auf, lief mit raschen, nervösen Schritten durch das Zimmer. »Und dieses Schlafwandeln heute nacht — wer weiß, ob es das erste Mal war. Bin ich ein neurasthenischer Jüngling, ein bleichsüchtiges Backfischchen? Ein hysterisches Weib in den Wechseljahren oder ein mondsüchtiges Frauenzimmer, das ihre Regeltage hat? Zum Henker, nein! Ich habe Angst — sage ich Ihnen — ganz gemeine Angst — vor — vor — irgend etwas!«
Er setzte sich wieder, sog an seiner Zigarette. »Und diese Furcht muß einen Grund haben. Ich bin krank — das wissen Sie ja — seit ich in dieser gottverdammten Stadt bin. Heute nicht — jetzt im Augenblick nicht — aber eben noch — und vielleicht morgen wieder. Eine komische Krankheit ist es dabei — von der keiner weiß, wie und wo — und ich am wenigsten. Sieben — nein, acht Ärzte haben mich untersucht — von Kopf zu Füßen — auf Frau van Neß' Befehl — und keiner hat etwas gefunden. Ein bißchen Nervenschwäche, sagen sie — das ist eine dicke Phrase. Ich solle nicht so viel rauchen, raten sie — das weiß ich selber. Und: gute Besserung — auf Wiedersehn! Dankeschön — das ist eine Kunst!«
Er schwieg wieder, wiegte den Kopf hin und her, überlegte. Fuhr dann fort: »Es ist eine Müdigkeit — ohne Grund. Eine körperliche Schwäche — manchmal ein rascher Schwindel — und alles ohne sichtbare Ursache. Das große Gefühl einer völligen Leere — das ist es — so, als ob ich keinen Tropfen Blutes mehr im Leibe habe. Als ob sich mein Blut in den Adern zersetze — als ob irgend etwas an mir sauge, mich leer trinke und ausschlürfe. So wie Kinder es mit den Apfelsinen machen — ein Loch hinein und dann ausgelutscht: ich bin die Orange!«
Er zog die Beine hoch; brannte eine neue Zigarette an.
»Furcht habe ich,« betonte er, »das steht fest. Bei Tage noch nicht — aber im Schlafen wohl: also ist diese Angst unbewußt, kommt aus dem tiefsten Instinkt. Dann aber — wovor habe ich Angst?« Er stockte, blickte starr seinen Sekretär an. »Sagen Sie mir, glauben Sie — daß es ein langsames Gift sein könnte?«
Ernst Rossius lachte hell auf. »Beruhigen Sie sich, Doktor, wir sind nicht mehr im Mittelalter!«
Da fuhr er auf. »Was meinen Sie? Ich sage Ihnen, nie war die Welt so wahnsinnig wie in unseren Tagen. Schaun Sie doch die Blätter an! Man schlachtet sich ab zu Hunderttausenden — wann sah je die Sonne ein solches Morden? Und wozu — warum nur? Jede Regierung schwatzt dieselben Phrasen in ihren Buntbüchern — und das eine ist so absurd, so schamlos dumm wie das andere. Viel phantastischer ist unsere Narrheit, als sie zur Zeit der Inquisition war, oder damals, als die rasenden Haufen der Geißelbrüder die Lande durchzogen und Europa in ein großes Irrenhaus verwandelten. Neuyork aber, Rossius, ist die romantischste Stadt der ganzen Welt, lebt heute noch im nebeldicksten Mittelalter!«
»Was sagen Sie da?« unterbrach ihn der Sekretär. »Das moderne Neuyork — mit seinen Untergrundbahnen und Wolkenkratzern und den hunderttausenden Automobilen!«
»Eben das!« rief er. »Eben das! Mit diesen Hoch- und Tiefbahnen, in den Sie mehr Wanzen und Flöhe bekommen als irgendwo in Neapel. Mit diesen Wolkenkratzern, die so viele Straßen in dunkle Grubenwege verwandeln. Und die Autos — Sie wissen so gut wie ich, daß viele Damen nicht wagen, allein in ein Taxicab zu steigen, dessen Firma sie nicht kennen. Warum? Weil ›kidnapping‹ hier an der Tagesordnung ist, weil sie fürchten, verschleppt zu werden, am hellichten Tage. Opiumhöhlen können Sie zu Dutzenden finden — nicht nur in Chinatown — jeder Polizist führt Sie hin. Und Heroin, Kokain, Morphium — was Sie nur wollen — in Hülle und Fülle. Unsere Nigger schlachten in ihrem Hoodookult ihrem Schlangengott ihre Kinder hier so gut wie irgendwo in Haiti! — Und wann findet man in Neuyork je einen Mörder heraus — schwarz oder weiß? Immer einen Ganzen auf ein halbes Hundert! Sklaven haben wir zu vielen Tausenden — lesen Sie doch die letzten Veröffentlichungen über das italienische Padronesystem am Hafen — Sklaven, die viel enger an der Kette liegen, als jemals in den Plantagen der Baumwollmagnaten. Zauberer dazu überall — in jedem Hause fast wohnt eine Pythia, die dummen Damen das Geld wegnimmt. Prostituierte in allen Lokalen und Theatern, auf jeder Straße — weibliche, männliche fast noch mehr — hier können Sie jede infamste Lust kaufen, wenn Sie nur die Dollartasche weit öffnen! Wie im Rom des sechsten Alexander: Mittelalter — wundervollstes Mittelalter! Darüber freilich — und das macht es geschmacklos und nimmt ihm den Patinaglanz der Renaissance — darüber fettige Buttersauce angelsächsischer Heuchelei. Die Mucker und Schleicher, die jedem freien Wort, jeder Annonce in der Zeitung nachjagen, jeden kleinen Händler denunzieren, der ein Damenbildchen verkauft, das ein wenig zu weit ausgeschnitten ist. Die Wassertrinker und Heiligtuer, die Theater und Sport am Sonntag verbieten, die die verlogensten Gesetze schaffen, vorne die Kneipen schließen, um von hinten hineinzugehn. Aber sehn Sie, auch diese Inquisition ist Mittelalter — nur ist sie nicht stark und grausam, wie in Spanien, sondern feige, kleinlich, englisch und gemein. Eins aber ist gewiß: nichts, nichts ist unmöglich in dieser Riesenstadt, diesem unendlichen Mülleimer, in den die ganze Welt ihren Kehricht zusammenfegt.«
Er lachte hell auf. »Wir zwei sind auch drin — Sie und ich. Aber es ist gut, daß man sich manchmal bewußt ist, wo man steckt — damit man hinauskriechen kann, wenn eine Gelegenheit da ist. Sonst verpestet die Seele — und merkt es kaum. Denn sehn Sie, Rossius — man gewöhnt sich dran — ist es nicht so? Und dann fühlt man sich recht wohl in all dem Schlamm und Schmutz.«
Er stand wieder auf, ging zum Fenster, schob es hoch. Wandte sich dann zurück.
»Gift so gut wie alles andere — warum nicht? Schnelles und langsames — ganz nach Belieben. Was die Medici konnten und die Borgia — das können die Neuyorker ganz sicher! Genau so gut wie sie ihre Orgien feiern können, nur im Stil haperts da und im Geschmack.« Er lachte, ging dann auf den Sekretär zu. »Sagen Sie, haben Sie schon mal eine Orgie hier mitgemacht?«
»Ja —« sagte der andere, »was wir so nannten. Mit Bier oder Whisky — mit Mädchen und Singen.«
Frank Braun unterbrach ihn: »Wo sind meine Einladungen? Suchen Sie die heraus von den Monddamen. Die haben ihr Stiftungsfest — ich werde Sie mitnehmen.«
Rossius suchte herum. »Hier sind sie,« sagte er. »Zum Neunzehnten — das war vorgestern.«
»Schade,« sagte Frank Braun, »da ists zu spät. Aber im Spätherbst oder Winter — erinnern Sie mich dran, wenn wir wieder eine Einladung bekommen.«
— »Die Post?« fragte Rossius. »Wollen Sie die Post sehn?«
Er winkte ab. »Nein, jetzt nicht — später. — Sonst irgend etwas?«
Der Sekretär besann sich, griff in seine Brusttasche, zog Papiere heraus. »O, ich vergaß — ich war gestern in der Bibliothek — habe nach dem Heiligen Ambrosius gesucht — das hat Mühe gekostet! Hier ist das Lied, das Sie wünschten — von der Unbefleckten Empfängnis.«
Er reichte ihm einen Zettel. Frank Braun las laut:
»Fit porta Christi pervia,
Referta plena gratia.
Transitque rex, et permanet
Clausa, ut fuit, per saecula.
Genus superni numinis
Processit aula virginis
— Sponsus, redemptor, conditor,
Suae gigas ecclesiae.«
»Das ist schön,« sagte er, »prächtig ist es. Die Vorstellungsstärke dieser Glaubensmänner ist erstaunlich. Wer kann das heute: Abstraktestes so wirklich geben? Diese bildende Kraft — die das Unwahrscheinlichste, Unmöglichste, jedem Menschenverstand Unfaßbare dennoch natürlich und selbstverständlich macht — nur mit dem Klang von ein paar Worten.«
Ernst Rossius sagte: »Ich habe versucht, es zu übersetzen, heute nacht, als ich auf Sie wartete —«
»Lesen Sie,« nickte Frank Braun. Und der Sekretär begann: »Da ward der Jungfrau Schoß zu Christi Tor, So aller Gnaden voll und wunderbar. — Einzog der Herr, der dies Gefäß erkor. Und dennoch blieb verschlossen — wie es war Durch die Jahrhunderte — das reine Tor. — Und blieb verschlossen, als der Gottheit Strahl Sich feierlich zum Lichte rang empor Aus ihres Leibes jungfräulichem Saal — Der Gründer, Heiland, mächtiger Altar Und seiner Kirche süßer Liebster war.«
Frank Braun nahm ihm das Papier aus der Hand. »Nicht schlecht,« sagte er, »nicht schlecht. Aber wissen Sie, daß das — Glossa ist?! ›Transitque rex‹ — da hat Ambrosius sicher wieder Christus gemeint — und Sie bringen uns den Heiligen Geist hinein — oder Gottvater! Immerhin, im Sinne ist es doch echt und ganz sicher ambrosisch. So ists noch stärker, noch gewaltiger: verschlossen bleibt ihres Leibes Tor beim Eintritt der Gottheit, wie bei dem Ausmarsch des Heilandes. Verschlossen, unbefleckt — durch alle Saecula!«
»Danke für die freundliche Anerkennung,« lachte Rossius. »Aber sagen Sie mir doch, Doktor, wozu wollten Sie das Lied eigentlich haben?«
»Und wozu, Ernst Rossius, haben Sie es übersetzt?« gab er zurück. »Nur aus Langeweile? Gewiß nicht! Da stehn Dutzende von Bänden, die Sie interessieren, und die Sie hätten lesen können. Und den Bericht für den Ausschuß, der uns schon seit drei Wochen darum drängt, haben Sie immer noch nicht angefangen. Setzen sich statt dessen hin und quälen sich eine Stunde lang ab, um ein paar christlich-mystische Brocken in einigermaßen erträgliche deutsche Verse zu bringen! — Wozu?«
»Ich weiß nicht —« sagte der andere.
»Nun, ich auch nicht!« rief Frank Brann. »Es ist vermutlich, weil irgendein Gott will, daß wir auch unser Teil beitragen — Sie und ich — an dem mittelalterlichen Hexensabbat dieser Stadt Neuyork. Diese graugoldenen Farben fehlen — da schafft uns das Schicksal an, daß wir sie mischen sollen.«
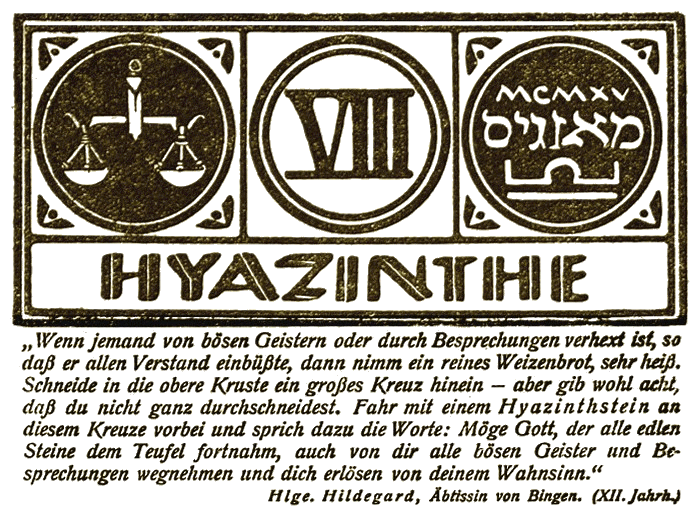
Als Frank Braun diesen Nachmittag nach Hause kam, saß sein Sekretär sehr nachdenklich vor der Schreibmaschine, beide Hände im Schoße.
»Nun, was haben Sie ausgefunden?« fragte er.
»Ich habe ausgefunden,« antwortete Rossius, »daß ich weder Ihr Füllfederhalter bin, noch Ihr Sektquirl. Daß ferner — wenn Sie ein Pferd hätten, eine Frau oder ein Fahrrad — ich vermutlich auch keines von diesen Dingen sein würde. Gibt es sonst noch Sachen, die man nicht gern verleiht, weil man sie nur sehr beschädigt oder überhaupt nicht wiederbekommt?«
»Hm —« sagte er, »die Zahnbürste. Die kriegt man zwar gewiß wieder und meist wenig beschädigt — aber man verleiht sie doch nicht gern.«
Der Sekretär erwiderte: »Dann bin ich eben Ihr Zahnbürstel auch nicht. Denn mich verleihen Sie nach Herzenslust — jeden Tag muß ich bei einer andern Zeitung aushelfen — oder bei einem der Komitees. Und dabei bin ich nur Anhängsel — Sie verleihen die Schreibmaschine — und da gehöre ich so mit dazu.«
»Sagen Sies doch, wenn Sie keine Lust haben!« lachte Frank Braun. »Kein Mensch zwingt Sie.«
»Doch!« seufzte Rossius, »das ist es eben. Ich bekomme überall ein paar Dollar extra — mein Fräulein Braut braucht wieder einen neuen Hut. Vorhin hat Herr Tewes angerufen —«
»Was sollen Sie für ihn schreiben?« forschte er.
»Fragen Sie ihn selber — ich weiß es nicht. Er kommt her, will hier diktieren.« Er sprang auf. »Da klopft es, da ist er schon.«
Der alte Diener meldete den Referendar Christoph Frylinghuis.
»Der?« schluckte Frank Braun. »Nun, in Gottes Namen.«
Der Referendar trat ein. Aber Tewes folgte ihm auf dem Fuße, warf Stock und Handschuhe auf einen Stuhl.
»Zigarren — Doktor?« rief er. »Wo steht Ihr Kistchen?« »Entschuldigen Sie, daß ich herkomme — aber ich muß für den Wachtel — wissen Sie, den dicken Metzger, den Vorsitzenden des Landwehrvereins — eine Stiftungsfestrede machen. Auf der Redaktion ists unmöglich — fünfzig Menschen in einem Raum — man versteht sein eignes Wort nicht. Nach Hause ists zu weit — das dauert drei Stunden nach Yonkers und zurück. Da komme ich her — hier ist man wenigstens ungestört.«
»Und stört niemanden, was?« rief Frank Braun.
»Gott, ja, natürlich stört man!« lachte der Journalist. »Da müssen Sie sich halt dran gewöhnen. Tee? Kann uns Rossius nicht Tee machen? Wissen Sie schon, daß Belgrad genommen ist — eben haben wir die Nachricht bekommen. Dann — ja, geben Sie mir doch mal Ihre Reden — da werde ich schon was Passendes finden für meinen Metzgermeister. Ich streiche alles heraus, was einigermaßen menschlich ist und lasse nur die faustdicken Phrasen stehn — und die werden noch einmal frisch angestrichen. Das spart mir die halbe Zeit — und wird grandios wirken bei den Kriegern.«
Er lief herum, war überall mit seinen langen Flügeln. Holte die Zigarrenkiste, setzte den Wasserkessel auf den elektrischen Kocher, trug Tassen, suchte die Vortragsmappe.
»Setzen Sie sich doch endlich!« fauchte Rossius. »Sie sind mir überall im Wege. Erst Tee trinken — das schafft Ihnen die nötige Ruhe — dann können Sie mir Ihr Meisterwerk diktieren.«
»Na, was führt Sie her, Herr Frylinghuis?« redete Frank Braun den Referendar an. »Gehts Ihnen gut in Ihrer neuen Stellung?«
»Gut?« seufzte der Referendar. »Hinausgeworfen bin ich nach zwei Tagen.« Er war klein und untersetzt — früher mußte er einmal dick gewesen sein, aber nun schlotterten ihm die Kleider rings um den Leib. Nur der Kopf war rund und rot geblieben — dieser Kegelkugelkopf, der sich fortzusetzen schien in dem spargeligen gleichstarken und gleichroten Hals. Er war rasiert und hatte nur wenig Haare noch auf dem Schädel — aber Schmisse, Schmisse überall. Auf beiden Seiten, über Kinn und Wangen und Schläfen und Ohren, dicht auf dem Kopf und hinab die Stirn und die Nase — das schrie durch alle Gassen: ich bin ein deutscher Student. Sein rechter Arm war ausnehmend kurz — da war es kein Wunder, daß ihm auf der Mensur ein jeder hineinlangen konnte, wo er nur wollte.
Der Mann war sein Schmerzenskind — es war nichts mit ihm anzustellen: er war Referendar und sonst nichts. Früh verwaist, hatte er sein kleines Vermögen auf der Universität verbraucht und im Korps, war grade zu Ende damit, als er glücklich das Examen machte. Es gelang ihm, im Kolonialdienst unterzukommen — man hatte ihn nach Samoa geschickt — dort lernte er Whisky trinken. War dann über den Pazifik gekommen — und nun war er da, suchte, suchte — und fand nichts.
»Warum ging es nicht auf der Farm?« fragte er ihn.
Der Referendar schlürfte seinen heißen Tee. »Weil ich Heuschnupfen habe! Das ist nun schon der dritte Versuch auf dem Lande — ein Tag, zwei Tage — länger gehts nicht. Dann triefen die Augen, dann läuft die Nase und ich wanke herum wie im Fieber — ich kanns keinem verdenken, wenn er mich fortjagt.«
Frank Braun haßte diesen Mann, dem er doch immer wieder half. Er hat kein Glück, dachte er — und er bringt Unglück!
»Klingeln Sie doch die Arbeiterhilfe an,« schlug Tewes vor. »Die Herren haben schon einer Reihe von Akademikern Stellung besorgt.«
Der Referendar schüttelte den Kopf. »Mir auch — aber es hält nicht. Es ist immer dasselbe — ich kann nichts. Länger als eine Woche hat mich nie einer gehalten — und dann wars nur Gnade und Barmherzigkeit! Ich kann weder Kurzschrift noch Schreibmaschine und meine Handschrift ist unerträglich schlecht.«
»Warum lernen Sie denn nicht?« fragte Tewes.
»Ich habs versucht — es geht nicht,« jammerte der Unglücksmensch und streckte seine kleine Hand vor mit den wurstigen Fingern. »Ich bekomme den Schreibkrampf, sowie ich eine halbe Stunde dabei bin. Wohl dreißig Berufe habe ich nun hier versucht. Ich war Geschirrwäscher — mehr als einmal — aber ich bin so ungeschickt, daß ich mehr zerschlage, als ich verdiene am Tag. Als Plakatträger habe ich mir die Sohlen durch- und die Füße wundgelaufen. Ich war ›Grüßaugust‹ in einem Restaurant — das war gut bezahlt und ich hätts durchgeführt, so beschämend es war. Aber der Wirt mußte mich wegschicken, einem Teil seiner Gäste gefiel ich zwar, die lachten über mich, aber die andern behaupteten, daß sie nicht essen könnten, wenn ich als lebendes Tartarbeefsteak da auf und ab wandle.«
»Sprechen Sie Englisch?« forschte der Redakteur.
Ein neuer Stoßseufzer kroch aus des Referendars Lippen. »Ja — ja! ich kann alles lesen und verstehn und sprechen. Aber ich habe mir in der Südsee das verdammte Pigeon so angewöhnt, daß mich jedermann hier auslacht. Das kostet mich schon drei Stellungen. Die Leute meinen, wenn sie einen Nigger haben wollten, da würden sie lieber gleich einen echten nehmen. — Ich war auch Nachtwächter und Ausrufer und —«
Frank Braun unterbrach ihn gereizt. »Schon gut, wir wissen, was Sie alles waren.« Aber gleich wieder bedauerte er seinen schroffen Ton, fügte hinzu: »Ehe ich im Sommer fortfuhr, meinte Dr. Ulrich von der Deutschwehr, daß er Sie vielleicht verwenden könne — wir können ihn mal anfragen.«
»Er hat mich schon verwandt —« stöhnte der Referendar. »Er hat mich nach Rochester geschickt, da sollte ich die neugegründete Deutschwehr organisieren. Es ging ganz gut, ich habe Propaganda gemacht, viele Mitglieder geworben, war bald sehr beliebt an allen Stammtischen. Aber —«
»Nun, Sie Unglücksrabe,« rief der Tewes, »worüber sind Sie gestolpert?«
Drei Seufzer — und ein langes verzweifeltes Schlucken. »Ich mußte Reden halten. Hier ist meine Rede —« Er nahm ein Manuskript aus der Tasche, fegte damit in der Luft herum. »Sie ist so gut wie jede andere. Aber es ging doch nicht — ich kann die Rampe nicht vertragen. So wie ich oben stand, bekam ich kindische Angst — und als ich endlich doch den Mund auftat — war es ein elendes Stottern. Die Leute lachten seelenvergnügt; endlich nahm einer meine Bogen und las meine Rede ihnen vor. Geschadet hat es nichts in Rochester — sicher nicht — aber ich muß Dr. Ulrich recht geben, wenn er meint, daß ich zur Propagandaarbeit unfähig sei: dazu muß man eben reden können.«
»Ja, Mensch,« lachte der Tewes, während er ihm eine Zigarre gab, »was können Sie Prachtexemplar denn eigentlich? Was haben Sie gelernt?«
»Ich — bin — Referendar,« hauchte der arme Teufel. Er nahm seine Visitenkarte heraus und gab sie ihm. »Referendar Christoph Frylinghuis, bitte. Ich war aktiv in Marburg bei den —«
Der Journalist warf einen Blick auf die Karte. »Wissen Sie, Mensch, Sie müssen sich Doktor nennen — so fängts mal an. Wenn Sie mit dem Gesicht hier herumlaufen, ohne den Doktortitel, hält jeder Sie für einen verbummelten Studenten — das flößt Mißtrauen ein.«
»Aber ich habe mein Doktorexamen nicht gemacht,« meinte der Referendar.
Der Tewes rief: »Gemacht — nicht gemacht — was kommts darauf an! Bilden Sie sich ein, daß Sie hier jemand nach den Papieren fragt?«
Der andere antwortete — und zum ersten Male klang ein wenig Festigkeit aus seiner Stimme: »Nein — das tu ich nicht. Das wäre Schwindel.«
»Wie es Ihnen beliebt!« höhnte der Journalist. »Haben Sie noch nicht bemerkt, daß dies ganze Land nur vom Schwindel lebt? Wenn man nichts hat und nichts ist und nichts kann — wie Sie — und dazu sich noch den Luxus leisten will, jeden kleinen Schwindel stolz zurückzuweisen — so wird mans erstaunlich weit bringen in Neuyork! Das können Sie mir glauben.«
»Aufs Wort glaube ichs Ihnen,« sagte der Referendar, »bis in die Knochen bin ich davon überzeugt.«
Er wandte sich an Frank Braun. »Herr Doktor, darum kam ich heute nachmittag zu Ihnen. Ich weiß, daß ich Ihnen lästig falle, ich weiß es! Sie haben mir so oft geholfen —«
»Wieviel brauchen Sie?« unterbrach er ihn.
»Nein, das ist es nicht —« antwortete der andere. »Mit dem Gelde, das ich auf der Farm verdiente, habe ich gerade meine Wäsche bezahlen können. Eine Schlafstelle habe ich nicht — keinen Cent in der Tasche — und seit gestern noch nichts gegessen —«
»Lassen Sie gleich ein paar Butterbrote machen,« wandte sich Frank Braun an Rossius. »Danke,« sagte der Referendar. »Aber, wie gesagt, das ist es nicht! Und wenn Sie mir wieder Geld geben — so ist es doch in wenigen Tagen alle. Und wenn Sie mir eine neue Stellung verschaffen, so werde ich doch nach vierundzwanzig Stunden weggejagt. Herr Doktor — ich — ich —«
Er schluckte, druckste und schluchzte. »Ja, was wollen Sie denn; Herr Frylinghuis?« fragte Frank Braun.
Der Referendar riß sich zusammen. »Sie — ich —« begann er. »Ich bitte Sie, ich flehe Sie an, Herr Doktor, besorgen Sie mir einen Paß! Ich habe gedient, ich bin Vizefeldwebel — und sie würden mich als Leutnant einstellen — da kann ich was tun — da drüben! Hier geh ich zugrunde —«
Der Tewes schlug eine laute Lache auf. »Sie — Sie wollen nach Deutschland? Und wenn Ihnen der Präsident eigenhändig den schönsten Yankeepaß ausstellen würde und seinen Namenszug noch obendrein beglaubigen ließe von seinem Vorgesetzten, König Georgs Gesandten — so würden Sie mit Ihrem Gesicht doch sicher nicht in Deutschland, sondern nur in einem englischen Gefangenenlager ankommen! Mit den Schmissen sind Sie ein deutscher Student und bleiben es bis an Ihr seliges Ende. Wir haben ja die Bestimmungen der britischen Seeoffiziere, die die Dampfer untersuchen, Doktor, zeigen Sie ihm die doch! Gleich auf der ersten Seite stehts, daß sie jeden festnehmen sollen; der ›deutsche Quernarben‹ im Gesicht hat — ganz ohne Rücksicht auf alle Papiere. Und Sie, Herr, haben Schmisse für Zwanzig — deutsche Quernarben, wie es die Engländer so hübsch nennen. Nein, Herr, nein! Wir sparen das Geld nicht, und benutzen — trotz Ihnen — jeden großen und kleinen Schwindel und jeden Kniff und Pfiff — um Offiziere hinüberzuschaffen und alle, von denen wir glauben, daß sie Deutschland drüben von Nutzen sein können. Aber wir haben keinen roten Cent übrig, um dem englischen Saupack einen Gefangenen mehr zuzuschanzen!«
Der alte Diener kam herein, brachte einen Teller mit Butterbroten. »Hier ist auch die neue Kupferschnur für den Kochapparat!« sagte er.
»Danke,« sagte Frank Braun, »diesmal hat die alte noch gehalten.« Er nahm die braune Schnur, spielte damit. »Sie müssen sich trösten, Herr Frylinghuis, mit der Reise ists nichts, das müssen Sie einsehn. Bitte — greifen Sie zu!«
Der Referendar schlang die Schnitten hinein. »Natürlich sehe ich es ein,« stöhnte er. »Ach — die Schmisse! Einmal habe ich ausgepaukt — achtzehnmal haben sie mich abgestochen. Und gebuttert hats bei mir — jedesmal — wie bei keinem andern. Aber gestanden habe ich, Doktor, gestanden —«
»Wie ein Fels im Meer!« spottete der Redakteur.
»Lachen Sie nicht,« bat er mit vollen Backen kauend, »es war wirklich so. Sie hätten mich zu Mus hacken können — und ich hätte doch nicht gezuckt. Ich war dreimal Zweiter — Fechtwart, wissen Sie — obwohl ich, mit dem kurzen Flügel, der elendesten Stöpsler im ganzen S. C. war. Noch Semester nach mir sagten sie in Marburg: ›Der steht wie der Frylinghuis‹.«
»Mich haben sie nie zum Zweiten gemacht,« sagte Frank Braun nachdenklich. »Obwohl ich ein sehr guter Fechter war, manchmal, wenn es gerade mein guter Tag war. Sagen Sie mal, Frylinghuis, haben Sie jemals Blut geleckt auf der Mensur?«
»Blut geleckt?« wunderte sich der andere. »Was meinen Sie damit?«
»O — was ich sage,« fuhr Frank Braun fort. »Auf meiner dritten Fuchsmensur war es, auf der ich mich zum Burschen pauken sollte. Der Preuße schlug mir die Temporalis durch, und das Blut floß warm über die linke Wange. Da vergaß ich, daß ich den Schläger in der Hand hielt. Ich sah nichts — aber ich fühlte, wie rot das Blut floß, so rot und weich und warm. ›Bist du verrückt,‹ zischte mein Leibbursch, der mir sekundierte, ›mach die Klappe zu! Steck die Zunge rein!‹ — Da merkte ich erst, daß ich Blut leckte. Ich tat, wie er sagte — aber sie kam doch wieder heraus, die Zunge — das Blut zog sie an. Und ich stand sehr schlecht auf dieser Mensur — wie ein Schwein, sagte mein Leibbursch.«
»Und das haben Sie immer so gemacht?« fragte der Referendar.
»Immer? Nein!« antwortete er. »Ich sagte ja, daß ich sehr gut focht, oft genug, manchen abstach auf Durchzieher und Hakenquart. Aber dann zuweilen — kam es wieder — ohne daß ichs wollte und wußte. Dann leckte ich Blut, vergaß völlig, wo ich war und was ich tat. Sagen Sie mir, Tewes, wenn ich jetzt ganz plötzlich ausholen würde, um Ihnen mit dem Messer auf den Kopf zu schlagen — was würden Sie im Augenblick tun?«
»Im Augenblick?« antwortete der Journalist. »Nun die erste Bewegung würde vermutlich die sein, den Arm hochzureißen, um den Schlag aufzufangen.«
»Das war genau das, was ich einmal tat auf der Mensur,« sagte Frank Braun, »als ich trunken war von meinem eigenen Blut. Ich riß die linke Hand aus dem Gürtel vom Rücken, warf sie hoch —«
»Was?« rief der Referendar entsetzt. »Was? Das ist ja scheußlich! — Sie wurden doch hoffentlich hinausgeklebt?!«
»Natürlich!« lachte Frank Braun. »Umgehend — solche Scherze darf man sich nicht erlauben auf unsern Mensuren: elendes Kneifen nennt man das! Dimittiert wurde ich, auf unbestimmte Zeit — wie es sich gehört. Und sie gaben mir die drei schwersten Partien, die sie finden konnten, um mich wieder reinzupauken. O ja — Blut lecken trägt wenig bei zu einem guten Stehn auf der Mensur.«
»Das will ich meinen!« nickte der Referendar mit tiefster Überzeugung. »Mir wäre so etwas nicht passiert.« Aber dann, plötzlich, brach sein bißchen Selbstbewußtsein wieder zusammen. »Was nutzt mir heute mein gutes Stehn!« sagte er kläglich. »Herrgott, was mache ich nur? Was soll ich anfangen?«
»Nichts kann man mit Ihnen anfangen,« höhnte der Journalist. »Hier nimmt keiner Unterricht im — Stehn!«
Frank Braun sagte: »Hängen Sie sich auf.« Das kam aus seinen Zähnen, ohne daß er es wollte. Er dachte es so — und sprach es zugleich. Es klang ernsthaft — das tat ihm leid im Augenblick. Und dennoch wiederholte ers, betonend und sehr bestimmt: »Hängen Sie sich auf. Das ist das einzige, was Ihnen übrig bleibt.«
Der Referendar zog die Brotschnitte vom Munde. Er starrte ihn an, stammelte: »Ist das Ihr Ernst, Doktor? Ist das wirklich Ihr Ernst?«
Frank Braun hielt seinen Blick.
Etwas riß ihn, zog ihn vorwärts. Es war ihm, als ob er auf der Bühne stände, als ob er dem Publikum — seinem Sekretär und dem Journalisten — etwas vormachen müßte. Zeigen, was er könne, welch ein Mensch er sei: der andere beherrsche, niederzwinge zu seinen Füßen, sie zu Sklaven mache und zu willenlosen Geschöpfen, zu Spielzeugen für seine frivolsten Launen.
»Lieber Herr,« begann er, »haben Sie denn selbst nie daran gedacht? Sie sind Korpsstudent — sind Offizier — ist Ihnen denn jede Ehre und Selbstachtung schon so verloren in diesem Lande? Der Krieg wird noch Jahre dauern, das wissen Sie so gut wie wir, Sie können nicht hinüber — nie! Und ebensowenig werden Sie hier etwas finden. Sie sind unfähig — zu allem — was sich auch denken läßt.«
»Ja — ja —« stöhnte der Referendar.
»Was nutzt das Heulen?« fuhr er fort. Unerbittlich klang seine Stimme, schneidend und scharf. »Sie müssen sich klar darüber werden — daß Sie auch nicht die geringste Aussicht in diesem Lande haben. Im allerbesten Falle fretten Sie sich so weiter — bekommen einen jämmerlichen Job für einen oder zwei Tage, der Ihnen ein paar Dollar einträgt, und suchen dann wieder ein paar Wochen herum. Und inzwischen, lieber Herr, leben Sie vom — Bettel! Bleiben Sie nur sitzen, regen Sie sich nicht auf — es ist notwendig, daß Sie einmal den Dingen klar ins Auge sehen. Solange Sie von mir Geld bekommen und von andern. Redakteuren und Stammtischleuten, mögen Sie's Pump nennen — obwohl Sie ja genau wissen, daß Sie nie die leiseste Möglichkeit haben, das Geld je wiederzugeben. Aber einmal hört das auf, nicht wahr? Dann laufen Sie zu den Unterstützungskassen der Pastoren — die Ihnen wieder helfen — bis sie sehn, daß dem Referendar Frylinghuis eben nicht mehr zu helfen ist. Sie wissen ja mittlerweile, was Hunger ist — aber man kann gut einen Tag hungern oder zwei — wenn man die sichere Hoffnung hat, dann jemanden zu finden, der einem die Mittel gibt, sich wieder sattzufressen. Warten Sie nur den Tag ab — wo Sie nirgend auch nur einen Nickel mehr bekommen werden.«
Die dicken Tränen rollten dem Unglücklichen über die Wangen. »Und Sie, Herr Doktor, Sie würden auch mich im Stich lassen?«
»Ich?« antwortete er hart. »Natürlich!« Er wußte, daß er log, daß er diesem Menschen — ob er ihn gleich haßte — dennoch geben würde, wieder und immer von neuem. Aber er fühlte zugleich, daß er sich dieser kindischen Schwäche schämte, dieser albernen Gutmütigkeit, die ihm jedes ›Nein‹ von den Lippen schleckte. Was ging es die Leute an, daß im Kern seines Herzens eine weiche Güte sich breit machte, die mit litt und mit liebte — überall und immer? Hochmütig war er bei alledem — nein, nein, dieser Mensch hatte kein Recht, in seine Brust zu sehn. »Man gibt eben so her,« sagte er, »ich, wie tausend andere.«
»Sie geben mehr weg, als Sie für sich selber gebrauchen!« rief der Referendar. »Ich weiß es, ich weiß es genau.«
Frank Braun zog die Schultern hoch. »Und wenn es so wäre — so tue ichs, weil ich leichtfertig bin und leichtsinnig und keinen rechten Begriff von Geld habe und von allen möglichen Pflichten. Aber sehn Sie, zuweilen habe auch ich einen lichten Augenblick und dann weiß ich, daß es eine Affenschande ist, Ihnen Geld zu geben. Die Dollarnoten, die ich Ihnen gebe, nehme ich andern weg, die sie besser gebrauchen können. Ihren sichern Zusammenbruch schiebe ich um ein paar jämmerliche Tage auf und derweil geht ein anderer zugrunde, der sich leicht hätte hocharbeiten können. Es ist verbrecherisch, Ihnen Geld zu geben.«
Der Referendar wischte die Tränen von den zerfetzten Wangen. Er starrte ihn an, lange, sprachlos, fassungslos. »Sie — Sie wollen — mir nicht mehr helfen?« stotterte er.
Er wollte ›Nein‹ sagen — und es ging nicht. — ›Nun ist es genug,‹ dachte er. ›Nun gib ihm — und du mußt ihm mehr geben diesmal.‹ — Und dann wieder: ›Das ist feige — du mußt ihn fortschicken.‹ — Aber es ging nicht, ging nicht: langsam schob er die Hand zur Tasche, um sein Scheckbuch zu nehmen.
Dann, plötzlich sprang er auf: »Nein!« schrie er. »Nein! Nein! — Hängen Sie sich auf!« Er warf ihm die Kupferschnur hinüber. »Das ist ein prächtiger Strick — hängen Sie sich auf!«
Der Referendar nahm die Schnur vom Boden auf, atmete tief und schwer. Seine Stimme klang weich und still, aber doch seltsam fest. Er sprach: »Sie haben recht — es ist sicher das Beste.« Er spielte mit der Schnur, betrachtete sie lange, sagte dann: »Darf ich mich hier aufhängen, Herr Doktor?«
»Danke schön!« lachte der Journalist. »Das wäre eine schöne Schweinerei. Polizei — Untersuchung und ein großes Geschrei in den Zeitungen — das ist gerade, was uns noch fehlte. Gehn Sie zum Zentralpark heute nacht — Sie werden eine wundervolle Auswahl finden von Bäumen und Laternen.«
»Es ist nur —« sagte der Referendar, »jetzt habe ich Mut.«
Und wieder war es Frank Braun, als ob er vor dem Publikum stehe — irgendeine Phrase mit großer Geste hinauswerfe, deren sicherer Wirkung er gewiß war. Er trat zu ihm hin, schlug ihn leicht auf die Schulter. »Bitte, wie Sie wollen, Herr Frylinghuis. Benutzen Sie Ihre starke Stimmung und meine Räume. Machen Sie sich keine Sorgen, wir werden schon alles ordnen hinterher. — Gehen Sie durch zum Schlafzimmer, dort, neben dem Badezimmer ist mein Ankleideraum. Da sind genug starke Haken in der Decke.«
»Danke,« sagte der Referendar, ganz ruhig und sehr gefaßt. »Darf ich die Butterbrote aufessen? Bitte eine Tasse Tee! Und wenn Sie die Güte hätten, mir noch eine Zigarre zu geben?«
»Bitte, bedienen Sie sich!« erwiderte er. Sie saßen herum; der Referendar aß, trank und rauchte.
»Haben Sie noch irgendwelche Wünsche?« fragte Frank Braun. »Mitteilungen? Briefe?«
»Meine Eltern sind lange tot —« erwiderte der Referendar. »Nähere Verwandte habe ich nicht. Wenn Sie so liebenswürdig sein wollten, an meine vorgesetzte Behörde zu schreiben — und dann an mein Korps.«
»Sehr gerne!« nickte er. »Was soll ich schreiben?«
»O, daß ich tot bin,« sagte der andere. »Nur erwähnen Sie nichts von der Art, bitte.« Ein kleines Lächeln zuckte um seine Lippen. »Er steht wie der Frylinghuis — heißt es in Marburg — das ist doch etwas, etwas. Und ich möchte nicht gerne, daß sie sagen würden: ›Er hängt wie der Frylinghuis‹.«
Dann stand er auf. »Ich danke Ihnen, Herr Doktor. Für alles, was Sie für mich taten. Und auch dafür, daß Sie heute die Augen mir weit öffneten.«
Frank Braun sprach kein Wort. Faßte mit den Zähnen die Unterlippe, biß, biß.
»Leben Sie wohl, meine Herrn!« sagte der Referendar. Er gab jedem die Hand, verbeugte sich, die Hacken zusammenschlagend. Nahm seine Schnur, ging langsam nach hinten.
Rossius sah ihm nach, wandte sich dann, ihm nachzueilen.
»Was wollen Sie?« rief Frank Braun.
»Ihn zurückhalten!« antwortete der Sekretär. »Der tuts wirklich!«
Frank Braun zischte: »Bleiben Sie!«
Der Redakteur lachte: »Wirklich? Der hängt sich ebensowenig auf, wie ich oder Sie! Sie sollen mal sehn, wie nett er wiederkommt nach kurzer Zeit — und dann kostets ein Extraschmerzensgeld.«
Frank Braun antwortete nicht. Er stand, aufgereckt, unbeweglich, mitten im Zimmer; blickte nach hinten.
Das Manuskript der Rede des Referendars lag zwischen den Tassen. Tewes nahm es auf, blätterte darin herum. »Das kann ich gebrauchen für meinen Metzgermeister, fast wie es da ist. — Geben Sie mal Ihren Federhalter, Rossius! Ein paar Striche hinein — dann drei Sätze zum Anfang und ebensoviel zum Schluß — diese Erbschaft spart mir eine halbe Stunde Zeit.« Und er saß schon, verbesserte, strich, schrieb, wie einer, der das Handwerk gründlich kennt. Reichte dem Sekretär ein paar Seiten hinüber. »Da, tippen Sie! Nur die Seiten, die stark korrigiert sind — und die, die gar zu schmutzig sind. Die übrigen bekommt mein Metzgermeister, glatt wie wir sie geerbt haben.«
Von hinten her hörte man einige Laute. Rossius richtete sich auf. »Er singt!« sagte er.
»Talmischwanengesang!« lachte der Redakteur. »Was ist es denn?«
Sie schwiegen, lauschten. Halblaut, aber hell und deutlich genug klang es durch die Räume:
»Bruder sauf einmal! — Du bist ja noch jung!
Im Alter ist zur Knackerei noch immer Zeit genung!
Denn die vollen Gläser sind für junge Leute —
Darum laßt uns heute
Frisch und fröhlich sein!«
Frank Braun dachte: ›Das Leiblied der Hasso-Nassovia in Marburg. Wann hörte ichs doch zuletzt?‹
Und es klang:
»Bruder, rauf einmal! — Du bist ja noch jung!
Im Alter ist zur Kneiferei noch immer Zeit genung!
Denn die langen Schläger sind für junge Leute —
Darum laßt uns heute
Frisch und fröhlich sein!«
Wieder dachte er: ›Der hat nie gekniffen — und wird es jetzt nicht tun. Der hat keine Angst — vor dem Strick so wenig, wie vor dem Schläger!‹
Und der dritte Vers:
»Bruder küß einmal! — Du bist ja noch jung!
Im Alter ist zur Impotenz noch immer Zeit genung!
Denn die hübschen Mädchen sind für junge Leute —
Darum laßt uns heute
Frisch und fröhlich sein!«
»Nicht übel, seine Lebensphilosophie,« nickte der Journalist. »Raufen und Saufen und Küssen — das möchte ich auch lieber, als politischen Mist zusammenschmieren oder für Metzgermeister Festreden hinsauen! O ja — aber man muß darnach gewachsen sein — und du bist es nicht, mein Junge!«
Nun, heller noch, lauter als bisher:
»Bruder, pump einmal! — Du bist ja noch jung!
Im Alter ist zum — —«
Da brach es ab. Etwas fiel um, stieß polternd auf die Dielen.
Tewes lachte laut auf. »Pump einmal — natürlich — das ist seiner Lebensweisheit tiefster Kern! Und er hat vollkommen recht — solange er noch Leute findet wie Sie, Doktor, denen ein bißchen sentimentale Studentenerinnerung das Herz wie Butter weich macht. Ah, ich kenne sie gut, die Alten Herren von Bonn und Heidelberg und Straßburg! Das spielt den Bürger, den lieben, langen Tag und die Wochen und Monate — aber sowie nur einer kommt und schwatzt was von Rheinfahrten und Bummelliedern, von Quodlibet und langen Messern, von Durchziehern und Landesvätern und andern Kösener Herrlichkeiten — da vergessen sie, daß sie Ärzte sind und Zeitungsfritzen und was immer! Da leuchtets aus ihren Triefaugen, da schwabbelts in ihren Schmerbäuchen, kribbelts in ihren Wurstfingern und im fetten Bierherz, pupperts von der alten Burschenherrlichkeit! Und die alten Stinker — hol mich der Teufel — werden weiß Gott jung für fünf Minuten — und besaufen sich an der Handvoll abgegriffener Worte, als ob sie den schönsten Mosel tränken!«
›Schweig doch!‹ dachte Frank Braun. ›Was weißt du davon!‹
Aber der Redakteur höhnte fort. »Die Einleitung war gut — rauf einmal, sauf und küß! Nun kommt er gleich zurück: pump einmal! — Was werden Sie zahlen, Doktor, für die Serenade?«
Nichts kam. Stille blieb es hinten und stumm. Der Sekretär stand auf von seiner Schreibmaschine, machte ein paar Schritte.
»Bleiben Sie!« flüsterte Frank Braun.
»Schreiben Sie!« rief Tewes. »Der Herr Referendar wird herkommen.«
»Er wird nicht kommen!« beharrte Ernst Rossius. Er setzte sich hin, spannte den Bogen ein, tippte ein paar Worte. Sprang dann plötzlich doch auf, rannte schnell durch die Räume.
»Dummkopf!« brummte der Journalist. »Ich brauche mein Manuskript. Wir haben genug Zeit verschwatzt.«
Da scholl des Sekretärs Stimme, schrill, schreiend. »Doktor!« rief er. »Doktor!«
»Was gibts?« gab Tewes zurück.
»Kommen Sie, kommen Sie schnell!« klang es wieder.
Sie gingen durch die Zimmer mit raschen Schritten. In der Ecke hing er, zwischen den Kleidern, die Fußspitzen nur wenige Zoll vom Fußboden. Neben ihm lag ein umgestoßener Stuhl.
»Ein Messer!« verlangte der Sekretär. Aber Tewes sagte: »Nein — Sie können den Draht nicht rasch genug durchschneiden. Schieben Sie den Stuhl heran.«
Sie hoben ihn auf, stellten ihn auf den Stuhl, hielten ihn fest, lockerten die Schlinge am Halse. Rossius nahm einen zweiten Stuhl, stieg hinauf, löste oben die Schnur vom Haken. Und Sie stellten ihn auf den Boden hin.
Er kam zum Bewußtsein, nach wenigen Minuten schon. Taumelte, schwankte, hielt sich an der Wand, vergrub den Kopf in die Arme. Begriff dann — wandte sich um mit einem Ruck.
»Lumpen!« brüllte er, »Lumpen! Warum habt ihr mich nicht hängen lassen!«
Er schlug um sich, wild, rasend, mit beiden Fäusten, schrie, tobte wie ein Besessener. Traf Frank Braun mit einem guten Faustschlage über Schläfe und Auge, stieß einen wuchtigen Tritt gegen das linke Bein des langen Journalisten.
»Danke,« schrie der, »das traf! Immer sanft, mein rasender Roland!«
Da faßte ihn Rossius von hinten, klammerte sich fest mit beiden Armen um seinen Leib.
»Laßt mich los, ihr Hunde!« kreischte der Referendar. »Laßt mich los.«
Der Sekretär hielt ihn gut und der lange Tewes griff seine Hände und hielt sie fest. »Schrei dich nur aus, mein Junge,« lachte er, »das erleichtert.«
Noch rang er, noch versuchte er sich loszureißen. Aber die wilde Kraft des Augenblicks verließ ihn bald, müde sank sein Kopf zur Brust, seine Beine schlotterten, als wollte er umsinken. So führten sie ihn, schleppten ihn mehr, nach vorne, setzten ihn in den großen Ledersessel.
Frank Braun schellte seinem Diener.
»Wollen Sie Wein?« fragte er den Referendar. Der stöhnte: »Whisky —«
Man gab ihm Whisky, und er trank, ohne Wasser, in großen Zügen. Er sprach kein Wort, saß für sich allein, trank, grübelte.
Der Sekretär setzte sich an die Schreibmaschine. Hinter ihn trat der Journalist, diktierte ihm halblaut. Frank Braun ging ins Badezimmer, kühlte das rasch geschwollene Auge.
Dann kam er zurück, setzte sich neben den Referendar, gab ihm eine Zigarre, reichte ihm Feuer. Der tat ein paar tiefe Züge.
»Was haben Sie da?« fragte Frylinghuis plötzlich.
»Sie haben ihn abgestochen!« lachte der Redakteur. »Die erste glatte Abfuhr, die Sie in Ihrem Leben ausgeteilt haben — sie hat wundervoll gesessen.«
Da reckte sich der andere. Und er lachte, ein stilles Lachen, kindlich, gutmütig, fröhlich fast. »Schade, daß —« begann er. Aber er sprach es nicht aus.
Tewes nahm es auf. »Schade, daß ich nicht auch eine Abfuhr mit bekam, was? Na — vielleicht das nächste Mal! Und nun — wie fühlen Sie sich?«
»Danke,« sagte der Referendar. Stand auf, machte ein paar Schritte durchs Zimmer. Dann setzte er sich wieder, hob sein Whiskyglas, führte es zum Munde. Aber er trank nicht, stellte es wieder auf den Tisch.
»Und jetzt?« rief er. »Und jetzt?«
Frank Braun füllte einen Scheck aus, gab ihn ihm. »Versuchen wirs noch einmal,« sagte er. »Bitte — nehmen Sie! Und — gehn Sie nun.«
Der Referendar nahm das Papier, schob es in die Tasche, dankte. Suchte seinen Hut, reichte allen die Hand, verbeugte sich. »Verzeihn die Herrn die Störung,« sagte er.
Dann ging er.
Der Journalist summte: »Bruder — pump — einmal!« Dann fragte er spöttisch: »Na, wieviel, Doktor?«
»Was gehts Sie an?« rief Frank Braun.
»Narr!« spuckte der Tewes. »Buttergelber Narr! Drei Stellen — was? Schämen sich wohl, die Ziffer zu nennen? Na, wenigstens haben Sie die Quittung zuvor bekommen — und können hübsch damit paradieren: eine Woche lang und mehr.«
Dann ging er ans Telephon.
»Wen wollen Sie anrufen?« fragte Frank Braun.
»Den Deutschen Verein in Newark — wo Sie reden sollen morgen!« rief der Redakteur. »Absagen für Sie, wenn Sie nichts dagegen haben. Und dann will ich Dr. Hertling anklingeln, daß der für Sie einspringt. Denn so können Sie nicht vors Publikum treten, lieber Herr, so nicht!«
Der Journalist hatte recht. Sein Auge schwoll auf, wurde rot und blau erst, dann gelb und grün — sein Sekretär stellte jeden Morgen sachkundig eine neue Farbenmischung fest.
»Regenbogig ists heute, Doktor!« lachte er. »Wissen Sie, daß Sie mächtig gewonnen haben in den Augen unserer Detektive? Die fragten natürlich — da habe ich ihnen erzählt, daß Sie im Athletikklub mit Jess Villard geboxt und ihm drei Runden gestanden hätten. Die Kerls waren ordentlich stolz auf Sie. — Haben Sie noch was zu tun für mich heute morgen? Sonst will ich zur Staatszeitung fahren — da brauchen sie mich.«
»Fahren Sie,« antwortete er. »Kommen Sie zur Teezeit wieder.«
Das Telephon rief; er sprach mit Ivy Jefferson ein paar Minuten. Nein, er könne nicht mit ihr ausreiten — morgen auch nicht. Er würde sich schon melden, wenn er sich wieder sehn lassen könne.
Dann war es Lotte van Neß, die ihn anrief. Und wieder sagte er: nein — und nein! Er ginge wirklich nicht — sie möge herkommen, wenn sie wolle.
Es war ihm ganz lieb, daß er zu Hause bleiben mußte diese Woche. Er lag auf dem Diwan, stundenlang, grübelte über die müde Leere, die ihn wieder faßte. Dachte nach, was es wohl sein möchte — und was er wohl tun könnte dagegen. Und immer wieder kam ihm der Gedanke an den anonymen Brief — irgendein Gift, dachte er. Und: von Frauen kommt es.
Sein Diener meldete Frau van Neß. Aber sie kam nicht allein; Dr. Samuel Cohn war mit ihr. Das war auch einer nach Lotte Lewis Herzen: deutsch und jüdisch zugleich. Ein guter Einschlag ins Phönizische, so mochte ein reicher Rheder in Karthago ausgesehn haben. Dieses Wellenhaar und die runden, großen Augen, ein bißchen kurzsichtig. Wulstige Lippen über großen, blanken Zähnen, weißgelblich die Haut und ein wenig ungesund — das verlangte Sonne. Sehr fleischig, überfettet fast — nicht genug Bewegung. Ungepflegt dazu — ein junggeselliger Vierziger — der eine Frau brauchte, die für ihn sorgte. In Neuyork geboren, aber deutsch in Erziehung und Empfinden — deutsch auch in seiner Kultur, viel mehr als jüdisch. Sehr gesucht als Arzt und nicht weniger als Redner bei allen Gelegenheiten in ganz Neuyork. Klug und gescheit — und gut dazu.
»Bleiben Sie ruhig liegen,« sagte er. »Nun, was macht das Auge?«
»Es spielt Chamäleon!« antwortete Frank Braun. »Sehr liebenswürdig, daß Sie herkommen, Doktor, aber es ist wirklich nicht nötig. Kühlen — nicht wahr — mit essigsaurer Tonerde —«
Aber Frau van Neß unterbrach ihn. »Ich habe ihn gebeten, mitzukommen. Er soll dich untersuchen.«
Frank Braun sah ihn an, schüttelte den Kopf. »Das ist der Neunte nun, Lotte, bei aller Hochachtung vor Dr. Cohns Kenntnissen — glaubst du wirklich, daß er mehr findet, als die andern?« Er seufzte, ließ sich zurückfallen in die Kissen. »Bitte, untersuchen Sie nur, wenns sein soll!«
Der Arzt ging an seine Arbeit, machte sie gewissenhaft genug. Sprach wenig, fragte nur die notwendigen Fragen. »Das ist ganz gewiß,« schloß er, »ihr Körper ist völlig gesund, innen und außen. Da das blaue Auge — und dann natürlich der chronische Rachenkatarrh vom Zigarettenrauchen.«
»Ich soll weniger rauchen,« rief Frank Braun, »wirklich, ich weiß es!«
»Das können Sie halten, wie Sie wollen,« erwiderte der Arzt. »Mit dem Raucherhusten können Sie dreimal dreihundert Jahre alt werden. Aber wolln Sie mir bitte noch einige Auskunft geben.«
»Fragen Sie nur,« antwortete er.
Ob er jemals Malaria gehabt habe? Wann und wo?
Ja, vor manchen Jahren einmal, in Singapore und Colombo, aber er habe nie wieder einen Rückfall gehabt, in den Tropen nicht und nicht in gemäßigtem Klima. Ob der Anfall stark gewesen sei? Ja, sehr stark. Womit behandelt? Mit Chinin natürlich — mit mächtigen Dosen. Ob er wisse, wo er die Krankheit erwischt habe?
Er sann nach. Zum Ausbruch gekommen war sie auf dem Lloyddampfer — aber bekommen hatte er sie wohl in der Südsee.
Wo? — In Neuguinea.
Ganz harmlos klang es: »Ach, da waren Sie auch? Davon müssen Sie mir erzählen gelegentlich. Sagen Sie doch, gibts dort noch richtige Kannibalen, Menschenfresser? Haben Sie jemals welche gesehn?«
Frank Braun lachte. »Obs da Menschenfresser gibt? Soviel Sie haben wollen — überall in Neuguinea, Neu-Mecklenburg, Neu-Pommern, Bugainville und Buka. Jeder einzelne Papua und Kanake von jedem Stamme wird Ihnen ganz bestimmt alle heiligsten Eide schwören, daß er niemals Kai-Kai gekostet habe — Menschenfleisch ist das. Aber jeder wird gleich hinzufügen, daß der Nachbarstamm nichts Besseres kenne. — Doch kannibalisch sind alle Stämme, wenn sie nur die Gelegenheit haben, ungestraft solche Leckerbissen zu genießen.«
»Alle!« fragte der Arzt. »Meinen Sie wirklich, daß jeder einzelne dort Menschenfleisch frißt, wenn er's kriegen kann?«
»Alle Stämme sagte ich,« antwortete Frank Braun. »Die Missionare behaupten, daß es in jedem Stamme immer nur einzelne Individuen seien, die auf diese Delikatesse schwören, während manche andere desselben Stammes sie nicht anrühren würden. Der Geschmack ist eben verschieden — selbst im Menschenfresserlande.«
»Hm,« machte der Arzt, »ich habe da neulich in der Zeitschrift für Tropenkrankheiten einen ganz interessanten Aufsatz gelesen. Der Verfasser behauptet, daß diese Wilden, die solch unstillbaren Hunger nach Menschenfleisch haben, an einer Krankheit litten — die in ihren Symptomen in etwas der Malaria gleiche. Es läßt sich nicht leugnen, daß die Symptome mit denen Ihres Leidens einige Ähnlichkeit haben.«
Frank Braun lachte hell auf. »Sie sind entzückend, Doktor!« rief er. Das ist Neuyork — das ist echt amerikanisch! Aber, leider Gottes, habe ich nie den leisesten Appetit auf Menschenfleisch gehabt. Sagen Sie mir, ist der Verfasser Ihres Aufsatzes auch ein Amerikaner?«
»Nein,« erwiderte der Arzt, »es ist ein Deutscher, Professor an dem Institut für Tropenkrankheiten in Hamburg; er war lange Jahre in der Südsee. Sie sollten auch nach Hamburg gehn — da ist der einzige Platz in der Welt, wo man ein klein wenig versteht von diesen merkwürdigen Tropenleiden.«
»Danke für das gute Rezept,« lachte Frank Braun. »Ich werde es benutzen, sowie die Herrn Engländer den Weg zur Apotheke freigeben. Von welchem Insektenstich stammt denn Ihre Kannibalenmalaria?«
»Von gar keinem Insekt,« antwortete Dr. Cohn. »Der Hamburger Arzt behauptet, daß sie von einer Art Fledermaus herrühre, von irgendeinem fliegenden Hunde, der im Schlafe seine Opfer überfällt und mit kleinstem Biß sich eine Öffnung schafft, um Blut zu saugen. Es klingt phantastisch genug, daß dieser Biß nicht nur ähnliche Folgen haben solle, wie der Stich der Anopheles, sondern auch den Durst und Hunger nach Menschenblut und Menschenfleisch erwecken solle. Aber unmöglich klingts nicht, wenn man weiß, was ein Stich der Tsetsefliege, ein Biß von Schlangen oder tollen Hunden alles hervorbringen kann. Da sind fixe Ideen und Wahnvorstellungen aller Art gar nichts Außergewöhnliches.«
Frank Braun horchte auf, wurde stutzig, schwieg; warf dann einen langen Blick auf Lotte van Neß. Sagte endlich lauernd:
»Was hältst du davon, Lotte?«
»Ich weiß nicht,« antwortete sie.
Das stärkte sein Mißtrauen. »Sag mir, warst du nicht auch in Neuguinea, mit deinem Mann?« fragte er.
»Nein,« sagte sie. »Wir kamen mit einem englischen Dampfer von Neuseeland herauf. Waren auf den Hebriden, auf den Salomoninseln — fuhren dann gleich durch nach Yokohama.«
»Ah —« nickte er. »Also in der Südsee warst du? Hast du auch Malaria gehabt?«
Sie sah ihn seltsam an, ihr Auge schimmerte in überlegenem Lächeln, ihre Lippen zogen sich hinauf, zuckten leise. »Nein,« sagte sie leichthin, »nie!«
Aber er dachte: ›Du lügst!‹ — Er wandte sich wieder an den Arzt. »Glauben Sie, daß diese seltsame Krankheit ansteckend ist? Auch von Mensch zu Mensch?«
Dr. Cohn wiegte den Kopf. »Möglich — oder auch nicht: ich habe keine Ahnung. Hier wirds Ihnen keiner sagen können — dazu müssen Sie schon hinüberfahren.«
Frank Braun nickte zustimmend. »Ja, drüben wissen sie's sicher! Sagen Sie mal, Doktor, deucht Sie nicht, daß ganz Europa von dieser Krankheit befallen ist und ein guter Teil der andern Welt noch dazu? Es kommt mir nämlich so vor. Wie wäre es, wenn Sie Ihre Theorie den Völkern der Erde bekannt gäben — vielleicht in einem Briefe an die ›Times‹ oder die ›World‹ oder ›Sun‹? Den Deutschen und Engländern, Russen, Franzosen, Türken und der ganzen Gesellschaft kund und zu wissen täten, daß das alles nur ein bedauerlicher Irrtum sei, nur die Folgeerscheinung einer sehr ansteckenden Südseekrankheit, die kannibalistische Gelüste erwecke und sie zwänge, sich gegenseitig aufzufressen? — Wenn die Völker das einsehn, ist morgen der Krieg zu Ende, und alles zieht regimenterweise nach Hamburg zum Institut für Tropenkrankheiten, um sich impfen zu lassen. Ihnen aber, Doktor, und Ihrem erleuchteten Kollegen von der Alster wird Frau van Neß ein Denkmal setzen lassen, vor den Hamburg-Docks in Hoboken — nicht wahr, Lotte?«
Sie sagte: »Nimm dich zusammen, ich bitte dich! Kannst du nicht ernsthaft bleiben?«
Er trat dicht vor sie hin, sah ihr scharf ins Auge, sagte: »Du kennst mich lange genug, Lotte Lewi. Du solltest wissen, daß ich nie ernsthafter bin, als wenn ich so scherze.«
Aber sie blickte weg, zuckte die Achseln. »Wie du willst.«
Er trat ans Fenster, trommelte an den Scheiben. ›Das ist es,‹ dachte er, ›das!‹
Aber was denn nur? Was? Er strengte sein Hirn an, fand nichts. Keine Zusammenhänge, keine Übergänge, weder Ursachen, noch Folgen — nichts! Er war krank — ja — fühlte sich müde — leer — ausgepreßt, wie eine Zitrone. Also mußte etwas da sein, das das alles schuf — das ihn aussog und austrank.
Lotte — Lotte Lewi? Die ihn liebte durch alle die Jahre, mehr als je eine andere Frau? Es war lächerlich und absurd.
Und doch wuchs in ihm dieses starke Gefühl: es hat mit ihr zu tun. Irgendwie hängt es zusammen mit dieser Frau — oder nicht allein mit ihr nur — o nein — mit andern auch —
Er trat zurück zu den beiden, die ruhig miteinander sprachen.
»Verzeihung, Doktor,« sagte er. »Ich wollte Sie nicht verletzen.«
Dr. Cohn gab ihm die Hand. »Vielleicht tritt ein neues Symptom auf, das uns einen Fingerzeig geben könnte. Dann lassen Sie's mich wissen!«
Er verabschiedete sich, herzlich und warm; Frank Braun geleitete ihn zur Türe.
Als er zurückkam, trat die Frau schnell auf ihn zu:
»Du hast einen Verdacht!« sagte sie. »Auf mich.«
Er antwortete: »Ja — auf dich.«
Schneidend klang ihr Lachen. »Auf mich! — Du?!« Dann nahm sie seine Hand, fuhr ruhig fort: »Sag mir, welchen?«
Er ließ ihr die Hand, die ihre Finger streichelten. »Welchen? Welchen —? Ah — ich weiß es nicht.«
In dieser Nacht wachte er auf, hell wach, völlig klar im Augenblick. Er drückte auf den Knopf, hielt seinen Finger darauf, minutenlang. ›Ich muß sehr gründlich schellen,‹ dachte er, ›sonst wacht der alte Esel nicht auf.‹ Dann kam der Diener, in Hemd und Hose, sehr verschlafen; fragte nach seinem Begehr.
Ja, was wollte er denn eigentlich? »Bringen Sie Wein,« sagte er, »von dem, den wir letzte Woche bekamen. Ich will ihn versuchen.«
Es war schwül in dieser Nacht. Doch hatte er keinen Durst. Er stand auf, warf den Kimono über, ging in sein Arbeitszimmer, trat an das offene Fenster. Der Mond war hinter den Steinmauern, aber er sah seinen Glanz in der bleichen Straße. Sehr still war es.
Dann kam der Diener zurück, im Frack diesmal und im steifen Hemde. Hielt mit beiden Händen die Silberplatte, auf der die Flasche stand und ein Glas.
Frank Braun setzte sich in den Lehnsessel, »Schenken Sie ein, Fred!« sagte er.
Der Wein war kühl, spritzig und voller Blume. ›Saarwein,‹ dachte er, ›Maximin Grünhäuser‹. Er sah auf das Etikett, freute sich, daß er richtig geschätzt hatte.
Unbeweglich stand der Diener neben ihm, wie aus Wachs, farblos und bleich. »Warum sind Sie nicht rasiert, Fred?« fragte er. Wartete nicht auf Antwort; fügte hinzu: »Es ist gut — Sie können zu Bett gehn.«
Er hörte die weichen Schritte des Alten, hörte die Türe leise schließen. Er trank sein Glas aus, stand auf, setzte sich an den Schreibtisch.
Etwas trieb ihn, die Feder zu greifen, den Block zu nehmen, zurechtzuschieben. Etwas diktierte, sagte: ›Schreib!‹
So schrieb er.
Die Geschichte vom weißen Wolf.
Da waren viele starke Wölfe, wo der Forst aufstieg zum Hochgebirg. Wo der Fluß herabsprang über felsiges Geröll, wo die Eichen aufhörten und die Kiefern standen und Föhren. Wo die Krähenschwärme die Bäume weiß färbten, wo die schwarzen Vögel den Falken jagten und zu Tode schlugen hoch oben im Äther.
Viele Wölfe, junge und alte. Graue und braune, gelbe auch, ein großes Volk, das das Land beherrschte, wie die Krähen die Luft. Mit denen teilten sie ihre Beute, oft genug, ließen ihnen den Rest des Mahles, wenn sie satt waren.
Einer war unter ihnen, ein weißer.
Er kam zur Welt wie sie und wuchs auf wie sie. Sog an der Mutter Zitzen, fraß das rote Fleisch, das sie brachte — wie seine Brüder. Wurde groß und stark — sprang aus mit ihnen zur Jagd. Wie alle andern.
Aber er war weiß. Gelb waren sie alle und grau und braun — dieser war weiß. Ohne einen Fleck — weiß.
Sie mochten ihn nicht, keiner. Sie sagten, daß er ein Lamm sei, das die Wölfin gefunden habe am Waldesrand. Mitgeschleppt zum Bau — nachdem sie seinen Vater gefressen, den blökenden Hammel, und seine Mutter, das zitternde Schaf. So satt habe sie sich gefressen, so voll und rund, daß sie kein Schaffleisch mehr habe anrühren mögen auf Wochen hinaus. Da habe sie ihn großgesäugt mit ihren Jungen.
Nun habe er Wolfsmilch gesogen und sei groß geworden und stark. Aber ein Lamm sei er doch — ein weißes Bählämmchen — und sei nur auf der Welt, weil die alte Wölfin so übervoll sich gefressen.
Wenn sie ein Reh erjagt hatten, oder eine Hirschkuh, wenn sie herumsaßen und lagen um das verendete Wild, gierig den scharfen Zahn einhieben, das Fell zerrissen und die Lefzen blutig färbten, dann schnappten sie nach ihm, bissen ihn weg. Und ein alter Wolf, ein sehr dunkler, sagte, ihn nähme er nicht mit zur Jagd, ihn nicht. Er leuchte durch die Büsche — das bringe Unglück.
Einmal, als sie laut bellend einen Hirsch jagten, er und zehn andere, über die Wiesen hetzten zu dem reißenden Wasser, wo er nicht weiter konnte, als sie im engen Halbkreise den Starken umlauerten, der mit gesenktem Haupte vor ihnen stand, die mächtigen Waffen zu gutem Stoße bereit, spielten die andern dem Weißen einen Streich. Sagten, er soll von vorne kommen, solle tun, als ob er springen wolle, daß der Hirsch allein nur auf ihn achte. Dann wollten sie den anfallen, von den Seiten und von hinten, sich an seinen Hals hängen, ihm die Adern zerbeißen —
Er tat, wie sie ihm sagten. Aber der alte Hirsch kannte das Spiel, ließ keinen aus den Augen, drehte das mörderische Geweih im Halbkreise von rechts nach links, hin und wieder zurück. — Sie bellten den Weißen an, daß er feige sei, sich hübsch zurückhalte, wo es sicher sei, daß er nicht wage heranzukommen. Ein Lamm sei er, und kein Wolf, das wisse man lange, ein weißes Lämmchen! Und sie hetzten ihn: er solle doch springen, wenn er Mut habe.
Da sprang er mit offenem Rachen geradezu auf den Feind. Der faßte ihn gut, nahm ihn hoch auf die spitzen Waffen, schleuderte ihn weit durch die Büsche. Wandte sich dann, dampfend und röhrend, gegen die andern: die flohen und jagten davon.
Lange lag der weiße Wolf zwischen dem dichten Laub, färbte das grüne Moos rot mit seinem Blute. Erwachte endlich, hinkte und kroch durch den Wald zu der großen Lichtung, wo sich die Rudel trafen, wenn die Sonne sank. Da lachten sie alle und höhnten und spotteten: nun sei es ausgemacht, daß er ein Lamm sei! Nur Schafsblut könne so dumm sein, einem Hirsch mitten ins Geweih zu springen.
Das waren seine ersten Wunden. Aber sie heilten und er wurde blank und weiß wie zuvor und kräftiger noch und viel stärker. Nun ging er allein auf die Jagd; begann mit Hasen und Fasanen, hetzte Rehe bald, brach in die Hürden ein. Würgte einen großen Schäferhund, überfiel einen starken Rehbock und zerriß ihn. Aber wenn er zur Nacht in die Lichtung der Wölfe kam, spotteten sie, ob er Heuschrecken gefressen habe und Frösche? Einer verlangte zu wissen, ob Krötenfleisch gut schmeckte, und ein anderer sagte, er habe ihn am Flusse gesehn, wo er saftiges Gras weidete, wie das Rindvieh.
Alle lachten sie. Und der alte, dunkle, fragte ihn, ob er auch wiederkäuen könne?
Da dachte er, daß er ihnen schon zeigen wolle, daß er Wolfsblut habe, wildes und echtes und besseres noch als sie. Er schlich durch die Wälder, lange Tage lang, bis er die Spur eines Einsiedlers fand. So nannten sie die Hirsche, die allein lebten und ganz für sich, nicht im Rudel mit den andern. Die fürchteten sie alle, und kein Wolf wagte es, sie anzufallen — sie flohen nicht, ließen sich nicht müde hetzen, wußten den Rücken zu decken, trafen mit tötlichen Dolchen jeden, der ihnen zu nahe kam. Er sah die Spur und folgte ihr, fand den mächtigen Hirsch am Waldesrande, schlich heran. Heulte auf, heulte, als ob dreißig aus dem Walde brächen und nicht er nur allein. Sprang zu, hing dem Hirsche am Halse, biß, biß, biß durch, brach nieder mit der schweren Last des stürzenden Tieres. Trank das Blut aus der zerfetzten Kehle, sprang dann auf, schrie weithin, daß es alle Lüfte zerriß, den wilden Ruf der Wölfe, die ein großes Wild zur Strecke gebracht.
Sie kamen heran, einer und noch einer und viele. Sie hörten, was er erzählte, trunken von seiner Jagd, trunken von dem heißen Blute — daß er, er ganz allein, den gewaltigen Einsiedlerhirsch gejagt und getötet habe. Sie gaben ihm keine Antwort, saßen nieder und fraßen, fraßen. Aber als sie zum Platzen satt waren, als nur noch Knochen herumlagen und jämmerliche Fetzen für das Krähenvolk, da meinte einer, er glaube die Geschichte nicht. Und die andern stimmten ein: gefunden habe er den Hirsch, tot, verendet, am Waldesrand. Schon seit Tagen sei der verreckt — man habe es gut schmecken können: Aas sei das und kein frisch erjagtes Wild. Da schlich er fort durch die Nacht, über die weiten Wiesen —
Ein Einsiedler wurde er, wie der Hirsch, den er erjagt, lebte allein durch die langen Zeiten. Sehr einsam war er. Da wuchs sein Mut und seine Kraft und sein Stolz.
Manchmal traf er die andern, wenn sie Spuren folgten. Dann sagte er, das sei sein Wild und es gehöre ihm. Fiel sie an, schnappte zu, biß sie fort. Einmal traf er den großen, dunkeln — im gelben Frühschein, ehe die Sonne herauf war. Er bellte nicht, heulte nicht, fiel ihn an im Augenblick. Würgte ihn tot.
Und die andern schlichen in die Büsche.
Das wußte der ganze Wald, daß ein weißer Wolf da war, und daß er es war. Und die Herden wußten es und die Hunde und Hirten und die Jäger auch. Er stieg hinauf — hoch, hoch, wo nur noch Felsen ragten, nur Vögel noch flogen und verkrüppelte Kiefern im Winde ächzten. Er zog hinab über die Wiesen und Felder, weit hinein, bis dahin, wo die Menschen wohnten. Aus ihren Ställen schleppte er seine Beute.
Er war ein weißer Wolf — war ein Wolf und war weiß — und das wußte jeder im Walde.
Sie setzten einen guten Preis auf ihn, hundert blanke Goldstücke. Und dazu noch sein weißes Fell, das schien den Jägern begehrlicher noch als das rote Gold. Sie zogen aus zu Dutzenden mit guten Gläsern und Flinten, trieben mit vielen Treibern durch die Wälder. Sie sahen ihn auch — einmal und mehr — schossen schnell — und manche brühwarme Kugel sengte sein weißes Fell. Sie stellten Fallen auf und scharfe Fangeisen, legten vergiftetes Fleisch an des Flusses Ufer, dorthin, wo er zu trinken pflegte. Aber er fraß nur die Beute, die er selbst gewürgt, ließ ihre Fleischstücke liegen für dumme Krähen und Füchse. Einmal schlug, versteckt unterm Laub ein Eisen zusammen über sein Bein, da riß er, riß und zerrte, daß sich die Haut löste über den Knochen, sich abstreifte wie ein Strumpf. Er zog das Bein heraus, blutig, roh und zerfetzt. Lag im Dickicht, durch manche Nächte, leckte, bis sich das Fleisch wieder deckte, frische Haut sich bildete über Narben und Rissen.
Und von neuem brach er in ihre Hürden, heißhungrig, wilder als je. Riß einen Ochsen, zerbiß ihm den Hals. Schlürfte das Blut, ließ das Fleisch liegen.
Viele Wölfe waren im Walde, sehr viele, gelbe und graue und braune. Was lag daran? Die Hirten schützten ihre Herden mit Stachelzäunen und scharfen Hunden — und wenn dennoch ein Tier zerrissen wurde, so fluchten sie und vergaßen es dann. Und die Jäger jagten die Wölfe, wie alles Wild, schossen sie, töteten sie — das war nichts Sonderliches. Ein Wolfsbalg nur — und nichts weiter. Aber der weiße — den mußten sie haben. Ihn haßten sie, ihn begehrten sie, von ihm träumten sie — Bauern und Hirten und Jäger — alle.
Im Winter zogen sie aus.
Sie gaben einem Hammel einen Trank, der sein Blut vergiftete, aber ihn leben ließ auf einen Tag und mehr. Ein gutes Gift, das seine große Wirkung erst zeigen sollte an dem Tiere, das das Bockfleisch fraß. Sie hängten ihm eine große Glocke um, trieben ihn in den Wald — da kamen bald die hungrigen Wölfe.
Aber der Weiße riß ihn nieder, er schlürfte sein Blut, ließ den andern das rote Fleisch.
Am andern Morgen kreisten die Menschen ihn ein. Stellten Eisen in großem Halbkreise, gruben Fanggruben, vom Flusse her rings am Waldesrand. So dicht, so versteckt, daß kein Marder durchgekommen wäre. Sie kamen von den Wiesen her, viele Hunderte, Jäger mit ihren Büchsen, Hirten mit dicken Knüppeln, Bauern mit langen Forken und Flegeln. Und Hunde, viele Hunde — die bellten hell in der Treiber Geschrei.
Der weiße Wolf hörte sie gut und er wußte, daß es ihm galt, und ihm allein. Ihm — weil er weiß war. Er sprang durch den Wald, rannte und lief unter den Eichen her, dann hinauf zwischen den Föhren. Da brachen die Hunde herunter, von den Felsen her, und hinter ihnen Jäger und Treiber; er sah sie wohl, gerade als er hinaustrat aus dem Wald. Aber sie sahen ihn nicht weniger, den weißen — da flogen die Flinten an die Backen, da krachte es auf, da jagten die Kugeln über den Schnee. Eine traf, eine nur. Am Halse irgendwo — nur eine Fleischwunde, die das Fell blutig färbte. Er drehte um, jagte zurück in den Wald.
Rannte zum Fluß hin, brach durch den Schnee in eine tiefe Grube, fiel auf ein Fangeisen, das zuschnappte, seine linke Flanke faßte. Er riß sich los, ließ einen großen Lappen zwischen den Zähnen der Falle. Er sprang in die Höhe, die Seite des Lochs hinauf, fiel zurück. Versuchte es wieder und noch einmal, rutschte hinab über die schwarze, kotige Erde, faßte endlich doch den Rand mit den Vorderbeinen. Hob sich, sprang hervor. Da schrie einer, da traf ihn ein schwerer Schlag mit dem Dreschflegel. Etwas zerbrach in ihm, das fühlte er wohl. Aber er rannte weiter.
Wieder schoß es und wieder traf es ihn, zerschlug ihm ein Bein. Aber er hinkte, kroch, schob sich durch das Holz, tiefer hinein und tiefer. Lag dann irgendwo, schweratmend, halb versteckt unter Laub. Über und über bedeckt mit Dreck und mit Blut, zerfetzt, zerschossen, zerschlagen. Und im Leib brannte das Gift, zerfraß seine Eingeweide — das sengte wie das rote Feuer der Menschen.
Zwei sah er kommen von unten her. Die blieben stehn, bückten hin zu ihm.
»Dort liegt einer,« lachte der Hirt. »Der hat auch vom Hammel gefressen — schieß doch!«
Aber der Jäger sagte: »Nein, das ist ein ganz gemeiner, den kannst du später totschlagen mit dem Knüppel. Komm, wir verlieren nur Zeit — dort hinaus muß er sein, der weiße!«
Da heulte der Wolf: »Schieß, schieß — ich bin der weiße Wolf.«
Aber die zwei zogen vorbei. Und der Hirt lachte: »Verreck du nur allein, elendiges Biest.«
Er sah ihnen nach, lange — lange, bis sie verschwanden zwischen den Eichenstämmen.
»Ich bin der weiße Wolf,« stöhnte er — —
»Bleib noch,« sagte Lotte van Neß. »Professor von Kachele kommt heute abend.«
Er setzte sich wieder. »Der? Wie weit ist er mit deinem Horoskop?«
Sie lächelte: »Er ist sehr gründlich, scheint es — da werde ich noch warten müssen. Übrigens hat er diese Studien unterbrochen — ich habe ihn gebeten, die Arbeit auszuführen, die er für dich skizziert hatte. Du hattest damals keine Zeit, aber ich habe mir alles erzählen lassen, ihn dann beauftragt, es für mich niederzuschreiben. Gestern wurde es fertig — darum kommt er.«
»Du hast die Arbeit gekauft, Lotte?« fragte er. »Ja — was willst du damit?«
Sie zuckte die Achseln. »Vielleicht gebe ich sie einer Zeitschrift — vielleicht schenke ich sie dir — was weiß ich. Warum soll ich nur Steine kaufen und Bücher, warum nicht einmal ein Manuskript?«
Der Professor kam, konnte es kaum abwarten, seinen Vortrag zu beginnen. Er aß viel, aber hastig und schlingend, stets bereit, von dem mitzuteilen, was ihn erfüllte. »Später, lieber Professor,« bat Frau van Neß, »später! Essen Sie erst!«
Sie gingen in die Bibliothek; dort rückte sie ihm einen großen Sessel hin. Sie selbst saß auf ihrem Diwan, schob viele Kissen zurecht, stützte die Ellenbogen auf.
»Nun beginnen Sie!« bat sie.
Er fing im Augenblick an. Sprach sehr rasch, stolpernd und eilend, unterbrach sich zuweilen auf eine kurze Sekunde, blätterte in seinem Manuskript, suchte irgendein gelehrtes Zitat, las es. Seine Stimme klang harsch und überlaut, nicht heiser, aber röchelnd manchmal und seltsam blökend.
Frank Braun saß hinten, zwischen den Büchern, auf einem riesigen Sessel. Die Beine übergeschlagen und lang vorgestreckt, die Arme auf den weichen Lehnen. Er sog an einer Zigarette, lauschte, versuchte das Ohr zu gewöhnen an das Poltern dieser Stimme.
Aber er hörte nur Laute. Worte, die keinen Sinn hatten — Sätze, deren Inhalt er nicht begriff.
Es war wieder einmal da, ganz plötzlich. Diese müde Leere, dies jämmerliche Gefühl des Ausgetrunkenseins. Jeden Tag nun faßte ihn das — eine, zwei Stunden — ohne Übergang, wie ein dichter Nebel, der aufstieg aus allen Ritzen.
Er schlief nicht, er träumte nicht — er hörte Klänge nur, kratzend und reibend, Töne, häßlich und unharmonisch — weither. Er wollte aufstehn, aber es ging nicht. Blieb sitzen, wie er saß, still, unbeweglich. Duldete, litt unter den Qualen dieser reißenden Stimme.
Dann klang Lottes weiche Cellostimme, da fiel der Bann. Er sprang rasch auf, ging zu auf den Professor, nahm ihm das Manuskript aus der Hand.
»Es war sehr interessant, Baron,« rief er. »Erlauben Sie, daß ich noch einiges nachlese.« Er wartete keine Antwort ab, ging aus dem Zimmer, hinüber in Lottes Schlafzimmer. Warf sich lang auf das Sofa, schloß die Augen.
Aber auf einen Augenblick nur — er war ganz wach nun, jede Müdigkeit schien geschwunden. Er sah das Manuskript in seinen Händen, begann zu lesen.
O ja, es interessierte ihn. Sehr, von den ersten Zeilen an —
Diese schürfende Arbeit! Ägyptische Texte, wieder koptische, hebräische, lateinische und griechische. Dann auch Gehez, die alte Kirchensprache Äthiopiens, assyrisch und babylonisch. Und weiter auf zwei Wegen, byzantinisch einmal, albanisch, mittelslawisch und magyarisch — und wieder abessynisch, amharisch, arabisch und hinein in die Negersprachen. Quer durch Afrika bis hin nach Dahome — und hinauf über Europa von Südosten aus. Und eines ins andere fließend so klar und überzeugend — eine lange Geschichte durch die Jahrtausende — von dem Sternenhimmel hinab zu den blutigen Opferhöhlen Neuyorks: ein Astralmythus, aber mit den Händen zu greifen heute noch.
Er erinnerte sich gut der schlanken, braunen Negerpriesterin, deren nächtlichem Opferfest er beigewohnt hatte, vor manchen Jahren nun. In Haiti, im Honfoûtempel zu Petit-Goaves. Die ihr eigen Kind schlachtete mit eigener Hand, sein Blut den Gläubigen kredenzte, mit Rum vermischt.
Der Professor sagte nun, daß das alles nur ein Mythos wäre, und beileibe nicht blutige Wirklichkeit. Ein Traum nur, aber einer, der zur wilden Wahrheit wurde. Die Wüstenphantasie eines sternedeutenden Hirten, eines träumenden Dichters nur, aber eines, dessen gewaltiges Schaffen durch manche Jahrtausende rings um die Erde lief.
Die Sonne ging unter und die Sonne ging auf — das sahen alle Geschöpfe, die auf Erden wandelten. Der Dichter aber in der Wüste sah mehr, viel mehr. Er sah und er sagte, daß sie, jung und schön, einen Tag nur alt, geraubt worden sei, erschlagen und gemordet von einer grausamen Gottheit. Die neue Sonne aber, die auferstand am nächsten Tage, strahlender noch und leuchtender als die andere, die sei der Toten jugendschönes Kind. Ihr Kind — und doch wieder die Sonne selbst, die auferstand in erneuter Pracht aus der Todesnacht. Das war das Sternenmärchen des Träume träumenden Hirten in der Wüste, der uralte Mythos vom zerstückelten Kinde.
Labartu hieß in Babylon die Sternengottheit, die das Sonnenkind stahl, in Stücke zerschlug und fraß — und sie war Baals Weib. Doch sie war keine andere, als die indische Kali, die furchtbare Durga, die Würgerin, die Gattin Schiwas, des Zerstörers. War seine ›Sakti‹, sein Ausfluß, war das Handeln seines Denkens — und die blutige Hand seines Hirns. Und wie sie des Himmels Kind fraß, die junge Sonne, so stellte sie auch den Kindern der Menschen nach, tötete sie im Mutterleibe oder kurz nach der Geburt. Und darum mußte man ihr Opfer bringen, mußte sie versöhnen, daß sie gnädig vorbeiginge an der jungen Mutter Haus. Das forderte Labartu für sich und für Baal. Und was ihr in Babylon recht war, schien ihr billig in Sydon und Tyrus und Karthago, wo sie sich Astarte nannte und als Molochs Gattin über Phöniziens Kinder herrschte.
Ihr floß hingeopfert das junge Blut aller Erstgeburt. Nur Mädchen verlangte die entsetzliche Durga — man ertränkte sie in Milch zu der Göttin Lust, noch heute im weiten Hindostan. Aber alles wollte Astarte — jedes junge Kind, das die Mutter brach. Das war ihr grausames Recht im Morgenlande. Und man gab es ihr, demütig und zitternd — alle Völker und nicht zuletzt Israel. Verschwand nicht — geheimnisvoll genug — jeder erstgeborene Sohn in dem ältesten Teil der Bibelgeschichte? Ismael zuerst und dann Esau. Abel wieder, Davids erster Sohn von der Bathseba. Und des Richter Jephta tanzfrohes Töchterlein — o — viele noch, viele —
Sollte nicht auch Isaak diesem Gedanken geschlachtet werden? Aber Jehovah wies das Opfer zurück. Mit dem Opfer zweier Tauben löste Israel später die Erstgeburt ab von der Gottheit Recht — dennoch opferten Salomon und viele andere jüdische Könige und Großen immer wieder Kinder der wilden Göttin. Schnitten ihnen die Kehlen durch mit eigener Hand, ließen ihr Blut fließen, zerstückelten sie — wie es Baaltis befahl.
Nach Rom kam der Kultus der kindermordenden Göttin — das erzählte Plinius. Zog von Griechenland hinauf über den ganzen Balkan, bis weit ins Donautal — zog nach Westen dann. Wuchs zum wildesten Leben auf im 17. Jahrhundert, als Elisabeth Bathory, die Blutgräfin, die Säle ihrer Schlösser mit gräßlichen Schreien füllte, jämmerlichen Todesschreien von elend zerpeitschten, grausam abgeschlachteten Ungarmädchen.
Ruhte nie, ward immer wach durch das ganze Mittelalter bis hin auf unsere Tage — überall in Europa. Blühte in schwarzen Messen, war nicht auszurotten trotz der Kirche strengem Kampf mit Schwert und Feuer.
Schlachtete nicht Herr Gilles de Rais mit eigener Hand über achthundert Kinder? Er, Marschall von Frankreich, berühmter Feldherr, Fahnenträger der Jungfrau von Orléans! Und die Marquise von Montespan, des vierzehnten Ludwig Geliebte und von ihm Mutter französischer Prinzen, ließ — mehr als einmal — auf ihrem eigenen nackten Leibe als köstlichem Altare in der Schloßkirche zu St. Denis durch den Abbé Guibourg neugeborene Kinder zerstückeln!
Den Teufel Astaroth rief sie an — wie der Baron von Rais das tat — der sollte ihr helfen, des Königs Liebe festzuhalten, wie dem Marschalle Gold zu machen. Astaroth — so nannte sich Astarte in dieser Zeit.
Von Karthago aber zog der Mordkult tief hinein nach Afrika, vielleicht auch quer durch von Abessinien her. Basileia, die Königin, nannten die Griechen Molochs Gattin Astarte, Bersilia machten die Semiten, Berzelya die Kopten daraus — das heißt die, die mit eisernen Händen die Kinder tötet. Und noch heute heißt in Abessinien Werzelya die entsetzliche Göttin, die Säuglinge raubt und zerstückelt und das Ungeborene grausam aus der Mutter Leib reißt.
Herüber dann vom Kongostrand mit den schwarzen Sklaven nach Amerika. Und wieder hieß — im Vaudoux — die Göttinpriesterin, wie bei den Griechen: Königin! Mamaloi — weil der Nigger das R nicht sprechen kann — Mama — Roi: Mutter und Königin!
Immer noch, immer trinkt sie der Kinder Blut: sie, Durga — Astarte — Mamaloi, die Würgerin. Heute noch — mitten in Neuyork!
Er stand auf; ging zurück in die Bibliothek, wo Professor von Kachele sprach, wie zuvor. Über Horoskope jetzt, über die seltsame Weissagung des Alexandriner für das Jahr —
Er unterbrach ihn, reichte ihm das Manuskript zurück. »Bei alle dem, Professor,« sagte er, »verstehe ich dennoch nicht, wie so plötzlich Ihr schrecklicher Sternenmythos irgendwo wieder lebendig werden kann. Sie überblicken die gesamte Entwickelung, tragen die ganze Geschichte durch alle Jahrhunderte zusammen, finden die Zusammenhänge. Aber Sie glauben doch nicht, Baron, daß etwa meine Mamaloi in Petit-Goaves auch nur die kleinste Ahnung davon gehabt habe? Daß Marschall Gilles de Rais, daß die ungarische Gräfin oder die französische Marquise sich bewußt waren, daß ihre zerstückelten Knaben oder Mädchen regelrechte Opfer des uralten Ritus waren?! Wie nun, Professor, denken Sie sich, daß urplötzlich, und in ganz neuer Form, der alte Gedanke in einem Menschenhirn auftauchen kann?«
Der Professor schwieg, rückte unruhig auf seinem Stuhle hin und her.
»Ich weiß wohl, das ist eine Lücke in meiner Arbeit,« sagte er endlich. »Ich könnte sie ausfüllen — vielleicht! Aber, wissen Sie, ich denke nicht gern darüber nach — spreche noch weniger gern davon.«
Er rieb sich mit den Fingern an der Nase, langsam, auf und ab. »Es ist absurd, an einen Gott zu glauben und an einen Teufel nicht,« begann er dann, »einer ist undenkbar ohne den andern. Der Teufel ist so stark wie der Herrgott auch. Er kommt hervor, wann er will und wo es ihm beliebt. Bei mir« — seine Stimme sank, wurde flüsternd, zitternd, und fast furchtsam — »bei mir hat er auch nicht lange gefragt, ob es mir recht sei. Alte Weiber, häßlich, stinkend und verpestet — das gefällt ihm, dem hohen Herrn, wenns grade seine gute Laune ist. Das hat schon Goethe gewußt — lesen Sie doch den zweiten Teil des Faust! Und ich — Sie wissen das ja Doktor — habs am eigenen Leibe erfahren.«
Er zog ein mächtiges Taschentuch heraus, schnaubte sich die Nase, wiehernd und dröhnend. Nahm die Brille ab, putzte sie sorgfältig, blinzte aus den gelben halbblinden Augen.
»Seh ich aus wie ein Faun?« fuhr er fort, »Würde einer ahnen, daß in mir der Satan-Phallus steckt, Pan, der Bocksgott, der kein Hirn hat und nur mit der Rute denkt?! Und doch hat es ihm beliebt, in diesen elenden Knochen seinen Tempel aufzurichten. Dies Mirakel, Doktor, sitzt grade vor Ihnen, sehr lebendig und wirklich — läuft mitten durch die Straßen Neuyorks — freut sich sehr, daß es zurzeit einmal wieder menschenwürdig arbeiten kann und keine Urinuntersuchungen anzustellen braucht. Was ich tat, Doktor, das weiß ich sehr genau — mit allen kleinsten Einzelheiten. Aber warum ichs tat — wieso dieser ungeheuerliche Gedanke mich plötzlich festnahm — einen stillen Gelehrten, den nüchternsten Professor in ganz Deutschland — davon weiß ich nichts, gar nichts. Er war da, krallte sich fest in mein Hirn — gab mich nicht frei. Seither weiß ich, was es heißt: besessen sein. Und seither wundert mich nichts mehr, kein Traum, keine Laune, kein wildester Gedanke: alles, alles ist möglich in Menschenhirnen.«
Frank Braun fragte: »Sie meinen also, Professor, daß —«
Aber er ließ ihn nicht aussprechen. »Ja, ja und ja!« rief er. »Ich meine — und ich habe meine Meinung teuer genug bezahlt — daß kein Mensch auch nur eine Viertelstunde seiner selbst sicher ist. Daß eines jeden Menschen Hirn ein Saal ist, in dem in jedem nächsten Augenblick irgend etwas — ein Gott, ein Teufel oder wie Sie es nun nennen wollen — die schönsten Tänze tanzen kann. Sehr fromme, sehr heilige — und sehr scheußliche auch, gemeine und grausame — wie das Schicksal will. Und wenn die schöne und gütige Dame, die vor Ihnen sitzt, wenn Frau van Neß in dieser Nacht sich entpuppen sollte als die wildeste Priesterin der Baaltis, wenn sie Knaben zerstückeln und ihr rotes Blut trinken sollte, so würde ich das keineswegs als etwas Außergewöhnliches ansehn. Ich würde es bedauern, aber als Gelehrter würde ich den interessanten Fall meiner Arbeit zufügen, rein sachlich, als ein neues Beispiel des uralten Labartukultus.«
Er schob seine Brille wieder auf die Nase, stand auf, legte das Manuskript auf den Tisch.
»Eine Zigarre mit auf den Weg, Baron?« fragte Frank Braun.
»Nein, danke,« antwortete der Professor. »Ich rauche noch immer nicht, trinke noch immer nicht, bin noch immer der nüchtern langweiligste Mensch von der Welt. Und wenn Ihnen dennoch das, was ich sage, phantastisch klingt — so denken Sie an das, was mich nach Amerika jagte.«
Über eine Stunde schon war der Professor fort. Aber die beiden saßen noch immer in ihren Sesseln in der Bibliothek, rauchten, nippten an ihren Gläsern. Sie sahen sich nicht an, keines das andere, sprachen kein Wort, schwiegen.
»Willst du das Auto haben,« fragte sie, »um nach Hause zu fahren?«
Er sah hin zu ihr, antwortete: »Ich möchte hier bleiben diese Nacht.«
Sie stand rasch auf, hob die schmalen Lippen. »O, wie du willst. Da steht der Wein, bediene dich. Ich werde Toilette machen — schicke dir die Zofe, wenn ich fertig bin.«
An der Türe blieb sie stehn, lächelte zurück. »Sag mir doch — möchtest du nicht sehn in dieser Nacht, ob ich vielleicht Astarte bin — die Blut trinkt? Du nanntest mich einmal die phönizische Göttin — Priesterin — was?«
Er antwortete nicht, ließ sie gehn.
Er dachte: ›Alles ist möglich im Menschenhirn.‹
Er sann nach —
Was denn nur? — Was mochte möglich sein?
O ja, sie hatte schon recht: er wollte hier bleiben heute nacht, wollte sie beobachten, belauern. Aber was nur, was wollte er finden? Sie, Lotte, als bluttriefende Priesterin — und er etwa das Opferböckchen, das zerstückelte Kind?
Es war so lächerlich, so absurd, wie des Dr. Cohn Geschwätz von der Südseekrankheit.
Und doch blieb der Verdacht — und doch konnte er diesen Gedanken nicht hinunterwürgen.
Er leerte ein letztes Glas, folgte der Zofe. Ging ins Badezimmer, duschte mit kaltem Wasser, entkleidete sich, nahm den seidenen Schlafanzug.
Sie saß auf dem großen Bett, als er hereinkam, ihr rotes Haar fiel offen hinab auf das Spitzenhemd. Sie hielt ein paar kleine, blitzende Dinger in der Hand, spielte damit, legte sie rasch auf den Nachttisch, als sie seinen leisen Schritt hörte. Er sah, wie das hell blitzte, sah, daß es kleine Scheren waren und hübsche offene Messerchen.
Und sie nahm einen Ring von der Tischplatte, schob ihn an ihren Finger.
Er trat hin zu ihr. »Ein neuer Ring?« fragte er. »Wieder ein Amulett?«
Sie streckte ihm die Hand hin. »Vielleicht. Aber neu ist er nicht.«
Es war ein häßlicher alter Silberring. Schlechte Fassung, die einen grünlichen Stein hielt, in den ein Wappen eingeschnitten war.
»Ich habe ihn gestern bei einem Althändler auf der zweiten Avenue gefunden,« lächelte sie, »hundert Dollar hat der schlechte Kerl mir dafür abgenommen, als er merkte, daß ich ihn durchaus haben wollte. Ich kann nicht handeln — es ist ein Jammer.«
»Nicht einen halben Dollar ist das Ding wert,« sagte er.
»Doch!« erwiderte sie. »Für mich ist er mehr wert. Sieh ihn dir an: ein Pelikan, der sich die Brust aufpickt, seine dürstenden Jungen zu tränken mit eigenem Blut.«
Er sah sie lauernd an: wieder dieser Gedanke!
»Weshalb interessiert es dich?« forschte er.
Sie zuckte leicht die Achsel. »Nur so! Es ist Magdeburgs Wappen — meiner Mutter Familie stammt aus Magdeburg.«
Sie stand auf, nahm vom Tisch ein großes Glas, bis oben gefüllt mit einer milchigweißen Flüssigkeit. Schritt zu ihm hin, streckte den Arm ihm entgegen.
»Trink, mein Freund,« sagte sie.
»Was ist es?« fragte er.
»Ein starker Schlaftrunk!« antwortete sie. »Dr. Cohn mischte mir ihn auf meine Bitte.«
Er schüttelte den Kopf. »Nein!« rief er. »Wozu brauche ich einen Schlaftrunk?«
Sie sagte: »So will ich ihn trinken.«
Sie hob das Glas, trank es aus zur letzten Neige. Sprach: »Eines von uns braucht den Trunk — für diese Nacht. Du, wenn — Und ich, wenn — —«
Sie stellte das Glas fort, legte beide Hände auf seine Schultern. Sagte lächelnd: »Siehst du — so ist es.«
»Was: wenn —!? Lotte, was nur?« rief er ungeduldig.
Aber sie drängte ihm ihre roten Locken an Kinn und Hals. »Frag nicht,« bat sie. »Du weißt ja, daß ich nichts sage, wenn ich nicht will.« Sie hob ihren Kopf, blickte ihn an, wurde sehr ernst.
Und eine tiefe Güte klang aus dem Cellosingen ihrer Stimme. »Es ist sehr schwer, Geliebter, was ich tue — schwer, schwer. Aber ich tu es gern.«
›Wie meiner Mutter Stimme,‹ dachte er.
Sie zog ihn zum Lager hin. »Komm, komm — greif die Minuten. Eine halbe Stunde nur — dann schlafe ich fest. Und ich bin dein Ding, wenn ich wach bin — und wenn ich schlafe — erst recht. Wenn du nur wüßtest, wie sehr —«
Er ritt im Zentralpark, mit Ivy Jefferson, am andern Abend.
»Warum sprichst du nicht?« fragte die Blonde. »An was denkst du?«
Er antwortete nicht gleich; da rief sie: »O ich weiß es recht gut — an wen du denkst. An Frau van Neß und keine andere! — Sag, ob ich recht habe.«
»Ja!« nickte er. »Woher weißt dus?«
Die kleine Ivy lachte auf. »Woher? Die ganze Stadt weiß es!« Und, ein wenig nachdenklich, fuhr sie fort: »Ich sah sie diesen Sommer, als sie in Neuport war. Sie ist stolz — und interessant — und sehr reich. Und vielleicht — auch schön. Ich kann es schon begreifen, daß sie den Männern gefällt — und dir.«
»Bist du eifersüchtig?« forschte er.
Sie lachte wieder: »Gewiß bin ich eifersüchtig. Aber es ist ein Sport und ein Kampf — so mag ichs. Ich hab mirs überlegt — wir sind gleich stark, beide. Sie ist klüger vielleicht, aber ich bin viel jünger. Wir wollen sehn, wer gewinnt.«
Sie ritt dicht an ihn heran, schob die Pferde zusammen, daß sich ihre Flanken berührten. Ihre Lippen waren geschlossen, aber die Nasenflügel bebten; es war, als ob sie einen starken Duft einsauge.
»Sag mir,« murmelte sie, »warst du bei ihr in dieser letzten Nacht?«
Er sah ihr scharf ins Auge. Rasch, brutal fast, rief er — mitten in ihr Gesicht —: »Ja, ich schlief bei ihr!«
Sie warf den Kopf zurück, sprach halblaut: »Ich wußte es. Ich habs gefühlt.«
Gab ihrem Tier den Sporn in die linke Weiche, schlug zugleich mit der Gerte scharf zu, zwei — dreimal, über die Hinterhand. Jagte davon.
Er folgte ihr nicht. Ritt weiter, in langsamstem Schritt, sah ihr hochmütig nach. ›Du wirst anklingeln — ich nicht!‹ dachte er.
Nahm die Gedanken wieder auf, die Träume, die die kleine Ivy unterbrach, seine Träume von der letzten Nacht.
Küsse, Küsse und Umarmungen. Kühl war er und sehr kalt, aber ihre liebe Wärme schmolz die Schneedecken. Küßte seines Herzens reichen Boden, ließ Blumen wachsen und blühen, so viele bunte Blumen. Die tropften von seinen Lippen, regneten über sie hin, deckten sie, hüllten sie ein.
O, er liebte sie, liebte sie — bis sie einschlief in seinen Küssen.
Solange es ging, hielt sie die Augen offen. »Ich danke dir,« hauchte sie — als ihre Lider sanken.
Genau nach einer halben Stunde — wie sie gesagt.
Er drehte das Licht an, saß neben ihr. Blickte sie an, unverwandt, ohne sich zu rühren, still, stumm.
Alles Glück versank — es war wieder das schleichende Fieber der entsetzlichen Leere, das ihn faßte. Und wieder, im Hirne, das jämmerliche Mißtrauen — dieser nagende Verdacht —
Nahm sie den Trank — um ihn zu betrügen? Wartete sie nur — bis er schlief — um dann —
Dann? Was dann?
Er ließ kein Auge von ihr. Saß auf, lauerte. Drehte das Licht wieder aus, legte sich nieder, tat, als ob er schliefe — kämpfte mit starkem Willen gegen seine Müdigkeit.
Lauschte. Lauerte. Stundenlang.
Aber nichts, nichts. Kaum ihren Atem konnte er hören.
Dann schlief er ein.
Erwachte sehr spät. Sehr frisch. Sehr gesund. Und stark, wie seit Monden nicht.
Aber Lotte van Neß lag, wie sie lag in der Nacht zugedeckt bis ans Kinn — schlief fest.
Er stand auf, badete, zog sich an, frühstückte, kam wieder in ihr Zimmer. Sie schlief.
Er fuhr nach Hause; schellte sie an ein paar Stunden später. Aber nur die Zofe antwortete: die gnädige Frau schlafe immer noch. Und sie habe gestern Befehl gegeben, sie nicht zu wecken, bis sie von selber aufwache.
— Er trieb seinen Gaul an, trabte, setzte ihn dann in Galopp. So stark fühlte er sich, zehn Stunden hätte er im Sattel sitzen können.
Und er dachte, daß er ihr unrecht getan hätte, bitter unrecht. Daß er zu ihr müsse, heute abend noch. Vor ihr knien, ihre Hände küssen, ihr sagen, wie lieb er sie habe —
Dann plötzlich fiel ihm was ein. Diese spitzen Scheren, die blanken, scharfen Messerchen, die sie auf den Nachttisch legte, als er ins Zimmer trat? Er hatte sich vorgenommen, darauf zu achten — das hatte er vergessen. Hatte keinen kleinen Blick hingeworfen, als er vom Bette sprang.
Wozu waren sie da? Was wollte sie damit? Was war mit ihnen geschehn in dieser Nacht?
War sie dennoch — während er schlief —?
Was denn nur, was?
Nichts fand er.
Aber der Verdacht faßte ihn wieder, stark und fest, schlug ihm die Krallen ins Hirn — ließ ihn nicht — —
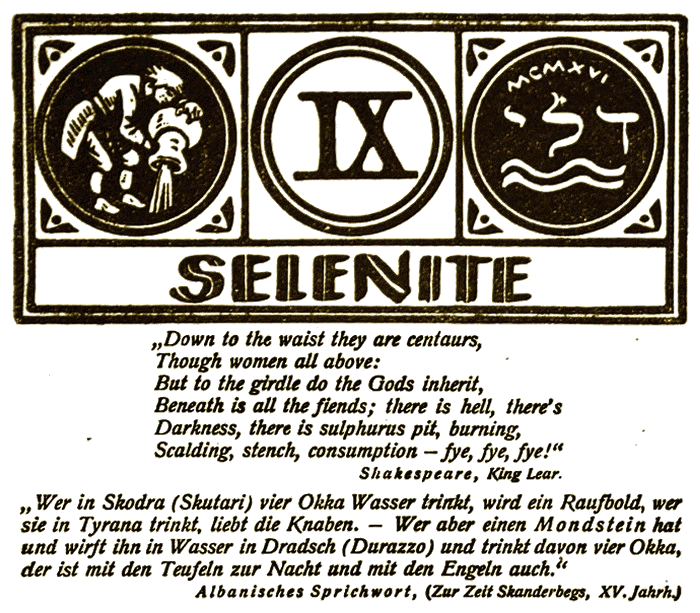
Sein Sekretär reichte ihm die Post. »Es ist eine Einladung von Miß Pierpont dabei,« sagte er. »Für ein Fest der Monddamen. — Sie wollten mich mit hin nehmen.«
»Geben Sie her,« sagte er, nahm das Kuvert, riß es auf. Las, schüttelte den Kopf.
»O je, nicht einmal ein Fest können sie selbst machen in dieser Papageienstadt!« rief er. »Da lesen Sie, Rossius: ›28 Januari A. D. 1490!‹ Das da ist die wörtliche Übersetzung einer Einladung des Fürsten Rimoff, und der Klimbim der Monddamen wird die verkitschte Nachahmung des Festes sein, das der Russe in Paris vor fünf oder sechs Jahren gab! Das wird kaum der Mühe wert sein.«
Der Sekretär fragte: »Waren Sie damals dabei, Doktor?«
»Nein,« erwiderte er. »Aber die Pierpont war dort, sie hat mir mal erzählt, wie herrlich es gewesen sei. Die Äbtissin von San Sixto, vom Orden des heiligen Dominikus von Guzman, gibt dem nach Rom zurückkehrenden Cesare Borgia ein Fest: das ist die Idee. Ausführung nach dem Tagebuch Burchards, des Zeremonienmeisters Alexander VI. In Paris mags erträglich gewesen sein — hier wirds gewiß fürchterlich: Renaissance bei der Pierpont in Neuyork!«
Ernst Rossius zog ein sehr langes Gesicht. »Sie wollen nicht hin, Doktor? Sie meinten doch, daß es sehr gut für mich sei, wenn ich einmal so eine — Orgie — dieser — dieser Damen sehn würde!«
Er lachte: »Sehr gut für Sie? Na, obs für Ihre Tugend grade so außerordentlich förderlich ist — weiß ich nicht. Aber interessieren wird Sies — das schon. Sagen Sie mal, bin ich an dem Abende frei?«
»Ganz frei!« rief der Sekretär. »Ich hab schon nachgesehn — keine Reden, kein Theater — nicht mal eine Einladung.«
Frank Braun sagte: »Gut also, gehn wir hin. Schreiben Sie gleich einen Brief, daß ich dankend annehme und bitte, Sie mitbringen zu dürfen. Warten Sie, da ist die Vorschlagsliste der Kostüme: päpstliche Garden — spanische Trachten — französische, venetianische Gesandte. Hier: Franziskaner — das tuts! Das ist das Einfachste und vermutlich das Echteste auch — an Kostümen werden wir etwas erleben können. Rufen Sie das Deutsche Theater an, ob uns der Direktor ein paar nicht allzu vermottete braune Mönchskutten leihen will.«
Sie kamen ein wenig spät: schon war der feierliche Empfang zu Ende, eben leitete die Äbtissin Benedikta ihren illustren Gast, den Neffen des Papstes, zum Refektorium, wo die Ergötzlichkeiten vor sich gehn sollten. Dorthin drängten sie sich. Es war ein weiter Saal des mächtigen Klubhauses, der dicht an den sehr großen Wintergarten stieß; die trennenden Glaswände hatte man für diese Nacht herausgenommen, so daß das Ganze ein ungeheurer Raum schien, der sich zu einem Garten öffnete.
Freilich, die Vorstellung, daß man in einem Kloster sei, hatte man gewiß nicht — ängstlich war in der Ausschmückung alles vermieden, was irgendwie mit Religion zu tun hatte. Kein Gekreuzigter, keine Jungfrau und keine Heiligen, weder Statuen noch Bilder. In diesem dunkelrot ausgeschlagenen Saale, den verdecktes Licht von oben her matt erleuchtete, konnte vor sich gehn, was nur mochte, ein Rokokofest so gut wie eines aus Tausendundeiner Nacht.
»Da steht Direktor André!« zeigte Rossius.
»Auch als Mönch?« sprach ihn Frank Braun an. »Dominikaner — Konkurrenz!«
»Ich bin der Savonarola,« lachte André. »Komme von San Marco aus Florenz. Ich bin hier, um Stoff zu sammeln für Bußpredigten.«
Ihm stand jedes Haus weit offen in Neuyork, wie in den ganzen Staaten. Noch aus der Zeit her, als er der große Tenor war in der Metropolitanoper, der alles sang. Der dann selbst Direktor der Oper wurde und für Jahre das Kunstleben beherrschte — der heute drei Operetten im Lande reisen hatte, und zugleich in allen möglichen anderen Sachen steckte: Film, Vaudeville, Zirkus.
»Kommen Sie, meine Herrn,« fuhr er fort, »wir stellen uns auf die Seitenrampe, da können wir die ganze Herrlichkeit überschaun.«
Eine lange Estrade war an die Längswand des Saales gebaut und zwei andere an den beiden Querwänden; vier Stufen führten hinauf. Viele Sessel und Stühle standen dort, alle in Rot und Gold — die rückten die Diener zurecht. Die Äbtissin in feierlichem Schwarz und Weiß schritt hinauf; sie geleitete Cesare Borgia zu ihrem Thronsessel, gerade in der Mitte.
»Sie sieht gut aus, Susan Pierpont!« sagte Frank Braun. »Aber wer ist ihr schöner Cesare? Der könnte schon ein bißchen spanischer sein.«
Ein zwölfjähriges Mädchen setzte sich zu Füßen der Äbtissin, Lucrecia Borgia, Cesares hübsches Schwesterlein.
Langsam schritten die Gäste durch den Saal, zogen die Stufen hinauf. Und bei einem jeden schmetterten Fanfaren und jedesmal verkündete ein Herold den Namen.
Neben die Äbtissin setzten sich des Papstes Mätressen, die Vanozza, Cesares Mutter, eine Vierzigerin, dann, mit ihrem Manne, dem Herzog von Orsini, die junge Julia Farnese — das war der Pierpont Freundin, Marion de Fox. Der Kardinal Alexander Farnese stand hinter ihr, hinter der Äbtissin des Papstes Zeremonienmeister, Burchard. Dann Adriana Mila, des Kardinals vertraute Freundin, Cesares Schwestern Isabella und Girolama, die die Marlborough spielte, das dritte Blättchen in dem Pierpontkleeblatt, das in Paris so bekannt war wie in Neuyork. Gioffre Borgia dann, Giovanni di Celano, Pier Luigi: alle neun Kinder des mächtigen Papstes Rodrigo, der sich Alexander der Sechste nannte. Sogar die kleine Laura und Giovanni hatte man nicht vergessen, des Papstes jüngste Kinder, die ihm die Farnese gebar; die hielt das Mädchen, während der Bub auf der Vanozza Schoß saß. Nur er selber, der Papst, war nicht da — nein, nein, das ging nicht, da mußte man Konzessionen machen. Aber alle seine Neffen und Verwandten: Sancia, Don Gioffres Gattin, die Bischöfe Collerando und Francesco Borgia, der Finanzminister; dann Luigi Pietro Borgia, der Kardinaldiakon von Santa Maria, und Rodrigo Borgia, der Kapitän der päpstlichen Garden. Auch der Geheimintendant, Juan Marades, Bischof von Toul, der prachtvoll echt aussah, Pietro Carranza, der Geheimkämmerer, und Giovanni Lopez, Bischof von Perugia, sein Vertrauter. Viele noch, viele —
»Remolino de Ilerdo,« meldete der Herold. »Giovanni Vera da Ercilla — Mitglieder des Heiligen Kollegiums.«
Frank Braun hatte sich geirrt — alle diese Kostüme waren geschmackvoll und echt — die Pierpont hatte es sich schon ein Stück Geld kosten lassen. Nur unter den geladenen Gästen sah man manche höchst sonderbare Meinungen von Renaissancetrachten. Auch die Regie des Ganzen war erträglich genug — man sah, daß hier eifrig geprobt worden war.
Alle hatten Platz genommen auf den Estraden, die nun dicht gefüllt waren. Frei blieb der weite Raum in der Mitte zum Garten hin, ihn durchschritten päpstliche Garden und dienende Brüder, die sich im Grünen verloren.
Nun begann eine Orgel, irgendwo hinten. Das Licht wurde matter, bläulich schimmernd wie Mondschein. Und ein leises Singen klang durch die Stille. Frauenstimmen, weiche Frauenstimmen.
Frank Braun schloß die Augen. Lauschte. Sann nach.
Wo nur hatte er dieses Lied gehört?
Das mußte lange her sein, lange. Lateinisch war es — ein Singen von Nonnenstimmen.
Ah einst — bei den Rosennonnen — in der Johannisnacht —
Wie war es doch?
Und er träumte zurück durch die Jahre — träumte im Singsang der Nonnen — sah sich wieder, wie er damals war.
Damals — damals —
Referendar war er, unten am Niederrhein. Sein Amtsrichter mochte ihn nicht, vom ersten Tage an nicht. Und immer weniger, mit jeder Woche und jedem Monate.
Damals haßte er den Amtsrichter, wie er jeden haßte, der ihn nicht leiden mochte.
Heute lächelte er. Ganz gewiß, der Amtsrichter hatte recht. Wozu bekam er einen Referendar? Der sollte ihm ein wenig von seiner Arbeit abnehmen. Und natürlich die unangenehmste, die allerlangweiligste. Ein bißchen arbeiten, Gott — drei, vier Stunden am Tage. Und dann am Abend mitkommen in die Weinstube, sich erzählen lassen. Auch: Protokoll führen, einen Vormittag in der Woche, und Skat spielen, einen Abend. Das war billig, das war gerecht, wozu gibt es denn juristische Ausbildung?
Er spielte nicht Skat. Er kam wohl in die Weinstube, aber einmal nur und nicht wieder. Er erklärte, daß ihn das langweile. Langweile! Ihn, den Herrn Referendar —?!
Er machte auch keine Besuche. Weder beim Bürgermeister noch beim Landrat, beim Konsistorialrat nicht und nicht beim Gymnasialdirektor. Dem Amtsrichter, der ihn zur Rede stellte, sagte er, er hätte die Herrn ja in der Weinstube gesehn: ein näherer Verkehr lohne sich nicht.
Einmal führte er Protokoll in der Sitzung, auch nur einmal. Als er seine Bogen dem Herrn Amtsrichter zur Unterschrift vorlegte, wurde der rot und blaß und wieder rot. Und er fragte: »Herr, was soll das sein?«
Er antwortete: »Mein Protokoll.«
Der Herr Amtsrichter schlug ihm die Akten auf den Tisch. O, er hätte sie gerne zerrissen, wenn es nur möglich gewesen wäre. Aber das Protokoll muß nun einmal gleich in der Sitzung geschrieben werden, das muß es.
So unterschrieb er, keuchend und schmerzvoll. Sagte, bleich wieder, ganz bleich: »In meiner zwanzigjährigen — zwanzigjährigen Praxis als preußischer Richter ist mir solche Schluderei noch nicht vorgekommen.«
Da meinte der Referendar: »Ich finde es auch sehr schlecht.«
Der Amtsrichter starrte ihn an, suchte nach etwas, das ihn kränken möchte. Fauchte endlich: »Herr! — Herr! Gehn Sie zu einem Elementarlehrer, lernen Sie Schönschreiben!«
Und er sagte: »Danke. Es lohnt nicht der Mühe.«
Er war unbrauchbar. Stets kam er eine Stunde zu spät aufs Gericht, drückte sich, wo es nur eben ging. Er vergaß alles, war unzuverlässig und ungeschickt. Unmöglich war er, wirklich ganz unmöglich. Und es war schon das beste, wenn er ganz wegblieb.
Der Amtsrichter war außer sich. »Hoffnungslos,« knirschte er, »völlig hoffnungslos.«
Aber einmal hatte er doch seine Rache.
Er ließ ihn kommen; hielt ihm eine schöne Rede, stimmungsvoll, väterlich fast. Man wolle doch einmal in aller Ruhe darüber sprechen — sine ira et studio! Was er sich denn eigentlich denke? Und wohin das alles führen solle?
Da sagte er: »Gar nichts denk ich mir. Das alles langweilt mich.« Und dann, als der Amtsrichter in Pathos kam und ihn abkanzelte, als er ihm seine Verbrechen vorhielt, hübsch ins Licht stellte, fein ausbürstete und bügelte, da sagte er hochmütig: »Herrgott, Herr Amtsrichter, melden Sie es doch dem Oberlandesgerichtspräsidenten! Schreiben Sies doch in meine Konduitenliste!«
Da war es, daß der Amtsrichter oben schwamm.
»Herr,« sagte er, »Herr, was denken Sie von mir? Ich soll Ihnen Ihre Karriere verpfuschen? Ich?! Sie bekommen dasselbe schöne Schema-F-Zeugnis, das ich hundertmal schrieb. Tun Sie, was Sie wollen! — Ich danke Ihnen! Sie können gehn.«
Das war ein glatter und runder Sieg. Und darum haßte er den Amtsrichter.
Außer dem dicken Pfarrer hatte er keinen Menschen da unten. Zu dem ging er, Schach zu spielen.
Der Pfarrer pflegte seine Weine und liebte sie. Nur Mosel trank er, wie alle guten Rheinländer. Oder auch, hie und da, ein Glas von der Saar und der Ruwer. Und es freute ihn, wie er, so allgemach, dem Referendar die Zunge bildete.
»Jahr?« fragte er.
»Dreiundneunziger!« sagte der Referendar, und der Pfarrer nickte. Weintrinken lernte er und Schachspielen. Er begriff, daß alles beides halb eine Kunst sei und halb eine Wissenschaft. Und er dachte, daß es ganz gewiß das beste sei, was er hier tun könne in dieser kleinen Stadt am Niederrhein.
So krochen die Monate —
»Waren Sie bei der Äbtissin?« Immer wieder fragte ihn das der Pfarrer. Dann schüttelte Frank Braun den Kopf — aber immer wieder erklärte er, daß er jetzt ganz gewiß in den nächsten Tagen zu den Dominikanerinnen gehen wollte. Er hatte es seiner Mutter versprochen und dem Pfarrer auch. Er vergaß es nicht, aber er schob es so hin — da wurde nichts draus. Und der Pfarrer schalt ihn.
Einmal sagte der Pfarrer: »Ich war im Kloster. Die Äbtissin läßt Ihnen sagen, daß Sie recht ungezogen seien.«
Er wurde rot. »Weiß Gott, sie hat recht! Morgen fahre ich hin.« erwiderte er.
Und der Pfarrer wieder: »Gut, daß Sies einsehn. Aber Sie brauchen morgen nicht hinzufahren — die Äbtissin ladet Sie ein zu Sonntag nacht.«
»Nacht?« fragte er erstaunt.
Der Pfarrer nickte: »Ja, zur Nacht! Um zehn Uhr fahren wir hin — da geht der Mond auf: dann beginnen die Nonnen ihr Rosenfest.«
Sie fuhren hin durch die Julinacht, in dem alten Sandschneider des Pfarrers. Der hielt selbst die Zügel und schnalzte. »Zieh, Zoefke, zieh!« rief er der alten Stute zu. Und die Blässe wieherte.
»Acht Jahre fahr ich nun schon hin in dieser Nacht,« sagte der Pfarrer. »Seitdem Schwester Beata Äbtissin ist. Seither blüht das Rosenfest.«
Der Referendar fragte: »Seither? So hat sie es geschaffen?«
»Nein,« erwiderte der Pfarrer, »es ist uralt. So alt wie das Kloster selbst, oder nur wenig jünger. Die erste Äbtissin, Klara von Pappenheim, soll das Fest gegründet haben, so im Beginn des dreizehnten Jahrhunderts. Nur, wissen Sie, Doktor, es ist nicht mehr zeitgemäß — wenigstens meinen viele Geistliche so. Man untersagte den Nonnen nichts, aber man wünschte und winkte — so verschwand ein alter Brauch nach dem andern. Bis schließlich nur noch der Name übrig blieb: Rosenfest. Aber unsere Äbtissin hat es wieder hochgebracht.«
»Was tat sie?« fragte er.
Der Pfarrer erzählte: »Sie nahm alle die alten Gebräuche wieder auf — wie sie verzeichnet stehn in der Klosterchronik. Nur ein paar allzu rohe ließ sie fallen. O, Sie werden ja sehn, wie es zugeht. Die Kölner sind sehr gegen sie; man befürchtet, daß das Trinkfest Ärgernis gäbe bei den Frommen und höhnisches Lachen auslöse bei den Heiden. Nur — die Äbtissin ist eine Droste, von der Vischeringlinie, wissen Sie, drei aus ihrer Sippe waren schon Äbtissinnen dieses Klosters. Und ihr Onkel ist der Mainzer Erzbischof, einer ihrer Brüder der Fürstabt von Trittheim. Da will man nicht zufassen. Solange sie lebt, blühn die Rosen in der Johannisnacht.«
Gegen zehn Uhr kamen sie zum Kloster; der taube Gärtner öffnete ihnen. Sie gingen durch den weiten Garten, über weiße Kieswege, die der Mond streichelte. Der Pfarrer zeigte ihm eine mächtige Zeder, die tiefschwarz sich hob in all dem Silberglanz.
»Vom Libanon!« sagte er. »Sie erzählen, daß eine Nonne sie mitgebracht habe als kleines Bäumchen, eine junge Nonne, die sich mit dem Kinderkreuzzug Peters von Amiens anschloß und dann zurückkehrte als uralte Frau. Aber es stimmt nicht. Ein Droste brachte das Bäumchen vom Libanon, vor hundertfünfzig Jahren erst, ein Vetter der dritten Äbtissin seines Geschlechtes.«
Der Gärtner führte sie in den Vorhof, dann in den Kreuzgang, hieß sie da warten. »Die Nonnen kommen gleich,« sagte er, »sowie die Andacht zu Ende ist.«
Frank Braun sah sich um. Rings im Klaustrum brannten wenige Lampen; aber der Mondschein fiel strahlend in den Kreuzhof. Glatt war der Boden gedeckt, mit mächtigen, weißen Marmorplatten; überall an den Säulen, hoch hinauf zu den Galerien krochen die Rosenbüsche. Weiße Rosen, viele Tausende weißer Rosen.
»Alles Niphetos und Boule de Neige,« sagte der Pfarrer. »Nur da vorne die drei Stämme sind Franziska Krüger, die habe ich gepflanzt vor zwölf Jahren nun.«
Zwei lange Tische standen am Hauptende. Sie waren gedeckt mit weißem Damast und vor jedem Stuhle stand ein Teller und ein geschliffenes Glas. Silberkörbe standen da, mit Konfekt gefüllt, überall aber auf den Tischen, hingestreut auf das Tuch und wieder hochwachsend aus großen Kristallvasen Rosen, viele, viele, weiße Rosen. Dann, dazwischen, Venediger Karaffen, enghalsig und weit gebaucht. Aber sie waren leer.
»Bald werden sie leuchten von schwerem Zyperwein,« erklärte der Pfarrer. Er wies auf einen Rosenbusch. »Da — schaun Sie.«
Überdeckt von Rosen ruhte auf dem Holzgestell ein gutes Faß. Und daneben ein kleines noch, eng sich anschmiegend. »Das kleine ist meines,« lachte er. »Bernkasteler Auslese, vom Gymnasium zu Trier. Ich schick es her — ich mag den Zyperwein nicht. Den trinken die Frauen. Ihr Herr Onkel schickt ihn, jedes Jahr von Rom.«
»Wer?« fragte der Referendar. »Mein Onkel?«
»Freilich!« rief der Alte. »Ihr Onkel! Der Jesuit. Der Monsignore. — Kennen Sie die Geschichte nicht?«
O ja, seine Mutter hatte ihm davon erzählt. Von seinem Onkel, der Husarenrittmeister war. Der dann, nach dem Siebziger Kriege, den Abschied nahm, nach Rom ging, katholisch wurde und geistlich. Irgend etwas hatte das wohl mit der Äbtissin zu tun, darum sollte er ja hingehn zu ihr. Aber er hatte kaum zugehört damals und längst wieder das bißchen vergessen.
»Es ist besser, daß Sie Bescheid wissen, ehe Sie die Äbtissin sehn,« sagte der Pfarrer. »Kommen Sie.«
Am Fußende des Kreuzganges stand ein kleiner Tisch; drei Stühle, drei Teller, drei Gläser. Ein Konfektkorb wieder und ein großer Busch Rosen.
»Da sitzen wir,« fuhr er fort, »Sie, ich und der Diakon, der jetzt die Andacht hält. Setzen Sie sich.« Er nahm zwei Gläser, ging zu dem Moselfäßchen, füllte sie. »Trinken Sie, Doktor — in der Nacht, da die Rosen blühn.«
So hell klangen die Gläser, mitten hinein in den Schlag der Nachtigall, die aus den Rosen sang. Und, ganz leise, weither klingend aus der Kapelle, erscholl der Nonnengesang.
»Stabat mater Speciosa!« sagte der Pfarrer. »Ich brachte das Lied der Äbtissin, ich! Sie läßt es singen, einmal nur im Jahre — in der Johannisnacht. Ich erzählte ihr von Jacopone von Todi —«
Das war das erstemal, daß der Referendar von der ›Speciosa‹ hörte und von dem Todaner.
Der Pfarrer leerte sein Glas. »Nun sind sie gleich zu Ende.« sagte er. »Hören sie also!«
Er begann die kleine Geschichte der Äbtissin, und gleich, bei den ersten Sätzen schon, fiel dem Referendar wieder ein, was ihm damals die Mutter erzählt hatte. Aber er unterbrach ihn nicht. Lauschte, träumte in die Rosen.
Sein Onkel — ja, der hatte einen Freund und Kameraden, Leutnant wie er im selben Regiment. Und der verlobte sich mit Lenore Droste — achtzehn Jahre war sie damals alt. Jung war sie und sehr schön; sie gab ihre Hand dem Jugendgespielen, dessen väterliches Gut neben dem Stammsitz ihres Geschlechtes lag. Er liebte sie — und sie mochte ihn gern — doch sie wußte nicht, was Liebe war. Damals nicht. Aber sie wußte es gut, drei Monate später, als sie den andern kennen lernte, ihres Verlobten Freund — seinen Onkel.
Die beiden wußten, daß sie sich liebten, doch sprachen sie nie davon. Dann kam der Krieg, und die Reiter ritten ins Feld. Da nahm sie Abschied von ihrem Bräutigam; der küßte sie und sie weinte. Aber eine Stunde später kam der andere. Sie wollten es nicht — keines — und doch lagen sie eines in des andern Armen — und sie küßten sich heiß, heiß, einmal fürs Leben — dennoch.
Der fiel, der andere. Gleich bei Spichern fiel er. Aber sein Onkel kam zurück, Rittmeister, Eisernes Kreuz — ein lachender Held.
Nur: die Geliebte fand er nicht mehr. Die hatte den Schleier genommen bei den Dominikanerinnen, tat Buße für den einen Kuß, der den Bräutigam verriet. So sind die Droste. Ihr Kuß verriet des Verlobten gute Liebe — und ihr Verrat wieder spitzte das Bajonett, das ihn vom Pferde stieß. — War es nicht wirklich so?
So — und nicht anders?
Lenore Droste glaubte es und auch der — den sie nie wiedersah. Er nahm Urlaub erst, reiste nach Italien. Nahm dann den Abschied, trat über zum katholischen Glauben, wurde geistlich — wie sie.
Aus heißer Überzeugung — ganz gewiß. Und doch auch: konnte er dieser Frau seine Liebe besser zeigen?
Sie stiegen beide. Monsignore war er und sie Äbtissin Beata. Sie schrieben sich nicht, nie, aber sie hörten voneinander. Und nun, seit Jahren schon, schickte er den Zyperwein für das Rosenfest.
Das war die Geschichte.
Aus der Türe der Sakristei, unter dem Säulengang her, kam der Diakon. Ein Sechziger, groß und stark, mit vollem, weißem Haare und klugen Augen. Der Pfarrer begrüßte ihn und stellte ihm seinen jungen Freund vor. »Kommt die Äbtissin?« fragte er.
»Gleich werden sie da sein,« antwortete der Diakon. Und er leerte ein Glas auf des Pfarrers Wohl.
Wieder setzte die Orgel ein, da öffnete sich die Türe der Kapelle. Langsam schritten die Klosterfrauen in das Klaustrum zu zwei und zwei; eine jede trug einen Zweig, und an jedem Zweige leuchteten drei Rosen.
Nicht weiße — rote, glutrote Rosen waren es.
»Die Wunden Christi,« sagte der Pfarrer.
»Und zugleich die Dreieinigkeit,« erklärte der Diakon. »Drei: Vater und Sohn und Heiliger Geist — und doch eines nur: eine Gottheit.«
Unter den Säulen des Klaustrum wandelten sie, leise singend, rundherum um den Kreuzgang, in den Mondschein hinaus. Durch die weißen Schleier der Rosen tropften die süßen Perlen von Palestrinas Klängen:
›Jesu! Dulcis memoria,
Dans vera cordi gaudia:
Sed super mel et omnia,
Ejus dulcis praesentia!
Sic, Jesu, nostrum gaudium —‹
So süße Worte. So süße Klänge.
Durch den vierten Bogen kamen die Nonnen hinaus in den Hof, umschritten die großen Tafeln, blieben stehn vor ihren Stühlen. Zuletzt die Äbtissin; ihr ging die alte Pförtnerin voraus. Die trat zur Seite, rückte die Kissen zurecht auf dem hohen Thronsessel. Und die Äbtissin stieg die kleine Stufe hinauf, setzte sich, gab mit dem Rosenzweige ihren Nonnen das Zeichen, Platz zu nehmen.
Frank Braun starrte hinüber zu ihr. Sie war schön, die Äbtissin, still und sehr schön. Wie alt mochte sie sein?
Er rechnete. Vierzig — oder nein, siebenunddreißig nur, achtunddreißig vielleicht. Und zwanzig Jahre im Kloster —
Die alte Pförtnerin bediente ihren kleinen Tisch. Sie füllte die Moselgläser. Aber vier junge Nonnen nahmen die blanken Karaffen, zapften den dunklen Wein und schenkten ringsum den Schwestern. Dann, auf ein Zeichen der Äbtissin, standen alle auf und beteten.
Ganz kurz nur, still und schweigend.
Und schweigend hob die Äbtissin ihr Glas und schweigend leerte sie es. Alle die andern taten wie sie.
Die Äbtissin Beata winkte mit dem Rosenzweig, da trat eine junge Nonne in des Kreuzgangs Mitte.
»Nun kommt das alte Spiel von der wunderkräftigen Liebe Jesu, von der Liebe, die nimmer aufhöret,« sagte der Pfarrer. »Man sagt, daß die erste Droste es erfand. Durch Jahrhunderte sprach mans lateinisch hier, aber unsere Äbtissin hats übersetzt in Deutsch. Schwester Agnes spricht es.«
Die junge Nonne begann, halb sprechend, halb singend, psalmodierend. Sie erzählte von Jesus Liebe, die viel größer sei, viel tiefer, als eines Menschen Hirn sichs ausdenken könne. Und wenn eine Seele noch so sehr beladen sei mit schlimmer Sünde, so könne sie dennoch errettet werden, wenn sie bußfertig zum Herrn Jesu komme. — Sieben Jahre war der Ritter Tannhäuser im Hörselberge bei Frau Venus, der schlimmen Teufelin, arg verstrickt in alle bösen Sünden. Dann entfloh er, zog nach Rom, um Buße zu tun. Er kniete nieder vor dem Papste Urban und küßte seiner Finger Spitze. Er beichtete alles, was er getan, flehte um Absolution. Aber der Heilige Vater war zornig über solch üblen Greuel, sagte, daß er ihn nimmer lossprechen könne, und daß er brennen müsse in tiefster Hölle. Keine Rettung gäbe es für ihn, keine — er sei verdammt auf ewig. Seinen Krummstab stieß er auf den Boden, sagte, wenn der alte Stock da frisch ausschlage, dann sei noch Hoffnung für den Ritter — und sonst nicht.
Der ganze Chor der Nonnen sang des Papstes harte Antwort, die so schloß:
»Nicht eh sich ein Leben im Holze da regt —
Eh aus diesem Krummstab ein Röselein schlägt,
Eh nicht!«
Da tat der Ritter Tannhäuser einen zweiten Kniefall, küßte des Heiligen Vaters Fuß, schluchzte, bat und flehte. Aber der Papst war noch zorniger, herrschte ihn an und wiederholte sein Nein!
»Nicht eh sich die ganze Welt verkehrt,
Von der Erde zum Himmel man abwärts fährt —
Eh nicht!«
Und zum dritten Male warf sich der Ritter zu Boden, küßte den Staub von den Schuhen des Papstes, jammerte und weinte sehr. Doch der Heilige Vater verharrte in seinem gerechten Zorn, jagte ihn fort von der geweihten Stätte, die er beschmutze mit seiner Gegenwart, zurück dahin, wo er gekommen und wohin er gehöre — zu der Teufelin Venus im Hörselberge. Nie und nimmer würde er Vergebung seiner Sünden erlangen!
»Nicht ehe es wintert zur Sommerzeit,
Eh Wein es regnet und Röselein schneit —
Eh nicht!«
Da erhob sich der Ritter vom Boden, nahm den Pilgerstab und ging davon. Und alle in dem großen Saale wichen scheu zurück vor ihm, für dessen arme Seele es keine Rettung mehr gab aus dem ewigen Feuer.
In der Nacht aber erschien im Traume dem Heiligen Vater ein schönes Knäblein, das trat heran zu ihm und sprach: »Nimm deinen Stab und folge mir.« Und verschwand in den Gärten.
Da wachte Papst Urban auf, und es war schon heller Morgen. Er ließ sich ankleiden, gedachte seines Traumes und befahl, daß man ihm seinen Krummstab bringen solle, da er wandeln wolle in seinen Gärten. Sie brachten ihm den Stab und der Heilige Vater nahm ihn und schritt die Treppen hinab. Er wandelte durch die Gärten und kam zu den Feigenbäumen, die hingen voll reifer Früchte. Da bekam der Papst Lust, Feigen zu essen. Er stieß seinen Stab in die Erde, ging rund um die Bäume, brach die schönsten Früchte ab und aß sie.
Hier unterbrach sich die Nonne. Eine dienende Schwester trat zu ihr, reichte ihr einen alten Stock in der Form eines Krummstabes. Den nahm sie und stieß ihn auf die Marmorplatten, als ob sie ihn in den Boden stoßen wolle — die Alte hielt ihn so fest. Dann ging Schwester Agnes herum im Kreuzgang, tat, als ob sie Früchte von den Bäumen bräche und sie äße; währenddessen drängten sich die andern Nonnen um die Alte, die den Stab hielt. Nun kehrte Schwester Agnes zurück, nach ihrem Stabe suchend.
Blieb stehn, erzählte weiter.
— Und der Papst Urban kam zu dem Platz zurück, wo er seinen Stab in die Erde gestoßen hatte, und fand ihn nicht. Er war verschwunden: an seiner Stelle aber stand ein Rosenbaum — der war gewachsen genau in der Form seines Krummstabes. Er trug nur wenig, ganz junges Grün und dazu drei kleine Rosenknospen.
Die Nonnen öffneten den Kreis — da fand Schwester Agnes ihren Stab wieder — der mit Rosenranken geschmückt war und mit drei Röselein.
— Und der Heilige Vater ging weiter durch seine Gärten. Es schien ihm, als ob in dem Flimmern der hellen Sonne ein Knäblein ihm vorausschritte, dem folgte er. Da kam er an einen kleinen, runden Teich, trat dicht heran, blickte hinein. Die Pinienbäume spiegelten sich in dem klaren Wasser und wuchsen tief hinunter, aber unten, ganz auf tiefstem Grunde leuchtete der blaue Himmel und die leichten, weißen Wölkchen, die darüber zogen —
Hier unterbrach Schwester Agnes ihren Sprechgesang zum andernmal. Trat heran an das Wasserbecken in der Ecke des Kreuzhofes, gefolgt von den Nonnen.
»Kommen Sie,« sagte der Diakon, »das ist sehr hübsch.« Und sie mischten sich zwischen die Nonnen am Wasser.
Eine brachte ein kleines Pappkästchen, das öffnete sie langsam und sehr vorsichtig.
»Den Schauspieler stelle ich zur Verfügung!« flüsterte der Pfarrer dem Referendar zu. »Eins meiner Firmkinder fängt ihn für mich jedes Jahr. Früher wohnte er in einer Zigarrenkiste ein paar Tage lang, um sich auf das Fest vorzubereiten, aber die Nonnen meinten, daß das zu grausam sei — weil er den Geruch vielleicht nicht vertragen könne. Nun tu ich ihn in eine Seifenschachtel — vermutlich riecht er das lieber.«
Die Nonne nahm einen kleinen Frosch aus der Schachtel — den setzte sie der Schwester Agnes auf die flache Hand. Es war ein entzückendes, kleines Fröschlein, das goldgrün im Mondschein blinkte. Und seine klugen Augen guckten sehr verwundert in die Welt.
Die weiße Hand der Schwester Agnes zuckte ein wenig. »Er ist ganz kalt!« sagte sie.
Aber gleich nahm sie ihre Rolle wieder auf, deklamierte.
— Der Heilige Vater saß an dem Wasser — da sprang ein kleines Fröschlein in seine offene Hand —
»Er spannt schon!« rief eine helle Stimme. Und all die Nonnen kicherten.
»Die ist aus Wien,« erklärte der Pfarrer, »eine Metternich ist es.«
Der kleine Grüne wartete nicht auf sein Stichwort. Er sprang hinab, plumps, in das Wasser.
Und ›Ahs‹ und ›Ohs‹ — alle drängten heran, bogen die Köpfe vor.
Frank Braun sah den kleinen Frosch, wie er sprang und tauchte. Wie er schwamm, in schnellen Stößen, von dem Gras hinab, das über den Rand hing, vorbei an den rosenumrankten Säulen, die sich spiegelten im Wasser. Dem Monde zu und all den Sternen zu und hinab in den strahlenden Himmel — von der Erde hinab.
Er nahm alles Interesse, und keines achtete mehr auf der Nonne Gesang. Ihr Fröschlein tat, wie das des Heiligen Vaters auch — nur schwamm das durch leuchtenden Sonnenglanz. Und verschwand irgendwo, tief im Grunde — unten, im Himmel.
»Ich seh ihn!« kicherte die Metternich. »Schaugts, da sitzt er!«
Alle traten wieder zurück; Schwester Agnes stand in der Mitte. Sie erzählte, wie Papst Urban sehr nachdenklich wurde und sehr ernst. Wie er Befehl gab, hundert reitende Boten auszuschicken, die sollten herumreiten und spähen und suchen und den Ritter Tannhäuser zurückbringen zur Engelsburg. Und er saß auf seinem hohen Stuhle und aß nicht und trank nicht und sprach kein Wort. Sann lange nach und wartete.
Aber in dieser Nacht, die die Johannisnacht war, hatte er den Dominikanerinnen versprochen, ihr Gast zu sein. Es war das erstemal, daß er hinging, mit ihnen zu feiern das Rosenfest zu des Herrn Jesu Ehren. Wie er aber eintrat in den Kreuzhof ihres Klosters, da schneite es weiße Röslein über ihn und regnete klaren Wein, und er hörte der frommen Schwestern Gesang:
»Des Herren Liebe tut Wunder allzeit,
Sie macht, daß es mitten im Sommer schneit.
Herr Jesus läßt regnen den goldnen Wein
Und schneit vom Himmel die Röselein!«
— Schwester Agnes sprach es nicht, alle die Nonnen sangen es. Oben aber auf den Galerien standen plötzlich zwölf Nonnen und mehr. Die einen hatten Schalen, in die tauchten sie die Finger und sprengten Wein hinab — wie goldene Tautropfen. Und die andern warfen Rosen, viele, viele, weiße Rosen, die schneiten hinunter von allen Seiten auf die hellsingenden Schwestern.
Dann schwiegen sie; Schwester Agnes beendete ihre Erzählung. Aber sie berichtete nicht, was mit dem armen Ritter geschehn sei, sie sagte nur, daß der Papst mit den Frauen niedergekniet sei und dem Herrn Jesu lobgesungen habe. Und das Ganze schloß mit einem jubelnden Preisgesang auf das Herz Jesu, dessen reine Liebe alle Kreatur umfasse und viel, viel tiefer sei, als Menschengedanken erfassen könnten.
— Die Äbtissin winkte der Schwester Agnes, die trat heran und kniete vor ihren Thronsessel. Die Äbtissin sagte ihr ein paar freundliche Worte und streichelte ihre Wange; dann entließ sie sie. Und alle Nonnen setzten sich an die Tafeln, nippten von dem Weine, knabberten von dem Konfekt. Es war ein Tuscheln und Kichern und Schwätzen und leises Lachen in dem Hofe, wie in einer Mädchenschule, wenn grade Pause ist.
Wieder erhob sich die Äbtissin. Sprach: »Laßt uns singen, Schwestern.«
Vier Nonnen traten heraus, eine alte, große und starke, zwei junge und eine kleine Novize. Sie stellten sich unter den Portikus, der wild überwuchert war von all den Rosen. Die Große gab den Takt mit ihrem Rosenzweig; vierstimmig sangen sie.
»Laßt uns singen und fröhlich sein,
In den Rosen,
Mit Jesus und den Freunden sein.
Wer weiß, wie lang wir hier noch sein
In den Rosen?«
Und alle nahmen es auf und hell klang es in die Mondnacht: »In — den — Rosen!«
»Die große ist eine Dalwigk,« flüsterte der Diakon, »und die rechts, die mit dem Stumpfnäschen, eine Romberg.«
»Jesus Wein ist aufgetan,
In den Rosen,
Da sollen wir allesamt hingahn,
So mögen wir Herzensfreud empfahn
In den Rosen.
Er soll uns schenken den Zyperwein,
In den Rosen,
Wir müssen alle trunken sein
Wohl von der süßen Minne sein,
In den Rosen.«
Sie schwiegen, und die Äbtissin stand auf. »Liebe Schwestern,« sprach sie, »trinkt auf des Bräutigams Liebe.« Sie trank ihr Glas aus zur letzten Neige und alle folgten ihr. »Schenkt ein!« rief sie. »Schenkt den Zyperwein!«
Schwester Klara, die Freiin Dalwigk, hob ihren Rosenzweig, gab den Einsatz: da sang die Novize allein. Fast ein Kind noch war sie, so jung und zart und schlank. Ihre Stimme klang wie flüssiger Mondschein, wie ein Regen im Mai, wie weiße Rosenblätter, die Kolombine in die Luft wirft —
»Setzt das Gläschen an den Mund,
In den Rosen,
Und trinkt es aus bis auf den Grund,
Da find't ihr den Heiligen Geist zur Stund
In den Rosen.«
»Ti — Ti — taa — taa!« scholl es wieder aus dem Säulengang. Und die Nachtigall griff den Ton und flötete »Tu — tü — tüü — tü!«
Da winkte die Äbtissin: »Antworte!« Die süße Novize sang, lauter und voller: »In — den — Rosen — —« und lauter und voller schlug die Nachtigall die Töne: »Tü — tü — tüü — tüü —«
Noch einmal, blank und hell, wie ein Hufschlag auf leuchtenden Marmorplatten, und wieder, sterbend fast, schmerzend und keuchend, wie ein Abschied von allem Leben —
Und immer antwortete die Nachtigall.
Da schluchzten die Nonnen. Und aus des Pfarrers Augen fielen zwei große Tränen.
»Das ist schön,« sagte er, »so schön!«
Aber der Diakon flüsterte: »Ja. Und sehr — heidnisch.« Doch auch seine Augen schimmerten feucht.
Die Äbtissin hob sich. Sie sagte: »Mitten unter uns ist er: Jesus, der Gott der Liebe.« Sie nahm ihr Glas, streckte den Arm aus und trank den Schwestern zu.
Sie stießen an, und sie tranken. Und sie sangen alle.
»Laßt das Gläschen ume gahn
In den Rosen!
So mögt ihr fröhlich heimwärts gahn
Und alle Zeit in Freuden stahn
In den Rosen!«
Auch der Diakon stand auf und der Pfarrer und der Referendar. Und sie sangen mit den Schwestern: »In — den — Rosen.«
Die alte Pförtnerin füllte ihre Gläser; die kleine Novize aber und die junge Schwester Ursula liefen geschäftig herum um die Tische, schwenkten die Karaffen und schenkten ein. Und alle tranken und sangen.
Dann winkte die Äbtissin dem Pfarrer, hieß ihn willkommen und begrüßte ihn. »Erzählen Sie von der Nachtigall, Vater,« lächelte sie, »wenn Sie Ihren Bericht machen für Köln.«
Der Pfarrer versprach: »Das werde ich gewiß tun!« Er rief den Referendar heran, stellte ihn der Äbtissin vor.
Sie sagte: »Der ist es also — der.«
Sie fragte ihn nach seiner Mutter und nach andern Verwandten. Nach seinem Onkel fragte sie nicht.
Er gab Auskunft, seine Lippen sprachen. Aber er dachte nichts, all sein Empfinden drang in die Augen. Er sah nur, sah —
Da saß auf ihrem Thronsessel, diese große schöne Frau. Gütig, heilig und ernst — tot in allem Leben. Nur die Hände sah er, und, rund ausgeschnitten, das Gesicht. Alles sonst verhüllt, streng, in jeder Falte härteste Form. Schwarz und Weiß des Ordenskleides. Hinter ihr der hohe Vorhang der weißen Rosen, aber rote Rosen auf ihrem Schoße — damit spielte die Hand. Diese Heiligenhand, klein, süß, ein wenig voll.
Und blanke, blaue Augen —
Sie ließ ihm ein Glas mit Zyperwein füllen — trank mit ihm.
Dann kniete er. Mit beiden Knien auf der Stufe ihres Sessels, dicht vor ihr. Etwas zog ihn dahin, und er kniete.
Er dachte: ›Nun muß ich ihren Segen bitten‹. Aber er sprach kein Wort.
Die Äbtissin hob die Hände, berührte leicht, mit den Fingerspitzen nur, seine Schläfen. Schaute ihn an, schweigend. Das deuchte ihn eine Ewigkeit.
»Wie er,« murmelte sie, »wie er.«
Sie hob seinen Kopf — beugte sich nieder zu gleicher Zeit.
Sie küßte seine Stirn und küßte ihm beide Augen. Drei Küsse gab sie ihm.
Dann, o ganz leicht nur, stieß sie ihn zurück. Sprang auf, hielt ihm den Rosenzweig hin.
»Geh!« sagte sie. »Geh!«
Er ergriff den Zweig mit den Blutrosen. Hob sich schwankend, taumelte. Wich zurück ein paar Schritte.
Stand bei dem Pfarrer und dem Diakon. Sie sprachen leise und schnell, aber er hörte nicht, was sie sagten. Starrte hinüber zu der schönsten Frau —
War es nicht die Gottesmutter, die ihn küßte?
Die Äbtissin stieg hinab von ihrem Throne, schritt schnell durch den Portikus. Und alle Nonnen folgten ihr.
Still war es in dem weiten Kreuzgang. Nur der Mond auf den Marmorfliesen, nur, rings herum, das weiße Rosenmeer. Ah — ein Leuchten —
»Ist das Fest zu Ende?« flüsterte er.
Der Pfarrer sagte: »Sonst nicht. Aber heute — wird es wohl zu Ende sein.« Er nahm seinen linken Arm; der Diakon faßte ihn rechts. So brachten sie ihn über den Kreuzgang. An den Säulen blieb er stehn. »Einen Augenblick —« bat er, »eine Sekunde noch —«
Er blickte zurück. Rosen, Rosen, weiße Rosen und Mondschein. Ein Glas war umgestoßen — da floß der Zyperwein über den strahlenden Marmor. Wie schwarzes Blut floß der Wein. Und die Nachtigall schluchzte.
Er preßte die Hand des Diakons. »Hochwürden,« flüsterte er, »sprechen Sie. Ein Wort nur — irgend was! Ich muß Ihre Stimme hören. Ich will wissen, daß alles das — Wirklichkeit ist!«
»Ja, ja —« sagte der Diakon. »Es ist Wahrheit. Kommen Sie, junger Freund.« Sie gingen durch den Klostergarten, schritten durch die kleine Pforte. Sie stiegen in den Einspänner, fuhren über Land. Durch den Birkenwald erst und über die Holzbrücke des Angerbaches — brachten den Diakon nach Hause.
Aber Frank Braun sah nichts, hörte nichts — träumte den Kreuzgang, aus dem die Nonnen flohen, den leuchtenden Kreuzhof und all die Mondrosen.
»Der Diakon hat recht,« sagte der Pfarrer. »Das war das letzte Rosenfest der rheinischen Nonnen.«
»Warum?« fragte er. »Warum?«
Der Pfarrer wiegte langsam den Kopf. »Das war eine Sünde damals, als die Freiin Lenore Droste den Freund ihres Verlobten küßte — und sie büßte die Sünde und nahm den Schleier. Sie büßte ihre Sünde durch zwanzig Jahre, bis —«
»Bis —?« drängte er. »Pfarrer — bis?«
»Heute nacht, zwischen Wein und Rosen, küßte die Äbtissin Beata ihres Freundes Neffen — oder auch: wieder ihren Freund. Wie Sie wollen. Das war eine schlimmere Sünde noch.«
Er flüsterte: »Eine Sünde war es? — Eine Sünde?«
Der Pfarrer sagte: »Nicht für Sie — und wohl nicht für mich. Vielleicht nicht einmal für den Diakon, der doch strenger ist. Aber ihr, der Äbtissin scheint es eine große Sünde. Ein Kuß verriet ihres Lebens Bräutigam — und ihrer Seligkeit Bräutigam — Jesum, ihren Erlöser — verriet sie wieder mit einem Kuß. In dieser Nacht! — Das ist gewiß das letzte Rosenfest — da mögen die Kölner zufrieden sein.«
»Was soll ich tun?« fragte er.
Seine Stimme zitterte, da streichelte der Pfarrer ihm die Wange. »Sie?« sprach er. »Nichts können Sie tun. Schlafen Sie gut und beten Sie für eine heilige Frau!«
Er träumte nicht in dieser Nacht. Er schlief fest und still. — Aber am nächsten Morgen ging er zum Pfarrer.
»Ich kann ihr doch helfen,« sagte er. »Ich will tun, was mein Onkel tat. Ich will katholisch werden.«
Der Pfarrer sah ihn an. Er sprach kein Wort, aber seine guten Augen strahlten. Langsam nickte er, reichte ihm die Hand.
»Ich will katholisch werden,« wiederholte Frank Braun.
— Aber dann vergaß er es wieder.
Vergaß es — wie er das Rosenfest vergaß, und den guten Pfarrer — und die Äbtissin. So reich war das Leben. — Dachte daran erst heute wieder, als das alte Lied die Schleier löste von den Vergangenheiten.
Sehr leise nur sang die Orgel und sehr leise klangen die Stimmen vom Garten her. Kein einziges Wort konnte man heraushören, nur die weichen Töne —
Dann aber griff eine volle Stimme den alten Sang. Wandelnd durch den Garten hin klang sie, süß, stark, wie aller Liebe heißester Glauben —
»So singt nur eine auf der ganzen Welt,« sagte André.
Und es klang:
»Jesu! Dulcis memoria,
Dans vera cordi gaudia —«
Rossius nickte: »Herrgott — hat das Weib eine Stimme!«
Langsam, zwei und zwei, kamen vierzig Dominikanerinnen aus dem Garten heraus, den Rosenkranz in den Händen. Sie bewegten die Lippen, als ob sie still beteten, schritten ringsherum an den Estraden, blieben jedesmal stehn vor der Äbtissin Thron, machten einen tiefen Knicks — gingen dann feierlich weiter. Stellten sich auf in der Mitte.
Und nur der Farstin allmächtige Stimme lebte in den weiten Sälen.
»Ich bin neugierig, was sie bekommt!« flüsterte André. »Unter drei Mille macht sie den Zauber nicht mit, das ist sicher.«
Dann schwieg die schönste Stimme. Die Gäste klatschten, als ob sie in der Oper wären. Aber die Äbtissin, Susan Pierpont, erhob sich, winkte mit der Hand. Da begriffen sie, daß das Stück noch nicht aus war, legten die Hände wieder in den Schoß.
Von neuem nahm der Nonnenchor das Lied auf, aber laut jetzt und voll, vierzig Frauenstimmen.
»Nun werden Sie was erleben, Doktor,« lachte André. »Es sind meine Chormädel, die ich der Pierpont ausgeborgt habe — mein Kapellmeister hat zwei Wochen mit ihnen geprobt und ist halb irrsinnig geworden von dem Geheul.«
Sie begannen:
»Nil cantitur suavius,
Nil auditur jucundius,
Nil cogitatur dulcius,
Quam Jesus Dei Filius!«
Aber die Schwarzweißen sprachen es englisch aus. Sie sangen:
»Neil kenteitör sjuäveiös, neil odeitör
dschököndeiös,
Neil kodscheitetör dölceiös, quäm dschisös diei
feileiös!«
Sangen es dazu synkopiert; wie ein Ragtime klang es, schauderhaft hingegröhlt aus ausgekrähten Operettenchorstimmen.
»Hat das Ihr Kapellmeister angeordnet?« fragte Frank Braun.
»Nein, nein,« lachte der Direktor, »er hat sich dagegen mit Händen und Füßen gewehrt. Aber die Pierpont hats halt gewünscht, sie meinte, das brächte ein wenig Leben in die Sache und wäre ein sehr guter Übergang zu dem burlesken Teile.«
Don Cesare verzog schmerzlich sein Gesicht bei dem Geheul, aber der Äbtissin gefiel es sehr und allen ihren Gästen. Sie klatschte zuerst — und nun durften alle klatschen, jetzt, da die Nummer aus war.
»Warum tanzen die Mädel nicht dazu?« fragte Rossius. »Wenn schon — denn schon!«
»Weil sie eben Nonnen sind —« erwiderte Andre, »und weil wir in Amerika sind. Einen Ragtime singen, das geht noch eben — aber tanzen? Da möchte der liebe Gott ernstlich böse werden.«
Die Nonnen zogen ab; Buffi sprangen in den Saal. Pulcinello, Arlequino und Pantalone, Frarassa, Colombina und Isabella. Brighella, auch Scaramuccia und Santorello. Man sah bei diesem Spiele, wie sehr sich der Regisseur abgequält hatte, den braven Leuten ein wenig Stilgefühl beizubringen. Aber eher hätte er gichtbrüchige Möpse zur Buffopantomime abrichten können. Es war ein klägliches Armeschwenken, ein unsinniges Gestenmachen, aus dem kein Mensch klug werden konnte.
»Wie gefällt Ihnen Kolombinchen?« fragte der Direktor. »Ein netter Kerl, was! Es ist die kleine Davies vom Knickerbockertheater, die jüngste Favoritin der Pierpont.«
Man klatschte natürlich, als die Buffi abzogen. Diener liefen herum mit großen Tellern, reichten Kuchen und Gefrorenes, schenkten Limonaden und Eiswasser. Dazu bekam jeder Gast einen seidenen Beutel mit Pralinés.
»Gibts denn keinen Wein?« fragte Rossius sichtlich entrüstet.
»Sie sind in Neuyork, junger Mann!« belehrte ihn André. »Vergessen Sie das nicht. Gehn Sie zu einer der Bars — vorne im Wintergarten ist die nächste — da bekommen Sie soviel Sekt und Wein und Whisky, wie Sie nur trinken wollen!«
Eine Schar von Weibern stürzte auf die Bühne, hupfte und sprang einen Tanz, der bacchantisch wild wirken sollte. Sie hatten nackte Beine, Arme und Nacken, trugen um den Leib dünne Schleier in allen Farben, die über der Schulter und am Gürtel leicht gehalten waren.
»Das sind die Nonnen wieder,« erklärte der Direktor, »sie haben sich inzwischen in Kurtisanen verwandelt — so gehts im Leben.«
Die Äbtissin erhob sich, öffnete ihren Seidenbeutel, warf Konfekt hinunter. Und alle folgten ihrem Beispiel. Da warfen sich die Mädchen auf die Erde, rafften auf, so rasch sie nur greifen konnten. Knüllten ihr Gewand zur Schürze, sammelten die Bonbons hinein, taten auch so, als ob sie sich raufen möchten, nahmen eine der der andern die Dinger weg. Der Herold blies — da hörten sie auf. Der Zeremoniemeister stieg von der Estrade herab; er war der Preisrichter. Diener zählten die Pralinés; einhundertsiebenunddreißig hatte eine Hagere eingeheimst, eine mit sehr dürren, langen Beinen. Sie war die Siegerin und die Äbtissin gab ihr den Preis: ein brillantenbesetztes Armband.
Die Mädel stellten sich hinten auf; unter den Klängen des Gladiatorenmarsches zogen jetzt die Athleten herein.
»Kennen Sie die?« grinste Herr André. »Fritz Rachmanns Ringkämpfer vom Manhattan-House! Na, Rossius, Sie haben ja im Sommer bei ihm gearbeitet — wer ist der Dicke da, der ohne Hals?«
Der Sekretär schnurrte: »Pierrard le Colosse! — Neben ihm steht Wladek Zbysko aus Krakau, dann Aberg und Lurich. Luigi Mazzantini, der richtig Müller heißt und Schiffskoch auf der ›Kronprinzessin‹ war. Albert Fürst, der Stolz von Hernais, sonst Kellner im Plazahotel, Linoff, der Kosak, Hevonpää, der Stern Finnlands —«
»Danke, danke!« sagte Andre, »Ihre sportlichen Kenntnisse sind erstaunlich.«
Die Männer hatten kein Trikot an, nur einen ganz schmalen Schurz um die Lenden. Die Diener schleppten zwölf große Matten herein, legten sie hier und dorthin auf den Boden. Dann trat der Herold zu den Athleten, ließ sie aus einem Helm Lose ziehen, verkündete laut, welche Ringer gegeneinander kämpfen würden.
Und die Starken traten, zwölf Paare zugleich, auf ihre Matten, faßten sich an. Sie machten Schaukämpfe nur, faßten Nelson, Armfallgriffe, Krawatten. Catch-as-Catch-Can hier, und daneben Griechisch-Römisch, gemischt auch, wies gerade kam. Es war ein Fioleringen und zahm genug für den Kenner — aber wer verstand hier etwas davon? Nacktes Muskelfleisch starker Männer für all die Frauenaugen — das war der Witz! Der Kosak Linoff fletschte ein paarmal die Zähne, wenn der Gegner aus seinen langen Affenarmen sich herauswand, und der Finne Hevonpää spielte den Wilden Mann. Schrie, brüllte, raste als Berserker herum, ballte die Faust gegen das Publikum — das war seine Note, dafür wurde er bezahlt.
Burchard der Zeremonienmeister, wirkte als Kampfrichter, und die Ringer machten ihm sein Amt leicht genug. Wo er nur hintrat an eine Matte, fiel einer, blieb mit beiden Schultern an den Boden geheftet, wie angenagelt.
»Sieger — Lindström, der schwedische Riese,« verkündete er. »Sieger — Winnetou, der Komanchenhäuptling.«
»Der heißt Huber und ist Metzgergeselle,« lachte Rossius.
»Sieger — Sam Einstein, die Hoffnung der Ostseite,« rief der Zeremonienmeister. Und wieder »Sieger — Pierrard le Colosse!«
Er führte die zwölf Sieger rund herum, dann hinüber, wo die Kurtisanen standen — die waren der Preis für die Helden im Liebeskampfe: jeder von ihnen sollte sich eine auserwählen. Diese Komödie war für die starken Männer viel schwerer als jeder Ringkampf. Sie sollten wild tun und gewaltsam eines der Mädchen greifen, die Beute hochheben und davontragen. Und die Kurtisanen sollten mit gierigen Blicken die Starken verschlingen, an sich locken, dann aber entsetzt sein und sehr erschreckt über so viel Kraft und brutale Gewalt; sollten schreien und weinen und um sich schlagen. Aber der Chordamen Blicke verschlangen gar nichts, und die nackten Ringer taten so geniert wie Gymnasiasten in der ersten Tanzstunde. Der Komanchenhäuptling Huber schlug die Hacken zusammen und stand stramm vor seiner Auserwählten, als ob er die Frau seines Unteroffiziers beim Kaiser-Geburtstagsball zum Tanze engagiere. Der Stolz von Hernals bot seiner Dame galant den Arm und Pierrard de Colosse — dreihundert Kilo schwer und mit dem runden Kegelkugelköpfchen eines fünfjährigen Kindes — stand völlig hilflos da und rührte sich nicht. Nur Hevonpää, der rasende Finne, spielte seine Rolle gut, ließ die Zunge lang heraushängen, gab grunzende Töne von sich und warf die Stieraugen von einer zur andern, als wollte er sie alle zugleich haben. Dann stürzte er plötzlich auf den schlanken Jim Hawkins, die schwarze Perle, die gerade einem dünnbeinigen, bleichsüchtigen Ding die Hand gereicht hatte, entriß dem Neger das Mädchen mit einem wilden Geheul, riß es hoch und trug es auf der Schulter durch den Saal. Das Chorfräulein bekam wirklich Angst, schrie um Hilfe und zappelte — und die Äbtissin und alle ihre Gäste lachten und klatschten.
Die Sieger zogen mit ihren Erwählten ab, ließen sie aber gleich wieder fahren, schritten nach rechts in den Garten, während die Chordamen links abgingen.
»Nun sind meine Mädchen fertig,« sagte André, »können sich anziehen und werden nach Hause geschickt. Sie bekommen hundert Dollar für den Abend und jede Probe besonders bezahlt mit zehn — ein gutes Geschäft!«
»Und die Ringer?« fragte Rossius.
»Ich weiß nicht,« sagte der Direktor, »vermutlich viel mehr. Übrigens beginnt erst ihre Haupttätigkeit; sie bleiben da, bekommen tüchtig zu essen und noch mehr zu trinken. Dann, wenn sie genügend eingetaucht sind, werden sie losgelassen — oder vielmehr die Mondweiber lassen sich selbst los, und die Kerle sind ihr Wild! Aber ich glaube, die Damen werden bitter enttäuscht sein: in puncto Liebe versagt fast jeder Athlet!«
Das Schauspiel war zu Ende. Der Herold ließ die Fanfaren blasen — die Äbtissin stand auf und stieg mit Cesare die Stufen hinab. Die Musik setzte ein und der Tanz begann. ›Hesitation‹ natürlich — in Renaissancegewändern!
Die drei gingen durch den Wintergarten zur nächsten Bar, um die enggedrängt Damen und Herren standen. Alles stürzte man hier hinunter, rasch durcheinander, Cocktails, Sekt, Whisky, wie es die Diener reichten.
Eine Hand legte sich auf Frank Brauns Schulter: er wandte sich um.
»Aimée Breitauer?« rief er. »Wie kommen Sie hierher?«
»Wie ich herkomme?« lachte sie. »Ich bin Amerikanerin so gut wie eine hier — bin Mitglied vom Klub!« Sie griff seinen Arm. »Sind Sie schon durchgewandert, Doktor? Kommen Sie, ich werde Sie führen.«
»Ich wollte ein Glas Wein trinken —« meinte er.
»Soviel Sie wollen,« rief sie. »Wir haben manch verschwiegene Plätzchen und einen kleinen Keller in jedem.« Sie zog ihn mit, in einen andern Saal, der sich anschloß an den Wintergarten. Hier standen viele kleine Zelte, die sich eng drängten, eines dicht an das andere. Der Saal war sehr dunkel, nur rot umhängte Lampen warfen hier und dort ein spärliches Licht. Sie schlug den Türvorhang eines Zeltes zurück, zog ihn hinein.
Persisch. Eine Ampel oben, viele Teppiche, Kissen. Ein paar Waffen an den Zeltwänden, und eine kleine Truhe hinten. Die öffnete die Breitauer: »Schau!« sagte sie.
Ein Sektkühler und ein paar Flaschen im Eise. Likörflaschen daneben, dann Kistchen mit Zigarren und Zigaretten. Auch Konfekt, Kuchen, Sandwiches.
Sie warf sich lang auf die Kissen. »Mach dirs bequem!« lachte sie. »Iß, trink, rauch — was du willst.«
»Wo haben Sie das Kostüm her?« fragte er. Sie sah erstaunlich gut aus, diese schlanke Frau, die nun Großmutter war schon seit zwei Jahren. Ihre Zähne leuchteten, eben und wundervoll gleichmäßig, wie die berühmte Perlenschnur, die sie nie vom Halse ließ. Aimée Breitauers Perlenschnur — zwei Meter zwanzig lang, über eine Million Dollar wert — davon sprach bewundernd jedes Ladenmädchen in Neuyork. Ihre Augen schimmerten in einem trunkenen Blau, wirkten geheimnisvoll durch ihre starke Kurzsichtigkeit. Alles war harmonisch in diesem gepflegten Gesicht, nur die gerade Lippenlinie zerriß es ein wenig. Sie trug ein eng anliegendes Gewand aus Silberbrokat, über und über bestickt, das rotblonde Haar war sehr hoch gekämmt und wieder durchzogen von Perlenschnüren. Große Perlen tropften von ihren Ohren, Perlen hielten ihre Platinringe —
»Mein Kleid?« antwortete sie. »Der Maler Runk hat mirs gezeichnet — die Blackland hats angefertigt — ich soll eine Fürstin darstellen aus Zypern — bin die Geliebte des Kardinals Colonna. Gefällt dirs? Paß mal auf!«
Sie öffnete den Silbergurt, löste dann eine Federspange vorn auf der Brust — da sprangen bis unter die Knie die Haken, alle zugleich. Und das Silberkleid flog auf nach beiden Seiten, wie eine Muschel völlig nackt lag ihr Leib vor ihm — weder Hemd hatte sie an noch Strümpfe.
Sie wand, schnell wie eine Schlange, ihre Arme aus den Ärmeln, warf sie hoch.
»Nun bin ich nur in Perlen!« lachte sie. »Küß mich!«
Er küßte ihre Hand, schenkte zwei Gläser voll, trank mit ihr. »Sie können sichs leisten, Aimée,« rief er, »mit dem Wuchs!«
»Danke!« sagte sie. »Aber sag ›du‹ — heute nacht! Fürstinnen aus Zypern sinds so gewohnt, und besonders wenn sie ausgezogen sind. Und Kardinalsliebchen erst recht —«
Sie unterbrach, sich, legte den Finger auf den Mund. »Sst!« machte sie. »Sst! Daneben ist jemand!«
Leises Sprechen hörte man aus dem Nachbarzelt. Sie kroch auf allen vieren, nahm eine Waffe ab von der Zeltwand, lauerte durch ein kleines Loch. Winkte ihn dann heran.
»Schau durch,« flüsterte sie. »Marion de Fox ists!«
Er sah durch das Loch. O ja, das war die, die die Farnese spielte, des Papstes Mätresse. Und bei sich hatte sie das blonde zwölfjährige Mädchen, Lucrezia Borgia, das auf ihrem Schoße saß während der Vorstellung. Sie zog dem Kinde Schuhe aus und Strümpfe, gab ihm ein Gläschen süßen Schnapses, fütterte es mit Konfekt. Flüsterte heiß, küßte die Kleine, streifte ihr das Gewand herunter —
Aimée Breitauer drängte ihn weg, lugte kniend durch das Schauloch. Atmete schnell, preßte beide Hände auf ihre festen, starken Brüste. Warf sich dann zurück —
»Komm!« rief sie.
»Habt ihr überall Gucklöcher in den Zeltwänden?« fragte er.
»Ja!« antwortete sie schnell und ungeduldig. »Überall! Das war Susan Pierponts Gedanke. Es regt auf, zu sehn — findest du nicht —? Komm — küß mich.«
Sie streckte die Arme und Beine weit aus, schleuderte die silbernen Sandalen von den Füßen —
Diese Füße — keine Frau hatte kleinere Füße als sie. Süße Füße, sehr gepflegte Füße — Füße, denen die Männer nachliefen auf den Straßen, in Theatern und Lokalen. Füße, die manche Köpfe verdrehten in ihren bizarren Stiefelchen — Füßchen, die närrisch machten, wenn sie nackt waren.
Aimée Breitauers Perlen — Aimée Breitauers Füße —
Aber er berührte sie nicht. Etwas stieß ihn ab.
Das schon — sie gehörte hierher — so gut wie eine der Monddamen. Sie war viele Millionen reich, diese deutsche Großschlächterstochter, war gierig nach jedem Genuß, konnte sich kaufen, was sie nur wollte. Und tat es — ohne viel Scham und Geschmack, offen genug — wie die andern. Einfacher vielleicht und natürlicher — weil es so ihre Art war — aber doch eine Dirne wie die.
Etwas hielt ihn zurück —
Kein Anfall von Keuschheit, Reinheit und Tugend, o nein, keine Scham und kein Ekel. Er aalte sich im Sumpfe wie alle diese Tiere, plantschte herum mit ihnen, fraß ihr Fressen. Und diese nackte Frau in den Perlen, dieser unendlich gepflegte Leib, dessen leuchtendes Fleisch lockend duftete, diese weichen Formen, die ewig jung schienen wie die der Aphrodite selbst —
Kroch nicht auch die einst aus einer Muschel, als die Strahlendnackte dem Meerschaum entstieg?
Und doch schüttelte er den Kopf. Sie war deutsch — das war es. Und es schien ihm, als ob die letzte Dirne in Deutschland eine Heilige sein müsse in dieser Zeit.
Aber sie wußte schon, wie sie ihn nahm. Sie richtete sich halb auf, schob sich hin zu ihm, die Arme nach hinten ausgestreckt, daß ihrer Brüste Pracht hell herauslachte über seine Schuljungenzweifel. Zog die Beine heran, gab ihm beide Füße auf den Schoß —
»Deine Füße sind schön,« sagte er, »süß sind sie wie — wie —«
Er suchte. O, es mußte das Süßeste sein, das es gab auf diesem Stern.
»Wie der Farstin Stimme,« entschied er. »Weiß der Himmel — sie singen, deine kleinen Füße.«
Und er summte die Melodie mit, die die Musik herüber trug, irgendwoher in das Liebeszelt: ›Auf dem Berge Ida droben —‹
O ja — sie saß vor ihm, die Göttin. Und er fühlte gut, daß er ihr den Apfel doch reichen würde — ihr, die des Meeres reichste Perlen schmückten —
Da sang die Frau zu ihm hin:
— »Doch Frau Venus stand daneben,
Still daneben und blieb stumm.
Ihr mußt ich den Apfel geben,
Kalchas, du weißt wohl warum!
Evoé! Que ces déesses,
Pour enjôler les garçons,
Evoé! Que ces déesses
Ont de drôles de façons!
— Ont de drôles de façons!«
Und ihre Füßchen kicherten, spielten, tanzten auf seinem Schoß.
»Weißt du,« flüsterte sie, »ich bekam einen Brief von dem Arbeitskomitee heute morgen. Sie brauchen Geld für ihre neue Preßkampagne — mich haben sie auf tausend Dollar eingeschätzt — die Ziffer grade, weil ich immer so viel gebe — nicht mehr und nicht weniger — für alle die Sachen. Ich will ihnen diesmal fünftausend schicken, wenn —«
Sie zog ihre Füße fort mit einem Ruck. Kniete auf, warf ihre Arme um seinen Hals, zog ihm die braune Kutte herunter. »Komm — was zierst du dich?«
»Warum willst du mich?« rief er.
»Bah —« lachte sie, »dich — und andere heute nacht. Dich will ich — weil es mir Freude macht, dich der van Neß wegzunehmen.«
»Wann schickst du den Scheck?« fragte er. Aber er fühlte gut, daß er sie küssen würde, um ihrer Füße willen und nicht um das Geld, das sie gab für die deutsche Sache.
»Morgen — sowie ich aufwache,« sagte sie. »Klingle nur an bei den Herrn!« Sie warf sich zurück — rollte sich über die Kissen. »O wie langsam du bist!« fuhr sie fort. »Und welche Idee — ein Frack unter der Mönchskutte! Da hatte es Venus bequemer, als sie ihren Paris küßte —«
Er kroch hinüber zu ihr, nackt wie sie.
Sie schlang ihre Arme um seinen Nacken, zog ihn herunter. »Wie küßt die van Neß?« fragte sie.
»Schweig!« zischte er.
Aber sie lachte ihn aus. Sie nahm die große Perlenkette vom Halse, hakte das Schloß auf, schlang sie um sich und um ihn. »Das ist mein Glück,« rief sie, »und meine Lust! Und Tränen den anderen Frauen! Ich bin das Leben — nimm mich!«
— — Langsam lösten sich ihre Leiber, fielen voneinander wie müde Schlangen. Er streifte die Perlen über den Kopf, hob sich halb.
»Champagner,« bat sie.
Seine Hand zitterte, verschüttete den Wein über ihren Leib. »Kühl, kalt!« sagte sie, trank gierig. Reckte die Glieder, ein wollüstiges Schauern lief durch ihre Haut. Langsam ließ sie ihre Perlen durch die Finger gleiten.
»Grüß Frau van Neß!« sagte sie nachdenklich. »Die ist eine kluge Frau — gewiß. Ich bin eine — Dirne, das weiß ich so gut wie sie. Sie hat dich — ich aber habe dich und viele noch. Viele Männer kommen zur Dirne — und eine Dirne braucht viele Männer.«
»Sentimental?« lachte er. »Elegisch?«
Sie nickte. Seufzte — lachte dann. »Immer ein wenig — hinterher, weißt du! Ich denke: dazu sind die Weiber gut — und zu nichts anderm mehr! Und die Männer — erst recht! Das ist das einzige, das es gibt im Leben — und nichts sonst — dazu allein sind wir auf der Welt. Warum ist nur die Lust so kurz?« Sie richtete sich auf, hielt ihm den Kelch hin. »Schenk ein!«
Sie leerte ihr Glas, atmete tief, daß sich die Brüste voll hoben. »Nun ists wieder gut — nun lache ich wieder. Bin bereit zu neuen Taten — wer sagt das noch? Reich mir mein Kleid.«
Er nahm es auf, hielt es ihr hin. Stutzte, sah auf die Zeltwand, die sich leicht bewegte. Ein leises Lachen scholl an sein Ohr. Und er sah — grade wie auf der andern Seite — ein kleines, kreisrundes Loch.
»Jemand ist daneben!« rief er. »Jemand hat uns belauert!«
Sie kniete im Augenblick. »Natürlich!« lachte sie fröhlich. »Dazu sind ja die Löcher da. Hoffentlich haben wir ihnen Spaß gemacht!« Sie kroch zu der Zeltwand, blickte hindurch. »Es ist die Gordon,« flüsterte sie, »sie hat den Maler da, den Italiener — der den Rodrigo Borgia spielte. Willst du zusehn?«
»Nein!« rief er kurz. Griff nach seinen Kleidern.
Aber sie kauerte, lauerte. Trank gierig das Schauspiel.
Er zog sich an, trank ein Glas Wein, brannte eine Zigarette an. Wartete.
Endlich wandte sie sich; ihre Augen funkelten.
»Sie ist ein Tier; die Gordon,« sagte sie. »Sie hat —« sie unterbrach sich — »ah, du bist schon angezogen? Hilf mir — bei mir geht's schnell — klipp, klapp — und ohne Zofe.«
Er hielt den Silberbrokat, sie schlüpfte hinein im Augenblick. Ging dann zu der kleinen Truhe, nahm einen großen Handspiegel heraus, Kämme, Puderbüchse —
»Wir haben an alles gedacht!« lachte sie. Stellte sich mitten unter die Ampel, zupfte ihr Blondhaar zurecht.
Legte plötzlich den Spiegel weg, griff eine Tasche, die ihr eng vom Gürtel herabhing. Nahm einen Platinrahmen heraus, in dem ein Papierblock steckte. Reichte ihm den hin und einen Bleistift dazu.
»Schreib,« sagte sie, »während ich mich aufputze. Deinen Namen, das Datum und die Stunde. Wenn du magst — schreib etwas hinzu — über mich!«
Er lachte, kam auf sie zu, küßte ihren Nacken. »Du bist prachtvoll, Aimée, grad so wie du bist! Das ist eine Sammlung — was? Autogramme von allen denen, denen du deine Gunst schenktest — niedergeschrieben gleich nach der Liebesstunde?«
Sie nickte: »Freilich, das ists! Meine schönsten Erinnerungen!«
Er setzte sich hin, sann einen Augenblick, schaute hinüber zu ihr, als ob er sie zeichnen wollte. Schrieb dann.
Sie puderte sich, legte neues Rot auf Lippen und Nasenflügel, fuhr leicht über die rosigen Nägel.
»Bist du fertig?« fragte sie. Er nickte, reichte ihr den Block zurück.
Sie las:
Für Aimée Breitauer.
»Ain Haupt von Behmerland
Zway weiße Ärmlein von Prafand
Ain Prust von Swaben her,
Von Kernten zwey Tüttlein ragend als ain Speer,
Ain Pauch von Österreich,
Zwai Pein von Flamland gleich
Und ein Ars von Polandt,
Auch ein bayrisch Fut daran,
Dazu zwey Füßlein von dem Rhein:
Das muß ein schöne Fraue gesein!«
»Das laß ich mir gefallen!« sagte sie. »Und der alte Dichter wußte doch, was Wert an Frauen! Heute schwatzen sie alle nur von Augen und Lippen und dünken sich wer weiß wie frei, wenn sie von Füßen reden und Brüsten. An die Hauptsache getraut sich nicht einer!«
Er lachte: »Recht hast du, Aimée! Aber der alte Dichter war selbst — eine Frau, hieß Klara Hätzlerin, lebte in Nürnberg, um die Zeit, die wir feiern heut nacht.«
Sie riß den Bogen ab, steckte ihn unten in den Rahmen.
»Frei für den nächsten?« rief er.
»Ja!« erwiderte sie, ganz ernsthaft. »Der Schreibblock und ich — beide!« Sie legte Spiegel und Büchse in die Truhe zurück, schloß sie zu, schob die Kissen zurecht. »Und dies Nest hier auch. Wo sind meine Schuhe?«
Er hob sie auf, streifte sie ihr an, küßte noch einmal diese kleinen Füße.
Sie zog ihn hoch, bot ihm die Lippen.
»Du warst sehr lieb,« sagte sie. »Ich danke dir. Und auf Wiederschaun!«
Er ging durch die Säle zur Garderobe hin, ließ sich den Mantel geben. Aber wie ihm der Diener hineinhalf, rief ihn André an. »Bleiben Sie noch, Doktor, ich nehme Sie später mit in meinem Auto. Ich suche einen vierten Mann zum Mauschelspiel — mein Kapellmeister wartet und die alte Godefroy — sie sitzen oben. Ein Stündchen nur.«
Er zog ihm den Mantel wieder aus, schob den Arm unter seinen.
Da kam die Farstin vorbei, tief versteckt im Pelz, bei ihr ein junges Ding, zierlich und schlank, aber im Mantel vergraben, wie die Diva.
»Auch schon genug, meine Herrn?« rief sie. »Gute Nacht!«
»Unerhört haben Sie gesungen!« rief sie. Direktor, »über alle Beschreibung schön! Es gibt nichts, mit dem man Ihre Stimme vergleichen könnte.«
»Doch!« sagte Frank Braun. »Ihre Stimme ist süß, wie — wie die Füßchen der Aimée Breitauer.«
»Er muß es ja wissen!« lachte André. »Die hat ihn nämlich mitgeschleppt — in ihr Liebeszelt.«
Emaldine Farstin trat einen Schritt auf ihn zu, starrte ihn an. »Die?« Sie wandte sich scharf um, rief zurück: »Der gönn ichs!«
Legte ihren Arm um die Kleine, zog sie mit sich fort.
»Was hat sie denn?« fragte der Direktor.
Frank Braun zuckte die Achseln. »Sie haßt mich — mag der Himmel wissen, warum!«
André lachte. »Oh, diese Weiber! Haben Sie gesehn, wen die Farstin sich mitnahm? Nein? Die kleine Davies wars, die Kolombinchen spielte. Sie hat sie der Pierpont ausgespannt — die wird platzen.«
Sie gingen an der Bar vorbei, da saß, halbnackt, völlig trunken, die Marlborough, gröhlte laut »Tipperary« mit ein paar Männern. Als sie zur Treppe kamen, blieb André stehn — warf einen raschen Blick in den Liebessaal.
»Da verschwindet gerade die Gouraud,« lachte er. »Schaun Sie doch — sie zieht drei in ihr Zelt — drei auf einmal!«
»Wen denn?« fragte er.
»Diener,« antwortete der Direktor, »Chorherrn — was weiß ich! Die Gouraud geht nach der Größe!«
Sehr zahm und artig, in eine Benediktinerkutte gehüllt, kam der wilde Finne Hevonpää die Treppe hinab. Mit ihm Aimée Breitauer, die schwenkte ein graues Gummiband in der Hand.
»Wißt ihr, was das ist?« lachte sie.
»Nun?« fragte er.
Da rief sie: »Des Ringers Lendenschurz — ich hab ihn ihm abgenommen! Der ist bequemer wie du — trägt nur Adams Frack unter der Kutte!«
»Als ich noch den Siegfried sang, wars umgekehrt,« meinte André. »Damals nahm ich der Brunhilde im Ringkampfe den Gürtel weg.« Er griff ihre Hand, küßte sie höflich. »Sagen Sie mir,« fuhr er fort, »siegfriedgürtelraubende Brunhild — wollen Sie sich wieder beteiligen? Ich bringe in drei Wochen auf Broadway eine neue Schau heraus, gebe, wie gewöhnlich, die Hälfte auf Anteile. Wieviel nehmen Sie?«
»Soviel Sie mir zuschicken!« nickte die Breitauer. »Aber laßt mir nun meinen Recken: ich will sehn, wie er steht — im Feuerzauber!«
»Salvete, o gladiator! Gaudium multum habeas!« rief André dem Ringer zu.
»Gratiam tibi ago, artifex! Suum quisque optimum facit,« antwortete der Berserker feierlich. Winkte mit der Hand, folgte seiner Dame.
Frank Braun fragte: »Was, der Kerl spricht Latein?«
»Und Griechisch und Hebräisch!« nickte der Direktor. »Er hat Theologie studiert — verlor seinen Glauben und seine Stipendien dazu. Kam herüber — hier nutzten ihm die Kenntnisse seines Hirns nichts — da mußte er Arme und Beine tummeln, um den Wanst zu füllen.«
Ziemlich leer war der gelbe Saal. An drei Tischen nur pokerte man; ganz in der Ecke saß Kapellmeister Milan mit dem prächtigen, frühergrauten Wuschelkopf. Bei ihm, im Nonnenkleide, die Godefroy, die dicke Zigarre im Munde. Eine starke Fünfzigerin, immer lachend, immer vergnügt, überall dabei, wo es nur etwas gab. Und ganz gewiß dann im Spielzimmer nach kürzester Zeit.
»Endlich!« rief sie. »Sie geben, Direktor! Da sind Ihre Marken, bitte nachzählen. Zehn Dollar die blauen, fünf die gelben, drei die roten und einen die weißen. — Einladung!«
Sie spielten. André verlor und wurde immer vergnügter, je mehr er verlor.
Sie spielten, rauchten und tranken. Sie plauderten auch, die Godefroy kannte alle neuen Witzworte und jeden frischesten Klatsch in der Stadt. »Wissen Sie, wer sich heute nacht den hübschen van Straaten geangelt hat? Baron de Bekker und Baronesse de Bekker — beide friedlich zusammen.«
Eine Stunde verrann und noch eine. Sie spielten und lachten und tranken.
Da schlich Ernst Rossius hinten in den Saal. Sah sich scheu um, setzte sich an einen Tisch. Zog etwas aus der Tasche, legte es auf die Platte. Beugte sich nieder, als ob er schreiben wolle.
Direktor André rief ihn heran. »Na, wie amüsieren Sie sich?«
Das junge Gesicht strahlte, die Augen leuchteten. »Ich habe etwas erlebt,« stammelte er. »Ich hätte nie geahnt, daß so etwas möglich wäre.«
»Schießen Sie los!« rief André. »Wer war es? Wir sind schrecklich neugierig.«
»Eher ließ ich mir die Hand abschneiden,« sagte er feierlich, »ehe ich ihren Namen verriete! Eine Dame hat meine Lippen geküßt — eine Dame — die herrlichste Frau der Welt!«
»Geküßt nur, sonst nichts?« fragte der Kapellmeister.
Rossius lachte hell. »Sonst? Wenn Sie nur ahnen könnten! Nie hat ein Mensch Ähnliches erlebt!« Er breitete die Arme weit aus, als ob er die Luft umarmen wollte. In der Rechten hielt er einen kleinen Rahmen.
Der schönen Aimée Sammelblock —
»Was haben Sie denn da?« rief Frank Braun. »Geben Sie doch mal her!«
Der reichte den Block arglos herüber. »Das gab sie mir — ich soll ihr ein Gedicht hinschreiben und ihrs dann wiederbringen. Ein Gedicht über — o Gott! Aber kein Byron könnte das beschreiben!«
»Setzen Sie sich!« riet der Kapellmeister. »Essen Sie, trinken Sie — da wird Ihnen schon was einfallen!«
Und der Junge setzte sich, ließ sich von der Godefroy den Teller hoch füllen, aß mit gesundem Hunger. Frank Braun hielt den Silberblock unter den Tisch, zog neugierig die oberen Blätter weg. Ein Namenszug auf dem ersten Blatt — mit einer sehr mäßigen Zeichnung dabei. Dann, quer über die zweite Seite in großen Lettern, die sich mächtig taten und blähten, das eine Wort: AMATO. Amato, der herrliche Kinostern!
Aber das dritte Blatt zeigte mehr, in klarer, ausgeschriebener, schöner Schrift. Da stand:
Bibet, miscet ill' cum illa
Miscet servus cum ancilla!
Miscet coqua cum factore!
Miscet Abbas cum Priore!
Et pro Rege et pro Papa
Bibunt vinum sine aqua.
Et pro Papa et pro Rege
Miscent omnes sine lege.
Miscent, bibunt hoc in mundo
Donec nihil sit in fundo!
Und darunter, in alten römischen Lettern, wie auf einem Grabstein, stand das breite Signum des gelehrten Ringkämpfers:
Sulonus Hevonpäus Helsingforsensis,
Qui studiosus Theologiae Dorpatensis,
Christum, Dominum, Sanctum Spiritum
Corde calidissimo quaesivit,
Studioque ardente. Quos atque perdidit.
Qui, doctus ludi Graeci-Romanique
Mundum percurrit, sed arte stultorum
Vivit. Qua nocte Coelum rapuit,
— Amato amatam Amatam amato —
Bibens, Amatam coiens.
Er steckte die Blätter sorgfältig zurück in den Rahmen, reichte Rossius den Block hin.
»Schreiben Sie,« sagte er, »ich weiß ein hübsches Gedicht für Sie!«
Der Sekretär nahm zögernd den Bleistift. »Ich sollte selber eins machen —« meinte er.
»Schreiben Sie nur,« lachte Frank Braun, »heut nacht fällt Ihnen ja doch nichts mehr ein. Und das, was ich Ihnen sagen werde, paßt wundervoll — schreiben Sie nur! Sie haben doch neulich erst Rabelais gelesen — erinnern Sie ein wenig die altfranzösische Orthographie? Die müssen Sie anwenden!«
»Das wird ja sehr gelehrt!« warf der Kapellmeister ein.
»Nicht gar zu sehr,« erwiderte Frank Braun. »Also los — mein Junge — wie ichs diktiere!« Er deklamierte:
»Nature n'est pas si sote,
Qu'ele faist nostre Marote
Tant solement por Robichon
Se l'entendement i fichon!
Ne Robichon por Mariete,
Ne por Agnès, ne por Perette!
Ele nous a faist, bele fille, n'en doutes,
Toutes por tous et tous por toutes,
Chascune por chascun commune
Et chascun commun por chascune!«
Ernst Rossius rückte unruhig auf seinem Stuhle, aber er schrieb weiter. »Ist es fertig?« rief er dann. »Das kann ich unmöglich abgeben!«
»Geben Sies nur ab,« sagte Frank Braun. »Schreiben Sie ›Le Roman de la Rose‹ darunter, Namen und Datum und vergessen Sie die Stunde nicht! — Aimée Breitauer wird sehr zufrieden sein mit dem Gedicht — und Sie wird Ihnen noch eine Stunde schenken — wenn Sie ihr sonst gefallen haben.«
Der Sekretär ließ die Arme sinken, starrte ihn an. »Woher wissen Sie den Namen, Doktor?«
»Weil ich diesen Block da kenne, mein Junge,« antwortete er. »Sie sammelt die Autogramme ihrer Liebhaber in einem wohlgefüllten Album!«
Da lachte der Direktor. »Der Breitauer Album? Ich steh auch drin — zweimal, glaub ich! Sie sind da in großer Gesellschaft, junger Freund, in guter und schlechter zugleich — wie überall in Neuyork.«
Ernst Rossius sprang auf, alles Blut wich aus seinem Gesicht. Er rang nach Worten, rief dann: »Das ist nicht wahr. Das ist eine Beleidigung, eine Infamie —« Er kam nicht weiter, die hellen Tränen brachen ihm aus den Augen.
»Gehn Sie,« sagte Frank Braun, »bringen Sie der schönen Frau ihren Liebesblock!«
Zum Tee bei Lotte am nächsten Tage.
»Du warst bei dem Fest der Monddamen?« fragte sie.
Er nickte. »Soll ich dir beichten, Lotte?«
Aber sie schüttelte den Kopf. »Das ist nicht nötig. Zeig dein Messerchen.«
Er nahm es aus der Tasche, gab es ihr. Schaute neugierig zu, wie sie es herausnahm aus dem Ledertäschchen, die Watte weggab, die Klinge öffnete —
Die blitzte hell, leuchtete blank wie je, kein kleinster Fleck beschmutzte sie.
Sie gab es ihm zurück, sehr zufrieden schien sie. »Nun weiß ich gut, daß du mir treu warst!«
Er starrte sie an. »Aber Lotte,« begann er, »ich —«
Sie legte ihm die Hand auf die Lippen. »Schweig nur,« lächelte sie, »was weißt du davon? Das Messerchen erzählt mir mehr, als du kannst.«
Er dachte: ›Einen Schmarrn weiß dein Messerchen!‹ Aber er ließ sie bei dem Glauben, der sie glücklich machte.
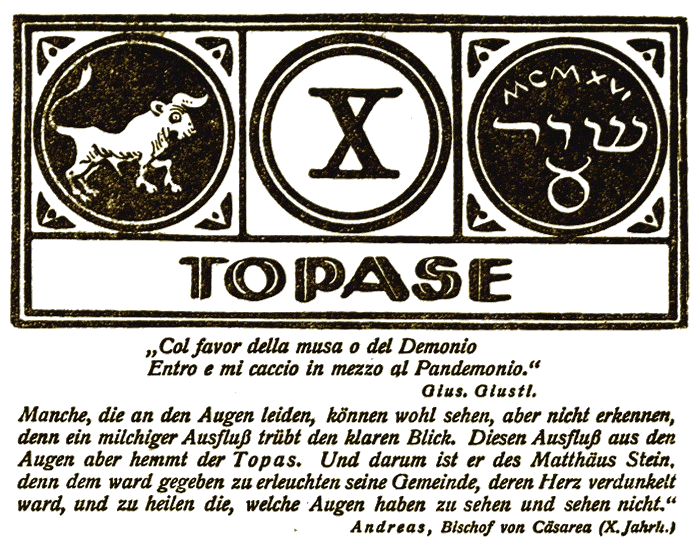
Drei saßen vor ihm, zwei Männer und eine Frau.
Paul Conchas, der stärkste Mann der Welt, Kanonenkönig, seit einem Vierteljahrhundert berühmt auf allen Varietés der Welt. Fünfzig bald, doch gewachsen wie der junge Mars — auf dem Vorhang der Dresdener Hofoper mag die Nachwelt seine Beine bewundern. Neben ihm sein Clown Fritz Neuhof aus Berlin, häßlich und grotesk — der den Athleten begleitete durch die Welt, die Pausen ausfüllte mit bizarren Scherzen, während sich der andere verschnaufte. Und eine Frau — schwedisch, schlank und blond.
»Haben Sie die Adressen aufgeschrieben?« fragte Frank Braun.
Sein Sekretär kam herüber. »Hier sind sie.«
Frank Braun reichte das Blatt dem Athleten. »Hier sind sie,« wiederholte er. »Wenn Sies riskieren wollen —«
»Aber klar!« sagte Conchas. »Nächste Woche schwimmt sie.«
»Wann war die Gerichtsverhandlung gegen Ihre Freundin?« fragte Frank Braun. »Was bekam sie?«
»Dreitausend Dollar Geldstrafe — vorgestern — es ist ein Wunder, daß die Schweine sie nicht eingesperrt haben!« antwortete der Artist.
»Ich werde sehen, daß ich das Geld für Sie auftreibe,« sagte er. »Wieviel brauchen Sie für die neue Sache?«
Paul Conchas erwiderte: »Nichts. Lassen Sie nur. Ich zahle alles schon selbst, das ist einfacher. Meine beiden Jungs sind an der Front drüben — die tun mehr als ich.«
Es galt wieder einmal den Versuch, Gummi hinüberzuschaffen — an dem es so sehr mangelte in Deutschland. Viermal schon war auf norwegischem Dampfer Anna Bergen hinübergefahren, des Kanonenkönigs Freundin, nun beim fünften Male war es mißglückt. Die amerikanischen Zollbehörden hatten vor der Abfahrt ihr Gepäck untersucht — zwanzig große Koffer — hatten den Gummi gefunden und sie festgenommen. Die Yankees ließen alle Ware nur heraus, wenn sie richtig deklariert war, aber sie gaben dann sofort den englischen Herrn Bescheid, die sie prompt herunterholten in Kirkwall. Deklarierte man aber die Ware nicht — so verging man sich gegen die Gesetze der Staaten, war ein Urkundenfälscher und wurde eingesperrt. Nicht ein Tag verging, ohne daß die Gerichte — zum höheren Ruhme Englands — Deutsche ins Gefängnis und Zuchthaus steckten.
»Mir wundert man bloß, daß ein Deutscher in dem Land noch spucken darf!« rief Neuhof.
Frank Braun wandte sich an die blonde Frau. »Wissen Sie, daß Sie diesmal bestimmt eingesteckt werden, wenn die Geschichte herauskommt?« fragte er. »Wollen Sie doch fahren?«
Die Schwedin nickte. »Ich weiß. — Ich fahre.«
»Natierlich fährt se!« rief der Berliner. »Wat den Paul seine Anna jekonnt hat, kann die Karin schon lange! Da kann se mal richtig zeigen, det se Sympathie fier Deutschland hat — det is bessa, als blos Stanniol sammeln.«
Der Sekretär sagte: »Wir haben auch noch was für Sie.« Er brachte ein Zigarrenkästchen heran, bis oben hin gefüllt mit flachgestrichenem Stanniolpapier.
»Wird akzeptiert mit bestem Dank von die Witwen und Waisen!« sagte Neuhof. »Wat jlauben Se — von unsa letzte Tournee haben wir eene janze kleene Tonne mitjebracht. Beinah siebzig Kilo.«
Das war ein Gedanke der deutschen Artisten, Stanniol zu sammeln von den Zigaretten, Zigarren, Bonbons und Schokoladen. Das Völkchen vom Varieté und vom Vaudeville, alle die Fratelli Salvini, Sisters Harrison, die Valière, Dixon, Korsakoff, die Parterreakrobaten, Tänzerinnen, Kraftmenschen, Trapezkünstler, die mit ihren guten deutschen Namen Huber und Maier und Klein und Schulze hießen, sie sammelten Stanniol. Schleppten es zusammen aus allen Städten des Landes, klaubten es auf in Lokalen und auf den Straßen, bettelten es jedem ab, der ein Stückchen hatte. Trugen es hin nach Neuyork, da kam es an die große Sammelstelle an Bord der ›Vaterland‹. O nein, es machte nicht viel aus, brachte nur achtundsechzig Cent fürs Pfund — und es war erstaunlich, wieviele der kleinen Papierchen auf ein Pfund gingen. Aber dennoch verdienten sie jeden Monat ein paar hundert Dollar fürs Rote Kreuz damit. Und dann — die Freude der Arbeit: immer, den ganzen Tag über und bis spät in die Nacht, wenn sie vor dem Schlafen ihr Stanniol glätteten, dachten sie an die Heimat, der sie halfen.
Ernst Rossius legte die Zeitungen auf den Tisch, die eben der alte Diener brachte.
»Neues Geschwätz über Friedensgerüchte,« sagte er.
»Wenns nur wahr wäre!« rief der Kanonenmann. »Jetzt wäre der gute Augenblick. — Im Osten stehen wir tief in Rußland, halten im Westen Belgien und Nordfrankreich, im Süden Serbien, Montenegro, Albanien. Die Engländer sind in Mesopotamien zurückgetrieben, haben die Dardanellen räumen müssen, werden im Sudan bedrängt und haben in Irland einen hübschen Hexenkessel. Die Mohammedaner haben die Katzelmacher aus Tripolis hinausgejagt, die Österreicher haben das Trentino reingefegt und brechen in Italien ein. Der Kronprinz schiebt sich in jeder Nacht näher heran an Verdun. Und immer halten wir uns in Afrika. Jetzt wäre der Augenblick da, jetzt!« Seine Stimme hob sich, die Augen leuchteten. Aber dann schlug er mit der Faust auf den Tisch, seufzte tief auf. »Und ich wette — es wird nichts daraus! Unsere Prachtjungen mögen zu Millionen ihr Blut verspritzen — das idiotische Gesindel, das bei uns Diplomatie spielt — wird sicher den rechten Moment verpassen. Und wenn sie auch Frieden machen würden — so würde es doch nur erbärmliche Flickarbeit werden. Serbien, Montenegro würden wiederhergestellt — die Belgier bekämen ihr Land zurück —«
Da sprang der Berliner auf. »Wat?« schrie er. »Jarnischt kriegen se! Det bißchen, wat se noch haben, det kenn se behalten! — Da kenn se Bollen druff ziehn, damit se weenen kennen!«
»Ja, wenn du Reichskanzler wärst!« rief Paul Conchas. »Aber so geben wir nicht nur alles zurück, wir zahlen noch zu obendrein: alle unsere Kolonien, dann Südtirol, Elsaß und Lothringen, Istrien, Triest, Dalmatien, Galizien, die Bukowina, unsere polnischen Fetzen — viel mehr noch, warts nur ab, Junge! — Aufhängen lassen sollte der Kaiser unser ganzes elendes Diplomatenpack, das sich seit zwanzig Jahren überall in der Welt um den Löffel balbieren läßt.«
»Det wird er ooch machen!« schrie Neuhof. »Paß nur mal uff! Ick bin en Sozialdemokrat — wähle nur Fritze Zubeil, wenn ick jerade mal bei Muttern bin. Aber dem Kaiser jebe ick allen Kredit! Herr Jott — wenn man weeß — wat se mit den forn Jeschrei jemacht haben überall in alle fünf Erdteile, wo wir nur hinjekommen sind, all die Zeit ieber! Man hätte schwören mögen, det er der beliebteste Mann wäre in der janzen Welt! — Und nu? Nu malen sen jeden Tag in die Blätter als eene Art Mißjeburt zwischen Varrickten und Schwervabrecher, eener von den man nich weiß, ob er aus em Zuchthaus oder em Irrenhaus ausjewischt is! Und nennen ihn in ihre Unterschriften nur nen lausigen Affen, tollen Hund, Massenmörder, Säuglingsschlächter und lauter sone liebliche Beiwörter. — Und det allens nur, weil der Mann det schaißliche Pech hat, ausjerechnet en Deutscher zu sein. Wenn ick nur wißte, wat wir se eijentlich alle jetan haben.«
»Neidisch sind sie auf uns,« rief Paul Conchas. »Weil wir bessere Köpfe haben, weil wir fleißig sind und arbeiten können. Was ist denn das ganze sogenannte internationale Artistentum? Deutsch alles, was nur einigermaßen 'ne Nummer ist. Und so ists bei den Kaufleuten, Ingenieuren, Chemikern, beim Militär, der Marine, der Industrie, der Verwaltung und der Kunst — wir sind an der Spitze — überall. Nur die Politik: da gibts keine größeren Esel, als wir sie hinausschicken. Hol mich der Henker — der Kaiser sollte —«
Aber der Berliner unterbrach ihn. »Reg dir bloß nich uff, Paule, sonst ärjert dir wieder dein Magen, vastehste! Un denn biste so unjenießbar, wie det Bier, det se uns jetzt hier als Pilsner andrehn wollen.« Er sprang auf, streckte Frank Braun die Hand hinüber. »Verlassen Se sich auf uns, Doktor, die Sache wird jemacht. Un scheenen Dank ooch für det Silberpapier.«
Frank Braun geleitete sie zur Türe, kam zurück. »Noch jemand da?« fragte er.
Der Sekretär nickte. »Einer wartet noch, ich werde ihn gleich hereinholen.«
Frank Braun setzte sich, stützte die Arme auf, ließ den Kopf schwer auf den Tisch fallen. So jammervoll müde war er heute, so elend leer und ausgesogen. ›Ich bin kein Mensch mehr,‹ dachte er. ›Eine aufgeblasene Schweinsblase bin ich. Ich tue dick und groß, mache schönen Lärm, wo ich aufschlage. Und bin hohl, leer, so leer —‹
Sehr abgerissen sah der Mann aus, den Rossius hereinführte. Pockennarbig, stiernackig, fast ohne Hals. Krummbeinig dazu, angeklebt die schmalzigen, schwarzen Haare. Und er roch nach Stall und nach Whisky. Er grüßte nicht, kam gleich auf ihn zu, unsicher und scheu. Hielt ihm eine schmutzige Karte hin.
Tewes' Visitenkarte. ›Vielleicht können Sie dem Mann helfen,‹ stand darauf.
»Nehmen Sie Platz,« sagte er. »Was wünschen Sie?«
Aber der Mann setzte sich nicht. Er drehte seine Mütze in der Hand. »Ich bin Deserteur,« sagte er dann. »Si vous voulez mich outkicken, tun Sies de seguido.«
Frank Braun legte die Karte vor sich auf den Tisch. »Wenn der Herr Sie zu mir schickt, hats schon seinen Grund,« sagte er. »Erzählen Sie — wann kamen Sie herüber — und wie?«
»Nicht heuer — sure!« antwortete der Mann. »Hay doce años, daß ich gemuhvt bin.«
Vor zwölf Jahren — vom Ulanenregiment aus St. Avold, dicht an der Grenze. Mit zwei andern zugleich, die ihm vorerzählt hatten, wie dumm das alles sei. Daß es doch keinen Krieg mehr geben würde in diesem zwanzigsten Jahrhundert in Europa, und daß die Heere nur da seien, um das Volk niederzuhalten und zu nichts sonst. — Aber nach vierzehn Tagen schon stak er wieder in einer neuen Uniform, war Fremdenlegionär geworden in einer wilden Rauschnacht, wachte erst wieder auf in dem Zuge, der ihn nach Marseille brachte. Zwei Jahre lang trug er den Tornister in Algerien, bis er Gelegenheit fand, von neuem zu desertieren; er entwich nach Marokko, kam nach Spanien und endlich hinüber nach Argentinien. War dort Pferdeknecht auf einem Rancho. Dann, als der Krieg ausbrach, litt es ihn nicht mehr in der Pampa, er verdang sich in Buenos Aires als Heizer, auf einem Dampfer, der hinauffuhr nach Neuyork.
»Und nun sitzen Sie hier fest — und kommen nicht rüber, was?« fragte Frank Braun. Diese Geschichte war ihm nicht neu, die hatte er schon manchmal gehört — so oder anders. Von allen Weltteilen waren sie zusammengeströmt nach Neuyork, von Ostasien und allen Ländern Amerikas, von Australien und den Inseln des Pazifik. Von Afrika auch, von Spanien und Portugal, von England selbst. Und saßen hier fest — kamen nicht weiter — dafür sorgte der Yankee. Selbst die Sprache des Mannes kannte er, dieses eigentümlich steife Deutsch, bunt durchsetzt mit spanischen, englischen, französischen Brocken.
»Nicht rüber, Señor?« rief der Schwarze. »Ich war déjà thrice in Europe in diesem Jahr. Nur nach Deutschland — that can't be done, vamos!«
Pferdeknecht war er sein ganzes Leben lang. Im Stalle aufgewachsen auf einem fränkischen Rittergut. Später Ulan, in der Legion Bursche beim Regimentsarzt, dessen Pferde er zu warten hatte, und durch all die Jahre nun Gaucho in der Pampa. Dann, in Neuyork, als er nach wochenlangem Herumlaufen sah, daß es keine Möglichkeit gab, nach Deutschland zu kommen, faßte er den Entschluß, Krieg zu führen auf eigene Faust. Pferdeknechte — das war es, was man brauchte in dieser Zeit, Wärter für die ungeheuren Transporte von Gäulen und Maultieren, die nach England, Frankreich, Italien gingen. Nur der letzte Auswurf fand sich dazu bereit, da konnte man nicht lange nach Ausweisen und Papieren fragen. Und er, schwarz und sonnverbrannt, mit seinem unmöglichen Sprachgemisch, konnte dem Engländer als Franzose, diesem als Spanier gelten. Da fand er bald seinen Platz, fuhr mit einem Transport nach Cherbourg, mit dem zweiten nach Saloniki.
Ernst Rossius fuhr ihn an: »Also Pferde haben Sie unsern Feinden auch noch gebracht?!«
Da grinste der Mann, wiegte sich auf den krummen Beinen. Sein Maul zog sich zu einem langen Lachen, zeigte zwischen häßlichen Lücken ein paar schwarze Zahnstummel. Er legte die Mütze auf den Tisch, wandte sich an den Sekretär.
Viel Freude hätten die Alliierten an diesen Pferden nicht gehabt. Ob er wisse, was Mallëin sei? Nein? Nun, das sei der Bazillenkram, der die Rotzkrankheit übertrage. Woher er es bekommen habe? In Neuyork bekomme man alles für Geld. Und das Zeug habe er den Tieren in die Nüstern geschmiert, jedem einzelnen — ach, er hoffe, daß sie noch manches andere angesteckt hätten.
Nun, beim dritten Male hatten sie ihn ertappt. Er sollte Pferde begleiten — nach Portsmouth diesmal — zweitausend Stück. Da mußte er früh anfangen mit der Arbeit, schon im Neuyorker Hafen. Siebenundzwanzig Tiere hatte er schon vergiftet, als ihn der kanadische Offizier abfaßte. Er floh, sprang die Treppen hinauf auf Deck, und der andere ihm nach. Der schoß, traf ihn in den linken Unterarm, dicht über der Hand — ach, nur ein Streifschuß, eine Fleischwunde und nichts mehr. Er sprang über Bord, schwamm durch den Hafen, rettete sich an Land.
»Wann geschah das?« fragte Frank Braun.
Heute nacht. Aber es sei noch nicht alles. Er sei herumgelaufen, bis seine Kleider getrocknet seien, habe vorher den blutenden Arm abgewaschen, verbunden mit seinem Taschentuch. Und dies Tuch sei wohl schmutzig gewesen, in Berührung gekommen mit dem Rotzgifte. Nun —
Er streifte mühsam den Ärmel zurück, zeigte seinen Arm. Bläulichrot, grüngrau bis zum tiefen Schwarz schien das gräßlich aufgeschwollene Fleisch, strahlenförmig zogen sich von der kleinen Wunde dicke blaue Lymphstränge nach allen Seiten.
Darum sei er hier. Zu einem beliebigen Arzt könne er nicht — der würde ihn sofort verhaften lassen. Und es sei höchste Zeit — er kenne das. Einem Gehilfen des Regimentsarztes in Sidi bel Abbas sei es passiert — der sei eingegangen, trotz aller Hilfe, nach wenigen Wochen.
Frank Braun überlegte ein paar Augenblicke, ging dann zum Telephon. Sprach lange, setzte sich wieder, schrieb eine Adresse auf. Gab das Zettelchen seinem Sekretär.
»Nehmen Sie ein Taxicab,« sagte er, »bringen Sie den Mann dorthin.« Er wandte sich an den Pferdeknecht. »Der Arzt ist ein Jude. Geben Sie beliebigen Namen und Adresse an; sonst wird er Sie nach nichts fragen. Er wird Sie in seiner Klinik behalten, bis Sie wieder gesund sind.«
»Well, nous verrons, carajo!« sagte der Mann. »Là, der Arm muß runter, dann could I be saved — peutêtre! Vamos! Um mich wär es nicht schade — je m'en fiche — wenn ich nur den Franzosen und Englischen noch ein few tausend potros verpoisenen könnte! Hasto luego, Monsieur — darf ich noch eine favor asken? Là, im Rock eingenäht sind meine Ersparnisse, mas als five hundert Dollars. Pagen Sie le Docteur damit, wenn er den dinero will — nicht das entierro, da whistle ich drauf — und le reste geben Sie dem Roten Kreuz! Für den Fall, daß ich deie — bien compris! Au revoir, Caballero — und munchisimas gracias!«
Frank Braun wollte aufstehn, dem Pferdemann die Hand zu reichen. Aber seine Beine zitterten, er sank zurück in seinen Stuhl. »Entschuldigen Sie bitte,« sagte er, »ich bin auch nicht ganz wohl.«
Der Sekretär sprang zu ihm hin, griff ihn unter die Schultern. »Kommen Sie zum Sofa, Doktor, strecken Sie sich ein wenig aus.«
Er wies die Hilfe zurück. Richtete sich allein auf, mit großer Willensanstrengung. Zog sich hoch am Tische, faßte die Stuhllehne, schwankte zum Diwan.
»Soll ich Fred Bescheid sagen, daß er Ihnen was zum Luncheon besorgt?« fragte Rossius. »Nein? So ruhn Sie sich aus, Doktor, bleiben Sie still liegen ein paar Stunden. Vergessen Sie nicht, daß Sie heute abend im Kaufmännischen Verein sprechen sollen, da müssen Sie wieder frisch sein. Ich komme um neun Uhr, Sie abzuholen.«
Er warf ihm eine schwere Decke über, rückte ein Tabouret heran. Holte ein Glas Wasser und stellte es hin, legte daneben die kleine Schachtel mit den Strychninpillen. »Vielleicht wollen Sie eine nehmen,« meinte er. »Manchmal hats etwas geholfen.«
Frank Braun nickte. Er wollte ihm sagen, daß er das Telephon abstellen solle, aber er konnte die Lippen nicht voneinander bringen: es war ihm, als ob sein Hirn nicht mehr imstande sei, einen Befehl auszugeben. Und er dachte, es sei schon gleich, denn seine Glieder würden ja doch die Order nicht ausführen können.
Er hörte die beiden gehn, hörte eine Türe öffnen und schließen. Und noch eine —
Nun war es still. Ihn fror, die Zähne schlugen aufeinander, klapperten. Er wollte sie fest aneinander pressen, das ging nicht. Dann versuchte er einen Rhythmus herauszuhören, aber es war keiner da, das klappte, klapperte, schneller und langsamer, setzte aus und begann wieder. Er wollte einen Schluck Wasser nehmen, aber konnte den Arm nicht ausstrecken.
Das Telephon klingelte, schrie. Wieder und noch einmal. Bohrte sich in seine Ohren, heulte grausam in sein Hirn. Er zog die Decke hoch, barg den Kopf hinein, steckte die Finger in die Ohrhöhlen. Aber es half nichts. Das schellte, bellte und gellte, gab nicht Ruhe, schlug ihn mit tausend sägenden Messern. Riß ihn hoch.
Er stand auf den Beinen, taumelte durch das Zimmer, fiel auf den Sessel, griff das Hörrohr. Lotte — ja! Warum er sie habe warten lassen? — Er habe das Schellen nicht gehört. — Aber seit einer Viertelstunde — Nein, nein, er habe es wirklich nicht gehört — Aber — Nein — nichts! — Seine Hand zitterte, seine Stimme weinte.
Ob er krank sei? Nein! — Doch, doch, sie höre es! — Ja also — ein bißchen nur. — Sie sei noch draußen in Atlantic City — sie würde den nächsten Zug nehmen, zur Stadt fahren. Ob er spreche, heute abend? — Ja, er würde sprechen. — Dann erwarte sie ihn zum Tee. — Ja, ja, er würde schon kommen.
Er hing das Höhrrohr ein, ein kalter Schweiß brach ihm aus allen Poren. Er ließ die Arme lang herunterhängen, den Kopf auf die Brust fallen. Er fühlte: jetzt würde er hinuntersinken von dem Stuhle. Dann würde er am Boden liegen, würde vergessen, nichts mehr wissen —
Wieder war es ein Geräusch, das ihn hielt. Ein Türöffnen, ein leises Schreiten —
Er sah Fred, den alten Diener vor sich stehn, stumm, gefühllos. Er wollte ihn bitten, anflehen, ihm zu helfen, ihn zu Bett zu führen —
Den? Ja, was denn — den — Warum war er nur da? Hatte er ihm geschellt?
Er sagte: »Mach mir ein Bad! Heiß, sehr heiß.«
Er lächelte. Warum denn ein Bad? O, irgend etwas — es war gleich. Nur ein Befehl für diesen Holzbesen — um ihn fortzuhaben.
Fred sagte: »Ja, Herr.« Er ging durch das Zimmer, nahm einen silbernen Teller vom Gesims, legte eine Karte darauf. Kam zurück, reichte ihm die Karte. »Diese Dame wünscht Sie zu sehn.«
Er nahm die Karte, warf einen Blick hin — aber er konnte die Buchstaben nicht lesen. Er hörte die Blechstimme: ›Eine Dame —‹ Aber er wußte nicht, was das sollte.
Er dachte: ›Geh, du Tier, geh. Warum quälst du mich?‹
Und er nickte. Sagte: »Ja.« Murmelte er: »Mein Bad —«
Er sah den Alten gehn, hörte wieder die Schritte auf den Teppichen. Dann ein Sprechen — und wieder Schritte. Eine Frau stand vor ihm, tief verschleiert.
»Wer bist du?'« flüsterte er. Er dachte: ›Lotte. — Und warum wieder der schwarze Schleier? Dein Mann ist lange tot, dein Vater auch —‹
Um wen trug sie Trauer?
Um ihn —? Aber er lebte doch — noch lebte er ja.
»Wer bist du?« flüsterte er wieder. Nun hörte er ihre Stimme. Was sagte sie nur —?
Spanisch — ja! Sie schlug den Schleier zurück. Jetzt sah er sie gut. Die Tänzerin, die Goyita — Dolores Echevarria. Die dunklen Saphire ihrer Augen leuchteten.
Ob er krank sei? fragte sie. Er nickte; ja, ein wenig; müde sei er.
Sie erzählte. Von Sonora komme sie; sei in Neuyork seit vorgestern, mit ihrem Wolfe und mit ihrem Leierkastenmann. Sie habe versprochen, ihm die Mescalfrüchte zu bringen; hier sei sie. Und hier sei auch der Mescal. Sie öffnete ihre Tasche, nahm ein Tüchlein heraus, knüpfte es auf, zeigte ihm die eingetrockneten Kaktusknöpfe.
Er richtete sich hoch im Augenblick. »Das muß helfen,« sagte er. »Gleich, gleich!«
Er nahm das Tüchlein mit zitternder Hand. Steckte die elektrische Schnur in den Stechkontakt. »Wasser!« rief er. »Fred, Wasser!«
Der Alte kam, füllte den kleinen Teekessel. »Ihr Bad ist fertig, Herr,« meldete er. »Haben Sie sonst noch Befehle für mich?«
Er sah ihn an, schüttelte den Kopf. »Nein, nein! Geh!«
Und der Alte ging.
Er wollte die Teekanne nehmen, mußte sie wieder hinstellen, so zitterte sein Arm. Er stützte sich auf die Stuhllehne, atmete hastig.
Die Tänzerin folgte seinen Bewegungen. »Was wollen Sie machen?« fragte sie.
»Tee kochen,« antwortete er. »Von den Peyotefrüchten. Vielleicht hilft es.«
Sie nahm den Kessel, setzte ihn auf die heiße Platte. »Lassen Sie mich machen,« rief sie. Gab die gelben Früchte in die Teekanne.
Er sagte: »Danke. — Ich will ein Bad nehmen. Mich dann niederlegen. Den Tee trinken.«
Die Goyita nickte. »Ja, gehn Sie! Ihr Tee wird fertig sein.«
Er ging ins Badezimmer, entkleidete sich, keuchend, stöhnend. Er hielt die Hand ins Wasser — das war glühheiß. Stieg doch hinein, streckte sich aus — glaubte zu verbrühen in dieser Hitze.
Gewöhnte sich dann an die Glut. Lag im Wasser, rührte sich nicht. Schlief nicht, wachte nicht, dachte nicht. Nichts war, nichts —
Außer ihm nichts, in ihm nichts. Nichts.
Dann fror ihn. Er stieg aus der Wanne, rieb sich ab. Zog den Schlafanzug an und den Kimono darüber. Ging zurück durch die Räume.
Am Diwan auf dem Tischchen stand die Teekanne. Eine Tasse daneben.
Er setzte sich, goß den dunklen Absud in die Tasse. Hob sie an den Mund, trank.
Dann hörte er eine Stimme. »Wie schmeckt es?«
Er blickte auf — sie war noch da, die Goyita. Saß dort hinten im Sessel ohne Hut, ohne Handschuhe.
»Schlecht!« antwortete er. »Sehr bitter.«
»Sie haben lange gebadet,« fuhr sie fort. »Ich bekam schon Angst um Sie. Wollte Ihrem Diener schellen. — Glauben Sie, daß der Mescaltee Ihnen helfen wird?«
Er zuckte die Achseln. »Vielleicht! Ich weiß nicht.«
»Man erzählt Wunderdinge davon in Mexiko,« sprach sie. »Wissen Sie etwas davon?«
»Es berauscht,« erwiderte er. »Ein seltsamer Rausch — ganz verschieden von allen andern. Ich habe sie alle versucht — früher einmal — Opium, Haschisch und Muscarin, Digitalin, Kawa-Kawa, Ganga und Kokain und vieles noch. Keines wirkt wie Mescal. Ein seltsamer Rausch — Farben, viele Farben.«
»Ich möchte es wohl versuchen,« sagte die Goyita. »Ist es schädlich?«
Er lächelte mühsam. »Schädlich? Nein, schädlich ists nicht. Morphinist kann man leicht werden, Schnapssäufer, Äthertrinker, Haschischesser — aber an Mescal kann man sich nicht gewöhnen. Das wissen Sie ja selbst, wie schwer es zu bekommen ist!«
Sie erhob sich, nahm eine Tasse, kam zu ihm hin. »Schenken Sie ein,« sagte sie.
Er goß ihr die Tasse hoch voll. »Fürchten Sie sich nicht?« fragte er. »Sie werden berauscht sein, bewußtlos daliegen für ein paar Stunden. Sie sind in fremdem Hause — bei einem Fremden —«
Die Tänzerin sah ihn lange an mit großen Saphiraugen: »O nein,« sagte sie ernst, »ich habe keine Furcht. Sie — sind ein Deutscher.«
Er dachte: ›Das?! Aber freilich — du brauchst keine Angst zu haben! Ich bin so schwach und so elend — und ich werde berauscht sein — wie du. So bist du sicher!‹
Er sagte: »Schließen Sie die Türe ab.«
Sie tat, wie er geheißen. Kam zurück, nahm die Tasse aus seiner Hand, leerte sie.
»Noch eine!« sagte er. Füllte beide Tassen von neuem.
Sie tranken.
Etwas verband ihn dieser Frau —
Sie lächelte: »Was nun? Ich bin sehr neugierig.«
Er sank zurück auf den Diwan, völlig erschöpft von all der Anstrengung. Sie sah es wohl, schob ihm freundlich die Kissen zurecht unter Nacken und Kopf.
»Ists so recht?« fragte sie.
Er nickte. »Danke!« flüsterte er. »Legen Sie sich auf den großen Sessel — dort auf den ledernen. Nehmen Sie Kissen. Dann — knöpfen Sie die Bluse auf — es ist gut, wenn Sie frei atmen können und wenn nichts drückt auf Ihrem Herzen, öffnen Sie auch Ihr Mieder — oder ziehn Sies aus.«
»Ich trage keins,« sagte die Frau.
Er sah — verschleiert nur, wie durch Nebel, wie sie nestelte an ihrem Kleide. Wie sie zu dem Ledersessel ging, Kissen hineinwarf, sich ausstreckte.
»Kennen Sie eine Copla der Rumba?« flüsterte er. »Bitte singen Sie mir den Rhythmus — bis Sie — schlafen.«
Sie sang, leise, sehr leise:
»La Rumbita que yo bailo,
La de Rumba, Rumba, Rumba,
Es muchissimo más dulce
Que unos labios de mujer!
Ay, ay, ay! Co, co, co.«
Eintönig, immer dieselben Worte. Denselben Rhythmus. Er suchte das Bild zu fassen, wie sie vor Villa tanzte und den Generalen. Aber er fand es nicht — sah nur Villas Affenfratze — und das adlernasige Gesicht seines Adjutanten. Dann der Tänzerin Kopf: saphirblaue Cabochonaugen in Weiß. Schwarz rund herum.
Nun schlief er —
Sonne, Sonne und der Weg am Strand. Grade über ihm stand die Sonne, hoch im Mittag, als er im Sande saß unter den kahlen Dünen. Das Meer strahlte und der Sand leuchtete. Manchmal zog ein Bauer vorbei, oben hängend auf dem vollbepackten Maultier. Still, langsam, ohne einen Laut. Tauchte auf in der Ferne, kam heran, verschwand wieder. Nirgend ein Schatten, nirgend. Gerade über ihm stand die Sonne im Mittag.
Dann erhob er sich, ging der Stadt zu.
Etwas war mit ihm — um ihn. Alles war still, alles war leuchtend klar um ihn her. Nur Sand und Meer und Sonne. Er blieb stehn, sah ringsum, schritt weiter.
Dann fand er es. Ein langer Schatten lief vor ihm her. Sein Schatten.
Rot und Gelb. Rot und Gelb. Überall Rot und Gelb in der Stadt. Heute war Festtag und große Corrida — Miurastiere, Belmonte, Gaona und Joselito — da wehten die Fahnen in den Landesfarben. Überall durch die Stadt — Rot und Gelb. Ein guter Wind blies vom Meere her aus Südwest — und nach Nordost wehten alle die Flaggen, die breite Straße hinauf, die er ging. Wehten, wie er ging, wie alle die Menschen da gingen, ins Land hinein, dorthin wo der Stierzirkus lag. Wie ein gewaltiger Magnet war es, der alles zu sich hinzog.
Keiner kam ihm entgegen, keiner. Alles zog hinauf diese breite Straße. Und mit ihnen zogen die Fahnen, Rot und Gelb — zur Corrida hin.
Aber eine, eine zog nicht mit. Er sah sie gut, eine große und alte, ausgefranst an den Enden. Sie hing nicht herunter von ihrem Mast, war nicht festgewickelt in ihren Leinen. Nein, sie wehte gut, wehte wie alle anderen Fahnen. Aber sie wehte — gegen den Wind.
Niemand sah es, niemand achtete darauf. Zur Corrida zogen die Fahnen und Menschen —
Das wußte er wohl: er lag da und träumte. Er hatte Mescal genommen, einen starken Absud, zwei große Tassen voll. Lag auf dem breiten Diwan in seiner Wohnung, in Neuyork in. der dreiundzwanzigsten Straße. Auf seinem Guanacofell. All dessen war er sich sehr bewußt.
Und er wußte auch: es ist ganz unmöglich, daß die Fahne gegen den Wind weht. Wie es unmöglich ist, einen Schatten zu werfen zur Mittagszeit.
Und dennoch warf er den langen Schatten. Und dennoch wehte die Rotgelbe gegen den Wind.
In Puerto Santa Maria, als er zum Stierkampf ging.
Einer saß neben ihm auf den Steinbänken, ein sehr Dicker. Ein gewaltig Dicker, ein ungeheuer Dicker, einer, der Platz nahm für drei, der überschwappte vorn und hinten und nach beiden Seiten.
»Wasser!« schnappte der Dicke. Und der Gallego goß ihm ein hohes Glas voll.
»Mehr!« keuchte der Dicke. Wieder eines und noch eins.
Fünfzehn Gläser trank der Dicke und zwanzig. »Mehr!« stöhnte er, »mehr!«
Unten machte Joselito seine Veronicas, der Bruder des kleinen Gallo.
»Olé!« jauchzte die Menge, wenn der Sevillaner das Scharlachtuch dicht vorbeizog vor des Stieres Augen, mit der linken sein Horn griff, niederkniete vor dem Tiere. »Olé!«
Aber der Dicke jappte: »Mehr!« Füllte sich an, schwemmte sich auf, wuchs nach allen Seiten. »Mehr!«
Der starke Veneno hing auf der Schindmähre, die der Stier traf. Zwei lagen schon im Sand — das war die dritte, die er auf die Hörner nahm. Der gepanzerte Picador kugelte herunter, plump, ungeschickt — bumm, auf den Schädel, wie immer. Kroch heraus unter dem Gaul her, erhob sich, watschelte davon. Aber der Stier bohrte die Hörner in des Pferdes Leib, riß die Eingeweide heraus. Wandte sich dann, raste hinüber nach der andern Seite — zu dem schwarzen Klepper, den Catilino ritt.
Da schrie ein Weib auf der Schattenseite. Sprang auf in der Loge, nahm den Schleier ab, warf ihr Tuch zu Boden. Schrie, kreischte, sprang die Stufen hinab — und über die Brüstung in den Sand. Lief hinüber, stand in der Sonne, schrie, schrie. Und begann sich auszukleiden.
Einer rief: »Sie ist wahnsinnig!«
»Greift sie! Holt sie heraus!« johlte die Menge. Die Toreros liefen auf sie zu.
Aber die Frau riß sich die Kleider vom Leibe, Röcke, Hemd. Stand da, nackt auf dem gelben Sand. Nur die Schuhe hatte sie an und lange rote Strümpfe.
Ein Banderillo sprang zu ihr hin, hing ihr seinen Mantel um. Dann ließ sie sich abführen, ging ruhig mit ihm zu den Planken hin. Blieb stehn einen Augenblick, stutzte, sah wie die rotröckigen Chulos des Catilino Mähre vor den Stier zerrten.
Da schrie sie wieder. Riß sich los, lief hinüber. Stellte sich dicht vor den elenden Gaul, als ob sie ihn schützen wolle. Breitete die Arme weit aus.
Floh doch in Todesangst, als der Schwarze von Miura die Hörner senkte. Rannte gellend durch die Arena.
Aber sie kam nicht weit. Stolperte, fiel — da nahm sie der Stier.
Warf sie hoch, stieß ihr die Hörner in den Leib. Ihre Eingeweide flossen in den Sand — wie die der Pferde.
Die Toreros schwenkten ihre Mäntel, lenkten den Stier ab im Augenblick. Und der Sevillaner tötete ihn schnell, recht und schlecht — wie die Klinge traf.
Die Krankenwärter kamen mit der Bahre. Legten die nackte Frau darauf, hüllten sie ein, trugen sie hinaus —
Unter dem gelbroten Tuche her schrie es, schrie es.
»Eine Verrückte!« gröhlten die Leute. »Eine Wahnsinnige!«
Aber der Dicke ächzte: »Mehr! Mehr!«
Trank immer noch Wasser. Nein, er trank nicht — er atmete Wasser.
Er saß in den Felsen am Strand mit dem kleinen Maler. Der sagte: »Gauguin hatte schuld und sonst keiner. Der war der schlechtere Mann und war eifersüchtig auf den Holländer. Und als er zu ihm kam nach Arles, ward van Gogh vergiftet durch des andern Wahnsinn. Da schnitt er sich die Ohren ab und ging ins Dirnenhaus und gab sie ab — mit einem schönen Gruß für Herrn Gauguin.«
»Warum schnitt er sich die Ohren ab?« fragte er.
Der Maler sagte: »Er schnitt sie sich ab — das ist Geschichte. Jeder weiß es. Die ganze Welt weiß es. Die Ohren hat der Picasso.«
»Wo hat er sie her?« forschte er.
»Ich weiß nicht,« rief der Maler, »das ist doch ganz gleichgültig. Er hat sie — das ist das Erbe van Goghs. Man könnte sagen, die Augen müßten es sein — oder die Hand — aber das ist ganz falsch. Man muß die Zeit hören — um seiner Zeit Maler zu sein. So wird der Picasso nichts mit dem Erbe anfangen können — obwohl er aus Malaga ist. Oder gerade darum.« Er rückte nahe heran, senkte seine Stimme, schaute ringsum, ob niemand hören könne.
Sie saßen ganz einsam in den Felsen, vor dem Meer in der Sonne.
»Ich wills Ihnen sagen,« flüsterte der Kleine. »Malen — das ist wie Torieren: da liegt das Geheimnis! Und nie, solange die Welt steht — ist ein guter Maler aus Malaga gekommen — noch ein guter Torero. Wer stammt aus Malaga? Die Larita, die Paco Madrid — lauter Brutos! Rohe Kerle, Espadas und sonst nichts — das hat keinen Schimmer von der Kunst! Das ist tapfer und geht drauf los — bringt im besten Falle eine wildwüste Estocada zustande. Aber Veronicas, ohne die Füße zu rühren, Quites mit Niederknien, Naturales über einem Arm, alles was Kunst ist in der Faëna — keine Ahnung. Gaona hat seine Goaneras erfunden — Joselito — Herrgott — diese Molinetes! — Belmonte — welche Mediaveronicas! Und der alte Gallo ist das gewaltige Genie! Ein Mensch ist er — ein Mensch! Hat den höchsten Mut und die unerreichteste Kunst heute — und läuft morgen weg vor dem Stier wie ein altes Weib, macht die infamsten Gemeinheiten! Wie neulich in Irun! Warum? Weil ihm ein schwarzer Hund über den Sand lief. — Bei mir ists der Schlips. Man siehts ihnen nie an, wenn man sie kauft — aber man merkts, wenn man arbeitet — der macht tapfer — und feige der andere. Weg mit ihm! Und dann lieber gleich die Leinwand zerschneiden. Aber der gute Schlips macht unendlich sicher — da kann man alles, alles! Ich habe den beiden Gallos ihre Schliche abgelauscht — denen und dem Belmonte!«
Er stand auf, schob seine Boina über den Kopf. »Das Meer wird schwarz,« sagte er. »Die Sonne wird grün. Wir wollen schwimmen.«
Sie schwammen weit hinaus, leicht und schnell, die Strömung trug sie.
»Können Sie das Land noch sehn?« fragte der Maler.
Er schüttelte den Kopf. »Die Wellen gehn hoch,« antwortete er. »Wir wollen zurück.« Sie wandten um.
Aber das Meer zog sie hinaus. Sie mußten treten, treten.
Und das Meer wurde dick, schleimig, fest. Er merkte, wie er zurückblieb, mehr mit jedem Stoße, sah, wie der andere weit vorausschwamm dem Lande zu.
»Warten Sie doch!« rief er.
Doch der andere erwiderte: »Nein! — Ich desertiere.«
Da schrie er durch die schwarzen Wogen: »Feigling!«
Der mit der Boina stand am Strande. Lachte: »Qué quiere? — Ich habe more travailliert für das Vaterland als Sie! — Plus que dreitausend horses!«
Und er sah, daß es der Pferdemann war, der in den Felsen verschwand. Nicht der Maler.
Das Schwarze war Tinte. Oder — nicht eigentlich Tinte. War ein schwarzfärbender, schleimiger Stoff, der sich löste im Wasser — und übel roch wie tote Fische. Darin mußte er schwimmen.
Dann hörte er ein Stöhnen und Keuchen und Japsen. Er wandte den Kopf — da schwamm der Dicke hinter ihm. Bleich, fleischfarben, eine ungeheure, schwappende Masse. Er konnte das Gesicht kaum erkennen, sah nur die kleinen, gierigen Augen, kreisrund, sah das große Maul — wie ein entsetzliches Loch, das sich füllte mit Wasser. Von dem Dicken strömte das schleimige Schwarz aus — irgendwo hatte er eine giftige Drüse, die ihren eklen Inhalt ausleerte ins Meer.
Nun begriff er auch, warum er nicht weiterkam. Die zähen Tinten hielten ihn fest und zugleich strömte das Meer in dies scheußliche Maulloch — das zog ihn zurück.
Der Dicke war es — da war kein Zweifel. Das Gesicht, das er sah, war ganz menschlich — kahl der Schädel und plattgedrückt. Keine Stirne, keine Nase und kein Kinn. Aber die kleinen, runden Augen und das entsetzliche Loch.
Der Dicke war es. Aber seine Finger wuchsen und seine Zehen wuchsen, während Arme und Beine sich hineinschoben in den Leib. Und der Hals blähte sich noch mehr auf und Kopf und Leib wurden eins — ein bleicher Schlauch, ein gewaltiger Sack, der Wasser schluckte. Die Finger und Zehen krochen ins Meer hinaus, wuchsen, wurden lang, lang, viele Meter lang. Breit dazu und dick wie starke Mannsarme, aber weich und ohne Knochen. Und mit Warzen bedeckt, überall.
Er dachte: darum ist der Maler weggeschwommen! Das ist ein Krake, der Dicke, ein großer Polyp! Aussaugen will er mich —
Angst hatte er eigentlich nicht — er lag ja auf seinem Diwan — träumte. Träumte von einem Dicken, der ein Polyp war, und wußte gut, daß er nur träumte. Ja, er wußte auch, woher dies Bild kam: in der alten Nummer irgendeiner Zeitschrift hatte ers gesehen, in der »Jugend« oder im »Simplizissimus« vor ein paar Tagen erst. Der dicke John Bull, der den Kraken spielte, die saugenden Fangarme ausstreckte über alle Länder und Meere. Er erinnerte sich gut, daß er die Zeichnung herzlich schlecht fand und sich dazu ärgerte über den Zeichner, der die alte Walze zum hundertsten Male abdrehte.
Billig war es, sehr billig. Ein guter Witz, als zum ersten Male ein Künstler den Gedanken hatte, für Napoleon vielleicht oder den fünften Karl oder sonst einen, der die Welt erobern wollte. Heute wars abgebraucht, war längst Klischee seit hundert Jahren und mehr.
Es stimmte — freilich stimmte es. Aber gerade darum wars schlecht, weil es immer stimmte. So wie Herz sich auf Schmerz reimte — wie grün die Farbe der Hoffnung war und die schöne Frauenstimme wie eine Nachtigall sang. Wie Rouge et Noir: Spiel bedeutete, und zwei mal zwei vier war.
Konvention —
Genial einmal. Abgeschmackt längst. Unerträglich am Ende.
Und er dachte: an dem allein ist nur eins schuld. Dieser gräßliche, schauderhafte gesunde Menschenverstand. Der und die Natur — die zumeist.
Jeden Herbst fielen die Blätter von den Bäumen, die wurden kahl. Dann schneite es und alles wurde weiß. Und im April oder Mai war alles wieder grün. Wo man hinsah, brachen Blätter heraus und Blüten —
Warum denn immer nur Blüten und grüne Blätter? Dasselbe, und ewig dasselbe durch die Jahrtausende und jedes Jahr und jedes einzelne Jahr — immer und ewig dasselbe. Gar nicht anders möglich war es, als daß diese elend verkitschte, stocklangweilige Natur das Menschengesindel auch verkitschen mußte. Das stellte sich ans Klavier, riß das Maul auf und sang was von Glocken, die läuten sollten, und daß nun der Lenz da sei.
Zum Erbrechen war es.
Warum hatte denn nicht ein einziges Mal so ein Apfelbaum einen besonderen Gedanken? Warum trieb er nicht einmal Korkenzieher statt der ewigen grünen Blätter, eingemachte Heringe statt der weißen Blüten? Gott, es mochte ja sein, was es nur wollte, Stachelschweine, Tintenfässer, Biergläser, Teetassen, alte Stiefel oder Zahnbürsten! Aber nein, nein, grüne Blätter mußten es sein! Flieder am Fliederbusch, Kirschen am Kirschbaum, Johannisbeeren am Johannisbeerstrauch. Und jedes Kanin bekam Kaninchen. Jede Katz ihre Kätzchen, jede Kuh ihre Kälber. Warum nicht — ein einziges Mal nur, zur kleinen Abwechslung — irgend was andres — und wenns auch ein blecherner Nachttopf gewesen wäre!
Und nun kroch diese niederträchtige Konvention gar in seine Träume hinein.
Er dachte: dazu brauchts keinen Mescal —
Furcht? Nein — recht eigentlich nicht. Es stimmte — gewiß — er war Deutscher. Und der Engländer verfolgte ihn — wie jeden andern im ganzen Lande — das konnte er alle Tage sehn. Wozu waren denn die Detektive da, die vor der Haustüre lungerten?
Es stimmte — sehr gut stimmte es. Ausgesogen war er — müde, krank und leer — und etwas war da, das ihn aussog., Er schwamm, schwamm in dem schwarzen Schlamm — schwamm und kam nicht weiter.
Nie würde er nach Hause kommen — nie wieder ans Land!
Und doch sah er das — sah das Land — nahe genug.
Dann teilte er sich; war — zwei. Eines lag auf dem Diwan und träumte. Und sah gut das andere sich elend abmühn in dem schwarzen Wasser. Sah es die Arme weit hinauswerfen und mit den Beinen stoßen gegen die ziehende Strömung. Und ob auch das eine gut wußte, daß es träumte, so wußte doch das andere nicht weniger gut, daß alles sehr wirklich war ringsherum. Daß der scheußliche Dicke näher kam und näher, daß die weichen Polypenarme weit sich reckten, bleich und weich sich hinausschoben durch die schleimigen Tinten.
Er schloß die Augen, schrie auf, trat, trat in jämmerlicher Angst.
Er kam weiter, dem Ufer zu — ah, nun fühlte er Boden unter den Füßen.
Er stand; wandte sich. So nahe war nun das Tier, daß alle die Arme herumspielten um seinen Leib. Und ob er gleich auf dem Strande stand, würde er doch nie die Felsen erreichen können, die die Flut nun bespülte.
Er suchte irgendeinen Stein — einen Stock — sich damit zu wehren.
Da fühlte er etwas in seiner Hand — klein und glatt.
Lottes Messer —
Er öffnete es — da wuchs es — wie die Saugarme des Dicken. Und er hieb um sich, schlug, traf mit scharfem Schlage einen Arm. Schnitt ihn durch — da ringelte das Ding im Wasser, wie eine große Schlange. Noch einmal holte er aus, und wieder, hieb die Arme herunter — wie durch Butter schnitt sein gutes Messer.
Rotes Blut mischte sich mit dem schwarzen Meer. Dazwischen schwammen die bleichen Fleischarme.
Er lief. Fiel nieder, dicht an dem Felsen, auf einem kleinen Fleckchen Sandes, eben breit genug, um sich auszustrecken.
Da lag er. Sah auf das Meer.
Sah den Dicken — der grinste. Schlürfte Wasser, viel Wasser — schwappte, tauchte unter. Aber in der blutigen Tinte schwammen die weißen Arme — sanken unter, tauchten auf — als ob sie ein eigenes Leben hätten. Kamen näher und näher dem Strande zu.
Einer hob sich — reckte sich. Schwarz floß das Wasser herunter über den weißen Leib — aber er sah, daß es Haare waren, nasse Wellen tiefschwarzer Haare. Und kein Arm war es: war ein Weib, ein nacktes Weib.
Noch eines da hinten — noch eines — wieder eines. Zu nackten Weibern wurden die weißen Saugarme.
Die kamen heran, krochen auf ihn zu. Still — still — ohne jedes Geräusch. Näher, näher —
Er versuchte aufzustehn, versuchte zu schrein. Er riß den Mund weit auf —
Aber kein Laut kam heraus. Nichts.
Hilflos lag er. Lautlos. Regungslos.
Nur ein Atmen. Nur ein Klopfen im Herzen. — Da schloß er die Augen.
Und er fühlte, wie sie ihn berührten. Naß, kalt — mitten auf die Brust. Ein Schmerz, stechend — aber sehr rasch, für einen Augenblick nur.
Und ein langes Saugen und Schlürfen.
Sie tranken ihn aus — sie tranken ihn aus.
Es tat nicht weh — nein. Wohlig war es. Weich und wohlig. Und es war, als ob auch er sauge — wie die Weiber. Als ob auch er tränke — wie sie. Er fühlte den Blutgeschmack auf der Zunge. Süßlich —
Fühlte auch, wie sich seine Adern füllten mit Blut. Wie er stark wurde und gesund.
Und doch tranken sie — ihn — sie, die Weiber.
Die abgetrennten Ausflüsse des Dicken, diese Saugarme, die eigenes Leben gewannen, selbst Wesen wurden, diese Saktis des gräßlichen Shiwa-Moloch. Sie sogen sein Blut — und er träumte nur. In sterbendem Röcheln, in letztem Todesschweiß.
Träumte — daß er Blut sauge —
Dick und voll sich tränke. Einschlafen darüber. Wieder träume:
Im Garten war es, hinter seiner Mutter Haus. Schulferien — seine Base Daisy war zu Besuch. Mit der spielte er am frühen Morgen unter den Kastanienbäumen. Sie hatten einen sehr großen Zinnteller, füllten ihn mit Wasser, stellten ihn in die Sonne — da kam die zahme Dohle und badete. Duckte sich, spritzte das Wasser mit den Flügeln, pickte mit dem scharfen Schnabel auf das glitzernde Metall. Sie hatten auch ein Meerschwein, das hieß ›Enkel‹, und zwei Igel — die mußten auch baden.
Dann rief eine Stimme — scharf und hell: »Dé—si—rée!«
Das war Tante Ida, Daisys Mutter. Nun war es aus mit dem Spiel. Nun mußte sie hinauf, mußte die Feder nehmen. Sich hinsetzen und einen französischen Aufsatz über Mahomet schreiben oder einen englischen über die Jungfrau von Orleans. Und dann Klavierübungen machen — drei Stunden wenigstens. Und noch eine Stunde — vierhändig mit der Mama.
Sie war gut zwei Jahre jünger als er. Und so viel wußte sie und konnte sie — das kam, weil ihre Mutter ein Wunderkind aus ihr machen wollte.
Freilich, mit der Armbrust schoß sie immer daneben. Konnte auch keine Kröte auf die Hand nehmen, wußte nicht einmal, was ein Splick war! Und vor toten Spatzen fürchtete sie sich nur dann nicht, wenn sie in Zeitungspapier eingewickelt waren.
Daisy ging, und er saß allein, überlegte lange. Mit den Kröten — das war ein sehr schwerer Fall! Die Igel fingen sie, warfen sie mit den Pfötchen auf den Rücken, bissen ihnen den Bauch auf und fraßen die Eier heraus. Ließen sie dann liegen. Nun fürchtete er sich gewiß nicht vor einer Kröte — aber eine, die auf dem Rücken lag, der man aus dem offenen Bauche Eier und Eingeweide herausgefressen hatte — das war doch was anders. Zertreten konnte man sie kaum — und totmachen mußte man sie doch! Den Kopf abschneiden mit einer scharfen Schere — das war sicher die schnellste Erlösung für die verstümmelten Tiere, die ja doch zu Tode sich quälen mußten. Er hatte es einmal getan — es war schrecklich schwer. Man mußte die Augen dabei zumachen — und dann schnitt man daneben.
Was konnte man nur tun? Er mochte die Kröten sehr gern, wegen ihrer goldenen Augen. Mochte die Igel auch sehr gerne — wegen ihres klugen Köpfchens und der kleinen Pfötchen und des Stachelfells. Und weil sie Junge kriegten, die gerade aussahen, wie stachliche Kastanien.
Freilich die Igel waren unverbesserlich, hörten nie, was man ihnen auch sagte. Sie brachen in die Küche ein und fraßen die Eier. Sie nagten jede Birne an, die herunterfiel vom Baum, und fraßen auch stets ihre eigenen Kinder auf.
Eines mußte man abschaffen — die Kröten oder die Igel. Aber die Igel waren so schrecklich komisch. Und sie konnten doch am Ende nichts dafür, wenn sie so furchtbar gern frische Kröteneier aßen. Er aß am liebsten die unreifen Stachelbeeren, die er hinten im Klostergarten stehlen mußte — das war auch verboten.
Er löste die Frage nicht. Er ging auf die Veranda, da wartete das Frühstück auf ihn.
Tante Henriette schenkte ihm den Kaffee ein, die war auch auf Besuch. Die zwiebelmustrige Kaffeekanne sah genau so aus wie Tante Henriette, dick, rund, halslos und in blauweißem Kleid. Und so freundlich und gut tat sie, genau wie Tante Henriette. Aber er dachte: es ist alles Schwindel. In seiner Tasse schwamm eine dicke Haut — die konnte er nicht ausstehn. Er fischte sie heraus — aber die Tante Henriette tat sie wieder hinein. Das sei das Beste — sagte sie. Und er solle Gott danken, wenn er stets in seinem Leben so schönen Milchkaffee bekomme.
Was wußte sie davon, Tante Henriette? Seinetwegen mochte sie sich den Bauch dick vollstopfen mit Haut und noch runder werden als sie schon war. Ihm — schmeckte es nicht! Und die Kaffeekanne war ein hinterlistiges Ding, das ihm in aller Güte hinterrücks die alten Lappen in die Tasse warf.
Er rührte herum; da fragte Tante Henriette, wann er endlich an die Arbeit gehn wolle? »Mangelhaft« stände in seinem Zeugnis, er habe große Lücken in der Mathematik auszufüllen —
Er stand auf. Schlich rasch in den Garten, als die Tante grade ihr Strickzeug nahm. Die Tasse ließ er unberührt, nur sein Schinkenbrot nahm er mit.
Sie ist gemein, die runde Tante Henriette, dachte er. Gemein und hinterlistig, wie die dumme Kaffeekanne, die sie mitgebracht hatte.
Schulferien! — Und dabei mußte die Daisy französische Aufsätze schreiben über Mahomet! Und er sollte Lücken ausfüllen in der Mathematik! Und die alten Igel fraßen die Eier aus den lebendigen Kröten —
Er seufzte sehr tief. O — das war ein Leben —
Wie die arme Kröte lag er da, auf dem Rücken an dem Felsen. Nun war es kein Igel, der seine scharfen Zähnchen ihm in den Leib schlug. Es war die Kaffeekanne, die saugte mit ihrer kurzen Schnute. Und die war nichts anders, als eben die Tante Henriette — die trank, die schlürfte — davon wurde sie ja so dick und rund.
Und sie hatte auch die Kröten ausgesogen, am Wegesrand — da hatte er den Igeln Unrecht getan — das war nun klar! Sie — oder der dicke Polyp, der über Nacht aus dem Meer über die Klostermauer kroch, hinein in den Garten.
Oder vielleicht dessen Arme? — Die nackten Weiber?
Einerlei, wer es war. Er war die Kröte. Die eine und die andern auch. Alle. Lag da mit offenem Leibe — starrte hilflos in die Sonne mit goldgrünen Augen —
Dann krochen die Spuckmäuse um ihn her. Die schwarzen, die der Mann ausspie in dem Pullmanwagen der Union Pacific, zwischen Saltlake City und Denver. Die sprangen heraus aus dem Spucknapf, saßen um ihn, piepsten, pfiffen.
Kicherten, zwitscherten auch, sangen —
So ein Mäuselied. Von dem Mäuserich, der über Wasser reisen wollte im Pißpott. Nach Rotterdam fahren. Aber er kam nie hin, weil er aus Beverland war, und das liegt in Deutschland.
— Sie steckten die Schwänze in seinen offenen Krötenleib. Leckten sie ab.
Aber es schmeckte ihnen nicht — gar nicht.
Sie ließen ihn liegen.
Die Nonnen kamen durch den Garten, die fanden die arme Kröte. Schoben sie mit spitzen Fingern auf ein großes Kastanienblatt, deckten ein anderes darüber, trugen sie fort, schritten durch den Garten, langsam und betend, zum Kreuzhof. Da sollte sie begraben werden.
Er dachte: wie gut wird es sein, da zu liegen. Dicht beim Wasser, wo das grüne Fröschlein hinabsprang zum Himmel. Bei der vierten Säule, unter all den weißen Rosen.
— Im Kreuzhof stand er, mitten zwischen den Nonnen. Aber die sahen ihn nicht, so beschäftigt waren sie mit Beten und Singen. Und er dachte: nun werden sie die leeren Blätter begraben — und werden nicht wissen, daß kein Krötlein drin ist —
Da sah er, daß es gar nicht die rheinischen Nonnen waren, nicht die Äbtissin Beata, nicht die Dalwigk, nicht die süße Metternich und die kleine Romberg mit dem Stumpfnäschen.
Es war die Pierpont und die de Fox. Und die dürren Chorweiber André's. Die schrien ein Lied, scheußlich, in synkopiertem Ragtime und englisch zerkautem Latein, warfen Rosen herab von den Galerien. Aber nicht weiße, sehr rote Rosen waren es —
Blutrote Rosen — Blut — —
Blut regnet herab, traufte über ihn, viel rotes Blut. Da kroch seine Zunge heraus aus den Lippen, wie einst auf der Mensur. Er leckte, schlürfte — Blut, warmes Blut —
Durstig war er — sehr durstig —
Trank — trank —
So gesund trank er sich, so stark und gesund.
Der Doktor Samuel Cohn stand da. Der sagte: »Nehmen Sie Hämatogen. Doktor Hommels Hämatogen. Das ist konzentriertes Blut, Ochsenblut. Die Wirkung ist eine verblüffend gute. Ein Eßlöffel Hämatogen hält mehr —«
Er starrte ihn an, verständnislos erst und verwirrt. Dann begriff er. »Nein, Doktor,« sagte er. »Nein! Es muß rot sein und warm und frisch. Muß Menschenblut sein. Und fließen muß es, fließen!«
Aber der Arzt schüttelte den Kopf, sehr bedenklich und vorwurfsvoll: »Das ist ein fester Strick für das Netz, in dem Sie stecken! Aus Hämatogen kann man keine Stricke drehn. Dr. Hommels Hämatogen ist in allen Apotheken erhältlich. Es —«
Er hörte nicht hin — und der Arzt sah es wohl. Da unterbrach er sich, zuckte die Achseln, ging. Ein Flüstern war an der Türe und ein schweres Schieben und Riegeln. Einer stand da in einer blauen Uniform, mit Silberknöpfen, aber ohne Mütze. Der ließ den Arzt hinaus.
Und einen andern hinein. Das war der Journalist, war der Tewes. »Wie fühlen Sie sich, Doktor?« fragte der.
Wie er sich fühlte? Welche Frage! Ausgezeichnet, stark, kräftig, sehr gesund.
»Wünschen Sie Tee?« fragte er den Redakteur.
»Tee — hier Tee?« gab der andere zurück.
Er sah sich um — nein, er war nicht in seinem Zimmer. Das war eine Zelle, eng, sehr klein — mit dumpfer, feuchter Luft. Ohne Fenster und dunkel genug — nur aus einer Ecke glühte eine elektrische Birne. Er saß auf einer Pritsche — und die Hände waren ihm zusammengeschlossen.
Er kannte den Raum gut. Hier hatte er den kranken Burade besucht, den vom Norddeutschen Lloyd. Der mit falschen Pässen ein paar Leute hinübergebracht hatte nach Deutschland, den sie zur Strafe dafür auf sieben Jahre nach Atlanta geschickt hatten, ins Staatszuchthaus.
Aber — ja doch — er selbst saß ja hier — gottweiß wie lange schon. In diesem elenden, schmutzigen Loch, in den ›Tombs‹, dem Neuyorker Gerichtsgefängnis —
»Ich habe die Zeitungen mitgebracht,« sagte der Redakteur, legte ein großes Bündel auf die Pritsche. »Alles Ausschnitte über die Verhandlung. Die ganze Presse ist einmütig in ihrem Lobe über die Geschworenen, die Sie verurteilt haben und damit das Vaterland gerettet.«
»Sind Sie auch verurteilt?« fragte er.
Der Journalist lachte: »Ich? Wie kann man mich verurteilen?! Ich bin doch Amerikaner!« Er öffnete das Bündel, griff ein paar von den Ausschnitten. »Ich komme soeben von Ihren Anwälten — die haben ein Telegramm aus Washington erhalten. Das Bundesgericht hat die Berufung verworfen — hat das Urteil der Geschworenen bestätigt in allen hundertundsiebzehn Punkten.«
›So — so,‹ dachte er, ›hundertundsiebzehn Punkte!‹
Der Journalist fuhr fort: »Die Exekution soll heute abend stattfinden. Da meine ich, es wäre gut, wenn Sie die Kollegen empfangen wollen, die Reporter und Photographen — das würde Sie vielleicht ein wenig zerstreuen. Sie sind der interessanteste Mensch in ganz Neuyork heute, Doktor, über sechzig Preßleute warten draußen. Darf ich sie hereinlassen?«
»Einen Augenblick,« sagte er. Er griff nach den Zeitungsausschnitten, starrte hinein. O, jetzt erinnerte er sich gut der ganzen Sache, wie er die Schlußrede des Gerichtspräsidenten da vor sich sah. Der war kurzatmig, jappte nach Luft, spie aus nach jedem Satze —
Hundertundsiebzehn Verbrechen hatte er begangen, große und kleine, wies grade traf. Manche nur einmal, manche in stetem Rückfalle und wieder in schönster Idealkonkurrenz mit den andern —
Und der Richter hatte gesagt: »Es scheint fast, als ob das ganze Leben dieses Menschen in unserm freien und gastfreien Lande nichts anders war als ein ständiges Nichtachten und Mitfüßentreten der Gesetze. Als ob dieses unendlich niedrige, vertierte, vom Satan besessene — mit einem Worte: dieses deutsche Hirn — nichts mehr denken konnte als Mord, Raub, Diebstahl, Verbrechen jeder Art.«
Da standen sie in der Zeitung, aufgezählt, alle hintereinander, seine hundertundsiebzehn Schandtaten — eine große Seite voll.
Urkundenfälschung — das war nur ein Punkt, aber in fast tausend einzelnen Fällen. Falsche Pässe, falsche Papiere, falsche Deklarationen für Konterbande, Schmuggelware nach Deutschland. Beleidigung der Landesfahne dann — er war sitzen geblieben auf seiner Bank am Madison Square, als ein vorbeiziehender Leierkastenmann das Lied vom Star-Spangled-Banner auf seiner Drehorgel gedudelt hatte. ›Weiße Sklaverei‹ — Mädchenhandel, weil er ›zum Zwecke der Unzucht eine amerikanische Bürgerin in einen fremden Staat verschleppt hatte‹. — O ja, es stimmte schon! Er war mit Lotte van Neß von Neuyork hinübergefahren nach ihrem Landhaus in Neujersey — genau vierzig Minuten weit mit dem Auto.
Dann Landesverrat — er hatte den Villa aufgehetzt, hatte ihm Waffen geliefert: ganze fünf Revolver! Er allein hatte die Japaner veranlaßt, gegen die Staaten Stellung zu nehmen — man bewies es genau! Beleidigung des Präsidenten, den er in seinen Reden einen Lakai der Engländer genannt hatte. Und Verunglimpfung Englands selbst, des heiligen Mutterlandes — das war viel schlimmer.
Verletzung der öffentlichen Sittlichkeit — er hatte am Strande gebadet, nur mit einer Schwimmhose bekleidet, ohne Brusttrikot. Ein Detektiv hatte es beobachtet durch ein Fernglas — der konnte es beschwören. Und Blasphemie, Gotteslästerung! Weil er behauptet hatte, daß der Stamm Levi in der Wüste eine schwarzweißrote Fahne habe. Die Fahnen aber der Stämme Israels in der Wüste seien eine göttliche Einrichtung, und es sei eine niederträchtige Beleidigung, zu behaupten, daß einer von ihnen die Mörderfahne Deutschlands geführt habe. Nichts davon stände in der Bibel: es sei eine tieferbärmliche, gemeinverlogene, deutsche Fälschung.
Und dann — die Sache mit der rotgelben Fahne. Es sei völlig ausgeschlossen, daß eine Fahne gegen den Wind wehen könne, das widerspreche den einfachsten Naturgesetzen — nur ein Deutscher könne einem amerikanischen Gerichtshofe mit solch albernen Ausreden kommen. Es sei gar keine Frage, daß es sich um eine flaggentelegraphische Nachricht gehandelt habe, irgendeine infame Spioniererei, die er auf diesem Wege seinen kindermörderischen Landsleuten übermittelt habe. Wie er denn auch, unter Umgehung des Postregals und unter Nichtachtung der Hoheitsrechte des Staates, zugestandenermaßen mehrmals Briefe durch nach Europa reisende neutrale Passagiere nach Deutschland habe schaffen lassen. In dieselbe Rubrik aber falle das Werfen eines langen, schwarzen Schattens genau zur Mittagszeit, das — naturgesetzlich ganz unmöglich und darum allein schon für jeden anständigen Menschen zu verdammen — keinen anderen Zwecken habe dienen können, als nur verbrecherische Nachrichten auf geheime Weise seinen Mitverschwörern zu übermitteln.
Und die Kröten! Die er lebendig aufgebissen habe, um ihnen mittels Schlürfens die Eier aus dem Leibe zu entfernen. Das sei eine entsetzlich Tierquälerei, eine wahrhaft teuflische Grausamkeit, eine echt deutsche Barbarei. Geradezu lächerlich seien seine Ausreden. Habe einer der Geschworenen je einen Igel Eier aus lebenden Krötenleibern essen sehn? Natürlich nicht! Noch dummer seien die Vermutungen des Angeklagten, daß es vielleicht die Kaffeekanne gewesen sei, oder seine Tante Henriette, oder gar der geheimnisvolle Dicke. Das alles sei regelrechter Wahnsinn! Wenn aber der Verbrecher sich einbilde, daß der Gerichtshof auf solch albernes Simulieren hereinfalle, auch nur eine Sekunde ihm Glauben schenke, wenn er versuche den Irrenhäusler zu spielen, so irre er sich sehr. Er sei bei ganz gesundem Verstande — soweit das bei einem Deutschen überhaupt möglich sei. Weder Igeln noch Tanten noch Kaffeekannen sei solch eine furchtbare Grausamkeit zuzutrauen — wohl aber ihm, der die Verbrechernatur in ihrer ganzen entsetzlichen Verruchtheit offenbare. Es sei das wahre Musterbeispiel deutscher Kultur!
Und endlich der gräßliche Lustmord an dem dicken alten Herrn — und seinen Töchtern, die er aufgeschnitten und ausgesogen habe. Die Aussage des Beschuldigten, daß er von der Familie am Meeresstrande angefallen und selbst ausgesaugt worden sei, sei wohl das Frechste, was sich jemals ein Angeklagter vor Gericht geleistet habe. Er ausgesaugt? Ja, wo denn? Er stehe doch da in voller blühender Gesundheit! Während die Familie des dicken Herrn und dieser selbst nirgend aufzufinden gewesen sei. Und dazu bestehe die Möglichkeit, daß diese Familie amerikanisch gewesen sei — oder englisch. So lange die Erde sich drehe, sei ein solches Verbrechen noch nicht vorgekommen — es sei einem Deutschen vorbehalten geblieben.
Dazu komme —
Er ließ die Hände sinken, legte das Blatt neben sich auf die Pritsche. Was noch, was noch? — Was sollte er antworten auf solche Beschuldigungen?
Tonlos fragte er den Redakteur: »Wozu bin ich verurteilt?«
Der sah ihn groß an. »Das wissen Sie nicht? — Zum Tode natürlich!«
Er wiederholte: »Zum Tode — natürlich! Zum elektrischen Stuhl!«
Aber der Tewes lachte. »Sie haben Ihr Gedächtnis verloren, Doktor. Keine Spur von elektrischem Stuhl! Sie sind zu derselben Todesart verurteilt, mit der Sie den dicken Herrn umgebracht haben. Erinnern Sie sich, mit welch puritanischer, echt amerikanischer Würde der Vorsitzende es aussprach, daß man zur alten Einfachheit dieses heiligen Landes zurückkehren, den verbrechentriefenden Bindestrichdeutschen hier ein warnendes Beispiel geben müsse?! Zurück von den modernen Sophistereien zu dem alten starren Bibelglauben: Auge um Auge, Zahn um Zahn! Sie werden ausgesogen werden auf elektro-mechanischem Wege, mittels einer zu diesem Zweck eigens konstruierten Schröpfkopfmaschine. Schauen Sie doch die Zeitungen an — überall ist schon die Maschine abgebildet — sie beruht auf dem alten Baunscheidtschen System.«
Er schüttelte unwillig den Kopf. »Unsinn! Der elektrische Stuhl ist die Todesart. So ist das Gesetz des Staates Neuyork!«
Tewes griff die Zeitungen auf, hielt sie ihm unter die Nase. »Lesen Sie, lesen Sie, wenn Sie mir nicht glauben wollen. Man hat das Gesetz umgeändert, hat ein neues geschaffen, eigens für Ihren Fall. Vorgestern ist die Bill durchgegangen in dem Kongreß des Staates, lesen Sie doch!«
Er sah in die Blätter — so war es, wirklich, so war es. Er nickte, seufzte dann, sagte: »Man macht schnell Gesetze in Albany!«
Der Journalist meinte: »Ja, ja — das muß man uns Amerikanern lassen: Gesetze machen können wir.«
— Dann hörte man Stimmen an der Türe und ein Rütteln und Schieben an den Schlössern und Riegeln. »Die Kollegen sinds,« rief Tewes. »Die Photographen und Reporter. Empfangen Sie sie — tun Sie mir den Gefallen. Ihnen kanns ja doch gleichgültig sein, was Sie tun in diesen letzten Stunden!«
Er sagte: »Gleich, gleich! Nur — entschuldigen Sie bitte — ich kann mit den engen Handschellen nicht schreiben. Nehmen Sie die Feder — ich möchte ein paar Zeilen diktieren — an meine Mutter —«
Aber der Redakteur schüttelte den Kopf. »Verlorene Zeit — verlorene Mühe, Doktor — wir werden doch den Brief nie hinüber bekommen. Ich will alle Zeitungsausschnitte über Prozeß und Hinrichtung hübsch sammeln und in ein Album kleben — das kann man ihr später übermitteln. Da hat die alte Dame eine hübsche Erinnerung.« Er sprang auf — plötzlich — lief zur Tür.
»Es sind nicht die Journalisten, Doktor!« rief er. »Es sind — es sind —«
Da faßte ihn die Angst. »Wer ist es? Wer?« fragte er.
Und Tewes antwortete: »Die — die Leute — die Sie holen wollen!«
»Schon?« schrie er. »Schon? Jetzt schon?« Er hörte den Lärm, unterschied auch die einzelnen Stimmen. Etwas war nicht in Ordnung am Schloß, man stieß und trat, als ob man die Türe sprengen wolle, er hörte ein Stöhnen in den Angeln. Noch hielt sie — o noch hielt sie!
Er wollte aufspringen, sich gegen die Tür stemmen, aber er kam nicht hoch. Er wollte schreien — und die Lippen gaben keinen Laut. Er schlotterte durch den ganzen Leib, zitterte jämmerlich, preßte die Hände fest zusammen.
»Heilige Jungfrau,« flüsterte er. »Allersüßeste Jungfrau! Mutter Gottes —«
Etwas betete in ihm:
»Quando corpus morietur, Fac ut animae donetur Tui Nati visio.«
Zu leisem Singen wurde das stammelnde Beten. Aus ihm kam es, aber er hörte, wie es rings im Räume erklang, in ihm und um ihm.
»Post virtutem Nati tui
Ora, ut electi sui
Ad patriam veniant!«
»Zurück,« flüsterte er, »zurück! In das Vaterland, heim — in meiner Mutter Haus. Zu meiner Mutter Maria —«
Da krachte ein heller Beilschlag auf das Schloß. Noch einer und ein dritter. Der Angstschweiß troff ihm von den Schläfen. Er starrte auf die wankende Türe. Riß dann, riß an den Handfesseln, mit unmenschlicher Kraft — die fielen klirrend herab —
Und er griff das Messer, das ihm zur Seite lag.
»Mögen sie kommen!« knirschte er. »Mögen sie kommen! Einer geht mit auf den Weg — einer — und mehr vielleicht!«
Da heulten die Angeln, da krachte die alte Tür, fiel schwer ins Zimmer. Da sprang er auf —
Ein rasches Knipsen — helles Licht überall. Das blendete —
Lotte van Neß stand vor ihm und Ernst Rossius. Hinter ihnen der alte Diener. Der hob still das Tabouret auf, das umgestürzt war, sammelte die Scherben der Teekanne und der Tassen.
Frank Braun ließ die Arme sinken — etwas fiel aus seinen Fingern; Fred nahm es auf vom Teppich, legte es auf das Tischchen. Lottes Messerchen war es.
Sie sah es wohl. Sie streckte die Hand aus, aber griff es nicht. Sie starrte ihn an, mit offenen Lippen, wandte den Blick ab, sah sich um rings im Raume. Und sah, lang ausgestreckt über den Ledersessel hin, die Frau liegen. Über der Armlehne lag ihr Kopf, tief herunter hing der linke Arm. Ihr Kleid war offen über der Brust.
Im Augenblick war Lotte bei ihr, bog sich über die Schlafende. Schrie auf — schrill und gell. Kam zurück zum Diwan, nahm das Messer auf, hob es hoch.
»Ich wußte es!« rief sie. »Ich wußte es.«
Frank Braun griff in den Ärmel seines Kimonos, zog ein Taschentuch heraus, wischte den Schweiß von Hals und Gesicht. »Was, Lotte, was?« fragte er.
Aber sie antwortete nicht. Sie stand wieder bei der Schlafenden, schob ihr das Kleid zurecht. »Heben Sie sie auf!« befahl sie. »Tragen Sie sie hinaus! In mein Auto!«
Rossius richtete die Tänzerin auf, stellte ihre Füße auf den Boden. Zog sie dann hoch, mit des Dieners Hilfe. Die Goyita stand, schwankend, taumelnd — aber sie stand. Schlug die blauen Augen weit auf, murmelte ein paar unverständliche Worte. Drohte umzusinken, schloß wieder die Lider, ließ sich willenlos hinausführen von den beiden.
Lotte van Neß trat auf ihn zu. Ihre Lippen bewegten sich; sie wollte etwas sagen und fand die Worte nicht. Nervös spielten ihre schmalen Finger mit dem Messerchen.
»Du,« flüsterte sie, »du —«
Aber sie kam nicht weiter. Ein heftiges Schluchzen riß ihre Brust, wilde Tränen brachen aus ihren Augen.
Er machte eine Bewegung hin zu ihr. »Was ist es, Lotte?«
Sie schüttelte den Kopf. Drehte sich scharf um, ging hinaus, ohne ein Wort.
Er lauschte. Er hörte ihren Tritt. Hörte von der Straße her Stimmen. Und das Schnaufen des abfahrenden Autos.
Was war denn geschehn?
Dann kam sein Sekretär zurück — lief gleich zu dem heftig schreienden Telephon.
»Ja! Ja!« rief er. »Wir kommen gleich! Sind schon fertig, ja! — In zehn Minuten steht der Doktor auf der Bühne. — Ganz sicher, ja!«
Er hing das Hörrohr ein. Rief dem alten Diener, der eben eintrat, zu, daß er gleich ein Taxicab holen solle. Wandte sich dann an Frank Braun.
»Es ist höchste Zeit, Doktor!« sagte er. »Neun Uhr vorbei! Sie müssen sich anziehn — wie fühlen Sie sich?«
Wie er sich fühlte? — Er machte ein paar Schritte, prüfte seine Muskeln. Herrgott, so wohl, wie seit Monden nicht!
Er entkleidete sich im Augenblick, sprang unter die kalte Dusche, während der junge Rossius den Frack zurecht legte, Hemd, Schleife, Lackschuhe. »Das war eine nette Geschichte,« lachte er. »Frau van Neß wird schön eifersüchtig sein! Eine fremde Dame hier bei Ihnen zu finden — schlafend, mit offenem Kleide dazu. — War sie denn hübsch? Ich hab kaum ihr Gesicht gesehen in all der Aufregung.«
Frank Braun antwortete nicht, rieb sich ab. griff das Hemd. »Warum zum Kuckuck habt ihr die Türe eingeschlagen?« fragte er.
»Warum?« antwortete der Sekretär. »Weil sie verschlossen war! — Warten Sie — da hinten fehlt das Knöpfchen! So hier ist der Kragen! — Über eine halbe Stunde haben wir vor der Türe gestanden, haben gerufen, geschrien, gebrüllt, mit Händen und Füßen gestoßen und getrampelt! Und keine Antwort — nur zuweilen ein Ächzen und Stöhnen und Seufzen. Wir dachten, es sei Ihnen gottweißwas geschehn!«
»Ich habe geschlafen,« sagte Frank Braun. »All die Zeit über, seit Sie fort waren. Geschlafen — und dummes Zeug geträumt. — Wie kam denn Frau van Neß her?«
»Ihr Auto fuhr vor, grade als ich ins Haus trat,« erwiderte Rossius. »Ich dachte, sie käme auch her, Sie abzuholen. — Hier ist die Weste! Und vergessen Sie nicht die Hosenknöpfe zuzumachen — neulich stand einer offen! Das macht sich schlecht beim Reden!«
Er half ihm in den Frack, dann in den Mantel. »Schnell, schnell!« rief er, »das Taxi wartet schon unten!«
Gesteckt voll war der mächtige Saal im Terrace-Garten: sie sangen grade, zweitausendstimmig, das Lied von Prinz Eugen.
»Einlage!« sagte der Vorsitzende, der an der Saaltür ihn empfing. »Zu Ehren unserer österreichischen Kollegen! — Kommen Sie, Doktor, es ist höchste Zeit!«
Er führte ihn an den Honoratiorentisch, vorne unter die Bühne, dicht bei der schmetternden Musik. Frank Braun schüttelte die Hände der Herrn, die da saßen, Ehrengäste spielen mußten in dieser Zeit, Abend für Abend fast, in Frack und weißer Binde. Den Konsuln, den Präsidenten der großen Vereine, den Hapag- und Lloydkapitänen der großen Dampfer.
»Auf Ihr Wohl, meine Herrn!« rief er, leerte ein großes Glas Gespritzten.
So jung fühlte er sich, so leicht und froh. Und er sang mit ihnen schallend hinaus in den weiten Saal:
»Prinz Eugenius, wohl auf der Rechten,
Tat als wie ein Löwe fechten,
Als General und Feldmarschall.
Prinz Ludewig ritt auf und nieder:
›Halt euch brav, ihr deutschen Brüder,
Greift den Feind nur herzhaft an!‹«
Die letzten Töne verklangen, der Vorsitzende erhob sich, ihn zu begrüßen. Ja so, nun mußte er gleich reden. Er besann sich, legte sich die ersten Sätze zurecht.
»Bitte, Kapitän,« wandte er sich an seinen Nachbar, »reichen Sie mir mal Ihr Programm. Ich muß doch wissen, worüber ich reden soll.«
»Ja, eigentlich schon!« schmunzelte der Kapitän, nahm den Zettel auf. »Da stehts: ›Wir und das Vaterland.‹«
Ja gewiß, das war es. Der Verein hatte das Thema ausgesucht, ihn besonders darum gebeten. Er hatte sich auch vorbereitet, gestern erst, wenigstens eine halbe Stunde lang. Aber er hatte den Faden gründlich vergessen, wußte nichts mehr, als nur die Worte, mit denen er schließen wollte — ein paar Verse von Grabbe.
›Da muß ich hin,‹ dachte er. ›Irgendwie muß ich dahin kommen.‹ O, es würde schon gehn.
Er stieg auf die Bühne, er nickte, dankte nach allen Seiten für das Klatschen. Er begann.
Froh war ihm und leicht. Und zum ersten Male freute er sich, daß er da stand vor Tausenden, und daß er sprach.
Er redete sehr rasch heute, viel schneller als gewöhnlich. Zu hastig fast, ohne Pausen, Satz schlagend an Satz. Aber auch einfacher, ohne Phrasen, sehr leicht und natürlich. Und doch fühlte er gut, wie die Menschen mit ihm gingen, wie sie jedes Wort gierig eintranken.
Sonst rang er mit dem Tiere da unten, dem vielköpfigen. Bändigte es, zwang es unter seinen Willen. Hielt es mit allen Nerven in seinem Bann.
Heute war es ein anderes. Er kämpfte nicht. Er wartete keine Wirkungen ab, verzichtete, ohne es doch zu wollen, auf alle Rednerkniffe. Ließ jede Kunst beiseite, überlegte nichts.
Heut war es, als ob das, was er sprach, nicht aus ihm komme. Als ob er nur der Mund sei, nur die eine Stimme der tausend Menschen. O ja, das war es: er war die Stimme ihrer Seele. Das machte: heute glaubte er an das, was er sprach.
Glaubte an die Heimat, glaubte an seiner Mutter Haus, glaubte an das Vaterland. Glaubte fest daran, daß sie alle — er und die da unten, Brüder seien und Schwestern — eines Blutes alle — deutschen Blutes —
Und er hob, zum ersten Male in seiner Rede, hoch seine Stimme, als er die Schlußworte sprach, zitternd in heißgläubiger Begeisterung. Als er seines deutschen Volkes Seele schallend hinaus jauchzte in den Saal:
»O, kein Donner an dem Himmel und kein Laut auf Erden, quoll er von schönster, süßester Lippe, gleicht an Macht dem Worte: Vaterland!«
Das glaubte er in diesem Augenblicke. Glaubte es innig und stark. Hob noch einmal seine Stimme, jubelte: »Vaterland!« — Und ein drittes Mal: »Vaterland!«
Und die Frauen und Männer da unten glaubten wie er, fühlten wie er. Standen auf — schrien, jauchzten das heilige Wort: »Vaterland!«
Rasch ging er ab in die Kulissen, wo Rossius wartete mit seinem Mantel. Fort nun, rasch weg. Sie gingen durch den Hinterausgang auf die Straße.
»Wo wollen Sie hin, Doktor?« fragte der Sekretär.
Er überlegte. »Wir könnten nachtmahlen — vielleicht bei —«
Aber er unterbrach sich. »Nein — nein. Ich habe noch etwas vor. — Auf morgen also!« Er reichte dem andern die Hand, ging langsam über die Straße zum Droschkenstand.
Stieg ein. »Parkavenue, Ecke dreiundfünfzigste Straße!« rief er dem Chauffeur zu.
Das war Lotte Lewis Haus. — Er mußte sie sehn in dieser Nacht.
Er wartete in der Bibliothek. Ging auf und nieder mit langen Schritten.
Endlich kam sie, grüßte leichthin, winkte ihm, Platz zu nehmen.
»Nun?« fragte er.
»Nun?« sagte sie. »Was — nun? Soll ich dir Erklärungen geben?«
Er trommelte mit den Fingern auf dem Tisch. »Wie du willst, Lotte. Jedenfalls gibt es da nichts, das ich vor dir verhehlen möchte. Willst du mir sagen, wie du so plötzlich ankamst.«
Sie lachte auf. »Das könntest du dir leicht selbst beantworten. Ich erwartete dich um sechs, und du kamst nicht. Ich wußte, daß du krank warst — so klingelte ich an gegen sieben. Über dreiviertel Stunden habe ich mit dem Hörrohr gesessen — das Telephonfräulein hat für mich getan, was es konnte. Du hattest das Telephon abgestellt.«
»Nein,« sagte er, »es war nicht abgestellt. Ich schlief, ich habe nichts gehört.«
»Dann mußt du sehr fest geschlafen haben, mein Freund!« rief sie. »Ununterbrochen hat es geschellt bei dir. Übrigens hast du mir heute mittag dasselbe gesagt.«
Er nickte. »Ja, Lotte, das weiß ich. Ich log — heute mittag. Ich lag da und war sehr müde. Und das Schellen quälte mich —. Als ich mit dir sprach, hatte ich nur ein Gefühl: so schnell wie möglich fertig zu sein. So sagte ich nur: ja und nein — wollte keine Fragen haben und keine langen Antworten geben. Da log ich — das kürzte das Gespräch ab.«
»Und jetzt?« fragte sie.
»Jetzt ist's die Wahrheit,« erwiderte er. »Ich habe nichts gehört. Ich schlief.«
Sie seufzte leicht. »Mag sein — ich glaube schon, daß es so war. Also du antwortetest nicht — da wurde ich unruhig. Wartete wieder — rief wieder an. Endlich bestellte ich mein Auto — fuhr zu dir. Vor der Tür fand ich deinen Sekretär — er half die Zimmertür aufbrechen — die du verschlossen hattest. Den Rest weißt du.«
»Wo ist das Mädchen?« fragte er.
Sie hob die Hand. »Hinten liegt sie, im Fremdenzimmer. Meine Zofe wacht bei ihr — sie schläft immer noch. Eben ging der Arzt fort — er sagt, sie müsse ein sehr starkes Rauschgift genommen haben — aber er wisse nicht, was.«
Er nickte. »Ja, ja, Mescal nahm sie. Zwei große Tassen voll — grade wie ich.« — Er erzählte ihr, daß es die spanische Tänzerin sei, von der er ihr gesprochen habe. Die von dem Fieberschiff, die er in Torreon wiedergetroffen habe, bei Pancho Villa. Erzählte ihr die kleine Episode, wie er vergebens versucht habe, Mescalknöpfe zu bekommen, wie die Goyita versprochen habe, ihm welche zu besorgen. Heute mittag sei sie gekommen — ganz unerwartet — eben als er das Telephongespräch beendet habe. Sie habe ihm die Kaktusfrüchte mitgebracht — er habe geglaubt, daß ihm die vielleicht helfen würden. — Übrigens habe er sich darin nicht geirrt: er fühle sich so gesund wie selten.
Lotte van Neß lachte laut. »So prachtvoll gesund!« rief sie. »Das glaube ich. Darum also kochtest du das Zeug und trankst es. Und gabst der Señorita gleich mit davon — vermutlich war sie neugierig, es zu kosten, was?«
»Es ist wirklich so,« antwortete er, »genau so. Sie hatte so viel reden hören vom Mescalrausch da unten in Mexiko, wollte es versuchen. Und, weiß Gott, Lotte — sie hatte mehr Vertrauen zu mir als du.«
Sie spottete: »O, ein felsenfestes Vertrauen! Das du völlig rechtfertigtest! — Ich weiß, ich weiß!«
Er wurde ärgerlich, stand auf, machte ein paar Schritte. »Ich gebe dir mein Wort, Lotte, ich habe sie nicht berührt.«
»Du lügst!« rief sie rasch.
Er blieb vor ihr stehn, wiederholte ernst: »Lotte, ich habe sie nicht angerührt.«
»Dann öffnete sie selbst ihr Kleid!«, höhnte sie.
»Ja!« erwiderte er. »Ehe wir einschliefen — auf dem Diwan ich, sie auf dem Sessel — sagte ich ihr, daß sie Hals und Brust frei machen solle, um leichter atmen zu können. Sie tat es. Ob du es nun glaubst oder nicht: ich bin nicht aufgestanden von meinem Diwan, habe sie nicht angerührt all die Zeit über. Nicht einmal die Hand gab ich ihr, als sie eintrat.«
Aber Lotte schüttelte den Kopf. »Und doch lügst du!« Sie trat an den Tisch, suchte herum, nahm das kleine Messerchen, reichte es ihm. Er öffnete es — die Klinge zeigte dicke, dunkle Flecke.
»Schmutzig ists,« sagte er. »Was solls?«
»Blutflecke!« sprach sie. »Siehst du nun, wie du lügst!'
Er sog die Luft ein, hielt mühsam an sich.
»Der Teufel hole deinen albernen Zauberfaxen!« rief er, warf im Bogen das Messer in das Kaminfeuer. »Heute belügt dich das Ding zum zweitenmal! Ich will dir was sagen, Lotte, auf dem Nachtfest der Monddamen betrog ich dich. Nahm die Breitauer. Oder: sie nahm mich — wie du willst! Einerlei: dein Messerchen blieb blitzblank — da schworst du auf meine Unschuld. Und doch, so wahr ich vor dir stehe, nahm ich sie.«
»Was gehts mich an!« rief sie. Wegwerfend, gleichgültig.
Aber er hörte nicht hin. »Und genau umgekehrt ists heute,« fuhr er fort. »Diesmal bin ich wirklich unschuldig — aber dein Messerchen ist blutbefleckt. Da bist du eifersüchtig.«
Sie nahm es auf. »Eifersüchtig?! Weißt du denn, was das ist, du? Ich weiß es — du hast michs gelehrt durch fünfzehn lange Jahre. Wenn man nicht schläft — im Bette sitzt — eine Nacht — noch eine Nacht — viele Nächte. Immer nur — immer nur denkt — an —«
Sie setzte sich, grub den Kopf in die Hände, stöhnte. Hob sich wieder mit einem Ruck, warf den Kopf zurück. »Eifersüchtig? O ja — auf alles, was du tust! Aber nicht mehr auf irgendeine Frau in der Welt als auf das Glas, das du an die Lippen führst, das Hemd, das du anziehst — das Bad, in das du steigst! Und nur eines gibts, eines nur — von dem ich will, daß es mein sei — eins nur!« Sie krampfte die Finger in die weiche Lehne, bog den Rumpf weit vor. Sagte: »Du nahmst — von einer andern — heute — was du nur nehmen solltest — von mir.«
Er stand vor ihr, senkte die Stimme. »Sieh, Lotte,« begann er, »warum sollte ich lügen? Ich sagte dir von der andern, das willst du nicht glauben. Die Spanierin nahm ich — nicht.«
Sie fuhr empor. »Wer spricht davon?« rief sie. »Daß du sie nicht nahmst, glaub mir — das weiß ich besser als du selbst!«
Er begriff nicht. »Wieso?« fragte er.
Sie zog die Lippen hinab, zuckte verächtlich die Achseln. »Es war eine Laune — ich ließ sie untersuchen von meinem Arzt. Seine Feststellung ist: Virgo intacta!«
Er starrte sie an, völlig verständnislos. »Ja — aber, Lotte — was denn noch? Was log ich dir dann? Und was — willst du noch?«
Sie strich mit der Hand über die Stirne. »Ob du sie nahmst — oder nicht — was liegt daran? Ob du jede nimmst — die dir über den Weg läuft — was machts mir aus? Schweig, schweig — du hast es getan — tust es heute noch. Tus nur, tus — es schmerzt mich, wenn ichs höre, o ja — immer noch. Aber du hast mich gewöhnt an solchen Schmerz, du! Das geht vorüber; ich küsse dich lachend, und du merkst nicht einmal, wie weh mir ist: so hast du mich gemacht. Dies aber — dies ist ein anderes!«
»Was denn, Lotte?« bat er.
Bitter genug klang es. »Zwei gute Augen hast du — die so klar sehn — und doch bist du blind. Das Messerchen da, das im Feuer glüht — das log nicht, das nicht! Das sprach die Wahrheit — erzählte mir alles, was du getan.«
Sie erhob sich schnell, trat dicht zu ihm hin. »Schau,« begann sie wieder, »ich will dir sagen, was es ist. Das Höchste, was ein Weib tun kann für den Mann, den sie liebt, eine Mutter für ihr einzig Kind, ein Heiland für die leidende Menschheit — das lehrtest du mich tun — das Allerherrlichste, das ewig Göttliche! — Und nun gehst du her — und nimmst das von irgendeiner — der ersten Besten grade, die deinen Weg kreuzt. Von einer dazu, die nicht einmal weiß, was geschah! Und die — wenn sie es wüßte — dich anspein würde! Das ist es.«
Er hörte jedes Wort — und verstand nichts. »Sag es noch einmal, Lotte,« bat er. »Etwas deutlicher —«
Aber sie schüttelte müde den Kopf. »Nein, nein, es nutzt nichts. Du wirst es doch nicht begreifen. Ein andermal vielleicht.«
Er nahm ihre Hand, streichelte sie. »Versuch es doch! Grade heute. Sonst bin ich müde oft, abgespannt, schwach — wie ausgeleert Hirn und Adern. Aber heute bin ich so klar und frisch — fühl mich stark und gesund.«
Da riß sie sich los, trat rasch zurück. Ein Ächzen faßte ihre Brust, ein Keuchen und Stocken. »Stark?« rief sie. »Gesund? — Wovon?!«
Er sagte: »Ich denke, der Absud hat mir geholfen. Der Mescal, mein ich.«
Wild klang ihr Schluchzen, hysterisch und gell. »Der Mescal?!« schrie sie. »Blut — Blut!«
Sie schritt an ihm vorbei, dicke Tränen fielen über die bleichen Wangen. Aber ihr Mund lachte, lachte: »Du Narr, du Narr — du dreimal blinder Narr!«
Sie ließ ihn stehn, verschwand in der Tür.

Sie wußte gut, was sie tat, die kleine Ivy Jefferson, legte ihr Netzchen klug genug. Sie erfuhr bald, daß eine spanische Tänzerin bei ihm gewesen sei und daß die van Neß ihn mit der erwischt habe. Sie wußte längst, was er auf dem Feste der Monddamen getrieben hatte und daß er nun in Aimée Breitauers berühmtem Buche stand. Irgend etwas mußte er auch mit der Farstin gehabt haben — das hatte ihr Direktor André gesteckt.
Sie hatte versucht, ihn ziehn zu lassen — hatte das brav durchgeführt ein paar Wochen lang — aber dann hatte sie doch wieder angerufen, als sie keinen fand, der ihr besser gefiel. »Thrill« brauchte sie, wie ihre Mutter, wie alle die Frauen ihrer Gesellschaft, und etwas war in diesem Deutschen, das ihre Nasenflügel beben machte.
Liebe? O je — eine Laune wars. Sie wollte eben — und war gewohnt, ihren Willen zu haben, seit sie denken konnte. So einfach war diese Logik: sie war erwachsen, war in der Gesellschaft, hatte ihren ›Beau‹ nun seit anderthalb Jahren. Jetzt würde sie heiraten. Ihn natürlich. Der ihr mehr sagte als die andern. Den sie dazu andern Frauen nicht gönnen mochte. Vielleicht fand sie, was sie suchte — o sie wußte nicht, was. Vielleicht fand sies — um so besser dann. Und sonst — ließ man sich scheiden — nichts war einfacher. Sie konnte jeden Tag haben, wen sie wollte, sie, Howard J. Jeffersons einziges Kind.
Er sah es gut. Vermied es, wo es nur anging, allein mit ihr zu sein. Wich ihr stets aus, wurde sehr erfinderisch in Ausreden und Entschuldigungen.
»Du bist der schlecht erzogenste Beau in Neuyork!« sagte sie.
»Such dir einen andern!« lachte er.
Sie pfiff — sie konnte prächtig pfeifen, wie ein Gassenbub. Daß er ihr den Willen nicht tat, nie und nimmer, das war eines, das sie reizte. Vieles noch. Manches, das sie wußte — manches auch, das sie nicht wußte. Aber sie würde es schon erfahren — das würde sie.
Noch einen Grund hatte er, jedes Alleinsein mit ihr zu vermeiden. Keinen Grund eigentlich, ein Empfinden nur — einen ängstlichen Instinkt. Etwas war geschehn an dem Nachmittag, als die Goyita ihn besuchte. Er fürchtete sich, ohne sich dessen recht bewußt zu sein, in einem Raume allein zu sein mit einer Frau — welche immer es war. Ausreiten ja — im Auto fahren ja — zum Luncheon irgendwo oder ins Theater. Da waren Leute rings herum — da war er sicher. Aber schon im Garten allein zu wandeln mit der blonden Ivy war ihm unbehaglich. Eine unbestimmte Angst, daß etwas geschehn könne — eine Furcht vor ihr — vor sich selbst — er wußte es nicht.
Sie merkte es wohl. Und ihr Spiel war, jede Gelegenheit zu greifen, wo immer sie ihn für sich haben konnte. Ihre Mutter half ihr, verschwand stets, wenn es nur eben ging, ließ sie allein — dafür half ihr Ivy mit ihrem Beau, dem Generalkonsul. Eine Zeitlang versuchte sie es, sich möglichst bloßzustellen mit ihm. Sie küßte ihn, wenn eben die Mutter hereintrat oder wenn einer kam von der Dienerschaft. Dann auch vor Fremden. Aber er tat, als ob es eine Kinderei sei, das törichte Getue eines Spielkätzchens. Einmal wurde die Mutter deutlich genug. »Wenn einer so oft ins Haus kommt wie Sie,« sagte sie, »und stets mit der Tochter zusammensteckt, dann erwartet man, daß er um ihre Hand fragt.«
Er sah sie an, lachte dann zu Ivy hinüber. »So?« machte er. Und kein Wort mehr.
»Ja!« unterstrich Frau Alice. »Allerdings. Das ist so Sitte bei uns.«
»Bei mir nicht,« erwiderte er.
»Sie verlangen wohl, daß wir Sie bitten sollen?« rief sie. Ihre Entrüstung war ehrlich und nicht gemacht; sie stand beleidigt auf vom Frühstückstisch.
»Ganz und gar nicht!« rief er ihr nach. Ivy nahm sich kaum die Mühe zu warten, bis die Mutter zur Tür hinaus war. »Und was würdest du antworten?« fragte sie. »Willst du mich zur Frau?«
Er tat, als ob es nur ein Scherz sei. »Nein!« sagte er. »Du taugst so wenig dazu, wie ich mich zum Ehemann eigne.« Er stand rasch auf. »Mach dich fertig, Ivy, das Auto wartet, wir wollten doch ausfahren heute nachmittag.«
Sie ließ ihn nicht aus diesmal. »Aber zu Mätresse möchtest du mich?« begann sie wieder.
»Nein,« lachte er, »auch nicht.« Er versuchte, es ins Lächerliche zu ziehn. »Was würden deine Eltern dazu sagen?! Komm nun, laß doch die Dummheiten.«
Sie blieb ruhig sitzen, wiegte ihr Köpfchen hin und her. Das war ihr Lieblingswort: ›Mätresse‹. Immerfort kokettierte sie damit, sprach nie anders von Frau van Neß als von ›seiner Mätresse‹. Sagte: ›Ich hab heute deine Mätresse gesehn — auf der fünften Avenue.‹ Oder, wenn er kam: ›Kommst du von deiner Mätresse?‹ Wenn er ging: ›Grüß deine Mätresse!‹
»Sie hält dich fest, deine Mätresse,« überlegte sie. »Sie will dich nicht loslassen, das ists. Du darfst nicht tun, was du willst, mußt tanzen, wie sie die Fäden zieht — ihr Püppchen bist du.«
»Dummes Geschwätz!« rief er.
Sie hob sich langsam, trat zu ihm hin. »Ich weiß, was ich sage,« beharrte sie. »Ich habe mirs gut ausgedacht. Alles, was du tust — deine ganze Arbeit — tust du nur, weil sie es so will. Und sie will es nur — damit du immer etwas zu schaffen hast — nie mehr dein eigener Herr bist, keine Zeit mehr hast, für dich zu denken und an dich. Sieh, ich mag schon keine Zeitungen mehr in die Hand nehmen — überall dieses gräßliche Geschrei für das Sternenbanner. Und wie sie für Amerika plärren — so schreist du für Deutschland, just so. Merkst gar nicht, daß es genau so dumm ist? Ich pfeif auf das Vaterland! Zehnmal lieber als irgendwo in den Staaten wäre ich in Paris oder London — vermutlich auch in Berlin oder Wien, wenn ich die Städte kennen würde. Für die Massen ist das Vaterland und all die andern Phrasen — nicht für uns.«
Sie sagte: »Für uns? — Das Leben!«
Noch immer mochte er sie nicht ernst nehmen. »Sag doch mal, Ivy,« fragte er wieder. »Woher hast du all die Weisheit?«
»Gelesen,« antwortete sie ruhig. »In einem Buch, das wir im College hatten. Vergessen — dann ists mir wieder eingefallen. Und ich hab drüber nachgedacht. Unten und oben — an den Grenzen — braucht man all das Zeug nicht: das Gerede von Vaterland und Moral und Staat und was es ist. Der Hobo, der Landstreicher, der Bettler weiß nichts davon. Der steht drunter — wir stehen drüber, wir!«
»Ihr?« rief er. »Wer seid denn: ihr?«
Aber sie hatte ihre Antwort: »Wir — sind die, die das Geld haben. Nicht alle — nein, nur die davon, die zugleich wissen, daß das alle Macht bedeutet. Und daß Macht zugleich Recht und Vaterland und Religion und Moral ist. In dem Buch — es war so ein Leitfaden durch die Philosophie über Plato und Aristoteles und Kant und Spencer und Buckle und wie sie alle heißen — stand auch ein Satz von Speinosä —«
»Spinoza!« rief er, »sprichs wenigstens richtig aus!
»Es ist mir völlig gleichgültig, wie er heißt!« sagte sie. »Der Satz hieß: ›Jeder hat soviel Recht, als er Macht hat!‹ Und der Mann mußte Linsen schleifen, hatte kein Geld und also keine Macht und darum gar kein Recht. Deshalb wurde er verbrannt!«
Frank Braun lachte: »Na — verbrannt wurde er nicht gerade. Sag mal, wie dick war denn eigentlich euer Lehrbuch der Philosophie?«
Sie zeigte: »So dick! — Über zweihundert Seiten! Du kannst drauf wetten, daß keine von uns es ganz gelesen hat!«
Er nickte: »Natürlich nicht!«
»Lach nur,« fuhr sie fort, »es bleibt drum doch recht, was ich sage. Wir — können tun, was wir wollen. Jedermann in Neuyork weiß, daß die van Neß deine Mätresse ist, und doch werden alle Türen ihr aufstehn. Und die Pierpont, die Fox, die Gordon, die Breitauer und all die andern — was? Ganz Amerika trieft von Moral — und sie feiern lustig ihre Feste. Sie dürfen es, weil sie drüber stehn mit ihrem Geld. So ists überall! Ma's Freund, der Generalkonsul, hat mir gesagt, daß die englischen, russischen, belgischen, rumänischen Herrscherfamilien alles Deutsche sind, Männer wie Frauen! Hohenzollern, Koburger, Holsteiner, Wittelsbacher, Hessen — er hat mirs aufschreiben müssen, und ich habs hübsch auswendig gelernt für dich. Die speien auf ihr deutsches Blut, auf das deutsche Vaterland! Und doch, wenn der Krieg aus ist, werden sie in Deutschland selbst genau so geehrt werden wie vor dem Kriege und wie überall sonst in der Welt. Sie können sichs eben leisten: haben Geld und Macht und Namen und Einfluß — da darf man tun, was man will.«
»Meinetwegen,« rief er, »aber wie paßts auf mich? Ich heiße weder Gould noch Rockefeller noch Koburg und Hohenzollern, hab kein Geld und keine Macht. Also kann ichs mir nicht leisten und muß mit der Masse gehn, nicht?«
»Nein,« sagte sie heftig, »nein! Es ist nicht das Geld allein — es gibt auch noch andere Menschen, die da stehn, wo wir sind. Nur, weil sie sich eben selbst dahin gestellt haben, darum nur! Das ist nicht leicht, glaub ich, und es ist gefährlich — jeden Augenblick können sie herabstürzen — was uns ja auch geschehn mag — wenn auch nicht ganz so leicht. Ich bilde mir ein, du gehörst dazu!«
So etwas hatte er auch einmal geträumt. Von einer Kulturnation — die über den Völkern stand. Freilich, mit Geld hatte das nichts zu schaffen, war sehr europäisch gedacht und gar nicht amerikanisch. Aber wars nicht im Grunde doch dasselbe? Kams nicht bei ihm — wie bei ihr — nur auf das eigene Hinausheben an? — Denn drüber stand der Pittsburger nicht, trotz seiner paar tausend Millionen, Herr Andrew Carnegie, den die böse Höllenangst plagte und der dem lieben Gott so gerne ein kleinstes Himmelsplätzchen abhandeln wollte, darum »gute Werke« tat und Millionen stiftete. So wenig, wie der bürgerliche Professor, ob er gleich »Speinosä« nicht nur richtig aussprach, sondern auch auswendig kannte, und alle die andern dazu.
Bildung oder Begabung, Geld, Geburt, Einfluß, Namen — irgend etwas nur. Aber der Wille mußte dabei sein und das Bewußtsein: über der Masse zu stehn, ihre Rechte brechen zu dürfen. Das Gefühl der Macht — einerlei, was diese Macht gab.
Sie hatte schon recht: er lief nun mit der Masse. Dachte, tat, genau das, was sie alle taten, drüben wie hüben. Und Lotte van Neß war es, die ihn eingespannt hatte ins Geschirr — auch das war wahr.
Sie unterbrach sein Schweigen nicht, wartete lauernd.
»Ich weiß nicht —« murmelte er.
Da fragte sie: »Sags doch — würdest du das alles tun und getan haben — aus dir heraus?«
Er wiederholte: »Ich weiß nicht. Vielleicht. Wenn sies nicht gewesen wäre, würde mich vermutlich ein andrer eingespannt haben. Und ich würde am Karren ziehn, grade wie jetzt.''
Sie schüttelte den Kopf. »Nein — du wärest längst ausgebrochen! Und es ist sehr klug, wie sie es macht, dich zu halten. Wenn sie dich geheiratet hätte — wärst du längst fort von ihr. So ist sie nur deine Mätresse — läßt dir alle Freiheit. Das wenigstens bildest du dir ein. In Wahrheit aber tust du nur, was sie will und nichts sonst. Selbst zu mir kommst du nur, weil sie dich schickt.«
»Mich schickt?« lachte er. »Sie hats nie getan.«
»Nie?« forschte Ivy. »Wirklich nie?«
Er dachte nach — freilich, das erstemal war es Lotte gewesen, die mit dem Tewes darauf bestanden hatte, daß er Besuch machte bei den Jeffersons. ›Gib der Kleinen die ersten Küsse!‹ hatte sie gesagt — war es nicht so?
»Einmal, ganz im Anfang!« sagte er zögernd. »Aber später hat sie kaum je deinen Namen erwähnt!«
Ivy Jefferson nickte: »O gewiß nicht — sie hat Instinkt, deine Mätresse, kennt dich ja auch lange genug. Immer muß es so aussehn, als ob du tun und lassen könntest, was dir nur beliebte. Nie darfst du merken, daß du nur tust, was sie will!« Sie nahm eine weiße Nelke vom Tisch, brach den Stengel ab, steckte die Blume ihm an. »Der neue Butler ist so unaufmerksam, vergißt stets Knopflochblumen zurecht zu machen. Der alte war viel besser. — Schade! Ich habe ihn wegschicken müssen.«
»Du?« lachte er. »Weshalb denn?«
»O, es war der beste Butler, den wir je hatten — vielleicht wirst du ihn bald wiedersehn —«
»So?« fragte er. »Wo denn?«
»In Frau van Neß' Haus,« sagte sie. »Ich habe ihn entlassen müssen, ihn und den zweiten Chauffeur — weil sie beide im Dienste deiner Mätresse standen. Sie berichteten ihr haarklein alles, was hier im Hause geschah.«
»Das ist nicht wahr!« fuhr er auf.
Sie lächelte. »Doch!« sagte sie ruhig. »Ich habe drei Telephongespräche überhört. Nun begreifst du wohl, warum sie nicht nötig hatte, dich zu fragen nach Ivy Jefferson?«
Er gab keine Antwort.
»Sie hatte sehr recht, deine Mätresse,« fuhr sie fort, »sie ist klug, man kann viel von ihr lernen. Ich hab noch mehr gelernt, du! Meinst du, ich wüßte nicht, warum du in diesem Hause bist?«
»Weil du mir gefällst,« erwiderte er schnell. »Weils eine Erholung ist für mich, mit dir herumzuspielen.«
»Vielleicht,« sagte sie, »ein bißchen! Aber das ist nicht der Grund — das ist nur etwas, das dir die Arbeit hier leichter macht. Glaub du nur nicht, daß mein Vater so dumm ist, wie ihr — du und meine Mutter — es euch einbildet. Er ließ mich gestern nach Wallstreet kommen in sein Büro — das tut er immer, wenn er ganz ernst mit mir reden will. Er sprach lange mit mir — glaub mir — er durchschaut dein Spiel ganz genau. Er weiß, daß du mir nur den Hof machst, meinen Beau spielst — und schlecht genug dazu! — weil du denkst, durch mich Einfluß zu haben auf Papa. Weil du annimmst — mit Recht vielleicht — daß er nichts tut, was ich nicht wünschen möchte. Darum! — Ists so? Leugne doch!«
Er kniff die Lippen zurück. »Es ist so,« sagte er.
»Ein: Aber?« lächelte sie.
Er schüttelte den Kopf: »Kein Aber!«
»Setz dich,« sagte sie. »Ich bin noch nicht zu Ende. Mein Vater hatte fünf Millionen, als er Teilhaber wurde in der Bank. Heute ist er allein der Herr und hat zwanzigmal so viel. Und — was mehr wert ist — sein Trust kontrolliert den ganzen Mittelwesten. Denk nicht, daß das alles nur Glück sei, und daß kein Verstand dazu gehöre. Die Leute da in Wallstreet erscheinen euch dumm — weil sie ungebildet sind. Und die Bessern von ihnen fühlen das gut, fühlen sich verängstigt, sind scheu, wenn sie mit euch zusammen sind, weil sie kein kleinstes Wörtchen mitreden können über Kunst und Musik, über Nationalökonomie, Philosophie und tausend andere Dinge. Aber ihr unterschätzt sie — und du auch! Sie wissen schon, was sie wollen!«
»Was wollen sie?« rief er.
Sie zog die Lippen hoch: »O — im allgemeinen: Geld verdienen. Und diesmal, im besondern, die neue englische Kriegsanleihe durchsetzen. Deshalb rief mich mein Vater nach Wallstreet.«
Er gab sich Mühe, sehr ruhig zu bleiben. Streckte ihr die Hand hin, sagte: »Leb wohl dann, kleine Ivy. Viel Glück wünsche ich dir und einen besseren Beau. Du begreifst wohl, daß ich keinen Schritt mehr in euer Haus setzen werde, wenn die Firma Jefferson die Anleihe zeichnet.«
Sie nahm die Hand nicht. »Morgen früh ist die Versammlung im Morganhause. Wenn mein Vater zeichnet, so wird es sein ganzer Trust tun — bis zum Mittag sind die tausend Millionen da, die London wünscht. Wenn ers nicht tut, wird es Monate dauern, bis die Anleihe mühsam abgesetzt ist — und ihr Kurs wird sehr herabgehn. Es ist ein recht gutes Geschäft für das Haus Jefferson — und mein Vater will zeichnen. Er wird es nicht tun, wenn —«
»Wenn?« wiederholte er.
Sie zupfte die Blätter von einer Nelke, knipste sie mit leichtem Finger von ihrem Kleide. »Die Deutschen sind gescheit,« sagte sie, »wie deine Mätresse. Sie haben wohl gewußt, warum sie dich in dies Haus sandten. Sie dachten: der ist der Köder — und die kleine Ivy beißt an. Sie haben sehr richtig gerechnet. Der Jeffersontrust ist der einzige rein amerikanische, der nicht mitmacht — für England — noch nicht! Da hast du mehr erreicht, als mit all deinem Reden und Schreiben. Aber nun sollt ihr Deutschen auch den Preis zahlen.«
»Das ist —« zischte er.
Sie nickte, lächelte. »Geschäft!« rief sie. »Nenns Erpressung — wie du willst. Aber warte noch, ehe du antwortest. Du hast die Blätter gelesen, du weißt, daß General Villa vor drei Tagen in Texas eingefallen ist, die Stadt Columbus verbrannt hat! Du warst unten bei ihm in Mexiko — du und andere: ihr Deutschen habts angestiftet!«
»Nein! Nein!« rief er. »Kein Deutscher hat seine Hand dabei im Spiele!«
»Darauf kommts nicht an!« erwiderte sie. »Wahr oder nicht — hier glauben sie, daß es so ist. Glaubst du, ich schelte dich darum? Ich gönns diesem Schreipack, wenn sie selbst mal ein bißchen merken würden, was Krieg ist; ich wünschte nur, daß der Villa zehnmal so stark wäre als er ist. Und wenn dus angestiftet hast — so find ichs sehr nett von dir! Aber davon will ich nicht reden. Ich weiß, mit wem du zusammengesteckt hast in Torreon — Oberst Pearlstone heißt er, Villas Adjutant, ein Neuyorker Jude.«
»Woher hast du das?« fragte er tonlos.
Sie wiegte den Kopf. »Mein Vater hat mirs gestern gesagt. Der hats aus Washington — von der japanischen Botschaft. Begreifst du nun?«
»Ah —« machte er.
Sie lachte: »Du sitzt morgen in den Tombs, wenn ich will! Und dann in Atlanta — zwanzig Jahre und mehr. Ich meine nur: es wäre doch möglich?«
»O ja!« nickte er. »Durchaus. Alles ist möglich in diesem Lande und zu dieser Zeit!«
Sie wartete einen kleinen Augenblick. Sagte dann: »Nicht? Ich denke, das ist das einzig Nette bei uns in Amerika. So ists möglich — und anders auch.«
»Wie anders?« fragte er. »Hast du noch mehr Überraschungen?«
»Nein,« sagte sie, »genug für heute. Ich meine nur, anders wäre es auch möglich. Daß du morgen deinen Namen nicht einzeichnest in das Empfangsbuch der Tombs — so wenig wie mein Vater den seinen in die Liste der englischen Anleihe. Ganz wie du magst! Willst du den Preis zahlen?«
Er verstand sie gut. Fragte dennoch: »Was meinst du, Ivy? Was ist dein Preis?«
Sie lachte wieder. »Du natürlich! Willst du dich mit mir verloben heute abend?« Sie stand auf, trat hin zu ihm. »Überleg dirs — aber nicht allzu lange. Ich spiele anders als deine kluge Mätresse. Ganz offen lege ich meine Karten hin — doch sinds schöne Trümpfe, was?«
Prächtige Trumpfkarten — das mußte er zugeben! Und er hatte nichts in der Hand —
Er suchte Zeit zu gewinnen. »Ich will darüber nachdenken,« begann er. »Werde dir morgen Antwort geben.«
Aber sie schüttelte langsam den Kopf. »Morgen? O nein! Willst wohl mit deiner Mätresse drüber sprechen?«
Er fand nichts andres; sagte: »Ja, das möchte ich.«
Viel Hohn klang aus ihrer hellen Stimme. Aber nicht beißend, gutmütig fast. »Freilich — wir müssen ihre Erlaubnis einholen. Aber das können wir schnell haben: sie soll herkommen!« Sie wandte sich, lief mit raschen Sprüngen durch den Raum.
Er folgte ihr. »Was willst du tun?« rief er. Sie stand schon am Telephon: »Plaza 376!« rief sie.
Er hörte, wie sie mit einem Diener sprach, dann mit Lottes Zofe. Wie sie Frau van Neß verlangte. Er wollte ihr das Hörrohr aus der Hand nehmen, wollte sagen, daß er —
Dann dachte er: ›Vielleicht ists gut, daß sie kommt, vielleicht findet sie einen Ausweg.‹
»Ist da Frau van Neß?« sagte die Kleine. »Hier ist Ivy Jefferson. — O bitte, verzeihen Sie die Störung. — Er ist hier — ja! — Ihr — Ihr Gelie —«
Sie sagte es doch nicht. »Ihr Freund ist hier — Herr Frank Braun. — Ja! — Er läßt Sie bitten, sofort hierher zu fahren. — Nein — ich kann es nicht am Telephon sagen! — Nein, nein, er kann nicht selber kommen, jetzt nicht! — Es ist wirklich sehr wichtig. — Für ihn auch. — O, danke sehr, also in zwanzig Minuten.«
Sie hing das Hörrohr an. »Sie kommt!« rief sie. »Du hast es gehört.«
Ihre Augen leuchteten. Sie ging mit raschen Schritten auf und nieder im Zimmer. Er setzte sich, grub den Kopf in beide Hände. Suchte. Fand nichts.
Sie sprachen kein Wort miteinander. Warteten.
Dann meldete ein Diener Frau van Neß. Er sprang auf.
Ivy Jefferson ging ihr entgegen, nahm ihre Hand, führte sie zu einem Sessel. »Wie lieb, daß Sie kommen!« rief sie. »Er will sich mit mir verloben, sehn Sie — und er meint, er brauche dazu Ihre gütige Erlaubnis. Ich finde es sehr begreiflich, sehr nett von ihm, daß er meint, nichts tun zu dürfen ohne das Einverständnis seiner — seiner —«
Sie zauderte, schwankte — aber nur einen kleinen Augenblick. Sie mußte diese Genugtuung haben, mußte es ihr sagen, mitten ins Gesicht.
»Seiner Mätresse,« fuhr sie fort. »Nicht wahr, Frau van Neß, Sie sind ja doch seine Mätresse?« Aber sie sagte es nicht scharf, nicht beleidigend. Sprach es lieb und weich, sanft schmeichelnd und klingend.
Sie wartete nicht auf ihre Antwort. Sie sprach schnell, klar und offen, sagte kein Wörtchen zu viel. Daß sie ihn haben wolle — weil sie ihn eben wolle. Es sei ihr Wunsch und ihre Laune — und sie müsse ihn haben. Daß sie gut wisse — und ihr Vater auch — wozu er geschickt sei in das Jeffersonhaus. Daß sie ihn fest in der Hand hielte heute — mit der Mexikogeschichte, mit der Anleihe — mit noch ein paar Sachen. Und noch etwas am Ende: nicht nur seinetwegen habe sie sie hergebeten. Auch sie, Ivy Jefferson, habe noch etwas mit ihr zu sprechen. Wenn Frau van Neß Ja sagen würde und Amen — und es sei ja sicher, daß sie das tun würde — dann wäre er ihr Verlobter, der ihr gehöre. Und sie wolle ihn für sich, allein für sich — wohl verstanden. Da sei es selbstverständlich, daß er seine frühere Mätresse nicht mehr sehn würde, nicht mehr in ihr Haus kommen. Daß es zu Ende sei — einmal und für immer —
Ganz weich klang es, zart und süß, wie ein Vogelflöten: »Ich möchte, daß Sie das gut verstehn, nicht wahr?«
Lotte van Neß stand auf. Sehr bleich war sie. Sie sprach kein Wort, nickte nur.
Ein kleines Schweigen dann, das Ivy Jefferson brach. Nicht mehr so sicher wie vorher, ein wenig zitternd klang ihre Stimme. »Es scheint, daß sie einverstanden ist — deine Mä —« Aber sie unterbrach sich schnell. »Nein, sie ist es ja nicht mehr — seit diesem Augenblick nicht mehr — ich bitte vielmals um Verzeihung! Frau van Neß ist einverstanden! — Darf ich dem Diener schellen, Sie hinauszugeleiten, gnädige Frau?«
Die blasse Frau sagte: »Haben Sie es so eilig? Ein Wort nur, Fräulein Ivy, von seiner — frühern — Mätresse. Sie sollten wissen — wissen —« sie zauderte, suchte nach einem Wort. Fuhr dann fort. »Sollten wissen, daß Ihr Verlobter etwas braucht, das Sie ihm vermutlich nicht geben können.«
Die blonde Ivy zog die Lippen hoch. »Man weiß nicht genau, wieviel Geld Sie haben, Frau van Neß! Auch mein Vater kann es nicht genau sagen — es mag sein, daß Sie mehr haben als wir. — Heute! Aber Sie verdienen nichts in dieser Zeit — und mein Vater wohl. Viel. Sehr viel. Ehe der Krieg zu Ende ist — sind wir viel reicher. Sie mögen sich beruhigen, Frau van Neß, ich glaube nicht, daß der Mann, den ich nehme, irgend etwas nicht hat, das er braucht.«
Ein rasches Lächeln zuckte um Lottes Mund. »Sie mißverstehn mich,« sagte sie. »Kaufen können Sie es nicht!«
»Was ist es denn?« fragte die Blonde.
Aber Lotte van Neß schüttelte den Kopf. »Ich kanns nicht sagen.«
Da wandte Ivy sich an ihn: »Weißt dus?«
Er warf einen langen Blick auf Lotte Lewi, fragend und bittend. Aber sie schwieg, sah ihn nicht an. »Ich weiß nicht, was sie meint,« antwortete er.
»Nun« fragte Ivy.
Lotte van Neß sagte: »Nein — er weiß es nicht. Wird es wissen — zu irgendeiner Zeit. Und wenn Sie ihm nicht geben können, was ihm das Leben gibt — dann weiß er, wo ers haben kann. Dann — wird er zurückkehren — zu mir!«
Die kleine Ivy antwortete nicht, sie drückte schnell auf den Knopf. Aber die andere wartete den Diener nicht ab, grüßte, leicht nickend, schritt hinaus.
Er sah ihr nach. ›Da geht die Mutter!‹ fühlte er.
Der Diener kam. »Bitten Sie Herrn und Frau Jefferson herzukommen,« befahl Ivy.
Dann wandte sie sich an ihn. »Darauf laß ichs ankommen,« sagte sie nachdenklich. »Etwas — das du brauchst? Das sie dir geben kann und ich nicht? Aber sie sagt nicht was — und du weißt es nicht? Entweder lügt sie — oder —«
Ihre Augen wurden groß, glitten über ihn, langsam und suchend. Griffen sein Gesicht, den ganzen Leib dann, als ob sie ihn ausziehn wollten. Verlangend, gierig fast.
»Oder —« wiederholte sie flüsternd, wie zu sich selbst, »oder —«
Sie stampfte mit dem Fuß auf, warf den Kopf zurück, atmete rasch und heftig, daß die Nüstern flogen. »Ich wills sagen,« rief sie, »ich wills sagen! Ich will alles sagen dürfen — du! — Dazu will ich dich!«
»Was denn?« fragte er. »Sags doch!«
»Ich will viel sagen,« begann sie. »Aber ich weiß die Worte nicht. Du mußt es mich lehren — nicht jetzt, nein! Ich weiß, daß ihr mehr wißt in der alten Welt, in Europa und Asien — als wir hier. Ihr habt mehr Bildung: Kultur schreien sie in den Blättern und sind neidisch auf euch! In allem mehr — und in der Liebe — auch! Die Liebe ist eine Kunst — das las ich einmal in einem französischen Buch. Ich will sie lernen, diese Kunst, so gut können — wie die van Neß auch! — Dazu will ich dich.«
Sie trat dicht zu ihm, legte auf seine Hand leis die ihre. Die zitterte und war feucht.
»Sag mir,« flüsterte sie, »meinte vielleicht deine — meinte Frau van Neß, daß du — irgend etwas besonders liebst — in der Liebe? Daß sie etwas wüßte — und könne — das ich nicht kann und nicht lernen könne? Sprich doch! Antworte doch!«
»Ich weiß nicht, was sie meint,« sagte er.
Ihre Finger schoben sich um seine Hand, ihre Augen glühten in seine Augen. »Du sollst es sagen,« verlangte sie, »du sollst keine Scham haben — vor mir.«
Aber er schüttelte den Kopf. »Mein Wort — ich weiß es nicht.«
Sie seufzte, schwieg eine kleine Sekunde. Sprach dann, fester und gewisser. »Und doch glaube ich nicht, daß sie log. Nur — sie dreht es um — das denk ich. Nicht du brauchst etwas — das sie nur dir geben könnte: sie ist es — sie, die von dir etwas nimmt! Das ists!«
Er riß sich los — starrte sie an. Biß die Zähne übereinander, stieß hervor: »Das — das dachte ich — mehr als einmal! Wie kommst du darauf?«
Sie nahm seine Hände von neuem, streichelte sie rasch und nervös. »Meinst du, ich hätte nicht gemerkt, wie du warst all die Zeit über? Sehr gesund oft — stark und blühend — und dann wieder so müde und leer und matt. Und Frau van Neß? Wo ich sie traf, habe ich sie beobachtet, in der Oper, in Carnegiehall bei den Konzerten. Wenn du kräftig aussahst, dann war sie sehr bleich und blaß — sah aus manchmal wie der Tod selbst. Und sie wurde frisch und blühte auf — immer dann, wenn du elend warst! Ich hab mirs notiert — seit einem Jahre fast — in einem Kalender: ich will dir die Daten zeigen, wenn du magst. Sag mir, was habt —«
Sie unterbrach sich — man hörte Schritte im Nebenzimmer.
»Jetzt nicht,« rief sie. »Vater kommt und die Mutter! Jetzt nicht. Aber das ist es — o ganz gewiß! Sie trank deine Kraft — und darum trieb sie dich hinein in den wirbelnden Strudel: daß dus nicht merken solltest — keine Zeit fändest, nachzudenken — über das, was sie tat mit dir!«
»Aber was denn?« rief er. »Wie denn und wann denn?«
Sie lachte auf. »Wie — was — das weiß ich nicht. Aber wann — das kann ich dir gut sagen: schliefst du nie bei ihr?«
Die Türe ging auf — da warf sie die Arme um seinen Hals. Sprang hoch an ihm, hing sich fest, küßte ihn. Riß sich los, lief den Eltern entgegen. »Du sollst die Anleihe nicht zeichnen, Vater!« rief sie. »Ich hab mich verlobt mit ihm.«
Er kam nicht zur Besinnung an diesem Nachmittag. Er mußte bleiben zum Tee, dann fuhr ihn Ivy nach Hause. Er ging langsam die Stiegen hinauf, fürchtete das: ›Endlich!‹ das ihn empfangen würde. Dieses ewige: ›Endlich‹ und das ›Nun aber schnell!‹
Zwei ›Endlich‹ schallten ihm entgegen, und der Sekretär gab noch ein ›Gottseidank‹ zu. Zog ihn ins Schlafzimmer — da stand sein Diener bereit, ihm beim Ankleiden zu helfen.
»Nun aber schnell, nicht wahr?« rief er. »Ich weiß schon! Zum Bazar — ja — ja! Könnt ihr mir nicht einen Abend Ruhe lassen!«
»Aber Doktor,« hielt ihm Rossius vor, »heute ist Sonntag! Der große Tag! Die Botschafter sind eigens aus Washington hergekommen.«
»Schon recht!« seufzte er. »Gib den Frack, Fred.«
— Viele Tausende drängten sich um den gewaltigen Bau des Madisonsquare-Gartens. Die Tore wären längst geschlossen; ein paar hundert Schutzleute hielten Ordnung: zehn Menschen kamen heraus — da ließen sie zehn andere hinein. Zehn — aber zehntausend warteten — und noch zehntausend. Standen da, geduldig, in strömendem Regen — durch die Stunden —
Heute, wie gestern — und morgen — durch sechzehn Tage hindurch. Warteten, lauschten auf ein Geräusch, das herausdrang durch die dicken Mauern. Wie artige Kinder. Da drinnen war Weihnacht — war der Himmel. Da drinnen war — Deutschland!
Sie fuhren von hinten herum, hämmerten an eine kleine Seitenpforte. Zogen ihre Karten aus den Taschen und die bunten Schleifen. Gaben einem Schutzmann eine Dollarnote, schmuggelten schnell ein Dutzend Menschen mit hinein.
Durch die Keller und dann hinauf in die Budenstadt des riesigen Zirkus.
Nürnberg — das der Kinderbilderbogen. Und es sah so aus — echter schon, wie das Nürnberg der ›Meistersinger‹ im Opernhause.
»Sie müssen Punkt halb acht von der Galerie sprechen,« erinnerte ihn der Sekretär. »Dann um dreiviertelneun im großen Saale! Und um —«
»Ich weiß,« unterbrach er ihn. »Versuchen Sie inzwischen jemanden von der Botschaft zu erwischen. Sagen Sie, der Jeffersontrust würde die neue englische Anleihe nicht zeichnen!«
Vereine zogen auf, mit Fahnen und Bannern. Die mußte er begrüßen von der Galerie herunter. Kein Mensch verstand ein Wort in all dem Lärm — aber man wußte: da stand einer und redete. Das war völlig genug.
Tewes stürzte vorbei, gab ihm rasch die Hand. »Haben Sie Dr. Hertling nicht gesehn?« rief er. »Er soll im Empfangssaal sprechen, wir suchen ihn.«
»Nein!« erwiderte er. »Es ist ein Blödsinn, dies ganze Gerede hier — man kann gerade so gut: la — la — la schreien.«
»Tun Sies doch,« lachte der Journalist, »nur machen Sie hübsch große Gesten dabei, das ist die Hauptsache! Aber ein Blödsinn ists ganz und gar nicht! Dreitausend Leute kommen heute her, nur um den Botschafter zu sehn. Andere wollen Professor Södering sehn, andere Dr. Cohn. Na, und Ihretwegen wird wohl auch ein halbes Dutzend hergekommen sein. Wir wollen über eine Million machen auf unserm Bazar — so müssen wir das Tamtam schlagen! — Da ist mein Mann — warten Sie, ich bin gleich wieder da!«
Frank Braun lehnte über die Galerie, schaute hinunter in dies Meer von klingenden Farben. Das wehte und wellte, das schob und drängte, das tönte und schrie. Bunte Wogen unter dem gewaltigen Tuchhimmel, der in weichen gelben Fluten das alles überspannte.
Da, vor dem Stadttore die mächtigen Automobile. Gleich sechs Stück nebeneinander, jedes zu gewinnen auf ein Halbdollarlos.
Dicht beim Tore die Puppenbude, in der die Schwestern des deutschen Hospitals verkauften. Links davon die Stände des »Arion«, des »Liederkranz«, des »Deutschen Vereins«. Und die Buden des »Heinebundes«, des »Sprachvereins«, der »Vereinigten Bäcker« — dicht an dicht hatte ein Verein neben dem andern sein Zelt aufgeschlagen.
— Er sah hinunter. Dort, neben den violetten Damen des Waffelstandes, war Lotte Lewis Bude. Er erkannte sie gut — Nürnberger Spielzeug verkaufte sie. Drei junge Damen halfen ihr — und sie hatte drei gewählt, die rotblondes Haar hatten, wie sie selbst. Seidenkleider von einem milchigen Stahlblau — duftige, nilgrüne Tücher darüber.
Ein Holzpferdchen verkaufte sie und den Karren dazu. Redete der dicken Dame, die vor ihr stand, noch eine Puppenküche auf, nahm nun einen Hampelmann. Sie zog unten an der Schnur — und der Hampelmann hampelte und strampelte erstaunlich gut. Die dicke Dame konnte nicht widerstehn, sie kaufte den Hampelmann noch dazu. Sie versuchte ihn gleich, aber wie sie sich auch abmühte, es kam nur ein armseliges Zappeln heraus.
›Lotte kanns besser!‹ dachte er. ›Sie versteht sich auf Hampelmänner — ob sie nun aus Holz sind oder aus Fleisch!‹ Es zuckte in ihm, er hatte ein Empfinden, als ob auch er Beine und Arme stracks aufklappen müßte — wie sie die Schnur zog.
Er kannte den Takt, wußte schon, wie es gemacht würde — ein närrisches Hopsen, so wie das des schwindsüchtigen Komikers, den er einmal zu Bonn gesehn hatte in einem Bumslokal —
Da saß er mit den Studenten, ganz vorne in der ersten Reihe. Sie warfen den Tänzerinnen Blumen hinauf und schickten Wien den Soubretten, die schauderhafte Lieder plärrten. Dann kam der Damenimitator — der war der elendste von allen. Er sang und tanzte, arbeitete mächtig für das bißchen Brot. Zum Schluß aber kam er als Hampelmann.
Sang ein scheußliches Lied mit sieben langen Strophen, stets einen Kehrreim dazu. Der lautete:
»Seht den kleinen Hampelmann,
Wie er hampeln, strampeln kann!
Und die Damen und die Herrn
Hampeln, pampeln, strampeln gern!
Frauchen zieht am Hampelmann
Und das Männchen strampelt dann,
Rampelt, pampelt Tag und Nacht,
Wie ihn Frauchen hampeln macht!«
Dann kam die Hampelei. Er sprang auf, warf rechts und links die Beine auseinander, riß zugleich die Arme in die Höhe. Fiel herunter, sprang von neuem auf — wieder und wieder. Grölte dazu die geistreichen Hampelverse. Sieben Strophen hindurch — und immer von neuem dies Gehopse. Aber man sah die Überanstrengung des schwindsüchtigen Männchens — dem Publikum gefiel die Nummer gar nicht.
Doch Frank Braun klatschte. »Er soll tanzen, bis er umfällt!« rief er. Winkte der alten Blumenfrau, griff in ihren Korb, warf bunte Sträußchen auf das Podium. Und die Korpsbrüder folgten seinem Beispiel, warfen Blumen, schrien und klatschten.
Da hampelte der Kerl von neuem. Seine Augen strahlten über den Erfolg — und doch lag eine starre Angst darin, ob ers aushalten möchte. Aber er hopste, sprang und sang.
Neuer Beifall, mehr Blumen. Geschrei und Gejohle. Da capo und Bis!
Das Männchen sprang. Der Schweiß rann ihm in Bächen herab, grub lange Rinnen durch Schminke und Puder. Seine Sprünge wurden matter und schwächer; dann biß es sich auf die Lippen, riß sich zusammen, schnellte von neuem hoch. Das war sein großer Tag, sein starker Erfolg — ah, es mußte aushalten.
Vielleicht begriff die Menge. Vielleicht auch machte sie nur mit, weil es ein wilder Spaß war, ein Radau und Fez. Alle klatschten nun, das ganze Publikum brüllte und schrie.
Hampeln mußte die Schwindsucht da oben, hampeln. Die Kehle war so ausgeschrien, daß kaum ein heiseres Krächzen noch herauskam, doch hörte man gut das Rasseln und Röcheln der halben Lungen. Aber die Musik ging weiter, schnell, schnell, warf ihm die dünnen Beinchen hoch.
Er stand unter der ersten Sufitte, verbeugte sich tief, dankte, machte Gesten mit den Händen, daß es nun nicht mehr ginge. Und sog doch diesen Jubel ein, strahlend glücklich, voll von schwellendem Stolz.
Nein, nein, sie ließen ihn nicht aus. Diese Grausamkeit, die von Frank Braun ausging, kroch in alle Hirne, schlug in Flammen heraus, verlangte rasend das jämmerliche Opfer. Alles heulte und brüllte, die Studenten warfen Geld hin zur Musik — daß sie von neuem einsetzte. Und der Kapellmeister schwang den Taktstock.
Nun war es nichts Menschliches mehr, das da oben sprang. Eine lahme Puppe wars, ein Hampelmann, dem die Strippe zerriß. Noch immer öffnete sich, schloß sich der Mund, aber zu einem Atemholen nur, zu einem elenden Japsen, zu einem Kampf nur mit einem krächzenden Husten. Dann hing das Maul offen — da fiel ihm das Gebiß heraus. Er griff es schnell, klemmte es fest in der Hand.
»Er löst sich auf!« lachte Frank Braun.
Der Schwindsüchtige kroch zurück in die Kulissen klammerte sich fest, schlotternd und zitternd. Doch die Menge schrie weiter und johlte.
Eine Soubrette trat auf, die Musik setzte ihr Lied ein. Aber man ließ sie nicht singen. Man schrie sie an, warf allen möglichen Kram nach ihr. Sie hielt aus, so gut es ging, da schleuderte einer der Studenten den leeren Blumenkorb hinauf. Nun riß sie aus.
Und das Publikum schrie nach dem Männchen. Alle kreischten den Kehrreim:
»Seht den kleinen Hampelmann,
Wie er hampeln, strampeln kann —«
Noch einmal kam es heraus, noch einmal sprang das Männchen. Zappelte, hopste. Fiel dann. Stand auf, überschlug sich, schwankte, rollte über den Boden. Knickte ein, schrie auf, preßte beide Hände vor den Mund. Stürmte in die Kulissen.
Immer noch klatschten sie. Wurden ruhig endlich. Ließen die Soubrette ihre Zoten grölen.
Die Studenten gingen. Aber einer blieb zurück, der kam erst später nach in die Weinstube.
»Ich war hinten,« sagte er. »Der Kerl hat einen Blutsturz bekommen.«
Ein anderer fragte: »Na, was hast du angeordnet? Bist doch Mediziner!«
»Nichts!« erwiderte der. »Es waren schon zwei Ärzte da.«
Einen Augenblick schwiegen sie. Da machte der lange Ballus seinen behäbigen alten Witz: »Daraus kann man wiederum ersehn, daß man nicht zu viel hampeln soll.«
Frank Braun rief: »Trinkt doch — was kümmert euch der Clown! Er hat seine Pflicht erfüllt in dem Leben da: hat mir Spaß gemacht dreiviertel Stunden lang!«
So lachte er, das war seine wilde Geste. Und doch: Lüge wars! — Er hatte bebend dagesessen all die Zeit über, zitternd, ächzend, sich windend in den Schmerzen des springenden Männchens. Hatte gelitten, ah, all diese Qualen —
Aber hochmütig die Maske, wüst und frech —
Damals hatte er die Schnur gezogen. Hatte den Hampelmann hopsen lassen, nach seiner Laune, bis das Spielzeug zerbrach.
Was lag an dem! Ein Damenimitator, tantig und verschnitten, einer, der nie herauskam aus dem Schlamm der Gosse, ein Ausgespieener, Schwindsüchtiger, sehr Pervertierter. Einer, dem nur drei Tore offen standen in diesem Leben — zum Krankenhause, Zuchthause, Irrenhause. Der eben deshalb sich rettete mitten ins Rampenlicht, aus seinen elenden Gebresten einen Kuchen formte, ihn dem Publikum vorsetzte für zehn Pfennig Eintrittsgeld. Und der, einmal nur, einmal diesen Groschen wert war — in der Nacht, als er sich hinaushampelte aus seinem Jammerleben, als er selbst zum Hampelmann wurde mit Seele und Leib, alle Strampelglorie, allen Hampelruhm in sich hineinfraß, bis die Strippe riß.
Und den er liebte — grade darum!
Nun hampelte er selber. Und das liebe Publikum johlte und schrie, ließ ihn nicht herunter von der Bühne. Heraus, heraus, wieder heraus: Bis und Da capo! Gestern, morgen und alle Tage.
Unten stand sie, die die Schnur zog. Die ihn hopsen ließ, immer von neuem, hampeln und pampeln vor dem Publikum.
O es war schon ein Unterschied. Er hatte das Männchen zu Tode gezappelt, roh und brutal. Aber schnell, schnell — dreiviertel Stunden nur dauerte der ganze Spaß. Die aber seine Schnur zog, war eine Frau. Die ließ ihn ruhn, wenn er zusammenbrach in den Kulissen, die pflegte ihn gut, wenn er hinsank, leer, jammervoll, müde, ausgepumpt. Bis er wieder gesund war und stark, bis er von neuem Arme und Beine warf, wie sie zog. Höher springen und noch höher.
Durch die Monate — durch die Jahre nun —
Bis auch seine Strippe einmal reißen würde!
Da unten stand sie — in ihrer Spielzeugbude.
Wickelte den Hampelmann in Papier, reichte ihn der dicken Dame, die ihn gekauft hatte —
Was? Hatte nicht Ivy Jefferson ihn gekauft — vor ein paar Stunden erst?
Er wischte den Schweiß von der Stirne, seufzte tief.
»Sie sind heiß, Doktor,« sagte einer, »kommen Sie, wir wollen ein Glas Wein trinken.«
Er wandte sich um — ah, der Tewes stand wieder neben ihm.
Sie gingen über die Galerien, angerufen jeden Augenblick. Kauften Lose auf Kissen und Uhren, auf Pelze und Häuser und Hunde, auf Leuchter und Europareisen, auf Schinken und Bierseidel und Bilder und Broschen, auf Lampen und Badewannen, auf Ferienaufenthalte und Hindenburgpostkarten, auf —
Da war nichts, das nicht verlost wurde. Sogar eine Südseeinsel hatte jemand gestiftet.
»Das ist der einzige Schwindel beim Bazar, glaub ich!« sagte der Tewes. »Die Insel werden die Engländer längst im Sack haben — und der glückliche Gewinner muß mit dem Photo zufrieden sein!«
Sie kamen zu den Ständen der befreundeten Völker. Da waren die Buden der Ungarn, Kroaten und Slovaken, hübsche Frauen standen drin, bunt genug in den farbigen Nationaltrachten. Bulgarische Bauerndirnen in ihren Früchteständen, dalekarlische Mädchen in den schwedischen Buden. Türken natürlich, die verkauften Süßigkeiten, hatten ein mächtiges Kaffeezelt, ein Kamel sogar: darauf konnte man reiten — zehn Schritte hin und zehn zurück. Viele irische Buden auch und jüdische.
Ein Musikchor zog vorbei; die schmetternden Trompeten fraßen seine Worte. Da zogen die Ehrengäste des Tages zur Tribüne hinauf, wo der Botschafter reden sollte. Dr. Cohn an der Spitze, mit ihm der Graf. Und zwischen beiden Herrn die Präsidentin des Bazars in kostbarem Brokatkleide mit vielen Rosen rings herum. Ihre guten blauen Augen sahen verwundert ringsum, verschüchtert und doch stolz, sprachen: »Herrgott, was macht ihr bloß mit mir!« Aber sie stapfte tapfer mit durch all den Lärm, stützte sich kokett auf ihren Stock, der war lang, goldknöpfig und beschleift, wie ein Schäferstab von Trianon.
»Halb neun!« rief der Journalist. »Sie müssen zum blauen Saale.«
»Ja, ja!« antwortete er. »Ich laufe schon.«
Hier hatte Loritz, der Bariton, sein Reich. Vier große Konzerte gab er jeden Tag. Schlag drei begann das erste, Punkt elf war das letzte zu Ende. Und in jedem hatte er drei gute Namen und einen ganz großen obendrein. Redner zwischendurch, lebende Bilder und Balletts.
Als man den Madisonsquare-Garten mietete für den Bazar, fand der Sänger diesen Saal. »Den übernehme ich!« rief er. »Allein das Reinemachen wird Ihnen Tausende kosten!« warnte der Besitzer. Aber Loritz antwortete: »Keinen Kupfercent! Wir sind eh' beim großen Aufwaschen, da kommts auf den Saal nicht an.« — Er setzte eine kleine Notiz in die deutschen Blätter: deutsche Frauen, die zu arm seien, um mit Geld bei dem großen Werke zu helfen, sollten sich melden — bei Herrn Augias, Bureauzimmer 23, im Madisonsquare-Garten. Und die armen deutschen Frauen kamen, viele Hunderte gleich am ersten Tage. Der Bariton band eine Schürze vor, wie sie, nahm eine feste Schaufel, kommandierte sein Schipperregiment — vierzehn mächtige Fuhren Dreck trugen sie hinaus. Jeden Morgen kamen die Kehrfrauen wieder, hielten alle die Räume sauber und rein: das war ihre Arbeit fürs Vaterland.
Frank Braun trat in den Saal. Oben auf dem Podium stand Kreisler, der beste, der deutscheste Geiger der Welt. Eben setzte er den Bogen ab, wandte sich zum Abgehn, blieb stehn, festgehalten vom rasenden Jubel der Menge. Er, Fritz Kreisler, den jeder in Amerika vergötterte, einerlei, welchen Blutes er war. Aber die da unten, die Deutschen, hatten noch bessern Grund dazu.
Der da, der Kreisler aus Wien, war im Kriege gewesen als Dragonerleutnant. War in Polen vom Pferd geschossen worden und lange geschleift, kam herüber als Invalide. Ein Held war er ihnen, einer dazu, der auch in diesem Lande weitergekämpft hatte. Nicht mit der Fiedel nur, auch mit alledem, was er erworben hatte mit seiner Geige. Drüben hatte er dem Russen gestanden — hier stand er einem just so gefährlichen Gegner: Charles Schwab und dem Morgantrust. Die Bethlehem-Aktien stiegen, stiegen jeden Tag, von siebzig auf über sechshundert — diese Blutaktien, die den Tod hinüberspieen nach Europa, die den Alliierten den schon wankenden Arm stählten und ein Tränenmeer schufen von der Nordsee zum Bosporus.
Das kroch in des Geigers Träume, das ließ ihm keine Ruhe mehr. Da hob er sein Geld von der Bank, er, der Künstler. Der Spieler — mit der Geige — mit dem Säbel — mit dem Goldbeutel nun. Nahm alles, was er hatte, durch die Jahre zusammengespielt auf seinen Triumphzügen durch die Welt. Spielte in Bethlehem-Aktien, wettete auf fallenden Markt. Lief als Bär in dieser hohen Zeit aller Bullen, kämpfte gegen Wallstreet — er; ganz allein. Sie schien ihm schon blank und gut, seine Waffe — eine ganze, große Million wars!
Und war doch nur eine jämmerliche, armselige Lumpenmillion — ein elender Schmarrn gegen das Rüstzeug der Morgan und Schwab! Eine Million — die zu nichts zerrann in kaum acht Tagen. Und so wachte er auf nach der einen Woche: ein Bettler, der nichts hatte als seine Geige — und eine halbe Million Schulden obendrein.
Wallstreet lachte. Wallstreet war großmütig, Wallstreet bildete ein Syndikat, ihn zu halten. Bezahlte seine Schulden schlankweg, setzte ihm auch ein Monatsgehalt aus, daß er bescheiden leben konnte. Nur freilich mußte er von nun an für das Syndikat spielen, fünf Jahre lang, bis alle Schulden abgezahlt waren und die Zinsen dazu.
Alles unterschrieb der Geiger, gab sich ganz in die Hände des Syndikats. Und nur um eines kämpfte er und nur eines setzte er durch: wo es sich handelte um ein Konzert für Österreich, für Deutschland oder Ungarn — da durfte er mitwirken, durfte umsonst spielen.
Und da spielte er, freier noch, herrlicher noch wie sonst, wuchs hoch hinaus über sich, gab seine ganze große Künstlerseele. Wie er sein Blut gegeben hatte und sein Gold.
Das war das letzte, war das einzige, das ihm noch blieb — und er gab es — immer wieder und wieder.
— Jetzt schwiegen sie unten, als er die Fiedel ansetzte.
Und er spielte. Spielte: »Gott erhalte —«
Die gewaltige Hymne aller Deutschen und Österreicher. Abgeschrien, abgeleiert, jeden Tag und jede Stunde, zur billigsten Münze geworden in jeder letzten Silbe. Und doch von ihm, ohne alle Worte, emporgehoben über alles Irdische, weit hinaus getragen in die blauen Sphären — über die Zeit.
Kein Fiedeln war es, kein Singen seiner süßen Geige. War ein ewiges, unendliches Gebet.
— Keiner wagte zu klatschen. Sie saßen da, still und stumm — weinten, weinten.
Eine sang. Frank Braun sprach. Die kleine Herma Lindt, — Wienerin, braune Samtaugen, braunes Samtkleid — saß wie ein Bub am Flügel, spielte den Donauwalzer —
Was war das alles? Nach dieser Geige Gebet!
Langsam ging er aus dem Saal hinaus. — Zwei Frauen kamen vorbei — rothaarig, in Stahlblau und Nilgrün.
Lotte van Neß wars mit einer ihrer Damen. Er folgte ihnen, sah, wie sie in das türkische Kaffeezelt traten. Wartete ein wenig, schlich vorbei, setzte sich, etwas entfernt, an einen Tisch.
Sie sahen ihn nicht, sprachen miteinander, tranken ihren Kaffee, kauften von jedem, der vorüberkam.
Er starrte hinüber —
Dann kam Dr. Cohn, setzte sich zu ihm, stürzte schnaufend ein großes Glas Wasser hinunter.
»Was haben Sie denn da eingekauft?« fragte er. »Ihr Frackschoß hängt herunter wie ein Mehlsack.«
Der Arzt zog mühsam einen schwarzen Kasten aus der Tasche. »Das?!« rief er. »Ach, das schleppe ich nun schon vier Tage mit mir herum. Ich habs Frau van Neß mitgebracht und vergesse es immer wieder!«
Er legte den Kasten auf den Tisch. »Was ists denn?« fragte Frank Braun. »Darf man sehn?«
Dr. Cohn öffnete den Kasten. »Ein Bistouri,« rief er, »ein sehr hübsches dazu — nirgends in der Welt bekommen Sie etwas, das besser schneidet.«
Frank Braun sah hin — ein vollständiges, medizinisches Besteck lag vor ihm. »Was will denn Frau van Neß damit?« forschte er.
»Berufsgeheimnis!« lachte der Arzt. »Aber Ihnen kann ichs ja sagen — sie braucht es für ihre Hühneraugen, Verehrtester!«
Frank Braun rief: »Aber Lo —« Er zerbiß das Wort in der Mitte. Starrte wie gebannt auf die blanken Messer. O, er kannte sie gut, ihre weißen, gepflegten Füße. Ringe trug sie auf den Zehen, viele bunte Steine, wenn es so ihre Laune war —
Aber Hühneraugen?! Lächerlich! — Sie, Lotte Lewi!
Der Arzt klappte seinen Kasten zu, reichte ihn ihm hinüber. »Tun Sie mir den Gefallen, geben Sies ihr, wenn Sie sie sehn. Sonst vergeß ichs heute zum fünften Male.«
»Geben Sies ihr selbst,« gab er zurück. »Da sitzt sie — nein, eben steht sie auf, zahlt grade. Nun kommt sie her.«
Dr. Cohn sprang auf. »Das trifft sich, gnädige Frau! Hier ist Ihr Bistouri.«
Sie nahm den Kasten, seufzte leicht auf, lächelte. »Ein wenig spät, lieber Doktor. Wer weiß, ob ich es je noch brauchen kann.« Sie wandte sich ihrer Freundin zu. »Darf ich Ihnen unsern Präsidenten vorstellen? — Dr. Cohn!«
Die beiden begrüßten einander, reichten sich die Hände, gingen langsam weiter.
Und Lotte setzte sich still an seinen Tisch, ohne ein Wort. Stellte den Kasten vor sich hin.
Keines sprach. Das Lächeln fror ein auf ihren Lippen, schlohweiß lagen ihre Hände über dem schwarzen Kasten, wie die eines Marmorbildes.
›Eine Tote,‹ dachte er, ›eine Tote.‹ Und er fühlte: so lieb hatte er sie, so sehr lieb.
Etwas krampfte sich ihm in der Brust. Tränen stiegen ihm in die Augen, tropften hinaus, liefen über die Wangen, still, langsam. Unaufhörlich doch. So lieb hatte er sie, so sehr lieb —
Sie stand auf. Strich leise über seine Stirn mit der kühlen Hand. »Leb wohl,« sprach sie. Wandte sich.
Da fiel sein Blick auf den Kasten. »Du vergißt dein Bistouri!« rief er.
Sie nickte, dankte. Nahm es.
»Später vielleicht —« sagte sie.
Ging dann —
Er nahm sein Tuch, wischte das Gesicht. Schlürfte den dicken, süßen Kaffee.
Nun sah er sie nicht mehr. Nun konnte er klarer denken.
Messerchen, viele gute Messerchen, blank und scharf. Die besten der Welt — zum Stechen und Schneiden!
Zum Hühneraugenschneiden hatte sie dem Arzte gesagt — sie, die ihr Lebtag nie eins hatte!
Wozu wollte sie das Besteck?
Und was hatte sie dem Arzt geantwortet — was denn? Zu spät sei es nun —
Er lachte hell auf. Zu spät! — Zu spät? Weil an diesem selben Tage die kleine Ivy Jefferson —?
O gewiß — die hatte den Hampelmann gekauft! Ihn!
Er rieb sich die Augen, starrte auf den Tisch. Für ihn hatte sie das Bistouri verlangt — da war kein Zweifel mehr! Hatte er nicht oft auf ihrem Nachttische solche Messerchen liegen sehn?
Und das kleine, blanke — das sie ihm mitgab nach Mexiko?
Das blutig war an dem Tage des Mescalrausches?
Da schlief er fest auf seinem Diwan, träumte absurde Träume. Aber das Messerchen ward blutig!
Was sagte die blonde Ivy? — Wie und was — das wisse sie nicht. Aber wann — ja! Wenn er schliefe bei ihr — dann!
Und hatte Lotte nicht die Tänzerin gleich mitgenommen in ihr Haus? Warum denn? Tat die, was ihr Lotte van Neß befahl — während er schlief? War sie ihr Werkzeug nur?
Wozu —?
Einerlei — was es auch war! Dies eine stand sicher fest: etwas war geschehn mit ihn — und war wieder geschehn — während er schlief! Und es hing irgendwie zusammen mit kleinen scharfen Messerchen — und mit rotem Blut. Und nicht minder mit dieser merkwürdigen Krankheit, die ihn immer wieder anfiel, diesem schleichenden Leiden, über das alle Ärzte unwissend den Kopf schüttelten. Das ihn aussaugte und leertrank!
Sie trank ihn aus — sie, Lotte Lewi, seine Geliebte!
So lieb hatte er sie — und nie fühlte er es so wie grade jetzt. So lieb hatte er sie — ah, er wollte das alles nicht glauben —
Und doch mußte es so sein — es war nicht möglich anders.
Er stand auf, trat noch einmal an die Galerie. Da stand sie in ihrer Bude mit ihren drei Damen — nilgrün die Tücher über milchigem Stahlblau. Und das Rot der Haare — welch ein Klang! — Holzpferdchen verkaufte sie, bunte Kühe, Puppenküchen, Kanonen, die mit Erbsen schossen. Keine Hampelmänner? — Nein, er sah keine mehr in ihrem Stand. Ausverkauft!
Er stieg die Treppe hinab in den Riesensaal, ließ sich schieben, wie ihn der Menschenstrom führte. Eine Hand legte sich auf seinen Arm — es war die Präsidentin.
»Führen Sie mich,« sagte sie, »ich muß zum Journalhaus.«
»Wo ist das?« fragte er.
Sie wies auf den breiten Weg, der sanft hinunterführte. »Dorthin — im Untergrundstock.«
Sie stützte sich fest auf ihn, er merkte gut, daß nur ein starker Wille diese Frau aufrechthielt. Durch manche Monate vorbereitende Arbeiten Tag um Tag, immer in Frauenvereinen, achtzig und mehr. Immer lächeln, immer freundlich sein, ach so liebenswürdig — nur so ging es! Und hier nun, zwölf Stunden am Tage, treppauf und treppab —
Ihre guten Augen irrten über die Menge. »Es ist eine hohe Ehre, Präsidentin zu sein,« sagte sie. »Aber glauben Sie mir, Doktor, es ist nicht so leicht.«
Er nickte. O nein, es war nicht so leicht, für Deutschland zu arbeiten in diesem Lande, das wußte er gut. Drückend wob sich die stickige Ausdünstung der Zehntausende durch die Räume, drang in Mund und Nasen, dieser dicke Dunst aus Schweiß und Staub.
›Die Masse frißt uns ein,‹ dachte er, ›die Masse verdaut uns. Nur Nährstoff sind wir und sonst nichts. Und wir rühren uns nicht — werden nur bewegt: peristaltisch.‹
— Sie waren im untern Stockwerk, das unter der Straße lag. Da war der mächtige Jahrmarktsrummel. Puppentheater und Ringelspiele, Schießbuden, große Bierzelte. In langen Reihen die Stände der Seeleute: Raritätenkabinette, Kasperltheater, Buden, in denen man ›Dicke Berthas‹ bewundern konnte, Unterseeboote, Zeppeline und Äroplane aller Arten. Hölzerne Rolande und Hindenburge zum Benageln, Buden mit Seeschlangen und Meerweibchen, Affentheater und Flohzirkusse: deutsche Kirmeß! Verschwiegene Weinzelte — denen geschickte Schiffsingenieure auf unbegreiflicher Weise sogar ein wenig Ventilation verschafft hatten, Pfefferkuchenstände, Kegelbahnen, Kaffeehäuser mit holländischen Waffeln, Wiener Kipfeln und Berliner Pfannekuchen.
Sie kamen zu dem Hause, das das »Deutsche Journal« gestiftet hatte. Hier wars aufgebaut und völlig eingerichtet — man konnte es gewinnen auf ein Dollarlos. Und natürlich den Grund und Boden dazu — der lag drüben an der Neujersey-Küste.
Die Frau Präsidentin machte ihren Besuch. Und die Damen und Herren der Redaktion eilten heraus, sie zu empfangen —
Er ging allein weiter. Trat ein in den hübschen Biedermeier-Garten, den die Breitauer führte.
Hier gabs nur Sekt und nichts sonst. Da saßen die Honoratioren und die sehr Reichen, das Volk drängte vorbei, blieb neugierig stehn an der Rosenhecke — flüsterte, zeigte mit den Fingern hinein: ›Sieh, da sitzt der —!‹
Aimée Breitauer stand in der Mitte unter dem Lindenbaum. Sie spielte die Wirtin, und ihr Kostüm war echt, wie das ihrer zwölf Schenkdamen.
Der Botschafter saß da, drückte sich bescheiden in eine Ecke. Aber draußen, hinter der Rosenhecke, hatte ihn doch einer erspäht.
»Da sitzt der Graf!« schrie er.
Der Graf — das war Deutschlands Symbol in diesem Lande. Das war des Kaisers Gesandter und des Kaisers Freund, das war die Heimat, war Deutschland selbst.
»Hoch!« schrien sie. »Hoch und hoch!« Ließen Deutschland leben und den Kaiser und den Grafen. Sangen die ›Wacht am Rhein‹, sangen ›Deutschland über alles‹ und das Preußenlied. Gaben nicht nach, bis er auf den Stuhl stieg und eine Ansprache hielt.
Jubelten wieder und jauchzten.
— Neben ihm zischte es: »Es ist eine Schande, wie ers treibt!«
Frank Braun wandte sich um. Eine Frau von reifer, üppiger Schönheit — ah, die Thistlehill wars.
»Was ist eine Schande?« fragte er.
»Sehn Sie doch,« zischte sie, »da sitzt sie wieder an seinem Tisch. Überall schleppt Euer Botschafter sie mit sich herum, seine Mätresse, die Black. Dies Miststück — das sich mit Brillanten behängt, seit sie einen Millionär geheiratet hat! Eine Dirne ist sie — haben Sie noch nicht mit ihr geschlafen, nein? Mein Mann hat sie gehabt, jeder hat sie gehabt hier im Garten!«
Sie schrie es heraus, daß man es möglichst weit hören sollte durch den Lärm.
»Schweigen Sie doch!« fuhr er sie an.
Aber Aimée Breitauer drehte sich um, klopfte ihr gemütlich auf die nackte Schulter. »Nun, nun,« lachte sie, »und dich vielleicht nicht, Kindchen? Warum denn eifersüchtig?!«
Sie ließ sie stehn, wandte sich zu Frank Braun: »Nun, wie gefällt dir mein Kleid?«
Er beschaute sie von oben bis unten. »Der Teufel mag wissen, wie dus anstellst, Aimée! Die älteste deiner Damen ist zehn Jahre jünger als du — und du siehst zehn Jahre jünger aus als die jüngste. Und dein Kleid — gib deiner Schneiderin einen Kuß von mir!«
Sie lehnte sich an ihn, sagte: »Es ist sehr bequem, mein Kleid — und es hat ein Geheimnis!«
»Schon wieder eins?« lachte er. »Es scheint, daß alle deine Kleider Geheimnisse haben — die freilich immer nur die Bequemlichkeitsfrage lösen. Aber was, Aimée, kannst du hier anfangen — mit bequemen Kleidern?!«
Sie zwinkerte ihm zu. »Komm mit,« flüsterte sie, »ich will dir was zeigen.«
Sie zog ihn hinter den kleinen Springbrunn, der über Schwertlilien sprang. Vorbei an einer kleinen Jasminlaube, deutete mit der Hand auf die Gaisblattwand.
»Siehst du was?« fragte sie. »Nein, nein, natürlich nicht. Keiner kanns sehn. Mein Gärtner ist so geschickt wie meine Schneiderin.« Sie nahm seine Hand, führte sie hinein in das grüne Laub. »Faß zu!« rief sie. »Zieh hoch — aber vorsichtig!«
Er fühlte eine Klinke in der Hand, zog sie langsam auf. Da öffnete sich leise eine schmale Tür.
»Genug!« flüsterte sie. »Schau durch den Spalt.«
Er lugte hindurch, wie sie verlangte.
Ein kleines Zimmer. Teppiche auf dem Boden — Spiegel rings an den Wänden. In einer Ecke ein kleiner Lederkoffer, ein paar Hocker noch. Auf dem schmalen Diwan saß sein Sekretär, Ernst Rossius. Vornübergebeugt, schreibend.
Sehr behutsam schloß sie die Tür. »Ich hab ihn eingesperrt,« lachte sie, »er muß mir ein Gedicht machen. Da ist er gut verwahrt, bis ich Zeit finde, mein Dessert zu essen. Ich freu mich schon drauf — es ist ein netter Junge!«

Er saß am Meere in der Silbernacht.
Er war ganz allein am Strande; sehr ferne träumte der Schein von Neuports Villen. Kein Mensch, kein Vogelschrei, kein leiser Hauch in der Luft. So still die Wasser, so weit.
Aber dorthin, ein wenig nach Norden hinauf, mußten die Dampfer fahren — Engländer, Franzosen, Italiener. Holländer auch, Norweger, Dänen und Griechen — nie, nie ein Deutscher.
Sie alle trugen Geschütze und Gewehre, Patronen und Granaten, Säbel und Pistolen. Trugen Äroplane und Unterseeboote, Revolverkanonen, Kriegsmaterial aller Art — was nur immer Amerika schaffen konnte, das blutende Deutschland in die Knie zu zwingen. Für sein Land — o ja, auch für sein Land hatten sie Kargo an Bord: ein paar Dutzend Postsäcke jedes neutrale Schiff. Die nahmen die Engländer ab in Kirkwall und Falmouth — nicht einmal ein paar Briefe gönnten die Herrn der Meere dem gehaßten Feind. Briefe — das erfrischte, das richtete auf, das war wie Brot — und Deutschland sollte verhungern.
Er saß am Meere in der Silbernacht. War hinausgeschritten aus Oakhurst, dem großen Besitze der Jeffersons. Saß im Sande, wartete auf Ivy, seine Verlobte.
Träumte hinaus.
Nun war er seit Wochen schon hier draußen. Er war in der heißen Stadt geblieben, solange es nur ging, hatte immer wieder seinen Besuch hinausgeschoben. War schließlich doch gekommen, froh am Ende, daß er da war. Mit Ivy schwamm er, ritt er, fuhr im Auto — lag in der Sonne des Strandes. Keinen sah er, außer seiner Verlobten. Ihren Vater noch, wenn er zum Wochenende herauskam, ihre Mutter auch und deren steifen Beau, den englischen Konsul. So wohl tat ihm diese Ruhe — und der reiche Luxus, der ihn umgab. Der gewaltige Park von Oakhurst mit dem Hirschgarten, mit den weiten grünen Rasenflächen, mit den unendlichen Treibhäusern. Hundert Gärtner arbeiteten da — und doch sah er kaum je einen, so groß war dieser Park. Sie fuhren herum in ihren Dogcarts, spannten auch Esel ein oder Ponys; spielten Golf, wenn gerade der alte Jefferson da war.
Abends aber, nach dem Essen, ging er allein aus dem Haus. Saß in den Dünen, träumte. Wartete bis Ivy ihm nachkam — dann wandelten sie am Strande.
Sie fragte wenig, ließ ihn sehr für sich. Aber sie lauschte, wenn er, selten genug, erzählte, hatte Interesse für alles, was er tat und sprach. Sie nahm ihn gut, schmiegte sich an, schmeichelte sich hinein in sein Empfinden. Ivy, dachte er, Efeu: die Eltern gaben ihr klug den Namen.
Sehr spät kam sie heute. Er sah ihre schlanke Gestalt weithin, aber er ging ihr nicht entgegen, blieb still sitzen, wartete, bis sie bei ihm war.
»Ich habe Ma zur Bahn gebracht,« sagte Ivy. »Sie ist zur Stadt gefahren.«
»Weil ihr Konsul nicht herauskam diese Woche?« fragte er.
Ivy nickte. »Ja. — Aber warum es sagen?«
»Warum nicht?« gab er zurück. »Es ist doch so.«
»Freilich ists so,« sagte sie. »Aber darum soll man es doch nicht sagen. Du weißt es — ich weiß es — wozu also? Es ist so deutsch, allen Dingen den rechten Namen zu geben.«
Er lachte. »Und so amerikanisch, es nicht zu tun! Und doch, Ivy, wie machst dus selbst? Wie nanntest du Frau van Neß?«
»Deine Mätresse!« antwortete sie. »Aber ich hatte einen guten Grund dazu. Dich wollte ich reizen — sie verletzen damit. Und — vielleicht auch — mir selber weh tun. Bei meiner Mutter ists anders — ich will nichts zerschlagen, will ihr helfen, wo ich kann. Das ist ihr Lebensglück: jung sein! Und sie ist jung, solange sie ihre Verehrer hat, und vor allem ihren Beau, den Generalkonsul.«
»Sag mal,« fragte er, »hilft ihr dein Vater auch?«
»Ich denke — ja,« sagte sie langsam. »Er läßt es gehn — und das ist gut so. Er hat seine Schauspielerinnen, seine Chormädchen — ich weiß das nicht, ich denk mirs nur so, weil jeder in Wallstreet sie hat. Und er kümmert sich nicht um das, was Mutter tut, sagt sich einfach: ›Es ist ganz selbstverständlich, daß es nur eine harmlose Freundschaft ist.‹ Und ich sage dasselbe, und du sollst es auch sagen — nun, dann ist es eben nicht anders! Vielleicht ist ja wirklich so: die beiden laden keinen dazu ein — wenn sie — allein sind.«
»Mir ists recht,« lachte er, »lügen wir uns hübsch alle was vor.«
Sie griff seine Hand, zog ihn hoch. »Ja doch!« rief sie. »Seit du mich bildest, find ich in jedem von den Büchern, die ich lesen muß, etwas, das mir gut gefällt! Paß auf — der Kardinal Meserein hat gesagt: »La vérité? Qu'est ce que c'est? — Une fable convenue!«
»Mazarin heißt der Kardinal,« verbesserte er. »Und dann hats auch nicht der gesagt, sondern Richelieu.«
»Aber ein Franzose wars!« erwiderte sie. »Und es stimmt, stimmt — und wenn er Billy Sunday hieße.«
Sie zog seinen Arm unter den ihren; langsam schritten sie weiter.
Sie sagte: »Wenn du es doch lernen wolltest — du und all ihr Deutschen!«
Er dachte: ›Wir können es nie lernen!‹ — O, es war schon richtig: das war das kluge Rezept, um groß zu werden, reich und mächtig. War die gescheiteste Lebensweisheit, für den einzelnen wie für die Völker. Drei klingende Wörtchen log der Franzos in die Welt hinaus: Liberté, Fraternité, Egalité — log sie so gut, daß jeder ihm glaubte — und er sich selber dazu. Und England sang: ›My home is my castle,‹ sagte dazu viele moralische Sprüchlein auf. Amerika aber übernahm alle Phrasen, die es nur irgendwo finden konnte und flickte sie zu einem Lorbeerkranz für ihr ruhmreiches Haupt. Grölte die absurdesten Lügen heraus, stempelte sie zu leuchtenden Wahrheiten. Freiheit — Gleichheit — Moral — alle Ideale: o Frankreich, England, Amerika!
Aber der Deutsche nannte die Dinge bei ihrem Namen. Und seine eigenen zuerst — da er die am besten kannte. Sagte; das ist schlecht bei uns — und das erst recht!
Da sang der Chor: ›Seht ihr, das ist das schlechteste Volk der Welt! — Sie sagens ja selbst! — Das schlechteste, das unfreieste, das unmoralischste —‹
Und zugleich glaubte der Deutsche, wie alle Menschen, an die schönen Phrasen, die die andern zu Wahrheiten münzten, glaubte: da ists besser als bei uns! Da hüten sie die höchsten Ideale der Menschheit — in England, Frankreich, Amerika!
Erkannte er aber all die Lügen, gab er auch fremden Dingen nun den rechten Namen — o so spie man ihn an in gerechtester Entrüstung. Und zu dem unfreiesten, zu dem unmoralischsten Menschen der Erde ward er nun auch der frechste Lügner der Welt — er, der es wagte, ›die heiligen Wahrheiten anzutasten‹. Der Letzte von allen war er, der Abschaum der Menschheit — dahin mußte ja ›deutsche Bildung führen und deutsche Kultur‹. Schon hatten die Hüter aller Ideale eine neue große Wahrheit geschmiedet, die alle Welt nun glaubte: deutsche Kultur, das ist das Krebsleiden der Menschheit, ist der Fluch des Antichrist, ist die Hölle selbst.
Und die Völker scharten sich um die heiligen Banner Englands, Frankreichs, Amerikas. Ausrotten, ausbrennen, aushungern mußte man diese schlangengiftige Pest der Deutschen!
So einfach war das Rezept, so lächerlich einfach. Jeder Franzose fühlte es, jeder Brite und Yankee: die Wahrheit ist ein gar gefährlich Ding, das man sehr, sehr selten nur gebrauchen kann. Aber die Lüge kann man immer gebrauchen. Jeden Tag, jede Stunde — immer von neuem!
Sie allein regiert die Welt.
Er dachte: ›Wir werden es nie lernen — nie! Wir — o jeder einzelne trägt irgendwo im Hirn versteckt eine glühende Sehnsucht nach aller Wahrheit. Die leuchtet durch, brennt ihm ein Mal auf die Stirne — das Kainszeichen der Deutschen.
Die kleine Ivy fühlt es gut. Sie braucht nicht die Weisheit Richelieus — ihr schenkte Natur den richtigen Instinkt: hüte dich vor der Wahrheit! Lüg dir ein hübsches Fabelchen zusammen — pfeifs in die Welt. Alle werden dir glauben, wenn du nur so tust, als ob du ihnen auch glaubst. Und versuch es nur: so leicht ists, so kinderleicht! Jeder Mensch begreifts auf der ganzen Welt — nur die Deutschen nicht, weil sie Barbaren sind, halbe Tiere.‹
Sie streichelte leise seine Hand. »Ihr werdet das Spiel verlieren,« sagte sie still. »Rumänien hat auch den Krieg erklärt.«
»Woher weißt dus?« fragte er.
Sie sagte: »Der Konsul hat vorhin angerufen, er hats Mutter gesagt — sie haben in Washington das Kabel bekommen vor einer Stunde erst. Er hat schon vor Wochen gesagt, daß es so kommen würde — ich wollte dir nicht davon sprechen, um dir nicht weh zu tun. Rumänien — das macht wieder sechshunderttausend Soldaten für die Alliierten. Und sie haben die besten Waffen und besten Geschütze — alles von Deutschland. Weißt du, daß ihr König ein Hohenzoller ist?«
Er nickte. Er preßte ihre Hand — sie verstand ihn gut. Schwieg. Still schritten sie über den Sand.
Er kannte ihn gut, diesen Hohenzollern. War mit ihm auf demselben Gymnasium gewesen, hatte den Prinzen ausgehöhnt und ausgelacht mit den andern Buben. Viele dummen Jungen drückten da die Schulbänke — aber so dumm war keiner wie der Prinz.
Prinz Kakadu nannten sie ihn.
Auf Schloß Jägerhof wohnte er. Das gehörte den Hohenzollern in jener Zeit — nun hatte es die Stadt gekauft und der Bürgermeister regierte da. Aber damals lag es einsam in seinem Parke, mitten in der Stadt, diente nur dem Prinzen, seinem Hofmeister und ein paar stillen Bedienten. Von dort ging er zum alten Gymnasium, das am Stadtgraben lag, vorbei am Malkasten, hinein in den schönen Hofgarten. Durch die Seufzerallee die Düsel entlang, an der Landskrone vorüber, über die Goldene Brücke dann beim Ananasberg. Jeden Morgen ging er dahin und jeden Mittag kam er zurück.
Einmal kam er nicht heim. Mittags nicht und nachmittags nicht und abends nicht. Der Hofmeister wurde unruhig, wurde aufgeregt, ganz verzweifelt am Ende. Sein Prinz war verschwunden.
Er lief zur Schule, zur Polizei dann, zur Gendarmerie. Ja, zu den Regimentern lief er, zu den Obersten der Neununddreißiger, der Husaren und Ulanen. Sein Prinz war weg — und alle sollten nun suchen helfen, die ganze Stadt.
Keiner fand ihn.
Mitten in der Nacht kam der Prinz nach Hause, ganz allein. Seltsam sah er aus — nur in Jacke und Weste, Schuhen und Strümpfen. Hemd fehlte, Hose und Unterhose. Völlig naß war er.
Er erzählte eine merkwürdige Geschichte. Als er nach Hause ging durch den Hofgarten, grade am hellen Mittag, da kamen drei Vermummte auf ihn zu. Griffen ihn, banden ihn, knebelten ihn. Schleppten ihn zum Rhein, zerrten ihn in ein Boot, segelten den Strom hinab. Banden ihn los auf dem Kahn — nahmen ihm nur die Kleider fort, damit er nicht entfliehn könnte. Aber in der Dunkelheit fand er doch einen günstigen Moment, als die drei eben nicht aufpaßten, sprang hinab in die Fluten, schwamm kühn zum Ufer hin. Die Räuber schossen nach ihm mit Flinten und Pistolen, ruderten ihm nach — verloren ihn doch in der Finsternis. Und er kam glücklich ans Land — bei Kaiserswerth etwa. Eilte zurück zum Schloß in der Nacht.
»Prinzenraub!« jammerte der arme Hofmeister, »Erpresserbande!« Schrie wieder nach Polizei und Militär, nach Staatsanwälten und Richtern. Man müsse die Grenze sperren, müsse die Räuber fangen, ehe sie entwischten nach Holland. Ein Hohenzollernprinz geraubt, am hellichten Tage, mitten in Deutschland am Ende des neunzehnten Jahrhunderts!
Oh, eine Schmach sei es, eine ewige Schande für die ganze Stadt!
Staatsanwälte und Richter, Polizeihauptleute und Obersten waren sehr bestürzt. Was sollten sie tun? So merkwürdig klang das alles — aber ein Prinz hatte es gesagt, ein Hohenzollernprinz! War verschwunden durch zwölf lange Stunden — kam zurück, pudelnaß, ohne Hemd und Hosen, um Mitternacht.
Man fand Hosen und Hemd, im Rheine, am nächsten Tage schon.
Da mußte etwas geschehn!
Und es wäre etwas geschehn — und wäre viel geschehn — ohne den Doktor Peter Schmitz, den Klassenlehrer der Obertertia. Der allein rettete die Behörden, rettete die Stadt.
Ihm fiel was ein — das er am selben Tage vorgetragen hatte in der Geschichtsstunde. Eine Stunde vor Mittag — da hatte es selbst der Prinz noch behalten.
Das war die Geschichte vom Raube des Kaiserknaben Heinrich IV. Den der Kölner Erzbischof Anno auf der Pfalz zu Kaiserswerth aus den Armen seiner Mutter Agnes raubte. Auf sein Schiff schleppte, den Rhein hinauf brachte und gefangensetzte im heiligen Köln.
Der Herr Ordinarius ging zum Jägerhof. Als er herauskam, strahlte sein feistes Gesicht, und er lachte sehr. Aber das Prinzlein heulte.
Es half ihm nichts, es mußte gestehn.
So wars:
Als er nach Hause ging, von der Schule, da passierte ihm etwas sehr Menschliches. Das kam öfter vor bei dem Prinzen, ob er gleich in Obertertia saß, und dazu zwei Jahre älter war als alle andern Jungen der Klasse. Er wußte gut, daß er viel zu alt war zu solchen Scherzen — so gescheit war er doch. Und er schämte sich, fürchtete sich vor seinen Hofmeister zu treten in dem Geruch.
Da lief er zum Rhein. Suchte ein stilles Plätzchen, zog Hosen aus, Unterhosen, Hemd. Wusch sie aus —
Aber der böse Rhein schickte eine freche Welle — da sprang er weg. Ließ die Wäsche fahren — die stahl der Strom.
Prinzenwäsche.
Der Prinz lief am Ufer, jammerte und heulte. Wagte sich gar in das Wasser bis an die Knie — das war so naß. Hemdchen und Höschen schwammen davon.
An den Weiden saß er und weinte. Bis ihm die Geschichte einfiel, die der Klassenlehrer eben erzählt hatte. Von dem jungen Hohenstaufenkaiser und dem bösen Erzbischof Anno. Von dem Schiff auf dem Rhein und der Pfalz bei Kaiserswerth.
Er war auch ein Prinz aus Königlichem Hause. War ein Hohenzoller — wie jener ein Hohenstaufe war.
Und etwas mußte er doch sagen, wenn er nach Hause kam.
Selbst konnte er nichts erfinden, dazu reichte es nicht. Aber die alte Suppe noch einmal aufwärmen, das ging — und er hatte schon das richtige Gefühl, daß sein Herr Hofmeister sie getreulich auslöffeln würde.
Der Dr. Schmitz schwieg nicht; am Abend noch wußte die ganze Stadt die Geschichte von den Höschen, aus denen ein Prinzenraub wurde. Und die Obersten der Regimenter, die Herren von der Polizei, vom Gericht und der Staatsanwaltschaft schickten stille Dankgebete zum Himmel, daß sie noch nichts getan hatten, noch gar nichts.
Aber am nächsten Tage, als der Prinz in der Zehnuhrpause auf den Spielplatz kam, da brach es los. Schrie aus hundert jungen Kehlen:
»Prinz Kakadu! Prinz Ka—ka—du!«
Keiner erfand es. Es war da, das Wort, wehte in der Luft, summte in den alten Räumen des Gymnasiums, füllte die Köpfe der blonden Jungen. Und brach los in der Freistunde, schlug um des Prinzen Kopf wie ein Trommelfeuer: »Prinz Ka—ka—du! Prinz Ka—ka—du!«
Es ist wahr, nur die ganz Kleinen schrien es, die Quartaner, Quintaner, Sextaner. Alle die andern wahrten das Gesicht, sagten kein Wort, blieben ruhig und still. Aber als der Prinz dann mutig wurde, sich einen der frechen Knirpse griff, um ihn durchzuprügeln, da legten sich die andern ins Mittel.
»Laß ihn gleich los!« befahl einer aus seiner eigenen Klasse. »Mach dir nicht die Hosen voll, dann werden sie dich nicht Prinz Kakadu nennen!«
In den unteren Klassen hagelte es Strafen, die gar nichts nutzten. Jeden Tag wurde das Geschrei lauter und wilder. Und die Kinder aller andern Schulen griffen es auf. Wo sich der Prinz nur sehn ließ, scholl es ihm entgegen: »Prinz Ka—ka—du!«
Eine Woche dauerte es, dann zog der Prinz ab mit seinem Hofmeister. Aber an die Woche wird er denken sein Leben lang.
Nach Rumänien kam er, ein paar Jahre später, wo sein Onkel König war und die Tante Königin. Die adoptierten ihn, wollten zum Erben wieder einen Deutschen, einen vom Rhein dazu, wie sie selbst. Deutsch waren sie und deutsch war ihr Hof. Ein Hohenzoller war der König, ein Hohenzoller sein Erbe. Und die Königin nannte sich Carmen Sylva, dachte nun gewiß, daß sie eine deutsche Dichterin sei, und machte Verse, die sich richtig reimten, zum Preise des Rheins. Die Studenten sangen sie, zu Bonn, wenn sie sehr viel Bowle getrunken hatten,
»Am ganzen Rheine der schönste Fleck,
Das ist der Bahnhof von Rolandseck —«
Der König starb und die Königin — beide in diesem Jahre. Und kaum hatten sie die Augen geschlossen, da verriet der junge König seiner Väter Land. Zog den blauen Rock der Hohenzollern aus, schlüpfte in die goldlitzige Hose nach englischem Schnitt. Er, Prinz Kakadu —
Frank Braun preßte die Hände zusammen. Wie ein Stoßgebet kam es aus seinen Zähnen: »So soll er sie sich wieder einmal vollmachen, die neuen Hosen! Dazu möge ihm Mackensen helfen — und der Hindenburger!«
»Was sagst du?« fragte Ivy.
»Nichts, nichts!« erwiderte er.
Sie sagte: »Der König ist ein Hohenzoller. Aber seine Frau ist eine Koburgerin. Auch der englische Statthalter in Kanada ist ein Koburger — der hat wieder eine Hohenzollern zur Frau. Die arbeitet auch, was sie nur kann, für England und gegen Deutschland!«
»Alles vom Konsul?« zischte er.
»Nein!« erwiderte sie. — »Die Koburger sind die vornehmste Familie in Europa. So etwa wie die Vanderbilts bei uns oder die Astors. Die Koburger geben alljährlich ein Buch heraus, so wie das ›Social Register‹ von Neuyork. Und dies Buch hat mir der Konsul neulich mitgebracht — daher weiß ichs.«
»Die Koburger geben gar nichts heraus!« sagte er. »Der Kalender erscheint zufällig in Koburg und heißt darum der Koburger.«
»Gut, gut,« lachte sie, »meinetwegen! Als obs nicht völlig gleichgültig wäre! Weißt du, daß auch der abgesetzte König von Portugal — Manuel heißt er — ein Koburger ist und wieder eine Hohenzollern zur Frau hat? Der will auch in die englische Armee eintreten! So klug sind die Engländer — ich bewundere sie — wirklich!«
Er blieb stehn, starrte sie an. »Ich auch, Ivy, ich auch! Ich bewundere sie — wirklich! Und sicher ehrlich! Sie sind so zehntausendmal klüger als wir. — Weißt du, daß die Revolution in Lissabon, die den Vater Manuels und seinen Bruder auf der Straße ermordete, nur mit englischem Gelde gemacht war? Daß die republikanische Regierung von heute, die auf Befehl Englands unsere Schiffe stahl und den Krieg uns erklärte, nur von England bezahlt ist? Warte, ich will dir noch mehr sagen — was ich neulich im Klub der portugiesischen Monarchisten hörte. Die wandten sich flehend an den deutschen Kaiser, er möge ihnen einen seiner Prinzen schicken, beschworen zugleich in den höchsten Tönen ihre Liebe und Bewunderung zu Deutschland. Weißt du, was unsere Diplomaten den Kaiser antworten machten? Das sei eben der Kern der monarchistischen Idee, daß man treu zum angestammten Herrscherhause halte — und zudem habe ja ihr verbannter König eine Hohenzollern zur Frau, sei also eng verbunden dem Kaiserhause! Zu Beginn des Krieges war das — als die Monarchisten im Norden einen großen Aufstand vorbereiteten, für den ihnen eines nur fehlte: der klingende Name des Führers. Das war die deutsche Antwort: ehrlich und — — ungeheuer dumm. Die Engländer spielten ihr Spiel besser — wie in Italien, wie in Rumänien, wie hier im Lande und überall in der Welt. Alles hat der kleine Manuel durch sie verloren, Krone und Reich und jeden letzten Cent! Nun geben sie ihm eine nette Pension jeden Monat, das ist so lieb von ihnen, so großmütig! Davon lebt er, davon bezahlt er seine Mätresse. Und die — sie tanzt im Hippodrom, wollen wir nicht hingehn? Gaby Deslys nennt sie sich, aber sie stammt aus Olmütz — die gibt jedem britischen Rekruten einen Kuß, macht nun hier mit ihren Beinen Propaganda, während ihr geliebter König gern englischer Leutnant werden möchte. Sehr dankbar müssen sie beide sein — und mit ihrer Dankbarkeit kann man so gut Reklame machen! Ja, ich bewundere England, das allmächtige England, das die herrliche Gabe hat, alle infamsten Lügen zu strahlenden Wahrheiten zu machen. Du hast dreimal recht, kleine Ivy, nie werden wir diesen Krieg gewinnen — da wir nie lernen werden, gut zu lügen!«
Er schrie es heraus, schluchzte, hustete krampfhaft. Sie legte ihren Arm auf seine Schultern, streichelte zärtlich seine heiße Wange. »Sei still,« flüsterte sie, »sei still — du kannst da nicht helfen!«
»Es war zu vermeiden,« fuhr er fort, leise unhörbar fast. »Es war zu vermeiden, daß sie gegen uns gingen: Italien, Rumänien, Portugal! Wenn wir ein klein wenig nur gelernt hätten von England. Dreieinhalb Millionen Soldaten wären weniger gegen uns! Noch halten wir fest, noch stehn wir, in Feindesland, ungebrochen dem fünffach stärkeren Feind. Dann aber hätten wir längst den Krieg gewonnen — längst wäre Frieden! Ganz gewiß war Deutschland stärker im ersten Kriegsjahre, aber der Engländer log der Welt vor: ›Wir sinds!‹ Und alle Völker glaubten ihm, und seine Lüge war stärker als die deutsche Wahrheit, viel, viel stärker! — Nach Osten und Westen schlug der Deutsche im ersten Kriegsjahre und hielt seine Stoßkraft weit ins zweite hinein. Im dritten nun steht er, steht fest und gut. Im vierten aber, im vierten —« er unterbrach sich, stöhnte. »Hundertundfünfzig Millionen sind auf unserer Seite — das ist hoch gerechnet! Aber achthundert Millionen zählen die Gegner. Und die ganze neutrale Welt wird reich an unserem Blute, läßt England und Frankreich hochleben, liefert unseren Feinden Waffen und Munition, Lebensmittel und Gold, was sie nur haben wollen. ›Die Lüge ist das Salz der Erde‹ — das ist ein russisches Sprichwort, aber die Engländer habens zum Evangelium gemacht. Und Englands Lüge ist längst zur Wahrheit geworden: sie sind die viel Stärkeren! Nur ihr fehlt noch — und euch wird der Engländer ganz sicher auch noch hineinhetzen in den Krieg — der und unserer Diplomaten verbrecherische Dummheit. Da müssen wir sterben!«
»Schweig doch,« schmeichelte sie, »schweig doch!« Sie schlang ihre Arme um ihn, küßte ihm Augen und Mund. »Sieh doch — so schön ist die Nacht!«
Flüssiges Silber rings. Alles aufgelöst darin — Sand, Meer, Himmel und Luft — Silber nur, Silber. Und sie allein, Ivy und er. Kein Mensch sonst, kein Vogelschrei, kein leiser Hauch in der Luft.
Er hob die Augen, blickte ringsum. Kühler, schmeichelnder Silbernebel — und die Sterne schnuppten hindurch. Auf dem Silbermeer ein Schein, den der Mond warf — wie ein heller Weg, der weit hinausführte zu einem leuchtenden Platz. Da sollte es tanzen — Wasserfrauen, Mondfrauen — viele — in glitzernden Silberschleiern —
Und doch war es gut, daß keines dort tanzte. Daß der weiße Platz im Meere still war und ganz verlassen. Leer und so einsam. Daß nur von ihrem Auge der Mondweg dahin führte, und daß diesen Weg nur ihre Sehnsucht schreiten konnte.
Ihrer beiden Sehnsucht, die eines ward. Seine — und die des blonden Mädchens —
Die auch? Die Ivys auch?
Er sah sie an — und sie nickte. Verstand sie seine Träume? — Ah, er wollte es glauben.
Sie gingen Hand in Hand in der Silbernacht. Still, schweigend — sehr einsam gingen sie.
So leicht, so still, als ob ihr Fuß kaum den Boden rühre. Wie ein Gleiten war es, wie ein Schweben. Sie glitten über den Sand — oder war es das Wasser?
Flüssiges Silber wars.
Zwei Sehnsüchte — die eine wurden. Oder: zwei Seelen —
Schwebten über das Wasser — oder war es die Luft? Alles war aufgelöst — Silber nur, Silber. Über den Meerweg zum Mondplatz hin.
Zwei Seelen — die eine wurden. Eine Seele: ihrer beiden Seele.
Alles war aufgelöst in dem Silbernebel — Sand, Meer, Himmel und Luft. Und ihre Seele war der leuchtende Nebel — der war und nichts sonst.
Nichts, nichts in allen Welten —
Nur ihrer Sehnsucht Silberseele.
Die schwebte, schwebte in Ewigkeiten.
Silberfüße — Silberflügel — —
Silbernacht —
Da schrie es — Ivy schrie. Sprang zur Seite, riß ihn zurück.
Ein Aas lag vor ihrem Fuß. Ein versoffener Hund — oder wars eine Katze?
Weiß war das Fell —
Sie schüttelte sich vor Ekel. »Fort,« bat sie, »fort!«
»Wo sind die Pferde?« fragte er.
Sie antwortete: »Jack wartet mit ihnen. Zu den Ulmen hab ich ihn bestellt.«
Sie eilten die Düne hinauf. Sie fanden die Schimmelhengste, sprangen hinauf.
»Hetz!« rief er. »Ivy — hetz! In den Mond hinein!«
Sie jagten, jagten — —
So schön war die Nacht —
An dem Tage, als Direktor André herauskam nach Neuport, war er ganz allein in Oakhurst. Ivy war zur Stadt gefahren mit der Mutter.
Sie war hineingesprungen in sein Schlafzimmer am frühen Morgen, auf sein Bett mit einem Satz. Weckte ihn mit einem raschen Kuß. »Wir sind zurück zum Abend!« rief sie.
»Was gibt es?« fragte er.
»O nichts!« machte sie. »Papa war schon zwei Wochen nicht draußen, bat uns, ihn abzuholen im Büro. Mit ihm zu frühstücken in seinem Klub.«
Küßte ihn noch einmal, sprang auf, huschte hinaus.
Er saß an seinem Schreibtisch. Nahm eine Feder auf, legte sie wieder fort. Griff einen Bleistift, dann wieder die Feder. Schob rasch Papier zurecht, kritzelte darauf.
»Liebe Lotte —« wurde es. Aber er wollte gar keinen Brief schreiben.
Er nahm die Post auf, die vor ihm lag, zählte seine Briefe. Sechs — acht — neun. Er öffnete keinen. Er nahm einen großen Umschlag, gab sie alle hinein, schrieb die Adresse seines Sekretärs darauf. Mochte der sie lesen; der konnte ihm später Bescheid sagen. Er griff die Zeitungen — aber er las sie nicht. Direktor André würde ja heute kommen — der hatte alles in der Bahn gelesen, konnte ihm mitteilen, was geschehn war.
Er steckte die Blätter in den großen Papierkorb.
Dann fiel ihm ein, daß er auch die Briefumschläge hineinwerfen könnte. Das füllte.
Sehr ernst machte er den großen Umschlag wieder auf, zerriß ihn. öffnete jeden der neun Briefe, vorsichtig, daß er nichts vom Inhalt sah, adressierte ein neues Kuvert, gab die offenen Briefe hinein, schloß es.
Voller wurde der Papierkorb, bunter der Inhalt. Er sah hinein, freute sich. Noch etwas? Ah — das bekritzelte Papier. Ein paar Papierfetzen dann, auf die er gestern geschrieben. Zwei leere Zigarettenschachteln.
Er erinnerte sich, daß er ein neues Stück Seife heute morgen genommen hatte. Rasch stand er auf, eilte ins Badezimmer, nahm das bunte Papier vom Toilettentisch. Trug es zurück, warf es in den Papierkorb.
Nun mochte schon ein Gedanke kommen — etwas, das ihn interessierte, das ihn beschäftigen würde. Vielleicht etwas, das ihm die Feder in die Hand gab, das aus der Feder auf das Papier floß. Ein Träumen vielleicht, das sich wieder fand in ihm, ein rasches Bild aus einem alten Rausch. Etwas, das ihn festhielt auf Sekunden — auf Stunden auch.
Wildes — zartes. Leichtes oder tiefes. Grausames: rotes oder hellichtes und sehr süßes — wie es der Wind hereinwehte vom Meere her.
Irgendeine Rolle spielte der Papierkorb dabei. Der mußte leer sein an jedem Morgen, und mußte sich vollfressen. Sonst kam nichts — gar nichts.
Er bekam nur sein gewöhnliches Futter, wie jeder Papierkorb, mußte fürlieb nehmen mit dem, was eben abfiel. Es nutzte nichts, wenn man ihn künstlich stopfte.
Das hatte er versucht, mehr als einmal. Hatte sich Papier kommen lassen, Zeitungen, Schachteln, hoch hinauf ihn gefüllt. Doch es war, als ob er das nur im Maule hielte, nicht hineinfresse. Jedes Verdauen ablehnte —
Aber dankbar war er, wenn man an etwas dachte, das ihm ehrlich zukam und das etwas aus dem Wege lag. Wie das Seifenpapier heute. Das erkannte jeder Papierkorb an.
Frank Braun lachte nicht darüber. Eine Seele hatten die Dinge.
— Das war gewiß, daß der Professor Södering viel besser sprach, wenn sein Regenschirm dabei war. Still in der Ecke stand, möglichst nahe bei ihm. Zuhörte. Sie hatten es versucht, hatten den Schirm weggenommen, ohne daß der Professor es wußte. Einmal nur — nie wieder — das war zu gefährlich. Tausend Dollar hatte er weniger erredet an diesem Tage.
Konnte Paul Conchas, der Kanonenkönig, seine schweren Kugeln fangen, wenn er nicht einen Kupferpfennig im Schuh trug? Ein alter Nagel brachte Max Reinhardt seine Erfolge, und dem Hötzendorf der Brief, den er jeden Morgen bekam von einer schönen Frau. Einen vom englischen Unterhaus kannte er, der nur sprechen konnte, wenn er die rote Weste anhatte, und einen Jockey, der nur gut ritt, wenn er grünweiße Farben trug. Wenn er der Sonnenseite seinen Stier weihen konnte, war Rafael Gallo der genialste Torero — er, der ein elender Fleischerlehrling war, wenn ein schwarzer Hund ihm durch den Sand lief. Des großen Napoleon Karneol — Sarasates kleine Goldfiedel —
Er dachte: eine Seele haben die Dinge. Alle — so gut wie die Menschen. Blumen, Tiere, Steine, Bilder und Bücher, Häuser, Tische und Stühle. Eine Seele haben sie — Farben und Düfte — Sterne und Meere. Und Nägel auch, Regenschirme, Ringe — Papierkörbe.
Und manchmal geschah es, daß solche Seelen der Dinge sich offenbarten, in Beziehung traten zu Menschen. Irgendeine chemische Sympathie brachte sie einander nahe, eine Ausdünstung vielleicht, ein Duft. Oder ein atmosphärischer Zusammenklang, eine harmonische Wellenbewegung, die von ihnen ausstrahlte. Irgend etwas. Er wußte es nicht — keiner wußte es — heute. Aber einmal würde man es schon wissen.
Das war es, was auch den einen Menschen zum andern führte, was Abneigung schuf oder Zuneigung — Liebe oder Haß. War das — was man die Seele nannte.
Oder ihre Äußerung — ihr Ausfluß. Sakti nannten es die Inder vor manchen tausend Jahren, legten ihm so hohe Bedeutung bei, daß sie zum eigenen Wesen es dachten, zu dem, was recht eigentlich alles tat in den sieben Welten. Nichts tat Shiva, der Zerstörer — alles geschah durch Durga, seine Sakti.
War es anders bei Jehova, der Juden Gott? Nicht er kam zu Maria, als er der Welt den Erlöser schenkte — seine Sakti sandte er, seine Seele: den Heiligen Geist.
Und die Griechen sahen so viele Seelen der Dinge. Ließen Saktis lebendig werden aus Sternen und Winden, aus Seen und Wiesen, aus Feuer, Luft, Steinen und Bäumen. Dryaden, Nymphen, Najaden — wie Elfen, Nixen, Feen und Alben im Norden wesenhaft waren.
Alles lebte — überall atmeten Seelen.
Das war die sichtbare Welt. Und der große Gott, der sie niederwarf, der Gott aus Nazareth, der Gott alles Unsichtbaren, vermochte dennoch nicht sie ganz auszutilgen. Die christliche Kirche leugnete die Seelen der Dinge durchaus nicht — nur nannte sie sie Dämone. Geister des Bösen — Teufel. Schon die Farben der Blumen verdammte der heilige Hieronymus — als des Satans lockenden Ausfluß.
Die christliche Wissenschaft, durch Jahrhunderte jämmerlich stolpernd in metaphysischen Bleistiefeln, war pfäffischer noch als alle Kirchen. Zerschlug alles, was Leben hatte in der Außenwelt, ließ den armen Menschen herumtappen in einem dunkeln, todkalten Sumpf. Glaubte endlich ihre jämmerliche Metzgerherrschaft zum großen Siege zu führen, als sie den Teufel absetzte — den doch noch Luther in hohen Ehren hielt.
Da fiel sie, da mußte sie fallen —
Der Gedanke sagte: ›Kein Hell ohne Dunkel. Kein Ja ohne Nein. Kein Gott ist möglich ohne den Teufel.‹
Und auch: ›Kein Ich — ohne die Außenwelt. Keine Seele des Ichs ohne die Seelen aller andern Dinge.‹
Leuchten wurde wieder in der Welt. Farben wuchsen und Klänge. Seelen, die glaubten, suchten einander.
Fanden sich manchmal — wie fremd sie auch waren.
— Seltsam — etwas verband ihn dem Papierkorb. Nicht dem grade, der neben ihm stand — nicht dem nur. Jedem — dem ganzen Geschlecht der Papierkörbe. Er hatte feine gehabt, blecherne, lackiert mit bunten Blumen drauf, pappene, goldbeklebt und mit Zierhenkeln, hölzerne mit brandgemalten Verschen. Ledergepunzte, rohrgeflochtene, einen gar, der in einem gestickten Überzug steckte. Armselige Körbe dann, alte Weinkisten, ausgediente Wassereimer, eine zerschlagene Hundehütte einmal. Runde Papierkörbe, viereckige und achteckige, breite und schmale, dicke, dünne, große und kleine.
Aber sie offenbarten ihm alle ihre Seelen, gleich am ersten Tage, sowie sie neben ihm standen, am rechten Tischende. Manche freilich hatten ihre Eigentümlichkeiten, die man erst mit der Zeit lernte. Einer konnte den Tabakgeruch nicht vertragen, mochte es nicht, wenn er in ihn den Aschenbecher ausleerte. Andere mochten grade wieder die Zigarettenreste für ihr Leben gern, konnten nicht genug davon bekommen, freuten sich, wenn er ihnen zu Ehren ein paar mehr rauchte. Einer, ein langer, schmaler, der wie ein Ofenrohr aussah, hatte einmal einen halbverwesten Fisch bekommen, den die Katze ins Zimmer geschleppt hatte; seither verlangte er nach totem Fisch. Er gab sich alle Mühe, ihn zufrieden zu stellen, ließ ein Stück beiseite legen, wenns Fisch gab, es anfaulen im Garten, gab ihm das am nächsten Tage. Es stank gräßlich — und doch war der Papierkorb nicht zufrieden: es mußte Fisch aus dem Zimmer sein, Fisch, der ihm ehrlich zukam. Aber die Katze brachte keinen mehr. Bisher war der Papierkorb erstaunlich gut gewesen — nun war nichts mehr mit ihm anzustellen. Er mußte ihn abschaffen.
Der, den er in Oakhurst hatte, liebte die kleinen Stummeln nicht. Wenigstens halb mußten die Zigaretten sein, wenn sie ihm schmecken sollten. Und er mußte den Aschenbecher immer von neuem in ihn ausleeren, alle zehn Minuten. Es war ein sehr vornehmer Papierkorb, aus schwarzem, chinesischem Geflecht.
Sehr zärtlich sah er ihn an —
Auf eine der Zeitungen fiel sein Blick, die im Papierkorb staken. Grade die eine zolldicke Überschrift konnte er lesen:
»Neue furchtbare Niederlage der Deutschen und Ungarn in Siebenbürgen.«
Er wußte, daß es eine Lüge war. Eine der hundert, die England jeden Tag übers Meer spie.
Warum mußte der Papierkorb ihm das zeigen? War das der Dank für zwei Zigaretten, die er kaum angeraucht hatte? — Und für das schöne blaue Seifenpapier?
— Nun war er da, nun hatte er ihn — der Gedanke an den Krieg. Wieder einmal, wie so viele tausend Male. Ließ ihn nicht los, faßte ihn fest, wie er tausend Millionen festhielt an jedem Tage.
Möglichkeiten, Wünsche, Träume — dann — dann — und dann —
Fliegen spielten um ihn herum, ließen sich nicht wegjagen. Summten ihm dicht an den Ohren vorbei, kitzelten ihn am Halse, setzten sich auf die Stirn, auf die Hand. Feierten Hochzeit grade auf seiner Nasenspitze — er konnte es gut sehn, wenn er hinunterschielte. Er schrie sie an, schlug mit dem Taschentuch durch die Luft. Aber sie kamen wieder, immer von neuem. Da sprang er auf, fing eine nach der andern in der hohlen Hand, setzte sie in die Streichholzschachtel. Ein paar Dutzend hatte er, rüttelte sie gut durcheinander.
Das Brautpaar fing er auch. Aber er trug es vorsichtig zum Fenster, warf es hinaus in den Garten. Dachte: ›Liebt euch, legt Eier. Setzt viele neue Fliegen in die Welt. Und jede davon soll einen Yankee ärgern.‹
Er ging zurück zum Schreibtisch, setzte sich wieder. Nahm behutsam eine Fliege aus der Schachtel. Ein Spiel fiel ihm ein, das er einmal gespielt als kleiner Junge. Damals stellten die Fliegen seine Lehrer vor, die ihn quälten und die er haßte, so stark er nur konnte. Und er spielte wieder das Knabenspiel.
»Du bist der Jansen,« murmelte er. »Du hast mich geschlagen, als du in die Klasse kamst — sagtest, ich hätte dich nicht gegrüßt auf der Straße. Wußtest recht gut, daß ich dich gar nicht gesehn hatte. Warte du!« Einen Flügel riß er der Fliege aus. »Und dann hast du mir ›Mangelhaft‹ unter meine Aufgabe gesetzt, und dem Kramer ›Genügend‹ — obwohl wir beide wörtlich abgeschrieben hatten vom Primus selbst. Warte nur, warte!« Den andern Flügel kostete der Fliege diese Ungerechtigkeit und noch ein Bein dazu. Wieder ein Bein riß er aus und noch eins — o die Fliege hatte nicht Beine genug für alles, was ihm der Mathematikprofessor angetan hatte. In das Tintenfaß warf er den gliederlosen Leib.
Nahm die nächste Fliege. »Du bist der Northcliffe!« sagte er. »Warte, ich werde die Lügenbeine dir ausreißen! Sechs Beine nur — zwei Flügel dazu: sechstausend Beine solltest du haben!«
Edward Grey richtete er hin, Poincaré und Clemenceau. Den Zaren, König Albert, König Peter und seine Jammerprinzen. Eine ganz kleine Fliege suchte er aus für den König der Katzelmacher, es war sehr schwer, ihre Beine einzeln zu erwischen. Auch der Mikado wurde entbeint.
Dann kamen die Amerikaner dran, die vor London krochen und englisches Gold eintauschten gegen deutsches Blut. Die Wilson und Lansing, die Morgan und Schwab. — Die Hetzer und Schreier, die ihm einfielen, die d'Annunzio und Ibañez, die Beck und Ochs, all die bezahlten Gauner der franco-britischen Lügenmacher auf beiden Seiten des Atlantik. Heraus die Beine und ins Tintenfaß!
Er war zu Ende, als er kaum angefangen. So viele waren noch abzutun. So viele.
Nur zwei Fliegen waren noch da. »Du bist Prinz Kakadu!« sagte er zu der ersten. »Es ist zu viel Ehre, wenn ich die Beine dir ausreiße. Du solltest ersticken — verrecken — in deinem eigenen Mist!«
Wie sie war, warf er die Fliege ins Tintenfaß.
Nahm die letzte aus seiner Schachtel. Zögerte: »Wer sollst du sein?«
Dann entschloß er sich: »Du — du bist der deutsche Diplomat. Du bist nicht gemein — nur gemeingefährlich. Du bist kein Schuft — bist kein Lügner — bist nicht bestochen und bezahlt. Nur — ungeheuer dumm bist du! Dir tue ich eine große Wohltat an, wenn ich dich totmache — du fliegst doch nur jeder Spinne ins Netz, die dich lebendig dann aussaugt.«
Er zerquetschte die Fliege zwischen den Fingern, strich sie zu den andern ins Tintenfaß.
Nahm es auf, goß Fliegen und Tinte in den Papierkorb, über die Zeitungen hin.
»Ich hab mir manches von dir gefallen lassen,« sprach er zu ihm, »nun ists genug!« Er schellte, gab dem Diener den Auftrag, den Papierkorb wegzuschaffen, ihm einen andern zu bringen.
Und er winkte mit der Hand. »Steh du irgendwo in einem Fremdenzimmer, das alle drei Jahre mal benutzt wird, du dummer Korb! Addio, hungre drauf los, bis du grün wirst!«
Dann kam Direktor André.
Aus der Türe rief er: »Ich habe ein Loch gefunden! Ein wundervolles Loch! Das herrlichste Loch der Erde! Herrgott, Sie müssen es sehn, Doktor, Sie werden außer sich sein vor Begeisterung — grade wie ich. Ein Loch — sage ich Ihnen — Mensch, ein Loch —« Er unterbrach sich: »Wo sind die Jeffersons?«
Frank Braun sagte, daß sie in der Stadt wären. Daß die Damen zum Abend wiederkämen — da müsse er schon die Nacht über hierbleiben.
André setzte sich. »Ich komme zu den Jeffersons zuerst — sie haben fünfzehntausend bei meinem ›Lila Domino‹ zugesetzt. Dafür werde ich sie jetzt an meinem Loch beteiligen. Zwanzigtausend sollen sie geben — das Fünffache werden sie wiederkriegen. Dies Loch, Herr, mein Loch —«
Er brannte eine starke Importe an, lehnte sich zurück in den Schaukelstuhl. Strahlte, erzählte von seinem Loch.
In Rockville-Center war es — mit der Bahn fuhr man eine Stunde dahin von Neuyork. Einmal — vor neun oder zehn Jahren — wollten die Leute da einen Stausee machen, alle umliegenden Orte mit Wasser zu versorgen. Sie gruben das Loch, zwanzig Meter tief, machten es wasserdicht, umkleideten Boden und Wände mit einer dicken Zementschicht. Dann stellte sich heraus, daß man nirgend in der Nähe genug Wasser hatte, um den riesigen See zu füllen. So blieb es liegen, das Loch.
»Achtzigtausend Personen gehn hinein,« rief der Direktor. »Achtzigtausend wenigstens, wenn ich nur zwei Drittel meines Lochs fülle und das andere Drittel für ein Festspiel lasse. Und wenn ich Tribünen baue, ringsherum, schaff ich für eine viertel Million Menschen Platz. Es schreit nach Gold — das Loch! — Wenn ich nur wüßte, was ich drin anfangen soll — haben Sie keinen Gedanken, Doktor?«
»Vielleicht können Sie es dem Gargantua als Spucknapf verkaufen,« schlug Frank Braun vor. »Der muß doch einen haben, wenn er mal nach Amerika kommt. Ihr Loch —«
»Mein Loch ist eine nackte Tatsache!« rief André. »Ist durchaus kein Witz. Ich mache schon was draus, sowie ich das nötige Kapital dazu habe — und das bring ich in acht Tagen auf. Mein Loch bedeutet die Möglichkeit, eine viertel Million Menschen hinsetzen zu können — das allein ist zwei Dollar wert für den Platz!« Er wurde nachdenklich, kraute sich am Kinn. »Parsifal vielleicht,« überlegte er, »Parsifal fürs Volk? — Natürlich versteht kein Mensch auch nur ein Tönchen. Oder ich laß den Bryan reden — nur kann den jeder billiger hören, oder gar umsonst, wenn er will! Am Ende ist doch ein Champion-Boxkampf das beste — Johnsons Revanche an Jess Villard — was meinen Sie? Ich lasse hunderttausend Ferngläser ankaufen — für einen Dollar das Stück, fünf zum Verkauf — Ferngläser, denn sonst kann man gar nichts sehn in dem Riesenloch. Und denken Sie an die Preise vorne, wo man mit bloßem Auge die Kämpfer sehn kann! Hundert Dollar — zweihundert, fünfhundert jeder Platz! Es ist ein Kapital, mein Loch, ein vergrabener Schatz, den ich heben muß.«
Er paffte dicke Rauchwolken, schwärmte weiter mit leuchtendem Auge von seinem Wunderloche in Rockville-Center. Millionen schlug er heraus.
Dann sprach er vom Kriege. Phantastisch, sehr romantisch, immer rechnend mit seltsamen Überraschungen und grotesken Möglichkeiten. Hatte er nicht beim Studpoker einmal Carusos vier Assen geschlagen mit einem Straight Flush? — Möglich wars, durchaus möglich!
Wenn — wenn — und wenn —
So wohltuend war der strahlende Optimismus dieses geborenen Spielers. So überzeugt, so siegesfroh — da verkrochen sich sehr beschämt in die Ritzen alle ›Aber‹.
Alle die Rückschläge in West und Ost — ach, das mache gar nichts. Waren nicht auch ihm ein Dutzend Sachen schief gegangen in den letzten Jahren? Die Ringkämpfe — drei Filme — ein halbes Dutzend Operetten? Sein Geld und das seiner Freunde war beim Teufel —
Da fand er das Loch in Rockville-Center!
Und Deutschland würde auch sein Loch finden — sein herrliches Loch — seinen Straight Flush, der die alliierte Karte schlagen würde, und wenn sie zwanzig Assen hätte!
Er stand auf, schellte. »Ich will in mein Zimmer gehn,« sagte er, »mich ein wenig waschen und zurecht machen. Wollen wir vor dem Frühstück noch ein bissel am Meere spazieren? — Gut, ich komme Sie abholen.«
Er ging — und mit ihm das herrliche Loch und der schönste Flush. All seine schillernden ›Wenn‹ flogen mit ihm hinaus und all die schwarzen ›Aber‹ krochen aus ihren Ritzen. Huschten herum, schlugen die unsichtbaren Flügel.
Frank Braun trat an das offene Fenster, blickte hinaus aufs Meer.
»Und wenn es anders kommt! — Wenn es doch anders kommt?!« murmelte er.
Spät erst kamen die Damen zurück. Direktor André ließ ihnen kaum Zeit, die Hüte abzulegen: er brannte lichterloh, mußte in Flammen setzen alles, was um ihn herum saß.
Er war sehr beliebt bei den Jeffersons, wie in allen Häusern — sie würden ihm Geld gegeben haben für jede dümmste Operette.
Diesmal aber schnappte Frau Alice recht ein. Dies Loch — dies Riesenloch in Rockville-Center — dies Loch, das da lag und den Himmel angähnte — das mußte jedes amerikanische Hirn mächtig aufregen. Und wenn es weiter nichts hatte als das eine: es ist — garantiert! — das größte Loch auf der Welt!
Das größte Loch — das mußte Amerika haben — natürlich. Schon darum mußte man sich dafür interessieren: das war Yankee-Evangelium. Ganz warm wurde Alice Jefferson, machte selbst Vorschläge, was man wohl anstellen könnte mit dem Wunderloch.
Ein Shakespeare-Festspiel?! Nein, das ginge nicht — das kam ein Jahr zu spät. War denn sonst niemand da, den man befestspielen konnte? Vielleicht konnte man auch den See mit Wasser füllen und das deutsche Unterseeboot mieten, das in Norfolk angekommen war. Das konnte Kriegsspiele machen, konnte tauchen und hochkommen, konnte ein paar andere Schiffe herunterschießen. Oder ein Kampf mit einem Hydroplan?
Nein, das ging nicht. Das würde die Sache viel zu teuer machen — und man wollte Gold herausschaffen aus dem Loch — und nicht welches hineinwerfen.
Sie kamen zu keinem Entschluß. Aber sie berieten eifrig die Gründung. Wenigstens die Hälfte des erforderlichen Kapitals wollte Frau Jefferson hineinstecken — und der Direktor wollte nicht darauf eingehn. Er hatte noch manche Freunde — die mußte er auch beteiligen bei dieser großartigen Gelegenheit. Für fünfzigtausend wolle er ihr Anteile verkaufen — das sei ein Fünftel des Betriebskapitals — mehr könne er ihr nicht abgeben, wirklich nicht —
— Ivy kam heran, legte ihre Hand auf Frank Brauns Schulter, winkte ihm. Er folgte ihr hinaus in das nächste Zimmer.
Sie sagte: »Weißt du, weshalb mich Papa zur Stadt kommen ließ? Der Herzog von Stratford hat um meine Hand angehalten!«
»Was hast du geantwortet?« fragte er.
»Daß ich herzlich danke,« lachte sie. »Daß ich schon versorgt sei fürs erste, daß ich dich habe und einstweilen noch ganz zufrieden sei mit dir.«
Sie zog die Lippen hoch, ein feuchter Glanz lag auf ihren Augen. »Ich hab noch gesagt, daß er sich nur gedulden möge. Daß — vielleicht, nur vielleicht — du doch eine Enttäuschung sein würdest. Und daß ich dann — später — vielleicht! — auf ihn zurückkommen würde.«
»Das hast du ihm gesagt?« flüsterte er.
Sie sagte: »Ja — wörtlich so. Und du weißt nun — daß — daß ich rückversichert bin.«
Er ging mit langen Schritten durch sein Zimmer, wartete auf Ivy. Er wollte noch mit ihr reden in dieser Nacht, hatte sie gebeten zu ihm zu kommen auf eine Viertelstunde.
Also der Herzog von Stratford — überlegte er. Das war die Mache der englischen Botschaft in Washington, noch mehr aber des Generalkonsuls. Sie waren erstaunlich, diese Engländer, zäh und hartnäckig, gaben nie die Partie verloren. Er, Frank Braun, war Ivys Verlobter — und recht gut wußte der Engländer, daß diese Verlobung allein ihr Werk war und nicht seines. Aber der Konsul kannte die Jeffersons so lange nun — hatte Ivy heranwachsen sehn durch manche Jahre. Eine Laune war diese Liebe — eine tief gewurzelte vielleicht, aber doch eine Laune. Er wußte gut, was er tat, als er die Karte ausspielte: Herzog von Stratford.
Herzogin von Manchester war eine Zimmermann; Lady Curzon, Vizekönigin von Indien, war eine Leiter, Herzogin von Suffolk ihre Schwester. May Goelet wurde Herzogin von Roxburgh, Margaret Drexel Viscountess Maidstone, Vivian Gould Lady Decies — so ging es weiter in langer Folge. Englischer Hochadel: das war der herrlichste Traum aller Geldsackdamen im Yankeeland.
Und dieser Herzog von Stratford war schon ein Schaustück. Freiwilliger in Flandern, dann Leutnant, Hauptmann, schwer verwundet und Viktoriakreuz. Ein Held. Allerbeste Familie dazu. Schlank, gut gewachsen, blond und blauäugig, gut erzogen und mit sehr gewinnenden Formen. Ein rechter, lieber Junge, gutmütig und bescheiden, sympathisch vom ersten Augenblick an. Man hatte ihn hinübergeschickt als Attaché zur Gesandtschaft — und ganz sicher in der Absicht, daß der junge Krieger eines der amerikanischen Riesenvermögen mit heimbringen solle. Das würde den uralten Namen der Stratford von neuem glänzen machen — war zugleich eine wohlzuschätzende Jahreseinnahme für Englands Steuer.
Drei kleine Schönheitsfehler hatte er. Das linke Bein war ein wenig steif von der deutschen Kugel; dazu stotterte er, sowie er in Erregung kam. Auch war er ein bißchen dumm.
Aber jedes davon mußte einer Frau vom Schlage Ivys nur erwünscht sein: glich ihr Gold schon den Standesunterschied aus, so mußten ihr diese kleinen Fehler die gewisse Überlegenheit über ihn sichern. Im Gehn, im Sprechen und Denken langsam und ein wenig behindert, mußte dieser junge Mann der allerbequemste Gatte werden. Verarmt dazu, wohlbekannt mit jedem Luxus, den er sich doch nicht leisten konnte, mußte ihr Reichtum — den sie sicher in der Hand halten würde — ihm bald unentbehrlich werden, ihn völlig abhängig machen von dieser Frau. Und sie würde freieste Hand haben für ihre absurdesten Launen, würde ihr eigenes Leben leben können in größtem Stile.
Frank Braun lachte. Da war kein Zweifel: im Vergleich zu ihm war Herbert Stratford der zehnmal bessere Mann für Ivy. Er war ein Deutscher — irgendeiner. Hatte keinen Adelsnamen, war kein Held. Er war launisch, ließ seine Launen hart genug die fühlen, die um ihn waren. Er konnte Formen haben, konnte gewinnend sein, wenn er gerade seinen guten Tag hatte — viel mehr als der Engländer. Aber er war unausstehlich, unerträglich fast am andern Tage — abstoßend wie ein hysterisches Frauenzimmer. Das war der andere nie.
Er würde ein höchst unleidlicher Ehemann sein. Keine Frau hatte es je mit ihm ausgehalten — oder auch er mit keiner. Was am Ende dasselbe war.
Und krank war er, krank. Sehr gesund war der andere.
Er setzte sich aufs Bett, zog die Schublade des Nachttisches auf — da stand seine Apotheke. Er schob die schwarze Bibel zurück — welche Nachttischschublade barg nicht eine Bibel in diesem Lande? — griff nach seinen Döschen und Fläschchen.
Das alles schluckte und spritzte er nun seit Monaten in fröhlichem Durcheinander. Strychnin, Arsenik, Laudanum, Heroin, Atropin, Mescal, Kokain. Alles half für eine kleine Weile, nichts auf die Dauer. Sein Zustand war latent in all der Zeit und fast stets sich gleichbleibend — diese müde Leere, dieses anämische Hindämmern wurde ein dauerndes, selbstverständliches. Freilich konnte er sich aufpeitschen — und tat es fast jeden Tag nun — konnte auf manche Stunden hinaus sich und den andern vorlügen, daß er gesund wäre, wie sie auch, durchaus normal.
Wie lange mochte es halten, wie lange noch? Das schleppte sich so hin, wurde nicht schlechter, nicht besser, blieb wie es war. Eines empfand er: wenn es schon Lotte van Neß war, die ihm diese Narrenseuche an den Leib gehext, ihm das Eigenleben ausgesaugt und ihn zum Hampelmann gemacht hatte, so war doch auch sie es gewesen, die das Geheimnis kannte, die Schnur zu ziehn, die ihn lustig tanzen ließ, ihn gesund machte auf Wochen heraus. Die kleine Ivy verstand nichts davon.
Die aber sollte er heiraten — gerade die. O ja, er hatte sie immer gern gemocht, mochte sie lieber fast mit jedem Tage. Sie verstand es gut sich anzuschmiegen, und es tat ihm so wohl, sich verwöhnen zu lassen. Dennoch: nichts reizte ihn an ihr, nie sah er in ihr das Weib. Sein kleiner Kamerad war sie, und er liebte sie, wie sein Spielzeug, wie seinen Hund.
Wie den? Nicht einmal so. Als man ihm seinen Pudel überfuhr, hatte er das schwere Tier nach Hause getragen, hatte die Nacht über gewacht bei ihm. Hatte ihm selbst die Zyankalispritze ins Herz gestoßen, als der Tierarzt erklärte, daß das Rückgrat gebrochen sei. Sah das Tier sterben in seinen Armen, Auge in Auge. Grub es ein, deckte es mit Erde, pflanzte die große Yuka darauf. Weinte —
Würde er weinen, wenn Ivy verunglücken möchte — morgen am Tage? Nein, nein — viel näher war ihm sein liebes Tier.
Aber dann selbst — wenn er sie lieben möchte, begehren mit all seinen Nerven — was möchte es ändern!? In kürzester Frist mußte diese Ehe in Stücke brechen — die nur angelsächsische Lebensweisheit halten konnte: nichts sehn, nichts, jede Lüge als große Wahrheit glauben.
Freilich — nicht seinetwillen sollte er ja Ivy Jefferson freien. Darum nur, damit ihr Vermögen deutsch würde — wie es englisch wurde, wenn sie den Herzog nahm. Und damit der große Jefferson-Trust hübsch neutral blieb, den Sturmlauf nicht mitmachte gegen Deutschland. Darum allein verkaufte er der Laune Ivys seine halbe Leiche.
Er überlegte: das ist am Ende das einzig richtige. Ich muß es erreichen, daß unter keinen Umständen dies Geld gegen Deutschland arbeitet. Der Gedanke tat ihm gut und machte ihn warm —
Oder doch: nicht dieser Gedanke. Ein anderer viel mehr: Lotte Lewys Augen würden leuchten, wenn sie wüßte, was er fühlte in diesem Augenblick. Das war es —
Alles sagte er der kleinen Ivy. Die hörte ruhig zu, sehr still und geduldig. Dann sagte sie »Ja — das mag schon so sein.«
»Und?« fragte er.
Sie kam hinüber zu ihm, setzte sich auf sein Knie, schlang beide Arme um seinen Hals.
»Hör zu, du!« begann sie. »Vielleicht werde ich so sein — wie du es siehst — in wenigen Monaten schon. Heute bin ichs noch nicht. Bin noch — ein Mädchen, habe keinen je geküßt — vor dir. Ich liebe dich, o ja — so gut ichs eben kann. Ich will dich —« Sie strich hastig, nervös, mit den Fingern über sein Haar. »Du gibst mir etwas — ich weiß nicht was — ich will mehr davon. Ich weiß wohl, du gabst es andern Frauen — vielen — dennoch will ich es. Der Herzog — und die andern Männer, die ich kenne — sagen mir nichts — geben mir nichts. Kalt bin ich und kühl — und bleibe es und werde noch kühler, wenn ich mit ihnen bin. Bei dir werde ich warm. Du machst mich Dinge träumen und wünschen — die — die — — Das ist es! Darum will ich dich!«
Ihre Finger zitterten, als sie zwei Haken löste. Sie nahm seine Hand, zog sie in ihre Bluse unter das Hemd. »Fühl doch, wie mein Herz klopft,« flüsterte sie. »Und du — du? Bin ich dir nichts — gar nichts?«
Ihre kleine Brust schmiegte sich in seine Hand, weich und warm. Und er fühlte ihres Blutes Pulsen.
Er schloß die Augen. Das war schon wahr, ihr Blut klopfte an seine Adern — als ob es hineinwolle. Und langsam, sehr langsam fühlte er ein wohliges Strömen durch seinen Leib. Sehr matt nur, sehr leise. Als ob — endlich wieder einmal — auch durch seine Adern warmes Blut flösse —
»Doch —« sagte er, »doch, Ivy — vielleicht — jetzt —«
Sie schob ihren Hals an den seinen, hob ihr Köpfchen. Raunte ihm ins Ohr: »Ich bin so dumm, so ungeschickt. Die van Neß war klug — sie verstand es, Flammen aus dir zu schlagen. Ich weiß nichts — hilf mir doch. Sag mirs — zeig mirs — ich will alles tun, was du willst.«
Er dachte: ›Sei meine Decke. Leg dich, du blondes Kind, sehr nackt über meinen nackten Leib. Hülle mich, decke mich — daß ich überall deines jungen Leibes Leben fühle. Und dein Blut — dein rotes Blut. Aber still, still — rühr dich nicht. — Und nichts sonst. Hörst du — nichts, nichts.‹
Aber er sagte es nicht. Ließ nur seiner Finger Spitzen leicht erwärmen an ihres Herzens Schlag.
»So willst du den Herzog nicht?« fragte er. Sie schüttelte hastig den Kopf. »Nein,« rief sie, »ich will dich!«
Er sagte: »So versprich mir, Ivy, daß — wenn — wenn —« Er machte sich los von ihr, stand auf.
»Wenn —« begann er wieder. »Versprich mir, daß — was auch kommen möge — daß du — und dein Vater und deines Vaters Geld — daß ihr nie etwas tun werdet — gegen Deutschland.«
Ihrer Stimme Klang wurde kühl im Augenblick. »Das ist die Hauptsache!« spottete sie.
»Ja,« rief er, »ja — ja! Ich muß frei davon sein, muß die Gewißheit haben für alle Zeit, wenn — wenn ich dich — Versprichst dus mir?«
Sie zuckte die Achseln, streckte ihm die Hand hin. »Ja,« sagte sie.
Er zögerte. So rasch, so gleichgültig kam dies ›Ja‹. Sie versprach es, gewiß — und sie würde lachen über dies Versprechen!
Da fiel ihm die Bibel ein. Ein Yankeemädchen war sie — da mußte die Bibel ihr etwas Besonderes sein. Und wie — trotz allem — ein Funken mädchenhaften Empfindens in ihr glimmte, so mußte auch, anererbt, anerzogen, eine scheue Hochachtung in ihr leben vor diesem schwarzen Buch. Eine kleine Angst, irgendein Respekt, eine unverstandene Ehrfurcht.
»Komm,« sagte er. Er nahm ihre Hand, ging hinüber mit ihr ins Schlafzimmer. Nahm die Bibel, gab sie ihr.
Sie öffnete den Deckel. »Meine!« sagte sie. »Die Mutter hat sie dir hingelegt, weil das Glück bringen sollte!«
»So möge es Glück bringen!« rief er. »Schwör mirs auf deine Bibel, daß du dein Versprechen halten wirst'«
Sie legte das schwarze Buch rasch aus der Hand.
»Warum schwören?« zauderte sie. »Warum —«
Er beobachtete sie gut — o ja, so konnte es gehn: diesen Schwur würde sie halten. Mochte sie dann immerhin den Herzog nehmen.
Wieder nahm sie die Bibel, faßte sie fest. »Ich will es schwören,« sprach sie. »Unter einer Bedingung.«
»Welche?« fragte er.
»Daß — du mich heiratest — jetzt schon.«
»Jetzt?« sagte er. »Das war fest ausgemacht zwischen uns — und auf besonderen Wunsch deines Vaters — nicht vor dem Friedensschluß.«
»Ich weiß!« rief sie heftig. »Aber damals glaubte ich, daß euer läppischer Krieg kaum noch Monate dauern würde. Heute weiß ich, daß es eine Dummheit war — eure europäische Dummheit zu unterschätzen. Ihr Deutschen werdet England nie schlagen — und die Alliierten werden noch Jahre brauchen, ehe sie euch besiegen können. Aber die Narrheit von allem ist so groß, daß keiner das begreifen will.« Sie trat dicht zu ihm, sah ihn voll ins Auge. »Ich will nicht mehr warten. Ich bin zwanzig Jahre alt. Ich — ich brauche — einen Mann — hörst du?«
Sie schrie es ihm ins Gesicht, deckte dann mit der Linken ihre Augen. Lachte auf, schluchzte.
»Ich bin schamlos —« flüsterte sie, »ja! ja! Du zwingst mich dazu. Ich kann nicht mehr warten — ich brauche dich. Ich will dich.«
Er antwortete nicht, nahm sie nicht in den Arm, rührte sie nicht an.
Sie faßte ihn wieder. »In acht Tagen können wir verheiratet sein, wenn du magst. Ich will dir schwören — und mein Schwur gilt von dem Augenblick an, wo — wo —«
»Wo Reverend Clark uns seinen Segen gibt,« schloß er. »Denn der wird es doch sein, da er schon deine Eltern getraut hat.«
»Ja,« rief sie, »der wird es sein. Aber nicht von da an soll mein Schwur gelten. Maud Pope, meine Kusine, hat vor Jahresfrist den hübschen Douglas geheiratet — sie läßt sich nun scheiden — weil — ach — weil er sie nicht angerührt hat in all der Zeit. So — will ich nicht heiraten. Mein Schwur soll gelten, wenn —« Wieder stockte sie, wiederholte ihr ›Wenn‹, suchte nach Worten. Schlug die Bibel auf den Tisch, rief laut: »Ich will es sagen — mags klingen, wie es will. Dann soll der Schwur gelten — wenn — ich — kein Mädchen mehr bin — durch dich.«
Ihre Augen glänzten, ihre Nüstern flogen. Blut hatte sie — Blut.
»Schwöre!« rief er. »Es gilt.«
Sie nahm seine Hand, legte sie zu der ihren auf das schwarze Buch. »Ich schwöre es dir — auf meine Bibel — beim allmächtigen Gott.«
Nun war es heraus, nun hielt er sie. Er seufzte auf, setzte sich auf sein Bett. Alle Anspannung fiel von ihm ab, er ließ die Arme schlaff hinabsinken.
Sie sah es nicht. Sie setzte sich zu ihm, drängte sich wieder nahe heran. »Nun bin ich deine Braut,« sagte sie. »Nun bin ich dir — ganz nahe.«
Er zwang sich, ihre Hand zu streicheln: »Ja,« sagte er, »sehr nahe.«
Sie flüsterte: »Wenn du willst — mag mein Schwur von dieser Nacht an gelten. Wenn du magst — will ich bei dir bleiben.«
»Nein, nein!« rief er. »Morgen, morgen, oder wann immer — heute nicht.«
Sie sah ihn an, mißtrauisch wieder und lauernd. »Ich bin müde, Ivy,« sagte er, »zum Umfallen müde. Geh jetzt, ich bitte dich, geh.«
Sie preßte die Lippen zusammen. Küßte ihn leicht, stand auf.
»Gute Nacht!« sagte sie. »Ich werde träumen von dir — wie jede Nacht. Bald —«
Noch ein rascher Kuß — dann ging sie. Er hörte ihre leichten Schritte durch die Räume, hörte die Türe leise schließen.
Allein —
Eine Stimme sang. Irgendwo war es — ja, in Wien — vor manchem Jahr. Eine Stimme sang: Marias Stimme. Die war seine Verlobte damals.
Ein Abschied war es. In drei Wochen sollte er wiederkommen, dann sollte Hochzeit sein. Doch er wußte gut, daß er nie kommen würde zu dieser Hochzeit, nie.
Ihre Stimme sang ihm. Die Brautlieder des Peter Cornelius. Eines, noch eines — alle.
›Nun, Liebster, geh und scheide — morgen ist auch noch ein Tag. — Morgen — morgen — —‹
Nein, nein! fühlte er. Morgen nicht und nie!
›Mir träumte von einem Myrtenbaum —‹ sang sie. Und wieder: ›Ach, Liebster, süßer Liebster, wie lange stehts noch an?‹
Wie Ivy, dachte er, wie Ivy.
Und doch — wie anders?
So einfach war alles bei diesem Wiener Kind. So natürlich, so still. Und einmal nur sang sie heraus, was sie fühlte — als er Abschied nahm.
Sie sang es, Ivy sprach es. Aller Unterschied zweier Weltteile lag darin.
Er kam nicht zurück, damals. Er fuhr in die Welt hinaus, allein. Schrieb ihr, daß es unmöglich sei — ganz unmöglich. — Einen sehr hübschen kleinen Revolver hatte sie, perlmutterbelegt. Den nahm sie —
Warum war es denn unmöglich, warum nur? Und warum mußte sie all den Phrasen glauben, die er schrieb? Warum fuhr sie ihm nicht nach, warum nahm sie nicht, was sie wollte?
Nichts trieb ihn fort, als ein dumpfes Träumen von Freiheit. Darum ließ er seine schöne Braut, ließ ihr Geld und allen wohligen Luxus. Ein Narr war er, damals, wie immer.
Ivy aber hielt ihn — die hatte ihn fest gekauft und bestand auf der Ware für ihr gutes Geld. Die würde nie den Revolver nehmen — die nicht. Seinen Leib hatte sie gekauft — und den würde sie haben.
In acht Tagen. Oder — früher schon.
Er sprang auf. Er mußte es hinausschieben Mußte — Zeit gewinnen.
Keine Frau hatte er berührt, seit er Lotte nicht mehr sah. Nicht weil er verlobt war — ach, darum hätte er jede Nacht eine andere genommen.
Etwas anders war es. Furcht wohl — und ein wenig Ekel. Er gab sich nicht Rechenschaft darüber — es mußte wohl mit seiner Krankheit zusammenhängen. Wenn er Ivy sah — oder irgendeine Frau — begehrte er sie nicht. Manchmal nur durchzuckte ihn etwas — wie neulich beim Konzert der Farstin. Es war, als ob er etwas wünschte von dieser Frau — etwas sehr Wildes, sehr Seltsames. Aber er wußte nicht, was es war — und ganz sicher war es nicht Liebe.
Wenn sie bei ihm geblieben wäre, Ivy, heute Nacht — schon der Gedanke machte ihn schütteln. Vielleicht hätte er sie fortgestoßen, roh und brutal, sie angespieen. Vielleicht auch hätte er sich gezwungen — mit aller Kraft seines Willens, hätte gegen sein Empfinden, gegen alles Gefühl, sie —
Er ekelte sich —
Und morgen? Oder nächste Woche? Würde es nicht genau so sein? Welches Gift sollte er fressen, um sich vorzubereiten für diese Hochzeitsnacht?
Er lief zum Telephon. Verlangte Neuyork, forderte Bryant 6335. Das war die Nummer seines Sekretärs.
Lange mußte er warten, hörte endlich doch die verschlafene Stimme.
Gleich aufstehn solle er. Ein Nachttelegramm aufgeben — lang und eingehend — das ihn sofort nach Neuyork riefe. Sehr dringlich müsse es klingen, sehr wichtig dazu.
Was für Gründe? — Herrgott, irgendwelche! Er solle nur etwas erfinden —
Er hing das Hörrohr an. Ah — nun würde er Henkersfrist haben — auf eine Woche wenigstens —
So müde war er. Er fiel in sein Bett.
Am Frühstückstisch wartete Ivy auf ihn.
»Direktor André läßt dich grüßen,« sagte sie. »Er ist mit Mama nach Neuyork mit dem ersten Zuge — ich habe sie beide zur Bahn gefahren.«
»Ah?« machte er. Sagte dann: »Deine Mutter ist auch zur Stadt?«
Ivy nickte. »Ja — sie bekam ein Telegramm von ihrer Schwester, die von Boston kommt. Für dich ist auch ein Telegramm da.«
Sie reichte es ihm hinüber. Er riß es auf — versuchte ein betrübt erstauntes Gesicht zu machen. Las laut: »Professor schwer erkrankt. Sie müssen bis auf weiteres seine Abende aufnehmen. Sofort nach Neuyork kommen. Rossius.«
Bis auf weiteres — er konnte kaum seine Befriedigung unterdrücken. Das hatte sein Sekretär glänzend gemacht: Bis auf weiteres! Das war wie Gummi, das konnte man ziehn und dehnen.
»Welcher Professor?« fragte Ivy.
»Dr. Soedering,« erwiderte er. »Er ist unerhört überanstrengt, der Professor. Als ich ihn zuletzt traf, sah er schon sehr leidend und abgespannt aus.«
Ivy meinte: »Vielleicht tat er nur so. Vielleicht verstellt er sich nur, damit er ein wenig Ferien machen kann — und du ihm die Rederei abnehmen sollst.«
»Wie kannst du nur so reden!« rief er. »Dieser Mann ist die Pflichttreue selbst, er würde sprechen, solange er noch einen Ton in der Kehle hat und sich auf Krücken auf die Tribüne schleppen kann. Er ist sicher völlig zusammengebrochen — der Arme.«
Sie streichelte seine Hand. »Wie lieb von dir, ihn so zu bedauern! Aber ich kann dich beruhigen: dein Professor ist völlig gesund.«
»Was?« rief er.
»Ja, ja!« lachte sie. »Viel gesünder als du. Übrigens soll ich dich von ihm grüßen, er läßt dich fragen, ob du heute abend zum Vortrag kommst? Er spricht nämlich hier in Neuport!«
Er starrte sie an mit offenem Mund. Da sprang sie auf, küßte ihn hellachend. »Entzückend bist du, wenn du dein dummes Gesicht machst! — Wir haben deinen Professor auf der Bahn getroffen, er kam mit dem Frühzug. André sprach mit ihm — stellte ihn uns vor. Schade, wenn ich gewußt hätte, daß dein Sekretär dir das drahten würde, hätte ich den Professor eingeladen zu uns zu kommen. Hätte ihn hinter den Vorhang versteckt und dir ihn jetzt vorgeführt — deinen überanstrengten, völlig zusammengebrochenen, schwerkranken Professor, den du vertreten sollst — bis auf weiteres.«
Bis auf weiteres — idiotisch hatte das der Rossius gemacht, geradezu blödsinnig! Konnte er nicht wissen, daß der Professor in Neuport sprechen würde?!
»Es muß ein Irrtum sein,« versuchte er. »Vielleicht ein anderer Professor.«
»Nein, kein anderer!« rief sie. »Gib dir keine Mühe, mein deutscher Junge — jedes Kind sieht dirs an, wenn du lügen willst! Und dazu hab ich in der Nacht gehört, wie du deinen Sekretär anriefst, dir das Telegramm bestelltest.«
»Gelauscht hast du?« sagte er. »An der Tür?«
Sie schüttelte den Kopf. »Viel schlimmer!« lachte sie. »Meinst du, nur unser Washingtoner Geheimdienst und die englischen Detektive könnten eure Telephondrähte anzapfen? Fünf ganze Dollars hats mich gekostet — nun schellts bei mir auch an, wenn du das Amt anrufst. Und ich höre alles hübsch mit, was du sprichst. Unsere Regierung hat schon recht: man muß die deutschen Verschwörer überwachen, muß sich nicht scheuen vor ein bißchen Unrecht und Rechtsbruch. Dann ertappt man sie — wie ich dich. Du hast dich verschworen gegen mich — du wolltest fort — gestehs doch!«
Wenn sie nur wenigstens gekränkt wäre, dachte er, beleidigt, entrüstet! Wenn sie wütend wäre, weinen würde —
Aber sie lachte nur. Ein Spiel war es — da freute sie sich, daß sie seinen dummen Bluff durchschaut hatte. Viel besser waren ihre Karten.
»Nun bleibst du hier, nicht wahr?« spottete sie. »Aber du könntest deinem Sekretär drahten, damit er nicht unnütz zur Bahn läuft. Hast du Papier in der Tasche? Bleistift? Schreib.«
Und sie diktierte: »Schwerkranker Professor redet heute Neuport. Sie sind ein Esel.«
Er schrieb, wie sie befahl. Fügte hinzu: »Ich auch.«
»Die Adresse!« rief sie. Schellte dem Diener, gab ihm das Papier.
»Eilig!« sagte sie. »Gleich besorgen!«
Sie wollte nicht mit ihm schwimmen an diesem Morgen. Er solle nur gehn, sie habe keine Zeit. Sie beide seien allein heute in Oakhurst, als rechte Brautleute zum erstenmal: das müsse man feiern. Sie würde das Luncheon vorbereiten.
»Du — als Hausfrau?« lachte er.
Sie lachte: »Laß mich nur. Warte auf mich am Strande — ich hol dich ab.«
Er ging in seine Zimmer. Stets kleidete er sich dort aus, wenn er baden wollte, ging in Bademantel und Schuhen durch den Park, lief dann über den Strand ins Meer. Nur um das Trikot an- und abzulegen benutzte er seine Kabine.
Lange trödelte er heute herum. Zögerte, ob er Strychninpillen schlucken solle oder Laudanum — entschloß sich endlich doch zu Arsenik.
Ging durch den Park. Machte einen Umweg, vorbei an den Wildgehegen. Fütterte die Rehe mit roten Rüben, gab den Hirschen glänzende Kastanien. Aber die schlanke, weiße Hindin, die ihm oft nachlief durch den ganzen Park, schnupperte an der Tasche seines Mantels. Er griff hinein, fand noch ein paar Stückchen Zucker für sie.
Er schwamm weit hinaus, lag dann am Strande in der Sonne. Still, regungslos, sehr lange. Schlief nicht, träumte nicht, dachte nichts. Freute sich, daß seine braune Haut straff sich spannte, daß die Augen ihm glänzten —
Soviel Arsenik hatte er genommen; das mochte ihn frisch halten bis zum späten Abend.
Meer — Himmel —
Manchmal murmelten seine Lippen etwas. Murmelten: Lotte.
Es war nur ein Wort. Nur fünf Buchstaben, die sein Mund mechanisch bildete — aus oft wiederholter Übung. Eine Reflexbewegung nur — nichts sonst.
Nun dachte er, daß doch Ivy kommen wollte. Er blickte zur Sonne — die stand weit über Mittag. Zwei Uhr mochte es sein, halb drei. Er blickte rings umher — kein Fuß kam über den Strand von Oakhurst.
Er stand auf, ging zu seiner Kabine. Zog das Badetrikot aus, duschte, schlüpfte in seinen Mantel. Ging langsam durch die kleine Pforte in den Park.
Zwei der Treibhausgärtner kamen über den Weg. Im Straßenanzug, die kleinen Pfeifchen im Mund.
»Wohin?« fragte er.
»Nach Neuport!« antwortete der eine. »Das Fräulein hat allen Urlaub gegeben für heute nachmittag.«
»Viel Vergnügen!« wünschte er. Sie dankten.
Was war denn heute, ein Feiertag?
Er kam vorbei an den Gewächshäusern, blickte durch die Scheiben. Mächtige blaue Trauben hingen da herab — bald würden sie reif sein.
Dann hörte er Ivys Stimme dicht hinter sich. Sie kam auf ihn zu, im Bademantel wie er. »Ich habe dich gesucht am Strande,« rief sie, »du mußt grade in den Park gekommen sein, als ich hier oben hinausging.«
»Willst du jetzt noch baden?« fragte er.
»Nein!« lachte sie. »Wir wollen nun frühstücken. Alles ist fertig.«
Er nickte: »Gut. Ich bin im Augenblick angezogen — schneller als du, was gilt die Wette?«
»Morgen will ich wetten,« rief sie, »heute nicht. Heute brauchst du dich nicht anzuziehn.« Sie nahm seine Hand, zog ihn hinein in das Treibhaus. Schloß die Türe hinter sich, drehte den Schlüssel ab.
»Was gibts denn?« fragte er.
Sie lachte. »Eine Überraschung für dich. Komm nur!«
Sie gingen durch die Traubenhäuser. Kamen zu den Pfirsichspalieren, zu den Birnen, Feigen und Granaten. Durch Lorbeer und Oleander zu dem kleinen Wäldchen der Zitronen und Pomeranzen. Dem Hause der Pampelmusen, der kleinen Kumquats, der Succaden, Limetten und Mandarinen —
Dann durch die tropischen Häuser, wo Aguacaten und Chirimoyen wuchsen, Mangos, Bananen, Kakis, Passionsfrüchte, Guanavanas, Mangostinen und Grenadillos. Heiß war es, sehr schwül unter den Glasdächern.
Durch die Häuser der Rosen und die der Kamelien. Durch die Hortensien, die Chrysanthemen, die Wicken, Päonien, Margeriten, Schneebälle —
Tuberosen wuchsen im nächsten Hause der gläsernen Stadt. Ein Meer weißer Tuberosen vom Boden auf; tiefviolette Klematis rings herum. Drei Säle der Lilien — hier deckte süßes Geißblatt die Wände. Weiße und japanische Lilien, Feuerlilien, Azucenas und Schwertlilien. Tiefblaue Iris, schlanke Graslilien —
Glassäle dann mit kleinen Teichen und Tümpeln. Callas, Nymphäen, Seerosen, Lotos — Glyzenen herab von der Decke. Und auf rundem Teiche im nächsten Hause die Riesenblätter der Viktoria Regia.
Vier Kakteenhäuser — in rasendem Rot jauchzte das letzte.
Und durch die sechs großen Räume der Orchideen.
Glashäuser, immer mehr, immer neue. Sehr niedrig bald, lang und schmal, hoch dann wieder, groß und breit wie eine weite Halle. Viele, so viele.
Alles ineinandergehend, ein gewaltiges Labyrinth. Türen auf und wieder zu. Und überall ein Rieseln und Plätschern von dem Wasser, das hindurchfloß.
Durch die kuppelgewölbten Palmenhäuser. Über siebenhundert Arten hatte der alte Jefferson, das war sein großer Stolz.
Durch die Koniferen. Durch den Gummiwald. Die rotglühenden Hibiskusbüsche —
Wieder eine Türe — die war verschlossen. Aus ihrer Tasche zog Ivy den Schlüssel, öffnete. Schloß wieder hinter ihnen.
Ein hohes Glashaus, mitten in allen andern. Hier wurde zum Bach das plätschernde Wasser, lief in einen Teich. Papyrus darin, Goldlotos, Wasserlilien. Viele Goldfische, ganz kleine, flinke, und andere, faule, wie Karpfen so groß.
Dicht das Grün überall. Musen, Philodendren mit riesigen Luftwurzeln. Mächtige Mangroven heraus aus dem Teich, breite Teppichbäume daneben, überdeckt von roten Flammen. Lianen überall, Farren und Frauenhaar. Orchideen von den Bäumen. — Ein wirres Durcheinander. Aber kein kleinster Lufthauch, still alles und tot.
Drei indische Tempelbäume — so süß in dem weichen Duft ihrer weißgelben Blüten. Aber kriechend die Wände hinauf, alles betäubend mit heißglühendem Duft, die kleinen Blumen der Dama de Noche. Und Bougainvillia von der Decke herab, rotviolett.
Sie ließ seine Hand nicht los, führte ihn über die schmalen Wege. Zum Teiche; ringsherum.
Hier — hinter dem Bambusdickicht war der Platz. Teppiche. Felle darauf. Viele Kissen. Ein Tischtuch in der Mitte — da stand ihr Mahl. Nun erst verstand er sie. Hier also — hier —
Er sprach kein Wort. Starrte sie an.
Sie hielt seinen Blick. »Ja,« sagte sie. Streifte ihren Bademantel ab, langsam, ohne Hast. Stand vor ihm nackt.
Er überlegte. Suchte — o, nur den Zehntteil eines Augenblicks. Über die Tafel fiel sein Blick — auf die Austern, Hummern, all die Schüsseln. Und die Flaschen dann — Sekt, Mosel, Burgunder, Kognak. Whisky auch —
Das war es — das war seine Rettung. Trinken mußte sie, sich berauschen. Mußte trinken, trinken, bis sie allen Willen verlor — völlig sinnlos, bewußtlos war — ihn vergaß, sich vergaß — alles!
Das war es.
Und er lächelte, wie sie. Zog den Mantel aus, wie sie. Stand vor ihr — nackt.
Er sah ihre Erregung, sah, wie sie kämpfte. Aber sie gab nicht nach —
Ein Sport war es, ein scharfes Spiel. Und sie wollte ihren Sieg haben und ihn auskosten zum letzten Tropfen.
›Heute nicht!‹ dachte er. ›Heute nicht!‹
Er schob ihr Kissen zurecht, und sie setzte sich. Sie legte ihm Speisen vor, fragte ihn, was er trinken wolle.
Einen Augenblick schwankte er. Sagte dann: »Champagner, wenn du magst.«
Sie nickte, zeigte auf die eisgefüllten Kübel.
Er zog eine Flasche heraus, suchte nach einem Öffner. Fand keinen. »Alles ist da!« rief er. »Doch nichts, um die Flaschen zu entkorken.«
Sie überlegte einen Augenblick. Sagte: »Warte!« Sprang auf. Lief durch die Büsche.
Er sah ihr nach. Schön war ihr schlanker Leib, geschmeidig und straff. Wie eine von Dianas Jägerinnen trug sie der leichte Fuß.
›Jung ist sie,‹ dachte er. ›Schön und gesund. Sehr reich dazu. Und sie will mich — will mich! Warum will ich sie nicht?‹
Sie kam zurück, einen großen Kasten im Arm. Den stellte sie vor ihn hin.
»Da!« sagte sie. »Gärtnerwerkzeug. Vielleicht findest du was.«
Viele Messer, große und ganz kleine, zum Pfropfen, Stutzen, Kopulieren und Okulieren. Haken, Scheren, kleine Sicheln, Spargelstecher. Dutzende Instrumente, von deren Verwendung er keine Ahnung hatte. Sogar einen Korkenzieher fand er.
»Nun wirds gehn,« sagte er.
Er entkorkte alle Flaschen, die da waren, eine um die andere. »Nichts soll übrig bleiben,« rief er, »von unserm Brauttrank. Mögen den Rest die Gärtner trinken — auf unser Glück!«
Er schenkte die Kelche hoch voll, stieß mit ihr an. Leerte sein Glas zur Neige, ließ sie das ihre leeren.
Sie aßen und tranken. Er achtete wohl darauf, daß die Gläser nie leer standen.
Schwül, schwül und so feucht. Das half ihm, das machte durstig —
Sie verlangte nach Wasser. Aber er nahm die Mineralwasser, goß sie aus in den Teich. »Nein!« rief er. »Kein Wasser! Berauscht wollen wir sein — du und ich — vom Wein und von —«
Er ließ den Burgunder bluten in das große Glas. Sah sie an mit strahlenden Augen — vergaß, daß es Arsenik war, das sie leuchten machte.
Wenig sprach er im Anfang. Wuchs dann hinein in seine Rolle, wurde lebhaft, erzählte.
Sprach von Silberreihern, die er geschossen hatte, früh am Morgen bei Santa Barbara de Samana. Von dem ersten Tiger, den er erlegt, tief im Urwalddickicht des Ganges. Von braunen Samoamädchen erzählte er, nannte sie Sonnenstrahlen, die Menschen wurden. Von süßen birmesischen Frauen, die nichts waren, als ein Lächeln, das Fleisch ward und Blut. Von dem blütenjungen Parsenmädchen, das viel weißer war als aller Schnee, von dem tannenschlanken Singsonggirl in Nanking — Va Jee hieß sie, das ist: Schönfinger.
Die war kein Mensch, war nur eine Hand. Oder — zwei Hände. Zwei Hände — lang, schmal — und so voll von allen verbotenen Sünden.
Diese Hände liebte er. Liebte den kühlsten Schnee und den Sonnenstrahl und das ewige Lächeln.
Eine Frau hatte er gekannt, die nichts anders war als Dreivierteltakt. Eine, die Wolfsblut war. In der Mezquita traf er eine, zu Cordoba, die war ein Klang von Silber und Schwarz.
»Was bin ich?« fragte die kleine Ivy.
Er sagte: »Ich weiß nicht — wirst erst etwas werden. Aber heute sollst du und ich — sollen wir beide — das hier werden.« Er breitete die Arme weit aus, ließ den Blick rings schweifen. — »Yankeeland — weit, weit. Und darin ein Park und darin eine gläserne Stadt. Und mitten darin ein heißer Traum in den Tropen. Und wieder darin — du und ich — und in uns — unser Rausch. Der soll wachsen und Flammen schlagen, soll uns glühend einschmelzen in diese verzauberte Schwüle. Eine schreiende Lüge ist unser gläserner Tropenwald — eine groteske, wilde Lüge, Ivy, wie unsere Liebe. Du weißt es — wie ich es weiß. Aber deine Yankeelaune will es so — so mag sie so wahr werden — heute — wie meiner Träume Narrentum sie schaffen mag!«
Er schenkte die Sektkelche halb voll, goß dann Burgunder hinzu. Nahm die Meukowflasche, füllte die Gläser mit Kognak auf.
Sie zögerte, als er das Glas ihr reichte. Da rief er: »Trink! Trink! Wir müssen weg von allem Alltag!«
Er führte ihr das Glas an die Lippen, setzte es nicht ab, ehe sie es geleert.
»Hier sollten stille Vögel fliegen,« sagte er, »bunte, sehr bunte. Eidechsen und Ghekkos sollten über die Wege laufen, faule Chamäleons auf den Luftwurzeln sitzen. Krabben müßten über die Mangroven huschen, Salamander träumen auf den Lotosblättern. Da auf der Liane sollte ein grüner Leguan lauern, Schlangen sollten sich durch den Bambus winden. Blaue Schmetterlinge in der Luft, rote und gelbe — so viele Schmetterlinge.«
— Heiß war es, schwül, so schwül.
Und ein Gurren. Irgendwo ein lockendes Gurren.
Klare Tropfen perlten von seiner Stirne — klare Silbertropfen überall von ihrem jungen Leib.
»Trink!« forderte er, »trink!«
Ein Duften — Duften — schwüler noch als die heiße Luft. Tempelblumen — Damas de Noche — irgendwo mußten auch Narden stehn.
»Durst hab ich,« flüsterte er, immer noch Durst. Laß mich trinken, Ivy, aus deinen Lippen.«
Er lehnte sich zurück in die Kissen. Sie kroch heran auf den Knien, griff das Burgunderglas. Nahm einen kleinen Schluck, führte ihren Mund an den seinen. Bot ihm den Trank. Aus ihren Lippen schlürfte er diesen Wein.
Sie dann, sie auch. Sie zitterte, bebte, wie er sie nur berührte mit seinen Fingern.
»Mehr!« verlangte er. »Mehr.«
Er fühlte wohl, wie auch seine Sinne der Wein nahm. Mochte er, mochte er: so trug ein Rausch sie hinaus — beide zusammen.
Venushaar brach er, schmückte ihr Blondhaar. Atmete tief all den blühenden Duft, bog den Kopf zurück, jauchzte hinaus:
»Me juvat: et multo mentem vincire Lyaeo
Et caput in verna semper habere rosa!«
»Was ist das?« lallte sie.
»Das ist — was wir hier tun in der tiefsten Zauberhöhle der verzauberten Glasstadt. Properz sang es, ein Römer, einer, der mehr wußte von der Kunst des Lebens als alle Menschen im Yankeeland. Trink — trink — und küß mich!«
Sie riß sich hoch, schlürfte den dunklen Wein. Warf das Glas hinaus in das Grün — wand ihren Arm um ihn, bot ihm die Lippen —
»Ivy,« flüsterte er, »Efeu —«
Ein sehr Dumpfes gärte in ihm. Ein Wunsch — eine wilde Lust —
Glatt war ihr Leib, feucht und warm. ›Eine Schlange ist sie,‹ dachte er, ›eine mit warmem Blut —‹
»Durst,« flehte sie, »Durst! Gib mir zu trinken Wein — Küsse —«
Was war es denn? Etwas reizte ihn, etwas begehrte er. — Was denn?
Und die Vögel gurrten. Unsichtbar — irgendwo.
Seine Finger liefen über ihre Haut. Irrten herum, unbewußt, kaum sie berührend, wie ein leichtes Flügelschlagen. Und sie wand sich, zitterte. Ein flehendes Stöhnen ward ihr Leib — ein gieriges Schluchzen nur, ein einziges Beben.
»Du —« keuchte sie, »du —«
Und wieder griff sie ein Glas. Leerte es, hielt ihm das leere hin. Einmal und noch einmal. Er schenkte ein und tat ihr Bescheid.
Dann lachte sie auf. Goß den Burgunder über ihn, ließ den Kelch fallen —
Ihre Augen flackerten. Alle Gier —
›Mänade!‹ dachte er. ›Tier — Tier — es erwacht.‹
Voreinander knieten sie. Die Arme hob sie, griff seine Schultern mit beiden Händen. Faßte zu, fest, stark, schlug ihm die spitzen Nägel ins Fleisch. Warf sich über ihn, grub ihre Zähne ein. Biß — biß.
Noch wußte er alles. Noch überlegte er: kein Mensch ist sie mehr, kein Mädchen. Ein tolles Tier ist sie nun — eine von Dionysos' Tigerkatzen.
Giftig ist ihr Biß —
Noch sah er alles. Sah dies weiße Weib, dessen Zähne in seinem Nacken hingen. Sah den Teich, sah das tiefe Grün rings herum. Das weiße Tafeltuch, die Teller und Gläser und Flaschen.
Dann ein roter Nebel. Ein Duft von Burgunder und Blut. Und dies Gurren der unsichtbaren Tauben —
Schmerz — Schmerz.
Er schrie.
Griff ihren Leib —
Hände — Zähne —
— dann wie ein Fallen. Und das Fell, auf dem er lag, hob sich, wurde weich wie Federflaum. Ein Bett war es. Aber es bewegte sich, zog dahin, wiegte sich leise, hin und her wie ein Boot.
Meerleuchten ringsherum in der tiefen Nacht. Kein Ruderschlag — nur das Plätschern der Wellen um das stille Boot.
Er hob sich hoch. Rieb sich die Augen, blickte umher. Nein, nein, kein leuchtendes Meer —
Ein Träumen war es. Doch hörte er deutlich das Rieseln der Wasser.
Er besann sich — schärfte den Blick.
Er war — ja doch, ja!
Noch konnte er einiges unterscheiden — Dämmerung mochte es sein — ein wenig Licht fiel von oben her.
Plätschernde Wasser und der Teich. Sehr dunkel ringsum.
Aber hell das Tuch, weiß. Und ein weißer Leib —
Flecken darauf — dunkel. Ah — Wein oder Blut.
Ivy —
Er hörte ihr Atmen.
Er erhob sich. Sein Fuß stieß an den Gärtnerkasten. Der war umgestürzt — alle die Dinger lagen zwischen den Tellern und Flaschen. Er sah die Mäntel. Nahm seinen, zog ihn an. Warf den andern über die Schlafende.
Langsam ging er. Fand die Türe, schloß auf, ging hinaus. Suchte seinen Weg durch die Hibiskusbüsche.
Etwas bewegte sich, etwas Großes, Weißes, dicht vor ihm. Er faßte es rasch — Ivys schwedische Zofe war es, Dagmar Erikson. Auf einem Stuhle saß sie, fest eingeschlafen.
Er rüttelte sie wach. Fragte sie, was sie hier mache? O — Auftrag ihrer Herrin — schon den ganzen Nachmittag säße sie da, warte. Dicht an die Türe solle sie sich setzen, befahl er, still warten, bis das Fräulein erwache.
Sie hatte die Schlüssel, die Zofe. Sie führte ihn, durch zwei, drei Häuser, ließ ihn hinaus.
Er trat in den Park, atmete diese starke, reine Luft. Diese Luft — die durch alle Poren strömte — die ihn jung machte, froh, im Augenblick.
Er prüfte seinen Schritt — schwellend, elastisch. Er reckte die Arme — ah, fliegen hätte er mögen — weit hinaus!
Und es hielt, hielt — wurde gewisser mit jedem Schritt.
Das war ein anderes als die Schwindelkraft — die ihm das Strychnin gab. Morphium oder Arsenik —
Das — das war — Gesundheit! War etwas — das er nicht mehr kannte, seit er schied von Lotte —
Dann aber — dann — —?
Dann hielt auch Ivy das Geheimnis?!
Sie — Ivy — seine Verlobte!
Jubelnd flog er durch den Abend — helljauchzend —
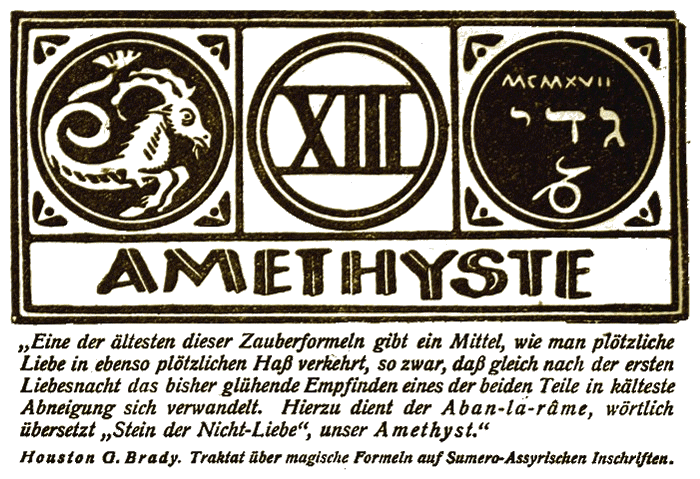
Drei Monate war er im Westen. Reden — reden —
Am Tage vor Weihnachten kam er zurück — nachmittags zur Teezeit. Niemand war an der Bahn.
Er fuhr nach Hause. Er packte seinen Kram aus, wusch sich. Warm war es, weich das Licht. Heimlich.
Aber nirgend Blumen. Und allein war er. Ging mit langen Schritten durch die weiten Zimmer.
Rossius mochte doch kommen — wie war noch die Nummer?
Frank Braun nahm das Höhrrohr. »Ich bin zurück in Neuyork!« rief er. »Können Sie herkommen?«
Aber der andere konnte nicht. Bis wenigstens zehn Uhr habe er auf der Zeitung zu tun. Gut, so wolle man sich dann treffen — bei Lüchows.
Er ging zum Schreibtisch. Setzte sich, schlürfte seinen Tee. Hübsch geordnet lag in großen Stößen seine Post da — er hatte sich nichts nachschicken lassen die Zeit über. Alles hatte Rossius erledigt, ihm nur Bericht erstattet und dann und wann einmal Bescheid erbeten.
Aber dort, unter der Zigarettendose, lagen ein paar geschlossene Briefe. Frauenschriften. Die waren nicht geöffnet.
Er nahm sie, einen um den andern. Eine Rechnung seiner Maniküre. Eine Bitte um ein Autogramm. Um ein Bild —
Ah, ein Brief seiner Mutter. Geöffnet vom englischen Zensor, wieder verklebt. Er riß den Umschlag auf — er war leer.
Noch ein Brief — Ivys Hand.
Er zögerte — das war das erste Lebenszeichen, das er bekam in all der Zeit.
Der Brief war nach Los Angeles geschickt, nachgesandt von dort. Er selbst hatte an sie geschrieben — dreimal, viermal.
Wo steckte sie nur?
Damals hatte er sie zuletzt gesehn, an dem Septembertage, in der gläsernen Stadt von Oakhurst —
Er war durch den Park gegangen, zur Villa. Hatte sich angezogen, war nach Neuport gefahren zu des Professors Vortrag. Hatte mit dem gesessen nachher, lange geplaudert. Zurück dann nach Oakhurst.
Er traf Ivys Zofe: — das Fräulein sei zu Bett, schlafe. Aber als er aufstand am nächsten Tage, sehr spät, war Ivy fort. Zur Stadt gefahren, mit der Zofe. Und keine Zeile für ihn.
Er fuhr auch nach Neuyork. Er wartete einen Tag und noch einen — hörte nichts. Er rief an, erfuhr dann, daß Ivy — mit ihrer Mutter — nach Boston wäre.
Wieder ein paar Tage später bekam er einen Brief von ihrem Vater. Ivy sei krank, nervenleidend — sie würde in Boston bleiben einstweilen. Aber sie würde ihm schreiben.
Da reiste er nach den Weststaaten, machte den Kreislauf, den Tewes für ihn ausgearbeitet hatte im Auftrag des Komitees. Hampelte, pampelte — jeden Abend.
— Noch immer zögerte er. Wie eine kleine Angst war es. Es waren die ersten Worte von ihr.
Was fürchtete er denn? Liebte er sie etwa — die kleine Ivy?
Etwas verband sie ihm.
Er riß den Umschlag auf — entfaltete ihren Brief. Zwei Zeilen nur — zwei arme Zeilen.
»Geh zurück zu deiner Mätresse.«
Und ihr Name. Dann: »Ich werde meinen Schwur halten.«
Nichts mehr — kein Wort. Langsam zerriß er den Brief.
Das war zu Ende. Ausgeträumt.
Dennoch — er verstand es nicht. Warum denn — weshalb nur?
Hatte er sich nicht gefügt ihrer Laune? Nicht getan — was sie verlangte?
War er gegangen? Nein — sie ging, sie!
Er nahm einen Briefbogen, schrieb. Sie solle doch wenigstens ihre Gründe sagen! Ihm erklären, wieso —?
Rasch schrieb er, heiß, verlangend. Ein Wünschen war das, ein Sehnen —
Das Papier deckte sich mit Worten. Die schrieen —
Er las seinen Brief durch, gab ihn in den Umschlag. Schrieb die Adresse, klebte die Marke auf. Schellte dem alten Diener.
Zerriß dann den Brief. »Räum den Tee ab,« sagte er, als Fred kam.
Wozu Erklärungen? So war es nun einmal — so. Und ihren Schwur würde sie halten.
Nur: allein war er — allein.
Lotte —? Nichts, nichts von ihr in all der Zeit.
Ja — Fred? Was wollte er noch?
Ob er ein Bad machen solle? Den Frack bereit legen? Der Herr Doktor sei doch gewiß eingeladen heute abend —
Eingeladen? — Ja, ja, er möge nur alles zurecht machen.
Die fünfte Avenue hinauf. Dick im Pelz — durch nassen Dezemberwind.
Acht Uhr vorbei — leer die Straßen an diesem Abend. Hier und dort an der Ecke ein Mensch, mit Kistchen und Körbchen — auf den Autobus wartend. Und die schellenden Kerle der Heilsarmee — roter Kapuzenrock, weißer Vollbart, brauner Sammeltopf für die milden Gaben zur Weihnachtsspeisung der Armen. Es war ein gutes Geschäft, dreißig Prozent bekam jeder Weihnachtsmann von allem, was er einnahm.
Er trat bei Sherrys ein. Legte ab, ging in die Halle. Kein Mensch dort — kein Gast in den weiten Speisesälen.
Eine Dame kam auf ihn zu. Stark und groß, hoher Pelzkragen, dicht verschleiert. Streckte ihm die Hand hin, bot ihm guten Abend.
Ah — Emmaldine Farstin!
»Mit wem sind Sie hier?« fragte sie.
»Ganz allein,« erwiderte er.
»Ich auch,« rief sie. »Da wollen wir zusammen speisen, wenns Ihnen recht ist.«
Er half ihr aus dem Pelz. Sie gingen hinein, wählten einen Tisch — bestellten.
»Allein also, Doktor!« lachte die Diva. »Allein zu Weihnachten.« Sie stieß mit ihm an. »Prosit! Auf gute Freundschaft!«
»Also wieder gut?« fragte er.
Sie nickte. »Ja — es ist am Ende das beste. Man muß sich abfinden mit allen Dingen — und den Menschen auch. Muß sie nehmen, wie sie eben sind. Nur: Distanz halten — so weit es unbedingt nötig ist für unser Seelenheil.« Sie lachte; schluckte ihre Austern. »So — über den Tisch herüber — sind Sie ganz amüsant, ganz lieb — und durchaus ungefährlich! Und darum — Freundschaft — nicht? Es ist Geschmackssache am Ende: meine Psyche sexualis ist Gourmet und Gourmand auch. Austern und Kaviar — und Irish Stew nachher und Schweinebraten — wies grade kommt. Aber sie bedankt sich nun einmal für Ihre Leckerbissen!«
»Meine?« fragte er erstaunt. »Welche sind das?«
»Red Ducks!« lachte sie. »Blutenten — auf Knickerbockerart!«
»Was für Zeug?« fragte er wieder. »Ich habe keine Ahnung, was Sie meinen.«
»Ach, tun Sie doch nicht so!« rief die Diva. Sie nahm die Speisekarte auf, suchte herum. »Da — die Dinger meine ich, Red Ducks — das Leibgericht aller Schlemmer in diesem Lande! Haben Sie es nie versucht?«
Doch, gewiß — man hatte es ihm ein paarmal vorgesetzt. Scheußlich fand ers. Hatte einen Bissen gekostet und keinen zweiten mehr. Man nahm eine Ente, briet sie leicht an. Gab die halbrohen Bruststücke auf den Teller, tat den Rest in eine große silberne Presse. Drehte und quetschte, preßte das Blut darüber aus.
»Was zum Kuckuck habe ich damit zu tun?« fragte er.
»Lassen wirs doch!« sagte die Diva. »Ich will mich nicht streiten mit Ihnen — heute erst recht nicht. Jeder hat sein eigenes kleines Pläsierchen — wie ihn der Herrgott erschaffen hat. Ich will nett sein zu Ihnen, Doktor — hübsch in Distanz — aber nett und lieb. Grade heute — wo alles zusammenkriecht, während Ihnen Ihre Teufelslaune wieder einmal so ein kleines Ganzalleinsein beschert hat. — Bitter nicht?«
Wovon sprach sie eigentlich, was wollte sie nur? »Was ist bitter?« forschte er.
Sie streckte ihm die Hand hinüber. »Herrgott — warum denn nur so eingekapselt? Können wir zwei nicht ruhig über alles miteinander reden — und sehr offen? Wie zwei alte Auguren — die sich verstehn, wenn sie nur mit den Augen zwinkern? Weshalb den Begriffsstutzigen spielen? Es ist doch bitter, daß Ihr Turteltäubchen weggeflogen ist, was?«
»Mein Täubchen?« sagte er. »Meinen Sie Fräulein Jefferson?«
Sie lachte: »Natürlich! Wen sonst? Sie sind allein — und am Weihnachtsbaum Ihres Exbräutchens hängt ein englisches Vogelbauer!«
»Wer sagt das?« fragte er.
»Wer das sagt?« rief sie. »In allen Abendzeitungen stehts. Mit den Bildern. In dieser Stunde verlobt sich — dreißig Blocks weiter hinauf — die kleine Ivy mit dem Herzog von Stratford. Sie hättens sich denken können. Doktor — hätten warten müssen — bis nach der Hochzeit!«
Er wurde ungeduldig. »Herrgott — was hätte ich mir denken können?« rief er heftig.
Sie sah ihm ins Auge. »Was? Nun, daß das Püppchen da nicht mittun würde, wo — selbst ich mich herzlichst bedankte. Das! Nun wissen Sies.« Sie lachte hart auf, wandte sich wieder ihren Austern zu.
Aber er wußte gar nichts. Was hatte er denn Ivy getan? — Und was dieser Frau?
Wer war sie denn? — Die größte Diva der Erde, die Frau, die die schönste Stimme hatte durch Jahrhunderte. Ja! Sehr klug dazu, sehr gebildet — o, eine Künstlerin in jeder Fingerspitze. Sie sang nicht nur, schrieb auch, komponierte. Und verstand zu sammeln — ihre alten Bilder schlugen die Sammlung von manchem Multimillionär. Aber zugleich war diese Frau Anbeterin aller Lüste. War Sappho und Katharina zugleich. Ihre erotische Bibliothek war viele Tausende wert — sie war stolz darauf, manches zu besitzen, das selbst im Hayn nicht stand. Und man wußte, daß sie die Männer zu Dutzenden nahm — und die Frauen auch. Daß einer der Chorführer der Oper in ihrem festen Solde stand, daß er immer frische Ware anbringen mußte, Nacht um Nacht. Sie dachte nicht daran, es zu leugnen. Sie stand über aller Gesellschaft: in königlicher Verschwendung tobte ihre — Psyche Sexualis.
Sie aber — Emmaldine Farstin — bedankte sich herzlich für ihn?!
Die? — Die! Was war denn nur?
Aber es war ja lächerlich! Sie machte sich lustig über ihn — und er war dumm genug, darauf hereinzufallen.
So lächelte er. »Sie haben vollkommen recht!« sagte er. »Man sollte in sich gehn und sich bessern, tugendhaft werden .. Ich werde mirs ernsthaft überlegen.«
Sie antwortete: »Verschwenden Sie nur Ihre Zeit nicht. Da hilft nichts mehr, wenn man, wie Sie, so eingelebt ist — in Sodom!«
›Da ist sie wieder,‹ dachte er. Nun gut — mochte sie ihren Willen haben.
Er nickte: »Ja, ja!«
»Ich nenne es Sodom,« fuhr die Diva fort, »denn darauf kommts hinaus am letzten Ende. Ich habs gut durchstudiert, dieses große Kapitel der Liebe — mit meiner Formel löst man am Ende alle Rätsel, so unverständlich sie anfangs scheinen mögen. Darüber könnte ich Ihnen lange Vorträge halten.«
»Tun Sies doch,« sagte er. »Ich komme vom Westen — habe durch drei Monate nur Bürger gesehen und Bauern — Geschöpfe, die mit Menschen in Ihrem Sinne nur sehr entfernte Ähnlichkeit haben. Reden Sie also — ich höre sehr gern zu.«
»Danke!« lachte die Diva. »Wenn ich Katzenjammer habe — das habe ich manchmal, wenn mich das alles anwidert — dann bin ich höchst keusch eine Zeitlang. Und studiere so herum — dazu sind meine Bücher da und meine Bilder. Das macht mir wieder Appetit. Da habe ich eines Tages meine Formel gefunden — eine höchst einfache, höchst abgeleierte. Aber nie so gesehn, wie ich sie fasse.«
»Und wie heißt diese Formel?« fragte er.
»In jedem Mensch steckt ein Tier,« erwiderte sie. »Das und nichts mehr. Das ist so binsenwahr, so abgegriffen, daß es schon lächerlich klingt und albern. Aber Sie kommen auf höchst erstaunliche Ergebnisse, wenn Sie ein wenig tiefer schürfen. Ein Tier — manchmal auch viele Tiere — und die wieder in den ergötzlichsten Mischungen. Es gibt kein Tier in der ganzen Naturgeschichte, das nicht in irgendeinem Menschen drinsteckt.«
Er sagte: »Das ist nicht ganz —«
Sie unterbrach ihn rasch. »Nicht ganz neu — natürlich nicht! Ich sagte Ihnen ja, daß es durchaus alter Kohl sei. Aber warten Sie nur ab. Die Sexualpsyche ist überhaupt nichts anders als solch ein Tier — und dies Tier sucht seinesgleichen. Nun nehmen Sie die Lehre von der Seelenwanderung, an die viele hundert Millionen Menschen glauben. Sie hat ein großes, dickes Loch. Nämlich: die Seele, immer dieselbe, wandelt durch eine unendliche Reihe von Leibern — eine Seele, wohlgemerkt, die immer sie selbst ist und sein muß, dieselbe im Frosch und im Löwen, im Kaiser und Bettler, in der Nonne und der Hure. Wäre das richtig, so müßten, untereinander, alle Froschseelen verschieden sein, wie alle Löwenseelen. Das sind sie aber nur in sehr geringem Maße — im großen und ganzen sind alle Hundeseelen einander ebenso gleich, wie alle Wanzenseelen und Hasenseelen — und sind zugleich sehr verschieden von allen andern. Also ist nicht die Seele an sich das Ursprüngliche, sondern eben die Froschseele und die Bettlerseele, die Löwenseele und Karpfenseele. Haben Sie es? — Je höher aber das Geschöpf steht — um so mehr Seelen finden in ihm Platz. Zwei Seelen, meinte Goethe, wohnten in seiner Brust — wenn Sie ihn aber lesen, so finden Sie, daß es nicht zwei waren, sondern zweihundert — wenigstens!«
»Was nennen Sie — Seele?« warf er ein.
»Das, was es ist!« sagte sie. »Das — Geschlecht! Zwei Triebe bestimmen die Handlungen jeden Geschöpfes: der Erhaltungstrieb und der Fortpflanzungstrieb. Das ist ein höchst absurder Begriff, denn nie denkt irgendein Wesen an die Fortpflanzung — der Geschlechtstrieb ist es — recht und schlecht. Wenn wir nun aber überhaupt Leib und Seele unterscheiden, so ist es klar, daß der Körper es ist, der sich erhalten will, trinken, fressen, leben, gesund bleiben. Dann aber bleibt dem andern Ding — der Seele — nur der Geschlechtstrieb. Der Körper ist sehr sterblich, geht zugrunde nach kurzer Zeit — sein Trieb, der ihm nur allein dient, ist also so klein und jämmerlich, wie er selbst. Die Seele aber ist unsterblich — und so ist ihre Emanation — ihr Trieb! Ist unsterblich wie sie — erbaut alle Welten. Das ist die Bestimmung dieser Erde — voll zu werden und immer voller von Geschöpfen — damit die Seelen immer neue Leiber finden, sich häuslich darin einzurichten für eine kleine Weile.«
»Wenn das die Bestimmung ist,« meinte er, »dann entziehn Sie sich ihr sehr erfolgreich. Bringen zwar viele Opfer Ihrem Seelentriebe, aber tun gar nichts für die Fortpflanzung!«
Sehr ernsthaft sagte sie: »Glauben Sie, Doktor? Das ist wohl wahr: die Zeit, um ein einziges Kind zu kriegen, deucht mich viel zu lange, um darum solange auf das zu verzichten, was mein Leben ist. Dennoch bilde ich mir ein, mehr für diese Bestimmung zu tun als manche tausend Frauen zusammen.«
»Wie das?« fragte er.
Sie sagte: »Gehen Sie doch in die Oper, wenn ich singe — wenn der Caruso singt! Aber werfen Sie keinen Blick auf die Bühne, schaun Sie nur das Publikum an. Beobachten Sie die Augen der Leute, diese Augen — da erwacht die Geilheit aller Tiere. Sie sagen nichts, sie verstehn nichts — fühlen nur und wissen nicht was. Aber ihre Brunst flammt auf und füllt weithin das Theater. Und sie fahren nach Hause, und liegen beieinander, und zeugen Kinder: meine Kinder, Carusos Kinder!«
Sie lachte laut auf: »Da sagen die Leute: ›O diese Stimme! Der Farstin Stimme! Göttlich, himmlisch! — Und Caruso — über alles Denken herrlich — o, eine Offenbarung!‹ Aber bei ihm empfinden die Weiber: ›Die Augen schließen, niederlegen, empfangen.‹ Und die Männer bei mir: ›Ein Weib nun, ein Weib!‹ — Nur wissen Sie, fühlen sies nicht so gewählt, wie ichs ausdrücke. Fühlens, wie eben Bürgerpack fühlt: recht gemein, deutlich, vulgär. Das ist ihre große Offenbarung! — Und der Witz dabei ist, daß es dennoch eine Offenbarung ist, eine ganz rechte, die ihre Seelen weckt.«
»Dann, Diva, Göttliche,« sagte er, »dann ist Ihr Gesang nichts anders — als Kanthariden!«
»Ganz richtig!« nickte sie. »Ist Sellerie für den Bräutigam und Spargel für das Bräutchen. Ist Sekt oder ein ausgeschnittenes Kleid, ein zotiges Buch, ein wilder Tanz — ein Hundepaar, das sich auf offener Gasse vergnügt. — Gar nichts anders — ich bin mir völlig klar darüber. Geschlecht ists — Geschlecht! Und da ich glaube, daß mancher Tiere Seelen aus mir schreien, wenn ich mich prostituiere auf der Bühne und im Konzertsaal, so werden manche Sehnsüchte wach da unten. Oft hab ich daran gedacht, wenn ich in der Kulisse auf mein Stichwort wartete, während Caruso sang. Bald ist er ein Stier, bald ein Affe — nun ein Eber und nun ein Nachtigallenmännchen. Und die kleinen grauen Nachtigallenseelchen da unten recken die Köpfchen, die Kühe unterbrechen ihr Wiederkäuen, die Äffinnen verdrehn die Augen und die Säue schwitzen vor geiler Lust.«
»Und nichts Menschliches?« fragte er. »Nichts?«
Sie seufzte: »Selten nur, unendlich selten! — Gibts doch so viel millionenmal mehr Tiere auf der Welt als Menschen. Und deren Seelen müssen ja wandern, wie die andern auch — stecken also zum größten Teile eben in Tieren. Da hälts schwer, so etwas zu finden: eine Menschenseele in einem Menschenleib!« Sie nahm ihre Dose aus der Tasche, bot ihm an, brannte selbst eine Zigarette an. »Wir müssen uns trösten,« fuhr sie fort, »die ganze Welt ist Sodom und wir leben darin. Tiere sind wir und müssen Tiere suchen — so war es vom Ei der Leda an.«
Er nahm es auf. »Die hatte eine Schwanenseele — darum kam Zeus als Schwan zu ihr hin.«
Sie nickte. »Und zu Europa als Stier, weil die eine Kuh war. Den hübschen Bub aber, den Ganymed, dessen junge Träume in alle Wolken flogen — den holte er sich als Adler. Alle Götter machten es so in allen Ländern und zu aller Zeit. Zu Gunnlod, der Riesentochter, kam Odin als Wurm, und die Heilige Jungfrau besuchte ein Täuberich. Ich weiß nicht, wie Lokis Riesenweib aussah, aber es muß eine seltsame Bestie gewesen sein, wenn er mit ihr den Fenriswolf zeugen konnte und die Weltenschlange. Und solche Mischwesen liefen überall herum: Früchte der Umarmung zwischen Gott oder Mensch und Tier — Sodom von Anbeginn in jeder Religion! Sagen — Phantasien — Hirngespinste — ja! Aber sie beweisen doch, wie sehr sich der Menschheit Gedanken immer wieder damit beschäftigten. Voll von solchen Flickwesen ist die indische, die ägyptische und babylonische Götterwelt — und die unsere nicht minder: lesen Sie nur die Offenbarung St. Johannis! Hellas hatte die Zentaurn und Faune, Sirenen und Melusinen, echte Sodomskinder, wie den Minotaurus, den Pasiphae ihrem Stier gebar. Glauben Sie, daß alle die Wundergeschichten, die überall leben, wo es Menschen gibt, nur aus den Fingern gesogen seien? Sie waren nur möglich, weil — von Urzeiten an — der Mensch sich dem Tiere vermischte. — Sie waren doch einmal Jurist, Doktor — sagen Sie mir: sind heutzutage solche Akte so selten?«
Er schüttelte den Kopf. »Sie kommen überall vor, in allen Ländern, und jeden Tag. Nur brauchen sich die Gerichte selten genug damit zu beschäftigen — weil sie stets in aller Heimlichkeit begangen und selten genug ans Licht gezerrt werden. Gottseidank!«
»Ich habe mir einiges ausgeschnitten,« sagte sie, »das ich gelegentlich in der Zeitung fand. In Chicago hielten sich sieben Chinesen ein Schwein — als Frau. Sie mästeten es dabei, fraßen es später auf — aus lauter Liebe vermutlich. In Berlin kannte ich einen Regierungsrat, der steckte seiner armen Frau Hühnerfedern in die Frisur — ließ sie laut gackern. Lebte seine Hahnenseele aus, krähte dabei wie ein Chantecler so stolz. Und ich weiß, daß Professor Harriman von Baltimore seit Jahren mit einer Äffin lebt — aus wissenschaftlichen Gründen, wie er angibt, um die Psyche des Tieres zu erforschen.«
»Gott ja!« lachte er. »Kein kalabrischer Ziegenhirt, keiner in den Pyrenäen oder der Pampa, der nicht unter seinen Geißen eine Geliebte habe! Gewohnheit macht Liebe — das ists. Man muß es komisch nehmen, wie Friedrich II. es tat. Wird ihm da ein Urteil vorgelegt — und das Dokument existiert noch — in dem ein Husar zum Tode verdammt ist, weil er sich mit seiner Stute vergangen hat. Da kritzelte der König an den Rand: ›Der Kerl wird zur Infanterie versetzt!‹«
Sie sagte: »Der wußte Bescheid, der König. Wissen Sie, was sein Freund Voltaire von ihm erzählt? Daß er seine Windhunde —«
»Ich weiß!« unterbrach er sie. »Aber das ist kein Kronzeuge — Voltaire!«
»Ganz recht,« nickte sie, »außerdem liegt die Hündin gewiß nicht in seiner Rasse Art. Das ist vielmehr der wilde Hengst — ein königliches Tier überall.«
Sie deklamierte:
»Zu Berlin im alten Schlosse
Sehen wir in Stein gemetzt,
Wie ein Weib mit einem Rosse
Sodomitisch sich ergötzt.
Und man sagt, daß diese Dame
Die erlauchte Ahnfrau ward
Unseres Fürstenstamms —«
»Heine!« rief er. »Glauben Sie den Dichtern nicht zu viel! Genau dasselbe — und sehr viel positiver — erzählt Alfred de Musset von seiner Freundin Georges Sand.«
»Und die war aus Wettiner Stamm,« entgegnete sie. »War eine Urenkelin des Marschalls Moritz von Sachsen, Königsblut — das edle Roß in Dresden wie in Berlin! — Glauben? Was heißt das: glauben? Ich kann es mir sehr gut vorstellen, daß die wilde Georges Sand dem frisierten Dichter einen Hengst vorzog! Eine Kuh liebte durch lange Jahre der König Wiswamitra, jede Rokokomarquise mußte ihr Fanfreluchehündchen haben. Vom goldenen Esel des Apulejus angefangen durch Tausend und Eine Nacht, Boccaccio und die Königin von Navarra ist überall Titanias Ohrenträger ein sehr begehrter Geliebter. Als Nelson starb, vertrat ein großer Neufundländer seine Stelle bei der schönen Lady Hamilton — und die englische Mode der weißen Angorakater hat hier in Neuyork auch manche begeisterte Freundin. Was wollen Sie — mehr wie ein Haus kenne ich in dieser Stadt, wo man für gutes Geld kaufen kann, was das Herz begehrt: Mädchen und Knaben und Ziegen und Enten und Esel — alles, alles! — Warum soll ich nicht glauben, was ich sah mit eigenen Augen?«
»Gut, gut,« rief er, »das mag alles sein. Aber Sie müssen mir zugeben, daß trotz alledem das verschwindende Ausnahmen sind, daß im großen und ganzen der Menschen Liebestrieb sich keineswegs irgendeinem Viehzeug zuwendet!«
Die Diva wiegte den Kopf hin und her. »Ja — und auch nein!« sagte sie. »Ich bin mir noch nicht ganz klar darüber. Das Gegebene wäre — das Einfachste — daß die Katzenseele im Menschenleibe den Kater suchen müsse. Den Kater — wie er da ist — mit Schweif und Pfoten und Schnurrbart. Da aber wird der Vorgang komplizierter: nicht den Kater — die Kater seele sucht sie, die allein. Und sehr unbewußt dazu, sehr instinktmäßig. Kein bißchen hilft ihr das Menschenhirn dazu, führt sie im Gegenteil auf Irrwege, wo es nur eben kann. So zwar, daß in vielen Millionen Fällen die arme Seele überhaupt nicht weiß, was sie eigentlich sucht, durch ein langes Körperleben im Dunkeln tappt, sich sehnt und sehnt und niemals weiß, wonach! — Findet sie aber durch Zufall in einem andern Menschen eine Seele ihresgleichen — dann ist sie glücklich — und weiß nicht warum. Sonst aber gibt sie, die Äffin, sich einem Fuchs oder Schwan oder Meerschwein hin. — Jeden Tag sehen Sie das, in allen Ehren, ringsherum! Und das ist das Köstlichste bei der ganzen Geschichte, daß solche Ehen und solche Lieben — bloß weil menschliche Leiber dabei sind — als normal gelten und als sehr natürlich, ob sie gleich wider alle Natur sind und recht eigentlich sodomitisch. Das aber, was die Menschlein sodomitisch nennen — wenn gleiche Seelen einander suchen und finden — das wieder ist das einzig Natürliche!«
Sie stand auf, ließ sich von ihm in den Pelz helfen. »Ich danke Ihnen, Doktor,« schloß sie, »daß Sie mir so hübsch zugehört haben. Denken Sie mal darüber nach, wenn Sie Zeit haben — es regt an. Mir hats Appetit gemacht — ich freue mich schon auf das Vögelchen, das unter meinem Christbaum auf mich wartet: ich denke, es soll ein paar Federn lassen in der Heiligen Nacht!«
Sie gingen hinaus in die Halle, warteten einen Augenblick, während der Page ihr Auto heranpfiff.
Noch einmal begann sie: »Manche Tierseelen wohnen in mir, das ist gewiß. Alles liebe ich, das groß ist und stark und wild und schön. Den Stier und den Hengst, den Adler und Schwan und Wolf.«
Sie schwieg; es war, als ob sie einen Einwurf erwarte — einen ganzen bestimmten.
Er zögerte. Sagte es dann doch, gezwungen fast, langsam genug. »Das alles bin ich also nicht?«
Da flammte ihr Blick. Da rief sie — und es war, als ob sie ihn anspeien wollte: »Nein! Nein! Du hast einer Wanze Seele, oder eines Flohs! Bist eine Mücke — eine Spinne vielleicht, eine Fledermaus! Bist alles — was saugt — das bist du!«
Triumphierend strahlte ihr Auge. »Auf Wiederschaun!« nickte sie. Ließ ihn stehn, schritt rasch hinaus.
Er stand da, blickte ihr nach mit offenem Munde. Fühlte gut, daß er ungeheuer blöd aussah in dieser Minute —
So wie damals, als er zum erstenmal in Hamburg war, ein Student. Er ging in den Alsterpavillon, wollte Zeitungen lesen; man sagte ihm, daß die nur im obern Stock seien. So stieg er die Treppe hinauf. Aber kaum hatte er die letzte Stufe genommen, da sprangen ein paar auf ihn zu — Gäste, Kellner, Hausknechte. Und es klatschte ihm schallend ins Gesicht, Ohrfeigen, gute Faustschläge — er flog die Treppe herunter im Handumdrehn. Riß auf dem Wege eine künstliche Palme mit und eine Küchenfrau, schlug unten ein Marmortischchen um und ein paar Stühle. Suchte seine Knochen zusammen, hob sich mühsam auf, stand da — mit offenem Maul —
Genau wie jetzt.
Dann kamen die Gäste und die Kellner — ein großer Auflauf rund herum. Ein Irrtum sei es, eine leidige Verwechslung. Ein anderer, der ihm sprechend ähnlich sähe —
Ja, irgend etwas hatte der andere angestellt — er verstand nicht recht, was. Aber er hatte die Ohrfeigen dafür bekommen. Sehr kräftige Ohrfeigen.
Sie klopften ihn ab, bemühten sich um ihn, redeten auf ihn ein. Er möge doch entschuldigen —
Dann lachte einer. Alle lachten — er auch. Es war doch komisch am Ende.
Aber seine Ohrfeigen hatte er weg. Die brannten gut.
Gerade wie jetzt.
Nur daß keiner kam und um Entschuldigung bat. Und daß keiner ein befreiendes Lachen anschlug.
Kein Irrtum, keine Verwechslung. Ihn meinte sie, ihn und keinen andern. Und ihn spie sie an, mitten ins Gesicht —
Der Page kam mit seinem Pelz. Langsam ging er auf die Straße.
Ein Autobus hielt an der Ecke, er stieg ein. Bemerkte dann erst, daß er die Straße hinauffuhr und nicht hinunter.
Zwei Herren nur im Gefährt. Aber der eine sprach ihn an — Dr. Samuel Cohn. Er trug Paketchen, wie jeder Mensch an diesem Abend.
»Wieder zurück?« rief der Arzt. »Da wird sich Ihre Braut freuen!«
Frank Braun nickte — gut, gut — der hatte die Abendblätter noch nicht gelesen — würde ihm also keine Fragen stellen. »Wo sind Sie heute abend?« fragte er rasch.
Der Arzt sagte: »Bei Ihrer alten Freundin. Sie hat nur ein paar Leute da, Professor von Kachele, Tewes, mich — noch zwei oder drei. Soll ich Grüße bestellen?«
»Ja — ja,« nickte er. »Grüßen Sie alle Bekannten. — Wie gehts Frau van Neß?«
»Besser nun, wirklich besser!« erwiderte Dr. Cohn. »Ich hatte sie ein paar Monate nach Saratoga geschickt, das hat ein wenig geholfen. Immerhin — sie ist halt sehr blutarm.«
Er stand auf, reichte ihm die Hand. »Ich muß aussteigen — hinüber zur Parkavenue. Fröhliche Feiertage!«
Auch der andere Herr stieg aus, ließ seine Zeitung liegen.
Frank Braun nahm sie auf, suchte herum. Da stand es — da waren die Bilder. Über die ganze Seite hin Ivys Bild. Auf der andern Seite ihre Eltern; dann der Herzog, blendend sah er aus, in Felduniform — wirklich ein junger Held. Ah, da war auch sein Bild — oben in der Ecke — ein kleines Medaillon, halbdollargroß.
Er zerknüllte das Blatt, warf es zu Boden.
Der Zentralpark — links. Nun mußte das Jeffersonhaus kommen, auf der andern Seite —
Überall Vorhänge vor den erleuchteten Scheiben. Dennoch feierlich — Weihnachtsfest, Verlobungsfest: unter allen Fenstern hingen kleine runde Kränze. Stechpalmen mit roten Beeren und roten Schleifen.
Er stieg aus an dieser Ecke. Blieb stehn, schaute hinauf einen kleinen Augenblick lang. Seufzte, rasch nur und leicht. Schlug den Kragen hoch, grub die Hände tief in die Taschen. Pfiff ein Studentenlied, stapfte zurück über nassen Asphalt.
Bitter? — Die Farstin irrte sich. Mochten die in dem mächtigen Steinhause so glücklich werden, wie sie nur konnten — Ivy, ihr Herzog, ihr Vater und ihre Mutter. Und der Generalkonsul auch — der war sicher dort oben zur Verlobungsfeier.
Allein war er — wieder einmal, wie die Diva sagte. Aber auch: frei — wieder einmal! Frei und allein — war es nicht dasselbe am Ende? — Er, der einzige Mensch in der Riesenstadt in dieser Nacht.
Keiner würde ein gutes Wort zu ihm sagen, heute am Christabend. Seine Mutter — gewiß war ihr Weihnachtsgruß in dem Umschlag gewesen. Aber der englische Zensor hatte sich die Zigarre damit angesteckt —
So brauchte er keinem dankbar zu sein. Sein Christgeschenk waren die Ohrfeigen, die ihm die Diva ins Gesicht spie.
Schade, daß er keinen Stock hatte! Es juckte ihn in der Hand, ein paar gute Lufthiebe zu schlagen —
Oder ein Pferd! — Jetzt durch den leeren Park!
Das hätte schon Ivy tun können — ihm zum Andenken die irische Fuchsstute schenken, die er am liebsten ritt. Eine Paßgängerin war sie, freilich — aber sie sprang, sprang! Was konnte ihr daran liegen — sie ritt sie doch nicht und hatte bessere Tiere, ein Dutzend und mehr.
Statt dessen: ihr Brief! Keinen Gruß — nicht einmal eine Anrede. Ein Weihnachtsgeschenk wie das der Sängerin: klatschende Ohrfeigen.
Ein Schaufenster noch hell erleuchtet: Cartier. Er blieb stehn, blickte durch die Scheiben. Eine Dame kaufte — einen Ring, eine Uhr — was es eben war.
Die Dame zahlte, nahm ihr Schächtelchen. Kam heraus, schritt dicht vorbei an ihm.
Das — das war — Dolores! War die Goyita —
Sie blieb stehen — erkannte ihn. Zuckte zusammen, schrie auf, hob ihre Röcke. Lief, floh über die Straße. Riß die Tür eines Taxameters auf, sprang hinein.
Weg —
Schnell, schnell — ehe er recht wußte, was geschah.
Noch eine Ohrfeige, dachte er. Das war sein drittes Christgeschenk.
Er trat zurück, zu dem Schaufenster hin — da war ein Spiegel an der Seite. Er starrte hinein.
›Wie ein Aussätziger bin ich,‹ dachte er. ›Wie ein Pestkranker.‹
Drinnen löschten sie das Licht — da ging er weiter. Aber die Spiegelfratze lief vor ihm her. Rückwärts — daß sie ihn immer anstarrte.
Angst sah er — und Gier.
Aber er wußte nicht, was er begehrte, und wußte nicht, wovor er sich fürchtete.
War er denn nicht froh gewesen, allein zu sein — frei zu sein von allem? Eben noch?
Er schritt, schritt weiter.
Wind und Regen. Und sein Schritt, sein tönender Schritt auf den Steinen. Klapp und Klapp.
Unionsquare — ein wirres Durcheinander. Zerbrochene Gitter, tiefe Löcher und mächtige Steinhaufen. Holzbuden, Plankenzäune, Laternenpfähle dazwischen und kahle Bäume. Ein paar zerschlagene Bänke — ein Denkmal dann. Ratten.
Ein Singen durch den nassen Wind. Irgendwoher aus einem Erdloch am Bau der neuen Untergrundbahn. Klänge der Kindheit, Traumklänge —
»O Tannenbaum, o Tannenbaum — —«
Nein, nicht die Worte — die Melodie nur.
Er blieb stehn, lauschte. Ah, das alte Kampflied der Iren in diesem Lande!
»Old Germany! Old Germany!
When do you set old Ireland free?«
Aber wie aus einem Grabe klang es.
Lüchows. Weiß gedeckte Tische, leere Stühle. Nirgend ein Gast.
Dann kam der junge Rossius auf ihn zu, schüttelte ihm die Hand. »Sie lassen lange auf sich warten, Doktor!« rief er. »Seit zwei Stunden sitz ich da.«
»Ists schon so spät?« sagte er. »Entschuldigen Sie. Setzen wir uns — erzählen Sie mir, was Neuyork inzwischen gemacht hat.«
Der andere druckste herum. Seufzte sehr vernehmlich, zog dann die Uhr heraus.
»Nun, was ist?« fragte Frank Braun.
»Ich bin nämlich eingeladen,« sagte Rossius. »Um zwölf Uhr — habe fest versprochen, pünktlich zu sein. Nun ists schon —«
»Ein neues Fräulein Braut?« lachte er. »Nun, sie wird warten können.«
Der andere sagte: »Es ist kein neues Fräulein Braut — ich habe überhaupt keine Braut mehr — weder alte noch neue. Ich bin eingeladen — Sie wissen ja, Herr Doktor.«
Er besann sich einen Augenblick. »Ah — bei Aimée, nicht wahr? Haben Sie auch ein hübsches Geschenk für sie?«
Der Sekretär griff in die Tasche, zog ein Manuskript heraus, reichte es ihm hin.
Da stand: »Die Perlenschnur. Ein Sonettenzyklus.« Und darunter: »Für Aimée B.«
»Also ihre Perlen haben Sie bedichtet!« rief er. »Warum nicht ihre Füße? Perlen haben viele Frauen, aber solche Füße nur Aimée Breitauer.«
»Die habe ich besungen — oft genug,« entgegnete Ernst Rossius. »Ihre Füße und Augen und Lippen — alles! Sie hat schon über vierzig Gedichte von mir — will sie herausgeben, wenn es genug sind für einen Band. Auf feinstem Japanpapier — in silbergraues Leder gebunden!«
Soviel Jugend, soviel Glück aus diesen blauen Augen —
»Laufen Sie,« rief er, »rennen Sie, fliegen Sie!«
»Auf morgen!« rief Ernst Rossius. Lief, war verschwunden im Augenblick.
Er setzte sich, bestellte sein Bier. Im nächsten Saale ragte ein gewaltiger Christbaum hoch zur Decke hinauf; von hinten her klangen die leisen Weihnachtslieder der Musikkapelle. Alles war richtig da, so wie es sich gehörte zur Christzeit.
Nur — kein Wachsgeruch, kein Duft von verbrannten Tannenzweigen. Glühbirnen hingen in diesem Baum.
Und die Lieder, die deutschen Lieder, die durch die Räume wehten, machten ihn krank. Er winkte dem Kellner, gab ihm Geld für die Kapelle — still sein möge sie. Aber der Kellner meinte, es sei schon Mitternacht, da würden die Musiker ohnehin nach Hause gehn.
Er saß da und wartete. Einer mochte: doch kommen von den vielen Gästen, die hier verkehrten. Einer konnte doch auch allein sein in dieser Nacht —
Wie er —
Niemand kam.
Die Musiker gingen. Dann die Leute von der Bar und die Kellner — einer um den andern.
Nur der eine blieb — der ihn bediente. Der wartete. Klebte an der Wand — lang, dünn und schmal — ein großes, vorwurfsvolles Ausrufungszeichen!
Frank Braun dachte: der hat eine Frau. Hat Kinder — die auch warten.
Auf ihn wartete niemand.
Er zahlte, schickte den Kellner fort. Blieb sitzen, starrte auf sein Glas, das er nicht berührte —
Saß da.
Manchmal kam der Hausknecht vorbei. Frank Braun winkte ihn heran, gab ihm Zigaretten und ein paar Dollarnoten. Winkte ihm, still zu sein, als er anheben wollte zu sprechen.
Dick war er, rot im Gesicht. Der hat schon gefeiert, dachte er, früh am Abend.
Und er saß da, blickte vor sich hin.
Dann stand er auf, ging ans Telephon. Rein mechanisch — willenlos fast.
Rief ihre Nummer — hörte ihre Stimme.
»Lotte —« sprach er.
Und er hörte: »Komm —«
Nichts sonst.
Aber er ging nicht.
Zurück an seinen Platz — setzte sich wieder vor sein schales Bier.
Saß da —
Nein — nein — er wollte nicht hin zu ihr. Fürchtete sich.
Drei Geschenke hatte er bekommen zu diesem Christfeste — drei, und das war genug. Von Ivy. Von der Farstin. Von der Tänzerin. Drei Geschenke. Und alle von gleicher Art.
Schallende Ohrfeigen —
Warum nur? Warum?
Und er saß — saß — durch die fröhliche Nacht —
Kroch nach Hause in der Dämmerung. Fiel in sein Bett.
Nein, er ging nicht zu Lotte van Neß. Blieb zu Hause einen Tag um den andern, arbeitete mit seinem Sekretär. Fühlte sich matt und müde und ausgeleert. Schlief viel, alle Nächte durch — stundenlang, auch mitten am Tage.
Er lag auf dem Diwan, spielte Schach mit Rossius eines Nachmittags, als ihr Auto vorfuhr. Sie ließ sich nicht melden, trat gleich ins Zimmer. War da.
Blieb, legte den Pelz ab. Setzte sich.
Keine Erklärung, keine Szene. Als ob sie gestern erst dagewesen sei, so tat sie. Als ob es so sein müsse und nicht anders.
Sie plauderte, sprach mit seinem Sekretär, schaute der Schachpartie zu, die langsam weiterging. Er sprach kein Wort.
Er hob den Turm, mit dem er eben ziehen wollte. Vergaß ihn niederzusetzen, hielt ihn fest in der Hand. Hörte zu, was sie sprach; vergaß dann, zuzuhören — blickte hinüber zu ihr — lange.
Vergaß endlich, sie anzusehen. Sank zurück — träumte, dämmerte so hin.
Schlief endlich.
Rote Schleier — immer nur rot. Rote Rosenblätter — roter Regen — blutendes Rot.
Und Angst, Angst — solch rasende Angst —
Da schrie er — erwachte von seinem eigenen Schrei. Sprang auf mit einem Satz. Tat ein paar Schritte, blieb stehn. Starrte um sich.
Allein war er — niemand im Raum außer ihm.
Aber ihr Duft ringsum, weich, süß — Jicky.
Was war denn geschehn? Was hatte sie gemacht? Blut sah er — soviel Blut —
Etwas preßte seine Hand —
Ein Messer — ja doch — ein kleines Messerchen.
Sie hatte es — und er riß es ihr fort. Das war es —
Er öffnete die Finger. Da fiel es auf den Teppich hin, ihm zu Füßen —
Kein Messer — die Schachfigur —
Draußen brüllte es — wieder fuhr er zusammen. Nein — ein Autotuten.
Dann ein Schreiten im Flur. Sein Sekretär kam zurück.
»Wo ist sie?« flüsterte er. »Wo ist — Frau van Neß?«
Der antwortete: »Ich habe sie eben zum Auto gebracht. Sie wollte Sie nicht aufwecken — so fest schliefen Sie.« Er hob die Schachfigur auf. »Wollen wir weiterspielen, Doktor? Sie sind am Zug.«
Frank Braun antwortete nicht. Blickte den andern an, lauernd, mißtrauisch —
Dann fühlte er einen leichten Schmerz. An der Schulter — unter der Achsel. Nein — tiefer im Rücken wars. Nein, nein — mitten auf der Brust —
Er riß Jacke herunter und Weste, Schuhe, Hosen und Hemd. Blickte herum an seinem Leib, suchte —
Fand nichts. Betastete sich sorgfältig von oben herab.
Die Wunde, wo war die Wunde?
Er lief hinüber ins Badezimmer. Stellte sich vor den großen Spiegel. Bog den Kopf herum, suchte am Rücken.
Nichts — nichts. Er schloß die Augen. Wo denn tat es weh?
Aber er fühlte nichts mehr.
Sein Sekretär kam ihm nach. »Was ist los, Doktor?« meinte er. »Was haben Sie denn?«
Er sagte: »Ich bin — gestochen. Irgendein Insekt hat mich gebissen. So helfen Sie mir doch suchen!«
Rossius drehte noch ein paar Lichter an, strahlend hell war das Badezimmer. Suchte herum, schüttelte den Kopf. Sagte dann: »Sie haben geträumt, Doktor.«
Nun fühlte er es wieder. Kein Schmerz — ein kribbelndes Jucken nur. Und nicht an einer Stelle — überall hin über die Haut. Klebrig — kalt dabei.
Er zitterte, klapperte mit den Zähnen. »Meine Kleider!« stotterte er. »Es ist kalt hier.«
»Kalt?« sagte Rossius. »Zwanzig Grad wenigstens!«
Sie gingen zurück und er zog sich an. Konnte er dem Jungen trauen? — Ach, der würde ihn verraten — jeden Augenblick! Nicht um Geld — gewiß nicht, aber um jeden Kuß von geschminkten Lippen.
Vorsichtig fragte er: »Wie lange schlief ich?«
»Eine gute Stunde!« erwiderte der andere.
Frank Braun schwieg eine Weile. Setzte sich, rückte seine Figur. Gab sich Mühe, recht gleichgültig zu sein, begann endlich: »Sie waren doch draußen, nicht? Ich habe Sie doch hinausgehn sehn, als Frau van Neß da war? — Haben Sie die Briefe besorgt?«
»Nein,« antwortete der Sekretär, »da liegen sie noch. Ich war gar nicht vor der Tür, wir haben beide dagesessen und leise geplaudert — um Sie nicht zu stören.«
Er schrie ihn an: »Sie lügen! — Sie lügen! Sie haben mich allein gelassen mit — mit —« Seine Stimme überschlug sich, seine Hände verkrampften sich. Ah — an die Kehle fahren wollte er ihm, würgen, würgen —
Sein Sekretär stand auf — aschfahl im Gesicht.
Nicht eine Silbe sprach er.
Frank Braun starrte ihn an — hilflos, fassungslos, flehend.
Der andere verstand ihn gut. Setzte sich wieder, zog den Läufer.
Und sie spielten weiter. Stumm, schweigend.
Eine Partie. Noch eine —
Sie gingen aus, spät genug. Broadway hinunter. Schlenderten so hin.
Ernst Rossius sprach. Erzählte von seines Lebens großem Abenteuer — von der schönen Aimée.
Er hörte hin, mit halbem Ohr, blickte zugleich ringsum auf das hastige Treiben.
Tenderloin. Manhattans Rippenstück.
Die Theater leerten sich. Pelze und Zylinder. Bunte Abendmäntel und Brillanten. Autos, Tausende von Autos.
Dirnen? Wenn welche da liefen — man hätte sie nicht herausfinden können. Sah doch jede Dame wie eine Straßendirne aus — geschminkt, dick gepudert, gemalt die Lippen, Augen und Ohren. Überdeckt mit buntem Schmuck.
Und gemalt auch die Bengel, die zuletzt kamen aus den Theatern, auf und ab schalanzten unter den hellen Schaufenstern. Chorherren, Arm in Arm, Affen, auf Ragtime dressiert, krank und verfault. Ausschußware jämmerlicher Qualität — die Broadway beherrschte um diese Zeit. Und die ihre Liebhaber fand — dennoch.
Dann, weiter unten, die Matrosen. Stramme Jungen, sonnverbrannt. Kräftig, gesund, reingewaschen. Auf und nieder — wie die Chorjüngelchen. Käuflich wie sie — nur billiger.
Weiber auch — nur Jüdinnen in dieser Gegend, die hinüberkamen von der Ostseite, langsam die deutschen Dirnen hier verdrängten. Die liefen jetzt oben herum — so um die achtzigste Straße.
Jede Gegend der Stadt, jede Vorstadt auch, trug ihren Charakter: in der Nacht brach er durch — Negerweiber dort — Griechenbengel an anderer Stelle. Irische Viertel, italienische, ungarische. Alle Nationen mochte man durchkosten in dieser Stadt. Konnte sich Armenierinnen einhandeln, Kubanerinnen, Böhminnen. Französinnen, Engländerinnen, soviel man haben wollte, Mädchen aus Kanada, aus Syrien und Rumänien —
Welch ein Markt! — Billig, billig! Ein Dollar aufwärts das Stück!
O ja, die Farstin hatte schon recht: jedes Laster konnte man hier kaufen — wie die roten Äpfel an den Obstständen der Straßenecken.
›Die Äpfel schmecken nicht,‹ dachte Frank Braun. ›Fad sind sie alle und schal — wie lauwarmes Wasser. Wie ihre Sünden auch — das Klima macht es!‹
Sie nahmen ein Taxi, fuhren hinauf zum Hotel Plaza, tranken Sekt im Grillraum, schauten dem Tanzen zu. Ins Biltmore dann, zum Maxim und zum Ritz. Überall dasselbe: Foxtrott, Lame Duck, Hesitation, Ragtime — immer wieder. Synkopiert alles — sogar den Feuerzauber synkopieren diese Kapellen.
Das tanzte ohne Unterbrechung. Zwei Kapellen überall — im Augenblick setzte die eine ein, wenn die andere zu Ende war. Das tanzte, tanzte — ohne Empfindung, ohne irgendein Gefühl. Nur ein Schreiten war es, nur ein Drehn — ein Bewegen, das schwitzen machte. Ein Bewegen, immer bewußt, immer kontrolliert — immer aufmerksam lauernd auf den nächsten Schlag der Synkope.
Immer unfrei, nie ein berauschtes Blut, nie ein Fleisch, das sich austoben mochte in Schleifen und Springen. Wie ein Sonntagsschulmeister saß irgendwo, dürr und neidisch, die Synkope, klopfte mit hartem Lineal alle Kinder auf die Finger, die nicht mäuschenstill und kerzengerade dasaßen. Hielt sie fest an der Strippe, wie gezähmte Affen, die die Peitsche fürchten.
Pfaffenmoral im Tanzsaal: Synkope!
Hinunter fuhren die beiden zum »Nachtasyl«. Deutsch wieder alles in diesem Bumms, dessen kluge Wirtin aus polterndem Radaupatriotismus dicke Stangen Goldes schmolz. Nationallieder, eins ums andere — da brüllte das ganze Lokal. Operettenkram dazwischen, dann Strophen auf Hindenburg und Mackensen und den Kaiser, auf die gemeinen Engländer und die italienische Lumpenbagasch. Und das trunkene Publikum lachte und weinte und jauchzte abwechselnd, fand sehr ergreifend, was eben ergreifen sollte, und komisch, was komisch sein sollte. Wirkte mit an allen Tischen, trank Wein und Bier und Sekt, küßte die deutschen und jüdischen Mädel, die ihm auf den Knien herumlagen und saßen.
Franz, der Klavierspieler, zerhämmerte sein Instrument, kämpfte verzweifelt, seine Kunst gegen diese Gäste durchzusetzen. Nie gelang es ihm, immer mußte er ein Stück abbrechen und die Melodie spielen, die die andern brüllten. Die meinten, daß ›noch die Tage der Rosen — Ro — sän — wären‹ und schrien es hinaus mit krachender Energie, daß nur ja keiner wagen solle, daran zu zweifeln.
— »Wohin nun?« fragte Frank Braun.
Ernst Rossius zog die Uhr. »Sechs schon! Ich habe grade Zeit, nach Hause zu fahren und ein Bad zu nehmen. Dann muß ich zur Redaktion.«
Nach Hause also.
Er ging die Stufen hinauf, schloß die Haustüre auf. Durch den Flur dann zu seinen Zimmern. Blieb stehn, stutzte — etwas bewegte sich da drinnen. Und ein Lichtschein drang durch die Ritzen. Er lauschte angestrengt. Ein leises Geräusch — als ob jemand auf und nieder gehe.
Fred? — Aber nein — unten vom Treppenloch her hörte er sein röchelndes Schnarchen.
Leise steckte er den Schlüssel ein. Drehte um, riß die Türe auf mit einem Ruck.
Vor ihm stand Lotte.
Und ein Duften rings — so viele glühende Rosen.

In diesen Zeiten schrieb er eine Art Tagebuch. Er schloß es sorgfältig ein, nahm es nur heraus, wenn er allein war und ganz sicher vor jeder Störung. Machte dann seine Eintragungen.
Mit einer Geschichte seines Leidens begann er. Er durchstöberte sein Gedächtnis, immer von neuem, grub und schürfte, trug alles zusammen, was damit in Verbindung zu sein schien. Schrieb es auf, wahllos zunächst, ordnete dann, suchte die Zusammenhänge.
In Europa hatte es begonnen, manche Monate, ehe er abfuhr. Eine Unruhe und Ungeduld, ein Gereiztsein aller Nerven. Ein Sehnen nach irgend etwas —
Etwas, das in ihm lag, seit —
Nein, er wußte nicht, seit wann.
Wohl erinnerte er sich einer Zeit, wo es nicht da war. Wo er das genoß, was die Stunde brachte. Stark und einfach, selbstverständlich, tierisch. Prachtvoll tierisch, dachte er.
Langsam wuchs es. Sehr langsam und ganz allmählich. Nahm Besitz von ihm, ließ ihn nicht mehr los. Machte ihn unstet und ungeduldig, trieb ihn fort am Ende.
Und wurde still, ruhig, kapselte sich ein — sowie er draußen war eine Zeitlang.
Wenn er die Gluten der Tropen trank, wenn er irrte in versunkenen Städten, die der Urwald fraß, wenn er die Einsamkeiten der Wüste atmete und seine Sehnsucht sich badete in den Unendlichkeiten aller Meere — das hielt ihn gut, das gab ihm neue Kraft für neue Jahre in der Heimat.
Einmal hatte ers so gemacht, zweimal und mehr: gesund kam er heim, stahlhart.
Wenn ers überdachte — nein, eine Krankheit war das nicht. War — im schlimmsten Falle — eine Anlage nur, ein Nährboden, auf dem ein Giftiges wuchern mochte.
Auch diesmal half das alte Mittel.
Denn gesund — oder doch fast gesund — war er schon an dem Tage in Antofagasta. Kaum ein Kleines noch war noch zurückgeblieben — irgendein Leichtes, Seltsames, Weiches und Verwildertes. An dem Tage, als er den Seelöwen zusah, die die Heringsschwärme hetzten, hineinjagten in die Silberwellen im Hafen von Antofagasta. An dem Tage, als das erste Wetterleuchten zuckte am Himmel der Heimat, als der Schrei rings um die Welt jagte, durch die Drähte in Meeren und Landen, durch die Lüfte in funkenden Wellen: der wilde Schrei von Sarajewos Mordtat —
Dann das Fieberschiff und das gelbe Sterben. Das Schneckenkriechen hinauf an der Westküste — die rasche Fahrt quer durch die Staaten. Und der Krieg, der Krieg —
Kein Symptom fand er aus dieser Zeit. Wenn er wirklich schon krank war, damals schon — wenn schon die Giftkeime eines Leidens in ihm steckten — so traten sie doch nicht in Erscheinung. Oder aber: er sah sie nicht — war blind und taub — achtete nur auf die Blitze, die dicht um ihn zuckten — und überall rings in der Welt.
Erst in Neuyork spürte er, daß er krank war, in den Wochen erst, als er sie wiederfand: Lotte Lewi.
Und das war gewiß: mit dieser Frage hing sein Leiden zusammen. Auch mit andern — vielleicht! Aber ganz sicher mit ihr.
Welches Leiden denn? Er trug alle Einzelheiten zusammen, verglich sie; schrieb nieder, was jeder einzelne gesagt hatte von all den Ärzten, die ihn untersuchten. Zum Verwechseln ähnlich ihre Diagnosen: er sei völlig gesund, Herz; Lungen, Nieren — alles. Eine Apathie nur, ein kleines Nervenleiden. Psychischer Ursache vermutlich — der Krieg! Nur der eine, Dr. Samuel Cohn, hatte wenigstens den Versuch gemacht, tiefer zu schürfen. Hatte von der Möglichkeit gesprochen, daß vielleicht ein schleichendes Tropenleiden —
Aber Vermutungen nur, vag und phantastisch, auf nichts gestützt. Er schrieb sie nieder, dennoch, Wort um Wort. Las sie durch, wog sie und wägte sie — konnte nichts damit anfangen am Ende.
So war das Bild seines Zustandes, das sich gleich blieb durch diese Jahre in allen großen Zügen:
Eine Müdigkeit zunächst. Aber eine, die nicht gewöhnlich war, die nicht verlangte nach Schlaf. Ja, oft war es grade umgekehrt: eben wenn er geschlafen hatte, lange, tief und fest — nachts oder auch tagsüber — grade dann fühlte er sich so müde und matt. Sein Schlaf war, wie er immer war, ruhig, tief und traumlos. Nur manchmal nun, in gewissen Spannen, schlichen sich zerrissene Träume hinein.
Diese Träume — vielleicht mochte er hier einen Anhaltspunkt gewinnen. Er nahm sich vor, sie niederzuschreiben, einen um den andern. Aber zunächst mußte er das Leiden selbst haben mit all seinen Erscheinungen.
Müdigkeit also. Oft ganz plötzlich, einsetzend im Augenblick. Dann wieder langsam sich vorbereitend, ganz allmählich besitznehmend von seinem armen Leib. Es kam vor, daß er nicht zuhörte, wenn jemand zu ihm sprach, oder, daß er wohl jedes Wort hörte, aber nicht den Sinn verstand. Auch, daß er selbst nicht weiter konnte, mitten im Satz stecken blieb, einen Namen, ein Wort, einen Satz verlor. Ein plötzliches Aussetzen des Gedächtnisses also.
Manchmal, wenn es ein rascher Anfall war: ein plötzlicher Schwindel, wie damals, als er in Torreon vom Pferde sank. Ein Taumeln, Zittern, Schlottern, das ihm jede Herrschaft über seine Glieder raubte. Dann wieder ein Hindämmern durch lange Stunden und Tage, ein Gefühl der Leere, des Ausgepreßtseins, des kläglichen Hinwelkens und Verwelkens.
Ein Schlafwandeln zuweilen. Einmal hatte ihn sein Sekretär dabei ertappt, ein paarmal der alte Diener. Und gewiß kam es öfters vor, ohne daß ers feststellen konnte.
Sehr verschieden schien ihm die Kraft dieser Anfälle. Zuweilen griffen sie nur den Leib, ließen das Hirn völlig frei, so daß er genau ihre Wirkungen beobachten konnte. Dann auch schienen sie bloß das Hirn zu verwirren — oder auch nur einen Teil davon. Das war ein paarmal vorgekommen, wenn er vor dem Publikum stand, mitten in einer Rede. Seine Lippen sprachen weiter, bildeten mechanisch die gewohnten Worte. Aber er fühlte, daß etwas fehlte, daß er nicht hinüberkam über die Rampe, daß eine mächtige Mauer aufwuchs zwischen ihm und den Leuten da unten.
Endlich auch kam es vor, daß ein guter Anfall beides nahm: Körper und Hirn zugleich.
Es gab Zeiten, wo er sich nicht krank fühlte — und doch nicht gesund. Dann tat er alles wie sonst, aber maschinenmäßig, vegetierte so hin, gleichgültig, leer und kalt.
Freilich, dazwischen, wenn er sich gesund fühlte, pulste sein Leben. Jung, kräftig, blühend und stark. Das war seltsam genug: gestern noch mochte es ihm eine ungeheure Anstrengung kosten, nur die Hand auszustrecken, und heute konnte er stundenlang schwimmen und wieder Stunden im Sattel sitzen.
Sein Aussehn?
Je nun, er sah gut aus, wenn er sich gesund fühlte. Und jämmerlich elend, wenn er krank war. Alle sahn es ihm an, mit denen er öfter zusammen kam, konnten ihm auf den Kopf zusagen, wie es heute bestellt war mit ihm. ›Wie Sauerbier und Spucke‹ hatte der Rossius einmal gesagt! Dann aber — und das sahn die andern kaum — kam ein sehr Fremdes in seinen Ausdruck. Zuweilen fiel es ihm leichthin auf — dann hatte ers ganz deutlich gesehn in der Christnacht — vor Cartiers Spiegelscheibe, als die Goyita aus dem Laden trat.
Ein Fremdes war es und Seltsames.
Jetzt, während er seine Aufzeichnungen machte, setzte er sich manchmal vor den Spiegel, lange genug. Studierte, suchte —
Etwas war in seinen Zügen, das früher nicht da war.
Nun war es da, stets, auch wenn er sich ganz gesund fühlte. Ein leiser Ausdruck der Unsicherheit — und zugleich ein Wünschen. Aber es steigerte sich, wurde sehr deutlich und klar, wenn diese Müde ihn griff, verzerrte sein Gesicht, wurde zur bizarren Fratze, wenn der Anfall gut einsetzte.
Zur leisen Furcht wurde dann seine Unsicherheit, und die kleine Furcht zur schmählichen Angst. Ein Begehren wurde sein Wünschen, eine wilde Gier das Begehren.
Und ein drittes dazu, das stärker wurde mit jedem Tage —
Das war: der Ausdruck einer jämmerlichen Verzweiflung.
Den verstand er, verstand er gut. Verzweiflung — darüber, daß er nichts begriff von dieser Angst und Gier!
Wonach? Weshalb?
Er war sich völlig klar darüber, daß all das Zeug, das er hineinfraß und spritzte, ohne jede Heilwirkung war. Mit kleinsten Dosen Strychnin fing er an, erst in Pulverform, später in Pillen. Dann hatte er Morphium versucht, Muscarin, Digitalin, Atropin und Kokain; jedes hielt ihn aufrecht für eine Weile. Nur sehr wenig half ihm Heroin, und völlig zwecklos schien Opium. Wenn er es rauchte, schlief er bald ein, träumte. Wachte später auf, genau so krank wie zuvor, noch zerschlagener womöglich. Dagegen mochte ihn Arsenik für manche Stunden frisch halten, auch Mescal, wenn er es in geringen Dosen nahm.
Aber all das konnte im besten Falle einen langsam schleichenden Anfall hinausschieben — nie ihn verhindern. Konnte ihn — auf einen Tag und noch einen, auf eine Woche vielleicht — zu dem Menschen machen, der er immer war, aber weiter nichts. Konnte ihn einen Abend retten, an dem er zu reden hatte, ihn fähig machen zu einem wilden Ritt — das war alles.
Eine größere Widerstandskraft gab es seinen Nerven, bis sie dann, in plötzlichem Anfall — um so jämmerlicher zusammenbrachen.
Stimulantien waren es — nicht einmal das.
Das war wohl nur Einbildung, daß er meinte, daß ihm eines helfe: menschliche Berührung. Eine fixe Idee nur, eine Autosuggestion.
Als er damals vom Pferde sank, bei dem Eisentor vor Villas Garten, die Zügel fallen ließ, hilflos vornüber stürzte — da genügte der starke Händedruck des Offiziers. Er erinnerte sich gut, wie er den warmen Druck spürte, wie im Augenblick alle Besinnung ihm wiederkam. Wie seine Schenkel zufaßten, wie die Hände wieder die Zügel griffen —
War es nicht dasselbe in Philadelphia — bei der Debatte gegen die Livingstone? So ausgebrannt war er, so leer, so völlig verloren — und trank alle neue Kraft aus der Diva rotgemalten Lippen.
So war es auch bei der kleinen Ivy — stark machte ihn die Berührung ihres jungen Leibes. Und je zärtlicher sie war, je näher und nackter sie sich an ihn schmiegte, um so mehr fühlte er dies in ihm erwachende Leben.
Aber mehr als bei ihr und viel, viel stärker hatte er dies Empfinden bei Lotte. Wenn nur ihre Wange ihn streifte, wenn ihre kleine Hand sich leise hineinschob in seine Hand —
Ihr Puls, ihr Puls —
Er brauchte nur die Augen zu schließen, um ihn zu fühlen.
Fühlen? Er beobachtete sich genau. Machte den Versuch wieder und wieder.
Fühlen? War es wirklich ein Fühlen? — Und nicht viel mehr: ein Wünschen nur und Begehren?
Das war es, was ihn stutzig machte.
Und er schob den Gedanken wieder fort — diese phantastische Hypothese, daß menschliche Berührung Einfluß habe auf sein Leiden.
Einbildung, Autosuggestion —
Tropenanämie, dachte er manchmal. Das war eine Annahme, die manches Bestechende hatte.
Diese Müdigkeit, die trostlose Gleichgültigkeit. Dies Hinwelken, dies Gefühl der Leere. Dieses Hindämmern, plötzliche Vergessen, Taumeln — Zittern, Umsinken. Die Atemnot. Und dies Herzklopfen — wie eine Schiffsschraube außer Wasser!
Aber dann: er war gar nicht anämisch, hatte Blut in Hülle und Fülle, voll von roten Blutkörperchen, recht gesunden, die von Farbstoff und Sauerstoff strotzten.
Und seine Lippen, sein Zahnfleisch, die Augen — alles gesund. Nirgend eine Spur von Blutarmut.
Auch mit den Träumen konnte er wenig anfangen, ob sie gleich, wenn er sie nun verglich, einander sehr ähnlich sahen, alle im Grunde auf dasselbe hinausliefen.
Aber wenn er sie zergliederte, so schien ihm die Form von dem Gift gegeben, das er eben zu sich genommen hatte, Mascarin, Mescal, was es grade war. Der Inhalt aber bot nichts als ein vages Bild seines Zustandes.
— Pferde, denen des Stieres Hörner die Eingeweide herausrissen. Die Igel, die mit ihren Pfötchen die dicken Kröten umdrehten, den Leib ihnen aufbissen und die Eier herausfraßen.
War er nicht die Kröte? Er das Pferd?
Oder der Dicke, der immer trank, trank?
Was denn? — Ihn!
Die Arme des Polypen, aus denen Weiber wurden: ihn saugten sie aus. Und das Urteil des amerikanischen Gerichtes, das ihn verdammte, auf elektrischem Wege ausgesaugt zu werden.
Freilich: dann kehrte es sich um. Dann war er es, der saugte und dick und fett dabei wurde. So wie das Urteil behauptete.
Objekt und Subjekt tauschten ihre Rolle: Mescalwirkung.
— Die roten Träume aber, die frei waren von der Einwirkung eines Rauschmittels, die ihm vage und wilde Bilder — albern genug oft — vorgaukelten, leuchteten immer nur in zwei Klängen: Angst und Gier.
Auch das war ja am Ende genau dasselbe — und hier so leicht zu erklären: Angst davor: ausgesaugt zu werden — leer zu sein, hinzuwelken.
Die Umkehrung wieder: die Gier, selbst zu trinken.
Es war nur wieder ein Ausfluß seines Leidens.
Überall tappte er im Dunkeln.
Heller wurde es nur, wenn er an Lotte dachte.
Und ganz greifbar, sehr wirklich und tatsächlich war etwas: ihre Messerchen.
Auf seiner Mexikofahrt hatte sie ihm das kleine Messer mitgegeben. Spiegelblank, ohne jeden Fleck. Schrieb ihm dazu: »Trag es für mich. Wenn du nicht mußt, gebrauch es nicht. Bring es mir zurück, wie es ist. Dir wird es nichts sagen — mir: alles.«
Er folgte ihrer Laune, trug es, wie sie es wünschte, in der Brusttasche seines Hemdes.
Aus Platin war der Griff, und sie hatte ihrer beiden Sternzeichen hineinschneiden lassen, den Skorpion und den Taschenkrebs. Irgendwelche Eigenschaft legte sie ihnen bei — das war sicher.
Sie sagte, das Messerchen werde ihr zeigen, ob er ihr treu bleibe. Das sagte sie — aber sie log vermutlich. Hatte ganz etwas andres dabei im Sinne.
Denn er betrog sie mit Aimée Breitauer auf dem großen Feste der Monddamen — strahlend blank blieb ihr Messerchen. Und es berührte sie ganz und gar nicht, als er ihr später davon sprach.
»Was gehts mich an?« hatte sie gerufen.
Dann aber — an dem Tage, als die Goyita ihn besuchte — ward das Messerchen blutig. Und doch — alle Eide hätte er schwören können, daß er sich nicht rührte von seinem Diwan in diesen Stunden. Daß er ruhig dalag, schlief und träumte, schwere Mescalträume —
Dennoch: das glaubte sie ihm nicht! Ihr Messer ward voller Blutflecke, und also war er schuldig! Dann also wäre er aufgestanden, mitten in seinen Träumen, hätte unbewußt —
Aber nein! Lotte van Neß hatte selbst ihm gesagt, daß sie die Tänzerin habe untersuchen lassen. Und das Resultat: Virgo intacta!
Was immer ihr Aberglauben war, ihre Narrenidee mit diesem Messerchen: mit seiner Treue und Untreue konnte es nichts zu tun haben.
— Und sie log, Lotte van Neß, ein zweites Mal. Ließ sich von Dr. Cohn ein schönes Bistouri geben, mit all den hübschen Instrumenten, Messerchen, Scheren, Pinzetten. Erzählte dem Arzte, daß sie es haben wolle für — ihre Hühneraugen. Hier hatte er sie ganz fest — das war eine glatte, bildschöne Lüge: nie hatte sie Hühneraugen gehabt ihr Leben lang.
Ein drittes Mal log sie. Das war, als er den Siegelring bei ihr fand, der Magdeburgs Wappen trug. »Meine Mutter stammt dort her,« erklärte sie ihm. »darum kaufte ich ihn.«
Doch die Kühbecks kamen aus Thüringen und nicht aus Magdeburg. Nur das Bild war es, das sie reizte an dem Steine: der Pelikan, der mit dem Schnabel die Brust sich aufriß, seine Jungen nährte mit dem eigenen Blute.
War es nicht wieder dasselbe? Bluttrinken aus lebendem Leib? Und mit diesem Steine siegelte sie alle ihre Briefe an ihn. Nie nahm sie einen andern. Aber die gute Wahrheit sprach sie, als sie dem Doktor antwortete, daß nun das Besteck wohl nicht mehr nötig sei. O ja: denn an diesem Tage hatte Ivy Jefferson ihr ihn weggenommen.
Dennoch behielt sie den schwarzen Kasten. Sagte: ›Später vielleicht.‹ Später: das war, wenn er zurückkehren würde zu ihr. Später — das war: jetzt.
Doch dies waren nicht ihre einzigen Dinge, die gut waren zum Schneiden oder Stechen. Er erinnerte sich der Nacht, als sie den Schlaftrunk ihm bot — den sie dann selbst trank. Da hatte er auf ihrem Nachtkasten eine Reihe anderer Messerchen liegen sehen — geöffnet, mit blanken Klingen. Er hatte sich vorgenommen darauf zu achten — hatte viele Stunden wachgesessen in ihrem Bett, lange sie belauert. War doch eingeschlafen am Ende, hatte vergessen auf die Messerchen.
Doch sah er — als er aufwachte: — einen großen Blutfleck in Lottes Kissen.
Daran konnte kein Zweifel sein: die Messerchen spielten ganz gewiß mit in der Narrenkomödie, deren Hauptrolle Lotte hielt und in der er einen unfreiwilligen Part hatte. Einen sehr passiven dazu, einen — leidenden!
— Daß ihre Messerchen auch in seinen Träumen auftraten, war sehr begreiflich. Da wuchs ihm das kleine Ding, das ihm Lotte gab, zum langen, breiten Messer, mit dem er sich verteidigte gegen die schleimigen Saugarme des gewaltigen Kraken, in den sich der Dicke verwandelte. Oder aber, er stand auf in der Nacht, öffnete das kleine Messer, ging an den Toilettentisch, spielte herum mit den Gilletteklingen — wie damals, da ihn der junge Rossius beim Schlafwandeln erwischt hatte.
Und dann: Blut sah er — im Schlafen und Wachen immer und immer wieder rotes Blut. Rote Röslein, die hinabfielen, roten Blutregen. Sah die Wunde auf der Goyita weißer Brust, als sie die Rumba tanzte. Einen kleinen, schmalen Blutstreif. Sah Blut oft — mitten in seinen Reden; Blut in all seinen Träumen.
Aber auch das war verständlich: wenn Messer schneiden, muß Blut fließen. Dann auch: ewig die Blutwolke, die herüberwehte von Europa, alle Blätter rot gefärbt, Tag um Tag.
Sehr rot war diese Zeit.
— Nur eines konnte das alles beweisen: daß sich auch während des Schlafes seine Phantasie mit Blut beschäftigte. Wie sie es oft genug tat am hellen Tage.
Dennoch diese Messerchen waren Lottes ureigene Idee. Sie waren da — und sie mußten einen Zweck haben.
Welchen nur?
Gebrauchte sie die Dinger? Gegen — ihn? Und wozu dann?
Wenn sie ihn verletzte — so mußte doch eine Wunde zurückbleiben! Das hatte er geglaubt, als sie neulich kam, mit dem Sekretär plauderte, während er einschlief. So fest geglaubt, daß er vermeinte, den Schmerz zu fühlen.
Darum riß er die Kleider ab, darum suchte er herum am Leibe wie nach Flohbissen.
Aber nichts, nichts. Nicht der kleinste Kratzer auf seiner Haut.
Einbildung nur, nervöse Überreizung —
Dennoch: dies war der Schlüssel — ihre Messerchen.
Er hielt ihn in der Hand — aber er wußte nichts damit anzufangen.
Sie aber, Lotte, wußte es gut. Offen genug hatte er seinen Verdacht ihr ausgesprochen — kaum gewehrt hatte sie sich dagegen. ›Gib dir keine Mühe!‹ hatte sie gesagt. ›Ich will es nicht sagen — so sage ichs nicht.‹
Er bestand nicht weiter. Er kannte sie gut: sie würde ihr Wort halten, keine Silbe mehr sprechen.
Seinen Verdacht teilte die blonde Ivy. Sie hatte ihm den kleinen Kalender gezeigt, in dem sie sehr sauber viele Daten angestrichen hatte. Perlikke-Perlakke war es — das reine Wetterhäuschen! Wenn er sehr gesund sich fühlte, dann war Lotte krank. Aber ganz gesund wieder, wenn ihn sein Leiden faßte. Gesund machte sie ihn und krank — wie sie grade wollte: und das hing auf das engste mit ihrem eigenen Befinden zusammen.
Es war, als ob er gar kein Eigenleben mehr habe. Eine Puppe war er in ihren kleinen Händen, ihr Hampelmann, den sie springen ließ.
Und er ließ sich leiten von ihr — wie sie es wollte. Sehr feminin war sein Empfinden zu dieser Frau — sie war der Mann, und nicht er. ›Du bist Boden. Bist Weib und Mutterschoß —‹, waren das nicht ihre eignen Worte?
Sie schob ihn. Was er tat, tat er für sie und durch sie. Ah — selbst ihr Denken trank er ein!
Und das hielt an, auch in der Zeit, da er sie nicht sah. In den langen Monden — da er mit Ivy war.
Krank war sie, schwach, leidend und elend, wenn er sehr gesund war.
Krank? Ja, was fehlte ihr denn?
Anämie — Blutarmut! Darauf behandelte sie Dr. Cohn, darum hatte er sie nach Saratoga gesandt.
Blutarm war sie, bleichsüchtig, anämisch. Hatte also das sehr natürliche Bestreben, alles zu versuchen, um frisches, gutes Blut zu bekommen. Darum fuhr sie ins Bad, darum nahm sie Arsenferratose, schluckte Hämatogen, Levico-Wasser, Somatose — alles was Eisen enthielt und Arsen. Um den Mangel an Hämoglobin und Sauerstoff ihren roten Blutkörperchen zu ersetzen.
Und sie war angesteckt von dem wilden Aberglauben dieses Landes. Jagte herum von einer Wahrsagerin zur andern, ließ sich zu Dutzenden Horoskope stellen. Nur nahm sie es ernster, wissenschaftlicher, europäischer, ging gründlich in die Tiefe, wo die andern an seichtester Oberfläche klebten. Studierte selbst in allen wilden Mystikern, nahm den Professor von Kachele in festen Sold. Wies tausend Absurditäten lächelnd zurück, aber glaubte doch an die tausendundeinste Möglichkeit.
Was hatte der Kachele gesagt? ›Es ist alles möglich in Menschenhirnen.‹ — Und daß das wahr sei, unumstößlich wahr, dafür war er selbst der lebendig herumlaufende Beweis.
Er — und der Weltkrieg: war der nicht auch ein rasender Wahnsinn — geboren aus Menschenhirnen?
Dann aber: wie war es verwunderlich, daß auch diese Frau nach einem Heilmittel für ihr Leiden suchte — weltenfern von aller ärztlichen Wissenschaft?
Darnach suchte — und — vielleicht? — es fand?
Eine kleine Kristallkugel trug sie an goldenem Kettchen um ihren Hals — ein Flügelgreif war hineingeschnitten. Der Professor erkannte gleich den Sinn des Amulettes: Milch sollte es bringen. Und sie hatte genickt: ›Ja, ja — rote Milch!‹
Rote Milch? Das war: Blut und nichts anders.
Und wenn sie noch so wenig daran glauben mochte — so spielte sie doch mit dem Gedanken. Keine Frage war es, daß ihr jedes Mittel gut war, recht, recht viel gesunde ›Milch‹ zu bekommen — rote Milch!
Er dachte an den Vortrag, den Professor von Kachele ihnen gehalten hatte. An den alten Mythos der Sternengöttin, die das Sonnenkind raubt und zerstückelt. Diese wilde, uralte Geschichte, die durch die Jahrtausende lief und in allen Völkern und zu allen Zeiten zu neuem Leben erwachte. Babylons Labartu, Sidons Astarte, die grause Durga der Inder — stets dieselbe Göttin in Rom und Karthago, durch Asien, Afrika und Europa. Die immer neue Anhänger fand, Priester und Priesterinnen, und immer neue blutige Opfer verlangte.
Und die endlich auch den Weg fand nach Amerika. Hatte er nicht gesehn, mit seinen zwei Augen, wie Adelaide, die schöne Negerin, mit der blauen Priesterbinde um die Stirne, ihr eigenes Kind schlachtete im Hoodootempel bei Petit-Goaves? Es der Gottheit opferte — die sie Dom Pèdre nannte? Es erwürgte, den Hals ihm durchschnitt, sein Blut trank —
Sie, die Mamaloi — die Mutter und Königin!?
Kein Phantasiegebilde war es, kein Traum überreizter Nerven. Es war nackteste Wirklichkeit — mitten in dieser erleuchteten Zeit —
Dieser herrlichen Zeit, die ihr Hirn zermarterte, um neue, noch stärkere Mittel zu erfinden, um Menschen zu töten, Blut fließen zu machen in immer wilderen Strömen. Auf dem Wasser und unter dem Wasser, auf dem Lande und hoch in der Luft!
Morden — Totschlagen! Neue Maienzeit für der Zerstörung gewaltige Göttin!
Nein, was die Mamaloi tat, war nichts Besonderes in diesen Tagen: alles war möglich in Menschenhirnen!
Möglich bei ihr — möglich bei Lotte van Neß.
Noch klangen ihm die Worte des gelehrten Barons im Ohre: ›Und wenn die schöne und gütige Dame, die vor Ihnen sitzt, in dieser Nacht sich entpuppen sollte als die wildeste Priesterin der Baaltis, wenn sie einen Knaben zerstückeln und sein rotes Blut trinken sollte, so würde ich das keineswegs als etwas sehr Außergewöhnliches ansehn können. Ich würde es tief bedauern — aber als Gelehrter würde ich den interessanten Fall ruhig meiner Arbeit einfügen, als ein neues Beispiel des uralten Labartukultus.‹
Die schöne und gütige Dame — das war Lotte Lewi!
Möglich schien es dem Dr. v. Kachele, möglich! — Ihm aber wurde diese Möglichkeit zur Wahrscheinlichkeit, zur Gewißheit fast.
War sie Labartu, war sie die Blutgräfin und die Vaudouxpriesterin — dann konnte nur einer ihr Opfer sein: er!
Eine neue Methode hatte sie, keine von denen, die der Professor kannte. Modern dachte sie, modern ging sie vor, sehr klug und bedächtig.
Kein rasches Mordopfer — o nein! Ein langsames grausames Spielen.
Und warum er — er grade? Je nun — ihn liebte sie! War es nicht aller Wollust glühendster Flammenkern, das hinzuopfern, was am heißesten man liebte?!
Seine Geliebte war sie. Seine Schwester. Und seine Mutter. Ihren lieben Jungen nannte sie ihn, ihr einziges Kind —
Mit stillen Wiegenliedern sang sie ihn schmeichelnd in Schlaf.
Wenn es so war — wenn sie Astarte war — so war er, er — das zerstückelte Kind!
Und das erklärte wenigstens eines deutlich genug: seine stets wachsende, immer sich steigernde Angst. Diese jämmerliche Furcht, die sich einfraß in sein Gesicht, die ihn nicht mehr los ließ, keinen Augenblick lang. Die er auch übertrug auf andere Frauen.
Die machte ihn fliehen aus ihrem Bett, wie aus dem der Diva, damals in Philadelphia. Die wehrte sich — in hundert Fällen — instinktiv dagegen, mit Ivy allein zu sein, ließ ihn alle möglichen Ausflüchte finden und Notlügen ersinnen.
Aber er hielt nun ihren letzten Grund.
Nur, das alles half ihm wenig weiter. Er sah wohl das Phänomen: Lotte-Labartu. Er hatte eine Tatsache: ihre Bleichsucht. Und die sehr greifbaren Messerchen.
Aber nichts hakte ineinander, nirgends begriff er die Zusammenhänge. Überall klafften mächtige Schluchten, die er nicht überbrücken konnte.
Ungern genug nahm er die phantastische Hypothese Dr. Cohns wieder auf. Der hatte an ihn gedacht — aber wenn sein Gedanke stimmte, mochte er besser noch für sie passen. Auch sie war in der Südsee gewesen, auf den Hebriden, den Salomoninseln.
Er hatte Malaria gehabt, mit all ihren typischen Erscheinungen. Auch in seinen Blutkörperchen schmarotzte einmal der Parasit der Anopheles. Aber er hatte pfundweise Chinin geschluckt, war die Krankheit losgeworden am Ende.
Sie leugnete, jemals das Fieber gehabt zu haben; tat, als wisse sie kaum, was Malaria sei.
Das schon schien ihm verdächtig.
»Kannibalentum — eine Krankheit!« so dozierte der Arzt. Hervorgerufen durch einen Insektenstich — nein, durch den giftigen Biß irgendeines Säugetieres, einer Fledermaus, eines fliegenden Hundes. Eine schleichende Krankheit, die als Folgeerscheinung die rasende Gier nach Menschenfleisch hervorrief, den wilden Durst nach Menschenblut.
So wie der Hund, den ein anderer, toller, beißt, selbst tollwütig wird, selbst wieder anfällt, was ihm vor die Zähne kommt.
Eine Art Tollwut also, ein Amoklaufen!
Möglich war es — auch das! Möglich so gut, wie des Professors v. Kachele Hypothese.
Und es würde — im Effekt — auf dasselbe hinauslaufen: sein Blut mußte sie trinken.
Eines freilich konnte er schwer nur reimen: wie war es mit den andern Frauen?
Er ging sie durch, eine nach der andern.
Eine mochte da gleich ausscheiden: Aimée Breitauer. So harmlos war dies Abenteuer, so einfach und natürlich, ohne den kleinsten, geheimnisvollen Nebel.
Die Tänzerin dann. Er zergrübelte sein Gedächtnis, zum zwanzigsten Male, um etwas zu finden, was an jenem Nachmittag geschehn sei. Nichts fand er, nicht das Kleinste. Dennoch — als sie ihn wiedersah — floh sie vor ihm, wie vor einem Pestkranken.
Er hatte keine Erklärung dafür. Aber — es mochte Lottes Werk sein, die sie zu sich nahm in jener Nacht. Und sicher auch wiedersah in der Zeit —
Ivy dann, seine Verlobte. Klar alles, sonnenklar — bis auf den letzten Tag. Jenen Rauschtag im Tropenhause der gläsernen Stadt. Und dann, Monate später — ihre kurze Absage: ›Geh zurück zu deiner Mätresse.‹
Auch sie liebte ihn, die kleine Ivy, so gut sie eben konnte. Dennoch jagte sie ihn fort —
Jede kleinste Einzelheit rief er sich zurück, von dem was geschehn war hinter dem Bambusdickicht. Bis zu der Sekunde, wo er alle Besinnung verlor, wo er völlig berauscht war — berauscht wie sie.
Nur eines fiel ihm auf, wenn er so nachdachte: der Gärtnerkasten.
An alles hatte sie gedacht für dieses Brautmahl. Nichts fehlte, nicht die kleinste Kleinigkeit.
Nur: Korkenzieher und Sektöffner. Die waren vergessen.
Seltsam —
Und zum Ersatz holte sie den Kasten mit den Instrumenten des Obergärtners. Haken, Scheren, Stecher, viele scharfe Messer.
Das konnte ein reiner Zufall sein — o ja!
Aber vielleicht — vielleicht — war es Absicht —
Messer — wie auf dem Nachtkasten Lottes!
Die Diva endlich.
Als er zurückkam in die Kulisse nach seiner Rede, als ihr heißer Blick ihn einlud für jene Nacht, da flüsterte sie: ›Meine Lippen hast du zerbissen — ich will es dir heimzahlen.‹
Geküßt hatte er sie — ja! Gebissen auch? Wenn es wirklich geschah — so wußte er es doch nicht.
Aber sie zahlte es ihm heim — und mit manchem Zins. Biß ihn, biß ihn, wie die kleine Ivy, als die Mänade erwachte in ihr. Ein Kämpfen war es, ein wilder Streit zweier großen Tiere —
Bis sie umsanken beide — völlig erschöpft. Einschliefen.
Fast zwei Jahre sprach er sie nicht. Aber zur Christnacht hielt sie ihm ihre schöne Rede über Sodom.
Spie ihn an zum Schluß: ›Eine Spinne bist du! — Bist alles — was saugt!‹
Und er dachte: ›Es paßt gut zu dieser wilden Frau. Sie — mit allen Hunden gehetzt — in allen Wassern gewaschen! Ein blutiger Hohn — ein rasender Spott, der ihr neuen Anreiz gibt zu Abenteuern.‹
Und doch — sie, die Sodoms tiefste Tiefen und höchste Höhen durchwandert hatte — sie mochte so gut Bescheid wissen, wie Lotte auch.
Dann aber war es nichts andres, als daß sie lachend es umkehrte — daß sie selbst das tat, was sie ihm unterschob.
Daß sie — die Spinne war — sie, sie!!
Wie Lotte Lewi —
Wie — ja, wie die kleine Ivy auch. Dann — dann wußte die gut, was der Gärtnerkasten sollte!
— Mit beiden Händen griff er sich an den Kopf.
Das — das — war — —
Unmöglich? — Nichts war unmöglich in Menschenhirnen! Und was sich in einem gebar, konnte gut in einem zweiten wachsen und dritten!
Wenn sie — Lotte und die Diva — und Ivy Jefferson — und am Ende die Tänzerin auch —? Wenn sie alle —?
Die anonymen Briefe fielen ihm ein. Sie häuften sich in dicken Mappen, seitdem Rossius sie wieder aufbewahrte, seine ganze Wohnung hätte er damit tapezieren können. Beschimpfungen meist — aber auch Drohungen, ehrlich genug gemeint. Man würde schon die Mittel finden, ihn aus dem Wege zu schaffen, diesen Aufwiegler und Verschwörer, diesen barbarischen deutschen Hund, den bezahlten Agenten des kindermordenden Kaisers!
Angelsächsische Wutausbrüche — o ja! Aber ohnmächtig? Ganz und gar nicht. Hielt nicht das englische Kabel jeden Tag die Fieberhitze der Yankees in neuer Glut? Ganz offiziell meldete der englische Bericht, daß die Deutschen über feindliche Städte Cholerabazillen ausstreuten, daß sie überall in Feindesland die Brunnen vergifteten. Nur Säuglinge, Kinder und Weiber töteten ihre Flugzeuge, und ihre Grausamkeiten an gefangenen Feinden schrien zum Himmel. Hände, Füße, Brüstchen und Geschlechtsteile schnitten sie zehnjährigen Mädchen und Buben ah, rissen das ungeborene Kind aus der Mutter Leib, trugen es triumphierend herum auf dem Bajonett: das war der höchste Gipfel ihrer Kultur! Und das alles illustrierte Paris und Rom in Zeichnungen und Bildern, die die Runde durch die Presse der Welt machten, tagtäglich den Haß der Yankees aufs neue anfachen mußten.
Wenns nottat, griff England auch selbst ein. Hatte nicht der britische Gesandte in Kristiania höchstselbst versucht, den Diener Sir Roger Casements zu verleiten, seinen Herrn zu ermorden? Wessen Werkzeug war der Mörder des Jean Jaurès, der heute noch ohne Urteil im fröhlichen Gefängnis saß? Wie starb König Karl von Rumänien, wie der Marquis von San Giuliano, wie der Tiroler Wörnz, der Jesuitengeneral — alle drei Deutschlands treueste Freunde? London wußte es gut, so wie es wußte, wer die Mordbuben von Sarajewo zahlte, die die Brandfackel stießen in Europas Pulverfaß.
Und er zog den richtigen Schluß: wenn man Millionen mordet mit Kugeln und Granaten, dann darf man nicht zögern, den Feind, den ein Zufall kugelsicher machte, auf andere Weise umzubringen. Mit einem guten Gift zum Beispiel —
Gift? Das war der erste Gedanke Oberst Perlsteins in Torreon! Und auf eine Art Vergiftung schloß auch Dr. Cohns Hypothese —
Ein langsames, schleichendes Gift? Warum nicht? Es war so möglich wie all der andere Wahnsinn, der doch zur greifbarsten Wirklichkeit wurde in diesen Narrenjahren. Und erst recht möglich in dieser Riesenstadt, in der jedes Laster und jedes Verbrechen rot lachende Blüten trieb!
Noch einmal las er seine Eintragungen durch. Schied alles aus, was romantisch klang und phantastisch, stellte nur die Tatsachen fest, die ein Kind mit Händen greifen mochte. Wenig genug blieb, zehn Zeilen kaum oder zwölf.
Dies schleichende Leiden mit seinen Wellen. Auf und nieder, bald zurückgehend, bald mächtig aufschwellend. Wie Flut und Ebbe, dachte er, und ganz gewiß abhängig von einem außerhalb Wandelnden — wie des Meeres Atmen vom Mond.
Mond — Mondgöttin — Astarte! Da war er wieder. Aber er strich die Worte aus, mit kurzen, harten Strichen.
Und dieses Außerhalbstehende konnte nur sie sein: Lotte. Andere Frauen — vielleicht; das war sehr ungewiß. Sie aber stand mit aller Sicherheit in Beziehung zu seinem Leiden — abhängig von dieser Frau war Flut wie Ebbe, war sein Gesunden wie sein Kranken.
Das dritte dann: der Schlüssel zu allem mochte vielleicht ihr Messerchen sein. Dies oder ein anderes, oder alle. Er unterstrich: ›Mochte‹ und ›Vielleicht‹. Es konnte schon so sein.
Und das letzte, wichtigste: Lotte van Neß kannte das Geheimnis. Wenn es ihm gelang, sie zum Sprechen zu bringen?
Mit langen Schritten lief er durch seine Zimmer. Auf und nieder, hin und zurück. Sann nach, trat an den Schreibtisch, schrieb eine Zeile hin. Sprang auf, grübelte wieder.
O, er mußte es zusammenbekommen, jede Strophe, jedes Wort, wie er es damals gehört hatte —
Primaner war er — und die Mutter hatte ihn nach England geschickt in den Schulferien. Hatte ihm alles aufgeschrieben: das mußt du sehn und das und dies.
Oben in Lincoln sollte er die Kathedrale bestaunen. Das sei die schönste in ganz England, hatte die Mutter gesagt.
Er besah die Kathedrale. Aber der Greis, der ihn führte, sagte, daß es noch etwas viel Interessanteres gäbe in Lincoln. Er brachte ihn nach einem alten Haus, das gerade so aussah, wie alle andern alten Häuser der Stadt.
Der Weißbärtige sagte, daß da einmal eine Judentochter gewohnt habe, vor vielen hundert Jahren. Die, die den kleinen Sir Hugh ermordet hatte, zur Osterzeit. Und er deklamierte mit heiserer Stimme die alte schottische Ballade —
Die suchte er nun. Die schrieb er auf. Langsam, Zeile um Zeile, durch lange Stunden. Nahm dann das Blatt, las es. Und noch einmal — laut.
»Im lustigen Lincoln rennt mancher Bub
Beim Ballspiel keck und schnell —
Da wirft seinen Ball der süße Sir Hugh
In den Garten vom Judenkastell.
Da 'naus und kam des Juden Maid,
So schön wie der Frühsonne Schein,
Sie brach einen Apfel weiß und rot,
Der lockte den Knaben hinein.
Sie lockte ihn durch ein schwarzes Tor,
Drei Tore und sechs und neun.
Sie legte ihn auf das Schlachtbrett hin,
Sie stach ihn ab wie ein Schwein.
Und aus und zog sie ein Federmess'r,
Sie hatts versteckt beiher —
Sie stachs dem süßen Sir Hugh in'n Hals —
Kein Wort sprach nimmer er mehr.
Und aus und kam das dick, dick Blut,
Und aus und kam es dann dünn,
Und aus und kam rot Herzensblut,
— Da war nichts mehr darin.
Sie rollt ihn in ein'n Kasten Blei,
Daß ewig drinn er schlief,
Warf ihn in tiefen Mariabrunn. —
War fünfzig Faden tief.
— Als Betglock klang und man Vesper sang,
jeder Knabe kam daheim;
Jede Mutter hatte daheim ihren Sohn,
Nur Lady Helen hat kein'n!
Sie rollt ihren Mantel um sich her
Und lief durch die dunkle Nacht,
Sie lief so schnell zum Judenkastell,
Wo alle schliefen zur Nacht.
»Mein kleiner Sir Hugh, mein süßer Sir Hugh!«
Die Mutter rief es und schrie.
Sie kam zu Sankt Marias Brunn
Und fiel in ihre Knie.
»O Mutter, der Brunn ist wundertief
Und das Blei ist wunderschwer,
Ein klein Federmess'r steckt mir im Hals,
Da sprech ich nimmermehr.
»Geh heim, geh heim, o Mutter lieb.
Näh mir ein Leichenkleid,
Drauß, hinter der lustigen Lincolnstadt
Lieg morgen ich an deiner Seit.«
Da ging Lady Helen nach Hause hin
Und nähte ein Leichenkleid —
Drauß, hinter der lustigen Lincolnstadt
Lag bald sie an seiner Seit.
Und jede Glocke in Lincolnstadt
Ohn Menschenhände klang,
Und jed' Liederbuch in der Lincolnstadt
Ohn Menschenzungen sang.
Man grub Lady Helen, grub ein Sir Hugh
Hauss' der lustigen Lincolnstadt.
Seit Adams Zeit solch einen Leichenzug
Man nimmer gesehen hat.«
Das war es. Er starrte auf das Blatt, saß da, rührte sich nicht. War das nicht wieder der alte Mythos vom Morde des Sonnenkinds?
Und es war sein Fall, seiner! Er sah ihre Messerchen liegen, klein, spitzig, spiegelblank. Die schnitten, die stachen — da floß sein Blut. Erst dick, dann dünn, endlich das Herzensblut. Bis nichts mehr drinnen war.
Ja, ja, kein Blut war mehr in ihm, ausgeleert, ausgepreßt war er zum letzten Tropfen. In den Ohren klang ihm die heisere Stimme des alten Mannes in Lincoln:
»A little penknife sticks in my throat
And I downa to you speak!«
Beim Tennisspiel hatte er einst Lotte Lewi zuerst getroffen, in des alten Juden großem Garten am Tiergarten zu Berlin. Jung war sie damals und blütenschön wie ein Frühsonnenstrahl im Aprilmond. Und der weißrote Apfel, der den armen Knaben lockte? Wie oft hatte diese Eva ihm die Frucht gereicht, die die Schlange vom Baume brach, Lilith, ihre Ahnfrau. Ah, er hatte davon gekostet, wieder und wieder, bis er einschlief in ihren Armen, bis —
Durch alle schwarzen Tore lockte sie ihn, tief hinein in den Zaubergarten ihrer Sünden. Nahm ihre Messerchen, schob ihn zurecht auf ihres Bettes Schlachtbrett. Stach zu.
Nun mochte sie ihn in den Bleikasten tun, mochte ihn in den Brunnen werfen, fünfzig Faden tief —
Ob wohl die Mutter kommen würde? Niederknien an des Brunnens Rand, ihn rufen? Er flüsterte:
»Gae hame, gae hame my mither dear,
Prepare my winding sheet —«
Bei ihr würde er liegen, draußen bei der lustigen Stadt am Rhein. Wo sein Vater lag und die Großeltern und Urgroßeltern. Da war wohl noch Platz in der alten Gruft.
Fast täglich sah er Lotte in diesen Monaten. Aber er hütete sich wohl, über Nacht zu bleiben in ihrem Hause. Oder auch einzuschlafen bei ihr am Tage. Sowie er fühlte, wie diese leere Müde in seine Glieder kroch, ließ er das Auto kommen, fuhr nach Hause. Er ließ ein Kunstschloß an seine Flurtür anbringen, schloß sich sorgfältig ein, wenn ein Anfall drohte, trug den Schlüssel stets bei sich. So glaubte er sicher zu sein vor Überraschungen.
Sehr gesund war sie in dieser Zeit — und er war sehr elend. Schleppte sich mühsam weiter mit all seinen Giften.
Ganz offenbar war es, daß Lotte nach ihm verlangte; sie dachte nicht daran, es zu verhehlen. Mehr als einmal sagte sie: »Bleib heute nacht — küß mich!«
Aber er blieb nicht. Obgleich alles in ihm darnach schrie, zu tun, was sie wollte.
Einmal schlief er dennoch ein bei ihr, nach dem Tee. Er sollte sprechen an diesem Abend.
Noch am Morgen des Tages fühlte er sich leidlich frisch. Aber nachmittags, bei ihr, faßte ihn ein Fieber und Schwindel. Sie merkte es gleich, stand auf, ging hinaus. Kam wieder, brachte ein Glas Wasser, schüttete ein Pulver hinein.
»Trink!« sagte sie.
»Was ist es?« fragte er.
Sie antwortete: »Chloral. Du wirst ein Stündchen schlafen. Wirst dich frischer fühlen, wenn du aufwachst!«
Die Finger juckten ihn, nach dem Glase zu greifen. Aber die Angst überwog. Er berührte den Trank nicht. Er klingelte seinen Sekretär an, bat ihn, herzukommen. Ihm Arsenik mitzubringen — aus der kleinen Schublade — links.
Sie schüttelte langsam den Kopf, traurig, mitleidig, voll von Liebe. Sie sprach nichts, setzte sich zu ihm hin, streichelte ihm den Kopf und die Hände. Da schlief er ein — dennoch.
Er wachte auf, als der Diener seinen Sekretär meldete. Sie war nicht mehr im Zimmer, Lotte.
Er sah auf die Uhr, kaum eine halbe Stunde hatte er geschlafen.
»Haben Sie das Arsenik?« rief er Rossius entgegen.
Der gab es ihm — und er schickte sich an, es zu nehmen. Stutzte dann — zögerte: er fühlte sich frisch und gesund. Weg war alle Leere und Müde. Wie fortgeblasen, weggestreichelt von Lottes süßen Händen.
Nur — es hielt nicht lange. Zehn Tage vielleicht — oder zwei Wochen.
Er hatte Angst. Er fürchtete sich, mehr und jeden Tag mehr.
Einmal dachte er: Manntiger.
Wie hatte er gelacht, als er zum ersten Male dies Wort hörte und die Geschichte dazu! In Radschputana war es, im Lande der Fürstensöhne —
Das Tier, das allein umherschleicht in der Nacht, rings um die Dörfer und die Hütten am Rande des Waldes, das die Wanderer überfällt auf den Landstraßen oder am Ufer des Flusses — das ist kein Tiger: ein Mensch ist es. Oder auch: es ist wohl ein Tiger, aber einer, in den sich ein Mensch verwandelte. Alle Inder glaubten daran, aber: die Europäer auch, alle die wenigstens, die nicht in den großen Städten wohnten, die ein wenig den feuchten Duft der Dschungel rochen, Offiziere, Ingenieure, Teepflanzer. Die wußten so gut, wie die Dorfleute: der da ist ein Manntiger — oder jener! Und zu jedem dritten Mond zieht er hinaus in den Busch, wird zum Tiger, lauert durch die Nächte, springt an, schlägt die Pranken in braunes Menschenfleisch, trinkt Menschenblut. Wohnt wieder still im Dorf durch lange Wochen, scheu, einsam. Ißt Reis, reibt Arekanuß, kaut Betel dazu. Gemieden — sehr gefürchtet.
Dann aber, Jahre später, im deutschen Kamerun, lachte er nicht mehr. Auch da lebte die Geschichte, wie überall in Indien. Nur war es der Leopard, den man hier Manntiger nannte, nicht der bengalische Königstiger.
Zum Amtmann kamen die Nigger, brachten einen kleinen stämmigen. Einäugig war er. Der sei ein Manntiger, schrien sie, und er habe es selbst gestanden: er sei es, der die zwei Kinder erwürgt habe in der letzten Woche — nun möge doch der Amtmann ihn hängen lassen. Der Kerl gestand, das war schon wahr. Aber der Amtmann ließ ihn doch nicht hängen — er glaubte nicht daran. Er hatte die Kinderleichen untersucht, die der Leopard überfallen und verschleppt hatte in den Wald, hatte das Tier selbst geschossen in der nächsten Nacht. Er ließ den Kerl einsperren zur Vorsicht — der entwich am selben Tage noch in den Busch.
Aber später, in Borna, sah er zwei Manntiger baumeln. Und diesmal gab es keinen Zweifel: man hatte sie erwischt an der Furt, wie sie die Mammi des Sergeanten überfielen. Der hörte selber ihr Schreien, ein alter Dominikmann, ein schwarzer Landsknecht, der seinen Leutnant fürchtete und keinen Teufel sonst. Der faßte sie, der brachte sie zum Revier. Zwei Burschen, eingenäht in Leopardenfelle, auf allen Fingern Stahlhüte, rundgebogen wie Krallen. Damit griffen sie zu, würgten sie ihre Opfer —
Und wieder im großen Chaco. Wie in Asien, wie in Afrika, so war auch hier, mitten in Südamerika, die Mär vom Manntiger lebendig. Kein Tiger, kein Leopard war es hier: der Jaguar. Und seltsam, nicht Männer nahmen seine Gestalt — nur von Weibern hörte er. Wilden Weibern, die sich in reißende Jaguare verwandelten zur Nachtzeit, Knaben überfielen und Mädchen. Aber auch Männer — starke Krieger, wohlerprobt auf der Jagd wie im Kampf. Und sie wehrten sich kaum, ließen sich würgen, töten, starr vor Angst.
Er hatte keinen Fall gesehen im weiten Waldland, nur die Geschichte gehört, wieder und immer wieder bei allen Stämmen — soweit der Chaco reicht in Paraguay, Bolivien und Argentinien. Und, von andern Reisenden, sie bestätigt gefunden für die Völker des brasilianischen Urwaldes, am Xingu, Tarpejos und Madeira — bis hinüber über den Amazonenstrom. Er konnte nicht feststellen, ob es sich um den Glauben an eine Seelenwanderung handelte, wie in Indien, oder um recht tatsächliche Geschehnisse, wie in Afrika — vom Kongo hinüber zum blauen Nil. Möglich auch, daß beides der Fall war, daß hier wie auf den andern Kontinenten sich phantastischer Glauben mischte mit blutiger Wirklichkeit.
Ohne jede Verbindung waren alle diese braunen und schwarzen und roten Völker, weit getrennt durch Land und Meer. Und dennoch lebte überall der gleiche Glaube: in ein reißendes Tier verwandelt sich zur Nachtzeit ein böser Mensch, lauert am Waldrande und an der Furt des Flusses auf seine Opfer. Überfällt sie, würgt sie, trinkt ihr Blut. Und immer war es eine große Katze — ein Königstiger, ein Leopard, ein Jaguar.
Daheim, in Europa, gab es nur kleine Katzen. Sehr zahme nur, die mit dem Menschen lebten seit Jahrtausenden. Und dennoch lebte auch da überall derselbe Glaube, ein wenig klein geworden, eingeschrumpft wie die Tiere. Die graue Katze war die stete Begleiterin des alten Weibes, das eine Hexe war, war dann die Hexe selbst, die herumschlich durch Haus und Dorf und Unheil brachte. Freilich wagte sie sich nicht an Erwachsene, nicht einmal an Knaben und Mädchen, dazu war sie viel zu klein. Aber die Säuglinge in der Wiege überfiel sie im Schlaf, drängte sich auf sie, erstickte sie. Lief nicht alle Jahre so eine Geschichte durch die Zeitungen, daß wieder einmal eine Katze ein Wickelkind umgebracht hatte? Und das Volk glaubte — nicht die Menschen, die in den Städten wohnten, aber die in den Bergen und in den Dörfern am Walde und am Wasser — daß die graue Katze kein Tier sei, vielmehr ein Unhold, ein Nachtmahr, eine Hexe: ein böser, unheilvoller Mensch, der sich auf Zauber verstand.
Ah — in der ganzen Welt lebte derselbe Glaube! Und in derselben Form — nur um ein Kleinstes geändert durch die verschiedenen Verhältnisse. Überall die Katze — nur selten trat der Wolf an ihre Stelle — der Werwolf, immer in Gegenden, wo er das einzige reißende Tier war, wo es keine große Katze gab und wo der Glaube doch stark genug war, über das hinauszuglauben, was eine Hauskatze tun konnte.
Ein Aberglauben — und überall derselbe? Zu allen Zeiten und in allen Teilen der Erde? Aber er hatte mit eigenen Augen die schwarzen Manntiger hängen sehn, hatte bei der Gerichtsverhandlung dabei gesessen, hatte eines der Leopardenfelle mit den scharfen Stahlkrallen dem Bezirksamtmann abgeschwatzt! Das hing in seiner Mutter Haus, über dem goldenen Daibuz, er würde es wiedersehen, wenn er je einmal nach Hause kam.
Der Manntiger, der Mensch, der sich in ein blutgieriges Tier verwandelte, auf höchst phantastische oder auch auf sehr natürliche Weise — der Mensch existierte, daran war kein Zweifel. War überall auf dieser Welt — warum nicht mitten in Manhattan?
Grün, wie jeder Katze, waren Lottes Lewis Augen. Leuchteten in der Dunkelheit —
Er fuhr hinüber nach Hoboken. Mächtige Eisschollen schwammen den Hudson hinab, krachten an die hölzernen Wände des Fährbootes. Brachen sich, trieben seitab, schiebend und knirschend.
Heute fuhr der Botschafter ab und sein Stab und alle deutsche Konsuln im Lande. Irgendeinen wollte er noch sprechen; der sollte eine Nachricht mitnehmen an seine Mutter.
Keinen Brief, o nein! Der dänische Dampfer, dem die deutsche Unterseebootblockade England verschloß, würde doch den Herrn der Meere als treues Hündchen gehorchen. Würde Halifax anlaufen: da würde man ihn so gründlich untersuchen wie in Kirkwall auch, da würde der Engländer jedes kleinste Fetzchen Papier herunternehmen.
Aber ein paar mündliche Worte — das mochte gehn.
Er kam nicht durch. Planken überall um die dänische Mole, lange Ketten von Schutzleuten und Soldaten. So sehr gefährlich schienen dem Yankee die paar hundert Männer und Frauen, die man aus dem Lande trieb. Wie giftige Tiere. Wie Aussätzige. Deutsche waren es.
Sternenbanner an allen Häusern, in allen Fenstern, quer über Straßen hin. Union-Jacks daneben, Trikoloren, russische, italienische Flaggen. Japanische, serbische, belgische — ein Meer von Farben; das schrie: Krieg, Krieg gegen Deutschland! Gegen die Hunnen, die Barbaren, die Kindermörder — gegen die Erzfeinde aller Menschheit, die Deutschen.
Er wußte: das war Englands großer Sieg. Hier war er gewonnen, nicht auf den Feldern Flanderns und Polens. Und war zugleich das Ende von Bismarcks Erbe, das Ende Deutschlands. Nun gab es nur eines noch: mit Anstand zu sterben. Was liegt am Menschenleben, dachte er, was liegt am Völkersterben — wenn nur die Geste schön ist.
Die aber würden sie nie haben, nie — die Deutschen nicht! Weil sie solch jämmerliche Stümper waren im Lügen, weil sie die Lüge nie lernen würden, die grandiose Lüge, die an sich selbst glaubt und sich selbst zur Wahrheit lügt. Die giftige, tötende — nie! Und die schöne, hoch hinaushebende — erst recht nicht! Sterben im schönsten Faltenwurf der Toga, Maestuoso, Verklärung — das ist Lüge, Kulisse, Kasperltheater — das wußten sie gut. Verrecken im Dreck, ausgemergelt vom Hunger, bedeckt mit Schwären und Wunden, die Eingeweide zerfressen von Gift und Schmarotzern, angespieen von allem was gesund ist — so geht alle Kreatur zugrunde, und das ist die Wahrheit. So würden sie Untergehn, so: erbärmlich, niederträchtig und gemein.
Er sollte dableiben. Sollte versuchen nach Mexiko zu kommen, dort arbeiten. Versuchen, ob vielleicht, vielleicht —
Er wußte gut: nun gab es kein ›Vielleicht‹ mehr. Nun stand die ganze Erde wider sein Land — da mochten die Marsmenschen Hilfe bringen!
Sehr früh fuhr der Zug, der ihn nach St. Louis bringen sollte.
Bei Lotte war er am Abende, um Abschied zu nehmen. Sie speisten, saßen dann in der Bibliothek. So lieb war sie, so lieb.
Hand in Hand saßen sie, plauderten. Müde war er, wie immer nun; es tat ihm wohl, wenn sie seine Hand hielt, wenn ihr Puls eng schlug an seinem.
»Bleib noch, bleib!« sagte sie, jedesmal wenn er Miene machte aufzubrechen. »Bleib noch, nur ein wenig noch, lieber Junge.«
Und er blieb. Er wußte es gut: sie wollte ihn behalten, bei sich, für diese Nacht. Alles Mißtrauen wurde wach in ihm und alle Angst. Aber stärker, viel stärker, war dieser Wunsch, ihr weißes Fleisch zu fühlen. Dieses Sehnen nach ihrer Berührung, nach dem leisen Streicheln ihrer Finger, nach dem leichten Pulsen ihres Blutes. Einschmeichelnd, lullend und wiegelnd.
Er blieb. Noch eine Stunde und noch eine. Saß bei ihr, hielt ihre Hand.
Dann stand sie auf. »Komm!« sprach sie.
Er schüttelte den Kopf. »Nein, nein!« flüsterte er. »Ich will nach Hause.«
Sie küßte ihn. »Fürchtest du dich — vor mir?« fragte sie sanft.
Er nickte nur. Starrte sie an, hilflos, flehend. Nur ein Wort noch, o, nur eine Berührung ihrer Hand — dann würde er ihr folgen.
Aber sie sprach es nicht, dies Wort. »Du sollst allein schlafen,« sagte sie. »Nur bleib — daß ich morgen früh dich einmal noch sehe, ehe du abfährst.«
Sie führte ihn in das Zimmer, das neben ihrem Schlafzimmer lag. »Sperr dich ein,« sagte sie, »schließ ab, schieb die Riegel vor. Warte, ich will eine Weckuhr bringen — damit du zeitig erwachst.«
Sie ging hinaus. Er sah sich um — das war das Zimmer, in dem sie zuweilen die Zofe schlafen ließ, wenn sie sich nicht wohl fühlte. Dort stand ein Bett, dort war ein kleines Badezimmer —
Er blieb stehn auf dem Fleck, wo er gerade stand. Rührte sich nicht. O, er sollte doch lieber nach Hause fahren —
Dann kam sie zurück, ausgekleidet schon, nur im Kimono; brachte den Wecker.
»Auf halb sechs hab ich ihn eingestellt,« sagte sie. »So frühstücken wir noch zusammen.«
Er nahm die Uhr, stellte sie vor sich auf den Tisch. Hob endlich die Augen, sah sie an.
Und es war, als ob es ihn hinrisse zu ihr. Kein Wünschen mehr, kein Sehnen — ah, ein Verlangen! Sie — sie —
Sie war sein Leben — sein Blut und seine Gesundheit!
Nur berühren, nur sie berühren.
Er nahm sie, faßte sie, küßte sie. Schlang seine Arme um sie, preßte sie an sich, eng, eng.
»Lotte!« schluchzte er. »Lotte!«
Dann riß er sich los, stieß sie fort. »Geh, geh!«
Und sie ging. »Gute Nacht!« hörte er. Und das Schließen der Tür.
Warum blieb sie nicht? — Warum nahm sie ihn nicht mit? Schreien wollte er, schreien! All seine Qual hinausschreien — all seine Gier —
Aber Angst, Angst! Ah — etwas würde geschehn in dieser Nacht!
Er rief sie nicht zurück. Er ging herum im Zimmer, verschloß die Türen, schob die Riegel vor. Dann nahm er Stühle, rückte sie vor die Türen, stellte auf jeden eine Wasserkaraffe. Das mußte umfallen, wenn man öffnen wollte. Mußte einen Mordslärm machen, ihn aufwecken.
Er setzte sich auf das Bett. Lauschte angestrengt.
Sprang wieder auf. Betastete die Wände, suchte nach einer Tapetentür. Öffnete die Schränke, blickte hinein, kniete nieder, schaute unter das Bett. Nichts. Und kein Laut aus ihrem Zimmer.
Dennoch wagte er nicht, sich auszuziehn, sich schlafen zu legen. Er ging ans Telephon, schellte seinen Sekretär an, hatte viel Mühe, ihn wach zu bekommen. Bestellte ihn zum Bahnhof. Dehnte das Gespräch aus, gab ihm alle möglichen überflüssigen Aufträge.
Setzte sich an den Tisch, nahm Feder und Papier, sann nach, an wen er schreiben könnte. ›Liebe Lotte‹ wurde es — und immer wieder: ›Liebe Lotte‹.
Er strich es durch — zerriß den Bogen, nahm einen neuen. Aber es half nichts —
Da gab er nach. Ah — sie mochte den Brief finden am nächsten Tage, mochte wissen, daß er mit ihr war, nur mit ihr, in diesen Stunden.
›Du‹ begann er, ›du — du‹. Wiederholte es, Zeilen hindurch. ›Liebste, schrieb er, Liebste — du‹ —
Kein Brief wurde es, kein Satz kam zustande. Nur Worte, Worte. Nur ein armseliges Stammeln, ein qualvolles Schluchzen und Stöhnen.
Sehnsucht, Angst und Verzweiflung —
Tränen und Blut.
Dann — dann fühlte er, wie die Hand ihm den Dienst versagte. Er starrte hin — sah die beiden Finger, die die Feder hielten. Still, steif — ohne Bewegung.
Sein Hirn gab den Befehl: drück die Feder hinab — auf das Papier nieder! Schreib!
Aber die Hand rührte sich nicht.
Kalter Schweiß deckte seine Stirn — ein Frösteln faßte ihn, ein Zittern und Schlottern. Ah, bekannt ihm genug — aber stärker heute — soviel kälter. Wie ein Erfrieren war es von unten herauf.
Er kämpfte, kämpfte. Nur auf die Hand ging sein Wille, nur auf die zwei Finger, die die Feder hielten. ›Schreib‹, preßte seine Seele, ›schreib! Schreib noch einmal, ein Wort nur, schreib!‹
Weit, weit offen starrten seine Augen. Glühten hinab auf die Hand, als wollten sie eine letzte Kraft ihr geben. Und er sah, sah, wie sie sich niederbog. Langsam — unendlich langsam — Ah — nun rührte die Feder das Papier.
›Schreib!‹ schrie seine Seele. ›Schreib: Lotte!‹
Da bewegte sich die Feder. Ganz dünn nur — kaum erkennbar. Schrieb: Mutter.
Fiel dann aus der kraftlosen Hand, rollte hin über den Tisch.
Aber das Wort stand da, das letzte Wort — Mutter. Er sah es gut.
Die Lider fielen ihm zu, schwer, tiefschattend. Aber er sah dennoch das dünne Wörtchen: Mutter.
Noch war ein Leuchten in ihm — irgendein Denken. Nun kommt es, fühlte er. Nun kommt — das Ende. Sehr dunkel ist es.
Und wieder: drinnen ist Licht. Wenn er nur aufstehn könnte — die Türe öffnen — zu ihr gehn. Drinnen ist Leben — rotes Leben —
Schwarz alles hier — so sehr dunkel. Alles löste sich darin. Alles — und er.
— Schwer sank sein Kopf auf die Tischplatte.
Ein rasendes Kreischen und Lärmen, das die Luft zerriß. Ein Schneiden und Hämmern und Pfeifen, ein wildes Krähen von hundert Hähnen, denen die Köchin das scharfe Messer durch die Gurgel zog.
Da wurde er wach.
Mitten im Zimmer stand er. Was gab es nur?
Er rieb sich die Augen — blickte um sich. Ah: die Weckuhr! Er ging zum Tisch, stellte sie ab. Halb sechs — ja doch — da sollte er aufstehn.
Völlig angekleidet war er. Er wandte sich um: zur Seite geruckt war der Stuhl, den er vor die Türe zu Lottes Zimmer gestellt hatte — die Wasserkaraffe stand daneben auf dem Teppich.
Und weit offen gähnte die Türe.
Er lauschte hinüber — keinen Laut hörte er.
So schlief sie noch, trotz des gräßlichen Weckers?
Dann fühlte er einen Geschmack auf der Zunge. Süß, sehr süß — wie ein leichter Brechreiz war es. Übernächtigt, dachte er.
Aber er stutzte — kannte er nicht diesen seltsamen Geschmack?
Er schloß die Augen — sann nach — leckte seine Lippen. Stärker schmeckte er es — süß, seltsam süß. So schmeckte es — genau so — als einst auf der Mensur sich die Zunge hinausstahl aus den Lippen.
Blutgeschmack!
Mund spülen, dachte er, Zähne putzen —
Er ging ins Badezimmer, trat vor den Toilettentisch. In den Spiegel fiel sein Blick.
Sah —
Blutig war sein Mund, voller Blut das Kinn. Und große Blutflecke zeigten Kragen, Hemd und Rock —
Und seine Hände — die Hände —
Rot, rot, als ob sie gebadet hätten in Blut.
Er starrte auf das Bild da im Spiegel. Das war er, er — Frank Braun. Überströmt mit Blut.
Was denn, was?
Er stürzte in Lottes Zimmer — hin an ihr Bett. Da lag sie — bleich — o so bleich! Eingewühlt in Kissen und Linnen, zugedeckt bis zum Kinn —
Aber Blutspritzer überall — große, rote Flecken, wohin nur sein Auge sah. Und auf dem Nachttisch, wild durcheinander, blutige Messerchen —
Er riß die Tücher zurück und ihr Hemd. Und er sah ihre Brust — sah Schnitte und Stiche — So viele Wunden —
Welch Tier — welch wildes, gieriges Tier hatte —?
Welch grausame, ekle Bestie — —
Ah: er! Er!
In die Knie sank er.
»Lotte! Lotte!«

Sieben Fuß lang, breit und hoch war seine Zelle. Arbeit war da genug: Wanzen fangen, Läuse und Kakerlaken. Das war nur möglich am Tage — da brannte eine kleine Birne. Still war es dann in dem gewaltigen Zuchthaus.
Aber zur Nachtzeit hob es an. Manchmal, wenn er eingeschlafen war auf Minuten, rasch wieder aufwachte, halbwach, wirr, schlaftrunken, glaubte er im Urwald zu sein. Irgendwo da, am obern Pilcomayo, mitten im Gran Chaco. Lauschte den Stimmen ringsherum, weither und nah bei ihm — diesen Stimmen, die ein eigen Leben hatten, zu Wesen wurden, losgelöst von Leibern, Kehlen und Zungen. Röhren des Tapirs — oder war es ein Ochsenfrosch? Brechen und Schieben von Landkrabben — nein, nein, ein Jaguar war das —
Dann, allmählich, fand er die Töne. Schnarchen, Seufzen, Singen und Lachen im Schlafe. Röcheln und Husten der Schwindsüchtigen. Und, von unten her, die zerfetzten Schreie derer, die man peitschte und schlug. Widerspenstige, arme Irrsinnige, solche auch, von denen man ein Geständnis erpressen wollte.
Allnächtlich.
Die Decken, die man ihm gab, waren besät mit Ungeziefer. Unsäglich schmutzig, dick verklebt mit Eiter aus eklen Geschwüren früherer Insassen. Nebenan hauste ein Nigger, wegen Mordes zum elektrischen Stuhle verurteilt. Der lehrte ihm, wie man sich mit Zeitungspapier zudecken könnte — das wärmte ein wenig.
— Stunden erst, dann Tage. Wochen. Und Monate.
Keine Verbindung mit der Außenwelt. Keine mit den andern hier im Zuchthause. Nichts. Die Zelle nur — und er darin. Von dem Kerl, der ihm das Fressen hereinschob, erfuhr er, daß noch andere Deutsche da waren. Eingesperrt wie er, in mächtigen, fensterlosen Steinmauern, hinter schweren Eisengittern, zwischen Einbrechern, Zuhältern, Mördern.
Einmal, mitten in der Nacht, hallten schwere Tritte; ein ganzer Trupp kam da an. Und eine helle Schwabenstimme rief, auf deutsch: »Giebt'sch hier auch Wanschen?«
Da scholl es lachend zurück, aus allen Ecken der riesigen Halle: »Ja! — Ja! — Soviel Sie nur haben wollen!«
Einen Bleistift hatte er, so ein zollanges Stümpchen. Er riß die Ränder von allen Zeitungen ab, machte die Fetzen hübsch gleich, legte sie aufeinander; wie ein Heft wurde es. Das sollte der Schluß seines Tagebuches werden. Die ersten Seiten ließ er frei — von dem Augenblick an, wo er umsank, vornüber fiel über die Tischplatte, bis zu dem andern, wo er sich wiederfand, mitten im Zimmer stehend, wachgeschrieen von der grausamen Weckuhr. Eine nur konnte diese Lücke ausfüllen: Lotte.
Dann schrieb er. Wie seine Zunge das süße Blut schmeckte, wie er vor dem Spiegel stand, blutüberdeckt. Wie er in Lottes Zimmer lief, wie er sie fand —
Er hielt sie in seinen Armen, betete ihren Namen. Doch daraus wurde — und er wußte nicht wie — ein anderes Wort: Maria.
›Seltsam,‹ dachte er, ›warum nannte er sie damals: Maria?‹
Maria — so hieß das Mädchen aus Wien. Die an ihn glaubte, die ihm die Brautlieder sang, als er Abschied nahm. Die nicht leben mochte ohne ihn — die den kleinen Revolver nahm, als sein Brief kam —
Sein Narrenbrief.
Und Maria hieß seine Mutter. ›Mutter Maria‹ nannte sie sein Knabenmund — und nie anders.
›Maria‹, betete er, als er kniete an Lottes Bett, ›Mutter Maria‹.
Dann wieder war es die andere — die, die sieben Schwerter trug in flammendem Herzen. Deren Brust rot blutete: Maria, Muttergottes, allerseligste Jungfrau! Ihren Namen stammelte er: Maria.
Betete leise:
»Eia Mater, fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac, ut — —«
— Jetzt hörte sie ihn, schlug die Augen auf.
Ganz leicht berührte ihr Finger seine Hand Und ihre Lippen bewegten sich.
Er schob seinen Kopf heran, las ihr die Flüsterlaute vom Munde. »Gib den Kasten weg,« sagte sie.
Er gehorchte. Warf die Scheren und Messerchen hinein, schloß das Bistouri in den Schrank. Kam zurück zum Bett.
Wieder flüsterte sie: »Wasch dich! Nimm ein reines Hemd.«
»Lotte,« flehte er, »Lotte! Du — du —«
Aber sie bestand: »Tus!«
Er tat, wie sie befahl. Zog sich aus, wusch sich, nahm Hemd und Kragen. Gab die blutigen Sachen in den Wäschekorb.
Sie folgte ihm mit den Augen, lächelte still.
Hauchte: »So ists gut. Nun ruf den Arzt an — Dr. Cohn.«
Er nahm das Hörrohr, schellte ihn an. Er möge kommen, gleich, zu Frau van Neß. — Nein, nicht in einer Stunde erst — Sofort, jetzt, jetzt gleich!
Was es denn wäre? Er zögerte —
»Blutsturz!« flüsterte sie.
»Blutsturz!« rief er ins Telephon.
Ob es —? Ja, es sei beängstigend, ja — sehr gefährlich! — Ob sie viel Blut verloren habe?
— Ja, sehr viel — entsetzlich viel! — Was, er sei noch im Bett? — Er werde sofort kommen, in dreißig Minuten sei er da! Und inzwischen solle man der Kranken zu trinken geben. — — Was denn? — Alles: Milch, Tee, Sekt, Mineralwasser, starken Kaffee, was da sei! — Alles! Soviel wie nur möglich! Trinken müsse sie — trinken!
Er hing das Hörrohr ein. Er sprang auf — aber ihr Blick hielt ihn. Zeigte auf ein blutiges Messerchen, das da noch lag neben dem Kopfkissen. »Such!« flüsterte sie. Er suchte in den blutigen Linnen — noch ein zweites fand er.
»Die Borsalbe!« sagte sie. »Dort!«
Auf dem Nachttischchen stand die Dose. Er nahm sie, öffnete den Deckel.
»Tu dus, Liebster,« flüsterte sie. »Niemand soll meine Brust sehn außer dir!«
Er schlug ihr Hemd zurück. Er wusch ihre Wunden mit Kölnisch Wasser, sieben zählte er, sieben.
Kleine Wunden — tief, tief. Rote Streifen — und ein Blutströpfchen an jedem.
Wie der Blutsstreifen, den er so oft im Traum sah. Auf der Goyita Brust, wenn sie die Rumba tanzte —
Seine Finger zitterten. Er wusch ihre Wunden — das schmerzte. Sie zuckte, zuckte.
Und er küßte sie, zart, weich — mit bebenden Lippen. Da lächelte sie.
»Bist du gesund?« flüsterte sie.
Er schrak auf — starrte sie an.
Aber sie lächelte. Hauchte: »Soviel Milch trankst du, mein lieber Junge! Soviel rote Milch!« Zärtlich, so zärtlich streichelte ihn ihr Blick.
›Mutter,‹ dachte er, ›liebe Mutter Maria.‹
Er gab die Salbe auf ihre roten Wunden, verteilte sie mit bebendem Finger. Schloß ihr blutiges Hemd, dicht am Halse.
Dann erst ließ sie ihn gehn. Er rannte hinaus, schrie nach der Zofe. Ließ Tee machen, Sekt heraufholen, griff nach dem Rhenser Wasser.
Saß wieder bei ihr — führte ihr das Glas an die Lippen.
»Trink, trink!«
— Dann kam Dr. Cohn. Aber ehe sie sich noch an den Arzt wandte, flüsterte sie: »Nun geh, mein Freund. Du wirst deinen Zug noch erreichen. Geh!«
»Ich bleibe!« rief er.
Aber sie schüttelte langsam den Kopf. »Nein, du mußt gehn. Ich will es. Denk an mich!«
Ganz leicht streichelten ihre Hände sein Haar, küßten ihre Lippen seine Augen. »Leb wohl,« hauchte sie, »leb wohl, lieber Junge. Ich — danke dir!«
›Ich danke dir!‹ sagte sie. Er hörte es gut: ›Ich danke dir.‹
Sie, sie ihm!
Er stand auf; er ging. Rückwärts zur Türe — sah einmal noch ihr süßes Lächeln.
Kam zur Straße. Kam zum Bahnhof.
Da griffen sie ihn. Legten ihm Handschellen an, brachten ihn ins Zuchthaus.
Ihn, den deutschen Agenten. Den sehr gefährlichen. Der es gewagt hatte, gegen England zu arbeiten in diesem Lande.
Was lag ihm dran? Und wenn sie alle Deutschen im Lande einsperrten — was lag ihm dran? — Nur sie nicht, sie nicht — Lotte!
Er legte die Fetzen zusammen. Sie mochte sie haben, sie — die ihn heilte.
Sie wußte wohl, was es war, all die Zeit über. Und schwieg, sagte nichts — da sie gut fühlte, daß ein Wort alles zerschlagen würde. Er — er durfte nicht wissen, was er tat. Denn, wenn ers wußte — so würde ers nicht mehr tun.
Und nur, daß ers tat: das hielt ihn, das allein. Nur das konnte ihn heilen am Ende.
So schwieg sie, schwieg.
Darum hing die kleine Kristallkugel an goldenem Kettchen um ihren Hals: der Flügelgreif sollte ihr Milch geben — rote Milch für ihr Kind. Darum trug sie den Ring mit dem Pelikan: ihre Brust riß sie auf, ihr Junges zu füttern. Spielereien, Launen einer bizarren Frau — aber einer Frau, die nichts andres dachte, als ihn und sein Glück.
Darum hatte sie die Scheren und Messerchen — daß er besser schneiden könne und tiefer in ihr Fleisch. Daß der Quell reicher fließe — der ihm Leben war —
Darum nahm sie den Schlaftrunk — um still zu liegen: sein jämmerlich blutendes Opfer. Um ihn nicht zu wecken durch einen Schrei ihrer Schmerzen, wenn er besessen war von der Gier nach Blut.
Aber später, später brauchte sie keinen Schlaftrunk mehr.
Ließ ihn stechen und schneiden und saugen und trinken. Ließ sich zerfetzen — lächelte dazu.
War die Priesterin, legte die Opfermesser zurecht. Schmückte auch das Opfer für ihn: sich selbst.
Und darauf allein war sie eifersüchtig, das allein gönnte sie keiner anderen Frau. Darum gab sie ihm das Messerchen mit auf die Mexikofahrt.
Das blieb blank, sehr blank. Und zeigte nur einmal blutige Flecken — nach den Mescalstunden mit der Goyita. Nun begriff er gut, was geschehn war.
Verstand die Ohrfeigen, die er bekam in der Christnacht. Ivys Brief und den höhnischen Haß der Diva. Und die entsetzte Flucht der Tänzerin.
Die spieen ihn an, für das, was er getan —
Aber Lotte Lewi küßte ihn! Immer von neuem, immer wieder. Für ihn reiste sie ins Bad, für ihn schluckte sie alles, was Blut gab. Damit seine gierigen Lippen sich rot färben, satt trinken mochten an ihrem Herzblut.
— So blind war er all die Zeit über. Sah nichts, nichts. Dachte, daß sie die blutdürstige Göttin sei, sie die Zauberin, die ihn vergiftete. Sie die Spinne — sie das ekle Tier!
Was sagte sie doch, als er zu ihr fuhr in jener Nacht vom Terracegarten? Er hörte wieder das Cellosingen ihrer Stimme: ›Das Höchste, was ein Weib tun kann für den Mann, den sie liebt, eine Mutter für ihr einziges Kind, ein Heiland für die leidende Menschheit — das, das lehrtest du mich tun: das Herrlichste, das Ewiggöttliche!‹
Göttlich nannte sie es, herrlich! — Sagte, daß er sie es lehrte — er! Dankte ihm noch: das war ihr letztes Wort, als er ging.
Sie — ihm!
So faßte sie es — Lotte Lewi.
»South 2. 19!« schrie es. Das war seine Nummer.
Sie traten im Hofe an, achtzehn Deutsche. Man kettete sie aneinander, je zwei und zwei; so zogen sie durch die Straßen, rings von Soldaten bewacht. Von ihrem Kerker in Brooklyn hinüber nach Manhattan. Über die Brücke, hübsch langsam, daß das Publikum sie recht angaffen mochte. Überall blieben sie stehn, halbestundenlang; warteten — keiner wußte, auf was.
»Hurensöhne«, spien die Leute, »elende Spione, deutsche Hunde!«
Fahnen, Fahnen! Neue waren hinzugekommen, deren Völker auf einen Wink Washingtons hin Deutschland den Krieg erklärten. Für Recht und Freiheit gegen Barbarentum — und daneben, um ungestraft deutsches Eigentum zu stehlen. China, Siam, südamerikanische, westindische, mittelamerikanische Affenrepubliken. Ihre Fahnen wehten so stolz gebläht wie alle andern.
Riesige Plakate an allen Häusern: »Kauft Freiheitsanleihe!« Pickelhaubige Landwehrmänner, die nackte Säuglinge auf ihre Bajonette spießten, edle amerikanische Rotekreuzschwestern, die mitten im Kugelregen ihre Verwundeten pflegten. Deutsche Offiziere, die lebend schwangere Frauen ans Kreuz nagelten; ein Chormädel von Broadway als Jungfrau von Orléans; ein englischer Sankt Georg, der den giftigen deutschen Lindwurm durchbohrte.
Über Park-Row zogen ein paar tausend Khakisoldaten, Plattfüßig manche und krummbeinig, schlanzend und watschelnd oft, aber doch in Tritt und Haltung mit gewisser Begeisterung. Das Sternenbanner wehte vor ihnen her und — eine andere Flagge. Blau und weiß gestreift, ein blauer Stern in der Mitte: der Mogen Dovids! Juden der Ostseite folgten dem Tuche, jüdische Legionäre, die nach Palästina sich einschifften. Sie zogen aus, den Deutschen zu bekämpfen, zogen aus, dem Engländer eine neue Provinz zu erobern.
Frank Braun lachte auf. ›Wo ist Lottes Fahne?‹ dachte er. ›Wo ist das Banner Levis?‹
Er wurde herumgerissen am Handgelenk, sein Fesselgenosse machte eine scharfe Bewegung zur Seite, wandte sich um.
»Was ist?« fragte Frank Braun.
»Ein altes Weib hat mir was in die Hand gedrückt,« antwortete der andere. »Einen Zettel,« Er nahm den Papierfetzen auf, las: »Es geht besser!«
Frank Braun warf einen Blick darauf. Er erkannte Dr. Cohns dünne Schrift. »Geben Sie her,« rief er, »das ist für mich.«
Sie zogen weiter. »Es geht besser,« murmelte er, »es geht ihr besser.«
Man brachte sie in ein anderes Gefängnis; ein paar Wochen später hinüber nach Neu Jersey in ein drittes. Hier hausten sie zu vierzig Deutschen, unten im Kohlenkeller. Auf eine Stunde jeden Tag führte man sie auf den schmalen Gefängnishof, frische Luft zu schnappen.
Von hier konnte er einige Male schreiben; bekam auch Nachricht von ihrem Arzte. Immer dieselbe: ›Es geht besser.‹
Aber nie: ›Es geht gut.‹ Nie — durch alle die langen Monde nicht.
Dann — und wieder durch lange Monde — im Gefangenenlager unten im Süden.
Dieselben Gesichter, dieselben Tage und Nächte. Wie ein Schlafwandler lief er durch diese Zeit.
Sie dachten alle, daß er wohl ein wenig verrückt wäre. Übergeschnappt, wie so manche andern. Das machte nichts aus, keiner stieß sich dran — man war es gewohnt im Lager.
Aber es war nur so, daß er nichts fühlte, nichts sah, nichts dachte —
Nur das eine: Lotte.
Dann, ganz plötzlich, brach es los. Ohne Übergang. Er stand am Stachelzaun, starrte hinaus. Ein Sergeant ging vorbei, den rief er an.
»Wollen Sie hundert Dollar machen?«
Der Amerikaner horchte auf. — Ach, es sei ganz leicht! Er solle ihn nur hinausschmuggeln, für eine Nacht mit zur Stadt nehmen. Und er hielt ihm den Schein unter die Nase.
Zu dreien holten sie ihn ab in der Dämmerung. Steckten recht auffällig ihre Revolver in den Gürtel. Und der Sergeant sagte: »Die sind alle beide abstinent!«
Frank Braun lachte. Nein, er wolle sie nicht trunken machen, wolle nicht ausreißen. Nur wieder einmal gewiß sein, daß er noch ein Mensch sei.
Sie fuhren zur Stadt. — Das, was man so Ausschweifung nannte in der knochentrockenen Provinz. Eine Kneipe zunächst, da gab es »starken Tee«: Bayrum, Witch-Hazel, Westphals Haarwuchsmittel nach Auswahl. In Tassen serviert, aber aus Originalflaschen, über siebzig Prozent Alkohol. Der Sergeant goß das Zeug in einem Zug herunter. Aber Frank Braun nippte nur, es schmeckte scheußlich.
»Nirgend was Besseres?« fragte er.
»Kommen Sie nur!« lachte der Sergeant.
Sie zogen durch Apotheken, durch Spielklubs und Hurenhäuser — da gab es Mondscheinwhisky. Schwarze und weiße Weiber gab es da, und man konnte Poker spielen, Faro und Roulette.
Da tobte er durch die Nacht. Zerriß seine Kette, lumpte durch wie ein Seemann nach langer Segelfahrt. Es war ein Schrei nach Freiheit, aus diesem Zwang heraus, der seine Tage mit der Elle teilte.
Das war es. Aber ein anderes auch — und das mehr noch: gesund war er und stark, und wollte diese Stärke fühlen. Ein Instinkt riß ihn, rein animalisch genoß er.
»Wie ein Tier,« dachte er, »gottseidank!«
Und er würfelte, kartete, trank, griff nach den Weibern.
Da saßen sie, drei Kerls in Khaki und er, zwischen zehn halbnackten Frauen. Eine saß am Flügel, klimperte, drei grölten das Hoola-Hoola-Lied. Über ihn lehnte eine Oktronin, flüsterte: »Komm mit!«
Er achtete sie nicht. Schlug den Lederbecher auf den Tisch: »Drei Assen!«
Die Oktronin beugte sich tief hinab, füllte sein Glas, drängte: »Kommst du?«
Er sah sie an. Sie war weiß und jung und sehr schön. Ihre nackte Brüste leuchteten.
Er schüttelte langsam den Kopf. »Nein,« sagte er.
Zwei Briefe im Monat gestattete der Zensor: die schrieb er der Mutter. Aber jeden Tag schrieb er nach Neuyork — das besorgten für gutes Geld die Soldaten. Wenige Zeilen — und nur einmal wurde es mehr. Irgendein Rhythmus lebte in ihm, so schrieb er Verse.
Schrieb:
»Und es geschah — ah, zweimal wohl und mehr
und noch einmal — seit jener schwülen Nacht
und jener Stunde, die die Wiederkehr
nie kennt — daß mich ein Schluchzen griff.
— Die Blonde, denk ich, hat dazu gelacht,
geweint vielleicht, da sie es nicht begriff —
Aus ihrem Schrei, aus ihrer Wollust Schrei,
klang deine Stimme, Lotte, rief dein Leib
und rief nach mir. Und du warst mir gepaart
und schriest: ›Ich — bin — dein — Weib!‹
— O du, ich war dir treu,
Lotte — auf meine Art.
»Und es geschah — so manches liebe Mal —
— Die Flaschen spieen und die Dirnen schrien,
der Saufkumpan stach mir — verdammt noch mal! —
mein schönes Aß mit seiner blanken Zehn —
Doch plötzlich ists, als ob die Dünste fliehn
in einem Duft von Jicky und Verveine,
in deinem Duft — und still ist das Geschrei.
Und einsam bin ich, Lotte, bin allein
und nur bei dir. Und fahre deine Fahrt
und trink dein Blut und schlürfe deinen Wein —
— O du, ich war dir treu,
Lotte — auf meine Art.
»Und es geschah — das war im frühen März —
Wach war ich kaum und staunte in die Welt;
in reifer Rotmund küßt' mein junges Herz
und eine kluge Weißhand führt' die Hand
den alten Weg, der immer neu gefällt —
O Lotte, lange eh ich dich gekannt!
Doch weiß ich, daß ich still und knabenscheu
zum Tempel trat und wie im Vorsaal ging,
und daß ein Sehnen aus dem Taumel ward:
zu dir mein Sehnen kniete am Altar —
O du, von Anbeginn war ich dir treu,
Lotte — auf meine Art.«
Und er schrieb ihren Namen darüber.
Einmal nur, in all der Zeit, eine Zeile von ihr. Telegramme oft, auch Briefe von ihrem Arzte. ›Es geht besser‹ hieß es, und wieder: ›Es geht besser!‹
Die Glocken läuteten, fern von der Stadt her. Und Kanonen brüllten und alle Dampfpfeifen bellten von allen Fabriken ringsum. Früh um vier Uhr begann es, raste durch den ganzen Tag: Waffenstillstand — sie betteln um Frieden, die Deutschen!
Wie gepeitschte Hunde krochen die Gefangenen durch den Sumpf ihres Lagers. Sprachen nicht, wagten sich nicht in die Augen zu sehn.
Schämten sich, einer vor dem andern —
Monate noch, Monate. Dann plötzlich ein Telegramm Lottes, daß er nun frei sei. Der Oberst ließ ihn kommen; auch er hatte Nachricht von Washington.
»Sie müssen ›Pull‹ haben!« rief er. »Wer ist es?«
Er antwortete ihm nicht.
Aber es dauerte noch Tage. Und jeden Tag telegraphierte er: ›Morgen‹ — und er zählte die Stunden, strich eine aus um die andere.
Im Fieber lief er herum.
Er saß im Pullmanwagen. Kaufte Zeitungen an jedem Bahnhof, las sie. Lief hin durch den Zug und zurück, setzte sich nieder und stand gleich wieder auf. Ungeduldig, unruhig —
Nahm ein Buch, begann zu lesen. Klappte es wieder zu.
Eine Zigarette und wieder eine.
Dann fand er den Rhythmus der Maschine. Lehnte sich zurück in seinen Sessel, summte ihn mit, schloß die Augen.
Schlief nicht ein; träumte nur so im Halbwachen.
Von dem Mann, der die schwarzen Mäuse spuckte. Von dem Dicken, der soviel Wasser trank — mehr, mehr! Von den Igeln, die die Eier der Kröten fraßen, von dem toten Chinesen, der um das Fieberschiff schwamm. Von dem kleinen Blutstreifen auf der Rumbabrust der Goyita — ah, und von den Wunden, den tiefen Schnitten auf Lottes süßen Brüsten.
— Wieder hatten sie ihn in den Tombs, wieder einmal. Neue Verbrechen — so viele neue. Und das schlimmste: dieser Lustmord an Frau van Neß.
Amerikanische Bürgerin war sie —
Er würde nicht leugnen — mochten sie ihn umbringen, wie sie nur wollten. Nur sehn wollte er sie, einmal noch sehn!
Er stieg die Stufen hinauf zu ihrem Hause. Der große Butler öffnete ihm — der, der früher bei Jefferson war. Er sah ihren Chauffeur und ein paar Diener und Mädchen, die vorn in der Diele Blattpflanzen umrückten. Er grüßte sie alle, aber sprach kein Wort, fragte nicht, wie es gehe. Er fürchtete sich —
Lottes Zofe führte ihn hinauf zur Bibliothek, hieß ihn dort warten. Nun zählte er die Minuten.
Endlich öffnete sich die Türe. Eine Krankenschwester kam herein, weißes Kleid, weiße Schürze und Haube. Er möge kommen, Frau van Neß erwarte ihn.
Er folgte ihr schweigend zum Schlafzimmer. Vor der Türe hielt sie ihn fest: nicht zu lange möge er drin bleiben, lasse der Arzt bitten, eine Viertelstunde, nicht mehr —
Dann trat er ein, dann war er an ihrem Bett, grub den Kopf in die Kissen.
»Da bist du wieder,« sagte sie. »Lieber Junge!«
Geschmückt hatte sie sich für ihn, er sah es wohl. Hoch frisiert war ihr Haar, reich und rot. Nilgrün war ihr Spitzenhemd, Smaragde strahlten von ihren Fingern. Aber schmal waren die, so schmal —
Ein wenig Rot auf den Lippen. Und Puder. Rouge-Brunette. Sie saß halb aufrecht, den Rücken gestützt in die Kissen. Nach Jicky duftete sie.
Die gelben Vorhänge zugezogen. Ein mattes weißes Licht, dämmerig. Wie ein Wachsbild sah sie aus, zum Leben erwacht gegen alle Natur.
Das war sie einmal, dachte er, das war sie — Lotte. Nun ist es ihr Wille noch, ihr Wille zum Dasein, der die Form hält. Dieser starke Wille, den ihre Liebe gebar — ihre Liebe zu mir. Für mich lebt sie, fühlte er, nur für mich.
»Für mich!« flüsterte er.
Sie nickte. »Ja, für dich tat ich, was ich tat. — Und für Deutschland auch.« Und sie wiederholte: »Nun bist du zurück, du Lieber.« Sie streichelte seine Wangen, fuhr leicht durch seine Haare. »Wie fühlst du dich, ist es wahr, daß du frisch bist und gesund?«
»Ja,« antwortete er, »ganz gesund.«
»Wie froh bin ich!« sagte sie. »Ich wußte es, du, ich fühlte es — in dieser letzten Nacht! Da trankst du dich gesund!«
»Lotte,« stöhnte er, »Lotte —«
»Schweig, schweig!« sagte sie. »Sag nichts. Froh bin ich, glücklich — in dir fließt mein Blut, das macht dich stark und jung. Laß dich küssen, komm!«
Sie nahm seinen Kopf in beide Hände, küßte ihn leicht, beide Augen und Wangen und den Mund. Griff seine Rechte, hielt sie fest.
Sah ihn lange an, begann dann wieder. »Du siehst anders aus als früher.«
Er fragte: »Wie anders?«
»Deutscher!« antwortete sie. »Soviel deutscher.«
Sie wiederholte. »Deutscher! Du gingst den Weg, den ich dich führte — den Weg zur Heimat. Gingst ihn — mit mir — für mich. Deutsch wurdest du: mein Blut fließt in dir.«
Und wieder küßte sie ihn.
»Ich weiß, was es war,« fuhr sie fort. »Ich hab mirs durchgedacht in den langen Monden, die ich hier lag. Still und allein — träumend von dir. Du, du tatest nur — was die Welt tat.«
Kosend streichelte ihn ihr zärtlicher Blick. »Ein wilder Wahnsinn aller Massen — wie er hundertmal da war in der Zeiten Lauf. Professor von Kachele soll mirs untersuchen, sowie er fertig ist mit seinem Buch: der wird die Zusammenhänge finden durch die Geschichte und sie hübsch ausbürsten und klarstellen. Dann wirst du sehn, daß ich recht habe. Ein heißer Glaube taucht auf — oder auch ein wilder Wahn — bald kennt man den Ursprung und bald nicht. Und wenn er Glück hat, findet er guten Boden und sät den Sturm, der üppig aufgellt und die Welt durchbraust. So ward das Christentum, so der Buddhismais und Mahomets Reich. So ward der Wahn der Hexen, die beim rasenden Sabbath zum Satan tanzten, und wieder der heiße Glaube der Inquisitoren, die aus den Hexenleibern die Seelen herausbrannten, um sie dem Himmel zu retten. Von den Kreuzfahrern, den Albigensern und Flagellanten bis hin zu unserer Zeit. Es geht vorbei — wie der Tangotaumel, wie der Synkopenwahn dieser Stadt — das ist dasselbe am Ende: klein und lächerlich, wie das andere groß und gewaltig ist. Einmal wird auch der wilde Wahnsinn schweigen, der heute die Welt durchrast.«
»Welcher Wahn?« fragte er.
Sie sagte: »Der Blutwahn ist es. Irgendwo fings an, in einem Lande oder in mehreren zugleich. Sehr ansteckend ist es, reißt mit, was mit ihm in Berührung kommt. Blut wollen die Menschen, Blut. Wie du!«
»Nein, nein!« rief er. »Lotte, nein! Ich wollte nichts, ich wußte nichts von alledem. Bis zu der letzten Nacht, wo ich aufwachte. Nichts wußte ich, nichts!«
Sie lächelte. »Ich weiß es, lieber Junge. Aber glaubst du, daß die Millionen da drüben mehr wissen? Unbewußt ist ihnen ihr wilder Wahn, ihr Durst nach Blut — wie er dir war.«
»Keiner will Blut trinken, Lotte, keiner,« sagte er.
Sie erwiderte: »Weißt du das so genau? Bist du so sicher, daß es keiner tat? Daß es keiner — wollte, nicht einmal wollte, ohne es selbst zu wissen? Wenn ein Sturm weht, so fliegen nur wenig Blätter, ganz wenige, hoch in die Wolken hinauf. Wieviel Christen drängten sich dazu, Märtyrer zu werden? Kaum einer auf hunderttausend. Die andern liefen so mit.«
Er küßte ihre beiden Hände. »Du bist der Märtyrer, Lotte — du. Ich — war das Tier in der Arena!«
»Ich auch,« nickte sie, »ich auch! So gut wie du — und wie alle. Meinst du, ich habe nicht auch von Blut geträumt? Von Meeren von Blut, unsere Feinde zu ertränken? Und wenn ich hinauswuchs darüber — so dank ichs nur dir. Alle Blätter faßte der Sturm, aber mich trug er empor bis in die Wolken und darüber hinaus — hoch in die Sterne hinauf.«
Eine Locke fiel ihr in die Stirne; sie strich sie zurück. Und ihre Augen leuchteten, wie die Smaragde auf ihrer Hand. »Frag hundert, frag tausend und Millionen — und keiner wird dir sagen können, wie es kam. Sie wissen es nicht — wissen nur, daß es so kommen mußte und nicht anders. Aber sie sehen rot — alle, alle! Wie ich es tat — wie du. Rot ist die Zeit, rot von Blut: und stärker nur, wilder offenbarte sie sich in dir. Tierischer — göttlicher — wie du willst. Fieberkrank war die Menschheit — und Blut muß sie trinken, um gesund zu werden und jung. Und sie trinkt, trinkt jeden Tag und jede Stunde. Wann, wann wird es ein Ende nehmen?«
»Es ist zu Ende!« sagte Frank Braun.
Sie schüttelte den Kopf. »Nein! Nein! Heute nicht und nicht übers Jahr. Und nicht durch manche Jahre!«
»Zu Boden liegen wir,« sagte er. »Deutschland ist nicht mehr.«
Da glänzten ihre Augen. »Es wird aufstehn vom Nichtsein, das Niedergebrochene!« flüsterte sie. »Man wacht über seinem Haupte am strahlenden Himmel. Es wird seine Feinde niederschlagen, wird triumphieren über alles, was gegen es steht — wie Horus, der Rächer seines Vaters.«
Sie unterbrach sich, streckte den Kopf vor, nach der Türe hin, die sich leise öffnete.
»Ja, ja,« rief sie der Schwester zu, »ich weiß: es ist Zeit. Du mußt nun gehn, Liebster — auf morgen denn.« So zärtlich koste ihn ihre Hand. »Du bist gesund — ich sehe es, ich fühle es. Du — du trankst dich gesund — wann wird der Menschheit Durst gestillt sein? Wann?« Sie sank zurück, müde klang das Cello ihrer Stimme. »Dienstag ist heute — wie habe ich mich gefreut auf diesen Dienstag! — Aber weißt du — der Tag ist nun alle Tage: Dienstag, Tirsdag, Tuesday — Mardi, Martes, Martedi! Der Tag des Mars und des Tiu, des Schwertgottes! — Alle Tage nun — heute und morgen und immer: Schwerttag, Kriegstag, Bluttag.«
Sie schloß die Augen. »Leb wohl, du!« flüsterte sie. »Auf morgen!«
Wie ein Wachsbild lag sie da, seltsam lebend, wider alle Natur.
Noch atmete sie — — —
(Geschrieben in den Jahren 1915 — 1916 in Neuyork — Granada, Málaga — Neuyork, Philadelphia — Cádiz, Rota, Sevilla — und wieder Neuyork. Kleinere Einfügungen in den beiden letzten Kapiteln: Gibraltar, Juni 1920.)