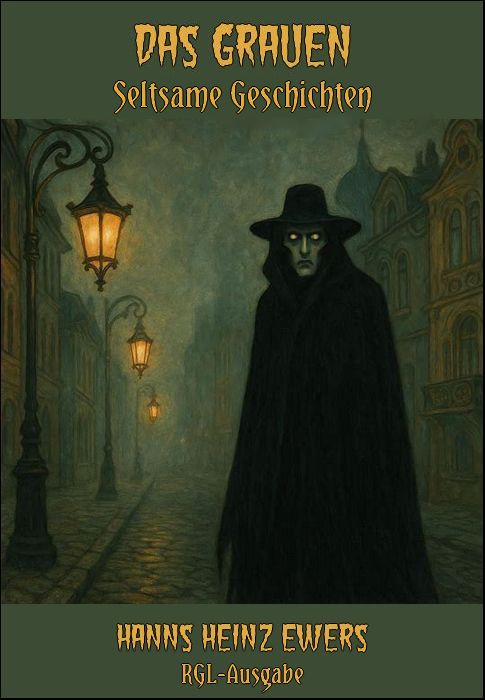
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.
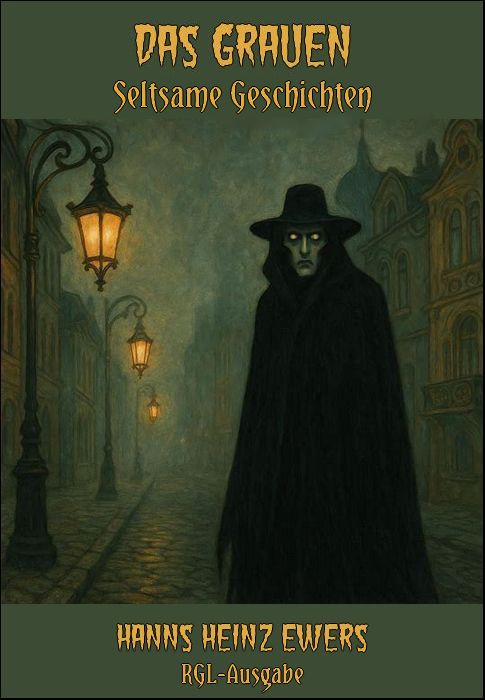
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
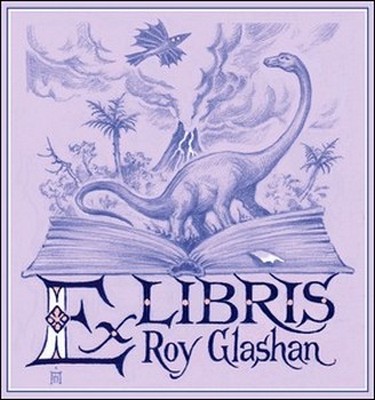
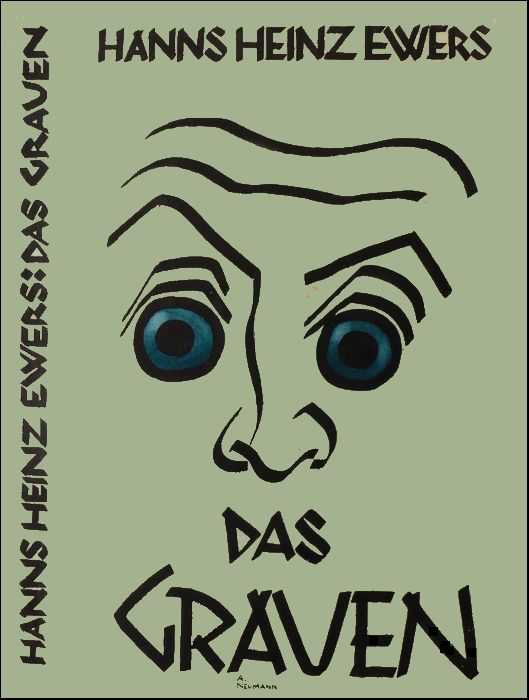
Schutzumschlag. Vermutlich für die Ausgabe von 1907.
Wer weit verreist, wird oftmals Dinge schauen,
Fernab von allem, was er sonst gedacht.
Erzählt er dann, so wird ihm niemand trauen
Und als ein Lügner sieht er sich verlacht;
Denn darauf will nur dummer Pöbel bauen,
Was sich ihm sichtbar und handgreiflich macht
Drum weiss ich wohl: den Leuten ohn' Erfahrung
Gibt meine Mär nur wenig Glaubensnahrung.
Doch wenig oder viel — — mir liegt mit nichten
An dummen Volks unwissendem Geschrei — —
—Ariosto, Orlando Furioso, Ges. VII. 1 ff.
Das erste Mal: vor fünf Wochen bei der Corrida, als der schwarze Stier von Miura den kleinen Quinito durch den Arm stiess — —
Und wieder am nächsten Sonntage und am folgenden — — bei jedem Stierkampfe traf ich ihn. Ich sass vorne, unten in der ersten Reihe, um Aufnahmen zu machen; sein Abonnementsplatz war neben dem meinen. Ein kleiner Mann, in rundem Hütchen und schwarzem englischen Pfaffenrock. Blass, bartlos, eine goldene Brille auf der Nase. Und noch etwas: ihm fehlten die Augenwimpern.
Gleich wurde ich aufmerksam auf ihn. Als der erste Stier den braunen Klepper auf die Hörner nahm und der lange Picador schwerfällig herabfiel. Als die Schindmähre mühsam vom Boden aufsprang, davontrabte mit aufgerissenem Leibe, hineintrat, mit den Beinen sich verwickelte in die eigenen blutigen Eingeweide, die lang herunterhingen und über den Sand schleiften. Da hörte ich neben mir einen leichten Seufzer — so einen Seufzer — — der Befriedigung.
Wir sassen den Nachmittag zusammen, sprachen aber kein Wort. Das hübsche Spiel der Banderilleros interessierte ihn wenig. Aber wenn der Espada seine Klinge dem Stier in den Nacken stiess, dass der Griff wie ein Kreuz sich über den mächtigen Hörnern erhob, dann griff er mit den Händen nach der Rampe, bog sich weit hinüber. Und die Garocha — das war ihm die Hauptsache. Wenn das Blut in armdickem Strahle aus der Brust des Gaules herausspritzte, oder wenn ein Chulo dem tödlich verwundeten Tiere mit dem kurzen Dolche den Gnadenstoss in das Hirn gab, wenn der rasende Stier die Pferdekadaver in der Arena zerfetzte, mit den Hörnern in den Leibern herumwühlte — — — dann rieb sich dieser Mann leise die Hände.
Einmal fragte ich ihn:
»Sie sind ein warmer Anhänger des Stierkampfes — — ein Afficonado?«
Er nickte, aber sprach kein Wort; er wollte im Schauen nicht gestört sein.
— — Granada ist nicht so gross, so erfuhr ich bald seinen Namen. Er war der Geistliche der kleinen englischen Kolonie; seine Landsleute nannten ihn stets den »Popen«. Man nahm ihn augenscheinlich nicht für voll, niemand verkehrte mit ihm.
An einem Mittwoch besuchte ich den Hahnenkampf. Ein kleines Amphitheater, kreisrund, mit aufsteigenden Bänken. In der Mitte die Arena, gerade unter dem Oberlicht. Pöbelgeruch, Kreischen und Speien — — — es gehört ein Entschluss dazu, da hineinzugehen. Zwei Hähne werden hineingebracht, sie sehen aus wie Hühner, da man Kamm und Schwanzfedern ihnen abgeschnitten. Sie werden gewogen, dann aus den Käfigen genommen. Und sie fahren aufeinander los, ohne Besinnen. Die Federn stäuben umher: immer wieder fliegen die beiden Tiere aufeinander, zerfleischen sich mit den Schnäbeln und Sporen — — ohne einen Laut. Nur das Menschenvieh ringsumher johlt und schreit, wettet und lärmt. Ah, der Gelbe hat dem Weissen ein Auge ausgehackt, pickt es vom Boden auf und frisst es! Die Köpfe und Hälse der Tiere, längst zerpflückt, wiegen sich wie rote Schlangen auf den Leibern. Keinen Augenblick lassen sie voneinander, purpurn färben sich die Federn; kaum erkennt man die Formen mehr, wie zwei blutige Klumpen zerhacken sich die Vögel. Der Gelbe hat beide Augen verloren, er hackt blind in der Luft herum und in jeder Sekunde fährt der Schnabel des andern scharf auf seinen Kopf. Endlich sinkt er um; ohne Widerstand, ohne einen Schmerzensschrei erlaubt er dem Feinde, sein Werk zu vollenden. Das geht nicht so rasch; fünf, sechs Minuten noch gebraucht der Weisse dazu, selbst von hundert Sporenhieben und Bissen zu Tode ermattet.
Da sitzen sie herum, meinesgleichen, lachen über die ohnmächtigen Schnabelhiebe des Siegers, rufen ihm zu und zählen jeden neuen Biss — — der Wetten wegen.
Endlich! Dreissig Minuten, die vorgeschriebene Zeit, sind vorbei, der Kampf zu Ende. Ein Kerl erhebt sich, der Besitzer des siegenden Hahnes, hohnlachend schlägt er mit seinem Knüppel das Tier des Gegners tot: das ist sein Vorrecht. Und man nimmt die Tiere, wäscht sie an der Pumpe und zählt die Wunden — — der Wetten wegen.
Da legt sich eine Hand auf meine Schulter.
»Wie geht's?« fragte der Pope. Seine wimperlosen Wasseraugen lächeln zufrieden hinter den breiten Gläsern.
»Nicht wahr, das gefällt Ihnen?« fährt er fort.
Ich wusste im Augenblick nicht, meinte er das im Ernst? Seine Frage schien mir so masslos beleidigend, dass ich ihn anstarrte, ohne eine Antwort zu geben.
Aber er missverstand mein Schweigen, nahm es für Zustimmung; so überzeugt war er.
»Ja,« sagte er ruhig und ganz langsam, »es ist ein Genuss.«
Wir wurden auseinander gedrängt, man brachte neue Hähne in die Arena.
— — An dem Abende war ich beim englischen Konsul zum Tee geladen. Ich war pünktlich, der erste der Gäste.
Ich begrüsste ihn und seine alte Mutter, da rief er:
»Ich bin froh, dass Sie so früh kommen, ich möchte ein paar Worte mit Ihnen sprechen.«
»Ich stehe ganz zur Verfügung«, lachte ich.
Der Konsul zog mir einen Schaukelstuhl heran, dann sagte er merkwürdig ernst:
»Ich bin weit davon entfernt, Ihnen Vorschriften zu machen, lieber Herr! Aber wenn Sie die Absicht haben sollten, länger hier zu bleiben und in der Gesellschaft, nicht nur in der englischen Kolonie zu verkehren, so möchte ich Ihnen einen freundschaftlichen Rat geben.«
Ich war gespannt, wo er hinaus wollte.
»Und der wäre?« fragte ich.
»Sie sind öfters mit unserem Geistlichen gesehen worden — —« fuhr er fort.
»Verzeihung!« unterbrach ich ihn. »Ich kenne ihn sehr wenig. Heute nachmittag hat er zum erstenmal einige Worte mit mir gewechselt.«
»Um so besser!« erwiderte der Konsul. »Ich möchte Ihnen also raten, diesen Verkehr, wenigstens öffentlich, so viel wie möglich zu meiden.«
»Ich danke Ihnen, Herr Konsul«, sagte ich. »Ist es indiskret, nach den Gründen zu fragen?«
»Ich bin Ihnen wohl eine Erklärung schuldig,« antwortete er, »obwohl ich nicht weiss, ob sie Sie befriedigen wird. Der Pope — Sie wissen, dass man ihm diesen Spitznamen gab?«
Ich nickte.
»Nun gut«, fuhr er fort, »der Pope ist einmal in der Gesellschaft verfehmt. Er besucht regelmässig die Stierkämpfe, — — das ginge noch — — verabsäumt nicht einen einzigen Hahnenkampf, kurz, er hat Passionen, die ihn in der Tat unter Europäern unmöglich machen.«
»Aber, Herr Konsul,« rief ich, »wenn man ihn deshalb so sehr verurteilt, aus welchem Grunde lässt man ihn dann in seinem, doch gewiss ehrenvollen Amte?«
»Immerhin — er ist ein Reverend«, sagte die alte Dame.
»Und dazu kommt,« bestätigte der Konsul, »dass er niemals seit den zwanzig Jahren, die er hier am Orte ist, auch nur den leisesten greifbaren Grund zur Klage gegeben hat. Endlich ist die Stelle des Geistlichen unserer winzigen Gemeinde die schlechtbezahlteste auf dem ganzen Kontinent — — wir würden so leicht keinen Ersatz finden.«
»So sind Sie also mit seinen Predigten doch zufrieden,« wandte ich mich an die Mutter des Konsuls und gab mir Mühe, ein etwas malitiöses Lächeln möglichst zu unterdrücken.
Die alte Dame richtete sich im Sessel auf.
»Ich würde ihm nie erlauben, auch nur ein einziges eigenes Wort in der Kirche zu sprechen«, sagte sie sehr bestimmt. »Er liest Sonntag für Sonntag einen Text aus Dean Harleys Predigtbuch.«
Die Antwort verwirrte mich etwas, ich schwieg.
»Übrigens«, begann der Konsul wieder, »wäre es ungerecht, nicht auch eine gute Seite des Popen zu erwähnen. Er hat ein nicht unbeträchtliches Vermögen, dessen Renten er ausschliesslich zu wohltätigen Zwecken verausgabt, während er selbst, von seinen unglücklichen Passionen abgesehen, ausserordentlich bescheiden, ja dürftig lebt.«
»Eine nette Wohltätigkeit!« unterbrach ihn seine Mutter. »Wen unterstützt er denn? Verwundete Toreadores und ihre Familien, oder gar die Opfer einer Salsa.«
»Einer — was?« fragte ich.
»Meine Mutter spricht von einer ›Salsa de Tomates‹.« erläuterte der Konsul.
»Einer — — Tomatensauce?« wiederholte ich. »Der Pope unterstützt die — — Opfer einer Tomatensauce?«
Der Konsul lachte kurz auf. Dann sagte er sehr ernst.
»Sie haben nie von einer solchen Salsa gehört? — Es handelt sich um eine uralte, furchtbare Sitte in Andalusien, die trotz aller Strafen der Kirche und des Richters leider immer noch besteht. Seitdem ich Konsul bin, hat zweimal nachweislich eine Salsa in Granada stattgefunden; die nähern Umstände hat man aber auch da nicht erfahren, da die Beteiligten trotz der in spanischen Gefängnissen üblichen schlagenden Ermahnungen sich lieber die Zunge abbissen, als ein Wörtchen zu erzählen. Ich könnte daher nur Ungenaues, vielleicht Falsches berichten; lassen Sie sich darüber von dem Popen erzählen, wenn Sie dies schaurige Geheimnis interessiert. Denn er gilt — ohne dass man es ihm beweisen kann — als ein Anhänger dieser entsetzlichen Greuel, und dieser Verdacht ist es hauptsächlich, weshalb man ihm aus dem Wege geht!«
— — Ein paar Gäste traten ein; unser Gespräch wurde unterbrochen.
Am nächsten Sonntag brachte ich zum Stierkampfe dem Popen ein paar besonders gut gelungene Photos des letzten Corrida mit. Ich wollte sie ihm zum Geschenk machen, aber er warf nicht einmal einen Blick darauf.
»Entschuldigen Sie,« sagte er, »aber das interessiert mich gar nicht.«
Ich machte ein verdutztes Gesicht.
»O, ich wollte sie nicht verletzen!« lenkte er ein. »Sehen Sie, es ist nur die rote Farbe, die rote Blutfarbe, die ich liebe.«
Es klang beinahe poetisch, wie dieser bleiche Asket das sprach: »die rote Blutfarbe.«
Aber wir kamen in ein Gespräch. Und mitten drin fragte ich ihn, ganz unvermittelt: »Ich möchte gern eine Salsa sehen. Wollen Sie mich nicht einmal mitnehmen!«
Er schwieg, die bleichen zersprungenen Lippen bebten.
Dann fragte er: »Eine Salsa? — — Wissen Sie, was das ist?«
Ich log: »Natürlich!«
Er starrte mich wieder an, da fielen seine Blicke auf die alten Schmisse auf meiner Wange und Stirne.
Und als ob diese Zeichen kindischen Blutvergiessens ein geheimer Freipass wären, strich er leicht mit dem Finger darüber und sagte feierlich:
»Ich werde Sie mitnehmen!«
Ein paar Wochen später klopfte es eines Abends an meiner Türe, so gegen neun Uhr. Ehe ich »herein« rufen konnte, trat der Pope ein.
»Ich komme Sie abzuholen«, sagte er.
»Wozu?« fragte ich.
»Sie wissen ja,« drängte er. »Sind Sie bereit?«
Ich erhob mich.
»Sofort!« rief ich. »Darf ich Ihnen eine Zigarre anbieten?«
»Danke, ich rauche nicht.«
»Ein Glas Wein?«
»Danke, ich trinke ebensowenig. Bitte, beeilen Sie sich doch!«
Ich nahm meinen Hut und folgte ihm die Treppen hinab in die Mondnacht. Schweigend gingen wir durch die Strassen, den Genil entlang unter rotblühenden Pyrrhusbäumen. Wir bogen links ein, stiegen hinauf auf den Mohrenberg und schritten über das Märtyrerfeld. Vor uns strahlten in warmem Silber die Schneekuppen der Sierra, rings herum aus den Hügeln brachen leichte Feuerscheine aus den Erdhöhlen, in denen die Zigeuner hausen und anderes Volk. Wir gingen herum um das tiefe Tal der Alhambra, das ein Meer grüner Ulmen fast bis oben hin ausfüllt. Vorbei an den gewaltigen Türmen der Nassariden, dann die lange Allee uralter Zypressen durch, zum Generalife hin, und weiter hinauf zu dem Berge, von dem der letzte Fürst der Mauren, der strohblonde Boabdil, seine scheidenden Seufzer dem verlorenen Granada sandte.
Ich schaute meinen seltsamen Begleiter an. Sein Blick, nach innen gekehrt, sah nichts von all dieser nächtlichen Herrlichkeit. Wie der Mondschein auf diesen schmalen blutleeren Lippen spielte, auf diesen eingefallenen Wangen und den tiefen Löchern an den Schläfen — da kam mir das Gefühl, als müsste ich seit Ewigkeiten schon diesen schrecklichen Asketen kennen. Und plötzlich, unvermittelt, fand ich die Lösung: das war ja das Gesicht, das der grauenhafte Zurbaran seinen ekstatischen Mönchen gab!
Der Weg ging nun zwischen breitblätterigen Agaven daher, die ihre verholzten Blütenschäfte dreimannshoch in die Luft strecken. Wir hörten des Darro Brausen, der hinter dem Berge über die Felsen sprang.
Drei Kerle kamen auf uns zu, in braunem zerlumptem Mantel; sie grüssten schon von weitem meinen Begleiter.
»Wachtposten«, sagte der Pope. »Bleiben Sie hier stehen, ich will mit ihnen reden!«
Er schritt auf die Männer zu, die ihn erwartet zu haben schienen. Ich konnte nicht verstehen, was sie sprachen, doch handelte es sich augenscheinlich um meine Person. Der eine der Männer gestikulierte lebhaft, sah mich misstrauisch an, schleuderte die Arme in der Luft herum und rief immer wieder: »Ojo el Caballero!« Aber der Pope beruhigte ihn, schliesslich winkte er mich selbst heran.
»Sea usted bienvenido, Caballero!« begrüsste er mich und zog seinen Hut. Die beiden anderen Späher blieben auf ihrem Posten zurück, der dritte begleitete uns.
»Es ist der Patron, sozusagen der Manager der Geschichte«, erklärte der Pope.
Nach einigen hundert Schritten kamen wir zu einer Höhlenwohnung, die sich durch nichts von den hunderten anderen der Bergabhänge Granadas unterschied. Vor dem Türloch war, wie gewöhnlich, ein kleiner Platz geebnet, von dichten Kaktushecken umgeben. Dort standen einige zwanzig Kerle herum — doch war kein Zigeuner dabei. In der Ecke brannte ein kleines Feuer zwischen zwei Steinen; darüber hing ein Kessel.
Der Pope langte in die Tasche, zog einen Duro nach dem andern heraus und gab sie unserm Begleiter.
»Die Leute sind so misstrauisch,« sagte er, »sie nehmen nur Silber.«
Der Andalusier kauerte sich an das Feuer und prüfte jedes einzelne Geldstück. Er warf sie auf einen Stein und biss mit den Zähnen darauf. Dann zählte er — hundert Peseten.
»Soll ich ihm auch Geld geben?« fragte ich.
»Nein!« sagte der Pope. »Wetten Sie lieber, das wird Ihnen hier eine grössere Sicherheit geben.«
Ich verstand ihn nicht.
»Eine grössere Sicherheit?« wiederholte ich. »Wieso denn?«
Der Pope lächelte:
»O — — Sie machen sich dann mehr gemein und mehr — schuldig mit diesen Leuten!«
»Sagen Sie mal, Referend,« rief ich, »weshalb wetten Sie dann nicht?«
Er hielt meinen Blick ruhig aus und antwortete nachlässig:
»Ich? — Ich wette niemals: das Wetten beeinträchtigt die reine Freude am Schauen.«
Inzwischen war noch ein halbes Dutzend höchst verdächtiger Gestalten gekommen, alle in das unvermeidliche braune Tuch gehüllt, das die Andalusier als Mantel benutzen.
»Worauf warten wir noch?« fragte ich einen der Leute.
»Auf den Mond, Caballero,« erwiderte er, »er muss erst untergehen.«
Dann bot er mir ein grosses Glas Arguardiente an. Ich dankte, aber der Engländer schob mir das Glas in die Hand.
»Trinken Sie, trinken Sie!« drängte er. »Es ist das erstemal für Sie — vielleicht werden Sie es nötig haben!«
Auch die anderen sprachen dem Branntwein reichlich zu; doch lärmte man nicht, nur ein hastiges Geflüster, ein heiseres Tuscheln drang hinaus in die Nacht. Der Mond barg sich im Nordwesten hinter der Cortadura, man holte lange Pechfackeln aus der Höhle und brannte sie an. Dann baute man mit Steinen einen kleinen Kreis in der Mitte: das war die Arena; rings herum stiess man Löcher in den Boden und steckte die Fackeln hinein. Und in dem roten Feuerschein entkleideten sich langsam zwei Männer. Nur die ledernen Hosen behielten sie an, dann traten sie in den Kreis hinein, setzten sich einander gegenüber und kreuzten die Beine, wie die Türken tun. Nun erst bemerkte ich, dass in dem Boden zwei starke Balken wagerecht eingelassen waren, deren jeder zwei eiserne Ringe trug. Zwischen diese Ringe hatten die beiden Kerle sich hingesetzt. Jemand lief in die Höhle und brachte ein paar dicke Seile mit, umschnürte den Leib der Männer und ihre Beine und band einen jeden an seinen Balken. Sie staken fest wie im Schraubstock, nur den Oberkörper konnten sie frei bewegen.
Sie sassen da, ohne ein Wort, sogen an ihren Zigaretten oder leerten die Branntweingläser, die man ihnen immer von neuem füllte. Sie waren zweifellos schon stark betrunken, ihre Augen stierten blöde auf den Boden. Und rings herum im Kreise zwischen den qualmenden Pechfackeln lagerten sich die Männer.
Plötzlich hörte ich hinter mir ein hässliches Kreischen und Knirschen, das die Ohren zerriss. Ich wandte mich um: an einem runden Schleifstein schliff jemand sorgfältig eine kleine Navaja. Er prüfte das Messer am Nagel des Daumens, legte es weg und nahm dann ein anderes.
Ich wandte mich an den Popen:
»Diese Salsa ist also eine Art — Duell?«
»Duell?« antwortete er. »O nein, es ist eine Art — Hahnenkampf!«
»Was?« rief ich. »Und aus welchem Grunde unternehmen die Männer da diese Art — Hahnenkampf? Haben sie sich beleidigt — ist es Eifersucht?«
»Keineswegs«, sagte ruhig der Engländer, »sie haben gar keinen Grund. Vielleicht sind sie die besten Freunde — vielleicht kennen sie einander gar nicht. Sie wollen nur — ihren Mut beweisen. Sie wollen zeigen, dass sie hinter den Stieren und den Hähnen nicht zurückstehen.«
Die hässlichen Lippen versuchten ein kleines Lächeln, als er fortfuhr:
»So etwa — wie bei Ihren deutschen Studentenmensuren.
Ich bin — im Auslande — immer Patriot. Das habe ich längst von den Briten gelernt: Right or wrong — my country!«
So antwortete ich ihm scharf:
»Reverend — der Vergleich ist albern! — Sie können das nicht beurteilen.«
»Vielleicht doch«, sagte der Pope. — »Ich habe in Göttingen sehr schöne Mensuren gesehen. — Viel Blut, viel Blut —«
Inzwischen hatte der Patron uns zur Seite Platz genommen. Er zog ein schmutziges Notizbuch aus der Tasche und einen kleinen Bleistift.
»Wer wettet auf Bombita?« rief er.
»Ich!« — »Eine Peseta!« — »Zwei Duros!« — »Nein, auf Lagartijillo will ich wetten!« — Die Branntweinstimmen krächzten durcheinander.
Der Pope fasste mich am Arm.
»Richten Sie Ihre Wetten so ein, dass Sie verlieren müssen«, rief er, »legen Sie lange Odds, man kann nicht vorsichtig genug sein mit der Bande.«
Ich hielt also eine ganze Reihe der angebotenen Wetten, und zwar immer drei zu eins. Da ich auf alle beide setzte, musste ich so notwendigerweise verlieren. Während der »Manager« mit schwerfälligen Zeichen alle Wetten zu Papier brachte, reichte man die scharfgeschliffenen Navajen herum, deren Klingen etwas über zwei Zoll lang waren. Dann gab man sie zusammengeklappt den beiden Kämpfern.
»Welche willst du, Bombita Chico, mein Hähnchen?« lachte der Schleifer.
»Gib her! Gilt mir gleich!« gröhlte der Betrunkene.
»Ich will mein eigen Messer!« rief Lagartijillo.
»So gib mir meines! Ist so besser!« krächzte der andere.
Alle Wetten waren eingetragen, der »Manager« liess den beiden noch ein grosses Glas Aguardiente reichen. Sie tranken es im Zuge aus, warfen dann die Zigaretten fort. Man gab einem jeden ein langes rotes Wolltuch, eine Gürtelbinde, die sie sich fest um den linken Unterarm und die Hand schlangen.
»Ihr könnt anfangen, kleine Burschen!« rief der Patron. »Klappt die Messer auf!«
Die Klingen der Navajen schnappten klirrend über die Zahnrädchen und hakten sich fest. Ein helles widerwärtiges Geräusch. — Aber die beiden Männer blieben ganz ruhig, keiner machte eine Bewegung.
»Fangt doch an, Tierchen!« wiederholte der Patron.
Die Kämpfer sassen unbeweglich, rührten sich nicht. Die Andalusier wurden ungeduldig:
»Fass ihn doch, Bombita, mein junger Stier! Stoss ihm das Hörnchen in den Leib!«
»Fang an, Kleiner, ich habe drei Duros auf dich gesetzt!«
»Ah, — Hähnchen wollt ihr sein? Hennen seid ihr! Hennen!«
Und der Chor gröhlte:
»Hennen! Hennen! — — Legt doch Eier! Feige Hennen seid ihr!«
Bombita Chico reckte sich hoch und stiess nach dem Gegner, der hob den linken Arm und fing den matten Stoss in dem dicken Tuche auf. Die beiden Kerle waren augenscheinlich so betrunken, dass sie kaum Herren ihrer Bewegungen waren.
»Warten Sie nur, warten Sie nur«, flüsterte der Pope. »Warten Sie nur, bis die Leute Blut sehen!«
Die Andalusier hörten nicht auf, die beiden zu hetzen, bald mit Aufmunterungen, bald mit beissendem Spott. Und immer wieder zischte es ihnen in die Ohren:
»Hennen seid ihr! — Legt doch Eier! — Hennen! Hennen!«
Sie stiessen nun beide aufeinander, fast blindlings. In der nächsten Minute erhielt der eine einen leichten Stich an der linken Schulter.
»Brav, lieber Kleiner, brav Bombita! — Zeig ihm mein Hähnchen, dass du Sporen hast!«
Sie machten eine kleine Pause, wischten sich mit dem linken Arm den schmutzigen Schweiss von der Stirne.
»Wasser!« rief Lagartijillo.
Man reichte ihnen grosse Kannen, und sie tranken in langen Zügen. Man sah, wie sie sich ernüchterten. Die fast gleichgültigen Blicke wurden scharf, stechend; hasserfüllt schauten sie aufeinander.
»Bist du fertig, Henne?« krächzte der Kleine.
Statt aller Antwort stiess der andere zu, zerschnitt ihm die Wange der Länge nach. Das Blut strömte über den nackten Oberkörper.
»Ah, es fängt an, es fängt an«, murmelte der Pope.
Die Andalusier schwiegen; gierig verfolgten sie die Bewegungen des Kämpfers, auf den sie ihr Geld gesetzt. Und die beiden Menschen stiessen zu, stiessen zu — —
Die blanken Klingen zuckten wie silberne Funken durch den roten Fackelschein, bissen sich fest in den wollenen Schutzbinden der linken Arme. Ein grosser Tropfen siedenden Pechs flog dem einen auf die Brust — — er merkte es nicht einmal.
So schnell schleuderten sie die Arme in der Luft, dass man gar nicht sehen konnte, ob einer getroffen war. Nur die blutigen Rinnen, die überall auf den Körpern sich zeigten, zeugten von immer neuen Rissen und Stichen.
»Halt! Halt!« schrie der Patron.
Die Kerle stiessen weiter.
»Halt! Bombitas Klinge ist gebrochen!« rief er wieder. »Trennt sie!«
Zwei Andalusier sprangen auf, nahmen eine alte Tür, auf der sie sassen, und warfen sie roh zwischen die Kämpfer, richteten sie dann hoch, dass sie einander nicht mehr sehen konnten.
»Gebt die Messer her, Tierchen!« rief der Patron. Die beiden gehorchten willig.
Sein scharfes Auge hatte recht gesehen; Bombitas Klinge war in der Mitte gebrochen. Er hatte seinem Gegner die ganze Ohrmuschel durchstochen, an dem harten Schädel war die Klinge zersprungen.
Man gab jedem ein Glas Branntwein, dann reichte man ihnen neue Messer und hob die Tür weg.
Und dieses Mal fuhren sie aufeinander los wie zwei Hähne, ohne Besinnen, blindwütend, Stich um Stich — —
Die braunen Leiber färbten sich purpurn, aus Dutzenden von Wunden rann das Blut. Von der Stirn des kleinen Bombita hing ein brauner Hautlappen herab, feuchte Strähne des schwarzen Haares leckten in die Wunde. Sein Messer verfing sich in der Schutzbinde des Gegners, derweil stiess ihm der andere zwei-, dreimal die Navaja tief in den Nacken.
»Wirf die Binde weg, wenn du Mut hast!« schrie der Kleine und riss sich selbst mit den Zähnen das Tuch vom linken Arm.
Lagartijillo zögerte einen Augenblick, dann folgte er dem Beispiel. Unwillkürlich parierten sie nach wie vor mit den linken Armen, die in wenigen Minuten völlig zerfleischt waren.
Wieder brach eine Klinge, wieder trennte man sie mit der morschen Tür; reichte ihnen neue Messer und Branntwein.
»Stoss ihn, Lagartijillo, mein starkes Stierchen, stoss ihn!« rief einer der Männer. »Reiss ihm die Eingeweide aus, dem alten Klepper!«
Der Angerufene gab, unerwartet, in dem Augenblick, als man die Türe wegzog, seinem Gegner von unten her einen furchtbaren Stoss in den Bauch und riss seitlich die Klinge hinauf. Wirklich quoll die ekelhafte Masse der Eingeweide aus der langen Wunde. Und dann, von oben her, stiess er blitzschnell wieder, traf ihn unter dem linken Schultergelenk und zerschnitt die grosse Ader, die den Arm ernährt.
Bombita schrie auf, bog sich zusammen, während ein armdicker Blutstrahl aus der Wunde spritzte, dem anderen mitten ins Gesicht. Es hatte den Anschein, als ob er ermattet umsinken wolle; doch plötzlich richtete er noch einmal die breite Brust in die Höhe, hob den Arm und stiess auf den blutgeblendeten Feind. Und er traf ihn, zwischen zwei Rippen durch, mitten ins Herz.
Lagartijillo schlug mit beiden Armen in die Luft, das Messer entfiel der rechten Hand. Leblos sank der mächtige Körper nach vorn über die Beine hin.
Und als ob dieser Anblick dem sterbenden Bombita, dessen entsetzlicher Blutstrahl in breitem Bogen auf den toten Gegner spritzte, neue Kräfte verleihe, stiess er wie ein Wahnsinniger immer, immer wieder den gierigen Stahl in den blutigen Rücken.
»Hör‹ auf, Bombita, tapferer Kleiner, du hast gesiegt!« sagte ruhig der Patron.
Da geschah das Schrecklichste. Bombita Chico, dessen letzter Lebenssaft den Besiegten in ein feuchtes, rotes Leichentuch hüllte, stützte sich mit beiden Händen fest auf den Boden und hob sich hoch, so hoch, dass aus dem handbreiten Riss an seinem Leibe die Fülle der gelben Eingeweide wie eine Brut ekelhafter Schlangen weit hinauskroch. Er reckte den Hals, reckte den Kopf, und durch das tiefe Schweigen der Nacht erscholl sein triumphierendes
»Kikeri-ki!!«
Dann sank er zusammen: das war sein letzter Gruss an das Leben — —
Es war, als ob sich plötzlich ein roter Blutnebel um meine Sinne legte; ich sah, hörte nichts mehr; ich versank in ein purpurnes, unergründlich tiefes Meer. Blut drang mir in Ohren und Nase, ich wollte schreien, aber wie ich den Mund öffnete, füllte er sich mit dickem warmem Blute. Ich erstickte fast — aber schlimmer, viel schlimmer war dieser süsse, grässliche Blutgeschmack auf meiner Zunge. Dann fühlte ich irgendwo einen stechenden Schmerz — doch dauerte es eine unendliche Zeit, bis ich wusste, wo es mich schmerzte. Ich biss auf etwas, und das, worauf ich biss, das schmerzte so. Mit einer ungeheueren Anstrengung riss ich die Zähne voneinander.
Wie ich den Finger aus dem Munde zog, erwachte ich. Bis zur Wurzel hatte ich während des Kampfes den Nagel abgenagt und nun in das unbeschützte Fleisch gebissen.
Der Andalusier fasste mich am Knie. »Wollen Sie Ihre Wetten erledigen, Caballero?« fragte er. Ich nickte; dann rechnete er mit vielen Worten vor, was ich verloren und gewonnen hätte. Alle die Männer umdrängten uns — keiner bekümmerte sich um die Leichen. —
Erst das Geld! Das Geld!
Ich gab dem Manne eine Handvoll und bat ihn, die Sache zu ordnen. Er rechnete und setzte sich unter heiserem Schreien mit jedem einzelnen auseinander.
»Nicht genug, Caballero!« sagte er endlich. Ich fühlte, dass er mich betrog, aber ich fragte ihn, wieviel ich noch zu zahlen habe, und gab ihm das Geld.
Als er sah, dass ich noch mehr in der Tasche hatte, fragte er: »Caballero, wollen Sie nicht das Messerchen des kleinen Bombita kaufen? Es bringt Glück, viel Glück!«
Ich erstand die Navaja für einen lächerlichen Preis. Der Andalusier schob sie mir in die Tasche.
Nun achtete niemand mehr auf mich. Ich stand auf und ging taumelnd in die Nacht hinaus. Mein Zeigefinger schmerzte, ich wand fest das Taschentuch herum. In langen, tiefen Zügen trank ich die frische Nachtluft.
»Caballero!« rief jemand, »Caballero!« Ich wandte mich um. Einer der Männer kam auf mich zu.
»Der Patron schickt mich, Caballero,« sagte er, »wollen Sie nicht Ihren Freund mit nach Hause nehmen?«
Ach ja — der Pope! Der Pope! — Während all der Zeit hatte ich ihn nicht gesehen, nicht gedacht an ihn!
Ich ging wieder zurück, bog durch die Kaktushecken. Noch immer lagen die blutigen Massen angefesselt am Boden. Und darüber bog sich der Pope, streichelte mit schmeichelnden Händen die jämmerlich zerfetzten Leiber. — Aber ich sah wohl, dass er das Blut nicht berührte — — o nein! Nur in der Luft bewegten sich hin und wieder seine Hände.
Und ich sah, dass es zarte, feine Frauenhände waren — —
Seine Lippen bewegten sich: »Schöne Salsa,« flüsterte er, »schöne rote Tomatensauce!«
Man musste ihn mit Gewalt fortziehen, er wollte den Anblick nicht missen. Er lallte und tappte unsicher auf den dürren Beinen.
»Zuviel Branntwein!« lachte einer der Männer. Aber ich wusste: er hatte keinen Tropfen getrunken.
Der Patron zog seinen Hut und die anderen folgten seinem Beispiel.
»Vayan ustedes con Dios, Caballeros!« sagten die Männer.
— Als wir auf der Landstrasse waren, ging der Pope gutwillig mit. Er fasste meinen Arm und murmelte:
»O, so viel Blut! So viel schönes rotes Blut!«
Wie ein Bleigewicht hing er an mir, mühselig schleppte ich den Berauschten der Alhambra zu. Unter dem Turme der Prinzessinnen machten wir halt, setzten uns auf einen Stein —
Nach einer langen Weile sagte er langsam:
»O das Leben! Wie herrliche Genüsse schenkt uns das Leben! — Es ist eine Lust zu leben!«
Ein eiskalter Nachtwind feuchtete unsere Schläfen, mich fror. Ich hörte den Popen mit den Zähnen klappern, langsam verflog sein Blutrausch.
»Wollen wir gehen, Reverend?« fragte ich.
Ich bot ihm wieder meinen Arm an.
Er dankte.
Schweigend stiegen wir zu dem schlafenden Granada hinab.
Als zu Ende September 1841 der Herzog Ferdinand von Orléans nach einem Landaufenthalte in sein Pariser Hotel zurückkehrte, überreichte ihm der Kammerdiener auf einem grossen goldenen Servierteller einen Stoss Korrespondenzen aller Art, die sich angehäuft hatten, da der Herzog sich niemals etwas, selbst die wichtigste Nachricht nicht, in seine Sommerfrische nachsenden liess. Unter diesen Briefen befand sich auch ein merkwürdiges Schreiben, das mehr als die andern des Herzogs Interesse wachzurufen geeignet war:
»Mein Herr!
Ich habe eine grössere Anzahl von Bildern meiner Hand, die ich Ihnen zu verkaufen beabsichtige. Ich werde für diese Bilder von Ihnen einen beispiellos hohen Preis fordern, der dennoch in keinem Verhältnis steht zu dem Reichtum, den sich Ihre Familie zusammengestohlen hat. Ja, Sie werden diesen Preis sogar bescheiden finden im Vergleich zu dem ausserordentlich hohen Wert, den, rein materiell, meine Bilder für das königliche Haus haben; Sie werden mir also für die Gelegenheit, die ich Ihnen biete, dankbar sein. — Ich sage Ihnen übrigens im vornhinein, was ich mit dem Gelde, das Sie mir zahlen werden, zu tun gedenke. Ich bin ein alter Mann ohne Familie und ohne persönliche Ansprüche; ich lebe von einer kleinen Rente und benötige nicht mehr. Ich werde also die Gesamtsumme den ›Leuten vom Berge, die nicht vergessen‹ vermachen. Sie wissen wohl, mein Herr, was das für ein Verband ist: es sind ehrliche Leute, die die Traditionen der Männer, die Ludwig Capet hinrichteten, treu aufrecht erhalten. Freilich hat der König, Ihr Vater, diesen Verband aus Paris und Frankreich ausgetrieben, aber er hat nun seinen Sitz in Genf und befindet sich recht wohl dort; ich hoffe, Sie werden noch oft von ihm hören. Diesen ›Leuten vom Berge, die nicht vergessen‹ werde ich sofort nach Erhalt das Geld anweisen, und zwar mit der ausgesprochenen Bestimmung, es zur Propagierung des Königsmordes zu verwenden. Ich denke, dass Ihnen diese Verwendung Ihres eigenen Geldes eine recht unsympathische ist, aber Sie werden mir zugeben, dass jeder mit seinem Gelde machen kann, was er will. Auch hege ich nicht das leiseste Bedenken, dass etwa diese zukünftige Bestimmung Ihrer goldenen Louis Sie veranlassen könnte, nicht zu kaufen; Sie werden unter allen Umständen meine Bilder erwerben, und ich verlange sogar, dass Sie mir einen, mit dem Siegel der königlichen Familie versehenen, eigenhändigen Brief schreiben, in dem Sie mir ausdrücklich Ihren Dank für mein Entgegenkommen aussprechen.
Martin Droling.«
Die formlose Offenheit dieses Briefes, der weder ein Datum noch die Adresse des Absenders zeigte, machte auf den verwöhnten Herzog einigen Eindruck. Seine erste Annahme, die auch von seinen Adjutanten geteilt wurde, dass das Schreiben von einem Geisteskranken herrühren müsse, vermochte sich nicht ganz bei ihm durchsetzen. Auch war es wohl die grosse Neugierde, welche ihn stets auszeichnete und ihm einmal in Algier schon beinahe das Leben gekostet hatte, die ihm den Entschluss eingab, einen seiner Adjutanten zu beauftragen, über das Tatsächliche des Briefes Erkundigungen einzuziehen und ihm dann Bericht zu erstatten.
Dies geschah schon am folgenden Tage. Der Adjutant, Herr de Touaillon-Geffrard, berichtete dem Herzog, dass der Verband der »Leute vom Berge, die nicht vergessen« in der Tat in Genf existiere. Die Regierung habe den Verein vor zwei Jahren aufgelöst und einige Mitglieder eingesperrt, im übrigen aber der Angelegenheit wenig Wert beigelegt, da es sich augenscheinlich nur um einige überspannte, aber völlig ungefährliche Phrasenhelden handelte. — Martin Droling sei ein Maler, übrigens ein stiller Greis von über achtzig Jahren, der nie in seinem Leben jemals irgendwie sich bemerkbar gemacht habe. Seit Jahrzehnten schon habe man nichts mehr von ihm gesehen und gehört, da er fast nie sein Atelier in der Rue des Martirs verlasse; ausgestellt habe er seit langer Zeit nicht mehr. Als junger Mann sei er dagegen fleissig gewesen, habe viele tüchtige Bilder gemalt, und zwar meist Kücheninterieurs. Eine dieser Küchenszenen sei vom Staate angekauft worden und hänge im Louvre.
Der Herzog von Orléans war von dieser Auskunft, die das seltsame Schreiben so jeder romantischen Farbe entkleidete, sehr wenig erbaut. »Dieser Mann scheint eine ausserordentlich hohe Meinung von dem Appetit der Bourbonen zu haben,« meinte er, »wenn er annimmt, dass wir uns so sehr für Kücheninterieurs interessieren! — Ich glaube nicht, dass es nötig sein wird, dem Kauz zu antworten.« — Er sagte: »çe dréle de Droling« und der Adjutant lachte, wie es sich gehörte.
Aber der Kauz schien über diesen Punkt wesentlich anderer Ansicht zu sein. Wenigstens erhielt der Herzog nach einigen Tagen wieder einen Brief des Malers, der in seiner befehlenden Bestimmtheit den ersten noch weit hinter sich liess:
»Mein Herr!
Es ist unbegreiflich, dass Sie sich noch nicht bei mir sehen liessen. Ich wiederhole, dass ich ein alter Mann bin; es ist deshalb für beide Teile besser, dass wir unser Geschäft sofort abschliessen, da das höchst unerfreuliche, aber immerhin bald mögliche Ereignis meines Todes es vereiteln möchte. Ich erwarte Sie daher bestimmt morgen früh um elfeinhalb Uhr in meinem Atelier; aber kommen Sie nicht früher, da ich ein Spätaufsteher bin und keine Lust habe, Ihretwegen früher aus den Federn zu kriechen.
Martin Droling.«
Der Herzog reichte den Brief seinem Adjutanten. »Er gibt wieder keine Adresse an; er nimmt es augenscheinlich als selbstverständlich, dass wir wissen, wo er wohnt. Nun, er hat recht: jetzt wissen wir's ja auch! Was meinen Sie, wollen wir dem strengen Befehl des Herrn Droling nachkommen. Lassen Sie anspannen morgen früh, lieber Touaillon, aber so, dass wir wenigstens eine halbe Stunde früher bei ihm sind. Ich denke, er wird lustiger sein in seinem Zorn.«
— — Der Herzog und Herr de Touaillon-Geffrard stiegen keuchend die vier hohen Treppen des schmutzigen Hofgebäudes hinauf. Sie klopften an eine grosse, gelbe Türe, die ein altes Schild mit dem Namen »Martin Droling« trug.
Aber sie pochten vergeblich, nichts rührte sich. Sie riefen und schlugen mit den Krücken ihrer Stöcke an die Türe. Den Herzog amüsierte diese Belagerung, die immer heftiger wurde; schliesslich verübten die beiden einen Höllenlärm.
Plötzlich hörten sie eine meckernde Stimme, ziemlich weit von der Türe entfernt. »Was ist denn los? Was gibt es denn?«
»Aufstehen, Papa Droling, aufstehen! Besuch ist da!« rief der Herzog äusserst belustigt.
»Ich stehe auf, wenns mir passt,« klang es zurück, »nicht wenns euch gefällig ist.«
Aber der Herzog war in Stimmung. »Wir müssen die Festung erstürmen«, rief er und kommandierte: »Feuer!« Beide traten in kurzen Stössen gegen die Tür, die in allen Fugen krachte. Dazwischen klopften sie mit den Stöcken und riefen immer wieder: »Aufstehen! Langschläfer! Besuch ist da! Raus aus dem Bett!«
Von drinnen hörten sie ein unverständliches Gemurmel von Flüchen. Dann nahten trippelnde Schritte der Türe. »Machen Sie, was Sie wollen, Sie werden doch nicht eher hineinkommen, bis ich mich gewaschen, angezogen und gefrühstückt habe.«
Der Herzog sprach, bat, fluchte; alles umsonst, er erhielt keine Antwort. Endlich ergab er sich und setzte sich mit seinem Adjutanten auf die oberste Treppenstufe. »So lerne ich auch einmal aus eigener Anschauung die höchst unangenehme Beschäftigung des Antichambrierens kennen, nur dass das Antichambre hier ein sehr dürftiges ist. Ich werde mich dafür rächen!«
Es ist aus den Memoiren der Fürstin Metternich bekannt, dass der Herzog sich in der Tat gerächt hat. Mit einer wahren Leidenschaft liess er in der nächsten Zeit alle Besucher bei sich antichambrieren, stundenlang. Oft liess er eben erst angekommene Bittsteller vor, nur um die Genugtuung zu haben, andere, die schon seit drei Stunden warteten, noch länger sitzen zu lassen.
Endlich bewegte es sich an der Türe. Man hörte ein Drehen im Schloss, das Abziehen eines Riegels und das dumpfe Schlagen einer schweren Eisenstange.
Dann öffnete sich die Türe und liess ein kleines, blasses Männchen in der Tracht des ersten Konsulates sehen. Die Kleidung war einmal elegant gewesen, aber schmutzig, verschossen und verschlissen. Das zerfurchte bartlose Gesichtchen schaute aus einer ungeheuren schwarzen Halsbinde mühsam hervor, oben umrahmte es eine Fülle schmutzigweisser Haartollen, die wild durcheinander fielen.
»Ich bin Martin Droling«, sagte das Männchen. »Was wünschen Sie?«
»Sie haben uns heute morgen zu Ihnen gebeten —« begann der Herzog.
Aber der kleine Maler unterbrach ihn. Er zog eine schwere silberne Uhr aus der Tasche und hielt sie dem Herzog unter die Nase. »Ich habe Sie ersucht, um halb zwölf Uhr zu mir zu kommen, nicht früher. Wieviel Uhr ist's jetzt? Zwanzig Minuten nach elf! Und Sie treiben schon seit einer halben Stunde hier Ihre albernen Scherze. Für jedes meiner Bilder werden Sie mir dafür tausend Franken mehr bezahlen, verstehn Sie! Ich werde Sie schon lehren, sich anständig zu benehmen. — Wer von Ihnen ist Herr Orléans?«
Dem Adjutanten ging das Benehmen des Alten seinem Herrn gegenüber schliesslich doch zu weit. Er hielt es für seine Pflicht, den Standpunkt zu wahren und sagte daher mit Betonung auf den Herzog weisend: »Herr Droling, vor Ihnen steht Seine Königliche Hoheit, der Herzog von Orléans!«
Der kleine Maler fauchte vor Wut. »Nennen Sie den Herrn, wie es Ihnen beliebt, das geht mich nichts an. Mir aber erlauben Sie, ihn so anzureden, wie er heisst. — Wer sind Sie denn eigentlich? Wollen Sie sich nicht vorstellen?«
Der Herzog weidete sich einen Augenblick an der sprachlosen Verblüffung seines Begleiters, dann sagte er mit allem Aufgebot seiner Liebenswürdigkeit: »Gestatten Sie, Herr Droling: mein Adjutant, Herr de Touaillon-Geffrard, Oberstleutnant im zweiten Kürassierregiment.«
Droling machte eine kleine Verbeugung. »Ich kenne Sie nicht, mein Herr, und wünsche auch nicht die Bekanntschaft Ihresgleichen zu machen. Ich habe Sie nicht hergebeten und beabsichtige nicht, Sie zu empfangen. Gehen Sie also.«
Der Herzog war, wie fast alle Mitglieder königlicher Häuser, völlig von seiner Umgebung abhängig. Er war aber nicht dumm genug, sich dieser Abhängigkeit nicht bewusst zu sein, so kam es, dass er seine Umgebung, die er doch nicht einmal auf Minuten entbehren konnte, stets hasste und sich über nichts mehr freute, als wenn dem einen oder andern etwas recht Blamables zustiess. Die Art, wie Herr Droling seinen Adjutanten, der auf seinen Kreuzritteradel so ungeheuer stolz war, behandelte, amüsierte daher den Herzog so sehr, dass er ein Lachen kaum zu unterdrücken vermochte.
»Gehen Sie, lieber Touaillon,« sagte er, »erwarten Sie mich unten im Wagen. Herr Droling hat recht: er braucht nur die Leute zu empfangen, die ihm angenehm sind.«
Nun aber hatte der wutschnaubende Adjutant, der nach einer tiefen Verbeugung sich schweigend der Treppe zuwandte, eine Genugtuung, die ihn fast wieder mit dem verrückten Maler aussöhnte.
Herr Droling sagte nämlich: »Wenn Sie sich einbilden, Herr Orléans, dass Sie mir angenehm sind, so täuschen Sie sich ganz gewaltig: Sie sind mir im Gegenteil höchst unsympathisch. Ich habe Sie nur hergebeten, weil ich geschäftlich mit Ihnen zu tun habe. Treten Sie ein!«
Herr de Touaillon grinste, als die Tür ins Schloss fiel. Er hasste, wie alle Adjutanten ihre Herrn, im Grunde seines Herzens den Herzog nicht weniger, als dieser ihn.
Während der Maler abschloss, den Riegel vorschob und die lange Eisenstange wieder quer über der Türe befestigte, schaute sich der Herzog im Atelier um. Da standen ein paar leere Staffeleien herum, hingen kaum erkennbare Studien und Skizzen an den Wänden, lagen auf Truhen, Kisten und Sesseln vergilbte Kostümstücke. Alles war verstaubt und verschmutzt. Ein Bild konnte der Herzog nirgends entdecken; resigniert liess er sich auf einen kleinen Malstuhl in der Mitte des Zimmers nieder.
Aber kaum sass er, als ihm die meckernde Ziegenstimme des Alten ins Ohr fuhr: »Habe ich Sie gebeten, sich da hinzusetzen? Nicht einmal den einfachsten Anstand scheint man in Ihrer würdigen Familie zu kennen, Herr Orléans! Was würden Sie sagen, wenn ich als Gast bei Ihnen, mich unaufgefordert niedersetzen würde? Ausserdem ist der da — mein Stuhl.«
Diesmal war der Herzog wirklich verblüfft; er sprang auf. Herr Droling warf einige alte Lappen von einem schweren Ledersessel herunter, zog ihn ein wenig vor und sagte dann förmlich: »Darf ich bitten, hier Platz zu nehmen.«
»Ich bitte: nach Ihnen,« erwiderte ebenso steif der Herzog, der sich fest vornahm, diese Komödie nun treulich durchzuspielen.
Aber Droling blieb stehn: »Nein, nach Ihnen. Ich bin hier zu Hause und Sie sind mein Gast.«
Der Herzog setzte sich in den Sessel, Droling trippelte zu einem mächtigen alten Schrank, öffnete ihn und nahm eine wundervoll geschliffene venetianische Karaffe und zwei Spitzgläser heraus.
»Ich habe selten Gäste, Herr Orléans«, begann er. »Wenn ich einen habe, pflege ich ihn mit einem Glase Portwein zu bewirten. Trinken Sie, auch an der Tafel Ihres Vaters im Schlosse werden Sie keinen besseren bekommen.« Er goss die Gläser voll und reichte eines dem Herzog. Ohne sich darum zu kümmern, ob dieser trinke, hob er sein Glas gegen das Licht, streichelte es dann zärtlich und trank in kleinen Schlucken. Auch der Herzog trank, und er musste anerkennen, dass der Wein ein ganz ausgezeichneter war. Droling füllte die Gläser von neuem, schien aber keine Miene zu machen, auf den Bilderkauf zu sprechen zu kommen. So begann der Herzog:
»Sie haben mich hierher gebeten, um mir einige Ihrer Gemälde zu verkaufen. Ich kenne Ihre Art von Ihrem ›Kücheninterieur‹ im Louvre —«
»Haben Sie das Bild gesehen?« unterbrach ihn der Maler eifrig. »Nun, wie gefällt es Ihnen?«
»O ganz ausserordentlich gut,« lobte der Herzog. »Ein sehr feines Gemälde. Wunderbar stimmungsvoll.«
Aber seine Worte hatten eine ganz andere Wirkung, als er erwartet hatte. Der Alte lehnte sich in seinen Stuhl zurück, fuhr mit den Fingern durch die weisse Mähne und sagte: »So? — Nun, das beweist, dass Sie nichts, aber auch gar nichts von Kunst verstehen. Sie sind ein Böotier! Das Bild ist nämlich langweilig, stimmungslos, kurz, herzlich schlecht. Gut gemalt, ja, aber mit eigentlicher Kunst hat es gar nichts gemein. Einzig der braune Topf mit den Abfällen hat etwas von Ludwig XIII. und daher — —«
»Von wem hat er etwas?« fragte der Herzog erstaunt.
»Von Ludwig XIII.« wiederholte Droling ruhig. »Aber wenig, ganz wenig. Es war ein erster schwacher Versuch, den ich damals machte, ein hilfloses Tasten. — Es ist traurig, dass Ihnen dieser Mist gefällt, Herr Orléans.«
Der Herzog begriff, dass ihm Diplomatie diesem närrischen Kauze gegenüber nichts nutzen würde, er beschloss daher, auf alle Kunststücke zu verzichten und es mit natürlicher Einfachheit zu versuchen. »Verzeihen Sie, Herr Droling,« begann er wieder, »dass ich versuchte, aus Höflichkeit Ihnen etwas vorzumachen. Ich habe nämlich Ihr Bild im Louvre niemals gesehen und kann daher auch gar nicht beurteilen, ob es gut oder schlecht ist. Übrigens verstehe ich in der Tat sehr wenig von Kunst, nicht halb so viel wie von Wein. Ihr Wein ist wirklich ausgezeichnet.«
Der Alte goss das Glas wieder voll. »So trinken Sie, Herr Orléans. — Also Sie haben mein Bild nicht gesehen und lügen mir vor, dass es sehr schön sei?« Er stellte die Karaffe auf den Boden und schüttelte den Kopf. »Pfui Teufel!« fuhr er fort. »Man merkt, dass Sie aus königlichem Hause sind! — Was kann man da anders erwarten.« Er betrachtete seinen Gast mit einem Ausdruck unerhörter Verachtung.
Der Herzog fühlte sich sehr ungemütlich, er rückte auf seinem Sessel hin und her und trank langsam seinen Wein. »Vielleicht wollen wir nun von unserm Geschäfte sprechen, Herr Droling? — Ich sehe nirgends ein Bild.«
»Sie werden die Bilder schon sehen, Herr Orléans, eins nach dem andern. Sie stehen dort hinter der spanischen Wand.« Der Herzog erhob sich. »Warten Sie noch, bleiben Sie sitzen. Es ist notwendig, dass ich Ihnen vorher den Wert auseinandersetze, den meine Bilder für Sie und Ihre Familie haben.«
Der Herzog setzte sich schweigend, Droling zog seine Beinchen hoch auf den dreibeinigen, lehnenlosen Malstuhl herauf und umfasste die Knie mit den Armen. Er sah aus wie ein selten hässlicher, uralter Affe.
»Glauben Sie mir, Herr Orléans, es ist nicht zufällig, dass ich mich an Sie wende. Ich habe mir das lange überlegt, und ich versichere Sie, dass es mir höchst widerwärtig ist, meine Bilder im Besitze einer so niederträchtigen Familie zu wissen, wie es die Valois-Bourbon-Orléans sind. Aber sehen Sie, selbst der begeistertste Liebhaber würde für meine Bilder nicht den Preis zahlen, den die Orleans geben werden, und das spricht eben mit. Ein anderer würde mir bieten, und ich müsste sein Gebot annehmen, wenn ich auf den Verkauf nicht verzichten wollte. Ihnen aber kann ich meine Preise einfach diktieren. Dazu kommt, dass die Familie der Könige von Frankreich auch gewissermassen ein Recht an den Bildern hat, da diese, freilich in etwas ungewöhnlicher Form, das enthalten, was für Ihr Haus seit Jahrhunderten das Allerheiligste war und es heute noch ist.«
»Ich verstehe Sie nicht ganz«, sagte der Herzog.
Martin Droling wippte auf seinem Stühlchen hin und her. »O, Sie werden mich schon verstehen, Herr Orléans«, grinste er. »Meine Bilder enthalten die Herzen des französischen Königshauses.«
Der Herzog gewann plötzlich die feste Überzeugung, es mit einem Irrsinnigen zu tun zu haben. Wenn das alles auch keineswegs gefährlich für ihn sein konnte — übrigens hat er ja in Algier häufig genug bewiesen, dass er keine Gefahr fürchtete — so war es zum mindesten sinn- und zwecklos für ihn. Unwillkürlich warf er einen Blick nach der Türe.
Der Alte bemerkte den Blick und feixte: »Sie sind mein Gefangener, Herr Orléans, so wie es einst Ihr Grossvater war. Ich dachte mir, dass Sie vielleicht fliehen möchten, deshalb schloss ich ab. Und die Schlüssel habe ich hier, hier in meiner Tasche!«
»Ich habe nicht die geringste Absicht, zu fliehen«, erwiderte der Herzog, dem das grossartige Getue des kleinen Männchens wirklich komisch vorkam. Er war ein grosser, sehr kräftiger Mann und hätte den Greis, der ihn als Gefangenen betrachtete, mit einem Schlage zu Boden werfen und ihm die Schlüssel abnehmen können. »Wollen Sie mir nicht endlich eines Ihrer Bilder zeigen?«
Droling hüpfte von seinem Stuhle herunter und trippelte zu der spanischen Wand. »Ja, ja, das will ich, Herr Orléans, Sie sollen Ihre Freude daran haben!« Er zog eine ziemlich grosse Leinwand im Keilrahmen hervor, schleifte sie hinter sich her und hob sie auf eine Staffelei, so zwar, dass das Bild dem Herzog den Rücken zukehrte. Sorgsam wischte er es mit einem Staublappen ab, dann trat er zur Seite und rief in dem kreischenden Tone der Marktschreier vor den Kirmesbuden: »Hier ist zu sehen das Herz eines der erlauchtesten Namen auf Frankreichs Königsthron, eines der grössten Schufte, die je die Erde getragen hat: das Herz Ludwig XI.!«
Mit diesen Worten drehte er die Staffelei um, so dass der Herzog das Bild betrachten konnte. Es stellte einen mächtigen kahlen Baum vor, in dessen Ästen ein paar Dutzend nackte, zum Teil verweste Menschen aufgehängt waren. In der dunklen Rinde des Baumes war ein Herz eingeschnitten, das das Zeichen »L. XI.« trug.
Das Bild deuchte den Herzog von einer unmittelbaren grausamen Lebenswahrheit. Ein widerlicher Verwesungsgeruch ging davon aus, er hatte das Gefühl, als ob er sich die Nase zuhalten müsse. Der Herzog kannte die Geschichte Frankreichs und besonders die des königlichen Hauses gut genug, um sofort das Gegenständliche des Gemäldes zu erfassen: es stellte den berühmten »Garten« seines hängefreudigen Ahnherrn, des frommen Ludwig XI. vor. Dass der Maler gerade ihm, von dem bekannt war, dass er während seines langjährigen afrikanischen Kommandos stets sehr human gewesen war und das beliebte Hängen dort auf ein Minimum beschränkt hatte, dieses Bild zum Kaufe anbot, kam ihm zum wenigsten recht geschmacklos vor. Auch fand er die Symbolik des Malers, sein Bild »Das Herz Ludwig XI.« zu nennen, oberflächlich genug. Es war in der Tat nur die Rücksicht auf den zweifellos kranken Greis, die ihn veranlasste, auch jetzt höflich zu bleiben.
»Ich muss Ihnen gestehn, Herr Droling,« sagte er, »dass, obwohl mir die malerischen Qualitäten Ihres Bildes ausgezeichnete zu sein scheinen, meinem persönlichen Geschmack dieses historische Motiv sehr wenig zusagt! So weit geht der Ahnenkult in meinem Hause denn doch nicht, dass wir uns für alle Greueltaten halbbarbarischer Vorfahren zu begeistern vermöchten. Ich muss sagen, ich finde das ein wenig —«
Der Herzog zögerte, er suchte nach einem möglich milden Worte. Aber der Maler trippelte, sich vergnügt die Hände reibend, auf ihn zu und drängte ihn feixend:
»Nun? Nun? Was denn?«
»Geschmacklos,« sagte der Herzog.
»Bravo!« grinste der Alte. »Bravo, ausgezeichnet! Das ist auch meine Meinung. Aber Ihr Vorwurf trifft mich nicht, trifft mich ganz und gar nicht. Trifft wieder einmal das Königshaus selbst. Sie sehen: alles Dumme und Alberne kommt von Ihrem Hause. Hören Sie, lieber Herr, diese Idee ist nämlich nicht von mir, sondern von Ihrem Grossvater.«
»Von wem?«
»Von dem Vater Ihres Vaters, der heute König von Frankreich ist, von meinem guten Freunde Philippe Egalité. Als wir von der Hinrichtung Ihres Onkels, des sechszehnten Ludwig, zurückkehrten, blies er mir den Gedanken ein. Übrigens ist die Idee nur künstlerisch schlecht, weil sie zu offenbar, zu dick aufgetragen und zu grobschlächtig ist, ich wundere mich nicht, dass Sie das bemerkt haben. Eine Kuh muss sehen, dass das des elften Ludwig widerliches Herz ist. Übrigens war es eines der grössten von allen, dabei hatte es einen scheusslichen Geruch; ich bekam immer Kopfschmerzen, wenn ich davon schnupfte. — Bei der Gelegenheit — nehmen Sie eine Prise?« Er zog eine breite goldene Dose heraus und hielt sie seinem Gaste hin; der Herzog, der in der Tat ein starker Schnupfer war, nahm ein wenig und schob es in die Nase.
»Es ist eine gute Mischung,« sagte der Alte. »Prinz Gaston von Orléans, Anna von Österreich und Karl V. Nun, wie schmeckt's? Es ist lustig, die besten Reste seiner erlauchten Ahnen aufzuschnupfen!«
»Herr Droling,« sagte der Herzog, »Ihren Schnupftabak muss ich loben, wie Ihren Wein. Aber, verzeihen Sie mir: Ihre Reden verstehe ich ganz und gar nicht.«
»Was verstehen Sie nicht?«
»Nun, was Sie mir da vorerzählen von meinen Vorfahren, die in Ihren Bildern und in Ihren Prisen stecken sollen.«
»Dumm wie ein Orléans!« krähte der Greis. »Wahrhaftig, Sie sind noch dümmer als Ihr Grossvater, obwohl er auch eselhaft genug war, zur Gironde überzugehen. Nun, er hat diesen Abfall ja unter der Guillotine bereut. — Also Sie begreifen nicht, Herr Orléans? So hören Sie, was ich sage: meine Bilder sind mit den Herzen des Königshauses gemalt! Haben Sie das verstanden?«
»Ja, Herr Droling, aber —«
»Und aus dieser Dose und andern pflege ich das zu schnupfen, was mir bei meiner Malerei von den Königsherzen übrig bleibt! Verstanden?«
»Ich höre recht gut, was Sie sagen, Herr Droling, Sie brauchen nicht so zu schreien. Nur erfasse ich den Zusammenhang nicht ganz.«
Der Maler seufzte, antwortete aber nicht. Schweigend ging er zu dem Schranke und entnahm ihm ein paar kleine Kupferplatten, die er dem Herzog reichte. »Da! Es liegen noch einunddreissig in dem Fache, ich schenke sie Ihnen alle. Sie bekommen sie als Zugabe zu den Bildern.«
Der Herzog betrachtete aufmerksam die Inschriften der beiden Platten, ging dann selbst zu dem Schranke und studierte die der andern. Die Inschriften besagten, dass die Platten von den Urnen stammten, welche die Herzen der Könige, Prinzen und Prinzessinnen des königlichen Hauses enthielten. Er fing langsam an, zu verstehen.
»Wie kommen Sie dazu?« fragte er. Gegen seinen Willen hatte sein Ton etwas Hochfahrendes.
»Ich habe sie gekauft«, antwortete der Alte in demselben Tone. »Sie wissen doch, dass sich Maler häufig für alten Trödel und Plunder interessieren.«
»So verkaufen Sie mir die Platten wieder.«
»Ich habe sie Ihnen ja geschenkt. — Sie können sie unten an meine Bilder hängen; ich werde Ihnen sagen, zu welchen sie gehören. Diese da«, er nahm dem Herzog eine Platte aus der Hand, »gehört unter eines meiner lustigsten Bilder, Sie sollen es gleich sehen.«
Er hing die Platte an einem Nagel des Standbrettes der Staffelei, nahm das Bild herunter und lehnte es an einen Stuhl. Dann trippelte er wieder hinter die spanische Wand und zog im nächsten Augenblicke ein sehr grosses Gemälde hinter sich heraus. »Helfen Sie mir, bitte, Herr Orléans, es ist ziemlich schwer.« — Der Herzog fasste den schweren Keilrahmen und hob ihn auf die Staffelei. Als er zurücktrat, klopfte der Alte mit den Fingern an die Kupferplatte und deklamierte: »Hier ist zu sehn das Herz Heinrich IV., des ersten Bourbonen! Es war ein wenig beschädigt durch den Dolchstoss Ravaillacs, eines Mannes von höchst lobenswerten Grundsätzen.«
Das Bild stellte eine sehr grosse Küche dar, die zum grössten Teile von einem ungeheuren Herde mit vielen Kochlöchern eingenommen wurde. Über all diesen Löchern, aus denen die Flammen herausschlugen, standen Kochtöpfe, in denen lebende Menschen schmorten. Manche versuchten herauszuklettern, andere fassten sich gegenseitig, heulten, schnitten entsetzliche Grimassen. Eine grässliche Angst, eine unerhörte Qual schrie aus all diesen verhungerten Gesichtern. Der braune Kochherd zeigte an einer Kachel ein aufgemaltes Herz mit den Initialen Heinrich IV.
Der Herzog wandte sich ab. »Ich verstehe nichts davon«, sagte er.
Droling lachte hell auf. »Und doch lesen Sie in jedem Schulbuch das grosse Wort Ihres biedern Ahnherrn: ›Ich will, dass jeder Bauer Sonntags sein Huhn im Topfe haben soll!‹ — Schauen Sie hin, da sehen Sie die Hähnchen, die der König selbst im Topfe hatte! Das ist wahrhaft ein königliches Herz, dieser Kochherd da! — Wollen Sie Ihrer Nase auch etwas von diesem Bourbonen zu kosten geben?« Er nahm aus dem Schranke eine andere Tabaksdose und hielt sie dem Herzog hin. »Es ist nur noch wenig da,« fuhr er fort, »aber nehmen Sie nur. Gute Mischung: Heinrich IV. und Franz I.! Versuchen Sie nur, man bekommt Raubtiergedanken davon.«
»Wollen Sie vielleicht sagen, Herr Droling,« fragte der Herzog, »dass dieser Tabak — dieser schwarzbraune Staub da — von den Herzen der beiden Könige herrühre?«
»Das will ich allerdings sagen, Herr Orléans. Von nichts anderm stammt er her: ich habe ihn selbst gemischt.«
»Woher haben Sie also die Herzen?«
»Gekauft habe ich sie, sagte ich das nicht schon? Interessieren Sie die Einzelheiten? So hören Sie.« Er schob dem Herzog den Sessel hin und sprang wieder auf sein Malstühlchen.
»Petit-Radel — haben Sie einmal etwas von Petit-Radel gehört? Nein? Na, Sie sind ungebildet, ein echter Orléans, das habe ich schon lange gemerkt. Ihr Grossvater war sehr befreundet mit dem Architekten Petit-Radel. Also der bekam eines Tages vom Ausschuss den Auftrag, die albernen Königsgräber in den Grabgewölben von Saint-Denis und Val-de-Grâce zu zerstören. Er hat es gründlich besorgt, sage ich Ihnen. Dann musste er dieselbe Operation auch in der Jesuitenkirche in der Rue Saint-Antoine vornehmen; Ihr Grossvater benachrichtigte mich davon. ›Geh mit ihm‹, sagte der brave Philippe, ›da wirst du billig Mumie kaufen können!‹ — Sie wissen doch, was das ist, Herr Orléans? Nicht? Nun, Mumie ist Mumie, es sind Reste einbalsamierter Körper, die man als Farbe verwendet. Und teuer ist diese Farbe, meiner Seel! Sie können sich also denken, wie ich mich freute, billig daran zu kommen. In der Jesuitenkirche fanden wir die Gefässe mit den einbalsamierten Herzen der Könige und Prinzen; Petit-Radel zerschlug die Urnen in Stücke; ich kaufte dabei die Kupferplatten und Herzen.«
»Und Sie mischten sich Farbe aus den Herzen?«
»Ja, natürlich, was sonst? Es ist das einzige, wozu ein Königsherz gut ist. Nein, ich übertreibe, als Prise ist es auch ausgezeichnet! — So bedienen Sie sich doch: Heinrich IV. und Franz I.«
Der Herzog lehnte ab. »Gestatten Sie mir zu danken, Herr Droling.«
Der Greis klappte die Dose zu. »Wie Sie wollen. Aber Sie tun unrecht, die Gelegenheit zu versäumen. Nie werden Sie wieder in die Lage kommen, Königsherzen zu schnupfen.«
»Den Teil der Herzen, den Sie nicht zum Schnupfen verwandten, haben Sie in Ihre Bilder vermalt?«
Allerdings, Herr Orléans, ich glaubte, Sie hätten das längst begriffen. Jedes Herz der Familie Valois-Bourbon-Orléans finden Sie in einem meiner Bilder. Aber Sie werden mehr darin finden, als nur die Materie: so billig habe ich mir die Sache nicht gemacht. Wessen Herz wünschen Sie nun zu sehen?«
»Ludwig XV.« sagte der Herzog aufs Geratewohl.
Bald stand ein anderes Bild auf der Staffelei, es war durchweg in dunklem Tone gehalten, selbst die Fleischtöne zeigten eine matte braune Farbe. »Sie scheinen viel Mumie hier verwandt zu haben, Herr Droling,« bemerkte der Herzog, »war das Herz so gross?«
Der Alte lachte: »Nein, es war sehr klein, ein Knabenherz, trotzdem es durch vierundsechzig Jahre schlug. Aber ich habe hier noch andere Herzen verwendet, die des Regenten, des Herzogs von Orléans, der Pompadour und der Dubarry. Es ist eine ganze Zeit, die sich Ihnen da auf tut.«
Das Bild zeigte das Gewimmel einer erstaunlichen Anzahl von Herrn und Damen, die alle in matten Bewegungen durcheinander gingen, sich aneinander vorbeischoben, übereinander krochen.
Einige waren ganz nackt, die meisten in der Tracht ihrer Zeit, mit hohen Toupets, Allongeperücken, Spitzenröcken und Jabots. Alle aber trugen statt eines Kopfes einen mit dünner, pergamentartiger Haut bekleideten Totenschädel auf den Schultern. Die kranken Bewegungen waren tierisch, ja hündisch, die virtuos gemalten Figuren und Trachten, die Glieder, namentlich die Hände, Arme und Schultern menschlich, der Ausdruck der einzelnen und namentlich des ganzen Milieus ein abstossend leichenhafter. Dieses seltsame Gemisch von Leben und Tod, von Tier und Mensch, klang so bewusst harmonisch ineinander, dass das Bild einen unerhört grauenhaften Eindruck auf den Beschauer machte. Droling, dem keine kleinste Bewegung seines Gastes entging, deutete auf die Karaffe.
»Bitte, bedienen Sie sich, Herr Orléans. Ihre stumme Kritik befriedigt mich in höchstem Masse.«
»Ich finde das Bild schauderhaft«, sagte der Herzog.
Der Alte krähte vor Vergnügen. »Nicht wahr? Ekelhaft, ganz widerwärtig. Mit einem Wort: echt königlich!« Dann wurde er plötzlich ernst: »Glauben Sie mir, Herr Orléans, es hat mich unerhörte Qualen gekostet, diese Bilder zu malen. Keine Marter aus Dantes Inferno mag dem gleichkommen: in den Tiefen königlicher Herzen herumzuwühlen. — Bitte, holen Sie ein anderes Bild her.«
Der Herzog ging hinter die spanische Wand, er sah eine ganze Reihe aufgespannter Keilrahmen, alle mit der Bildseite der Wand zugekehrt. Die nächsten ergriff er und hob sie auf die Staffeleien.
»Ah, Sie haben Karl IX. Herz erwischt; keines von allen dürstete so nach Blut, wie das seine.«
Der Herzog sah einen breiten Fluss, der sich träge zwischen flachen Ufern durch den Abend schob. Ein endloses Floss schwamm auf dem trüben Wasser: ein Floss von Leichen. Ganz vorne stand, hochaufgerichtet, der Fährmann, eine magere, in roten Königspurpur gehüllte Gestalt, das bleiche Antlitz von Schwären zerfressen, den irren Blick starr geradeaus gerichtet. Einen mächtigen Bootshaken stiess er in den Grund, so trieb er seine furchtbare Fracht den Strom hinab.
Das andere Gemälde deuchte den Herzog noch schrecklicher zu sein. Es zeigte einen lebensgrossen männlichen Leichnam, der völlig in Verwesung übergegangen war. Würmer krochen aus den Augenhöhlen heraus, eine Sorte schwarzer, rotgelb getupfter Käfer frass an Nase und Mund. Auf dem aufgehackten Leibe sassen zwei, übrigens grandios gemalte Geier, der eine hatte Kopf und Hals tief in den Leib gestossen, der andere schlang an den herausgezerrten Eingeweiden. Am Fussende sah man einige Ratten, die gierig an den angefaulten Zehen nagten.
Der Herzog wandte sich leichenblass ab, er hatte ein Gefühl, als ob er sich erbrechen müsse. Aber der Alte fasste ihn am Rockärmel: »Nein, nein, betrachten Sie das Bild genauer, es ist mein allerbestes und würdig Ihres grossen Ahnherrn Ludwig XIV.! Erkennen Sie ihn nicht? — Er war es, der das freche Wort sprach: ›Der Staat — das bin ich!‹ Nun da haben Sie in Wahrheit diesen Staat, der er war, verfault, zerfressen, zerrissen, verwest.«
Der Herzog setzte sich auf den Sessel, den Rücken den Bildern zugekehrt. Er goss sein Glas voll und trank. »Gestatten Sie mir, Herr Droling, Ihre Kunst setzt starke Nerven voraus.«
Der Maler trat nahe zu ihm und hielt ihm sein Glas hin: »Bitte schenken Sie mir auch ein. Danke sehr. Stossen Sie mit mir an, Herr Orléans, darauf, dass ich nun endlich, endlich — von dem Fluche erlöst bin.« Die Gläser klangen aneinander.
»Ja, ich bin nun frei«, fuhr der Greis fort, und es klang wie Jubel aus der zitternden Stimme. »Alle diese entsetzlichen Herzen sind vermalt, das bisschen, was mir von ihnen blieb, ist in meinen Tabaksdosen. Mein Lebenswerk ist vollbracht, nie wieder brauche ich einen Pinsel in die Hand zu nehmen. Wenn Sie heute nachmittag die Bilder holen lassen, so wollen Sie bitte auch all meine Malutensilien wegschaffen lassen, Sie werden mich verbinden, wenn Sie das tun.« Dann schrie er beinahe in leidenschaftlichem Tone: »Und nie, nie wieder brauche ich all das Entsetzliche zu sehen. Frei bin ich, ganz frei nun!« Er rückte sein Malstühlchen dicht an den Sessel des Herzogs und ergriff mit beiden Händen dessen Rechte.
»Sie sind ein Orléans, sind der Sohn des Königs von Frankreich. Sie wissen nun, wie sehr ich Ihre Familie hasse. Aber in diesem Augenblick bin ich so unendlich froh, dass ich fast vergesse, welche grässlichen Martern ich durch Jahrzehnte hindurch durch Ihre Familie zu erdulden hatte! So lange die Erde steht, hat nie ein Mensch ein schrecklicheres Leben geführt. — Hören Sie, ich will Ihnen sagen, wie das alles gekommen ist; ein Mensch muss es doch wissen, warum soll es nicht der Thronerbe dieses unglücklichen Landes sein.
»Ich sagte Ihnen schon, dass es Ihr Grossvater war, Philippe Egalité, der mich darauf aufmerksam machte, dass ich die Königsherzen kaufen und so billig Mumie erhalten könne. Er war mein guter Freund und besuchte mich häufig, ihm habe ich es auch zu verdanken, dass mein Bild damals vom Staate für den Louvre angekauft wurde. Diese Küchenszene war das erste Bild, zu dem ich ein Herz benutzte, aus Verachtung für den König gebrauchte ich damals die Mumienfarbe, einen kleinen Teil des Herzens Ludwig XIII. für den Abfalltopf. Ein billiger und geschmackloser Scherz! Übrigens waren zu jener Zeit meine Gefühle für Ihr Haus nicht die von heute; den König und die Österreicherin hasste ich zwar, aber nicht mehr wie alle Pariser. Und Philippe war ja mein guter Freund! Sein Hass gegen seine eigene Familie war viel grösser als meiner, und er war es, der mir die Idee auseinandersetzte, von diesen Königsherzen für meine Bilder nicht nur das Stoffliche für den materiellen, sondern auch für den gedanklichen Inhalt zu nehmen. Er war es, der mir die erste banale Idee brachte, den Garten Ludwig XI. zu malen, um so dem Herzen dieses Königs einen seiner würdigen Ausdruck zu geben.
»Ich sage Ihnen, Herr Orléans, ich war damals entzückt von der Idee Ihres Grossvaters! Dreiunddreissig Herzen hatte ich, davon allein achtzehn von Königen. Ich konnte in achtzehn Bildern die Geschichte Frankreichs malen, so wie sie sich zur Darstellung brachte in den Herzen dieser Könige, ich konnte zu diesen Bildern ihre Herzen selbst benutzen! Können Sie sich für einen Künstler etwas Verlockenderes denken? Ich ging sofort an die Arbeit, begann das Bild Ludwig XI. und studierte zugleich die Geschichte meines Landes, von der ich nicht gerade sehr viel wusste. Ihr Grossvater schaffte mir, was er nur an Büchern erwischen konnte, aus den Bibliotheken heran, dazu eine Menge von Geheimakten, Tagebüchern, Memoiren aus der Sorbonne, aus dem Schlosse, aus dem Rathause. Jahrelang habe ich mich hineingefressen in die blutrünstige Geschichte Ihres Hauses, jeden Lebensweg Ihrer Ahnen habe ich bis zum letzten Atemzuge verfolgt. Und immer mehr kam mir zum Bewusstsein, welche furchtbare Arbeit ich auf mich geladen hatte. Ein jedes Bild sollte ja die extrahierte Quintessenz des Herzschlages eines Königs sein, aber was ich auch immer an Scheusslichkeiten ersinnen konnte, es blieb stets unendlich weit hinter der Wahrheit zurück. Meine Arbeit war so ungeheuer gross, erforderte eine solche Riesensumme aller entsetzlichen Gedanken, die je ein Menschenhirn durchzuckt haben, dass ich immer wieder verzweifelte, zusammenbrach unter dieser verfaulten widerlichen Last meiner Aufgabe. Die Verbrechen der Valois, Bourbons und Orléans waren so ungeheuer gross, dass es schier unmöglich schien, sie künstlerisch zu bezwingen. Zusammengebrochen in diesem Kampfe schlich ich spät nachts zu Bett, um am frühen Morgen von neuem zu kämpfen: je mehr ich eindrang in diesen blutigen Pfuhl verruchten Wahnsinns, um so undenkbarer erschien es mir, je Herr darüber zu werden.
»So wuchs in mir der tödliche Hass gegen das Königshaus und zugleich der Hass gegen den, der mich in diese Seelenqual gestürzt hatte. Ich hätte Ihren Grossvater erwürgen mögen. Er blieb damals lange Zeit fern von mir, ich war froh, dass ich ihn nicht sah. Aber eines Tages stürzte er aufgeregt in mein Atelier. Er war zur Gironde übergetreten, galt als Verräter und Dantons Leute waren hinter ihm her. Ihr Vater war klüger gewesen, er hatte treu zu den Jakobinern gehalten, bis er mit Dumouriez floh. Nun bat mich Philippe, ich solle ihn schützen, ihn verstecken. — O, in ganz Paris hätte er keinen Menschen finden können, der ihn mit grösserer Wonne dem Henker ausgeliefert hätte! Ich schickte sofort meinen Diener zum Ausschuss, sperrte dann die Türe ab und behielt ihn als Gefangenen, bis die Gardisten ihn abholten. Zehn Tage später wurde er hingerichtet: als Belohnung für meine patriotische Tat bat ich mir sein Herz aus.«
Der Herzog unterbrach ihn: »Aber Sie konnten doch unmöglich mit dem frischen Herzen malen?«
»Gewiss nicht. Aber ich hatte ja Zeit! Entsetzlich viel Zeit —, alle die andern Herzen konnte ich vorher verbrauchen. Ich habe das Herz Ihres Grossvaters einbalsamiert und trocknen lassen, sechsunddreissig Jahre lang; es hat ausgezeichnete Mumienfarbe geliefert. Es ist mein letztes Bild, warten Sie, ich will es Ihnen zeigen.«
Er sprang hinter die spanische Wand und schleppte einen andern Keilrahmen heraus. »Hier, Herr Orléans! Was Sie da sehen, habe ich oft, oft klopfen hören — auf demselben Stuhle, auf dem Sie jetzt sitzen: das Herz Ihres Grossvaters, des Herzogs von Orléans, Philippe Egalité.«
Der Herzog griff sich unwillkürlich an die Brust, er hatte ein Gefühl, als müsse er sein Herz festhalten, als habe der grässliche Alte die Gewalt, es auch ihm aus dem Leibe zu reissen. Kaum wagte er das Gemälde zu betrachten.
Das Bild zeigte im Hintergrunde ein eisernes Gitter mit vielen Spitzen, das die ganze Länge der Leinwand einnahm. Auf dem Raume vorne waren viele hundert Pfähle in den Boden geschlagen und alle diese Pfähle trugen ebenso wie die Spitzen des Gitters jeder einen abgeschlagenen Menschenkopf. Die Pfähle waren in Herzform aufgestellt, so zwar, dass das Gitter in zwei gleichen Halbkreisen die obere Grenze des Herzens darstellte. Auch der innere Raum des Herzens war ganz mit den Pfählen angefüllt, dass es aussah, als ob die Todesblumen aus dem braunen Herzboden herauswüchsen. Hoch über den Pfählen aber sah man in der graugelben Luft eine verschwommene Fratze schweben, die eigentlich nur ein einziges dämonisches Grinsen war. Und diese Fratze — wenn man näher zusah, auch ein abgeschlagener Kopf — hatte wieder eine Herzform: die charakteristische Birnenherzform der Mitglieder des Hauses Orléans. Der Herzog kannte seinen Grossvater nicht, aber die Ähnlichkeit dieser Birnenfratze mit seinem Vater, ja mit sich selbst, fiel ihm sofort auf. Immer mehr erfasste ihn eine beklemmende Furcht, er konnte den Blick nicht lassen von dieser grässlichen Schaustellung guillotinierter Köpfe. Wie aus der Ferne schien die Stimme des Alten an sein Ohr zu schlagen:
»Ja, sehen Sie nur genau hin, Herr Orléans, das sind alles Porträtsköpfe, alles! O es hat mir viele Mühe gekostet, die Bilder von all den Herrschaften zu erhalten. Wollen Sie wissen, von welchen Leuten die Köpfe sind, über die Ihr Grossvater da oben — ganz Herz ist er jetzt, schauen Sie nur! — sich so herzlich freut? Es sind die Köpfe aller derer, denen er zur Guillotine verhalf! Hier ist der Herzog von Montpensier, da die Marquise von Clairemont. Hier ist Necker, da Turgot, da Beaulieu-Rubin. Hier ist sein Vetter, Ludwig Capet, den Sie König Ludwig XVI. nennen. Warten Sie, ich werde Ihnen das Verzeichnis geben.«
Er suchte in seiner Rocktasche und brachte ein altes vergilbtes Büchlein zum Vorschein. »Nehmen Sie, Herr Orléans, es ist das Vermächtnis Philippe Egalités an seinen Enkel, den Thronerben von Frankreich. Es ist sein Taschenbuch, getreulich hat er darin Buch geführt über alle die Leute, die er zum Schaffot brachte. Das war sein Sport, wissen Sie: darum ward Ihr Grossvater ein Jakobiner. Hier, hier, nehmen Sie diese königlichen Bekenntnisse. Mir gab sie sein Henker; ich zahlte ihm hundert Sous dafür.«
Der Herzog nahm das Büchlein und blätterte darin herum. Aber er vermochte kein Wort zu lesen, die Buchstaben verschwammen ihm vor den Augen. Schwer liess er sich in den Sessel zurückfallen. Der Alte kam mit kleinen Schritten heran, stellte sich gerade vor ihn hin.
»Schon der Anblick dieses Bildes macht Sie schaudern? Da war der, mit dessen Herz es gemalt ist, ein anderer Mann — das Herz hätte ihm gelacht, wenn er es gesehen hätte: so wie er jetzt da lacht! Wirklich, ich habe ihm ein schönes Denkmal gesetzt. — Aber nun begreifen Sie vielleicht, Herr Orléans, was ich durchgemacht habe?
»Sehen Sie, ich habe die Seele eines jeden Ihrer Vorfahren mir zu eigen gemacht. Hier in diesem alten Leibe, der da vor Ihnen steht, haben Sie alle gehaust, die Ludwige und Heinriche, die Franze, Karle und Philippe. Besessen war ich von ihnen, wie von Teufeln, alle ihre Verbrechen musste ich noch einmal begehen. So war meine Arbeit.
»Und nun stellen Sie sich vor, dass ich nicht wie irgendein armer Verrückter unbewusst von einem Wahne befallen wurde, sondern dass ich jedesmal mit ungeheuerer Willensanstrengung von neuem einen Wahnsinn künstlich in mir erwecken musste. Dass ich Wochen, Monate dazu gebrauchte, mich in die Höllen ihrer königlichen Phantasien hinein zu finden, hinab zu stürzen in die gifthauchenden Abgründe ihrer Gedanken. Es gibt kaum ein Mittel, Herr Orléans, das ich zu diesem Zweck nicht versucht habe. Ich habe gefastet und mich kasteit, um die blutrünstig-heiligen Ekstasen in mir zu erleben, die unserm Verständnis von heute so unendlich ferne liegen. Ich habe gerast in täglichen Weinräuschen, aber in meinen wildesten Delirien kamen mir immer nur die gutmütigen Phantasien des harmlosen Martin Droling. Da kam mir der Gedanke, es mit dem Schnupfen zu versuchen; ich zerrieb einen kleinen Teil von jedem meiner Herzen und priste sie. Sie sind selbst ein Schnupfer, Herr Orléans, Sie wissen, wie der Kitzel des feinen Tabaks auf die Schleimhäute der Nase wirkt, wie er das Hirn freier zu machen scheint. Es ist, als ob es von einem Drucke erlöst würde, als könne es plötzlich leichter atmen.
»Ich aber empfand mit diesem eigentümlich angenehmen Gefühl zugleich etwas anderes. Es war, als ob die Seele des Königs, dessen Herz ich schnupfte, von meinem Hirne Besitz ergriffe. Sie setzte sich darin fest, vertrieb den Geist Martin Drolings in die letzte Ecke und schaltete hoch als Herr und König. Und mein kleines Ich hatte nur die einzige Kraft, die königlichen Blutlaunen auf die Leinwand zu bringen — mit der Farbe königlicher Herzen. Ja, Herr Orléans, Sie sehen in mir zugleich alle Ihre Ahnen, die sich wiedererzeugten in meinem Hirne, alle, von Ihrem Grossvater bis hinauf zu Philippe V., dem ersten Valois, der mit blutigen Fingern die Kapetinger Krone sich aufs Haupt setzte! Und sie zeugten in mir — mit mir — ihre Seele noch einmal: in meinen Bildern. Ich war der Künstler: das Urbild des Weibes, das sie alle besassen, das sie alle schändeten, mit dem sie alle zeugten: ihre Kinder, meine Kinder — — die Bilder da! Ja, ja, der Künstler ist ein Weib: wie eine Dirne lockt er die Gedanken heran, lässt sich von ihnen nehmen und knechten und gebiert in grässlichen Qualen seine Werke.«
Die Stimme des Alten klang erstickt, fast niedergebrochen. Aber noch einmal hob sie sich, scharf und schneidend, mit alles verachtender Bitterkeit.
»Ich bin die lebendige Hure der toten Könige von Frankreich. Und nun präsentiere ich Ihnen, Herr Orléans, dem letzten Spross des Hauses, die Rechnung für die Liebesnächte — nehmen Sie dafür ihre Früchte. Es ist die Schuld Ihrer Väter, wenn sie nicht schöner sind.«
Er überreichte dem Herzog einen grossen weissen Bogen mit dem Verzeichnis der Bilder und der Preise. Der Herzog faltete ihn zusammen und steckte ihn in die Tasche.
»Ich werde Ihnen heute mittag das Geld zusenden und zugleich die Bilder abholen lassen. Weisen Sie den Leuten alles das an, was Sie fortgeschafft zu wissen wünschen. Ich danke Ihnen, Herr Droling. Darf ich Ihnen zum Abschied die Hand geben?«
»Nein,« antwortete Martin Droling, »Sie sind ein Orléans.«
Der Herzog verbeugte sich stumm.
Am 13. Juli 1842 starb Herzog Ferdinand von Orléans infolge eines Sturzes aus dem Wagen. In seinem Testament fiel die eigentümliche Bestimmung auf, dass der Herzog sein Herz dem Maler Martin Droling, 34 Rue des Martirs, vermachte. Voraussichtlich hätte König Ludwig Philippe diese Verfügung seines Sohnes, kraft seines hausgesetzlichen Vetorechtes verhindert; doch brauchte er davon keinen Gebrauch zu machen, da der alte Maler schon vor Monaten gestorben war.
Seine Bilder scheinen verschwunden zu sein. In dem Testament des Herzogs werden sie nicht erwähnt und aus den Tagebüchern seines Adjutanten, des Herrn de Touaillon-Geffrard, ist die einzige Stelle, die von ihnen zu sprechen scheint, herausgeschnitten.
Man muss in den Louvre gehen, um noch etwas von den Herzen des französischen Königshauses zu finden. Man suche sie in Drolings Bilde »Intérieur de cuisine«, Kat.-Nr. 4339.
Donald Mac Lean erwartete ihn im Kaffeehaus. Als Lothar eintrat, rief er ihn an:
»Endlich. Ich glaubte, Sie würden nicht mehr kommen.«
Lothar setzte sich, er stocherte in der Limonade, die ihm das Mädchen brachte.
»Was gibt es?« fragte er.
Mac Lean bog sich ein wenig vor.
»Es dürfte Sie interessieren,« sagte er. »Sie studieren doch die Verwandlungen Aphroditens? — Nun, Sie könnten vielleicht die Schaumgeborene in einem neuen Gewande sehen.«
Lothar gähnte:
»Ah! — Wirklich?«
»Wirklich«, sagte Mac Lean.
»Erlauben Sie einen Augenblick,« fuhr Lothar fort. »Venus ist Proteus echte Tochter, aber ich glaube, all' ihre Maskeraden zu kennen. Ich war über ein Jahr in Bombay bei Klaus Petersen —«
»Nun?« fragte der Schotte.
»Nun? — Sie kennen also Klaus Petersen nicht? — Herr Klaus Petersen aus Hamburg ist ein Talent, ein Genie vielleicht! — Der Marschall Gilles de Rais war ein Charlatan — an ihm gemessen!«
Donald Mac Lean zuckte mit den Achseln:
»Das ist nicht die einzige Kunst!«
»Gewiss nicht! Aber warten Sie nur. Oskar Wilde war mein guter Freund, wie Sie wissen. — Und Inez Seckel habe ich durch lange Jahre gekannt. Jeder Name sollte Ihnen eine Fülle von Sensationen geben!«
»Doch nicht alle,« warf der Maler ein.
»Nicht alle?« Lothar trommelte auf den Tisch. »Aber die besten wohl! — Also kurz: ich kenne Venus, die sich in Eros verwandelt, ich kenne die, die den Pelz anzieht und die Geissel schwingt. Ich kenne Venus als Sphinx, die ihre Krallen blutgierig in zartes Kinderfleisch schlägt. Ich kenne die Venus, die sich wollüstig in fauligem Aas wälzt, und ich kenne die schwarze Liebesgöttin, die bei Satansmessen des Priesters ekles Opfer über der Jungfrau weissen Leib spritzt. — Laurette Dumont nahm mich mit in ihren Tierpark, ich weiss, was wenige wissen, wie seltene Reize Sodom birgt! Noch mehr, ich habe in Genf der Lady Kathlin Mac-Mardochs Geheimnis gefunden, um das kein anderer lebender Mensch weiss! Ich kenne die verdorbenste Venus, — — oder soll ich sagen, die »reinste«? — — die die Blumen dem Menschen vermählt! — — Glauben Sie immer noch, dass der Liebe Göttin eine Maske wählen könne, die mir neu wäre?«
Mac Lean schlürfte langsam seine Strega.
»Ich verspreche Ihnen nichts«, sagte er. »Ich weiss nur, dass der Herzog Ettore Aldobrandini seit drei Tagen wieder in Neapel ist. Ich traf ihn gestern auf dem Toledo.«
»Ich würde mich freuen, ihn kennen zu lernen«, erwiderte Lothar. »Ich hörte schon oft von ihm, er soll einer von den wenigen Menschen sein, die es verstehen, aus dem Leben eine Kunst zu machen, — und die — Mittel dazu haben.«
»Ich glaube, man wird Ihnen nicht zu viel erzählt haben«, fuhr der schottische Maler fort. »Sie können sich bald selbst überzeugen: der Herzog gibt übermorgen eine Gesellschaft, ich will Sie einführen!«
»Danke,« sagte Lothar.
Der Schotte lachte.
»Aldobrandini war sehr aufgeräumt, als ich ihn traf. Dazu kommt, dass die ungewöhnliche Zeit, zu der er mich einlud — fünf Uhr nachmittags — ganz gewiss durch irgend etwas begründet ist. — Ich glaube daher, dass der Herzog für seine Freunde eine ganz besondere Überraschung hat; wenn das aber der Fall ist, so können Sie überzeugt sein, dass wir etwas Unerhörtes erleben. Der Herzog geht nie in ausgetretenen Wegen.«
»Hoffen wir, dass Sie recht haben!« seufzte Lothar. »Ich werde also das Vergnügen haben, Sie übermorgen in Ihrer Wohnung abzuholen?«
»Bitte sehr!« entgegnete der Maler.
»Largo San Domenico!« rief Mac Lean dem Kutscher zu. »Palazzo Corigliano!«
Die beiden stiegen die breite Barocktreppe hinauf, ein englischer Diener führte sie in den Salon. Sie fanden sieben oder acht Herren, alle im Frack; nur ein Priester in violettener Soutane war darunter.
Mac Lean stellte seinen Freund dem Herzog vor, der Lothar die Hand reichte.
»Ich danke Ihnen, dass Sie zu mir gekommen sind«, sagte er mit einem liebenswürdigen Lächeln. »Ich hoffe, Sie werden nicht allzu enttäuscht sein.«
Er verbeugte sich und wandte sich dann mit lauterer Stimme an alle Anwesenden.
»Meine Herren!« sagte er. »Ich erbitte Ihre Verzeihung, dass ich Sie zu einer so unpassenden Stunde belästigt habe. — Ich befinde mich aber in einer Zwangslage: das kleine Rehchen, das ich heute Ihnen vorzuführen die Ehre haben werde, ist leider aus einer ausserordentlich guten und anständigen Familie. Es kann nur unter grossen Schwierigkeiten zu mir hinkommen und muss unter allen Umständen um halb sieben Uhr abends wieder zu Hause sein, damit Mama und Papa und die englische Gouvernante nichts merken. Das aber, meine Herren, sind Momente, auf die ein Kavalier Rücksicht nehmen muss! — Und nun bitte ich Sie, mich auf wenige Minuten zu entschuldigen, ich habe noch ein paar kleine Vorbereitungen zu treffen. Inzwischen haben Sie wohl die Güte, ein wenig den kleinen Erfrischungen da zuzusprechen!«
Der Herzog winkte seinen Dienern, machte wieder ein paar Verbeugungen und ging alsdann hinaus.
Ein Herr mit riesigem Viktor-Emanuelschnurrbart näherte sich Lothar; es war di Nardis, der politische Redakteur des Pungolo, der unter dem Pseudonym »Fuoco« schrieb.
»Ich wette, wir werden einen arabischen Scherz zu sehen bekommen,« lachte er, »der Herzog ist gerade aus Bagdad zurückgekommen.«
Der Priester schüttelte den Kopf.
»Nein, Don Goffredo,« sagte er, »wir werden ein Stückchen römische Renaissance gemessen. Der Herzog studiert seit einem Jahre Valdominis Geheimgeschichte der Borgia, die ihm nach langem Betteln der Direktor des Reichsarchives in Severino e Sosio geliehen hat.«
»Nun, wir werden ja sehen«, sagte Mac Lean. »Wollen Sie mir derweil zu morgen die Renntips geben, die Sie mir versprachen?«
Der Redakteur zog sein Notizbuch heraus und vertiefte sich mit dem Priester und dem schottischen Maler in ein eingehendes Turfgespräch. Lothar ass langsam Orangeneis von einem Kristallteller. Er betrachtete das hübsche goldene Löffelchen, das das Wappen der Aldobrandini zeigte, den gezackten Querbalken: zwischen sechs Sternen.
Nach einer halben Stunde schlug ein Diener die Portieren zurück.
»Der Herr Herzog lässt bitten!« rief er. Er führte die Herren durch zwei kleine Zimmer, dann öffnete er eine Doppeltüre, liess alle eintreten und schloss schnell hinter ihnen. Sie befanden sich in einem grossen, sehr langen Räume, der nur ganz schwach erleuchtet war. Den Boden deckte ein weinroter Teppich, die Fenster und Türen waren durch schwere Vorhänge von derselben Farbe verhangen, in der auch die Decke gemalt war. Die Wände, die völlig leer waren, trugen ebenfalls eine weinrote Stofftapete; mit dem gleichen Stoffe waren die wenigen Sessel, Diwane und Longchairs umkleidet, die an den Wänden herumstanden. Das hintere Ende des Zimmers war völlig verdunkelt, mit Mühe konnte man dort ein grosses Instrument erkennen, über dem eine schwere rote Decke lag.
»Ich bitte die Herren, Platz zu nehmen«, rief der Herzog. Er selbst setzte sich und die übrigen folgten seinem Beispiele. Der Diener trat rasch von einem der goldenen Wandleuchter zum andern und löschte die wenigen Kerzen.
Als der Raum ganz finster war, hörte man einen schwachen Akkord vom Klavier her. Leise flog eine Folge rührender Klänge durch den Saal.
»Palestrina«, murmelte der Priester leise. »Sie sehen, dass Sie unrecht hatten mit Ihren arabischen Vermutungen, Don Goffredo.«
»Nun,« antwortete der Redakteur ebenso leise, »haben Sie vielleicht besser geraten, als Sie an Cesare Borgia dachten?«
Man hörte übrigens, dass das Instrument ein altes Spinett war. Die einfachen Töne erweckten eine seltsame Sensation in Lothar, er sann nach, aber er konnte nicht recht herausfinden, was es eigentlich war. Jedenfalls war es etwas, das er lange, lange nicht empfunden hatte.
Di Nardis beugte sich zu ihm hin, dass der lange Schnurrbart seine Wange kitzelte.
»Ich habe es!« raunte er ihm ins Ohr. »Ich wusste gar nicht, dass ich noch so naiv sein könne!«
Lothar fühlte, dass er recht hatte.
Nach einer Weile brannte der stille Diener zwei Kerzen an. Ein matter, fast unheimlicher Schimmer fiel durch den Saal.
Die Musik ging weiter — —
»Und trotzdem« — flüsterte Lothar seinem Nachbar zu, »und trotzdem liegt eine seltsame Grausamkeit in den Tönen. Ich möchte sagen, eine unschuldige Grausamkeit.«
Der stille Diener brannte wieder ein paar Kerzen an. Lothar starrte in die rote Farbe, die den ganzen Raum wie ein blutiger Nebel erfüllte — —
Diese Blutfarbe erstickte ihn fast. Seine Seele klammerte sich an die Töne, die ihm die Empfindung eines mattleuchtenden Weiss erweckten. Aber das Rot drängte sich vor, gewann die Oberhand: immer mehr Kerzen brannte der stille Diener an.
»Das ist nicht mehr zu ertragen«, hörte Lothar den Redakteur neben sich zwischen den Zähnen murmeln.
Jetzt war der Saal halb erhellt. Das Rot schien alles drückend zu decken und das Weiss der unschuldigen Musik wurde schwächer — schwächer — —
Da tritt hinten an dem Spinett vorbei eine Gestalt hervor, ein junges Mädchen, in ein grosses, weisses Tuch gehüllt. Es schritt langsam mitten in den Saal, eine leuchtende, weisse Wolke in der roten Glut.
Dann blieb das Mädchen stehen. Es bog die Arme auseinander, dass das Foulardtuch rings herunterfiel. Wie stumme Schwäne küsste das Tuch ihre Füsse, aber das Weiss des nackten Mädchenleibes leuchtete noch mehr.
Lothar bog sich zurück, unwillkürlich hob er die Hand an die Augen.
»Das blendet fast«, hauchte er.
Es war ein junges, kaum entwickeltes Mädchen, von einer entzückenden, knospenden Unreife. Eine souveräne, keines Schutzes bedürftige Unschuld und wieder ein sicheres Versprechen, das einen masslosen Wunsch auf Erfüllung wachrief. Die blauschwarzen Haare, in der Mitte gescheitelt, wellten sich über die Schläfen und Ohren, um hinten in schwerem Knoten sich zu schliessen. Die grossen, schwarzen Augen blickten gradaus auf die Herren, teilnahmlos, ohne jemanden zu sehen. Sie schienen zu lächeln, wie die Lippen: ein seltsames, unbewusstes Lächeln grausamster Unschuld.
Und das strahlend weisse Fleisch leuchtete so stark, dass rings alles Rot zurückzuweichen schien. Es klang wie ein Jubeln aus der Musik. — —
Jetzt erst bemerkte Lothar, dass das Mädchen auf der Hand eine schneeweisse Taube trug. Es bog den Kopf ein wenig hinab und hob die Hand, da streckte die weisse Taube das Köpfchen vor.
Und die Taube küsste das weisse Mädchen. Das streichelte sie, kraute das Köpfchen und drückte das Tierchen leicht an die Brust. Die weisse Taube hob ein wenig die Flügel und schmiegte sich eng, eng an das leuchtende Fleisch.
»Selige Taube!« flüsterte der Priester.
Da hob — mit einer plötzlichen, raschen Bewegung das weisse Mädchen die Taube mit beiden Händen in die Höhe, grad über den Kopf. Es warf den Kopf weit in den Nacken, und dann, dann riss es mit einem starken Ruck die weisse Taube mitten auseinander. Das rote Blut floss hinab, ohne das Gesicht mit einem Tropfen zu berühren, in langen Strömen über Schultern und Brust, über den strahlenden Leib des weissen Mädchens.
Ringsherum schob sich das Rot zusammen, es war, als ob das weisse Mädchen in einem gewaltigen Blutbade unterginge. Zitternd, hilfesuchend kauerte es sich nieder. Da kroch von allen Seiten die wollüstige Glut heran, der Boden öffnete sich wie ein Feuerrachen; das schreckliche Rot verschlang das weisse Mädchen. — —
In der nächsten Sekunde hatte sich die Versenkung wieder geschlossen. Der stille Diener riss die Portieren zurück und führte die Herren schnell in die vorderen Zimmer.
Niemand schien Lust zu haben, ein Wort zu sprechen. Schweigend liessen sie sich ihre Mäntel geben und gingen hinunter. Der Herzog war verschwunden.
»Meine Herren!« sagte auf der Strasse der Redakteur des Pungolo zu Lothar und dem schottischen Maler. »Wollen wir auf Bertolinis Terrasse zu Abend speisen?«
Die drei fuhren hinauf. Schweigend tranken sie den Champagner, schweigend starrten sie auf das grausamschöne Neapel, das die letzte Abendsonne in leuchtende Gluten tauchte.
Der Redakteur zog ein Notizbuch heraus und schrieb ein paar Zahlen auf.
»Achtzehn = Blut, vier = Taube, einundzwanzig = Jungfrau«, sagte er. »Ein schönes Terno, ich werde es diese Woche im Lotto setzen!«
Als der Hapagdampfer im Hafen von Port-au-Prince lag, stürmte Blaubändchen in den Frühstücksaal. Atemlos lief sie herum um den Tisch.
»Ist Mama noch nicht da?«
Nein, Mama war noch in ihrer Kabine. Aber die Offiziere und Passagiere sprangen alle auf, um Blaubändchen auf den Schoss zu nehmen. Nie war eine Dame an Bord des »Praesident« so gefeiert worden, als ihre sechs lachenden Jahre; aus wessen Tasse Blaubändchen seinen Tee trank, der war glücklich den ganzen Tag. Sie trug immer ein weisses Batistkleidchen und die kleine blaue Schleife küsste ihre blonden Locken. Man fragte sie hundertmal am Tage: »Warum heisst du Blaubändchen?« Dann lachte sie: »Damit man mich wiederfindet, wenn ich verloren gehe!« — Aber sie ging nicht verloren, obwohl sie in jedem fremden Hafen allein umherlief; sie war ein Texaskind und klug wie ein Hündchen.
Keiner am Tisch konnte sie heute erwischen. Sie lief an die Spitze der Tafel und kletterte dem Kapitän auf den Schoss. Da lächelte der starke Friese; Blaubändchen bevorzugte ihn immer und das war das einzige, auf das er stolz war. »Tunken!« sagte Blaubändchen und stippte ihren Zwieback in seine Teetasse.
»Wo warst du denn heute früh schon wieder?« fragte der Kapitän. »O, o!« sagte das Kind, und seine blauen Augen leuchteten noch heller wie das Band in seinem Haar. »Mama muss mitkommen! Ihr müsst alle mitkommen! Wir sind im Feenland!«
»Im Feenland — Haiti?« zweifelte der Kapitän. Blaubändchen lachte. »Ich weiss gar nicht, wie das Land hier heisst — aber das Feenland ist es! Ich hab sie selbst gesehen, die wunderschönen Ungeheuer, sie liegen alle beisammen auf der Brücke am Marktplatz. Eines hat Hände so gross wie eine Kuh und das neben ihm einen Kopf wie zwei Kühe! Und eines hat eine Schuppenhaut wie ein Krokodil — o, sie sind noch schöner und wundervoller wie in meinem Märchenbuche! — Willst du mitkommen, Kapitän?«
Dann sprang sie auf die schöne Frau zu, die eben in den Saal trat. »Mama, schnell, trink deinen Tee! Schnell, schnell! Du musst mitkommen Mama: wir sind im Feenlande!«
Alle gingen mit, sogar der erste Ingenieur. Er hatte gar keine Zeit und war nicht einmal zum Frühstück erschienen; irgend etwas stimmte nicht in seiner Maschine und das musste er in Ordnung bringen, so lange man im Hafen lag. Aber Blaubändchen mochte ihn gut leiden, weil er so hübsche Schnitzarbeiten machte aus Schildkrot. Und deshalb musste er mitkommen, denn Blaubändchen führte das Kommando an Bord. »Ich werde eben die Nacht durcharbeiten«, sagte er zu dem Kapitän. Blaubändchen hörte es und nickte ernst: »Ja, das kannst du tun. Dann schlafe ich doch.«
Blaubändchen führte und sie eilten durch die schmutzigen Hafengassen, überall steckten die Nigger neugierige Fratzen aus Fenster und Türen. Sie sprangen über die breiten Gossen und Blaubändchen lachte vergnügt, als der Doktor fehl trat und das schmutzige Wasser ihm weit hinauf auf den weissen Anzug spritzte. Sie schritten weiter, zwischen den elenden Buden des Marktes, durch einen ohrzerreissenden Lärm kreischender Negerweiber.
»Seht, seht, da sind sie! O die süssen Ungeheuer!« Blaubändchen riss sich los von ihrer Mutter Hand, stürmte hinauf zu der kleinen Steinbrücke, die über den vertrockneten Bach führt. »Kommt alle, kommt schnell, seht die Wundergeschöpfe, die herrlichen Ungeheuer!« Sie klatschte vor Lust in die Hände und sprang mit schnellen Schritten durch den heissen Staub.
— — Da lagen die Bettler; sie stellten ihre entsetzlichen Krankheiten hier zur Schau. Der Neger geht achtlos vorüber, aber kein Fremder kann an ihnen vorbei, ohne tief in die Tasche zu greifen. Das wissen sie wohl. Und sie schätzen ihn ein: der, der zurückprallt, bei ihrem furchtbaren Anblick, wird schon einen Quarter geben und die Dame, die seekrank wird, wenigstens einen Dollar.
»O schau nur, Mama, den da mit der Schuppenhaut! Ist er nicht schön?«
Sie zeigte auf einen Nigger, dem eine grässliche fressende Flechte den ganzen Leib entstellt hatte. Grünlichgelb sah er aus und der verharschte Schürf hing wirklich in dreieckigen Schuppen über seiner Haut.
»Und der da, Kapitän, sieh doch, der da! O wie lustig ist er anzuschauen! Er hat einen Büffelkopf und die Pelzmütze ist ihm gleich festgewachsen!« Blaubändchen klappte mit ihrem Sonnenschirm einem riesigen Schwarzen auf den Kopf. Er litt an einer entsetzlichen Elephantiasis und sein Kopf war angeschwollen wie ein Riesenkürbis. Dazu waren die Wollhaare verfilzt, dicke, lange Lappen hingen von allen Seiten herunter. Der Kapitän suchte die Kleine von ihm abzuziehen, aber sie zerrte ihn, zitternd vor Lust, zu einem andern hin.
»O lieber Kapitän, hast du je solche Hände gesehen? Sage doch, sind sie nicht wunder — wunderschön?« — Blaubändchen strahlte vor Begeisterung, sie beugte sich tief zu dem Bettler hinab, dessen beide Hände die Elephantiasis zu ungeheuerlichen Formen hatte anschwellen lassen. »Mama, Mama, schau nur: seine Finger sind viel dicker und länger als mein ganzer Arm! O Mama, wenn ich doch auch solch schöne Hände haben könnte!« Und sie legte ihr Händchen in die weit ausgestreckte Hand des Niggers, wie ein kleines, weisses Mäuschen huschte es auf der ungeheuren braunen Fläche.
Die schöne Frau schrie hell auf, in tiefer Ohnmacht fiel sie in die Arme des Ingenieurs. Alle beschäftigten sich um sie, der Doktor füllte sein Taschentuch mit Eau de Cologne und legte es ihr auf die Stirne. Aber Blaubändchen suchte in den Taschen der Mutter, nahm das Riechfläschchen heraus und hielt es ihr dicht unter die Nase. Sie kniete am Boden, und grosse Tränen tropften aus den blauen Augen und netzten der Mutter Gesicht.
»Mama, liebe, süsse Mama, bitte werde wieder wach! Bitte, bitte, bitte, Mama! O werde rasch wieder wach, liebe Mama, dann will ich dir noch so viele von den wunderschönen Geschöpfen zeigen! Nein, du darfst jetzt nicht schlafen, Mama: wir sind ja im Feenland!«
Den Fischen, den Raubtieren und Vögeln ist es gestattet, dass eines das andere fresse, denn keine Gerechtigkeit ist über ihnen. Den Menschen aber gab Gott die Gerechtigkeit — —
—Isidorus Hisp, Orig. seu etym. libr. XX.
»Glauben Sie mir, Herr Assessor«, sagte der Staatsanwalt, »der Jurist, der nicht nach einer, sagen wir zwanzigjährigen Praxis, zu der absoluten Überzeugung kommt, dass jedes, aber auch jedes einzelne Strafurteil in irgend einer Beziehung schmählich ungerecht ist, ist ein Trottel! Jeder von uns weiss, dass das Strafrecht das reaktionärste Ding ist, das es gibt, dass drei Viertel der Paragraphen aller Strafgesetzbücher der Welt schon am Tage ihres Inkrafttretens nicht mehr zu ihrer Zeit passen. Mümmelgreise am Tage ihrer Geburt, würde mein Aktuar sagen, der bekanntlich der beste Karnevalsschwätzer unserer Stadt ist!«
»Sie sind ja der reine Anarchist!« lachte der Landgerichtspräsident. »Prost, Herr Staatsanwalt.«
»Prosit!« antwortete dieser. »Anarchist? — Nun ja — wenigstens unter uns — am Juristenstammtische. Und auch da würde ich mir nicht den Schnabel verbrennen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass alle die Herren und besonders Sie, Herr Präsident, meine Ansichten vollkommen teilen.«
»Na, man arbeitet in Berlin ja augenblicklich wieder an einer verbesserten und wahrscheinlich vermehrten Neuausgabe unseres Strafgesetzbuches,« lachte der Präsident. »Da sollten Sie eine Denkschrift verfassen und der Kommission unterbreiten. Vielleicht bekommen wir dann wirklich was Vernünftiges.«
»Sie weichen mir aus,« erwiderte der Staatsanwalt, »weil Sie mir zustimmen müssten! — Eine Denkschrift? — Was käme dabei heraus? Weder ich noch irgend ein anderer kann da etwas ändern. Kleine Verbesserungen könnten wir bringen, ein paar ganz dumme Paragraphen hinauswerfen, in der Hauptsache aber ist jede Verbesserung unmöglich. Das Strafrecht bedingt ja in sich selbst die unerhörteste Ungerechtigkeit.«
»Na erlauben Sie mal!« rief der Präsident.
»Ich will Ihnen Ihre eigenen Worte wiedergeben«, fuhr der Staatsanwalt unbeirrt fort. »Sie erinnern sich, dass der Bankier, den wir neulich wegen betrügerischen Bankrotts zu vier Jahren Zuchthaus verurteilen mussten, bei der Verkündung des Urteils in die Worte ausbrach: ›Das überlebe ich nicht!‹ Man brauchte ihn nur anzusehen, um zu wissen, dass er recht hatte, dass er die Anstalt nie lebend verlassen würde.
»In der darauffolgenden Sache verurteilten wir einen Schiffsheizer wegen Notzucht zu derselben Strafe, der Kerl sagte ganz vergnügt: ›Danke, Herr Gerichtshof, ick nehme die Strafe an; is nich so schlimm in die Pension!‹ — Da sagten Sie zu mir, Herr Präsident: ›Das ist doch keine Gerechtigkeit! Was dem einen ein langsamer qualvoller Tod ist, ist dem andern fast ein Vergnügen! Es ist ein Skandal!‹ War es nicht so?«
»Gewiss!« antwortete der Präsident, »und ich glaube, dass alle im Saale Anwesenden diese Ansicht teilten.«
»Das glaube ich auch,« bekräftigte der Staatsanwalt. »Es ist eben ein kleines Beispiel von der ewigen Ungerechtigkeit aller Strafen. Sie wollen noch berücksichtigen, dass wir in beiden Fällen, ich als Vertreter der Staatsanwaltschaft sowohl, wie die Herren Richter, uns haben beeinflussen lassen, wie wir uns ja — — hier können wir doch ehrlich sein — — in jedem einzelnen Falle so lange beeinflussen lassen, bis wir völlig verknöchert sind, bis wir willenlose Maschinen, lebendige Paragraphen geworden sind. — Wir haben bei dem Bankier, in dessen gastfreiem Hause wir verkehrten, den wir in anderer Beziehung schätzten und achteten, Milde angewandt: weniger wie vier Jahre Zuchthaus konnten wir für sein Verbrechen, das Hunderte von kleinen Existenzen ruinierte, unmöglich geben. Auf der andern Seite hat uns das freche, herausfordernde Betragen des Heizers vom ersten Augenblick an gereizt, bei einem andern hätten wir im gleichen Falle kaum die Hälfte gegeben. Und trotzdem ist der Bankier ungleich härter bestraft worden! — Was ist für den Mann aus dem Volke eine kleine Gefängnisstrafe wegen Diebstahls! Ein Nichts, er sitzt sie ab und vergisst sie am Tage darauf. Der Rechtsanwalt aber, der Beamte, der wegen irgendeiner kleinen Depotunterschlagung auch nur einen Tag brummen muss, ist für sein Leben verloren, er wird aus seinem Stande ausgestossen und ist sozial gerichtet. Ist das Gerechtigkeit? Und nun nehmen Sie ein noch krasseres Beispiel. Was ist die Zuchthausstrafe für einen Mann von der universalen Bildung, von der vielleicht überraffinierten Kultur Oskar Wildes? — Ob er zu Recht oder zu Unrecht verurteilt wurde, ob der famose Paragraph ins Mittelalter gehört oder nicht, ist ganz gleichgültig, sicher ist, dass dieselbe Strafe für ihn tausendfach härter war als für jeden anderen! Alles moderne Strafrecht ist auf dem Prinzip einer allgemeinen Gleichheit aufgebaut — — die wir nicht haben, vielleicht nie haben werden! Und deshalb muss, unter allen Umständen, fast jedes einzelne Urteil ein ungerechtes sein. Die Themis ist die Göttin der Ungerechtigkeit, und wir, meine Herren, sind ihre Diener!«
»Ich verstehe nicht, Herr Staatsanwalt,« bemerkte der kleine Landrichter, »warum Sie mit diesen Ansichten es nicht vorziehen, der Dame Themis den Rücken zu wenden!«
»Und doch sind die Gründe sehr einfach,« erwiderte jener, »ich bin nicht unabhängig, ich habe eine Familie. Glauben Sie mir, dass nur dieses recht mässige Gehalt, auf das wir alle schimpfen, die grosse Mehrzahl von uns am Richterstuhle fesselt, wenn wir einmal zur Einsicht gekommen sind! — — Ausserdem würde ich draussen auch auf nichts anderes stossen; unser ganzes gesellschaftliches System ist ja auf Ungerechtigkeit aufgebaut, das ist die Basis.«
»Zugegeben, dass es so wäre,« sagte der Präsident, »so sagen Sie doch selbst, dass eine Änderung unmöglich ist! — Warum also eine schmerzliche Wunde berühren, die wir nicht heilen können?«
»Eine schmerzliche Wunde — ja, aber es ist eine Art wollüstiger Schmerz!« antwortete der Staatsanwalt. — »Nach jedem Urteil empfinde ich einen ekelhaften, bitteren Geschmack im Munde, und dass es Ihnen ebenso geht, Herr Präsident, beweist Ihre Äusserung, die ich Ihnen soeben wiedergegeben habe. — Ich fühle mich als eine Maschine, als ein Sklave elender Druckzeilen, da will ich wenigstens draussen das Recht haben, einmal denken zu dürfen — so beim Biere, wissen Sie!«
Er setzte den Krug an die Lippen und leerte ihn. Dann fuhr er nachdenklich fort:
»Sehen Sie, meine Herren, am nächsten Dienstag habe ich wieder einer Hinrichtung beizuwohnen. Mir graut vor dem Gedanken — —«
Der Referendar streckte den Kopf vor.
»Ach, Herr Staatsanwalt,« unterbrach er, »wollen Sie mich nicht mitnehmen? Ich möchte so schrecklich gern eine Hinrichtung sehen. Bitte!«
Der Staatsanwalt sah ihn bitter lächelnd an.
»Natürlich!« sagte er. »Natürlich! So habe ich auch das erstemal gebettelt! Ich werde Ihnen abraten, und Sie werden mit dem Kopf schütteln. Und wenn ich's Ihnen abschlage, wird Sie nach Jahr und Tag ein anderer Kollege mitnehmen. Also kommen Sie nur, ich verspreche Ihnen, dass Sie sich schämen werden, wie nie in Ihrem Leben.«
»Danke!« sagte der Referendar und hob sein Glas. »Danke Ihnen sehr! Darf ich mir erlauben, Herr Staatsanwalt?« Der Staatsanwalt hörte nicht, er folgte seinem trüben Gedankengange.
»Wissen Sie,« wandte er sich an den Präsidenten, »das ist das schlimmste: wenn das Verbrechen selbst, das erbärmlichste, niederträchtigste Verbrechen, uns zum Bewusstsein bringt, dass es noch höher, oh, viel höher steht, als wir scheinheiligen Diener der Gerechtigkeit! Wenn es uns in seiner bodenlosen Verruchtheit eine Grösse zeigt, die all unseren Formelkram zu Fetzen weht, wenn es wie mit Feuer den eisernen Panzer all der Gesetze und Paragraphen von der Brust wegschmilzt, dass wir wie nackte Würmchen vor ihm im Staube kriechen.«
»Ich bin neugierig«, sagte der Präsident.
»Oh, ich will Ihnen einen solchen Fall erzählen«, fuhr der Staatsanwalt fort. »Es ist der tiefste Eindruck, den ich in meinem Leben empfangen habe. Es war vor vier Jahren, am 17. November, als ich in Saarbrücken der Guillotinierung des Raubmörders Koschian beiwohnte — Marie, noch einen Krug!« unterbrach er sich.
Die dicke Kellnerin war schon herangekommen, sie wurde aufmerksam, als er von Guillotine und Raubmörder sprach. »Erzählen Sie!« drängte der Referendar.
»Warten Sie nur!« rief der Staatsanwalt. Er hob sein Glas und sagte: »Ich trinke meine Blume dem Andenken dieses erbärmlichsten aller Verbrecher, dieses Pestauswurfes der Menschheit, der doch — — vielleicht — — ein Held war.«
Langsam setzte er in dem Schweigen den Krug auf den Tisch.
»Mit Ausnahme von Ihnen, Herr Referendar,« fuhr er fort, »haben Sie gewiss alle, meine Herren, einmal einem solchen traurigen Schauspiele zugeschaut, Sie wissen, wie sich dabei die Person benimmt, die die Hauptrolle zu spielen hat. So ein Mörder, wie ihn z. B. der ausgezeichnete Montmartredichter Aristide Bruant in seinem Liede von La Roquette, dem Pariser Richtplatze, besingt, ist eine sehr seltene Ausnahme. Der Dichter lässt da den Verbrecher seinen Monolog schliessen: ›Mit festen Schritten will ich gehen — Zur Guillotine — Und keiner soll mich zittern sehen — Vor der Maschine — Verdammt, wenn mir der Nacken zuckt — Steckt er im Brette — Bevor ich in den Sack gespuckt — Auf La Roquette.‹ — Das war ein sehr löblicher Vorsatz des Mörders, aber ich fürchte, es kam ganz anders. Ich fürchte, er machte es gerade so wie sein Berliner Kollege, den Hans Hyan in seiner ›Letzten Nacht‹ sein Selbstgespräch also endigen lässt: ›Wie kleen der Jas uf eenmal brennt — Der Morjen kraucht schon durch die Jitter — Na, Maxe, nun man nich jeflennt — Jetzt heesst et Mut, un keen Jezitter! — Se kommen ... Wat? Is denn schon Zeit? — Na ja, dat is vor die so'n Futter! — Wat? ... Ick? ... Jawoll, ick bin bereit! — Herr Paster ... Meine Mutter! — Mutter!!‹ — Dieses entsetzliche Geschrei: Mutter! Mutter!, das dem, der es einmal gehört, nie wieder aus den Ohren will, das ist das Charakteristische! Es gibt Ausnahmen, freilich, aber sie sind dünn gesät; lesen Sie die Memoiren des Scharfrichters Krauts, so werden Sie sehen, dass unter seinen hundertundsechsundfünfzig Delinquenten sich nur ein einziger ›männlich‹ betragen hat, nämlich der Kaiserattentäter Hödel.«
»Was machte er?« fragte der Referendar.
»Interessiert Sie das so?« fuhr der Staatsanwalt fort. »Nun, er sprach vorher mit seinem Partner, eben dem Scharfrichter Krauts, und liess sich eingehend von ihm die ganze Geschichte erklären. Er versprach ihm, seine Rolle ausgezeichnet zu spielen, und bat, ihm nicht die Hände fesseln zu wollen. Krauts schlug diese Bitte ab, obwohl er sie, wie die Folge lehrte, recht gut hätte gewähren können. Denn Hödel kniete ruhig nieder, legte seinen Kopf auf den Block, duckte ihn ein wenig, blinzelte mit dem linken Auge hinauf und fragte: ›Ist es so gut, Herr Scharfrichter?‹ — ›Ein bisschen mehr nach vorne‹, erwiderte dieser. Der Delinquent schob seinen Kopf etwas nach vorne und fragte wieder: ›So richtig?‹ — Aber diesmal erwiderte sein Partner nicht mehr. Es war richtig so. Das quecksilbergefüllte Richtbeil fiel nieder, und der Kopf, der noch eine Antwort erwartete, sprang in den Sack. Krauts gesteht, dass er aus Angst zuschlug, hätte er dem Delinquenten noch einmal geantwortet, sagt er, so hätte er nicht mehr die Kraft gehabt, seine Pflicht als Nachrichter zu erfüllen.
Hier haben wir also eine Ausnahme, aber wir brauchen nur die Akten dieses hirnverbrannten, zweck- und sinnlosen Attentates zu lesen, um zu wissen, dass wir es bei Hödel nicht mit einem normalen Menschen zu tun hatten. Sein Benehmen von Anfang bis zu Ende war ein unnatürliches.«
»Welches ist denn das natürliche Benehmen eines Menschen bei seiner Hinrichtung?« fragte der blonde Assessor.
»Das will ich Ihnen sagen«, erwiderte der Staatsanwalt. »Vor einigen Jahren wohnte ich in Dortmund der Hinrichtung einer Frau bei, die mit Hilfe ihres Geliebten ihren Mann und drei Kinder vergiftet hatte. Ich kannte sie von dem Prozesse her, hatte ich doch selbst die Anklage gegen sie vertreten. Es war ein rohes, unglaublich gefühlloses Weib, und ich konnte mir in meiner Rede einen Vergleich mit der Medea nicht verkneifen — zumal ich drei Gymnasiallehrer unter den Geschworenen hatte. Nun ist in Dortmund der Hof, auf dem die Hinrichtungen vollstreckt werden, in dem neuen Gefängnis, etwas ausserhalb der Stadt, während die Mörderin in der Stadt in dem alten Gefängnis interniert war. Während ihrer Überführung um fünf Uhr morgens schrie sie in ihrem Wagen wie eine Besessene, ich glaube, halb Dortmund ist von diesem fürchterlichen: ›Mama! Mama!‹ aus dem Schlafe geweckt worden. Ich folgte mit dem Gerichtsarzte in einem zweiten Wagen; wir stopften uns die Finger in die Ohren, was natürlich nichts nützte. Die Fahrt schien uns eine Ewigkeit; als wir endlich ausstiegen, wurde der gute Doktor seekrank — — na, ich war auch nicht weit davon entfernt, um die Wahrheit zu sagen!
Da gelang es dem Weibe, während sie auf das Schafott geführt wurde, die auf dem Rücken gefesselten Hände zu lösen und damit den unbedeckten Hals zu umschlingen. Sie wusste — da schlägt man dir durch; diese gefährdete Stelle also wollte sie schützen. Die drei Henkersknechte, herkulische Kerle, ungeschlachte Metzgergesellen, sprangen auf sie zu, rissen ihr die Hände herunter. Aber sowie sie eine gelöst hatten, brachte das Weib mit einer verzweifelten Kraft die andere wieder hinten an den Hals. Wie Krallen gruben sich ihre Nägel tief ins Fleisch, sie fühlte: solange sie da festhielt, war ihr Leben gerettet. Dieser schmähliche Kampf dauerte fünf Minuten, und dazwischen erschütterte die Morgenluft ihr ohrzerreissendes Geschrei: ›Mama! Mama! Mama!‹
Schliesslich riss einem der Knechte, dem sie den Finger halb durchgebissen hatte — — der Doktor hat ihn nachher amputieren müssen — die Geduld. Er hob die Faust und liess sie krachend auf den Schädel des Weibes niedersausen. Sie sank zusammen, betäubt auf einen Augenblick; man benutzte natürlich die Gelegenheit.
— Sehen Sie, Herr Assessor, das Benehmen dieses Weibes — — — das ist das natürliche!«
»Pfui Teufel!« sagte der Assessor und trank sein Bier aus.
»Gehen Sie doch,« rief ihm der Staatsanwalt zu, »ich bin überzeugt, Sie würdens nicht anders machen — und ich auch nicht! Sie waren doch zusammen mit mir bei der letzten Hinrichtung — wie war's denn da? Genau so wie bei denen, die die übrigen Herren anzusehen das Unglück hatten, und wie bei den vierzehn oder fünfzehn, denen beizuwohnen mich die Pflicht zwang. Vor Angst Halbtote schleppte man in den Hof, sie gingen nicht, man trug sie die Stufen hinauf zur Guillotine oder zum Richtblock. Immer dasselbe — selten eine Abweichung! Und immer wieder der verzweifelte Ruf nach der Mutter, als ob die hier helfen könne. Ich habe einen Kerl, der seine Mutter selbst totgeschlagen hatte, in dieser letzten Viertelstunde wie ein Wahnsinniger seine Mutter um Hilfe anflehen hören! — Und das heisst: nicht mit erwachsenen, denkenden Menschen hat es der Henker zu tun, sondern mit Kindern, mit schwachen, hilfeschreienden Kindern!«
»Bei alledem«, warf der Landgerichtspräsident ein, »sind Sie von dem, worauf Sie hinauswollten, völlig abgekommen.«
»Geben Sie dem Referendar die Schuld, Herr Präsident,« erwiderte der Staatsanwalt, »er wollte so gerne von Hödel hören. Aber Sie haben recht, ich werde mich beeilen!«
Er leerte seinen Krug und fuhr fort:
»Sie werden mir zugeben, meine Herren, dass der Eindruck einer Hinrichtung auf alle Beteiligten ein entsetzlicher ist. Wir können uns hundertmal vorreden: dem Kerl geschieht ganz recht; es ist ein Segen für die Menschheit, dass man ihm den Kopf herunterschlägt und derlei schöne Phrasen, wir werden doch nie darüber hinauskommen, dass wir einem völlig wehrlosen Menschen das Leben rauben. Dieses ›Mutter, Mutter‹-Schreien, das uns an die eigene Kindheit, an die eigene Mutter erinnert, wird nie verfehlen, in uns das Gefühl zu erwecken, dass wir eine feige, erbärmliche Handlung begehen. Und alles, was wir dagegen einwenden, erscheint uns, in der Viertelstunde wenigstens, als schlechte, inhaltlose Redensarten. — Ist das richtig?«
»Ich für mein Teil teile diese Ansicht vollkommen,« bestätigte der Landgerichtspräsident.
»Nun gut,« begann der Staatsanwalt von neuem, »ich glaube, dass auch die anderen Herren diese Überzeugung haben. Wollen Sie sich daran während meiner Erzählung erinnern!
Vor vier Jahren also hatte ich den Raubmörder Koschian dem Nachrichter zu übergeben. Es war ein Bursche, der trotz seiner neunzehn Jahre bereits ein paar Dutzend Vorstrafen hatte, und sein Verbrechen war eines der rohesten und gemeinsten, die mir in meiner Praxis vorgekommen sind. Er wanderte durch die Eifel, traf im Hochwald einen anderen, einundsiebzig Jahre alten Landstreicher und erschlug ihn mit dem Knüppel, um ihn seiner Barschaft von sieben Pfennigen zu berauben. Das ist nichts Aussergewöhnliches; aber ein Bild von der unglaublichen Rohheit dieser Bestie können Sie sich machen, wenn ich Ihnen sage, dass er drei Tage nach der Tat, aus jenem merkwürdigen Gefühl heraus, das die Mörder so häufig wieder zu ihren Opfern zurücktreibt, denselben einsamen Weg zog und den Alten noch lebend und leise röchelnd in dem Strassengraben fand, in den er ihn geworfen. Jeder Mensch, der nur ein Fünkchen Gefühl im Leibe hat, wäre bei diesem Anblick entsetzt geflohen, von Furien gepeitscht, wie mein Aktuar sagt! Koschian dachte nicht daran, er nahm wieder seinen Knüppel und hieb auf des Alten harten Schädel ein. Dann blieb er noch einen halben Tag lang in der Nähe seines Opfers, um sich zu vergewissern, dass er diesmal ganze Arbeit getan, durchsuchte nochmals die Taschen — vergeblich — und ging ruhig davon.
Nach einigen Tagen wurde er festgenommen, leugnete erst, bequemte sich dann aber, da alle Indizien gegen ihn sprachen, zu einem zynischen Geständnis, dem wir diese Einzelheiten verdanken. Na, die kurze Verhandlung endete natürlich mit einem Todesurteil. — Auch machte die Krone von ihrem Begnadigungsrecht keinen Gebrauch. So hatte ich denn in kurzer Zeit die Pflicht, mich wieder einmal zu einem solchen letzten Gange zu rüsten.
Es war ein dunkler, nebelfeuchter Novembermorgen. Auf punkt acht Uhr war die Hinrichtung festgesetzt. Als ich in Gesellschaft des Arztes auf dem Gefängnishofe eintraf, war der Scharfrichter Reindl, der abends vorher mit der Guillotine aus Köln eingetroffen war, damit beschäftigt, seinen Gesellen die letzten Anweisungen zu geben. Der Henker, wie gewöhnlich in Frack und weisser Binde, prüfte sorgfältig, während er mühsam die weissen Glacéhandschuhe über die roten Fleischerhände zog, das Holzgerüst und die Maschine, liess die Leute noch ein paar Nägel einschlagen, den Sack ein wenig nach vorne schieben und strich leise mit dem Finger über die Schneide des Messers. — Wie bei jeder Hinrichtung, so fiel mir auch jetzt das alte Revolutionsliedchen ein, das die Bastillenstürmer auf den Erfinder der Mordmaschine, den Pariser Arzt Guillotin, sangen; gegen meinen Willen murmelten meine Lippen die Worte:
Guillotin,
Médecin Politique,
S'imagine un beau matin
Que pendre est trop inhumain
Et peu patriotique.
Aussitôt
Il lui faut
Un supplice,
Qui sans corde ni couteau
Lui fait du bourreau
L'office.
Ich wurde unterbrochen, der alte Gefängnisdirektor kam zu mir mit der Meldung, dass alles bereit sei. Ich gab also Befehl, den Delinquenten herzubringen, und kurz darauf öffnete sich die Hoftür. Der Mörder, die Hände auf dem Rücken gefesselt, wurde von einem halben Dutzend Gefängniswärter herausgeführt, begleitet von dem Geistlichen, dessen Zuspruch er übrigens mit unflätigen Redensarten zurückgewiesen hatte. Er schlenderte ganz gemütlich daher, mit demselben frechen, hochfahrenden Gesicht, das er auch bei der Verhandlung zur Schau getragen. Prüfend schaute er auf das Gerüst, dann sah er scharf auf mich. Und als ob er meine Gedanken erraten habe, spitzte er die Lippen und pfiff laut: Tá, tá, tá — Tí, tí, tí — Tâ, tâ, tâ! Mich überlief eine Gänsehaut; mag der Himmel wissen, woher der Bursche diese Melodie hatte! Man führte ihn die Stufen zum Schafott hinauf; ich begann, wie gewöhnlich, das Urteil zu verlesen: Im Namen des Königs! usw. Das dauerte eine Weile, und während dieser ganzen Zeit hörte ich ihn immer das Guillotineliedchen pfeifen, diese Melodie, die mir selbst im Kopfe herumspukte: Tá, tá, tá — — tí, tí, tí — Tâ, tâ, tâ.
Endlich war ich zu Ende, ich hob den Kopf und richtete an den Verbrecher die übliche Frage, ob er noch etwas zu bemerken habe, eine Frage, auf die man keine Antwort erwartet und auf die man das: ›Dann übergebe ich Sie dem Nachrichter!‹ im Augenblick folgen lässt. Das ist der grauenvolle Moment, diese letzte Sekunde vor dem gewaltsamen Tode, die denen, die diesen Tod geben und ansehen müssen, nicht weniger qualvoll ist, als dem, der ihn zu erdulden hat. Dieser Moment, der die Lungen zusammenpresst und das Blut erstarren macht, der sich wie ein Alp um die Kehle schnürt und einen ekeln Blutgeschmack auf die Zunge streicht.
Da sah ich, wie der Mörder einen letzten Blick umherwarf über die kleine Versammlung, auf den Geistlichen, den Arzt, auf mich und die Leute des Gefängnisses. Er lachte schrill auf, und mit unsagbar verächtlichem Tone rief er:
»Ihr könnt mich alle im — — —«
Die Henkersknechte warfen sich auf ihn, wie gewöhnlich, rissen ihn im Augenblicke herunter, schlangen die Riemen herum und schoben ihn vor. Der Herr Scharfrichter drückte auf den Knopf, das Fallbeil sauste herunter, und der Kopf sprang in den Sack. Das alles geht ja so ungeheuer schnell.
Ich hörte neben mir einen tiefen Seufzer, aus dem es wie Erlösung klang. Es war der Gefängnisgeistliche, ein sensibler, schwachnerviger Mensch, der sonst nach jeder Hinrichtung acht Tage lang krank zu sein pflegte.
»Donnerwetter,« rief der alte Direktor, »seit bald dreissig Jahren leite ich diese Anstalt, aber das ist das erstemal, dass ich nach solch einer Gelegenheit keinen Schnaps zu trinken brauche!«
Als mir am anderen Tage der Arzt sein Protokoll für die Akten brachte, sagte er zu mir:
»Wissen Sie, Herr Staatsanwalt, ich habe darüber nachgedacht: der Kerl war Herr der Situation!«
Ja, meine Herren, das war er! Wir alle waren ihm in dem Augenblicke dankbar wegen dieses befreienden Wortes und sind es, gegen unseren Willen, heute noch, wenn wir daran denken. Das aber ist das Entsetzliche, dass wir diese Befreiung von einer drückenden Seelenqual einem furchtbaren Mörder verdanken mussten und dem gemeinsten, rohesten Pöbelausdruck, den die Sprachen der Völker kennen. Dass wir diese Befreiung der Erkenntnis verdanken, dass der niedrigste, erbärmlichste Verbrecher sich mit diesem widerlichen Schimpfworte noch hoch hinaushob über uns — — seine tugendhaften Richter, die Repräsentanten des Staates, der Kirche, der Wissenschaft, des Rechtes und alles dessen, wofür wir leben und arbeiten!«
Mir ist min êrriu rede
enmittenzwei geslagen.
—Walter v. d. Vogelweide.
Es war einmal ein junger Mann, der die Welt mit etwas anderen Augen ansah als die, die mit ihm lebten. Er träumte am Mittag und Hess um Mitternacht Gedanken hinausflattern, die die sehr närrisch fanden, die um ihn herum sassen. Sie nannten ihn einen buttergelben Narren; er aber glaubte, dass er ein Dichter sei.
Wenn sie über seine Verse lachten, so lachte er mit. Da merkten sie nicht, Wie weh es ihm tat.
Es tat ihm so weh, dass er einmal hinausging an den Rhein, der die lehmigen Märzfluten klatschend gegen den alten Zoll warf. Es war wohl nur ein Zufall, dass er damals nicht hineinsprang. Wohl nur, weil er irgendeinen Freund traf, der ihm sagte:
»Komm mit ins Weinhaus!«
Im Weinhaus sass er und trank mit dem Freunde Josephshöfer erst und Maximi Grünhäuser und Forster Kirchenstück hernach. Dann fielen ihm ein paar Zeilen ein, die schrieb er mit Bleistift auf die Weinkarte. Als aber die Herren Kollegen kamen, die Referendare und Assessoren, der Staatsanwalt und die beiden Landrichter, las er sie ihnen vor:
»... im Karpfenteiche
Schwamm einmal eine bläulich bleiche
Und schleimig weiche Wasserleiche.«
Er erzählte, wie die Karpfen sich über die Leiche unterhalten, sich in Vermutungen ergehen; wie der eine Gutes, der andere Schlechtes von ihr sagt. Dann fuhr er fort:
»Jedoch ein alter, hundertjähriger Knabe
Erfreute sich der guten Gottesgabe,
Er sprach kein Wort. Er frass und frass,
Dass er die Welt darob vergass, Und dacht':
›Nicht immer gibts im Teiche
Solch eine schöne, schleimig weiche
Und bläulich bleiche Wasserleiche‹.«
Da hättet ihr die Herren Kollegen sehen sollen! Die Referendare und die Assessoren, den Staatsanwalt und die beiden Landrichter!
»Mensch!« sagte der Staatsanwalt. »Nehmen Sie's mir nicht übel, wenn ich sie immer verulkt habe! Ein Genie sind Sie, Sie werden noch mal Karriere machen!«
»Jrossartig,« rief der blonde Landrichter, »jrossartig! Das macht die juristische Bildung! Aus solchem Holze werden Joethes geschnitzt!«
»Habemus poetam!« jubelte der kugelrunde Referendar. Und alle sagten ihm, dass er ein Dichter sei, ein echter Dichter, ein eigenartiger Dichter, ein Dichter »fit« für unsere Zeit und »up to date«.
Der junge Mann lachte und stiess mit ihnen an, weil er glaubte, dass sie Scherz trieben. Als er aber sah, dass es wirklich ihr Ernst war, ging er hinaus aus dem Weinhause. Er war im Augenblicke wieder nüchtern, so nüchtern, dass er beinahe wieder zum Rhein gegangen wäre. So also war es: wenn er sich als Dichter fühlte, so schalten sie ihn einen Narren; nun, wo er den Narren spielte, erklärten sie ihn zum Dichter.
— Natürlich behielt der Staatsanwalt recht: der junge Mann machte Karriere. Auf Parkettböden und Podien, auf grossen und kleinen Brettern, überall musste er seine Verse hersagen. Dann zog er den Mund rund wie ein Fischmaul, schmatzte, wie er sich so dachte, dass Karpfen schmatzen würden, und begann:
»Im Karpfenteiche
Schwamm einmal eine bläulich bleiche
Und schleimig weiche Wasserleiche.«
Das weiss man ja, dass seine Herren Kollegen nicht zu viel gesagt hatten, die Referendare und Assessoren, die zwei Landrichter und der Staatsanwalt. Das weiss man ja alles, wie sehr man ihn anerkannte und lobte und ihm zujubelte und zuklatschte in allen deutschen Städten. Und dass Schauspieler und Rezitatoren und Vortragsmeister überall sein Gedicht aufgriffen und seinen Ruhm noch mehr verbreiteten. Und dass Komponisten es in Musik setzten und singen liessen und durch Naturlaute das Schmatzen der Karpfen noch mehr zu verinnerlichen trachteten.
Das weiss man ja alles. — —
Der junge Mann dachte: Es ist ganz gut so. Lass sie nur jubeln und klatschen und deine Weinlaunenverse für grosse Poesie ausschreien. Lass sie nur! — Du wirst bekannt werden, überall bekannt, und hernach wirst du leicht dich durchsetzen mit dem, was du kannst. So dachte der junge Mann.
Und deshalb offenbarte er den entzückten Ohren von vielen Tausenden die Geschichte von der bläulich bleichen und schleimig weichen Wasserleiche und sagte keinem Menschen, wie ekelhaft ihm das alles sei. Er biss sich auf die Lippen, machte erst ein liebenswürdiges Gesicht und schnitt dann die Karpfenmaulfratze.
Der junge Mann vergass, dass die höchste Tugend des Deutschen die Treue ist. Und dass er von seinen Dichtern vor allem anderen Treue verlangt: sie sollen immer und immer wieder in den Tönen singen, in denen sie zuerst gesungen, und beileibe nicht anders. Wenn sie etwas anderes singen, so ist das falsch und untreu und verwerflich, und der Deutsche verachtet sie.
Und als dieser junge Mann nun von Asphodelos träumte, und von Orchideen, von gelben Malven und hohen Kastanienkerzen, drehte man ihm den Rücken und lachte ihn aus.
Nicht überall. Die vornehme Welt ist ja so gebildet, von der Kinderstube an. Als er neulich abends in der Ringstrasse nach der Hofopernsängerin und nach dem langlockigen Tondichter vortragen sollte und mit müder Stimme von Blumenseelen sprach, da lachte man nicht. Man klatschte sogar und fand es sehr nett. So gebildet ist man dort. Aber der junge Mann fühlte doch, dass die Herren und Damen sich langweilten, und war gar nicht erstaunt, als einer rief:
»Die Wasserleiche!«
Er wollte nicht; bis die Dame des Hauses auf ihn zutrat:
»Ja, bitte, Herr Doktor, die Wasserleiche!«
Er seufzte, biss sich in die Lippen, schnitt die Karpfenmaulfratze und trug zum dreitausendzweihundertundachtundzwanzigsten Male diese grässliche Geschichte vor. Er erstickte fast daran — —.
Aber die Damen und Herren klatschten und jubelten ihm zu. Da sah er, wie eine alte Dame von ihrem Sessel aufsprang, kurz, heiser schrie, und wieder zurücksank.
Die Herren brachten Kölnisches Wasser und wuschen der Ohnmächtigen Stirn und Schläfen. Aber der junge Mann kniete zu ihren Füssen und küsste ihre Hand; er fühlte: wie seine Mutter liebte er sie.
Wie sie die Augen aufschlug, traf ihn ihr erster Blick. Sie zog ihre Hand fort wie von einem unreinen Tier und schrie:
»Jagt ihn weg!«
Da sprang er auf und lief fort. Hinten in der Ecke des Saales setzte er sich nieder und stützte den Kopf in die Hände. Während sie die alte Dame hinausbegleiteten, die Treppen hinunter zu ihrem Wagen, sass er da: er wusste alles genau, ganz genau vorher, ehe ihm einer nur ein Wort gesagt hatte.
Es war wie eine Erfüllung; er fühlte, dass es einmal so kommen musste.
Und als sie dann zu ihm kamen mit ihrem »Schrecklich!«, »Ganz furchtbar!«, mit ihrem »Tragik des Lebens!« und »Grausamer Zufall!« — — da war er gar nicht erstaunt.
»Ich weiss schon«, sagte er. »Die alte Dame hat vor ein paar Jahren ihren einzigen Sohn verloren; er ertrank im See, und nach Monaten erst fand man die grässlich unkenntliche Leiche. Und sie, die Mutter selbst, musste die Leiche identifizieren —?«
Sie nickten. Da richtete sich der junge Mann auf. Er schrie fast:
»Und um euch Affen einen Spass zu machen, habe ich Narr einer unglücklichen Mutter diesen Schmerz bereitet! So lacht doch! Lacht doch!«
Er schnitt die Karpfenmaulfratze und schmatzte:
»Im Karpfenteiche
Schwamm einmal eine bläulich bleiche
Und schleimig weiche Wasserleiche.«
Aber diesmal lachten sie nicht, sie waren viel zu gebildet dazu.
Vor einer guten Reihe von Jahren sassen wir einmal im Klub zusammen und plauderten über die Art und Weise, wie wohl ein jeder von uns sein Ende finden würde.
»Was mich betrifft, so kann ich auf einen Magenkrebs hoffen«, sagte ich. »Das ist zwar wenig angenehm, ist aber mal eine gute alte Familientradition; voraussichtlich die einzige, der ich treu bleibe.«
»Nun, und dass ich im ehrenvollen Kampfe mit einem Dutzend Milliarden Bazillen über kurz oder lang unterliegen werde, steht auch fest«, meinte Christian, der schon seit einem Jahre die zweite Hälfte seines letzten Lungenflügels spazieren führte.
Und so wenig romantisch wie diese waren die anderen Todesarten, die die übrigen mit mehr oder weniger grosser Bestimmtheit sich prophezeiten. Banale, erbärmliche Todesarten, für die wir eigentlich alle viel zu schade waren.
»Ich gehe am Weibe zugrunde«, sagte der Maler John Hamilton Llewellyn.
»Ach, wirklich?« lachte Dudley.
Der Maler stutzte einen Augenblick, dann fuhr er langsam fort:
»Nein, ich werde an der Kunst zugrunde gehen.«
»Jedenfalls eine angenehme Todesart.«
»Oder auch nicht.«
Natürlich lachten wir ihn aus. Und legten ihm lange Odds, dass er ein sehr schlechter Prophet sei.
Nach fünf Jahren sah ich Trower wieder, der damals auch im Pall-Mall war.
»Wieder einmal in London?« fragte er.
»Seit zwei Tagen.«
Ich fragte ihn, ob er heute abend zum Klub komme. Nein, er habe den ganzen Tag am Gericht zu tun. Ich glaube, Trower ist so etwas wie Staatsanwalt, wenn er nicht im Klub ist. — Ob ich bei ihm speisen wolle? Natürlich, Trower speist sehr gut.
Um zehn Uhr waren wir mit dem Kaffee fertig, und der Diener trug den Whisky auf. Lang im Ledersessel und die Füsse am Kamin. Sagt Trower:
»Du wirst sehr wenige von damals noch im Klub finden, sehr wenige.«
»Warum?«
»Die Jungens haben es überaus eilig gehabt, ihre Prophezeiungen wahr zu machen. Erinnerst du dich des Novemberabends, als wir über unsere Todesarten sprachen?«
»Freilich! Tags darauf reiste ich von London weg, um jetzt erst wieder einmal die Nase hineinzustecken.«
»Nun, Christian Breithaupt war der erste; nach einem halben Jahre starb er in Davos.«
»Kunststück! Der hatte leicht Wort halten.«
»Schwerer hatte es schon Dudley von den ›Queens Own‹. Wer hätte damals denken können, dass die je aus London herauskämen? Er erhielt am Spionskop eine Kugel mitten vor die Stirn.«
»Damals glaubte er, er würde an einem Schuss in die Brust sterben. Aber immerhin — das kommt ja auf eins heraus.«
»Wir waren zu acht — — fünf sind schon fort, jeder auf seine Art. Sir Thomas Wimbleton ist der dritte: Lungenentzündung — natürlich. Zum vierten Male. Er konnte eben das Entenjagen nicht lassen, fünf Stunden bis zum Bauch in der Themse. Mag der Teufel wissen, was das für ein Vergnügen ist!«
»Und Bodley?«
»Der lebt noch, du wirst ihn im Klub treffen. Ist gesund und frisch — wie du und ich. — Wie lange noch? Aber Macpherson ist auch tot, Schlagfluss, vor zwei Monaten. Er war fett wie ein Truthahn zu Weihnachten, nur dass es so schnell gehen würde, hätte niemand gedacht. — Fünfunddreissig ist er nur alt geworden, der gute Junge!«
»Bleibt der Maler übrig. Was ist aus ihm geworden?«
»Llewellyn hielt sein Wort besser als einer von uns. Er geht am Weibe zugrunde und an der Kunst.«
»Er geht zugrunde? Wie soll ich das verstehen, Trower?«
»Nun, er ist seit zehn Monaten im Narrenhaus zu Brighton, Abteilung für Unheilbare. Sein junges Modell, wohl zwanzigtausend Jahre alt, löste sich bei seinem heissen Kuss in Wohlgefallen auf. Das fuhr ihm derart ins Gehirn, dass er wahnsinnig wurde.«
»Ich bitte dich, Trower, lass einmal deine Spässe, zumal wenn sie so haarsträubend albern sind wie der da! — Spotte, so viel du willst, über den feisten Macpherson und den bleichen Christian, über den hübschen Dudley und über Wimbletons Wasserjagden, aber lass mir Hamilton in Ruhe! Über Tote mag man lachen, aber nicht über Lebende, die im Irrenhaus sitzen.«
Trower strich langsam die Asche seiner Zigarette ab und mischte sich einen neuen Whisky. Dann nahm er das Eisen und stocherte in den glühenden Scheiten herum. Seine Züge veränderten sich ein wenig, die Unterlippe zog sich noch mehr herunter.
»Ich weiss, der Maler stand dir näher als wir anderen. Das hindert nicht, dass auch du, wenn du seine Geschichte kennst, versuchen wirst, deine Lippen zum Lachen zu zwingen. Es gibt eine Tragik, deren lähmender Wirkung wir uns nur durch Spott entziehen können, und wo ist die Geschichte, die nicht irgendein lächerliches Moment böte? — Wenn wir Germanen erst einmal gallisch zu lächeln gelernt haben, werden wir die erste Rasse der Welt sein; noch mehr als wir es schon sind, würdest du hinzufügen.«
»Komm zu John Hamilton!«
»Seine Geschichte ist kurz das, was ich dir vorhin sagte: eine junge Dame, die er malte und liebte, im holden Alter von wohl zwanzigtausend Jahren, löste sich bei seinem Kuss in Wohlgefallen auf; darüber wurde er wahnsinnig. Das ist alles; wenn du willst, kann ich dir aber auch eine längere Erklärung geben.«
»Bitte! — Du kennst den Fall genau?«
Sehr genau! Genauer, als mir lieb ist. — Ich hatte die amtliche Untersuchung zu führen und hätte mir den Kopf zerbrechen können, ob ich wegen Einbruchdiebstahls, wegen Sachbeschädigung, wegen Leichenschändung oder Gott weiss wegen welcher anderer Delikte noch die Anklage gegen Llewellyn hätte erheben müssen, wenn nicht seine Überführung ins Irrenhaus der Untersuchung ein Ende gemacht hätte.«
»Das wird ja immer merkwürdiger!«
»So merkwürdig, dass du alle Kraft zusammennehmen musst, um es überhaupt zu glauben.«
»So erzähle!«
»John Hamilton Llewellyn arbeitete wohl schon ein halbes Jahr im britischen Museum. Ich glaube, es war Lord Hunstanton, durch dessen Vermittelung er den Auftrag erhielt, die Wandgemälde im dritten Sitzungssaale zu malen. Er ist mit einer Wand kaum fertig geworden, und die Arbeit ist immer noch unvollendet. Man findet eben so leicht niemanden, der ihn ersetzen könnte. Er hatte Talent, Llewellyn, und Phantasie dazu: die war es auch, die ihn ins Narrenhaus brachte.
Zu jener Zeit erhielt das britische Museum eine Sendung von unschätzbarem Werte. Du hast gewiss vor einigen Jahren die Notiz gelesen, die damals alle Zeitungen durchflog und in der ganzen Welt ein berechtigtes Aufsehen erregte. Lamutische Jukagiren hatten in einem Eisspalt der Beresowka im Kolymadistrikt ein ausgewachsenes, fast völlig unversehrtes Mammut gefunden, nur der Rüssel war ein wenig beschädigt; der Gouverneur von Jakutsk hatte sofort darüber lang und breit nach Petersburg berichtet. Auf Veranlassung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften entsandte die Regierung den bekannten Forscher Otto Herz, den Konservator des Zoologischen Museums von St. Petersburg, sowie den Russen Aksakow und den deutschen Präparator Pfitzenmayer nach dem äussersten Nordosten, und es gelang ihnen, nach viermonatiger Reise und zweimonatiger Arbeit den riesigen Eisblock mitsamt dem vorsintflutlichen Dickhäuter unbeschädigt an die Newa zu bringen. Das Mammut ist eines der prächtigsten Zierden des Zarenmuseums, das einzige Stück dieser Art, das unsere Zeit besitzt. — Ich bemerke übrigens, dass diese ganze Gegend voll solcher Riesengeschöpfe steckt, wenn sie auch begreiflicherweise fast alle nur in Bruchstücken vorhanden sind. Die sibirische Sage nennt sie »Mammantu«, das heisst »Erdgräber«, und behauptet, dass sie riesige in der Erde lebende Wühltiere seien, die sterben, sobald sie ans Tageslicht kommen. Die chinesische Elfenbeinindustrie verarbeitet seit Tausenden von Jahren fast ausschliesslich in der Erde gefundene sibirische Mammutstosszähne. Auch in der Lenamündung wurde im Jahre 1799 ein nur wenig versehrtes Mammut gefunden, das sieben Jahre später durch Adams nach Petersburg geschafft wurde, und dessen Bruchstücke durch alle Museen der Welt verstreut sind.
Nun, kurze Zeit nach dieser Expedition erhielt die Verwaltung des britischen Museums einen geheimnisvollen Brief, der sie bewog, sofort den Schreiber nach London kommen zu lassen. Und dieser Schreiber war niemand anders als der famose Aksakow, der sich durch einen genialen Diebstahl einige Millionen verdiente und heute in Paris seine Renten verzehrt. Aksakow hatte nämlich, als er mit seiner Tungusenkarawane das Mammut aus dem sibirischen Eise herausholte, dort einen noch weit wertvolleren Fund gemacht. Davon hatte er seiner Regierung kein Wörtchen gesagt, er liess seinen Schatz vielmehr ruhig dort liegen, wo er schon viele tausend Jahre lag, und pilgerte seelenruhig mit seinem Dickhäuter nach Petersburg zurück. Der Mann hatte wirklich eine Heidenarbeit mit seiner Expedition gehabt und bekam einen Wutanfall nach dem andern, als, nachdem der Zar das seltene Tier im Museum besichtigt hatte, seine Vorgesetzten, der Konservator und der Präparator des Museums, Deutsche natürlich, eine tüchtige Belohnung und hohe Orden erhielten, während er sich mit der vierten Klasse desselben Ordens begnügen musste. — Wer weiss, ob der Bursche nicht auch ohne diesen Vorfall seinen Brief geschrieben hätte; jedenfalls begründete er sein Vorgehen so, und die Direktion des britischen Museums hörte gern seine Gründe an; muss man doch das Gute nehmen, wo man es findet, und nicht lange fragen, wie es genommen wurde, namentlich wenn man das britische Museum zu verwalten hat.
»Der Vorschlag Aksakows war, seinen zweiten Fund aus Sibirien zu holen und persönlich nach London zu bringen. Bei der Ablieferung sollte sofort die Zahlung von 300 000 Pfund erfolgen. Ein Risiko hatte das britische Museum gar nicht, mit Ausnahme von einer verhältnismässig geringen Summe, deren der Russe für die Ausrüstung der neuen Expedition bedurfte. Zur Vorsicht gab man ihm, der inzwischen aus dem russischen Staatsdienst ausgetreten war, noch zwei zuverlässige Engländer aus dem Stabe des Museums mit; ein englischer Walfischfänger brachte die Gesellschaft über Schweden und Kola ins Eismeer. Man landete irgendwo, und während das Schiff herumkreuzte, und seine Besatzung sich mit Robben- und Fischfang die Zeit vertrieb, zog der Russe mit seinen beiden englischen Genossen und einer Horde gemieteter Tungusen ins Land hinein. Diese Expedition Aksakows war naturgemäss ungleich gefährlicher als die erste: damals war er mit dem Geleitbrief des weissen Zaren versehen, der ihm wie ein Zauberstab alle Hilfe gab, die überhaupt zu finden war; jetzt war er nicht nur auf sich ganz allein angewiesen, sondern er musste noch tausend und eine List ersinnen, um nicht von irgendeinem der vielen Millionen Augen seines Zaren erblickt zu werden. Robert Harford, Lord Wilberforces Sohn, der mit bei der Partie war, erzählte mir davon; es war eine verteufelte Geschichte. Ein verdammt feiner Bursche war der Russe, wenn er auch ein Schwindler war: genau in der abgemachten Woche traf er mit der Expedition in der als Stelldichein bestimmten Bucht wieder ein, und zehn Wochen später fuhr der Wallfischfänger die Themse herauf. — Das Geheimnis war so gut gewahrt worden, dass nicht einer von der Mannschaft wusste, was man eigentlich an Bord hatte; still und ohne Aufsehen hatte man in der Zwischenzeit im Museum einen besonderen Raum für den kostbaren Fund herrichten lassen. Dort sollte er ruhig einige dreissig Jahre ruhen, ohne dass ausser den Allerintimsten des Museums auch nur ein Mensch wusste, welch neuen Schatz London beherbergte. Nach dreissig Jahren — nun, da konnte man ihn der Welt schon zeigen, da waren die Leute tot, die heute verantwortlich waren, da würden keine politischen Komplikationen mit den Russen mehr erfolgen, da ja die Tatumstände nicht mehr zu ermitteln waren. In dreissig Jahren, pah, da war aus dem kleinen Diebstahl eine Argonautenfahrt nach dem goldenen Vlies geworden!
So kalkulierte die Verwaltung des Schatzhauses der Welt, und die Rechnung wäre sicher richtig gewesen, wenn nicht unser Freund John Hamilton Llewellyn einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht hätte.
Er gehörte zu den wenigen Sterblichen, die gewürdigt waren, der asiatischen Prinzessin auf englischem Boden den Willkommgruss zu bieten; denn, um nur gleich mit der Sprache herauszurücken: die geheimnisvolle Sendung enthielt nichts anderes als einen kolossalen Eisblock, in dem seit vielen tausend Jahren vollkommen unversehrt ein nacktes junges Weib stak. Die Dame ist da auf dieselbe Weise hineingekommen, wie ihr Zeitgenosse, das Mammut im Petersburger Museum. Wie? — Nun, das ist nicht so leicht zu sagen; schon über das Mammut haben sich viele grosse Gelehrte den Kopf zerbrochen, und bei unserm Fund lag die Sache noch komplizierter.
Das Gemach, das der jungen Dame als zukünftiger Wohnraum zugewiesen war, war sehr merkwürdig. Es lag im zweiten Keller und war zwanzig Meter hoch, vierzig Meter breit und ebenso lang. Längs der Wände standen vier Ammoniakeismaschinen, die jedoch verdeckt waren von hohen, bis in die halbe Decke hinüberragenden Eiswänden. Man hatte für den seltenen Besuch aus dem Norden etwas übriges tun wollen und den unterirdischen Saal, in dessen Mitte der Eisblock gesetzt wurde, in einen wahren Eispalast verwandelt, dessen Temperatur dank der Maschinen stets auf fünfzehn Centigrade unter dem Gefrierpunkte gehalten wurde. Eine platte Eisdecke bildete den Boden, von dem hier und da Eissäulen aufragten, die zum Teil die mit starren Eiszapfen besäte Decke trugen. Geschickt angebrachte elektrische Birnen erleuchteten diesen Winterpalast.
In das Gemach führte eine einzige, luftdicht schliessende, schwere eiserne Doppeltür, die von innen durch einen Eisblock verdeckt war. Nach aussenhin öffnete sie sich zu einem behaglich eingerichteten Vorgemach, in dem die Besucher sich an einem lustig prasselnden Kaminfeuer wieder die Hände wärmen konnten. Smyrnateppiche, ein türkischer Diwan, bequeme Schaukelstühle — — alles war hier ebenso gemütlich, wie es da drinnen ungemütlich war.
Die Schöne war also glücklich in ihrem Eispalast geborgen, der Russe hatte aus dem geheimen Fonds der Verwaltung sein Geld bekommen und war abgereist; die erste Aufregung über den seltenen Schatz hatte sich langsam wieder gelegt. — Zwei würdige Herren waren die beiden einzigen regelmässigen Besucher des Eispalastes: ein Londoner Anthropologe und sein Kollege, ein Edinburger Professor. Sie nahmen Messungen vor, oder wenigstens versuchten sie das, so gut man eben etwas messen kann, das in einem Eisblock von zwölf Kubikmetern eingeschlossen ist. Der Edinburger Herr, Jonathan Honeycock, war einen Monat lang in Petersburg gewesen, um dort das Mammut zu studieren; er gab unserer jungen Dame dasselbe Alter wie diesem, nämlich zwanzigtausend Jahre. Stein und Bein schwor er darauf, dass beide in ein und derselben Stunde kaltgestellt worden seien. Diese Hypothese unterstützte Aksakows Bericht, demzufolge die beiden Fundstellen keine Büchsenschussweite voneinander lagen, beide nach seiner Behauptung in dem alten Bette der Beresowka. Leider fand er durchaus nicht den Beifall seines Londoner Kollegen, des braven Herrn Pennyfeather, M. A., K. C. B. Dieser behauptete, die Tatsache, dass die Fundstellen so nahe beieinander lägen, sei eine rein zufällige. Die junge Dame sei wenigstens dreitausend Jahre jünger als das Mammut, wie ihr ganzes Äussere bewiese. Die menschlichen Zeitgenossen des Mammuts hätten ganz anders ausgesehen. Er legte seinem Kollegen eine Anzahl von Abbildungen vor, die solche Menschen darstellten. Und in der Tat, unsere Prinzessin sah ganz anders aus. Bei den Akten befinden sich eine Reihe von Zeichnungen und eine grosse Studie von Llewellyns Hand, und der war der einzige, der sie ohne ihre Eishülle sah. Milchweiss, mit einem reinen Pfirsichteint, tiefen blauen Augen und blondem Gelock, ein Körper, der dem Praxiteles als Modell hätte dienen können. — Pennyfeather hatte ganz recht: das war etwas anderes als die starkkiefrigen, schlitzäugigen Urzeitweiber auf jenen Abbildungen. Er kam aber schlecht an bei dem Edinburger. Wer habe denn diese Zeichnungen gemacht? fragte jener. Jedenfalls Leute, die nie ein solches Wesen zu Gesicht bekommen hätten. Elende Theoriefuchser, die mit Zuhilfenahme von Affenhäusern und einer unglaublich unästhetischen Phantasie solche Fratzen in die Welt gesetzt hätten. Er, Honeycock, erkläre, dies sei das Weib der Urzeit, und die Verleger täten nichts besseres, als sofort aus allen anthropologischen Werken jene dummen Greuelbilder herauszureissen. Worauf Pennyfeather sagte, Honeycock sei ein Esel. Worauf Honeycock Pennyfeather eine Ohrfeige gab. Worauf Pennyfeather Honeycock in den Bauch boxte. Worauf Honeycock Pennyfeather verklagte. Worauf Pennyfeather Honeycock wieder verklagte. Worauf der Richter Honeycock sowohl wie Pennyfeather zu je zehn Pfund verurteilte, und die Direktion des britischen Museums Pennyfeather sowohl wie Honeycock ihre Türen verschloss.
Nach dieser kleinen Episode hatte die sibirische Jungfrau für einige Zeit Ruhe vor zudringlichen Besuchern. Dann aber kam einer, dessen Besuch für sie ebenso verhängnisvoll werden sollte wie für ihn selbst.
Ich sagte dir schon, dass John Hamilton einer der wenigen war, die bei dem Einzuge der Eisprinzessin zugegen waren. Bei dieser Gelegenheit waren von ihr einige photographische Aufnahmen gemacht worden, die aber mehr oder weniger alle missglückten, da der Eispanzer durch seine eigentümliche Strahlenbrechung solche Verzeichnungen und Verzerrungen auf der Platte hervorrief, dass die junge Dame aussah, wie in einem Lachspiegelkabinett. So war Llewellyn von einigen der Herren von der Verwaltung gebeten worden, doch gelegentlich zu versuchen, eine Zeichnung von ihr zu machen. Selbst sehr interessiert, kam er dem Wunsche gern nach und zeichnete zu verschiedenen Malen in Gegenwart des einen oder anderen Museumsbeamten in dem Eispalast. In der Tat ist es Llewellyn gelungen, an irgendeiner Seite einen besonders günstigen Blick auf die spröde Schöne zu erwischen, denn diese Blätter sind ganz ausserordentlich scharf und klar.
Während dieser Sitzungen nun muss etwas Seltsames in Hamilton vorgegangen sein. Die Beamten gaben später bei ihrer Vernehmung an, dass sie anfänglich nichts Besonderes wahrgenommen hätten, dagegen sei es ihnen bei den letzten Sitzungen aufgefallen, dass der Maler minutenlang, ohne einen Strich zu zeichnen, auf die Eisprinzessin gestarrt habe. Auch habe er, als er vor Kälte den Stift kaum mehr habe festhalten können, sich nicht bewegen lassen, aufzuhören, sondern mit grosser Willenskraft seine Zeichnung beendet. Endlich habe er bei den letzten Sitzungen die Beamten aufgefordert, ja geradezu genötigt, in das Vorzimmer zu gehen. Sie hätten zuerst nichts Auffälliges darin gefunden und es lediglich als eine übertriebene Liebenswürdigkeit des Malers betrachtet, der ihnen statt des unheimlich kalten Eispalastes das behaglich erwärmte Vorzimmer anempfahl. Schliesslich sei es ihnen aber doch merkwürdig vorgekommen, da der Maler ihnen übermässig hohe Trinkgelder gab, damit sie ihn allein liessen. Ein paarmal hätten sie vom Vorzimmer aus im Eissaale sprechen gehört und dabei die Stimme Llewellyns erkannt.
Etwa um dieselbe Zeit erhielt der Direktor Llewellyns Besuch. Dieser bat ihn um die Schlüssel zu den Gemächern der Eisprinzessin. Er wolle ein grösseres Bild von ihr anfertigen und dazu jederzeit ungehindert freien Zutritt haben. Unter anderen Umständen würde seiner Bitte gewiss gewillfahrt worden sein, da ja Llewellyn in das Geheimnis schon eingeweiht war; aber das Benehmen des Malers bei diesem Besuche, die ganze Art, wie er sein Anliegen vorbrachte, war so seltsam, dass der Direktor Argwohn schöpfte, und ihm höflich, aber bestimmt, seine Bitte abschlug. Bei dieser Absage sprang der Maler auf, zitterte heftig, stotterte einige unzusammenhängende Worte und stürzte, ohne Adieu zu sagen, hinaus. Natürlich bestärkte dieses merkwürdige Benehmen den instinktiven Argwohn des Direktors noch mehr, und er erliess an alle Beamten des Museums den strengen Befehl, von nun an keinen Menschen mehr ohne seine besondere schriftliche Erlaubnis in die unterirdischen Räume einzulassen.
Nach einiger Zeit ging im Museum das Gerücht, dass jemand den Versuch gemacht habe, einige Beamte zu bestechen, um in das Eisgewölbe zu gelangen. Der Direktor hörte davon, und da er für den teuren Schatz verantwortlich war, liess er die Sache streng untersuchen. Siehe da, der Herr war niemand anders als unser Freund John Hamilton. Der Direktor begab sich zu ihm in den Sitzungssaal, in dem er malte, er fand ihn auf einem Schemel hockend, das Gesicht in den Händen vergraben. Zur Rede gestellt, bat er den Direktor sehr höflich, aus diesem Zimmer, in dem er augenblicklich Hausherrnrechte habe, so bald wie möglich hinauszugehen. Da der Direktor sah, dass der Künstler jedem Worte unzugänglich sei, ging er achselzuckend fort. Er liess nun drei Kunstschlösser an die Tür zu dem Vorzimmer legen und die Schlüssel im Geldschrank seines Privatzimmers aufbewahren.
Drei Monate lang war alles ruhig. Jede Woche zweimal stattete der Direktor selbst in Begleitung zweier Beamten, die die Eismaschinen nachzusehen hatten, den Wohnräumen der verzauberten Schönen einen Besuch ab — den einzigen, den sie erhielt. Llewellyn kam Tag für Tag in den Sitzungssaal, in dem er malte, aber er arbeitete nichts mehr, die Farben trockneten auf der Palette und die Pinsel lagen ungewaschen auf dem Tisch. Manchmal sass er stundenlang auf dem Schemel, dann wieder rannte er unaufhörlich mit grossen Schritten im Saale auf und nieder. — Die Untersuchung hat mit ziemlicher Sicherheit alles festgestellt, was er in dieser Zeit getrieben hat. Irgendwie auffällig sind nur einige Besuche, die er bekannten Londoner Geldverleihern gemacht hat. Er versuchte, übrigens ohne Erfolg, auf die recht ferne Aussicht einer grösseren Erbschaft hin nicht weniger als zehntausend Pfund zu leihen. Fünfhundert erhielt er schliesslich gegen hohe Zinsen bei Helpless und Neckripper in der Oxfordstreet.
Eines Abends erschien Hamilton nach langer Pause wieder einmal im Klub; wie ich später festgestellt habe, an demselben Tage, an dem er das Geld bekommen hatte. Er begrüsste mich kurz im Lesezimmer und fragte, ob Lord Illingworth da sei. Illingworth, wie du wohl weisst, ist die enragierteste Spielratze in allen drei Königreichen. — Als Llewellyn hörte, dass der Lord wohl erst spät abends kommen würde, nahm er meine Einladung zum Abendessen an, war aber dabei so schweigsam, dass es mir und den anderen, die mit uns speisten, auffiel. Später plauderten wir im Klubzimmer; Llewellyn war dabei so nervös, dass er ordentlich ansteckend wirkte. Immerfort sah er nach der Tür, rutschte auf seinem Sessel hin und her und trank einen Whisky nach dem anderen. Gegen zwölf Uhr sprang er auf und lief Illingworth entgegen, der gerade eintrat.
›Sie sind mir noch Revanche schuldig!‹ rief er ihm zu. ›Wollen Sie heute mit mir spielen?‹
›Aber gewiss!‹ lachte der Lord. ›Wer hält mit?‹
Standerton war natürlich dabei, auch Crawford und Bodley. Wir gingen ins Spielzimmer. Während der Diener die Karten zum Poker brachte, fragte Illingworth:
›Nun, wieviel wollen Sie heute verlieren, Hamilton?‹
›Tausend Pfund in bar und das, wofür ich Ihnen gut bin‹, antwortete der Maler und zog die Noten aus der Brieftasche. Er hatte augenscheinlich ausser dem Geld des Wucherers noch alles mitgebracht, was er besass.
Bodley schlug ihm auf die Schulter.
›Du bist verrückt, Junge! In deiner Lage spielt man nicht so hoch!‹
Unwillig drehte sich Llewellyn zur Seite.
»Lass mich in Ruh', ich weiss, was ich will! Entweder gewinne ich heute zehntausend Pfund, oder ich verspiele, was ich habe!‹
›Viel Glück!‹ lachte Illingworth. ›Wollen Sie mischen, Crawford?‹
Und das Spiel begann ...
Hamilton spielte wie ein Kind. In dreiviertel Stunden hatte er sein Geld bis auf die letzte Krone verloren. Er bat Bodley um hundert Pfund, die dieser ihm nicht gut abschlagen konnte, da er fast alles gewonnen hatte. Llewellyn spielte weiter und war in einer Viertelstunde wieder zu Ende. Diesmal wollte er von mir Geld haben. Ich gab ihm nichts, da ich sicher war, dass er doch alles verspielen würde. Er bettelte und flehte mich an, aber ich blieb standhaft. Er ging zum Spieltisch zurück, sah noch einen Augenblick zu, winkte mit der Hand und ging hinaus.
Da mich das Spiel nicht weiter interessierte, ging ich ins Lesezimmer. Ich las noch ein paar Zeitungen, dann stand ich auf, um nach Hause zu gehen. Während mir der Diener in den Mantel half, stürzte Llewellyn in die Garderobe und warf seinen Hut an den Haken. Er bemerkte mich und fragte:
›Spielt man drinnen noch?‹
›Ich weiss nicht.‹
Er hatte kaum zugehört, war mit langen Schritten ins Spielzimmer geeilt. Ich zog meinen Mantel wieder aus und ging ihm nach. Hamilton sass schon am Spieltisch, vor ihm lagen etwa zweihundert Pfund. Wie ich später erfuhr, war er zum Royal-Yacht-Klub gefahren, wo er sich das Geld auf Ehrenwort bis zum nächsten Tage von Lord Henderson geliehen hatte.
Diesmal spielte er mit ziemlichem Glück, da aber die Einsätze verhältnismässig niedrige waren, so hatte er doch im Verlaufe einer Stunde noch kaum tausend Pfund vor sich. Er zählte ein über das andere Mal die Scheine durch und brummte ein paar Flüche vor sich hin.
Lord Illingworth lachte. Sein sprichwörtliches Glück beim Spiel kommt daher, dass er meist der kapitalkräftigste Spieler ist; mit achtzigtausend Pfund Renten im Jahr war er allen anderen im Klub weit überlegen.
›Sie wollen mit Gewalt heute reich werden, Llewellyn! Poker dauert Ihnen zu lange, wollen wir Bac spielen?‹
Der Maler sah ihn so dankbar an, als ob ihm der Lord das Leben gerettet habe. Crawford steigerte die Bank, und das Baccarat fing an. Durch Hamilton angefeuert, war der Lord auch allmählich warm geworden, die Einsätze wurden höher und höher.
›Es ist nicht gerade nett, immer wieder sein Geld durchzuzählen‹, brummte Bodley.
›Ich weiss,‹ antwortete Hamilton bescheiden wie ein Schuljunge, ›aber heute muss ich es tun.‹ Und er zählte hastig weiter. — Er verlor und gewann, einmal hatte er wohl achttausend Pfund zusammen. Da die anderen in bescheidenen Grenzen blieben, spitzte sich schliesslich das Spiel zu einem Duell zwischen dem Maler und Lord Illingworth zu, der inzwischen die Bank übernommen hatte.
Hamilton überzählte wieder einmal sein Geld, er hatte gerade ein paar hohe Schläge gewonnen.
›Noch fünfzig Pfund!‹ murmelte er.
Aber er gewann die fünfzig Pfund nicht. Eine Karte nach der anderen schlug für seinen Gegner, und bald war er wieder kahl wie eine Ratte.
Das Spiel wurde aufgehoben, und die Herren gingen hinaus. Nur Llewellyn blieb sitzen. Er starrte auf die Karten, die verstreut auf dem Tische lagen, und trommelte nervös auf seinem Zigarettenetui. Plötzlich kam der Lord wieder zurück und klopfte ihm auf die Schulter. Hamilton fuhr auf.
›Sie brauchen zehntausend Pfund für irgendeinen Zweck?‹
›Das geht Sie nichts an!‹
›Nicht so schroff, junger Mann!‹ lachte der Lord. ›Ich kaufe für den Preis Ihr Bild, das ich letzten Sommer in Paris auf dem Marsfeld sah. Hier ist das Geld!‹
Er zählte die Noten der Bank von England langsam auf den Tisch. Llewellyn griff danach, aber der Lord hielt die Hand darauf.
›Nicht so schnell, ich stelle eine Bedingung! Ich verlange Ihr Ehrenwort, dass Sie nie wieder spielen.‹
›Nie wieder!‹ rief der Maler und streckte dem Lord seine rechte Hand hin.
Er hat sein Wort gehalten, wie das, das er Henderson gab, dem er am Morgen sein Geld zurücksandte.
Zwei Tage später befand ich mich in der unangenehmen Notwendigkeit, auf einen Aktendeckel schreiben lassen zu müssen:
Contra
John Hamilton Llewellyn
und Genossen.
Die Untersuchung wurde von der Verwaltung des Britischen Museums beantragt. Ausser gegen unseren Freund richtete sie sich gegen einen Modellsteher und einen unteren Museumsbeamten. Diesen erwischte man sogleich, während es dem anderen, einem dutzendmal vorbestraften, mit allen Hunden gehetzten Jungen gelang, sich davonzumachen. Der Beamte legte ein volles Geständnis ab. Er war mit zweitausend Pfund, die er übrigens wohlweislich in Sicherheit gebracht hatte, von Llewellyn bestochen worden, während seiner Nachtwache die Augen zuzudrücken. Er hatte sich erst dazu bereit gefunden, nachdem der Maler ihm auf das Testament geschworen hatte, dass nichts gestohlen werden würde. Gegen neun Uhr abends sei der Maler mit einem anderen Manne, den er Jack nannte, zum Museum gekommen, er habe ihnen geöffnet, und sie seien zum Direktionsbureau gegangen. Die Tür habe der besagte Jack mit einem Nachschlüssel geöffnet, dann habe er eine grosse Menge von Schlüsseln und Drückern aus der Tasche geholt und versucht, den Geldschrank zu öffnen. Dies sei ohne viele Mühe gelungen, da der Schrank von einem sehr alten, mangelhaften System sei. Aus dem Schranke habe der Maler nur Schlüssel herausgenommen, dann sei er wieder geschlossen worden.
Nun seien alle drei zum Keller hinuntergegangen, hätten dort die kunstvollen Schlösser des Eispalastes geöffnet und seien in das Vorzimmer getreten. Der Maler habe ihm befohlen, Feuer in den Kamin zu legen, und bald sei eine behagliche Wärme im Raume gewesen, währenddessen habe Jack einen Malkasten und eine zusammengeklappte Staffelei, die er mitgebracht, hingestellt. Dann habe der Maler ihm das versprochene Geld gegeben und dem Jack noch viel mehr Geld; wieviel, wisse er nicht. Jedenfalls war es der Rest von Lord Illingworths Summe, denn bei Hamilton fand man keinen Schilling mehr vor. — Der Maler befahl dann den beiden, ihn allein zu lassen, sie gingen hinaus, und er schloss die Tür von innen ab. Die beiden Kumpane gingen in die Portierloge und tranken auf ihren guten Verdienst ein paar Glas Grog zusammen. Der Modellsteher empfahl sich schliesslich, und der Beamte schlief den Schlaf des Gerechten, bis er um sechs Uhr morgens abgelöst wurde. Er ging nach Hause, schlief noch ein paar Stunden und überlegte sich dann ganz ruhig, was nun zu tun sei. Herauskommen würde ja die Geschichte ganz sicher, früher oder später. Fortgejagt würde er also auch ganz sicher. Aber sonst? Er hatte ja nichts getan, was ihn mit dem Gesetz in Konflikt bringen könnte; gestohlen war gewiss nichts worden, dafür bürgte ihm der heilige Schwur des Malers. Für alle Fälle brachte er vorher sein Geld in Sicherheit, dann setzte er sich hin und schrieb ganz gemütlich einen Brief an die Verwaltung, in dem er alles nett auseinandersetzte. Dieses Schreiben trug er selbst zum Britischen Museum. Das war nachmittags um fünf Uhr; der Direktor war gerade im Begriff, nach Hause zu gehen. Er las den Brief, überzeugte sich in dem Geldschranke von dem Verlust der Schlüssel und stürzte mit ein paar Beamten zu dem Keller hinunter, um zu sehen, was geschehen sei. Aber die Eisentür mit den kunstvollen Schlössern widerstand. Der Direktor liess Schlosser holen und schickte inzwischen auch zur Polizei. Nach vierstündigem Arbeiten gelang es ihnen mit Brecheisen und Schmiedehämmern, die ganze Tür herauszuheben, sie fiel krachend in das Vorzimmer; man stürmte hinein. Ein entsetzlicher Dunst schlug ihnen entgegen, der alle im ersten Augenblick wie betäubt zurückweichen liess. Der Direktor hielt sich mit seinem Taschentuch Mund und Nase zu, lief dann durch das Vorzimmer in den Eispalast, gefolgt von den anderen. Der Eisblock war in der Mitte quer durchgespalten, seine Bewohnerin — — — verschwunden.
Da ertönte aus einer Ecke ein klägliches Wimmern, in dem man kaum eine menschliche Stimme erkennen konnte. Fest eingekeilt zwischen dem Eise, fast erfroren, mit dunklem, geronnenem Blute an Gesicht und Händen, in Hemdärmeln und zerfetzten Kleidern, stak John Hamilton Llewellyn. Die Augen stierten ihm aus den Höhlen, und zwischen den Zähnen tropfte ihm Schaum heraus. Nur mit Mühe konnte man ihn zwischen dem Eise hervorzerren, auf alle Fragen hatte er nur ein verständnisloses Lallen. Als man ihn durch das Vorzimmer hinausschaffen wollte, schrie er wie besessen und sträubte sich mit Händen und Füssen. Vier Mann mussten ihn aufnehmen, aber als sie in die Nähe der Tür kamen, riss er sich mit furchtbarem Gebrüll wieder los und stürzte in die entfernteste Ecke. Eine wahnsinnige Angst vor dem Vorzimmer gab dem halb erfrorenen, fast leblos steifen Körper eine solche Kraftenergie, dass den Schutzleuten nichts weiter übrig blieb, als ihn an Händen und Füssen zu fesseln und wie einen Klotz hinauszutragen. Und selbst da noch riss er sich mit einem schrecklichen Schrei vor der Tür los und fiel zu Boden. Sein Kopf schlug hart auf das Eis; er verlor das Bewusstsein.
Nur so konnte er in das Krankenhaus geschafft werden und von dort vier Monate später in die Krankenabteilung des Irrenhauses zu Brighton. Ich habe ihn einmal dort besucht, er sah jämmerlich aus. Beide Ohren und vier Finger der linken Hand sind ihm abgefroren, ein entsetzlicher, röchelnder Husten, der alle Viertelstunden den ganzen Körper erschüttert, zeigt an, dass er sich während jener schrecklichen Nacht im Eispalast auch die Schwindsucht geholt hat, der er hoffentlich bald erliegen wird. Die Sprache hat er nicht wiedererlangt, ebensowenig hat er auch nur einen lichten Moment gehabt. Ein furchtbarer Verfolgungswahn quält ihn Tag und Nacht, so dass er nicht einen Augenblick ohne Aufsicht sein kann.
Was aber ist in jener Nacht in den Gewölben des Britischen Museums vorgegangen?
Ich habe mir redliche Mühe gegeben, alle, selbst die unscheinbarsten Momente zusammenzutragen, um ein klares Bild zu gewinnen; ich habe seine Mappen und Fächer durchsucht, hier gab eine Zeichnung, dort eine Zeile mir Aufschluss über seine Träume. — Natürlich beruht auch so noch vieles auf Hypothesen, aber ich glaube, nicht zu viel Trugschlüsse gemacht zu haben.
John Hamilton Llewellyn war ein Phantast. Oder ein Philosoph, was dasselbe ist. Vor Jahren traf ich ihn eines Abends auf der Strasse, wie er gerade in ein Cab sprang. Er fuhr zur Sternwarte, und ich begleitete ihn. Er war dort gut bekannt und seit seiner Knabenzeit häufiger Gast. Und wie bei allen Astronomen verschoben sich auch bei ihm die Begriffe von Zeit und Raum. Der Astronom sieht in einer Sekunde einen Stern viele tausend Millionen Meilen durchfliegen, die ungeheuren Grössen, mit denen er rechnet, müssen ihm den Sinn für den jämmerlich winzigen Horizont unseres Erdenlebens völlig abstumpfen. Ist aber der Sternbeschauer noch dazu ein Künstler von der Begabung und der Phantasie, wie Hamilton sie besass, so muss sich der Kampf seiner Seele mit dem Stoff zu einem ungeheuren Ringen auswachsen. — Nur von diesem Standpunkte aus wirst du, wenn du seinen Nachlass, den Bodley erworben hat, durchsuchst, seine merkwürdigen Kartons verstehen können. — So war Hamilton durchs Leben gegangen, stets den Alpdruck der Unendlichkeit auf der Brust. Sekundenstaub erschien ihm alles, der Dreck in der Pfütze sowohl, wie das schönste Menschenbild aus Fleisch und Blut. Und dieser Gedanke war es auch, der ihn stets vor der geistigen Reaktion bewahrte, die man Liebe zu nennen pflegt, obwohl mehr wie eine schöne Frau dem blonden, traumäugigen Maler sich wie auf einem Teebrett präsentierte. ›Bitte!‹ Aber Hamilton sagte: ›Danke!‹ und träumte weiter.
Um ihn zu erobern, musste das Unwahrscheinlichste wahr werden, musste eine Schönheit kommen, die so sehr über Zeit und Raum erhaben war wie er selber. Und dieses Unmöglichste wurde wahr: der suchende Ritter fand mitten in dem nebligen, stinkenden London — Dornröschen, die verzauberte Prinzessin. Was denn? Eine schöne, junge Frau, die vor vieltausend Jahren irgendwo in Sibirien geatmet hatte, kam, so wie sie war, zu ihm nach London, um ihm Modell zu stehen. Es war, als ob sie auf ihn blicke, zärtlich, lang, ohne mit den Wimpern zu zucken. Was wollte sie denn nur? Ja, sie hatte sich über eine gewaltige Zeitspanne hinweggesetzt, um ihn zu finden, wie Dornröschen in ihren Rosen war diese sibirische Prinzessin im Eise eingeschlafen, um auf ihren einzigen Ritter zu warten.
Aber sie ist ja tot, sagte er sich. Nun, was soll das? Wenn sie auch tot ist, sollte er sie darum nicht lieben können? Pygmalion liebte eine Statue, der seine Liebe Leben einhauchte, und Jesu Menschenliebe schenkte Jairi totem Töchterlein das Leben wieder! Wunder — ja — aber war denn dies Wunder, das vor ihm stand, ein weniger grosses? Und dann — was ist tot? Ist die Erde tot, die rings Blumen hervortreibt? Ist der Stein tot, der Kristalle bildet? Oder der Wassertropfen, der am Fenster erfriert und Farn und Moos auf das Glas zaubert? — Es gibt keinen Tod!
Diese einzige Frau hatte die allmächtige Zeit besiegt, durch Tausende von Jahren hatte sie ihre Jugend und Schönheit bewahrt. Caesar und Kleopatra und der grosse Napoleon, Michelangelo, Shakespeare und Goethe, die stärksten und grössten Menschen aller Jahrhunderte, sind von dem Fusstritt der Zeit zermalmt worden, wie Würmer am Wege, aber diese kleine schlanke Schönheit hatte ihr mit ihren weissen Händchen ins Gesicht geschlagen und die grosse Mörderin zum Rückzuge gezwungen! — Der Maler träumte und — bewunderte und — — — liebte.
Je öfter er in den Eispalast kam, um seine schöne Frau zu zeichnen, um so klarer malte sich in seiner Seele das Bild, das er schaffen wollte, das grosse Bild seines Lebens: der Sieg der menschlichen Schönheit über die Unendlichkeit. Das war die Mission dieser Frau, darum war sie zu ihm gekommen! So trieb sein träumender Geist die herrlichste Blüte, die nur in vielen hundert Jahren einmal dem menschlichen Geschlechte beschert ist: Liebe und Kunst zu einem reinen, mächtigen Empfinden vereinigt.
Aber nicht so in ihrem Eisblock wollte er seine Liebe malen. Frei, lächelnd, sollte sie auf einem Felsenbett ruhen, in der Hand eine leichte Gerte. Vor ihr die mörderische Zeit, ohnmächtig vor ihrer sieghaften Jugend. Und dieses Bild sollte den Menschen das Bewusstsein ihrer Göttlichkeit geben, das herrlichste Geschenk, das sie je empfangen hatten. Er, mit der überschäumenden Künstlerkraft in der Brust, und dieses herrliche Weib, das die Zeit besiegt, wollten das Ungeheure zuwege bringen.
So reifte in ihm der Gedanke, sie aus dem Eisblock zu befreien, und die Schwierigkeiten, die sich ihm entgegenstellten, spornten und stachelten ihn nur noch mehr an. Sein Faktotum Jack, eins von den Modellen, die alles machen, der einzige, zu dem er von seinem Plane sprach, wusste ihm diesen noch schwieriger und gefahrvoller darzustellen, um ihm schliesslich die Idee zu suggerieren, dass er ihn und irgendeinen Museumsbeamten nur durch ungeheure Summen für das Vorhaben gewinnen könne. Daher all seine vergeblichen Versuche, bei den Wucherern Geld aufzutreiben. — Unterdessen war ihm durch den Direktor der weitere Besuch des Eispalastes unmöglich gemacht worden. Er brütete allein in seinem Saale, und sein Wunsch, die Geliebte zu befreien und mit ihr zusammen der Menschheit das Höchste zu schenken, wuchs in diesen einsamen Stunden ins Grenzenlose.
Dann kam die Nacht, in der er in Pall-Mall versuchte, mit den Karten in der Hand das Schicksal zu zwingen. Das Schicksal lachte ihn aus und nahm ihm alles ab, was er hatte. Aber wie eine schöne Frau, die allen Bewerbungen ihres Liebhabers widersteht, um ihm endlich, wenn er trostlos verzweifeln will, sich freiwillig zu schenken, lächelte ihm schliesslich das Schicksal zu und gab ihm durch Lord Illingworths Hand das Geld, das er nötig zu haben glaubte. — Nun zögerte er keinen Augenblick mehr, schon die nächste Nacht wurde zur Ausführung des Planes bestimmt. Es traf sich gut, dass gerade der Beamte, den Jack gewonnen, die Wache hatte; die Schlüssel wurden geholt, der Eispalast erschlossen, und Hamilton gab den beiden das grösste Trinkgeld, das wohl jemals Pförtner erhalten haben.
Er drehte im Vorzimmer von innen dreimal die Schlüssel ab; so, nun war er allein. Er blieb stehen, lauschte, wie die Schritte der beiden sich in den Gängen verloren. Tapp, tapp — — tapp — nun hörte er nichts mehr. Er schöpfte tief Atem, dann entschloss er sich und ging mit raschen Schritten in den Eispalast.
Ah, da war sie! Warum sprang sie nicht heraus aus dem Eise, ihm entgegen? Aber ihre Augen schienen ihn anzusehen und nun — war es nicht, als ob auch ihre Hand ihm winke? Er griff in die Brusttasche und nahm ein kurzes, unten spitz zugeschliffenes Handbeil heraus.
›Verzeih' meiner Ungeduld‹, murmelte er, ›wenn ein Schlag zu rauh wird und dich unsanft berührt!‹ Er ging an die Arbeit, die mit dem unvollkommenen Instrument keine leichte war. Mit unendlicher Vorsicht und Liebe schlug er seinen Weg, ohne die Kälte zu achten, die seine Finger erstarren machte. Wie unsäglich langsam kam er weiter, schon stundenlang glaubte er bei der Arbeit zu sein! Aber es war, als ob ihn die Schöne von Zeit zu Zeit ermunternd anschaue:
›Nur Geduld, Liebster, bald lieg ich in deinen Armen!‹
Krachend brach nach allen Seiten das Eis herunter. Noch ein leiser Schlag und noch einer und noch einer! Er fürchtete einen Augenblick, dass vielleicht am Kopfhaar und an den kleinen Härchen der Haut das Eis festkleben möchte. Aber nein, der Körper war mit einem feinen, wohlriechenden Öle gesalbt, so dass er sie glatt und unverletzt von ihrem Eisbett aufheben konnte. Seine Arme zitterten, sein ganzer Körper schlotterte vor Kälte. Rasch trug er sie auf seinen Armen hinaus, in das warme, entzückend behagliche Vorzimmer, wo die rote Flamme im Kamine ein seltsames Liedchen summte. Leise, ganz sachte legte er sie auf den Divan, ihre Augenlider waren gesunken, sie schien zu schlafen.
Nun den Keilrahmen her, die Staffelei zurecht gerückt und Farben heraus! Er malte mit einem Eifer, einer Begeisterung — — so hatte noch nie ein Maler vor seinem Bilde gestanden! Die Stunden flogen dahin, es schienen ihm Sekunden zu sein. — Unterdessen leckte die mächtige Flamme im Kamin immer höher hinauf, es war eine schier unerträgliche Hitze im Raume. Dicke Schweisstropfen perlten von der Stirne, er glaubte, dass ihn die Aufregung so heiss mache. Warf seinen Rock ab und malte in Hemdärmeln weiter.
Da — — bewegte sich nicht ihr Mund? Er blickte genau hin — wirklich, sie schien die Unterlippe zu einem unmerklichen Lächeln zu verziehen. Hamilton fuhr sich mit der Hand vor die Augen, um die Träume zu verscheuchen. Aber nun, was ist das? — Ihr Arm glitt langsam, ganz langsam herunter — — — sie winkt ihm? — Er warf die Pinsel fort und stürzte zum Diwan. Kniete nieder, ergriff die kleine, weisse Hand, auf der die feinen, blauen Adern hervortraten. Sie liess ihn ruhig gewähren. Und er drückte und presste diese Hand und hob sein Haupt und sah sie wieder an. Mit einem leisen Schrei warf er sich in ihre Arme, schloss die Augen und küsste ihre Wangen und den Mund und den Hals und ihre strahlenden, schneeweissen Brüste.
Und all seine lang verhaltene Liebe und all seine unendliche Sehnsucht nach Schönheit und Kunst küsste er auf den Busen dieses Weibes.
Aber diesem höchsten Augenblick folgte der entsetzlichste. Ein feuchter, ekelhafter Schleim floss ihm über das Gesicht. Er sprang auf, wich ein paar Schritte zurück. — Die Linien verwischten sich — — — was war das, was auf dem Diwan lag? Ein widriger, unerträglicher Geruch drang auf ihn zu, der in den roten Flammen des Feuers Formen anzunehmen schien. Und aus dem zu schleimigem Gallert zerfliessenden Leichnam stieg ihm ein entsetzliches Gespenst entgegen, das seine Polypenarme nach ihm ausstreckte: die grausame Riesin Zeit rächte sich.
Er wollte entfliehen, rannte zur Türe — die Schlüssel, die Schlüssel! Er fand sie nicht, riss und zerrte an der Türe, zerkratzte sich die Hände, warf sich dann mit dem Gesicht dagegen, dass das Blut heruntertroff. — Das Eisen rührte sich nicht! Und immer mächtiger, immer gewaltiger wuchs das furchtbare Gespenst empor, schon fühlte er, wie seine saugenden Finger ihm in Nase und Mund drangen. Er schrie wie ein Besessener, rannte zu der anderen Türe, hinein in den Eispalast, wo er sich in jämmerlicher Todesangst in die äusserste Ecke drängte.
— — Da fand man ihn: ein armes, wahnsinniges Menschlein, das einst geglaubt hatte, die Unendlichkeit mit Füssen treten zu können!«
»O, wie viel Zaub'rer, wie viel Zauberinnen Gibt's unter uns, von denen man nichts weiss!«
—Artosto: Orlando Furioso. Ges. VIII, 1.
Wenn ich, verehrter Herr Sanitätsrat, Ihrem Wunsche nachkomme und die Seiten des Heftes, das Sie mir gegeben haben, ausfülle, so wollen Sie mir glauben, dass ich das nach reiflicher Überlegung und mit einer wohldurchdachten Absicht tue. Denn im Grunde handelt es sich doch nur um einen Kampf zwischen uns beiden, Ihnen, dem leitenden Arzt dieser Privat-Irrenanstalt und mir, dem Patienten, der seit drei Tagen hier untergebracht ist. Die Anklage, wegen der ich hier gewaltsam untergebracht bin, — — entschuldigen Sie einem Studenten der Rechte, dass er mit Vorliebe juristische Bilder wählt! — wirft mir vor, dass ich »an der fixen Idee leide, ein Orangenbaum zu sein«. Nun, Herr Sanitätsrat, versuchen Sie, den Beweis zu erbringen, dass das eine »Vorspiegelung falscher Tatsachen« sei, — — gelingt es Ihnen, mich von dieser Ihrer Meinung zu überzeugen, so bin ich ja »geheilt«, nicht wahr? Wenn Sie mir beweisen, dass ich ein Mensch sei wie alle anderen, dass ich lediglich infolge einer Fülle nervenzerrüttender Aufregungen von einer krankhaften Monomanie befallen sei, wie viele Tausende von Kranken in allen Sanatorien der Welt, so haben Sie mit diesem Beweise zugleich mich den Lebenden wiedergegeben, die »Nervenkrankheit« ist dann im Nu von Ihnen weggeblasen.
Auf der anderen Seite habe ich als Angeschuldigter das Recht, den Wahrheitsbeweis anzutreten. Es ist der Zweck dieser Zeilen, Sie, sehr geehrter Herr Sanitätsrat, von der Unanfechtbarkeit meiner Behauptungen zu überzeugen.
Sie sehen, dass ich ganz nüchtern denke, jedes Wort ruhig abwäge. Ich bedauere herzlich die Auftritte, die ich vorgestern machte; es betrübt mich sehr, dass ich durch mein albernes Gebaren den Frieden Ihres Hauses störte. Sie wollen das den vorangegangenen Aufregungen zugute halten, Sie wollen bedenken, dass, wenn man Sie, verehrter Herr Sanitätsrat, oder irgendeinen anderen gesunden Menschen plötzlich hinterlistig in ein Irrenhaus brächte, er auch nicht viel anders sich benehmen möchte. Unsere stundenlange Unterredung von gestern abend aber hat mich völlig beruhigt; ich sehe ein, dass meine Verwandten und Korpsbrüder lediglich mein Bestes wollten, als sie mich hierher brachten. Und nicht nur »wollten«; ich glaube, dass es wirklich so das Beste ist. — Denn wenn es mir gelingt, einen Psychiater von europäischem Rufe, wie Sie, Herr Sanitätsrat, von der Richtigkeit meiner Aufstellungen zu überzeugen, so muss auch der grösste Skeptiker sich vor dem sogenannten »Wunder« beugen.
Sie baten mich, in dies Heft einen möglichst ausführlichen Lebenslauf meiner Person zu schreiben, auch alle meine Gedanken über das, was Sie meine »fixe Idee« nennen. Ich verstehe sehr wohl, wenn Sie das auch nicht aussprachen, dass es sich für Sie, einen pflichttreuen Diener der Wissenschaft, darum handelt, aus dem »Munde des Kranken selbst ein möglichst getreues Krankheitsbild zu erhalten«. — Ich will bis aufs kleinste Ihren Wünschen nachkommen, in der bestimmten Voraussetzung, dass Sie, nachdem Sie Ihren Irrtum erkannt, auch mir bei meiner von Stunde zu Stunde realere Formen annehmenden Baumwerdung hilfreiche Hand leisten werden.
Sie werden, Herr Sanitätsrat, beim Durchsehen meiner Papiere, die sich ja zurzeit in Ihrem Gewahrsam befinden, bei meiner Meldung zu der juristischen Doktorprüfung ein eingehendes curriculum vitae finden, das alle äusseren Einzelheiten enthält. Ich kann mich daher hier sehr kurz fassen; Sie werden aus dem Schriftstücke entnehmen, dass ich der Sohn eines rheinischen Industriellen bin, im achtzehnten Jahre mein Abiturientenexamen machte, mein Jahr als Einjähriger in einem Berliner Garderegiment abdiente, auf verschiedenen Universitäten als Student der Rechte meine Jugend genoss, dazwischen eine Reihe grösserer und kleinerer Reisen machte und zuletzt in Bonn mich auf die Referendar- und Doktorprüfung vorbereitete.
Das alles hat für Sie, Herr Sanitätsrat, ebensowenig Interesse wie für mich. Die Geschichte, die uns interessiert, beginnt erst am 22. Februar vergangenen Jahres. An diesem Tage lernte ich bei einem Faschingsballe die — auf die Gefahr hin, lächerlich zu erscheinen, schreibe ich es nieder — Zauberin kennen, die mich in einen Orangenbaum verwandelte.
Es ist wohl nötig, einige Worte über die Dame zu sagen, der ich bei jenem Feste vorgestellt wurde. Frau Emy Steenhop war eine sehr auffallende Erscheinung, die alle Augen unwiderstehlich auf sich zog. Ich verzichte auf eine Beschreibung ihrer Reize; Sie möchten die Schilderung eines Verliebten vielleicht als starke Übertreibung belächeln. Doch ist es Tatsache, dass unter meinen Freunden und Bekannten nicht einer war, den sie nicht im Augenblick fesselte, der nicht glücklich war für jeden Blick, für jedes Wort, das sie an ihn richtete.
Frau Emy Steenhop bewohnte damals seit etwa zwei Monaten eine geräumige Gartenvilla in der Koblenzerstrasse, die sie äusserst geschmackvoll hatte einrichten lassen. Sie führte ein offenes Haus, in dem allabendlich die Offiziere der Königshusaren und die Mitglieder der angesehensten Korps sich versammelten. Es ist richtig, dass keine Damen bei ihr verkehrten, doch bin ich überzeugt, dass das nur aus dem Grunde geschah, weil Frau Steenhop, wie sie häufig lachend erklärte, Weibergeschwätz für den Tod nicht ausstehen mochte. Ebensowenig verkehrte die Dame jemals in irgendeiner Bonner Familie.
Es ist begreiflich, dass der Klatsch der Kleinstadt sich sehr bald mit der auffallenden Fremden beschäftigte, die täglich in ihrem schneeweissen 64 HP.-Mercedes durch die Strassen steuerte. Bald gingen die abenteuerlichsten Gerüchte von Mund zu Mund über die nächtlichen Orgien in der Koblenzerstrasse; das klerikale Hetzblättchen brachte gar einen absurden Artikel, der »Eine moderne Messalina« überschrieben war und in seinen Anfangsworten — »Quousque tandem« — jedenfalls die »höhere Bildung« des Herrn Redakteurs dokumentieren sollte. Ich kann versichern — und bin überzeugt, dass alle die Herren, die jemals die Ehre hatten, von Frau Emy Steenhop empfangen zu werden, das Gleiche tun werden — dass niemals in ihrem Hause auch nur das Allergeringste vorkam, das gegen die strengste gesellschaftliche Form verstiess. Ein Handkuss — das war das einzige, was die Dame ihren Verehrern — und zwar allen — gestattete; einzig der kleine Husarenoberst hätte das Vorrecht, seinen martialischen Schnurrbart auf den weissen Unterarm drücken zu dürfen. Frau Emy Steenhop hatte uns alle so am Fädchen, dass wir artig wie Pagen in fast ritterlich-romantischer Form unserer Herrin dienten.
Trotzdem geschah es, dass urplötzlich ihr Haus verödete. Ich war zu dem Geburtstage meiner Mutter am 16. Mai nach Hause gefahren; als ich zurückkehrte, hörte ich zu meinem Erstaunen, dass durch einen Befehl des Obersten den Offizieren des Husarenregiments der weitere Besuch in dem Hause der schönen Frau verboten sei. Die Korps waren sofort diesem Beispiel für ihre Angehörigen gefolgt. Ich fragte nach dem Grunde, meine Korpsbrüder teilten mir mit, dass für ihr Vorgehen lediglich der Regimentsbefehl massgebend sei; es sei unmöglich, dass in einem vom Husarenregimente gemiedenen Hause Korpsstudenten verkehren könnten. In der Tat hatten in dieser Beziehung von jeher die beiden Korporationen aufeinander Rücksicht genommen, schon aus dem Grunde, weil alljährlich so viele Korpsangehörige bei den Husaren dienten oder dem Regiment als Reserveoffiziere angehörten.
Den Grund des Vorgehens des Obersten kenne man nicht, auch den Offizieren selber sei er unbekannt. Doch vermute man, dass es mit dem urplötzlichen Verschwinden des Leutnants Baron Bohlen zusammenhänge, für das man auch nicht die geringsten Gründe sich zusammenreimen könne.
Da mir Harry von Bohlen persönlich nahe stand, so ging ich noch denselben Abend in das Husarenkasino, um vielleicht Einzelheiten zu erfahren. Der Oberst empfing mich sehr liebenswürdig, lud mich zu einem Glase Sekt ein, vermied es aber, auf die Angelegenheit zu sprechen zu kommen. Als ich ihm endlich ins Gesicht meine Frage stellte, lehnte er höflich, aber sehr kurz ab, sie zu beantworten. Ich machte einen letzten Versuch und sagte:
»Herr Oberst! Ihre Anordnungen und die der Korps sind gewiss für Ihre Offiziere und die Korpsstudenten bindend. Für mich sind sie es nicht. Ich kann heute noch aus meiner Verbindung austreten und bin dann Herr meiner Handlungen.«
»Tun Sie, was Ihnen beliebt!« antwortete der Oberst nachlässig.
»Ich bitte Sie, mich einen Augenblick geduldig anzuhören«, fuhr ich fort. »Jedem andern mag es vielleicht nicht so schwer fallen, das Haus in der Koblenzerstrasse zu missen. Er wird manchmal mit leisem Bedauern an die schönen Abende sich erinnern und sie schliesslich vergessen. Ich aber — —«
Er unterbrach mich.
»Junger Mann,« rief er, »Sie sind der vierte, der mir diese Rede hält! Zwei meiner Leutnants und einer Ihrer Korpsbrüder waren schon vorgestern bei mir. Ich habe den beiden Leutnants Urlaub erteilt, sie sind bereits abgereist; Ihrem Korpsbruder habe ich denselben Rat erteilt. Auch Ihnen kann ich nichts anderes sagen. — Sie müssen vergessen, hören Sie! — Ein Opfer ist genug!«
»So klären Sie mich wenigstens auf, Herr Oberst!« drängte ich. »Ich weiss ja nichts und kann nirgends etwas erfahren. Steht das Verschwinden Bohlens in einem Zusammenhang mit Ihrem Befehle?«
»Ja!« sagte der Oberst.
»Was ist aus ihm geworden?«
»Das weiss ich nicht«, antwortete er. »Und ich fürchte, ich werde es niemals wissen.«
Ich ergriff seine beiden Hände.
»Sagen Sie mir, was Sie wissen!« bat ich, und ich fühlte, dass in meiner Stimme ein Klang zitterte, der ihn zwingen musste, zu antworten. »Um Gottes willen, sagen Sie mir, was ist aus Bohlen geworden, und weshalb erliessen Sie den Befehl?«
Er machte sich los und sagte:
»Donnerwetter, mit Ihnen scheint's wirklich noch schlimmer zu stehen als mit den anderen!«
Er schenkte die beiden Kelche voll und schob mir mein Glas hin.
»Trinken Sie, trinken Sie!« rief er.
Ich goss den Champagner herunter und beugte mich vor.
»Sagen Sie mal,« fuhr er fort und sah mich scharf an, »waren Sie es nicht, der damals die Gedichte vorlas?«
»Ja,« stammelte ich, »aber — —«
Der Oberst strich sich seinen Schnauzbart.
»Damals beneidete ich Sie fast,« sagte er nachdenklich; »unsere Fee erlaubte Ihnen, ihr zweimal die Hand zu küssen. — Waren es Ihre eigenen Gedichte? Es kam sowas von allen möglichen Blumen drin vor.«
»Ja, ich habe die Gedichte selbst gemacht«, erwiderte ich.
»Es war ein schrecklicher Unsinn!« sagte er wie zu sich selbst. »Entschuldigen Sie,« fuhr er lauter fort, »ich verstehe von Gedichten gar nichts, durchaus gar nichts. Möglich, dass sie auch sehr schön waren. Die Fee fand das ja.«
»Aber, Herr Oberst,« warf ich ein, »was sollen denn jetzt meine Gedichte? Sie wollten — —«
»Ich wollte Ihnen was anderes erzählen, gewiss«, unterbrach er mich. »Aber gerade wegen der Gedichte tue ich das. Man sagt, dass die Leute, die Gedichte machen, alle Träumer seien. — Ich glaube, der arme Kerl, der Bohlen, machte auch ich insgeheim Gedichte.«
»Was ist also mit Bohlen?« drängte ich.
Er überhörte den Einwurf.
»Und die Träumer,« spann er seinen Gedankengang weiter, »die Träumer, das sind augenscheinlich die, die sie am leichtesten fängt. — Ich will Sie warnen, Herr, so gut ich es vermag.«
Er richtete sich auf.
»Hören Sie also!« sagte er sehr ernst. »Heute vor sieben Tagen kam Leutnant Bohlen nicht zum Dienste. Ich schickte in seine Wohnung, er war verschwunden. Wir haben mit Hilfe der Polizei, der Staatsanwaltschaft alle Schritte getan, ohne jeden Erfolg. Und trotz der kurzen Zeit, die inzwischen verflossen ist, bin ich für meine Person von der Fruchtlosigkeit aller weiteren Bemühungen durchaus überzeugt. Irgendwelche äusseren Gründe sind nicht vorhanden. Bohlen war sehr vermögend, hatte keine Schulden, war sehr gesund und sehr glücklich in seinem Beruf als Reiteroffizier. Hinterlassen hat er nichts als ein kurzes Schreiben an mich — — dessen Inhalt ich Ihnen in seinen Einzelheiten nicht mitteilen kann.«
Mich fasste eine grenzenlose Enttäuschung, die mein Gesicht sofort verriet.
»Warten Sie!« sprach der Oberst weiter. »Ich hoffe, dass das, was ich Ihnen sage, genügen wird, Sie wenigstens zu retten. Ich glaube, dass Leutnant Bohlen tot ist, dass er sich in geistiger Umnachtung das Leben genommen hat.«
»Schreibt er das?« warf ich ein.
Der Oberst schüttelte den Kopf.
»Nein!« sagte er. »Kein Wort! Er schreibt nur: Ich verschwinde nun. Ich bin kein Mensch mehr. Ich bin ein Myrtenbaum.«
»Was?« rief ich.
»Ja,« sagte der Oberst, »ein Myrtenbaum! Er glaubt, dass er von der Zauberin — von Frau Emy Steenhop — in einen Myrtenbaum verwandelt worden sei.«
»Aber das sind ja dumme Träumereien!« rief ich.
Der Oberst richtete wieder seinen forschenden, mitleidigen Blick auf mich.
»Träumereien?« wiederholte er. »Sie nennen es Träumereien. Man kann es auch Wahnsinn nennen. Aber das ist gewiss: unser armer Kamerad ist daran zugrunde gegangen. Er glaubte sich verzaubert. Waren wir denn nicht alle ein wenig von der schönen Frau verhext? Bin ich alter Esel nicht wie ein Schulbub um sie herumgeschwänzelt? Ich sage Ihnen, dass mich jeden Abend eine masslose Sehnsucht überfällt, zu ihrer Villa zu gehen, um meinen grauen Schnauzbart auf ihre weiche Haut zu pressen. Und ich sehe es meinen Offizieren an, dass es ihnen nicht anders geht. Der Oberleutnant Graf Arco, den ich vorgestern auf Urlaub sandte, hat mir gestanden, dass er fünf Stunden lang im Mondschein vor ihrem Hause auf und ab gelaufen sei, und ich fürchte, er ist nicht der einzige gewesen. Ich kämpfe mit einem Galgenhumor meine geheimen Wünsche herunter, bleibe jede Nacht als letzter im Kasino und gebe ein — gutes Beispiel. Ich versichere Sie, so viel Champagner wie in dieser Woche ist bei uns seit Jahren nicht getrunken worden — — aber geschmeckt hat er keinem. — — Trinken Sie, Trinken Sie! Bacchus ist der Feind der Venus.«
Er goss wieder die Gläser voll und fuhr fort:
»Nun sehen Sie, junger Herr, wenn ein so prosaischer Kerl wie ich das Jucken nicht loswerden kann, wenn ein so blasierter Weiberheld wie Arco einsame Mondschein-Promenaden macht, musste ich da nicht befürchten, dass der Fall Bohlen nicht der einzige bleiben würde? — Und ich danke dafür, mein Offizierkorps in einen Myrtenwald verwandelt zu sehen!«
»Ich danke Ihnen, Herr Oberst!« sagte ich.
»Sie haben von Ihrem Standpunkt aus zweifellos richtig gehandelt.«
Er lächelte.
»Sehr liebenswürdig von Ihnen, das anzuerkennen!« spottete er. »Aber Sie würden mich mehr verbinden, wenn Sie meinen Rat befolgen würden. Ich war nun einmal der Älteste, gewissermassen der Führer bei dem Hexenkult in der Koblenzerstrasse; nun ist es mir, als ob ich für alle, nicht nur für meine Offiziere, verantwortlich sei. Und ich habe das Gefühl — nichts als ein Gefühl, aber ich kann es nicht loswerden —, als ob noch mehr Unheil von jener schönen Frau ausgehen würde. Nennen Sie mich einen alten Toren, einen Narren, aber versprechen Sie mir, nie wieder jenes Haus zu betreten!«
Er sprach so ernst, so eindringlich, dass auch mich plötzlich eine seltsame Angst fasste.
»Ja, Herr Oberst!« sagte ich.
»Das beste ist, Sie verreisen auf ein paar Monate, wie es die anderen getan haben. Arco ist mit Ihrem Korpsbruder zusammen nach Paris gefahren, gehen Sie doch auch dahin! Das wird Sie zerstreuen; Sie werden die Zauberin vergessen.«
Ich erwiderte: »Ja, Herr Oberst!«
»Ihre Hand darauf!« rief er.
Ich streckte ihm die Rechte hin, die er kräftig schüttelte.
»Ich werde sogleich meine Sachen packen und den Mitternachtzug nehmen«, sagte ich fest.
»Recht so!« rief er und schrieb ein paar Worte auf seine Visitenkarte. »Hier der Name des Hotels, in dem Arco und Ihr Freund abgestiegen sind; grüssen Sie beide von mir, amüsieren Sie sich, lumpen Sie meinetwegen ein bisschen, aber kommen Sie mir wieder — ohne dieses — trübsinnige Lächeln!«
Er strich mit seinem Zeigefinger über meine Mundwinkel, als ob er sie glätten wolle.
Ich lief sofort nach Hause in der festen Absicht, in drei Stunden abzureisen. Meine Koffer standen noch gepackt da, ich nahm einige Sachen heraus und tat andere hinein. Dann setzte ich mich an den Schreibtisch und schrieb meinem Vater einen kurzen Brief, in dem ich ihm von meiner Reise Mitteilung machte und ihn bat, mir nach Paris Geld zu senden. Als ich nach einem Umschlag suchte, fiel mein Blick auf einen dünnen Stoss Briefe und Karten, die während meiner Abwesenheit angekommen waren. Ich dachte; »Die können liegen bleiben, bis ich von Paris zurück bin.« Dann streckte ich doch die Hand aus — — und zog sie wieder zurück. »Nein, ich will sie nicht lesen«, sagte ich. Ich nahm eine Münze aus der Tasche und dachte: »Ist der Kopf oben, liest du sie.« — Ich warf das Geldstück auf den Tisch, das Wappen fiel nach oben. — »Also gut,« sagte ich, »ich lese sie nicht.« In demselben Augenblick ärgerte ich mich über diese Dummheiten und griff nach den Briefen. Ein paar Rechnungen, Einladungen, Geschäftsempfehlungen — — dann ein violetter Umschlag, der in grossen, steilen Buchstaben meinen Namen trug. Ich wusste sogleich: das war es, warum ich die Briefe nicht anschauen wollte. Ich wog den Brief prüfend in der Hand, aber ich fühlte wohl, dass ich ihn lesen musste. Ich hatte nie die Schrift gesehen, und ich wusste doch, dass er von ihr war. Plötzlich sagte ich halblaut:
»Jetzt fängt es an.«
Ich dachte mir nichts dabei, ich hatte keine Ahnung, was denn jetzt anfangen sollte. Aber ich fürchtete mich.
Ich zerriss den Umschlag und las:
»Mein Freund!
Vergessen Sie nicht, die Orangenblüten heute abend zu bringen.
Emy Steenhop.
Der Brief war vor zehn Tagen geschrieben, an dem Tage, als ich nach Hause gefahren war. Ich hatte am Abend vorher ihr erzählt, dass ich in dem Treibhause eines Gärtners blühende Orangenbäume gesehen hätte, und sie hatte darauf den Wunsch ausgesprochen, Blüten zu haben. Gleich am anderen Morgen, vor meiner Abreise, war ich zu dem Gärtner gegangen und hatte ihn beauftragt, ihr mit einer Karte am Abend die Blüten zu senden.
Ich las die Zeilen ganz ruhig, dann steckte ich den Brief in die Tasche. Ich zerriss den Brief an meinen Vater.
Mit keinem Gedanken dachte ich mehr an das Versprechen, das ich dem Obersten gab.
Ich sah auf meine Uhr — halb zehn; das war die Zeit, zu der sie ihren Hofstaat zu empfangen pflegte. Ich liess einen Wagen holen und zog mich um.
Ich fuhr zu dem Gärtner und liess mir Blüten abschneiden. Und dann, endlich, war ich vor ihrer Villa.
Ich liess mich melden, und das Mädchen führte mich in den kleinen Saal. Ich setzte mich auf den Diwan und streichelte das weiche Guanakofell, das darüber lag.
Dann kam sie herein, in einem langen, gelbseidenen Teekleide. Die schwarzen Haare fielen von dem glatten Scheitel über die Ohren, drehten sich dort zu leichten Krönchen, so wie sie Lucas Cranachs Frauen tragen. Sie war ein wenig bleich, ein violetter Schimmer leuchtete aus ihren Augen.
»Das ist, weil sie Gelb trägt«, dachte ich.
»Ich war verreist,« sagte ich, »zu dem Geburtstag meiner Mutter. Ich bin erst heute abend vor einigen Stunden zurückgekommen.«
Sie stutzte einen Augenblick.
»Erst heute abend?« wiederholte sie. »So wissen Sie nicht — —« Sie unterbrach sich: »Aber natürlich wissen Sie!« lächelte sie. »In den paar Stunden hat man Ihnen längst alles erzählt!«
Ich schwieg und drehte meine Blüten.
»Natürlich hat man!« fuhr sie fort. »Und Sie haben doch den Weg hierher gefunden? Ich danke Ihnen.«
Sie streckte mir die Hand hin, die ich küsste.
Da sagte Sie ganz leise: »Ich wusste ja, dass Sie kommen würden.«
Ich richtete mich auf.
»Gnädige Frau!« sagte ich. »Ich fand bei meiner Rückkehr Ihren Brief vor. Ich habe mich beeilt, Ihnen die Blüten zu bringen.«
Sie lächelte.
»Lügen Sie doch nicht!« rief sie »Sie wissen, dass ich vor zehn Tagen schon den Brief schrieb. Und Sie sandten mir ja auch gleich die Blüten.«
Sie nahm die Zweige aus meiner Hand und führte sie zum Gesicht.
»Orangenblüten, — Orangenblüten,« sagte sie langsam, »wie herrlich sie duften!«
Sie sah mich fest an und fuhr fort:
»Sie brauchen keinen Vorwand, um hierher zu kommen. — Sie kamen, weil sie mussten, nicht wahr?«
Ich verbeugte mich.
»Setzen Sie sich, mein Freund,« sagte Frau Emy Steenhop, »wir wollen Tee trinken!«
Dann klingelte sie.
Glauben Sie mir, Herr Sanitätsrat! Ich könnte jeden der vielen Abende, die ich mit der Dame verbrachte, Ihnen eingehend erzählen, Wort für Wort Ihnen jede unserer Unterhaltungen wiedergeben. Wie in Erz ist das alles in mein Gedächtnis eingemeisselt, ich würde nicht eine Handbewegung, nicht das leichte Spiel ihrer Augenbrauen vergessen. — Ich will Einzelheiten herausgreifen, die für das Bild, das Sie von mir wünschen, wesentlich erscheinen.
Einmal sagte Frau Emy Steenhop:
»Wissen Sie, was aus Harry Bohlen geworden ist?«
Ich erwiderte: »Ich weiss, was die Leute sagen.«
Sie fragte: »Glauben Sie, dass ich ihn in einen Myrtenbaum verwandelt habe?«
Ich ergriff ihre Hand, um sie zu küssen:
»Wenn Sie das wünschen, schöne Frau,« lachte ich, »will ich es gern glauben.«
Aber sie entzog mir die Hand. Sie sprach — und aus ihrer Stimme klang eine solche Gewissheit, dass ich zitterte:
»Ich glaube es!«
Sie hatte den Wunsch ausgesprochen, dass ich ihr jeden Abend Orangenblüten bringen möchte. Als ich ihr eines Abends wieder die weissen Blüten überreichte, flüsterte sie:
»Astolf.«
Dann fuhr sie lauter fort:
»Ja, ich werde Sie Astolf nennen. Und wenn Sie wollen, mögen Sie Alcina zu mir sagen.«
— Ich weiss, verehrter Herr Sanitätsrat, wie wenig Musse unsere Zeit hat, sich mit alten Sagen und Geschichten zu beschäftigen. So werden Ihnen voraussichtlich diese beiden Namen gar nichts sagen, während sie mir das nahe Bevorstehen eines entsetzlichen und doch süssen Wunders im Augenblick offenbarten. Wenn Sie Ludovico Ariosto kennen würden, wenn Sie irgendeine Heldengeschichte des Cinquecento gelesen hätten, so würde Ihnen die schöne Fee Alcina wie mir eine alte Bekannte sein. Sie fing Astolf von Engelland in ihren Netzen, den gewaltigen Rüdiger, den Haimons-Sohn Reinold von Montalban, den Bayardritter und viele andere Helden und Paladine. Und sie pflegte ihre Geliebten, wenn sie ihrer überdrüssig war, in Bäume zu verwandeln —
Sie legte mir beide Hände auf die Schultern und sah mich an:
»Wenn ich Alcina wäre,« sagte sie, »möchtest du ihr Astolf sein?«
Ich sprach nichts, aber meine Augen antworteten ihr. Und dann sagte sie:
»Komm'!«
Sie sind Psychiater, Herr Sanitätsrat, und ich weiss, dass Sie eine anerkannte Autorität sind. Ich habe Ihren Namen oft in allen möglichen Blättern gelesen, man sagt Ihnen nach, dass Sie durchaus neue Gedanken entwickelt hätten. Und weil ich nun glaube, dass nie ein Mensch allein sogenannte neue Gedanken hat, sondern dass diese zu gleicher Zeit in den verschiedensten Hirnen in die Erscheinung treten, so habe ich eine Hoffnung, dass Ihre neuen Gedanken in bezug auf die menschliche Psyche sich vielleicht mit den meinen decken könnten. Eben dies Gefühl lässt mich Ihnen gegenüber ein so unbegrenztes Vertrauen fassen.
Der Gedanke, nicht wahr, das ist das Primäre, ja das ist das einzige, das wirklich ist. Es ist ein knabenhafter Unfug, die Materie als etwas Wirkliches aufzufassen. Das, was ich sehe, fasse und greife, kann ich schon vermöge der unvollkommensten Hilfsmittel als ganz etwas anderes erkennen, als ich es mit meinen paar Sinnen auffasse. Ein Wassertropfen scheint meinen erbärmlichen Menschenaugen eine kleine, klare, durchsichtige Kugel; ein Mikroskop aber, wie es die Kinder als Spielzeug benutzen, lehrt mich, dass er ein Tummelplatz der wildesten Infusorienschlachten ist. Das ist eine höhere Einsicht — aber nicht die höchste; denn zweifellos wird man in hundert Jahren selbst über unsere glänzendsten wissenschaftlichen Hilfsmittel ebenso lächeln, wie wir es über die Instrumente Äskulaps tun. Es ist also die Erkenntnis, die ich den wunderbarsten Hilfsmitteln verdanke, ebensowenig wirklich wie die meiner armseligen Sinne. Wie ich auch die Materie fassen mag, sie ist immer anders als ich sie begreife. Aber ich kann nicht nur das Wesen der Materie niemals völlig erkennen, sondern sie hat überhaupt kein Sein. Spritze ich den Wassertropfen gegen den heissen Ofen, so ist er im Augenblick verdampft, werfe ich ein Stück Zucker in den Tee, schmilzt es. Zerschlage ich dann die Schale, aus der ich trinke, so habe ich Scherben, aber keine Tasse mehr. Wenn aber ein Sein im Handumdrehen in ein Nichtsein verwandelt werden kann, so verlohnt es sich nicht, es überhaupt als ein Sein anzusprechen. Das Nichtsein, der Tod, ist für alle Materie das eigentliche Wesen, das Leben ist nur eine Verneinung dieses Wesens für eine unendlich kleine Zeitspanne. — Der Gedanke aber des Wassertropfens, des Stückchens Zucker bleibt unvergänglich, er kann nie zerbrechen, verdampfen, zerschmelzen. Ist dieser Gedanke also nicht mit viel grösserem Rechte als Wirklichkeit anzusprechen als die flüchtige Materie?
Nun sind wir Menschen, Herr Sanitätsrat, ebensosehr Materie wie alles um uns; jeder Chemiker kann uns mit Leichtigkeit nachweisen, aus wieviel Prozenten Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff usw. wir bestehen. Wenn aber in uns der Gedanke sich offenbart — welches Recht haben wir, anzunehmen, dass er sich in anderen Materien nicht offenbaren sollte?
Ich gebrauche stets das Wort »Gedanken«, Herr Sanitätsrat, nur aus dem Grunde, weil dieses Wort mir persönlich für den Begriff, den ich im Sinne habe, am besten liegt. Wie die verschiedenen Sprachen für einen Begriff die verschiedensten Worte haben, wie der Italiener das Ding, mit dem wir sprechen, »bocca« nennt, während der Engländer »mouth«, der Franzose »bouche«, der Deutsche »Mund« sagt, so haben auch die verschiedenen Wissenschaften und Künste für denselben Begriff die verschiedensten Worte. Was ich »Gedanke« nenne, möchte der Theosoph mit »Gott« bezeichnen, der Mystiker mit »Seele«, der Arzt mit »Bewusstsein«; Sie, Herr Sanitätsrat, würden vielleicht das Wort »Psyche« wählen. Aber Sie werden mit mir darüber übereinstimmen, dass dieser Begriff, wie man ihn auch nennen möge, das Ursprüngliche und zugleich das einzig Wirkliche ist.
Wenn nun dieser losgelöste Begriff, der alle die Eigenschaften hat, die die Theologen dem sogenannten persönlichen Gott beilegen, der also unendlich, ewig, unbegrenzt ist, in unserm Hirn sich offenbart, warum sollte es ihm nicht freistehen, ebensogut in allen anderen Dingen in Erscheinung zu treten? Ich kann mir wenigstens angenehmere Wohnplätze denken als die Hirne so mancher Menschen.
Das alles ist durchaus nichts Neues; haben doch Milliarden von Menschen zu allen Zeiten daran geglaubt — oder glauben heute noch daran —, dass die Seele sich auch in Tieren zeigt. Die Lehre Buddhas zum Beispiel hat ja die Theorie der Seelenwanderung aufgenommen. Was hindert uns, einen Schritt weiter zu gehen und Quellen, Bäumen, Felsen Seelen beizulegen, wie man es — vielleicht nur aus poetisch-ästhetischen Gründen — in Hellas tat? Ja ich glaube, dass die Zeit gekommen ist, die den menschlichen Verstand so weit entwickelt hat, dass er fähig ist, die Seelen von manchen organischen Wesen zu erkennen.
Ich sprach Ihnen schon von meinen Gedichten, die ich einmal der Dame vorgelesen habe, und die der Oberst so schrecklichen Unsinn nannte. Das mögen sie sein — ich habe kein Urteil darüber. Es ist auch weiter nichts als ein stammelnder Versuch, in menschlicher Sprache die Seelen einiger Blumen wiederzugeben.
Woher kommt es, dass jedem Künstler ein Eucalyptusbaum den Gedanken an nackte, sich sehnend ausbreitende Frauenarme erweckt? Dass der Asphodelos uns unwillkürlich an den Tod mahnt? Dass die Glycene uns das Bild eines blonden Pfarrerstöchterleins vorzaubert, dass die Orchidee uns an Hexensabbath und schwarze Messen erinnert?
Deshalb — weil der Gedanke daran in diesen Blumen und Bäumen lebt.
Glauben Sie, dass es Zufall ist, dass bei allen Völkern der Welt die Rose als das Symbol der Liebe, das Veilchen als das der Bescheidenheit gilt? Es gibt Hunderte von kleinen duftigen Blumen, die ebenso versteckt und verborgen blühen wie das Veilchen, keine von ihnen allen übt auf uns eine ähnliche Wirkung aus. Brechen wir aber ein Veilchen, so denken wir instinktiv: Bescheidenheit. Dabei geht dieses seltsame Gefühl nicht einmal von dem für unsere Sinne Charakteristischsten der kleinen Blume aus, das heisst von ihrem Dufte. Nehmen Sie ein Flacon »Vera violetta«, dessen Geruch so täuschend ist, dass Sie im Dunkeln ihn von dem Dufte eines grossen Veilchenstrausses nicht zu unterscheiden vermögen, werden Sie niemals dieselbe Empfindung haben.
Ebenso hat das Gefühl, das uns in der Nähe eines blühenden Kastanienbaumes gegen unseren Willen erfasst, der Gedanke der ewig siegenden Männlichkeit, auch nicht das geringste mit dem zu tun, was unsere Sinne zuerst fesselt: dem mächtigen Stamm, den breiten Blättern, den tausend leuchtenden Blütenkerzen. Erst durch Überlegung kommen wir zu der Erkenntnis, dass es hier der kaum bemerkbare Duft ist, der uns den Gedanken, die Seele des Baumes, offenbart.
Augenscheinlich kann der Begriff, den ich »Gedanken« nenne, alle Formen und Gestalten annehmen; die Tatsache allein, dass ich oder irgendein anderer das denken kann, ist schon ein vollgültiger Beweis dafür.
Denn da der Gedanke eben überhaupt keine Grenzen kennt, so ist die Materie für ihn nicht die geringste Schranke. Kein einsichtiger Mensch kann sich heute den Wahrheiten — die freilich relativ sind wie alle anderen — der monistischen Weltauffassung entziehen, und die lehrt uns, dass wir Menschen als Materie uns in nichts von jeder anderen Materie unterscheiden. Wenn ich das zugeben muss, und auf der anderen Seite des »Gedankens« Sein — — in seinem eigentlichen gewaltigen Sinne — mich in jedem Augenblicke zur Anerkennung zwingt, so kann ich nur zu dem einen Schluss kommen, den übrigens tausend Beispiele bestätigen, dass der »Gedanke« nicht nur den Menschen, sondern auch jede andere Materie beliebig zu durchdringen vermag, warum also nicht Stamm, Blätter und Blüten eines Orangenbaumes?
Für die Faust-Natur des Philosophen besteht die Glaubenslehre, die die Kulturvölker angenommen haben, nur in ihren Anfangsworten: »Im Anfang war das Wort.« Und sie stocken alle und werden nie über das geheimnisvolle »Logos« hinauskommen, bis es sich eines Tages in irgendeinem Kopfe in seiner ganzen Grösse selbst offenbart. Denn da das menschliche Hirn von aller Materie auf dem toten Sternchen, das wir Erde nennen, nun einmal das Vollkommenste ist, so wird für uns diese Offenbarung wohl dort zur Erscheinung werden.
Aber das ist das Falsche, dass alle die Menschen, die, wie die Mystiker, an eine solche Offenbarung des »Logos« glaubten und sich mit ihr beschäftigten, stets annahmen, dass sie plötzlich, wie ein Blitz, käme. Sie wird kommen, wie sie kam, langsam, Schrittchen für Schrittchen, wie sich die Sonne aus dem Nebelfleck, wie sich der Mensch aus der Amoeba primitiva entwickelte. Sie ist unendlich und nie vollendet, darum wird sie auch nie vollkommen sein.
Es vergeht keine Stunde, keine Sekunde in der der Gedanke sich nicht offenbart, grösser, herrlicher als vorher. Immer, immer mehr erkennen wir diesen Begriff, der alles ist.
Und eine solche grössere Erkenntnis ist es, von der ich glaube, dass sie in meinem Hirn sich gespiegelt hat. O, ich bilde mir nicht ein, der einzige zu sein; ich sagte Ihnen schon, Herr Sanitätsrat, dass ich glaube, dass nie ein Gedanke ein Hirn allein befruchtet. Aber in vielen wird der Samen des Geistes verdorren, in wenigen nur mag er Blüten treiben.
Eines Nachts hatte die Frau, die ich Alcina nannte, das Lager, auf dem wir ruhten, ganz mit Orangenzweigen bedeckt. Wenn sie mich umschlang, zitterten die feinen Nasenflügel, die sie eng an meinen Hals presste.
»Mein Freund,« sagte sie, »du duftest wie die Blüten!«
Ich lachte, und glaubte, dass sie scherze. — Aber ich habe mich später überzeugt, dass sie recht hatte.
Eines Tages kam die Dame, bei der ich wohnte, in mein Zimmer. Sie schnupperte in der Luft herum und sagte:
»O, wie gut das riecht! Haben Sie wieder Orangenzweige da?«
Aber ich hatte seit Tagen keine Blüten in meinem Zimmer gehabt.
Ich sagte mir: Beide können sich täuschen, die menschliche Nase ist ein so schlecht entwickeltes Organ.
Aber mein Jagdhund wird sich nicht täuschen lassen; seine Nase ist unfehlbar.
So machte ich einen Versuch. Ich liess meinen Hund in Wohnung und Garten oft einen Orangenzweig apportieren; ich versteckte ihn dann sorgfältig, lehrte ihn, ihn zu bringen, wenn ich rief: »Such' die Blüten!« Stets brachte er den Zweig nach kurzer Zeit aus dem verstecktesten Platz zurück.
Ich wartete dann einige Tage, während der ich keine Blüten in meiner Wohnung hatte. Eines Morgens nahm ich das Tier mit in die Schwimmanstalt. Als ich aus dem Wasser stieg, rief ich:
»Ali! Apport! Such' die Blüten!«
Der Jagdhund hob den Kopf hoch, schnupperte ein paarmal in den Luft herum und kam dann ohne Bedenken auf mich zu. Ich ging in meine Badezelle und wies ihm die Kleider, die vielleicht irgendeinen Duft aufbewahrt haben konnten. Aber der Jagdhund beroch sie kaum, er beschnupperte mich immer wieder: es war mein Fleisch, an dem er den Duft roch.
Nun, Herr Sanitätsrat, wenn das dem Hunde mit seinem hochentwickelten Organ passierte, brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn Sie denselben Irrtum hegten, als Sie bei mir Zweige vermuteten. Ich hörte, wie Sie, nachdem Sie mich gestern abend verliessen, dem Diener auf dem Gange sagten, er möge, wenn ich im Garten spazieren ginge, sorgfältig mein Zimmer durchsuchen und die Orangenzweige entfernen. Ich nehme Ihnen das nicht übel; Sie glaubten, ich habe solche Blüten bei mir versteckt und hielten es für ihre Pflicht, alles das fernzuhalten, was mich an »meine fixe Idee« erinnere. Herr Sanitätsrat, Sie hätten Ihrem Diener die Mühe sparen können: er kann stundenlang täglich suchen und wird nicht eine kleine Blüte finden. Aber wenn Sie wieder mich besuchen, so werden Sie wieder den Duft riechen, der von meinem Fleische ausgeht.
Einmal träumte mir, ich ginge durch einen weiten Garten zur Mittagszeit. An dem runden Springbrunnen vorbei, durch eine Pergola mit zerbrochenen Marmorsäulen. Und über lange, glatte Rasenflächen. Ich sah einen Baum, der funkelte über und über von blutroten Glutorangen. Da wusste ich, dass ich dieser Baum war.
Der leichte Wind spielte in meinen Blättern, und in unendlicher Lust dehnte ich mich und streckte meine vollen Äste. Über den weissen Kiesweg kam eine hohe Frau gegangen, in weitem gelben Gewande. Aus tief violetten Augen streichelten mich ihre Blicke.
Da rauschte ich aus den dichten Zweigen:
»Brich dir von meinen Früchten, Alcina!«
Sie verstand diese Sprache und hob den weissen Arm. Brach einen Zweig ab mit fünf, sechs goldenen Früchten.
Das war ein leiser, süsser Schmerz; ich erwachte davon.
Ich sah sie neben mir kauern, auf dem weichen gelbweissen Felle. So seltsam starrten ihre Augen mich an.
»Was tust du?« fragte ich.
»Still!« flüsterte sie. »Ich lausche deinen Träumen.«
An einem Nachmittag waren wir über den Rhein gefahren, vom Drachenfels hinab zum Kloster Heisterbach gegangen. Hinter den efeuumrankten Ruinen hatte sie sich aufs Gras geworfen. Ich sass neben ihr, sog in vollen Zügen die linde Luft ein, hob die Brust und streckte weit die Arme aus.
»Ja,« sagte sie und deckte die Augen mit den tiefen Wimpern, »ja, breite deine Zweige aus! Wie kühl ruht sich's in deinem Schatten!«
Dann erzählte sie. —
Oh, Nächte hindurch erzählte sie mir. Uralte Sagen, Märchen und Geschichten. Immer schloss sie die Augen dabei. Wenig nur öffneten sich ihre feinen Lippen, wie ein Klingen von silbernen Glöckchen tropften ihr die Worte vom Munde:
»›Du raubtest mir meinen Gürtel,‹ sagte Flordelis zu ihrem Ritter; ›so bring' mir einen anderen, der meiner wert ist!‹
»Da sattelte der blonde Gryph sein Ross und jagte durch alle Lande der Welt, um seiner Herrin einen Gürtel zu schaffen. Schlug sich mit Riesen und Rittern, mit Hexen und Nekromanten und erkämpfte die herrlichsten Gürtel. Aber in den Staub warf er sie, oder Bettlern in den Schoss, und rief, dass es armselige Lappen seien und nicht wert, seiner Dame Lenden zu schmücken. Und als er der Venus eigenen Gürtel dem gewaltigen Rodomont abgerungen, riss er ihn in Fetzen und schwur, dass er einen Gürtel ihr schaffen wolle, wie ihn nie eine Göttin getragen. Den Zauberer Atlas erschlug er und raubte sein Flügelross; durch Sturm und Wind ritt er in die Luft und riss mit kecker Hand die Milchstrasse herab vom Himmel.
»Zu der Herrin kam er zurück und küsste ihren weissen Fuss. Um ihre Hüften schlang er den Gürtel, auf dem als Geschmeide viel tausend Sterne funkelten — —«
»Lies mir das vor, was du über die Orchideen schriebst!« sagte sie.
Da las ich ihr:
»Als der Teufel ein Weib ward,
Als sich Lilith
Die schwarzen Haare zum schweren Knoten schlang
Und die bleichen Züge
Mit Botticellis krausen Gedanken
Rings umrahmte,
Als sie leise lächelnd
Um alle die schmalen Finger
Goldreifen zog mit bunten Steinen,
Als sie Bourget las
Und Huysmans liebte
Als sie Maeterlincks Schweigen verstand
Und die Seele badete
In Gabriel d'Annunzios Farben,
Lachte sie einmal —
— —
Und wie sie lachte,
Sprang ihr die kleine Fürstin der Schlangen
Heraus aus dem Mund.
Da schlug die schönste der Teufelinnen
Nach der Schlange,
Schlug die Königin der Schlangen
Mit beringtem Finger,
Dass sie sich wand und zischte,
Zischte, zischte
Und Geifer spritzte.
Aber Lilith sammelte die Tropfen
In der schweren Kupfervase,
Feuchte Erde,
Schwarze, feuchte Erde
Streute sie darauf.
Leichthin kosten ihre grossen Hände
Rund herum
Diese schwere Kupfervase,
Leichthin sangen ihre bleichen Lippen
Ihren alten Fluch. —
Wie ein Kinderreim erklang ihr Fluchen,
Weich und müde —
Müde wie die Küsse,
Die vom Munde
Ihr die feuchte Erde trank.
Aber Leben hob sich in der Vase,
Und gelockt von ihren müden Küssen,
Und gelockt von diesen süssen Klängen,
Krochen langsam aus der schwarzen Erde
Orchideen — —
— —
Wenn die Liebste
Vor dem Spiegel ihre bleichen Züge
Rings umrahmt mit Botticellis Nattern,
Kriechen seitwärts aus der Kupfervase
Ochideen —
Teufelsblumen, die die alte Erde,
Die durch Liliths Fluch mit Schlangengeifer
Sich vermählt, zum Lichte hat geboren, Orchideen — —
— — Teufelsblumen — —«
»Das ist schön«, sagte Alcina.
Ja, Herr Sanitätsrat, so war unser Leben: ein Märchen, aus Sonnenstrahlen gewoben. Eine verlorene Vergangenheit atmeten wir ein; eine nie geahnte Zukunft wuchs aus unseren Küssen.
Und immer klarer, o kristallklar wurden die Harmonien unserer Träume. Einmal unterbrach sie mich mitten in einem Liede.
Sie sagte: — »Schweige!« und presste ihr Gesicht eng an meine Brust. Ich fühlte, wie die feinen Nüstern auf meinem Fleische zitterten — minutenlang.
Dann hob sie den Kopf und sagte:
»Du brauchst nicht zu sprechen; es duften deine Gedanken.«
Sie schloss die Augen — und langsam sprach sie meine Verse zu Ende. —
— Oder sie nahm meinen Kopf eng in ihren Arm, berührte die Schläfen mit den schmalen Fingern.
Dann fühlte ich, wie ihre Wünsche in mich hinüberglitten, schmeichelnd Besitz nahmen von meiner Seele.
Wie eine süsse Musik spielte es durch meine Schläfen, wie ein Sang von tanzenden Sonnenstrahlen:
Wo die grünen Flächen sich dehnen, wo über schneeige Marmorschwellen kühle Bergwasser springen, wo sich grosse Falter zwischen Magnolienblüten wiegen und weisse Pfauen einsame Träume sinnen, da steht ein Baum.
Weit streckt er ringsum seine Äste aus, und ein Duften von Hochzeit und Liebe erfüllt um ihn die Luft. Weisse Blüten heben sich aus den Blättern, und dazwischen funkeln die goldenen Früchte.
Eine Fee aber ruht in dem kühlen Schatten, sie erzählt Märchen dem Baume, der ihr der Geliebte ist.
Sie spricht, und er rauscht in den Winden ihr seinen Duft zu.
So plaudern die beiden.
So wuchs in mir die Erkenntnis, langsam, allmählich, so wie alle Offenbarung kommt. So harmonisch, dass ich nicht einen einzigen Markstein bezeichnen könnte. Die paar Einzelheiten, die ich Ihnen wiedergegeben habe, Herr Sanitätsrat, habe ich aus Tausenden herausgegriffen. Das Wunder, begann, als ich zum ersten Male diese Frau sah, — aber vielleicht begann es weit früher. Muss ich nicht meine Gedanken, die zum Beispiel, die ich in den Gedichten zum Ausdruck brachte, schon als einen ersten leisen Anfang ansprechen?
Vollendet aber wird das Wunder sein, wenn ich da draussen in der Sonne stehe, weisse Blüten und goldrote Früchte trage.
Dazwischen die Entwicklung, ruhig fortschreitend, stark, selbstbewusst, ohne einen Widerstand zu kennen.
Nicht nur der Seele, auch des Leibes. Sagte ich Ihnen nicht schon, dass all mein Fleisch mit dem süssen Dufte getränkt sei? — Überzeugen Sie sich doch, Herr Sanitätsrat!
Dann kamen die letzten Nächte. Einmal sagte sie mir:
»Nun muss ich dich bald lassen.«
Da erschrak ich nicht. Jede Sekunde bei ihr war eine Ewigkeit, und durch unendliche Ewigkeiten noch durften meine glücklichen Arme sie umfangen.
Ich nickte, dann fuhr sie fort:
»Du weisst, was dann kommen wird, Astolf?«
Ich nickte wieder und fragte:
»Wohin wirst du gehen?«
Da fielen zwei Tränen über ihre Wangen. Sie richtete sich auf, und ihr Auge leuchtete wie ein einsam Nachtgestirn auf vereister Steppe.
»Übers Meer«, sagte sie, »dahin, woher ich kam. — Aber ich will dir schreiben. — Und dann, später, wenn du draussen blühst, wenn die leichten Winde in deinen Zweigen spielen, dann, später, komme ich wieder. Komme zu dir, Liebster, und ruhe in deinem Schatten. Ruhe bei dir, Liebster, und träume mit dir unsere süssesten Träume.«
»Liebster«, sagte sie, »Liebster!« Und wie um Stamm und Zweige sich des Efeus grüne Ranken schmiegen, so umschlang sie mich ... so.
Was dann kam, wissen Sie, Herr Sanitätsrat. Als ich eines Abends zu ihrer Villa kam, schellte ich vergebens. Sie war fort, ihre Villa geräumt. Ich setzte Polizei und Detektive in Bewegung, rannte tagelang wie ein Narr umher. Ich machte lächerliche Torenstreiche, aber ich versichere Sie, Herr Sanitätsrat, dass das alles nur auf die Rechnung des Verliebten zu setzen ist, dem seine Schöne plötzlich wie mit einem Zauberschlag entrückt war.
Meine Korpsbrüder kümmerten sich wieder um mich, mehr als mir lieb war. Sie waren es, die meinen Eltern telegraphierten. Dann kam der Wutausbruch, das, was Sie die »Katastrophe« nennen, und was doch eine so leicht erklärliche Selbstverständlichkeit war. Meine Freunde, die nach meinen Torheiten mich keinen Augenblick mehr allein liessen, hatten bemerkt, dass ich stets auf den Briefträger lauerte. Und als der Brief kam, ihr Brief, nahmen sie ihn auf der Strasse dem Boten ab. Heute weiss ich sehr wohl, dass sie eine gute Absicht leitete, dass sie eine neue Aufregung mir fernhalten wollten. Aber in dem Augenblick, als ich das vom Fenster aus sah, wurde mir rot vor den Augen; eine Entweihung schien es mir, dass sie mit ihren Händen das Papier berührten, dass ihre Augen die Schrift lesen wollten, die sie geschrieben. Ich riss den scharf geschliffenen Schläger von der Wand und eilte auf die Strasse. Ich rief ihnen zu, mir den Brief herauszugeben; als sie das weigerten, schlug ich dem, der ihn hielt, mit der Waffe ins Gesicht. Das Blut spritzte, befleckte den Brief, den ich ihm entriss. Ich sprang auf mein Zimmer, verriegelte mich und las die Zeilen.
Sie schrieb:
»Wenn du mich liebst, so bringst du es zu Ende. — O, ich werde kommen, zu dir kommen, Liebster! Werde ruhen in deinem kühlen Schatten und dir süsse Sagen erzählen.
Alcina.«
Nun bin ich fertig, Herr Sanitätsrat. Mit List brachte man mich hierher, aber jetzt danke ich dem Schicksal, das mich hierhin führte. Die Aufregungen sind vorüber, in dieser wunderbaren Ruhe habe ich meinen Frieden wiedergefunden. Ich sitze in dem süssen Dufte, der von mir ausgeht, und fühle, weiss, dass ich es zu Ende bringe. Schon wird mir das Schreiben schwer, Herr Sanitätsrat, die Finger wollen nicht mehr zusammenhalten, sie spreizen sich, streben auseinander wie die Zweige.
Ihre Anstalt liegt in einem herrlichen weiten Parke; ich bin heute morgen darin gewandelt, er ist so gross und schön. Ich weiss, Herr Sanitätsrat, meine Worte haben Sie überzeugt, oh, sie haben es getan! Wenn also die Stunde kommt, die so nahe ist, so wollen Sie nicht versuchen, die Erfüllung zu hemmen. Dort hinter der grossen Wiese werde ich stehen, wo die Kaskaden plätschern. Ich weiss, Sie werden mich pflegen lassen, Herr Sanitätsrat, der Gärtner vom Bonner Talweg versteht sich ja auf Orangenbäume, er wird Ihnen Anweisungen geben. Denn ich will ja nicht verkümmern, ich will wachsen und blühen, damit sie sich freue an meiner Pracht.
Sie wird schreiben, Herr Sanitätsrat, Sie werden ihre Adresse wissen.
Und noch eins: in jedem Sommer, wenn meine Krone funkelt von tausend goldenen Früchten, dann wollen Sie die schönsten brechen und in ein Körbchen legen. Das senden Sie ihr.
Ein Zettelchen aber soll man hineintun mit den süssen Worten, die ich nächtens einmal auf den Strassen Granadas hörte:
»Liebste, nimm die Blutorange,
Die ich still im Garten brach.
Liebste, nimm die Blutorange! —
Doch nicht schneid' sie mit dem Messer,
Denn du würd'st mein Herz zerschneiden
Mitten in der Blutorange!«
Als es zwölf Uhr schlug, sagte der Schauspieler: »Und nun ist der Tag gekommen, an welchem vor nunmehr —«
Aber der, den er anredete, unterbrach ihn: »Bitte, lassen Sie. Dieses Datum ist mir höchst zuwider.«
»Ah, er fängt an, sentimental zu werden! Steht Ihnen schlecht!« höhnte jener.
Der andere sagte: »Nein. — Aber es sind Erinnerungen —«
»— — so unerhört erschrecklicher Natur, dass Stein und Bein gefrieren«, lachte der Schauspieler. — »Wie alle Ihre Erinnerungen! Also bitte: erleichtern Sie sich.«
»Ich tu es nicht gern«, sagte er. »Das alles ist so masslos roh —«
»Oh, Sie Lämmerschwänzchen! Seit wann nehmen Sie Rücksicht auf unsere Nerven? Während alle auf seidenen Teppichen schreiten, stapft Ihr Lederschuh durch schlammiges Blut. Sie sind eine Mischung von Brutalität und Stilgefühl.«
»Ich bin nicht brutal«, sagte er.
»Das ist Geschmacksache!«
»So will ich schweigen.«
Der Schauspieler schob ihm das Zigarettenetui über den Tisch. »Nein, erzählen Sie. Es ist gut, dass man nicht vergisst, dass auch heute noch Blut fliesst in dieser besten aller Welten. Ausserdem ist das gar nicht wahr, dass Sie nicht erzählen wollen: Sie wollen sprechen und wir sollen hören. Also hören wir.«
Der Blonde öffnete das Etui. »Englischer Dreck!« brummte er. »Alles ist Dreck, was aus diesem verfluchten Lande kommt.« Er brannte sich seine eigene Zigarette an. Dann begann er.
Das ist nun schon manches Jahr her. Ich war damals ein krasses Füchslein, siebzehn Jahre alt. Ich war so unschuldig wie ein Känguruhchen in der Mutter Bauchtasche, aber ich spielte den zynischen Lebemann. So wie er sich darstellte in dem Känguruhköpfchen, es muss komisch genug gewesen sein.
Einmal bollerte es nachts an meine Türe.
»Aufstehn!« schreit es. »Sofort aufmachen!«
Ich fuhr aus dem Schlafe, alles schwarz ringsum.
»Aber so wach doch auf, zum Teufel!« — jetzt erkannte ich die Stimme meines Leibburschen — »Wie lange willst du mich hier warten lassen?«
»Komm herein,« antwortete ich, »ist ja nicht abgeschlossen.«
Krachend flog die Türe auf. Der lange Mediziner stolperte ins Zimmer und brannte die Kerze an.
»Raus aus dem Bett!« schrie er.
Ich warf einen entsetzten Blick nach der Uhr. »Aber erlaube mal, ist ja noch nicht vier Uhr! Ich habe kaum zwei Stunden geschlafen.«
»Und ich überhaupt nicht,« lachte er, »komme grad von der Kneipe. Raus aus dem Bett, sag ich dir, und geschwind in die Kleider, Füchslein!«
»Aber was ist denn los? Ein Vergnügen ist das nicht.«
»Soll's auch nicht sein. Zieh dich an, ich erzähle dir derweil.«
Während ich mühsam den Schlaf aus den Augen wusch und zähneklappernd in die Hosen fuhr, setzte er sich schnaufend auf den Sessel und paffte seine grässliche Brasilzigarre. Ich hustete und spuckte.
»Kannst wohl den Rauch nicht vertragen, Füchslein?« rülpste er. »Na, wirst dich schon dran gewöhnen! Also pass auf, heute morgen haben wir eine Pistolenkiste, draussen im Kottenforst. Ich bin Sekundant und der Gossler wollte auch mitkommen. Nun haben wir zwei durchgebummelt, um pünktlich zur Stelle zu sein, da ist der Kerl mir schlapp geworden. Das ist alles. Also eil dich!«
Ich unterbrach mein Gurgeln: »Ja aber — was soll ich denn dabei?«
»Du? — Herrgott, bist du ein Rindvieh! Ich hab doch keine Lust, allein da rauszufahren, stundenlang. Ich nehm dich mit. Fertig!«
Es war eine scheussliche Nacht. Regen, Wind und aufgeweichte Strassen. Wir liefen über die Gassen zum Korpshause, da wartete unser Wagen. Die andern waren schon vorausgefahren.
»Natürlich!« schimpfte der Leibbursch. »Da sitzen wir, nüchtern wie die Schweine, und der Korpsdiener hat den Frühstückskorb mit. Lauf hinauf, Füchslein, sieh zu, ob du im Kneipzimmer eine Flasche Kognak erwischst.«
Schellen, warten, fluchen, frieren; aber ich bekam meinen Kognak. Wir stiegen ein und der Kutscher hieb auf die Gäule.
»Heut ist der dritte November!« sagte ich. »Mein Geburtstag, der fängt nett an.«
»Trink!« rief mein Leibbursch.
»Und einen Jammer hab ich auch. Und was für einen!«
»Trink doch, Rhinozeros!« schrie er. Er paffte mir den ekelhaften Rauch ins Gesicht, dass ich fast seekrank wurde.
»Warte, mein Junge,« grinste er, »ich werde dir den Jammer vertreiben.«
Und nun erzählte er Medizinergeschichten vom Seziertisch. Ho, er war ein Kerl! Ass sein Butterbrot im Leichensaal, ohne die Finger zu waschen, mitten zwischen dem Präparieren. Ho, abgeschnittene Beine und Arme, blossgelegte Hirne, kranke Lebern und Nieren und Gebärmütter, das gefiel ihm. Je fauler, je besser, schön verwesen lassen, den Dreck. Und dann doch ein Präparat herauskitzeln, blitzsauber alle Muskeln und Venen.
Natürlich trank ich. Aus der Flasche, einen Schluck nach dem andern. Zwanzig Geschichten erzählte er mir und eine verfaulte Milz war noch das Appetitlichste, das darin vorkam. Verdammt noch mal, das lernt man im Korps; seine Nerven meistern.
Zwei Stunden, dann hielt der Wagen. Wir krochen hinaus und wateten vom Wege in den Wald hinein. Im dämmernden Morgennebel durch die kahlen Bäume.
»Wer knallt denn heute eigentlich?« fragte ich.
»Halt's Maul! Wirst es schon früh genug sehn«, brummte der Leibbursch. Er war plötzlich schweigsam geworden. Ich hörte, wie er laut schluckte und seine Trunkenheit hinunterwürgte. Wir kamen auf eine Lichtung, etwa ein Dutzend Menschen standen da herum.
»Fax!« rief der Leibbursch.
Unser Korpsdiener kam in langen Sprüngen hergelaufen.
»Soda!« Der Korpsdiener brachte den Korb; drei Flaschen Soda trank der Leibbursch.
»Schweinezeug!« brummte er und spie aus. Aber ich sah wohl: er war völlig nüchtern geworden.
Wir gingen über den Platz und grüssten. Da standen bei ihren ausgebreiteten Verbandskästen zwei Ärzte, der eine war ein Alter Herr von uns. Dann drei Korpsburschen von Marchia und deren Korpsdiener, der mit dem unsern plauderte. Und, ganz allein, abseits an einen Baum gelehnt, ein kleiner Jude.
Jetzt wusste ich, um was es sich handelte. Das war Selig Perlmutter, Stud. phil., und er sollte sich mit dem langen Märker schiessen. Eine Wirtshausgeschichte; die Märker hatten in ihrem Stammlokal gesessen, als Perlmutter mit ein paar Freunden hereintrat, laut begrüsst von wütenden: »Juden raus!« Die andern gingen, aber Perlmutter hatte schon den Hut an den Haken gehängt; er wollte nicht weichen, setzte sich und rief nach Bier. Da war der Märker aufgesprungen, hatte ihm den Stuhl von hinten weggezogen, dass er zur Erde fiel unter lautem Gejohle der Korpsbrüder. Hatte dann den Hut vom Ständer gerissen und zur Türe hinausgeworfen in den Kot. »Marsch nach, Saujud!« Aber der kleine Jude war kreideweiss aufgesprungen, hin zu dem langen Märker, und hatte ihm, klatsch! eine Ohrfeige mitten ins Gesicht geschlagen. Dann freilich war er unter Hieben und Tritten aus dem Lokal geflogen. Andern Tags hatte der Märker ihm seinen Kartellträger geschickt und der Jude hatte angenommen: fünf Schritt Distanz, dreimaliger Kugelwechsel.
Selig Perlmutter hatte bei uns Waffen belegt. »Was will man machen,« hatte mein Leibbursch gesagt, der als zweiter Chargierter alle Ehrenhändel zu erledigen hatte, »Waffenschutz muss man jedem honorigen Studenten geben! Und ein honoriger Student ist man, hol mich der Teufel, so lange man noch keine silbernen Löffel gestohlen hat, selbst wenn man Se — se — selig P — P — P — Perelmutter heisst!« Der kleine Jude stotterte nämlich derartig, dass er nicht einmal seinen eigenen Namen sprechen konnte, er hatte damals wohl eine Viertelstunde gebraucht, um sein Anliegen glücklich herauszubringen.
Da stand er an einen Baum gelehnt, den verschlissenen Mantelkragen hochgeschlagen. Herrgott, war er hässlich! Die schmutzigen Schuhe mit den schiefen Absätzen bogen sich nach innen, darüber schlotterten die zerfransten Hosen. Ein mächtiger Nickelkneifer mit langer schwarzer Schnur hing schief über der ungeheuren Nase, die fast die blauroten, zersprungenen Lippen bedeckte. Sein gelber, pockennarbiger und grässlich unreiner Teint schien noch eine Nuance fahler. Die Hände staken tief in den ausgeweiteten Manteltaschen, er starrte auf den lehmigen Boden.
Ich trat auf ihn zu, streckte ihm die Hand entgegen: »Guten Morgen, Herr Perlmutter.«
»Wa — warum — warum eigentli — li — lich —« stotterte er.
»Leibfuchs, bring sofort den Pistolenkasten!« rief schrill mein Leibbursch.
Ich drückte kräftig die schmutzige Hand, die er mir zögernd bot. Lief zu unserm Korpsdiener, nahm den Pistolenkasten und brachte ihn dem Leibburschen.
»Bist du verrückt?« zischte er mich an. »Was fällt dir ein, mit dem Judenbengel zu schwatzen?«
Der Unparteiische, der erste Chargierte der Preussen, sprach ein paar Worte mit den Sekundanten, dann mass er in langen Sprungschritten die Distanz. Die beiden Gegner wurden an ihre Plätze geführt.
»Meine Herrn,« begann der Preusse, »es ist meine Pflicht als Unparteiischer, wenigstens den Versuch zu machen, eine Versöhnung herbeizuführen.«
Er machte eine kleine Pause.
»Ich mö — mö — möchte —« stotterte leise der kleine Jude, »we — we — wenn —«
Mein Leibbursch sah ihn wütend an und hustete, so laut er konnte; verschüchtert schwieg jener.
»Also die Herrn lehnen eine Versöhnung ab«, stellte schnell der Unparteiische fest. »Ich bitte Sie nun auf mein Kommando zu achten, ich werde zählen: eins — zwei — drei. Zwischen eins und drei dürfen die Herren schiessen, nicht aber vor eins und nach drei.«
Die Pistolen wurden umständlich geladen, die Sekundanten losten darum. Mein Leibbursch brachte eine Pistole seinem Paukanten.
»Herr Perlmutter,« sagte er förmlich, »hier übergebe ich Ihnen eine Waffe unseres Korps. Es ehrt Sie, dass Sie sich entschlossen haben, auf studentisch-ritterliche Art Ihren Streithandel auszufechten, anstatt zum Kadi zu laufen. Ich hoffe nun, dass Sie unseren Waffen auch hier auf dem Platze Ehre machen werden.« Er drückte ihm die Pistole in die Hand. Herr Perlmutter nahm sie, aber sein Arm zitterte so, dass die Hand sie kaum zu halten vermochte.
»Zum Teufel, fuchteln Sie doch nicht so herum mit dem Schiessprügel!« fuhr ihn mein Leibbursch an. »Lassen Sie doch den Arm gesenkt. Auf das Kommando: Eins! heben Sie blitzschnell die Pistole und knallen los. Geben Sie sich keine Mühe auf den Kopf zu zielen, Sie können ja doch nicht schiessen. Zielen Sie ruhig auf den Bauch, das ist das sicherste! Und wenn Sie geschossen haben, halten Sie die Pistole hoch vor's Gesicht, das ist Ihre einzigste Deckung. Sie nutzt zwar nicht viel, aber möglich ist's doch immerhin, dass Ihr Gegner, wenn er später als Sie schiesst, statt Ihrer Person das Schiessgewehr trifft. Und ruhig Blut, Herr Perlmutter!«
»Da — da — danke —« sagte der Jude.
Mein Leibbursch fasste mich unter den Arm und ging mit mir in den Wald zurück.
»Ich möchte wirklich wünschen, dass unser Zinkenkönig dem Märker eins aufbrennt«, brummte er. »Ich kann den Kerl nicht leiden. Ausserdem ist er ganz sicher selbst ein Jud!«
»Aber er ist doch der grösste Judenfresser im ganzen S. C.« wandte ich ein.
»Eben darum! Ich habe die Märker schon lange in Verdacht, dass sie Juden nehmen. Guck doch mal seine Nase an! Getauft mag er ja sein, und die Eltern auch — aber ein Jud ist er doch. Und das schreit dann am meisten! Unsere stotternde Spottgeburt aus saurem Bier und Spucke ist mir ordentlich sympathisch, weil sie dem langen Märker eine geklebt hat. Und es ist eigentlich ein Skandal, dass wir den armen Teufel hier herausschleppen und wie ein Kalb zur Schlachtbank führen.«
»Ja — aber er wollte sich doch versöhnen«, meinte ich. »Wenn du nicht so gehustet hättest —«
Er schnitt das Gespräch ab: »Halt's Maul, Fuchs, das verstehst du nicht.«
Alle waren zur Seite in die Büsche getreten, nur die beiden Gegner standen allein auf der Lichtung in der grauen Dämmerung.
»Also Achtung!« rief der Unparteiische. »Ich zähle: Eins — — — Zwei — — —«
Der Märker schoss, seine Kugel klatschte laut in einen Baum; Herr Perlmutter hatte nicht einmal seine Pistole erhoben. Alle kamen auf die beiden zu.
»Ich frage an, ob von seiten Normannias geschossen wurde?« fragte der Sekundant der Märker.
»Der Paukant von Normannia hat nicht geschossen«, konstatierte der Unparteiische.
Wütend eilte mein Leibbursch zu seinem Klienten.
»Herr!« schnaubte er ihn an. »Sind Sie wahnsinnig? Meinen Sie, wir wollten wegen Ihnen solche Schweinereien im Paukbuch stehen haben? Schiessen Sie, wohin Sie wollen, aber knallen Sie los! Machen Sie sich meinethalben die ganze Hose voll, aber schiessen Sie, zum Teufel noch mal! Fühlen Sie denn nicht, dass Sie das ganze Korps blamieren, dessen Waffenschutz Sie gemessen?«
»Ich mö — möchte —« stammelte der kleine Jude. Von seiner Stirne tropften dicke schmutzige Tropfen.
Aber niemand achtete auf ihn. Die beiden erhielten andere Pistolen und wieder zogen sich alle zurück.
»Eins — — Zwei — — und — — Drei.«
Gleich nach eins hatte der Märker geschossen, seine Kugel schlug in einen Stumpf ein, drei Meter von seinem Gegner. Perlmutter hatte wieder die Pistole nicht erhoben, sein Arm schlenkerte in nervösen Stössen hin und her.
— »Ich frage an, ob von Seiten Normannias diesmal geschossen wurde?«
»Der Paukant von Normannia hat es vorgezogen, auch diesmal nicht zu schiessen.«
Die Märker grinsten, der Preusse lächelte von oben herunter. Mein Leibbursch sah sie mit wütenden Blicken an.
»So ein Pack!« knirschte er. »Eine Schweinerei, dass ich der Bande nicht an den Hals kann!«
»Wieso?« fragte ich.
»Herrgott, so dumm kann nur ein krasser Fuchs fragen!« fauchte er. »Du weisst doch, dass hier Burgfriede herrscht, dass man während der Dauer einer Mensur nicht kontrahieren darf! — Aber heute abend erhalten die drei feinen Herrn von Marchia jeder eine schwere Säbelforderung von mir. Ich wette, da werden sie andere Gesichter machen. Zu Mus werde ich sie hacken, zum Henker noch mal! Schau doch, wie sie feixen, wie sie Triumph heulen über unsern armen Jammerlappen!«
Seinem Klienten gegenüber zog er diesmal eine andere Seite auf.
»Herr Perlmutter, ich appelliere jetzt nicht an Ihren Mut, das scheint ja nichts zu nützen, sondern an Ihren Verstand«, sagte er sehr ruhig. »Sehen Sie mal, Sie haben doch gewiss keine Lust, sich hier wie ein Schwein abstechen zu lassen. Nun haben Sie aber keine andere Möglichkeit, dem zu entgehen, als dass Sie selbst schiessen. Das muss Ihnen doch Ihr Selbsterhaltungstrieb sagen! Wenn Sie Ihren Gegner in den Bauch schiessen, garantiere ich Ihnen, dass er Ihnen nichts mehr tun kann, und ein gutes Werk haben Sie obendrein noch getan.« — Dann wurde er fast sentimental. »Es ist doch wirklich viel angenehmer für Sie, wenn Sie mit heiler Haut hier wegkommen, Herr Perlmutter. Denken Sie doch an Ihre armen Eltern!«
»Ich habe k — k — keine Eltern me — mehr«, sagte der Jude.
»Nun, so denken Sie an ihre Geliebte —« fuhr mein Leibbursch fort, aber er stutzte, als er des Juden hässliches Gesicht betrachtete, das plötzlich ein grauenhaftes, seltsam wehmütiges Grinsen entstellte.
»Verzeihung, Herr Perlmutter, ich verstehe ja, dass Sie mit Ihrem — na, wie nennen Sie's denn? — mit Ihrem — Ponem — keine Geliebte haben! Entschuldigen Sie — ich wollte Sie wirklich nicht verletzen. Aber etwas haben Sie doch gewiss — vielleicht — vielleicht einen — Hund?«
»Ich habe — einen k — k — kleinen Hund!«
»Also sehen Sie, Herr Perlmutter, etwas hat jeder Mensch. Ich habe auch einen Hund, und ich glaube nicht, dass es etwas gibt, das ich lieber hätte. — Denken Sie also an Ihren Hund! Stellen Sie sich die Freude vor, wenn Sie gesund wiederkommen, wenn das Viech an Ihnen heraufspringt und bellt und jubelt und mit dem Schwanze schlägt. Denken Sie an Ihren Hund und — — auf das Kommando: Eins! — schiessen Sie.«
»Ich we — werde schiessen«, würgte der kleine Jude. Zwei dicke Tränen kullerten über die Pockennarben und Hessen helle Streifen zurück. Er fasste die Pistole fester an, die ihm mein Leibbursch gab. Er sah ihn wehmütig, elend bittend an, irgendein Wunsch quälte ihn.
»Ich — — w — we — wenn —« stotterte er.
Aber mein Leibbursch half ihm. »Sie wollen mich bitten, für Ihren Hund zu sorgen, wenn Ihnen etwas zustossen sollte? Ist es das, Herr Perlmutter?«
»Ja!« sagte der kleine Jude.
»Nun, darauf gebe ich Ihnen mein Wort und werd's halten, so wahr ich ein Korpsbursch bin! Das Tier soll's gut haben, verlassen Sie sich darauf.« Er streckte ihm die Hand hin, die der Jude ergriff.
»Da — danke sehr.«
— »Sind die Herrn bereit?« fragte der Unparteiische.
»Jawohl!« rief mein Leibbursch. — »Schiessen Sie, Herr Perlmutter, schiessen Sie: es ist Notwehr. Denken Sie an Ihren Hund und schiessen Sie!«
Wir gingen wieder hinter die Bäume, der Unparteiische stand dicht neben mir. Meine Augen hingen an dem kleinen Juden.
»Also Achtung: — — Eins — —«
Herr Perlmutter riss seine Pistole in die Höhe und knallte, die Kugel flog irgendwo hoch durch die Äste. Er stand da, den Arm weit ausgestreckt.
»Bravo!« murmelte mein Leibbursch.
»Zwei — —«
»Wenn der Märker einen Funken von Anstand im Leibe hat, schiesst er jetzt in die Luft«, brummte er wieder.
»Und — — Drrrei!«
Auf Schlag drei krachte des Märkers Schuss.
Selig Perlmutter öffnete den Mund, hell und klar kamen die Worte von seinen Lippen. Zum ersten Male in seinem Leben stotterte er nicht. Nein wirklich, er sang, sang ganz laut:
»Es leben die Studenten
Nur in den Tag hi — nein — —«
Die Pistole glitt ihm aus der Hand, mit einem dumpfen Krach fiel er vornüber. Wir sprangen auf ihn zu, sorgfältig wandte ich ihn um.
Die Kugel war ihm mitten durch die Stirn gegangen; ein kleines rundes Loch — —
»Das werd ich ihm halten, was ich ihm versprach«, flüsterte mein Leibbursch. »Der Fax soll den Köter heute noch holen, er wird schon Freundschaft schliessen mit meinem Nero. Und die beiden Biester werden sich freuen, wenn ich ihnen nächste Woche erzählen werde, wie ich die edlen Herrn von Marchia vermöbelt habe. — Gute Nacht, Selig Perlmutter,« fuhr er noch leiser fort, »du warst ein dreckiger Speiekel, der seinem Namen wenig Ehre machte! — Aber hol mich der Teufel, ein honoriger Student warst du doch, und die Märker sollen mir's entgelten, dass sie dich so elend zusammengeschossen haben. Das bin ich schon deinem Köter schuldig. — Hoffentlich hat das Viech nicht zuviel Flöhe. —«
Die Ärzte traten hinzu, tupften mit Watte an der Wunde herum, schoben ein Gazetampon hinein, um die Blutung zu stillen.
»Glatt Rest!« sagte unser Alter Herr. »Es bleibt nichts übrig, als den Totenschein auszustellen.«
»Wollen wir frühstücken?« schlug der Unparteiische vor.
»Danke sehr!« erwiderte mein Leibbursch sehr förmlich. »Wir müssen unsere Pflicht gegenüber unserm Paukanten erfüllen. Fass an, Leibfuchs!«
Wir nahmen die Leiche auf und trugen sie mit Hilfe der Korpsdiener durch den Wald zu der Strasse hin, hoben sie in unsern Wagen.
»Wissen Sie hier Bescheid, Kutscher?« fragte mein Leibbursch.
»Nee.«
»Aber irgendwo liegt doch hier im Wald ein Gemeindekrankenhaus?«
»Ja, Herr, das grosse von Denkow.«
»Wie weit von hier?«
»Na zwei Stunden!«
»Also dahin, das ist das nächste! Da werden wir ihn schon loswerden.«
Wir sassen auf den Rücksitzen, der Korpsdiener mir gegenüber. Auf dem andern Vorderplatz sass Herr Selig Perlmutter; es hatte einige Zeit gedauert, ihn in die sitzende Stellung zu bringen. Die Pferde zogen an, man musste ihn festhalten, dass er nicht vornüber kippte.
»Merkst du jetzt, dass es gut war, dass ich dich vorhin etwas abgehärtet habe, Leibfuchs? Jetzt kannst du deine Nerven gebrauchen. Fax, öffnen Sie den Frühstückskorb!«
»Ich danke«, sagte ich, »ich möchte nicht essen.«
»So?« fuhr der Leibbursch auf. »Du dankst? Und ich sage dir, du wirst essen und trinken, dass die Schwarte kracht! Ich habe die Verantwortung für dich, mein Junge, und ich habe keine Lust, dich mit einem Kollaps nach Hause zu bringen. Prosit!«
Er goss mir ein grosses Glas Kognak ein, ich stürzte es herab. Ich würgte an den Schinkenbroten; ich glaubte, ich würde nicht eines herunterbekommen, aber ich ass vier, spülte sie mit Kognak hinunter.
Der Regen hatte mit frischer Kraft eingesetzt, goss in Bächen gegen die zitternden Scheiben. Die Kutsche stolperte über die aufgeweichten Wege; abwechselnd musste einer von uns dem Toten gegenüber sitzen, um ihn festzuhalten. Um zehn Uhr sollten wir ankommen, einer nach dem andern zog die Uhr heraus. Keiner sprach, selbst mein Leibbursch vergass es, Witze zu machen. Nur: »Prosit, prosit!« Und wir tranken.
Endlich waren wir am Ziele und sprangen aus dem Wagen. Der Korpsdiener lief durch den Garten dem Hause zu, derweil gaben wir dem Kutscher zu essen und zu trinken.
Zwei Wärter kamen heraus und ein älterer Herr, der Leiter der Anstalt. Mein Leibbursch stellte sich vor und eröffnete sein Anliegen, das dem Arzte augenscheinlich sehr peinlich war.
»Verehrter Herr Kollege«, sagte er, »die Angelegenheit ist recht unangenehm, wir sind durchaus nicht auf solche Fälle eingerichtet. Ich weiss wirklich nicht, wohin mit der Leiche. Könnten Sie nicht vielleicht —«
Aber mein Leibbursch blieb fest. »Unmöglich, Herr Sanitätsrat, wohin denn? Übrigens sind Sie verpflichtet, uns die Leiche abzunehmen und die Meldung zu machen. Das Duell fand in den Grenzen Ihrer Gemeinde statt.«
Der Chefarzt spielte mit seiner Uhrkette. Unvermittelt fragte er den Kutscher: »Können Sie mir die Stelle beschreiben?«
Der Kutscher tat das, so gut er konnte. Da hellte sich das vertrocknete Gesicht auf: »O, ich bedauere ausserordentlich, meine Herren! Aber diese Lichtung liegt gerade ausserhalb unserer Grenze, sie gehört zur Gemeinde Hugen. Fahren Sie dorthin, zur Provinzialirrenanstalt, dort wird man Ihnen die Leiche abnehmen.«
Mein Leibbursch biss die Zähne übereinander.
»Wie lange dauert es?«
»Nun, zweieinhalb bis drei Stunden, wenn Sie zufahren.«
»So — wenn wir zufahren? Das heisst wenigstens vier Stunden bei dem Wetter für unsere abgetriebenen Gäule, die seit fünf Uhr früh auf dem Weg sind!«
»Es tut mir sehr leid, meine Herrn.«
Mein Leibbursch nahm einen neuen Anlauf. »Herr Sanitätsrat, wollen Sie uns wirklich in diesem Zustand fortschicken? Ich lamentiere nicht gern, aber ich versichere Sie bei meiner Ehre, dass unsere Nerven auf der Fahrt zu Ihnen das äusserste geleistet haben.«
»Es tut mir wirklich sehr leid«, wiederholte der Arzt, »aber ich darf nicht einmal Ihnen die Leiche abnehmen. Sie müssen sie in dem zuständigen Gemeindebezirke abliefern. Ich kann die Verantwortung nicht auf mich nehmen.«
»Nun, Herr Sanitätsrat — — ich würde in einem solchen Falle dennoch die Verantwortung auf mich nehmen.«
Der alte Herr zuckte die Achseln.
Mein Leibbursch verbeugte sich stumm. »Also los, Kutscher, zur Provinzialirrenanstalt im Walde von Hugen!«
Nun aber streikte der Kutscher. Er wäre nicht verrückt, und er würde seine Gäule nicht zu Tode schinden. Mit einer halben Wendung blickte mein Leibbursch noch einmal den Sanitätsrat an, der zuckte wieder mit den Achseln. Da trat der Leibbursch an den Kutschbock:
»Sie fahren, verstehen Sie! Was aus den Gäulen wird, ist gleichgültig, das ist meine Sache! Und Sie bekommen hundert Mark Trinkgeld, wenn wir in vier Stunden in Hugen sind!«
»Jawohl, Herr Doktor«, sagte der Kutscher. Da drängte sich der Korpsdiener heran. »Ich möchte auf dem Bock fahren, wenn's den Herrn recht ist. Es ist doch bequemer für Sie zu drei, es ist ja so eng da drinnen.«
Mein Leibbursch lachte laut auf und fasste ihn an den Ohren.
»Du bist zu rücksichtsvoll, Fax, aber wir wollen dir nichts schuldig bleiben. Du könntest dich ja erkälten da oben im Regen, und da würde deine Hausehre jammern! Also marsch hinein in den Wagen!« — Er wandte sich noch einmal sehr kühl zu dem Anstaltsarzt. »Ich bitte Sie, Herr Sanitätsrat, unsern Kutscher genau über den Weg zu instruieren!«
Der alte Herr rieb sich die Hände. »Aber gern, verehrter Herr Kollege, von Herzen gern. Alles was ich für Sie tun kann —« Und er beschrieb in allen Einzelheiten dem Kutscher den Weg.
»O diese infame Canaille!« zischte mein Leibbursch. »Und ich kann ihn nicht einmal fordern.«
Wir sassen wieder im Wagen. Mit dem Plaidriemen, an dem der Korpsdiener den Frühstückskorb getragen hatte und mit unsern Hosenträgern banden wir den Toten so gut es gehen wollte in seiner Ecke fest, um wenigstens in etwas der grässlichen Aufgabe enthoben zu sein, ihn immerfort stützen zu müssen. Dann lehnten wir uns in die Ecken zurück.
Es schien überhaupt nicht Tag werden zu wollen. Immer noch herrschte diese drückende graue Dämmerung, der Wolkenhimmel lag fast auf der Erde. Die Strasse war von dem strömenden Regen so aufgeweicht, dass wir ein über das andere Mal im Kote stecken blieben, der Dreck spritzte in gelben Lehmstreifen hoch an die Fenster hinauf. Unsere Absicht, durch ein freies Fleckchen im Glase hinauszuspähen, blieb vergeblich, kaum vermochten wir die Bäume an den Seiten zu erkennen. Jeder von uns gab sich die unerhörteste Mühe, seiner Stimmung Herr zu werden; aber es ging nicht, die grässliche kalte Stickluft in dem kleinen Räume kroch in Nüstern und Mund und klebte auf allen Poren.
»Ich glaube, er stinkt schon«, sagte ich.
»Na, das hat er im Leben wahrscheinlich auch getan«, antwortete mein Leibbursch. »Da, brenn dir eine Zigarre an!« — Er sah mich und den Korpsdiener an: ich glaube, unsere Gesichter waren nicht weniger bleich wie das des Toten. — »Nein«, sagte er, »so geht's nicht weiter. — — — Machen wir einen Frühschoppen!«
Die Rotweinflaschen wurden entkorkt, und wir tranken. Der Leibbursch kommandierte:
»Wir singen als erstes offizielles Lied: Weg mit den Grillen und Sorgen!«
Und wir sangen:
»Weg mit den Grillen und Sorgen!
Brüder, es lacht ja der Morgen
Uns in der Jugend so schön!
Ja so schön!Lasst uns die Becher bekränzen,
Lasst bei Gesängen und Tänzen
Uns in die Unterwelt gehen, gehen,
Bis uns Zypressen umwehn!«
— — — »Schönes Lied ex! Ein Schmollis den fröhlichen Sängern!«
Ja, wir tranken! Einer Flasche nach der andern brachen wir den Hals und tranken. Dazu sangen wir. Wir sangen und tranken. Wir soffen und brüllten.
— »Ein Trauersalamander auf das Wohl unseres stillen Gastes, des Herrn Selig Perlmutter! — Ad exercitium Salamandris eins — zwei — drei! — Salamander ex est! — Der Fax hat nachgeklappt, Rest weg!«
— »Na, zum Teufel, Perlmutter, alter Bierschisser, Sie können doch wenigstens Prost sagen, wenn man einen Salamander auf Sie reibt? Da trink mal, du Knacker!« Der Leibbursch hielt ihm sein Glas unter die Nase. »Willst nicht, Freundchen? Na warte!« Und er goss ihm den roten Wein durch die Lippen. »So — prosit! Und wohl bekomm's!«
Der Korpsdiener, längst völlig betrunken, krähte vor Vergnügen. »He, he! Rauchen gefällig?« Er brannte sorgsam eine lange Virginia an und klemmte sie dem Toten zwischen die Zähne: »Wein und Tobak, da lebt sich gut!«
»Sakrament, Kinder!« rief der Leibbursch dazwischen. »Ich habe ja ein Spiel Karten bei mir, wir werden einen Skat kloppen! Zu Vieren, einer passt!«
»Das wird wohl meist der Herr Perlmutter sein«, sagte ich.
»Was fällt dir ein? Der spielt so gut wie du. Sollst mal seh'n! — Los, du gibst, Leibfuchs.«
Ich verteilte die Karten und nahm zehn für mich auf.
»Nichts da, Füchschen, die gibst du dem Herrn Perlmutter. Steck sie ihm nur in die Finger; er spielt selbst. Freilich ist er etwas abgespannt heute, was wir ihm nicht weiter übelnehmen dürfen. Deshalb musst du ihm ein wenig helfen.«
Ich nahm des Toten Arm auf und steckte ihm die Karten zwischen die Finger.
»Passe!« sagte der Leibbursch.
»Tournée!« rief der Korpsdiener.
»Grand mit Vieren!« erklärte ich für Herrn Perlmutter.
»Donnerwetter noch mal! So ein Duselfritze!«
»Ouvert! Schneider und Schwarz angesagt!« fuhr ich fort.
»So ein Sauglück!« gröhlte mein Leibbursch.
»Jetzt gewinnt der Jude noch nach seinem Tode ein Vermögen.«
Wir spielten ein Spiel nach dem andern und immer gewann der Tote. Nicht ein Spiel liess er aus.
»Himmelherrgott«, fluchte der Korpsdiener, »wenn er nur halb so gut hätte schiessen können. Ein Glück, dass wir ihm nichts zu bezahlen brauchen.«
»Nicht bezahlen?« schnaubte mein Leibbursch. »Nicht bezahlen willst du, infamige Laus? Weil der arme Kerl tot ist, willst du dich vom Bezahlen drücken? Sofort heraus mit dem Geld und gib es ihm in die Tasche! Wieviel macht es, Leibfuchs?«
Ich machte die Rechnung, und jeder steckte die Silberstücke in des Toten Tasche. Mein Blick fiel auf die Karte, auf der ich angeschrieben hatte, es war die Einladung einer befreundeten Familie, die mich heute zur Feier meines Geburtstages zum Essen gebeten hatte. Unwillkürlich seufzte ich.
»Was hast du?« fragte mein Leibbursch.
»Ach nichts, mir fiel nur eben wieder ein, dass heute mein Geburtstag ist.«
»Ist ja wahr, ich habe es ganz vergessen. Also, prosit Füchslein, sollst leben! Ich gratuliere.«
»Ich gratuliere auch«, rief der Korpsdiener.
Da erscholl aus der Ecke eine stockernde Stimme:
»Ich g — g — gr — gr — gratuliere auch.«
Wir liessen die Gläser fallen. Was war das? Wir blickten in die Ecke. Starr hing der Tote in den Riemen; der Körper schwankte, aber keine Regung bewegte das Gesicht. Die lange Virginia klebte noch zwischen den Zähnen. Ein dünner schwarzer Blutstreif triefte seitwärts über die Nase und die aschfahlen Lippen. Nur der kotbespritzte Nickelkneifer, den er auch im Falle nicht verloren, zitterte ein wenig hin und her.
Mein Leibbursch fasste sich zuerst. »So ein Blödsinn!« sagte er. »Mir war, als ob — — — Ein anderes Glas!«
Ich nahm ein neues Glas aus dem Korbe und goss es voll.
»Prosit!« rief er.
»P — Pr — Prosit!« — klang es aus der Ecke.
Der Leibbursch fasste sich mit der Hand an die Stirn, dann goss er schnell den Wein hinunter. »Ich bin besoffen«, murmelte er.
»Ich — auch«, stammelte ich und drückte mich fest in die Ecke, möglichst weit fort von dem grässlichen Nachbar.
»Einerlei!« schrie mein Leibbursch. »Wir spielen weiter. Fax, Sie sind am Geben.«
»Ich mag nicht mehr spielen«, wimmerte der Korpsdiener.
»Angströhre, wovor fürchten Sie sich? — Vielleicht, dass Sie noch mehr verlieren?«
»Er mag all mein Geld haben — aber ich rühre keine Karte mehr an«, heulte jener.
»Memme!« rief der Leibbursch.
»M — M — Memme!« stotterte es aus der Ecke.
Eine entsetzliche Angst packte mich. »Kutscher«, schrie ich, »Kutscher! Anhalten! Halt! Halt! Um Gottes willen Halt!« Aber der hörte nicht, klatschte weiter auf die Gäule durch Regen und Kot.
Ich sah, wie mein Leibbursch sich in die Unterlippe biss, zwei Blutstropfen krochen über das Kinn. Er richtete sich steif auf, füllte von neuem sein Glas.
»Ich werde euch zeigen, dass ein Korpsbursch von Normania keine Angst kennt.« Dann wandte er sich zu dem Toten. »Herr Selig Perlmutter«, sagte er langsam und jedes Wort mühsam betonend, »ich habe Sie heute als durchaus honorigen Studenten schätzen gelernt: gestatten Sie, dass ich Ihnen Schmollis anbiete?« Er goss den Rotspon hinunter. — »So! Und nun, lieber Perlmutter, bitte ich dich, uns nicht mehr zu belästigen. Wir sind zwar alle total besoffen, aber soviel Direktion habe ich doch noch im Leibe, dass ich genau weiss, dass ein toter Jude nicht mehr reden kann! Also halte gefälligst das Maul!«
Da grinste Selig Perlmutter und lachte ganz laut:
»Ha — ha — ha!«
»Still!« schrie mein Leibbursch. »Still, du Hund, oder —«
Aber Selig Perlmutter feixte:
»Ha — ha — ha!«
»Den Pistolenkasten! — Wo ist der Pistolenkasten?« Der Leibbursch zog den schmalen Kasten unter dem Sitze hervor, stiess ihn auf und riss eine Waffe heraus. »Ich schiess dich tot, du Aas, wenn du noch ein Wort von dir gibst!« schrie er in wahnsinniger Wut.
Aber Selig Perlmutter krähte:
»Ha — ha — ha!«
Da hielt er ihm den Lauf gerade ins Gesicht und schoss los. Es krachte, als ob der ganze Wagen auseinanderfliegen müsse.
Aber durch den Pulverdampf hindurch klang noch einmal das entsetzliche Lachen des Selig Perlmutter — lange — lange, als ob er nie wieder aufhören wolle:
»Ha — ha — ha — ha — —«
— — — Ich sah, wie mein Leibbursch vornüber fiel, stöhnend, über des Toten Knie. Ich hörte aus der andern Ecke das jämmerliche Winseln des Korpsdieners — — —
Und durch viele Ewigkeiten hin fuhren wir weiter, immer weiter durch den furchtbaren grauen Regentag — — —
— — Wie wir ankamen — — das alles erinnere ich nur wie im Nebel: ich weiss, dass man uns den Toten abnahm und dass man den Leibbursch auch heraustrug. Ich hörte ihn schreien und brüllen, ich sah, wie er um sich schlug und wie ihm der Schaum vor den Mund trat. Ich sah, wie sie ihm die Zwangsjacke anlegten und in die Anstalt brachten. Er ist heute noch dort. Akute Paranoia, hervorgerufen durch chronische Alkoholvergiftung, stellten die Ärzte fest.
— Den Hund nahm ich zu mir, es war ein grässlicher kleiner Bastard. Zehn Jahre lang habe ich ihn gehabt, aber er hat mich nie leiden mögen, was ich auch immer anstellte, um sein Wohlwollen zu gewinnen. Immer schnappte er nach mir und kläffte mich an. Einmal fand ich ihn in meinem Bett, das er völlig verschmutzt hatte. Als ich ihn wegjagen wollte, biss er mir die Finger blutig, da hab ich ihn erwürgt, so, mit meiner Hand.
Das war vor vier Jahren, an einem Gedenktage, dem dritten November — —
Verstehen Sie nun, meine Herren, warum gerade dieses Datum einen so hässlichen Beigeschmack für mich hat?
Ich hân gesehn in der
werlte ein michel wunder.
—Walter v. d. Vogelweide.
Zimmer suchen! Das ist so eine der unangenehmsten Beschäftigungen. Treppauf, treppab, aus einer Strasse in die andere, immer dieselben Fragen und Antworten, — o du arme Seele!
Seit zehn Uhr war ich unterwegs, nun war's drei mittlerweile. Müde wie ein Karusselpferd natürlich.
Also noch mal hinauf, drei Stockwerk.
»Ich möchte die Zimmer sehen.«
»Bitte.«
Die Frau führte mich durch den dunklen Gang, dann öffnete sie eine Türe.
»Hier.«
Ich trat hinein. Das Zimmer war groß, geräumig und nicht allzu erbärmlich möbliert. Diwan, Schreibtisch, Schaukelstuhl, alles war da.
»Wo ist das Schlafzimmer?«
»Die Türe links.«
Die Frau öffnete und zeigte mir den Raum. Ein englisches Bett sogar! Ich war entzückt.
»Der Preis?«
»Sechzig Mark monatlich.«
»Schön. Wird Klavier gespielt hier? Sind kleine Kinder da?«
»Nein, ich habe nur eine Tochter, die in Hamburg verheiratet ist. Klavier wird auch nicht gespielt, nicht einmal unten.«
»Gott sei Dank!« sagte ich. »Also ich miete die Zimmer.«
»Wann wollen Sie einziehen?«
»Wenn es geht, heute noch.«
»Gewiss geht es.«
Wir traten wieder in das Wohnzimmer. Da war gerade gegenüber noch eine Tür.
»Sagen Sie mal,« fragte ich die Frau, »wohin führt diese Türe?«
»Da sind noch ein paar Zimmer.«
»Bewohnen Sie die?«
»Nein, ich wohne nach der andern Seite. — Die Zimmer sind augenblicklich leer, sie sollen noch vermietet werden.«
Mir ging ein Licht auf.
»Aber die Zimmer da haben doch hoffentlich einen besonderen Ausgang zum Korridor?«
»Leider, nein. — Der Herr Doktor müsste schon erlauben, dass der andere Mieter hier durchgehen kann.«
»Was?« schrie ich. »Ich danke schön! Ich soll Wildfremde durch mein Zimmer gehen lassen — das wäre ja noch schöner!«
Also deshalb war der Mietspreis so gering! Wirklich rührend!! Ich war wütend zum Platzen, aber dabei so müde von all dem Laufen, dass ich nicht einmal ordentlich schimpfen konnte.
»Nehmen Sie doch alle vier Zimmer!« sagte die Frau.
»Ich brauche nicht vier Zimmer!« brüllte ich. »Der Teufel soll Sie holen!«
In diesem Augenblick schellte es, die Frau ging hinaus, um zu öffnen und liess mich stehen.
»Sind hier die möblierten Zimmer zu vermieten?« hörte ich.
Aha! Das ist schon wieder einer, dachte ich. Und ich freute mich darauf, was dieser Herr wohl zu der netten Zumutung der Frau sagen würde. Ich trat rasch in das Zimmer nach rechts, dessen Türe halb offen stand. Es war ein mittelgrosser Raum, zugleich als Schlaf und Wohnzimmer eingerichtet. Eine schmale Türe an der andern Seite führte in ein kleines leeres Zimmerchen, das spärlich durch ein winziges Fenster erhellt wurde. Dies, wie auch die übrigen Fenster der Wohnung, gingen auf einen grossen, mächtigen Parkgarten, einen der wenigen, die Patrizierstolz in Berlin noch leben lässt.
Ich ging wieder zurück, nun waren die Vorfragen wohl erledigt, jetzt bekam der Herr die Kehrseite der Medaille zu sehen! Aber ich irrte mich. Ohne nach dem Preise zu fragen, erklärte er, er könne die Zimmer nicht gebrauchen.
»Ich habe noch zwei andere Zimmer«, sagte die Frau.
»Wollen Sie mir die zeigen?«
Die Wirtin und der fremde Herr traten herein. Er war klein, in kurzem, schwarzem Rock. Blonder Vollbart und Brille. Er sah recht unscheinbar aus; so einer, an dem man immer vorbeigeht.
Ohne mich weiter zu beachten, zeigte ihm die Frau diese beiden Zimmer. Für das grössere hatte der Herr gar kein Interesse, dagegen besichtigte er recht genau den kleinen Nebenraum, der ihm sehr zu gefallen schien. Auch, als er bemerkte, dass die Fenster kein Gegenüber hatten, huschte ein zufriedenes Lächeln über sein vertrocknetes Gesicht.
»Diese beiden Zimmer möchte ich mieten«, erklärte er.
Die Frau nannte den Preis.
»Gut!« sagte der Herr, »ich werde heute noch meine Sachen herschaffen lassen.«
Er grüsste und wandte sich zum Gehen.
»Wo geht's hinaus?«
Die Frau machte ein verzweifeltes Gesicht.
»Sie müssen durch das vordere Zimmer.«
»Was?« sagte der Herr. »Diese Zimmer haben keinen besonderen Eingang? — Ich soll immer durch ein fremdes gehen?!«
»Nehmen Sie doch alle vier Zimmer!« jammerte die Frau.
»Aber das ist mir viel zu teuer, vier Zimmer. — Herrgott, jetzt kann die Lauferei wieder von vorne anfangen!«
Der armen Frau liefen dicke Tränen über die Backen.
»Ich werde die Zimmer nie vermieten«, sagte sie. »Es waren wohl hundert Herren da in den letzten vierzehn Tagen, allen gefiel die Wohnung, aber alle gingen wieder fort, weil der dumme Baumeister keine Türe hier nach dem Gange gemacht hat. — Der Herr wäre auch sonst geblieben!«
Sie wies auf mich und trocknete sich derweil die Augen mit der Schürze.
»Sie wollten auch diese Zimmer mieten?« fragte der Herr.
»Nein, die beiden andern. Aber ich bedanke mich natürlich für die Annehmlichkeit, andauernd fremde Leute durch mein Zimmer marschieren zu lassen. — Übrigens können Sie sich trösten: ich bin auch schon seit zehn Uhr früh auf dem Trab.«
Die kurze Unterhaltung gab der Wirtin wieder einen Hoffnungsschimmer.
»Die Herren verstehen sich doch so gut«, sagte sie. »Wäre es denn nicht möglich, dass die Herren zusammen die vier Zimmer nähmen?«
»Ich danke sehr!« sagte ich. Der Herr sah mich aufmerksam an, dann trat er auf mich zu.
»Ich bin die Sucherei herzlich müde,« sagte er, »und diese beiden Zimmer passen mir vorzüglich. Wie wäre es, wenn wir einen Versuch machten?«
»Ich kenne Sie ja nicht einmal«, rief ich entrüstet.
»Fritz Beckers heisse ich, ich bin sehr ruhig und werde Sie kaum stören. Wenn's Ihnen nicht passt, können Sie ja jederzeit gehen, es ist ja keine Heirat.«
Ich antwortete nicht. Er fuhr fort:
»Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Der Gesamtpreis ist neunzig Mark, davon zahlen wir jeder die Hälfte. Ich nehme diese beiden Räume, Sie nehmen die beiden andern. Nur muss ich freies Durchgangsrecht haben und ausserdem möchte ich morgens in Ihrem Wohnzimmer meinen Kaffee nehmen; ich frühstücke nicht gerne im Schlafzimmer!«
»So gehen Sie doch in den kleinen Raum da.«
»— Den brauche ich für — — andere Zwecke. — Ich versichere Sie nochmals, ich werde ihnen in keiner Weise lästig fallen.«
»Nein!« sagte ich.
»Na —« erwiderte Herr Beckers, »dann ist freilich nichts zu machen! Dann bleibt uns beiden nichts anderes übrig, als von neuem auf die Jagd zu gehen.«
Noch einmal treppauf, treppab —? Lieber Steine klopfen!
»Bleiben Sie!« rief ich ihm zu. »Ich will's mit Ihnen versuchen!«
»Also gut!«
Die Wirtin strahlte:
»Das ist ein Glückstag heute.«
Ich schrieb ihr einen Zettel und bat sie, durch ein paar Dienstleute meine Koffer und Kisten holen zu lassen; dann verabschiedete ich mich. Ich fühlte einen Mordshunger und wollte irgendwo Mittagbrot speisen.
Schon auf der Treppe tat mir mein Entschluss wieder leid. Am liebsten wäre ich umgekehrt und hätte die Sache rückgängig gemacht.
Auf der Strasse traf ich Paul Haase.
»Wohin?« fragte ich.
»Ick habe keene Bleibe. — Ick suche.«
Da war ich ordentlich froh, dass ich doch wenigstens eine »Bleibe« hatte. Ich ging mit dem Maler in ein Restaurant, wir speisten sehr ausführlich.
»Kommen Se heute abend mit zu Griebeln sein Atelierfest«, schlug er vor. »De Luxen ist ooch da. Ick komm Se abholen!«
»Gut«, sagte ich.
Als ich in meine neue Wohnung kam, waren die Koffer gerade angekommen. Die Dienstmänner und die Wirtin halfen mir; in ein paar Stunden war alles umgekrempelt, die Öldrucke und Nippfiguren waren hinausbefördert und die Zimmer hatten schon etwas den Charakter ihres Bewohners angenommen.
Es klopfte, der Maler trat ein:
»Na, det sieht ja schon janz vernünftig hier aus«, meinte er. »Aber nu kommen Se man, et is schon neun Uhr!«
»Was?« Ich sah auf die Uhr, er hatte recht.
In diesem Augenblick klopfte es wieder.
»Herein!«
»Entschuldigen Sie, ich bins.« Herr Beckers trat ein, hinter ihm schleppten zwei Dienstleute mächtige Kisten.
»Wer war det denn?« fragte Paul Haase, als wir in der Strassenbahn sassen.
Ich erzählte ihm mein Mietsgeheimnis.
»Da haben Se sich ja scheen in die Brennnesseln gesetzt! — Übrigens: wir müssen hier aussteigen.«
Es war ziemlich spät, als ich am andern Morgen aufstand. Als die Wirtin den Tee brachte, fragte ich, ob denn der Herr Beckers schon gefrühstückt habe.
»Schon um halb acht«, antwortete sie.
Das war mir sehr angenehm. Wenn er immer so früh aufstand, würde er mir wenig lästig fallen. Und in der Tat: ich sah ihn überhaupt nicht. Vierzehn Tage war ich schon in der neuen Wohnung und hatte meinen Mitmieter fast vollständig vergessen.
Eines Abends gegen zehn Uhr klopfte es an der Zwischentüre. Auf mein Herein öffnete Fritz Beckers und kam ins Zimmer.
»Guten Abend! Störe ich Sie?«
»Nicht im geringsten. Ich bin gerade mit meiner Schreiberei fertig.«
»Darf ich also ein wenig zu Ihnen kommen?«
»Bitte sehr! Aber unter einer Bedingung: Sie rauchen da eine lange Pfeife und die kann ich in der Seele nicht vertragen. Zigarren oder Zigaretten stehen zu Ihrer Verfügung.«
Er ging in sein Zimmer zurück und ich hörte, wie er aus dem Fenster den Pfeifenkopf ausklopfte. Dann kam er wieder und schloss die Türe hinter sich. Ich schob ihm den Zigarrenkasten hin.
»Bitte bedienen Sie sich.«
»Danke sehr! — Können Sie eine kurze Pfeife auch nicht vertragen?«
»Doch, sehr gut.«
»So erlauben Sie, dass ich mir eine stopfe.«
Er zog eine kurze, englische Pfeife aus der Tasche, füllte sie und brannte sie an.
»Ich störe doch wirklich nicht?« fragte er noch einmal.
»Aber ganz und gar nicht. Ich bin in meiner Arbeit an einen toten Punkt gelangt und muss wohl oder übel aufhören. Ich gebrauche die Schilderung einer Osirisfeier; ich will morgen einmal zur Bibliothek, da werde ich schon was finden.«
Fritz Beckers lächelte:
»Vielleicht kann ich Ihnen helfen.«
Ich stellte einige Fragen, die er mir verblüffend gut beantwortete.
»Sie sind Orientalist, Herr Beckers?«
»Ein wenig«, antwortete er.
— Von jenem Tage an sah ich ihn zuweilen. Meistens am späten Abend kam er zu mir, noch ein Glas Grog zu trinken; manchmal rief ich ihn auch. — Wir unterhielten uns sehr gut über alles mögliche; Fritz Beckers schien auf allen Gebieten sattelfest. Nur über sich selbst vermied er jedes Wort.
Er war ein wenig geheimnisvoll. Vor die Türe, die zu meinem Zimmer führte, hatte er einen schweren persischen Teppich gehängt, der fast jedes Geräusch unhörbar machte. Wenn er ausging, schloss er die Türe fest zu und die Wirtin durfte nur morgens früh hinein, um das Zimmer zu machen, während er in meinem Zimmer frühstückte. Wenn Samstags reingemacht wurde, blieb er stets zugegen, setzte sich in einen Sessel und rauchte seine Pfeife, bis die Wirtin fertig war. Dabei war auch nicht das geringste in seinem Zimmer, das irgendwie auffällig gewesen wäre. Freilich, hinten der kleine Raum, der mochte alles mögliche beherbergen. Auch diese Türe war mit schweren Vorhängen verhangen; dabei hatte er zwei starke Eisenstäbe anbringen lassen, die mit amerikanischen Buchstabenschlössern angeschlossen waren.
Die Wirtin war natürlich furchtbar neugierig auf diesen geheimnisvollen Raum, in dem er den ganzen Tag arbeitete. Eines schönen Tages war sie in den grossen Park gegangen; sie hatte mit vieler Mühe die Bekanntschaft des Gärtners gemacht, nur um einmal nach dem kleinen Fenster hinaufsehen zu können.
Vielleicht sah sie was!
Aber sie sah gar nichts. Das Fenster war ausgehangen, um mehr frische Luft hereinzulassen, die Öffnung aber war mit einem schwarzen Tuche verhangen.
Bei Gelegenheit stellte ihn die Frau zur Rede.
»Warum haben Sie eigentlich das kleine Fenster immer verhangen, Herr Beckers?«
»Ich liebe es nicht, dass man mich beobachtet bei meiner Arbeit.«
»Aber Sie haben ja kein Gegenüber, es kann doch gar niemand hineinschauen!«
»Und wenn jemand auf eine der grossen Ulmen klettern würde?«
Starr vor Staunen erzählte mir die Frau dieses Gespräch. War das ein geheimnisvoller Mensch, der an solche Möglichkeiten dachte!
»Er ist vielleicht ein Falschmünzer!« sagte ich.
Von dem Tage an wurde jede Mark und jeder Groschen, die aus Herrn Beckers Händen kamen, genau untersucht. Die Frau liess sich absichtlich ein paarmal Scheine von ihm wechseln und trug alles Geld, das er ihr gab, zu einem befreundeten Bankbeamten. Es wurde mit der Lupe untersucht, aber nie war ein falsches Stück darunter. Ausserdem erhielt Herr Beckers an jedem Ersten zweihundert Mark durch den Briefträger, und es lag auf der Hand, dass er nicht einmal diese Summe ausgab. — Mit der Falschmünzerwerkstatt war es also nichts.
Verkehr hatte Herr Beckers überhaupt nicht. Ab und zu erhielt er grosse und kleine Kisten von allen möglichen Formaten, immer durch Dienstleute überbracht. Was darin war, konnte die Frau trotz aller Mühe nicht herausfinden; Beckers schloss sich ein, nahm den Inhalt heraus und gab ihr die alten Kisten als Brennholz.
— Eines Nachmittags war meine kleine Freundin bei mir. Ich sass am Schreibtisch, sie lag auf dem Diwan und las.
»Du, es hat schon ein paarmal geschellt!«
»Schad't nichts!« brummte ich.
»Aber es wird nicht aufgemacht.«
»Schad't auch nichts!«
»Vielleicht ist deine Wirtin nicht da?«
»Nein, sie ist ausgegangen.«
In diesem Augenblick schellte es wieder, sehr energisch.
»Soll ich aufmachen?« fragte Änny, »am Ende ist's was für dich!«
»Wenn's dir Spass macht! Aber sei vorsichtig.«
Sie sprang auf.
»Hab' keine Angst,« sagte sie, »ich sehe erst durch das Guckloch.«
Nach ein paar Minuten kam sie zurück.
»Es ist ein Paket für dich. Gib mal ein paar Groschen, ich muss dem Mann doch ein Trinkgeld geben.«
Ich gab ihr das Geld, der Dienstmann stellte eine viereckige Kiste ins Zimmer, bedankte sich und ging.
»Wir wollen gleich sehen, was es ist!« rief Änny und klatschte in die Hände.
Ich stand auf und sah die Kiste an. Es war keine Adresse darauf.
»Ich wüsste wirklich nicht, von wem das sein könnte«, sagte ich, »vielleicht ist's ein Irrtum.«
»Wieso?« rief Änny. »Der Mann hatte doch einen Zettel, darauf stand: Winterfeldstrasse 24 dritte Etage bei Frau Paulsen. Ausserdem sagte er: für den Herrn Doktor! Das bist du doch!«
»Ja!« sagte ich. Weiss der Kuckuck, dass ich gar nicht an Beckers dachte.
»Also geh! Wir wollen die Kiste aufmachen. Es ist sicher was zu essen drin.«
Ich probierte mit einem alten Dolchmesser den Deckel aufzubrechen. Aber die Klinge zerbrach. Ich schaute umher, nirgends war ein Instrument, das ich hätte benutzen können.
»Es geht nicht«, sagte ich.
»Bist du dumm!« lachte die Kleine. Dann lief sie in die Küche und kam gleich darauf mit Hammer, Zange und Stemmeisen wieder.
»Das lag in der Schublade im Küchentisch. — Du weisst auch gar nichts!«
Sie kniete und machte sich an die Arbeit. Aber es war nicht so leicht, der Deckel sass fest auf. Ihre bleichen Wangen röteten sich und das Herz pochte hörbar an das Mieder.
»Da, nimm du!« sagte sie und presste die kleinen Hände auf die Brust. »— Ah! das dumme Herz!«
Sie war das lustigste Spielzeug von der Welt, aber so zerbrechlich. Man musste sich höllisch mit ihr in acht nehmen, ihr Herz war arg in Unordnung.
Ich zog ein paar Nägel heraus und hob den Deckel. Krach! Nun sprang er los. Oben lagen Sägespäne; Änny griff rasch mit den Händchen hinein. Während dessen wandte ich mich, um das Werkzeug auf den Tisch zu legen.
»Ich hab's schon«, rief sie. »Es ist was Weiches!«
Plötzlich schrie sie jämmerlich, sprang auf und fiel nach hinten. Ich fing sie auf und trug sie auf den Diwan, sie lag in tiefer Ohnmacht. Ich riss ihr schnell die Bluse auf und löste das Mieder, ihr armes Herzchen hatte wieder einmal ausgesetzt. Ich nahm Eau de Cologne und wusch Schläfen und Brust, ganz allmählich fühlte ich« wieder ein leises Schlagen.
Indessen hörte ich draussen einen Schlüssel in der Flurtüre drehen und gleich darauf klopfte es.
»Wer ist da?«
»Ich bin's.«
»Kommen Sie nur durch!« rief ich, und Beckers trat ein.
»Was ist denn los?« fragte er.
Ich erzählte ihm, was vorgefallen war.
»Die ist ja für mich, die Kiste!« sagte er.
»Für Sie? Ja, was ist denn eigentlich drin, dass die Kleine so erschreckt war?«
»O, nichts besonderes.«
»Tote Katzen sind drin!« schrie Änny, die aus ihrer Ohnmacht erwachte. »Die ganze Kiste ist voll toter Katzen!«
Fritz Beckers nahm den Deckel, um ihn wieder auf die Kiste zu legen; ich ging hin und warf schnell einen Blick hinein. Wahrhaftig, da waren tote Katzen drin, oben auf lag ein starker schwarzer Kater.
»Zum Kuckuck, was wollen Sie denn mit dem Viehzeug?«
Fritz Beckers lächelte, dann sagte er ganz langsam:
»Wissen Sie, man sagt, dass Katzenfelle sehr gut für Gicht und Rheumatismus seien. Ich habe eine alte Tante in Usedom, die sehr leidend ist: der will ich die Katzenfelle schicken!«
»Ihre hässliche alte Tante in Usedom ist sicher des Teufels Grossmutter!« rief Änny, die schon wieder aufrecht im Sofa sass.
»Glauben Sie!« sagte Fritz Beckers. Dann machte er eine verbindliche Verbeugung, nahm die Kiste auf und ging in sein Zimmer.
— Etwa eine Woche später kam wieder ein Paket für ihn an, diesmal mit der Post. Die Wirtin brachte es durch mein Zimmer und winkte mir rasch zu. Als sie aus seinem Zimmer herauskam, trat sie zu mir und zog einen Zettel aus der Tasche, den sie mir gab.
»Das ist darin«, erklärte sie, »ich habe die Postdeklaration abgeschrieben.«
Das Paket war aus Marseille und enthielt zwölf Kilo — — Moschus! Genug, um alle Priesterinnen der Venus vulgivaga in ganz Berlin auf zehn Jahre zu versorgen!
Wirklich, ein merkwürdiger Mensch war er, dieser Herr Fritz Beckers!
Ein andermal trat mir die Wirtin ganz aufgeregt entgegen, als ich nach Hause kam und gerade die Haustüre öffnete.
»Heute morgen bekam er eine ganz grosse Kiste, wohl zwei Meter lang und einen halben Meter hoch. Es war sicher ein Sarg darin!«
Aber Fritz Beckers schickte die Kiste nach wenigen Stunden zum Zerschlagen heraus; und trotzdem die Wirtin tagelang beim Aufräumen eifrigst herumguckte, konnte sie auch nicht das geringste entdecken, war irgendwie mit einem Sarge Ähnlichkeit gehabt hätte.
Allmählich verschwand unser Interesse für Fritz Beckers' Geheimnisse. Er erhielt nach wie vor zuweilen mysteriöse Kisten, meist kleine, wie die, in der die toten Katzen waren, ab und zu auch eine lange. Wir gaben es auf, dies Rätsel zu lösen, zumal Fritz Beckers sonst auch nicht das geringste Auffallende hatte. Zuweilen kam er am späten Abend auf ein paar Stunden zu mir; und ich muss sagen, es war ein Vergnügen, mit ihm zu plaudern.
Da passierte mir eine höchst unangenehme Geschichte.
Meine kleine Freundin wurde immer kapriziöser. Wegen ihres kranken Herzchens nahm ich jede Rücksicht auf sie, aber es wurde von Tag zu Tag schlimmer. Den Herrn Fritz Beckers konnte sie nun auf den Tod nicht ausstehen. Wenn sie mich besuchte und Beckers gerade auf ein paar Minuten hereinkam, so gab es sicher eine Szene, die damit endete, dass Änny in Ohnmacht fiel. Sie fiel in Ohnmacht, wie andere niesen. Sie fiel immer in Ohnmacht, bei jeder Gelegenheit. Sehr häufig auch ohne Gelegenheit. Und diese Ohnmachten wurden immer länger und beängstigender, stets fürchtete ich, dass sie mir unter den Händen wegsterben würde. Das arme liebe Ding!
Eines Nachmittags kam sie an, lachend und vergnügt.
»Die Tante ist nach Potsdam«, rief sie, »ich kann bis elf Uhr bei dir bleiben!«
Sie kochte Tee, dann setzte sie sich auf meine Knie.
»Lass mal lesen, was du geschrieben hast!«
Sie nahm die Blätter und las. Sie war sehr zufrieden und gab mir einen grossen Kuss. Unsere kleinen Freundinnen sind doch unser dankbarstes Publikum.
Sie war so fröhlich und gesund heute.
»Du, ich glaube, es geht viel besser mit meinem dummen Herzen. Es klopft ganz ruhig und regelmässig.«
Sie nahm meinen Kopf in beide Hände und drückte mein Ohr an ihr Herzchen, um mich hören zu lassen.
Abends machte sie den Speisezettel. Sie schrieb alles auf: Brot, Butter, Schinken, Frankfurter Würstchen und Eier. Dann schellte sie der Wirtin.
»So! Gehen Sie uns das holen!« befahl sie. »Aber sehen Sie zu, dass Sie gute Ware bekommen!«
»Sie werden nicht klagen, Fräuleinchen, ich werde alles fein besorgen«, antwortete die Frau. Und sie strich mit der schwieligen Hand liebkosend über Ännys Seidenärmel. — Ich finde, alle Berliner Wirtinnen sind begeistert von den Freundinnen ihrer Mietsherren.
»Ach, ist es nett heute bei dir!« lachte Änny. »Wenn nur der grässliche Beckers nicht kommt!«
Und da war er auch schon. Tack, tack — — Herein! — »Ich störe?«
»Ja, natürlich stören Sie! Sehen Sie das denn nicht?« rief Änny.
»Ich ziehe mich gleich wieder zurück.«
»Ach, Sie haben uns ja schon gestört. Wenn Sie nur schon ihren Kopf hineinstecken, wird's ungemütlich. Gehen Sie doch, gehen Sie doch endlich! Worauf warten Sie denn noch? Sie — Katzenmörder!«
Beckers hatte schon die Klinke in der Hand, um wieder hinauszugehen, er war nicht eine Minute im Zimmer gewesen, Änny aber war es schon viel zu lange. Sie sprang auf, ihre weissen Finger fassten die Tischkante.
»Siehst du denn nicht, dass er mit Gewalt dableiben will, der Mensch! Wirf ihn doch hinaus. Beschütze mich doch, schlag' ihn doch, den hässlichen Hund!«
»Bitte, gehen Sie!« sagte ich zu Beckers.
Er stand in der Türe und warf Änny noch einen Blick zu. Einen langen, seltsamen Blick.
Die Kleine wurde wie rasend.
»Hinaus, hinaus, du Hund!« schrie sie. »Hinaus!«
Ihre Stimme schlug um, die Augen traten weit aus den Höhlen. Langsam lösten sich die krampfhaft geschlossenen Finger von der Tischkante: sie fiel steif hintenüber auf den Diwan.
»Da haben wir's!« rief ich. »Wieder mal ohnmächtig. Es wird unerträglich mit ihrem Herzen. — Entschuldigen Sie, Herr Beckers, sie ist arg krank, die arme Kleine!«
Wie gewöhnlich öffnete ich Bluse und Mieder und begann sie mit Eau de Cologne zu reiben. Aber es half nichts. Sie blieb starr da liegen.
»Beckers!« rief ich, »bitte holen Sie mal den Essig aus der Küche.«
Er brachte ihn, aber auch diese Einreibungen nutzten gar nichts.
»Warten Sie«, rief er, »ich habe etwas anderes.«
Er ging in sein Zimmer und kam mit einer bunten Schachtel zurück.
»Halten Sie sich das Taschentuch vor die Nase«, sagte er. Dann nahm er ein Stück persischen Kampfers aus der Schachtel, das er dem Mädchen unter die Nase hielt. Es roch so scharf, dass mir die Tränen von den Wangen liefen.
Änny zuckte, ein minutenlanger, heftiger Krampf schüttelte ihren ganzen Körper.
»Gott sei Dank, es hilft!« rief ich.
Sie richtete sich halb auf, die Augen öffneten sich weit. Da erblickte sie über sich Beckers Gesicht. Ein grässlicher Schrei entfuhr ihren blauen Lippen, sogleich fiel sie wieder zurück.
»Eine neue Ohnmacht! Hol's der Kuckuck!«
Wieder versuchten wir alle Mittel, die wir wussten, Wasser, Essig, Eau de Cologne. Wir hielten ihr den persischen Kampfer dicht unter die Nase, dessen beissender Geruch eine Marmorstatue niesen gemacht hätte. — Sie blieb leblos.
»Donnerwetter! Eine schöne Geschichte!«
Ich legte mein Ohr an ihre Brust, ich konnte auch nicht das geringste Klopfen wahrnehmen. Auch die Lungen arbeiteten nicht mehr. Ich nahm einen Handspiegel und hielt ihn dicht vor die offenstehenden Lippen, kein leiser Hauch trübte ihn.
»Ich glaube —« sagte Beckers, »ich glaube —«
Dann unterbrach er sich: »Wir wollen Ärzte holen.«
Ich sprang auf:
»Ja, natürlich! Sofort! Im Hause gegenüber wohnt einer, gehen Sie dahin. — Ich laufe um die Ecke zu meinem Freunde, dem Doktor Martens; er ist sicher zu Hause.«
Wir stürzten zusammen die Treppe hinunter. Ich hörte noch, wie Beckers an dem Hause gegenüber heftig schellte. Ich lief so rasch ich konnte, endlich war ich an Dr. Martens Wohnung und drückte auf den Knopf. Es kam niemand. Ich schellte noch einmal. Schliesslich drückte ich den Finger auf den Knopf, ohne loszulassen. — Immer noch niemand? Es war mir, als ob ich schon tausend Jahre da stände.
Endlich kam Licht. Dr. Martens kam selbst, nur im Hemde und in Pantoffeln.
»Na, Sie machen aber einen Radau?«
»Wen man so lange warten muss!«
»Entschuldigen Sie, das Mädchen ist fort, ich war ganz allein und bei der Toilette, wie Sie sehen. Ich ziehe mich gerade für eine Gesellschaft an. — Na, was gibts denn?«
»Kommen Sie sofort mit, Doktor! Sofort!«
»So im Hemde? Ich werde doch wenigstens erst eine Hose anziehen können! — Kommen Sie hinein, ich werde mich fertig machen und Sie erzählen mir derweil, was los ist!«
Ich folgte ihm ins Schlafzimmer.
»Sie kennen doch die kleine Änny? Ich meine, Sie trafen Sie einmal bei mir? Also — —«
Und ich machte ihm Bericht. Endlich, endlich war er fertig — Himmel, jetzt zündet er erst noch eine Zigarre an!
Auf der Strasse kam uns Beckers entgegen.
»Ist Ihr Arzt schon oben?« fragte ich ihn.
»Nein, er muss jeden Augenblick kommen. Ich habe ihn hier erwartet.«
Als wir vor dem Hause waren, öffnete sich gegenüber die Haustüre und ein Herr trat heraus. Es war der andere Arzt. Alle vier eilten wir die Treppen hinauf.
»Nun, wo liegt unsere Patientin?« fragte Martens, der zuerst ins Zimmer trat.
»Dort auf dem Diwan«, sagte ich.
»Auf dem Diwan? — Da liegt niemand!«
Ich trat heran — Änny war nicht mehr da. Ich war sprachlos.
»Vielleicht ist sie aufgewacht aus ihrer Ohnmacht und hat sich nebenan aufs Bett gelegt«, meinte der andere Arzt.
Wir gingen ins Schlafzimmer, niemand war da; auch war das Bett völlig unberührt. Wir gingen in Beckers Zimmer; auch dort war sie nicht. Wir suchten in der Küche, in den Zimmern der Wirtin, überall in der ganzen Etage, sie war verschwunden.
Martens lachte: »Na, Sie haben sich mal unnütz aufgeregt! — Sie ist ruhig nach Hause gegangen, während Sie uns harmlosen Bürgern Ihre Mordgeschichten erzählten.«
»Aber dann hätte sie Beckers ja sehen müssen, er war doch die ganze Zeit über unten auf der Strasse.«
»Ich bin auf- und abgegangen,« sagte Beckers, »es wäre nicht unmöglich, dass sie vielleicht hinter meinem Rücken aus dem Hause geschlüpft wäre.«
»Aber es ist ganz unmöglich!« rief ich. »Sie lag ganz steif und starr, das Herz klopfte nicht mehr, die Lungen hatten ausgesetzt. Da kann niemand, so mir nichts dir nichts, aufstehen und gemütlich nach Hause gehen!«
»Sie hat Ihnen was vorgespielt, Ihre Kleine, und hat sich ins Fäustchen gelacht, als Sie verzweifelt die Treppen hinunterstürzten, um Hilfe zu holen.«
Die Ärzte gingen lachend weg; bald darauf kam die Wirtin zurück.
»Ach das Fräuleinchen ist schon fort?«
»Ja«, sagte ich, »sie ist nach Hause gegangen. Herr Beckers wird mit mir zu Abend essen. — Darf ich Sie einladen, Herr Beckers?«
»Danke sehr«, sagte er. »Mit Vergnügen.«
Wir assen und tranken.
»Ich bin wirklich neugierig, wie sich das erklären wird!«
»Werden Sie ihr schreiben?« fragte Beckers.
»Ja, natürlich! Am liebsten möchte ich gleich morgen zu ihr gehen. Ein Vorwand liesse sich schon finden. Wenn ich nur wüsste, wo sie wohnt.«
»Sie wissen nicht, wo sie wohnt?«
»Aber keine Ahnung! Ich weiss ja nicht einmal wie sie heisst. Ich lernte sie vor etwa drei Monaten in der Stadtbahn kennen, dann trafen wir uns ein paarmal im Ausstellungspark. Ich weiss nur, dass sie im Hansaviertel wohnt, keine Eltern hat, aber eine reiche Tante, die höllisch auf sie aufpasst. Ich nenne sie Änny, weil der Name so nett zu ihrem Persönchen passt. Aber sie mag eigentlich Ida, Frieda oder Pauline heissen — was weiss ich.«
»Wie korrespondieren Sie denn mit ihr?«
»Ich schrieb ihr — übrigens selten genug — Ännchen Meier — Postamt 28. Eine hübsche Chiffre, was?«
»Ännchen Meier — Postamt 28«, wiederholte Fritz Beckers nachdenklich.
»Na prost, Herr Beckers, auf gute Freundschaft! Wenn Ännchen Sie auch nicht leiden mag, heute abend hat sie ihnen ja das Feld geräumt.«
»Prosit!« Die Gläser klangen aneinander. Wir tranken und plauderten, und es war sehr spät als wir uns trennten.
Ich ging in mein Schlafzimmer und trat an das offene Fenster. Der grosse Garten lag da unten und das Mondlicht spielte auf den Blättern, die ein leiser Wind leicht schaukelte.
Da war es mir, als ob draussen jemand meinen Namen rief. Ich horchte scharf hin, da klang es wieder — — es war Ännys Stimme.
»Änny!« rief ich durch die Nacht. »Änny!«
Es kam keine Antwort.
»Änny!« rief ich noch einmal. »Bist du da unten?«
Keine Antwort. — Wie sollte sie auch in den Park kommen? Und dann um diese Zeit!
Zweifellos — ich war betrunken.
Ich ging zu Bett und schlief im Augenblick. Ganz fest, ein paar Stunden. Dann wurde mein Schlaf unruhig, ich begann zu träumen. Und ich bemerke, dass mir das nur selten, sehr selten vorkommt.
Sie rief mich wieder.
Ich sah Änny daliegen; Beckers beugte sich über sie. Sie riss die entsetzten Augen weit auf, die kleinen Hände hoben sich, um ihn zurückzustossen. Und die armen, bleichen Lippen bewegten sich, mit unsäglicher Anstrengung drang der Schrei aus ihren Lippen — — mein Name.
Ich erwachte. Ich wischte mir den Schweiss von der Stirne und lauschte. Jetzt wieder, ganz leise, aber klar und durchdringend hörte ich sie rufen. Ich sprang auf und eilte ans Fenster.
»Änny! Änny!«
Nein! Alles war still. Schon wollte ich wieder zu Bett gehen, da klang es noch ein letztes Mal, lauter wie sonst, wie in wahnsinniger Angst.
Kein Zweifel, das war ihre Stimme! Aber diesmal kam der Ton nicht vom Garten her, es war mir, als ob er irgendwo her aus den Zimmern komme.
Ich steckte die Kerze an und suchte unter dem Bett, hinter den Vorhängen, in den Schränken. Ganz unmöglich, hier konnte niemand verborgen sein. Ich ging ins Wohnzimmer. Nein, sie war nirgends.
Wenn Beckers — —? Aber der Gedanke war ja absurd! Trotzdem, was ist unmöglich? Ohne mich lange zu besinnen, ging ich an seine Türe und, drehte die Klinke. Sie war verschlossen. Da warf ich mich mit aller Kraft dagegen: das Schloss zerbrach und die Türe flog weit auf. Ich ergriff das Licht und stürmte hinein.
»Was gibt's denn?« fragte Fritz Beckers.
Er lag in seinem Bett und wischte sich den Schlaf aus den Augen. Meine Vermutung war wirklich kindisch gewesen!
»Entschuldigen Sie meine Albernheiten«, sagte ich. »Ein närrischer Traum liess mich alle Vernunft verlieren.«
Ich erzählte ihm, was ich geträumt hatte.
»Merkwürdig,« sagte er, »ich habe ganz etwas Ähnliches geträumt.«
Ich sah ihn an, ein überlegener Hohn lag auf seinen Zügen.
»Sie brauchen sich nicht über mich lustig zu machen!« knurrte ich und ging.
— Am anderen Morgen schrieb ich ihr einen langen Brief. Fritz Beckers trat herein, als ich gerade die Adresse schrieb, er sah mir über die Schulter und las: »Ännchen Meier. Postamt 28. Lagernd.«
»Wenn Sie nur bald eine Antwort bekommen«, lachte er.
Aber ich bekam keine. Ich schrieb nach vier Tagen noch einmal und ein drittes Mal nach vierzehn Tagen.
Schliesslich bekam ich eine Antwort, aber in einer mir gänzlich fremden Handschrift:
»Ich will nicht, dass Sie noch mehr Briefe von mir in Händen haben, darum diktiere ich diese Zeilen einer Freundin. Ich bitte Sie, mir unverzüglich alle meine Briefe und was sie sonst an Erinnerungen von mir haben, zurückschicken zu wollen. Den Grund, weshalb ich nichts mehr von Ihnen wissen will, können Sie sich selbst denken: wenn Sie Ihren ekelhaften Freund mir vorziehen, so gehe ich lieber selbst!«
Eine Unterschrift fehlte, dagegen waren in dem Kuvert meine letzten drei Briefe uneröffnet beigeschlossen. Ich schrieb ihr noch einmal, aber auch diesen Brief erhielt ich wenige Tage darauf uneröffnet zurück. So entschloss ich mich denn, packte all die Briefchen, die ich je von ihr empfangen, in ein grosses Kuvert, legte die anderen Kleinigkeiten hinzu und sandte es an die postlagernde Adresse.
Als ich abends Beckers davon erzählte, fragte er mich:
»Sie haben alles zurückgesandt?«
»Ja, alles!«
»Gar nichts zurückbehalten?«
»Nein, gar nichts; weshalb fragen Sie?«
»Ich meinte nur. Es ist auch besser so, als sich mit allen möglichen alten Erinnerungen herumzuschleppen.«
— — Ein paar Monate vergingen, da erklärte Beckers eines Tages, dass er die Wohnung kündige.
»Sie gehen fort von Berlin?«
»Ja«, antwortete er. »Nach Usedom zu meiner Tante. Ein sehr schönes Land — Usedom!«
»Wann fahren Sie?«
»Ich sollte eigentlich schon fort sein. Aber übermorgen feiert ein alter Freund von mir ein Jubiläum, da habe ich versprechen müssen, hinzukommen. Übrigens würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir das Vergnügen machten, mit hinzugehen.«
»Auf das Jubiläum Ihres Freundes?«
»Ja! Sie werden etwas anderes finden, als Sie sich vorstellen. Übrigens haben wir nun fast sieben Monate friedlich miteinander gehaust, da werden Sie mir die kleine Bitte nicht abschlagen können, den letzten Abend mit mir zu verbringen.«
»In Gottes Namen«, sagte ich.
An dem Abend kam Beckers gegen acht Uhr zu mir, um mich abzuholen.
»Sogleich!« sagte ich.
»Ich gehe schon vor, um eine Droschke zu holen. Ich werde unten auf Sie warten. Darf ich Sie noch bitten, schwarze Beinkleider, Gehrock und schwarzen Schlips anzuziehen, auch schwarze Handschuhe zu nehmen? Sie sehen, ich bin auch so angezogen.«
»Auch das noch!« brummte ich. »Das scheint ja ein nettes Jubiläum zu werden.«
— Als ich aus der Haustüre trat sass Beckers schon in einer Droschke. Ich stieg ein und wir fuhren durch Berlin, ich achtete nicht auf die Strassen. Nach etwa dreiviertel Stunden hielten wir; Beckers zahlte Und führte mich durch einen grossen Torbogen. Wir kamen dann in einen langen Hof, der hinten von einer hohen Mauer umgrenzt war. Beckers stiess eine niedere Tür in der Mauer auf und wir gelangten zu einem kleinen Hause, das dicht an der Mauer lag. Dahinter breitete sich ein mächtiger Garten aus.
»Sieh mal an, noch ein so grosser Privatgarten in Berlin? Man lernt doch nie aus!«
Ich hatte aber keine Zeit genauer hinzusehen, Beckers war schon oben auf der Steintreppe und ich beeilte mich, ihm zu folgen. Die Tür wurde geöffnet; wir traten aus dem dunklen Flur in einen kleinen, bescheiden eingerichteten Raum. In der Mitte stand ein weissgedeckter Tisch, darauf eine grosse Steingutbowle. Rechts und links brannten Kerzen in zwei schwersilbernen, fünfarmigen Leuchtern, ein paar ebensolche hohe Kirchenleuchter warfen auf einer als Büfett dienenden Kommode ihr Licht auf einige grosse Schüsseln voller Butterbrote. An den Wänden hingen ein paar uralte Öldrucke, auf denen man kaum mehr die Farben erkennen konnte, ausserdem eine Unmenge von Kränzen, alle mit schönen breiten Seidenschleifen. Der Jubilar war augenscheinlich Sänger oder Schauspieler. Und tüchtig musste er sein! Soviel Kränze hatte ich bei der gefeiertsten Diva nicht gesehen. Vom Fussboden bis zur Decke hingen sie hinauf, meist als und verwelkt, aber es waren auch ganz frische darunter, die kaum einen Tag alt sein mochten und die der Jubilar wohl gerade zu seinem Jubelfeste bekommen hatte.
Jetzt stellte Beckers mich vor;
»Ich habe Ihnen hier meinen Freund mitgebracht«, sagte er. — »Herr Laurenz — seine Frau — — und Familie!«
»Recht so! Recht so, Herr Beckers!« sagte der Jubilar und schüttelte mir die Hand. »Es ist eine hohe Ehre für uns.«
Nun habe ich schon manche seltsame Pflanze auf deutschen Bühnen blühen und wachsen sehen, aber so eine!? Man stelle sich vor: der Jubilar war ganz ausserordentlich klein und wenigstens fünfundsiebzig Jahre alt Seine Hände waren so schwielig wie eine alte Soldatenschuhsohle und dabei, obwohl er augenscheinlich für die Feier einen energischen Reinigungsversuch unternommen hatte, von einer dunkelbraunen Erdfarbe. Sein Gesicht war vertrocknet wie eine Kartoffelschale, die zwei Monate lang in der Sonne lag, und seine riesigen Ohren standen wie Wegweiser in die Luft hinein. Über den zahnlosen Mund hing ein struppiger, grauer Schnurrbart, der von Schnupftabak starrte, dünne Haarsträhne von einer undefinierbaren Farbe klebten hier und da auf dem blanken Schädel.
Seine Frau, nicht viel jünger als er, schenkte uns ein und stellte einen Teller mit Schinken- und Wurstbrötchen vor uns hin — die übrigens sehr lecker waren, was mich einigermassen mit ihr versöhnte. Sie trug ein schwarzes Seidenkleid, und Brosche und Armbänder aus schwarzem Jett. Auch die anderen Gäste, etwa fünf bis sechs Herren, waren alle in Schwarz. Einer war dabei, der noch kleiner und älter war als der Jubilar, die übrigen mochten vierzig bis fünfzig Jahre zählen.
»Ihre Verwandten?« fragte ich Herrn Laurenz.
»Nein. Nur der da, der Einäugige, das ist mein Sohn! Die andern sind meine Leute.«
Also seine Leute waren es! So war also meine Vermutung, dass Herr Laurenz eine Bühnengrösse sei, doch falsch. Aber woher hatte er dann alle diese prachtvollen Kränze bekommen? — Ich las die Widmungen auf den Seidenbändern. Da stand auf einem schwarzweissroten Bande: »Unserm tapfern Hauptmann — die treue Grenadierkompagnie der St. Sebastianschützengilde.« — Also Schützenhauptmann war er! Auf einem andern Bande war zu lesen: »Die Reichstagswähler des Christlichen Central-Comités.« — In Politik machte er auch! — »Dem grössten Lohengrin aller Zeiten!« — Er war also doch Opernsänger? — »Dem unvergesslichen Kollegen — Der Berliner Presseklub.« — Was? Dazu noch ein Mann der Feder? — »Der Leuchte deutscher Wissenschaft, der Zierde deutschen Bürgertums — Der freisinnige Verein Waldeck.« — Wirklich, ein bedeutender Mensch, der Herr Laurenz. Ich schämte mich ordentlich, nie von ihm gehört zu haben. — Eine blutrote Schleife zeigte die Worte: »Dem Sänger der Freiheit — Die Männer der Arbeit«; während auf einer grünen Schleife zu lesen war: »Meinem treuen Freund und Mitkämpfer — Stöcker, Hofprediger a. D.« — Was war das für ein seltsamer Mann, der alles verstand und von allen gleich verehrt wurde? — Da in der Mitte hing eine mächtige Schleife mit den drei inhaltschweren Worten: »Deutschlands grösstem Sohne.«
»Entschuldigen Sie, Herr Laurenz,« begann ich bescheiden, »ich bin tief unglücklich, nie vorher von Ihnen gehört zu haben. Darf ich mir die Frage erlauben —«
»Gewiss das!« sagte Herr Laurenz jovial.
»— welches Jubiläum Sie eigentlich heute in so reizend kleinem Familienkreise feiern?«
»Hunderttausend!« sagte Herr Laurenz.
»Hunderttausend?« fragte ich.
»Hunderttausend!« sagte Herr Laurenz und spuckte mir auf den Stiefel.
»Hunderttausend!« sagte sein einäugiger Sohn nachdenklich. »Hunderttausend!«
»Hunderttausend!« wiederholte Frau Laurenz. »Darf ich Ihnen noch ein Glas Bowle einschenken?«
»Hunderttausend!« sagte Herr Laurenz noch einmal. »Ist das nicht eine schöne Zahl?«
»Eine sehr schöne Zahl!« sagte ich.
»Wirklich, es ist eine sehr schöne Zahl!« sagte Fritz Beckers, stand auf und erhob sein Glas. »Hunderttausend! Eine ausserordentlich schöne Zahl Hunderttausend! Bedenken Sie doch!«
»Es ist eine wundervolle Zahl!« sagte der eine Gast, der noch älter und kleiner war als Herr Laurenz. »Eine ganz wundervolle Zahl: Hunderttausend!«
»Ich sehe, Sie verstehen mich, meine Herren,« fuhr Fritz Beckers fort, »und darum brauche ich keine langen Worte zu machen. Ich beschränke mich auf das eine Wort: Hunderttausend! Ihnen aber, lieber Jubilar, wünsche ich: Noch einmal Hunderttausend!«
»Noch einmal Hunderttausend!« riefen seine Frau und sein Sohn und seine Leute und alle stiessen mit dem Jubilar an.
Mir ging ein Licht auf: Herr Laurenz hatte die ersten Hunderttausend beisammen, Mark oder Taler, und deshalb gab er eine Bowle!
Ich nahm auch mein Glas und stiess mit ihm an: »Erlauben Sie mir, mich aus vollem Herzen dem Wunsche des Herrn Beckers anzuschliessen! Noch einmal Hunderttausend! Prosit! Non olet!«
»Was sagt er da?« wandte sich der Jubilar an Beckers.
»Non olet: — es stinkt nicht!« erklärte dieser.
»Stinkt nicht?« — Herr Laurenz lachte. —
»Na, wissen Sie, junger Freund, Sie würden sich schon die Nase halten! Fast alle stinken. Mir können Sie's glauben.«
Auf welch gaunerische Weise mochte dieser alte Sünder zu seinem Gelde gekommen sein, wenn er so zynisch davon sprach!
Beckers stand wieder auf und nahm ein Paket, das er vorher auf die Kommode gelegt hatte.
»Ich habe Ihnen hier, Herr Laurenz, ein kleines Zeichen meiner Erkenntlichkeit mitgebracht, zugleich eine Erinnerung an unsere Freundschaft und an Ihr schönes Jubiläum.«
Er nahm das Papier ab und brachte einen grossen blanken Totenschädel zum Vorschein, schön in Silber gefasst. Die Schädeldecke war abgesägt und wie ein Bierglasdeckel wieder aufgesetzt, sie bewegte sich hinten in einem Scharnier.
»Geben Sie den Bowlenlöffel!« sagte er. Dann schenkte er den Schädel bis obenhin voll, trank und reichte ihn dem Jubilar. Dieser trank auch und reichte ihn weiter, so machte der Schädel die Runde.
»Du, Alte!« lachte der Jubilar. »Der ist gut für meine kleine Frühstücks-Weisse.«
Fritz Beckers sah auf seine Uhr:
»Viertel nach Zehn? Ich muss mich beeilen, mein Zug fährt mir davon.«
»Lieber Freund und Gönner!« bat der Jubilar. »Nur etwas noch! Noch ein Viertelstündchen! Ich bitte Sie, lieber Freund und Gönner!«
Fritz Beckers war der Gönner dieses berühmten Mannes? Das wurde immer rätselhafter.
»Nein, es geht nicht«, sagte der Gönner energisch und reichte mir die Hand. »Auf Wiedersehen!«
»Ich gehe mit Ihnen.«
»Sie würden einen grossen Umweg machen, ich muss zum Stettiner Bahnhof. — Ich laufe zur nächsten Haltestelle und werde Ihnen eine Droschke herschicken. — Adieu! Ich muss mich beeilen, wenn ich den Zug noch erwischen will.«
Alle brachten ihn hinaus; ich blieb allein und trank mein Glas aus. Der Alte kam, um es mir wieder voll zu schenken.
»Wissen Sie,« sagte er zu mir, »wenn Sie etwas brauchen, kommen Sie nur. Ich bediene Sie gut. Sie können ja Herrn Beckers fragen. Nur frische Ware!«
Also Kaufmann war er! Jetzt hatte ich es heraus.
»Gewiss, ich werde bei Bedarf an Sie denken. Augenblicklich bin ich noch versorgt.«
»Sooo? — Von wem denn?« — Der Jubilar erschrak ordentlich.
Richtig, ich hatte ja keine Ahnung, mit was der Alte eigentlich handelte.
»Von Wertheim«, sagte ich, das schien mir am sichersten.
»O die Warenhäuser!« jammerte er. »Sie ruinieren den kleinen Mann! — Aber Sie werden sicher nicht gut bedient, probieren Sie's mal mit mir. Was Sie bei Wertheim kriegen, ist gewiss nicht gut, faule Fische, abgestanden — —«
Also Fischhändler war er! Endlich! Beinahe hätte ich ihm eine Bestellung gemacht, aber es fiel mir gerade noch ein, dass wir am Ende des Monats waren.
»Für die erste Zeit bin ich noch versehen, aber nächsten Monat können Sie mir etwas schicken. Geben Sie mir Ihre Preisliste.«
Der Alte war ganz verdutzt:
»Eine Preisliste? — Hat Wertheim eine Preisliste?«
»Natürlich hat er! Billige Preise und gute Ware, ganz frisch, spring-lebend.«
Der Jubilar sprang entsetzt auf und fiel seiner Frau fast besinnungslos in die Arme.
»Du, Alte!« stöhnte er, »Wertheim liefert lebend!!«
In diesem Augenblick hörte ich draussen die Droschke vorfahren. Ich benutzte die Verwirrung, lief aus der Stube, nahm Mantel und Hut und schlüpfte aus dem Hause. Rasch sprang ich die Steintreppe hinunter, ging durch die Gartentüre in der Mauer und öffnete den Droschkenschlag.
»Café Secession!« rief, ich dem Kutscher zu.
Ich stieg ein und die Pferde zogen an. Schnell warf ich noch einen Blick zurück, da sah ich neben der Türe ein kleines weisses Schild. Ich kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können, und las mit einiger Mühe:
JACOB LAURENZ.
TOTENGRÄBER.
— — Donnerwetter! Der Jubilar war Totengräber!
Einige Monate, nachdem Beckers fortgezogen war, zog ich auch aus. Die Wirtin half mir meine Koffer und Kasten zusammenpacken. Ich war gerade dabei, eine Bilderkiste zuzunageln, als der Griff des Hammers zersprang. »Zum Kuckuck!« rief ich.
»Ich habe noch einen andern da«, sagte die Wirtin, die gerade die Anzüge fein säuberlich zusammenlegte. »Warten Sie, ich hole ihn.«
»Lassen Sie nur, ich laufe schon selber. Wo liegt er?«
»In der Schublade im Küchentisch. Aber ziemlich nach hinten.«
Ich ging in die Küche. Die Schublade war voll von nützlichen und unnützen Gegenständen. Alle möglichen Werkzeuge, Nägel, Knöpfe, Bindfäden, Türklinken und Schlüssel. Plötzlich zog ich ein blaues Bändchen heraus, daran hing ein unscheinbares goldenes Medaillon. — War das nicht Ännys? — Ich öffnete es, es war eine verblasste kleine Photographie darin, das Bild ihrer Mütter. Sie trug dieses einzige Andenken an die Tote immer auf der Brust wie ein Amulett.
»Das will ich mit mir ins Grab nehmen«, sagte sie mir einmal.
Ich nahm das Medaillon mit ins Zimmer.
»Wo haben Sie das her?« frug ich die Wirtin.
»Ich habe es neulich gefunden, als ich Herrn Beckers Zimmer aufwusch. Es lag hinten in dem kleinen Räume in einer dunklen Ecke. Ich wollte es ihm aufbewahren, vielleicht kommt er noch mal her.«
»Ich werde es an mich nehmen«, sagte ich. — Ich stecke das Medaillon in meine Brieftasche; da hat es jahrelang geruht. Später schenkte ich es dem Museum für Naturkunde in der Invalidenstrasse. Neulich erst, vor acht Tagen.
Ich sass nämlich im Café Monopol, vor mir einen Berg von Zeitungen. Da flog der kleine Beermann vom Börsencourier herein.
»Schale Haut, Herr Doktor?« fragte der Kellner.
»Schale Haut!«
Er setzte sich an einen kleinen Tisch und putzte die beschlagenen Zwickergläser. Dann blickte er sich um.
»Ah, Sie da?« rief er, als er mich bemerkte. »Bringen sie den Kaffee dort hin, Fritz!«
Er kam zu mir hinüber, während der Kellner die Tasse vor ihn stellte.
»Ihr Wiener seid grässliche Menschen! Wie kann man das Zeug da trinken!«
»Finden Sie?« sagte er. — »Ich bin selig, dass ich Sie getroffen habe, Sie müssen mir einen Gefallen tun!«
»Hm!« machte ich. »Ich habe absolut keine Zeit heute abend.«
»Aber Sie müssen mir helfen! Unbedingt. Es ist ja niemand anders hier heute abend und ich muss gleich wieder fort!«
»Was gibt's denn?«
»Ich muss in die Premiere zum Deutschen Theater. Und da fällt mir plötzlich ein, dass ich noch eine andere Sache heute abend habe, die ich total vergessen hatte.«
»Was denn?«
»Im Museum für Naturkunde hält heute abend Professor Köhler einen Vortrag über die neuen ägyptischen Erwerbungen dieses Museums. Der ganze Hof wird erscheinen. Eine sehr interessante Sache!«
»Ausserordentlich interessant.«
»Nicht wahr? — Also tun Sie mir den Gefallen und gehen Sie hin. Ich werde Ihnen sehr dankbar sein.«
»Kann ich mir denken! Aber wissen sie was: mich interessiert das gar nicht.«
»Ich bitte Sie! — Das aktuellste, was es geben kann! Alle die neuen Funde werden vorgeführt. Ich bin ganz unglücklich, dass ich selbst nicht hin kann.«
»Also machen wir's so: Sie gehen ins Museum und ich gehe zum Deutschen Theater.«
»Unmöglich! Leider ganz unmöglich! Ich habe meiner Kusine versprochen, sie heute mit ins Theater zu nehmen.«
»Ach was Sie nicht sagen!«
»Also bitte, tun Sie mir den Gefallen! Sie werden es nicht bedauern. Sie müssen mir aus der Verlegenheit helfen.«
»Aber —«
Er sprang auf und warf ein paar Groschen auf den Tisch:
»Fritz! Für den Kaffee! — Hier sind die Karten. Zwei. Sie können noch einem andern eine Freude machen!«
»Eine nette Freude! Ich — —«
»Da — und vergessen Sie nicht, den Bericht noch heute abend in den Kasten zu stecken, damit ich ihn mit der ersten Post auf der Redaktion finde! Vielen Dank! Zu Gegendiensten stets bereit! Servus! Servus!«
— Und fort war er.
Da lagen die Karten vor mir. Himmel, ich musste wohl hin, er hatte mir schon so oft Gefälligkeiten erwiesen. — Der grässliche Kerl!
Ich versuchte gar nicht erst, irgendeinem anderen die Karten aufzuhängen, ich wusste ja doch, dass ich sie nicht los werden würde.
Natürlich ging ich erst hin, als schon dreiviertel des Vortrags zu Ende war. Ich setzte mich zu dem Philologen der »Norddeutschen«, und liess mir von ihm Notizen geben. Ich erfuhr, dass das Museum durch die wahrhaft fürstliche Munifizenz der Herren Kommerzienräte Brockmüller (Javol) und Lilienthal (Odol) in die glückliche Lage gekommen war, die prachtvollen Funde in den Pyramiden von Togbao und Kumo im Bausche für eine ungeheure Summe anzukaufen. Diese fast völlig zerstörten Pyramiden waren von einem jungen Forscher einige hundert Kilometer südlich vom Tschadsee aufgefunden worden, im Reiche des Rabeh, dessen Gefangener der deutsche Gelehrte jahrelang war. Als der Tyrann am 22. April 1900 den Franzosen unter Lamy erlag und ein indischer Scharfschütze den Kopf des Sklavenfürsten in das französische Lager trug, schleppte sein Sohn Fadel-Allah den jungen Deutschen weiter mit sich nach Bergama im Reiche Bornu, wo ihn seine kriegerische Schwester, die Amazone Hana, die Witwe Haiatus, zum Ehemann nahm. Als dann am 23. August 1901 morgens fünf Uhr die Engländer unter Dangeville bei Gudjha die letzten »Basinger« im Schlafe überfielen und töteten, fand er endlich die Freiheit und begab sich nun zu den Senussi, deren Ordensoberhaupt ihm als Deutschen sehr entgegenkam, da diese fanatischen Mohammedaner, denen von allen Seiten die franzosenfeindlichen Tuaregs zuströmen, augenblicklich gegen Frankreich ihre Politik richteten. So gelang es ihm, mit Hilfe der Leute von Kanun die Schätze zu bergen und sie über Nordkamerun an die Küste und von dort nach Deutschland zu schaffen.
Leider war der junge Gelehrte selbst nicht anwesend, er war wenige Wochen nach seiner Ankunft in Europa wieder nach Zentral-Afrika abgereist.
Dagegen waren, Gott sei dank! die beiden Herren Kommerzienräte anwesend, sie sassen nebeneinander in der ersten Reihe, und sie schwollen ordentlich von dem Ruhme, Spuren altägyptischer Kultur am Tschadsee nachgewiesen zu haben.
»Und nun darf ich Sie wohl bitten«, schloss Professor Köhler seinen Vortrag, »nach vorn treten zu wollen und unsern unschätzbaren Fund selbst in Augenschein zu nehmen.«
Er liess einen Vorhang zurückziehen, hinter dem die Herrlichkeiten aufgebaut waren.
»Es dürfte Ihnen allen nicht unbekannt sein, dass im alten Ägypten die Katze als ein heiliges Tier verehrt wurde, ebenso wie das Krokodil, der Ibis, der Sperber und alle diejenigen Säugetiere, die dem Ptah geweiht wären, das heisst, einen dreieckigen, weissen Fleck auf der Stirne trugen. Deshalb wurden diese Tiere, geradeso wie die Pharaonen, Oberpriester und Vornehmen des Landes einbalsamiert; in allen Pyramiden und Matasben finden wir Katzenmumien. Unser Fund ist darin besonders reich, ein Beweis, dass die ägyptischen Kolonisten am Tschadsee aus der Katzenstadt Bubastis stammten; wir zählen nicht weniger wie zweihundertachtundsechzig dieser Reliquien aus grauer Vorzeit.«
Und der Professor wies stolz auf die langen Reihen hin, die aussahen wie ein Regiment vertrockneter Wickelkinder.
»Dort sehen Sie«, fuhr er fort, »weiter vierunddreissig Menschenmumien, wahre Prachtexemplare, um die uns jedes Museum beneiden wird. Und zwar sind diese Mumien nicht, wie die aus Memphis, schwarz, vertrocknet und leicht zerbrechlich, sondern ähnlich den thebanischen von gelber Farbe und von mattem Glanze. Man muss wirklich staunen vor der ungeheuren Kunst der altägyptischen Einbalsamierer! — Nun aber komme ich zu dem schönsten Edelstein dieser reichen Fundgrube: hier liegt eine echte Topharmumie! Nur drei solche kennt die Welt, die eine kam 1834 durch Lord Hawthorne in das South-Kensington-Museum zu London, die andere, wahrscheinlich die Gattin des Königs Mereure aus der sechsten Dynastie, um 2500 v. Chr., ist im Besitze der Harvard-Universität, ein Geschenk des Milliardärs Gould, der dem Khediven Tewfik nicht weniger wie achtzigtausend Dollars dafür bezahlte. Und das dritte Exemplar verdankt unser Museum der grossherzigen Liberalität und dem hohen wissenschaftlichen Interesse der Herren Kommerzienräte Brockmüller und Lilienthal!«
Javol und Odol strahlten über die fetten Gesichter.
»Die Topharmumie«, fuhr der Professor fort, »ist nämlich ein Denkmal eines der eigentümlichsten und zugleich grauenhaftesten Gebräuche, die die Weltgeschichte kennt. Wie im alten Indien der Brauch bestand, dass die Witwe lebend dem verstorbenen Gatten in die Flammen folgte, so galt es in Ägypten als ein Zeichen der allerhöchsten Treue, wenn eine Gattin dem verstorbenen Gatten in die Totengruft folgte und sich — lebend — einbalsamieren liess. Nun bedenken Sie, bitte, dass nur die Leichen der Pharaonen und der Allervornehmsten einbalsamiert wurden, bedenken Sie ferner, dass diese unerhörte Probe der Gattentreue eine freiwillige war, dass sich also nur sehr wenige Frauen dazu entschlossen haben, so werden Sie ermessen, wie ungeheuer selten solche Tophars sind. Ich möchte behaupten, dass in der ganzen ägyptischen Geschichte kaum sechsmal die grosse Topharzeremonie gefeiert wurde! — Die Topharbraut, wie sie die ägyptischen Dichter nennen, begab sich mit grossem Gefolge in die unterirdische Totenstadt, um ihren jungen Leib den schrecklichen Einbalsamierern anzuvertrauen. Diese machten mit ihr dieselben Manipulationen wie mit den Leichen, mit dem Unterschiede, dass sie sehr langsam dabei zu Werke gingen, um den Körper so lange wie möglich am Leben zu erhalten. Im einzelnen ist uns die Art und Weise der Einbalsamierung noch wenig bekannt, wir kennen sie nur aus einigen, höchst mangelhaften Notizen Herodots und Diodors. Soviel aber ist sicher, dass die Topharbraut unter unerhörten Qualen lebend zur Mumie verwandelt wurde. Freilich, einen schwachen Trost hatte sie dafür: ihre Mumie vertrocknete nicht, sie blieb frisch wie im Leben und verlor auch nicht die leiseste Farbe. Überzeugen Sie sich selbst, man sollte glauben, dass diese schöne Frau hier soeben erst eingeschlafen wäre!«
Mit diesen Worten zog der Professor ein seidenes Tuch weg.
»Ah! — Ah! — Ah!« riefen die Leute.
Da lag ein junges Weib auf dem Marmortisch, bis zur Brust hinauf mit feinen Leinenstreifen umwickelt. Schultern aber, Arme und Kopf waren frei, schwarze Ringellocken spielten über der Stirne. Die feinen Nägel der kleinen Hände waren mit Henna gefärbt, an der Linken trug sie auf dem dritten Finger einen Scarabaeus. Die Augen waren geschlossen, die schwarzen Wimpern sorgsam mit Fliegenbeinen verlängert.
Ich trat mit den andern heran, ganz nahe, um besser sehen zu können — — —
Gerechter Himmel! Das war ja Änny!
Ich schrie laut auf, doch mein Schrei vertönte in dem Geräusche der Menge. Ich wollte sprechen, aber es war mir, als ob ich die Zunge nicht bewegen könne, ich starrte entsetzt auf die Tote.
»Diese Topharbraut«, hörte ich den Professor sagen, »ist zweifellos kein Fellahmädchen. Ihre Gesichtszüge tragen unverkennbar den Typus der indogermanischen Rasse, ich vermute, dass sie eine Griechin ist. Und dies Faktum ist doppelt interessant, beweist es doch die Spuren nicht nur ägyptischer, sondern auch hellenischer Kultur am Tschadsee, mitten in Zentralafrika — —«
Mein Blut hämmerte an den Schläfen, ich hielt mich an einer Stuhllehne, um nicht umzusinken. Da legte sich eine Hand auf meine Schulter.
Ich drehte mich um und sah ein glattrasiertes Gesicht — und doch — ah, das war ja — — beim Himmel — — Fritz Beckers!
Er fasste mich am Arm und zog mich aus der Menge heraus. Ich folgte ihm, fast willenlos.
»Ich werde Sie dem Staatsanwalt anzeigen!« zischte ich durch die Zähne.
»Sie werden das nicht tun, es würde gar keinen Zweck haben. Sie würden sich nur selbst Unannehmlichkeiten machen. Ich bin niemand, absolut niemand! Wenn Sie die ganze Erde durch ein Sieb schütten würden, Sie würden Fritz Beckers nicht darin finden. — So hiess ich ja wohl in der Winterfeldstrasse?«
Er lachte, und sein Gesicht nahm einen widerlichen Ausdruck an. Ich konnte ihn nicht ansehen; wandte mich halb um und starrte auf den Boden.
»Und übrigens,« raunte er mir in die Ohren, »ist es denn nicht besser so? Sie sind doch ein Dichter — — ist Ihnen Ihre kleine Freundin so nicht lieber, in ewiger Schönheit, als auf einem Berliner Kirchhof von Würmern zerfressen?«
»Satan!« stiess ich hervor. »Hündischer Satan!«
Ich hörte ein paar leichte Schritte und blickte auf. Ich sah, wie Fritz Beckers hinten durch eine Saaltüre schlüpfte.
Der Professor hatte seinen Vortrag beendet; man hörte lautes Beifallsklatschen. Er wurde beglückwünscht und schüttelte viele Hände, ebenso wie die Herren Kommerzienräte. Die Menge drängte zum Ausgang. — Unbemerkt trat ich an die Tote. Ich nahm das Medaillon mit dem Bild ihrer Mutter aus der Brieftasche und schob es leise auf ihre junge Brust, gerade unter die Leinenstreifen. Dann beugte ich mich vor und küsste sie leicht zwischen die Augen.
»Adieu, liebe kleine Freundin!« sagte ich.
Ich erhielt folgenden Brief:
Petit-Goaves (Haiti), 16. August 1906.
Lieber Herr!
Also halte ich mein Versprechen; ich werde alles schreiben, wie Sie es wünschen, von Anfang an. Machen Sie damit, was Sie wollen, nur verschweigen Sie meinen Namen um meiner Verwandten in Deutschland willen. Ich möchte Ihnen einen neuen Skandal ersparen; der andere ist ihnen schon übel genug an die Nerven gegangen.
Hier haben Sie zuerst, auf Ihren Wunsch, meine ganze bescheidene Lebensgeschichte. Ich kam mit zwanzig Jahren herüber, als junger Mann, in ein deutsches Geschäft in Jérémie; Sie wissen ja, dass die Deutschen in diesem Lande fast den ganzen Handel in ihren Händen haben. Das Gehalt verlockte mich — 150 Dollars im Monat —, ich sah mich schon als Millionär. Na, ich machte die Karriere von allen jungen Leuten, die in dies schönste und verdorbenste Land der Erde kommen: Pferde, Weiber, Saufen und Spielen. Nur wenige reissen sich da heraus und auch mich rettete nur meine besonders kräftige Konstitution. An Vorankommen war nicht zu denken; im deutschen Spital zu Port-au-Prince habe ich halbe Jahre herumgelegen. — Einmal machte ich ein vorzügliches Geschäft mit der Regierung, drüben würden sie's freilich einen unerhört frechen Betrug nennen. Da hätten sie mich dafür drei Jahre ins Zuchthaus gesteckt, hier stieg ich zu hohen Ehren. Überhaupt, wenn ich für all das, was hier jeder Mensch macht, und das sie drüben Verbrechen zu nennen belieben, die festgesetzten Strafen des R. St. G. B. bekommen hätte, so müsste ich wenigstens 500 Jahre alt werden, um aus dem Zuchthaus wieder heraus zu kommen! Aber ich will sie gerne abbrummen, wenn Sie mir einen Menschen meines Alters hier im Lande bezeichnen können, dessen Konto ein kleineres wäre! Freilich müsste auch bei Ihnen ein moderner Richter uns stets allesamt freisprechen, denn es fehlt uns durchaus das Bewusstsein der Strafbarkeit unserer Handlungen: im Gegenteil, wir halten diese Handlungen für ganz und gar erlaubt und höchst honett.
Also gut, ich legte mit dem Bau der Mole zu Port-de-Paix — von der natürlich nicht ein Stein gebaut wurde — den Grundstein zu meinem Vermögen; ich teilte mich mit ein paar Ministern in den Raub. Heute habe ich eines der blühendsten Geschäfte auf der Insel und bin ein schwer reicher Mann. Ich handle — oder schwindle, wie Sie sagen, — mit allem was es überhaupt gibt, wohne in meiner schönen Villa, spaziere in meinen herrlichen Gärten und trinke mit den Offizieren der Hapagschiffe, wenn sie unsern Hafen anlaufen. Ich habe Gott sei Dank weder Weib noch Kind — — Sie freilich mögen die Mulattenrangen, die in meinen Höfen herumlaufen, als meine Kinder ansehen, bloss weil ich sie gezeugt habe — der Herr erhalte Ihnen Ihre Moral! — Ich tu's nicht. Kurz, ich fühle mich ausserordentlich wohl.
Jahrelang hatte ich freilich ein elendes Heimweh. Vierzig Jahre war ich von Deutschland fort gewesen — Sie verstehen. Ich nahm mir vor, meinen ganzen Kram schlecht und recht loszuschlagen und meine alten Tage in der Heimat zu verbringen. Als ich mich dazu entschlossen hatte, wurde die Sehnsucht plötzlich so stark, dass ich die Abfahrt gar nicht mehr erwarten konnte; ich verschob also den endgültigen Abbruch meines Geschäftes und fuhr Hals über Kopf mit einem tüchtigen Batzen Geld im Sack vorläufig zu einem halbjährigen Besuche herüber.
Na, drei Wochen bin ich dort gewesen, und hätte ich einen Tag noch gezögert, so würde mich der Staatsanwalt gleich auf fünf Jahre dabehalten haben. Das war der Skandal, auf den ich eben anspielte. »Ein neuer Fall Sternberg« schrieb man in den Berliner Blättern, und meine hochanständige Familie sah darunter fett ihren ehrenwerten Namen gedruckt. Ich werde nie die letzte Unterredung mit meinem Bruder vergessen — der arme Mensch ist Oberkonsistorialrat. Das Gesicht, das er machte, als ich ihm ganz harmlos versicherte, dass die Mädchen wenigstens 11 oder gar 12 Jahre alt gewesen seien! Je mehr ich mich vor ihm reinzuwaschen suchte, um so mehr rannte ich mich herein. Als ich ihm sagte, dass es doch wirklich nicht so schlimm sei, und dass wir hierzulande alle mit Vorliebe Mädchen von acht Jahren nehmen, da wir sonst nur fast kranke und Jungfrauen überhaupt nicht mehr bekämen — griff er sich an die Stirne und sagte: »Schweige, unglückseliger Bruder, schweige! Mein Auge blickt in einen Pfuhl ruchloser Fäulnis!« — Drei Jahre hat er mir gegrollt, und nur dadurch habe ich seine Versöhnung wiedererlangt, dass ich jedes seiner elf Kinder mit 50 000 Mark im Testament bedacht habe und ihm ausserdem einen sehr anständigen Monatszuschuss für seine Söhne sende. Dafür schliesst er mich allsonntäglich in sein Gebet ein. Wenn ich ihm schreibe, verfehle ich nie, ihm mitzuteilen, dass wieder eine junge Dame meines Ortes in das passende Alter von acht Jahren getreten sei und sich meiner Gunst erfreut habe. Er möge für mich alten Sünder beten. Hoffentlich nutzt das! Einmal schrieb er mir, er habe stets mit seinem Gewissen gekämpft, ob er das Geld eines so unverbesserlichen Menschen annehmen dürfe, oftmals sei er nahe daran gewesen, es zurückzuweisen; nur die Rücksicht und das christliche Mitleid für seinen einzigen Bruder habe ihn immer wieder veranlasst, das Geld zu nehmen. Nun aber sei es ihm plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen, und jetzt wisse er, dass ich immer nur gescherzt habe. Denn ich sei ja jetzt 69 Jahre alt und daher zu solchen Schandtaten gottlob nicht mehr fähig. Aber er bäte mich recht sehr, auch diese frivolen Scherze in Zukunft zu unterlassen.
Ich antwortete ihm — die Kopie, die ich als guter Kaufmann aufbewahrt habe — will ich hierher setzen:
Mein lieber Bruder!
Dein Brief hat mich sehr in meiner Ehre gekränkt. Ich sende Dir beifolgend ein Paket mit Rinde und Blättern des Toluwangabaumes, die mir allwöchentlich ein alter Nigger besorgt. Der Kerl behauptet 160 Jahre alt zu sein — na, 110 ist er wenigstens. Dabei ist er — dank des ausgezeichneten Absudes aus dieser Rinde — der grösste Don Juan unserer ganzen Gegend, neben Deinem lieben Bruder. Letzterer ist übrigens seiner Sache von Natur aus noch recht sicher und bedient sich nur in aussergewöhnlichen Fällen des köstlichen Trankes. Deshalb kann ich Dir ruhig einiges von meinem Reichtum abgeben und garantiere für prompte Wirkung. Übermorgen, zur Feier Deines Geburtstages, will ich ein kleines Gelage veranstalten und zu diesem Ehrentage zwei siebenjährige Nüsslein knacken, wie das bei uns zur Erhöhung der Freude seines Festtages üblich ist. Dabei will ich auf Dein Wohl trinken!
Einliegend zum nahen Weihnachtsfest einen kleinen Extrascheck über 3000 Mk. (dreitausend Mark). Mit herzlichen Grüssen für Dich und all die Deinen
Dein treuer Bruder.
P.S. Ich bitte mir mitzuteilen, ob Du auch Weihnachten in Deinem Gebete meiner gedacht hast.
D.O.«
Wahrscheinlich hat mein guter Bruder auch diesmal wieder schwer mit seinem Gewissen zu kämpfen gehabt, aber schliesslich hat dann das christliche Mitleid mit mir armem Sünder in seinem guten Herzen doch gesiegt. Wenigstens hat er den Scheck behalten. — —
Ich wüsste wirklich nicht, was ich Ihnen sonst noch von meinem Leben mitteilen sollte, lieber Herr. Ich könnte Ihnen hundert kleine Abenteuer und Scherze erzählen, aber sie werden alle derselben Art sein, wie Sie sie auf Ihren Streifzügen durch unser Land von allen Weissen überall gehört haben. Beim Durchlesen dieses Schreibens fällt mir auf, dass drei Vierteile des Briefes, der doch ein »curriculum vitae« sein sollte, auf das Thema »Weib« fallen — na, das ist gewiss charakteristisch für den Schreiber. Übrigens: was hätte ich Interessantes sagen sollen über meine Gäule, über meine Waren und meine Weine? Und dem Poker bin ich untreu geworden; in meinem Ort bin ich der einzige Weisse, ausser dem Hapagagenten, und der spielt ebensowenig wie die Offiziere seiner Linie, die mich gelegentlich besuchen.
Bleibt das Weib — was wollen Sie?
So, nun werde ich diesen Brief in das Heft legen, in das die merkwürdigen Aufzeichnungen kommen sollen, die Sie von mir wünschen und von denen ich selbst noch keine leise Ahnung habe. Wer weiss also, wann Sie den Brief erhalten — und — vielleicht mit einem ganz leeren Hefte!
Ich grüsse Sie, lieber Herr, und bin Ihr ergebener
"F.X.
Diesem Briefe folgten anschliessend folgende Aufzeichnungen:
18. August.
Wie ich dies leere Heft aufschlage, habe ich das Gefühl, als trete etwas Neues in mein Leben. Was denn? Der junge Doktor, der mich drei Tage besuchte, hat mir das Versprechen abgenommen, ein Geheimnis zu erforschen und ein seltsames Abenteuer anzufangen. Ein Geheimnis, das vielleicht gar nicht existiert, und ein Abenteuer, das nur in seiner Phantasie lebt! Und ich habe ihm das so leichthin versprochen — — ich denke, er wird recht enttäuscht sein.
Freilich, er hat mich verblüfft. Fünf Monate streift er in diesem Lande herum und kennt es viel besser als ich, der ich nun fünfzig Jahre hier hause. Tausend Dinge hat er mir erzählt, die ich nie vernommen, oder die ich wohl einmal gehört, aber stets ungläubig beiseite geschoben habe. Wahrscheinlich hätte ich es auch mit seinen Erzählungen so gemacht, wenn er nicht aus mir selbst durch Fragen alles mögliche herausgeholt hätte, über das ich mir nie recht klar geworden bin und das mir nun in einem ganz anderen Lichte erscheint. Und doch würde ich das alles bald genug vergessen haben, wenn nicht der kleine Vorfall mit Adelaide gewesen wäre.
Wie war es doch? Das Negermädchen — sie ist die schönste und kräftigste von meinen Dienerinnen und eigentlich meine Favoritin, seitdem sie im Hause ist — deckte uns den Teetisch. Der Doktor unterbrach plötzlich das Gespräch und sah sie aufmerksam an. Als sie hinausging, fragte er mich, ob ich den kleinen Silberreif mit dem schwarzen Steine am Daumen ihrer rechten Hand bemerkt habe. Ich hatte den Ring tausendmal gesehen, aber nie darauf geachtet. Ob ich bei einer anderen schon einmal einen solchen Ring gesehen habe? Nun, das sei möglich, freilich erinnere ich mich nicht. Er schüttelte nachdenklich den Kopf.
Als das Mädchen wieder auf die Veranda kam, um den Tee zu servieren, sang der Doktor, ohne sie anzusehen, halblaut ein paar Töne. Eine absurde Melodie mit blöden Niggerworten, die ich nicht verstand:
Leh! Eh! Bomba, hen, hen!
Cango bafio tè
Cango moune dè lé
Cango do ki la
Cango li!
Krach! Das Teebrett lag auf den Steinen, die Kannen und Tassen in Scherben. Mit einem Schrei rannte das Mädchen ins Haus. Der Doktor sah ihr nach, dann lachte er und sagte:
»Ich gebe Ihnen mein Wort: sie ist eine Mamaloi!«
Wir plauderten bis Mitternacht, bis die Dampfpfeife ihn auf das abfahrende Schiff zurückrief. Als ich ihn in meinem Boot an Bord brachte, hatte er mich beinahe überzeugt, dass ich wie ein Blinder in einer höchst wunderbaren Schreckenswelt lebe, von deren Existenz ich bisher keine Ahnung hatte.
Nun, ich habe Augen und Ohren geschärft. — Bisher ist mir noch gar nichts Sonderbares aufgefallen. Ich bin sehr neugierig auf die Bücher, die mir der Doktor von New York aus senden will; übrigens will ich ihm gerne zugeben, dass es ein Skandal ist, dass ich in all der Zeit noch nicht ein einziges Werk über dies Land gelesen habe. Immerhin — ich wusste ja gar nicht, dass es solche Bücher gäbe — ich habe nie bei einem Bekannten eines gesehen.
27. August.
Adelaide ist wieder einmal für acht Tage fort, zu ihren Eltern ins Innere. Sie ist eigentlich das einzige Negermädchen, bei dem ich je eine so grosse Liebe zu ihrer Familie bemerkt habe; ich glaube, sie würde weglaufen, wenn ich ihr nicht den Urlaub bewilligte. Tagelang vorher ist sie dann ganz närrisch und wenn sie zurückkehrt, hat sie der Trennungsschmerz jedesmal so angegriffen, dass sie mir schon während der Arbeit zusammengefallen ist. Man denke: ein Negermädchen! Übrigens habe ich während ihrer Abwesenheit in ihrem Zimmer Haussuchung gehalten; ganz rationell, ich habe mir zu dem Zwecke vorher das betreffende Kapitel in einem Detektivroman durchgelesen. Ich habe gar nichts Verdächtiges, aber auch nicht das allergeringste, gefunden. Die einzige ihrer Habseligkeiten, deren Bedeutung mir nicht sofort klar war, war ein schwarzer länglich runder Stein, der auf einem Teller in Öl lag. Ich denke mir, sie wird ihn zum Massieren gebrauchen, alle diese Mädchen massieren sich ja.
4. September.
Die Bücher sind aus New York angekommen; ich will mich gleich an die Lektüre machen. Es sind drei deutsche, drei englische und fünf französische Werke, zum Teil illustriert. Adelaide ist zurückgekommen, sie ist so elend, dass sie sich gleich zu Bett legen musste. Na, ich kenne das, in ein paar Tagen ist sie wieder kreuzfidel.
17. September.
Wenn nur der zehnte Teil von dem wahr ist, was in diesen Büchern steht, so verlohnt es sich allerdings, dem Geheimnis nachzugehen, das der Doktor in meiner nächsten Nähe vermutet. Aber diese Reisenden wollen sich interessant machen daheim, und dann schreibt immer der eine von dem andern den grössten Blödsinn ab. Bin ich denn wirklich ein solch blinder Esel, dass ich von dem ganzen Vaudouxkult mit seiner Schlangenanbetung und seinen Tausenden von Menschenopfern jahraus jahrein kaum etwas bemerkt haben sollte? Einzelne Kleinigkeiten sind mir ja aufgefallen, ich habe sie nie beachtet. Ich will versuchen, aus meiner Erinnerung das herauszusuchen, was etwa mit dem Vaudouxkult in Zusammenhang zu bringen wäre.
Einmal weigerte sich meine alte Haushälterin, — ich wohnte damals in Gonaives — auf dem Markte Schweinefleisch einzukaufen. Es könnte Menschenfleisch sein, behauptete sie. Ich lachte sie aus und hielt ihr vor, dass sie doch das ganze Jahr über Schweinefleisch einkaufe. »Ja, aber nie zur Osterzeit!« — Sie liess sich von ihrer fixen Idee nicht abbringen, und ich musste eine andere auf den Markt schicken. Ich habe auch oft diese Caprelatas gesehen — Hougons nennt man sie in unserer Gegend — gebrechliche Greise, die »Wanges« verkaufen. Das sind kleine Säckchen mit Muscheln und bunten Steinchen, die als Amulette getragen werden. Sie unterscheiden zwei Sorten, die »Points«, die unverwundbar machen, für Männer, und die »Chances«, für Frauen, die den Besitz des nackten Geliebten sichern. Aber ich habe nie gewusst, dass diese Schwindler — nein, diese Kaufleute — eine Art niederer Priester des Vaudouxkultes seien. Ebensowenig habe ich damit in Verbindung gebracht, dass so viele Speisen für manche Neger Tabu sind; so rührt zum Beispiel Adelaide weder Tomaten noch Auberginen an, sie isst kein Ziegen- und kein Schildkrötenfleisch. Dagegen hat sie oft gesagt, dass Bockfleisch gesegnet sei und auch das »Maiskassan«, ihr geliebtes Maisbrot. Ich weiss auch, dass die Zwillinge überall mit Jubel begrüsst werden; dann feiert die Familie ein Fest, wenn eine Frau, oder gar eine Eselin »Marassas« bekommen hat.
Aber, du lieber Gott, die Geschichte mit dem Menschenfleisch auf dem Markt ist gewiss eine Fabel und die andern Sachen erscheinen mir alle ungeheuer harmlos. Kleiner Aberglauben — — in welchem Lande der Welt fände man nicht Ähnliches?
19. September.
Was Adelaide betrifft, so scheint der Doktor wirklich recht zu haben, wenn eben seine Weisheit nicht auch allzusehr aus den Büchern geschöpft ist. Einen solchen Ring erwähnt der Engländer Spencer St. John; ihn soll die »Mamaloi«, die Priesterin des Vaudoux, tragen. Übrigens muss ich sagen, dass in dieser Bezeichnung und in der analogen des Oberpriesters mehr Geschmack steckt, als ich diesen Niggern zugetraut habe. »Papaloi«, »Mamaloi« — das »loi« steht in ihrem korrumpierten Französisch natürlich für »roi« — kann man sich einen schönern Titel denken? Mutter und Königin — Vater und König, das klingt doch besser wie Oberkonsistorialrat, wie mein gottesfürchtiger Herr Bruder sich betitelt?! — Auch ihren Stein, von dem ich annahm, dass er zum Massieren diene, habe ich in den Büchern gefunden, sowohl Tippenhauer wie Moreau de St. Méry kennen ihn. Fabelhaft, ich habe einen leibhaftigen Gott in meiner Villa, der Kerl heisst Damtala! Ich habe mir das Ding in ihrer Abwesenheit noch einmal genau betrachtet, die Beschreibung stimmt durchaus. Es ist zweifellos ein altes, vorzüglich geschliffenes Steinbeil aus der Karaibenzeit. Die Neger finden solche im Walde, können sich ihren Ursprung nicht erklären und halten sie für göttlich. Sie legen ihn auf einen Teller; er kennt die Zukunft und spricht durch Klappern. Um ihn bei guter Laune zu erhalten, erhält er alle Freitage ein Bad in Olivenöl. Ich finde das ganz köstlich und meine Geheimpriesterin gefällt mir alle Tage besser. Freilich, Geheimnisse sind schon zu erforschen, da hat der Doktor recht — — aber etwas Schauriges ist nicht dabei!
23. September.
Jetzt in meinem siebzigsten Lebensjahre muss ich einsehen, wie gut es ist, sich auf allen Gebieten zu bilden! Nie würde ich die köstliche Geschichte von gestern erlebt haben, wenn ich nicht in den Büchern studiert hätte!.
Ich trank meinen Tee auf der Veranda und rief nach Adelaide, die den Zucker vergessen hatte. Sie kam nicht. Ich ging in mein Zimmer, in die Küche, sie war nicht dort, auch die andern Mädchen nicht; den Zucker konnte ich auch nicht finden. Wie ich über den Flur ging, hörte ich ein halblautes Sprechen in ihrem Zimmer. Ich eilte also in den Garten — der Raum liegt zu ebener Erde — und schaute hinein. Da sass meine hübsche, schwarze Priesterin, wischte mit ihrem besten seidenen Tuche den Stein ab, legte ihn auf den Teller und goss vorsichtig frisches Öl darüber. Sie war sehr erregt, die Augen standen ihr voll Tränen. Vorsichtig nahm sie den Teller zwischen zwei Fingerspitzen und streckte den Arm aus. Das dauerte eine Weile, dann begann ihr Arm zu zittern, leise erst, dann immer stärker. Und natürlich klapperte der Stein. Adelaide sprach mit ihm, leider konnte ich nichts verstehen.
Aber ich habe es herausgebracht, fein, der Doktor kann mit mir zufrieden sein. Ich auch, denn im Grunde ist die Sache nur schmeichelhaft für mich. Also am Abend nach dem Essen ging ich in ihr Zimmer, nahm den Klapperstein und setzte mich in meinen Lehnstuhl. Als sie hineinkam, um den Tisch abzuräumen, legte ich schnell die Zeitung weg, nahm den Teller zur Hand und goss frisches Öl auf den Stein. Der Effekt war grossartig, sie liess, bums! das Tablett fallen, das scheint ihre Spezialität zu sein in solchen Augenblicken. Gott sei Dank war es leer diesmal. Ich winkte ihr, still zu sein und sagte ruhig: »Freitag! Er muss heute ein frisches Bad haben!« — »Sie wollen ihn fragen?« flüsterte sie. »Natürlich!« — »Über mich?« — »Gewiss!« — Das kam mir sehr gelegen, jetzt würde ich schon ihr Geheimnis herausbekommen. Ich winkte ihr hinauszugehen und die Tür hinter sich zu schliessen. Das tat sie, aber ich hörte wohl, dass sie draussen stehen blieb und lauschte. Nun liess ich meinen Gott nach Herzenslust klappern, er sprang auf seinem Ölteller herum, dass es eine Freude war. Das Klapp! Klapp! mischte sich mit den langen Seufzern Adelaides, die von der Türe herkamen.
Im Augenblick, als ich dem Donnergott Ruhe gab und den Teller auf den Tisch setzte, schlüpfte sie herein.
»Was hat er gesagt?«
Ja, zum Kuckuck, was hatte er gesagt? Geklappert hatte er, weiter nichts. Ich schwieg also.
»Was hat er gesagt?« drängte sie. »Ja? oder Nein?«
»Ja!« sagte ich auf gut Glück.
Sie jubelte: »Petit moune? Petit moune?« (*)
(*) Kreolisch, das Patois der Haitineger, für »Petit monde« = Kleines Kind.
»Natürlich: Petit moune!« wiederholte ich.
Sie hüpfte im Zimmer herum, sprang von einem Bein aufs andere.
»Oh, er ist gut, so gut, der liebe Donnergott! Mir hat er's auch gesagt! Und nun muss er's halten, da er's zweimal versprochen hat an einem Tage!«
Plötzlich wurde sie wieder ganz ernst: »Was hat er gesagt, ein Junge oder ein Mädchen?«
»Ein Junge«, antwortete ich.
Da fiel sie auf die Knie vor mir, weinte und heulte und schluchzte immer wieder, ganz aufgelöst vor Wonne: »Ach endlich! Endlich!«
28. September.
Ich weiss, dass Adelaide mich liebt seit langer Zeit, und dass sie sich nichts sehnlicher wünscht, als von mir ein »petit moune« zu haben. Neidisch ist sie auf die andern Mädchen, die im Hofe ihre Rangen herumlaufen haben, obwohl ich mich weiss Gott nicht darum kümmere. Ich glaube, sie möchte ihnen am liebsten die Augen auskratzen. Deshalb also die gute Behandlung des Donnergottes. — Übrigens war sie heute abend ganz reizend, ich meine, ich hätte nie ein so liebes Negermädchen gehabt. Ich glaube, ich habe sie wirklich gern und was mich anlangt, soll gewiss alles geschehen, ihren kleinen Wunsch zu erfüllen.
6. Oktober.
Es ist skandalös, dass ich als guter Kaufmann nie darüber Buch geführt habe, inwieweit ich zur Verbesserung der niederträchtigen Rasse dieses schönen Landes beigetragen habe. Ich habe augenscheinlich meine kulturellen Verdienste immer viel zu niedrig eingeschätzt. Heute habe ich also die Statistik nachgeholt; es war nicht schwer. Ich habe nämlich auch am Daumen drei Gelenke und die scheinen erblich zu sein. Was also in der Stadt mit drei Gelenken am Daumen herumläuft, ist gewiss von mir. Eine lustige Entdeckung habe ich bei dem kleinen Léon gemacht. Ich habe den Mulattenjungen immer für meinen Sprössling gehalten und auch die Mama schwört darauf. Aber: der Bengel hat nur zwei Gelenke am Daumen. Da stimmt etwas nicht. Ich habe den schönen Christian im Verdacht, einen der Hapagoffiziere, der hat mir gewiss ins Handwerk gepfuscht. — Übrigens fehlen nicht weniger wie vier von meinen Rangen. Es heisst, dass sie weggelaufen sind, seit Jahren schon; niemand konnte mir irgend welche Anhaltspunkte geben. Ist ja auch so gleichgültig.
24. Oktober.
Der Klappergott hat recht prophezeit. Adelaide ist selig und zu mir von einer Flitterwochenzärtlichkeit, die fast beunruhigend ist. Ihr Stolz und ihre Freude wirken beinahe ansteckend, noch nie im Leben habe ich mich um das Gedeihen eines zukünftigen Erdenbürgers bekümmert, und jetzt — ich kann's nicht leugnen — habe ich ein augenscheinliches Interesse daran. Dazu kommt das immer nähere Verhältnis, in das ich zu Adelaide getreten bin. Freilich hat es manches Sträuben und Zögern, manches Tränchen, manche Zärtlichkeit gekostet, bis ich ihr ganzes Vertrauen errungen habe. Diese Schwarzen können ja schweigen, wenn sie wollen; das, was sie nicht sagen wollen, holt man nicht aus ihnen heraus und wenn man sie mit glühenden Zangen kneipen würde.
Auch hier war es wieder ein besonders glücklicher Umstand, der mir das Mittel in die Hand gab, sie zu zwingen, auch die letzte Maske abzulegen.
Adelaide hat nämlich gar keine Eltern mehr! Ich erfuhr das von einem uralten Mütterchen, das Phylloxera heisst und seit vielen Jahren in meinen Gärten Unkraut jätet. Es ist ein verhuzzeltes Weibchen, das mit ihrem Urenkel, einem schmutzigen, verlausten Buben, in einer elenden Hütte in der Nähe haust. Der nichtsnutzige Junge hatte wieder einmal Eier bei mir gestohlen und sollte diesmal gründlich die Peitsche bekommen; da kam die Alte, ihn loszubitten. Als Gegenleistung bot sie mir Mitteilungen über Adelaide an, natürlich war auch ihr nicht entgangen, in welcher Gunst die jetzt bei mir steht. Und diese Mitteilungen — ich habe der Alten bei allen Heiligen schwören müssen, sie nicht zu verraten — sind wirklich so interessant, dass ich ihr noch einen amerikanischen Dollar obendrein gab. Adelaide hat gar keine Eltern und also hat sie sie auch nie besucht. Sie ist eine Mamaloi, eine Priesterinkönigin des Vaudoux-Kultes. Wenn sie von mir Urlaub nahm, so geschah es, um zu dem »Honfoû« zu eilen, dem Tempel, der menschenfern auf einer Lichtung im Wald liegt. Und meine kleine zärtliche Adelaide spielt da die grausame Priesterin, beschwört die Schlange, erwürgt Kinder, trinkt Rum wie ein alter Schiffskapitän und feiert unerhörte Orgien! Kein Wunder, dass sie immer völlig erschöpft nach Hause kam! — Na, warte, du kleine schwarze Kanaille!
26. Oktober.
Ich sagte, dass ich nach Sâle-Trou reiten müsse, und liess mein Pferd satteln. Die Alte hatte mir so ungefähr den Weg zum Tempel beschrieben, so gut wie ein Negerweib eben einen Weg beschreiben kann. Natürlich verritt ich mich und hatte das Vergnügen, im Urwald übernachten zu können; zum Glück hatte ich eine Hängematte mit. Erst am nächsten Morgen fand ich den Honfoûtempel, nämlich eine sehr grosse aber elende Strohhütte auf einer Lichtung, die gestampft und geglättet war wie ein Tanzplatz. Eine Art Pfad führte auf den Tempel zu, zu beiden Seiten sah ich in die Erde gesteckte Pflöcke, auf denen abwechselnd die Kadaver schwarzer und weisser Hühner steckten. Zwischen den Pflöcken lagen ausgeblasene Truthahneier, und grotesk geformte Steine und Wurzeln. Ein grosser Erdbeerbaum, den die Gläubigen Loco nennen und als göttlich verehren, stand am Eingang des Tempels, rund herum hatte man, ihm zu Ehren, viele Gläser, Teller und Flaschen zu Scherben zerschlagen.
Ich trat in den Raum. Ein paar Löcher im Dach gaben genügend Licht, unter einem davon stak an einem Pfeiler eine herabgebrannte Kienfackel. Die Tempeleinrichtung war äusserst lustig. An den Wänden sah ich die Bildnisse Bismarcks aus der »Woche« und König Eduards aus den »Illustr. London News«. Beide stammen ganz gewiss von mir, wer hätte sonst die Blätter hier halten sollen? Wahrscheinlich hatte sie Adelaide grossmütig gestiftet. Da waren weiter ein paar Heiligenbilder, grässliche Öldrucke, die den heiligen Sebastian, den heiligen Franziskus und die Madonna darstellten, daneben Blätter aus dem »Simplicissimus« (auch von mir!) und der »Asiette au Beurre«. Zwischendurch hingen ein paar alte Fahnenlappen, Muschelketten und bunte Bänder aus Papierschnitzeln. Hinten, etwas erhöht, bemerkte ich einen starken Korb. Aha, dachte ich, darin steckt er also, Hougonbadagri, der grosse Vaudouxgott! Sehr vorsichtig öffnete ich den Deckel und sprang zurück, ich hatte durchaus keine Lust, mich von irgendeinem giftigen Vieh beissen zu lassen. Aber ach! Eine Schlange war wohl im Korbe, aber es war eine harmlose Ringelnatter und sie war elend verhungert. Das ist echt Negerart, etwas als Gott anbeten, um sich dann, nach den Festen, nicht mehr darum zu bekümmern! Freilich, ein Ersatzgott ist ja im Handumdrehen im Walde zu fangen! Jedenfalls hat es Damtala, der brave Klappergott, entschieden besser, als der allmächtige Houedosobagui, der da elend zusammengeschrumpft tot vor mir lag; jener bekommt doch Öl jeden Freitag, während dieser, der doch in diesem verrückten heidnisch-christlichen Vaudouxkult Johannes der Täufer selber ist, nicht einmal ein Fröschlein oder Mäuslein erhält!
29. Oktober.
Als ich am nächsten Tage Adelaide mit meiner neuen Wissenschaft auftrumpfte — ich tat so, als ob mir alles längst bekannt sei —, machte sie gar keinen Versuch mehr zu leugnen. Ich sagte ihr, dass mich der Doktor eingeweiht habe, der ein Abgesandter Cimbi-Kitas, des Oberteufels sei und zeigte ihr eine Axt, über die ich etwas rote Tinte gegossen hatte. Die in Blut getränkte Axt ist nämlich das Symbol dieses bösen Dämons.
Das Mädchen zitterte, schluchzte und war kaum zu beruhigen.
»Ich wusste es,« schrie sie, »ich wusste es und habe es auch dem Papaloi gesagt! Er ist Dom Pédre selbst!«
Das bejahte ich — warum sollte der gute Doktor nicht Dom Pédre selbst sein? Nun erfuhr ich, dass gerade unser Ort, Petit Goaves, der Hauptsitz der Teufelssekte Dom Pédres ist. Das war ein Mann — ein schöner Schwindler mag er gewesen sein —, der vor langer Zeit aus dem spanischen Teil der Insel herüber kam und hier den Kult Cimbi-Kitas, des grossen Teufels, und seines Knechtes Azilit begründete. Ein gutes Stück Geld muss er damit verdient haben. Aber er selbst und alle seine Ober- und Unterteufel mögen mich lebendig holen, wenn ich nicht auch aus der ganzen Geschichte ein gutes Geschäft mache! Ich habe schon meine Idee.
18. November.
Heute hörte ich das Néklesin, das eiserne Triangel, durch die Strassen schallen. Wie oft habe ich diese kindische Musik gehört und habe mir nie etwas dabei gedacht; jetzt erst weiss ich, dass es das unheimliche Zeichen ist, das die Gläubigen zum Tempel ruft. Ich habe sofort meine kleine Mamaloi kommen lassen und ihr mitgeteilt, dass ich diesmal an dem Opferdienste teilnehmen würde. Sie war ausser sich, bat und flehte, jammerte und schrie. Aber ich gab nicht nach; ich zeigte ihr wieder das alte Holzbeil mit der roten Tinte, das sie vor Schrecken fast zu Stein erstarren liess. Ich sagte ihr, dass ich besondern Auftrag von Dom Pédre habe und dass alles genau so zugehen müsse wie gewöhnlich. Sie ging fort, um mit ihren Houcibossales zu reden, den tätowierten Vaudouxleuten; ich denke mir, sie wird den Papaloi selbst aufsuchen.
Ich habe ihre Abwesenheit benutzt, um noch ein paar Kapitel in meinen Büchern durchzulesen, hier habe ich mir einige Daten zusammengestellt, die wohl ihre Richtigkeit haben. Danach war der Befreier Haitis, Toussaint Louverture, selbst ein Papaloi, ebenso der Kaiser Dessalines und der König Christophe. Auch Kaiser Soulouque war ein Vaudouxpriester, ich sah ihn noch, den schwarzen Schuft, als ich 1858 nach Port-au-Prince kam. Und der Präsident Salnave, mein guter Freund Salnave, brachte 1868 selbst das Menschenopfer, das Opfer des »ungehörnten Bockes«. Salnave, wer hätte das gedacht! Der Spitzbube, mit dem ich — genau in demselben Jahre — die wundervolle Mole von Port-de-Paix — nicht baute, womit ich mir mein erstes Vermögen verdiente. Kommt Präsident Salomon, der uralte Trottel, der auch ein eifriger Förderer des Vaudoux war. Dass Hippolyte, sein Nachfolger, nicht viel anders war, habe ich oft gehört, aber dass er sich die Skelette der von ihm geschlachteten Opfer zur Erinnerung aufbewahrte, ist doch ein netter Zug von ihm. Als er vor zehn Jahren starb, fand man in seinen Räumen eine ganze Reihe solcher Skelette; er hätte mir wirklich ein paar davon vermachen sollen, ich habe so manches gute Geschäft mit ihm gemacht. Immer Halbpart und dabei hat er alle Uniformen umsonst von mir bekommen, mit soviel goldenen Litzen, als er nur wünschte! Und alle »Kalypsos« gingen aus meiner Tasche, nie hat er einen Centime ausgegeben als kleines Trinkgeld für die Herren Deputierten.
Also die zwei Präsidenten aus den sechziger und siebziger Jahren Geffrard und Boisrond-Canal traten dem Vaudoux entgegen? Ausgerechnet die beiden, mit denen am schwersten Geschäfte zu machen war! In ihre Zeit fallen auch die Prozesse gegen die Vaudouxleute. Da wurden 1864 zu Port-au-Prince acht Leute erschossen, weil sie ein zwölfjähriges Mädchen geopfert und aufgegessen hatten, eben deshalb wurde 1876 ein Papaloi zum Tode verurteilt und zwei Jahre später ein paar Weiber. Viel ist das gerade nicht, wenn wirklich, wie Texier meint, alljährlich ein paar tausend Kinder — cabrits sans cornes — geschlachtet und verzehrt werden.
— Adelaide ist noch immer nicht zurückgekehrt. Aber ich werde meinen Willen unter allen Umständen durchsetzen. Ich gehöre diesem Lande an und habe ein Recht, es in seinen Eigenarten kennen zu lernen.
Abends zehn Uhr.
Der Papaloi hat einen Abgesandten geschickt, einen Avalou, so eine Art Küster, der für seinen Herrn eine Unterredung mit mir erbat. Ich habe ihn weggeschickt und mich auf nichts eingelassen. Vorher habe ich dem Kerl noch meine Tintenaxt gezeigt, die auch diesmal ihre Wirkung nicht verfehlte. Ich habe dem Papaloi sagen lassen, dass ich ihn niederschiessen würde, wenn meine Wünsche nicht erfüllt würden.
Um neun Uhr kam der Kerl noch einmal zurück, um zu parlamentieren; er hatte übrigens einen Heidenrespekt und traute sich nicht mehr in mein Zimmer. Ich fluchte fürchterlich im Namen Cimbi-Kitas, des Oberteufels. Der Mann wenigstens ist von meiner teuflischen Mission ebenso fest überzeugt wie Adelaide! Sie ist noch immer nicht zurück, ich bin gewiss, dass sie festgehalten wird. Ich habe dem Avalou gesagt, dass ich, zusammen mit Dom Pédre selbst, sie holen würde, wenn sie in einer Stunde nicht zu Hause sei.
Nachts zwölf Uhr.
Alles ist geordnet, die Expedition kann morgen vor sich gehen. Der Papaloi sah wohl ein, dass ich von meinem Willen nicht abzubringen sei, deshalb fügte er sich meinen Wünschen. Als echter Pfaffe suchte er schliesslich noch etwas für sich zu retten und stellte durch Adelaide die Bedingung, dass ich zwanzig Dollars für die Armen der Gemeinde stifte. »Die Armen« — das ist er natürlich selber, ich habe ihm also gleich das Geld zugesandt. Nun wird der schwarze Oberkonsistorialrat wohl zufrieden sein.
Dafür schickte er mir eine Handvoll verfaulter Pflanzen, davon solle ich mir ein Bad machen lassen, um Canzou zu werden, das heisst die Weihe zu erhalten. Eigentlich muss man vierzig Tage in solchem Dreckbade hocken, bis es ganz verdunstet ist, doch wurde für mich ein abgekürztes Verfahren gestattet. Ich warf den Kram gleich in den Kehricht, dagegen ass ich Adelaide zuliebe die zweite Gabe, Verver, ein Gemisch aus Mais und Blut. Es schmeckte scheusslich. Nun bin ich vorbereitet genug, um morgen nacht unter die Teufelspriester, die Bizangos und Quinbindingues aufgenommen zu werden.
22. November.
Ich muss mir Mühe geben, die Feder zu halten, der Arm zittert und die Hand will nicht gehorchen. Zwei Tage habe ich auf dem Diwan gelegen und noch heute laufe ich im Fieber herum; alle meine Knochen sind wie zerschlagen. Adelaide liegt immer noch im Bette. Kein Wunder nach dieser Nacht! Wenn ich die Geschehnisse meinem Bruder mitteilen würde, ich glaube, der fromme Herr würde vielleicht doch einen beiliegenden Scheck zurückweisen.
Kreuzelement, wie mich der Rücken schmerzt! Jede leiseste Bewegung macht mich schreien. Ich höre Adelaide aus ihrem Bette wimmern. Vorhin war ich bei ihr, sie sprach kein Wort, sie weinte nur leise vor sich hin und küsste meine Hand. Und ich konnte gar nicht begreifen, dass dieses arme Tierchen dieselbe grausame Priesterin sei, die mit verzerrten blutgierigen Händen — —
Ich will alles ruhig erzählen. Adelaide ging schon am Morgen weg, ich stieg am Nachmittag auf meinen Falben, meine guten Brownings staken in der Satteltasche. Diesmal kannte ich den Weg zum Honfoû, bei Sonnenuntergang war ich schon dort. Schon von weitem vernahm ich durch den Wald das Gelärme aufgeregter Stimmen, dazwischen die schrillen Laute des Néklésin. Die grosse Lichtung war voll von schwarzen Leibern, sie hatten alle Gewänder abgelegt, nur ein paar zusammengeknüpfte rote Taschentücher um den Leib gewunden. Sie tranken aus ihren weitbäuchigen Tafiaflaschen, liefen durch den Weg, auf dessen spitze Pfähle man schwarze und weisse Hühner lebend aufgespiesst hatte und zerschmetterten schreiend die Flaschen unter dem göttlichen Erdbeerbaume. Augenscheinlich erwartete man mich, ein paar Männer kamen auf mich zu, banden meinen Gaul an einen Baum und führten mich über den Weg, wobei sie aus irdenen Krügen die jämmerlich gackernden und flatternden Hennen auf den Pfählen mit Blut begossen, wie Blumen in Töpfen. Am Eingange des Tempels drückte mir einer eine leere Flasche in die Hand, ich zerschmetterte sie unter dem Erdbeerbaum. Wir schritten in den weiten Raum hinein, alles drängte im Augenblick nach; geschoben von nackten Körpern gelangte ich in die Nähe des Schlangenkorbes. Mächtige Kienfackeln staken an den Balken und russten durch die offenen Dachlöcher in die Nacht hinaus. Mir gefiel dieser rote Feuerschein auf den schwarzen glänzenden Leibern; ich muss sagen, ich kam in Stimmung dadurch.
Neben dem Schlangenkorb brannte ein Feuer unter einem mächtigen Kessel, dabei hockten die Schläger auf ihren Trommeln, Houn, Hountor und Hountorgri, die den drei Aposteln Petrus, Paulus und Johannes geweiht sind. Hinter ihnen stand ein baumlanger Kerl, der die riesige Assauntortrommel rührte, die mit der Haut eines verstorbenen Papaloi überzogen ist. Immer schneller und schneller gingen die Wirbel, immer lauter dröhnten sie in den überfüllten Raum.
Die dienenden Avalous drängten die Menge nach den Seiten zurück und schufen einen freien Platz in der Mitte. Trockenes Holz und Reisig warfen sie hin und stiessen Fackeln hinein — im Nu brannte ein helles Feuer auf dem festgestampften Boden. Dann führten sie fünf Adepten in den Kreis, drei Weiber und zwei Männer; die hatten gerade die vierzigtägigen Weihen in dem Schmutzbade durchgemacht, die mir glücklicherweise erspart geblieben waren. Die Trommeln schwiegen und der Papaloi trat hervor.
Es war ein alter magerer Nigger; wie die andern nur mit roten, zusammengeknüpften Taschentüchern bekleidet. Dazu trug er ein blaues Band um die Stirne, unter dem die langen, ekelhaft verfilzten Haarsträhne hervorquollen. Seine Unterpriester, die Djions, gaben ihm ein grosses Büschel von Haaren, Hornstücken und Kräutern in die Hand, das er langsam in die Flamme streute. Dabei rief er die himmlischen Zwillinge, Saugo den Blitzgott und Bado den Windgott an, dass sie die heilige Flamme schüren möchten. Dann gab er den zitternden Adepten den Befehl, in das Feuer zu springen. Die Djions trieben und zerrten die Zögernden in die Flammen, es sah prächtig aus, wie sie da zappelnd hin- und hersprangen. Endlich durften sie heraustreten und nun führte sie der Papaloi an den dampfenden Kessel neben dem Schlangenkorbe. Opété, den göttlichen Truthahn, rief er jetzt an und Assouguié, den himmlischen Schwätzer. Ihnen zu Ehren mussten die Adepten in das kochende Wasser greifen, Fleischstücke herausreissen und den Gläubigen auf grossen Kohlblättern reichen. Immer wieder tauchten die grässlich verbrannten Hände in die siedende Brühe, bis auch der letzte sein Kohlblatt bekommen hatte. Dann erst nahm sie der magere Greis als gleichberechtigte Mitglieder in seine Gemeinde auf — im Namen Attaschollôs, des grossen Weltengeistes — und überliess sie endlich ihren Verwandten und Freunden, die ihnen Salben auf die elend verbrannten Glieder schmierten.
Ich war neugierig, ob dieser menschenfreundliche Priester auch von mir eine solche Zeremonie verlangen würde, aber niemand bekümmerte sich um mich. Wohl reichte man auch mir ein Stück Fleisch auf dem Kohlblatt, und ich ass es wie alle übrigen.
Die Djions warfen neue Nahrung in das Feuer und richteten einen Spiess darüber. Dann zogen sie an den Hörnern drei Böcke herein, zwei schwarze und einen weissen, brachten sie vor den Papaloi. Der stach ihnen mit einem mächtigen Messer in die Kehle, zog durch, und trennte mit einem einzigen langen Schnitte den Kopf ab. Mit beiden Armen riss er die Köpfe in die Höhe, zeigte sie erst den Trommelschlägern, dann den Gläubigen und warf sie, die er dem Herrn des Chaos Agaou Kata Badagri weihte, in den dampfenden Kessel. Während dessen fingen die Djions in grossen Gefässen das Blut auf, mischten es mit Rum und reichten es zum Trunke herum. Dann häuteten sie die Tiere und steckten sie an die Spiesse.
Auch ich trank, einen Schluck erst, dann mehr und mehr. Ich fühlte eine seltene Trunkenheit in mir aufsteigen, eine wilde, gierige Trunkenheit, wie ich sie nie gekannt hatte. Ich verlor ganz das Bewusstsein meiner Rolle als unbefangener Zuschauer, ich wuchs immer mehr wie ein Zugehöriger in diese wilde Umgebung hinein.
Die Djions zogen mit Holzkohlenstückchen neben dem Feuer einen schwarzen Kreis, da hinein trat der Papaloi. Und während die Braten schmorten, die er segnete, rief er mit lauter Stimme Allégra Vadra an, den Gott, der alles weiss. Er bat ihn, seinen Priester zu erleuchten, ihn und die gläubige Gemeinde. Und der Gott antwortete durch ihn, dass die Erleuchtung kommen werde, wenn das Bockfleisch genossen sei. Da sprangen die schwarzen Gestalten zu den Spiessen hin, rissen mit den Händen das Fleisch herab und verschlangen es, heiss und halb roh. Sie brachen die Knochen und benagten sie mit den grossen Zähnen, warfen sie dann hoch durch die Dachluken hinaus in die Nacht, zu Ehren Allégra Vadras, des grossen Gottes.
Und wieder dröhnten die Trommeln. Houn, die kleinste begann, dann Hountor und Hountorgri. Und endlich brüllte die gewaltige Assauntortrommel ihr scheussliches Lied. Immer stärker wurde die Erregung, immer heisser und enger drängten sich um mich die schwarzen Leiber. Die Avalous räumten die Spiesse weg und zertraten das Feuer, die ganze Menge schob sich nach vorne.
Da stand plötzlich, ich weiss nicht, woher sie gekommen, Adelaide, die Mamaloi, auf dem Schlangenkorbe. Sie trug, wie die übrigen, nur ein paar rote Taschentücher, die über die Lenden und die linke Schulter hingen. Die Stirn zierte das blaue Priestertuch, ihre herrlichen weissen Zähne leuchteten im roten Scheine der Fackeln. Sie war prachtvoll, ganz prachtvoll. Der Papaloi reichte ihr mit gesenktem Haupte einen gewaltigen Krug voll Rum und Blut, sie leerte ihn auf einen Zug. Die Trommeln schwiegen und sie begann, leise erst, dann immer mehr anschwellend das grosse Lied der göttlichen Schlange:
Leh! Eh! Bomba, hen, hen!
Cango bafio tè
Cango moune dè lé
Cango do ki la
Cango li!
Zwei-, dreimal sang sie die wilden Worte, bis aus ein paar hundert trunkenen Lippen es ihr wieder entgegenschallte:
Leh! Eh! Bomba, hen, hen!
Cango bafio tè
Cango moune dè lé
Cango do ki la
Cango li!
Die kleine Trommel begleitete ihren Gesang, der wieder leiser wurde und fast zu ersterben schien. Sie wiegte sich in den Hüften hin und her, senkte das Haupt und hob es, zog seltsame Schlangenlinien mit den Armen in der Luft. Und die Menge schwieg, atemlos in Erwartung. Leise flüsterte einer: »Sie sei gesegnet, Manho, unsere Priesterin!« Und ein anderer: »Johannes der Täufer küsse dich, dich, Houangan, seinen Liebling!« Die Augen der Neger traten aus den Höhlen, alles starrte auf die leise summende Mamaloi.
Da sagte sie, still, mit fast verzagender Stimme: »Kommt her! Houedo hört euch, die grosse Schlange!«
Alle drängten sich heran, mühsam vermochten die Diener und Priester Ordnung zu halten.
»Bekomme ich einen neuen Esel diesen Sommer?« — »Wird mein Kind gesund werden?« — »Wird er zurückkehren, mein Geliebter, den sie zu den Soldaten nehmen?« — Jeder hatte eine Frage, einen Wunsch. Die schwarze Pythia antwortete, mit geschlossenen Augen, den Kopf tief auf die Brust gesenkt, die Arme nach unten gestreckt, steif, die Finger krampfhaft gespreizt. Richtige Orakelantworten, die nicht ›ja‹ und nicht ›nein‹ sagten, und aus denen doch ein jeder das entnehmen konnte, das er zu hören wünschte. Befriedigt gingen sie zur Seite, warfen Kupferstücke in den alten Filzhut, den der Papaloi hinhielt. Aber auch Silber fiel hinein.
Die Trommeln schlugen wieder, langsam schien die Mamaloi aus ihrem Traume zu erwachen. Sie sprang herab von dem Korbe, riss die Schlange heraus und stieg wieder hinauf. Es war eine lange, gelbschwarze Natter; verwirrt von dem Feuerschein züngelte sie und wand sich lang um den ausgestreckten Arm der Priesterin. Die Gläubigen fielen zu Boden, berührten die Erde mit der Stirne. »Lange lebe die Mamaloi, unsere Mutter und Königin, sie, Houdja-Nikon, unsere Gebieterin!« Und sie beteten zu der grossen Schlange und die Priesterin nahm ihnen den Schwur ewiger Treue ab. »So soll euer Hirn verfaulen und in euch eure Eingeweide, wenn ihr je das brecht, was ihr schwurt!« Da riefen sie: »Wir schwören drei starke Eide, dir Hougon-badagri, Johannes dem Täufer, der du zu uns kommst als Sobagui, als Houedo, der grosse Vaudouxgott!«
Jetzt öffnete die Mamaloi einen andern Korb, der hinter ihr stand. Hühner griff sie heraus, schwarze und weisse und warf sie hoch in die Luft. Die Gläubigen sprangen vom Boden auf, griffen nach den flatternden Tieren und rissen ihnen die Köpfe ab. Tranken gierig aus den Leibern das frisch strömende Blut. Warfen sie dann zum Dach durch die Luken hinaus: »Für dich, Houedo, für dich Hougon-badagri, zum Zeichen, dass wir unsern Eid halten!«
Von hinten her drängten sich sechs Männer um die Mamaloi. Sie trugen Teufelsmasken, Ziegenfelle hingen von den Schultern und die Leiber waren rot mit Blut bemalt.
»Furcht, Furcht vor Cimbi-Kita!« heulten sie. Die Menge drängte zurück, schaffte einen freien Raum, in den sie traten. Ein Mädchen von zehn Jahren führten sie an einem Strick um den Hals. Das Kind sah verwundert um sich, ängstlich, furchtsam, aber es schrie nicht. Es schwankte, vermochte sich kaum zu halten auf den Füssen, völlig trunken von Rum. Der Papaloi trat zu ihm hin: »Azilit gebe ich dich und Dom Pèdre, sie mögen dich hintragen zu ihm, aller Teufel grössten, zu Cimbi-Kita!« Er streute dem Kinde Kräuter in das krause Wollhaar, Hornstückchen und Haarflecken, legte einen brennenden Scheit darauf. Aber ehe das entsetzte Kind noch mit seinen Händen in die brennenden Haare greifen konnte, warf sich die Mamaloi wie eine Rasende mit einem grässlichen Schrei von ihrem Korbe herunter. Ihre Finger krampften sich um den schmalen Hals, sie hob das Kind. hoch in die Luft und erwürgte es.
»Aa-bo-bo!« schrie sie.
Sie schien ihr Opfer gar nicht mehr freigeben zu wollen. Endlich entriss ihr der Oberpriester das leblose Kind und trennte ihm, wie den Böcken mit einem einzigen Schnitt den Kopf vom Rumpfe. Und dazu sangen die Teufelspriester mit gewaltiger Stimme ihren entsetzlichen Triumphgesang:
»Interrogez le cimetière,
il vous dira
de nous ou de la mort,
qui des deux fournit
les plus d'hôtes.«
Wieder zeigte der Papaloi mit erhobenen Armen das Haupt den Trommelschlägern, wieder warf er es in den dampfenden Kessel. Starr, teilnahmslos stand die Mamaloi dabei, während die Teufelspriester das Blut in den Rumkrügen auffingen und den Leib zerhackten. Wie Tiere warfen sie den Gläubigen die rohen Fleischstücke hin, die sich darauf stürzten, sich balgten und rissen um die Fetzen.
»Aa-bo-bo! Le cabrit sans cornes!« heulten sie.
Und alle tranken das frische Blut, vermischt mit dem starken Rum. Ein grässliches Getränk, aber man trinkt es, muss es trinken, mehr und immer mehr — —
Nun stellte sich einer der Teufelspriester in die Mitte, neben die Priesterin. Er riss die Maske ab, warf das Fell herunter. Nackt stand der schwarze Kerl da, den Leib wunderlich mit Blutzeichen bemalt, die Hände tief rot von Blut. Alles schwieg, nirgends hörte man einen Laut. Nur die kleine Hountrommel wirbelte leise zu dem Teufelstanz, dem Tanz Dom Pèdres, der nun beginnen sollte.
Unbeweglich stand der Tänzer da, ohne sich zu rühren, minutenlang. Langsam wiegte er sich hin und her, den Kopf erst, dann den Leib leise wiegend. Alle seine Muskeln spannten sich, eine seltsame Erregung bemächtigte sich seiner, schien wie ein magnetisches Fluidum allen sich mitzuteilen.
Man betrachtet einander, noch regt man sich nicht, aber man fühlt, wie die Nerven zucken. Nun tanzt der Priester, dreht sich langsam erst, dann schnell und schneller, lauter tönt die Hountrommel und die Hountortrommel fällt ein. Da kommt Bewegung in die schwarzen Leiber, den Fuss hebt eines, das andere den Arm. Sie verschlingen einander mit den Blicken; schon fassen sich zwei und drehen sich im Tanze. Nun brüllt auch die Hountorgri und die mächtige Assauntortrommel, ihr Fell aus Menschenhaut heult einen wütenden aufreizenden Wollustschrei. Alle springen auf, drehen sich im Tanze, stossen, treten einander, machen gewaltige Bocksprünge, werfen sich zu Boden, schlagen den Kopf auf die Erde, springen wieder auf, schleudern Arme und Beine und rasen und schreien in dem wilden Rhythmus, den die Priesterin singt. Stolz steht sie in der Mitte, hebt die göttliche Schlange hoch in die Luft und singt ihren Sang:
»Leh! Eh! Bomba, hen! hen!«
Neben sie drängt sich der Papaloi, aus grossen Kübeln spritzt er Blut über die schwarzen Gestalten, die immer wilder springen, immer wütender das Lied der Königin heulen.
Sie fassen einander, reissen sich die roten Lappen vom Leibe. Die Glieder verrenken sich, heisser Schweiss rieselt von den nackten Körpern. Trunken von Rum und Blut, aufgepeitscht zu massloser Wollust, springen sie aufeinander wie Tiere, werfen sich zu Boden, schleudern sich in die Höhe, schlagen die gierigen Zähne dem andern in das schwarze Fleisch. Und ich fühle, dass ich mit hinein muss in diesen Teufelstanz rasender Menschen. Eine wahnsinnige Lust jauchzt durch den Saal, ein blutgieriger Liebestaumel, der über alles Irdische hinauswächst. Längst singen sie nicht mehr, aus ihren Konvulsionen und Delirien schallt nur der grässliche Teufelsschrei: »Aa-bo-bo!«
Ich sehe Männer und Weiber sich ineinander beissen, in allen Stellungen und Lagen nehmen sie sich. Blutrünstig, wild, schlagen sie die Nägel ins Fleisch und reissen sich tiefe Kratzwunden. Und das Blut trübt ihre Sinne, ich sehe Männer auf Männer, Weiber auf Weiber kriechen. Da wälzen sich fünf in einem schwarzen Knäuel ineinander, da steigt einer, wie ein Hund, über den Schlangenkorb. Ihre rasende Wollust kennt keine Geschlechter mehr, unterscheidet nicht einmal mehr lebende Wesen und tote Gegenstände.
Zwei Negerdirnen stürzen auf mich zu, zerren an meinen Kleidern. Und ich greife sie an den Brüsten, reisse zu Boden. Wälze mich herum, heule, beisse — tue wie alle andern. Ich sehe wie Adelaide ohne Wahl einen Mann nach dem andern nimmt, aber auch Weiber, immer andere, immer neue, unersättlich in dieser teuflischen Wollust. Sie springt auf mich zu, nackt, nackt, rotes Blut sickert von ihren Armen und Brüsten. Nur die blaue Priesterbinde schmückt noch die Stirne, wie schwarze Nattern kriechen die dicken Haarlocken darunter. Sie reisst mich zu Boden, nimmt mich mit Gewalt, springt wieder auf und stösst mir ein anderes Weib in die Arme. Und sie taumelt fort, umfangend und umfangen, immer von andern schwarzen Armen — —
Und, ohne Widerstand nun, werfe ich mich in den wildesten Taumel, in die unerhörtesten Umarmungen, springe, rase und schreie, wilder und wahnsinniger als einer, das entsetzliche: »Aa-bo-bo!«
Ich fand mich draussen auf dem Tanzplatze liegen, in einem Haufen schwarzer Weiber und Männer. Die Sonne war schon aufgegangen, ringsum lagen schlafend, im Traume stöhnend und zuckend, die schwarzen Körper. Mit einer ungeheuren Willensanstrengung stand ich auf; mein Anzug hing mir in blutigen Fetzen vom Leibe. Ich sah Adelaide in der Nähe liegen, blutrünstig von oben bis unten. Ich nahm sie auf, trug sie zu meinem Pferde. Woher ich die Kraft nahm, weiss ich nicht; doch gelang es, ich hob sie auf's Pferd und ritt nach Hause, die Ohnmächtige in meinen Armen vor mir im Sattel. Ich liess sie zu Bett bringen und ging selbst zu Bett — — —
— — — Ich höre sie wieder wimmern, ich will hingehen, ihr ein Glas Limonade bringen.
7. März 1907.
Nun sind Monate vergangen. Wie ich diese letzten Seiten durchlese, kommt es mir vor, als habe ein anderer, nicht ich, das alles erlebt. So fern ist es mir, und so fremd. Und erst, wenn ich mit Adelaide zusammen bin, muss ich mich zwingen, daran zu glauben, dass sie dabei war. Sie, eine Mamaloi — — sie, dieses zärtliche, hingebende, glückliche Geschöpfchen? Nur einen Gedanken hat sie: ihr Kindchen. Wird es auch wirklich ein Junge werden? Ganz und ganz gewiss ein Junge? Hundertmal fragt sie das. Und ist jedesmal selig, wenn ich ihr sage, dass es ganz bestimmt ein Junge sein würde. Es ist zu komisch: dieses Kind, das noch gar nicht da ist, nimmt einen grossen Platz in meinen Gedanken ein. Schon haben wir seinen Namen ausgemacht, schon liegt all die kleine Wäsche für es bereit. Und ich bin beinahe so besorgt um das Würmchen wie Adelaide selbst.
Übrigens habe ich neue hervorragende Eigenschaften in ihr entdeckt. Sie ist jetzt mit vollem Gehalt angestellter Abteilungschef in meinem Geschäft und bewährt sich ausgezeichnet. Ich habe nämlich eine neue Branche eingeführt, die mir ungeheuren Spass macht Ich fabriziere ein Wunderwasser, das für alle möglichen Sachen gut ist. Die Herstellung ist sehr einfach: Regenwasser, das mit ein wenig Tomatensaft rosa gefärbt ist. Das wird in kleine bauchige Fläschchen gefüllt, die ich gleich etikettiert aus New York beziehe. Die Etikette ist nach meinen Angaben ausgeführt, sie zeigt die blutige Axt Cimbi-Kitas und dazu die Inschrift: Eau de Dom Pèdre. Das Fläschchen kostet mich drei Cent das Stück und ich verkaufe es zu einem Dollar. Dabei ist der Absatz ein glänzender, die Nigger reissen sich darum; seit letzter Woche versende ich auch ins Innere. Übrigens sind die Käufer sehr zufrieden, sie behaupten, dass das Wunderwasser in der Tat ausserordentliche Erfolge bei allen möglichen Krankheiten erziele. Wenn sie schreiben könnten, würde ich schon eine Menge von Dankschreiben haben. Adelaide ist natürlich auch von der Heilkraft überzeugt, sie handelt mit wahrem Feuereifer. Ihr Gehalt und ihre Prozente — sie bekommt auch Prozente vom Verkauf — überbringt sie mir stets, dass ich sie für »ihren Jungen« aufbewahren soll. Sie ist wirklich entzückend, dieses schwarze Kind; ich glaube beinahe, ich bin ganz verliebt in sie.
26. August 1907.
Adelaide ist ausser sich vor Glück: sie hat ihren Jungen. Aber das ist noch nicht alles, der Junge ist weiss, und darüber kennt ihr Stolz keine Grenzen. Alle Negerkinder kommen bekanntlich nicht schwarz, sondern, wie die Kinder der Weissen, ziemlich krebsrot zur Welt. — Aber wie diese weiss, so werden die Negerkindlein sehr bald kohlrabenschwarz oder wenigstens braun in Mischfällen. Das wusste natürlich Adelaide, mit Tränen in den Augen wartete sie darauf, dass ihr Kindlein schwarz werden sollte. Sie liess es nicht aus den Armen, nicht eine Sekunde lang, als könnte sie es so davor bewahren, seine Naturfarbe zu bekommen. Aber Stunde auf Stunde verging Und ein Tag nach dem andern, und ihr Kind wurde weiss und blieb weiss, schneeweiss, wahrhaftig weisser als ich. Wenn es nicht die kleinen schwarzen Krollhärchen hätte, sollte man nicht glauben, dass es Negerblut habe. Erst nach drei Wochen erlaubte mir Adelaide, es einmal auf den Arm zu nehmen. Ich habe nie im Leben ein Kind auf dem Arm gehabt, es war ein komisches Gefühl, wie der kleine Kerl mich anlachte und mit den Ärmchen um sich schlug. Eine solche Kraft hat er schon in seinen Fingerchen, besonders in den Daumen — drei Gelenke hat er natürlich — wirklich ein prächtiger Bursche!
Es ist ein Vergnügen, die Mutter zu sehen, wenn sie im Laden hinter ihrer Theke steht, die roten Wunderfläschchen vor sich aufgebaut. Die kräftige schwarze Brust leuchtet aus der roten Taille heraus und der gesunde weisse Bengel trinkt aus Leibeskräften. Wahrhaftig, ich fühle mich wohl auf meine alten Tage und so jung wie nie zuvor. Ich habe aus Freude über den Geburtstag meines Sohnes meinem lieben Bruder eine tüchtige Extrasendung geschickt; ich kann mir's ja leisten, es bleibt doch mehr wie genug für den Jungen.
4. September.
Ich hatte mir das Wort gegeben, dass ich nichts mehr mit den Vaudouxleuten zu tun haben wollte — es sei denn wegen meines Wunderwasserbetriebes. Nun habe ich mich doch noch einmal mit der Bande befassen müssen, freilich diesmal nicht in teilnehmender, sondern in angreifender Form. Gestern kam heulend das alte Huzzelweibchen zu mir, die Phylloxera, die im Garten jätet. Ihr Urenkel sei verschwunden. Ich tröstete sie, er sei wohl in den Wald gelaufen. Das habe sie auch erst geglaubt, sie habe tagelang nachgeforscht und nun wisse sie: die Bidangos hätten ihn gefasst. Nun würde er festgehalten in einer Hütte vor dem Dorfe, und nächste Woche solle er geopfert werden zu Ehren Cimbi-Kitas, Azilits und Dom Pèdres. Ich versprach ihr meine Hilfe und machte mich auf den Weg. Vor der Strohhütte kam mir ein schwarzer Kerl entgegen, ich erkannte ihn, es war der Vortänzer der Teufelspriester. Ich stiess ihn zur Seite und drang in den Raum. Da fand ich den Jungen, er kauerte in einer grossen Kiste, festgebunden an Händen und Füssen. Grosse Stücke von Maisbrot, das mit Rum getränkt war, lagen neben ihm, mit blöden, tierischen Augen starrte er mich an. Ich schnitt ihn los und nahm ihn mit, der Priester wagte nicht die kleinste Einwendung. Ich liess den Jungen gleich auf den Hapagdampfer bringen, der heute abend abfährt; dem Kapitän gab ich ein Schreiben an einen Geschäftsfreund in St. Thomas mit, der soll sich des Jungen annehmen. So ist er in Sicherheit; wäre er hier geblieben, so wäre er doch über kurz oder lang dem Schlachtmesser verfallen: die Vaudouxleute lassen so leicht keinen aus, dem einmal der Todesstoss bestimmt ist. Das alte Mütterchen schluchzte vor Freude, als sie ihr einziges Glück — das übrigens eine ganz niederträchtige Range ist — sicher an Bord wusste. Nun braucht sie nichts mehr zu fürchten; wenn er wiederkommt, ist er längst ein Mann, der selbst schlachten kann.
Übrigens bin ich auch froh über meine Tat. Es ist eine Art Rache für die Mulattenrangen, die von meinem Hofe verschwunden sind. Das Huzzelweibchen hat mir's gesagt: sie sind denselben Weg gegangen, den ihr Urenkel gehen sollte.
10. September.
Seit langen Monaten habe ich zum erstenmal wieder einen Zwist mit Adelaide gehabt. Sie hatte erfahren, dass ich Phylloxeras Urenkel gerettet hatte und stellte mich deshalb zur Rede. Die Priester Cimbi-Kitas hätten das Kind zum Tode bestimmt, wie hätte ich wagen können, es Ihrer Hand zu entreissen?
In all der Zeit hatten wir nicht mehr über das Vaudoux gesprochen, seit dem Tage, als sie, kurz nach der Opferfeier, mir aus freien Stücken erklärt hatte, dass sie ihrer Würde als Mamaloi entsagt habe. Sie könne nicht mehr Priesterin sein, sagte sie, weil sie mich zu sehr liebe. Ich hatte damals gelacht, aber es war mir doch lieb gewesen.
Nun fing sie wieder mit diesem grässlichen Aberglauben an. Ich versuchte zuerst, sie zu widerlegen, schwieg aber bald, da ich sah, dass ich ihr nicht einen Glauben entreissen konnte, den sie mit der Muttermilch eingesogen hatte. Ausserdem bemerkte ich wohl, dass ihre Vorwürfe nur aus ihrer Liebe zu mir, aus ihrer grossen Angst um mich herauswuchsen. Sie weinte und schluchzte, ich konnte sie durch nichts beruhigen.
15. September.
Adelaide ist unerträglich. Überall sieht sie Gespenster. Sie bleibt dicht an meiner Seite, wie ein Hund, der mich beschützen will. Das ist zwar sehr rührend, aber auch arg lästig, zumal der Junge, den sie nicht aus den Armen gibt, eine ungeheuer kräftige Stimme hat. Alles, was ich esse, bereitet sie selbst, damit nicht zufrieden, kostet sie erst jede Speise, ehe sie mir erlaubt, sie zu berühren. Nun weiss ich zwar, dass die Nigger grosse Giftmischer sind, die sich famos auf die Botanik verstehen, aber ich glaube nicht, dass einer es wagen würde, bei mir seine Kenntnisse zu versuchen. Ich lache also Adelaide aus, aber mir ist nicht recht wohl dabei.
24. September.
Also die »Seele« haben sie mir schon genommen! Ich weiss das von Phylloxera, das alte Weib ist nicht weniger aufgeregt und besorgt um mich wie Adelaide. Sie kam heute zu mir, um mich zu warnen. Ich wollte Adelaide aus dem Zimmer schicken, aber sie bestand darauf, zuhören zu dürfen. Die Priester haben demnach das Gerücht ausgestreut, dass ich Cimbi-Kita, dem ich geschworen, verraten habe; ich sei ein Loup-Garou, ein Werwolf, der den Kindern im Schlafe das Blut aussauge. Darauf haben einige der Djions mir »die Seele geraubt«, indem sie aus Ton ein Bildchen von mir formten und im Tempel aufhingen. Das ist ja an und für sich ein ganz harmloses Verfahren, aber es hat eine sehr unangenehme Seite: nun bin ich ein Mensch »ohne Seele«, und den darf jeder umbringen. Ja, er tut sogar ein gutes Werk damit.
Trotzdem lege ich der Geschichte keine übertriebene Bedeutung bei und denke nicht daran, die Befürchtungen der Weiber zu teilen. Solange meine Bluthunde vor meiner Türe und meine Brownings neben meinem Bette liegen, solange Adelaide mein Essen bereitet, fürchte ich die schwarzen Kerle gewiss nicht.
»Seit Menschengedenken hat es kein Nigger gewagt, sich an einem Weissen zu vergreifen!« tröstete ich Adelaide.
Aber sie antwortete: »Sie betrachten dich nicht mehr als Weissen! Sie nehmen dich als einen der Ihren, seit du Cimbi-Kita geschworen hast.«
2. Oktober.
Die arme Frau tut mir so leid. Wie mein Schatten folgt sie mir, nicht eine Sekunde lässt sie mich aus dem Auge. Sie schlummert kaum mehr in der Nacht, sitzt an meinem Bett auf dem Sessel und bewacht meinen Schlaf.
Sie weint nicht mehr, still, schweigsam geht sie neben mir, es ist, als ob sie mit irgendeinem grossen Entschluss ringe.
— — Wie wäre es, wenn ich nun doch mein Geschäft hier aufgeben würde? Nach Deutschland mag ich nicht gehen, nicht weil ich fürchtete, wieder mit den dummen Gesetzen in Konflikt zu kommen, — ich kümmere mich ja längst nicht mehr um andere Weiber, seit ich Adelaide und den Jungen habe. Aber ich kann doch unmöglich eine Schwarze als meine Frau hinüberbringen.
Ich könnte mich nach St. Thomas zurückziehen. Adelaide würde sich gewiss dort wohl fühlen. Ich würde mir eine schöne Villa bauen und irgendein neues Geschäft anfangen — eine Arbeit muss ich haben. Wenn ich nur meinen Kram hier zu halbwegs günstigen Bedingungen losschlagen könnte.
Ich schreibe in meinem Arbeitszimmer, das wie eine Festung aussieht. Adelaide ist nämlich ausgegangen; sie hat mir nicht gesagt, wohin, aber ich bin überzeugt, dass sie mit den Vaudouxleuten parlamentieren will. Die drei Hunde liegen im Zimmer vor der verschlossenen Türe, meine Revolver vor mir auf dem Schreibtisch. Es ist geradezu lächerlich — — als ob ein Nigger es wagen würde, bei hellem Tage mir auch nur ein Härchen zu krümmen! Aber ich musste mich den Wünschen Adelaides fügen. Sie ist allein fort, der Junge liegt neben —mir auf dem Diwan und schläft. Hoffentlich bringt sie gute Nachricht zurück.
30. Oktober.
Ich glaube, Adelaide ist verrückt geworden. Sie schrie und hieb gegen die Türe; ich konnte nicht rasch genug hinlaufen, um zu öffnen. Sie stürzte sofort zu ihrem Jungen, fasste ihn und erdrückte ihn beinahe mit ihren Liebkosungen. Der kleine Kerl fing jämmerlich an zu heulen. Aber sie liess ihn nicht los, küsste ihn, umarmte ihn, ich fürchtete, sie möchte ihn ersticken mit ihren Küssen.
Ihr Wesen ist ganz erschreckend. Sie sagte kein Wort, aber augenscheinlich hat sie Erfolg gehabt. Sie kostet nicht mehr von meinen Speisen, ihre Angst um mich scheint verschwunden. Und das bedeutet ganz sicher, dass jede Gefahr gehoben ist. Aber sie folgt mir nach wie vor wie ein Hündchen. Beim Nachtmahle sass sie schweigend neben mir, ohne einen Bissen zu berühren; aber nicht eine Sekunde liess sie die Augen von mir.
Irgend etwas Schreckliches scheint in ihr vorzugehen, aber sie spricht nicht, kein kleines Wort vermag ich aus ihr herauszubringen. Ich will sie nicht quälen, ich sehe ja, wie das arme Weib sich in Liebe zu mir verzehrt.
Ich werde alle Schritte tun, um so bald wie möglich von hier fortzukommen. Ich habe schon mit dem Hamburg-Amerika-Agenten gesprochen. Er ist im Prinzip nicht abgeneigt, aber er will kaum den vierten Teil von dem geben, was die Sache wert ist, und auch das nur auf Abzahlungen. Und doch werde ich darauf eingehen, ich habe ja längst mein Schäfchen im Trocknen und kann schliesslich auch einmal ein Geschäft mit Verlust machen. Herrgott, wird sich Adelaide freuen, wenn ich ihr das sagen werde. Ich will sie dann auch heiraten, des Jungen wegen; sie hat es wirklich um mich verdient. Erst wenn alles fix und fertig ist, werde ich ihr die Mitteilung machen: »So, Kind, nun kannst du packen — —« Sie wird ja rasend werden vor Freude!
11. November.
Meine Verhandlungen nehmen einen guten Verlauf; nun ist auch das Telegramm der deutschen Bank eingetroffen, dass sie meinem künftigen Nachfolger die nötige Barsumme vorstrecken wird. Damit ist die Hauptschwierigkeit gelöst, über die Einzelheiten kommen wir rasch weg, da ich ja das Entgegenkommen selbst bin. Der Kerl merkt das, und nennt mich stets recht ostentativ »seinen Freund und Wohltäter«; na, ich nehm's ihm nicht übel, dass er über ein so fabelhaftes Geschäft seine Freude nicht verheimlichen kann.
Ich muss mir ordentlich Mühe geben, mein Geheimnis vor Adelaide zu verbergen. Ihr Zustand wird immer bedenklicher. Nun, diese Woche wird sie es schon noch aushalten, und dann ist ihre Freude um so grösser. Sie war noch ein paarmal bei ihren Vaudouxleuten, jedesmal kehrte sie in einem entsetzlichen Zustande zurück. Ich verstehe nichts davon, es scheint doch jede Gefahr vorüber zu sein. Alle Türen bleiben nachts wie früher offen, und selbst das Kochen überlässt sie den Mädchen. Was hat sie also?
Sie spricht kaum ein Wort mehr. Aber ihre Liebe zu mir und dem Jungen wird mit jedem Tage grösser, wächst schier ins Ungemessene. Diese Liebe hat etwas Unheimliches, das mir fast den Atem benimmt. Wenn ich den Jungen auf das Knie nehme und mit ihm spiele, schreit sie auf, stürzt aus dem Zimmer, wirft sich auf ihr Bett und weint und schluchzt zum Herzbrechen.
Gewiss ist sie krank, und steckt mich an mit ihrer seltsamen Krankheit. Ich werde den Augenblick segnen, in dem wir dieses Unglücksnest verlassen können.
15. November.
Heute morgen war sie ganz aus dem Häuschen. Sie wollte eine kleine Besorgung machen und ihr Kind mitnehmen. Zu diesem Zwecke nahm sie einen Abschied von mir, der nichts Natürliches mehr hatte. Ihre Augen sind längst von dem vielen Weinen rot und entzündet, aber heute morgen stürzten ganze Wasserfälle heraus. Sie konnte sich nicht losreissen aus meinen Armen, immer wieder hielt sie mir den Jungen zum Küssen hin. — — Ich war ganz erschüttert von dieser Szene. Gott sei Dank kam bald darauf der Hapagagent, um mir die Verträge zur Unterschrift zu bringen. Nun stehen die Namen drauf, und der Scheck auf die Bank ist in meiner Hand. Dies Haus gehört nicht mehr mir, ich bat den Käufer, mich noch einige Tage hier wohnen zu lassen. »Ein halbes Jahr, wenn Sie wollen!« sagte er. Aber ich verspreche ihm, dass ich kaum eine Woche mehr bleiben werde. Am Samstag geht der Dampfer nach St. Thomas, da muss alles gepackt sein.
Jetzt werde ich Blumen auf den Tisch stellen: wenn Adelaide zurückkommt, soll sie die Freudenbotschaft hören!
Abends 5 Uhr.
Das ist furchtbar. Adelaide kam nicht, kam nicht. Sie kam nicht. Ich lief in die Stadt, niemand hatte sie gesehen. Ich ging wieder nach Hause, sie war nicht zurück. Im Garten suchte ich nach dem Huzzelweibchen; es war nicht da. Ich lief hinaus zu ihrer Hütte — da fand ich sie — an den Pfeiler gebunden. »Endlich kommen Sie, endlich! Eilen Sie, ehe es zu spät ist!« Ich schnitt sie los, es kostete Mühe, aus der verstörten Frau Vernünftiges herauszubringen. »Sie ist zum Honfoû, die Mamaloi«, stotterte die Alte. »Zum Honfoû mit ihrem Kinde. Man hat mich gebunden, dass ich Ihnen nicht Bescheid sagen könne.« Ich lief wieder nach Hause, meine Pistolen zu holen. Ich schreibe das, während man mein Pferd sattelt. — Herrgott, was mag — — —
16. November.
Ich ritt durch den Wald.
Ich glaube nicht, dass ich an etwas dachte. Nur daran: du musst noch zur Zeit ankommen, du musst noch zur Zeit ankommen.
Die Sonne war schon herunter, als ich über die Lichtung ritt. Zwei Kerle fielen mir in die Zügel, ich hieb ihnen die Peitsche durchs Gesicht. Ich sprang ab, warf die Zügel über den Erdbeerbaum. Dann drang ich in den Honfoû, stiess rechts und links die Menschen zurück.
Ich weiss, dass ich schrie. Da stand im roten Scheine die Mamaloi auf dem Korbe, die Schlange wand sich über die blaue Binde. Und hoch ausgestreckt hielt sie am Halse mein Kind. Mein Kind und ihr Kind. Und würgte es, würgte es, würgte es.
Ich weiss, dass ich schrie. Ich riss die Brownings aus der Tasche und schoss. Zwei Schüsse, ins Gesicht einen, den andern in die Brust. Sie stürzte herab vom Korbe. Ich sprang hin und hob das Kind auf; ich sah gleich, dass es tot war. Und war noch so warm so glühend warm.
Nach allen Seiten schoss ich hinein in die schwarzen Leiber. Das drängte und stob auseinander, das heulte, bellte und schrie. Ich riss die Fackeln von den Balken und warf sie in die Strohwände. Wie Zunder flammte es auf.
Ich stieg zu Pferde und ritt nach Hause, brachte mein totes Kind heim. Gerettet habe ich mein Kind: nicht vor dem Tode, aber doch vor den Zähnen der schwarzen Teufel.
— Auf meinem Schreibtische fand ich diesen Brief — ich weiss nicht, wie er dahin kam.
Herrn F. X.
Du hast Cimbi-Kita verraten und sie wollten Dich töten. Doch wollen sie es nicht tun, wenn ich mein Kind opfere. Ich liebe es so, aber ich liebe Dich noch mehr. Darum will ich tun, was Cimbi-Kita verlangt. Ich weiss, dass Du mich wegjagen wirst, wenn Du hörst, was ich getan habe. Darum werde ich Gift nehmen und du wirst mich nicht mehr sehen. Aber Du wirst wissen, wie sehr ich Dich liebe. Denn nun bist Du ja ganz gerettet.
Ich liebe Dich sehr.
Adelaide.
Nun liegt mein Leben in Stücken da. — Was soll ich tun? Nichts weiss ich mehr. Ich werde diese Blätter in ein Kuvert geben und absenden. Das ist noch eine Arbeit.
Und dann?
— — Ich beantwortete den Brief sofort. Mein Schreiben trug die Unteradresse des Hapagagenten und den Vermerk: »Ev. bitte nachsenden.« Ich erhielt es zurück mit dem andern Vermerk: »Adressat tot.«
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.