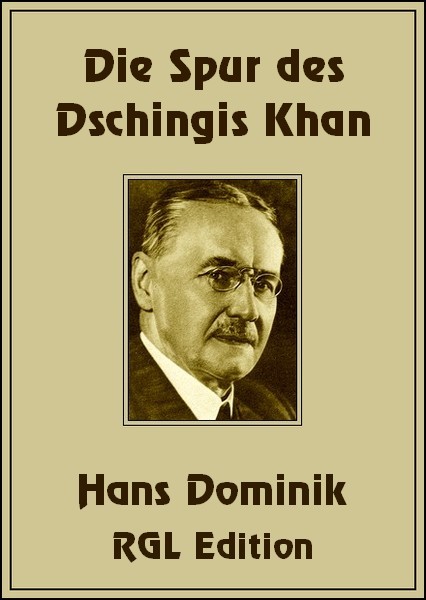
RGL e-Book Cover 2016©
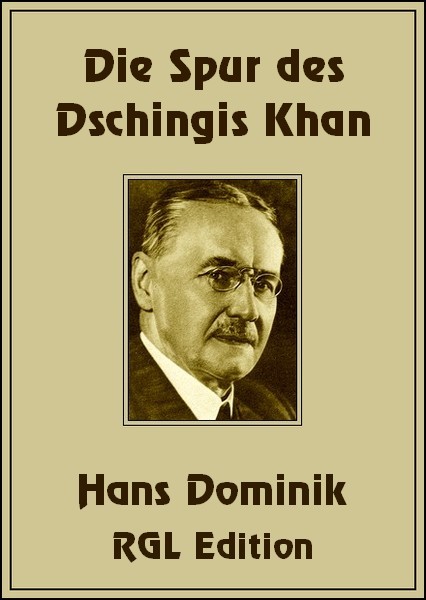
RGL e-Book Cover 2016©
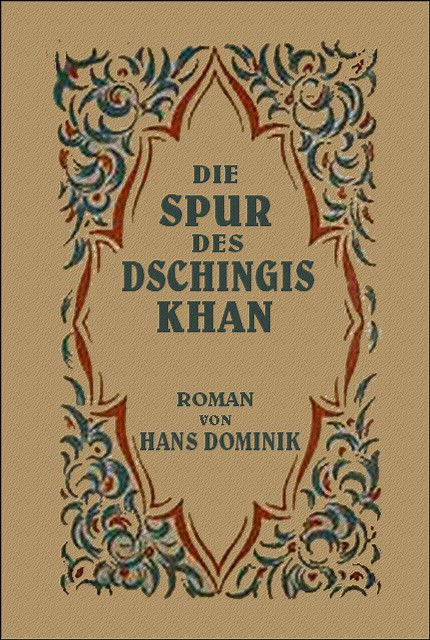
"Die Spur des Dschingis-Khan," Scherl-Verlag, Berlin, 1923
Der Dichter-Ingenieur Hans Dominik, in dem sich weitschweifende Phantasie mit realem Wissen vereinigt, schildert in seinen Zukunftsromanen, auf der Basis modernster, wissenschaftlicher Erkenntnis aufbauend, wohin die rasende Entwicklung unserer Zeit die Welt führen wird.
In dem vor vorliegenden Roman bilden die weiten Räume Osteuropas bis zum Großraum Asien den Schauplatz abenteuerlicher Handlungen im Kampf um die Vorherrschaft über diese Gebiete. Weltweite Spannungen tragen dazu bei, erfolgreiche Erfindungen bis zur endgültigen Verwirklichung weiterzutreiben. Die praktische Anwendung der neu entwickelten Geheimwaffen zeitigt erschreckende Verluste in machthungrigen asiatischen Kreisen, die der Spur des Dschingis-Khan folgen wollen und von einem neuen Weltreich träumen. Durch den Einsatz der neuesten technischen Errungenschaften werden die gelben Riesenheere vernichtet und damit die Bahn freigemacht für eine verständnisvolle Zusammenarbeit aller Völker und Nationen.
Archibald Wellington Fox, der Berichterstatter der Chicago Press, und Georg Isenbrandt, ein Oberingenieur der Asiatischen Dynothermkompagnie, gingen zusammen den Bismarckdamm in Berlin entlang. Ihr Ziel war ein mächtiges Sandsteingebäude, das einen ganzen Straßenblock einnahm. Weithin glänzte von seiner Front ein goldenes Wappen. Drei Ähren, von einer Sichel umschlungen. Darunter ein Monogramm aus den drei Buchstaben E.S.C.
Wellington Fox sprach: »Das war ein guter Zufall, daß ich dich hier in Berlin auf der Straße treffen mußte. Sonst hätte ich dich im fernen Turkestan aufsuchen müssen … wo es für Kriegsberichterstatter nächstens gute Arbeit geben kann.«
Er drängte an den Freund heran und sah ihm forschend ins Gesicht.
»Ich meine, daß erheblich viele Grade der Wahrscheinlichkeit dafür sprechen … müßten. Aber meine Meinung wird von dem Direktorium der E. S. C. leider nicht geteilt.«
»Georg, Krieg! … Krieg zwischen dem Vereinigten Europa und dem großen Himmlischen Reich!«
Der andere nickte stumm. Sein Gesicht blieb unverändert. Nur ein Funkeln seiner Augen zeigte, daß sein Inneres keinen Teil an seiner äußerlichen Ruhe hatte.
In dem Gehirn des Journalisten kreuzten sich wirr tausend Gedanken. Eine Weile schritten sie wortlos nebeneinander her.
»Du weißt, Wellington, daß unsere Unterhaltungen keine Interviews sind. Der Journalist Wellington Fox von der Chicago Press hört von unseren Gesprächen nichts.«
»Kein Zweifel, Georg. Doch sag, zu welchem Zweck bist du hier in Berlin?«
»Um einen letzten Versuch zu machen … die Herren der E.S.C. zu meiner Ansicht zu bekehren. Ich habe um fünf Uhr eine Konferenz mit ihnen.«
»Und wenn …? Was wird dann aus dem großen Werk der E.S.C.? Den Hunderttausenden von europäischen Siedlern in Turkestan … und deinen großen Arbeiten? Werden sie nicht durch den Krieg schwer leiden?«
»Du fürchtest für sie? … Ich nicht, wenn man mir folgt … sie zu verteidigen … zu sichern auf Menschenalter … darauf gehen meine Pläne …«
Jede Gleichgültigkeit war jetzt von dem Sprecher abgefallen. Ein eiserner Wille, eine unbeugsame Energie prägte sich auf dem scharf geschnittenen Gesicht mit der kantigen Stirn aus.
Staunen, Überraschung malten sich in den Zügen des Journalisten. Mit einem zweifelnden Blick maß er die Gestalt des einstigen Schulkameraden.
»Bist du dir auch bewußt, mit welchem furchtbaren Gegner Europa … du … zu kämpfen haben würdest? Das große geeinte Gelbe Reich ist eine Macht, wie sie die Geschichte der Völker selten gekannt hat. Sein Herrscher, der Kaiser Schitsu, ist ein Mann vom Blut und Schlage des Dschingis-Khan.«
»Ich weiß es. Die Gefahr ist groß! Aber sie wird mit jedem Jahr größer. Deshalb heißt es, ihr zu begegnen … jetzt, ehe es zu spät ist.
Der Kaiser ist todkrank. Stirbt er, wird man mir leichter folgen. Die Angst vor ihm ist größer als vor seinem Land. Doch wir sind am Ziel.«
Er deutete auf den Sandsteinpalast, den sie jetzt erreicht hatten.
»Was da drinnen in den nächsten Stunden beschlossen wird, ist entscheidend für das Schicksal von Millionen Menschen.«
Unwillkürlich hatte sich seine Hand erhoben und gegen die Quadern des Riesenbaues gereckt. Dann senkte sie sich langsam in die des Freundes.
»Auf Wiedersehen denn heute abend bei dir im Hotel.«
Noch ein Händedruck, und Georg Isenbrandt trat durch das Hauptportal in das Gebäude ein. Unschlüssig blieb Wellington Fox auf der Straße stehen.
Das Haus hier war das Verwaltungsgebäude der großen, von den europäischen Staaten mit einem Milliardenkapital begründeten Siedlungsgesellschaft, die den Überschuß der europäischen Bevölkerung seit zehn Jahren in Asien ansiedelte. Auf meilenweiten Ländereien, die nach der Erfindung des Dynotherms bestes Ackerland geworden waren. Hier in Berlin war der Hauptsitz dieser großen internationalen und mit staatlichen Hoheitsrechten ausgestatteten Gesellschaft. Ihr Arbeitsgebiet lag in Asien. Dort reichte es vom Kaspischen Meer bis zu den Grenzen des chinesischen Reiches.
Wellington Fox war mit der Betrachtung des Gebäudes zu Ende und ging weiter, dem Grunewaldpark zu. Die letzten Worte seines Freundes gaben ihm reichlich Anlaß zum Nachdenken. Und so übersah er es, wie eine elegant gekleidete Gestalt, die ihm entgegenkam, bei seinem Anblick schon von weitem einen Bogen schlug, um auf die andere Seite der Straße zu gelangen und dann im Hause der E.S.C. zu verschwinden.
Ein dumpfer Knall riß ihn wenige Minuten später aus seinem Sinnen. Der Luftdruck einer schweren Explosion brachte ihn momentan ins Wanken. Mit einem jähen Ruck warf er sich herum und sah aus den zersplitterten unteren Fenstern des E.S.C.-Gebäudes dünne Rauchschwaden ziehen.
Instinktiv lief er auf den Eingang des Gebäudes zu. Durch die aufgerissenen Flügeltüren drang er in das Haus ein und stürmte die Treppen empor. Ein Gemisch von Staub und Rauch benahm ihm fast den Atem. Eine schreiende Menge drang ihm entgegen. Zwischendurch … darüber hinweg bahnte er sich seinen Weg bis in das zweite Stockwerk, wo er den Freund wußte.
Hier war es ruhiger. Hier ließ auch der Qualm nach. Er lief über einen Korridor und sah die Person, die ihm auf der Straße entgangen, in einen Seitengang verschwinden. Mit einem Ruck blieb er stehen. Dann schlug er den entgegengesetzten Weg zu den Direktionszimmern ein. Noch ehe er sie erreichte, kam ihm Georg Isenbrandt mit einigen Herren entgegen.
»Georg, was ist los?«
»Das wissen wir selbst noch nicht. Wir müssen die Untersuchung abwarten.«
»Ein verbrecherischer Anschlag?«
»Nicht so eilig! Warte mit deinen Telegrammen, bis die Untersuchung Klarheit geschaffen hat.«
Der Donner einer zweiten Explosion in der Nähe verschlang die letzten Worte Isenbrandts. Ohne sich noch aufhalten zu lassen, stürmte der Amerikaner dem Weg nach, den der Fremde vorher eingeschlagen hatte. Die zweite Explosion hatte neue Rauchmengen entwickelt. Er rüttelte an verschlossenen Türen und stieß schließlich auf eine Tür, die nachgab. Sah zuerst einen mächtigen Tresor, der durch die Gewalt der Explosion von oben bis unten aufgerissen war. Die Kraft der Sprengung hatte die in ihm verwahrten Dokumente durch das Zimmer zerstreut. Sah dann nur undeutlich in dem rauchgefüllten Raum, wie der Gesuchte bemüht war, mehrere Schriftstücke in seinen Taschen verschwinden zu lassen. Mit ein paar tigerähnlichen Sätzen schoß Wellington auf ihn los. Doch noch schneller hatte der Fremde die Tür zum Nebenzimmer aufgerissen. Als Wellington Fox die Klinke berührte, hörte er, wie der Schlüssel im Schloß von außen umgedreht wurde.
Wellington Fox blieb stehen. Das Vergebliche einer weiteren Verfolgung hier im Gebäude war ihm klar.
Seine Exzellenz Herr Wang Tschung Hu, der chinesische Botschafter bei der Deutschen Republik, saß allein in seinem Arbeitszimmer. Nervös spielte seine Rechte mit einem Bleistift, während sein Auge den langsamen Fortgang des Uhrzeigers auf dem Zifferblatt verfolgte.
Die Uhr hub aus und schlug halb sechs. In ihren verhallenden Schlag mischte sich der Klang der Telephonglocke.
Die Meldung des Sekretärs, daß Mr. Collin Cameron soeben die Botschaft betreten habe.
Wang Tschung Hu legte den Apparat wieder auf die Gabel, suchte einen Moment zwischen verschiedenen, an dem großen Diplomatentisch befestigten Hebeln und legte einen davon um. Im gleichen Augenblick war ein Telephon auf seinem Tisch mit den Lauschmikrophonen verbunden, die sich in der Wohnung des Hausmeisters der Botschaft befanden. Jedes Wort, was dort unten gesprochen wurde, mußte hier oben klar und deutlich aus dem Apparat kommen.
Die Gründe, die Seine Exzellenz veranlaßt hatten, diese Verbindung herstellen zu lassen, waren von besonderer Art. Wutin Fang, der da unten in der bescheidenen Stellung eines Hausmeisters wirkte, war in Wirklichkeit Generalstabsoffizier und Chef der gelben Spionage in Europa. Der Botschafter mußte jederzeit offiziell versichern können, daß er Leute, wie jetzt diesen Mr. Collin Cameron, nicht kenne. Aber Seine Exzellenz hatten ein großes Interesse daran, zu erfahren, was solche Leute mit Wutin Fang verhandelten. So saß Wang Tschung Hu jetzt mit gespannter Aufmerksamkeit vor dem Telephon. Stimmen erklangen aus dem Apparat.
»Was bringen Sie uns, Mr. Cameron?«
»Schlechte Neuigkeiten, Herr Wutin Fang. Es hat nicht geklappt.«
»Ich verstehe nicht, wie das möglich war?«
»Wie das möglich war? … Ihre Leute haben ein harmloses Feuerwerk veranstaltet, aber keine Sprengung … Ein paar Fensterscheiben in Trümmer, ein paar Türfüllungen herausgeschlagen, aber die Tresore kaum beschädigt … Ganz unmöglich, an die Proben des Dynotherms heranzukommen … ich habe das Menschenmögliche versucht.«
»Verdammt, wir müssen die Analysen haben. Wenn es heute nicht ging, muß es das nächstemal gehen.«
»Halten Sie die Direktoren der Compagnie nicht für Kinder! Ein zweites Mal wird sich eine Gelegenheit nicht wieder bieten … ganz bestimmt nicht. Isenbrandt war während der Sprengung im Gebäude. Meinen Sie, der wüßte nicht, um was es sich gehandelt hat …«
»Wir werden die Analysen bekommen. Wenn nicht morgen, dann übermorgen.«
»Machen Sie, was Sie wollen … ich kann mich mit der Angelegenheit nicht mehr abgeben. Ich bin gesehen worden …«
»Von wem … von Isenbrandt?«
»Nein. Ein Freund von ihm, ein amerikanischer Journalist … ein verdammter Schnüffler. Ich muß Berlin sofort verlassen.«
»Ihr Bericht ist wenig befriedigend, Mr. Cameron … Sie haben uns zu dem Unternehmen veranlaßt … Jetzt ziehen Sie sich zurück.«
»Weil ich muß. Die Gründe habe ich Ihnen gesagt. Das Unternehmen ist fehlgeschlagen, weil Ihre Leute schlecht gesprengt haben … Immerhin … Ich habe daraus zu machen versucht, was sich machen ließ. An die Analysen in den Panzergewölben war nicht heranzukommen. Für den Tresor im ersten Stock reichten die Sprengmittel, die ich bei mir hatte …«
»Mir wurde von zwei Explosionen berichtet … Haben Sie …«
»Ich habe es getan, weil ich es für die letzte Gelegenheit hielt, in das Compagniegebäude zu kommen … Auf die Gefahr hin, verhaftet zu werden … auf die Gefahr hin, nichts zu finden … Ich habe gefunden.«
»Was haben Sie …«
»Wollen Sie, bitte, selbst sehen!«
Wang Tschung Hu hörte deutlich das Knistern, wie wenn Papiere ausgebreitet und geradegestrichen werden.
Dann wieder die Stimme Collin Camerons:
»Ich meine, der Besuch hat sich gelohnt.«
»Das Ilidreieck …«
Seine Exzellenz preßte den Hörer mit Gewalt gegen das Ohr, aber er hörte nichts mehr. Wutin Fang schwieg, als habe er mit dem einen Wort schon zuviel gesagt. Collin Cameron sprach weiter:
»Ich lasse Ihnen die Pläne hier. Ich kann es nicht mehr riskieren, sie selbst nach China zu bringen. Die Marchesa di Toresani ist hier. Die kann das besorgen … ich muß auf dem schnellsten Wege nach Kaschgar.«
Wang Tschung Hu hörte, wie Papiere gefaltet wurden und die Tür eines Tresors ins Schloß fiel. Dann Blättern wie in einem Buche und dann die Stimme Wutin Fangs: »In vierzig Minuten geht das Ostschiff. Sie können es noch erreichen.«
Die Hände tief in den Taschen seines Mantels verborgen, ging Wellington Fox auf der gegenüberliegenden Seite der Straße vor der chinesischen Botschaft auf und ab. Der feine kalte Regen schien seiner guten Stimmung keinen Abbruch zu tun.
»Hab’ ich dich endlich, mein Freund«, kam es im Selbstgespräch von seinen Lippen. »Deine Schliche kenne ich jetzt … und die sind schlimmer, als ich dachte. Georg wird Augen machen, wenn ich ihm volle Aufklärung über den Täter gebe.«
Er wollte sich eben dem Innern der Stadt zuwenden, als das plötzliche Halten eines Autos vor der Botschaft ihn noch einmal stillstehen ließ.
Eine Dame verließ den Wagen und schritt, von einem grauhaarigen Diener begleitet, durch den Vorgarten in das Haus. Als Wellington Fox den Wagen erreichte, kam die Besucherin mit ihrem Diener bereits wieder aus dem Gebäude. Ein dichter Schleier verbarg ihre Züge. Aber Wellington Fox starrte den beiden nach und starrte noch, als das Auto längst verschwunden war.
»Hallo! Was war das? Vor einer Minute hätte ich noch geschworen, daß der Diener ein alter, grauhaariger Bursche war. Und jetzt hatte er schwarzes Haar. So schwarz wie deines, mein Freund Collin Cameron.«
Der Präsident Dr. Reinhardt sprach in der Direktoriumssitzung der Europäischen Siedlungsgesellschaft: »… über die wirtschaftlichen und technischen Erfolge im letzten Jahre gibt der Bericht des Aufsichtsrates der Gesellschaft ein erfreuliches Bild. Ich möchte nur die wichtigsten Punkte hervorheben. Die Schmelzarbeiten haben mit 3,6 Milliarden Kubikmeter Wasser die Ziffer des Vorjahres um 600 Millionen übertroffen. Die Zahl der europäischen Siedler auf unseren Gebieten hat sich, die russischen nicht miteingerechnet, um 200 000 vermehrt, die auf etwa 50 000 Quadratkilometer Neuland angesetzt sind. Auf das Gesellschaftskapital von einer Milliarde Pfund Sterling wird eine Dividende von 6 Prozent in Aussicht gestellt. Die Börse bewertete unsere Aktien schon seit dem Bekanntwerden des neuen Dynotherms nach dem Verfahren unseres Herrn Isenbrandt mit 150 Prozent des Nennwertes.
Die Aussichten für die Zukunft sind ebenfalls günstig. Aber ein voller Erfolg könnte unseren Arbeiten nur beschieden sein, wenn wir auch im Quellsystem der Flüsse schmelzen dürften, die im chinesischen Ilidreieck entspringen und in unserem Gebiet münden. Ich berühre hier eine heikle Frage, über die Herr Isenbrandt Ihnen näheren Vortrag halten wird. Herr Isenbrandt hat das Wort.«
Als dieser sich erhob, füllte sich der Raum mit Spannung. »Meine Herren! Ich will nur ganz kurz auf die heutigen Anschläge auf unsere Tresore zurückkommen, um ihnen zu sagen: Das war gelbe Arbeit. Der Raub der Analysen und Synthesen des neuen Dynotherms ist jedoch mißlungen.
Der zweite Anschlag ist leider gelungen. Die Pläne für die Besetzung und Bearbeitung des chinesischen Iligebietes sind fort … in chinesischen Händen. Und doch …!« Die Gestalt des Sprechers straffte sich. »Wir müssen das Ilidreieck haben!«
»Keinen Krieg!« Der Russe rief es und sprang erregt auf. »Wir sind als nächste Nachbarn des Gelben Reiches am besten über die Machtverhältnisse informiert. Wollen Sie die blühenden Fluren Turkestans in Wüsten verwandelt sehen?«
Lebhaftes Stimmengewirr erfüllte den Saal. Die Meinungen waren geteilt. Gelassen schaute Isenbrandt eine Weile auf die erregten Gruppen. Dann erhob er seine Stimme von neuem:
»Um diese Gefahren zu vermeiden, machte ich meinen Vorschlag. Ich will jetzt nicht von unseren Arbeiten sprechen, die ohne das Ilidreieck nicht zur vollen Auswirkung gelangen können. Ich will mich auch nicht auf die Tatsache stürzen, daß das Land vor 150 Jahren schon einmal russischer Besitz war. Ein Blick auf die Karte hier an der Wand müßte genügen, um Sie von der Notwendigkeit zu überzeugen, daß das Iligebiet unser wird.«
Er war an die Karte herangetreten.
»Sie sehen, wie hier vom Pamirplateau aus nördlich ziehend das Altaigebirge und anschließend der Thian-Schan die Grenze gegen China bilden. Da springt auf dem 80. Längengrad die Grenze plötzlich vom Gebirgskamm ab und geht über das offene Ilital nach Norden, statt naturgemäß auf dem Gebirgskamm zu bleiben.
Was ist die Folge davon? Die Gelben haben hier ein Glacis, das eine ständige Drohung für uns ist.
Die gelbe Gefahr ist noch im Werden. Sie verkörpert sich nicht nur in der Person des Kaisers Schitsu. Stirbt er, wird ein anderer kommen, unter dem sich die Entwicklung fortsetzen wird. Der Kaiser ist nur ein Exponent der Verhältnisse, die sich in jedem Fall durchsetzen. Nicht um Augenblickspolitik wollen wir handeln. Auf Menschenalter müssen wir uns sichern.«
Georg Isenbrandt hatte geendet. Wiederum begann eine lebhafte Debatte, bis der Präsident sich Gehör verschaffte.
»Meine Herren, wir werden morgen um dieselbe Zeit wieder zusammenkommen, um über das heute Besprochene abzustimmen.«
Die Strahlen der Aprilsonne vergoldeten die Kuppeln von Orenburg und ließen sie aufleuchten und schimmern.
Die Sonnenstrahlen überfluteten das Bahnhofsgebäude und glitzerten in tausend Reflexen in den gewaltigen Eisenkonstruktionen des großen Postflughafens neben dem Bahnhof.
Zur Höhe von zweihundert Meter reckten sich die stählernen Bauten. Wie feine Filigranarbeit stand ihr Fachwerk in der Frühlingsluft, ein Fachwerk, das stark genug war, um in schwindelnder Höhe noch die schweren Plattformen zur Aufnahme der großen Flugschiffe zu tragen.
Jetzt, gegen Mittag, war der Flugplatz leer. Scheinbar unbewohnt lag das Posthotel inmitten der parkartigen Gartenanlagen.
Auf der Nordostecke der Landeplattform erhob sich ein eiserner Turm und ragte noch einmal fünfzig Meter in die Höhe. In seinem obersten Teil lagen die Diensträume für den Stationschef und die Telegraphisten.
Der Stationschef trat in den Telegraphistenraum.
»Was Neues, Gregor Iwanowitsch?«
»Alles in Ordnung, Fedor Fedorowitsch.«
Der Chef blätterte in dem Stationsbuch, das aufgeschlagen auf dem Tisch lag.
Orenburg war ein Knotenpunkt für den Luftverkehr. Die große europäische Linie Berlin – Moskau – Orenburg spaltete sich hier in drei Zweigstrecken. Die sibirische Linie nach Omsk und Tomsk, die Südostlinie nach Ferghana und die persische Linie nach Teheran.
Der Stationschef verglich seine Uhr mit der Normaluhr über dem Apparatetisch.
»Noch fünfundvierzig Minuten bis zur Ankunft des Moskauer Schiffes … Starke Besetzung heute … Nach den Listen hundertsechzig Passagiere … Gregor Dimidow ist ein beliebter Kapitän … Obwohl Nummer achtzehn längst nicht mehr das neueste Schiff ist …«
Das plötzliche Ansprechen eines der Geräte unterbrach die Worte des Stationschefs.
»Achtzehn … tick tick tick, tä tä tä, tick tick tick …«
Achtzehn war die Nummer des Schiffes Moskau – Orenburg, das hier in fünfundvierzig Minuten erwartet wurde. Die Morsezeichen bedeuteten den internationalen Notruf für höchste Gefahr.
Was war geschehen?
Mit einem Ruck schaltete der Telegraphist die eigene Sendeanlage ein. Er wollte rückfragen, aber er kam nicht dazu.
Gerade in diesem Augenblick begann es im Telephonapparat zu rauschen und zu pfeifen. Dem erfahrenen Beamten war es klar, daß eine andere starke Station mit der gleichen Wellenlänge wie Nummer achtzehn Signale gab. Offensichtlich, um die Notrufe des Schiffes zu übertönen und unwirksam zu machen. Über seine Apparate gebeugt, versuchte er durch schnelle Umstimmung der Wellenlängen die Verständigung wiederherzustellen.
Als es ihm nicht gelang, nahm er die Verbindung mit den Städten im Umkreis auf. Wohl hatte man auch auf diesen Stationen den Hilferuf von Nummer achtzehn vernommen, aber es waren auch dort keine Polizeischiffe zur Verfügung. Viertelstunde auf Viertelstunde verstrich, ohne daß sich eine Möglichkeit bot, dem Postschiff Hilfe zu senden.
Der Telegraphist legte seinen Apparat wieder auf die Wellenlänge von Nummer achtzehn um. Jetzt herrschte Ruhe im Hörer. Das Zwischensprechen der Störungsstation hatte aufgehört. Aber auch das Postschiff meldete sich nicht. Vergeblich rief der Telegraphist es an. Schon war die Ankunftszeit, zu der es hier in Orenburg eintreffen sollte, um zehn Minuten überschritten.
Kurs Ost zu Südost zog das Postschiff Nummer achtzehn der Linie Moskau-Orenburg in zehn Kilometer Höhe seine Bahn. Vor einer Stunde hatte es über Samara die letzte Post abgegeben und empfangen. Noch fünfundvierzig Minuten, und es sollte in Orenburg landen.
In der Zentrale des Schiffes stand der Kommandant Gregor Dimidow neben dem wachhabenden Offizier. Angestrengt spähte der Kapitän nach Süden.
»Schneller als wir! Keine Flagge, kein Zeichen … Was ist …?«
Während der Kommandant die Worte sprach, war das fremde Schiff verschwunden.
Der Kommandant ließ das Glas sinken.
»Was halten Sie von der Geschichte?«
Der Wachhabende machte aus seiner Meinung kein Hehl.
»Da stimmt etwas nicht, Kapitän! Seitdem wir über die Wolga gingen, treibt sich das Schiff in unserer Nähe herum.«
Der Kapitän ging mit unruhigen Schritten in dem kleinen Kommandantenraum hin und her. Die Verantwortung für das wertvolle Schiff mit hundertsechzig Passagieren lastete schwer auf ihm. Sollte er telephonischen Alarm geben … Unterstützung von Orenburg erbitten? … Oder sollte er notlanden?
»Dort!«
Das fremde Schiff war wieder aus den Wolken herausgetreten und wurde schnell größer. Der Kommandant faßte seinen Entschluß.
»Wenn es weiter auf uns zuhält, dann nehme ich telephonische Verbindung auf und rufe um Hilfe.«
Aber während der Kommandant dem Wachhabenden diesen Entschluß mitteilte, überlegte er schon weiter, welche Wirkung er sich von dieser Maßnahme versprechen dürfe. Orenburg war noch zu weit. Ganz unmöglich würde er den Flughafen vor dem fremden Schiff erreichen können … Hilfe von dort? … Raubüberfälle auf Postschiffe waren seit zwanzig Jahren selten geworden. Die Gegend hier galt als vollkommen sicher. Es war unwahrscheinlich, daß irgendein Polizeischiff hier schnell zur Stelle sein konnte.
Auf einen Wink des Kommandanten schaltete der Wachhabende die Sendestation ein. Automatisch begann das Typenrad zu laufen und gab die Nummer des Schiffes in den Raum … Und dann blitzte ein Wölkchen auf dem fremden Schiff auf. Zweihundert Meter seitlich vom Postschiff platzte das Geschoß.
Mit einem Satz stand der Wachhabende an der Morsetaste. Mechanisch hämmerten seine Finger den internationalen Notruf.
Jetzt war alle Unschlüssigkeit vom Kommandanten gewichen. Er selbst stand am Steuer und gebot durch den Maschinentelegraphen den Turbinen die Hergabe der höchsten Leistung.
Zickzackfahren, den Kurs so schnell und so sprunghaft ändern, daß die da drüben mit ihrem Schießen immer zu spät kommen mußten … daß nur Zufallstreffer dem eigenen Schiff gefährlich werden konnten … Zeit gewinnen … Raum gewinnen!
Wellington Fox kam von seinem Rundgang durch die Maschinenräume des Kompagnieschiffes wieder in die Zentrale zurück.
»Alle Wetter, Georg! Meine Hochachtung vor der Chartered Company und ihren Schiffen …«
»E. S. Compagnie!« verbesserte Isenbrandt. »Nicht Charte red Company! Der Name hat einen schlechten Klang in der Geschichte.«
»Meinetwegen! Aber es kommt doch auf etwas Ähnliches heraus. Eure Gesellschaft ist mit staatlichen Hoheitsrechten ausgestattet, hält auf eigene Rechnung Soldaten und wird vielleicht eines Tages Krieg führen … auf eigene Rechnung.« »Laß, Fox! Deine Vergleiche hinken zu stark!«
»Na! Jedenfalls gibt diese Fahrt mir Stoff für einen guten Bericht nach Chikago. Fehlt nur noch ein regelrechtes Abenteuer.«
Georg Isenbrandt saß bequem in einem Korbsessel und verfolgte das Zeigerspiel der mannigfachen Apparate in der Zentrale, während er ab und zu halblaute Worte mit dem Kommandanten des Schiffes, Baron von Löwen, wechselte, wobei klar wurde, daß das Compagnieschiff unter dem Befehl Isenbrandts stand.
Wellington Fox sprach weiter:
»Mein Kompliment, Herr von Löwen! Die Maschinen vorzüglich … Ihre Ausrüstung unübertrefflich. Sie müssen bei forcierter Fahrt tausendfünfhundert Kilometer in der Stunde hinter sich bringen …«
»Gewiß, Mr. Fox. Es macht mir Freude, einen der schnellsten Kreuzer der Compagny zu führen. Aber der Dienst wird auf die Dauer eintönig.
Wir patrouillierten vom Balkasch bis zum Altai. Tagein, tagaus der gleiche Dienst. Es passiert nichts mehr. Die Zeiten der Lufträuberromantik sind dahin.«
»Es wäre nicht ganz ausgeschlossen, Herr von Löwen, daß der heutige Tag eine kleine Abwechslung in Ihren Dienst bringt.«
Der Kommandant sah ihn einen Augenblick erstaunt an. »Hm … Es war mir schon eine angenehme Abwechslung, Herr Isenbrandt, als ich den Befehl bekam, in forcierter Fahrt nach Moskau zu gehen und Sie an Bord zu nehmen.« Isenbrandt zog seine Uhr.
»Das Postschiff Nummer achtzehn muß in fünfundvierzig Minuteruin Orenburg landen. Wo stehen wir?«
Der Kommandant beugte sich über die Karte.
»Wir stehen fünfzig Kilometer hinter Nummer achtzehn.« »Halten Sie den Abstand bis Orenburg, wenn nicht …« Das Wellentelephon schlug an. Scharf und abgehackt kamen die Morsezeichen.
»Nummer achtzehn, tick, tick, tick, tä, tä, tä, tick, tick, tick …«
Herr von Löwen starrte abwechselnd auf den Apparat und auf den Oberingenieur. Georg Isenbrandt blieb unbewegt sitzen. Nur seine Augen blitzten.
»Also doch … äußerste Fahrt voraus! Dem Postschiff nach … Ihre Kanoniere bekommen Arbeit, Herr von Löwen!« Ein jäher Ruck ging durch das Wachschiff und warf Wellington Fox gegen den Türpfosten. Jetzt rissen die mächtigen Maschinen das schnittige Gefährt plötzlich mit tausendfünfhundert Kilometern durch den Raum. Und jetzt sahen sie, was geschah.
Ein schnelles, gut bewaffnetes Schiff ohne Flagge feuerte unablässig hinter dem langsamer fliegenden Postschiff her, das sich durch scharfe Wendungen und eine Flucht nach Norden dem Angriff zu entziehen versuchte.
Wellington Fox war an das Fenster gesprungen. Herr von Löwen sprach durch den Apparat mit den Batterien. Unablässig arbeiteten die automatischen Entfernungsmesser und gaben die errechneten Entfernungen zu den Geschützen weiter. »Halte dich fest, Fox!«
Die Warnung Isenbrandts kam zu spät. Der schwere Donner eines Schusses, und gleichzeitig führte das Schiff unter der Gewalt des Rückstoßes eine Schlingerbewegung aus, die den Berichterstatter der Chicago Press der Länge nach auf den Fußboden schleuderte. Mit der Gewandtheit einer Katze sprang er wieder auf und klammerte sich an der Fensterbrüstung fest. »Dicht Backbord vorbei, Georg!«
Schon rollte ein zweiter Donner, und der Rückstoß des zweiten Schusses legte das Compagnieschiff schwer über. Wellington Fox machte einen Freudensprung.
»Hurra, der hat gesessen! Eine Backborddüse ist beim Teufel!«
Beim letzten Wort machte Wellington Fox wieder Bekanntschaft mit dem Fußboden. Ein dritter Schuß war aus den Rohren des Compagnieschiffes gefahren.
»Ich rate dir wirklich, dich festzuhalten, Fox.«
Georg Isenbrandt sagte es mit unerschütterlicher Ruhe, während er durch ein gutes Glas die Schußwirkungen auf dem Raubschiff beobachtete.
Ohne Pause krachten jetzt die acht Schnellfeuergeschütze des Compagnieschiffes und schleuderten einen Strom von Stahl und Dynamit auf das Raubschiff hin. Aber obschon schwer getroffen, setzte dies den Angriff auf das Postschiff fort. Nur noch aus einem Rohr vermochte es jetzt zu feuern, aber es feuerte, bis ein Treffer des Compagnieschiffes auch dies letzte Rohr in Trümmer schlug.
Georg Isenbrandt kniff die Lippen zusammen.
»Halt! … Das darf nicht sein … Herr von Löwen!« Der Kommandant folgte mit den Blicken dem Finger des Oberingenieurs. Ein gelbes Pünktchen löste sich von dem Raubschiff und sank in die Tiefe. Der Kommandant sprach durch das Telephon. In dichten Salven feuerte das Compagnieschiff. Weiße Schrapnellwölkchen umhüllten das niedersinkende gelbe Fleckchen und wischten es aus dem blauen Himmel.
Aber schon tropfte es weiter aus dem todwunden Raubschiff.
Ein zweiter, dritter, vierter und fünfter Fallschirm löste sich fast gleichzeitig von ihm und sank nach unten.
Die Geschütze des Compagnieschiffes arbeiteten wie Schnellfeuerpistolen. Die Wolken der platzenden Schrapnells umhüllten den vierten Fallschirm so dicht, daß man das Gelb seiner Form nicht mehr zu erkennen vermochte.
»Jetzt hat’s ihn! … Nein, da ist er noch … jetzt hat’s ihn doch … nein … ich weiß nicht …«
Wellington Fox stieß die Worte mit Leidenschaftlichkeit eines Jägers hervor, während er das Schicksal des vierten Fallschirms verfolgte.
In den letzten Minuten war das Kompagnieschiff dem bewegungslosen Raubschiff immer näher gekommen. Noch einmal drei Schüsse aus den schwersten Rohren. Dann brach das führerlose Schiff in drei Teile auseinander. Wie Steine stürzten sie in die Tiefe und schlugen dumpf auf den Boden auf. Die Rohre des Compagnieschiffes schwiegen. Unwahrscheinlich wirkte die Stille nach dem Getöse des vorangegangenen Kampfe«.
Der Kommandant brach als erster das Schweigen.
»Horrido! Herr Isenbrandt … Das war also Ihre kleine Abwechslung!«
Isenbrandt trat auf ihn zu und schüttelte ihm die Hand. »Das war gute Arbeit, Herr von Löwen. Es waren nicht die hundert oder zweihundert Passagiere des Postschiffes, die Sie vor dem Tode bewahrt haben … Denn offensichtlich ging die Absicht der Piraten nicht auf Raub, sondern auf Vernichtung … Es war diesmal mehr …
Doch nun ‘runter! Besehen wir uns die Strecke in der Nähe.« Im schnellen Gleitflug stieß der Kreuzer in die Tiefe. Nach wenigen Minuten setzte er dicht neben den Überresten des abgeschossenen Schiffes auf.
Mit dem Kommandanten standen Georg Isenbrandt und Wellington Fox zwischen den Trümmern des Wracks. Verbogenes Fachwerk, zerfetzte Bleche, zerschlagene Transmissionen. Zwischen zertrümmerten Lafetten lagen die Überreste mensch licher Körper.
»Mongolen … Mongolische Räuber?«
Zweifelnd brachte der Kommandant die Worte hervor. »Jedenfalls Gelbe, Herr von Löwen! Gelbe! Es ist wichtig, daß Sie das in Ihrem Bericht an die Gesellschaft betonen …
Was macht Nummer achtzehn?«
»Ah! … Da!«
Der Kommandant deutete nach Nordosten.
»Es hat wieder Richtung Orenburg genommen. Seine Beschädigungen scheinen nicht allzu schwer zu sein. Es erreicht mit eigener Kraft den Hafen.
Wir sollten bis Ferghana durchfahren, Herr Isenbrandt. Mit Ihrer Zustimmung würde ich indes gern in Orenburg zwischenlanden.«
»Bitte, Herr von Löwen!«
Wenig später nahm das Compagnieschiff Kurs auf Orenburg.
Nummer achtzehn steuerte von Norden her den Orenburger Hafen an. Jetzt konnte man auch mit unbewaffnetem Auge erkennen, daß sein Rumpf an mehr als einer Stelle schwere Verletzungen aufwies. Nur mit Mühe konnte der Führer sein Schiff in der Luft halten.
Jetzt senkte es sich über der Plattform und warf die Leinen aus. Geschickt griff das Bodenpersonal zu. Aber sie hatten heute viel länger als sonst zu richten und zu dirigieren, bevor das Schiff endlich über dem Gleis stand und seine starken Räder in die Schienen eingriffen.
Propellerschwirren lenkte die Blicke von neuem aufwärts. Das Wachtschiff der E.S.C. erschien.
Sicher und schnell, ohne die Hilfe der Bedienungsmannschaften abzuwarten, setzte das Schiff auf der Plattform auf. Seine Treppe wurde ausgelegt. Georg Isenbrandt und Wellington Fox traten in Begleitung des Kommandanten ins Freie.
Zu dritt bestiegen sie einen der Fahrstühle, fuhren in die Tiefe und begaben sich zum Posthotel.
Georg Isenbrandt wandte sich an Herrn von Löwen:
»Während Sie sich mit dem Kommandanten von Nummer achtzehn besprechen, werde ich mit Mr. Fox im Hotel eine Erfrischung nehmen. Sie werden die Liebenswürdigkeit haben, es uns wissen zu lassen, wenn Sie abfahrtbereit sind.«
In der kleinen Trinkstube hinter dem großen Speisesaal fanden die beiden Freunde eine behagliche Ecke, in der sie allein und ungestört sitzen konnten.
Der Raum war im Stile der alten deutschen Ratsstuben gehalten. Nur der Funkschreiber, der auf einem Tischchen an der Wand stand und unablässig Depeschen aus aller Welt auswarf, verriet, daß man sich im 20. Jahrhundert befand.
Wellington Fox sprang auf und trat an den Apparat heran.
»Höre mal, Georg, was die Wun-Fang-Ti-Agentur meldet …«
Georg Isenbrandt machte eine abwehrende Handbewegung.
»Laß, Fox! Sie lügen wie gedruckt.«
»Die Agentur meldet: Peking, den 7. April. Die erleuchtete Güte wandelt auf dem Wege der Genesung. Der wachsende Mond wird Seiner Himmlischen Majestät die volle Kraft zurückbringen …«
Georg Isenbrandt zuckte mit den Achseln.
»Mit allen ihren Lügen können sie das Leben des KubelaiKhan um keine Minute verlängern. Wenn kein Wunder geschieht, stirbt der Kaiser in wenigen Tagen an der Kugel, die Wang Tschung auf ihn abfeuerte.«
»Ja, zum Teufel, warum lügen die Kerle so gräßlich?«
Ein sarkastisches Lächeln ging über die Züge Isenbrandts.
»Fox, du müßtest den Braten doch riechen. Kubelai-Khan, der als Kaiser Schitsu den Thron des Gelben Riesenreiches bestieg, hat nur einen unmündigen Sohn. Die Kugel des Republikaners, die ihn niederwarf, bedroht den Weiterbestand der neuen mongolischen Dynastie. Die ganze Lebensarbeit des Kubelai-Khan ist umsonst gewesen, wenn es nicht gelingt, in Peking eine starke Regentschaft einzusetzen, bevor der Tod des Kaisers öffentlich bekannt wird. Darum glaube ich, Fox, wir werden Bulletins der bisherigen Tonart noch lange zu lesen bekommen.«
Wellington Fox saß wieder am Tisch und stützte den Kopf in die Hand.
»Ich glaube, du hast recht, Georg.«
Wellington Fox nahm einen tiefen Zug aus seinem Glase.
»Weißt du auch, daß derselbe Mann, der in Berlin sprengte und deine Pläne stahl, heute den Überfall auf das Postschiff inszenieren ließ, in dem man dich vermutete?«
»Meinst du diesen Collin Cameron?«
»Den meine ich, Georg! Hüte dich vor Collin Cameron!«
Am Nordufer des Kisil, dort, wo er bei Kaschgar dem Yarkand zuströmt, lag die Villa Witthusen. Rings um das ganze Gebäude zog sich, von dem flachen Dach mit überdeckt, eine breite Veranda. Das Innere des Hauses enthielt große und luftige Räume.
Hier saß Theodor Witthusen, der Chef des großen Handelshauses Witthusen & Co, im Gespräch mit Mr. Collin Cameron, dem Vertreter der angesehenen amerikanischen Firma Uphart Brothers. Ein beträchtlicher Teil des Handels, der über Kaschgar nach Westen geht, lag in den Händen dieser beiden Firmen. Das russische Haus Witthusen & Co. importierte Häute und Teppiche, während das Haus Uphart Brothers mit Tee und Seide handelte. Collin Cameron war soeben von seiner Europareise zurückgekommen und hatte die erste Gelegenheit wahrgenommen, den Chef des befreundeten Hauses aufzusuchen.
Theodor Witthusen strich sich über den langen, leicht ergrauten Vollbart. Seine Züge verrieten Besorgnis.
»Wir sitzen hier in der Wetterecke, Mr. Cameron. Das politische Barometer ist gefallen und fällt noch weiter. Ich merke es an meinem Hauptbuch. Haben Sie Bestellungen aus dem Westen mitgebracht?«
Collin Cameron schlug sich auf die rechte Brusttasche.
»Gewiß, mein lieber Witthusen. Eine ganze Tasche voll. Die Nachfrage war sehr stark.«
Theodor Witthusen schüttelte den Kopf.
»Ich habe seit Wochen keine Bestellungen mehr. Man traut dem Frieden nicht. Die Auftraggeber halten zurück …«
»Sie sehen unnötig schwarz. Es gab eine Krise, ich will es zugeben. Kurz nach dem Attentat auf den Kaiser. Die Gefahr ist überwunden. Ich habe zuverlässige Nachrichten. Die Kugel ist entfernt. Das Befinden des Schitsu bessert sich von Tag zu Tag. Wir haben nichts mehr zu fürchten …«
Theodor Witthusen war der Rede Collin Camerons mit wachsender Aufmerksamkeit gefolgt.
»Ich weiß, Sie haben gute Verbindungen. Wenn Sie es sagen, glaube ich es. Ich hatte schon den Plan erwogen, Kaschgar zu verlassen und nach Rußland hinüberzugehen. Weg von hier nach Andischan … oder sonst irgendwohin ins Ferghanatal.«
»Sie weg von hier? … Und Ihre Lager? … Millionenwerte … Das dürfen Sie nicht … Schon Ihrer Tochter wegen nicht, der Sie das Vermögen erhalten müssen …«
»Gerade meiner Tochter wegen, Mr. Cameron. Ich bin ein alter Mann, und wenn man mich hier totschlägt, so … aber um meine Tochter bin ich in Sorge. Sie ist von Riga nach hierher unterwegs. Ich möchte sie heute noch warnen, ihr telephonieren, daß sie auf russischem Gebiet bleibt. Maria Feodorowna soll in Andischan warten, bis ich ihr weitere Nachrichten gebe.« Collin Cameron war den Ausführungen seines Geschäftsfreundes mit unbeweglicher Miene gefolgt.
»Ich glaube, mein bester Witthusen, Sie sind viel zu ängstlich. Ich komme von England … war auch in Deutschland … Kein Mensch denkt an kriegerische Verwicklungen. Von Ihnen werde ich direkt zum Bürgermeister gehen, ihm meine Aufwartung machen. Wenn der Taotai irgendwelche Befürchtungen hat, wird er es mich wissen lassen. Sollte ich irgend etwas hören, gebe ich Ihnen Nachricht. Aber Ihre Besorgnisse sind sicherlich unnötig.«
Mit einem Händedruck empfahl sich Collin Cameron.
Vor dem Hause wartete sein Kraftwagen auf ihn. Ein kurzer Wink, und das Fahrzeug setzte sich in Bewegung.
Cameron fuhr zum Taotai. Eine Einladung … ja beinahe ein Befehl rief ihn dorthin.
Seine Gedanken flogen zurück. Wie lange schon steckte er in diesem Spiel? Vor neun Jahren war es, an einem Wintertag. Da waren die Würfel gefallen, die über sein weiteres Leben entschieden. Da war der große Prozeß zu seinen Ungunsten entschieden, der ihm die Lordschaft Lowdale bringen sollte. An jenem Tage hatte er sich in seiner Verzweiflung den Gelben verschrieben.
Das Knistern des Papiers riß ihn aus seinen Gedanken. Er zog es aus der Tasche und entfaltete es. Eine Einladung des Taotai. Mit chinesischen Lettern auf zähes Papier gepinselt. Unverfänglich für jeden, der nur den Text las und das unscheinbare Zeichen neben dem Namenszug des Taotai übersah.
Das Zeichen der Schanti-Partei.
Als Kubelai-Khan vor zwanzig Jahren das neue Reich schuf und als Kaiser Schitsu den Thron bestieg, war Toghon-Khan sein bester Feldherr. Seit Jahren saß Toghon-Khan als Vizekönig von Kaschgarien in Dobraja. Ebenso wie der Kaiser hatte er einen chinesischen Namen angenommen. Als Schanti herrschte er unter dem Zepter des Schitsu, wie er als Toghon an der Seite des Kubelai in die Schlachten geritten war.
Viele Augen im Reiche richteten sich auf den klugen und mächtigen Vizekönig, der hier an der westlichen Grenze des Reiches Wache hielt und ein starkes Heer unter seinen Fahnen hatte.
Solange Schitsu herrschte, würde Schanti als treuer Paladin stets an seiner Seite stehen. Aber der Tod konnte seiner Herrschaft ein Ende bereiten, und Schanti hatte seit langem für sich und seine Herrschaft vorgesorgt. In aller Stille war die große, auf den Namen des Schanti eingeschworene Organisation entstanden.
Collin Cameron blickte auf das winzige Zeichen neben der Unterschrift am Fuße der Einladung und wußte, daß nicht der Taotai, der einfache Bürgermeister, ihn erwartete.
Nun hielt der Wagen vor dem Amtsgebäude. Collin Cameron schritt die Treppe empor. Tief verneigten sich die Diener vor ihm. Lautlos wiesen sie ihm den Weg. Nicht der Taotai empfing ihn. Er stand vor Wang Ho. Der Generalstabschef der Armee des Schanti war es, der seinen Besuch gefordert hatte.
»Das Berliner Unternehmen, zu dem Sie uns veranlaßten, ist mißlungen.«
»Schroffe Abweisung trat auf die Züge des Angeredeten.
»Nicht meine Schuld, Herr General. Ich hatte in meinem Bericht ausdrücklich betont, daß die Hauptpanzer zu sprengen wären. Die Sprengung ist mit unzulänglichen Mitteln unternommen worden. Ich muß die Verantwortung für die Durchführung dieser Unternehmung ablehnen.«
»Auch das Orenburger Unternehmen ist mißlungen! Vor fünf Minuten ist der telephonische Bericht eingegangen. Sie hatten uns gemeldet, daß der Oberingenieur Isenbrandt im fahrplanmäßigen Postschiff fährt. Wir haben das Schiff angreifen lassen. Unser Schiff ist von einem Compagniekreuzer vernichtet worden. Der Oberingenieur ist nicht in dem Postschiff gefahren. Er hat im Gegenteil das Compagnieschiff kommandiert. Wie erklären Sie ihren unzutreffenden Bericht?«
Collin Cameron fuhr sich mit der Hand über die Stirn. Sekunden hindurch verharrte er in nachdenklichem Schweigen.
»Erklären? … Es gibt nur eine Erklärung. Ich vermute … ich fürchte, hier hat ein Verräter seine Hände im Spiel.«
»Dann wird es Ihre Aufgabe sein, ihn zu finden.«
»Herr General, ich lehne jede Verantwortung für das Mißlingen meiner Pläne ab. Den Verräter zu suchen, ist Ihre Aufgabe. Zu etwas anderem … Bitte, lesen Sie …«
Cameron griff in die Brusttasche, entfaltete schweigend ein Papier und überreichte es dem General.
Wang Ho hatte seine Miene in der Gewalt. Unwillkürlich neigte er das Haupt, als er die eigenhändige Unterschrift des Schanti erblickte. Mit unbewegter Miene gab er das Papier zurück.
»Sie haben recht, Mr. Cameron. Es geht um größere Dinge.«
Sorgfältig barg Collin Cameron das Papier wieder in der Brieftasche. Ruhig sprach er weiter.
»Sie haben die Pläne des Ilidreiecks erhalten, Herr General?«
»Sie sind in meiner Hand. Die Toresani hat sie durch einen zuverlässigen Boten von Andischan an mich geschickt.«
»Die Wichtigkeit wird von Ihnen richtig gewürdigt?«
»Die Compagnie zeichnet Dämme und Schmelzanlagen auf chinesisches Gebiet ein. Voraussetzung dafür ist, daß sie das Gebiet in ihre Gewalt nimmt.«
»Sie wird es tun, Herr General! Der europäische Staatenbund wartet nur auf die entscheidende Meldung aus Peking, um vorzugehen.«
»Der Bund wird uns nicht unvorbereitet finden, Mr. Cameron. Diese Pläne hier geben uns einen guten Grund, unsere Vorbereitungen in großem Maßstab zu treffen.«
»Was werden Sie mit den Ausländern in den Grenzgebieten machen? In Aksu, in Yarkand, in Khotan, auch hier in Kaschgar sitzen zahlreiche europäische Familien.«
»Wir werden sie von heute an überwachen. Sowie es losgeht, schieben wir sie in Lager nach dem Innern des Landes ab.«
»Ich habe es nicht anders vermutet. Nur in einem besonderen Fall möchte ich selbst den Schutz oder, wenn Sie so wollen, die Aufsicht übernehmen. Meine Firma unterhält freundschaftliche Beziehungen zu dem hiesigen Hause Witthusen. Ich bitte Sie um die nötigen Vollmachten …«
Wang Ho beugte sich über den Tisch und schrieb. Collin Cameron nahm das beschriebene Blatt, trocknete es sorgfältig ab und steckte es zu den übrigen Dokumenten in seine Brieftasche.
Der Sergeant, der die Meldung des Barons von Löwen an Georg Isenbrandt überbrachte, daß das Schiff in zehn Minuten startbereit sei, vergaß, bei seinem Fortgehen die Tür hinter sich zu schließen. So blieb sie halb offen stehen und gestattete den Freunden, zu sehen und zu hören, was in dem anstoßenden Hotelsaal vor sich ging.
Aus dem Stimmengewirr hoben sich deutsche Worte heraus. Eine Frauenstimme war es. Ein junges Mädchen, das mit einem der Platzschaffner sprach. Wellington Fox sah ein feines Gesicht. Lichtblondes Haar umrahmte die schmale Stirn, unter der lichtblaue Augen erglänzten.
Sie beklagte sich über den Ausfall des Schiffes nach Andischan.
»Mein Vater erwartet mich. Was wird er sagen, wenn ich ausbleibe? … Er wird in Angst um mich sein … Was soll ich nur tun?«
Der gutmütige Schaffner suchte sie zu trösten.
»Wir können ja telephonieren. Wohin wollen Sie denn … nach Kaschgar …«
Wellington Fox wiederholte mechanisch die letzten Worte.
»Nach Kaschgar will sie … wer mag sie sein?«
»Wer mag sie sein …«
Georg Isenbrandt saß geistesabwesend auf seinem Stuhl. Wellington Fox wandte ihm halb den Rücken zu, so daß er die plötzliche Veränderung nicht bemerken konnte, die im Wesen seines Freundes vorging.
»Weißt du, als Ritter ohne Furcht und Tadel sollten wir uns des armen Dinges annehmen. Wir haben den ganzen Luftkahn für uns. Was steht dem im Wege, daß wir sie bis Ferghana mitnehmen … Soll ich zu ihr gehen, es ihr anbieten?«
Er erhielt auf seine Frage keine Antwort und wandte sich um.
»Georg! Wie denkst du darüber?«
Noch einmal kam die Frage von den Lippen Georg Isenbrandts: »Wer mag sie sein?«
Jetzt wandte Wellington Fox sich ganz um.
»Was hast du denn, Georg … was ist dir?«
Georg Isenbrandt stürzte seine Stirn in die Hände.
»Eine Erinnerung aus schönen Tagen.«
Isenbrandt sprach stockend, als ob ihm die Worte nur schwer von den Lippen wollten:
»Dieses junge Mädchen … wie ich die Stimme hörte … als ich ihre Gestalt sah … als ob ich sie wiedersähe … Maria Ortwin …!«
Wellington Fox versuchte sich die Szene zu erklären. Er wußte von dem kurzen Glück seines Freundes. Lodernde, brennende Liebe … und dann die jähe Trennung durch den Tod.
Wellington Fox war damals in den Vereinigten Staaten. Er hatte die verstorbene Braut seines Freundes nie gesehen. Aber er begriff wohl, daß hier eine täuschende Ähnlichkeit obwalten müsse.
»Ich glaube, Georg, wir tun ein gutes Werk, wenn wir die junge Dame mitnehmen. Soll ich sie auffordern?«
»Ja … wenn sie mit uns fahren will. Sprich du mit ihr.«
Mit großer Geschwindigkeit ging Wellington Fox daran, diesen Auftrag zu vollziehen.
Und dann stand Wellington Fox bei ihm und machte ihn mit Maria Feodorowna Witthusen bekannt.
»Ich danke Ihnen, mein Herr, daß Sie mir die Möglichkeit geben, sofort nach Ferghana weiterzukommen.«
»Ich bin glücklich, wenn ich Ihnen diesen Dienst erweisen kann …«
Er stockte und schwieg. Auch das Mädchen schwieg. Wie im Traum schritt Georg Isenbrandt an ihrer Seite. Wie im Traum glaubte er an der Seite derjenigen zu schreiten, die er einst so sehr geliebt hatte.
Zu dritt bestiegen sie den Compagniekreuzer und nahmen In der reservierten Kabine Platz.
Mit voller Kraft schoß der Kreuzer über die Hungersteppe dahin. Der alte Name hatte heute nur noch historische Bedeutung. Wo sich früher eine dürftige und trostlose Steppe dehnte, da grünten jetzt üppige Felder.
Georg Isenbrandt erhob sich, um eine Karte aus dem Nebenraum zu holen. Forschend schaute ihm Maria Feodorowna nach. Dann richtete sie eine Frage an Wellington Fox.
»Ist Ihr Freund immer so schweigsam und ernst?«
»Nicht immer … Gewiß, sein Charakter ist ernst. Heute kommt ein besonderer Grund hinzu … ein Grund, der Ihnen auch die besonders ernste Stimmung meines Freundes erklären kann …«
»Sie machen mich neugierig, Mr. Fox. Darf man den Grund wissen?«
»Ich sehe nicht ein, warum ich ihn verheimlichen sollte. Sie gleichen in Stimme und Gestalt einer Frau, die Georg Isenbrandt vor Jahren über alles geliebt hat …«
»… einer Frau, die Ihr Freund liebte? … Wo ist sie jetzt?«
»Sie ist tot … in wenigen Tagen wurde sie dahingerafft … Ich war in Amerika, als sie Maria Ortwin begruben. Als ich zurückkam, war mein Freund ein stiller Mann geworden, der nur noch seiner Arbeit lebte …«
Wellington Fox legte den Finger an die Lippen. Georg Isenbrandt kam wieder in den Raum. Er trug die Karten und breitete sie auf dem Tisch aus. Wellington Fox begann von den Arbeiten zu sprechen, während Georg Isenbrandt nur wenige erläuternde Worte hinzufügte. Sein Blick umfing die Gestalt Maria Feodorownas.
Maria Witthusen horchte auf die Erklärungen von Wellington Fox. Der Kreuzer hatte jetzt reinen Südostkurs. Im Südwesten stand eine gewaltige Wolkenwand an dem bisher so klaren Himmel. Eine mächtige Bank brodelnden und wogenden Wasserdampfes.
Wellington Fox erklärte:
»Der erste der großen kochenden Seen. Alles Wasser, was von den Bergen in den See strömt, dampft hier auf und wird von den Winden nach Norden mitgenommen.« Er deutete auf Isenbrandt: »Und hier ist der Oberkoch, der die Berge dampfen und die Seen brodeln läßt.«
Marias Blicke flogen zu Georg Isenbrandt hinüber. Nachdem sie den Grund seiner Schweigsamkeit vernommen hatte, gewannen diese scharfen und entschlossenen Züge ein besonderes Interesse für sie.
Während der Kreuzer mit unveränderter Geschwindigkeit seinen Kurs verfolgte, traten die Wolkenmassen über dem Aralsee allmählich zurück. Georg Isenbrandt blickte ihnen kurze Zeit nach. Dann wandte er sich an Maria Feodorowna.
»Wir müßten viel weiter südlich fliegen. Wir müßten dem Hochgebirge folgen. Dann würden Sie unsere Arbeiten sehen können. Da heben wir die Wassermengen in den Äther, die das Land bis in den hohen Norden warm und fruchtbar machen …«
»Oh ja! Ich sah etwas davon in Kaschgar. Da sehen wir es im Westen und im Norden dampfen und nebeln, soweit das Auge den Horizont zu erfassen vermag. Sie können viel, Herr Isenbrandt, aber den Winden können Sie doch nicht gebieten.
Der Wind tut Ihnen nicht immer den Gefallen, nach Norden zu wehen. Bläst er nach Osten, so bekommen wir den ganzen Segen. Auch unsere Flüsse dort fließen stärker, seitdem die Berge im Norden und Westen brennen.«
Wellington Fox griff den Faden auf.
»Ja! Sag mal, Georg … Fräulein Witthusen hat recht. Da scheitern deine Künste. Die unerwünschte Windrichtung tritt ja Gott sei Dank nur selten ein. Bedenklich wäre es aber doch, wenn es dem guten Gott der Winde gefiele, ein paar Monate hintereinander auf Abwegen zu wandeln.«
Georg Isenbrandt preßte die Lippen zusammen. Die leicht hingeworfenen Worte seines Freundes betrafen ein Problem, an dessen Lösung er im stillen schon seit Jahren arbeitete. Noch nie war die Frage so brennend gewesen wie jetzt. Seit langen Wochen waren die Winde unregelmäßig geworden. Er wußte auch, daß ein Zusammenhang zwischen diesen Abweichungen und den immer größer werdenden Schmelzarbeiten bestehen müsse. Schon waren aus einzelnen Siedlungsgegenden im Norden Berichte gekommen, die über Regenmangel klagten.
Wellington Fox unterbrach sein Grübeln.
»Sieh hier, Georg! Wieder neue Dörfer … Auf der Karte nicht eingetragen … merkwürdiger Baustil … das sieht ja beinahe amerikanisch aus.«
Ein leichtes Lächeln spielte um die Lippen Isenbrandts.
»Es ist auch amerikanisch, Fox! Deutsch-amerikanisch! Pfälzer aus den Seestaaten, die jetzt nach hier übergesiedelt sind.«
Das Schiff stand jetzt über Perowsk und folgte eine größere Strecke dem vielfach gewundenen Lauf des Sir Darja.
Isenbrandt deutete in die Tiefe, wo der breite, grüne Strom deutlich zu sehen war.
»Jetzt sind wir am alten Jaxartes. Bis hierhin ist der große Alexander auf seinen Eroberungszügen vorgedrungen. Wir sind weitergekommen. Fünfhundert Meilen weiter nach Osten. Wir schaffen Neuland für Hunderte von Millionen Menschen.« Maria Feodorowna spann seinen Gedankengang weiter:
»Ein gewaltiges Werk! Doch die Gelben sehen es nicht gern. Ich höre, wie sie bei uns in Kaschgar darüber sprechen. Fremde Teufeleien, die dem Gelben und dem Blauen Fluß das Wasser nehmen. Vielleicht müssen wir eines Tages den Ort verlassen, an dem wir seit zwanzig Jahren wohnen.«
Prüfend ruhte der Blick Georg Isenbrandts auf den Zügen der Sprecherin.
»Der Tag kann schneller kommen, als Sie denken. Ich werde Sie warnen. Versprechen Sie mir, meiner Warnung zu folgen …«
Maria Feodorowna streckte dem Reisegefährten die Rechte entgegen. Ihre Blicke trafen sich.
»Ich danke Ihnen, Herr Isenbrandt!«
Der Kreuzer hatte jetzt den Stromlauf verlassen. Während der Fluß einen weiten Bogen nach dem Süden schlug, verfolgte er Südostkurs, überflog die Hochgebirgskette bei Chotkal und stand jetzt schon dicht vor Andischan. Es wurde Zeit, an den Abschied zu denken.
Auf dem Hangar neben dem Endbahnhof der Strecke Andischan-Osch-Kaschgar landete das Compagnieschiff.
Erst die Technik des Dynotherms hatte es ermöglicht, in kurzer Zeit und mit geringen Baukosten den großen Tunnel durch das gewaltige Terekmassiv zu bohren und die neue Linie bis Kaschgar durchzuführen.
Georg Isenbrandt und Wellington Fox begleiteten Maria Witthusen zum Zug. Sie standen dort, bis sich der Zug in Bewegung setzte. Wellington Fox zog ein seidenes Tuch und winkte. Georg Isenbrandt sprang auf das Trittbrett des rollenden Zuges. Er beugte sich zu Maria Feodorowna, flüsterte ihr wenige Worte zu und war mit einem Sprung wieder neben seinem Freund.
Der Knall des Schusses, der den Kaiser des Himmlischen Reiches auf das Schmerzenslager warf, war bis in die letzten Erdenwinkel gedrungen. Millionen Herzen bebten … wie immer, wenn das Schicksal einen ganz Großen unter den Menschen traf, von dessen Sein oder Nichtsein dasjenige von Millionen Kleiner abhing. Und je länger die Zeit des Wartens, desto unerträglicher wurde die Spannung.
Wie alljährlich, hatte sich der Herrscher zu Wintersausgang nach Schehol begeben, um hier Erholung von der Last der Regierungsgeschäfte zu suchen. Hier, wo die strenge Bewachung seiner Person nicht so scharf wie in Peking durchgeführt wurde, hatte ihn die Kugel eines Republikaners getroffen.
Der Schuß war tödlich. So lautete der Bericht der Ärzte für die wenig Vertrauten der nächsten Umgebung. Aber die Lage des Reiches verbot eine Veröffentlichung dieses Berichtes.
Kaum zwanzig Jahre waren vergangen, seitdem der junge, tatkräftige Mongolengeneral Kubelai die Herrschaft des Riesenreiches an sich gerissen hatte. Bis dahin war China eine Republik, deren beste Kräfte durch nie zur Ruhe kommende Wirren aufgezehrt wurden.
Auf schneller, blutiger Bahn war der Mongolenkhan an die Spitze des Riesenreiches geeilt, alles niederwerfend, was sich ihm in den Weg stellte. Dann hatte er das Spiel gespielt, das von jeher jedem Usurpator geläufig war. Um seine Herrschaft zu festigen, wurde das chinesische Nationalbewußtsein aufgepeitscht, bis alle Augen gegen den äußeren Feind gerichtet waren.
In zähem Ringen hatte er den Europäern eine Position nach der anderen entrissen, bis er das Land von den »Ausbeutern« befreit hatte. Mit der gleichen Energie und Tatkraft widmete er sich dann dem Ausbau der inneren wirtschaftlichen Kräfte seines Landes.
Mit seinen Erfolgen wuchs sein Ehrgeiz ins Unermeßliche. Schon bevor die Europäische Siedlungsgesellschaft ihre Tätigkeit in Turkestan begann, hatte sich ein Auge auf diese Gebiete gerichtet. Doch damals schien ihm der mögliche Gewinn den Preis der hohen Opfer nicht wert.
Erst als die Pläne der Siedlungsgesellschaft bekannt wurden, Pläne, die dort ein großes, weißes Kulturland zu schaffen versprachen, erschienen ihm jene Länder begehrenswert.
Ein neues Schlagwort war bald gefunden: Panmongolismus! Vereinigung aller Gelben mit dem großen Himmlischen Reich. Schnell wurde es aufgenommen. Bald war eine rege Irredenta in den bis dahin politisch völlig indifferenten Gegenden im Gange.
Die gelben Emissionäre fanden einen Boden, dessen Bearbeitung ihnen die Siedlungsgesellschaft notgedrungen erleichterte. Da die dort ansässigen mongolischen Stämme durch die europäischen Siedler in ihrer Nomadenwirtschaft gehindert oder gar verdrängt wurden, gab es Unzufriedene genug. Das diplomatische Spiel hatte bereits begonnen, da krachte der verhängnisvolle Schuß.
Über den Gärten von Schehol lag eine milde Frühlingssonne. Auf einer weiten Dachterrasse des Palastes stand das niedere Lager, auf dem der Kaiser ruhte. Auf den weißen Seidenkissen wirkte das Antlitz wie das eines Toten.
Die Blicke des Kaisers hingen starr am Horizont. Dort hinten … hinter den Schneegipfeln des Thian-Schan lag das Reich seiner Feinde, der Westländischen.
Ein leichter Glanz belebte die starr blickenden Augen. Wie sie ihn fürchteten … da drüben hinter den Mauern des Himmelsgebirges!
Und jetzt? … Wie würden sie frohlocken, wenn er tot … Er stöhnte unterdrückt. Seine Hand tastete nach einer Schale mit goldenen Kugeln und ließ eine davon in ein klingendes Bronzebecken fallen. Hinter einem seidenen Vorhang wurde ein Diener sichtbar.
»Toghon-Khan!«
Seit er die Gewißheit hatte, daß er sterben müsse, hatte er sie zu sich gerufen … die Großen seines Landes … einen Starken zu finden, der für seinen unmündigen Sohn das große Reich leiten und schützen könne.
Und alle hatte er wieder weggehen lassen, als zu leicht befunden. Keiner darunter, der würdig war, den Ring zu tragen, der den vierten Finger der kaiserlichen Rechten umschloß.
Ein einziger noch … der letzte, der in Frage kam. Schanti, der Herr von Dobraja und Aksu. Nicht nur ein tüchtiger General, sondern auch ein hervorragender Staatsmann, hatte er es in zäher Energie verstanden, hinter das Geheimnis des Schmelzpulvers der Weißen zu kommen. Zwar war es ihm noch nicht gelungen, Arbeiten in so großzügiger Weise auszuführen, wie sie die Europäische Siedlungsgesellschaft in RussischTurkestan betrieb, doch war immerhin ein Anfang gemacht.
Aber würde Toghon-Khan auch der gewaltigen Aufgabe gewachsen sein, die ihm die Regentschaft über das ganze Riesenreich bringen mußte?
Wieder ließ der Kaiser eine Kugel in die Schale fallen. Die seidenen Vorhänge rauschten auseinander, und ein Mann in Generalsuniform trat auf die Terrasse. Ein markantes Gesicht. Das ganze Äußere zeugte für ein glutvolles und leidenschaftliches Temperament.
Einen kurzen Moment ruhten die Augen des Eingetretenen auf dem todgeweihten Herrn.
Langsam ließ er sich auf die Knie nieder und beugte die Stirn, bis sie den Boden berührte.
Schwach, wie aus weiter Ferne kommend, schlug eine Stimme an sein Ohr.
»Ich danke dir, Toghon, daß du meinem Ruf schnell gefolgt bist … meine Zeit ist kurz, die Ahnen rufen mich …«
Regungslos verharrte Toghon-Khan, die Stirn am Boden. Leise kam seine Antwort:
»Himmlische Weisheit, du wirst das Reich noch lange lenken …«
»Nein, Toghon … die Ahnen rufen mich. Ich gehe bald … Aber schwer ist mein Herz … Die Sorge um mein Land und mein Haus …«
Erschöpft schwieg der Kaiser. Minuten verflossen, bis er neue Kraft fand. Toghon-Khan sprach: »Die Blüte des Lotos ist von der allerhöchsten Weisheit gesegnet …«
»Nein, Toghon … Mein Sohn ist ein Knabe und spielt mit den Frauen im Palast. Jetzt wollte ich ihn zu mir nehmen … einen Mann aus ihm machen … Die Vorsehung hat es nicht gewollt.«
»Du wirst genesen …«
Toghon-Khan fühlte, wie die matte Hand auf seinem Haupte zitterte.
»Nein, Toghon. Ich sterbe … in Sorge um das Reich. Wolken stehen am Himmel. Von Westen drohen sie. Wer wird das Reich führen? … Ich habe sie alle gehört … Die Statthalter des Nordens und des Südens … den Hohen Rat und die Ratskammer … Kleine Köpfe … kleine Mittel … alle … alle. Du bist der letzte! … Wirst du mich auch enttäuschen? … Was hast du zu sagen …«
»Die Wolken, die das Land bedrohen, werden vor der Sonne weichen … Aber wenn sie der Sonne nicht weichen, wird ein Blitzstrahl sie zerreißen. Ein Blitzstrahl des Himmels wird den Himmel wieder klarmachen.«
»Ein Blitzstrahl des Himmels?«
Der Kaiser wechselte die Sprache und sprach mongolisch weiter:
»Nur denen hilft der Himmel, die sich selber helfen.«
Langsam erhob Toghon-Khan die Stirn vom Boden. Seine Hände ergriffen die Hand des Kaisers, seine Lippen preßten sich darauf. Langsam hob sich sein Haupt, bis es die Kissen erreichte, bis seine Lippen das Ohr des Kaisers berührten. Flüsternd drangen die Worte in das Ohr des Kaisers.
Leichte Röte trat in das Antlitz des Kranken. Glanz kehrte in seine erloschenen Augen zurück, während Toghon-Khan flüsternd weitersprach.
Jetzt schwieg er. Der Kaiser ließ die Hand sinken. Er öffnete die Faust und legte die Rechte über die Augen. Die Rechte, an deren viertem Finger der kaiserliche Ring mit den Zeichen des Dschingis-Khan gleißte.
»Toghon, du Treuester aller Treuen … Auch im Tode verläßt du mich nicht …«
Von der abgezehrten Rechten streifte der Kaiser den Ring. Mit immer schwächer werdenden Händen griff er die Linke des Toghon-Khan und schob ihm den Ring auf den vierten Finger.
»Du bist … du wirst das Reich verwesen, bis mein Sohn …«
Betäubt und geblendet starrte Toghon-Khan auf den Ring an seiner Linken.
Noch einmal kamen dem sterbenden Kaiser Kraft und Sprache zurück.
»Geh, Toghon! Du hast den Ring … Ich bin müde … Jetzt werde ich schlafen … geh ….«
Der Körper des Kaisers sank auf das Lager zurück. Langsam erhob sich Toghon-Khan. Den Körper geneigt, das Gesicht gegen das Lager des Kaisers gewandt, schritt er rückwärts langsam dem Ausgang zu. Noch eine tiefe Verneigung zum Lager des stillen Kaisers. Toghon-Khan wandte sich um und trat in den Vorsaal.
Lange war er allein bei dem Kaiser gewesen. Lange hatten die im Palast versammelten Würdenträger des Reiches geharrt, daß er vom Lager Schitsus zurückkehren möchte.
Was brachte Toghon-Khan? … Was hatte der Kaiser mit ihm beschlossen? In den Herzen aller brannte die Frage, aber nichts verrieten die steinernen Züge des Toghon-Khan. Bis in die Mitte des Saales schritt er Blieb dort hochaufgerichtet stehen und ließ den Blick über die Versammlung schweifen, die Hände unter den verschränkten Armen verborgen.
Fünfzig Augenpaare waren auf ihn gerichtet. Suchend flog sein Blick durch den Raum.
Ein kurzer Wink. Ein mongolischer General eilte auf ihn zu.
»Mangu-Khan übernimmt den Befehl über die Palastwache. Geh!«
Der Angeredete verharrte überrascht und zögernd. Auch auf den Gesichtern der übrigen Anwesenden prägten sich Staunen und Zweifel.
Wie konnte Toghon-Khan solchen Befehl geben?
»Geh!«
Zum zweitenmal fiel das Wort scharf von den Lippen des Schanti. Die verschränkten Arme öffneten sich. Die Linke wies gebieterisch zur Tür.
»Niemand betritt oder verläßt den Palast ohne meine Erlaubnis!«
Es war ein neuer, schwerwiegender Befehl. Doch allen sichtbar glänzte an der ausgestreckten Hand der kaiserliche Ring, und im Augenblick wandelte sich das Bild im Saale. Sie alle, die eben noch einen Gleichberechtigten, einen Mitwerber erwartet hatten, sehen jetzt den vom Kaiser bestimmten Regenten vor sich stehen.
Ehrfurchtsvoll waren die Verbeugungen. Niemand wagte es, dem vom Kaiser selbst ernannten Regenten die schuldige Achtung zu verweigern.
Weithin dehnt sich das alte Siebenstromland zwischen dem Balkasch- und dem Issisee. In Wierny, der Hauptstadt des Landes, hatte Georg Isenbrandt sein Standquartier. Von hier aus leitete er die Arbeiten, welche die ihm unterstellten Ingenieure und Schmelzmeister in den südlich und westlich gelegenen Gebirgen ausführten.
Am Frühstückstisch saßen die beiden Freunde sich gegenüber. Wellington Fox sprach: »Die Lampe hat gestern noch lange bei dir gebrannt, Georg …«
»Berufsarbeit, lieber Freund. Instruktionen für die Schmelzmeister … neue Pläne für die ganze Schmelzstrecke … die Pläne sind zum größten Teil fertig … Die Instruktionen beginnen heute. Beeile dich, damit wir bald aufbrechen können.«
Wellington Fox ließ sich das nicht zweimal sagen. Beim Schlag der neunten Morgenstunde erhob sich das kleine schnelle Flugzeug des Oberingenieurs. Isenbrandt selbst führte das Steuer und setzte den Kurs nach Süden.
Hoch und immer höher, bis sie den Kamm des Himmelsgebirges erreicht hatten, das hier die Grenze zwischen Rußland und China bildete.
Den Gebirgsgrat entlang in nordöstlicher Richtung führte Georg Isenbrandt jetzt die Maschine. In brodelndem, wogendem Nebel lag das Massiv unter ihnen.
Vom Dynotherm getrieben, arbeiten die Turbinen der Flugmaschine vollkommen geräuschlos, und mühelos konnten die Freunde ihr Gespräch führen.
Jetzt warf Isenbrandt das Steuer herum und setzte das Schiff auf Nordwestkurs. Wellington Fox sah, wie die Nebelmassen hier wie abgehackt aufhörten.
»Warum, Georg … warum geht es hier nicht weiter?« »Weil wir am kritischen Punkt sind. Du siehst die natürliche Grenze, das Gebirge weiter nach Osten ziehen. Die politische Grenze biegt scharf nach Norden um. Was da halbrechts vor uns liegt, ist das Ilidreieck, seit 150 Jahren ein strittiges Gebiet bald unter chinesischer, bald unter russischer Herrschaft. Heute wieder chinesisch.«
Das Flugzeug folgte der Grenze nach Norden. Ein mächtiger Strom wälzte unter den Reisenden seine Wogen nach Westen. Georg Isenbrandt senkte die Maschine so tief, daß sie den Boden fast zu berühren schien Und dann stand sie doch plötzlich wieder hoch über dem Grund; denn in jähem Abfall senkte sich das Gebirge. Ein breites, tiefes Tal, auf beiden Seiten von schroffen Felsmauern umsäumt, durch das der Ilistrom seinen Weg nahm. Von den Felsen her ein riesenhafter Staudamm, im Bau begriffen.
Georg Isenbrandt runzelte die Brauen, während das Flugschiff langsam über der Dammkrone dahinzog.
»Verdammt! Wir kommen hier nicht so schnell vorwärts, wie ich möchte … Ich werde MacClure ablösen lassen … Mag er auch zehnmal ein Protektionskind sein!«
»Ist der Dammbau so eilig, Georg?«
»Sehr eilig! … Die Gelben besitzen ebenfalls Dynotherm und schmelzen damit in ihrem Lande. Fällt es ihnen eines Tages ein, hier im Ilidreieck allzu stark zu schmelzen, so vernichtet das Hochwasser unsere Siedlungen im Siebenstromland.«
In steilen Kreisen ließ Isenbrandt die Maschine steigen. Kilometer um Kilometer ging sie in die Höhe, und immer weiter dehnte sich die Landschaft. Jetzt dämmerte am Osthorizont Kuldscha herauf. Die Hauptstadt des umstrittenen Gebietes. Jetzt lag das ganze Dreieck wie ein offener Kessel unter ihnen.
Isenbrandt deutete mit der Rechten dorthin.
»Begreifst du es wohl, daß wir das Ilidreieck haben müssen?«
Wellington Fox umfaßte mit prüfendem Auge die riesenhafte Talmulde. Ein sarkastisches Lächeln glitt über seine Züge.
»Ich vermute, mein lieber Georg, hier wird es eines Tages gehen wie im Erlkönig … Und folgst du nicht willig, dann brauch’ ich Gewalt …«
Georg Isenbrandt antwortete nicht. Jetzt stellte er die Maschine ab und ließ das Schiff im gestreckten Gleitflug in die Tiefe schießen. Und dann setzte es leicht und sicher auf einer Bergwiese auf. Sie waren vor einem Bezirkshaus des Abschnitts gelandet. Etwa ein Dutzend Ingenieure war hier versammelt, durch Fernruf benachrichtigt.
Isenbrandt wandte sich an einen jungen Menschen, der in der Nähe stand.
»Franke, führen Sie den Herrn hier zu Ihrem Großvater. Er soll ihm alles zeigen, was er zu sehen wünscht … Lieber Fox! Du hast drei Stunden Zeit, einen unserer interessantesten Schmelzpunkte zu besuchen. Um vier Uhr bitte pünktlich wieder hier!«
An der Seite des jungen Mannes machte Wellington Fox sich auf den Weg. Er war ein tüchtiger, trainierter Bergsteiger, aber er mußte sich anstrengen, um mit dem hier vorgelegten Tempo Schritt zu halten.
Schließlich standen sie auf einer Alm vor einer rohgezimmerten Blockhütte. Mißtrauisch begrüßte der alte Schmelzmeister den Ankömmling.
»So! Zeitungsschreiber sind Sie? … Nee, nee, da kann ich Ihnen nichts zeigen …«
Der junge Franke mußte sich energisch ins Mittel legen und den Auftrag Isenbrandts wiederholen, bevor der Alte sich endlich bereit fand.
»Zeitungsschreiber … Ich kenne die Brüder noch von damals … damals, als der Kessel kochte …«
Wellington Fox horchte auf. »Als der Kessel kochte …« Hatte nicht Isenbrandt die Worte erst vor kurzem gebraucht …?
Wie ein Jäger auf seine Beute, stürzte er sich auf den Alten, und in zwei Minuten hatte er ihn soweit, daß er zu erzählen begann:
»Zweiundvierzig, nein, dreiundvierzig Jahre ist es jetzt her. Im Leunawerk bei Merseburg war’s. Der Betriebsingenieur hatte mir den Auftrag gegeben, einen großen Reservekessel für den nächsten Tag anzuheizen. Früh um vier kam ich in das Kesselhaus.
Ich also … als erstes, was ich tue … ich drehe allererst den Wasserleitungshahn auf, um den Kessel erst mal voll Wasser laufen zu lassen. Derweil das Wasser läuft, suche ich mir Holz zum Feuermachen zusammen, und so allmählich kommen auch meine Kollegen … Sie müssen wissen, Herr, ich war damals der jüngste und mußte zuallererst da sein.
Wie ich so mein Holz zusammentrage, wird mir warm und immer wärmer, und dabei hatten wir 15 Grad Kälte im Freien.
Wie ich noch so stehe und mir den Schweiß von der Stirn wische, da gibt mir mein Kollege einen Stoß in die Rippen und zeigt auf das Manometer am Kessel. Und da denke ich doch, der Deubel soll mich holen … da zeigt das Manometer auf zwölf Atmosphären. Dabei, Herr, kein Stückchen Feuer auf den Rosten … eben erst kaltes Wasser aus der Leitung in den Kessel gepumpt.
Da kommt gerade der Ingenieur. Der sagt ganz harmlos: ›Na, Leute, ihr habt ja schon ganz schönen Dampfdrucks ›Ja!‹ sage ich. ›Aber den Kessel hat der Deubel geheizt.‹
›Wieso?‹ fragte der Ingenieur. Ich gehe langsam an den Kessel ‘ran, mache die Feuertür auf und zeige ihm die kahlen Roste.
Mit einem einzigen Satz ist er an der Tür und verschwindet, ohne noch ein Wort zu sagen.
In fünf Minuten war er mit dem Direktor wieder da. Und wie der Direktor die Bescherung sieht, stellt er sich hin und lachte. Dann sprang er plötzlich zu und schaltete den unheimlichen Kessel auf die Maschinen. Es war aber auch nachgerade Zeit, denn der Druck war inzwischen auf fünfundzwanzig Atmosphären gestiegen.
Da kam der Direktor zurück und sagte nur ganz trocken: ›Der Doktor Frowein soll mal kommen.‹ Und als der kam, da guckte er ihn bloß an und sagte: ›Junge, Junge, daß dir das gelungen ist!‹ Und dann fiel der Direktor dem Doktor Frowein um den Hals.
Als er ihn wieder losließ, da sagte er zu uns: ›Kinder, merkt euch den heutigen Tag. Der 13. Februar 1963 wird noch für Jahrhunderte ein Gedenktag bleiben. Heute fängt ein neues Kapitel der Zivilisation an. Der hier ist’s, dem die Menschheit das verdankt.‹
Wie es dann mit der Erfindung weiterging, das wissen Sie ja wohl. Kohlen zum Heizen brauchten wir nicht mehr, Öl auch nicht mehr. Die Bergarbeiter wurden größtenteils überflüssig. Die ganze Wirtschaft wurde auf den Kopf gestellt. Na, ganz glatt ist das ja nicht gegangen. Auf einmal so viele Menschen ohne Brot! … Zwanzig Millionen Leute aus Europa wohnen jetzt hier in bestem Wohlstand, wo früher ein paar Kirgisen kümmerlich hausten. Aber kommen Sie! Ich will Sie zu unserer Schmelzstelle bringen.«
Gespannt hatte Wellington Fox der Erzählung des alten Schmelzmeisters gelauscht, während der Magnetograph in seiner Tasche sie Wort für Wort niederschrieb. Jetzt folgte er dem Alten, der ihn auf einem neuen Pfad weiter bergan führte. Die Luft war hier verhältnismäßig klar. Noch eine kurze Wendung, und vor ihnen lag ein mächtiger Gletscher. Wohl mehrere Kilometer breit schob sich der gigantische Eisstrom zu Tal. Wellington Fox konnte hier und da schwarze Punkte wie Fliegen über die Fläche kriechen sehen. Er nahm sein Glas zu Hilfe und sah, daß es große tankartige Fahrzeuge waren, die das Gletschereis befuhren und gleichmäßig mit Dynotherm bestreuten.
Während seine Augen an dem interessanten Schauspiel hingen, nahm der Schmelzmeister seine Erklärungen wieder auf:
»Sehen Sie, Herr, wie der Strom des erschmolzenen Wassers etwa fingerhoch über der Gletscherfläche zu Tal läuft. Meilenweit über das Eis läuft und dabei immer heißer wird.«
Wellington Fox ließ sein Glas sinken.
»… Und wie lange hält der Gletscher aus?«
»Ja … eigentlich sollte der Gletscher längst verbraucht sein, wenn nicht …«
»Wenn was nicht?«
»Ja … die Gelehrten behaupten, daß hier überhaupt viel mehr Regen und Schnee fällt, seitdem die Schmelzerei im Gange ist. Trotzdem könnten die Gletscher hier bald zu Ende gehen, wenn wir nicht sparsam schmelzen müßten … Ja, wenn wir da oben im Quellgebiet des Ili schmelzen könnten … aber das gehört ja den Gelben … und die lassen uns nicht ‘ran, obgleich sie auch Vorteile dabei hätten.
Und dabei könnten wir noch so viel Wasser gebrauchen, da doch der Balkaschsee mit dem Pulver nächstens zum Dampfer gebracht werden soll. Sie wissen, Herr, damit die Wolkenbildung und die Niederschläge reichlicher werden. Sie machen da unten schon große Vorbereitungen für die großen Feierlichkeiten, die bei der Gelegenheit von Stapel gelassen werden. Na, davon habe ich nichts. Aber ich werde dann hier oben abgelöst und komme ‘runter an den See. Das ist mir auch viel lieber.
Die alten Knochen wollen nicht mehr so recht. Warme Buden haben wir ja … aber die feuchte Luft … der ewige Nebel …«
Der Junge mischte sich ein: »Großvater, erst wolltest du gar nichts sagen, und jetzt kannst du kein Ende finden. Der Herr muß jetzt fort!«
Eine halbe Stunde später saßen die beiden Freunde wieder im Flugzeug, das sie nach Wierny zurückbringen sollte.
»Na, Fox, hat unsere Arbeit deinen Beifall gefunden?«
»Aber gewiß, Georg! Interessant war mir auch die Erzählung des alten Schmelzmeisters. Lebt eigentlich Frowein noch?«
»Aber ja! Der alte Herr sitzt im Aufsichtsrat unserer Gesellschaft.
»Sage mal, Georg, wie ist denn der damals darauf gekommen?«
»Fox, du fragst verkehrt! Ich bin über die Entstehung der Erfindung orientiert. Aber um dir das zu explizieren, müßte ich dir tagelange Vorträge halten.«
»Na, dann versuch mal, mir die Sache in ihren Grundzügen zu erklären. Ich weiß nur, daß Dynotherm ein künstlich hergestellter radioaktiver Stoff ist, der, mit Wasser zusammengebracht, Wärme entwickelt.«
»Damit hast du den Kern der Sache getroffen. Frowein hatte jahrelang mit natürlichen radioaktiven Substanzen gearbeitet. Ihm war es gelungen, den Zerfall dieser Stoffe, der bis dahin unwandelbar an bestimmte Zeiten gebunden zu sein schien, zu beeinflussen. Von da war es nur noch ein Schritt, das Verfahren auch an Stoffen zu versuchen, die man bis dahin als nicht mehr radioaktiv kannte. Frowein hat diesen Schritt getan, und seine Folgen siehst du hier vierzig Jahre später.«
»Sehr schön! Der Mann hat meine volle Hochachtung! Die Kohlenzeit damals muß schauderhaft gewesen sein. Aber du! Was hast du daran verbessert?«
Isenbrandt kniff die Lippen zusammen. Über seine eigenen Leistungen sprach er ungern. Aus seiner Tasche zog er zwei kleine Zinntuben.
»Da sind je zehn Gramm des neuen, nach meinem Verfahren hergestellten Dynotherms. Sie wirken wie zwei Zentner des älteren Präparates …«
Wellington Fox griff nach den winzigen Röhrchen.
»Alle Achtung, Georg! Ich kann mir jetzt schon Fälle denken, wo man das Pülverchen gut verwenden kann, ohne gerade Schnee zu schmelzen.«
Isenbrandt sah ihn nachdenklich an.
»Du könntest recht haben, Fox! Behalte sie, wenn du willst. Aber vergiß nicht, daß in jeder dieser winzigen Röhrchen ein Vulkan schlummert, der, von wenigen Tropfen Wasser geweckt, seinem Träger Lebensgefahr bedeutet. Bewahre sie wohl. Wer weiß … wann du sie brauchen wirst!«
Sorgsam barg Wellington Fox die Tuben in seiner Brieftasche.
»Herzlichen Dank, Georg! Leider muß ich das meiste, was ich bei dir sah, den Lesern der Chicago Press vorenthalten.«
Um die sechste Abendstunde stand Wellington Fox auf der Westveranda des Kogarthauses. Nur gedämpft drang die Musik aus den Gesellschaftsräumen des großen Luxushotels bis hierher. Ungestört konnte er Ausschau hallen.
Zweitausend Meter unter ihm strömten im Süden die Fluten des Sirflusses durch das Paradies der Ferghanaebene. In allen Tönen spielten die heißen Strahlen der sinkenden Sonne mit den Dampfwolken der heißen Quellen von Andischan. Doch diesen Schönheiten widmete Wellington Fox nur geringes Interesse. Sein Blick haftete auf den Abhängen der Kogartberge, die das Panorama nach Norden zu begrenzten. Mit einem Glas durchforschte er die Schneehänge der Kogartberge, die jetzt in den Strahlen der scheidenden Sonne rosig aufzuglühen begannen.
»Verfluchter Leichtsinn! Bei solchem Firnwind eine Skitour zu unternehmen. Nicht einmal einen vernünftigen Führer haben sie mitgenommen … Auf die Renommierereien dieses MacGornick sind sie ‘reingefallen. Aus purem Trotz mit dem alten Trottel losgegangen. Möchte er sich das Genick brechen … und die edle Gräfin Toresani meinetwegen auch. Aber Helen Garvin …«
Daß sie mit bei der Tour war, das verursachte seine Unruhe.
Helen Garvin, dieser kleine Trotzkopf! Vor der Tour und vor der Komtesse di Toresani hatte er sie gewarnt …
Er ließ sich in einen Sessel fallen. Sein Auge haftete auf den Abhängen der Kogartberge. Ihm selbst kaum merklich verschwammen die schneeigen Konturen allmählich und nahmen die Gestalt der Sierra Nevada an. Garvins Park auf San Matteo tauchte vor ihm auf.
Wie er damals Helen Garvin zum erstenmal sah …
Mißmutig war er durch den prächtigen Park geschlendert, in dem die Launen des Besitzers neben den herrlichen Gartenanlagen auch allerlei Merkwürdigkeiten geschaffen hatten. Das Labyrinth wollte er sehen, jenes wunderliche Bauwerk, das der Milliardär dort in die Felsen von San Matteo hatte sprengen lassen.
Ein junges Mädel, das er um den Weg fragte, hatte ihn dorthin geführt. Als er ihr, hingerissen von ihrer jugendlichen Schönheit, allzu lebhaft seinen Dank ausdrücken wollte, da hatte das Mädel plötzlich darauf aufmerksam gemacht, daß er sich im Park ihres Vaters befände … Und sie würde gleich die Diener rufen … und ihn hinausspedieren lassen.
Der Schalk, der dabei aus ihren Augen blitzte, verriet ihm zwar, daß das nicht bitterer Ernst war, aber …
Seitdem kannte er Helen Garvin.
Allein war er damals in das Labyrinth gegangen. Durch Kreuz- und Quergänge, bis er den Mittelbau erreichte. Ein mächtiges, elliptisches Gewölbe. Eine reiche Sammlung aztekischer Altertümer war hier aufgestellt. Interessiert hatte er die Sachen betrachtet, ohne auf andere Besucher zu achten. Da hatten auf einer Bank zwei Männer gesessen und leise miteinander gesprochen. Als er weit von ihnen entfernt vor einer Maske des Mexiki stand und die scheußlichen Züge des alten Götzen musterte, waren plötzlich gut verständliche Worte an sein Ohr gedrungen. Worte, die ihn lange und gespannt lauschen ließen.
»Das Ohr des Dionysos!« … Eine halbvergessene Schulerinnerung kam ihm wieder Das elliptische Gewölbe, das die Laune des Milliardärs hier in den Fels getrieben hatte, ließ ihn in einem Brennpunkt verblüffend deutlich hören, was in der Nähe des anderen viele Meter von ihm entfernt geflüstert wurde. So hatte er hier durch Zufall alles das gehört, um dessentwillen er schon seit Wochen suchte.
Hörte, bis das Flüstern erstarb … sah dann … und sah zwei Gesichter.
Seitdem kannte er Collin Cameron.
Das ferne Donnern einer zu Tal gehenden Lawine riß ihn aus seinen Träumen.
Mit einem Satz stand er auf beiden Beinen.
Er schickte sich an, die Veranda zu verlassen. An der großen Flügeltür stieß er auf Wilhelm Knöpfle, den Leiter des Kogarthauses. Der hatte die Schneeberge von Davos mit denen vom Ferghana vertauscht, als der Wintersport hier oben in Mittelasien Mode wurde. Die Begegnung gab Wellington Fox Veranlassung, seinem Herzen Luft zu machen.
»Schlechtes Wetter, Herr! Die Luft gefällt mir nicht. Ich fürchte, es wird nach Sonnenuntergang noch mehr Lawinenschläge geben. Einige Leute hier hätten ihre Unternehmungslust zügeln sollen.«
Der Direktor zuckte kaum merklich mit den Achseln.
»Drinnen ist die Luft auch nicht besonders. Gewitterspannung.«
Wellington Fox warf ihm einen fragenden Blick zu.
»Sind neue Nachrichten aus Peking da?«
»Immer noch das alte Lied. Die verhüllte Weisheit befindet sich auf dem Weg zur vollen Genesung …«
Jetzt war es an Wellington Fox, mit den Achseln zu zucken.
»Der Weg scheint sich in die Länge zu ziehen … Ich mache mir meinen Vers auf die Sache …«
»Gehen Sie in den Gesellschaftsaal, Mr. Fox. Sie werden einen interessanten Fünfuhrtee finden!«
Wellington Fox betrat den großen, prunkvoll ausgestatteten Saal, in dem eine kaukasische Kapelle ihre Weisen ertönen ließ. In zweitausend Meter Höhe an den Hängen der Kogartberge gelegen, bot das Haus seinen Gästen bis tief in den Frühling hinein Gelegenheit zu allem alpinen Sport.
Aus allen Enden der Welt kamen die Gäste hier zusammen. Aus Europa und Amerika waren sie da. Neben Mongolen und Tataren, Turkmenen und Persern saßen Inder und Japaner. Die Tage waren dem Sport gewidmet, die Abende dem gesellschaftlichen Vergnügen.
An kleinen Tischen saßen die Gäste in dem großen Saal. Erfrischungen aller Art wurden gereicht, und die Kapelle übertönte die Unterhaltung der einzelnen Gruppen.
Wellington Fox fand einen leeren Tisch in einer Ecke. Er begann seine Musterung und fand die Bemerkung des Hoteldirektors bestätigt. Er hätte darauf wetten mögen, daß die Gelben hier mehr wußten als er.
Die Instinkte des Jägers und des Berichterstatters wurden in ihm wach. Zum Teufel … weg mit diesen Gedanken … Die Sorge um Helen Garvin nahm ihn wieder gefangen.
Wellington Fox erhob sich und schritt durch den Saal. Irgendwie mußte er sich Gewißheit verschaffen. Er trat in die Kanzlei und starrte auf die stummen Apparate … Da … ein Ruf eines der Telephone.
MacGornick sprach: »… großes Unglück … sofort vom Hotel Rettungsexpedition schicken … Lawinenschlag … Begleiterinnen Gräfin Toresani und Helen Garvin verschüttet.«
Bevor noch der Portier eingreifen konnte, hatte Wellington Fox den Schalthebel gedreht und die Geberstation des Hotels eingeschaltet. Scharf und knapp kamen seine Rückfragen … wo der Unfall geschehen sei … am Ketmansteg … unterhalb des Kogartpasses.
Im nächsten Moment stürmte Wellington Fox aus der Kanzlei. Im Vorraum stand allerlei Sportgerät. Ohne Besinnen griff er die ersten besten Skier und eilte weiter. An einem Haken sah er den dicken Pelz eines der eingeborenen kirgisischen Führer hängen und riß ihn mit einem Ruck an sich.
So stürmte er ins Freie. Der aufgehende Mond beleuchtete unsicher die schneebedeckten Hänge und Flächen. Mit geübten Händen zog er die Bindungen der Skier über seine Lackschuhe. Schon im Gleiten, warf er den Pelz über.
Eine Minute nach dem Empfang von MacGornicks Notruf schoß Wellington Fox in sausender Talfahrt auf den dreihundert Meter tiefer gelegenen Ketmansteg zu.
Jetzt sah er eine einzelne Gestalt auf der weiten weißen Fläche … war im Augenblick heran … versuchte im letzten Moment durch Abdrehen der windenden Fahrt Herr zu werden … und merkte, daß es nicht mehr ging. Gewaltige Schneemassen versperrten ihm den Weg. Mit Aufbietung aller seiner Kraft schnellte er sich in die Höhe, streifte MacGornicks Gestalt und landete inmitten der aufgetürmten Schneemassen.
Das Mondlicht reichte eben aus, um die Dinge in der nächsten Umgebung zu erkennen. Eine gewaltige Lawine war halb schräg von der Paßhöhe her zu Tal gegangen. Er konnte ihre Spur die Hänge hinauf bis weit nach Norden erblicken.
Bevor MacGornick sich durch die Schneemassen langsam zu ihm hinabzuarbeiten begann, strebte er der Stelle zu, wo die Bruchstücke eines Schneeschuhes aus den eisigen Massen ragten. Das letzte Zeichen der Personen, die hier vom weißen Tod überrascht worden waren.
Seine Rechte fuhr zur Brusttasche. Jetzt hielt er eine der winzigen Tuben in der Hand, die ihm Georg Isenbrandt in Wierny gegeben hatte. Mit den Fingerspitzen streute er die Stäbchen wie Samenkörner in die Schneewüste, während er den gebrochenen Ski in immer weiter werdenden Spiralen umkreiste.
Jetzt war die Tube leer, und jetzt stieß er auf MacGornick.
Der Schotte wollte sprechen … wollte fragen, ob die Hilfsexpedition schon unterwegs wäre.
Mit einem unterdrückten Fluch wandte Wellington Fox ihm den Rücken … und sah über der ganzen Fläche, die er eben noch bestreut hatte, dichte Nebel wallen.
Eben noch standen sie kaum fußhoch. Jetzt wogten sie schon in Augenhöhe und stiegen in jeder Sekunde höher. Mit einem Schrei stürzte er in der Richtung davon, in der er eben noch die Skitrümmer erblickt hatte. Warme, dunstige Treibhausluft umfing ihn. Aber eisig umflutete ihn Schmelzwasser bis zu den Knien.
Schon war der eben noch froststarrende Schnee über die ganze Fläche hin eine schmelzende, auseinanderfließende Masse geworden. Jetzt stieß sein linker Ski auf Widerstand. Das mußte der zerbrochene Ski sein.
Mechanisch faßten seine Hände in die Taschen des fremden Pelzes … und griffen eine der tausendkerzigen elektrischen Fackeln, wie sie Bergführer bei sich zu tragen pflegen.
Im nächsten Moment flammte die mächtige Leuchte auf. Auch in die Klüfte und Spalten der schmelzenden Lawine drang das Licht. Mit einem Ruck entledigte sich Wellington Fox der störenden Schneeschuhe und warf sich auf die Knie in den eisigen Schlamm, um einer dunklen Stelle in den schmelzenden Massen näherzukommen. Schob mit den Händen den erweichenden Schnee zurück, bekam ein Stück Stoff zu fassen und zog eine menschliche Gestalt zu sich heran.
Kalt und leblos lag die Gerettete in seinen Armen. Der immer stärker schmelzende Schnee hatte ihre Kleidung vollkommen durchnäßt.
Beim Schein der starken Leuchte betrachtete er die Züge der Geretteten. Die, die er vor allem suchte, war es nicht. Die Marchesa di Toresani hielt er hier in den Armen. Aber Helen Garvin lag noch irgendwo verschüttet, von den schmelzenden Massen immer stärker bedroht.
Er ließ die regungslose Gestalt zu Boden gleiten. Sah dabei, daß der Riemen ihrer Umhängetasche gerissen war, und ließ die Tasche mechanisch in seinen Pelz gleiten. Dann begann er mit der Kraft der Verzweiflung von neuem zu suchen.
Er suchte und fand. Die schmelzenden und dampfenden Massen gaben den Zipfel eines Gewandes frei. Im Moment stürzte sich Wellington Fox darauf und hielt Helen Garvin in seinen Armen. Ebenso bleich und regungslos wie ihre Gefährtin.
Jetzt schnell heraus aus den dampfenden und schmelzenden Massen. Nur wenige Minuten waren verstrichen, aber wie hatte sich das Bild in kurzer Zeit verändert. Schon stand er in einer tiefen Mulde, und von allen Seiten her schoß das Schmelzwasser die Abhänge hinab, um gurgelnd und brausend seinen Weg zu Tal unter den Schneemassen fortzusetzen.
Mit den Zähnen faßte Wellington Fox die Fackel. An seiner linken Brust ruhte Helen. Mit dem rechten Arm umklammerte er den Körper der Toresani. Mit der doppelten Last mußte er sich an dem schmelzenden Abhang in die Höhe arbeiten. Schritt um Schritt kämpfte er sich empor, alle Muskeln und Sehnen bis zum äußersten gespannt.
Bis endlich die Steigung geringer, der Schnee unter seinen Füßen fester wurde. Bis das Licht einer anderen Fackel in seine Augen fiel.
MacGornick hatte sich endlich zur Tat aufgerafft, hatte sich der eigenen Fackel erinnert. Mit ihr war er jetzt in das Nebelmeer eingedrungen und auf Wellington Fox gestoßen. Mit einer letzten Anstrengung legte ihm Wellington Fox den regungslosen Körper der Marchesa di Toresani in die Arme.
»Zurück … auf trockenen Schnee …«
Im Süden von San Franzisko auf der Hochebene von San Matteo liegen, von wundervollen Parkanlagen umgeben, die Sommersitze der westlichen Finanz- und Industriemagnaten.
Der schönste unter den schönen Landsitzen der von Francis Garvin. Unter den reichen Männern der Union einer der reichsten Francis Garvin.
Die Grundlagen zu seinem riesenhaften Vermögen hatte er in jener denkwürdigen Landspekulation gelegt, als er vor einem halben Menschenalter die großen wüsten Landstriche zwischen der Sierra Nevada und dem Koloradofluß für einen Spottpreis an sich brachte und dann durch die Wirkungen des Dynotherms fruchtbar machte und besiedelte.
Auf der großen Terrasse, die über Wälder und Wiesen hinweg einen Blick auf die Fluten des Stillen Ozeans gewährte, saßen Francis Garvin und Helen, seine einzige Tochter.
Unruhig maß der Milliardär die Terrasse in ihrer ganzen Länge. Bald fuhren seine Hände in die Taschen, bald gestikulierten sie in der Luft.
In einen Korbsessel vergraben saß Helen und sah dem Vater halb belustigt, halb ängstlich zu. Gewiß hatte sie nicht erwartet, seinen ungeteilten Beifall zu finden, als sie ihm vor einer Viertelstunde in vorsichtigen Andeutungen ihre Liebe zu Wellington Fox gestand. Aber auf so heftigen Widerstand war sie auch nicht gefaßt gewesen.
»Habe ich ein Leben voll endloser Sorgen und Mühen geführt, habe ich gearbeitet wie ein Zugstier, um alles, was ich besitze, schließlich einen Zeitungsschreiber in die Tasche stecken zu sehen?!«
»Pa!« klang es strafend aus dem Korbsessel. »Mr. Fox ist ein Gentleman, der mit eigener Gefahr deine Tochter gerettet hat und dem du höchsten Dank schuldest.«
»Ich werde mich revanchieren, my Darling. Morgen kaufe ich die Chicago Press und schenke sie diesem Fox. Du wirst sehen, der Mann …«
»Der Mann wird das Geschenk nicht annehmen …«
Helen hatte sich umgedreht und sah ihren Vater mit blitzenden Augen an.
»Abwarten, mein Kleines! … Die zwölf Millionen Dollar, die die Zeitung kosten wird, nimmt jeder, dem Francis Garvin sie schenken will. Du hältst diesen Fox für einen schlechten Geschäftsmann.«
»Ich halte ihn für einen Gentleman, der dir dein Geschenk vor die Füße werfen wird.«
»Wetten, daß nicht?«
»Das gilt, Pa! Verlierst du, mußt du mich zu der Einweihung des Balkaschsees mit nach Asien nehmen! … Abgemacht!« …
Ein Diener brachte eine Karte und überreichte sie Helen Garvin. Ein freudiges Leuchten ging über ihr Gesicht, das aber schnell einem Schein der Trauer wich.
»Florence Dewey! Gut. Ich gehe gleich mit. Auf Wiedersehen, Pa. Die Wette gilt …
Florence!«
Sie flog auf die Freundin zu und faßte sie an beiden Schultern.
»Du bist es wirklich … Ein unerwarteter Besuch.«
Ein größerer Gegensatz als zwischen diesen beiden Freundinnen war kaum denkbar. Helen Garvin … das Köpfchen von goldig schimmernden Locken umgeben, große blaue Augen, ein Stumpfnäschen mit rosigen Flügeln … Das Ganze eine Nippesfigur aus Meißner Porzellan.
Daneben Florence Dewey, schlank und stolz. Schwarzes Haar um ein bleiches Antlitz, dessen Alabaster durch einen kreolenartigen Hauch gefärbt wurde. Trotz ihrer Jugend lag Ernst, ja Trauer in den schönen Zügen des Mädchens.
Von Jugend an waren Helen Garvin und Florence Dewey, die Töchter der beiden reichsten Leute von Frisko, eng befreundet.
Helen Garvin fragte:
»Du bist noch hier? Ich glaubte, du hättest die geplante große Reise längst angetreten?«
»Es war mehr der Plan meines Vaters als meiner. Ich habe ihn wohl erwogen … aber verworfen. Es hätte ausgesehen wie eine Flucht.«
Eine glühende Röte bedeckte ihr Gesicht, und ihre Stimme nahm einen leidenschaftlichen Klang an.
»Ich fliehen? Vor häßlichem Klatsch?! Nein … niemals.«
»Und doch waren es sicherlich schwere Tage, die du damals durchlebt hast.«
Helen legte den Arm teilnahmsvoll um die Schulter der Freundin.
»Was weißt du, Kleines, von den Kämpfen, die mir das Herz zerrissen!
Wäre es nur das eine gewesen … daß der schwarze Blutstropfen, der von Vaters Seiten in meinen Adern rollt, mir in einer rein weißen Gesellschaft Schwierigkeiten macht … gelacht hätte ich darüber. Aber daß ich deshalb auch meine Liebe lassen mußte …«
Die Kehle schien ihr zugeschnürt. Die Stimme versagte.
»Quäle dich nicht, Florence … versuche Averil Lowdale zu vergessen! Ein Mann, der dich um solch Vorurteil lassen konnte, ist deiner nicht würdig, hat dich nie wahrhaft geliebt.«
»Averil mich verlassen?! … Nein. Er tat es nicht!«
»Ich verstehe dich nicht. Schicktest du ihn von dir?«
Mit einer müden Handbewegung strich sich Florence über die Stirn, als wolle sie die quälenden Gedanken hinwegwischen. Dann begann sie mit ruhiger, tonloser Stimme zu erzählen: »Du weißt, Helen, wie ich Averil Lowdale kennen- und lieben lernte. Er hielt bei meinem Vater um meine Hand an, der sie ihm nicht verweigerte. Auch der alte Lord Lowdale war mit unserem Bund einverstanden … Warum auch nicht? … Das Vermögen der Lowdale war nie groß gewesen. Ein langjähriger Prozeß um die Lordschaft hatte den größten Teil der Revenuen verschlungen. Die Millionen meines Vaters kamen sehr erwünscht.
Da erhielt mein Verlobter plötzlich ein Telegramm, umgehend nach England zurückzukehren. Wenige Tage später hatte mein Vater einen Brief des alten Lords in den Händen: ›Seine Lordschaft zieht ihr Einverständnis mit dem Ehebund von Deweys Tochter mit seinem Sohn zurück. Weil …‹ weil ich nicht rein weißer Abstammung sei. Der Vater meines Vaters habe eine Quadronin zur Frau gehabt …«
»Unmöglich, Florence … und wäre die Behauptung wahr, so wäre es doch nur ein vorgeschobener Grund!«
»Du wirst es vielleicht besser verstehen, Helen, wenn ich dir die Vorgeschichte erzähle. Als der Vorgänger des jetzigen Lords Lowdale starb, trat sein Neffe als nächster Erbberechtigter auf. Seine Ansprüche, an sich unanfechtbar, wurden ihm von dem jetzigen Lord streitig gemacht, weil er Halbblut sei. Seine Mutter war eine Gelbe. Ein jahrelanger Prozeß entspann sich um die Erbschaft. Eine besondere Parlamentsbill entschied schließlich zugunsten des Halbblutes. Seit jener Zeit ist Lord Lowdale ein eifriger Verfechter der Bestrebungen für Reinhaltung der Rasse.«
»Und darum …«
»Darum durfte Averil keine Herrin in die Halle von Lowdalehouse bringen, unter deren Ahnfrauen eine ist, deren Wiege in einem Negerdorf gestanden hatte.«
»Und Averil? Fügte er sich widerspruchslos dem Verbot des alten Lords?«
Florence blickte traumverloren ins Weite.
»Nein, Helen … Averil trat mutig an meine Seite. Er war bereit, das Vaterhaus zu verlassen, mit seinem Vater zu brechen. Er kündigte mir seine Abreise von London an. Da … da gab ich ihm sein Wort zurück.«
»Warum, Florence? … Zweifeltest du doch an Averil … an seiner Treue?«
Tief atmend lehnte sich Florence zurück und bedeckte mit der Hand ihre Augen.
»Warum? … Weil ich ihn liebte … mehr liebte als mein Glück. Averils Entschluß war eine Tat, die mich beseligte … mich beglückte. Wer England und seine Institutionen kennt, weiß, was er meinetwegen aufgeben wollte. Sein Opfer war groß. So groß, daß ich es nicht annehmen durfte …
Laß die Vergangenheit. Es ist nutzlos, davon zu sprechen. Weg mit den Erinnerungen an jene Tage und Nächte der Verzweiflung …«
Sie erhob sich und ging ein paarmal durch das Gemach.
»Deine Erzählungen von den wunderbaren Arbeiten in Asien reizen meine Neugier, Helen. Du sprachst davon, daß du vielleicht mit deinem Vater zur Einweihung des Balkaschsees dorthin zurückgehen würdest. Wäre dir meine Begleitung angenehm?«
»Du fragst, Florence?! … Mit tausend Freuden begrüße ich deine Begleitung. Aber … es ist noch zweifelhaft, ob ich selbst gehe. Ich muß …«
Ein Lächeln stand in ihrem Gesicht. »Ich muß erst noch eine Wette gegen Pa gewinnen.«
Der reiche John Dewey saß in seinem Palast in Nob-Hill zu Frisko in seinem Arbeitszimmer. Ihm gegenüber Melan Fang, Seit Jahren waren sie bekannt. In letzter Zeit schienen die lockeren Verbindungen enger geworden zu sein. Enorme Summen waren von Deweys Konten auf das chinesische Handelshaus überwiesen worden. Es verlautete, daß John Dewey, der die meisten Silbergruben des amerikanischen Kontinents in seiner Hand vereinigte, große Konzessionen im südlichen Altai erhalten habe. Man sprach auch davon, daß er sie zusammen mit der chinesischen Firma ausbeuten wolle.
Zwischen den beiden Partnern lag ein mit vielen Zahlen bedecktes Papier.
»Wenn Zahlen allein beweisen könnten, wäre ich überzeugt, Melan Fang, aber in der Bilanz fehlen einige Imponderabilien, deren Bedeutung nicht zu unterschätzen ist!«
»Sie meinen die überlegene Intelligenz der weißen Rasse, Mr. Dewey?«
»Zweifellos!«
»Der Gedanke, daß die weiße Rasse der gelben und der schwarzen an Intelligenz weit überlegen sei, muß als erledigt angesehen werden. Die weiße Rasse teilt das Schicksal vieler anderer Rassen, die vor ihr waren und ihr Ende fanden. Sie ist an der gefährlichen Stelle der Zivilisation angekommen, die ein Volk nicht erreicht, ohne von unwiderstehlichem Drang erfaßt zu werden, sich in den Abgrund zu stürzen.
Im Bereich der praktischen Wissenschaften und der Technik mögen die kommenden Jahrhunderte noch von den Weißen zu lernen haben. Sonst hat … diese Rasse … kaum etwas geleistet … was den Leistungen des Orients auch nur verglichen werden könnte … Ein paar Menschenalter, und die Weltherrschaft der Weißen ist nur noch eine Episode der Weltgeschichte.«
John Dewey hatte während dieser langen Auseinandersetzung seines Gegenübers gedankenvoll auf den bunten Teppich geblickt.
»Und Sie halten jetzt schon den Zeitpunkt für gekommen, der Herrschaft der weißen Rasse für immer ein Ende zu machen?«
»Der Kampf beginnt jetzt! Mehr will ich nicht sagen. Wir würden schneller zur Entscheidung kommen, wenn der große Schitsu am Leben geblieben wäre. Aber unser Land ist nicht arm an großen Männern. Ein anderer wird das Werk vollenden.«
»Wer wird für den unmündigen Thronerben die Regentschaft übernehmen? Wird … er es sein?«
Der Chinese nickte.
»Er ist ein Mann der Tat. Er wird keinen Tag verlieren. Der diplomatische oder militärische Sieg in der Besitzfrage des Kuldschagebietes wird die große Umwälzung einleiten …«
»Sie rechnen mit dem Sieg, Melan Fang?«
»Unbedingt! Die größeren Machtmittel sind auf unserer Seite … nicht zu reden von unserem unerschöpflichen Menschenreservoir.«
»Und doch …«
Ein nervöses Zucken lief über das Gesicht des Chinesen, als diese Frage des kühlen Rechners Dewey sein Ohr traf.
»… und doch will er den entscheidenden Schritt nicht wagen, ohne der Hilfe der schwarzen Rasse sicher zu sein … wollten Sie sagen.«
Dewey nickte schweigend.
»Ich kann Ihre Bedenken nicht teilen. Haben Sie bei ihren großen geschäftlichen Unternehmungen nicht auch zuweilen mit der Hilfe anderer gerechnet?«
Wieder schüttelte Dewey den Kopf.
»Nie!«
Melan Fang rückte unruhig auf seinem Stuhl.
»Es ist wichtig, den kommenden Krieg schnell und sicher zu beenden. Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, dazu alle Mittel, die sich bieten, zu benutzen.«
Ein ironischer Zug legte sich um Deweys Mund.
»Schlagwörter wie Menschlichkeit haben schlechten Kurs in solchen Fällen. Sprechen wir offen, Melan Fang. China allein fühlt sich nicht stark genug. Es will die Kräfte Amerikas binden, damit Europa auf keine amerikanische Hilfe zählen kann. Der Bürgerkrieg zwischen Weißen und Schwarzen in der Union scheint das beste Mittel.
Der Plan ist gut. Aber …«
»Aber?«
»Ich bezweifle seinen Erfolg!«
»Sie sprechen in Rätseln, Mr. Dewey!«
»Es mag Ihnen rätselhaft vorkommen, daß ich meine Hände in ein Geschäft stecke, zu dessen Verlauf ich kein Vertrauen habe. Ihre Interessen und die der amerikanischen Negerbevölkerung sind grundverschieden.
Wir … mich einbegriffen … obgleich niemand mich jemals im Leben als black man taxiert hat … bis auf jenen englischen Lord … Wir kämpfen um die Gleichberechtigung mit anderen Rassen. Sie kämpfen um Macht und Land.
Unser Kampf hat ein ideales Ziel, ist eine interne Angelegenheit der Vereinigten Staaten. Ihr Streit wird die Weißen der ganzen Welt unter einer Fahne vereinigen, denn es geht um die weiße Existenz.«
Melan Fang wollte sprechen, aber John Dewey ließ sich nicht unterbrechen.
»Die weiße Intelligenz wird in diesem Kampf neue, unerhörte, ungeahnte Leistungen vollbringen und … vielleicht die Oberhand behalten.«
Der Chinese war aufgestanden.
»Sie müssen gestehen, daß ein Kampf zwischen China und den Westländern eine gute Unterstützung Ihres Streites um die Gleichberechtigung der Bürger ist. Unser Zusammengehen bringt beiden Vorteil …«
Er streckte Dewey die Hand hin, die dieser ergriff.
»Abgemacht!«
»Wann?«
»Nach der Wahl um den Gouverneursposten von Lousiana. Wird Josua Borden, der schwarze Kandidat, gewählt und nicht bestätigt, beginnt der Kampf!«
»Ich bekam heute ein Telegramm aus Peking. Er will den genauen Termin wissen. Bei Ihnen und bei uns muß der Schlag gleichzeitig fallen.«
»Den Tag anzugeben, ist unmöglich.«
»Der Tag der Wahl ist bestimmt und wird nicht verschoben?«
»Ich wüßte keinen Grund …«
»Sind Sie des unverbrüchlichen Schweigens aller Mitwissenden sicher, Mr. Dewey?«
»Unbedingt! … Warum fragen Sie?«
»Man hat mich auf einen Berichterstatter der Chicago Press aufmerksam gemacht. Es hat den Anschein, als sei er … der Organisation auf die Spur gekommen.«
»So muß alles geschehen, was geeignet ist, Unheil zu verhüten. Sie haben wohl Mittel und Wege dazu, Melan Fang …«
Georg Isenbrandt stand in seinem Laboratorium in Wierny. Er hatte die Tür des Raumes sorgfältig verschlossen. Niemand sollte ihn bei diesen Versuchen stören, die ihm die letzte Sicherheit bringen mußten.
Das Dynotherm wirkte wie eine radioaktive Substanz. Seine Materie zerfiel, löste sich scheinbar in das Nichts auf und verschwand aus der Schöpfung. Dafür aber traten riesenhafte Energiemengen auf, entstanden scheinbar ebenfalls aus dem Nichts, und dienten bei den Arbeiten der Compagnie dazu, die Hochgebirge Asiens in einen heißen Nebeldampf zu hüllen.
War das Prinzip umkehrbar, ließ sich eine Kombination finden, bei der neue Materie aus dem Nichts entstand und als Gegenwert Energiemengen gebunden wurden, spurlos aus der Schöpfung verschwanden. Seit Jahren bewegte diese Frage Georg Isenbrandt. In rastloser Forscherarbeit war er dem Problem immer näher gekommen. Der heutige Versuch mußte den letzten Beweis erbringen.
Er saß vor der Apparatur und schüttete eine sorgfältig abgewogene Prise seines neuesten Präparates in das Wasser einer hohlen Quarzkugel, die ihrerseits die Kugel des Heliumthermometers umgab.
Er saß und verfolgte die Skala des Thermometers. Was sich hier etwa an neuer Materie bildete, konnte rechnungsmäßig nur Bruchteile eines Milligramms ausmachen. Aber die Energiemengen für die Schaffung auch dieser geringen Stoffmenge mußten gewaltig sein. Das Thermometer mußte ihm zuerst und unfehlbar Aufschluß geben, ob Praxis und Theorie auch wirklich übereinstimmten.
So saß er und verfolgte den schmalen roten Weingeiststreifen, der das im Thermometer eingeschlossene Heliumgas von der Außenwelt abschloß.
Das Thermometer fiel. Schon hatte es den Gefrierpunkt erreicht, und langsam, aber stetig wanderte der rote Faden in dem Thermometerrohr weiter nach unten. Jetzt begann sich die Quarzkugel, in der das Präparat arbeitete, mit einer Eisschicht zu überziehen. Bei der Berührung mit der Zimmerluft schlug sich der in dieser vorhandene Wasserdampf sofort als massives Eis an der Quarzwand nieder.
Und immer noch fiel das Thermometer. Jetzt hatte es 100 Grad Kälte erreicht, jetzt stand es schon auf 180 Grad. Ein massiver, wohl einen halben Fuß starker Eisblock umgab bereits die ganze Apparatur.
Ein eigenartiges Prasseln und Knattern ließ Georg Isenbrandt aufhorchen. Es klang, als ob jemand Schrotkörner auf den Fußboden fallen ließ.
Schon zeigte das Heliumthermometer 250 Grad Kälte. Wo immer die Luft mit der Apparatur in Berührung kam, ging sie selbst sogleich in den flüssigen Zustand über, wurde dann fest und fiel zu Boden und verdampfte dort wieder nebelnd und brodelnd. Aber es wurde kalt und immer kälter auch im Zimmer bei diesem Vorgang. Georg Isenbrandt spürte die Kälte nicht. Wie gebannt hing sein Auge am Thermometer.
… 260 Grad … 270 Grad … nur noch drei Grade trennten die Apparatur von dem absoluten Nullpunkt.
Ein Kältegefühl an den Knien ließ ihn aufschaudern. Er faßte mit der Hand nach dem Rockzipfel und brach ein Stück des feinen flämischen Tuches glatt ab. Die flüssige Luft hatte den Stoff durchtränkt und war schließlich in ihm gefroren.
Achtlos warf er das Stück zur Seite. Nur noch das Thermometer interessierte ihn … 271 Grad … der rote Faden blieb plötzlich regungslos stehen. Der Alkohol war von der Kälte erreicht worden und zu einer massiven Stange gefroren. Jetzt aber sah er, wie die Heliumfüllung in Tropfen im Thermometer hinunterzufallen begann, wie das Heliumgas als feste Kruste an der Innenwand haftete.
Der absolute Nullpunkt war erreicht. Auch der flüchtigste aller bekannten Stoffe, das Heliumgas, erlag dieser exzessiven Kälte.
Georg Isenbrandt ließ sich auf einen Sessel sinken. Minutenlang haftete sein Blick auf dem erstarrten Thermometer.
Ein Rütteln an der Tür riß ihn aus seinen Gedanken.
»Wer ist da?«
»Ich! Wellington Fox.«
»Einen Augenblick, Fox … sofort …«
Georg Isenbrandt sprang auf und machte mit größter Schnelligkeit eine Dynothermlösung zurecht. Im nächsten Augenblick goß er sie über den Apparat aus und riß die Fenster auf. Dann ging er, um die Tür zu öffnen.
Wellington Fox stand vor ihm. Regennaß.
»Ich störe dich bei deinen Arbeiten? Du hast dich eingeschlossen …«
»Nein, du störst mich nicht. Du kamst zu einer glücklichen Stunde …«
»Glücklichen Stunde? … Du meinst, weil es hier endlich kräftig gießt. Es war wohl höchste Zeit … Ich habe allerlei gehört. Hier blieb es dürr, und woanders war der Segen zu reichlich. Richtig wird die Sache erst, wenn ihr eure Suppen auch den Mäulern vorsetzen könnt, die sie brauchen.«
Georg Isenbrandt blieb unbewegt. Sein Gesicht zeigte gleichmäßige, freundliche Mienen. Dann sprach er:
»Ja … das … sag mal, Fox, willst du nicht ablegen? Du triefst ja.«
Wellington Fox schüttelte sich.
»Naß bin ich, aber eine sibirische Kälte ist hier bei dir … Was hast du denn da auf dem Tisch?«
Wellington Fox trat näher heran und betastete den in eine wogende Nebelwolke gehüllten Apparat.
»Dampf? … Eis? … Ja, das ist ja kalt!«
»Eis ist meistenteils kalt, lieber Fox.«
Wellington Fox hauchte auf seine weiß angelaufene Fingerspitze.
»Weiß ich, Georg … ist mir nicht neu. Aber das Eis hier ist ja wenigstens 100 Grad kalt.«
»Sage ruhig 200 Grad, Fox. Luft ist hier gefroren. Du siehst, was das Dynotherm zu tun hat, um die Frostmasse aufzutauen und zu verdampfen.«
Wellington Fox betrachtete die dampfende und nebelnde Apparatur, von der die Wolken jetzt bereits bis zur Zimmerdecke emporstiegen.
»In der Tat, Georg. Wenn ich bedenke, wie fabelhaft schnell eine ganz große Lawine auf eine kleine Tube von deinem Dynotherm Wasser und Dampf wurde. Ich habe dir ja mein Abenteuer schon telefonisch erzählt.«
Isenbrandt lachte.
»Ja, Fox, so kopflos darauf loszupudern! Habe ich dich nicht gewarnt, vorsichtig damit umzugehen?«
Wellington Fox lächelte etwas gezwungen.
»Zwei so hübsche junge Damen, wie dort im Schnee begraben lagen, konnten auch einen alten Fuchs zu Torheiten veranlassen … Na, jedenfalls … ich habe da etwas gefunden, was mich veranlaßte, dich aufzusuchen.«
Wellington Fox griff in die Tasche und brachte ein in Maroquinleder gebundenes Notizbuch zum Vorschein.
»Das ist ein Souvenir an die eine der beiden Damen, die Gräfin di Toresani.«
»Ah? Also ein Andenken an die Herzallerliebste.«
»Falsch geraten, Georg. Die schöne Toresani ist eine Abenteuerin, die Spionendienste für die gelbe Seite leistet.«
»Hast du Beweise dafür?«
»Ja – das heißt erst mal starken Verdacht. Den strikten Beweis hoffe ich in diesem Büchelchen zu finden. Es geriet mir in die Hände, als ich die Toresani aus der schmelzenden Lawine hervorzog.«
Wellington Fox öffnete das kleine Buch.
»Unter diesen harmlosen Notizen hier ist nichts Interessantes. Aber da fand ich hier noch diesen …«
Er blätterte weiter und hielt Isenbrandt die Seite hin. Sie war vollkommen weiß. Nur am Rand, wo offenbar die Nässe gewirkt hatte, traten einzelne Buchstaben hervor. Die äußersten stärker, die innersten nur schwach.
b … r … a … n … d … t … entzifferte Georg Isenbrandt nicht ohne Mühe.
»Und du meinst?«
Er sah Wellington Fox fragend an.
»Ich wette, daß das Wort vollständig Isenbrandt heißt.« »Und was weiter?«
»Daß hier zweifellos noch einige für dich sehr interessante Notizen stehen, dich ich leider nicht lesen kann. Der Teufel mag wissen, mit welcher Tinte das geschrieben ist.«
Georg Isenbrandt hielt das aufgeschlagene Buch zwischen den Händen.
»Mag es geschrieben sein, womit es will. Auf Dynotherm reagiert es. Das dynothermhaltige Schmelzwasser der Lawine hat diese wenigen Buchstaben sichtbar gemacht … Sehen wir weiter …«
Er wandte sich nach dem Laboratoriumstisch und fuhr mit dem Buch über den dort stehenden und immer noch dampfenden Eisblock, bis die beiden Seiten völlig durchfeuchtet waren. Dann kehrte er wieder zu Wellington Fox zurück.
Gespannt waren vier Augen auf das Papier gerichtet. Buchstabe auf Buchstabe trat hervor.
Wellington Fox hatte das Buch ergriffen und las die Worte langsam herunter. Als er geendet, legte er es vorsichtig auf den Tisch und wandte sich zu Isenbrandt.
Einen Augenblick schauten sie sich wortlos an.
»Der Fund hat sich gelohnt, Georg! Über die Absicht der Orenburger Räuber besteht nun kein Zweifel mehr. Es ging um dein Leben.«
»Du hast recht, Fox. Der Fund war gut. Eine Warnung für die Zukunft.«
»Na … siehst du, Georg, ich hatte doch eine glückliche Hand, als ich die starken Prisen auf den Schnee ausstreute.«
»Es ist noch einmal gut gegangen, alter Fox. Trotzdem muß ich dich warnen. Mit dem Dynotherm ist nicht zu spaßen. Was war damals mit dir los? … Irgend etwas anderes? Fox, mein Junge, ich glaube fast, daß dein Herz auch eine Dosis Dynotherm abbekommen hat.
Da es nicht die Gräfin Toresani ist, so muß es logischerweise die kleine Garwin sein, die es dir derart angetan hat … Immerhin … Francis Garwin ist dir großen Dank schuldig …«
»Und da Mr. Garwin niemand etwas schuldig zu sein wünscht, so hat er mir eine Vertragsurkunde zugehen lassen, die mich zum alleinigen Besitzer der Chicago Press macht.«
»Oho …!«
»O ja! Francis Garvin läßt sich nicht lumpen … Aber Wellington Fox auch nicht, denn ich habe ihm seinen Vertrag fein säuberlich ohne Unterschrift zurückgeschickt.«
»Gut gemacht, Fox! Deine Beziehungen zu Francis Garvin werden damit nicht abgebrochen sein … taxiere ich. Ich werde die weitere Entwicklung mit Interesse verfolgen … Willst du mich jetzt auf einem Flug begleiten?«
»Gern, Georg! Aber erst muß ich mich bei dir umkleiden. Der Regen ist durch und durch gegangen.«
Eine Viertelstunde später stieß das schnellste Flugzeug der Station Richtung Nord zu Nordwest durch den strömenden Regen. Nur die beiden Freunde waren an Bord, und Georg Isenbrandt steuerte selbst.
Je weiter sie vorwärtskamen, desto schwächer wurde der Regen, bis er jenseits des Balkaschsees ganz aufhörte. Grüne Felder und Triften zogen unter ihnen hin, während Isenbrandt die Maschine auf die höchste Geschwindigkeit setzte.
Grauer wurde das Grün unter ihnen. Die Zeichen der Trockenheit, ja der Dürre mehrten sich.
Über einer unbesiedelten Steppe ließ Isenbrandt das Flugschiff tief hinabgehen. In einer Höhe von kaum hundert Metern zog er an einem Hebel. Wellington Fox glaubte durch die Scheiben der Kabine eine glitzernde, flockende Masse nach unten fallen zu sehen. Es war ihm, als ob etwas auf die Fläche eines kleinen, beinahe ausgetrockneten Landsees aufschlug. Aber er war seiner Sache nicht sicher. Schon hatte Isenbrandt die Steuerung herumgeworfen und ließ das Fahrzeug in steilen Spiralen steigen.
Wellington Fox hatte den jähen Abstieg und das schnelle Wiederaufsteigen der Maschine mit Verwunderung beobachtet. Jetzt stellte Isenbrandt die automatische Steuerung ein und trat frei in den Raum.
»Was war das? … Was bedeutete das?«
In Erregung stieß Wellington Fox die Frage hervor. Instinktiv spürte er, daß etwas Außergewöhnliches im Gange war.
Isenbrandt trat an die Fenster und wies mit der Hand nach Osten.
»Sieh dort hin!«
Wellington Fox trat neben ihn.
»Ja, was denn? … Nebel … Ich sehe die Kämme des ThianSchan … Im Nebel … Die Wolken strömen hierher … Sie werden immer größer … sie kommen hierher … Immer schneller … Und jetzt … Und jetzt …«
Wellington Fox war in höchster Erregung.
»Georg! Du? Dein Werk ist das?«
Schweigend nickte Isenbrandt.
Waffenklirren … Kommandorufe … Der Schritt kleiner Formationen. Die helle Maisonne bestrahlte das Lager der Compagnietruppen am Nordabhang des Alatau. Von einer Übung im Gebirge kehrten die Truppen zurück.
Die wirtschaftliche Autonomie der Siedlungsgebiete bedingte den Selbstschutz. Im Innern der Gebiete, soweit sie nicht unter russischer Hoheit geblieben waren, durch eine Siedlermiliz. An den Grenzen durch jene Berufstruppe.
Das Flugzeus Isenbrandts landete auf dem Flugplatz des Lagers. Das Compagniewappen, das groß und weithin sichtbar seine Flanken zierte, erlaubte es ihm, die Lagergrenzen zu überfliegen und hier niederzugehen. Auf die Meldung des Wachhabenden am Lagertor erschien ein Adjutant des Generals Effingham, des Oberstkommandierenden der Compagnietruppen. In seiner Begleitung gingen sie zur Wohnung des Generals.
Wellington Fox blieb mit dem Adjutanten auf dem Vorplatz vor dem Haus zurück. Georg Isenbrandt trat ein und traf im Vorzimmer den Obersten von Bülow, der dem Kommandierenden als Stabschef beigegeben war.
Mit herzlichem Händedruck begrüßte Isenbrandt den Offizier.
»Sie wünschen den Herrn General zu sprechen, Herr Isenbrandt?«
Isenbrandt nickte. Der Oberst fuhr fort:
»Schlecht Wetter heute! Er hat sich den Knöchel verrenkt. Können Sie Ihren Besuch nicht verschieben?«
»Nein! Die Sache ist von Wichtigkeit!«
»Na, dann Hals- und Beinbruch! Wollen Sie mir, bitte, folgen.«
Wellington Fox und der Adjutant Averil Lowdale saßen in der warmen Frühlingssonne auf ein paar Feldstühlen vor der Baracke des Generals. Die Unterhaltung der beiden schleppte sich nur mühselig weiter.
Schließlich kam das Gespräch ganz ins Stocken. Wellington Fox betrachtete von der Seite her das verschlossene Gesicht seines Partners. Es verriet ihm noch mancherlei zu dem, was er bereits wußte. Die Affäre Lowdale-Dewey hatte in der Union Wochen hindurch den Gesprächsstoff gebildet. So waren Wellington Fox alle Einzelheiten dieser Affäre natürlich genau bekannt. Aber jetzt erst hatte er Gelegenheit, den Hauptbeteiligten zu sehen.
Averil Lowdale saß immer noch in tiefe Gedanken versunken, während die scharfen Ohren des Journalisten bereits Bruchstücke der Unterhaltung aus dem Generalszimmer auffingen. Dort war der Wortwechsel inzwischen recht lebhaft geworden.
»Zum Teufel mit Ihrer Gespensterseherei! … Das traurige Kirgisenvolk halten unsere Gendarmen in Ordnung …«
»Sie weigern sich also, Herr General, meinem Ersuchen zu willfahren?«
»Selbstverständlich weigere ich mich! … Ich denke gar nicht daran, die Milizen aus den Kolonien zu mobilisieren. Kirgisenaufstände … Humbug … Macht auf mich keinen Eindruck …«
»Dann bitte ich Sie, Herr General, dies hier zu lesen …«
»Was soll das?! … Was? … Vollmacht!? … Den Wünschen des Ingenieurs Isenbrandt ist unbedingt Folge zu leisten …«
Die Stimme des Generals war im Begriff, sich zu überschlagen.
»Ich … Folge leisten …«
Das Gebrüll hatte auch Averil Lowdale aus seiner Apathie aufgerüttelt. Er hielt es für geboten, den Berichterstatter der Chicago Press aus der Hörweite der Unterhaltung herauszubringen. Aber seine Versuche stießen auf außergewöhnliches Nichtverstehen. Wellington Fox lauschte angespannt.
»Wie Sie denken, Herr General! Ich ersuche Sie hiermit, Ihr Kommando an Herrn Oberst Bülow abzugeben!«
»Sind Sie verrückt, Herr?«
»Ich denke nicht! Bitte, hier! Lesen Sie auch diese Vollmacht!«
Averil Lowdale hielt es jetzt für angebracht, seinen Gast mit sanfter Gewalt aus der Reichweite dieses Dialogs zu entfernen.
Georg Isenbrandt sprang aus dem Coupe, als der Zug in den Bahnhof von Kaschgar einfuhr. Mit größtmöglicher Schnelligkeit folgte ihm Wellington Fox. Durch das Gewühl der Passagiere suchten sie den Weg ins Freie.
»Noch einmal, Georg … Es ist ein bodenloser Leichtsinn, daß du dich hier geradewegs in die Höhle des Löwen wagst. Kann ich das nicht allein ebensogut ausrichten?«
»Nein!«
Während Georg Isenbrandt gleichmäßig weiterschritt, traf ein entschlossener Blick den Freund.
»Nein! Ich habe es versprochen.«
Wellington Fox gab es auf, weiter in ihn zu dringen. Aber seine Hand tastete nervös nach der kleinen Waffe in der Rocktasche.
»All right! Georg Isenbrandt am hellichten Tage in den Straßen Kaschgars, am Sitze des chinesischen Generalkommandos … Das Stückchen ist nicht übel.«
Sie durchwanderten Straßen und Gassen und standen vor dem Gartentor des Witthusenschen Hauses. Sie zögerten betroffen, noch ehe sie die Glocke zogen.
Die Vorhänge herabgelassen … Alle Fenster verhängt. Schon von außen ein Bild der Verlassenheit.
Mit einem energischen Ruck riß Fox an der Klingel. Endlich öffnete sich ein Spalt in dem massiven Tor. Das Gesicht des alten chinesischen Boys kam zum Vorschein.
»Herr Witthusen?«
Wellington Fox stellte die Frage, während er gleichzeitig den Fuß in die Türspalte schob und den Flügel so weit zurückdrängte, daß sie eintreten konnten.
»Herr Witthusen ist nicht zu Haus?«
Zum zweitenmal und noch dringlicher fragte Fox.
Der Chinese schüttelte den Kopf.
»Und Fräulein Witthusen?«
Das Gesicht des Gelben sagte mehr als Worte.
Wellington Fox schob sich zwischen Georg Isenbrandt und den Boy. Eine Banknote raschelte in der Faust des Gelben und verschwand schnell in der faltigen Kleidung.
»Wo sind sie hin?« fragte Fox. »Wann sind sie abgereist?«
Der Gelbe krümmte sich verlegen.
»Wohin sie sind, hoher Herr … Hui-Fang weiß es nicht … Vorgestern abend kam ein Auto vorgefahren. Zwei Offiziere stiegen aus und gingen zu dem Herrn … Und dann kamen sie wieder heraus … Mit ihnen der Herr und Fräulein Maria Feodorowna und … stiegen zusammen in das Auto und fuhren fort.«
»Wohin sind sie?«
Georg Isenbrandt hatte Fox beiseite geschoben und stand vor dem Chinesen.
»Wohin? … Bei den Geistern deiner Ahnen!«
Das gelbe Gesicht wurde grau. Der Boy sank in die Knie und hob beschwörend die Hände.
»Ich weiß es … nicht … hoher Herr! Ich weiß es nicht.«
Wellington Fox fragte: »Hat der Herr etwas hinterlassen? … Befehle?«
»Nein! Nichts …« Nach einer Weile kam es zögernd von den Lippen des Gelben. »Gestern war Mr. Cameron hier. Der sagte, der Herr ist verreist und kommt vorläufig nicht wieder. Mr. Cameron hat alles verschlossen … hat alle Schlüssel mit sich genommen …«
Als der Name »Cameron« fiel, zuckte Wellington Fox zusammen.
»Ist Mr. Cameron noch in Kaschgar?«
»Ich weiß nicht … Ich glaube …«
Georg Isenbrandt fuhr dazwischen. Mit der Rechten hatte er das Gewand des Gelben an der Brust gepackt und schüttelte ihn.
»Wo ist Mr. Cameron?«
»In Peking.«
Mit jähem Ruck schob Georg Isenbrandt den Boy weg.
»Komm, Fox, wir haben hier nichts mehr zu tun!«
Fast mechanisch schlugen sie den Weg zum Bahnhof ein. Minuten hindurch gingen sie stumm nebeneinander her. Dann brach Wellington Fox das Schweigen.
»Also nach Peking!«
»Wer?«
»Ich! … Mit dem nächsten Postschiff! Colin Cameron ist jetzt ein doppeltes Jagdobjekt für mich. Ich werde ihn finden … und ihm das Handwerk legen.«
»Fox … du guter Freund … du wirst mir Nachricht geben … auch von der kleinsten Spur.«
Einen Moment standen sie sich Hand in Hand gegenüber.
»Frisch auf, Georg!«
»Halt! Noch eins!«
Georg Isenbrandt griff in seine Tasche und holte eine kleine Glasröhre hervor.
»Du kommst nach Peking. Du wirst morgen früh dort sein. Um die Mittagsstunde wirf dies hier von irgendeiner Brücke ins Wasser!«
Wellington Fox ließ das Röhrchen in die Tasche gleiten.
»Noch etwas?«
»Ja! Bevor du es wirfst, mußt du den Korken öffnen. Aber auch keine Sekunde früher.«
»All right, Georg!«
»Der Himmel hat seinem erlauchten Sohn die Gesundheit wiedergegeben. Schitsu, der Hwangti, der Herr und Kaiser, kehrt in seine Residenz zurück.«
Seit 24 Stunden hielt diese Nachricht die Bewohner Pekings in Atem. Seit den frühen Morgenstunden begannen die Volksmassen aus dem Stadtinnern hinauszuströmen und die Straße zu umlagern, die von Schehol nach Peking führt.
Um die zwölfte Stunde marschierten von Peking her die Garden des Schanti heran. Nach Ausbildung und Ausrüstung Elitetruppen. Die anmarschierenden Regimenter schwenkten nach rechts und links gegen die Straßenränder aus, drängten die Menge über die Gräben zu beiden Seiten zurück und bildeten einen zusammenhängenden Kordon.
Die Straße war jetzt hermetisch abgesperrt. Die Menge, zur Seite gedrängt, breitete sich über die Felder aus und suchte erhöhte Punkte, von denen aus über die Köpfe der absperrenden Garden hinweg möglichst viel von dem kommenden Schauspiel zu sehen sein mußte.
Auf einer kleinen Erhöhung hatte Wellington Fox seinen Platz gefunden. Dort stand er, wartete und sah, wie plötzlich Bewegung in die Menge kam.
Der Wagen des Kaisers kam. Eine der alten, schwervergoldeten Staatskarossen mit großen Glasscheiben. Von acht Pferden gezogen.
Der Kaiser aufrecht auf dem Rücksitz, allein im Wagen. Wellington Fox verschlang das Bild mit den Augen. Als der Wagen die Straße gerade vor ihm passierte, konnte er seine Neugierde nicht länger meistern und brachte sein scharfes Perspektiv an die Augen. In greifbarer Nähe erblickte er jetzt die markanten Züge des Kaisers. Doch nur für einen kurzen Augenblick.
Er fühlte, wie seine Füße plötzlich nach hinten gerissen wurden. Unsanft schlug er zu Boden. Wütend blickte er um sich und sah in eine Reihe von Augen, aus denen drohender Haß blitzte.
Beim Nahen des kaiserlichen Wagens hatte sich alles Volk, dem alten Brauch folgend, auf die Knie geworfen. Er allein hatte in seiner Erregung nicht darauf geachtet und war stehengeblieben.
Es glückte ihm, von dem Haufen loszukommen. Auf einem Richtweg zwischen bebauten Feldern und Wiesen strebte er wieder der Stadt zu. Und während er dahinschritt, jagten sich die Gedanken in seinem Gehirn.
Wie war das möglich? … Wie konnte das sein? … Hatte ihm nicht Isenbrandt auf das bestimmteste versichert, daß die Tage des Kaisers gezählt seien?
Und was hatte er eben gesehen?
Was hatte er gesehen? … Einen Mann in militärischer Kleidung in der großen Staatskarosse … Der Kaiser? … Der Kaiser!
Wie schauten die Augen des Mannes? … So starr … so ernst … so tot?
Aber hatte er sich nicht bewegt? Hatte er die Grüße des ihm huldigenden Volkes nicht erwidert?
Der Weg führte Fox an einer Telegraphenstation vorbei. Einen Augenblick zögerte er. Bericht an die Chicago Press geben? … Nein! … Nichts!
Fest entschlossen schritt er weiter der Stadt zu. Seine Gedanken konzentrierten sich auf die Person, derentwegen er hierhergekommen war. Collin Cameron!
Ein Blitzen in der Ferne erinnerte ihn an Isenbrandts Auftrag. Da blinkte über die Felder her in den hellen Strahlen der Maiensonne der Spiegel eines kleinen Weihers. Wellington Fox schlug einen Seitenpfad ein und schritt darauf zu. Die Gelegenheit war günstig. Weit und breit kein Mensch zu sehen.
Er rief sich die Vorschrift Isenbrandts ins Gedächtnis. Dann griff er in die Brusttasche. Ein kurzer Ruck, und der Pfropfen war entfernt. In weitem Bogen flog die Tube in das Wasser. Wellington Fox wandte sich um und ging mit schnellen Schritten der Stadt zu. Mochte Georg Isenbrandt da für die Bewohner Pekings zusammengebraut haben, was er wollte, es war jedenfalls nicht angebracht, daß irgend jemand hier Wellington Fox bei der Ausführung dieses Auftrages beobachtete.
Er gelangte in die Stadt zurück. In einer Teestube, gegenüber dem Hotel, in dem Collin Cameron abgestiegen war, nahm er an einem Fenster Platz. Der, auf dessen Kommen er hier lauerte, saß indessen im Palast des Regenten dem Schanti gegenüber.
»Das Wunder, das an dem Sohn des Himmels geschah, war unfaßbar groß … so groß, daß es niemand glauben kann, der es nicht gesehen hat.«
»Sie sahen den Kaiser?«
»Nein, Hoheit. Ich wartete hier im Palast.«
Ein leichtes, kaum merkbares Lächeln glitt während der Antwort über Collin Camerons Züge.
»Sie werden noch heute nach den Vereinigten Staaten fahren! Es ist der Wille unseres Herrn, dem die Götter so wunderbar die Gesundheit wiedergeschenkt haben. Am 6. Juli, das heißt an dem Tag nach der Wahl Josua Bordens, sollen die Pläne der höchsten Weisheit zur Ausführung kommen.«
Collin Cameron sah den Regenten erstaunt an. »Und wenn die Wahl nicht am 5. Juli stattfindet?«
»Auch dann!«
Mit einem Ruck war Collin Cameron aufgestanden.
»Auch dann?«
Der Regent nickte.
»Die Wahl soll am fünften stattfinden … Es wäre gut, wenn es geschähe. Doch es könnte sein, daß die Wahl verschoben wird … Das Geheimnis scheint nicht gut gewahrt worden zu sein … Es wäre möglich, daß man einen Strich durch alle Pläne macht, indem man die Gouverneurswahl verschiebt. Ein solcher Aufschub würde die Absichten des großen Herrn stören. Ihre Aufgabe ist es, dahin zu wirken, daß die schwarze Bewegung unter allen Umständen am sechsten losbricht!«
»Hoheit! Die schwarzen Führer dahin zu bringen, ist unmöglich!«
»Dann ist es Ihre Aufgabe, die Bewegung auch ohne die Führer zum Ausbruch zu bringen. Das ›Wie‹ ist Ihre Sache. Mittel aller Art stehen zur Verfügung.«
Collin Cameron starrte stumm vor sich hin. Der Schanti sprach weiter: »Sie werden die Aufgabe annehmen … und vollbringen!«
Noch immer schwieg Collin Cameron. Erst nach einer geraumen Weile erhob er sich.
»Der schwerste Auftrag, den mir Eure Hoheit je gegeben. Ich übernehme ihn.«
Collin Cameron verließ den Raum. Im Vorzimmer fiel ihm das verstörte Gesicht eines Adjutanten auf, der sich dem Zimmer des Regenten näherte.
Ein Klopfen an der Tür ließ diesen aufschrecken.
»Was ist?«
Sein persönlicher Adjutant stand vor ihm. Das Gesicht war verstört, seine Augen blickten irre.
Noch einmal rief der Schanti: »Was ist?!«
»Es ist Winter geworden, Hoheit!«
Der Adjutant deutete nach den durch schwere Seidenvorhänge verhüllten Fenstern. Mit einem Ruck sprang der Regent auf und riß die Vorhänge auseinander. Ein schweres, dichtes Schneetreiben verdunkelte die Luft.
War das Natur? … Menschenwerk? … Dann …
Er wollte es schreien, als sein Blick auf den Adjutanten fiel, der stumm dastand. Im Augenblick hatte er sich wieder in der Gewalt.
»Was willst du? … Hast du noch keinen Schnee gesehen? … Fürchtest du dich vor Schneeflocken? … Geh!«
In einer Baumlaube des Garvinparks in Frisko saß Wellington Fox. Die Sonne war längst untergegangen. Vom Ozean her wehte eine kühle Brise. Fröstelnd schlug Fox den Kragen seines Jacketts in die Höhe.
»… Daß ich hier seit einer geschlagenen Stunde sitze und geduldig auf das Kommen eines kleinen Mädchens warte, hätte ich mir vor ein paar Monaten nicht träumen lassen …«
Ein leises Knirschen des Kiesweges ließ ihn aus seinem Träumen aufschrecken. Schnell warf er die Zigarre auf den Boden und trat mit der Schuhsohle darauf. Im nächsten Augenblick stand Helen Garwin vor der Laube. Sie schrie leise auf, als sie sich plötzlich an der Hand ergriffen fühlte und mit sanfter Gewalt in das Dunkel der Laube gezogen wurde.
»Komm, Helen. Das dichte Blätterdach schützt uns vor allen Späherblicken.«
Im Nu hatten starke Arme Helens Schulter umfaßt und eine Flut von Küssen verschloß ihren Mund …
»Jetzt ist es aber genug.« Atemlos klang die Stimme dicht an Wellingtons Ohr. Sie entwand sich Wellingtons Armen und begann, ihr verwirrtes Haar in Ordnung zu bringen.
»Schämen Sie sich, Sie schrecklicher Mensch.«
»Wann wollen wir nun heiraten?« war Wellingtons ganze Antwort.
»Heiraten? … Wir … heiraten?«
Helen trat entrüstet auf Fox zu, der sich auf der Bank niedergelassen hatte und mit einer Handbewegung Helen einlud, neben ihm Platz zu nehmen.
»Erstens will ich gar nicht heiraten … und zweitens nicht einen Mann wie Sie, den allerunhöflichsten Menschen, den ich je kennengelernt habe. Alle anderen Männer sind höflich und zuvorkommend zu mir. Besonders die, die mir Heiratsanträge gemacht haben.«
»Wenn du mich nicht heiraten willst, kleine Helen, warum hast du dich dann mit mir verlobt?«
»Verlobt?«
»Gewiß, Helen! Eine wohlerzogene junge Dame küßt keinen Mann, wenn sie nicht mit ihm verlobt ist. Und ist sie verlobt, muß sie ihn doch schließlich heiraten … klar?«
Einen Augenblick stand Helen wortlos.
»Ja … ja, das mag schon richtig sein. Aber wenn nun mein Vater nicht damit einverstanden ist, eine Abneigung gegen Sie hat und gar nicht mit sich reden läßt?
Ich bin deshalb heute zum letztenmal hierhergekommen … und will Ihnen sagen …«
»Daß du morgen abend um dieselbe Zeit hierher …«
»Herr Fox! Ich gehe jetzt und komme nicht wieder!«
»Gut!«
»Sie dürfen mir auch nicht mehr schreiben.«
»Gut!«
»Sie dürfen mich auch nicht so ansehen.«
»Gut … Noch etwas?«
»Nein!«
Helen raffte ihr Kleid zusammen und schickte sich an zu gehen.
Am Ausgang der Laube drehte sie sich nochmals um. »Adieu, Sie Ungeheuer … Sie, Sie …«
Mit drei Schritten stand sie vor Wellington Fox und hielt ihm die kleine geballte Faust vors Gesicht. Da fühlte sie sich plötzlich neben Fox sitzen und sein Mund verschloß den ihren. Erst nach geraumer Weile klang die Stimme Wellingtons wieder:
»Glaubst du wirklich, meine liebe kleine Helen, Wellington Fox ließe sich das Glück seines Lebens entgehen, weil ein alter, harter Mann ihn seines schmalen Beutels halber nicht für würdig hält? Ihn und alle seine Schätze mag der Teufel …«
»Wellington, es ist mein Vater.«
»Leider, Helen! Doch Geduld. Wir wollen sehen, wessen Schädel auf die Dauer der härtere ist.«
»Ach Wellington, du hoffst ihn zu zwingen? Dann werde ich nie im Leben die Deine werden.«
Tränen erstickten Helens Stimme. Weinend barg sie ihr Gesicht an Wellingtons Brust.
»Geduld, Geduld, kleine Helen! Ich weiß, wie man Leute vom Schlage deines Vaters auf seine Seite zwingt. Man muß etwas tun, was ihnen imponiert, was ihnen Respekt beibringt.
Noch einige Wochen. Dann ist die Saat reif, dann …« »Du sprichst so geheimnisvoll, Wellington, was meinst du?« »Nichts, kleine Helen. Doch noch eins, Liebste. Es könnte sein, daß ich morgen auf ein paar Tage verreisen müßte. Wünsche mit mir, daß diese Reise guten Erfolg hat. Sie wird uns auch unserem Glück näherbringen. Am Balkaschsee treffen wir uns bestimmt wieder.«
Es war eine kleine, gut bürgerliche Teestube, die Tschung Fu in der Chinatown von Frisko hielt.
Aber diese solide Teestube war nur der Vorhang vor schlimmeren Dingen. Die gelben und weißen Gäste Tschung Fus konsumierten nicht nur den duftigen Trank der Pekkoblüte. Sie huldigten auch dem Genuß des Opiums. Diesem Zweck diente der hintere Raum des Teehauses.
Es war um die dritte Nachmittagsstunde. Schon hatte das Lokal Tschung Fus reichlichen Zuspruch gehabt. Alle Nischen des hinteren Raumes waren belegt, alle Polster und Kissen im Raum selbst besetzt. Gelbe und auch einzelne Weiße lagen hier. Die meisten bereits im tiefen Rausch.
Jetzt begleitete der Wirt dienernd und kriechend Collin Cameron und dessen Begleiter, ein gelbschwarzes Halbblut, in den Raum.
»Es tut mir sehr leid, Mr. Cameron … alle Kojen sind besetzt …«
Collin Cameron blieb zögernd mitten im Raum stehen. Sein Blick glitt über die Gäste, die hier als die willenlosen Sklaven einer Droge auf den Kissen lagen.
»Verdammtes Pack!«
Er machte eine Bewegung, als ob er den nächsten mit einem Fußtritt von seinem Lager hinabschleudern wolle.
Der Wirt deutete einladend auf einen unbesetzten Tisch in der Mitte des Raumes. Collin Cameron fragte: »Wer ist hier?«
»Nur alte Bekannte! Sie schlafen alle. Man könnte sie hinaustragen, ohne daß sie es merken.«
Noch einmal ein kurzes Überlegen. Dann ließ sich Collin Cameron an dem Mitteltisch nieder und lud seinen Begleiter durch eine Handbewegung ein, das gleiche zu tun. Der Wirt brachte ihnen selbst den frischen Tee. Dann zog er sich zurück.
Collin Cameron eröffnete die Unterhaltung.
»Was Neues?«
»Nein, Mr. Cameron. Sie haben die letzten Artikel in meinem Blatt gelesen. Waren sie nicht gut?«
»Sie waren gut. Aber von nun ab muß ein anderer Ton angeschlagen werden.«
»Noch schärfer? Vergessen Sie nicht, daß mein Blatt schon jetzt in Gefahr stand, verboten zu werden.«
»Die Wahl Josua Bordens ist verschoben!«
»Verschoben! Warum? … Ein böses Zeichen … Verrat?«
»Es kann nicht anders sein.«
»Was nun?«
»Das frage ich Sie.«
»Dann muß eben alles andere auch verschoben werden.«
»Ausgeschlossen!«
Der andere pfiff leise durch die Zähne und kniff die Schlitzaugen noch enger zusammen.
»Unsere Führer werden nicht mitmachen.«
»Dann werden andere die Führer sein! Einer davon Sie!«
Der andere sank in seinen Sessel zurück.
»Es wird nicht gehen, Mr. Cameron. Die Massen werden uns nicht folgen.«
»Zugegeben! Die große Masse der Schwarzen nicht … das heißt nicht sogleich … Aber sind Sie der Hafenarbeiter sicher?«
Ein übles Grinsen ließ die Züge des schwarzgelben Halbblutes noch abstoßender erscheinen.
»Mit genügend … so etwas …«, seine Hände machten die Bewegung des Geldzählens, »und dem nötigen Whisky … Ja!« »Wie steht’s mit den Mortonwerken?«
»Das kann ich nicht sagen. Aber der Führer ist empfänglich für …« Wieder vollführten die Finger des Sprechenden die Bewegung des Geldzählens.
»Ich werde mit ihm reden. Wie steht’s mit der schwarzen Universität? Ihre Organisation ist die beste. Ihr Beispiel würde große Wirkung haben.«
»Die jungen Hitzköpfe müßten sich bei zweckmäßigerer Behandlung wohl gebrauchen lassen … Ein geschickt inszenierter Streit mit den weißen Studenten … Alles im richtigen Moment … Das dürfte genügen.«
»All right! Die Arbeit in Frisko lege ich in Ihre Hände.«
Collin Cameron zog ein Scheckbuch heraus und reichte es seinem Gegenüber.
»Wie hoch?«
»In jeder Höhe!«
Das Grinsen auf den Zügen des anderen verbreiterte sich. Seine Finger umklammerten das Buch.
»Ich fahre heute nacht nach Louisiana, um dort weiterzuarbeiten.«
Ein Nicken des anderen. Noch einmal ließ Collin Cameron einen Blick über den Raum und seine Insassen gleiten. Dann schritt er mit seinem Partner dem Ausgang zu. Ihre Schritte verklangen auf dem Flur.
Plötzlich blieb Collin Cameron stehen und schlich leise wieder dem eben verlassenen Raum zu. Mit unendlicher Vorsicht schob er den Vorhang um wenige Millimeter zur Seite, daß sein Auge eben den Raum überblicken konnte. Alles war noch genau so, wie er es verlassen hatte. Als er sich umdrehte, stand der gelbe Wirt katzbuckelnd vor ihm.
»Alles in Ordnung, Mr. Cameron. Die Toten haben keine tauberen Ohren als meine Gäste.«
Während Collin Cameron dem Ausgang zuschritt, kehrte der Wirt in das Gemach zurück. Sein Auge blieb an einem Weißen hängen, der in tiefem Schlaf der Wand zugekehrt dalag.
»Du Sohn eines Schakals … Deinethalben hat Tschung Fu eine böse Stunde gehabt. Du bist ja keiner von meinen Stammgästen, für die ich mich verbürgt habe … Du sollst es mir bezahlen.«
Unhörbar schlich er auf seinen Filzsohlen auf den Schläfer zu. Prüfend glitten seine Hände über die Kleidung des Daliegenden und tasteten nach der Gegend der Brieftasche.
Von einem Faustschlag getroffen, flog er bis in die Mitte des Raumes zurück.
»Du Schurke, bezahlt bist du schon im voraus!«
Es war Wellington Fox, der von dem Diwan aufsprang. Doch bevor der Berichterstatter der Chicago Press den Ausgang erreichen konnte, hatte sich der Wirt aufgerafft. Schon war der Wirt draußen und ließ einen gellenden Pfiff ertönen.
Wellington Fox stürmte ihm nach. Aber es war nicht der Gang nach der vorderen Teestube, sondern ein anderer, ein viel längerer und winkliger Gang, in den er geriet und durch den er bis auf den Hof gelangte. Hier sah er sich plötzlich von allen Seiten umringt.
Wellington Fox war in einer Falle. Von allen Seiten schlossen steile Wände den Hof ein. Nur an einer Stelle führte an der Wand des Nebenhauses eine schmale Stiege empor. Er stürmte sie hinan und landete atemlos auf dem flachen Dach des Nachbarhauses. Chinesische Wäscher betrieben hier ihr Gewerbe.
Einen Augenblick blieb er schnaufend stehen und blickte sich orientierend um. Der Anblick eines gelben Kopfes, der sich über die Dachkante schob, mahnte ihn an seine Gegner. Vor einem plötzlichen Fußtritt wich dieser Kopf zurück. Aber ein Blick über den Dachrand belehrte Wellington Fox, daß die Stiege bis hinauf zum Dach bereits dicht mit Gelben besetzt war.
Suchend sah er sich nach einer geeigneten Waffe um. Sein Blick fiel auf den zur Hälfte mit Wasser gefüllten Waschzuber.
In der nächsten Sekunde hatte er jene zweite Dynothermtube Isenbrandts herausgerissen und in den Zuber ausgeschüttet. So schnell wie möglich zerrte er den Zuber über das Dach bis zur Stiege hin. Schon stiegen gewaltige Dampfwolken aus dem Bottich, schon trafen einige Spritzer des siedenden Wassers seine Hände und verursachten große Brandblasen.
Dann war es geglückt … Der Inhalt des Bottichs über die Stiege hinabgegossen.
Schreie des Entsetzens belehrten ihn, wie das Dynotherm gewirkt hatte. Schon war der ganze Hofraum in seiner Tiefe ein einziges wogendes Dampfmeer. Schon strömten die Dampfwolken weiter empor zur doppelten und dreifachen Höhe des Hauses, während dort unten das letzte Wimmern erstarb. Schon mischte sich brenzliger Qualm in den Wasserdampf. Schon zuckte es feurigrot aus den wogenden weißgrauen Massen.
Das Haus, auf dessen Dach Wellington Fox stand, war nicht allzu hoch. Mit schnellen Griffen hatte er die Wäscheleine gelöst und um einen Pfosten an der Vorderseite des Hauses geschlungen. Schnell glitt er an ihr auf die Straße hinab.
Er sah sich um. Ein kleines, ihm unbekanntes Seitengäßchen. Aufs Geratewohl lief er darin entlang und erreichte die Hauptstraße. Noch ein Blick rückwärts. Feuerlohe schlug zum Himmel, wo das Teehaus gestanden hatte.
Langsam glitt das Schiff Isenbrandts flußabwärts der Mündung des Ili zu. Schon zogen sich die mächtigen Schilfhorste zu beiden Seiten des Stromes weit auseinander, und unmerklich vermischten sich die Wellen des Ili mit den Wassern des Balkaschsees.
Kreischend stiegen ganze Schwärme von Wasservögeln empor, die der Kurs des Schiffes in ihrer Abendruhe störte.
Georg Isenbrandt lehnte sich in seinen Sessel zurück. Noch trug er den Gesellschaftsanzug, in dem er den ganzen Tag hindurch die offiziellen Empfänge der zahllosen Gäste aus allen Weltteilen mitgemacht hatte. Seine Miene verriet Ermüdung und zeigte, daß die Anstrengung dieser Feierlichkeiten selbst für seine eisernen Nerven recht reichlich gewesen waren.
So war er gern dem Vorschlag von Wellington Fox gefolgt, eine Abendfahrt von Wierny zum Balkaschsee zu unternehmen, um hier wieder Stärkung für die Strapazen des kommenden Tages zu finden. Denn die heutigen Empfänge waren ja nur der Auftakt für die großen Feierlichkeiten des morgigen Tages.
Von morgen an sollte der große Balkaschsee ein neues wichtiges Glied in der Kette der Unternehmungen der E.S.C. werden. Der Plan ging dahin, die vielen hundert Milliarden Kubikmeter Wasser, die hier die Schale des Sees füllten, als fruchtbaren Regen nach Norden und Nordosten zu senden. In seiner ganzen Größe konnte er nicht ausgeführt werden, solange dem See die verstärkten Zuflüsse aus dem chinesischen Gebiet fehlten, dem Ilidreieck.
»Deine Einrichtung mit diesen Mückennetzen ist zweifellos ohne Tadel, Georg. Sieh nur, wie die Fenster schon davon bedeckt sind … Eine ganze Schicht … Ja … das heißt … auf diese Weise sehe ich ja nichts mehr … und um zu sehen bin ich doch hierhergekommen.
Heute nacht noch muß mein erster Bericht nach Chikago gehen. Die Manuskripte der Reden hast du mir ja schon zur Verfügung gestellt.«
»Hast du eskamotiert, mein Lieber«, warf Isenbrandt trocken ein.
»Fehlt mir nur noch die Kenntnis der Stätten, an denen sich alles abspielen wird … Aber by Jove, es ist wirklich kaum noch was zu sehen. Hol der Teufel die Mückenbrut!«
Isenbrandt griff nach einem Schalter und sprach von seinem Platz aus ein paar Worte. Fast im gleichen Moment hob sich das Schiff leicht von den Fluten ab. Während das Wasser noch von seinem Kiel tropfte, reckte es zwei weite Schwingen aus und strich wie ein gewaltiger Nachtvogel über die Seefläche. Schnell verjagte der frische Fahrwind die unwillkommenen Gäste. In freiem Ausblick konnte Wellington Fox den See und seine südlichen Ufer überschauen.
»Ein wunderbares Bild, Georg. Wie schade, daß das alles verschwinden muß! Schon morgen werden Nebel und Dämpfe verhüllen … Doch eins, Georg. Was ich bei unserer letzten Fahrt in der Steppe erlebte … Was ich in Peking sah … ist danach das alles hier noch notwendig?«
»Ich habe dich einen tiefen Blick in meine Karten tun lassen, alter Fox, weil ich deine Verschwiegenheit kenne … Deine Frage ist an sich berechtigt. Doch andere Gründe spielen mit, bewegen mich, das geschehen zu lassen, was morgen geschieht.«
Während Georg Isenbrandt sprach, schien alle Abspannung von ihm zu weichen. Er erhob sich und schritt in der Kabine hin und her.
»Das Programm für den morgigen Tag wurde früher erdacht als das, was du gesehen. Das Programm aufzugeben, wäre in doppelter Hinsicht verkehrt. So gut kommt die Gelegenheit nie wieder, die Augen des Mutterlandes Europa auf uns zu richten, die wir hier im Fernen Osten als Pioniere kämpfen. Gerade hier sollen die Herren Diplomaten sehen, wie wichtig die Ilifrage für uns ist. Und dann … mein letzter Trumpf muß bis zum letzten in meiner Hand bleiben. Ist der einmal ausgespielt, dann mag auch der See sein altes Aussehen wiedergewinnen!«
Während Georg Isenbrandt sprach, ging das Schiff wieder bis auf den Seespiegel hinab. In langsamer Fahrt näherte es sich einem gewaltigen, bojenartigen Körper, dessen massiger Rumpf sich silbergrau von den Fluten abhob.
Unheimlich wirkte der riesige Metallkörper an dieser Stelle. Wellington Fox sprach zuerst.
»Also hier schwimmt der Mörder des Sees.« Schon hatte er den photographischen Apparat gerichtet. Eine Leuchtkugel entschwebte seiner Hand, stieg empor und badete die Landschaft für den tausendsten Teil einer Sekunde in einer Überfülle ultravioletten Lichtes.
»Auch eskamotiert, mein lieber Georg! Nun weiter, zu der Strandkanzel hin, von der sie morgen die Leichenreden halten werden.«
Georg Isenbrandt lachte. »Deine Presse wird hier besser von dir bedient als damals in Peking. Übrigens, unter den Gästen ist auch Mr. Francis Garvin.«
»Nebst Tochter!«
»Ah, du weißt schon, schlauer Fuchs?«
»Verabredetermaßen.«
»Mit ihm oder der Tochter?«
»Wo denkst du hin. Der Alte verhält sich ablehnend.«
»Armer Fox!«
»Keine Bange um mich, Georg! Mit dem Alten werde ich fertig. Aber du? Hast du Nachricht über Maria?«
Die Züge Isenbrandts verfinsterten sich. Schweigend schüttelte er den Kopf.
Am steilen, schilffreien Südufer des Sees erhob sich, von mächtigen, blumengeschmückten Tribünen umflankt, die Kanzel für den Festtag. Die Flaggen aller europäischen Staaten und die Embleme der E.S.C. zierten den hochragenden Balkenbau.
Den größten Teil der Besucher stellten die Siedler aus den Kolonien der E. S. C. Zu Tausenden umbrandeten sie die Tribüne.
Weiter zurück Massen der alten Herren des Landes, der Kirgisen. Die Neugier trieb sie wohl hierher, doch ihre finsteren Gesichter verrieten, daß sie wenig Freude an dieser Feier hatten.
Um die elfte Stunde bestieg der Präsident der E.S.C. die Kanzel. Zehntausende lauschten aufmerksam seiner Rede.
In kurzen, knappen Worten schilderte er die Arbeiten der Gesellschaft von ihren Anfängen am Aralsee bis zur Mauer des Thian-Schan. Er sprach auch von den vielen Schwierigkeiten, die Himmel und Erde, Wasser und Luft, Zeiten und Winde und nicht zuletzt die Menschen selbst dem Werke bereitet hätten. Er betonte den friedlichen Zweck der Arbeiten. Wie sie bestimmt seien, allen, auch den früheren Bewohnern dieser ehemaligen Wüsten, nur Nutzen zu bringen.
Doch gar mancher Kopf unter den Zuhörern wandte sich der Diplomatentribüne zu, auf der die Vertretungen der asiatischen Nationen ihren Platz hatten, als er fortfuhr:
»Wenn dies Ziel heute noch nicht voll erreicht ist, so bedauern wir das. Unverstand und Mißtrauen haben in Verkennung unserer Absichten manchmal die friedliche Entwicklung unserer Arbeiten gestört. Und« – hier wandte er sich zu den Vertretern der Kolonien – »und oft werden eure Augen mit Bangen nach Sonnenaufgang geblickt haben. Heute kann ich euch sagen, daß die Mutter, die euch aus ihren Armen entlassen hat, stets hilfsbereit hinter euch steht.«
Seine weiteren Sätze gingen unter in dem tosenden Jubel und den brausenden Beifallsstürmen, die bei diesen Worten in allen Sprachen Europas aus den Kehlen der Kolonisten drangen.
Der Beifallssturm mochte dem Redner wohl etwas überraschend kommen. Um die Spitze, die unverkennbar darin enthalten war, abzubrechen, schritt er zum Taster, der die Funkenstation auf der Tribüne betätigte.
Ein kurzer Druck seiner Hand auf die Tasten … ein Rad begann sich schnurrend zu drehen. Auf Ätherwellen flog die Sprengdepesche über den See hin.
Von Menschen verlassen, unbemannt, lag dort die Riesenboje. Aber in ihrer Antenne fingen sich die Zeichen der Depesche. Exakt arbeiteten ihre Relaiswerke und begannen ihrerseits zu schalten und zu wirken.
Noch tobte der Jubel der großen Masse. Schon aber richteten die Tribünenbesucher, welche die Bewegung des Präsidenten aus nächster Nähe gesehen und richtig gedeutet hatten, ihre Gläser auf die weite Seefläche.
Die Riesenboje, eben noch durch scharfe Gläser deutlich sichtbar, war verschwunden, spurlos in die Tiefe versunken.
Aber rot leuchtete es aus dieser Tiefe.
Dann kam die Wirkung.
Unter Donnern und Krachen stieg aus dem See ein riesiger Geiser in die Höhe. Aber ein Geiser, dessen Wasser nicht wieder in die Tiefe zurückfielen, sondern frei in der Luft kochten und zu Dampf versprühten.
Schon wurde aus dem Geiser ein anderes Gebilde, das an den Ausbruch eines Vulkans erinnerte. Wie eine gigantische Dampfpinie stand es auf der Seefläche, ein enormer Stamm, dessen Äste sich in Wolkenform ausbreiteten.
Und dann … beinahe so pünktlich, als ob es auch auf dem Programm gestanden hätte, begann ein frischer Südostwind zu wehen. In immer schärferem Zuge jagten die Luftmengen über den See. Sie packten den phantastischen Dampfbaum und zerbrachen seinen Stamm. Sie ergriffen seine Zweige und trugen sie als regenschwangere, fruchtbringende Wolken in nordwestlicher Richtung von dannen, wo das durstende junge Siedlungsland seit Wochen auf das kostbare Naß wartete.
Dann lenkten die Klänge militärischer Märsche die Aufmerksamkeit der Massen nach einer anderen Richtung. Auf einer großen, freien Fläche am Südufer des Sees begann die Parade der Compagnietruppen.
Alles, was auch nur irgendwo innerhalb der weiten Siedlungsgebiete von Streitkräften der Compagnie entbehrlich war, hatten die großen Transportflieger hierhin zusammengebracht. Diese Parade sollte denen, die es anging, auch zeigen, daß die E.S.C. über schlagkräftige Mittel verfügte, um das Ihre zu wahren.
Die Fußtruppen eröffneten die Parade. Ihre Ausrüstung war gleichmäßig für die Ebene und die Hochalpen geeignet. Im Ernstfall verwandelte sich jeder einzelne dieser ausgesuchten Leute in eine Kampfmaschine, von deren Furchtbarkeit sich nur wenige ein Bild machen konnten. Ein Heer des vorigen Jahrhunderts hätte diesen Truppen etwa gegenübergestanden wie ein Haufe nackter Kannibalen einer Panzertruppe.
Die Artillerie, die nun folgte, zeigte auch äußerlich die große Veränderung gegenüber vergangenen Zeiten. Die Rohre mit ihren Lafetten wurden hier von kleinen Dynothermtraktoren gezogen. Aber es hätte nur eines kurzen Kommandos und einiger weniger Griffe der Bedienungsmannschaften benötigt, und jede dieser unscheinbaren Zugmaschinen reckte Schwingen aus und erhob sich in die Lüfte, ihr Geschütz unter sich.
Es gab weder in der Ebene noch im Hochgebirge eine Stellung, die nicht schnellstens von dieser Artillerie besetzt werden konnte. Eigentliche technische Truppen hatte die Compagnie nicht. Jeder ihrer Soldaten war in allen Sätteln der Kriegstechnik gerecht.
Während die Regimenter und Batterien vorüberzogen, die Musikkapellen ihre Märsche schmetterten, lagen die Schiffe der Luftflotte, die sie gebracht hatten, in weitem Bogen auf dem anschließenden Blachfeld. Als der letzte Mann der Truppenparade vorübergezogen war, ging ein Ruck durch die Flotte. Alle Flugschiffe erhoben sich vom Boden und zogen zunächst in geschlossenen Reihen über das Paradefeld.
Auf ein neues Kommando teilte sich der Schwarm in zwei Parteien, die sich voneinander entfernten. In rasendem Flug schossen sie dann wieder gegeneinander. So unvermeidlich schien der Zusammenstoß, daß manchem der Zuschauer der Herzschlag stockte. Doch im letzten Moment wichen die schwergepanzerten Luftkreuzer elegant und sicher dem Zusammenstoß aus und eröffneten gleichzeitig aus allen Rohren das Feuer.
Während noch das Scheingefecht in der Luft tobte, hatten die Truppen in einer eigentümlichen, schachbrettartigen Aufstellung das Paradefeld besetzt.
Ein neues Manöver! Die Luftflotte ordnete sich in neuen Formationen, ähnlich der Truppenaufstellung auf dem Felde. Ein neues Kommando, und die Schiffe gingen senkrecht nach unten. Schon stand neben jedem Truppenkörper ein Schiff.
Wieder Kommandos! Im Augenblick waren die Truppen in den Kreuzern verschwunden. Schon erhob sich der Schwarm wieder und trug die Streitkräfte der Compagnie in schnellem Flug zu ihren verschiedenen Stationen zurück.
Der Höhepunkt der Festlichkeiten war überschritten. Eine Reihe von rauschenden Tagen, während der kochende See unaufhörlich unendliche Wolkenmengen nach Nordosten entsandte.
Die offiziellen Gäste waren abgereist, die Siedler zu ihren Farmen zurückgekehrt. Die Mitglieder des Direktoriums der E.S.C. und die diplomatischen Vertreter der europäischen Staaten weilten aber noch in Wierny. In den letzten Maitagen traten die Direktoren hier zusammen. Es war ein besonderer Wunsch Isenbrandts gewesen.
Isenbrandt sprach in dieser Sitzung. Er knüpfte an die Salzung des Balkaschsees an. Überzeugend wies er nach, daß dieses Unternehmen nur teilweise Wirkung haben könne, solange die politische Grenze die Schmelzungen im oberen Ilitale unmöglich mache.
Georg Isenbrandt sprach weiter:
Ich berühre damit ein Ihnen wenig angenehmes Thema … Die Besitzfrage des Ilidreieckes …«
Ein nervöses Summen ging durch die Versammlung. Einen Augenblick war es still. Dann sprang der französische Direktor auf:
»Ich begreife nicht, wie diese Frage gerade jetzt aufs Tapet gebracht werden kann, da sie doch dem Schiedsgericht unterliegt, das in nächster Zeit seinen Spruch fällt. Nach meinen Informationen ist ein für uns günstiges Ergebnis zu erwarten.«
»Letzteres ist mir neu«, sagte Isenbrandt. »Wäre es wahr, würde die Frage noch viel dringender sein.
Sie sehen mich fragend an, meine Herren. Wie der Schiedsspruch auch ausfallen mag, gutwillig wird China diese starke Position nicht aus den Händen lassen.«
»Aber der feierlich beschworene Vertrag?«
»Der Schiedsgerichtsvertrag wurde zwischen Europa und dem Kaiser Schitsu geschlossen.«
»Und weiter?« schallte es ihm entgegen.
»Er wird keine Geltung haben. Kaiser Schitsu ist tot. Schanti … Toghon-Khan von Dobraja ist Regent!«
Der Eindruck der Worte auf die Versammlung war nicht zu beschreiben.
»Wie können Sie es nur wagen, uns solche Märchen aufzutischen?«
Über das Stimmengewirr erhob sich die schneidende Stimme des Franzosen:
»Wie können Sie ableugnen, was tausend Augen gesehen haben?«
Wieder trat Stille ein. Man wartete auf die Rechtfertigung Isenbrandts.
»Tausend Augen haben gesehen, daß ein Mann von Schehol in einem Glaswagen nach dem Kaiserpalast in Peking gefahren wurde.«
Isenbrandt hielt einen Augenblick inne. Mit einem Lächeln sah er auf die Gesichter, die gespannt zu ihm aufblickten.
»Ich leugne nicht, daß dieser Mann Kaiser Schitsu war … aber der Mann war tot! … Komödie war alles!«
Wie eine Bombe wirkten die Worte Isenbrandts. Keiner blieb auf seinem Platz. Von allen Seiten bestürmten sie den Sprecher mit Fragen.
»Meine Herren!« – die Stimme des Präsidenten durchbrach das Stimmengewirr – »ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Herr Isenbrandt wird seine Behauptungen begründen.«
Der stand einen Augenblick sinnend da.
»Begründen? … Wie soll ich das begründen? Ich kann Ihnen nur folgendes versichern.
Am 5. Mai um die sechste Abendstunde ist Kaiser Schitsu in Schehol an seiner Schußwunde gestorben. Am 4. Mai ernannte er den Herzog von Dobraja, den Schanti, zum Regenten. Der ominöse Ring des Dschingis-Khan ist am Finger des Schanti.
Glauben Sie mir … oder glauben Sie mir nicht! Für mich stehen diese Tatsachen fest.«
Georg Isenbrandt schwieg. Zum Zeichen, daß er nicht gewillt sei, noch weitere Erklärungen zu geben, nahm er auf seinem Stuhl Platz.
Wieder ein Durcheinander von Reden und Gegenreden. Dann der Präsident:
»Meine Herren! Mag der Kaiser oder der Regent in China herrschen. Ich für meine Person bin geneigt, den überraschenden Mitteilungen des Herrn Isenbrandt Glauben zu schenken. Aber ich kann nicht glauben, daß eine neue chinesische Regierung nicht die von der alten unterzeichneten Verträge halten sollte. – Der Spruch des Schiedsgerichts ist bestimmt in kurzer Zeit zu erwarten. Wir müssen ihn abwarten, bis dahin die Grenzen respektieren. Ich bitte die Herren, die meiner Meinung sind, aufzustehen.«
Die bei weitem größere Anzahl der Anwesenden erhob sich. Isenbrandt war überstimmt.
Der Basar in Wierny zeigte unter dem Einfluß der Festlichkeiten ein besonders lebensvolles Bild.
In buntem Strom zogen Fremde und Einheimische durch die schmale Basargasse.
Vor einer Auslage mit feinem chinesischen Porzellan stand Helen Garvin mit ihrer Freundin Florence.
»O sieh, Florence, da, die wundervollen, zarten Muster! Noch schöner als die von Kaschgar, die mir Pa in einer bösen Laune verdarb.«
»Du kaufst ja, als ob du eine Ausstattung kaufen müßtest. Kann dein Vater so böse werden, daß er das Eigentum seines Lieblings zerschlägt?«
»Ach, Florence, nur dann, wenn der Name Wellington Fox fällt.«
»Wer ruft hier Wellington Fox?« klang es hinter ihnen.
»Ach … du? … Sie? …« Helen Garvin drehte sich um.
Mit einem freundlichen Lächeln begrüßte Florence Dewey den Journalisten.
»Es bedarf wohl keiner Vorstellung mehr, meine Gnädige. Miß Helen wird Ihnen von mir erzählt haben, wie sie mir von Ihnen sprach. Sie werden es mir nicht übelnehmen, wenn ich die Gelegenheit benutze, einige Worte mit Miß Helen zu sprechen.«
»Meine Sympathien sind ganz bei Ihnen beiden. Doch ich glaube, aus den paar Worten werden viele werden. Du wirst verzeihen, liebe Helen, wenn ich mich eine Weile entferne. Am Ende der Straße sahen wir einen kleinen Park. Dort kannst du mich später wieder treffen.«
Mit schnellen Schritten eilte Florence ihrem Ziel zu. Tief aufatmend trat sie in das kühle Grün. Die Stille, die in dem parkartigen Garten herrschte, legte sich beruhigend auf ihr erregtes Herz.
Sie schloß die Augen und versank in unruhiges Träumen … Plötzlich war’s ihr, als sei ein Schatten vor sie getreten. Noch zögerte sie, die Augen zu erheben, da klang das Wort »Florence« an ihr Ohr.
Mit einem leichten Aufschrei taumelte sie empor. »Averil!«
Halb ohnmächtig sank sie auf die Bank zurück.«
»Nein! … Nein, Averil! Laß mich gehen, gehe fort!«
»Oh, sei nicht so grausam, Florence. Höre mich an … was tat ich, daß du meine Liebe zurückwiesest? … Soll ich büßen, was mein Vater dir antat? Florence, bei der Erinnerung an die seligen Stunden unseres Glücks … war es Wahrheit, was du in deinem Brief schriebst … oder war es gekränkter Stolz, der dich so schreiben ließ? Antworte mir!«
»Averil!«
Sie hatte den Namen kaum hörbar geflüstert, und doch lag in diesem Hauch mehr als in dem lautesten Schrei.
»Florence!«
Averil kniete nieder und küßte die Hände, die sie ihm willenlos überließ.
»Kann Liebe so grausam sein?«
Ein Wunsch schien sich in ihr zu regen, den sie nicht ausdrücken konnte. Sie schlang ihre Arme um seinen Nacken. Da zog er sie an sich und küßte sie auf ihren Mund.
»Alles ist verschwunden. Nur unsere Liebe ist geblieben … Daß ich ihn je wieder küssen würde, deinen süßen, reinen Mund!«
Ein Schauer rann durch ihre Glieder.
»Das ist er nicht mehr … der reine Mund«, sagte sie mit leisem Klagelaut. »Ich bin einem anderen versprochen.«
»Florence! Du …«
Averil war aufgesprungen. Regungslos stand er da.
»Du liebst den anderen? … Nein! Du liebst ihn nicht … Kannst ihn nicht lieben. Und doch willst du ihm folgen! … Und ich?«
Er löste ihre Arme und drängte sie zurück.
»Und ich? … Ich soll zugrunde gehen?«
»Averil!«
Flehend kam es von ihren Lippen. Alle Kraft schien von ihr gewichen. Schwach sank sie auf der Bank zusammen.
Plötzlich hob sie den Kopf. Ihre Augen blickten mit totenhafter Starrheit ins Weite, als sähen sie etwas, was nicht da war.
»Ich war krank … ich hatte nur den einen Wunsch zu sterben, um die Qual zu kürzen. Ich hatte dich von mir gewiesen und sah und dachte nichts anderes als dich. Du warst in mir, wie eine Qual … ein Feuer … ein Wahnsinn … Ein mexikanischer Geschäftsfreund meines Vaters besuchte uns. Ich kannte Don Manuel Oregon seit meiner frühesten Jugend … Ich sah in ihm nie mehr als einen liebevollen väterlichen Freund. Es war kurz vor meiner Abreise mit Helen Garvin … Er warb um mich … Er sah meine Seelennot. Er nahm meine Hände und sprach liebevoll … demütig zu mir. Und doch lag in seinen Worten der Wille und die Kraft, mich zu befreien … mir das Glück zu geben, für das mein Herz noch Raum bot. Und … ich gab ihm meine Hand.«
»Und du wirst ihm folgen … diesem Mann? … Liebelos?«
Alles heiße Wünschen, alle Leidenschaft, Empörung und Klage sprach aus Averils Worten.
»Florence, ich lasse dich nicht. Mein bist du … allen zum Trotz.«
Er preßte sie an sich und verschloß die widerstrebenden Lippen mit glühenden Küssen.
Gewaltsam befreite sie sich aus seinen Armen, sprang von der Bank empor und wich vor ihm zurück.
»Sei gut zu mir, Averil! Schone mich. Es kann nicht sein … Du mußt nun gehen, vergiß mich!«
»Ich dich vergessen? … Ich gehen, wo ich weiß, du liebst mich … liebst mich noch!«
Seine Augen rangen mit ihr in stummer Verzweiflung. Da schritt sie auf ihn zu und legte die Hände auf seine Schultern.
»Averil! Ich habe dich lieb … bis in den Tod. Und wenn meine Liebe dich bittet, zu gehen, wirst du es tun?«
Ein Beben ging durch die Gestalt des Mannes. Alles Blut wich aus seinem Gesicht. Kaum verständlich, nur ein rauhes Flüstern war sein: »Leb wohl!«
Kaum hatte Wellington Fox seinen Namen genannt, als ihn der Diener in das Arbeitszimmer Garvins führte. Schwere Vorhänge verhüllten die Fenster und schufen ein leichtes Dämmerlicht.
An einem kleinen Schreibtisch saß Francis Garvin, das Gesicht verschlossen und eisig kühl.
Mit einem kurzen Kopfnicken beantwortete er die Verbeugung von Fox. Noch ehe dieser auf einem Sessel Platz genommen hatte, begann er die Unterhaltung.
»Ich habe Sie zu einer Unterredung gebeten, um Ihnen das mündlich zu sagen, was Sie sich bei einiger Überlegung selbst hätten sagen können.«
Seine harten, grauen Augen sahen Fox durchdringend an.
»Daß ich meine Einwilligung zu einer Verbindung zwischen Ihnen und meiner Tochter Helen nicht geben werde.«
Fox nickte.
»Ich habe darüber keinen Zweifel gehabt.«
»Dann darf ich wohl fragen, weshalb Sie sich meiner Tochter Helen in so unzarter Weise genähert haben? Helen ist ein Kind. Sie haben eine schwere Schuld auf sich geladen, als Sie Helens Dankbarkeit für die Errettung aus dem Schneesturz in einer Weise ausnutzten, die den Seelenfrieden meines Kindes tief stören muß.«
Wellington Fox schlug ein Bein über das andere und lehnte sich bequem in seinen Sessel zurück.
»Ihr Vorwurf trifft mich nicht, Mr. Garvin. Zunächst ist Helen kein Kind mehr. Sie ist seit einem Jahr volljährig. Ihre Einwilligung zu unserer Verbindung ist daher ohne Belang. Wenn Helens Natur viel von der Unbefangenheit und Fröhlichkeit eines Kindes behalten hat, so sehe ich darin ein Geschenk Gottes, für das ich ihm von ganzem Herzen dankbar bin … aber Ihre Einwilligung … die brauche ich nicht, Mr. Garvin.«
Es schien einen Augenblick, als wolle Garvin aufspringen, um dem unverschämten Gast die Tür zu weisen. Doch er beherrschte sich. Er schluckte einige Male. Bevor er reden konnte, sprach Fox mit unerschütterlicher Ruhe weiter:
»Ich bin Ihrer Einladung gefolgt, weil ich mich, wenn irgend möglich, mit dem Vater meiner Frau gut stellen möchte.«
Francis Garvin lehnte sich tiefatmend in seinen Stuhl zurück. Er preßte die Hände ineinander und schaute zur Decke empor.
Wellington Fox sah mit einem gewissen Mitleid auf den Vater Helens.
Armer Kerl, dachte er bei sich, meine letzten Worte haben dir den Knockout gegeben.
Francis Garvin sprach: »Sie wollen also, Mr. Fox, ohne meine Einwilligung eine Ehe mit Helen eingehen?«
»Das zweite ganz gewiß. Ob auch das erstere, hängt von Ihnen ab.«
»Haben Sie auch darüber nachgedacht, wie Sie Helen standesgemäß ernähren und kleiden werden? Ich taxiere, daß Helens Hutbudget Ihr Jahresgehalt beträchtlich übersteigt.«
Wellington Fox zuckte die Achseln. Während er mit seiner Antwort zögerte, ging es ihm klar durch den Kopf: Aha, alter Freund! Dein Widerstand läßt nach. Es fällt dir nur zu schwer, dich offen geschlagen zu bekennen.
Dann sprach er: »Den Luxus von Garvins Palace Helen zu bieten, bin ich selbstverständlich nicht in der Lage. Doch mein Einkommen genügt durchaus, einer Frau ein behagliches, glückliches Heim zu bieten, die ihre Ansprüche nicht allzu hoch stellt …«
»Glück ist in der kleinsten Hütte«, warf Garvin ein, doch der Hohn, der darin liegen sollte, war matt.
»Unser zukünftiges Heim wird im Vergleich zu Garvins Palace eine Hütte sein, gewiß, Mr. Garvin. Aber es stände schlimm um die Menschheit, wenn das Glück nur in den Schlössern der Reichen zu finden wäre.«
Francis Garvin machte eine wegwerfende Gebärde.
»Verliebte Leute sehen den Himmel voller Geigen. Der Katzenjammer bleibt nicht aus. Ich will mein Kind davor bewahren. Ich möchte unsere Unterredung damit beenden, Mr. Fox, daß ich Ihnen für Ihre aufopfernde Tat bei der Rettung Helens meinen herzlichsten Dank ausspreche. Ich wollte Sie zum Besitzer der Chicago Press machen, um meinen Dank auch tatkräftig zum Ausdruck zu bringen. Sie haben mein Angebot zurückgewiesen. Wir sind quitt!«
»Ich nicht!«
Wie ein Wirbelwind war ein weißes Etwas aus dem Nebenzimmer hereingeflattert. Mr. Garvin war plötzlich unter einer Wolke von hellem Batist verschwunden.
Fox sah den grauen Kopf Garvins über Helens blonde Locken gebeugt, sah, wie dessen Arme sein Kind fest umschlossen, und verließ leise das Zimmer.
Im Vorraum schritt er ruhelos auf und ab. Tausend Ideen schossen durch sein Hirn.
Und dann ging es ihm plötzlich wie Mr. Garvin. Wie durch einen Schleier sahen seine Augen eine weiße Gestalt auf sich zueilen. Zwei liebevolle Arme umschlossen seinen Hals.
Ein Stammeln … ein Weinen … ein Lachen.
»Wie glücklich bin ich, Wellington!«
Nach einer Weile drang die Stimme Garvins in den Raum.
»Mr. Fox, Sie haben gesiegt. Helens Wille war stärker als der meine … Es fällt einem alten Mann schwer, sein einziges Kind wegzugeben … Ich werde alt, ihr müßt Geduld mit mir haben … Der Gedanke quält mich, daß Helen in den veränderten Verhältnissen ihres neuen Lebens doch gar manches Liebgewonnene aus dem Vaterhaus vermissen wird …
Ich bitte Sie, Mr. Fox, mir zu erlauben, Ihre Stellung in irgendeiner Weise zu verbessern. Der Gedanke ist mir unerträglich, daß … Mr. Fox, Sie dürfen nicht weiter ein einfacher Berichterstatter bleiben …«
Francis Garvin war bei den letzten Worten auf Wellington Fox zugetreten und drückte ihm die Hände. Wellington Fox hatte seine volle Selbstbeherrschung wiedergewonnen.
»Daß Sie mir Ihre Helen nicht gern geben, weiß ich … will es Ihnen auch nicht verdenken. Meine Position zu verbessern? … Ich habe schon lange daran gedacht … und daran gearbeitet. Unsere Wünsche begegnen sich also. Doch die Vorschläge für eine Verbesserung überlassen Sie, bitte, mir. Sie haben mich bisher nur als einfachen Journalisten kennengelernt. Sie wissen nichts … weniger als nichts von meinen sonstigen Plänen und … Unternehmungen, Mr. Garvin.«
»Unternehmungen?«
Fragend und zweifelnd war das eine Wort von den Lippen Garvins gekommen.
»Unternehmungen, Mr. Garvin. Sie werden anders von mir denken, wenn einige Wochen ins Land gegangen sind. Ich möchte Sie bitten, Mr. Garvin, meine Verlobung mit Helen nicht vor dem August bekanntzugeben.«
Verwundert und fragend blickte Francis Garvin auf Fox.
»Ich verstehe Sie nicht, Mr. Fox.«
»In wenigen Wochen werden Sie mich um so besser verstehen. Sie werden dann, das hoffe ich sicher, die Veröffentlichung unserer Verlobung mit willigem Herzen vornehmen. Sie werden an diesem Tage wissen, Mr. Garvin, daß der Verlobte Ihrer Tochter etwas mehr ist als der einfache Berichterstatter, für den Sie ihn jetzt nehmen … für den die Welt ihn vorläufig noch nehmen muß.«
Georg Isenbrandt befand sich in seiner Station zu Wierny. Seit jener letzten Sitzung des Direktoriums der E. S. C, in der die maßgebenden Herren den Beschluß gefaßt hatten, den Spruch des Schiedsgerichts abzuwarten, war er in gedrückter Stimmung.
Die Ereignisse des heutigen Tages waren in ihrer Gesamtheit nicht geeignet, einen Stimmungsumschwung bei ihm hervorzurufen. Zwar der Vormittag hatte ihm eine große, kaum erwartete Freude gebracht: Ein Telegramm von Wellington Fox. Georg Isenbrandt hatte es Wort für Wort dechiffriert, hatte tiefaufatmend die Nachricht gelesen, daß Fox die Vermißten, Theodor Witthusen und Maria Feodorowna, in Urga entdeckt habe.
Aber andere Nachrichten waren geeignet, Isenbrandts Stimmung wieder hinabzudrücken. Seit zwölf Stunden liefen unaufhörlich Hochwassermeldungen aus dem oberen Ilital bei seiner Station ein. Von Stunde zu Stunde stiegen die Zuflüsse des Stroms aus dem chinesischen Gebiet.
Die Sonne sank hinter die Berge. Dämmerung schlich durch den Raum, in dem Georg Isenbrandt an seinem Arbeitstisch saß. Die Vermutung, die ihm schon in den Nachmittagsstunden durch den Kopf gegangen war, wurde jetzt zur Gewißheit. Das war nicht mehr ein zufälliges Naturereignis. Gewiß war im Frühjahr mit Hochwasser zu rechnen. Aber die Wassermengen, die hier von allen Seilen des Quellgebietes gemeldet wurden, überstiegen das normal zu Erwartende bei weitem.
Er verband sich direkt mit der Station von Terek. Dort hatte er den gewaltigen Staudamm anlegen lassen, um plötzlich einbrechende Wassermengen sicher auffangen und speichern zu können. Durch die Unfähigkeit eines Bauleiters hatten die Arbeiten sich stark verzögert. Erst in den letzten Wochen hatte Georg Isenbrandt mit eiserner Hand dazwischengegriffen und die Vollendung des riesigen Betondammes mit allen Mitteln betrieben.
Der Damm war jetzt fertig. Aber die letzten Teile der gewaltigen Staumauer waren erst vor 48 Stunden in die Holzformen eingestampft worden. Diese Zeit war viel zu kurz, um den Beton schon erhärten zu lassen. Kamen jetzt plötzlich die schwersten Hochwasser, so war eine Katastrophe zu gewärtigen.
Er fragte durch den Apparat und erschrak über die Antwort. Das Wasser schon zwei Meter unter dem frischgestampften Teil. Stieg die Flut in dem bisherigen Tempo weiter, mußte sie in kürzester Zeit die frischen Teile erreichen, und dann begann die schwere Gefahr.
Georg Isenbrandt sprang auf und lief unruhig im Raum hin und her. Einen Augenblick erwog er den Gedanken, selbst nach der Terekstation zu fahren, um ihn dann sofort wieder zu verwerfen. Etwas anderes … etwas Größeres mußte geschehen. Während er hin und her wanderte, fiel sein Blick auf die Apparatur, in der ihm neulich das Helium erstarrt war. Da … greifbar vor ihm lag das Mittel, alles zu verhindern, was er befürchtete. Mußte er es nicht auf jeden Fall anwenden? Waren nicht auch Hunderte von Menschenleben auf das schwerste bedroht, wenn die Hochwasser des Dammes von Terek Herr wurden?
Die Verantwortung war fürchterlich schwer. Ruhelos lief er durch den Raum.
Was tun? Was waren die Menschenleben, und wären es auch Hunderte, gegen die Tausende und aber Tausende, die ihr Leben lassen mußten, wenn er sein Spiel zu früh aufdeckte?
Das Mittel einmal anwenden, hieß eine vollkommen veränderte Lage schaffen, hieß die besten Waffen vorzeitig schartig werden lassen.
Einen Ausweg! Das Übel kam von den chinesischen Bergen … Das Unheil an der Quelle verstopfen … Sollte das möglich sein, ohne das Geheimnis preiszugeben?
Der alte Schmelzmeister Franke trat ein. Der hauste jetzt seit einigen Wochen unten am Balkaschsee. Er kam, um sich Instruktionen zu holen. Die gewaltigen Wassermengen, die der Ili seit zwölf Stunden in den See trug, beeinflußten dort die Dampfentwicklung. Der Alte wollte wissen, ob neues Dynotherm in den See gegeben werden sollte. Er meldete, daß die Rohrhorste am südlichen Seeufer schon zum Teil überflutet seien, und er fluchte grimmig auf die Gelben. Ebenso fest wie Isenbrandt war er davon überzeugt, daß diese plötzliche Flut nur auf Schmelzungen im chinesischen Iligebiet zurückzuführen sei.
Es war bekannt, daß auch die Gelben über große Dynothermvorräte verfügten, wenn sie auch das neueste Präparat Isenbrandts noch nicht besaßen. Seit langem puderten sie auf ihren Bergkämmen herum. Bisher war das aber immer nur in kleinem Maßstab geschehen und immer so, daß die erschmolzenen Wassermengen den chinesischen Strömen zugute kamen und die Nachbarn jenseits der Grenze nicht gefährdeten.
Isenbrandt unterbrach den Redefluß des Schmelzmeister:
»Ob der Damm noch zu retten sein wird, ist fraglich. Aber die Möglichkeit besteht, den Schrecken zu kürzen, die Zeit der Furcht und der Gefahr zu verkleinern.«
Verständnislos blickte ihn der Alte an.
»Wie sollte das möglich sein, Herr Isenbrandt?«
Georg Isenbrandt ging zur Tür und schloß sie ab. Dann ging er zu dem Alten und legte ihm die Hände auf die Schultern.
»Hören Sie, alter Freund! Es gibt ein Mittel, um das Unheil zu bekämpfen. Ich habe es! . . Aber ich kann es nicht selbst tun, und ich weiß keinen anderen und besseren als Sie, der sich schon so lange Jahre als treu und zuverlässig erwiesen hat. Ich weiß keinen besseren als Sie, dem ich das Geheimnis dieses Kampfmittels anvertrauen könnte. Kein Mensch, auch keiner der Herren von der E.S.C. weiß darum. Ihnen will ich es in dieser Stunde der Not zu treuen Händen geben. Ehe ich Sie aber frage, ob Sie bereit sind, die Tat zu vollbringen, will ich Ihnen sagen, welche Gefahren damit verbunden sind. Es muß jemand mit einem Flugschiff die chinesischen Kämme abfliegen und an allen, wenigstens an den Hauptstellen, wo die Gelben gesalzen haben, das Gegengift streuen.«
»Gegengift? Gegen unser Dynotherm?«
»Ja, Franke! Es gibt ein Mittel. Wird es auf die Puderstellen gestreut, so wird die Wirkung des Dynotherms gebunden … Aber die Sache ist nicht ohne Gefahr. Sie müßten noch in dieser Nacht mit einem Schiff, von dem alle Kennzeichen der E.S.C. entfernt sind, den Flug unternehmen …«
»Da ist nichts zu überlegen, Herr Isenbrandt. Schon das freut mein altes Herz, daß Sie mir so viel Vertrauen schenken, mir Ihr Geheimnis sagen. Und dann noch das Vergnügen, den verdammten Gelben einen Streich zu spielen …«
»Ich wußte, lieber Franke, daß ich mich auf Sie verlassen kann, und danke Ihnen von ganzem Herzen …«
Er schüttelte die Hand des alten Gefährten mit kräftigem Druck.
Eine knappe halbe Stunde später schoß die schnelle Maschine, von dem alten Schmelzmeister gesteuert, in den dunklen Abendhimmel und verschwand nach Osten zu.
Georg Isenbrandt hat die Maschine und den Alten nie wiedergesehen. Der blieb von dieser Stunde an verschollen. Es ist auch niemals bekannt geworden, ob der Alte bei der Schleichfahrt durch die dunklen Berge gegen eine Felsschroffe rannte oder ob er mit seiner Maschine das Opfer chinesischer Kugeln wurde. Aber es muß ihm doch gelungen sein, den Auftrag Isenbrandts zum weitaus größten Teil auszuführen, denn schon am übernächsten Tag ließ der plötzliche Zustrom aus den chinesischen Bergen nach, und bereits am Ende der Woche herrschten wieder normale Wasserverhältnisse im Ilital.
In jener ersten Flutnacht ging es freilich desto stürmischer zu.
Der Staudamm bei Terek bot ein wildromantisches Bild. Brüllend und gurgelnd stauten sich die Wildwasser hinter ihm zu einem Riesensee.
Jetzt stand die Oberfläche dieses höllischen Wirbels kaum noch einen Meter unter der Dammkrone. Stieg das noch weiter, so mußten die Fluten über die Krone hinweg in breitem Schwall zu Tal stürzen … Vorausgesetzt, daß der Damm hielt.
Schon auf die ersten Nachrichten von dem bedrohlichen Steigen der Fluten hatte Georg Isenbrandt die Siedler im unteren Ilital telegraphisch warnen lassen. Sobald ihn der alte Schmelzmeister verlassen hatte, bestieg er selbst ein Flugschiff und fuhr nach den Terekanlagen.
Er kam, sah … und fand seine schlimmsten Befürchtungen übertroffen. Jeder Augenblick konnte die Katastrophe, den Dammbruch bringen.
Schnell gab Isenbrandt seine Befehle. Nur ein Mittel gab es noch, der drohenden Katastrophe zuvorzukommen. So schnell wie möglich mußte man die neuen, noch weichen Teile des Dammes von dem Wasserdruck entlasten, den Stausee absenken.
Das war nur möglich, wenn man einen Einschnitt von gehöriger Tiefe und Breite in den alten Teil der Staumauer einsprengte. Dort mußte es geschehen, denn der neue Teil der Mauer hätte die Beanspruchung einer Explosion nicht ertragen. Er wäre sicherlich sofort in seiner ganzen Ausdehnung zu Bruch gegangen.
Nur mit den schärfsten Sprengmitteln ließ sich aber die Sprengung in den granitharten Dammassen des alten Teiles bewerkstelligen. Gelang sie, so würden sich freilich sehr gewaltige Wassermengen durch die gesprengte Lücke talabwärts ergießen. Sie würden sicherlich beträchtlichen Schaden anrichten. Aber dieser Schaden und diese Gefahr blieben immerhin in übersehbaren Abmessungen. Und der Spiegel des Stausees mußte sich dann schnell senken. Der Druck auf den schwachen Teil des Dammes mußte sofort nachlassen.
Nach den Anordnungen Isenbrandts lief das Sprengkommando über die Dammkrone nach der anderen Berglehne hinüber. Im mittleren Teil war die frische Stelle. Am Nordufer, im harten alten Teil, sollte die entlastende Scharte ausgesprengt werden.
Im taghellen Licht der Scheinwerfer sah man vom Ufer aus die Mannschaft über die Dammkrone eilen. Sie mochte etwa die Mitte erreicht haben, als ein Blitz an dieser Stelle aufzuckte, ein krachender Donner das Toben der Elemente übertönte.
An der schwachen Stelle des Dammes war eine schwere Sprengladung explodiert. Einen Moment noch stand die Mauer dort zitternd im Strudel. Dann riß sie breit auf, neigte sich zu Tal und brach in Riesenbrocken auseinander. In wütendem Schwall stürzten die entfesselten Fluten zu Tal.
Verschwunden war an dieser Stelle der Damm … Verschwunden die Leute des Sprengkommandos auf ihm.
Ein Schrei des Entsetzens aus vielen tausend Kehlen.
Isenbrandt selbst stand unter der Wucht der Katastrophe wie erstarrt.
Ein Verbrechen? … Nur ein Verbrechen konnte es sein. Von wem? … Es bedurfte keiner Frage.
Mit schweren Schritten wandte er sich zum Ufer und begab sich in das Büro der Werkleitung.
»War unter dem Sprengkommando ein Gelber?«
Einer der Ingenieure beantwortete die Frage.
»Jawohl! Alibeg! Ein kirgisischer Vorarbeiter … Einer, der sich durch besondere Anstelligkeit auszeichnete.«
Ein Held! dachte Isenbrandt bei sich … sicher ein gelber Ingenieur, der sich hier unter falscher Flagge als Werkmann verdingt hat.
Dann wandte er sich an den Stationsleiter.
»Ich kehre nach Wierny zurück. Alle Nachrichten für mich bitte dorthin! Hier ist Menschenhilfe vergeblich. Vertrauen wir auf Gott.«
Noch einmal warf er einen Blick auf das Tal, in dem das entfesselte Element dahinschoß.
In Urga, der alten Hauptstadt der Chalka-Mongolen, hatte Wellington Fox mit Hilfe des getreuen Ahmed die Witthusens ermittelt. Viele Wochen hindurch war Ahmed in der Maske eines sartischen Händlers durch das mongolische Land gezogen. Hatte mit großem Geschick geforscht, bis er endlich die Spur hatte.
Dann war Wellington Fox zu ihm gestoßen. Der kam als russischer Teehändler mit einer großen Handelskarawane aus dem nahen Kjachta über die russische Grenze. Vorzüglich hatte er es verstanden, sein Äußeres der Rolle, die er hier spielen mußte, anzupassen. Den Mangel seiner russischen Sprachkenntnisse verbarg er geschickt unter einem freilich recht holperigen Chinesisch.
In einer der großen Herbergen der Stadt, in der die Karawane Quartier nahm, hatte er sein Unterkommen gefunden. Daß er hier häufig mit einem sartischen Händler zusammenkam, fiel nicht weiter auf.
Es war um die Zeit der Abenddämmerung. Wellington Fox saß in dem einfachen Raum, der ihm in der Karawanserei als Unterkunft diente.
Ein leises Klopfen an der Tür. Wellington Fox schob den schweren Holzriegel zurück. Der Sarte trat in den Raum.
»Bist du da, Ahmed? … Wie steht’s?«
»Gut, Herr! Euer Papier ist in den Händen des alten weißen Herrn.«
»Will er es tun?«
»Ja, Herr … er machte das verabredete Zeichen …«
»So wirst du also um neun Uhr mit den Gefangenen das Haus verlassen. Bist du ganz sicher, daß der Wärter keinen Verrat übt?«
»Er wird seinen Schwur halten, Herr. Wirst du ihn aber auch im Flugschiff mitnehmen, wie du versprochen? Er fürchtet die Strafe, wenn die Flucht entdeckt ist.«
»Ich werde ihn mitnehmen … samt seinen fünfhundert Dollar. Er mag sie in Frieden in Kjachta verzehren.
Der Weg vom Haus bis zum Brunnen ist kurz. Um neun Uhr werde ich dort unter dem Schein einer Notlandung niedergehen.«
»Wenn du da bist, wird alles gut sein, Herr!«
Ahmed verließ den Raum. Wellington Fox blieb mit seinen Gedanken allein. Noch einmal überlegte er alle Chancen.
Es waren ein paar helle, freundliche Räume, in denen die Witthusens die Tage ihrer Gefangenschaft verbrachten. Der alte Herr saß seiner Tochter gegenüber. Ein Schachbrett, das ihnen die Stunden ihrer Haft kürzte, stand zwischen ihnen. Aber seitdem das Papier des sartischen Händlers durch den bestochenen Wärter in ihren Händen war, standen die Figuren unberührt auf den Feldern.
Mit gedämpfter Stimme … fast flüsternd sprachen sie. »Die Freunde, Maria, an die ich zuerst gedacht, haben nichts für uns getan … vielleicht nichts tun können … Der Konsul … wie oft war er in unserem Hause … nichts …
Collin Cameron … am Tage vor unserer Gefangennahme rühmte er sich seiner guten Beziehungen … auch er … nichts …
Die beiden Jungen, eine flüchtige Reisebekanntschaft von dir … an die hätte ich zuletzt gedacht … Die Not zeigt, wo die wahren Freunde sitzen. Herr Fox kommt ja zweifellos im Einverständnis … mit Unterstützung seines Freundes Isenbrandt.«
»Glaubst du, Vater« – das leichte Rot auf Marias Wangen vertiefte sich – »daß Herr Isenbrandt bei seinen vielen großen Arbeiten noch Zeit hat, sich um uns zu kümmern?«
»Würde sonst sein Diener mit hier sein? … Ihn selbst mögen seine Arbeiten festhalten, aber er denkt auch an uns.«
»Er hat uns früh genug gewarnt … Du ließest dich durch Mr. Cameron beschwichtigen. Ich weiß nicht, Vater … ich kann dein großes Vertrauen in Mr. Cameron nicht teilen … sein ganzes Wesen … sein überfreundliches Benehmen stoßen mich ab.«
»Ach Kind, das sind unkontrollierbare Gefühle … Ich kenne ihn seit Jahren und habe nie Anlaß gehabt, an ihm zu zweifeln.«
Ein Klopfen an der Tür unterbrach ihr Gespräch.
Collin Cameron trat ein.
»Ah, Herr Cameron! … Wo kommen Sie her? … Bringen Sie Gutes?«
Witthusen war aufgesprungen und reichte dem Besucher die Hand.
»Soeben noch tat ich Ihnen unrecht. Wir sprachen von den Freunden, auf deren Beistand wir vergeblich hoffen … und darunter waren auch Sie.«
»Auch ich … und was waren es sonst noch für Freunde?«
»Oh, alle aus Kaschgar … Der russische Konsul … die Upharts … viele andere …«
Er brach seine Rede jäh ab, unterdrückte die Namen Fox und Isenbrandt, die ihm schon auf der Zunge lagen. Eine Spur jenes Mißtrauens, das Maria vorhin geäußert, hatte sich ihm mitgeteilt.
»Bringen Sie gute Nachricht?«
»Wenn nicht heute, so doch bald! Ich freue mich, daß Sie mich unter Ihre Freunde zählen … Auch Ihnen, Fräulein Maria, meinen Dank, daß Sie meiner in Freundschaft gedacht haben.«
Collin Cameron nahm auf dem Stuhl Witthusens am Schachtisch Platz. Seine Augen versenkten sich brennend in diejenigen Marias.
»Ich hoffe, daß es meinen guten Beziehungen bald gelingen wird, Ihre Freilassung durchzusetzen.«
»Weshalb sind wir überhaupt gefangen?« fragte Witthusen. »Wie konnte man es wagen, uns wie Verbrecher aus unserem Haus zu holen und wegzuschleppen?«
»Ich erfuhr Ihre Verhaftung leider erst am anderen Morgen … Konnte nicht sofort feststellen, wohin Sie gebracht worden waren. Mit vieler Mühe brachte ich heraus, daß Sie verdächtigt sind, mit Chinas Feinden in Verbindung zu stehen.«
Witthusen fiel ihm erregt ins Wort.
»Feinden? Mit wem liegt China im Krieg?«
»China liegt im geheimen Krieg mit der E.S.C. Ihr Verkehr mit dem Ingenieur Isenbrandt hat Sie in den falschen Verdacht gebracht.«
»Deshalb diese Gewalttat!« Marias kleine Faust schlug kräftig auf den Tisch … Ich kann es nicht glauben! Die gelben Spione arbeiten nicht so schlecht, daß sie aus einer flüchtigen Reisebekanntschaft eine Verschwörung machen.«
»Und doch ist es so, Fräulein Maria … doch Geduld! Der Tag wird kommen, an dem Sie, gereinigt von allem Verdacht, in das alte Haus in Kaschgar zurückkehren können.«
Maria erhob sich.
»Nie wieder kehre ich nach Kaschgar zurück! Verhaßt ist mir die Stadt. Verhaßt das Land, wo solche Gewalttat geschehen konnte!«
»Oh, nicht doch, Fräulein Maria! Beruhigen Sie sich! … Volle Genugtuung wird Ihnen gewährt werden.
Ihr Heim in Kaschgar wartet auf Sie, so wie Sie es verlassen haben. Als ich Ihre Verhaftung erfuhr, ließ ich mir Vollmacht geben, über Ihr Eigentum zu wachen. Die Schlüssel des Hauses sind in meiner Hand. In Ihrem Stübchen steht alles, wie Sie es verlassen haben. Werfen Sie nicht alle erfreulichen Erinnerungen um eine Unerfreulichkeit von sich!
»Nein! Maria hat recht!« erklärte Witthusen. »Nie wieder kehren wir in das alte Haus nach Kaschgar zurück! Wer gibt uns Gewähr, daß wir nicht jederzeit auf irgendeinen unsinnigen Verdacht hin neue Leiden erdulden müssen?«
Collin Cameron biß sich auf die Lippen. Unverwandt hatte er Maria mit den Augen verschlungen.
»Wäre es nur das Haus? … Würde es auch so sein, wenn Sie es mit einem anderen vertauschen, Fräulein Maria?«
Er warf einen Seitenblick auf Witthusen, der jetzt am Fenster stand und in die Nacht hinausblickte. Auch Collin Cameron erhob sich jetzt und trat dicht an Maria heran.
»Mit einem anderen?« fragte sie.
»Ja, mit dem meinen!«
Einen Augenblick sah ihn Maria verständnislos an.
»In Ihrem Haus? … Ich in Ihrem Hause?«
»Als mein Weib!«
Ein jäher Schreck zuckte über Marias Züge. Mechanisch wich sie vor Collin Cameron zurück.
»Nie, Mr. Cameron!«
»Oh, Fräulein Maria … lassen Sie unsere Worte ungesprochen sein! … Ich vergaß die Lage, in der Sie sich befinden. Verzeihen Sie mir! Es war töricht, von Liebe zu sprechen, wo es sich um die Freiheit handelt.«
Er trat auf sie zu und versuchte ihre Hand zu fassen.
»Verzeihen Sie mir, bitte, verzeihen Sie mir, Fräulein Maria. Nur um ein Kleines möchte ich Sie bitten. Lassen Sie mich nicht ohne jede Hoffnung von hier gehen. Sie wissen nicht, was Sie für mich bedeuten. In besseren Tagen werde ich wieder zu Ihnen kommen …«
Witthusen trat vom Fenster zurück an die beiden heran. Maria drängte sich an ihn.
»Und wann denken Sie, Mr. Cameron, daß wir Urga verlassen dürften?«
»Was an mir liegt, soll geschehen, um Ihnen die Freiheit zu verschaffen. Ich fahre morgen nach Peking. Alle Verbindungen, die mir dort zur Verfügung stehen, werde ich für Sie ausnutzen. Wenn es das Glück will, bin ich in wenigen Tagen wieder hier und hoffe von Ihnen frohen Empfang … auch von Ihnen, Fräulein Maria.«
Er ergriff ihre Hand und drückte einen Kuß darauf.
Vater und Tochter waren wieder allein. Sie sprachen über den unerwarteten Besuch Camerons. Aber das Gespräch schlich mühsam dahin.
Langsam verschlichen die Viertelstunden. Der Wärter brachte die Mahlzeit. Sie blieb unberührt stehen.
Die Erregung des Kommenden nahm sie ganz gefangen. Sie stieg aufs höchste, als die Uhr die neunte Stunde zeigte.
Minute auf Minute verrann. Maria sprang nervös auf und trat ans Fenster.
Ein Klopfen an der Tür ließ sie auffahren. Der Wärter trat ein. Das Licht seiner Kerze fiel auf ein verstörtes Gesicht.
»Was ist?«
Von zwei Seiten scholl ihm die Frage entgegen.
»… Ahmed ging soeben vorbei … er winkte verstohlen … nichts! … Heute nichts …«
Maria sank auf ihren Sessel. Sie ließ den Kopf auf das Schachbrett fallen. Der Alte trat auf sie zu und legte den Arm um sie.
»Sei gefaßt, Maria! … Wenn nicht heute, dann morgen! … Gib die Hoffnung nicht auf. Die Freunde werden uns nicht im Stich lassen …«
So suchte er ihr Trost zuzusprechen und verbarg seine eigene starke Befürchtung, daß der Plan von Fox entdeckt sein könne.
Witthusens Befürchtung war leider nur allzu begründet. Durch ein unnötiges Wagnis hatte Wellington Fox den so gut vorbereiteten Plan in der letzten Stunde gestört und die eigene Freiheit verloren.
Die Ungeduld hatte ihn aus seinem sicheren Versteck vorzeitig in die Nähe des Hauses getrieben, in dem die Witthusens gefangengehalten wurden.
So geschah es. Als Collin Cameron das Haus verließ, erkannte er Wellington Fox trotz dessen Verkleidung. Im Augenblick war Cameron in den Schatten getreten. Wellington Fox hatte ihn nicht erkannt. Er war ganz mit der Überprüfung des Fluchtplanes beschäftigt.
Die Zeit verstrich darüber. Während er hier noch spähte, waren die Häscher, die ihn fangen sollten, bereits auf dem Weg.
Eine drückende Stimmung lastete über Peking.
Seit dem Tage des Einzugs hatte niemand den Herrscher wieder erblickt. Die Bulletins der Ärzte sprachen von Ruhe und Schonung, deren der Sohn des Himmels noch bedürfe. Der abnorme Schneefall am Tage des Einzugs war von Abergläubischen als ein böses Zeichen gedeutet worden.
Die hermetische Abschließung des Kaisers gab vielen zu denken. Ebenso wie die Veränderungen in der Garnison. Immer neue mongolische Regimenter zogen in die Residenz ein und lösten die chinesischen Besatzungen ab.
Wie damals gleich nach dem Attentat, so wurden auch jetzt wieder von neuem energische Schritte gegen alle republikanisch Gesinnten unternommen.
Weshalb? fragte sich die große Menge. Wo war die Gefahr, der man durch solche Maßnahmen entgegentreten wollte?
Im Kaiserpalast hatte der Schanti seit der Rückkehr des Kaisers seinen ständigen Wohnsitz genommen.
In dem alten kaiserlichen Arbeitszimmer saß der Regent. Um ihn sein enger Rat.
Mongolisch war hier die Sprache. Nur die treuesten seiner Getreuen, die besten der mongolischen Generale und Staatsmänner hatte der Schanti in diesen Rat gerufen.
Damals, als er von Schehol zurückkehrte, den Ring des Dschingis-Khan am Finger, den nahen Tod des Kaisers vor Augen, da hatte er dessen mongolische Paladine zusammengerufen.
Mit den Künsten des genialen Staatsmannes hatte er sie für sich zu gewinnen gewußt. Wohl gab ihm der Ring an seinem Finger die Autorität des Regenten, dem sie den Gehorsam nicht verweigern konnten.
Aber Toghon-Khan wollte mehr. Seine Klugheit verbot ihm, diese Macht bedingungslos auszunutzen. Nicht stummen Gehorsam wollte er. Mit Leib und Seele wollte er sie gewinnen, und es gelang ihm.
Damals hatte er sie auch mit den Plänen des Kaisers bekannt gemacht. In einer Weise, daß alles, was jetzt auf seine Anordnung geschah, unmittelbar auf den Befehl des Kaisers zu geschehen schien. Jedem von ihnen hatte er große Aufgaben übertragen, die nicht nur Arbeit, sondern auch Ehre und Macht brachten.
Als dann der Tod des Kaisers wirklich eintrat, konnte er es wagen, im Einverständnis mit ihnen jenen ungeheuren Betrug zu unternehmen.
»Wie weit sind die Truppenbewegungen an der russischen Grenze durchgeführt?« wandte der Regent sich an den Generalstabschef.
»Die Umgruppierung nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, weil sie verschleiert durchgeführt werden muß. Sie könnte schneller vonstatten gehen, wenn ich die Vollmacht bekäme, die Verkehrsmittel zu beschlagnahmen. Die Militärschiffe können die Massen nicht so schnell bewältigen.«
Der Schanti wehrte ab.
»Unmöglich! Jede auffällige Maßnahme muß unterbleiben. Es genügt, wenn zuerst die Truppen in Jünnan und Kwangsi ausgewechselt werden. Die anderen Bewegungen können später erfolgen. Die Magazinbestände an den Westgrenzen sind voll aufgefüllt?«
»Es ist geschehen, Herr.«
Der Generalstabschef sprach weiter:
»Leider ist es noch nicht gelungen, hinter das Geheimnis der Compagnieschiffe zu kommen. Unsere Agenten brachten uns die Nachricht, daß Kreuzer mit Streuvorrichtungen ausgerüstet werden, von deren Zweck man noch keine Kenntnis hat.«
Die Falten auf der Stirn des Regenten vertieften sich.
»Der Ingenieur Isenbrandt! Er ist das Haupt unserer Gegner. Längst hätte er unschädlich gemacht werden müssen.
Geht es einmal vom Ili los, muß Wierny das erste Ziel sein … Nein! … Wierny muß früher fallen. Den Schiedsspruch beantworten wir sofort mit dem Aufstand der russischen Kirgisen. Wie weit ist er vorbereitet?«
Der Generalstabschef antwortete:
»Es bedarf nur eines Funkens, um ihn auflodern zu lassen. Die Irredenta arbeitet gut. Die Sprengung am Terekdamm zeigt, wozu die kirgisischen Brüder fähig sind.«
Die Linke des Regenten ballte sich zusammen.
»Die Schmelzarbeit war schlecht! Sie ist die Scherereien nicht wert, die wir jetzt darum haben …
Man verlangt von uns Entschuldigungen und Wiedergutmachung. Wir behandeln die Angelegenheit dilatorisch.
Da man uns von der Errichtung des Ilidammes bei Terek offiziell nicht benachrichtigt hat, konnten wir ihn als nicht existierend betrachten. Damit entfällt für uns die Pflicht, allen Schaden zu ersetzen. Ohne den Dammbruch wäre die Katastrophe nicht so bedeutend gewesen …«
Ein grimmiges Lächeln huschte über die Züge des Schanti.
»… Unsere Schmelzarbeiten werden jetzt in einem Maße fortgesetzt, daß der Wiederaufbau des Dammes nur mit größten Schwierigkeiten vonstatten gehen könnte.
Aber vielleicht wird die Compagnie ihn gar nicht wieder aufbauen, da sie ihn bei einem für sie günstigen Schiedsspruch nicht mehr braucht.
Das Schiedsgericht … das will über unser altes Recht urteilen! … und wird es vergewaltigen … allen geschichtlichen Tatsachen zum Hohn.
Uns gehört das Ilital! Zu uns gehört es nach Bevölkerung und Geschichte!
Wir werden es festhalten! Allen Schiedssprüchen zum Trotz … und wenn die Götter es wollen, auch alles Land uns vereinigen, in dem unsere Brüder wohnen, die zu uns wollen.
Das war das Ziel des kaiserlichen Herrn … das sollte sein großes Werk krönen. In seinem Namen rufe ich euch zur Tat. Alles, was sich dem entgegenstellt, muß beseitigt werden. Der Kämpfer im Westen darf hinter sich keine Feinde haben.«
Der Gouverneur von Jünnan gab seinen Bericht:
»Alle wichtigen Plätze des Südens sind mit Regimentern aus dem Norden belegt. Jeder Versuch eines republikanischen Aufstandes wird scheitern.«
Der Regent fragte weiter. Jeder war seiner Aufgabe nachgekommen. Es fehlte nichts als der Tag.
Ein Dutzend Augenpaare ruhten fragend auf dem Regenten. Der Schanti sprach:
»Sie wissen, nicht alle Völker der Welt sind frei vom Haß gegen die Weißen. Was daraus folgt, wird sich bald zeigen. Im Kampf werden wir nicht allein stehen.
Betreiben Sie Ihre Rüstungen und Vorbereitungen so, daß zum 6. Juli erfolgen kann, was will.«
Der Rat war auseinandergegangen. Der Regent saß allein in seinem Zimmer, als ihm Collin Cameron gemeldet wurde. Der Schanti blickte auf ein vor ihm liegendes Aktenstück, das die Telegramme Camerons enthielt.
»Ich habe gesehen, daß Sie die Aufgabe in den Staaten gelöst haben.«
»Es ist geglückt, Hoheit … besser als ich zu hoffen wagte. Sogar ein Teil der Führer hat sich bereit finden lassen, auf meine Vorschläge einzugehen. Es hat viel Mühe gekostet und … viel Geld.«
»Das ist ohne Bedeutung … am 6. Juli! … Werden Sie drüben sein? … Ich lege Wert darauf … Haben Sie sonst noch etwas Wichtiges zu dieser Angelegenheit zu sagen?«
»Ja, Eure Hoheit! Es gab Verräter … Unser Plan in seiner ersten Form hatte feindliche Mitwisser …«
»Wieviel?«
»Ich weiß es nicht. Einer der gefährlichsten … einer, der mir persönlich nachgestellt hat, ist in China gefangen.«
»Wer ist das?«
»Es ist der Freund Isenbrandts, der amerikanische Vertreter der Chicago Press, Wellington Fox.«
»Wie wurde er gefangen?«
»Er kam in der Maske eines russischen Teehändlers von Kjachta nach Urga. Wollte dort eine Familie befreien, die der Gouverneur von Kaschgar wegen Konspiration mit der Compagnie verhaftet hatte. Ich habe alle Personen der größeren Sicherheit halber nach Karakorum bringen lassen.«
»Gut! Haben Sie irgendwelche Geständnisse abgelegt?«
»Nein, Hoheit.«
»So müssen sie dazu gebracht werden!«
Colin Cameron erschrak bis ins Innerste. An eine solche Wendung der Dinge hatte er nicht gedacht, als er die Angelegenheit dem Regenten vortrug. Mit Grauen und Entsetzen dachte er an die Mittel der chinesischen Rechtspflege.
»Wollen Eure Hoheit mir das übertragen?«
»Ja … Sie wissen am besten, was zu fragen ist … Die Gefangenen werden Karakorum nie wieder verlassen!«
Der Streik im Minengebiet des algerischen Atlas kam überraschend. Man hatte nicht erwartet, daß die Erhöhung der Schichten um eine Stunde täglich bei der schwarzen Bevölkerung auf solchen Widerstand stoßen würde. Zwar hatten sich die schwarzen Arbeiter bereit erklärt, die eine Stunde mehr zu fahren, aber nur gegen doppelten Lohn. Damit hatten sich die Unternehmer nicht einverstanden erklären können.
Die Arbeitsniederlegung war die Antwort der schwarzen Bergleute.
Die Unternehmer befanden sich in einer Zwangslage. Die französische Regierung drängte zu einer Entscheidung. Sie war mit Rücksicht auf die verwickelte Lage in Asien verpflichtet, dem europäischen Staatenbund beträchtliche Mengen afrikanischer Erze zu liefern. Dabei war der Preis so festgesetzt, daß die Unternehmer bei dem verlangten doppelten Lohn ohne Gewinn arbeiten mußten.
Die hatten gehofft, der Widerstand der Arbeiter würde bald in sich zusammenbrechen. Aber zweifellos waren fremde Emissäre am Werk, die jedes Nachgeben der Arbeiterschaft verhinderten.
Jetzt war es so weit gekommen, daß sogar die Verrichtung der Notstandsarbeiten verhindert wurde. Die Unternehmer sahen darin einen begründeten Anlaß, ein scharfes Vorgehen des Militärs zu verlangen. Wohl oder übel hatte die Regierung diesem Verlangen nachgeben müssen.
Auf dem Jaurèsschacht kam es zum ersten Zusammenstoß. Hauptmann Méchin von den Marokkoschützen ließ seinen Zug anlegen.
Noch einmal eine Aufforderung an die schwarzen Grubenarbeiter, auseinanderzugehen … den Platz zu räumen. Die dachten gar nicht daran, der Aufforderung Folge zu leisten. Sie fühlten sich in ihrem guten Recht und wollten der Forderung der Direktoren nicht nachkommen.
»Gerechtigkeit! … Arbeit! … Brot! … Keine Ausnutzung! schallte es der Truppe aus dem Haufen entgegen.
»Feuer!«
Scharf kam das Kommando von den Lippen des Hauptmannes.
Kein Finger krümmte sich, kein Schuß krachte.
Der Hauptmann stürzte nach vorn … die gespannte Schußwaffe in der Hand, entschlossen, die ersten Meuterer niederzuschießen. Da sah er die Gesichter der Soldaten, sah in die Augen der beiden Offiziere und begriff, daß seine Macht hier zu Ende war.
Von seiner Truppe verlassen … als Offizier entehrt …
Ein kurzer Augenblick, dann richtete er die Schußwaffe gegen sich selber. Ein Knall. Sterbend sank er nieder.
Aber der kurze scharfe Knall wirkte weiter. Auf die Truppe, die jetzt zu begreifen begann, daß das Blut, das dort in den Sand rann, viel anderes Blut fordern würde. Auf die streikenden Grubenarbeiter, unter denen unverkennbar Emissäre tätig waren.
Schon sprang einer von denen auf eine umgestürzte Tonne und hielt eine donnernde Ansprache. Zum Teil an die Arbeiter … mehr noch an die Soldaten gerichtet.
»Bravo! … Bravo! … Der Sultan wollte Hunderte von euch ermorden … Eure Brüder sind ihm nicht gefolgt … zu uns gehören sie … in unsere Reihen …«
Fahnen wurden geschwungen. Viele hundert Arme streckten sich den Soldaten entgegen.
Im Augenblick kam es zur Verbrüderung. Die einzelnen Soldaten wurden umarmt, auf die Schultern gehoben. Hilfreiche Hände nahmen ihnen die Gewehre, die Patronentaschen ab, und im Nu waren die Waffen in der Arbeitermenge spurlos verschwunden … in die Hände ganz anderer Leute übergegangen.
Ein schwarzer Korporal schwang sich im Augenblick zum Befehlshaber der führerlosen Truppe auf. In einer kurzen Ansprache wies er die Schützen darauf hin, daß ihr Blut nicht den Ausbeutern und deren selbstsüchtigen Zwecken, sondern den schwarzen Brüdern gehöre.
Die klirrenden Fensterscheiben des Verwaltungsgebäudes lenkten die Aufmerksamkeit der Menge von seinen Worten ab. Durch die Fensterhöhle konnte man schon einzelne Arbeiter beim Plündern beobachten.
Unwiderstehlich reizte der Anblick den ganzen Haufen. Ein paar große Schnapsfässer, aus den Kantinenräumen auf den Hof gerollt, taten das übrige.
Drei Tage waren die europäischen Zeitungen mit aufregenden Nachrichten aus dem nordafrikanischen Minengebiet gefüllt. Am vierten Tag meldete der offizielle Telegraph, daß es mit Hilfe der Truppen gelungen sei, der Lage Herr zu werden. Schon am ersten Tag hatte die französische Regierung mit Hilfe aller verfügbaren Flugschiffe die nötige Truppenmacht über das Meer geworfen. Mit Energie hatte man die Aufstandsbewegung niedergeschlagen und den Streik beendet.
Doch kaum hatten sich die Gemüter beruhigt, als neue Hiobsposten aus Afrika kamen … diesmal aus dem Sambesigebiet.
Hier war um die nach Millionen von Pferdestärken zählenden Wasserkräfte der großen Sambesifälle herum seit einem halben Jahrhundert eine gewaltige Industrie entstanden.
Hier war eine der Hauptquellen, aus denen die Wirtschaft des alten Europa neue Kräfte schöpfte. Hier, wo das tropische Klima die Zahl der weißen Bevölkerung von vornherein niedrig hielt, bildeten die schwarzen Arbeiter naturnotwendig den Hauptträger der industriellen Leitung.
In diesem Gebiet war es bisher nie zu Aufständen gekommen. Jetzt aber war auch hier die Lage bedenklich.
Jetzt weigerten sich die schwarzen Arbeiter ganz plötzlich, die größere Arbeitszeit weiter zu leisten. Auch hier wurde das Wirken fremder Emissäre zweifelsfrei festgestellt.
Schon waren die Unternehmer unter dem Druck der Regierungen bereit, den Forderungen nachzugeben, als die Dinge eine schlimme Wendung nahmen. In einer Nacht waren die Fabriken und Werke im Tschotigebiet von Ausständigen besetzt und die Werkleiter massakriert worden. Die Gefahr, daß das ganze dortige Industriegebiet verlorenging, war riesengroß.
Da zeigte sich die jahrhundertealte englische Kunst, Kolonialpolitik zu treiben, in hellstem Lichte. Mit vielen Versprechungen und Erleichterungen auf der einen, mit Energie auf der anderen Seite wurde die Ordnung wiederhergestellt. Doch waren es wieder bange Wochen, die Europa schwer bedrückten. Aber noch konnten es die wenigsten verstehen, ja nur ahnen, was die Signale zu bedeuten hatten.
Etwas anderes, ganz Unerklärliches ereignete sich in dieser Zeit an den europäischen Börsen. Langsam, aber unaufhaltsam sank der Kurs der Aktien der E.S.C.
Das Direktorium wurde mit Anfragen bestürmt. Seine Auskünfte vermochten die Sache nicht zu klären, keinen begreiflichen Grund für das Sinken der Papiere zu geben.
Eins stand fest. Der Anstoß zu dieser ganzen Baissebewegung war von Amerika gekommen. Das europäische Publikum war dann mit Angstverkäufen gefolgt. Aus dem Ball drohte eine Lawine zu werden.
Da kam ein Tag, an dem der Sturz zum Stillstand kam und der Kurs sogar einige Punkte gewann, um sich von nun an ganz langsam zu erholen.
Was war geschehen? Am Abend vor diesem Tag hatte eine Sitzung des Direktoriums der E.S.C. stattgefunden. Zum allgemeinen Erstaunen der meisten Teilnehmer war kurz nach der Eröffnung der Sitzung Georg Isenbrandt in das Zimmer getreten. Er folgte einer dringenden Einladung des Präsidenten.
Eine knappe Stunde hatte er gesprochen. War im Anschluß daran sofort nach Asien zurückgekehrt. Als die Mitglieder des Direktoriums nach der Sitzung das Gebäude verließen, zeigten ihre Gesichter nichts mehr von der Sorge, die bis dahin auf ihnen gelastet hatte.
Mittagsglut lag auf den Ruinen von Karakorum. Zerfallen waren die alten Paläste, in Trümmern lagen die Häuser. Nur noch wenige ärmliche Ansiedler hausten in den Überbleibseln der einstigen großen Hauptstadt.
Außerdem noch die Gefangenen Collin Camerons. Als damals Wellington Fox in Urga auftauchte, wußte Cameron sofort, daß der Aufenthalt der Witthusens entdeckt sei, daß Freunde am Werk wären, um sie zu befreien. Ein anderer sicherer Ort mußte für sie gefunden werden, und Cameron verfiel auf die alte Thingstätte der Mongolen, auf Karakorum. Hier, in der Schamowüste, fern von allem Verkehr, würde sie so leicht niemand suchen und finden.
Noch in der Nacht nach der Gefangennahme von Wellington Fox war eine Karawane aus Urga nach dem Südwesten aufgebrochen und hatte die Gefangenen nach Karakorum geschafft.
Seit vielen Jahrhunderten war die Stadt ein Trümmerhaufen. Aber unter den Ruinen gab es auch weniger verfallene, die zur Not bewohnbar waren. Einen solchen Bau hatte Collin Cameron für seine Gefangenen bestimmt. Die Wärter, die er ihnen mitgab, die würden sich auch nicht bestechen lassen. Dessen glaubte er sicher zu sein. Hatte er sie zur größeren Sicherheit doch noch den schmerzvollen Tod jenes bestochenen Wärters in Urga mit ansehen lassen, bevor die Karawane aufbrach.
Wellington Fox ging mit langen Schritten rastlos in dem von einer hohen Mauer umgebenen Hof ihres neuen Gefängnisses im Kreis entlang.
Hundertfünfzig Schritte in der einen Richtung, wenn er linksherum ging … hunderteinundfünfzig Schritte in der anderen Richtung, wenn er den Kreis an den Mauern und Wänden rechtsherum lief.
Diese Differenz von einem Schritt zwischen den beiden Richtungen schuf ihm unaufhörliches Nachdenken … und dieses Denken zusammen mit der körperlichen Bewegung des Rundganges bewahrte ihn vor jener trostlosen Erschlaffung, der Theodor Witthusen zu erliegen drohte.
Wellington Fox spazierte und zählte dabei:
»… Hundertneunundvierzig … hundertfünfzig … hunderteinundfünfzig … Himmeldonnerwetter, wie ist denn das möglich … es bleibt bei der unerklärlichen Differenz von einem Schritt … All right … versuchen wir es noch einmal in der anderen Richtung.«
Auf dem linken Absatz vollführte er eine energische Kehrtwendung. Doch bevor er den Marsch in der anderen Richtung wieder antrat, blieb er erst kurze Zeit stehen, zog das Tuch und trocknete sich den strömenden Schweiß von der Stirn.
Dann ging er wieder los und begann mechanisch die Schritte zu zählen. »… Eins … zwei … drei …«
Auf seinem Rundgang kam er an der Stelle vorüber, an der Witthusen im Schatten saß. Er blieb stehen und trocknete sich von neuem die Stirn.
»Eine schauderhafte Hitze, Herr Witthusen … Wie erträgt es Ihre Tochter?«
Mit einer matten Bewegung hob Witthusen den Kopf.
»Sie bleibt fast den ganzen Tag in ihrem Zimmer. Sie leidet und hofft …«
»Hofft sie auch, daß Isenbrandt uns schließlich auch hier entdecken und dem gelben Gesindel entreißen wird?«
»Sie hofft, Herr Fox … wir alle hoffen … auch andere Freunde bemühen sich um uns. Mr. Cameron ist in Peking und wird alles tun, um unsere Freilassung …«
»Mr. Cameron!«
Scharf und hart war Fox dem Alten ins Wort gefallen.
»Mr. Cameron! … Sie glauben, daß er …«
Jäh brach Wellington Fox seine Rede ab. Was hatte es für einen Zweck, sich mit Witthusen über Cameron zu unterhalten.
Wellington Fox machte sich wieder auf den Marsch. Dann blieb er stehen und betrachtete kopfschüttelnd den Himmel. Dessen stahlblauer Glanz begann einem verwaschenen Grau zu weichen.
Wellington Fox marschierte weiter. Jetzt war der ganze Himmel nur noch ein einziges dunkles Grau. Ein leichter Luftzug bewegte die Zweige der halbvertrockneten Bäume jenseits der Hofmauer.
Vor Witthusen machte Wellington Fox wieder halt.
»Sehen Sie den Himmel, Herr Witthusen?«
Der Alte blickte empor.
»Ich sehe … Regenhimmel? … Wolken hier in der Wüste, in der es oft jahrelang nicht regnet … das verstehe ich nicht, Herr Fox.«
Wellington Fox streckte die Hand aus und wartete, bis die ersten Tropfen ihm auf die Hand fielen.
Verständnislos blickte Witthusen auf die Hand von Fox.
»Regen … ich weiß nicht, was es zu bedeuten hat.«
Wellington Fox streckte beide Hände in das stärker fallende Naß. Dann vollführte er einen Luftsprung.
»Mann … Witthusen! Wissen Sie auch, wo der Regen herkommt?«
Witthusen blickte ihn stumm fragend an.
»Isenbrandts Werk ist das!«
»Ich verstehe Sie nicht, Herr Fox.«
»Und ich möchte Ihnen vorläufig nicht mehr sagen … Nur das eine noch, Isenbrandt ist auf unserer Spur!«
Stärker rauschte der Regen jetzt herab. Er zwang die Männer, das schützende Dach aufzusuchen.
Wellington Fox trat als erster ins Haus.
Maria Witthusen lag auf einem dürftigen Ruhebett.
»Es regnet, Fräulein Maria! Fühlen Sie die wunderbare Frische, die ins Zimmer dringt?«
Einen Augenblick schien Maria Feodorowna aus ihrer Apathie zu erwachen.
»Ja! … Es regnet?«
Dann sank sie wieder in ihre alte Teilnahmslosigkeit zurück. Fox überlegte einen Augenblick, wie er ihr die frohe Nachricht beibringen können. Er fürchtete, daß ein allzu jäher Umschwung der Empfindungen ihr Gefahr bringen könnte.
Die kleine kirgisische Dienerin Marias huschte an ihm vorbei und beugte sich zu ihr.
»Ein gutes Mittel für die kranke Herrin! Ein Mittel gegen die Kopfschmerzen. Ein durchziehender sartischer Händler gab es mir … Es wird der Herrin helfen. Er sagte, es muß so gebraucht werden, wie es dabei geschrieben steht.«
Bei der Nennung des sartischen Händlers hatte Wellington Fox aufgehorcht Er schritt an die Ruhestätte heran und nahm der Kirgisin das Päckchen aus der Hand.
»Geh! Deine Herrin ist müde. Ich werde es ihr später geben!«
Kaum hatte die Dienerin den Raum verlassen, so zerriß er mit fieberhaften Händen die Umhüllung. Eine Tube von der ihm so gut bekannten Form fiel ihm in die Hand. Mit schnellen Griffen löste er den Zettel, der sie umhüllte.
»An Wellington Fox oder die, die es bekommen!
Heute nachmittag um 5 Uhr 30 müßt ihr den Inhalt der Tube in ein Wassergefäß in eurem Zimmer schütten.«
Der Zettel in Maschinenschrift. Kein Name darunter.
»Ein vorzügliches Rezept! … Ein brillantes Rezept!«
»Was ist’s?«
Der alte Witthusen war zu ihnen getreten und ließ sich auf dem Rande von Marias Lager nieder. Er ergriff ihre Hände und streichelte sie leise.
»Was ist, Vater? Du schaust so froh?«
»Sprechen Sie weiter, Herr Fox … Sie werden es besser sagen können.«
»Also, Fräulein Maria! Hier ist das beste Mittel gegen Ihre Kopfschmerzen, das es in der Welt gibt.«
»Sie kennen das Mittel?«
»Jawohl! Es wird hergestellt und vertrieben von meinem Freund Georg Isenbrandt!«
Maria erhob sich halb von ihrem Lager. Ihre Augen wanderten zwischen Fox und ihrem Vater hin und her.
»Von Isenbrandt? Was ist’s«, drängte sie. »Sagen Sie es, Herr Fox! Was schickt uns Georg Isenbrandt?«
Fox lächelte spitzbübisch.
»Das Mittel, um Sie von Ihren Kopfschmerzen und uns aus der Gefangenschaft zu befreien … Er selbst ist gekommen.«
Mit einem Ruck erhob sich Maria Feodorowna. Alle Müdigkeit, alle Erschlaffung war von ihr gewichen. Sie eilte zur Tür. Ihre Augen suchten forschend durch das fahle Grau. Mit gierigen Atemzügen zog sie die frische Kühle ein.
»Sein Bote! … Der Regen!« sagte Witthusen.
Maria drehte sich um und schaute ihren Vater fragend an.
»Wann kommt er selbst?«
»Bald, Kind! … Bald kommt er und bringt uns Freiheit.«
Ein Zittern ging durch Marias Gestalt. Witthusen nahm sie in seinen Arm und führte sie zu ihrem Lager zurück.
»Zuviel des Guten! Mut, Kind! … Mut!«
Wolkenbruchartig strömte jetzt der Regen herab. Schon bildete der ganze Hof eine einzige Lache.
»O Gott, was für ein Unwetter!«
»Ein Unwetter, das uns die Freiheit bringt.«
»Kann ein Mensch Sturm und Wetter senden, wie er will? … Erinnern Sie sich, Herr Fox. Wir sprachen auf der Fahrt von Orenburg nach Ferghana darüber. Es war der Punkt, an dem die Künste Ihres Freundes versagten.«
»Damals, Fräulein Maria!«
»Und heute?«
»Und heute ist es … vielleicht anders.«
Eine kurze Pause des Schweigens. Unterbrochen durch schwere Donnerschläge und zuckende Blitze. Inmitten der strömenden Regengüsse kam ein Gewitter von unerhörter Stärke zum Ausbruch.
Erschreckt drängte sich Maria an ihren Vater. Die kleine Kirgisin kam wieder in den Raum. Verstört und hilfesuchend. Das Unwetter schien den Weltuntergang einzuleiten.
Jetzt war es ganz dunkel in dem Zimmer. Nur die Blitze warfen durch die kleinen, hoch unter der Decke liegenden Fenster ihre jähen Reflexe.
Wellington Fox allein blieb ruhig und äußerlich wenigstens unbewegt. Wieder zog er die Uhr.
»Zwanzig Minuten nach Fünf.«
In einer Pause zwischen zwei Donnerschlägen klangen die Worte durch den Raum.
Der Regen begann jetzt milder zu fallen. Aus dem Wolkenbruch wurde ein Landregen.
Seltener wurden die Donnerschläge, seltener die zuckenden Blitze. Aber die Helligkeit im Raum wurde nicht geringer. Der Himmel selbst schien zu leuchten.
Wellington Fox lief bis an die Hoftür. Er streckte die Hände in den Regen und zog sie mit einem Aufschrei zurück. Kochendes Wasser hatte ihn verbrüht.
Er kehrte in das Zimmer zurück und rieb sich die schmerzende Hand. Spürte dabei, wie die Wärme auch im Zimmer zunahm.
Wellington Fox sah auf die Uhr.
»Halb sechs!«
Mit schnellem Griff löste er den Verschluß der Tube, schüttete den ganzen Inhalt auf den Krug, warf auch die Tube nebst Deckel hinein. Trat dann wieder zu den Witthusens.
Wie Feuer leuchtete der Himmel durch die Fenster. Soweit das Firmament durch die kleinen Öffnungen zu übersehen war, schien es in Flammen zu stehen.
Noch einmal wagte Wellington Fox den Gang bis zur Hoftür. Schon auf dem Flur vom Zimmer bis zum Hof schlug ihm drückende Hitze entgegen.
Dann stand er einen Augenblick an der geöffneten Tür und sah, wie aus dem Wasserregen ein Feuerregen geworden war.
Die brennende Hitze trieb Wellington Fox zurück. Er schlug die schwere Bohlentür hinter sich zu und eilte über den Flur wieder in das Zimmer.
Erfrischende Kühle umfing ihn hier. Er blickte zum Tisch.
Wo er vor kurzem noch den Krug gesehen hatte, lag jetzt ein gewaltiger massiver Eisblock. Graue Nebel umwallten ihn, liefen über die Tischplatte, fielen schwer zu Boden und wogten durch das Zimmer, um an den Wänden langsam emporzusteigen. Nebel, die eine herbe Kälte durch den ganzen Raum verbreiteten.
Wellington Fox begann den Plan des Freundes zu begreifen. Da draußen tobte die Wut des Dynotherms, ließ Feuer vom Himmel fallen und vernichtete alles Leben, soweit es in den Ruinen vorhanden war. Hier drinnen bei ihnen in diesem kleinen Raum arbeitete die Macht des Antidynotherms der Glut entgegen und schützte ihr Leben.
Mit wunderbarer, genau abgemessener Genauigkeit vollzog sich das Spiel und Gegenspiel der Riesenkräfte und ließ in der brennenden Ruinenstadt hier allein einen Ort, an dem das Leben den allgemeinen Untergang überstehen konnte.
Mit Staunen und Grauen sahen die Eingeschlossenen das furchtbare Schauspiel. Auch dem sonst nie um Worte verlegenen Fox fehlte die Sprache.
Unablässig fiel das Feuer … bis es nach langer Zeit schwächer wurde.
Nur noch matt glänzten jetzt die Fensteröffnungen. Ganz allmählich ging dort der gelbe Schimmer in einen grünlichen über.
Eine Viertelstunde … und dann noch eine.
Ein Geräusch schreckte sie aus ihrer Erstarrung empor.
Ein Rasseln an der Außentür. Ein Poltern, als ob sie in Trümmern zusammenstürzte.
Dann Schritte auf dem Flur.
Die Tür zum Zimmer wurde aufgerissen. Rotgolden flutete das Licht der Abendsonne in den Raum. Vor ihnen stand Georg Isenbrandt.
»Hurra! Gerettet!« schrie Wellington Fox.
Mit erhobenen Armen eilte Theodor Witthusen auf den Retter zu.
Doch der sah sie beide nicht. Seine Augen waren auf Maria gerichtet.
»Maria!«
»Georg!«
Mr. Garvin streifte nachdenklich die Asche von seiner Zigarre. Sein Blick glitt über die Abhänge des Matteostocks und die blaue Flut des Stillen Ozeans, um dann an der Gestalt von Wellington Fox haften zu bleiben.
Anders als damals in Wierny blickte Francis Garvin heute auf den Journalisten, der in lässiger Haltung auf der schmalen Balustrade saß und vergnügt mit den Beinen schlenkerte, als hätte er eben irgendeine Belanglosigkeit zum besten gegeben. Schon der gute Humor, mit dem Fox seine Abenteuer in Urga und Karakorum erzählte, hatte dem kühlen Geschäftsmann gefallen.
»Und niemand hat außer Ihnen beizeiten die schwere Gefahr erkannt, die unser Land bedroht?«
»Keine Seele! Als ich dem Meister unseres Weißen Ordens hier in Frisko die nötigen Mitteilungen machen wollte, feierten sie gerade das hohe Fest des Holundermarks …«
Garvin schaute ihn fragend an.
»Was ist das?«
»Ein Humbug in Reinkultur. Der Meister hatte gerade die Zeremonie beendet, als ich ihn um eine Unterredung bat.
Ich habe selten ein so erstauntes Gesicht gesehen bei einem Mann, der doch sonst als kluger und energischer Politiker bekannt ist.«
Garvin lachte.
»Und weiter?«
»Ich mußte es bewundern, wie schnell und richtig er dann aber die Sache anfaßte und seine Maßnahmen traf.«
»Wurden Sie nicht daraufhin um dreizehnundeinhalb Grad hinauf befördert?«
»Stop, Sir! Wenn Sie heute in sechs Wochen noch sind, was Sie heute sind, werden Sie es nicht in letzter Linie dem Weißen Orden verdanken. Wer unseren Orden mit den alten KuKluxKlan-Leuten vor hundertfünfzig Jahren verwechselt, der befindet sich in einem schweren Irrtum. Der Geist ist ein ganz anderer geworden … und andere Wege verfolgt er zu seinem Ziel. In den kommenden Wochen wird er die Feuerprobe bestehen …«
Garvin wiegte in leisem Bedenken das weißbuschige Haupt.
»Ich bezweifle die Richtigkeit Ihrer Mitteilungen nicht, lieber Fox. Doch möchte es mir scheinen, als ob Sie die Gefahr als zu groß ansehen …«
Wellington Fox deutete mit der Hand auf die blaue Küste.
»Meine Ansicht ist die, Mr. Garvin, daß es sich empfehlen dürfte, Ihre Jacht fahrbereit hier unten zu Ihrer Verfügung liegen zu haben … Es sei denn, daß Ihre Liebe zu Helen nicht so groß wäre als meine …«
»Was ist mit Helen?«
Mit einem Sprung war Helen über den Marmorboden hin auf die beiden zugeeilt. Fox glaubte, sie wolle ihm um den Hals fallen, fühlte sich aber mit einem energischen Ruck nach vorn gezogen. Ein kräftiger Klaps von Helens kleiner Hand bewies ihm noch näher, daß er mit seiner ersten Vermutung im Irrtum gewesen war.
»Wellington! … Was bist du für ein fürchterlicher Mensch! … Du sitzt da auf der Balustrade wie in einem Klubsessel, während es hinter dir fünfzig Meter in die Tiefe geht. Und du, Pa, siehst das mit an?!«
Der alte Garvin schmunzelte.
»Ich halte Mr. Fox für viel zu klug, um hier herunterzufallen … Und wenn er’s täte, würde es ihm wahrscheinlich auch nichts schaden.«
»Pa …«, klang es vorwurfsvoll aus Helens Mund. »Wie kannst du so etwas sagen. Ich meine, du solltest doch jetzt anders über Wellington denken.«
»Tue ich auch, mein liebes Kind! Meine Hochachtung ist immer mehr gestiegen, je länger ich ihn kenne. Jetzt bin ich schon beinahe so weit, daß ich auch das große Geschäft, das er mir damals in Aussicht stellte, nicht mehr für eine Fata Morgana halten würde.«
»Oh, wie freue ich mich darüber, Pa! Einen Kuß für dich und zwei für Wellington!«
Helen fiel ihrem Vater um den Hals.
In der Redaktionsstube des Frisco Black Herald saß der Redakteur Johnson in einem von den Motten reichlich angefressenen Polsterstuhl. Ihm gegenüber stand Collin Cameron.
»Gut, daß Sie kommen, Mr. Cameron! Die Arbeit in den letzten Wochen war fürchterlich. Sie hat viel Schweiß gekostet und viel Geld …«
Dabei warf Mr. Johnson eine leere Brieftasche auf den Tisch.
»Schon gut!«
Collin Cameron zog ein Scheckbuch aus der Tasche, riß ein Formular heraus, füllte es mit einer hohen Summe aus und legte es vor sich hin.
»Berichten Sie! Aber vermeiden Sie auch die kleinste Unrichtigkeit.«
Mr. Johnson verrenkte sich fast die Augen, um die Summe auf dem Scheck zu lesen. Doch vergeblich. Mit einem Seufzer lehnte er sich in sein Stuhlwrack zurück.
»Das Programm, das wir bei Ihrem letzten Besuch aufstellten, ist erfüllt. Auch die Führer … Smith von den Mortonwerken, Wessels vom Hafen und Bavery sind gewonnen … war sehr kostspielig.«
»Wird Ihr Anhang diesen Führern auch unter veränderten Umständen folgen?«
»Oh … wenn Smith, Wessels und Bavery rufen, bleibt keiner zurück.«
»Die Waffen?«
»Unsere Lager sind gefüllt … können jederzeit auf die Bezirke verteilt werden. Das Hafenvolk besitzt schon genügend Waffen.«
»Ist etwas vom Weißen Orden zu fürchten?«
Ein Grinsen verzerrte das Gesicht Johnsons.
»Der Weiße Orden? … Der feiert seine Feste … Es wird wie alle anderen überrumpelt werden.«
»Der Plan für den 6. Juli steht fest. Erstes Ziel ist Nob-Hill. Das lockt auch das weiße Gesindel … bindet Militär und Polizei …
Die Hauptmasse bemächtigt sich währenddessen der öffentlichen Gebäude und der Flugstation. Sie haben die Liste der prominenten Leute, die sofort als Geiseln gefangenzusetzen sind.
Johnson nickte zustimmend.
»Wo Widerstand geleistet wird, kein Zögern und keine Schonung!«
»All right, Sir!« … Johnson zögerte einen Moment … »Wie ist’s mit den Schiffen und Flugzeugen, Mr. Cameron?«
»Sie kennen die Taktik. Immer weiße Gefangene unter die Trupps nehmen! Dann wird man nicht wagen, zu schießen.«
»All right, Sir!«
»Ist sonst noch etwas?«
»Ja, Mr. Cameron.«
»Was denn?«
»Das Geld!«
Collin Cameron deutete auf den vor ihm liegenden Scheck und griff nach seinem Hut.
»Hier, Mr. Johnson! Ich gehe nach Louisiana. Vor dem Wahltag bin ich noch einmal hier.«
Ohne Gruß verließ er das Zimmer. Noch ehe sich die Tür geschlossen hatte, schoß Johnson auf den Scheck zu. Mit gierigen Augen überflog er die Summe.
Die Wahlkampagne um den Gouverneursposten von Louisiana war seit Wochen im Gange. Je näher der Wahltag kam, desto erregter wurde die Stimmung.
Zum erstenmal in der Geschichte der Union war die Losung: Hie Weiß, hie Schwarz!
Die Propaganda der Weißen und der Schwarzen arbeitete mit riesenhaften Summen.
In New Orleans, der Hauptstadt des Staates, tobte der Kampf am heftigsten. Täglich bewegten sich große Züge der Parteien durch die Hauptstraße.
Reden und Versammlungen wuchsen allmählich ins Ungemessene. Serien von Rednern auf den öffentlichen Plätzen lösten sich ab.
Die Zeitungen füllten ihre Spalten nur noch mit Wahlnachrichten. Obwohl man mit Josuah Borden einen Mann von untadeliger Gesinnung und Vergangenheit aufgestellt hatte, wurde seine Person von der Presse durch den Schmutz gezogen.
Im großen Saal der City-Hall von New Orleans sprach Josuah Borden. Der riesige Raum war bis auf den letzten Platz gefüllt.
An einer bevorzugten Stelle innerhalb des Komitees saß Collin Cameron. Die glänzende Rede Josuah Bordens, die häufig von lebhaften Beifallsbezeigungen unterbrochen wurde, ging wirkungslos an seinem Ohr vorüber, das durch die vielen Reden dieses Wahlkampfes schon abgestumpft war.
Seine Gedanken weilten in Karakorum. Bevor er, dem Befehl des Regenten folgend, nach den Staaten flog, war er nach der Ruinenstadt gegangen, um da reinen Tisch zu machen. Er war innerlich bereit, seine ganze Vergangenheit abzuwerfen, an der Seite Marias ein neues Leben zu beginnen. Glückte ihm das … ließ sich Maria dazu bereit finden, dann wollte er auch dem Journalisten das Leben schenken.
In dieser Stimmung war er nach Karakorum gekommen … und fand einen Kirchhof in der Wüste.
Von seinen Gefangenen keine Spur! Waren sie mitverbrannt? Oder waren sie entkommen, bevor die Katastrophe eintrat?
Katastrophe? … Was war das für ein furchtbares Ereignis gewesen? … Es lebte niemand, der ihm hätte Auskunft geben können. Eine Feuersbrunst von ungeheurer Gewalt mußte gewütet haben.
Aber was war denn Brennbares da? Das wenige Holz konnte eine derartige Hitze nie entwickeln.
Irgendwie mußte es von außen gekommen sein. Ein Erdbeben mit feurigem Ausbruch? … Nein! … Das hätte die Ruinen umstürzen … andere Spuren hinterlassen müssen.
Wie konnte es sonst geschehen sein? Ein Naturereignis? Kaum denkbar!
Menschenwerk? … Seit dem Anblick der Ruinen lebte ein Verdacht in ihm. Er war noch stärker geworden, als Collin Cameron in Frisko von Johnson erfuhr, daß dort sein alter Unterschlupf, die Opiumhöhle, auf rätselhafte Weise ein Raub der Flammen geworden sei.
Kaum ein Mensch auf der gelben Seite war so hinter die Geheimnisse Isenbrands gekommen wie er. Faßte er alles zusammen, so drängte sich ihm immer wieder der Schluß auf: Die Katastrophe mußte Isenbrandts Werk gewesen sein.
Eine Stimme, schneidend und scharf, riß ihn aus seinem Sinnen. Er stützte die Hände auf den Tisch, an dem er saß, und starrte auf die Tribünen. Dann sank er zurück und legte die Hand auf die Augen. Noch einmal ließ er sie fallen und schaute auf.
Es war kein Zweifel. Da stand er, der Journalist Fox, den er tot geglaubt hatte. Der Freund Isenbrandts. Auf der Rednertribüne stand er und sprach als erster Diskussionsredner gegen Josuah Borden.
Collin Cameron hörte nicht auf die Worte, mit denen Wellington Fox jetzt dem Redner des Tages in die Parade fuhr. Er sah nur die verhaßte Gestalt seines Feindes.
Seine Gedanken überstürzten sich. Wie kam Fox hierher? … Wo war Maria? … Wer hatte die Gefangenen befreit und gerettet?
Er senkte den Kopf, als habe ihn ein schwerer Schlag getroffen. Die Pläne des Regenten … alles, wofür er gekämpft hatte, schien ihm bedroht … verloren.
Dann straffte er sich. Eine maßlose Wut tobte in ihm. Er rief den Führer des Schutztrupps zu sich. Ein paar leise geflüsterte Worte.
Ihre Wirkung zeigte sich bald. Bei der nächsten scharfen Wendung, die Wellington Fox gebrauchte, brach der Gegensturm los. Johlende Protestrufe erschollen von allen Seiten. Eine Masse Schwarzer ballte sich plötzlich um die Rednertribüne zusammen.
Der Redner war in höchster Gefahr. Da brach plötzlich aus einer anderen Ecke ein weißer Stoßtrupp durch. Noch ehe die Schwarzen an ihn herankonnten, war Wellington Fox von sehnigen, kräftigen Gestalten umringt, die alle das Abzeichen des Weißen Ordens trugen.
Minutenlang preßten die Parteien gegeneinander. Von beiden Seiten flogen wüste Schimpfreden. Wer würde mit Tätlichkeiten beginnen?
Collin Cameron hatte sich halb bewußt von der Strömung mitreißen lassen. Nur wenige Schritte trennten ihn von seinem Gegner. Das Auge Wellington Fox’ zeigte keine Überraschung. Er hielt den Wutblicken Collin Camerons mit lächelndem Gleichmut stand. In diesem Moment gelang es der Versammlungsleitung, rechts und links Saaltüren zu öffnen und die feindlichen Parteien langsam auseinanderzudrängen.
Kaum fühlte Wellington Fox die Hände frei, als er Collin Cameron höchst vergnüglich zuwinkte.
»Auf Wiedersehen ein andermal, Mr. Cameron. Die Gelegenheit war diesmal nicht günstig, um Ihnen von Karakorum und seinen Gästen zu erzählen. Ihre zweifellos berechtigte Neugierde wird bald befriedigt werden …«
Vom Pamir bis zum Altai und westwärts bis zum Uralgebirge brach es fast gleichzeitig los. Die alten Herren des Landes, die Kirgisen, rüttelten an ihrem Joch.
Vom Osten war der Ruf zu ihnen gedrungen. In jahrelanger Arbeit hatte die Irredenta die Saat reifen lassen.
Der erste Angriff ging gegen die technischen Anlagen. Hier wurden Kanäle zerstört und Schleusen geöffnet … dort Staudämme gesprengt … dort Brücken unterminiert und Wege ungangbar gemacht. Es fing als eine planmäßige Sabotage an.
Aber als die ersten Nachrichten kamen, daß auch Dynothermlager der Compagnie zum Brennen gebracht waren, da wußte man, daß es mehr als Sabotage war.
Die Siedler griffen zu ihren Verteidigungsmitteln. Die Polizeitruppen waren Tag und Nacht mobil. Wo sie hinkamen, schafften sie Ordnung. Sobald sie den Rücken kehrten, ging es wieder los.
Und es blieb nicht bei diesen Zerstörungsakten einzelner. Es kam zur regelrechten Bandenbildung in den Grenzgebieten. Die Ausrüstung und Organisation war dabei derartig, daß die fremde Unterstützung außer allem Zweifel war.
Sogar Flugzeuge standen den Banden zur Verfügung.
Kurz nach Sonnenaufgang kam der vom Baron von Löwen geführte Compagniekreuzer in das obere Amutal. Hier befanden sich gewaltige Stauanlagen, die das von den Bergen kommende Wasser auffingen und in einem Kanalsystem über das Siedlungsland im alten Turkmenengebiet verteilten.
Hier hatte die E.S.C. vor zwanzig Jahren ihre Arbeiten begonnen … richtiger gesagt, die alten Arbeiten der russischen Regierung in technisch viel vollkommenerer Weise fortgeführt. Dicht besiedelt war das Land hier. Lebenswichtig für das Gedeihen der Siedlung war das gute Funktionieren des Kanalsystems und der Stauanlage.
Georg Isenbrandt war seit Beginn des Aufstandes Tag und Nacht unterwegs. Der Kreuzer des Herrn von Löwen war seit Tagen sein ständiges Quartier. Als das Schiff jetzt an der großen Schleuse von Kula Kul niederging, kam sofort der Adjutant des Generals Bülow, der Hauptmann Averil Lowdale, an Bord, um Rapport abzustatten.
Mit gespanntem Interesse lauschte Isenbrandt dem Bericht des Offiziers. Erst in der vergangenen Nacht hatte es hier einen scharfen Kampf gegeben. Ein überraschend starkes Geschwader hatte nach Anbruch der Dunkelheit einen Angriff auf die Anlagen unternommen. Hauptmann Lowdale hatte ihn mit gutem Erfolg abgewehrt. Die Anlagen waren nur leicht beschädigt worden.
Der Hauptmann war mit seinem Bericht an Isenbrandt zu Ende.
»Sie haben recht, Herr Hauptmann! Es hat keinen Zweck, hier ständig große Kräfte zu binden. Es ist besser, das Übel bei der Wurzel zu fassen.
Ihre Meinung, daß die Angriffe über die gelbe Grenze herkommen, teile ich nicht. Sie mögen die Unternehmungen von dort aus unterstützen. Aber ich halte die Regierung von Peking für zu vorsichtig, sich eine derartige Blöße zu geben. Berichten Sie in diesem Sinne auch an den General. Er möchte die hiesigen Grenzgebiete durch eine schnelle Kreuzerflotte gründlich absuchen lassen. Es müßte doch mit dem Teufel zugehen, wenn die Burschen nicht zu finden wären.«
Eine Viertelstunde später strich der Kreuzer in niedrigem Fluge langsam über die Kämme der Grenzgebirge. In der Zentrale stand Hauptmann Lowdale neben Isenbrandt und verfolgte an Hand der Karte und der Erklärungen Isenbrandts das unter dem Kreuzer langsam hingleitende Gelände.
Jetzt teilte sich der Gebirgskamm. Der eine Rücken ging nach Nordosten, der andere nach Osten. Herr von Löwen ließ den Kreuzer dem Nordostkurs folgen.
»Halt, Herr von Löwen! Wo wollen Sie hin?«
»Der Grenze folgen, Herr Isenbrandt.«
»Die Grenze läuft auf dem Ostkamm weiter.«
»Unmöglich, Herr Isenbrandt. Hier, bitte, die Karte!«
»Dann ist die Karte hier ungenau! Nehmen Sie auf meine Verantwortung den Ostkurs.«
In scharfem Winkel bog der Kreuzer auf den befohlenen Kurs ab. Gebirgswüste dehnte sich unter ihnen. Kein Baum und Strauch, geschweige denn ein Zeichen menschlichen Lebens. Jetzt strichen sie an dem Eingang eines nach Süden laufenden Seitentales vorbei.
Während der Hauptmann und Baron von Löwen vorwärts blickten, suchte Isenbrandt die Talmulde mit seinem Perspektiv ab. Die Kämme ringsherum waren mit leichtem Firneis bedeckt. Nur an einer Stelle brach der kahle Fels ohne jede Spur von Eis und Schnee durch.
Wie war das möglich? Nach der Gebirgsbildung mußte auch hier Schnee liegen. Isenbrandts Auge ruhte unverwandt auf der Stelle.
Nur Menschenhände konnten hier gewirkt haben.
Isenbrandt nahm das Glas von den Augen und überlegte. Augenscheinlich war hier in letzter Zeit mit Dynotherm geschmolzen worden. Von seiten der Compagnie konnte es nicht geschehen sein.
»Ruder Steuerbord!« kam es scharf von seinen Lippen. Überrascht sahen ihn seine Begleiter an. Noch während der Kreuzer das Kommando ausführte, folgte sein zweiter Befehl:
»Höhensteuer!«
In steiler Fahrt strebte das Schiff größere Höhen an, während sein Kurs es über jene Talmulde hinführte.
»Bombe bereit.«
»Wir haben sie, Herr Isenbrandt! Der Teufel hätte sie hier suchen sollen!« schrie von Löwen.
Der geübte Blick des alten Schiffsführers hatte jetzt auch erkannt, daß diese Talmulde einen mit raffinierter Kunst kaschierten Flughafen verbarg. In geschickter Weise war ein Teil der Mulde mit einem leichten Gerüst überbaut und die Bedachung, um die Täuschung vollständig zu machen, mit einer dünnen Sanddecke belegt.
»Bombe ab!«
Noch ehe der Lufttorpedo seinem Rohr entglitt, öffneten sich wie von Geisterhänden bewegt weite Luken in der Sandfläche. Wie ein Schwarm aufgescheuchter Krähen schoß ein halbes Dutzend schneller kleiner Schiffe daraus hervor, die sich sofort auseinanderzogen und den Compagniekreuzer einkreisten.
Ehe weitere Schiffe folgen konnten, erreichte der Lufttorpedo sein Ziel. Ein Blitz! Noch bevor der Donner der Explosion den Kreuzer erreichte, sah man von dort aus die furchtbare Wirkung. Weit aufgerissen klaffte jetzt die Decke dieses heimlichen Hafens. Vernichtet mußte alles sein, was darunter verborgen war.
Die Insassen des Kreuzers hatten keine Zeit, sich weiter um die Trümmerstätte zu kümmern. Die Schar der Angreifer beanspruchte ihre volle Aufmerksamkeit.
Schon arbeiteten die Batterien des Kreuzers und feuerten aus allen Rohren. Aller Wahrscheinlichkeit nach mußte das Compagnieschiff mit den Gegnern schnell fertig werden. Seine gute Panzerung bot ihm gegenüber den ungepanzerten Angreifern einen wesentlichen Vorteil. Diese schienen sich auch auf einen ernsten Kampf nicht einlassen zu wollen. Sie suchten die Entfernung zwischen sich und dem Kreuzer ständig zu vergrößern, wobei sie abwechselnd nach rechts und links entflohen und fliehend feuerten. Ihr Bestreben ging dahin, die nahe Grenze zu gewinnen.
Isenbrandt erkannte das Manöver. In forcierter Fahrt suchte er ihnen den Weg zu verlegen. Das Manöver, rücksichtslos ausgeführt, war für das Triebwerk der Motoren zu stark.
Eine Welle brach. Splitter der brechenden Welle gerieten in die Zentralsteuerung. Sie wurde ungangbar. Es gab keine andere Möglichkeit, als mit größter Vorsicht den Boden aufzusuchen und die Hemmungen in der Steuerung zu beseitigen.
Mit einem Fluch gab Herr von Löwen den Befehl zur Landung.
»Die Kerls haben Glück! Da ziehen sie ab. Sie entkommen über die Grenze!«
Schwerfällig setzte der Kreuzer auf dem Boden auf, nicht weit von den Trümmern des zerstörten Hafens. Infolge der gelähmten Steuerfähigkeit mußte er auf dem schrägen Hang einer Mulde landen.
Während Herr von Löwen sofort seine Techniker an die Reparatur setzte, verließen Isenbrandt und Lowdale das Schiff. Mit ihren Gläsern verfolgten sie die am Südosthorizont kaum noch sichtbaren Schiffe.
»Schade, Herr Isenbrandt, um die verpaßte Gelegenheit, den Burschen einmal eine gründliche Lektion zu geben. Ich will mir das so geschickt gebaute Nest mal aus der Nähe besehen.«
Isenbrandt hatte nur mit halbem Ohr zugehört. Seine Gedanken folgten den flüchtigen Feinden in der Luft. Seine Augen hafteten an der Steuerbordbatterie des Kreuzers. Infolge der schrägen Lage des Schiffes zeigten auch die Geschütze eine anomale Überhöhung. Es mußte möglich sein, in dieser Stellung eine ganz außergewöhnliche Schußweite zu erreichen.
Isenbrandt hatte seinen Entschluß gefaßt. Ohne sich nach dem Adjutanten umzusehen, der auf den zerschossenen Hafen zuschritt, eilte er in den Kreuzer zurück und stieg in die Batterie.
Der Batterieraum war verlassen. Neben den Geschützen standen die schußfertigen Granaten. Nicht ohne Anstrengung schraubte Isenbrandt den Zünder einer Schrapnellgranate ab und entfernte die Ladung aus dem Geschoß. Dann griff er nach einer in der Nähe stehenden Wasserkanne und füllte das Hohlgeschoß mit dem Naß. Jetzt ließ er eine Zinntube hineingleiten und schraubte den Zünder wieder auf.
Schnell war ein Geschütz mit der so veränderten Granate geladen. Ein Druck auf den Feuerknopf. Krachend fuhr der Schuß aus dem Rohr. Leicht schwankte der Kreuzer unter dem Rückstoß hin und her.
Während das Echo des Schusses noch vieltönig von den Bergwänden zurückgeworfen wurde, ertönte plötzlich Maschinengewehrfeuer von den Hafenruinen her. Der Kanonenschuß hatte die Besatzung des Kreuzers schon alarmiert. Sie sahen Isenbrandt neben dem Geschütz stehen und glaubten zunächst, er hätte nach dem Flughafen geschossen.
Jetzt nahm Isenbrandt sein Glas, um den Ursprung des Maschinengewehrfeuers zu erspähen. Und sah mit Schrecken, wie Averil Lowdale in weiten Sprüngen über die Sandfläche hin auf den Kreuzer zueilte. Ihm galt zweifellos das Feuer.
»Verflucht! Sind doch noch einige Halunken dem Torpedo entgangen … Ah …«
Georg Isenbrandt preßte die Lippen zusammen. Er sah Averil Lowdale fallen.
Hastig eilte er nach unten. Aber als er die Bordtür öffnete, kam ihm der Adjutant schon entgegen. Er preßte mit der Linken den rechten Arm fest an. Eine Blutspur zeichnete seinen Weg. Sein Gesicht war blaß. Keuchend stand er an der Treppe. Mit kräftigen Armen hob ihn Isenbrandt hinein. Die ersten Gewehrkugeln prasselten gegen den Schiffsrumpf.
»Gott sei Dank, Herr Hauptmann! Ich fürchtete das Schlimmste, als ich Sie stürzen sah. Sie werden sofort verbunden werden. Hoffentlich ist die Verletzung nicht allzu schwer.«
Er geleitete Averil Lowdale zu Herrn von Löwen, der dem Verwundeten seine Hilfe angedeihen ließ und den Arm sorgfältig bandagierte.
»Ich bin kein Doktor von Profession, Herr Hauptmann«, sagte er lachend, »aber ich kann Ihnen doch mit einiger Sicherheit sagen, daß der Schuß ungefährlich ist. Immerhin wird er Sie für ein paar Monate dienstunfähig machen.«
Isenbrandt sah auf die Uhr.
»Ist der Maschinenschaden noch nicht behoben?«
»Sofort, Herr Isenbrandt. Es kann sich nur noch um Minuten handeln.«
»In zwei Minuten müssen wir fertig sein!«
»Warum?«
»Blicken Sie auf den Horizont über den Kämmen im Südosten! … Sehen Sie die zackigen, gelben Wolken? … Da braut sich ein Unwetter zusammen. Es darf uns nicht am Boden überraschen.«
Der Kommandant schaute prüfend nach der angegebenen Richtung.
»Oho! … Sie haben recht, Herr Isenbrandt … Da braut sich allerlei zusammen … Der fahle Himmel … die gelben Wolken … das bedeutet nichts Gutes …«
Er eilte zum Barometer.
»Richtig! Das Glas ist plötzlich um zwei Zentimeter gefallen … fällt sichtbar weiter … Wenn wir hier nicht im Hochland von Pamir wären, würde ich wetten, daß uns ein starker Taifun bevorsteht … Unerklärlich … Hier habe ich dergleichen noch nie erlebt … nie gehört, daß es hier geschehen wäre …«
»Fertig!« kam die Meldung von unten.
»Bravo! Höchste Zeit!« sagte Löwen. »Los!«
Langsam richtete sich das schrägliegende Schiff auf. Die Propeller gingen an, und in glatter Fahrt verließ es den Landungsort.
»Volldampf nach Norden!« lautete der Befehl.
Es war hohe Zeit gewesen, daß der Kreuzer die Gewalt über sein Element zurückgewann, der Orkan brach los.
Ein Wirbelsturm von unerhörter Stärke, gegen den selbst dieser starke Kreuzer nicht direkt ankämpfen konnte. Während das Schiff in weitem Bogen über das iranische Hochland gerissen wurde, setzte Herr von Löwen seine ganze Steuerkunst daran, sich Meter um Meter vom Zentrum dieses Taifuns loszuringen, das ganz offenbar dort hinten über den Südostkämmen jenseits der Grenze lag.
Bis endlich die Grenze der Sturmzone erreicht und überschritten war, bis der Kreuzer mit voller Maschinenkraft in einer ruhigen Atmosphäre den geraden Kurs nach Norden verfolgen konnte.
Durch die großen Heckscheiben der Kabine blickten die beiden Männer zurück nach dem Süden und Südosten. Da stand es wie ein riesenhafter und unheimlicher Trichter von schwefelgelber Farbe über den Bergen. Wie eine gigantische Saugpumpe hatte der wirbelnde Orkan den Staub und Sand vieler Quadratmeilen emporgerissen und führte ihn in immer größere Höhen. Alles, was in diesen Strudel gelangte, ihm nicht rechtzeitig mit eigener starker Kraft zu entfliehen vermochte, wurde gepackt, in das Zentrum gerissen, zerrieben und zerschmettert.
Lange blickte Herr von Löwen durch sein scharfes Glas. Er glaubte Trümmerstücke von zerrissenen Flugmaschinen inmitten des Höllenwirbels zu sehen.
»Was wir nicht vermochten, tut die Natur. Aller Berechnung nach sind die Gelben mitten im Taifun. Da kommt kein Flügel lebendig zur Erde.«
Isenbrandt nickte.
»Ich denke auch. Und damit wird hoffentlich für lange Zeit hier Ruhe herrschen …«
In Wierny hatten Witthusen und Maria nach ihrer Befreiung aus der Ruinenstätte Karakorums einen sicheren Zufluchtsort gefunden. Auf der niederen Veranda, die das Haus umgab, saßen Isenbrandt und Marias Vater.
Aus dem kühlen Schatten des Halbdaches sah man weit hinaus in die fruchtbare Landschaft.
»Ein gesegnetes Jahr!« sagte Witthusen. »Wer wie ich Turkestan noch vor einem halben Menschenalter gekannt hat, wird es immer wieder mit Staunen sehen, wie Menschengeist und Menschenhand die Sandwüsten in ein fruchtbares, dichtbesiedeltes Land verwandelt haben. Sollte das Paradies hier wirklich der Erisapfel zwischen Europa und dem Gelben Reich werden?«
Isenbrandt zuckte die Achseln. Er hatte die Worte Witthusens nur halb vernommen. Sein Auge hing noch an der Tür, hinter der Marias Gestalt soeben verschwunden war. Die Ereignisse der letzten Wochen hatten die Herzen der beiden rascher und fester miteinander verbunden, als jedes werbende Wort es sonst wohl vermocht hätte.
Sie hatten sich damals in Karakorum die Hände gereicht und in dem stürmenden Pulsschlag, der zu ihrem Herzen überströmte, hatte sich offenbart, was der Mund noch verschwieg … jetzt noch verschweigen mußte.
In Wierny hatte sich Witthusen alsbald mit seinen alten Geschäftsfreunden in Kaschgar in Verbindung gesetzt, um sich sein Besitztum und seine Warenvorräte zu sichern. Sie waren immer noch von den Chinesen beschlagnahmt, und es bestand wenig Hoffnung, sie freizubekommen.
Jetzt, nachdem die Gefangenen dem Arm der chinesischen Machthaber entronnen waren, beeilte man sich, das illegale Verfahren in ein gesetzmäßiges zu verwandeln. Ein regelrechter Prozeß wegen Landesverrates wurde gegen Witthusen eingeleitet. Bis er beendet, konnten Jahre vergehen.
Die Sorge um seinen Besitz und um die Zukunft Marias trübte den Blick Witthusens. So waren ihm die feinen Fäden entgangen, die sich zwischen Isenbrandt und Maria woben. Am Ende eines arbeitsreichen Lebens sah er sich als Bettler, und der Gedanke an die Zukunft ließ ihm die Freude über die Rettung aus der Gefangenschaft manchmal vergessen. Auch jetzt hatte er wieder einmal seinen Sorgen Luft gemacht und halb im Scherz und halb im Ernst für Marias Zukunft ein wenig rosiges Prognostikum gegeben. Da hatten die beiden einander lächelnd in die Augen gesehen, bis ein Zucken um Marias Lippen spielte, bis ein leichter Schleier sich vor ihre Augen legte. Klopfenden Herzens war sie aufgesprungen und in das Haus geeilt. Wie gebannt hing der Blick Isenbrandts an der Tür, durch die sie geschritten war.
»Daß ich von Mr. Cameron so furchtbar getäuscht worden bin, kann ich immer noch nicht verwinden«, fuhr Witthusen fort. »Wäre er nicht gewesen, würde ich mein Haus in Kaschgar schleunigst liquidiert und mich mit dem Erlös rechtzeitig in Sicherheit gebracht haben. Zu spät muß ich einsehen, daß das ganze Verfahren gegen mich nur auf die Intrigen dieses Menschen zurückzuführen ist.
Ich kenne ihn nun schon seit vielen Jahren und habe ihn stets für einen Gentleman gehalten. Ich kannte seine Geschichte, und ein gewisses Mitleid mit seinem harten Geschick ließ den Verkehr mit ihm enger werden. Er hat in den ersten Jahren unserer Bekanntschaft häufig von seinem Prozeß um die englische Lordschaft erzählt. Seine Verbitterung war mir durchaus verständlich, und ich machte ihm kein Hehl aus meinen Sympathien. Daß er aber in seinem Haß so weit gehen könnte, als Agent der chinesischen Regierung tätig zu sein, hätte ich niemals für möglich gehalten.«
»Die Engländer waren durchaus im Recht, als sie die Erbschaft Lowdale zusprachen.«
Eine gewisse Schärfe lag in der Erwiderung Isenbrandts, und in der gleichen Tonart fuhr er fort: »Wir wissen, daß es früher weite Kreise der Bevölkerung gab, denen die Gleichberechtigung aller Menschen auf der Welt gleichgültig war. Wir wissen aber auch, daß die unterdrückten Völker mit Erfolg ihren Ruf nach Freiheit und Gleichberechtigung erschallen ließen. Nur die Erfüllung dieser Wünsche und das Zusammenarbeiten aller Völker und Rassen sichert der Menschheit die weitere Existenz vor der drohenden gegenseitigen Vernichtung.«
»Sie haben recht, Herr Isenbrandt. Die Zeiten sind vorbei, da man glaubte, von der Überlegenheit der weißen Rasse sprechen zu müssen.
Ich kenne China seit einem Menschenalter. Der Aufschwung der letzten Jahrzehnte wird anhalten. Die durchaus konservative Gesinnung der Chinesen hindert ihn nicht, sie fördert ihn. Obwohl China als Industriestaat noch jung ist, ist es an wirtschaftlicher Organisation schon sehr weit entwickelt. Soziale Fragen existieren fast nicht. Trotz der ungeheuren Ausdehnung ist von einem Ende des Reiches bis zum anderen bei der eingeborenen Rasse ein und dasselbe Verständnis für die Kultur verbreitet, die es besitzt. Vergleiche ich seine jahrtausendealte Zivilisation mit der europäischen, so kommt mir die letztere vor wie eines jener auf Zeit auftauchenden Eilande, welche die Gewalt unterseeischer Vulkane über den Meeresspiegel emporgehoben hat. Der zerstörenden Einwirkung der Strömungen preisgegeben und von den Kräften, die sie zuerst gehalten, verlassen, geben sie eines Tages nach, und ihre Trümmer versinken wieder in den Fluten …«
»Alles ist im Fließen, alles in der Entwicklung, Herr Witthusen. Einmal wird vielleicht die Bürde des weißen Mannes von seinen Schultern genommen werden, und ein stärkerer wird sie auf sich nehmen. Aber der Tag liegt in grauer Ferne. Noch sind die Kräfte der weißen Rasse nicht verbraucht. Die Gefahren, die ihr drohen, werden ein Jungbrunnen für sie sein.
Große Taten, größer als die Welt ahnt, harren ihrer.
Was Sie in Karakorum sahen … war nicht allein mein Werk … nicht in erster Linie … es war das Resultat der Geistesarbeit vieler Intelligenzen vor mir und mit mir. Andere werden daran weiterarbeiten, andere werden neue Leistungen von noch viel größerer Tragweite vollbringen. Und sie werden sich auswirken zum Nutzen der ganzen Menschheit!
Doch lassen wir das, kommen wir zum Zweck meines heutigen Besuches zurück. Ich möchte Sie bitten, Wierny zu verlassen und weiter im Westen, jenseits des Urals, einen Zufluchtsort zu suchen. Die Ereignisse der letzten Tage haben gezeigt, daß der Aufenthalt in Turkestan mit Gefahren verknüpft ist. Es könnte sein, daß der Kirgisenaufstand vom Ilidreieck aus neu geschürt und gestärkt wird. Die nahe Lage Wiernys zur Grenze dürfte bedenklich sein.«
»Schon wieder den Wanderstab ergreifen?«
Maria sprach es. Ungehört war sie aus dem Haus getreten und stand jetzt fragend vor ihm. Sie war in ein dunkles, hoch hinauf schließendes Hausgewand gekleidet, das ihre schlanke, ebenmäßige Gestalt vortrefflich hervortreten ließ.
Ein Ruck ging durch Isenbrandts Körper. Als er sie so vor sich stehen sah, hätte er sie in seine Arme nehmen, sie an sich pressen mögen. Das Blut schoß ihm jäh in das Gesicht. Mit Gewalt beherrschte er sich, zwang sich zu einem Lächeln.
»Der Wanderstab ist nicht vonnöten, Maria Feodorowna. Mein Flugschiff bringt Sie nach Orenburg.«
… Orenburg … Sein geistiges Auge sah in schnellen Bildern noch einmal die Szenen ihres ersten Zusammentreffens.
»Von Orenburg bringt Sie das Postschiff sicher nach Odessa oder Moskau.«
Witthusen fiel ihm ins Wort: »Nun, dann mag die Reise auch noch ein paar tausend Kilometer weiter gehen. Dann fahren wir weiter nach Deutschland, der Heimat unserer Ahnen. Ich habe noch Guthaben dort stehen, die uns einen längeren Aufenthalt gestatten. Einmal wird ja doch der Tag kommen, wo wir ungefährdet zurückkehren werden.«
»Er wird kommen … bald!«
»Sie sagen das mit solcher Zuversicht, Herr Isenbrandt?« »Bald kommt der Tag!«
Georg Isenbrandt sagte es lächelnd. Aber es war ein rätselhaftes Lächeln, das nur den Mund bewegte.
Er wandte sich zu Maria und reichte ihr die Hand.
»So sei es dann heute ein Abschied für Ihre Reise. Eine Gebirgstour zu unseren Schmelzstellen hält mich eine Zeitlang von hier fern. Ich werde, bevor Sie Wierny verlassen, nicht zurückkehren können. Leben Sie wohl, Maria Feodorowna. Wir sehen uns bald wieder … bald.«
Einen kurzen Moment ruhten ihre Blicke ineinander, ihre Finger umschlossen sich zu festem Druck.
Vor einem mit Plänen bedeckten Tisch saß General Bülow, neben ihm der russische Oberst Popoff. Wie zwei Schachspieler bewegten sie kleine, bunte Nadelfähnchen auf den Karten hin und her. Ihr lebhafter Disput bewies, daß sie sich über die endgültige Stellung der Fähnchen keineswegs einig waren.
Seitdem die Lage an der chinesischen Grenze sich zuzuspitzen begann, hatte das Hauptquartier in Petersburg den Obersten mit einigen anderen Offizieren dem Generalstab der E.S.C. Truppen attachiert. Für den Kriegsfall unterstanden die militärischen Streitkräfte der E.S.C. dem vereinigten europäischen Oberkommando.
Der früher so lange Zeit hindurch als Ideologie abgetane Gedanke der Vereinigten Staaten von Europa war unter dem Druck der Weltgeschehnisse wenigstens zu einem Teil verwirklicht worden. Zwar war kein geschlossenes Staatsgebilde im Sinne der amerikanischen Union zustande gekommen. Aber die Solidarität der europäischen Völker fand bei voller Wahrung der nationalen Selbständigkeiten und Eigenarten dadurch Ausdruck, daß bei Fragen der großen Weltpolitik nicht jeder einzelne kleine Staat, sondern Europa als geschlossenes Ganzes auftrat und handelte.
Hinter den Kulissen war freilich ein steter Kampf um die Stellung des primus inter pares. Rußland glaubte in erster Linie Anspruch darauf zu haben.
Schon unter dem Kommando des Generals Effingham war das Verhältnis zum Petersburger Hauptquartier nicht reibungslos gewesen. Der temperamentvolle Bülow war fast ständig auf Kriegsfuß mit dem Oberkommando. Dessen Anordnungen erfolgten stets unter dem Gesichtspunkt, unbedingt die sibirischen Grenzen zu schützen.
Gegen diese Kräfteverteilung kämpfte Bülow schon seit langem. Immer wieder versuchte er es durchzusetzen, daß die Hauptkräfte auf die turkestanische Linie konzentriert wurden.
Die Gebirgszüge des Thian-Schan, Alatau und Tarbagatai boten an sich eine gewaltige, kaum überschreitbare Schutzmauer. Jedoch nur so lange, als es gelang, die drei Durchgangspforten abzuriegeln. Der Übergang von Kaschgarien nach Ferghana war verhältnismäßig leicht durch Sprengung der Kunstbauten an der Gebirgsbahn Kaschgar – Osch zu sperren. Viel größere Schwierigkeiten bot die dsungarische Pforte, jenes Tor, durch das sich schon einmal im Mittelalter die mongolischen Schwärme über Europa ergossen hatten. Der dritte gefährliche Punkt aber blieb die chinesische Angriffsbastion, das Ilidreieck.
Ein großartig angelegtes Bahnnetz, das von Chami aus strahlenförmig zur Grenze führte, gab hier den Gelben Gelegenheit, ihren Nachschub schnellstens durch die offenen Pässe zu leiten.
Der Kirgisenaufstand im Siedlungsgebiet hatte Europa notgedrungen den Anlaß gegeben, seine Streitkräfte im Osten zu verstärken. Während die russischen Abteilungen in Sibirien in volle Bereitschaft gebracht wurden, sammelten sich jenseits des Urals Teile der vereinigten westeuropäischen Heere.
Aber die immer noch divergierenden Einflüsse der verschiedenen europäischen Kabinette ließen umfassende Maßnahmen, wie die Lage sie erfordert hätte, nicht zu. Ein überraschender Angriff von chinesischer Seite nach Westen hin hätte mit den vorhandenen Mitteln nicht lange aufgehalten werden können. Bülow verlangte daher immer wieder, daß wenigstens das Gros der russischen Luftflotte zur Verteidigung der turkestanischen Grenze angesetzt würde.
Jetzt, nach einem letzten langen Kampf mit dem Obersten Popoff sah er das Vergebliche seiner Bemühungen ein.
»Meine Meinung von Ihnen, Herr Oberst, ist viel zu hoch, als daß ich annehmen könnte, Sie billigten die Pläne des Hauptquartiers. Ihre Gegenargumente trugen so wenig den Stempel der Überzeugung, daß es eines besseren Beweises für die Richtigkeit meiner Ansicht nicht bedarf. Wenn nicht in kurzer Zeit erhebliche Verstärkungen aus Westeuropa ankommen, stehe ich hier auf verlorenem Posten. Gnade Gott den Siedlern!«
»Sie sehen zu schwarz, Herr General«, erwiderte der Oberst, indem er seine Verlegenheit nur schlecht verbarg. »Ist es doch noch ganz ungewiß, ob und wann die Gewitterwolke zur Entladung kommt. Übrigens sind, wie mir vor kurzem gemeldet wurde, starke deutsche Truppenmassen vom Ural her im Anfliegen.
Sichern Sie hauptsächlich das Ilital, Herr General. Für das Irtyschtal können Sie im Falle der Not auf russische Verstärkungen rechnen.«
»Das Ilital! Sehr schön, Herr Oberst«, entgegnete Bülow in bitterem Ton. »Ich könnte es, wenn ich mehr Flugschiffe hätte. So werde ich voraussichtlich das Siebenstromland preisgeben müssen.«
Sein Adjutant trat ein und überbrachte ihm eine Karte. »Georg Isenbrandt«, las er. Ging hinaus, um ihn zu empfangen.
Der streckte ihm die Hand entgegen und begrüßte ihn. »Immer noch die gefurchte Stirn, Herr General?«
»Man verliert die Lust, Herr Isenbrandt, wenn man immer wieder gegen Unvernunft und Eigennutz anrennt.«
»Kommen Sie mit mir, Herr General! Zu einem kleinen Gang ins Freie. Vielleicht sehen Sie danach etwas freundlicher aus.«
Sie verließen die Stadt und schlugen den Weg zu einer kleinen Anhöhe ein, von der man nach allen Seiten einen freien Blick hatte. Weithin sichtbar dehnte sich die in voller Frühlingspracht stehende Landschaft vor ihnen aus. Nicht umsonst galt das Siebenstromland als die Riviera Westsibiriens.
»Wieder war mein Kampf umsonst, Herr Isenbrandt, dieses Paradies vor dem Untergang zu bewahren. Der Russe will keine Vernunft annehmen. Solange es geht, werde ich es zu verteidigen suchen. Aber ich weiß bestimmt, daß ich eines Tages das ganze Gebiet bis zum See hin räumen muß. Bei Telek will ich den Gelben ein Thermophylä errichten. Ich glaube nicht, daß ich es länger als eine Woche halten kann. Die Bewohner müßten schon jetzt zur Räumung veranlaßt werden. Man möchte verzweifeln, wenn man daran denkt, daß die russischen Luftstreitkräfte uns das alles ersparen könnten. Vermögen Sie nicht noch einen letzten Schritt zu tun?«
Er blickte auf und sah, daß Isenbrandt ihm kaum zugehört haben konnte. Dessen Auge hing wie weltverloren an den fernen grauen Kämmen des Gebirges. Minuten verstrichen. Dann fielen die Worte von Isenbrandts Lippen:
»Nein, Herr General! Nein! Nichts wird von dem geschehen, was Sie befürchten! Mit eigener Kraft, ohne Hilfe der anderen werden wir das Land schützen, den Feind abwehren.«
Den General drängte es zu fragen. Aber ein Blick auf die Züge des Ingenieurs ließ die Frage verstummen. Da begann dieser wieder zu sprechen.
»Sie werden, Herr General, alles, was an schnellen Flugzeugen zu Ihrer Verfügung steht, ohne Rücksicht auf die Ladefähigkeit hier in Wierny konzentrieren und zu kleinen Geschwadern zusammenstellen. An dem Tage, an dem es gilt … ich werde ihn bestimmen … werden Sie von einem Orenburger Schiff der Compagnie die Ladungen für dieses Geschwader empfangen. Die Geschwader werden die Grenze überfliegen. Jedes Geschwader bekommt vor dem Abflug sein bestimmtes Ziel … und das Ziel wird sein … Wasser … Wasser überall dort, wo gelbe Streitkräfte in größeren Mengen versammelt sind …«
»Wollen Sie dampfen? … Dynothermdampf?«
Isenbrandt überhörte die Frage.
»Kämpfe sind nur anzunehmen, wenn es zur Erreichung des Zieles unvermeidlich ist.«
»Das dürften nicht viele sein, die gegen die Übermacht ihr Ziel erreichen.«
»Ich rechne zehn Prozent«, kam es kalt von den Lippen Isenbrandts. »Das wird genügen.«
»Und was wird dann geschehen?« drängte der General, indem er an Isenbrandt herantrat.
Einen Augenblick stand Georg Isenbrandt wieder wie geistesabwesend. Dann neigte er seinen Mund zu dem Ohr des Generals und sprach zu ihm … flüsternd, als fürchte er, der Wind könne die Laute an menschliche Ohren tragen.
Und während er sprach, trat Grauen in die Augen des Generals.
Sein Auge starrte auf die frühlingsprangende Landschaft, als sähe er die fürchterlichen Bilder der Vernichtung, des Todes …
Mit Gewalt raffte er sich zusammen. Er warf einen schrägen Blick hinüber zu dem anderen. Der stand starr. Wie aus Marmor gehauen die bleichen, kantigen Züge. Die Augen regungslos in die Ferne gerichtet.
»Es wird geschehen, wie Sie es befehlen«, kam es da von den Lippen des Generals.
»Noch heute! Sofort! Kommen Sie!«
Sie schritten der Stadt zu.
»Der Kaiser … der Sohn des Himmels … tot.«
Um die Mittagsstunde war es dem chinesischen Volk kundgegeben worden. Bis in die entferntesten Teile des Landes hatte der Telegraph die Nachricht verbreitet. Und während noch die Herzen der Millionen unter dem Eindruck der Ereignisse standen, kam die zweite Botschaft:
»Schanti, Tothon-Khan, der Herzog von Dobraja, ist Regent.«
Da regte es sich im Lande. Gefesselte Hände zerrten an ihren Banden. Gefesselte Zungen wollten sprechen. Und dann war es wieder still wie am Tage zuvor.
In der Nacht, die dazwischen lag, hatte die Faust des Schanti schon zugegriffen. Was gegen ihn war, befand sich in den Händen seiner Häscher. Die Stimmen der führerlosen Gefolgschaft wurden schwächer, und dann verstummte alles vor der Wucht der neuen Losung:
»Krieg den Europäern!«
Wie ein Steppenfeuer lief es durch die weiten Ebenen des Reiches und entflammte alle Geister.
Und dann schallte es weiter und fand sein Echo auf der ganzen Erde … Krieg!?
Es war um die sechste Morgenstunde desselben Tages. Toghon-Khan saß im großen Beratungszimmer des Palastes. Die fensterlosen Wände waren bedeckt mit großen und kleinen Karten. Die langen, niederen Tische waren verborgen unter den Stößen von Papieren und Plänen.
Die kleine Gestalt des Regenten verschwand fast in dem großen Sessel. Er schien zu schlafen. Die Augen waren geschlossen, die Lippen fest zusammengepreßt. Die ganze Nacht hatte er allein in dem Raum zugebracht. Ruhelos war er von einer Karte zur anderen geschritten, immer wieder die Stellung der kleinen Nadelfähnchen prüfend und vergleichend, immer wieder Zahlenkolonnen zusammenstellend und gegeneinandersetzend.
Dann hatte er sich in den Sessel geworfen und versucht, in kurzem Schlaf Erholung zu finden … Um sieben Uhr waren seine Generale zu ihm befohlen.
Mit halbgeschlossenen Lidern blickte er vor sich hin. Der Schlaf wollte die Herrschaft über ihn gewinnen. Nur noch undeutlich sah er die Papiere auf den Tischen … weite, weiße Flächen …
Seine Hände umkrampften die Lehnen, sein Oberkörper beugte sich vor.
Schnee …!
Er fiel in den Sessel zurück und preßte die Hände auf die Augen.
Was war das damals am Tage des Einzuges des Kaisers? Schwerer Schnee aus lichtem Frühlingstag …
War es ein Zeichen des Himmels? War alles Menschenwerk? Werk dieses einen da drüben? Dann …
Mit jähem Ruck riß er sich empor, die Augen weit geöffnet. Das Weiße vor ihm gewann feste Gestalt, es waren die weißen Papiere, die dort auf den Tischen lagen. Nervös fuhr er sich über die Augen.
Menschenwerk? Nein! Kein Mensch würde jemals so tief in die Geheimnisse der Natur eindringen, kein Mensch jemals die Folge der Zeiten verändern können.
»Zuviel habe ich gearbeitet in den letzten Wochen … zuviel war es, was meine Nerven spannte. Ruhe brauche ich … die Ruhe wird kommen, wenn die Würfel gefallen sind.«
Er drückte auf den Bronzeknopf. Ein Adjutant trat ein.
»Die Generale!«
Sie traten in den Raum. Die Feldherrn des großen KubelaiKhan. Seine Kampfgenossen.
Sie verneigten sich tief. Toghon-Khan setzte sich. Schweigend nahmen die anderen ihre Plätze ein.
Sein Blick glitt prüfend über die Versammelten.
»Es ist geschehen!« kam die Antwort.
»Sind unsere Hände frei, um das große Werk, das der Kubelai-Khan begann, zu vollenden?«
»Sie sind es!«
»Das Schiedsgericht über das Ilidreieck hat gegen uns entschieden! … Heute nacht kam die Nachricht zu meinen Händen. Daß es so kommen würde, wußtet ihr alle. Ein Glied des Reiches soll von uns gerissen werden. Wir werden das nicht dulden!«
Er blickte in die Runde.
»Die Antwort an Europa, in der wir dem Schiedsgericht die Anerkennung verweigern, liegt bereit. Wir könnten es darauf ankommen lassen, ob sie es wagen, sich ihre Beute mit Gewalt zu holen. Ich bezweifle es sehr.«
Ein dünnes Lächeln umspielte seine Lippen.
Die Zeit ist gekommen! Morgen fällt die Entscheidung in Amerika. Sie wird das Signal sein für den Kampf aller gegen alle. Wir stehen nicht allein.
Die Europäer haben es gewagt, uns eine Drohnote zu schicken, weil Brüder von uns den Kirgisen zu Hilfe geeilt sind. Ich habe ihnen geantwortet, daß das Unrecht auf ihrer Seite liegt, und meinerseits gedroht, auf die Seite der Unterdrückten zu treten, wenn die grausamen Verfolgungen nicht sofort aufhörten. Als Antwort hat man gestern über zweihundert dieser Freiheitskämpfer an der Grenze des Kuldschagebietes erschossen.
Unsere Geduld ist erschöpft! Wir werden marschieren!«
Unbewegt hatten die Generale den Worten des Regenten gelauscht.
Die letzten Worte. »Wir marschieren!« zerbrachen alle diese Bande einer gekünstelten Ruhe.
Laute Rufe der Zustimmung schallten dem Regenten entgegen. Im Nu war er umringt.
Der Regent wartete, bis wieder Ruhe im Saal herrschte. Dann sprach er weiter:
»Unsere Bundesgenossen werden Kräfte und Mittel unserer Feinde fesseln. Europa wird reichlich in Afrika zu tun bekommen. Die amerikanische Industrie wird in den nächsten Wochen ruhen … die russische ein Ziel unserer Luftstreitkräfte sein. Das winzige Europa wird gegen Asien allein stehen. Wer kann da am Sieg zweifeln?
Morgen wird Europa eine Botschaft übergeben, die alles Gebiet bis zum Aral und Ural für unser Land erklärt!«
Einen Augenblick war es still. Die Größe des Planes ließ die Hörer erstarren. Dann brachen sie los. Sie knieten vor ihm. Sie küßten sein Gewand und seine Hände. Toghon-Khan schritt zum Tisch und griff einen Stoß der Papiere.
Es waren die Operationsbefehle.
In den Morgenstunden des 6. Juli hatte die Wahl in Louisiana begonnen. Je weiter der Tag fortschritt, desto größer wurde die Erregung.
Als die sechste Abendstunde die Wahl abschloß, war ganz New Orleans auf den Beinen, um so bald wie möglich etwas von den Ergebnissen des Wahlkampfes zu erfahren. In dem Zeitungsviertel stauten sich die Massen. Wie die Resultate aus den einzelnen Teilen des Staates einliefen, wurden sie in leuchtenden Darstellungen sofort zur allgemeinen Kenntnis gebracht.
Findige Unternehmer hatten sich sofort als Buchmacher aufgetan und konnten riesige Einnahmen verzeichnen. Je näher die Stunde der Entscheidung kam, desto größer wurden die Einsätze, desto größer die Erregung über die Ungewißheit des Ausganges.
Von 11 Uhr 30 Minuten an hatte es den Anschein, als würde es ein totes Rennen, so dicht standen die beiden Reiter im Bilde nebeneinander. Da, 11 Uhr 45 Minuten, fiel ganz unerwartet die Entscheidung. Mit einem gewaltigen Ruck schob sich der schwarze Kandidat durchs Ziel. Das Ziel war durch die Hälfte der gesamten Wählerzahl des Staates gegeben und in dieser bildlichen Darstellung durch einen leuchtenden Pfosten markiert. Wer es überschritt, mußte die absolute Majorität haben.
Die Spannung der schwarzen Zuschauermenge entlud sich zuerst in einem orkanartigen Gebrüll.
Die Weißen blieben die Antwort nicht schuldig. Auf Worte folgten Schläge. Hier im Zeitungsviertel kam es zu richtigen Straßenschlachten.
Der Morgen des nächsten Tages brachte die Ernüchterung. Jetzt lagen die genauen offiziellen Zahlenergebnisse vor. Der Sieg Josua Bordens gründete sich nur auf eine äußerst geringe Mehrheit. Bei der aufs äußerste gereizten Stimmung des ganzen Landes konnte die Regierung gar nicht daran denken, diese Wahl sofort zu bestätigen.
Die Erregung hielt die Massen auf den Straßen. Wo immer Zeitungstelegramme zu lesen waren, wurden sie von Scharen Neugieriger umlagert. In den Außenvierteln erneuerten sich die Schlägereien des vergangenen Tages.
Noch wilder wurden die Szenen, als in der Stunde des Geschäftsschlusses Nachrichten aus Afrika in die Menge platzten. Ihre Wirkung war am größten auf die Schwarzen.
Aufstand der Minenarbeiter im Randgebiet! … Aufstand der Schwarzen im Industriegebiet des Sambesi! … Neue Aufstände im nordafrikanischen Minengebiet! … Schwere Kämpfe mit weißen Truppen! …
Die Feuer, die im Norden und Süden Afrikas aufloderten, schlugen im Sambesigebiet zusammen. Die großen Kraftwerke gesprengt! … Die Energiequelle für das ganze Industriegebiet verschüttet. Die riesigen Turbinen zerstört, in denen die zehn Millionen Pferdestärken der Sambesifälle zur Nutzarbeit gezwungen wurden. Eine gewaltige Industrie auf unabsehbare Zeit lahmgelegt.
Den Telegrammen folgten ausführliche Berichte. Sie ließen die Größe der Gefahr erst im vollen Umfang erkennen.
Der Bericht über den Untergang der großen Sambesizentrale brachte grauenvolle Einzelheiten.
Auf die Kraftquellen folgten die Industriezentren. In sinnlosester Weise wurden hier die Arbeitsmöglichkeiten und Erwerbsquellen für Millionen auf Jahre hinaus zerstört.
Wo die Weißen in fliegender Hast in Südafrika einen bewaffneten Widerstand organisierten, wurden sie von den übermächtigen, wohlausgerüsteten schwarzen Massen überwältigt.
Die Nachrichten aus Europa gaben wenig Trost. Anscheinend stand man dort den Ereignissen ratlos gegenüber.
Wo immer auf der Welt Weiße regierten, schien das System zu wanken. Der Abend des gleichen Tages brachte eine Kunde, deren Auswirkungen in den Vereinigten Staaten schlimm gedeutet werden konnten.
Die Regierung in Washington versagte der Wahl von Josua Borden zum Gouverneur des Staates Louisiana die Bestätigung. Als Grund gab sie an, daß die verschiedenen Ungesetzlichkeiten beim Wahlvorgang kein klares Bild über die wirkliche Volksmeinung ergäben.
Wenn auch die Regierung es klugerweise vermieden hatte, sich auf jene so viel angefeindete Bill zu stützen, so war es doch der weißen Bevölkerung sofort klar, daß die Gegenpartei den Regierungsbescheid trotzdem auf die Bill hindrehen würde. Wie befürchtet, geschah es. Kaum war der Bescheid bekannt, als im ganzen Gebiet der Union eine maßlose Agitation gegen die Regierung ausbrach.
Noch in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli wurden in New Orleans alle Regierungsgebäude von farbigen Kräften besetzt. Im Morgengrauen befand sich die Stadt in den Händen einer schnell errichteten provisorischen Regierung. Die letzten Flugschiffe, die New Orleans in der Richtung nach Norden oder Nordosten verließen, überflogen die Zonen schwerer Kämpfe zwischen Weißen und Farbigen.
Aus Asien her drang am Morgen des 8. Juli eine neue Schreckenskunde durch die weiße Welt. Chinesische Truppen hatten an verschiedenen Stellen die Grenze überschritten. Das Ende Europas schien gekommen. Durch die Aufstände in der ganzen Welt jeder Hilfe beraubt, stand es allein dem gelben Riesenreich gegenüber.
Schon in der Nacht zum 8. Juli waren gelbe Luftgeschwader weit vorgestoßen. Ihre Bomben hatten wichtige Anlagen des Siedlergebietes bis zum Ural hin zerstört. Bis in die Industrieanlagen des Ural waren sie vorgebrochen und hatten schwere Vernichtungen hinter sich zurückgelassen.
Die Luftstreitkräfte der Weißen schienen zu schwach und zu machtlos zu sein, denn man hörte wenig oder gar nichts von Luftkämpfen. Man wußte wohl, daß das große russische Luftgeschwader die südsibirische Grenze verteidigte. Aber man hörte kein Wort von Angriffen nach jenem Ziele. Der gelbe Stoß ging glatt nach Westen. In der Luft schienen die Gelben in diesem Kampfe unwidersprochen die Oberhand zu haben. Mit Zagen erwartete man die ersten Nachrichten vom Zusammentreffen der Landstreitkräfte.
Am Abend des 7. Juli saßen General Bülow und Georg Isenbrandt in dessen Quartier in Wierny. Der General gab Bericht.
»Der Übergang von Kaschgar ist für große Truppenmassen unpassierbar. Die Reste des Telekdammes sind zur Verteidigung ausgebaut, so gut es in der kurzen Zeit möglich war. Die Berge zu beiden Seiten sind von unserer Artillerie besetzt. Ein Durchbruch durch das Ilital ist unmöglich. Wenn keine Umgehung gelingt, hält diese Stellung, bis die Verstärkungen heran sind.
Die dsungarische Pforte – sie steht offen! Was auf unserer Seite darunterliegt, ist auf dreihundert Kilometer geräumt. Die Russen haben weder Mann noch Schiff abgegeben.
Die Compagnieluftkräfte sind, wie Sie anordneten, in Wierny konzentriert. Abwehrmaßnahmen sind an den technisch wichtigen Stellen schnell organisiert worden, aber ich überschätze ihre Bedeutung nicht. Das Land ist gegen Luftangriffe so gut wie wehrlos. Die dsungarische Pforte steht offen. Dort ist der Weg auf dreihundert Kilometer frei.«
Georg Isenbrandt nickte.
»Gut, Herr General. Sie sagten dreihundert Kilometer … warum nicht noch etwas weiter?«
»Weil dort die besten Aufnahmestellungen waren!«
Georg Isenbrandt sann einen Augenblick.
»Es wird auch so gehen. Das Orenburger Schiff ist gekommen?«
Der General nickte.
»Die Übernahme seiner Ladung wird in einer Stunde beendet sein … Herr General! Diese Luftflotte hält sich alarmbereit. Ich vermute, daß in drei Stunden die Zeit, ihren Auftrag auszuführen, für sie gekommen sein wird.«
»Ich staune über die Genauigkeit Ihrer Nachrichten, Herr Isenbrandt!«
Um Isenbrandts Lippen spielte ein dünnes Lächeln.
»Gold wirkt auf beiden Seiten gut. Gegen Gift hilft nur Gegengift. Das ist eine alte Regel.«
Er brach seine Rede jäh ab und wandte sich der Wand zu, wo plötzlich der automatische Funkschreiber zu arbeiten begann. Seine Augen überflogen die Zeichen auf dem herausquellenden Papierstreifen.
»Hallo! Die Gelben fliegen ab … Unsere Dispositionen ändern sich. Die Geschwader, die ihre Ladung genommen, fliegen sofort nach ihren Zielen!«
Der General eilte in das Nebenzimmer. Durch seinen Adjutanten ließ er die telephonischen Befehle hinausgehen. Dann kam er zurück.
Georg Isenbrandt hatte inzwischen die Depesche zu Ende entziffert.
»In der Morgendämmerung werden die chinesischen Landstreitkräfte die Grenze überschreiten. An der sibirischen Grenze nur mit schwachen Kräften. Der Hauptstoß dort erfolgt später.«
General Bülow warf einen Blick auf die Karte.
»Man möchte verzweifeln, wenn man daran denkt, daß die russischen Luftstreitkräfte dort im Norden unbeschäftigt stehen und hier bitter fehlen. Wieviel Siedlerblut und -gut wird uns diese russische Hartnäckigkeit kosten?«
Georg Isenbrandt hatte sich erhoben.
»Herr General, ich gehe jetzt zu den Standplätzen unserer Flugschiffe. Sobald das letzte Geschwader von hier fort ist, fliege ich nach Norden zum Saisan-Nor. Wir treffen uns später in Semipalatinsk in Ihrem Hauptquartier.«
Am Abend des 7. Juli war Toghon-Khan in Khami angekommen. Hier liefen die Nachrichten von allen Stellen seiner Front ein.
Georg Isenbrandt hatte seinen Plänen durch die Errichtung des Dammes von Telek ein schweres Hindernis entgegengesetzt. Wohl war es seinerzeit gelungen, den Damm durch die Hochwasserkatastrophe und die Sprengung zum größeren Teil zu zerstören. Aber auch die gewaltigen Reste des Riesenbauwerkes boten den vorstoßenden chinesischen Streitkräften noch ein schwer überwindliches Hindernis. Wenn die Compagniekräfte ihrerseits eine plötzliche Schmelze in den Ilibergen verursachten, wenn die plötzlich zu Tal gehenden Wassermassen sich auch nur von den Kammruinen stauten, was das Tal für jede größere Truppenmenge kaum passierbar. Die Gebirge des oberen Ilitales waren daher schon seit Wochen unter einer derartigen Bewachung durch gelbe Luftstreitkräfte, daß an ein Schmelzen in größerem Stil nicht gedacht werden konnte.
Trotzdem war der Weg durch das untere Ilital außerordentlich erschwert. Nur wenn es gelang, die Compagniestellung an den Berglehnen zu umgehen, den Damm selbst zu nehmen und in seine Trümmer breite Durchfahrten einzusprengen, war die Passage für größere Heeresmassen möglich. An diese Aufgabe hatte der Regent seine besten Truppen aus den mongolischen Randgebirgen gesetzt. Von der Schnelligkeit, mit der hier der Vorstoß gelang, hing der Erfolg des Krieges ab.
Anscheinend viel einfacher gestaltete sich der Durchbruch im Irtyschtal. Durch seinen Nachrichtendienst hatte der Regent erfahren, daß die weißen Truppen jenes Tal beinahe bis Semipalatinsk hin geräumt hatten. Vergeblich hatte er mit seinem Stab die Gründe für diese Bewegung zu erforschen gesucht. Er wußte zur Genüge, daß er an dem General von Bülow einen erfahrenen, verschlagenen Gegner hatte. Daß hinter dieser unerklärlichen Maßnahme eine Finte stecken müsse, sah er ein. Aber welche?
Nur mit halbem Herzen schloß er sich der Ansicht seiner Generalstäbler an, die den Standpunkt vertraten, daß die Kompagniekräfte sich dorthin und auch noch weiter zurückziehen würden, bis starke europäische Truppen zu ihrer Aufnahme da wären. Seine Besorgnis war so groß, daß er noch in letzter Stunde große Teile der Nordarmee auf die dsungarische Pforte dirigierte. Weil aber die Eisenbahnen und sonstigen Verkehrsmittel schon durch die Transporte nach dem ersten Plan voll in Anspruch genommen waren, mußten diese zusätzlichen Streitkräfte in der Hauptsache marschieren.
Im Laufe des 8. Juli kamen die Meldungen der gelben Luftstreitmächte nach Khami. Vorflug ohne Widerstand!
Der Regent vernahm es mit Verwunderung. Gerade an der Grenze hatte er den stärksten Widerstand der Compagniekräfte erwartet.
Bombardements der Siedlungen!
Er geriet in Unruhe. Wo waren die Compagniekräfte? Das kampflose Vordringen verstärkte sein Mißtrauen immer mehr …
Wo konnte die Compagnieflotte stecken?
Die nächsten Meldungen brachten ihm Antwort. Eine Antwort, die freilich an Klarheit viel zu wünschen übrigließ.
Kleine Geschwader weit verteilt, überall in der Dsungarei! Aus unsichtbaren Höhen stießen sie, wie gemeldet wurde, herab.
Mit einem Gefühl der Erleichterung nahm der Regent die Meldungen auf. Die Entsendung vieler kleiner Geschwader schien darauf hinzudeuten, daß sie die Aufgabe hatten, den Anmarsch durch Bombenabwürfe zu stören. Die merkwürdige Tatsache, daß diese Geschwader allen Kämpfen fast ängstlich auswichen, mußte diese Auffassung bestärken.
Er hatte genug Luftkräfte in der Reserve, um diesen verstreuten Kompagniegeschwadern entgegenzutreten. Jetzt endlich glaubte der Schanti, den gegnerischen Plan zu durchschauen. Zeit gewinnen! Den Vormarsch in der Dsungarei erschweren und an der Front durch langsames Zurückgehen verzögern.
Der nächste Tag brachte Nachrichten von allen Seiten. Nachrichten, die wohl geeignet waren, den Regenten in seiner Auffassung der Lage zu bestärken.
Die Meldungen vom linken Flügel seiner Kräfte lauteten nicht günstig. Die Übergänge in das Ferghanatal waren durch Sprengungen und künstliche Hindernisse so erschwert, daß nur die Möglichkeit geblieben war, die Truppen in Transportkreuzern vorzubringen. Nur einem Teil dieser Kreuzer war es gelungen, Truppen unversehrt zu landen. Plötzlich waren hier starke Kampfschiffe der Compagnie aufgetreten und hatten der gelben Flotte schweren Schaden zugefügt. Es sah gerade so aus, als ob die Luftstreitkräfte der Compagnie hier bewußt Versteck gespielt hätten, um nach dem Durchflug der leichten gelben Luftkräfte nach Westen die schweren Panzerkreuzer, welche die Truppenkonvois begleiteten, mit unverbrauchten Kräften anfallen zu können. Die Lage der dort gelandeten chinesischen Truppen war besorgniserregend, da sie sofort in schwere Kämpfe mit den gegnerischen Truppen verwickelt wurden. Aber schließlich war der Stand der Dinge im Ferghanatal für die Gesamtlage nicht von großer Bedeutung.
Die weiteren schlechten Nachrichten aus dem Ilital hatte Toghon-Khan beinahe erwartet. Daß der General von Bülow hier in der Linie des Telekdammes einen scharfen Widerstand leisten würde, war für den alten Mongolenfeldherrn eine Selbstverständlichkeit. Deshalb hatte er ja seine Kerntruppen dort angesetzt. Aber die Stärke des Widerstandes überraschte ihn.
Die Berichte, soweit sie bisher vorlagen, meldeten ungeheure Verluste der Angreifer. Wenn Bülow seinerzeit Georg Isenbrandt gegenüber von einem Thermophylä gesprochen hatte, das er hier errichten wolle, so bewiesen diese Meldungen, wie ernst er seine Worte gemeint hatte. Auch die Truppen, welche die chinesische Heeresleitung zur Umgehung der Telekstellung angesetzt hatte, kamen nur Schritt für Schritt und unter schwersten Opfern vorwärts. Ein Forcieren des Durchbruches an dieser Stelle würde in jedem Falle ungeheure Verluste erfordern und im Erfolg zweifelhaft bleiben.
Der große Erfolg mußte im Irtyschtal gesucht werden. Die breite dsungarische Pforte erlaubte es, viel stärkere Kräfte vorzuwerfen. Waren sie hier erst einmal bis zum Siedlerland durchgedrungen, wo eine freie Entfaltung der Front möglich wurde, dann war die Ilistellung der Gegner so im Rücken bedroht, daß sie unhaltbar wurde.
Aus dieser Gesamtlage ergab es sich, den Vormarsch durch das Irtyschtal mit größter Schnelligkeit und stärksten Kräften zu betreiben. Noch am Abend dieses Tages ergingen die Befehle nach allen Seiten, und im Laufe der Nacht begab sich der Regent mit seinem Stab von Khami nach der dsungarischen Grenze. Hier erreichten ihn am frühen Morgen des 10. Juli die Meldungen, daß seine Spitzen den Gebirgszug zwischen Ust Kamenogorsk und Arkatsk gegen schwachen feindlichen Widerstand genommen hätten.
Das strategische Spiel schien gewonnen. Weit offen stand das Völkertor, durch welches sich seit Tausenden von Jahren die asiatischen Stämme nach Westen ergossen hatten.
Als die Sonne über die Bergkämme des Altai heraufkam, stand Toghon-Khan allein am Ufer des Irtysch, den die Mongolen Kara Erthis nennen. Sinnend schaute er den gen Westen strömenden Wellen des jungen Flusses nach. Hinter ihm war das Land sicher. Die ungünstigen Nachrichten von der Südfront wurden durch die Meldungen wettgemacht, daß die Luftgeschwader in seinem Rücken teils niedergekämpft, teil vertrieben seien.
Vorwärts ging es mit der Sonne. Er brauchte nur seinem Schatten zu folgen. Kaum hundert Schritte vor ihm lag der Grenzgraben. Er wandte sich um und winkte sein Pferd herbei. Mit einem Schwung saß er im Sattel.
Vorwärts! Nach ein paar Sätzen hielt er am Grenzgraben. In diesem Augenblick loderten links und rechts von seinem Wege mächtige Scheiterhaufen auf, die seine Getreuen aus umgestürzten Grenzpfählen errichtet hatten. Mit einem stolzen Lächeln quittierte der Regent die Huldigung.
Ein Spornstoß! Sein Roß sprang in einem mächtigen Satz über den Graben. Ein Ruck in den Zügeln, das Pferd stand wie aus Erz gegossen.
Er war auf erobertem Boden. Von allen Seiten umbrauste ihn der Jubel der vorüberziehenden Truppen.
Toghon-Khan saß starr auf seinem Pferd. Die schwarzen Glutaugen weit offen nach Westen gerichtet. Der Ring an seiner Linken schien zu glühen, seine Sinne wanderten.
Aus den Truppen, die da neben ihm in modernster Ausrüstung vorwärts hasteten, wurden die Krieger der goldenen Horde, wie sie der große Dschingis-Khan vor acht Jahrhunderten nach Westen geführt hatte.
Er sah sie vorwärtsstürmen. Er sah sie die weiten Steppen Vorderasiens überschwemmen. Er sah, wie die uralten Königreiche unter ihren Tritten zusammenbrachen. Er sah, wie sie ihre Rosse an den blauen Wassern des Hellespontes tränkten, wie sie die Donau stromaufwärts zogen, über das Balkangebirge gingen … und bis in das Herz Europas stießen.
Ihm nach!
Seine Sporen stießen gegen die Flanken seines Pferdes.
Wütend stürzte das edle Tier vorwärts. Erst nach einer Weile brachte er es in seine Gewalt zurück.
Ein kalter, frischer Wind fuhr ihm über das Antlitz. Er hob den Helm und badete seine heißen Schläfen in dem erquickenden Luftzug.
Vorwärts! Vorwärts! … Ihm nach!
Wetteifernd mit den Fluten des Irytsch, strömten die mongolischen Myriaden an seinen Ufern westwärts. Meile um Meile gewannen sie, bis die Gebirge zurückwichen und der Fluß sich zum See weitete. Jetzt strömten auch die Massen auseinander. Die niedere Gebirgskette quer vor ihnen war das letzte Hindernis.
Die Sonne war höher gekommen. Doch der kühle Morgenwind hatte sich auch um die Mittagszeit nicht gelegt. Im Gegenteil. Er war von Stunde zu Stunde kälter geworden.
Jetzt ging eine seltsame Veränderung des Himmels vor sich. Die Sonne verschwand hinter einem grauen Dunstschleier.
Die Kälte nahm immer mehr zu. Der Wind wehte mit immer stärkerer Kraft. Dann war es plötzlich, als bräche das ganze Himmelsgewölbe zusammen. Erde und Himmel verschwanden in einem rasenden Schneesturm. Nur hin und wieder vermochte das Auge durch das dichte Treiben der weißen Flocken dünne Ketten geduckter Gestalten zu erblicken, die sich mühsam durch das Chaos vorwärts kämpften. Die Räder der Fahrzeuge schnitten bis an die Achsen in den Boden ein, der sich mit dem Schnee vermischte.
Peitschenhiebe und Rufe! Flüche in allen Zungen Asiens schallten durch die Luft. Dazwischen das ängstliche Schnauben der Pferde und das Gebrüll der Kamele.
Immer häufiger brachen Tiere und Menschen erschöpft zusammen. Was auf dem Weg liegenblieb, wurde rücksichtslos zur Seite gestoßen. Die Hilferufe verhallten ungehört im Geheul des Sturmes.
Dazwischen die anspornenden Rufe der Offiziere.
Vorwärts! … Vorwärts! … Jenseits der Berge winkten die warmen Fluren Turkestans … Vorwärts! … Jenseits der Berge ist Sommer.
Aber die Gebirge waren unsichtbar. Hinter den wirbelnden Schneeflocken verborgen. Die Ebene, durch die sie marschierten, von den immer mächtiger niedergehenden Schneemassen bald mit einem dichten Leichentuch bedeckt.
Gegen Mittag ließ die Gewalt des Sturmes nach. Für Augenblicke brach die Sonne durch das dunkle Gewölk. Es wurde Rast gemacht und gegessen.
Ermattet warfen die Truppen sich auf das weiße Schneelager. Die aus dem rauhen Norden des Landes stammenden Mannschaften erholten sich verhältnismäßig schnell. Die südchinesischen Regimenter in ihrer leichten Ausrüstung wurden ungleich stärker mitgenommen. Ihre erstarrten Finger vermochten kaum die Mahlzeit zum Munde zu führen.
Auf einem felsigen Promontorium hielt der Stab des ToghonKhan. Er selbst hatte sich in ein schnell aufgeschlagenes Zelt zurückgezogen. Die Offiziere standen fröstelnd auf dem schneefreien Gestein.
Scheu, mit leiser Stimme flüsterten sie sich ihre Betrachtungen und Beobachtungen zu. Zwei Generale aus dem engsten Gefolge des Regenten saßen unter einer mächtigen Eiche, den Blick auf die tief unten liegende Straße gerichtet.
Es waren Batu-Khan und Ugetai-Khan, die treuesten Anhänger des verstorbenen Kaisers. Schon zu Lebzeiten des Schitsu waren sie Rivalen des Toghon gewesen. Sie neideten ihm das besondere Vertrauen des Kaisers. Sie neideten ihm den Ruhm des großen Feldherrn.
Ihre Blicke ruhten auf dem Tal. Verschwunden war jede Spur von Grün. Weiß war das Land bis zum fernen Horizont. Wie Maulwurfshaufen die hingeworfenen Gestalten der Soldaten. Nur hin und wieder schwelgende Lagerfeuer, wo es den Truppen gelungen war, das mühsam zusammengesuchte Gestrüpp zu entzünden. Düster sahen die Generale auf das unheildrohende Bild. Das stärkste Heer, das das Himmlische Reich jeweils unter Waffen gehabt hatte, würde es der großen Aufgabe gerecht werden können, wenn ihm hier ein unerwartetes … ein unerklärliches Unwetter die Schwingen lähmte?
Ihr abergläubischer Sinn sah in diesem Wetter ein böses Vorzeichen für den ganzen Feldzug. Ugetai brach das Schweigen:
»Was ist’s mit dem Toghon? Als die ersten Flocken fielen, wurde sein Gesicht bleicher als der Schnee. So sah ich ihn nie in den dreißig Jahren unserer gemeinsamen Kämpfe.«
Es dauerte, bis Batu die Antwort fand:
»Auch ich erschrak, als ich die Miene Toghons sah. Furcht ist in Toghon! Er scheut das Antlitz der zürnenden Natur. Wer hätte sonst jemals den Toghon im Felde im Zelt gesehen?«
Er, der Toghon, ruhte im schnell errichteten Zelt auf einem niederen Lager. Die Augen, weit geöffnet, starrten zu der braunen Leinendecke.
Ein schwerer Atemzug hob die Brust des Liegenden. Seine Hand warf den Teppich zurück, der ihn bedeckte. Mühsam richtete er sich auf. Und dann begann er zu wandern. In dem engen Geviert des Zeltes schritt er rastlos hin und her.
Dieser ungeheure Schneefall … es war ein Eishandschuh, den Europa ihm vor die Füße warf … und den er nicht aufzunehmen vermochte.
Aber wie weit reichten Schnee und Frost? Bis in die warmen, weichen Steppen des Siedlerlandes? … Unmöglich!
Wo blieben die Flugzeuge, die ihm Meldung brächten, wie es da vorne stand? Der Schneesturm ließ keinen Boten durch …
Lauschend hob er das Ohr … da! … Ein Surren von Propellerflügeln. Er riß den Vorhang zurück und trat ins Freie.
Prüfend überflog sein Auge das dunstige Himmelsgewölbe. Da … In höchster Höhe ein Pünktchen … War’s einer von seinen Fliegern? …
Mit kaum bezähmter Ungeduld wartete er. Sein Auge fiel auf die Gruppe der Offiziere, die ihn schweigend anstarrten. Ein argwöhnischer Blick überflog prüfend die Gesichter. Sahen sie die Verzweiflung, die in ihm tobte?
Der Ruf: »Flieger von uns!« drang an sein Ohr und wirkte erlösend. Noch wenige Minuten, in denen alle Aufmerksamkeit der näherkommenden Maschine galt. Dann landete das Flugzeug. Der Flieger kam, von vielen Händen gewiesen, den Abhang hinaufgeeilt. Stand vor ihm.
»Wo kommst du her?«
»Vom Ural!«
»Wie weit reicht der Schnee?«
»Bis zum Saisan-Nor! Die Ebene des Saisan-Nor ist noch braun und weiß. Je weiter ich nach Osten kam, desto weißer wurde das Land.«
»Das Siedlerland …«
»Liegt grün in hellem, warmem Sonnenschein.«
»Vorwärts!«
Weithin hallte seine Stimme. Das alte Siegesbewußtsein kam zurück. Mit einer stolzen Geste wandte er sich zu seiner Umgebung.
»Vorwärts! In ein paar Tagesmärschen sind wir im blühenden Siedlerland. Da ist Sommer! … Da finden wir den Gegner und schlagen ihn! Jeder Schritt bringt uns näher an das sonnige Ziel und an den Feind.«
Wie ein Lauffeuer pflanzte das Kommando sich fort.
Auf! … Vorwärts! schallte es durch die rastenden Kolonnen. Hier schneller, dort langsamer erhoben sich die lagernden Truppen. Die Formationen schlossen sich zusammen. In unablesbarem Zuge strebte die gelbe Heeresmacht von neuem gen Westen.
So ging es Stunden hindurch. Schon stand die Sonne, die an diesem Morgen mit ihnen im Osten aufgebrochen war, weit vor ihnen im Westen. Doch ihre Strahlen fehlten. Kahl und grau blieb der Himmel. Unabsehbar streckte sich das weiße Gefilde.
Die Dämmerung kam … und stärker wurde der Frost. Er preßte der Luft die letzte Feuchtigkeit aus. An den bizarren Skeletten der im vollen Sommerlaub erfrorenen Bäume bildete sich wunderlicher Rauhreif. Einzelne dicke Reifflocken fielen aus der fast windstillen Luft.
Hin und wieder zerriß ein weithin hallendes Krachen und Donnern die Abendstille. Dann war irgendwo der so plötzlich gefrorene Boden auseinandergerissen.
Nur noch mühsam hielten sich die Kolonnen in Bewegung. Immer häufiger wurden die Stürzenden. Da endlich kam der Befehl:
»Halt!«
Glücklich die, in deren Nähe Wald wuchs. Im Augenblick krachten die Stämme unter den Schlägen der Äxte. Um die lodernden Feuer drängten die Soldaten ihre erstarrten Glieder.
An vielen Stellen zerriß schon jetzt die Ordnung. Die kein Holz mehr fanden, verließen ihre Plätze und eilten zu den wärmeverheißenden Feuern. Die meisten, ohne sich um Ausrüstung und Waffen zu kümmern. Dicht aneinandergedrängt erwarteten sie den Morgen.
Nach endloser Nacht verriet das Grau im Osten den kommenden Tag. Fast niedergebrannt waren die Feuer, verschwunden jeder Wald, soweit er erreichbar.
Der neue Tag begann mit neuer Qual. Der Frost nahm immer mehr zu.
Nur widerwillig folgten die Truppen dem Signal zum Aufbruch … soweit sie noch zu folgen vermochten.
Schwerfällig setzten die gelichteten, kaum geordneten Kolonnen sich in Bewegung. Schon nach kurzer Zeit versagten die Kräfte von neuem. Bei geringen Unebenheiten des Bodens taumelten die Marschierenden, konnten sich nicht mehr aufrechthalten und stürzten nieder. Immer größer wurden die Haufen der Nachzügler, die nach der verscheidenden Glut der verlassenen Feuerstätten schwankten und sich dort niederwarfen … zur Ruhe … die meisten zur ewigen Ruhe.
Um die Mittagsstunde war die Kälte so gestiegen, daß jeder Weitermarsch zur Unmöglichkeit wurde. Schon seit Stunden säumten die fortgeworfenen Waffen die breiten Heerstraßen. Die Hände der abgesessenen Berittenen vermochten nicht mehr die Zügel zu leiten. Führerlos zerstreuten sich die Tiere über die Ebene.
Jetzt lösten sich die letzten Bande jeder Ordnung. Instinktmäßig strebten die Massen von der kahlen Straße fort zu den Gehölzen. An Ort und Stelle, dort, wo die erstarrten Arme noch einen Stamm zum Fallen brachten, entzündeten sie das Holz und drängten sich in wildem Kampf ums Leben an die rettende Wärme.
Toghon-Khan ritt allein auf der verlassenen Heerstraße vorwärts. Niemand folgte ihm mehr.
Mit gebeugtem Haupt ritt er vorwärts. Der schneidende Wind zwang ihn, die Lider halb zu schließen. Die dunkle Glut seiner Augen war erloschen. In ihrem starren Blick lag nichts mehr von der Energie des Welteroberers,, des Siegers … Es war der Blick des Todgeweihten.
Ein Surren in seinem Rücken brachte Bewegung in die eisigen Züge. Die Starrheit wich. Die Augen öffneten sich. Ein leichter Glanz belebte sie. Toghon zügelte sein Roß und hob die Hand.
In gestreckten Spiralen sank das Flugschiff zu ihm nieder. Es war derselbe schnelle Kreuzer, der ihm die Meldung aus dem Ural gebracht hatte. Er hatte ihn nach rückwärts geschickt mit dem Befehl, schnellstens alle verfügbaren Dynothermmengen in Transportschiffen heranzubringen. Es hatte ihn, als er den Befehl gab, noch ein leises Fünkchen Hoffnung bewegt, mit Hilfe der wärmenden Kraft des Dynotherms den tückischen Plan des Gegners zu parieren.
Zwar war er sich über das Wie nicht klar. Aber er klammerte sich an diese … die letzte Hoffnung. Vielleicht, daß der wärmespendende Stoff, längs der Heerstraße ausgestreut, die Kälte so weit paralysierte, daß ein Weitermarsch möglich war …
Das Flugschiff stand neben ihm. Neubelebt glitt er vom Pferd und sprang in das Schiff. Automatisch schlug hinter ihm die Tür ins Schloß. Die wohlige Wärme, die ihn hier umgab, wollte ihm im ersten Moment den Atem rauben. Zu groß war der Gegensatz zwischen dem todbringenden Frost da draußen und der belebenden Temperatur hier drinnen.
Er sank in einen Sessel. Endlich rang sich die Frage von seinen Lippen:
»Ist der Befehl ausgeführt?«
»Er ist ausgeführt, Hoheit. Die Schiffe sind auf dem Wege.«
»Wie weit sind sie?«
»Vor morgen werden sie nicht hier sein können.«
Mit einem Sprung stand Toghon-Khan vor dem Sprechenden.
»Morgen? … Morgen! … Heute noch müssen sie hier sein!«
Der Angeredete erblaßte. Nur stotternd kam seine Antwort.
»Zu lang … zu lang ist der Weg … Hoheit … Die Arbeit der Schiffe, Dynotherm zu streuen, muß schon weit hinten an der Ostgrenze der Dsungarei beginnen …«
»Die Hälfte muß es dort tun! Die anderen Schiffe sofort nach vorn! … Bevor die Dämmerung kommt, müssen sie hier sein! … Geben Sie telegraphischen Befehl. Unser Schiff mit voller Kraft nach vorn zum Saison-Nor! … Mittelhöhe!«
Langsam stieß das Schiff vom Boden ab. Vom Stern des Fahrzeuges aus sah der Regent auf die verlassene Straße. Kein lebendiges Wesen auf ihr. Nur sein Pferd, das treue Tier, stand regungslos, dem wegziehenden Schiffe nachschauend.
Mit schweren Schritten drehte er sich um und trat an den Bug des Kreuzers. Der hatte jetzt Höhe gewonnen und schoß in schneller Fahrt vorwärts. Das Auge des Regenten haftete am Außenthermometer. Mit düsterem Gesicht verfolgte er das langsame, aber unaufhörliche Fallen des Zeigers.
40 Grad … 40 Grad unter Null! … So stand der Zeiger, als er ihn das erstemal betrachtete … Jetzt war er schon auf 46 gesunken. Kilometer auf Kilometer stieß das Schiff nach vorn … und mit jedem Kilometer fiel der Zeiger.
Schon lag in nebliger Ferne der Kessel des Saisan-Nor. Sprunghaft fiel jetzt der Zeiger.
Ein schwerer Stoß, der das Schiff seitwärts traf, brachte ihn ins Wanken. Er packte den Fenstergriff und hielt sich aufrecht. Das Schiff lag schwer nach Backbord über. Er hörte wie durch Nebel, wie der Kommandant den Befehl gab, höher zu steigen. Er glaubte die Erschütterung des mit äußerster Kraft arbeitenden Triebwerkes zu spüren.
Dann drehte das Schiff in neuem jähen Ruck ganz nach Backbord um.
»Volle Kraft rückwärts!«
Der Befehl des Kommandanten klang an sein Ohr.
Zu spät!
Das Schiff gehorchte nicht mehr … weder dem Steuer noch dem Triebwerk. Wie ein Fetzen Papier vom Wirbel gegriffen, wurde es widerstandslos vorwärts gerissen.
Ein neues fremdartiges Geräusch übertönte das Tosen der Elemente. Starr standen die Insassen. Ihre Hände umklammerten krampfhaft jeden greifbaren Halt.
Es klang wie das Prasseln von Schrot gegen Stahl. Es klang wie schwerer Hagel, der auf ein Wellblechdach prasselt.
Es hämmerte auf das Hirn des Toghon-Khan … hämmerte ihm die Gewißheit des unabwendbaren Unterganges ein …
Mit voller Klarheit übersah er Entstehen und Ende der Katastrophe. Sein geschulter Geist beherrschte auch die physikalischen und technischen Grundbedingungen der Geschehnisse um ihn. Mit Klarheit sah er jetzt alle Handlungen seines Gegners sich in logischer Folge entwickeln.
Der hatte das Mittel, das dem Dynotherm entgegengesetzt wirkte! Das Mittel, das ebenso ungeheure Energiemengen band, wie das Dynotherm sie freimachte. Der halte dann überall im Zuge des einbrechenden Heeres gestreut, wo immer nur Wasser war.
So entstanden jene Kältepole, die infolge der Zusammenziehung der darüber lagernden Luft barometrische Minima ergaben, denen die entfernte Luft von allen Seiten zuströmen mußte. Dabei gab es eine Ausdehnung der zuströmenden Winde, die naturnotwendig eine Abkühlung verursachte.
So kamen jene Schneefälle zustande. So ergab sich jener Maischnee in Peking. So der Schneesturm des vorgestrigen Tages. So die Kälte.
Das unaufhörliche Fallen des Thermometers, das jetzt auf 170 Grad unter Null stand, bewies ihm überzeugend, daß das Schiff einem dieser extremen Kältepole zugerissen wurde. Der große Saisan-See mußte in der Tat nach Einstreuung dieses Mittels einen Kältepol von ungeheuerster Stärke ergeben.
Dieser unwiderstehliche rasende Luftstrom gab ihm die Gewißheit. Es war soweit!
Hier stürzte die Atmosphäre selbst verflüssigt zu Boden, Hier drang von allen Seiten her die Luft mit Riesengewalt wie in einen luftleeren Raum ein und riß jeden Körper, der sich in ihr befand, bis zum Kältepol hin.
Mit vollkommener Klarheit des Geistes erwartete ToghonKhan das Ende.
Das Schiff stellte sich auf den Kopf und stürzte mit rasender Wucht auf das Eismassiv des bis zum Grund gefrorenen Sees. Tief drang sein metallener Sporn ein. Ein Funkenstrom umsprühte das einhauende Metall. Der Zünder für die fürchterliche Fackel, die im selben Augenblick gegen den Himmel stand. Sprühend verbrannte das Metall des Schiffsrumpfes im flüssigen Sauerstoff … Verbrannte das Schiff mit allem an und in ihm in Sekunden zu nichts …
Dann ging die Natur ihren Gang weiter, bis der Tag sich neigte … und die Nacht die Fesseln löste.
Linder wurde der Frost. Die Macht des Sturmes ließ nach. Dichte Nebel krochen über die eisbedeckte Erde … und sie hoben sich und fanden milde Südwinde und fielen nieder in warmen Tropfen und weckten das tote Land.
Der Schnee schmolz. Von den Bergen schossen die Wasser. Immer stärker wurde das Wehen des Südwindes, immer größer seine Wärme. Wie im Spiel zerbrach er die Decke des SaisanSees. Wo lebendige Wesen noch ihr Leben bewahrt, frohlockten die Herzen.
Der Morgen kam und mit ihm die Sonne.
Das Siedlerland war gerettet, das Abendland vom Untergang bewahrt. Mit Sturmesschnelle eilte die Kunde von der Katastrophe im Herzen Asiens über die ganze Welt hin.
Verhältnismäßig lange blieb man in Peking selbst über das Schicksal der großen dsungarischen Armee im Ungewissen. Im tödlichen Frost waren auch die Formationen der Nachrichtentruppen zugrunde gegangen, die sonst wohl jene Schreckenskunde in den Äther gefunkt hätten. Und die es sonst noch wußten, die der Katastrophe entronnen waren, die wollten nicht, daß die schlimme Botschaft früher als sie selbst in das Gelbe Reich kam.
Als Toghon-Khan in jenen letzten Stunden rastlos vorwärtsstürmte, nur noch von dem einen Wunsch getrieben, das warme Siedlerland zu erreichen, sein Heer der todbringenden Umarmung des Frostes zu entreißen, da waren die beiden Besten seiner Getreuen zurückgeblieben. In jener Stunde sahen BatuKhan und Ugetai-Khan den Stern des Regenten rettungslos sinken, und alter, so lange mühsam gedämpfter Ehrgeiz gewann neue Kraft in ihren Herzen.
Als Toghon-Khan auf der Straße nach dem Saisan-Nor Schutz vor der grimmigen Kälte im Flugschiff suchte, da flog Ugai-Khan schon in einem anderen schnelleren Kreuzer der dsungarischen Armee gen Osten. Mit höchster Maschinenkraft jagte das mächtige Schiff über die verschneiten Ebenen und Gebirge. Es entrann dem grimmigen Winter, den Georg Isenbrandt hier der einbrechenden gelben Armee bereitet hatte. Am Abend des gleichen Tages, der den Tod des Regenten sah, landete dieses Schiff in Schehol.
Noch wußte man hier in der Stille der kaiserlichen Gärten nichts von der Katastrophe der gelben Wehrmacht. Als Vertrauter des Regenten und als siegreicher Armeeführer wurde Ugetai-Khan empfangen. Leicht, fast zu leicht wurde es ihm gemacht, sich des unmündigen Kaisersohnes zu bemächtigen. Den Thronerben, den Knaben des Schitsu an seiner Seite, raffte er die mongolischen Regimenter Pekings und der nächsten Umgebung zusammen.
Als endlich die Kunde vom Untergang der großen Armee und vom Tod des Regenten nach Peking kam, hatte UgetaiKhan nicht nur diese Truppen fest in der Hand, sondern er war auch der Herrscher der größeren Hälfte des Gelben Reiches. Da war er in kaum zweimal vierundzwanzig Stunden an jenes Ziel gelangt, das ihm früher das höchste und unerreichbare zu sein schien.
Nur einen Gegner hatte seine Macht: Auch Batu-Khan war der Katastrophe entkommen – später als Ugetai-Khan, zu spät, um vor ihm in Peking zu sein und dort seiner Macht Abbruch tun zu können. Aber früh genug, um nach dem Norden zu gehen und dort die mongolischen Kerntruppen um sein Banner zu scharen. Der größere Teil des Landes gehorchte dem Ugetai, aber die stärkere, die am besten disziplinierte Truppenmacht war in der Hand des Batu-Khan.
Wem würde die Macht schließlich verbleiben? Wer von diesen beiden alten und kampferprobten Generalen würde die Regentschaft des Gelben Reiches führen, bis einmal der Erbe des Schitsu sich selbst die Krone aufs Haupt setzte? Noch hatte das Reich ja einen äußeren Feind: das vereinigte Europa.
Der Friede mit den Weißen mußte gemacht werden, und Ugetai war es, der ihn für die Gelben schloß.
Ein schneller und billiger Frieden konnte es dank der Mäßigung der Sieger werden. Gegen den Angriff, gegen die Bedrohung ihrer blühenden Siedlungen hatten sich die Weißen mit allen Mitteln zur Wehr gesetzt, welche der Erfindungsgeist eines der ihrigen ihnen in die Hand gab. Nachdem die Entscheidung gefallen, der feindliche Ansturm im Frosttod gescheitert war, wurden die Friedensbedingungen milde gestellt.
Das Ilidreieck, jenes strategische Glacis, das die Arbeiten Isenbrandts so lange gestört hatte, fiel an Europa. Außerdem gab es nur geringfügige Grenzberichtigungen. Georg Isenbrandt sorgte dafür, daß die Gletscherfelder, die er längst der Grenze für seine Arbeiten benötigte, ihm auch durch den Friedensvertrag zur Verfügung gestellt wurden. Aber das waren unbewohnte Eiswüsten, deren Verluste das gelbe Riesenreich kaum empfand. Darüber hinaus wurde auch von weißer Seite beim Friedensabschluß sorgfältig alles vermieden, das etwa Keime zu neuen Kriegen abgeben konnte. Jede Kriegskostenentschädigung wurde vermieden, und Ugetai beeilte sich, diese günstigen Bedingungen so schnell wie möglich anzunehmen.
Er tat es um so mehr, als die Dinge in China selbst seine ganze Tatkraft erforderten. Die alte republikanische Bewegung im Süden des Reiches, vom Kaiser Schitsu mit Gewalt niedergehalten, von Toghon-Khan mit brutaler Gewalt niedergeschlagen, flammte jetzt mit neuer Kraft auf. Ugetai besaß nicht die Macht, ihr entgegenzutreten, denn von Tag zu Tag wurden seine eigenen Kräfte durch die ständig wachsende Macht des Batu-Khan in Urga gebunden.
Mit der Stoßkraft des Gelben Reiches nach außen hin war es für lange Zeit vorbei.
Noch in den letzten Augusttagen konnte Ugetai von Peking aus den Frieden mit Europa schließen. Aber schon in der ersten Septemberwoche brach der Bürgerkrieg im Gelben Reich aus. Der Süden erklärte sich zur unabhängigen Republik. Vom Norden her aber trat Batu-Khan gegen Peking hin seinen Vormarsch an, der erst nach langen, langen Monaten voller Kämpfe mit dem Tode des Ugetai und der Herrschaft des Batu-Khan endigen sollte.
Schneller als nach China selbst war die Kunde von der Frostkatastrophe nach allen anderen Erdteilen gedrungen. Unfaßbar war es zunächst aller Welt erschienen, daß Menschenkraft die Elemente der Natur in so unerhörter Weise meistern konnte.
Als dann die Wahrheit unzweifelhaft zutage lag, da erstarkten die verzagten Herzen der weißen Menschen. Jener eisige scharfe Sturm, der dort oben in Asien seinen Anfang nahm, schien um den ganzen Erdball zu fahren. Mit einem Schlag war die an vielen Orten so schwüle, unheilschwangere Atmosphäre gereinigt. Wo immer die Herrschaft der Vernunft zu wanken drohte, wurde sie durch jenes Ereignis wieder gestützt und gefestigt.
Und diese Stützung tat bitter not. Denn das gewaltige Feuer, das Toghon-Khan auf der ganzen Erde entfacht hatte, war nicht so leicht zu dämpfen.
In schnellem, unwiderstehlichen Sturmlauf hatten die schwarzen Heere in Afrika die geringfügigen weißen Streitkräfte überrannt und sich zu Herren der Lage gemacht. Alles, was die schwarze Rasse einst in der Kriegsschule der Weißen gelernt hatte, kehrte sich jetzt gegen die Lehrer. Bemerkenswert war die Disziplin, die dabei von beiden Seiten gewahrt wurde. Die Plünderungen blieben in Grenzen, und weitere Zerstörungen, namentlich der großen Industriewerke wurden verhindert.
Im Laufe weniger Tage war ganz Afrika in der Hand der Afrikaner. Und nun zeigte sich sofort die Notwendigkeit, dem Industrieproletariat dort Brot und Arbeit zu scharfen. Die neuen Machthaber mußten wirtschaftlich genau an derselben Stelle fortfahren, wo die früheren Herren aufgehört hatten. Soweit die Werke bei den Kämpfen betriebsfähig geblieben waren, wurden sie von der schwarzen Industriebevölkerung aus Selbsterhaltungstrieb so gut es ging in Gang gehalten. Soweit sie zerstört waren, suchte man so schnell wie möglich und mit allen Mitteln Kapital und Intelligenz aus der Bevölkerung Amerikas zu ihrer Wiederherstellung heranzuziehen. Aber in Ermangelung einer einheitlichen Organisation war das Ganze reichlich chaotisch. Man mußte überall improvisieren, und es ließ sich mit Sicherheit voraussehen, daß die Entwicklung bis zu einer Wiederherstellung normaler Verhältnisse lange Zeit in Anspruch nehmen würde.
Um so mehr, als die politischen Machtverhältnisse in Afrika durchaus strittig waren. Zwar die seitherigen Herren waren erschlagen oder verjagt. Aber die seit so vielen Jahren von Idealisten geplanten Vereinigten Staaten von Afrika standen noch in weitem Felde. Einstweilen gab es verschiedene große Reiche, deren Herrscher sich Großmacht-Träumen hingaben.
Eigenartig wirkten sich die afrikanischen und amerikanischen Verhältnisse aufeinander aus. In Amerika waren die Dinge anders gegangen als in Afrika. Die Kunde von der Vernichtung der großen gelben Armee hatte in Amerika dem an sich schon gut organisierten Widerstand der weißen Bevölkerung verstärkte Schlagkraft verliehen. Unter solchen Verhältnissen mußten die Aussichten und Möglichkeiten, sich in Afrika erfolgreich und frei betätigen zu können, für Teile der schwarzen amerikanischen Bevölkerung einen großen Anreiz zur Auswanderung bieten.
Die so nach der Niederschlagung des amerikanischen Aufstandes sofort stark einsetzende Auswanderung versprach der amerikanischen Union in absehbarer Zeit eine Entlastung von der schwarzen Bevölkerung. Freilich bedeutete diese Auswanderung auch einen starken Aderlaß an Kapital und an Arbeitskräften. Eine Wirtschaftskrise für die Union war unvermeidlich. Doch ihr Ende ließ sich voraussehen, da die Isenbrandtschen Erfindungen auch in diesem Gebiet neue und bessere Lebensmöglichkeiten schaffen konnten.
Doch dieser Verlauf der Dinge ergab sich erst in Wochen und Monaten. Im Anfang war die schwarze Bewegung gefährlich genug, und erst nach schweren und erbitterten Kämpfen konnte die Ordnung wiederhergestellt werden.
In Frisko war die Bewegung zunächst verhältnismäßig harmlos verlaufen. Die Organisation des Weißen Ordens hatte hier dank umfangreicher Vorbeugungsmaßnahmen sofort mit aller Schärfe eingegriffen. So wurde es möglich, die regulären Truppen von dort nach und nach fortzunehmen und in bedrohteren Staaten zu verwenden. Aber der Schutz der Stadt lag jetzt fast ausschließlich in den Händen der freiwilligen Organisation.
Es war in den ersten Tagen des August. Eine schwüle, drückende Hitze lag über Frisko. Selbst auf dem hochgelegenen San Matteo vermochte die leichte Seebrise nur wenig Kühlung zu bringen.
Auf der meerwärts gewandten Terrasse von Garvin Palace saßen Francis Garvin und Helen unter einem leichten Leinenzelt. Helens Hände spielten mit dem Papierstreifen des Wellentelegraphen. Das Schlagen einer Standuhr ließ sie aufhorchen.
»Vier Uhr, Pa! Wellington muß schon in Frisko sein.« »Er muß jede Minute kommen!«
»Mir scheint, Pa, deine Ungeduld nach Wellington ist größer als meine. Die Tatsache, daß sein Name jetzt in aller Munde ist, daß die Zeitungen auch außer der Chicago Press fast täglich über ihn schreiben, scheint dir gewaltig zu imponieren.«
»Das gestehe ich unumwunden ein. Ich hätte das, was er hier in den letzten schweren Zeiten geleistet, nicht von ihm erwartet. Ich sehe nicht ein, weshalb er nicht auch später noch eine Rolle in der Politik der Union spielen sollte. Er hat den Kopf zu Größerem!«
»Nur nicht! … Ich will keinen Politiker zum Mann. Die haben alle keine Zeit, an ihre Frau und an ihre Familie zu denken.«
»Du bist eigennützig, Helen! Was ich sagte, war mein voller Ernst. Es wäre schade, wenn Wellington Fox seine große Begabung nicht voll auswirken lassen könnte.«
»Hör auf, Pa, mit deinen Lobpreisungen. Ich erröte für Wellington. Er würde dich sicher auslachen, wenn er dich so hörte. Doch halt! Ich sehe ein Auto in den Park einfahren.
Wellington ist darin. Der dort neben ihm ist sicher sein Freund Lowdale, den er sich aus Turkestan eingeladen hat. Er wurde in den Kämpfen mit den Kirgisen verwundet.«
»Lowdale?« fragte Mr. Garvin. »Ist das jener Lowdale, der einst Florence …«
»Ja, Pa!«
»Dann ist es wohl gut, daß sie eben fort ist. Ein Zusammentreffen hier wäre sicher für alle peinlich gewesen.«
»Ja, Pa! … Doch da sind sie schon.«
Sie eilte dem Wagen zu. Mit einem großen Sprung stand Wellington Fox auf ebener Erde. Dann fing er sie in seinen Armen auf, und ein halbes Dutzend Küsse bekräftigte die Freude des Wiedersehens.
»Immer wieder wie ein Brausewind!« schalt Helen, während sie sich aus seinen Annen losmachte. »Verzeihen Sie ihm, Mr. Lowdale!«
Sie reichte dem Gast die Hand, während Wellington Fox zu Francis Garvin trat und angelegentlich mit ihm sprach.
»Willkommen in Garvins Palace! Ich will Sie gleich mit meinem Vater bekanntmachen, der … was ist denn, Pa?«
Die eben noch so heiteren Züge Garvins zeigten plötzlich einen tiefen Ernst.
»Schlimme Nachrichten, Helen! Unsere Freude wird nur kurz sein.«
»Was ist, Wellington?«
Sie eilte zu ihrem Verlobten und drängte sich an ihn.
»Unruhen in der Stadt, Helen! Der Pöbel aller Farben ist mobil. Irgend jemand hat es verstanden, der schwarzen Plebs unter Vorspiegelung politischer Ziele noch einmal zum Kampf aufzuhetzen.
Schwere Stunden … vielleicht Tage … stehen bevor. Ich riet deinem Vater, sich mit dir sofort für alle Fälle auf eure Jacht zu begeben.«
»Und du?« fragte Helen besorgt.
»Wenn’s wo etwas Interessantes zu sehen gibt, muß ich doch der Chicago Press Meldung schicken können.«
»Ach, Wellington! Wenn du nur deshalb hierbliebst, wäre ich ohne Sorge. Aber leider wirst du das nicht tun«, ihre Stimme zitterte, sie kämpfte mit unterdrückten Tränen. »Ganz sicher wirst du immer da sein, wo es am schlimmsten zugeht …«
»… und kräftig mittun! Der Tanz wird gleich beginnen. Ich kam nur hierher, um euch zu warnen. Unser Wagen wartet, um uns sofort nach der Stadt zurückzubringen. Im Hafenviertel wird es inzwischen schon losgegangen sein. Der Hauptstoß richtet sich gegen Nob Hill, das Millionärsviertel …«
»Nob Hill?« Sie drückte erschrocken die Hand aufs Herz. »Oh, die arme Florence! Vor kurzem noch war sie hier. Eine Viertelstunde früher hättet ihr sie hier getroffen.«
»Verfl…!« preßte Fox durch die Zähne und warf einen Blick auf seinen Begleiter.
Averil Lowdale war erblaßt. Trotz seiner äußeren Unbewegtheit war seine Aufregung unverkennbar. Ein düsteres Feuer brannte in seinen Augen.
Fox hatte sofort begriffen.
»Du siehst, Helen, daß wir sofort zurück müssen.«
Er wandte sich zu Francis Garvin.
»Sie werden sich unverzüglich mit Helen auf Ihre Jacht be- geben? Das Bewußtsein, daß Sie mit Helen außer Gefahr sind, würde mich sehr beruhigen.«
»Ich werde Ihrem Wunsch willfahren, Mr. Fox, obwohl es mir schwerfällt, aus Garvins Palace zu fliehen.«
»Danke, Mr. Garvin! Leb wohl, Helen!«
Er zog sie an sich und küßte ihr die Tränen von den Wangen.
Helen sah ihrem Verlobten nach. Dann hörte sie den Wagen anfahren. Noch ein Winken der Insassen, und dann war er um eine Wegbiegung verschwunden.
Während die Hauptmasse des aufgehetzten Pöbels sich noch beim Plündern der Läden in den großen Geschäftsstraßen aufhielt, war eine offenbar besonders gut dressierte Gruppe, die unter einem außergewöhnlich gerissenen Führer zu stehen schien, ganz überraschend durch unbewachte Seitenstraßen in das Viertel von Nob-Hill eingebrochen. Fast ungehindert, nur mit vereinzeltem Widerstand der Bewohner kämpfend, hatten sie eine Reihe reicher Privathäuser ausgeräumt. Die Kostbarkeit ihrer Beute sprach für die Richtigkeit ihres Planes, der nach den Anweisungen des Führers streng systematisch durchgeführt wurde.
Erst als sie sich dem Haus von John Dewey näherten, weigerten sich die Farbigen aus der Bande, hier mitzumachen. Nach kurzem, erregtem Wortwechsel trennte sich die Gesellschaft. Die meisten Farbigen zogen weiter, während der Rest mit dem weißen Gesindel in Deweys Haus eindrang.
Das verschlossene Tor war schnell erbrochen. In der großen Halle des Erdgeschosses trat ihnen John Dewey entgegen, während eine kleine Gruppe Bedienter sich ängstlich im Hintergrund verhielt.
»Was soll das? … Was wollen Sie hier?«
Drohend aufgerichtet stand er vor den Eindringlingen.
Einen Augenblick stutzte der Haufe.
»Einen kleinen Zehrpfennig für die Reise!« erscholl es da aus dem Hintergrund.
Dewey richtete seine Augen auf den Sprecher.
»Sie, Mr. Cameron? … Sie hier unter diesen Plünderern?«
»Sehr wohl, Mr. Dewey!«
Collin Cameron war ein paar Schritte vorgetreten und stand dicht vor dem Hausherrn. Hohnlächelnd weidete er sich an der grenzenlosen Überraschung Deweys. Die Maske des Gentleman war von ihm abgefallen.
»Sehr wohl, Mr. Dewey! Da unsere gemeinsamen Transaktionen nicht den gewünschten Erfolg gehabt haben, sehe ich mich genötigt, meinen Teil am Geschäft zu liquidieren. Da von dem bankrotten Haupthaus in Peking nichts zu erwarten ist, muß ich mich an den noch zahlungsfähigen Sozius … an das Haus Dewey halten … Da ich für Schecks in meiner augenblicklichen Lage keine Verwendung habe, möchte ich Sie ersuchen, die Rechnung in bar zu begleichen.«
John Dewey stand starr. Mit einem Blick unsäglicher Verachtung maß er den Gegner. Collin Cameron hielt den Blick kühl lächelnd aus.
»Mit Rücksicht auf unsere früheren angenehmen Beziehungen bin ich bereit, die Angelegenheit kulant zu erledigen. Ich wünsche nichts als den Schmuckkasten Ihrer Tochter … Aber auch auf diesen Kasten würde ich sogar verzichten, wenn Sie mir den Preis dafür in bar erlegen … Sie sehen, ich bin bescheiden.«
Dewey hatte die höhnische Suada Collin Camerons zunächst mit beherrschter Ruhe angehört. Erst als der Name seines Kindes fiel, stieg Röte in sein Gesicht. In dem Augenblick, in dem Collin Cameron seine Worte mit einer ironischen Verbeugung schloß, stürmte er mit geballten Fäusten auf ihn los.
»Hund …!«
Ein Schlag seiner Rechten traf die Wange Collin Camerons.
Im selben Augenblick war Dewey von einem Dutzend kräftiger Arme gepackt und zu Boden geschleudert. In rasender Wut halle Collin Cameron eine Schußwaffe gezogen und zielte auf den Daliegenden. Im letzten Augenblick besann er sich und steckte sie wieder zu sich.
»Vorwärts!« rief er seinen Kumpanen zu. »Nehmt, was ihr findet!«
Mit schnellen Sprüngen eilte er allen voran die Treppe empor. Während die meisten seiner Begleitung sich in den ausgedehnten Räumen zerstreuten, schritt er mit sicherer Ortskenntnis nach den Zimmern von Florence.
Durch den Lärm aufmerksam geworden, trat sie ihm an der Tür entgegen. Fassungslos sah sie auf Collin Cameron und die wüsten Gestalten seiner Begleitung.
»Was geht hier vor? … Wo ist mein Vater?«
»Ihren Schmuckkasten, Miß Dewey … Etwas schnell, wenn ich bitten darf. Wir sind in Eile!«
»Mein Vater! … Wo ist mein Vater? … Sie haben ihn getötet!«
Mit einem Schreckensschrei suchte sie an Collin Cameron vorbeizukommen, um nach unten zu eilen.
»Halt! Hiergeblieben! Ihrem Vater ist nichts geschehen … Zeigen Sie uns, wo Sie Ihren Schmuck verwahren, und alles ist in Ordnung!«
Mit einem lauten Schrei »Vater!« taumelte Florence zurück.
Wie im Nebel sah sie plötzlich Collin Cameron von hinten niedergerissen werden. Sie fühlte, wie ein Arm sie umschlang. Eine ihr so wohlbekannte Stimme drang an ihr Ohr.
»Florence! Ich bin bei dir! … Hierher, Kameraden! … Hierher!«
Vom Erdgeschoß drang der Knall mehrerer Schüsse nach oben. Für die Plünderer in den Räumen ein Signal, schleunigst die Flucht zu ergreifen. Auch Collin Camerons Begleiter waren im Augenblick verschwunden, ohne sich um ihren Führer zu kümmern, der halb betäubt am Boden lag. In den unteren Räumen und im Garten entspann sich zwischen den flüchtenden Banditen und dem vordringenden weißen Stoßtrupp ein reguläres Feuergefecht. Alle Aufmerksamkeit der Befreier konzentrierte sich hierhin.
Der Lärm dieses Kampfes drang auch nach oben und weckte Collin Cameron aus seiner Betäubung. Er öffnete die Augen und sah um sich. Schnell hatte er die Situation erfaßt. Er kannte das Haus von früher her gut und wußte, daß von Florences Zimmern ein offener Balkon direkte Verbindung mit dem Garten hatte. Einmal aus dem Haus, würde er sich unter die weißen Stoßtrupps mischen und sich bei Gelegenheit unbemerkt entfernen.
Er erhob sich und trat durch die Tür in das benachbarte Zimmer. Blitzschnell glitt sein Blick überall prüfend umher. Vielleicht konnte er den Aufbewahrungsort des Schmuckes doch noch im letzten Augenblick entdecken. Da sah er durch die halbgeöffnete Tür im dritten Raum die Gestalt eines Mannes, der in seinen Armen Florence Dewey hielt.
Er stutzte und blieb lautlos stehen. Da … ein Zittern ging durch seine Glieder. Er erkannte Averil Lowdale, den Sohn des Mannes, der ihm die Lordschaft Lowdale geraubt hatte.
Nur einen kurzen Moment, und er hatte die Ruhe wiedergewonnen, hob die Schußwaffe, zielte sorgsam und drückte ab. Mit einem Sprung war er an der Balkontreppe. Mit wenigen Sätzen stand er im Garten und eilte um das Haus zur Straße.
Da knallte es hinter ihm. Er fühlte, wie eine Kugel seinen Rücken streifte. In rasender Eile stürmte er weiter. Noch mehr Schüsse hinter ihm, doch keine Kugel traf ihn.
Dort, wo die Havel das Spandauer Gemünd verläßt und sich zum See weitet, lag an den Hängen des Ostufers das Besitztum Georg Isenbrandts. Gleich von der Uferstraße aus stieg das Gelände hier scharf in die Höhe, und das geräumige Landhaus lag wohl fünfzig Meter höher als der Fluß. Ein weiter Garten, mit alten Laubbäumen dicht bestanden, erstreckte sich von der Höhe des Hauses bis zur Uferstraße hin. Schon zeigte das Laub in diesen Septembertagen jene leichte Vergilbung, die den kommenden Herbst und Laubfall zuerst verkündet. Aber die Sonne, die schon ziemlich tief über dem Westufer des Sees stand, warf breite Ströme goldenen Lichtes über das Laub der Eichen und Kastanien, ließ die uralten Kiefern in purpurner Pracht erstrahlen.
Die Villa Isenbrandt hatte Gäste. An einem Kaffeetisch unter der Krone einer mächtigen Kastanie saßen Theodor Witthusen und Francis Garvin. Dem Amerikaner ließen die Geschäfte auch hier keine vollkommene Ruhe. Eine beträchtliche Post lag vor ihm auf dem buntgemusterten Damast, und eifrig durchlas er Brief auf Brief. Während er die Schriftstücke studierte und hin und wieder mit Randnoten versah, blickte Witthusen in gemächlicher Ruhe auf das weiter Panorama, das sich da vor ihm dehnte: die grünen, vom Sonnenlicht goldig gefleckten Flächen des Gartens, den breiten, blauen Havelsee und dann die Uferberge von Spandau bis Potsdam.
Jetzt wanderte sein Blick aus den Fernen zurück und ruhte lange auf dem Paar, das dort unten im Garten an der Böschungsmauer stand: Maria und Helen. Arm in Arm standen sie dort und spähten die Uferstraße entlang, als warteten sie auf das Erscheinen weiterer Gäste. Äußerlich ein ungleiches Paar, die zierliche kleine Helen und die hochgewachsene Maria. Beide hatten sich schnell miteinander befreundet. Maria hatte den Arm um Helens Taille gelegt und hörte geduldig und freundlich dem munteren Geplauder Helens zu.
»Meine Freundinnen in Amerika haben mich weidlich um die romantische Art beneidet, in der Wellington um mich geworben hat. Aber genau besehen ist das doch eigentlich gar nichts gegen die Art, in der du mit Georg Isenbrandt zusammenkamst. Die Schreckensstunden in den Ruinen von Karakorum und die Errettung durch Isenbrandt, das wäre an sich schon eine Brautwerbung, wie sie so leicht nicht wieder vorkommt. Aber die Art, wie Isenbrandt überhaupt auf dich aufmerksam wurde, das scheint mir doch der Gipfel der Romantik zu sein. Die Ähnlichkeit mit seiner toten Braut benutzt das Schicksal, dich ihm zuzuführen.«
»Nun ja, Helen … ein reiner Zufall war es doch nicht. Die Ähnlichkeit ist schließlich doch durch eine wenn auch entfernte Blutsverwandtschaft begründet.«
»Ja, das mag ja sein, Maria. Aber wunderbar bleibt diese Fügung des Schicksals doch. Eine derartige fabelhafte Ähnlichkeit ist schon ein großes Wunder. Ich weiß, du mit deinem kühlen Blut empfindest das gar nicht so wie ich. Wenn ich das meinen Freundinnen drüben in den Staaten erzähle, wird man es mir kaum glauben wollen. Bitte, erzähle mir einmal genau, wie das war … damals auf dem Kirchhof.«
Einen Augenblick sah Maria über die weite Fläche, und ein ernsterer Ausdruck lag auf ihrem Gesicht. Dann wandte sie sich zu Helen.
»Es war kurze Zeit, nachdem wir hier in Berlin unser Heim gegründet hatten. Georg führte die Reste seines Haushalts von Wierny hierher. Darunter war auch ein Bild der Maria Ortwin. Die frappante Ähnlichkeit ließ mich sofort erraten, wen das Bild vorstellte. Dieses wunderbare Naturspiel wollte mir nicht aus dem Sinn gehen. Ich kam auf die Vermutung, daß hier irgendeine Blutsverwandtschaft vorliegen müsse. Aber von Georg konnte ich darüber nichts erfahren. Auf dem Bild standen nur der Geburtstag und der Todestag des Verstorbenen.
An dem Sterbetag, der wenige Tage später war, forderte ich Georg auf, mich bei einer Spazierfahrt zu begleiten. Dem Chauffeur hatte ich den Kirchhof als Ziel angegeben. Georg achtete gar nicht auf den Weg. Erst als der Wagen vor dem Tor hielt, merkte er den Zweck der Fahrt.
»Es ist heute ihr Todestag«, sagte ich zu ihm, als wir den Friedhof betraten. »Ich hätte ihn vergessen«, sagte er, aber der Druck seiner Hand zeigte mir, daß er mir dankbar war. Bald standen wir an dem Grab. Es war ein Familienbegräbnis. Neugierig suchte ich auf den anderen Grabsteinen nach Namen. Auf einem efeuüberwucherten Stein fand ich vermooste Buchstaben, den Geburtsnamen der Großmutter Marias. Es war der gleiche, den die Mutter meines Vaters als Mädchen trug.
An diesem alten Grab fand meine Vermutung die erste Stütze. Ich forschte weiter nach, und es gelang mir durch Verwandte der Maria Ortwin, die fehlenden Glieder der Kette zusammenzubringen. Jene Ahne Marias und die Mutter meines Vaters waren in der Tat Basen. Das Zauberspiel hatte eine natürliche Erklärung gefunden.«
Der Ruf »Helen!« schnitt dieser, die der Erzählung gespannt gelauscht hatte, die weiteren Fragen ab. Sie winkte ihrem Vater, der mit einem Brief in der Hand am Tisch stand, Antwort zu. Während sie sich ihm näherte, rief er schon: »Nachricht von Florence!«
»Ein Brief von ihr?«
Mit ein paar Sprüngen stand Helen neben ihrem Vater. »Nicht von ihr, my darling!«
»Von wem dann?«
»Von ihrem Vater.«
»Wie kommt das? Was will John Dewey von dir?« »John Dewey wird alt. Der nüchterne, kalte Rechner scheint sich jetzt Idealen zu widmen. Seine Zuneigung zu den seiner Meinung nach unterdrückten Rassen treibt sonderbare Blüten. Er bittet, indem er seinem Wunsch ein philantropisches Mäntelchen umhängt, um nicht weniger als um meine Vermittlung zwischen ihm und Georg Isenbrandt.«
»Und wozu, Pa?«
»Um die Erfindungen Georg Isenbrandts auch für Afrika und die gesamte Welt herzugeben, ihre Wirkungen dort zu nutzen …«
»Ach, Pa! Davon später! Was schreibt er von Florence?« »Nichts Gutes, Helen. Ihr Zustand hat sich anscheinend in keiner Weise gebessert. Die Lethargie, die sie nach dem Tod Lowdales umfängt, will nicht weichen. Sie lebt immer noch einsam, jeden Verkehr meidend, in ihren ständig verdunkelten Räumen dahin. Jeder Versuch, sie dieser schädlichen Selbstpeinigung zu entreißen, ist mißlungen. John Dewey hofft, daß sie ihm folgen wird, wenn er demnächst nach Afrika übersiedelt. Er hofft, daß die veränderten Verhältnisse einen heilsamen Einfluß auf ihren Zustand ausüben werden. Mag er nicht vergebens hoffen. Ihr Geschick ist von einer Tragik, die kaum zu überbieten ist. Vielleicht hätte das Schicksal mitleidiger gehandelt, wenn die Kugel, die das Herz, an dem sie ruhte, traf, auch sie mit hinweggerafft hätte. Wie sich ihr und ihres Geliebten Geschick gestaltet hätte, wenn jene Kugel ihr Ziel verfehlte? …
Wer weiß es?«
Nach einer kurzen Pause des Schweigens ergriff Helen wortlos den Arm Marias und zog sie zum Strand hinab. Das traurige Schicksal der Freundin ging ihr tief zu Herzen.
Francis Garvin reichte den Brief, den er bisher in der Hand gehalten hatte, an Witthusen.
»Lesen Sie selbst und sagen Sie mir, ob ich nicht recht habe, wenn ich den Wunsch John Deweys als reichlich naiv bezeichne. Wäre es nicht gerade so, als ob ich einem Gegner dieselbe Waffe reichen wollte, mit der ich ihn eben erst besiegte? Isenbrandts Erfindungen gehören durchaus uns. Lizenzen werden nur an zuverlässige Leute gegeben, und auch dann nur zu Zwecken rein wirtschaftlicher Natur. So groß sind die Möglichkeiten und Auswirkungen der Erfindung, daß Forscherarbeit von Jahren dazu gehört, um sie zu erschöpfen. Die Gefahren, die sie birgt, sind größer als die dem Laien zunächst offensichtlichen Vorteile. Ein Kollegium von europäischen Gelehrten hat sich bereits an diese Riesenarbeit gemacht. Schon bei der Besprechung der Vorfragen ist man sich schlüssig geworden, daß an eine allgemeine Freigabe der Erfindung auch nur für Europa vorläufig nicht zu denken ist. Nur dann kann es glücken, die Naturgesetze so zu meistern, daß nur Nutzen und kein Schaden entsteht, wenn diese Forschungen abgeschlossen sind und dann von einer Stelle, in der sämtliche Nationen der Erde vertreten sind, aus nach einem festen Plan und Willen gearbeitet wird. Afrika wird vielleicht noch lange warten müssen.«
Nachdem die Dinge in Asien geordnet waren, war Isenbrandt nach Berlin zurückberufen worden und in das Direktorium der E.S.C. eingetreten. Nach jenen sensationellen und politisch so einschneidenden Vorgängen war es von den Berichterstattern der großen internationalen Presse bestürmt worden, die ihn, den Drachentöter, wie ihn der Volksmund nannte, interviewen wollten.
Doch kein Wort war über seine Lippen gekommen. Auch jetzt, nachdem bereits mehrere Monate vergangen waren, verlautete nichts Näheres über seine wunderbaren Entdeckungen. Übereinstimmend hatten sich natürlich die gelehrten Köpfe jeder Art dahin geäußert, daß diese Entdeckungen in ihrer Anwendung einen völligen Wandel der Weltwirtschaft zur Folge haben müßten. In ununterbrochenen Artikeln beschäftigte sich die Presse der ganzen Erde damit und erschöpfte sich in Vermutungen, ob und wann diese Erfindungen zur allgemeinen Kenntnis und Anwendung kommen würden.
Eine allgemeine Weltkonferenz aller Nationen würde über die schwierige Frage entscheiden müssen, wie und wo diese so scharf in den Gang der Natur eingreifenden Mittel arbeiten durften. Bisher war jedoch von einer Einberufung einer solchen Konferenz nichts bekannt.
Bereits jetzt regten sich Stimmen, die Europa beschuldigten, das Mittel für sich allein behalten zu wollen. Nur das war bekannt geworden, daß die Analysen und die genauen Beschreibungen der Verfahren an wohlgesicherten und versteckten Orten aufbewahrt seien. Und auch dies war nur geschehen, um der Welt das Zwecklose eines etwaigen Attentats auf den Erfinder klarzumachen.
Am Bismarckdamm in Berlin stand Wellington Fox vor dem Palast der E.S.C. und wartete auf Georg Isenbrandt. Die Herbstsonne stand schon tief, als der Erwartete endlich aus dem Gebäude trat.
»Das hat ja lange gedauert, Georg!«
»Oh, entschuldige, Fox. Aber die Sitzung war von großer Wichtigkeit.«
»Schadet auch nicht viel. Es fiel mir, während ich hier warte te, so mancherlei von dem ein, was sich ereignet hat, seitdem ich das letztemal hier stand.
Ein schicksalsreicher Sommer! Und vieles von dem, was geschah, seitdem wir uns trennten, bleibt noch zu erzählen. Ich denke, wir gehen den Weg zu deiner Wohnung an diesem schönen Herbsttag zu Fuß.«
Sie bogen von dem hohen Damm zu dem tiefergelegenen Havelufer ab, das mit einem Kranz stattlicher Landhäuser besäumt war. Wellington Fox begann, während sie langsam der sinkenden Sonne nachschritten:
»Denk dir nur, vorhin erhielt ich die Nachricht aus Amerika, daß es dort immer noch unter der Asche glimmt. Der Widerstreit scheint nicht zur Ruhe kommen zu wollen.«
»Wird so schnell nicht zur Ruhe kommen!« warf Isenbrandt ein.
»Du hast recht, Georg. Aber man kann doch nicht sämtliche schwarzen Bürger der Union auf Schiffe verfrachten und nach ihrer Heimat zurückschicken.«
»Natürlich nicht! Aber man sollte es machen, wie man es vor 150 Jahren im kleinen in Liberia machte. Die schwarze Intelligenz muß dabei den Anfang machen. Sie findet in der neuen alten Heimat ein unendlich viel reicheres Betätigungsfeld. Ich bin auch fest überzeugt, daß bei dem Stolz der Schwarzen die Frage in diesem Sinne gelöst werden wird.«
»Hoffen wir, daß du recht behältst! Ich bin etwas skeptisch.
Blieben also schließlich noch die Halfcasts. Die Frage ist buchstäblich eine weitverzweigte. Oft ist kaum zu entscheiden, wo das Halfcast aufhört oder anfängt. Denke zum Beispiel an John Dewey und seine Tochter Florence.«
»Allerdings. Dein Beispiel ist typisch. Hier wird die Schwierigkeit der Frage evident. Das Schicksal der Florence Dewey und des jungen Viscount Lowdale ist tragisch. Die Nachricht von dem Tode Averil Lowdales hat mich tief berührt. Auch der General Bülow betrauert in ihm einen guten Kameraden und tüchtigen Offizier. Du warst bei seinem Tode zugegen?« »Ich kam leider zu spät. Ich konnte dem Mörder, dem Cameron nur noch ein paar Kugeln nachschicken, von denen eine auch Gott sei Dank getroffen hat.«
»Wie? Du erschossest ihn?«
»Nicht direkt. Ich verwundete ihn nur. Er lief mir fort. Ungefähr eine Woche später gab es eine Razzia im Chinesenviertel, wo sich viele der Komprimittierten versteckt hatten. Dort fand man auch Collin Cameron. Er lag in den letzten Zügen. Die schlecht behandelte Wunde führte sein Ende herbei.« »Was wurde aus den Deweys?«
Wellington Fox zuckte die Achseln.
»Sie verzogen aus Frisko und befinden sich seitdem ständig auf Reisen. Die arme Florence ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Nach dem tragischen Ende Averil Lowdales lag sie wochenlang auf den Tod danieder. Für den Vater war diese Krankheit in einer Beziehung sogar ein Vorteil. Man ließ deswegen davon ab, ihm wegen gewisser Konspiritationen den Prozeß zu machen. Ich habe mich auf Helens Bitten in diesem Sinne sehr bemüht …«
»Und da du, alter Freund«, vollendete Georg Isenbrandt lachend, »neuerdings einiges in den Staaten zu bedeuten hast, ist dir das natürlich glänzend gelungen.«
»Spotte nur, alter Junge!« lachte Fox. Schwiegerpapa bedauert täglich, daß ich nicht in den Staaten geboren bin. Sonst wä re mir nach seiner Meinung der Präsidentenstuhl sicher. Über meine Absichten für die Zukunft wußte er bisher noch nichts Gewisses. Erst jetzt, nachdem ich mit mir klar bin, will ich ihm damit kommen Erst mußte ich sicher sein, daß meine Pläne deine Unterstützung finden.«
»Die hast du, Fox!«
Die beiden Freunde hatten auf ihrer Wanderung den höchsten Punkt der Straße erreicht. Hier blieben sie eine kurze Zeit stehen. Vom Gold der sinkenden Sonne beleuchtet, dehnte sich weit vor ihren Blicken die Havel. Weit drüben am Horizont schimmerten die Türme und Bauten von Siemensstadt. Gerade jetzt erhob sich dort eine Flotille mächtiger Flugschiffe. In schneller Folge stiegen sie auf, setzten sich in Kiellinie und nahmen Kurs nach Osten. Unablässig gewannen sie dabei an Höhe, wurden klein und immer kleiner und waren schon fast Punkte, als sie über den Köpfen der beiden Freunde dahinzogen.
Wellington Fox verrenkte sich beinahe das Genick, um sie zu beobachten.
»Was ist das, Georg?«
Es dauerte lange Sekunden, bevor Isenbrandt die Antwort gab: »Was das ist, Fox? Ein neuer heiliger Frühling, den das alte Europa nach Asien schickt. Junge Siemensstädter sind es mit ihren Frauen und Bräuten, die dorthin gehen. Das sind keine Bauernsiedler, sondern Industriesiedler.«
Wellington Fox unterbrach den Freund: »Ich hörte davon.
Aber ich wußte noch nicht, daß diese Pläne sich bis zur Ausführung verdichtet haben. Bisher wollte sich europäisches und amerikanisches Kapital nicht recht an die Ausbeutung der asiatischen Bodenschätze heranwagen.«
»So war es, Fox, solange die politischen Machtverhältnisse da drüben in Asien unsicher waren. Jetzt hat sich das radikal geändert. Was Europa vielleicht in Afrika verloren hat, findet es in Asien dreifach wieder.«
Die letzten Flugschiffe der Flotille waren jetzt am dunklen Osthimmel verschwunden. Wellington Fox sprach wieder: »Wenn aber Kapital und Bevölkerung in diesem großen Maße nach Osten verpflanzt werden, wird sich dann nicht der Schwerpunkt Europas, sein Schwerpunkt in jeder Beziehung nach Osten verschieben?«
»Nein, Fox. Man wird dort Eisen schmelzen und Halbfabrikate machen. Aber die Feinfabrikation bleibt in Europa. Die Schreibtische … die Organisation … das Hirn, das diesen ganzen Mechanismus steuert, bleibt hier. Du brauchst keine Entvölkerung Europas zu befürchten. Es bleibt das Land einer hochwertigen Intelligenz und Organisation.
Langsam weiterschreitend hatten sie das Heim Isenbrandts erreicht. Unter dem Schatten einer alten Kastanie saß Frau Maria im Kreise ihrer Gäste.
Theodor Witthusen … Francis Garvin … Helen Fox, geb.
Garvin. Ihr Geplauder schallte den Eintretenden entgegen. Jetzt hatte Helen die beiden erspäht.
Schnellfüßig eilte sie ihnen entgegen.
»Endlich kommt ihr. Wir hatten uns so auf die gemeinsame Kaffeestunde gefreut, und jetzt, wo sie vorüber ist, kommt ihr erst. Daran bist du sicher schuld.«
Wellington Fox deutete auf Georg Isenbrandt.
»Ich wasche meine Hände in Unschuld. Da steht er, der Missetäter. Nimm dir ein Beispiel an dem Gesicht Marias, Helen dear. Nichts von Vorwürfen … nichts von Ungeduld. Glückse lig der Mann, der ein sanftmütig Weib freite!«
»Wellington! … Du Ungeheuer … Du unhöflichster aller Menschen …«
»Diese Versicherung hörte ich seit dem ersten Tag unserer Bekanntschaft wohl täglich ein dutzendmal.«
»Pfui, Wellington! Du bist …«
»… der unhöflichste Mensch auf Erden.«
Ein leiser Klaps auf Wellingtons Wange quittierte seinen Einwurf. Lachend enteilte sie seinem Griff und hing sich an Marias Arm, die an Isenbrandts Seite zur Terrasse emporschritt.
Wellington Fox ging ihnen nach. Sein Auge haftete auf den beiden ebenmäßigen hohen Gestalten der Isenbrandts. Äußerlich wie innerlich schienen diese beiden Menschen wie füreinander gemacht. Der Zufall, der sie einst zusammengeführt, hatte sie eng aneinandergebunden.
Und dann glitt sein Blick zu Helen. Mit Entzücken verfolgte er die Bewegungen ihrer zierlichen Glieder und dachte bei sich:
Ich hätte mein Leben nicht geglaubt, daß es so ein famoses Mädel gibt. Weiß der Teufel, was die Dollarkönige einen anständigen Menschen abschrecken können. Na! Schließlich hat sich doch auch mein treuer Schwiegerpapa als ganz famoser old fellow entpuppt.
Dann war Wellington Fox bei seiner Frau und legte seinen Arm unter den ihren.
»Die Abrechnung zwischen uns beiden wird später geschehen. Ich habe mir meine Rache inzwischen gründlich überlegt.
Teuerste Frau Maria, Sie täten unendlich viel Gutes an einem Unglücklichen, wenn Sie diesen Wirbelwind etwas in die Schule nähmen.«
»Ich werde mich hüten, Mr. Fox!« antwortete Maria lachend.
»Für Sie ist Helen so, wie sie ist, gerade die Richtige.« »Bravo, Maria!« rief Helen. »Gib’s ihm tüchtig! Zu gut … viel zu gut bin ich für diesen …«
»… unhöflichsten aller Menschen«, vollendete gelassen Fox. Und dann saßen alle zusammen um den runden Tisch im Schatten des alten Baumes. Wellington Fox hatte neben seinem Schwiegervater Platz genommen.
Er entzündete sich eine Zigarre und legte sich behaglich in seinen Stuhl zurück.
»A propos, teuerster Mr. Garvin, wäre Ihnen mit einer guten Position gedient?«
Der Milliardär sah ihn erstaunt an.
»Hm! … Wie meinen Sie, lieber Wellington?«
»Ob Ihnen mit einer guten Position gedient wäre?« Jetzt verriet Garvin das leise Zucken um Wellingtons Lippen den Schalk, der hinter der Frage steckte, und er beeilte sich, darauf einzugehen.
»Das wäre, Mr. Fox? Es ist zwar schon lange her, daß ich eine Position … Sie meinen doch wohl eine Anstellung bei irgend jemand … bekleidet habe. Nach einer dreißigjährigen selbständigen Geschäftsführung würde mir das nicht so leicht fallen …
Ganz abgesehen von der Frage des Salärs, würde die Person meines Chefs für die Frage von ausschlaggebender Bedeutung sein.«
Mit unterdrücktem Lachen folgten die anderen dem Wortgefecht der beiden.
»Hm!« machte Wellington Fox und blies einen Rauchring von sich. »Sie treffen den Punkt nicht ganz, Mr. Garvin. Ihre Stellung würde weniger die eines Angestellten als die eines Partners sein. Der Chef wäre ich!«
»Ah!«
Mr. Garvin beugte sich vor und machte Fox eine Verbeugung. »Dürfte ich den Herrn Chef nach seinen Bedingungen fragen?«
»Bedingungen, Mr. Garvin, trifft wieder nicht ganz das Richtige. Ich sehe, meine Frage war nicht ganz präzis. Die Sache ist einfach die, ich habe ein gutes und großes Geschäft vor und suche dazu einen kapitalkräftigen Partner.«
»Sehr wohl!« sagte Francis Garvin. »Und Sie wollen mir die Ehre erweisen, mich zu Ihrem Partner zu nehmen?«
»Eventuell, Mr. Garvin.«
»Eventuell?«
»Ja! Das heißt nämlich, ich brauche ziemlich viel Kapital … und da ich über Ihre Vermögensverhältnisse nicht genau unterrichtet bin, so hängt es davon ab, ob Sie in der Lage sind, das nötige Kapital einzuschießen.«
»Interessant! … Höchst interessant!« flüsterte Garvin. »Um was handelt es sich? Bitte, reden Sie!«
Wellington Fox sah einen Augenblick einem seiner kunstvoll geblasenen Rauchringe nach.
»Es handelt sich darum, einen Erdteil zu kaufen!« Garvin fuhr mit einem so komischen Ausdruck des Staunens in seinen Sessel zurück, daß alles hell auflachte.
»Nicht möglich, Mr. Fox! Ihre Idee ist großartig! Und da ich weiß, daß Sie sich mit Kleinigkeiten nicht abgeben, vermute ich, daß es der größte sein wird … also Asien?«
»Nicht doch, Mr. Garvin! Ich meine den kleinsten.« »Australien? … Meines Wissens gehört Australien dem australischen Volk.«
»Ihr Einwurf trifft wieder nicht ganz das Richtige, Mr. Garvin. Gewiß! Der australische Erdteil gehört dem australischen Volk. Aber der größte Teil gehört ihm ebenso, wie ihm die Luft darüber gehört. Es hat ihn und hat ihn doch nicht. Insofern nämlich, als der größte Teil davon Wüste und für menschliche Siedlungen ungeeignet ist.«
»Ah!« Garvin legte den Finger an seine Nase und sah Fox bewundernd an. Der kluge Geschäftsmann witterte etwas von den Plänen seines Schwiegersohnes.
»All right, Mr. Fox! Soweit stimmt Ihr Kalkül. Ich bin ge spannt auf das Nähere.«
»Gut, Mr. Garvin! Ich werde Ihnen meinen Plan in aller Kürze auseinandersetzen. Sie wissen, daß von den hundertvierzigtausend Quadratmeilen Australiens fünfzigtausend ganz Wüste und sechzigtausend nur knappes Weideland – in dürren Jahren auch ganz unfruchtbar sind.
Der Ozean bringt von allen Seiten Regen heran. Aber die Randgebirge, die den Erdteil fast wie einen geschlossenen Kranz umgeben, lassen die wasserhaltigen Winde nicht in das Innere des Landes vordringen. An den Außenwänden ein Überfluß von Regen, in der Riesenwanne zwischen den Gebirgen ewige Trockenheit.
Die Frage der Besiedlung hängt davon ab, ob sich die Niederschläge im Landesinnern in genügender Weise steigern lassen. Diese Frage dürfte durch die Anwesenheit unseres verehrten Hausherrn ihre Antwort finden. Er würde in unserem Geschäft als stiller Teilhaber tätig sein. Es würde seinen Verstand einschießen. Seines Beitrittes habe ich mich bereits versichert.
Wie denken Sie nun über Ihre Partnerschaft, verehrtester Mr. Garvin?«
Garvin saß starr. Die Größe des Planes von Wellington Fox schien ihn zu überwältigen. Dann kam es endlich von seinen Lippen.
»Da Mr. Isenbrandt hier sitzt und gegen Ihre im ersten Augenblick so phantastisch klingenden Pläne keinen Widerspruch erhebt, sage ich: Topp, Wellington!
Es wird ein Geschäft werden. Ein großes … ein smartes Geschäft. Was sagen Sie zu meinem Schwiegersohn, Mr. Isenbrandt? War es nicht der glücklichste Griff, den ich je in meinem Leben getan habe?«
»Das sagst du, Pa?« Helen warf sich laut lachend in ihren Stuhl zurück. »Du … der du mich enterben … verstoßen wolltest, wenn ich diesem Journalisten meine Hand geben würde? Soll ich hier die Worte erzählen, mit denen du seine Werbung aufnahmst?«
»Ich würde mich an deiner Stelle hüten, hier zu verraten, daß du am Schlüsselloch gehorcht hast«, erwiderte Garvin lachend.
»Also nochmals: Topp, Mr. Fox! Das Geld ist da! Der Kredit von Francis Garvin genügt zu dem Geschäft.«
»Selbstverständlich!« beeilte er sich dann zu sagen. »Aber wird auch genügend Material da sein? Es gehören viele Millionen von Siedlern dazu, um das Neuland zu besetzen. Die E.S.C. zieht alles nach Asien. Jetzt, nachdem die gelbe Gefahr beschworen, wird der Drang nach Osten ungeheuer werden.« Georg Isenbrandt nahm das Wort:
»Ihre Besorgnis ist unbegründet, Mr. Garvin. Die wirtschaftliche Entwicklung wird auf Grund der neuen Entdeckungen einen derartigen Lauf nehmen, daß Europa einen bedeutenden Bevölkerungsüberschuß abgeben kann. Wir müssen in Turkestan viel Neuland für die Nachkommen unserer Siedler in Reserve halten. Australien als weiteres Siedlungsland ist uns erwünscht, muß uns willkommen sein. Die Patenstelle, die Freund Fox dort übernimmt, gibt ihm eine Aufgabe von größter Bedeutung. Australien soll ein Jungbrunnen der ganzen Menschheit werden.«
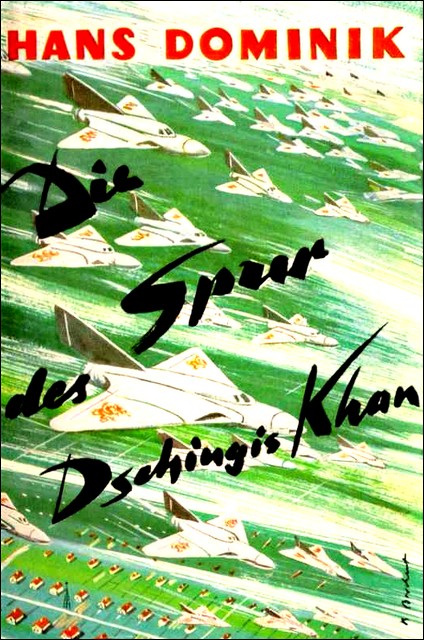
"Die Spur des Dschingis-Khan," Gebrüder Weiß-Verlag, Berlin, 1952