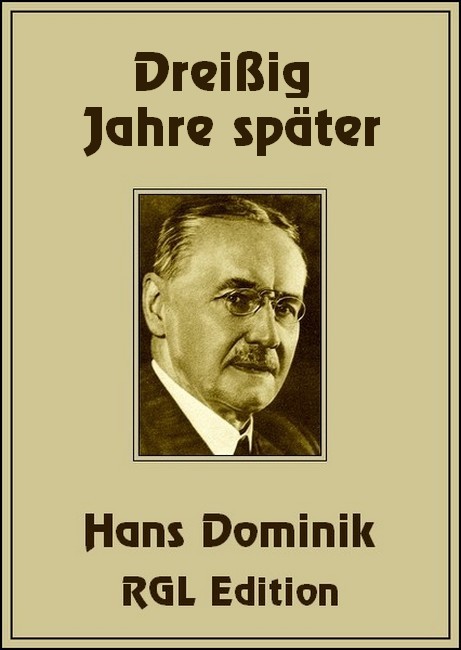
RGL e-Book Cover 2017©
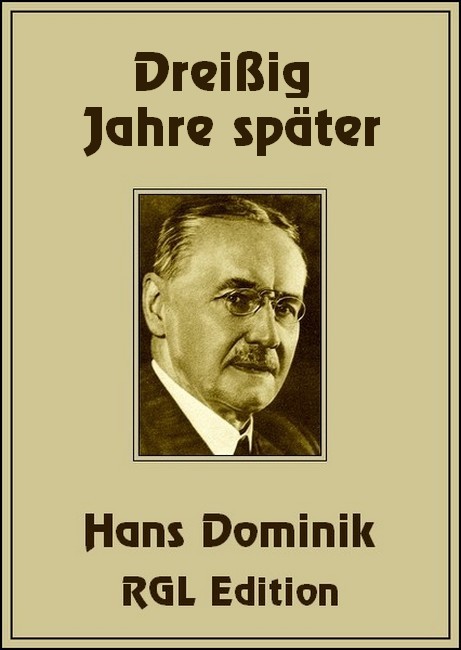
RGL e-Book Cover 2017©
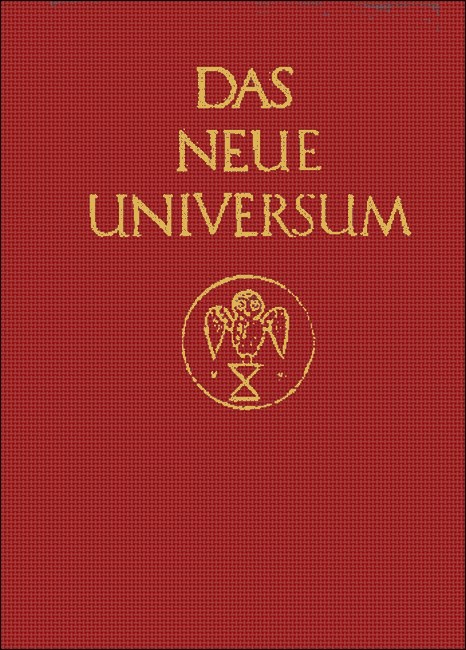
Das Neue Universum, Jahrgang 51, 1930,
mit der Erzählung "Dreißig Jahre später"
Ein schöner Herbsttag des Jahres 1940. In der Berliner Gartenbauausstellung drängten sich die Besucher um einen gewaltigen Kürbis, der mit reichlich zwei Meter im Durchmesser wie ein goldiger Riesenglobus breit und massig in den Strahlen der Abendsonne glänzte. Nur eine kleine Tafel war davor: »Gezüchtet von Professor Olearius«.
Ausrufe und abgerissene Sätze schwirrten im Publikum hin und her.
»Alle Wetter, der Mann kann was! Von dem möchte ich mal Mohrrüben und Kartoffeln sehen«, rief ein jüngerer Herr.
»Kartoffeln? Na, Sie wissen doch, Doktor, daß der Durchmesser der Kartoffeln im umgekehrten Verhältnis zum Quadrat von der Intelligenz des Ökonomen steht«, erwiderte ihm sein Begleiter, dem man den praktischen Landwirt schon von weitem ansah.
»Ach was, machen Sie mir den Professor Olearius nicht schlecht! Was Sie da übrigens von der Intelligenz behaupten, das gilt bloß für euch Landwirte, die ihr über Kali und Thomasphosphatmehl immer noch nicht hinausgekommen seid. Mit dem neuen mitogenetischen Verfahren von Olearius ist das aber etwas ganz anderes. Da steckt wirklich Gehirnschmalz dahinter.«
Der andere schüttelte den Kopf. »Mag sein, lieber Doktor. Aber was im Laboratorium geht, wenn man einen Professor dabei hat, das geht noch längst nicht auf freiem Feld in Wind und Wetter.«
Der Doktor zog seine Brieftasche heraus und entnahm ihr zwei Karten.
»Professor Olearius hält heute abend vor einem kleinen geladenen Kreis einen Vortrag über seine Entdeckungen. Ich hatte das Glück, zwei Karten zu bekommen. Wollen Sie mitgehen, Herr Domänenrat? Es wird sehr interessant werden.«
Der andere überlegte einen Augenblick. »Eigentlich hätte ich eine wichtige Verabredung...«
»Keine Ausflüchte, Verehrtester! Die Vorführung ›Von der Erde zum Mars‹ können Sie sich auch morgen abend noch ansehen.«
»Also gut, ich werde mitkommen. Aber daß ich daraufhin künftig meine Kartoffeln nach dem Verfahren Olearius züchte, kann ich Ihnen nicht versprechen.«
Der Doktor lachte. »Nach dem Vortrag können wir darüber weiterreden.«
Schon geraume Zeit vor Beginn des Vortrags war der große Saal der Ausstellung bis auf den letzten Platz besetzt.
»Eine schauderhafte Fülle«, stöhnte der Domänenrat. »Ich ziehe den Aufenthalt in der frischen Luft meiner Felder diesem Gedränge hier ganz bedeutend vor.«
»Seien Sie zufrieden, daß wir die guten Plätze bekommen haben! Von hier aus werden wir alles gut hören und sehen können. Da kommt der Professor schon.«
Der Vortragende, ein älterer Mann, der ausgesprochene Typ des gelehrten Forschers, trat an das Pult. Unverkennbar waren die Spuren langer und schwerer Geistesarbeit in seine Züge gegraben. Aber als er jetzt zu reden begann, straffte sich die gebeugte Gestalt, und mit jedem Wort, das er sprach, nahm sein Vortrag die Zuhörer immer mehr gefangen.
»Meine Herren«, hub er an, »die Arbeiten, mit denen ich Sie heute bekannt machen will, gehen bis in das Jahr 1921 zurück. Damals gelang dem Professor Alexander Gurwitsch zuerst der Nachweis, daß alle im Wachstum befindlichen lebendigen Organismen eine Strahlung aussenden, durch die andere Organismen ebenfalls zum Wachstum angeregt werden. Gurwitsch stellte damals seinen berühmten Zwiebelversuch an, den ich Ihnen im Lichtbild zeigen werde.«
Der Saal wurde dunkel, während der Projektionsapparat Bilder auf die weiße Leinwand warf.
»Sie sehen hier eine gewöhnliche Küchenzwiebel, die man auf ein mit Wasser gefülltes Glas gestellt hat und die ebenso, wie es Ihnen ja von der Hyazinthenzwiebel her bekannt ist, glasigweiße Faserwurzeln in das Wasser getrieben hat. Wir haben es bei diesen Wurzeln mit sehr schnell wachsenden Organismen zu tun. Das Wachstum erfolgt einerseits durch eine ständige Zellteilung, andererseits durch ein einfaches Größerwerden der infolge der Teilung entstandenen kleinen neuen Zellen.«
Das Bild auf dem Schirm wechselte. Professor Olearius fuhr fort: »Hier erblicken Sie einen stark vergrößerten Querschnitt durch eine dieser Zwiebelwurzeln. Wie Sie sehen, ist die kreisförmige Fläche mit dunklen Punkten durchsetzt. Diese dunkleren Stellen sind Orte, an denen gerade Zellteilungen stattfinden. Die Abbildung läßt erkennen, daß das Wachstum durch Zellteilung über den ganzen Querschnitt hin erfolgt, wie aus der gleichmäßigen Verteilung der schwarzen Stellen unzweifelhaft hervorgeht.«
Wiederum warf der Apparat ein anderes Bild an die Wand.
»Hier, meine Herren, sehen Sie nun den berühmten Fundamentalversuch, nach dessen Bekanntwerden man geradezu von ›Zwiebelstrahlen‹ sprach. Links auf dem Bild ist die Wurzel einer lebendigen Zwiebel in eine senkrechte gläserne Kapillarröhre eingezogen. An einer Stelle ist die Röhre unterbrochen, so daß sich die Wurzel hier in freier Luft befindet. Rechts davon ist eine Wurzel einer anderen Zwiebel in einer waagrechten Kapillarröhre untergebracht. Das Ende dieser Wurzel ist etwa zwei Zentimeter von der ersten Wurzel entfernt.
Ja, meine Herren, das ist der ganze Versuch. Kindlich einfach, vielleicht kindisch einfach, werden manche sagen. Als aber Gurwitsch nach einigen Stunden von der ersten Wurzel links an der Stelle, die in der Höhe der waagrechten Wurzel gelegen hatte, einen Querschnitt machte und mikroskopisch untersuchte, da zeigte sich, daß auf der der zweiten Wurzel zugekehrten Seite die Zahl der Zellteilungen ganz gewaltig vermehrt war. Zweifellos hatte hier unter der Wirkung einer von der zweiten Wurzel ausgehenden Strahlung eine bedeutende Anregung des Wachstums der ersten Wurzel stattgefunden.
Nachdem Gurwitsch seinen Experimentalversuch mehrere hundertmal mit dem immer gleichen positiven Ergebnis wiederholt hatte, setzte er seine Arbeiten fort. An Stelle der unversehrten Wurzel benutzte er ein an der Spitze offenes Röhrchen, das er mit dem frischen Brei einer soeben zerriebenen Zwiebelwurzel füllte. Wieder gab es einen positiven Erfolg, eine unzweifelhafte Wachstumsanregung. Nun tat Gurwitsch einen bedeutenden Schritt vorwärts. An Stelle des Wurzelbreies nahm er Brei von frisch zerriebenen Kaulquappen zur Füllung des Röhrchens, und wieder zeigten sich die bekannten Wachstumsanregungen an der Zwiebelwurzel. Jetzt war der Schluß erlaubt, daß man es hier mit einer allen stark wachsenden Organismen gemeinsamen Strahlung zu tun haben müsse. Die Idee von einer nur der Zwiebel eigentümlichen Strahlung wurde hinfällig. Man konnte ganz allgemein von Lebenstrahlen oder von Wachstumstrahlen sprechen. Professor Gurwitsch erfand dafür die Bezeichnung ›mitogenetische Strahlung‹.
So standen die Dinge um 1926, als sich auch andere Forscher dieser Sache anzunehmen begannen. Insbesondere waren es die Doktoren Reiter und Gabor, die es unternahmen, in Verbindung mit dem physikalischen Laboratorium von Siemens & Halske in Berlin und durch die reichen Hilfsmittel dieses Laboratoriums unterstützt, der Natur mit Hebeln und Schrauben ihre Geheimnisse zu entreißen. Zunächst wiesen sie die mitogenetische Strahlung bei allen stark wachsenden Gebilden, auch bei den bösartigen Krebsgeschwülsten nach. Sie werden vielleicht wissen, daß aufgrund dieser Entdeckung eine ziemlich wirksame Heilmethode für Krebserkrankungen entwickelt wurde.
Weiter aber bemühten sie sich, die geheimnisvolle Strahlung physikalisch zu ergründen. Ich will Sie mit den zahllosen, unendlich mühevollen und geistreichen Versuchen, die zu diesem Zweck angestellt wurden, nicht langweilen, sondern nur die Versuchsergebnisse, die zum ersten Male vor elf Jahren bekanntgegeben wurden, mitteilen. Danach ist die mitogenetische Strahlung eine einfache ultraviolette Strahlung innerhalb der Wellenlängen von zweihundertfünfzig bis dreihundertachtzig millionstel Millimeter. Innerhalb dieses Gebietes ist die Wirksamkeit der Strahlung aber stark verschieden. Ein Maximum der Wirksamkeit liegt bei zweihundertachtzig, ein anderes, noch viel stärkeres, bei dreihundertvierzig millionstel Millimeter Wellenlänge. In dem Gebiet dazwischen ist die Wirkung der Strahlen dagegen nicht nur gleich Null, sondern sogar negativ. Dieser Teil der Strahlung verhindert die Zellteilung. Wenn ich noch hinzufüge, daß es den zuletzt genannten Forschern auch noch, freilich mit unendlicher Mühe, gelang, das Vorhandensein dieser Wachstumstrahlung objektiv durch die Schwärzung einer hochempfindlichen fotografischen Platte nachzuweisen, so habe ich Ihnen damit einen allgemeinen Überblick über die Errungenschaften auf diesem Forschungsgebiet im Jahre 1929 gegeben.
Um diese Zeit nun begann ich mich selbst mit dieser Strahlung zu beschäftigen, und fast sofort stießen mir eine Reihe von scheinbar unlöslichen Fragen auf. Das stand ja fest: Der wachsende Organismus sendet Strahlen aus, die wachstumsfähige Organismen in seiner Umgebung ebenfalls zum Wachstum anregen. Also mußte ich fragen: Warum dauert diese Wechselwirkung nicht ununterbrochen weiter, warum wachsen beispielsweise die Teile einer Pflanze nicht bis ins Ungemessene? Die Ursache dafür, so sagte ich mir, kann nur darin liegen, daß der wachsende Organismus gleichzeitig auch wachstumverhindernde Strahlen aussendet. Vielleicht werden diese Strahlen im Laufe der Entwicklung immer stärker. Vielleicht wird schließlich ein Gleichgewichtszustand zwischen beiden Strahlungsarten eintreten, bei dem das Wachstum aufhört, sobald eine gewisse Grenze erreicht ist.
Ich möchte da, meine Herren, noch einmal weit in die Vergangenheit zurückgreifen. Schon vor fünfzig Jahren hat der Schriftsteller Wells in dem fantastischen Buch ›Die Riesen kommen‹ diese Frage behandelt, freilich ganz unwissenschaftlich und in vollkommen fantastischer Weise. Er läßt einen Erfinder auftreten, der sich zunächst mit den Wachstumskurven der verschiedensten lebendigen Organismen beschäftigt. In diesen Kurven sind auf der Waagrechten die Zeiten, auf den Senkrechten die dazugehörigen Wachstumslängen aufgetragen. Immer ergibt sich dabei, mag es sich nun um Pflanzen, um Tiere oder um Menschen handeln, das gleiche Bild. Die Kurve steigt zunächst sehr schnell an, beginnt sich dann aber zu krümmen und geht zu einer Zeit, die man als Wachstumsende, als Zeit der Reife bezeichnen kann, in eine Waagrechte über, das heißt, der betreffende Organismus wächst nicht mehr weiter. Wells läßt nun seinen Helden einfach ein Pulver erfinden, das etwa wie Kindermehl eingenommen oder bei Pflanzen wie Kunstdünger verwendet werden kann und die erstaunliche Eigenschaft besitzt, die Wachstumskurve ganz anders zu gestalten. So entstehen aus Kindern, die dieses Pulver von Jugend auf bekamen, Riesen von vierzig Fuß Höhe, aus Brennesseln und Bienensaugpflanzen, auf die aus Versehen etwas davon fiel, große Urwaldbäume.
Nun, meine Herren, so einfach ist die Sache in Wirklichkeit nicht. In einer Beziehung hat übrigens Wells doch das Richtige vorausgeahnt: er läßt seine Riesen nicht bis in die Unendlichkeit weiterwachsen. In der Tat gibt es hier eine Grenze. Der alte Satz, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen, besteht auch heute noch zu Recht. Immerhin aber ist es der Wissenschaft gelungen, die Wachstumskurven von Pflanzen durch die Anwendung einer künstlichen ultravioletten Bestrahlung doch ganz wesentlich zu verändern.
Durch systematische Untersuchungen, die ich während der letzten zehn Jahre ausführte, fand ich meine erste Vermutung bestätigt, daß während des Ausreifens einer Pflanze oder Frucht die wachstumfördernde Strahlung immer schwächer, die wachstumhindernde immer stärker wird, so daß das Wachstum aufhört, sobald die Früchte oder Pflanzenteile eine gewisse Größe erreicht haben. Daß diese Größe an sich nicht ein für allemal festliegt, sondern auch durch andere Umstände, beispielsweise durch eine gute Bodendüngung und kräftige Sonnenbestrahlung innerhalb gewisser Grenzen veränderlich ist, werden die praktischen Landwirte unter Ihnen, meine Herren, selbst zur Genüge wissen. Für mich war die Frage zu untersuchen, ob man sie auch durch Bestrahlung der Organismen mittels ultravioletten Lichtes von den genannten günstigen Wellenlängen nach oben verschieben könne. Wie ich Ihnen bereits sagte, ist die natürliche Strahlung der wachsenden Organismen sehr schwach; sie vermag eine fotografische Platte erst im Laufe von vierundzwanzig Stunden zu schwärzen. Aber in unseren Quarzlampen besitzen wir ja künstliche Lichtquellen, die eine millionenfach stärkere ultraviolette Strahlung aussenden, eine fotografische Platte schon im Bruchteil einer Sekunde schwärzen.
Mit solchen Lampen begann ich meine Arbeiten. Ich will gleich vorausschicken, daß mir Fehlschläge dabei nicht erspart geblieben sind. Es zeigte sich hier wie auf allen anderen Gebieten der Strahlungsforschung, daß es für den guten Erfolg auf eine genaue Bemessung der Strahlungsenergie ankommt. Bei meinen ersten Versuchen – ich bestrahlte die Blüten eines Birnbaumes, sobald die Befruchtung stattgefunden hatte, mit sehr starken Lampen – erzielte ich schon im Laufe der ersten Stunden ganz erstaunliche Wachstumserscheinungen. Die Früchte wuchsen buchstäblich zusehends, aber der hinkende Bote kam nach. Was hier unter dem Einfluß der übermächtigen Strahlung entstand, war eine krankhafte Wucherung, deren Riesenzellen sehr bald ebenso wie bei den Krebsgeschwülsten in Verfall und Zersetzung gerieten, den ganzen Organismus vergifteten und zu schnellem Absterben brachten.
Es hat viele Versuche gekostet, bis ich die richtige Dosierung fand. Dann aber, als ich sie hatte, kamen auch Erfolge, von denen Sie nun einige sehen sollen.«
Der Lichtbildapparat wurde ausgeschaltet, der Saal wieder beleuchtet. Auf einen Wink des Professors trat ein Diener hinzu und zog die Vorhänge hinter dem Rednerpult auseinander. Mit ungläubigen Augen blickten die Zuhörer auf das, was sie da sahen. Ausrufe des Staunens, der Verwunderung wurden laut.
»Na, Verehrtester, was sagen Sie nun?« Der Doktor stieß seinen Nachbar an.
»Unmöglich... unglaublich«, murmelte der vor sich hin, »so ungefähr muß wohl die Weintraube ausgesehen haben, die die beiden Boten dem Aaron aus dem Lande Kanaan zurückbrachten.«
Der Vergleich war in der Tat nicht unpassend gewählt. Hing doch dort unter den ausgestellten Früchten eine blaue Traube von reichlich einem Meter in der Länge und einem halben Meter in der Breite, deren einzelne Beeren die Größe normaler Äpfel aufwiesen. Daneben befanden sich Kern- und Steinfrüchte aller Größen, wie sie bisher keines Menschen Auge gesehen hatte. Auf das höchste interessiert, drängten sich die Zuhörer um diese Ausstellung und hielten mit ihrer Bewunderung, aber auch mit Zweifeln aller Art nicht zurück. Eine Weile ließ sie der Professor gewähren, dann ergriff er von neuem das Wort: »Meine Herren, ich entnehme aus Ihren Äußerungen, daß Sie Zweifel über die Güte dieser Früchte haben. Ich kann diese Zweifel auch recht gut verstehen, denn in der Tat werden ja Früchte, deren Wachstum man mit andern Mitteln und in viel geringerem Maße vergrößert hat, nur allzu leicht aromalos und unschmackhaft. Aber Sie sollen sich überzeugen, daß das bei meinen Züchtungen nicht der Fall ist.« Dabei winkte er den Dienern, die jetzt begannen, die Riesenfrüchte zu zerschneiden, einzelne Beeren der Traube abzupflücken und all das auf Teller verteilt in die Menge zu geben.
»Ich bitte die Herrschaften, zu kosten und sich durch den eigenen Geschmack zu überzeugen, daß die Früchte gut sind«, rief Professor Olearius mit lauter Stimme in den Saal. Seiner Aufforderung wurde von allen Seiten Folge geleistet, und bald verriet allgemeines Kauen, Kosten und Schmecken, daß hier in der Tat ein auserlesener Genuß geboten wurde.
»Ich bin einfach platt und erschlagen«, wandte sich der Domänenrat an den Doktor. »Die Dinger sind vorzüglich. Doktor, wenn diese Erfindung wirklich für die große Praxis brauchbar wäre – wir stünden wahrhaftig vor einer neuen Zeit in der Landwirtschaft. Wenn ich mir vorstelle, daß ich jedes Jahr hundert solcher Trauben an meinem Weinspalier ziehen könnte – Himmel, was für Geld würde das in die Kasse bringen! Und wenn es glückte, das Verfahren auf Getreide und Kartoffeln anzuwenden – mit einem Schlage wäre es ja mit der Not der Landwirtschaft überhaupt vorbei.«
Die Zuhörer bildeten Gruppen, in denen die wunderbaren Forschungsergebnisse des Professors lebhaft besprochen wurden. Der stand noch eine Weile vor dem Pult, gab hier und da eine Auskunft und wollte sich dann still zurückziehen. In diesem Augenblick ergriff der Doktor den Domänenrat beim Arm und schob sich mit ihm durch das Gedränge dem Professor nach. Gerade als der die kleine Schlupftür öffnete, hatten sie ihn erreicht und folgten ihm.
»Hallo, Herr Professor!«
Der wandte sich um.
»Sie sind doch – ah, Herr Doktor Reuter. Was bringen Sie mir Gutes?«
Der Doktor schob seinen Begleiter vor. »Gestatten Sie, daß ich die Herren bekannt mache. Mein Freund, Herr Domänenrat Arnoldi – mein alter Lehrer, Herr Professor Olearius. Herr Professor, hier bringe ich Ihnen den Mann, auf dessen Gütern Sie Ihre Versuche in größerem Stil fortsetzen müssen.«
Vergeblich suchte ihn der Domänenrat zu unterbrechen. Unbeirrt fuhr der Doktor fort: »Er hat mir selbst schon vorhin den lebhaften Wunsch ausgesprochen, seine Weintraubenzucht nach Ihrem Verfahren zu verbessern. Im übrigen verfügt er über ausgedehnte Obstplantagen und zweitausend Hektar guten Weizenboden. Es müßte merkwürdig zugehen, wenn sich da nicht Platz für einige Versuchsfelder finden sollte.«
Lange saßen die drei an diesem Abend noch zusammen, erwogen Möglichkeiten, schmiedeten Pläne und besprachen alles Notwendige.
»Arnoldi ist vollkommen verdreht«, sagten die Nachbarn der Domäne Rexow, wenn die Rede auf deren Pächter kam. »Er hat sich mit dem Doktor Reuter und einem verschrobenen Professor aus Berlin zusammengetan und stellt kostspielige Versuche an, bei denen er noch alles verlieren wird.«
Die Reden der Nachbarn waren nicht ganz ungerechtfertigt. Im frühen Frühjahr waren wunderliche Apparate auf Rexow angefahren worden. Monteure waren gekommen, die diese merkwürdigen Dinger, riesenhafte Scheinwerfer schienen es zu sein, rings um ein Feld herum aufstellten. Elektrische Leitungen wurden bis dorthin gezogen und mit den Scheinwerfern verbunden. Es konnte nicht ausbleiben, daß sich immer wieder Neugierige bei diesem Feld versammelten, obwohl der Domänenrat jeden Unbefugten davonjagte.
Trotzdem kamen Sie immer wieder, und die Glossen, die hier gemacht wurden, als die Sommersaat aufzugehen begann, waren alles andere als schmeichelhaft für das neue Unternehmen.
»Was ist bloß in den Arnoldi gefahren?« hieß es. »Das hier soll eine Weizensaat sein! Die Körner sind ja ausgelegt, als ob es sich um Kartoffeln handelte. Hier ein Korn und erst dreißig Zentimeter weiter das nächste. So etwas hat man doch noch nicht gesehen, seitdem Weizen gebaut wird.«
Dann sahen sie die Halme aus dem Boden sprießen und faßten sich an den Kopf. Ja, war denn das überhaupt Weizen? Waren diese tiefgrünen, reichlich fingerstarken Triebe, die dort aus dem Boden des Versuchsfeldes emporbrachen, nicht Mais- oder Hirsesprossen? Und was hatte es mit den merkwürdigen Scheinwerfern auf sich? Kein Mensch hatte sie bisher weder bei Tag noch bei Nacht jemals leuchten sehen, obwohl die Elektriker der Domäne im Dorfkrug versicherten, daß die Anlage jeden Tag vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang in Betrieb sei.
Tage vergingen, Wochen reihten sich zu Monaten. Auf dem Versuchsfeld stand die rätselhafte Saat jetzt voll im Halm. Mais war es nicht und Hirse auch nicht, darüber waren sich die Nachbarn klar. Reichlich fingerstarke Halme von doppelter Mannshöhe standen da, und an ihren oberen Enden trugen sie wohl auch Weizenähren, Ähren freilich, stärker als ein Maiskolben und dreimal so lang. Ein fantastischer Riesenweizen war hier im Wachsen und Werden, darüber konnte kein Zweifel mehr bestehen. Aber wie war das Ganze überhaupt zustande gekommen?
Die Neugierigen steckten sich hinter die Wirtschafter und Knechte von Rexow und begannen zu spionieren. Düngung? Eine außergewöhnlich reichliche Kunstdüngung, etwa das Dreifache der sonst üblichen Gaben, besonders an Stickstoff. Die Saat? Sicherlich ein sehr guter Saatweizen, aber doch die gleiche Saat, die auch auf tausend anderen Feldern zur Verwendung kam und dort nur Halme und Ähren gewöhnlicher Größe hervorbrachte. Nur die eine Lösung für das Rätsel gab es: Jene geheimnisvollen Scheinwerfer, die noch niemand leuchten sah, mußten die Ursache dieses Riesenwuches sein.
Aber hatte das Ganze irgendwelchen Zweck, würden die Unkosten für diese elektrische Anlage nicht jeden Mehrertrag bei der Ernte zehnmal aufwiegen?
Während sich die Nachbarn noch die Köpfe darüber zerbrachen, war die Zeit der Ernte schon herangekommen. Schwere Arbeit für die Schnitter gab es. Mit den gewöhnlichen Kornsensen war gegen diese Pflanzenschäfte, die, völlig verholzt, mehr an Bambusrohr als an Weizenhalme erinnerten, nichts auszurichten. Schon bei den ersten Hieben wurden die Klingen stumpf und schartig. Auch die Mähmaschine versagte. Mit Faschinenmessern mußten die Schnitter an die Ernte gehen und die Halme wie junge Baumstämme niederschlagen. Mit Flegeln mußten die Ähren nach der Urväterweise auf der Tenne ausgedroschen werden, weil die Dreschmaschinen dieses Strohes nicht Herr zu werden vermochten und die Schlagtrommeln an den mit Kieselkristallen durchsetzten eisenhaften Halmen einfach zerbrachen.
Von Hand also wurde der Ausdrusch vollendet. Dann stand die Körnerfrucht dieses ersten großen Versuchsfeldes in Säcken gescheffelt und gebeutelt da, und zusammen mit Doktor Reuter und Professor Olearius errechnete der Domänenrat das wirtschaftliche Ergebnis. Die Unkosten betrugen auf der einen Seite: Dreifache Düngung und die Amortisations- und Betriebskosten der Strahlungsanlage. Als Gewinn ergab sich auf der anderen Seite: Dem Körnergewicht nach das Fünffache einer Durchschnittsernte, dazu eine beträchtliche Ersparnis an Saatgut. Die geernteten Körner selbst schwankten zwischen der Größe einer Haselnuß und einer Pflaume und enthielten, wie Schnittproben zeigten, in der dünnen Kleberhülle duftige, aromatische Weizenstärke.
Ein großer, ein zweifelloser Erfolg war dieser erste Versuch. Eine weitere Aufgabe war noch das Ausmahlen der Riesenkörner. Die Mühle, die es übernahm, mußte besondere Vorkehrungen treffen, den Abstand ihrer Steine so zu vergrößern, daß er zu dem Durchmesser dieser Körner paßte. Doch dann ging auch das. Sauber wurde im ersten Mahlgang die Kleie von den Körnern geschält, und schlohweißes Mehl lief bei den weiteren Gängen in die Beutel.
Dann stand das erste Brot, das aus diesem Mehl gebacken war, auf dem Tisch, und alle, die es versuchten, fanden es vorzüglich. Nun konnte man den endgültigen Erfolg übersehen: Durch eine systematische Anwendung der Wachstumstrahlung lassen sich die Kornfruchterträge der deutschen Landwirtschaft verfünffachen, und den Landwirten selbst bleibt dabei auch nach dem Abzug aller Unkosten noch ein reichlicher Gewinn. Das war das Ergebnis, daß schnell bekannt wurde und sich in den kommenden Jahren praktisch auszuwirken begann.
Jahrzehnte waren verstrichen; die Wachstumstrahlen waren in dieser Zeit Allgemeingut aller landwirtschaftlichen Betriebe geworden. Wo immer sich Kornfelder dehnten, da waren auch jene mächtigen Scheinwerferanlagen zu sehen, die, von den Überlandnetzen mit elektrischer Kraft gespeist, der Saat die nutzbringende Strahlung zuführten. Nur bei den Feldfrüchten, die sich im Dunkel der Erde selbst bilden, bei Kartoffeln und Rüben aller Art, versagte die Erfindung noch, weil das Erdreich für die ultraviolette Strahlung ebenso undurchdringlich ist wie für das sichtbare Licht.
Im Herrenhaus von Rexow saßen Arnoldi und Doktor Reuter mit Professor Olearius zusammen. Nicht spurlos waren die Jahre an ihnen vorübergegangen. Schneeweiß war das Haar des Professors geworden, vom Alter gebeugt seine Gestalt. Aber in unverändertem Glanz strahlten seine Augen, die in einem langen Leben so viel gesehen, erforscht und entdeckt hatten.
»Nun zum letzten!« hub er an. »Andere werden vollenden müssen, was ich begann. Der erste Teil meiner Entdeckung, die Vervielfachung der Ernten mit Hilfe der Wachstumstrahlen, hat sich allgemein durchgesetzt. Der zweite – vielleicht wird er gleiche Wichtigkeit erlangen. Alles, was ich darüber feststellen konnte, liegt hier in diesen Papieren aufgezeichnet für den Fall, daß ich einmal abberufen werde.«
»Lieber Professor«, begann Doktor Reuter, »wir hoffen alle, daß Sie uns noch lange...«
»Lassen Sie, Doktor, jeder weiß am besten, wie er sich fühlt! Hören Sie, was ich zu sagen habe! Durch eine ultraviolette Strahlung von genau bemessenem Kraftgehalt und bis auf Millionstel eines Millimeters genau festgestellter Wellenlänge können wir die Ernten der Menge nach beeinflussen, praktisch wenigstens verfünffachen. Durch andere Strahlen aus dem gleichen ultravioletten Gebiet – alle Einzelheiten darüber stehen hier geschrieben –«, er legte die Hand auf das Schriftstück vor sich, »können wir das Wachstum auch zeitlich beeinflussen und ganz wesentlich beschleunigen.«
»Sie meinen?« unterbrach ihn Arnoldi. »Sie glauben...«
»Bevor ich Ihnen meine Gedanken und Meinungen im einzelnen auseinandersetze, meine Herren, will ich Ihnen einen Versuch zeigen, der mehr als viele Worte sagt. Einen Versuch, der vielleicht auch die Erklärung für ein so lange unerklärliches Experiment der indischen Gaukler enthält.«
Der Professor brachte einen Blumentopf mit fruchtbarer Erde und ein Schälchen mit im Wasser aufgequollenen Erbsen herbei. Mit einem Streichholz kratzte er kleine Höhungen in die Oberfläche und legte die Erbsen so hinein, daß sie mit den Keimstellen, die an den erweichten Hülsenfrüchten deutlich zu sehen waren, in der freien Luft lagen. Sorgsam drückte er die Erde um die einzelnen Erbsen fest und sprach dabei weiter: »Wenn wir diesen Topf der Natur und sich selber überlassen, so werden die Erbsen im Laufe der nächsten drei Tage keimen, im Laufe von drei Wochen werden sich, die nötige Wärme und Sonne vorausgesetzt, Erbsenranken daraus entwickeln. Wenn wir sie gleichzeitig den Wachstumstrahlen aussetzen, so werden wir, wie Sie ja wissen, Riesenerbsen von zwei Zentimeter im Durchmesser erzielen.«
Der Professor war mit der Glättung der Erdoberfläche fertig und schob den Topf bis zur Mitte des Tisches. Nun begann er daneben eine Apparatur aufzubauen, zunächst eine Quecksilberquarzlampe von der Art, wie sie zu jener Zeit allgemein für die Bestrahlung der Felder im Gebrauch waren. Ein versilberter Parabolspiegel umschloß den Quarzkörper der Lampe. Ein Woodsches Filter bedeckte die Spiegelöffnung, so daß nur die unsichtbare ultraviolette Strahlung, aber keinerlei optisch wahrnehmbares Licht aus dem Scheinwerfer in das Freie fallen konnte. Nun schob er ein zweites Stativ mit einer großen Quarzlinse vor den Scheinwerfer und danach ein drittes, das ein mächtiges Quarzprisma trug. Dann zündete er eine einfache Stearinkerze an und winkte dem Doktor, die dichten Fenstervorhänge zu schließen.
Tiefe Dämmerung, nur schwach von der flackernden Kerze durchbrochen, herrschte in dem Gemach. Ein viertes Stativ, das einen Fluoreszenzschirm trug, brachte der Gelehrte herbei, rückte es in den Gang der aus dem Quarzprisma austretenden unsichtbaren Strahlung und löschte die Kerze aus. Volle Finsternis war jetzt vorhanden. Das Klinken eines Schalters unterbrach die Stille. Elektrischer Strom durchflutete die Lampe, und gleichzeitig leuchtete der Schirm in mattem, geisterhaftem Fluoreszenzlicht auf. Breit ausgezogen zeigte sich das Spektrum der an sich unsichtbaren ultravioletten Strahlung auf ihm. Sorgsam prüfte es Olearius mit einer Lupe, bezeichnete durch einen Nadelstich eine bestimmte Stelle auf dem Schirm, griff dann nach dem Blumentopf und stellte ihn mit Hilfe eines fünften Stativs so in den Strahlengang, daß die Erbsen von einer ganz bestimmten Wellenlänge getroffen werden mußten.
»Nun die Vorhänge wieder auf!« rief er dem Doktor zu. »Sie sollen das alte Fakirwunder bei hellem Tageslicht erleben.«
Doktor Reuter eilte zu den Fenstern und zog an den Schnüren. Breit floß das Sonnenlicht in den Raum, so daß die drei geblendet für einen Augenblick die Augen schließen mußten. Blinzelnd öffneten sie sie wieder, rissen sie weit auf und starrten wie verzaubert auf den schlichten Blumentopf auf dem Tisch dort.
Lebendig schienen die Erbsen da geworden zu sein. Was sie alle gelegentlich schon bei kinematographischen Zeitrafferaufnahmen gesehen hatten, das spielte sich hier in Wirklichkeit vor ihren Blicken ab. Sich hin und her windende, sich hoch und immer höher aufrichtende züngelnde Schlangen schienen diese Erbsenkeime geworden zu sein. In wenigen Minuten vollzog sich der Keimvorgang, der sonst wohl drei Tage beansprucht hätte. Schon waren aus den Keimen kleine Ranken geworden, die sich um Stäbe emporwanden, Blätter trieben und Blütenknospen ansetzten.
Das Yoghiwunder der in wenigen Minuten aus einem Samenkorn sprießenden, wachsenden und blühenden Pflanze vollzog sich vor ihren Augen. Hoch aufgerichtet stand Olearius, das schneeige Haar, das bleiche Gesicht vom Gold der sinkenden Sonne überstrahlt, jetzt selber beinahe einem jener indischen Zauberer gleichend, deren Kunst die tausendjährigen Gesetze der Natur ins Wanken zu bringen vermag.
Lautlos standen die drei und blickten auf den wundersamen Vorgang, der sich hier vor ihren Augen abspielte. Schon flockte weiße Blütenpracht wie Schnee um die grünenden Ranken, schon glitt leises Welken über die Blüten, da riß Olearius plötzlich den Schalter herum und unterbrach den Strom.
»Warum das? Warum die Unterbrechung?« fragten die anderen.
»Weil es nicht weitergeht, oder wenn es weitergeht, dann ist es nicht mehr schön anzusehen.«
»Wieso? Weshalb? Warum?« schwirrte es durch den Raum.
»Warum? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Weshalb? Ich weiß es selbst noch nicht. Aber...«
»Aber so lassen Sie uns doch sehen, was weiter geschieht!«
»Wenn Sie durchaus wollen, dann meinetwegen.«
Der Professor drückte den Schalthebel wieder zurück, und brodelnd ließ der Strom das Quecksilber der Lampe aufkochen. Leben schien wieder in den blühenden Erbsenbusch zu kommen. Die Fruchtböden reckten sich, grüne Spitzen, die ersten Anfänge der jungen, sich bildenden Schoten schossen zwischen den vergilbenden Blütenblättern hervor, wollten wachsen und blieben doch plötzlich wie gehemmt in der Entwicklung stecken.
Dann ging es wie ein Erzittern und Sterben durch das Gerank. Schlaff wurden die eben noch strotzenden Stengel, welk und gelb die saftgrünen Blätter. Eben noch gelb, jetzt schon schwarz und ganz verdorrt. Zusehends schrumpfte alles zusammen. Wenige Minuten, und nur noch unansehnliches, dunkles Gestrüpp, wie man es wohl nach einem harten, schneereichen Winter auf einem Erbsenfeld finden mag, hing an den Stäben. Mit einem Seufzer ließ sich Professor Olearius in seinen Sessel fallen.
»Sie haben gesehen, was mir gelang, haben auch gesehen, wo meine Kunst bisher noch scheitert. Sicher, vollkommen sicher und außer allem Zweifel für mich ist die Tatsache, daß man durch eine geeignete Strahlung das Wachstum nicht nur vergrößern, sondern auch ganz bedeutend beschleunigen kann. Ich weiß nicht, ob es zehntausend oder hunderttausend Versuche waren, die ich in den letzten zwanzig Jahren angestellt habe, um die richtige Strahlung, die richtige Bemessung dieser Strahlung zu finden. Die geeignete Wellenlänge habe ich entdeckt; das haben Sie hier gesehen. Aber die Bemessung – wie immer ich’s auch anstellte, stets scheiterten meine Versuche, wenn die Entwicklung bis zum Beginn der Fruchtbildung vorgeschritten war.
Hätten wir diese Erbsen hier, als ich vorhin den Strom unterbrach, sich selber überlassen, so würden Sie einige Tage gekränkelt haben, dann aber doch zur natürlichen Fruchtbildung gekommen sein. Die weitere Anwendung der Strahlung hat sie – ich wußte ja vorher, daß es so kommen mußte – zu schnellem Welken und Sterben gebracht.«
Für kurze Zeit schien der Gelehrte zusammenzusinken. Mit Gewalt raffte er sich zusammen und wurde der Schwäche Herr. Danach sprach er erst stockend, dann flüssiger weiter: »Ich hinterlasse meinen Nachfolgern noch ein schweres Stück Arbeit. Der Gedanke, der mir vorschwebte – Sie werden ihn begreifen, noch bevor ich ihn ausgesprochen habe –, ist, die Entwicklungszeit durch geeignete Strahlung so abzukürzen, daß wir in einem Jahr in Deutschland zwei Ernten haben können. Was das für unser Volk, für die Lebensmöglichkeiten innerhalb unserer Grenzen bedeutet – ich brauche es wohl nicht auseinanderzusetzen.
Die Wahrscheinlichkeit, das Ziel zu erreichen – ich wüßte keinen zwingenden Grund dagegen. Haben wir nicht in anderen, unter einer gesegneteren Sonne liegenden Ländern zwei, ja sogar drei Kornernten im Laufe eines Jahres? Sollte es uns wirklich unmöglich sein, das, was die Natur dort freiwillig gibt, in unserem Klima durch eine künstliche Strahlung zu erzwingen? Es sind noch viele Fragen; schwer, die Antwort darauf zu finden.
Den Anfang des Weges wenigstens, der zu diesem Ziel führt, glaube ich entdeckt zu haben. Alles Wissenswerte darüber« – wieder ließ er die Hand auf das vor ihm liegende Schriftstück sinken – »habe ich hier aufgezeichnet. Mögen es meine Nachfolger versuchen, den von mir beschriebenen Weg bis zum glücklichen Ende weiterzugehen. Mehr als eines Mannes Kraft, mehr als ein Menschenalter mögen dafür vielleicht nötig sein. Die feste Hoffnung nehme ich mit mir, daß der Weg gefunden, jenes herrliche Ziel erreicht wird.«