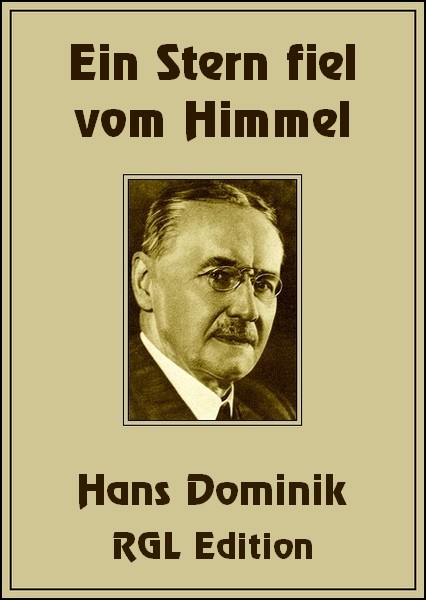
RGL e-Book Cover 2016©
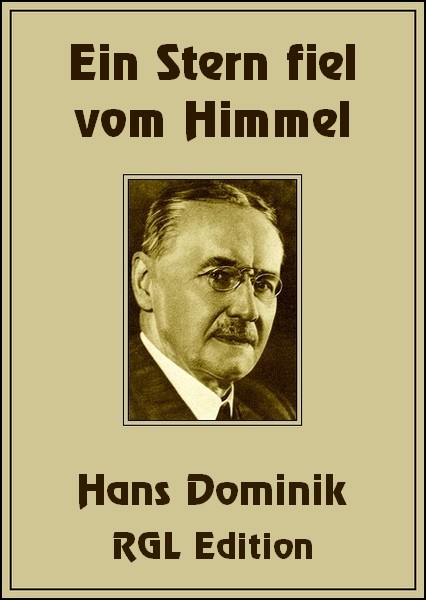
RGL e-Book Cover 2016©
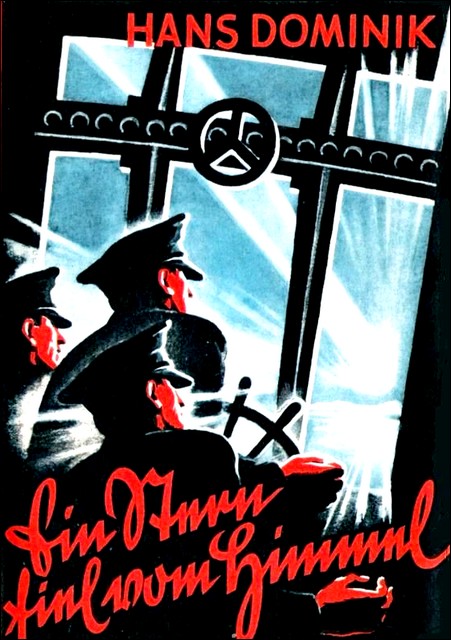
"Ein Stern fiel vom Himmel," Verlag v.Hane & Koehler, Leipzig, 1934
Prof. Eggerths St.-Piloten haben durch Zufall erlebt, wie ein riesiger Meteor vom Himmel stürzt. Prof. Eggert greift ein. In aller Stille entstehen am Südpol gewaltige Werke zur Ausbeutung des Boliden, weil dieser wertvolle Metalle enthält. Eine wilde Folge von Abenteuern, Verhandlungen, Großplanungen hat der geheimnisvolle Stern heraufbeschworen. Wie es gelingt, das wertvolle Material zum Besten der Menschheit zu nutzen, berichtet das packende Buch.
Wie alles, was Hans Dominik geschrieben, ist auch dies Buch voll ungeheurer Spannung, phantastisch, doch in den Grenzen des Möglichen, des vielleicht morgen schon Erreichten. Professor Eggerth, der geniale Konstrukteur und großzügige Organisator, diese Lieblingsgestalt Hans Dominiks, steht mit seinen jüngeren Mitarbeitern wieder im Mittelpunkt des Geschehens. Sie beobachten den Aufprall eines gewaltigen Meteors in der Antarktis, versuchen in aller Heimlichkeit ihn auszubeuten. Aber auch die Gegner, die Spekulanten, sind auf dem Plan. So ergibt sich eine wilde Folge von Abenteuern, von schwierigen Verhandlungen und Großplanungen, von Überraschungen, bis es gelingt, die Schätze, die der Meteor bietet, zum Nutzen der Menschheit zu nützen.
Hans Dominik, der Meister des technischen Zukunftsromans, schuf in der Gestalt des Prof. Eggerth eine Persönlichkeit, begeisternd wie ein Sherlock Holmes, Winnetou oder Old Shatterhand, die in einer Reihe packender Abenteuerbücher wiederkehren und so Volkstümlichkeit in der ganzen Welt erlangten. Auch Professor Eggerth und seine jüngeren Mitarbeiter sind ihren Lesern ans Herz gewachsen, man verfolgt sie mit innerster Anteilnahme in immer neuen Abenteuern auf den verschiedensten Gebieten der Erde. Sie sind die Helden der Zukunft und werden es bleiben. Der geniale Erfinder und Organisator technischer Großtaten, der Bezwinger der Naturgewalten, und seine St.-Piloten, die Kameraden unerhörter technischer Abenteuer, hart an der Grenze des Möglichen, sie lassen jeden Leser atemlos miterleben, was jetzt noch Wunschtraum des Menschen im technischen Zeitalter sein mag, doch morgen schon Keimzelle neuer Wirklichkeit wird.
›St 8‹ auf dem Heimflug. Die Tränen des heiligen Laurentius. Ein Bolide stürzt. Sturm in der Stratosphäre. Orkan und Vernichtung in der deutschen Station. ›St 8‹ in Deutschland.
Ein leuchtender Fleck in der dunklen Polarnacht. Auf hohen Masten erstrahlen vier mächtige Lampen. Ihre Lichtflut wird von schimmernden Schneemassen zurückgeworfen. Sie beleuchten ein Gebäude, halb Haus, halb Schuppen, das der Forscherdrang eines Gelehrten in der Eiswüste der Antarktis entstehen ließ. Ihre Strahlen brechen sich in glänzenden Reflexen an physikalischen Instrumenten, die frei im Schnee stehen, und lassen die Umrisse eines Flugschiffes erkennen.
Schwer und massig wie der Leib eines gestrandeten Riesenwals lastet der mächtige Metallrumpf auf dem Schneefeld. Keine Räder, kein Kufengestell, die ihm eine Möglichkeit zum Starten geben können. Wurde das Schiff von seiner Besatzung verlassen? Ist es dazu verdammt, bis an das Ende aller Tage in der Schneewüste liegenzubleiben?
Als wolle es Antwort geben auf die Fragen, schlägt das Ungeheuer die Augen auf. Zwei gläserne Luken an seinem Kopfteil erstrahlen plötzlich in hellem Licht, und fast gleichzeitig beginnen sechs Propeller über dem Rumpf sich in rauschendem Spiel zu drehen. Der Donner der Motorexplosionen dröhnt durch die eisige Luft.
Noch liegt der Leib des Flugdrachens regungslos auf dem Schnee, während seine leuchtenden Augen wie zornig in die Ferne starren. Und dann—so mag wohl ein Kampfsaurier der Urzeit im Angriff den Stachelkamm gesträubt haben—hebt es sich aus dem Rücken des Flugschiffes, wächst empor und beginnt sich wirbelnd zu drehen. Schneller und immer schneller rotiert die mächtige Hubschraube, lauter brüllen die Motoren. In schimmernden Wolken stiebt der Propellerwind den Schnee auf, schon beginnt der Zug der Hubschraube zu wirken. Schwerelos hebt sich der gewaltige Metallbau vom Boden und schwebt senkrecht empor. Jetzt hat er die Höhe der Lampen erreicht. Jetzt ist er über ihnen und ist im Augenblick von der Dunkelheit verschlungen.
Immer höher steigt das Schiff, immer kleiner wird der Lichtfleck unter ihm. Jetzt ist es nur noch ein leuchtender Punkt, der davon Kunde gibt, daß dort unten am magnetischen Südpol eine deutsche Expedition ihr Lager errichtet hat.
Zwei Kilometer zeigt der Höhenmesser im Kommandoraum des Flugschiffes, da setzen mit voller Kraft die sechs Propellermotoren ein. Schon tragen die Schwingen den Leib des Drachens, und langsam senkt sich die gesträubte Rückenflosse. Die Hubschraube wird in den Rumpf zurückgezogen. Hermetisch wird der ganze Bau geschlossen. Immer höher steigt die Maschine und stürmt durch die Polarnacht dahin. ›St 8‹, das neueste und größte Stratosphärenschiff der Eggerth-Werke, hat seinen Rückflug nach Deutschland begonnen.
Im Kommandoraum des Flugschiffes saß Hein Eggerth vor der Steuerung. Sein Blick hing an dem Höhenmesser, dessen Zeiger langsam über die Skala dahinglitt. 13 Kilometer ... 14 Kilometer ... 15 Kilometer. Seine Hand bewegte ein blankes Gleitstück an dem Steuerapparat, und der Zeiger des Höhenmessers stellte seine Wanderung ein. Eine kurze Zeit noch beobachtete Eggerth das Instrument, dann erhob er sich von seinem Platz.
»So, Wolf! Der Automat ist eingestellt. Vorläufig können wir ›St 8‹ sich selber überlassen.«
Wolf Hansen stand an der großen Backbordscheibe des Stratosphärenschiffes. Zusammen mit Georg Berkoff, dem dritten Mann der Besatzung, schien er dort durch das starke Kristallglas hindurch irgend etwas zu beobachten. Auf die Worte Eggerths hin wandte er sich um.
»Der Robot tut seine Schuldigkeit, Hein? Um so besser! Da draußen ist allerlei zu sehen. Können wir das Licht ausmachen? Es stört die Beobachtung.«
Hein Eggerth nickte und bewegte einen Schalthebel. Die hellen Lampen im Kommandoraum erloschen. Nur noch die Skalenscheiben der Meßinstrumente leuchteten magisch in dem dunklen Raum. Noch einmal blickte Eggerth darauf hin.
»15 Kilometer Höhe, 1500 Stundenkilometer. Alles in Ordnung. Was habt ihr denn da, was euch so interessiert?«
Noch während er es sagte, bemerkte er, daß von außen her durch die Backbordscheibe Licht in den Kommandoraum fiel. Licht, das seine Farbe fortwährend änderte. Jetzt eben noch bläulich-grünlich, dann wieder gelblich, rötlich. Einen Augenblick später schien alles wie blutübergossen.
»Ein Südlicht, Hein«, rief ihm Hansen zu, »so schön habe ich noch keins gesehen.«
Hein Eggerth schaute eine kurze Weile mit den beiden andern zusammen hinaus, dann schaltete er das Licht wieder ein.
»Kommt in den Mittelraum. Da werden wir es viel besser beobachten können.«
Die Decke des Mittelraums bestand zum größten Teil aus klarem Kristallglas. Die Einrichtung war getroffen worden, um Stern- und Sonnenhöhen genau messen zu können, deren Kenntnis für eine sichere Navigierung des Stratosphärenschiffes ja unbedingt erforderlich war.
»Alle Wetter, Wolf! Hein hat recht!« rief Berkoff, als sie in den Mittelraum traten. In der Tat konnten sie hier viel besser als vorher das wunderbare magnetische Feuerwerk beobachten, das die Polarnacht zu ihren Häupten anzündete. Leuchtende, hin und her wallende, ihre Farben fortwährend ändernde Vorhänge schienen es zu sein, die eine überirdische Macht vom Firmament herunterhängen ließ. Ein fortwährender Wechsel der Farben und der Formen. Bald stiegen die farbigen Säume in rasendem Flug nach oben, bald wieder fielen sie bis auf den Erdboden hinab.
»Man merkt, daß wir den 80. Breitengrad überflogen haben«, sagte Hansen mit einem Blick auf seine Uhr. »So schön wird Dr. Wille an seinem magnetischen Südpol da unten die Lichter kaum jemals zu sehen bekommen.«
Berkoff schüttelte den Kopf. »Du bist im Irrtum, mein Lieber. Dr. Wille hat sich ja gerade an den magnetischen Südpol gesetzt, weil er ihn für den Einfallspunkt der Sonnenelektronen hält ... also sozusagen für den Keimpunkt aller Südlichter.«
»Theorie und Praxis!« lachte Wolf Hansen. »Während der drei Wochen, in denen wir ihm seine Station einrichteten, haben wir kein Südlicht zu sehen bekommen. Hier, ein paar hundert Kilometer südlicher, treffen wir sofort auf ein großartiges Exemplar der Gattung.«
»Macht mir den Dr. Wille nicht schlecht!« mischte sich Hein Eggerth ein. »Der Mann hat schon seine guten Gründe dafür, daß er sich gerade auf den magnetischen Südpol gesetzt hat.«
»Ah, bah«, warf Hansen ein, »magnetischer Pol, Drehpol, Kältepol ... alles vielleicht ganz interessante wissenschaftliche Punkte, aber schließlich doch einer so scheußlich wie der andere. Die Herrn Entdecker sind in diese gottverlassene Gegend gekommen, haben allerlei schöne Namen hinterlassen, aber geerbt haben sie bei ihren abenteuerlichen Fahrten nichts. Die ganze Gegend ist keinen Schuß Pulver wert. Bester Beweis dafür: Keine einzige der verschiedenen Nationen ist bisher auf die Idee gekommen, hier etwa Land zu annektieren.«
»Stimmt nicht, Wölfchen«, widersprach Berkoff, »seit 1840 behaupten beispielsweise die Franzosen, daß ihnen Adélie-Land südöstlich von Dr. Willes Station gehört. Die Vereinigten Staaten beanspruchen Marie-Byrd-Land für sich, und die Engländer sind natürlich der Meinung, daß der ganze antarktische Kontinent von Rechts wegen englisch ist.«
»Theorien! Georg«, warf Eggerth dazwischen. »Im Ernst denkt keiner daran, hier irgendwelche Ansprüche geltend zu machen. Die Unkosten für einen Gouverneur und die Zollwächter würden sich nicht lohnen.«
»Meinetwegen Theorie!« verteidigte sich Berkoff. »Aber die Ansprüche sind da und könnten unter Umständen eines Tages praktisch geltend gemacht werden, wenn ...«
Hansen lachte laut auf: »... wenn, ja wenn man vielleicht plötzlich entdecken sollte, daß die Erdachse 100 Meter dick ist und aus purem Gold besteht. Dann würden sich die Norweger darauf versteifen, daß ihr Amundsen am 14. Dezember 1911 am Südpol gewesen ist, und würden die bergmännische Ausbeutung der Erdachse für sich beanspruchen.«
»Und dann würden Engländer und Amerikaner natürlich anderer Meinung sein, und wir hätten den schönsten internationalen Konflikt am Südpol«, meinte Eggerth, »vielleicht ist es wirklich ein Glück, daß es hier nur Schnee und Eis gibt.«
»Und außerdem eine mittlere Sommertemperatur von 40 Grad unter Null und Schneestürme, die den stärksten Mann umwerfen«, führte Hansen die Aufstellung Eggerths weiter. »Sogar Eisbären ziehen es vor, hier nicht zu existieren. Ich bewundere Dr. Wille, der ein volles Jahr in dieser Schneewüste aushalten will.«
Während die drei Freunde so ihre Meinungen über den Wert oder Unwert der Antarktis vertraten, war das bunte Spiel der leuchtenden zuckenden Bänder über ihnen schwächer geworden. Noch einmal ein fahles schwaches Zucken, dann erloschen die letzten Lichtstreifen. Tiefschwarz wölbte sich das Firmament. Deutlich konnten die drei Insassen des Stratosphärenschiffes durch das klare Kristallglas der Decke hindurch die funkelnden Sterne erkennen.
»Ah, eine Sternschnuppe! Ich habe mir was gewünscht«, rief Hansen. »Da! Schon wieder eine! Da eine dritte! Hoffentlich geht mein Wunsch in Erfüllung.«
»Merkwürdig«, Berkoff strich sich über die Stirn, »wir schreiben den 9. August, die Tränen des heiligen Laurentius wären also nach dem Kalender fällig. Aber ich habe noch nie gehört, daß sie auch in den Polarzonen auftreten.«
»Da! Schon wieder eine, hier noch eine!« Hansen deutete mit der Rechten zum Firmament. »Laurentius hin, Laurentius her, wie es scheint, fließen seine Tränen auch am Südpol.«
Schweigend blickten die drei Freunde während der nächsten Minuten in die Höhe. Immer wieder leuchtete es hier und dort am Firmament auf, zog einen leuchtenden Streifen und erlosch.
»Ein ganz hübscher Schwarm, der unserer alten Erde da das Fell kratzt«, meinte Hansen.
»Du wolltest wohl sagen, der ihr die Atmosphäre ankratzt«, verbesserte Eggerth. »Wenn all die Sternensplitter, die sich da in der Nähe der Erdbahn im Weltraum dahertreiben, wirklich bis zur Erdoberfläche kämen, wäre es schlecht um die Menschheit bestellt. Ein Glück, daß unsere Atmosphäre uns vor diesen Weltraumbummlern schützt.«
»Sagen wir: einigermaßen schützt«, unterbrach ihn Berkoff. »Die meisten Boliden tauchen ja nur in die äußersten dünnsten Schichten unserer Atmosphäre ein, kommen dabei durch die Reibung für einige Sekunden zum Glühen und zum Leuchten und verschwinden dann wieder im Weltraum. Aber bisweilen kommt doch mal ein ordentlicher Brocken runter, und wer den auf den Kopf kriegt, der braucht keinen neuen Hut mehr.«
»Ausnahmen, lieber Georg, größte Ausnahmen. Man hat milliardenmal mehr Aussichten, das Große Los zu gewinnen, als von einem Meteoriten erschlagen zu werden«, warf Hansen dazwischen. »Vorläufig brauchen wir uns darüber keine Sorgen zu machen, aber in hundert Jahren vielleicht, wenn wir einmal Raketenschiffe haben und ganz aus der Atmosphäre hinausgehen, dann könnte die Geschichte am Ende eklig werden.«
»Warum?« fragten Berkoff und Eggerth gleichzeitig.
»Weil dann auch das kleinste Splitterchen katastrophal werden kann. Stellt euch mal vor, ihr wäret in einem Raketenschiff in 300 Kilometer Höhe, und es käme euch so ein Weltkiesel von etwa Faustgröße mit 20 Sekundenkilometern entgegen. Der würde durch euer Schiff durchfliegen wie durch Butter. Na, und die Löcher, die das gibt! Ehe ihr sie dichten könntet, wäre euer bißchen Luft in den Weltraum verpufft. Das Ende könnt ihr euch wohl selber denken.«
»Wölfchen hat diesmal recht«, bestätigte Eggerth, »eine künftige Weltraumschiffahrt, die sich aus der schützenden Erdatmosphäre hinausbegibt, wird solchen Zufällen ausgesetzt sein. Ein Mittel dagegen läßt sich kaum finden. Seien wir zufrieden, daß wir in unserm Stratosphärenschiff noch reichlich 100 Kilometer Atmosphäre über uns haben.«
Das Gespräch schlief ein. Schweigend standen die drei in dem von unsicherm Sternenlicht erfüllten Raum. Eggerth betrachtete die leuchtenden Skalenscheiben der Instrumente, die auch hier den Kurs, die Geschwindigkeit und die Höhenlage des Flugschiffes anzeigten. Hansen schaute nach wie vor durch die gläserne Decke und zählte Sternschnuppen. Berkoff ließ sich in einen Sessel fallen und hing seinen Gedanken nach.
»Ah, da! Seht doch nur, eine Sternschnuppe! Nein, ein Meteor!« Hansen hatte die letzten Worte mehr geschrien als gesprochen. Im Augenblick waren die beiden andern neben ihm, starrten ebenso gebannt wie er zum Firmament.
Eine Sternschnuppe war es, die Hansen gesehen hatte, aber wie hatte sich ihr Aussehen in wenigen Sekunden verändert. Ein fahler Lichtstreifen war es zuerst, wie jede Sternschnuppe ihn an das Firmament malt. Ein rötlich strahlender Stern war es inzwischen geworden. Einen kurzen Moment noch so hell, wie die vielen andern Sterne dort oben. Nun schon viel heller, die andern mit seinem Glanz überstrahlend und verdunkelnd.
Ein fallender Stern, eine Sonne, die vom Firmament stürzte. Jetzt stand sie senkrecht über dem Stratosphärenschiff. Grell fielen ihre Strahlen durch das gläserne Dach in den Raum und erleuchteten ihn tageshell bis in die letzten Winkel.
Würde der Bolide das Stratosphärenschiff treffen und zerschmettern? Schon schien die glühende Kugel größer als die Sonnenscheibe zu sein. Unerträglich wurde der Glanz, der von ihr ausging. Nur noch blinzelnd mit zusammengedrückten Lidern vermochten die drei im Stratosphärenschiff nach ihr hinzuschauen ... und sahen dabei, wie das strahlende Gestirn langsam von Steuerbord nach Backbord über der Deckenscheibe entlang zog. In Sekunden wurde es ihnen klar, daß der Bolide links ab vom Flugschiff die Erdoberfläche treffen würde.
Als erster stürmte Eggerth aus dem Mittelraum zu der Kommandostelle. Eilend
folgten ihm die andern. Hier waren ja Seitenscheiben vorhanden, durch die man
die Erdoberfläche sehen, den Aufprall des Boliden vielleicht beobachten
konnte.
Wie von vollem Sonnenlicht beleuchtet erblickten sie die Eiswüste unter sich, als sie die Gesichter an die Scheibe preßten. Die Atmosphäre in der Tiefe war klar, frei von Nebeln und Schneestürmen. Aus einer Höhe von 15 Kilometern konnten sie deutlich die vergletscherten Kämme eines Gebirgszuges erkennen. In tausend Lichtern spielte das bläulichgrüne Gletschereis in immer grellerer Beleuchtung, flimmernd und schimmernd streckte sich eine verschneite Ebene östlich von den Gebirgen in endlose Ferne.
Noch starrten sie wie fasziniert auf das wunderbare Schauspiel, als eine neue, noch viel stärkere Lichtflut sie zwang, die Augen zu schließen. Eine Sonne kam vom Himmel herab. Eine Feuerkugel stürzte backbords vom Stratosphärenschiff auf den Erdball. Sie wußten nicht, wie groß die Kugel war, sie wußten nicht, wie fern oder nah von ihnen sie niederfiel. Nur den Eindruck hatten sie, daß das Gestirn in ihrer nächsten Nähe abgestürzt sei. Und dann drang ein dumpfes Pfeifen und Brausen in ihr Gehör und übertönte das Spiel der Motoren. Ein dröhnender donnernder Lärm erfüllte die ganze Atmosphäre.
Ein schweres Schwanken des Flugschiffes riß sie aus ihrer Erstarrung. Mit
einem Satz war Hein Eggerth am Steuerapparat und suchte die Maschine durch
verzweifelte Manöver wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Minutenlang hatte
er zu kämpfen. Die ganze Stratosphäre, jene hohe, von allen Stürmen und
Orkanen der Erde unberührte Luftschicht war in ein brodelndes kochendes Meer
verwandelt. Das Flugschiff stampfte und schlingerte wie ein Dampfer in
schwerster See. Wie ungeheuerlich mußte die Atmosphäre an der Erdoberfläche
durch den Sturz des Boliden aufgewirbelt worden sein, um solche Störungen bis
in die Stratosphäre zu entsenden?
Während Eggerth sich mühte, das Schiff vor dem Absturz zu bewahren, beobachteten Hansen und Berkoff die Katastrophe weiter. Einen Feuerball sahen sie auf die verschneite Ebene aufschlagen, sahen die Ebene um die feurige Kugel herum aufschwellen und in Sekunden zu gewaltiger Höhe emporwachsen, bis sie wie das Ringgebirge eines Kraters rings um die Glut stand. Noch starrten sie auf den neuen Feuerberg, als Nebel von ihm aufstieg. Auf weite Entfernungen hin verdampften Eis und Schnee, und wie eine dichte Wolkenwand legten sich die Dampfmassen über die Einschlagstelle. Kurze Sekunden noch sahen die beiden das Licht des glühenden Boliden durch den Nebel schimmern, dann verbargen es die Wolken.
Eggerth hatte das Stratosphärenschiff wieder in der Gewalt, als Berkoff zu
ihm trat. Kurze Frage und Antwort, dann griff Eggerth in die Seitensteuerung.
Das Schiff drehte nach Backbord ab, bis es rechtwinklig zu seinem bisherigen
Kurs stand. Geradehin auf die Einschlagstelle ging jetzt der Flug. Berkoff
sah auf die Uhr, als die Schwenkung vollendet war. Es dauerte dann noch neun
Minuten, bis das Stratosphärenschiff senkrecht über dem dichten Gewölk stand.
Die Rechnung war danach einfach zu machen. 1500 Kilometer legte das
Stratosphärenschiff in der Stunde zurück. Nur 225 Kilometer war es von der
Einschlagstelle entfernt, als der Bolide niederging.
In weitem Bogen kreiste das Schiff über dem Schauplatz der Katastrophe. In langen Spiralen ging es mit gedrosselten Motoren nach unten. Der Zeiger des Höhenmessers begann zu fallen. 10 Kilometer ... 8 Kilometer ... 5 Kilometer ... da gerieten sie in die brodelnden kochenden Wolken. Im Augenblick war jede Sicht verschwunden. Weiß und milchig schimmerte es im Licht der Lampen an den Scheiben des Kommandoraums.
»Es hat keinen Zweck, tiefer zu gehen«, sagte Eggerth und griff in die Höhensteuerung.
Das Schiff schraubte sich wieder empor ... 5,5 Kilometer ... 6 Kilometer ... da kam die Sicht langsam wieder, aber das Schiff flog in dichtem Schneegestöber. Noch einmal 500 Meter höher, dann hatten sie das Schneetreiben unter sich. Das Schiff stand über dem Grenzgebiet, in dem sich die emporgerissenen Dampfmassen in der Kälte der Polarnacht zu Schneeflocken verdichteten.
In 10 Kilometer Höhe kreiste die Maschine über dem Wolkenberg. Berkoff stand
im Mittelraum und arbeitete mit einem Sextanten. Er notierte Sternhöhen,
schlug Tabellen auf, rechnete, schrieb schließlich zwei Zahlen nieder:
›83 Grad 14 Minuten Süd, 158 Grad 12 Minuten Ost.‹ Das Papier
mit den Zahlen in der Hand kam er in den Kommandoraum zurück.
»Den genauen Ort haben wir, was machen wir jetzt?«
»Merkwürdige Frage«, erwiderte Eggerth, »wir haben den Auftrag, nach Deutschland zurückzufliegen. Alles übrige kann uns egal sein.«
Noch während er es sagte, brachte Eggerth das Schiff wieder auf den alten Kurs. »Wir müssen uns dranhalten, wenn wir morgen mittag in Bitterfeld sein wollen.«
»So eilig ist es doch nicht, Hein«, widersprach Hansen, »dein alter Herr kann sich für einige Zeit auch ohne uns behelfen. Ich hätte verdammt Lust, mir erst noch mal den Boliden aus der Nähe anzusehen.«
»Junge, Junge, da kannst du dir eklig die Finger verbrennen«, warf Berkoff ein, »der Brocken, der da runterkam, war wohl einen Kilometer dick. Was meinst du, was das für eine Portion Hitze bei dem Anprall gegeben hat. Ich habe es eben mal überschlagsweise berechnet. Da kommen Billionen von Kalorien raus. Es wird wenigstens Wochen dauern, ehe man sich der Einschlagstelle nähern kann.«
Hansen machte ein betrübtes Gesicht.
»Schade! Ich habe mir das so schön gedacht, den Fall gleich auf frischer Fahrt zu untersuchen. Na denn nicht! Du hast doch wenigstens die genaue Ortsbestimmung, Georg, damit wir die Stelle beim nächsten Male wieder finden?«
»Habe ich, Wolf. Fürchte aber, daß es beim nächsten Mal noch zu früh sein wird. Übrigens könnten wir ja mal den guten Wille anklingeln, ob er was von dem Boliden gesehen hat.«
Berkoff ging zur Funkstation des Schiffes und schob sich die Kopfhörer über die Ohren. Die Morsetaste begann zu klappern. Schon nach kurzer Zeit hatte er die Verbindung mit der Station hergestellt.
»Gesehen haben sie etwas, aber nicht viel«, rief er Eggerth zu. »Außer vielen Sternschnuppen wollen sie auch dicht über dem Südhorizont eine Feuerkugel beobachtet haben. Dr. Wille nimmt an, daß ein kleiner Meteorit in etwa 100 Kilometer Entfernung von seiner Station niedergegangen ist.«
Hansen lachte auf:
»Hundert Kilometer! Da hat sich der gute Mann gründlich verkalkuliert. Tausend Kilometer war das Ding von ihm ab ... kleiner Meteorit, na ich danke ... mir war der Brocken groß genug!«
Die Taste tickte unter seinen Fingern. Es war eine lange Depesche, die er nach der Station funkte.
»So, denen da unten habe ich den Star gestochen. Die wissen jetzt Bescheid, was passiert ist.«
Er schaltete wieder auf Empfang um.
»Sie scheinen's noch nicht recht glauben zu wollen. Na, dann kann ich ihnen auch nicht helfen.«
Eggerth setzte das Flugschiff wieder auf seinen alten Kurs. Mit voller Maschinenkraft stürmte es durch die Stratosphäre dahin und brachte in jeder Minute 25 Kilometer hinter sich.
Für die nächsten Stunden verschwand der Bolide aus der Unterhaltung der drei.
Schon hatte ›St 8‹ den südlichen Drehpunkt des Erdballes
überflogen und folgte einem Kurs auf dem 15. Grad östlicher Länge. Die Nacht
wurde lichter. Als sie den 70. Breitengrad kreuzten, tauchte die Sonne auf.
Endloses Packeis ließen ihre Strahlen in rötlichen Reflexen erschimmern. Bald
wurden es treibende Schollen, und dann lag das eisfreie blaue Meer unter
ihnen.
Noch einmal zwei Stunden und der Südatlantik war überflogen; der afrikanische Kontinent erreicht. Mit unverringerter Geschwindigkeit raste das Stratosphärenschiff weiter nach Norden. Eine Nacht kam und ging. Am folgenden Morgen war es über Deutschland.
Fünf absonderliche Pelzwesen hatten dem Stratosphärenschiff kurze Zeit nachgeschaut, als es die Station in der Antarktis verließ. Aber die grimme Kälte und der schneidende Wind luden nicht zu längerem Verweilen im Freien ein. Sobald ›St 8‹ ihren Blicken entschwand, kehrten sie in das Stationshaus zurück, in dem die elektrische Heizung eine behagliche Wärme verbreitete.
Hier waren die gewaltigen Bärenpelze nicht mehr vonnöten, und wie sie abgelegt wurden, kamen menschliche Gestalten zum Vorschein. Aus dem ersten Pelz schälte sich ein mittelgroßer Herr, der etwa in der Mitte der Vierziger sein mochte. Seine hohe Stirn und die klugen Augen verrieten den Gelehrten, während das starke Kinn zähe Tatkraft und Entschlossenheit kündete. Es war Dr. Rudolf Wille, der die Station hier am magnetischen Südpol unter 73 Grad Süd und 115 Grad Ost aus eigenen Mitteln, aber mit tatkräftiger Unterstützung der Eggerth-Werke errichtet hatte.
Die Gestalt neben ihm, zwei Köpfe größer und sehr viel dünner, entpuppte sich als sein Assistent, Dr. Schmidt. Aus dem dritten Pelz sprang ein schlanker Junge von siebzehn Jahren, Rudi Wille, der Sohn des Stationsleiters. Aus dem vierten kroch Karl Hagemann, Mechaniker von Beruf und Faktotum bei Wille. Daneben noch Maschinist, Proviantmeister, Koch und Hans Dampf in allen Gassen. Alles in allem ein Universalgenie und für die Station unentbehrlich. Dem fünften Fell endlich entschlüpfte der blonde Jens Lorenzen, von der friesischen Wasserkante, früherer Funkergast bei der deutschen Marine, jetzt absoluter Herr über das Funkwesen in Willes Station.
Während Dr. Wille seine vereiste Brille reinigte, verstaute Hagemann die schweren Pelze mit bemerkenswerter Geschwindigkeit in einem Nebenraum und fragte:
»Brauchen mich Herr Doktor jetzt?«
Wille schüttelte den Kopf. »Vorläufig nicht, Hagemann. Kümmern Sie sich um das Abendbrot.«
»Sehr wohl, Herr Doktor.«
Hagemann tauschte einen kurzen Blick mit Rudi Wille und verließ zusammen mit ihm den Raum. Ihr Weg führte sie durch einen schmalen Gang zu dem am einen Ende des Stationshauses angebauten Vorratsschuppen. Hagemann öffnete die Tür, schaltete die Beleuchtung ein. Das Licht der elektrischen Birnen zeigte einen Vorrat an Lebensmitteln, der für die fünf Personen der Station auf Monate reichen mußte.
»Schauen Sie her, Rudi«, sagte Hagemann, »Sie haben die Herrlichkeiten noch gar nicht gesehen, die uns ›St 8‹ mitgebracht hat.«
Er deutete dabei auf Regale, die mit Konserven aller erdenklicher Art gefüllt waren.
Rudi zuckte die Achseln.
»Konserven, Hagemann, Konserven und nochmal Konserven. Ich habe genug von dem ewigen Blechbüchsenfutter.«
»Sehr richtig, Rudi. Ist auch nur für den Notfall gedacht. Als Reserve, wenn die regelmäßige Zufuhr ausbleiben sollte. Aber sehen Sie sich mal das hier an!« Er öffnete die Tür zu einem Nebenraum, in dem die elektrische Heizung so schwach eingestellt war, daß die Temperatur nicht viel über dem Gefrierpunkt lag.
Rudi Wille blickte in die Kammer und sah Dinge, die sein Herz erfreuten. Da lagen frische Gemüse und Kartoffeln in Mengen. Da hingen an Haken ausgeschlachtete Kälber und Schweine und daneben Geflügel aller Art. Hagemann stieß ihn in die Seite.
»Was, Rudi!? Das ist ein Fressen für die Götter. Vorläufig brauchen wir keine Blechbüchsen aufzumachen. Ja, ja! Die Eggerth-Werke! Wenn wir die nicht hätten, sähe es traurig um uns aus. Na für heute wollen wir uns mal ein feudales Roastbeef mit Bratkartoffeln leisten.«
Während er es sagte, säbelte er von einem Rinderviertel ein tüchtiges Stück herunter. »So, das soll uns schmecken! Ich will's gleich in die Pfanne hauen.«
Das Fleisch in der Hand verließ er den Vorratsraum. Rudi Wille begleitete ihn nur ein Stück. Dann verabschiedete er sich, um zu Lorenzen zu gehen.
Hagemann trat in die Küche. »Alte Bastlerseele« knurrte er vor sich hin, »immer bei Lorenzen in der Funkerbude hocken und morsen ... na meinetwegen kann er das Vergnügen haben. Wer weiß zu was es gut ist ... Ist wenigstens noch einer in der Station, der den Funkkram versteht, wenn Lorenzen mal der Schlag treffen sollte.«
So vor sich hinbrummend, machte sich Hagemann daran, die Kartoffeln für das Abendbrot zu schälen. Währenddessen saß Rudi schon bei Lorenzen und vertrieb sich die Zeit damit, Funksprüche aus allen Teilen der Erde aufzufangen.
Lorenzen ließ ihn gewähren. Er war aufgestanden und schaute durch das Fenster in die dunkle Ferne. Ganz weit im Süden dicht über dem Horizont sah er bunte Streifen aufwallen und wieder verschwinden, den Abglanz eines fernen Südlichtes. Dann blickte er zum Himmel empor, sah Sternschnuppen häufiger und schöner fallen als in früheren Nächten und sah schließlich auch einen besonders starken und glänzenden Meteor am fernen Horizont hinabschießen.
»Schade, Rudi! Da haben Sie etwas versäumt. Eine wunderbare Sternschnuppe, war schon beinahe eine Feuerkugel. Höchstens hundert Kilometer kann das Ding von uns ab gewesen sein.«
Rudi Wille hörte nur mit einem Ohr zu. Am anderen behielt er das Telephon und verfolgte mit sichtlichem Interesse einen Depeschenwechsel zwischen zwei Dampfern in der Nähe von Kapstadt. Dabei kamen Lorenzen seine Instruktionen in die Erinnerung.
»Es geht nicht, Rudi, daß Sie hier den ganzen Äther abfrühstücken. Der Empfänger muß auf unserer Stationswelle stehen. Besonders jetzt, wo ›St 8‹ unterwegs ist«, sagte er und stellte den Empfänger wieder auf die mit den Eggerth-Werken verabredete Geheimwelle ein. Rudi warf den Kopfhörer auf den Tisch.
»Gemeinheit, Lorenzen! An der interessantesten Stelle haben Sie mir das Gespräch abgekniffen. Aber ich weiß, was ich tue.«
»Na, was denn, mein Jungchen?« lachte der Funker.
»Sehr einfach! Morgen fange ich an und baue mir einen eigenen Empfänger. Wir haben ja genug Einzelteile im Lager.«
Und nun begann Rudi zu erzählen, was für einen großartigen Empfänger er sich bauen würde und begeisterte sich dabei immer mehr für den eben erst gefaßten Plan. Mitten in seine Schilderung hinein brummte der Summer des Stationsempfängers. »Wie gut, Rudi, daß wir richtig auf Empfang stehen«, meinte Lorenzen, während er sich den Kopfhörer überschob.
Es war ›St 8‹, das anfragte, ob man auch auf der Station etwas von dem Boliden gesehen habe. Da konnte nun Lorenzen dienen, und da er seine eigenen Ansichten mit der Autorität von Dr. Wille bemäntelte, gab es ein längeres Hin- und Herfunken, bis die Station wieder auf Empfang stand und Rudi seine Baupläne weiter ausspinnen konnte.
In einem Mittelraum des Stationshauses hatte Dr. Wille sein erdmagnetisches
Kabinett eingerichtet. Als Observatorium war es ursprünglich gedacht, aber in
den wenigen Monaten, die sie hier waren, war daraus bereits zum Teil ein
Laboratorium mit ganz ungewöhnlichen Apparaten und Einrichtungen geworden.
Neben den üblichen Magnetometern für die fortlaufende Registrierung der
erdmagnetischen Intensitäten standen hier auch hochempfindliche elektrische
Meßinstrumente, und schließlich nahmen bizarr geformte Glasröhren, in denen
Dr. Wille den Einfall der Sonnenelektronen studieren wollte, einen guten Teil
des Raumes in Anspruch.
Nach dem Abflug des Stratosphärenschiffes hatte sich Wille mit seinem Assistenten hierhin begeben, und jetzt waren die beiden Gelehrten in eine lebhafte Meinungsverschiedenheit geraten. Schmidt, der lange dürre Schmidt, eine international anerkannte Kapazität auf dem Gebiet des Erdmagnetismus, hatte an der Elektronentheorie Willes allerlei auszusetzen.
»Sie geben doch wenigstens zu, Herr Schmidt, daß ein Zusammenhang zwischen den Sonnenflecken und den Änderungen des Erdmagnetismus besteht«, rief Dr. Wille, ärgerlich über die Einwände des anderen.
Schmidt kniff die schmalen Lippen zusammen und antwortete zögernd, wie wenn er jedes Wort abwägen müsse. »Ein Zusammenhang scheint vorhanden zu sein, aber wir kennen das Wesen dieses Zusammenhanges noch nicht.«
Wille griff nach einem kleinen Modell. Es stellte eine Erdkugel dar, an deren beiden Polen eigenartig gewundene Drähte angebracht waren.
»Der Zusammenhang muß für jeden denkenden Menschen vollkommen klar sein«, fuhr er fort. »Aus den Sonnenflecken werden Unmengen von Elektronen mit enormen Geschwindigkeiten in den Weltraum geschleudert. Ein Teil davon kommt der Erde so nahe, daß er unter den Einfluß des erdmagnetischen Feldes gerät. Und dann ...« Er fuhr mit dem Finger an den Drähten des Modells entlang, »sausen sie in Kurven um den großen Erdmagneten herum, bis sie an einem der beiden Pole in den Erdball eintreten.«
»Man hat sie noch nicht eintreten sehen«, warf Schmidt ein.
»Ich werde Ihnen den Eintritt in diesen Vakuumröhren zeigen, Herr Schmidt. Aber Sie haben ihn auch schon vorher gesehen. Jedes Nordlicht, jedes Südlicht ist ja nichts anderes als ein solcher Elektronenhagel in der obersten dünnen Atmosphäre.«
»Eine hübsche Theorie, aber noch nicht bewiesen«, widersprach Schmidt.
»Am Modell im Laboratorium klipp und klar bewiesen, Sie ungläubiger Thomas!« ereiferte sich Wille. »Geben Sie endlich den Elektronenfluß von der Sonne her in die beiden Erdpole zu?«
Der lange dürre Schmidt sah in diesem Augenblick noch länger und noch dürrer aus als gewöhnlich.
»Höchstens als Arbeitshypothese, Herr Wille, deren Wahrheitsgehalt sich erst erweisen muß«, sagte er, bewegte den Mund, als ob er etwas verschluckt hätte, und kniff die Lippen wieder fest zusammen.
»Meinetwegen können Sie auch Hypothese statt Theorie sagen. Jedenfalls ist dieser riesige Elektronenfluß nichts anderes als ein enorm starker elektrischer Strom, der den Erdmagneten umfließt und ihn ... das werden Sie mir nicht bestreiten können, Herr Schmidt ... in seiner Intensität verstärken oder verschwächen, jedenfalls beeinflussen muß!«
»Wenn er tatsächlich vorhanden ist!« warf der unverbesserliche Schmidt ein.
»Herrgottssakra, Schmidt! Bei Ihnen kann man die Geduld verlieren. Kommen Sie! Wir wollen zu den Instrumenten auf dem Hof gehen und noch mal sehen, wie schnell die Kondensatoren sich aus der freien Luft aufladen ... mit Sonnenelektronen, Herr Schmidt. Darum dreht sich's.«
Immer noch in ihren Disput verwickelt, zogen die beiden Gelehrten sich die vorsintflutlichen Pelze über und traten auf den Hof hinaus. Die Einrichtungen, die Wille hier aufgebaut hatte, erinnerten einigermaßen an die Freiluftanlagen eines modernen Umspannwerkes. Da standen mannshohe Zylinder aus Eisenblech, die wetterfest eingebaute Hochspannungskondensatoren enthielten. Über jedem Eisenzylinder standen auf Isolatoren zwei blinkende Messingkugeln, die mit den beiden Belägen des Kondensators verbunden waren. Dr. Wille trat an einen der Apparate heran, griff nach einem Funkenzieher und berührte die beiden Kugeln damit.
»Der Kondensator ist leer, Herr Schmidt. Nicht das kleinste Fünkchen ist zu sehen. Nun passen Sie bitte auf!«
Er bewegte einen Luftschalter und erdete dadurch den einen Kondensatorpol. Er bewegte einen andern Schalter und brachte dadurch den zweiten Pol mit einer Leitung in Verbindung, die an einem hölzernen Gittermast etwa hundert Meter in die Höhe ging und dort in einem Gebilde von metallischen spitzen Kämmen endigte.
»9 Uhr, 5 Minuten, 10 Sekunden Greenwichzeit, Herr Schmidt«, fuhr er mit einem Blick auf seine Taschenuhr fort. Er behielt die Uhr in der Hand und folgte dem Fortschreiten des Sekundenzeigers. Schmidt stampfte ungeduldig auf seinem Platz hin und her. Trotz des dicken Pelzes und der gefütterten Gummistiefel drang ihm die Kälte empfindlich in seine dürren Knochen.
Die Sekunden verstrichen. Als die fünfzigste herankam, begannen die Kugeln zu knistern, hin und wieder huschte ein bläulicher Schimmer über sie hin. Als die Minute voll war, schlug ein krachender heller Blitzfunke zwischen ihnen über. Wille steckte seine Uhr wieder in die Tasche.
»Eine Minute, Herr Schmidt, um einen Kondensator von hundert Mikrofarad auf eine Spannung von 50 000 Volt aufzuladen. Wie denken Sie jetzt über die Sonnenelektronen?«
Dr. Schmidt hatte noch ein gutes Dutzend Einwände auf Lager. Aber es fror ihn zu sehr, um sie hier draußen an den Mann zu bringen.
»Ich schlage vor, daß wir die Sache drinnen besprechen«, sagte er ... wollte er sagen ..., da kam ein dumpfes Brausen durch die Luft. Wie der tiefe Ton einer mächtigen Schiffssirene klang es zuerst, schwoll in Bruchteilen einer Sekunde zu unerträglicher Stärke an. Dann traf ein orkanartiger Sturmstoß die beiden. Einen Augenblick sah Schmidt noch die hohen Lichtmasten wie Streichhölzer zusammenknicken und niederstürzen. Dann wurde es dunkel. Er sah nichts mehr, fühlte sich nur von dem Orkan mit unwiderstehlicher Kraft in wirbelndem Schnee über den Hof dahingerissen und stürzte nieder. Über ihm häufte sich der Schnee zu einer starken Wehe.
Um die gleiche Zeit saß Rudi immer noch mit Lorenzen zusammen und schmiedete
hochfliegende Empfängerpläne. Die beiden hörten das aufkommende Brausen und
Dröhnen, vernahmen etwas von dem Krachen der niederstürzenden Masten, sahen
den Hof dunkel werden. Erschreckt starrten sie sich an. Da fühlten sie den
Boden unter sich beweglich werden. In jähem Ruck hob sich die ganze
Funkerbude von ihren Fundamenten. Dabei zerrissen die Leitungen, es wurde
auch hier dunkel. Eine kurze Strecke wirbelte die Bude durch die Luft, drehte
sich dabei und schlug seitlich auf den Boden. Dichte Schneemassen wirbelten
darüber hin und begruben sie unter sich.
Karl Hagemann hatte den elektrischen Herd eingeschaltet und sein Roastbeef
eben in die Pfanne getan. Mit Gott und der Welt zufrieden stand er dabei und
freute sich, wie das Fleisch in dem brodelnden Fett briet. Da schleuderte ihn
ein jäher Stoß in die Ecke neben dem Herd. Er spürte, daß sich alles um ihn
bewegte, hörte Wände brechen. Schneewirbel umgab ihn. Ehe er sich rühren,
sich aufrichten konnte, war er von dichten Schneemassen bedeckt. Im Schnee
begraben waren im Laufe weniger Sekunden alle fünf Insassen der Station. Sie
konnten nicht mehr sehen, wie der Orkanstoß auch den Maschinenschuppen
demolierte und das große Stationshaus schwer beschädigte.
Was war geschehen? Mit Schallgeschwindigkeit hatte sich eine explosionsartige
Luftwelle von der Einschlagstelle des Boliden her nach allen Seiten
ausgebreitet. Wenn man sich erinnert, daß ihre Ausläufer noch in 100
Kilometer Entfernung die Stratosphäre in Aufruhr versetzten, so wird man es
begreifen, daß ihre Wirkungen auf der Erdoberfläche über alle Maßen
entsetzlich waren. Fünfzig Minuten nach dem Sturz des Boliden erreichte die
Explosionswelle Dr. Willes Station und verwandelte sie im Augenblick in einen
Trümmerhaufen. Wer vermochte zu sagen, ob noch Leben unter den Schneewehen
vorhanden war, die sich dort über Ruinen türmten?—
Mit unverminderter Geschwindigkeit stürmte die Welle weiter und brachte noch Sturm und Unwetter über die südlichen Teile von Afrika, Australien und Amerika. Die Meßinstrumente in allen Bebenwarten der Erde gerieten in Aufruhr und zeichneten ein schweres Fernbeben in der Antarktis auf. Geologen und Meteorologen zerbrachen sich ihre Köpfe über die möglichen Ursachen. Den wahren Ursprung all dieser Erscheinungen vermochte niemand anzugeben. Nur die Besatzung von ›St 8‹ hatte ja den Boliden stürzen sehen, der schuld an alledem war.
Von den Türmen Bitterfelds läutete es zu Mittag, als ›St 8‹ an seiner Hubschraube über dem Hof der Eggerth-Werke hing.
»Allerhand Volk scheint sich ja zu unserem Empfang versammelt zu haben«, meinte Hansen nach einem Blick durch die Fenster des Kommandoraumes.
»Wird sich am Ende auch so gehören«, sagte Berkoff, »wir haben ja unsere Ankunftszeit auf die Minute genau gefunkt.«
Während das Stratosphärenschiff langsam tiefer sank, fuhr Hansen fort, die Menschengruppe auf dem Werkhof zu betrachten. Plötzlich wandte er sich zu Hein Eggerth.
»Du, Hein, dein alter Herr ist nicht dabei. Der Herr Professor scheint Abhaltung zu haben.«
Hein fand keine Zeit zur Erwiderung. Die sichere Navigierung des großen Flugschiffes nahm ihn voll in Anspruch. Jetzt schwebte der mächtige Bau nur noch wenige Meter über dem Rasen des Hofes. Jetzt setzte er sanft auf dem Traktorengestell auf, das ihn in die Halle bringen sollte. Eggerth schaltete den Vertikalmotor aus. Noch einige matte Drehungen machte die gewaltige Hubschraube. Dann stand sie still und sank in den Rumpf des Flugschiffes hinein.
Eggerth erhob sich aus dem Sessel vor der Steuerung und fuhr sich mit einem Taschentuch über die Stirn: »So, da wären wir wieder glücklich zu Haus. Sagtest du etwas zu mir, Wolf?«
»Nichts von Bedeutung, Hein«, erwiderte Hansen, der bereits dabei war, den luftdichten Verschluß der Tür zu lösen.
Dann standen sie auf dem heimatlichen Boden und sahen sich einer großen Menschenmenge gegenüber. Ein beträchtlicher Teil der Werkbelegschaft benutzte die Mittagspause, um der Landung ihres neuesten und größten Stratosphärenschiffes beizuwohnen. Heilrufe aus hundert Kehlen, Armwinken und Tücherschwenken, doch vergeblich sah sich Eggerth nach einer der leitenden Personen des Werkes um. Der alte Meister Wulicke, der schon seit einem Menschenalter im Werke war, trat auf ihn zu.
»Herzlich willkommen zu Haus, Herr Eggerth, und ich soll Sie für den Herrn Professor begrüßen, weil er selber nämlich jetzt keine Zeit hat.«
Hein Eggerth schüttelte dem alten Faktotum herzlich die Hand.
»Ich danke Ihnen, lieber Wulicke. Was hat denn mein Vater vor, daß er seinen erstgeborenen Sohn nicht selber begrüßt?«
Meister Wulicke kraute sich den Kopf.
»Schwere Sitzungen, Herr Eggerth. Immerzu sitzen die Herren jetzt zusammen. Tag und Nacht geht das jetzt mit den Konferenzen. Japaner sind auch wieder da. Das soll nämlich wegen der neuen Linien sein, die mit den ›St‹-Schiffen eingerichtet werden sollen.«
Hansen unterbrach den Alten lachend.
»Also der Laden geht, das Geschäft blüht, Wulicke? Ist ja großartig! Aber unser gutes altes Kasino haben die Herren doch hoffentlich nicht auch mit Beschlag belegt?«
»Nein, Herr Hansen. Durchaus nicht! Die Herren sitzen nämlich immer in dem großen Konferenzzimmer, und der Koch hat auch schon feines Essen für Sie da. Es gibt Gulasch mit Nudeln«, schloß er seinen Bericht.
»Na, denn wollen wir mal!« sagte Eggerth und setzte sich in der Richtung auf das Kasino in Bewegung. »Ich habe nachgerade etwas Appetit bekommen.«
»Bei mir könnte man's schon fast Hunger nennen«, meinte Berkoff.
»Mir hängt der Magen bis in die Kniekehlen«, schloß Hansen die Debatte.
Im Kasino fanden sie alles, was Meister Wulicke ihnen in Aussicht gestellt hatte und noch einiges mehr. Aber der Tag verging, ohne daß sie einen der leitenden Herren zu Gesicht bekamen. Was Konferenzen und Sitzungen anbetraf, herrschte wirklich Hochbetrieb im Werk. Erst am nächsten Vormittag konnte Hein seinem Vater über den Flug nach der antarktischen Station berichten. Im Arbeitszimmer Professor Eggerths saßen sie sich gegenüber. Professor Eggerth nickte und legte die Aufstellung, die ihm Hein überreicht hatte, wieder aus der Hand.
»Sehr gut, Hein. Fünfzig Tonnen Nutzlast, 15 000 Kilometer Flugstrecke, dafür ist der Brennstoffverbrauch erfreulich gering. Diese Zahlen werden uns bei unseren augenblicklichen Verhandlungen sehr nützlich sein.«
»Ich hörte es schon gestern von Wulicke, daß ihr in dicken Verhandlungen über neue Linien steckt«, fiel ihm Hein ins Wort. Der Professor winkte ab.
»Davon später, Hein. Die Verhandlungen scheinen allerdings recht aussichtsvoll zu sein, aber vorläufig wollen wir bei der Expedition von ›St 8‹ bleiben. Ihr habt das Material für Dr. Wille hingebracht und auch noch geholfen, es mit einzubauen. War alles auf der Station in Ordnung?«
»Alles tadellos, Vater. Wille stürzte sich sofort auf die neuen Röhren. Er war ganz in seinem Element.«
»Was macht Schmidt?«
»Immer die alte Leier. Er macht ... ich möchte sagen, gewerbs- und gewohnheitsmäßig ... Opposition, sowie Wille auf seine Elektronentheorie kommt.«
Professor Eggerth lächelte. »Wird Wille die ewige Nörgelei nicht zuviel?«
Hein schüttelte den Kopf. »Ich glaube, nein. Mir scheint's manchmal, als brauchte Wille den Widerspruch von Schmidt geradezu, um sich für seine eigene Theorie zu entflammen und kräftig an ihr weiter zu arbeiten.«
»Kannst recht haben, Hein. Der Streit ist der Vater aller Dinge. Vielleicht trifft das alte Wort auch hier zu. Mögen die beiden sich weiter aneinander reiben und dabei was Vernünftiges zustande bringen. Mit allem Nötigen sind sie ja nun für längere Zeit versehen. Wenn sie etwas brauchen, werden sie sich schon melden. Das ist recht gut so. Wir müssen den Kopf jetzt für andere wichtige Dinge frei haben. Wie war's nun mit dem Rückflug?«
Hein räusperte sich. »Der Rückflug war auch ganz schön, Vater, aber um ein Haar wären wir dabei mit ›St 8‹ zum Teufel gegangen!«
»Was? Wie? Wie war das möglich? War etwas im Schiff in Unordnung?«
»Nein, die Geschichte kam von außen her. Ein mächtiger Bolide, der nur 100 Kilometer von uns ab auf die Erde stürzte ...«
Hein Eggerth berichtete nun ausführlich das Abenteuer, das sie auf dem Rückflug, kurz nach ihrem Start gehabt hatten. Als er geendet hatte, saß der Professor eine ganze Weile schweigend und sinnend da.
Nach einiger Zeit begann Hein weiterzusprechen. »Ich habe die Absicht, bei dem nächsten Fluge in die Antarktis die Stelle zu besuchen, um genauer zu sehen, was da eigentlich vom Himmel gefallen ist. Es interessiert mich doch ...«
»Tue das, Hein«, unterbrach ihn Professor Eggerth, »aber sprich bitte zu niemandem über diese Angelegenheit. Verpflichte auch Berkoff und Hansen zum Schweigen.«
Hein sah ihn erstaunt an. »Warum so geheimnisvoll, Vater? Ich verstehe nicht recht, warum wir ...«
»Weil die Sache wichtiger und wertvoller sein kann, als ihr ahnt. Du schätzt den Durchmesser des Meteors auf rund einen Kilometer?«
»Auf wenigstens soviel, soweit eine genaue Schätzung aus hundert Kilometer Entfernung überhaupt möglich ist. Ich kann nur immer wieder sagen, es war ein Mordsbrocken, der da 'runterkam. Aber warum interessiert dich die Größe so sehr?«
Professor Eggerth strich sich über die Stirn. »Es ist schon öfter vorgekommen, Hein, daß solche Mordsbrocken, wie du dich auszudrücken beliebst, aus dem Weltraum auf die Erde stürzten. Das letztemal geschah es in dem Jahr vor dem großen Kriege. Da ist ein Meteor von ähnlicher Größe in die ostsibirische Tundra eingeschlagen. An der Einschlagstelle hat sich auch ein kraterartiges Ringgebirge gebildet. Man ist jetzt dabei, den Meteoriten, der aus reinem Nickeleisen besteht, bergmännisch auszubeuten.«
Hein schaute interessiert auf. »Ich beginne zu begreifen, Vater. Du meinst, wir könnten etwas Ähnliches mit dem Meteoriten in der Antarktis unternehmen.«
Professor Eggerth schüttelte den Kopf. »Nicht ganz so, wie du denkst, Hein. Ein Eisenbergwerk am Südpol wäre vielleicht auch nicht zu verachten. Aber es könnte sich auch um Wertvolleres handeln.
In Arizona in den Vereinigten Staaten ist ein Bolide von ungefähr derselben Größe niedergegangen und hat ein Loch von 500 Meter Tiefe in die Erdkruste geschlagen. Das soll, wie die Geophysiker behaupten, schon vor 50 000 Jahren geschehen sein, doch das ist unwesentlich. Hauptsache ist, daß dieser Meteorit noch vorhanden ist und daß er nicht aus einfachem Nickeleisen, sondern aus einem platinhaltigen Eisen besteht. Trotzdem man mehr als 300 Meter in die Tiefe gehen muß, um an den Boliden heranzukommen, ist man doch kräftig dabei, das kostbare Mineral abzubauen, und tut es mit gutem wirtschaftlichen Erfolg.«
Hein sprang auf. »Alle Wetter, Vater! Das wäre eine Sache. Platin ist meines Wissens ebenso wertvoll wie Gold. Da könnte man schnell und schmerzlos Millionär werden.«
Eggerth schüttelte den Kopf. »So einfach ist die Sache nicht, mein Junge. Das ist auch gar nicht der Zweck der Übung, daß der eine oder andere von uns da Reichtümer sammelt. Aber für unser Land, für unsere Volkswirtschaft könnte die Angelegenheit von größter Bedeutung werden, wenn ... ja, das müßt ihr eben bei euerm nächsten Flug feststellen, was da eigentlich vom Himmel gefallen ist. Erst wenn wir Teile des Meteoriten genau analysiert haben, läßt sich sagen, ob die Geschichte sich lohnt. Und dann, ich binde es dir nochmal auf die Seele ... tiefstes Stillschweigen über alles, was ihr da etwa seht und findet.«
Er warf einen Blick auf die Uhr. »Jetzt mußt du mich entschuldigen. In zehn Minuten beginnt die Besprechung mit den Japanern. Baron Okuru ist selber aus Tokio gekommen, um die Verhandlungen schneller vorwärts zu bringen.«
Hein überlegte einen Augenblick. »Okuru ... Baron Okuru? Mir ist es, als ob ich den Namen schon mal gehört habe.«
»Höchstwahrscheinlich, Hein. Der Mann ist Abteilungschef im japanischen Luftfahrtministerium. Es handelt sich um eine Linie Tokio—Frisko, die flugplanmäßigen Anschluß an unsere amerikanische Linie Frisko—New York bekommen soll. Um eine Nordsüd-Linie von Korea über die japanischen Inseln bis nach Formosa und um eine mandschurische Linie. Das alles soll mit unseren Stratosphärenschiffen beflogen werden.«
»Großartige Sache, Vater! Ich rechne, daß wir den Gelben wenigstens ein Dutzend von unseren ›St‹-Schiffen verkaufen werden.«
Der Professor nickte. »Es dürften sogar zwanzig werden, aber die Finanzierung und die Organisation der geplanten Linien machen uns noch viel Kopfzerbrechen. Ich muß jetzt in die Besprechung. Auf Wiedersehen später!«
In den nächsten Tagen und Wochen wurden die drei Piloten von
›St8‹ vollkommen von ihrer Ingenieurtätigkeit in dem
Bitterfelder Werk in Anspruch genommen. Von Professor Eggerth bekamen sie
kaum etwas zu sehen. Bis über den Hals steckte er in Unterhandlungen, nicht
nur mit den japanischen Bevollmächtigen, sondern auch mit südamerikanischen
Interessenten. Überall dort, wo bisher bereits längere Überseelinien mit den
gewöhnlichen Flugschiffen betrieben wurden, trug man sich mit dem Gedanken,
die so viel leistungsfähigeren Stratosphärenschiffe der Eggerth-Werke
einzusetzen. Bedeutende Kapitalien waren dazu notwendig, und deren
Beschaffung war nicht einfach. Neue Betriebsgesellschaften mußten gegründet
werden, und gegen seine ursprüngliche Absicht war Professor Eggerth genötigt,
die Bezahlung für die neuen zu erbauenden Schiffe zu einem erheblichen Teil
in Aktien der neuen Gesellschaften anzunehmen.
Gegen Ende der zweiten Woche nach der Rückkehr von ›St 8‹ wurden endlich die japanischen Verträge von allen Kontrahenten unterzeichnet, und fünf Tage später kamen auch die brasilianischen Abmachungen glücklich unter Dach und Fach.
Professor Eggerth sah angegriffen und überarbeitet aus, als er seinen Namen unter den letzten Vertrag schrieb, aber noch durfte er sich keine Ruhe gönnen. Die neuen Schiffe mußten sofort auf Stapel gelegt, das ganze Werk auf drei Arbeitsschichten umgestellt werden, denn nur so war es möglich, die vereinbarten Bauzeiten innezuhalten. Tag und Nacht dröhnte jetzt das Lied der Arbeit durch die Werkhallen.
Mit dreifacher Belegschaft ging es an die Ausführung der großen neuen Aufträge. Alle Ingenieure des Werkes, auch Hein Eggerth, Hansen und Berkoff steckten so tief in der Arbeit, daß sie oft nicht wußten, wo ihnen der Kopf stand.
Für eine kurze Mittagspause waren die drei ins Kasino gegangen, noch ganz
erfüllt von Ideen an Umkonstruktionen und Verbesserungen für die neuen
›St‹-Schiffe. Zwischen Suppe und Braten fragte Hein
unvermittelt:
»Hat sich eigentlich Dr. Wille wieder gemeldet?«
Die Frage riß die beiden anderen aus ihren Gedanken. Dr. Wille ... die Station in der Antarktis. Daran hatte in dem Trubel der letzten Wochen keiner von ihnen gedacht.
»Keine Ahnung«, sagte Hansen lakonisch. »Ich weiß es auch nicht«, fügte Berkoff hinzu.
»Dann wollen wir mal nach dem Essen zu unserer Funkstation gehen und hören, ob Nachrichten vorliegen«, schlug Hein vor.
Die Auskunft, die sie dort erhielten, beunruhigte sie stärker, als sie es
wahrhaben wollten. Seit Wochen war kein Funkspruch aus der antarktischen
Station an das Werk gekommen. Gewiß, es konnte sein, daß dort alles in bester
Ordnung lief, und einfach nichts zu telegraphieren war. Aber das mußte man
doch einmal feststellen.
Auf Veranlassung von Hein Eggerth versuchte der Werkfunker die Verbindung mit Dr. Willes Station aufzunehmen. Doch so oft er sie auch auf der verabredeten Geheimwelle anrief, der Äther blieb stumm. Es kam keine Antwort aus der Antarktis.
Ein Entschluß mußte gefaßt werden und er wurde gefaßt. Als die Abenddämmerung hereinbrach, lag ›St 8‹ startbereit auf dem Werkhof, beladen mit allen erdenklichen Dingen, die der antarktischen Station für den Fall eines Unglückes vonnöten sein konnten.
Das Kratererz im Eggerth-Werk. Mr. Haynes nimmt aus ›St 10‹ ein »Andenken« mit. Professor Eggerth macht Analysen. Drei Stratosphärenschiffe am Bolidenkrater. Hinab in den Abgrund. Mr. Garrison läßt sich von Mr. Haynes das »Andenken« schenken. Die Sternwarte von Pasadena meldet sich.
Ein Trümmerhaufen, vergraben unter Schneewehen, verloren in der dunklen, eisigen Polarnacht, war die Station, nachdem jene fürchterliche Sturmwelle über sie hinweggebraust war. Hatte die Katastrophe auch fünf Menschenleben ausgelöscht?
Stöhnend griff Karl Hagemann im Dunkeln um sich. Langsam kam ihm das Bewußtsein wieder. Sein Kopf schmerzte, mit Mühe brachte er die Hände empor und ertastete an seiner Stirn eine Wunde. Dann spürte er, wie es ihm von hinten her feucht in den Nacken tropfte. Er versuchte, sich zu erheben und fühlte sich dabei durch irgend etwas gehemmt, das ihn von allen Seiten umgab.
Nach langem Mühen ... endlos schien ihm die Zeit ... glückte es ihm, auf die Knie zu kommen, sich umzudrehen. Seine suchenden Hände faßten etwas Hartes, Eckiges, das sich warm anfühlte. Erinnerung kam ihm dabei zurück. Der elektrische Kochherd mußte das sein. Neben ihm hatte er ja gestanden, gegen den war er geschleudert worden, als das Unheimliche, Unerklärliche hereinbrach. Nun wurden seine Gedanken klarer. Er begann zu begreifen, was sich ereignet hatte. An dem heißen Herd war etwas von den hereinwirbelnden Schneemassen geschmolzen. Daher die Nässe, die er zuerst gefühlt.
Mit beiden Händen griff er nach der oberen Herdkante und zog sich mit Gewalt in die Höhe. Jetzt endlich stand er aufrecht, bis an die Schultern noch in pulvrigem Schnee, aber den Kopf hatte er frei, konnte endlich tief und kräftig atmen. Und nun erschaute er auch im unsicheren Sternenlicht etwas von den Verwüstungen, welche die Katastrophe angerichtet hatte. Das Dach und zwei Wände der Küchenbaracke waren fortgerissen. Neben dem Herd stand er im Freien und steckte bis an den Hals in einer Schneewehe.
Nur allmählich kamen seine Gedanken wieder in Gang. Was war geschehen? Wo waren die andern? ... Die andern! Er mußte sie suchen ... mußte ihnen Hilfe bringen.
Langsam gewöhnten sich seine Augen an das unsichere Licht. Er erkannte, daß die Schneewehe nach außen zu flacher wurde. Mit den Armen rudernd, stampfend und schnaubend arbeitete er sich von der Herdwand fort ins Freie. Schon ging ihm der Schnee nur noch bis zu den Knien, dann stand er auf nacktem Felsboden. Aber nun spürte er auch die Kälte, gegen die ihn der Schnee so lange geschützt hatte. Fühlte, wie die durchnäßten Stellen seiner Kleidung in dem grimmigen Frost sofort starr und steif wurden.
Mit klappernden Zähnen eilte er zu dem Mittelbau des Stationshauses. Auch hier Verwüstung und Trümmer. Die Wände zum Teil eingedrückt und umgerissen, dort wo die Tür war, bis zum Dach im Schnee vergraben. Durch ein Fenster gelangte er in das Innere, atmete auf, als er dem tödlichen Frost entronnen war, griff nach einem Lichtschalter … vergeblich, kein Strom in der Leitung. Im Dunkeln tastete er sich weiter zur Kammer hin, in der die Pelze lagen. Als er das schwere Bärenfell über die Schultern zog, fühlte er sich vor dem Schlimmsten geborgen. Erschöpft ließ er sich zu Boden sinken, schloß minutenlang die Augen. Dunkelheit und tiefe Stille umgaben ihn.
Doch nein, ein pochendes, tackendes Geräusch drang an sein Ohr. War es der eigene Herzschlag, den er hörte? Er lauschte schärfer ... die Maschine mußte es sein, der Dieselmotor, der trotz allem, was geschehen, unermüdlich weiterlief. Der Motor, das pochende Herz der Station, das Wärme, Licht und Leben gab.
Licht! Licht war das erste, das Notwendigste, was er haben mußte, ehe er nach den andern suchen, ihnen zu Hilfe kommen konnte. Der Gedanke riß ihn empor, trieb ihn wieder hinaus in Nacht und Frost.
Durch Trümmer und Schneewehen arbeitete er sich bis zum Maschinenschuppen hin. Auch hier ein Bild der Zerstörung, das Dach und eine Wand fortgerissen. Aber der Motor lief noch, lief leer, wie er am Maschinengeräusch sofort erkannte. Die Katastrophe mußte einen schweren Kurzschluß in der Leitung verursacht haben. Die Hauptsicherungen waren durchgeschlagen, die Dynamomaschine dadurch entlastet worden.
Hagemann fühlte seine Hände in der Kälte erstarren, steckte sie in die Taschen des Pelzes und fühlte eine Streichholzschachtel zwischen den klammen Fingern. Licht! Eine Möglichkeit, sich Licht zu verschaffen. Ein Streichholz flammte auf, ein Kerzenstumpf nährte ein spärliches Flämmchen. Es genügte ihm, um Werkzeug zu finden. Mit Schraubenzieher und Zange begann er zu hantieren, ungeschickt erst noch und unsicher mit den froststarren Händen. Doch schon spürte er, wie die Arbeit sein Blut in Bewegung brachte, schon ging es schneller und besser, als er nun Drähte zog.
Dann verblaßte der Schein der Kerze neben der strahlenden Helligkeit einer starken Glühlampe. Wenigstens hier an dieser einen Stelle hatte er wieder Licht. Mit schnellem Blick überflog er den Maschinenraum und sah, daß hier bei allem Unglück noch Glück gewaltet hatte. Es hätte schlimmer kommen können. Wohl hatte die Orkanwelle Teile des Schuppens fortgeschleudert, aber im Raum selbst nichts Wesentliches zerstört. Nicht nur das Maschinenaggregat und die Schalttafel waren unversehrt geblieben, auch die Regale, in denen die Reserveteile und das Installationsmaterial lagerten, waren von der Vernichtung verschont geblieben.
Er wollte wieder hinaus ins Freie, doch tiefe Dunkelheit hemmte seinen Schritt. Seine Augen, durch das reichliche Licht in dem Schuppen verwöhnt, vermochten hier draußen nichts mehr zu erkennen. Einen Augenblick überlegte er, begann dann in den Regalen zu kramen, bis er fand, was er suchte. Eine Rolle biegsamen Kabels und eine Reflektorlampe. Schnell war das Kabel an die Schalttafel angeschlossen, die Leuchte in seiner Hand flammte auf. So ausgerüstet, das Kabel von der Rolle ab und hinter sich herziehend, ging er auf die Suche. Wie ein langer leuchtender Balken huschte das Licht der Handlampe über den Hof hin und her. In dessen Schein sah er die Trümmer der niedergebrochenen Maste, sah, daß die zentnerschweren Kondensatoren umgerissen und nach allen Seiten hin verstreut waren. Sah dazwischen nach der Wand des Mittelbaues hoch aufgeschichtet endlose Schneemassen.
Gerade wollte er den Lichtkegel weitergleiten lassen, als er stockte. Etwas Dunkles, Unbestimmtes hatte er auf dem Schnee erblickt. Er schritt darauf zu, leuchtete es stärker an und stutzte. Nichts anderes konnte das Ding da sein, als die Pelzmütze von Dr. Schmidt, ein Kleidungsstück, durch seine Form und Größe ebenso auffallend wie der ganze Doktor.
Er stand und überlegte. Wie kam die Mütze hier ins Freie? Er hatte die beiden Gelehrten in ihrem Observatorium vermutet. Sollten sie aus irgendwelchen Gründen ins Freie gegangen und hier von der Katastrophe überrascht worden sein? Dann lagen sie am Ende in den Schneemassen an der Hauswand begraben, waren vielleicht schon längst erstickt oder erfroren.
Erfroren? Ah, bah! Er schob den Gedanken von sich in der Erinnerung daran, wie warm ihn selbst der Schnee eingehüllt hatte. Erstickt?! Die Vorstellung beunruhigte ihn. Die Wehe hier war erheblich stärker als die Schneemassen, unter denen er gelegen hatte. Jedenfalls war es notwendig, die Verschütteten so schnell wie möglich zu finden und zu befreien. Aus dem Maschinenschuppen holte er eine kräftige Schaufel, wurde sich dabei der Schwierigkeiten bewußt. Wenn er die Verschütteten nicht bald fand, wenn er vielleicht genötigt war, die ganze lange Schneewehe umzuschaufeln, konnte das Werk tagelang dauern, dann kam die Hilfe sicher zu spät.
Die Mütze ... die Mütze, ging es ihm fortwährend durch den Kopf, wo die Mütze liegt, kann Dr. Schmidt nicht weit ab sein. In ihrer nächsten Nähe begann er den Schnee fortzuschaufeln; schnell, aber doch vorsichtig, damit er die Verunglückten nicht verletzte. Die Vorsicht war sehr am Platze. Kaum ein Dutzend Schaufeln Schnee hatte er beiseitegeschafft, als er auf etwas Hartes stieß. Vorsichtig grub er weiter, griff mit den Händen zu, faßte einen Pelz. Er zog und hob daran. Eine Schulter kam zum Vorschein, ein Arm, ein ganzer Mensch schließlich. Es war Dr. Schmidt. Er zog ihn vollends aus dem Schnee, wollte ihn aufrichten. Aber der Doktor rückte und rührte sich nicht. War er bewußtlos ... ohnmächtig ... oder hatte Hagemann nur einen Toten aus dem Schnee geholt? Er packte den regungslosen Körper, schleppte ihn in das Maschinenhaus und legte ihn auf eine Werkbank. Er riß ihm den Pelz auf und begann den Körper zu kneten und zu reiben. Wie ein Verzweifelter arbeitete er, bis ihm der helle Schweiß von der Stirn lief. Lange, bange Minuten verstrichen, da tat der Gerettete einen tiefen Atemzug und schaute sich um, stieß unzusammenhängende Worte hervor. Hagemann schüttelte und rüttelte ihn derweil mit allen Kräften weiter, bis Dr. Schmidt eine abwehrende Armbewegung machte.
»Was ist denn, Hagemann? Sind Sie verrückt geworden, so mit mir umzugehen?«
Der ließ von ihm ab und zog unter der Werkbank eine Flasche Kognak vor.
»Trinken, Herr Doktor! Ordentlich trinken!« Ohne sich um die Proteste des langen Schmidt zu kümmern, schob er ihm die Flasche zwischen die Zähne und gab nicht nach, bis der eine gehörige Dosis geschluckt hatte.
Krächzend und hustend versuchte der Doktor sich aufzurichten, und mit Hilfe des andern gelang es ihm.
»Was in aller Welt ist los, Hagemann? Mit Ihnen ... mit ...«
Er sah sich erstaunt in dem Raum um. Erst jetzt bemerkte er die Zerstörung, wollte weiterfragen. Hagemann ließ ihn nicht zu Worte kommen.
»Wo ist Dr. Wille? War er mit Ihnen zusammen auf dem Hof?«
Schmidt griff sich an die Stirn. Erst jetzt schien ihm die volle Besinnung wieder zu kommen.
»Ja natürlich! Wir waren zusammen auf dem Hof, als etwas geschah ... was war es denn?«
»Bleiben Sie ruhig hier liegen, Herr Doktor.«
Hagemann drückte ihm die Kognakflasche in die Hand und stürmte ins Freie. Die beiden haben sicher dicht zusammengestanden, wo der eine lag, muß auch der andere zu finden sein, schoß es ihm durch den Kopf, während er schon wieder eifrig schaufelte.
Doch diesmal bestätigte sich seine Vermutung nicht. Immer tiefer grub er sich in die Wehe hinein, ohne etwas zu finden. Verzweiflung wollte ihn überkommen, während er Schaufel um Schaufel des körnigen Schnee zur Seite schleuderte. Da hörte er eine Stimme hinter sich.
»So kommen wir nicht zum Ziel, Hagemann. Wir müssen systematisch vorgehen.«
Es war Dr. Schmidt, dem der ungewohnte Kognak überraschend schnell auf die Beine geholfen hatte. Jetzt stand er neben Hagemann mit einem langen Besenstiel in der Rechten.
»Wir müssen sondieren, Hagemann. So macht man das immer, wenn Leute in eine Lawine geraten sind.«
Während er es sagte, watete der lange Dr. Schmidt in der Wehe herum und stieß den Besenstiel in kurzen Abständen vorsichtig in die Schneemassen hinein.
Hagemann hielt mit seiner Schaufelei inne und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Trotz der ernsten Lage konnte er kaum ein Lachen unterdrücken. »Wie der Storch im Salat«, dachte er, als er den langen Doktor methodisch in der Schneewehe herumstapfen und mit dem Besenstiel hantieren sah. Dabei leuchtete ihm aber die Zweckmäßigkeit des Verfahrens ein. Er lief zum Maschinenschuppen zurück, holte sich auch einen Stiel und begann am andern Ende der Wehe nach Schmidts Methode zu sondieren.
»Hier, Hagemann, hier liegt was unter dem Schnee!« rief Dr. Schmidt. Hagemann eilte zu ihm, die Schaufel trat wieder in Tätigkeit. Und dann fanden sie auch den Dr. Wille und trugen ihn zusammen in den Maschinenschuppen.
Der Stationsleiter war von der Sturmwelle zwischen die Bruchstücke eines Gittermastes geschleudert worden. Dieser Umstand hatte ihn vor dem Tode des Erstickens bewahrt, da die Schneemassen in dem sperrigen Gitterwerk einen Hohlraum ließen. Aber er hatte bei dem Anprall Kontusionen davongetragen und stöhnte schwer, als Hagemann es versuchte, ihn durch Reiben und Massieren aus der Ohnmacht zu erwecken.
»Vorsichtig, Sie Gewaltmensch! Vorsichtig!« unterbrach Schmidt die Tätigkeit Hagemanns. »Es könnte was gebrochen sein.« Der Doktor griff selbst mit zu, und nach vielem Mühen schlug Dr. Wille unter den Händen der beiden endlich die Augen auf. Doch es bedurfte längerer Zeit, bis er wieder vollständig zu sich kam. Der Unfall hatte ihn viel schwerer mitgenommen als seinen Assistenten, und die Verletzungen an der rechten Schulter schienen nicht unbedenklich zu sein.
Hagemann griff auch hier zu seinem Universalmittel und flößte dem Verletzten eine tüchtige Portion Kognak ein. Während er noch damit beschäftigt war, schien sich Dr. Schmidt mit einem Rechenexempel zu befassen. Jetzt kam er damit heraus.
»Wir waren fünf. Wo sind die andern zwei?«
»Die beiden andern, Herr Doktor? Lorenzen und Rudi! Die waren ja in der Funkerbude. Ich will gleich nachsehen.«
Er lief wieder ins Freie hinaus, Dr. Schmidt folgte ihm. Mit der Reflektorlampe leuchteten sie die Gegend ab. Eine Lücke dort, wo vorher noch der Funkraum stand. Hagemann griff sich an den Kopf.
»Verflucht und dreimal zugenäht! Die ganze Bude ist weggeflogen. Weiß der Teufel, wohin. Schöne Geschichte, das.«
Schmidt unterbrach ihn.
»Allzuweit wird der Sturm sie nicht mitgenommen haben. Wir müssen sie suchen. Vorwärts! Los, Hagemann!«
Das war leichter gesagt als getan. Das Kabel der Reflektorlampe reichte eben nur bis zu der Stelle hin, wo die Funkerbude gestanden hatte. Darüber hinaus mußten sie im Dunkeln weitertappen. Nur allmählich gewöhnten sich ihre Augen an das unsichere Sternenlicht, und dann entdeckten sie einige 60 Meter hinter dem Stationshaus einen Schneehügel, in dem die vermißte Bude möglicherweise stecken mochte.
Dr. Schmidt schüttelte den Kopf.
»In der Dunkelheit ist nichts zu machen.«
»Das wollen wir schnell haben, Herr Doktor«, rief ihm Hagemann zu. »In fünf Minuten brennt hier elektrisches Licht.«
Er eilte zum Maschinenhaus zurück und begann dort allerlei zu basteln und zu schalten. Fünf Minuten später kehrte er zu Dr. Schmidt zurück, ein Kabel hinter sich herschleifend, eine brennende Starklichtlampe in den Händen, mit der er den verdächtigen Hügel von allen Seiten anstrahlte. Da stellte sich der wahre Sachverhalt denn schnell heraus.
Es war eine jener felsigen Erhebungen, etwa 25 bis 30 Meter hoch, wie sie in dieser Gegend häufiger vorkommen. An der steilen Wand, die der Station zugekehrt war, hatte der Orkan den Schnee zu einer riesigen Wehe zusammengewirbelt. Aus der weißen Masse ragte das Ende eines abgebrochenen Balkens hervor, von dem Hagemann mit Bestimmtheit behauptete, daß er zur Funkerbude gehöre. Dr. Schmidt überprüfte die Lage mit der objektiven Sachlichkeit des Gelehrten.
»Der Sturm hat die Funkerbude 60 Meter mit durch die Luft gerissen und gegen den Felsen geschleudert«, begann er dann zu dozieren, als ob er in Deutschland auf seinem Katheder stünde. »Die Bude hätte zertrümmert, unsere beiden Jungen hätten zerschmettert werden müssen, wenn nicht ... ja sehen Sie, Hagemann, das ist das Gute dabei, daß Pulverschnee besser fliegt als die schwere Funkerbude.«
Hagemann sah ihn verständnislos an. Er begriff nicht, wo der Doktor mit seinen Erklärungen hinauswollte. Der fuhr unentwegt fort.
»Erst mal hat der Sturmstoß hier eine dicke Schneewehe hingeblasen. Dann erst kam die Funkerbude angesegelt, und weil sie in den weichen Schnee fiel, kann der Anprall nicht so schlimm gewesen sein. Passen Sie auf, wir finden die beiden gesund und munter vor.«
Unwillkürlich ergriff Hagemann Dr. Schmidts Rechte und drückte sie: »Wenn Sie recht hätten, Herr Doktor. Wenn wir die Jungens lebendig herausholten ...«, er hatte bereits die Schaufel in der Hand und begann mit aller Macht zu graben.
»Ich werde Ihnen helfen«, sagte Schmidt und ging, um sich auch eine Schaufel zu holen. Im Maschinenschuppen fand er Dr. Wille in etwas besserer Verfassung vor. Nur der rechte Arm schmerzte bei jeder Bewegung. Schmidt knotete ein passendes Stück Kabel zusammen und legte ihm damit den kranken Arm in eine Schlinge. Dann kehrte er zu Hagemann zurück, und die beiden gruben zusammen weiter. Schon hatten sie um das Pfahlstück herum eine mannshohe Schneeschicht weggeräumt, da stießen sie auf Holzwerk und sahen, was eigentlich geschehen war. Die Bude hatte sich während ihrer unfreiwilligen Luftfahrt vollkommen überschlagen und steckte mit der Decke nach unten im Schnee.
»Dumme Geschichte, wenn die Jungens dabei die schweren Apparate auf den Kopf gekriegt haben«, brummte Schmidt. Hagemann grub schon an der einen Seitenwand weiter. Dann zerklirrte eine Fensterscheibe unter dem Stoß seiner Schaufel. Er brachte die Lampe heran und leuchtete in den Raum.
Es sah drinnen wild aus. Apparate, Möbelstücke, Reserveteile lagen wirr durcheinander in einer Ecke. Aber als Hagemann den grellen Lichtkegel darauf richtete, regte sich etwas dazwischen. Eine Stimme ließ sich vernehmen. Es war Rudi Wille, der sich als erster aus dem Chaos herausarbeitete. Er war unverletzt. Schon stand er auf seinen Füßen, begann Teile des Haufens beiseite zu zerren, und dann war auch Lorenzen frei. Er hatte ein paar tüchtige Beulen abbekommen, sein Schädel brummte, aber sonst war er heil und munter. Mit Hagemanns Unterstützung kamen die beiden zum Fenster heraus und gingen mit zur Station zurück. Sie hatten Eile dorthin zu gelangen, denn sobald sie ins Freie kamen, spürten sie die Kälte empfindlich.
»Der Schnee«, murmelte Schmidt vor sich hin. »Der Schnee hat uns gerettet. Ohne den wären wir alle erfroren. Ein Glück bei allem Unglück, daß der verteufelte Orkan uns alle in den Pulverschnee gepackt hat.«
»Ich habe bannigen Hunger«, sagte Lorenzen, Dr. Schmidt sah auf die Uhr.
»Kann ich begreifen, Lorenzen, vor sechs Stunden hatten wir die Absicht zu Abend zu essen.«
»Da räumt ihr beiden mir mal erst den Schnee aus der Küche«, wandte sich Hagemann an Rudi und Lorenzen. »Ich will inzwischen eine Notleitung ziehen und den Herd wieder anschließen. Wie denkt ihr über Roastbeef mit Bratkartoffeln?«
Die Aussicht auf etwas Derartiges gab den beiden Riesenkräfte. Als Hagemann die neue Leitung an den Herd schraubte, war die letzte Schneeflocke aus der Küche entfernt. Dann brannte auch hier elektrisches Licht, Dr. Schmidt kam dazu und begutachtete die Lage.
»Wenn wir jetzt mit vereinten Kräften die beiden Wände wieder aufrichten können, und wenn es uns gelänge, auch noch das Dach wieder darauf zu legen, so könnte es hier ganz erträglich werden.«
Für drei kräftige Männer, denen die Not im Nacken saß, war die Aufgabe nicht unlösbar. Alle Teile der Stationsgebäude, Wände und Decken bestanden aus Holzfachwerk mit vielfacher Asbest- und Luftisolierung. Nach einem neuen Verfahren hergestellt, gewährten sie einen vorzüglichen Schutz vor der Kälte und waren trotzdem verhältnismäßig leicht.
Unter dem Kommando Schmidts machten die drei sich an die Arbeit. In kurzer Zeit hatten sie die beiden fortgewehten Wände wieder herangeschleppt und aufgerichtet. Viel größere Schwierigkeiten machte ihnen das Aufbringen der Decke. Sie mußten dazu die eine Wand wieder niederlegen und mußten sich in Sturm und Kälte ein Gerüst bauen, mußten alle vier im Schweiß ihres Angesichtes heben und würgen, bis es nach stundenlanger Arbeit endlich gelang und die Oberkanten der Wände richtig in die Randnuten des Daches sprangen.
»Uff! Das wäre geschafft!« sagte Hagemann und warf seinen Pelz ab. Sowie der Küchenraum wieder geschlossen war, begann der elektrische Herd als Ofen zu wirken und verbreitete eine behagliche Wärme. »So, jetzt wird weiter gebraten«, fuhr er fort und befaßte sich mit dem Roastbeef, dessen Werdegang durch die Sturmkatastrophe jäh unterbrochen wurde. Dr. Schmidt winkte Rudi.
»Kommen Sie, Rudi! Wir wollen Ihren Vater holen. Es ist Zeit, daß er ins Warme kommt.«
Er hatte damit nicht unrecht. Wohl hatten sie Dr. Wille in dem offenen Maschinenraum mit allen erreichbaren Pelzen und Kleidungsstücken zugedeckt, aber eine Kälte von 40 Grad dringt schließlich durch die stärksten Hüllen.
Nun waren sie zu fünft in der kleinen Küche. Es war reichlich eng, aber sie hatten wenigstens Wärme, Licht und Nahrung und waren für den Augenblick gerettet.
Das Roastbeef, das Hagemann ihnen vorsetzte, war allen Lobes wert. Die Kartoffeln aber waren so süß, daß keiner eine rechte Freude daran hatte.
»Kein Wunder«, bemerkte Dr. Schmidt, »die haben stundenlang in der Kälte gelegen, sind steinhart gefroren gewesen.«
Hagemann fuhr auf: »Unser Vorratsraum, verfluchte Geschichte, wenn die zwanzig Zentner Kartoffeln da auch gefroren sind.«
Schmidt zuckte gleichmütig die Achseln. »Das wird wohl so sein, Hagemann. Schadet auch nichts. Die Vitamine, auf die es uns ankommt, zerstört der Frost nicht. Daß er Stärkemehl in Zucker verwandelt ... na, dann werden wir eben für die nächste Zeit süße Kartoffeln essen müssen.«
Die gute Mahlzeit, die Wärme, das Gefühl vorläufigen Geborgenseins ... alles
zusammen ließ jetzt Müdigkeit aufkommen. Wie sie saßen und lagen, schlief
einer nach dem andern ein. Der lange Schmidt war der letzte. Doch während er
seine Uhr aufzog, fielen auch ihm die Augen zu.
Ein langer Schlaf gab den Ermatteten neue Kraft und frischen Lebensmut. Mit
vereinten Kräften gelang es danach auch, den Maschinenschuppen wieder instand
zu setzen. So hatten sie wenigstens zwei Räume, in denen sie vorläufig leben
konnten.
Hoffnungslos aber war der Zustand des eigentlichen großen Stationshauses. Hier hatte die Explosionswelle derart gewütet, daß eine Wiederherstellung, ein Wohnlichmachen dieser Räume bei ihren geringen Hilfsmitteln ausgeschlossen war. Nur mit Mühe und nicht ohne Gefahr gelang es Hagemann, einige Kleidungsstücke und andere unentbehrliche Dinge aus dem Trümmerhaufen herauszuholen.
Ganz trostlos stand es schließlich um die Funkstation. Was dort an Apparaten vorhanden gewesen, war bei der Katastrophe restlos zu Bruche gegangen. In scherzhaftem Übermut hatte Rudi vorher geplant, aus den zahlreich vorhandenen Reserveteilen neue Sender und Empfänger zu bauen. Jetzt war die schnelle Ausführung dieses Planes eine bittere Notwendigkeit geworden. Das Schicksal der Station, ihr Leben würde davon abhängen, ob es ihnen gelänge, neue Geräte zu schaffen und mit der Welt in Verbindung zu treten.
In Begleitung von Oberingenieur Vollmer ging Professor Eggerth über den Werkhof auf die Stelle zu, wo ›St 8‹ startbereit lag.
Er wollte sich von der Besatzung des Stratosphärenschiffes verabschieden und seinem Sohn noch besondere Mitteilungen für Dr. Wille mitgeben. Eben betrat er die leichte Aluminiumtreppe, die noch an den Schiffsrumpf angelehnt stand, als ein Mann über den Hof gelaufen kam. Schon von weitem rief er und schwenkte ein Blatt Papier in der Hand. Es schien eine wichtige Nachricht zu sein.
Professor Eggerth drehte sich um und erkannte den zweiten Werkfunker. Vom schnellen Laufen außer Atem, kam er heran. »Wir haben eben Verbindung mit der Südpolstation bekommen.«
Der Professor griff nach dem Blatt und warf einen Blick drauf. Neugierig, was es da plötzlich gab, war Hein Eggerth in die Schiffstür getreten.
»Noch nicht starten! Wille funkt!« rief ihm sein Vater zu und machte sich auf den Weg zur Funkstation des Werkes.
»Start verschoben! Wille funkt!« gab Hein den Ruf in das Schiff weiter und lief dem Alten nach.
»Was gibt's, Lohmüller?« fragte Professor Eggerth, als er in die Station
trat. Der Funker, die Kopfhörer aufgestülpt, saß am Empfänger und schrieb im
Eiltempo mit, was aus der Antarktis gesendet wurde. Ohne aufzusehen, schob er
dem Professor mehrere engbeschriebene Blätter zu. Der nahm und las. Ließ sich
dabei auf einen Stuhl nieder und las sitzend weiter. Die ganze lange
Geschichte des Elendes, das die Station betroffen hatte. Der unerklärliche
Ausbruch eines plötzlichen fürchterlichen Orkanes. Die Verheerungen, die das
entfesselte Element angerichtet hatte. Die Schicksale der fünf
Expeditionsteilnehmer. Wie sie seit Wochen im Maschinenraum und der kleinen
Küche hausen mußten. Wie es ihnen nach vielen Fehlschlägen endlich gelang,
neue Funkgeräte zu bauen und an notdürftig geflickten Masten eine Notantenne
hochzubringen.
Als er die letzte Zeile las, schob ihm der Funker schon wieder ein neues Blatt hin. Die dringende Bitte um Hilfe. Der Betriebsstoff für das Maschinenaggregat reichte nur noch für drei Tage.
Die Nacht über herrschte reges Leben auf dem Hof. Aus allen Abteilungen des
Werkes wurden Hilfskräfte herangezogen. Manches von dem, was im Rumpf von
›St 8‹ verstaut war, mußte wieder ausgeladen werden. Andere
Dinge, die vielfach erst mit Kraftwagen aus benachbarten Städten
herbeigeschafft wurden, kamen dafür hinein. Fast ununterbrochen stand die
Funkstation des Werkes mit der antarktischen Station in Verbindung. Neue
Hoffnung regte sich wieder in den Herzen von fünf Menschen, die am
Verzweifeln waren.
Um die fünfte Morgenstunde begannen die Motoren von ›St 8‹ zu
arbeiten. Das Schiff erhob sich in die Stratosphäre und stürmte auf fünfzehn
Grad östlicher Länge nach Süden.
Es blieb nicht das einzige seiner Art, das an diesem Tage das Werk verließ. Wenige Stunden später folgten ihm ›St 9‹ und ›St 10‹ auf dem gleichen Kurs. ›St 9‹ hatte zwanzig Werkleute und reichliches Ersatzmaterial an Bord. In ›St 10‹ flog Professor Eggerth selber mit.
Auf den August war im Laufe der letzten aufregenden Wochen der September gefolgt. Die lange Polarnacht der Antarktis begann heller zu werden. Schon kündete ein leichter Schein, der in 24 Stunden um den Horizont herumwanderte, das höher kommende Tagesgestirn an. Das Morgengrauen eines neuen Polartages lag über dem endlosen Schneefeld und ließ die Zerstörungen, von denen die Station betroffen worden war, in ihrer ganzen Größe erkennen. Aber nun war das Schwerste überwunden, die Verbindung mit der Außenwelt war nach langer verzweifelter Arbeit wieder hergestellt, Hilfe war zugesagt, das rettende Schiff bereits unterwegs.
Dr. Schmidt stand mit Hagemann auf dem Hof und spähte in den dämmernden
Himmel nach Norden.
»Von da müssen sie kommen, Hagemann.«
Hagemann folgte der weisenden Hand des Doktors mit unruhigem Blick. »Hoffentlich recht bald, Herr Doktor. Ich will meinem Schöpfer danken, wenn sie erst hier sind.«
Schmidt warf ihm einen fragenden Blick zu. »Warum auf einmal so pressiert, Hagemann? Auf ein paar Stunden kommt es doch nicht an.«
»Doch, Herr Doktor. Ich habe es Ihnen damals nicht gesagt, um Sie nicht noch mehr zu beunruhigen. Unser Motor hat bei der Geschichte damals auch einen Knacks abbekommen. Er hat einen Sprung im Zylinderblock.«
Dr. Schmidt vermochte seinen Schreck nicht zu verbergen.
»Der Motorzylinder gesprungen, Hagemann? Pfui Teufel, das ist ernst! Was haben Sie dagegen getan?«
»Zuerst war der Sprung nur im äußeren Kühlmantel. Da habe ich mit Kitt und Bandagen so gut gedichtet, wie es ging. Aber der Block ist in den letzten Tagen noch weiter nach innen zu gerissen. Es kommt jetzt bei jedem Kolbenhub etwas Kühlwasser in die Zylinder. Seit 12 Stunden läuft der Motor unregelmäßig. Sie können es hier hören, wie er manchmal aussetzt.«
Dr. Schmidt lauschte in die frostige Luft. Jetzt hörte er das Tacken des Motors ... jetzt blieb es aus ... jetzt kam es stoßweise wieder. Aber unregelmäßig waren die Explosionstakte. Schlägen eines kranken Herzens glichen sie, das zum Sterben kommt. Nur noch kurze Minuten, dann stand der Motor still.
Hagemann eilte zum Schuppen. Als er die Tür aufriß, quoll ihm dichter Dampf entgegen. Der Druck der letzten Motortakte hatte die Bruchstelle weit aufgerissen und das heiße Kühlwasser durch den Raum verspritzt. Der Motor, von dessen Arbeit das Leben der Station abhing, war niedergebrochen.
Dr. Schmidt zog den Pelz dichter um seine Schultern. Ihn fröstelte bei dem Gedanken, daß in diesem Moment auch die elektrische Heizung aufhörte, daß die grimmige Kälte nun langsam, aber unwiderstehlich in ihre kargen Zufluchtsräume eindringen würde. Wie lange würden sie ihr widerstehen können? —
Hagemann deutete zum Zenit. »Da, Herr Doktor! Ein Flugschiff!«
Ein winziges Pünktchen war es, das seine scharfen Augen dort eben erspäht hatten. Es dauerte geraume Zeit, bis auch Schmidt es sah, da war es schon größer geworden. Schnell kam es tiefer, wuchs dabei immer mehr, bis der mächtige Rumpf von ›St 8‹ dicht über ihnen schwebte, dicht neben ihnen landete. Eine Tür wurde geöffnet, ein Laufsteg ausgeworfen, dann hielt Hein Eggerth den langen Doktor in den Armen und wirbelte ihn in der Freude des Wiedersehens auf dem Schneefeld herum, bis beiden der Atem knapp wurde. Hansen kam dazu:
»Eine nette Bruchbude habt ihr hier!« sagte er und besah sich mit Kennerblicken den eingestürzten Mittelbau. »Wie habt ihr denn das angestellt?«
Hagemann zuckte die Achseln: »Ist wirklich nicht unsere Schuld, Herr Hansen. Der Teufel mag es wissen, wie der Orkan so plötzlich die ganze Station auf den Kopf stellte?«
Hansen zog es vor, auf diese Frage keine Antwort zu geben, über alles, was mit dem großen Meteor zusammenhing, sollte ja—darüber waren sich die drei Piloten von ›St 8‹ einig—allen anderen gegenüber Schweigen bewahrt werden.
Als dritter kletterte Berkoff aus dem Schiff und warf einen kurzen Blick auf die Station und meinte achselzuckend zu Eggerth: »Das kriegen wir drei allein auch nicht weiter ins Lot.«
»Und der Motor, Herr Berkoff«, sagte Hagemann, »unser Motor ist uns vor einer halben Stunde auch zum Teufel gegangen. Es wird kalt in unsern Löchern da drüben.«
»Um so molliger ist es bei uns im Bauch von ›St 8‹«, unterbrach ihn Hansen. »Da wollen wir uns die Sache mal erst in Ruhe überlegen.«
Und dann saßen sie alle acht gemütlich zusammen im Mittelraum des
Stratosphärenschiffes. Der lange Schmidt und Dr. Wille, dessen Arm in den
vergangenen Wochen wieder in Ordnung gekommen war, Rudi, Lorenzen und der
wackere Hagemann, der sich sofort in der Schiffskombüse nützlich machte.
Begreiflicherweise drehte sich das Gespräch in erster Linie um die
Katastrophe und die möglichen Ursachen. Dr. Wille stellte eine geistvolle
Hypothese darüber auf, Dr. Schmidt widersprach ihm, und in Kürze waren die
beiden gelehrten Häuser in einen endlosen Disput verwickelt. Die Zeit
verstrich darüber, bis Hagemann sich eine Bemerkung erlaubte.
»Geschehen ist geschehen, Herr Doktor. Unsere Station liegt in Klump. Wie können wir sie wieder in Ordnung bringen?«
Sein Einwand riß die beiden Doktoren aus ihren Theorien und brachte sie wieder in die Wirklichkeit zurück. Schmidt betrachtete prüfend die um ihn Versammelten.
»Leicht wird's nicht sein, Herr Eggerth. Aber wenn Sie ordentlich Hebezeuge mitgebracht haben, könnte es schließlich doch wohl gehen.«
Hein Eggerth lächelte in sich hinein. Nach einem verstohlenen Blick auf seine Uhr meinte er: »Kommt Zeit, kommt Rat, Herr Dr. Schmidt! Wir werden schon Mittel und Wege finden, um die Geschichte in Ordnung zu bringen.«
Und dann verstand er es geschickt, das Gespräch in andere Bahnen zu lenken. Es gab ja auch soviel zu erzählen von den gemeinsamen Bekannten in Deutschland, von den neuen Erfolgen der Eggerth-Werke und von vielen anderen mehr.
Die Stunden gingen darüber hin, da brauste es in den Lüften. Neben ›St 8‹ legte sich ›St 9‹ auf das Schneefeld, und kaum ruhte es auf dem Boden, da senkte sich ›St 10‹ aus der Höhe herab und legte sich daneben.
»Was, was ist das?« fragte Dr. Wille erstaunt.
»Ich sagte es Ihnen ja«, lachte Eggerth, »kommt Zeit, kommt Rat. Jetzt werden wir den Kram hier schnell ins Lot kriegen.«
Noch während er es sagte, öffnete sich die große Ladeluke von ›St 9‹. Ein Schwärm von Werkleuten quoll heraus. Unter dem Kommando eines Ingenieurs wurden Hebezeuge aufgestellt und Bauteile aller Art aus dem Schiff ins Freie gebracht.
»Wir wollen uns die Sache aus der Nähe besehen und auch ›St l0‹ begrüßen«, schlug Eggerth vor. »Kommen Sie mit, Dr. Wille? Mein Vater wird sich freuen, Sie wieder zu sehen.«
In den nächsten Stunden war es, als wären die Heinzelmännchen über die
Station gekommen. Maste wuchsen im Laufe weniger Stunden in die Höhe. Bald
leuchteten von ihren Spitzen wieder starke Lampen, vorläufig noch von der
Maschine von ›St 8‹ gespeist, und übergossen die Station mit
Tageshelle. Dann war ›St 9‹ restlos ausgeräumt, leer wie eine
taube Nuß, während Bauteile aller Art daneben lagerten. Aber das Wichtigste,
eine neue Kraftmaschine fehlte. Man hatte nicht damit gerechnet, daß die alte
zu Bruche gehen könnte, weil davon nichts in den Funksprüchen zu lesen stand.
Da hieß es für ›St 9‹ noch einmal nach Deutschland
zurückzujagen und schnellstens eine Reservemaschine heranzuschaffen.
Auch im günstigsten Fall bedeutete das einen Zeitverlust von 48 Stunden, und für die nächsten Tage waren die fünf von der Station auf die Gastfreundschaft von ›St8‹ angewiesen, denn kurz nach dem Start von ›St 9‹ stieg auch ›St 10‹ auf. Nur die drei Piloten von ›St 8‹ waren in diesem Schiff und außerdem Professor Eggerth selbst. Über das Ziel ihres Fluges hatten sie sich gründlich ausgeschwiegen.
Mit Nordkurs verließ das Schiff die Station. Erst als deren Gebäude am Horizont versunken waren, drehte es in weitem Bogen nach Süden zurück und nahm Kurs auf die Einschlagstelle des Boliden.
Eintönig dehnte sich das verschneite, vereiste Land unter dem dahinstürmenden
Stratosphärenschiff ... eine halbe Stunde ... und noch eine Viertelstunde.
Dann verschwand das Weiß, rostrot und braun trat das nackte Gestein zutage.
Es sah aus, als ob hier ein Riesenbesen gefegt und in weitem Umkreis jeden
Schneefleck beseitigt hätte. Tiefer ging ›St 10‹. In
verlangsamtem Flug strich es in 2000 Meter Höhe über das Land hin. Da wurde
der Boden wieder weiß, aber nicht Schnee war es, der ihm die Farbe gab.
Dichte Nebelbänke lagerten über dem Boden.
Professor Eggerth blickte nachdenklich in die Tiefe, während sein Sohn zu ihm trat.
»Ich fürchte, Hein, wir kommen noch zu früh. Der Widerstreit der polaren Kälte mit der Hitze der Aufschlagstelle ... das muß Nebel geben wie überall, wo heiße und kalte Luft zusammentreffen. Wer weiß, wie lange das noch dauert, bis es hier wieder klare Sicht gibt.«
Berkoff kam mit einer neuen Ortsbestimmung in den Raum.
»Wir sind noch 200 Kilometer von der richtigen Stelle entfernt.«
Der Professor schüttelte den Kopf. »So starke Nebelbildung bis auf 200 Kilometer Entfernung. Ungeheure Wärmemengen müssen beim Aufprall des Meteors freigeworden sein.«
Hansen setzte den Kurs des Schiffes noch tiefer. Dicht über der Nebelbank glitt es dahin, verschwand bisweilen auf Sekunden in der milchigen Masse. Berkoff warf einen Blick auf den Höhenzeiger. »Die Nebelbank wird flacher, Herr Professor. Wir fliegen nur noch in 700 Meter Höhe. Nach Kurs und Log sind wir noch 100 Kilometer vom Sturzpunkt ab.«
Professor Eggerth nickte. Er schien etwas sagen zu wollen, schwieg aber. In langsamem Flug glitt das Schiff weiter über den Nebel dahin. Schon mußten sie die Hubschraube in Betrieb nehmen, um nicht durchzusacken. Immer tiefer sank das Schiff dabei ... 300 ... jetzt nur noch 200 Meter hoch war es über dem Land.
»Wie weit noch, Herr Berkoff?« fragte Professor Eggerth.
»Noch 40 Kilometer.«
Der Professor griff sich an die Stirn.
»Ein Ringnebel? ... Es wäre möglich, ja das muß es sein, es kann gar nicht anders sein.«
»Wie meinst du, Vater?«
Professor Eggerth deutete durch das Fenster nach unten. Nur noch schwacher Dunst lag unter dem Schiff, hin und wieder wurde der felsige Boden deutlich sichtbar.
»Ich meine«, sagte Professor Eggerth, »daß wir jetzt landen.«
»Wir sind aber noch 20 Kilometer vom Ziel entfernt«, warf Berkoff ein.
»Trotzdem wollen wir erst landen. Bitte, Herr Hansen.«
Hansen schaltete die Horizontalpropeller aus. Das Schiff hing nur noch an seiner Hubschraube und senkte sich langsam zu Boden.
Berkoff wollte dem Professor seinen Pelz bringen. Der winkte lächelnd ab.
»Nicht nötig, lieber Berkoff! Ich vermute, wir werden es draußen eher zu warm als zu kalt finden.«
Eine Tür im Schiffsrumpf wurde geöffnet und milde Luft schlug ihnen von draußen entgegen. Fast 40 Grad unter Null zeigte das Thermometer in der Station, als sie fortflogen. Hier herrschten dagegen mehrere Grad Wärme. Professor Eggerth stieg aus dem Schiff und berührte den Felsboden mit den Händen. Er hatte die gleiche milde Temperatur, wie die Luft darüber.
»Wir wollen sehen, wie weit wir kommen«, sagte der Professor, als er ins Schiff zurückkam, und gab Befehl, in 150 Metern Höhe langsam weiterzufliegen. Ein Fenster im Kommandoraum ließ er offen. Immer angenehmer, immer frühlingshafter strömte die Luft während des Weiterfluges in den Raum. Dabei nahm die Dunkelheit wieder zu. In der hohen Breite hier war die Strahlung des höherkommenden Tagesgestirns noch nicht merkbar. Professor Eggerth ließ die beiden starken Scheinwerfer des Schiffes anstellen und schräg nach unten richten. Eine breite grellbeleuchtete Fläche huschte vor dem langsam fliegenden Schiff auf dem Felsboden dahin. Zehn Kilometer waren sie noch von ihrem Ziel entfernt, als er zum zweiten Male landen ließ. Ein Felsstück, das im Licht der Scheinwerfer funkelnd aufglänzte, hatte seine Aufmerksamkeit erregt. In Begleitung seines Sohnes ging er darauf zu. Die andern wollten ihm folgen.
»Bleiben Sie beide an Bord!« rief er ihnen zu, »es ist nicht ratsam, ›St 10‹ hier unbemannt zu lassen. Ein unglücklicher Zufall, und wir wären alle verloren.«
Kopfschüttelnd sahen ihm Berkoff und Hansen nach. Was sollte wohl hier passieren, wo sich in der lauen Luft nicht der geringste Hauch rührte?
Professor Eggerth blieb vor dem glänzenden Brocken stehen. Es war ein verhältnismäßig kleines Erzstück. Ein Volumen von höchstens zehn Litern mochte es haben. Der Professor bückte sich, um es aufzuheben. Es gelang ihm nicht. Sein Sohn kam ihm zu Hilfe, aber auch mit vereinten Kräften glückte es ihnen eben nur, das Erzstück umzukanten. Hein mußte zum Schiff zurückgehen und Berkoff holen. Erst zu dritt vermochten sie den Brocken die kurze Strecke bis zum Schiff zu schleppen.
»Alle Wetter! Der hat's in sich!« rief Berkoff und wischte sich aufatmend die Stirn. »Was für Zeug mag das sein?«
Der Professor stand geraume Zeit nachdenklich vor dem Findling.
»Das wird sich bald herausstellen«, beantwortete er die Frage Berkoffs, »mir scheint, wir haben keinen schlechten Griff getan. Vielleicht entdecken wir noch mehr von der Sorte. Achten Sie bitte darauf, wenn wir jetzt weiterfliegen.«
Kaum 50 Meter über dem Boden glitt das Schiff langsam vorwärts. Da blitzte es wieder auf. Eine neue Landung. Wieder wurde ein metallischer Brocken gefunden, diesmal so groß und gewichtig, daß sie ein Hebezeug holen mußten, um ihn an Bord bringen zu können. Und je weiter sie kamen, desto öfter wiederholte sich das. Wohl ein Dutzend solcher Fundstücke im Gesamtgewicht einer Tonne etwa hatten sie schließlich im Schiff.
»Ein schweres Bombardement ist das gewesen«, sagte der Professor. »Der Bolide hat nicht schlecht um sich gestreut. Selbst wenn wir nicht mehr viel weiterkommen, so wissen wir jetzt doch, was wir wissen wollten.«
Die Befürchtung, daß ein weiteres Vordringen bald unmöglich werden könne, war nicht von der Hand zu weisen. Es herrschte draußen eine fast tropische Temperatur und auch der Boden war an der letzten Landungsstelle schon reichlich warm.
»Noch etwa drei Kilometer dürften wir von der Sturzstelle entfernt sein«, meldete Berkoff. In der Tat begann das Gelände jetzt sehr merklich zu steigen. Das Schiff war an dem äußeren Hange des Kratergebirges angekommen, das der Bolide bei seinem Anprall aus der Ebene emporquellen ließ.
Mit geringster Geschwindigkeit glitt es dicht über dem Boden den Abhang hinauf. Im Licht der Scheinwerfer blinkte es auch hier an zahlreichen Stellen metallisch auf, aber der Professor sah im Augenblick von einer Landung ab.
Nun hatte das Schiff den Kamm des Kratergebirges erreicht. Wild, zackig und zerrissen sah der scharfe kreisförmige Grat aus, wie man es wohl durch ein gutes Fernrohr an den Ringgebirgen des Mondes beobachten kann. Sanft stieg das Land von außen her an, doch jenseits des Kammes fielen die Kraterwände nach innen zu fast senkrecht ab. ›St 10‹ hing über der klaffenden Wunde, die der Bolide bei seinem Sturz in die Erdkruste geschlagen, und ließ seine Scheinwerfer in die Tiefe spielen. Leichte Dunstschwaden wallten im Grunde etwa 200 Meter unter dem Schiff. Wo sie lichter wurden, schimmerte der Kraterboden unter den Scheinwerferstrahlen in tausend Reflexen.
Hansen führte die Rechte zu einem Hebel. »Sollen wir sinken?«
Der Professor schüttelte den Kopf: »Noch nicht!«
Er trat zu dem geöffneten Fenster und beugte sich hinaus. Unerträglich warm schlug ihm die Luft entgegen. Irgendwelche Gase mußte sie enthalten, die ihn einen Augenblick schwindeln machten und zum Husten zwangen. Mit jähem Ruck schloß er das Fenster.
»Steigen! Schnell steigen!« schrie er Hansen zu.
Stärker wirbelte die Hubschraube, ›St 10‹ stieg und schob sich gleichzeitig mit seinen Horizontalpropellern von der Kratermündung fort. Als es wieder über dem Außenhang stand, befahl Professor Eggerth zu landen.
»Was hast du beschlossen?« fragte Hein, als das Schiff aufsetzte. Professor Eggerth sah blaß aus, wie wenn noch ein großer Schreck in ihm nachwirkte. Es dauerte eine Weile, bevor er zu sprechen begann.
»Das hätte böse ausgehen können. Der Krater ist mit Gasen ... wahrscheinlich mit Kohlenwasserstoffgasen bis zum Rande gefüllt. Ein wenig tiefer noch und unsern Motoren hätte die Verbrennungsluft gefehlt. Wir wären mit unserem Schiff in die Tiefe gestürzt und zerschellt.«
Er machte eine Bewegung, als ob er den Gedanken an die eben überstandene Gefahr abschütteln wollte, sprach dann ruhig weiter:
»Trotzdem ... das Wagestück hat sich gelohnt. Sie alle haben es da unten auf dem Kratergrunde wohl schimmern gesehen. Für mich ist es sicher, daß der Bolide in seiner Hauptmasse aus den gleichen Stoffen besteht, wie die Brocken, die wir vorher fanden. Wir wollen sehn, ob wir hier noch mehr davon entdecken können.«
Auf seinen Wink hob sich das Flugschiff wieder einige Meter empor und trieb langsam den Hang entlang. Die Stunden verstrichen, während ›St 10‹ das Ringgebirge absuchte. Ein paar dutzendmal lockte glänzender Schimmer sie zu neuer Landung. Der Boden war heiß hier, so heiß, daß er ihre Sohlen fast versengte. Jedesmal brachten sie dabei Stücke jenes schweren glänzenden Metalls in das Schiff, die der Bolide bei seinem Sturz so reichlich verstreut hatte. Mehrere Tonnen des unbekannten Sternenstoffes hatten sie an Bord, als die Umfahrt über dem Kratergebirge vollendet war.
Noch einmal machte Berkoff eine genaue Ortsbestimmung, wahrend Hein Eggerth eine Skizze des Geländes entwarf. Sie zeigte eine ziemlich genau kreisförmige Krateröffnung von 1200 Metern im Durchmesser, umgeben von einem etwa 300 Meter hohen Ringgebirge, das nach außen hin gleichmäßig abfiel und in die umgebende Ebene auslief. Der Professor nahm ihm das Blatt ab und steckte es in seine Brieftasche.
»Das soll die Unterlage werden, Hein«, sagte er dabei, »nach der wir unsere künftigen Pläne ausarbeiten wollen. Jetzt wieder Kurs auf die Station von Wille und absolutes Stillschweigen über alles, was wir hier gesehen haben.«
Mit voller Motorenkraft schoß das Schiff von dannen. Bald lag wieder die eisige Antarktis unter ihm, und die Dunkelheit wich allmählich grauer Dämmerung. Der helle Schein der neuen Lampen wies ihnen die Station, das Knarren von Kränen und das Geräusch von Hammerschlägen drang zu ihnen, als das Schiff sich senkte. Nur etwa sechs Stunden hatte die Exkursion von ›St 10‹ beansprucht. Rüstig waren währenddem die Arbeiten in der Station fortgeschritten. Starke Kräne rissen die Trümmer des niedergebrochenen Mittelbaus auseinander, hier eine Wand, dort ein Stück Dach. Vieles davon war hoffnungslos zerknickt und zerbrochen. Manches aber war beim Einsturz unversehrt geblieben und konnte für den späteren Wiederaufbau verwendet werden. Für das Zerstörte boten die Baustapel, die ›St 9‹ zurückgelassen hatte, reichlich Ersatz. Besonders schwer hatte, wie es sich jetzt beim Aufräumen herausstellte, das Observatorium gelitten. Von der niederstürzenden Deckenkonstruktion waren die empfindlichen Meßinstrumente übel mitgenommen worden. Keine einzige der vielen Vakuumröhren war heil geblieben.
Kopfschüttelnd besah sich Professor Eggerth die Stätte der Zerstörung.
»Sie haben Glück gehabt, Herr Dr. Wille, daß die Katastrophe Sie nicht in Ihrem Observatorium überraschte. Da wären Sie kaum mit dem Leben davongekommen.«
Dr. Wille sprang gerade zur Seite, um nicht von einem niedergehenden Kranhaken gefaßt zu werden. Die Worte des Professors hörte er kaum. Sein ganzer Schmerz galt den vernichteten Instrumenten. Verzweifelt suchte er zwischen den Trümmern herum, immer noch hoffend, daß der eine oder andere Apparat der Zerstörung entgangen sein mochte. Mit einiger Gewalt mußten die Werkleute ihn schließlich von der Stelle fortziehen, wo er sie störte und sich selbst gefährdete.
Planmäßig gingen die Arbeiten weiter. Oberingenieur Großmann hatte seine
zwanzig Mann in zwei Schichten geteilt, die sich alle sechs Stunden an der
Baustelle ablösten. So konnte ohne Unterbrechung mit stets frischen Leuten
gearbeitet werden.
Zweimal war der Dämmerschein heller und immer heller werdend um den Horizont gewandert, da kam ›St 9‹ zurück. In seinem Rumpf trug das Schiff neben manchem anderen auch eine neue Maschinenanlage. Ein halbes Dutzend Kräne packten zu, um das schwere Aggregat herauszuheben, schwankend und schaukelnd schleiften sie es bis zum Maschinenschuppen.
Ein halber Tag schwerer Arbeit noch, dann konnte Hagemann ein Ventil aufdrehen. Ein Zischen der Druckluft in den Zylindern, ein Tacken und Donnern, die ersten Explosionen der neuen Maschine dröhnten über den Hof. Licht strahlte aus den Fenstern des wiederhergestellten Stationshauses, die Wärme der elektrischen Heizung begann dessen Räume wieder zu füllen.
Einige Tage würde es noch erfordern, um auch die letzten äußeren Spuren der Katastrophe zu beseitigen. Der Professor hatte nicht die Absicht, so lange zu bleiben. Noch eine letzte Besprechung mit Dr. Wille. Eine lange Liste drückte der ihm dabei in die Hand. Neue Instrumente aller Art waren es, die der Doktor dringend wünschte und die ihm Professor Eggerth schleunigst zu schicken versprach. Ein letzter Händedruck noch, ein Abschied von denen, die hierblieben, dann schloß sich die Tür von ›St 10‹. Die Schrauben begannen zu arbeiten, das Schiff stieg empor. Als es den Boden verließ, lugte der Sonnenball zum ersten Male nach der langen Polarnacht über den Nordhorizont. Seine Strahlen übergossen das neue Stationshaus mit purpurnem Schimmer. Wie ein rosenfarbiges Wölkchen erschien das Stratosphärenschiff in der Höhe, das dem Tagesgestirn geraden Weges entgegenstürmte.
Fünf Menschen im Schnee verschüttet. Karl Hagemann lebt. Dr. Schmidt wird gefunden, Dr. Wille ausgegraben. Auch die Funker entgingen dem Tode. ›St 8‹ bringt der Station Hilfe aus Deutschland. ›St 10‹ am Bolidenkrater. Ein kostbarer Fund.
In Südwesten schließt sich an die Eggerth-Werke eine größere Ebene. Ihr Boden besteht aus dem Abraum eines Braunkohlenbergwerkes, das im Tagebau betrieben wird und mit seiner Abbaustelle im Laufe der Zeit fünf Kilometer weiter nach Süden gerückt ist. Es kann noch Jahre dauern, bevor dies Land unter dem Einfluß von Regen, Luft und Sonne einmal fruchtbar werden wird. Einstweilen ist es Ödland, von Mensch und Tier gemieden.
Hier ging ›St 10‹ kurz nach Mitternacht mit abgeblendeten Scheinwerfern nieder. In einer halben Meile Entfernung sahen seine Insassen die Eggerth-Werke im strahlenden Glanz von tausend Lichtern liegen. Dort wurde ja Tag und Nacht gearbeitet, um die neuen großen Aufträge zu bewältigen.
Hansen verließ das Schiff und marschierte durch die Dunkelheit davon. Der Professor blieb mit seinem Sohn und Berkoff zurück. Noch einmal setzte er den beiden seinen Plan auseinander, dessen Einzelheiten genau innegehalten werden mußten, wenn die Tarnung gelingen sollte, die er für notwendig hielt.
Auf der Landstraße im Westen wurden die Lichter eines Kraftwagens sichtbar.
Sie verschwanden, tauchten wieder auf, waren eine Weile wiederum
verschwunden, und dann stand ein großer Lastkraftwagen dicht neben dem
Stratosphärenschiff. Hansen kletterte vom Führersitz und klopfte im
Morserhythmus gegen den Rumpf von ›St 10‹. Der Professor kam
heraus und besah sich den Wagen.
»Gut, Herr Hansen! Wo haben Sie ihn her?«
»Von Müller & Bergmann. Trotz der nachtschlafenden Zeit war da noch Gott sei Dank jemand im Kontor. Die Leute haben in den letzten Tagen viel Fuhren für unser Werk gemacht. Sie gaben mir den Wagen, ohne irgendwelche überflüssigen Randbemerkungen zu machen.«
»Um so besser, Herr Hansen! Jetzt an die Arbeit. Wir werden wohl alle etwas schwitzen müssen.«
Die Arbeit, zu der Professor Eggerth rief, war im buchstäblichen Sinne des Wortes eine schwere. Es handelte sich darum, die Erzbrocken, die sie aus der Antarktis mitgebracht hatten, aus dem Schiff in das Auto zu transportieren. Kantige, zackige Stücke, einzelne darunter im Gewicht von mehreren Zentnern, alles in allem eine Menge von reichlich fünf Tonnen. Sie stöhnten und ächzten dabei, und ihre Hände trugen manche Blase und manchen Riß davon, bis die Arbeit endlich getan und das letzte Stückchen Erz in den Wagen umgeladen war.
Hansen setzte sich an das Steuer des Kraftwagens und fuhr in der Richtung auf die Chaussee fort. ›St 10‹, die Lichter immer noch abgeblendet, stieg wieder empor und jagte einige Meilen nach Süden. Dann erst ließ es seine Scheinwerfer wieder aufstrahlen und meldete seine Ankunft durch Funkspruch und dann hing es über dem hellerleuchteten Flugplatz des Werkes und ließ sich langsam auf das bereitstehende Traktorengestell nieder.
Von allen Seiten strömten Menschen heran, Arbeitsleute im blauen Kittel, Ingenieure des Werkes. Außerdem noch Vertreter der Presse, die hier seit Stunden lauerten, um die neuesten Nachrichten über das Schicksal der deutschen Station in der Antarktis zu erfahren, um sie sofort telegraphisch weiterzugeben.
Kaum war die Treppe herangeschoben und die Tür geöffnet, als die Berichterstatter schon in das Schiff kletterten und seine Besatzung umringten. Wohl oder übel mußten der Professor und seine beiden Begleiter Rede und Antwort stehen und auf unzählige Fragen Auskunft geben.
Für die Morgenzeitungen war es inzwischen doch zu spät geworden. Da wollten die ungebetenen Gäste auch noch das Schiff besichtigen und möglichst viel von seiner Ladung sehen, um Stoff für Stimmungsberichte zu sammeln. Wollten womöglich auch noch irgendeine Kleinigkeit, die ›St 10‹ aus der Antarktis mitgebracht hatte, zum Andenken mitnehmen.
Professor Eggerth ließ den Ansturm mit stoischer Ruhe über sich ergehen und duldete es mit nachsichtigem Lächeln, daß die Zeitungsleute sich danach von Berkoff und Hein durch alle Räume des Stratosphärenschiffes führen ließen. Mochten sie ihrer Neugier frönen; es war ja nichts mehr an Bord, was man vor ihnen hätte verbergen müssen. Er selbst hatte Wichtigeres zu tun, als diesen Rundgang mitzumachen, griff nach Hut und Mantel und verließ das Schiff. So konnte er nicht sehen, wie Mr. Haynes, der Vertreter der American associated Press, sich hinter dem Rücken von Berkoff im Laderaum von ›St 10‹ plötzlich bückte, etwas Glänzendes, Schimmerndes aufhob und in seiner Manteltasche verschwinden ließ.
Langsam ging Professor Eggerth über den Flugplatz auf das Werk zu. Sein Ziel
war ein unscheinbares, einstöckiges Gebäude, das etwas abseits von den großen
Montagehallen lag. Dies Haus war, wenn man so sagen darf, die Keimzelle, aus
der sich im Laufe der Zeit die Eggerth-Werke zu ihrer gegenwärtigen Größe
entwickelt hatten. Als der Professor vor einem Menschenalter nach Bitterfeld
kam, ließ er zuerst dies Gebäude errichten und begann in ihm seine
Forschungsarbeiten, die für die ganze Flugzeugtechnik so bedeutungsvoll
werden sollten.
Er zog ein Schlüsselbund aus der Tasche und öffnete die schwere Eisentür mit einem vielfach gezackten Schlüssel. Seine Rechte griff zum Schalter, elektrisches Licht erleuchtete seinen Weg. Über einen Vorflur kam er zu einer zweiten Tür, und wieder war ein kunstvoller Schlüssel nötig, um das Sicherheitsschloß zu öffnen. Dann war er in seinem Privatlaboratorium, in das er sich auch jetzt noch des öfteren zurückzog, wenn es sich um wichtige Arbeiten und Versuche handelte, die er keinem anderen überlassen wollte.
Ein geräumiger Saal war dies Laboratorium und ausgestattet mit allem, was das Herz eines Physikers und Chemikers sich nur wünschen konnte. Mit mächtigen Zerreißmaschinen begann es am einen Ende des Raumes, mit denen man jeden Werkstoff auf seine Eigenschaft prüfen konnte. Eine Reihe von Öfen folgte, die es gestatteten, Materialien aller Art den verschiedensten Wärmebehandlungen zu unterziehen. Nach dem andern Ende hin kam dann die Chemie zu ihrem Recht. Auf langen Laboriertischen waren Retorten, Destillierkolben und Tiegel der verschiedensten Formen und Größen aufgebaut. In hohen Regalen an den Wänden standen Tausende von Flaschen und Gläsern, die alle für chemische Untersuchungen erforderlichen Reagenzien enthielten. —
Einen prüfenden Blick ließ Professor Eggerth über die Flaschenbatterien gleiten. Seine Augen schienen gefunden zu haben, was er suchte. Er trat an ein Regal, nahm mehrere Flaschen heraus und stellte sie auf einen der Arbeitstische. Von einer andern Stelle holte er eine feine chemische Waage herbei. Dann zog er sich einen bequemen Stuhl heran und ließ sich nieder. Wie spielend griff er in die Rocktasche, und Bröckchen jenes wunderbaren Sternenstoffes, den ›St 10‹ aus der Antarktis mitgebracht hatte, fielen aus seiner Hand auf die Tischplatte.
Ein Stück nach dem andern untersuchte er auf der Waage. Er wog sie in der Luft, er wog sie im Wasser, er arbeitete mit dem Rechenschieber und notierte das spezifische Gewicht jedes Stückes. Es war für alle fast genau das gleiche. 11,5 schrieb seine Rechte auf das Papier; ›Elf Komma fünf‹ murmelten seine Lippen. Mit dem Bleistift begann er eine neue Rechnung, blickte auf das Resultat und strich sich sinnend über die Stirn. Halblaut sprach er zu sich selber: »Edelmetall ... schwerstes Edelmetall ... ein hoher Prozentsatz davon muß in dem Erz vorhanden sein. Nun, wir werden sehen.«
Aus einer der Flaschen goß er wasserklare Flüssigkeit in ein Reagenzglas und ließ einen der Brocken hineingleiten. Gasbläschen bildeten sich an dessen Oberfläche und ließen die Flüssigkeit aufschäumen. Doch nicht lange dauerte das Spiel. Schon nach wenigen Minuten hörte die Gasentwicklung auf. Mit einer gläsernen Pinzette holte der Professor das Metallstück wieder heraus und legte es beiseite. Aus einer Flasche goß er ein paar Tropfen zu der Flüssigkeit im Reagenzglas. Im Augenblick begann sie sich zu färben, zeigte grünlich-bläuliche Streifen.
»Nickeleisen«, murmelte er vor sich hin, »der leichtere Bestandteil ist natürlich Nickeleisen. Es kann ja kaum anders sein.«—
Andere Flaschen holte Professor Eggerth aus den Regalen, scharfe Säuren goß er in einem großen Glasgefäß zusammen und warf alles Erz hinein. Mächtig schäumte es in dem Gefäß auf, restlos löste sich das Metall in der Flüssigkeit. Nach andern Flaschen und Büchsen griff er dann wieder und gab etwas davon zu der Lösung. Verschiedenfarbige Niederschläge bildeten sich dabei, von der er die übrigbleibende Flüssigkeit jedesmal sorgsam abgoß.
Die Stunden strichen darüber hin. Längst glänzte die Mittagssonne eines schönen Septembertages am Himmel. Der Professor, hinter den verschlossenen Läden seines Laboratoriums ganz in seine Arbeit versenkt, merkte nichts davon. Flammen von Knallgasbrennern begannen zu zischen. Mit reduzierenden Stoffen vermengt, schmolz er jene vielfarbigen Pulver, die er aus seinen Lösungen gewonnen hatte, in feuerfesten Schalen nieder.
Schon ging die Sonne zur Rüste, da war das Werk endlich getan; da waren die Erzbrocken in ein Dutzend verschiedenfarbige Schmelzproben umgewandelt. Ein dunkelgrauer Regulus aus chemisch reinem Eisen lag neben einem anderen bläulichweiß schimmernden, der nur reines Platin enthielt. Gelblich glänzte ein dritter, in dem alles Gold der Brocken vereinigt war. Aus Iridium, Palladium, Silber und anderen Metallen bestanden die übrigen.
Professor Eggerth verschloß sie in einem Panzerschrank. Sorgsam beseitigte er danach alle Spuren seiner Arbeit. Die Lampen auf dem Werkhof brannten bereits, als er das Laboratorium verließ, um nach seiner Wohnung zu gehen. Neben der Skizze, die Hein Eggerth von dem Bolidenkrater entworfen hatte, steckte ein zweites Blatt in seiner Brieftasche, das die genaue Analyse des Sternenstoffes enthielt. Nach einem kurzen Imbiß warf er sich in seinem Arbeitszimmer auf ein Ruhelager. Eine kurze Weile noch, dann begann die Flut seiner Gedanken zu verebben. Die Natur forderte ihre Rechte.
In der zweiten Morgenstunde schrillte der Wecker auf dem Schreibtisch. Der
Schläfer bewegte sich, als wolle er etwas Lästiges verscheuchen, aber das
rasselnde Geräusch ließ nicht nach. Noch ein paar Bewegungen, dann erhob sich
Professor Eggerth, griff nach Stock und Hut und verließ den Raum. Nur einen
kurzen Weg hatte er über die Landstraße, die sein Haus von den Werkanlagen
trennte, dann stand er vor dem Fabriktor. Der Nachtportier zog ehrfurchtsvoll
die Mütze, als sein Chef plötzlich vor ihm erschien. Der Professor winkte
ab:
»Bleiben Sie bedeckt, Müller. Ich möchte wissen, ob Herr Ingenieur Hansen schon angekommen ist. Er besorgt neue Instrumente für die Südpolstation.«
Der Portier schüttelte den Kopf: »Ich habe Ingenieur Hansen seit mehreren Tagen nicht gesehen, Herr Professor.«
Noch während er es sagte, tönte von der Straße her eine Autohupe. Ein schwerer Lastkraftwagen hielt vor dem Portal.
»Sind Sie es, Hansen?«
Der Professor war an den Wagen herangetreten. So laut, daß der Portier jedes Wort verstehen konnte, fragte er weiter:
»Haben Sie die Instrumente für Dr. Wille in Jena bekommen?«
»Alles in bester Ordnung, Herr Professor«, antwortete Hansen vom Steuersitz des Wagens her. »Dr. Wille wird zufrieden sein.«
»So! Das freut mich, mein lieber Hansen. Wir wollen die Sachen vorläufig in mein Laboratorium stellen.«
Der Portier öffnete das eiserne Tor, und der Wagen fuhr auf das Werkgelände.
»Darf ich Ihnen ein paar Leute besorgen, Herr Professor?« fragte der Portier.
»Nicht nötig, Müller. Die Sachen bringe ich zusammen mit Herrn Hansen schon allein in mein Laboratorium.«
Während der Portier die Torflügel wieder schloß, rollte der Wagen schon weiter. Professor Eggerth folgte ihm zu Fuß; zwei Gestalten traten aus dem Dunkel und schlossen sich ihm an, Berkoff und Hein Eggerth.
Das Laboratoriumsgebäude lag abseits von dem eigentlichen Werkbetrieb. Niemand konnte es beobachten, wie vier Menschen hier arbeiteten und schleppten, bis endlich der letzte Brocken des wertvollen Erzes sicher im Laboratorium geborgen war.
»Uff«, sagte Hansen und wischte sich die Stirn. »Das wäre mal wieder glücklich geschafft. Was jetzt weiter, Herr Professor?«
»Am besten, Herr Hansen, Sie bringen den Wagen gleich wieder zu Schmidt & Bergmann. Dann können Sie sich erst mal aufs Ohr hauen und ordentlich ausschlafen.«
»Danke schön, wird gemacht, Herr Professor.«
Berkoff kletterte zu Hansen in den Wagen, beide fuhren los.
Professor Eggerth kehrte mit Hein zu seinem Hause zurück. Es ging bereits auf die vierte Morgenstunde, als sie dort in das Arbeitszimmer traten, aber der Professor dachte nicht an Ruhe. Es drängte ihn, mit seinem nächsten Vertrauten, seinem Sohn, das Ergebnis seiner Untersuchungen zu besprechen.
Kaum hatten sie Platz genommen, als er diesem ein Blatt Papier hinreichte.
»Sieh dir bitte diese Zahlen an!«
Hein überflog das Blatt und wiederholte dabei halblaut, was er las: »60% Eisen ... 10% Platin ... 12% Gold ...«
Verwundert ließ der das Blatt sinken. »Was bedeutet das, Vater?«
»Die Analyse von ein paar Erzproben des Meteors. Ich habe sie in der vorletzten Nacht gemacht.«
Noch einmal und jetzt mit größerer Sorgfalt las Hein Eggerth die Zahlen. Erregt sprang er auf.
»Vater! Es ist ja nicht denkbar! ... 10% Platin ... 12% Gold ... unermeßliche, unerschöpfliche Reichtümer wären ja dann mit dem Meteor vom Himmel gefallen! Aber ... es ist ja nicht möglich ... ist dir vielleicht nicht doch ein Irrtum unterlaufen?«
Professor Eggerth schüttelte den Kopf. »Ich bin meiner Sache ganz sicher, Hein. Die Gewichte der einzelnen extrahierten Metalle stimmen bis auf wenige Zentigramm mit dem Gesamtgewicht der verarbeiteten Erzproben überein.«
»Ja dann, Vater ... dann stehen wir ja vor etwas ganz Neuem ... noch nie Dagewesenem.«
Er lief aufgeregt im Zimmer hin und her. Der Professor wartete, bis er sich wieder gefaßt hatte. Dann sprach er weiter.
»Meine Analysen sind unbedingt zuverlässig, Hein, aber sie erstrecken sich nur auf wenige hundert Gramm zufällig aufgelesener kleiner Brocken. Ein Zufall könnte uns genarrt haben. Es könnte sein, daß gerade diese paar Stückchen so gehaltreich waren, während die große Masse des Meteoriten viel ärmer, vielleicht nicht einmal abbauwürdig ist.«
Hein Eggerth sah enttäuscht aus. Eine kurze Weile sann er vor sich hin. Dann begann er wieder zu sprechen, langsam, stockend, sich oft unterbrechend.
»Es wäre möglich, Vater ... aber doch nicht eben wahrscheinlich. Ein sonderbarer Zufall müßte das sein, der dir gerade ein paar kostbare Stückchen in die Hände spielte ... und die gewaltige andere Masse sollte wertlos sein. Das kann ich nicht glauben ... will es auch nicht glauben ... und du, Vater, glaubst es wohl auch nicht?«
Professor Eggerth lehnte sich in seinen Sessel zurück und brachte die Fingerspitzen seiner Hände zusammen.
»Ich will vorläufig gar nichts annehmen oder glauben, Hein. Ich wollte nur die Möglichkeit andeuten, daß dieses günstige erste Ergebnis vielleicht einer weiteren Prüfung nicht standhalten könnte.«
Wieder sprang Hein von seinem Sitz auf. »Aber wir haben doch genug Erz mitgebracht. Auf fünf Tonnen schätze ich die Masse. Wir können ja sofort weiteruntersuchen.«
»Sehr richtig, mein Sohn, das können wir tun und werden es auch schnellstens machen. Aber die Bearbeitung dieser Massen ... du sagst selbst, daß es rund hundert Zentner sind ... ist eine Heidenarbeit. Sie erfordert Geduld, Hingabe, Gewissenhaftigkeit und ein Quantum Zeit, das ich ihr im Augenblick nicht widmen kann. Dabei muß die Sache absolut diskret behandelt werden. Ich möchte sogar nicht, daß Hansen oder Berkoff etwas davon erfahren.«
Während der Professor sprach, glitt ein Schein des Verständnisses über die Züge Heins. Er unterbrach den Professor: »Ich verstehe dich, Vater. Ich soll das Erz weiterbearbeiten.«
Professor Eggerth nickte.
»Es ist so, Hein. Die Chemie ist nicht dein Gebiet. Trotzdem mußt du die Sache übernehmen, denn ich darf und will keinen andern in das Geheimnis einweihen. Ich werde dich morgen mit der Technik dieser chemischen Scheidungen vertraut machen und dann ... ja dann, mein lieber Junge, wirst du dich für die nächsten sechs bis acht Wochen in mein Laboratorium zurückziehen und ganz gehörig schuften müssen, bis alles Erz aufgearbeitet ist.«
Hein Eggerth schüttelte ungläubig den Kopf.
»Sechs bis acht Wochen, Vater, das ist wohl übertrieben. Vierzehn Tage höchstens, denke ich.«
Ein Lächeln glitt über die Züge des Professors.
»Du wirst dich wundern, mein Lieber. Hundert Zentner verarbeiten, das ist schon ein chemischer Mittelbetrieb, und wir müssen es notgedrungen mit meinen Laboratoriumseinrichtungen schaffen. Es wäre nicht zweckmäßig, im Augenblick eine größere Anlage dafür zu errichten. Würde sich auch im Werk schwer geheimhalten lassen.«—
Noch ein Viertelstündchen sprachen die beiden miteinander, und der Professor gab seinem Sohn genaue Verhaltungsmaßregeln für die nächsten Wochen. Der helle Morgen schien bereits in das Zimmer, als sie sich trennten, um endlich zur Ruhe zu gehen.
Am nächsten Tag hörte Wolf Hansen zu seiner Verwunderung von Oberingenieur
Vollmar, daß Hein Eggerth mit Spezialaufträgen seines Vaters nach
Süddeutschland verreist sei. Am Nachmittag traf er Professor Eggerth, der
gerade aus seinem Laboratorium herauskam. Der Professor trug eine verdrossene
Miene zur Schau.
»Mit unserm Erz scheint nicht viel los zu sein«, sagte er beiläufig zu Hansen. »In der Hauptsache ist es reines Nickeleisen. Wenn nicht doch noch Stücke mit etwas besserer Ausbeute dazwischen sind, wird es kaum lohnen, der Sache weiter nachzugehen. Trotzdem, Herr Hansen, wollen wir über die ganze Angelegenheit vorläufig noch Stillschweigen bewahren.«
»Selbstverständlich! Herr Professor«, erwiderte Hansen und ging zu seiner Abteilung. Die Arbeit für die neuen Aufträge nahm ihn die kommenden Wochen derart in Anspruch, daß er kaum noch Gelegenheit fand, an den Boliden zu denken, der in der fernen Antarktis vom Himmel stürzte.
Man schrieb den 22. Dezember. In Deutschland rüstete man für das Weihnachtsfest, auf der südlichen Hälfte des Erdballes war Hochsommer. Zwar reichte die Kraft der Sonne nicht aus, um den schweren Eispanzer des sechsten, des antarktischen Kontinents merklich zum Schmelzen zu bringen, aber das Tagesgestirn blieb jetzt in jenen hohen südlichen Breiten dauernd über dem Horizont und seine ständige Strahlung machte das Klima erträglich. Die Herren Wille und Schmidt brauchten sich nicht mehr in ihre schwersten Pelze zu wickeln, wenn sie einmal in das Freie traten, um sich an dem Anblick des großen Christbaumes zu erfreuen, den ›St 8‹ vor zwei Tagen in der Station abgeliefert hatte.
Überhaupt ›St 8‹! Was wäre die ganze Station ohne dieses wunderbare Schiff gewesen? Wie ein richtiger Weihnachtsmann war Wolf Hansen bei diesem letzten Besuch aufgetreten, hatte Kisten, Kästen und Pakete in schwerer Menge ausladen lassen, ihren Aufschriften nach für die einzelnen Mitglieder der Station bestimmt und bei Androhung schwerster Strafen erst am Heiligen Abend unter dem Christbaum zu öffnen.
Hansen hätte die paar Tage wohl dableiben und das Christfest mit auf der Station feiern können. Aber er lehnte die Einladung Willes dankend ab und schützte dringende Geschäfte in Deutschland vor.
So verließ ›St 8‹ am 22. Dezember nachmittags drei Uhr nach Greenwichzeit wieder die Station und steuerte auf gradestem Kurs die Einschlagstelle des Boliden an. Eine Stunde später hing es schon über der großen Krateröffnung. Während es sich langsam sinken ließ, trieb es einer Stelle auf dem Kamm des Ringgebirges zu, auf der bereits seine Schwesterschiffe ›St 9‹ und ›St 10‹ lagen.
Die Maschinen von ›St 9‹ und ›St 10‹ arbeiteten mit voller Kraft. Weithin dröhnte der Donner der starken Motoren über das Land. Ihre Propeller aber standen still, sie waren abgeschaltet. Die ganze Kraft der Motoren kam den mächtigen Luftkompressoren zugute. Deren Aufgabe war es ja, wenn das Schiff in der Stratosphäre flog, die stark verdünnte Luft der Umgebung anzusaugen und mit normalem Atmosphärendruck in den Schiffsraum zu werfen. Doch bevor Professor Eggerth diesmal mit den drei Schiffen zur Antarktis aufbrach, hatte er einige bauliche Veränderungen an den Maschinenanlagen vornehmen lassen, und diese wurden jetzt ausgenutzt. Die großen Kompressorpumpen warfen die von ihnen erfaßten Luftmengen nicht mehr in das Innere des Schiffsrumpfes, sondern drückten sie in mehrere Meter weite Hanfschläuche hinein, die über den Kraterrand hinab in die dunkle Tiefe reichten.
Die Leute im Werk hatten sich über den Zweck der Änderungen die Köpfe zerbrochen. Seinen drei Mitarbeitern, Berkoff, Hansen und Hein hatte der Professor den Zweck mit den Worten erklärt:
»Der ganze Krater ist bis zum Rande mit unerwünschten Gasen gefüllt. Wir werden ihn mit frischer Luft ausspülen.«
Und dann hatte er ihnen eine kleine Rechnung aufgemacht, daß man etwa eine viertel Milliarde Kubikmeter Frischluft in den Krater pumpen müsse, wenn man ihn richtig säubern wolle. Seine Mitarbeiter blickten sich erschrocken an, als er ihnen damals diese Zahl nannte, aber mit einer weiteren kurzen Erklärung hatte er es verstanden, ihre Bedenken zu zerstreuen. Und nun lagen die Schiffe hier, arbeiteten nach seinem Plan und augenscheinlich ging alles wunschgemäß.
Die Besatzung der Schiffe war außergewöhnlich gering, denn um das Geheimnis zu wahren, war der Professor genötigt, sich auf seine bereits eingeweihten drei Mitarbeiter zu beschränken. Diese allein, zu denen der Professor als vierter kam, hatten die drei gewaltigen Schiffe von Deutschland nach der Antarktis gebracht, ein Wagnis, das nur durch die vorzügliche automatische Steuerung möglich war.
Nach einer kurzen Begrüßung des Professors kehrte Hansen zu seinem Schiff zurück und ließ einen elektrischen Haspel angehen. Auch von ›St 8‹ wurde ein Schlauch ausgerollt und in den Krater hinabgelassen. Dann vermengte sich der Motordonner des Schiffes mit dem der beiden anderen. 30 000 Pferde insgesamt waren an der Arbeit, Frischluft auf den Kratergrund hinunterzudrücken, und da die Kompression dafür nur unbedeutend zu sein brauchte, so wurden die bewegten Luftmengen selbst um so größer.
Handelte es sich doch in der Tat, wie Professor Eggerth damals erklärt hatte, mehr darum, durch die tunnelartig weiten Schläuche einen sturmartigen Wind bis zum Kratergrund zu blasen, als eigentliche Kompressionsarbeit zu leisten. Man durfte daher hoffen, im Laufe von 24 Stunden die errechneten Luftmengen zu bewältigen.
Am Abend des nächsten Tages wurden die Maschinen stillgelegt. Fast
unnatürlich erschien den vieren die plötzliche Ruhe nach vielstündigem
Motorgedröhn. Auf dem Kamm des Ringgebirges nahe dem Kraterrand hatte
Professor Eggerth sich auf einer Felszacke niedergelassen. Es war
frühlingsmäßig warm hier; er konnte dort im einfachen Arbeitsrock verweilen,
ohne sich der Gefahr einer Erkältung auszusetzen.
Die Sonne stand immer noch über dem Horizont, doch bei weitem nicht hoch genug, um in die Kratertiefe hineinzuleuchten. Deren Grund lag in undurchdringlicher Dunkelheit. Der Professor warf einen kurzen Blick auf ein Blatt Papier, auf dem er sich den Gang der nächsten Arbeiten notiert hatte.
»Ad eins, Hein! Temperaturmessung mit dem registrierenden Fernthermometer.«
In Begleitung von Hansen ging Hein zu ›St 8‹. Sie rollten ein Kabel von dem Schiff her bis zum Kraterrand aus, zogen eine fahrbare Elektrowinde heran und verbanden sie mit dem Kabel. Noch einmal kehrten sie danach zu dem Schiff zurück und holten ein eigenartiges Instrumentarium. Ein leichtes Tischchen, auf dessen Platte ein Meßinstrument befestigt war. Unter der Tischplatte befand sich eine Kabelrolle. Etwas Rundes, von Korbgeflecht Umgebenes, das einer Boje ähnelte, war am Ende des Kabels befestigt.
Hansen schäkelte das Seil der Elektrowinde in einem Karabinerhaken der Boje ein und ließ sie dann nach innen zu über den Kraterrand abrollen, Professor Eggerth war an den Tisch getreten. Er legte ein Dosenthermometer darauf und verglich es mit der Angabe des Meßinstrumentes. Nickte dann kurz.
»Geht in Ordnung, Hein. Beide Instrumente zeigen 20 Grad Celsius. Laß die Winde langsam angehen.«
Eine Schalterbewegung von Hein, und das Seil der Winde begann auszulaufen. Blaue und rote Stellen markierten an ihm die Meter nach Zehnern und Hunderten. Stetig glitt es in die Tiefe. Jetzt waren 150 ... jetzt 200 Meter Seil abgelaufen. Jetzt gab es einen leichten Ruck. Die Korbkugel hatte den Kratergrund in 220 Metern Tiefe erreicht und lag dort unten irgendwo im Dunklen.
Der Zeiger des Instrumentes auf dem Tische kletterte langsam weiter.
»35 Grad ... 36 Grad ... 37 Grad ...«, las der Professor von der Skala ab. »Wir wollen ein Viertelstündchen warten, bis der Apparat sich ausgeglichen hat«, sagte er, »obgleich ich nicht mehr glaube, daß die Temperatur uns Schwierigkeiten machen wird.«
Er warf wieder einen Bück auf seinen Zettel, »Ad zwei, Herr Berkoff! Untersuchung der Luft im Krater.«
Mit Hein und Hansen ging Berkoff zu ›St 9‹. Zu dritt zogen sie eine Aluminiumlaufbrücke aus dem Schiffsrumpf, bis sie eine schwach geneigte Fahrbahn von der Tür bis zum Felsboden darbot. Ein leichter Kran mit weiter Auslage wurde auf ihr ins Freie geschoben. Berkoff sprang auf dessen Führerstand, schaltete, und ein Kabel aus dem Schiffsbauch nach sich ziehend, rollte der Kran, elektromotorisch bewegt, bis zum Kraterrande hin.
Hansen und Hein Eggerth folgten zu Fuß. Gemeinsam schleppten sie einen größeren Gegenstand, der sich bei näherer Betrachtung als eine ganz gewöhnliche Petroleumlampe entpuppte. Der Himmel mochte wissen, wo Professor Eggerth dies Stück aufgetrieben hatte. Es war eine jener altertümlichen Hängelampen, wie sie in den siebenziger Jahren des vorigen Jahrhunderts vor Einführung des elektrischen Lichtes in bürgerlichen Haushaltungen allgemein gebräuchlich waren. Allerlei alte Erinnerungen schienen ihm durch den Kopf zu gehen, als er sie nun eigenhändig an dem durch die Kranrolle laufenden Seil befestigte. Beinahe neugierig schauten ihm Hein und seine Freunde zu, wie er dann den Glaszylinder abzog, den Docht entzündete und danach Zylinder und Milchglasglocke wieder aufsetzte. Sie kannten diese Technik eines längst verrauschten Jahrhunderts nicht mehr. Nach ihrer Erfahrung machte man Licht, indem man einfach einen Schalter von links nach rechts schnappen ließ.
Die Lampe brannte mit einem milden Licht. Obwohl der große Rundbrenner wohl an 25 Kerzen liefern mochte, war der Lampenschein im hellen Sonnenlicht kaum zu sehen.
»Um so besser wird sie in dem dunklen Kraterschacht leuchten«, meinte der Professor lächelnd, während der Kranausleger um einen rechten Winkel schwenkte. Zwanzig Meter von ihnen entfernt hing die Lampe jetzt über dem Schacht. Langsam ließ Hansen die Kranleine auslaufen.
»Vorsichtig ... recht langsam!« rief ihnen Professor Eggerth zu. »Wir wissen nicht, wie die Kraterwand verläuft.«
In Gesellschaft seines Sohnes ging er selbst etwa hundert Meter auf dem Kamm des Ringgebirges weiter, bis er zu einer Stelle kam, wo er dicht an den Kraterrand herantreten und den Weg der in die Tiefe sinkenden Lampe verfolgen konnte. Die hatte den von den Sonnenstrahlen erhellten Teil des Schachtes bereits verlassen. Wie eine leuchtende Kugel erglänzte sie in dem darunterliegenden Dunkel.
Hein Eggerth mußte laut auflachen. »Eigentlich eine komische Idee, Vater, die Luft in einem Bolidenkrater mit einer alten Petroleumlampe auf ihre Brauchbarkeit zu untersuchen.«
»Aber noch längst nicht die schlechteste Methode, mein lieber Junge. Im allgemeinen gilt noch immer der alte Satz, daß da, wo eine Petroleumlampe zu brennen vermag, ein Mensch auch atmen und leben kann ...«, der Professor brach jäh ab. »Halt! Stopp!« schrie er zu Hansen hinüber und winkte ihm. Die Lampe befand sich dicht über dem Kraterboden. Ein Glitzern und Funkeln unter ihr verriet, daß der Kratergrund aus blankem Erz bestand.
»Langsam hissen!« kommandierte Professor Eggerth weiter, während er zu der alten Stelle zurückkehrte.
Klar brennend kam die Lampe wieder zutage, wurde gelöscht und vorläufig beiseitegelegt.
»Atembare Luft bis zum Kratergrund vorhanden, die Temperatur dort beträgt 38 Grad Celsius«, faßte der Professor sein Urteil nach einem Blick auf das Meßinstrument zusammen.
»Jetzt ad drei. Wer will als erster den Abstieg riskieren?«
»Ich!« »Ich!« »Ich!« scholl es ihm dreifach entgegen.
Jeder wollte der erste sein, keiner wollte dem andern den Vortritt gönnen.
Eine kurze Weile sah der Professor sich den Streit mit an, denn entschied er kurzerhand: »Wir werden losen, dann kann sich keiner von Ihnen benachteiligt fühlen.« Drei Streichhölzer, die er auf verschiedene Länge gebrochen hatte, hielt er seinen Mitarbeitern mit den Köpfen hin. Sie griffen danach; Hein Eggerth zog das längste Holz und hatte damit das Anrecht gewonnen, als erster den Abstieg zu machen.
Die Vorbereitungen dazu wurden getroffen. ›St 10‹ schob sich so
dicht an den Kraterrand heran, wie es eben möglich war. Eine Winde zog aus
dem Schiffsrumpf eine aus kräftigem Stahldrahtseil geflochtene Leiter heraus
und ließ sie in den Krater hinabgleiten. Der Kran fuhr dicht an die Leiter
heran. An seinem Ausleger hing jetzt ein starker Scheinwerfer, dessen
Lichtkugel die Tiefe um die Leiter herum bis zum Grund erhellte.
»Na, denn wollen wir mal!« rief Hein lustig und schickte sich an, zu der Strickleiter zu gehen.
»Nicht so fix, mein Junge!« hielt ihn der Professor zurück, und Hein mußte sich anseilen lassen. Das Seil, das sie ihm um die Brust schlangen, enthielt ein Telephonkabel. Kopfhörer wurden ihm über die Ohren geschoben, ein Mikrophon hing dicht vor seinem Mund.
Telephon und Mikrophon der Gegenstation nahm der Professor selbst, Berkoff und Hansen wurden beordert, das Seil zu halten und nur Schritt für Schritt auszulassen.
Dann begann der Abstieg. Wie sein Vater es gewünscht hatte, gab Hein, während er Stufe um Stufe hinabkletterte, ununterbrochen durch das Mikrophon Bericht nach oben. Sein Weg war nicht ganz einfach. Je dreißig Zentimeter waren die Sprossen der Leiter voneinander entfernt, über 730 Sprossen hatte er hinabzusteigen, bis er endlich in einer Tiefe von 220 Metern auf festem Grund stand. Etwa eine Viertelstunde hatte die Kraxelei gedauert.
»Es ist schandbar heiß hier unten«, meldete er nach oben. »Ich schwitze wie ein Braten, aber sonst ist's ganz gemütlich. Die Luft gut atembar. Der Boden besteht, soweit ich sehen kann, aus gediegenem Erz.«
»Davon werden wir uns später selber überzeugen. Im Augenblick ist es mir wichtig, daß du ohne Beschwerden atmen kannst und dich wohl befindest.«
»Ist unbedingt der Fall, Vater. Ich hätte jetzt Lust, eine kleine Expedition quer durch den Krater bis zur anderen Seite zu machen. Dazu müßtet ihr mir aber kräftig Seil nachlassen.«
»Warte damit, Hein, bis ich unten bin, ich werde jetzt Hansen das Telephon geben.«
Einen Augenblick herrschte Ruhe in der Leitung, dann vernahm Hein Eggerth die Stimme Hansens aus dem Kopfhörer, der alle möglichen und unmöglichen Einzelheiten über den Aufenthalt dort unten von ihm wissen wollte.
Er unterbrach den Fragestrom mit einer Gegenfrage.
»Warum kommt nicht lieber einer von euch herunter? Für meinen alten Herrn wird der Abstieg über die Leiter etwas anstrengend sein.«
Er hörte, wie Hansen am andern Ende der Leitung lachte, und in das Lachen mischte sich Motorengedröhn. ›St 9‹ schob sich an seiner Hubschraube hängend langsam vorwärts, bis es mitten über dem Krater stand. Dann sank das Schiff wie ein fallendes Blatt allmählich nach unten, bis es sanft auf dem Kraterboden aufsetzte. Der Professor kletterte heraus und eilte auf seinen Sohn zu.
»So, mein lieber Junge, jetzt können wir die von dir geplante Expedition antreten.«
Er löste das Hein um die Brust geknotete Seil und rief Hansen durch das Mikrophon ein paar Verhaltungsmaßregeln zu. Die beiden dort oben, Berkoff und Hansen, sollten für etwa eine Stunde ruhig auf sie warten.
Die Scheinwerfer von ›St 9‹ wurden so gedreht, daß sie einen breiten Lichtkegel über den Kraterboden bis zur gegenüberliegenden Wand warfen. Im Schein dieser mächtigen Lichtquellen wanderte Professor Eggerth mit Hein über ein Erzfeld, das in tausend Reflexen glänzend ihre Augen oft blendete. Aus dem gleichen schimmernden Sternenstoff schien der ganze Kraterboden zu bestehen, von dem sie bereits früher Proben nach Bitterfeld mitgenommen hatten. Je weiter sie kamen, desto befriedigter blickte Professor Eggerth um sich, obwohl auch ihm bei dem Spaziergang in dieser Backofentemperatur der Schweiß aus allen Poren brach.
Dann standen sie wieder am Ausgangspunkt ihrer Wanderung, und Professor Eggerth beorderte durch das Telephon jetzt auch Berkoff und Hansen nach unten. Auf der Leiter kletterten die beiden in die Tiefe, und dann begann eine Arbeit, zu der Professor Eggerth eine Planskizze vorlegte. An 200 über den Kraterboden gleichmäßig verteilten Stellen sollten Erzproben genommen werden. Im ersten Augenblick erschien die Aufgabe unüberwindlich groß, aber der alte Eggerth hatte sich dafür ein Verfahren zurechtgelegt, das sie wesentlich vereinfachte. Jeder mit einer kräftigen Elektrobohrmaschine ausgerüstet, machten die vier sich an das Werk. Für den Zweck, den der Professor dabei im Auge hatte, genügte es, mit einem halbzölligen Spiralbohrer etwa eine Handbreit in das Erz hineinzubohren und die dabei entstehenden Späne in ein Glasröhrchen zu schütten, dies zu verkorken und mit der entsprechenden von der Planskizze angegebenen Nummer zu versehen.
Fünfzig Proben hatte jeder zu nehmen. In vier Stunden war die ganze Arbeit getan, aber es waren doch anstrengende Stunden. Keiner von ihnen hatte einen trockenen Faden mehr am Leibe, als sie in das Schiff kletterten und ›St 9‹ wieder nach oben schwebte.
»Vor den Kampfpreis haben die Götter den Schweiß gesetzt«, sagte Berkoff halb lachend, halb seufzend, während er 200 Glasröhren sorgsam in einem Schrank des Mittelraums verwahrte.
»Und einen Durst habe ich«, stöhnte Hansen, während er, ohne abzusetzen, eine Literflasche Mineralwasser austrank.
»Über Mangel an Appetit kann ich mich auch nicht beklagen«, fügte Hein Eggerth hinzu. »Ich glaube, wir haben seit acht Stunden nicht mehr gegessen.«
»Erst umziehen und dann essen«, kommandierte der Professor. »Wir wollen uns keinen Schnupfen holen.«
Bald saßen sie gemütlich im Mittelraum von ›St 9‹ zusammen und
taten einem aus den Schiffsvorräten schnell zusammengestellten Mahl alle Ehre
an.
»Dies Huhn mit Curry-Reis ist prima, prima«, meinte Hansen, vergnüglich kauend, und warf dabei einen Blick auf den Wandkalender.
»Herrschaften, wie wird mir denn?« rief er und ließ Messer und Gabel sinken. »Wir schreiben ja schon den 25. Dezember, morgens drei Uhr nach Greenwichzeit. Den Heiligen Abend haben wir ja richtig über unsrer Bohrerei da unten vertrödelt.«
»Wir wollen sagen, übersehen«, verbesserte ihn der Professor. »Im übrigen steht nichts im Wege, mein lieber Hansen, daß Sie jetzt noch einen Punsch brauen und das Versäumte nachholen.«
»Wird gemacht, soll sofort bestens besorgt werden«, sagte Hansen und lief zum Vorratsraum, um das Notwendigste zu holen.
»Aber bitte den Punsch nicht zu stark, Herr Hansen«, rief ihm der Professor lachend nach. »Sie müssen mir ›St 8‹ heil nach Bitterfeld bringen.«
Dann dampften die Punschgläser auf dem Tisch und klangen zusammen. Sie stießen an auf die ferne Heimat und feierten in der Antarktis ein deutsches Weihnachten. Den Reden, die dabei gehalten wurden, fehlte es weder an Stoff noch an Schwung. Waren sie doch alle von dem Gefühl durchdrungen, daß ein neues gewaltiges Unternehmen von unabsehbarer Tragweite unter ihren Händen entstehen sollte.
Um die siebente Morgenstunde hob der Professor die Tafel auf.
»In die Kojen, Herrschaften! Wir sind alle übernächtig. Erst mal acht Stunden Schlaf. Dann geht's mit Volldampf nach Deutschland zurück.«
Die ›City of Baltimore‹ auf der Rückreise von Hamburg nach New York verließ die Reede von Southampton und lief auf Westkurs der Kanalmündung und dem Atlantischen Ozean entgegen. Zu ihren Passagieren gehörte Mr. Haynes. Nach mehrjährigem Aufenthalt in Deutschland hegte der Vertreter der American associated Press den Wunsch, wieder einmal die gesegnete Luft der Vereinigten Staaten zu atmen. Unter den Amerikanern, die in Southampton auf das Schiff kamen, hatte er einen alten Bekannten entdeckt, Mr. James Garrison, der in der großen kalifornischen Sternwarte in Pasadena tätig war und von einer englischen Studienreise nach den Staaten zurückkehrte.
Nach der Mittagsmahlzeit—sie war so gut und reichlich, wie es auf den großen atlantischen Dampfern üblich ist—zog Mr. Haynes sich seinen flauschigen Ulster über, um durch einen tüchtigen Spaziergang allen Folgen der üppigen Verpflegung entgegenzuwirken. Er beabsichtigte, vierzigmal um das Oberdeck herumzumarschieren. Das bedeutete eine Promenade von vier Seemeilen, nach deren Erledigung er getrost dem Supper entgegensehen konnte.
Nach der zwanzigsten Runde gesellte sich Mr. Garrison zu ihm, und ein Gespräch kam in Gang. Wie jede amerikanische Unterhaltung begann es mit dem Wetter, um dann der ›City of Baltimore‹ voraus nach Westen zu eilen. Von dem kalifornischen Paradies um Pasadena schwärmte Garrison, von New York, der Empire City, sprach Haynes. Ein scharfer Westwind blies ihnen entgegen, als sie wieder nach vorn marschierten.
Unwillkürlich steckte Haynes seine Hände tiefer in die Manteltaschen, da spürte seine Rechte etwas Hartes, Schweres. Er zog die Hand heraus und hielt ein glitzerndes Stückchen Metall von der Größe einer Haselnuß etwa zwischen den Fingern.
»Oh, Mr. Haynes, was haben Sie da?« fragte ihn Garrison interessiert.
Einen Augenblick mußte Haynes sich besinnen, dann erinnerte er sich wieder, wie er zu dem Brocken gekommen war.
»Ein Andenken aus der Antarktis, wie ich vermute, Mr. Garrison.«
»Aus der Antarktis? Wie kommen Sie dazu?«
Haynes erzählte ihm, wie er vor Monaten in Bitterfeld war, um die Ankunft der Eggerthschen Stratosphärenschiffe abzuwarten, und wie er bei der Gelegenheit das Stückchen im Laderaum des Flugschiffes fand und unbemerkt in die Tasche steckte.
»Ein reiner Zufall, daß ich es jetzt wieder entdeckte«, schloß er seinen Bericht, »ich habe diesen Mantel seit Monaten nicht mehr getragen. Das Stück muß irgendwie aus der Station eines gewissen Dr. Wille am magnetischen Südpol stammen. Sie haben vielleicht von dem Mann und von seinem Unternehmen gehört.«
Garrison nickte. »O ja, gewiß! Schade, daß Dr. Wille kein Amerikaner ist. Er ist eine Kapazität auf dem Gebiet der Geophysik. Nur sein Assistent, ein Dr. Schmidt, könnte ihm darin noch über sein. Man interessiert sich in Pasadena sehr für die Arbeiten der beiden ... dies Mineral ... merkwürdig, recht merkwürdig.«
Während Garrison die letzten Worte sprach, nahm er Haynes das Stückchen Erz aus der Hand und wog es prüfend mit den Fingern.
»Was soll daran merkwürdig sein?« fragte Haynes. »Das nichtswürdige Zeug hat mir das ganze Taschenfutter zerrissen. Werfen Sie es doch einfach über Bord.«
Garrison schüttelte den Kopf. »Würden Sie mir das Stück überlassen? Ich möchte es in Pasadena gern genauer untersuchen.«
»Herzlich gern, wenn ich Ihnen damit einen Gefallen tun kann.«
»Besten Dank, Mr. Haynes. Sie meinen, das Stück stammt aus der deutschen Station?«
»Nach meiner festen Überzeugung, ja! Das Stratosphärenschiff hatte allerlei Ausrüstungsgegenstände dorthin gebracht und anderes Material, das nicht mehr benötigt wurde, zurückgeholt. Da muß der Brocken wohl irgendwie mit in das Schiff gekommen sein. Sonst könnte er nur aus den Eggerth-Werken in Bitterfeld stammen.«
Mr. Garrison wickelte die Erzprobe in ein Stück Zeitung und versenkte sie in seine Brusttasche.
»Well, Mr. Haynes, ich bin Ihnen sehr verbunden. Aber es wird mir hier oben doch zu frisch. Ich werde in meine Kabine gehen. Kommen Sie mit unter Deck?«
Haynes sah nach der Uhr.
»Noch nicht, Mr. Garrison. Habe noch sechs Runden zu machen. Ist unbedingt nötig!«
»All right«, nickte Garrison und wandte sich zur Treppe. Haynes trabte allein weiter, um sein Pensum zu erledigen.
Vier Tage später landete die ›City of Baltimore‹ im Hafen von
New York. Mr. Haynes stürzte sich in den solange entbehrten Trubel der Empire
City, Mr. Garrison fuhr noch am gleichen Tage nach Kalifornien weiter. In
seinem Koffer lag ein Stückchen jenes blinkenden Sternenstoffes, der vor
einigen Monaten in der Antarktis vom Himmel gefallen war.
Der Betrieb in der antarktischen Station lief in der alten Weise weiter. Wohl blieb die Sonne jetzt ständig über dem Horizont, auf die lange Polarnacht war der ebenso lange Polartag gefolgt. Doch öde und leer blieb das verschneite Land umher. Von den endlosen Vogelschwärmen, die wenige hundert Kilometer nordwärts im Licht des neuen Tages die Küsten belebten, war hier nichts mehr zu merken. Nach wie vor blieben die fünf Insassen der Station in der ungeheuren Einsamkeit auf sich selbst angewiesen, und es war gut für sie, daß sie durch ihre Tätigkeit voll in Anspruch genommen und von gefährlichen Grübeleien abgehalten wurden.
Da mag an erster Stelle Rudi Wille genannt werden. Dem hatte der Weihnachtsmann Wolf Hansen eine Kiste unter den Baum gestellt, von der nach Lorenzens sachverständigem Urteil ein mittlerer Radioladen zwei Jahre leben konnte, und Rudi wußte dies Geschenk zu würdigen. Unter seinen geschickten Händen entstand aus den Einzelteilen im Laufe weniger Wochen ein Meisterstück von einem Kurzwellensender und ein Empfänger gleicher Qualität, mit denen er nun unabhängig von den Geräten der Station den lieben langen Tag im Äther spazierengehen konnte.
Auch Lorenzen hatte sich nicht über Mangel an Beschäftigung zu beklagen, denn der Funkverkehr der Station nahm einen bemerkenswerten Aufschwung. Da waren nicht nur die Eggerth-Werke, die jetzt fast täglich einen längeren Meinungsaustausch mit Dr. Wille pflogen. Auch die deutschen wissenschaftlichen Institute meldeten sich immer häufiger, und der brave Lorenzen hatte stundenlang zu tun, um die endlosen Zahlentabellen, die der lange Schmidt ihm auf den Tisch legte, an die erdmagnetische Warte in Potsdam zu funken. Und dann meldeten sich auch die Amerikaner.
In der zweiten Februarwoche fing Rudi mit seinem neuen Apparat einen Anruf der Sternwarte von Pasadena auf, den er pflichtgemäß an Lorenzen weitergab, und nach kurzem Hin und Her entwickelte sich daraus ein Funkverkehr, der demjenigen nach Deutschland bald nicht mehr nachstand.
Die Herren Schmidt und Wille nahmen die amerikanische Korrespondenz mit gemischten Gefühlen auf. Dr. Wille, weil er gerade zu dieser Zeit andere wissenschaftliche Sorgen hatte, der lange Schmidt, weil er grundsätzlich mit seinen Forschungsergebnissen zurückhielt. Nach seiner Meinung sollten die reichen Amerikaner gefälligst selber eine Expedition ausrüsten, wenn sie Genaueres über die magnetischen Verhältnisse in der Antarktis wissen wollten. Sobald seine Telegramme nach Pasadena über trockenes Zahlenmaterial hinausgingen, leuchtete dieser Standpunkt unverhüllt aus ihnen hervor.
Vergeblich versuchte Dr. Wille dem Einhalt zu tun. »Sie werden so lange machen, Schmidt«, sagte er ärgerlich, »bis die Amerikaner wirklich herkommen, und dann ...« »... sind sie hier«, vollendete Schmidt den Satz.
Dr. Wille schlug mit der Faust auf den Tisch.
»Jawohl, Herr Dr. Schmidt, sehr richtig! Dann sind sie da, und dann haben wir den Salat. Vielleicht gerade jetzt, wo wir sie am wenigsten brauchen können.«—
Die gereizte Stimmung Dr. Willes hatte ihren guten Grund. Je weiter die Zeit verstrich, um so weniger stimmten die Beobachtungen mit seinen Theorien überein, und hartnäckig verschloß er sich den Gründen, die Schmidt dafür anführte. Für den war die Frage längst geklärt. Der magnetische Südpol, auf einer säkularen Wanderung begriffen, befand sich nicht mehr an der Stelle, an der Shackleton ihn vor Jahrzehnten einmal festgestellt hatte. Seine Verschiebung mußte aber logischerweise auch den Strom der Sonnenelektronen mit sich ziehen und die Erscheinungen, die Dr. Wille nach seiner Theorie erwartete, sehr merklich beeinflussen.
Mr. Garrison in der deutschen Station. Rudis »Klamottenkiste«. Garrison als Prospektor. Professor Eggerth bei Exzellenz Schröter. Eine Million im Laboratorium. Georg Berkoff blufft Garrison. Der Sturz in die Schneekuhle. Ein Funkspruch geht nach Deutschland.
Dr. Wille experimentierte auf dem Hof mit den neuen Kondensatoren. Dr. Schmidt stand neben ihm, seinen Chronometer in der Hand, und machte ein Gesicht, bei dessen Anblick, wie Hagemann sich ausdrückte, die Milch sauer werden mußte. Krachend schlug gerade ein Kondensatorenfunke über. Der lange dürre Schmidt, die Augen starr auf die Uhr gerichtet, kniff die Lippen noch fester zusammen.
»Was haben Sie denn, Schmidt?« fuhr ihn Wille unwirsch an. »Die Sache funktioniert doch.«
»Nicht schnell genug, Herr Wille. Wir sind hier nicht an der richtigen Stelle.«
»Ja, in drei Teufels Namen, was sollten wir denn nach Ihrer Meinung tun?«
»Mit unsern Magnetometern auf die Suche gehen, Herr Wille, bis wir den Punkt finden, an dem die magnetischen Kraftlinien genau senkrecht in den Erdball eintreten.«
Dr. Wille richtete sich auf und blickte in die Runde über das weite Schneefeld.
»Netter Vorschlag von Ihnen! In dieser Schneewüste auf die Suche gehen, bis wir den Punkt finden ... wo vermuten Sie ihn denn ungefähr?«
Dr. Schmidt zuckte die Achseln.
»Ist schwer zu sagen, Herr Wille. Wahrscheinlich weiter südlich, vielleicht auch ein paar hundert Kilometer nach Osten oder Westen verschoben. Man müßte versuchsweise nach Süden wandern und dabei ständig die Inklination messen. Dann würden wir den Punkt schon finden.«
Dr. Wille hüllte sich fester in seinen Pelz. »Ein schauderhafter Gedanke, Schmidt, Hunderte von Kilometern durch die Schneewüste zu ziehen. Nachts im Zelt kampieren ... man friert bei dem Gedanken daran ...«
»Die Eggerth-Werke müßten uns natürlich einen großen guten Kraftwagen schicken«, unterbrach ihn Schmidt. »Der Wagen müßte in allen Teilen aus unmagnetischen Stoffen bestehen, so daß man zuverlässige Messungen im Wageninneren vornehmen kann, und man müßte auch bequem darin schlafen können. Dann läßt sich die Sache schnell erledigen.«
»Und nachher müßten wir mit unserer ganzen Station nach diesem Punkt übersiedeln, nicht wahr, Herr Schmidt? Das ist doch Ihrer Rede Sinn? Würden Sie mir vielleicht verraten, wer den Umzug bezahlen soll?«
Über die hölzernen Züge Schmidts glitt ein verunglücktes Lächeln.
»Die Eggerth-Werke natürlich, Herr Wille. Sie erbieten sich ja in ihren Funksprüchen fast täglich dazu.« Er griff in seinen Pelz und zog ein zerknittertes Telegramm hervor.
»Hier, da haben Sie eine Depesche von vorgestern. Professor Eggerth ist der Meinung, daß wir achthundert Kilometer südlich viel bessere Arbeitsverhältnisse haben würden.«
Dr. Wille warf ärgerlich den Kopf zurück.
»Was versteht der Professor von Geophysik? Der Mann soll seine Flugzeuge bauen und sich um seinen eigenen Kram kümmern.«
»Seien Sie nicht undankbar, Herr Dr. Wille«, unterbrach ihn Schmidt in schärferem Tone. »Ohne die Unterstützung von Professor Eggerth wären wir nicht hier.« Bei den letzten Worten wollte er zum sich Gehen wenden, und Dr. Wille hielt es für geboten einzulenken.
Sie standen bei den Apparaten immer noch in ihren Disput verwickelt, als Rudi über den Hof gelaufen kam. Schon von weitem schwenkte er ein Stück Papier.
»Wir bekommen Besuchs Vater, ein Funkspruch von einem Mr. Garrison von der Sternwarte in Pasadena. In einer Stunde gedenkt er hier zu landen.«
»Da haben Sie die Bescherung, Schmidt«, knurrte Dr. Wille und stopfte das Telegramm wütend in seinen Pelz. »Der Yankee wird hier bei uns schnüffeln, und dann wird sich die amerikanische Konkurrenz auf den besten Platz setzen.«
»Darin müssen wir ihr eben zuvorkommen«, wollte Schmidt den alten Streit von neuem beginnen, aber Dr. Wille mochte im Augenblick nichts mehr davon hören. Begleitet von Rudi ging er zur Funkstation, um weitere Nachrichten von dem amerikanischen Flugschiff zu hören.
»Pünktlich ist der Yankee«, brummte Wille vor sich hin, als 55 Minuten nach
dem Empfang des ersten Funkgespräches ein Flugzeug am nördlichen Horizont
sichtbar wurde und schnell näher kam. Es war eine gute englische Maschine,
aber mit den ultraschnellen Stratosphärenschiffen der Eggerth-Werke durfte
man sie natürlich nicht in einem Atem nennen. Mr. Garrison war mit der großen
amerikanisch-australischen Luftlinie von Pasadena nach Melbourne gekommen und
hatte die Maschine dort für den Flug nach der deutschen Südpolstation
gechartet. Bis dorthin waren es von Melbourne noch reichlich 4000 Kilometer,
und nur auf die bindende Zusicherung hin, daß in der deutschen Station neuer
Treibstoff genommen werden könne, hatte der Eigentümer der Maschine sich zu
dem Flug bereit finden lassen.
Über eine Hubschraube, die ein sicheres Starten und Landen auf jedem Gelände gestattete, verfügte das englische Flugzeug nicht. Auf der Ausschau nach einer Landungsmöglichkeit kreiste es jetzt über der Station. Hagemann lief ins Freie und steckte einige Wimpel aus, um eine dafür geeignete Stelle zu bezeichnen, während Lorenzen dem englischen Piloten durch Funkspruch Anweisung gab. Dann kam es im Gleitflug herunter und rollte ohne Unfall aus. Als einziger Passagier kletterte Mr. Garrison heraus und stapfte durch den hohen Schnee auf Wille und Schmidt zu.
Die Begrüßung war beinahe so, wie zwischen alten Bekannten, denn obwohl der Amerikaner die beiden Deutschen noch niemals von Angesicht zu Angesicht gesehen hatte, war er doch über ihre wissenschaftlichen Leistungen genau unterrichtet und ließ das gleich in den ersten Worten durchblicken. Schon während sie von der Landungsstelle her auf das Haus zuschritten, kam eine lebhafte Unterhaltung in Gang, für welche die letzten Arbeiten in der antarktischen Station den Stoff abgaben, und Dr. Willes schlechte Laune verschwand dabei zusehends. Ohne lange Vorrede lud er Mr. Garrison zunächst einmal zu einem kräftigen Imbiß ein.
Gemütlich saßen sie zu dritt in Dr. Willes wohlig durchwärmtem Arbeitszimmer,
das des öfteren als Speiseraum dienen mußte, und taten den Dingen, die der
kochgewandte Hagemann vor ihnen aufbaute, alle Ehre an. Die wissenschaftliche
Unterhaltung nahm dabei ihren Fortgang, und bald war Mr. Garrison mit dem
allezeit streitlustigen Dr. Schmidt in eine lebhafte Debatte über gewisse
magnetische Theorien verwickelt, während Dr. Wille diesmal die Rolle des
vergnügten Dritten spielen konnte.
Wer weiß, wie lange sich dieser Meinungsaustausch noch hingezogen hätte, wenn Hagemann nicht mit einer Meldung ins Zimmer gekommen wäre.
»Herr Doktor, der englische Pilot hat Treibstoff genommen, er will wieder starten.«
Die Nachricht rief die drei Gelehrten mit jähem Ruck aus der Welt wissenschaftlicher Ideen in die rauhe Wirklichkeit zurück. Garrison sprang auf und griff sich verwirrt an die Stirn.
»Haben Sie mit dem Mann keine Abmachungen wegen des Rückfluges getroffen?« fragte sachlich und trocken wie immer der lange Schmidt.
Garrison mußte bekennen, daß er es versäumt hatte. Er hatte nur einen Flug von Melbourne nach der deutschen Station mit dem Engländer abgemacht und vor dem Start bezahlt.
»Dann ist der Pilot formell in seinem Recht«, entschied Schmidt.
»Aber das ist unmöglich! Ich muß über den Rückflug mit ihm verhandeln«, rief Garrison und wollte das Zimmer verlassen. Wille hielt ihn zurück.
»Sie sind unser Gast, Mr. Garrison. Solange es Ihnen bei uns gefällt. Lassen Sie den Engländer in Gottesnamen abschweben.«
»Besten Dank für Ihre Einladung, Doktor. Aber wie komme ich später von hier wieder fort?«
Dr. Wille lachte.
»Haben Sie schon mal was von Eggerthschen Stratosphärenschiffen gehört?«
Der Amerikaner nickte. »O ja, Dr. Wille, sie fliegen bei uns auf der Strecke Frisko—Neu-York.«
»Nun, bisweilen verirrt sich auch eins zu uns, Mr. Garrison. Auf ein paar Tage mehr oder weniger kommt es Ihnen doch hoffentlich nicht an. Wir freuen uns, nach langer Einsamkeit einen Gast bei uns zu haben.«
Noch bevor Garrison etwas erwidern konnte, klang von draußen her Motorgeräusch. Der englische Pilot startete bereits, und wohl oder übel mußte Garrison die Einladung Dr. Willes annehmen.
Wie im Fluge verstrichen die nächsten Tage. Mit Interesse verfolgte Garrison
Willes Experimente mit den Kondensatoren und Elektronenröhren und gab
gelegentlich Ratschläge, die von Sachkenntnis zeugten. Stundenlang
diskutierte er mit Schmidt über wissenschaftliche Zukunftsmöglichkeiten und
brachte den biederen Doktor durch die Voraussetzungslosigkeit seiner Annahmen
öfter als einmal zu heller Verzweiflung.
Aber auch mit den übrigen Mitgliedern der Station hatte er sich angefreundet. Mit Hagemann beriet er sehr gründlich und tiefsinnig die Herstellung gewisser mixed drinks. In der Funkerbude war er ein häufiger Gast und bediente im Verkehr mit Pasadena selber die Morsetaste und auch mit dem jüngsten der kleinen Gemeinschaft, mit Rudi Wille, hatte er schnell Freundschaft geschlossen und kümmerte sich um alles, was der tat und trieb.
»Ein verrückter Kerl ist der Yankee doch«, sagte Dr. Wille zu Schmidt. »Heut morgen traf ich ihn weiß Gott über Rudis Klamottenkiste.«
Selbst der ernste Schmidt konnte seine Heiterkeit nicht verbergen, als dies Wort fiel.
Die ›Klamottenkiste‹, wie Dr. Wille sagte, die Mineraliensammlung, wie Rudi das Ding hochtrabend nannte, gab dem Vater ständigen Anlaß zu sarkastischen Bemerkungen, während der Sohn sie mit dem Eifer des Sammlers hegte und pflegte.
Ein paar besonders schön schimmernde Quarz- und Granitstückchen, die Rudi an schneefreien Stellen in der Umgebung der Station fand, hatten den ersten Anstoß dazu gegeben, und dann war der Junge von der Sammelwut gepackt worden. Wo immer er ein Steinstückchen oder einen Mineralbrocken entdeckte, nahm er ihn mit. Bald reichte ein Pappkarton nicht mehr aus, erst ein Kasten und schließlich eine große Kiste, in der ›St 8‹ einmal hundert Büchsen condensed Milk nach der Station gebracht hatte, wurde nötig, um die Sammlung aufzunehmen. Als der lange Polartag anbrach, unternahm Rudi immer ausgedehntere Wanderungen und kehrte jedesmal mit vollen Taschen zurück. Schon war die erste Kiste ziemlich gefüllt, die Inbetriebnahme einer zweiten nur noch eine Frage der Zeit.
Bei den Mitgliedern der Station fand Rudi wenig Verständnis für seinen Sammelsport. Um so erfreuter war er, als Mr. Garrison sofort Interesse dafür zeigte, als er auch nur andeutungsweise von der Existenz dieser Sammlung hörte. Da hatte Rudi endlich einen Menschen gefunden, der auf seine Pläne einging und mit ihm zusammen in den Schätzen der verpönten Kiste kramte. Und das Schöne dabei war, daß Mr. Garrison offensichtlich über mineralogische Kenntnisse verfügte und auch wußte, wie man eine solche Sammlung wissenschaftlich anlegen und ordnen mußte.
»Den Fundort und das Datum des Fundes, Master Wille. Das ist sehr wichtig«, sagte Garrison, während er ein Stück schweren schimmernden Erzes in der Hand wog. »Das müssen Sie bei jedem Fund auf einer Etikette notieren und dann auf das Stück kleben, dieser Brocken hier zum Beispiel ... man müßte wissen, wo und wann Sie den gefunden haben?«
Rudi dachte einen Augenblick nach. »Das kann ich Ihnen ziemlich genau sagen, Mr. Garrison. Das Stück habe ich erst vor drei Tagen mitgebracht. Ich fand es ziemlich genau fünf Kilometer südlich von unserer Station.«
Mr. Garrison schien sich von dem Erzbrocken nicht trennen zu können. Noch immer hielt er ihn in der Hand.
»Ein merkwürdiges Mineral, Master Wille. Mehr von der Sorte haben Sie nicht entdeckt?«
Rudi schüttelte den Kopf. »Nein, Mr. Garrison, es war reiner Zufall, daß ich dies Stück fand. Es lag unter dem Schnee, und ich stieß mit dem Fuß dagegen. Möglich, daß sich mehr davon finden läßt, wenn ein ordentlicher Sturm dort mal den Schnee wegfegt.«
Zwei Tage nach diesem Gespräch lieh sich Garrison einen tüchtigen Pelz von
Dr. Wille, um in Gesellschaft Rudis einen größeren Spaziergang zu
unternehmen. Der Amerikaner schlug die Richtung nach Süden ein und schritt so
kräftig aus, daß Rudi fast Mühe hatte, ihm zu folgen. Endlos dehnte sich die
weite, weiße Ebene vor ihnen, nur hin und wieder von dunklen Stellen
unterbrochen, wo der scharfe Nordwind der letzten Tage den Schnee
fortgeblasen hatte.
Schon eine Stunde waren sie marschiert. Rudi zog den Amerikaner am Ärmel.
»Wir dürfen uns nicht zu weit von der Station fortwagen, sonst finden wir nicht wieder zurück.«
Schon öfter hatte Garrison vorher zur Verwunderung Rudis auf seine Taschenuhr gesehen. Jetzt zog er sie wieder und hielt sie seinem Begleiter lachend hin.
»Sie vergessen, Master Wille, daß wir in dieser nach Ortszeit gehenden Uhr einen absolut zuverlässigen Kompaß bei uns haben. Sehen Sie hier.« Er hielt die Uhr flach vor sich, so daß der kleine Zeiger nach der Sonne wies, der Zeigerschatten genau unter dem Zeiger lag.
»Sehen Sie, so macht man das. Norden liegt dann genau in der Mitte zwischen der Zwölf und dem kleinen Zeiger. Wenn ich eine Uhr hätte, deren Stundenzeiger in 24 Stunden einen Umgang machte, wäre die Sache noch einfacher. Dann brauchte ich diesen Zeiger nur auf die Sonne zu richten und Norden läge bei der Zwölf.«
»Famose Sache!« rief Rudi begeistert. »Da können wir ja getrost noch ein Stück weitermarschieren.«
»Das wollen wir auch tun«, sagte Garrison, und sie gingen weiter. Aber bei jeder schneefreien Stelle blieb Garrison stehen, und mehr als einmal hatte er Glück bei seinem Suchen. Als sie sich nach fast drei Stunden Marsch schließlich zur Rückkehr entschlossen, trug er ein halbes Dutzend Brocken jenes so merkwürdig schweren und schimmernden Erzes im Gesamtgewicht von etwa einem Kilogramm bei sich. Daß Rudi sich die Tasche seines Pelzes mit allerlei anderm Gestein zum Bersten vollpfropfte, übersah er stillschweigend.
In der Station mußte man sich ohne die beiden an den Mittagstisch setzen.
Dafür nahm ein anderer Gast an der Mahlzeit teil, Georg Berkoff, der kurz
nach dem Aufbruch von Garrison und Rudi mit ›St 9‹ angekommen
war, um gewisse, schon seit längerer Zeit bestellte Apparate abzuliefern.
Dr. Wille war über das lange Ausbleiben seines Sohnes etwas beunruhigt, aber Schmidt zerstreute seine Bedenken mit dem Hinweis, daß Garrison schon mehr als eine Expedition in polare Gebiete mitgemacht hätte. Fast zwangsläufig kamen sie danach, trotzdem Lorenzen und Hagemann mit am Tisch saßen, auf das Thema zu sprechen, das sie schon seit Tagen bewegte, auf die Frage: Was will der Amerikaner eigentlich in unserer Station?
»Unsere magnetischen Untersuchungen scheinen ihm ziemlich gleichgültig zu sein«, meinte Schmidt.
»Nach seinen bisherigen Äußerungen scheint man auch in den Vereinigten Staaten nicht die Absicht zu haben, eine Expedition in die Antarktis zu schicken«, sagte Wille.
»Wenn er die wirkliche Absicht der Yankees nicht verschweigt und uns hinters Licht führt«, setzte Schmidt den Gedankengang fort.
Dr. Wille rieb sich nachdenklich das Kinn. »Ich verstehe nicht, was dieser Mr. Garrison neuerdings mit meinem Jungen zu kramen hat? Der lange Ausflug heute wieder ... irgendeinen Zweck und Sinn muß er doch damit verfolgen ... aber was kann das sein ... ich kann doch nicht im Ernst annehmen, daß die stümperhafte Mineraliensammlung Rudis ihn wirklich interessiert ...«
»Verzeihen, Herr Doktor, wenn ich mich in Ihr Gespräch mische«, unterbrach ihn Lorenzen, »der Amerikaner funkt auf unserer Station oft mit Pasadena ...«
»Haben Sie Depeschen gesehen?« warf Schmidt ein.
»Gesehen nicht, aber gehört. Ich kann einen Funkspruch aus dem Klappern der Morsetasten ziemlich sicher mit hören ...«
»Und was haben Sie da gehört?« fragte Berkoff interessiert.
»Er funkt natürlich in englischer Sprache, Herr Berkoff. Aber ich konnte heraushören, daß von Erz, von Gold und Silber etwas vorkam. Dann einmal ›high weight‹, heißt meines Wissens hohes Gewicht. Das war mir nicht ganz verständlich. Man sagt englisch doch besser heavy weight ...«
»Er meinte spezifisches Gewicht«, raunte Schmidt Dr. Wille zu.
Berkoff preßte die Serviette in seiner Rechten zusammen, daß seine Knöchel weiß wurden. »Haben Sie noch mehr gehört, Lorenzen?«
»Nicht mehr viel, Herr Berkoff. Von einem Stück Erz war noch die Rede, das er gefunden hätte, und er hoffte noch mehr zu entdecken. Ich wollte Ihnen das nur sagen. Der Amerikaner scheint mir so eine Art Prospektor zu sein, der auf irgendwelche Erzfunde aus ist.«
Schmidt und Wille sahen sich eine kurze Weile verdutzt an, dann mußten beide lachen.
»Total verrückt!« platzte Wille heraus, »in der gottverlassenen Gegend hier nach Erzen zu suchen, wo wir auf einer blanken Granitscholle sitzen. Das kriegt auch nur ein Yankee fertig. Meinen Sie nicht auch, Herr Berkoff?« fragte er immer noch lachend den Ingenieur.
»Reichlich überspannt, in der Tat«, erwiderte der, aber er lachte nicht, als er die Antwort gab.
»Kompletter Irrsinn ist es«, sagte Dr. Schmidt in einem Ton, als ob er das letzte Urteil in dieser Sache zu fällen habe. »Kompletter Irrsinn, natürlich. Aber wenn man den Mann über Sonnenelektronen reden gehört hat, kann man auch das von ihm erwarten.«
Dr. Schmidt hatte gut reden. Er wußte ja nichts von einer Analyse, die vor vier Wochen in Pasadena an einem Stückchen Erz gemacht worden war und unter anderm einen Gehalt von 10% Platin und 10% Gold ergeben hatte. Und er konnte auch nichts davon wissen, daß man in Pasadena die deutsche antarktische Station für den Fundort dieses Brockens hielt.
Der einzige am Tisch, der Zusammenhänge ahnte, wenn er sie auch noch nicht klar zu erkennen vermochte, war Berkoff. Kaum war die Mittagsmahlzeit vorüber, als er in die Funkerbude eilte und in dem Geheimkode der Eggerth-Werke einen langen Funkspruch nach Bitterfeld morste. Eine kurze Antwort hielt er in den Händen, als Rudi mit dem Amerikaner nach sechsstündiger Abwesenheit in die Station zurückkam. Aus der Chiffre in Klartext übersetzt, lautete sie: Die Spur verwischen!
Professor Eggerth war mit seinem Sohn zusammen im Privatlaboratorium, als man ihm den Funkspruch Berkoffs brachte.
»Es wird Zeit, Hein. Wir dürfen nicht länger zögern.«
Das war alles, was er sagte, nachdem er die Depesche gelesen hatte. Während Hein die Antwort des Professors verschlüsselte und zur Funkstation brachte, stand der alte Eggerth sinnend vor einem Plan, der in einer Ausdehnung von drei Metern im Quadrat die eine Wand des Laboratoriums bedeckte. Er stellte den Bolidenkrater dar. An 200 Stellen waren kleine Kreise eingezeichnet, und neben jedem Kreis stand eine Reihe von Zahlen. Es waren die Analysen der Erzproben, welche ›St 10‹ aus der Antarktis bei seinem letzten Flug nach der Antarktis aus dem Kratergrund mitgebracht hatte. Prüfend glitten seine Blicke noch einmal darüberhin. Dann zog er die Reißnägel, mit denen der Plan an der Wand befestigt war, heraus, faltete ihn zusammen und machte schließlich eine kleine Rolle daraus. Dann hatte er ein längeres telephonisches Gespräch mit Berlin.
Eine halbe Stunde später hielt sein Kraftwagen vor dem Laboratorium. Eine Rolle in der Hand, nahm Professor Eggerth in ihm Platz. Zwei mäßig große Pakete legte Hein noch in den Wagen. Noch ein kurzes Grüßen und Winken, der Wagen rollte aus dem Werk und schlug die Richtung nach Berlin ein. —
»Ich habe mich für Sie frei gemacht, mein verehrter Herr Professor, weil Sie
mir die Angelegenheit am Fernsprecher als äußerst wichtig und dringend
bezeichneten«, empfing ihn Minister Schröter in Berlin im Finanzministerium.
»Nehmen Sie bitte Platz. Ich bin bereit, Sie zu hören. Handelt es sich um
neue Auslandslinien mit Ihren Stratosphärenschiffen?«
Professor Eggerth setzte sich und begann zu sprechen. Erstaunt blickte der Minister auf, als der andere von der Antarktis und von dem Sturz eines riesenhaften Boliden erzählte, unterbrach ihn dann:
»Verzeihung, Herr Professor, das scheint mir eine rein wissenschaftliche Angelegenheit zu sein, die Sie besser im Kultusministerium vortragen. Ich verstehe nicht recht, was mein Ressort damit zu tun hat.«
»Sie werden es sofort sehen, Herr Minister. Wollen Sie die Güte haben, dies hier zu öffnen.« Während Professor Eggerth es sagte, schob er dem Finanzminister ein kleines Paket über den Tisch zu. Der griff danach, wollte es anheben und erstaunte über das hohe Gewicht. Befremdet fragte er: »Was soll das? Was ist das, Herr Professor?«
Professor Eggerth reichte ihm lächelnd eine Schere. »Keine Höllenmaschine, Herr Minister. Sie können es getrost öffnen.«
Unter leichtem Kopfschütteln zerschnitt der Minister die Schnur und schlug das Papier auseinander. Ein gelb schimmernder Metallwürfel lag vor ihm.
»Was ist das, Herr Professor?« fragte er noch einmal.
»Es ist Gold, Herr Minister. Gediegenes Gold aus dem Körper jenes Boliden, von dem ich eben sprach, und ich glaube, für Gold ist doch das Finanzministerium an erster Stelle zuständig.«
Wie gebannt blickte der Finanzminister auf den schimmernden Würfel. »Gold, gediegenes Gold?!«
Er griff mit beiden Händen danach, hob das Stück mit Mühe ein wenig empor, ließ es dann wieder auf die Tischplatte sinken.
»Schwer, Herr Professor, sehr schwer ... an die 40 Pfund schätze ich.«
»Richtig geschätzt, Herr Minister, es ist genau ein Kubikdezimeter Gold im Gewicht von 19,3 Kilogramm.«
Der Minister warf ein paar Zahlen auf ein Blatt Papier und machte eine kurze Rechnung.
»54000 Mark, Herr Professor. Das ist das Stückchen unter Brüdern wert. Dafür nimmt es Ihnen die Reichsbank sofort ab. Haben Sie noch mehr davon?«
»Hier bei mir nicht, aber in meinem Laboratorium in Bitterfeld. Ich möchte Sie bitten, mich dorthin zu begleiten, wenn wir hier fertig sind.«
»Aber das andere Paket? Sie haben ja noch eins da«, unterbrach ihn der Minister.
»Bitte sehr, Herr Minister.« Der Professor schob ihm das andere Paket auch hin. »Es stammt aus der gleichen Quelle, aber es ist kein Gold.«
»Sondern?«, rief Exzellenz Schröter, während er die Schnur zerschnitt.
Ein silbergrau blinkender Würfel kam zum Vorschein.
»Ist es Silber, Herr Professor?«
»Gediegenes Platin. Ebenfalls ein Kubikdezimeter im Gewicht von 21,5 Kilogramm.«
Nur mit Mühe vermochte der Minister diesen zweiten Würfel ein wenig anzuheben. Dann lehnte er sich in seinem Sessel zurück.
»Bitte, Herr Professor, sprechen Sie weiter. Ich bin bereit, Ihnen zuzuhören, und wenn es Abend darüber werden sollte.«
Professor Eggerth sprach, und nur selten unterbrach ihn während der nächsten Viertelstunde der Minister mit einer kurzen Zwischenfrage oder Bemerkung. Er berichtete von seinen Flügen zu dem Bolidenkrater, von den ersten Erzfunden und den Ergebnissen ihrer Verarbeitung. »Aus den ersten fünf Tonnen habe ich 400 Kilogramm reines Gold gezogen ...«
»400 Kilogramm, Herr Professor ... das ist mehr als eine Million Reichsmark Gold ... das haben Sie in Ihrem Laboratorium?«
»Allerdings, Herr Minister. Deshalb bat ich Sie, nachher mit mir zusammen nach Bitterfeld zu fahren.«
Professor Eggerth berichtete weiter. Er entfaltete dabei den großen Plan, um seine Darlegungen durch Zahlen und Analysen zu unterstützen. Eifrig half ihm der Minister, den großen Karton zu entfalten und auszubreiten. So sehr stand er im Bann von Professor Eggerths Darlegungen, daß er alle Ministerwürde darüber fallen ließ, über die Zeichnung gebeugt, folgte er dem Finger des Professors, der hier und dort auf besonders gehaltreiche Stellen des Kratergrundes hinwies.
»Durch die Analyse an Proben von 200 verschiedenen Stellen des Kratergrundes können wir uns ein ziemlich genaues Bild von der chemischen Zusammensetzung des Boliden machen«, fuhr der Professor in seinen Ausführungen fort. »Den Hauptteil des gewaltigen Meteoriten bildet zweifellos reines Nickeleisen. Es ist aber von starken gold- und platinhaltigen Adern durchsetzt, in denen der Gehalt an diesen Edelmetallen stellenweise über 10 % ansteigt.«
Und dann zog Professor Eggerth eine Berechnung hervor und verlas Zahlen über die ungefähre Gesamtmasse des Boliden und den mutmaßlichen Gehalt an Gold und Platin. Der Minister sprang auf und griff sich an den Kopf.
»Halten Sie ein, Herr Professor, mir schwindelt bei Ihren Zahlen. Trifft auch nur ein Bruchteil Ihrer Annahmen zu, so steht Deutschland vor einem Ereignis, das sein Wirtschaftsleben auf Menschenalter hinaus beeinflussen muß. Natürlich kann ich selbst in einer Angelegenheit von derartiger Tragweite keine Entscheidung treffen. Das wird später Sache des gesamten Kabinetts sein. Jetzt werde ich mit Ihnen fahren, ich möchte selbst die Schätze sehen, die Sie in Ihrem Laboratorium haben.«
Er griff zum Telephon, führte noch ein kurzes Gespräch und ging dann mit Professor Eggerth zusammen zu dessen Wagen. Während das Gefährt über die Landstraße dahinrollte, nahm die Unterredung der beiden Herren ihren Fortgang. Professor Eggerth setzte dem Minister auseinander, wie er sich die weitere Aktion dachte. Kühn und gewaltig erschien diesem der Plan, allzu kühn bisweilen, doch als der Wagen nach zweistündiger Fahrt in das Bitterfelder Werk einfuhr, war der Minister bereits für die neuen Ideen gewonnen.
Dann standen sie zusammen in dem Laboratorium. Ein Schaltergriff—und
Starklicht flutete durch den Raum. Einen einfachen grünen Vorhang zog der
Professor zur Seite, und es glänzte und gleißte dem Minister in goldigem und
platingrauem Schimmer entgegen. Dutzende der kleinen Würfel, wie er deren
zwei in seinem Arbeitszimmer in Händen gehalten hatte, standen hier aufgebaut
und bildeten vor der steinernen Wand des Laboratoriums eine zweite unendlich
viel kostbarere. Der Minister trat näher heran. Wie liebkosend glitten seine
Hände über das kühle glänzende Metall. Hier und dort griff er einen der
Würfel heraus, hob ihn empor und erkannte an dem hohen Gewicht, daß er
gediegenes Gold oder reines Platin in seinen Händen hielt.
Eine Weile ließ ihn der Professor gewähren. Dann schob er ihm einen Sessel hin und nahm selbst neben ihm Platz. Nachdenklich blickte der Minister auf den Schatz.
»Ich denke, Herr Professor, Sie lassen das Gold zur Reichsbank bringen und sich den Gegenwert ... es wird wohl eine runde Million sein ... gutschreiben. Ich werde die Bankleitung anweisen, daß sie Ihnen das Gold ohne unbequeme Rückfragen abnimmt.«
Professor Eggerth wiegte den Kopf hin und her. Leicht stockend begann er zu sprechen.
»Wir könnten eine derartige Stärkung unseres Betriebskapitals in der Tat recht gut gebrauchen, Herr Minister. Trotzdem habe ich gewisse Bedenken ... gerade im Augenblick muß alles vermieden werden, was auch nur die Spur eines Verdachtes erregen könnte ...«
Und nun berichtete er dem Minister von dem plötzlichen Erscheinen Mr. Garrisons in der deutschen antarktischen Station und von dem merkwürdigen, ganz unerklärlichen Interesse dieses Amerikaners für die Mineralien in der dortigen Gegend. Zuletzt legte er ihm den Funkspruch Berkoffs vor.
»Ich hoffe, Herr Minister«, schloß er seinen Bericht, »daß es unserem Herrn Berkoff gelingen wird, den Yankee auf eine falsche Fährte zu setzen und unverrichteter Dinge abziehen zu lassen. Aber ich halte es nicht für ratsam, wenn meine Firma gerade jetzt Gold, noch dazu in solcher Menge, in die Reichsbank bringt. Eine derartige Transaktion würde vielleicht doch nicht vollkommen geheim bleiben und könnte unbequeme Folgen haben.«
Nach kurzem Überlegen antwortete der Minister: »Sie haben recht, Herr Professor Eggerth. Wir müssen alles vermeiden, was vorzeitig Verdacht erregen könnte ... und wir werden so schnell wie möglich in dem von Ihnen angedeuteten Sinne vorgehen. Das Gold muß bis auf weiteres hierbleiben ... aber wird es hier auch sicher sein?«
»Herr Minister, um die Existenz des Edelmetalles hier weiß außer Ihnen und mir nur noch mein Sohn, der es in monatelanger Arbeit aus den Erzen herausgezogen hat. Kein anderer hat eine Ahnung, daß etwas Derartiges in meinem Laboratorium vorhanden ist.«
»Das ist gut, Herr Professor. Aber Sie erwähnten vor kurzem einen Herrn Berkoff, der auch eingeweiht ist.«
»Doch nicht ganz, Exzellenz. Die Herren Berkoff und Hansen haben zusammen mit meinem Sohn den Sturz des Boliden beobachtet. Sie sind auch zusammen mit mir in dem Krater gewesen, aber über den Edelmetallgehalt der Erze wissen sie nichts Bestimmtes. Obwohl ich den beiden Herren in jeder Beziehung trauen kann, habe ich sie absichtlich im Dunkeln gelassen und auf Ehrenwort zu absolutem Schweigen verpflichtet.«
»Gut, Herr Professor«, der Minister erhob sich, »so muß es auch weiter bleiben, bis wir unsere Vorbereitungen getroffen haben. Die ganze Aktion muß bereits vollendet sein, ehe die Welt ahnt, um was es sich hier handelt. Sie werden in den nächsten Tagen von mir hören.«
In Professor Eggerths Begleitung verließ er das Laboratorium, um nach Berlin zurückzukehren.
Georg Berkoff nutzte die Zeit, während Garrison mit Rudi noch unterwegs war, aus, um sich erst einmal gründlich zu informieren und danach einen Plan zu machen. Ein vorsichtiges Gespräch mit Wille und Schmidt gab ihm die Gewißheit, daß die beiden Gelehrten von dem Boliden überhaupt nichts gesehen hatten und nicht im entferntesten daran dachten, die Sturmkatastrophe, von der die Station betroffen worden war, mit einem solchen Ereignis in Verbindung zu bringen. Auch Hagemann in seiner Küche hatte nichts davon gemerkt.
Bedenklicher stand die Sache mit Lorenzen. Der hatte, zusammen mit Rudi, den Meteoriten fallen sehen, aber er verschwor sich Stein und Bein, daß der Absturz in einer Entfernung von höchstens hundert Kilometern erfolgt sei. Für diese vorgefaßte Meinung brachte er eine Reihe von scheinwissenschaftlichen Gründen vor, die sich ganz plausibel anhörten. Berkoff hielt es für angebracht, ihn noch darin zu bestärken. Wenn der verteufelte Amerikaner schon durchaus suchen wollte, so sollte er wenigstens an der falschen Stelle suchen.
Nach der Unterhaltung mit Lorenzen machte Berkoff sich über Rudis Mineraliensammlung her und räumte die große Kiste aus. »Schauderhafter Klamottenkram«, kam es von seinen Lippen, während er Stein um Stein herausnahm. Aber dann stutzte er. Seine Hände hatten ein Stückchen blinkendes Erz von ungewöhnlicher Schwere gegriffen. Ein Zweifel war für ihn kaum möglich, er hielt ein Stückchen jenes wunderbaren Sternenstoffes zwischen seinen Fingern. Schon in großer Höhe mochte es infolge der starken Erhitzung von dem Boliden abgesprengt worden sein, hatte danach seine eigene Bahn beschrieben und war in der Nähe der Station niedergefallen.
Durch einen Zufall ... einen unglücklichen Zufall ... nannte Berkoff es bei sich, hatte Rudi das Stück gefunden. Daß auch der Amerikaner es kannte, stand außer Frage. Mit der Tatsache mußte Berkoff rechnen. Er packte die Sammlung wieder ein und zog sich in Dr. Willes Arbeitszimmer zurück, um in Ruhe über die nächsten Schritte nachzudenken.
Als Rudi und Mr. Garrison zurückkehrten, hatte er seinen Plan gefaßt. Nur durch einen riesigen Bluff konnte er den neugierigen Amerikaner unschädlich machen.
Während sich Garrison und Rudi, nach dem langen Marsch ausgehungert, über ihre Mahlzeit hermachten, setzte er sich zu ihnen und fing ein Gespräch über mineralogische Dinge an. Bei Rudi fand er damit ohne weiteres Anklang. Der sprang sofort auf, brachte die Steine, die er gesammelt hatte, herbei und breitete sie am dem Tisch aus. Ausnahmslos waren es Brocken irdischen Gesteins von zum Teil auffallenden Formen und Farben. Berkoff betrachtete sie mit scheinbarem Interesse, obwohl seine Gedanken ganz wo anders waren. Mr. Garrison widmete seine ganze Aufmerksamkeit der Mahlzeit.
»Sie scheinen weniger glücklich als Freund Rudi gewesen zu sein?« fragte ihn Berkoff unvermittelt. Bevor der Amerikaner antworten konnte, platzte Rudi los. »Doch, Herr Berkoff, Mr. Garrison hat ein paar hübsche Stückchen Erz gefunden von der Art, wie ich auch eins in meiner Sammlung habe.«
Die Bemerkung Rudis war dem Amerikaner sichtlich unangenehm. Noch suchte er nach Antworten, um den Eindruck von Rudis Bemerkung zu verwischen, als Berkoff ganz unbefangen sagte:
»Ach so, Rudi, du meinst Meteoritenerz. Da mag wohl hier und dort noch ein Stückchen zu finden sein, obwohl wir die Hauptsache schon vor vier Monaten in Sicherheit gebracht haben.«
Einen Augenblick vergaß es der Amerikaner, den Mund zu schließen, in den er gerade einen Bissen geschoben hatte. Dann raffte er sich zusammen.
»Oh, Mr. Berkoff, Sie sagen Meteoritenerz. Das ist interessant. Wie meinen Sie das?«
Während er die Worte langsam herauskaute, arbeitete sein Gehirn fieberhaft ... Die Hauptsache in Sicherheit gebracht ... die Deutschen waren natürlich mit ihrem Stratosphärenschiff dort gewesen ... hatten von dem Erz eingeladen, was sich finden ließ ... ein Stückchen davon war im Laderaum liegengeblieben ... Mr. Haynes hatte es an sich genommen, ganz zwanglos erklärte sich jetzt dieser seltsame Fund, aber im gleichen Augenblick fühlte Garrison auch alle Hoffnungen schwinden, mit denen er hierhergekommen war.
»Das ist schnell gesagt«, erwiderte Berkoff auf seine letzte Frage. »Vor einem halben Jahr ist hundert Kilometer südlich von der Station ein größerer Meteorit niedergegangen. Durch eine Reihe von Beobachtungen war der Funker Lorenzen in der Lage, den Fallort recht genau festzustellen ... Sie wissen, Mr. Garrison, optische und akustische Erscheinungen eines Ereignisses gestatten eine zuverlässige Entfernungsberechnung ... jedenfalls interessierte uns die Sache. Bei unserm nächsten Besuch hier machten wir mit unserm Flugschiff einen Abstecher zu der Stelle hin. Es muß ein ganz tüchtiger Brocken gewesen sein, der da vom Himmel fiel, alles in allem konnten wir an die fünf Tonnen Erz an Bord nehmen, bei dem hohen Gehalt an Edelmetall war es ein recht annehmbares Geschäft für uns. Schade, daß nicht mehr von dem Zeug vorhanden war.«
Unruhig rutschte der Amerikaner auf seinem Stuhl hin und her, während Berkoff mit ehrlichstem Gesicht seine Geschichte vorbrachte. Als er geendet hatte, griff er in die Tasche und brachte einige Erzproben zum Vorschein.
»Es ist aber noch mehr von dem Erz vorhanden, Mr. Berkoff, sehen Sie bitte hier, das habe ich heute gefunden, nur etwa fünf Kilometer von der Station entfernt.«
Berkoff zuckte die Achseln.
»Gewiß, Mr. Garrison, das will ich Ihnen gern glauben. Wenn so ein Meteorit in die tiefere Atmosphäre kommt, spritzt er leicht etwas um sich. Die Wissenschaft kennt ja mehr als einen Fall, wo Steinmeteoriten ganz und gar zerplatzten und die Erdoberfläche nur noch in Form eines Steinregens erreichten. Aber bei Erzmeteoren ist das kaum der Fall. Da bleibt die Hauptmasse jedenfalls beisammen, was wir ja auch tatsächlich konstatieren konnten.«
Für den Augenblick brach Berkoff das Gespräch ab. Mochte der Amerikaner die Mitteilungen, die er ihm soeben vorgesetzt hatte, zunächst eine Weile verdauen. Erst am folgenden Morgen kam Berkoff wie zufällig auf das Thema zurück und lud ihn zu einem Flug nach der Fallstelle des Meteoriten ein. Mit Vergnügen ging Mr. Garrison auf diesen Vorschlag ein. Er sprach viel von seinem wissenschaftlichen Interesse an Meteoriten und ähnlichen Erscheinungen, während sie zum Schiff gingen.
»Lüge du und der Deibel!« dachte Berkoff bei sich. »Was du willst, weiß ich, und auf den Leim führe ich dich doch!« In der Tat verband er mit der Einladung zu diesem Flug eine ganz bestimmte Absicht.
Es wäre natürlich verfehlt gewesen, dem Amerikaner irgendeinen Punkt in der endlosen Ebene zu zeigen und zu behaupten, daß dort der Meteor niedergegangen sei. Aber es gab da südlich von der Station und auch etwa hundert Kilometer von ihr entfernt eine Stelle, an der das Gelände dicht neben einer leichten Hügelwelle eine kleine merkwürdig gezackte Mulde bildete. Vielleicht war dort zu irgendeiner Zeit sogar wirklich einmal ein Meteor eingeschlagen. Bei früheren Flügen war Berkoff die Stelle aufgefallen, und er versuchte jetzt, sie wiederzufinden.
Absichtlich vermied er es dabei, in die Stratosphäre zu gehen. In knapp 2000 Metern Höhe strich das Flugzeug über den Boden hin. Nun glaubte er gefunden zu haben, was er suchte. Noch ein paar Kreise zog das Schiff über der verdächtigen Stelle, dann hing es an seiner Hubschraube und sank langsam nach unten. Prüfend blickte Berkoff in die Runde, nachdem sie das Schiff verlassen hatten.
»Hier muß es sein, Mr. Garrison. Leider ist heute alles tief verschneit, der Nordwind hat den Schnee gegen die Hügelkette geweht. Damals hatten wir bessere Verhältnisse. Aber ich kenne die Gegend wieder. Gerade vor uns muß es sein ...«
Er wollte noch weitersprechen, aber der Amerikaner lief bereits auf die Stelle zu.
»Vorsicht, Mr. Garrison, das Loch ist tief«, schrie ihm Berkoff noch nach. Aber da war das Malheur schon geschehen. Der Amerikaner war über den Rand der etwa zehn Meter tiefen Mulde hinabgestolpert und steckte da unten irgendwo tief im Schnee.
»Na, weh getan wird er sich nicht haben, Schnee ist weich«, ging es Berkoff durch den Kopf, während er vorsichtig Fuß vor Fuß setzend bis zum Rande der Mulde schritt.
»Hallo, Mr. Garrison. Ich habe Sie gewarnt. Haben Sie sich verletzt?« Er schrie es, während er mit den Händen einen Trichter vor seinem Munde bildete. Aus dem Schnee klang es dumpf und undeutlich herauf. Soviel Berkoff verstehen konnte, war der Amerikaner nicht zu Schaden gekommen, aber er war nicht imstande, sich ohne Hilfe aus den Schneemassen herauszuarbeiten.
»Warten Sie, Mr. Garrison, ich gehe zum Schiff zurück und bringe Ihnen eine Leiter«, schrie Berkoff und machte sich auf den Weg.
»Das wird dir schon gut tun, mein Junge«, dachte er dabei, »wenn du aus der Schneekuhle wieder glücklich raus bist, wird dein Wissensdurst hoffentlich ein für allemal gestillt sein.«
Es gab in dem Stratosphärenschiff kurze Aluminiumleitern, die man nach Bedarf zusammenstecken konnte. Sie dienten bei Landungen auf unebenem Gelände zum Verlassen des Schiffes und hatten sich für diesen Zweck gut bewährt. Berkoff griff drei davon und kehrte zu der Unfallstelle zurück.
»Hallo, Mr. Garrison. Sind Sie noch vorhanden?«
Ein unwilliges Brummen aus dem Schnee kam als Antwort auf die Frage. Berkoff steckte die Leitern zusammen und stieß das lange Gebilde dann vorsichtig in den Schnee hinein nach unten, schrie dabei: »Achtung Mr. Garrison, Vorsicht! Die Leiter kommt.«
Er mußte niederknien und die oberste Sprosse noch ein Stück über den Muldenrand nachlassen, dann fühlte er, wie die Leiter festen Grund faßte.
»Leiter steht! Haben Sie sie?« schrie er mit voller Lungenkraft. Mr. Garrison antwortete nicht mehr. Die Luft mochte ihm allmählich knapp geworden sein, aber an den Erschütterungen der Leiter merkte Berkoff, daß der Amerikaner sie gefaßt hatte und sich Stufe um Stufe auf ihr in die Höhe drückte. Es ging nur langsam vorwärts. Öfter als einmal mußte er haltmachen, um wieder frischen Sauerstoff in die Lungen zu pumpen. Aber schließlich war es doch geschafft. Die Schneedecke bewegte sich, und über und über weiß bezuckert wie ein Weihnachtsmann tauchte Mr. Garrison aus ihr heraus. Berkoff streckte ihm die Hand entgegen und zog ihn mit kräftigem Schwung auf sicheren Boden.
»Wie konnten Sie nur, Mr. Garrison?« sagte er dabei. »Ich rief Ihnen doch nach, warnte Sie noch, das hätte leicht böse ausgehen können.«
Garrison atmete in tiefen Zügen und begann dabei sich den Schnee abzuklopfen. Es dauerte eine Weile, bis er wieder Worte fand.
»Wie tief ist das verfluchte Loch denn eigentlich?«
Berkoff lachte. »Tief genug, lieber Garrison, um sich das Genick zu brechen, wenn der Schnee nicht glücklicherweise Ihren Sturz gemildert hätte. Sie werden es gleich sehen.«
Während Berkoff es sagte, machte er sich daran, die Leiter wieder emporzuziehen, und bei jeder Sprosse, die aus dem Schnee auftauchte, wurde Garrisons Gesicht länger.
»Ja, ja mein lieber Herr«, meinte Berkoff, während er die Leiter wieder auseinandernahm, »Sie sind da reichlich zehn Meter runter gesegelt, lassen Sie sichs eine Warnung sein. Es ist schade, daß das Gelände hier so verschneit ist. Sie hätten sich sonst durch den Augenschein überzeugen können, daß wir das Meteoritenerz restlos mitgenommen haben. Hier ist weit und breit kein Stückchen davon liegengeblieben.«
Der Amerikaner brummte etwas vor sich hin, was ebensogut ja wie nein heißen konnte. Ganz offensichtlich hatte der Sturz in die Schneekuhle ihm die Laune gründlich verdorben. Während sie zum Schiff zurückgingen, wollte er wissen, ob die Gegend hier immer so verschneit wäre.
»Das hängt von den Windverhältnissen ab, Mr. Garrison«, beantwortete Berkoff seine Frage. »Ein tüchtiger Südsturm würde die Ebene hier bald blank fegen, in letzter Zeit hatten wir aber, wie Sie aus den meteorologischen Aufzeichnungen der Station ersehen können, vorwiegend leichten Nordwind.«
Sie hatten inzwischen das Schiff erreicht und traten den Rückflug zur Station an.
»Sie kommen oft in diese Gegend, Mr. Berkoff?« wollte Garrison weiter wissen.
Der Deutsche nickte.
»Ich kann wohl sagen ja, Mr. Garrison. Ich bin sozusagen der Verbindungsmann zwischen den Eggerth-Werken und der Station. So durchschnittlich alle zwei Monate hat die Antarktis das Vergnügen, mich zu sehen.«
»Das muß sehr interessant sein für Sie«, meinte der Amerikaner. »Wie lange gedenken Sie diesmal hierzubleiben?«
»Nicht mehr lange, Mr. Garrison. Morgen, spätestens übermorgen wird Dr. Wille mit der Durchprüfung der neuen Apparate, die ich ihm diesmal mitbrachte, fertig sein. Dann gibts noch eine kleine Besprechung und wahrscheinlich einen langen Wunschzettel und danach gehts wieder auf dem schnellsten Wege nach Deutschland. Wenn Sie wollen, Mr. Garrison, nehme ich Sie gern mit.«
»Sehr liebenswürdig von Ihnen, Mr. Berkoff. Ich denke, ich werde Ihre Einladung wahrscheinlich annehmen.«
»Wenn Sie jetzt nicht mitkommen, werden Sie voraussichtlich zwei Monate in der Station bleiben müssen«, sagte Berkoff trocken. ›Du Riesenkamel, nu komm schon mit‹, dachte er im stillen.
Die nächsten beiden Tage benutzte der Amerikaner noch zu ausgiebigen Märschen
in der südlichen Umgebung der Station, aber das Glück war ihm dabei nicht
hold. Er fand kein einziges Stückchen des schweren blinkenden Erzes, nach dem
er so eifrig ausspähte. Als Berkoff am Abend des zweiten Tages startete,
befand sich Mr. Garrison an Bord von ›St 10‹ und ließ sich nach
Deutschland mitnehmen. Aus seinen Gesprächen glaubte Berkoff entnehmen zu
können, daß er die Hoffnung, in der Antarktis Erz zu finden, endgültig
begraben habe.
Zum erstenmal in den beiden Jahrzehnten, während deren die beiden Gelehrten nun schon zusammen arbeiteten, gab es einen regelrechten Krach zwischen Wille und Schmidt. Die Sache nahm ihren Ausgang von dem in den letzten Wochen so oft behandelten Thema: Wollen wir die Station weiter nach Süden verlegen, oder sollen wir hier bleiben? Wie stets bisher war Dr. Wille dafür, an der alten Stelle zu bleiben, während Schmidt energischer als je zuvor für eine Verlegung eintrat.
»Es ist prinzipiell verkehrt, daß wir monatelang ... bald wird es ein Jahr sein ... an der gleichen Stelle sitzen, statt durch das Land zu ziehen und die besten Bedingungen für unsere Arbeiten ausfindig zu machen«, begründete Schmidt seinen Standpunkt.
Wille fuhr ärgerlich auf.
»Herr Dr. Schmidt, habe ich diese Expedition hier mit meinen Mitteln durchgeführt oder sind Sie es gewesen?«
»Die Frage ist unnötig, Herr Dr. Wille, Sie wissen sehr genau, daß ich nicht über die Mittel verfüge, um ein derartiges Unternehmen ausrüsten zu können. Aber trotzdem beanspruche ich die Freiheit, es Ihnen zu sagen, wenn Sie nach meiner Meinung im Begriff sind, einen Fehler zu begehen.«
»Meinung hin, Meinung her, Herr Schmidt! Gegen Ihre Ansicht setze ich die meinige. Das dürfte sich dann ja wohl so ziemlich heben.«
Eine Weile stand der lange dürre Schmidt mit zusammengekniffenen Lippen schweigend da. Schon glaubte Dr. Wille, daß der Streit damit beendet sei, als sein Assistent wieder zu sprechen begann.
»Ich stehe mit meiner Meinung nicht allein da, Herr Wille. Sie wird von andern geteilt.«
»Machen Sie mich nicht verrückt!« brauste Wille auf, »was sind denn das für Eideshelfer, auf die Sie sich da stützen wollen?«
»Da wäre zuerst Professor Eggerth zu nennen, Herr Wille.«
»Unsinn, Herr Schmidt! Ich habe, glaube ich, schon einmal gesagt, daß der Mann sich um seinen eigenen Kram kümmern soll. Von unserer Sache hat er wirklich keine Ahnung.«
»Dann möchte ich an zweiter Stelle Herrn Ministerialdirektor Gerhard aus dem Kultusministerium nennen.«
Dr. Wille pfiff durch die Zähne.
»Das Kultusministerium hat bis jetzt keinen Pfennig zu meiner Expedition beigesteuert und da berufen Sie sich mir gegenüber auf diese Behörde. Ich begreife Sie nicht mehr.«
»Sie werden mich vielleicht besser verstehen, Herr Dr. Wille, wenn ich Ihnen sage, daß das Kultusministerium jetzt bereit ist, die Expedition finanziell zu unterstützen.«
Dr. Wille ließ sich in einen Sessel fallen. Er brauchte Zeit, um die unerwartete Nachricht zu erfassen, und er schien sie zunächst überhaupt nicht glauben zu wollen.
»Davon hätte ich als Leiter der Expedition doch zuerst etwas erfahren müssen«, fuhr er nach einer Weile fort, »vorläufig ist mir nichts davon bekannt. Ich würde es mir auch noch sehr überlegen, ob ich eine solche Unterstützung annehme. Sie wird wahrscheinlich nicht sehr bedeutend sein, und das Ministerium wird mir dafür in unerträglicher Weise in meine Arbeiten hineinreden.«
Schmidt schüttelte den Kopf.
»Das würden Sie kaum zu befürchten haben. Das Ministerium wünscht nur, daß wir mit den Transportmitteln, die es uns zur Verfügung stellen will, einen Teil der Station motorisieren und Forschungsreisen in südlicher Richtung unternehmen, bis wir die besten Bedingungen für unsere Arbeiten gefunden haben ...«
»Und dann natürlich die ganze Station dorthin verlegen«, führte Wille den Satz zu Ende.
»Vielleicht, Herr Doktor. Das würde sich im weiteren Verlauf der Arbeiten herausstellen.«
Dr. Wille hatte einen Bleistift ergriffen und spielte nervös damit. Stockend, oft lange Pausen machend, sprach er weiter: »Herr Dr. Schmidt ... ich muß Sie daran erinnern ... es geschieht zum ersten Male in den langen Jahren, die wir zusammen arbeiten ... daß Sie mein Assistent sind und bei mir in Brot und Lohn stehen. In Ihrem Anstellungsvertrag befindet sich ein Passus, daß die Arbeiten der Expedition nach meinen Anweisungen zu erfolgen ...«
»Verzeihung, Herr Wille«, unterbrach ihn Schmidt, »hier würde in Zukunft eine Änderung eintreten. Das Kultusministerium beabsichtigt, mich mit Beamteneigenschaft in den Staatsdienst zu übernehmen. Sie werden es begreiflich finden, daß ich eine solche Chance nicht vorbeigehen lassen kann.«
Der Bleistift in Willes Händen zerbrach in zwei Stücke. »Großartig, Herr Dr. Schmidt«, rief er, während er sie achtlos beiseite warf, »Sie werden also Staatsbeamter, wahrscheinlich Ministerialrat, werden mir hier womöglich vor die Nase gesetzt ... und ich habe keine Ahnung von alledem, was sich da bereits hinter den Kulissen abgespielt haben muß. Pfui Teufel, Herr Schmidt, das hätte ich von meinem langjährigen Mitarbeiter nicht erwartet.«
Der lange Schmidt machte eine verzweifelte Abwehrbewegung.
»Nicht doch, Herr Dr. Wille. Sie verkennen die Situation vollkommen, man denkt gar nicht daran, hinter Ihrem Rücken vorzugehen. Es besteht im Ministerium die Absicht, unsere ganze Expedition zu verstaatlichen und auch Sie in den Staatsdienst zu übernehmen ... wenn Sie dazu bereit sind, Herr Wille ...«
»Und wenn ich nicht dazu bereit bin?«
Schmidt zuckte die Achseln.
»Dann würden wir uns trennen müssen, wollen Sie sagen, Herr Schmidt? So ist es doch!« schrie ihm Wille ins Gesicht.
Minuten vergingen, in denen keiner der beiden ein Wort sprach. Dann begann Schmidt von neuem.
»Wir wollen versuchen, Herr Wille, diese Unterredung unter Beiseitelassung aller Nebensächlichkeiten zu Ende zu bringen. Die Regierung erkennt Ihre großen wissenschaftlichen Verdienste voll an. Sie will die antarktische Expedition, die Sie bisher aus Ihrem Privatvermögen finanzierten, zu einer dauernden Institution des Deutschen Reiches machen, und sie will Ihnen dabei durchaus diejenige Stellung geben, die Ihnen nach Ihrer ganzen Vergangenheit zukommt. Es wäre ein schwerer Verlust für die deutsche Wissenschaft, wenn Sie dieses Angebot nicht annehmen.«
Dr. Wille sprang erregt auf. »Sie sprechen von einem Angebot, Schmidt. Aber man hat mir ja noch gar kein Angebot gemacht. Von allen diesen Dingen höre ich zum erstenmal aus Ihrem Mund.«
Der Schein eines Lächelns huschte über die faltigen Züge Schmidts. »Darf ich ganz offen zu Ihnen sprechen, als ... als Ihr alter Mitarbeiter ... und Freund, Herr Dr. Wille?«
Wille warf ihm einen verwunderten Blick zu. »Sprechen Sie als was Sie wollen, aber sagen Sie mir endlich, was hier eigentlich gespielt wird.«
»Mein sehr verehrter Herr Dr. Wille, man kennt Ihr Temperament in Berlin und man möchte sich dort keiner Ablehnung von Ihrer Seite aussetzen. Sie begreifen, daß ein Refus, von Ihnen vielleicht in einer ersten Aufwallung gegeben, die Verhandlung sofort auf einen toten Punkt bringen würde. Man bat deshalb Professor Eggerth, zunächst zu sondieren ...«
»Der Professor hat mir auch kein Wort davon gesagt«, fiel ihm Wille ins Wort.«
»Weil er die gleichen Bedenken hatte. Deshalb hat man den alten Schmidt vorgeschickt, der sich von seinem hochverehrten Chef gern ein paar Dutzend Grobheiten an den Kopf werfen läßt, wenn es ihm nur gelingt, ihn für die große neue Sache zu gewinnen. Mein lieber Herr Dr. Wille, geben Sie mir bitte keinen Korb.«
Er streckte Wille langsam die Rechte hin.
»Schlagen Sie ein, versprechen Sie mir, daß Sie den Vorschlag der Regierung annehmen werden.«
Langsam griff Wille nach Schmidts Hand.
»Mein lieber alter Schmidt, ich habe Ihnen unrecht getan. Ich glaubte, Sie wollten mich verlassen. Ich will Ihnen versprechen, das Angebot nach bestem Wissen und Gewissen zu prüfen, sobald es mir offiziell gemacht wird.«
»Auch anzunehmen, Herr Wille? Das ist mir die Hauptsache. Soviel ich weiß, beabsichtigt man, Ihnen den Titel und Rang eines Reichskommissars zu geben.«
Dr. Wille fuhr sich wie träumend über die Stirn. »Titel und Rang eines Reichskommissars, merkwürdig Schmidt, merkwürdig ... wenn ich mich recht erinnern kann, waren Wißmann und Peters einmal Reichskommissare. Das erinnert ja beinahe an die Erwerbung unserer ersten Kolonien.«
Dr. Schmidt versuchte zu lachen.
»Hier in der Antarktis dürfte es kaum etwas zu kolonisieren geben, Herr Wille. Der Titel wurde wohl gewählt, um Ihnen die notwendige Stellung gegenüber dem Ministerialrat Schmidt zu geben, den die Herren in Berlin aus mir machen wollen.«
Dr. Schmidt stand auf.
»Darf ich an Professor Eggerth funken, daß Sie bereit sind, das Angebot der Regierung anzunehmen?«
»Es kommt zu schnell, lieber Schmidt. Lassen Sie mir noch ein paar Stunden Bedenkzeit. Sagen wir heute abend. Nach dem Essen werde ich Ihnen meine Entscheidung mitteilen.«
Und dann war Dr. Wille allein. In der Gesellschaft von tausend Gedanken und Überlegungen, die auf ihn einstürmten.
Schweigend hatte Dr. Schmidt den Raum verlassen. Mit langen Stechschritten stelzte er durch den Schnee zur Funkerbude hin. Lorenzen sah ihn mißtrauisch herankommen. ›Wahrscheinlich bringt der wieder einen halben Zentner irrsinniger Zahlen, die nach Potsdam zu funken sind‹, dachte er, als der Doktor bei ihm eintrat, aber diesmal brachte der Doktor keine seiner endlosen Tabellen zum Vorschein. Nach kurzem Gruß griff er sich einen von den Schreibblöcken, warf ein Dutzend Worte darauf und schob ihn Lorenzen hin.
»An Professor Eggerth persönlich. Bitte sofort senden.«
Mechanisch griff Lorenzen nach dem Papier. Während seine Augen über die Buchstaben gingen, stutzte er. Was war das für eine verrückte Depesche! Bestimmt nicht im Geheimkode der Eggerth-Werke, denn den kannte er nach langer Praxis zur Genüge. Kopfschüttelnd machte er sich an die Arbeit und nahm die Verbindung mit den Eggerth-Werken auf. Dr. Schmidt blieb neben ihm sitzen, bis der Funkspruch abgegangen und sein Empfang aus Bitterfeld bestätigt worden war. Dann ging er zur Station zurück.
Um die gleiche Zeit hielt Professor Eggerth eine Depesche aus der Antarktis
in den Händen. Verschlüsselt, wie sie angekommen war, hatte der Werkfunker
sie dem Professor geschickt, denn mit dem Kode der Eggerth-Werke ließ sie
sich nicht entziffern. In seinem Arbeitszimmer machte sich der Professor
selbst daran, den Funkspruch unter Verwendung eines andern Schlüssels auf
Klartext zu bringen. Und dann standen die Worte vor ihm.
›Das Eis ist gebrochen. Heute abend soll es sich entscheiden. Schmidt.‹
Der Abend kam herauf, aber er brachte die Entscheidung noch nicht; nur einen
zweiten Funkspruch an Professor Eggerth: ›48 Stunden Bedenkzeit
erbeten, Dr. Wille.‹
Nachdenklich wog der Professor die Depesche in der Hand. Ein leichter Zweifel wollte ihm aufsteigen, ob es richtig war, den nüchternen Dr. Schmidt mit einer Mission zu betrauen, die immerhin ein wenig Psychologie verlangte. Und doch ... je länger er hin und her überlegte, desto mehr kam er zu der Ansicht, daß es keinen besseren Mann als Dr. Schmidt dafür gab. Kein anderer verstand sich so auf die kleinen Eigenheiten Willes, kein anderer hätte es jemals so lange bei dem eigenwilligen Gelehrten ausgehalten wie Schmidt.
Irgendwelche neuen Hemmungen mußten eingetreten sein. Anders war die Bitte um eine so lange Bedenkzeit nicht zu erklären, und Professor Eggerth war selbst genügend Psychologe, um die Gefahr, die darin lag, sofort zu erkennen. Der tote Punkt mußte überwunden werden und er glaubte, die Mittel dafür zu besitzen.
Mit ›St 11‹ zur deutschen Station. Drei Mammutwagen. Dr. Wille läßt sich überzeugen. Mr. Garrison interessiert einen Millionär für das »Andenken«. Der lange Schmidt wird Geheimrat, die deutsche Station ein Reichsinstitut. Die Reichsflagge geht am Funkmast hoch.
Man war im Werk gerade dabei, die ersten Schiffe von Typ ›St 11‹ aus der Neufabrikation für die Pazificlinien einzufliegen. ›St 11a‹ hatte die ersten 10 000 Kilometer bereits hinter sich, als es um die achte Abendstunde auf dem Werkhof niederging. Hein Eggerth kletterte aus dem Rumpf, Berkoff und Hansen folgten ihm.
»Der Kahn ist großartig«, rief Hansen vergnügt und schwenkte dabei das Logbuch von ›St 11a‹ in der Rechten.
In der Hoffnung auf ein gutes Abendessen schlugen die drei Piloten zusammen den Weg zum Kasino ein, als der Professor ihnen in den Weg trat. Eine kurze Begrüßung, ein kurzer Bericht über den letzten Flug, und der Professor ging zusammen mit ihnen weiter.
»Die Herren wollen sich restaurieren. Ist recht so! Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen.«
Zu viert nahmen sie auf Einladung des Professors an dem runden Stammtisch im hinteren Zimmer des Kasinos Platz und bald duftete es angenehm aus vollen Schüsseln. Professor Eggerth saß neben seinem Sohn und studierte aufmerksam das Logbuch des neuen Stratosphärenschiffes, während die anderen sich über die aufgetragenen Gerichte hermachten. Eine Weile ließ er sie gewähren, dann zog er Hein beiseite und begann mit ihm zu sprechen. Leise, fast flüsternd zuerst, bald danach lauter, so daß auch die andern hören konnten, um was es sich handelte und was ihnen bevorstand. In einer halben Stunde sollten sie mit ›St 11a‹ zur Antarktis starten. »Pfui Deibel«, sagte Hansen, aber vorsichtigerweise so leise, daß es der Professor nicht hören konnte.
»Ich hätte mich eigentlich aufs Bett gefreut«, flüsterte Berkoff ihm zu.
»Es ist von Wichtigkeit für unser Werk und für noch mehr, meine Herren«, sagte Professor Eggerth, und da waren Müdigkeit und Abspannung im Augenblick abgeschüttelt.
»Was sollen wir mitnehmen?« fragte Hein.
»Keine Sorge für dich, mein Junge. Draußen wird schon alles eingeladen. Zwanzig Minuten könnt ihr hier noch gemütlich sitzen, dann wird gestartet.«
Zur festgesetzten Zeit schraubte sich ›St 11a‹ in die Höhe und stürmte nach Süden davon.
Professor Eggerth hatte mit seiner Vermutung recht, daß eine Hemmung eingetreten sei. Während Dr. Wille in langen Stunden sein bisheriges Lebenswerk durchdachte, während er sich vorzustellen versuchte, wie er es zukünftig unter andern vielleicht günstigeren Bedingungen weiterführen sollte, geriet er immer wieder an einen Punkt, über den er nicht hinwegkam. Sein ureigenstes Werk war diese ganze antarktische Station, wenn er auch die tatkräftige Hilfe der Eggerth-Werke nicht unterschätzte. Von ihm war die Idee ausgegangen, und sein ganzes nicht unbedeutendes Vermögen hatte er in ihren Dienst gestellt. Von ihm stammte auch der Generalplan, nach dem die Expedition bisher gearbeitet hatte, und auf die Ergebnisse dieser Arbeiten durfte er mit Recht stolz sein.
Eine Fülle neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse war im Laufe dieses letzten Jahres gewonnen worden. In den gelehrten Zeitschriften aller Kulturvölker waren Berichte darüber erschienen und hatten seinen Namen in der ganzen Welt bekannt und berühmt gemacht.
Nun sollte das plötzlich anders werden. Nicht mehr nach seinen eigenen Ideen, sondern nach denen der deutschen Regierung ... eines Ministeriums der Regierung ... irgendeines unbekannten ... vielleicht unbedeutenden Dezernenten dieses Ministeriums sollte zukünftig gearbeitet werden. Er kam nicht darüber hinweg, sooft er in seinen Gedanken bis an diesen Punkt gelangt war.
Die Station zum Teil motorisieren ... alle Messungen nicht mehr an einer einzelnen Stelle, sondern über einem großen Gebiet vornehmen ... er konnte sich der Erkenntnis nicht verschließen, daß der Gedanke grundsätzlich richtig war. Er mußte sich selbst eingestehen, daß er den Vorschlägen Schmidts mehr aus Eigensinn als aus triftigen Gründen widersprochen hatte.
Ja war es denn wirklich nur Eigensinn? Hatten nicht andere Gründe in seinem Unterbewußtsein, ihm selbst kaum erkenntlich, mitgesprochen? Gründe, über die er sich in langem selbstquälerischen Grübeln klar zu werden suchte, und die er schließlich zu finden glaubte.
Das war es, was ihn allen Vorschlägen Schmidts so schroffen Widerspruch entgegensetzen ließ. Eine Motorisierung der Station würde neue bedeutende Kosten verursachen, seine eigenen Mittel wahrscheinlich vollkommen aufzehren. Die Hilfe der Eggerth-Werke aber auch dafür in Anspruch zu nehmen, widerstand ihm instinktiv. Das waren, er erkannte es jetzt klar, die tieferen Gründe für seinen fortwährenden Streit mit Schmidt. Sollte er jetzt nachgeben, weil die deutsche Regierung sich hinter sein Unternehmen stellen wollte?
Ein Geräusch riß ihn aus seinen Überlegungen und Erwägungen. Motorgedröhn
drang in den stillen Raum. Er trat an ein Fenster und zog die Vorhänge
zurück. Im matten Schein der tiefstehenden Sonne senkte sich ein Flugschiff
langsam auf die Hoffläche hinab, ein Schiff viel größer und mächtiger als die
Stratosphärenschiffe, die bisher die Verbindung der Station mit Deutschland
aufrechterhielten.
Es duldete ihn nicht länger im Zimmer. Er warf den Pelz über und trat ins Freie, voller Erwartung, was dies neueste und größte Schiff der Eggerth-Werke wohl bringen mochte.
Doch auf halbem Wege verhielt er den Schritt. Da kam von links her Schmidt, der ebenfalls zu dem Stratosphärenschiff wollte. Dr. Wille wollte umdrehen und ins Haus zurückgehen, aber da war der lange Schmidt schon bei ihm und schob, als ob es gar nicht anders sein könnte, seinen Arm unter den Willes.
»Kommen Sie mit, Herr Dr. Wille. Wir wollen uns zusammen ansehen, was Professor Eggerth uns schickt.«
Während sie durch den kalten lichten Polartag weiterschritten, klang ihnen aus dem Rumpf des Stratosphärenschiffes das Geräusch von Werkzeugen entgegen. Wie wenn an vielen Stellen zugleich mit Schraubenschlüsseln und Hebeln hantiert würde, hörte es sich an. Kommandorufe dazwischen; nur dumpf und gedämpft vermochten sie durch die starke Metallwand nach außen zu dringen. Und dann plötzlich klaffte es breit in dem mächtigen Bau. Knarrend öffneten sich die beiden Flügeltüren einer gewaltigen Ladeluke und schwangen langsam nach außen.
Wie oft hatten sie es schon mit angesehen, wenn eins der älteren Stratosphärenschiffe hier niederging, wenn eine Tür in seinem Rumpf sich öffnete. Doch viel großartiger, viel imposanter war das Schauspiel, das sich jetzt ihren Augen bot. Der freie Blick in das Schiffsinnere auf zahlreiche Werkleute, die dort nach den Anweisungen von Meistern und Ingenieuren tätig waren.
Ein neues Kommando klang auf, breit und massig schob sich eine schwere Brücke aus der klaffenden Ladeluke und reckte sich weit hinaus, bis sie mit dem freien Ende auf dem verschneiten Feld auflegte. Aus dem gleichen schimmernden Leichtmetall bestand sie wie der Rumpf des Stratosphärenschiffes.
Der Ton einer Hupe zerriß die stille Luft. Wie das Atmen eines schlafenden Riesen war es plötzlich anzuhören, etwas Großes, Dunkles bewegte sich im Schiffsraum, ein Gebilde, mächtig und riesenhaft wie der Leib eines Mammuts stand auf der Brücke, rollte über die Brücke hinab und glitt auf breiten Raupenketten geräuschlos über den Schnee, bis es dicht bei der Stelle, wo Wille und Schmidt standen, zum Halten kam.
Betroffen von dem unerwarteten Anblick, bedrückt von den ungeheuren Ausmaßen des gigantischen Kraftwagens stand Dr. Wille, als neue Hupensignale ertönten. Noch ein zweites und noch ein drittes Gefährt, von der gleichen riesigen Bauart tauchten aus dem Bauch des Stratosphärenschiffes auf, glitten über die Brücke und über den Schnee. Wie drei Mastodonten der Urzeit standen die drei gewaltigen Raupenwagen jetzt in Reih und Glied nebeneinander.
Dr. Wille griff sich an die Stirn. »Was ist das, Schmidt? Was soll das bedeuten?«
Der lange Schmidt zuckte die Achseln. Er hielt es im Augenblick für klüger, seine Gedanken für sich zu behalten.
»Ich weiß es nicht, Herr Wille, doch ich denke, die Herren, die das Stratosphärenschiff hierhergebracht haben, werden es uns sagen können. Da kommt ja der junge Eggerth, wir wollen ihn fragen.«
Hein Eggerth schüttelte den beiden Gelehrten die Hände, und Wolf Hansen drückte sie ihnen so kräftig, daß Dr. Wille die Zähne zusammenbeißen mußte und für den Augenblick alle Grillen fahren ließ. Und dann kam Georg Berkoff, ein Schlüsselbund in der Hand, und bat um die Ehre, die Herren mit einigen technischen Neuheiten bekanntmachen zu dürfen.
Ein Schlüssel seines Bundes schnappte in einem Schloß des ersten der drei Motorriesen. Gleichzeitig mit der aufspringenden Tür schob sich eine Treppe hinaus, über die Stufen traten sie in das Wageninnere, geräuschlos fiel die Tür hinter ihnen wieder ins Schloß.
In einem großen angenehm durchwärmten Raum standen sie, in dem elektrisches Licht jeden Winkel erhellte. Es mußte das Innere jenes großen Raupenwagens sein, in den sie eben in dieser Sekunde hineingeklettert waren. Immer wieder sagte sich Dr. Wille das, während er ungläubig um sich blickte. Denn was seine Augen hier sahen, das erinnerte auch nicht im geringsten an ein Kraftfahrzeug, das war vielmehr ein vollständiges mit den besten Apparaten ausgerüstetes Observatorium für erdmagnetische Beobachtungen.
Die Stimme Berkoffs riß ihn aus seinem Staunen.
»Hier das Neueste aus Jena, Herr Dr. Wille. Ein Universal-Erdinduktor. Es glückte unserm Professor, das zweite Instrument, das im Zeiß-Werk fertig wurde, zu bekommen.«
Noch während er es sagte, drückte Berkoff auf einen Knopf, das leise Schnurren eines Elektromotors wurde hörbar, und drei Skalen leuchteten in mattem Licht auf.
»Die X-Komponente des Erdmagnetismus an der Stelle, wo wir jetzt sind«, fuhr er in seiner Erklärung fort und deutete auf den Zeiger, der zitternd über den Ziffern der ersten Skala spielte. »Alles nach Gauß-Einheiten geeicht, Herr Dr. Wille, jetzt ...«, er bewegte einen Hebel, »haben wir die Y-Komponente auf der zweiten«, er bewegte einen andern Hebel, »die Z-Komponente auf der dritten Skala.«
Mit wachsendem Interesse war Wille den Erklärungen Berkoffs gefolgt. Unter dessen Anleitung griff er jetzt selbst zu, ließ bald die eine, bald die andere Skala spielen und überschüttete den Ingenieur mit einer Flut von Fragen; aber Berkoff hatte sich darauf präpariert und blieb ihm keine Antwort schuldig. Bald dies, bald jenes wollte Dr. Wille von ihm wissen, schließlich zog er eine Notizbuch aus der Tasche und verglich Zahlen, die dort eingetragen waren, mit den Angaben des neuen Induktors.
»Stimmt, Herr Berkoff, stimmt bis auf die dritte Dezimale mit unsern alten Messungen«, meinte er danach befriedigt und ließ sich nun die Regelvorrichtung des Elektromotors erklären, durch die dessen Umdrehungszahl auf einen genau gleichbleibenden Wert gehalten wurde. Die Zeit verstrich darüber, und immer noch war die Wißbegierde Willes nicht gestillt. Vergeblich suchte Berkoff ihn zu den andern Instrumenten dieses fahrbaren Observatoriums hinzubringen, er klebte an dem Induktor wie die Fliege am Leim. Schließlich zog Berkoff die Uhr.
»Ich schlage vor, daß wir umkehren, Herr Doktor, in den beiden andern Wagen gibt es auch noch allerlei zu sehen.«
»Umkehren?! Was heißt umkehren?« fragte Wille verwundert.
»Nun, wir können uns die Gegend ja mal ansehen«, erwiderte Berkoff und griff nach einem Telephon, durch das er mit dem Führer des Wagens sprach. Wille glaubte etwas wie eine Bewegung zu spüren und mußte sich einen kurzen Augenblick an der Wagenwand festhalten. Berkoff ließ die Tür aufspringen und trat, von dem Doktor gefolgt, ins Freie. Weit und breit herum beschneites Feld, soweit ihre Augen blicken konnten. Einförmig verschwammen Schnee und Himmel überall am Horizont.
»Wo ist die Station?« fragte Wille.
Berkoff deutete auf eine Stelle des Horizonts. »Den Funkmast werden Sie vielleicht noch sehen können, Herr Doktor, wenn Sie gute Augen haben. Wir sind etwa zwanzig Kilometer von der Station entfernt.«
»Zwanzig Kilometer, aber ... aber ...« Dr. Wille fing an zu stottern. Berkoff kam ihm zu Hilfe.
»Die Zeit vergeht schneller, als man denkt, mein verehrter Herr Doktor, wenn man sich so nett unterhält, wie wir es eben getan haben. Wir sind 40 Minuten unterwegs gewesen.«
»40 Minuten ...«, Wille sah auf die Uhr, »Herrgott ja, Sie haben recht ... zwanzig Kilometer ... in 40 Minuten ... wir sind mit 30 Stundenkilometern gefahren, ohne daß ich etwas davon gemerkt habe ... wie wäre das möglich ... und die Instrumente ... die Instrumente haben während der Fahrt gearbeitet und richtig gezeigt ... unbegreiflich ... ganz unbegreiflich, Herr Berkoff.«
Ein leichtes Lächeln ging über die Züge des Ingenieurs.
»Ein kleiner Trick, Herr Dr. Wille. Der rotierende Teil des Induktors ist mit einem Kreiselkompaß gekuppelt. Sie ließen mich noch nicht dazukommen, Ihnen auch diesen Teil der Anlage zu zeigen, aber die Wirkung dürfte Ihnen auch so ohne weiteres einleuchten. Der Wagen kann in beliebiger Richtung fahren, der Induktor wird durch den Kompaß doch stets so gesteuert, daß er seine Richtung im Raum unverändert beibehält und die drei Komponenten richtig anzeigt.«
Wille wollte etwas erwidern, aber Berkoff unterbrach ihn. »Brr, Herr Doktor! Es ist schandbar kalt hier draußen. Kommen Sie zurück in den Wagen.«
Drinnen hatte Wille eine Weile mit seiner Brille zu tun, die sich in dem gewärmten Raum sofort beschlug. »Aber jetzt merke ich doch«, meinte er, während er die Gläser putzte, »daß wir fahren. Die Erschütterungen sind deutlich zu spüren.«
Berkoff lachte. »Wir fahren in der Tat, Herr Doktor, und zwar ...«, er deutete auf ein Meßinstrument an der Wand, »... mit etwas mehr als fünfzig Stundenkilometern. Das wäre für ein Raupenfahrzeug selbst auf guter Straße eine sehr anständige Geschwindigkeit. Hier kommt noch hinzu, daß wir über freies Feld kutschieren. Immerhin, Sie sehen, Herr Doktor, daß man ganz nette Landpartien mit unserm Vehikel machen kann. In zehn Stunden können Sie fünfhundert Kilometer damit zurücklegen, wenn Sie es eilig haben.«
Dr. Wille schüttelte den Kopf und redete allerlei von exakten wissenschaftlichen Messungen und Langsamfahren, bevor ihn Berkoff endlich zu den andern Instrumenten bringen und ihm die übrigen Einrichtungen des Wagens erklären konnte, und er war noch längst nicht damit zu Ende, als der Wagen schon wieder auf dem Hofe der Station anhielt.
Weitere Stunden verstrichen bei der Besichtigung der beiden andern Wagen, und
als endlich das letzte Stück betrachtet und erklärt worden war, gab sich Dr.
Wille gefangen. Sein Widerspruch verstummte vor den Wundern einer
raffinierten bis in die kleinsten Einzelheiten durchdachten Technik, die ihm
hier vorgeführt wurden. In dem zweiten Gefährt befand sich ein komplettes
elektrisches Observatorium. Ein Hebelgriff genügte hier, und Motorkraft schob
das Wagendach fort und ließ drei Wagenwände auseinanderklappen, so daß die
ganze Anlage, wie es für diese Untersuchungen notwendig war, im Freien stand.
Ein anderer Hebelgriff und Fontänenmasten kurbelten sich in die Höhe und
verbanden das elektrische Potential höherer Luftschichten mit den
Kondensatoren der Anlage.
Der dritte Wagen entpuppte sich schließlich als ein Wohnwagen mit allem Komfort der Neuzeit ausgerüstet und mit Proviant auf Wochen hinaus versehen, in dem die Mitglieder der Expedition es in der antarktischen Schneewüste wohl aushalten konnten, ohne irgend etwas zu entbehren.
Dr. Wille mußte es sich selbst und den andern eingestehen, daß das Problem, die Station zu motorisieren, mit diesen drei Fahrzeugen in einer geradezu idealen Weise gelöst war.
Während der ganzen Zeit von der Ankunft von ›St 11a‹ an hatte er noch kein Wort mit Schmidt gesprochen. Jetzt nahm er ihn beim Arm und zog ihn zur Seite.
»Schmidt, alter Freund! Sie haben schon längst um alle diese Dinge gewußt.«
Der lange Schmidt brachte ein verlegenes Hüsteln hervor.
»Gestehen Sie, Schmidt, Sie haben darum gewußt.«
»Nicht um alles, Herr Wille. Ich wußte nur, daß man die Motorisierung der Station vorbereitete. Man wollte Ihnen damit eine Überraschung bereiten, sobald Sie ...«
»Sobald ich meine Einwilligung zu den Vorschlägen der Regierung gegeben habe. Sie haben recht, daß Sie mich daran erinnern, mein lieber Schmidt. Kommen Sie, wir wollen den Funkspruch zusammen aufgeben.«
*
»Hübsche Sache, Sir. Nur schade, daß Sie nicht mehr von dem Zeug gefunden haben. Das bißchen hat Ihre Reise in die Antarktis bei Gott nicht gelohnt.« Mr. Bolton sagte es, während er mit Metallstückchen von verschiedener Farbe spielte, die vor ihm auf dem Tisch lagen.
Garrison zuckte schweigend die Achseln. Bolton griff nach einem goldig blinkenden Stückchen.
»Ist ja aller Ehren wert, Mr. Garrison, was Sie aus den paar Erzbrocken, die Sie mir nach Ihrer Rückkunft zeigten, herausgeholt haben. Zehn Gewichtsprozente reines Gold, alle Wetter! Hätte ein großartiges Geschäft werden können, wenn ... ja, wenn Sie mehr davon mitgebracht hätten. Dumme Geschichte, daß die Eggerth-Leute das Nest vorher ausgenommen haben.«
Mr. Garrison wollte etwas sagen. Doch Joe Bolton ließ ihn nicht zu Worte kommen. »Well, Sir! Geschehene Dinge sind nicht mehr zu ändern. Die Eggerth-Boys haben den job und wir das Nachsehen. Strich darunter! Die Kosten für Ihre Reise in die Antarktis habe ich Ihnen à fonds perdu gegeben. Dafür gehören mir die netten glitzernden Dingerchen hier. War ein faules Geschäft diesmal, will es Ihnen aber nicht nachtragen, Garrison. Kommen Sie ruhig wieder zu mir, wenn Sie mal was Gutes an der Hand haben.«
Diese Unterhaltung fand im Hoover-Hotel in Pasadena statt, acht Tage nachdem Dr. Wille sich entschlossen hatte, das Angebot der deutschen Regierung anzunehmen.
Mr. Joe Bolton aus Frisko, mehrfacher Millionär, siebenmal ausgekochter Geschäftsmann, betrachtete das Gespräch als beendet und wollte sich erheben. Mit einer bittenden Bewegung hielt ihn Garrison zurück.
»Was wollen Sie noch, Sir? Ich glaube, wir haben uns im Augenblick nichts mehr zu sagen.«
»Doch, Mr. Bolton, doch!« Garrison stieß die Worte hastig hervor. »Es ist unmöglich, Mr. Bolton, daß die Eggerth-Leute alles Erz weggeschafft haben ... es kann nicht wahr sein ... ich habe triftige Gründe dafür, Sie müssen mich noch anhören!«
Bolton warf ihm einen erstaunten Blick zu. »Ich verstehe Sie nicht, Garrison. Sie haben mir selber erzählt, wie Sie in das Loch hineingeflogen sind, aus dem die Burschen das Erz geräumt haben. Der Fall liegt sonnenklar.«
»Etwas zu klar, Mr. Bolton! Damals, als ich im Schnee steckte und fast zu ersticken meinte, habe ich's auch geglaubt. Aber in diesen letzten Tagen, während ich auf dem Mount Wilson in meinem Laboratorium saß und das Erz analysierte, ist es mir klar geworden, daß man mich geblufft hat. Sie müssen mich anhören, Mr. Bolton!«
Bolton warf einen ungeduldigen Blick auf die Uhr. »Well, Mr. Garrison! Der Zug nach Frisko geht 15 Uhr 10. Fünfundzwanzig Minuten habe ich noch für Sie übrig. Schießen Sie los, wenn Sie noch was zu sagen haben.«
Garrison begann zu sprechen. Während der nächsten zehn Minuten redete er von jenen Stürmen und Unwetterkatastrophen, die vor rund einem halben Jahr über die südlichsten Zipfel Afrikas und Amerikas dahingebraust waren, von den alarmierenden Messungen der Erdbebenwarten, kurz von allen jenen Naturerscheinungen, die der Sturz des gewaltigen Boliden damals hervorgerufen hatte.
Mr. Bolton unterbrach ihn gelangweilt. »Mögen ganz interessante Geschichten für euch Sternwartenleute sein, aber nicht für mich, Mr. Garrison.« Wieder sah er auf die Uhr: »Ich kann Ihnen noch zehn Minuten geben, aber ich glaube, es hat nicht viel Zweck.«
»Doch! Doch!« fiel ihm Garrison lebhaft ins Wort. »Es muß auch Sie interessieren. Alle diese Naturerscheinungen beweisen unzweifelhaft, daß in der Antarktis ein riesenhafter Meteorit mit tausend ... nein mit hunderttausend ... mit Millionen Tonnen dieses wertvollen Erzes niedergestürzt ist. Ich muß blind gewesen sein, daß ich den Zusammenhang nicht schon früher erkannt habe.«
Bolton zuckte die Achseln. »Warum haben Sie diesen Meteoriten oder Boliden oder wie Sie das Ding sonst nennen mögen, denn nicht gefunden? Zu dem Zweck hatte ich Sie für mein gutes Geld an den Südpol geschickt, Mr. Garrison.«
»Weil ich geblufft worden bin, Mr. Bolton! In der nichtsnutzigsten und infamsten Weise geblufft von einem Ingenieur der Eggerth-Werke. Auf Bluff war jedes Wort von diesem Menschen von vornherein angelegt, und ich ... ich kann es nicht leugnen, Mr. Bolton, ich habe mich bluffen lassen wie ein Greenhorn.«
Garrison sprach weiter, und jetzt hörte ihm Bolton aufmerksam zu, denn alles, was mit Bluff und bluffen zusammenhing, hatte für diesen eingefleischten Pokerspieler Interesse.
»Ein Bluff, ein Riesenbluff war schon die erste Behauptung dieses Eggerth-Ingenieurs, daß der Meteorit nur hundert Kilometer von der Station entfernt niedergestürzt sei«, schrie Garrison. »Ich Narr, ich dreimal verdammter Narr, habe es ihm geglaubt, weil er sich so treuherzig auf die Beobachtungen eines Funkers der deutschen Station berief. Ha, ha!« Er schlug sich mit beiden Händen vor die Stirn, »kein Fetzen von der ganzen Station wäre bei dem andern geblieben, wenn dieser Riesenmeteor, der bis nach Afrika hin Stürme entfesselte, nur hundert Kilometer von ihr entfernt niedergefallen wäre. Wie mag dieser verfluchte Hund, dieser Berkoff, im stillen über mich gelacht haben, als er mich in eine Schneekuhle stürzen ließ und mir seine Märchen erzählte.«
Der Zug nach Frisko war längst fort, aber noch immer saß Mr. Bolton im
Hoover-Hotel und verschlang jedes Wort von dem, was Garrison weiter
vorbrachte.
»Halt! Stop!« unterbrach er ihn, als Garrison sich weitläufig über die Meßtechnik der Erdbebenwarten auslassen wollte. »Hier ist der Punkt, auf den es ankommt. Sie behaupten, Mr. Garrison, daß Sie nach den Aufzeichnungen der verschiedenen Erdbebenwarten die Stelle, wo der Bolide niederstürzte, bis auf einige Meilen genau feststellen können.«
Garrison nickte. »Jawohl, Mr. Bolton, das kann ich.«
»Sie behaupten ferner, daß Ihnen in Ihrer Eigenschaft als Mitglied des Lick-Observatoriums die Aufzeichnungen aller Erdbebenwarten zur Verfügung stehen.«
Wieder ein Nicken Garrisons. »So ist es, Mr. Bolton. Die Aufzeichnungen der amerikanischen Warten haben wir schon da, diejenigen der afrikanischen und europäischen Stationen kann ich mir schnell verschaffen.«
»Was heißt schnell?« unterbrach ihn Bolton.
»Das kommt auf die Spesen an, die Sie bewilligen. Auf dem gewöhnlichen Postwege würde es etwa anderthalb Monate dauern, wenn wir mit Funkspruch und Bildfunk arbeiten, können wir alle nötigen Unterlagen in spätestens 48 Stunden hier haben.«
»Kostenpunkt, Mr. Garrison?«
»Sagen wir tausend Dollars.«
Einen Augenblick schien Bolton zu schwanken. Dann zog er ein Scheckbuch aus der Tasche und legte es vor sich auf den Tisch. Während er langsam seinen Füllfederhalter aufschraubte, sagte er:
»Diese tausend Dollars will ich auch noch à fonds perdu in das Geschäft stecken. Gesetzt den Fall, Mr. Garrison, Sie geben mir auf Grund besagter Unterlagen genau den Ort an, wo der Bolide niederstürzte, wie gedenken Sie dann weiter zu verfahren?«
»Man müßte natürlich hinfliegen, Mr. Bolton. Man müßte ein großes leistungsfähiges Flugschiff haben, mit dem man die Stelle aufsucht und gleich beim erstenmal so viel Erz mitnimmt, daß alle bisherigen Ausgaben reichlich gedeckt sind.«
Bolton stützte das Kinn in die rechte Hand.
»Hm, Mr. Garrison. Die Sache ließe sich hören, aber die Piloten ... die Besatzung des Flugzeuges ... man müßte schon eine ganz große Maschine dafür chartern ... die würden doch den Mund nicht halten ... faul, Mr. Garrison. Mitwisser können wir bei dem Geschäft nicht gebrauchen.«
Eine Weile schwiegen beide, jeder mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt.
»Was die Eggerth-Boys konnten, sollten wir auch können«, knurrte Bolton vor sich hin.
»Im Augenblick dachte ich dasselbe, Mr. Bolton. Wir müssen ein Flugzeug mit guter automatischer Steuerung chartern; mit dem wir den Flug allein unternehmen.«
»Hm, hm!« Bolton kratzte sich nachdenklich den Schädel. »Mein kleines Sportflugzeug steuere ich seit Jahren selber, aber mit einer dieser neuen großen Lastmaschinen allein losgehen ... ich weiß doch nicht ...«
»Sie überschätzen die Schwierigkeiten, Mr. Bolton, ich habe schon am Steuer dieser großen Maschinen gesessen. Sie fliegen sich leichter als die kleinen Sportmaschinen. Schließlich könnten Sie sich ja auch noch ein paar Tage einfliegen, bevor wir auf unsere Expedition gehen ...«
Garrison merkte, wie der Millionär mit neuen Zweifeln kämpfte, und gab dem Gespräch eine andere Wendung. Mit beredten Worten malte er ihm die gewaltigen Gewinnmöglichkeiten aus, wenn es gelang, auch nur ein paar hundert Zentner des kostbaren Erzes aus der Antarktis nach Amerika zu bringen. Vor den Millionenziffern, mit denen er dabei jonglierte, schwand Boltons Widerstand dahin. Er füllte den Scheck über tausend Dollars aus, doch bevor er ihn an Garrison gab, zog er ein anderes Schriftstück aus der Brieftasche. Es war ein Vertragsentwurf, den er bereits vor jenem ersten ergebnislosen Flug Garrisons nach der Antarktis aufgesetzt hatte. In einer langen Reihe von Paragraphen waren darin die Rechte und die Pflichten der beiden Partner geregelt, und es war in Mr. Boltons Natur begründet, daß der Vertrag mehr Rechte für ihn und mehr Pflichten für Garrison enthielt. Darüber war Garrison sich auch vollkommen klar, aber wohl oder übel mußte er seinen Namen unter dies Dokument setzen, bevor er Boltons Scheck in Empfang nehmen durfte.
Der sprang jetzt auf. »Höchste Zeit, Mr. Garrison. Ich komme gerade zum nächsten Zug zurecht. Rufen Sie mich in Frisko an, sowie Sie etwas haben.« —
Mr. Bolton hatte den Raum verlassen. Garrison griff nach Stock und Hut; nachdenklich ging er durch die Straßen von Pasadena bis zur Drahtseilbahn, die ihn zur Sternwarte auf dem Mount Wilson bringen sollte.
Zwei schlichte Zeilen im Reichsanzeiger gaben amtliche Kunde von der Veränderung in der antarktischen Station. Sie befanden sich auf der Seite, die die Überschrift »Ernennungen und Beförderungen« trägt, und lauteten: »Zur besonderen Verwendung durch das Kultusministerium in den Staatsdienst übernommen Dr. Martin Wille mit dem Titel und Rang eines Ministerialdirektor; Dr. August Schmidt mit dem Titel und Rang eines Ministerialrat.«
In der Menge der anderen gleichartigen oder ähnlichen Mitteilungen gingen diese beiden Zeilen für die breite Öffentlichkeit spurlos unter. Nur im Kultusministerium, das sie ja besonders angingen, wurden sie gelesen und erregten zunächst einige Verwunderung. Was waren denn das für unbekannte Outsider, die das Ministerium so plötzlich mit nicht zu verachtenden Beamtenqualitäten in den Staatsdienst übernahm? Schmidt ... August Schmidt? Ein Sammelname, aus dem niemand etwas zu machen wußte. Dr. Martin Wille? Leute in den Büros des Ministeriums, die sich für jede Ernennung interessierten, wälzten allerlei Nachschlagewerke und konnten auch nichts Rechtes entdecken.
»Dr. Martin Wille, Privatgelehrter. Arbeitet auf geophysikalischem Gebiet. Unternahm im vergangenen Jahr eine Expedition in die Antarktis«, stand in einem dieser Handbücher zu lesen und machte das Kopfschütteln noch größer. Bis es dann von oben her durchsickerte, und zwar mit einer gewissen Absichtlichkeit durchsickerte, daß dieser bisherige simple Privatgelehrte tatsächlich mit dem neuernannten Ministerialdirektor identisch sei und daß die nachgeordneten Stellen ihre verehrlichen Köpfe und Schnäbel nicht unnötig anstrengen möchten. Der Wink war deutlich genug und wirkte.
Als Hein Eggerth mit ›St 8‹ bei der antarktischen Station
landete, fand er das Nest ziemlich leer. Nur Lorenzen, dem er seine Ankunft
durch Funkspruch gemeldet hatte, stand auf dem Hof und begrüßte ihn, als er
das Schiff verließ.
»Guten Tag, Lorenzen. Alles wohl und munter? Wo stecken denn die andern?«
»Ausgeflogen, Herr Eggerth. Sie sind alle mit den neuen Wagen weg, da nach Süden runter. Sogar Hagemann ist mit. Ich muß mir mein Futter hier allein kochen und auch noch für den ganzen Maschinenkram sorgen. Ist etwas viel für einen einzelnen Mann.«
Hein Eggerth lachte. »Na, Lorenzen, Sie sehen nicht danach aus, als ob Sie sich hier totarbeiten. Haben Sie eine Ahnung, wann die Herrschaften von ihrem Ausflug zurückzukehren gedenken?«
»Das kann lange dauern, Herr Eggerth. Die Herren sind ungefähr 400 Kilometer von der Station ab. Gleich nachdem ich Ihren Funkspruch erhielt, habe ich die Verbindung mit Herrn Wille aufgenommen. Ich habe ihm Ihre bevorstehende Ankunft gemeldet und mir den Standort der Wagen geben lassen. Hier ist er.« Er zog einen Schreibblock aus der Tasche und gab ihn Hein Eggerth. Der überflog die Zahlen, die darauf notiert waren. »74 Grad 14 Minuten Süd, 150 Grad 23 Minuten Ost.« Währenddem war Berkoff aus dem Schiff gekommen. Über die Schulter Hein Eggerths hinweg las er die Zahlen mit.
»Ja, dann helpt dat nix, Hein. Da wollen wir den Herrschaften mal schleunigst nachfliegen«, meinte er, während Eggerth den Schreibblock in seine Brusttasche steckte. »Wer besorgt denn übrigens die Funkerei bei der Expedition, Lorenzen?«
»Der Rudi Wille, Herr Berkoff. Der Junge hat sich zu einem tadellosen Funker entwickelt. Alle Achtung, wie der jetzt morsen kann.«
»Auf welcher Welle?« unterbrach ihn Berkoff.
»Auf unserer alten Werkwelle, Herr Berkoff. Sie können ihn jederzeit erreichen. Er hat sich einen Wecker an seinen Apparat angebaut, der jeden Anruf auf der alten Welle sicher meldet.«
»Danke schön, Lorenzen, das wollen wir mal gleich versuchen«, sagte Berkoff und ging zusammen mit Hein Eggerth in das Schiff zurück. Gleich danach begann dessen Hubschraube zu arbeiten. ›St 8‹ stieg wieder auf und ließ dabei seine Antenne aus.
Im Mittelraum des Flugschiffes erhob sich bei der Rückkehr Eggerths ein
älterer Herr aus einem Sessel.
»Nun, Herr Eggerth, wie steht's?«
»Nicht ungünstig, Herr Ministerialdirektor. Wille und Schmidt sind mit den Motorwagen unterwegs. Sie befinden sich gegenwärtig 400 Kilometer südlich von hier.«
»Ah, das ist gut, Herr Eggerth. 400 Kilometer, das läßt sich schon hören. —Noch 300 Kilometer mehr, und wir können in unserem Sinne vorgehen.«
Ministerialdirektor Reute setzte sich wieder, Hein Eggerth nahm ihm gegenüber Platz.
»Wir sind im Begriff, zu den Herren hinzufliegen, Herr Ministerialdirektor. Bei etwas Glück können wir sie in einer halben Stunde erreichen. Dann werden wir Näheres hören.
Wenn ich bedenke, wie hartnäckig der gute Dr. Wille früher an ein und derselben Stelle klebte, kann ich es mir kaum erklären, wie er jetzt für eine derartige ausgedehnte Expedition zu haben war. Der lange Schmidt muß mit Engelszungen geredet haben, um ihn dafür zu gewinnen. Aber ob es möglich sein wird, ihn noch 300 Kilometer nach Süden vorstoßen zu lassen, das wage ich nicht zu entscheiden, so erwünscht und nötig es auch für unsere Unternehmung wäre.«
Der Ministerialdirektor wollte etwas erwidern, als Berkoff in den Raum kam.
»Verzeihen Sie die Störung, Herr Ministerialdirektor. Wir haben Verbindung mit Dr. Wille. Aus den Funksprüchen geht unzweifelhaft hervor, daß die Herren von den neuen Arbeitsmöglichkeiten, die ihnen die motorisierte Station bietet, voll befriedigt sind.«
»Beide oder nur einer?« fragte Reute.
»Alle beide«, beeilte sich Berkoff zu antworten, »Dr. Schmidt war ja stets für eine Ausdehnung der Messungen über ein größeres Gebiet. Aber auch Dr. Wille scheint durch die neuen Erkenntnisse, die er bei dieser Expedition gewonnen hat, gründlich bekehrt zu sein. Ursprünglich sollte die Fahrt nur über etwa 200 Kilometer gehen, aber dann war es gerade Wille, der sie immer weiter ausdehnte und auch jetzt noch nicht recht Lust hat, umzukehren.«
Hein Eggerth und der Ministerialdirektor warfen sich einen Blick zu. Sie hatten den gleichen Gedanken, daß man den so plötzlich erwachten Wandertrieb Willes in jeder Weise fördern müsse. Berkoff wollte den Raum verlassen, als ihn Hein Eggerth fragte: »Wurde sonst noch etwas von Bedeutung gefunkt?«
»Eigentlich kaum, nur das vielleicht, daß Dr. Wille seine alten Theorien über die Bahnen der Sonnenelektronen auf Grund der neuen Messungen stark umgearbeitet hat. Er hat darüber bereits eine längere Arbeit geschrieben. Wir sollen sie nach Deutschland mitnehmen und dort für eine geeignete Veröffentlichung Sorge tragen.«
»Hm, hm. Der gute Dr. Wille verlangt nachgerade allerlei von uns«, meinte Eggerth. »Jetzt sollen wir auch noch für die Veröffentlichung seiner Arbeiten aufkommen.«
»Bitte, Herr Eggerth, lassen Sie das meine Sorge sein«, fiel ihm der Ministerialdirektor ins Wort. »Ich werde dafür sorgen, daß diese Arbeit schnellstens und in wirksamster Form veröffentlicht wird. Wir können gar nicht genug dafür tun, daß ...«
Er brach den Satz plötzlich ab und warf Hein Eggerth einen Blick zu, den der verstand.
»Lieber Georg, es ist gut. Wenn Ihr neue Funksprüche habt, gib uns bitte Bescheid.«
Erst als Berkoff draußen war, führte der Ministerialrat seinen Satz zu Ende.
»Wir können gar nicht genug tun, um der internationalen Gelehrtenwelt die große wissenschaftliche Bedeutung der Willeschen Expedition vor Augen zu führen.«
Hein Eggerth nickte. »Ich verstehe vollkommen, und ich glaube auch, daß es an Stoff dafür nicht fehlen wird. Ich weiß, daß Dr. Schmidt schon seit Monaten eine druckreife Arbeit vom Umfang eines besseren Folianten liegen hat. Von Wille dürfte nach seiner Umstellung sicher auch noch mancherlei an Veröffentlichungen zu erwarten sein.«
»Sehr gut, sehr gut, Herr Eggerth.« Reute rieb sich vergnügt die Hände. »Je mehr, desto besser. Gerade jetzt können wir gar nicht genug von derartigen Berichten über die bisherigen Leistungen der Expedition bekommen. Nur auf diese Weise wird das Interesse, welches das Reich plötzlich an der Expedition nimmt, im Ausland keinen Verdacht erregen. Wir werden den beiden Herren Druckerschwärze in unbegrenzter Menge zur Verfügung stellen.«
Das Trommeln der Motoren wurde schwächer, hörte ganz auf. Im Gleitflug ging
›St 8‹ aus der Stratosphäre in tiefere Luftschichten hinab und
beschrieb dabei einen weiten Kreis. Ein neues Donnern und Dröhnen, ein
Zeichen, daß die Hubschraube ihre Arbeit begonnen hatte. Hein Eggerth trat
zusammen mit dem Ministerialdirektor an das Fenster. In immer noch etwa 1000
Meter Höhe hing das Stratosphärenschiff in der Luft. Endlos dehnte sich unter
ihm die verschneite Ebene, nur hin und wieder von kleinen Höhenzügen
unterbrochen.
Gerade unter ihnen auf dem Schnee drei schwarze Punkte. Ungefähr wie drei Fliegen auf einer Tischdecke sahen die mächtigen Kraftwagen aus dieser Höhe aus. Nur allmählich gewannen sie an Größe, während das Stratosphärenschiff tiefer sank. Ein leichtes Rucken und Schüttern, es setzte auf dem Schneefeld auf. Durch das Fenster beobachtete Hein Eggerth, wie aus dem einen der drei Fahrzeuge, dem Wohnwagen, eine Gestalt kletterte und durch den Schnee auf das Flugschiff zu trabte.
»Nanu!? Nur der brave Hagemann stellt sich zum Empfang ein«, murmelte er vor sich hin, während er zusammen mit dem Ministerialdirektor und Berkoff über die Laufbrücke aus dem Flugschiff ins Freie ging.
»Tag, Hagemann«, begrüßte er ihn. »Wo stecken die andern? Herr Dr. Wille weiß doch, daß wir ihn besuchen wollen?«
Hagemann trat im Schnee von einem Fuß auf den andern und druckste eine Weile, bevor er antwortete.
»Herr Dr. Wille und Herr Dr. Schmidt sitzen seit heute früh in dem elektrischen Wagen zusammen und lassen keinen rein. Vor drei Stunden wollte ich sie zum Essen holen, da haben sie mich einfach rausgeschmissen. Schade um den schönen Labskaus, den ich für heute gemacht habe.«
Hein Eggerth wandte sich zu Reute. »Darf ich Ihnen hier Herrn Hagemann vorstellen, Herr Ministerialdirektor, seines Zeichens Mechaniker, außerdem Küchenchef der Expedition. Alles in allem ein Mann, dessen Bedeutung für das Wohl und Wehe der Expedition nicht zu unterschätzen ist.«
Das Wort »Ministerialdirektor« gab Hagemann einen Ruck, er machte eine formvollendete Verbeugung.
»Freue mich über die Ehre, Herrn Ministerialdirektor kennenzulernen. Hagemann ist mein Name. Aber ...« er wandte sich an Eggerth, »wie Sie die Herren aus ihrem Wagen herauskriegen wollen, weiß ich nicht. Wollen Sie nicht lieber erst etwas essen?«
Eggerth nickte. »Ich glaube, Herr Ministerialdirektor, der Vorschlag hat was für sich. Wie wäre es, wenn wir uns erst gemütlich zu Tische setzten und die offizielle Verhandlung noch etwas verschieben?«
»Meinetwegen«, erwiderte Reute, »eine solide Mahlzeit käme mir nicht ungelegen.«
Von Hagemann geleitet gingen sie in den Wohnwagen. Ein behaglicher Raum mit bequemen Klubsesseln ausgestattet, nahm sie auf, und dann lief Hagemann eifrig zwischen der Küche und diesem Raum hin und her und begann aufzutafeln. Er wollte zeigen, was seine Küche zu bieten vermochte.
»Alle Wetter! Herr Eggerth«, sagte Reute, während er genießerisch eine Ochsenschwanzsuppe löffelte, »dieser Mann, dieser Hagemann verdiente Küchenchef im Ritz-Carlton zu sein.«
»Warten wir erst einmal ab, wie ihm der Labskaus geraten ist«, warf Berkoff ein.
Aber der Labskaus kam nicht. Anstatt dessen stellte Hagemann ein Chateaubriand auf den Tisch, das köstlich duftete und noch köstlicher schmeckte, und der Burgunder, den er dazu einschenkte, war für sich ein Gedicht.
»Auch in der Antarktis läßt sich's leben«, sagte Reute, als er zum zweiten Male von dem Fleisch auf seinen Teller nahm.
»In dem Wohnwagen hier bestimmt so gut wie in einem besseren Hotel«, bestätigte Berkoff die Meinung Reutes. »Sie müßten sich später einmal die elektrische Küche und die Schlafräume ansehen«, fuhr er fort, »das sind Leistungen, auf die unsere Technik stolz sein kann.«
Während Hagemann den Kaffee servierte und Zigarren anbot, stand Eggerth auf. »Entschuldigen Sie mich einen Augenblick, meine Herren.« Er verließ den Raum. Mit langen Schritten stampfte er durch den Schnee zu dem zweiten Wagen hin, während er in seiner Westentasche nach einem Schlüssel fingerte. Mochten die beiden Gelehrten sich immerhin einschließen, er hatte ja ein Duplikat des Wagenschlüssels bei sich. Mochten sie den biederen Hagemann auch kurzerhand hinausgeworfen haben, bei ihm sollte das ihnen nicht so ohne weiteres gelingen. Er wollte ihnen die Wichtigkeit dieser Stunde schon so klarmachen, daß sie ihre wissenschaftlichen Marotten darüber fahren ließen.
Jetzt hatte er den Schlüssel glücklich herausgefischt und war bis auf wenige Schritte an den Wagen herangekommen, als dessen Tür plötzlich von selber aufsprang.
In ihrem Rahmen erschien Dr. Wille heftig gestikulierend, das Gesicht gerötet, das Haar in Unordnung, als ob er sich wiederholt mit den Fingern hindurchgefahren hätte.
»Reden Sie nicht weiter, Schmidt! Hat gar keinen Zweck mehr. Die Geschichte ist absolut klar, kommen Sie, wir wollen essen gehen.«
Er schickte sich an, aus dem Wagen zu steigen, als der lange Schmidt ihn zurückhielt.
»Vergessen Sie Ihren Pelz nicht, Herr Wille. Es ist etwas kühl draußen.« Mit sanfter Gewalt zwang er ihn in den Pelz, bevor er ihn losließ. Dann stürmte Dr. Wille ins Freie und stand plötzlich vor Hein Eggerth. Erst jetzt bemerkte er ihn.
»Sie hier, Herr Eggerth? Ach ja! Sie gaben ja einen Funkspruch, daß Sie kommen wollten. Großartig, daß Sie da sind. Wir haben neue Entdeckungen gemacht. Ich sage Ihnen, Herr Eggerth, die Welt wird staunen. Das muß ich Ihnen gleich erzählen.«
»Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über«, dachte Hein Eggerth bei sich, während Dr. Wille ihn mit einer Flut von neuen Theorien und Beobachtungen überschüttete. Soviel er aus Willes Darlegungen zu erkennen vermochte, handelte es sich um eine Schar von logarithmischen Spiralen, auf denen der Elektronenstrom von der Sonne her besonders kräftig auf den Erdball einfiel.
Bedächtig hatte Schmidt inzwischen die Wagentür verschlossen und kam hinter den beiden her. Es fiel ihm nicht schwer, sie einzuholen, denn eben jetzt hatte Dr. Wille sein Opfer bei einem Rockknopf gefaßt und hielt ihn daran fest, während er unermüdlich weiterdozierte. Hein Eggerth benutzte die Ankunft Schmidts, um seinen Knopf aus Willes Fingern zu befreien.
»Ungeheuer interessant, Herr Schmidt, was Herr Dr. Wille mir hier eben auseinandergesetzt hat. Ich glaube aber, Sie werden Ihre Expedition noch weiter ausdehnen müssen, um die neuen Theorien stichhaltig zu erweisen.«
»Ganz gewiß, Herr Eggerth. Dann wird es sich zeigen, daß die Spiralen nicht logarithmisch, sondern exponential sind.«
»Unsinn, Schmidt!« brauste Wille auf. »Müssen Sie mir denn immer Opposition machen?«
Hein Eggerth hatte das Gefühl, daß er hier anfrieren würde, wenn er dem Disput der beiden streitbaren Doktoren nicht schleunigst ein Ende bereitete.
»Lassen wir jetzt die wissenschaftlichen Dinge, meine Herren«, sagte er sehr entschieden. »Ich bin nicht allein hier, Herr Ministerialdirektor Reute aus dem Finanzministerium ist mit uns hierhergekommen, um Sie als Staatsbeamte in Pflicht und Eid zu nehmen.«
Verschieden wirkten seine Worte auf die beiden. Der lange dürre Schmidt wurde noch um einige Grade hölzerner und steifer als gewöhnlich. Dagegen bedurfte es noch einiger Anstrengungen, bis Wille seine Theorien beiseite schob und sich auf die neue Situation einstellte.
»Ruhe, Fassung, Würde, lieber Doktor!« flüsterte ihm Eggerth lachend ins Ohr, »nehmen Sie sich ein Beispiel an Schmidt. Der ist schon jetzt jeder Zoll ein Ministerialrat.«—
Sie kamen in den Speiseraum des Wohnwagens und wurden Reute, der sie noch nicht persönlich kannte, vorgestellt. Lächelnd sah der Ministerialdirektor zu, wie Schmidt und Wille sich erst einmal kräftig über die Speisen hermachten, lächelnd hörte er die Erklärung Eggerths an, daß die beiden gelehrten Häuser sich zwölf Stunden hindurch über ein wissenschaftliches Thema verbiestert hätten, ohne dazwischen Nahrung zu sich zu nehmen. »Mit gesättigten Leuten ist besser zu verhandeln als mit hungrigen«, dachte er im stillen.
Dann aber bei Kaffee und Zigarren kam die Unterhaltung in Gang. Sie ging schnell vonstatten, weil Reute die großzügigen Bedingungen der Deutschen Regierung sofort klipp und klar auf den Tisch legte: Übernahme der bisherigen Privatexpedition Willes durch das Reich in Form eines antarktischen deutschen Institutes. Ersatz der bisherigen, von Dr. Wille persönlich getragenen Unkosten durch die Überweisung einer Summe, die ihn voll entschädigte. Leistung der weiteren Ausgaben nach einem Etat, den Reute bis in alle Einzelheiten ausgearbeitet mitgebracht hatte. Verwundert blätterte Wille ihn durch. Er wußte ja nicht, wieviel Zahlenmaterial sein Assistent zu dieser Aufstellung geliefert hatte. Schließlich dann die Übernahme der beiden Herren Wille und Schmidt in den Reichsdienst. Hier stutzte Wille. Hatte Schmidt nicht einmal von einer Stellung als Reichskommissar gesprochen? Er wollte etwas sagen. Schmidt stieß ihn an, winkte ihm zu schweigen.
Noch einige Paragraphen des Vertrages, die das Verhältnis der übrigen Mitglieder der Station betrafen, verlas Reute und fragte dann: »Sind Sie mit alledem, was ich verlesen habe, einverstanden, meine Herren?«
Wille nickte. Schmidt stieß ein ›Ja‹ heraus, als ob er vor dem Standesbeamten stünde und getraut werden sollte.
»Dann bitte ich Sie, Ihre Namen unter den Vertrag zu setzen ... und nun, meine Herren«, fuhr er fort, als die Namen auf dem Papier standen, »... übergebe ich Ihnen Ihre Bestallungsurkunden.«
Während er es sagte, überreichte er den beiden Doktoren zwei Dokumente, in denen in kalligraphischer Ausführung ihre neuen Titel und Würden zu lesen waren. Doch sie kamen nicht dazu, lange darin zu studieren, denn nun bat der Ministerialdirektor sie, sich zu erheben, und ließ sie die Eidesformel nachsprechen, durch die sie sich verpflichteten, von jetzt an ihr ganzes Wirken und alle ihre Kräfte in den Dienst des Reiches zu stellen.
Ein Handschlag danach und der Akt war beendet. ›Es ist wirklich wie bei einer Trauung, wo aus dem Fräulein plötzlich eine gnädige Frau wird‹, mußte Berkoff bei sich denken, als gleich nach vollzogenem Handschlag der Ministerialdirektor den langen Schmidt als ›Herr Ministerialrat‹ anredete und zu Dr. Wille sogar ›lieber Kollege‹ sagte.
Dann saßen sie wieder zu fünft am Tisch. Eggerth zog Hagemann beiseite und flüsterte eine Weile mit ihm. Der verschwand und kam nach kurzer Zeit mit einem großen Packen unter dem Arm wieder.
»Ich danke Ihnen, Hagemann, Sie können wieder gehen«, sagte Hein Eggerth, während er ihm den Ballen abnahm. Kaum hatte sich die Tür hinter ihm geschlossen, als Reute das frühere Gespräch wieder aufnahm.
»Ja, mein lieber Kollege, Ihre Expedition ist nun offiziell eine Unternehmung des Reiches geworden. Wie Sie aus Ihrem Vertrag ersehen haben, rangiert das deutsche antarktische Institut parallel mit den Kaiser-Wilhelm-Instituten. Nur ein Unterschied ist dabei. Das neue Institut befindet sich ... die Art seiner Forschungen bedingt es ja ... außerhalb der Reichsgrenzen im Niemandsland der Antarktis. Das Institut vertritt hier das Deutsche Reich. Es muß deshalb die Reichsflagge zeigen.«
Während der letzten Worte Reutes hatte sich Hein Eggerth daran gemacht, den Ballen aufzuwickeln. Eine neue große Reichsflagge kam daraus zum Vorschein.
»Wollen wir sie hissen, Herr Ministerialdirektor?«
Reute nickte. »Ja, Herr Eggerth, aber gleichzeitig einen Funkspruch nach Berlin absenden, daß das Reich die frühere Expedition Wille als Reichsinstitut übernommen hat.« Er griff nach Bleistift und Papier und entwarf eine Depesche. Dann gingen sie zu dem zweiten Wagen, bei dem Hagemann von Eggerth instruiert schon wartete. Langsam stieg aus dem mächtigen Bau des Kraftwagens ein Mast in die Höhe. An seiner Spitze nahm er die Reichsflagge mit. Flatternd wehte ihr Tuch im Winde, von den Strahlen der tief am Horizont stehenden Polarsonne beleuchtet.
Hein Eggerth ließ sich von Reute die Depesche für Berlin geben. Während die übrigen zu dem Wohnwagen zurückkehrten, ging er damit zu dem dritten Wagen, in dem Rudi Wille sich mit seiner Radioanlage häuslich eingerichtet hatte. Als er hineinkam, tönte ihm das Klappern der Morsetaste entgegen. Rudi hockte gebückt vor seinen Apparaten, die Kopfhörer an den Ohren, völlig in seine Arbeit vertieft, so daß er den eintretenden Eggerth gar nicht merkte. Der ließ ihn eine Weile gewähren, dann trat er näher und legte Rudi die Hand auf die Schulter. Der blickte nur einen Moment auf, er hatte seine Station inzwischen schon wieder auf Empfang umgeschaltet und notierte hastig mit, was er hörte. Mit einer kurzen Bewegung schob er Hein Eggerth ein paar beschriebene Blätter hin ... Der überflog sie, behielt sie in der Hand und verließ mit ihnen den Funkraum.
SOS-Rufe aus einem amerikanischen Flugzeug. ›St 8‹ eilt zu Hilfe. Garrison und Bolton dicht am Erfrieren. ›St 8‹ nimmt sie und ihr Sternenerz auf. Hein Eggerth hat eine Idee. Garrison und Bolton erwachen auf der Robinsoninsel.
»Nun, Herr Eggerth«, fragte Reute, als Hein in den Wohnwagen kam, »ist unser Funkspruch expediert?«
»Noch nicht, Herr Ministerialdirektor, die Station war anderweitig besetzt.«
Ein kurzes Befremden zeigte sich auf Reutes Zügen.
»Oh, das ist bedauerlich, Herr Eggerth. Es handelt sich hier um eine Staatsdepesche, die natürlich jedem Privatfunk vorgeht. Daran werden Sie sich gewöhnen müssen, meine Herren, nachdem Ihre Expedition ein Reichsunternehmen geworden ist.«
Eggerth setzte sich an den Tisch und breitete die Blätter, die er von Rudi erhalten hatte, vor sich aus. Ohne weiter auf den Vorwurf Reutes einzugehen, sagte er: »Hören Sie bitte zu, meine Herren. ›Funkspruch, aufgenommen 15 Uhr 16 Greenwichzeit. SOS-Ruf von ›W 16‹. Amerikanisches Flugzeug ›W 16‹ aus Treibstoffmangel 300 Kilometer südlich von hier notgelandet, bei Landung havariert. An Bord zwei amerikanische Bürger, Garrison und Bolton. Erbitten dringend Hilfe von Station Wille.‹«
Schon bei den ersten Worten, die Hein Eggerth verlas, hörten die Anwesenden aufmerksam zu. Sie wußten ja alle, daß ein SOS-Ruf jeder Staatsdepesche voranging. Als der Name ›Garrison‹ fiel, räusperte sich der Ministerialdirektor sehr merklich. Hein Eggerth legte das erste Blatt beiseite, um zum zweiten zu greifen, als Reute fragte:
»Garrison ... Mr. Garrison ... da war meines Wissens doch ein Mr. Garrison in der Station am Pol, den Sie, Herr Berkoff, mit nach Deutschland nahmen.«
»Ein Mr. James Garrison aus Pasadena. Jawohl, Herr Ministerialdirektor. Wenn's derselbe ist, wäre es nicht sehr erfreulich.«
Hein Eggerth warf ihm einen Blick zu, der ihn schweigen ließ, und nahm das nächste Telegrammblatt vor. Was er von ihm und den folgenden Blättern las, ließ zur Genüge erkennen, daß die beiden Amerikaner sich in einer sehr üblen Lage befanden. Bei der Notlandung auf unebenem Gelände war das Fahrgestell ihrer Maschine so vollkommen zerstört worden, daß an einen Start, auch wenn sie neuen Treibstoff erhielten, nicht zu denken war. Außerdem drohte ihnen die Polarkälte verhängnisvoll zu werden. Von dem Augenblick an, da die Motoren des Flugzeuges stillstanden und die Heizung nicht mehr arbeitete, drang die Polarkälte unaufhaltsam durch die metallischen Wände in das Innere des Flugzeuges.
Hein Eggerth war mit seiner Vorlesung zu Ende, als Rudi in den Raum trat. Er brachte noch ein Blatt, das er Eggerth gab. Nach einem kurzen Augenblick sagte er: »Die Verbindung ist abgerissen, der Sender der Amerikaner arbeitet nicht mehr. Es hat den Anschein, als ob ihnen die Akkumulatoren eingefroren sind ...«
Reute stand auf.
»Ich glaube, Herr Eggerth, es ist Christenpflicht, daß Sie sich sofort mit ›St 8‹ aufmachen und den verunglückten Amerikanern zu Hilfe eilen. Nehmen Sie bitte auf meine Person gar keine Rücksicht«, fuhr er fort, als Hein Eggerth etwas erwidern wollte. »Je eher Sie das amerikanische Flugzeug finden, um so besser wird es sein. Ich fürchte, es geht hier um die Minuten.«
Kurz darauf stieg ›St 8‹ auf und jagte in südlicher Richtung davon, um die Suche nach den Amerikanern aufzunehmen.
Reute wandte sich an Dr. Wille.
»Ich bitte Sie nun, Kollege, für die schleunigste Erledigung dieser Staatsdepesche Sorge zu tragen und ferner nach Bitterfeld zu funken, daß ein Stratosphärenschiff hierher kommt und mich an Bord nimmt.«
Die Unternehmung der Herren James Garrison und Joe Bolton ließ sich anfangs recht aussichtsvoll an. Aus den Aufzeichnungen der verschiedenen Erdbebenwarten gelang es Garrison, die Aufschlagsstelle des Boliden mit einer Genauigkeit zu ermitteln, die Professor Eggerth und seinen Freunden wahrscheinlich schlaflose Nächte bereitet haben würde, wenn sie darum gewußt hätten.
Gleich danach eilten die beiden Amerikaner unter Benutzung der australischen Luftlinie nach Adelaide, wo ihnen das Glück zweimal hold war. Es gelang Bolton für einen verhältnismäßig billigen Preis ein gutes schweres Flugzeug der Type ›W 16‹ zu erwerben, und sie fanden überdies einen Walfischfänger, der gerade von Adelaide nach dem Roß-Meer ausfahren wollte und sie mitsamt ihrem Flugzeug und einer gehörigen Menge Reservebenzol bis zum 75. Grad südlicher Breite mitnahm.
Bis dahin klappte alles über Erwarten gut. Das Flugzeug hatte Treibstoff für rund 4000 Kilometer an Bord. Sie konnten also mit voller Sicherheit einen Flug zu der von Garrison ermittelten Stelle unternehmen und danach zu dem Walfischfänger oder wenn es ihnen anders besser paßte, auch zu der Willeschen Station zurückfliegen. Ohne Schwierigkeiten erreichte ihre Maschine Süd-Viktorialand und steuerte weiter auf das von Garrison angegebene Ziel zu. Bei klarem, sonnigem Wetter strich das Flugzeug in etwa 300 Metern Höhe dahin, als ein Glitzern und Blinken auf dem Boden Bolton veranlaßte, trotz heftigen Widerspruches von seiten Garrisons niederzugehen. Eine Anzahl großer Brocken jenes schweren fremdartigen Erzes im Gesamtgewicht von gut drei Zentnern waren es, die Bolton gesehen hatte und die er jetzt in das Flugzeug schleppte, obwohl ihm Garrison das Törichte und Überflüssige seiner Handlungsweise sehr deutlich vorhielt.
»Ah bah, Garrison!« wies er dessen Einwände kurzweg ab, »was wir haben, haben wir. Einige 20 000 Dollar dürfte der Kram doch wert sein.«
»Sie sind ein Narr, Bolton«, schrie Garrison erbittert, »nur noch 300 Kilometer weiter nach Süden und Sie können so viel von dem Zeug in das Schiff packen, wie es zu tragen vermag. Schade um jede Viertelstunde, die wir hier verlieren.«
Einen Augenblick schaute sich Bolton noch suchend um, ob ihm irgendein Erzbrocken entgangen wäre, dann folgte er Garrison wieder in das Flugschiff und jetzt nahm dieser den Platz am Steuer ein, um alle weiteren Zwischenlandungen zu verhindern. Während ›W 16‹ wieder aufstieg, beschäftigte sich Bolton damit, das gefundene Erz in eine der vielen Kisten zu verpacken, die er vorsichtigerweise von Adelaide mitgenommen hatte. Eben war er damit fertig, als er aufhorchte. Das Trommeln der Motoren ließ plötzlich nach, verstummte ganz. Er sprang auf und eilte nach vorn in den Führerstand. Dort arbeitete Garrison verzweifelt an allen möglichen Hebeln und Schaltern, aber die Motorkraft kam nicht wieder. Unaufhaltsam ging ›W 16‹ im Gleitflug zu Boden.
Boltons Blick irrte über die Apparatenwand und blieb dann an einem Skalenzeiger haften.
»Kein Treibstoff, Garrison? Wir haben keinen Treibstoff mehr?« schrie er Garrison in die Ohren. Ein Krachen und Splittern mischte sich in seine letzten Worte. In hartem, jähem Stoß setzte die Maschine auf, unter der Wucht des Aufpralles ging das Fahrgestell in Trümmer.
So heftig war der Stoß, daß Bolton zu Boden geschleudert wurde, Garrison sich mit Mühe in seinem Sessel hielt. Lange Sekunden dauerte es, bis die beiden wieder klar zu denken vermochten.
Fast mechanisch wiederholte Bolton seine letzten Worte: »Keinen Treibstoff, Garrison, wir haben keinen Treibstoff mehr?«
»Unmöglich, Bolton. Wir müssen noch für mehr als 3000 Kilometer haben.« Sein Blick folgte der Hand Boltons. Der Zeiger der Benzinuhr stand auf Null. Ein kurzes Hin- und Herreden, dann spannte Garrison eine Notantenne und machte sich an der Radioanlage zu schaffen. Die Akkumulatoren für den Bordsender waren glücklicherweise voll geladen und von seinem Aufenthalt in Willes Station her kannte Garrison die dortige Senderwelle. So kam eine Funkverbindung zustande, zwar nicht mit der festen Station, weil Lorenzen zu dieser Stunde gerade mit der Zubereitung seiner Mahlzeit beschäftigt war, wohl aber mit der motorisierten Station, in der Rudi Wille getreulich am Empfänger saß. Hin und her flogen die Funksprüche von Antenne zu Antenne. Sie brachten das Versprechen schneller Hilfeleistung von seiten der Deutschen, dann aber wurde die Verbindung schwach, immer schwächer und riß schließlich ganz ab.
Vergeblich fingerten die beiden Amerikaner an ihrer Apparatur herum. Nur zu deutlich zeigte ihnen das Amperemeter, daß weder in ihrem Sender noch in ihrem Empfänger Strom vorhanden war, und gleichzeitig merkten sie dabei, daß ihre Finger steif wurden, daß sie beide zitterten. Die Kälte, schon seit geraumer Zeit stark fühlbar, war bis zur Unerträglichkeit gestiegen. Fröstelnd suchten sie Mäntel und Decken zusammen, hüllten sich darin ein, suchten sich durch allerlei Bewegungen wieder zu erwärmen. Es war höchste Zeit, daß sie es taten, denn das Thermometer im Führerstand stand auf 20 Grad unter Null.
»Wenn sie uns nicht bald finden, Bolton«, sagte Garrison zähneklappernd, »gehen wir vorher an der Kälte zugrunde.«
Bolton raffte sich auf und ging nach hinten. Mit einer Flasche guten alten Whiskys kam er zurück.
»Sie werden uns schon finden«, meinte er, während er den Korken aus der Flasche zog, »heizen wir mal ordentlich von innen ein.«
Er setzte die Flasche an den Mund und tat einen tüchtigen Zug. »Brr! Scharf und kalt ist das Zeug, aber es wärmt, Garrison, genehmigen Sie sich auch einen.«
Garrison zögerte, die Flasche zu nehmen.
»Ich weiß nicht, Bolton. Es sind rund 700 Kilometer von hier bis zur Station. Wenn nicht gerade eines von den Stratosphärenschiffen da ist, kann es lange dauern, bis sie uns finden.«
Bolton sah die Dinge unter dem Einfluß des Whiskys schon etwas rosiger an.
»Nonsens, Garrison! Sie haben uns schnellste Hilfe versprochen. Das hätten sie nicht getan, wenn sie kein Flugzeug bei der Hand hätten.«
Mit Gewalt nötigte er ihm die Flasche auf und ließ nicht nach, bis auch Garrison eine tüchtige Dosis daraus genommen hatte.
»Die beste Methode, um schnell und schmerzlos zu erfrieren«, meinte der, als er sie zurückgab. »Man spürt danach die Kälte nicht mehr, aber man erfriert doch. Nein! Ich will nicht!« Garrison sprang auf und lief im Führerstand hin und her, um sein stockendes Blut in Bewegung zu bringen. Vor der Radioanlage blieb er stehen. »Zum Teufel, Bolton, ich möchte wissen, warum kein Strom da ist. Die Akkumulatoren müssen noch geladen sein.«
»Prost, Garrison!« rief Bolton und nahm einen neuen Zug aus der Flasche. Garrison achtete nicht weiter auf ihn. Er kniete vor der Funkanlage, löste Verbindungen, zog einen der Akkumulatoren hinaus und hielt ihn gegen das Licht.
»Ha, Bolton! Da haben wir den Grund. Unsere Akkumulatoren sind eingefroren. Da sehen Sie!« Vor Boltons Augen drehte er das Akkumulatorenglas. Der Spiegel der Schwefelsäure machte die Drehung mit, sie bildete einen starren Block.
»Wenn man die Säure auftauen könnte, würden wir wieder funken können.«
»Vergebliche Mühe«, lachte Bolton, den der Alkohol in eine aufgeräumte Stimmung versetzt hatte, »in dem verfluchten Kahn hier ist alle Heizung elektrisch. Wenn die Motoren streiken, ist es aus damit. Eine Saukälte hier, Garrison.«
Schwerfällig stand er auf und suchte sich noch eine Decke, die er zu vielen andern um sich wickelte. »Kalt, Garrison! verflucht kalt hier, müde wird man dabei, müde. Ich könnte gleich einschlafen.«
»Und nie wieder aufwachen, Bolton! Sind Sie denn ganz des Teufels, Mann?«
Mit Schrecken erkannte Garrison, daß sein Gefährte von jener verhängnisvollen Schläfrigkeit befallen wurde, die dem ewigen Schlaf des Frosttodes vorauszugehen pflegt.
Er sprang auf und begann ihn von allen Seiten her mit kräftigen Faustschlägen zu bearbeiten. James Garrison verstand etwas vom Boxen. Seine Hiebe drangen durch die Decken und Hüllen hindurch und brachten das erstarrte Blut Boltons wieder in Wallung.
»Munter, Bolton! Ich will dich schon munter prügeln, mein Junge!« rief Garrison, während er einen langen Graden auf Boltons linker Schulter landete.
»Verfluchter Kerl! Ich will dir ...«
Bolton hatte die Decken abgeworfen und versetzte Garrison, eh der sichs versah, einen Schlag in die Magengegend, daß er gegen die Apparatenwand taumelte. Alle Lethargie war von ihm abgefallen und mit weiteren kräftigen Hieben drang er auf seinen Gefährten ein.
Eine gute solide Schlägerei schien sich entwickeln zu wollen, als von außen her Motordröhnen in den Raum drang und die beiden aufhorchen ließ. Dicht über ihrem Flugzeug hing ›St 8‹ an seiner Hubschraube, sank tiefer und setzte auf das Schneefeld auf. Eine Tür des Stratosphärenschiffes öffnete sich, ein Mann in einen dicken Pelz gehüllt kam heraus und ging auf das amerikanische Flugzeug zu. Garrison biß sich auf die Lippen. Verdammt, das war ja derselbe deutsche Ingenieur, der ihn damals in die Schneekuhle gelockt hatte, der ihn wieder und immer wieder bluffte und schließlich mit nach Deutschland nahm. Jeden anderen hätte er jetzt lieber getroffen als gerade diesen Berkoff. Doch der hatte ihn schon durch das Fenster des Führerstandes erblickt und winkte ihm vergnügt zu. Kletterte jetzt auf die Flugzeugschwinge, riß die Tür auf und kam hinein.
»Hallo, Mr. Garrison! Freue mich riesig, Sie wiederzusehen. Haben hier ein kleines Malheur gehabt? Ja, ja mein lieber Mr. Garrison, die Antarktis hat's in sich. Verflucht kalt hier bei Ihnen, Sie werden sich einen Schnupfen holen. Es wird das beste sein, wenn Sie schleunigst zu uns hinüberkommen, da ist's angenehm warm. Der Herr dort ist wohl Mr. Bolton?«
»Bolton ist mein Name, Sir«, sagte Bolton und schüttelte Berkoff die Rechte. »Bin Ihnen aufrichtig verbunden, daß Sie uns so schnell zur Hilfe kamen. Ist mir unerklärlich, wie unser Treibstoff so schnell zu Ende ging. Würden gerne von Ihnen welchen übernehmen, damit wir weiter können. Gegen Kasse natürlich, Mr. Berkoff, gegen gute amerikanische Dollars.«
Berkoff zuckte die Achseln. »Ich glaube nicht, Mr. Bolton, daß Sie wieder starten können. Ihr Fahrgestell ist hoffnungslos zerbrochen, übrigens ..., was für einen Treibstoff haben Sie in Ihrer Maschine?«
»Benzol, Mr. Berkoff. Mit fünf Tonnen besten Benzols sind wir im Roßmeer aufgestiegen. Ist einfach unverständlich, daß der Stoff schon zu Ende ist.«
Berkoff pfiff durch die Zähne. Er dachte an die Heizvorrichtungen für die Treibstofftanks, die man in langjähriger Arbeit in den Eggerth-Werken entwickelt hatte, um ein Einfrieren des Öles in der Kälte der Stratosphäre zu verhüten. Zu Bolton gewandt sagte er: »So, so! Benzol haben Sie? Da brauchen Sie sich nicht weiter zu wundern, daß Ihre Motoren plötzlich streikten. Der Stoff besitzt die bedenkliche Eigenschaft, bei Null Grad zu erstarren. Er dürfte in Ihrem Tank zu einem massiven Block gefroren sein, und da war's natürlich mit der Herrlichkeit zu Ende.«
Bolton schlug sich vor die Stirn.
»Dumme Sache, Garrison! Daran hätten wir denken müssen. Was soll jetzt geschehen?«
Garrison schwieg, Berkoff sprach weiter.
»Es gibt keine Möglichkeit, Ihr Flugzeug von hier fortzubringen. Es wäre zwecklos, es in das Schlepp von ›St 8‹ zu nehmen. Sein Rumpf würde nicht heil vom Boden abkommen. Sie müssen es verloren geben und mit uns mitkommen.«
Mit jedem Wort, das Berkoff sprach, war die Miene Boltons trüber geworden. Das Flugzeug verloren geben, das bedeutete ja für ihn, die Summe von hunderttausend Schillingen, die er dafür in Adelaide bezahlt hatte, in den Rauchfang zu schreiben. Wieder einmal schien das große Geschäft, das so aussichtsreich begonnen hatte, mit einem traurigen Defizit zu enden.
»Es hilft nichts, Mr. Bolton«, erklärte Berkoff noch einmal kurz und bündig, »Ihre Maschine ist nicht zu retten. Aber wenn Sie irgend etwas an Bord haben, was Sie mitnehmen wollen, so können Sie es gerne nach ›St 8‹ rüberbringen.«
»Ja, Bolton, das wollen wir machen«, fiel Garrison dazwischen, »wir haben ein paar Sachen hier, die müssen unbedingt mit.«
Ein eifriges Hin und Her zwischen der gestrandeten Maschine und dem
Stratosphärenschiff hub an. Kleidungsstücke und wertvolle Instrumente
schafften die beiden Amerikaner nach ›St 8‹ hin.
»Sind wir mit dem Kram bald fertig?« fragte Berkoff, der ihnen dabei behilflich war.
»Gleich, Mr. Berkoff, nur noch ein Stück, eine kleine Kiste, dann haben wir alles«, erwiderte Garrison. Berkoff wischte sich die Stirn. Trotz der grimmigen Kälte war ihm bei der Arbeit in seinem dicken Pelz warm geworden.
»Also noch eine Kiste, Gentlemen, dann haben wir's Gott sei Dank geschafft.«
Zusammen kletterten sie in den hinteren Raum des Flugzeuges. Verwundert schaute Berkoff sich um. Beinahe wie in einer Packerei sah es hier aus. Kisten der verschiedensten Größen standen da aufgestapelt. Er stieß mit dem Fuß gegen eine, die ihm im Wege stand. Sie war leicht, offenbar leer und ließ sich leicht zurückschieben.
»Was wollen Sie denn mitnehmen?« fragte er Garrison.
»Dies Stück hier, Mr. Berkoff.« Garrison deutete auf eine kleine Kiste, die kaum größer als ein mäßiger Handkoffer war.
»Na, denn mal los! Das werden wir schnell haben.«
Berkoff beugte sich über die Kiste und griff zu. Er hatte die Absicht, sie einfach unter den Arm zu nehmen. Verdutzt ließ er nach dem ersten vergeblichen Versuch, sie emporzuheben, davon ab.
»Pfui Teufel, das Ding hat Gewicht! Einer bringt das nicht weg. Darf man fragen, was Sie da drin haben?«
Auf Garrisons Zügen malte sich Verlegenheit, er zog es vor, zu schweigen.
»Mineralien, Sir, hier in diesem gottverlassenen Land mit Mühe und Not gesammelt«, antwortete Bolton an seiner Statt.
Berkoff nickte Garrison verständnisvoll zu.
»Ach so, Mr. Garrison. Ich verstehe. Sie sind doch noch auf die Erzsuche gegangen und scheinen ja noch einiges entdeckt zu haben. Dann wollen wir den kostbaren Fund mal mit vereinten Kräften anpacken.«
Das geschah denn auch, und unter mancherlei Stöhnen und Ächzen der drei daran Beteiligten wurde die Kiste, die gut und gerne ihre drei Zentner wog, in den Laderaum von ›St 8‹ geschleppt.
»Ist jetzt alles hier?« fragte Berkoff.
»Alles, Sir«, bestätigte Bolton.
»Gut, dann können wir starten«, erwiderte Berkoff und machte sich daran, die Tür des Stratosphärenschiffes wieder luftdicht zu verschrauben. Neugierig blickten sich die beiden Amerikaner um. Zwar waren sie beide schon in einem Stratosphärenschiff der Linie Frisko—New York geflogen, aber diese neue Maschine der Eggerth-Werke hier schien ihnen doch näherer Betrachtung wert zu sein. Mit einer Handbewegung lud Berkoff sie ein, ihm zu folgen.
»Bitte, darf ich Sie in den Salon führen?«
Er öffnete eine Tür zur Linken. Ein großer, behaglich eingerichteter Raum bot sich den Blicken der Eintretenden. Der Boden des Gemaches war von einem echten Teppich bedeckt, die Wände im unteren Teil mit Nußbaum getäfelt, in der oberen Hälfte mit einer lichten Gobelintapete bespannt. An zwei gegenüberliegenden Wänden gewährten breite Fenster einen Ausblick ins Freie. Daß die Scheiben, um den Druckunterschied in der Stratosphäre auszuhalten, aus vierzölligem Kristallglas bestanden, war ihnen nicht anzusehen. An der einen Querwand strahlte wärmende Glut aus einem elektrischen Kamin.
Berkoff wies auf zwei Ledersessel, »bitte, Gentlemen, nehmen Sie Platz. Ich will Ihre Ankunft den anderen Herren melden. Wollen Sie sich inzwischen bedienen.«
Er stellte Zigarren und zur offensichtlichen Freude Boltons auch Soda und Whisky auf den Tisch und verließ den Raum.
»Alle Wetter, Garrison, hier läßt sich's leben«, brummte Bolton vor sich hin, während er sich den Whisky heranzog. »So ein Schiff wie das hier hätten wir für unseren Trip haben müssen, dann wäre uns die Schweinerei nicht passiert.«
Garrison antwortete ihm nicht. Er hatte seinen Sessel zur Seite gedreht, blickte durch das Fenster und sah, wie das Land tief und immer tiefer unter dem aufsteigenden Schiff versank.
Berkoff trat in den Führerstand und zog die Tür hinter sich zu.
»Er ist's also, Georg, wenn ich deine Zeichen richtig verstanden habe?« fragte ihn Hein Eggerth.
»Natürlich ist er's, Hein, in Begleitung eines Mr. Bolton ..., das scheint der Geldmann bei der Geschichte zu sein ... sie sind mit einer amerikanischen Maschine hierhergekommen, um nach dem bewußten Erz zu suchen. Haben auch ein paar Zentner gefunden.«
Hein Eggerth pfiff durch die Zähne.
»Das ist eine dumme Geschichte. Noch ein Glück für uns, daß ihre Maschine hier zum Teufel ging. Sonst wären die Brüder vielleicht doch noch an die richtige Stelle gekommen.«
»Die Geschichte ist ernster, Hein, als wir alle ahnten«, fuhr Berkoff fort, »als ich in das Flugzeug kam, waren die beiden Amerikaner in eine ganz hübsche Boxerei verwickelt ...«
»Was hatten die Yankees für einen Grund sich zu prügeln?« fragte Hein Eggerth.
»Ich nehme an, sie taten es, um sich warm zu machen. Es war scheußlich kalt in ihrem Flugzeug. Jedenfalls hat einer von ihnen dabei etwas verloren.«
Berkoff zog ein kleines Heft aus seiner Tasche. »Dies hier, Hein. Ich hielt es für zweckmäßig, es unbemerkt an mich zu nehmen, und leider ..., leider ist der Fund von großer Wichtigkeit.«
Er blätterte in dem Heft, schlug eine Seite auf und hielt sie Hein Eggerth hin. Der las die wenigen Zeilen halblaut vor. »83 Grad 14 Minuten Süd, 158 Grad 12 Minuten Ost.« Er erblaßte, während er die Zeilen über die Lippen beachte.
»Um Himmels willen, Georg, das ist ja die genaue Einschlagsstelle des Boliden, wie kommen die Amerikaner zu diesen Zahlen?«
»Die Erklärung dafür findest du auf den ersten Seiten des Heftes, Hein. Dieser Garrison ist gerissener, als wir dachten. In seiner Eigenschaft als Mitglied der Sternwarte Pasadena war es ihm ein leichtes, sich Aufzeichnungen der verschiedenen Erdbebenwarten zu verschaffen. Mit einer Genauigkeit, die für uns fatal ist, hat er daraus die Einsturzstelle des Boliden berechnet.«
Eine Weile schwiegen die beiden. Nach langer Pause sagte Hein Eggerth:
»Das ist fatal, Georg, mehr als fatal! Was können wir dagegen tun?«
»Wie ich Garrison kenne, wird er nicht locker lassen«, meinte Berkoff, »das Heft hat er dazu nicht nötig. Die Aufschlagsstelle kann er sich jederzeit neu berechnen. Wahrscheinlich hat er sie sowieso noch anderswo notiert.«
Hein Eggerth warf sich in einen Sessel und stützte den Kopf in beide Hände. Minutenlang saß er so und grübelte. Dann sprang er plötzlich wieder auf.
»Eine Möglichkeit wüßte ich, Georg.« Hein Eggerth mußte selbst über den Gedanken lächeln, der ihm eben gekommen war. »Du weißt ja, Georg, es gibt da so schöne abgelegene Kokosinseln in der Südsee. Unbewohnt, kaum jemals von einem Schiff besucht. Idyllische Inseln; ein Mensch findet dort alles, was er zum Leben braucht in reichlicher Fülle, Kokosnüsse, Schildkröten, Schildkröteneier, und sonst noch mancherlei ...«
Georg Berkoff sah seinen Freund verwundert an.
»Sehr hübsch gesagt, Hein. Du willst wohl auf deine alten Tage noch unter die Poeten gehen? Aber was bezweckst du denn eigentlich mit dieser Schilderung?«
»Herrgott, Georg! Heute hast du mal wieder eine lange Leitung. Ich meine ganz einfach, wenn man die beiden Yankees auf solch einer Insel der Seligen absetzte, dann wäre man für geraume Zeit vor ihrem Tatendrang sicher.«
Georg machte Miene, Hein Eggerth um den Hals zu fallen.
»Eine großartige Idee, Hein. Meine Hochachtung! Auf die Weise wären wir alle Sorgen los.«
»Na endlich!« lachte Hein Eggerth. »Endlich hast du's kapiert, Georg. Ich halte die Idee nicht nur für fein, sondern geradezu für patentfähig. Ein Glück übrigens, daß Ministerialdirektor Reute nicht mit uns geflogen ist. Wenn wir den an Bord hätten, wäre es sicher Essig mit unserm schönen Plan.«
Die beiden steckten die Köpfe über Seekarten zusammen, suchten, redeten hin und her und schienen endlich gefunden zu haben, was sie suchten. Die Folge ihrer Unterhaltung war, daß der Kurs des Stratosphärenschiffes um fast 60 Grad geändert wurde.
Mr. Bolton hatte den Flüssigkeitsspiegel in der Whiskyflasche bereits
beträchtlich gesenkt, als Berkoff zusammen mit Hein Eggerth in den Salon kam.
Eine Vorstellung und Begrüßung, dann setzten sie sich zusammen um den runden
Mitteltisch des Salons.
Berkoff drückte auf einen Knopf und gab dem eintretenden Steward einen Auftrag. Kurz darauf wurde eine Mahlzeit serviert, die den beiden Amerikanern Hochachtung abnötigte. Bolton fiel wie ein ausgehungerter Wolf über die Gerichte her, und auch Garrison tat ihnen alle Ehre an. Erst jetzt kam den beiden so recht zum Bewußtsein, daß sie vor reichlich acht Stunden zum letztenmal gegessen hatten. Verschiedene gute Weine kamen dabei auf den Tisch, und zwischen Essen, Plaudern und Trinken verstrichen die Stunden wie im Fluge.
»Einen ordentlichen Mokka noch zum Schluß, Gentlemen«, schlug Berkoff vor und ging selbst hinaus, um den Auftrag zu geben. Nach kurzer Zeit schon kam er zurück, ein Tablett mit vier gefüllten Tassen in der Hand.
»War schon alles vorbereitet, Gentlemen«, sagte er, während er jedem eine Tasse hinstellte. »Hier ist Sahne, hier Zucker, bitte bedienen Sie sich.«
Der Mokka war gut und stark. So stark, daß er beinahe bitter schmeckte, wie es Garrison vorkam. Bolton war nicht in der Lage, über den Geschmack zu urteilen, da er sich sofort einen tüchtigen Schuß Whisky dazuschüttete.
Die Tassen waren geleert. »Soll ich noch mehr bringen?« fragte Berkoff. Er bekam keine Antwort mehr. In dem einen Sessel schnarchte Bolton, den Kopf auf die Lehne gelegt, als wolle er einem Sägewerk Konkurrenz machen. In dem anderen Sessel war Garrison eingenickt. Ein paarmal versuchte er noch der Müdigkeit Herr zu werden, dann übermannte auch ihn der Schlaf.
Berkoff warf einen Blick auf die Uhr.
»In einer Viertelstunde werden wir da sein, Hein, die Sache klappt großartig.«
»Du meinst, Georg?«
»Sicher, Hein, für die nächsten sechs Stunden schlafen die beiden den Schlaf der Gerechten. Die Morphiumdosis in ihrem Kaffee war darauf abgestimmt.«
Langsam rückte der Baumschatten nach Osten weiter. Jetzt gab er den Kopf des Schläfers frei, das volle Sonnenlicht fiel in dessen Gesicht. Er machte eine Armbewegung, als wolle er etwas fortwischen, aber das Warme, Kitzelnde spielte ihm weiter um Mund und Nase. Ein Zucken ging durch seine Gesichtsmuskeln und dann ... hatschi, hatschi ... Bolton mußte kräftig niesen und kam dabei aus dem Land der Träume allmählich in die Wirklichkeit zurück.
Er richtete den Oberkörper auf und starrte verwundert um sich. Nur langsam gelang es ihm, seine Gedanken zu ordnen. War er nicht eben noch im Stratosphärenschiff mit den Eggerth-Boys zusammen gewesen und hatte mit denen gut gegessen und noch besser getrunken? ... Aber das hier, das war alles andere, nur kein Stratosphärenschiff ... ein sandiger weißer Strand vor ihm, auf den die Wellen einer unwahrscheinlich blauen See wie spielend aufliefen. Unter ihm, neben ihm ... er griff mit den Händen um sich ... schwellender grüner Rasen. Dicht bei ihm eine Baumgruppe, in deren Schatten er wohl geschlafen haben mußte, bis die Sonne ihn weckte. Und dort ... er griff mit den Händen zum Kopf, in dem es nach der Zecherei noch etwas rumorte ... auf der Wiese mitten in dieser zauberhaften Landschaft eine Kiste, die Kiste mit dem kostbaren Erz, das er zusammen mit Garrison in der Antarktis gesammelt hatte. Garrison ... Garrison, wo mochte der nur stecken?
Mühsam rappelte Bolton sich auf, bis er, noch etwas schlaftrunken, auf seinen Beinen stand, und blickte sich nach allen Seiten um. Da, direkt an den Wurzeln eines dunkel glänzenden Baumes lag Garrison. Den hatte die Sonne noch nicht erreicht, der schlief noch fest.
Bolton ging zu ihm, rüttelte ihn, suchte ihn zu ermuntern. Es war ein schweres Stück Arbeit, denn auf Garrison wirkte das Morphium stärker als auf den ausgepichten Bolton. Endlich hatte er ihn so weit, daß er sich aufrichtete und sich verschlafen die Augen rieb.
»Was ist, Bolton? Was wollen Sie?« Mit Mühe und Not bekam er die Augen auf. »Was ist, Bolton? Wo sind wir?«
»Das will ich Sie ja gerade fragen, Garrison«, schrie Bolton erbost. »Irgendwo sind wir auf diesem gesegneten Erdball. Im Stratosphärenschiff jedenfalls nicht.«
Während er es sagte, zerrte er Garrison empor und stellte ihn auf die Füße.
»Sehen Sie sich um, Mann! Hier sind wir. Wo wir sind, wie wir hergekommen sind, möchte ich von Ihnen hören.«
»Keine Ahnung, Bolton, keine blasse Ahnung.«
Bolton griff ihn unter den Arm und zog ihn mit zu der Stelle, wo die Kiste stand. Als sie näher kamen, bemerkten sie daneben noch einen Haufen allerlei anderer Dinge. Da lagen alle die Kleidungsstücke, die sie aus ihrem Flugzeug mit nach ›St 8‹ gebracht hatten. Daneben Konservenbüchsen, der Zahl nach genug, um zwei Menschen wenigstens auf eine Woche zu verproviantieren.
»Ich begreife nicht, was das bedeuten soll«, stöhnte Garrison und rieb sich die Stirn. Bolton wühlte inzwischen in den Kleidungsstücken herum und stieß plötzlich einen Ruf der Überraschung aus. Unter einem der Mäntel hatte er ein gutes Jagdgewehr und ein großes Paket mit Patronen entdeckt. Er nahm die Waffe in die Hand und untersuchte sie sachverständig. Von solchen Dingen verstand Bolton etwas, denn er war passionierter Jäger.
»Ich begreife nicht, ich begreife nicht«, stöhnte Garrison zum zweiten Male.
»Aber ich fange an zu begreifen«, schrie Bolton. »Wenn die Konserven zu Ende sind, sollen wir uns unser Futter selber schießen. Die Hunde ... die verfluchten Hunde haben uns betrunken gemacht und auf irgendeiner verdammten Insel ausgesetzt. Schöne Schweinerei, in die Sie mich reingeritten haben, Garrison ... mit Ihrer verrückten Idee.«
Während Bolton die Worte wütend herausstieß, kam auch Garrison das Verständnis ihrer Lage.
»Ausgesetzt, Bolton, auf einer Insel ausgesetzt? Das ist der beste Beweis dafür, Bolton, daß meine Ideen nicht verrückt sind. Die Deutschen fürchten, daß wir ihnen ins Gehege kommen ... natürlich wieder der Berkoff ... wir hätten besser auf unserer Hut sein sollen, und trotzdem ... ich verstehe immer noch nicht, warum ...«
Er hatte während der letzten Worte mehrmals in seine Taschen gegriffen. »Haben Sie das Buch, Bolton?«
»Welches Buch?«
»Die Berechnung der Einschlagstelle.«
Bolton griff in seine Taschen, ebenfalls vergeblich.
»Unsinn, Garrison, ich habe das Buch nicht.«
»Dann hat der verfluchte Berkoff es gestohlen. Jetzt begreife ich alles.«
»Hat lange gedauert bei Ihnen«, knurrte Bolton, hing sich das Gewehr über und stopfte sich die Taschen voll Patronen.
»Kommen Sie, Garrison, wir wollen uns das Plätzchen wenigstens mal ansehen, das die Banditen für uns ausgesucht haben.«
Er faßte Garrison beim Ärmel und wollte ihn mit sich ziehen. Der zögerte, holte seine Uhr hervor, zog sie auf und sagte dann:
»Wir wollen die Uhren vergleichen.«
»Hier bitte! Wenn Ihnen das jetzt gerade Spaß macht, Garrison.« Bolton zog ein goldenes Chronometer aus der Tasche und ließ den Deckel aufspringen. Beide Uhren gingen nach Greenwich-Zeit und stimmten auf die Viertelminute überein.
»Ziehen Sie sie auch auf, Bolton. Vergessen Sie niemals, sie rechtzeitig aufzuziehen. Die Kenntnis der genauen Greenwich-Zeit gibt uns die einzige Möglichkeit, herauszubekommen, wo wir eigentlich sind.«
Bolton tat, wie ihm geheißen und versenkte das Chronometer wieder in seine Tasche.
»Das ist Ihre Sache, Garrison. Dafür sind Sie Astronom. Kommen Sie endlich!«
Zusammen machten sie sich auf den Weg und schritten an der Grenze von Gras und Sand das Ufer entlang. Zu ihrer Linken landeinwärts schlossen sich an die Wiese dichtbewaldete mäßige Höhen an. Zu ihrer Rechten dehnte sich bis zum Horizont die See. Schon nach wenigen Schritten stießen sie auf einen Bach, der von den Waldbergen herunterkam und hier ins Meer mündete.
Bolton bückte sich, schöpfte etwas Wasser in die Hand und kostete davon.
»Süßwasser, Garrison! Verdursten brauchen wir wenigstens nicht.«
Mit einem kräftigen Sprung kamen sie über den Bach hinweg und marschierten weiter. Es wurde ihnen warm dabei, denn die Sonne war inzwischen ein gutes Stück höhergekommen und brannte von dem wolkenlosen Himmel herunter.
Nach einer halben Stunde blieb Bolton stehen und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
»Hol's der Teufel, Garrison, das Marschieren hat auch keinen Zweck, wer weiß, wie groß die verfluchte Insel ist. Kommen Sie, hier geht's in die Höhe. Wir wollen mal auf den Berg klettern. Da können wir mehr übersehen.«
Der Weg war nicht ganz einfach. Hin und wieder mußten sie das dichte Unterholz mit Gewalt zur Seite drücken, um durch zukommen. Schon waren sie ein gutes Stück gestiegen, als der Wald lichter wurde und schließlich in eine große Wiese ausging.
Bolton blieb stehen und packte Garrison am Arm.
»Sehen Sie! Sehen Sie da, Garrison, Ziegen! Es gibt Ziegen hier, weiß Gott, Ziegen.«
Er nahm die Büchse von der Schulter und schob zwei Patronen in die beiden Läufe. Das Gewehr unter dem Arm stieg er weiter. Schwitzend und keuchend folgte ihm Garrison. Fast eine Stunde verging, dann hatten sie endlich den unbewaldeten Gipfel des Berges erreicht. Wohl an die 500 Meter hoch mochte sich das Land hier über die See erheben. Nach allen Seiten hin hatten sie freien Ausblick und mußten erkennen, daß ihr Reich nicht allzu groß war. Eine Insel war es, wie sie gleich zu Anfang vermuteten. Etwa zehn Kilometer mochte sie sich in die Länge strecken, kaum drei in die Breite.
Bolton stieß ein wütendes Gelächter aus.
»Schön gemacht, Herr Berkoff! Fein gemacht, Herr Eggerth! Unbequeme Konkurrenten bringt man auf eine einsame Insel. Da können sie jahrelang Robinson und Freitag spielen. He! Sie Garrison-Freitag! Was sagen Sie zu der Sache?«
Garrison wußte nicht viel zu sagen. Während Bolton schimpfte und polterte, zog er die Uhr und beobachtete aufmerksam die Sonne.
»Reden Sie doch, Mann! Was sagen Sie zu der Schweinerei?« brüllte Bolton.
Garrison schüttelte den Kopf.
»Stören Sie mich nicht, Bolton. Der Platz hier ist für eine Beobachtung günstig.« Er suchte sich einen kurzen graden Ast und steckte ihn senkrecht in die kurze Grasnarbe.
»Was ist das für ein verrückter Zauber?« fuhr Bolton dazwischen.
»Stören Sie mich nicht, Bolton.« Während Garrison es sagte, markierte er das Schattenende des Stabes mit einem Steinchen auf der Rasenfläche und suchte danach noch andere Steinchen zusammen.
»Was soll denn der Unsinn, Garrison, sind Sie ganz und gar übergeschnappt?«
»Davon verstehen Sie nichts, Bolton. Setzen Sie sich eine Weile ins Gras und stören Sie mich nicht.«
Bolton schüttelte ärgerlich den Kopf.
»Dann erklären Sie mir doch wenigstens den Hokuspokus, den Sie da treiben.«
Garrison war eben beschäftigt, mit Hilfe von Uhr und Sonne die Nord-Süd-Linie festzulegen.
»Die Sache ist sehr einfach, Bolton, in etwa 10 Minuten haben wir den wahren Mittag. Das gibt uns schon ... leider nicht ganz genau ... den Längengrad der Insel. Wenn es mir auch noch glückt, die Sonnenhöhe im Mittagspunkt zu messen, werden wir ungefähr wissen, auf welchem Breitengrad wir sitzen.«
Bolton zuckte die Achseln.
»Brotlose Kunst, Garrison, was soll uns das helfen? Selbst, wenn Sie's richtig herausbekommen, wir haben keine Geräte bei uns ... keinen Funk, durch den wir Hilfe herbeirufen könnten.«
Garrison kümmerte sich nicht um seine Einwände. Unverdrossen arbeitete er weiter, schrieb Zahlen und Zeitangaben auf ein Blatt Papier, während er dazwischen immer wieder neue Steinchen auf das Ende des langsam fortschreitenden Stabschattens legte.
»Sind Sie bald fertig mit dem Kram, Garrison?«
»Bald, Bolton. Haben Sie zufälligerweise eine Logarithmentafel bei sich?«
Boltons Gesicht verzog sich zu einem Lachen.
»Nett von Ihnen, Garrison, daß Sie noch faule Witze machen können. Mir ist nicht sehr danach zumute. Eine Logarithmentafel?! Haben Sie noch ähnliche Wünsche?«
»Wenigstens einen Zollstock, Bolton?«
Bolton kramte in seinen Taschen. »Sie haben Glück, Garrison, so was Ähnliches habe ich zufälligerweise bei mir.«
Er holte ein kurzes Bandmaß hervor und drückte es Garrison in die Hand.
»Sehr gut, Bolton, das kann uns helfen.«
Der Schatten des Stabes lag jetzt genau auf der von Garrison gezogenen Nord-Süd-Linie. Mit möglichster Genauigkeit maß er die Länge des Schattens und diejenige des Stabes, notierte sich beide Werte auf das Blatt, sah dabei wieder auf die Uhr.
»Na, haben Sie was rausbekommen?«
Garrison machte eine kurze Rechnung auf und nickte dann.
»Wir befinden uns ungefähr auf dem 152. Grad westlicher Längs von Greenwich. Die Breite ...« Garrison legte sich der Länge nach ins Gras und begann eifrig zu rechnen.
»Dauert lange, Garrison.«
»Die Insel liegt etwa auf 20 Grad südlicher Breite. Soweit ich die Karte im Kopf habe, müssen die Gesellschaftsinseln in der Nähe sein.«
Garrison erhob sich, steckte seine Berechnungen in die Tasche und fragte: »Was wollen wir jetzt machen, Bolton?«
»Zurückgehen, wo wir hergekommen sind. Ich habe Hunger, Garrison, Sie auch?«
»Ich kann's nicht leugnen, gehen wir.«
Sie schritten wieder zum Ufer hinab, und mancher Fluch und manches Donnerwetter auf ›St 8‹ und seine Piloten kam dabei von ihren Lippen. Als sie den Bach erreichtem, tranken sie beide in vollen Zügen, obwohl Bolton sonst gerade kein Freund von einfachem Wasser war.
An ihrem ersten Lagerplatz angelangt, mußten sie feststellen, daß Berkoff und Eggerth doch an alles gedacht hatten. Nicht nur Öffner für die verschiedenen Konservenbüchsen fanden sich zwischen den hier aufgestapelten Dingen. Bei genauerem Zusehen entdeckten sie Feuerzeuge und Streichhölzer in reichlicher Menge und weiter Geschirr und Eßbestecke, die es ihnen ermöglichten, ihre Mahlzeit auf gesittete Manier zu sich zu nehmen.
Nach dem Essen entdeckte Bolton in einem der Mäntel eine volle Zigarrentasche und steckte sich eine Zigarre an.
»Ja, Garrison«, stieß er zwischen zwei Rauchwolken hervor, »da sitzen wir mit dem Talent und können's nicht verwerten. Das verfluchte Erz ist an allem schuld.«
Er stand auf, schlenderte zu der Kiste hin, gab ihr einen Tritt. Stutzte dann. Wie merkwürdig hatte das dadrin geklirrt. Ganz anders wie die schweren Erzbrocken. Er beugte sich nieder, wollte die Kiste ankanten, da blieb ihm der Deckel in den Händen. Er war nur leicht aufgelegt. In der Kiste war kein Erz mehr, dafür Werkzeuge aller Art. Verschiedene Sägen, ein scharfes Handbeil und anderes mehr.
»Garrison, Garrison! Kommen Sie her«, Boston heulte beinahe vor Wut. »Kommen Sie her! Unser Erz haben uns die Hunde auch noch gestohlen.«
Garrison betrachtete verständnisvoll den Inhalt der Kiste.
»Ich glaube, Bolton, in unserer augenblicklichen Lage wird uns das hier viel nützlicher sein als die Erzproben.«
Prüfend wiegte er das Beil in der Hand.
»Sehen Sie mal das hier, Bolton. Damit könnte man vielleicht einen Baumstamm aushöhlen, ein Boot bauen, könnte damit zu einer bewohnten Insel in der Nachbarschaft kommen.«——
Die nächsten Stunden verbrachten beide damit, ihre Vorräte sorgfältig zu durchmustern, und sie entdeckten dabei noch manches, was ihnen von Nutzen sein konnte. Berkoff schien den Werkzeugschrank von ›St 8‹ zu ihren Gunsten sehr gründlich geplündert zu haben.
Immer tiefer war inzwischen die Sonne gesunken. Jetzt berührte ihre Scheibe die Kimmlinie zwischen Meer und Himmel. Wie ein feuriger Ball versank sie in der Flut. Nur noch wenige Minuten einer kurzen Dämmerung, dann brach die Tropennacht herein. Der erste Tag der beiden unfreiwilligen Inselbewohner ging zu Ende.
Dr. Schmidt hat allerlei Sorgen. Fremde Sender in der Antarktis. Drei Raupenwagen steuern nach Süden. Lichter in der Ferne. Sirenensignal und Rotfeuer. Die Flotte der Stratosphärenschiffe am Krater. Dr. Schmidt wird von seinen Sorgen befreit. Robinson-Bolton und Freitag-Garrison bauen ein Boot.
Immer schwächer wurde die Dämmerung in der Antarktis. Die lange, fast sechs Monate währende Polarnacht, die zweite Nacht für die Willesche Expedition brach an.
Im letzten Schimmer des sinkenden Tages kehrten die drei Motorfahrzeuge zu der festen Station zurück. Bis auf 800 Kilometer nach Süden waren sie noch vorgestoßen, bevor Dr. Wille sich zur Umkehr entschloß. Eine Fülle von Aufzeichnungen und Forschungsergebnissen brachten die beiden Gelehrten von diesem Ausflug mit, und während der nächsten zwei Wochen saßen sie wie festgemauert vor ihren Schreibtischen. Galt es doch, das gewaltige Material zu ordnen und danach eine zusammenfassende Darstellung der neugewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu geben.
Das Ergebnis dieser Arbeit war bei Dr. Wille eine Broschüre, in der er in knappen Umrissen seine Theorie über den Einfall der Sonnenelektronen auf die Erde entwickelte und durch Hunderte von Beobachtungen bestätigte. Beim langen Schmidt ... der Umfang seiner Bücher ging immer über seinen eigenen Umfang hinaus ... wurde das Werk ein mächtiger Wälzer, aber auch hier bot der Inhalt für die Wissenschaft viel Neues und Interessantes. An der Tatsache, daß der magnetische Südpol seit seiner ersten Feststellung durch die Expedition Shackleton eine starke Verschiebung erlitten habe, war danach nicht mehr zu zweifeln. Merkwürdigerweise war es den Forschern aber nicht gelungen, eine andere Stelle zu finden, an der die Magnetnadel senkrecht stand, die man also als magnetischen Pol ansprechen konnte.
Die Tinte auf den Manuskripten war kaum trocken, als ›St 8‹ landete. Das Schiff brachte allerlei nützliche und gute Dinge für die Station. Als es nach kurzem Aufenthalt wieder startete, nahm Hein Eggerth auch die Arbeiten der beiden Doktoren mit und hinterließ ein Versprechen des Ministerialdirektors Reute, daß die Veröffentlichung schleunigst erfolgen würde.
Langsam verstrichen die Stunden der endlosen Polarnacht. Dr. Wille hatte nach seiner Broschüre nichts mehr zu schreiben und beschäftigte sich wieder mit seinen elektrischen Messungen. Dr. Schmidt teilte seine Zeit zwischen dem Schreibtisch und der Funkstation. Denn einmal war ihm eingefallen, daß er noch sehr vieles zu sagen habe, was er in seinem ersten Buch noch nicht gesagt hatte. Und dann mußte er mit Hilfe der Funkstation natürlich die Drucklegung seines ersten Buches überwachen und brachte Lorenzen dadurch langsam zur hellen Verzweiflung. Doch schließlich war auch das überstanden. Mit Hilfe der Ätherwellen hatte Dr. Schmidt auch für den letzten Bogen die Druckerlaubnis gegeben. Nun hatte er eigentlich nichts Rechtes mehr zu tun und begann sich zu langweilen.
Mißmutig kramte er in den Zeitungen und Zeitschriften herum, die ›St 8‹ beim letzten Besuch dagelassen hatte. Illustrierte Journale ... Magazine mit Preisboxern und Filmschönheiten ... der lange Schmidt hatte gar kein Interesse für derartige Lektüre und schob sie achtlos beiseite. Aber dort, ein Heft der »American Geophysical Research« ... das konnte was sein.
Er zog es aus dem Stoß heraus und machte es sich damit neben dem Ofen des Wohnraumes bequem. Mit der pedantischen Systematik, die für ihn so kennzeichnend war, begann er das Heft von hinten nach vorn durchzustudieren. Eine lange Arbeit über Anomalien der Schwerkraft im Gebiete der Anden. Eine andere über magnetische Mißweisungen in der Nähe elektrischer Vollbahnen. Eine dritte über die Versalzung des Grundwassers in der Nähe der Meeresküste ... gewissenhaft ackerte er alles durch und kam schließlich zu den vermischten Nachrichten.
Er stutzte, als er dort seinen Namen las. Die Notiz behandelte die Übernahme der Willeschen Station durch die Reichsregierung. Mit leichter Ironie wurden die Titel, welche den Herren Wille und Schmidt bei dieser Gelegenheit verliehen waren, aufgezählt. Zum Schluß lobte das amerikanische Blatt aber das Vorgehen der Reichsregierung und sprach den dringenden Wunsch aus, daß man in Washington bald etwas Ähnliches für die Antarktis organisieren sollte.
Nach seiner Gewohnheit kniff Schmidt dabei die dünnen Lippen zusammen und machte ein Gesicht, als ob er etwas Bitteres geschluckt habe.
»Könnten uns grade noch fehlen«, murmelte er vor sich hin. »Die Yankees hier als Konkurrenten, gräßlicher Gedanke.«
Dann las er weiter und stieß schon in der nächsten Notiz wieder auf bekannte Namen ... Garrison ... Mr. James Garrison ... Mitglied der Sternwarte von Pasadena ... Bolton ... er brachte das Blatt näher an die Augen und las die Mitteilung noch einmal:
»Seit dem 22. August wird Mr. James Garrison aus Pasadena, ein bekanntes Mitglied der dortigen Sternwarte, vermißt. Es konnte festgestellt werden, daß er sich mit dem Millionär Joe Bolton aus Frisco zu einer Reise in die Antarktis zusammengetan hat. Garrison und Bolton sind auf dem Luftweg nach Australien gekommen. Sie haben in Adelaide am 20. August ein amerikanisches Flugzeug W. 16 gekauft und sind mit ihm ohne Piloten am 22. August in die Antarktis gestartet. Seitdem haben sie kein Lebenszeichen mehr gegeben.«
Die Notiz brachte noch einen Hinweis, wie notwendig für derartige
Expeditionen die staatliche Unterstützung sei, und schloß mit einem Hymnus
auf das Vorgehen der deutschen Regierung.
Schmidt ließ das Blatt sinken und strich sich über die Stirn. Was sollte das bedeuten? ›St 8‹ war doch aufgestiegen, um die Schiffbrüchigen zu holen. Eine Kleinigkeit mußte das für ein Stratosphärenschiff wie ›St 8‹ sein. Als ganz selbstverständlich hatten sie angenommen, daß ›St 8‹ die beiden Amerikaner bald fand und mit nach Deutschland nahm. Als so selbstverständlich, daß sie nicht einmal in ihren Funksprüchen danach gefragt hatten ...
Schmidt sprang auf. Mit dem Blatt in der Hand machte er sich auf die Suche nach Dr. Wille. Er fand ihn in seinem Arbeitszimmer am Schreibtisch mit der Auswertung seiner letzten elektrischen Messungen beschäftigt.
»Was haben Sie, Schmidt?« fragte Wille und schaute kaum von seinen Zahlen auf; er ließ sich bei der Arbeit nicht gerne stören. Schmidt schob die amerikanische Zeitschrift vor ihn hin.
»Hier, Herr Wille, lesen Sie. Garrison und Bolton werden vermißt.«
Kopfschüttelnd überflog Dr. Wille die Notiz.
»Unsinn, Schmidt! Weiß der Teufel, was die amerikanischen Reporter sich da mal wieder aus den Fingern gesogen haben. Fragen Sie doch einfach in Bitterfeld an, wenn Sie's genau wissen wollen.«
»Sie haben recht, Herr Wille, das werde ich auch schleunigst tun.«
Auf Willes Tisch standen zwei Uhren. Die eine zeigte die mitteleuropäische, die andere die Greenwich-Zeit an. Mit einer Handbewegung darauf sagte er:
»Ungünstige Zeit, lieber Schmidt. Zwei Uhr nachts in Bitterfeld. Sie werden auf die Antwort etwas warten müssen, aber fragen Sie nur an.« —
Wille behielt mit seiner Behauptung recht. Es dauerte reichlich sechs Stunden, bevor Schmidt die Antwort auf seine Frage in Händen hielt. Sie lautete kurz und bündig:
»Bolton und Garrison ihrem Wunsche gemäß am 25. August an der italienischen Küste zwischen Neapel und Sorrent an Land gesetzt. Hein Eggerth.«
Daß dieser Funkspruch so spät einlief, war keineswegs, wie Dr. Wille meinte, durch die ungünstige Zeit verursacht. Als der Funker der Eggerth-Werke Schmidts Anfrage des Nachts kurz nach zwei Uhr erhielt, erschien sie ihm so wichtig, daß er sie zu Hein Eggerth schickte. Der schimpfte erst auf den Boten, der ihn aus dem Schlafe riß. Aber als er sie gelesen hatte, wurde er vollständig munter und verspürte ein reichlich unbehagliches Gefühl. Das erste war, daß er den Boten gleich weiterschickte und Berkoff holen ließ.
Zu zweit studierten sie den Funkspruch, überlegten hin und her und konnten sich doch nicht darüber einig werden, was darauf zu antworten wäre. Eine Antwort aber ... das war ihnen beiden klar ... mußte gegeben werden, denn sonst war Schmidt in seiner übertriebenen Gewissenhaftigkeit imstande, mit der Sternwarte von Pasadena zu funken und bei der Gelegenheit Dinge bekanntzugeben, die vorläufig besser geheim blieben.
Nach einer Stunde Hinundherredens faßte Hein Eggerth einen Entschluß.
»Es hilft nichts, Georg! Wir müssen mit dem Ding zu meinem alten Herrn gehen, der wird schon die richtige Antwort darauf wissen ...«
Berkoff machte eine unsichere Bewegung.
»Keine angenehme Geschichte, Hein, der Herr Professor machte neulich so ein merkwürdiges Gesicht, als wir ihm von der Ausbootung der beiden Yankees berichteten. Willst du nicht lieber allem zu ihm gehen?«
»Meinetwegen, Georg! Ich habe damals die Idee gehabt und will sie auch weiter vertreten.«
Professor Eggerth las die Depesche, die ihm Hein ins Schlafzimmer brachte und
die Falten auf seiner Stirn vertieften sich dabei.
»Was hältst du davon, Vater?« fragte Hein.
»Die Notiz in der amerikanischen Zeitschrift ist unwichtig«, meinte Professor Eggerth nach kurzem Überlegen. »In der Union verschwinden jeden Tag tausend Personen und tauchen nach Wochen oder Monaten irgendwo anders gesund wieder auf. Daß hier irgendein Reporter aus dem Verschwinden Garrisons eine Sensation zu machen versucht, hat auch nicht allzuviel zu bedeuten. Das Bedenkliche ist nur, daß unser Schmidt das Blatt in die Finger bekommen hat.«
»Ganz meine Meinung, Vater. Wir müssen ihm so antworten, daß er nicht auf die Idee kommt, überflüssige Funksprüche loszulassen.«
Professor Eggerth unterdrückte ein Lächeln. »Leicht gesagt, aber schwer getan, mein Junge.« Er überlegte eine Weile. »Ja, ich denke, so wird's gehen.« Griff zum Bleistift und entwarf eine Depesche über die Ausbootung der beiden Amerikaner an der italienischen Küste.
Mit zweifelnder Miene überflog Hein Eggerth den Text. »Glaubst du, das wird genügen?«
Der Alte nickte. »So ist's schon richtig, Hein. Laß es aber erst morgen früh funken, um so unverfänglicher wird es wirken.«—
Dr. Schmidt las die Antwort auf seine Anfrage verwundert zum zweiten und dritten Male. Wie war es bei dieser klaren Sachlage möglich, daß die amerikanische Zeitung eine derartig unsinnige Nachricht verbreiten konnte? Lange ging er mit sich zu Rate, was er dagegen unternehmen könne ... nach Pasadena funken? ... der amerikanischen Zeitschrift eine Richtigstellung schicken, in der die erfolgreiche Hilfeleistung des deutschen Stratosphärenschiffes nicht zu kurz kommen sollte? ...
Nun zeigte es sich, daß Professor Eggerth doch ein guter Psychologe war. Der lange Schmidt verwarf die erste Möglichkeit und entschied sich für die zweite. Sofort ging er daran, eine geharnischte Richtigstellung an die »American Geophysical Research« zu entwerfen. Die konnte das nächste Stratosphärenschiff, das zur Station kam, dann mitnehmen und weiterbefördern.
Für Schmidt war die Angelegenheit damit erledigt, und seine wissenschaftlichen Interessen nahmen ihn wieder in Anspruch. Nach dem Abendessen folgte er Wille in dessen Arbeitszimmer.
»Was haben Sie jetzt wieder für Schmerzen, lieber Schmidt?« fragte Wille und blickte mißtrauisch auf eine mehrfach zusammengefaltete Karte, die Schmidt unter dem Arm hatte
»Haben Sie einen Augenblick Zeit für mich, Herr Dr. Wille?«
Wille kannte die ›Augenblicke‹ von Schmidt. Meistens wurden halbe oder ganze Stunden daraus.
»Bitte sehr, Herr Schmidt. Wenn es wichtig ist ...« erwiderte er mit einem leichten Seufzer.
Schmidt breitete eine große Karte der Antarktis auf dem Mitteltisch aus. Wille warf einen Blick darauf. »Mal wieder ein echter Schmidt«, dachte er bei sich, als er die zahllosen mit Bleistift auf der Karte eingezeichneten Magnetlinien sah. All die vielen Messungen ihrer letzten Expedition waren hier eingetragen und zu einem Netz geschlossener Linien vervollständigt worden.
Wille beugte sich tiefer über die Karte und verfolgte die verschiedenen Eintragungen, blickte Schmidt dann erstaunt an.
»Ja, was haben Sie sich denn hier geleistet, Schmidt? Die Linien gehen ja weit über das von uns untersuchte Gebiet hinaus.«
»So ist es, Herr Wille. Ich habe mir die Arbeit gemacht, die Linien weiter nach Süden in das Gebiet hinein, in dem wir selbst nicht waren, zu verlängern ...«
Wille schüttelte abweisend den Kopf. »Ach so, Sie haben extrapoliert. Ein undankbares Geschäft, mein lieber Schmidt. Es kommt selten was Vernünftiges dabei heraus.«
Schmidt kniff die Lippen zusammen, bevor er antwortete.
»In vielen Fällen mögen Sie recht haben. In diesem Falle ergibt sich aber doch ein äußerst bemerkenswertes Resultat. Wie Sie hier sehen, laufen die sämtlichen von mir verlängerten Linien auf 83 Grad 14 Minuten Süd, 158 Grad 12 Minuten Ost zusammen.«
»Hm ... hm ... allerdings sonderbar, Herr Kollege. Was folgern Sie daraus?«
»Den einzig möglichen Schluß, Herr Wille, daß der magnetische Südpol, den wir bisher vergeblich suchten, an dieser Stelle liegen muß.«
»Hm! ... Hm! ... Hm! ...« Wille lag mit dem Oberkörper über der Karte und prüfte die Zeichnung mit einer Lupe. »Ich glaube fast, Schmidt, Sie könnten recht haben ... wenn dort wirklich die neue Lage des Südpols wäre ... ja, Schmidt, dann müßten wir ja mit unserer ganzen Station zu der Stelle übersiedeln.«
Der lange Schmidt nickte bedächtig.
»Hin müßten wir zu der Stelle unbedingt. Wir haben ja die motorisierte Station. Was hindert uns, daß wir uns schon morgen oder übermorgen auf den Weg machen?«
»Die Nacht, die Nacht, Herr Dr. Schmidt! Der einbrechenden Nacht wegen sind wir ja das letztemal umgekehrt.«
»Unnötigerweise nach meiner Meinung, Herr Wille. Sie wissen, daß ich damals durchaus dagegen war. Wir haben genügend Starklichtlampen, um auch während der Nacht im Freien arbeiten zu können.«
Wille zuckte die Achseln. »Ich weiß nicht, Herr Schmidt, ob wir nicht besser warten, bis die Sonne wieder heraufkommt ...«
»In etwa vier bis fünf Monaten, Herr Wille. Zeit genug, daß auch die Amerikaner hierherkommen und uns die besten Rosinen aus dem Kuchen herausholen.«
»Die Amerikaner? Wie kommen Sie auf die ausgefallene Idee?«
»Einen Augenblick, Herr Wille.« Schmidt verließ das Zimmer und kam gleich danach mit der amerikanischen Zeitschrift zurück. »Hier können Sie es lesen. Die Yankees liebäugeln stark mit dem Gedanken, im nächsten Frühjahr eine staatlich subventioniere Expedition in die Antarktis zu schicken.«
»Teufel ja! Sie haben auch diesmal recht, lieber Schmidt. In der Tat, wir müssen unsere Zeit ausnutzen.«
Als Schmidt endlich das Zimmer verließ, konstatierte Wille mit einem Blick
auf die Uhr, daß der ›Augenblick‹ diesmal geschlagene zwei
Stunden gedauert hatte, aber die Zeit war ihm nicht lang geworden.
Die Vorbereitungen für die neue Expedition wurden schnell getroffen. Mit einigem Brummen und Knurren nahm Lorenzen davon Kenntnis, daß er wieder allein in der Station zurückbleiben sollte. Immer noch brummend klapperte er mit der Morsetaste, um den langen Funkspruch abzusenden, in dem die Herren Wille und Schmidt an die Eggerth-Werke über die neue Expedition und deren Ziele berichteten.
»Darf ich Ihnen die Sachlage kurz darstellen?« fragte Professor Eggerth, während er gegenüber Finanzminister Schröter in dessen Arbeitszimmer Platz nahm.
»Ich bitte darum, Herr Professor.«
»Meine Werke haben die Neubauten für die Pacific-Linie mit allen Kräften beschleunigt. Wir haben zur Zeit acht Stratosphärenschiffe der größten und leistungsfähigsten Type fertig und sind dabei, sie einzufliegen. Vertragsgemäß sind diese Schiffe erst im Januar an die Pacific-Linie abzuliefern. In der Zwischenzeit könnte man mit ihnen alles bequem zu dem Krater schaffen, was dort benötigt wird. Nach meinem Erachten sollte das Reich diese Gelegenheit nicht ungenutzt vorübergehen lassen.«
Der Minister zögerte eine Weile, bevor er antwortete.
»Ihr Vorschlag würde bedeuten, Herr Professor, daß wir mit den Arbeiten am Krater schon beginnen, bevor das Reich sich das Gebiet gesichert hat. Ich darf Ihnen nicht verhehlen, daß das Kabinett zu einem solchen Vorgehen wenig Neigung zeigt. Sie wissen, daß wir in Rücksicht auf das Ausland gezwungen sind, das Unternehmen zu tarnen.
Nach dem Plan der Regierung sollen sich die Dinge folgendermaßen entwickeln. Das antarktische Reichsinstitut verlegt seine feste Station weiter nach Süden bis auf etwa hundert Kilometer an den Krater heran. Dieser Ortswechsel muß auf irgendeine Weise wissenschaftlich begründet werden, damit das Ausland keinen Verdacht schöpft ...«
»Verzeihen Sie, das ist und bleibt der schwierigste Punkt bei der Sache«, warf Professor Eggerth ein. »Die Herren Wille und Schmidt sind unbestechliche Wissenschaftler. Wenn nicht ein Wunder geschieht, weiß ich nicht, wie wir sie mit ihrer Station an den gewünschten Platz hinbekommen sollen.«
Der Minister machte eine Handbewegung, als ob er etwas vom Tische schieben wollte.
»Fassen Sie die Sache nicht so schwer auf, Herr Professor. Auf 800 Kilometer sind die Herren schon nach Süden vorgestoßen. Ich habe mir über ihre letzten Arbeiten Bericht erstatten lassen. Besonders Dr. Wille scheint ganz hübsche Entdeckungen gemacht zu haben, die ihn wahrscheinlich sehr bald veranlassen werden, noch weiter nach Süden zu gehen. Steht dann die feste Station an der gewünschten Stelle und veröffentlichen die beiden Herren fleißig neue Entdeckungen, dann kann das Reich dort ein Gebiet von ... sagen wir einmal 300 Kilometern im Durchmesser in Besitz nehmen und zu einer deutschen Kolonie erklären. Weder Frankreich noch England werden uns die trostlose Schneewüste streitig machen. Das wissenschaftliche Mäntelchen, das wir der Sache umhängen, wird uns vor allen neugierigen Augen schützen und dann können wir mit den eigentlichen Arbeiten am Krater anfangen.«
»Wie lange meinen Sie, daß das noch dauern kann?« fragte der Professor.
»Ein paar Monate höchstens, denke ich. Wenn in der Antarktis wieder die Sonne scheint, werden wir hoffentlich beginnen können.«
»Spät ... sehr spät ... hoffentlich nicht zu spät«, sprach Professor Eggerth mit leichtem Seufzen vor sich hin.
Die Glocke des Tischtelefons schrillte dazwischen. Der Minister nahm den Hörer ab.
»Ja ... wie? ... äußerst dringend? ... Legen Sie das Gespräch hierher.« Er winkte Professor Eggerth heran. »Ein dringender Anruf für Sie aus Ihrem Werk.«
»Bitte um Verzeihung, Herr Minister.« Der Professor nahm den Hörer. »Wer ist da? ... du, Hein? ... Was ist? ...«
Er griff nach Schreibblock und Bleistift. Der Minister sah, wie es in seinen Zügen arbeitete, während er Worte und ganze Sätze auf das Papier warf.
»Einen Augenblick, Hein! ... Verzeihung, Herr Minister«, wandte er sich an Minister Schröter. »Eine Sache von größter Bedeutung. Das Wunder, von dem wir eben sprachen, scheint sich ereignet zu haben ...«
Er sprach wieder in das Mikrophon. »Bitte, Hein, lies den ganzen Funkspruch noch einmal langsam vor.« Auf einem neuen Blatt Papier schrieb er während der nächsten Minuten eifrig mit.
»Ich danke dir, Hein, das genügt. Ich rufe dich in einer Stunde wieder an.«
Er griff nach dem Taschentuch, wischte sich die Stirn und holte ein paarmal tief Atem.
»Nun, Herr Professor? Sie sprachen von einem Wunder? Was hat's denn gegeben?«
»Die Herren Schmidt und Wille brechen heute zu einer neuen Expedition nach dem Süden auf ...«
»Sehr gut, Herr Professor, das freut mich, ich sagte Ihnen ja, der Appetit kommt mit dem Essen.«
»Etwas zu viel Appetit, Herr Minister. Das Wunder ist etwas zu kräftig geraten. Die Herren wollen graden Wegs zu einer Stelle unter 83 Grad 14 Minuten Süd, 158 Grad 12 Minuten Ost. Der biedere Schmidt glaubt herausgefunden zu haben, daß jetzt dort der magnetische Südpol liegt.«
»Ist ja ganz vorzüglich, Herr Professor. Was gefällt Ihnen an dem Plane nicht?«
Professor Eggerth hielt das Blatt mit seinen Notizen in der Hand. Immer wieder überflog er die Zeilen.
»Was gefällt Ihnen daran nicht?« fragte der Minister zum zweiten Male.
»Es ist der genaue Ort des Kraters, Herr Minister. Erst begriff ich's nicht, jetzt fange ich an, zu verstehen. Die ungeheuren Eisenmassen des Boliden ... viele Millionen Tonnen sind es ja ... es wäre schon möglich, daß dieser Eisenberg die erdmagnetischen Linien zu sich hinzieht, daß Dr. Schmidt guten Grund hat, an dieser Stelle den magnetischen Südpol zu vermuten, aber ... in unsere Pläne paßt es nicht ganz.«
Minister Schröter sah nachdenklich vor sich hin. »Sie haben recht. Direkt bis an den Krater sollten die Herren nicht kommen.«
»In spätestens acht Tagen werden sie da sein. Wenn wir nicht rechtzeitig etwas dagegen tun, werden diese weltfremden Gelehrten die Entdeckung eines Bolidenkraters in alle Welt hinausfunken, und dann können wir unsern ganzen Plan begraben.«
»In spätestens acht Tagen ... dann heißt es, sofort handeln.«
Der Minister erhob sich. »Herr Professor, ich werde mit allen Mitteln versuchen, im Laufe der nächsten vierundzwanzig Stunden einen Beschluß des Kabinetts herbeizuführen. Ich nehme davon Kenntnis, daß acht neue Stratosphärenschiffe Ihres Werkes der Regierung zur Verfügung stehen.«
Auch der Professor stand auf.
»Die Schiffe liegen startbereit zur Verfügung des Reichs. Sie können sie jederzeit durch den Fernsprecher beordern.«
»Ich danke Ihnen, lieber Professor, in spätestens vierundzwanzig Stunden hören Sie von mir.«
Seit vier Tagen waren die Mammutwagen des deutschen antarktischen Institutes unterwegs. Unaufhaltsam mahlten ihre mächtigen Raupenketten sich den Weg durch ein Gelände, in dem jeder gewöhnliche Kraftwagen rettungslos steckengeblieben wäre. Schluchten mußten durchfahren werden, deren Steilhänge die Maschinen der Fahrzeuge aufs höchste beanspruchten. Schneewehen wurden durchquert, in denen die Schneemassen über den mächtigen Wagenkästen zusammenschlugen. Wie riesenhafte Bohrwürmer arbeiteten sich die Raupenwagen durch die weiße Masse hindurch. Und als auch das überwunden war, führte die Fahrt in langer stetiger Steigung hoch und immer höher. Man näherte sich dem Markham-Gebirge, das sich fast 5000 Meter über die See erhebt.
Die Spitze des Zuges hatte der Wagen mit den magnetischen Meßinstrumenten, den Schmidt seit der Abfahrt der Station nicht mehr verließ. In einem Sessel gönnte er sich hier bisweilen einen kargen Schlaf. Aus dem Wohnwagen ließ er sich während der kurzen Rasten die Mahlzeiten bringen und hockte die ganze übrige Zeit bei den Meßinstrumenten.
Blätter mit Hunderten und aber Hunderten von Zahlen bedeckt lagen zwischen den Apparaten umher. In der charakteristischen spitzen Schrift von Schmidt enthielten sie Aufzeichnungen über ebenso viele magnetische Messungen, die der unermüdliche Doktor während der Fahrt gemacht hatte. Unterbrach er die Arbeit einmal, so geschah es nur, um nach vorn zu gehen und den Wagenführern, die irgendwie vom Kurse abgewichen waren, neue Weisung zu geben. Denn jede Abweichung verrieten ihm seine Instrumente sofort. Nach dem neuen magnetischen Südpol sollte ja die Reise gehen, und das bedeutete nichts anderes, als unentwegt und genau der südweisenden Spitze der Magnetnadel zu folgen.
Ein schriller rauher Ton heulte auf. Es war die Sirene des Wohnwagens, die zu
kurzer Rast rief. Unwillig verzog Schmidt die Lippen, als sein Wagenführer
den Motor stillsetzte. ›Essen und Trinken, was anderes versteht das
Volk nicht‹, knurrte er bissig vor sich hin, als er ihn im Lichte des
fast vollen Mondes über den Schnee dahineilen und im Wohnraum verschwinden
sah. Sein Blick fiel auf den Kilometerzeiger. 954 Kilometer hatten sie bis
jetzt zurückgelegt ... noch mehr als 100 Kilometer waren es bis zum Magnetpol
... Ärgerlich stampfte er in dem Raum hin und her, bis Hagemann herankam und
ihm sein Essen brachte.
Noch ein anderes Mitglied der Station nahm während dieser Fahrt nicht an der gemeinsamen Tafel im Wohnwagen teil. Das war Rudi Wille, der die kurzen Aufenthalte jedesmal dazu benutzte, um die Funkstation in Betrieb zu nehmen. Auch jetzt kurbelte sich aus dem dritten Wagen der Antennenmast in die Höhe. Die Kopfhörer an den Ohren saß Rudi vor seinem Apparat. Gewohnheitsgemäß nahm er zuerst die Verbindung mit der festen Station auf und hatte das Glück, Lorenzen am Empfänger zu erwischen.
Ob es irgendwas Neues gäbe, wollte Rudi wissen.
»Neues? Ja!« Vor etwa sechs Stunden hatte Lorenzen eine ganze Reihe von Funksprüchen aufgefangen. Sie waren verschlüsselt in einem ihm unbekannten Kode, so daß er sie nicht entziffern konnte.
Rudi lachte, während er zurückmorste, daß so etwas wohl öfters vorkäme und kaum der Rede wert sei. Aber die Antwort Lorenzens machte ihn stutzig. So außerordentlich stark seien die Funksprüche angekommen, als ob sich der Sender in nächster Nähe befände.
»Fast noch lauter«, endete Lorenzens Mitteilung, »als wie wenn unsere Stratosphärenschiffe ihre Ankunft funken.«
Rudi überlegte. Sollte wieder eins der Eggerth-Schiffe auf dem Wege zur Station sein? Dann war es vielleicht empfehlenswert, direkt mit ihm in Verbindung zu treten. Er ließ sich von Lorenzen die Wellenlänge der aufgefangener Depeschen geben. Als er sie eben notierte, kam Hagemann und stellte ein Tablett mit dem Mittagessen vor ihn hin.
»Na, heute so brummig, Hagemann?« fragte Rudi, und klopfte ihm den Schnee aus dem Pelz.
»Grund genug dazu, Rudi, wenn man hier in Eis und Nacht den Servierkellner machen muß. Bei Ihnen hat's ja einen Sinn. Sie müssen während der Rastzeiten immer am Funk hängen, armer Junge. Aber der lange Schmidt hat doch weiß Gott nichts in seinem Wagen verloren. Der könnte ruhig zu Tische kommen.«
»Aber Hagemann! Wie können Sie? Es heißt: Herr Ministerialrat Schmidt.«
»Gut, Rudi. Dann kann also der Herr Ministerialrat Schmidt mir den Buckel lang rutschen!« rief Hagemann und schlug die Wagentür hinter sich zu. —
In der nächsten Viertelstunde war Rudis Aufmerksamkeit zwischen den Schüsseln und seinen Apparaten geteilt. Die Gabel in der Linken, fingerte er mit der Rechten an den Abstimmknöpfen der Anlage herum. Jetzt hatte er die Welle, die Lorenzen ihm angab. Er horchte am Empfänger, nichts war zu hören. Im Augenblick funkte der fremde Sender jedenfalls nicht. Er warf den Schalter seiner Anlage vom Empfang auf Senden herum, rief selber an, meldete die motorisierte Station des deutschen antarktischen Institutes, schaltete dann wieder um und lauschte. Auf die Antwort brauchte er nicht lange zu warten. Eilig schrieb er mit, was im Geheimkode der Eggerth-Werke aus den Hörern klang.
»St 11f, Pilot Hein Eggerth unter 83 Grad 14 Minuten Süd, 158 Grad 12 Minuten Ost am magnetischen Südpol. Erwarten Ihre Ankunft. Bitten dringend, nichts über unser Hiersein an andere Stationen zu funken.«
Rudi bestätigte das Radiogramm und schaltete danach wieder auf Empfang um. Doch vergebens lauschte er. Die Station von ›St 11f‹ sendete schon wieder in einer anderen Chiffre, die er nicht zu entschlüsseln vermochte. Ein Sirenenschrei vom Wohnwagen her mahnte zum Aufbruch. Schleunigst kurbelte er den Antennenmast wieder ein und lief zu dem mittleren Wagen hinüber, bevor die Motoren wieder ansprangen. Kaum war er dort, als die abenteuerliche Fahrt durch die Polarnacht schon weiterging.
Kopfschüttelnd las Wille den Funkspruch, den sein Sohn ihm in die Hand drückte.
»Sonderbar, Rudi! Ein Eggerthschiff liegt schon an der Stelle, zu der wir hinwollen? ... Wir sollen nichts darüber funken ... Was ist denn plötzlich in Professor Eggerth gefahren? Solche Geheimniskrämerei bin ich von ihm nicht gewohnt. Bin neugierig, was Schmidt dazu sagen wird.«—
Dr. Schmidt stand in seinem Wagen und starrte, die Uhr in der Hand, auf den
Kilometerzeiger. Immer stärker hatte ihn wahrend der letzten Stunden die
Empfindung überkommen, als ob der starke Raupenwagen viel schneller liefe als
früher. Dies Gefühl hatte ihn schließlich von seinen Instrumenten zu dem
Kilometerzeiger hingetrieben. Gespannt verfolgte er dessen Lauf zusammen mit
dem Gang des Sekundenzeigers auf seiner Uhr. Ein Zweifel war kaum noch
möglich, der Wagen entwickelte jetzt auf dem ebenen, nur mit einer leichten
Schneelage bedeckten Gelände eine Stundengeschwindigkeit, die an die 40
Kilometer herankommen mochte.
Er ging nach vorn zum Führersitz und sah nach dem Geschwindigkeitsmesser. Der Zeiger des Instrumentes spielte über die 40, seine frühere Beobachtung war richtig. Er überschlug die Zeit seit der letzten Rast. Wohl an 80 Kilometer konnte der Wagen seitdem zurückgelegt haben, nur noch 20 Kilometer trennten ihn vom Ziel der langen Fahrt.
Er ließ die Tür zum Führerraum offen und kehrte zu seinen Instrumenten zurück. Ein Blick auf die Magnetnadel zeigte ihm, daß der Fahrer um 10 Grad nach Westen vom Kurse abgekommen war. Vor sich hinbrummend griff er nach einem tragbaren Kompaß und eilte damit in den Führerstand, um dem Mann die genaue Richtung zu weisen. Dicht vor das Gesicht hielt er ihm die Bussole. »So müssen Sie fahren, Mann! Immer der Nase nach, immer der Nadel nach.«
Der Fahrer drehte das Lenkrad, in weitem Bogen schwenkte der Wagen nach Osten, bis die feine Magnetnadel genau in der Richtung seiner Längsachse zitterte.
»So ist's richtig. Behalten Sie den Kurs bei«, sagte Schmidt, während er einen Augenblick durch die Glasscheiben hinaus nach vorn schaute.
Wohl an die hundert Meter weit lag das Schneefeld vor dem Wagen im glänzenden Licht der Scheinwerfer. Aber außerhalb seines Glanzes hatte der Doktor noch etwas gesehen, das ihn veranlaßte, länger und schärfer hinzublicken.
»Schalten Sie die Scheinwerfer aus!« rief der dem Führer zu.
Ein Schaltergriff, das Licht erlosch. Nur noch im Mondenlicht schimmerte die weite Schneefläche vor dem Wagen. Aber stärker sichtbar wurde jetzt das, was dem Dr. Schmidt vorher aufgefallen war.
In weiter Ferne am Horizont genau geradeaus vor ihnen in der Richtung, in der sie fuhren, glänzte ein heller Schein auf. Ein leuchtender Dunst lag dort über dem Land, wie man ihn in dunklen Nächten wohl aus der Ferne über einer Stadt bemerken kann.
»Kann ich die Scheinwerfer wieder einschalten?« fragte der Fahrer. Er mußte zum zweiten und dritten Male fragen, bevor er Antwort erhielt. Wie hypnotisiert starrte Schmidt auf den fernen Lichtschein.
»Darf ich wieder einschalten, Herr Geheimrat?«
»Noch nicht, fahren Sie ohne Licht weiter. Sehen Sie den Schein dahinten! Darauf müssen Sie zuhalten.«
Schweigend fuhr der Chauffeur weiter, schweigend stand Schmidt hinter ihm ... hundert Gedanken kreuzten sich in seinem Kopfe ... Was für ein Licht war das da vorn? ... Ein Südlicht vielleicht? Nein, mit den flatternden, lodernden Feuerbändern der Südlichter war dieser ferne, ruhige Schein nicht zu verwechseln ... eine andere Naturerscheinung vielleicht? ... es gab Vulkane in der Antarktis, die Lava und Feuer spieen ... auch das konnte es nicht sein. Ein Vulkan hätte einen röteren, unruhigeren Schimmer geben müssen ...
Vergeblich durchdachte Dr. Schmidt alle Möglichkeiten, er fand keine Erklärung für dies merkwürdige Licht, das zusehends stärker wurde, während der Wagen einen Kilometer nach dem andern zurücklegte. Dr. Schmidt überschlug noch einmal die Zeiten und Geschwindigkeiten. Nur noch etwa 4 Kilometer konnten sie jetzt von dem Ziel ihrer Fahrt entfernt sein. Er holte sich sein scharfes Glas, um die sonderbare Erscheinung noch besser zu beobachten. Er preßte es an die Augen, stellte es genau ein und sah in dem milchigen hellen Schimmer eine Anzahl heller Punkte. Wie Perlen auf einer Schnur schienen sie aufgereiht zu sein. Unwillkürlich mußte er an elektrische Lampen denken, die eine Landstraße säumen und von weitem wohl ähnlich aussehen können.
Sirenenklang vom Mittelwagen her riß ihn aus seinen Gedanken. Es war das Signal zum Halten. Verwundert sah er auf die Uhr. Kaum drei Stunden waren seit der letzten Rast verstrichen. Warum sollte jetzt schon wieder haltgemacht werden? Zu längerem Überlegen ließ ihm Hagemann keine Zeit, der herankam, um ihn zu Dr. Wille in den Wohnwagen zu bitten. Kopfschüttelnd warf er sich seinen Pelz über und folgte dem Boten.
»Haben Sie die absonderliche Lichterscheinung grade voraus auch beobachtet?«
fragte er beim Eintreten.
Wille nickte. »Grade deswegen ließ ich halten und Sie zu mir bitten. Irgendwas muß dort im Gange sein, über das ich mir Klarheit verschaffen möchte, bevor wir weiter fahren.«
Schmidt zuckte die Achseln. »Ich habe mir vergeblich den Kopf darüber zerbrochen. Mit irgendeiner Naturerscheinung hat es jedenfalls keine Ähnlichkeit.«
Wille schob ihm den Funkspruch von ›St 11f‹ hin. Schmidt las ihn, kniff dabei nach alter Gewohnheit die Lippen zusammen.
»Ein Stratosphärenschiff ist dort? ... Eigentümlich ... Was haben die Herren von den Eggerth-Werken da zu suchen? ... Merkwürdig, Herr Wille, wir sollen an niemand über ihr Dortsein funken ... Das scheint mir etwas weit zu gehen, das sieht ja fast so aus, als ob die Herren eine Funksperre über uns verhängen wollten ...«
Er ließ das Blatt sinken. »Ein Stratosphärenschiff ist dort ... gut, mag sein ... aber das erklärt immer noch nicht die Lichterscheinung. Ich habe vorher durch mein Glas etwa dreißig Lichtpunkte gezählt. Möglicherweise könnten es Lampen an hohen Masten sein ... aber was für eine Veranlassung sollte das Stratosphärenschiff haben, mitten in der Antarktis eine derartige Festbeleuchtung zu veranstalten. Einen vernünftigen Grund dafür kann ich nicht entdecken.«
»Ich auch nicht, Herr Schmidt. Aber ich bitte Sie, jetzt hierzubleiben. Wir wollen uns die Sache zusammen ansehen, während wir weiterfahren.«
Ein kurzes Sirenensignal, und der Wagenzug setzte sich wieder in Bewegung. Schmidt und Wille standen im Führerraum. Jetzt konnten sie bereits mit bloßem Auge einzelne starke Lichter in dem leuchtenden Schein sehen. Das Gelände begann wieder zu steigen. Mit verminderter Geschwindigkeit rollten die schweren Raupenwagen einen langen Hang hinauf.
›Sonderbar, sonderbar‹, murmelte der lange Schmidt vor sich hin. ›Gerade hier an diesem Punkt ein Berg ... ziemlich hoch sogar ...‹
Kopfschüttelnd versank er wieder in Schweigen und kniff die Lippen noch fester zusammen, als plötzlich dicht voraus ein Rotfeuer aufflammte und eine Gestalt daneben den Fahrzeugen Halt winkte.
Die Motoren standen still. Dr. Wille stieg aus dem Wagen und lief Hein Eggerth in die Arme, der ihn mit kräftigem Händedruck begrüßte und sofort in ein Gespräch verwickelte. Schmidt blieb ein wenig zurück und schaute sich um.
Ein eigenartiges Bild bot sich seinen Blicken. Er stand auf einer Art von Gebirgskamm, der eine Kreislinie zu bilden schien. Ein Kreis, in gleichmäßigen Abständen mit hohen Gittermasten besetzt, die in etwa dreißig Meter Höhe mächtige Starklichtlampen trugen. Jetzt begriff er die Ursache der sonderbaren Lichterscheinung, die ihm während der Fahrt so rätselhaft war.
Aber noch etwas anderes erblickte er, das ihn vor neue Rätsel stellte. Dort zur Linken in einer Entfernung von kaum hundert Metern lag der schimmernde Rumpf eines Stratosphärenschiffes. Viel größer und gewaltiger war der Metallbau als der von ›St 8‹, den er kannte. Das mochte wohl ein Schiff der neuen stärkeren Type sein. Doch zur Rechten lag auch solch Flugschiff und noch andere lagen daneben. Acht dieser riesenhaften walfischartigen Ungeheuer zählte er. Eine ganze Flotte von Stratosphärenschiffen hatten die Eggerth-Werke hierhin entsandt. Wie um sich zu vergewissern, ob er nicht träume, strich er sich über die Augen. Das Bild blieb. Es war Wirklichkeit, wunderbare, unverständliche Wirklichkeit, die sein Blick erfaßte.
Nachdenklich schritt er langsam weiter, den Hang hinab. Er kam nicht weit. Der Boden, hier auffallenderweise schneefrei und von den Starklichtlampen grell beleuchtet, hörte plötzlich wie abgeschnitten vor ihm auf. Jäh verhielt er den Schritt, um nicht in den Abgrund zu stürzen, und erkannte im Augenblick, daß er am Rande eines gewaltigen Kraters stand, durch den ... vor undenklichen Zeiten vielleicht ... ein Vulkan seine Glutmassen emporgeschleudert haben mochte. Regungslos stand er am Rande der steilen Kraterwand, schaute hinab und sah auch in der Tiefe dort unten Lichter, erkannte Manschen, die sich dort unten bewegten. Ein dumpfer, hämmernder Lärm drang aus dem Schlund empor, als ob Maschinen auf seinem Grunde arbeiteten.
»Herr Ministerialrat Schmidt!« Der Ruf war hinter ihm erklungen. Er drehte sich um. Nur wenige Schritte von ihm entfernt stand Reute. Nur mühsam fand Dr. Schmidt Worte.
»Ich begreife das alles nicht, Herr Ministerialdirektor. Eine Flotte von Stratosphärenschiffen hier! Diese Arbeiten ... grade hier am magnetischen Pol, wo wir unsere Messungen machen wollen.«
Ein leichtes Lächeln glitt über die Züge Reutes.
»Ich fürchte, Herr Ministerialrat, daß der Ort wenig dafür geeignet ist. Sie werden keine große Freude an Ihren Messungen erleben.«
»Wie meinen Sie das? Hier ist der Pol, die Magnetnadel weist hierhin.«
Das Lächeln auf Reutes Gesicht wurde stärker.
»Kein Wunder, Verehrtester. Dort auf dem Grunde liegen schätzungsweise fünf Milliarden Tonnen reines Eisen. Das ist für die Magnetnadel schon ein triftiger Grund, nach dieser Stelle zu weisen. Wir kannten den Ort dieser riesenhaften Eisenmasse schon früher. Mein Kompliment, Herr Kollege, daß Sie ihn nach Ihren magnetischen Messungen auch so genau ermittelt haben.«
Während Reute sprach, wurde das Gesicht des langen Schmidt immer verdutzter. Ein paar Sekunden starrte er den Sprecher mit offenem Munde an, bevor er etwas zu sagen vermochte.
»Ja, aber ... ja ... dann wären ja alle meine Vermutungen über die wirkliche Lage des Magnetpols hinfällig, dann ... ja, dann Herr Ministerialdirektor müssen wir ... alle Bedingungen haben sich dann verändert ... dann müssen wir aufs neue auf die Suche gehen ... das ist ... ich verstehe, eine so enorme Eisenmasse muß natürlich eine Störung in den erdmagnetischen Fluß bringen ... aber ich begreife doch wieder nicht ... warum kommt die Störung erst jetzt. Wir haben im vergangenen Winter in unserer Station am Shackleton-Pol nichts davon gemerkt, die Störung muß erst später aufgetreten sein ... wie ist das möglich, Herr Ministerialdirektor ...«
Reute griff ihn unter den Arm und zog ihn mit sich.
»Das ist eine lange Geschichte, lieber Ministerialrat. Zu lang, um sie Ihnen hier draußen zu erzählen. Kommen Sie mit in mein Haus. Da wollen wir in Ruhe darüber sprechen.«
Wie benommen ging Schmidt neben Reute her. Er schaute kaum um sich, als der ihn an einem Stratosphärenschiff vorbeiführte, und sah erst auf, als sie vor einem Haus standen, das in seiner Ausführung den Gebäuden der Willeschen Station sehr ähnlich sah. Neben dem Haus erhob sich ein Mast, an dem die Flagge des Deutschen Reiches in leichtem Winde flatterte.
»Treten Sie bitte ein«, sagte Reute. »Herr Wille ist schon hier. Wir müssen diese Angelegenheit zu dritt gründlich besprechen.«
Hätte Berkoff den Gebrauch voraussehen können, den Bolton und besonders Garrison von den ihnen überlassenen Werkzeugen machten, so wäre er vielleicht etwas weniger freigebig damit gewesen. Auf die Gefahr hin, die beiden Yankees zu Rohköstlern zu machen, hätte er ihnen dann vielleicht nicht einmal Streichhölzer und Feuerzeuge dagelassen.
Scharfe Handbeile und Arte, Sägen und Stemmeisen hatte er ihnen damals in die Erzkiste gepackt, um ihnen die Möglichkeil zu geben, Bäume zu fällen und sich eine menschenwürdige Behausung zu errichten. Aber die Herren Bolton und Garrison hatten ganz und gar nicht die Absicht, sich auf ihrer Insel seßhaft zu machen. Auch jetzt noch ... der Kalender, den Garrison nach Robinsons Vorbild in Kerbschnittmanier an einem Baumstamm angelegt hatte, zeigte bereits den dreißigsten Tag ... bestand ihre Behausung nur aus einem primitiven Zelt, das aus drei Baumstämmen und ein paar wollenen Decken zusammengebaut war. Sie konnten nicht viel Zeit für seine Herstellung erübrigen, denn ihre ganze Arbeit galt einem anderen für sie viel wichtigeren Zweck.
Während der ersten zehn Tage ihres Aufenthaltes auf der Insel beschäftigte sich jeder der beiden auf seine eigene Art. Bolton unternahm Streifzüge, schoß Ziegen und allerlei Geflügel und betätigte sich nach erfolgreicher Jagd als Koch. Nach Urväterweise briet er das erlegte Wild über loderndem Holzfeuer am Spieß. Wenn der Braten gar war, mußte man die verkohlte Außenseite mit einem Stemmeisen entfernen, aber was danach übrigblieb, war recht schmackhaft und bekömmlich.
Garrison kehrte immer wieder nach jenem waldlosen Gipfel zurück, den sie schon am ersten Tage aufgesucht hatten. Viele Stunden lang saß er hier, machte Schattenmessungen, schrieb und rechnete.
Auf der Suche nach neuem Papier ... das letzte Blatt seines Notizbuches war bereits mit Zahlen vollgekritzelt ... machte er sich auch über die Konserven her. Vielleicht, daß das Papier, mit dem die Blechbüchsen beklebt waren, für weitere Rechnereien einen brauchbaren Untergrund liefern konnte.
Büchse um Büchse ließ er durch seine Hände gehen. Condensed Milk, Corned Beef und Ox-Tail-Soup und was sonst noch alles an guten Dingen die Vorratskammer von ›St 8‹ für sie hergegeben hatte. Plötzlich stutzte er. Eine Büchse ... nach der Aufschrift enthielt sie Hummer ... war ihm in die Hände gekommen. Aus irgendwelchen Gründen ... die Wege der Reklame sind bisweilen ebenso unerforschlich wie diejenigen Gottes ... hatte der Erzeuger dieser schmackhaften Konserven es für zweckmäßig gehalten, eine Karte der Südsee auf der Büchse anzubringen.
Mit zitternden Fingern drehte Garrison den kostbaren Fund hin und her. Dicht an die Augen brachte er die Büchse, um die Darstellung in allen Einzelheiten zu prüfen. Mit unbeschreiblicher Freude stellte er fest, daß er nicht irgendeine Phantasiedarstellung, sondern eine richtige Karte mit eingetragenem Gradnetz entdeckt hatte.
Tiefer sank die Sonne. Die Flinte über die linke, ein halbes Dutzend Tauben
über die rechte Schulter gehängt, kam Bolton von der Jagd zurück. Verwundert
schaute er seinen Gefährten an. Der lag der Länge nach im Grase, eine
Konservenbüchse und sein Notizbuch vor sich, und zirkelte in einer
unbegreiflichen Weise an der Büchse herum.
»He, Garrison, was haben Sie da? Hat's Ihnen der Hummer von Jenkins & Parry angetan oder fehlt Ihnen sonst was?«
Garrison sprang auf und streckte Bolton die Konservenbüchse mir einem so mächtigen Schwung entgegen, daß der einen Schritt zurücktrat.
»Bolton! Ich weiß, wo wir sind. Hier! Sehen Sie, hier!«
Er wies auf ein Bleistiftkreuz, das er auf die Büchse gemacht hatte.
»Hier sind wir, kaum zweihundert Kilometer von Tahiti entfernt. Da müssen wir hin, Bolton ... schnellstens hin.«
Kopfschüttelnd nahm ihm Bolton die Büchse aus der Hand und sah sie sich genau an.
»Gott segne Jenkins & Parry dafür, daß sie uns diese Karte sandten. Aber ... zweihundert Kilometer ... ein langer Weg, Garrison. Fliegen können wir nicht ... wie sollen wir über das Meer kommen?«
»In einem Boot natürlich, Bolton, wie andere Leute auch.«
»Erst eins haben, Garrison. Wo sollen wir auf dieser dreimal verfluchten Insel ein Boot finden?«
»Wir werden uns eins bauen, Bolton.«
»Ein Boot bauen?« Bolton ließ vor Überraschung die Tauben fallen. »Ein Boot wollen Sie bauen, mit dem man zweihundert Kilometer über die See fahren kann ...?«
»Nicht ich allein, wir beide zusammen werden es bauen, und wir werden damit fahren.«
»Alle Wetter, Garrison, Sie haben Unternehmungsgeist! Wie Sie das machen wollen, ist mir freilich schleierhaft.«—
An diesem Abend sprach Garrison nicht weiter von seinen Plänen. In einer fast
ausgelassenen Stimmung schaute er den Kochkünsten Boltons zu und ging danach
dem Taubenbraten gehörig zu Leibe.
»Wir werden in der nächsten Zeit alle unsere Kräfte gebrauchen, Bolton«, meinte er, mit vollen Backen kauend. »Stärken Sie sich auch ordentlich, damit ich eine gute Hilfe an Ihnen habe.«—
Lange noch lag Garrison während der Nacht wach in dem Zelt. Stunden hindurch
konnte er keinen Schlaf finden. Zu sehr arbeiteten die Gedanken in seinem
Hirn. Immer festere Formen gewannen dabei seine Pläne. Bis in alle
Einzelheiten hatte er sie durchdacht, als er endlich einschlummerte.
—
Während der nächsten Tage führte Garrison ein Wanderleben. Nach beiden Seiten hin durchstreifte er die Uferwaldungen, bis er nach langem Suchen fand, was ihm für seine Zwecke brauchbar dünkte.
Er entdeckte es an einer Stelle, an der ein steiler Felshang dicht an das Ufer herantrat. Nur einen knappen Steinwurf breit war der flache sandige Strand davor. Aus anderem, niedrigem Gehölz ragte dort ein mächtiger Brotfruchtbaum empor. Fast zwanzig Meter reckte sich der glatte astlose Stamm einer Säule gleich in die Höhe, bevor die Baumkrone begann. Gut anderthalb Meter war der Stamm stark.
Gleich nach der Mittagsmahlzeit führte er Bolton dorthin, zeigte ihm den Baum und erklärte ihm seine Absichten. Der sah sich den mächtigen Stamm an und warf Garrison einen mitleidigen Blick zu.
»Den Riesenstamm wollen Sie mit unseren Werkzeugen umlegen? ... Ist ja ganz unmöglich! Ebenso gut kennen Sie's mit Ihrem Taschenmesser versuchen ... und dann noch ein Boot aus diesem Mordsbaum herausarbeiten ... unmöglich, ganz unmöglich, was Sie sich da in den Kopf gesetzt haben.«
In einem Punkt behielt Bolton recht. Es war eine schwere langwierige Arbeit,
den mächtigen Baum umzulegen, und zwar so umzulegen, daß er nach außen hin
auf den Strand stürzte. Vom ersten Morgenschein bis zum Untergang der Sonne
arbeiteten sie daran. Mit schmerzendem Rücken, in Schweiß gebadet, die Hände
voller Schwielen hieben sie unablässig Span um Span aus dem zähen Holz, bis
endlich am Abend des dritten Tages ein Schüttern durch den Riesen des
Tropenwaldes ging, der gewaltige Baum sich langsam neigte und krachend auf
den Strand niederstürzte.
Einen Tag gönnten sie sich Ruhe, dann kam ein zweites, kaum minder schweres Stück Arbeit. Die Krone mußte vom Stamm gekappt werden. Nur kurze Pausen machten sie für die Mahlzeit; längere, unwillkommene mußten sie einlegen, um die stumpf werdenden Äxte immer wieder zu schärfen. Eine Woche war vergangen, seitdem Garrison den Baum entdeckte, da lag der Stamm von allem Astwerk befreit auf dem Sand.
»Was kommt jetzt?« fragte Bolton und besah sich seine zerschundenen Hände.
»Jetzt wird es viel leichter, Bolton. Jetzt soll das Feuer für uns arbeiten, Sie werden es bald sehen«, tröstete ihn Garrison. »Brennholz brauchen wir jetzt, viel trockenes Brennholz, das müssen wir noch herschaffen.«
Als die zweite Woche zu Ende ging, sah das Bild ganz anders aus. Der ganzen Länge nach brannte auf dem mächtigen Stamm ein Feuer, sorgfältig genährt durch fortwährend neu aufgelegtes Brennholz, aber in genau vorgezeichneten Grenzen gehalten durch Wasser, das die beiden mit leeren Konservenbüchsen unablässig aus der See schöpften und sofort ausgossen, wo das Feuer die Grenze überspringen wollte.
Mit Feuer sollten die Wilden Baumstämme aushöhlen und sich so ihre Boote herstellen. Öfter als einmal hatte Garrison das gelesen und als Physiker hatte er schnell begriffen, daß es nur möglich war, wenn man das Feuer durch Wasser im Zaume hielt und es nur da brennen und fressen ließ, wo es brennen sollte.
Anerkennend verfolgte Bolton den Fortschritt der Arbeit. Im Laufe zweier Tage war die obere Hälfte des runden Stammes von dem Feuer restlos verzehrt, verascht und verschwunden. In den übrigbleibenden Halbzylinder fraß die Glut jetzt eine Höhlung hinein, die durchaus der inneren Form eines Bootes entsprach. Wie Zunder brach das verkohlte Holz unter dem Stemmeisen fort. Nach nochmal achtundvierzig Stunden war die innere Höhlung sauber und glatt ausgearbeitet, fix und fertig. So viel hatte der Stamm durch diese Feuerarbeit an Gewicht verloren, daß sie ihn ohne allzu große Mühe mit kleineren Stämmen umkanten konnten. Mit der Höhlung nach unten lag er nun auf dem Sand. Der letzte Teil des Werkes, die Ausarbeitung der äußeren Form begann. Seufzend machte sich Bolton auf neue schwere Arbeit mit Beil und Axt gefaßt, aber vorsichtig, sehr vorsichtig freilich, nahm Garrison auch hier das Feuer zu Hilfe. Geschickt brannte er soweit vor, daß die Schneide der Axt keinen großen Widerstand mehr fand.
An dem Tage, an dem Garrison den vierzigsten Strich in seinen Kalender kerbte, schoben sie das fertige Boot auf untergeschobenen Rundhölzern die wenigen Meter über den Strand in das Wasser. Fast kamen ihnen die Tränen, als sie es leicht und sicher schwimmen sahen, als es sie beide sicher trug. Sorgfältig zogen sie es nach dem ersten Versuch auf den Strand zurück, denn unfaßbar, unerträglich war ihnen der Gedanke, daß etwa ein aufkommendes Wetter das Erzeugnis so langer und harter Arbeit auf das offene Meer entführen könnte.
Was noch weiter zu tun war, wurde schnell erledigt. Ein Mastbaum erhob sich im vorderen Drittel des Bootes, aus Decken wurde ein Segel genäht, Ruder wurden mehr zweckmäßig als schön aus jungen Palmenstämmen zugehauen. Proviant und Trinkwasser, soviel die leeren Konservenbüchsen zu fassen vermochten, trugen sie hinein.
Dann kam ein sonnenklarer strahlender Morgen, an dem das Boot von der Insel
abstieß. Wenige Ruderschläge nur, dann fing sich eine frische Brise in seinem
Segel und ließ die Flut vor seinem Bug aufrauschen. Am Heck saß Garrison, das
Steuer in der Rechten, die Uhr in der Linken, die ihm bei dieser Seefahrt den
Kompaß ersetzen mußte. Neben dem Mast hatte sich Bolton niedergelassen und
zündete sich eine Zigarre an, die letzte ihres Vorrats, die er zufällig noch
kurz vor der Abfahrt entdeckt hatte.
Leise atmend wogte die See auf und nieder, frisch wehte die Brise. Weithin am Horizont sah Bolton die Insel langsam versinken. Himmel und Meer nur noch umgab die einsamen Seefahrer in ihrem selbstgezimmerten Boot.
›St 8‹ kreuzte über der Insel. Berkoff war in dem Schiff. Wie
der heilige Nikolaus ungesehen kommt und geht, sollte er für die Amerikaner
allerlei Lebensmittel und andere wünschenswerte Dinge bringen. Er kam drei
Tage zu spät, die Insel war verlassen. Vergeblich durchsuchte er sie mit der
Mannschaft seines Schiffes nach allen Ecken und Enden. Nur ein paar
Feuerstellen verrieten, daß hier vor nicht allzu langer Zeit Menschen gehaust
hatten. Alles andere war verschwunden. Nicht einmal eine leere
Konservenbüchse vermochte Berkoff zu entdecken. Er stand vor einem Rätsel und
er fühlte wohl, daß die Lösung dieses Rätsels recht unangenehm werden
könnte.
›St 8‹ stieg wieder auf. Mit höchster Maschinenkraft stürmte das Stratosphärenschiff auf Nordostkurs über die Südsee dahin, um die Kunde nach Deutschland zu bringen, daß die beiden amerikanischen Mitwisser um das Geheimnis des kostbaren Erzes ihren Verbannungsort verlassen hatten.
Dr. Wille wird Reichskommissar. Bolton und Garrison schiffbrüchig an Bord der ›Fréjus‹. Die deutsche Südpolkolonie. Captain Andrew tritt in Erscheinung. Sein Pakt mit Bolton.
Eine Stunde und eine zweite fast noch vergingen, aber noch immer war die Unterredung zwischen Reute und den beiden Doktoren nicht beendet. Röte im Gesicht, Glanz in den Augen folgte Wille den Worten, die aus Reutes Mund kamen. Mit unbewegter Miene, hölzern und steif wie immer hörte Schmidt sie an. Viel schwerer als Wille ließ er sich davon überzeugen, daß die reine Wissenschaft sich hier dem gemeinen Wohl unterordnen und ein Opfer bringen müsse. Langsam nur schmolz sein Widerstand, während Reute ihm zum dritten und vierten Male auseinandersetzte, wie sich ein befruchtender Lebensstrom von dem Krater hier in die deutsche Wirtschaft ... später vielleicht in die ganze Weltwirtschaft ergießen würde, wenn man das Unternehmen nach den Plänen der Regierung durchführte. Die enorme Eisenmasse, die da unten in dem Krater steckte und die erdmagnetischen Kraftlinien in Unordnung brachte, war dem braven Schmidt immer noch viel wichtiger als die Goldmengen, die man aus diesem Erz gewinnen und nach Deutschland schaffen wollte. Erst als Reute ihm versicherte, daß er seinem Forscherdrang auch in Zukunft keine Zügel anzulegen brauche, daß man die feste Station des antarktischen Instituts nur in der Nähe des Kraters haben wolle, um das Unternehmen der Regierung für das Ausland zu tarnen, gab er seine Zustimmung zu allem, was von ihm verlangt wurde.
»Dann, meine Herren«, sagte Reute, während er nach einem Schriftstück griff, »habe ich die Ehre und das Vergnügen, Ihnen, Herr Dr. Wille, die Bestallung als Reichskommissar zu überreichen.«
Er zog eine Karte der Antarktis heran, auf der ein Gebiet von etwa dreihundert Kilometern im Durchmesser rot schraffiert war. »Sie sehen hier das zukünftige deutsche Gebiet, dessen Erwerbung durch das Reich die Regierung in den nächsten Tagen öffentlich verkündigen und den anderen Regierungen notifizieren wird. Ihnen, Herr Reichskommissar, untersteht die Verwaltung dieses Gebietes, für die Sie dem Reich verantwortlich sind.«
Trotz seiner gehobenen Stimmung konnte Dr. Wille bei den letzten Worten ein leichtes Lächeln nicht unterdrücken.
»Ich glaube, Herr Ministerialdirektor«, warf er ein, »es wird in dieser Eiswüste nicht viel zu verwalten geben. Meine Station ... nun, ich glaube, ich habe sie ohne besondere Anstrengung bisher ganz gut verwaltet. Und außerdem ...«
»Außerdem«, unterbrach ihn Reute, »unterstehen Ihnen in Ihrer Eigenschaft als Kommissar alle Personen, die in unsere neue Kolonie einwandern, und alle Unternehmungen, die sich in ihr auftun. Sie haben sie zu beaufsichtigen und ihnen erforderlichenfalls den Schutz des Reiches zu gewähren.«
Reute erhob sich, die beiden anderen Herren folgten seinem Beispiel. Er verlas eine Eidesformel, die Wille Wort für Wort nachsprach, und verpflichtete ihn auf sein neues Amt.
»Ich gratuliere als erster, Herr Reichskommissar«, sagte der lange Schmidt und schüttelte Wille die Hand.
»Danke, lieber Schmidt, Sie bleiben nach wie vor mein bester Mitarbeiter. Was sollen wir jetzt tun, Herr Ministerialdirektor?«
»Ich möchte Ihnen erst einmal die Arbeiten hier zeigen und Sie darüber ins Bild bringen, was hier entstehen wird.«
Gemeinsam traten sie ins Freie. Suchend blickte sich Schmidt umher. So scharf er auch nach allen Seiten hin ausschaute, er konnte nur noch zwei Stratosphärenschiffe sehen.
»Sie vermissen die sechs anderen Schiffe, Kollege Schmidt«, sagte Reute, der seine Gedanken erriet, »die sind schon wieder auf dem Wege nach Deutschland, um neues Material und neue Menschen zu holen.«
»Menschen? Es wird also doch Ansiedler in der antarktischen Kolonie geben?« warf Wille ein.
»Wir brauchen Hände für die Arbeiten, die hier geleistet werden sollen«, erwiderte ihm Reute. »Hände und Köpfe. Absolut zuverlässige Leute, die wir auf das sorgfältigste ausgewählt haben. Zweihundert Menschen werden hier tätig sein. Verschwiegene opferwillige Männer, die den Staatsgedanken über alles stellen, die nur von dem einzigen Wunsch beseelt sind, ihrem Vaterlande zu dienen. Vom einfachen Arbeiter bis zum Chefingenieur ist jeder von ihnen von dieser Idee erfüllt. Schwierigkeiten mit der Verwaltung werden Sie hier nicht haben, Herr Doktor.«—
Über den Bergkamm schritten sie einer Stelle des Kraterrandes zu, an der sich ein blinkender Metallbau erhob. Ein Fahrstuhl nahm sie auf und glitt mit ihnen in die Tiefe. Dunkel wurde es über eine Strecke und dann wieder heller, als der Liftkasten sich dem Kratergrunde näherte. Ein leichter Druck, der Kasten stand still. Reute öffnete die Tür und trat als erster hinaus; die andern folgten ihm. Warme trockene Luft schlug ihnen beim Verlassen des Fahrstuhls entgegen.
Trotzdem nun schon ein rundes Jahr vergangen war, seitdem der Bolide aus Weltraumfernen kommend in die Erdkruste einschlug, strahlte die Erzmenge noch immer eine Wärme aus, die für die drei aus der Kälte der Polarnacht Kommenden doppelt stark fühlbar war.
»Das lassen wir besser hier«, meinte Reute, während er seinen Pelz ablegte und in den Fahrstuhl warf. Während Wille und Schmidt das gleiche taten, zog Reute eine Karte hervor. Es war die verkleinerte Nachbildung jenes Planes, den Professor Eggerth mit seinen Leuten vor vielen Monaten von dem Kratergrund aufgenommen hatte. Reute wies auf einzelne farbig markierte Punkte der Zeichnung.
»Wir wollen zunächst«, erklärte er, »diejenigen Stellen abbauen, an denen das Erz nach den Feststellungen von Professor Eggerth den größten Gehalt an Edelmetallen hat.«
Der Boden, über den sie dahinschritten, wies rauhe zackige Unebenheiten auf und zeigte an vielen Stellen, wo das Meteoreisen durch Luft und Feuchtigkeit oxydiert war, eine dunkle rostbraune Färbung.
»Gehen Sie vorsichtig, meine Herren«, warnte Reute, »der Boden hier greift das Schuhzeug scharf an. Schade, Herr Schmidt, daß Sie keine Magnetnadel mit haben. Hier würde sie senkrecht nach unten zeigen, Sie könnten hier den magnetischen Südpol damit feststellen.«
Schmidt zuckte die Achseln und murmelte etwas Unverständliches vor sich hin. Nach seiner persönlichen Meinung war dieser ganze Bolide ein höchst unerwünschter Eindringling, lediglich deshalb aus dem Weltraum hierhergekommen, um ihm bei seinen Arbeiten und Messungen unabsehbare Schwierigkeiten zu bereiten.
Weitergehend stießen sie auf ihrem Wege auf ein Feldbahngleis und folgten ihm ein Stück. Es endete bei einer Arbeitsstelle. Mächtige Bohrmaschinen waren hier aufgebaut. Wie Schlangenleiber zogen sich die Starkstromkabel, die ihnen die Energie zuführten, über den Kraterboden dahin, bis sie im Schatten der Steilwand verschwanden.
Zitternd und knirschend fraßen sich die Drehbohrer schräg in das Erz hinein. Fast armstarke Spiralbohrer, aus höchstwertigem härtesten Spezialstahl gefertigt. Das schrille Geräusch einer der Bohrmaschinen wurde plötzlich dumpf und scharrend. Einer der Arbeiter sprang zu einem Schaltpult und hantierte an verschiedenen Hebeln. Die Drehung des Bohrers hörte auf. Die Maschine zog ihn aus dem mehr als zwei Meter tiefen Bohrloch heraus, ein Rohr senkte sich in das Loch, pfeifend und zischend strömte Preßluft aus dem Rohr und jagte eine Wolke glänzender Bohrspäne in die Luft.
Reute stellte eine kurze Frage an den Schachtmeister der hier arbeitenden Kolonne und wandte sich dann an Wille.
»Es wird noch eine halbe Stunde dauern, bis hier gesprengt werden kann. Wir wollen inzwischen zu einer andern Stelle gehen, an der die Sprengung in wenigen Minuten fällig sein dürfte.«
Beim Weiterschreiten sahen sie plötzlich in weiter Entfernung ein rotes Licht aufflammen. Reute blieb stehen.
»Nicht weiter, meine Herren. Rotlicht heißt Sprengung. Nehmen wir auf alle Fälle Deckung.« Er zog die beiden Gelehrten mit sich zu einem gewaltigen Löffelbagger, der in der Nähe stand. »Hier hinein! In dem schweren stählernen Löffel sind wir vor Sprengstücken sicher.«
Es war kein Teelöffel, sondern ein halbkugeliges Gefäß von zwei Kubikmetern Inhalt, dem der Löffelbagger seinen Namen verdankte. Zu dritt krochen sie hinein und duckten sich im Schutz des starken Stahlbleches dicht zusammen. Aus der Ferne drang ein Ruf an ihr Ohr.
»Die Zündschnur wird angebrannt«, flüsterte Reute.
Eine kleine Ewigkeit dünkten ihnen die nächsten Minuten. Dann ein Donnern und Krachen, das von den Kraterwänden in hundertfältigem Echo zurückgeworfen wurde, bis die Schallwellen den Ausweg nach oben ins Freie gewannen. Langsam verklang der Lärm.
»Jetzt können wir weiter gehen«, sagte Reute und kletterte als erster aus dem Baggerlöffel. Sie schritten weiter und kamen zu der Sprengstelle. Arbeiter waren dort bereits dabei, die während der Sprengung weit zurückgenommenen Starklichtlampen wieder heranzurollen.
»Man ist noch dabei«, fuhr Reute in seiner Erklärung fort, »die beste Sprengmethode für das zähe Erz ausfindig zu machen. An der Stelle, von der wir eben kommen, treibt man eine größere Anzahl von Bohrlöchern schräg in das Metall, um durch mehrere gleichzeitige Sprengungen einen Block aus dem Boden herauszubrechen. Hier dagegen hat man es mit einer einzigen sehr starken in zehn Meter Tiefe angebrachten Ladung versucht. Einige unserer Sprengsachverständigen halten dies Verfahren für unzweckmäßig. Wir wollen sehen, was es geschafft hat.«—
Dann standen sie unmittelbar an der Sprengstelle. Die Gewalt der Explosion hatte hier eine kegelförmige Vertiefung in den Boden gerissen. Das darüber liegende Erz war, in größere und kleinere Stücke zerbrochen, wie aus einem Kanonenrohr emporgeschleudert worden. Reute sprach mit dem Sprengmeister und sagte dann kopfschüttelnd:
»Ich fürchte, meine Herren, die Sachverständigen behalten recht. Im Verhältnis zu der Bohrarbeit und der Größe der Sprengladung ist die Erzausbeute hier verhältnismäßig gering. Wahrscheinlich werden die Arbeiten nach dem anderen Verfahren bessere Ergebnisse liefern. Kommen Sie bitte weiter.«
Sie standen jetzt ungefähr in der Mitte des Kraters. Hoch zu ihren Häupten sahen sie ein kreisrundes Stück des tiefschwarzen Nachthimmels mit funkelnden Sternen besät. Wie ein leuchtender Kranz umgab es der Lichtschein, den die oben am Kraterrande stehenden Starklichtlampen verbreiteten. Es bedurfte einer zweiten Aufforderung Reutes, bevor sie sich von dem eigenartigen Bild zu trennen vermochten.
Unter der Führung des Ministerialdirektors gingen sie weiter auf die gegenüberliegende Wand zu. Wohl zwei Dutzend Arbeitsstellen, die aus der Ferne wie Lichtflecken wirkten, konnten sie auf der weiten Fläche des Kraterbodens beobachten. Von allen Seiten her drang Maschinengeräusch zu ihnen und zweimal noch der Donner von Sprengungen, bevor sie die Kraterwand erreichten. Fast diametral lag die Stelle derjenigen gegenüber, von der aus sie ihre Wanderung angetreten hatten, und wieder stießen sie auf einen Fahrstuhl, doch diesmal war es ein schwerer Lastenaufzug, der an die Förderschalen in Bergwerken erinnerte.
Eine Weile mußten sie warten. Loren, voll beladen mit blinkenden Erzbrocken, rollten auf einem Gleis heran, wurden in die Förderschalen geschoben und verschwanden in schneller Fahrt nach oben. Endlich erklang ein neues Glockenzeichen, das Signal, daß die Anlage nun für Personenfahrt frei war. Sie traten in den Förderkorb, zwei Glockenschläge, die Schale stieg empor. Meter um Meter versank der Boden neben ihnen in die Tiefe. Lichterglanz, ein scharfer Luftzug, die Schale hielt an, sie traten ins Freie und schauerten. Nach dem langen Aufenthalt in einer tropischen Temperatur standen sie plötzlich wieder in der eisigen Polarluft.
»Unsere Pelze! Dumme Sache! Wir werden uns schwer erkälten«, rief der lange Schmidt. Aber da sprang schon ein Arbeiter hinzu und reichte ihnen die Pelze, die sie zu Beginn ihrer Wanderung an der anderen Seite des Kraters abgelegt hatten.
»Gut, gut! Aber einen Schnupfen werden wir uns doch noch holen«, brummte Schmidt weiter.
»Wir sind erst seit wenigen Tagen hier an der Arbeit, Herr Kollege«, suchte ihn Reute zu beschwichtigen. »Natürlich ist noch alles sehr provisorisch. Später wird von der Förderanlage ein geschlossener Gang zu den Aufbereitungswerken führen. Sie dürfen mir glauben, daß der starke Temperaturunterschied zwischen dem Kraterinnern und dem Oberland uns schon ziemliches Kopfzerbrechen gemacht hat. Wir müssen unsere Leute mit allen Mitteln davor schützen, um Erkrankungen zu vermeiden.«
Der Weg führte sie weiter eine Bohlenbahn entlang zu einem Hallenbau. Er war in jener Holztechnik errichtet, die sich bei der Willeschen Station in zwei Polarwintern bereits so gut bewährt hatte. Betäubendes Geräusch von Werkzeugen und Maschinen drang ihnen entgegen, als sie in den großen hell erleuchteten Raum traten. In einer Reihe standen dort gewaltige Dieselmotoren, die beiden ersten schon betriebsfertig, einer davon in vollem Lauf. Die folgenden noch in der Montage; für die letzten wurden eben erst die Fundamente gelegt.
»Sie sehen hier unser Kraftwerk«, schrie ihnen Reute in die Ohren, um sich in dem Lärm verständlich zu machen. »Zwölf Verbrennungsmotoren von je 5000 Pferden, direkt mit ihren Dynamo-Maschinen gekuppelt. Für den ersten Ausbau wollen wir mit 60 000 Pferden arbeiten.«
»60 000 Pferde? Für ein Kraftwerk nicht gerade viel«, warf Dr. Wille ein.
Reute lachte. »Für ein Kraftwerk ist es nicht viel, da haben Sie recht. Aber für ein Baukraftwerk ists schon ganz anständig. Kommen Sie einmal in einem Jahr wieder, wenn erst die Hüttenwerke fertig sind. Dann werden wir Ihnen wahrscheinlich mit einer halben Million Pferdestärken dienen können. Vergessen Sie nicht, Herr Doktor, daß wir erst seit Tagen hier sind. Dafür ist schon Bedeutendes geleistet.«
Weiter ging ihr Weg vom Kraftwerk zu einer benachbarten Stelle. Hier war der Felsboden durch Sprengungen geebnet, und an die hundert Mann waren dabei, die Fundamente für das Hüttenwerk zu legen. Von einem Lagerplatz holten sie die einzelnen Bauteile dafür herbei, auf dem gewaltige Mengen von Material aufgestapelt waren. Wille schüttelte verwundert den Kopf.
»Unbegreiflich, Herr Ministerialdirektor, wie haben Sie das alles in der kurzen Zeit hierher geschafft?«
»Die Bauteile lagen schon seit mehreren Wochen fix und fertig in Deutschland, Herr Doktor. Wir wollten eigentlich erst später mit den Arbeiten beginnen. Als wir aber Ihre Absicht erfuhren, mit der motorisierten Station hierherzukommen, entschlossen wir uns, sofort zu handeln. Zweimal sind inzwischen schon acht Stratosphärenschiffe zwischen Deutschland und dem Südpol hin- und hergeflogen. Sechzehn Schiffsladungen entspricht das alles, was Sie hier gesehen haben. Aber bald werden es hundert Ladungen sein und ... und ich sagte es Ihnen ja schon, in einem Jahr wird es hier ganz anders aussehen.«—
In der Nähe des Lagerplatzes hielt ein Kraftwagen. Ebenso wie die Fahrzeuge der motorisierten Station lief er auf breiten Raupenketten. Reute nötigte Wille und Schmidt einzusteigen.
»Es ist keine reine Freude, hier zwei Kilometer über zerrissenes Gelände durch die Polarnacht zu laufen«, meinte er dabei. Wohnwagen ihrer Station. Sie waren nicht in der Laune zu sprechen, zu sehr erfüllte sie all das Neue, kaum Faßbare, was sie während der letzten Stunden erlebt hatten.
Von einer halbraumen Brise getrieben, machte das Boot, mit dem die beiden Amerikaner ihre Insel verlassen hatten, gute Fahrt. Garrison, der am Steuer saß, warf des öfteren Holzstückchen über Bord und beobachtete, wie sie zurückblieben.
»Was machen Sie da?« fragte Bolton.
»Ich versuche unsere Geschwindigkeit festzustellen. Nach meiner Schätzung läuft das Boot gut und gern vier Knoten. Wenn es weiter so bleibt, können wir in 24 Stunden Tahiti erreichen.«
»24 Stunden?« Bolton verzog das Gesicht. Drei Stunden waren sie nun unterwegs, immer höher war die Sonne heraufgekommen und brannte unbarmherzig auf sie nieder. Da das Boot mit der Brise lief, vermochte diese nur wenig Kühlung zu geben.
»Noch mehr als 20 Stunden Fahrt, Garrison. Verflucht lange ist das.« Bolton stand auf und suchte sich eine andere Stelle, wo ihm das Segel Schatten bot. Dort machte er sichs bequem. Bald verrieten seine tiefen Atemzüge, daß er eingeschlafen war.
Weiter verstrich die Zeit, hoch stand die Sonne am Zenit, als die Stimme Garrisons ihn weckte. Nur langsam ermunterte er sich und schaute um sich. Glatt wie ein Spiegel dehnte sich die See, schlaff hing das Segel am Mast, kein Lüftchen regte sich mehr.
»Was ist's, Garrison? Was wollen Sie?«
»Flaute, Bolton! Seit einer halben Stunde liegen wir auf derselben Stelle.«
Er wies auf ein paar Holzstückchen, die neben dem Boot im Wasser lagen.
»Verdammt, Garrison! Was sollen wir jetzt machen?«
»Wir haben zwei Möglichkeiten, Bolton. Entweder ruhig warten, bis wieder Wind aufkommt, oder die Riemen in die Hand nehmen und kräftig pullen.«
Bolton schüttelte den Kopf. »Ich danke schön! 150 Kilometer rudern, pfui Teufel!«
Garrison zuckte die Achseln. »Es wäre die eine Möglichkeit. Viel Lust dazu habe ich selber nicht. Ich glaube, wir können's ruhig abwarten. Gegen Abend wird die Brise wieder kommen.«
»Ganz meine Meinung«, pflichtete Bolton ihm bei, »sparen wir unsere Kräfte für bessere Dinge auf.«
Garrison verließ seinen Platz am Steuer und suchte sich neben Bolton ein schattiges Fleckchen. Beide merkten, daß sie seit Stunden nichts genossen hatten und nahmen aus ihren Vorräten erst einmal eine ordentliche Mahlzeit zu sich.
»Wenn's so weiter geht«, bemerkte Bolton nachdenklich, »dann kann's lange dauern, bis wir nach Tahiti kommen. Ich weiß nicht, Garrison, ob wir klug daran taten, die Insel zu verlassen ...«
Eine plötzliche Bewegung des Bootes unterbrach seine Betrachtungen. Ein kurzer, jäher Windstoß fegte über die See daher, packte das Segel und legte das Boot schwer auf die Seite. Mit einem Sprung war Garrison wieder an seinem alten Platz und hantierte mit Steuer und Segelleine.
»Die Brise kommt wieder«, schrie er Bolton zu. Zweifellos war seine Bemerkung richtig. Wind kam wieder auf, und zwar in einer solchen Stärke, daß er alle Kunst anwenden mußte, um ein Kentern zu vermeiden. Aber der Wind kam aus einer andern Richtung wie früher, und das Boot ohne Kiel oder Schwert war kein Kreuzer. Notgedrungen mußte Garrison es vor dem Winde laufen lassen in einer Richtung, die fast rechtwinklig zu ihrem ursprünglichen Kurs stand. Bolton merkte von dieser Änderung nichts; er beobachtete nur mit Vergnügen, daß sie schnelle und immer schnellere Fahrt machten.
Desto größere Sorgen empfand Garrison. Blieben die Windverhältnisse noch lange so wie jetzt, dann wurden sie weit von ihrem Ziele abgetrieben in eine insellose Gegend der Südsee und dann konnte diese Bootsfahrt ein böses Ende nehmen. Doch die Ereignisse ließen ihm nicht Zeit, weiter darüber nachzudenken, denn von Minute zu Minute wurde der Wind stärker.
»Reffen! Segel reffen!« schrie er Bolton zu.
Mit der Möglichkeit, daß sie in einen Sturm geraten, daß schnelle Segelmanöver notwendig werden könnten, hatten sie bei der Fertigstellung ihres Bootes nicht gerechnet. Die Takelage war infolgedessen nur primitiv ausgefallen. Es war nicht möglich, das Segel zu reffen. Mit Mühe gelang es Bolton, die Leinwand einigermaßen zusammenzufalten und mit einem Tauende an den Mast zu binden. So wirkte es immer noch wie ein Sturmsegel, vor dem das Boot mit erheblicher Geschwindigkeit durch die gröber werdende See lief. Trotzdem Garrison alle Kunst aufwandte, um den Kurs senkrecht zu den Wogenkämmen zu halten, schlug hin und wieder ein Brecher über die niedrige Bordwand. Wie hatte sich die ewig sonnige blaue Südsee in kurzer Zeit verändert. Weißgemähnt jagten die Wellen heran, überholten das Boot, drohten jeden Augenblick, es vollzuschlagen und kentern zu lassen.
Verzweifelt kämpften die vom Sturm Verschlagenen um ihr Leben. Auf dem Boden des Bootes kniend war Bolton unablässig bemüht, die über die Bordwand schlagenden Wassermengen mit der größten Konservenbüchse, die er fassen konnte, wieder herauszuschöpfen. Alle Nerven und Muskeln gespannt, handhabte Garrison das Steuer, nur noch bemüht, das schwankende Fahrzeug von einer bis zur anderen Woge heil durchzubringen. Längst hatte er die Orientierung verloren. Eine verlorene Nußschale war das Boot in der endlosen Wasserwüste, dem unvermeidlichen Untergang schienen seine Insassen geweiht zu sein.
Die Zeit lief weiter. Schon senkte sich die Sonne nach Westen, als Garrison
in der Ferne an der Kimme fast, wo Meer und Himmel sich berühren, etwas
Dunkeles zu bemerken glaubte. Schärfer schaute er danach hin. Ein
Rauchwölkchen konnte es sein, die Rauchfahne eines Dampfers vielleicht.
Wollte das Schicksal Erbarmen zeigen, führte es auf diesem so wenig
befahrenen Meer ein Dampfschiff in ihren Kurs? Er ließ den fernen
Rauchstreifen nicht mehr aus den Augen, während er gleichzeitig alle
Aufmerksamkeit anwenden mußte, um das Boot durch die immer höher gehende See
zu bringen. Erkannte dabei, an welch schwachem Faden ihre Rettung hing. Ganz
ausgeschlossen war es ja, den Kurs irgendwie auf jene die Rettung bringende
Rauchwolke zu setzen. Schon eine geringe Abweichung von der Richtung, die er
einhielt, hätte ihm schwere Brecher über Bord und den sofortigen Untergang
gebracht. Noch wagte er nicht, Bolton von dem, was seine Augen erblickten,
etwas zu sagen. Zu unsicher schien ihm die Hoffnung, an die er sich selber
klammerte.
Größer wurde die Wolke, schon vermochte er die schwarzen Umrisse eines
Dampfers zu unterscheiden, und größer wurde auch die Hoffnung in seinem
Herzen. Das fremde Schiff schien einen Kurs zu steuern, der ihren eigenen
schneiden mußte. Würden sie es schaffen? Würden sie dem Dampfer so nahe
kommen, daß man sie dort sah, dort etwas zu ihrer Rettung unternahm? Er
konnte nicht länger an sich halten.
»Bolton«, rief er, »Bolton, sehen Sie den Dampfer rechts voraus?«
Der hielt mit dem Schöpfen inne und blickte in die Richtung, die Garrison ihm wies. Noch ehe er etwas sagen konnte, kam ein schwerer Brecher über Bord und durchnäßte ihn von oben bis unten.
»Schöpfen Sie! Schöpfen Sie, Bolton!« schrie Garrison verzweifelt.
Immer kleiner wurde die Entfernung. Jetzt hatten die auf dem Dampfer wohl Segel und Mast des Bootes gesehen. Das Schiff änderte seinen Kurs und kam schnell heran. Garrison sah, wie Matrosen an der Reling winkten. Rufe und Worte drangen an sein Ohr, französische Laute schienen es zu sein.
Wenige aufregende Minuten noch, dann lag der Dampfer neben dem Boot, ein Fallreep wurde heruntergelassen. Als erster griff Bolton danach. Als Garrison ihm folgte und seinen Fuß in eine Leitermasche setzte, faßte eine mächtige Woge das Boot, stürzte es um und riß es im Schaumgischt ihres brechenden Kammes mit sich.
Erschöpft, durchnäßt, Schiffbrüchige, die nur noch das ihr eigen nannten, was sie auf dem Leib trugen, kamen die beiden Amerikaner an Bord des französischen Frachtdampfers ›Fréjus‹, der sich aus der Fahrt von Tahiti nach dem australischen Hafen Brisbane befand.
Gastfreundlich wurden sie auf dem französischen Schiff aufgenommen. Ohne nach
dem Woher und Wohin zu fragen, ließ der Kapitän ihnen sofort eine behagliche
Kabine anweisen. Ein Matrose brachte trockene Kleidung, ein anderer stellte
ein Tablett mit Speisen und Getränken auf den Tisch. Garrison, der die
französische Sprache gut beherrschte, sprach den Seeleuten seinen Dank dafür
aus. Dann schloß sich die Tür, sie waren allein.
»Uff!« stöhnte Bolton, während er sich die nassen Sachen vom Leibe riß, »das ging hart auf hart. Ein bißchen anders und wir wurden Haifischfutter.«
»Schon gut, Bolton«, unterbrach ihn Garrison, »wichtiger ist jetzt die Frage, was wir den Leuten vom ›Fréjus‹ nachher erzählen wollen. Die werden doch natürlich wissen wollen, wie wir hierher geraten sind.«
»Furchtbar einfach, Garrison! Wir werden den Leuten sagen, wie es gewesen ist. Wir werden ihnen den gemeinen Streich erzählen, den die Deutschen uns gespielt haben. Wie sie in der Antarktis scheinbar als Retter zu uns kamen und uns hinterher auf einer verlassenen Insel aussetzten. Das sollen die Franzosen alles haarklein von mir zu hören bekommen, und ich werde ...«
»Ein Glück, daß Sie nicht französisch können«, unterbrach ihn Garrison. »Es wäre die größte Dummheit, die wir machen könnten, wenn wir andern Leuten ... noch dazu Franzosen ... unser Abenteuer auf die Nase binden wollten.«
Erst mit Hemd und Hose bekleidet ging Bolton an den Tisch, mischte sich ein Glas Kognak und Soda halb und halb und goß es in einem Zuge hinunter.
»Ah, das tut gut! Hm, hm ... Sie meinen also, Garrison, daß wir besser tun, uns über unsere Angelegenheiten auszuschweigen.« Der so lange entbehrte Alkohol brachte sein Blut und seine Gedanken in Schwung. Lebhaft fuhr er fort:
»Da müssen wir uns sofort eine glaubhafte Geschichte ausdenken. Daß wir vom Himmel in die Südsee gefallen sind, können wir ihnen nicht erzählen. Auf welche plausible Weise könnten wir denn hierher gekommen sein?«
Garrison zwängte seinen Leib eben in einen blauen Sweater. Als sein Kopf wieder zum Vorschein kam, antwortete er:
»Selbstverständlich sind wir vom Himmel gefallen, Bolton. Merken Sie sich die Geschichte, falls man Sie auf englisch ausfragen sollte. Am 22. August haben wir in Adelaide ein Flugzeug gekauft, um damit einen Forschungsflug über die Südsee zu unternehmen. Infolge einer Motorstörung mußten wir nach 40 Stunden niedergehen ...«
»Sie meinen in der Antarktis damals, Garrison?« unterbrach ihn Bolton.
»Unsinn, Bolton! Die Antarktis hat in unserer Geschichte gar nichts zu suchen. Bei einer einsamen Insel in der Südsee mußten wir niedergehen. Unser Flugzeug wurde von der Brandung zerstört. Es gelang uns, an Land zu kommen. Im Laufe mehrerer Wochen haben wir uns dann ein Boot gebaut, um damit Tahiti zu erreichen. Von unserer angeblichen Notlandung an erzählen wir die Geschichte so, wie sie wirklich gewesen ist. Desto weniger laufen wir Gefahr, uns zu verheddern und widerstreitende Angaben zu machen. Sind Sie jetzt im Bilde?«
Bolton nickte und mischte sich einen zweiten Soda-Kognak.
Mit Interesse hörte Kapitän Monsieur Lemaître den Bericht der beiden
Schiffbrüchigen und bat sie, sich auf der ›Fréjus‹ bis zur
Landung in Brisbane wie zu Hause zu fühlen. Mit sehr gemischten Gefühlen
vernahmen die Amerikaner, daß die Reise bis dorthin noch rund vierzehn Tage
beanspruchen würde. Zwei lange Wochen, die noch verstreichen mußten, bevor
sie wieder etwas in der Angelegenheit unternehmen konnten, auf die beide
jetzt mehr denn je versessen waren.
Die ›Fréjus‹ war nur ein kleiner Frachtdampfer von 1200 Tonnen, eins jener Tramp-Schiffe, die in der Südsee schlecht und recht ihr Leben machen, indem sie bei den Inseln Fracht, meistens Kopra, nehmen und nach den australischen Häfen bringen. Erfreulicherweise befand sich wenigstens eine Funkanlage an Bord, und Monsieur Lemaître ließ es sich nicht nehmen, mit allen Einzelheiten die Nachricht in die Welt hinauszufunken, daß seine opfermutige Mannschaft zwei amerikanische Forscher gerettet habe und mit nach Brisbane bringe.
Der Funkspruch wurde in Australien aufgenommen. Mit dem Zusatz, daß man nun über das Schicksal der so lange als verschollen betrachteten Amerikaner nicht mehr in Sorge zu sein brauche, gab ihn der Kurzwellensender von Melbourne weiter. Von vielen Stationen der Erde wurde die australische Sendung empfangen. Auch Rudi Wille hörte sie an seinem Apparat und schrieb sie nieder.
Verwundert ging er mit dem Radiogramm zu seinem Vater und Dr. Schmidt, und bei denen löste es ein schweres Rätselraten aus. Wie ließ sich diese Nachricht aus Australien mit jener andern zusammenbringen, daß ›St 8‹ die beiden Amerikaner bei Neapel abgesetzt habe? Ein Depeschenwechsel entwickelte sich daraus, der den Herren in Bitterfeld noch mancherlei Kopfzerbrechen verursachen sollte.
Kapitän Lemaître hatte die Amerikaner eingeladen, an den regelmäßigen
Mahlzeiten in der Offiziersmesse der ›Fréjus‹ teilzunehmen. Es
war um die Mittagszeit des dritten Tages. An dem langen Tisch in der Messe
saßen die Steuerleute und Ingenieure des Dampfers beisammen und gingen einem
auf Marseiller Art zubereiteten Fischgericht mit gesundem Appetit zu Leibe,
als der Funker in die Messe kam und ein Radiogramm vor Kapitän Lemaître
hinlegte.
Der las es und brach in ein schallendes Gelächter aus. »Das Neuste aus Deutschland, meine Herren. Deutschland hat ein Gebiet in der Antarktis in Besitz genommen und zu einer deutschen Kolonie erklärt.«
Schon während der letzten Worte wurde das Gelächter am Tisch allgemein. Worte flogen dazwischen hin und her ... armes Deutschland ... eine Kolonie am Südpol ... in Schnee und Eis ... Nacht und Kälte ... sind sie ganz toll geworden die Boches, oder bezwecken sie etwas damit? ...
Zwei Menschen beteiligten sich nicht an diesem Geschwätz und Gelächter. Bolton ... weil er den französischen Text des Radiogramms nicht verstanden hatte ... und Garrison, weil ihm der Herzschlag zu stocken drohte, als er den Funkspruch hörte. Er schwieg, bis sich Lemaître direkt mit der Frage an ihn wandte, wie man wohl in den Vereinigten Staaten über solch neue Kolonialpolitik Deutschlands denken mochte.
»Die Nachricht kommt mir vollkommen überraschend«, erwiderte er dem Kapitän, wie aus tiefem Nachdenken erwachend. »Man müßte Genaueres wissen, bevor man darüber urteilen kann. Meines Wissens gehört das Marie-Byrd-Land den Vereinigten Staaten, seitdem Admiral Byrd dort im Jahr 29 das Sternenbanner hißte. Die Union würde es bestimmt nicht dulden, daß Deutschland sich auf diesem Gebiet festsetzt.«
Kapitän Lemaître machte eine leichte Verbeugung zu dem Amerikaner hin.
»Vorzüglich! Ganz vorzüglich, Monsieur Garrison, daß Ihr schönes Vaterland sich seine Rechte nicht schmälern lassen wird!«
»Ich hoffe, Herr Kapitän, daß auch das Ihrige seinen Besitz nicht antasten lassen wird.«
Lemaître sah ihn fragend an. »Ich verstehe Sie nicht, Monsieur Garrison. Frankreich hat in der Antarktis keine Interessen.«
Garrison schüttelte den Kopf. »Sie irren sich, Kapitän Lemaître. Formell wenigstens gehört Adélie-Land unter dem 70. Breitengrad seit langer Zeit zu Frankreich.«
Die Reihe, den Kopf zu schütteln, war jetzt an Kapitän Lemaître.
»Adélie-Land … eine französische Kolonie … Adélie-Land, ich habe in meinem Leben nicht davon gehört.«
»Das mag wohl sein, Herr Lemaître. Die Geschichte ist so alt, daß sie inzwischen vielleicht schon wieder vergessen wurde. Wenn ich mich recht erinnere, hat D'Urville das Land im Jahre 1840 entdeckt und im Namen Frankreichs in Besitz genommen.«
»Ah, das wäre ja interessant«, rief Kapitän Lemaître und pfiff durch die Zähne. »Wenn uns die Deutschen dort ins Gehege kämen ...«
Garrison machte eine abweisende Handbewegung.
»Es hätte wenig Sinn, sich um diese Gebiete zu streiten. Es sind froststarrende Eiswüsten, die höchstens die Wissenschaftler interessieren können. Für einen andern Menschen ist dort absolut nichts zu holen. Das gilt für Ihr Adélie-Land ebenso wie für unser Marie-Byrd-Land.«
»Warum aber zum Teufel setzen sich jetzt plötzlich die Boches dort fest?« fiel ihm Lemaître ins Wort. »Irgendeinen Zweck müssen sie doch damit verfolgen.«
Über diesen Zweck hätte Garrison nun dem Kapitän Lemaître in der Tat mancherlei sagen können, aber er zog es vor, die Achseln zu zucken und zu schweigen. Mit Ungeduld sehnte er das Ende der Mahlzeit herbei, um sich unter vier Augen mit Bolton über die neue Situation auszusprechen.
Kaum waren die Amerikaner in ihrer Kabine allein, als Garrison mit dem eben
Gehörten herausplatzte. Auf Bolton wirkte die Nachricht wie ein Keulenschlag.
Stumm hockte er auf seiner Koje, unfähig etwas zu sagen, kaum fähig etwas zu
denken.
»He, Bolton! Reden Sie doch endlich, sprechen Sie doch auch ein Wort!« schrie ihn Garrison an. Der preßte den Kopf in beide Fäuste und brachte ein dumpfes Stöhnen hervor. Nur allmählich ordneten sich seine Gedanken. Einem Schatz war er auf der Spur ... einem Schatz, so groß ... so unermeßlich, daß alle Reichtümer der Welt dagegen verblassen mußten ... fast greifbar nahe hatte der Schatz vor ihm gelegen ... und nun ... nun waren andere gekommen ... Verbrecher ... hatten ihm seinen Schatz geraubt ...
Mit einem rauhen Schrei sprang er auf. Schweigend saß Garrison auf der Bank unter dem Bulley und beobachtete ihn, wie er ruhelos wie ein wildes Tier in der Kabine hin und her lief. Flüche, wilde Verwünschungen kamen aus seinem Munde, Haß und Wut verzerrten sein Gesicht. Garrison traute sich nicht, ihn anzusprechen, in diesem Augenblick hatte er Furcht vor ihm.
Mit einem Ruck blieb Bolton plötzlich mitten in der Kabine stehen.
»Ich werde funken, Garrison! Sofort an unsern Präsidenten funken ...«
»An den Präsidenten? Was wollen Sie ihm ...«, wagte Garrison einzuwerfen.
»... dagegen protestieren«, brüllte Bolton ihn nieder, »daß zwei Bürger der amerikanischen Union von Deutschland um ihre Entdeckung bestohlen werden.«
Vergeblich wandte Garrison während der nächsten Stunde seine ganze
Beredsamkeit auf, um Bolton von diesem Entschluß abzubringen. Vergeblich
versuchte er ihm klarzumachen, daß er sich durch eine solche Depesche ein für
allemal die Möglichkeit verschütte, doch noch etwas von dem kostbaren Erz zu
erobern. Vergeblich erklärte er wieder und immer wieder, daß allein das
Geheimnis ihre Entdeckung so wertvoll mache, daß der Wert in dem Augenblick
dahin sei, in dem die Öffentlichkeit etwas von der Existenz erführe. Bolton
war wie ein Stier, der das rote Tuch sieht. Durch nichts ließ er sich von
seinem Entschluß abbringen, sofort eine lange Depesche an den Präsidenten der
Vereinigten Staaten aufzusetzen.
Garrison sah ein, daß es unmöglich war, diesen Starrsinn zu brechen. Während Bolton sich an den Tisch setzte und zu schreiben begann, verließ er die Kabine. Mit heißem Kopf ging er draußen auf dem Verdeck auf und ab und ließ sich den Wind ums Gesicht wehen. Unablässig überlegte er, was der törichte Funkspruch Boltons für Folgen haben könnte, ja wahrscheinlich haben müßte. Der Funker in der ›Fréjus‹ beherrschte, wie Garrison bereits herausgefunden hatte, das Englische nur sehr mangelhaft. Es bestand wenigstens die Möglichkeit, daß der den vollen Sinn von Boltons Depesche nicht faßte, während er sie in die Welt morste.
Aber von hundert andern Stellen, die des Englischen mächtig waren, würden sie wahrscheinlich mitgehört werden, und dann war es mit der Hoffnung auf Erz und Reichtum ein für allemal vorbei. War der Funkspruch einmal aus der Antenne heraus, dann konnte er, Mr. James Garrison, nur ruhig nach Pasadena zurückkehren und dort den Rest seiner Tage als mäßig bezahlter Assistent der Sternwarte verbringen ...
Der Glockenschlag der Schiffsuhr riß ihn aus seinen Gedanken. Schon eine Viertelstunde sinnierte er hier auf dem Deck, schon eine Viertelstunde schmiedete unten in der Kabine Bolton an der irrsinnigen Depesche. Jeden Augenblick konnte er damit erscheinen und dann ... dann nahm das Unheil seinen Lauf.
Garrison beschloß zu handeln. Er eilte die eiserne Leiter zur drahtlosen Station hinauf. Monsieur Longin, der Funker der ›Fréjus‹, war anwesend, und Garrison hatte eine hastige Unterredung mit ihm, wobei eine Zwanzigpfundnote aus Garrisons Hand in diejenige von Monsieur Longin hinüberwechselte. Dann hatte der Funker die Wünsche und Besorgnisse Garrisons verstanden. Der andere amerikanische Herr, durch den vorherigen Funkspruch maßlos erregt ... nervös überreizt, im Begriff, eine unüberlegte Depesche an den amerikanischen Präsidenten zu schicken ... unter allen Umständen verhindern ... Depesche abnehmen, aber nicht absenden, ... höchstens zum Schein absenden ...
Garrison stellte dem Funker für eine geschickte Ausführung des Auftrages noch eine zweite Banknote in Aussicht und machte, daß er weiterkam, denn ein Zusammentreffen mit Bolton an dieser Stelle wollte er unter allen Umständen vermeiden. Er war noch nicht lange fort, als Bolton auftauchte und mit zwei Depeschen in die Funkstation trat. Monsieur Longin nahm die Blätter in Empfang und raffte sich zu einem ›Yes Sir, all right Sir‹ auf.
Während er den Text studierte, wurde ihm klar, wie recht der andere Amerikaner mit seinen Vermutungen und Befürchtungen hatte. Eine Depesche an den Präsidenten der amerikanischen Union ... schon eine sehr ungewöhnliche Sachs ... soweit er den Text zu verstehen vermochte, ein aufgeregter Protest gegen Räuber und Diebe, von denen Mr. Bolton schwer geschädigt zu sein glaubte ... immerhin, wäre Mr. Garrison nicht vorher bei ihm gewesen, so hätte er sie einfach an die amerikanische Kurzwellenstation auf Nantuket-Island gemorst. Mochten die dortigen Funker sehen, wie sie sie weiter an das ›Weiße Haus‹ in Washington expedierten ... aber der Text auf dem zweiten Blatt ... ein Blinder mußte ja merken, daß Mr. Bolton aus Frisko übergeschnappt war ... ein Funkspruch an das große Bankhaus von Barkley-Brothers in Adelaide, sofort das schnellste Flugzeug, das sie auftreiben konnten, für Mr. Boltons Rechnung zu chartern und der ›Fréjus‹ entgegenzuschicken.
Während er sich noch kopfschüttelnd bemühte, den vollen Sinn des englischen Textes zu erfassen, legte sich Boltons Hand schwer auf seine Schulter. Mit kaum mißzuverstehenden Worten und Gebärden forderte ihn der Yankee auf, die beiden Funksprüche sofort abzusenden.
Hartnäckig wie alle Verrückten ... Irrsinnigen, darf man nicht widersprechen ... dachte Monsieur Longin bei sich und begann an seiner Apparatur zu fingern. Drehte Abstimmknöpfe, schaltete hin und her, morste, lauschte eine Weile, morste dann wieder. Zehn Minuten später verließ Bolton die Funkstation mit dem Bewußtsein, daß seine Depeschen an die richtigen Adressen unterwegs seien.
Etwas beruhigter kehrte er in seine Kabine zurück und zündete sich eine Zigarre an. Drei Tage höchstens ... drei Tage noch dachte er zwischen zwei Rauchwolken, dann ist das Flugzeug hier ... dann werde ich mit diesen Räubern abrechnen.
Zu derselben Zeit konnte Monsieur Longin eine zweite Banknote in Empfang
nehmen. Aufmerksam las Garrison die beiden Depeschen Boltons. Mißbilligend
schüttelte er den Kopf bei der Lektüre der ersten. Alles hätte Bolton in
seiner blinden Wut verdorben, wenn dieser Funkspruch wirklich abgegangen
wäre. Nachdenklich wurde er bei der zweiten.
Der Gedanke, sich ein Flugzeug kommen zu lassen, war gar nicht so übel. Zwar etwas kostspielig, aber Bolton verfügte ja über die nötigen Millionen. Man würde auf diese Weise acht bis zehn Tage sparen, würde schneller in der Lage sein, wieder in den Gang der Dinge einzugreifen ...
Monsieur Longin begann auch an dem Geisteszustand Garrisons zu zweifeln, als er den Auftrag bekam, diesen Funkspruch genau so wie ihn Bolton aufgesetzt hatte, wirklich zu funken. Aber ... was gingen ihn im Grunde die Geschäfte dieser spleenigen Yankees an. Sein Geld hatte er sicher, und das Funken war ja schließlich sein Beruf. Gleich danach begann die Morsetaste unter seiner Hand zu klappern, und diesmal war Strom in der Antenne.
Durch ihre diplomatischen Vertretungen gab die Reichsregierung den andern Mächten von ihrem Entschluß Kenntnis, ein Gebiet in der Antarktis in einer Ausdehnung von rund 5000 Quadratkilometern zu einem deutschen Schutzgebiet zu erklären. Lage und Grenzen des neuen Kolonialgebietes waren in der Note, welche die deutschen Vertreter den Regierungen überreichten, genau angegeben. Das Schriftstück führte weiterhin aus, daß das betreffende Gebiet herrenlos sei. In der Sprache des Völkerrechtes also eine ›terra, nullius‹, ein Niemandsland, welches das Reich nehmen könne, ohne irgendwelche älteren Rechte zu verletzen. Motiviert wurde der Entschluß endlich mit den großen wissenschaftlichen Interessen, die das Reich, bzw. das deutsche antarktische Institut in jener Gegend habe.
Die erste Wirkung dieser Mitteilung in den verschiedenen auswärtigen Ministerien war derjenigen nicht unähnlich, welche der Funkspruch an Bord der ›Fréjus‹ auslöste. Man lachte zwar nicht so laut und unverhohlen, wie die Männer in der Offiziersmesse des französischen Dampfers. Man lächelte mehr diplomatisch und zurückhaltend, aber wirklich ernst vermochte keins der fremden Ämter die Sache zu nehmen.
Nach dem Weltkriege hatte man dem niedergeworfenen Deutschland seine blühenden Kolonien unter fadenscheinigen Gründen abgenommen und bisher war es ihm nicht gelungen, wenigstens einen Teil davon wiederzuerhalten. War es Prestigesucht, die das inzwischen neu geeinte und verjüngte Reich veranlaßte, diesen unbegreiflichen Schritt zu tun? Wissenschaftliche Interessen ... die Begründung erschien den meisten nicht stichhaltig. Wie viele andere Expeditionen waren in der Antarktis tätig gewesen, ohne daß die Länder der betreffenden Forscher deswegen Veranlassung genommen hatten, in der trostlosen Eiswüste Kolonialbesitz zu erwerben.
Dann begann man sich an alte, fast vergessene Dinge zu erinnern. Es bestanden doch allerlei Ansprüche auf den antarktischen Kontinent, die auf früheren Abmachungen basierten. Da gab es ja einen australischen Sektor und einen englischen. Da gab es Gebiete, die formell und offiziell zu Frankreich und zu den Vereinigten Staaten gehörten. Mit wissenschaftlichen Dingen hatte das freilich blutwenig zu tun. Ausnahmslos handelte es sich dabei um Fischerei-Interessen und nur die äußersten Küstenstreifen jenes unter Eis und Schnee vergrabenen Kontinentes hatten für die betreffenden Staaten einen gewissen Wert. Keiner von ihnen hatte jemals daran gedacht, seine Ansprüche weiter auf das Innere des Landes auszudehnen.
So hatte es denn mit dem Passus der deutschen Note, daß es sich hier um ein Niemandsland handele, seine Richtigkeit. Obwohl man am Quai d'Orsay und in der Downingstreet der deutschen Unternehmung schon aus alter Gewohnheit ganz gern Schwierigkeiten bereitet hätte, ließen sich beim besten Willen keine Gründe dafür finden. Es blieb den fremden Regierungen nichts weiter übrig, als die Besitzergreifung des bezeichneten Gebietes durch Deutschland zur Kenntnis zu nehmen. Einige Verklausulierungen, eine Nachprüfung eventueller älterer Rechte betreffend, konnten von den deutschen Vertretern auf Grund der tatsächlichen Verhältnisse entkräftet werden.
Der Reihe nach trafen denn auch die offiziellen Anerkennungen des neuen Kolonialbesitzes in Berlin ein. Von den skandinavischen Staaten, von Holland und Italien kamen sie zuerst. Costarica, Honduras und Guatemala folgten. Als erste außereuropäische Großmacht erkannte Japan die neue deutsche Erwerbung an. Langsam folgten andere Großstaaten seinem Beispiel.
Die völkerrechtliche Lage war derartig, daß eine Versagung der Anerkennung auf die Dauer nicht möglich war. Um so mehr zerbrach man sich in Washington, London und Paris den Kopf über den wirklichen Zweck dieser neuen Kolonie. Kein Gerücht war so abenteuerlich, daß es nicht Glauben gefunden hätte. Servierten die Pariser Boulevard-Blätter ihren Lesern heute eine fette Ente über die wirklichen Absichten der Deutschen in der Antarktis, so wurden sie am folgenden Tag von den New-Yorker Zeitungen überboten, die etwas noch Unglaublicheres auftischten. Das mindeste war, daß Deutschland dort in der Nähe des Poles einen Startplatz für seine ersten Mondraketen anzulegen beabsichtige. In langen pseudowissenschaftlichen Artikeln wurde erklärt, daß nur in nächster Nähe der Erdpole ein sicherer Schuß zum Monde möglich sei. Fast noch wichtiger wäre dies Gebiet für eine sichere Landung bei der Rückkehr von unserm Trabanten, deshalb hätten die schlauen Deutschen es sich beizeiten gesichert.
In den Reichsministerien legte man alle diese Erzeugnisse einer zügellosen Phantasie gelassen zu den Akten. Unangenehmer wurde ein Aufsatz in der französischen Fachzeitschrift ›La nature‹ empfunden, der unter dem Titel ›Ungehobene Schätze in der Antarktis‹ erschien.
Ein Mineraloge von anerkanntem Ruf entwickelte darin den Gedanken, daß der antarktische Kontinent mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit gewaltige Bodenschätze enthalten müsse. Nicht nur wertvolle Metalle, sondern auch riesige Kohlen- und Erdöllager. Möglicherweise hätten die Leiter des deutschen antarktischen Institutes ergiebige Fundstellen entdeckt, und das Reich hätte sich daraufhin dort festgesetzt.
Mit einem leichten Stirnrunzeln gab Professor Eggerth diesen Aufsatz an Minister Schröter zurück.
»Der Mann hat die Glocken läuten hören, Herr Minister. Gott sei Dank weiß er nicht, wo sie hängen. Trotzdem ... solche Veröffentlichungen könnten unangenehm werden.«
Der Minister legte die Zeitschrift in eine Mappe. Während er sie zuschlug, erwiderte er:
»Sie haben recht, Herr Professor, man muß etwas dagegen tun. Ich habe einen Aufsatz veranlaßt, der die Dinge in einem andern Licht zeigt. Ein Eispanzer, stellenweise mehrere tausend Meter stark, der den weitaus größten Teil des sechsten Kontinentes bedeckt. Wie sollte es da möglich sein, Erzfunde zu machen oder gar an ihren Abbau zu denken? In überzeugender Weise und gestützt auf eine Fülle wissenschaftlichen Materials werden darin die Vermutungen, die der französische Autor in ›La nature‹ aufstellt, ad absurdum geführt. Sobald die Veröffentlichung erschienen ist, werde ich Ihnen ein Exemplar zugehen lassen.«
Jene vom Minister Schröter veranlaßte Arbeit war in der Tat ein Meisterstück.
Auf den Beobachtungen und Mitteilungen nicht nur deutscher, sondern auch
amerikanischer und englischer Forscher fußend, gab sie ein plastisches Bild
der Antarktis und zeigte den sechsten Kontinent in seiner ganzen
Schrecklichkeit, als eine vergletscherte, von eisigen Stürmen durchbrauste
Einöde. Die Veröffentlichung erschien in den ›Geographischen
Mitteilungen‹, und Auszüge daraus gingen nicht nur in die deutschen,
sondern auch in die ausländischen Zeitungen über.
Von der andern Seite her wirkte sich die Veröffentlichung in ›La nature‹ in ähnlicher Weise aus. Mit einem Schlage stand die Antarktis im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Jede Zeitung, die wußte, was sie ihren Lesern schuldig war, sah sich veranlaßt, etwas über den sechsten Kontinent zu bringen. Je nachdem die Blätter sich dabei mehr an die deutsche oder an die französische Auffassung hielten, fand sich Richtiges und Unrichtiges in ihren Artikeln vermischt.
Auch die reichlich trockenen wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Herren Wille und Schmidt fanden einen Leserkreis, der ihnen unter anderen Umständen niemals zuteil geworden wäre. In den fremden Ämtern und Redaktionen studierte man sie in der Erwartung, irgend etwas Wichtiges darin zu entdecken. Doch diese Hoffnung trog. Außer schwer verdaulichen wissenschaftlichen Theorien, die mit einem überwältigenden Zahlenmaterial belegt wurden, ließ sich nichts in ihnen finden.
Verborgen blieb es der Öffentlichkeit, daß täglich Stratosphärenschiffe, beladen bis an die Grenze ihrer Tragfähigkeit, in Deutschland aufstiegen und in Höhen, in denen sie unhörbar und unsichtbar blieben, nach Süden stürmten. Keine Ahnung hatte die Welt von dem, was diese Schiffe in die Antarktis trugen und was sie aus ihr zurückbrachten.
Monsieur Longin erweiterte sein Urteil über die beiden an Bord befindlichen Amerikaner dahin, daß sie bei aller Spleenigkeit doch anständige Kerle wären. Diese Meinung gründete sich auf mehrere größere Banknoten, die er während der nächsten Tage sowohl von Bolton, wie auch von Garrison in Empfang nehmen konnte.
Bolton drückte Longin einen Zehndollarschein in die Hand, als er ihm einen chiffrierten Funkspruch aus Adelaide überbrachte. Die Laune des Amerikaners, die bis dahin unter dem Gefrierpunkt stand, wurde nach der Lektüre dieses Telegrammes zusehends besser. Garrison tätigte ein anderes Geschäft mit dem französischen Funker. Durch die Überlassung mehrerer Pfundnoten bestimmte er ihn, täglich den Nachrichtendienst der Kurzwelle von Radio-City für ihn aufzunehmen. Dies Abkommen vertrug sich nicht ganz mit den Dienstvorschriften, aber um seiner Seelenseligkeit hätte Monsieur Longin sich das vorteilhafte Nebengeschäft nicht entgehen lassen.
Eben hatte er Garrison wieder zwei eng beschriebene Blätter auf den Tisch gelegt. Interessiert las der Amerikaner sie. Plötzlich stutzte er und brummte etwas vor sich hin.
»Merkwürdige Sache, Bolton. Wir scheinen Konkurrenz in der Antarktis zu bekommen.« Er las dem andern den Teil der Depesche vor. Radio-City meldete, daß der durch mehrere erfolgreiche Reisen bekannte Südpolforscher Captain Andrew eine neue Expedition vorbereite.
»Lassen Sie den Narren machen, was er will«, knurrte Bolton dazwischen.
»Bitte, hören Sie weiter, Bolton. Captain Andrew geht diesmal nicht auf wissenschaftliche Unternehmungen aus. Wie hier steht, vertritt er jetzt die Meinung, daß der sechste Erdteil reich an Kohlen- und Erdöllagern sei ...«
»Lächerlich!« unterbrach ihn Bolton.
»Und daß ... hören Sie gut zu, Bolton ..., daß sich dort auch Edelmetalle, speziell Gold und Silber in großen Mengen finden müßten.«
»Verflucht!« Bolton sprang auf. »Sie haben recht. Der Kerl kann eine unangenehme Konkurrenz für uns werden. Andrew ... der Name hat einen guten Klang in den Staaten. Es wird ihm sicher gelingen, das Geld für seine Expedition zusammenzubringen.«
»Damit scheint es noch zu hapern«, warf Garrison ein, »in dem Funkspruch ist die Rede davon, daß die Fabrik in Albany eine Bankgarantie abwarten will, bevor sie mit dem Bau eines großen Raupenwagens für Kapitän Andrew beginnt. Es sieht beinahe so aus, als ob man zu Andrew dem Goldsucher weniger Vertrauen hat als zu Andrew dem Forscher.«
Eine Weile überlegte Bolton. Plötzlich kam ihm eine Idee.
»Wissen Sie was, Garrison? Ich werde Captain Andrew finanzieren.«
Kopfschüttelnd sah ihn Garrison an. »Sie wollen die Konkurrenz unterstützen?«
Bolton pfiff vor sich hin. »Dann ist es ja keine Konkurrenz mehr. Ich kaufe mir den Mann, und er muß tun, was ich will. Je länger ich mir die Sache überlege, desto vorteilhafter erscheint sie mir ... nochmal mit einem Flugzeug in die Antarktis ... ich muß offen sagen, daß ich vom ersten Male noch genug habe. In einem großen Raupenwagen ... der Deutsche, Dr. Wille, soll etwas Ähnliches haben, also schlecht kann es nicht sein ... dazu Captain Andrew, der die Antarktis kennt, es ist die beste Lösung, Garrison ...«
Bolton war so versessen auf seine Idee, daß er sich sofort hinsetzte und ein langes Telegramm an Andrew niederschrieb. Kurze Zeit darauf konnte Monsieur Longin ein nettes Trinkgeld für die prompte Absenkung des Funkspruches in seine Tasche stecken und ein größeres kam hinzu, als Bolton die Antwort las, in der Andrew seine Bereitwilligkeit aussprach, mit Mr. Bolton weiter zu verhandeln.
Zwei Tage später begaben sich die beiden Amerikaner nach dem Essen auf das
Achterdeck der ›Fréjus‹, um einen kleinen Verdauungsspaziergang
zu machen. In tiefem Blau dehnte sich die Südsee, wie ein Azurschild wölbte
sich der wolkenlose Himmel darüber. Nur das schwache Schüttern der
Schiffsschraube war hörbar. Dann schien etwas anderes sich in dies Geräusch
zu mischen, etwas Fremdes, Schnelles, Tackendes. Instinktiv horchten beide
auf. Immer stärker wurde der pochende Ton.
»Unser Flugzeug!« schrie Bolton und packte Garrison am Arm. Zusammen mit ihm lief er zum Vorderdeck, denn ihnen entgegen von der Richtung von Australien her mußte die ersehnte Maschine ja kommen.
In der blauen Ferne sahen sie einen grauen Punkt. Aus dem Punkt wurde ein
Flugschiff, das schnell näher und tiefer kam und nahe bei der
›Fréjus‹ auf die glatte See niederging. Die Maschinen des
Dampfers gingen langsamer, stoppten, schlugen rückwärts, standen still,
bewegungslos lag das Seeschiff. So dicht konnte bei der Windstille das
Flugzeug herantreiben, daß seine Schwingen unmittelbar neben der Reling der
›Fréjus‹ lagen.
Ein kurzer herzlicher Abschied von Kapitän Lemaître und seinen Leuten. Ein guter amerikanischer Scheck ging dabei aus Boltons Hand in diejenige des Kapitäns über ... dann standen sie auf der Schwinge des Flugschiffes und traten durch die geöffnete Tür in dessen Rumpf ein. Unter dem Rufen und Winken der französischen Matrosen rauschte der Aeroplan über die See, löste sich vom Wasser, stieg und verschwand schnell in der Ferne. Ein verlorener Punkt im endlosen Ozean blieb die ›Fréjus‹ zurück.
Die Besprechung zwischen Bolton und dem Chefpiloten der australischen
Maschine war nur kurz. Sie ergab, daß das Flugschiff genügend Treibstoff an
Bord hatte, um Hawai bequem zu erreichen. Unmittelbar darauf wurde der Kurs
Nordost zu Nord auf Hawai gesetzt. Eine halbe Stunde Aufenthalt gab es dort,
um neues Öl zu nehmen, dann ging der Flug sofort nach Frisko weiter.
Auch der Bordfunker bekam reichlich zu tun, sobald Bolton im Flugschiff war. Dutzende von Telegrammen gingen während des weiteren Fluges zwischen Bolton und Andrew hin und her.
48 Stunden, nachdem die beiden Amerikaner die ›Fréjus‹ verlassen hatten, wasserte ihre Maschine im Hafen von Frisko. Am Pier erwartete sie Captain Andrew, der ihnen auf dem Luftwege von Chicago her entgegengekommen war.
Die Verhandlungen verliefen nicht so glatt, wie Bolton es erwartete. Obwohl
er sich bereit erklärte, das Unternehmen sofort und großzügig zu finanzieren,
machte Andrew Schwierigkeiten, als er hörte, daß Bolton und Garrison die
Expedition begleiten wollten. Das Geld Boltons hätte er gern genommen, aber
die Gegenwart der beiden Amerikaner war ihm bei den besonderen Absichten, die
er verfolgte, aus mehr als einem Grunde unerwünscht.
Tagelang standen die Verhandlungen auf einem toten Punkt und wären vielleicht trotz der Millionen, die Bolton ins Feld führen konnte, gescheitert, wenn Garrison nicht vermittelnd eingegriffen hätte. In seiner vorsichtigen Weise und ohne ein Wort zuviel zu verraten, berichtete er Captain Andrew von seinen eigenen Entdeckungen in der Antarktis und legte zum Schluß seiner Rede die Schmelzproben auf den Tisch, die er aus den seinerzeit in der Nähe der Willeschen Station gesammelten Erzbrocken gewonnen hatte. Vollkommen unerwartet kamen Andrew diese Mitteilungen. Fest eingesprengt in das Felsmassiv des sechsten Erdteils hatte er bisher die Bodenschätze der Antarktis vermutet, und hier zeigte man ihm Edelmetall, das vom Himmel gefallen sein sollte, das frei auf der Oberfläche lag und mit Leichtigkeit und in großen Mengen eingesammelt werden konnte.
Jetzt verstand er, warum die beiden mit bei der Partie sein wollten. Er begriff auch, daß er seine eigenen Pläne vorläufig aufschieben müßte, wenn er Boltons Vorschlag annähme. Auf der andern Seite verfehlten die blinkenden Metallkegel, die vor ihm lagen, ihre Wirkung nicht. Allmählich unterlag er ihrer Lockung, das neue Abenteuer begann ihn zu reizen, Schritt um Schritt gab er den Forderungen Boltons nach. Als der Nachmittag in Dämmerung überging, setzte er seinen Namen unter einen Vertrag, der in vielen Paragraphen alle Rechte und Pflichten für die drei Teilnehmer der neuen Expedition regelte.
Noch in der Nacht traf Bolton daraufhin seine Dispositionen. Bereits am folgenden Morgen bekam das Werk in Albany eine Anzahlung und begann sofort mit dem Bau des von Andrew gewünschten Raupenfahrzeuges, zu dem die Pläne fix und fertig vorlagen. Bolton selbst ging zusammen mit Andrew nach Albany. Unter Zuhilfenahme von Überstunden und Nachtschichten schritt die Arbeit schnell voran. Man durfte hoffen, schon in drei Wochen die ersten Probefahrten mit dem neuen Wagen machen zu können.
Einen Übelstand brachte diese forcierte Arbeit freilich mit sich. Sie erregte
sehr gegen den Willen Boltons die öffentliche Aufmerksamkeit. Die
amerikanischen Reporter ließen es sich nicht nehmen, über alle Einzelheiten
des Baues an ihre Zeitungen zu berichten und in dem Bestreben, ihre Artikel
möglichst inhaltsreich zu gestalten, teilten sie dabei auch mit, daß der
Geldmann des Unternehmens, Mr. Bolton aus Frisko, und Mr. Garrison, der
bekannte Wissenschaftler aus Pasadena, die Expedition in die Antarktis
begleiten würden. Die Nachricht erschien zuerst im Chicago-Herald. Durch
Rundfunk und Telegraphenagenturen fand sie schnell weite Verbreitung. Zur
gleichen Zeit ungefähr, zu der ein von Bolton gecharterter Dampfer Frisko mit
allem für die Expedition Erforderlichem verließ, war sie auch in deutschen
Zeitungen zu lesen.
Ein Goldbergwerk im Bolidenkrater. Reichtum oder Goldinflation? Die Amerikaner landen im Mac-Murdo-Sund. Am Krater trifft man Vorbereitungen für ihren Empfang.
Hundert Kilometer nördlich vom Bolidenkrater stand die feste Station des deutschen antarktischen Institutes seit vier Wochen an derjenigen Stelle, welche die Reichsregierung dafür in Aussicht genommen hatte. Den Herren Wille und Schmidt war diese Verlegung ziemlich gleichgültig, weil sie jetzt, wie Schmidt sarkastisch bemerkte, ihr Gewerbe im Umherziehen betrieben. Auf kurze Aufenthalte in der festen Station folgten jedesmal längere Reisen mit den drei Raupenwagen. Unablässig wuchs dabei das Beobachtungsmaterial, und in stetiger Arbeit wurden neue physikalische Theorien ausgebaut und erhärtet.
Hagemann, das altbewährte Faktotum, gehörte natürlich zu der motorisierten Station,, und Rudi besorgte dort den Funkdienst. Trotzdem brauchte Lorenzen kein Einsiedlerleben zu fuhren, denn der neue Etat sah für die feste Station noch einen Maschinisten und einen Koch vor, so daß es dort wenigstens für ein gemütliches Kartenspiel langte, wenn die Kraftfahrzeuge unterwegs waren.
Die Raupenwagen bewährten sich in einer Weise, die über jedes Lob erhaben
war. Mochte draußen der Schneesturm brausen, mochten Nebel und wirbelnder
Eisstaub jede Sicht versperren, stets bot das Innere dieser Fahrzeuge einen
gut durchwärmten Zufluchtsort. Vor allen Unbilden eines mörderischen Klimas
geschützt, konnten die Forscher hier unbehindert ihrer Arbeit obliegen, und
wenn es galt, die Station zu verlegen, dann erwiesen sich die auf breiten
Raupenbändern überall, auch im zerklüfteten Gelände schnell und sicher
laufenden Kraftwagen als überaus leistungsfähige Verkehrsmittel.
Öfter als einmal holte sich Schmidt nach dem Abendessen einen Band aus dem Bücherschrank und las mit sichtlichem Behagen darin. Es war eine Beschreibung der antarktischen Expedition von Scott aus dem Jahre 1903. Unter unsäglichen Strapazen hatten die Forschungsreisenden sich damals ihren Weg durch die Eiswüste suchen müssen, hatten selbst ihre Schlitten über das Eis schleifen müssen, nachdem die letzten Hunde geschlachtet und verzehrt waren. Ein Teil der Mitglieder war unterwegs vor Erschöpfung gestorben. Am Ende ihrer Kräfte erreichten die wenigen Überlebenden schließlich die Küste, mehr Gespenstern als Menschen ähnlich, als sie das rettende Schiff betraten ...
Ein wohliges Gruseln lief dem langen Doktor über den Rücken, während er die Schilderung las, und unwillkürlich rückte er dabei noch näher an den elektrischen Ofen heran.
Ein wohlbekanntes Geräusch riß ihn aus seiner Lektüre, das trommelnde Donnern
eines Stratosphärenschiffes. Dicht neben dem Wohnwagen ließ sich ›St
11‹ auf den Schnee nieder. Unerwarteten Besuch aus Deutschland brachte
das Flugschiff, außer Berkoff und Hein Eggerth auch den Ministerialdirektor
Reute und den alten Professor Eggerth.
Wille und Schmidt verließen ihren Wagen, um zu dem Schiff hinüberzugehen. Nach den eintönigen Wochen in ihren Fahrzeugen bedeutete der Aufenthalt in dem großen Salon von ›St 11‹ für sie eine angenehme Abwechslung. Nach kurzer Begrüßung war bald ein allgemeines Gespräch im Gang, an dem sich nur der hagere Schmidt nicht beteiligte. In seiner hölzernen Manier saß er mit zusammengekniffenen Lippen schweigend da.
»Das lange Gerippe hat mal wieder was auf dem Herzen«, flüsterte Hein Eggerth Berkoff zu. »Ich will ihm Gelegenheit geben, sein Gemüt zu erleichtern.«
Mit vergnügtem Gesicht zog er sich einen Stuhl zu Schmidt heran und begann sich intensiv nach dem Befinden und den Arbeiten des verehrten Herrn Ministerialrats zu erkundigen. Das war die Zündschnur an die Bombe, und prompt explodierte Schmidt.
»Sie haben mein letztes Radiogramm unbeantwortet gelassen, Herr Eggerth«, schoß es zwischen den schmalen Lippen heraus.
»Welches Radiogramm, Herr Ministerialrat? Ich wüßte nicht ...«
»Meine Anfrage in Sachen Bolton und Garrison. Wie kommen die beiden Amerikaner, die von Ihnen bei Neapel abgesetzt wurden, als Schiffbrüchige mitten in die Südsee? Die Frage interessiert mich außerordentlich ... ganz außerordentlich, Herr Eggerth.«
»Mich nicht, Herr Geheimrat. Ich falle auf amerikanische Enten nicht mehr rein. Mich interessiert das hier viel mehr.«
Während der letzten Worte zog er eine deutsche Zeitung aus der Tasche und hielt Dr. Schmidt eine rot angestrichene Notiz hin. Der las sie, bewegte dabei die Kiefern, als ob er an einem zähen Bissen kaute, ließ das Blatt dann sinken, während Zweifel und Staunen sich in seinen Zügen malten.
»Ja, verehrter Herr Ministerialrat, die Herren Bolton und Garrison sind rührige Leutchen. Mal trifft man sie in der Antarktis, mal wird ihr Vorhandensein mitten aus der Südsee und danach aus Amerika gemeldet, und jetzt sind sie auf dem Wege zum Mac-Murdo-Sund, wahrscheinlich schon im Roß-Meer, dicht bei der Küste ...«
»Undenkbar! Unglaublich!« preßte Dr. Schmidt durch die Zähne.
»Leider nur zu glaubhaft«, fuhr Hein Eggerth fort. »Die Angelegenheit war uns wichtig genug, um genaue Erkundigungen einzuholen. Die neue Expedition Captain Andrews dürfte in spätestens acht Tagen im Mac-Murdo-Sund an Land gehen und es besteht eine ziemliche Wahrscheinlichkeit, daß die Herren Bolton und Garrison Ihnen, Herr Ministerialrat, in nächster Zeit wieder ins Gehege kommen.«
»Aber das ist ja abscheulich«, war alles, was Schmidt schließlich herausbrachte.
Hein Eggerth stand auf. »Machen Sie sich keine Sorge, Herr Ministerialrat. Wir sind über die Absichten der Herren Bolton und Garrison im Bilde und werden rechtzeitig unsere Maßnahmen treffen. Sobald die Andrewsche Expedition deutsches Gebiet betritt, hat sie sich den Anweisungen des Reichskommissars zu fügen. Herr Reute bringt für diesen Fall ausführliche Instruktionen mit.« —
Kurze Zeit darauf erschien Hein Eggerth in Begleitung zweier Mechaniker, die
eine ziemlich umfangreiche Apparatur mit sich schleppten, in der Funkkabine
des dritten Wagens, und mit offensichtlichem Vergnügen sah Rudi Wille zu, wie
die Mechaniker einen schönen neuen Funkpeiler in seine Station einbauten. Als
die Montage vollendet und die Mechaniker wieder gegangen waren, blieb Hein
Eggerth noch eine gute Stunde bei Rudi, über die Bedienung des neuen Gerätes
brauchte er ihm nicht viel zu erzählen. Von seiner langjährigen Bastelei her
wußte der Junge damit recht gut Bescheid. Schon nach wenigen Versuchen peilte
er die Funkstation am Krater bis auf wenige Bogenminuten genau an ...
Erheblich längere Zeit nahmen die Instruktionen in Anspruch, die ihm Hein Eggerth über den eigentlichen Zweck und die dadurch bedingte Anwendung der Peilanlage gab. Sie liefen darauf hinaus, daß drei neue Peilstationen, eine am Krater, die andere in der festen Station und die dritte in der motorisierten Station in gemeinsamer Zusammenarbeit den Standort der Andrewschen Expedition möglichst frühzeitig feststellen und danach ständig weiter verfolgen sollten.
Rudi Wille spitzte die Ohren nicht schlecht, als er vernahm, daß sein alter Bekannter, Mr. Garrison, wieder im Lande sei, und mit Begeisterung übernahm er die neue Aufgabe, den unerwünschten Besuch mit überwachen zu helfen. Kaum hatte Hein Eggerth den Wagen verlassen, als auch schon Funksprüche zwischen Rudi und Lorenzen hin und her flogen. Lorenzen hatte das neue Peilgerät bereits vor zwei Tagen erhalten und fleißig damit gearbeitet. Nach den Mitteilungen, die er Rudi darüber machte, war auch der schnell in der Lage, einen Sender anzupeilen, dessen Zeichen aus der Richtung des Mac-Murdo-Sundes kamen. Die Herren Bolton und Garrison waren bereits avisiert, bevor sie ihren Fuß auf die Antarktis setzten.
»Sie wissen, Herr Wille, daß die Amerikaner wieder ...«
»Ich bin informiert, mein lieber Schmidt«, schnitt ihm Dr. Wille die Frage ab. »Sie können ganz unbesorgt sein. Ich werde Sie jetzt auf etwa 24 Stunden verlassen und bitte Sie, für diese Zeit die Leitung des Institutes zu übernehmen!«
Dr. Schmidt kehrte in seinen Wagen zurück. ›St 11‹ zog sich an seiner Hubschraube wieder in die Höhe und schlug die Richtung nach dem Krater ein. Für die kurze Entfernung von hundert Kilometern lohnte es sich nicht, in die Stratosphäre zu steigen. In mäßiger Höhe strich das Schiff über das sonnenbeglänzte Gelände dahin. Etwa die Hälfte des Weges mochte es zurückgelegt haben, als Reute nach unten wies. Ein Kraftwagen lief dort über den Schnee, ein Raupenfahrzeug ähnlich denjenigen, die ›St 11‹ vor kurzem verlassen hatten.
»Was soll das werden?« fragte Wille.
»Eine Vorbereitung für den Empfang der amerikanischen Expedition«, erklärte Reute. »In einem Abstand von 50 Kilometern legen wir um die Kraterstation herum eine Kontaktleitung, die am Krater sofort die Stelle meldet, an der sie etwa von dem Raupenwagen Andrews überfahren wird. Das Gebiet innerhalb dieser Ringleitung ist für die Amerikaner tabu. Sie dürfen es nicht berühren.«
»Und wenn sie es doch tun?« fragte Wille.
»Dann treten die Instruktionen in Kraft, Herr Kollege, über die wir nun unter vier Augen sprechen müssen«, sagte Reute und führte Wille aus dem Salon in sein Arbeitszimmer.
Die Unterredung der beiden Herren war noch nicht beendigt, als ›St 11‹ am Kamm des Kraterringes aufsetzte. Geraume Zeit wurde sie noch in dem Haus, das Reute hier zur Verfügung hatte, fortgesetzt und es war unverkennbar, daß Dr. Wille von ihrem Inhalt recht befriedigt war. Als die beiden danach wieder ins Freie traten, gesellte sich Professor Eggerth zu ihnen.
»Es ist wohl sechs Monate her, seitdem Sie das letztemal hier waren, Herr Doktor Wille«, sagte der Professor, »sicher wird es Sie interessieren, zu sehen, was inzwischen entstanden ist.«
Er brauchte nicht viel weiteres zu sagen, Dr. Wille sah bereits selber, wie sehr sich hier alles in dem letzten halben Jahr verändert hatte. Tiefe Polarnacht war es damals, heute lag das ganze Ringgebirge um den Kraterschacht im rötlichen Sonnenlicht des langen Polartages. Heinzelmännchen schienen hier an der Arbeit gewesen zu sein, um in einer verhältnismäßig kurzen Zeit all die neuen Anlagen aus dem Boden wachsen zu lassen.
Da stand ein mächtiges Kraftwerk. Leichter Dunst entstieg seinen Schloten.
»200 000 Pferde«, sagte der Professor, »50 Tonnen Treiböl schlucken die Motoren in jeder Stunde, 1200 Tonnen jeden Tag. Wir mußten eine Flotte von zwanzig Stratosphärenlastschiffen größter Bauart einsetzen, um den Brennstoffbedarf dieses Kraftwerkes sicher decken zu können.«
Während sie am Kraterrande weitergingen, dröhnte aus dessen Tiefe fast ununterbrochen der Donner von Explosionen empor.
»Die Sprengarbeiten sind in gutem Fluß«, sagte Reute, »wir bohren und sprengen nur dort, wo vorhergehende Proben goldreiche Adern gezeigt haben und fördern jetzt täglich tausend Tonnen Erz.«
»Tausend Tonnen, eine Riesenmenge!« unterbrach ihn Wille erstaunt.
»In Wirklichkeit nicht so schlimm, wie es sich anhört«, fuhr der Professor fort. »Bei dem hohen Gewicht des Erzes sind es einige 70 Kubikmeter pro Tag. Leider vermögen unsere Aufbereitungsanlagen vorläufig erst den fünften Teil davon zu verarbeiten. Wir bereiten jetzt täglich 200 Tonnen auf und ziehen daraus zwanzig Tonnen gediegenen Goldes im Handelswert von 50 Millionen Reichsmark.«
»50 Millionen jeden Tag!« Dr. Wille faßte sich an den Kopf, als könne er die Zahl schwer fassen. »50 Millionen jeden Tag ... das wäre eine Milliarde in 20 Tagen, zehn Milliarden in 200 Tagen ... soviel ich weiß, beträgt der nachweisliche Goldbesitz der Menschheit zur Zeit 50 Milliarden. Bei diesem Arbeitstempo könnten Sie ihn in tausend Tagen verdoppeln.«
»Soweit wollen wir nicht voraus rechnen«, sagte Reute, »es ist sehr zweifelhaft, ob wir das tun werden. Im Augenblick wissen wir nicht einmal, ob wir es überhaupt tun können.«
Während ihrer Unterhaltung hatten die drei Herren die Aufbereitungsanlage erreicht und traten in die große Halle ein. Eine fast atembeklemmende Stille umfing sie.
Wer etwa hier die Einrichtungen der sonst wohl gebräuchlichen Erzaufbereitungsanlagen zu finden erwartete, wäre enttäuscht gewesen. Da waren keine polternden Erzbrecher, keine ratternden Schüttelrutschen, keine Röst- und Schmelzöfen. Nur würfelförmige Tröge aus hartgebranntem, glasiertem Ton enthielt der Raum, jeder einzelne Trog reichlich mannshoch und ebenso lang und breit. In schnurgeraden langen Reihen waren die Tröge aufgestellt, reichlich armdicke Starkstromkabel führten zu jedem von ihnen. Ein Deckenkran huschte über die Trogreihen hin, öffnete hier und dort das Maul seines Behälters und ließ Brocken des schimmernden Erzes in die Flüssigkeit fallen, mit der die einzelnen Gefäße bis obenhin gefüllt waren. Ein leichter Dunst, der undefinierbar nach irgendwelchen Säuren und Chemikalien roch, legte sich Wille auf die Brust, daß er hüsteln mußte.
»Kommen Sie, Doktor«, sagte der Professor und zog ihn mit sich ins Freie. »Das elektrolytische Naßverfahren, nach dem wir die Erze ausbeuten, ist zwar technisch glänzend, aber für die menschlichen Lungen weniger zuträglich. Wenn unsere Leute dort drinnen zu tun haben, müssen sie stets Gasmasken vorbinden.«
Wille zog erst ein paarmal in kräftigen Zügen die klare kalte Polarluft ein, bevor er antwortete.
»Nach einem elektrolytischen Naßverfahren scheiden Sie die Metalle. Ich muß sagen, das überrascht mich, kommen Sie denn damit wirtschaftlich zurecht?«
»Glänzend, Herr Doktor«, erwiderte ihm Professor Eggerth, »freilich dürfen Sie dabei nicht an die älteren derartigen Methoden denken. Es handelt sich hier um ein ganz neues, überaus wirksames Verfahren. Um es genau zu sagen, werden dabei gleichzeitig chemische und elektrolytische Wirkungen ausgenutzt. Die Elektrolytenflüssigkeit muß deshalb auch nach einer gewissen Zeit regeneriert werden. Wir haben zu dem Zweck die chemische Fabrik errichtet, die Sie dort zur Rechten liegen sehen. Wir wollen nicht hineingehen«, unterbrach er sich, als Dr. Wille seine Schritte dorthin lenken wollte. »Da drinnen stinkt und raucht's noch mehr als in der Aufbereitung.«
Er zog Wille am Ärmel zurück. »Hier rechts lang geht unser Weg. Wir wollen erst mal ordentlich frühstücken.«—
Ein Frühstücksraum, der in manchen Einzelheiten an das gemütliche Kasino der Eggerth-Werke in Bitterfeld erinnerte, nahm sie auf, und während ihnen eine gute Mahlzeit serviert wurde, ging das Gespräch weiter.
»Ihre Zahlen habe ich gehört, Ihre Anlagen habe ich gesehen«, sagte Wille. »Aber zu begreifen vermag ich das alles nicht.« Er griff sich wieder an den Kopf. »Bei allem Hinundherdenken kann ich keine andere Auswirkung dieses ganzen Unternehmens finden als eine Goldinflation, welche die kranke Weltwirtschaft noch kränker machen wird. Wenn Sie es besser wissen, dann sagen Sie es mir.«
Reute rührte nachdenklich in seiner Fleischbrühe herum. Langsam kamen die Worte von seinen Lippen.
»Wenn wir unvorsichtig vorgingen, Herr Kollege, könnte eine solche Inflation in der Tat die Folge sein, und ihre Auswirkungen könnten unheilvoll werden. Aber wir werden nicht unvorsichtig sein. Die Pläne unserer Regierung sind bereits bis in alle Einzelheiten durchdacht und ausgearbeitet.«
Wille zuckte die Achseln. »Ich sehe keine Möglichkeit, wie Sie das vermeiden wollen.«
Professor Eggerth kam Reute mit der Antwort zuvor.
»Das liegt, glaube ich, daran, Herr Dr. Wille, daß Sie das Gold wie jedes beliebige andere Erzeugnis ansehen, bei dem Angebot und Nachfrage den Preis regulieren.«
»Zweifellos, ich glaube, ich habe recht damit.«
»In diesem Falle haben Sie unrecht, Herr Wille, frei nach Goethe möchte ich sagen: Gold ist ein ganz besonderer Stoff. In dem Sinne nämlich, daß es auch heute noch trotz aller Versuche, davon loszukommen, irgend etwas anderes an seine Stelle zu setzen, der einzige internationale Wertmesser ist.«
»Mag alles sein. Aber wenn Sie ...«, versuchte Wille einzuwenden.
»Kein ›Aber‹, Herr Doktor«, fuhr Eggerth fort. »Sie unterschätzen den ungeheuren Goldhunger der ganzen Welt. Nach den bitteren Erfahrungen, welche die Sparer fast aller Nationen mit ihren nur auf Papier beruhenden Währungen gemacht haben, ist er größer als je. Wir sind davon überzeugt, daß fünf Milliarden, ja sogar zehn Milliarden, wenn wir sie in Form gemünzten Goldes vorsichtig, ich betone immer wieder, vorsichtig ... in den Verkehr bringen, spurlos in den Sparstrümpfen der ganzen Welt verschwinden. Sie werden in der goldhungrigen Welt gewissermaßen versickern, ohne daß die Öffentlichkeit überhaupt etwas von ihrem Vorhandensein weiß.«
Wille schüttelte den Kopf und machte ein ungläubiges Gesicht.
»Sie können es mir glauben«, fuhr Eggerth in seinen Auseinandersetzungen fort, »den ersten großen Gewinn von der Goldinjektion, die wir auf diese Weise der Menschheit versetzen, werden natürlich das Reich und die deutsche Wirtschaft haben. Wir sind aber überzeugt, daß danach auch eine Wiederbelebung der Weltwirtschaft einsetzen, daß unser Vorgehen schließlich für die ganze Welt nützlich sein wird. Hätten wir diese Überzeugung nicht, dann hätten wir uns nicht dazu entschlossen, des dürfen Sie gewiß sein.«
»Aber die Inflation, die Goldinflation«, flog es Wille unwillkürlich heraus.
»Ist ein grundsätzlicher Irrtum von Ihnen«, fiel ihm Professor Eggerth ins Wort. »Sie dürfen die Papierinflationen der vergangenen Jahrzehnte nicht mit einer verstärkten Golderzeugung in einen Topf werfen. Eine papierne Banknote bleibt immer nur ein Zahlungsversprechen, das an Stelle der Zahlung genommen wird, solange das allgemeine Vertrauen dazu bereit ist. Ein Goldstück dagegen bedeutet kein Zahlungsversprechen mehr, sondern eine wirkliche Zahlung.«
Wille stürzte mit einem Ruck seine Bouillon herunter.
»Gestatten Sie mir nun auch einmal einen Einwand auszusprechen, meine Herren. Nach der Entdeckung Amerikas brachten die spanischen Eroberer mühelos erworbene Goldmengen nach Europa, durch die der europäische Goldschatz plötzlich verdoppelt, wie einige sagen, sogar verdreifacht wurde. Sie können nicht bestreiten, daß dies Ereignis tief einschneidende und keineswegs erfreuliche Folgen für die Wirtschaft der Alten Welt gehabt hat. Eine Umschichtung aller Stände und Lebensverhältnisse. Nach einer durchaus plausiblen Theorie sollen der deutsche Bauernkrieg und das ganze Raubrittertum eine Folge davon sein, daß Cortez den unglücklichen Mexikanern ihr Gold gestohlen hat ...«
Reute wollte den Doktor unterbrechen, aber der war zu geladen. Erst mußte einmal heraus, was er auf dem Herzen hatte, unbeirrt fuhr er fort:
»Der Zusammenhang ist vollkommen logisch. Als das spanische Gold durch Handel und Wandel in die Hände der deutschen Bürger und Kaufleute kam, legten sie sich einen höheren Lebensstandard zu. Die Ritter auf ihren Burgen wollten es ihnen natürlich gleichtun. Da sie aber selbst keine Kaufleute waren, blieben ihnen nur zwei Möglichkeiten. Entweder die reichen Pfeffersäcke auf den Landstraßen zu überfallen und ihnen die guten Dinge abzunehmen, das heißt Raubrittertum, oder aber ihre leibeigenen Bauern bis aufs Blut auszupressen und das hatte dann die Bauernkriege zur Folge. Fürchten Sie nicht, meine Herren, daß Ihr Bolidengold etwas Ähnliches hervorrufen könnte?«
Er schwieg und blickte die andern fragend an. Reute machte eine verneinende Bewegung.
»Sie verkennen, Herr Kollege, daß wir es bei den heutigen Goldwährungen mit verkappten Energiewährungen zu tun haben. Zu 99,9% wird Gold heute nicht mehr gefunden, sondern erarbeitet. Praktisch ist der Goldvorrat in den südafrikanischen Goldminen unbegrenzt, jedenfalls viel größer als derjenige in unserm Bolidenkrater. Aber um es zu gewinnen, um die 10 bis 12 Gramm aus einem Kubikmeter härtesten Quarzgesteins herauszuholen, muß man Maschinenarbeit im Betrage vieler Pferdekraftstunden leisten. Die Verhältnisse sind so, daß der heutige Goldpreis diese Unkosten deckt und den afrikanischen Minengesellschaften noch eine mäßige Verzinsung ihres Kapitals gewährt. Tatsächlich liegen die Dinge so, daß auf diese Weise der Preis der Pferdekraftstunde oder, wenn Sie elektrisch rechnen wollen, der Kilowattstunde einerseits und des Goldes andererseits auf das engste verbunden sind. Würde es plötzlich möglich, die Kilowattstunde zum zehnten Teil des bisherigen Preises zu erzeugen, so müßte logischerweise auch der Goldpreis auf etwa den zehnten Teil absinken. Dann könnten Sie vielleicht von einer Goldinflation reden, obwohl es letzten Endes eine Energieinflation wäre.«
»Jetzt habe ich Sie gefangen, Herr Ministerialdirektor«, platzte Wille los. »Sie gewinnen hier das Gold mit dem hundertsten, dem tausendsten Teil ... was weiß ich ... derjenigen Energie, die man in den südafrikanischen Minen dafür braucht. Also ...«
»... müßte das Gold hundert oder tausendmal billiger werden«, führte Reute den Satz weiter, »wenn die übrige Welt das auch könnte. Aber sie kann es nicht, Herr Dr. Wille, und das ist der springende Punkt.
Zur Erläuterung will ich eine andere Möglichkeit heranziehen. Wie Sie wissen, hat die Zerlegung der chemischen Elemente mittels schneller Kathodenstrahlen in den letzten Jahren bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Nehmen wir einmal nun an, es gelänge—was theoretisch durchaus denkbar ist—mit Hilfe dieser Strahlen von dem Quecksilberatom drei Wasserstoffkerne abzuschlagen, so müßte ein Goldatom übrigbleiben. Nehmen wir weiter an, ein genialer Physiker entdeckte ein besonders günstiges Verfahren, bei dem sich die Umwandlung von einem Kilogramm Quecksilber in ein Kilogramm Gold mit dem Aufwände von nur einer Kilowattstunde bewerkstelligen läßt, dann könnte ... ja, dann müßte in der Tat das eintreten, was Sie jetzt zu Unrecht von unserm Vorgehen befürchten. Zwangsläufig müßte dann der Goldpreis bis auf den Preis des Quecksilbers hinab sinken, denn jedermann könnte sich ja dann Quecksilber kaufen und es mit ganz geringen Kosten in Gold verwandeln. Begreifen Sie jetzt den Unterschied zwischen einem solchen Zustand und unserer Lage, Herr Doktor Wille?«
»Ich glaube, ich verstehe Sie«, sagte Wille nachdenklich. »Sie wollen sagen, daß nur Deutschland über dieses vom Himmel gefallene Gold verfügt, daß aber für die übrigen Staaten nur die bisherige Art der Goldgewinnung in Frage kommt und daher auch der jetzige Weltpreis bestehen bleiben wird.«
»So ist es, Herr Doktor«, bestätigte ihm Professor Eggerth seine Worte. »Für die übrige Welt wird der Goldpreis immer mit dem jeweiligen Preis der Kilowattstunde verbunden bleiben, gleichgültig, ob wir zehn oder zwanzig Milliarden Gold in die Adern der Weltwirtschaft pumpen oder nicht. Wir müssen es nur, wie ich bereits betonte, vorsichtig tun. Nachrichten über die Größe des Goldvorrates in dem Bolidenkrater hier dürfen nicht in die Öffentlichkeit gelangen.«
»Was um so leichter ist, als wir selbst nicht Genaues darüber wissen«, fiel Professor Eggerth ein. »Es wäre möglich, daß der Bolide in seiner ganzen Ausdehnung mit Goldadern durchsetzt ist. Es ist aber ebensogut möglich, daß sie sich nur bis zu einer geringen Tiefe erstrecken, und dann wäre der Vorrat gar nicht so überwältigend groß. Dann könnten wir mit zwanzig, höchstens dreißig Milliarden überhaupt am Ende unserer Kunst sein. Ich hoffe, Herr Dr. Wille, daß Sie nach dieser Mitteilung den Alpdruck einer Goldinflation loswerden.«—
Das Mahl war beendet.
»Bevor ›St 11‹ Sie zu Ihrer Station zurückbringt, Herr Kollege«, sagte Reute, »wollen wir Ihnen nun auch noch das Letzte zeigen.«
Die Herren warfen sich ihre Pelze über und trafen wieder im! Freie. Reute ging geradeswegs auf ›St 11‹ zu.
»Ich denke, ich soll noch etwas sehen?« fragte Wille.
»Sehr richtig, Herr Doktor. Sie sollen die goldenen Eier sehen, die unsere Henne hier legt. Schauen Sie dorthin.«
Wille blickte sich um, erst jetzt fiel ihm auf, daß ›St 11‹ seinen Liegeplatz inzwischen gewechselt hatte. Es lag unmittelbar neben einem kleineren Gebäude, dessen hohem Schornstein ein weißlicher Rauch entquoll.
»Hier steht der Schmelzofen, in dem das elektrolytisch gewonnene Gold in Barren umgeschmolzen wird«, gab Reute die Erklärung. »Es sind Barren zu je zwanzig Kilo. 2000 Stück davon, die Ausbeute von zwei Tagen, nimmt ›St 11‹ heute nach Deutschland mit.«
›St 11‹ lag in einer kleinen Mulde dicht neben dem Gießhaus, etwas tiefer als dieses. Zu einer Ladeluke in der hinteren Hälfte seines Rumpfes führte eine Aluminiumbrücke, die infolge dieses Höhenunterschiedes waagerecht lag. In kurzen Abständen kamen Elektrokarren mit stumpfgelben Gußbarren beladen aus dem Haus und rollten über die Brücke in das Schiff.
Die drei Herren kamen gleichfalls den Weg über die Brücke und gingen in den Laderaum, der sich im Unterteil des Rumpfes dort befand, wo an dessen Oberteil die Schwingen ansetzten. Eine Weile standen sie hier und sahen zu, wie die Werkleute Barren um Barren von den Karren hoben und auf dem Boden des Lagerraumes dicht nebeneinander schichteten.
»40 Tonnen sind immerhin 40 Tonnen, meine Herren«, sagte Professor Eggerth. »Man kann sie auch in einem Stratosphärenschiff von der Größe von ›St 11‹ nicht an einer beliebigen Stelle verstauen. Sie müssen dort gelagert werden, wo senkrecht über ihnen die Tragkraft der Schwingen angreift. Schwanzlastige oder kopflastige Flugschiffe könnten zu unangenehmen Zwischenfällen führen. Auf diese Weise haben wir im Salon nachher das Vergnügen, unmittelbar über hundert Millionen zu sitzen.«
»Ich sehe, daß Sie die Barren nur in einer Schicht auf dem Boden ausbreiten«, fragte Wille.
»Es geschieht, um die Last besser über das Fachwerk des Rumpfes zu verteilen«, erwiderte der Professor. »Wollte man diese Goldmenge von zwei Kubikmeter etwa auf einer nur zwei Quadratmeter großen Fläche einen Meter hoch aufstapeln, so würde sie uns das Fachwerk zweifellos zerdrücken.«
Dr. Wille schwieg. Er schien in allerlei Gedanken versunken zu sein.
»Warum auf einmal so tiefsinnig, Herr Kollege?« fragte ihn Reute.
Wille lachte. »Ich mußte eben an das Märchen aus ›Tausend und eine Nacht‹ denken, wo der Kalif einem Günstling erlaubt, so viel Gold aus seiner Schatzkammer mitzunehmen, wie er zu tragen vermag.«
»Doch ein ganz anständiger Vorschlag«, meinte Reute.
»Ja, aber allzuviel kommt nicht dabei heraus. Nehmen wir einmal an, daß dieser Günstling ein Athlet war und mit einem runden Zentner abziehen konnte. Dann wären das immer nur 125 000 Mark. Gewiß ein recht nobles Geschenk, aber nach den Worten des Kalifen hätte ich, offen gesagt, mehr erwartet.«
»Tja, Gold hat sein Gewicht, lieber Doktor«, warf der Professor ein. »Ein Scheck läßt sich in der Brieftasche viel bequemer mitnehmen. Aber wir dürfen nicht vergessen, daß er nur Wert hat, wenn Deckung für ihn vorhanden ist, und letzten Endes wird diese Deckung durch das Gold dargestellt, das in den Kellern der Bank liegt, bei der er präsentiert wird.«
»An und für sich ist es unsinnig, Milliarden und aber Milliarden von Pferdekraftstunden aufzuwenden, um damit ein bestimmtes gelbes Metall (das Gold) aus dem Quarzgestein herauszuarbeiten und als Währungsunterlage in die Keller der Banken einzulagern«, meinte abschließend Reute, »denn das Vertrauen der Öffentlichkeit zu der gesunden Wirtschaft eines Volkes und seiner Regierung ist die beste Unterlage für seine Währung. Weil aber andere Staaten den Goldfimmel haben, so wollen wir auf einen Schelmen anderthalbe setzen und mit dem Golde, das der Himmel uns in den Schoß warf, zum Besten unseres Landes wirtschaften.«
Der letzte Karren hatte seine wertvolle Ladung abgegeben und rollte über die Brücke ins Freie. In einer Länge von zehn Metern und einer fast ebenso großen Breite war der Boden des Schiffsraumes jetzt mit einer Decke gediegenen Goldes belegt.
»Ein kostbarer Teppich. Es gibt keinen kostbareren in der Welt«, sagte Professor Eggerth nachdenklich, während er über die gelbschimmernde Fläche zu einer Treppe hinging. Sie führte nach oben zu dem Vorraum des großen Salons. Hier verabschiedete sich Reute, der in der Kraterstation zurückbleiben wollte. Dr. Wille und Professor Eggerth gingen in den Salon. Kurz darauf wurden alle Luken und Türen verschraubt. ›St 11‹ stieg auf, um zunächst Wille zu seinen Motorwagen zurückzubringen.
»Ich bin noch wie benommen von dem, was Sie und Herr Reute vorher andeuteten«, sagte er zu Eggerth, »mag der Himmel geben, daß Ihre Pläne gelingen und unserem Vaterland alles bringen, was Sie davon erhoffen.«
Ein tiefer Ernst lag während der letzten Worte auf seinen Zügen.
»Sie werden gelingen, Herr Wille«, erwiderte Professor Eggerth, der ebenfalls ernst geworden war, »wenn sie in allen Einzelheiten richtig durchgeführt werden. Ein Teil der Verantwortung dafür liegt auch bei Ihnen, Herr Dr. Wille. Er liegt in den Instruktionen, die Ihnen Herr Reute für Ihr Verhalten gegenüber der amerikanischen Expedition gegeben hat. Ich bitte Sie auf das dringendste, genau danach zu verfahren, über irgendwelche Folgen brauchen Sie sich dabei keine Gedanken zu machen. In dieser Angelegenheit steht das Reich hinter Ihnen. Als Reichskommissar handeln Sie in seinem Auftrag und Namen.«—
Wie Fliegen auf weißem Zucker wurden in weiter Ferne die drei Motorwagen des
Institutes sichtbar. Bald darauf lag das Flugschiff neben ihnen. Wille
drückte dem Professor die Hand und ging zu dem Wohnwagen hinüber. Gegen seine
sonstige Gewohnheit erwiderte er den Gruß des langen Schmidt nur wortkarg und
zog sich gleich danach in seinen Arbeitsraum zurück. Der Tag und auch der
nächste Tag noch vergingen, bevor er wieder richtig zu seinen
wissenschaftlichen Arbeiten kam. Zu sehr gingen ihm all die neuen Eindrücke
durch den Kopf, die er in der Kraterstation empfangen hatte.
Die ›City of Boston‹, welche die Andrewsche Expedition nach der Antarktis brachte, hatte das Glück, im Roß-Meer erträgliche Eisverhältnisse zu finden. Schon war die Felsküste von Viktoria-Land deutlich am Horizont erkennbar, als sich ihr die ersten Eisschollen in den Weg schoben. Krachend zerbarsten sie, wenn der scharfe Bug des Schiffes sie traf. Vorsichtig, mit halber Maschinenkraft vermochte das Schiff seinen Weg fortzusetzen. Vorläufig war es immer noch lockeres Treibeis.
Kilometer um Kilometer brachte die ›City of Boston‹ hinter sich, höher und höher wuchs das Ufergebirge empor, doch größer und stärker wurden auch die Eisschollen. Schon war es dem Schiff nicht mehr möglich, sie mit dem Vordersteven zu zerspalten. Es mußte sie umfahren und sich sorgfältig seinen Weg auf den schmalen Wasserstreifen zwischen ihnen suchen. Oft schien es, als ob der Weg unwiderruflich zu Ende sei, doch immer wieder ließ sich eine schmale Rinne entdecken, durch die das Schiff sich mit voller Schraubenkraft hindurchzwängte, während die scharfkantigen Schollenränder sich knirschend an seinen Flanken rieben.
Dem Kapitän Lewis war nicht wohl bei dieser Fahrt. Sprang etwa der Wind um, trieb er die Schollen gegen die Küste hin, dann mußten sie sich ja zu dem gefürchteten Packeis zusammenschieben, würden sein Schiff umklammern, einschließen ... für lange Zeit, vielleicht für immer. Alles kam darauf an, daß der Landwind anhielt, solange das Schiff sich in diesem gefährlichen Gebiet befand. Er war froh, als das Ziel endlich erreicht war und die ›City of Boston‹ unmittelbar neben einem Felsplateau ihre Anker in zwanzig Faden Wassertiefe niederrasseln ließ, und gab Befehl, sofort mit der Ausschiffung der Expedition zu beginnen.
Eine schwere, für diesen Zweck in den Albany-Werken besonders konstruierte Laufbrücke wurde von zwei Schiffskränen zu dem Plateau hinausgelegt, und der schwere Raupenwagen glitt über sie hin an Land. Der Treibstoff folgte. Eiserne Fässer, jedes hundert Kilo enthaltend, wurden über die Brücke gerollt und von der Mannschaft auf dem Plateau aufgestapelt.
Mr. Bolton hatte aus seinem früheren Unfall eine Lehre gezogen und diesmal ein tief siedendes Benzin gewählt, das auch bei der strengsten Kälte nicht erstarrte. Zweihundert solcher Fässer wurden an Land gebracht. Sie bedeuteten einen Treibstoffvorrat von zwanzig Tonnen, ausreichend für eine Fahrtstrecke von mehr als 20 000 Kilometern. Hier hatte Bolton nicht gespart, denn Treibstoff bedeutete ja Bewegungsmöglichkeit, Bewegungsfreiheit für die Expedition, bedeutete Wärme und Licht während der langen Fahrten durch die eisige Einöde.
Proviant kam nach dem Treibstoff ans Land. Konserven aller Art, die Büchsen in Kisten zu handlichen Gepäckstücken vereinigt, eine hinreichende Menge, um den Nahrungsbedarf der fünf Teilnehmer der Expedition auf viele Monate sicherzustellen. Danach Pelze und Bekleidungsstücke in beträchtlicher Zahl, obwohl der mächtige Raupenwagen einen sicheren Schutz vor allen Unbilden des polaren Klimas bot.
Kaum war das letzte Stück an Land, als die Brücke zurückgenommen wurde. Dumpf heulte die Sirene der ›City of Boston‹ auf, grollend kam das Echo von den Felswänden zurück ... Die Schrauben begannen zu arbeiten. Langsam beschrieb der graue Rumpf in dem engen Fahrwasser einen kurzen Bogen, vorsichtig entfernte sich das Schiff von der Küste und suchte den Weg zum freien Meer zu gewinnen. Zusehends waren die offenen Rinnen in der kurzen Zeit, die es hier gelegen hatte, schmaler geworden, denn der Wind hatte sich derweil gedreht. Mit Mühe glückte es Lewis noch, das offene Meer zu gewinnen. Erleichtert atmete er auf, als sein Schiff in eisfreiem Wasser mit voller Maschinenkraft nach Norden dahinzog.
Bolton und Garrison standen mit Captain Andrew am Rande des Plateaus und
schauten der ›City of Boston‹ nach, bis ihre Schornsteine am
Horizont verschwanden. Scharf blies ihnen der Wind von der See her entgegen
und nahm von Minute zu Minute an Stärke zu. Sturmartig peitschte er jetzt die
See und drückte die Eismassen mit unwiderstehlicher Gewalt gegen das Ufer.
Donnernd und krachend zerbarsten die mächtigen Schollen, wenn die vereinigte
Wucht von Sturm und Meer sie gegen die Felsschroffen schleuderte. Doch immer
neue Schollen trieben heran, schoben sich aufeinander, türmten sich hoch und
immer höher. Schon stand das Eis mehrere hundert Meter weit wie eine kompakte
Masse vor der Steilküste, ächzte und stöhnte unter dem gewaltigen Druck und
wuchs immer weiter in die See hinaus.
»Wir haben Glück gehabt, Mr. Bolton«, sagte Captain Andrew. »Wenn wir eine Stunde später kamen, hätten wir lange nach einer Landungsmöglichkeit suchen können. Möge uns das Glück auch weiterhin günstig sein.«
Garrison fröstelte in dem eisigen Sturm.
»Gehen wir in unsern Wagen«, schlug er vor, »und fassen wir dort unsere Entschlüsse für die nächste Zukunft.«
Der Wagen, nach den Entwürfen von Andrew gebaut, war wesentlich größer als die Fahrzeuge der Willeschen Station. Gut fünfzehn Meter lang und über drei Meter breit enthielt er reichlichen Raum nicht nur für Bolton, Garrison und Andrew, sondern auch für den Wagenführer Parlett und für den Funker Bowson und vermochte außerdem noch eine bedeutende Nutzlast mitzunehmen.
Die Tanks dieses riesigen Vehikels faßten zwei Kubikmeter und schluckten somit fast anderthalb Tonnen Treibstoff. Unter einigermaßen normalen Verhältnissen mußte diese Menge für 150 Fahrstunden ausreichen.
Bei Annahme einer Stundengeschwindigkeit von dreißig Kilometer ließen sich damit gut 2000 Kilometer bewältigen, und mit dieser Tatsache operierte Bolton bei der Besprechung, welche die drei jetzt in dem Wagen hatten. Mit Zähigkeit vertrat er die Ansicht, man müsse sofort in das Gebiet unter dem 80. Breitengrad vorstoßen und dort von dem kostbaren Erz soviel einsammeln, wie der Wagen eben zu tragen vermöge. Während Garrison sich neutral verhielt, trat Andrew diesem Plan energisch entgegen, wobei er sich auf seine langen Erfahrungen berufen konnte.
Captain Andrew wollte von Anfang an systematisch vorgehen und so, wie er es
von seinen früheren Expeditionen her gewöhnt war, auf der Strecke, die sie
einzuschlagen beabsichtigten, in nicht allzu weiten Abständen eine Kette von
Treibstoff- und Lebensmitteldepots anlegen. Ohne Zweifel schaffte ein
derartiges Vorgehen größere Sicherheit für die Expedition, aber ebenso
zweifellos mußte es auch mit einem erheblichen Zeitverlust verbunden sein.
Immer wieder mußte man ja bei seiner Ausführung zu der Landungsstelle
zurückkehren und neue Ladung nehmen, bis endlich alles einmal in der
gewünschten Weise verteilt war. Bolton aber war ganz von der Idee beherrscht,
daß sie keine Zeit mehr verlieren dürften. Ärgerlich schlug er während der
Aussprache auf den Tisch und schrie Andrew an:
»So etwas hat man nicht nötig, wenn man über einen zuverlässigen Raupenwagen verfügt. Der deutsche Dr. Wille denkt gar nicht daran, seine Zeit mit solchem Humbug zu vertrödeln. Er fährt los, wohin er will und kehrt erst um, wenn er die Hälfte seines Treibstoffes verbraucht hat.«
Andrew schüttelte den Kopf.
»Sie vergessen, Mr. Bolton, daß Dr. Wille einen unbezahlbaren Rückhalt in den deutschen Stratosphärenschiffen hat, die er im Notfalle immer zu Hilfe rufen kann. Hätten Sie Lust, die Deutschen heranzufunken, wenn uns irgendein Zwischenfall passiert? Möchten Sie sich dann von einem der ›St‹-Schiffe, etwa von Mr. Eggerth jun. oder Mr. Berkoff nach Hause bringen lassen?«
Bolton und Garrison tauschten einen Blick, in dem eine ganze Geschichte lag. Die Namen Eggerth und Berkoff lagen beiden noch schwer im Magen.
»Von den Deutschen müssen wir unter allen Umständen unabhängig sein«, sagte Garrison mit Entschiedenheit.
»Dann müssen wir so verfahren, wie ich es Ihnen eben vorgeschlagen habe, und die Strecke mit Depots besetzen«, erklärte Andrew, und nun gab Bolton seinen Widerstand auf.
»Ich freue mich, daß Sie sich von mir raten lassen, Mr. Bolton«, sagte Andrew.
Die wahren Gründe dieser Meinungsänderung konnte er ja nicht wissen, da es die Herren Bolton und Garrison vorgezogen hatten, über ihr Abenteuer auf der Robinson-Insel zu jedermann zu schweigen. Andrew legte eine Karte auf den Tisch, auf der er die geplante Route bereits eingetragen und die Depots markiert hatte. Bolton musterte sie mit kritischen Blicken und fragte dann:
»Wozu der große Umweg, Captain? Wie ich sehe, wollen Sie zunächst nach Westen bis zum magnetischen Südpol vorstoßen und dann erst nach Süden abbiegen.«
»Aus dem einfachen Grunde, Mr. Bolton, weil der direkte Weg über ein ungemein schwieriges Gelände führt. Sehen Sie hier die Alpenkette mit dem Mount Lewick, fast dreitausend Meter hoch? Ich ziehe es vor, diesem Hindernis aus dem Wege zu gehen und meinen Weg in ebenem Gelände zu suchen. Das finden wir auf der Route, die hier eingezeichnet ist.«—
Den Gründen Andrews konnte sich weder Bolton noch Garrison verschließen und so wurde nach seinen Vorschlägen verfahren. Mit Proviant und Treibstoff bis an die Grenze seiner Tragfähigkeit beladen, stieß der große Raupenwagen zunächst nach Westen vor. Fast unablässig machte Captain Andrew dabei astronomische Ortsaufnahmen, und in Abständen von hundert zu hundert Kilometer wurde ein kleines Depot mit je hundert Kilo Treibstoff und einigen Lebensmitteln errichtet.
Das kostete Zeit, denn Andrew bestand darauf, bei jedem Depot eine reichlich mannshohe Steinpyramide aufzutürmen. Mit Ungeduld sah Bolton darüber die Stunden dahinschwinden.
»Wozu die unnötige Arbeit?« fragte er verdrießlich, »in der Antarktis gibt es weder Eisbären noch Füchse, die uns an die Vorräte gehen könnten.«
»Aber Schneestürme, Mr. Bolton«, erwiderte ihm Andrew, »die uns unser Depot ohne die Steinkegel so verwehen könnten, daß wir sie nie wieder finden.«
Ärgerlich schüttelte Bolton den Kopf und gab sich unwillig in das Unvermeidliche. Er begann es bereits zu bereuen; daß er sich überhaupt mit Andrew eingelassen hatte.
Das sechste Depot war angelegt.
»Für ein siebentes haben wir noch Vorrat im Wagen«, sagte Andrew. »Dann müssen wir zur Küste zurück und neues Material holen. Es geht ungefähr auf, wenn wir das siebente an der Stelle anlegen, an der Dr. Wille seine Station hat.«
Er griff wieder zum Sextanten, um eine neue Ortsbestimmung zu machen, denn auf den Kompaß war in diesem Gebiet so nahe dem magnetischen Südpol kaum Verlaß.
»Die Beobachtungen von Dr. Schmidt scheinen zu stimmen«, sagte er, während er zu rechnen begann. »Der magnetische Südpol muß seit seiner ersten Entdeckung von Shackleton stark nach Süden abgewandert sein. Ich denke aber, daß wir die Stelle mit Hilfe der astronomischen Ortsbestimmungen finden werden.«
»Es genügt, wenn wir nur in die Nähe kommen«, warf Garrison ein. »Der hohe Funkmast, die andern Masten für die elektrischen Messungen von Dr. Wille, das läßt sich gar nicht verfehlen. Man sieht es schon auf ein paar Meilen.«
Aber vergeblich spähte Garrison danach aus, während der Wagen Kilometer um Kilometer weiterrollte.
»Hier müßte es sein«, erklärte Andrew, der eben wieder eine Ortsbestimmung gemacht hatte, und befahl dem Wagenführer zu halten. Bolton warf sich den Pelz über und kletterte aus dem Fahrzeug hinaus. Soweit das Auge reichte, dehnte sich die antarktische Hochebene nach allen Seiten, über größeren Flächen hatte der ewige Sturm die Schneemassen fortgeblasen, rötlichgrau trat der nackte Felsboden zutage. Nur hier und da, wo geringfügige Erhöhungen Halt und Widerstand boten, zeigten sich weiße Flecken, ein Zeichen, daß sich dort Schneewehen gebildet hatten. Bolton brachte einen scharfen Feldstecher vor die Augen und musterte das Gelände damit. Plötzlich ließ er ihn wieder sinken und deutete mit der Hand nach vorn.
»Da! Etwa einen halben Kilometer weg, da scheint was Sonderbares zu liegen. So werden Sie es nicht erkennen, Garrison. Nehmen Sie mal mein Glas.«
»In der Tat, merkwürdig«, meinte Garrison nach längerer Betrachtung, »das müssen wir uns in der Nähe besehen—«
Kurz danach hielt der Wagen an jener Stelle. Kopfschüttelnd schritt Garrison um einen Haufen mehr oder weniger zerbrochener hölzerner Bauteile herum, der hier Veranlassung zu einer Schneewehe gegeben hatte und ihnen dadurch von weitem aufgefallen war.
»Merkwürdig, höchst merkwürdig«, wiederholte er immer noch kopfschüttelnd. »Ich erinnere mich, daß der Stapel damals unmittelbar neben der Station von Dr. Wille lag. Wo zum Teufel ist denn die Station geblieben?«
Er fand keine Antwort auf seine Frage, und ebenso vergeblich bemühten sich Bolton und Andrew, das Rätsel zu lösen, denn die deutsche Regierung hatte es nicht für notwendig erachtet, der Öffentlichkeit die Verlegung des antarktischen Institutes bekanntzugeben. Das konnten sie jedoch mit Sicherheit feststellen, daß sie an der richtigen Stelle waren. Die großen in den Felsboden einbetonierten stählernen Haken, an denen früher die Abspannseile des Funkmastes befestigt waren und die man bei der Verlegung der Station zurückgelassen hatte, lieferten einen untrüglichen Beweis dafür.
Während sie dicht neben dem Stapel ihr siebentes Depot anlegten, zerbrach sich Garrison den Kopf, woher die beschädigten Bauteile stammen mochten. Bei seinem damaligen Aufenthalt war er achtlos an ihnen vorübergegangen, und Dr. Wille und seine Leute hatten ihm gegenüber kein Wort über die Sturmkatastrophe verloren, von der die Station betroffen worden war. Blitzartig kam ihm jetzt der Gedanke, daß auch diese Trümmer hier mit dem Bolidensturz zusammenhängen müßten. Wie riesenhaft mußte jenes Geschoß aus dem Wellraum gewesen sein, wenn es noch auf tausend Kilometer derartige Zerstörungen anzurichten vermochte.
Ein Ruf Boltons riß ihn aus seinem Sinnen. Das Depot war fertig. In schneller
Fahrt und ohne zu rasten ging die Reise zur Mac-Murdo-Bucht zurück, um dort
neue Ladung zu nehmen. Ging danach wieder nach Westen auf der schon einmal
befahrenen Route. Nach anderthalb Tagen waren sie wieder bei ihrem siebenten
Depot und der eigentliche Vorstoß nach Süden konnte beginnen.
Mit wachsender Ungeduld ertrug Bolton die mehrfachen Aufenthalte, die Andrew durch seine wissenschaftlichen Beobachtungen und weiterhin durch die Benutzung der Funkstation verursachte. Bei Benutzung der Radioanlage war es ja unvermeidlich, den hohen Mast auszukurbeln, und das konnte nur geschehen, während der Wagen auf vollkommen ebenem Gelände sicher feststand. Der Funkverkehr Andrews war Bolton ein Dorn im Auge. Am liebsten wäre es ihm gewesen, wenn die Welt gar nichts über den weiteren Verbleib der Expedition erfahren hätte. Wie wäre er erst aufgebraust, wenn er geahnt hätte, daß jedes Funkgespräch Andrews den deutschen Peilstationen Gelegenheit gab, seinen jeweiligen Standort, bis auf wenige Kilometer genau, festzustellen.
Eine gewisse Entschädigung bot ihm das Schicksal dafür in Gestalt einiger Erzfunde. Sooft es einen Aufenthalt gab, stürzte er aus dem Wagen und suchte das über große Strecken schneefreie Gelände mit dem Glas ab. Mehr als einmal sah er es dabei verführerisch aufblinken, eilte zu der betreffenden Stelle hin und konnte einen Erzbrocken in die Tasche stecken. Die einzelnen Stücke waren nicht groß, höchstens einmal ein paar Kilogramm schwer, aber allmählich begann sich ihr Gewicht erfreulich zu addieren. Vergnügt zeigte er Garrison eine Kiste, die fast bis zum Rande mit den Fundstücken gefüllt war, und meinte dazu:
»Wenn's so weiter geht, muß ich es bald ebenso machen wie Captain Andrew.«
»Wie meinen Sie das?« fragte Garrison.
»Depots anlegen, old chap! Wenn ich neben jedem unserer Lebensmitteldepots ein ordentliches Erzdepot aufbauen kann, will ich zufrieden sein.«
Garrison schüttelte den Kopf. »Dazu langt's vorläufig noch nicht, aber vielleicht ein paar hundert Kilometer südlicher. Wenn wir in ein Gebiet kommen, über das der Bolide tüchtig gestreut hat, könnte es Ihnen wohl glücken.« Während er sprach, erwärmte er sich an seinen eigenen Worten. »Das wäre eine Sache, was Bolton? Wenn wir eine volle Schiffsladung für die ›City of Boston‹ an den Mac-Murdo-Sund bringen könnten. 3000 Tonnen kann der Dampfer bequem laden. 3000 Tonnen Erz, Bolton, da wäre für uns beide ausgesorgt.«
›Für mich bestimmt‹, dachte Bolton, aber er zog es vor, den Gedanken für sich zu behalten.
Ein Köder wird gelegt. Bolton und Garrison beißen an. Die ersten Goldmilliarden in Deutschland. Reichsbanknoten werden wieder in Gold eingelöst. Die Devisensperre fällt. Deutschland, ein reiches Land. Neue Pläne für die Zukunft.
Mit gemischten Gefühlen verfolgte man auf deutscher Seite das Vorrücken der amerikanischen Expedition. Ging es in dem bisherigen Tempo weiter, so mußte sie in wenigen Tagen die Grenze des deutschen antarktischen Gebietes erreichen und man würde dann genötigt sein, in irgendeiner Form offiziell zu ihr Stellung zu nehmen. Eine längere Beratung gab es daraufhin in der Kraterstation zwischen dem Ministerialdirektor Reute und Professor Eggerth, zu der zum Schluß auch noch Hein Eggerth hinzugezogen wurde.
»Ihr Herr Vater sagte mir, daß Sie eine brauchbare Idee haben«, empfing ihn Reute, »hoffentlich ist sie nicht so radikal wie Ihr neulicher Einfall, die beiden Amerikaner einfach auf einer einsamen Insel auszusetzen.«
»Durchaus nicht, Herr Ministerialdirektor. Im Gegenteil«, beeilte sich Hein Eggerth ihn zu beruhigen. »Mein Vorschlag ist diesmal rein psychologischer Art. Er gründet sich auf dem Charakter der Herren Bolton und Garrison, den ich einigermaßen zu kennen glaube, und ich möchte meine Hand dafür ins Feuer legen, daß er die gewünschte Wirkung haben wird.«
In kurzen Worten entwickelte Hein Eggerth seinen Plan, und überraschend schnell stimmte Reute ihm bei. Kurz darauf wurde im Krater an einer Stelle gebohrt und gesprengt, die bisher nicht auf dem Arbeitsplan verzeichnet stand, und wiederum kurz danach stieg ein Schiff der St-Type auf. In seinem Leib trug es eine Last von hundert Tonnen, viele tausend Brocken des eben an der neuen Sprengstelle gewonnenen Erzes. In nördlicher Richtung stürmte es in zehn Kilometer Höhe dahin. Neben dem Piloten stand Hein Eggerth und suchte mit einem Fernrohr die Gegend ab. Jetzt schien er gefunden zu haben, was er suchte. Das Schiff ging bis auf 5000 Meter herunter, eine Klappe öffnete sich, an der Unterseite seines Rumpfes, blank und stückig, begann es aus der Öffnung in die Tiefe zu rieseln, während das Schiff in langsamer Fahrt nach Süden drehte. Um hundert Tonnen erleichtert, kehrte es zum Krater zurück und noch mehrere Male wiederholte es den Flug.
Einen Augenblick horchte Garrison auf. »Hörten Sie etwas, Bolton? Mir war's
eben fast so, als hätte ich irgendwo ein Flugzeug gehört.«
Eine kurze Zeit lauschte Bolton, dann schüttelte er den Kopf. »Ein Irrtum von Ihnen, Garrison. Ich höre nur den Wagenmotor. Unsere Maschine macht für ihre siebzig Pferde einen ganz anständigen Krach.«
Gerade in diesem Augenblick gab Andrew den Befehl zu halten, der Wagenführer setzte den Motor stille.
»Sehen Sie, daß ich recht hatte«, sagte Bolton. »Jetzt müßte man es bestimmt hören, wenn ein Flugzeug in der Nähe wäre.«
Während er es sagte, war ›St 11‹ schon wieder in die Stratosphäre gestiegen, aus der kein Ton und auch kein Motorgeräusch bis zur Erde hinabdrang. Indes aus dem Wagen langsam der Antennenmast in die Höhe wuchs, eilte Bolton seiner Gewohnheit getreu ins Freie, um die Gegend nach Erz abzusuchen. In der Ferne weit voraus sah er es in den Strahlen der tiefstehenden Sonne aufblinken. Hier und da und dort, an mehreren Stellen zugleich. Schon lief er darauf zu. Kaum daß er sich noch die Zeit nahm, dem andern zuzurufen:
»Da liegt wieder Erz, Garrison.«
Nach etwa dreihundert Meter erreichte er das erste blinkende Stück und griff begierig danach. Es war ein stattlicher Brocken, an die zehn Kilogramm schwer, zackig und sperrig, zu groß, um ihn in eine Tasche zu stecken. Bolton behielt ihn im Arm, wandte sich der nächsten Stelle zu, an der er das lockende Blinken bemerkt hatte, und sah mißmutig, daß Garrison bereits dorthin eilte und etwas Schimmerndes aufhob, bevor er selbst heranzukommen vermochte. Schnell lief er auf einen dritten Punkt zu und traf keuchend von dem Lauf bei einem dritten Brocken, der noch größer als die beiden ersten war, mit Garrison zusammen. Gleichzeitig wollten beide danach greifen, bückten sich und prallten hart mit den Köpfen zusammen. Fluchend rieb sich Bolton den Schädel.
»So geht das nicht, Garrison. Überhaupt ...«, noch einmal schaute er sich prüfend nach allen Seiten um. Von mehr als zwanzig Stellen blinkte es ihm aus größerer und geringerer Entfernung entgegen, »überhaupt brauchen wir hier etwas anderes, um den Segen aufzulesen. Mehr als die drei Brocken hier können wir ja kaum schleppen. Wollen die mal erst zum Wagen zurückbringen und sehen, wie wir es weiter machen.«
Polternd fielen in dem Raupenwagen drei Erzbrocken, zusammen wohl einen halben Zentner schwer, in eine Kiste, und schon liefen die beiden Amerikaner wieder ins Freie hinaus. Zu groß war ihre Gier nach dem kostbaren Erz und in der Eile wollte ihnen kein besserer Weg einfallen, es zu holen. Doppelt so lange Zeit wie beim ersten Male blieben sie diesmal fort. Jeder brachte zwei große Brocken herangeschleppt, als sie in der Nähe des Wagens wieder zusammentrafen.
»Ich glaube, Garrison«, stieß Bolton zwischen heftigen Atemstößen heraus, »wir haben eine Stelle entdeckt, an der sich's lohnt. An wenigstens hundert Punkten habe ich es funkeln und blinken sehen.«
»Ich auch, Bolton«, bestätigte Garrison seine Entdeckung. »Der Bolide muß hier kräftig gestreut haben. Aber lange Zeit wird es in Anspruch nehmen, bis wir das alles zusammensuchen und in den Wagen bringen. Wer weiß, ob Captain Andrew uns die nötige Zeit dafür läßt. Sehen Sie, der Funkmast wird schon wieder eingezogen, gleich wird die Fahrt weitergehen.«
Wie eine gereizte Bulldogge fuhr Bolton empor.
»Andrew wird warten, solange es uns beliebt.«
Sie stiegen in den Wagen, um ihren Fund in Sicherheit zu bringen.
»Zeit, Gentlemen«, empfing sie Andrew. »Wir wollen weiter.«
Mit einer schroffen Bewegung hielt ihm Bolton das Erz vors Gesicht.
»Was sagen Sie dazu, Mr. Andrew?«
Prüfend beugte sich Andrew noch dichter darüber.
»Meteoriteneisen, wenn ich mich nicht irre. Vermutlich Nickeleisen ...«
»Nickeleisen oder sonst ein Eisen«, fiel ihm Bolton ins Wort, »jedenfalls ist es hier in Mengen zu finden, und wir wollen kein Stück davon liegenlassen.«
Vergeblich versuchte Andrew zu widersprechen. Bolton zog seinen Vertrag aus der Tasche und deutete auf eine bestimmte Stelle darin. Es war ein kleiner aber schwerwiegender Paragraph, den Andrew mit allen andern Paragraphen des Vertrages damals unterschrieben hatte, ohne ihm besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Aber genau besehen besagte er nicht mehr und nicht weniger, als daß Mr. Bolton die Bewegungen der Expedition zu bestimmen hatte, sobald sie in ein Gebiet kamen, in dem Meteoritenerz lag.
Nach kurzem Überlegen gab Andrew das Schriftstück zurück.
»Sie haben recht, Mr. Bolton. Wenn hier Erze liegen, muß ich Ihnen die Zeit lassen, sie aufzuheben ... sie aufzuheben ... berücksichtigen Sie das wohl ... so ist der Wortlaut unseres Vertrages. Von irgendwelchen Fahrten, um das Erz zu entdecken, steht nichts darin.«
»Ist auch nicht nötig. Captain. Es liegt hier. So weit man sehen kann, blinkt und blitzt es ...« Bolton hielt es für angebracht, etwas zu übertreiben, »... an tausend Stellen.«
»Dann heben Sie es in Gottes Namen auf«, sagte Andrew und machte sich an seinen Instrumenten zu schaffen.
Naturgemäß hatte Hein Eggerth keine Ahnung von dem Vertrag zwischen Captain
Andrew und seinen Partnern, aber wenn er ihn Wort für Wort gekannt hätte,
hätte er nicht zweckmäßiger verfahren können, als er es getan hatte. Läßt man
aus einem sich mäßig schnell bewegenden Flugzeug aus 5000 Meter Höhe
Erzbrocken von der hier benutzten Größe herausfallen, so streuen sie bei
ihrem Sturz bis zur Erde recht hübsch nach allen Seiten. Etwa tausend Tonnen
der blinkenden Lockspeise hatte ›St 11‹ auf seinen Flügen
ausgeworfen. Mehr als hunderttausend Brocken waren es, die ziemlich
gleichmäßig verteilt, ein etwa fünf Kilometer breites und dreihundert
Kilometer langes Gelände bedeckten. Nicht Tage, sondern Wochen mußte es
beanspruchen, diese Erzmenge aufzusammeln.
Au allem Überfluß bog die derartig gesalzene Strecke unter dem 75. Grad südlicher Breite nach Westen ab. Wenn die beiden Erzliebhaber ihr, wie Hein Eggerth es voraussetzte, folgten, mußten sie sich wieder von der deutschen Grenze entfernen.
Die nächsten Tage brachten den Beweis, daß der Plan geglückt, der ausgelegte Köder angenommen worden war. Wie die deutschen Funkpeilungen ergaben, rückte die amerikanische Expedition nur noch sehr langsam vor und schwenkte unter dem 75. Grad nach Westen ab.
»Gelungen! Mr. Bolton hat angebissen«, rief Hein Eggerth und machte einen
Freudensprung.
»Hoffentlich kommen die Herrschaften nicht auf den Gedanken, gleich das spezifische Gewicht ihrer Funde zu bestimmen«, warf Reute ein.
Hein Eggerth lachte. »Und wenn sie es zehnmal täten, Herr Ministerialdirektor, es würde sie doch nicht davon abbringen, den blanken Brocken nachzulaufen, soweit sie sie glänzen und blitzen sehen.«
Er behielt mit seiner Prophezeiung recht. Wie hypnotisiert folgten Bolton und Garrison dem schimmernden Köder, den ›St 11‹ ihnen über den Weg gestreut hatte, und wohl oder übel mußte Captain Andrew sich ihrem Tun fügen.
Eine Fläche von mehr als 1500 Quadratkilometern, von rund 30 Quadratmeilen also, mußte abgesucht werden. So raffiniert war das Erz über sie verstreut, daß die nächsten Brocken stets in fünfzig bis hundert Metern Abstand aufblinkten. Es lohnte sich nicht recht, für solche Entfernung erst wieder in den Wagen zu klettern, und so kamen Tage, an denen Bolton und Garrison über Fels und Eis liefen und das Erz zusammenschleppten, bis sie vor Erschöpfung niederbrachen.
Andrew ließ sie gewähren, ohne sich selbst irgendwie an dieser mühevollen Arbeit zu beteiligen. Schweigend beschäftigte er sich mit seinen Instrumenten und wissenschaftlichen Aufzeichnungen, und ebensowenig waren der Fahrer Parlett und der Funker Bowson geneigt, das Spiel mitzumachen, obwohl ihnen Bolton königliche Trinkgelder in Aussicht stellte.
Mit Mühe erreichte es Bolton, daß Andrew über die reichen Funde von Meteoritenerz nichts funken ließ. Für die Welt, soweit sie auf Funksprüche angewiesen war, befand sich die Andrewsche Expedition in langsamem Fortschreiten in südwestlicher Richtung, eifrig mit wissenschaftlichen Arbeiten und Entdeckungen beschäftigt.
Nur in der deutschen Kraterstation wußte man über ihre wirkliche Tätigkeit Bescheid und stellte Berechnungen an, wie lange sie wohl noch dauern könnte. Tausend Tonnen Erz waren zusammenzusuchen und an einzelnen Punkten aufzustapeln. Das mochte wenigstens sechs Wochen in Anspruch nehmen. Dann war das Erz nach dem Mac-Murdo-Sund zu bringen. Soviel man über den Raupenwagen Andrews wußte, konnte er neben seiner sonstigen Ladung, höchstens noch zwanzig Tonnen Erz mitnehmen. Das bedeutete einige fünfzigmal die lange Reise dorthin und wieder zurück zu machen. Für mehrere Monate waren die Herren Bolton und Garrison demnach anderweitig beschäftigt, und man brauchte sich in der Kraterstation vorläufig nicht weiter um sie zu kümmern.
*
Die Welt wußte wenig über die wirkliche Tätigkeit der Andrewschen Expedition, aber noch weniger über die deutschen Arbeiten in dem neuen antarktischen Kolonialgebiet, nämlich gar nichts. Es war tatsächlich gelungen, die Errichtung der großen Station am Krater vollkommen geheimzuhalten. Wie bereits gesagt, hatte man ausgesuchte Leute dorthin geschickt, auf deren Verschwiegenheit und Zuverlässigkeit das Reich sich nach ihrer ganzen politischen Vergangenheit unbedingt verlassen konnte. Die Löhne für die zweihundert Mann, die in der Kraterstation arbeiteten, waren so hoch bemessen, daß sie reichlich davon nach Hause schicken und darüber hinaus schöne Ersparnisse machen konnten. Weiter hatte man mit allen Mitteln der Technik und Hygiene Lebens- und Arbeitsverhältnisse geschaffen, die irgendwelche Unzufriedenheit und Sehnsucht nicht aufkommen ließen. Und schließlich ... alle Beteiligten hatten sich dem freiwillig und gern unterworfen ... hatte man eine Zensur für die Korrespondenz in die Heimat eingeführt. In allen Briefen, die aus der Antarktis nach Deutschland kamen, stand nur zu lesen, daß man eifrig mit Schürf- und Abteufarbeiten beschäftigt sei und stellenweise bereits auf abbauwürdige Kohle fündig geworden sei.
Begreiflicherweise ließ es sich nicht vermeiden, daß solche Briefe in Deutschland von Hand zu Hand gingen und daß gelegentlich der eine oder andere auch einmal in unrechte Hände geriet. Aber ihr Inhalt war infolge der Zensur so unverfänglich, daß weder im Inland noch im Ausland irgend jemand den wahren Sachverhalt ahnte.
In den ausländischen Zeitungen erschienen hin und wieder ironisch gefärbte Artikel über deutsche Kohlenfunde in der Antarktis, verbunden mit Berechnungen, welche die wirtschaftliche Aussichtslosigkeit derartiger Unternehmungen überzeugend zu beweisen versuchten. Mit der Erwerbung der antarktischen deutschen Kolonie hatte man sich in den andern Staaten längst abgefunden. Es lohnte sich nicht, um diesen Fetzen vereisten Landes noch diplomatische Noten zu wechseln, es wäre schade um das dabei verschriebene Papier gewesen.
So war die allgemeine Lage, als der Tag sich jährte, an dem die ersten Bauten an dem Krater entstanden waren und die ersten Maschinen dort zu arbeiten begonnen hatten. Unablässig waren seitdem die Stratosphärenschiffe mit ihrer kostbaren Last nach Deutschland geflogen, zuerst noch mit Goldbarren, seit Monaten schon mit gemünztem Gold beladen. Nach reiflicher Überlegung hatte sich die Reichsregierung entschlossen, auch die Ausprägung der Goldmünzen in der Antarktis vorzunehmen, weil nur dort absolute Gewähr für die Geheimhaltung gegeben war. Stetig war der Goldschatz in der Reichsbank dabei gewachsen, bis an die Gewölbedecken ihrer Keller war die goldene Flut gestiegen.
Da kam die große Überraschung, die der internationalen Hochfinanz für Tage
die Sprache raubte und die Welt den Atem anhalten ließ. Drei kurze Zeilen im
Reichsanzeiger waren es, welche diese gewaltige Wirkung hervorriefen:
›Die Verfügung vom 2. August 1914 wird aufgehoben. Die Reichsbank ist wieder verpflichtet, ihre Banknoten in Gold einzulösen.‹
Dunkel kam den älteren Leuten die Erinnerung an längst versunkene Zeiten vor dem großen Kriege, da noch funkelnde Goldstücke von Hand zu Hand gegangen waren. Die jüngeren wußten nichts davon, hatten noch niemals in ihrem Leben ein goldenes Zwanzigmarkstück gesehen.
»Vater, was sind denn Goldstücke? Mutter, was heißt das, Goldmünzen?« fragten die Kinder.
»Soll es wirklich wieder so werden, wie in jenen alten Zeiten? Soll man wieder bestimmen dürfen, ob man eine Summe in Papier oder in Gold haben will?« zweifelten die Alten. Nur vorsichtig wagten sie den Versuch. Hier und dort gab der eine oder andere in einer Bankfiliale einen Schein hin, fragte zögernd, stockend, wie benommen, ob er Gold dafür erhalten könne. Sah dann, daß kein Traum ihn narrte, daß das Wunder Wahrheit wurde. Klingend sprang der Gegenwert seines Bankscheines in Form neuer blinkender Goldmünzen auf das Zahlbrett und wurde ihm hingeschoben.
Wie ein Lauffeuer ging die Kunde von Mund zu Mund: ›es ist wirklich wahr. Man bekommt in den Banken Gold für sein Papier, für das es soviel lange Jahre immer nur wieder anderes Papier gab.‹
Schimmerndes gemünztes Gold, dem keine Inflation seinen Wert rauben konnte, das seine Kaufkraft unter allen Umständen behalten mußte. Wer wollte noch Papier nehmen, wo er ohne Schwierigkeit Gold bekommen konnte? Zu bitter brannte im Gedächtnis von Hunderttausenden noch das große Verbrechen der Inflation, die Erinnerung an die Ausplünderung eines fleißigen sparsamen Volkes durch eine schwindelhafte Ausgabe von ungedecktem Papiergeld.
Tagelang drängte sich das Volk an den Bankschaltern und in den Wechselstuben, um seine Noten einzulösen; jeder von dem Gedanken getrieben, noch rechtzeitig zu kommen, noch etwas von dem goldenen Segen zu erhaschen. Denn daß der Schatz nicht ewig reichen könne, daß er bald, vielleicht schon morgen ... vielleicht schon in der nächsten Stunde erschöpft sein müsse, das hielten alle für gewiß. Nicht nur in Deutschland, sondern auch an den auswärtigen Geldplätzen war man felsenfest davon überzeugt.
Die Reichspost konnte in diesen Tagen hohe Einnahmen verbuchen. Auf viele Stunden mieteten sich die Berliner Korrespondenten der großen ausländischen Zeitungen die teuersten Drähte, um jede Phase der neuen Entwicklung ihren Redaktionen sofort zu melden, und geringfügige Zwischenfälle blieben in dieser aufgeregten Zeit auch nicht aus. Hin und wieder geschah es, daß der Goldvorrat irgendeiner Depositenkasse dem Ansturm nicht gewachsen war und die Auszahlungen unterbrochen werden mußten. Selten dauerte es länger als eine Stunde, bis dann ein Panzerauto vor der Filiale hielt, schwere Kisten ausgeladen wurden und gleich danach wieder das klingende Spiel auf den Zahltischen einsetzte. Das gab den Berichterstattern Gelegenheit, wilde Nachrichten über die Grenzen zu kabeln, die schon kurz danach in den ausländischen Zeitungen unter schreienden Schlagzeilen erschienen.
›Der Gold-Run in Deutschland‹, ›Die Reichsbank zusammengebrochen‹, ›Das Ende des deutschen Experimentes‹, ›Unmöglicher Wahnsinn‹ ... waren so etwa die Überschriften, die noch druckfeucht, wie sie aus der Maschine kamen, auf den Boulevards von Paris und in der Londoner City verschlungen wurden, während in Deutschland die Auszahlung schon längst wieder glatt weiterging.
Am zehnten Tage nach der Wiederaufnahme der Goldeinlösung begann der Andrang bei den Bankschaltern nachzulassen. Der erste Golddurst des Publikums war gestillt und langsam, wie es ja in den wirtschaftlichen Notwendigkeiten begründet und von der Reichsregierung richtig vorausgesehen war, setzte ein Rückfluß der goldenen Münzen zu den Kassen des Staats und der Banken ein.
Nicht alles Gold kam wieder. Als man in der Zentrale der Reichsbank Inventur machte, stellte es sich heraus, daß zwei Milliarden gemünzten Goldes im Umlauf geblieben, teils in den Sparstrümpfen des deutschen Volkes verschwunden waren.
Der entsprechende Betrag an Noten war dafür zur Bank zurückgekehrt. Der Öffentlichkeit wurde diese Tatsache nicht bekanntgegeben. Eine Mitteilung der Reichsbank besagte nur, daß die Wiedereinführung der Goldeinlösung sich reibungslos, ohne nennenswerte Erschütterungen und Zwischenfälle vollzogen habe. Das Ausland stand vor einem Rätsel. War das Volk im neuen Deutschen Reich wirklich so wohldiszipliniert, ließ es den Gemeinnutz tatsächlich so vor jeden Eigennutz gehen, daß hier möglich wurde, was kein anderer Staat mehr zu tun wagte, daß man das Gold frei zirkulieren lassen konnte? Viele Fragen, auf die keiner der fremden Banksachverständigen eine Antwort zu geben wußte.
Ein Monat und noch ein zweiter waren darüber ins Land gegangen, als die
Weltwirtschaft durch neue Verfügungen der deutschen Regierung in Erregung
geriet. Mit einem Schlage wurden die schweren Beschränkungen des
internationalen Zahlungs- und Handelsverkehrs, die man in den schlimmen
Jahren der Wirtschaftsschrumpfung anordnen mußte, von ihr aufgehoben.
Unbehindert durfte jedermann in Deutschland wieder fremde Devisen gegen
Reichsbanknoten kaufen und verkaufen. Gleichlautend fiel das Urteil über die
neuen Maßnahmen an allen großen Bank- und Börsenplätzen der Welt aus.
›Die Deutschen sind wahnsinnig geworden‹, hieß es kurz und
bündig überall. Während die Leiter der fremden großen Geldinstitute sich ihre
Köpfe noch über die Beweggründe der Reichsregierung zerbrachen, wurde das
internationale Schiebertum sofort sehr mobil.
An der deutschen Grenze mußten die Fernzüge ihren Aufenthalt verdoppeln, weil es nicht mehr möglich war, die in das Reich strömenden Fremden in der vorgesehenen Zeit abzufertigen. In hellen Haufen kamen sie von Osten und Westen her. Viele Hunderte brachte jedes Schiff, das in Hamburg oder Bremen anlegte, von Übersee mit.
Zu neunzig Prozent waren es wenig erfreuliche Zeitgenossen, deren Geschäfte gewöhnlich das Licht zu scheuen hatten. Seit Jahren lebten die meisten von den Gewinnmöglichkeiten, welche die Devisenvorschriften aller Staaten denjenigen boten, die sich über das Gesetz hinwegzusetzen verstanden. Ganz legal konnten sie jetzt in Deutschland die fremden Noten, die sie mit allen möglichen Listen und Tücken aus dem eigenen Lande herausgebracht hatten, an jedem Bankschalter gegen klingendes Gold einwechseln, konnten frei und ungehindert mit dem so heiß begehrten gelben Metall das Reichsgebiet wieder verlassen. Das letztere geschah etwas zwangsläufig, denn auf eine längere Anwesenheit dieser fremdländischen Gäste legte Deutschland so wenig Wert, daß es ihnen im allgemeinen nur eine kurz bemessene Aufenthaltsbewilligung erteilte. Doch diese wurde nur selten voll ausgenutzt. Sowie sie ihre Devisen eingewechselt hatten, waren sie bestrebt, die Beute in Sicherheit zu bringen, das Gold im eigenen Lande mit Gewinn abzusetzen und möglichst schnell einen neuen Fischzug zu unternehmen.
Die Fährlichkeiten ihres Geschäftes begannen erst außerhalb der deutschen Grenzen, denn dort gab es noch allerlei Vorschriften, die das Goldhamstern, ja sogar den Besitz weniger Goldstücke unter schwere Strafen stellten. Aber das war den Schiebern gerade recht. Hier waren sie in ihrem eigentlichen Element, denn eben diese Vorschriften gaben ihnen ja die Möglichkeit, das deutsche Gold mit hohem Aufgeld an ängstliche Sparer des eigenen Landes abzusetzen.
Bis auf das Tüpfelchen genau traf alles so ein, wie es die deutsche Regierung bei der Aufhebung der gesetzlichen Beschränkungen vorausgesehen hatte. Kratergold im Werte von fünf Milliarden war drei Monate später aus Deutschland verschwunden, aber in keinem Ausweis der großen ausländischen Banken kam es zum Vorschein. Spurlos war es in Millionen von Sparstrümpfen und privaten Safes versickert.
Die deutsche Reichsbank konnte dafür auf einem Geheimkonto den Betrag von fünf Milliarden in fremden Devisen verbuchen und besaß damit eine furchtbare Waffe. Jede fremde Währung hätte sie auf das schwerste erschüttern können, wenn sie diese auswärtigen Zahlungsmittel etwa in Mengen auf die ausländischen Märkte warf. Aber etwas Derartiges lag nicht in der Absicht der Reichsregierung. Im Gegenteil ging ihr großzügiger Plan ja dahin, mit jenem gewaltigen Goldreichtum, den ein glückliches Geschick ihr in den Schoß geworfen, zunächst die eigene Wirtschaft und im Anschluß daran die Weltwirtschaft zu neuer Blüte zu bringen.
Professor Eggerth notierte sich sorgfältig die Zahlen, die Minister Schröter
während des langen Gespräches nennte. Bei den letzten Ziffern ließ er den
Bleistift sinken.
»Zwanzigtausend Tonnen Nickel sollen meine Werke in Kanada kaufen? Wird das möglich sein, Herr Minister, ohne unerwünschtes Aufsehen zu erregen? Zwanzigtausend Tonnen ... es ist meines Wissens die halbe Jahresproduktion Kanadas.«
»Macht nichts, Herr Professor. Infolge der allgemeinen Absatzkrise lagert in Kanada noch aus früheren Jahren her ein Vorrat von mehr als fünfzigtausend Tonnen. Die Leute werden heilfroh sein, wenn sie auf einen Plutz zwanzigtausend loswerden und für unsere kanadischen Devisen ist es die beste Anwendung.«
»Gut, ich werde meine amerikanischen Vertreter telegraphisch anweisen, den Kauf zu tätigen ... mit der nötigen Vorsicht natürlich, um ein ungesundes Emporschnellen des Nickelpreises zu verhüten. Aber ...« kopfschüttelnd beugte sich der Professor wieder über seinen Schreibblock.
»Haben Sie irgendwelche Bedenken oder Zweifel?« fragte der Minister.
»Offen gesagt, Herr Minister, ich wundere mich.«
»Darf ich fragen, worüber, Herr Professor?«
»Über die Tatsache, daß wir das Nickel in Kanada kaufen, während wir es doch ebenso gut aus dem Kratererz gewinnen könnten.«
»Aber nicht ebenso vorteilhaft, Herr Professor Eggerth, das ist der Unterschied. Aus dem Kratererz können wir mit genau den gleichen Unkosten und der gleichen Mühe ebensogut ein Kilogramm Gold wie ein Kilogramm Nickel herausziehen, und für ein Kilogramm Gold bekommen wir auf dem internationalen Metallmarkt, wie Ihnen bekannt sein dürfte, fünfhundert Kilogramm Nickel. Wir kommen also fünfhundertmal besser weg, wenn wir in Kanada kaufen und unser Meteoritennickel liegen lassen, wo es liegt.«
»Sie haben recht, Herr Minister! Meine Frage war unüberlegt. Aber ich glaube doch, daß der Kauf einer solchen Menge durch mein Werk zu allerlei Erörterungen und Mutmaßungen Anlaß geben wird. Man weiß schließlich draußen in der Welt, daß die Eggerth-Werke vorwiegend Leichtmetalle verarbeiten.«
Der Minister griff nach einer Zeitung, schlug sie auf und schob dem Professor eine rot angestrichene Notiz hin. Der überflog sie und konnte sich eines Lächelns nicht erwehren.
»Sehr gut, was man doch alles so en passant aus der Zeitung erfährt.«
Auch der Minister Schröter lachte.
»Ja, mein lieber Professor, das wußten Sie noch gar nicht, daß die Münzanstalt in Berlin mit den Eggerth-Werken über eine große Lieferung von Nickelblechen für die Ausprägung von Scheidemünzen in Verhandlung steht Übermorgen werden Sie noch etwas Genaueres darüber lesen können. Daß es sich nämlich um die neuen Nickelstücke im Gesamtwert von hundert Millionen Mark handelt. Hundert Millionen Mark, das entspricht gerade 20 000 Tonnen. Die Reichsregierung beabsichtigt ... ich möchte das nebenbei bemerken ... in Zukunft auch die Scheidemünzen als ein vollwertiges ehrliches Geld auszuprägen, bei dem der wirkliche Wert ebenso wie bei den Goldmünzen dem Nennbetrag entspricht. Sie sehen jedenfalls, daß der Nickelkauf auf diese Weise so getarnt ist, daß kein vernünftiger Mensch im In- und Ausland etwas dabei finden kann.«
Der Professor verabschiedete sich, um auf schnellstem Wege nach Bitterfeld zurückzukehren. Er war nicht der einzige Industrielle, der in diesen Tagen vom Finanzminister empfangen wurde. Die Führer der großen Elektrokonzerne wurden ebenso wie die führenden Männer der Textilindustrie in das Finanzministerium gebeten und hatten mit dem Minister ähnliche Unterredungen wie Professor Eggerth. Sie bekamen Kauforders auf Kupfer, Kautschuk und ausländische Faserstoffe, daß sie vor der Höhe der dazu erforderlichen Beträge erschraken. Aber ihre Bedenken und Einwände wußte der Minister mit wenigen Worten zu zerstreuen. Es war stets die gleiche Antwort, die sie von ihm erhielten:
»Kaufen Sie, Herr Direktor. Die Reichsbank stellt Ihnen die erforderlichen Devisen zur Verfügung, und das Reich übernimmt die Ware von Ihnen. Ihre Firma wird durch die Transaktion nicht belastet.«
Im übrigen waren auch für diese Käufe in jedem Falle Zeitungsartikel und Handelsnotizen vorbereitet, welche sie ganz unverfänglich erscheinen ließen. Zielbewußt führte die Reichsregierung den Plan durch, sich mit Hilfe ihres Devisenschatzes für lange Zeit mit allen denjenigen Rohstoffen zu versorgen, die Deutschland selbst nicht hervorzubringen vermochte oder im Besitze eines reichen Goldschatzes nicht mehr selbst erzeugen wollte. In erster Linie geschah es, um der einheimischen Industrie wieder volle Beweglichkeit und Arbeitsmöglichkeit zu verschaffen. Darüber hinaus aber führte dies Vorgehen, wie die kommenden Monate zeigen sollten, zu einer Wiederankurbelung des internationalen Handelsverkehrs. Es erwies sich bald, daß das kühne Experiment der Reichsregierung geglückt war, daß die Weltwirtschaft, die so lange krank daniedergelegen hatte, durch die Injektion von sieben Goldmilliarden wieder zu Kräften kam und aufzuleben begann.
Tief stand die Sonne in der Antarktis. Wie ein roter Kupferball kroch sie in 24 Stunden einmal um den Horizont herum. Nur noch wenige Tage, und sie würde unter ihn hinabsinken, eine neue Polarnacht würde beginnen, die dritte würde es für die Expedition sein.
Im letzten Schein des schwindenden Tages bewegten sich die drei Raupenwagen von Süden her über das endlose Schneefeld auf die Station zu. Am Abend des 5. April langten sie bei ihr an. Nach langen Wochen saßen alle Mitglieder der Expedition endlich wieder einmal beim gemeinsamen Mahl in dem großen Raum des Stationshauses zusammen. Schon während der letzten Stunden der Fahrt hatte ein Schneetreiben eingesetzt. In pfeifenden Stößen fuhr der Sturm jetzt um das Stationshaus und trieb die immer dichter fallenden Schneemassen gegen die Fenster.
»Der antarktische Winter meldet sich an«, meinte der lange Dr. Schmidt, stand auf und drehte die elektrische Heizung stärker an. Wille schob seinen Teller zurück und verschränkte die Arme über der Brust.
»In Deutschland wird es jetzt Frühling, Herr Schmidt. An der Bergstraße blühen schon die Obstbäume.«
Dr. Schmidt kniff die Lippen zusammen und schüttelte den Kopf, als ob er eine Erinnerung verscheuchen wolle. Wille sprach weiter.
»In Deutschland springen jetzt die Knospen an allen Zweigen ... grüne Blätter ... Frühlingslaub ... ich habe Sehnsucht danach. Seit drei Jahren habe ich es nicht mehr gesehen. Es war ja Herbst, die Bäume ließen ihre Blätter fallen, als wir aus Deutschland nach der Antarktis fuhren.«
Es war, als hätte Dr. Wille den andern damit ein Stichwort gegeben. Während draußen die Dunkelheit anbrach und der Schneesturm zum Orkan anwuchs, rückten sie näher zusammen, begannen durcheinanderzureden und vom Frühling in der Heimat zu erzählen. Von den alten Weidenbäumen im friesischen Marschenland sprach Lorenzen, die dort als die ersten Boten eines späten Frühlings ihre Kätzchen herausstecken. Von den Buchen des Thüringer Waldes hub Hagemann an zu schwärmen, die den Weg zur Wartburg hinauf umsäumen und ihr lichtes Grün mit dem Dunkel der alten Bergtannen vermischen.
»Ich möchte mal wieder durch den Tiergarten in Berlin gehen, wenn Rhododendron und Faulbaum blühen«, warf Rudi dazwischen.
»Und Sie, Herr Dr. Schmidt, haben Sie keinen Wunsch?« fragte Wille. Der kaute und schluckte eine Weile an irgend etwas nicht Vorhandenem, ehe er sich zur Antwort bereit fand.
»Ich möchte mal wieder gern im Frühling durch das Fuldatal bei Kassel wandern, aber ...« er machte eine kurze abwehrende Bewegung. »Das kommt natürlich gar nicht in Frage. Meine Arbeiten hier sind noch nicht abgeschlossen, den nächsten Frühling vielleicht, diesen noch nicht.«
Wille betrachtete seinen alten Mitarbeiter kopfschüttelnd.
»Alle Achtung vor Ihrem Pflichteifer, Herr Kollege, aber einen kleinen Erholungsurlaub sollten Sie sich nach dreißig Monaten in der Antarktis auch einmal gönnen. Sie haben ihn zumindest ebensosehr verdient wie die andern hier.«
Abweisend schüttelte Schmidt den Kopf. »Erst wenn ich meine Arbeiten abgeschlossen habe, vorher auf keinen Fall.«
Auf die übrigen wirkte das Wort ›Erholungsurlaub‹ wie ein elektrischer Funke. Hatte Wille es mit einer bestimmten Absicht gesagt, steckte etwas Positives dahinter? Mit wehmütigen Gefühlen hatten sie die Sonne versinken sehen. Der Gedanke, zum dritten Male hier die lange Polarnacht durchzumachen, wirkte auf alle mit Ausnahme des langen Schmidt niederdrückend, doppelt niederdrückend jetzt, da sie des Frühlings gedachten, der eben in Deutschland seinen Einzug hielt.
Mit stillem Vergnügen beobachtete Wille die Wirkung seiner Worte auf die um den Tisch Versammelten, während er einen Brief aus der Brusttasche zog. Der Adler auf dem Umschlag und die blaue Verschlußoblate ließen schon von weitem erkennen, daß es ein amtliches Schreiben war, offenbar aus einem Ministerium an Wille gerichtet. Mit behaglicher Langsamkeit entfaltete er das Schriftstück und putzte sich umständlich die Brillengläser, während seine Leute ihn verwundert anschauten, neugierig, was jetzt wohl kommen mochte.
»Ja also, meine Herren«, begann er endlich, »wir haben eben in gemeinschaftlicher Beratung festgestellt, daß jetzt in Deutschland der Frühling beginnt ...« er machte eine kleine Kunstpause.
›Herr Gott, wat klöhnt der Alte heut bloß zusammen‹, dachte Lorenzen bei sich, und die Gedanken der andern waren nicht sehr verschieden davon. Dr. Wille fuhr fort:
»Das Ministerium erteilt deshalb uns allen, die wir hier zusammensitzen, Urlaub bis zum 15. Oktober ... bei voller Gehaltszahlung natürlich. Morgen bringt ›St 11‹ die Ablösung und nimmt uns nach Deutschland mit.«
Eine Sekunde herrschte nach Dr. Willes Worten Totenstille im Raum. Dann brach der Jubel los. Sie sprangen auf, sie fielen sich in die Arme und tanzten schließlich einen wilden Indianertanz um den Tisch herum, in den sehr gegen seinen Willen sogar der lange Schmidt hineingerissen wurde.
Eine Weile ließ sie Wille gewähren, dann schrie er dazwischen.
»Ruhe, Herrschaften! Genug von dem Radau! In acht Stunden ist ›St 11‹ hier. Kümmern Sie sich um Ihre Sachen. Es muß alles gepackt sein, wenn das Schiff kommt.«
Im Augenblick wirbelten sie aus dem Raum hinaus, jeder eifrig darauf bedacht, die Anordnungen des Chefs zu befolgen. Nur Schmidt blieb zurück.
»Nun, Herr Kollege«, fragte Wille, »wollen Sie nicht auch Ihre Vorbereitungen treffen?«
Der lange Schmidt schüttelte den Kopf. »Nein, Herr Wille, ich ziehe es vor hierzubleiben. Erstens meiner Arbeiten wegen und zweitens ... es muß jemand hierbleiben, der die Herren Bolton und Garrison gebührend empfängt, wenn sie uns doch ins Gehege laufen sollten.«
Alle Versuche, ihn umzustimmen, waren vergeblich. Unerschütterlich verharrte er bei seinem Vorsatz. Es blieb Wille schließlich nichts anderes übrig, als ihn gewähren zu lassen.
Die Sonne war verschwunden, unter den Horizont gesunken. Dafür stand der Mond
jetzt hoch am Himmel. Langsam zog seine volle Scheibe in 24 Stunden einen
weiten Kreis und übergoß das verschneite Gefilde mit mattem Silberlicht. Das
Unwetter hatte sich ausgetobt, auf das Schneetreiben waren Windstille und
schneidender Frost gefolgt.
Auf dem Hof waren Hagemann und Lorenzen damit beschäftigt, durch die Schneemassen einen Weg zu den im Freien aufgebauten Instrumenten hin zu schaufeln. Plötzlich warf Hagemann die Schaufel beiseite.
»Hörst du, Jens, da kommt ›St 11‹. Soll mein Nachfolger hier weiterschippen, ich streike.«
»Hast recht, Karl. Aber wer weiß, vielleicht will der Alte noch mal zu seinen Apparaten, ehe wir von hier abhauen. Dann raucht's am Ende, wenn er durch den Schnee ...«
Die letzten Worte von Lorenzen gingen im Motorgeräusch verloren. An seiner Hubschraube hing ›St 11‹ über dem Hof und ließ sich langsam nieder; und dann mußten Hagemann und Lorenzen doch noch einmal zu ihren Schaufeln greifen und den Weg bis an das Stratosphärenschiff freimachen.
›St 11‹ kam von der Kraterstation, wo es die übliche Goldladung an Bord genommen hatte. Als erster stieg Reute über die Aluminiumtreppe hinab, begleitet von Berkoff und Hein Eggerth. Dr. Wille empfing sie am Fuß der Treppe und geleitete sie und fünf weitere Personen, die ihnen folgten, nach dem Hause hin.
»Ich bringe Ihnen die Ablösung, Herr Kollege«, sagte Reute. »Sie alle haben einen Urlaub redlich verdient.«
Während sie auf das Haus zuschritten, unterrichtete Dr. Wille den Ministerialdirektor von der Absicht Schmidts, hierzubleiben. Verwundert schüttelte Reute den Kopf.
»Ein sonderbarer Heiliger, dieser lange Doktor. Aber ... wenn ich es recht bedenke, wer weiß zu was es gut ist? Mag er in Gottes Namen hier bleiben, um so besser und schneller werden sich die andern einarbeiten können.«
Die nächsten Stunden waren der Übergabe der Geschäfte an die neue Besatzung der Station gewidmet, und es ging wirklich alles viel glatter und schneller, weil Dr. Schmidt in der Antarktis zurückblieb.
Dann noch ein letztes Winken und Grüßen. Hermetisch schlossen sich die Türen von ›St 11‹. Das Schiff stieg wieder auf, schraubte sich in die Höhe und stürmte in Südwestrichtung davon. Eine Stunde und noch eine Stunde raste es über endlose mondbeschienene Eisöde. Dann war über Enderby-Land bei Kap-Anne die Küste des sechsten Kontinents erreicht. Die Sonne kam wieder, dunstig blau wogte in ihrem Licht tief unter dem Schiff die See.
In ihrer Steuerbordkabine preßten Lorenzen und Hagemann die Nasen gegen das Fenster. Blaues Meer, offenes Wasser ... sie konnten sich nicht satt daran sehen. Wie lange hatten sie den Anblick entbehren müssen. Noch trieben Eismassen auf dem Ozean, aber immer seltener wurden sie, je weiter das Schiff kam.
Inseln tauchten auf und verschwanden wieder, und dann kam die afrikanische Küste in Sicht. Wie aus einer Spielzeugschachtel aufgebaut zog Kapstadt unter dem Flugschiff dahin und versank im Süden. Von Stunde zu Stunde veränderte sich das Bild. Erst sandige Wüsten, undurchdringliche Urwälder danach, durch die der Kongostrom sein schimmerndes Band zog.
Dann geschah es, daß Hagemann in eine Koje sank und Lorenzen in die andere,
und ehe sie sich's versahen, lagen beide in festem Schlaf. Seit 24 Stunden
waren sie nicht aus ihren Kleidern gekommen, und unerbittlich forderte die
Natur nun ihr Recht. Sie schliefen, während ›St 11‹ über die
Lybische Wüste dahinjagte. Sie sahen nichts vom Mittelmeer, nichts vom
italienischen Stiefel und auch nichts von den Alpen.
Eine Hand legte sich auf Hagemanns Schulter, rüttelte und schüttelte so lange
an ihm, bis er endlich verschlafen die Augen rieb. Die Stimme Berkoffs drang
an sein Ohr.
»He, Hagemann, altes Faultier, jetzt wird nicht weiter gedachst. Wir sind über Deutschland. Kommen Sie rüber in den Salon, das Essen steht auf dem Tisch.«
Während Hagemann sich langsam aufrappelte, wandte Berkoff sich zu der andern Koje hin. Nach dem Geräusch zu schließen, war Jens Lorenzen eben dabei, einen kräftigen Ast abzusägen. Allzu verlockend hing sein Achterteil über den Kojenrand, Berkoff konnte nicht widerstehen. Seine Hand knallte darauf ... zweimal ... dreimal, dann war auch Lorenzen unter Fluchen und Brummen munter und folgte den beiden andern in den Salon.
Die Sonne stand bereits tief im Westen, als sie ihn betraten. In knapp vierzehn Stunden hatte ›St 11‹ den langen Weg von der Antarktis nach Deutschland hinter sich gebracht. Es blieb ihnen eben noch Zeit, in Ruhe zu Abend zu essen. Dann tauchten die Lichter der Reichshauptstadt auf. Aus der Stratosphäre stieß das Schiff nach unten und ließ sich langsam auf den Flugplatz von Staaken hinab.
Noch im Schiff schüttelte Dr. Wille Hagemann und Lorenzen die Hand zum Abschied, rief ihnen, während sie schon ins Freie stürmten, noch nach:
»Am 14. Oktober, zehn Uhr morgens, pünktlich hier auf dem Flugplatz.« Die beiden mußten sich beeilen, um noch die Abendzüge nach Thüringen und Friesland zu erreichen. Zusammen mit Rudi fuhr Wille danach im Wagen Reutes in die Stadt, um vorläufig in einem Hotel Wohnung zu nehmen. Er war fremd hier geworden während der langen Jahre, die er im fernen Süden in der Antarktis seiner Wissenschaft geopfert hatte.
Garrison bricht zusammen. Bolton muß seine Pläne fahren lassen. Rückzug auf den Mac-Murdo-Sund. Der Sturz in die Eiskluft. Rettung durch ›St 11‹. Die Amerikaner an Bord der ›City of Boston‹.
Über den Verbleib der Andrewschen Expedition drangen seit jenem Novembertage, an dem ›St 11‹ ihr die glänzenden Brocken über den Weg streute, nur spärliche Nachrichten in die Öffentlichkeit. Aus Funksprüchen, die häufiger von dem deutschen Sender in der Antarktis als von der Expedition selber kamen, wußte man wenigstens, daß sie nicht verschollen war, sondern sich unter 75 Grad südlicher Breite langsam in westlicher Richtung durch Viktoria-Land bewegte.
Schweigend hatte sich Captain Andrew in das Unabänderliche gefügt. Er ließ Bolton und Garrison, die er für unheilbare Narren hielt, ihrer Leidenschaft frönen und wartete geduldig auf den Tag, an dem sie unter den Anstrengungen und Strapazen ihrer gegenwärtigen Tätigkeit zusammenbrechen mußten. Seine Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt. Sechs lange Wochen hindurch hielten Bolton und Garrison sich mit Gewalt aufrecht und arbeiteten in zäher Verbissenheit schwerer als die Lastträger in irgendeinem Hafen. Unermüdlich sammelten sie die Erzbrocken auf dem weiten Schneefeld und schleppten sie zu Stapeln zusammen, obwohl ihre Hände zerrissen und zerschunden waren und jeder Muskel, jedes Glied sie schmerzte.
Den fünfzigsten Stapel hatten sie gesetzt, da kam bei Garrison der Zusammenbruch. Als ihn Bolton aus unruhigem, fiebrigem Schlaf weckte, vermochte er sich nicht mehr von seinem Lager zu erheben. Apathisch blieb er liegen, so viel Bolton auch tobte und wetterte. Fluchend gab er es schließlich auf und verließ in übler Laune den Wagen, um allein an die schwere Arbeit zu gehen.
Jetzt hielt Captain Andrew es an der Zeit, einzugreifen. Im Verlauf seiner früheren Expedition hatte er gewisse ärztliche Erfahrungen gesammelt, die ihm nun bei einer gründlichen Untersuchung Garrisons zugute kamen. Das Ergebnis übertraf seine Befürchtungen.
Andrew fand eine durch übermäßige Anstrengungen hervorgerufene Herzerweiterung verbunden mit einer Herzschwäche, die ihn veranlaßte, schleunigst zu den Digitalistropfen des Arzneischrankes zu greifen. Dazu vernachlässigte Erfrierungen an den Händen und Füßen, die stellenweise schon brandig zu werden drohten.
Kopfschüttelnd stellte Andrew das alles fest. Wie konnte ein Mann von der wissenschaftlichen Vorbildung Garrisons es so weit mit sich kommen lassen? Wie sehr mußte er in seine fixe Idee verrannt sein, daß er alle diese bedrohlichen Erscheinungen so lange unbeachtet ließ!
Unter der sachkundigen Behandlung Andrews besserte sich Garrisons Zustand im Laufe der nächsten Stunden zusehends. Er vermochte seine Glieder wieder zu bewegen und betrachtete verwundert seine Hände, die in dicken Verbänden steckten.
»Bleiben Sie ganz ruhig liegen, Mr. Garrison«, befahl Andrew, als er es versuchte, sich in seinem Bett aufzurichten.
»Ich muß raus, Captain, muß Bolton helfen, das Erz einzusammeln. Jede Stunde ist kostbar.«
Andrew drückte ihn auf das Kissen zurück.
»Damit ist es vorläufig vorbei, dear Sir. Wenn ich Sie über den Berg bringen soll, brauchen Sie für die nächsten Wochen absolute Ruhe und größte Schonung. Sie haben sich einen Herzknacks geholt, der sich unter Brüdern sehen lassen kann ...«
»Aber ich muß, Captain! Was wird Bolton sagen, wenn ich ihm nicht weiter helfe?«
Andrew zuckte die Achseln. Er erkannte, daß hier nur brutale Offenheit helfen konnte.
»Mr. Bolton kann sich höchstens an Ihrem Begräbnis beteiligen, wenn Sie jetzt ungehorsam sind und gegen meine Verordnungen handeln. Ein Begräbnis in der Antarktis, Mr. Garrison! Es wäre nicht das erste, dem ich beiwohnen würde. Man hackt ein Loch in das Eis, packt den Toten hinein, schichtet die Eisbrocken über ihn und steckt ein Holzkreuz daneben. Sechs solcher Kreuze kenne ich, Mr. Garrison. Sie stehen drüben in Marie-Byrd-Land. Vor vier Jahren habe ich sie dort hingesetzt. Es täte mir leid, wenn ich hier ein siebentes in den Schnee stecken müßte.«
Die Worte Andrews, der ernste, fast düstere Ausdruck, der in seinen Mienen lag, während er sie sprach, verfehlten ihre Wirkung auf den Kranken nicht. Zum erstenmal seit Wochen versuchte er wieder nüchtern zu denken und sich von dem Goldtaumel frei zu machen. In der ruhigen objektiven Art, die Andrew von früher her an ihm kannte, begann er Fragen über seinen Zustand zu stellen.
»Ihr Zustand ist derartig, mein lieber Mr. Garrison«, erwiderte ihm Andrew, »daß Sie Ihrem Schöpfer danken müssen, wenn die Herzschwäche in den nächsten Tagen nachlaßt. Ob wir ohne Amputation einiger Finger und Zehen auskommen werden, ist im Augenblick noch zweifelhaft. Ich sage Ihnen nochmals: unbedingte Ruhe für die nächste Zeit. Mit Mr. Bolton werde ich selber ein ernstes Wort reden.«
Das Wort wurde gesprochen, als Bolton nach dreistündiger Abwesenheit zu dem
Wagen zurückkam, aufgeregt, polternd und fluchend, daß Garrison immer noch
schlappmache.
Bolton hatte sich ein großes Weinglas bis an den Rand voll Whisky gegossen und wollte es eben zum Munde führen, als die Rechte Andrews sein Handgelenk umklammerte und ihn zwang, das Glas wieder niederzusetzen.
»Einen Augenblick, Mr. Bolton. Ich möchte erst einmal Ihr Herz untersuchen.«
Vergeblich mühte sich Bolton, seine Hand loszumachen. Er hätte sie eher aus einem Schraubstock frei bekommen als aus der muskulösen Faust Captain Andrews. Bolton war gewiß kein Schwächling, aber der körperlichen Kraft Andrews und seinen gewandten Griffen war er nicht gewachsen. Wie ein Kind zog ihn der hinter sich her in den Nebenraum. Ehe er sich's versah, lag er dort auf einem Ruhelager. Mit der Rechten drückte der Captain ihn nieder, mit der Linken öffnete er ihm wie spielend Rock und Weste und legte ihm die Brust frei. Hatte dann plötzlich ein Stethoskop in der Hand und begann die linke Seite des Liegenden abzuhorchen.
Bolton gab den Widerstand auf. Jetzt, da er hier ausgestreckt und entspannt auf dem Polster lag, spürte er erst richtig, wie miserabel ihm eigentlich zumute war. Neugierig verfolgte er die Untersuchung, die Andrew mit ihm anstellte. Der behorchte und beklopfte ihn von allen Seiten, schob dann das Stethoskop zusammen und steckte es in die Tasche. Ohne ein Wort zu sagen, betrachtete er seinen Patienten lange mit nachdenklichem Ernst, wiegte dabei den Kopf kaum merklich. Bolton wurde sein Schweigen schließlich unheimlich. Er konnte nicht länger an sich halten und brach los.
»Reden Sie doch, Captain Andrew! Haben Sie was entdeckt?«
Die wiegende Bewegung von Andrews Haupt wurde stärker. »Ich habe mir sagen lassen, Mr. Bolton, daß ein Herzschlag der schönste Tod sein soll. Es wird einem schwarz vor Augen, man fällt um und ist in der nächsten Sekunde im Jenseits.«
Bolton starrte ihn mit aufgerissenen Augen an.
»Was sprechen Sie von Herzschlag? Wie kommen Sie darauf?«
»Sie riskieren jedesmal einen hübschen kleinen Herzschlag, Mr. Bolton, wenn Sie von Ihrer irrsinnigen Arbeit erschöpft hierherkommen und sich mit einer Mordsdosis Alkohol zu neuen Anstrengungen aufpeitschen. Hundertmal mag's gut gehen, beim hundertunderstenmal spielt der mißhandelte Herzmuskel nicht mehr mit und dann ... ich hatte bereits Gelegenheit, Ihrem Freund Garrison ein Begräbnis in der Antarktis zu schildern. Die Toten halten sich gut im Polareis. Die sechs drüben in Marie-Byrd-Land dürften heut noch ebenso frisch aussehen wie damals vor vier Jahren, als wir sie in das Eis betteten ...«
Bolton hatte sich aufgerichtet und starrte Captain Andrew wie ein Gespenst an. Der fuhr unbewegt fort. »Für Ihre Seele, Mr. Bolton, möchte ich auf Grund unserer bisherigen Bekanntschaft jede Garantie ablehnen. Wenn Sie aber Wert darauf legen, daß Ihre sterblichen Überreste für die nächsten zehntausend Jahre gut konserviert werden, dann empfehle ich Ihnen, jetzt Ihren Whisky auszutrinken und wieder auf das Eis hinauszulaufen.«
Boltons Kehle war trocken, heiser kamen die Worte aus seinem Munde: »Sie scherzen, Captain Andrew ... Sie wollen mich erschrecken ...«
»Wo es um Leben oder Sterben geht, scherze ich nicht, Mr. Bolton. Ihr Freund Garrison ist körperlich zusammengebrochen, es wird langer Zeit bedürfen, um ihn wieder auf dir Beine zu bringen. Sie sind der Robustere. Sie können das Spiel noch ein Weilchen weitertreiben, aber lange auch nicht mehr, das sage ich Ihnen aus voller Überzeugung. Jeden Augenblick kann Ihr Schicksal Sie ereilen, wenn Sie so unsinnig weiterleben.«
Die rote Gesichtsfarbe Boltons war einer fahlen Blässe gewichen. Alt und verfallen sah er plötzlich aus, wie er jetzt dasaß und erschrocken zu Andrew hinaufschaute.
Der spürte Mitleid mit ihm. »Ich habe Ihnen ebenso offen wie vorher Garrison meine Meinung über Ihren Zustand gesagt. Es steht ganz bei Ihnen, ob Sie hier zugrunde gehen oder wieder gesunden wollen.«
»Sie glauben, Captain, das wäre möglich?«
»Unbedingt, Bolton. Wenn Sie sich jetzt strikte meinen Anordnungen fügen, können Sie noch hundert Jahre alt werden. Sie haben, mit Respekt zu sagen, eine Ochsennatur. Die Aussicht auf eine völlige Wiederherstellung ist bei Ihnen größer als bei Garrison, aber folgsam müssen Sie sein. Kommen Sie jetzt mit hinüber, wir wollen zusammen essen. Danach müssen Sie sich dann ein paar Stunden aufs Ohr legen.«
Das Mahl begann schweigsam. Die Blicke Boltons gingen zwischen dem leeren
Platz Garrisons und dem vollen Whiskyglas hin und her. Andrew nahm das Glas,
goß seinen halben Inhalt in die Flasche zurück und schob es Bolton hin.
»Eine kleine Herzstärkung muß ich Ihnen schon erlauben, weil Sie nun einmal daran gewöhnt sind. Aber mit Maßen, alter Freund, sonst ... Sie wissen, was Ihnen passieren könnte.«
Bolton trank und fühlte sich danach wohler. Langsam kehrten seine Gedanken zu dem zurück, was ihn diese letzten Wochen so sehr beschäftigt hatte, und schließlich hielt er es nicht mehr aus, er mußte davon zu Andrew sprechen.
»Das Erz, Captain Andrew, das kostbare Erz ... ich möchte sagen, der Himmel hat's uns auf unfern Weg gestreut. Sollen wir es denn wirklich liegen lassen?«
»Ich will Ihnen mal etwas sagen«, unterbrach ihn Andrew. »Nach meinen Beobachtungen haben Sie bisher rund fünfzig Erzhaufen zusammengeschleppt. Das Gewicht jedes einzelnen davon taxiere ich auf etwa zwei bis drei Tonnen. Macht zusammen hundert bis hundertundfünfzig Tonnen. In Frisko erzählten Sie mir, daß allerlei Edelmetall in dem Zeug stecken soll. Da müßten doch hundert Tonnen schon einen recht annehmbaren Wert haben.«
»Aber es liegt ja noch viel mehr da, Captain. Hunderte, vielleicht Tausende von Tonnen. Soweit man sehen kann, ist das Land damit besät.«
»Stop, Bolton! Wir sprechen hier nur von dem, was Sie bereits zusammengelesen haben. Wie hoch schätzen Sie den Wert davon?«
Während Andrew es sagte, griff er nach Bleistift und Papier. Bolton schwieg und überlegte. Bisher hatten Garrison und er es vermieden, Andrew irgendwelche genaueren Angaben über den wirklichen Gehalt der früher von ihnen analysierten Proben zu machen. Sollte er das Geheimnis jetzt preisgeben, um dadurch den Captain vielleicht für ein weiteres Einsammeln zu interessieren? Zögernd begann er zu sprechen.
»Es könnte recht wohl sein, daß bis zu zehn Prozent Gold in dem Erz stecken ...«
Der Bleistift in Andrews Hand glitt über das Papier.
»Zehn Prozent von hundert Tonnen sind zehn Tonnen oder zehntausend Kilogramm, Mr. Bolton. Zehntausend Kilogramm Gold ... der Marktpreis für das Gold beträgt meines Wissens 2700 Mark ... das wären ja 27 Millionen, die Sie bisher zusammengelesen haben. Ja, Mann Gottes, genügt Ihnen denn das immer noch nicht?«
»Wenn man tausend Tonnen hätte ... wenigstens tausend Tonnen, Captain Andrew.«
»Würde man gar nicht wissen, wie man sie an den Mac-Murdo-Sund und ins Schiff bringen sollte. Schon die hundert oder meinetwegen hundertundfünfzig Tonnen werden uns allerlei Kopfschmerzen machen. Wenigstens fünfmal werden wir fahren müssen, um das Zeug an die Küste zu bringen. Es wäre heller Wahnsinn, wenn Sie auch nur noch einen Zentner mehr davon sammeln wollten.«
Notgedrungen fügte sich Bolton schließlich den Gründen Andrews. Er konnte
sich ihnen nicht verschließen, aber das Herz blutete ihm bei dem Gedanken,
daß so viel von dem kostbaren Erz in der Antarktis zurückbleiben sollte, und
es erfüllte ihn mit Bitterkeit, daß vielleicht irgendein anderer kommen und
diese Schätze heben könnte.
Die Möglichkeit dazu war nach den amerikanischen Nachrichten, welche die Funkstation der Expedition in den letzten Tagen aufgefangen hatte, zweifellos gegeben. In ihrem Taumel hatten sich bisher weder Garrison noch Bolton um diese Funksprüche gekümmert, jetzt benutzte Bolton die erzwungene Ruhe, um sie nachträglich zu lesen und ersah daraus mit Unbehagen, daß auch noch andere Leute ihr Glück in der Antarktis versuchen wollten. Nicht weniger als vier Expeditionen waren danach in Vorbereitung und sollten im nächsten Sommer nach dem sechsten Kontinent abgehen. Mit einem starken modernen Flugzeug wollte es Ellsworth versuchen. Bolton kannte den Mann von Frisko her und wußte, daß der auszuführen pflegte, was er sich vornahm.
Ganz auf die alte Manier mit Schlitten und Hunden beabsichtigte der in den Vereinigten Staaten lebende Norweger Lars Rinsen, einen Vorstoß in die Antarktis zu unternehmen. Er vertrat den etwas verstaubten Grundsatz, daß kleine Trupps von drei bis vier Mann mit fünfzig Polarhunden die Pole leichter erobern als ganze Armeen. Auch der alte Byrd rührte sich. Ein Funkspruch aus Boston meldete, daß er seinen bei früheren Polfahrten bewährten Kutter ›Bear‹ frisch auftakeln ließ. Endlich machte Hubert Wilkins wieder von sich reden. Er ließ an einem neuen U-Boot arbeiten, mit dem er unter dem antarktischen Eis vordringen wollte. Ein wahrer Wettlauf nach der Antarktis schien plötzlich einzusetzen.
Andrew saß bei seinen Instrumenten, mit allerlei Messungen beschäftigt, als
Bolton, die Depeschen in der Hand, zu ihm kam. »Begreifen Sie das, Captain?
Ich, offen gestanden, nicht. Gleich vier Expeditionen auf einmal? Sind denn
die Leute in den Staaten übergeschnappt?«
Schweigend schob ihm Andrew ein anderes Blatt hin. Es war ein neuer Funkspruch, erst vor wenigen Minuten aufgenommen. Bolton las ihn und fühlte seine Knie schwach werden. Schwerfällig ließ er sich auf den nächsten Stuhl nieder.
»Was heißt das, Andrew? Deutschland löst seine Banknoten wieder in Gold ein? Was soll das bedeuten?«
»Ich nehme an, Mr. Bolton, daß Deutschland in seiner neuen Kolonie in der Antarktis eine ergiebige Goldmine entdeckte, die ihm den Luxus erlaubt, wieder zur Goldwährung zurückzukehren. Damit haben Sie auch gleich die Antwort auf Ihre übrigen Fragen. Die Herren Ellsworth und Genossen wollen natürlich auch Gold in der Antarktis finden. Mit wissenschaftlichen Dingen haben ihre Expeditionen nach meiner Meinung wenig zu tun.«
Eine geraume Weile blieb Bolton schweratmend auf seinem Stuhle sitzen. Er brauchte Zeit, um diese Neuigkeiten zu verdauen. Andrew überließ ihn sich selber und widmete seine ganze Aufmerksamkeit einem neuen hochempfindlichen Bathometer, das die Schwerkraft bis auf Bruchteile eines Grammes genau registrierte.
»Es wäre nicht ausgeschlossen, daß hier Gold in größeren Mengen vorhanden ist«, sagte er mit einem Blick auf die von dem Meßinstrument gezeichnete Kurve, »aber es muß sehr tief liegen. Es dürfte kaum möglich sein, es zu erreich ...«
Die Stimme Boltons fuhr dazwischen. »Höchste Zeit, Captain Andrew, daß wir unser Gold in Sicherheit bringen. Es muß in den Staaten längst auf dem Markt sein, bevor die andern hierherkommen. Wir müssen sofort alles an den Mac-Murdo-Sund schaffen und nach Frisko funken, damit die ›City of Boston‹ rechtzeitig da ist.«
Im deutschen antarktischen Institut trug der lange Dr. Schmidt während der
nächsten Tage und Wochen mit gewohnter Methodik und Sorgfalt die
Peilmeldungen über die Andrewsche Expedition in eine Karte ein. Er war eben
wieder damit beschäftigt, als ein Stratosphärenschiff von der Kraterstation
her ankam und Reute zu ihm ins Zimmer trat.
»Sie funkten mir, Kollege Schmidt, daß die Andrewsche Expedition in diesem Jahre unsere Kreise nicht mehr stören wird«, fragte er beim Hereinkommen.
Schmidt wies auf die Karte, die mit verschiedenfarbigen Linien bedeckt war. »Ich bin davon überzeugt, Herr Ministerialdirektor. Sie sind seit Wochen eifrig dabei, das gesammelte Erz nach dem Mac-Murdo-Sund zu schaffen. Drei Reisen dorthin haben sie schon hinter sich. Die schwarze Linie hier bedeutet die erste, die rote die zweite und die blaue die dritte Reise. Ich kann's mir plastisch vorstellen, wie die Herren Bolton und Garrison dabei sind, die Erzstapel in ihren Tankwagen zu bringen. Sie werden ihn wohl jedesmal bis unters Dach vollpacken, und danach geht die Fahrt dann mit vollem Dampf an die Küste. Augenblicklich bewegt sich die Expedition wieder landeinwärts, um neue Ladung zu fassen. Ich nehme an, daß sie ihre Beute noch in Sicherheit bringen wollen, bevor das Eis im Mac-Murdo-Sund zugeht.«
Aufmerksam betrachtete Reute die Karte, meinte dann: »Es wäre ja sehr erfreulich, wenn Sie recht hätten, Herr Doktor. Soviel ich über die beiden Amerikaner gehört habe, werden sie sich von ihrem Erz kaum trennen, sondern es mit sich nach Frisko nehmen. Ein Glück wär's, wenn wir sie hier wirklich loswürden. Captain Andrew ist reiner Wissenschaftler, ein durch und durch anständiger Kerl und wird uns nicht stören.«—
Ganz so wie Schmidt die Dinge im Geiste sah, spielten sie sich nun in
Wirklichkeit nicht ab. Der lange Schmidt wußte ja nichts von dem
Zusammenbruch Garrisons und der Erkrankung Boltons. Noch immer hatte Garrison
sorgsame Pflege nötig, und auch Bolton durfte sich nicht persönlich an dem
Einladen der Erzstapel beteiligen. Das besorgten jetzt Parlett und Bowson
gegen eine reichliche Extrabezahlung. Aber Bolton ließ es sich nicht nehmen,
dabeizustehen, und dreimal hatte es zwischen Andrew und ihm schon mächtigen
Krach gegeben, weil er jedesmal mehr Erz mitnehmen wollte, als sich mit der
Tragfähigkeit des Wagens vereinbaren ließ.
Jetzt waren sie zum vierten Male dabei, Ladung zu nehmen, und sie hatten Eile damit. Schon war die Sonne unter den Horizont gesunken, und die Dämmerung der aufkommenden Polarnacht begann einzusetzen. Nach den letzten Funksprüchen befand sich die ›City of Boston‹ auf dem Wege zur Antarktis bereits in der Nähe des Polarkreises und meldete von dort neues Treibeis. Es kam alles darauf an, mit dem Rest der wertvollen Beute rechtzeitig die Küste zu erreichen und sich einzuschiffen, bevor die Eisverhältnisse noch schlechter würden.
Um Tage, vielleicht sogar nur um Stunden ging es, wenn man in diesem Jahr noch glücklich von der Antarktis fortkommen wollte. Noch eine fünfte Fahrt etwa war bei der Knappheit der Zeit vollkommen ausgeschlossen. Das wußte auch Bolton sehr gut, und in seiner Goldgier ließ er sich zu einem Schritt hinreißen, der schwerwiegende Folgen nach sich ziehen sollte.
Um zwei Uhr morgens nach mitteleuropäischer Zeit fing der neue Funker, der
jetzt an Lorenzens Stelle in der deutschen Station seines Amtes waltete,
einen Hilferuf der Andrewschen Expedition auf.
»Also doch!« war alles, was Dr. Schmidt über die verkniffenen Lippen brachte, als man ihm das Telegramm vorlegte.
Es war in englischer Sprache gehalten, und die wenigen Worte ›an ugly breakdown‹ darin erhellten ihm blitzartig die Situation. Natürlich hatten die Amerikaner in ihrer Sucht, möglichst viel von dem Erz mitzunehmen, den Wagen überladen und ebenso natürlich war der unter der übermäßigen Belastung zusammengebrochen.
Während Dr. Schmidt diesen ersten Notruf noch studierte, kam der Funker bereits mit einem zweiten Telegramm, demzufolge die Lage noch ernster schien. Das Fahrzeug Andrews war demnach im Begriff, einen ziemlich steilen Abhang hinaufzufahren, als in dem letzten Teil des Getriebes, der die Motorkraft auf die in der Raupenkette laufenden Räder übertrug, ein Bruch eintrat. Schon in der Ebene wäre das ein übler Zwischenfall gewesen, hier wurde es noch schlimmer. Infolge der übertriebenen Belastung begann der Wagen, jetzt nicht mehr vom Motor gehalten, rückwärts zu Tale zu rollen. Alle Versuche des Wagenführers, zu bremsen, waren vergeblich. Schnell und immer schneller ging die Fahrt rückwärts, während das angebrochene Getriebe restlos zermalmt und zerstört wurde. Bei der Schnelligkeit, mit der sich alles abspielte, verlor der Fahrer in der Dunkelheit die letzte Gewalt über den mächtigen Tankwagen. Steuerlos raste das Fahrzeug einen Steilhang hinab und prallte schließlich in eine Eiskluft, in der es mit jähem Schlag und Ruck fast senkrecht steckenblieb.
Im stillen bewunderte Dr. Schmidt die eiserne Ruhe Captain Andrews, der in solcher Lage noch eine genaue Ortsbestimmung gemacht hatte und in dem zweiten Funkspruch die Stelle des Unfalls auf Bogenminuten genau angab. Der Doktor zeichnete den Punkt auf derselben Karte ein, auf der er bereits die früheren Fahrten der Andrewschen Expedition markiert hatte und maß die Entfernung bis zur deutschen Station ab. Es waren etwas mehr als siebenhundert Kilometer. Auch bei forcierter Fahrt würden die deutschen Wagen viele Stunden gebrauchen, um dorthin zu gelangen.
Er überlegte noch, als der Funker wiederkam und um weitere Instruktionen bat.
»Fragen Sie erst bei Captain Andrew an, ob der Motor noch läuft und die Amerikaner noch Licht und Wärme in ihrem Wagen haben. Wenn ja, kommen Sie mit der Antwort zu mir, wenn nein, nehmen Sie sofort Verbindung mit der Kraterstation und fragen Sie, ob ein Stratosphärenschiff abkömmlich ist.«
»Sehr wohl, Herr Ministerialrat«, sagte der Funker und verschwand wieder.
Seitdem der lange Doktor während Willes Urlaub das deutsche antarktische Institut zu leiten hatte, war er noch um ein beträchtliches Stück ministerialrätlicher geworden; in allen seinen Entscheidungen und Anweisungen kam das zum Ausdruck. Auch jetzt war seine Anordnung bei aller Knappheit zweifellos sachlich richtig.
Nur eins hatte er dabei übersehen und konnte es auch beim besten Willen nicht wissen. Den Umstand nämlich, daß ›St 11h‹ mit Hein Eggerth und Berkoff als Piloten an Bord nach Ablieferung einer Ladung Treibstoff vor kurzem die Kraterstation verlassen hatte.
»Wollen doch mal hören, was der biedere Schmidt in seinem Bau treibt, vielleicht erwischen wir ein Lebenszeichen von ihm«, meinte Berkoff und stellte den Empfänger des Stratosphärenschiffes auf die Welle der deutschen Station ein. Von Dr. Schmidt vernahm er zunächst nichts, aber er kam gerade noch zurecht, um den zweiten Notruf der amerikanischen Expedition aufzufangen, der auf dieser Wellenlänge von Andrews Funker gegeben wurde. Eilig notierte er die Ortsbestimmung.
»Was gibt's?« fragte Eggerth, der ihn schreiben sah.
»Schöne Geschichte, Hein. Captain Andrew hat einen ›Breakdown‹, der nicht von schlechten Eltern zu sein scheint. Sein Wagen steckt kopfheister in einer Eiskluft. Er bittet Schmidt um schnelle Hilfe.«
Noch während er sprach, hatte Hein Eggerth ihm das Blatt aus der Hand genommen und verglich die Ortsbestimmung mit der Karte neben der automatischen Steuervorrichtung des Stratosphärenschiffes, die den jeweiligen Standort des Schiffes selbsttätig anzeigte. Berkoff hörte und schrieb inzwischen weiter, schüttelte den Kopf und brummte vor sich hin.
»Schlechte Aussicht für Captain Andrew. Im Augenblick kein anderes Schiff am Krater. Schmidts Wagen können vor morgen früh nicht an der Unfallstelle sein.«
»Aber wir, Georg! Wenn wir unsern Motoren etwas Kattun geben, können wir in einer Stunde da sein.«
Noch während er es sagte, griff Hein Eggerth in die Steuerung, das Schiff beschrieb einen Viertelkreis und jagte auf neuem Kurs der Stelle zu, an der Andrews Tankwagen vom Verhängnis ereilt worden war.
»Sage mal, Georg, beißen sie dich, oder aus welchem andern Grunde kratzt du dir so nachdrücklich deine Tolle?« fragte Eggerth nach einiger Zeit.
»Hm, Hein ... hm wie stellst du dir eigentlich unser Wiedersehen mit den Herren Garrison und Bolton vor? Ich fürchte, es wird dabei nicht ohne einige Auseinandersetzungen abgehen.«
»Ei verdammt ja! Du könntest am Ende mit deiner Vermutung recht haben. Aber das hilft nun nichts, wir müssen Captain Andrew mit seiner Karre aus dem Dreck ziehen.«
»Müssen wir, Hein. Ist unsere Pflicht. Captain Andrew wird uns auch dankbar dafür sein. Aber ich fürchte sehr, daß Bolton und Garrison bei der Gelegenheit die alte Geschichte von der Robinson-Insel aufs Tapet bringen werden. Wie wollen wir uns da verhalten?«
Die beiden Piloten überlegten hin und her, aber sie fanden keine rechte Antwort auf die schwierige Frage.
»Ah, bah«, meinte Berkoff schließlich und zündete sich eine Zigarette an. »Wir wollen die Dinge einfach an uns herankommen lassen. Im entscheidenden Moment wird uns schon eine passende Antwort einfallen. Vielleicht ist es am besten, wenn wir uns absolut dumm stellen ... so tun, weißt du, Hein, als ob die Amerikaner die Geschichte von der Insel überhaupt nur geträumt haben. Wer weiß, in welchem Ausland wir sie vorfinden, vielleicht glauben sie's sogar am Ende selber.«
Schon während der letzten Worte hatte Berkoff wieder zum Bleistift gegriffen und notierte die Funksprüche mit, die zwischen Captain Andrew und der deutschen Station hin und her flogen. »Aha! Das ist es Hein. Sie erwarten ihren Dampfer, die ›City of Boston‹, im Mac-Murdo-Sund, möchten ihn mit dem havarierten Wagen noch erreichen, bevor das Eis in der Bucht zugeht ... leicht gesagt, aber schwer getan, mein lieber Captain Andrew. Den Wunsch wirst du dir wohl verkneifen müssen.«
Geraume Zeit schwiegen beide. Sie waren der Unfallstelle jetzt so nahe, daß genaue astronomische Ortsbestimmungen notwendig wurden, die Berkoff für die nächsten Minuten vollauf in Anspruch nahmen. Als er sie hatte, schob er sie Hein Eggerth hin, der danach den Kurs des Stratosphärenschiffes ein wenig änderte und halblaut bemerkte:
»Vielleicht können wir dem Captain seinen Wunsch doch erfüllen. ›St 11 h‹ fliegt fast leer. Wir haben diesmal nur wenig mehr als zwei Tonnen Gold an Bord genommen«—
Es sah böse in dem amerikanischen Wagen aus, als er nach dem Unfall endlich
zum Stillstand kam. Zwar steckte er nicht ›kopfheister‹, wie
Berkoff sich ausdrückte, in der Eiskluft, sondern mit dem Vorderteil höher
als mit den Hinterrädern, aber um einen Winkel von mehr als 45 Grad geneigt.
Selbst in unversehrtem Zustand hätte er sich mit eigener Kraft nicht
herausarbeiten können.
Motoren und Dynamomaschinen waren außer Betrieb. Glücklicherweise hatte die Akkumulatorenbatterie nicht gelitten, aber ihre Leistung war begrenzt. Es ließ sich auf die Minute voraussehen, wie lange sie noch Strom für die schwache Notbeleuchtung und die Funkanlage zu liefern vermochte. Längst bevor die deutschen Wagen hier sein konnten, mußte sie erschöpft sein. Ohne Licht und ohne Verständigungsmöglichkeiten mit der Außenwelt würden die Insassen des verunglückten Wagens dann allen Unbilden der Polarnacht preisgegeben sein.
Die waren verhältnismäßig glimpflich davongekommen. Da sie sich schon während des Unfalles, während der Wagen führerlos schnell und immer schneller den Abhang hinunterraste, zu Boden warfen und irgendwie und irgendwo festzuklammern versuchten. So waren Captain Andrew und der Funker mit ein paar unbedeutenden Schrammen davongekommen. Der Wagenführer auf seinem Sitz und Garrison auf seinem Krankenlager waren von Anfang an so gesichert, daß ihnen kaum etwas passieren konnte. Nur Bolton war von dem letzten Sturz überrascht mit dem Kopf gegen einen Türpfosten geschleudert worden. Der Pfosten erwies sich bei diesem Zusammenprall als der stärkere, und Bolton trug eine faustgroße Beule auf der Stirn davon, die er fluchend drückte und kühlte, während er die Vorwürfe Garrisons über sich ergehen lassen mußte.
Sofort nach dem Unglück war Andrew an die Funkanlage geeilt. Er atmete auf, als er sie unversehrt fand und die Verbindung mit der deutschen Station aufnehmen konnte. Das Ergebnis war freilich wenig befriedigend. Vor vierundzwanzig Stunden konnte die deutsche Hilfe nicht zur Stelle sein. Er übergab die Anlage danach wieder Bowson und ging in den Raum, in dem Garrison lag.
»Es hat keinen Zweck mehr, über geschehene Dinge zu sprechen, Mr. Garrison«, unterbrach er dessen Rede. »Es ist besser, wenn wir uns über unsere weiteren Maßnahmen klarzuwerden versuchen. Die Aussicht, die ›City of Boston‹ noch rechtzeitig zu erreichen, ist natürlich zum Teufel. Sie dürfte schon jetzt im Mac-Murdo-Sund kreuzen und vergeblich auf uns warten.«
Bolton wollte mit allerlei Vorschlägen dazwischenfahren, aber Andrew hieß ihn schweigen.
»Ich kenne die deutschen Fahrzeuge nicht genauer, Gentlemen, aber es ist mir mehr als zweifelhaft, ob sie stark genug sind, um unsern Wagen aus der Kluft herauszuziehen. Wir werden vielleicht gezwungen sein, ihn hier bis zum nächsten Frühjahr liegen zu lassen und die Gastfreundschaft der deutschen Station in Anspruch zu nehmen. So, Mr. Bolton, das wollen wir mal erst als das Wahrscheinlichste voraussetzen. Jetzt können Sie Ihre Vorschläge, was weiter geschehen soll, machen. Die vergebliche Fahrt der ›City of Boston‹ geht selbstverständlich auf Ihre Rechnung ...«
Bevor Bolton noch etwas erwidern konnte, fuhr Captain Andrew fort:
»Und ebenso selbstverständlich die Wiederinstandsetzung des Wagens, denn Sie haben ihn durch Ihre irrsinnige Überlastung mit dem verdammten Erz mutwillig zerstört.«
Andrew schwieg und ließ Bolton ungehindert reden, obwohl nicht viel Vernünftiges in dem war, was der vorbrachte.
In den Disput hinein platzte Bowson mit einem neuen Funkspruch. Andrew las ihn und sprang auf.
»Eine neue Wendung der Dinge, Gentlemen! Ein Stratosphärenschiff der Eggerth-Werke kommt uns zu Hilfe. Nach dem Funkspruch ist es bereits in nächster Nähe.«
Ein Stratosphärenschiff der Eggerth-Werke … Garrison und Bolton tauschten hinter dem Rücken Andrews einen vielsagenden Blick. Ein unheimliches Gefühl überkam beide im gleichen Moment. Konnten … durften sie sich diesem Schiff anvertrauen, um vielleicht wieder an einer weltverlorenen Stelle des Erdballs abgesetzt zu werden. Während ihre Gedanken noch durcheinanderwirbelten, drang plötzlich grelles Licht von außen in den Wagen und überstrahlte die schwache Notbeleuchtung. An seiner Hubschraube hing ›St 11h‹ über der Kluft und leuchtete die Unfallstelle mit seinen starken Scheinwerfern ab. Jetzt hatten die Lichtkegel den Wagen gefaßt und hielten ihn fest. Ein wenig weiter schob sich das Schiff, bis es genau über ihm stand und sank dabei langsam tiefer. Regungslos hing es dann in der Luft, kaum um eines Mannes Länge war sein Kiel noch von dem höchsten Punkt des Wagens entfernt.
Um das nun folgende Manöver zu verstehen, muß man die maschinellen Einrichtungen von ›St 11h‹ genauer kennen. ›St 11h‹ war ein Montageschiff, speziell dazu bestimmt, die schweren Dieselmaschinen von Deutschland nach dem Kraftwerk der Kraterstation zu bringen. Diesem Zweck entsprechend hatte man es mit mächtigen Greifervorrichtungen ausgerüstet, die es ihm ermöglichten, Lasten bis zu 100 Tonnen aufzunehmen und in seinen Rumpf hineinzuziehen, und diese Vorrichtungen kamen ihm jetzt zu passe.
Die drei Amerikaner in ihrem Wagen konnten nicht sehen, was dicht über ihnen geschah, wie sich dort an der Unterseite des Rumpfes die Metallhaut des Stratosphärenschiffes kulissenartig auseinanderschob, aber ein Zuschauer, der etwa seitlich von der Schlucht gestanden hätte, würde jetzt einen eigenartigen Anblick gehabt haben.
Es sah etwa aus, wie wenn ein fliegender Käfer, der seine sechs Beine bisher eng an den Leib gezogen hatte, sie plötzlich ausstreckt, um im Fluge eine Beute damit zu haschen.
Wie fasziniert starrten Andrew und Bolton durch die Wagenfenster. Blinkend im Licht der Scheinwerfer kam zu beiden Seiten etwas Massiges, Gelenkiges, Bewegliches hinab. Es klang, wie wenn Metall sich an Metall reibt, und ein leichtes Knistern ging durch die Wagenflanken. Dann brüllten die Motoren des Stratosphärenschiffes so gewaltig auf, daß sie jedes andere Geräusch übertönten.
Nur noch ein Schüttern spürten die Amerikaner und merkten, wie ihr Wagen aus seiner schrägen wieder in die waagerechte Lage zurückkehrte, hatten dann die Empfindung, als ob er sich hob und emporschwebte.
Wenige Sekunden noch fiel das Licht der Scheinwerfer von außen her in den Raum, dann verschwand es. Wie tiefe Dunkelheit kam Andrew und seinen Gefährten nach der blendenden Helligkeit das schwache Licht der Notbeleuchtung vor.
Noch einmal eine leichte Erschütterung des Wagens, während gleichzeitig ein mildes gleichmäßigeres Licht von außen her durch die Fenster drang. Es beleuchtete nicht mehr die grünglasigen Wände der Eiskluft; silbrig schimmerndes Fachwerk, Spanten, Nieten und Platten wurden in seinem Schein sichtbar. Die Greifervorrichtungen hatten den Tankwagen in den Rumpf des Schiffes hineingezogen und auf den wieder geschlossenen Boden abgesetzt.
»Gesehen habe ich es. Begreifen und glauben kann ich es trotzdem nicht«, rief Andrew und eilte zur Tür. Sie hatte sich durch den Anprall beim Sturz in die Schlucht verzogen und klemmte. Erst mit Bowsons Hilfe und unter Anwendung von Werkzeugen gelang es, sie zu öffnen. Andrew stand im Türrahmen, ein Mann trat ihm entgegen.
»Captain Andrew, wenn ich nicht irre.«
Andrew vermochte nicht zu sprechen, nur stumm zu nicken.
»Mein Name ist Eggerth, Hein Eggerth von den Eggerth-Werken in Bitterfeld. Wir haben Ihren Wagen an Bord genommen. Wohin sollen wir Sie bringen?«
Während Andrew noch nach einer Antwort suchte, bemerkte er, daß Hein Eggerth plötzlich lebhaft zu der Wagentür hin winkte. Er wandte den Kopf zurück, hinter ihm stand Bolton und sah in diesem Augenblick weder schön noch geistreich aus. Die Beule auf seiner Stirn schimmerte in allen Regenbogenfarben, sein Mund war halb geöffnet, seine Augen starrten auf den Deutschen, als ob er ein Gespenst erblickte.
Hein Eggerth trat einen Schritt näher und winkte ihm vergnügt zu.
»Hallo, Mr. Bolton! Auch mal wieder im Land? Freue mich, Sie gesund und munter anzutreffen. Was macht Mr. Garrison?«
Bolton schnappte nach Luft wie ein Fisch auf dem Trockenen. An seiner Stelle antwortete Andrew. »Mr. Garrison geht's nicht gut. Er ist krank. Aber ...« Andrew raffte sich zusammen und sprang aus dem Wagen. »Meinen aufrichtigsten Dank für Ihre tatkräftige Hilfe, Mr. Eggerth. Bei Gott, Sie kamen zur rechten Zeit. Darf ich Sie noch weiter in Anspruch nehmen?«
»Wir stehen ganz zu Ihrer Verfügung, Captain Andrew. Sie brauchen nur zu bestimmen, wohin Sie gebracht werden wollen.«
»Unser Schiff, die ›City of Boston‹ kreuzt im Mac-Murdo-Sund. Wenn es möglich wäre, Mr. Eggerth ...«
»Es ist möglich, Captain Andrew, entschuldigen Sie mich einen Augenblick, ich will den Befehl in den Pilotenraum geben.«
Über eine schmale Aluminiumtreppe verschwand Hein Eggerth nach oben. Andrew wandte sich an Bolton.
»Sie machen ein merkwürdiges Gesicht, Bolton. Haben Sie etwas gegen diesen Mr. Eggerth?«
Einen Augenblick schluckte und würgte Bolton, als ob er etwas hinunterbringen müßte.
»Ich ... etwas gegen den Deutschen? ... nein, Captain. Wie kommen Sie auf die Vermutung?«
»Um so besser, wenn ich mich geirrt habe, wir sind Mr. Eggerth zu großem Dank verpflichtet. Ich müßte es bedauern, wenn irgendein Mißklang dazwischen käme.«
Die letzten Worte sagte Andrew in einem Ton, der jeden Widerspruch ausschloß, selbst wenn Bolton hätte widersprechen wollen.
Aber Bolton hatte gar nicht mehr die Absicht. Ebenso wie kurze Zeit vorher Berkoff war er zu dem Entschluß gekommen, die Episode auf der Robinson-Insel als nicht geschehen zu behandeln, denn eine andere Sorge lag ihm augenblicklich viel näher.
Wenn dies verteufelte Stratosphärenschiff sie mit ihrem Wagen kurzerhand draußen im Sund auf dem Deck des ›City of Boston‹ absetzte, so war ihm das Erz, das er auf den drei vorangehenden Fahrten an die Küste geschafft hatte, vorläufig verloren ... für immer verloren, wenn irgendein anderer ihm zuvorkam und es als herrenloses Gut an sich nahm.
Er hörte die Worte, die Andrew noch weiter sprach, ohne ihren Sinn zu erfassen. Fieberhaft überlegte er, auf welche Weise er die Deutschen dazu bringen könnte, auch diese Stapel auf den Dampfer zu schaffen. Sehr aussichtsreich erschien ihm sein Verhalten nicht, wenn er sich daran erinnerte, wie damals auf der Insel ihr ganzer Erzvorrat spurlos verschwunden, gegen eisernes Werkzeug ausgewechselt worden war. Während er noch hin und her überlegte, kam Hein Eggerth zurück, um Captain Andrew und ihn zu einem Imbiß in den Salon des Stratosphärenschiffes zu bitten. —
Sie speisten nur zu dritt. Berkoff hatte es doch vorgezogen, die alte
Bekanntschaft mit Mr. Bolton nicht zu erneuern, sondern lieber unsichtbar zu
bleiben. Dafür nahm das Gespräch mit Hein Eggerth eine Wendung, die Bolton
aufs höchste erfreute. Ganz von selbst kam Eggerth auf die noch am Ufer
liegenden Vorräte der Expedition zu sprechen.
»Sie müssen sich mit der Tatsache abfinden«, sagte er, »daß das Eis im Sund bereits geschlossen ist. Nach den soeben mit der ›City of Boston‹ gewechselten Funksprüchen kreuzt der Dampfer auf dem 74. Breitengrad an der Eisgrenze. Ein direkter Verkehr zwischen der Küste und Ihrem Schiff ist ausgeschlossen, es liegen etwa 300 Kilometer ungangbaren Packeises dazwischen.«
»Verdammt!« Bolton konnte den Ausruf nicht unterdrücken. Hein Eggerth überhörte ihn und fuhr fort.
»Ich nehme an, daß Sie dort noch mancherlei lagern haben, was Sie gern mit nach Amerika nehmen wollen. Wenn wir Sie abgesetzt haben, sind wir gern erbötig, zur Küste zurückzukehren und Ihnen alles, was Sie uns näher bezeichnen, auf die ›City of Boston‹ nachzubringen.«
Captain Andrew schüttelte den Kopf.
»Danke, Mr. Eggerth. Wir wollen Ihre Güte nicht mißbrauchen. Unsere Treibstoff- und Lebensmitteldepots können bis zum nächsten Sommer dortbleiben, ich müßte sonst doch alles wieder dorthin bringen, wenn ich in sechs Monaten zurückkomme.«
Bolton saß wie auf glühenden Kohlen. Vergeblich versuchte er Andrew unter dem Tisch auf den Fuß zu treten, um ihn zum Schweigen zu bringen. Der Captain zog seine gefährdeten Extremitäten einfach zurück und sprach in dem Sinne wie bisher ruhig weiter.
Bolton vermochte nicht länger an sich zu halten, er wollte losplatzen, als Hein Eggerth von sich aus auf das Thema zu sprechen kam, das seinem Gegenüber so am Herzen lag.
»Sie haben recht, Captain Andrew, Ihre Vorräte lassen Sie am besten an der Küste. Aber meines Wissens haben die beiden anderen Herren im Verfolg ihrer geologischen Untersuchungen verschiedenes Material gesammelt, das sie vielleicht doch lieber gleich mitnehmen möchten.«
»So ist es, Mr. Eggerth!« rief Bolton. »Garrison und ich haben allerlei Erz- und Steinproben gesammelt und neben Captain Andrews Depot aufgestapelt. Wir wären Ihnen außerordentlich verpflichtet, wenn Sie es an Bord der ›City of Boston‹ bringen würden.«
»Ich glaube, Bolton, Sie sind doch übergeschnappt«, fuhr Andrew dazwischen, »das dürfen Sie nicht verlangen, es hieße die Freundlichkeit Mr. Eggerths über alle Gebühr beanspruchen. Allerlei Gesteinsproben ... wissen Sie, was das in Wirklichkeit bedeutet«, fuhr er zu Eggerth gewandt fort. »Annähernd hundert Tonnen eines schweren, wie es scheint, in der Antarktis häufiger vorkommenden Erzes. Diese gewaltige Last sollen Sie ihm nach der ›City of Boston‹ bringen. Das ist natürlich ganz ausgeschlossen.«
Die Gesichtsfarbe Boltons wurde um einige Töne dunkler. Am liebsten hätte er den Captain in diesem Augenblick niedergeschlagen. Über die Züge Hein Eggerths huschte ein leichtes Lächeln, während er weitersprach.
»Aber ich bitte Sie, meine Herren, das ist für ›St 11h‹ eine Kleinigkeit. Hundert Tonnen können wir bequem mitnehmen. Es soll uns ein Vergnügen sein, die Bitte von Mr. Bolton zu erfüllen. Sowie wir Ihren Wagen abgesetzt haben, kehren wir zur Küste zurück und bringen dem Dampfer das Gewünschte nach.«
Während der letzten Minuten war ›St 11h‹, ohne daß die drei im Salon etwas davon merkten, aus der Stratosphäre wieder nach unten gegangen und strich in einer Höhe von wenigen hundert Metern über das Wasser des Roßmeeres dahin. Ein dumpfes Brausen und Heulen kam auf, die Sirene der ›City of Boston‹ meldete sich. Die Scheinwerfer von ›St 11 h‹ blitzten auf, ihre Lichtbalken huschten suchend über die See.
Sie trafen auf dunkles, fast unbewegtes Wasser, dessen Fläche hier und dort von großen Treibeisschollen unterbrochen war, dann blieben sie an etwas Grauem, Massigem hängen, sie hatten den Dampfer gefunden. Die ›City of Boston‹ fuhr mit gebänkten Feuern und geringster Maschinenkraft, sie machte eben noch gerade so viel Fahrt, um steuerfähig zu bleiben. Wenige Sekunden später hing ›St 11 h‹ über dem Schiff, während seine Funkstation unablässig arbeitete. Verwundert las Kapitän Lewis die Funksprüche, die man ihm auf die Kommandobrücke brachte. Das deutsche Flugschiff hatte nicht nur Andrew und seine Leute, sondern auch den gewaltigen Tankwagen an Bord? ... Die ›City of Boston‹ sollte die große Ladeluke für den Wagen klarmachen und die Reling runternehmen? ... Er ließ erst noch einmal rückfragen, bevor er Befehl gab, die deutsche Anordnung auszuführen.
Kaum war es geschehen, als ›St 11 h‹ wie ein fallendes Blatt langsam niedersank, während seine Scheinwerfer die Umgebung tageshell erleuchteten. Sein gewaltiger Rumpf lag quer zu der ›City of Boston‹. Kapitän Lewis hielt den Atem an. Jeden Augenblick erwartete er, daß das Deck seines Schiffes von der Last des Riesenflugzeuges eingedrückt werden müsse. Die wenigen Zentimeter, die das Stratosphärenschiff noch über dem Deck der ›City of Boston‹ hing, konnte er von seinem Standort nicht wahrnehmen; ebensowenig, wie die sechs Greiferarme, die den Tankwagen schnell und sicher durch die Luke in den Laderaum senkten und dort absetzten. Er sah nur, wie das Flugschiff plötzlich wieder emporstieg, starrte ihm noch erstaunt nach, als ihm ein neuer Funkspruch gebracht wurde:
›Tankwagen mit Andrew Expedition auf ›City of Boston‹ abgesetzt. Luke schließen. Andere Luke für hundert Tonnen Gestein öffnen. Kommen schnellstens zurück. St 11 h‹.
Kapitän Lewis lief von der Brücke hinunter auf das Vorderdeck und schaute durch die offene Luke in den Laderaum; er rieb sich die Augen, wie wenn er einen Traum verscheuchen wolle. Da unten stand tatsächlich der große Raupenwagen an seinem alten Platz, als ob er den Bauch der ›City of Boston‹ niemals verlassen hätte, und aus der geöffneten Tür kletterte Andrew so seelenruhig, als ob die ganze Geschichte die selbstverständlichste Sache auf der Welt wäre. Da begriff Kapitän Lewis, daß es angebracht sei, auch den weiteren Anordnungen dieses unbegreiflichen Stratosphärenschiffes nachzukommen, und er gab die entsprechenden Befehle.
In Boltons Kopf war nur der eine Gedanke. Werden die Deutschen wiederkommen? Werden sie mir mein sauer erworbenes Erz wirklich abliefern? Ungeduldig lief er neben Kapitän Lewis auf der Kommandobrücke hin und her, während die Zeit verstrich. Eine Stunde und noch eine andere. Dann blitzten die Scheinwerfer des Stratosphärenschiffes zum zweiten Male die ›City of Boston‹ an. Wieder schwebte es kurze Zeit dicht über dem Deck des Dampfers. Wie aus einer geöffneten Schleuse ergossen sich hundert Tonnen des blinkenden Metalles aus dem Flugschiff rasselnd und polternd in die offene Luke des Dampfers.
»Eigentlich«, sagte Berkoff lachend zu Hein Eggerth, der neben ihm im Kielraum von ›St 11 h‹ stand, »eigentlich hätten wir das Erz gleich beim erstenmal in die ›City of Boston‹ werfen können. Wir hätten unsern Freunden Garrison und Bolton viel Mühe erspart.«
»Uneigentlich war es aber so jedenfalls besser«, meinte Eggerth und mußte ebenfalls lachen.
Zu seinem Glück konnte Bolton dies Gelächter nicht hören. Es ging in dem Dröhnen des niederstürzenden Erzes unter. Er sah nur den schimmernden Segen aus dem Stratosphärenschiff in den Dampfer fallen und überschlug den Gewinn, den er ihm bringen sollte.
Warum hatten die Deutschen das erstemal auf jener verwünschten Insel das Erz behalten, warum hatten sie es ihm diesmal wiedergegeben? Im Augenblick kam ihm der Gedanke an diese Frage nicht. Auch noch nicht während der Wochen, in denen die ›City of Boston‹ die blaue See durchpflügte und die Andrewsche Expedition nach Frisko zurückbrachte.
Erst viel später, als er seine Beute in den chemischen Werken von Detroit verarbeiten ließ und aus der ganzen gewaltigen Masse nur eben eine Tonne Platin und ein wenig Silber gewann, begann er sich Gedanken darüber zu machen, aber da war es zu spät. Für die nächsten Monate wenigstens schützte die lange Polarnacht das Geheimnis der Antarktis.
Drei Männer beraten. Ein Nibelungenhort von acht Milliarden. Seegrund soll Ackergrund werden. Eine Spundwand durch die Nordsee. Meteoreisen für den Bau. Ein Plan wird beschlossen.
Die Obstbäume, an deren duftigem Flor Dr. Wille und seine Leute sich bei ihrer Rückkehr nach Deutschland erfreut hatten, waren verblüht, und die Früchte an ihren Zweigen begannen sich zu runden. Dem Frühling war der Sommer gefolgt, und überall ging in die Ferien, wer die Zeit und das Geld dazu hatte. Ausnahmen von der allgemeinen Ruhe- und Ferienstimmung waren nur in einigen Ämtern der deutschen Reichsregierung zu finden, in denen man sich mit gewissen immer dringender werdenden Fragen beschäftigte. Minister Schröter hatte den Ministerialdirektor Reute und Professor Eggerth zu sich gebeten, um im kleinen Kreise noch einmal die Fragen durchzusprechen, die auf der Tagesordnung der nächsten Kabinettssitzung standen.
Reute war dazu besonders von der Kraterstation nach Berlin gekommen und erst vor kurzem eingetroffen. Er brachte die neuesten Untersuchungen der dortigen Sachverständigen mit, über die er eben Vortrag hielt.
»Das Gesamtergebnis unserer Gutachter«, sagte er zum Schluß seiner Ausführungen, »läßt sich wie folgt zusammenfassen. Die Erzschicht auf dem Kratergrund ist ein- bis zweihundert Meter stark. Unter ihr liegt das Urgestein der Antarktis. Das Erz besteht zum weitaus größten Teil aus reinem Nickeleisen. Nur vereinzelt sind Adern eingesprengt, die Edelmetalle führen, stellenweise bis zu zehn Prozent Gold oder Platin. Im Laufe der letzten achtzehn Monate haben wir Gold im Werte von fünfzehn Milliarden Reichsmark daraus gewonnen. Unsere Sachverständigen glauben, daß noch etwa fünf Milliarden herausgezogen werden können. Danach dürfte der Goldvorrat des großen Meteoriten so ziemlich erschöpft sein. Wir werden ... vorläufig wenigstens ... mit dem Gesamtbetrag von zwanzig Milliarden zu rechnen haben.«
Reute faltete das Schriftstück, aus dem er die Zahlen verlesen hatte, wieder zusammen. Der Minister räusperte sich.
»Zwanzig Milliarden also, mit denen wir sicher rechnen dürfen.«
Reute nickte. »So ist es, Herr Minister. Es wäre ein glücklicher, aber nicht wahrscheinlicher Zufall, wenn man doch noch auf andere Goldadern stieße.«
»Wer weiß, ob es ein Glück wäre«, sprach der Minister nachdenklich vor sich hin, sagte dann zu Professor Eggerth und Reute gewandt:
»Ziehen wir das Fazit, meine Herren! Alles in allem können wir nach dem Gehörten mit zwanzig Milliarden rechnen. Zwei Milliarden stecken in deutschen Sparstrümpfen und werden sobald nicht wieder ans Tageslicht kommen. Fünf weitere hat das Ausland in gleicher Weise geschluckt. Dafür hat die Reichsbank den Gegenwert in Devisen vereinnahmt. Zur Ankurbelung unserer Industrie und Wirtschaft haben wir aber auswärtige Rohstoffe im Betrage von vier Milliarden Reichsmark über unsere sonstigen normalen Einkäufe hinaus erworben ...« Minister Schröter schrieb einige Zahlen auf den vor ihm liegenden Block, während er weitersprach: »Nach Adam Riese verbleiben uns noch eine Milliarde in Devisen und dreizehn Milliarden in Gold, mit denen wir zweckmäßig weiterzuwirtschaften haben.«
»Gestatten Sie mir eine Zwischenbemerkung«, warf Professor Eggerth ein, »zu wiederholten Malen hat man mir nicht nur in Industriekreisen, sondern auch in Regierungsstellen, von der Möglichkeit einer Goldinflation gesprochen. Ich möchte, bevor ich auf das komme, was ich Ihnen, Herr Minister, später unterbreiten werde, betonen, daß eine solche Gefahr nicht besteht.
Die sieben Goldmilliarden sind, wie bereits mehrfach gesagt, spurlos versickert. In keinem Goldausweis irgendeiner der großen Banken sind sie wieder zum Vorschein gekommen. Nach wie vor beträgt der nachweisliche Goldvorrat der Welt nur fünfzig Milliarden. Bei diesem Tatbestand können aber unsere dreizehn Milliarden niemals eine Inflation heraufbeschwören. Rund fünf davon würde ja die Reichsbank unter allen Umständen in ihren Gewölben behalten, was einer hundertprozentigen Golddeckung unseres Notenumlaufes entspricht. Es verbliebe uns noch eine Reserve von acht Milliarden. Acht Milliarden in barem Gold, Herr Minister; eine gewaltige Summe, mit der man viel kaufen kann, wenn sich ein Verkäufer findet. Darf ich frei aussprechen, wie ich darüber denke?«
Der Minister nickte. »Bitte, Herr Professor. Herr Ministerialdirektor Reute darf alles hören, um so mehr, als sich unsere Gedanken auf halbem Wege begegnen. Wir sind uns alle darüber einig, daß wir neuen Raum, jungfräuliches Land, für unser Volk brauchen.«
»Das ist es, Herr Minister!« sagte Professor Eggerth lebhaft. »Wir brauchen Neuland. Fruchtbares Land mit einem erträglichen Klima. Neue Scholle, auf der wir deutsche Bauern ansetzen können.«
»Wo gäbe es das heut noch?« Resignation klang aus der Zwischenfrage von Reute.
»Es gibt es schon, Herr Reute«, fuhr der Professor fort, »aber leider besitzen es heut die anderen und halten es fieberhaft fest, obwohl manche herzlich wenig damit anzufangen wissen.«
Der Minister machte eine ungeduldige Bewegung. »Das hilft uns nicht weiter, Herr Professor. Ich hoffte, von Ihnen einen positiven Vorschlag zu hören.«
Professor Eggerth quittierte den Vorwurf mit einer leichten Verbeugung. »Was heut nicht ist, Herr Minister, kann vielleicht in wenigen Jahren sein. Die Stunde kann kommen, in der bare Goldmilliarden für einen Staat wichtiger sind als brachliegendes Land. Die Geschichte bietet uns mehr als ein Beispiel dafür. Wer das Gold dann bereit hat und entschlossen zugreift, der wird Land kaufen können, das ihm zusagt. Viele Millionen Quadratkilometer wahrscheinlich, wenn er acht Milliarden auf den Tisch legen kann.«
»Daraufhin wollen Sie acht Milliarden horten, Herr Professor?« fragte Reute kopfschüttelnd.
»Ganz recht, Herr Reute. Acht Milliarden, von denen die Welt nichts wissen darf, um die wir allein nur wissen. Das ist das Wesentliche dabei, daß dieser Nibelungenhort ... wenn ich einmal so sagen darf ... verborgen bleibt, bis die Stunde für seine Verwendung schlägt.«
Reute vermochte mit seiner Meinung nicht länger hinter dem Berge zu halten. »Ich würde es volkswirtschaftlich für verkehrt halten, Herr Professor, eine derartige Summe zinslos liegen zu lassen. Ich meine, man sollte ...«
»Verzeihung, Herr Reute. Genau dasselbe haben die Finanzleute schon vor einigen Menschenaltern gesagt, als das deutsche Reich einen Kriegsschatz von einer viertel Milliarde Gold im Juliusturm aufspeicherte, und wie nützlich hat es sich später erwiesen.«
»Herr Professor Eggerth trifft mit seinem Vorschlag vielleicht doch das Richtige«, mischte sich der Minister ein, »aber damit kommen wir im Augenblick nicht weiter. Das deutsche Reich braucht schnell neues Land. Wir können nicht Jahre ... vielleicht Jahrzehnte darauf warten, daß sich eine Gelegenheit bietet, es zu kaufen. Das ist die Frage, um die sich's dreht.«
»Sehr wohl, Herr Minister, und weil wir's heut noch nicht kaufen können, müssen wir's uns selber schaffen.«
Wie elektrisiert fuhren der Minister und Reute zusammen, als die Worte von den Lippen des Professors fielen.
»Wie?!« Kaum hörbar stieß der Minister die kurze Frage heraus.
»Seegrund muß Ackergrund werden, Herr Minister«. Noch während Professor Eggerth es sagte, griff er nach seiner Aktentasche und breitete eine Landkarte auf dem Tisch aus, welche die deutsche Küste von der Emsmündung bis zum Kurischen Haff zeigte. Mit Rotstift waren Striche in die blau angelegten Meeresflächen eingezeichnet. Leicht geschwungen zog sich eine Linie von der Südspitze der Insel Sylt über Helgoland nach Juist hin. Ein kurzer Strich verband Juist mit Borkum. Ein anderer führte von Borkum zur Ostküste des Dollart. Von Flensburg ging eine Linie nach Fehmarn, strich dicht an Laaland vorbei, umging Rügen im weiten Bogen, um dann nach Osten und Nordosten zu verlaufen.
»Hier liegt unser Neuland«, sagte Professor Eggerth, während er mit einem Bleistift über diese Linien fuhr. »Reichlich fünftausend Quadratkilometer in der Nordsee, annähernd hunderttausend Quadratkilometer in der Ostsee. Nehmen wir alles in allem hunderttausend Quadratkilometer oder zehn Millionen Hektar an. Rechnen wir das Bauerngut zu hundert Morgen oder fünfundzwanzig Hektar, so können hier vierhunderttausend selbständige Bauern angesiedelt werden. Rechnen wir für die Familie einschließlich Mägden und Knechten zehn Köpfe für jedes Gut, so haben wir hier Raum für vier Millionen Menschen und gewinnen neue Nahrung für zehn bis zwölf Millionen. Es ist nicht so viel, wie es sein sollte. Unter uns gesagt, meine Herren, unser altes Deutsch-Ostafrika mit seiner Million Quadratkilometern wäre mir lieber, aber dafür würde dieses der See abgerungene Neuland den Vorteil haben, daß es unmittelbar an unser altes Reichsgebiet grenzt.«
Schon während der Professor sprach, hatte der Minister nach Block und Bleistift gegriffen, warf Ziffern auf das Papier und rechnete.
»Ihre Zahlen sind richtig, Herr Professor«, sagte er, als Eggerth schwieg, »aber ...«
»Es wird außenpolitische Verwicklungen geben, wenn wir die See bis Helgoland für uns nehmen«, vollendete Reute den Satz des Ministers.
»Darüber glaube ich Sie beruhigen zu können«, wies Professor Eggerth den Einwand zurück. »Nach internationalem Recht gehören Verlandungen demjenigen Staat, an dessen Küsten sie erfolgen. Unter diesem Gesichtspunkt habe ich den Plan für die Arbeiten aufgestellt. Wir wollen es der Sicherheit halber vermeiden, irgendwo aus der offenen See neue Inseln entstehen zu lassen. Das deutsche Sylt wird nach Südwesten wachsen, Juist nach Nordosten, Helgoland nach beiden Richtungen, und bald ... sehr bald, meine Herren, wird die deutsche Bucht ein Binnensee sein. Ganz ähnlich werden wir in der Ostsee verfahren und auf diese Weise alle politischen Verwicklungen vermeiden, überall werden unsere Deiche und Verlandungen aus der offenen See erst große Binnenmeere herausschneiden.«
»So könnte es in der Tat gehen«, sagte der Minister.
»Ein Binnensee ist aber noch kein Land, Herr Professor Eggerth. Woher wollen Sie den Boden nehmen, um diesen See auszufüllen?« fragte Reute.
»Aus der See, Herr Reute. Ich bin mir darüber klar, daß wir etwa eine Billion Kubikmeter Boden für die Auffüllung benötigen. Zum größten Teil wird sie uns die See selber liefern. Nur wo die Naturkraft nicht ausreicht, werden wir mit Strahlpumpen nachhelfen.«
Wieder griff der Professor nach seiner Mappe, holte neue Pläne, Zeichnungen, Berechnungen und Tabellen hervor, und was er jetzt vor seinen Zuhörern ausbreitete, das sah schon ganz anders aus als jener erste skizzenhafte Plan. Da waren bereits die mächtigen eisernen Spundwände eingezeichnet, die man in der Trace der geplanten Deiche in die See schlagen mußte. Da sah man Elbe und Weser sich bei Cuxhaven vereinigen und in gemeinsamem Bett das offene Meer bei Helgoland erreichen. Sah Straßen, Eisenbahnen und Ortschaften, wo jetzt noch die offene See wogte.
»Was ist das?« fragte Reute und wies auf schraffierte Stellen in den projektierten Spundwänden. Fast wie Reisig sah es auf der Zeichnung aus, das eigenartig gelegt war, breit offen zu gegen die See, enger zusammenlaufend nach der Landseite.
»Sandfänger, Herr Ministerialdirektor. Jede Woge, die von außer her gegen den Damm schlägt, bringt Millionen von Sandkörnern mit sich. Herein lassen sie die Fänger, hinaus können sie nicht wieder. Ich habe die Erfindung gründlich ausprobiert, bevor ich sie in mein Projekt einsetzte. Die Verlandung hinter den Deichen wird rapid fortschreiten, sobald die Wände einmal stehen und die Fänger eingebaut sind.«
Während Professor Eggerth dem Ministerialdirektor die Einzelheiten seines Planes weiter erläuterte, hatte der Minister für sich eine Rechnung aufgemacht.
»Es wird Eisen kosten, Herr Professor«, sagte er, als er mit seiner Rechnung zu Ende war, »so etwa fünf Millionen Tonnen Eisen wird Ihr Damm verschlingen. Viel Eisen, Herr Professor ... wo sollen wir das hernehmen?«
»Aus dem Bolidenkrater, Herr Minister.«
Der warf den Bleistift hin und lachte laut auf. »Wie konnte ich das vergessen. Natürlich haben Sie recht. Dort liegt ja gediegenes Eisen in unerschöpflichen Mengen. Die Frage um das Eisen braucht uns wahrhaftig keine Kopfschmerzen zu machen.«
Auch Professor Eggerth hatte zum Bleistift gegriffen und rechnete, während er sprach. »Hundert Tonnen kann ein Stratosphärenschiff mitnehmen. Gibt fünfzigtausend Schiffsladungen. Wenn das Reich für diesen besonderen Zweck seine schweren Stratosphärenbomber zur Verfügung stellt und wir unsere Werkflotte hinzunehmen, könnten wir tausend Schiffe einsetzen. Daraus ergäbe sich eine fünfzigmalige Fahrt der ganzen Flotte. Rechnen wir einen halben Tag für Laden und Entladen, einen Tag hin und einen Tag zurück, so ergeben sich hundertfünfundzwanzig Tage. In vier Monaten könnten wir alles Eisen, das wir für das Projekt brauchen, hier in unsern Walzwerken haben.«
»Wir werden es hier haben, Herr Professor,« der Ton, in dem der Minister die Worte sprach, ließ keinen Zweifel daran, daß er entschlossen war, das Projekt tatkräftig anzupacken.
»Kosten ...? Arbeitskräfte? ...« Wie Stichworte warf Reute es in die Unterredung; Professor Eggerth griff es auf, als ob er darauf gewartet hätte.
»Ich rechne zunächst nur mit zehntausend Mann auf etwa einem Dutzend Baustellen an deutschen Küsten. Technisch könnte man auch anders vorgehen und sofort an hundert Stellen in der offenen See von Pontons aus mit den Arbeiten beginnen. Aus den politischen Gründen, die Sie bereits erwähnten, Herr Reute, halte ich es aber für zweckmäßig, nur an unsern Küsten anzufangen, so daß sich das ganze wirklich wie eine natürliche Verlandung abspielt. Ich habe hier einen Arbeitsplan entworfen.« Professor Eggerth breitete einen neuen Plan vor seinen Zuhörern aus und zeigte auf die Daten, die an verschiedenen Stellen eingetragen waren.
»Ich habe die Zeiten so eingesetzt, daß die eisernen Spundbohlen in dem gleichen Tempo in den Seegrund geschlagen werden können, in dem sie von den Walzwerken angeliefert werden. Hier haben Sie ...«, der Professor legte ein anderes Blatt auf den Tisch, »... einen Arbeitsplan für unsere Hütten- und Walzwerke. Ich habe aus gutem Grunde von Neuanlagen abgesehen und lediglich eine forcierte Ausnutzung der vorhandenen Einrichtungen eingesetzt. Das war möglich, weil es sich bei dem reinen Kratereisen ja nicht mehr um die Verhüttung eines Erzes, sondern nur um ein einfaches Niederschmelzen handelt. Wenn wir nach diesem Plan hier arbeiten, können die Dämme in ihrer ganzen Länge heut übers Jahr stehen. Ein zweites Jahr wird die vollkommene Verlandung des eingedeichten Gebietes beanspruchen. In drei Jahren werden wir mit den ersten Ernten rechnen dürfen. Die Zahl der beschäftigten Hände wächst naturgemäß in dem gleichen Maße, in dem neues Land aus der See steigt.«
Während Professor Eggerth weitersprach, wies er auf die Zahlen einer Tabelle. »Für die Ramm- und Spülarbeiten wächst die Zahl der Beschäftigten mit der Länge der Dämme. Es werden schließlich 50 000 Mann am Werk sein, und das Aufbringen einer fruchtbaren Schlick- und Humusdecke wird das Heer der Werktätigen auf hunderttausend bringen. Gleichzeitig setzt in diesem Stadium schon die Anlage von Bahnen, Straßen und Ortschaften ein. Hier ließ ich mich von den Erfahrungen leiten, die Deutschland bereits in früheren Jahren mit der Ausnutzung urbar gemachter Gebiete sammeln konnte. Die Arbeiten schreiten in einem solchen Tempo fort, daß sie die allgemeine Wirtschaftslage auf lange Zeit beleben, aber keine überhitzte Hochkonjunktur schaffen.«
Der Minister nickte zustimmend.
»Wie berechnen Sie die Kosten, Herr Professor?« fragte Reute. Professor Eggerth zog eine Rentabilitätsberechnung aus seiner Mappe. Seiten voller Zahlen. Millionen von Tagewerken, Aufstellungen über Materialkosten. Er schlug die Blätter um, bis er zu den Schlußergebnissen kam.
»Hier haben Sie das Fazit, meine Herren. Das Neuland aus der See stellt sich billig. Zweihundert Mark werden wir für den Morgen fruchtbaren Marschlandes aufzuwenden haben, einen Betrag, um dessen Verzinsung und Amortisation wir uns wirklich keine Sorgen zu machen brauchen.«
»Das wäre in der Tat tragbar«, sagte Reute. »Ist es sicher, daß wir damit auskommen?« Der Professor schob ihm den Kostenanschlag zu und erhob sich.
»Meine Herren, ich lasse Ihnen die sämtlichen Unterlagen zur genauen Nachprüfung hier, überzeugen Sie sich selbst von der Richtigkeit meiner Aufstellungen und geben Sie mir Nachricht, wenn endgültige Entschlüsse gefaßt worden sind.«
Für einen Augenblick herrschte Schweigen. In die Stille fielen die Worte des Ministers.
»Wir werden einen Mann brauchen, der die Ausführung dieses Riesenprojektes in die Hand nimmt. Keinen besseren wüßte ich dafür als Sie, Herr Professor.«
Nachdenklich legte Professor Eggerth die Fingerspitzen seiner beiden Hände zusammen. »Ich habe es mir gedacht, Herr Minister, daß man mich eines Tages vor diese Aufgabe stellen könnte. Ich bin dazu bereit, denn ich glaube, daß ich sie besser als mancher andere zu lösen vermag. Doch vorerst muß der Plan beschlossen sein. Ich stehe dann zu Ihrer Verfügung. Vergessen Sie nicht, daß wir schnell arbeiten müssen.«
Ein Händedruck, eine kurze Verbeugung, Professor Eggerth ging aus dem Zimmer.
Die Tür fiel hinter ihm ins Schloß.
»Ein Kerl von Format«, sagte Reute bewundernd.
Während der nächsten Stunden vertieften sich der Minister und Ministerialdirektor Reute in die Unterlagen, die ihnen Professor Eggerth dagelassen hatte, und bevor der Abend hereinbrach, entstand in gemeinsamer Arbeit der beiden ein Dokument, keine dicke Schrift, sondern nur ein kurzes Exposé, das in knappster Form von wenigen Seiten alle Für und Wider des Projektes abwog. Es bildete die Unterlage für die folgende Kabinettssitzung, in der die Durchführung des Eggerth-Planes beschlossen wurde. Schon vierundzwanzig Stunden später stießen die ersten Stratosphärenschiffe der Reichsflotte in die Antarktis vor, um das Kratereisen zu holen, aus dem die neuen Seedeiche geformt werden sollten.
Bolton und Garrison machen Bilanz. Das letzte Gold geht nach Deutschland. Die Werke am Krater verschwinden. Ein gigantischer Sprengschuß. Noch einmal die Amerikaner. Dr. Schmidt spielt seine besten Trümpfe aus.
Captain Andrew war nicht zugegen. Reichlich dreitausend Kilometer trennten ihn von der Stadt Detroit, wo Bolton in einem Zimmer des Flint-Hotels saß und verdrossen in allerlei Schriftstücken blätterte. So konnte der Captain auch nicht Einspruch erheben, als Bolton nach der Flasche griff und sich einen Soda-Whisky mischte. Er goß ihn hinunter, schritt zum Fenster und starrte schweigend in die Woodward-Avenue hinaus.
In einem bequemen Sessel saß Garrison. Gute Pflege und die Kunst der Ärzte hatten ihn wieder hergestellt. Hätten an seiner Rechten nicht zwei Finger gefehlt, so hätte nichts mehr an jene Leidenszeit in der Antarktis erinnert.
Bolton brummte etwas Unverständliches vor sich hin.
»Sie sind enttäuscht, Bolton. Ich bin es auch. Aber trotzdem können wir im Grunde doch immer noch ...«
Mit einem Ruck drehte sich Bolton um und fiel ihm jäh ins Wort.
»Den Teufel was können wir, Garrison! Noch ein Dutzend solcher Geschäfte wie das und ich kann den Laden zumachen.«
Er kehrte zu dem Tisch zurück und griff wieder nach den Papieren. »Hier ist die Abrechnung der Melting and Refining Company: Hundert Tonnen Erz empfangen und verarbeitet. Kostenpunkt: tausend Dollars pro Tonne, macht hunderttausend Dollars. Ergebnis: neunhundert Kilogramm Platin, vier Tonnen Silber, Spuren von Gold. Alles in allem aus den hundert Tonnen noch längst kein Kilo Gold. Der Rest reines Eisen. Schönes Geschäft, Mr. Garrison, zu dem Sie mich da beschwatzt haben.«
Garrison zog seinen Sessel näher an den Tisch heran und begann mit Bleistift und Papier zu rechnen.
»Vier Tonnen Silber, sagten Sie, Bolton?«
Der knurrte etwas Unverständliches, Garrison fuhr fort.
»Das Kilogramm Silber notiert augenblicklich zwei Dollars. Sind immerhin schon achttausend Dollars. Neunhundert Kilogramm Platin, die letzte Notierung für das Kilogramm lag bei tausend Dollars. Macht neunhunderttausend, zusammen mit dem Silber 908 000 Dollars. Ziehen wir die Rechnung der Melting and Refining Company ab, bleiben 808 000 Dollars für uns.«
Bolton wühlte in den Schriftstücken und zerrte ein anderes Blatt hervor.
»Sie rechnen wie ein Schuster, Garrison! Hier sind unsere andern Unkosten zusammengestellt. Ich will Ihnen nur die wichtigsten Posten nennen. Ein Flugzeug verloren. Zwei Reisen der ›City of Boston‹ nach dem Mac-Murdo-Sund. Captain Andrews Expedition ausgerüstet. Zum Schluß noch der unverschämte Zoll, den sie uns in Frisko für das Erz abgenommen haben. Alles in allem eine halbe runde Million Dollars. Ich danke schön für das Geschäft ... was Sie so ›Geschäft‹ zu nennen belieben.«
Ungeduldig griff Garrison wieder zum Bleistift und rechnete weiter. Ziehen wir also die halbe Million Dollars auch noch ab, so bleiben immer noch 308 000 Dollars Reingewinn. Ich meine, auch damit könnten Sie zufrieden sein.«
Bolton griff sich an die Stirn und warf seinem Partner einen wütenden Blick zu.
»Sie sind ein kompletter Narr, Garrison! Anders kann ich mir Ihre Rede nicht erklären. Bilden Sie sich denn wirklich im Ernst ein, daß ich mir ein volles Jahr meines Lebens um die Ohren schlage, mich in Abenteuer und Strapazen stürze, um schließlich mir einem lumpigen Gewinn von 300 000 Dollars ...«
»... 308 000 Dollars,« wagte Garrison einzuwerfen.
»... von 300 000 Dollars, die ich noch nicht einmal habe, herauszugehen,« brüllte Bolton. »Ich habe sie ja noch nicht einmal. Die neunhundert Kilogramm Platin müssen erst noch an den Mann gebracht werden. Es sind zwanzig Prozent der jährlichen Weltproduktion. Wer weiß, wie der Markt darauf reagieren wird. Mit Gold wäre es etwas anderes. Das hält seinen Preis. Der Platinpreis schwankt von Jahr zu Jahr. Er braucht nur um dreihundert Dollar pro Kilo abzuschlagen, dann ist der ganze Gewinn beim Teufel.«
»Man muß das Metall vorsichtig auf den Markt bringen. In kleineren Mengen, so daß der Preis nicht gedrückt wird,« versuchte ihn Garrison zu beschwichtigen.
Bolton lachte auf. »Sehr hübsch gesagt! Sie haben ja keine Ahnung, wie es an der Metallbörse in Wirklichkeit zugeht. Die Interessenten in Chicago und New York wissen heute schon längst, daß für meine Rechnung bei der Melting and Refining Company neunhundert Kilogramm Platin lagern. Darauf können Sie Gift nehmen, Garrison! Sie wissen auch, daß ich damit auf den Markt kommen muß, und sie werden ihre Preise danach machen. Der Metallhandel ist nicht besser als der Pferdehandel.«—
Bolton sprach aus Erfahrung. Er hatte in früheren Jahren manchen fetten Fischzug an der Metallbörse gemacht, und kannte sich in allen dabei üblichen Tricks und Kniffen genau aus. Einen Teil seiner Millionen hatte er mit Kupfer und Zinn verdient, indem er blanko teuer verkaufte und vor dem Liefertermin die Preise durch allerlei dunkle Manöver ins Bodenlose drückte. Jetzt waren die Rollen vertauscht und während der nächsten Wochen bedurfte es aller Gerissenheit von Seiten Boltons, um seine Vorräte abzusetzen, ohne daß die Preise dabei allzu sehr sanken.
Als er das letzte Kilo glücklich los war und das Fazit zog, blieb ihm gerade noch ein Reingewinn von zweihundertfünfzigtausend Dollars. Mit saurem Gesicht schrieb er den Scheck aus, der Garrison zehn Prozent davon überwies. Die Feder spritzte, als er den Schlußstrich seines Namens zog.
»So Garrison! Da haben Sie Ihren Anteil. Einmal und nicht wieder. Von der Antarktis bin ich kuriert.«
Garrison löschte den Scheck ab und barg ihn sorgsam in seiner Brieftasche.
»Captain Andrew hofft,« begann er vorsichtig, »daß Sie ihm die Mittel für seine nächste Expedition zur Verfügung stellen werden ...«
»Da hofft Captain Andrew vergeblich,« unterbrach ihn Bolton unwirsch. »Er soll sich seinen verdammten Wagen flicken lassen, von wem er Lust hat. Die nächste Reise mag ihm meinetwegen des Teufels Großmutter bezahlen. Ich nicht, Garrison! Ein zweites Mal falle ich auf den Schwindel nicht rein.«
»Aber das Gold, Mr. Bolton. Sie haben es selbst gesehen. Ich habe Ihnen doch meine ersten Schmelzproben gezeigt.«
Bolton machte eine wegwerfende Bewegung.
»Was haben Sie mir denn gezeigt? Einen Fingerhut voll Gold! Ich könnte mir heute noch die Haare ausraufen, daß ich darauf reingefallen bin. Ein paar hundert Gramm Gold hat die Melting-Company aus den hundert Tonnen herausgeholt, das war die Mühe weiß Gott nicht wert.«
Vergeblich versuchte es Garrison noch ein letztes Mal mit dem Hinweis auf die großen Goldgewinne der deutschen Regierung, seinen Partner umzustimmen.
»Niemals, Garrison! niemals wieder! Das ist mein letztes Wort in dieser Sache. Wenn Sie einen Dummen brauchen, müssen Sie sich an jemand anderes wenden. Für mich ist die Sache ein für allemal erledigt.«
Garrison sah das Zwecklose seiner Bemühungen ein und wollte gehen, als Bolton noch einmal anfing. »Ein wahres Glück übrigens, daß mein Telegramm an den Präsidenten, das ich damals auf der ›Fréjus‹ aufgab, nicht angekommen ist. Das hätte eine schöne Blamage für mich werden können. Manchmal haben auch Ätherstörungen ihre Vorteile.«
Garrison hielt den gegenwärtigen Augenblick nicht für angebracht, Bolton darüber zu unterrichten, daß jene Depesche in Wirklichkeit niemals abgegangen war. Er verabschiedete sich, um vorläufig nach Pasadena zurückzukehren.
Bolton machte keinen Versuch, ihn zurückzuhalten. Sein Hirn spielte bereits mit andern Ideen, die ihm während der Abwicklung des Platingeschäftes gekommen waren. Die verlorene Zeit, der verlorene Gewinn eines Jahres mußten irgendwie wettgemacht werden, und er sah Möglichkeiten dafür, die ihn von Stunde zu Stunde mehr beschäftigten. Sie waren vielleicht nicht ganz mit den Gesetzen der amerikanischen Union in Einklang, aber sie versprachen einen schnelleren und größeren Gewinn als das antarktische Unternehmen, an das er in späteren Jahren nur noch mit flüchtigem Bedauern zurückdachte.
Ein neuer Tag brach in der Antarktis an. Wie in flüssiges Gold getaucht erschienen die Industriebauten am Bolidenkrater in den Strahlen der wieder hochkommenden Sonne. Fast zwei Jahre waren verflossen, seitdem man hier mit dem Abbau der wertvollen Erzadern begann. Viele lange Monate hindurch hatten sich die Bohrmaschinen ohne Unterbrechung in den metallischen Grund hineingefressen, fast unablässig hatte der Donner schwerer Sprengungen den Krater durchtost. In steter Arbeit hatte der elektrische Strom in den Aufbereitungsanlagen das gediegene Gold aus dem gewonnenen Erz gezogen, durch fast fünfhundert Tage und ebenso viele Nächte war ununterbrochen das dröhnende Spiel der Münzstempel erklungen, die es zu Kronen und Doppelkronen ausprägten. Jeder Ader, die das gelbe Metall enthielt, waren die Sprengungen in die Teufe nachgegangen, soweit sie lief. Weite Mulden waren dort entstanden, wo man während der letzten Wochen noch das Eisen für den deutschen Deichbau gebrochen hatte.
Nun ging die Arbeit zu Ende. Das Goldnest war leer, war restlos ausgenommen. Professor Eggerth und Ministerialdirektor Reute, die am Rande des Kraters standen, die Abbaupläne des Kratergrundes in den Händen, konstatierten es in der gleichen Sekunde.
»Ihre Schätzung traf genau zu, Herr Professor,« sagte Reute. »Mit dem letzten Gold, das unsere Schiffe heute nach Deutschland mitnehmen, kommen wir auf zwanzig Milliarden und ein paar Millionen.«
Professor Eggerth faltete die Pläne nachdenklich zusammen.
»Ein gewaltiges Geschenk, Herr Reute, das uns hier buchstäblich vom Himmel fiel. Es lag in der Tiefe verborgen. Nun, wir haben nicht wie der Schalksknecht der Bibel gehandelt, wir ließen unser Pfund nicht vergraben. Wir haben es herausgeholt und wollen getreulich damit wirtschaften.«
Reute ging ein paar Schritte weiter zu dem Kraterrand hin und Professor Eggerth folgte ihm.
Beide blickten in den Schlund hinab. Es war still dort in der Tiefe, wo noch vor kurzem der brausende Takt rastloser Arbeit dröhnte. Nur noch wenige Lampen erhellten den dunklen Grund, Werkleute waren an der Arbeit, Bohrmaschinen und Feldbahngleise zu demontieren und die einzelnen Teile zu den Fahrstühlen zu bringen.
»Kehraus, mein lieber Reute!« sagte der Professor. »Es stimmt immer ein bißchen wehmütig, wenn man mit ansieht, wie eine Arbeitsstätte aufgegeben wird.«
Der Ministerialdirektor schüttelte den Kopf.
»Es will mir immer noch nicht recht eingehen, Herr Eggerth, daß wir den Abbau schon aufgeben. Die Regierung in Berlin hat es beschlossen und als Beamter muß ich den Beschluß ausführen. Aber mit vollem Herzen bin ich nicht dabei. Die vielen Tausende von Tonnen reinen Nickeleisens, die da unten noch lagern ... und dann vor allen Dingen die Unmengen von Platin, die man aus dem Erz ziehen könnte. Ich sehe nicht ein, warum man das nicht ausnutzen will.«
Der Professor konnte ein leichtes Lächeln nicht unterdrücken. Es lag noch auf seinem Gesicht, als er Reute antwortete.
»Haben Sie vergessen, Herr Ministerialdirektor, wie sehr der Platinmarkt schon durch die paar hundert Kilo erschüttert wurde, die wir unserem Freunde Bolton zukommen ließen? Der Platinbedarf der Welt ist nur gering. Es gibt genug vollwertige Ersatzstoffe dafür. Kämen wir auch nur mit ein paar Dutzend Tonnen dieses Metalls auf den Markt, so würden die Preise sofort ins Bodenlose stürzen. Es lohnt sich wirklich nicht, den Abbau hier noch fortzusetzen, so verlockend er auf den ersten Blick vielleicht auch scheinen mag.«
Reute schüttelte den Kopf. »Ich weiß, Herr Professor, daß der Beschluß unserer Regierung zum Teil auf Ihr Gutachten zurückzuführen ist. Trotzdem will es mir nur schwer eingehen, daß wir die Kraterstation aufgeben sollen.«
Professor Eggerth merkte wohl, daß die Angelegenheit dem Ministerialdirektor ernstlich zu Herzen ging, und er wurde selbst ernst, während er weitersprach.
»Sie dürfen überzeugt sein, Herr Reute, daß mein Gutachten auf sehr genauen Berechnungen basiert. Wir müßten das Nickeleisen hier mit immerhin ziemlich erheblichen Kosten gewinnen und um den halben Erdball nach Deutschland schaffen. Das ließ sich nur durchführen, solange der Hauptspesenanteil der Kraterstation durch die Goldausbeute gedeckt wurde. Vor allen Dingen aber dürfen wir die Einschlagstelle nicht länger offen liegen lassen, Herr Reute. Denken Sie an die verschiedenen höchst unerwünschten Neugierigen, die auf dem Wege nach der Antarktis sind. Es ist besser, wenn sie nicht einmal eine Spur mehr von dem finden, was hier einmal gewesen ist. Es mag für manchen schmerzlich sein, aber in unserer Lage ist es das Richtige, und ich freue mich, daß unsere Regierung hier meinem Vorschlag zugestimmt hat.«
Die beiden Herren verließen ihren Standort am Kraterrand und gingen weiter zu dem Verwaltungshaus, in dem Reute und jetzt während dieser letzten Woche auch Professor Eggerth ihre Büros hatten. Arbeit in Menge harrte ihrer dort. —
Von allen Seiten trommelte und dröhnte es in den Lüften. Es schien, als ob
die ganze Luftflotte der Eggerth-Werke sich hier in der fernen Antarktis ein
Stelldichein gäbe. In kurzen Zwischenräumen kamen die neuesten größten
Stratosphärenschiffe an. Maschinen und Bauteile aller Art verschwanden in
ihren Rümpfen und voll beladen mit Material und Menschen stiegen sie bald
wieder auf, um ihre Last nach Deutschland zu bringen.
Schon seit Tagen war der Krater selbst vollkommen geräumt. Viel schneller als sie einst entstanden waren, verschwanden nun auch die Bauten an seinem Rande. Nur noch der geebnete Felsboden verriet die Stelle, an der das große Kraftwerk so lange gestanden hatte. Verschwunden waren die ausgedehnten Wohnbaracken zusammen mit der bergmännischen Belegschaft, die in ihnen gehaust hatte. Nur eine kahle Stelle zwischen Erzhalden verriet dem Wissenden, daß hier einmal die Erzaufbereitung stand. Reute hatte seinen Arbeitsplatz in eine Kabine von ›St 14‹ verlegen müssen, die Professor Eggerth ihm einräumte. Man schrieb den siebenten April, als der leitende Ingenieur ihn dort aufsuchte und meldete.
»Herr Ministerialdirektor, die Arbeiten sind beendet. Die letzten Schiffe sollen in einer Stunde nach Deutschland abgehen.«
Reute nickte. »Ich danke Ihnen. Glücklichen Heimflug für Sie und alle die andern.«
Der Ingenieur wollte gehen, als ihn Professor Eggerth aufhielt.
»Sind die Sprengkammern geladen?«
»Jawohl, Herr Professor, es ist alles planmäßig geschehen.«
»Ist die Zündung nach den Spezialzeichnungen vorbereitet?«
»Auch das, Herr Professor. Sie brauchen nur einzuschalten, um die scharf zu machen.«
Der Professor stand auf und drückte dem Ingenieur die Hand. »Dann danke ich Ihnen. Auch ich wünsche Ihnen einen guten Heimflug. Auf Wiedersehen in Deutschland.«
Der Ingenieur war gegangen. Schweigend blieben Reute und Eggerth in der Kabine zurück. Nicht lange, dann drang das Dröhnen von Motoren zu ihnen. Eins der Stratosphärenschiffe nach dem andern schraubte sich in die Höhe und verschwand am Nordhorizont. Nur noch ›St 14‹ lag allein in der eisigen Einöde am Kraterrand.
Professor Eggerth erhob sich und warf den Pelz über.
»Es wird Zeit, Herr Ministerialdirektor. Der letzte Akt des Dramas beginnt. Wollen Sie mitkommen?«
Reute schüttelte den Kopf. Er zog es vor, im Schiff zu bleiben. Ohne ihn ging Professor Eggerth über das verschneite Land zu einem Mastenpaar, das man allein von allen den vielen Masten hier stehengelassen hatte. Eine Antenne war zwischen den Mastspitzen ausgespannt. Ein Draht von ihr führte zu einem Schalter. Von dem Schalter lief ein isoliertes Kabel weiter und verschwand zwischen den Felsen. Der Professor legte den Schalter um und kehrte zum Schiff zurück. Gleich danach begann auch die Hubschraube von ›St 14‹ einen dröhnenden Wirbel zu schlagen. Das Schiff stieg auf und trieb in großer Höhe langsam nach Norden ab.
Im Funkraum stand der Professor zusammen mit Reute. Tief unter ihnen lag der verlassene Krater. Wie eine Mondlandschaft wirkte das ganze in den Strahlen der tiefstehenden Sonne. Sorgsam stimmte Professor Eggerth selbst den Sender ab und in einem eigenartigen Rhythmus gab er danach Striche und Punkte mit der Morsetaste. Kein Funker hätte dies Telegramm entziffern können, aber eine eigenartige Wirkung hatte es.
Kaum hatte der Professor das letzte Zeichen gegeben und die Hand von der Taste zurückgezogen, als das Land um den Krater zu erzittern und zu beben begann. Einen Augenblick schien's, als ob das ganze Ringgebirge sich von seiner Unterlage ablösen und in die Höhe steigen wolle. Dann brach es in sich zusammen, kippte von allen Seiten nach der Mitte hin und ließ unendliche Gesteinmengen in den Kraterschlund stürzen. Graugelber mißfarbiger Qualm, durchzuckt von roten Stichflammen, brach aus den stürzenden Gesteinsmengen hervor und im Augenblick war das Bild verwandelt, nur noch eine trümmerbesäte Ebene, wo sich vor Sekunden noch deutlich das runde Ringgebirge zeigte.
Noch starrte Reute auf das so plötzlich verwandelte Gelände, als der Donner der gewaltigen Sprengung das Schiff erreichte und ihn für Sekunden fast taub machte. Rollend und grollend verdröhnten allmählich die gewaltigen Schallwellen und das Geräusch der Schiffsmotoren drang wieder durch.
›St 14‹ änderte seinen Kurs und kehrte zu der Stelle zurück, an der früher die Kraterstation stand. In verschiedenen Höhen kreuzte es über dem Platz und immer zufriedener wurde dabei das Gesicht des Professors.
»Fürchterlich!« sagte Reute. Es war das erste Wort, das seit der Sprengung über seine Lippen kam.
»Großartig, Herr Reute!« erwiderte der Professor. »Genau so dachte ich es mir. Die tausend Tonnen Dynamit haben genau so gewirkt, wie ich es wollte. Kein Mensch wird hier noch einen Bolidenkrater vermuten. Nun mögen die Amerikaner, Norweger und wer sonst noch will in den nächsten Monaten hier spazieren fliegen, soviel sie Lust haben. Was hier einmal war und was hier noch ist, das werden sie niemals entdecken. Und das ist gut für uns, Herr Reute. Glauben Sie es mir, ich hatte sehr triftige Gründe, als ich unserer Regierung diese Sprengung vorschlug.«
Er gab einen neuen Befehl in den Führerstand. ›St 14‹ drehte nach Norden ab und setzte seinen Kurs auf Deutschland.
»Tag, alter Schmidt, da sind wir wieder.« Dr. Wille sagte es auf der Schwelle von Schmidts Arbeitszimmer, während er sich die Schneeflocken vom Pelz schüttelte. Nur langsam tauchte die lange dürre Gestalt Schmidts aus seinem Wust von Papieren und Tabellen empor. Es bedurfte einiger Zeit, bis seine Gedanken sich aus dem Reich der Theorien und Zahlen in die Wirklichkeit zurückfanden, und die schmalen Lippen sich zu ein paar Worten bequemten.
»Schon wieder hier, Herr Wille? Schon wieder sechs Monate vorüber? Die Zeit ist schnell vergangen, aber ich bin auch gut weiter gekommen.«
Er griff nach einer Kurvenkarte und ehe Dr. Wille noch dazu kam, seinen Pelz abzulegen, hatte er ihn schon in ein schwer gelehrtes Gespräch über seine neuen Entdeckungen verwickelt. Eine Weile ließ Wille ihn gewähren, dann winkte er ab.
»Schon gut, lieber Schmidt, das müssen Sie mir später in Ruhe erzählen, oder besser noch, ich lese es. Wie ich Sie kenne, alter Freund, haben Sie darüber ja doch schon wieder eine neue Veröffentlichung unter der Feder. Aber von Deutschland soll ich Sie grüßen. Briefe habe ich auch für Sie mitgebracht. Hier ist einer aus Kassel«, er faßte in seine Rocktasche. »Hier sind zwei aus Leipzig und noch einer aus Gotha ... der deutsche Sommer, Schmidt, Sie haben doch viel versäumt.«
Der lange Schmidt schüttelt abweisend den Kopf.
»Die Arbeit hier, Herr Wille ... Wenn Sie das Neue erst alles erfahren, Sie werden staunen ...« wieder steckte er nach wenigen Sätzen mitten in seinen erdmagnetischen Theorien, bis ihn Wille gewaltsam unterbrach.
»Das Neuste, lieber Schmidt, das wissen Sie ja noch gar nicht. Das Neuste ist, daß wir jetzt auf Wunsch unserer Regierung die Zelte hier wieder abbrechen und hundert Kilometer weiter nach Süden gehen. Die Schiffe, die den Transport besorgen sollen, sind schon zusammen mit unserm angekommen. Aber Sie hören und sehen ja nichts, obwohl sechs Stratosphärenflugschiffe bei ihrer Landung doch einen ziemlichen Krach machen. Wenn nicht wenigstens der neue Maschinist herauskam, wäre überhaupt kein Mensch zu unserem Empfang dagewesen.«
Schmidt kniff die Lippen fest zusammen und brummelte etwas Unverständliches vor sich hin. Es war ihm unschwer anzusehen, daß der Gedanke, die feste Station wieder einmal zu verlegen, ihm höchst unsympathisch war. Immer noch knurrend und murrend begann er die Unmenge von Tabellen und Aufzeichnungen, die den großen Arbeitstisch vollkommen bedeckten, zusammenzulegen und in einzelne Mappen einzuordnen.
Schweigend überließ ihn Dr. Wille seiner Beschäftigung und ging kopfschüttelnd in den Vorraum zurück.
»Was hast du, Vater?« fragte ihn Rudi.
»Der gute Schmidt fängt an, wunderlich zu werden. Ich glaube, mein Junge, es war nicht gut, daß wir ihn hier ein halbes Jahr alleingelassen haben. Es wird höchste Zeit, daß er mal wieder nach Deutschland unter andere Menschen kommt, sonst schnappt er uns am Ende noch über. Das nächste Mal muß er mit, ob er will oder nicht.«—
Schon in den nächsten Stunden begannen die Abbauarbeiten. Es wiederholte sich
das alte Spiel, das die Station schon einmal erlebt hatte. Die
Stationsgebäude wurden auseinandergenommen und alles, was nicht niet- und
nagelfest war, verschwand in den Laderäumen der Stratosphärenflotte. Als
vorletztes Frachtstück verstauten sie den Dieselmotor der Maschinenanlage,
als letztes den langen Schmidt mitsamt einem Berg von Mappen.
Dann brach die Flotte auf. Schneewüste und eisige Einöde war wieder, wo fast ein Jahr das deutsche antarktische Institut seinen Platz hatte.
Hundert Kilometer südlicher ließen sich die Schiffe vorsichtig sinken und suchten nach einem brauchbaren Landungsplatz. Anders sah das Gelände an dieser Stelle jetzt aus wie damals, als Professor Eggerth und Reute es nach der Sprengung verließen. Wie ein weißes Tuch hatte der Schnee sich darüber gelegt und alle Schroffen und Schrunden, alle Narben und Wunden mitleidig verdeckt, die ein gewaltiges Naturereignis und menschliche Technik der alten Erdkruste hier geschlagen hatten. Erst als die Werkleute die Schiffe verließen und auf die Suche nach einer passenden Baustelle gingen, merkten sie, wie uneben und zerrissen das Land unter der Schneedecke war.
Nach längerem Suchen fanden sie eine Stelle, die allen Anforderungen genügte, und auf den Abbruch folgte nun der Wiederaufbau. Zwei Tage und zwei Nächte nahm er in Anspruch. In Wechselschichten arbeiteten die Mannschaften, die in den Schiffen mitgekommen waren. Dann war das Werk vollendet. Fertig und arbeitsbereit stand die Station an dem Ort, an dem man noch vor kurzem unendliche Goldmengen aus der Tiefe holte.
Ein kurzer Abschied, ein letztes Winken und Grüßen, und die Stratosphärenflotte stieg zum Rückflug nach Deutschland auf. Nur auf sich selbst angewiesen waren die wenigen Menschen wieder allein, die im Dienste der Wissenschaft und im Kampfe mit einer unwirtlichen Natur schon so viele Monate in der Antarktis verbracht hatten. Als läge kein Urlaub, kein deutscher Frühling und Sommer dazwischen, nahm die altgewohnte Arbeit wieder ihren Anfang.
Aus Tagen wurden Wochen und die Wochen begannen sich zu Monaten zu summen. Schon war die Mitte des kurzen antarktischen Sommers erreicht, Dr. Wille befand sich mit den Fahrzeugen der motorisierten Station auf einer Forschungsreise, die ihn bis zu den Hängen des Markham-Gebirges führen sollte. Der lange Schmidt war in der festen Station zurückgeblieben, eifrig damit beschäftigt, das letzte Kapitel seines neuen Werkes niederzuschreiben.
Au seinem Leidwesen konnte auch Hagemann an der Expedition nicht teilnehmen. Dr. Wille hatte ihn mit dem sehr bestimmten Auftrag zurückgelassen, sich um Doktor Schmidt zu kümmern und dafür Sorge zu tragen, daß der immer mehr in seine Arbeit verbiesterte Gelehrte wenigstens die Mahlzeiten regelmäßig innehielt. Die Maßnahme war nicht unbegründet, denn öfter als einmal hatte Dr. Schmidt vierundzwanzig Stunden hintereinander am Schreibtisch gesessen, ohne außer etwas schwarzem Kaffee etwas zu sich zu nehmen, und soweit es bei ihm überhaupt noch möglich war, war er in den letzten Monaten noch magerer und dürrer geworden.
Ein mächtiger Raupenwagen, der gleiche, den vor Monaten ›St
11h‹ an Bord der ›City of Boston‹ absetzte, glitt nach
Süden hindurch die Antarktis. Jetzt verlangsamte er seine Fahrt und hielt auf
dem verschneiten Feld. Eine Tür öffnete sich, Captain Andrew kletterte hinaus
und ging ein paar Schritte über den Schnee. Parlett folgte ihm, würdig wie
ein englischer Lord, obwohl er mit allerlei Gerätschaften beladen war. Vor
Captain Andrew begann er sie aufzubauen. Ein dreifüßiges Stativ zuerst, auf
das er sorgsam einen Theodoliten mit allem Zubehör aufschraubte. Ein
Tischchen kam daneben, auf dem ein Präzisionschronometer und ein elektrisches
Chronoskop ihren Platz fanden.
Als alles aufgebaut war, ging Captain Andrew an seine Arbeit, die nicht ganz einfach war. »83 Grad, 14 Minuten Süd, 158 Grad, 12 Minuten Ost« lautete die Ortsbestimmung, die ihm Garrison als Ziel der Reise genannt hatte. Für das Versprechen, ihn wieder mitzunehmen und diese Stelle aufzusuchen, hatte Garrison tief in die Tasche gegriffen und die größere Hälfte seines von Bolton erhaltenen Anteils für die neue Expedition des Captains beigesteuert.
Soweit man sich auf die im Wagen und während der Fahrt gemachten Ortsbestimmungen verlassen konnte, mußte die Andrew'sche Expedition sich in nächster Nähe dieser Stelle befinden. Aber von dem, was Garrison dort zu finden erwartete und was er Captain Andrew auf der langen Reise hierher öfter als einmal mit plastischer Deutlichkeit ausgemalt hatte, war weit und breit nichts zu sehen. Kein Krater, kein Ringgebirge, nichts von alledem, was nach Garrisons fester Überzeugung ein Bolide von der vermuteten Größe verursacht haben müßte.
Captain Andrew wollte sein Wort halten, aber er wollte auch nicht allzu viel von der kostbaren Zeit der wenigen Sommermonate für ein Unterfangen opfern, das ihm reichlich phantastisch vorkam. Diese Ortsbestimmung hier sollte der letzte Versuch sein. Mit den besten Mitteln und der größten überhaupt möglichen Genauigkeit wollte er sie vornehmen. Einfach würde die Arbeit nicht sein, darüber war der Captain sich klar. Nur die in mäßiger, wenig veränderlicher Höhe um den Horizont kreisende Sonne stand ihm ja dafür zur Verfügung. Was unter Zuhilfenahme des gestirnten Nachthimmels eine Kleinigkeit war, was Hein Eggerth und Berkoff früher einmal im Flugzeug in wenigen Minuten mit Leichtigkeit feststellen konnten, das würde hier mehrstündige subtile Beobachtung erfordern und selbst dann waren Irrtümer von der Größe einer Bogenminute immer noch möglich. Es waren die gleichen Umstände, die schon früher einmal den ersten Forschern, die zur Zeit des langen Polartages den Nordpol erreichten, die genaue Feststellung ihrer Entdeckung so sehr erschwerten.
Geduldig machte sich Captain Andrew an sein Werk. Immer wieder visierte er die Sonnenscheibe an, drehte an Mikrometerschrauben, las feinste Skalen mit der Lupe ab, schrieb endlose Ziffern in ein Buch, Winkelgrade und Winkelminuten und die dazugehörigen mit dem Chronoskop ermittelten Zeiten. Griff dazwischen zu astronomischen Tabellen und versuchte zu rechnen, während ihm die Finger klamm wurden.
Mr. Parlett erschien wieder auf der Szene, um Captain Andrew einen heißen
Toddy zu bringen. Der trank davon und stürzte sich dann neugestärkt wieder
auf seine Rechnung. Parlett trat näher an das Stativ heran. Das blinkende
Fernrohr des Theodoliten interessierte ihn. Spielerisch drehte er es hin und
her und brachte dabei ein Auge an das Okular, um hindurch zu schauen.
Plötzlich zuckte er zusammen.
»Mr. Andrew!«
Captain Andrew blickte von seiner Rechnung auf.
»Zum Teufel, Parlett, was fällt Ihnen ein? Was haben Sie da zu spielen, Sie haben mir die ganze Einstellung verrückt.«
»Captain, ich sehe etwas. Ganz deutlich! Einen Funkturm!«
Mit einem Satz war der Captain bei dem Apparat und schaute selbst hindurch. Ein Zweifel war nicht möglich. Deutlich war durch das stark vergrößernde Fernrohr des Theodoliten das feine Fachwerk eines Funkmastes zu sehen. Jetzt, nachdem er es durch das Fernrohr erblickt hatte, glaubte er den Mast sogar mit bloßen Augen am Südhorizont erkennen zu können. Mit einem Ruck raffte er seine Papiere zusammen.
»Los Parlett! Alles zusammenpacken, in den Wagen bringen! Sie können den Mast auch sehen. Wir fahren darauf zu.«
Gespannt kam Garrison Captain Andrew entgegen, als er in den Wagen zurückkehrte.
»Haben Sie die genaue Ortsbestimmung, Captain?«
Captain Andrew schüttelte den Kopf. »Nicht mehr nötig, Mr. Garrison. Wir haben einen Funkturm entdeckt, noch keine zehn Kilometer von hier entfernt. Sicher eine deutsche Station. Da wollen wir jetzt hinfahren. Vermutlich werden ja Leute dort sein. Die werden uns schon Bescheid sagen können, wo wir uns befinden.«—
Der brave Hagemann hatte an einer freien Stelle von Schmidts Arbeitstisch ein
Frühstück aufgebaut, das seiner Kochkunst alle Ehre machte. Aber vergeblich
hatte er schon zum dritten Male gemeldet: »Herr Ministerialrat, es ist
angerichtet.« Der lange Doktor an der anderen Seite des Tisches über sein
Manuskript gebeugt, ließ die Feder über das Papier rasen und hörte und sah
nichts von dem, was um ihn herum vorging.
Karl Hagemann wußte, wie es kommen würde, wenn er jetzt das Zimmer verließ. Nach Stunden würde das Frühstück noch unberührt auf seinem Fleck stehen, das Fleisch kalt, die Sauce erstarrt, das ganze ungenießbar.
Der Auftrag Willes kam ihm in den Sinn. ›Zu was schließlich‹, dachte er bei sich, ›hat der Tischler Rollen unter den Sessel geschraubt?‹ Nach kurzem Überlegen entschloß er sich zu einem Gewaltstreich. Vorsichtig trat er von hinten heran, griff mit der einen Hand die Sessellehne, mit der andern eine Schulter Schmidts, zog den Sessel mitsamt dem Doktor vom Tisch fort, karrte ihn nach der andern Seite und schob ihn dort vor das Frühstück hin.
Sprachlos hatte der lange Schmidt die Gewalttat im ersten Augenblick über sich ergehen lassen, noch ein paar Worte in die Luft geschrieben, als seine Feder das Papier nicht mehr erreichte. Jetzt brach er los.
»Hagemann, Sie unverschämter Kerl! Was fällt Ihnen ein?«
»Befehl von Herrn Dr. Wille. Herr Ministerialrat müssen essen«, sagte Hagemann, während er ihm die Feder fortnahm und dafür Messer und Gabel in die Hand drückte. Dr. Schmidt wollte noch weiter schimpfen, als der Hupenton eines Kraftwagens vom Hofe her klang.
»Nanu! Sind unsere Herrschaften schon wieder zurück«, sagte Hagemann, während er dem Doktor eine Tasse Tee einschenkte, »entschuldigen mich Herr Ministerialrat einen Augenblick.«
Mit Befriedigung sah er noch, wie der lange Doktor, nun einmal gewaltsam von seiner Arbeit fortgerissen, sich mit gesundem Appetit über das Frühstück hermachte und verließ den Raum.
Ein Raupenwagen stand auf dem Hof, ähnlich den deutschen Fahrzeugen, doch
viel größer als diese. Verwundert besah sich Hagemann das Vehikel, als sich
an dem eine Tür öffnete. Ein Mann kam heraus und redete ihn in englischer
Sprache an. Hagemann raffte seine englischen Brocken zusammen, und wußte nach
wenigen Worten, daß er es mit Captain Andrew, dem Führer einer amerikanischen
Expedition zu tun habe.
»Herr Dr. Wille ist nicht anwesend«, sagte Hagemann, »Herr Ministerialrat Schmidt vertritt ihn im Institut ...« er wollte fortfahren »er wird sich sicher freuen, Sie zu sehen«, als eine zweite Person aus dem Wagen stieg, bei deren Anblick ihm die Rede stockte.
Das war ja Mr. Garrison, jener bedenkliche Yankee, der schon einmal in der Station zu Besuch war. Die Herren Wille und Schmidt hatten es nach Möglichkeit vermieden, in Gegenwart dritter über die Amerikaner zu sprechen. Aber Karl Hagemann war eben Karl Hagemann, Universalgenie und Hans Dampf in allen Gassen. Er hatte doch mancherlei aufgeschnappt, was nicht für seine Ohren bestimmt war und sich seinen Vers darauf gemacht. Schnell hatte er seine Selbstbeherrschung wiedergefunden und lud die beiden Amerikaner mit einer verbindlichen Bewegung ein, näher zu treten.
»Nehmen Sie Platz, meine Herren. Ich werde Herrn Ministerialrat sofort benachrichtigen.«
Damit verschwand er. Captain Andrew sah sich interessiert in dem saalartigen Raum um, in den Hagemann sie geführt hatte. Behagliche Möbelstücke, die gleichmäßige Wärme der elektrischen Heizung, die hohen vierfach verglasten Fenster ... das alles gefiel ihm.
»Komfortabel haben sich die Deutschen hier eingerichtet. Man kann immer noch von ihnen lernen«, sagte er schließlich zu Garrison. Der hörte kaum auf ihn. Er lief bald zu der einen, bald zu der andern Fensterseite, starrte hinaus auf die weite Ebene und suchte vergeblich nach einem Bolidenkrater, der doch nach seiner felsenfesten Überzeugung hier sein mußte.
Captain Andrew ließ ihn gewähren. Seine Aufmerksamkeit wurde von einigen Instrumenten gefesselt, die an der Schmalwand des Raumes standen. Es waren Magnetometer verschiedener Konstruktion, darunter auch Bussolen, um die magnetische Deklination und Inklination zu messen. Sein wissenschaftliches Interesse wurde lebendig. Er trat näher heran und hatte, ehe er sich's versah, die Arretierung eines Inklinometers gelöst. Die Nadel, nicht mehr festgehalten, folgte der magnetischen Richtkraft und stellte sich genau senkrecht.
»Der Pol, Garrison! Sehen Sie her! Hier ist der magnetische Südpol. Die Deutschen haben ihr Institut genau auf den Pol gesetzt. Nach dem, was man über Willes Elektronentheorie weiß, mußte man es ja auch eigentlich erwarten.«
Mit leichter Gewalt zog er Garrison vom Fenster weg zu den Instrumenten und fing mit ihm ein Gespräch über die Willeschen Arbeiten an, obwohl dessen Gedanken bei ganz andern Dingen weilten.
Als Hagemann in Schmidts Arbeitszimmer zurückkam, schob der Doktor eben den
letzten Bissen in den Mund und legte Messer und Gabel beiseite.
»Sie können das Tablett herausnehmen«, sagte er und wollte sich wieder an sein Manuskript setzen.
»Herr Ministerialrat, es sind nicht unsere Leute«, platzte Hagemann mit seiner Neuigkeit heraus. Der lange Doktor sah ihn verwundert an. Mit allen Gedanken ganz bei seiner Arbeit, hatte er die Ankunft des Kraftwagens schon längst wieder vergessen.
»Es sind nicht unsere Leute«, wiederholte Hagemann seine Meldung. »Es sind Amerikaner, Captain Andrew ist hier und außerdem der andere, der schon mal hier war, der Mr. Garrison, Sie werden sich erinnern, Herr Geheimrat.«
Der lange Schmidt ließ die Feder sinken und geruhte von den Höhen reiner Wissenschaft wieder in die Niederungen der realen Wirklichkeit hinabzusteigen. Captain Andrew ... Garrison ... unangenehme Vorstellungen waren mit diesen Namen untrennbar für ihn verbunden. Unerwünschte Konkurrenten sah er in ihnen, die in ein Gebiet einbrachen, das er als seine ureigenste Domäne betrachtete. Mit tiefem Mißtrauen hatte er die Bewegungen der amerikanischen Expedition verfolgt, soweit sie sich nach dem Fortfall der dritten deutschen Peilstation noch feststellen ließen. Jetzt waren diese Eindringlinge plötzlich hier auf seiner Station in seinem Institut, und sein neues großes Werk, in dem er der Welt überraschende Forschungsergebnisse mitteilen wollte, war noch nicht im Druck, war noch nicht einmal im Manuskript abgeschlossen. Vielleicht würden die ihm mit irgendwelchen Veröffentlichungen zuvorkommen, die seinen Entdeckungen die Priorität rauben konnten. Ein Glück, daß sie nicht wußten, was er wußte, daß sie den letzten Grund aller dieser magnetischen Erscheinungen nicht kannten ...
Die Stimme Hagemanns riß ihn aus seinen Gedanken.
»Wollen Sie die amerikanischen Herren empfangen, Herr Ministerialrat? Ich habe sie in den großen Mittelraum geführt.«
Dr. Schmidt stand auf und zog sich seinen Rock zurecht.
»Es ist gut, Hagemann, ich komme sofort.«
Als Schmidt eintrat, war Captain Andrew dabei, Garrison an einer Bussole zu
zeigen, daß die horizontale Richtkraft der Magnetnadel hier gleich Null war.
In jeder beliebigen Stellung, in die er die Magnetnadel drehte, blieb sie
ruhig stehen.
Die Amerikaner waren so eifrig bei der Sache, daß sie den Eintritt des langen Doktors überhörten. Ein paar Sekunden beobachtete der sie schweigend und der Versuch eines Lächelns lief über seine hölzernen Züge.
›Wenn ihr wüßtet, ihr Tröpfe‹, ging es ihm durch den Kopf, ›daß kaum zweihundert Meter unter euren Füßen ein paar Millionen Tonnen Eisen liegen, dann würdet ihr euch nicht mehr wundern. Gut, daß ihr es nicht wißt.‹
Er machte sich durch ein Räuspern bemerkbar und trat näher. Captain Andrew fuhr auf, als ob er bei etwas Unrechtem ertappt wäre.
»Ich sehe, die Herren beschäftigen sich schon mit den magnetischen Verhältnissen der Station«, sagte der lange Schmidt und schüttelte den Amerikanern die Hand. Captain Andrew überwand seine Verlegenheit.
»Sie entschuldigen, Herr Dr. Schmidt, aber es ist so interessant. Sie sitzen hier in der Tat genau auf dem magnetischen Südpol.«
»Vorläufig stehen wir noch darauf«, sagte der lange Schmidt trocken. »Aber wir wollen uns setzen.«
Er bat seine Gäste, wieder Platz zu nehmen, und ließ durch Hagemann einige Erfrischungen bringen. Es währte nicht lange, und er war mit Captain Andrew in ein tiefgründiges Gespräch über Polwanderungen im allgemeinen und die auffällige Wanderung des magnetischen Südpols im besondern verwickelt. Öfter als einmal wurde Hagemann gerufen, um Bücher und Broschüren herbeizuholen, aus denen Dr. Schmidt seine Theorie mit einer Unmenge von Zahlenmaterial belegte.
Verwundert kam Hagemann diesen Aufträgen nach, kopfschüttelnd suchte er draußen an der Tür etwas von dem Gespräch zu erlauschen. Sollte der Doktor sich etwa von seinem wissenschaftlichen Eifer fortreißen lassen und den Amerikanern in der Hitze des Gefechts mehr verraten als gut war? Hagemann machte sich schwere Gedanken, denn solchen gelehrten Häusern, wie Dr. Schmidt eins war, traute er alle möglichen Dummheiten zu. Schließlich konnte er es nicht unterlassen, durch das Schlüsselloch zu schauen. Da bemerkte er um die Lippen des langen Schmidt einen gewissen mokanten Aug, den er von früheren Gelegenheiten her kannte. Erleichtert atmete das biedere Faktotum auf.
›Und er führt die Yankees doch über den Gänsedreck‹, murmelte er vor sich hin, während er in seine Küche zurückkehrte.
Was Hagemann hier etwas unparlamentarisch ausdrückte, war in der Tat der Fall. Es darf nicht verschwiegen werden, daß der lange Schmidt sich während der Stunden, die er mit den beiden Amerikanern verbrachte, nicht derjenigen Aufrichtigkeit befleißigte, die man mit Fug und Recht von Wissenschaftlern des gleichen Faches erwartet. Er pumpte Captain Andrew eine erdmagnetische Theorie ein, die von Anfang bis zu Ende eine raffinierte, aber um so glaubwürdigere Täuschung war, weil sie den wirklichen Grund aller Erscheinungen, das Meteoreisen in der Tiefe, verschwieg. Und er führte Garrison, der wieder und immer wieder auf einen Riesenmeteor zurückkam, der hier gefallen sein sollte, in einer Weise irre, daß der Amerikaner an allen seinen bisherigen Theorien und Berechnungen zu zweifeln begann.
Wer der Unterhaltung der drei Wissenschaftler mit voller Kenntnis der wirklichen Sachlage gefolgt wäre, hätte sich der Erkenntnis nicht verschließen können, daß der lange Schmidt eine glänzende Begabung für das Pokerspiel besitzen mußte. Er bluffte die neugierigen Gäste in einer meisterhaften Weise, und als sie Abschied nahmen, um weiter zu ziehen, hatten sie keine Ahnung, wie schwer sie geblufft worden waren.
»Also sehen Sie nun, Garrison, daß Sie einem Hirngespinst nachgelaufen sind«, sagte Captain Andrew, als sie wieder in ihrem Wagen saßen. »Hier, wo nach Ihrer fixen Idee ein Riesenbolide gefallen sein soll ... wir haben ja die genaue Ortsbestimmung von dem Institut bekommen ... da ist der magnetische Südpol und sonst weiter gar nichts als eine Ebene, so glatt wie meine Hand ... und was haben Sie mir alles von einem Bolidenkrater vorphantasiert, der an dieser Stelle sein müßte.«
Garrison strich sich über die Stirn. Es dauerte eine Weile, bis er sich zur Antwort aufraffte. »Ich muß zugeben, Captain Andrew, daß ich mich geirrt habe, das kann schließlich auch einmal einem Wissenschaftler passieren.«
»Gut, daß Sie es endlich selber einsehen, Garrison«, sagte Andrew und wandte sich wieder seinen Instrumenten zu.
An seinem Arbeitstisch saß Dr. Schmidt und schlürfte behaglich seinen
Tee.
»So«, sagte er, als er die Tasse niedersetzte. »Die Gefahr ist abgewendet, die kommen nicht wieder, und das wirkliche Geheimnis des deutschen Goldes werden sie niemals entdecken.«
Dann griff er nach der Feder, um die letzte Seite seines großen Werkes zu vollenden.
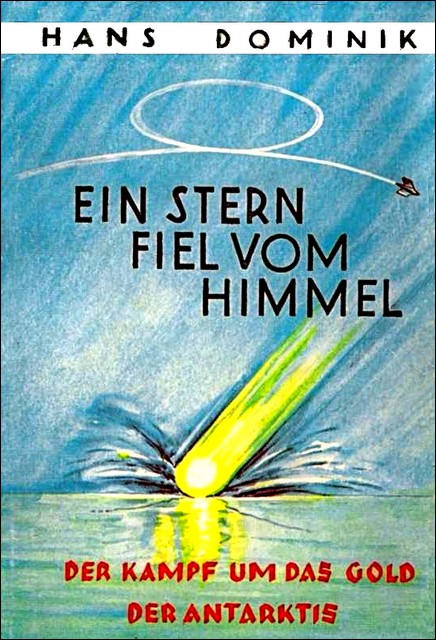
"Ein Stern fiel vom Himmel," Koehlers Verlagsgesellschaft, Biberach an der Riss. 1952