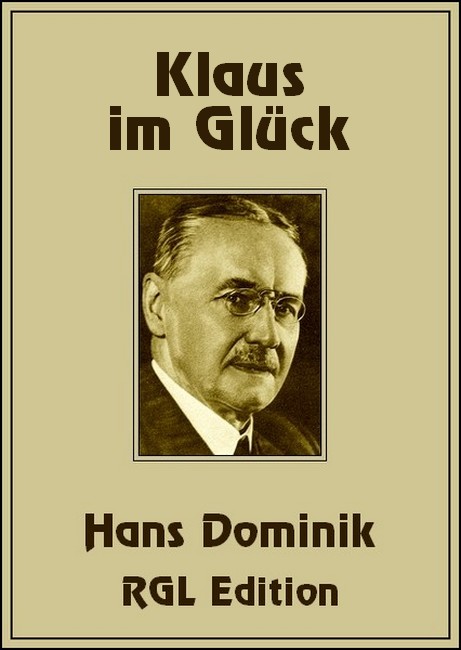
RGL e-Book Cover 2017©
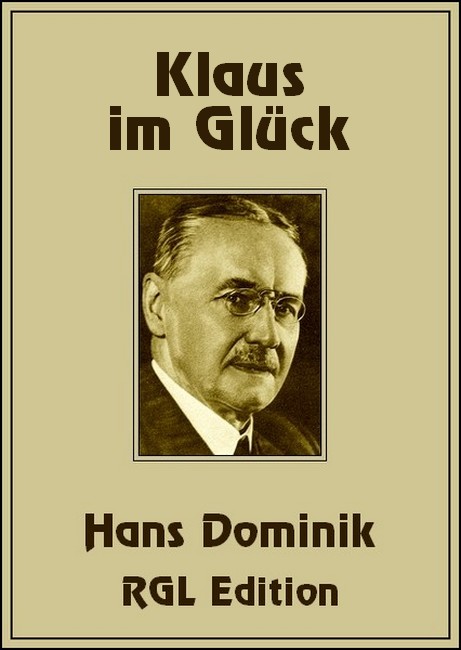
RGL e-Book Cover 2017©
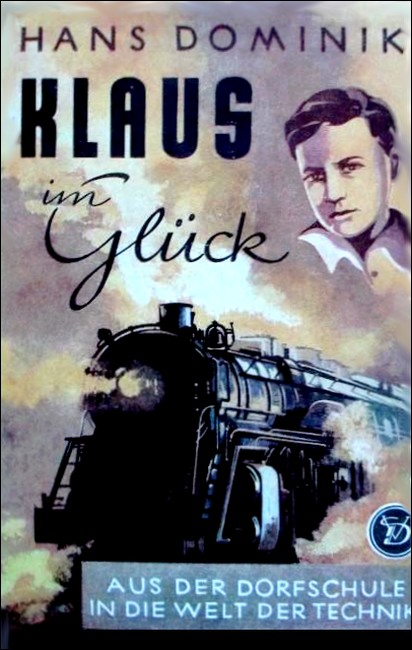
"Klaus im Glück,"
Österreichischer Diana-Verlag, Wien, ca. 1950
»Halt! Nicht doch! Bande, verfluchte! Laßt nach!«
Eine helle Knabenstimme schrie die Worte und übertönte damit zeitweise den Lärm, der um diese Juli-Mittagsstunde in dem alten, dumpfen Klassenzimmer herrschte.
»Niederträchtige Bande, ihr sollt nachlassen!« schrie Klaus Kröning noch einmal aus der Mitte der Schulbank her. Aber Karl Kundtke und Fritz Lautensach, die beiden Jungen, die die Eckplätze der langen Bank innehatten, dachten gar nicht daran, dieser Aufforderung Folge zu leisten. Fest stemmten sie sich mit den Füßen gegen die Wände des Klassenzimmers und preßten alles, was zwischen ihnen auf der langen Bank saß, immer dichter und enger zusammen.
»Saft machen« nannte man diese schöne Übung seit alters her in der Dorfschule von Seehausen, und Karl Kundtke und Fritz Lautensach, erprobte Meister in dieser Kunst, zeigten durchaus keine Neigung, sich bei ihrem Vergnügen durch irgendwelche Hilferufe der in der Bankmitte Zusammengepreßten stören zu lassen. Unentwegt drückten sie weiter. Irgendwie mußte die in der Bank eingepreßte lebendige Masse sich Luft machen, und jetzt entlud sie sich nach oben. Mit Gewalt war es Klaus Kröning gelungen, sich über die Schultern seiner Nebenmänner in die Höhe zu arbeiten. Mit einem letzten gewaltigen Ruck riß er sich ganz empor und sprang auf den Banktisch, während der so schön begonnene »Saft« unter ihm zusammenbrach.
»Ihr Schwefelbande!« Er betrachtete sich von allen Seiten, ob seine Kleidung bei der Gewalttour nicht zu Schaden gekommen sei. »Ihr kauft mir keinen neuen Rock, wenn mein alter dabei zerrissen wird. Ich will euch schon...«
Heinz Hennicke schoß vom Flur her in die Klasse. »Pst! Der Alte kommt.« Im Augenblick ließen Kundtke und Lautensach von weiteren Unternehmungen ab. Klaus Kröning konnte gerade noch auf seinen Platz zurückschlüpfen, als der alte Kantor Justus Wendelmut in die Klasse trat.
Die letzte Schulstunde brach an, die letzte Stunde vor dem Beginn der großen Ferien. Rechnen stand auf dem Stundenplan.
Rechnen in der letzten Stunde vor den Ferien! Einfach ausgeschlossen. Kaum hatte der Kantor sich auf dem Katheder niedergelassen, als es ihm von vierzig Jungenstimmen entgegenbrummte und -summte.
»Vorlesen, Herr Kantor!... Geschichten vorlesen!... Letzte Stunde!...«
Eine kleine kleine Weile ließ Kantor Wendelmut den Sturm über sich ergehen. Dann begann er mit seiner Kohorte zu verhandeln.
»Habt ihr was zum Lesen mitgebracht?«
Die Frage war das Signal zu einem neuen Sturm.
»Jawohl, Herr Kantor! Hier, Herr Kantor! Nein meins, Herr Kantor!« klang es von allen Bänken her. Fritz Lautensach schwenkte einen alten Lederstrumpf, Karl Kundtke hielt einen Band von Karl May in die Höhe, Heinrich Hennicke zeigte Schweinfurths Fahrt durch Afrika, und noch ein Dutzend anderer Bücher kamen zum Vorschein.
»Wer die Wahl hat, hat die Qual«, lachte Wendelmut. »Da hilft das nichts, Jungens, da müssen wir losen. Jeder von euch schreibt den Titel seines Buches auf einen Papierstreifen. Alle Streifen kommen hier in meinen Hut, und dann wird einer von euch mit geschlossenen Augen einen Streifen herausgreifen. Was er zieht, das lesen wir.«
Die Lose waren schnell fertiggemacht, und von Rechts wegen hätte die Ziehung jetzt vonstatten gehen können. Aber dem alten Kantor kamen, während er die Streifen einsammelte und die Buchtitel las, allerhand Gedanken. Prägten sich nicht in den verschiedenen Büchern, die seine Schüler da mitgebracht hatten, ganz bestimmte Interessen und Neigungen aus? Konnte man aus der Wahl dieser Lektüre nicht schon mancherlei Schlüsse auf den künftigen Werdegang des einzelnen ziehen? Unwillkürlich begann er beim weiteren Einsammeln zu fragen.
»Was willst du denn später mal werden?«
Das hätte Justus Wendelmut aber lieber unterlassen sollen, denn dabei wurde er das Opfer eines Komplottes.
»Schauspieler, Herr Kantor.« Wie aus der Pistole geschossen kam die Antwort Lautensachs.
»So, so, du willst Schauspieler werden? Na und du, Kundtke?«
»Seeräuber, Her Kantor.«
»Was, Kundtke, du bist wohl ganz und gar verrückt. Und du, Hennicke?«
»Schauspieler, Herr Kantor.«
In schöner Einträchtigkeit kamen die Antworten der nächsten. Immer abwechselnd Schauspieler oder Seeräuber. Wendelmut warf einen vielsagenden Blick in die Ecke, in der ein schlankes, spanisches Rohr stand.
»Und du, Kröning?« fragte er weiter.
»Briefträger, Herr Kantor.«
»Endlich mal ein vernünftiger Beruf«, brummte Wendelmut vor sich hin. »Na, dann komm mal her, Kröning, mach die Augen zu und ziehe einen Streifen. So, also ›Im Herzen von Afrika‹ von Schweinfurth. Gut, das werden wir lesen.«
Und dann zogen die vierzig Jungen in Gedanken mit dem kühnen deutschen Forschungsreisenden durch den schwarzen Erdteil. Sie wanderten durch die Länder der Kopfjäger und Menschenfresser. Sie kamen bis zu den unbekannten Quellen des Nilstromes und in die Gebiete geheimnisvoller Zwergvölker. Wie im Fluge verging der Rest der Stunde.
Jetzt noch eine kurze Schlußandacht, und dann stürmte die Klasse hinaus in den hellen Julitag... in die großen Ferien.
Zusammen mit Fritz Lautensach und Karl Kundtke ging Klaus Kröning die Dorfstraße entlang. Die dichten Kronen mächtiger alter Linden boten hier Schutz gegen die glühende Sommersonne. Der Bach, der die Dorfaue entlang floß, um sich wenige Kilometer weiter in die Hörsel zu ergießen, gab ihnen eine willkommene Gelegenheit, in dem klaren Wasser langzutapsen. Das ging ohne weitere Umstände, denn Schuhe und Strümpfe trugen die drei im Sommer nur an Sonntagen. Jetzt blieb Fritz Lautensach stehen und stieß Klaus Kröning in die Seite.
»Sag mal, Klaus, das von dem Briefträgerwerden, das hast du doch nur gesagt, weil der Alte plötzlich so nach dem gelben Onkel schielte.«
Klaus Kröning blieb stehen und bohrte den rechten Fuß bis an den Knöchel in den weißen Bachsand.
»Da bist du aber mächtig im Irrtum, Fritz. Das war mein voller Ernst. Ich denke mir das prachtvoll. Eine schöne Uniform haben, zu allen Leuten in die Häuser kommen, ihnen Briefe bringen, das ist doch was Besseres, als hier bei den Bauern als Knecht arbeiten.
Karl Kundtke sprang auf, daß das Bachwasser in hellem Bogen spritzte.
»Hört doch, was der Klaus für ein feiner Mann ist. Briefträger will er werden. Kaiserlicher Reichspostbriefträger will der Älteste von unserem Gemeindehirten werden.«
Klaus Kröning runzelte die Stirn.
»Denkst du, ich werde dich erst um Erlaubnis fragen, wenn ich's werden will?«
»Brauchst du ja nicht«, antwortete Karl Kundtke wegwerfend.
»Kinder, vertragt euch«, suchte Fritz Lautensach zu beschwichtigen. »Die Sache hat ja noch ein paar Jahre Zeit. Du bist gerade vor vier Wochen 14 Jahre alt geworden. Also sei mal erst 20, dann kommst du zu den Soldaten, und wenn du 22 bist und den Kommiß hinter dir hast, dann kannst du ja Briefträger werden.« Er lachte laut auf. »Menschenskind! Das sind ja noch acht Jahre. Wer wird denn so weit vorausdenken.«
»Denkt ihr, was ihr wollt«, knurrte Klaus Kröning. »Und ich sage euch, ich werde doch Briefträger.«
Sie waren inzwischen bis zu den letzten Häusern des Dorfes gekommen, wo Kundtke und Lautensach wohnten. Klaus Kröning zog allein weiter. Das bescheidene Häuschen seiner Eltern—man hätte es eher Hütte als Haus nennen müssen—lag noch ein gutes Stück weiter, nur noch wenige hundert Meter von der Hörsel entfernt. Während er so fürbaß schritt, begannen seine Gedanken in die Runde zu gehen.
14 Jahre war er jetzt schon. Noch ein Vierteljahr bis Michaelis, dann hatte er die Schule hinter sich—was dann? Dann hieß es, sich bei einem Bauern des Dorfes eine Stelle suchen. Die ersten beiden Jahre als Hofjunge. Später als Jungknecht—und dann—ja, da hatte Fritz Lautensach vollkommen recht, dann kam man zu den Soldaten. Manchen gefiel es da. Die blieben dabei, wurden befördert. Andere gingen vom Militär ab, sobald ihre Zeit rum war, und blieben dann in der Stadt. Im Dorfe hörte man selten mehr von denen, und was man hörte, war nicht immer erfreulich. Und die wieder zurückkamen, die wurden dann wieder Knechte auf den Domänen oder bei den reichen Bauern—scharwerkten ihr Leben lang als Tagelöhner—nein! Klaus Kröning riß sich zusammen. Der Gedanke, Briefträger zu werden, war entschieden weit besser.
Er hatte erzählen hören, daß die Post schon damit anfing, den Landbriefträgern Fahrräder zu geben. Schöne goldgelbe Fahrräder, mit denen man schnell wie der Wind von Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus flitzen konnte. Wie schön mußte das sein, wenn man den Leuten die Post zu Rade ins Haus brachte. Wie oft hatte er sehnsüchtig, fast neidisch den Radlern nachgeschaut, die auf den jetzt eben erfundenen Niederrädern durch Seehausen kamen.
Es war kein Zweifel. Der Gedanke war gut. Klaus mußte nur erst den Weg ausfindig machen, auf dem sich das bewerkstelligen ließ. Gewiß mußte man dazu irgendwie Bekanntschaften bei der Post haben. Mächtige Fürsprecher, die einem behilflich waren—Aber wie die bekommen?
Bisher kannte er von der ganzen großen Reichspost nur den einen alten Landbriefträger, der jeden Mittag von Waltershof her nach Seehausen kam, den Knotenstock in der Rechten, die große schwarze Brieftasche an der linken Seite. Und selbst den kannte er nur vom Ansehen, denn in das Haus der Eltern war der kaum jemals gekommen.
Ernst Kröning, der Gemeindehirt von Seehausen, bekam keine Briefe. Es hätte auch wenig Zweck gehabt, ihm welche zu schicken, denn der biedere Gemeindehirt konnte weder lesen noch schreiben. Daß er trotzdem seine Herde gut zusammenhielt und jeden Abend vollzählig nach Seehausen zurückbrachte, hatte mit der Schriftgelehrsamkeit nichts zu tun.
Jetzt hatte Klaus sein Ziel erreicht. Durch einen kleinen Vorgarten, in dem Phlox und Rittersporn in voller Blüte dufteten, schritt er in das Häuschen. Zwei Räume nur. Ein größerer, in dem der Herd stand und die Lagerstätten für die sechs Kinder des Hirten aufgeschlagen waren. Ein kleinerer Nebenraum, in dem die Eltern schliefen.
Die Mutter erwartete ihren Ältesten bereits.
»Bist du da, Klaus. Kannst gleich zum Vater gehen, ihm das Essen bringen, kannst draußen mit ihm essen.«
»Ja, Mutter.«
Klaus legte seine Bücher auf die Fensterbank, ergriff die Trage mit zwei Schüsseln und machte sich auf die Wanderschaft. Es war ein ziemliches Stück Weges durch die sonnenüberfluteten Wiesen, immer den Bach entlang, der hier schon viel breiter und tiefer als im Dorfe der Hörsel zuströmte. Jetzt sah er die Herde. Blanke, schwere Kühe. Nur noch wenige Stücke standen und weideten. Die Mehrzahl hatte sich in der Mittagshitze niedergelegt und käute in stiller Behaglichkeit wieder. Ein einzelner Baum in der Nähe des Bachufers, der Schatten gab. Dort erblickte Klaus seinen Vater und ging auf ihn zu.
»Tag, Vater! Ich bringe das Essen für uns beide.«
»Ist recht so, mein Junge. Was hat denn Mutter gekocht?«
»Kartoffeln und Hering, Vater!«
»Alle Wetter, Junge, Mutter hat einen Hering gekauft?«
»Zweie, Vater. Die anderen zu Hause haben auch davon.«
»Das ist fein, Klaus! Na, da wollen wir mal essen.«
Die beiden machten sich an das Mahl. Als Kartoffeln und Hering vertilgt waren, stopfte sich Vater Kröning die kurze Pfeife. Was er da rauchte, war sein eigenes, tiefstes Geheimnis. Waldmeister, Faulbaumblätter, Kirschblätter und zu alledem sogar noch ein wenig wirklicher, richtiger Tabak von der grobschnittigen Sorte, von der der Krämer im Dorf das Pfund für 2½ Groschen verkaufte. Der Rauch dieser Mischung war ein vorzügliches Abwehrmittel gegen die Bremsen und Schnaken, und das war gut, denn so konnte der Alte, während die Pfeife langsam weiterglimmte, in ein Mittagsschläfchen verfallen, während Klaus sich um die Herde kümmerte.
Das Amt war jetzt nicht schwer zu verwalten. Die ganze Herde lag und war mit Wiederkäuen beschäftigt. Es war keine Gefahr, daß einzelne Stücke weiterlaufen und etwa in die Rübenfelder übertreten würden. So konnte Klaus seine Gedanken da weiterspinnen, wo er beim Eintritt in das Elternhaus aufgehört hatte.
Was sollte er anfangen, wenn er Michaelis von der Schule kam? Seit Wochen schon quälte ihn die Frage. Zum erstenmal war es damals über ihn gekommen, als er seinen vierzehnten Geburtstag feierte. Seitdem wollte es ihn nicht wieder loslassen.—Was konnte er unternehmen? Ein gutes Handwerk lernen. Ja, wenn man reich wäre. Dazu gehörte Geld—viel mehr, als seine Eltern hatten. Vier Jahre mußte man in die Lehre gehen—dann freilich—dann stand einem die Welt offen. Wer Schlosser gelernt hatte, der konnte in die großen Fabriken gehen, dort eine Menge Geld verdienen—aber die lange Lehre. Das war ja nicht zu machen. Fünf Geschwister noch, für die seine Eltern sorgen mußten—es war ganz ausgeschlossen. Von Michaelis an mußte er für sich selber sorgen, auf eigenen Füßen stehen...
Ein Schrei ließ ihn auffahren, dann aufspringen. Was er sah, erfüllte ihn mit Schrecken. Der Bulle, der bisher wie die übrigen Stücke ruhig gelagert hatte, war plötzlich wild geworden. Ein Fremder, der über die Weide daherkam, hatte wahrscheinlich durch seine helle Kleidung den Zorn des Stieres erregt. Der Mann hatte die Gefahr zu spät erkannt. Vergeblich suchte er sich jetzt durch rasende Flucht in Sicherheit zu bringen. Laut schreiend stürmte er auf den Baum zu, unter dem Klaus Kröning saß. Aber es war fraglich, ob er ihn noch erreichen würde. Und auch wenn er ihn erreichte, wenn es allen dreien gelang, sich rechtzeitig in die Krone zu retten, standen die Dinge immer noch schlimm genug. Dann konnten Stunden vergehen, bis das wütende Tier sich beruhigte, bis man es ohne Gefahr wagen konnte, wieder vom Baum hinabzusteigen.
In Bruchteilen von Sekunden war alles das Klaus Kröning durch den Kopf geschossen. Schon hatte er seine blaue Leinenjacke von den Schultern gerissen und rannte dem Stier entgegen. Klaus war für seine Jahre gut entwickelt, körperlich gewandt, ein vorzüglicher Springer und Läufer, öfter als einmal war er hier auf der Wiese mit kurzem Anlauf glatt über eine weidende Kuh hinweggesprungen. So konnte er das tollkühne Stück wagen, zu dem er sich jetzt anschickte.
In Riesensätzen hatte er den Stier erreicht. Der beachtete ihn nicht, stürmte in blinder Wut dem Fremden nach. Mit jähem Ruck schwenkte Klaus jetzt um, rannte dicht neben dem Stier her. Einen Moment nur, dann lag die Jacke über dem Stierkopf, die beiden Ärmel über die beiden mächtigen Hörner gezogen, das Jackentuch vor dem Gesicht des Bullen.
Und dann war es geschehen. In dem Moment, in dem das dunkle Tuch ihn blendete, schien alle Wut und Angriffslust von dem Stier abgefallen zu sein. Jählings blieb er stehen, schüttelte wild den Kopf, um das unbekannte Hindernis abzuwerfen. Aber Klaus hatte ihm die Jacke so gut verpaßt, die Ärmel so sicher über die Hörner gezogen, daß das nicht ging. Hilflos stand das mächtige Tier auf dem Rasen.
Ein neuer Schrei ließ Klaus Kröning auffahren. Bis jetzt hatte seine ganze Aufmerksamkeit dem Stiere gehört. Keinen Blick hatte er für den Fremden übrig gehabt. Jetzt wandte er sich nach dem um. Kaum zehn Meter von ihm entfernt war der gestolpert, hingestürzt. Hatte im Sturze noch einmal in höchster Todesangst aufgeschrien.
Klaus Kröning lief auf ihn zu. Der starrte ihn wie geistesabwesend an.
»Der Stier!... Die Bestie!... Wo ist der Stier?« kam es röchelnd von seinen Lippen.
»Dahinten, Herr!—Tut Ihnen nichts!«
Der Blick des Fremden ging nach der Richtung, in die Klaus deutete.
»So nah der Stier!« Entsetzt wollte er aufspringen, weiterfliehen. Klaus hielt ihn am Arm zurück.
»Der tut Ihnen nichts, Herr!... kann nichts sehen... das Tuch um die Augen...«
Klaus stieß die Worte keuchend hervor. Auch sein Herz ging in wilden Schlägen. Es war ein Rennen auf Leben und Tod gewesen. Das letzte hatten die Muskeln und Sehnen dabei hergeben müssen. Um die Sekunde war es gegangen. Jetzt stand er und atmete in tiefen Zügen. Allmählich beruhigten sich seine Lungen. Er konnte wieder zusammenhängend sprechen, sich um den Fremden kümmern.
Den hatte das Abenteuer schlimmer mitgenommen. Als jetzt die Gefahr vorüber, kam die Reaktion. Mit einem Seufzer sank er ohnmächtig zusammen. Eine tiefe Blässe bedeckte seine Züge.
Klaus sprang auf und lief zum Bach. Schnell war er wieder zurück, trug eine wassergefüllte Schüssel in den Händen. Sorgsam bettete er den Fremden, daß dessen Kopf auf einer kleinen Bodenerhebung zu liegen kam. Begoß ihm Stirn und Schläfen mit dem kühlen Bachwasser und sah, wie nach langen Minuten die tödliche Blässe zu weichen begann und das Leben in die Gestalt des vor ihm Liegenden zurückkehrte. Jetzt versuchte er sich zu erheben. Von Klaus gestützt, gelang es ihm. Schritt um Schritt geleitete Klaus ihn bis zu dem Baume, ließ ihn dort wieder im Schatten niedersitzen.
»Erholen Sie sich, Herr!«
Er ging wieder zum Bache, holte eine neue Schüssel voll Wasser. In langen Zügen trank der Fremde. Das klare kalte Wasser tat ihm wohl. Zusehends kehrten ihm die Kräfte zurück.
»Erholen Sie sich, Herr. Wenn Sie sich kräftig genug fühlen, will ich Sie über die Weide zur Landstraße bringen, wo Sie in Sicherheit sind.«
Die Stimme Klaus Krönings ließ den Gemeindehirten aus seinem Schläfchen auffahren.
»Mit wem redest du da, Klaus? Ist jemand gekommen?«
»Ja, Vater, ein Fremder. Ich habe ihn hierhergebracht. Der Stier wollte wild werden.«
Der Hirt wandte sich zu dem Fremden.
»Ja, wie kann der Herr aber auch mitten durch die Herde über die Gemeindewiese gehen. Man weiß doch, daß mit dem Bullen nicht zu spaßen ist.«
»Weiß Gott, da habt Ihr recht, Alter. Es war kein Spaß. Ohne Euren Sohn hier stünde es jetzt wohl übel um mich. Ein kluger, tapferer Junge. Ist's Euer Einziger?«
»Nein, Herr, der Älteste von Sechsen.«
»Klaus heißt du?«
»Jawohl, Herr, Klaus Kröning.«
»Gut, Klaus, ich bin dein Schuldner. Du hast mir das Leben gerettet. Ohne dich...« der Fremde bedeckte die Augen mit der Hand. Ein leises Schauern ging durch seinen Körper, als käme ihm erst jetzt die ganze fürchterliche Gefahr zum Bewußtsein.
»Höre, Klaus. Bezahlen kann ich dir meine Schuld nicht. Ein Leben ist unbezahlbar. Aber man soll nicht sagen, daß Baumeister Jensen nicht wenigstens versucht hätte, nach Möglichkeit abzuzahlen. Also raus mit der Sprache! Was treibst du jetzt?«
Klaus sah den Fremden zweifelnd an.
»Jetzt... jetzt, Herr Baumeister, gehe ich in die Schule von Seehausen und... nein, jetzt sind ja Ferien... und in meiner freien Zeit helfe ich dem Vater auf dem Acker und bei der Herde «
Baumeister Jensen musterte prüfend die kräftige, gut entwickelte Gestalt Klaus Krönings.
»Du siehst mir so aus, Klaus, als ob du in der obersten Klasse säßest und bald mit der Schule fertig wärst.«
»So ist's, Herr Baumeister. Zu Michaelis bin ich fertig.«
»Und was dann, Klaus? Hast du dir schon irgendeinen Plan gemacht?«
Klaus zuckte die Achseln. Sollte er dem Fremden erzählen, was er heute vormittag seinen Mitschülern gesagt hatte? Er setzte an und stockte wieder. Irgendwie erschien ihm der Plan, den er vor kurzem noch so eifrig verteidigt hatte, gar nicht mehr so erstrebenswert.
»Na! Raus mit der Sprache, Klaus. Irgend etwas scheinst du dir doch schon vorgenommen zu haben.«
Eine flüchtige Röte huschte über die Züge Klaus Krönings.
»Ja, Herr Baumeister, ich hatte wohl einen Plan. Ich wäre gern Briefträger geworden. Aber ich glaube, das ist sehr schwer. Wenn man keine Freunde bei der Post hat, kommt man da kaum an.«
Baumeister Jensen blickte amüsiert auf den Jungen.
»Weißt du, Klaus, das ließe sich am Ende schon machen. Ich habe einige gute Freunde bei der Post, die das vermitteln könnten.«
»Wirklich, Herr Baumeister, das wäre ja herrlich. Ich wäre Ihnen so dankbar.«
»Das mag ja alles ganz gut sein, Klaus. Gewiß ist Briefträger ein hübscher Beruf, aber eigentlich habe ich andere Pläne für meinen Lebensretter. Wir wollen es uns mal in aller Ruhe überlegen, ob sich für dich nicht am Ende etwas Geeigneteres findet und du eine höhere Stufe erklettern kannst.«
Noch etwas Besseres? Klaus starrte den Baumeister ganz verwundert an. Seine Gedanken und Wünsche begannen sich zu überschlagen. Welche Zukunftsaussichten deutete der Fremde ihm da an. Sollte ihm am Ende doch die Möglichkeit gegeben werden, eine ordentliche Lehre durchzumachen, ein tüchtiges Handwerk zu lernen?
Der Baumeister sprach weiter. »Du hast ja jetzt Ferien. Zeit in Hülle und Fülle, wir wollen uns das in aller Ruhe überlegen. Ich selbst habe noch die nächsten Wochen hier in der Gegend zu tun. Du sollst mich dabei begleiten. Dann, wenn ich dich kennengelernt habe, wollen wir unsere Entschlüsse fassen. Einverstanden, Klaus?«
»Ja, Herr Baumeister.«
»Dann schlag ein, Klaus.«
Baumeister Jensen streckte Klaus Kröning die Hand entgegen. Der legte seine Rechte hinein.
»Abgemacht, Klaus, wenn dein Vater nichts dagegen hat.«
Der Hirt nickte.
»In Gottes Namen, Herr.«
»Gut. Morgen ist Sonntag. Morgen arbeiten wir nicht. Frage morgen früh um acht in dem Gasthaus zur Post in Waltershof nach mir. Und jetzt bringe mich hier sicher von der Wiese weg auf die Straße.«
»Sag mal, Karl, was ist denn mit dem Ältesten von unserem Gemeindehirten los? Man bekommt ihn gar nicht mehr zu sehen.«
Fritz Lautensach stellte die Frage an Karl Kundtke, der gerade damit beschäftigt war, ein Stückchen roten Fries an eine Angelschnur zu knüpfen.
»Nanu Fritze, du weißt doch sonst alle Neuigkeiten. Hast du nichts davon gehört? Klaus hat eine Anstellung bekommen,« Während er das sagte, warf Kundtke das Ende der Schnur mit dem roten Lappen in das Bachwasser.
»Eine Anstellung bekommen?—Wo denn? Wie denn?«
»Ja, der Kerl hat mächtiges Glück gehabt. Irgendwie hat er die Bekanntschaft mit einem Baumeister von der Bahngesellschaft gemacht. Du weißt doch, daß wir hier eine Bahn herkriegen sollen. Und der Baumeister hat ihn... hallo hopp!...«
Karl Kundtke zog die Schnur aus dem Wasser heraus. Ein großer Frosch hatte nach dem roten Läppchen geschnappt, hielt es mit den Kiefern krampfhaft fest und ließ sich aus dem Wasser herausholen.
»So, da hätten wir wieder einen.«
»Laß doch den dummen Frosch.«
»Bist selber ein Frosch«, gab Kundtke schlagfertig zurück.
»Ach was, erzähle doch lieber. Was hat denn Klaus da zu tun, und vor allen Dingen, bekommt er was für seine Arbeit?«
Karl Kundtke steckte den Frosch in die Botanisiertrommel.
»Dumme Frage! Natürlich bekommt er was dafür. Denk dir mal, eine blanke Mark pro Tag.«
»Donnerwetter, eine Mark, jeden Tag, da muß er ja reich werden. Was hat er denn dafür zu tun?«
Karl Kundtke hängte sich die Botanisiertrommel um und wickelte seine Schnur zusammen.
»Geschenkt bekommt er das Geld nicht. Er arbeitet bei einem Feldmesser, der hier die Bahnstrecke ausmißt. Wenn wir den Bach weiter runtergehen, können wir ihn vielleicht bei seiner Arbeit beobachten.«
»Gut, Karl, das wollen wir machen.«
Die beiden wanderten den Bach entlang und näherten sich den Hörselwiesen. Plötzlich blieb Kundtke stehen und deutete in die Ferne.
»Kannst du sehen? Da hinten.«
Fritz folgte der Richtung des ausgestreckten Armes. Da, weit hinten auf der Wiese war ein großer gelber Sonnenschirm aufgestellt. Darunter stand ein Mann vor einem dreibeinigen Stativ, das eine Tischplatte und darüber eine Art von Fernrohr trug. Der Mann machte mit beiden Händen abwechselnd Zeichen.
»Was hat denn der? Was bedeutet das?« fragte Fritz Lautensach.
»Das gilt unserem Freunde Klaus. Sieh mal da weiter, etwa zweihundert Meter nach rechts, da kannst du ihn wie einen Frosch auf der Wiese herumspringen sehen.«
Fritz Lautensach kniff die Augen zusammen, um schärfer sehen zu können. Es war in der Tat Klaus Kröning, der dort in weiter Ferne durch das Gras lief, eine Meßlatte in der Hand, ein weiteres halbes Dutzend davon unter dem linken Arm. Jetzt blieb er stehen. Ein neuer Wink von dem Manne unter dem Schirm her. Er stieß die eine Latte senkrecht in den Boden und trabte mit den anderen weiter.
Eine ganze Weile standen Karl Kundtke und Fritz Lautensach und beobachteten die Tätigkeit ihres Kameraden.
»Na Karl, sehr kurzweilig stelle ich mir das nicht vor, den ganzen Tag auf der Wiese rumlaufen und Stäbe in den Boden zu stecken. Frösche fangen macht mehr Spaß.«
Karl Kundtke bewegte nachdenklich den Kopf.
»Das schon, Fritz. Aber denke doch mal, eine Mark den Tag. Was der Klaus sich da zusammensparen kann. Der ist ja ein reicher Mann, wenn die Schule wieder anfängt.«
Karl Kundtke begann zu rechnen und genierte sich nicht, die Finger dabei zu Hilfe zu nehmen. Kantor Wendelmut wäre sicher entrüstet gewesen, wenn er es gesehen hätte.
»Ich sage dir, Fritz, er wird wohlhabend. Sechs Wochen Ferien, die Woche zu sechs Tagen, 6x6... Menschenskind, der hat ja 36 Mark, wenn die Ferien vorbei sind.«
Fritz Lautensach zuckte abweisend mit den Schultern. »Ach was, das Geld darf er ja nicht behalten. Das muß er doch seinem Alten abliefern. Dafür verdirbt er sich die ganzen Ferien und nachher ist's wieder so, wie's war.«
Karl Kundtke schüttelte den Kopf.
»Du, das glaube ich nicht. Der Klaus bleibt dabei. Der bleibt bei der Eisenbahn. Der geht nicht mehr zum Bauern, wenn wir die Schule hinter uns haben.«
Hätte Karl Kundtke in diesem Moment die Gedanken Klaus Krönings gekannt, er wäre nicht so fest davon überzeugt gewesen, daß der dabei bleiben würde. Klaus war jetzt fünf Tage dabei als Gehilfe des Landmessers Wendt, der ihn auf den Wunsch des Baumeisters Jensen angenommen hatte. Fünf Tage, in denen er mehr gelaufen und gesprungen war als früher in fünf Wochen. Schon am frühen Morgen begann die Arbeit. Da zogen die beiden aus und Klaus hatte einen leichten Handwagen zu ziehen, der mit dem ganzen Feldmeßgerät beladen war. An der letzten Latte, die sie am vorangegangenen Tage gesteckt hatten, machten sie halt. Hier wurde der Schirm aufgestellt und darunter der Stativtisch mit dem wunderlichen Fernrohr. Einen Theodolithen nannte Feldmesser Wendt das Ding. Dann ging die Arbeit los, eine Arbeit, die für Klaus hauptsächlich im Laufen bestand.
Aber wie mußte er laufen. Das hatte ihm Wendt gleich am ersten Tage beigebracht.
»Klaus, mein Junge«, hatte der zu ihm gesagt, »die Hauptsache ist, daß ein Feldmesser einen konstanten Schritt besitzt. Ja, du hast natürlich keine Ahnung, was das bedeutet. Also jetzt marschiere mal geradeaus auf die Pappel da zu und zähle dabei deine Schritte. Du mußt ganz natürlich marschieren, wie du immer zu gehen pflegst. Beim hundertsten Schritt bleibst du stehen und drehst dich zu mir um.«
Klaus hatte das getan. Dann war der Feldmesser ihm nachgegangen, wobei er die eigenen Schritte ganz automatisch zählte, hatte etwas in sein Notizbuch geschrieben, einen Bruch, soviel Klaus sehen konnte, und dann hatte sich das gleiche Experiment noch ein halbes Dutzend mal wiederholt. Darauf hatte Wendt ihn einen Blick in das Notizbuch tun lassen, in dem sechsmal hintereinander der gleiche Bruch geschrieben stand.
»Du hast einen ganz guten Schritt, mein Junge. Vielleicht kann aus dir noch mal was werden. Aber merk es dir und beherzige es. Immer genau so gehen, wie du jetzt gegangen bist und immer die Schritte zählen... genau zählen, sonst hat die Sache keinen Zweck.«
Und dann war die Arbeit angegangen. In einer bestimmten Richtung wurde Klaus ins Feld geschickt. Sobald er um ein geringes abwich, brachte ihn Wendt durch Zurufe wieder auf den richtigen Kurs. Alle hundert Schritt mußte er eine Latte stecken, während der Feldmesser dazu seine Eintragungen auf der Karte machte. Wenn dann wieder so eine Strecke von etwa einem Kilometer abgesteckt war, dann fing die Lauferei von Klaus erst so richtig an. Dann hieß es die Grenzsteine auf den Wiesen suchen, die jetzt im hohen Gras besonders schwer zu finden waren. Bei jedem Stein mußte er mit einer Latte Aufstellung nehmen und stramm stehen, während Wendt mit dem Theodolithen visierte, Winkel maß und seine Richtlinien auf der Karte eintrug.
Das strengte Sehnen und Muskeln ganz gehörig an. Wenn der Tag vorüber war, schmerzten Klaus alle Gelenke. So anstrengend hatte er sich seine Tätigkeit bei der Eisenbahngesellschaft doch nicht vorgestellt. Die ersten Tage wollte er fast verzweifeln. Aber schon in der zweiten Woche merkte er, wie sein Körper sich unter dieser Anstrengung zu kräftigen begann. Er lernte das kennen, was der Sportsmann als Training bezeichnet. Von Tag zu Tag wurde ihm die Arbeit leichter, und dann kam etwas dazu, was er bald gar nicht mehr missen mochte, die mittägliche Plauderstunde mit dem Feldmesser Wendt.
Die Trassierungsarbeiten mußten ja zum größten Teil in so weiter Entfernung von bewohnten Ortschaften ausgeführt werden, daß es nicht möglich war, zum Essen in irgendein Wirtshaus zu gehen. Da hieß es dann die mitgebrachten Vorräte im Freien verzehren, und während dieser einen Stunde wurde Wendt gesprächig und unterhielt sich gern mit seinem jungen Gehilfen. In den ersten Tagen hatte er sich nur über die Verhältnisse von Klaus erkundigt, nach seinen Eltern und seinem bisherigen Leben gefragt. Dann aber, als er sah, daß Klaus mit Lust bei der Sache war, begann er ihn in die Geheimnisse der Feldmesserkunst einzuweihen, und ohne daß er es recht merkte, lernte Klaus an jedem Tage von ihm.
Da war dieser geheimnisvolle Apparat auf dem Plantisch. Ein Fernrohr?—Gewiß! Wendt ließ ihn hindurchschauen, drehte das Rohr nach allen Seiten. Klaus staunte. War es doch das erstemal, daß er durch solch ein Rohr blickte. Immer wieder wunderte er sich darüber, wie handgreiflich nahe die fernen Dinge durch dies kleine Rohr herankamen.
Aber das war nur der Anfang. Wendt machte ihm bald klar, daß dies Fernrohr eigentlich nur ein nebensächlicher Teil des ganzen Apparates sei, daß man es zur Not auch durch einen einfachen Visierstab ersetzen könne. Und dann wies er ihm die Gradeinteilungen an dem Theodolithen. Zeigte ihm, wie man mit Hilfe der an dem Apparat montierten Magnetnadel den Winkel jeder Visierlinie mit der Nord-Süd-Linie messen könne. Wie man mit Hilfe der Libelle auch die Höhenunterschiede bis auf Zentimeter zu ermitteln vermöge. Schon in der zweiten Woche kannte Klaus den Theodolithen in allen seinen Einzelheiten, und in der dritten Woche hätte er es sich wohl zugetraut, selbst damit zu arbeiten.
Daran war ja nun vorläufig nicht zu denken, aber er wußte doch jetzt wenigstens, was es mit seinen verschiedenen Märschen und Gängen über die Felder auf sich hatte, was es zu bedeuten hatte, wenn er bald hier, bald dort Grenzsteine aufsuchen und markieren mußte. Und mit dem Verständnis wuchs die Liebe zur Arbeit.
Wie im Fluge vergingen die Tage. Schon war die letzte Ferienwoche angebrochen. Rüstig waren in dieser Zeit die Trassierungsarbeiten um viele Kilometer fortgeschritten. Immer länger und beschwerlicher wurde für Klaus der Weg zwischen dem Elternhaus und seiner Arbeitsstelle. Außerdem machte er sich Gedanken, wie es nun am Ende der Ferien weiter werden solle. Die Schule—morgens von 7 bis 11—dazu zweimal in der Woche von 2 bis 4—er sah keine Möglichkeit, wie er gleichzeitig die Schule besuchen und bei der Eisenbahn bleiben könne.
Gelegentlich hatte er seine Sorgen und Zweifel in der Mittagspause dem Feldmesser zu offenbaren versucht. Aber der war jedesmal mit ein paar Scherzworten darüber hinweggegangen.
»Laß nur, Klaus! Das findet sich alles beim Ausfegen. Das werden wir schon zur rechten Zeit ins Lot bringen. Du hast in Baumeister Jensen einen Freund, der dir wohl will.«
Ja, Baumeister Jensen—den hatte Klaus seit jenem Sonntag im Gasthaus zur Post nicht wiedergesehen. Wo mochte der jetzt wohl stecken?
Als die Arbeit an diesem Tage vollendet war, machte sich Klaus auf den Heimmarsch. Reichlich zwei Meilen hatte er zu marschieren. Jetzt sah er den Kirchturm von Seehausen, jetzt hatte er die Dorfstraße erreicht. Unwillkürlich ging er schneller, wie ein Pferd, das die Nähe des Stalles wittert. Nun noch eine letzte Wegbiegung, und das Haus lag vor ihm. Da plötzlich stutzte er, blieb stehen, beschattete die Augen mit der Hand, blickte schärfer. Standen dort nicht zwei Männer im Vorgarten—nein, drei sogar, der eine davon sein Vater. Der andere, das war doch sein Lehrer, der alte Kantor Wendelmut. Und der dritte... Klaus stieß einen Freudenschrei aus und lief auf das Haus zu. Der dritte, das war ja der Baumeister Jensen, der da mit den beiden anderen sprach. Klaus trat in den Garten. Beim Eintritt bemerkte er ein funkelnagelneues Fahrrad, das an der Wand lehnte. Offenbar war Jensen damit gekommen.
»Hallo Klaus, da bist du ja!« Der Baumeister streckte ihm die Hand entgegen.
»Herr Baumeister, wie freue ich mich, Sie zu sehen.«
»Die Freude ist ganz auf meiner Seite, mein Junge. Ich habe gehört, daß dir's bei der Eisenbahn gefällt und daß du deine Sache gut machst.«
Klaus wurde rot bei dem Lob.
»Ja, Herr Baumeister, ich bin gern dabei... aber...« Er warf einen Seitenblick auf den Kantor. Baumeister Jensen fing ihn auf und lachte.
»Ich kenne deine Sorgen, Klaus. Herr Wendt hat mir davon erzählt. Nun wird's Zeit, daß wir die Sache ins reine bringen. Was meinen Sie, Herr Kantor?«
Justus Wendelmut schob die Brille auf die Stirn und blickte Klaus prüfend an.
»Es ist so, wie ich's Ihnen sagte, Herr Baumeister. Der Junge ist ein guter Schüler und sitzt schon das zweite Jahr in der ersten Klasse. Viel lernen kann er bei mir nicht mehr. Wenn Sie ihm Gelegenheit geben, sich neben seiner Arbeit weiterzubilden, so will ich ihn schon jetzt in Gottes Namen von der Schule dispensieren.«
Klaus Krönings Augen leuchteten auf. Mit einem Schlage sah er die Sorge, die ihn die letzten Wochen bedrückt harte, schwinden. Baumeister Jensen sprach weiter.
»Dann sind wir also einig, Klaus, daß du bei der Eisenbahn bleibst. Schlag ein.«
Freudig schlug Klaus in die dargebotene Hand.
»So, mein Junge, das wäre abgemacht. Nun zu Punkt zwei unserer Tagesordnung. Die Trassierung geht immer weiter, die Wege werden für dich immer länger.«
»Oh, Herr Baumeister, ich laufe gerne.«
»Du hast genug bei der Arbeit zu laufen. Zeit ist Geld. Auf dem Rade kommst du in 15 Minuten so weit wie zu Fuß in einer Stunde. Also da schau her, das Rad dort ist deins.«
Seine Freude war so groß, daß er erst nach einiger Zeit Worte des Dankes finden konnte. Jensen wehrte lächelnd ab.
»Laß gut sein, Klaus. Das geschah im Interesse unserer Gesellschaft. Es liegt uns daran, daß du frisch bei der Arbeit bist und nicht schon halb kaputt ankommst. Die Hauptsache ist jetzt, daß du auch fahren lernst. Das Rad allein tut's ja nicht.«
Der Sommertag ging zur Neige. Schon war die Sonne hinter den Bergkämmen im
Westen versunken, und die Schatten begannen zu wachsen.
»Sieh mal, da!« Während er die Worte ausstieß, packte Karl Kundtke seinen Freund Fritz Lautensach am Arm, daß er am nächsten Tage blaue Flecke hatte. Ärgerlich riß er sich los.
»Was soll ich denn sehen? Meinst du den Radfahrer da? Die sind doch keine Seltenheit mehr.«
»Radfahrer da?... Mensch, sperr doch die Augen auf. Hast du nicht gesehen, wer's war?«
»Keine Ahnung. Woher soll ich jeden Radfahrer kennen?«
»Na, dann paß jetzt auf. Dahinten kommt er zurück. Sieh ihn dir ordentlich an.«
In der Ferne tauchte ein blinkendes Rad auf und kam schnell näher. Wie ein Wirbelwind sauste der Fahrer an ihnen vorüber. Fritz Lautensach stand da und sperrte Mund und Nase auf.
»Ist das?... war das nicht...?«
»Klaus Kröning war's! Hast du's endlich begriffen?«
»Ja, aber... wie kommt der zu einem Rad?... Wo hat er fahren gelernt?«
»Keine Ahnung. Ich weiß es sowenig wie du.«
Fritz Lautensach kratzte sich bedenklich hinterm Ohr.
»Na, wenn wir ihn nicht vorher sehen, in vier Tagen fängt ja die Schule an. Da muß der Duckmäuser mit seinen Geheimnissen rausrücken.«
Die Wochen summten sich zu Monden. Schon flog der Altweibersommer durch das Thüringer Land, und die Kastanien begannen zu vergilben.
Einmal hatte der alte Landbriefträger doch den Weg in die Hütte des Gemeindehirten gefunden. Als Klaus am Abend von der Arbeit nach Haus kam, hielt sein Vater einen Brief in der Hand.
»Klaus, mein Junge, ich habe hier einen Brief bekommen. Weiß der Himmel, wo Mutter wieder meine Brille verkramt hat. Lies du mir mal vor.«
Klaus unterdrückte ein Lächeln.
»Gerne, Vater, gib nur her.« Er ergriff den Brief, las die Aufschrift: An Herrn Klaus Kröning.
Er stutzte. Der Vater hieß doch Ernst.
»Na, Junge, nu lies doch endlich! Das sieht ja beinahe aus, als ob du nicht lesen kannst«, rief der Alte ungeduldig.
»Der Brief ist nicht an dich, Vater.«
»Nicht an mich? Warum hat ihn denn der Briefträger hier abgegeben?«
Unschlüssig bewegte Klaus den Briefumschlag zwischen den Händen. Erst jetzt bemerkte er den Stempel auf der Rückseite: Voßberg & Co., Eisenbahngesellschaft. Ein jäher Schreck durchzuckte ihn. Was hatte die Gesellschaft ihm schriftlich mitzuteilen. Er riß den Brief aus dem Umschlag und las mit stockender Stimme:
»Herrn Klaus Kröning!
Wir teilen Ihnen hierdurch mit, daß wir Ihnen für die Zeit, in der Sie mehr als 30 km von Seehausen entfernt für uns tätig sind, eine tägliche Zulage von 2 Mark ausgeworfen haben.
Hochachtungsvoll Voßberg & Co.«
»Was soll das bedeuten, mein Junge?« fragte der Alte verwundert. Er bekam keine Antwort. Klaus ließ den Kopf auf die Arme sinken und konnte die Tränen nicht zurückhalten.
Von diesem Tage an begann ein neues Leben für ihn. Nun fuhr er des Abends
nicht mehr nach Haus, sondern blieb mit dem Landmesser Wendt zusammen im
Gasthaus des Dorfes, das ihrer augenblicklichen Arbeitsstelle jeweils am
nächsten gelegen war. Nur noch des Sonntags kam er nach Seehausen, dann sahen
ihn seine alten Kameraden auf dem Rade durch die Dorfstraße dahinsausen und
zerbrachen sich den Kopf, wo er wohl stecken, was er wohl treiben
möge.—
Immer weiter war die Trassierung der Bahnstrecke inzwischen fortgeschritten.
Schon befanden sie sich in Gegenden, die Klaus nicht kannte, in die er früher
niemals gekommen war.
Bedenklich schüttelte Wendt den Kopf, brummte einige unverständliche Worte vor sich hin.
»Was haben Sie, Herr Wendt?«
»Nichts Besonderes, Klaus. Nur daß der Teufel hier Bahnlinien trassieren soll. Ich fürchte, wir kommen ganz scheußlich in die Soße.«
Die Bemerkung des Feldmessers war nicht unbegründet. Sie befanden sich jetzt in der Nähe von Reinhardsbrunn und Georgental. Kristallklar und rauschend strömen hier eine große Zahl von Gebirgswassern zu Tale. Sobald sie aber in die Ebene kommen, verlangsamen sie ihren Lauf, beginnen zu stagnieren und verwandeln weite Flächen in Sumpfland. Das war es, was Wendt zu seinem Ausruf veranlaßte.
Über eine Länge von etwa 500 Metern mußte die Strecke durch den Sumpf geführt werden. Zweifelnd betrachtete Klaus das Gelände, über dessen tückischen Charakter das reichlich sprießende Wollgras keinen Zweifel ließ.
»Wie soll hier jemals eine Eisenbahn fahren, Herr Wendt?«
Der Feldmesser schüttelte den Kopf.
»Das ist eine spätere Sorge, Klaus. Man wird zuerst einen tiefen Graben anlegen, der dem Moor einen guten Abfluß in das tiefere Gelände ermöglicht und den Sumpf trockenlegt. Dann wird man einen Sanddamm schütten, wie man es in solchen Fällen immer tut. Der Sand wird durch sein Gewicht den Moorboden zur Seite drücken. Nach einiger Zeit wird der Damm mit seiner Sohle den festen, tragfähigen Untergrund erreicht haben, und dann werden die Züge auf seiner Krone sicher über diese Wiese rollen.
Das werden unsere Leute später schon ganz richtig besorgen. Bedenklich ist es, daß wir jetzt durch den Sumpf hindurch unsere Trasse abstecken müssen.«
Heute mußte der Handwagen zurückbleiben. Auch Stiefel und Strümpfe ließ Klaus zurück und brachte die einzelnen Sachen in mehrfachen Gängen zu dem von Wendt bezeichneten Punkt.
Es ging besser als er dachte. Leichtfüßig von einem kräftigen Grasbüschel zum anderen tretend, gelangte er glücklich zu der gewünschten Stelle, und bald waren Schirm und Stativ aufgestellt. Bedeutend schwieriger war das, was Klaus mit seinen 110 Pfund Körpergewicht glückte, für den erheblich schwereren Feldmesser. Bedenklich schwankte der Boden unter dessen Tritten. Aber Klaus hatte auf seinen wiederholten Gängen einen einigermaßen sicheren Pfad ausfindig gemacht, und unter seiner Führung kam auch Wendt glücklich zu seinem Plantisch. Gemächlich ließ er sich nieder und griff in die Brusttasche, um sein Reißzeug herauszuholen. Griff in diese und in andere Taschen. Vergeblich—das Reißzeug war nicht da. Jetzt fiel es ihm auch ein. Am Kaffeetisch hatte er es gegen seine sonstigen Gewohnheiten herausgezogen, offenbar vergessen, es wieder einzustecken.
Das Reißzeug war unentbehrlich. Ohne Zirkel und Feder konnte er nicht trassieren. Aber der Schaden ließ sich leicht kurieren. Mit dem Rade konnte Klaus in zehn Minuten im Gasthaus sein, das vermißte Stück herbeiholen. Während Klaus auf seiner Maschine davonsauste, steckte Wendt eine Zigarette an und ließ seine Blicke in die Runde gehen.
Schön war das Thüringer Land hier. Besonders schön in diesen klaren Herbsttagen. In allen Farben und Tinten vom leuchtenden Rot und Gelb bis zum tiefen Grün schimmerte das Laub der wilden Obstbäume an den Berghängen. In weiter Ferne hob sich die dunkelblaue Silhouette des Thüringer Waldes vom Horizont ab. In tausend Reflexen spielte die goldene Oktobersonne über dem Ganzen.
Tief atmend sog der Feldmesser die würzige Herbstluft ein, schloß dann für Minuten die vom Schauen gesättigten Augen.
Ein Gefühl der Kälte an den Füßen riß ihn aus seinen Sinnen. Er blickte nach
unten und sah, daß er bis zu den Knöcheln im klaren Wasser war. Eben noch bis
zu den Knöcheln—jetzt schon bis zu den Waden—bis zu den
Knien.
Unter der dauernden Belastung hatte die dünne Rasendecke, die hier auf dem flüssigen Moor schwamm, sich allmählich gesenkt und eine Mulde gebildet, die sich langsam mit dem aufsteigenden Wasser füllte.
Unwillkürlich machte Wendt eine jähe Bewegung, um aus der Mulde heraus auf trockenen Boden zu kommen. Da geschah das Unglück. Die dünne Pflanzendecke zerriß. Er fühlte, daß seine Füße keinen Widerstand mehr fanden und stürzte. Bis zur Brust stürzte er in das flüssige Moor hinein. Mit knapper Not gelang es ihm im letzten Augenblick, mit ausgebreiteten Armen den Sturz abzubremsen. Sonst hätte sich wohl die grüne schwimmende Decke über ihm geschlossen. Spurlos wäre er in der schaurigen Tiefe versunken, der Sumpf hätte ein neues Opfer gehabt.
Aber auch jetzt war die Lage verzweifelt. Bis zur Brust steckte er in einem dünnflüssigen Moorbrei. Nur mit Mühe konnte er sich mit den Händen auf der zerrissenen Rasendecke so weit abstützen, daß er den Mund über dem Wasser behielt. Jeder Versuch, sich mit eigener Kraft herauszuarbeiten, verschlimmerte die Lage. Er fühlte, wie die Rasendecke unter seinen Fingern immer weiter riß, wie jede Beinbewegung ihn immer weiter in die Tiefe zog.
Kälte und Hitze jagten durch seinen Körper. Schweißtropfen standen auf seiner Stirn. Seine Glieder begannen in dem eisigen Moorwasser zu erstarren. Er fühlte, wie seine Kräfte nachließen. Nur noch mit äußerster Anstrengung vermochte er den Mund über Wasser zu halten. Wie lange noch, und er würde den letzten Halt verlieren, in die grundlose Tiefe versinken. Seine Gedanken begannen zu wandern. In traumhaften Bildern zog sein bisheriges Leben an ihm vorbei. Die Sinne begannen ihm zu schwinden.
Klaus sprang vom Rade und eilte in die Gaststube. Da stand der Kaffeetisch noch so, wie sie ihn verlassen hatten. Die Zeitung neben dem Korb mit den Brötchen. Das Reißzeug war nicht zu sehen. Er stürmte nach oben in Wendts Zimmer. Kehrte alle Schubladen und Fächer um. Auch hier nichts. Wo konnte es sein? Sollte Wendt es etwa unterwegs verloren haben? Noch einmal ging er in die Gaststube—instinktiv schob er die Zeitung zur Seite. Da lag das schwarze Kästchen. Weil die Zeitung es so vollständig verdeckte, hatte Wendt wohl vergessen, es mitzunehmen. Eilig ließ er es in die Tasche gleiten und sprang auf die Maschine. Wertvolle Minuten hatte er beim Suchen verloren. Die wollte er jetzt wieder einholen. Mit aller Gewalt trat er in die Pedale und sauste die Landstraße entlang. Dahinten an der Biegung kam die Wiese in Sicht. Im 30-Kilometertempo jagte er darauf zu. Jetzt sah er den Handwagen, jetzt war er neben ihm, sprang ab und schaute nach Wendt aus.
Wo war der geblieben? Dort in der Richtung mußte er doch sitzen. Klaus kniff die Augen zusammen, um schärfer zu sehen.
Dahinten—ja—da hob sich ein Stückchen Gelb aus dem Grün der Wiesenfläche—Wendts Schirm?—Aber wo war Wendt?—War er verunglückt, im Moor versunken?
Im Augenblick hatte Klaus Schuhe und Strümpfe abgeworfen, griff ein paar Meßlatten und drang auf dem tragfähigen Pfad zu der Unglücksstelle vor.
Jetzt sah er auch Wendt—das wenige, was von dem noch zu sehen war. Mit Aufbietung seiner letzten Kräfte hielt der Feldmesser den Kopf noch eben so weit empor, daß er zu atmen vermochte. Schnell war Klaus bei ihm.
»Herr Wendt, halten Sie aus! Noch einen Augenblick.«
Er legte sich der Länge nach auf den Boden, kroch dicht heran und schob dem Verunglückten eine Latte hin. Der wollte sie greifen, sich daran klammern, aber die Kräfte verließen ihn. Noch tiefer sank er bei der schwachen Bewegung. Jetzt verschwand sein Kopf in dem trüben Wasser. Ein paar Blasen stiegen auf.
Verzweifelt kroch Klaus weiter vor, die Latten hinter sich nachziehend. Auch unter ihm senkte sich die schwimmende Decke. Schon lag er vollkommen im Wasser. Aber er fühlte, wie das Wasser seinen Körper trug. Und jetzt—keine Sekunde zu früh—gelang es ihm, die erstarrte Hand Wendts zu packen. Vorsichtig zurückkriechend suchte er den schweren Körper des Feldmessers hinter sich herzuziehen. Die erste kurze Strecke glückte es. Er brachte es dahin, daß Wendt mit dem Munde wieder über dem Wasserspiegel war, zerrte den Bewußtlosen bis an den Rand der Einbruchsstelle. Dann aber merkte er mit Schrecken, daß er nicht vorwärts kam. Der trügerische Rasen begann weiter und immer weiter zu reißen. Jeden Augenblick konnte sich auch unter ihm das nasse Grab öffnen und dann—er erkannte es mit visionärer Klarheit—waren sie beide rettungslos verloren.
In diesen Sekunden der höchsten Gefahr begann Klaus wie unter einem Zwange zu handeln. Während seine Rechte mit Aufbietung aller Kräfte den Versinkenden zu halten suchte, zog er mit der Linken die Latten heran und schob sie unter dessen Körper. Wohl boten diese starken, fast drei Meter langen Meßlatten dem Ohnmächtigen einen gewissen Halt. Aber jeden Augenblick konnte er durch eine unwillkürliche Bewegung davon abgleiten.
Ihn festbinden!—Aber womit? In dem Handwagen da am Wiesenrand war alles, was ihm in dieser Not helfen konnte. Feste Meßketten und Seile. Doch er durfte es ja nicht wagen, die Stelle hier zu verlassen.
Noch während er den Gedanken dachte, glitt seine Linke über seine Kleidung—Die Hosenträger! Damit konnte es gehen. Schon hatte er sie gelöst, die Schulter Wendts fest mit der Latte verknüpft. Jetzt endlich konnte er selbst zurückkriechen, fühlte, wie der Boden sicherer wurde, stand hochaufatmend auf einem festen Grasblock.
Schnellste Hilfe tat not. Doch weit und breit war kein Mensch zu sehen. Sollte er ins Dorf zurückfahren, dort Beistand holen? Wer weiß, wann der kam, und ob er nicht zu spät kommen würde. Hier die zwanzig Meter lange Meßlatte aus kräftigem Stahlband. Mit der mochte es vielleicht glücken. Er zog sie hinter sich her, kroch zur Unfallstelle zurück, bis er wieder mit dem ganzen Leib im Wasser lag. Mit unendlicher Behutsamkeit—jede unvorsichtige Bewegung konnte ja auch unter ihm die schwankende, trügerische Decke zum Zerreißen bringen—legte er das Band um den Körper des Feldmessers und verknotete es zu einer festen Schlinge. Dann kroch er zurück, bis er wieder sicheren Boden unter den Füßen hatte, und begann an dem Band zu ziehen. Langsam, Schritt für Schritt holte er den schweren Körper des Verunglückten zu sich heran. Zwar riß die Decke auch jetzt noch weiter, aber allmählich glückte es ihm doch, den Körper auf festeren Boden zu bringen.
Jetzt endlich hatte er es erreicht. Wendt lag auf einer Stelle, an der eine starke Grasnarbe dem Boden einige Tragfähigkeit verlieh. Aber jetzt war Klaus auch selbst am Ende seiner Kräfte. Und immer noch blieb ihm ein schweres Stück Arbeit zu tun. Wohl hätte er es sich zugetraut, den Feldmesser auf die Schulter zu heben und ein Stück Weges zu tragen. Doch hier auf dem gefährlichen Boden durfte er das nicht wagen. Unter der doppelten Last wäre die Decke auch sicher hier noch gerissen. Vorsichtig, selbst rückwärts kriechend, schleifte er Wendt hinter sich her, bis er endlich den Rand des Moores erreicht hatte. Dort legte er ihn nieder, begann ihn zu reiben und zu massieren. Es dauerte lange Zeit, bis Wendt anfing, wieder Lebenszeichen von sich zu geben, schließlich die Augen aufschlug.
»Wo bin ich? Was ist mit mir, Klaus?«
»Später, Herr Wendt... später. Sie waren im Moor eingebrochen. Wir müssen ins Dorf zurück. Sie müssen in trockene Kleider kommen.«
Der Feldmesser machte einen Versuch, sich aufzurichten, taumelte und fiel sofort zurück.
»Es geht nicht, Klaus. Fahre du ins Dorf und hole Hilfe herbei.« Die Zähne schlugen ihm hörbar aufeinander, während er die Worte hervorbrachte.
Klaus schüttelte den Kopf, entfernte sich ein paar Schritte, kam mit dem Handwagen zurück.
»Keine Zeit, erst ins Dorf zu laufen. Sie müssen schnell ins warme Bett.«
Mit vielem Stützen, Heben und Zureden gelang es ihm, Wendt in den Wagen zu bringen. Dann ergriff er die Deichsel und zog mit seiner Last los. Jetzt auf der harten Landstraße ging es schon besser. Schnell brachte er das Fuhrwerk vorwärts. Bereits tauchten die ersten Häuser des Dorfes vor ihm auf, als er Wendts Stimme hinter sich vernahm.
»Halt, Klaus, halt.«
»Was ist, Herr Wendt, was wünschen Sie?«
»Unmöglich, Klaus, daß wir in diesem Aufzug in das Dorf kommen. Du als Vorspann, ich wie ein Bund Flicken auf dem Wagen. Die Bauern würden ihren Spaß daran haben.«
»Ja, aber, Herr Wendt...«
»Kein Aber, Klaus! Hilf mir mal auf die Beine.«
Klaus hatte nicht viel Zutrauen, daß dieser Versuch gelingen würde. Aber es ging besser, als er erwartete. Jetzt stand Wendt, wenn auch noch schwankend und zähneklappernd auf seinen Füßen. Versuchte es, auf Klaus gestützt, vorwärts zu kommen. Wohl ging's noch unsicher, aber es ging. Bei jedem Schritt quoll ihm das Sumpfwasser spritzend aus den Schuhen und hinterließ eine nasse Spur auf der Landstraße.
Klaus wunderte sich über die Wassermassen, die da von Wendt abflossen. Nie hätte er es für möglich gehalten, daß ein Mensch solche Wassermengen in seiner Kleidung bergen könne.
Die Bewegung tat dem Feldmesser sichtlich gut. Von Minute zu Minute gewannen seine Bewegungen an Sicherheit. Schon versuchte er, mit einem Scherzwort über die heikle Situation hinwegzukommen.
»Langsam, Klaus, langsam! Wo bliebe sonst unsere Würde? Du mußt jetzt den Wagen ziehen und dann... dann wollen wir vor allen Dingen versuchen, möglichst ungesehen in unser Logis zu gelangen. Sonst—wenn die Bauern uns hier ankommen sehen wie die gebadeten Katzen—du weißt ja, wer den Spaten hat, braucht für den Schutt nicht zu sorgen.«
Klaus lachte.
»Ich bin schon fast wieder trocken, Herr Wendt.«
»Trotzdem, Klaus, sofort auf ein paar Stunden ins Bett, wenn wir im Gasthaus sind.«
Es glückte wider Erwarten. Umgesehen kamen sie in den großen Flur des Dorfkruges. Klaus, der augenblicklich entschieden der Repräsentablere von beiden war, holte die Stubenschlüssel von der Theke.
»Ins Bett, Klaus. Vor allen Dingen erst mal ins Bett.«
Mit diesen Worten verschwand Wendt in seinem Zimmer. Klaus hatte nicht allzu große Lust, dem Befehl zu folgen. Er betastete und befühlte sich von allen Seiten. Von außen her hatte unter dem Einfluß von Wind und Sonne ein gewisser Trocknungsprozeß begonnen. Es hatte sich eine schokoladenartige feste Kruste gebildet. Darunter aber war's feucht und warm. Er hatte das Gefühl, als ob er in einem einzigen großen Prießnitzumschlag steckte. Mit Mühe begann er sich die nassen Sachen vom Leibe zu ziehen. Das haftete und klatschte alles aneinander, als ob das Sumpfwasser eine ganz besondere Klebkraft besäße.
Endlich war's gelungen. Klaus stand da wie weiland Urvater Adam am siebenten Tage der Schöpfungsgeschichte. Arbeitete mit Wasser und Frottiertuch, um den Modergeruch loszuwerden, und kroch in das hochgetürmte Bauernbett.
War's die Anstrengung, war's das kalte Oktoberbad oder der überstandene Schrecken, schon nach wenigen Minuten war er fest eingeschlafen. Tief und traumlos zuerst. Dann aber kamen verworrene Träume.
Nicht jetzt lebte er, sondern ein halbes Jahrtausend früher. War auch nicht mehr Lehrling beim Feldmesser Wendt, sondern Jungknappe des Burgherrn von der Waxenkuppe.
Sein Herr lag in Fehde mit den Nachbarn. In wilden Kampf mit feindlicher Übermacht waren sie plötzlich verwickelt. Schwerter und Morgensterne blitzten in der Sonne, prasselten dröhnend auf die Panzer nieder. Immer schlimmer wurde die Bedrängnis, immer kleiner die Zahl der geharnischten Knechte, die noch um den Waxenritter kämpften. Jetzt strauchelte auch dessen Pferd und fiel. Der Ritter mußte fliehen. Der Knappe folgte ihm. Der schwere Panzer hinderte und drückte ihn bei jeder Bewegung. Trotzdem suchte er zu entrinnen, er lief, daß der Schweiß ihm aus allen Poren brach. Dort drüben sah er die Burg. Dort war Sicherheit vor den Verfolgern. Der nächste Weg dorthin ein Pfad durchs Moor. Köhler und Wildschützen gingen ihn bisweilen.
Not bricht Eisen. Der fliehende Waxenritter wagte den Gang. Der Knappe folgte ihm, ging auf schwankenden Pfaden vorwärts. Hörte, wie die Verfolger hinter ihm am Rande des Moores haltmachten, Lärm und Geschrei schwächer wurden. Nur ein paar Bolzen, von den Armbrüsten der Verfolger abgeschnellt, summten ihm noch um die Ohren.
Nun hatte er die Mitte des Weges hinter sich. Bedenklich schwankte der trügerische Boden. Doch unmöglich, umzukehren. Rettung und Sicherheit lagen vor ihm, Gefangenschaft und Tod drohten hinter ihm.
Weiter... immer weiter vorwärts. Da brach die trügerische Decke. Klaus, der Jungknappe, sah seinen Herrn stürzen, sinken, verschwinden. Er wollte ihm zu Hilfe eilen, ihm die lange Ritterlanze zur Rettung hinstrecken, da stürzte er selbst. Wollte schreien, doch vergeblich jeder Versuch zu rufen. Keinen Ton brachte er aus der Kehle. Fühlte, wie er tiefer und tiefer sank, wie der schwere Panzer ihn unwiderstehlich nach unten zog. Jetzt brachen die Fluten über ihm zusammen, verschlossen ihm Mund und Nase. In höchster Atemnot schlug er um sich, wollte sich mit Aufbietung letzter Kraft vor dem Tod im Moore retten.
Ein Schrei brach aus seiner Kehle. Mit einer verzweifelten Anstrengung schob er die Moormassen beiseite—erwachte und merkte, daß er den Kampf auf Leben und Tod mit dem dicken Daunenbett geführt hatte.
Schon herrschte Dämmerung im Zimmer. Er sprang auf, zündete die Petroleumlampe an und kam allmählich aus dem 14. ins 20. Jahrhundert zurück. Ein Gutes hatte der wilde Traum gezeitigt. Einen Schweißausbruch, der auch die letzten Spuren einer etwaigen Erkältung wegfegte. Frisch umgekleidet trat Klaus kurze Zeit danach in die Stube von Wendt. Der kam ihm entgegen.
»Ich hörte dich schreien, Klaus.«
»Ein Traum, Herr Wendt, ein verrückter Traum. Haben Sie auch geträumt?«
»Nein, Klaus... und doch, vielleicht habe ich auch etwas geträumt... was bald Wahrheit werden soll.«
Er ergriff Klaus' Rechte mit beiden Händen und drückte sie lange und fest.—
Ende November war die Trassierung der geplanten Bahnlinie beendet. Ein selten
schöner und milder Herbst war dem Feldmesser Wendt dabei zustatten gekommen.
Jetzt saß er mit dem Baumeister Jensen zusammen in der Erfurter Niederlassung
von Voßberg & Co. Die Besprechung der beiden Herren über die laufenden
Arbeiten war zu Ende. Wendt schob seine Papiere zusammen. Eigentlich hätte er
jetzt gehen können. Doch er blieb noch und schickte sich umständlich an,
seinen zerkauten Zigarrenstummel noch einmal in Brand zu setzen, während der
Baumeister nachdenklich allerlei Arabesken auf ein Blatt Papier malte.
Einige Minuten des Schweigens. Jensen sprach zuerst.
»Ja, mein lieber Wendt, nun zu unserem gemeinschaftlichen Pflegling...«
»Sie meinen Klaus.«
»Ganz recht, Klaus Kröning. Wir sind ihm beide verpflichtet. Meinen Sie, daß...?«
Der Feldmesser unterbrach Jensen, ehe er den Satz vollendete.
»Ja, Herr Baumeister. Ich meine, daß wir den Jungen mit gutem Gewissen als Lehrling in die Firma nehmen können. Er hat einen hellen Kopf, ist willig und anstellig. Schon jetzt versteht er gut mit Zirkel und Reißzeug umzugehen. Weiß der Teufel, wie er sich's angeeignet hat. Nach meiner Meinung hat er jedenfalls das Zeug dazu, einmal ein tüchtiger Eisenbahntechniker zu werden.«
Der Baumeister nickte.
»Gut! Alles ganz gut und schön. Bliebe noch die Frage zu erörtern, wo und wie wir ihn hier in Erfurt unterbringen. Auf einen Zuschuß von zu Hause kann der Junge während seiner Lehrzeit nicht rechnen. Das Gehalt, das wir ihm von der Firma auswerfen können...«
Wendt unterbrach ihn.
»Lassen Sie das meine Sorge sein, Herr Baumeister. Ich werde den Jungen zu mir ins Haus nehmen.«
»Sie wollten, lieber Wendt?«
»Ich will.«
So wurde die weitere Zukunft Klaus Krönings bestimmt. Als Pflegesohn kam er in das Haus des Feldmessers Wendt, als Lehrling zu der Firma Voßberg & Co. Für den ersten Winter nahm ihn Wendt in sein eigenes Büro.
Klaus hätte keinen besseren Lehrer finden können. Unermüdlich war Wendt bestrebt, ihn in die Geheimnisse seiner Kunst einzuweihen. Klaus lernte... und wie lernte er. Er erlebte es förmlich mit, wie jetzt aus den im freien Felde aufgenommenen Trassenkarten die eigentlichen Baupläne entstanden.
Erst jetzt begriff er, was das zu bedeuten hatte, was Wendt seinerzeit während der Feldarbeiten als das Nivellement bezeichnet hatte. In der Horizontalebene war ja die Eisenbahnlinie bereits auf den Trassenkarten genau festgelegt. Aber in der Senkrechten zeigte diese Linie Steigungen und Gefälle, die man einer Eisenbahn niemals zumuten durfte. Jetzt handelte es sich darum, nach dem damals aufgenommenen Nivellement die günstigste Lage des Bahnkörpers in der Senkrechten zu bestimmen. An den tiefer gelegenen Teilen der Strecke waren Dammschüttungen vorzusehen, an höher gelegenen Geländeeinschnitte. Die Kunst, die der alte Feldmesser meisterhaft beherrschte, bestand darin, diese Angleichung der geplanten Strecke an die Bedingungen des Eisenbahnverkehrs mit möglichst geringen Erdbewegungen zu erreichen.
Die dafür notwendigen Berechnungen waren freilich für Klaus noch zu hoch. Er sah, wie Wendt tage- und wochenlang saß, rechnete und immer wieder rechnete. Dicke Bücher füllten sich unter seiner Hand mit endlosen Zahlenreihen und führten zu Resultaten, die Hunderttausende von zu bewegenden Kubikmetern bedeuteten. Gewaltig waren diese Endsummen bei den ersten Rechnungen. Aber immer geringer wurden sie, je weiter die Arbeit fortschritt, und endlich hatte Wendt das Minimum errechnet.
Nun konnte mit der zeichnerischen Ausarbeitung der Pläne begonnen werden, und Klaus fand reichlich Gelegenheit, sich mit Bleistift und Reißfeder zu betätigen. Bogen um Bogen, Streckenabschnitt um Streckenabschnitt zeichnete er, und während der Arbeit begann er die meisterhafte Technik zu begreifen, die in diesen Plänen steckte. Er empfand einen reinen Genuß dabei, wenn er immer wieder neue Kniffe und Kunststücke entdeckte, mit denen Wendt Herr über die Tücken des Geländes geworden war.
Wie im Fluge verstrichen ihm die Wochen und Monate über solcher Arbeit. Ehe er sich's recht versah, wurden die Tage schon wieder länger. Immer höher stieg die Sonne und gewann neue Kraft. Schon steckten die Hasel- und Erlenbüsche ihre Blütenkätzchen aus, und die Glocken begannen das Osterfest einzuläuten. Da schrieb der Feldmesser Wendt seinen Namen unter den letzten der großen Nivellementspläne, warf die Feder zur Seite und sagte:
»Fertig, Klaus!«
»Sie meinen, Herr Wendt?«
»Ich meine, Klaus, daß heute Ostersonnabend ist, und daß du deine Eltern lange nicht gesehen hast... Also, Junge...«
Er zog ein Kuvert aus der Tasche.
»Hier hast du Reisegeld und außerdem acht Tage Urlaub. Tummle dich, der nächste Zug nach Eisenach geht in anderthalb Stunden.«
Klaus wußte kaum, wie ihm geschah. Abwechselnd drückte er die Hände des Feldmessers und redete allerlei wirres Zeug durcheinander... saß auf der Bahn und fuhr der Heimat entgegen.
Das letzte Stück des Weges legte er auf seinem Rade zurück. Und dann hing er am Halse seiner Mutter, während sein Bruder Bert das Rad hineinschob und die Tür verschloß.
»Klaus, Junge, wo kommst du her? Ist etwas nicht in Ordnung?«
Der Gemeindehirt stieß die Worte hervor.
»Alles in bester Ordnung, Vater. Habe eine Woche Urlaub... Reisegeld hat mir die Firma auch gegeben... Aber Mutter...«
Schnuppernd sog Klaus den Duft vom Herde her ein.
»Einen Wolfshunger habe ich, Mutter. Hoffentlich habt ihr mir noch was übriggelassen.«
»Gewiß mein Junge, es ist noch reichlich da.«
Während die Mutter auftischte, begann er auszupacken. Vater Kröning mußte den reinen Pastorentabak, den Klaus ihm aus Erfurt mitgebracht hatte, probieren. Klaus bestand darauf, daß es ohne jede Beimischung der heimischen Flora geschah, obwohl der Gemeindehirt solch Unterfangen für verschwenderisch und sündhaft erachtete.
Mit glänzenden Augen erzählte Klaus von seinem Leben in Erfurt und von seinen Zukunftsplänen. Bis jetzt hatten sie im Bureau mit der Ausarbeitung der Bauzeichnungen zu tun gehabt. Nun sollte der Bau beginnen. Mit eigenen Augen würde er jetzt sehen, wie alles das, was sie auf dem Papier errechnet und gezeichnet hatten, zur Ausführung käme.
Bedächtig drückte Vater Kröning den Tabak in seiner Pfeife fester.
»Ja, und was macht ihr dabei? Ihr guckt bloß zu, wie die anderen arbeiten?«
Klaus lachte.
»So wie du's dir denkst, ist's doch nicht, Vater. Das weiß ich vom Feldmesser Wendt besser. Wir müssen dabei sein und fortwährend nachkontrollieren, ob die Ausführung auch genau mit unseren Zeichnungen übereinstimmt. Da gibt's zum mindesten ebensoviel für uns zu tun, wie vorher bei den Trassierungsarbeiten.«
Der Alte schüttelte den Kopf.
»Na ja, Junge, wenn du's sagst, wird's wohl so sein. Davon verstehe ich nichts.«
Der erste Feiertag brachte Frühlingswetter mit hellem Sonnenschein. Nach dem
Frühstück setzte sich Klaus aufs Rad und fuhr ins Dorf. Es drängte ihn, seine
alten Freunde, besonders Karl Kundtke und Fritz Lautensach, wiederzusehen. Er
hatte gehört, daß die beiden seit Michaelis auf dem nahgelegenen Vorwerk
einer Staatsdomäne untergekommen waren. Heute durfte er wohl hoffen, sie hier
im Dorf zu treffen.
Die beiden dort hinten auf dem Kirchplatz, die schienen's doch zu sein. Forsch trat er in die Pedale, war in kurzer Zeit bei ihnen.
»Hallo, Fritz, hallo Karl, fröhliche Ostern!«
Der Gegengruß, den er bekam, war nicht sehr erfreulich.
»Na, da bist du ja, Klaus im Glück! Hast's wohl schon weit gebracht mit deinem Dienern und Scharwenzeln...«
Die beiden machten keine Miene, die dargebotene Hand zu ergreifen. Versenkten die Arme bis an die Ellbogen in die Hosentaschen und grinsten ihn höhnisch an. Karl Kundtke wandte sich zu Fritz Lautensach.
»Große Ehre für uns. Der Herr Eisenbahndirektor läßt sich herab, mit ganz gewöhnlichen Hofjungen zu reden.«
Die Röte stieg Klaus ins Gesicht.
»Seid ihr beiden denn ganz und gar verrückt«, brach er los, »könnt ihr auf ein freundliches Wort keine freundliche Antwort geben?«
Karl Kundtke zuckte die Achseln.
»Wir sind deine Freunde nicht mehr. Geh du nur zu deinen Leuten und laß uns in Ruhe.«
Klaus nahm sein Rad.
»Wie ihr wollt. Ich dränge mich euch nicht auf. Jetzt ist's an euch, mir das erste freundliche Wort zu geben.«
Er schwang sich in den Sattel und fuhr langsam zurück. Hörte noch, wie Fritz Lautensach ihm nachrief:
»Da kann der Herr Eisenbahndirektor lange warten, bis wir ihm ein gutes Wort geben.«
Verstimmt und nachdenklich fuhr Klaus durch das Dorf. Wie kamen die beiden alten Schulfreunde dazu, ihn so zu behandeln. Gewiß, er hatte Glück gehabt. Durch glückliche Zufälle war es ihm gelungen, einflußreiche Freunde zu gewinnen, in eine Laufbahn zu gelangen, die ihm ganz andere Zukunftsaussichten bot als die hergebrachte Arbeit hier im Dorf. Aber tat er den anderen dadurch irgendwie Schaden oder Abbruch?—Wären die um einen Deut besser daran, wenn er ebenfalls zu Michaelis irgendwo als Hofjunge untergekommen wäre?
Er schüttelte den Kopf. Zum ersten Male in seinem jungen Leben mußte er die Erfahrung machen, daß jeder Erfolg, mag er auch noch so ehrlich errungen sein, Neid erweckt und Feinde schafft.
Der Sommer kam und brachte Arbeit in Fülle. Klaus lernte seinen Lehrmeister dabei von immer neuen und anderen Seiten kennen. War Wendt im verflossenen Jahr hauptsächlich als Geometer und Mathematiker tätig gewesen, so wirkte er jetzt in schneller Abwechslung als Ingenieur, Bauleiter, Organisator, Diplomat, ja bisweilen sogar als Volksredner. Staunend beobachtete Klaus diese Vielseitigkeit. Nur allmählich begriff er, daß sie unbedingt notwendig war, wenn die Bauarbeiten terminmäßig und glatt vonstatten gehen sollten.
Daß es trotzalledem doch noch bisweilen Anstände gab, daß selbst die Geschicklichkeit Wendts nicht alle Hindernisse aus dem Wege zu räumen vermochte, zeigte sich, als der Bahnbau bei Bodenberg an der Aache im Gange war. Die Bahn lief hier am Nordufer des Flusses. Unmittelbar daneben lag die Stadt Bodenberg, auf dem anderen Ufer der Ort Radenfelde. Zu dem Projekt von Voßberg & Co. gehörte auch eine eiserne Brücke über die Aache, um den Radenfeldern einen bequemen Zugang zum Bahnhof zu bieten. Aber dieser Brückenbau fiel nicht unter die eigentliche Bahnkonzession, sondern mußte von den beiden Gemeinden Bodenberg und Radenfelde genehmigt werden. Selbstverständlich waren die Radenfelder mit Feuer und Flamme für die Brücke, aber die Bodenberger oder wenigstens ihr Stadtbaurat schienen anders zu denken. Schon des öfteren hatte Klaus den Namen Holzschneider gehört. Bald von Wendts, bald von Jensens Lippen. Selten ohne Beiwörter, die meistens der Zoologie entnommen waren. Aber als er einmal fragen wollte, hatte Wendt abgewinkt.
»Ruhig, Klaus. Frage nicht danach. Das geht dich nichts an.«
Da hatte er geschwiegen, doch seine Neugier war rege geworden.
Nun waren die Bauarbeiten am Bahnhof Bodenberg im vollen Gange. Schon erhob sich neben dem frischgeschütteten Damm der Rohbau des Bahnhofsgebäudes. Jeden Mittag gegen ein Uhr erschien ein hageres, bewegliches Männchen auf der Baustelle, grüßte Wendt sehr höflich und spazierte am Flußufer entlang wieder nach Bodenberg zurück. Wütend machte Wendt eine Faust hinter ihm her. Trotz des Verbotes konnte Klaus die Frage nicht unterdrücken.
»Das war doch der Stadtbaurat Holzschneider, Herr Wendt?«
Wendt schlug mit der Faust auf den Tisch, daß die Papiere umherflogen.
»Zum Kreuzhimmeldonnerwetter, ja doch, Junge! Das ist der verfluchte Kerl, der uns auf die Brückenkonzession warten läßt, bis wir schwarz werden... So geht's nicht weiter. Ich will an den Baumeister telegrafieren. Der muß ins Ministerium gehen, sich über die Schlampereien beschweren.«
Er griff nach Bleistift und Papier, um die Depesche aufzusetzen. Klaus unterbrach ihn.
»Herr Wendt...«
»Was denn, Junge, was willst du?«
»Eine kurze Frage nur, Herr Wendt. Brauchen wir denn die Genehmigung von dem... dem Herrn Baurat Holzschneider für unseren Brückenbau?«
»Selbstverständlich, Klaus.«
»Ja, ich meine, Herr Wendt, wenn wir aber ohne die Genehmigung bauen würden...?«
»Dann, ja dann, Klaus, würde uns der Baurat mit Polizeigewalt daran hindern.«
»Ach so, Herr Wendt. Und dann müßten wir alles wieder abreißen?«
Wendt saß schweigend in seinem Sessel und rieb sich die Stirn. Vergeblich wartete Klaus auf eine Antwort. Wendt schien ihn vergessen zu haben. Wie im Selbstgespräch bewegten sich seine Lippen, während seine Rechte allerhand Zahlen auf das Papier warf. Jetzt griff er nach einem frischen Bogen und begann eifrig zu schreiben. Ein langer Brief wurde es, den er kuvertierte und adressierte. Dann zog er die Uhr.
»Mach dich fertig, Klaus. Du mußt den Brief an seine Adresse bringen.«
Klaus warf einen schnellen Blick darauf. Das Schreiben war an Baumeister Jensen in Erfurt adressiert. Wendt hatte die Uhr vor sich auf den Tisch gelegt.
»Mach fix, Klaus. In fünf Minuten mußt du auf dem Rade sitzen. Den Brief mußt du hüten wie deinen Augapfel und dem Baumeister Jensen persönlich übergeben. Zeig mal, hast du eine zuverlässige innere Brusttasche? So, das wird gehen. Hier hast du Reisegeld. Jetzt los!«—
Baumeister Jensen war gerade im Begriff, sein Bureau zu verlassen, als Klaus
atemlos hineinstürmte.
»Was ist, Klaus, was bringst du?«
»Einen Brief von Herrn Wendt.«
Jensen riß den Umschlag auf, warf einen Blick auf die Zeilen und winkte Klaus, sich zu setzen. Er las das Schreiben einmal und noch einmal und schließlich ein drittes Mal. Jetzt nahm er ein Streichholz, zündete den Brief an, warf ihn in den Ofen und wartete, bis er vollkommen verbrannt war. Rührte danach die Aschenreste bis zur vollkommenen Unkenntlichkeit durcheinander. Und dann begann der Herr Baumeister Jensen ein fideles Studentenlied zu pfeifen, was Klaus bisher noch niemals an ihm beobachtet hatte.
»Komm, mein Junge, wir fahren mit dem nächsten Zuge, ich komme mit nach Bodenberg.«
Er griff nach Hut und Stock und warf die Bürotür ins Schloß. So vergnügt und aufgeräumt wie auf dieser Fahrt hatte Klaus den Baumeister Jensen kaum je gesehen. Er kam zu der Überzeugung, daß Wendt dem etwas sehr Lustiges geschrieben haben müsse.—
Der Mittag des nächsten Tages kam heran und brachte wie gewöhnlich den Besuch
des Stadtbaurates Holzschneider. Doch weder Jensen noch Wendt gaben sich die
Ehre, ihn besonders zu begrüßen. Die saßen zusammen in einer Baubude und
beobachteten mit der Uhr in der Hand, wie er den üblichen Gang zum Flusse
machte.
»Riskant bleibt die Geschichte, Herr Wendt.« Jensen kratzte sich dabei hinter dem Ohr. »Zum mindesten wird's eine gehörige Ordnungsstrafe setzen.«
»Ah bah, Herr Baumeister, die verbuchen wir als ›Unvorhergesehenes‹ im Kostenanschlag. Ich habe mir's hin und her überlegt. Es bleibt die einzige Möglichkeit, um endlich vorwärtszukommen.«
»Wie sind Sie denn eigentlich auf die tolle Idee gekommen?«
»Wenn ich's genau sagen soll, durch unseren Klaus. Der Junge stellte in seiner Naivität ein paar Fragen, und da kam mir plötzlich die Erleuchtung.«
Baumeister Jensen lachte hell auf.
»Aha! Und was kein Verstand der Verständigen sieht, das übt in Einfalt ein kindlich Gemüt. Also, unser Klaus ist der eigentliche Urheber dieser Verschwörung.«
Wendt legte die Finger auf die Lippen.
»Der Junge hat keine Ahnung davon, Herr Baumeister.«
»Also lassen wir ihn auch weiter in seiner Ahnungslosigkeit.« Jensen warf einen Blick durch das Fenster. »Freund Holzschneider scheint seine Inspektion beendet zu haben und kehrt zur Stadt zurück. Haben Sie alles vorbereitet?«
»Jawohl, Herr Baumeister.«
»Dann in Gottes Namen los!«
Sie verließen die Bude. Wendt führte den Baumeister zum Ufer. Dort lagen ein paar Fetzen Dachpappe. Als er sie mit dem Stock beiseiteschob, kamen vier in den Boden geschlagene Pfähle zum Vorschein, welche die Ecken eines sechs Meter langen und anderthalb Meter breiten Rechteckes markierten. Jetzt zog er eine Trillerpfeife. Ein Pfiff gellte über den Platz. Noch ehe er verklungen, strömte eine Kolonne von zwölf Mann mit Spaten und Karren heran. Wendt brauchte nichts mehr zu sagen. Er hatte seine Instruktionen dem Polier bereits während der Mittagspause gegeben und der doppelte von ihm für diese Arbeit bewilligte Akkord tat das übrige. Mit Gewalt fuhren die Schaufeln in den Boden, und wie durch Zauberhand füllten sich die Karren. Von Minute zu Minute gewann die Grube an Tiefe. Zwei Stunden nach dem ersten Spatenstich war sie auf anderthalb Meter ausgeschachtet, das Vorspiel des Dramas war beendet. Ohne jegliche Zwischenpause traten die Mitwirkenden des nächsten Aktes, die Maurer auf den Plan. Während die Erdarbeiter jetzt unablässig Steine und Mörtel herbeikarrten, begann ein massiver Mauerklotz aus der Fundamentgrube emporzuwachsen.
Man sagt den Maurern bisweilen nach, daß sie sich zu ihrer Arbeit noch mehr Zeit lassen als andere Handwerker. Aber das gilt nur für Lohnmaurer. Wenn es um Akkordarbeit geht, dann verstehen sie es auch, sich ganz gehörig ranzuhalten, und denen, die hier mauerten, hatte Wendt den doppelten Akkord bewilligt. In sinnverwirrendem Spiel flogen die Steine durch die Luft zur Arbeitsstätte hin. Einen Moment im Wasserkübel, im nächsten Augenblick schon in Mörtel gebettet und mit der Kelle auf ihrem Platz festgeklopft.
Die Stunden verrannen darüber, doch niemand dachte an Feierabend. Als die Sonne unter dem Horizont verschwand und die Schatten der Dämmerung sich niedersenkten, flammten Gasolinscheinwerfer auf und tauchten die Arbeitsstätte in waberndes, grelles Licht. Schon hoben sich Rüststangen um das Bauwerk, Bretter fügten sich zu Plattformen, und unaufhörlich ging die Arbeit weiter. Als die Glocke die zweite Morgenstunde verkündete, war sie vollendet. Schnell wurde noch die Rüstung abgebaut, und dann endlich lag die Stätte so langer fieberhafter Tätigkeit verlassen im Dunklen.—
Der Herr Stadtbaurat Holzschneider kam wie immer von der Bahnbaustelle her
und schritt zum Flußufer hin. Jetzt blieb er stehen, stutzte, strich sich
über die Augen—ging weiter, bis er dicht vor dem Bauwerk stand, das
hier in der vergangenen Nacht aus dem Boden gewachsen war. Er betastete es,
stieß mit dem Stock dagegen. Kein Zweifel, die Augen trogen ihn nicht. Das
war solides, gutes Zementmauerwerk.
Er griff sich zum Halse, als ob der Kragen ihm zu eng würde, und wechselte die Farbe, von tiefster Blässe bis zu dunkelster Röte.—
Wendt beobachtete den Vorgang von seiner Baubude aus. Jetzt kniff er Klaus so
kräftig in den Arm, daß der kaum einen Schrei unterdrücken konnte.
»Klaus, Junge, ich glaube, der will den Pfeiler fressen. Der möchte am liebsten ein Ende davon abbeißen. Na, wir werden ja hören, was er uns zu sagen hat.«
Er brauchte nicht lange darauf zu warten. Baurat Holzschneider kam in die Bude gestürmt.
»Herr Wendt, was soll das?... Was bedeutet das? Was haben Sie da ohne Konzession gebaut?«
Der zuckte die Achseln.
»Ich verstehe Sie nicht, Herr Baurat. Vorarbeiten zum Bahnhof Bodenberg. Auf besondere Anordnung des Herrn Baumeister Jensen ausgeführt.«
»Vorarbeiten!...« Die Stimme des Baurates schnappte vor Erregung über. »Vorarbeiten nennen Sie das, wenn Sie hier einen soliden Brückenpfeiler an den Fluß setzen. Wollen Sie mich dumm machen, Herr!«
»Ich würde etwas Derartiges für zwecklos halten, Herr Baurat«, antwortete Wendt ebenso höflich wie doppelsinnig.
Holzschneider zwang sich gewaltsam zur Ruhe.
»Ich erkläre Ihnen hiermit ausdrücklich, Herr Wendt, daß ich den Brückenbau verbiete und polizeilich verhindern werde, solange nicht die behördliche Konzession vorliegt.«
»Ich denke, die liegt nachgerade lange genug bei Ihnen«, brummte Wendt dazwischen.
»... polizeilich verhindern werde, Herr Wendt«, schrie der Baurat und schoß aus der Tür.
Wendt zuckte die Achseln.
»Kann er uns nicht zwingen, den Pfeiler wieder abzureißen?« fragte Klaus.
»Nein, mein Junge«, lachte Wendt. »Das ist ja das Schöne an der Sache, daß er das nicht kann.«
Schon der nächste Tag zeigte, daß Holzschneider es mit seiner Drohung ernst meinte. Um acht Uhr morgens erschien ein Amtsdiener von Bodenberg und bezog seinen Wachtposten neben dem Brückenpfeiler. Bis sechs Uhr abends, bis die Bauhandwerker Feierabend machten, blieb er dort, und das wiederholte sich die folgenden Tage und Wochen. Manchen derben Scherz mußte er dabei von den Maurern einstecken, bis Wendt eingriff und seine Leute anhielt, dem Manne seinen Auftrag nicht unnötig zu erschweren. Währenddem wuchs auf dem Radenfelder Ufer gemächlich der zweite Brückenpfeiler in die Höhe. Mit Mißfallen bemerkte es der Baurat Holzschneider bei seinen täglichen Besuchen, und noch etwas anderes war geeignet, ihn aufs äußerste zu beunruhigen.
Senkrecht zum Ufer hin bauten sie auf dem anderen Flußufer ein Bohlengerüst, und bald begannen sich dort unter den Schlägen der Niethämmer eiserne Träger und Winkel zu einer schöngeschwungenen Fachwerkbrücke zusammenzuschließen. Zwar lag die Brücke jetzt noch auf dem festen Lande, aber Holzschneider war geneigt, den Leuten von Voßberg & Co. jede Ungesetzlichkeit zuzutrauen. An dem Tage, an dem sie auf Radenfelder Grund die letzte Niete in die Brücke schlugen, verdoppelte er die Wache. Wenn der Tagespolizist seinen Dienst beendigte, trat ein anderer an, der die Nacht über bei dem Bodenberger Pfeiler zu wachen hatte.
»Hm«, sagte Wendt und steckte sich eine Zigarre an, »habe ich dir nicht gesagt, Klaus, daß der Mann uns mehr Schwierigkeiten machen würde, als wir unbedingt nötig haben?«
Klaus zuckte die Achseln.
»Ich weiß nicht, was Sie da tun könnten, Herr Werdt... Den Wächter betäuben... oder...«
»Oder vergiften oder zum mindesten mit dem Lasso fangen«, fiel Wendt lachend dazwischen. »Nein, mein Junge, solche Indianergeschichten machen wir hier nicht. Höchstens ein bißchen Wild-West.« Aber als Klaus wieder bei seiner Arbeit saß, kam das Wort »betäuben« dem Feldmesser nicht aus dem Sinn.—
Dann geschah es in der nächsten Woche, daß sie auf den Dachstuhl des Bahnhofs Bodenberg eine Tannenkrone mit vielen bunten Bändern pflanzten, weil nun das Haus gerichtet war. Und am Abend des gleichen Tages—es war etwas nach Feierabend, und der Nachtpolizist hatte seinen Posten schon bezogen—da kamen die Maurer und Zimmerleute mit bunten Bändern an den Hüten singend zum Flußufer hinab, um nach Radenfelde überzusetzen. Begehrlich schaute ihnen der Wächter nach.
»Heute ist Richtfest, heute trägt keiner den dummen Pfeiler weg. Komm mit nach Radenfelde. Da wollen wir ordentlich einen heben«, rief ihm einer von den Maurern zu und schwenkte eine volle Flasche dabei. Und dann saß der feurige Bote des Baurats Holzschneider mit im Kahn, saß mit im Krug, und es gab nicht nur Freibier in Fülle, sondern auch andere schärfere Sachen..
Das war's, worauf Baumeister Jensen und Wendt gewartet hatten. Aus einer flußaufwärts gelegenen Krümmung der Aache brach Jensen mit seinen Prähmen und Hilfsmannschaften hervor wie weiland Ziethen aus dem Busch. In unglaublich kurzer Zeit war die Brücke mittels schwerer Topfschrauben von ihrer Balken-Unterlage abgehoben und auf Feldbahnloren gesetzt. Kähne brachten schwere Flaschenzüge vom Brückenende an das andere Ufer. Viele Dutzende von Händen griffen zu, Seile strafften sich, der ganze Brückenbau geriet in Bewegung, rollte auf den Fluß zu. Schon hing sein vorderes Ende weit über das Flußbett, als ihn schwer beladene Prähme unterfuhren. Schnell wurden die Bleibarren, welche die Ladung bildeten, in andere Kähne übergeladen. Die entlasteten Prähme hoben sich, trugen die ganze Brücke frei.
Ein erneutes Arbeiten mit Flaschenzügen von dem Ufer her. Langsam fuhr die Brücke zwischen die beiden Pfeiler ein. Jetzt schwebten ihre Enden etwa einen viertel Meter über den Pfeilerköpfen. In Eile wanderte die Bleilast in die Prähme zurück. Tiefer und tiefer senkten sie sich dabei, knirschend setzten die Brückenenden auf die Pfeiler auf.
In zwei Stunden war alles geschehen. Fest und sicher spannte sich die eiserne Brücke über die Aache. Jensen schickte seine Flottille in ihre Schlupfwinkel zurück. Schweigend hatte Klaus während dieser Zeit am Ufer gestanden. Es verschlug ihm fast den Atem, wenn er sah, wie hier alles zusammengriff, wie die Riesenlast der Brücke von tausend Händen gleichzeitig bedient und beeinflußt sich hob und vorschob, genau hinkam, wohin sie kommen sollte. Wie wenige kurze Kommandoworte und Winke genügten, um dies ganze wunderbare Räderwerk der Arbeit in Gang zu halten.
Nun war alles vorüber. Noch lag die Dämmerung des langen Sommerabends über dem Flusse, als Jensen zurückkam. Ein Weilchen besah er sich schweigend sein Werk und rieb sich die Hände.
»Gut gemacht! Feine Sache! Was, Klaus? Aber halt! Wir haben ja noch was vergessen.«
»Vergessen?« Wendt schaute ihn fragend an.
»Die Brückenlaternen, Wendt. Der Kerl schickt uns noch ein Extrastrafmandat, wenn wir die Brücke eine Nacht unbeleuchtet lassen. Lauf mal hin, Klaus, in der Bude mußt du sie finden. Vier Laternen, zwei rote und zwei grüne. Vergiß die Ölkanne und die Streichhölzer nicht.«
Bald kam Klaus mit dem Gewünschten zurück.
»So, Junge, nun turne mal los, aber falle nicht in die Aache... es ist nicht deinetwegen, ich weiß, daß du schwimmen kannst. Aber es würde den Laternen schaden.«
Der Auftrag des Baumeisters war nicht ganz einfach zu erfüllen. Noch fehlte der Brücke der Bohlenbelag, und Klaus mußte zwischen den Fachwerkfeldern vorwärts klettern. Aber nach einer Viertelstunde war auch das erledigt. Die Brückenlaternen saßen an ihren Stellen und warfen rotes und grünes Licht über die Wellen der Aache.
»So«, sagte Jensen, »so ist die unvorschriftsmäßig gelegte Brücke wenigstens vorschriftsmäßig beleuchtet. Das hätten wir auch glücklich hinter uns. Jetzt können wir getrost nach Hause gehen.«
Aber Klaus hatte noch eine Frage auf dem Herzen. »Sagen Sie, Herr Baumeister, was wird nun aus dem Wächter? Er hat sich doch verleiten lassen, ist von seinem Posten gegangen.«
Jensen lachte.
»Das kann ich dir mit ziemlicher Sicherheit sagen, Klaus, den schmeißt unser Freund Holzschneider morgen sofort achtkantig raus. Der ist das erste Objekt, an dem er seine Wut ausläßt. Wir kommen erst später dran. Haben Sie Lust, Wendt, auf eine Bierlänge zum Richtfest mitzukommen?«
Klaus gab noch keine Ruhe.
»Herr Baumeister, dann wird der Mann aber seine Stellung los. Wer weiß, ob er so leicht eine andere wiederfindet.«
Baumeister Jensen blieb stehen und wandte sich Klaus zu.
»Mein Junge, du brauchst nicht zu denken, daß Voßberg & Co. andere Leute ins Unglück bringen. Für den Mann ist gesorgt. Wir haben bereits einen Posten bei uns für ihn in Aussicht genommen. Wahrscheinlich zieht er es vor, die persönliche Begrüßung vom Baurat Holzschneider erst gar nicht abzuwarten, sondern schriftlich zu kündigen. Wenn er will, kann er morgen schon bei uns anfangen.«
Klaus atmete erleichtert auf. Erst jetzt empfand er volle Freude über das Husarenstückchen, das sich da vor seinen Augen abgespielt hatte.
Der nächste Morgen kam und pünktlich um acht Uhr trat der Tagespolizist seinen Dienst an. Der sah, was geschehen, und lief spornstreichs zum Baurat. Dann stand Holzschneider vor Jensen, und jetzt drohte das kleine quecksilberne Kerlchen wirklich zu explodieren. Nur stoßweise und abgerissen konnte er die Worte hervorbringen.
»Herr Baumeister!... Unerhört... unfaßlich... die Brücke da... wie kommt die da hin?...«
Jensen saugte mit unerschütterlicher Ruhe an seiner Morgenzigarre.
»Ja, Herr Baurat, die muß einer hier in der Nacht über die Aache gelegt haben. Gestern abend lag sie noch am Lande.«
Holzschneider zitterte vor Wut.
»Einer 'rübergelegt!... Trotz des polizeilichen Verbotes... trotzdem der Polizist die ganze Nacht hier gestanden hat...«
Jensen schüttelte den Kopf.
»Hier hat die Nacht kein Polizist gestanden.«
»Kein Polizist gestanden!« Die Stimme Holzschneiders überschlug sich vor Wut. »Den Kerl kassier' ich! Den schmeiß' ich 'raus! Den bring' ich vors Gericht.«
»Das, mein verehrtester Herr Baurat, können Sie halten wie die Dachdecker, das geht mich persönlich nichts an«, erwiderte Jensen.
Die unerschütterliche Ruhe Jensens brachte den Baurat zur vollkommenen Raserei.
»Und Ihnen«, schrie er wütend, »Ihnen verbiete ich es ein für allemal, die Brücke in öffentlichen Verkehr zu nehmen...«
Jensen schmunzelte.
»Hochverehrter Herr Baurat, Sie überschreiten Ihre Befugnisse. Sie vergessen, daß sich Ihre Jurisdiktion nur über Bodenberg und die Bodenberger erstreckt. Aber ich will Ihnen entgegenkommen. Wenn ein Passant sich beim Betreten der Brücke als Bodenberger legitimiert, sind wir bereit, ein Brückengeld von ihm zu nehmen.«
Das schlug dem Faß den Boden aus.
»Sie werden noch von mir hören«, brüllte Holzschneider und trabte in der Richtung nach Bodenberg davon.
Wendt rieb sich die Hände. »Ich glaube, Herr Baumeister, das hat ihm den Rest gegeben.«
Jensen lachte.
»Bis er zum Rathaus kommt, wird seine Wut sich etwas gelegt haben. Letzten Endes ist er der Blamierte bei der Geschichte und so etwas wirkt auf die Dauer abkühlend.«
Jensen behielt recht. Acht Tage später kam endlich die Konzession, und von einem Brückengeld war nicht mehr die Rede.
Wieder war man im Juli. Drei Jahre waren vergangen, seitdem Klaus Kröning auf die Empfehlung des Baumeisters Jensen vom Feldmesser Wendt als Gehilfe angenommen wurde. Jetzt ging er ins achtzehnte Jahr, hatte inzwischen viel gesehen und viel gelernt. Wendt mochte seinen jungen Gehilfen nicht mehr missen. Der war ihm eine wirkliche Stütze geworden, und nahm ihm nicht nur im freien Felde, sondern auch im Büro einen merklichen Teil der Arbeit ab. Alle jene Nivellementsberechnungen, die er einst bei Wendt bewundert hatte, beherrschte er jetzt selber.
Klaus mußte dabeisein, wo immer Wendt zu trassieren und zu bauen hatte. Und das war bei Gott nicht wenig. In allen Teilen Deutschlands baute die Firma Voßberg & Co. in dieser Zeit Kleinbahnen. Von Thüringen aus war Klaus mit Wendt bis in die nordöstliche Ecke Deutschlands, an das Kurische Haff gekommen. Jetzt waren sie oben in Schleswig und bauten da eine Bahn durch das Geestland.
Für den heutigen Tag war die Arbeit vollendet. Feldmesser Wendt und Klaus saßen im schattigen Garten eines Dorfwirtshauses und warteten auf ihr Abendessen. Der alte Feldmesser holte eine Zigarre hervor und setzte sie mit behaglicher Behutsamkeit in Brand. Während sich die blauen Rauchwölkchen in der stillen, heißen Sommerluft kräuselten, blickte er auf Klaus.
»In einem Jahr ist deine Lehrzeit vorüber. Ich bin stolz auf dich, mein Junge. Auf dich, und fast möchte ich sagen, auch auf mich. Du hast allerhand bei mir gelernt. Kannst es ruhig riskieren, dich auch zur Feldmesserprüfung zu melden, wenn deine Lehrzeit um ist. Aber sage mal, hättest du nicht Lust, einmal auf der Lokomotive zu fahren?«
Die Augen Klaus Krönings glänzten.
»Wie gern möchte ich das, Herr Wendt. Aber wird es möglich sein?«
Der Feldmesser streifte die Asche von seiner Zigarre.
»Bis jetzt war die Möglichkeit kaum vorhanden. Aber hier könnte sie sich doch wohl bieten. Auf dem westlichen Teil unserer Strecke haben wir große Dammschüttungen, zu denen die Erdmassen mit Arbeitszügen herangeschafft werden. Da ließe sich's am Ende wohl machen.«
»Aber wie, Herr Wendt?«
»Sehr einfach, Klaus. Einer von den Lokomotivführern ist ein alter Freund von mir. Mit dem werden wir morgen einen Ton reden. Eventuell müssen wir uns Baumeister Jensen zu Hilfe holen. Dann geht's unter allen Umständen.«
»Wie gern möchte ich, Herr Wendt. Aber meine Arbeit bei Ihnen, wer soll die machen?«
Der Feldmesser lachte.
»Du natürlich! Überstunden, mein Junge, Überstunden! Wer lieben will, muß leiden, oder wenn du's klassisch haben willst: Vor den Kampfpreis haben die Götter den Schweiß gesetzt. Deine Arbeit bei mir darf darunter nicht leiden. Doch ich denke, es wird dir selber Freude machen, wenn du so in vier bis sechs Wochen imstande bist, eine Lokomotive mit einem langen Arbeitszug dahinter zu führen.«—
Als sie an diesem Abend auf ihre Zimmer gingen, rief Wendt seinen Gehilfen zu
sich herein.
»Sieh mal hier, Klaus.« Er reichte ihm drei ziemlich starke Oktavbände. »Da mußt du jetzt deine Nase auch etwas reinstecken.«
Klaus schlug den ersten Band auf und las: Die Schule des Lokomotivführers. Er blätterte weiter und fand eine klare und übersichtliche Darstellung des ganzen rollenden Eisenbahnmaterials und der Lokomotive im besonderen.
»So, mein Junge, damit mußt du dich anfreunden.«
Wendt lag schon lange im festen Schlaf, als Klaus immer noch aufsaß und die »Schule des Lokomotivführers« studierte. Erst als es grau durch das Fenster zu schimmern begann, kroch er noch schnell auf ein paar Stunden ins Bett.—
Und dann kam Klaus zu Albert Müller auf die Lokomotive. Müller stammte aus
Berlin und war ein Original im besten Sinne des Wortes. Ursprünglich
Lokomotivführer bei der Staatsbahn, hatte er sich mit seinem Vorgesetzten
überworfen und war dann zu Voßberg & Co. gegangen. Eine lächerliche
Kleinigkeit gab den Grund zu diesem Entschluß. Eines Tages war ein als
besonders scharf bekannter Betriebsinspektor in den Schuppen gekommen. So
etwas kam öfter vor und wurde im allgemeinen mit einigem Fluchen und Brummen
von seiten der Betroffenen erledigt. Aber Albert Müller versteifte sich auf
das, was er sein gutes Recht nannte. Und es gab einen langen Disput zwischen
dem Betriebsinspektor und ihm.
Ob er etwa bestreiten wolle, daß seine Maschine in einer scheußlichen Weise gequalmt hätte.
Das nicht. Aber es sei nicht seine Schuld, der Rauchfang des Schuppens habe heute bei dem Wetter keinen rechten Zug.
Dann hätte er doch den Bläser anstellen können, meinte der Betriebsinspektor. Der Bläser ist eine mit dem Kessel in Verbindung stehende und im Lokomotivschornstein endende Rohrleitung, durch die man Dampf aus dem Schornstein strömen lassen und dadurch einen künstlichen Zug erzeugen kann.
Müller hatte auf das Manometer gezeigt. Noch nicht eine Viertel Atmosphäre Dampfdruck im Kessel. Wie sich der Herr Betriebsinspektor das mit dem Bläser dächte.
Der Betriebsinspektor wurde grob. Es sei nicht seine Aufgabe, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. In den Dienstvorschriften wäre es klipp und klar zu lesen, daß die Lokomotiven den Schuppen nicht verqualmen dürften, und somit wäre die Strafe von zwei Mark voll berechtigt.
Da war aber Albert Müller noch viel gröber geworden und hatte allerlei von Leuten vom Grünen Tisch gesagt, die unerfüllbare Vorschriften fabrizierten. Das Ende dieses Dialogs bestand darin, daß der Lokomotivführer Müller seine Stellung bei der Staatsbahn aufgab. Damals hatte er sich an den Feldmesser gewendet, den er von früher her kannte. Voßberg & Co. hatten ihn gern genommen, denn es kam selten vor, daß Lokomotivführer, die schon eine längere Praxis im Staatsdienste hinter sich hatten, in die Dienste der Privatindustrie traten.
Freilich, es war etwas anderes, hier die Bauzüge zu fahren als die Schnellzüge von Berlin nach Leipzig. In ruhigen Stunden hätte sich Albert Müller eigentlich sagen müssen, daß er bei seinem Tausch vom Pferde auf den Esel gekommen sei. Aber das tat er nun ganz und gar nicht. Noch jetzt, sechs Jahre nach diesem Vorfall, war er stolz darauf, daß er damals die zwei Mark nicht bezahlt und sein Recht behalten habe.
Das war der neue Lehrmeister, zu dem Klaus auf Veranlassung von Wendt kam. Äußerlich präsentierte er sich mit einem wohlgepflegten weißen Kaiser-Franz-Joseph-Bart sehr würdevoll und bemühte sich, bei seinen Unterweisungen den Berliner Dialekt nach Möglichkeit zu unterdrücken. Daß ihm aber trotz aller Würde der Schalk im Nacken saß, mußte Klaus während der folgenden Wochen öfter als einmal bemerken.
Zur Besetzung einer Lokomotive gehören zwei, der Führer und der Heizer. Der Heizer war in diesem Falle ein langer Mecklenburger namens Gustav Loewitz, von Müller dienstlich und außerdienstlich nur kurzweg »Justav« gerufen. Die letzten Jahre war Klaus ausschließlich mit dem Feldmesser zusammen gewesen, der zu den höheren Beamten von Voßberg & Co. gehörte. Hier auf der Lokomotive bekam er es wieder mit einfachen Leuten aus dem Volke zu tun. Wendt hatte ihn am Abend dem Lokomotivführer übergeben und war allein ins Gasthaus zurückgegangen. Voller Erwartungen kletterte Klaus in den Führerstand, blickte auf das Gewirr von Hebeln, Ventilen und Hähnen und versuchte im stillen, noch einmal zu wiederholen, was er die Tage vorher in der »Schule des Lokomotivführers« gelesen.
»Na, wie ist's denn mit dem Einstand, junger Mann?« riß ihn die Stimme des Heizers aus seinem Nachdenken.
Klaus war gewappnet. Wendt hatte ihm gesagt, daß er den Abend für das Maschinenpersonal ein paar Glas Bier ausgeben müsse.
»Gewiß, Herr Loewitz, wenn es Ihnen recht ist, gehen wir nachher ins Gasthaus.«
»Nee, nee, junger Mann!« Der Heizer schüttelte energisch den Kopf, »da haben wir keine Zeit zu. Ich habe schon vorgesorgt, einen Kasten Bier angeschafft.«
Bei diesen Worten klappte der Heizer den Deckel einer Kiste auf, in der Klaus Werkzeug vermutete. Eine Flaschenbatterie wurde sichtbar.
»Auch gut, Herr Loewitz. Wieviel macht's?«
»Drei Mark.«
Der Heizer steckte vergnügt den Taler ein, den Klaus ihm reichte und zog drei Flaschen aus der Kiste.
Mit der Grandezza eines spanischen Hidalgo nahm Albert Müller eine davon in Empfang und öffnete den Verschluß.
»Na, denn Prost, Klaus! Ich nehme Sie als Lehrling an.
Ich habe Menschenkenntnis, Sie werden sich auf der Lokomotive bald wie zu Hause fühlen und mit ihr umzugehen wissen. Sie werden das Dampfroß schon meistern und zum Ziele bringen.«
Sie stießen mit den Flaschen zusammen, denn Gläser gab's auf der Lokomotive nicht.
»Na, nun erzählen Sie mal ein bißchen, was Sie von der Sache schon wissen. Herr Wendt sagte mir, daß er Ihnen die ›Schule des Lokomotivführers‹ gegeben hat.«
Klaus begann. Er sprach vom Lokomotivlangkessel, von der Feuerbuchse und den Rosten.
»Halt«, unterbrach ihn Müller, »darüber können Sie sich morgen früh um vier mit Loewitz unterhalten, wenn Sie Ihr erstes Feuer anzünden. Jetzt erzählen Sie mir mal, was Sie hier in dem Führerstand sehen?«
Klaus wollte anfangen, aber Müller unterbrach ihn sofort.
»Halt, mein Sohn, nicht so fix voran. Nach der Wichtigkeit sollen Sie mir die Dinge aufzählen. Wonach sieht ein Lokomotivführer zu allererst, wenn er in den Führerstand kommt?«
»Nach... nach...« Klaus stotterte.
Müller fiel ihm ins Wort.
»Mit beiden Augen zugleich nach dem Manometer und dem Wasserstandsglas.« Er deutete bei den Worten auf die beiden Instrumente. »An dem Manometer sieht er den Dampfdruck. Der Deubel soll den Heizer frikassieren, wenn der Zeiger auch nur einen Strich unter oder über zwölf Atmosphären steht. Und dann das Wasserstandsglas...« Er zeigte auf zwei etwa fünfzehn Zentimeter voneinander entfernte rote Striche an dem Glasrohr. »Zwischen den beiden Strichen muß der Wasserspiegel stehen. Ist er darüber, dann versäuft der Kessel, spuckt mit dem Dampf Wasser in die Zylinder, und es gibt allerhand Malheur. Steht er darunter, dann liegen feuerberührte Teile des Kessels ohne Wasserdecke, es droht die Gefahr einer Kesselexplosion.«
Klaus beugte sich näher zu dem Wasserstandsglas heran. Der Heizer zog ihn zurück. Denn in demselben Augenblick hatte Müller den oberen Wasserstandshahn gedreht und im Moment war der ganze Führerstand in dichten weißen Dampf gehüllt. Der Führer schlug den Hahn wieder zu. Der Dampf verzog sich. Doch sofort riß er den unteren Wasserstandshahn auf, ein Strahl heißen Wassers prasselte auf die eiserne Plattform. Jetzt schloß er ihn wieder.
»Das ist das zweite, Klaus, was der Führer tut, wenn er auf die Maschine kommt. Er überzeugt sich davon, daß die Zuführungshähne nicht verstopft sind, daß das Wasserstandsglas auch wirklich den richtigen Wasserstand des Kessels anzeigt.«
Klaus schaute ihn fragend an. Albert Müller zog sich eine zweite Flasche Bier zu Gemüte und fuhr in seinem Vortrag fort.
»Es sind nämlich schon manchmal Nachtwächter bei Tage gestorben, will sagen, es ist schon manchmal vorgekommen, daß die Zuführungen zum Wasserstandsglase verstopft waren. Der Führer glaubte immer noch genügend Wasser im Kessel zu haben, und als Gott den Schaden besah, war der Kessel halbleer und ausgeglüht.«
Klaus deutete auf zwei Messinghähne an der Kesselwand.
»Ich las, Herr Müller, daß man dafür die besonderen Probierhähne hat.«
Der Führer klopfte ihm auf die Schulter.
»Theorie, lieber Freund. Sie wissen doch, was Goethe sagt: Grau, lieber Freund, ist alle Theorie, und blau des Lebens roter Baum.«
Albert Müllers Zitate pflegten sich im allgemeinen mehr durch Originalität als durch Richtigkeit auszuzeichnen.
»Theorie«, fuhr er fort, »die Praxis sieht anders aus.«
Plötzlich hing eine Blechkanne unter dem einen Probierhahn, ohne daß Klaus recht wußte, wo sie hergekommen war. Seiner Handtasche entnahm der Führer ein weißes Paket und ließ ein Dutzend frischer Wiener Würstchen in die Kanne gleiten. Dann öffnete er den Hahn, das weit über den Siedepunkt erhitzte Kesselwasser ergoß sich über die Würstchen in der Kanne. Schon hatte Müller den Hahn wieder zugeschlagen und zog die Uhr aus der Westentasche.
»Und dann, Klaus, das können Sie sich bei dieser Gelegenheit auch gleich merken, ein Lokomotivführer muß immer eine unbedingt richtiggehende Uhr bei sich haben. Die kann ihm nicht mal der Gerichtsvollzieher wegnehmen, die gehört zu seiner offiziellen Dienstausrüstung. Erstens nämlich, damit er den Fahrplan genau innehalten kann, und zweitens... wissen Sie auch, warum zweitens?«
Klaus schüttelte den Kopf.
»Und zweitens, damit Würstchen nicht zu lange ziehen, Eier nicht zu hart werden... na, überhaupt alles, was so mit dem Probierhahn hier zusammenhängt.«
»Ja, der Probierhahn, der hat dat so in sich«, warf Loewitz auf mecklenburgisch dazwischen.
»Justav, sup, aber halt dat Mul!« rief ihm Müller zu. Mit einem kühnen Schwunge goß er das heiße Wasser von den Würstchen ab und dann—Klaus hatte sich früher schon öfter gewundert, warum die Lokomotivführer immer mit so großen, dicken Handtaschen zum Dienst kamen—dann entnahm er seiner Tasche eine Dose Mostrich und verschiedene Semmeln.
»So, nun wollen wir mal erst, Klaus! Irgendwo steht es geschrieben: Bayrisch Bier allein tut es nicht, es müssen auch Würstchen und Schrippen dabeisein.«
Klaus ließ sich nicht nötigen und griff herzhaft zu. Er mußte gestehen, daß diese à la Lokomotivführer zubereiteten Würstchen ganz vorzüglich waren, und fühlte sich danach aufs neue fähig, die weisen Lehren Albert Müllers in Empfang zu nehmen. Die ließen denn auch nicht lange auf sich warten. Eben wollte er das zusammengefaltete Wurstpapier zum Stand hinauswerfen, als Müller ihm in den Arm fiel.
»Halt, mein Sohn, nicht die Strecke verunreinigen. So was kommt unter den Kessel.«
Mit einem Schwung riß Loewitz die Feuertür auf, das Papier flammte im Moment auf und zerging zu Asche.
»Gustav, mach das Feuer rein!« befahl Müller.
Schon hatte der Heizer die Feuerkrücke ergriffen. Klaus sah, wie er damit das Feuer auseinanderschob und mit einer ihm unglaublich scheinenden Geschicklichkeit einen Teil der glühenden Masse herausholte und auf die eiserne Plattform vor dem Kessel fallenließ.
»Warum geschieht das?« fragte er.
»Weil's Schlacke ist, Klaus. Das werden Sie auch noch lernen, glühende Kohlen und glühende Schlacke zu unterscheiden.«
In der Tat, jetzt, als die herausgezogene Masse langsam dunkler wurde, erkannte auch Klaus, daß es keine Kohlen, sondern nur noch ausgebrannte Schlacken waren. Loewitz vertauschte die Feuerkrücke mit der Schaufel und warf die frischen Kohlen in weitem, geschicktem Schwung über die glühende Fläche hin, so daß sie gleichmäßig davon bedeckt wurde. Gleichzeitig griff Müller nach einem Hebel, Klaus hörte ein Zischen und sah weißen Dampf aus dem Lokomotivschlot herausfahren, der sich jetzt mit dem dunklen Qualm der frisch anbrennenden Kohlen zu einer grauen Masse vermengte. Müller hatte den Bläser in Tätigkeit gesetzt. Schon machte sich die Wirkung des neuen Brennstoffes bemerkbar, der Zeiger des Manometers begann zu klettern und näherte sich dem roten Strich, der bei vierzehn Atmosphären auf der Skala stand. Klaus deutete auf das Zifferblatt.
»Herr Müller, die Spannung steigt. Die Sicherheitsventile müssen gleich abblasen.«
Der Lokomotivführer Albert Müller zog ein Päckchen aus der Westentasche und biß ein Stück dicken, braunen Kautabaks ab. Dann zog er die Uhr.
»In fünf Minuten müssen wir den Bauzug holen. In fünf Minuten werden die Ventile blasen. Na, was tut man da, Klaus, um den überflüssigen Dampfdruck loszuwerden?«
Klaus dachte einen Augenblick nach.
»Man läßt die Bremspumpe gehen, Herr Müller, und pumpt Druckluft in den Bremskessel.«
Müller schüttelte den Kopf und wies auf das Druckluftmanometer der Bremseinrichtung.
»Nichts zu machen, Klaus! Da haben wir schon bis auf den roten Strich aufgepumpt. Eine andere Lösung dieses schwierigen Problems, wenn ich bitten darf.«
Klaus zögerte mit der Antwort. Müller kam ihm zuvor.
»In diesem Falle greift der Mann zur Waffe, will sagen, zum Injektorhebel.«
Auf einen Wink Müllers setzte Loewitz den Injektor in Tätigkeit, jene geistreiche Dampfstrahlpumpe, die allein mit Hilfe des hochgespannten Kesseldampfes ohne alle bewegten Maschinenteile das kalte Frischwasser aus dem Tender in den Kessel drückt. Klaus hörte das eigenartige schlürfende Pfeifen des Injektors, sah am Wasserstandsglas, wie der Wasserstand im Kessel langsam stieg und der Manometerzeiger etwas zurückging.
»Genug, Gustav!«
Loewitz stellte den Injektor ab, Müller sah wieder auf die Uhr.
»In einer Minute müssen wir losfahren, Klaus! Was tut der Führer, wenn er abfahren will?«
Klaus dachte an ein Dutzend verschiedener Antworten..., er betätigt die Dampfpfeife..., er öffnet den Dampfschieber..., er bewegt die Steuerungskurbel..., und noch mancherlei mehr wollte er sagen. Wieder kam ihm Müller zuvor.
»Er überzeugt sich, daß seine Bremse in Ordnung ist. Anfahren ist leicht, Stillhalten viel schwerer. Sie werden's noch selber merken, Klaus.«
Bei seinen Worten hatte er den Bremsgriff betätigt. Dröhnend schlugen die Bremsklötze gegen die Räder der Maschine.
»So«, fuhr er in seinen Erklärungen fort, während er den Bremshebel auf eine neue Stellung brachte, »und dann löst der Führer seine Bremse. Es sind bedauerliche Fälle aus der Geschichte des Eisenbahnwesens bekannt geworden, in denen ein Führer mit festgebremsten Rädern loszufahren versuchte, was entweder gar nicht ging oder sonstwie Malheur zur Folge hatte.«
»Ich werde mir's merken, Herr Müller. Aber jetzt können wir doch losfahren.«
Müller schob den Primtabak aus der einen in die andere Backentasche.
»Schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort. Merken Sie sich auch das noch. Der Lokomotivführer steht immer mit dem einen Fuß im Grabe und mit dem anderen auf der Anklagebank. Wenn ich täte, was Sie, von jugendlichem Tatendrang geschwellt, von mir verlangen, würde der Herr Staatsanwalt in Flensburg den dringenden Wunsch nach einer längeren Unterredung mit mir äußern. Einladungen vom Staatsanwalt sind unangenehm. Wenn's irgend möglich ist, vermeide ich sie.«
Klaus folgte mit den Blicken dem ausgestreckten Arm des Führers und bekam einen roten Kopf. In der Tat, das Signal stand ja auf Halt. Wie hatte er das übersehen können? Müller schmunzelte vergnügt vor sich hin.
»Na, die alte Schlafmütze von einem Blockwärter werden wir schon munter kriegen. Bis ans Signal ran dürfen wir fahren. Was machen wir jetzt, Klaus?«
»Wir öffnen den Dampfschieber.«
Müller tat es.
»Und was jetzt, Klaus?«
»Jetzt stellen wir die Steuerung mit Hilfe der Steuerkurbel auf Vorwärtsgang.«
Der Führer schüttelte den Kopf.
»Falsch, mein Sohn! Wir stehen hier seit länger als einer Stunde still. Die Zylinder und Schieberkästen sind derweil kalt geworden. Lassen wir Dampf in die kalten Zylinder, dann schlägt er sich zum großen Teil in Form von Wasser nieder. Und dann... dann kommt der Kolben in dem Zylinder langmarschiert... treibt das Wasser vor sich her, und dann sagt sich der Zylinderdeckel: der Klügere gibt nach, und zerbricht mit einem mächtigen Krach in tausend Fetzen. Das wußte übrigens schon Großvater Stephenson, und er schuf deswegen die Zylinderhähne.«
Albert Müller unterbrach seinen Vortrag, um die trockene Kehle mit einer dritten Flasche Bier zu befeuchten. Dann fuhr er fort:
»Also, Klaus, wir heizen die Zylinder erst mal an.«
Bei diesen Worten bewegte er einen Hebel im Führerstand. Im gleichen Augenblick begann es vorn unten an der Maschine zu zischen, mächtige Dampfwolken stiegen auf und hüllten das ganze Vorderteil der Lokomotive in dichte Schleier.
»Hören Sie, Klaus, wie das da vorn spuckt, wie ein großer Teil des Frischdampfes als Kondenswasser aus den Zylinderhähnen wegsuppt.«
Klaus horchte und konnte die Richtigkeit dieser Bemerkung nicht bestreiten.
»So, jetzt wird's gehen.«
Müller ließ die Zylinderhähne immer noch offen und drehte die Steuerkurbel langsam auf Vorwärtsgang. Zischend trat der Kesselfrischdampf durch die Schieberkästen in die Zylinder. Langsam setzte die Maschine sich in Bewegung. Noch ein paar Sekunden, dann schloß Müller die Zylinderhähne und stellte auch den Bläser ab. Als er einen fragenden Blick von Klaus auffing, erklärte er weiter.
»Den Bläser brauchen wir beim Fahren nicht mehr. Bei jedem Kolbenspiel pufft der verbrauchte Dampf durch den Schornstein ins Freie und wirkt viel kräftiger ventilierend als der Bläser.«
Die Lokomotive hatte sich inzwischen dem immer noch geschlossenen Signal bis auf etwa hundert Meter genähert. Der Führer stellte die Steuerung wieder auf den Nullpunkt und schloß den Dampfschieber. Nur noch nach dem Gesetz der Trägheit rollte die Lokomotive weiter.
»So, Klaus, jetzt können Sie auch mal für Ihr Geld was tun. Ziehen Sie an dem Hebel da.«
Klaus tat es und fuhr im nächsten Augenblick zusammen. Kaum einen Meter von ihm entfernt brüllte die Dampfpfeife los.
»Na, bitte weiter, mein Sohn. Ordentlich!... Feste! Der Kerl schläft auf beiden Ohren.«
Klaus folgte der Weisung und vollführte ein gründliches Pfeifkonzert. Müller befand sich auf der rechten Seite des Führerstandes, die Hand am Bremshebel, den Blick unverwandt auf das Signal gerichtet. Nur noch wenige Meter waren sie davon ab. Schon wollte Müller den Bremshebel bewegen, als das Signal im letzten Moment hoch ging.
»O Karl, es hat gewirkt«, zitierte Müller frei nach Schiller und brachte Schieber und Steuerung wieder in die Fahrstellung. Unter der Wirkung des Dampfes begann die Lokomotive ihre Bewegung zu beschleunigen, schneller und schneller zu laufen. Schnurgerade dehnte sich die Strecke vor ihnen aus.
»Achtung! Warschau!« Während Loewitz die Feuertür aufriß und neue Kohlen gab, zog Müller Klaus zu sich heran und wies ihm den Geschwindigkeitszeiger, der allmählich über 50 und 60 bis auf 75 Kilometer Stundengeschwindigkeit kletterte. Jetzt war auch hier der rote Strich erreicht. Der Führer drehte die Steuerkurbel ein wenig zurück, verringerte dadurch das Dampfquantum, das die Zylinder bei jedem Kolbenhub aus dem Kessel bekamen.
»Schneller geht es nicht?« fragte Klaus,
Müller tauschte einen Blick mit Loewitz, sah noch einmal auf die Strecke. Das nächste Signal, noch in weiter Ferne, zeigte freie Fahrt. Er griff wieder zum Steuerhebel und gab den Zylindern stärkere Füllung. Sofort beschleunigte sich die Fahrt. Der Geschwindigkeitszeiger kletterte über die 80 und 90, kam jetzt dicht an 100.
Aber noch etwas anderes trat dabei ein. Bisher war die Maschine ruhig und stabil gelaufen. Jetzt fing sie an zu schwanken und zu stampfen, so daß sich Klaus an einer Stütze festhalten mußte. Etwa drei Minuten ließ der Führer die Maschine im 100-Kilometertempo laufen, dann schloß er die Steuerung und brachte sie wieder auf 75 Kilometer.
»So Klaus, den Gefallen habe ich Ihnen getan. Ich hoffe, daß Ihre Neugier jetzt ein für allemal befriedigt ist. Jede Maschine ist für eine Höchstgeschwindigkeit gebaut. Läßt man sie schneller laufen, dann fängt sie an zu stampfen, und schließlich springt sie aus den Schienen, was ja eigentlich nicht der Zweck der Übung ist. Also merken Sie sich noch eins der zehn Gebote des Lokomotivführers: Du sollst die roten Striche auf deinen Skalenscheiben achten, auf daß es dir wohl gehe und du lange lebest auf Erden.«
Der Heizer war inzwischen auf den Tender geklettert und begann mit einem Vorschlaghammer die groben Kohlenstücke zu zerkleinern. Jetzt kam er zurück, wollte neue Kohlen aufs Feuer werfen. Müller nickte ihm zu.
»Na, soll er mal?«
Der Heizer winkte ab.
»Nee, Albert! Wir kriegen in Flensburg einen schweren Zug. Wenn er mir das Feuer versaut...«
Müller reichte dem Heizer eine neue Flasche.
»Drei Schaufeln, Gustav... bloß drei Schaufeln.«
»Na denn meinetwegen...«
Klaus ergriff de schwere Kohlenschaufel. Er hatte genau beobachtet, wie Loewitz das machte. Wie der mit einem mächtigen Schwung mit der vollen Schaufel durch die enge Feuertür fuhr und dann die Kohlen durch eine kurze ruckartige Drehung des Schaufelstieles breitwürfig über die Glut verteilte. Genau so wollte er's machen und stieß mit der Schaufel vor...
Albert Müller brach als erster das Schweigen.
»Sehen Sie, Klaus, das ist es ja, was den Philosophen immer wieder so traurig stimmt, daß auf dieser schlechten Welt die Dicke des Daumens nur in den seltensten Fällen im richtigen Verhältnis zur lichten Weite des Nasenloches steht.«
Hier handelte es sich zwar nicht um Daumen und Nasenloch, sondern um Schaufel und Feuertür, aber sonst war die Sache die gleiche. Nur wenige Zentimeter war die Schaufel schmäler als die Feuertür. Man mußte sehr genau zielen, wenn man glatt durchkommen wollte. Mit mächtigem Schwung hatte Klaus die Schaufel vorgestoßen und den Türrahmen getroffen. Polternd ergoß sich die Kohle auf die eiserne Plattform vor dem Kessel. Loewitz warf einen wehmütigen Blick auf seine Schaufel. Albert Müller nahm einen tiefgründigen Schluck aus seiner Flasche.
»Beim ersten Streiche fällt keine Eiche. Noch mal, aber besser, Klaus.«
Klaus unternahm den Versuch zum zweiten Male. Diesmal kam er ohne Havarie durch die Feuertür, aber der Schwung war nur matt. Die meisten Kohlen fielen dicht am Anfang der Feuerung in die Glut, während sie Loewitz jedesmal zwei Meter weit in die Feuerkiste geworfen hatte.
Müller warf einen Blick auf die Strecke und überzeugte sich, daß das nächste Signa! auf freie Fahrt stand. Dann wandte er sich wieder interessiert der Feuertür zu. »Du mußt es dreimal sagen!« kam's wie ein Orakelspruch von seinen Lippen.
Klaus biß die Zähne zusammen und versuchte es zum dritten Male. Diesmal glückte es besser. In vollem Schwung fuhr die Schaufel durch die enge Tür und warf die Kohlen ziemlich weit in das Feuer. Tief aufatmend stand er da. Die körperliche Anstrengung, die strahlende Hitze aus der geöffneten Tür trieben ihm das Blut ins Gesicht. Albert Müller klopfte ihm anerkennend auf die Schulter.
»Na, Gustav, was habe ich gesagt. Was ein Häkchen werden will, wird in die Wand geschlagen.«
Der Heizer antwortete nicht. Er ergriff die Feuerkrücke, breitete die frischen Kohlen in der Glut aus und gab noch ein paar Schaufeln nach. Erst jetzt verstand Klaus die Geschicklichkeit, mit der das geschah, voll zu würdigen.
Die Lokomotive hatte derweil manchen Kilometer hinter sich gebracht, und in der Ferne tauchten die Bahnhofsanlagen von Flensburg auf. Müller mäßigte die Fahrt der Maschine bis auf 30 Kilometer, über Weichen und Herzstücke ging es in ein unübersehbares Gewirr von Geleisen und Signalen hinein. Jetzt sperrte ein Signal die Fahrt, und sie mußten eine kurze Weile halten. Dann ging es in noch langsamerer Fahrt wieder ein Stückchen weiter, und dann waren sie bei dem Arbeitszug, den sie holen sollten.
»Heiliger Maybach, steh uns bei«, stöhnte Müller, als er die Bescherung sah, »da haben die Brüder uns ja was Nettes aufgebaut. Wenigstens 180 Achsen sind das. Gustav, halt dich 'ran, daß wir ihn ohne Vorspann wegbringen. Unsere Reputation steht auf dem Spiel.«
Es war so, wie der Führer sagte. Ein unendlich langer Güterzug. Einige siebzig zwei- und dreiachsige Wagen zählte Klaus, während sie daran vorüberfuhren. Allerlei Material, Hausteine und Eisenkonstruktionen für die neue Strecke, die Voßberg & Co. in Nordschleswig bauten.
»Wohin fahren wir jetzt?« fragte Klaus.
Müller strich sich würdevoll den weißen Vollbart. »Die Welt ist rund und muß sich drehen. Auf die Drehscheibe fahren wir.«
Nach einigen Minuten hatten sie die neue große Drehscheibe vor einem der Lokomotivschuppen erreicht. Kurz davor hielt die Maschine.
»Es sind schon bessere Kerls in die Grube gefahren«, brummte Müller vor sich hin und ließ verschiedene Male die Dampfpfeife trillern. Es dauerte mehrere Minuten, bis ein paar Leute aus dem Schuppen kamen und die Drehscheibe mit Hilfe einiger Handwinden in Bewegung setzten. Der Lokomotivführer Albert Müller benutzte die Pause, um Klaus weiter gute Lehren zu geben.
»Da ist der alte Eisenbahndirektor Moser, der fragt bei der Lokomotivführerprüfung immer: Worauf hat der Führer besonders zu achten, wenn er in den Schuppen fährt? Er verlangt die Antwort: Der Führer soll sich orientieren, ob die Schuppentür auch geöffnet ist. Ich sage Ihnen, Klaus, der Mann hat vollkommen unrecht. Ich meine: Der Führer soll sich genau orientieren, ob die Drehscheibe auch richtig auf sein Geleis steht.«
»Ich denke, Herr Müller, man sollte beides tun.«
»Nein, mein Lieber. Wenn die Drehscheibe falsch steht, dann kippt der Führer mitsamt seiner Maschine in die Grube und macht außerdem noch die Drehscheibe kaputt. Wenn er gegen eine geschlossene Tür fährt, schmeißt er höchstens ein paar Türflügel entzwei. Das ist denn doch ein gewaltiger Unterschied. Eine Drehscheibe ist hundertmal teurer als eine Tür, und außerdem kostet es beträchtliche Gelder, die Maschine wieder aus der Grube herauszuholen. Und außerdem... na, was noch?«
Klaus wußte nicht zu antworten.
»Und außerdem?... Na, Menschenskind, überlegen Sie sich's mal. Sehen Sie sich doch mal den Schuppen da drüben an. Was wäre denn los, wenn wir hier mit unserer Maschine in der Scheibengrube lägen?«
»Ja, man müßte uns wieder herausheben, Herr Müller. Das würde wohl wenigstens 24 Stunden dauern.«
Der Führer unterbrach ihn. »Ja und während der 24 Stunden wären die ganzen Maschinen in dem Schuppen eingesperrt, dem Betriebe entzogen. Wenn die Drehscheibe bei dem Abenteuer beschädigt wird, kann die Geschichte sogar noch viel länger dauern. Sehen Sie mal rüber! Zählen Sie mal! 16 Maschinen stehen da in dem Schuppen. Was meinen Sie, was aus dem Flensburger Eisenbahnbetrieb wird, wenn die 16 Maschinen für mehrere Tage ausfallen. Das ist viel schlimmer als eine zerbrochene Schuppentür, und darum sage ich, der Eisenbahndirektor Moser hat unrecht.«
Klaus betrachtete die Schuppenanlage genauer und mußte zugeben, daß Müller recht hatte. Die Geleise aus dem halbkreisförmigen Schuppen liefen alle strahlenförmig auf die davor befindliche Drehscheibe zu. Nur über die Scheibe konnten die Maschinen aus dem Schuppen auf die Streckengeleise gelangen. Wurde die Scheibe lahmgelegt, war auch der ganze Schuppen blockiert.
Die Männer an den Winden hatten die Scheibe inzwischen richtig gedreht und festgestellt. Vorsichtig brachte Müller seine Maschine mit Tender auf die Scheibenplattform. Hier konnte Klaus beobachten, wie sicher der seine Lokomotive in der Hand hatte und auf den Zentimeter genau stillzusetzen verstand. Jetzt betätigte er die Bremse und ließ die Maschine mit festangezogenen Bremsklötzen stehen, während die Leute an den Winden wieder zu arbeiten begannen.
»Ich bewundere, Herr Müller, wie genau Sie Ihre Maschine stillsetzen können.«
Müller lachte.
»Das will gelernt sein. Mancher lernt's nie und selbst dann noch unvollkommen. Im Anfange, als ich noch junger Führer war, hatte ich oft einen scheußlichen Traum. Ich träumte immer, ich führe mit meiner Maschine über die Drehscheibe in den Schuppen. Auf der Scheibe passierte nie etwas. Aber im Schuppen konnte ich die Maschine partout nicht zum Stehen bringen, rannte langsam aber sicher die Schuppenwand ein. Schauderhaft war das, wenn ich an allen möglichen Hebeln herumfingerte, und die Maschine der Schuppenmauer trotz alledem Zoll um Zoll näher kam... Na, heute träume ich so was schon lange nicht mehr.«
Die Arbeiter hatten die Scheibe inzwischen um 180 Grad gedreht und wieder stillgesetzt. Müller löste die Bremse und fuhr langsam von der Scheibe herunter. Wieder ging's an dem langen Bauzug vorbei. Sie hielten. Eine Weiche hinter ihnen wurde umgelegt und rückwärts ging die Fahrt. Langsam... immer langsamer... jetzt ein Ruck, ein Klang. Die Puffer des Tenders berührten die vorderen Puffer des Bauzuges. Klaus hörte, wie die Kupplungen eingehakt und verspannt, die Luftdruckleitungen verbunden wurden. Der Mann, der das besorgt hatte, kletterte unter den Puffern hervor, rief: »Alles in Ordnung.«
»Das glaubt dir der Deubel!« knurrte Müller und schickte Loewitz den Zug entlang, während er ein paarmal die Bremsprobe machte.
»Warum das?« fragte Klaus.
»Darum, mein Sohn, weil es nicht das erstemal wäre, daß irgendwo mitten im Zuge ein Hahn der Bremsleitung geschlossen ist. Die Druckluftleitung jedes Wagens hat an jedem Wagenende einen Abstellhahn. Bevor man den einzelnen Wagen vom Zuge abkuppelt, muß man die Hähne schließen, sonst bremst sich der Wagen sofort automatisch fest.
Soweit ist's ganz schön, aber leider wird's manchmal vergessen, die Hähne wieder zu öffnen, nachdem die Wagen wieder angekuppelt sind.«
»Ich verstehe, Herr Müller. Dadurch sind dann die Bremsen aller Wagen hinter dem geschlossenen Hahn außer Tätigkeit.«
Müller nickte.
»Außerordentlich richtig, mein Freund. Und wenn ich dann hier in voller Fahrt bremse, schieben die ungebremsten Wagen mit roher Gewalt nach und werfen mir den ganzen Zug aus dem Geleise. Prost Mahlzeit, ich danke dafür.«
Loewitz kam zurück, meldete, daß alles in Ordnung wäre.
»Na denn, Helm ab zum Gebet!« sagte Müller, öffnete den Schieber und stellte die Steuerung langsam auf immer stärkere Füllung ein. Um eine Kleinigkeit bewegte sich die Maschine vorwärts. Dann stand sie wieder wie festgebannt. Und dann plötzlich in schnellster Folge pufften die Dampfschläge aus dem Schlot, während die Räder sich in rasendem Tempo auf der Stelle drehten. Im Augenblick hatte Müller den Dampfschieber zugerissen. Klaus sah, wie er die Steuerung jetzt auf rückwärts stellte und den Schieber wieder öffnete. Langsam ging die Maschine etwa anderthalb Meter zurück, bis Müller den Dampf absperrte und die Bremsen einschlug. Wieder legte er die Steuerung nach vorn, löste die Bremsen und gab im gleichen Moment Dampf durch die Schieber. Die Maschine setzte sich nach vorwärts in Bewegung, und jetzt begannen ihr die Wagen zu folgen. Unendlich langsam kam Klaus dies Anfahren vor. Ewigkeiten schienen ihm zwischen den einzelnen Dampfschlägen im Schlot zu liegen. Nur ganz allmählich wurde das Tempo schneller, und der lange Zug kam ins Rollen.
»Was war das vorhin?« fragte er. »Warum sind wir da erst rückwärts gefahren?«
»Weil... ja, da muß ich Ihnen erst wieder ein kleines Privatkolleg über die Eisenbahnkupplungen halten. Aber das Reden macht durstig...« Müller langte sich eine neue Flasche Bier aus dem Kasten.
»Sehen Sie mal, Klaus, Sie kennen doch die Kupplungshaken an den einzelnen Wagen. Die sind nicht starr mit dem Wagengestell verbunden, sondern durch Spiralfedern ganz ähnlich den Pufferfedern. Je nachdem, wie ein Zug gerade zum Stillstande kam, können sich diese Zughakenfedern in verschiedenem Zustande befinden. Sie können entweder zusammengedrückt oder in die Länge gezogen oder auch ohne jede Spannung sein. Das erstere ist für den Lokomotivführer das Angenehmste. Dann kann seine Maschine den ersten Wagen des Zuges etwas in Schwung bringen, während die Kuppelfedern zwischen dem ersten und zweiten Wagen sich ausdehnen und der zweite Wagen vorläufig noch stehenbleibt. So geht das dann von Wagen zu Wagen weiter, und der Zug kommt verhältnismäßig leicht ins Rollen. Auch wenn die Federn spannungslos sind, geht es noch, wenn auch schwerer. Aber wenn alle Federn in die Länge gezogen sind, dann wird's zapfenduster. Dann müßte die Lokomotive ja den ganzen Zug auf einmal in Bewegung setzen. Das kann sie aber natürlich nicht, und dann schleudern die Räder auf der Stelle,—die Lokomotive putzt sich die Schuhe ab.
Na, da bleibt denn eben nichts anderes übrig, als rückwärts zu fahren, den Zug ein Stückchen in sich zusammenzuschieben. Dabei werden alle Kuppelfedern und überdies noch die Pufferfedern zusammengedrückt, und das Anfahren geht verhältnismäßig glatt... Prost, Klaus! Herrgott, soviel wie heute habe ich in den letzten zehn Jahren nicht geredet...
Also so war's vorhin. Und jetzt wollen wir zum Himmel beten, daß wir überall offene Signale finden und nicht x-mal zu halten brauchen. Sonst können Sie das Manöver noch öfter genießen.«
Der Himmel neigte den Wünschen Müllers gnädig sein Ohr. Die Signale standen alle auf freie Fahrt, und im Dreißig-Kilometertempo brachte die Maschine keuchend und puffend den schweren Bauzug nach der bestimmten Station. Klaus bemerkte dabei, daß Müller die Steuerung jetzt nicht mehr wie bei der Hinfahrt auf ungefähr fünf Prozent Zylinderfüllung, sondern auf fast fünfzig Prozent stellte, und er sah ferner, wie Loewitz fast unaufhörlich beim Kohlenklopfen und Kohlenschaufeln blieb.
Müller reichte dem Heizer, der jetzt aus allen Poren schwitzte, zwei Flaschen Bier auf einmal aus dem bewußten Kasten.
»Ja, ja, mein liebes Kläuschen, das Leben des Lokomotivführers ist veränderlich. Mit einer leeren Maschine spazierenfahren, das kann Lehmanns Kutscher auch. Aber einen Zug mit hundertsechzig Achsen glücklich nach Hause bringen, das will gelernt sein.«
Er blickte auf das Wasserstandsglas und das Manometer.
»Dampf, Gustav! Mach ordentlich Dampf, Gustav. Wir müssen gleich wieder speisen.«
Klaus sah auf die Instrumente. Das Manometer hatte knapp elf Atmosphären, und der Wasserstand näherte sich bedenklich dem unteren Strich. Loewitz arbeitete wie ein Tiger. Er reinigte das Feuer mit der Krücke und schleuderte ganze Berge von Kohlen in die Glut. Unendlicher Qualm entstieg dem Schlot. Eine lange Rauchfahne zog der schwere Zug hinter sich her, aber das Manometer begann wieder zu steigen. Kilometer um Kilometer blieb hinter ihnen, und glücklich rollte der Bauzug um neun Uhr abends in die Zielstation ein. Hier kuppelten sie die Lokomotive ab und fuhren in den Schuppen. Klaus sprang von der Maschine.
»Es war wunderschön, Herr Müller. Darf ich morgen wiederkommen?«
»Dürfen, Klaus?... Im Gegenteil, sollen, müssen! Morgen früh um vier Uhr hier im Schuppen. Pünktlich, wenn ich bitten darf. Ich habe Herrn Wendt versprochen, Ihnen tüchtige Lokomotiven-Kenntnis und -Praxis beizubringen. Na, ich sehe, Sie sind ja mit Feuer und Flamme dabei. Da werden Sie wie ein Expreß vorwärtskommen. ›Rauch ist alles ird'sche Wesen‹, sagte schon der große Goethe. Glückliche Fahrt, junger Dampfentwicklungsrat!«
Baumeister Jensen tat einen langen Zug aus der großen Berliner Weißen, die vor ihm stand. »Herrgott, ich bekomme jetzt noch Durst, wenn ich an die Schwellenschlepperei beim Regiment zurückdenke. Ich weiß nicht mehr genau, wieviel Kilometer Feldbahn ich in meinem Dienstjahr aufgebaut und wieder abgerissen habe. Aber schätzungsweise muß die Strecke ungefähr dreimal um den Äquator reichen.«
»... macht bei dreihundert Arbeitstagen im Jahr täglich vierhundert Kilometer. Eine recht achtbare Leistung«, warf Wendt trocken ein.
»Na!« Baumeister Jensen winkte ab. »Ich wollte nur sagen, eine ungetrübte Freude war das Dienstjahr nicht. Aber trotzdem, man blieb immerhin mit dem Eisenbahnwesen in Verbindung. Namentlich die Zusammenarbeit mit den Pionieren bei Brückenschlägen war recht interessant. Wenn du also Lust hast, Klaus, will ich dir die Wege zu den Eisenbahnern öffnen.«
»Mit Freuden, Herr Baumeister. Ich wäre Ihnen von Herzen dankbar dafür.«
»Gut, mein Junge, abgemacht.«—
Am 30. September erhielt Klaus von Voßberg & Co. seinen Lehrbrief. Es
wurde ihm darin bescheinigt, daß er vier Jahre hindurch bei der Trassierung
und dem Bau von Kleinbahnen fleißig mitgearbeitet und sich alle diejenigen
Kenntnisse erworben habe, die ein Eisenbahnbautechniker besitzen müsse.
Um sechs Uhr morgens am 1. Oktober begann sein Militärdienst bei den Eisenbahnern, und er war damit für geraume Zeit aus der zivilistischen Welt verschwunden und ausgelöscht.
Baumeister Jensen hatte nicht zuviel behauptet, als er sagte, daß der Dienst hier eine doppelt schwierige Angelegenheit sei. Die ersten sechs Wochen bekamen sie weder vom Eisenbahnwesen noch von der Infanterie etwas zu sehen. Da wurde ihnen erst mal in einer mehr rauhen als herzlichen Weise klargemacht, daß sie keine Ahnung hätten, wie sie ihre Knochen richtig gebrauchen müßten. Nur ganz allmählich gab man zu, daß sie jetzt schon gewisse Spuren von Menschenähnlichkeit zu zeigen begönnen.
Jeden Morgen von sieben bis acht gab es Instruktionsstunde. Da lernten sie goldene Sprüche der Weisheit. Etwa, daß der Stiefel das Pferd des Infanteristen sei, das Gewehr aber seine Braut. Weiter wurden sie mit der Welt bekanntgemacht, die über ihnen thronte, bis zum General hinauf.
Klaus schaffte es im Laufe der nächsten Wochen, dies kitzlige Gebiet zu beherrschen. Manche seiner Kameraden konnten es auch am Ende des ersten Jahres noch nicht. Denen gab man zur Sicherheit ein Paket »von wenigstens der Größe eines halben Kommißbrotes« mit, denn durch diese Beigabe vereinfachten sich die Ehrenbezeugungen ganz beträchtlich.
Um Weihnachten herum wurde der Dienst etwas interessanter. Die Rekruten bekamen Karabiner in die Hand, und in der Instruktionsstunde wurde die technische Einrichtung dieser Waffe erläutert. Freilich war es noch ein langer Weg vom Empfang der Waffe bis zum Schießen damit. Zunächst diente auch der Karabiner nur dazu, vom frühen Morgen bis zum späten Abend Gymnastik zu treiben. »Gewehr über« und »Gewehr ab« wurde geübt, bis es nicht nur im Traume, sondern auch im Tiefschlaf vollkommen automatisch klappte.
Im Frühling endlich ging's auf die Schießstände, und sie bekamen scharfe Patronen in die Hand. Das Scharfschießen machte Klaus Vergnügen, und bald gehörte er zu den besten Schützen.
So zog der Sommer heran. Nun kamen sie endlich auch allmählich mit der Eisenbahntechnik in Berührung. Da ging es freilich etwas anders zu als bei Voßberg & Co. Hier lernte Klaus den Begriff des »Behelfsmäßigen« kennen, der ihm bisher fremd geblieben war. Die Aufgaben, die gestellt wurden, waren den Verhältnissen im Kriege angepaßt. Auf langwierige Erdbewegungen konnte man sich nicht einlassen. Auch der Begriff der Wirtschaftlichkeit hatte keine Geltung.
Meistens lautete die Aufgabe: Zwei Punkte sind so schnell wie möglich durch eine eingleisige Feldbahn zu verbinden. Zunächst befanden sich diese beiden Punkte auf dem Kasernenhof, später wurden sie auf einen großen Truppenübungsplatz verlegt. Schon beim Morgengrauen zog die Truppe an den Platz ihres Wirkens. Vom Materialschuppen her begann man die zu erbauende Linie vorzustrecken. Fertige Gleisstücke, die Schienen gleich mit den eisernen Hohlschwellen fest verschraubt, bildeten das Baumaterial. Das einzelne Stück so gemessen, daß zwei Mann es transportieren konnten.
Und dann ging's los. Da fuhren die Wagen mit dem Baumaterial auf der bereits fertiggebauten Strecke vor. Zwei Mann warfen Gleisabschnitte in gleichmäßigem Tempo vom Wagen, andere Mannschaften legten sie auf dem Boden zurecht, verbanden sie durch Haken und Schrauben, und in einer märchenhaft kurzen Zeit war eine Bahn von zehn Kilometern Länge fertiggebaut. Hauptmann Karsten stand mit der Uhr dabei und notierte die Zeit zwischen dem Auswerfen der ersten Gleisstücke und dem Befahren der Strecke durch einen Feldbahnzug.
War die Bahn glücklich gebaut, dann kam der zweite, nicht minder schwere Teil der Übung. Die eben erst mit so vieler Mühe hergestellte Strecke mußte wieder abgerissen, alles Material auf die Loren verstaut werden. Es war viel leichter, die Gleisstücke von den Wagen zu werfen, als sie wieder hinaufzuheben. Versuchte man es langsam, war's doppelt schwer und umständlich. Klaus hatte das Glück, einen Kameraden zu finden, der ebenso groß und kräftig wie er selber war. Die beiden ergriffen das Gleisstück und warfen es mit einem einzigen sicheren Schwung auf den Wagen. Das ging Schlag auf Schlag, während andere Leute das Material viel langsamer in die Wagen brachten.
Der Hauptmann fragte nach dem Namen der beiden eifrigen Leute am vierten Wagen.
»Berken und Freiwilliger Kröning«, erhielt er zur Antwort.
Als der Herbst ins Land kam, konnte Klaus sich seiner Beförderung erfreuen.
Zu Michaelis kamen die neuen Rekruten. Klaus war jetzt ein »alter Mann«. Das bezog sich nicht auf seine neunzehn Jahre, sondern auf die Tatsache, daß er nun ein Jahr beim Militär war.
Die Zeit zwischen dem Herbstmanöver und dem Einrücken der neuen Eingezogenen bildete eine wohlverdiente Ruhepause. Wer von den Gedienten Urlaub beantragte, bekam ihn.—–—
Wieder war ein Winter vergangen. Die Abteilung des Eisenbahnregimentes, zu der Kröning gehörte, marschierte von den Schießständen zurück. Klaus entließ seine Leute auf die Stube und überlegte einen Augenblick, was er anfangen solle. Das Schießen, der lange Marsch; er verspürte Durst, beschloß auf ein Glas Bier in die Kantine zu gehen.
Er trat in den Schankraum, der heute auffallend stark besucht war. Berken setzte sich zu ihm.
»Paß auf, Kröning, heute gibt's noch Überraschungen.«
»Wieso, Berken? Weißt du was Besonderes?«
Berken lächelte geheimnisvoll.
»Ich hab's vom Schreiber. In einer halben Stunde läßt der Alte uns antreten.«
»Nanu, Berken! Eine unvermutete Lumpenparade?«
Berken zuckte mit den Achseln.
»Bei Gott und dem Militär ist kein Ding unmöglich.«
Klaus trank sein Glas aus und ging auf die Stube. Er war kaum dort, als der Befehl zum Antreten durch die Gänge ertönte.
Und dann standen sie da, das ganze Eisenbahnregiment acht Glieder tief aufgebaut, so daß jeder deutlich die Worte des Obersten hören konnte.
Der Oberst sprach von den schweren Kämpfen, die das Deutsche Reich in Süd-West-Afrika gegen die aufständischen Schwarzen zu führen habe. Wohl hätten die deutschen Truppen die Hauptmacht der Aufrührer entscheidend geschlagen. Aber noch bliebe viel zu tun übrig. Immer noch durchzögen versprengte Trupps der Schwarzen die Kolonie und überfielen einzelne Farmen.
In dieser Lage erginge auch an das Eisenbahnregiment der Ruf, Freiwillige für Süd-West-Afrika zu stellen. Heute noch sollten Meldungen erfolgen.
Eine Viertelstunde später befanden sich die Eisenbahner wieder in ihren Stuben.
Die Meldungen der Freiwilligen wurden eingesammelt. Klaus gab seine Liste. An der Spitze stand er selber, dahinter Dreiviertel seiner Leute. Der Feldwebel warf einen Blick darauf.
»Nanu! Ihr seid wohl totalement verrückt geworden? Alle wollen zu den Kaffern. Das scheint euch besser zu passen, als hier Dienst zu tun—Und Sie natürlich auch, Kröning—Nee, meine Jungchen, da habe auch ich noch ein Wort mitzureden.«
Der Feldwebel nahm die Liste und ging weiter. Kurz danach trat Klaus zu Berken in die Stube.
»Wozu melden wir uns, Berken, wenn gesagt wird, man ließe uns doch nicht weg?«
Berken lachte.
»Laß den Alten nur brummen, über unsere Meldungen hat nicht er, sondern das Regiment zu entscheiden.«
»Hm, du meinst?«
»Ganz bestimmt, Kröning.«
Nachdenklich ging Klaus in seine Stube zurück. So ganz sicher erschien ihm das nicht, was Berken da behauptete. Doppelt genäht hält besser, dachte er und setzte sich hin, um einen Brief an Baumeister Jensen zu schreiben. Der war mit dem Regimentsadjutanten gut bekannt. Er trug den Brief selbst zum Kasten, ging dann in die Kaserne zurück.
In steigender Erwartung vergingen die folgenden Tage. Schon war eine Woche verstrichen und immer noch keine Entscheidung da. Berken nahm die Sache von der leichten Seite.
»Blinder Alarm, Kröning. Die denken nicht daran, einen einzigen Mann vom Regiment nach Afrika zu lassen. Ist ja auch viel schöner, wenn sie uns hier ordentlich schleifen und bimsen können.«
Aber dann am zehnten Tage nach der Einreichung der Meldungen kam die Entscheidung. Die Liste derjenigen wurde verlesen, die als Freiwillige für Süd-West-Afrika bestimmt waren. Da gab es lange Gesichter. Viele, die sich gemeldet hatten, wurden nicht verlesen. Klaus stand auf der Liste.
Schon am folgenden Tage wurden die für Süd-West-Afrika angenommenen Freiwilligen neu eingekleidet. Helm und Mütze blieben zu Hause. Dafür gab's einen grauen Filzhut mit einer unheimlich großen Krempe, den die deutsche Kokarde schmückte. Auch vom blauen Tuch mußten die Freiwilligen sich trennen. In einem eigenartigen lehmigen Grau war die neue Uniform gehalten. Man konnte nicht behaupten, daß sie besonders schmuck aussahen.
In der elften Abendstunde kam der Befehl, sich marschfertig zu machen. In
Rotten zu vieren marschierten die Freiwilligen vom Kasernenhof durch
menschenleere Seitenstraßen nach dem Lehrter Bahnhof. Es schien fast, als
wäre es beabsichtigt, den Transport so unauffällig wie möglich aus Berlin
herauszubringen. Eine eigenartige ernste Stimmung befiel Klaus Kröning
während dieses Marsches durch die dunklen Gassen. Er fühlte, daß er einen
folgenschweren Schritt getan hatte, daß ein neuer, wichtiger Abschnitt in
seinem Leben begann.
Als sie dem Bahnhof näher kamen, stießen immer neue Trupps zu ihnen. Zu den Eisenbahntruppen kamen Scharen freiwilliger Reiter, alle bereits in der Tropenuniform.
»Das wird recht reichlich«, meinte einer von Klaus' Leuten, »soviel Platz ist ja gar nicht auf dem Bahnsteig.« Ein anderer unterbrach ihn lachend.
»Wenn der Kerl an der Sperre für uns alle Billetts knipsen muß, kriegt er einen Muskelkrampf.«
Aber sie kamen weder an die Bahnsteigsperre, noch auf den Bahnsteig. Von der Straße aus ging es seitlich ab über Schienen und Schwellen auf das Gelände des Lehrter Güterbahnhofs, wo die Militärzüge bereitstanden.
Wohl eine Stunde nahm die Einwaggonierung in Anspruch, dann setzte der Zug sich in Bewegung und rollte in die Nacht hinaus.
Bald waren die letzten Häuser der Großstadt verschwunden, Spandau lag hinter ihnen. In einförmigem Takt hämmerten die Räder auf den Schienen, in unsicherem Mondlicht dehnte sich zu beiden Seiten die märkische Kiefernheide.
»Na, einen Blitzzug haben wir nicht gerade erwischt«, meinte Klaus' Nachbar. »Wenn's in dem Tempo weitergeht, sind wir vor morgen früh um acht Uhr nicht in Hamburg.«
Klaus hatte sich einen Eckplatz gesichert und versuchte sich's da mit Hilfe einiger Decken so behaglich wie möglich zu machen.
»Morgen früh um acht, meinen Sie, Cords?« erwiderte er. »Da haben wir noch mehr als sieben Stunden Zeit. Benutzen wir sie, um zu schlafen.«
Sein Ratschlag fand allgemeine Befolgung. Selbst die drei Skatratten am anderen Fenster, die unermüdlich Karten dreschen, seitdem sie das Abteil bestiegen hatten, gaben es schließlich auf und verfielen in einen gesunden Dauerschlaf. Die Sommernacht verstrich darüber. Strahlend ging die Sonne eines neuen Tages auf und beleuchtete die fruchtbare hannoversche Tiefebene. Der Zug rollte durch Lüneburg, erreichte Harburg und setzte über die Elbe.
»Ich bin neugierig, wo sie uns hier in Hamburg auspacken werden«, meinte der Scherzbold, der in Berlin den Knipser bedauert hatte.
»Ganz bestimmt nicht in Sankt Pauli«, entgegnete Cords, »fürs Militär haben sie bei der Eisenbahn immer ganz besonders schöne Stellen.«
Die Voraussage dieses Propheten ging in Erfüllung. Ehe die Insassen es sich recht versahen, fuhr der Zug mitten durch die Straßen Hamburgs, ohne daß sie einen Bahnhof zu Gesicht bekommen hätten.
»Wirklich eine schöne Landpartie«, meinte Cords. »Jetzt bin ich doch wirklich, gespannt, wo der Deubel uns hinkarrt. Da ist ja sogar Wasser.«
Der Zug passierte mehrere kleine Brücken hintereinander. Verhältnismäßig enge Wasserläufe, auf denen kleinere Fahrzeuge, Ewer und Schuten, schaukelten. Nun rollte er durch ein Gittertor, an dem mehrere Männer in grünen Uniformen standen.
»Die Zöllner und die Sünder«, rief Cords, »mir schwant was! Wir rollen direkt in den Hamburger Freihafen. Na, ein Trost ist dabei. Auf dem Wasser kann der Zug nicht weiterfahren. Also wird er doch bald halten müssen.«
Jetzt machte das Gleis einen weiten Bogen. An einem Komplex hoher roter Backsteinbauten ging es vorbei. Dann kam eine lange Reihe niedriger Lagerschuppen, vor denen unendliche Mengen von Kisten und Tonnen aufgestapelt lagen, und dann—
Ein kräftiges Hurra! drang aus vielen Kehlen. Vor ihnen lag der Dampfschiffhafen mit den großen, seegehenden Schiffen, Kolossen von vielen tausend Tonnen. Immer langsamer wurde die Fahrt. Der Zug hielt. Befehle wurden gegeben, Ladeplanken an die Güterwagen geschoben. Das Ausladen des Transportes begann. Bald standen sie mit ihrem Material auf dem Kai. Eine Güterlok kam heran und holte den leeren Zug zurück. Das letzte Andenken an die alte Garnison entschwand mit den Wagen, die wieder in das Häusermeer untertauchten.
»Jetzt knurrt mir aber doch der Magen«, wandte sich Cords an Klaus. »Seit gestern abend haben wir nichts mehr empfangen, und gleich ist's elf Uhr Vormittag.«
Klaus lachte.
»Menschenskind, sind Sie denn schon mit dem halben Brot fertig, das jeder von uns vor dem Abmarsch zum Lehrter Bahnhof empfangen hat?«
Cords klopfte auf seinen Brotbeutel, in dem noch ein stattlicher Kanten schaukelte.
»Das nicht, aber... ich könnte mir denken, jetzt eine gute Ochsenschwanzsuppe mit Madeira... danach vielleicht ein Beefsteak à la Meyer und...«
»Mensch, hören Sie auf«, schrie Klaus. »Das Brot rutscht nicht mehr, wenn man Sie reden hört.«
»Antreten!« scholl das Kommando über den Kai.
Die Kolonne setzte sich in Bewegung. Ein kurzes Stück noch ging es am Kai entlang. Dann lag es vor ihnen, massig und grau. Ein riesenhafter Kasten. »Professor Wörmann« entzifferte Klaus die goldenen Lettern am Heck des Schiffes. Hoch ragte das Deck über die Kaifläche. Vom Deck aus führte eine große Laufbrücke, die Gangway, zum Kai hinab. Fünf Minuten später befanden sich die Eisenbahner an Bord des »Professor Wörmann«.
Im Zwischendeck war alles für ihre Aufnahme vorbereitet. Offiziere der Schiffsbesatzung zusammen mit den eigenen Offizieren wiesen den Mannschaften ihre Kojen und Schränke an. Die Freiwilligen machten sich daran, ihre Sachen für die lange Seereise zu verstauen. Wie ein Lauffeuer ging dabei ein Gerücht durch das Zwischendeck: Um zwölf Uhr gibt's warmes Mittagessen.
»Hoffen wir das Beste davon«, murmelte Cords vor sich hin. Da riß ihn ein Befehl aus seinen Betrachtungen.
»Sie da! Mit acht Mann zur Pantry, Essen empfangen!«
Also doch! Cords fiel ein Stein vom Herzen. Seine acht Mann hatte er schnell beisammen. Aber wo sollte er das Essen empfangen? Was hatte man ihm gesagt? Pantry oder so ähnlich, er hatte das Wort in seinem Leben noch nicht gehört. Ein Bootsmann bemerkte seine Verlegenheit.
»Kommt man mit, Jungens. Ick will euch dat wiesen.«
Über einen langen Gang ging's und über eine Treppe, und dann kamen sie in eine Region, in der es verheißungsvoll nach dicken Erbsen und Speck duftete. Das Essen stand in großen Kesseln bereit. Je zwei Mann mußten zufassen, und dann ging's ins Zwischendeck zurück.
»Na, Cords, rutscht es? Ist zwar kein Beefsteak à la Meyer, aber...«
»Der Hunger treibt's 'rein«, antwortete Cords, aber seine Taten straften seine Worte Lügen.
»Sehen Sie mal da, Cords.« Klaus deutete auf das kleine runde Fenster, auch wohl Bulley oder Ochsenauge genannt, vor ihnen. Cords warf einen Blick darauf. Langsam zogen die Lagerschuppen des Kais an dem Fenster vorüber.
»Alle Wetter, sind wir schon in Fahrt? Man merkt ja gar nicht, daß der alte Kahn sich bewegt«, rief Cords. Die Mannschaften strömten auf Deck, um die Ausfahrt aus Hamburg nicht zu versäumen. Ganz langsam schob der »Professor Wörmann« seinen riesenhaften grauen Rumpf aus dem Dampfschiffhafen in die Elbe. Matrosen, die gerade dienstfrei waren, erklärten die Gegend.
Hier ist der Grasbrookhafen, hier der Sandtorhafen. Da geht's zum Binnenhafen. Da ist der Turm der Michaeliskirche. Hier kommt die Alster in die Elbe. Da sind die Landungsbrücken. Da oben auf dem Berg liegt das Seemannshaus.
Langsam glitt die wechselnde Silhouette der alten Hansestadt an den Afrikafahrern vorüber. Altona kam in Sicht und verschwand. Jetzt nur noch Dörfer und Flecken in der tiefgrünen Ebene. Blankenese, die Villenstadt, tauchte am rechten Elbufer auf.
»Gut, daß der alte Professor nicht wackelt«, sagte Cords zu dem Matrosen, der ihm die wechselnden Ufer erklärte, und strich sich dabei den Magen, in dem er ein gutes Pfund Speck verstaut hatte.
»Töv man, mien Jung«, lachte der, »hinter Kuxhaven wird dat woll anders werden.«
Immer breiter wurde der Elbstrom. Einmal hielt das Schiff an. Klaus sah, wie ein Mann den Dampfer verließ, ein anderer an Bord kam. Er fragte einen Matrosen.
»Lotsenwechsel«, war die kurze Antwort. Dann wurde die Elbe so breit, daß man das rechte Ufer kaum noch erkennen konnte. Das Schiff hielt sich dicht am linken Ufer und Kuxhaven kam in Sicht. Der »Professor Wörmann« fuhr ohne stillzulegen daran vorüber.
»Jetzt sind wir auf der Nordsee«, erklärte ein Matrose, der neben Klaus an der Reling stand. »Da auf Backbord liegt die Insel Neuwerk, auf Steuerbord der Böschsand.«
Wieder stoppte der Dampfer. Ein Segelboot kam herangeschaukelt.
»Was gibt's jetzt?« fragte Klaus.
»Der Böschlotse geht von Bord. Nun sind wir bis Afrika auf uns selber angewiesen.«
Auch ohne besondere Erklärung war es zu merken, daß man sich jetzt auf der Nordsee befand. Ganz leise hob und senkte sich der Riesenrumpf des »Professor Wörmann« in einer langen Dünung. Das Lotsenboot aber tanzte und schaukelte in einer Weise, daß man schon vom Zusehen schwindlig werden konnte. Eben noch lag es dicht an der grauen Wand des Dampfers und im nächsten Augenblick schon wieder mehrere Meter ab. An einem Tau, mit dem einen Fuß in einer Schlaufe stehend, wurde der Lotse außenbords hinabgelassen. Schwebte eben noch über einer mächtigen grünen Woge, hatte dann den richtigen Moment abgepaßt und war mit einem Satz in seinem Boot.
Die Maschinen des »Professor Wörmann« gingen wieder an. Der gewaltige Rumpf setzte sich in Bewegung und durchfurchte mit Nordwestkurs die Nordsee. Die Silhouette von Helgoland tauchte auf.
»Grön is dat Land, rot is de Kant, witt is de Sand, dat sind de Farben von Helgoland«, zitierte einer. Das Schiff drehte auf Westkurs. Die Dämmerung des langen Sommertages begann einzufallen. Einer nach dem anderen suchte die Koje auf, um sich durch einen langen Schlaf von den Strapazen der letzten achtundvierzig Stunden zu erholen.—
Am Nachmittag des nächsten Tages fuhren sie in den englischen Kanal ein.
Klaus stand mit anderen Kameraden auf dem Vorderdeck und lauschte den
Erklärungen des Schiffszimmermannes.
»Jetzt kommen wir an die engste Stelle im Kanal. Seht ihr, Jungens, da nach Steuerbord die weißen Kreidefelsen? Da liegt Dover und auf Backbord habt ihr Calais.«
Der Kurs des Schiffes lag der französischen Küste näher als der englischen. Deutlich war das hügelige, mit dichtem Tannenforst bestandene Ufer zu erkennen. Dunkel und schroff sah die französische Küste aus, ganz anders als die englische. Dort hoben sich die weißen Kreidefelsen zart und licht vom Horizont ab, doch man war zu weit entfernt, um Einzelheiten zu erkennen. Schon wurde der Kanal wieder breiter und beide Ufer verschwanden.
An einem Morgen wurde Klaus in seiner Koje wach. Genauer gesagt, er kam aus
einem gesunden Schlaf allmählich zum Bewußtsein. Was war denn das? Machten
die Kerls auf der Nebenstube so einen fürchterlichen Krach? Das klang ja, als
ob die Pritschen und die blechernen Waschschüsseln mit Gewalt auf den Boden
geworfen würden. Zum Himmeldonnerwetter, da sollte doch gleich...!
Bums, krach... schon wieder der Mordsradau... das mußte die Stube von Berken sein... bums... krach... schwall... unmöglich, dabei wieder einzuschlafen.
Er riß die Augen auf. Das war ja doch gar nicht... er war ja auf der Fahrt nach... bums... krach... schwall... jetzt machte ihn der Lärm vollkommen munter. Er blickte um sich. Die elektrischen Lampen erhellten das Zwischendeck zur Genüge, um alle Einzelheiten zu erkennen. Ihm gegenüber lag die Koje von Cords. Der steckte eben den Kopf heraus, hatte einen Blechtopf in der Hand und spuckte, was er spucken konnte. Und da und dort und drüben und in jener Ecke machten es die Kameraden genau so. Dabei zeigten die sonst so gesunden roten Gesichter einen Teint, der ungefähr die Mitte zwischen Schweinfurter Grün und Düsseldorfer Mostrich hielt.
Bums... krach... schwall... kam der Lärm wieder von oben. Jetzt klang's, als ob da Riesenkübel voller Wasser auf das Deck geschleudert würden.
Klaus sprang aus der Koje und ging zu einem der Bulleys. Der Morgen graute schon. Eben konnte er einen Blick durch das Fenster auf die See tun. Aber auch nur für wenige Sekunden. Dann sah es glasiggrün hinter der Scheibe aus, und dann bums... krach... schwall... kam wieder der Lärm von oben. Eine ganze Weile dauerte es, bis die Sicht durch das Fenster wieder frei wurde, er einen Blick auf das weite, sturmgepeitschte Meer tun konnte. Nach allen Regeln der Kunst stampfte und schlingerte der mächtige Dampfer.—
Alles auf der Welt nimmt einmal ein Ende, auch eine Fahrt über die stürmische
Biskaya. Nachdem der alte »Professor« vierundzwanzig Stunden getaumelt und
getorkelt hatte, tauchte Kap Finisterre auf Backbord auf, und wie mit einem
Schlage war alles anders. Eben noch ein Sturm, daß, wie die Matrosen sagten,
nicht sieben alte Weiber einen Besenstiel grade in der Luft halten konnten,
und jetzt fast Windstille. Eben noch Kälte und Regen, und jetzt blauer Himmel
und warmes Sommerwetter. Das Schiff setzte den Kurs fast genau auf Süd, und
geraume Zeit blieb die spanisch-portugiesische Küste auf Backbord sichtbar.
Dann tauchte sie weg, und wieder war alles nur Himmel und Wasser.
Die Tage vergingen darüber. Längst war Sturm und Seekrankheit vergessen. Azurblau fast wie ein Spiegel die See, tiefblau der Himmel darüber. Man hätte restlos glücklich sein können, wenn nicht... wenn nicht in dieser so idealen Lage der Dienst sich wieder gemeldet hätte. Für jeden Tag wurden sechs Stunden Dienst angesetzt, und da man auf dem Deck des »Professor Wörmann« nicht gut Eisenbahnen bauen und auch kaum scharf schießen konnte, so blieb nichts anderes übrig als jene gymnastischen Übungen, die zwar in ihren Wirkungen erfreulich, aber bei der Ausübung sterbenslangweilig sind.
Doch da konnte nun nichts helfen. Der Herr Hauptmann hatte zu befehlen geruht, und die nachgeordneten Stellen hatten zu gehorchen. So wurde geübt, als der »Professor Wörmann« an Funchal und Teneriffa vorbeifuhr, es wurde geübt, als sein Kiel den Wendekreis des Krebses kreuzte und Kap Verde passierte, und man übte noch auf der Höhe von Freetown. Dann machte die Natur dem Dienst einen Strich durch die Rechnung. Das Tropenklima mit Wärmegraden von ungeahnter Höhe trat in die Erscheinung, und aus der Erwägung heraus, daß man die Eisenbahner doch lebendig nach Afrika bringen mußte, wurden die Übungen bis auf weiteres eingestellt. Dafür brachte die Passage des Äquators auf andere Weise Leben in das Schiff. Gott Neptun selber erschien mit reichlichem Gefolge an Bord, und am Abend dieses Tages konnten achthundert Täuflinge stolz den Brief in die Tasche stecken, der ihnen bekundete, daß sie die Äquatortaufe mit Erfolg empfangen hätten.—
Zwei Wochen waren sie in See, und immer noch lief der Dampfer unentwegt nach
Süden. St. Helena wurde passiert, und dann kam nach langen, langen Tagen zum
erstenmal wieder Land in Sicht, das Festland von Süd-West-Afrika. Eine
endlose kahle Küste, an der tagein, tagaus eine brüllende Brandung stand. Es
schien, als wollten die mächtigen Wogen des Atlantik hier alle Kraft und Wut,
die sie auf ihrem langen Lauf vom Westen her gespeichert hatten, mit einem
Schlage loswerden. Auch für den Nichtseemann war es klar, daß jedes Schiff,
das an diese Küste geriet, dem sicheren Untergange verfallen war.
Am Ende der dritten Woche änderte sich das Bild. Eine lange, tiefe Bucht tat sich auf und in dem Augenblick, in dem der »Professor Wörmann« hinter die schützende Landzunge einfuhr, war die Brandung verschwunden. Der sichere Hafen von Lüderitzbucht nahm das Schiff auf. Unmittelbar am Kai machte der Dampfer halt, die lange Reise war zu Ende.
Zwei Monate waren verstrichen, seitdem Klaus Kröning den Fuß auf afrikanischen Boden gesetzt hatte. Im Hochsommer war er von Deutschland abgefahren und mitten in den südafrikanischen Winter gekommen. Bitter kalt waren die Nächte hier, die wenigen Wasserlachen jeden Morgen mit einer Eisschicht bedeckt. Doch es war kein deutscher Winter mit verschneiten Tannenforsten. Es war Winter in einer Wüste, in der erbarmungsloser Flugsand alles beherrschte.
Ganz anders hatte Klaus sich den dunklen Erdteil vorgestellt. Von undurchdringlichen heißen Urwäldern hatte er geträumt, durch die nur die Axt dem Wanderer den Weg zu bahnen vermag. Von riesigen Strömen, von gewaltigen Wasserfällen. So mochte es auch wohl hoch im Norden, im äquatorialen Teil des Landes aussehen. Hier waren die Ströme ganz anderer Art. Die flossen nicht über, sondern unter dem Sand. Breite Flußbetten gab es zwar, aber man mußte metertief graben, um zu dem Wasser zu gelangen, das sich in der Tiefe zum Meere hinzuquälen versuchte und es doch nicht erreichte.
Die Vegetation: Graue, verstaubte Büsche, nicht zu vergleichen mit den grünen Laubbäumen des deutschen Waldes. Besonders nichtsnutzig und widerwärtig eine Gestrüppart mit langen, nach rückwärts gebogenen Dornen. »Wart een bisken« nannten die burischen Farmer dies Unkraut. Der Name war treffend gewählt. Wer mit solchem Strauch in Berührung geriet, der mußte sich sorgfältig daraus lösen und durfte mit der Zeit nicht sparen, wenn er mit heilen Kleidern oder wenigstens mit heiler Haut freikommen wollte.
Die Sprache! Es wurde den Deutschen nicht schwer, sich mit den hier ansässigen Buren zu verständigen. Die sprachen ein abgeschliffenes Holländisch, das sich wie ein gemütliches Platt anhörte. Mit den Schwarzen ging's auch zur Not. Wenn die nicht schon etwas deutsch gelernt hatten, sprachen sie wenigstens einige Brocken burisch. Aber leider—es gab nicht nur Schwarze, die zur deutschen Sache hielten, sondern auch andere, die heimtückisch und mit Gewalt gegen alles vorgingen, was deutsch oder überhaupt weiß war. Deswegen waren ja Klaus und seine Kameraden ins Land gerufen worden.
Die Regierung hatte die Notwendigkeit erkannt, das große Gebiet der Kolonie durch Eisenbahnlinien zu erschließen. Schon seit Jahren war ein Plan dafür entworfen, tropfenweis nur die Mittel dafür bewilligt worden. Die Ausführung lag in den Händen von Voßberg & Co. Die Strecke Lüderitzbucht—Keetmanshoop war das erste Glied des geplanten Eisenbahnnetzes. Die ersten zweihundert Kilometer landeinwärts waren fertig. Jetzt baute man an der Endstrecke zwischen Brackwasser und Keetmanshoop.
Von Lüderitzbucht aus waren die Eisenbahner nach ihrer Ausschiffung auf die Bahn verladen und über die Strecke hin bis Keetmanshoop verteilt worden. An einem geplanten Haltepunkt zwischen Brackwasser und Bethanien hatten Klaus Kröning und acht Mann ihren Posten. Ihre Aufgabe war es, die Strecke gegen feindliche Überfälle zu sichern, Anforderungen um Hilfe, die seitens der Bauverwaltung an sie gestellt wurden, nach Möglichkeit nachzukommen. Die Strecke von Brackwasser nach Bethanien, eine nur dreißig Kilometer lange Seitenlinie der Hauptbahn, war bereits trassiert. Die Erdbewegungen waren fast vollendet und stellenweise wurde schon mit dem Legen der Geleise begonnen.
Ein Oktobertag neigte sich seinem Ende zu, als ein Kaffernboy atemlos in die
Station gesprengt kam. Klaus ging ihm entgegen. Der Schwarze stammelte wirres
Zeug, kaffrisch und burisch durcheinander. Nur so viel verstand Klaus, daß er
Hilfe verlangte. Dabei hielt er in der Rechten einen Brief. Klaus riß ihm das
Papier aus der Hand, öffnete es, las.
Wenige Zeilen in fliegender Hast mit Bleistift hingeworfen:
»Bitte dringend um Hilfe. Werden auf Farm Kupried von starker Hererobande belagert.«
Die Unterschrift... Klaus rieb sich die Augen und blickte schärfer auf die Buchstaben. Das hieß doch... kein Zweifel, das ließ sich nur als »Baumeister Jensen« lesen. Oder sollten die wirren Buchstaben »Hauptmann Jensen« heißen?
Er überlegte. Die Farm lag etwa fünfzehn Kilometer landeinwärts. Die Instruktion befahl ihm, Ersuchen um Hilfe seitens der Bauverwaltung nachzukommen, nach Möglichkeit.
Klaus zog seine Schlußfolgerungen: Hauptmann Jensen kann befehlen. Baumeister Jensen gehört zu Voßberg & Co. Voßberg & Co. haben die Bauleitung, folglich gehört auch Baumeister Jensen dazu.
Was konnte passieren, wenn er die Station hier allein ließ? Die Mauersteine, Schienen und Schwellen würden die aufständischen Schwarzen kaum wegtragen. Drüben auf der Farm waren Weiße, waren Leute vom Bau in Gefahr und riefen um Hilfe.
In wenigen Minuten waren seine Leute um ihn versammelt. Wasserflaschen, Brotbeutel und Patronentaschen gefüllt, Extra-Patronengürtel um die Brust geschlungen. In scharfem Trab sprengte die Kavalkade nach Osten zu durch das afrikanische Veldt. Einsam blieb die halbvollendete Station zurück.—
Baumeister Jensen visierte sorgfältig und drückte ab. Ein Feuerstrahl zuckte
durch das Nachtdunkel und ein Schrei aus dem trocken-gelben Gras verriet, daß
die Kugel ihr Ziel erreicht hatte.
»Einer weniger, Mynher van Deuren.«
Der antwortete erst, nachdem er auch geschossen hatte.
»Zweie weniger, Mynher Jensen. Viele bleiben noch!«
Jensen schob eine neue Patrone in den Lauf.
»In einer Stunde geht der Mond unter. Die eine Hoffnung, daß Ihr Boy eine unserer Militärstationen erreicht. Sonst...« Baumeister Jensen vollendete den Satz nicht. Das »sonst« konnte sich jeder der hier von den Schwarzen Belagerten selbst ausmalen. Gelang es der schwarzen Bande, bei Dunkelheit an das Haus heranzukommen, Feuer an den Bau zu legen, dann war ihr Schicksal besiegelt. Dann geschah es ihnen wie schon so vielen Weißen auf anderen Farmen. Die Truppen, die endlich kamen, fanden nur noch verkohlte Leichen unter den Trümmern.
Die Hereros waren nicht zu unterschätzende Gegner. Hochgewachsene, sehnige Gestalten von kriegerischer Haltung, ganz anders als die Klippkaffern und Buschleute. Dazu—das war das Schlimme—mit neuzeitlichen kleinkalibrigen Gewehren bewaffnet, die sie gut zu gebrauchen verstanden. Wohl hatte die deutsche Schutztruppe ihre Hauptmacht mehrfach geschlagen und zersprengt. Aber Reste davon hatten sich nach Süden über die Grenze retten können. Eigentlich hätten sie dort entwaffnet und interniert werden müssen. Aber doch unbehelligt wechselten die schwarzen Banden über die Grenze, um über kurz oder lang mit neuen Waffen und Patronenvorräten versehen wieder in Südwest einzubrechen.
Abermals prasselte ein Kugelregen gegen das Wellblechhaus der Farm. Nur die meterstarken Barrikaden, die die Belagerten aus Sandsäcken aufgeschichtet hatten, verhüteten das Schlimmste. Trotzdem—ein Streifschuß hatte Mynher Josias van Deuren verletzt. Schlaff hing sein rechter Arm nach unten. Eine Büchse weniger auf der Seite der Verteidiger.
Die älteste Tochter sprang hinzu. Befühlte den Arm. Kein Knochen verletzt, nur ein Fleischschuß. Schnell war der Ärmel aufgeschlitzt, ein Tuch fest um die blutende Wunde geschlungen. Schon stand die Tochter mit der Büchse des Vaters in der Reihe der Verteidiger, und wieder rollte Schuß um Schuß aus den Schießscharten. Noch hielt das Feuer die Angreifer in Entfernung. Aber immer tiefer sank der Mond, immer schwächer, unsicherer wurde das Licht. Wie lange noch, und die Schwarzen konnten von allen Seiten her den Sturm auf das Gebäude wagen?
Jensen prüfte die Patronenvorräte. Noch zweihundert Schuß. Reichlich genug, um die Angreifer in Schach zu halten, solange es hell blieb. Zuwenig, wenn die Dunkelheit ins Land fiel. Er warf einen Blick auf die Uhr. Noch eine halbe Stunde—dann mußte das unausbleibliche Ende, der letzte Verzweiflungskampf, kommen.
Eine neue Salve von da drüben... Nein! Ein Knattern und Rollen. Keine Kugel schlug hier an der Hauswand ein. Ein wildes Gebrüll der Hereros... jetzt wurde es schwächer... ging in ein Geheul über... und immer noch knatterten ganze Salven dazwischen.
Hier und dort sprangen schwarze Gestalten auf, rannten durch das verdorrte Gras, brachen nach wenigen Sprüngen nieder.
»Gerettet!« Jensen ließ den Kolben seiner Büchse zur Erde sinken und starrte durch die Schießscharten ins Freie.
»Gerettet, Mynher van Deuren! Unsere Leute sind da, machen reinen Tisch mit den Schwarzen.«
Jensen hatte recht. Klaus und seine Leute hielten gründliche Abrechnung mit den Hereros.—
Weit zurück blieben die Pferde hinter einem Dornbusch versteckt. Schleichend
und kriechend pürschte sich Klaus mit seinen Leuten im Halbkreis an die
Schwarzen heran.
»Jeder seinen Mann genau aufs Korn nehmen. Nur auf Kommando schießen, auf Kommando Feuer stopfen!«
Regungslos lagen sie im Anschlag.
»Feuer!« Aus zehn Läufen blitzte es. Der fünfte Teil der Bande war erledigt.
»Neues Ziel nehmen!«
Sekunden verstrichen.
»Feuer!«
Eine neue Salve tat ihre Wirkung. Aber dann hatten die Hereros die Stellung des neuen Feindes erspäht und wandten ihre Waffen dorthin. Es waren tapfere Krieger. Die Bewaffnung auf beiden Seiten fast gleich, die zahlenmäßige Übermacht auf Seiten der Schwarzen.
Eine Salve prasselte über Klaus und seine Leute hin. Zu hoch, um zu treffen. Das Mündungsfeuer verriet denen, wo die Gegner im Grase lagen.
»Schnellfeuer!«
Aus zehn Armeekarabinern prasselte es. Es gab denen den Rest. Viele blieben für immer im Grase liegen. Manche sprangen verwundet auf, gaben nun erst recht ein gutes Ziel.
»Feuer stopfen!«
Unheimlich wirkte die Stille nach dem Lärm des Gefechtes. Einige von Klaus' Leuten wollten aufspringen. Ein scharfer Befehl zwang sie zurück. Klaus hatte genug von der Kampfweise der Hereros gehört. Im Notfalle sich totstellen, den Gegner ahnungslos herankommen lassen, aus nächster Nähe auf ihn schießen. Solcher Gefahr wollte er seine Leute nicht aussetzen.
»Vorsichtig zurück!«
An die hundert Meter krochen sie zurück, umgingen in weitem Bogen den Kampfplatz, erreichten die Farm von der anderen Seite. Klaus schlug mit dem Karabinerkolben gegen das Tor.
»Wer da?«
»Gut Freund! Deutsche Truppen!«
Die Tür öffnete sich. Beim Scheine einer Petroleumlampe erkannte Klaus die Gestalt Jensens.
»Herr Baumeister!«
Jensen drückte ihm stumm die Hand und zog ihn in das Haus. Seine Leute folgten ihm. Sorgfältig schob einer der Söhne van Deurens wieder den schweren Torbalken vor. In diesem Augenblick sank der Mond unter den Westhorizont, volle Dunkelheit lag über dem Veldt.
»Gerettet!« Das Wort sagte Jensen. Endlich gelang es Klaus, seine Rechte aus der Jensens zu lösen.
»Ich denke, Herr Baumeister, viel wird von denen da nicht übriggeblieben sein. Wir haben sie gut im Kreuzfeuer gehabt... Sie haben einen Verwundeten?«
In Begleitung Jensens trat er an das Bett, auf dem der alte van Deuren noch mit dem Notverband lag. Winkte einem seiner Leute.
»Sedelmeyer!«
»Ja, bitte.«
»'ran hier mit dem Pflasterkasten!«
Der Gerufene war der Sanitäter der Truppe. Schnell hatte er seinen Verbandskasten ausgepackt und machte sich bei dem Verwundeten zu schaffen. Befühlte und betastete den Arm, daß van Deuren ein Stöhnen nicht unterdrücken konnte.
»Was ist's, Sedelmeyer?«
»Ein Fleischschuß. In vierzehn Tagen ist alles wieder gut.«
Er legte dem Verletzten einen Verband an und bettete den Arm in einer Schlinge. Die Folgen der Behandlung zeigten sich schnell. Die Schmerzen ließen nach. Bald saß van Deuren unter den Seinen am Tisch, auf dem das burische Nationalgetränk, der Kaffee, aus einer mächtigen Kanne dampfte.
Jetzt ließ die Aufregung des glücklich überstandenen Kampfes nach, und ein allgemeines Gespräch kam in Gang. Was Klaus da von van Deuren und Baumeister Jensen zu hören bekam, klang freilich nicht erfreulich. Der Hererotrupp, den sie hier zusammengeschossen hatten, war nicht der einzige. An zahlreichen Stellen sollten wieder schwarze Banden über die Grenze gekommen sein. Aus dem ganzen Gebiet zwischen Keetmanshoop und Warmbad lagen Hiobsposten vor. Bei Kalkfontain sollten sich die Schwarzen in größerer Stärke gesammelt haben. Deutsche Streitkräfte waren im Anmarsch dorthin. Bis sie ankamen, konnten noch Tage vergehen.
Klaus ballte die Faust.
»Ich verstehe nicht, daß unsere Leute mit der Bande nicht längst fertig sind. Es müßte doch möglich sein, die Aufständischen einzukesseln, zu vernichten oder gefangenzunehmen.«
Baumeister Jensen schüttelte den Kopf.
»Sie kennen Süd-West noch nicht, Klaus. Seit zwanzig Jahren haben wir das Land und ungefähr ebensolange wird hier gekämpft. Ohne Übertreibung kann man behaupten, daß ein Herero mit einem Gewehr im südafrikanischen Veldt reichlich soviel wert ist wie ein europäischer Soldat.
Die sind schnell da, wo unsere Truppen nicht sind, und verschwinden ebenso schnell. Wär's nicht so traurig, man müßte die Führer dieser Banden bewundern. Meisterhaft verstehen sie's, sich an geeigneter Stelle stark zu machen und dann den Gegenschlag des Feindes abzuducken.«
»Es müßte möglich sein, sie von allen Seiten einzukesseln und vernichtend zu schlagen. Es stehen an die zehntausend Mann von uns in der Kolonie.«
Jensen rührte nachdenklich in seiner Kaffeetasse.
»Wenn sich der Krieg in Europa abspielte, hätten Sie recht. Aber hier... nur wenige Wasserlöcher in einer trostlosen Wüste. Entfernungen bis zu hundert Kilometern zwischen den einzelnen Wasserstellen. Gelingt es den Aufständischen, ein einziges der Löcher mit Übermacht zu besetzen und zu halten, ist die Etappe gesprengt, die Truppe, die dem Wasserloch zumarschiert, dem Dursttode verfallen. Glauben Sie mir, so mancher brave deutsche Reiter ist während der letzten Jahre in diesem vermaledeiten Lande verschmachtet, weil die Schwarzen ihm das Wasser sperrten.«
Mynher van Deuren mischte sich ein.
»Denken Sie an die große Schlacht am Waterberg vor zwei Monaten. Wie war's da?«
Klaus hatte von der Schlacht gehört. Der mörderische, zweitägige Kampf hatte mit der vollständigen Niederlage der mit dem Mute der Verzweiflung fechtenden Hereros geendet. Tausende von ihnen waren gefangen worden, Tausende in der Sandwüste dem Durst, dem Hunger und den Geschossen der Verfolger erlegen. Nur geringe Teile hatten sich unter ihrem Oberhäuptling Maharo auf fremdes Gebiet flüchten können. Und doch waren ihre Banden jetzt wieder da und brachten Tod und Verderben über friedliche Farmer.
Baumeister Jensen führte das angefangene Thema fort.
»Mynher van Deuren hat recht. Mit fast zehntausend Mann wurde die Einkesselung der Schwarzen am Waterberg begonnen. Sollte das Unternehmen sicheren Erfolg haben, mußten alle Wasserlöcher fest in deutscher Hand sein. Was das an Mannschaften erforderte, geht aus den Zahlen des Schlachtberichtes hervor. Nur mit eintausendfünfhundert Mann, dreißig Geschützen und zwölf Maschinengewehren konnte unsere Streitmacht schließlich den Waterberg einschließen. Alles übrige hatte die Sicherung der Etappenstraßen beansprucht.
Freilich! Es hat gelangt, und nach der Schlacht erwies sich die starke Besetzung der Wasserlöcher als nützlich. Diesmal waren die Rollen vertauscht. Da saßen wir am Wasser. Es blieb den geschlagenen Schwarzen nur die Wahl, sich gefangen zu geben oder zu verdursten.«—
Fast ein Jahr war darüber vergangen. In der Glut des südafrikanischen Sommers
hatte Klaus das Weihnachtsfest gefeiert. Schon war es wieder Winter, als
endlich die Soldaten zur Entlassung kamen. Viele kehrten in die Heimat
zurück. Klaus erinnerte sich der Worte, die Baumeister Jensen einmal in
Schleswig zu ihm sagte:
»Vergessen Sie nicht, daß Sie zu Voßberg & Co. gehören!«
Für ihn gab es hier im Lande Arbeit bei der Firma. Die große Nord-Südbahn von Otavi über Omaruru–Karibib und Rehoboth nach Keetmanshoop wurde in Angriff genommen.
Klaus betrachtete nachdenklich die große Wandkarte über seinem Schreibtisch. In starken schwarzen Linien markierte sich dort die Eisenbahn, soweit sie bereits ausgebaut war. Schwächere rote Linien zeigten die Strecken, deren Bau für die kommenden Jahre geplant war. Zusammen mußte das alles ein wunderbares Verkehrsnetz werden. Die fertiggestellten drei Hauptlinien bildeten das Gerippe des ganzen Systems. Da war die fast hundert Meilen lange Otavibahn, die von Swakopmund nordöstlich bis zu den großen Erzlagern von Otavi und Grootfontein vorstieß, dann die Linie Swakopmund–Windhuk und drittens die Lüderitzbahn, die von Lüderitzbucht in östlicher Richtung bis nach Keetmanshoop in das Landesinnere vordrang. Durch die nun vor vier Wochen eröffnete Nord-Südbahn wurden diese Linien zu einem System zusammengeschlossen. Von Kalkfontein im Süden bis nach Grootfontein im Norden führte der Bahnstrang jetzt über eine Länge von mehr als tausend Kilometer mitten durch die Kolonie.
Fürwahr, ein schönes, großes Werk! Klaus erinnerte sich der Bilder der letzten Wochen. Wie überall an den Haltestellen der neuen Strecke in Gründorn, Gibeon, Rehoboth und an vielen anderen Plätzen noch die Farmer mit ihren altfränkischen Ochsenkarren versammelt waren und die ersten Züge mit donnerndem Hurra begrüßten.
Was erhofften die nicht alles von der neuen Eisenbahn. Einen schnellen billigen Transport ihrer Erzeugnisse zu den beiden großen Küstenplätzen Swakopmund und Lüderitzbucht. Die Möglichkeit, ihre Herden günstiger auszunutzen als früher. Da gab es phantastische Naturen unter den Siedlern, die bereits an eine großzügige Fleischversorgung Deutschlands von Südwest her dachten. Da waren Leute, die im Geiste schon Tag und Nacht die Kühlwagen auf der neuen Strecke rollen sahen.
Klaus warf einen Blick auf die Uhr. Vor fünf Stunden war kein Zug fällig, die Strecke für lange Zeit frei. Er sprang auf, ergriff den Tropenhelm und verließ den Raum. Geblendet von den grellen Strahlen der südafrikanischen Sonne schloß er für einen Moment die Augen, gewöhnte sich nur allmählich an die Überfülle von Licht.
Da lag der schimmernde Schienenstrang vor seinen Füßen. Glitzernd zog sich das eiserne Band durch das afrikanische Veldt.
»Morro, Baas!« klang ihm der Gruß seines schwarzen Boys entgegen.
»Morro, Abraham! Mach die Draisine bereit! Vier Leute dazu.«
Der Boy beeilte sich, die Befehle des weißen Baas zu erfüllen. Von vier kräftigen Klippkaffern getreten, rollte die Eisenbahndraisine heran. Klaus nahm seinen Platz darauf ein.
»Vorwärts!« Er wies mit der Hand nach Norden. »Ach so!... Die Maschine muß erst geheizt werden.«
Er griff in die Tasche, zog ein paar braune Stücke heraus, warf sie den Kaffern zu. Es war hydraulisch gepreßter Blocktabak vom Aussehen und von der Härte alten Mahagoniholzes. Ein Europäer würde sich vergeblich daran versucht haben, die starken Gebisse der Schwarzen wurden damit fertig. Knirschend und krachend zermalmten sie das harte Zeug, und dann kam die Draisine in Gang und rollte in flotter Fahrt nach Norden hin.
Immer spärlicher wurde die Vegetation zu beiden Seiten der Strecke. Jetzt war das letzte Grün verschwunden. Nur noch die trost- und laublosen Dornbüsche unterbrachen hier und da die öde Sandfläche. Klaus hatte Zeit, sich seinen Gedanken hinzugeben. War das wirklich das richtige Leben, was er hier führte? War es das, was er sich erträumt hatte, als er den Entschluß faßte, in Afrika zu bleiben?
Auf Meilen hin war er hier der einzige Weiße unter dem schwarzen Volk, sprach mit denen einen undefinierbaren Dialekt, ein Gemisch aus holländischen, englischen und kafferischen Brocken. Er erinnerte sich der Erzählungen, die er in Lüderitzbucht und Swakopmund gehört hatte. Der Geschichten von weißen Siedlern, die in ständigem Zusammenleben mit den Schwarzen vollkommen »verkaffert« waren.
Sollte ihm hier ein ähnliches Schicksal bevorstehen? Nein! Er erkannte die Gefahr. Was ihm zuerst ein Vorteil schien... die schnelle Erfassung und Beherrschung dieser primitiven Umgangssprache, die Fähigkeit, mit den Eingeborenen gut und glatt fertig zu werden... das alles konnte ihm hier, wo er fast dauernd allein unter ihnen leben mußte, gefährlich werden. Er würde sich selbst scharf beobachten, würde lieber wieder nach Deutschland zurückkehren, bevor er hier...
Aber nein!... Er strich sich mit der Hand über die Augen... soweit war es noch nicht. Ein Lächeln lief über seine Züge.
Fing er jetzt schon an, Grillen zu fangen? Was sollten da die anderen sagen, die Faktoreibesitzer, die zwei und noch mehr Jahre mutterseelenallein irgendwo hinten im Busch zwischen dem schwarzen Volke hausten.
Mit Gewalt verscheuchte er die lästigen Gedanken und musterte die Umgebung. Unermüdlich traten seine vier Nigger in die Pedale, während ihnen die braune Tabaksbrühe aus den Mundwinkeln floß. In unverändertem Tempo rollte die Draisine auf dem Schienenstrang nach Norden. Das Land zeigte hier eine andere Formation. Nicht mehr flach und eben wie ein Brett dehnte sich das afrikanische Veldt. Langgestreckte Hügel, dünenartige Bildungen zeigten sich zu beiden Seiten der Bahn.
Noch zehn Minuten weiter ging die Fahrt. Dann ließ Klaus halten.
»Hallo, Twenty five!« Einer der Kaffern sprang auf. Er war es von Kindheit an gewohnt, auf den Namen zu hören. Der Teufel mochte wissen, wie er an den Namen »Fünfundzwanzig« gekommen war. Vielleicht hing es mit dem Schambock, der kurzen Nilpferdpeitsche zusammen. Klaus hatte es längst aufgegeben, sich über die sonderbaren Rufnamen der Eingeborenen zu wundern.
»Twenty five! Du bleibst hier stehen und hältst die Latte so.« Mit diesen Worten dirigierte er den Kaffern zu einem Kilometerstein an der Strecke, drückte ihm eine Meßlatte in die Hand, ging zu seinem Sitz zurück und gab den anderen das Zeichen, wieder zu treten. Fünf Kilometer weiter ließ er zum zweiten Male halten und die Draisine von den Schienen heben.
»Hallo, Josua! Du bleibst hier.«
Klippkaffer Nr. 2 wurde ebenfalls mit einer Meßlatte neben einen Kilometerstein postiert und ermahnt, die Latte in der angegebenen Weise zu halten.
»Ihr anderen kommt mit.«
Die beluden sich mit allerlei Gepäck und folgten ihrem weißen Baas querfeldein. Der hielt den Kompaß in der Hand und schritt genau nach Westen weg auf einen Dünenzug am Horizont zu. Es war ein schwieriger und langwieriger Marsch durch den lockeren Sand, öfter als einmal blieb Klaus dabei stehen und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Jetzt waren sie fast eine Stunde unterwegs und hatten den Fuß der etwa hundert Meter hohen Düne erreicht. Der Aufstieg begann. Noch lockerer war hier der Sand, noch schwieriger das Vorwärtskommen. Bis über die Knöchel sank Klaus bei jedem Schritt in den Boden ein und arbeitete sich mühsam nach oben. Immer näher kam er dem Dünenkamm, der sich messerscharf von dem tiefblauen Himmel abhob. Diese Sandfläche hier sah so frisch und unberührt aus, als hätte seit der Erschaffung der Welt noch niemals ein Mensch seinen Fuß darauf gesetzt. Und doch wußte Klaus sicher, daß er genau an der gleichen Stelle schon einmal vor vier Wochen auf die Düne gestiegen war.
Steiler wurde der Hang. Nun ging es beinahe in einer Neigung von fünfundvierzig Grad nach oben, und dann war der Kamm erreicht. Weithin dehnte sich vor seinen Augen die andere Seite der Düne, die viel flacher verlief.
Hier blieb er stehen und ließ seine Blicke suchend nach rechts und links gehen. Das, was er suchte, konnte er nirgends entdecken. Die Meßlatte, die er vor vier Wochen an dieser Stelle in den Dünenkamm gesteckt hatte, war und blieb verschwunden. Was tun? Einer von den beiden Kaffern hier war auch das vorige mal mit dabeigewesen. Den danach fragen? Lieber nicht! Die beiden Kerls grinsten so vor sich hin, als ob sie schon mehr dächten, als Kaffern zu denken gesund ist.
Er winkte die beiden mit ihren Traglasten zu sich heran. Der große Feldmessersonnenschirm wurde aufgespannt, das Stativ mit dem Theodolithen darunter aufgestellt. Der weiße Mann begann mit seiner Zauberei, die bei den Kaffern immer wieder eine Mischung von Furcht und Neugierde erregte. Sorgfältig visierte er durch das Fernrohr des Theodolithen die beiden schwarzen Gentlemen bei Kilometerstein 180 und 185 an und maß den Winkel zwischen beiden Visierlinien. Zur größeren Sicherheit stellte er auch die genaue West-Ostlinie fest und notierte die Winkel, die sie mit den beiden Visierlinien machte.
An der Stelle, wo bisher der Theodolith gestanden, ließ er eine Visierlatte senkrecht in den Sand stecken. Dann ging es den alten Weg zurück zur Bahnlinie und zur Draisine. Wieder wurde der Theodolith aufgebaut und erst die verlassene Meßlatte auf dem Dünenkamm anvisiert, dann die Latte, die »Twenty five« fünf Kilometer entfernt am Bahndamm in die Luft hielt. Darauf ging die Fahrt nach Süden zurück.—
Zwei Stunden später saß Klaus wieder an seinem Schreibtisch. Zu seiner Linken
lag die Logarithmentafel, vor ihm ein Schreibblock, mit Zahlen dicht bedeckt.
Kopfschüttelnd besah er sich das Resultat seiner Rechnung und zog jene andere
ältere Rechnung zum Vergleich heran, die er vor vier Wochen nach der ersten
Expedition auf die Düne aufgestellt hatte.
Er konnte... wollte es nicht glauben, was ihm die Zahlen hier doch klipp und klar bewiesen. Noch einmal stellte er beide Rechnungen von vorn auf und dann... dasselbe Resultat. Jeder Irrtum ausgeschlossen! Im Laufe der letzten vier Wochen war der Kamm der gewaltigen Düne der Bahnlinie um volle vierhundert Meter näher gekommen. Gerade noch fünf Kilometer war er jetzt vom Schienenstrang entfernt. Kein Zweifel mehr! Die mächtige Düne wanderte unaufhaltsam auf die Bahn zu.
Wie spielend glitt der Bleistift in seiner Rechten über das Papier und schrieb ein Exempel. 5000:400. Er strich die überschüssigen Nullen fort und schrieb das Resultat... 12,5 nieder. 12,5 mal 4 Wochen... 50 Wochen... nicht ganz ein Jahr, dann würde die neue, mit so vielen Hoffnungen eröffnete Bahn an dieser Stelle unter der Düne begraben sein.—
Unmöglich! Er sprang auf und trat vor die Wandkarte. Unmöglich! Es war doch
undenkbar, daß alle die klugen und gewissenhaften Fachleute, die das
Bahnprojekt ausarbeiteten, diese Gefahr nicht vorausgesehen haben
sollten.
Gewiß! Sie hatten mancherlei vorausgesehen und auch nach Möglichkeit Abhilfe geschaffen. Schon während des Baues waren Sandverwehungen der Strecke durch die fast ständig von Westen her kommenden Küstenwinde an der Tagesordnung gewesen. Aber weder der Direktor Hartung noch der Baumeister Jensen hatten diese Vorkommnisse tragisch genommen. Mit gutem Erfolg wurden dagegen die Steckzäune angewandt, deren merkwürdige Wirkung Klaus schon während des Bahnbaues kennengelernt hatte.
Die Steckzäune waren ein probates Mittel gegen einfache Sandverwehungen und auch dagegen, daß einem nicht die ganze Bahnstrecke unterwühlt wurde und zusammensackte. Aber was konnten diese Zäune noch helfen, wenn die ganze gewaltige, vier Kilometer breite und viele Meilen lange Düne gegen die Bahnstrecke losmarschierte. Wie sollten die kaum zwei Meter hohen Zäune gegen diese fünfzigmal so hohen Sandmassen schützen.
Hatten die Herren von der Oberleitung die Gefahr der Wanderdünen wirklich übersehen?... Oder hatten sie auch dagegen ein besonderes Mittel in Bereitschaft, wenn die Gefahr dringend wurde?... Oder narrten ihn seine Sinne?... Sah er Gefahren, die nicht vorhanden waren?
Was hatte ihn heute dazu getrieben, die Expedition in die Dünen zu unternehmen? Was hatte ihn schon vor vier Wochen zum ersten Male dazu veranlaßt? Er hatte gefunden, daß die Karten von Süd-West, die sonst jeden Flußlauf, jedes Wasserloch mit größter Genauigkeit wiedergaben, die Dünen teils gar nicht, teils widersprechend enthielten. Das war ihm aufgefallen, da er von Deutschland her an Karten gewöhnt war, die jede Bodenerhebung zuverlässig verzeichneten. Das hatte ihn vor vier Wochen bewogen, die Lage der großen Düne zwischen Gründorn und Fahlgras trigonometrisch festzustellen und in seine Karte einzutragen.
Bis dahin war alles klar. Aber was hatte ihn heute veranlaßt, das Experiment noch einmal zu wiederholen? Es war plötzlich wie ein Drang, wie ein unwiderstehlicher Trieb über ihn gekommen. Doch was war die Ursache dafür? Er sann und überlegte.
Ja, das mochte wohl der Grund gewesen sein. Gestern abend hatte er eine Beschreibung der Kolonie durchblättert. Von riesenhaften Sandmassen stand da geschrieben, die alljährlich durch die Stürme hin und her getrieben werden und im Laufe der Jahre große, früher gut benutzbare Häfen vollkommen verschwinden ließen.
Er trat zu einem Regal und suchte das Buch hervor, schlug die Stelle auf, an die er dachte. Da stand es schwarz auf weiß: »Den größten Teil des Jahres fallen von Westen her scharfe Seewinde in das Land ein und halten die Sandmassen in ständiger Bewegung. Der Wind schiebt die lockeren Sandkörner auf der ihm zugewandten Luvseite der Düne bis zur Kammhöhe empor, läßt sie dann auf der Leeseite hinabrollen. Auf diese Weise wird die Düne auf der Luvseite ständig abgebaut, auf der Leeseite neu aufgebaut. Ihr Kamm und ihr ganzes Massiv wandert allmählich im Sinne der Windrichtung weiter. Auf diese Weise werden gewaltige Sandmassen von der Küste her bis weit in das Innere des Landes vertragen, wo sie in regenreichen Gebieten endlich zur Ruhe kommen und sich begrünen.«
Klaus legte sich ein Lesezeichen in das Buch und stellte es wieder in das Regal. Unruhig ging er in seinem Büro auf und ab. Was sollte er tun?
Der Oberleitung der Bahn seine eigenen Beobachtungen und Befürchtungen vortragen?... Sich dabei wie schon öfter in seinem Leben den Mund verbrennen? Wäre es nicht klüger, die Entwicklung der Dinge abzuwarten... erst zu reden, wenn die Gefahr ganz unverkennbar geworden war?...
Und dann?... Würde man ihm dann nicht erst recht Vorwürfe machen, daß er so lange geschwiegen oder daß er die Gefahr nicht früher erkannt habe? War er nicht schließlich als Bahningenieur für die dauernde Betriebsfähigkeit seiner Strecke verantwortlich? Legte ihm sein Amt nicht die Pflicht auf, jede Bedrohung der Strecke rechtzeitig zu erkennen und weiterzumelden?...
Klaus schlug mit der Faust auf den Tisch. Gewiß! So war es, und ungesäumt beschloß er zu tun, was er für seine Pflicht hielt.
Kaum hatte der Nachmittagszug nach Keetmanshoop die Station passiert, als er seinen Bericht für die Herren in Windhuk und Swakopmund abfaßte.
Nur kurz war der Text. Eine einfache Meldung, daß die große Wanderdüne zwischen Gründorn und Fahlgras sich im Laufe der letzten vier Wochen der Bahnlinie um vierhundert Meter genähert habe. Um so eindringlicher wirkten die beiden Anlagen dieses Berichtes, Zeichnungen und trigonometrische Errechnungen der Verschiebung des Dünenkammes.
Der Abendzug nahm das Schreiben nach Swakopmund mit.
*
Baumeister Jensen hatte Vortrag bei dem Eisenbahndirektor Hartung:
»Herr Direktor, eine Meldung des Ingenieurs Kröning aus Gründorn...«
Hartung blickte auf.
»Was gibt's dort? Was hat der Kröning? Sind ihm die Kaffern da aufsässig?«
»Sein Bericht ist nur kurz. Gestatten Sie, daß ich ihn vorlese.«
Hartung nickte, Jensen las. Als er geendet, zerknitterte der Direktor nervös ein Stück Papier, das ihm in die Finger geriet.
»Zum Teufel, Jensen! Das wäre... Was halten Sie von dem Bericht?«
Der Baumeister zuckte die Achseln.
»Der Bericht sagt kein Wort zuviel. Das Schlimmste, die Skizzen und Berechnungen, die Kröning ihm beigefügt hat. Sie beweisen, was der Bericht behauptet.«
Der Direktor war aufgesprungen. Im Selbstgespräch lief er in dem Raum auf und ab.
»Kröning!... Er ist einer unserer tüchtigsten Leute... Bis jetzt hatte alles Hand und Fuß, was er tat. Was sollen wir tun?«
Jensen blickte von den Triangulationsskizzen Krönings auf.
»Für alle Fälle die Feststellungen Krönings nachprüfen und weiterverfolgen. Ich möchte selbst die Messung des Dünenkammes alle vierzehn Tage wiederholen...«
»Und wenn Ihre Messungen die Behauptungen Krönings bestätigen?... Was dann? Dann bleiben uns etwa noch neun Monate und unsere Strecke liegt unter der Düne. Die ganze Nordsüdbahn wäre blockiert...«
Jensen fiel ihm ins Wort.
»Dazu darf es nicht kommen. Ich schlage vor, daß wir uns aus Deutschland schnellstens Literatur über die Bekämpfung von Wanderdünen kommen lassen.«
Hartung strich sich über die Stirn.
»Sie haben recht, Jensen. Ich erinnere mich. Wir sind auch zu Hause mit Derartigem gesegnet... Auf den Nehrungen... auf den friesischen Inseln... Jawohl... Wenn ich mich recht erinnere, hat man eine besondere Art von Strandhafer gezüchtet, der meterlange Wurzeln durch den Sand treibt und die wandernden Dünen in kurzer Zeit zur Ruhe bringt.
... Sie haben recht!... Schleunigst die ganze Literatur darüber hierher. Telegrafieren Sie heute noch nach Leipzig. Der ›General‹ verläßt in acht Tagen Hamburg. Er muß die Bücher mitnehmen. In einem Monat müssen wir sie haben.«—
Der Bericht Klaus Krönings schien einem Steinchen vergleichbar, das eine
Lawine zum Rollen bringt. Als der ›General‹ in Swakopmund
anlegte, hatte er für die Bahnleitung eine schwere Bücherkiste an Bord. Und
dann saßen Hartung und seine Leute tief in ein botanisches Studium versenkt,
das nur Jensen bisweilen unterbrach, um nach Gründorn zu fahren und den
Standort der verhängnisvollen Düne nachzumessen. Vergeblich versuchte Klaus
Näheres über die Pläne der Bahnverwaltung zu erfahren. Baumeister Jensen
hüllte sich in unverbrüchliches Schweigen.
Wochen vergingen darüber und summierten sich zu Monaten. Um ein bedenkliches Stück war die große Düne inzwischen der Bahnlinie näher gerückt. Da kam eines Morgens das so lange gehütete Geheimnis an den Tag. Ein langer Arbeitszug lief auf der Station Gründorn ein. Eine Unmenge von Steckzäunen waren auf offenen Loren zu hohen Bergen gestapelt. Andere Loren waren mit mehreren hundert schwarzen Arbeitern besetzt. Geschlossene Wagen verbargen vorläufig noch ihren Inhalt. Einem Personenwagen entstieg Baumeister Jensen mit einigen anderen Herren der Bahnverwaltung.
»Guten Tag Kröning, da sind wir. Jetzt wollen wir Ihrer verflixten Düne mal das Wandern abgewöhnen.«
Klaus zuckte die Achseln.
»Wenn das man glückt, Herr Baumeister.«
»Kommen Sie mit, dann können Sie sehen, wie wir's machen.«
Klaus stieg mit in das Abteil, der Zug fuhr weiter, bis er gegenüber der großen Düne hielt. Die Schwarzen sprangen von ihren Wagen, und ein lebhafter Verkehr nach der Düne hinüber setzte ein. Zuerst wurden die Steckzäune dorthin gebracht. Es waren das roh aus Brettern zusammengeschlagene Zäune, etwa anderthalb Meter hoch und zehn Meter lang, die man mit Hilfe längerer, nach unten herausragender Stiele in den Sand stecken konnte. Im südwestafrikanischen Bahnbetrieb hatten sie sich bereits recht nützlich erwiesen. Auf der Windseite dicht neben dem Bahnkörper aufgestellt, hielten sie den heranwehenden Sand zunächst auf, so daß sich hinter ihnen eine Sandanhäufung bildete. Hatte diese schließlich die obere Zaunkante erreicht, so genügte die Kraft des Windes meistens, alles, was an Sand noch hinzukam, über die Bahnstrecke hinwegzuwerfen, so daß sie vor Verwehungen geschützt blieb.
Aber was wollten Baumeister Jensen und seine Leute hier auf der Riesendüne mit den Zäunen. Klaus wanderte mit hinüber und beobachtete, was hier geschah. Die Zäune wurden auf der schwachgeneigten Luvseite der Düne schachbrettartig aufgestellt, so daß Hunderte von ihnen umschlossene Quadrate von etwa zehn Meter Seitenlange entstanden. Noch zerbrach sich Klaus den Kopf über den Zweck dieser sonderbaren Übung, als er die nächste Überraschung erlebte. Jetzt verwandelten sich die Zaunquadrate in Gärtchen. Aus den geschlossenen Wagen brachten die Kaffern Hunderttausende von jungen Strandhaferpflänzchen und besetzten den ganzen durch die Steckzäune geschützten Dünenrücken damit.
Es war eine Arbeit, die nicht an einem Tage erledigt werden konnte. Mehr als eine Woche verstrich darüber, bis die große Düne auf diese Weise bepflanzt war.
Baumeister Jensen blickte fragend auf Klaus.
»Sie scheinen mit unseren Maßnahmen nicht ganz einverstanden zu sein. Was mißfällt Ihnen daran?«
Es dauerte geraume Zeit, bis Klaus die Antwort fand.
»Hier ist's schwer prophezeien, Herr Baumeister. Aber wenn das glückt, will ich nicht mehr Klaus Kröning heißen.«
Baumeister Jensen zwang sich, eine gewisse Gereiztheit zu verbergen.
»Sprechen Sie sich aus! Was befürchten, was bezweifeln Sie denn?«
»Ich zweifle, ob die jungen Pflanzen in dem staubtrockenen scharfen Quarzsand überhaupt Wurzeln fassen werden.«
Jetzt lachte der Baumeister.
»So schlau sind wir auch! Natürlich müssen die Dinger die erste Zeit begossen werden.«
»Begießen? Womit denn?«
»Mit Wasser selbstverständlich, Sie ungläubiger Thomas. Wozu haben wir denn die Bahn, wenn wir nicht so viel Wasser damit von Lüderitzbucht anfahren sollten, wie wir für den Zweck gebrauchen.«
Klaus schüttelte den Kopf.
»Ich fürchte, Herr Baumeister, das wird ein teures Experiment.«
»Jedenfalls billiger, als wenn uns die Düne die Bahn verschüttet.«—
Die nächsten Wochen rollten jeden Tag zwei lange Wasserzüge von Lüderitzbucht
an und hundert Klippkaffern waren den langen Tag über eifrig an der Arbeit,
die Anlage auf der Düne zu besprengen. Zusehends gediehen und wuchsen die
jungen Pflanzen dabei, streckten Wurzeln, trieben Ausläufer.
Reichlich ein Monat war darüber verstrichen. Fast schien es, als solle Klaus mit seinen Zweifeln unrecht behalten. Der hatte sich im stillen eine Rechnung aufgemacht: sechzig Wasserzüge... dreißig Tage Arbeitslohn für hundert Mann... dachte sich im übrigen sein Teil.—
Heute stand er wieder mit Baumeister Jensen auf der Düne.
»Na, Kröning, Sie alter Unglücksprophet, sind Sie endlich überzeugt? Besser konnte es gar nicht glücken. Heute bauen wir die Zäune ab.«
»Warten Sie noch, Herr Baumeister. Warten Sie wenigstens noch einen Monat. Vielleicht, daß dann...«
»Unmöglich, lieber Freund. Die Sache kommt uns schon teuer genug. Jetzt muß es ohne Wasser und ohne Zäune gehen.«
»Dann lassen Sie wenigstens die Zäune noch stehen. Es kostet nicht mehr, ob sie hier stehen oder im Magazin in Lüderitzbucht liegen.«
Jensen schüttelte den Kopf.
»Unmöglich, Kröning. Anordnung der Direktion...«
Am Spätabend rollte der Zug mit den Steckzäunen nach Lüderitzbucht zurück. Die Nacht brach herein und mit ihr kam der Weststurm. Erst gegen Mittag ließ das Wehen nach. Klaus beschloß, die Düne aufzusuchen, fuhr mit der Draisine los—
Und dann stand er auf dem Kamm. Weiß und glatt dehnte sich, soweit das Auge
reichte, die Luvseite der Düne. Auch nicht eine Spur der hunderttausend
Pflanzen, die hier noch vor vierundzwanzig Stunden grünten, war mehr zu
sehen. Restlos hatte der Küstenwind sie bloßgelegt und weit ins Land
hineinverweht. Keine Spur mehr von dem umständlichen und kostspieligen
Unternehmen, das die Herren in Lüderitzbucht in langen Monaten ausgeklügelt
und durchgeführt hatten.
*
»Herr Direktor, ich rate dringend, den Plan anzuhören, den der Ingenieur Kröning uns vortragen will. Nachher können wir immer noch machen, was wir wollen.«
Direktor Hartung schob ein Aktenstück zur Seite, deutete mit der Hand darauf.
»Hier drin sind einige fünfzig Vorschläge, die Wanderdünen zum Stillstand zu bringen. Einer immer unmöglicher als der andere. Glauben Sie, daß uns Kröning etwas Besseres bringen wird?«
»Ich weiß es nicht, Herr Direktor, ich bitte nur, ihn anzuhören. Vielleicht, daß...«
»Dann lassen Sie ihn in Gottes Namen kommen.«
Klaus trat in den Raum. Direktor Hartung deutete auf einen Stuhl.
»Nehmen Sie Platz. Sie wissen, worum sich's handelt. Auf welche Weise wollen Sie die Dünen zum Stillstand bringen?«
»Ich will sie gar nicht zum Stillstand bringen, Herr Direktor.«
»Was?... Wie?... Sie wollen sie gar nicht zum Stillstand bringen?«
»Nein, Herr Direktor, das hieße etwas Unmögliches versuchen. Die Wanderdüne hält keine menschliche Kraft in ihrer Wanderung auf.«
Direktor Hartung war aufgesprungen.
»Herr, sind Sie nur hierhergekommen, um mir das zu erzählen?«
»Nein, Herr Direktor! Ich bin gekommen, um Ihnen ein Mittel anzugeben, durch das man nach meiner Überzeugung die Wanderdünen für die Bahn unschädlich machen kann.«
Der Direktor ließ sich wieder in den Sessel fallen.
»Sie verstehen es jedenfalls, die Menschen neugierig zu machen, Herr Kröning. Was wollen Sie also zunächst unternehmen?«
»Zunächst gar nichts, Herr Direktor.«
Hartung spielte nervös mit einem Falzbein.
»Was heißt: zunächst gar nichts?«
»Es heißt, daß es jetzt noch zu früh wäre, etwas zu unternehmen. Mein Mittel hat erst Aussicht auf Erfolg, wenn die Düne so weit vorgerückt ist, daß der Fuß ihres Leehanges unmittelbar neben der Bahn liegt.«
Der Direktor lachte in einem Anflug von Galgenhumor.
»Na, dieser erste Teil Ihres Programms läßt sich jedenfalls durchführen. Ich glaube, Ihnen garantieren zu können, daß die Düne in... in...« er warf einen Blick auf den Wandkalender... »in sechzehn Wochen neben der Bahn liegt. Und was dann?«
»Dann muß man sie veranlassen, über die Bahn hinwegzufliegen, ohne die Strecke zu verschütten.«
Der Direktor Hartung griff in eine Schachtel, holte eine Zigarette hervor, wollte sie anzünden und zerbrach sie in der Aufregung. Griff eine zweite, stieß ein paar Rauchwolken aus.
»So, so, Herr Kröning! Die Düne soll fliegen? Ich fürchte, sie wird Ihnen den Gefallen nicht tun.«
»Ich bin sicher, daß sie es tut, Herr Direktor, wenn wir sie richtig behandeln.«
Es lag etwas Zwingendes und Überzeugendes in den Worten Klaus Krönings.
»Ich bin gespannt, worin diese Behandlung besteht. Wollen Sie sich bitte deutlicher erklären?«
»Ich will es tun und hoffe, Sie schnell zu überzeugen. Der Küstenwind trifft auf die langgestreckte Luvseite der Düne, stößt an ihr hinauf und belädt sich dabei mit Milliarden von Sandkörnern. Diese Belastung raubt ihm den größten Teil seiner Stoßkraft und Geschwindigkeit. Oben angekommen, hat er eben nur noch die Kraft die Sandmassen über den Dünenkamm zu treiben und läßt sie auf der Leeseite fallen. Daher die Steilheit dieser Seite gegenüber dem langgestreckten Hang der anderen.«
Hartung und Jensen horchten auf. Sie konnten sich der Stichhaltigkeit der hier von Klaus entwickelten Theorie nicht verschließen. Blieb alles andere, was er noch zu sagen hatte, ebenso klar und überzeugend, so konnte diese Unterredung vielleicht fruchtbar werden.
»Was schlagen Sie vor, um das zu ändern?« fragte Hartung.
»Man muß dafür sorgen, daß der Wind den Dünenkamm noch mit großer Geschwindigkeit trifft. Dann wird er imstande sein, die Sandmassen einige hundert Meter weit über die Bahn hinweg mit sich zu tragen, bevor er sie fallen läßt.«
»Das ist ein Problem. Ich will auch zugeben, ein richtig gestelltes Problem. Doch haben Sie auch eine Lösung dafür?«
»Ich glaube, Herr Direktor, eine einfache und verhältnismäßig billige...«
»Da wäre ich neugierig. Bitte, halten Sie mit Ihrem Geheimnis nicht hinter dem Berge.«
Eingehend setzte Klaus seinen beiden Zuhörern seinen Plan auseinander. Je weiter er sprach, desto gespannter wurden deren Mienen. Als er geendet, wechselte Direktor Hartung einen Blick mit Baumeister Jensen.
»Was halten Sie davon, Jensen?«
Der zuckte die Achseln.
»Die Tatsache ist jedenfalls unbestreitbar, daß die Düne in etwa zwölf Wochen dicht neben der Bahn liegen wird. Es müßte ein Wunder geschehen; wenn es anders käme. Ich meine, wir sollten das Mittel versuchen. Wir können nichts verlieren, alles gewinnen.«
Eine geraume Weile saß der Direktor nachdenklich zwischen seinen Akten. Dann stand er auf.
»Ich gebe meine Zustimmung. Veranlassen Sie, daß alles Nötige aus Deutschland bestellt wird.«—
*
Ein Vierteljahr war ins Land gegangen. Schwer und drohend lag das Massiv der großen Düne unmittelbar neben der Strecke. Auch jeder Unkundige mußte jetzt sehen, daß der Bahn eine Katastrophe drohte.—
Auf dem Dünenkamm stand Klaus Kröning und kommandierte ein halbes hundert
Kaffern. Unaufhörlich hoben sie schwere Ballen aus einem neben der Düne
haltenden Zuge und schleppten sie über den Kamm nach der Luvseite hin. Lange
Bahnen eines groben Jutestoffes waren es. Jetzt begannen die Kaffern den
ersten Stoffstreifen am Fuße der Luvseite parallel dem Dünenkamm aufzurollen.
Dem ersten Streifen folgte ein zweiter, dem zweiten ein dritter. Jeder
folgende Streifen überlappte den vorangehenden ein wenig. Einzelne Feldsteine
wurden daraufgelegt, um das Ganze festzuhalten, denn von Westen her blies es
scharf.
Jutebahn auf Jutebahn wurden so gelegt und befestigt, bis die ganze Luvseite der Düne bis etwa auf einen Meter an den Kamm heran ihre Stoffverkleidung hatte. Am Spätnachmittag war das Werk vollendet. Jetzt mußte sich's zeigen, ob der neue Plan Rettung bringen konnte oder ob die Bahnstrecke dem Untergange verfallen war.
Zwei Stunden blieb Klaus auf dem Dünenkamm stehen, beobachtete, maß und verglich. Bei sinkender Sonne kehrte er nach Gründorn zurück, gab ein Telegramm an Baumeister Jensen auf.—
Als der Frühzug des nächsten Tages in Gründorn hielt, sprang Jensen aus einem
Abteil.
»Sehen, Kröning! Erst sehen, bevor ich's glaube.«
»Ganz Ihrer Ansicht, Herr Baumeister. Kommen Sie, die Draisine steht bereit.«
Sie standen auf dem Dünenkamm. Klaus deutete auf die Luvseite. Soweit das Auge reichte, bedeckte der braune Jutebelag den Hang.
»Nun, und...?« Baumeister Jensen blickte sich fragend um. »Sie sind ja mit dem Belag bis an den Kamm gegangen. Ich hatte es anders verstanden...«
»Verzeihung, Herr Baumeister, ich bin reichlich einen Meter davon abgeblieben.«
»Ja, aber...?« Jensen deutete auf die oberste Stoffbahn, die haarscharf mit dem Dünenkamm abschloß. »Sie sind mit dem Belag doch am Kamm.«
Klaus konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Er winkte die Kaffern heran. Auf seinen Befehl rollten sie die oberste Stoffbahn zusammen, so daß wieder ein Streifen von etwa einem Meter Breite bis zum Kamm hin freilag.
»So sah es gestern aus, Herr Baumeister, als wir die Düne verließen.«
»Und das oberste, unbedeckte Stück hier...?«
Klaus machte eine breitausholende Handbewegung nach Osten hin.
»Weggeflogen! Weg über die Bahn hin ins Land verweht!«
Jensen schüttelte den Kopf.
»Unbegreiflich... Sie meinen, daß...?«
Seit gestern abend weiß ich, daß es gelingt. Merken Sie, mit welcher Gewalt der Wind hier den Hang raufpfeift?«
Baumeister Jensen stand schweigend und beobachtete lange Zeit den Dünenkamm. Ein wunderbares Bild. Der Wind entwickelte über dem glatten Stoffbelag eine ganz ungewöhnliche Kraft. Mit Gewalt riß der aufsteigende Luftstrom den Sand des schmalen, unbedeckten Streifens an der Luvseite empor und trug die gelbrötlich schimmernden Staubwolken in großer Höhe mit sich nach Osten—Verschleppte sie weit, weit ins Land hinein.
Eine Stunde konnte vergangen sein, seitdem Klaus die oberste Stoffbahn wegnehmen ließ. Unverkennbar war die nagende und abtragende Wirkung des Windes. Bereits war die Böschung des freiliegenden Teiles viel flacher geworden. Wie eine riesenhafte Feile wirkte der Sturm und raspelte stetig und unaufhaltsam die Dünenkante ab, soweit sie der Jutebelag nicht schützte.
Noch eine zweite Stunde stand Jensen auf dem Kamm und verfolgte das Schauspiel. Dann wandte er sich zu Klaus.
»Jetzt glaube ich, daß Sie's schaffen!«
Eine Woche verging, die zweite brach an. Unablässig war Klaus mit seinen Schwarzen an der großen Düne tätig.
Und dann kam der Tag, an dem ein Telegramm nach Lüderitzbucht flog.
Direktor Hartung las es und schüttelte den Kopf.
»Wenn es wahr wäre, Jensen?! Noch kann ich's nicht glauben.«
»Hinfahren und selber sehen, Herr Direktor!«
Mit dem nächsten fahrplanmäßigen Zug fuhren sie ab, rollten an Gründorn vorüber. Weiter nach Norden ging's. Unverwandt blickte Hartung nach Westen, während der Zug einen Kilometer nach dem anderen hinter sich brachte. Weit und eben dehnte sich dort die Sandwüste. Nur in weiter Ferne waren Dünenkämme zu sehen.
»Kilometer 190! Hier war's!« Jensen stieß die Worte hervor und deutete auf einen Kilometerstein.
»Was war?«
»Hier stand die Düne.«
»Unmöglich, Sie müssen sich irren.«
Baumeister Jensen entfaltete eine Kartenskizze.
»Sehen Sie selbst! Von Kilometer 190 an ist die große Wanderdüne eingezeichnet. Da...!« Er deutete auf einen vorüberfliegenden Kilometerstein. 196 las Hartung... Schaute und starrte nach Westen, bis der Zug auf der nächsten Station hielt.
Kein Zweifel mehr. Klaus Kröning hatte die große Wanderdüne besiegt. Restlos hatte er sie mit seinen Mitteln als unschädlichen Staub über die Bahnlinie hinweg nach Osten gejagt. Die Gefahr, die das neue Werk zu verderben drohte, war gebannt.
Seit dem Tage galt Klaus als einer der tüchtigsten und befähigtsten Techniker der Gesellschaft. Voßberg & Co. ernannten ihn zum Oberingenieur und übertrugen ihm die Aufsicht über die Strecke der ganzen Nord-Südbahn.
Wieder waren zwei Jahre verflossen. Vier Jahre war Klaus jetzt im Lande. Längst gehörte er zu den »alten Afrikanern«.
Während andere mit einer ähnlich langen Dienstzeit häufig für einen längeren Europaurlaub reif waren, fühlte er sich so frisch wie ein Fisch im Wasser. Das Klima von Süd-West bekam ihm vorzüglich. So zog er es vor, jedes Jahr einen Urlaub von einigen Wochen zu nehmen und zu Reisen im Lande selbst zu verwenden. Soweit es ging, benutzte er dabei die Bahn. Wo der Schienenstrang endigte, machte er sich beritten und durchstreifte mit dem Kompaß und einem Geologenhammer ausgerüstet das Land.
Die Beschäftigung mit den geologischen Verhältnissen der Kolonie war in den letzten Jahren seine Leidenschaft geworden. Das hatte ihn damals gepackt, als er gleich nach der Fertigstellung der Nord-Süd-Bahn eine Fahrt in das Minengebiet von Otavi unternahm. Welche wunderbaren Bodenschätze hatte er da zu sehen bekommen. Eisenerze, Zinkerze und reiche Kupferstufen. Tiefblau, malachitgrün und brennendrot schimmerten die schweren Erzdrusen, die er dort erblickte. Schon das war ein Schauspiel, das jeden Menschen mit gesunden Sinnen fesseln mußte.
Und dann hatte er vernommen, wie diese Schätze entdeckt worden waren. Wie deutsche Geologen das Land durchstreiften, die Schluchten und Klüfte untersucht hatten. Wie sie aus dem Vorkommen bestimmter Gesteinsarten auf das Vorhandensein von verhüttbaren Erzen schlossen, wie man dann schürfte und fündig wurde. Wie hier im Otavigebiet in kurzer Zeit eine reiche Minenindustrie emporblühte.
Etwas Ähnliches erreichen, auch irgendwo irgendwelche Bodenschätze entdecken, das war der Gedanke, der ihm seit jener Zeit traumhaft vorschwebte. Doch wie es erreichen? Wohl waren seine Satteltaschen jedesmal schwer von Gesteinsproben, wenn er von einem seiner Ausflüge in die Otaviberge zurückkehrte. Schon konnte er eine stattliche Mineraliensammlung sein eigen nennen. Aber dort waren ja schon längst andere vor ihm fündig geworden, hatten alle wertvollen Erzvorkommen für sich belegt.
Und hier im Westen in der endlosen Sandwüste der Wanderdünen, hier waren derartige Schätze kaum zu erwarten. Nur scharfer, feiner Sand, so weit das Auge reichte. In nimmermüdem Spiel jagten die Seewinde die Sandmassen landeinwärts, legten hier einmal ein abgeschliffenes Steinchen, dort irgendwo Muschelschalen bloß. Die ganze Gegend mochte wohl uralter Seeboden sein, den die Stürme im Laufe der Jahrtausende ins Land getragen hatten.
Die Stürme! Schon wieder hatten sie gewaltige Sandmassen bis dicht an den Bahnkörper geschleppt. Im Laufe der letzten beiden Jahre war die nächste große Düne, deren Kämme damals noch weit im Westen lagen, bis dicht an den Gleisstrang herangewandert. Es wurde Zeit, das erprobte Mittel gegen sie anzuwenden.
Wieder stand Klaus auf dem Kamm und beobachtete, wie die Böen den Hang hinauffegten und die Sandwolken über die Strecke hin nach Osten jagten.
Da, im flimmernden Spiel der Sonnenstrahlen traf ein Glitzern sein Auge. Er schritt darauf zu, beugte sich, hielt ein Stückchen Glas von der Größe etwa eines Streichholzkopfes zwischen den Fingern—schob es mechanisch in die Westentasche.
Da—während er den Kamm weiter entlangging—wieder ein Funkeln—ein zweites Stückchen Glas.
Er behielt die Stücke in der Hand. Betrachtete, wie der scharfe Quarzsand im Spiel der Winde ihre Fläche angerauht, ihren Kanten und Ecken aber verhältnismäßig wenig Abbruch getan hatte. Wie kam das Glas hier in den Dünensand?
Seine Gedanken begannen zu wandern. Ein Schiff da draußen weit im Westen auf dem Ozean in schwerer Seenot. Als der Untergang unvermeidlich, hatte die Besatzung ihre letzte Botschaft einer schwimmenden Flasche anvertraut. Nach Wochen oder Monaten mochte sie auch die Küste erreicht haben. Da aber hatte die Brandung sie gepackt, mit wütender Gewalt an das Ufer geschleudert, in zahllose Splitter zerschmettert. Verloren die Botschaft der Schiffbrüchigen. Die Splitter hatte der Sturm gepackt, zerschliffen, zerschlissen... mit den Sandmassen landeinwärts geschleppt.
War's so gewesen, wie's die Phantasie ihm vorspiegelte? Eine Flasche aus reinweißem Glase mußte es dann gewesen sein. Keine Spur von dem grünlichen Schimmer, der sonst allem Flaschenglase eigen ist, war an diesen Splitterchen zu merken, die er hier in der Hand hielt.
Wie lange mochte es her sein, daß die Flasche da fern im Westen am Gestade zerschellte. Wieviel Jahre... Wie viele Jahrzehnte mochten diese Stückchen gebraucht haben, um von der See bis hierher zu gelangen. Wunderbar blieb's, daß sie die lange Wanderung so gut überstanden. Klaus erinnerte sich, an der Nordsee am Strande viel größere Glasstücke gefunden zu haben, die bereits vollkommen kugelig geschliffen waren. Wie kam's, daß diese Splitterchen hier der vereinten Kraft des Windes und des scharfen Sandes so gut widerstanden hatten?... Ein Ruf seines Boys riß ihn aus seinem Sinnen. Der brachte ihm ein drittes Steinchen.
»Noch ein Glasscherben? Was soll ich damit, Abraham? Achtlos wollte Klaus die Steine wieder fallen lassen.
»Nein, Baas, kein Glas!... Ein Stein!... Man liebt die Steine in Johannisburg.«
»Ach, Abraham, du bist ja ein großer Esel.«
»Kein Esel, Baas!... Die Steine liebt man in Johannisburg.«
»Unsinn!«...
Aber dann... Klaus stutzte, erinnerte sich. Der Boy hatte in der Tat in einer der Minen von Kimberley gearbeitet. Sollte vielleicht doch...?
Er ließ die Splitterchen in die Westentasche gleiten und ging zum Zuge zurück. Es war schon Nacht, als sie auf der Station ankamen. Bevor Klaus in das Haus ging, griff er in die Tasche und holte ein Markstück hervor.
»Hier, Abraham! Für deinen guten Willen! Geh und kaufe dir eine Flasche Bier dafür.«
Grinsend und dienernd zog der Boy mit dem Gelde ab.
Klaus war allein in seinem Zimmer. Er griff nach einem Trinkglas, nahm eines der etwa erbsengroßen Steinchen und kratzte damit an dem Glase—und spürte, wie ihm das Herz plötzlich bis in den Hals schlug. Das unscheinbare Steinchen hatte mit einer spitzen Kante tief in die Glasmasse eingeschnitten. Was konnte das sein, was Glas schnitt?...
Klaus Kröning preßte die Hände vor die Augen, um sich zur Ruhe zu zwingen. Was konnte Glas ritzen?—Alles, was härter war als Glas—jedenfalls als das Glas hier vor ihm—unter Umständen jeder Kiesel, jedes Stückchen Quarz, wenn das Trinkgefäß zufällig aus weichem Bleiglase bestand.
Wer konnte das wissen? Wenn es nun doch aus einer harten Glassorte geblasen war—dann waren nur noch die Edelkorunde härter—aber die gab's in Südafrika nicht.
Diamanten? Er wagte es nicht, das Wort laut über die Lippen zu bringen. Sollten es doch Diamanten sein, diese rauhen, unscheinbaren Stückchen hier vor ihm auf dem Tisch? Wie konnte er sich Sicherheit verschaffen?—Sicherheit, ohne einen anderen ins Geheimnis zu ziehen?
Es gab nur eine Möglichkeit. Er mußte selbst nach Johannisburg fahren. Da gab es Sachverständige, die ihm sichere Auskunft über die unscheinbaren Splitterchen geben konnten. Nach Johannisburg—die Reise würde einige Tage beanspruchen.
Die Steine durch die Post dorthin schicken?... Er verwarf den Gedanken im Moment, da er auftauchte. Das war ausgeschlossen. Die Leute in Johannesburg, an die er sich wenden wollte, mußten unter allen Umständen in dem Glauben gehalten werden, daß er die Steine dort irgendwo gekauft habe. Nicht die leiseste Vermutung, daß es solche Steine auch innerhalb der Grenzen dieser Kolonie geben könnte, durfte dort aufkommen. Das fühlte Klaus mit visionärer Deutlichkeit.
Am nächsten Tage war Klaus sich über das, was er tun mußte, klargeworden.
Telegrafisch beantragte er einen vierzehntägigen Urlaub. Schnell waren die
wenigen Sachen gepackt, die er für die Reise brauchte. Mit dem Abendzug mußte
er nach Lüderitzbucht wegfahren, um den Dampfer nach Kapstadt zu bekommen.
Eine gute Stunde noch bis zur Ankunft des Zuges.
Aber während der letzten zwei Tage war noch etwas anderes geschehen. Abraham, der Klippkaffernboy, war spurlos verschwunden. Ärgerlich nahm Klaus von dieser Tatsache Kenntnis. Es kam bisweilen vor, daß ein Schwarzer aus dem Dienste lief und irgendwo in einem Kafferndorf untertauchte. Von Abraham hätte er jedoch etwas Derartiges nicht erwartet. Der Boy stand schon mehrere Jahre in seinem persönlichen Dienst, war stets willig und anstellig gewesen. Klaus war sich bewußt, ihn immer freundlich behandelt zu haben. Was mochte dem in die wollige Krone gefahren sein, daß er gerade jetzt davonlief.
Die Gründe für dieses Vorkommnis waren in der Tat außergewöhnlicher Art. Unter der anregenden Wirkung von einer Flasche Exportbier hatte Abraham sich zu der ziemlich ungewohnten Tätigkeit des Denkens aufgerafft. Mit der Logik, die diesen großen schwarzen Kindern eigentümlich ist, hatte er ungefähr folgendermaßen geschlossen:
Wenn der Baas mir für ein Steinchen eine Flasche Bier schenkt, wird er mir für mehr Steine auch mehr Bier geben. Im Besitze dieser mühsam gewonnenen Erkenntnis hatte Abraham sich seinerseits zum Handeln entschlossen.
Als Klaus eben seine Handtasche zuschloß, klopfte es. Der Schwarze trat zu
Klaus ins Zimmer.
»Herrgottshimmeldonnerwetter, Abraham! Was fällt dir ein' Was ist das für eine Manier, einfach ohne Urlaub wegzulaufen?... Wo hast du die letzten vierundzwanzig Stunden gesteckt?«
Der Boy holte ein Leinenbeutelchen hervor, hielt es Klaus entgegen.
»Baas, ich habe noch mehr Steine gesucht.«
Bei Klaus überwog die Neugier den Ärger. Er nahm den Beutel, öffnete ihn. Wohl an fünfzig Glassteinchen waren darin, viele davon größer als die, die er gestern auf der Düne gefunden. Die größten reichlich bohnengroß.
»Abraham, Menschenskind, wo hast du das Zeug her?«
Der Schwarze deutete nach Westen in der Richtung nach der Küste.
»Hinter den Dünen, Baas, dahinten in der Wüste.«
»In der Wüste?... So, so! Gibt's da noch mehr von der Sorte?«
Abraham zögerte. Wenn er zuviel von dem verriet, was er wußte, würde ihm sein Baas vielleicht kein Bier geben.
Langsam holte Klaus Kröning vier einzelne Markstücke heraus und legte sie vor sich auf den Tisch.
»Vier Mark, Abraham, vier Flaschen Bier für dich. Aber du mußt mir die volle Wahrheit sagen.
»Vier Flaschen für mich. Darf ich, Baas?«
»Nimm dir das Geld.«
Im Moment waren die Silberlinge in der Tasche des Klippkaffern verschwunden.
»Jetzt antworte auf meine Frage, Abraham. Gibt's da noch mehr von der Sorte?«
»Viel, Baas! Soviel...« der Schwarze machte mit den Händen eine umfassende Bewegung, als wolle er die Größe des Diamantenhaufens andeuten, den man dort sammeln könne.
»Soviel, Baas... immer mehr, wenn man weit nach Westen geht. Viele Steine im Sande.«
»Gut, Abraham! Ich höre meinen Zug kommen. Trinke dein Bier mit Gesundheit und halte dein Maul über die Sache. Verstehst du, Abraham, Maul gehalten über die Steine.«
»Ja, Baas! Abraham wird Maul halten, noch mehr Steine für Baas suchen.«
*
Fünfzehn Tage nach seiner Abreise traf Klaus wieder in Gründorn ein. Jetzt saß er vor seinem Schreibtisch. Er fühlte es, das Schicksal bot ihm hier eine Chance von unerhörter Größe, doch alles kam darauf an, daß er die Gelegenheit richtig zu nutzen verstand. Ein einziger verkehrter Schritt und alles war verdorben.
Bis jetzt glaubte er richtig gehandelt zu haben. Seinem Boy hatte die Aussicht auf weiteres Flaschenbier den Mund hermetisch geschlossen. Den Besuch in Johannesburg hatte er selbst erledigt. Vorläufig wußte kein Mensch außer ihm und dem einen Klippkaffern, daß die kostbaren Steine auch in Südwest zu finden waren.
Was nun weiter? Gelegentlich seiner geologischen Studien hatte Klaus sich auch mit dem Bergrecht beschäftigt. Der Gang der Dinge war ihm klar.
Erst mußte man fündig werden; dann mußte man für die Gebiete, auf denen man fündig geworden war, bei der Bergbehörde muten. Claims beanspruchen, nannten es die Kolonisten im Lande hier halb englisch.
Fündig werden?... Sein Auge haftete an dem Häufchen glitzernder Steine, das vor ihm auf der Tischplatte lag. Genügte das schon?
Wer konnte wissen, wo und wie lange Abraham umhergelaufen war, um diese Splitterchen zusammenzutragen? Claims belegen, das kostete aber erhebliches Geld. Das hatte er auch schon gelernt. Es war besser, wenn er sich erst selbst genau über die tatsächlichen Vorkommen unterrichtete, bevor er auch nur einen Schritt zum Bergamt hin tat. Sein Entschluß stand fest. Hatte Abraham nicht gesagt, daß die glitzernden Steinchen da weit hinten in der Wüste nach Westen zu zu finden wären? Er mußte selbst dorthin, mußte selbst sehen.—
Noch glänzte der dunkle Sternenhimmel über der Station, als Klaus in
Begleitung Abrahams sie verließ. Ihre Pferde trugen Wasser und Proviant für
eine Woche. Geradeaus nach Westen ging der Ritt. Bald verschwanden die
letzten Spuren der Vegetation, die unendliche Wüste des afrikanischen Veldtes
nahm die Reiter auf. Bald im Schritt, bald im Trab ging es vorwärts.
Mächtige Dünen hemmten ihren Weg. An den Zügeln mußten sie ihre Pferde darüber führen. Glühend brannten die unbarmherzigen Strahlen der afrikanischen Sonne. Unentwegt hielt Klaus den Kurs nach Westen. Schon sank die zweite Nacht hernieder und zwang sie zur Rast.—
Eben erst begann die Dunkelheit einem unbestimmten Grau zu weichen, als Klaus
nach kurzem Schlaf aufsprang und zum Aufbruch trieb. Das Rinnsal eines
vertrockneten Flusses wurde durchschritten, eine neue, gewaltige Düne baute
sich vor ihnen auf. Wieder mußten sie den Sattel verlassen. Trotz der
empfindlichen Morgenkühle wurde es Klaus warm, als er sein Pferd hinter sich
am Zügel den steilen Hügel emporzog.
Jetzt war der Kamm erreicht. Weiten Ausblick hatten sie hier nach allen Seiten. Rot flammte hinter ihnen der Horizont. Langsam schob sich der Sonnenball über die Kimme und überflutete das Gelände vor ihnen mit rosigem Licht. Kurze Minuten noch lag die Luvseite der Düne im Schatten. Jetzt wurde auch sie von der höher kommenden Sonne schräg beleuchtet.
»Da, Baas!« Der Kaffer deutete mit der Hand nach vorn. Klaus folgte der Richtung mit den Blicken. Sah und wollte nicht glauben was seine Augen sahen. Etwa fünfzig Meter vor ihnen auf dem Hang eine Stelle, da glitzerte und flimmerte es, als wäre der Sand dicht mit blitzenden Glasstücken besät.
Sie trabten heran, hielten die Pferde an. Abraham sprang aus dem Sattel, begann eifrig die Steine in den mitgebrachten Beutel zu sammeln. Klaus blickte ihm zu. Die Stelle war nicht groß. Ein kreisförmiger Fleck, etwa zehn Meter im Durchmesser, der aber auch wie besät mit Diamanten. Klaus mußte an die Pflaumenbäume in Seehausen denken. Wenn sie die zur Zeit der Reife schüttelten, hatten die Pflaumen auch so dagelegen.
Abraham sammelte unermüdlich. Schon war ein großer Beutel gefüllt, und ein zweiter kam an die Reihe. Klaus überlegte derweil. Wie war dies eigenartige Vorkommnis zu erklären? Wie war es möglich, daß hier auf diesem einen kleinen Fleck die edlen Steine gleichsam gehäufelt vorkamen, während anderwärts...
Er zog den Feldstecher vor die Augen, beobachtete die Ebene vor sich. Und jetzt—die Sonne war inzwischen wieder ein Stück höher gekommen—jetzt sah er, daß es nicht an einem, sondern an Hunderten von Punkten in diesem Sandfeld aufblitzte. Er ritt dem nächstgelegenen zu. Ein glänzendes Steinchen im gelben Sand.
Er stieg ab, beugte sich zur Erde, hielt einen rohen Diamanten in der Hand. Und wie er mit dem Fuß durch den Sand scharrte, da blitzte es an zwei anderen Stellen aus der staubenden Masse, zwei andere Steine kamen zu dem erstgefundenen.
Durchsetzt schien der Sand hier mit Edelsteinen zu sein. Der Seewind, der unaufhörlich durch die Wüste strich, trieb die Sandkörner landeinwärts, baute die Wanderdünen aus ihnen auf. Die schwereren Diamanten blieben liegen, widerstanden der Kraft des Windes, wurden freigelegt, kamen so zutage. Irgendein wunderlicher Zufall mochte an jener einen Stelle, von der Abraham jetzt mit drei vollen Beuteln ankam, eine besonders starke Häufung auf engstem Raume bewirkt haben. Aber das war außer allem Zweifel. Die ganze Wüste hier, soweit er sie zu überblicken vermochte, war diamanthaltiger Grund.
Er rief den Boy an.
»Laß jetzt das Sammeln, Abraham! Wir haben Wichtigeres zu tun.«
Während der Schwarze wieder auf seinen Gaul kletterte, breitete Klaus eine Karte vor sich auf dem Sattel aus. Sorgfältig hatte er in den beiden vorangegangenen Nächten durch Messung von Sternhöhen das jedesmalige Ortsbesteck genommen. Eine rote Linie auf der Karte gab bis auf wenige hundert Meter genau ihren bisherigen Marsch an.
Reichlich hundert Kilometer waren sie hier in die Wüste vorgestoßen, drei Tagemärsche von der nächsten Wasserstelle entfernt. Nachdenklich schüttelte Klaus den Kopf. Es würde nicht ganz einfach sein, diese Schätze hier in der Wüste zu heben. Doch diese Sorge mußte einer späteren Zeit überlassen bleiben. Er legte den Reisekompaß vor sich in die flache Hand und setzte sein Pferd in Bewegung. Genau in westlicher Richtung ging der Ritt weiter. Viel Zeit hatte er nicht zu verlieren. Bevor der mitgenommene Wasservorrat zu Ende ging, mußten sie das Vegetationsgebiet im Osten wieder erreicht haben, denn sonst...
Gar mancher deutsche Reiter war im Hererokriege von der Straße abgekommen, hatte das nächste Wasserloch verfehlt, war unter schrecklichen Qualen in dem dürren Veldt verschmachtet. Auch ihr Leben und das Leben ihrer Tiere hing jetzt buchstäblich an dem Wasservorrat, den sie in gummierten Leinenbeuteln mit sich führten.
Eine Stunde und noch eine andere verrann. Unverändert das Bild. Gelblich-rötlicher Wüstensand, in dem es in den Strahlen der afrikanischen Sonne immer wieder schimmernd aufblitzte. Ein untrügliches Zeichen, daß die kostbaren Steine überall vorhanden waren. Aber kleiner und flacher wurden die Dünenzüge, die sie auf ihrem Ritt zu überqueren hatten.
Schon seit geraumer Zeit gingen die scharfen Augen des Kaffernboys spähend am nordöstlichen Horizont entlang. Der Schwarze sah mit unbewaffnetem Auge besser als sein Baas mit dem guten Feldstecher. Jetzt drängte er sein Pferd an Klaus heran, berührte dessen Arm.
»Was ist, Abraham?«
»Wasser, Baas.« Der Boy deutete mit der Hand auf einen Punkt am Horizont. Klaus nahm den Feldstecher zu Hilfe.
In der Tat, dort schien sich etwas Dunkleres aus der Ebene zu heben. Noch war es ihm unmöglich, zu erkennen, was es wohl sein mochte. Sie änderten ihren Kurs, trabten darauf zu. Noch eine Stunde verstrich, und dann gab es keinen Zweifel mehr. Vor ihnen streckte sich eins jener trockenen afrikanischen Flußbetten, an dessen Rändern Bäume und Sträucher wuchsen. Nun war der Riviere erreicht. Staubtrocken auch der Boden dieser Rinne. Und doch mußte noch irgendwie Wasser vorhanden sein, denn sonst wäre die Vegetation hier unerklärlich gewesen.
Abraham sprang von seinem Gaul und schritt suchend in dem Flußbett hin und her. Klaus ließ ihn gewähren. Er wußte ja zur Genüge, daß die Eingeborenen instinktmäßig jede Spur von Wasser zu finden vermögen.
Wohl eine halbe Stunde hatte Abraham gesucht. Dann warf er sich zu Boden und begann in Ermangelung eines Werkzeuges mit den Händen den Sand aufzugraben. Nur langsam kam er dabei in die Tiefe. Doch jetzt wurde der Sand feucht, und dann einen Meter unter der Oberfläche wurde er zum flüssigen Brei. Noch ein paar Zoll tiefer, und klares Wasser sammelte sich in der Grube. Mit Geduld und Vorsicht konnten sie ihre Wasserbeutel frisch füllen. Kam auch einiger Sand dabei mit hinein, so war es doch ein erquickender kühler Trank, ein Labsal nach dem lauwarmen Wasser, auf das sie bisher angewiesen waren.
Eine große Sorge war damit von Klaus genommen. Der feste Proviant ließ sich zur Not immer strecken, aber das Wasser war in der afrikanischen Wüste unentbehrlich, ein Lebenselement im wahrsten Sinne des Wortes. Nun hatten sie wieder frisches Wasser für sieben Tage, konnten in Muße die Umgebung durchstreifen, die Ausdehnung des besten Diamantengrundes feststellen.
Viele rote Linien und Kreuze kamen in den folgenden Tagen auf die Karte von Klaus, bevor sie die Köpfe ihrer Pferde nach Osten drehten. Mit knurrendem Magen erreichten sie nach langem Ritt durch die Wüste schließlich das Vegetationsgebiet im Osten. Bei Dunkelheit kamen sie in Gründorn an. Klaus war das gerade recht. Es brauchte nicht jeder zu sehen, woher sie kamen und wo sie gewesen waren.
»Abraham viel Hunger, Baas«, sagte der Boy und rieb sich mit kläglicher Gebärde die Magengegend.
»Friß, mein Sohn, friß meinetwegen, bis du platzt! Aber Maul halten, Abraham! Niemand sagen, wo wir gewesen sind!«
Der Boy grinste über das breite, schwarze Gesicht.
»Ja, Baas. Abraham wird fressen, Abraham wird Maul halten.« Mit dieser Versicherung verschwand er in die Küche.
Als Klaus eine Stunde später in die Küche kam, hatte er doch den Eindruck, daß der Klippkaffer seinen Auftrag allzu wörtlich ausgeführt habe. Ein halber Hammel ungefähr fehlte in der Speisekammer. Der Leib Abrahams war prall kugelförmig aufgequollen, doch unermüdlich stopfte der noch immer mehr Fleisch in sich hinein.
Klaus ließ ihn gewähren. Er wußte, was für Unmengen ein Kaffernmagen nach einer längeren Fastenzeit vertragen kann, ohne Schaden zu nehmen.
*
Baumeister Jensen streckte seinem Besuche die Rechte hin.
»Willkommen, Kröning. Nehmen Sie Platz. Was führt Sie zu mir?«
»Eine Angelegenheit von größter Bedeutung, Herr Baumeister. Eine Angelegenheit, in der ich Ihre tatkräftige Hilfe brauche.«
Jensen warf seine Zigarre in den Aschenbecher.
»Schießen Sie los, lieber Kröning, ich bin ganz Ohr.«
»Darf ich Sie vorher um Ihr Ehrenwort bitten, Herr Baumeister, daß Sie alles, was ich Ihnen mitzuteilen habe, als unverbrüchliches Geheimnis wahren werden? Gleichviel, ob wir einig werden oder nicht.«
Jensen warf einen prüfenden Blick auf Klaus
»Warum so feierlich, lieber Kröning. Sie wissen doch, daß ich keine Waschfrau bin.«
»Wenn ich's nicht wüßte, wäre ich nicht zu Ihnen gekommen. Trotzdem, ich bitte um Ihr Ehrenwort.« Klaus streckte Jensen die Rechte entgegen. »Ihre Hand und Ihr Ehrenwort auf absolute Verschwiegenheit.«
Der Baumeister schlug ein.
»In Gottes Namen denn, ja. Mein Ehrenwort darauf. Doch nun schießen Sie endlich los. Sie haben mich reichlich neugierig gemacht.«
»Gut denn, Herr Baumeister. Die Diamantenvorkommen in der Kapkolonie und in Transvaal sind Ihnen sicherlich bekannt.«
Jensen nickte. Klaus fuhr fort.
»Ist Ihnen bekannt, daß auch in Süd-West-Afrika Diamanten vorkommen?«
Der Baumeister pfiff durch die Zähne.
»Hören Sie mal, Kröning, das scheint mir eine faule Geschichte zu werden. Unsere Leute haben beim Bahnbau hin und wieder Diamantsteinchen gefunden. Der Teufel mag wissen, wie diese Splitterchen hier in die Gegend gekommen sind. Wir gaben damals Anweisung, daß jeder derartige Fund an uns abzuliefern sei. Ich will nicht behaupten, daß der Befehl immer prompt befolgt worden ist. Die Ausbeute war jedenfalls kläglich. Kaum drei Dutzend solcher Steinchen wurden von den Streckenarbeitern abgeliefert. Ich glaube danach zu der Annahme berechtigt zu sein, daß man von einem auch nur einigermaßen abbauwürdigen Diamantenvorkommen in Südwest nicht reden kann.«
»Ich bin anderer Ansicht, Herr Baumeister. Es gibt reiche und ausgedehnte Vorkommen in unserer Kolonie.«
Jensen schüttelte den Kopf.
»Wir sind keine Kinder, Kröning. Wir haben uns damals sofort an tüchtige Geologen gewandt. Sie haben einstimmig Diamantenvorkommen in Südwest für unwahrscheinlich, ja für unmöglich erklärt. Diamanten kommen immer nur vergesellschaftet mit Olivingestein vor. Olivin haben wir hier in der Kolonie nicht, also können auch keine Diamanten vorhanden sein. Machen Sie sich von dieser unglücklichen Idee so schnell wie möglich frei. Es sollte mir leid tun, wenn Sie, wie schon so mancher tüchtige Kerl vor Ihnen, von dem Minenfieber gepackt würden.«
Klaus erhob sich, ging zur Tür und schob den Riegel vor.
»Was soll das? Was wollen Sie, Kröning?«
»Es ist nicht nötig, Herr Baumeister, daß irgendein Dritter dazukäme und auch sähe, was ich Ihnen zeigen will. Sie sagten, nur drei Dutzend Steine wären während des ganzen Bahnbaues abgeliefert worden?«
»Steine! Das Wort sagt zuviel. Steinchen, Steinsplitterchen höchstens! Keiner hatte mehr als Erbsengröße.«
Klaus hatte sich an seiner Handtasche zu schaffen gemacht und einen, stattlichen Leinenbeutel hervorgeholt. Umständlich löste er die Verschnürung und schüttelte den Inhalt des Beutels auf die Tischplatte aus. Mehrere Hände voll jener Glassteine, die er im Wüstensande gefunden. Die größten Exemplare darunter mehr als bohnengroß.
»Wissen Sie, was das ist, Herr Baumeister?... Ich will es Ihnen sagen. Das Ergebnis einer kaum halbstündigen Sammlung an einer geeigneten Stelle.«
»Sie wollen doch nicht?... Kröning! Mensch!... Himmeldonnerwetter! Sie wollen doch nicht etwa behaupten, daß alle diese Steine hier auf dem Tisch gute Diamanten sind?«
Klaus entnahm seiner Brieftasche einige zusammengefaltete Papiere und schob sie Jensen zu. Der nahm und las. Jedes einzelne der Blätter ein Zertifikat, daß der am 30. September des Jahres von Mr. Kröning vorgelegte Stein ein guter Diamant von soundso viel Karat und dem und dem Wert sei. Jedes der sechs Zertifikate von einem anderen Johannisburger Sachverständigen ausgestellt. Jedes Zertifikat auf eine andere Karatzahl und einen anderen Wert lautend. Einmal... zweimal, dreimal las Jensen die Zertifikate.
»Alles das da Diamanten?«
Klaus nahm ein Trinkglas, griff wahllos einen Stein aus der Menge. Knisternd zog der Stein einen tiefen Schnitt in die Glaswand.
»Bitte, überzeugen Sie sich selbst. So kann man Glas nur mit einem Diamanten schneiden.«
Kopfschüttelnd nahm Jensen das Glas und versuchte es mit anderen Steinen. Immer wieder das gleiche Resultat.
»Das wäre, Kröning...« Jensen preßte die Lippen zusammen. Jetzt schien er selber vom Fieber gepackt zu werden.
»Das wäre, Kröning... Mann! Welchen Wert besitzen die Steine, die Sie hier ausgeschüttet haben?«
Klaus deutete auf die Zertifikate.
»Nehmen wir einen Durchschnittswert von zehn Pfund an, obwohl auch größere und wertvollere Steine dazwischen sind. Im ganzen dürften es etwa fünfhundert Steine sein... also fünftausend Pfund oder hunderttausend Mark.«
Jensen pfiff durch die Zähne.
»Alle Wetter, Kröning, ich gratuliere. Für hunderttausend Mark Steine in einer halben Stunde gesammelt... das Geschäft hat sich gelohnt.«
»Ich hätte mehr bringen können, wenn ich mich länger mit Suchen aufgehalten hätte.«
»Warum haben Sie's nicht getan, Kröning?«
»Weil ich es für richtiger hielt, die an Diamanten besonders reichen Gebiete zu erforschen und auf der Karte festzulegen.«
Klaus entnahm seiner Tasche eine Karte des Küstengebietes, auf der mehrere Flächen rot schraffiert waren.
»Das sind die Felder, die wir belegen, deren Ausbeutung wir in Angriff nehmen müssen. Dazu brauche ich Ihre Hilfe. Es ist reichlich... immer noch überreichlich für jeden, auch, wenn wir teilen.«
Jensen beugte sich über die Karte, die Klaus vor ihm ausgebreitet hatte. Mit einem Zirkel überprüfte er die rot eingetragenen Flächen, rechnete auf einem Schreibblock, verglich hin und wieder mit dem Kartenmaßstab.
»A la bonheur, Herr Kröning! Mit Kleinigkeiten scheinen Sie sich nicht abzugeben. Das sind ja rund hundert Quadratkilometer, die Sie hier schraffiert haben. Soll das alles diamanthaltiger Grund sein?«
»Wie tief die Diamanten noch im Grunde stecken, weiß ich nicht. Für viele Jahre genügt es, die Steine zu sammeln, die der Wind freigelegt hat, die offen zutage liegen oder doch unmittelbar unter der Oberfläche im losen Sande zu finden sind.«
Jensen starrte wie fasziniert auf die Karte. Klaus fuhr fort:
»Wir müssen schnell und möglichst unauffällig die Rechte auf diese Felder anmelden und nehmen. Das muß geschehen, bevor andere Leute in der Kolonie oder in Deutschland eine Ahnung davon bekommen, daß es hier Diamanten gibt. Denn sonst... wenn die Kapitalisten und Banken in Deutschland erst mobil werden, ist es für uns zu spät.«
Jensen nickte.
»Ich verstehe. Sie haben recht. Die Claims müssen schnell und ohne unnützen Lärm genommen werden. Und dann...?«
»Dann müssen wir die Ausbeutung der Felder in Angriff nehmen... und dann müssen wir unsere Aufnahme in das Londoner Diamantensyndikat durchsetzen und eine anständige Beteiligungsquote für uns durchsetzen. Und dann...
Doch das alles kommt später. Das Nächste und Wichtigste ist Geld, Herr Baumeister. Geld!... Viel Geld! Für die Belegung der Claims und den Beginn der Ausbeutung. Deswegen bin ich zu Ihnen gekommen.«—
Eine Stunde verstrich und noch eine. Die Blockblätter vor Klaus und dem
Baumeister bedeckten sich mit immer neuen Zahlenmengen. Und immer wieder
blieb das Ergebnis das gleiche.
»Es langt nicht, Kröning! Es langt nicht!« rief Jensen unmutig und warf den Bleistift auf den Tisch. »Darin stimme ich Ihnen vollkommen bei. Wir müssen das Unternehmen so aufmachen, daß wir für geraume Zeit wenigstens kein fremdes Geld gebrauchen...« Wieder warf der Baumeister ein paar Ziffern auf das Papier. »Und wenn ich alles, was ich besitze, bis auf den letzten Pfennig flüssig mache... es ist zuwenig! Viel zuwenig für ein solches Unternehmen. Mit einer halben Million eigenen Kapitals müßten wir anfangen. Dann würde es gehen.«
Erregt zerknitterte Klaus das vor ihm liegende Papier. Sollte der große Plan, den er während der letzten Tage in allen Einzelheiten durchdacht und überlegt hatte, scheitern, sobald er den Versuch machte, ihn in die Wirklichkeit umzusetzen? Wollte sein Schicksal ihn narren? Zeigte es ihm hier märchenhafte Schätze, um sie zurückzuziehen, sobald er die Hand danach ausstreckte? In einer Art von Galgenhumor stieß er die Worte hervor:
»Eine halbe Million... leicht gesagt. Aber woher nehmen und nicht stehlen?«
Jensen antwortete nicht. Unablässig glitt dessen Bleistift über das Papier. Eine neue Bilanz entstand unter seinen Händen. Die Bilanz des ersten Betriebsjahres einer südwestafrikanischen Bergbaugesellschaft mit einem Grundkapital von einer halben Million Mark. Ein Posten nach dem anderen wurde eingesetzt, von den ersten Kosten der Gesellschaftsgründung an bis zu den Verhandlungen mit dem Londoner Syndikat. Jetzt ließ Jensen den Bleistift sinken und schob das Blatt zu Klaus hin.
»Sehen Sie, so geht's. So geht's glatt auf...«
»Aber die halbe Million!« fiel ihm Klaus ins Wort. »Ich sehe keine Möglichkeit...«
»Aber ich, Kröning! Es bleibt nur eine Möglichkeit. Wir müssen Direktor Hartung mit in das Konsortium nehmen...«
»Meinen Sie?... Hat er?...«
»Er hat, Kröning! Er hat!... Wenn er das seine flüssig macht, bekommen wir das Geld zusammen. Wir kommen nicht anders durch. Wir müssen ihn ins Vertrauen ziehen und als dritten Partner aufnehmen.«—
Den Rest des Tages saßen Baumeister Jensen und Direktor Hartung mit Klaus
Kröning im verriegelten Zimmer zusammen Am nächsten Morgen fuhren sie zu
dritt nach Windhuk. Zum Notar zuerst, wo der Vertrag geschlossen und die neue
Gesellschaft gegründet wurde. Zum Bergamt danach. Möglichst still und schnell
wurde in den folgenden Wochen alles erledigt, was die Drei hinter
verschlossenen Türen geplant... und doch nicht still genug.—
Ein Flüstern und Raunen hub in der Kolonie an. Von Windhuk lief das Gerücht
nach Norden und nach Süden, von Grootfontein flog es nach Kalkfontein, wurde
in Bethanien und Keetmanshoop gehört, in Rehoboth und Omaruru.
»Klaus Kröning ist ein Esel!« ging es von Mund zu Mund »Klaus Kröning hält Katzenaugen für Diamanten! Klaus Kröning bildet sich ein, im Dünensand Schätze gefunden zu haben!«
Auch zur Küste kam das Gerücht nach Swakopmund und Lüderitzbucht. Auf dem Wege bis dahin war's noch größer und wilder geworden.
»Klaus Kröning ist toll geworden!« hieß es da. »Er hat seinen guten Posten bei Voßberg & Co. weggeworfen, um im Dünensand nach Diamanten zu suchen.«
Von der Küste nach Deutschland ist's nicht mehr soweit. Auch nach Deutschland flog das Gerücht. Es kam in die Spalten der Presse und kam sogar in das Parlament. Da lachten sie über den dummen Klaus, zogen die verstaubten Gutachten von allerlei Geologen aus den Schränken, sprachen von Küstenklatsch und haltlosen Phantastereien.
Aber das Gerücht flog auch in die Kabinette der Banken, und hier lachten sie gar nicht über Klaus Kröning.
Hier nahmen sie den ernst und wurden schnell hellhörig. Von hier schickten sie andere Geologen und Sachverständige nach Südwest, um zu sehen, was Wahres an der Sache sei.
Doch als die an der Mole von Swakopmund landeten, da war es schon zu spät. Da besaß die neue Gesellschaft schon über hundert Quadratkilometer der besten Claims. Da waren schon Hunderte von Schwarzen unter der Leitung Jensens tagaus, tagein an der Arbeit, die kostbaren Steine im großen zu gewinnen. Da saßen Klaus Kröning und Direktor Härtung schon in London am Verhandlungstisch mit den Herren des Diamantensyndikats zusammen.
Es waren zähe Kaufleute, die von London aus die Diamantenproduktion der ganzen Welt kontrollierten, den Brillantenmarkt der Erde monopolartig beherrschten. Sehr zuwider war ihnen diese Gesellschaft, die jetzt zu ihnen kam und ihr Kontingent am Weltmarkt forderte. Wochenlang kamen die Verhandlungen nicht vom Fleck. Allzu weit klaffte die Schlucht zwischen dem, was Klaus und seine Partner verlangten, und dem, was das Syndikat bewilligen wollte.
Jetzt zeigte es sich, wie wertvoll der Rat Jensens gewesen war, Hartung und sein Vermögen als dritten Partner zu nehmen. Gut fundiert und kapitalstark konnte die junge Gesellschaft ihre Forderungen erzwingen.
Der Tag kam, an dem Klaus die Geduld riß und er ein Ultimatum stellte.
»Entweder, meine Herren, Sie beteiligen uns mit dem geforderten Kontingent, oder wir werfen unsere ganze Ausbeute frei auf den Markt...«
»Dann stürzen die Diamantenpreise in den Abgrund«, warfen die Londoner Herren ein.
»Gewiß! Sie werden stürzen. Bis wie weit, das wird sich zeigen. Vergessen Sie nicht, daß Ihre anderen Mitglieder die Steine aus dem festen Grunde gewinnen müssen. Wir brauchen sie nur aus dem losen Sande aufzuheben, wo wir sie finden. Wir werden noch mit Gewinn verkaufen können, wenn die Preise bereits unter ihre Werbungskosten gefallen sind. Dann werden viele Ihrer anderen Betriebe schließen müssen, wir werden erst recht das Monopol haben.«
Dies Argument schlug durch. Die Londoner wußten, daß die neue Gesellschaft gut fundiert war, daß sie im Ernstfalle ihre Drohungen wahrmachen konnte. Äußerlich gelassen, innerlich ergrimmt bewilligte das Syndikat der jungen Gesellschaft das geforderte Kontingent.
Der Vertrag, der geschlossen wurde, sicherte mit einem Schlage die Zukunft der neuen Gründung. Das Syndikat verpflichtete sich darin, das bewilligte Kontingent an Steinen zu den bekannten Syndikatspreisen laufend gegen Barzahlung abzunehmen. Die deutsche Gesellschaft verpflichtete sich, nicht über dies Kontingent hinaus zu produzieren und ihrerseits keine Steine auf den Markt zu bringen. Als die Unterschriften unter dem Vertrage standen waren die drei Partner der neuen Gesellschaft gemachte Leute.
Deutsches Kapital wurde ihnen jetzt von allen Seiten angeboten. Sie nahmen davon, soviel sie für gut und nützlich hielten. Immer nur so viel, daß sie selbst die Majorität in der Gesellschaft behielten, Herren im eigenen Hause blieben.
Ein Jahr verstrich darüber. Ein Jahr reich an Arbeit, reich auch an Erfolgen. Der erste Abschluß der neuen Gesellschaft wurde bekannt, und wieder ging ein Raunen durch die Kolonie. Aber anders lautete das jetzt als vor zwölf Monaten.
Klaus im Glück! hieß es jetzt. Seht den Glücklichen. Nur den Mund braucht der aufzumachen, und die gebratenen Tauben fliegen ihm hinein. Seht den Diamantenkönig! Aus dem Wüstensand gewinnt der Millionen.
Aber Klaus Kröning beschränkte sich keineswegs darauf, nur den Mund aufzumachen. Der saß schon wieder im Sattel und durchstreifte wochenlang das Wüstengebiet der Dünen bis zur Küste hin, um neue Felder zu entdecken, neue Claims zu erwerben.
Klaus Kröning hatte nicht zuviel behauptet, als er dem Baumeister Jensen in jener ersten Unterredung in Lüderitzbucht zukünftige Millionengewinne in Aussicht stellte. Groß, über alles Erwarten und Hoffen hinaus groß wurden diese Gewinne.
Im Süden unten in Kimberley auf britischem Gebiete, da mußte man in die Tiefe gehen, mußte den ziemlich festen, diamanthaltigen Grund ausschaufeln und Karre für Karre durch Siebe schütteln, um aus einem Kubikmeter derartig verarbeiteten Bodens schließlich ein paar Steinchen des kostbaren Minerals zu gewinnen. Hier in Südwest hatte der Seewind im Laufe der letzten Jahrtausende bereits die Hauptarbeit verrichtet. Unzählige Kubikmeter des feinen Quarzsandes hatte er in Wolkenform in das Innere des Landes vertragen, jedes Diamantsteinchen aber als zu schwer an Ort und Stelle liegenlassen. So steckte der Reichtum hier in der allerobersten lockeren Sandschicht und ließ sich mit leichter Mühe und mit geringen Unkosten gewinnen.
Schon das, was die von den Gesellschaften beschäftigten Schwarzen beim einfachen Absuchen der Felder sehen und sammeln konnten, war beträchtlich. Viel größer aber noch die Menge der Edelsteine, sobald man daranging, diesen gesegneten Sand mit Rechen und Sieben zu bearbeiten.
In dichtgefugten, verschlossenen und plombierten Holzkästen wurde die tägliche Ausbeute jeden Abend von den verschiedenen Feldern her in das Hauptbüro der Gesellschaft gebracht. Mit Hilfe besonderer automatisch arbeitender Siebgruppen fand hier eine Trennung der Steine nach ihrer Größe, ihrem Karatgehalt statt. Die einzelnen so gesonderten Mengen wurden gewogen und danach in größere eiserne Kästen geschüttet, die ihren Platz in schweren Panzerschränken fanden.
Klaus stand vor diesen Kästen, ließ die flimmernden Stückchen in vollem Strom durch die Finger rieseln und hing dabei seinen Gedanken nach. Es waren wirklich Millionenwerte, in die er hier mit vollen Händen griff. Millionen, die sich auf den Kreditseiten der deutschen Gesellschaften in London und auf ihren Bankkonten häuften. Wohl forderte auch der Staat einen hohen Anteil an dem Gewinn, wohl waren mancherlei Unkosten zu tragen, aber überreich war noch der Teil, der den Gründern und Aktieninhabern der Gesellschaften als Gewinn zufloß.
Klaus wurde reich und lernte mit dem Reichtum neue Sorgen kennen. Sein Gehalt bei Voßberg & Co. war für ihn mehr als ausreichend gewesen. Während der letzten Jahre hatte er jeden Monat einen festen, wenn auch kleinen Betrag als Ersparnis für sich selbst zurücklegen können. Hatte darüber hinaus ständig Geld nach Deutschland geschickt, nicht so sehr um die Eltern zu unterstützen, als für die Geschwister. Die beiden Alten in ihrer rührenden Bedürfnislosigkeit brauchten und verlangten nichts. Aber gern nahmen sie seine Zuschüsse, die es ihnen erlaubten, den andern Kindern eine bessere Ausbildung zukommen zu lassen.
Das war jetzt ganz anders geworden. Mehr als das Hundertfache seines früheren Gehaltes floß Klaus nun fast automatisch zu. Wohin mit diesen gewaltigen Summen? Das war die Frage, die er schon öfter an Baumeister Jensen gerichtet hatte und auch jetzt wieder stellte.
Der Baumeister lachte.
»Ja, lieber Freund, Reichtum bringt Sorgen. Mehr als eine Zigarre kann auch ein Millionär nicht auf einmal rauchen, und wenn er nach dem ersten Beefsteak gesättigt ist, hat es keinen Zweck, ein zweites zu bestellen. Früher sagten wir im Scherz: ›Ihre Sorgen möchte ich haben und Rothschilds Geld.‹ Jetzt kommen wir so langsam dahinter, daß auch der Herr Baron von Rothschild einige Sorgen haben dürfte.«
Klaus wurde ungeduldig.
»Sie reden ganz unterhaltsam, lieber Jensen. Aber Ihre Philosophie hilft mir nicht weiter, Ihren Rat möchte ich haben.«
»Da muß ich erst noch einmal den schon erwähnten Herrn von Rothschild zitieren, lieber Kröning. Der sagte einem Kunden mal in ähnlicher Lage: Das kommt darauf an. Wollen Sie gut essen oder gut schlafen? Das heißt, wollen Sie eine möglichst hohe Verzinsung oder eine möglichst hohe Sicherheit Ihres Kapitals. Danach richtet sich die Art der Anlage...«
Klaus unterbrach ihn.
»Sicherheit natürlich in erster Linie. Was nützt mir die höhere Verzinsung, wenn ich vielleicht nach kurzer Zeit das ganze Kapital einbüße.«
»Wenn Sie durchaus auf sicher gehen wollen, dann müssen Sie fest verzinsliche Werte kaufen. Etwa Hypothekenpfandbriefe... oder Sie können auch direkt Hypotheken ausleihen, sich die sichersten Objekte selber aussuchen.
Wenn wir die Frage einmal theoretisch erörtern wollen, was wohl die allersicherste Anlage in der Welt ist, so möchte ich sagen: Eine erste Hypothek auf eine fruchtbare Geestwiese.«
Klaus sann eine Weile nach. Dann sagte er:
»Meinen Sie nicht, daß es dann noch sicherer wäre, die Geestwiese selber zu kaufen?«
Jensen fiel ihm ins Wort.
»Wir sprachen von Kapitalsanlagen, Kröning. Eine erste Hypothek auf die Geestwiese ist eine Kapitalsanlage. Die Geestwiese zu kaufen, bedeutet etwas anderes. Damit werden Sie Grundeigentümer und bekommen neue Sorgen. Entweder müssen Sie die Wiese verpachten, und wenn der Pächter seine Pacht nicht zahlt, können Sie Ihrem Gelde nachlaufen. Oder Sie müssen die Wiese selbst bewirtschaften, dann sind Sie nicht mehr Kapitalist, sondern Landwirt.«
»Aber sicherer ist es doch, Jensen, die Wiese zu kaufen, als eine Hypothek darauf zu geben.«
Der Baumeister zuckte die Achseln.
»Mag sein, mag auch nicht sein. Darüber könnte übrigens einer seine Doktorarbeit schreiben. Aber wir sprechen von Kapitalsanlagen. Was halten Sie von Voßberg & Co?«
Klaus sah ihn fragend an.
»Wie meinen Sie das, Herr Jensen?«
»Ich meine, wir beiden kennen die Firma seit einer Reihe von Jahren in- und auswendig recht genau. Wir sollten besser als viele andere wissen, ob man ihr sein Geld anvertrauen kann oder nicht.«
Klaus schlug mit der Hand auf den Tisch.
»Alle Wetter, Baumeister, das ist eine Idee und ein Rat! In unsere alte Firma habe ich volles Vertrauen.«
»Na, also, dann wären wir ja einig. Kaufen wir vorläufig mal Aktien von Voßberg & Co. Alles andere findet sich später.«—
Einige Monate später traten Klaus Kröning und Baumeister Jensen als Großaktionäre in den Aufsichtsrat von Voßberg & Co. ein. Wo Klaus noch vor zehn Jahren als Lehrling gearbeitet hatte stand er jetzt an höchster und verantwortungsreichster Stelle.
Doch der Segen nahm kein Ende. Jeder Monat brachte neue, große Gewinne. Weiter gute Papiere kaufen, riet Jensen. Deutsche Industrieaktien... englische, amerikanische Shares.
Klaus schüttelte den Kopf. Gedanken, die damals zuerst in ihm auftauchten, als er mit Jensen über die Geestwiese gesprochen arbeiteten in der Stille in ihm weiter. Während der vergangenen Jahre war er auf seinen Streifzügen in alle Ecken und Winkel der Kolonie gekommen, war manche Nacht auf deutschen und burischen Farmen zu Gaste geblieben. Für ihn, den einfachen, nur auf sein Gehalt angewiesenen Eisenbahningenieur lag damals der Gedanke, selbst eine Farm zu erwerben, außerhalb des Bereiches jeder Möglichkeit. Trotzdem hatte er die Augen aufgemacht, hatte gesehen, wie die Farmer es trieben, und was sie erreichten.
Fast immer war es dasselbe Lied. Kapitalmangel hinderte die Besitzer daran, den höchsten Ertrag aus ihrem Anwesen zu ziehen. Die Regierung gab das Land billig, stundete den Kaufpreis für lange Zeit. Aber außerdem war Kapital notwendig. Viel mehr, als die meisten deutschen Siedler, die sich hier eine neue Heimat gründen wollten, über den Ozean mitbrachten. Da waren manche, die schlugen sich ihr erstes Haus buchstäblich aus Kistendeckeln zusammen, hausten darin fast noch bedürfnisloser als die Schwarzen und kamen doch auf keinen grünen Zweig. Eine einzige besonders starke Dürre vernichtete ihnen den eben erst gewonnenen Viehbestand. Mit geringem Besitz waren sie ins Land gekommen. Als Bettler, den weißen Stab in der Hand, verließen viele es wieder.
Klaus sprach mit Jensen über die Farmerfrage. Der zuckte die Achseln.
»Ohne Kapital geht's nicht, lieber Kröning. Kapital ist das Lebenselixier für jeden Betrieb. Leute, die in Deutschland nicht daran denken könnten, auch nur ein Bauerngut zu erwerben, kommen hierher und hoffen ihr Glück als Farmer zu machen. Diejenigen aber, die sich in Deutschland ein Rittergut kaufen können, schenken uns nicht die Ehre ihres Besuches. Letzten Endes ist es dumm von den Leuten. Sie hätten hier ganz andere Zukunftsmöglichkeiten als auf dem übervölkerten und ausgemergelten Boden Europas.«
»Sie meinen also, mit genügend Geld in der Hand könnte ein Farmer hier sein Glück machen?«
»Gewiß, Kröning, er könnte es. Aber merken Sie wohl auf. Er müßte nicht nur Geld haben, er müßte auch ein tüchtiger Landwirt... oder sagen wir, ein tüchtiger Farmer sein, der alle Möglichkeiten klar erkennt und keine Ausgaben scheut, dem Lande das Höchste abzugewinnen. Nur wenn diese beiden Voraussetzungen zusammentreffen, ist ein Erfolg wahrscheinlich.«
Klaus überlegte eine Weile.
»Sie sprachen vor einiger Zeit vom Ausleihen von Hypotheken, Jensen, nannten es eine sichere Kapitalsanlage. Würden Sie Farmern in unserer Kolonie Hypotheken geben?«
Jensen machte eine abwehrende Bewegung.
»Nicht um die Welt, Kröning! Die Geschichte wäre mir zu unsicher. Die erste Hypothek hat immer die Regierung für den Kaufpreis des Bodens. Was danach kommt, schwebt in der Luft. Alles hängt von der Tüchtigkeit und Umsicht des Farmers ab. Das Ganze wird schließlich eine rein persönliche Angelegenheit, läuft auf einen Personalkredit hinaus. Darauf läßt sich das Kapital nicht ein. Sie sehen ja auch, daß es unseren Farmern hier nur in Ausnahmefällen gelingt, Geld aufzunehmen, und dann sind die Bedingungen gewöhnlich mehr als hart.«
Jensen hatte geendet, war damit beschäftigt, seine ausgegangene Zigarre wieder in Brand zu setzen. Auch Klaus schwieg. Eine lastende Stille herrschte in dem Raum. Jetzt warf Jensen das Streichholz in den Aschbecher und blickte auf Klaus.
Wie verändert schaute der aus. Seine Stirn krauste sich, es zuckte und arbeitete in seinen Mienen.
»Was haben Sie, Kröning? Geht Ihnen das Schicksal unserer Farmer so nahe?«
Klaus erhob sich langsam. Sein Entschluß war gefaßt. In eigener Arbeit wollte er mit dem Reichtum, den das Schicksal ihm geschenkt, etwas Neues, Wertvolles für die Kolonie schaffen.
»Ich danke Ihnen für Ihre Mitteilungen, Baumeister. Ich werde selbst Farmer werden.«
Jensen schüttelte den Kopf. Er verstand Klaus Kröning nicht mehr.—
Lange fuhr Klaus Kröning durch die Kolonie. Endlich glaubte er gefunden zu
haben, was er suchte. Im Landesinnern, östlich der Nord-Südbahn, da, wo es
keine Wanderdünen mehr gibt und dichte Weide den Boden bedeckt, kaufte er
Boden. Er kaufte bar, das Scheckbuch in der Hand. Auch für afrikanische
Begriffe war es ein gewaltiges Areal. Manches deutsche Herzogtum mochte ein
gutes Stück kleiner sein als das Gebiet in Süd-West-Afrika, auf dem Klaus
Kröning seinen Farmerbetrieb errichtete.
Durch das Gebiet, das er erworben hatte, zog sich von Nordosten nach Südwesten ein breites mächtiges Flußbett, einer der sogenannten Riviere. Nur in der Regenzeit führte es Wasser, die übrigen Monate lag es wie fast alle Flüsse dieses Landes trocken.
Hier entstand die erste Anlage eines großen Farmhofes. Von Windhuk her kamen auf den schwerfälligen Ochsenwagen, die abseits der Bahn noch immer das einzige Verkehrsmittel des Landes bildeten, Baustoffe, Maurer und Zimmerleute. Klaus Kröning begann seine Laufbahn als Farmer nicht, wie so manche andere, in einer aus Kistendeckeln zusammengeschlagenen Hütte, sondern in einem stattlichen, massiven Herrenhaus, an das sich reichlich Vorratsgebäude und Lagerhäuser anschlossen. Etwa zwanzig Kilometer davon entfernt auf dem Kamme eines bewaldeten Höhenzuges ließ er sich ein zweites Wohnhaus errichten. Es lag fast tausend Meter höher als der Farmhof am Flußbett. Auch während der heißen Jahreszeit war hier ein mildes Höhenklima zu erwarten. Während der nächsten Jahre sollte der Aufenthalt in diesem Hause auf dem Berge Klaus die Europareise ersetzen, denn vorläufig wollte er bei den Schöpfungen bleiben, die hier unter seiner Hand neu entstanden.
Das Gebiet, das er sich für seine Siedlung gewählt und erworben hatte, gehörte zu jener südwestafrikanischen »Parklandschaft«, die den europäischen Besucher immer wieder bezaubert und doch für einen Ackerbau europäischer Art unbrauchbar ist. Weite, schwellende Grassteppen unterbrochen von ausgedehnten Baum- und Buschgruppen. Die Flußläufe an den Ufern von dichten Galeriewäldern begleitet. Ein ideales Gelände—scheinbar.
Doch das Land hier hat zwei Gesichter. Anders sieht es zur Regenzeit, anders zur Zeit der Dürre aus. Wenn im Dezember die große Regenzeit einsetzt, die sich bis in den Mai hinzieht, dann grünen und blühen die weiten Steppen. Überall sprießt junges, grünes Gras, und Tausende von bunten Blumen bedecken die Steppe. Dann schmücken sich Büsche und Bäume mit neuen Trieben, und die ganze Natur atmet Frische und Wohlsein.
Sechs Monate etwa dauert die Regenzeit. Dann beginnt die Trockenheit. Das grüne Gras wechselt seine Farbe. Es beginnt zu vergilben, geht schließlich in ein immer satter werdendes Gelb über. Schon im September leuchten die Weideflächen wie schimmerndes Gold. Dann beginnen auch Büsche und Bäume unter der Dürre zu leiden. Immer grauer und glanzloser wird ihr Laub. Verstaubt und verdurstet liegt das Land während der letzten zwei Monate, bis endlich der Dezember neuen Regen und neues Leben bringt.
Bisweilen gibt es wohl im September und Oktober eine zweite kurze Regenzeit, die der verschmachtenden Natur neue Frische bringt. Aber gelegentlich bleibt sie auch Jahre hindurch aus, und der afrikanische Farmer darf nicht mit ihr rechnen. So war das Land beschaffen, in dem Klaus Kröning sein Leben als Farmer begann. Er kannte das Land und seine Tücken. Er wußte aber auch, was aus ihm zu machen war.
Wie ein Feldherr legte er sich seinen Schlachtplan zurecht und führte ihn Zug um Zug aus. Der nächste Punkt, der jetzt auf seinem Programm stand, hieß: Arbeiterbeschaffung. Klaus rief seinen alten Boy, der noch von der Eisenbahnerzeit her bei ihm geblieben war.
»Abraham!«
»Der Aubaas wünscht?«
Seitdem Klaus seine Stellung bei Voßberg & Co. aufgegeben und sich selbständig gemacht hatte, war er bei Abraham avanciert. Er war nicht mehr der Baas (der Herr), sondern der Aubaas (der große Herr).
»Abraham, ich brauche Arbeiter für meine Farm.«
»Oje, Oje, der Aubaas braucht Brüder von Abraham.«
»Aber anständige Brüder, Abraham. Leute, die Salz und Tabak ehrlich verdienen und keine Ochsen stehlen.«
Der Klippkaffer schnitt ein gekränktes Gesicht.
»Brüder von Abraham stehlen keine Ochsen. Der Aubaas wird viel Salz und viel Tabak geben?«
Klaus nickte gelassen.
»Der Aubaas wird geben«, sagte er gravitätisch.
Mit einem dreitägigen Urlaub wurde Abraham entlassen. Die Folgen seiner Sendung zeigten sich schnell. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich unter den Klippkaffern und Hereros das Gerücht, daß der gute Baas von Gründorn im Osten Farmland gekauft habe. In Trupps kamen die Schwarzen von allen Seiten herbeigezogen und boten ihm ihre Arbeitskraft an.
Systematisch teilte Klaus sein Land ein. Sieben große Vorwerke wuchsen aus dem Boden, jedes einzelne von einem zuverlässigen weißen Verwalter geleitet. Zuchtvieh wurde gekauft, zum Teil von benachbarten Farmern, zum andern Teil in Europa. In endlosen Zügen wanderten die Herden von Windhuk her durch die Steppe, bis sie Krönings Farm erreichten. Eine neue Arche Noah schien ihren Inhalt hier von sich zu geben. Rindvieh, Wollschafe und Perserschafe, Angoraziegen, Pferde, Maultiere, Esel, Kamele und Schweine füllten bald die Koppeln der neuen Farm. Geflügel aller Art wurde in den schwerfälligen Ochsenkarren herangebracht. Bald herrschte reges Leben auf den endlosen Weiden, auf denen vor kurzem nur vereinzelte Springböcke und Hartebeests geäst hatten.
Und dann besann sich Klaus eines Bibelwortes, das er vor langen Jahren von seinem Vater, dem alten Gemeindehirten, gehört hatte. »Das Auge des Herrn macht das Vieh fett.« Wohl an sechzig Kilometer weit streckte sich seine Farm den Riviere entlang von Südwesten nach Nordosten. Wohl an zwanzig Meilen hätte er jeden Tag reiten müssen, um wirklich alles zu sehen, seine Augen überall zu haben. Eine neue Technik bot ihm die Mittel, das Unmögliche möglich zu machen...
Die Sonne stand schon tief im Westen. In Freshwater, dem nördlichsten von Klaus Krönings Vorwerken, waren die Klippkaffern schwatzend und lachend mit dem Melken des Milchviehs beschäftigt. In Strömen ergoß sich das weiße Naß aus den strotzenden Eutern in die Melkkübel. Da drang von weither ein fremdartiger Ton über die Steppe. Fast ähnlich wie das Schreien eines wilden Ochsen klang es. Die Schwarzen horchten auf, unterbrachen die Arbeit, suchten mit ihren scharfen Augen den Horizont ab.
Irgend etwas kam dort aus der Ferne daher. Ein Wagen schien's zu sein. Ein Ochsenkarren vielleicht, dessen Zugtiere geblökt oder geschrien hatten. Aber so schnell kam der Wagen heran. Viele Male schneller, als schwerfällige Zugochsen jemals zu laufen vermocht hätten.
Und jetzt—die scharfen Augen der Schwarzen erkannten es ganz deutlich—ein Zauberwagen mußte es sein. Ohne Zugvieh davor rollte er mit Windeseile über die ebene Steppe daher.
»Zauberei!« Ein Teil der Schwarzen stürmte in wilder Flucht querfeldein davon. Andere warfen sich zu Boden, bedeckten das Gesicht mit den Händen. Zitterten am ganzen Leibe, als es in nächster Nähe bei ihnen fauchte und puffte, wieder der Schrei eines wilden Ochsen in ihr Ohr drang.
Plötzlich verstummte das Geräusch. Und dann—dann brach die unendliche Neugier dieser schwarzen Kinder durch. Vorsichtig blinzelten sie durch die Finger zu dem unbekannten Ungetüm hin und sahen, daß ihr wohlbekannter Baas in dem Zauberwagen saß. Da wich die Scheu. Erst vorsichtig, immer kühner, dann kamen sie näher heran. Und dann brach es von allen Seiten los. Ein Geschnatter wie von hundert Enten, eine Flut von Rufen und Fragen.
»Was ist das?... Was hat der Baas da?... einen Wagen ohne Rinder!... Einen Wagen, der von selber fährt... Einen Feuerwagen...«
Immer näher kamen sie heran, begannen vorsichtig einzelne Teile zu betasten. Die Reifen—die Karosserie—die Motorhaube.
Vielstimmiges Geschnatter. Die Haube war warm. Da mußte das Feuer drin sein. Wildes Geschrei jetzt. Die Vorwitzigsten hatten den heißen Kühler betastet und sich die Finger verbrannt. Erschreckt stürzten sie zurück.
Klaus mußte lachen. Dann rief er ihnen in dem bekannten Mischmaschdialekt zu:
»Das ist ein eiserner Ochs!«
Im Nu lief das Wort in hundert Variationen durch die schwarze Gesellschaft... ein eiserner Ochs!... Der Baas hat einen eisernen Ochsen...
Das Kühlwasser war während der langen Fahrt zum beträchtlichen Teile weggedampft, eine Nachfüllung notwendig. Klaus wandte sich wieder an die Menge.
»Der eiserne Ochs will saufen!«
Neues, endloses Geschnatter... der eiserne Ochs will saufen... der Feuerochs vom Baas will saufen! Schon liefen sie nach allen Seiten auseinander, strömten nach wenigen Minuten zurück und brachten in allerhand Kannen und Töpfen Wasser heran. Waren stolz, es selbst durch den Trichter in den Kühler hineingießen zu dürfen. Gekränkt nur die, die mit ihrem Wasser zu spät kamen, als der Kühler schon voll war.
So machten Klippkaffern und Hereros die erste Bekanntschaft mit einem vierzigpferdigen Daimler. Überall, wo Klaus zum ersten Male damit auftauchte, gab's den gleichen Schreck, dasselbe Staunen bei den Schwarzen.
Bald freilich verblaßte der Reiz der Neuheit. Nur die eine unbehagliche Tatsache blieb bestehen, daß man niemals wußte, wo der Aubaas eigentlich steckte. Allzu schnell konnte sein Zauberwagen laufen. In knapp zwei Stunden rannte sein eiserner Ochse vom südlichsten bis zum nördlichsten Vorwerk durch die Steppe. Nicht immer ließ ihn der Aubaas dabei brüllen. Ganz leise kam er manchmal an, war schon mitten unter ihnen, bevor sie ihn recht bemerkt hatten. Da blieb ihnen nichts anderes übrig, als fleißig ihre Arbeit zu tun, wenn sie den großen Baas nicht böse machen wollten. So geschah es, daß Klaus Krönings Farmereibetrieb von Anfang an besser gedieh als viele andere.—
In der Nachbarschaft zuckten sie die Achseln über Klaus, nannten ihn den
Gentlemanfarmer. Wer in einem dieser neumodischen Maschinenwagen im Veldt
herumkutschierte, anstatt auf dem Pferderücken zu sitzen, der konnte in ihren
Augen kein rechtschaffener Farmer sein. Bald sollten sie noch mehr
Gelegenheit bekommen, ihre Glossen über Klaus zu machen.
Als die Dürrezeit begann, kamen von Windhuk her viele Ochsenkarren, beladen mit Feldbahngleisen, mit Loren und mit Lokomotiven. Deutsche Schachtmeister kamen und neuangeworbene schwarze Arbeiter mit ihnen. Klaus aber besann sich auf das, was er einmal vor vielen Jahren bei dem alten Feldmesser Wendt gelernt hatte. Wieder schweifte er mit dem Theodolithen und mit Meßlatten durch das Land. Der Riviere machte bei dem neuen Farmhof einen Bogen. Dicht daneben, vom Flußlauf nur durch einen schmalen Landrücken getrennt, zog sich eine ausgedehnte Bodensenke dahin.
Hier maß und nivellierte Klaus eine Woche hindurch. Dann streckten sich Feldbahngeleise, Lokomotiven pfiffen und Loren rollten. An hundert Schwarze waren beschäftigt, einen Kanal vom Riviere zu diesem Tal zu graben. Rastlos schaufelten sie den ausgehobenen Boden in die Loren. Mit ihrer Last rollten die Feldbahnzüge zum Riviere und schütteten einen Damm quer durch die halbe Breite des Bettes.
»Ein kostspieliges Vergnügen«, meinten die Farmer in der Umgebung. »Aber der Diamantenkönig hat's ja dazu. Jeder wird sein Geld auf seine Weise los.« Klaus lachte, als er davon hörte.
»Laßt sie sich die Mäuler zerreißen«, sagte er zu Georg Schmidt, seinem ersten Verwalter, »sie werden noch öfter Gelegenheit haben, sich über mich zu wundern.«
Die Gelegenheit ließ nicht lange auf sich warten. Neue Transporte kamen aus Windhuk. Schwere Eisenteile, Betonmischmaschinen, Motoren und unendliche Mengen Zement. Ein vollkommenes Einlaufwerk mit Schleusentoren wuchs dort aus dem Boden, wo der neugegrabene Kanal stromaufwärts dicht vor dem geschütteten Damm in den Riviere mündete.
Die Dürre ging weiter. Auch Klaus mußte ihr seinen Tribut zahlen. Das Vieh fiel ab, manches gute Stück ging ein. Und doch bewährte sich auch hier wieder sein schon fast 'sprichwörtlich gewordenes Glück. Eine Regenwoche im September verhütete das Schlimmste. Und dann endlich war die Dürre vorüber. Die große Regenzeit setzte ein. Der Riviere, so lange ein trostloses, sandiges Tal, verwandelte sich in einen schäumenden Strom. Gewaltige Wassermassen trug er vom Nordosten her durch das Land. Vor dem frisch geschütteten Damm stauten sich die Fluten hoch auf, strömten in mächtigem Schwall durch den Kanal in die Bodensenke. Wo seit undenklichen Zeiten niemals Wasser gewesen, streckte sich jetzt der Spiegel eines großen Sees.
Als das Wolkengrau lichter wurde, als das erste Himmelsblau hindurchbrach, begannen die Wasser des Riviere sich zu verlaufen. Da wurden alle Tore und Schützen in dem Einlaufwerk geschlossen. Den gefangenen Fluten war der Rückweg abgeschnitten. Längst lag das Flußbett wieder gelb und staubig da, aber der neugewonnene große See blieb stehen.
Er bot dem durstenden Vieh nicht nur willkommene Tränkplätze, Klaus ließ auch Gräben von ihm aus weit in das Land hineinziehen, durch die das kostbare Naß über die Weide verteilt und beträchtliche Flächen auch während der Dürrezeit saftig grün erhalten blieben.
Das war die erste große Verbesserung, mit der Klaus in sein zweites Farmjahr ging. Genauer gesagt, der Anfang einer Verbesserung, denn in den folgenden Jahren wurden solche Stauseen noch an zahlreichen anderen Stellen von ihm angelegt. So gewann er ein bedeutendes Areal, das auch für einen nutzbringenden Ackerbau geeignet war.—
Die lange Dürre war und blieb der schlimmste Feind des Farmers in Südwest.
Wenn das Gras vergilbte, begann das Vieh abzufallen. Blieb im September die
zweite kurze Regenperiode aus, dann trat eine Krankheit auf, die von den
burischen Farmern die Lahme genannt wurde. Die Tiere verloren die Herrschaft
über ihre Glieder, und der Tod hielt reiche Ernte unter ihnen. Auch
reichliche Tränkung vermochte das Unheil nicht aufzuhalten. Das Übel kam von
dem verdorrten Futter.
»Der Diamantenkönig macht neue Experimente«, sagten die Farmer in der Nachbarschaft. »Schade um das schöne Geld, was da verpulvert wird.« Auch seine weißen Verwalter zuckten die Achseln. Selbst der erste Administrator, ein erfahrener und umsichtiger Landwirt, sagte ihm Mißerfolge voraus. Klaus schlug ihm auf die Schulter.
»Lieber Schmidt, wenn auf zwanzig Mißerfolge ein Erfolg kommt, bin ich zufrieden. Im übrigen kann ich nicht einsehen, warum hier in Afrika nicht gehen soll, was in Deutschland schon seit langem geübt wird.«
»Deutschland ist nicht Afrika, Herr Kröning«, erwiderte der Administrator.
»Aber Gras ist Gras, lieber Schmidt. Es müßte mit dem Teufel zugehen, wenn wir hier nicht auch zu einem brauchbaren Verfahren kämen.«
Klaus stand während dieser Unterredung mit Schmidt hinter den Wirtschaftsgebäuden vor einer Reihe großer, glatt ausbetonierter Gruben.
»Wir werden ganz systematisch vorgehen, Herr Schmidt. Sobald die Regenzeit vorüber ist, beginnen wir mit dem Füllen der ersten Grube, nehmen Woche für Woche eine neue Grube vor. In allen Fällen wird Süßfutterzusatz gegeben. Ich habe die erforderlichen Chemikalien bereits aus Deutschland kommen lassen. Die gefüllten Gruben werden mit Lehm abgedeckt.«
»Ja, aber, Herr Kröning...«
»Jetzt kein ›Aber‹, Herr Schmidt. Es haben schon Leute vor Ihnen geglaubt, daß Klaus Kröning ein Esel ist, und haben...«
»Verzeihung, Herr Kröning, nichts liegt mir ferner als...«
Klaus lachte.
»Gedanken sind zollfrei. Denken Sie, was Sie Lust haben, aber führen Sie meine Anordnungen aus. Später mögen Sie meinetwegen reden.«—
Die Regenzeit ging vorüber, die neue Dürre brach ein. Als der Oktober ins
Land zog, stand Klaus mit seinem Administrator wieder vor den Silos. Ein paar
Klippkaffern machten sich daran, die Lehmdecke von der ersten Grube
abzuräumen, fuhren erschrocken zurück und hielten sich die Nasen zu. Ein
fürchterlicher Gestank kam aus der Grube.
Schmidt drehte sich um und biß sich auf die Lippen. Klaus zog sein Taschenbuch, in dem er die einzelnen Versuche mit allen Daten notiert hatte, und machte durch die erste Position einen roten Strich.
»Zum nächsten Silo!« sagte er kurz.
Die Decke der zweiten Grube wurde aufgebrochen. Auch hier ein entsetzlicher Gestank. Ein zweiter roter Strich in dem Buch.
So ging es von Silo zu Silo weiter.
Der Administrator räusperte sich.
»Sagten Sie etwas, Herr Schmidt?«
»Nein, Herr Kröning. Aber ich meine...«
»Es ist noch zu früh zum ›Meinen‹, Herr Schmidt. Wir sind noch nicht am letzten Silo.«
Schmidt hielt sich die Nase zu und schüttelte den Kopf.
»Es wäre besser, Sie machten die Nase wieder auf und prüften den Geruch.«
Der Administrator schwieg. »Geruch nennt der Mann diesen bestialischen Gestank«, dachte er bei sich.
Als die achte Grube aufgebrochen wurde, trat Klaus dicht heran und witterte über der Öffnung.
»Kommen Sie näher, Herr Schmidt, riechen Sie auch mal.«
»Danke vielmals, Herr Kröning, ich bin nicht so vergnügungssüchtig.«
Klaus machte den achten Strich in sein Buch.
Als die zehnte Grube an die Reihe kam, trat auch der Administrator näher. Tiefbraun, fast frischem Torf ähnlich lag die eingestampfte Masse hier unter dem Lehm. Ein würziger, honigartiger Geruch ging von ihr aus. Ebenso war's an der elften und zwölften Grube. Drei rote Kreise kamen in Krönings Buch.
»Na, Herr Schmidt! Was meinen Sie jetzt?«
Der Administrator kratzte sich den Kopf.
»Es wird darauf ankommen, Herr Kröning, ob das Vieh das Zeug frißt, und wie es ihm bekommt.«
Klaus lachte.
»Sie sind ein unverbesserlicher Zweifler. Den Versuch werden wir schnell machen.
Einen Ochsenkarren her! Vollgeladen aus Grube zehn und elf, und in die nächste Koppel damit!«
Wenig später lief der eiserne Ochse über das verbrannte Veldt, trug Klaus und seinen Administrator zu der Koppel. Gierig drängte sich das matte Vieh um das hingeworfene Süßfutter, fraß und kaute mit vollem Behagen. Eine Weile betrachtete Klaus das Schauspiel schweigend. Dann wandte er sich zu seinem Begleiter.
»So, lieber Schmidt, jetzt ist die Reihe an Ihnen. Jetzt können Sie reden.«
»Sie haben recht behalten. Ich habe nichts mehr zu sagen, Herr Kröning.«
»Einverstanden, Herr Schmidt. Wir wollen nicht mehr reden, sondern handeln.«—
Bald erhoben sich auf allen Vorwerken die charakteristischen Bauten neuer,
großer Silos. Von jetzt an wurde Viehfutter im großem nach dem von Klaus
Kröning entdeckten Verfahren konserviert. Zuerst geschah es nur auf seiner
Farm. Bald kamen auch die Nachbarn, die so lange über ihn gespottet
hatten.
Sie sahen und staunten. Dann ließen sie sich von ihm in das Verfahren einweihen. Der Kernpunkt der Erfindung lag in der richtigen Zeitwahl. Das Gras für die Silos mußte zu einer ganz bestimmten Zeit nach der Regenperiode geschnitten und gespeichert werden, wenn es bereits leicht vergilbt war. Nur dann machte es eine süße, würzige Gärung durch und ergab ein wunderbares Futter, das den notleidenden Herden in der Dürrezeit sehr zugute kam. Der Erfolg war so augenscheinlich, daß sein Verfahren schnell allgemein zur Anwendung kam.
Bald war die Farm von Klaus Kröning als Musterwirtschaft in der ganzen Kolonie bekannt. Auch durch ihre Größe begann sie Aufsehen zu erregen, denn von Jahr zu Jahr wuchs ihr Areal durch Neuerwerbungen. Immer wieder gab Klaus seinen Nachbarn Grund zum Staunen. Als er die erste Straußenfarm anlegte und eine Straußenzucht im großen begann, steckten sie die Köpfe zusammen und lachten. Aber als die ersten Federsendungen nach Europa gingen und vom dortigen Markt zu hohen Preisen aufgenommen wurden, verging ihnen das Lachen. Wieder einmal hatte Klaus Kröning ihnen gezeigt, daß er weiterblickte als sie und den Erfolg zu zwingen verstand.
Auf einem anderen Gebiet freilich wollte es ihm nicht glücken, so viele Opfer er auch seiner Idee brachte. Eine wirklich lohnende Fleischversorgung im großen war nur möglich, wenn man das Fleisch der auf der Farm geschlachteten Rinder sicher konservieren konnte. Es gab keine neue Erfindung, kein neues Konservierungsverfahren, über das er sich nicht eingehend informiert hätte.
Spielend leicht mußte das Problem zu lösen sein, wenn auch nur die Hälfte von dem zutraf, was die Erfinder versprachen. Aber leider traf es nicht zu. Tausende und Abertausende gab Klaus in diesen Jahren für neue Konservierungsanlagen aus. Fast jeder Dampfer, der in Swakopmund anlegte, hatte Apparate und Maschinenteile für seine Farm an Bord. Keine Mißerfolge konnten ihn davon abbringen, den einmal gefaßten Plan mit größter Zähigkeit zu verfolgen. In einem alten großen Schuppen seiner Hauptfarm begannen die als unbrauchbar erkannten Apparate sich zu Bergen zu häufen. Wohl oder übel mußte er auf die Durchführung dieses Planes verzichten.
»Vorläufig nur und bis auf weiteres«, sagte er zu sich selber, als er sich anderen Dingen zuwandte, die inzwischen sein Interesse erregt hatten.
Als seine Leute den Sperrdamm in dem großen Riviere schütteten, waren Klaus zum ersten Male merkwürdige schwarze Steine aufgefallen. Während die Steppen der Parklandschaft von einer ziemlich starken Humusschicht bedeckt waren, trat in dem Flußbett ein scharfer, gelber Sand zutage, der mit größeren und kleineren schwarzen Brocken durchsetzt war. Der alten Gewohnheit treu hatte er begonnen, diese Steine zu sammeln. Von jedem seiner Gänge zum Riviere hatte er eine Handvoll mitgebracht. Schon lag eine ziemliche Menge davon in einem seiner Schreibtischkästen.
Jetzt saß er davor, ließ die schwarzen, glasig schimmernden Brocken durch die Finger gleiten. Auffallend schwer schienen ihm die Steine zu sein. Prüfend wog er einen der größten in der Hand. Sein Blick fiel auf die Briefwaage, mechanisch legte er den Stein darauf. Der Zeiger spielte bis zur 26, blieb dann stehen.
26 Gramm Gewicht. Aber das wollte er ja gar nicht wissen Das spezifische Gewicht interessierte ihn. Er griff nach einem Faden, knotete den Stein ein und band ihn an das Knie der Briefwaage, daß er frei nach unten hing. Wieder spielte der Zeiger auf die 26. Er schob ein leeres Glas unter den Brocken, begann es aus der Karaffe vorsichtig zu füllen. In dem Maße, in dem das Wasser den Brocken umspülte, ging der Zeiger zurück.
Jetzt war der Stein vollkommen im Wasser. 22,2 Gramm zeigte die Waage. Klaus griff nach Bleistift und Schreibblock, begann zu rechnen. 26 minus 22,2 gleich 3,8 Gramm. Also Gewicht des Steines 26 Gramm, Gewicht eines gleichen Volumens Wasser 3,8 Gramm. Spezifisches Gewicht des Brockens gleich 26 dividiert durch 3,8 gleich 6,85...
Er ließ den Bleistift sinken. Spezifisches Gewicht 6,85... fast siebenmal so schwer als Wasser war dieser Brocken. Er wiederholte den Versuch mit anderen der schwarzen Steine. Stets das gleiche Resultat. Erze eines Schwermetalles mußten es sein, die hier vor ihm lagen. Und reiche Erze ganz zweifellos, denn nur so ließ sich dies hohe spezifische Gewicht erklären.
Sein Spüreifer wurde rege. Aus einem anderen Fach des großer. Schreibtisches holte er ein Trockenelement und ein Galvanometer hervor, schaltete sie zusammen, begann mit den beiden blanken Drahtenden den Brocken abzutasten. Da!... Über die ganze Skala schlug der Zeiger des Galvanometers aus. Der Stein war ein guter Leiter für den elektrischen Strom. Nur ein hochwertiges reiches Metallerz konnte sich so verhalten. Er griff in den Kasten nahm andere Brocken, prüfte sie in der gleichen Weise. Überal1 dasselbe Verhalten.
Klaus spürte, wie die Erregung des Jägers ihn packte, der sein Wild zum Schuß bekommt.
Die Erze durch einen Sachverständigen untersuchen lassen? Ah bah! Er verwarf den Gedanken so schnell wie er kam. War er nicht selber sachverständig genug. Ein Metallerz war es sicher, was da vor ihm lag. Wahrscheinlich eine Metallsauerstoffverbindung, im ungünstigsten Falle ein Schwefelmetall. Eine mit reduzierenden Mitteln geschmolzene Probe mußte ihm Aufschluß geben. Die Mittel für solche Analysen hatte er sich seit langem beschafft.
Schon stand der Benzinbrenner auf dem Tisch und begann zischend und brausend seine heiße Flamme nach oben zu recken. Im Mörser zerstampfte Klaus eine Portion der schwarzen Brocken, mischte das gewonnene Pulver mit Kohlenstaub, schüttete es in eine Quarzschale, bedeckte es mit gestoßenem Borax und schob die Schale über die Flamme.
Die Uhr in der Hand stand er davor und beobachtete. Die Hitze begann sich dem Inhalt der Schale mitzuteilen. Ein leichter Rauch stieg empor. Knisternd gab der Borax sein Kristallwasser ab und begann zusammenzusintern.
Nun floß die Masse auseinander, eine glasartige Schicht geschmolzenen Boraxes stand über dem Schaleninhalt. Zischend umspülte die Flamme des Blaubrenners das Gefäß, höher und immer höher stieg die Temperatur. Ohne zu erweichen oder sonst Schaden zu nehmen, ließen sich diese aus reinem Bergkristall erschmolzenen Retorten ja bis auf tausend Grad erhitzen.
Jetzt wallte es in der Schale auf. Das schwarze unter der Boraxdecke liegende Pulver begann Gase auszustoßen. Die erwartete Reaktion setzte ein. Mit dem Sauerstoff des Erzes verband sich der beigefügte Kohlenstaub zu Kohlensäure und entwich durch den schäumenden Borax. Das Metall wurde frei.
Minuten verstrichen, dann ließ das Schäumen nach. Der Prozeß war zu Ende. Klaus hob die Schale vom Feuer und betrachtete sie von der Seite. Durch die klare Quarzwand konnte er den Inhalt gut erkennen. Unter der schützenden Boraxdecke stand ein silbern schimmerndes Metallbad. Was war's, was er da aus den schwarzen Steinen erschmolzen hatte?
Er griff ein Stück Karton, tauchte es in Wasser und kniffte eine kleine Form daraus. Dann griff er von neuem nach der Schale, schüttete den geschmolzenen Inhalt in die Form. Der feuchte Karton begann unter der Hitze zu dampfen, sich stellenweis zu bräunen. Er tropfte Wasser darauf, griff dann das Ganze mit der Pinzette und warf's in ein Wasserglas.
Ein kurzes Zischen. Das erwärmte Wasser begann den Borax zu lösen, das Papier der Form blätterte ab. Er griff in das Wasser, zog ein silberweißes Metallstäbchen heraus. Mit der Spitze der Pinzette fuhr er darüber hin. Tiefe Furchen ritzte der scharfe Stahl in das Metall. Für Zink war's zu weich. Blei oder Zinn, das war die Frage.
Er brachte das Stäbchen dicht an sein Ohr, bog es zusammen und hörte dabei ein feines, knisterndes Kreischen. Zinn! Das typische, jedem Chemiker so wohlbekannte Zinngeschrei war an sein Ohr gedrungen. Dieses Stäbchen hier in seiner Hand mußte zum überwiegenden Teil aus reinem, metallischem Zinn bestehen, sonst hätte es diesen Ton nicht hervorbringen können.
Mit einem Stichel kratzte er eine Spur von der Schmelzprobe ab, brachte sie in den Blaubrenner, blickte durch das Spektroskop darauf. Klar und deutlich sah er die charakteristischen Linien des Zinnspektrums. Jeder Zweifel war jetzt beseitigt. Ein hochwertiges, reines Zinnerz war es, mit dem er hier die Schmelzprobe gemacht. In Millionen von Brocken und Bröckchen lag dieses Erz auf seinem Grund und Boden in dem Riviere. Wieder zeigte ihm das Schicksal einen Glücksfund. Ihn fassen, ihn greifen und festhalten, das war jetzt die Aufgabe.—
Die Stunden verstrichen. Als die Mitternacht heraufzog, saß Klaus immer noch
vor der brausenden Lötflamme und machte quantitative Schmelzen. Der Bogen vor
ihm bedeckte sich mit Zahlen. 60 %... 70 %... 75 %. Er ging an den
Bücherschrank, griff einen Band, las und verglich. Da stand es schwarz auf
weiß zu lesen. Noch zweiprozentige Erze verhüttete man in Deutschland und kam
zurecht damit. Siebzigprozentige Erze lagen hier im Boden seiner
Farm.—
Die kommenden Tage verbrachte Klaus im Riviere. An vielen Stellen ließ er
graben. Wo immer seine Kaffern den Spaten in den Flußgrund stießen, stand er
dabei, ließ den ausgehobenen Sand durch die Finger rieseln. Dann wußte er,
was er wissen wollte, überall, wo er gegraben, enthielt der Sand das Zinnerz
in ziemlich gleichbleibender Menge. Von Walnußgröße bis hinab zu
Stecknadelkopfgröße waren die schwarzen Brocken und Stäubchen überall zutage
getreten, wo der Spaten in den Sand gestoßen wurde.
Der Schatz war da. Ihn zu heben, seine Aufgabe.
Klaus entsann sich einer Szene aus seiner ersten afrikanischen Zeit. Es war noch während des Hererokrieges, als die Lebensmittel überall knapp waren. Ein eigenartiges Bild hatte er damals gesehen. Damaraweiber saßen da etwas abseits von der Bahnstrecke. Jede hatte eine große runde Holzschale vor sich, die sie gleichmäßig mit beiden Händen schwenkten und dazu in regelmäßigen Intervallen auf das Knie aufstieß.
Er war herangegangen, um sich das merkwürdige Schauspiel aus der Nähe zu besehen, und hatte des Rätsels Lösung erfahren. Die Schwarzen hatten einen Termitenbau gefunden, einen jener großen weit über mannshohen Lehmkegel, in dem die afrikanischen Ameisen hausen. Erst hatten sie das Ding mit Hilfe von feuchtem Stroh gründlich ausgeräuchert, denn gereizte Termiten beißen dermaßen, daß es auch einer schwarzen Haut zuviel wird. Dann hatten sie den Bau aufgebrochen und die großen massiven Lehmstücke der Seitenwände fortgeworfen. Was übrigblieb war ein Gemenge von Lehmstaub, Termiteneiern und Grassamen, den die fleißigen Insekten als Nahrungsmittel gesammelt und in ihrem Bau gespeichert hatten.
Termiteneier! Ein Leckerbissen für die Kaffern. Man konnte sie roh essen, konnte auch knusprige Kuchen aus ihnen backen. Grassamen! Ein vorzügliches Material für Suppen. Aber der Lehm dazwischen, der mußte weg. Den konnte auch ein Negermagen nicht verdauen.
Separieren hieß es. Das war die Aufgabe, die die schwarzen Weiber dort mit einer wohl schon Jahrhunderte alten primitiven Technik erledigten. Sie schütteten das Gemenge in die großen Holzschalen, und durch jene eigenartige drehende und stoßende Bewegung brachten sie es in überraschend kurzer Zeit dahin, daß Grassamen, Termiteneier und Lehmstaub sich voneinander trennten. In kurzen Pausen konnten sie Eier und Grassamen mit Holzkellen aus den Schalen schöpfen, bis schließlich nur noch klarer Lehm darin war, der weggeworfen wurde.
Wer etwa vier Wochen später den Riviere durch Klaus Krönings Farm entlanggewandert wäre, hätte ein wunderliches Schauspiel gesehen. In langen Reihen saßen Klippkaffern, Männer und Frauen bunt durcheinander, am Flußbett, schwenkten und stießen emsig die mit dem erzhaltigen Sand gefüllten Holzschalen. Ein großer Jutesack lag neben jedem der Arbeiter. Schwarz, und immer schwärzer wurde während der Schüttelbewegungen eine Stelle des gelben Sandes in den Schalen. Dann griffen sie mit Holzlöffeln dorthin, schöpften das reine, vom Sand getrennte Erz und schütteten es in die Säcke. Setzten die Schalen von neuem in Bewegung, schüttelten und stießen weiter, bis auch die letzten Erzbrocken gewonnen waren, und der taube weiße Sand einer neuen Füllung aus dem Flußgrunde Platz machen mußte.
So arbeiteten sie den lieben langen Tag hindurch, und das Ergebnis war gut. Klaus kannte seine Leute und hatte sie auf Akkord gesetzt. Nur wenn die wußten, daß sie für jedes Pfund Erz bezahlt bekamen, war zu hoffen, daß sie ihre natürliche Faulheit überwinden würden.
Als der erste Monat des neuen Betriebes sich seinem Ende zuneigte, lagerte bereits manche Tonne reinen Zinnerzes in den Schuppen auf Klaus Krönings Farm. Am Riviere aber waren die Spuren dieser Arbeit kaum zu merken. Jahre, ja, Jahrzehnte konnte in dem gewaltigen, viele Quadratkilometer großen Flußbett so gearbeitet werden, bevor einmal eine Abnahme der Schätze zu merken sein würde. Viele Tausende von Tonnen des edlen Erzes waren hier zu gewinnen. Während der Schatz in seinen Lagern sich zu häufen begann, überdachte Klaus alle Möglichkeiten seiner Verwertung.
Zinn hatte seinen festen Marktpreis. Gewaltige Mengen davon brauchte die junge, kraftvoll aufblühende Industrie des afrikanischen Kontinentes. Allein die Eisenbahnen benötigten alljährlich viele Tonnen des edlen Weißmetalls für ihre Achslager. Aus England, aus Kanada oder von den Straits in Hinterindien mußten sie es beziehen. Würde es nicht besser und wirtschaftlicher sein, wenn er das Metall hier aus den einheimischen Erzen unmittelbar gewönne?
Neue, große Möglichkeiten sah Klaus vor sich. Pläne wurden gesponnen. Eigene Schmelzöfen hier am Riviere. Unmittelbar neben dem Gewinnungsort konnten die Erze verhüttet werden. Das Papier vor ihm bedeckte sich mit Zahlen. Und wie er das Problem von allen Seiten durchdachte und durchrechnete, stieß er immer wieder auf einen unsicheren Faktor.
Der Brennstoff hier im Lande war zu teuer. Das Fünffache des europäischen Preises mußte man für die Kohle bezahlen. Trockenes Gras und Büffelmist waren das landesübliche Brennmaterial, mit dem sich seine Kaffern in allen Lebenslagen behalfen.
Für den Betrieb einer Zinnhütte kam das nicht in Betracht. Zweifellos würde er das Brennmaterial für solchen Betrieb aus Europa importieren müssen. War's dann aber nicht besser, an Stelle der Kohle die viel ausgiebigeren Öle zu verwenden, eine Schmelze für Ölfeuerung anzulegen?
Von Tag zu Tag fühlte Klaus deutlicher, daß er hier vor einer Reihe von Fragen stand, die nur durch eine Studienreise nach Europa und Deutschland geklärt werden konnten. Betrieb er einstweilen die Gewinnung der Erze durch seine Kaffern behelfsmäßig, so mochte vorläufig auch die Verwertung eine behelfsmäßige sein.
Er setzte sich mit größeren Zinnhütten in England und in den Straits in Verbindung, sandte Proben seiner Erze dorthin. Es gab langwierige und umständliche Verhandlungen. Klaus Kröning mußte die Erfahrung machen, daß es gar nicht so leicht war, die wertvollen Bodenschätze, die er hier gewann, zu angemessenen Preisen auf dem Weltmarkt unterzubringen. Bald bekrittelten die Geschäftsfreunde in London den Prozentgehalt seiner Erze, bald hatten die in den Straits allerhand daran auszusetzen. Das alles unverkennbar in der Absicht, die Preise für das Erz bis an die Grenze des Möglichen zu drücken,
Schon wollte er die Verkaufsverhandlungen abbrechen und die Aufstellung eigener Öfen energisch in Angriff nehmen, als ihm von einer anderen Seite Hilfe kam. Eine Zinnhütte auf Borneo machte ihm Angebote, die ihm einen guten Gewinn ließen.
Gerade von dieser Verbindung hatte er sich nur wenig versprochen. Die Hütte auf Borneo war im Besitze von Chinesen und Malaien. Nach dem, was er bisher von den Geschäftspraktiken der Gelben und Braunen gehört, fürchtete er schlimme Erfahrungen. Doch das Gegenteil trat ein. Die Besitzer der Hütte hielten getreulich, was sie versprachen.
Zug um Zug kam jetzt ein lebhaftes Geschäft in Gang. Jeder Dampfer, der von Kapstadt nach Borneo ging, nahm eine stattliche Anzahl von Tonnen der Kröningschen Erze mit. Ebenso prompt lief die Zahlung ein. Es waren wunderliche Papiere, die Klaus da oft in Händen hielt. Wechsel und Zahlungsanweisungen in chinesischen und malaiischen Schriftzügen, deren Inhalt ihm unentzifferbar war. Papiere, die oft schon einen langen Weg durch die Handelshäuser des fernen Ostens zurückgelegt hatten, bevor sie zu ihm kamen. Aber Papiere, die ihren Betrag in gutem deutschem oder englischem Gelde wert waren und von den Banken ohne Zaudern honoriert wurden.
Der nächste und einfachste Weg der Verwertung war das freilich nicht. Die Erze, die da unten in Südwestafrika gewonnen wurden, segelten erst nach Osten hin um den vierten Teil der Erde, um verhüttet zu werden. Das gewonnene Zinn schwamm wieder nach Westen zurück, um dort auf den Markt zu kommen. Aber alle Beteiligten kamen dabei zurecht, und Klaus beließ es bei dieser Art der Ausnutzung.
Vorläufig... jeden Tag wiederholte er es sich jetzt... vorläufig sollte alles so bleiben, bis er selbst in Europa gewesen war und dort die besten Separatoren und Schmelzöfen gefunden hätte.
Das Jahr 1914 brachte den großen Weltbrand. Vergeblich waren alle Bemühungen, den Krieg auf Europa zu beschränken. Englische Truppen drangen in Deutsch-Südwest ein. Im Verlauf weniger Wochen war die Schutztruppe umzingelt und entwaffnet.
Nur noch selten kam Kunde von draußen zu den Farmern im Binnenlande. Hin und wieder ein Zeitungsblatt aus Kapstadt oder Kimberley, das von ungeheuren Siegen der Engländer und ihrer Verbündeten berichtete. Bisweilen irgendein schwarzer Läufer, der mündlichen Bericht über den großen Orlog brachte. So saßen die Deutschen von der Welt abgeschnitten auf ihren Farmen und sahen unruhevoll jedem neuen Tag entgegen.
Wieder waren Wochen vergangen. Ein klarer Oktobermorgen lag über dem Veldt, als eine englische Patrouille auf Krönings Hof am Riviere trabte. Vor dem Wohnhaus zügelten sie ihre Pferde. Der englische Offizier rief den erstbesten Kaffer an, wo sein Baas stecke. Dienstbeflissen lief der Schwarze, ihn zu suchen, kehrte nach einer Weile in Begleitung eines Weißen zurück.
Die Unterhaltung war nur kurz.
»You are the Baas here, Sir?«
»Yes, Sir.«
»Come along with me.«
Die englischen Soldaten veranlaßten den Baas, ein Pferd zu besteigen. Schnell wie sie gekommen, trabte die Patrouille wieder vom Hof. An ihrer Spitze zufrieden der englische Offizier. Wider Erwarten glatt hatte er den Befehl, sich Klaus Krönings zu bemächtigen, ausführen können.—
*
Von Pretoria aus trat Mijnheer van der Straten, ein burischer Prospektor, seine Europareise an. Über Johannisburg brachte ihn die Bahn nach Durbar, wo die englischen Dampfer anlegten. Drei Stunden später ging er an Bord der »Cyanous«.
Das Schiff war sehr mäßig besetzt. Kaufleute und Ingenieure, die aus Kapstadt nach der englischen Heimat zurückkehrten. Ein paar Portugiesen und Franzosen. Schließlich englische Offiziere und Beamte. In diesen Wochen war eine Seereise auch hier unten nicht gefahrlos.
Es wurde unter Beobachtung aller Vorsichtsmaßregeln und mit verdoppelten Wachen gefahren. Die »Cyanous« hielt sich stets dicht unter der Küste, um im Notfalle immer noch im letzten Augenblick in einen rettenden Hafen schlüpfen zu können. Aufregend waren diese Tage für die Schiffsbesatzung und auch für die Passagiere, so wenig sie sich's merken lassen wollten. Stunde für Stunde suchten die Wachen der »Cyanous« sorgsam den Horizont ab, ob nicht irgendwo die verdächtige Rauchfahne eines feindlichen Schiffes auftauchte.
In der allgemeinen Nervosität und Aufgeregtheit behielt Mijnheer van der Straten seine holländische Ruhe. Seine Sorgen waren ganz anderer Art, und er verhehlte sie weder dem Offizier der »Cyanous« noch den Passagieren, mit denen er ins Gespräch kam Die Fahrt der »Cyanous« ging nach Plymouth. Er aber wollte weiter nach Amsterdam. Wie von England heil über die Nordsee nach Holland kommen?
So verstrichen die Tage, Socotra und mit ihm englische Kriegsschiffe kamen in Sicht. Der gefährlichste Teil der Reise war überstanden. Vor Aden warf die »Cyanous« Anker, um frische Kohlen zu nehmen. Die Passagiere gingen an Land, um dem unendlichen Schmutz zu entgehen, der mit der Kohleneinnahme untrennbar verbunden ist. Schon hier bekamen sie einen kleinen Vorgeschmack von der Glutfahrt durch das Rote Meer, die ihrer wartete. Trostlos die Dürre in Aden, wo es durchschnittlich nur alle drei Jahre einmal regnet. Nirgends auch nur die bescheidenste Spur eines Pflanzenwuchses, überall nur in der Sonne glühender Fels, glutheißer Staub. Sehnsüchtig zählten die Passagiere die Stunden, da sie wieder an Bord konnten und die Fahrt weitergehen sollte.
Eine kleine Überraschung gab es vor der Abfahrt. Als die Reisenden über die Gangway das Deck betraten, fanden sie die »Cyanous« von einer Militärwache besetzt. Zur nochmaligen Paßrevision wurden alle Passagiere in den Smokingroom befohlen.
Eine reine Formalität, aus dieser Kriegszeit geboren, schien es zu sein. Waren doch die Pässe schon bei der Abfahrt von Kapstadt und Durbar sorgfältig geprüft worden. Schnell und glatt ging die Revision vonstatten, als plötzlich der englische Beamte zwei Franzosen beiseite treten ließ. Erregt unterhielten sich die beiden in ihrer Muttersprache über die sonderbare Maßnahme. Mijnheer van der Straten war der nächste an der Reihe. Gelassen legte er seinen Paß vor, beantwortete in einem südafrikanischen, mit burischen Brocken durchsetzten Englisch die Fragen des Kommissars. Durfte dann passieren.
Die Kontrolle war beendet. Der Beamte wandte sich an die beiden Franzosen.
»Sie bleiben in Aden, meine Herren.«
»Mais pourquoi donc, Monsieur?« Entrüstet kam die Frage französisch.
»Weil Sie deutsche Untertanen: Georg Mattäi aus Remscheid und Peter Schmidgen aus Köln sind.«
Der englische Beamte sprach auf einmal ein ganz brauchbares Deutsch. Die Franzosen überschütteten ihn mit einem Wortschwall ihrer Muttersprache, protestierten dann auf englisch, aber einem scharfen Auge konnte es nicht entgehen, daß sie bei den ersten deutschen Worten des Kommissars erblaßt waren.
»Geben Sie sich keine Mühe, meine Herren, wir sind vollkommen über Ihre Personen unterrichtet. Sie bleiben hier. An der zuständigen Stelle können Sie vorbringen, was Sie vorzubringen haben.«
Die Wache nahm die beiden als Deutsche erkannten Franzosen mit an Land. Die »Cyanous« lichtete die Anker und trat die Fahrt über die Straße von Babelmandeb in das Rote Meer an.
Vier Tage währte die Fahrt. Die Glut der Hölle war über das Schiff und seine Insassen ausgegossen. Träg, ölig glatt wie ein Spiegel lag die See. Kein Lüftchen wehte. Der schwache Fahrwind, den das Schiff sich selbst durch seine Fahrt schuf, schien erst recht geeignet, alles Lebende bis auf die letzte Faser auszudörren. Unendliche Mengen von Eiswasser und Zitronenlimonade wurden vertilgt, bis endlich Suez in Sicht kam und die Fahrt durch den Kanal begann.
Eine romantische Fahrt bei Scheinwerferlicht. Mitten durch die Wüste schien der mächtige Ozeandampfer zu fahren. Rechts und links zu beiden Seiten endlose Sandflächen, hier und da im jähen Strahl der Scheinwerfer die Silhouette eines Beduinen und seiner Kamele.
So kam die »Cyanous« nach Port Said, und wieder kamen englische Soldaten an Bord.—
*
»Haben Sie ihn, Sir?«
Der englische Hauptmann stellte die Frage an den Patrouillenführer, der von Krönings Hof nach Windhuk zurückkam.
»Yes, Captain! Die Sache ging glatter, als ich dachte. Da in der zweiten Reihe reitet er zwischen meinen Leuten.«
Der Hauptmann legte die Hand schattend über die Augen, blickte dorthin, rief dem Gefangenen zu.
»Hallo, Sir. Wollen Sie gefälligst etwas näher kommen.«
Der Baas ritt zu dem Hauptmann heran.
»Hier bin ich, Sir. Aus welchem Grunde lassen Sie einen friedlichen Zivilisten von seiner Arbeitsstätte wegholen?«
Der Hauptmann kniff die Lippen zusammen, um ein Lächeln zu unterdrücken.
»Weil wir besondere Gründe haben, Mr. Kröning, uns Ihrer Person zu versichern. Die Regierung der Südafrikanischen Union hat beschlossen, sich der führenden Kolonisten in Deutsch-Südwest zu bemächtigen...« Er hielt inne, als er das Staunen auf dem Gesicht seines Gegenübers bemerkte.
»Wie belieben Sie mich zu nennen, Sir?« fiel ihm der ins Wort.
»Einen führenden Kolonisten, Mr. Kröning.«
Der Gefangene machte eine ironische Verbeugung.
»Mr. Kröning wird über dies Kompliment sicherlich erfreut sein. Nur mich geht's leider nichts an. Mein Name ist Schmidt. Georg Schmidt... ich bin der erste Verwalter des Herrn Kröning.«
Erregt wandte sich der Hauptmann an den Patrouillenführer.
»Sie hatten den Auftrag, Mr. Kröning zu verhaften. Haben Sie sich nicht genau nach der Person des Gesuchten erkundigt?«
Der Leutnant stotterte eine Entschuldigung.
»Als ich auf den Hof kam, fragte ich nach dem Baas. Die Schwarzen brachten mir diesen Gentleman hier!«
Fragend schaute der Hauptmann auf den Gefangenen. Trotz seiner bedenklichen Lage konnte der ein Lachen nicht unterdrücken.
»Der Herr Leutnant ist noch neu im Lande und kennt die hiesigen Rangstufen nicht. Er hat nach dem Baas, dem Herrn, gefragt, und das bin ich. Er hätte nach dem Aubaas, dem großen Herrn, fragen müssen, wenn er Herrn Kröning zu sprechen wünschte. Ein kleiner Formfehler, Gentlemen. Auch kleine Fehler haben manchmal große Folgen.«
Der Hauptmann überlegte eine kurze Weile. Dann entschied er.
»Sie, Mr. Schmidt oder Mr. Kröning, oder wer Sie sonst sein mögen, bleiben vorläufig hier, bis Ihre Persönlichkeit sicher festgestellt ist. Sie, Herr Leutnant, mit Ihrer Patrouille halten sich bereit, sofort zum Riviere zurückzureiten, wenn es sich herausstellt, daß Sie den Falschen gegriffen haben.«
Der Administrator protestierte. Die Schwarzen seien wie Kinder. Ohne weiße Aufsicht würde auf der Farm alles drunter und drüber gehen. Vergeblich waren alle seine Einwände. Es geschah, wie der Hauptmann es befohlen hatte.—
An Bord des »Cyanous« in Port Said der gleiche Vorgang wie in Aden. Wieder
mußten die Passagiere zur Paßkontrolle antreten. Diesmal ließ der Kommissar
einen Portugiesen und zwei Engländer beiseite treten und sagte ihnen ihre
deutschen Personalien auf den Kopf zu.
Verwundert betrachtete Mijnheer van der Straten die Szene. Nur eine Erklärung gab's dafür. Die Engländer mußten einen vorzüglichen Spionagedienst unterhalten, jede neue Ermittlung über verdächtige Passagiere den Schiffen sofort per Funk vorausschicken. Anders war's gar nicht möglich, daß sie jetzt nach fast zwanzigtägiger Fahrt noch Reisende verhafteten, die in Südafrika mit guten Papieren anstandslos an Bord gekommen waren, und die—das mußte man neidlos anerkennen—ihre Rollen als Franzosen oder Portugiesen täuschend getreu gespielt hatten.
Wie viele mochten wohl jetzt noch unter den Reisenden sein, denen ein ähnliches Schicksal in Gibraltar oder schließlich bei der Landung in Plymouth bevorstand. Nach den bisherigen Vorkommnissen konnte sich ja wirklich jeder unter diesen Engländern, Franzosen, Portugiesen und Holländern am Ende noch als irgendein deutscher Wehrpflichtiger entpuppen, der mit falschen Papieren der bedrohten Heimat zustrebte.
Von Port Said nahm die »Cyanous« ihren Kurs durch das Mittelmeer nach Westen. Drei Tage nur Meer und Himmel, dann kam wieder Land in Sicht. Die Ostküste von Sizilien tauchte am Horizont auf. Die »Cyanous« steuerte den Hafen von Syrakus an.
Nur ein kurzer Aufenthalt war hier vorgesehen. Das Schiff blieb auf der Reede liegen. Ein Tender kam heraus, um ein paar Italiener von Bord zu bringen. Die Gangway wurde vom Tender zum Schiff gelegt. In dichtem Gedränge umstanden die Reisenden die Laufbrücke, während die Italiener zum Tender hinuntergingen, die Stewards ihr zahlreiches Gepäck hinter ihnen herschleppten.
Auch Mijnheer van der Straten war unter den Neugierigen, verschwand vorübergehend ganz in der Schar der Stewards.—
Als die »Cyanous« Kap Passero an der Südspitze Siziliens ansteuerte, rief der
Gong die Reisenden zum Diner. Der Platz Mijnheer van Stratens blieb bei
dieser Mahlzeit leer, obwohl die See ruhig war—obwohl der Holländer
während der langen bisherigen Fahrt überhaupt niemals Spuren von Seekrankheit
gezeigt hatte. Am folgenden Morgen mußte der Kabinensteward dem ersten
Offizier Mijnheer van der Straten als vermißt melden. Sein kleines Gepäck
stand in der Kabine, sein großes Gepäck—man sah die Ladelisten durch
und stellte fest, daß der Holländer in Durbar nur mit einem Handkoffer an
Bord gekommen war.
Zwei Möglichkeiten gab's. War er über Bord gestürzt—oder hatte er in Syrakus das Schiff unbemerkt verlassen?—
Zwei Tage später im Hafen von Gibraltar. Die gleichen Szenen hier zum dritten
Male. Mit einer unheimlichen Exaktheit arbeitete der englische
Nachrichtendienst. Schon hatte der Kommissar sechs Passagiere zurückgehalten,
ihnen gesagt, daß ihre Pässe falsch, daß sie wehrpflichtige Deutsche wären.
Jetzt rief er Mijnheer van der Straten auf.
Der Holländer meldete sich nicht. Der Offizier der »Cyanous« flüsterte dem Kommissar einige Worte zu... vermißt... über Bord gefallen?... oder?
Der Kommissar schlug mit der Faust auf die Liste.
»Damned, Sir! Er ist uns entwischt!... Mr. Kröning ist in Syrakus an Land gegangen.«—
Als der englische Beamte in Gibraltar diese Worte sprach, fuhr Klaus schon
dem Brennerpaß entgegen. Aus dem würdigen Holländer Mijnheer van der Straten
war in Syrakus wieder ein braver Deutscher geworden, den die rollenden Räder
des Diretissimo nicht schnell genug nach Norden bringen konnten.
Das Etschtal hinauf ging die Fahrt. Rosig grüßten im Morgensonnenschein die Schneegipfel der Dolomiten, als der Zug die Brennerhöhe erreichte. Weiter vom Brenner dann nach Innsbruck und München. So kam Klaus nach langen Jahren wieder in seine Heimat. Anders als er's sich in den langen afrikanischen Monden gedacht und geträumt. Das Vaterland, das er reich und blühend verlassen, stand im schwersten Kampf um sein Dasein.
Die erste Nacht auf deutschem Boden. Nach langer Seereise, nach mehrtägiger Eisenbahnfahrt gönnte sich Klaus den Genuß, wieder in einem feststehenden Bett zu schlafen. Am nächsten Morgen ging's weiter, der alten, thüringischen Heimat zu. In Erfurt nahm er einen Kraftwagen, um schneller nach Seehausen zu kommen. Es drängte ihn, die Eltern wiederzusehen. Mit eigenen Augen zu schauen, wie sie sich ihr Leben mit dem eingerichtet, was er ihnen in all diesen Jahren aus seinem Überfluß gespendet.
Jetzt tauchte im frühen Abendrot des Novembertages der Kirchturm von Seehausen auf. Der Wagen rollte durch die Dorfstraße, Da lagen die alten, Klaus so wohlbekannten Gebäude. Hier das Gemeindehaus, dort schräg von der Kirche weg der Krug. Aber wo stand das Haus seiner Eltern? Er wußte es nicht. Der Chauffeur mußte in den Krug gehen und danach fragen. Dann ging's weiter. Im Kruge drückten sie sich die Nasen an den Fensterscheiben platt.
Der Kraftwagen lenkte in eine Seitenstraße, die einen Hügel hinauf in die Höhe führte. Da lag das Haus, das Klaus suchte Er erkannte es nach den Zeichnungen wieder, die ihm vor Jahren nach Südwest geschickt worden waren. Ein solides, steinernes Haus, in dem die Eltern ihren Lebensabend verbrachten. Klaus sprang aus dem Wagen, eilte die Treppe hinauf—und lag in den Armen seiner Mutter.
Er hatte von München telegrafiert. Unendlich groß trotzdem die Überraschung, die Freude des Wiedersehens. Jetzt kam auch der Vater hinzu. Der war in den letzten Jahren recht klapperig geworden, pflegte den größten Teil des Tages im Lehnstuhl zu sitzen. Auch hier ein freudig bewegtes Wiedersehen nach so langer Trennung.
Eine lange Unterhaltung gab's, über die schwere Kriegszeit sprachen sie. Klaus fragte nach seinen Geschwistern. Seine beiden Brüder standen schon seit Kriegsbeginn im Felde, waren bis jetzt gesund geblieben.
Dann wollten die Alten wissen, wie es ihm in der langen Zeit im fernen Lande ergangen war. Wie er dort mit den schwarzen Menschenfressern zurechtkäme. Wie die Schwarzen lebten?... Wovon sie lebten?... Welche Sprache sie sprächen?... Ob sie jetzt noch Menschen fressen dürften?... Das waren so einige der ersten Fragen. Mit Verwunderung hörten die Alten, daß die Neger ganz brave, gutartige Menschen wären, mit denen man sich sogar deutsch unterhalten könne. Von Klippkaffern und Buschleuten, von Hereros und Ovambos erzählte ihnen Klaus, und die Alten vergaßen vor Verwunderung fast den Mund zuzumachen. Mit grenzenlosem Staunen hörten sie, daß Klaus mehrere Hundert dieser Wilden auf seinen Farmen beschäftigte, die unter der Aufsicht von einem Dutzend Weißer ihre Arbeit ordentlich und fleißig verrichteten. Sie wollten es nicht glauben, fragten immer wieder, ob er denn ohne Schießgewehr und Peitsche ausgehen könne.
Ja, das könne er, meinte Klaus. Das Gewehr nähme er nur mit, wenn er einen Springbock oder eine Antilope schießen wolle. Und eine Peitsche brauche er nur beim Reiten. Wo er sich auf den Farmen sehen ließe, kämen ihm seine schwarzen Leute, Männlein und Weiblein, vergnügt entgegen und begrüßten ihn lustig als ihren Aubaas.
Das war nun offenbar wieder ein wenig zuviel gesagt. Vater Kröning saugte gedankenvoll an seiner unvermeidlichen Pfeife. Mutter Kröning druckste, wurde verlegen... verhaspelte sich und platzte schließlich mit der Frage heraus, ihr Sohn Klaus würde ihr doch nicht etwa eine schwarze Schwiegertochter mit ins Haus bringen. Es dauerte eine ganze Weile, bis Klaus vor Lachen wieder reden konnte und seiner Mutter versicherte, daß etwas Derartiges nicht zu fürchten wäre.
Den nächsten Tag, einen Sonntag, verbrachte Klaus noch in Seehausen. Wohl hatte er in diesen Jahren des Aufstiegs und des Glücks auch manche schlimme Erfahrung mit Menschen gemacht. Manch einem hatte er Wohltaten erwiesen, der ihm schlecht dafür dankte. Aber doch trieb's ihn, die alten Stätten und die alten Bekannten aufzusuchen.
Fast zwanzig Jahre waren vergangen, seit er Dorf und Elternhaus verlassen. Wie ein Traum erschien ihm die Zeit. Wo waren die Jahre geblieben? Fast gestern schien's ihm zu sein, als er hier aus der Schule kam, den Baumeister Jensen kennenlernte.
Gestern? Ach nein... die Grabsteine auf dem Friedhof sprachen eine andere Sprache. Schon seit zehn Jahren schlief Justus Wendelmut, der alte Kantor, hier unter dem grünen Rasen. Und die Inschriften auf den benachbarten Steinen. Alles Namen, die Klaus wohl kannte, deren Träger er im Geiste noch vor sich sah. Der alte Krugwirt, dessen Sohn jetzt das Geschäft führte. Bauern und Büdner, deren Äpfeln und Birnen er mehr als einmal zu nahe gekommen war. Jetzt lagen sie hier und ruhten von allen Sorgen und Arbeiten aus.—
Am folgenden Tage erhielt Klaus seinen Gestellungsbefehl, am Dienstag stand
er auf dem Kasernenhof. Unübersehbar die Menge, die hier zusammenströmte.
Schwere Kriegsjahre erlebte Klaus.
Die zweite Kriegsweihnacht verbrachte er im Schützengraben. Hier erhielt Klaus die ersten Briefe aus Afrika. Viele Monate waren die unterwegs gewesen, bis sie über die neutrale Schweiz nach Deutschland gelangten, durch die Feldpost in seine Hände kamen. Briefe von seinen weißen Verwaltern, Briefe von englischen Geschäftsfreunden aus Kapstadt und Johannisburg.
Schlimm genug war der Inhalt. Sein ganzes Privatvermögen beschlagnahmt. Seine Verwalter gefangengenommen. Seine Farmen aufsichtslos den Eingeborenen überlassen.
Es war nicht eben schwer, die Bilanz aus diesen Nachrichten zu ziehen. Alles, was er in jahrelanger Arbeit in Afrika aufgebaut hatte, war für ihn verloren.
Was in den Briefen aus Johannisburg stand, war noch schlimmer als das, was seine Verwalter ihm aus dem Gefangenenlager schrieben. Die Schwarzen sahen, daß die Weißen untereinander Krieg führten und verloren darüber den Respekt vor den weißen Herren. Würde es jemals möglich sein, ihnen den wieder einzuflößen? Hundert Fragen, hundert Zweifel!
Dann nahte das bittere Ende. Die Ereignisse begannen sich zu jagen. Der November kam. Ein Waffenstillstand wurde geschlossen. In Paris beriet man viele Monate hindurch über den Friedensvertrag mit Deutschland.
Im Januar 1919 glückte es Klaus nach vielen Bemühungen, das Schweizer Visum für seinen Paß zu bekommen. Lange Wochen blieb er in der Schweiz. Hier war damals viel mehr zu erfahren als in Deutschland. Auch Nachrichten aus Südafrika empfing er hier, und was sie enthielten, gab ihm Anlaß zu langem Nachdenken.
Die Regierung der Südafrikanischen Union begann jetzt einzusehen, daß ihr Vorgehen gegen die deutschen Farmer in Südwest dem Lande schweren Schaden getan hatte. Durch die gewaltsame Brachlegung der weißen Kräfte war die Kolonie wirtschaftlich heruntergekommen. Die Schwarzen waren verwildert, englische Untertanen zeigten wenig Neigung, mit ihrem Kapital dorthin zu gehen und wieder aufzubauen, was zerstört war.
Klaus Kröning horchte, beobachtete und kombinierte. In weiter Ferne wie durch einen Nebel zuerst noch sah er Möglichkeiten, doch noch zu retten, was er schon aufgegeben hatte. Freilich tat schnelles Handeln not. Darüber ließen ihm die Mitteilungen seiner englischen Bekannten keinen Zweifel, daß die Verhandlungen in Paris für Deutschland wenig Gutes versprachen.
Nur die eine Möglichkeit gab's. Das deutsche Eigentum mußte englisch werden, bevor man in Paris den Frieden unterzeichnete. Die deutschen Gesellschaften mußten sich in englische Kompanien verwandeln. Klaus sah einen Weg, das zu erreichen.
Freilich mußte man dazu selbst in Afrika sein. Mußte zuverlässige Afrikaner zu Freunden haben, die man vorschob und als Partner in die neu zu gründenden angloafrikanischen Gesellschaften aufnahm. Alle Verträge mußten in Afrika unter Zuziehung der geschicktesten dortigen Juristen abgefaßt und geschlossen werden.
Eine Möglichkeit war's, wenn auch nur eine schwache. Klaus zog die Bilanz seines Lebens, seiner bisherigen Arbeit. Sein Vermögen hier in Deutschland schrumpfte von Tag zu Tag in dem gleichen Maße mehr zusammen, in dem der Währungsverfall Fortschritte machte. Zu seinem Glück hatte er vor dem Kriege einen Teil seines Vermögens in holländischen Gesellschaften investiert. Nur dieser Umstand hatte ihm die Mittel gerettet, die er für die geplante große Transaktion benötigte. Er raffte sich zusammen. Der Entschluß ist der Vater der Tat! Jenes Wort seines alten Bataillonsführers kam ihm in den Sinn, straffte ihn selber zu neuen Taten.
Anfang April hatte er alle Papiere, die er brauchte. Die Vollmachten seiner deutschen Gesellschaften, die Einreiseerlaubnis der englischen Regierung nach Südwest. In den letzten Tagen des April segelte er mit der »Empereß« von Southampton ab. Nach Süden trug ihn der Kiel, nach seinem geliebten Südwest.
An der Mole von Swakopmund betrat er den afrikanischen Boden. Fünf Jahre war's her, daß er ihn verlassen. Ein Weltgeschehen lag dazwischen. Wie anders war hier alles geworden. Englische Straßennamen und Schilder. Der Union Jack, wo damals die schwarzweißrote Flagge wehte. Swakopmund, die große deutsche Siedlung war eine englische Hafenstadt geworden.
Nur wenige der alten Freunde traf Klaus wieder. Baumeister Jensen und Doktor Härtung, die die Kriegsjahre hinter Stacheldraht verbracht hatten, waren darunter. Die weihte er in seine Pläne ein. Zuerst verstanden sie kaum, was er beabsichtigte, erklärten sein Unterfangen für aussichtslos. Dann begannen sie zu begreifen, stimmten zu, den Versuch zu wagen.
Freilich, man mußte Opfer bringen. Man mußte bindende Vorverträge mit sorgfältig ausgewählten, zuverlässigen Partnern schließen. Die hatten dann das sequestrierte deutsche Eigentum von der südafrikanischen Regierung zu erwerben und en bloc in die zu gründenden englischen Gesellschaften einzubringen, um dafür einen beträchtlichen Teil der neuen Shares zu erhalten.
Die kühne Transaktion wäre vielleicht auch Klaus Kröning mißlungen, wenn ihm nicht die veränderten Verhältnisse dabei zustatten gekommen wären.
Vor zwanzig Jahren hatte das mächtige englische Weltreich die Burenrepubliken in Südafrika besiegt und sich ihr Land als englisches Gebiet einverleibt. Restlos hatten die Buren diesen ersten Krieg verloren. Einen zweiten hatten sie im Weltkriege gewonnen, ohne zu den Waffen zu greifen. Burische Generäle wie Smuts und Herzog, die im ersten Kriege erbittert gegen England gefochten, saßen jetzt in der neuen Regierung. Das mochte noch angehen, denn von jeher war es ja englische Politik, den Gegner von gestern zu versöhnen und zum Freunde von morgen zu machen. Aber die Entwicklung war weit darüber hinaus gegangen. Von Tag zu Tag war das burische Element während des Weltkrieges in Südafrika mächtiger geworden. Eine Konzession nach der anderen wurde ihnen von London gemacht. Als vollkommen gleichberechtigt neben der englischen war die burische Sprache als Statssprak anerkannt worden. In beiden Sprachen mußten alle Behörden und Ämter verhandeln und verkehren.
Nicht mehr Engländer, sondern burische Afrikander waren es, mit denen Klaus bei seinen Transaktionen zu tun hatte. Die suchten Männer, die eine Gewähr dafür gaben, daß sie das verwilderte und menschenleere Land wieder in die Höhe bringen würden. So glückte das Unterfangen. Als Hauptaktionär einer südafrikanischen Landgesellschaft konnte Klaus Kröning die Hand wieder auf seine alten Farmen legen.
Der Tag kam, an dem er wieder in den Hof einritt, von dem er vor fünf Jahren nach Europa gezogen. Herr Schmidt, sein Hauptverwalter, empfing ihn. Den hatten die Engländer vor Jahresfrist aus dem Gefangenenlager entlassen. Mit vieler Mühe und Not war es ihm gelungen, die Reste der Viehbestände zusammenzuholen, die Schwarzen wieder einigermaßen an Arbeit zu gewöhnen.
Schlimm genug sah es immer noch aus. Die Kaffern wußten, daß Schmidt lange Zeit hinter Stacheldraht gefangen saß. Konnten sie noch Respekt vor einem weißen Baas haben, der eingesperrt worden war? Wie eigensinnige, ungezogene Kinder folgerten sie, daß Baas Schmidt allerlei verbrochen haben müsse, denn sonst hätten ihn die anderen weißen Herren doch nicht gefangengesetzt.
Es war ein langer und böser Bericht, den Schmidt an Klaus Kröning in dessen Arbeitszimmer gab. Das Schlimmste daran der Mangel an Autorität.
Klaus klopfte ihm auf die Schulter.
»Kopf hoch, lieber Schmidt! Das werden wir schon kriegen. Der Teufel soll die schwarze Gesellschaft holen, wenn sie nicht Räson annimmt.«
»Sie haben gut reden, Herr Kröning. Von Ihnen wissen die Kaffern nur, daß Sie über das große Wasser fortgefahren sind, ehe der Orlog ins Land kam. Aber die Bande hat gesehen, wie die englischen Soldaten hier auf die Farm kamen und mich gefangen wegbrachten. Das macht einen großen Unterschied.«
Klaus lachte.
»Gewiß, Herr Schmidt, das ist ein Unterschied. Ich gedenke ihn zu benutzen, um die Rotte Korah fest in die Hand zu bekommen.«
Wie ein Lauffeuer hatte sich inzwischen unter den Schwarzen das Gerücht verbreitet, daß der große Baas, der Aubaas, über das große Wasser auf seine Farm zurückgekommen sei. Immer mehr der Schwarzen strömten auf den Hof, schwatzten und schrien. Der Verwalter deutete auf die aufgeregten Gruppen.
»Da sehen Sie, Herr Kröning, wie die Gesellschaft außer Rand und Band ist. So hätten sie sich vor dem Kriege hier auf dem Hofe nie zu benehmen gewagt.«
Klaus schaute ruhig auf das Treiben da vor ihm. Hörte, wie das Wort »Aubaas« immer deutlicher aus dem Lärm emporscholl.
»Lassen Sie, Schmidt! Es sind Kinder, müssen wie Kinder behandelt werden. Und...« Klaus lachte... »an ihrem alten Herrn hängen sie trotz allem doch noch.« Er zog die Uhr. »Verkünden Sie, Herr Schmidt, daß der Aubaas in einer halben Stunde ein Palaver mit seinen Leuten zu halten wünscht.«
Der Verwalter erschrak.
»Um Himmels willen, Herr Kröning, tun Sie das nicht. Wenn Sie sich erst selber mit der Gesellschaft in Verhandlungen einlassen, geht der letzte Rest von Autorität flöten.«
Klaus schüttelte den Kopf.
»... Oder die Autorität kommt wieder, Herr Schmidt. Lassen Sie alles vorbereiten. In einer halben Stunde ist Palaver.«—
Auf dem Farmhofe stand ein großer, bequemer Klubsessel. Ein etwas kleinerer
daneben. Vor dem größeren Sessel ein Tischchen. In weitem Kreise davor etwa
hundert Schwarze. In der Mehrzahl Klippkaffern und Ovambos. Die hockten mit
untergeschlagenen Beinen auf der Erde. Außerdem etwa ein Dutzend Hereros.
Große, ebenmäßige Gestalten mit guter Haltung, die es vorzogen, zu
stehen.
Auf den Glockenschlag genau öffnete sich zur angegebenen Zeit die Tür des Farmhauses. Klaus Kröning trat heraus, den Tropenhelm auf dem Haupt und schritt wie ein König auf den großen Klubsessel zu. Ihm zur Seite ging der Verwalter, das dicke Hauptbuch der Farm unter dem linken Arm.
»Morro, Aubaas! Morro, Aubaas!« scholl's aus dem schwarzen Kreise her, sobald sie ihres Herrn ansichtig wurden. Klaus stand vor dem großen Sessel, überblickte die Runde.
»Morro!« kam der Gegengruß von seinen Lippen. Dann ließ er sich nieder. Der Verwalter legte das Buch vor ihn auf den Tisch und nahm selbst auf dem kleinen Sessel Platz. Ein Geschnatter lief durch die schwarzen Reihen. Der Aubaas ist über das große Wasser zurückgekommen, war das Thema, das sie in hundert Variationen wiederholten.
Klaus hob die Hand und gebot Schweigen. Ruhe trat ein.
»Ja, meine Kinder, ich bin über das große Wasser zurückgekommen. Ich konnte nicht früher kommen, weil ich im Orlog in Europa zu tun hatte. Aber jetzt bin ich wieder bei euch. Ich danke euch, daß ihr meine Herden während des Orlog gut gehütet habt...«
Oje! Das hätte er nicht sagen sollen, dachte Schmidt bei sich. Aus den Reihen der Klippkaffern kam eine Frage.
»Kann der Aubaas über das große Wasser sehen? Woher weiß er, daß wir seine Herden gehütet haben?«
Klaus legte die Hand auf das Hauptbuch.
»Nein, meine Kinder, meine Augen sind schwach geworden. Ich kann nicht mehr über das große Wasser sehen. Aber dafür habe ich das große Buch dagelassen. Das hat alles gesehen. Es hat gesehen, was jeder von euch hier gemacht hat und hat mir alles erzählt.«
»Das große Buch!... Das große Buch erzählt dem Aubaas alles, was wir gemacht haben«, ging es durch die schwarzen Reihen. Klaus winkte Ruhe.
»Viele von euch, haben meine Herden gut gehütet. Aber einige von euch haben sie schlecht gehütet. Das große Buch hat mir erzählt, daß Rinder von meinen Herden an den Wasserplätzen geschlachtet worden sind.«
Wieder Geschnatter im Kreise. Einer der Ovambos sprach.
»Aubaas, das große Buch lügt. Keiner hat deine Rinder an den Wasserlöchern geschlachtet.« Er sprach die Worte mit der überzeugenden Kraft gekränkter Unschuld. Klaus wandte sich in deutscher Sprache an den Verwalter. Der platzte los.
»Gerade den Kerl da habe ich dabei erwischt, wie er eine trächtige Kuh am Riviere schlachtete.«
Klaus schlug das Hauptbuch auf, blätterte, ließ seine Finger über die Zahlen der Ein- und Ausgaben gleiten, tat, als lese er darin und warf dabei einen schnellen Blick auf einen kleinen Zettel mit allerlei Notizen, den er verborgen in der Hand hielt. Jetzt schaute er den Ovambo scharf an.
»Schweig und höre!« donnerte er ihn an, während er eine andere Stelle des Buches aufschlug. »Höre, was das Buch mir hier von schwarzen Hühnern erzählt... von Hühnern, die verschwanden. Nur noch Federn...«
»Ein Schakal hat die Hühner geholt, Aubaas, ein Schakal.«
Klaus schaute angestrengt in das Buch.
»... Nur noch Federn und die abgehackten Köpfe wurden gefunden. He, du Lügner, hacken Schakale den Hühnern die Köpfe ab?«
Der Gescholtene duckte sich unter dem Vorwurf. Das allwissende Buch wurde ihm unheimlich. Klaus ließ die Seiten blätternd durch die Finger gleiten.
»Soll ich euch weitererzählen, was das Buch hier gesehen hat... viel weiße und rote Leinewand ist verschwunden... das Buch sah, wie einer zur Nacht Mehl aus dem Magazin holte... und wie... jemand den Keller aufbrach und meinen Branntwein stahl...«
»Hör auf, Aubaas!... Genug, Aubaas! Verzeih uns, Aubaas!...« Von allen Seiten hier erklangen die Rufe... »Es war Orlog, Aubaas. Wir hatten keine Kraft mehr, Aubaas.«
Nach der Vielseitigkeit der Rufe zu schließen, waren sie alle an den Diebstählen beteiligt, hatten alle ausnahmslos ein schlechtes Gewissen.
»Keine Kraft hattet ihr?«
Bei den Kaffern bedeutet Kraft haben soviel wie fett und wohlgenährt sein. Klaus wandte sich an einen der Schreier, der sich durch Wohlbeleibtheit auszeichnete.
»Du hast doch Kraft. Soll ich dir zeigen, wo deine Kraft steckt? Soll ich sie dir wiederabnehmen?«
Erschrocken fuhr der Schwarze zurück und hielt sich den Leib.
»Aubaas, du wirst mir doch nicht den Bauch aufschneiden?... Das wäre ja grausam.«
Klaus verbiß sich das Lachen.
»Ich brauche dir den Bauch nicht aufzuschneiden, um deine Kraft zu sehen. Aber abtreiben werde ich sie dir, mein Junge.«
Eine kurze Weile dauerte ein allgemeines Geschwätz der Schwarzen an. Klaus erhob sich und sprach mit lauter Stimme.
»Hört, was ich euch jetzt sage. Das, was ihr im Orlog getan habt, das will ich vergessen. Aber jetzt bin ich wieder hier. Wenn ich euch auch nicht sehe, das Buch hier erzählt mir jeden Tag, was jeder von euch tut. Hütet euch, daß es mir nichts Schlechtes erzählt.«
Zufriedenes Schnattern in den Reihen der Schwarzen. Der große Baas wollte vergessen, was sie im Kriege gestohlen und verdorben hatten. Aber es waren Kinder, große schwarze Kinder. Kaum war diese Sorge von ihren Herzen genommen, als sie mit einer Unzahl von Wünschen hervorbrachen, für alles mögliche und unmögliche Bakschisch vom Aubaas begehrten. Klaus schrie dazwischen.
»Ruhe! Haltet die Mäuler!... Einer nach dem anderen!«
Er winkte einen Herero heran, der vor zehn Jahren als Knabe auf die Farm gekommen und bis jetzt hiergeblieben war.
»Warum schreist du? Was willst du?«
»Damals, Aubaas... im ersten Jahr, als ich hier war, da haben wir Bäume vom Riviere geholt und hinter dem Hause gepflanzt...«
Klaus nickte.
»Ich weiß, ihr habt damals Bäume geholt und hier gepflanzt. Nun, und was weiter?«
»Ja, Aubaas, die Bäume sind gewachsen. Jedes Jahr sind sie größer geworden. Immer größer, und...« er schloß in vorwurfsvollem Ton, »und Herr Schmidt hat nicht ›danke‹ zu mir gesagt.«
»Herr Schmidt hat nicht ›danke‹ gesagt... nicht ›danke‹ hat Herr Schmidt gesagt«, kam das Echo aus der Reihe der schwarzen Zuhörer. »Danke sagen« bedeutet Bakschisch geben in ihrer Sprache.
Klaus zwang sich, ernst zu bleiben. Sprach dann.
»Höre mal zu, mein Junge. Als du damals die Bäume holtest, warst du noch klein. Ein ganz kleiner Boy warst du damals. So klein bist du gewesen...«
Klaus deutete mit der Hand an, wie klein der Hererojunge damals gewesen sein mochte.
»So klein ist er gewesen... so klein ist er damals gewesen«, kam das schwarze Echo.
»Und sieh mal, nun bist du auf der Farm geblieben und bist gewachsen. Wie die Bäume hinter dem Hause bist du gewachsen. Jedes Jahr bist du ein Stück größer geworden. So groß bist du jetzt...«
Mit einer Handbewegung zeigte Klaus Kröning die Größe des Herero.
Wie der Chor in der antiken Tragödie begleitete die schwarze Zuhörerschaft den Dialog.
»So groß ist er geworden... wie die Bäume ist er gewachsen... so groß ist er jetzt.«
»Und siehst du, mein Junge, daß du hier all die Jahre hindurch so schön gewachsen bist... das ist das ›Danke‹ von Herrn Schmidt für das Bäumepflanzen.«
»Oje, oje!... Oje, oje!« kam es lachend von der schwarzen Seite. Den hatte der Aubaas gut abgeführt. Der bekam keinen Bakschisch mehr. Mit ganzem Herzen standen sie bei diesem Disput auf der Seite ihres Aubaas. Mit verdutzter Miene trat der Herero in den Kreis zurück. Auch den anderen waren durch diese Abfuhr die besonderen Bakschischwünsche vergangen. Klaus fühlte, daß er seine Leute wieder in der Hand hatte und beschloß, das Eisen zu schmieden, solange es warm war.
Unter anderem hatte ihm der Verwalter auch erzählt, daß die Schwarzen jetzt mit der Verpflegung Schwierigkeiten machten. Seit jeher bekamen sie einen Teil ihres Lohnes in Naturalien. Nach der Anzahl der beschäftigten Köpfe wurden Rinder geschlachtet und jeden Abend die Fleischportionen ausgegeben. Vor dem Kriege war das reibungslos gegangen. Seitdem schien der Teufel in die Schwarzen gefahren zu sein. Plötzlich wollten sie alle Lendenstücke oder alle ein Herz oder eine Leber haben, und die Verwalter konnten es keinem recht machen. Klaus blickte auf die Uhr, ließ sich dann wieder im Sessel nieder.
»Habt ihr sonst noch Wünsche?«
Da brach's von allen Seiten los.
»Ja, Aubaas, ja. Die Verwalter geben uns nicht das richtige Fleisch.«
Klaus schmunzelte.
»So, so. Habt ihr schon mal eine Kuh mit drei Lebern gesehen?«
»Nein, Aubaas, nein.«
»... Oder habt ihr schon mal eine Kuh mit fünf Lenden gesehen?«
»Nein, Aubaas, nein.«
»Na, wie sollen die Verwalter denn dann jeden von euch Leber oder Lendenstück geben?«
»Oje, oje!... Oje, oje!« Sie kratzten sich die wolligen Schädel und schauten sich verdutzt an. Was der Baas da eben gesagt hatte, war zweifellos richtig.
Klaus sprach weiter.
»Ihr wißt, daß wir seit dem Orlog eine neue Regierung haben. Die neue Regierung erlaubt, daß ich euch kein Fleisch, sondern Geld gebe...«
»Oje!... Oje, oje!« Wieder allgemeines Köpfekratzen.
»... Für das Geld könnt ihr euch dann bei den Verwaltern euer Fleisch kaufen. Jeder, soviel er will und was er will... zu den Preisen, die ich festsetzen werde.«
»Oje, oje!« Sie schüttelten die Köpfe zu dem Vorschlag.
»Es wird nicht gehen, Aubaas. Wir werden keine Kraft haben, wenn wir das Fleisch für Geld kaufen müssen.«
Klaus lachte.
»Überlegt's euch bis morgen, ob ihr das Fleisch nehmen wollt, was die Verwalter euch geben, oder ob ihr lieber Geld nehmen wollt.«
»Kein Geld, Aubaas, kein Geld... Fleisch!... Das Fleisch, was die Verwalter uns geben.«
Klaus war zufrieden. Er hatte auf der ganzen Linie gesiegt, und er beschloß, das Palaver mit einem großen Schlußeffekt zu enden.
»Gut, meine Kinder, dann soll's so bleiben, wie es war. Und zur Feier meiner Rückkehr schenke ich euch für heute abend noch einen Extraochsen. Ihr könnt ihn euch selber im Kraal aussuchen. Ihr werdet schon einen finden, der Kraft hat, ohne daß ihr ihm vorher den Bauch aufzuschneiden braucht.«
Ein endloser Lärm begleitete die letzten Worte Klaus Krönings. Sie tanzten und schrien wild durcheinander.
»... der Baas schenkt uns einen Ochsen... einen Ochsen mit viel Kraft schenkt uns der große Baas...«
Klaus erhob sich und ging mit dem Verwalter ins Haus zurück. Das Palaver war zu Ende.
Bis tief in die Nacht hinein dröhnten durch das afrikanische Veldt die monotonen Gesänge, in denen die Schwarzen ihren großen Baas priesen, während sie sich mit Ochsenfleisch bis zum Rande vollstopften.
So bekam Klaus seine schwarzen Arbeiter wieder fest in die Hand. Mit einer fast übermenschlichen Energie widmete er sich während des nächsten Jahres seinen afrikanischen Farmereibetrieben, und bald konnte er konstatieren, daß seiner Arbeit der Erfolg nicht versagt blieb. Doch während er in Südwest mit unverwüstlichem Optimismus seine alten Pläne wieder aufnahm, begann die wirtschaftliche Katastrophe des durch den Krieg zerfleischten und verarmten Europa sich über den ganzen Erdball auszubreiten, ihre Kreise auch bis nach Südafrika zu ziehen. Hier traf sie zuerst den Diamantenmarkt.
Das Londoner Diamantensyndikat war eine gute und nützliche Einrichtung. Zu bestimmten Sätzen nahm es die ganze Diamantengewinnung der Erde auf und brachte davon alljährlich nur so viel auf den Markt, daß die Preise jahraus, jahrein unverändert gehalten wurden. Vor dem Kriege galt dabei der bewährte Erfahrungssatz, daß der Weltmarkt jährlich neue Steine im Gesamtwerte von 250 Millionen Goldmark aufzunehmen vermochte. Was über diesen Betrag hinaus an Steinen gewonnen wurde, stapelte das Syndikat in seinen Panzerschränken auf.
Das Ganze war eine Valorisation größten Maßstabes, wie man sie inzwischen auch auf manchen anderen Gebieten, beispielsweise für die südamerikanische Kaffee-Ernte anzuwenden gelernt hatte. Für den Diamantenmarkt wirkte diese Maßnahme nach jeder Richtung hin vorteilhaft. Alle Juweliere der Welt hatten volles Zutrauen zum Syndikat. Sie wußten, daß es die Preise stabil halten würde, daß der Ankauf von Steinen unter allen Umständen eine sichere Kapitalsanlage für sie war. Deshalb kauften sie jahraus jahrein und wußten auch ihrer Kundschaft die Überzeugung beizubringen, daß ein in Brillanten angelegtes Vermögen niemals verlorengehen könne. So trieb ein Keil den anderen. Der Markt blieb gesund, und das Syndikat brauchte nur wenig Ware zurückzuhalten.
Das war die Lage vor dem Kriege gewesen. Jetzt war das ganz anders geworden. Das verarmte Europa fiel als Käufer fast vollkommen aus. Das wäre zur Not zu verwinden gewesen, da ja andererseits Amerika im Golde schwamm und desto mehr kaufte. Aber etwas anderes trat hinzu. Der Markt wurde plötzlich mit russischen Steinen überschwemmt. Die Bolschewisten in Moskau hatten sich nicht nur die Kronjuwelen angeeignet, sondern auch die unendlichen Edelsteinschätze der Klöster beschlagnahmt. Das waren die einzigen reellen Werte, die sie in der Hand hatten, und die Not zwang sie dazu, sie auf den Markt zu bringen.
Es war eine kritische Lage für das Syndikat. Zwar hielten die Juweliere der ganzen Welt zu ihm. An vielen Türen wurden die Verkäufer der neuen russischen Regierung abgewiesen und bekamen böse Dinge zu hören. Aber das hatte schließlich wieder den Erfolg, daß die Agenten die Steine zu immer niedrigeren Preisen anboten, um überhaupt Geld für ihre notleidende Regierung in die Hände zu bekommen. Wohl oder übel mußte das Syndikat sich entschließen, einen Teil dieser Steine zu übernehmen, um eine Katastrophe auf dem Markte zu vermeiden.
Vieler Monate bedurfte es, bis diese Krise glücklich vorüberging. Dann waren die russischen Steine in die Safes der amerikanischen Milliardäre und Kriegsgewinnler gewandert, und das reguläre Diamantengeschäft begann sich allmählich wieder zu beleben.
Für Klaus waren es unruhevolle Zeiten, die ihn nachdenklich stimmten. Zwar diesmal war eine Katastrophe vermieden worden. Aber würde es immer so ausgehen? Der russischen Überschwemmung hatte man Herr werden können, weil die Menge der plötzlich angebotenen Steine obwohl groß, doch schließlich begrenzt war.
Wie nun, wenn durch irgendeinen Zufall plötzlich neue große Felder erschlossen wurden? Oder wenn es der fortschreitenden Wissenschaft und Technik am Ende sogar gelang, die Steine synthetisch herzustellen? War's nicht vor Jahren schon bei den Edelkorunden, beim Saphir und Rubin geglückt? Hatten die bunten Steine danach nicht einen ungeheuerlichen Preissturz erlitten? Wie nun, wenn es einem Genie gelang, den bisher so spröden Kohlenstoff doch in der Retorte zur Kristallisation zu bringen.
Bisher war's noch nicht gelungen. Aber die Natur selbst zeigte ja, daß es möglich war, daß der Kohlenstoff in die kristallinische Struktur übergehen könne. Gewiß, Diamanten kamen in der Natur nur selten vor. Man hätte daraus vielleicht schließen können, daß die Bedingungen für eine Kristallisation doch sehr eng umrissen seien, Bedingungen, über die man zu alledem noch so gut wie gar nichts wußte.
Aber was wußte man denn überhaupt vom Vorkommen der Diamanten? Man kannte ja nur die oberste Erdschicht, die im Vergleich zum ganzen Erdball noch dünner war als der Reifhauch auf einem Apfel, im Verhältnis zur ganzen Frucht. Wer konnte wissen, ob nicht schon in wenigen Kilometern Tiefe Diamanten in ganz anderen Mengen vorkamen. Vielleicht war die Kristallisation des Kohlenstoffes dort eine alltägliche Erscheinung.
Unter solchen Erwägungen und Überlegungen traf Klaus ein Brief, der aus München kam. An sich nur ein Brief, wie er deren schon so manchen bekommen hatte. Das Angebot eines Chemikers, Diamanten synthetisch herzustellen. Aber diesmal schien ihm die Angelegenheit ernsthafter Natur zu sein. Der Mann, der ihm schrieb, er hieß Ewald Grothe, besaß durch andere Erfindungen, bereits einen guten Namen und hatte sich seit langem theoretisch mit den Möglichkeiten beschäftigt, Kohlenstoff zur Kristallisation zu zwingen.
Im Gegensatz zu den anderen Mitgliedern des Diamanten-Syndikates hielt es Klaus durchaus für möglich, daß es eines Tages gelingen würde, den König der Edelsteine, den Diamanten, auf synthetischem Wege herzustellen. Glückte das aber, dann war's jedenfalls besser, wenn man dadurch nicht überrascht wurde, wenn man von Anfang an die Hände in der Sache hatte und rechtzeitig seine Maßnahmen treffen konnte.—
Am nächsten Morgen fuhr er selbst zur nächsten Poststation und gab ein langes
Telegramm nach München auf. Fünf Wochen später landete Grothe in Swakopmund,
nach wenigen Tagen traf er auf Krönings Hof ein. Und dann saßen sie in jeder
Stunde, die Klaus sich frei machen konnte, in langen Gesprächen zusammen.
Was sein Gast dabei vorbrachte, das klang in der Tat ganz anders als das, was Klaus bisher von Projektenmachern und Phantasten gehört hatte. Grothe war bei seinen Untersuchungen von dem Vorkommen von Diamanten in Meteorsteinen ausgegangen. Er stützte sich auf die Tatsache, daß in zahlreichen von der Wissenschaft genau verbuchten und untersuchten Meteoriten kleine, ganz gut kristallisierte Diamanten vorkommen.
»Wer sagt Ihnen, Herr Grothe, daß diese Diamanten nicht schon von Anfang an in den Meteorsteinen vorhanden waren, sich irgendwo auf einem anderen Stern gebildet haben?«
Der Chemiker legte ihm stark vergrößerte Fotografien der diamanthaltigen Meteore vor.
»Nein, Herr Kröning, aus der ganzen Form und Anlage der Diamanten geht unzweifelhaft hervor, daß sie sich erst während des Fluges der Meteoriten durch den Weltraum gebildet haben. Kohlenstoffhaltige Gase sind dabei entwichen. Beim Entweichen hat sich ein Teil zersetzt, und der freiwerdende Kohlenstoff ist in kristallinische Form übergegangen.«
Klaus schüttelte den Kopf.
»Ich kann mich so schnell nicht in Ihre Theorie hineinfinden.«
Grothe wurde lebhaft.
»Es ist die einzige stichhaltige Theorie, Herr Kröning! Überlegen wir ganz systematisch! Wann geht ein Körper in die Kristallform über? In allen Lehrbüchern lesen Sie, daß er dazu flüssig sein muß. Das spricht sich so leicht aus. Aber... wir können den Kohlenstoff nicht schmelzen trotz allem, was in dieser Hinsicht behauptet worden ist. Wir können ihn auch nicht auflösen, denn es gibt kein Lösungsmittel für den reinen Kohlenstoff. Wie sollen wir ihn also in die flüssige Form bringen, die zu seiner Kristallisation notwendig sein soll?«
»Gestatten Sie, Herr Grothe! Soviel ich weiß, ist flüssiges Eisen ein Lösungsmittel für Kohlenstoff. Auf diesem Wege hat Moissan wenigstens Spuren von Diamanten hergestellt.«
Grothe zuckte die Achseln.
»Haben Sie die Moissanschen Diamanten gesehen, Herr Kröning?«
»Nein, Herr Grothe. Aber...«
»Sie haben davon gelesen, wie die meisten anderen Leute. Gesehen hat diese Diamanten außer Moissan kaum jemand, und ich habe ernsthaften Grund, überhaupt an ihrer Existenz zu zweifeln.«
»Aber Herr Grothe, diese Kristalle Moissans sollen doch Glas geritzt haben,«
Grothe lachte.
»Es ist nicht alles Diamant, was Glas ritzt, Herr Kröning. Es gibt kaum ein Gußeisen, das nicht mit Silizium und ähnlichen Stoffen verunreinigt ist. Nach meiner Meinung wäre es geradezu ein Wunder, wenn Moissan nach dem Auflösen des Eisenkörpers in Salz- oder Salpetersäure nicht allerlei unlösliche harte Rückstände wie Karborund und dergleichen gefunden haben sollte. Nur den Beweis dafür, daß Diamanten unter diesen Rückständen waren, ist er uns schuldig geblieben.«
»Nun, und Sie meinen?...«
»Ich meine, daß sich bei diesem Verfahren keine Diamanten bilden können.«
»Warum, Herr Grothe?«
»Weil die Temperatur viel zu hoch ist. Die Temperatur des flüssigen Gußeisens, aus dem der Franzose seine Diamanten gewonnen haben will, liegt zwischen 1200 und 1400 Grad Celsius. Es gibt ein einfaches Experiment. Ich habe es selber gemacht, obwohl mir die Diamanten nicht so zur Verfügung stehen wie Ihnen. Ich habe Diamanten in eine schützende Hülle gebracht, beispielsweise in eine Atmosphäre aus reinem Argon- oder Neongas und dann bei den verschiedensten Drucken erhitzt. Bei einer Temperatur von mehr als 800 Grad Celsius waren die Steine stets restlos in Graphit verwandelt, jene andere Modifikation des Kohlenstoffes...«
»Und Sie schließen daraus?«
»Ich schließe daraus, daß die Entstehung auch der natürlichen Diamanten unter allen Umständen bei einer tieferen Temperatur als 800 Grad Celsius vor sich gehen muß, weil sich sonst nicht kristallisierter Kohlenstoff, sondern amorpher Graphit bildet.«
»Sie behaupten, Herr Grothe, daß wir den Kohlenstoff weder schmelzen noch lösen können. Ja, zum Teufel, wie wollen Sie ihn denn überhaupt zum Kristallisieren bringen?«
»Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, Herr Kröning. Eine Möglichkeit, auf die die Lehrbücher der Kristallkunde zuwenig Rücksicht nehmen, obwohl man derartige Vorgänge häufig genug beobachten kann.«
»Sie machen mich neugierig. Bitte, schießen Sie los! Was ist das für eine Möglichkeit?«
»Es ist der sogenannte Status nascendi, wie die Chemiker sagen. Es ist der Augenblick, in dem ein Körper aus seiner bisherigen chemischen Verbindung frei wird und... die Sache wird anschaulicher, wenn Sie sich die Atome eines Stoffes einmal für kurze Zeit als lebendige Wesen vorstellen. Es ist der Moment, in dem solch ein Atom seine bisherigen chemischen Bindungen verliert, plötzlich sozusagen allein und hilflos in der weiten Welt dasteht und sich nach irgend etwas anderem umsehen muß, um wieder Betätigung für seine Bindungskraft zu finden. In diesem Moment ist... ich möchte sagen, fast alles möglich. In diesem Augenblicke des Freiwerdens geht, um nur ein Beispiel zu nehmen, der Wasserstoff Verbindungen ein, die er im gewöhnlichen Zustande niemals bilden könnte. In diesem Augenblicke kann sich auch der Kohlenstoff nach der kristallinischen Seite hin orientieren und—ich komme damit zum Kernpunkt meiner Theorie—man muß den Kohlenstoff unter ganz bestimmten Bedingungen aus einer geeigneten Verbindung frei werden lassen, dann wird er im Augenblicke der Freiwerdung Diamantkristalle bilden.«
Klaus Kröning überlegte geraume Zeit, sprach dann langsam, fast zögernd.
»In Ihrer Theorie, Herr Grothe, sind noch zahlreiche unbekannte Größen—geeignete Verbindung—geeignete Verhältnisse. Das kann wenig, aber auch viel bedeuten.«
»Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen meine Theorie weiterentwickle?«
»Bitte sehr, Herr Grothe.«
»Sie kennen zweifellos den Schwefelkohlenstoff, jene Verbindung eines Atoms Kohlenstoff mit zwei Atomen Schwefel, die sich durch ihr außerordentliches Lichtbrechungsvermögen auszeichnet.«
Klaus nickte.
»Ich kenne den Schwefelkohlenstoff. Wir benutzen ihn zum Prüfen unserer Diamanten. Eine wasserhelle Flüssigkeit. Wirft man einen Diamanten hinein, so sieht man nur noch dessen Fehler, da das Lichtbrechungsvermögen eines fehlerfreien Steines fast genau das gleiche ist wie das des Kohlenstoffes.«
»Sehr gut, Herr Kröning! Nun diese Eigenschaft hat von jeher die Aufmerksamkeit aller Diamantenmacher erregt. Sie sagten sich, ich weiß nicht, ob mit oder ohne Grund, daß die Kohlenstoffatome hier schon in ähnlicher Weise angeordnet sein müßten wie im Diamanten. Immer wieder wurde es versucht, unter Anwendung enormer Drucke und unvernünftig hoher Temperaturen aus dem Schwefelkohlenstoff direkt Diamanten zu gewinnen. Nach dem Rezept etwa: Man jage den Schwefel heraus und sorge dafür, daß die Kohlenstoffatome die kristallinische Anordnung beibehalten.«
»Was ist dabei herausgekommen?«
»Natürlich nichts Vernünftiges. Man hat in den Retorten nie etwas anderes gefunden als stark mit Schwefel verunreinigten Graphit.«
»Ein mangelhaftes Ergebnis. Wie wollen Sie es besser machen?«
Grothe erhob sich und holte eine Glasröhre, die mit einem gelblich-bräunlichen Pulver gefüllt war, öffnete die Tube, streute eine Messerspitze ihres Inhaltes auf eine Glasplatte.
»Was soll das?« fragte Klaus.
»Das ist Zyanwasserstoff oder Blausäure. Aber eine Blausäure von ganz besonderer Art. Hier ist das Kohlenstoffatom nicht mit seinen vier Valenzen gebunden, sondern nur mit zweien. Zwei seiner vier Hände behält der Kohlenstoff dabei frei. Die hat er sozusagen unbeschäftigt untereinandergeschlagen und lauert auf eine Gelegenheit, irgend etwas damit anzufangen.«
Grothe entzündete ein Streichholz und brachte es an das Pulver auf der Glasplatte. Im Augenblick huschte eine Flamme darüber hin. Ein Geruch wie von Ammoniak oder Salmiakgeist stieg auf. Feiner Ruß, feinstverteilter Kohlenstoff war auf der Platte, wo eben noch das gelbe Pulver gelegen.
»Das«, fuhr Grothe fort, »ist der Ausgangspunkt für mein Verfahren. Eine der vielen Unbekannten, die Sie an meiner Theorie tadelten, habe ich bereits weggeschafft.«
Neugierig betrachtete Klaus die Tube mit dem Pulver.
»Wo haben Sie den Stoff her? Wie sind Sie darauf gekommen?«
»Eine lange Geschichte, Herr Kröning. Ich will sie Ihnen ein andermal ausführlich erzählen. Einen versteckten Hinweis, daß es diesen Stoff geben müsse, fand ich bei einem französischen Chemiker. Heute kann ich ihn mir in jeder gewünschten Menge herstellen. Er soll das Ausgangsmittel für meine Versuche sein.«
Klaus nickte.
»Einverstanden, Herr Grothe. Setzen wir also diesen modifizierten Zyanwasserstoff einmal als vorhanden voraus. Was wollen Sie weiter damit machen?«
»Ich will ihn unter einen sehr hohen Druck bringen. Unter einen Druck, der vielleicht mehrere 10 000 Atmosphären betragen muß. Dann will ich ihn gerade soweit erwärmen, daß die chemische Reaktion einsetzt, die Verbindung zerfällt. Bei dem richtigen Druck und einer Temperatur, die vielleicht um 400 Grad herum liegt, muß der freiwerdende Kohlenstoff kristallisieren. Es müssen sich Diamanten bilden, Herr Kröning. Diamanten müssen es werden, während Moissan...«
Klaus winkte ab.
»Lassen wir Herrn Moissan. Ich denke, wir wollen selber etwas machen.«
Klaus führte den Chemiker in einen großen, saalartigen Raum, in dem nur ein langer Tisch und ein paar Stühle standen. Er winkte ihm, Platz zu nehmen, und griff zu Block und Bleistift.
»Dieses Zimmer hier soll Ihr Laboratorium werden, Herr Grothe. Nun raus mit der Sprache. Was brauchen Sie alles für Ihre Versuche?«
Eine lange Liste wurde es, die da unter Klaus Krönings Hand auf dem Papier entstand. Hochspannungstransformatoren, elektrische Heizapparate, starke hydraulische Pressen, mancherlei wunderlich geformte Glaskörper. Vieles davon war auf dem Markte nicht vorhanden, mußte nach Zeichnungen, die Grothe seiner schier unerschöpflichen Aktentasche entnahm, erst angefertigt werden.
Als die Liste endlich geschlossen war, warf Grothe einen bänglichen Blick auf Klaus. Würde der wohl wirklich geneigt sein, alle diese teuren Apparate und Einrichtungen zu beschaffen, mit denen der Chemiker den Traum langer Jahre zu verwirklichen hoffte?
Klaus schob ihm die Liste zu und riß ihn aus seinen Zweifeln.
»Schreiben Sie mir hinter die einzelnen Positionen, bei welchen Firmen in Deutschland wir die Sachen am besten bekommen.«
So schnell, wie Klaus es wünschte, ging es nun leider nicht. Grothe mußte selbst noch einmal nach Europa fahren und die Herstellung vieler Dinge nach seinen Zeichnungen an Ort und Stelle überwachen. Aber mit der nächsten Regenzeit kam er nach Krönings Farm zurück, und auf vielen Ochsenkarren kamen mit ihm die Maschinen und Apparate, die er in Deutschland erworben hatte.
Ein Bauen und Hämmern hub in jenem Saale an, der ihm als Laboratorium bestimmt war, und bald sah es hier aus wie in der Hexenküche eines modernen Alchimisten.—
Als Klaus eines Tages in das neue Laboratorium trat, machte sich Grothe an
seinem Glasschrank zu schaffen, wie ihn Chemiker für Versuche mit giftigen
Stoffen zu gebrauchen pflegen. Gas strömte durch eine eigenartige
doppelwandige Röhre. Grothe bewegte ein paar Schalthebel. Ein
Hochspannungstransformator begann zu brummen, die ganze Röhre schimmerte in
blauem Glimmlicht. Wenige Minuten, und die Glaswände begannen sich mit einem
gelblichen Niederschlag zu bedecken.
»So geht das, Herr Kröning. Die Röhre hier ist doppelwandig. Ihr innerer Teil ist mit Wasser gefüllt, außerdem steht sie in einem größeren Wassergefäß. Innen- und Außenwasser sind mit den beiden Polen unseres Hochspannungstransformators verbunden. So wird der schmale Luftspalt zwischen den Glaswänden zu einem Glimmraum.
Sie wissen vielleicht, daß diese stillen blauen Entladungen großen Einfluß auf die molekulare Zusammensetzung von Körpern haben, gewöhnlichen Sauerstoff beispielsweise in Ozon umwandeln. Hier lasse ich gewöhnliche Blausäure—wenn das Zeug nur nicht so niederträchtig giftig wäre—durch den Glimmraum strömen, und den Effekt sehen Sie. Der modifizierte Zyanwasserstoff schlägt sich als fester Körper an den Wänden nieder.«
Grothe zog eine Tischlade auf und wies auf eine Reihe von Phiolen, die bereits mit dem bräunlich-gelblich schimmernden Pulver gefüllt waren.
»Der Vorrat beginnt sich zu häufen, Herr Kröning. Ich denke, in einigen Wochen werde ich mit den Versuchen unter der Presse beginnen können.«
Klaus drückte ihm die Hand.
»Lassen Sie mich es wissen, sobald Sie etwas Neues haben. Glückauf, Herr Grothe.«
Gleich nach Kriegsende hatte Klaus die Ausbeutung des alluvialen Zinnerzes wieder aufgenommen. Tagaus, tagein schüttelten seine Leute das schwarze Erz aus dem Sande des Riviere. Jeden Monat verfrachtete er mehrere Tonnen davon an auswärtige Zinnhütten. Nun schien ihm die Zeit gekommen, die Sache im großen anzupacken.
Das Alluvialerz im Riviere! Viele, viele tausend Tonnen des wertvollen Erzes barg der Flußsand hier. Aber um sie zu gewinnen, mußte man die riesige Fläche des Riviere Kubikfuß für Kubikfuß durch die Siebe schütteln—oder umfangreiche und kostspielige Separationsanlagen errichten.
Von woher mochten die Wasser einst in längst vergangenen Zeiten diese schwarzen Brocken hergetragen und in den Sand gewaschen haben?—Wenn man das wüßte, wenn man diese Stellen ausfindig machen könnte, wo das Erz noch im Muttergestein steckte. Dort würde man sich nicht mit Brocken und Bröckchen abzuplagen haben. Da würde man es blockweise brechen und sprengen können. Ganz anders, viel großartiger, viel nutzbringender würde sich dort die Gewinnung gestalten.
Immer klarer schälte sich für Klaus aus all diesem Sinnen und Grübeln die neue Aufgabe heraus. Die ursprünglichen Vorkommen des Erzes mußte er finden! Nur wenige Anhaltspunkte gab ihm die Natur dafür. Wasser hatte die Brocken hier in den Riviere verschleppt. Wasser floß immer nur von oben nach unten. Also mußten die ursprünglichen Vorkommen höher liegen als der Riviere. Und mit gewaltiger Kraft mußten die Wasser die Brocken verschleppt haben. Ein erhebliches Stück mußten die Erzgänge und Nester höher liegen als das Flußbett hier. In den Bergen mußte er suchen. In den hohen Bergen, die in der Gegend lagen, aus denen der Riviere herkam. Aber viele Berge gab's dort hinten im Nordosten, wo der Fluß seinen Ursprung nahm.
Er versenkte sich in die geologischen Karten der Kolonie. Mit dem Spürsinn und Eifer eines Jägers, der im Begriff steht, sein Wild enger und immer enger einzukreisen, arbeitete er. Der Lauf des Riviere gab ihm die erste Möglichkeit, bestimmte Teile des Gebirges als verdächtig anzusehen. Die geologische Karte zeigte ihm die Zusammensetzung dieser Berge. Nur Granit, Quarz und Schiefer konnten in Betracht kommen. Beträchtliche Teile fielen dadurch aus. Das zu untersuchende Gebiet wurde wesentlich kleiner, aber immer noch war es gewaltig groß, bedeckte viele hundert Quadratkilometer.
Soweit war Klaus mit den vorhandenen Hilfsmitteln gekommen. Er machte sich daran, einen Plan zu zeichnen, der das Gebiet, in dem er das wertvolle Erz vermuten durfte, in großem Maßstabe wiedergab. Marschlängen, Ruhetage—Zeiten für die notwendigen Schürfarbeiten.
Unschlüssig ließ er den Bleistift sinken. Wollte er das ganze Gebiet in dieser Weise durchforschen, er würde nicht Wochen, sondern ungezählte Monate darauf verwenden müssen. Gab es denn keine Möglichkeit, den ursprünglichen Ort der Erze genauer zu ergründen, das mutmaßliche Fundgebiet noch enger zu begrenzen?
Klaus schloß die Augen. Rastlos arbeitete sein Geist. Wie eine Intuition kam's über ihn. Wie hatten sich die geologischen Ereignisse in dem Lande hier abgespielt? Eine Eiszeit war hier niemals gewesen. Wenigstens war sie nicht nachweisbar, waren keine Spuren davon zu entdecken. Nur Eis, nur Wasser und Frost in Gemeinschaft vermochten die kristallinischen Urgesteine, die Granite zu zermürben und zu zerschleifen. Hier aber zeigten die Granitgebirge kaum Spuren einer beginnenden Verwitterung. Das hatte er schon vor Jahren bei seinen Streifzügen durch die Otaviberge öfter als einmal festgestellt. Wasser allein vermochte dem vulkanischen Urgestein wenig anzuhaben.
Er preßte die Hände vor die Augen.
War's nicht am Ende auch ein Fingerzeig, den das Schicksal ihm durch den Diamantenfund gegeben? Die lagen im Quarzsand und stammten doch woanders her. Sollte es hier ebenso sein? Sollten die Zinnerze im Schiefergebirge liegen, von dorther erst in den Quarzsand vertragen worden sein? Die Stunden verrannen, während er sich den Kopf darüber zermarterte. Unmöglich, die Frage hier am Schreibtisch zu entscheiden. Der Versuch, die Expedition selbst konnte allein die Antwort darauf geben.—
In den nächsten Tagen traf Klaus die Vorbereitungen zur Expedition. Er vermied es, seinen weißen Leuten gegenüber ein einziges Wort von seinen Plänen und Absichten fallen zu lassen. Nur Schwarze sollten ihn auf seiner Expedition begleiten. In erster Linie sein alter Boy Abraham, den er seinerzeit von der Eisenbahn mit auf die Farm genommen hatte. Außerdem noch etwa ein Dutzend Klippkaffern, die ihm bei der Jagd auf die Erze nützlich sein konnten. Er suchte sie selbst sorgfältig unter den Schwarzen aus, die am Riviere bei der Separation beschäftigt waren. Die steckten verwundert die Köpfe zusammen.
Der Aubaas wollte weit fort durch das Land reiten. Der Aubaas wollte sie mitnehmen, wollte viele Tage fortbleiben und Springböcke schießen. Sie leckten sich die Lippen bei dem Gedanken an das viele Fleisch, das da für sie abfallen würde. Aber warum befahl der Baas ihnen, ihre Siebschüsseln mitzunehmen? Warum ließ er die Pferde, die den Trupp begleiteten, auch mit Hämmern und Hacken und Schaufeln beladen? Das waren bedenkliche Anzeichen irgendwelcher drohenden Arbeit, geeignet, die allgemeine Fröhlichkeit etwas herunterzustimmen. Aber es blieb ihnen keine Zeit, darüber nachzudenken, noch gar, mit den anderen Schwarzen darüber zu schwätzen. Kaum waren die Packpferde beladen, als Klaus auch schon mit der Kolonne aufbrach und dem Lauf des Riviere nach Nordosten folgte.
Die ersten Tage verflossen ziemlich eintönig. Kurz nach Sonnenaufgang wurde aufgebrochen und bis um die Mittagsstande marschiert. Dann gab's eine mehrstündige Rast und ein auskömmliches Mahl. Dann wieder Marsch und dann ein Nachtlager unter den Randbüschen des Riviere.
Am fünften Tage begann die Landschaft sich zu verändern. Bisher dehnte sich das Flußbett flach in der weiten Ebene der Parklandschaft. überall im Bett der trockene, von Erzbrocken durchsetzte Sand. Bei jeder Rast mußten sie etwa einen Meter tief graben, um das für Mensch und Vieh unentbehrliche Wasser zu bekommen. Jetzt wurde das anders. Das Bett wurde schmäler, die Ufer steiler. Schon standen hier und dort breite Wasserlachen im Riviere. Hügelig wurde die Umgebung, immer näher kamen die Berge, die sie in den ersten Tagen nur in blauer Ferne am Horizont erblickt hatten.
Da hatten die Kaffern wieder Gelegenheit, die Köpfe zusammenzustecken. Ihr Baas hielt sich nicht mehr an die hergebrachte Tagesordnung. Fortwährend hatte er das geheimnisvolle Papier in den Händen, auf dem allerlei rote und schwarze Flecken zu sehen waren. Ganz unvermittelt sprang er hier und da plötzlich vom Pferde und ließ Rast machen, obwohl man erst wenige Stunden unterwegs war. Und dann—das war gar nicht schön vom Aubaas—dann befahl er ihnen, mitten auf der Reise zu arbeiten. Die Schüttelpfannen wurden aus dem Gepäck geholt, und sie bekamen den Auftrag, hier genau so wie auf der Farm Erze aus dem Flußgrund zu holen. Nur eins war gut dabei. Der Baas bewilligte ihnen hier für die gewonnenen Erzmengen den doppelten Lohn als daheim auf der Farm. Da konnte man schönes Geld verdienen—Geld für Tabak und Bier. Eifrig machten sie sich an die Arbeit.
Die Stelle, an der Klaus Kröning haltgemacht und seinen Schwarzen den Befehl zur Arbeit gegeben hatte, war von besonderer Art. Das Hauptflußbett machte hier einen schwachen Knick nach Norden, von Nordosten her stieß ein schmälerer Fluß dazu. Direkt auf der Landzunge zwischen den beiden Strombetten ließ er sein Zelt aufschlagen. Verschwand darin. Voller Neugier versuchten die Kaffern den Boy Abraham auszufragen, was der Baas im Zelte trieb. Erhielten zur Antwort, daß er sich mit dem Zauberpapier unterhielte, schüttelten die Köpfe, machten sich dann wieder eifrig an die Arbeit mit den Schüttelpfannen.
Der Abend kam darüber heran, und die Nacht fiel herein. Die Schwarzen saßen nach der Mahlzeit noch um ein loderndes Feuer. Lebhafter als sonst war heute ihr Geschnatter. Eine Weile beobachtete Klaus sie von seinem Zelt her von weitem. Dann trat er an das Feuer, verteilte etwas Blocktabak unter sie und erfuhr bei der Gelegenheit, worum ihr Disput ging. Die einen hatten mehr Erz gefunden als die anderen.
Klaus lachte.
»Das ist nicht meine Sache. Ihr könnt euch ja die Stellen, an denen ihr graben wollt, selber aussuchen. Die Hauptsache ist, daß ihr ordentlich Erz schafft. Dafür bezahle ich euch.«—
Den Vormittag des nächsten Tages benutzte Klaus zu einem Pirschgang in
Begleitung Abrahams. Mit zwei erlegten Springböcken kamen sie gegen elf Uhr
zum Lager zurück.
Vergeblich suchte Klaus seine Schwarzen an den gewohnten Plätzen. Verlassen lagen die Schürfstellen in dem großen Flußbett. Er mußte um die Landspitze herum und den Nebenfluß ein paar hundert Meter aufwärts gehen, bevor er sie entdeckte. Dort hockten sie in einer weit auseinandergezogenen Linie und arbeiteten mit den Schüttelpfannen, daß es nur so eine Art hatte.
»Nach dem Essen reisen wir weiter, Kinder.«
Mit Widerspruch nahmen sie die Mitteilung auf. »Weiterreisen, Baas?... Jetzt Weiterreisen, wo wir so schönen Sand gefunden haben?...«
»Es hilft nichts, Kinder, wir werden noch besseren finden.«
Mit ein paar Stücken Blocktabak beschwichtigte er sie. Um zwei Uhr mittags ging die Reise weiter. Die Expedition verließ das Hauptbett und folgte dem schmalen Riviere nach Nordosten in die Berge hinein.
Noch öfter als einmal wiederholte Klaus das Experiment, das er hier zum ersten Male gemacht hatte. Wo immer der Weg ihm zweifelhaft wurde, wo Nebenflüsse in das Bett traten, ließ er seine Klippkaffern mit den Schalen arbeiten. Mit untrüglichem Instinkt fanden die stets das Tal oder Rinnsal, in dem die schwarzen Brocken am dichtesten gesät waren.
Am zehnten Tage nach dem Aufbruch befand sich die Expedition mitten in den Bergen. In Bergen, die sich, wie Klaus leicht festzustellen vermochte, fast ausschließlich aus Tonschiefern aufbauten. Aber hier schienen die alten Künste zu versagen. Schon bei den letzten Gabelungen hatten die Schwarzen sich ganz gleichmäßig über die verschiedenen Rinnsale verteilt, sobald es ans Erzgraben ging. Irgendwie und irgendwo mußte das Erz hier in diesen Schieferbergen vorkommen. Daß dem so sein müsse, erkannte Klaus mit visionärer Deutlichkeit. Aber wie diese Stellen finden?
Er ließ Rast machen und unternahm, nur von Abraham begleitet, einen Marsch in die Berge, Hacke und Hammer in der Hand, Auge und Aufmerksamkeit aufs äußerste gespannt.
Da, eine Stelle! Die letzten Spuren eines kümmerlichen Rasens hatten hier aufgehört. Die Schieferschichten traten nackt zutage—und dazwischen?—Schimmerte es da nicht fettig-schwarz-glänzend, ganz so wie die Brocken im Riviere? Mit Hammer und Meißel schlug er die verdächtigen Stücke los, prüfte, untersuchte mit den Mitteln, die er bei der Hand hatte. Kein Zweifel mehr möglich. Das war Zinnerz, von derselben hochwertigen Qualität, wie es bei ihm im Riviere lag.
Ein guter Schritt weiter zum Ziel. Aber das Ziel selbst, wie weit war es dennoch entfernt? Er wußte, Zinnerz kommt in Gängen oder in zerstreuten Nestern vor. War das letztere der Fall, dann brachte ihn der Fund hier immer noch nicht allzuviel weiter. Dann fand sich das kostbare Erz in einem Umkreise von vielleicht ein bis zwei Metern und ringsherum war doch nur taubes Gestein. Das hieß es erst einmal mit Hilfe der Kaffern feststellen.
Klaus blieb am Fundort zurück. Abraham bekam den Auftrag, die ganze Expedition dorthin zu bringen. Dem hatte Klaus nichts weiteres gesagt, ihm aber auch kein Schweigen auferlegt. So kam's, daß die ganze schwarze Gesellschaft schon über den Vorfall unterrichtet war, als sie schwatzend und schnatternd am Fundplatz erschienen.
Der Baas hat die schwarzen Steine im Felsen gefunden!... der Baas hat die schwarzen Steine mit dem Hammer aus den Bergen geschlagen... das war das Thema, das sie auf dem Marsche dorthin in allen nur denkbaren Wiederholungen und Formen abwandelten. Dann standen sie um ihren Baas versammelt und begannen zu begreifen, warum Hämmer und Hacken mitgenommen waren. Der Baas wollte, daß sie die schwarzen Steine aus den Bergen heraushieben.
Das wollten sie wohl tun. Aber der Baas würde ihnen doch hier dasselbe dafür zahlen wie im Riviere. Klaus überlegte. War's ein guter Erzgang, den er hier entdeckt hatte, dann konnte das Geschäft unter Umständen sein Portemonnaie schwer treffen. Aber dann war ja auch der Zweck der Expedition erreicht, der Fund so groß, daß er die Spesen rechtfertigte. War's nur ein Nest, dann fand die Freude ein schnelles Ende—und dann war's vielleicht gut, wenn die Kaffern mit vollem Herzen an der Sache interessiert waren. So bewilligte er die Forderung.
Und dann ging's los. Er mußte dazwischenfahren, damit sie sich in ihrer plötzlichen Arbeitswut nicht gegenseitig verletzten. In Fetzen flog das mürbe Gestein unter den Hieben der Hacken und Picken davon. Schnell sammelten sich die schwarzen Erzklumpen in den mitgebrachten Säcken. Die Stunden des Nachmittags verstrichen darüber. Schon gähnte ein kraterförmiges Loch, etwa zwei Meter breit und ebenso tief an der Schürfstelle, da ließ der Eifer der Schwarzen plötzlich nach. Der dröhnende Lärm der Hacken und Hämmer verstummte, ein Geschnatter hub an. Klaus trat hinzu.
»Was ist's, Kinder, warum arbeitet ihr nicht weiter?«
»Oje!... oje, Aubaas! Keine Steine mehr... keine schwarzen Steine mehr, Aubaas.«
Vielstimmig kam ihm die Antwort. Ein Blick auf die Arbeitsstelle bestätigte ihm die Tatsache. Aus taubem Gestein bestanden die Wände der Höhlung, die die Kaffern hier in den Berg geschlagen hatten.
»Schluß für heute, Kinder. Morgen werden wir weiter suchen.«—
Als Klaus am nächsten Morgen aus seinem Zelt trat, traf er nur seinen Boy an.
Das Lager war leer.
»Wo stecken die anderen, Abraham?«
»Die suchen, Aubaas, die suchen die schwarzen Steine.«
Ein Lächeln lief über die Züge Klaus Krönings. Die Dinge nahmen den Verlauf, den er wünschte. Durch den doppelten Lohn angespornt, hatten sich seine Klippkaffern freiwillig auf die Suche nach neuen, lohnenden Schürfstellen gemacht. Das war viel besser, als wenn er sie erst dazu hätte antreiben müssen.
Freilich, wenn sie nur einzelne Nester fanden, dann kam er auf diese Weise auch nicht viel weiter. Dann würden sie jedes entdeckte Nest restlos ausbeuten wollen. Aber bestand nicht die Möglichkeit, ja die Wahrscheinlichkeit, daß sie bei ihrer Suche auch auf zusammenhängende Erzgänge stießen? Er sah keinen Ausweg. Vorläufig mußte er den Dingen ihren Lauf lassen.
Eine Erinnerung kam ihm in den Sinn. Die Erinnerung an die Schweine, mit denen die französischen Bauern die Trüffeln suchen. Mit untrüglichem Instinkt wittern die Borstentiere die Stellen, an denen die Trüffeln unter der Erde wachsen, brechen den Rasen auf, legen sie bloß. Dann aber muß der Bauer flink hinzuspringen, damit die Schweine die Trüffeln nicht selber fressen. Auch seine Schwarzen sollten nicht jeden Fund, den sie machten, restlos ausbeuten.
Er trug die Lage des ersten von ihm selbst entdeckten Nestes genau in die Karte ein, machte sich dann auf die Suche nach seinen Leuten. Ein paar hundert Meter mußte er gehen, bis er die ersten fand. Nur zwei waren es, die dort zusammenhockten, gemeinschaftlich auf den Schiefer einhieben. Als er bei ihnen ankam, sah er wieder einige hundert Meter entfernt eine andere kleine Gruppe bei der Arbeit. Die Schwarzen hatten sich nach allen Richtungen hin in die Berge verteilt, sich in kleineren Gruppen an den lohnendsten Stellen an die Ausbeute gemacht. Auf dem Wege von dem einen zum anderen Arbeitsplatz fand er das Gestein auch noch an vielen anderen Stellen von dunkelglänzenden Zinnerzstreifen durchsetzt. Aber das alles waren keine Gänge. Das ganze Gebiet war nur reich an Nestern. Die ergiebigsten davon hatten die Schwarzen sich ausgesucht, um möglichst viel Erz zu gewinnen, möglichst viel Geld zu verdienen.
»Wie die borstigen Trüffelsucher!« lachte er vor sich hin, während er zum Lager zurückging... »Eßt euch meinetwegen für heute satt, morgen sollt ihr an anderen Stellen wühlen.«
In Begleitung von Abraham zog er zu Pferde los und durchstreifte das Gebiet, die Karte in der Hand. Er folgte flachen Rinnsalen und Schluchten, brauchte kaum einmal abzusteigen. Das gute scharfe Glas, dessen er sich bediente, gestattete ihm auch vom Sattel aus an vielen, vielen Stellen der dunklen Schieferwandungen das Vorkommen zahlreicher Erznester festzustellen.—
Es war ein langer Ritt von mehreren Meilen, der ihn erst gegen Abend in das
Lager zurückbrachte. In weit ausholendem Bogen hatte er das Gelände
durchzogen, überall das Erzvorkommen festgestellt, die Marschroute in die
Karte eingetragen. Das Gebiet, das sein Weg umschloß, war jedenfalls wert,
belegt und später systematisch ausgebaut zu werden.—
Am nächsten Tage zogen sie weiter. Die Schwarzen murrten, wollten
hierbleiben, für den Baas schwarze Steine suchen.
Aber es ging weiter, von Tag zu Tag immer weiter in die Berge hinein. Hier und da ein Rasttag, an dem er den Kaffern erlaubte, Nester auszunehmen und Erze zu sammeln. Schon hatte Klaus viele Quadratkilometer erzhaltigen Grundes auf seinen Karten eingetragen, schon waren sie vierzehn Tage in den Bergen. Immer schroffer und wilder wurde das Gelände, immer seltener wurden die Nester. Die Kaffern begannen zu murren. Klaus selbst wurde nachdenklich. Stand er nicht am Ende im Begriff, sich wieder von den erzreichen Gebieten zu entfernen?
Das letzte Nachtlager hatten sie in einem ziemlich engen Tal aufgeschlagen. In einer Neigung von 45 Grad stiegen die Wände zu beiden Seiten in die Höhe. Ziemlich genau von Norden nach Süden verlief die Schlucht. Geraume Zeit lagen ihre Wände noch im Schatten, während die Sonne des neuen Tages von Osten her ihre Wanderung begann. Jetzt zur Mittagszeit stand sie fast genau im Norden und beleuchtete die Talwände im schrägen Licht. Klaus suchte die dunklen Schieferflächen mit dem Glase ab. Wenn irgend etwas, so mußte ja gerade diese schräge Beleuchtung geeignet sein, ihm die glasig schimmernden Erze zu verraten, wenn überhaupt welche vorhanden waren.
Dort oben am Hang, fast hundert Meter über ihm, ein paar Stellen, die verdächtig schimmerten. Er schickte sich an, den Hang zu erklimmen. Jetzt hatte er die erste der beobachteten Stellen erreicht. Das bekannte Erz war's, zweifellos das gleiche schwarze Zinnerz, das ihn die Riviere aufwärts und durch die Berge bis hierher begleitet hatte. Aber anders als bisher war die Einlagerung im Schiefergestein hier. Wie eine schmale Ader zog es sich in einem mehrere Meter langen zusammenhängenden Strang zwischen den Schieferschichten hin. Mit Fäustel und Schlägel begann er zu arbeiten. Die Schieferscherben klirrten zu Boden. Zoll für Zoll drang er tiefer in den Berg ein. Fürchtete, daß das Erz jeden Augenblick zu Ende sein könne und sah, daß es weiterlief daß die Schicht sogar stärker wurde.
Da ließ er den Schlägel sinken, wischte sich den Schweiß von der Stirn, schrie in das Tal hinunter, winkte, daß sie ihm nachkommen sollten. Da unten wurde es lebendig wie in einem Ameisenhaufen.
Der Baas hat neue Steine gefunden...! Wir werden viel Geld bekommen!
Sie stürmten den Hang hinauf, machten sich an den Stellen, die Klaus ihnen wies, ans Werk. In ihrer ganzen Breite nahmen sie die Ader dort, wo sie zutage trat, in Angriff, hieben in das verwitterte, weiche Gestein, daß die Brocken nach allen Seiten spritzten. Als die Sonne sich zur Rast neigte, war kein Zweifel mehr möglich. Ein breiter, den Abbau lohnender Erzgang zog sich hier in den Berg hinein.
Während die Schwarzen an dieser Stelle arbeiteten, untersuchte Klaus den Hang an anderen Stellen. An mehr als zwanzig Stellen entdeckte er Adern, die nach allem, was er an der ersten Schürfstelle beobachtet hatte, eine reiche Ausbeute versprachen.—
Drei Tage noch zog die Expedition durch diese Schlucht. Überall boten die
Wände das gleiche Bild, zeigten zahlreiche Adern. Dann brachen die
Erzvorkommen plötzlich wie abgehackt ab. Aber Klaus Kröning war mit dem
Erreichten vollauf zufrieden. Weit über hundert Quadratkilometer erzhaltiger
Felder hatte er in seine Karten eingetragen. Jetzt befahl er die Umkehr. In
Eilmärschen ging's nach Südwesten der Heimat zu.
Dann standen sie wieder auf dem Farmhof. Ein runder Monat war verflossen, seitdem sie ihn verlassen.—
Wieder ging's an ein Planen und überlegen, an ein Wägen und Wagen, das die
volle Kraft Klaus Krönings in Anspruch nahm. Nur kurze Tage war er die
nächsten Monate auf seinen Farmen. Er steckte bald in Lüderitzbucht, Windhuk
oder Swakopmund, bald in Kapstadt oder Johannisburg.
Ein neues Werk stand vor seinem geistigen Auge, viel größer, viel schwerer, aber nach menschlichem Ermessen auch viel gewinnbringender als alles, was er bisher in Afrika geschafft und erreicht hatte. Die Ausbeutung der neuentdeckten Bodenschätze unter Benutzung der besten Methoden und Maschinen schwebte ihm vor. Aber gewaltige Mittel würde dies neue Werk verlangen. Maschinen zur Gewinnung des Erzes in den Bergen. Vorrichtungen, um es in die Ebene zu transportieren. Hüttenanlagen schließlich, in denen man das weißblinkende Zinn aus den schwarzen Steinen erschmelzen konnte. Klaus nahm es auf sich, das alles zu schaffen und zu organisieren.
Klaus trat in Grothes Laboratorium. Der Chemiker stand vor einem Tisch, auf dem mit endlosen Zahlen bedeckte Bogen lagen. Es waren die Protokolle über Hunderte von Versuchen, die er in den letzten Monaten ausgeführt hatte.
»Nun, lieber Freund, ist der Kohinoor fertig?«
Grothe schüttelte den Kopf.
»Ganz so schnell geht es nicht, Herr Kröning. Aber wir sind ein gutes Stück weitergekommen. Haben Sie ein Stündchen Zeit?«
Klaus lachte und ließ sich auf einen Stuhl nieder. »Ihre ›Stündchen‹ kenne ich, Herr Grothe. Es wird wohl ein halber Tag daraus werden.«
Grothe griff eine der schweren stählernen Preßformen, füllte sie mit dem geheimnisvollen Pulver, schob einen elektrischen Heizmantel darüber und stellte das Ganze in die Presse.
Die Ölpumpe begann zu arbeiten, der Zeiger des Manometers hub an, über die Skala zu klettern. Knirschend drang der Chromstahlstempel in die Form hinein, preßte das Pulver darin zu einem massiven Block.
Jetzt war der höchste Druck erreicht, zitternd blieb der Zeiger des Manometers stehen.
»Der Druck ist da, Herr Kröning. Ein Druck von 20 000 Atmosphären...« Grothe schaltete die elektrische Heizung ein. »Jetzt noch die richtige Temperatur und... Sie werden sehen. Bei 400 Grad setzt die Reaktion ein.«—
Minuten verstrichen und ballten sich zu Viertelstunden.—Da plötzlich
ein Ruck in der Presse. Der Zeiger sprang um einige Skalenteile weiter, das
Sicherheitsventil der Presse schleuderte ein paar Tropfen Öl aus. Der
Chemiker schaltete den Heizstrom aus.
»Die Reaktion ist eingetreten. Der Kohlenstoff hat sich frei gemacht... Wir müssen warten, bis die Form sich verkühlt hat.«
Eine halbe Stunde verstrich und noch eine viertel danach. Klaus wurde
ungeduldig.
»Ist's endlich soweit?«
»Wir können es wagen.«
Grothe ließ den Druck von der Presse. Der Stempel ging nach oben. Mit einem Tuch griff er die immer noch heiße Form und zog sie aus der Presse heraus.
Eine Kreissäge heulte auf und zerschnitt kreischend die schwere Stahlwand der Form. In zwei Hälften fiel sie auseinander. Ließ ihren Inhalt erkennen. Eine glasige lavaartige Fläche, noch beizenden Geruch ausstoßend.
Klaus schüttelte den Kopf.
»Na, lieber Grothe, offen gesagt, das Resultat hätte ich mir etwas anders vorgestellt. Das sieht nicht gerade nach Kohinoor und Cullinan aus.«
Der Chemiker gab keine Antwort. Schweigend füllte er eine Quarzschale mit Königswasser und warf die zerschnittene Form hinein, schob das Ganze unter den Abzug des Giftschrankes.
Brodelnd und schäumend stieg die starke Säure in dem Gefäß und stieß schwere, rotbraune Gasschwaden aus. Grothe stand neben dem Schrank. Die Augen dicht an die starke Spiegelscheibe gepreßt, versuchte er zu beobachten, was da drinnen vorging.
Allmählich ließ die Reaktion nach. Nur noch schwach kochte die Flüssigkeit.
Der Zylinder, von der scharfen Säure zerfressen, war in einzelne Brocken
zerfallen.
Schweigend winkte Grothe Klaus zu sich heran, deutete auf die Schale hinter dem Glase.
Klaus kniff die Augen zusammen, um besser zu sehen. Täuschten ihn seine Sinne, oder sah er dort wirklich kleine, wasserhelle Stellen in der zerfallenden Preßmasse. Wie klares Glas schien es in den dunklen Körper eingesprengt zu sein.
Grothe griff die Schale, goß die verbrauchte Säure ab, gab noch einmal frische darauf. Wieder begann es zu wogen und zu qualmen, bis der ganze Schrank mit rostbraunen Schwaden erfüllt war. Der Chemiker ließ den Ventilator gehen, um die giftigen Stickoxyde in die Esse fortzudrücken.—
Noch eine Stunde verstrich, während Klaus vor Ungeduld fieberte. Dann hatte
die Säure ihr Werk vollendet. Unter der Wasserleitung schüttete Grothe den
Inhalt der Schale in ein feines Platinsieb, ließ Wasser darüber laufen, bis
die letzten Spuren der Säure fortgewaschen waren, breitete das, was
übrigblieb, dann auf einer Porzellanplatte aus.
Stumm saßen die beiden sich gegenüber. Erst nach Minuten brach Grothe das Schweigen.
»Nun, Herr Kröning, was meinen Sie?«
Noch immer fand Klaus keine Antwort. Mit einer Pinzette griff er einzelne der kleinen, wasserhellen Steine, die da vor ihm lagen, nahm die Lupe zur Hand, um sie schärfer zu betrachten.
»Nun, was sagen Sie?« kam zum zweiten Male die Frage Grothes.
Klaus schüttelte den Kopf. Noch immer verschlug es ihm die Sprache. Seine Gedanken jagten sich, überstürzten sich. Waren diese gläsernen Brocken da vor ihm wirklich Diamanten... dann...
Stockend kamen die Worte von seinen Lippen.
»Reine Oktaeder sind es, Herr Grothe. Unverkennbar ist die Kristallform. Oktaeder... beinahe Erbsengröße haben die Kristalle. Aber es sind doch... es können doch keine Diamanten sein... unmöglich, Herr Grothe!«
Der deutete auf den Apparatentisch.
»Bitte, Herr Kröning, prüfen Sie selbst. Härte... Lichtbrechungsvermögen... alles, was Sie dafür brauchen, steht dort...«
Die Stunden verstrichen. Raum und Zeit vergaß Klaus, während er diese zauberhaften Splitter prüfte, die Grothe da mit der Säure aus der Preßform herausgeätzt hatte.
Die letzte Probe jetzt noch. Kaum noch nötig nach dem, was er bereits geprüft und gefunden—die Verbrennung einiger dieser Steine in reinem Sauerstoff—das Verbrennungsprodukt reine Kohlensäure. Die letzte Spur eines Zweifels war behoben. Nur reiner, kristallisierter Kohlenstoff, echter Diamant konnte es sein, was hier vor ihm lag.
Er ließ sich in einen Sessel fallen.
»Ziehen wir das Fazit, Herr Grothe. Es ist Ihnen gelungen, den Kohlenstoff zur Kristallisation zu zwingen, aber die Steine sind vorläufig noch klein.«
Grothe strich sich über die Stirn.
»Groß oder klein, Herr Kröning, das ist mir vorläufig ganz nebensächlich. Die Hauptsache für mich ist, daß meine Theorie stimmt...« Er deutete mit der Hand auf die Steinchen. »Da liegt der Beweis dafür, daß sie stimmt. Wir können den Kohlenstoff bei seinem Freiwerden durch hohen Druck und geeignete Temperatur zur Kristallisation zwingen. Das war's, was ich immer behauptete... was ich jetzt bewiesen habe.«
»Ich gebe es unumwunden zu, Herr Grothe, Sie haben den Beweis geliefert. Aber diese synthetischen Steine sind noch recht klein. Glauben Sie, daß Ihnen auch größere gelingen können?«
Grothe nickte.
»Das ist lediglich eine Geldfrage. Bedenken Sie, daß wir diese Steine hier in einer Preßform von wenigen Kubikzentimetern Inhalt hergestellt haben. In größeren Formen mit größerem Rauminhalt werden auch die Kristalle beträchtlich größer werden. Ich kann Ihnen zwar keinen Kohinor oder gar Cullinan in sichere Aussicht stellen. Aber ich glaube, daß wir bei weiteren Versuchen mit entsprechend größeren Pressen und Preßformen in absehbarer Zeit Kristalle von wenigstens einem Karat schaffen werden.«
Klaus überlegte eine Weile. Dann fragte er.
»Sie meinen, daß es mit den jetzigen Mitteln wenig Zweck hat, noch weiter zu experimentieren?«
Grothe schüttelte den Kopf.
»Im Gegenteil, Herr Kröning. Auch mit den jetzigen Mitteln will ich die Versuche fortsetzen. Die Reaktion geht mir jetzt noch zu stürmisch vonstatten. Ich denke an Möglichkeiten, sie zu verlangsamen. Wenn der Kohlenstoff nicht, wie jetzt, in Bruchteilen einer Sekunde frei wird, sondern allmählich im Laufe von Minuten oder Stunden, wäre es nach meiner Meinung recht wohl möglich, daß auch in diesen kleinen Formen viel größere Kristalle wüchsen.
Viel Arbeit wird das noch kosten. Ich sehe endlose Versuchsreihen vor mir. Vielleicht werde ich sogar genötigt sein, von einer ganz anderen Kohlenstoffverbindung auszugehen. Doch daran, daß wir auch dies Ziel erreichen, zweifle ich nicht.«
Klaus erhob sich.
»Gut, Herr Grothe, arbeiten Sie weiter und halten mich auf dem laufenden. Vor allen Dingen: kein Wort an irgend jemand über das, was hier bereits geschaffen wurde. Noch viel weniger über das, was Sie zu erreichen hoffen.«—
Dann saß Klaus allein in seinem Zimmer, und jetzt erst zog er wirklich das
Fazit dessen, was er eben gesehen und erlebt hatte.
Es war also doch möglich, auch den Diamanten synthetisch herzustellen. Was man seit Moissan hundertmal versucht hatte, was bisher niemals gelingen wollte, hier war's geglückt.
Die praktische Bedeutung dieser Erfindung?—Vorläufig war's jedenfalls noch viel billiger und einfacher, die Steine aus dem Wüstensand aufzulesen, als sie mit den umständlichen und kostspieligen Mitteln des Laboratoriums herzustellen.
Aber wenn es morgen oder übermorgen gelang, auch größere Kristalle von Haselnußgröße—von Walnußgröße in der Retorte wachsen zu lassen—was dann?
Schon wenn das, was er hier eben gesehen, bekannt wurde, mußte es eine schwere Erschütterung des Diamantenmarktes, aller Diamantenpapiere zur Folge haben. Seine Gedanken liefen rückwärts zu jenen Jahren, in denen die synthetischen Rubine und Saphire aufkamen. Zuerst erschien auch das nur eine interessante wissenschaftliche Spielerei. Erbsengroße Steinchen mit unkontrollierbaren Einschlüssen und Trübungen, die den Vergleich mit den Natursteinen auch nicht im entferntesten aushalten konnten. Doch während die Juweliere noch die Köpfe schüttelten, glückten den Chemikern schon die nächsten Würfe. Ehe man sich's recht versah, waren große synthetische Steine von reinstem Wasser auf dem Markte, und die Preise der Natursteine stürzten unaufhaltsam.
Klaus zog das Fazit aus der Lage. Vom nächsten Tage an begann er seine Diamantenaktien zu veräußern. Er vermied jede Überstürzung, jede Beunruhigung des Marktes. An den Börsen in Kapstadt und Johannisburg brachten seine Bankiers die Shares in kleinen Posten zum Verkauf.
Monate verstrichen darüber. Als wieder eine Regenzeit in das Veldt kam, besaß Klaus keine Diamantenaktien mehr. In den Banken von Süd-Afrika, England und Amsterdam standen dafür gute Pfunde, Dollars und Gulden auf der Kreditseite seines Kontos.
Dreierlei war erforderlich, um die reichen Bodenschätze zu erschließen: Kapital, Maschinen und Arbeitskräfte. An Kapital fehlte es Klaus nicht. Durch den Verkauf seiner Diamantenshares hatte er Hunderttausende von Pfunden flüssig gemacht.
Arbeitskräfte?... Diese Angelegenheit war vielleicht nicht so ganz einfach. Für seine Farmen bekam er mit Leichtigkeit schwarze Arbeiter, soviel er nur haben wollte. Aber würden sie auch gewillt sein, in die menschenleeren Einöden zu ziehen, in denen gerade die reichsten der von Klaus belegten Zinnfelder lagen?
So wie das Land dort heute aussah, durfte das zum mindesten fraglich sein. Aber Geld und Arbeit können ein Land ja gründlich wandeln. Klaus hatte es zur Genüge erfahren, als er in der Parklandschaft seine Farmen schuf. Auch die Einöde in den Zinnbergen konnte anders werden, wenn dort erst artesische Brunnen sprudelten, wenn das lebenspendende Naß dort eine Vegetation hervorzauberte. Wenn dort Siedlungen entstanden, in denen die Schwarzen mit ihren Familien hausen konnten.
Das alles würde eine spätere Sorge sein. Maschinen waren zuerst notwendig. Maschinen für die Krafterzeugung und Wassererschließung. Bergwerksmaschinen, um das kostbare Erz aus den Felsen zu brechen. Transportanlagen, Seil- und Feldbahnen, um es vom Gewinnungsort zu Tale zu fördern. Am Ausgang des Gebirges schließlich eine vollkommene Hüttenanlage, um die Erze zu brechen, vom tauben Gestein zu separieren, das silberweiße Metall aus ihnen zu schmelzen.
Wo gab's die besten derartigen Maschinen? über die Antwort war Klaus keinen Augenblick im Zweifel. Nur in Deutschland würde er sie finden, dort wollte er sie kaufen. So verließ er das Land, das ihm in langen Jahren eine zweite Heimat geworden war. Im Herbst des Jahres 1922 fuhr er nach Europa zurück. In Hamburg betrat er den deutschen Boden und glaubte in ein Irrenhaus zu kommen. Unablässig war in diesen vier Jahren nach dem großen Kriege der Niederbruch der deutschen Währung weitergegangen und hatte die große Umwertung aller Werte gebracht.
»Sachwerte« hieß die Lösung dieser Zeit. Jeder, der deutsches Papiergeld besaß, versuchte es so schnell wie möglich loszuwerden, irgendwelche Sachwerte dafür einzuhandeln. Mochten, es leere Weinflaschen, Perserteppiche oder Maschinen irgendwelcher Art sein, das blieb sich gleich. Nur das schlechte Geld, das in der Tasche brannte und zerschmolz, schleunigst loszuwerden, war das Bestreben aller.
In einer Scheinblüte keuchte die deutsche Industrie und war nicht imstande, die Aufträge zu bewältigen, die ihr von allen Seiten zuflossen.
Groß waren die Aufträge, die Klaus zu vergeben hatte. Nur freibleibend wollten deutsche Fabriken sie annehmen, sich an keine Lieferzeit binden.
»Ja, wenn Sie Devisen hätten«, sagte man ihm, als er zur persönlichen Verhandlung in den Werken erschien.
»Wenn ich Devisen hätte... was dann?« fragte Klaus.
»Dann könnten wir natürlich sofort feste Lieferungsverträge in Dollars oder Pfunden abschließen und würden Ihre Aufträge allen anderen vorziehen.«
Klaus lachte. Und dann schloß er die neuen Verträge. Der augenblickliche Papiermarkpreis umgerechnet in Pfunde oder Dollars. Bei der Ablieferung der so ermittelte Preis in Devisen zahlbar. Nun griffen die Lieferanten begierig zu, zogen seine Bestellungen allen anderen Aufträgen vor. Schnell kamen die Lieferungen in Fluß, und jeder Dampfer nahm Ladungen für die neue Gesellschaft Klaus Krönings an Bord. Ehe ein halbes Jahr verging, schwammen die letzten Teile für seine Anlage schon auf der Nordsee.—
Klaus benutzte die Pausen, die ihm seine Geschäfte ließen, zu wiederholten
Besuchen bei seinen Eltern in Seehausen. Da sah es nicht zum besten aus. Der
Vater fühlte sich in dieser veränderten, verrückten Welt nicht mehr wohl, in
der man für einen Zentner Kartoffeln hunderttausend Mark bezahlte. Von Tag zu
Tag war er stiller und immer wunderlicher geworden. Stundenlang saß er im
Sonnenschein der warmen Vorfrühlingstage in der Laube und sprach vor sich
hin. Weit zurück in frühere, schönere Zeiten wanderten die Gedanken des
Alten. Zurück in die Jahre, in denen er jung und stark gewesen.
Die Mutter hatte ihre liebe Not, ihn von diesem Grübeln und Sinnieren, bei dem er seine Kräfte verzehrte, abzubringen. Auch ihr wollte die neue Zeit, in der alle Deutschen »Millionäre« waren, nicht in den Kopf hinein. Eine Zeitlang sah sich Klaus das mit an. Dann beschloß er einzugreifen.—
»Höre mal, Mutter!«
»Ja, was ist denn, Klaus?«
»Ihr müßt hier mal 'raus, du und Vater.«
»Was hätte das für einen Zweck? Wo sollten wir noch hingehen?... Noch dazu jetzt, wo alles so entsetzlich teuer ist.«
Klaus verbiß sich ein Lächeln. Seine letzte Reise von Berlin nach München im D-Zug hatte ihn genau achtzig Goldpfennige gekostet. Das nannten die Leute hier teuer.
»Ganz egal, wohin! In andere Länder, unter andere Leute..., sonst werdet ihr mir hier noch tiefsinnig.«—
Es war kein leichtes Stück, aber Klaus hatte schon schwerere Aufgaben
bewältigt. In den nächsten Tagen wurde der Widerstand der beiden Alten
schwächer. Dann saßen sie mit ihm im Zuge, kamen zum erstenmal in ihrem Leben
über die Grenzen der engeren Heimat hinaus.—
Von Basel aus ging die Fahrt durch die Alpen nach Süden. Mit wunderndem
Staunen sahen die Alten, wie die Berge immer gewaltiger, die Schneefirnen
immer mächtiger wurden. Das Bild des deutschen Frühlings bei Göschenen. Dann
Finsternis, durch die der Zug donnernd dahinstürmte. Nach vielen, vielen
Minuten wieder Tageslicht, eine verwandelte Landschaft, der Sommer, die
immergrünen Haine Italiens. Von Airolo aus eilte der Zug der Poebene zu. Nun
standen sie im Hafen von Genua.
Zum erstenmal erblickten die Eltern das ewige Meer. Willenlos ließen sie all das Neue, Gewaltige auf sich einstürmen, als das Schiff den Kurs nach Westen nahm, an Spanien vorbei durch die Straße von Gibraltar in den Atlantik steuerte. Wie ein Traum kam ihnen das alles vor. Wie ein altes, halbvergessenes Bild in verblichenen Farben erschien ihnen das frühere Leben in Seehausen. All die quälenden und peinigenden Gedanken fielen von ihnen ab.
Viele Tage nur Himmel und Meer von allen Seiten. Dann kam der Tag, an dem das Schiff an der Mole von Swakopmund Anker warf. Und dann ging's mit der Bahn landeinwärts. Die Eltern sprachen wenig. Sie staunten immer wieder über das Land—über die Menschen—die vielen schwarzen Menschen, die hier überall herumliefen.
Klaus sah es und freute sich im stillen. Er wußte, diese Reise war ein Gewaltmittel gewesen. Ein Mittel, das vielleicht auch zum üblen hätte ausschlagen können. Aber jetzt sah er von Tag zu Tag deutlicher, daß es half, daß die überwältigende Fülle der neuen Eindrücke wie ein Jungbrunnen auf die Eltern wirkte.
In Rehoboth hielt der Zug. Hier mußten sie die Bahn verlassen. Ein Schwarzer trat an den Zug heran.
»Morro, Aubaas!«
Er wollte Klaus das Handgepäck abnehmen. Stutzte, als er merkte, daß die Alten in dem Abteil zu ihm zu gehören schienen. Klaus redete ihn in dem bekannten Mischmaschdialekt an.
»Morro, Abraham, alte schwarze Seele! Ich habe meine Eltern mitgebracht. Was sagst du jetzt?«
Ein breites Grinsen ging über das Gesicht des Kaffern.
»Um Gottes willen, hör mit dem Grinsen auf. Deine Ohren kriegen ja Besuch von dem Munde. Sei manierlich, Abraham, sei höflich... sage meinen Eltern guten Tag.«
Der Kaffer raffte sich zusammen und brachte eine Bewegung zustande, die ungefähr zwischen Strammstehen und arabischem Salem die Mitte hielt. Versuchte es dann auf deutsch.
Die Alten stutzten, als sie die deutschen Brocken aus schwarzem Munde hörten. Klaus lachte.
»Ja, ja, mein Abraham ist ein perfekter Gentleman, ihr könnt euch stundenlang mit ihm auf deutsch unterhalten.«—
Vor der Bahn stand der Kraftwagen bereit. Schnell war das Gepäck
verladen.
»Los, Abraham, laß den eisernen Ochsen laufen!«
Der Boy saß am Steuer. Schnell und immer schneller stürmte der starke Wagen durch das afrikanische Land auf die große Farm zu.—
»Ist's noch weit, Klaus?« fragte die Mutter.
Klaus deutete auf eine Baumgruppe an einem halbvertrockneten Rinnsal.
»Hier beginnt mein Grund und Boden, Mutter.«
Weiter sauste der Kraftwagen über den harten, ebenen Boden dahin. Viehherden wurden sichtbar, Hunderte von Rindern, vereinzelte Schwarze dabei. Klaus wies in die Richtung.
»Vieh von mir, Mutter.«
Versonnen blickte die alle Frau über die schon leicht vergilbte, endlose Weidefläche hin.
»Vater hatte weniger zu hüten. Ist's noch weit bis zu deinem Haus?«
»Noch etwa vier Meilen... eine halbe Stunde Fahrt, dann sind wir da.«
»Vier Meilen eigenes Land... alles dein Besitz?«
»Nach der anderen Seite, nach Osten über das Haus weg sind's noch mal vier Meilen, Mutter. Nach Norden und Süden sind's mehr.«
Das Haus kam in Sicht, der Wagen fuhr auf dem Hof. Die Schwarzen empfingen die Ankommenden. Eine neue, märchenhafte Welt war's für die Alten, die altgewohnte Stätte langer und harter Arbeit für Klaus. Kaum hatten die Eltern sich auf der Farm ein wenig eingelebt, als er schon wieder zu einer neuen Expedition in die Zinnberge aufbrach.
*
Klaus zügelte sein Pferd und sprang aus dein Sattel. Schroff stiegen zu beiden Seiten des engen Tales die Schieferklippen in die Höhe. Weit hinter ihm war die Karawane der schweren Ochsenwagen zurückgeblieben, die er in achttägiger Reise hierherbrachte.
Das Pferd am Zügel führend, schritt er langsam weiter talaufwärts. Prüfend flogen seine Augen über die wenigen Reste verdorrten Grases, die hie und da den Talboden bedeckten. Jetzt haftete sein Blick an einem Holzpflock, der dort in den Boden geschlagen war. Er selbst hatte ihn damals gesetzt, als er mit seinen Schwarzen hier auf der Jagd nach Erzen fündig wurde. Er erkannte die Stelle wieder. Kein Zweifel mehr, er war am Ziel.
Mit einer Schlinge knüpfte er den Halfter seines Pferdes an den Pflock, reckte die vom langen Ritt steifgewordenen Glieder.
Von der Karawane war noch immer nichts zu sehen. Eine Stunde mochte vielleicht noch vergehen, bis die mit den schwerbeladenen Wagen hier ankamen. Reichlich blieb ihm Zeit, und er beschloß, sie zu nutzen.
Aus einer der Satteltaschen holte er eine hölzerne Rute von Gabelform hervor. Von einem Dornbusch hatte er sie damals geschnitten, als er das erstemal hier war. Würde sie ihm heute bestätigen, was sie ihm damals verraten?
Mit beiden Händen griff er die Gabelzinken. Die Rute waagrecht vor sich haltend, ging er kreuz und quer über den Talgrund. In immer engeren Spiralen umkreiste er den Pflock. Mit halbgeschlossenen Augen schritt er dahin, die Zinken der Gabel elastisch auseinandergespreizt.
Ein leises Zittern ging durch die Rute. Für einen Beobachter konnte es scheinen, als suche eine unsichtbare Gewalt den Stiel der Gabel bald schwächer, bald stärker nach oben zu reißen.
Dicht führte sein Weg den Rutengänger jetzt an dem Holzpflock vorüber. In diesem Augenblick schlug die Rute mit Gewalt nach oben, traf ihn hart vor die Brust, zerbrach splitternd in seinen Händen.
Wie angewurzelt blieb Klaus stehen, stieß eine der abgebrochenen Zinken in den Boden.—
Menschenstimmen rissen ihn aus seinen Sinnen. Die Karawane zog heran. In
weitem Kreise fuhren die Kaffern die Wagen auf, schirrten die Ochsen los,
warfen ihnen Futter vor. Prüfend musterte der deutsche Monteur das Gelände,
trat dann zu Klaus heran.
»Ungünstige Gegend hier, Herr Kröning! Niemand kann garantieren, daß wir hier Wasser finden. Hoffentlich geht's uns nicht so wie neulich in Uis.«
»Was war in Uis?« unterbrach ihn Klaus.
»In Uis haben wir an fünf Stellen gebohrt, haben viel Geld verbohrt. Sind erst mit dem fünften Bohrloch in achtzig Meter Tiefe auf Wasser gestoßen.«
Klaus deutete auf das Stäbchen zu seinen Füßen.
»Setzen Sie hier Ihr Rohr an. Genau an dieser Stelle hier, und bohren Sie, bis Sie auf Wasser stoßen.«
Der Mann wollte sich noch des langen und breiten über die Schwierigkeit der Bohrung ergehen. Klaus schnitt ihm das Wort ab.
»An diesem Punkte wird gebohrt, bis wir auf Wasser stoßen. Was es kostet, bezahle ich.«
Der Monteur zuckte die Achseln.
»Wie Sie wünschen, Herr Kröning. Wir haben dreihundert Meter Rohrlänge mitgebracht.«
»Ich glaube, wir werden nicht den sechsten Teil davon brauchen. Lassen Sie anfangen.«
Klaus stand dabei, als der Bohrturm errichtet wurde. Er wich nicht vom Fleck, während das eiserne Fachwerk hoch und immer höher wuchs. Schweigend beobachtete er es, wie seine Schwarzen unter der Aufsicht der weißen Hilfsmonteure die erste Rohrlänge genau dort auf den Boden stellten, wo die Gabelzinke steckte.
Knirschend drang das starke Mannesmannrohr unter einer schweren Belastung in den Sand ein. Unter ständigem Drehen schraubte es sich tief und immer tiefer, während der Bohrlöffel die Bodenmasse aus dem Rohr herausschaffte. Erst als die Schatten der Dunkelheit durch das Tal krochen, wurde die Arbeit für diesen Tag eingestellt.—
Die Tage verstrichen und summierten sich zu Wochen. In einer Tiefe von
zwanzig Metern war das Rohr auf eine felsharte Tonschicht gestoßen. Der
Bohrlöffel mußte herausgezogen und durch einen Bohrer mit diamantbewehrter
Bohrkrone ersetzt werden.
Keine Spur von Wasser hatte sich bisher gezeigt, über einen Weg von zwei Tagereisen schafften die Ochsen das kostbare Naß heran, das zum Spülen des Bohrloches notwendig war. Immer härter wurde der Ton, ging langsam in Kalkstein über. Schon seit Tagen ließ Klaus in doppelter Schicht arbeiten, aber trotzdem drangen sie in vierundzwanzig Stunden kaum zwei Meter weiter in die Tiefe. Endlich war der vierzigste Meter erreicht.
Die deutschen Monteure wurden immer schweigsamer, zuckten nur die Achseln, wenn Klaus sie zu neuer Arbeit antrieb.
»Ungünstige Gegend hier, Herr Kröning«, nahm der Obermonteur seinen alten Faden wieder auf. »Ich fürchte, wir werden...«
»Wir werden beim fünfundvierzigsten Meter wahrscheinlich Wasser finden«, unterbrach ihn Klaus schroff.
Der schüttelte den Kopf.
»Beim fünfundvierzigsten Meter?... Dreiundvierzig haben wir jetzt, das wäre in vierundzwanzig Stunden spätestens.«
»Spätestens!« wiederholte Klaus dessen letztes Wort.
Ein Summen und Pfeifen ließ sie aufhorchen. Aus dem Bohrrohr kam ein Ton, als ob eine mächtige Orgelpfeife angeblasen würde. Ein tiefes Summen erst... ein Poltern und Sprudeln dann. Eine Staubwolke brach aus dem Rohrmund. Wild tanzte das Bohrgestänge auf und nieder. Brocken flogen empor, in gelblich-lehmigem Schwall ergoß sich's aus der Röhre.
Im Augenblick waren die deutschen Monteure auf ihrem Posten. Das Gestänge mit der Bohrkrone wurde herausgewunden. In breitem Schwall folgte ihm das Wasser. Nicht mehr lehmig jetzt, sondern klar und frisch.
In vierundvierzig Meter Tiefe waren sie bei der ersten Bohrung auf eine starke artesische Quelle gestoßen. Das Lebenselement für die Bergwerksanlagen, die hier entstehen sollten, war sichergestellt.
Überall im regenarmen Südwest war ja die Wasserfrage die wichtigste. Auf seinen Farmen hatte Klaus sie durch die Anlage großer Staubecken gelöst. Dort hinderten starke Dämme das Wasser in den Rivieren am Abströmen, hielten es über die Zeit der Dürre in Form großer künstlicher Seen im Lande zurück.
Wo aber Menschenkunst nicht eingriff, da verschwand das köstliche Element nach der Regenzeit, zog sich tief und immer tiefer unter den trockenen Sand der Flußbetten zurück. Durch primitive Anlagen von Wasserlöchern hatten sich die Eingeborenen geholfen, bevor die Weißen in das Land kamen.
Erst die europäische Technik brachte andere, bessere Mittel. Vielfach stand das Grundwasser in größerer Tiefe unter wasserundurchlässigen Schichten unter einem starken hydraulischen Druck. Glückte es, solche Wasseradern anzubohren, dann sprudelte es mit Gewalt aus dem Brunnenrohr. Aber es war nicht leicht, solche Stellen zu finden. An einem Punkte konnte man hundert Meter tief bohren und blieb doch immer in trockenem Fels, während ein zweites Rohr nur wenig entfernt davon angesetzt, unter Umständen nach dreißig oder vierzig Metern eine reiche Wasserader anschlug.
Alle Wissenschaft der Geologen versagte hier. Nur die geheimnisvolle Fähigkeit der Rutengänger vermochte dieser Schwierigkeiten Herr zu werden. Trotz aller anfänglichen Anfeindungen durch die offizielle Wissenschaft hatte man doch schon während des Hererokrieges deutsche Rutengänger nach Südwest gerufen, und nach ihren Angaben waren an vielen Plätzen ergiebige Brunnen erbohrt worden. Auch Klaus hatte sich damals mit der Rute versucht, hatte gefunden, daß sie in seiner Hand über Wasseradern lebendig wurde. Jetzt hatte diese Kunst ihm geholfen, das flüssige Element für seine neuen Hüttenwerke zu erschließen.
Dem ersten Brunnen folgten schnell andere. Hütten für die schwarzen Arbeiter, Häuser für weiße Bergleute und Hütteningenieure wuchsen aus dem Boden. Tag und Nacht dröhnte in dem stillen Tal, das so lange in unendlicher Einsamkeit gelegen, der Schlag der Hämmer, das Kreischen der Sägen, das Rasseln der Maschinen.
Die Fundamente eines vieltausendpferdigen Kraftwerkes wurden gelegt. Elektrische Leitungen streckten sich vom Talgrunde her über die Berglehnen bis zu den Gipfeln.
Überall an den Hängen fraßen sich die Bohrmaschinen knirschend in die Erzadern ein, schwere Explosionen zerrissen den Leib der zinnhaltigen Berge. Auf Drahtseilbahnen wanderte das geschossene Erz zur Talsohle zu der neuen Brecherei und Separation.
Wie riesenhafte Ungeheuer einer sagenhaften Vorzeit kauerten dort die großen Steinbrecher. In unermüdlichem Spiel gingen ihre stählernen Backen hin und her, zerkauten und zerbrachen mit dumpfem, grimmigem Grollen die schweren Blöcke, lieferten feines Geröll in die Separation. Hier schwemmte strömendes Wasser das leichte, taube Gestein mit sich fort. Übrigblieb schweres, wertvolles Erz, das in Kübeln und Loren zu den Ofenbatterien hinwanderte.
Viele Monate verstrichen, bis alles fertig wurde und in Betrieb kam. Bis die starken Motortraktoren, die tagein, tagaus das Treiböl für das neue Kraftwerk heranbrachten, mit silberweißen Zinnbarren schwer beladen wieder zurückfahren konnten. Monate, in denen Klaus hier ständig in dem neuen Unternehmen steckte, keine Zeit fand, auf seine Farmen zu kommen.—
Endlich nach vielen, vielen Wochen gab's einen freien Sonntag für ihn. Er
benutzte ihn, auf seinem Hof nach dem Rechten zu sehen, die Zeitungen aus
Johannisburg und Kapstadt zu lesen, die sich inzwischen auf seinem
Schreibtisch zu Bergen gestapelt hatten.
Jetzt endlich fand er Gelegenheit, sie zu überfliegen. Was stand dort? Sein Blick stutzte, blieb auf den Überschriften haften...
Neue große Diamantenfunde in dem Grenzgebiet zwischen der Kapkolonie und Transvaal... Diamanten, wo man sie vorher nie gesehen, nie vermutet... die Größe der Funde noch nicht abzusehen... die südafrikanische Regierung gibt das ganze Gebiet für die Ausbeutung frei...
Klaus ließ das Blatt sinken. War auch nur die Hälfte von dem wahr, was er hier gedruckt las, so würde das Syndikat einen schweren Schlag auszuhalten haben. Einen Schlag, den es vielleicht nicht parieren konnte.—
Die nächsten Wochen bestätigten die ersten Alarmnachrichten in vollem Maße.
Neue Siedlungen schossen aus dem Boden. Tausende von Glücksjägern hatten sich
auf den neuentdeckten, diamanthaltigen Grund gestürzt, hatten Claims belegt
und begannen die Felder abzuernten, ohne sich um das Syndikat zu kümmern.
Immer neue Nachrichten, unübersehbar die Größe der märchenhaften Funde.
Die schwere Erschütterung des Marktes, die Klaus in früheren Jahren so oft befürchtet, jetzt war sie da, drohte sich zu einer Panik auszuwachsen. Nicht die synthetischen Künste der Chemiker, sondern dieser plötzliche, allzu reichliche Segen von guten, natürlichen Steinen zerrüttete den Markt. An den Börsen von Johannisburg und Kapstadt folgte ein schwarzer Tag dem anderen. In jähem Sturz gingen alle Diamantenpapiere nach unten und brachten auch andere Werte ins Wanken.
In den Bankbüros der Südafrikanischen Union aber hub ein neues Raunen an... Klaus Kröning, der reiche Kröning... Klaus im Glück, der hat's vorher gewußt. Der hat seine Shares rechtzeitig abgestoßen, sein Vermögen in Sicherheit gebracht...
Gute Freunde suchten ihn auf und steckten ihm, was in den Offices der Broker und Jobber hinter seinem Rücken gesprochen wurde.
Klaus lachte.
»Laßt sie reden. An der Börse geht's noch immer nach dem Satz, daß den letzten die Hunde beißen. Man muß es vermeiden, der letzte zu sein. Das Syndikat wird sich auch eines Tages mit den neuen Feldinhabern einigen und dann... dann werde ich vielleicht wieder Shares kaufen, wenn...«
Die warteten nicht ab, was er etwa noch weiter sagen wollte. Auf schnellsten Wegen eilten sie nach Johannisburg und Kapstadt, um aus dem bloßen Gerücht, daß Klaus wieder kaufen wolle, Geld zu machen. Der blickte ihnen nach, bis die Staubwolken ihrer Wagen am Horizont verschwanden.
Kaufen!?... Wenn die wüßten, was in seinem Hause hier in Retorten und Pressen schimmernd und flimmernd entstand, sie würden sich den Kauf wohl zehnmal überlegen.
Er bestieg den eigenen Wagen und fuhr nach den Bergen, um die Inbetriebsetzung einer neuen Ofenbatterie anzusehen.
Polternd fielen Erze und Zuschläge in die Ofenwannen, brausend spielten die lichtblauen Flammen der Ölbrenner darüber hin. In roter Glut strahlten die Wannen.
Klaus blickte in die ziehenden Flammengase. Auf und nieder wogten die Dampfschleier. Das Bild seiner Zukunft glaubte er darin zu erblicken. Ein langes, arbeitsreiches und gesegnetes Leben hier in diesem schönen Lande, das ihm eine zweite Heimat geworden war.