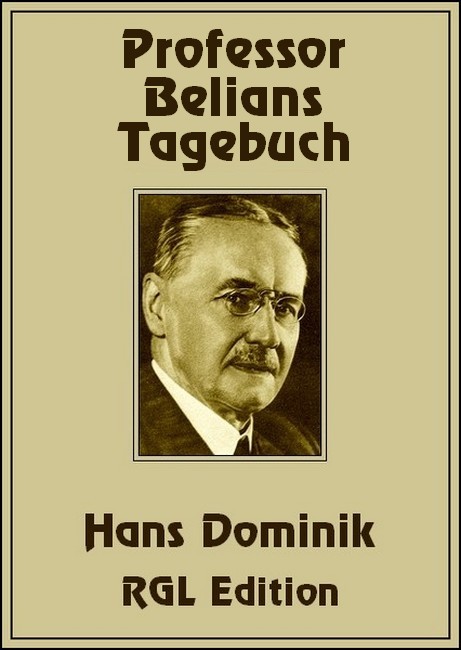
RGL e-Book Cover 2017©
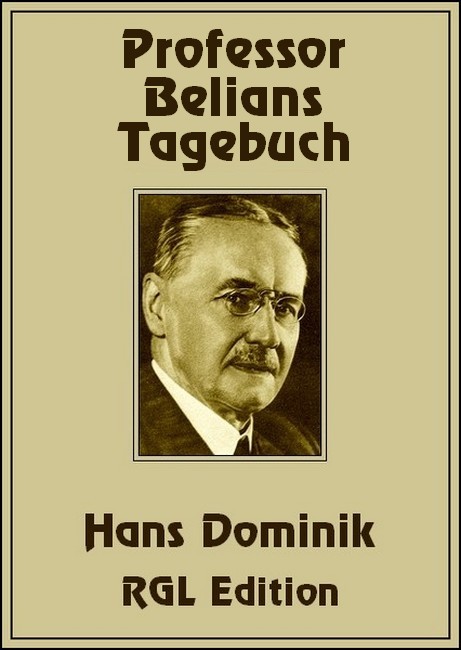
RGL e-Book Cover 2017©
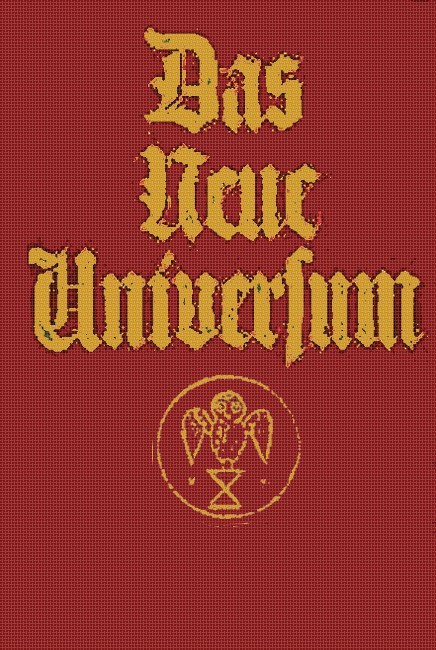
Das Neue Universum, Jahrgang 54, 1933,
mit der Erzählung "Professor Belians Tagebuch"
Durch die endlose Wasserwüste des Pazifiks pflügte sich ein schnittiges kleines Segelboot seinen Weg. Mit halbraumem Achterwind lief es wohl acht Knoten in der Stunde, den Kurs nach Westen gerichtet.
Ein roter Schein brach am Horizont empor und nahm schnell zu. Schon verblaßten die Gestirne am Firmament, und glühend hob sich der Sonnenball aus der stahlblauen Flut. Seine Strahlen spielten um den weißen Bootsrumpf und ließen das Gold der Lettern erglänzen, die am Vordersteven den Namen ›Möwe‹ zeigten. In wenigen Minuten vollzog sich der Übergang von der Nacht zum hellen Tag, zum zwanzigsten Tag dieser Reise.
Der Mann am Steuer der ›Möwe‹ warf einen Blick in Wind und Wetter, dann machte er die Ruderpinne mit einer Seilschlaufe fest und verschwand unter Deck, um seine beiden Kameraden zu wecken.
Es war der Maschinistenmaat Klaus Jensen, der jetzt seine Fahrtgenossen, den stud. techn. Fritz Bergmann und den Jungmatrosen Heinz Gerlach, in einer etwas rauhen Weise aus Morpheus’ Armen riß, wie man poetisch wohl zu sagen pflegt. Klaus Jensen, von der friesischen Wasserkante, war ein Seemann mit Leib und Seele und mit seinen vierundzwanzig Jahren ein Hüne von Gestalt, dem das blühende Leben aus den Augen strahlte. Diese abenteuerliche Fahrt von dem peruanischen Hafen Callao her über fünftausend Kilometer in einem Boot, das in der Unermeßlichkeit des Weltmeers schließlich doch nur eine Nußschale war, hätte er um keinen Preis missen mögen. Mit Wonne war er darauf eingegangen, als ihm Fritz Bergmann in Deutschland vor einem halben Jahr den Vorschlag machte.
Fritz Bergmann, zwanzigjährig, etwas kleiner und schlanker als Klaus, erschien jetzt angekleidet auf Deck.
»Höchste Zeit, Fritz«, rief ihm Klaus zu, »du mußt das Besteck nehmen. Wir müssen erst mal wieder genau wissen, wo wir sind, sonst rutschen wir bei dem guten Wind am Ende noch an deiner Zauberinsel vorüber.«
Fritz Bergmann postierte sich breitbeinig auf dem Verdeck und zielte mit dem Sextanten nach der Sonne. Danach kamen jene fünf Minuten des Tages, während deren die beiden andern immer wieder mit Hochachtung zu ihm aufblickten, die Minuten, während deren er über astronomische Tabellen gebeugt saß und aus der gemessenen Sonnenhöhe den Standort der ›Möwe‹ ermittelte.
Die Rechnung war beendet. Bei hundertzweiundvierzig Grad siebzehn Minuten westlicher Länge und zwanzig Grad dreizehn Minuten südlicher Breite markierte Fritz den Standort des Bootes auf der Seekarte und schrieb das Datum daneben. Dann griff er in die Brusttasche und brachte einen Brief zum Vorschein. Zerknittert war dessen Umschlag und durch Ölflecke und Seewasserspuren unansehnlich geworden. Die Briefmarken auf ihm zeigten, daß er vor sieben Monaten in Kanada zur Post gegeben war. Die Anschrift in etwas flackrigen Zügen, jetzt kaum noch zu lesen, war an Herrn stud. techn. Fritz Bergmann in Hamburg gerichtet. Auf diesen Brief hin hatte Fritz Bergmann vor einem halben Jahr Studium Studium sein lassen, hatte seine Freunde Klaus Jensen und Heinz Gerlach zusammengetrommelt und war mit ihnen auf die weite Reise gegangen, erst mit einem Trampdampfer von Hamburg um das Kap Hoorn herum nach Callao und dann weiter mit der ›Möwe‹, die er billig in Callao erstanden hatte, über den Pazifik.
Fritz Bergmann zog ein Schreiben aus dem Umschlag und breitete es auf der Seekarte aus. Zwei Stellen darin waren mit Rotstift unterstrichen, einmal ein kurzer, fast wie ein Ruf um Hilfe klingender Satz: »Fritz, ich brauche dich«, und dann eine Ortsangabe: »Hundertzweiundvierzig Grad fünfundvierzig Minuten westlicher Länge und zwanzig Grad dreizehn Minuten südlicher Breite.« Er blickte auf diese Zahlen und verglich sie mit seiner letzten Eintragung auf der Seekarte.
»Kurs genau auf West halten!« rief er Heinz zu, der jetzt am Steuer stand. »Herrschaften, die Breite haben wir auf die Minute genau. Achtundzwanzig Seemeilen vor uns im Westen muß die Insel liegen. Jetzt heißt’s aufpassen! In spätestens drei Stunden müßte sie sichtbar werden.«
»Hoffen wir, daß der alte Herr ein richtiges Besteck genommen hat«, brummte Klaus Jensen vor sich hin, »sonst können wir uns hier zwischen den zehntausend Inseln totsuchen!«
Die Stunden verstrichen, während der Rumpf der ›Möwe‹ unter dem Druck der prallen Segel mit unverminderter Geschwindigkeit die See durchschnitt.
»Land voraus!« rief Heinz, der von allen die besten Augen hatte.
»Ich sehe vorläufig erst mal Dunst über der Westkimme«, meinte Klaus, »aber vielleicht kann’s Land werden.«
Und es wurde Land, während sich die Minuten zu Viertelstunden reihten. Erst war es noch ganz fern und blau verschwommen, dann wurde es immer schärfer und deutlicher. Hoch und immer höher hob sich die Silhouette einer Insel über den Horizont. Nun waren schon einzelne Bergspitzen zu unterscheiden, und jetzt konnte man bereits die charakteristischen Umrisse einzelner Palmen wahrnehmen. Dann stand schaumweiß und brüllend eine weitgestreckte Brandung vor ihnen. Die ruhige, glatte Fahrt auf offener See ging zu Ende. Der schwierigste Teil der ganzen Reise, die Landung in diesem gefährlichen Wasser, stand bevor.
Schnell und scharf kamen die Kommandos von Klaus, und ebenso schnell wurden sie von Fritz und Heinz ausgeführt. Schon waren die Segel bis auf den kleinen Treiber am Klüver aus dem Wind genommen und wurden geborgen. Unter dem schwachen Druck des Treibers schob sich die ›Möwe‹ in mäßiger Fahrt näher an die Küste heran. Klaus stand am Ruder und starrte nach vorn.
»Verwünschte Geschichte! Eine Korallenbarre, soweit man sehen kann! Da soll man das Boot heil durchbringen!«
Er spähte nach rechts und nach links, ohne zu finden, was er suchte. Heinz kam ihm zu Hilfe.
»Da drüben nach Steuerbord, Klaus, etwa dreihundert Meter von hier, da sieht’s ruhiger aus.«
Klaus folgte der weisenden Hand mit den Augen und legte die Steuerpinne um. Die ›Möwe‹ bog nach rechts ab und lief parallel zu dem Brandungsstreifen im ruhigen Wasser. Jetzt hatte sie den Punkt erreicht, eine Stelle in dem schaumigen, brüllenden Streifen, kaum zwanzig Meter breit, wo die schwere Brandung eine Lücke zeigte. Fast ohne Fahrt schaukelte das Boot davor im freien Wasser. Klaus tauschte einen Blick mit den Gefährten.
»Tja, dann helpt dat wohl nix«, murmelte er, »vorsichtig is de Modder mit der Porzellankiepe. Uplopen un steckenbliewen dörpen wir hier nich.«
Heinz wurde mit einem Lot neben den Klüverbaum gestellt, und Fritz zog den Treiber weiter aus dem Wind, während Klaus das Boot auf die brandungsfreie Enge hinsteuerte.
»Vier Faden! – Drei Faden! – Zwei Faden!« meldete Heinz beim Loten. »Anderthalb Faden! – Zweieinhalb Faden! – Drei Faden! – Vier Faden!«
Dann war’s geglückt. Die Enge war durchfahren. Langsam trieb die ›Möwe‹ in dem stillen Wasser zwischen der Barre und dem Strand weiter.
»Dat is mal gut gegangen.« Klaus atmete auf.
»Jetzt kommt der zweite Teil der Tragödie«, sagte Fritz, »jetzt heißt’s einen Landungsplatz finden. Der Strand sieht sehr flach aus. Das Segel kann uns nicht mehr viel helfen. Aber wozu hat denn die ›Möwe‹ ihren Hilfsmotor?«
Während Heinz das letzte Stück Leinwand einzog, machte sich Fritz daran, den Motor in Betrieb zu setzen. Unter dem Druck der kleinen Hilfsschraube gewann das Boot von neuem Fahrt und zog in mäßiger Eile zwischen Strand und Barre seine Bahn.
»Es muß einen Fluß auf dieser Insel geben«, sagte Fritz, »und dieser Fluß muß zweifellos irgendwo in die See münden. Wenn wir die Flußmündung entdecken, dann haben wir erstens einen brauchbaren Landungsplatz, und zweitens sind wir auch auf dem besten Weg, meinen Oheim zu finden. Er schrieb mir, daß er seine Kraftanlage mit einer Wasserturbine betreibt.«
»Nimm mir’s nicht übel«, meinte Klaus, »aber ich halte es für eine komplette Kateridee von dem Herrn Professor und Nobelpreisträger Doktor Belian, sich mit seinem ganzen Kram hier auf diese verlorene Insel zurückzuziehen. Wenn’s auch dein Onkel ist, es ist und bleibt – sagen wir, reichlich überspannt.«
Fritz schüttelte den Kopf.
»Du weißt nicht, Klaus, was ihn dazu bewogen hat. Er hat recht schlechte Erfahrungen mit seinen lieben Mitmenschen gemacht. Mir ist bekannt, daß ihm einmal eine wertvolle Entdeckung oder Erfindung – du kannst es nehmen, wie du willst – gestohlen worden ist. Jahrelang war er deswegen verbittert. Dann glückte ihm etwas anderes, was ihm den Nobelpreis für Physik eintrug. Und dann – eine gewisse Großzügigkeit wirst du ihm nicht absprechen können –, dann nahm er diesen Preis und sein eigenes, gar nicht geringes Vermögen, legte den größten Teil davon in Maschinen und Apparaten für die Erforschung eines neuen großen Problems an und ging damit – es ist schon einige Jahre her – in die Einsamkeit, um ungestört und unbestohlen arbeiten zu können.«
»Achtung! Bucht an der Küste!« schrie Heinz vom Vordersteven her. Klaus kniff die Augen zusammen.
»Da scheint Gelegenheit zum Landen zu sein. Wollen’s mal versuchen.«
Klaus brachte die ›Möwe‹ noch näher an den Strand. Hier öffnete sich eine schmale, dreieckige Bucht. Mit gedrosseltem Motor fuhr das Boot in sie hinein, während Heinz wieder loten mußte. Immer enger traten die beiden Ufer zusammen, zunächst noch flach und sandig, dann steiler und von einem üppigen Pflanzenwuchs bedeckt. Nun waren sie noch dreißig, kurz danach kaum zehn Meter voneinander entfernt. Fritz ließ einen Eimer über Bord, zog ihn mit Wasser gefüllt wieder empor und kostete davon. »Süßwasser, Herrschaften! Gut trinkbar! Wir sind auf dem Fluß.« Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr, die er bei der Aufnahme des letzten Bestecks vor einigen Stunden neu auf die Ortszeit der ›Möwe‹ gestellt hatte. »Rund zwölf Uhr mittags! Heinz, schreib in unser Logbuch, daß die ›Möwe‹ um zwölf Uhr mittags die Insel erreicht hat!«
»Die Insel, jawohl! Aber den Herrn Professor haben wir noch nicht«, warf Klaus dazwischen.
»Dafür aber noch sechs Stunden Helligkeit, mein lieber Klaus. Die werden uns hoffentlich reichen, um ihn zu finden.«
Der strahlende Sonnenschein machte einer grüngoldenen Dämmerung Platz, während das Boot seinen Weg flußaufwärts verfolgte. Hoch über ihm vereinigten die Palmen und Tropenbäume von beiden Ufern her ihre Wipfel und bildeten ein Zeltdach, in dessen Schatten es dahinglitt. Doch nicht lange hielt diese Märchenstimmung an. Schon wurde es weiter vorn wieder licht. Der schmale Flußlauf erweiterte sich zu einem kleinen See, und das Rauschen eines Wasserfalls drang herüber. In steilem Sturz fiel das Wasser vom Berghang in die Tiefe zu dem See herab.
»Da! Dort! Da muß es sein!« kam es gleichzeitig von drei Lippenpaaren. Dicht am Ufer erhob sich ein Wohnhaus, in leichtem Bungalowstil aus Bambusrohr und breiten Palmblättern errichtet. Daneben, unmittelbar an dem Wassersturz, stand ein zweites Gebäude. Eine Art Landungssteg war davor in das Wasser gebaut. Die ›Möwe‹ hielt darauf zu. Langsamer lief die Schraube und begann dann rückwärts zu schlagen. Das Boot stand vor dem Steg. Mit einem Satz sprang Heinz vom Vorderdeck an Land und schlug das Tau der ›Möwe‹ um einen Pflock. Die lange Reise war beendet. Ihr Ziel hatten sie erreicht. Würden sie auch den finden, den zu suchen sie ausgezogen waren?
Zu dritt betraten sie das Wohnhaus. Auf einem Ruhelager waren Decken und Kissen noch ungeordnet, als ob es ein Schläfer vor kurzem verlassen hätte. Ein Schreibtisch war mit allerlei Papieren, Zeichnungen und Berechnungen bedeckt, und in einem Schrank hingen verschiedene Kleidungsstücke. Es war außer Zweifel, daß sie sich in der Behausung Professor Belians befanden.
Aber wo steckte der Professor selber und wo sein Assistent Doktor Schaffer, mit dem zusammen er seinerzeit über das große Wasser gefahren war? Sie schritten zu dem andern, höher am Wasserfall gelegenen Gebäude. Es war verschlossen, doch seine Tür leistete einem kräftigen Schulterdruck von Klaus keinen ernsthaften Widerstand. Wie ein breiter Lichtbalken fiel der Schein der schon tiefer stehenden Sonne durch die aufgestoßene Tür in das Innere und spielte über Maschinen und Apparate von eigenartigem Aussehen.
Dort, an einem Ende des großen, saalartigen Raumes, das war auf den ersten Blick zu erkennen, stand eine elektrische Kraftanlage, eine Wasserturbine, die Klaus mit Kennermiene auf fünfhundert Pferdekräfte schätzte. Mit ihr war eine Dynamomaschine gekuppelt. An der Wand daneben befand sich eine große Schalttafel. Schwieriger war schon zu bestimmen, was dann mehr in der Mitte des Raumes zu sehen war.
»Irgendeine ausgefallene Pumpe muß das Ding doch sein«, meinte Fritz.
Klaus nickte. »Stimmt auffallend! Scheint mir eine Gasverflüssigungsanlage zu sein, und zwar eine bessere Sorte. Verstaubt ist der Kram, man kann ja seinen Namen drauf schreiben!«
Von der Pumpenanlage erstreckte sich die Apparatur noch weiter bis an das andere Ende des Saales, aber hier standen die drei Freunde trotz aller Fachkenntnisse vor einem unlösbaren Rätsel.
»Alle Achtung vor dem Glasbläser, der das gemacht hat!« meinte Fritz.
»Wenn ich nur den Schimmer einer Ahnung hätte, was es sein soll!« knurrte Klaus. »Elektromagnetwicklungen in Dewarsche Flaschen eingebaut? Begreife nicht, was sich der Herr Professor Doktor Belian dabei gedacht haben mag. Wenn er da wäre, möcht’ ich ihn wohl danach fragen.«
»Aber er ist ja nicht da!« fiel Fritz ihm ins Wort. »In den Häusern hier steckt er bestimmt nicht, vielleicht irgendwo auf der Insel. Wir werden ihn suchen müssen und wenn wir gezwungen wären, die ganze Insel umzukehren und hinter jeden Baum und Strauch zu kriechen.«
»Aber nicht mehr heute«, sagte Klaus phlegmatisch. »Die Sonne steht dicht am Horizont. In einer halben Stunde haben wir Nacht.«
Sie verließen das Maschinenhaus und kehrten zu ihrem Boot zurück. Heinz machte sich in der Kombüse zu schaffen, in der es bald erfreulich brutzelte und duftete. Fritz stand auf dem Landungssteg und blickte nach dem anderen Ufer, als ihn Klaus plötzlich bei der Schulter packte.
»Sieh da, Fritz! Da, neben dem Wasserfall, da hat sich eben etwas bewegt! Da kommt jemand!«
Fritz kniff die Lider zusammen, um bei der schnell einfallenden Dämmerung besser sehen zu können.
»Ja, du hast recht! Da hat sich etwas bewegt. Ah! Sieh mal! Ah!«
Der Ausruf des Staunens war berechtigt. Dort oben, wo sie jemand zu sehen geglaubt hatten, war ein helles Licht aufgeflammt. In schneller Folge schlossen sich diesem ersten Licht viele andere an. Wie eine beleuchtete Straße zog es sich von dem oberen Wasserfall zu dem Bungalow hin, und nun fiel auch helles Licht aus dessen Fensteröffnungen, während draußen die Nacht niedersank.
»Hm!« sagte Fritz, »hm, hm!«
»Ich will einen Besen verschlucken«, rief Klaus, »wenn das nicht Onkel Belian ist. Der hat da an dem oberen Fall eine Lichtmaschine in Betrieb gesetzt und kommt jetzt mit Festbeleuchtung nach Hause. Na, die Überraschung, wenn er uns hier findet!«
In der Tat konnten sie bald beobachten, wie eine Gestalt den beleuchteten Weg von den Fällen her herabstieg. Immer näher kam der Wanderer. Nun war auch schon zu sehen, daß er eine Art von Ranzen auf dem Rücken hatte und in der Rechten ein Netz trug, an dem er schwer zu schleppen schien. Jetzt überschritt er den Platz vor dem Wohnhaus und verschwand im Gebäude.
»Na also«, triumphierte Klaus, »da ist er ja! Jetzt hin zu ihm!«
In dem Bungalow saß ein alter Mann am Schreibtisch und blätterte in Papieren, während er ab und zu nach einer Schale mit saftigen tropischen Früchten griff. Das Haupthaar, schon mehr weiß als grau, fiel ihm bis auf die Schultern, und auch der volle Bart schien lange Zeit mit keinem Schermesser in Berührung gekommen zu sein. Die Zeit hatte ihre Runen in seine hohe Stirn gezeichnet, unter der ein Paar Augen groß, klar und gütig strahlten. An den Füßen trug er Sandalen eigener Fertigung. Die leichte leinene Tropenkleidung, stellenweise zerfasert, war offensichtlich schon viele Male durch das Waschfaß gegangen.
Die Gedanken des Einsamen wanderten zurück in jene Zeit, da er noch kühne Pläne gehegt hatte, da er ausgezogen war in die Einsamkeit, um hier fern von allem Treiben der Menschen seine Entdeckung auszubauen und der Menschheit damit ein Geschenk von unerhörter Größe zu machen.
Wie anders war es gekommen! Der einzige Mensch, auf dessen Mithilfe er bei seinen Arbeiten angewiesen war, dem er volles Vertrauen geschenkt hatte, der hatte ihn verlassen. Der Mann, auf dessen Treue er gebaut hatte, war fahnenflüchtig geworden. Für unmöglich hätte er es gehalten, bis der böse Tag kam, an dem das Unmögliche Wirklichkeit wurde, wo er allein auf der Insel stand. Verschwunden der Mann, den er so viele Jahre mit Stolz seinen Jünger nannte, verschwunden mit dem Boot, das die einzige Verbindung zwischen dem einsamen Eiland und der übrigen Welt bildete. Von ihm gegangen, heimlich, treulos, ohne ein Wort des Abschieds. Einsam, kaum fähig, ohne Hilfe seine Arbeiten fortzusetzen, hatte der Verlassene die immer gleichen Tage auf dem paradiesischen Eiland kommen und gehen sehen, bis nach Monaten ein Kopradampfer vor der Insel halt machte und ein Boot ausschickte, um sich mit frischem Trinkwasser zu versorgen.
Damals hatte der Alte mit sich gerungen, ob er bleiben oder seine Anlagen im Stich lassen und zu den Menschen zurückkehren solle. Unmöglich, sich von seinem Lebenswerk zu trennen! Doch einen Brief hatte er damals geschrieben und den Männern in dem fremden Boot auf die Seele gebunden, ihn der nächsten Poststation anzuvertrauen. Hatten die es getan? Oder war der Brief verloren, vernichtet worden? Wie viele Monate waren seitdem vergangen? Würde die Hilfe niemals kommen, würde er den Rest seines Lebens hier in der Einsamkeit verbringen müssen? Immer hastiger, immer fiebriger jagten sich seine Gedanken, während er der letzten, schlimmsten Möglichkeit nachsann.
»Onkel Max!«
Der Alte saß regungslos vor dem Tisch, in seine Erinnerungen versunken.
»Onkel Max!«
War eben ein Ruf an sein Ohr gedrungen? Er fuhr empor und starrte um sich. Da, zum dritten Male: »Onkel Max!«
Der Alte richtete sich taumelnd auf. »Wer ruft da?« kam es heiser aus seiner Kehle.
»Ich bin es! Dein Neffe Fritz Bergmann, Onkel Max! Ich habe deinen Brief erhalten und bin hierher gekommen.«
Mit einem Sprung drang Fritz in den Bungalow ein. Er kam eben noch zurecht, um den Alten auffangen und auf sein Lager betten zu können. Dem hatte die ungeheure Überraschung die Sinne benommen. Minuten vergingen, bevor er das volle Bewußtsein wiedererlangte und die frohe Botschaft verstehen und fassen konnte, daß sein Hilferuf das Ziel erreicht habe, daß das schlimme Jahr der Einsamkeit zu Ende sei.
»Du bist hier, Fritz? Du bist wirklich hier und gehst nicht wieder fort?«
»Ich bin hier, Onkel Max, ich bin hier und bleibe hier. Ich bin auch nicht allein hier. Ich habe zwei treue Freunde mitgebracht, und wir werden dir helfen.«
Nur mit Mühe vermochte er schließlich seine Hände aus denen des Alten zu lösen; er lief zum Ufer, um die Freunde zu holen.
Dann saßen sie zu viert am Tisch, und Rede und Gegenrede rissen viele Stunden hindurch nicht ab. Es war schon spät nach Mitternacht, als sie sich endlich zur Ruhe begaben. —
Freude und Hoffnung sind die besten Ärzte. Professor Belian, gestern noch ein müder, gebrochener Mann, schaute mit neugewonnenem Lebensmut in den jungen Morgen. Unter dem schattigen Vorbau des Bungalows stand der Tisch, an dem er seine Gäste und künftigen Helfer bewirtete und ihnen bei Speise und Trank seine Pläne entwickelte. Fritz und seine Freunde wußten kaum, worüber sie mehr staunen sollten, über die hochfliegenden Pläne, die der alte Professor hier mit einer bescheidenen Selbstverständlichkeit vortrug, oder über das auserlesene Mahl, das er ihnen vorsetzte.
Im Licht der Morgensonne zeigte sich jetzt, was alles gestern abend Professor Belian von seiner Streife durch die Insel mitgebracht hatte. Da standen auf dem Tisch frische Austern von einer Größe und Schmackhaftigkeit, daß Klaus Jensen mit Ausdrücken der Hochachtung nicht sparte. Da gab es gebratenes Geflügel, das Fritz den besten Fasanen für ebenbürtig erklärte, wenn er auch die Art zoologisch nicht zu bestimmen vermochte. Da prangte ein Eierkuchen, der Heinz immer wieder zu neuen Angriffen ermutigte, obwohl er nach der Meinung von Klaus längst bis an die Ankerklüsen geladen hatte. Und da waren schließlich saftige Früchte von einem wunderbaren Aroma, die Fritz veranlaßten, Schulerinnerungen auszukramen und einen längeren Vortrag über die Lotosesser des alten Homer zu halten. Mit stillem Lächeln hörte Professor Belian seinen begeisterten Ausführungen zu.
»Du hast recht, mein Junge. Unsere Insel bietet Genüsse kulinarischer Art, daß wohl auch manch anderer hier lange Jahre aushalten könnte. Ich glaube, daß ich meinen Arbeitsplatz nicht schlecht gewählt habe. Wir haben hier alles, was der Mensch sich wünschen kann: ein paradiesisches Klima und beste Nahrung in Hülle und Fülle, weiter eine Wasserkraft, die mich bei meinen Arbeiten von jedem Brennstoff unabhängig macht. Gerade die war, das kann ich wohl sagen, verhältnismäßig schwer zu finden. Lange Zeit habe ich den Archipel durchreist und viele Inseln besucht, bevor ich fand, was ich brauchte. Als ich – manch Jahr ist seitdem vergangen – hier landete und das Wildwasser da in hohem Sturz von den Bergen herunterbrausen sah, da wußte ich, hier, nur hier ist der Ort, an dem ich meine Arbeit vollbringen kann, mein Ziel erreichen werde.«
Professor Belian entwickelte seine Pläne. Es ging um die alte, so viel umkämpfte Frage der Atomenergie. Die Absicht des Professors war, die Bausteine der Materie, die Atome, durch elektromagnetische Kräfte zu zerbrechen. Er wollte sie nach der neuen Lehre der Atomphysik in das Nichts auflösen und für die auf diese Weise aus der Schöpfung verschwindende Stoffmenge die entsprechende riesengroße Energiemenge gewinnen.
Fritz strich sich über die Stirn. »Ein gewaltiges Unterfangen, Onkel Max! Doch, wird es mit unsern schwachen Laboratoriumsmitteln jemals möglich werden, das Problem zu lösen? Ich gebe zu, wir wissen, daß solche Umwandlungen der Materie im Innern aller Sonnen vonstatten gehen. Aber dort haben wir auch eine Temperatur von dreißig bis vierzig Millionen Grad Celsius und Drucke von Milliarden von Atmosphären. Das sind doch Verhältnisse, die der Mensch mit seinen schwachen irdischen Mitteln niemals nachahmen kann.«
Professor Belian nickte. »Mit Hitze und Druck können wir es nicht schaffen, wohl aber mit elektromagnetischen Feldern, und in dieser Richtung laufen meine Arbeiten.«
Fritz schloß kurz die Lider und dachte nach.
»Ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, Onkel Max, daß man ein elektromagnetisches Feld von wenigstens fünf Millionen Gauß erzeugen muß, wenn man den Bau der Atomkerne wirklich zerbrechen will.«
»Ganz richtig, Fritz. Wenigstens fünf Millionen Gauß, vielleicht müssen es auch noch ein paar Millionen mehr sein.«
»Gauß? Was heißt Gauß?« fragte Klaus.
»Der alte Maschinenbauer kennt das physikalische Maß nicht!« rief Fritz lachend. »Merke dir für die Zukunft, Klaus, ein Gauß bedeutet in der Physik genau dasselbe, was eine Kraftlinie je Quadratzentimeter in der Technik ist!«
»Donnerkeil! Fünf Millionen Kraftlinien werden hier gebraucht! Alle Wetter, das gibt’s doch gar nicht! Vierzigtausend sind doch das höchste, was man schaffen kann!« Fritz hatte einen Bogen Papier zu sich herangezogen und begann zu rechnen. Professor Belian folgte kopfnickend den Zahlen, die sein Neffe auf das Papier warf.
»Stimmt, Fritz! Ist ganz richtig! Um ein Magnetfeld von fünf Millionen Gauß zu erzeugen, brauchst du eine Spule, die auf das laufende Zentimeter etwa vier Millionen zweihunderttausend Amperewindungen hat.«
Fritz ließ den Bleistift fallen. »Ja, aber um alles in der Welt, Onkel Max, wie soll man denn eine solche Spule bauen? Das geht doch nicht, das ist doch einfach unmöglich!« Er griff wieder zum Bleistift und rechnete von neuem. »Nimm an, daß du das Quadratmillimeter Kupferquerschnitt mit zwei Ampere belasten kannst, das würde ja eine Spule geben – von dem Raum, den die Drahtisolation einnimmt, will ich mal ganz absehen –, das würde ja eine Spule werden, die zweihundertzehn Meter Wandstärke haben müßte! – um’s Himmelswillen, Onkel Max! – eine Spule, die über vierhundert Meter Durchmesser besäße! Wenn sie irgendwo läge, würde sie ebenso hoch wie die Berge der Insel sein. Undenkbar, Onkel Max! Physikalisch und technisch undenkbar!«
Professor Belian strich sich den schütteren Bart. »Hältst du mich für einen solchen Toren, daß ich etwas Derartiges versuchen würde, Fritz?« fragte er.
»Aber ich sehe keine Möglichkeit, Onkel Max.«
»Das liegt an dir und nicht an der Möglichkeit, Fritz. Du hast die Aufgabe von der falschen Seite angefaßt. Du hast die Rechnung für deine Magnetspule mit gewöhnlichem Kupfer angesetzt, und das war der Fehler. Nimm einmal einen Draht, den du nicht mit zwei, sondern mit zehntausend Ampere je Quadratmillimeter Querschnitt belasten kannst, und rechne aus, wie stark die Drahtwandung der Spule wird!«
»Zehntausend Ampere je Quadratmillimeter? Unmöglich! So etwas gibt es doch in der Welt nicht!« Kopfschüttelnd griff Fritz wieder zum Bleistift. Nach wenigen Sekunden stand das Ergebnis da.
»Zweiundvierzig Millimeter, Onkel Max!«
»Richtig, Fritz! Nehmen wir also noch an, daß wir der Spule einen mittleren Hohlraum von sieben Zentimeter Durchmesser geben, so wird sie alles in allem rund fünfzehn Zentimeter stark, und das ist doch ein Maß, über das sich reden läßt.«
»Gewiß, Onkel Max! Aber welchen Leitungsstoff willst du denn für diese Zauberspule nehmen? Ich bitte dich, woraus willst du diese Spule bauen?«
»Ich will sie nicht erst bauen, Fritz, ich habe sie schon vor Jahren gebaut und viel mir ihr gearbeitet.«
»Aber woraus, Onkel, woraus?«
»Aus Kupfer, lieber Fritz, aus isoliertem Kupferdraht.«
Fritz sperrte Mund und Nase auf. Es dauerte eine Weile, bis er sich wieder gefaßt hatte. »Aus Kupfer, Onkel Max? Aus gewöhnlichem Kupfer, und dann zehntausend Ampere Belastung auf das Quadratmillimeter? Das verstehe, wer kann, ich nicht!«
»Ick ooch nich!« brummte Klaus vor sich hin.
»Tja, meine lieben Freunde«, sagte Professor Belian schmunzelnd, »ihr vergeßt den Temperaturkoeffizienten der Metalle. Ihr rechnet immer mit einem Kupferdraht bei gewöhnlicher Stubentemperatur, und da mag Fritz mit seinen zwei Ampere je Quadratmillimeter recht haben. Aber je kälter ein Metall wird, desto besser leitet es auch. Könnte ich einen Kupferdraht bis auf den absoluten Nullpunkt, also bis auf zweihundertdreiundsiebzig Grad Celsius unter Null abkühlen, so würde auch sein elektrischer Widerstand gleich Null werden. Ich könnte dann durch einen Draht von einem Quadratmillimeter Querschnitt einen unendlich großen Strom schicken...«
»Peng! Knall! Bum!« schrie Klaus und schlug mit der Faust auf den Tisch. »Die Pumpe da drüben, Fritz! Habe ich dir nicht gleich gesagt, daß das nach Luftverflüssigung und Kältetechnik aussieht?«
»So, so! Da drüben seid ihr schon gewesen?« erkundigte sich der Professor mit einem fragenden Blick auf Fritz.
»Ja, Onkel Max, wir haben dich natürlich überall gesucht, nachdem wir hier gelandet waren.«
»Auch gut, Fritz. Aber mit der flüssigen Luft hat Freund Klaus unrecht. Mit flüssiger Luft habe ich angefangen. Ich konnte meine Spule damit bis auf hundertachtzig Grad Kälte herunterkühlen und zweitausend Ampere durch das Quadratmillimeter jagen. Ein ganz schöner Anfangserfolg, aber natürlich nicht annähernd genug. Sobald ich mit der Belastung weiterging, spielte der Kupferdraht nicht mehr mit. Er bekam plötzlich wieder einen höheren Widerstand, erhitzte sich trotz aller Kühlung, und die Sache war zu Ende.«
»Wie schade!« entfuhr es Fritz, »aber trotzdem, zweitausend Ampere auf das Quadratmillimeter! Damit ließ sich doch auch schon allerhand anfangen. Die Spule hätte etwas größer werden müssen. Aber die fünf Millionen Gauß hätten sich immer noch mit erträglichen Abmessungen erreichen lassen.«
»Vielleicht, mein Junge. Aber ich hatte so meine eigenen Ideen. Ich bin eben einfach von der flüssigen Luft zum Wasserstoff übergegangen. Das heißt, ganz so einfach war die Sache nicht.«
»Hm, hm.« Klaus dachte ein Weilchen nach. »Eigentlich, Herr Professor, kommt mir die Sache jetzt aber doch sehr einfach vor. Ich wundere mich, daß nicht schon andere Leute auf die Idee gekommen sind.«
Professor Belian fuhr sich durch den Bart. »Lieber Freund, was in der Theorie sehr einfach ist, kann in der Praxis noch manchen Haken haben. Auch bei uns gibt’s solche Schwierigkeiten. Um so mehr freue ich mich, daß ich jetzt drei tüchtige Helfer habe.«
Er warf einen Blick auf seine Uhr. »Es ist schon nach zwölf. Wir haben den Vormittag verplaudert. Ich schlage vor, daß wir jetzt ordentlich essen, dann zwei Stunden ruhen – die Mittagstunden sind auch hier reichlich warm – und uns danach in die Praxis stürzen.«
Die Posten und Arbeiten waren unter die vier Inselbewohner verteilt. In der elektrischen Zentrale schaltete und waltete Heinz als Elektromaschinist. Wenn die Anlage auch mit vielen automatischen Einrichtungen versehen war, so hatte er doch alle Hände voll zu tun. Das lange Jahr, währenddessen sie stillgelegen hatte, war nicht ohne Spuren an ihr vorübergegangen, und es dauerte einige Zeit, bis alle Teile wieder gut und reibungslos liefen.
Als die elektrische Zentrale klar war, ging man zu der Gasverflüssigungsanlage und fand, daß hier noch wesentlich mehr in Ordnung zu bringen war. Zwei lange Tage gingen ins Land, bevor auch hier wieder alles richtig arbeitete, zwei Tage, an denen Klaus im blauen Kittel am Schraubstock stand, Lager einpaßte, Ventile nachschliff und neue Kolbendichtungen einsetzte, während sich Fritz und Professor Belian als Glasbläser betätigten. —
Endlich arbeiteten alle Maschinen. In der Elektrozentrale stand Heinz. Bei den Gaspumpen waltete Klaus seines Amtes. Mit dem letzten und verwickeltsten Stück der Anlage beschäftigten sich Fritz und der Professor. Von dem großen Dynamo führte die Stromleitung in Form schenkelstarker Kupferbarren hierher und verschwand in einem Meisterstück der Glasbläserkunst. Es war ein zylindrisches, nach Art der Dewarschen Flaschen doppelwandig geblasenes gläsernes Gebilde, durch das der Länge nach eine zylindrische Öffnung ging. Durch die gläsernen Wände konnte man sehen, wie sich die schweren Leitungsbarren in diesem Glasbau verjüngten und schließlich zu millimeterstarken Drähten wurden, die nun Anschluß an die eigentliche Spulenwicklung hatten. Gläserne, ebenfalls doppelwandige Röhren führten von den großen Vorratsflaschen für den flüssigen Wasserstoff hierher. Andere liefen zu den Flaschen zurück.
»Wir müssen die Apparatur erst vorsichtig niederkühlen«, sagte der Professor und gab Klaus ein Zeichen. Ein Ventil wurde geöffnet, und durch die gläserne Leitung strömte der flüssige Wasserstoff hinzu. Jetzt hatte er den großen Glaskörper erreicht und umspülte die kupfernen Teile darin. Blasen brodelten auf wie beim Gießen von Wasser auf eine rotwarme Herdplatte. Gewaltige Mengen gasförmigen Wasserstoffs ließen die Sicherheitsventile des gläsernen Körpers entweichen, während ein Knistern und Knirschen durch die ganze Apparatur ging. Nur sehr allmählich wurde die Gasentwicklung schwächer, nahmen alle metallischen Teile, die in dem Glasgebilde eingeschlossen waren, die Tieftemperatur des verflüssigten Gases an.
Professor Belian beobachtete noch einmal den gläsernen Behälter der Spule. Hier hatte die Bläschenbildung jetzt aufgehört.
»Wir wollen Strom geben.« Er griff zu dem Telefon, das die Verbindung mit der Elektrozentrale herstellte. Langsam kamen seine Kommandos, und langsam steigerte Heinz nach diesen die Stromstärke. Fritz stand neben dem Professor und starrte auf das Amperemeter, dessen Zeiger über die Skala zu klettern begann: tausend Ampere – dreitausend – fünftausend – achttausend Ampere.
Der Professor hatte einen Schreibblock ergriffen und rechnete. »Sechs Millionen Gauß, Fritz. Schon eine Million mehr, als die Theorie zur Auflösung der Atome verlangt. Trotzdem, ich bin erst zufrieden, wenn zehntausend Ampere durch die Spule gehen.«
Wieder liefen Kommandos durch das Telefon zur Maschinenanlage hin, und Heinz ließ die Dynamos noch stärker erregt laufen. Weiter kletterte der Zeiger des Amperemeters: neuntausend Ampere – neuntausendfünfhundert – zehntausend Ampere.
»Stopp!« schrie der Professor ins Telefon. »Stopp mit der Erregung!«
Zitternd blieb der Zeiger bei zehntausend stehen. Professor Belian gab dann den Befehl, die Erregung abzuschalten. Langsam sank der Zeiger des Instruments wieder auf Null.
Der Versuch, den Professor Belian jetzt anzustellen im Begriff war, nahm sich äußerlich recht einfach aus. In den mittleren Hohlraum des gläsernen Spulenkörpers legte er ein dünnes Rohr aus harter, klingender Elementenkohle. Über dessen eines Ende schob er einen Gummischlauch, der zu einer stählernen Flasche mit komprimiertem gasförmigem Wasserstoff führte. Vor das andere, offene Ende stellte er ein Thermometer so, daß dessen Kugel von einem durch das Rohr fließenden Wasserstoffstrom getroffen werden mußte. Das waren die ganzen Vorbereitungen. Und doch handelte es sich um einen grundlegenden Versuch, von dessen gutem Gelingen unendlich viel abhing.
Glücken mußte es ihm, die einzelnen Atome des durch das Rohr fließenden Wasserstoffs durch das ultrastarke magnetische Wechselfeld in das Nichts aufzulösen, war es ihm doch schon vor mehr denn Jahresfrist gelungen, freilich mit einer unzulänglich arbeitenden Apparatur nur schwach und gerade nachweisbar. Viel stärker müßte diesmal die Atomvernichtung gelingen. Aber damit entstand auch eine Gefahr. Verlief die Reaktion zu stark, wurde etwa der gesamte durch das Kohlenrohr geblasene Wasserstoffstrom durch das Wechselfeld vernichtet, so mußten Energiemengen von einer fast unvorstellbaren Größe frei werden. Dann mochte sich wohl die ganze Apparatur im Augenblick in ein einziges Glutmeer verwandeln.
Hier hieß es vorsichtig vorgehen, die einzelnen wirkenden Kräfte des Versuchs aufs feinste bemessen und nur sehr allmählich steigern. Der Professor ließ die Stromstärke der Spule wieder auf fünftausend Ampere bringen und öffnete das Ventil der Stahlflasche. Leise zischend strömte der Wasserstoff durch das Kohlenrohr. Das Thermometer blieb unbewegt.
Siebentausend – neuntausend – zehntausend Ampere. Wie gebannt starrten Fritz und der Professor auf das Thermometer. Die Quecksilbersäule in dessen Rohr begann zu steigen. Tief aufatmend wandte sich der Professor seinem Neffen zu. Fast tonlos kamen die Worte von seinen Lippen: »Die kritische Feldstärke ist erreicht, Fritz. Der Wasserstoffzerfall beginnt.«
Er gab den Befehl in das Telefon, die Stromstärke noch zu steigern, »aber ganz langsam, Heinz, ganz langsam, und sofort wieder runtergehen, wenn ich rufe.«
Der Zeiger des Amperemeters kletterte weiter über die Skala, erreichte die elf tausend Ampere und stieg noch höher.
Knacks, klirr! Das Thermometer war zerbrochen. Die Quecksilbersäule war über die Skala hinaus gestiegen, hatte das ganze Rohr erfüllt und das Thermometer gesprengt. Der Professor brachte die Hand vor das offene Ende des Kohlenrohrs und zog sie mit einem Schrei zurück. Glühend heiß zischte es aus dem Apparat. Auch das Kohlenrohr änderte sein Aussehen. Von der Mitte her begann es rot aufzuglühen. Immer weiter breitete sich die Glut zu seinen Enden hin aus. Jetzt strahlte es schon gelb in der Mitte.
»Strom abstellen!« schrie der Professor ins Telefon und schloß dann mit schnellem Griff das Ventil der Stahlflasche. Langsam, sehr langsam nur nahm die Glut des Kohlenrohrs wieder ab. Mit einem Tuch fuhr sich der Professor über die feuchte Stirn. Aufatmend ließ er sich auf einen Stuhl fallen.
»Der Grundversuch ist gelungen! Der Wasserstoff zerfällt und liefert Energie. Bei«, er warf einen Blick auf seine Notizen, »bei einer Feldstärke von elf Millionen sechshunderttausend Gauß, aber wie viele neue Fragen tauchen in diesem Augenblick schon wieder auf! Die freiwerdende Energie bändigen, richtig abfangen, nutzbar machen – ein Menschenleben wird kaum hinreichen, um alle diese Fragen zu lösen.«
»Onkel Max!« Fritz schlug dem Professor auf die Schulter. »Ich verstehe dich nicht, du hast den schönen, großen Erfolg errungen, und in diesem Augenblick kommen dir neue Zweifel. Das Schwerste ist doch geschafft. Mit dem Rest werden wir auch noch fertig werden.«
Professor Belian hatte sich an einem Tischchen niedergelassen und rechnete. Nun ließ er den Bleistift fallen.
»Ihr habt gut reden. Ihr kennt die Gefahr nicht in ihrer ganzen Größe. Wenn ihr sie auch nur ahntet, das Blut müßte euch in den Adern gefrieren.«
Fritz schüttelte den Kopf. »Aber wieso denn, weshalb denn, Onkel Max?«
»Weil«, der Professor wies auf die Zahlen, die er eben geschrieben hatte, »weil ein einziges Gramm Wasserstoff, das wir hier in unserm Kohlenrohr vernichten, die gleiche Wärmemenge gibt wie zweitausend Tonnen bester Steinkohle bei ihrer vollkommenen Verbrennung. Kannst du dir auch nur annähernd vorstellen, welche ungeheuerlichen katastrophalen, ich möchte sagen vulkanartigen Energieausbrüche hier in dieser kleinen Spule zu erwarten wären, wenn wir auch nur ein Gramm Wasserstoff etwa in einer Sekunde vernichteten?
Du hast die Glut in dem Kohlenrohr gesehen, und dabei haben wir vielleicht nur Millionstel eines Milligramms vernichtet. Größte, allergrößte Vorsicht wird bei den weiteren Versuchen nötig sein. Auf das genaueste werden wir die Feldstärke regeln und in der Hand behalten müssen. Und dabei«, der Professor war aufgesprungen und starrte seinen Neffen wild an, »dabei habe ich das Letzte, das Fürchterlichste, noch gar nicht erwähnt. Nimm an, die Feldstärke überschreitet den kritischen Punkt, bei dem auch der flüssige Wasserstoff zu Bruch geht! Mehrere Kilogramm flüssigen Wasserstoffs befinden sich doch in der kühlenden Umhüllung der Spule im Innern des Feldraums. Es ist nicht auszudenken, nicht auszumalen, was geschehen müßte, wenn diese Mengen bei Überschreitung der kritischen Feldstärke plötzlich zu Bruch gingen.«
Grundlegende Änderungen waren unvermeidlich, wenn man mit einiger Sicherheit für Leib und Leben weiterarbeiten wollte. Der Professor beschloß, diese Arbeiten für einige Tage zu verschieben und sich und seinen Mitarbeitern eine Ausspannung zu gönnen. Schon seit Tagen sah es in ihrer Speisekammer mehr als bedenklich aus. Wieder und immer wieder hatten sie auf die Vorräte der ›Möwe‹ zurückgegriffen. Hier mußte gründlich Wandel geschaffen werden. So beschloß man eine Verproviantierungsexpedition nach der anderen Seite der Insel unter Mitnahme der ›Möwe‹. In die wollte man von den Schätzen, welche die Natur dort bot, hineinpacken, soviel sie zu tragen vermochte. Das mußte dann wieder für längere Zeit ausreichen.
Schon kurz nach Sonnenaufgang kreuzte das Boot unter Ausnutzung der frischen Morgenbrise in dem Wasser zwischen Barre und Ufer und kam gut vorwärts. In wenig mehr als drei Stunden erreichten sie eine geschützte Bucht auf der anderen Seite der Insel und gingen an Land.
Das Jagdglück war ihnen günstig. Professor Belian mit seiner treffsicheren Büchse holte Mengen des verschiedensten Geflügels aus den Wipfeln des Waldrandes herunter. Heinz schleppte das leckerste Obst körbeweise zur ›Möwe‹, während Klaus und Fritz den Strand nach all den wohlschmeckenden Dingen absuchten, welche die See für ihre Tafel liefern konnte. Auch sie brauchten sich über mangelnde Beute nicht zu beklagen. Alle erdenklichen Früchte des Meeres befanden sich zu Mittag in überreicher Fülle an Bord der ›Möwe‹. Es glückte ihnen sogar, mittels selbstgefertigter Angeln verschiedene Fische zu erbeuten, von denen Professor Belian erklärte, daß sie das Delikateste vom Delikaten seien.
Um die Mittagszeit lagerte man sich am Strand im Schatten einer überhängenden Klippe. Heinz und Fritz trugen trockenes Reisig zusammen. Bald loderte ein munteres Feuer empor, an dem Heinz seines Amtes als Koch zu walten begann. Verheißungsvoll zog von dem am Spieß bratenden Geflügel ein leckerer Duft durch die flimmernde warme Luft. In einem Topf kochte ein Fisch, in einem andern entstand eine einladende Fruchtpastete. Ein Stündchen etwa, dann waren die Speisen fertig, und mit Behagen gab sich das vierblättrige Kleeblatt ihrem Genuß hin.
Dann kam jener Zeitpunkt, den Klaus für den schönsten des ganzen Tages hielt, jener Zeitpunkt nämlich, an dem er nach der Mahlzeit seine Pfeife herauszuholen pflegte, von einem Stück wie altes Mahagoniholz aussehenden Blocktabak Späne abschnitzelte, in die Pfeife stopfte und mörderisch zu rauchen begann. Genießerisch fuhr er in seine Tasche.
»I du Dunnerslag! Doar heb ick doch mine Pief un min Tabaksbüdel vergessen! Dat geiht aber nich!«
Fritz und Heinz lachten, und selbst der alte Professor konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Vergeblich, daß Klaus alle möglichen und unmöglichen Stellen seiner Kleidung durchsuchte, Pfeife und Beutel waren nicht da. Zweifellos ruhten sie friedlich im Bungalow auf der andern Seite der Insel, wo Klaus sie zuletzt benutzt hatte. Entschlossen erklärte er, daß er schnell quer über die Insel zum Bungalow laufen und sich seine Pief und seinen Büdel selber holen werde. Höchstens anderthalb Stunden, dann sei er wieder zurück.
Die anderen sahen ihm nach, wie er mit lang ausholenden Schritten auf dem Waldpfad verschwand. Ein wenig Schadenfreude war dabei, und mit doppeltem Behagen genossen sie ihre Siesta auf dem warmen Ufersand.
Eine Weile ging das Gespräch zwischen ihnen noch hin und her, ebbte dann aber mehr und mehr ab. Eine wohlige Müdigkeit überkam sie, der sie sich widerstandslos hingaben. Bald schliefen Fritz und Heinz den Schlaf der Gerechten, und auch Professor Belian leistete sich ein Nickerchen.
Wenn die vier an diesem Morgen, als sie mit der ›Möwe‹ losfuhren, schärfere Ausschau gehalten hätten, so hätten sie fern an der Kimme die beiden Segel eines Schoners erblicken können, und dann hätten sie vielleicht ihre Fahrt für diesen Tag aufgegeben. Vielleicht auch, ja wahrscheinlich sogar wäre dann manches anders gekommen, als es nun kam. Ein unscheinbarer Zufall nur, ein wenig Dunst am Horizont, ein wenig blendender Sonnenglanz auf dem Wasser hatten den aufkommenden Schoner ihren Blicken entzogen. Der kam schnell näher, während die ›Möwe‹ im Binnenwasser nach der anderen Inselseite fuhr.
Es war ein schmuckes, stattliches Schiffchen, die ›Dorothea‹ mit ihren hundert Registertonnen und den beiden vollgetakelten Masten, und vielmals geräumiger und sicherer als die ›Möwe‹, auf der die drei Freunde die weite Fahrt über das Wasser gewagt hatten.
In der großen Kabine der ›Dorothea‹ saßen vier Personen an einem Tisch, die sich durch Hautfarbe und Kleidung recht wesentlich von der farbigen Besatzung unterschieden, zweifellos Angehörige der weißen Rasse. Unverkennbar war der Yankeetyp bei dreien von ihnen, während der vierte wohl ein Europäer sein mochte. In breitem Yankee- Englisch wurde die Unterhaltung zwischen ihnen geführt.
»Ich muß den Vorwurf wiederholen, Herr Doktor, den ich Ihnen in diesem letzten Jahr schon des öftern gemacht habe. Sie sind zu früh fortgegangen! Es war ein Fehler, daß Sie Professor Belian verließen, Herr Doktor Schaffer, ohne im vollen Besitz seiner Kunst zu sein.«
»Ich bitte Sie, Mister Jefferson! Ich stehe immer noch vor einem vollkommenen Rätsel. Als ich damals fortging, mußte ich glauben, alle seine Künste zu kennen.«
Mister Jefferson strich mit der Hand über den Tisch, als ob er etwas wegwischen wollte. »Schluß damit, Doktor! Geschehene Dinge sind nicht zu ändern. Irgendwie hat Sie der Alte hereingelegt. Irgendwie müssen wir’s jetzt wieder gutmachen. Wird aber leider, fürchte ich, nach Ihrer Desertion recht schwierig sein. Sicher ist, Sie dürfen dem Alten vorläufig nicht unter die Augen kommen. Erst müssen Stokes und Belgrave mal ihr Glück versuchen.«
Mister Stokes zuckte die Achseln, und Mister Belgrave schüttelte den Kopf.
»Äußerst schwierige Sache, Mister Jefferson! Der Alte ist sehr mißtrauisch. Wird sich schwer hüten, uns in seine Karten gucken zu lassen, wenn er sogar vor seinem eigenen Assistenten Geheimnisse hat.«
Jefferson hieb mit der Faust auf den Tisch. »Mir einerlei! Geschafft muß es werden, sei es im Guten, sei es im Bösen. Und wenn ich dem alten Gauner Daumenschrauben ansetzen soll, hinter seine Künste müssen wir kommen.«
Auf dem Weg zu seiner geliebten Pief hatte Klaus den Wald durchschritten und wandte sich jetzt dem Bergpfad zu, der den Wassersturz entlang zu dem kleinen See führte, an dem Bungalow und Maschinenhaus lagen. Er war von dem eiligen Lauf durch den Wald einigermaßen außer Atem gekommen, und notgedrungen verlangsamte er jetzt seinen Marsch auf dem engen, steil ansteigenden Pfad. Der Weg war doch länger und anstrengender, als er ihn sich in seinem Tabakshunger vorgestellt hatte.
Unvermittelt, ganz plötzlich traf ihn ein schwerer Schlag gegen die Schläfe. Er taumelte. Es wurde ihm dunkel vor den Augen. Er sank in die Knie und fühlte noch, ehe ihm die Sinne schwanden, daß viele Hände nach ihm griffen. —
Die Sonne war schon stark nach Westen gerückt, als Professor Belian aus seinem Schlummer auffuhr und einen Blick auf die Uhr warf. Mit einigen Stößen ermunterte er Fritz und Heinz.
»Unbegreiflich, Fritz! Fast vier Stunden haben wir hier gelegen, und dein Freund Klaus ist immer noch nicht zurück. Das beunruhigt mich.«
Fritz lachte. »Keine Ursache zur Unruhe. Der gute Klaus ist höchstwahrscheinlich zu faul, den Weg noch mal zu machen, und raucht seine Pfeife auf der anderen Seite der Insel.«
Professor Belian erhob sich. Sein Gesicht hatte sich gewandelt. Tiefer Ernst lag auf den faltigen Zügen.
»Nein, Fritz! Das ist ganz unmöglich! Dein Freund hat versprochen, in anderthalb Stunden zurück zu sein. Er ist nicht zurückgekommen, also muß ich annehmen, daß ihm irgend etwas zugestoßen ist, daß er unsere Hilfe braucht. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als ihm auf dem gleichen Weg zu folgen, den er vor vier Stunden eingeschlagen hat. Los! Vorwärts! Wir haben keine Zeit zu verlieren.«
In Eile traten sie den Rückmarsch an. Schon umfing sie der Wald. So schnell, wie es auf dem schmalen Pfad möglich war, schritten Sie vorwärts. Professor Belian hatte die Führung. Jetzt bog er von dem Weg, den Sie früher benutzt hatten, auf einen Seitenpfad ab, der bergaufwärts führte.
Endlich, eine knappe Stunde waren sie gelaufen, aber eine Ewigkeit schien es ihnen, traten sie aus dem Wald hinaus auf eine kleine felsige Plattform. Tief unter ihnen stürzte das Wildwasser zu Tal. Da schimmerten aus dem Waldgrün die Dächer des Bungalows und des Maschinenhauses. Da lag die kleine Bucht, in die sich der Wassersturz ergoß. Da war der Bootsteg, an dem vor langen Wochen die ›Möwe‹ angelegt hatte. Und an diesem Steg – Professor Belian sah es, und die Knie wankten ihm –, an diesem Steg lag ein fremdes Boot. Das Boot war leer. Nur ein halbes Dutzend Riemen darin verriet, daß es von Menschenhänden hierher gebracht worden war. Wo aber waren die Menschen?
Fieberhaft schnell arbeitete das Gehirn des Professors. Greifbar deutlich stellte er sich vor, was hier geschehen sein mußte. Die Leute in dem Boot hatten die Barre durchfahren. Sie hatten natürlich die Bucht gefunden und waren den Flußlauf bis zum See hinaufgerudert. Dann hatten sie auf der als unbewohnt geltenden Insel zu ihrem Staunen plötzlich eine menschliche Niederlassung entdeckt, den Bungalow.
Ein Schrei hinter ihm ließ ihn zusammenfahren. Die Stimme von Heinz, dachte er, da wurde es ihm dunkel vor den Augen. Von hinten her war ihm ein Tuch über den Kopf geworfen worden. Er fühlte, wie ihn Hände packten, wie ein Strick in vielen Windungen um seinen Körper und seine Arme geschlungen wurde. Stimmen drangen an sein Ohr, die Stimmen von Heinz und Fritz, Geräusche wie von einem Kampf, andere Stimmen dazwischen, die in englischer und spanischer Sprache schrien und kommandierten, und dann wurde es still.
Professor Belian fühlte, wie man ihn auf eine Bahre legte und den Pfad hinabtrug, und merkte nach einer langen Zeit, daß die Bahre abgesetzt wurde und irgendwo ruhig auf dem Boden stand.
In der Kabine der ›Dorothea‹ saßen jene vier Herren zusammen, deren Bekanntschaft der Leser bereits gemacht hat. Mister Jefferson rieb sich ärgerlich die Schläfe.
»Verwünscht, Gentlemen! Das ändert die Sachlage. Wer hat die drei Burschen hierher gekarrt? Hätte nicht viel gefehlt, und die Sache wäre schiefgegangen. Mußten scharf zugreifen, um die Gesellschaft unschädlich zu machen. Mit unserem ersten Plan ist’s nichts mehr.«
»Bleibt nur die zweite Möglichkeit«, unterbrach ihn Mister Stokes. »War für meine Person gleich mehr dafür. Ich möchte den Wissenschaftler kennenlernen, der sich nicht schließlich ködern ließe, wenn man ihm unbegrenzte Forschungsmöglichkeiten eröffnet.«
»Bleibt aber doch ärgerlich!« fuhr ihm Mister Belgrave in die Rede. »Es wäre einfacher gewesen, wenn wir ihm als harmlose Globetrotter die Würmer aus der Nase gezogen hätten.«
»Ärgerlich bleibt’s!« bestätigte Mister Jefferson die Meinung von Belgrave. »Wir müssen jetzt unter allen Umständen versuchen, den Alten bei seinem Forscherehrgeiz zu packen. Können wir damit das Spiel nicht gewinnen, dann haben wir’s ein für allemal verloren.« —
Die drei Freunde Klaus, Fritz und Heinz waren nur wenige Meter von der Stelle entfernt, an der dieses Gespräch zwischen den Herren Jefferson, Stokes und Belgrave stattfand. Leider war aber ihr Aufenthaltsort derart beschaffen, daß sie nicht die geringste Aussicht hatten, ihre Freiheit wiederzugewinnen. Sie befanden sich in einem mäßig großen Raum ohne die Spur irgendwelcher Möbel. Ein kleines Bullauge verbreitete spärliches Licht und ließ zur Not erkennen, daß es sich hier um einen Raum in einem hölzernen Schiff handelte.
Einige Stunden hatte Klaus Gelegenheit gehabt, sich der Betrachtung seines neuen Aufenthaltsortes allein zu widmen. Dann hatte sich für ein paar Augenblicke eine Tür geöffnet. Von abenteuerlich aussehenden Burschen waren zwei andere gefesselte Gestalten, Heinz und Fritz, in den Raum gestoßen worden. Unmittelbar danach war die Tür wieder ins Schloß gefallen.
»Junge, Junge! Dat is’ mal eine Bescherung! Wo habt ihr den Professor gelassen?«
Die zuckten die Achseln, soweit die Stricke es ihnen erlaubten.
»Keine Ahnung, Klaus. Wir wurden überfallen, niedergeschlagen, weggeschleppt, ins Boot gepackt. Der Professor muß noch auf der Insel sein.«
»Verwünschter Schiet!« knurrte Klaus und wälzte sich hin und her. Verzweifelt suchte er irgendwo eine scharfe Ecke oder Kante zu entdecken, an der er den Strick zerreiben könnte. Sein Suchen war vergeblich, und die Sonne tauchte darüber ins Meer. Die Dunkelheit brach ein und machte die traurige Lage der drei Freunde noch trauriger. —
Dämmerung und Dunkelheit schlichen auch in den Bungalow, wo Professor Belian immer noch gefesselt auf seiner Bahre lag. Die Ruderschläge des zurückkehrenden Bootes drangen an sein Ohr. Er vernahm Schritte und Stimmen. Seine Bande wurden gelöst, das Tuch zurückgezogen. Grell fiel das Lampenlicht auf sein Gesicht, für kurze Zeit mußte er die Augen schließen. Als er sie wieder öffnete, sah er drei Personen vor sich stehen, die ihn gespannt betrachteten, sich über ihn beugten, ihm aufhalfen und ihn sorgsam zu einem Sessel geleiteten. Einen Augenblick schwindelte ihm. Was war das? Waren das Freunde, Rettung in letzter Stunde nach dem hinterlistigen Überfall? Verwirrt blickte er sich um, wollte sprechen, setzte mehrmals an, stockte und stieß endlich die Fragen heraus: »Was soll das? Wer sind Sie? Was hat das zu bedeuten?«
Die Fremden tauschten Blicke untereinander. Schweigen herrschte im Raum, minutenlang, steigerte sich zu unerträglicher Spannung, bis einer von ihnen das Wort nahm und in englischer Sprache sagte: »Ich irre mich wohl nicht, wenn ich glaube, Herrn Professor Doktor Belian vor mir zu sehen, den Nobelpreisträger, den berühmten Atomforscher?«
Der Professor schaute den Sprechenden groß an und antwortete dann ebenfalls in englischer Sprache.
»Der bin ich. Wer sind Sie?«
»Mein Name ist Belgrave. Sie werden ihn ebensowenig kennen, Herr Professor Belian, wie die Namen dieser Herren hier, der Herren Jefferson und Stokes. Wir sind mit unseren Arbeiten nie an die Öffentlichkeit getreten. Es dürfte Sie aber vielleicht interessieren, daß wir uns mit der gleichen Frage beschäftigen wie Sie, Herr Professor.«
Der Alte warf einen mißtrauischen Blick auf den Sprecher.
»Wollen Sie sich, bitte, deutlicher erklären, Mister Belgrave! Hängen Sie mit dem Überfall auf mich und meine Freunde zusammen oder kommen Sie als Freunde?«
Mister Belgrave vermied es, den ersten Teil der Frage zu beantworten.
»Wir kommen durchaus als Freunde, verehrtester Herr Professor. Ich will Ihnen ganz reinen Wein einschenken. Wir sind bei unseren Arbeiten auf gewisse Schwierigkeiten gestoßen, die sich nicht überwinden ließen, obwohl uns die besten Apparate und sehr große, ich möchte fast sagen, unbeschränkte Mittel für unsere Versuche zur Verfügung stehen. Durch einen Zufall erfuhren wir, daß Sie das Problem mit ganz ähnlichen Mitteln bearbeiten wie wir. Mister Stokes kann es Ihnen bestätigen.«
Mister Stokes nickte zustimmend. »In der Tat, Herr Professor, es ist so, wie mein Kollege sagt. Wir arbeiten mit stark unterkühlten Feldspulen, benutzen ebenfalls flüssigen Wasserstoff zur Kühlung...«
Der Professor hatte sich aufgerichtet. »Mister Stokes, woher wollen Sie denn wissen, mit welchen Mitteln ich hier auf diesem weltverlassenen Eiland gearbeitet habe?«
Mister Stokes zuckte die Achseln. Mister Belgrave antwortete.
»Es mag Ihnen genügen, daß wir es wissen, Herr Professor. Und hätten wir noch Zweifel gehabt, eine gründliche Besichtigung Ihrer Anlagen während Ihrer Abwesenheit heute früh hätte diese Zweifel zerstreut. Wir ziehen an dem gleichen Strick, und aus diesem Grund haben wir Ihnen einen Vorschlag zu machen. Mister Jefferson wird ihn Ihnen mitteilen.«
Dem alten Professor war die Zornröte ins Gesicht gestiegen. Er machte eine heftige abwehrende Bewegung.
»Ich bin nicht gewillt, irgendwelche Vorschläge von Ihnen anzunehmen. Ich habe mich aus guten Gründen auf diese einsame Insel zurückgezogen. Ich will hier ungestört und unbeobachtet arbeiten. Sie mögen daraus ersehen, daß mir Ihr Besuch in jeder Beziehung unwillkommen ist. Sie können überhaupt nur durch einen Vertrauensbruch etwas über meine Arbeiten erfahren haben.« Der Alte fuhr sich über die Stirn. »Ich ahne auch, wem ich Ihren unerwünschten Besuch zu verdanken habe. Kennen Sie einen gewissen Doktor Schaffer?«
Die drei Amerikaner tauschten verlegene Blicke. Eine Weile herrschte drückendes Schweigen. Der alte Professor brach die Stille zuerst.
»Sie kennen ihn! Ich merke es an Ihrem Benehmen. Dieser gewissenlose Mensch steckt mit Ihnen unter einer Decke. Ich danke ein für allemal für Ihre Vorschläge.«
Verlegenheit und Nervosität spiegelten sich in den Mienen von Belgrave und Stokes. Der robuste Jefferson beschloß, den Stier bei den Hörnern zu packen.
»Wenn Sie es klipp und klar wissen wollen, nun denn, ja! Doktor Schaffer ist unser Gewährsmann und gehört schon seit langem zu uns. Jetzt machen wir Ihnen den Vorschlag, ebenfalls der Unsere zu werden.«
»Niemals! Niemals, Mister Jefferson! Ich denke gar nicht daran!«
»Sie haben Zeit zur Überlegung, Herr Professor, und ich bin sicher, daß Sie sich die Sache überlegen werden. Hören Sie unsere Bedingungen: Rückhaltloses, ehrliches Zusammenarbeiten mit uns. Dafür stehen Ihnen unsere unbegrenzten Mittel für alle Versuche zur Verfügung, und ein angemessener Gewinnanteil wird Ihnen zugesichert.«
»Niemals! Niemals, Mister Jefferson! Merken Sie sich das, niemals!«
»Oder«, Mister Jefferson sprach langsam und betonte jedes einzelne Wort scharf, »oder Sie bleiben auf dieser Insel hier so lange unter unserer Obhut, bis Sie sich zur Annahme unserer Vorschläge entschließen, und wenn es Jahre dauern sollte, Herr Professor Belian. Wir haben Zeit.«
»Ich Ihr Gefangener? Sind Sie toll geworden?«
»Sie mißverstehen mich. Sie können sich auf der Insel frei bewegen. Nur an Ihre Apparate werden Sie nicht heran dürfen, solange Sie unsere Vorschläge nicht angenommen haben. Mit denen werden wir uns unter Hinzuziehung des Herrn Schaffer beschäftigen.«
»Unerhört! Niemals!«
»Wir haben Zeit, verehrtester Herr Professor, ungeheuer viel Zeit. Es ist heute auch schon reichlich spät geworden. Beschlafen Sie sich die Sache in aller Ruhe! Wir wollen morgen, übermorgen, an jedem Tag, der Ihnen recht ist, weiter darüber sprechen.«
Professor Belian machte eine abwehrende Bewegung. »Es ist zwecklos, darüber zu sprechen. Wo sind meine Gehilfen?«
»Ihre Freunde, Herr Professor Belian, genießen zur Zeit unsere Gastfreundschaft an Bord der ›Dorothea‹. Wir hoffen, daß sich auch mit diesen im Lauf der nächsten Zeit ein annehmbares Übereinkommen treffen lassen wird. Für heute wünschen wir Ihnen eine gute Nacht, Herr Professor.«
Die Fremden waren gegangen. Rastlos, ruhelos lief der Professor in dem Wohnraum umher. Seine Gedanken überstürzten sich. Fast hellseherisch durchschaute er, was da von langer Hand gegen ihn gesponnen worden war. Vor einem Jahr hatte ihn Doktor Schaffer verlassen, war zu den anderen gekommen, hatte geglaubt, das Geheimnis zu kennen, und dann war’s nicht gegangen. Fast ein Jahr mußten sich die anderen vergeblich bemüht haben. Nur deshalb waren die jetzt hier, weil sie allein mit der Erfindung nicht weiterkamen.
Immer tiefer wurden die Falten auf der Stirn des Alten, immer schärfer vergegenwärtigte er sich die Änderungen, die er nach dem Fortgang seines Assistenten noch an der Anlage getroffen hatte. Das war’s. Jetzt fiel’s ihm wieder ein. Die Wärmeableitung nach außen durch die kupfernen Stromzuführungen war bei der alten Apparatur viel zu stark gewesen. Von Grund auf hatte er den gläsernen Bau um die Spulen und Leitungen damals umgeändert. Danach erst war es ihm möglich geworden, die hohen Strom- und Feldstärken zu erreichen, mit denen er während der letzten Tage so gute Erfolge erzielt hatte. Das mußte es sein. Auf diese Verbesserung waren die andern noch nicht gekommen. Daran haperte es bei denen. Aber sie brauchten ja nur die Anlage hier zu besehen. Doktor Schaffer mußte die Änderung sofort erkennen, und dann kamen die auch auf den richtigen Weg, der zum Erfolg führte. Das durfte unter keinen Umständen geschehen. Niemals durften die hinter seine Erfindungen kommen. Noch war es Zeit. Mit eigener Hand wollte er den Glasbau zertrümmern, den er in monatelanger Arbeit kunstvoll geformt und zusammengeschmolzen hatte. Nur noch Trümmer sollten die von der anderen Seite finden, wenn sie morgen wiederkamen.
Der alte Professor sprang auf und trat aus dem Zimmer auf die Veranda hinaus. Erfrischend wehte ihm die kühle Nachtluft um die heiße Stirn. Ein mattes Licht goß der im letzten Viertel stehende Mond über die Tropenlandschaft. Weit und breit war kein lebendiges Wesen zu sehen. Mit schnellen Schritten eilte der Professor den Pfad entlang, der vom Bungalow zum Maschinenhaus führte. Jetzt hatte er es erreicht. Die Tür war unverschlossen. Er öffnete sie und wollte hineingehen. Eine üble Gestalt trat ihm entgegen. Ein spanisch-englisches Kauderwelsch schlug an sein Ohr. Halb verstand, halb erriet er, was das Mischblut da vor ihm sagte: Eintritt strengstens verboten. Befehl von Mister Jefferson, niemand in den Raum hineinzulassen.
Einen Augenblick überlegte der Professor, ob er den Menschen überrennen, niederstoßen und so vielleicht doch zu seinem Ziel gelangen könne. Da bemerkte er noch mehrere Gestalten in dem halbdunklen Raum, ein halbes Dutzend etwa hielten dort bei den verschiedenen Teilen der Anlage Wache, wilde, verwegene Burschen, zweifellos zu allem fähig. Die von der anderen Seite hatten offensichtlich gut vorgesorgt und die Besatzung ihres Schiffes als Wache in das Maschinenhaus gelegt. Unmöglich, hier irgend etwas zu verändern oder gar zu zerstören. Schon beim ersten Versuch würden ihn diese Halbwilden überwältigen und unschädlich machen. Professor Belian kehrte zu dem Bungalow zurück. Seine Züge waren starr, wie versteinert, auch sein Blick gewandelt. Ein Entschluß, in Sekunden gefaßt, aber fest und unwiderruflich, schien ihn ganz zu beherrschen. Aus einem verborgenen Fach nahm er ein Buch heraus. Es war in festes Leder gebunden, ein Band in Quartformat. Er nahm es zum Schreibtisch mit, setzte sich, schaltete die Tischlampe ein und schlug es auf. Es war das Tagebuch, in das er Tag für Tag seine Arbeiten, seine Versuche und Erfolge eingetragen hatte, ein Geheimbuch, das er in den stillen Nachtstunden geführt, in das bisher noch kein anderer Mensch außer ihm geblickt hatte. Auch Doktor Schaffer war dieses Buch nie zu Gesicht gekommen.
Professor Belian griff zur Feder und begann zu schreiben. Der Kiel in seiner Hand glitt über das Papier und bedeckte Seite um Seite mit neuen Zeilen, mit Skizzen und Berechnungen. Alle die Besorgnisse und Gefahren, die er den drei Freunden bei dem letzten Versuch nur angedeutet hatte, legte er hier noch einmal ausführlich schriftlich nieder. Die Zeit verrann darüber. Nur das Rascheln der Feder auf dem Papier unterbrach die Stille. Endlich, eine Stunde nach Mitternacht, war der Alte fertig. Er warf die Feder beiseite und erhob sich. Sorgfältig barg er das Buch in seinem Rock und ging wieder ins Freie. In weitem Bogen führte ihn der Weg um das Maschinenhaus herum zu jenem Pfad, der über das Gebirge und durch den Wald zur anderen Seite der Insel lief.
Am Osthorizont malte sich bereits das erste Rot der aufkommenden Dämmerung, als Professor Belian von einem langen Nachtmarsch zurückkehrte. Erschöpft warf er sich auf sein Lager und fiel in einen unruhigen Schlaf. —
Die Sonne kam herauf; ein neuer Tag war da. Sein Licht übergoß die grünende, blühende Vegetation der Insel und das tiefblaue Meer. Es drang auch durch die Luken der ›Dorothea‹ und erhellte den Raum, in dem Klaus, Fritz und Heinz eine wenig erfreuliche Nacht verbracht hatten.
»So eine Lumperei!« murrte Klaus, »einen hier wie ein Bund Flicken zusammenzuschnüren. Schurken, verwünschte! Ich drehe euch den Kragen um, wenn ich euch kriege!«
Fritz hatte sich dicht an Klaus herangerollt und sagte: »Deine Hände sind doch von den Knöcheln ab frei.«
»Weiß ich!« brummte Klaus, »aber damit komme ich nicht an den Knoten, mit dem die Schufte den Strick über meiner Brust zusammengebunden haben.«
»Nein! Aber du kannst damit an den Knoten bei mir kommen, wenn ich mich richtig an dich ranwälze. Er sitzt an meiner linken Schulter. Wir müssen es versuchen. Eine andere Möglichkeit, hier loszukommen, sehe ich nicht.«
»Na, denn man tau, Fritz!«
Nicht ohne Mühe gelang es Fritz, sich so an Klaus heranzurollen, daß der den Knoten mit seinen Fingern zu fassen bekam. Und dann begann eine lange, verzweifelte Arbeit für Klaus. Fingernägel brachen ihm ab. Oft glaubte er auch, daß die Finger ihm dabei brächen. Stunden verstrichen darüber. Der Schweiß rann ihm von allen Gliedern, bis endlich der mit Gewalt zu einem Knoten zusammengerissene harte Strick nachgab, seine Schlingen sich lösten und die Enden frei wurden. Das andere ging leicht. Schnell rollte sich Fritz aus der Fesselung heraus und brachte durch einige kräftige Bewegungen seinen stockenden Kreislauf wieder in Gang. Dann ein Griff in die Tasche zum Messer. Zerschnitten fielen die Stricke ab, die Klaus und Heinz gefesselt hielten.
Die nächste Viertelstunde verbrachten sie damit, durch kräftige Bewegungen erst wieder die volle Gewalt über ihre Gliedmaßen zurückzugewinnen. Nach wie vor war die Lage wenig ersprießlich. Wohl waren sie der Fesseln ledig, aber gefangen waren sie nach wie vor, und nur allzufest war der Gefängnisraum gebaut. Das enge Bullauge in der Bordwand bot keinen Weg ins Freie. Starke, schwere Holzbohlen bildeten die Wände, den Boden und die Decke. Aus gleich starken Bohlen war auch die Tür gefügt und von außen durch einen schweren Riegel gesichert.
»Sehr schwierige Lage!« mußte auch Fritz zugeben. »Trotz allem, die Tür bleibt die einzige Stelle, wo wir mit einiger Aussicht etwas unternehmen können.«
Er betrachtete zweifelnd das Taschenmesser in seiner Rechten, dann die schweren Bohlen der Tür und schüttelte mutlos den Kopf. »Das Ding bricht bei dem ersten Versuch ab.«
Klaus griff in seine Tasche und förderte ein Messer zutage, dessen Klinge dreimal so lang und stark war wie die an dem Messer von Fritz.
»Das schafft schon besser«, meinte der anerkennend. Dann kam die Reihe an Heinz. Der brachte ein Instrument zum Vorschein, das allerseits mit Freuden begrüßt wurde, einen Marlspieker.
»Alle Wetter!« schrie Klaus, »wenn ich das Ding vorher gehabt hätte, hätte ich mir nicht stundenlang die Finger zu schinden brauchen.«
Ein Marlspieker ist ein längeres, kräftiges, am einen Ende zugespitztes Rundeisen, dessen sich die Seeleute bedienen, um Knoten aufzumachen. Für diesen Zweck kam’s ja nun zu spät. Aber die Freunde waren sich einig darüber, daß es auch vorzüglich geeignet sei, den Türriegel zurückzuschieben, wenn man erst einmal so viel von der Türbohle weggeschnitten hatte, daß man an das Riegeleisen heran konnte.
Während Fritz den Spieker noch prüfend in der Hand wog, stand Klaus bereits an der Tür und säbelte mit seinem handfesten Messer kräftige Späne vom Rand der äußersten Bohle ab.
Um die zehnte Morgenstunde wurde Professor Belian durch ein Geräusch munter. Langsam wich der tiefe, bleierne Schlaf, in den er nach den Aufregungen und Erschütterungen des verflossenen Tages schließlich doch versunken war, von ihm. Das Bewußtsein seiner Existenz und all der Dinge, die während der letzten vierundzwanzig Stunden geschehen waren, kam ihm zurück. Ein tiefer Seufzer entrang sich der Brust des Liegenden. Er schlug die Augen auf, blickte um sich und erkannte die Ursache des Geräusches, das ihn aus seinem Schlummer gerissen hatte. Mister Jefferson war mit Stokes und Belgrave in den Raum gekommen. Ohne Rücksicht auf den Schlafenden zu nehmen, hatten sie es sich auf Stühlen und Sesseln bequem gemacht und schnüffelten neugierig in den Papieren, die den Schreibtisch bedeckten. Professor Belian hatte die Augen wieder geschlossen; durch einen schmalen Lidspalt beobachtete er das Treiben an seinem Tisch. Ein verächtlicher Zug spielte kaum merklich um seine Lippen. Minuten verstrichen so, während sich die unwillkommenen Gäste am Tisch einzelne Papiere zuschoben und halblaute Bemerkungen austauschten. Dann machte der Professor der Sache ein Ende. Als ob er eben erst erwache, reckte er die Arme, gähnte ein paarmal und blickte die Fremden unwillig an.
»Was machen Sie da an meinem Tisch?« fragte er.
Mister Jefferson zeigte die gleiche Dickfelligkeit wie am vergangenen Tag.
»Wir suchen uns zu informieren, Sir.«
Professor Belian lachte kurz auf. »Glauben Sie im Ernst, daß ich nach den gestrigen Vorkommnissen geeignete Informationen für Sie umherliegen lasse?«
Belgrave und Stokes flüsterten miteinander und nickten sich zu. Ihre Äußerungen und Bewegungen schienen die Worte des Alten zu bestätigen. Jefferson nestelte verlegen an seinem Kragen.
»Well, Professor, darf ich fragen, haben Sie sich meine Vorschläge überlegt?«
»Über Ihre Vorschläge wird später zu reden sein. Erst werden Sie mir zwei Fragen zu beantworten haben.«
»Bitte, Herr Professor.«
»Wo sind meine drei Gehilfen?«
»Ich hatte bereits Gelegenheit, Ihnen zu bemerken, daß Ihre Gehilfen die Gastfreundschaft der ›Dorothea‹ genießen. Aus verschiedenen Gründen erschien es uns angebracht, Sie von Ihren Freunden zu trennen, eine Zeitlang, so lange wenigstens, bis wir über unsere weiteren Beziehungen, über eine friedliche Zusammenarbeit, Herr Professor Belian, einig geworden sind.«
»Wo befindet sich die ›Dorothea‹?«
Jefferson zuckte die Achseln. »Das ist schließlich kein Geheimnis. Die ›Dorothea‹ ankert draußen am inneren Rand der Barre. Ihre Freunde sind dort vollkommen sicher.«
Professor Belian fuhr sich nachdenklich über die Stirn. Erst nach längerer Zeit sprach er weiter.
»Gut! Nun zum zweiten Punkt. In welcher Weise, in welchem Umfang werden Sie mich an den Erträgnissen meiner Entdeckung, verstehen Sie mich recht, Mister Jefferson, meiner Entdeckung beteiligen, die Sie mir mit mehr oder weniger Zwang wegzunehmen im Begriff stehen?«
Jefferson überlegte eine Weile und sprach dann immer noch stockend und überlegend: »Es ist nicht ganz einfach, Ihnen eine bindende Zahl zu nennen, bevor wir wissen, was Sie bereits wirklich erreicht haben. Man müßte das sehen. Im Augenblick kann ich Ihnen nur folgendes sagen: Entspricht das, was Sie bereits können, auch nur annähernd unseren Erwartungen, so bin ich bevollmächtigt, Ihnen ein Angebot zu machen, das Ihre weitestgehenden Ansprüche befriedigen dürfte.«
»Schöne Worte, aber keine Zahlen«, fiel ihm der Professor scharf in die Rede. »Ich wünsche ein genaues zahlenmäßiges Angebot von Ihnen zu hören.«
»Dann muß ich erst fragen, was Sie jetzt bereits können, Herr Professor?«
»Ich kann die Wasserstoffatome vernichten und die entsprechende Energie gewinnen.«
Jefferson war aufgesprungen. Auch Stokes und Belgrave erhoben sich. Belgrave fragte: »Sie können Wasserstoff nach Belieben vernichten, Herr Professor?«
»Nach Belieben, Mister Belgrave. Ich kann Ihnen den grundlegenden Versuch vorführen. Bei einer ganz bestimmten Feldstärke, einer Feldstärke, deren Größe Sie da unter den Papieren durchaus vergeblich suchen dürften, meine Herren, geht der Wasserstoff in das Nichts über. An seiner Stelle tritt Energie auf.«
Wieder ein Raunen und Flüstern zwischen den Fremden. Stokes nahm das Wort.
»Wir haben zuverlässige Kunde von Ihrem früheren Mitarbeiter, daß Ihnen tatsächlich die Wasserstoffvernichtung schon gelegentlich gelungen ist. Doktor Schaffer vermochte das Experiment jedoch nicht zu wiederholen.«
Professor Belian runzelte die Stirn.
»Doktor Schaffer ist ein Esel von Überlebensgröße, ein Schuft außerdem noch! Es gehört mehr als die Kenntnis der Feldstärke dazu, wenn das Experiment gelingen soll. Auch die Wechselzahl des Feldes muß genau auf die Eigenschwingung der Wasserstoffatome abgestimmt sein. Daran hat er nicht gedacht, dieser Herr Doktor Schaffer; ein recht ungeschickter Dieb, meine Herren, den Sie da in Ihren Diensten haben.«
»Well, Herr Professor«, nahm Jefferson das Wort. »Zeigen Sie uns den Versuch! Gelingt er, dann ist unser Konzern bereit, Ihnen zehn vom Hundert von allen Gewinnen zu garantieren, die jemals durch Ihre Entdeckung erzielt werden. Jemals, das heißt natürlich, solange diese Gewinne dem Konzern zufließen, solange wir Patentschutz auf ihre Entdeckung haben. Wir können einen richtigen Vertrag abschließen, sobald Sie durch das Experiment den Beweis für Ihre Behauptungen erbracht haben.«
Professor Belian saß schweigend auf seinem Lager. Seine Gedanken begannen sich zu jagen. Der Versuch mußte gemacht werden, und zwar so, daß der gläserne Spulenbau durch die freiwerdende Energie vollkommen zerstört wurde, bevor sich diese Eindringlinge Einzelheiten davon merken oder gar abzeichnen konnten. War das geschehen, dann mochten sie machen, was sie wollten. Keine menschliche Gewalt sollte ihm die genauen Feldstärken und Schwingungszahlen des Feldes entreißen, die für den Versuch notwendig waren. Aber nicht ganz ungefährlich war das. Genau mußten die Größen bemessen werden, wenn die Zerstörung im gewollten Umfang eintreten sollte, nicht zu schwach, daß die aus den Trümmern noch etwas lernen konnten, auch nicht zu stark.
»Nun! Wie ist’s, Professor?«
»Ich bin bereit, Ihnen den Versuch zu zeigen, aber ich brauche Gehilfen dazu, meine Gehilfen.«
Mister Jefferson schüttelte den Kopf. »Nicht nötig. Die Herren Stokes und Belgrave sind, wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, Kollegen von Ihnen, ebenfalls Physiker.«
Eine kurze Pause des Schweigens, Überlegens. Dann erhob sich der Alte.
»Ich bin bereit, meine Herren! Gehen wir zu dem Maschinenhaus!«
Professor Belian gab seine Anordnungen und verteilte die Posten. Diesmal wollte er die Bedienung der Elektrozentrale übernehmen, um die Feldstärken und Schwingungszahlen selbst unmittelbar kontrollieren zu können. Die WasserstoffVerflüssigungsanlage wurde Mister Stokes übergeben. Bei dem gläsernen Spulenbau standen Belgrave und Jefferson. Ein neues Thermometer war vor dem Wasserstoffrohr aufgebaut, um die Energieentwicklung messen zu können.
Ordnungsgemäß begannen alle Maschinen zu laufen, alle Apparate zu spielen. Brodelnd flutete der flüssige Wasserstoff durch den Glasbau und kühlte die Spule nieder. Neugierig, wie etwa Urwaldaffen dem Treiben einer weißen Forschungsexpedition zuschauen, blickten sechs braune, zerlumpte Gestalten, die ehrenwerte Besatzung der ›Dorothea‹, auf das rätselhafte, unheimliche Maschinenspiel.
»Narr!« rief der Professor, sprang auf einen von denen zu, riß ihm die brennende Zigarette aus dem Mund und trat sie mit dem Fuß aus. »Nicht rauchen!« schrie er, während er ein Stück weiter durch den Raum lief, auf Stokes zu. »Es werden große Knallgasmengen frei. Ein Funke genügt, um den ganzen Bau in die Luft gehen zu lassen.«
Er sah, wie Belgrave am Spulenbau ein paar anderen Leuten von der Besatzung die Zigaretten wegriß. Aber er sah noch etwas anderes, was ihm bisher auf seinem entfernteren Standpunkt in der Elektrozentrale entgangen war. Neben Belgrave und Jefferson stand noch ein Dritter neben der Spule: Doktor Schaffer, den er seit Jahresfrist nicht gesehen hatte. Der stand dort, hatte einen Zeichenblock und skizzierte sorgsam den ganzen Glasbau, arbeitete mit einem Zollstock, nahm Maße und schrieb sie in seine Zeichnung ein.
Einen Augenblick wollte der Alte weitereilen, sich auf Schaffer stürzen, ihn niederschlagen, ihm die Skizze entreißen. Zögernd stand er dort, mit sich selbst kämpfend. Tiefe Röte und leichenhafte Blässe wechselten auf seinen Zügen. Totenblaß war er, als er mit zusammengepreßten Kiefern zu der Elektrozentrale zurückkehrte.
»Ist der Wasserstoffstrom durch das Kohlenrohr angestellt?« fragte er durch das Telefon.
»Noch nicht!« kam die Antwort von Jefferson zurück, »es sind noch einige Feststellungen zu machen.«
Unnatürlich weiteten sich die Augen in dem starren, bleichen Gesicht des Alten. Nicht mehr gütig und verstehend blickten sie. Ein feindlicher Glanz schimmerte aus ihnen. Marionettenhaft waren die Bewegungen, mit denen er den Schalter für die Erregung der Dynamos über die Kontaktknöpfe zog. Automatisch vollführte er die Griffe an der Frequenzregelung.
Ein Schrei drang vom anderen Ende der Halle an sein Ohr – ein dumpfes Brausen, und dann –
»Swinskram!« rief Klaus, während ihm der Schweiß in Strömen von der Stirn lief. Das alte Eichenholz der Türbohle war viel härter und widerstandsfähiger, als es anfangs schien. Sein Messer wurde stumpf. Schon hatte er ein paar tüchtige Blasen an den Händen, und noch immer war der Riegel nicht zu erreichen.
»Wenn du nicht kannst, laß mich mal!« versuchte Fritz zu scherzen, nahm ihm das Messer aus der Hand und arbeitete an Klaus’ Stelle weiter.
Nach einiger Zeit kam Heinz als Ablösung an die Reihe, und dann fing es von neuem mit Klaus an. So arbeiteten sie nun schon viele Stunden, schnitten und brachen mühselig Span um Span von dem knorrigen Holz los. Ins Unerträgliche steigerte sich dabei ihr Durst. In der dumpfen, heißen Luft des engen Raums wurde ihnen das Atmen schwer. Die Kleider klebten ihnen am Leib. Mit verbissener Wut arbeiteten sie weiter. Span um Span fiel zu Boden. Immer breiter wurde der Spalt und immer tiefer dabei. Endlich war das Eisen des Riegels zu sehen und mit dem Marlspieker zu fassen. Ein Rucken, ein Zucken. Das Riegeleisen schob sich zurück, die Tür sprang auf.
Taumelnd drangen sie aus ihrem Gefängnis, gerieten in einen Gang und kamen an eine Treppe, die nach oben führte.
»Die Messer zur Hand!« schrie Klaus. »Wehe dem ersten Schuft, der mir vor die Klinge kommt!«
Die Waffen stoßbereit, zum Äußersten entschlossen, schritten sie die Stufen hinauf und kamen an eine Tür, die unverschlossen war. Sie stießen sie auf und standen im grellen Licht der Nachmittagssonne auf dem Verdeck der ›Dorothea‹.
Kein Mensch war weit und breit zu sehen. Das Schiff schien verlassen zu sein. Die Segel waren heruntergelassen. Kaum merklich wiegte sich der Schoner in dem ruhigen Wasser an seinen Ankerketten. Er lag zwischen Barre und Insel. Kaum fünfzig Meter seewärts tobte die Brandung über die Barre.
Fritz blickte sich suchend um.
»Was zu trinken, Klaus! Ein Königreich für einen Schluck Wasser!«
Sie suchten weiter, kamen unter Deck in die Kombüse und entdeckten ein paar Flaschen Mineralwasser.
»Ah! Das tut gut!« stöhnte Heinz, während er sich den Inhalt der zweiten Flasche in die Kehle rinnen ließ.
Sie tranken sich satt, fanden eine Handvoll Zwieback und gingen, während sie ihn kauten, wieder auf Deck.
»Ja, wat nu?« fragte Klaus mit einem Blick nach der Insel hinüber.
»Ja, wat nu?« echote Fritz ihm nach.
Klaus warf prüfende Blicke auf die Takelage.
»Junge, Junge! Wir sind drei. Wenn wir den Kahn flottmachen, mit dem durch die Barre gehen – dat wär ein Spaß!«
Fritz schüttelte den Kopf.
»Wäre schon ganz schön, Klaus, aber mein Oheim! Du vergißt, daß er in der Gewalt der Banditen ist. Mag der Himmel wissen, was die im Schilde führen, etwas Gutes sicherlich nicht.« —
In den Sekunden, wo Fritz diese Worte sprach, stand der alte Professor im Maschinenhaus, den Schalter für die Erregung in der Rechten, den Griff des Frequenzreglers in der Linken. —
»Wir müssen zur Insel, ihm zu Hilfe kommen. Kein Boot hier! Wie kommen wir rüber?«
Die Worte blieben Fritz im Mund stecken, die Stimme verschlug ihm.
Dort drüben hinter dem Uferrand, dort, wo Bungalow und Maschinenhaus lagen, hob es sich empor wie eine schwarze, düstere Explosionswolke, wie der Ausbruch eines Vulkans, eben noch eine Wolke, von feurigen Blitzen durchzuckt, dann ein Feuermeer, das hoch und immer höher zum strahlend blauen Himmel empordrang, ein Glutmeer, das auch nach den Seiten weiterfraß, im Augenblick den grünen Wald auf weite Entfernung hin verkohlte und veraschte.
Der Berg, halb durch die Feuergarbe verdeckt, schien zu wanken. Die ganze Insel erbebte in ihren Grundfesten. Mit aufgerissenem Mund, mit weitgeöffneten Augen starrten die drei auf das Fürchterliche, das Entsetzliche, auf das in seiner Schrecklichkeit doch so majestätisch schöne Schauspiel. Dann folgte dem Blitz der Donner.
Ein unbeschreiblich gewaltiges Dröhnen und Krachen drang herüber. Mit unwiderstehlicher Gewalt fegte in Luft und Wasser die Explosionswelle heran. Mit Orkanstärke packte sie die Freunde auf dem Verdeck und schleuderte sie auf die Planken nieder. Mit Riesenkraft erfaßte sie die ›Dorothea‹, hob sie einen Augenblick hoch aus dem Wasser und brach wie Glas die Ankerketten. Den Rumpf der ›Dorothea‹ warfen die entfesselten Elemente mit zerschmetternder Gewalt auf die Barre. In gigantischem Kampf stießen hier zwei Brandungen zusammen, die der See von außen und eine neue, stärkere, welche die Wut der Explosion ihr von der Insel her entgegenwarf.
Was war geschehen? Als Professor Belian den Mann, den er von ganzem Herzen und von ganzer Seele haßte, an seinen Apparaten stehen und Aufzeichnungen machen sah, hatte ihn die Selbstbeherrschung verlassen. In jähem Impuls hatte er Feldstärken und Frequenzen eingestellt, bei denen auch der flüssige Wasserstoff, der die Spule kühlte, zu Bruch gehen mußte. Mit jähem Ruck, im Bruchteil einer Sekunde waren mehrere Kilogramm Wasserstoff atomistisch explodiert. In riesenhaften, unvorstellbar gewaltigen Mengen brach die freiwerdende Energie nach allen Seiten hin aus der Explosionsstelle hervor. In einem feurigen Flammenmeer war der Alte zusammen mit seinen Feinden zugrunde gegangen. —
Die Stunden verstrichen, Stunden, in denen sich die riesige, so plötzlich freigewordene Energiemenge im Raum ausbreitete, verdünnte und allmählich unschädlich wurde.
Einem Glücksfall verdankten Fritz, Klaus und Heinz ihr Leben. Die erste Explosionswelle hatte sie in den Schutz der Schanzkleidung des Schoners geschleudert. So war die wabernde Lohe über sie hingebraust, ohne sie zu verbrennen. Nur die Masten der ›Dorothea‹ und ihr Rumpf waren in Brand geraten. Die folgenden Sturzseen hatten das Feuer gelöscht.
Lange Zeit verfloß, bis den Geretteten die Besinnung zurückkam, sie sich schwerfällig, taumelnd erhoben und zu begreifen vermochten, was hier geschehen sein mußte.
Die ›Dorothea‹ lag auf der Korallenbarre mit zerschmetterten Rippen auf der Seite, den Kiel der offenen See zugewandt. Ihr Deck war um fünfundvierzig Grad gegen die Horizontale geneigt. Wild schäumend brachen sich die Wogen der Brandung an ihrem Rumpf. Bei jedem Wogenprall bewegte sich das Schiff wie ein weidwundes Tier ein wenig hin und her. Bei dem schweren Sturz war der Rumpf auf die zackige Krone der Barre aufgespießt worden. So mußte das Schiff hier liegenbleiben, bis in Wochen, in Tagen, vielleicht schon in Stunden die wütende Brandung ihr Zerstörungswerk vollendete, den Rumpf zerschlug und die einzelnen Trümmerstücke an das Ufer der Insel warf. Schon krachte es in den Holzverbänden bedenklich bei jeder neuen Woge, die ihren glasig grünen Leib in schwerem Anprall gegen den Rumpf des Schoners schmetterte.
»Wir müssen zur Insel!« Fritz schrie die Worte, um sich im Toben der Elemente verständlich zu machen.
»Dat ist woll klar!« schrie Klaus zurück, »aber wie rüber kommen?«
»Ein Floß bauen!« mischte sich Heinz ein.
Dicht zusammengedrängt berieten sie den Plan. Die Lage war nicht einfach. Die Entfernung bis zum Ufer war fast vierhundert Meter weit. Die Möglichkeit, daß Haifische vorhanden waren, schien nicht ausgeschlossen.
Klaus arbeitete sich zu einem der Eingänge hin, die unter Deck führten. Er behielt dabei keinen trockenen Faden am Leib, aber er erreichte den Eingang und verschwand unter Deck. Nach einiger Zeit kam er zurück, womöglich noch nässer als zuvor, in der einen Hand eine schwere Zimmermannsaxt, in der andern ein langes, kräftiges Schiffstau. Zunftgerecht knotete er das Seil mit dem einen Ende an das flache, muldenförmige Dach des Aufbaus, unter dessen Seeseite sie Schutz vor der Brandung gefunden hatten, und befestigte das andere Ende an die Reling der ›Dorothea‹. Dann schmetterte die Axt gegen den Aufbau. Ihre Schläge unterstützten das Zerstörungswerk der Wogen. Späne flogen, Holzverbände krachten. Noch ein letzter gewaltiger Schlag mit der Axt. Eine mächtige Woge riß das Dach ganz los und schleuderte es leewärts fort über die Reling in die See. Da schwamm es und wäre sofort von den Ausläufern der Brandung gegen das Land getrieben worden, wenn das Tau es nicht gehalten hätte.
»Jetzt noch etwas zum Rudern!« schrie Klaus und führte mit der Axt von neuem Schläge gegen die Ruine des Aufbaus. Drei Schläge nur und jeder der drei hielt ein gutes Brett in der Hand. Klaus zog das schwimmende Dach am Seil dicht an die ›Dorothea‹ heran. Bei der Schräglage des Rumpfes war die Reling nun kaum ein Meter von dem behelfsmäßigen Floß entfernt.
Als erster sprang Heinz darauf. Ihm folgte Fritz. Klaus warf den beiden seine Ruderplanke zu und sprang nach, die Axt in der Hand. Mit einem Axtschlag kappte er das Seil. Sofort wurde das Floß von der auslaufenden Brandung gepackt und landwärts getrieben. In kurzer Zeit war es hundert Meter von der Barre entfernt. Dann ließ die treibende Kraft des Wassers nach. Jetzt hieß es rudern und sorgsam das Gleichgewicht wahren, denn ein reichlich unsicheres Fahrzeug war das Kombüsendach.
An den beiden Längsseiten hockten Fritz und Heinz und paddelten mit ihren Planken. Bei jedem Ruderschlag schaukelte das Floß, und das Wasser lief ihnen über die Füße. Am hinteren Ende kniete Klaus. Er handhabte seine Planke abwechselnd als Steuer oder als Wrickruder. In der Rechten hielt er die Axt. So kamen sie vorwärts, nicht eben schnell, denn das schwere Dach ruderte sich so unbequem wie ein Prahm, aber doch immerhin stetig.
»Noch zweihundert Meter!« rief Fritz mit einem Blick zur Küste.
»Töw, du Biest!« schrie Klaus und führte mit der Axt einen blitzartigen Schlag in das Wasser. Es färbte sich rot, als er die Axt zurückzog. Den weißen Bauch nach oben, trieb ein toter Haifisch seitlich ab.
»Junge, Junge!« Klaus rieb sich den Kopf. »Dat wär mal slimm gegangen, wenn wir geschwommen wären.«
Noch öfter fuhr die Axt ins Wasser und machte rote Flecke in der blauen See. Dann endlich war das Ufer erreicht. Schürfend stieß das Floß auf den flachen Strand und saß fest. Sie sprangen auf das Land, blickten sich um, und unwillkürlich fanden sich ihre Hände, die sich in festem Druck umschlossen. Sie fühlten es in dieser Minute, sie waren hier die letzten Überlebenden einer unerhörten Katastrophe, drei Menschen, allein auf einer weltverlorenen Insel inmitten der ungeheueren Wasserwüste.
Dort draußen auf der Barre lag der zerschmetterte Leib der ›Dorothea‹. Rötlich schimmerte in den Strahlen der tiefstehenden Sonne die Gischt der Brandung, die ihn donnernd umsprühte. Vor ihnen landeinwärts ein Gebiet der Verwüstung, des Todes. Bis zum Uferrand hin waren die Palmen versengt, war der Hafen verkohlt. Sie gingen den Strand entlang bis zur Flußmündung und folgten dem Flußlauf nach oben. Es war heller Tag, wo früher grüngoldiges Dunkel einer üppigen Pflanzenwelt das Flußbett umhüllt hatte. Kahlgemäht, glattrasiert hatte die entfesselte Energie hier die Ufer, jeden Halm, jedes Blatt zu Asche verbrannt.
Sie gingen weiter und kamen zu dem See, an dem gestern noch Bungalow und Maschinenhaus standen. Der See war größer geworden. An der Stelle des Maschinenhauses hatte die explodierende Materie einen tiefen Krater in den Boden gerissen. Der See hatte ihn ausgefüllt. Eine neue Bucht erstreckte sich dort landeinwärts. Weiße Asche nur war dort, wo der Bungalow einmal gestanden hatte. Sie folgten dem Pfad zu den Bergen. Brand und Verwüstung auch hier bis zum Kamm.
Erst als sie die Berghöhe erreicht und überschritten hatten, wurde es besser. Die wabernde Lohe der Atomexplosion war den Berghang hinauf gefegt und hatte alle Vegetation auf ihm in Asche gelegt. Aber der Berghang hatte der ausbrechenden Energie die Richtung in die Höhe aufgezwungen, sie nach oben geworfen, daß sie wie ein ungeheures Fanal gegen das Firmament aufloderte.
Auf der andern Seite des Berges hörte die Zerstörung wie mit einem Schlag auf. Grüner Wald umfing sie wieder, als sie in der nun schnell einbrechenden Dämmerung weiterschritten. Dunkelheit fiel ein, als sie die Uferwiese erreichten. Im letzten unsicheren Licht erkannten sie die ›Möwe‹, die hier sicher vor Anker lag. Leicht schaukelte ihr Rumpf an der Kette. Die Wut der ausbrechenden Atomenergie, die auf der anderen Seite des Eilands die so viel größere ›Dorothea‹ wie ein Spielzeug auf das Riff schleuderte, war nicht bis hierher gedrungen. In einer Höhe von vielen Kilometern mußte die entfesselte Energie nach dieser Seite hin abgeströmt sein.
Sie warfen sich auf den Sand. Lange lagen sie dort, ohne ein Glied zu rühren. Sie fühlten es kaum, daß sie durstig waren und seit anderthalb Tagen fast keinen Bissen zu sich genommen hatten. Sie spürten es nicht, daß ihre Kleider durchnäßt, ihre Hände zerschunden waren. Schweigend lagen sie da, die Augen zu dem schimmernden Sternenhimmel gerichtet, und gedachten des Mannes, des gütigen, stillen Gelehrten, der von ihnen gegangen war und dem bei seinem Lebenswerk zu helfen sie ausgezogen und hierher gekommen waren.
Kein Zweifel war möglich, daß auch er bei dieser Katastrophe den Tod gefunden hatte. Aber wie war das alles geschehen? Hatte er selbst den Untergang gewollt? Hatte die Energie gegen seinen Willen die Fesseln gesprengt? Verloren war jedenfalls sein Lebenswerk, unwiederbringlich verloren, was er in einem langen, selbstlosen Forscherleben entdeckt und geschaffen.
Verworren, traumhaft wurden ihre Gedanken. Die Natur verlangte ihr Recht. Die Übermüdung, die Überanstrengung nach vierzig durchwachten Stunden machte sich geltend. Einer nach dem anderen fiel in einen Schlummer, der bald in tiefen Schlaf überging.
Die Sterne verblaßten. Zu neuer Fahrt erhob sich die Sonne im Osten. Ihre Strahlen übergossen die Schläfer, umspülten, erwärmten sie. Blendender wurde das Licht, heißer die Sonnenglut. Da kam Leben in die Liegenden, unruhige, zuckende Bewegungen erst, ein Wälzen, ein Drehen der Körper danach. Sie öffneten die Augen und blinzelten in die blendende Helle.
Als erster sprang Klaus auf, schlug die Arme ineinander, um sich zu erwärmen, und brachte auch die anderen empor.
»Junge, Junge, hab’ ich einen Kohldampf!« Er stieß es heraus und preßte die Hände auf den Magen.
»Und ich mal erst!« pflichtete ihm Heinz bei.
»Essen müssen wir, erst mal gründlich essen! Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen«, bestätigte Fritz.
Bald flammte ein Feuer am Strand. Speisen kochten und brieten, von Heinz’ bewährten Händen betreut. Es wurde eine reichhaltige Mahlzeit, und eifrig sprachen alle ihr zu, aber es blieb ein trübseliges Mahl. Unablässig weilten ihre Gedanken bei dem Mann, der noch vor zwei Tagen hier mit ihnen zusammen gewesen, mit ihnen zusammen gegessen, gesprochen, gelebt hatte.
Nur stockend schleppte sich das Gespräch zwischen ihnen hin. Es war ja allen klar, was die nächste Zeit bringen mußte. Ihre Aufgabe auf der Insel hier war beendet, richtiger gesagt, war nicht mehr zu erfüllen, nachdem Professor Belian in loderndem Riesenbrand sein eigenes Werk und sein eigenes Ich vernichtet hatte. Sie mußten zurück in die Welt, zu den Menschen. Nur die Frage war noch offen, ob sie es versuchen sollten, mit der ›Möwe‹ wieder nach Callao zu gelangen oder durch das Gebiet der zehntausend Inseln den australischen Kontinent anzusteuern. Pläne wurden darüber gemacht und wieder verworfen. Lebhafter gingen Rede und Gegenrede hin und her. Das Leben, die Gegenwart forderten ihr Recht – auch bei Klaus. Gefühlsmäßig griff er in seine Taschen, begann nach alter Gewohnheit zu suchen, wo Pfeife und Tabaksbeutel wohl stecken möchten, fand sie natürlich nicht und begann heftig zu schimpfen.
Den anderen war nicht zum Lachen zumute, und doch konnten sie sich des Lachens nicht erwehren, als Klaus immer noch suchend und schimpfend aufsprang und am Strand hin und her lief.
»Such nicht mit den Beinen, sondern mit dem Kopf!« rief ihm Fritz zu. Klaus blieb stehen, starrte ihn groß an, dachte nach und schlug sich plötzlich vor die Stirn.
»I du Dunnerslag! Ick glöv, du hättst recht, Fritz! In der ›Möwe‹!«
Er lief zu dem Schiff, kletterte an Deck und verschwand in der Kajüte. Nur undeutlich hörten die anderen noch, wie er etwas von einer zweiten Pief vor sich hinbrummte.
»Er wird eine Weile suchen können«, meinte Heinz. »Weiß der Himmel, wo er seine zweite Pfeife verstaut hat!«
»Höchstwahrscheinlich im Vorratsraum bei unseren Kleidern«, warf Fritz ein.
Sie brauchten nicht lange zu warten. Klaus erschien wieder auf Deck und erreichte mit einem kräftigen Satz das Ufer. In der Rechten schwang er Pfeife und Tabaksbeutel. In der Linken hielt er ein Buch, einen Quartband, in starkes, braunes Leder gebunden, von einer bronzenen Schließe zusammengehalten.
»Kiek mal her, Fritz! Wat ick doar funden hebb! Dat haben wi doch goar nich an Bord hebbt!«
Er reichte das Buch Fritz hin. Der öffnete den Verschluß, schlug es auf. Auf der ersten Seite stand in den flackrigen Schriftzügen des alten Professors: »Mein Tagebuch.« Die Schriftzüge waren schon etwas vergilbt. Darunter stand in frischerer, dunklerer Tinte, als wäre es eben erst geschrieben: »Mein Vermächtnis an meinen Neffen Fritz Bergmann, der mein Werk fortsetzen und vollenden soll. Professor Doktor Max Belian.«
Erschüttert starrten sie auf das Blatt. Wann hatte der Alte das geschrieben? Wann war dieses Buch an Bord der ›Möwe‹ gekommen?
Sie blätterten weiter, und Blatt um Blatt gab ihnen Aufschluß über das Lebenswerk des Toten. Versuche, Formeln, neue Versuche. So ging es vom ersten Tag an, da die Arbeiten auf der Insel begannen, und war fortgesetzt bis zu dem letzten gelungenen Versuch, den sie noch vor wenigen Tagen gemeinsam gemacht hatten. Überall dabei genaue Angaben über die Feldstärken und die Frequenzen, die der Alte bisher geheimgehalten und nur diesen Blättern anvertraut hatte. Seitenlang danach – offensichtlich erst vor ganz kurzem geschrieben – genaue Schilderungen der Gefahren, die bei diesen Versuchen drohten, und ausführliche Angaben über ihre Verhütung.
Die Stunden verrannen, während die Freunde mit fliegenden Pulsen und bebenden Lippen das Tagebuch des Toten lasen. Fritz schlug es zu und schloß den Deckel.
»Das Vermächtnis eines großen, eines unendlich tiefen Geistes. Mir vermacht, auch euch, meinen Freunden, vermacht. Wir wollen beweisen, daß wir des Vermächtnisses würdig sind. Morgen geht’s in See, zurück nach Europa. Da wollen wir schaffen und arbeiten, wollen wuchern mit dem Pfund, das uns der Tote hinterließ.«
Am nächsten Morgen lief die ›Möwe‹ mit geschwellten Segeln aus der Barre in die offene See.
In der Kombüse stand Heinz und waltete hinter Töpfen und Pfannen seines Amtes als Koch. Am Steuerruder stand Klaus und hielt die ›Möwe‹ in vollem Wind, den Kurs nach Westen gerichtet, auf die zehntausend Inseln, den australischen Kontinent zu. In der Kajüte saß Fritz, den Kopf in die Hand gestützt. Vor ihm aufgeschlagen lag Professor Belians Tagebuch. Wieder und immer wieder las er die Seiten, rechnete nach, prüfte, studierte.