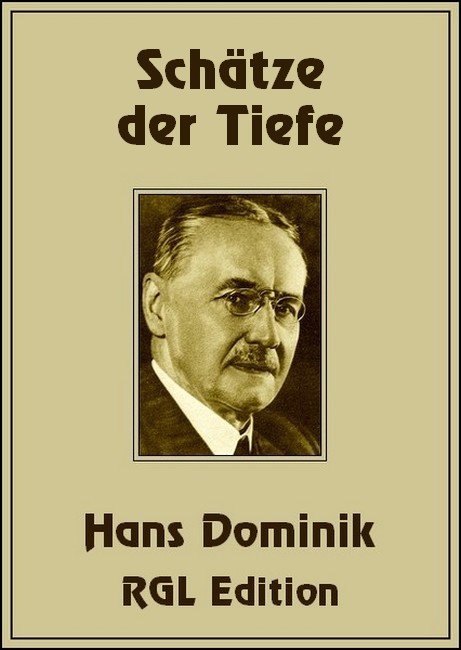
RGL e-Book Cover 2017©
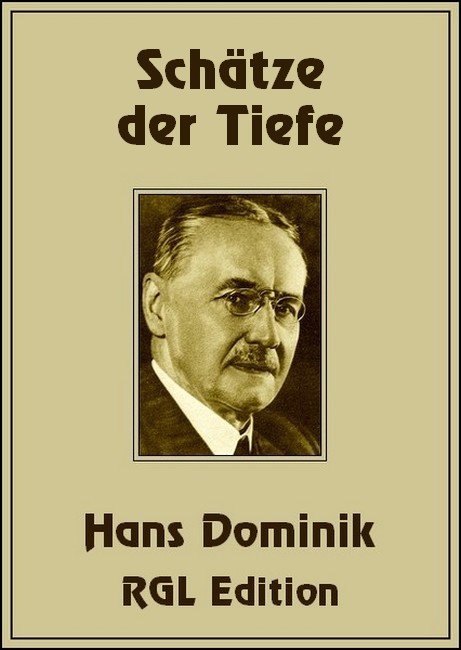
RGL e-Book Cover 2017©
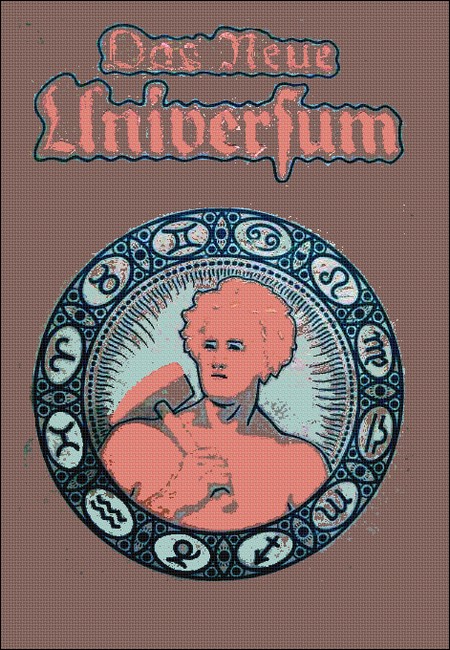
Das Neue Universum, Jahrgang 40, 1919,
mit der Erzählung "Schätze der Tiefe"
»Also«, sagte Professor Meißner, der als Volkswirtschaftler einen geachteten Namen hatte, »in spätestens siebenhundert Jahren sind die englischen Kohlenschätze, in fünfzehnhundert Jahren die deutschen abgebaut. Der Himmel mag wissen, wie wir dann ohne Kohle weiterkommen. Vielleicht daß man dann in Mittelafrika und China neue große Abbaustätten findet, aber dann wird wohl auch politische Macht und Kultur zu jenen Stätten hinwandern.«
Der Ingenieur Rudolf Engelhardt hatte bisher den Erörterungen des Professors ruhig zugehört. Jetzt nahm er seinerseits das Wort: »Wie tief, Herr Professor, liegen die tiefsten Kohlen?«
»Etwa zwölfhundert Meter, mein Freund.«
»Gut, und wir wissen, daß diese Kohlen niedergebrochene alte Wälder sind. Wir glauben annehmen zu dürfen, daß heißer Schlamm diese Wälder vor langer, langer Zeit begrub und daß der Schlamm im Laufe der Jahrhunderttausende zu Kohlenschiefer erhärtete.«
Der Ingenieur fuhr bei diesen Worten mit der Feuerzange in den Ofen und fischte ein Stück glühenden Schiefergesteins zwischen den Koksstücken heraus.
»Sehen Sie, Herr Professor, wie man an dem glühenden Stück die einzelnen Schichten unterscheiden kann. Da muß sich ganz allmählich aus einer Schlammbrühe Schicht um Schicht niedergeschlagen haben. Ganz sicher ist dieser Schiefer neptunisches Gestein und in vorsintflutlichen Meeren schon einmal gelöst gewesen. Wo er aber vordem steckte, als unsere Erde noch ein paar hundert Grad auch an der Oberfläche warm war, das weiß man wohl kaum.«
»Zugegeben, lieber Freund«, unterbrach ihn der Professor, »aber was wollen Sie damit eigentlich sagen?«
»Ich will damit sagen, daß unser ganzer Kohlenbau sich in den obersten durch hundert Sintfluten verrührten und verwaschenen Schichten bewegt, während die wahren Schätze der Erde viel tiefer liegen. Und den Beweis will ich Ihnen in der Theorie sehr schnell erbringen. Nimmt man ein sogenanntes Erdmetall, beispielsweise Kalzium oder aber auch Natrium, Kalium, Lithium oder sonst eines, zweitens Kohlenstoff und drittens Sauerstoff, bringt man diese drei Elemente in einen geschlossenen Raum und beobachtet ihr Verhalten bei steigender Temperatur, so wird bei langsamer Erwärmung zuerst eine Verbindung zwischen dem Sauerstoff und dem Erdmetall eintreten. Es bildet sich Kalziumoxyd oder dergleichen. Treibt man die Temperatur bis auf Rotglut, so zeigt auch der Kohlenstoff Neigung zum Sauerstoff. Soweit noch überschüssiger Sauerstoff vorhanden ist, wird er sich mit dem Kohlenstoff zu Kohlensäure verbinden. Soweit aber der Sauerstoff bereits mit dem Metall verbunden ist, wird er bei diesem bleiben. Und nun treiben wir die Temperatur immer höher, über die Weißglut von tausend Grad und die Blauglut von zweitausend Grad hinaus bis auf dreitausend Grad. Da trennt sich der Sauerstoff sowohl vom Metall wie von der Kohle. Dieser Stoff, der bei geringen Temperaturen so begierig ist, chemische Verbindungen einzugehen, bleibt jetzt für sich. Dafür aber verschmelzen Metall und Kohle zu einem Karbid. Kalk und Kohle bilden Kalziumkarbid, Lithium und Kohle, Lithiumkarbid und so fort.«
»Sie meinen also...«, sagte der Professor.
»Ich meine, daß in größerer Tiefe auf der ganzen Erde unendliche Karbidvorräte lagern müssen und daß es eine Aufgabe der künftigen Technik sein muß, diese Schätze für die Menschheit genauso zu erschließen, wie heute die Kohlenschätze erschlossen sind. Ich nehme an, daß es eine Zeit gegeben hat, zu der die ganze Oberfläche des Erdballes ein flüssiges Karbidmeer bildete. Auf diesem schwammen teilweise leichtere Gesteinsplatten, teilweise war die Oberfläche frei. Ich nehme an, daß die Temperatur der Oberfläche allmählich sank. Als nun die helle Rotglut mit etwa sechshundert Grad Celsius erreicht war, begann auf der gasförmigen Atmosphäre der Erde, die damals aus Stickstoff, Kohlensäure und Wasserdampf bestand, der Stickstoff auf das Karbid zu wirken und verwandelte es an der Oberfläche in Zyanamid. Es spielte sich im großen derselbe Vorgang ab, den wir heut im kleinen Maßstab künstlich bei der Herstellung von Kalkstickstoff nachahmen. Wie tief diese Umwandlung eingedrungen ist, hängt von der Zeitdauer der Einwirkung ab. Jedenfalls ging auch die Abkühlung weiter, und eines Tages war die Temperatur unter hundert Grad gesunken, das erste tropfbar flüssige Wasser konnte sich bilden. Sobald aber der erste Regen auf die Metallzyanamidebenen fiel, setzte jene bekannte Reaktion ein, die diesen Stoff in einen lockeren überaus fruchtbaren Boden verwandeln mußte. Während die Schlacken, die Granite, Basalte und sonstigen plutonischen Gesteine vom Wasser unangegriffen blieben, bildete sich an allen anderen Stellen ein fruchtbares Beet, bereit, das erste Pflanzenleben aufzunehmen.
Das ist meine Theorie, und wenn sie Ihre Zustimmung findet, Herr Professor, dann reden Sie freundlichst mit Ihren Millionären ein ernstes Wort, damit wir der Theorie die Praxis bald folgen lassen können.«
Der Schacht ›Else-Tiefbau‹ schien dem Geheimen Kommerzienrat Großmann nach seiner Unterredung mit Professor Meißner für den Bohrversuch durchaus geeignet. Denn dieser Schacht hatte bereits seine Vorgeschichte, und der Geheime Kommerzienrat selbst dachte mit einer Mischung von Ärger und Enttäuschung an vergebliche Arbeiten und vergeudete Summen, sobald ›Else-Tiefbau‹ ihm durch irgendeinen Zufall ins Gedächtnis kam. Der Grund war folgender. Die Grube ›Else-Tiefbau‹ war so ziemlich abgebaut. Bis zu einer Tiefe von zwölfhundert Metern hatte man den Hauptförderschacht heruntergebracht und in die verschiedenen Kohlenflöze die waagrechten Strecken von dem Hauptförderschacht aus geschlagen, bis dann auch die untersten Flöze abgebaut waren und das letzte Stückchen Kohle, das man von diesem Schacht aus erreichen konnte, zu Tage gefördert war. Dann kam jene berühmte Sitzung, in der die Meinungen schroff aufeinander platzten. Den Betrieb stillegen und die Reserven, die die Gewerkschaft ›ElseTiefbau‹ während der letzten dreißig Jahre beiseite gelegt hatte, als letzte Dividende an die Gewerken der Gesellschaft ausschütten, das rieten die Praktiker. Der Geheime Kommerzienrat Großmann aber wollte klüger sein als die Praktiker und verfuhr nach seinem Kopf, da er die Mehrzahl der Gewerke selbst besaß. Er wollte einfach nicht glauben, daß die Kohle bei zwölfhundert Meter Tiefe zu Ende sei und teufte daher den Schacht weiter ab. Auf dreizehn- und vierzehnhundert Meter noch mit frohem Mut, auf fünfzehn-hundert Meter mit verbissenem Grimm. So war der Hauptförderschacht von ›Else-Tiefbau‹ auf fünfzehnhundert Meter getrieben, doch nicht eine Spur von Kohle dabei gefunden worden. Schon wollte der Geheimrat die fruchtlose Arbeit aufgeben und die verlorenen Summen endgültig auf das Avalkonto schreiben lassen, als Professor Meißner zu ihm kam und ihm die Pläne Engelhardts auseinandersetzte.
Da hatte der Geheimrat sich zusammengenommen und zunächst einmal selbst weiterbohren lassen. Meter um Meter war der Schacht über die fünfzehnhundert Meter hinaus in die ewige Teufe hinein abgesenkt und der Geheimrat dabei aus einer Erregung in die andere gestürzt worden. Nach zehn Metern weiterer Bohrung hatte man ein Kohlenflöz gefunden. Aber es war nur zwei Zentimeter stark. Nach fünf Metern war man auf ein zweites Flöz gestoßen, aber es hatte nur einige Millimeter Stärke. Noch öfter waren derartig schwache, gänzlich unabbauwürdige Flöze durchfahren worden, und dann hörte der Schiefer gänzlich auf. Dann stieß der Schacht bei fünfzehnhundertfünfundvierzig Meter Tiefe in den Granit, jenes vulkanische Urgestein, in dem selbst der Geheimrat Großmann keine Kohle mehr zu vermuten wagte. Darüber aber waren die letzten Reserven von ›Else-Tiefbau‹ verbraucht, und brennender denn je stand die Frage zur Erörterung, was nun werden solle. Sollte man die Pumpen überhaupt noch in Betrieb halten, oder sollte man ›Else-Tiefbau‹ aufgeben, die Maschinen herausnehmen und die Grube ersaufen und verfallen lassen?
So lagen die Dinge, als Professor Meißner und Ingenieur Engelhardt sich, einer Einladung folgend, bei dem Geheimrat Großmann zu einer Besprechung einfanden.
Geraume Zeit ging der Geheimrat nach dem Empfang seiner Gäste schweigend in dem großen Konferenzraum auf und ab. Dann eröffnete er das Gespräch.
»Fünfzehnhundertfünfzig Meter habe ich gebohrt. Die Temperatur darf mit fünfundfünfzig Grad trotz guter Bewetterung auf der Sohle des Schachtes als recht hoch gelten. Durch den Schiefer bin ich hindurch, der Schacht steht bereits sechs Meter in reinem Granit. Was soll nun werden?«
Nach diesen Worten setzte sich der Geheimrat in einen Klubsessel und zündete sich eine Zigarre an. Nun erhob sich Rudolf Engelhardt und führte die Rede des Geheimrats da fort, wo dieser sie abgebrochen hatte.
»Das heißt also, daß der Schacht die gesamten neptunischen Schichten durchfahren hat und im plutonischen Urgestein steht. Das heißt es doch, Herr Geheimrat?«
»In der Tat, das heißt es«, entgegnete der Gefragte.
»Wir stehen also eben im Anfang des Urgesteins«, fuhr Rudolf Engelhardt fort, während er sich seinerseits in einen Sessel niederließ. »Das heißt, wir haben soeben die Schlackenschicht angeschnitten, die nach meiner Theorie über der Karbidschicht schwamm, als der Erdball noch bis zur Oberfläche feurig flüssig war. Wenn wir nun auch durch diese Schlackenschicht hindurchgehen, so müssen wir die Karbidschicht erreichen.«
»Sehr richtig«, warf der Geheimrat ein. »Aber wie dick ist diese Granitschicht, tausend Meter... zweitausend Meter... dreitausend Meter... wer kann das sagen.«
Rudolf Engelhardt zuckte mit den Achseln und erwiderte: »Das ist natürlich gänzlich ungewiß. Vielleicht fünfhundert Meter und vielleicht fünftausend. Sicher ist nur, daß eine Schicht reinen Karbids von wenigstens zwanzig bis, dreißig Kilometern Mächtigkeit zu erwarten ist, wenn wir das darüberliegende Gestein durchfahren.«
Der Geheimrat überlegte eine Weile, dann verkündete er seinen endgültigen Entschluß: »Ich stelle den Schacht ›ElseTiefbau‹ nebst den Entwässerungs- und Bewetterungsanlagen einer zu gründenden Gesellschaft gegen vier Millionen Mark Anleihe zur Verfügung. Weiteres Kapital stecke ich aber nicht in die Sache. Treffen Sie danach Ihre Dispositionen.«
»Sie sind getroffen«, erwiderte Professor Meißner. »Wir gründen eine Studiengesellschaft mit zehn Millionen Kapital. Vier Millionen bringen Sie, Herr Geheimrat, in Form des Schachtes in die neue Gesellschaft ein. Eine Million wird dem Herrn Engelhardt als sein Anteil für seine erfinderische Idee gutgeschrieben, und fünf Millionen legen meine Freunde in bar ein. Wir gründen die Gesellschaft noch heute, und vom morgigen Tage an laufen die Entwässerungs- und Bewetterungsmaschinen auf Kosten der neuen Firma. Bevor wir jetzt zum Notar fahren, noch ein kurzes Wort über die geplanten Arbeiten. Wir treiben vom Boden des Schachtes ›Else-Tiefbau‹ ein zwanzig Zentimeter starkes Bohrloch weiter. Mit fünf Millionen Mark können wir schlimmstenfalls etwa fünftausend Meter bohren. Dann wird es sich entscheiden, was weiter zu tun ist. Gelingt es uns, innerhalb der fünftausend Meter das Karbidlager zu erreichen, so muß die Studiengesellschaft sofort in eine bergbauende Gewerkschaft umgewandelt werden. Gelingt es uns nicht, dann werden wir weiter sehen. Nun kommen Sie, bitte, mit zum Notar.«
Ein Jahr war seit dieser Unterredung ins Land gegangen. Ein Jahr angespanntester Arbeit für Rudolf Engelhardt. Wir folgen ihm heute auf seiner Einfahrt in den Schacht der alten ›ElseTiefbau‹. Mit Eilzugsgeschwindigkeit bringt die elektrisch betriebene Förderschale eine kleine Gesellschaft vom Schachthaus in die Tiefe hinab. Rudolf Engelhardt, Professor Meißner und Geheimrat Großmann sind uns von früher her bekannt. Außerdem haben sich zwei andere Herren der Gesellschaft der Fahrt angeschlossen. Geheimer Bergrat Stauch und Bankdirektor Tischler, beide mit je eineinhalb Millionen an der Studiengesellschaft beteiligt.
Wärmer und wärmer wird es, während die Schale in die Tiefe sinkt. Jetzt hält sie. Auf Leitern geht es die letzten hundert Meter hinab, und dann stehen die Herren auf der völlig trockenen und sauberen Schachtsohle. Beim Schein der mächtigen Bogenlampe ist das Bohrgestänge deutlich sichtbar. Genau zwanzig Zentimeter ist das Bohrloch weit, und genau achtzehn Zentimeter ist das Bohrgestänge stark. Nur einen Zentimeter Luft gibt es allerseits zwischen Loch und Gestänge. Aus einzelnen fünfzig Meter langen, kräftigen, starkwandigen Stahlrohren ist das Gestänge zusammengeschraubt. Ziemlich genau tausend Meter ist es jetzt lang und trägt am unteren Ende die mit Diamanten besetzte Bohrkrone. Unaufhörlich drehen Elektromotoren dieses mächtige Gestänge, während sie es gleichzeitig leicht anliften und wieder hart auffallen lassen. Unaufhörlich auch dringt durch das Hohlrohr selbst ein Strom eiskalten Spülwassers in die Teufe und fließt mit Bohrschmand beladen zwischen Bohrrohr und Lochwand wieder aus dem Loch hinaus. Durchschnittlich drei Meter sind während des letzten Jahres jeden Tag gebohrt worden, und seit vier Tagen ist der Granit zu Ende. Seit vier Tagen fördert das Spülwasser nicht mehr Granitschlamm nach oben, sondern blauen Quarz. Seitdem aber läßt Rudolf Engelhardt das Spülwasser nicht mehr in den Pumpensumpf absaugen, sondern sammelt es sorgfältig in einem mächtigen eisernen Behälter, und seine Chemiker sind an der Arbeit, den Bodensatz dieses Spülwassers, eine Menge von bläulichem Schlamm, zu analysieren.
»Also hier werden unsere Millionen unter sachkundiger Leitung so langsam verpulvert«, eröffnet der Bankdirektor nach einer Pause die Unterhaltung. »Ein Jahr gleich eine Million. Die Rechnung ist einfach.«
»Und stimmt«, unterbricht ihn Rudolf Engelhardt. »Fünf Jahre zu je tausend Metern sind ja vorausgesehen. Ich könnte noch weitere vier Jahre bohren und erst dann mit der Meldung zu Ihnen kommen, daß das Geld verbraucht und das Karbid noch nicht erreicht ist. Wenn ich Sie heute schon hierher gebeten habe, und wenn ich insbesondere auch Herrn Geheimrat Stauch bat, mit zu erscheinen, so hat das seinen besonderen Grund. Der Granit, die völlig wertlose Schlacke ist bereits nach neunhundert Metern Mächtigkeit durchfahren.«
»Und dafür sind Sie auf Quarz gestoßen«, unterbrach Geheimrat Großmann den Redner. »Quarz oder Granit, das ist ziemlich gleichgültig. Beides ist wertlos und kostet uns Zeit und Geld.«
»Mit Unterschied, Herr Geheimrat. Der Granit ist wirklich wertlos. Mit dem Quarz dagegen ist es etwas ganz anderes. Mit dem blauen Quarz nämlich, Herr Geheimrat«, bei diesen Worten wandte er sich an den Bergrat Stauch, »Sie kennen das Mineral doch von Ihrer Tätigkeit in Südafrika her zur Genüge?«
Geheimrat Stauch rückte die Brille zurecht.
»Der blaue Quarz. Ich kenne ihn wohl. Er ist an und für sich genau solch wertloses Gestein wie der Granit. Aber er ist der Träger des Goldes. Das Gold hat im blauen Quarz Afrikas seine primäre Lagerungstätte. Wenn Sie hier bei uns in Deutschland blauen Quarz finden, so ist wenigstens die entfernte Möglichkeit gegeben, daß auch Gold vorhanden ist... und eigentlich ... nachdem wir in früheren Jahrhunderten in Deutschland recht bedeutende Goldmengen an ihren sekundären Lagerstellen gefunden und erwaschen haben, wäre es nur naturgemäß, wenn es sich irgendwo auch in primärer Lagerung vorfände.«
Rudolf Engelhardt winkte seinen Chemiker heran und nahm ihm ein Reagenzglas ab, in dem eine etwa linsengroße Menge eines goldig funkelnden Staubes vorhanden war.
»Kennen Sie das, Herr Geheimrat?« so sagte er, während er dem Angeredeten das Reagenzglas in die Hand gab.
»Goldstaub, wie es scheint, richtiggehender Goldstaub. Und gar nicht einmal so wenig. Lassen Sie uns einmal rechnen. Sie haben 0,3 Kubikmeter Quarz dazu benutzt oder bei einem spezifischen Gewicht dieses Gesteines von 2,5 etwa 0,75 Tonnen...«
»Sehr richtig, Herr Geheimrat«, unterbrach ihn Rudolf Engelhardt. »Und der Goldstaub in diesem Röhrchen wiegt ziemlich genau 7,5 Gramm. Wir haben einen Quarz mit zehn Gramm Gold auf die Tonne angebohrt. Das steht jetzt bereits fest, und damit ist die Abbauwürdigkeit der Quarzschicht ohne weiteres gegeben. Ich glaube, daß die Ausbeute bei weiterem Bohren auf zwanzig und mehr Gramm steigen wird, und ich denke, daß der Quarz noch einige hundert Meter weit reichen wird. Das alles kann sich naturgemäß erst in den nächsten Wochen herausstellen. Es war mir aber ein Bedürfnis, die Herren schon heute hierher zu bitten, um Ihnen zu zeigen, daß wir höchstwahrscheinlich heute schon das Vermögen der Studiengesellschaft gesichert haben, daß wir unter allen Umständen den goldhaltigen Quarz abbauen können, wenn selbst wider Erwarten das Karbidlager nicht so bald erbohrt werden kann. Ich schlage also vor, das Bohrloch noch hundert Meter weiter in den Quarz zu treiben und den erbohrten Quarzschlamm ständig auf Gold zu untersuchen. Bleiben die folgenden hundert Meter ebenso gut, wie die soeben erbohrten zehn Meter sich anlassen, so wird es sich lohnen, den Schacht zunächst um elfhundert Meter weiter abzuteufen und den Quarz bergmännisch abzubauen. Daneben bleibt uns dann noch immer das alte Ziel, das Bohrloch in dieser Tiefe von neuem anzusetzen und nach Karbid zu bohren.«
Zwei Jahre sind seit diesem Besuch der Vorstandsmitglieder der Studiengesellschaft verflossen, und in dieser Zeit ist in dem alten Schacht ›Else- Tiefbau‹ mächtig geschafft worden. Unter Anwendung der neuesten Bohrverfahren, unter Benutzung der wirksamsten Sprengstoffe ist es gelungen, den Hauptförderschacht mit einem runden Querschnitt von acht Metern im Durchmesser um volle achthundert Meter abzuteufen. Große Schwierigkeiten hat dabei die wachsende Temperatur des Erdinnern bereitet. Zwar die alte Erfahrung, daß die Temperatur auf hundert Meter Tiefe um drei Grad zunimmt, hat sich im Durchschnitt erfreulicherweise nicht bewährt. Vielmehr ist mit wachsender Teufe die Temperatursteigerung geringer geworden. Aber insgesamt hat man doch mit einem Temperaturzuwachs von ungefähr fünfzig Grad zu rechnen gehabt, das heißt, es ist nur unter Anwendung einer ausgiebigen Bewetterung möglich gewesen, in der erreichten Teufe zu arbeiten und von dem Hauptschacht her waagrechte Strecken in den goldhaltigen Quarz vorzutreiben. Aber es ist gelungen, und jetzt am Schluß des dritten Jahres nach dem Beginn der Arbeiten durch die Studiengesellschaft beginnt glückverheißend die Förderung des goldhaltigen Quarzes.
Während unter Tage die Abteufungsarbeiten kräftig vorwärts gingen, ist man auch über Tage nicht müßig gewesen. Die alten Gebäude der ehemaligen Kohlenzeche sind gründlich für den neuen Zweck umgebaut worden. Eine elektrische Zentrale von hunderttausend Pferdestärken liefert die nötige Energie und betreibt unter anderem ein Pochwerk mit tausend Stempeln, das den geförderten Quarzstein sofort zu feinem Sand zerpochen kann. Hundert Brechwerke sperren begierig ihre gefräßigen eisernen Mäuler auf und harren des Quarzsteines, den sie in Brocken bis zu Kürbisgröße verschlucken, um ihn auf Apfelgröße zerkleinert an die Pochwerke weiterzugeben. Die alte ehemalige Kohlenwäsche ist in eine moderne Amalgamierungstation umgewandelt, woselbst der von den Pochwerken kommende goldhaltige Quarzsand über Quecksilber strömt und den größten Teil seines Goldes als Goldamalgam an das Quecksilber bindet. Und schließlich bemerken wir ganz neue Anlagen, die Zyanidbottiche, in denen der Sand, nachdem ihm das Quecksilber bereits den größten Teil seines Goldes entrissen hat, noch einmal der Zyanlauge ausgesetzt und von den letzten Goldspuren befreit wird. Nach den besten Erfahrungen der südafrikanischen Goldminen ist alles eingerichtet.
In der Zentrale steht Rudolf Engelhardt, begleitet von Professor Meißner und umgeben von den Herren des Direktoriums der neuen Grube ›Else-Tiefbau‹. Denn die Studiengesellschaft hat einstweilen aufgehört zu bestehen. Eine neue Erwerbsgesellschaft ›Else- Tiefbau‹ hat sich gebildet, und schon jetzt sind die Kuxe dieses neuen Unternehmens, noch bevor sie öffentlich gehandelt werden, unter der Hand stark gefragt.
Ein Wink von Rudolf Engelhardt und die Dampfturbinen gehen an. Ein neuer Wink und die mächtigen Generatoren der Station beginnen ihren Lauf. Schalthebel werden eingeschlagen und das Netz steht unter Spannung. Fünf Minuten später beginnt ein Poltern und Krachen vom Brecherbau her. Die elektromotorisch angetriebenen Brecher sind eingeschaltet worden und zerkauen mit ihren mächtigen stählernen Kinnbacken die erste Ladung Quarzgestein. Und wieder eine halbe Stunde später mischt sich in das Krachen der Brecher das dumpfe Poltern der Stampfwerke. In rastlosem Spiel beginnen die Stempel von je zehn Zentner Gewicht auf und ab zu tanzen und zerpochen die Quarzbrocken, die ihnen vom Brecherwerk her in stetem Strom zufließen, zu feinem Mehl.
Die neue Grube ist in Betrieb, und zu einem kleinen Festmahl vereinigen sich die Direktoren danach im Zechenhaus.
»Ich denke«, so bemerkt Geheimrat Großmann, »der neue Goldbau wird uns mehr einbringen, als es die alte Kohle jemals vermochte.«
»Ich halte es für sehr bedeutungsvoll, daß Deutschland dadurch vom englischen Goldmonopol unabhängig wird«, äußert sich der Bankdirektor Tischler. »Wir können jeden Tag recht gut zweitausend Tonnen Quarz fördern. Die Tonne Gestein enthält nach unseren Analysen bis zu siebzehn Gramm Gold. Rechnen wir durchschnittlich fünfzehn Gramm, so haben wir eine tägliche Ausbeute von dreißig Kilogramm Gold. Bei unserer heutigen Valuta ist das Kilogramm Gold dreitausend Mark wert, so daß wir auf neunzigtausend Mark Goldausbeute im Tag gelangen. In dreihundert Arbeitstagen können wir also für siebenundzwanzig Millionen Mark Gold fördern. Fürwahr ein schöner Anfang.«
»Aber doch nur ein Anfang«, unterbricht Rudolf Engelhardt den Redner. »Bedenken Sie, meine Herren, daß wir den Quarzbau erst auf einer Sohle in Angriff genommen haben. Allein in den hundert Metern Tiefe, die unser Schacht jetzt durch den Quarz fährt, können wir vier weitere Sohlen anlegen und kommen damit auf über hundert Millionen Goldausbeute im Jahr. Das ist immerhin schon etwas. Eine Goldausbeute, die unserer Volkswirtschaft wohltun wird. Aber es ist nur ein kleiner Anfang, denn wir wollen ja weiter bohren. Ich persönlich halte diese Goldgewinnung für gänzlich überflüssig und bedauere die Arbeit, die wir hier aufwenden, um Unmengen von Urgestein einige Gramm Gold zu entreißen. Aber wir machen es und müssen es machen, solange das Gold einmal internationaler Wertmesser ist, solange nicht Energieträger das rote Metall verdrängen. In diesem Sinn heiße ich den Goldbau willkommen. Aber nur als Einnahmequelle, die es uns ermöglichen soll, nun weiter zu graben, bis wir die wahren Schätze der Tiefe, die Karbidlager, erreicht haben.«
Darauf wurde vereinbart, die alte Studiengesellschaft wieder aufleben zu lassen und sofort mit zehn Millionen Mark auszustatten. Es wurde ferner beschlossen, fünf vom Hundert des Reingewinnes der neuen Grube ›Else- Tiefbau‹ der Studiengesellschaft dauernd zuzuführen, und schließlich festgesetzt, daß die Arbeiten der Studiengesellschaft unverzüglich wieder weitergehen sollen.
In den folgenden vier Jahren kam Rudolf Engelhardt nicht eben viel zur Ruhe. Schon am Tage nach jener feierlichen Eröffnung der Goldgrube ›Else-Tiefbau‹ hatte er die Arbeiten der Studiengesellschaft wieder aufgenommen und zunächst die weitere Abteufung des Hauptförderschachtes durchgesetzt. Warum sollte man im goldhaltigen Quarzgestein erst die Mühe eines Bohrloches auf sich nehmen, wo doch der Betrieb der goldbauenden Gewerkschaft gebieterisch die weitere Abteufung des Schachtes verlangte. So waren tausend Meter weiterer Teufe in zwei Jahren abgesenkt worden, und dabei hatte man eine Quarzschicht erschlossen, die bis zu fünfzig Gramm Gold auf die Tonne Gestein führte. Schwierigkeiten bereitete die ständig steigende Temperatur, die jetzt bereits siebzig Grad betrug. Bei dreitausenddreihundert Meter Tiefe nahm der Quarz ein Ende, und eine glasharte Schicht begann, die einigermaßen an erstarrte Lava erinnerte und den Werkzeugen einen fast unüberwindlichen Widerstand entgegensetzte. Es war eine Gesteinsart, wie man sie auf der Erdoberfläche noch niemals gesehen hatte. Die Analysen zeigten, daß es völlig geschmolzene Kieselsäure vermischt mit Tonerde und anderen Metalloxyden sein mußte. Umfragen ergaben, daß ähnliche Zusammensetzungen sich bisweilen in der Masse der Meteorsplitter gefunden hatten.
Rudolf Engelhardt nahm die Dinge, wie sie nun einmal waren. Zweihundert Meter tief führte er den Schacht selbst noch in diese glasige Gesteinsmasse hinein. Dann stellte er den Schachtbau vorläufig ein und brachte das Bohrgestänge wieder in Anwendung. Und seit zwei Jahren mahlten nun die Diamantkronen in dem Glas, seit zwei Jahren drang ein neues Bohrloch weiter in das Erdinnere. Aber es war eine harte und nur langsam fortschreitende Arbeit. Wenn eine Bohrkrone drei Meter des glasigen Urgesteins fortgekratzt hatte, so war sie auch selbst stumpf geworden. Dann mußte das ganze Gestänge emporgewunden und eine neue Krone angesetzt werden. Das dauerte aber seine Zeit, und so verlangsamte sich der Gewinn an weiterer Teufe von Tag zu Tag. Im ersten Jahr war es noch gelungen, mit täglich vierundzwanzig Stunden Arbeit tausend Meter vorwärts zu dringen. Dann aber nahmen die Erneuerungsarbeiten des Bohrbesatzes immer mehr Zeit in Anspruch, und jetzt am Ende des vierten Jahres war eben eine Gesamttiefe von fünfzehnhundert Metern für das Bohrloch, von fünftausend Metern Gesamttiefe erreicht, und die Temperatur auf der Sohle des Bohrloches hatte die hundert Grad bereits erheblich überschritten.
Als der letzte Tag jenes vierten Jahres, gleichzeitig der Schluß des siebenten Jahres seit dem Beginn der Arbeiten überhaupt, herankam, war Rudolf Engelhardt recht mutlos. Gewiß, er hatte gehofft, in höchstens fünftausend Metern unterhalb der Sohle der alten ›Else-Tiefbau‹ das Karbid anzutreffen. Es waren also noch zwölfhundert Meter zu erbohren, bevor er eingestehen mußte, daß seine Schätzung zu niedrig war, daß das Karbid vielleicht erst in zehntausend Meter Teufe erreicht werden konnte. Aber jene fünftausend Meter waren ja auch die äußerste Grenze seiner Schätzung gewesen. Ein Maß, das ihn gegen die anderen nur decken sollte. Ganz bei sich hatte er die Erwartung gehegt, daß es ihm schon viel früher gelingen werde, das Karbid zu finden. Den Goldquarz hatte er als glücklichen Zwischenfall gern mitgenommen. Aber was die Leute dort fünfhundert Meter über seiner Bohrstelle trieben, das interessierte ihn letzten Endes doch nur soweit, als es ihm eben die Möglichkeit bot, selber seinem Ziel nachzustreben. Dieses Ziel aber war und blieb das Kalziumkarbid, das blieben jene gewaltigen Karbidlager, die sich nach seiner Theorie unbedingt unter einer Schlacke finden mußten. Und weil diese Lager sich nun vor seiner unermüdlich schürfenden Arbeit gewissermaßen zu verstecken schienen, weil er ihnen in siebenjähriger Arbeit immer noch nicht näher gekommen war, darum verbrauchte Rudolf Engelhardt den siebenten Jahrestag seiner Arbeiten auf diesem Gebiet in recht bedrückter Stimmung.
Am 14. Juli, etwa fünfzehn Wochen nachdem die Studiengesellschaft in das achte Jahr ihres Bestehens eingetreten war, zeigte sich bei den Bohrarbeiten eine Veränderung, die den beaufsichtigenden Ingenieur veranlaßte, Rudolf Engelhardt schleunigst telefonisch herbeizurufen. In sausender Fahrt brachte diesen der Förderschacht in die Tiefe, und nach einem letzten Abstieg über die Leitern stand er an der Bohrstelle. Der Ingenieur Vollmar trat ihm aufgeregt entgegen.
»Herr Engelhardt, ich glaube, durch die Lava sind wir glücklich hindurch. Heut früh begann das Wasser weißschäumig aus dem Bohrloch zurückzufließen. Auch machte der Bohrer viel schnellere Fortschritte. Ich habe Sie danach sofort telefonisch angerufen. Inzwischen aber ist der Bohrer um volle zehn Meter vorwärts gekommen. Es scheint, als ob wir wirklich Karbid gefaßt haben, als ob das Wasser da unten eine Zersetzung einleitet. Die oberflächliche chemische Untersuchung ergibt in der Tat Kalkwasser und Blasen eines brennbaren Gases. Ich habe den Wasserzufluß sofort nach dem Auftreten der ersten Erscheinungen abgestellt und den Bohrer trocken weiterarbeiten lassen.«
»Gut so«, unterbrach ihn Rudolf Engelhardt. »Immerhin sind einige Kubikmeter Wasser im Bohrloch und werden in das Karbid eine gehörige Höhle fressen. Nun vor allen Dingen schweres Teeröl heran, damit wir das Wasser herausspülen und unter dem Schutz des Öles einige Bohrproben zu Tage fördern.« Die nächsten vierundzwanzig Stunden verflossen für Rudolf Engelhardt in fieberhafter Arbeit. Das Wasserrohr, das bis dahin frisches Spülwasser in das Bohrloch geliefert hatte, mußte seiner ganzen Länge nach bis über Tage vom Wasser entleert und an einen Teerölbehälter angeschlossen werden. Dann begann das schwere Teeröl durch das Rohr in die Tiefe zu fallen, und nach einer Stunde quoll es breiig und schlammig neben dem Rohrgestänge wieder hervor. Aber schon waren inzwischen Behälter aufgestellt worden, in denen dieses Öl aufgefangen und von den Chemikern der Studiengesellschaft sofort untersucht wurde. Jede Spur von Wasser hatte sich inzwischen dort unten mit dem Kalziumkarbid verbunden. Kalkschlamm war in der Tiefe zurückgeblieben. Azetylengas war durch das Bohrloch nach oben entwichen. Jetzt begann das Teeröl den Kalkschlamm aufzurühren und ebenfalls mit nach oben zu reißen. Dick und weiß legte sich die schlammige Brühe in die Bottiche. Dann floß das Öl klarer, und endlich kam es so klar wieder heraus, wie es in das Bohrgestänge hineingelassen wurde.
Jetzt ließ Engelhardt den Bohrer wieder arbeiten und entdeckte, daß der Widerstand zwar geringer geworden war als die vorangegangenen sechzehnhundert Meter, daß aber immer noch reichlich viel Widerstand vorhanden war. Und dann wurde der Ölstrom wieder angelassen und förderte den Bohrschmand als ein schwärzliches, im Öl suspendiertes Pulver zu Tage. Die Stunden verstrichen und immer noch stand Rudolf Engelhardt am Bohrort und betrachtete die zu Tage tretende dunkel getrübte Ölflut, während die Chemiker bereits in einem anderen Bottich das klare Öl vom Bodensatz abzogen, den Bodensatz zusammenkratzten und in Platinschalen sammelten.
Dann wurde im Laboratorium der ölige Schlamm zunächst einmal in der blauen Flamme der Bunsenbrenner geglüht, damit jede Spur von Öl daraus entfernt wurde. Und dann... es war am Mittag des zweiten Tages... stand Rudolf Engelhardt vor einer mit Wasser gefüllten Maßflasche und brachte mit einer Pinzette einzelne Stückchen jener dunklen porösen Masse unter das abschließende Quecksilber der Wanne, um sie danach frei emporsteigen zu lassen. Sowie jene Stückchen aber in das Wasser der Maßflasche traten, begannen Sie alsbald gewaltig zu gasen und dabei immer kleiner zu werden, während das Wasser sich weißlich färbte. Dann drehte Rudolf Engelhardt einen Hahn auf, zündete ein Streichholz an und gleich danach strahlte das hellweiße Azetylenlicht aus einem Schmetterlingsbrenner.
Die letzten Zweifel waren behoben. Am Nachmittag des 15. Juli wußte Rudolf Engelhardt, daß er in fünftausendeinhundert Meter Teufe das als sicher vorhanden vermutete Karbidlager auch tatsächlich erbohrt hatte. Nur zur größeren Sicherheit ließ er den Bohrer noch bis in den August hinein weiterarbeiten und hundertfünfzig Meter Mächtigkeit des Karbidlagers bohrtechnisch feststellen. Um die Mitte des August konnte er die Gesellschafter der Studiengesellschaft zusammenrufen und ihnen die Ergebnisse der bisherigen Bohrung sowie die Vorschläge für weitere Arbeiten unterbreiten.
Drei Jahre sind seit jener Sitzung des Aufsichtsrates der Studiengesellschaft ins Land gegangen. Für Rudolf Engelhardt waren es in der Hauptsache ruhige Zeiten, in denen er von quälender Verantwortung frei sein Leben genießen konnte. Während der Schöpfer dieses ganzen Werkes seine Tage in ruhigem Dasein verbrachte, arbeiteten auf der Zeche ›Else-Tiefbau‹ die Belegschaften mit drei Schichten von je acht Stunden unermüdlich am Absenken des Schachtes. Sie übernahmen den Bau in dreitausendfünfhundert Meter Teufe am Ende der goldhaltigen Quarzschicht und sprengten hier an der Grenze der Lavaschicht erst einmal eine Maschinenhalle von hundert Metern im Geviert Grundfläche und dreißig Meter Höhe aus, um einen bequemen Arbeitsort und den Raum für die Aufstellung der neuen Fördermaschinen zu gewinnen. Dann aber wurde der eigentliche Schacht vorgenommen und in der alten Mächtigkeit von acht Metern im Durchmesser mit rundem Querschnitt durch die Lavamasse vorgetrieben. Unaufhörlich ratterten die Bohrmaschinen, hatten sie zwei Meter gebohrt, so wurde die Dynamitladung eingebracht und das Gestein auf zwei Meter Tiefe weggeschossen. Es folgte das Abräumen der Gesteinstrümmer, und zwei Stunden später waren die Bohrmaschinen schon wieder an Ort und Stelle und begannen ihre Arbeit von neuem.
So ging es unaufhörlich das erste und das zweite Jahr. Dann war die Grenze der Lavaschicht erreicht, und an Ort und Stelle konnte man sich überzeugen, wie das Wasser in dem ehemaligen Bohrloch gewirkt hatte, als es auf das Karbid getroffen war. Wie etwa ein hohler Zahn sah die Grube hier aus. Eine Höhlung von gut einem Meter im Durchmesser und zwei Metern in der Länge war zackig und unregelmäßig in das Gestein gefressen, bis dann das Öl dem Wasser das Handwerk gelegt hatte, und das Bohrloch wieder glatt und sauber weiterführte.
Bis zur Grenze der Lavaschicht war der Schacht im Laufe von zwei Jahren abgeteuft, und durch Berieselung der Wände hatte man bis hierher der wachsenden Temperatur Herr werden können. Sobald aber die Grenze der Lavaschicht erreicht war, mußte jedes Wasser sorgfältig ferngehalten werden. Anstatt dessen legte man an den Wänden des Schachtes eiserne Röhren, die von gewaltigen Kältemaschinen ständig mit einer etwa dreißig Grad kalten Salzlösung gespeist wurden. Auf diese Weise herrschte im Schacht selbst eine annehmbare Temperatur, während das Gestein an der unteren Grenze der Lavaschicht doch bereits hundertfünfzig Grad hatte. Danach brachte man die Schachtzimmerung bis zur Grenze der Lavaschicht ein und setzte die neuen Fördermaschinen in Betrieb. Am Ende des dritten Jahres konnte die Karbidförderung aufgenommen werden. Schon während der eigentliche Förderschacht endgültig fertiggestellt wurde, hatte man in der Karbidschicht selbst vier gradlinige Strecken nach den vier Himmelsrichtungen angelegt und jede derselben zweihundert Meter weit in das Karbid vorgetrieben. Jetzt wurden in je fünfzig Meter Abstand Querschläge angesetzt, die diese Hauptstrecken unter sich verbanden, und nun konnte die eigentliche Förderarbeit beginnen.
Im Gegensatz zur Kohle, die ja immer nur in dünnen Flözen vorkommt, hatte man hier ein mächtiges natürliches Lager von unabsehbarer Ausdehnung vor sich. Die Studiengesellschaft hatte alles in allem etwa dreißig Millionen verbaut. Dafür aber war nun ein Lager erschlossen, dessen Mächtigkeit jeden Gedanken einer Erschöpfung innerhalb irgendwelcher angebbaren Zeit zunichte machte. Man war ja in das natürliche Karbidlager gekommen, das die ganze Erdoberfläche ziemlich gleichmäßig bedecken und in unbekannte Teufen reichen mußte.
Freilich machte der Abbau noch einige Schwierigkeiten, denn das Karbid hatte an den soeben bloßgelegten Flächen eine Temperatur von hundertfünfzig bis hundertachtzig Grad. Besonders zum Schießen mußten Sicherheitssprengstoffe verwandt werden, die bis zu zweihundert Grad völlig explosionssicher waren. Dafür aber war die Ausbeute auch über die Maßen vorteilhaft. Unter Zugrundelegung des alten Satzes, daß drei Kilogramm Karbid beim Zusammenbringen mit Wasser einen Kubikmeter Gas ergeben, lohnte es sich durchaus, die erhöhten Kosten für die Förderung und Kühlung in Kauf zu nehmen.
Als daher an einem Sonntag jenes dritten Jahres der Betrieb in vollem Gange war und die Direktoren der dritten Zeche ›Else-Tiefbau‹ sich versammelt hatten, konnte Rudolf Engelhardt mit Recht zu der folgenden Ansprache das Wort ergreifen.
»Meine Herren. Am heutigen Tag beginnt ein neuer Zeitabschnitt in der Technik der Völker. Wir haben als die ersten den Entschluß gefaßt, die weite öde Strecke zwischen der unteren Kohle und dem obersten Karbid zu durchstoßen. Andere werden uns an anderen Stellen zweifellos folgen. Das natürliche Karbid wird in der Technik an die Stelle der Kohle treten, und es ist glücklicherweise so reichlich vorhanden, daß wir mit einer Erschöpfung der Lager nie zu rechnen brauchen.
Eine neue Technik beginnt mit dem heutigen Tag. Einstweilen wird unsere Förderung gern von den zahlreichen Werken für die autogene Schweißung aufgenommen, die bisher auf das künstliche Kalziumkarbid angewiesen waren. Aber ich hoffe, daß wir bald genügend fördern werden, um auch anderen Zweigen der Technik den neuen Stoff in ausreichendem Maß zur Verfügung stellen zu können. Großgasmaschinen werden künftig mit dem Azetylengas des natürlichen Kalziumkarbides laufen. Die Gasanstalten werden nicht mehr Kohle, sondern Kalziumkarbid beziehen und reines Azetylengas in ihre Rohrnetze senden. Sogar der Hausbrand wird durch Kalziumkarbid ersetzt werden, und die heiße Azetylenflamme wird an Stelle der Kohlengase die Stubenöfen erwärmen. Meine Herren, wir stehen am Anfang einer neuen technischen Zeit, die glücklich und segenbringend für die Menschheit werden möge.«