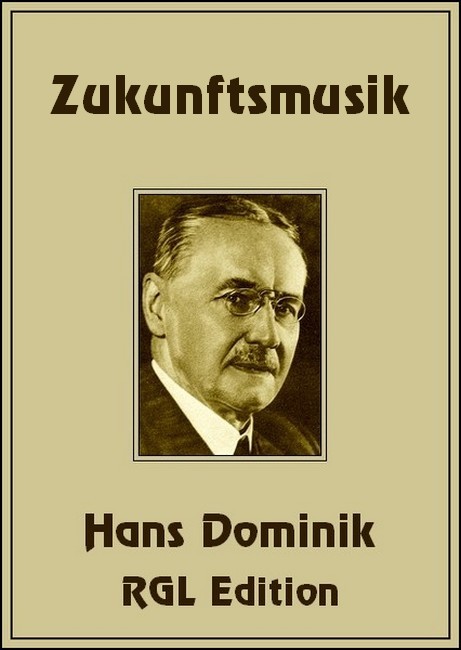
RGL e-Book Cover 2017©
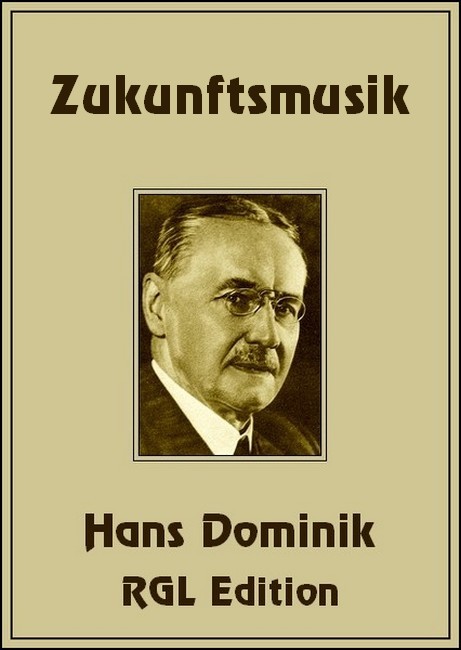
RGL e-Book Cover 2017©
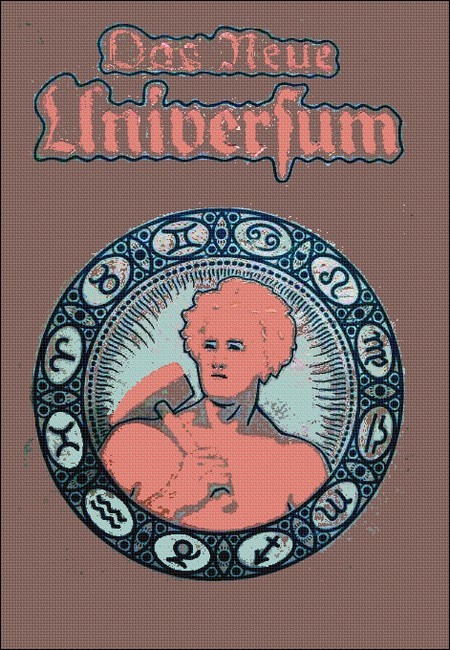
Das Neue Universum, Jahrgang 42, 1921,
mit der Erzählung "Zukunftsmusik"
Professor Hansen rückte sich in seinem Klubsessel bequem zurecht, um in längerer Rede auf die letzten Ausführungen seines Kollegen, des Professors Barella, näher einzugehen.
»Sie behaupten, die Kämpfe, die den kranken Leib Europas nun schon seit beinahe zehn Jahren in immer neuen Fieberschauern erzittern lassen, drehten sich letzten Endes um die Energievorräte, um die Kohlenlagerstätten. Mag sein, daß Ihre Theorie richtig ist. Aber das ändert nichts an der Tatsache, daß die Menschen dann eben verblendet sind, daß sie um die paar Energiequellen, die sie handgreiflich vor Augen haben, einander erschlagen und darüber die unendlich viel größeren, bis jetzt noch unerschlossenen Quellen achtlos beiseite lassen...«
»Zukunftsmusik, lieber Kollege«, warf Barella ein. »Sie sind Physiker und ich bin Volkswirtschaftler. Man nennt die Physik eine exakte Wissenschaft, und man wirft der Volkswirtschaft oft vor, daß sie allzu subjektiv arbeite, daß sie allzu eng mit dem Tun und Treiben der Menschen verflochten sei und daher alle Augenblicke umlernen müsse. Aber jetzt möchte ich doch behaupten, daß meine Wissenschaft die exaktere sei und daß ihr Physiker euch in fantastischen Theorien ergeht und allen wirklichen Boden unter den Füßen verloren habt. Als Volkswirtschaftler sage ich mir, daß allein die Kohle die jederzeit greifbare Energiequelle ist. Dabei weiß ich, daß ein Kilogramm Steinkohle achttausend Kalorien enthält, die frei werden, wenn ich dies Kilogramm vollständig zu Kohlensäure verbrenne. Ich weiß ferner, daß eine Kalorie gleichwertig einer mechanischen Arbeit von vierhundertvierundzwanzig Meterkilogramm ist. Ein Kilogramm Kohle liefert mir also 3,4 Millionen Meterkilogramm. Von dieser theoretischen Energiemenge kann ich in unseren landläufigen Wärmekraftmaschinen nur etwa zwanzig vom Hundert, also sechshundertachtzigtausend Meterkilogramm nutzbar machen. Nur mit dieser nutzbar gemachten Energie darf ich als exakter Volkswirtschaftler praktisch rechnen. Was bedeutet also ein Kilogramm Steinkohle für mich? Auch hierfür gibt die Rechnung schlüssige Antwort. Eine Pferdestärke bedeutet eine Leistung von fünfundsiebzig Meterkilogramm in der Sekunde. Da die Stunde dreitausendsechshundert Sekunden hat, so ist also eine Pferdekraftstunde gleich einer Arbeitsmenge von zweihundertsiebzigtausend Meterkilogramm, und ich kann mit meinem Kilogramm Steinkohle Maschinenarbeit im Betrag von zweieinhalb Pferdekraftstunden wirklich und praktisch jederzeit erzeugen. Das allein ist Tatsache, mein lieber Kollege von der anderen Fakultät, und alles übrige ist, wie gesagt, Zukunftsmusik. Wir dürfen uns daher wirklich nicht wundern, wenn die Menschheit wie wild um die Kohlenschätze rauft.«
Professor Hansen hatte dem Erguß seines Gegenübers geduldig zugehört.
»Alles sehr schön«, erwiderte er nun. »Noch vor zehn Jahren hätten Sie mit dieser Anschauung recht behalten. Inzwischen ist aber die Welt und mit ihr auch die physikalische Wissenschaft ein gutes Stück weitergekommen. Man hat inzwischen die Elektronentheorie ausgebaut, und man hat in der Relativitätstheorie eine ganz neuartige Naturanschauung erschlossen, die alles Geschehen viel universeller erfaßt und erklärt als die bisher übliche ältere Newtonsche Weltanschauung.«
Professor Barella zog an seiner Zigarre und murmelte etwas Unverständliches in den Bart.
»Brummen Sie nicht, Kollege«, unterbrach ihn Hansen. »Trinken Sie erst Ihren Kaffee und dann hören Sie mich in Ruhe an. Bei aller gegenwärtigen politischen und wirtschaftlichen Unerfreulichkeit leben wir doch wissenschaftlich augenblicklich im blühenden Frühling. Unsere Zeit gleicht etwa derjenigen um 1550, da es politisch auch wenig schön aussah. Damals brachen die Lehren eines Kopernikus und seiner Nachfolger sich eben mühsam Bahn. Auch damals erklärte der sogenannte gesunde Menschenverstand jeden für töricht, der die allgemein gültige Ansicht, daß die Erde der Mittelpunkt des Weltalls sei, anzuzweifeln versuchte. Wer damals von der Kugelgestalt der Erde sprach und behauptete, daß ›oben‹ und ›unten‹ nur relative Begriffe wären, dem wurde das Widersinnige sofort klargelegt, man zeigte einfach nach oben beziehungsweise unten und behauptete, daß das doch grundverschiedene Begriffe wären. Na... Sie wissen ja, wie sich die Sache weiter entwickelt hat. Kopernikus stellte die Lehre auf, Kepler kleidete sie in mathematische Form, und Newton entwickelte die Lehre von der allgemeinen Anziehungskraft, schmiedete sich das Werkzeug der Infinitesimalrechnung und begründete die mathematischen Formeln Keplers durch seine Gravitationstheorie in bündigster Weise. Sie wissen auch, daß der wissenschaftliche Frühling, der damals anbrach, nicht auf die Theorie beschränkt blieb, sondern reiche praktische Früchte zeitigte. Die Erkenntnis von der Kugelgestalt der Erde führte zu den Entdeckungsfahrten nach Amerika und Australien. Neue Länder wurden erschlossen, und ein Strom von Gold ergoß sich über Europa, demgegenüber alle Schätze des alten Roms und Indiens verblassen.«
Professor Barella zuckte unwillig mit den Achseln.
»Ob dieser Goldstrom ein Glück für die Menschheit war, das möchte ich gerade als Volkswirtschaftler füglich bezweifeln. Andererseits ist freilich nicht zu leugnen, daß die theoretischen Spekulationen des Kopernikus weittragende praktische Folgen gehabt haben...«
»Nun kommen wir der Sache schon ein wenig näher«, nahm Hansen den Faden des Gespräches wieder auf. »Und ich sage Ihnen, daß auch die jetzige neue Theorie tiefeinschneidende praktische Folgen haben wird. Wir wissen nach dieser Theorie, daß die Masse eines Körpers und die Energie wesensgleich sind. Nicht mehr das Gesetz von der Erhaltung der Energie und dasjenige von der Erhaltung der Masse gelten getrennt, sondern nur die Summe von Masse und von Energie ist unveränderlich. Ein Körper kann Energie abgeben und seine Masse wird dabei ständig geringer, bis sie schließlich gleich Null geworden, bis der Körper aus der existierenden Welt verschwunden ist. Messen wir die Masse eines Körpers in Kilogrammen und die Lichtgeschwindigkeit in der Sekunde in Meter, so ist die in irgendeinem Körper schlummernde Energie gleich einer Masse, multipliziert mit dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Und nun will ich Ihnen Ihre Rechnung mit dem Kilogramm Kohle noch einmal nach der neuen Theorie wiederholen. Ein Stück Kohle im Gewicht von einem Kilogramm hat, wie Sie wissen, eine Masse von etwa hundertvier Gramm oder 0,104 Kilogramm. Ich erhalte die Masse, indem ich das Gewicht durch die am Wiegungsort herrschende Intensität der Schwerkraft, also durch 9,81 dividiere. Die Lichtgeschwindigkeit beträgt dreihundert Millionen Meter in der Sekunde. Diese Geschwindigkeit im Quadrat ergibt neunzigtausend Billionen. Diese Ziffer mit 0,104 Kilogramm multipliziert, ergibt neuntausenddreihundertsechzig Billionen Meterkilogramm. Das aber, mein lieber Herr Kollege, ist denn doch recht erheblich viel mehr, als die 3,4 Millionen Meterkilogramm, die Sie bei vollkommener Verbrennung aus dem Kilogramm Kohle herausholen können. Es ist nämlich 2,7 Milliarden mal soviel.«
Professor Barella war aufmerksam geworden.
»Eine bedeutende Zahl, in der Tat«, murmelte er. »Bitte fahren Sie in Ihren Auseinandersetzungen fort.«
»Das soll sehr schnell geschehen. Die jährliche Kohlenförderung Deutschlands vor dem Krieg betrug zweihundert Millionen Tonnen oder zweihundert Milliarden Kilogramm. Diese ganze gewaltige Kohlenmenge wurde zu Kohlensäure verbrannt, ein Verfahren, das zwar auf die Länge der Zeit unser Klima günstig beeinflussen muß, aber im übrigen wenig wirtschaftlich ist. Wenn Sie dagegen die geringe Menge von vierundsiebzig Kilogramm oder eineinhalb Zentner Steinkohle restlos zerbrechen, wenn Sie also nicht nur die Moleküle dieser Kohlenmenge umlagern, wie dies bei der Verbrennung geschieht, sondern auch ihre Atome zersplittern und in Nichts auflösen, dann werden Sie aus diesen eineinhalb Zentnern genau die gleiche Energiemenge freimachen können, die Sie durch die Verbrennung jener zweihundert Milliarden Kilogramm gewonnen haben. Ich denke, diese Rechnung verlohnt sich wohl der Mühe. Mit einer Menge Kohlen, die Sie im Handkoffer noch zur Not fortschaffen können, können Sie den Energiebedarf ganz Deutschlands für ein volles Jahr decken. Und – noch eins – es braucht keine Kohle zu sein. Nur auf die Masse kommt es an. Mit eineinhalb Zentnern Kieselsteinen oder Seewasser oder Luft können Sie die gleiche Wirkung erreichen. Es kommt nur darauf an, ein Verfahren zu finden, bei dem die Atome dieser eineinhalb Zentner wirklich in Nichts zersplittern und ihre Arbeit in nutzbringender Form von sich geben. Die Lösung dieser Aufgabe, die ich Ihnen hiermit erläutert habe, ist nicht meine Sache, sondern die der künftigen Technik. Als Theoretiker überschaue ich die Dinge nur und erblicke schon jetzt die großen Zukunftsmöglichkeiten, die die Theorie uns erschließt. Kommt alles so, wie ich es mit Sicherheit erwarte, so gehen wir einem technischen Zeitalter entgegen, demgegenüber die ganze Dampftechnik der letzten hundertfünfzig Jahre überhaupt nur eine verschwindende Episode bedeutet. Und darum, lieber Freund, betrachte ich auch die gegenwärtigen Kämpfe um die Kohlenlager der Welt nur für ein sehr vorübergehendes Zwischenspiel, zwar peinlich für die augenblicklich davon Betroffenen, aber höchst gleichgültig für die weitere Entwicklung der Menschheit.«
Wir befinden uns im Laboratorium des Professors Hansen. Ein neuzeitliches Laboratorium, das sich in mancher Beziehung von älteren derartigen Instituten unterscheidet. Zwar gibt es auch hier allerlei Retorten, Reagenzgläser, Maßgefäße und so weiter. Aber den Kernpunkt bilden doch die elektrischen Einrichtungen. Hier sieht man ein Induktorium, das eine Spannung von einer halben Million Volt erzeugen kann. Hier finden sich alle Vorrichtungen, um Glas zu schmelzen und zu blasen, und hier stehen endlich jene modernsten Luftpumpen, die sich zur alten zweistiefligen Laboratoriumsluftpumpe ungefähr verhalten wie ein modernes Schnellfeuergewehr zu einem alten Vorderlader mit Steinschloß. Luftpumpen, mit denen es möglich ist, den Gasdruck in einem Glasgefäß auf den hundertbillionsten Teil des atmosphärischen Druckes zu verringern. Das will aber immerhin schon etwas heißen. Bei gewöhnlichem Atmosphärendruck sind ja in einem Kubikzentimeter mit irgendeinem Gas gefüllten Raumes sechsundzwanzig Trillionen Moleküle enthalten. Es ist dies die berühmte Loschmidtsche Zahl. Wenn also der Druck auf ein Hundertbillionstel verringert wird, so sinkt die Zahl der Moleküle im Kubikzentimeter auf zweihundertsechzigtausend. Wir sind zwar noch himmelweit von dem sogenannten absoluten Vakuum entfernt, wie wir es uns etwa im Weltraum vorstellen, aber wir haben doch schon eine ganz achtunggebietende Leere erzeugt, in der sich die einzelnen Moleküle ganz anders bewegen können als in dem Gewimmel bei atmosphärischem Druck.
In solchem Laboratorium treffen wir Professor Hansen mit seinem Assistenten bei der Arbeit. Eine Glasröhre von etwa fünfzig Zentimeter Länge und vier Zentimeter im Durchmesser ist erst mit reinem Stickstoff gefüllt und dann mit Hilfe der Luftpumpen wieder nach Möglichkeit evakuiert worden.
»Es liegt mir daran«, wendet der Professor sich jetzt an seinen Assistenten, »vor allen Dingen erst einmal den klassischen Versuch von C. Rutherford nachzuprüfen. Wie Sie wissen, vertritt C. Rutherford die Theorie, daß das Stickstoffatom aus Helium- und Wasserstoffatomen aufgebaut ist, die um einen gemeinschaftlichen Schwerpunkt kreisen und durch dazwischengelagerte Elektronen verkuppelt sind. Der Bau des Stickstoffatoms ist aber so solid, daß man ihn mit den gangbaren physikalischen und chemischen Mitteln nicht zertrümmern kann. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Man muß fremde freie Elektronen mit annähernder Lichtgeschwindigkeit auf das Stickstoffmolekül abschießen. Millionenmal wird man es überhaupt nicht treffen. Hunderttausendmal wird man es treffen, aber man wird keinen lebenswichtigen Teil des Atoms berühren und der Schuß wird wirkungslos abprallen. Einmal vielleicht unter einer Milliarde von Schüssen wird man glücklicherweise eins der kuppelnden Elektronen erwischen, und dann kann dieses wohl von dem mit Lichtgeschwindigkeit heranstürmenden fremden Elektron aus dem Atomgefüge mit herausgerissen werden, dann kann es uns vielleicht gelingen, den ganzen Atombau zum Einsturz zu bringen und freie Heliumund Wasserstoffatome zu erhalten. Diesen Versuch, mein Herr, wollen wir jetzt machen. Ich werde also die Wolframkathode in der Stickstoffröhre mit Hilfe des elektrischen Stromes zum Glühen bringen. Ich werde den hochgespannten Strom des Induktoriums durch die Röhre schicken. Negativ geladene Elektronen müssen dann mit Lichtgeschwindigkeit aus dem glühenden Wolfram hinausfliegen und durch die Röhre sausen. Neben der Röhre steht ein Spektroskop, durch das ich Sie bitte, die Röhre zu beobachten. Sobald nach dem Einschalten des Stromes neben den Stickstofflinien des Spektrums Heliumoder Wasserstofflinien auftreten, geben Sie mir ein Zeichen.«
Nach dieser Erklärung schaltete Professor Hansen den Heizstrom ein, und das Kathodenblech der Röhre glühte dunkelrot auf, um allmählich in Gelbglut und helle Weißglut überzugehen. Danach setzte er das Induktorium in Betrieb. Es war nach der praktischen Erfindung von Professor Dessauer gewickelt und gab die enorm hohe Spannung von einer halben Million Volt. Alsbald erglühte das Ende der Röhre, an dem die von der Kathode weggeschleuderten Elektronen das Glas trafen, in hellem, grünem Licht. Nach außen hin ging hier von diesem Röhrenende, durch die aufprallenden Elektronen erregt, eine äußerst harte und starke Röntgenstrahlung aus, die Professor Hansen veranlaßte, eine schwere Bleikappe über dies Röhrenende zu schieben. Dann ließ er das Induktorium ruhig weiter spielen und machte es sich in seinem Sessel bequem.
»Wasserstoff«, murmelte der Assistent, »eben habe ich die drei charakteristischen Linien rot, grün und blau aufleuchten sehen. Jetzt sind sie wieder verschwunden. Jetzt waren sie wieder da.«
Professor Hansen nahm ein Taschenspektroskop vom Tisch und visierte auch seinerseits die Röhre an. Die Beobachtung stimmte. Neben den zahlreichen Linien des Stickstoffes waren die drei Wasserstofflinien ebenso unverkennbar wie die Heliumlinien. Die Zerschmetterung des Stickstoffes, jenes chemischen Elementes in zwei andere chemische Grundstoffe, war zweifellos zum Teil gelungen.
»Rutherford hat also recht«, wandte sich Professor Hansen an seinen Assistenten. »Es gibt ein Mittel, um die Atome aufzubrechen, und dieses Mittel ist das mit Lichtgeschwindigkeit fliegende freie Elektron. Die Nachprüfung des Versuches ist einwandfrei gelungen. Mancherlei ist erreicht, aber unendlich viel bleibt noch zu tun.«
Der Assistent räusperte sich. »Ich meine, Herr Professor, man müßte es einmal mit gewaltigen Drucken und hohen Temperaturen versuchen. Wenn man den Stickstoff etwa auf tausend Grad erhitzte und gleichzeitig auf tausend Atmosphären zusammenpreßte, so müßte er sich doch am Ende auch in seine Bestandteile auflösen.«
»Ganz verkehrt, mein Lieber«, fiel ihm der Professor ins Wort. »Druck und Hitze sind physikalische Mittel, mit denen Sie allenfalls die Moleküle, aber niemals die Atome beeinflussen können. Soviel wissen wir nun wenigstens vollkommen sicher. Unser nächster Schritt muß eine genaue Buchführung über die verbrauchten und die gewonnenen Energien liefern. Weiter empfehle ich Ihnen auf das angelegenste das Studium der verschiedenen Spektra, und endlich müssen wir jetzt darangehen, die schwereren Elemente, beispielsweise Blei, in Dampfform in die Röhre zu bringen und dem Anprall der Elektronen auszusetzen. In dieser Richtung müssen sich unsere Arbeiten in der nächsten Zeit bewegen, wobei ich bemerken möchte, daß diese nächste Zeit vielleicht einen Zeitraum von zwanzig Jahren umfassen kann.«
Jahre waren seit diesem Versuch verflossen. Zwar nicht zwanzig, aber doch immerhin deren fünf waren ins Land gegangen, als Hansen mit seinem Freund Barella zusammen das Laboratorium betrat. Hansen ergriff ein langes evakuiertes Rohr und zeigte es seinem Freund.
»Sie sehen hier eine der gewöhnlichen Kathodenröhren. Die Kathode besteht aus Wolfram und ist mit einem Bleiüberzug versehen. Die Evakuierung dieser Röhre ist ungemein weit getrieben. Es befinden sich kaum noch ein paar tausend Gasmoleküle in ihr. Ihr Widerstand gegen den Durchgang des elektrischen Stromes ist daher auch ganz außerordentlich hoch. Sie sehen, daß diese Röhre ungefähr ein Meter lang ist. Ich schalte jetzt die Spannung des Induktoriums auf das Rohr und habe neben und parallel zu ihm eine freie Funkenstrecke in der Luft. Sie sehen, daß der Strom sich mit Gewalt in Form knallender Funkenentladungen durch die atmosphärische Luft Bahn bricht und das beinahe absolute Vakuum in der Röhre nicht zu überspringen vermag. Jetzt aber will ich ganz allmählich den Heizstrom einschalten und die Kathode etwas erhitzen. Der Zweck dieser Erwärmung ist ein doppelter. Einmal werden durch die Wärme die Elektronen in der Kathode so weit gelockert, daß sie von der elektrischen Spannung fortgeführt werden können. Es muß also ein Stromübergang in der Röhre zustande kommen. Ferner aber wird durch die Hitze auch eine kleine Spur des Bleiüberzuges verdampft. Eine kleine Spur heißt immerhin, daß sich ein paar Millionen Bleidampfmoleküle in dem Rohr befinden. Wie Sie sehen, steht mein Rohr senkrecht und die Wolframkathode bildet gewissermaßen ein Becherchen, in dem sich das unter dem Einfluß des Heizstroms schmelzende Bleitröpfchen sicher hält, ohne auf die Glaswandung der Röhre hinabzutropfen. Es muß sich also in der Röhre Bleidampf bilden. Wir nehmen dabei nach der Theorie an, daß im dampfförmigen Zustand der Zusammenhang der Bleiatome, die das Bleimolekül bilden, aufgehoben ist. Es schwirren also freie Bleiatome in der Röhre herum, und diese sind den Stößen der Elektronen ausgesetzt. Was dabei herauskommt, das, mein lieber Freund, wollen Sie nun freundlichst durch das Spektroskop beobachten. Ich schalte jetzt ein, und Sie sehen zunächst das reine Spektrum des glühenden Bleidampfes. Hier haben Sie eine Tafel, auf der die Spektra sämtlicher Metalle verzeichnet sind. So...! Der Strom fließt, die Kathode ist geheizt. Nun beobachten Sie, bitte, ob neue Linien auftreten und was für welche.«
Wohl eine Viertelstunde beobachteten die beiden Gelehrten den Gang der Ereignisse durch Spektroskope. Dann richtete sich Professor Barella auf und betrachtete prüfend und vergleichend die Spektraltafel.
»Alle Wetter, Herr Kollege«, brach er dann los, »das ist ja ein ganzer Hexenkessel. Ich glaube, dort mit Sicherheit die Linien des Natriums und Lithiums zu sehen. Und das hier, die violette und die dunkelrote Linie sind doch für das Kalium charakteristisch. Hier taucht das Spektrum des Heliums auf. Jetzt sehe ich die drei Wasserstofflinien, und jetzt scheinen mir die Spektra von Gold und Silber über das Bild zu huschen.«
»Sie haben richtig gesehen«, erwiderte Professor Hansen. »Das Blei wird durch die Elektronen in Gold und Helium zerschmettert. Das Gold wird weiter in Kalium, Silber und Wasserstoff zertrümmert. Wenn ich die Röhre zehntausend Jahre in Betrieb hielte, dürfte voraussichtlich alles Blei in Wasserstoff und Helium verwandelt sein.«
»Zehntausend Jahre sind sogar für einen Professor der Physik eine etwas lange Zeit«, unterbrach ihn Barella sarkastisch. »Ich würde Ihnen vorschlagen, das Experiment abzubrechen, sobald sich das Blei in Gold verwandelt hat. Dann kommt bei dem Geschäft wenigstens ein kleiner Gewinn heraus.«
»Der Volkswirtschaftler kann sich nun einmal nicht verleugnen«, entgegnete Professor Hansen lachend. »Nehmen wir wirklich einmal den Fall an, ich könnte beliebige Bleimengen mit einem ganz geringen Aufwand von elektrischer Energie in lauteres Gold verwandeln. Was würde nach Ihrer Meinung die Folge sein?«
Professor Barella überlegte einige Zeit. Dann erwiderte er: »Selbstverständlich müßten Sie diese Erfindung strengstens geheimhalten. Sie müßten sich sofort mit der deutschen Regierung in Verbindung setzen, und diese müßte das Monopol haben und so viel Gold fabrizieren, daß wir vom Ausland endlich ohne Sorge alles kaufen könnten, was wir für unser Wohlergehen brauchen, insbesondere also Lebensmittel und Rohstoffe.«
Professor Hansen setzte sich in Positur. »Jetzt gestatten Sie mir einmal, daß ich, der Physiker, den Volkswirtschaftler belehre. Der Wert des Goldes beruht lediglich auf seiner Seltenheit. Sie erinnern sich vielleicht, daß die alten Inka, die Überfluß an diesem gelben Metall hatten, es gar nicht so sehr schätzten und die gewöhnlichsten Gegenstände des täglichen Gebrauchs daraus fertigten. Sobald wir heute von Staats wegen nach Belieben Gold anfertigen, würde es damit genauso gehen, wie während des Weltkrieges und in den ersten fünf Jahren nach ihm mit der Papierwährung. Wie wir damals eine Überflutung des Verkehrs mit Papiergeld hatten und die Kaufkraft des Papiergeldes entsprechend fiel, so würde es dann mit dem Gold gehen. Außerdem ist ein Geheimnis, um das mehr als zwei Leute wissen, kein Geheimnis mehr. Wenn wir eine staatliche Goldfabrik mit einigen hundert Personen in Betrieb setzten, würde das Geheimnis sehr schnell offenkundig werden, und man würde allem deutschen Gold mit dem größten Mißtrauen begegnen. Schließlich liegt aber eine Erfindung immer in der Luft, und ich bin überzeugt, daß es C. Rutherford in England ebenfalls gelungen ist, Blei in Gold umzuwandeln. Wenn er seine Versuche systematisch fortgesetzt hat, muß er ebenso sicher darauf gekommen sein wie ich, der ich ja von seinem Fundamentalversuch ausging. Im übrigen aber drehen sich meine Versuche überhaupt nicht darum, Gold zu machen, sondern Energie zu gewinnen. Was aber auf diesem Gebiet erreicht ist, das sollen Sie jetzt sehen.«
Mit diesen Worten führte Hansen seinen Besuch zu einem Tisch im Hintergrund des Laboratoriums. Dort stand eine kleine Dampfmaschine mit Kessel und Kondensationsanlage, etwa von jener Größe, wie sie manche gut ausgerüsteten Schullaboratorien besitzen. Der Dampfkessel faßte etwa fünfzig Liter Wasser, und die Maschine war ein überaus sauber gearbeitetes Modell einer Zweizylinder- Verbundmaschine. Die Maschine war in vollem Gang. Das Manometer am Kessel zeigte sechs Atmosphären. Die Dampfmaschine trieb eine kleine Dynamomaschine, die ihren Strom auf eine fünfzigkerzige Glühlampe wirken ließ.
»Dieses Maschinchen läuft nun bereits Tag und Nacht ununterbrochen seit sechs Monaten«, begann Hansen mit seiner Erklärung. »In der ganzen Zeit habe ich nur ab und zu die Schmiergefäße nachgefüllt. Der vom Kessel erzeugte Dampf verrichtet seine Arbeit in der Maschine. Er gelangt dann in einen Kondensator, wird als Wasser niedergeschlagen, und das Wasser wird in den Kessel zurückgepumpt. Irgendwelche Heizung bemerken Sie an dem Kessel nicht. Das schmiedeeiserne Gefäß, das das Wasser enthält, ist nur durch einen Mantel aus Filz und Kork bestens gegen Wärmeverluste geschützt...« »Ja, wie läuft denn dann aber die Maschine und wodurch entsteht der Dampf?« fragte Barella.
»Das ist eine lange Geschichte, lieber Freund. Eines schönen Tages bemerkte ich, daß eine solche Kathodenröhre, in der ich sehr lange Zeit Blei zersetzt hatte, sich nicht recht abkühlen wollte. Auch nach vierundzwanzig Stunden war die Röhre noch so heiß, daß man sie nicht anfassen konnte. Ich beobachtete die Erscheinung weiter. Schließlich zerschlug ich die Röhre und fand, daß das Bleitröpfchen in dem Wolframbecherchern immer noch geschmolzen war. Ich schüttete das Tröpfchen in ein großes Glas Wasser, und nach einiger Zeit begann das Wasser zu dampfen. Da wußte ich, daß ich auf der richtigen Spur war. Durch die Behandlung in der Kathodenröhre war das Blei in seinem Atombau so weit erschüttert, daß es auch nach dem Aufhören der elektrischen Einwirkung freiwillig weiter zerfiel. Das alte Problem, unter Auflösung von Masse Energie zu gewinnen, war offenbar gelöst. Einstweilen half ich mir nun kurzerhand in der Weise, daß ich einfach das Bleitröpfchen in diesen Dampfkessel warf und die erzeugte Energie zum Betrieb der Dampfmaschine benutze. Selbstverständlich ist das ganz und gar keine anständige und einwandfreie Art der Ausnutzung. Ich verwandle die Bewegung der aus den splitternden Atomen herausfliegenden Elektronen erst wieder in eine unregelmäßige Molekularbewegung, die sogenannte Wärme, und verwende diese dann in einer Dampfmaschine mit dem bekannten schlechten Wirkungsgrad zur Erzeugung mechanischer Arbeit. Die mechanische Arbeit wird in der Dynamomaschine wiederum in elektrischen Strom, das heißt in regelmäßige und geordnete Elektronenbewegung umgesetzt, und die Elektronenbewegung schließlich geht in der Glühlampe wiederum in Wärme über. Dabei werden dann glücklich etwa zwei von Hundert der als Elektrizität vorhandenen regelmäßigen Elektronenbewegung als gleiche Arbeit in Form von Licht wiedergewonnen. Die kleine Dampfmaschine hat etwa zehn vom Hundert Wirkungsgrad. Die kleine Dynamo bringt es immerhin auf fünfundsiebzig vom Hundert, so daß ich 8,25 vom Hundert als Elektrizität gewinne. Davon aber werden in der Lampe etwa zwei vom Hundert in Form von Licht nutzbar gemacht, so daß die ganze Anlage einen wirklichen Nutzeffekt von 1,6 vom Tausend gibt. Das ist natürlich wirtschaftlich ganz grober Unfug. Es muß unsere Aufgabe sein, die Energie beim Zerfall der Masse sofort in Form von Elektrizität oder Licht zu gewinnen. Darüber wird sich die künftige Technik jedenfalls noch einigermaßen den Kopf zu zerbrechen haben. Mir genügt es, als Physiker wenigstens den Beweis geliefert zu haben, daß sich durch den Zerfall von Masse riesenhafte Energiemengen gewinnen lassen. Ich gedenke, dieses Maschinchen hier in den nächsten Tagen der Akademie der Wissenschaften in Berlin zur Aufbewahrung und zur Beobachtung zu übergeben.«
Zwanzig Jahre sind seit jener Vorführung im Laboratorium von Professor Hansen ins Land gegangen. In einem besonderen Raum in der Akademie zu Berlin steht unter Glas die kleine Dampfmaschine und verrichtet tagaus, tagein ohne Unterlaß ihre Arbeit. Nur noch als historisches Gedenkstück wird sie dort aufbewahrt und gepflegt, denn längst hat sie zahlreiche Nachkommen erhalten. Obwohl der Weg, Wasser durch zerfallende Materie zu erhitzen, energiewissenschaftlich keineswegs ideal ist, ist er doch immerhin hundertmal besser als das ältere Verfahren, die Energie durch Kohlenverbrennung zu erzeugen. So sind denn solche Dampfmaschinen mit einer Gesamtleistung von vielen Millionen von Pferdestärken auf der ganzen Erde in Tätigkeit. Kohle wird zwar noch gegraben, aber nicht mehr als Brennstoff wird sie benutzt, sondern in chemischen Fabriken auf wertvolle Kohlenstoffverbindungen hin weiter verarbeitet. Die Verhältnisse haben sich einfach so eingestellt, daß etwas Masse, und zwar Blei im Gewicht von etwa zweitausend Kilogramm jährlich, auf der Erde spurlos verschwindet und durch den Zerfall dieser Masse der ganze Energiebedarf reichlich gedeckt wird. Die Erde wird also in jedem Jahr um zweitausend Kilogramm leichter. Da sie aber einige Quadrillionen Kilogramm wiegt, wäre dieser Verlust auf Milliarden von Jahren überhaupt nicht merkbar. Überdies aber stürzen jährlich aus dem Weltraum Gesteinsmassen auf unseren Planeten, deren Gewicht wenigstens das Hundertfache dieser zweitausend Kilogramm beträgt. Ein Ende dieser neuen Energiewirtschaft läßt sich also rechnungsmäßig überhaupt nicht voraussehen. Man könnte die Dinge ruhig gehen lassen, wie sie gehen, aber der menschliche Erfindungsgeist arbeitet rastlos weiter.
Professor Hansen, den wir zum Beginn unserer Erzählung als einen Mann Ende der Dreißigerjahre angetroffen haben, ist mittlerweile ein hoher Sechziger geworden. Unablässig aber geht er seiner Forschung nach und verfolgt das gesteckte Ziel, die beim Zerfall der Materie freiwerdende Energie wirtschaftlicher auszunutzen. Die Theorie ist ja völlig geklärt. Das zerfallende Blei schleudert sowohl freie negative Elektronen wie auch positiv geladene Wasserteilchen aus. Gelingt es, diese Teilchen und Elektronen irgendwie zu steuern, so daß sie bei ihrem Flug nicht wild durcheinander schwirren, sondern daß die negativen Teile etwa nach einem Metallpol, die positiven nach einem anderen hinströmen, so ist die Bedingung für die Entstehung eines elektrischen Stromes gegeben, und es muß gelingen, die gesamte bei dem Zerfall freiwerdende Arbeit unmittelbar in elektrische Energie umzusetzen. Ein solches Mittel nun, die fliegenden Teilchen zu steuern, ist der Wissenschaft seit langem bekannt. Es ist das starke elektromagnetische Feld, das die negativen Teilchen nach der einen, die positiven nach der anderen Richtung hin ablenkt. Aber gewaltige Schwierigkeiten blieben trotzdem immer noch zu überwinden. Aus irgendeinem Stück zerfallender Masse treten die Teilchen ja nach allen Richtungen heraus. Wenn es nicht gelingt, die Teile von Anfang an einigermaßen zu ordnen, so müssen alle Steuerungsmittel dennoch versagen.
Die letzten zwanzig Jahre hat Professor Hansen unermüdlich über dieses Problem nachgesonnen. Der Zufall ist ihm dabei zu Hilfe gekommen. Gelegentlich seiner Untersuchungen an Kristallen hat er ein Salz entdeckt, dessen kristallinischer Aufbau derartig maschenförmig ist, daß die kleinen negativen Elektronen durch die Maschen ungebremst hindurchfliegen können, während die zweitausendmal größeren positiven Teilchen von dem Kristallgeflecht elastisch reflektiert werden. In jahrelangen Versuchen ist es ihm gelungen, auf polierten Kupferblechen einen atomdünnen gleichmäßigen Überzug dieses kristallisierten Salzes zu erzeugen. Damit aber hatte er sich ein vollkommenes Sieb geschaffen, das die gesamte von der zerfallenden Masse ausgehende negative elektrische Strahlung auf der metallischen Unterlage ansammelte. Dagegen wurde die positive Strahlung elastisch reflektiert. Schlug sie also senkrecht auf das Sieb auf, so mußte sie zu ihrem Entstehungsort zurückgeschleudert werden. Auf diesen Grundlagen hat der Professor unermüdlich praktisch weitergebaut, und heute ist eine gelehrte Kommission seiner Einladung gefolgt, um seine fertigen Apparate zu besichtigen. Inmitten der Besucher steht der Professor und zeigt auf einen kugelförmigen Apparat von etwa einem Meter Durchmesser. Es scheint eine einfache Metallkugel zu sein, die dort auf einem porzellanenen Hochspannungsisolator steht. Aber von diesem Metallkörper geht eine starke Kupferdrahtleitung ab, und durch den Isolator ist offenbar eine zweite Leitung in das Innere der Kugel eingeführt. An Hand einer Schnittzeichnung erklärt Professor Hansen seinen Gästen seine Erfindung.
»Sie sehen hier, meine Herren, in der Mitte der Kugel eine geringe Menge, etwa einen Kubikzentimeter zerfallenden Bleies. Die Bleikugel ruht in einer Kupferschale, von der eine Leitung durch den Isolator ins Freie tritt. Diese Schale befindet sich genau im Mittelpunkt einer Metallkugel von einem Meter Durchmesser, die auf der Innenseite mit dem Salzgitter belegt ist. Der Raum in der Kugel ist vollkommen evakuiert. Von dem metallischen Kugelgehäuse zweigt der negative Pol meines Elektronenelementes ab. Die Wirkung, die diese Anordnung theoretisch haben muß, liegt ja auf der Hand. Alle negative Strahlung sammelt sich auf der äußeren Metallkugel, alle positive Strahlung wird nach dem Mittelpunkt der Kugel auf die Bleimasse zurückgeworfen und von dort abgeleitet. Die praktische Wirkung sehen Sie dort...«
Mit diesen Worten öffnete der Professor die Tür zu einem Nebenraum. Man sah, wie die beiden Leitungen hier zu einer Schalttafel führten und wie ein großer Widerstand dort in matter Rotglut erstrahlte.
»Das ist das Eigenartige, um nicht zu sagen, der schwache Punkt der Erfindung«, fuhr Professor Hansen in seiner Erklärung fort. »Mein Elektronenelement muß natürlich dauernd elektrische Arbeit nach außen abgeben, da ja der Zerfall der Materie und die Energiestrahlung ununterbrochen vonstatten geht. Würde ich das Element mit freien Polen stehen lassen, so würde die negative Spannung auf der äußeren Kugel steigen und immer weiter steigen, so lange, bis die Abstoßung der negativ geladenen Kugel auf die ja ebenfalls mit negativer Ladung herankommenden Elektronen so groß wird, daß diese ebenfalls nach dem Mittelpunkt zu reflektiert werden. Dann würde aber wieder eine unregelmäßige Wärmebewegung der sämtlichen in meinem Element enthaltenen Materie eintreten. Es würde sich erhitzen, und zwar würde seine Temperatur so weit steigen, bis die äußere Wärmeausstrahlung der ständig neu erzeugten Energie das Gleichgewicht hält. Das würde aber bei dem Element, das Sie hier sehen, erst bei etwa zweitausend Grad der Fall sein, und bei zweitausend Grad wäre meine Metallschale längst geschmolzen. Das heißt also, wenn ich mein Element offenstehen lasse, geht es in kurzer Zeit an Selbsterhitzung zugrunde. Ich muß es daher stets schließen, und wenn es keine Nutzarbeit zu leisten hat, schließe ich es über den Widerstand, den Sie hier in voller Glut sehen. Ich bitte nun die Herren, einmal der Reihe nach hier auf den Isolierschemel zu treten und die Hand auf die äußere Kugel zu legen. Der Isolierschemel ist notwendig, weil die Kugel gegen die Erde eine Spannung von etwa zweitausend Volt besitzt. Sie werden bei der Berührung der Kugel eine merkliche Erwärmung spüren, ein Zeichen, daß die gesamte freiwerdende Energie in Form von elektrischem Strom abgeführt wird. Noch eine kleine Überschlagsrechnung kann ich Ihnen bieten. Eine Kugel von einem Meter Durchmesser hat eine Oberfläche von 3,14 Quadratmeter. Der Widerstand, den Sie hier mit etwa fünfhundert Grad glühen sehen, besitzt dagegen eine Fläche von mehr als fünfzig Quadratmeter. Nun steigt der Strahlungsausgleich mit dem Quadrat der Temperatur. Es wäre also bei zweitausend Grad eine sechzehnmal geringere Fläche notwendig als bei fünfhundert Grad. Fünfzig durch sechzehn ergibt aber ungefähr 3,14. Sie sehen also, daß meine Behauptung, die Kugel würde sich bei offenen Polen auf etwa zweitausend Grad erhitzen, wohl begründet ist. Nun aber wollen wir das Element Nutzarbeit verrichten lassen.«
Mit diesen Worten schaltete der Professor einen Hebel der Marmortafel ein, und eine fünfhundertpferdige Dynamomaschine setzte sich schnurrend in Bewegung. Schnell kam sie auf Tourenzahl und lief alsbald mit voller Last.
»Sie sehen, meine Herren«, schloß der Professor seine Ausführungen, »ein Teil des Problemes ist jedenfalls gelöst. Wir können die Energie der zerfallenden Materie ohne jeden Verlust in elektrische Energie umsetzen und können sie mit etwa fünfundneunzig vom Hundert mit Hilfe der Dynamomaschine in mechanische Arbeit verwandeln. Es bleibt uns noch die Aufgabe zu lösen, die Energie des Zerfalls unmittelbar in Lichtstrahlung zu verwandeln.«
In der großen Bleihütte von Smith & Co. in Nebraska war der größte Ofen in vollstem Gang. Ein rotglühendes Bleibad im Gewicht von zwanzig Tonnen stand in dem Ofenrund aus feuerfestem Gestein und wurde durch reduzierende Ofenflammen von allen Unreinlichkeiten befreit. Brausend schossen die bläulichen Flammen über die Oberfläche dahin, und wo sie diese bestrichen und beleckten, verschwanden alle Reste von Oxyden und Schlacken, und der blanke Bleispiegel trat klar zutage. Die Arbeit nahm einen erfreulichen Fortgang, aber unerfreulich war die Stimmung unter der Belegschaft der Hütte. Schwere Lohnstreitigkeiten waren zwischen der Arbeiterschaft und der Verwaltung der Hütte ausgebrochen. Die Arbeiter, meistenteils zugewanderte Italiener, dachten bereits an das letzte Kampfmittel, den Streik. Aber zu schlecht waren die Erfahrungen, die sie damit das letzte Mal gemacht hatten. Da hatten die Grubenbesitzer einfach die Öfen ausblasen lassen und die Belegschaft kurzerhand auf die Straße gesetzt. Zwei Monate hatte der Streik gedauert. Dann waren die Gewerkschaftskassen leer, und zu niedrigeren Lohnsätzen als vor dem Streik mußte die Arbeiterschaft wieder anfangen. Die Aussichten waren also schlecht, und dumpf gärte es unter der Arbeiterschaft.
Mit verbissener Miene stand der Vorarbeiter Emanuele Perona vor dem Ofen und rührte das glühende Bleibad in kurzen Zeitabständen mit einer grünen Holzstange durch. Dann geriet die ganze Masse infolge der dem Holz entweichenden Wasserdämpfe jedesmal in ein Sieden und Wallen. Glimmend und verkohlt wurde die Holzstange herausgezogen, beiseite geworfen und durch eine frische ersetzt. Eben hatte der Vorarbeiter eine solche Stange weggeworfen. Nun begab er sich zu seinem Schrank und entnahm diesem ein Gefäß, das etwa ein halbes Pfund zerfallenden Bleies enthielt. Diese beträchtliche Menge entwickelte eine ziemliche Eigenwärme und war daher ständig in flüssigem Zustand. Wie die italienischen Arbeiter sich bereits hundert Jahre früher immer wieder gelegentlich ihrer Sprengarbeiten Dynamit zu verschaffen wußten und dieses dann zu allerlei Attentaten mißbrauchten, so hatte Perona jetzt dieses zerfallende Blei während der letzten Jahre seiner Tätigkeit grammweise zusammengestohlen und aufbewahrt. Jetzt wollte er versuchen, sich mit Hilfe dieser Substanz an den Herren der Hütte zu rächen. Mit kurzem Schwung kippte er den Inhalt des Gefäßes in den Ofen. Dann ergriff er einen neuen Holzstock und begann eifriger denn je zu rühren. Ein leichtes Erzittern und Aufschäumen ging durch die Bleimasse, als Perona den Inhalt des Gefäßes hineinkippte. Dann beruhigte sich das Bad, und bald war alles gleichmäßig vermengt und verrührt.
Die Hüttenglocke gab das Signal zur Mittagspause. Die Arbeiter verließen den Raum, um eine Stunde Erholung zu finden. In der Kantine des Werkes saßen sie, schlangen das mitgebrachte Essen hinunter und besprachen das Thema, das alle interessierte, das Thema der Lohnforderungen.
Etwa fünfundfünfzig Minuten der Mittagsstunde mochten verflossen sein, und hier und dort packte bereits der eine und der andere seine Sachen zusammen, um wieder zur Arbeit zu gehen, als Feueralarm über den Hof schrillte. Das Ofenhaus stand in hellen Flammen. Brennbar war an ihm freilich nur der hölzerne Dachstuhl, aber der brannte auch lichterloh.
Wenige Minuten nach dem Alarm rückte die Feuerwehr an und gab Fluten von Wasser auf das brennende Dach. Aber der Brand schien unlöschbar zu sein, und erst nachdem das letzte Endchen Dachsparren restlos von der Flamme verzehrt war, hörte das Feuer auf. Dafür aber stand jetzt, wie man nun deutlich bemerken konnte, der ganze große steinerne Ofen in heller Weißglut. Obwohl die Ofenfeuerung bereits seit einer halben Stunde abgestellt war, glühte der ganze Bau, und dichte Wolken leuchtenden Bleidampfes entwichen aus dem Ofenmund. Vergeblich versuchte man, durch Fluten von Wasser die Glut zu dämpfen. Die Wassermassen verzischten in der Luft, noch bevor sie den Ofen selbst erreichten.
Schließlich gab die feuerfeste Wand dieser Höllenglut nach und brach auf. In glühendem Strom ergoß sich das Blei auf den Boden und breitete sich weithin aus. Der vollkommen ebene Estrich des Ofenhauses begünstigte diese Ausbreitung. Beinahe tausend Quadratmeter dieses glatten Steinbodens waren jetzt gleichmäßig mit einer etwa millimeterstarken Bleischicht bedeckt, und jetzt ließ die Glut endlich nach. Zwar behielt das Blei immer noch eine Temperatur von etwa vierhundert Grad und blieb flüssig, aber man konnte sich doch in die Nähe wagen, konnte kleine Proben nehmen und untersuchen, was eigentlich geschehen war. Diese Untersuchung aber ergab ein wunderbares Resultat. Die ganze gewaltige Bleimenge war in das Stadium der zerfallenden Materie eingetreten. Was man dreißig Jahre hindurch im Laboratorium vergeblich erstrebt hatte, war hier durch einen Zufall, durch einen verbrecherischen Versuch geglückt. Eine Menge von zwanzig Tonnen in geschmolzenem Zustand war durch die Beigabe von einem halben Pfund zerfallender Masse ebenfalls in Zerfall geraten. Durch die Beigabe dieser geringen Menge hatte man ohne besonderen Aufwand den Energiebedarf der ganzen Welt für die nächsten zehn Jahre gedeckt. Wieder einmal hatte das Spiel des Zufalles die Technik ein großes Stück vorwärts gebracht.
Auf der Tagesordnung der Naturforscherversammlung, die im August des Jahres 1965 in Stuttgart tagte, stand auch ein Vortrag von Professor Hansen. Bei der allgemeinen Anerkennung und Wertschätzung, deren sich der greise Gelehrte in der wissenschaftlichen Welt erfreute, hatte man seinen Vortrag selbstverständlich mit größter Bereitwilligkeit angenommen. Aber die Teilnehmer jenes Kongresses wunderten sich im stillen doch über das eigenartige Thema, das Hansen sich gewählt hatte. Der Titel seines Vortrags lautete nämlich: ›Über eigenartige Lichterscheinungen auf dem dunklen Begleiter des Sternes Gamma Cygni.‹ Man wußte, daß Hansen sein ganzes Leben hindurch auf dem Gebiet der Physik und speziell auf demjenigen der energetischen Technik gearbeitet hatte, aber man konnte sich nicht recht einen Vers darauf machen, wie er plötzlich zu solchen Sternbeobachtungen gekommen war. Trotzdem herrschte gespannte Aufmerksamkeit, als Hansen an das Rednerpult trat und seine Ausführungen begann. Er sagte ungefähr folgendes:
»Sie wissen alle, meine verehrten Herren Zuhörer, daß der Stern Gamma Cygni einen dunklen Begleiter hat, der mit ihm zusammen um den gemeinschaftlichen Schwerpunkt der beiden Sterne kreist. Die Existenz des dunklen Sternes verrät sich durch die periodischen Verdunklungen des hellen Sternes, die wir von der Erde aus sehr gut wahrnehmen können. Obwohl wir den dunklen Stern selbst niemals erblickt haben, konnte man aufgrund dieser Verdunklungen genau seine Umlaufzeit, seine Maße und die übrigen Elemente seiner Bahn berechnen. Sie sehen nun hier das Spektrum des leuchtenden Sternes...« Bei diesen Worten entwarf der Professor mit Hilfe eines Projektionsapparates ein vergrößertes Bild dieses Spektrums auf eine weiße Wandfläche und fuhr dann fort: »Sie sehen, daß das Spektrum demjenigen der Sonne durchaus ähnlich ist. Es finden sich auf ihm die Linien sämtlicher Elemente, die auch im Sonnenspektrum vorkommen. Aus der Helligkeitsverteilung des Spektrums können wir mit großer Sicherheit schließen, daß die Temperatur dieses Sternes siebentausendfünfhundert Grad beträgt. Der Stern ist etwa fünfzehnhundert Grad wärmer als unsere Sonne, und nach den Ergebnissen der theoretischen Physik sind wir daher zu der Annahme berechtigt, daß seine Masse ungefähr das 1,25fache der Sonnenmasse beträgt.
Dies nächste Bild zeigt Ihnen dasselbe Spektrum noch einmal, aber zur Zeit der beginnenden Verdunklung durch den Begleiter aufgenommen. Sie bemerken hier einige Absorptionslinien, die den Beweis liefern, daß der dunkle Stern eine ziemlich bedeutende Atmosphäre besitzt, die in der Hauptsache aus Helium besteht. Nun, meine Herren, ein derartig massenhaftes Vorkommen von Helium ist immer verdächtig. Es läßt den ziemlich sicheren Schluß zu, daß auf einem derartigen Stern radioaktive Zerfallsvorgänge, deren Endprodukt ja das Helium ist, in großem Maßstab stattfinden oder zum mindesten stattgefunden haben. Bis hierher ist alles ziemlich einfach, und Sie werden sich sicherlich gewundert haben, daß ich Ihnen gerade über ein buchstäblich so weit abliegendes Thema wie diesen Doppelstern etwas erzählen will. Ich tue es aber, weil sich im Laufe der letzten zwei Jahre auf dem dunklen Stern etwas ereignet hat, was uns allen zum Nachdenken und zur Vorsicht Veranlassung geben muß. Das Spektrum, das Sie hier noch sehen, ist im Frühjahr 1962 aufgenommen worden. Das Spektrum, das ich Ihnen jetzt zeige, stammt aus dem August desselben Jahres und wurde an dem Tag aufgenommen, an dem nach den langjährigen früheren Beobachtungen die größte Verdunklung zu erwarten war. Der dunkle Stern steht hier genau vor dem hellen Stern und verdeckt ihn dermaßen, daß nur noch ein Zehntel seines Lichtes zu uns kommt. Die photometrische Messung hat aber gezeigt, daß die Lichtstärke bei dieser Verdunklung nur auf den vierten Teil ihres normalen Wertes herabsank. Das Spektrum, das ich Ihnen jetzt zeige, ist zur selben Zeit aufgenommen und besteht aus den charakteristischen Linien des zerfallenden Bleies und des Heliums. Angedeutet finden sich Linien von Gold und Silber.
Ich will noch nicht in die Erörterung der Vorgänge eintreten, die sich offenbar zu jener Zeit auf dem dunklen Stern abgespielt haben müssen, sondern Ihnen sofort die weiteren Spektra zeigen. Hier ist dasjenige von der Frühjahrsverdunklung von 1963. Die Lichtschwächung beträgt überhaupt nur noch fünfundzwanzig vom Hundert, und die Linien des zerfallenden Bleies sind unverkennbar. Außerdem ist ein kontinuierliches Spektrum vorhanden, ein Beweis dafür, daß der ganze dunkle Stern ins Glühen geraten ist. Auch die Temperatur dieser Glut ergibt sich mit Sicherheit aus dem Helligkeitsmaximum des kontinuierlichen Spektrums. Sie liegt bei zweitausend Grad. Das nächste Bild zeigt Ihnen die Herbstverdunklung des Jahres 1963, die aber gar keine Verdunklung mehr ist. Ich will daher in Zukunft nur noch von der Opposition des früher dunklen Sternes sprechen. Die Temperatur berechnet sich hier auf siebentausendfünfhundert Grad, das heißt, der ehemals dunkle Stern glüht ebenso stark wie der helle. Hier haben Sie die Spektralaufnahme der Opposition vom Frühjahr 1964. Die Temperatur des aufglühenden Sternes ist auf zwölftausend Grad gestiegen, die Opposition bedeutet jetzt in Wirklichkeit eine Erhellung des ganzen Objektes. Hier das nächste Bild, die Herbstaufnahme von 1964, zeigt eine Temperatursteigerung auf fünfundzwanzigtausend Grad. Außerdem läßt das Spektrum erkennen, daß sich um den glühenden festen Kern des Sternes bereits ein weiter Mantel von glühendem Bleidampf gebildet hat. Hier die Aufnahme vom Frühjahr 1965 zeigt nur noch ein ganz schwaches kontinuierliches Spektrum, ein Zeichen dafür, daß der feste Kern fast völlig verschwunden ist. In der Hauptsache ist nur noch eine Wolke von glühendem Bleidampf übriggeblieben. Hier schließlich sind die neuesten Aufnahmen, die ich erst gegen das Ende der vorigen Woche gemacht habe. Sie beweisen, daß der feste Kern gänzlich verschwunden ist. Nur noch eine glühende Dampfwolke treibt dort im Weltraum. Über ihre Temperatur können wir gar nichts aussagen und müssen abwarten, wie sich die Dinge weiter entwickeln werden.
Was ist denn nun hier vor sich gegangen? Meine Herren, die Aufnahmen, die ich Ihnen vorführte, zeigen mit zwingender Logik folgendes: Der dunkle Stern muß offenbar zu einem sehr erheblichen Teil aus reinem Blei bestanden haben. Wir können annehmen, daß er vor Milliarden von Jahren aus Uran bestand und daß dieses in der bekannten Weise allmählich in Blei zerfiel. Beim Blei hören die freiwilligen radioaktiven Zersetzungen ja bekanntlich auf, und so mag dieser Stern, ein dunkler, kalter Bleiblock, Millionen von Jahren um seinen hellen Begleiter gekreist haben. Dann aber, und zwar im Sommer des Jahres 1962, ist etwas ganz Merkwürdiges und bis dahin noch niemals Beobachtetes passiert. Aus vorläufig unbekannten Ursachen hat ein weitergehender Atomzerfall des Bleies eingesetzt, und der ganze Stern ist von neuem in Brand geraten. Es hat ein allgemeiner, scheinbar freiwilliger radioaktiver Zerfall der Masse eingesetzt. Riesenhafte Energiemengen sind freigeworden, und Masse im Betrag von Milliarden von Kilogrammen ist dafür verschwunden. Heute ist von jenem Stern nur noch eine Dampfwolke übrig, und nach unserer Kenntnis der Zerfallserscheinungen müssen wir annehmen, daß auch dieser Dampf sich in Wohlgefallen auflösen wird. Ich, meine Herren, befürchte sogar, daß dieser radioaktive Dampf noch den hellen Stern anstecken wird, daß auch dieses Gestirn dem Weltenbrand zum Opfer fallen wird.
Nun, meine Herren, was lehrt uns dieser Vorgang? Er zeigt uns, daß sich mit diesen Zerfallserscheinungen nicht spaßen läßt. Er zeigt uns, daß wir bei unvorsichtigem Gebaren wohl auch eines Tages den Atombrand auf unserer Erde entzünden könnten und daß unser Erdball ebenfalls im Lauf weniger Jahre aufglühen und wegdampfen könnte. Von irgendeinem unserer zahlreichen Maschinenhäuser, die mit größeren Mengen zerfallender Masse arbeiten, könnte ein solcher Brand unvermutet seinen Ausgang nehmen, und ich wüßte nicht, wie wir ihn löschen sollten. In wenigen Stunden wäre das Maschinenhaus dann ein Glutmeer. Nach ein paar Tagen würde eine Fläche von mehreren Quadratmeilen in hellster Weißglut stehen. In dieser Zeit müßte der Brand auch bereits die feste Erdkruste nach unten hin durchbrochen haben, und Ausbrüche des flüssigen Erdinneren dürften die Katastrophe beschleunigen und vergrößern. Im Laufe weniger Monate wäre die Menschheit und überhaupt jedes lebendige Wesen auf der Erde dem Feuertod geweiht. Nach der kurzen, für astronomische Vorgänge fabelhaft kurzen Zeit von kaum zehn Jahren würde nur noch eine Dampfwolke auf dem Kreis der früheren Erdbahn als letzte Spur der ganzen Erde übrig sein. Das, meine Herren, ist die riesengroße Gefahr, die uns und unseren Planeten bedroht, wenn wir bei der weiteren Ausnutzung unserer neuen Energiequellen nicht mit der größten Vorsicht verfahren. Seitdem die Menschheit sich des Feuers bediente, hat es auch Brände und Feuersbrünste gegeben. Seitdem wir den Massezerfall als Energiequelle ausnutzen, ist die neue Gefahr aufgetreten, daß dieser Zerfall unseren Planeten ergreift. Solange wir aber noch an ihn gebunden sind, solange wir noch nicht imstande sind, nach anderen schöneren Sternen auszuwandern, müssen wir eine solche Katastrophe unter allen Umständen vermeiden, denn ein derartiger Brand wäre, wie gesagt, unlöschbar. Sie auf diese Gefahr aufmerksam zu machen, war der Zweck meines Vortrages. Wir wollen die neue Energiequelle zum Nutzen der Menschheit weiter verwenden, aber bei ihrem Gebrauch die größte Vorsicht walten lassen.«