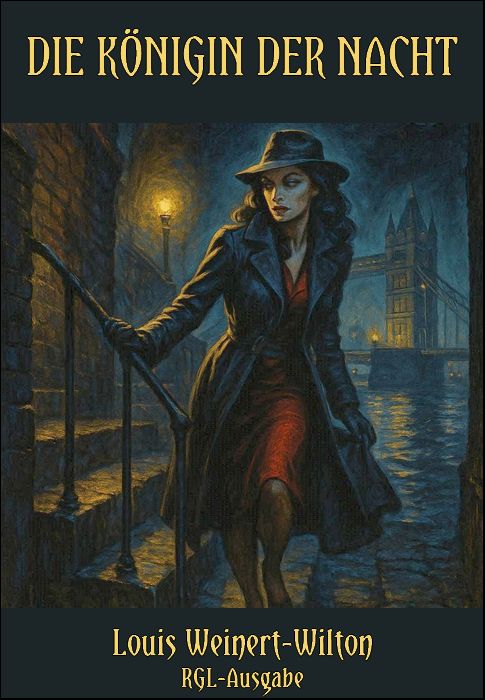
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.
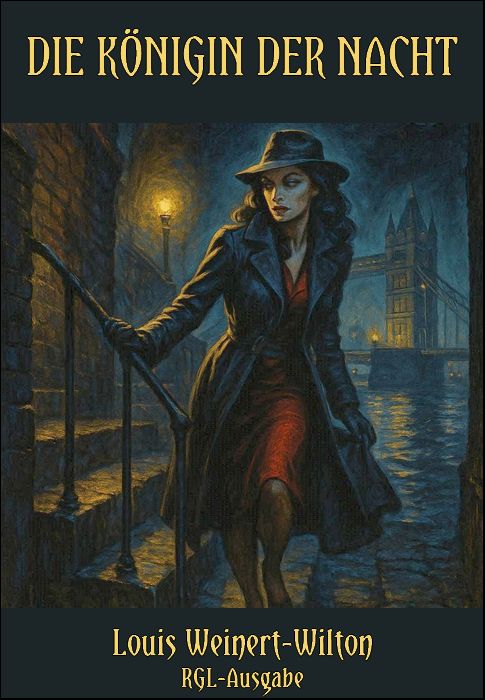
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software

»Die Königin der Nacht« ist ein klassischer Kriminalroman, der in der düsteren Londoner Unterwelt spielt und von einer geheimnisvollen Frau handelt, die Angst und Schrecken verbreitet.
Im Zentrum der Handlung steht eine mysteriöse Gestalt, die nur als »Königin der Nacht« bekannt ist. Niemand weiß, wer sie wirklich ist, und diejenigen, die ihr begegnet sind, schweigen aus Furcht. Die Geschichte beginnt mit Jack Beery, einem kleinen Taschendieb, der durch Zufall in die Machenschaften dieser dunklen Fürstin hineingezogen wird. Seine Begegnung mit ihr ist flüchtig, aber beunruhigend — ein sanfter Schlag wie von einem Nachtvogel, und sie verschwindet wieder im Dunkel.
Die Ermittlungen übernimmt Chefinspektor Terry von Scotland Yard, unterstützt von seinem ehemaligen Kollegen Clive Boyd. Gemeinsam versuchen sie, das Netz aus Intrigen, Erpressung und Mord zu entwirren, das sich um die »Königin der Nacht« spannt. Dabei geraten sie in die Kreise des mächtigen Cartwright-Zeitungskonzerns, dessen Direktoren und Angestellte ebenfalls in die Geschichte verwickelt sind.
Jack Beery war von Beruf ein harmloser, bescheidener Taschendieb, aber wenn er genügend getrunken hatte, was ziemlich häufig vorkam, ließ er sich auch auf großzügigere und gewagtere Unternehmungen ein.
Unerläßliche Voraussetzung hierfür war allerdings, daß die Sterne gut standen. Jack hatte zwar von der wunderbaren Astrologie nie im Leben etwas gehört, und seine Bildung war so gering, daß er nicht einmal wußte, was ein Horoskop war. Aber seit dem Tag, da er eine Brieftasche geklaut hatte, die nichts anderes enthielt als einige bedruckte, sehr abgegriffene Blätter, war ihm so etwas wie eine Offenbarung von dieser geheimnisvollen Wissenschaft und ihrer außerordentlichen Bedeutung für das praktische Leben geworden.
An einem langweiligen, verregneten Oktoberabend hatte er in diesen Papieren etwas verständnislos gelesen, daß Merkur Venus mit Jupiter in gutem Aspekt begegne und daß kühne Ausführung der Pläne zu Erfolg und Vorteil führe. Als er aber einige Stunden später tatsächlich nebst verschiedenen Kleinigkeiten zwei Taschenuhren und einige Börsen mit zusammen fünfzehn Pfund sechs Schilling gezogen hatte, war sich Jack Beery vollkommen klar darüber, welch kostbaren Schatz er in seinen unscheinbaren Blättern besaß, und sein Glaube an das, was sie verkündeten, war fortan unerschütterlich.
Deshalb hielt er auch die Augen offen, als er von Hampstead nach Paddington hereinkam. Er hatte bis gegen Mitternacht mit einigen Zunftgenossen in der gemütlichen Bar ›Zur schwarzen Bauchtänzerin‹ ausgezeichneten Portwein und ebenso ausgezeichneten Whisky getrunken und harrte gespannt der Dinge, die da kommen sollten. Denn es stand geschrieben: ›Ein besonders guter Tag für Sie ist der 17. März, wenn Sie es verstehen, außerordentliche Gelegenheiten, die sich Ihnen bieten, zu erkennen und entschlossen auszunützen.‹
Bis jetzt hatte Jack trotz eifrigster Umschau allerdings nichts von einer derartigen Gelegenheit wahrgenommen. Die Leute, mit denen er im Bus gefahren war, hatten nicht danach ausgesehen, als ob bei ihnen etwas zu holen wäre, und die Straßen, die er nun fröstelnd durchwanderte, waren fast menschenleer. Hie und da fuhr ein Windstoß durch den gelben Nebel zwischen den Häusern und peitschte von dem verhangenen Himmel beißendes Schneewasser herab. Es war eine wenig einladende Nacht, und wenn die Verheißung der Sterne nicht gewesen wäre, hätte Jack schon längst wieder irgendwo Unterschlupf gesucht. Aber er war augenblicklich zu abgebrannt, um eine todsichere Chance aufzugeben. Deshalb setzte er seinen Weg unverdrossen fort, aber er kam bis in die Nähe von Porchester Square, bevor seine Aufmerksamkeit durch eine Kleinigkeit außerordentlich in Anspruch genommen wurde.
Er war eben an der Vorderfront eines vornehmen einstöckigen Hauses vorbeigegangen und um die Ecke in eine enge, dunkle Seitengasse eingebogen, als er plötzlich haltmachte. Sein scharfes Auge hatte entdeckt, daß einer der Fensterflügel in dem kaum fünf Fuß hohen Parterre nicht ordentlich geschlossen war und bei jedem Windstoß bedenklich in den lockeren Angeln klirrte.
Jack schaute eine Weile das klappernde Fenster an, dann ging er einige Schritte weiter und überlegte. Er war zwar kein Fachmann in solchen Dingen, aber auch kein unerfahrener Neuling, und die gediegene Vornehmheit des Hauses ermunterte entschieden zu einem kleinen Wagnis. Schließlich durfte er sich auf seinen Instinkt und seine Gewandtheit und vor allem darauf verlassen, daß ihm für diesen Tag von geheimnisvollen höheren Mächten ein besonderer Erfolg vorherbestimmt war.
Jack Beery kam rasch zu einem Entschluß, aber er war nicht der Mann, ein solches Unternehmen zu übereilen. Er stopfte sich trotz Sturm und Schneeschauer sorgfältig seine Pfeife, setzte sie in Brand und begann dann mit prüfenden Blicken neuerlich einen langsamen Rundgang um das Haus. Aus den Fenstern drang nicht ein Laut und nicht der Schimmer eines Lichtes, und auch ringsumher war alles wie ausgestorben. Nur als er wieder in die Gasse mit dem verführerischen Fenster einbog, kam ihm eine Gestalt entgegen, die wie er den Kragen des Mantels hochgeschlagen und den Hut tief in die Stirn gedrückt hatte. Jack machte mit ausgesuchter Höflichkeit auf dem Gehsteig Platz.
Erst als der andere in der Finsternis untergetaucht und seine Schritte völlig verhallt waren, hielt der Dieb den günstigen Augenblick für gekommen. Er drückte sich dicht neben dem klappernden Fenster an das Mauerwerk und horchte intensiv. Dann reckte er seine hagere Gestalt und war bereits im Begriff, die Arme auszustrecken und sich hochzuziehen, als er ein Geräusch vernahm, das ihn sofort wieder zusammenknicken und förmlich eins mit der dunklen Hausfront werden ließ.
Über ihm hatte für den Bruchteil einer Sekunde ein Riegel geknackt, und Jack wußte, daß das nicht der Wind gewesen war. Er fühlte, daß in greifbarer Nähe ein anderes menschliches Wesen stand, über dessen Absichten er sich nicht klar war. Hatte man im Haus den Lärm des Fensters vernommen, und sollte im letzten Augenblick die günstige Gelegenheit vereitelt werden — oder...?
Jack Beery wurde durch die Ereignisse rasch des Grübelns enthoben. Er hörte ein leises Schleifen, und dann erspähte er erst ein Bein, hierauf ein zweites, das sich über die Fensterbrüstung schwang. Es waren außergewöhnlich schlanke und wohlgeformte Beine, die sekundenlang in der Luft baumelten, aber Jack hatte keine Zeit, sich mit dieser überraschenden Tatsache zu beschäftigen. Für ihn ging es um das Geschäft, und das schien ihm in dieser Minute sicherer, müheloser und lohnender denn je.
Seine Arme langten blitzschnell in die Luft, und seine gelenkigen Hände umklammerten beide Beine mit eisernem Griff.
»Ich helfe dir herunter«, tuschelte er. »Aber selbstverständlich nur gegen eine anständige Belohnung. Sonst schlage ich Lärm.«
Jack hob mit einem liebenswürdigen Grinsen den Blick zum Fenster, aber mit einemmal erstarrte er, und wenn sich seine Finger nicht eiligst aus dem krampfhaften Griff lösten, so lag dies nur daran, weil Furcht und Entsetzen ihn völlig lähmten.
Er hatte eine Erscheinung gesehen, die ihm das Blut in den Adern erstarren ließ, weil sie unbedingt Schlimmes bedeutete. Man sprach in seinen Kreisen nur im Flüsterton davon, und niemand wußte etwas Bestimmtes darüber. Aber wenn es Unheil gab, ging scheu ein Name von Mund zu Mund, ohne daß man wußte, wie, wann und wo er in die Welt gekommen war. Niemand hatte die ›Königin der Nacht‹ bisher gesehen, aber sie war da und bald hier, bald dort an ihrem unheimlichen Werk.
Er, Jack Beery, war vielleicht der erste, der sie leibhaftig zu Gesicht bekam, aber auch er sollte sie nie gesehen haben...
Eine Hand schnellte jäh in das Dunkel, und der entsetzte Mann fühlte einen sanften Schlag gegen sein Kinn, als ob ihn der Flügel irgendeines kleinen Nachtvogels gestreift hätte.
Einige Atemzüge später warf er die Arme in die Luft und stürzte wie ein gefällter Baum zu Boden.
Der schwarze Schatten mit der silbernen Mondsichel und den drei flimmernden Sternen glitt aus dem Fensterrahmen lautlos wieder in das Haus zurück, und der nächste Windstoß kam um sein Spiel mit den klappernden Scheiben.
Eine kleine Weile später lief irgendwo auf der anderen Seite beim Porchester Square ein Motor an, eben als der Mann mit dem hochgeschlagenen Kragen und dem tief herabgezogenen Hut wieder in der Gasse erschien. Er hatte die Hände in die Taschen seines triefenden Wettermantels vergraben und kam diesmal mit den gemessenen, gleichmäßigen Schritten einer militärischen Runde auf dem gegenüberliegenden Gehsteig daher. Unter der schützenden Krempe suchten seine Augen ununterbrochen die Front des kleinen, vornehmen Hauses ab, bis sie plötzlich auf das regungslose Bündel an der Mauer fielen. Er stand mit zwei raschen Sätzen bei ihm, und seine Taschenlampe leuchtete grell über das fahle Gesicht und die steife Gestalt Jack Beerys. Als er sich wieder aufrichtete, kam ein halblauter ärgerlicher Fluch über seine Lippen, und wieder flogen seine Blicke über die dunklen Fensterreihen des Hauses. Dann leuchtete er rasch den Boden um den Toten herum ab, aber sein Suchen blieb erfolglos.
Es dauerte ziemlich lange, bis auf sein schrilles Pfeifen ein diensteifriger Polizeibeamter eilig aus dem Nebel auftauchte.
»Hier gibt es etwas für Sie zu tun«, sagte der Mann in dem Wettermantel kurz.
Bevor er sich mit der Gestalt am Boden beschäftigte, die ihm sicher war, sah sich der Polizeibeamte erst einmal mit dem vorgeschriebenen Mißtrauen den Sprecher an, aber was er bemerkte, ließ jeden Verdacht schwinden. Er hatte offenbar einen vornehmen Herrn vor sich, wenn auch von dessen Gesicht so gut wie gar nichts zu erkennen war. Aber schon die Art, wie er sprach, verriet das, und der schwere Regenmantel war ein gediegenes Stück, das mindestens seine zwanzig Pfund gekostet hatte.
Der Wachtmeister war beruhigt, und er wurde noch beruhigter, als er einen Blick auf den Toten geworfen hatte. Jack Beery war ein der Polizei bekannter Dieb, und wenn solch einen Kunden endlich einmal das Geschick ereilte, so verursachte das keine allzu große Aufregung. Aber der Wachtmeister fand überhaupt nichts, was auf ein gewaltsames Ende gedeutet hätte, und das vereinfachte die Sache noch mehr. Nur um seinen Vorschriften zu entsprechen, fragte er den Herrn überaus höflich nach Namen und Adresse und bekam auch bereitwilligst Auskunft.
Als man später den Zeugen zur Totenschau und noch aus anderen wichtigen Gründen brauchte, stellte sich allerdings heraus, daß seine Angaben falsch gewesen waren.
Etwa eine Viertelstunde später, knapp nach halb zwei Uhr morgens, wurde der Pförtner des vornehmen, kleinen Hauses durch das Schrillen des Telefons aus tiefem Schlummer aufgeschreckt. Als er sich schlaftrunken und mürrisch meldete, schlug eine ungeduldige, herrische Stimme an sein Ohr.
»Sehen Sie sofort nach, ob Sir Nicholas etwas zugestoßen ist.«
Der Befehl klang so seltsam, daß ihn der Hausmeister nicht sofort zu fassen vermochte. Er wußte, daß sein Herr am vergangenen Abend das Haus überhaupt nicht verlassen und sich bereits gegen elf Uhr zurückgezogen hatte, und er begriff nicht, wie seither in dem wohlbehüteten Haus irgend etwas geschehen sein sollte. Einen Augenblick dachte er an einen üblen Scherz und wollte gerade etwas fragen, aber die Verbindung war bereits unterbrochen. Der alte Mann bekam es nun plötzlich mit der Angst zu tun. Er schlurfte eilig nach der Stube des Dieners, der ihn überrascht und bestürzt anhörte, und dann eilten beide in das erste Stockwerk.
Das Schlafzimmer von Sir Nicholas lag am äußersten Ende der Galerie, die um die Halle lief, gegen den kleinen Garten zu. Es war nie versperrt, sondern bloß durch ein Schnappschloß gesichert, zu dem außer ihm selbst nur der Diener einen Schlüssel besaß.
Der Diener war auch der erste, der sich zu einem Entschluß aufraffte, nachdem sie minutenlang mit angehaltenem Atem an der Tür gelauscht hatten, ohne dadurch irgendwelche beruhigende Gewißheit zu erlangen. Er öffnete mit unsicherer Hand und suchte zunächst durch einen kleinen Spalt einen Blick nach dem Bett zu werfen, das in der einen Fensterecke des nicht allzu großen Zimmers stand. Aber der Raum war durch die dichtgeschlossenen Portieren in undurchdringliches Dunkel gehüllt, und die Stille, die drinnen herrschte, hatte etwas Beklemmendes. Nicht ein Atemzug war zu hören, und die beiden Lauscher an der Tür standen mit fliegenden Pulsen und feuchten Stirnen.
Endlich glaubte der Diener die Verantwortung für das Außergewöhnliche auf sich nehmen zu müssen und schaltete das Licht ein.
Sir Nicholas Morton, ein langer, sehniger Mann, lag, das Gesicht der Wand zugekehrt, in seinen zerwühlten Kissen, und die unnatürliche, krampfhafte Verrenkung der Glieder verriet auf den ersten Blick, daß das nicht der Schlaf eines Lebenden war. An dem Körper war nicht ein Blutfleck, nicht das geringste Anzeichen einer Gewalttat zu entdecken, aber die verzerrten Züge sprachen von einem furchtbaren Todeskampf.
An dem Vormittag, der dieser Nacht folgte, lag über dem Riesengebäude der Cartwright-Presse Gewitterstimmung. Man wußte, daß ein Unwetter im Anzug war, aber man war sich noch nicht im klaren, wo es einschlagen würde.
Der augenblicklich allmächtige Chef, der Anwalt Mr. Thomas Hyman, den täglich mindestens hundertmal der Schlag hätte treffen müssen, wenn es nach den liebevollen Wünschen so ziemlich aller Angestellten gegangen wäre, war bereits um zehn Uhr vorgefahren, und der ›süße Pat‹, der Portier, hatte kaum einen Blick aus den kalten, farblosen Augen aufgefangen, als er auch schon eiligst die Tagesprognose ›Sturm‹ an die einzelnen Abteilungen ausgab. Diese Voraussage war für alle Abteilungsleiter und Redakteure, soweit sie überhaupt mitzählten, eine sehr wichtige Sache, denn Mr. Hyman an einem kritischen Tag unter die Augen zu kommen, war gleichbedeutend mit einer Katastrophe.
Deshalb bezog Pat Coppertree aus seiner inoffiziellen Obliegenheit auch ein weit höheres Einkommen als aus seiner sonstigen vielstündigen, aber langweiligen Tätigkeit, und man mußte zugeben, daß er alles daran setzte, um sich seiner wichtigen Aufgabe und des aufgewandten Geldes würdig zu erweisen. Denn so ausdruckslos das breite, schwammige Gesicht des Gewaltigen der Cartwright-Presse selbst in den Augenblicken zügellosester Erregung und grimmigster Laune auch war, der kleine, krummbeinige Ire mit den verschmitzten Augen und dem bärtigen Affengesicht war innerhalb weniger Wochen doch dahintergekommen, was hinter der ewig gleichen starren Maske des gefürchteten Chefs jeweils vorging.
So bedenkliche Anzeichen wie heute hatte er allerdings noch nie wahrgenommen, und er hatte auch nicht unterlassen, dies in seinem ›Wetterbericht‹ nachdrücklichst hervorzuheben.
Der Reportersaal der ›London Sensations‹ war noch ziemlich leer, als die beunruhigende Meldung eintraf, aber fünf bis sechs Herren lungerten doch schon an ihren Tischen herum, und der Mann vom Gerichtssaal war der erste, der fünf Schilling auflegte, daß der Blitz in die außenpolitische Abteilung einschlagen werde, weil man in der heutigen Morgenausgabe Paris wieder einmal zu offen die Meinung gesagt habe, was in die augenblickliche politische Orientierung nicht so recht passe. Demgegenüber setzte der gemütliche Mr. Bilkert, der das Gras wachsen hörte, denselben Betrag auf einen gewaltigen Rüffel für den Volkswirtschaftler, weil im Handelsteil eine abfällige Bemerkung über Aktien stehe, an denen wahrscheinlich Mr. Hyman interessiert sei, und der Bearbeiter von Verkehrsunfällen gab seine letzten drei Schilling für die feste Überzeugung hin, daß der Redakteur des lokalen Teiles endlich hinausfliegen werde, weil dieser alle interessanten Berichte, die er ihm auf den Tisch lege, skrupellos in den Papierkorb werfe.
Der sehr jugendliche, aber äußerst gerissene Mr. Fish, der wegen seines roten Haarschopfes und seines von Sommersprossen übersäten Gesichts sowie wegen einiger anderer Eigenschaften kurz der Fliegenpilz genannt wurde, schob nach einiger Überlegung rasch ebenfalls fünf Schillingstücke auf den Tisch, von denen drei etwas verdächtig aussahen, hielt jedoch als kluger Mann mit seiner Meinung vorläufig noch zurück.
Nur Noel Wellby beteiligte sich nicht an der Sache, und nicht einmal dem sonst recht zudringlichen Fish fiel es ein, ihn dazu zu animieren. Man hatte mit dem Mann, der erst wenige Wochen der Redaktion angehörte, noch keine rechte Fühlung, weil er in seinem ganzen Gehabe zwar sehr korrekt, aber ebenso zurückhaltend war. Er schien an den Vergnügungen und Späßen, mit denen man sich im Reporterzimmer die freie Zeit vertrieb, keinen sonderlichen Geschmack zu finden, und die leicht angegrauten Schläfen waren dafür keine ausreichende Begründung. Denn erstens taten auch ältere, würdige Herren dabei gern mit, und zweitens sah das junge, wettergegerbte Gesicht Wellbys gar nicht aus, als ob er durch harte Lebenskämpfe zu einem griesgrämigen Menschenfeind geworden wäre. Dem mißtrauischen ›Fliegenpilz‹ kam es sogar zuweilen vor, als ob der seltsame Kollege, der immer stumm und anscheinend völlig teilnahmslos hinter seinen Zeitungen vergraben saß, mit gespitzten Ohren auf jedes Wort hörte und manchmal sogar den dünnen, bartlosen Mund zu einem Lächeln verzöge.
»Ein aufgeblasenes Ekel«, entschied Mr. Fish am dritten Tag in seiner bestimmten Art, und so oft er fortan in die Nähe Wellbys kam, warf er ihm einen mißtrauischen Blick zu.
Die Debatte über die Streitfrage, wen der Zorn Mr. Hymans heute treffen würde, war auf ihrem Höhepunkt angelangt, als sie ganz unvermittelt verstummte. Mr. Fish, der das große Wort führte und dazu lebhaft und ausdrucksvoll mit den Händen gestikulierte, blieb ein halber Satz in der Kehle stecken, und er verharrte mit ausgestreckten Handtellern wie eine Statue von Offenbachs König Mydas.
In der Tür stand der gefürchtete Boy des Gewaltigen und schnarrte mit selbstbewußter Würde seinen Auftrag herunter.
»Mr. Hyman wünscht Mr. Wellby sofort zu sprechen.«
Am wenigsten überrascht und betroffen schien Noel Wellby zu sein. Er räkelte sich nicht allzu eilig aus seiner bequemen Lage auf und nahm sich sogar noch Zeit, einen Griff nach seiner Krawatte zu tun und die Bügelfalten seiner etwas spiegelnden Hose umständlich glattzustreichen.
Als er endlich gegangen war, war der fünfundzwanzigjährige Mr. Fish der erste, der seine Fassung wiedergewann. Er riß die wasserblauen Augen auf, verzog den Mund von einem Ohr bis zum andern, schnalzte vielsagend mit der Zunge und strich zunächst einmal bescheiden, aber mit einiger Hast die aufgelegten Beträge ein, ohne sich durch die etwas betretenen Gesichter seiner Kollegen irgendwie beirren zu lassen.
»Nun, was habe ich Ihnen gesagt?« meinte er unverfroren. »Nicht nur lumpige fünf Schilling, ganze hundert Pfund hätte ich wetten können, wenn ich Sie hätte 'reinlegen wollen. Lesen Sie die Notiz über den Tod von Sir Nicholas Morton in den heutigen ›London Sensations‹, und Sie werden wissen, weshalb der Alte so schief gewickelt ist. In seinem eigenen Blatt muß er gleich beim ersten Frühstück so etwas finden.« Der junge Mann grinste schadenfroh und klimperte befriedigt mit den Schillingen in seiner Hosentasche. »Dabei hat sich dieser Naivling Wellby wahrscheinlich die Beine ausgerissen, um die Geschichte noch in der Morgenausgabe unterzubringen — auf eigene Verantwortung, weil nicht einmal der Nachtredakteur mehr anwesend war. Toll, was er jetzt zu hören bekommen wird. Ich glaube, Hyman schmeißt ihn eigenhändig die Treppe hinunter. Das könnte mir den Alten geradezu sympathisch machen.«
Der gemütvolle Fish legte keinen Wert darauf, die Wirkung seiner Worte abzuwarten. Er hatte es plötzlich sehr eilig, rückte den Hut weit nach hinten auf seinem roten Birnenkopf und schoß mit wichtiger Miene davon.
Das in Ebenholz, Kardinalsrot und mattem Gold gehaltene riesige Chefzimmer war noch in dem etwas prunkliebenden Geschmack des kürzlich verstorbenen Sir Benjamin Cartwright eingerichtet, und Thomas Hyman machte darin keine gute Figur. Von dem mächtigen borstigen Schädel bis zu den gewaltigen behaarten Händen und den riesigen Füßen war alles an ihm von einer geradezu erschreckenden Grobschlächtigkeit, und sein Körper schien an dieser Masse zu viel zu tragen zu haben, da er ständig vornübergeneigt war.
Wie ein verdrießlicher Stier, dachte Noel Wellby respektlos, als er das Zimmer betrat und minutenlang warten mußte, bevor der Chef von seiner Anwesenheit Notiz nahm und seinen schwerfälligen Spaziergang in dem großen Raum unterbrach.
Dafür machte es Hyman nun kurz. Von einer Begrüßung, selbst in der flüchtigsten Form, sah er überhaupt ab, einmal, weil er kein Freund von Förmlichkeiten war, und zweitens, weil er sie einem so untergeordneten Wesen gegenüber, wie einem Reporter, doppelt überflüssig fand. Er stützte seine massige Gestalt auf den Schreibtisch und kam in seiner direkten Art sofort auf den Kern der Sache.
»Waren Sie betrunken oder leiden Sie zuweilen unter Wahnvorstellungen?« krächzte er kurzatmig, indem er die Rechte aus der Hosentasche zog und wuchtig auf die letzte Ausgabe der ›London Sensations‹ fallen ließ.
Wellby beeilte sich mit seiner Antwort auf diese grobe Frage nicht, sondern betrachtete zunächst einmal den gefürchteten Mann, dem er zum erstenmal gegenüberstand, mit dem sorglosen Interesse, das man etwa einem gereizten Löwen hinter Gitterstäben entgegenbringt. Er wollte vor allem wissen, was er von dem ergrimmten Koloß zu halten hatte und wie dieser zu nehmen war.
»Weder das eine noch das andere«, gab er endlich mit unverschämtem Phlegma zurück. »Um jemals betrunken zu sein, vertrage ich zuviel, und auf meine Sinne kann ich mich mindestens ebenso verlassen, wie Sie sich auf die Ihren.«
Es war wohl die frechste Antwort, die der allmächtige Hyman in diesem Raum je erhalten hatte, und sie kam so unerwartet, daß er den Sprecher aus seinen verquollenen Augen wie ein Wundertier anstarrte. Dann stieg eine Blutwelle in sein ungesundes Gesicht, die die Adern an den Schläfen in dicken Knoten hervortreten ließ, und er fuhr sich mit seinen gewaltigen Fingern um den gedrungenen Hals, als ob ihm sogar der gut einen halben Zoll abstehende Kragen zu eng würde.
Der Reporter wartete gefaßt auf eine Explosion, aber sie kam wider Erwarten nicht. Hyman war zwar eine cholerische, brutale Natur, aber er war nicht umsonst lange Jahre hindurch einer der gewiegtesten Anwälte Londons gewesen, bevor er in den Zeitungspalast eingezogen war, und er wußte sich zu beherrschen, wenn es not tat. Und diesmal schien es ihm dringend geboten. Der Mann, der mit so unerschütterlicher Ruhe und so impertinenter Schlagfertigkeit vor ihm stand, hatte Andeutungen in eines der Blätter seines Konzerns geschmuggelt, die ihm höchst unangenehm waren, und er mußte erfahren, ob es sich hier bloß um einen seltsamen Zufall handelte oder ob dieser Noel Wellby von der heiklen Geschichte wirklich etwas wußte und vielleicht seine erste Karte ausgespielt hatte.
»Dann kann ich nur annehmen«, lenkte er daher in verbissenem Grimm ein, »daß Sie mit Ihrer albernen Nachricht die Leute zum Narren halten wollten. Sie scheinen vergessen zu haben, daß Sie für ein ernstes Blatt arbeiten und nicht für die Boulevardpresse, die sich derart blödsinnige Sensationen gestatten darf. Ganz Fleet Street wird vor Vergnügen kopfgestanden haben, als man Ihre Notiz bei uns las, und ich glaube, wir werden einige recht anzügliche und unangenehme Bemerkungen zu hören bekommen.«
Er nahm die Zeitung, die er vor sich liegen hatte, auf, und obwohl er die betreffenden Zeilen bereits ungezählte Male überflogen und der andere sie ja selbst geschrieben hatte, fühlte er sich doch veranlaßt, sie mit seiner dicken, heiseren Stimme unter nachdrücklicher Betonung einiger Stellen vorzulesen:
»Sir Nicholas Morton in seiner Wohnung tot aufgefunden wie vor einigen Monaten Sir Benjamin Cartwright. — Was wollte die ›Königin der Nacht‹?«
Die Stimme Hymans wurde bei jedem dieser Titel, die einen geheimnisvollen Fall gellend in die Welt schrien, immer knarrender und wütender, bis sie sich schließlich völlig überschlug.
»Sind Sie bei den ›London Sensations‹ angestellt oder wo sonst?« fauchte er atemlos. »Mit einer solchen Geschmacklosigkeit hätten Sie Ausrufer bei einer Schaubude, aber nicht Reporter werden sollen.«
»Das war ich bereits«, gab der junge Mann mit höflicher Gelassenheit zurück. »Aber jeder Mensch hat den Ehrgeiz, es weiter zu bringen.«
Wieder verschlug diese Antwort dem gewaltigen Mann die Sprache, und sein Blick wurde flackernd und unsicher.
»Mit solchen Dingen werden Sie nicht weit kommen«, sagte er dann sarkastisch, und seine Augen, verhießen nichts Gutes. »Wenigstens bei mir nicht.« Er schlug wiederum verächtlich auf das unschuldige Blatt, und um weiter zu gelangen und aus dem anderen möglichst unauffällig das herauszubringen, was er wissen mußte, las er weiter vor:
»Wie wir nach Redaktionsschluß erfahren, ist der bekannte Finanzier und Sammler Sir Nicholas Morton heute nacht kurz nach ein Uhr in seinem Haus in der Nähe des Porchester Square tot aufgefunden worden. Das plötzliche Ableben des allgemein geschätzten Mannes, der sich um das öffentliche Leben hervorragende Verdienste erworben hat, kommt um so überraschender, als Sir Nicholas erst achtundvierzig Jahre alt war und sich der besten Gesundheit erfreute. Unwillkürlich erinnert der Fall an den ebenso unerwartet raschen Tod Sir Benjamin Cartwrights vor fünf Monaten. Seltsamerweise waren die beiden Männer eng befreundet und haben vor zwölf Jahren eine afrikanische Jagdexpedition unternommen, die in völlig unerforschte Gebiete vorgedrungen ist. Diese eigenartigen Umstände dürften wohl den seltsamen Gerüchten, die bereits nach dem Ableben von Sir Benjamin in Umlauf kamen, neue Nahrung geben und diesmal hoffentlich zu einer etwas nachdrücklicheren Untersuchung führen...«
Der große, starke Mann hatte den letzten Satz Wort für Wort hervorgestoßen und dabei kein Auge von seinem Gegenüber gewandt. Nun beugte er sich vor, und das Zittern seiner blutleeren Lippen verriet, wie sehr er sich beherrschen mußte.
»Zum Teufel, was sind das für Gerüchte? Sind Sie wirklich übergeschnappt oder so einfältig, daß Sie auf das Gewäsch von Klatschweibern hereinfallen?« Er rang heftig nach Luft. Der Reporter zuckte gleichmütig die Achseln.
»Ich kann doch nicht gut annehmen, daß dieses ganze Haus aus lauter alten Klatschweibern besteht«, gab Wellby gelassen zurück. »Wohin Sie hören, wird davon geflüstert, sobald die Rede auf den verstorbenen Sir Benjamin kommt. Und auch draußen munkelt man allerlei.«
Hyman öffnete den Mund, aber erst nach einer Weile kam ein Ton heraus, der halb wie ein Glucksen, halb wie ein Gurgeln klang, aber wahrscheinlich ein spöttisches Lachen sein sollte.
»So... Man munkelt allerlei... Da haben Sie wohl auch die seltsame Geschichte aufgefangen, die Sie zum Schluß zum besten geben?«
Er senkte den Blick wieder auf das Zeitungsblatt und begann neuerlich zu lesen:
»Weiter erhalten wir von einem zuverlässigen Gewährsmann die interessante Mitteilung, daß Sir Nicholas Morton am verflossenen Freitag einer großen Gesellschaft bei Lord Etheridge beigewohnt hat und dort unmittelbar vor seinem Weggehen von einer dicht verschleierten Frau angesprochen wurde, die ihm die Worte zuflüsterte: ›Königin der Nacht vom Brunnen der sieben Palmen wartet noch das Viertel eines Mondes ab.‹ — Auf Sir Nicholas schien diese Begegnung einen außerordentlichen Eindruck zu machen, denn er brauchte mehrere Minuten, um sich zu fassen, und verließ dann verstört und in fluchtartiger Eile die Gesellschaft. — Das Viertel eines Mondes wäre morgen abgelaufen gewesen.«
Der Chef des Cartwright-Konzerns knüllte die Zeitung mit seinen schaufelartigen Händen geräuschvoll zusammen und warf die Papierkugel verächtlich in eine Ecke.
»Woher haben Sie dieses gruselige Märchen?« fragte er ironisch, vermochte aber sein lebhaftes Interesse doch nicht ganz zu verbergen.
»Dieses gruselige Märchen habe ich mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört«, erklärte der Reporter, und Hyman horchte bei dem ruhigen, bestimmten Ton, in dem Wellby sprach, mit ungeduldiger Spannung auf.
»Sie wollen mir also einreden...«, begann er nach einem kurzen Schweigen etwas stockend, aber Wellby fiel ihm sofort sehr entschieden ins Wort.
»Ich will Ihnen gar nichts einreden, sondern Sie dürfen überzeugt sein, daß sich alles so verhielt, wie ich es berichtet habe. Ich kenne die Bedeutung unseres Blattes zu gut, um unseren Lesern irgendwelchen lächerlichen Tratsch aufzutischen. Die Geschichte von der ›Königin der Nacht‹ mag sich ja etwas sonderbar anhören, aber sie hat sich tatsächlich zugetragen.«
Thomas Hyman schob die Hände in die Hosentaschen und sah mit starren Augen lauernd auf den jungen Mann.
»Wenn ich Ihnen das glauben soll, müssen Sie schon etwas deutlicher werden«, knurrte er.
»Nichts ist leichter als das. Ich habe nämlich dicht neben Sir Nicholas hinter einer Portiere gestanden, als die Frau ihm in den Weg trat, und so leise sie auch sprach, konnte ich doch jedes ihrer Worte deutlich vernehmen.«
Es schien, als ob Hymans graues Gesicht noch um einen Ton fahler geworden wäre, und er nagte erregt an den Lippen, bevor er sich abwandte und etwas zögernd weiterfragte.
»Hat Sir Nicholas irgend etwas erwidert?«
»Nein. Er war so entsetzt, daß er die Erscheinung wie ein Wesen aus einer anderen Welt anstarrte und vor ihr zurückwich.«
»Wie sah sie aus?«
Wellby hob die Schultern.
»Wie alle die anderen Damen, die anwesend waren. Lord Etheridge hatte gegen zweihundert Einladungen ergehen lassen, und weil die Sache ein so großes gesellschaftliches Ereignis war, hatte mich der Chef mit noch zwei Kollegen von unserem Blatt hinbeordert. Die Frau trug ein schwarzes Abendkleid, wie ich noch viele andere gesehen habe. Nur der Kopfputz war apart: Ein dunkler Turban aus feinstem Gewebe mit einer großen silbernen Mondsichel und drei Sternen in der Mitte der Stirn. Davon war eine Falte so geschickt drapiert, daß sie mit einem Griff Gesicht und Hals völlig verdecken konnte, aber diese Maskierung konnte praktisch ebenso mit einem einzigen Griff wieder entfernt werden.
»War es eine jüngere oder eine ältere Frau?« wollte Hyman nach längerem Schweigen weiter wissen.
»Nach der Figur und den Bewegungen eine junge Frau. Außerdem —«
Wellby brach plötzlich ab, aber der andere war nicht gewillt, sich mit dem unvollendeten Satz zufrieden zu geben.
»Was wollten Sie noch sagen?« drängte er, indem er den jungen Mann mit einem seiner unangenehmen, lauernden Blicke ansah.
»Oh, nichts von Bedeutung«, erwiderte der Reporter leichthin, und der gleichmütige, etwas gelangweilte Ausdruck in seinem Gesicht schien dies zu bestätigen.
Der Anwalt fühlte, daß der Mann ihm etwas Wesentliches vorenthielt. Aber schon das, was er gehört hatte, genügte, um ihn außerordentlich zu beschäftigen. Er beendete die Unterredung, die er so polternd eingeleitet hatte, mit einer stummen entlassenden Geste, und als Wellby ebenso stumm gegangen war, begann er, mit gesenktem Kopf und hochgezogenen Schultern, schwerfällig auf und ab zu marschieren.
Mrs. Evelyn Dyke blieb noch einige Augenblicke regungslos über die offene Lade ihres Schreibtisches gebeugt, bevor sie den winzigen Kopfhörer vom Ohr nahm, in der dazugehörigen Kassette verwahrte und dann die Lade mit besonderer Sorgfalt abschloß. Hierauf schob sie die Riegel an den Türen zurück, die sie vor jeder Störung gesichert hatten, nahm einige Papiere und drückte auf einen Klingelknopf. Das leise schnarrende Signal bedeutete, daß ihr der Weg durch die dick gepolsterte Doppeltür in das anstoßende Chefzimmer offenstehe.
Hyman empfing sie mit seinem, wie gewöhnlich, unfreundlichen Gesicht und einem kurzen Knurren, denn er konnte diese Frau noch weniger ausstehen als seine übrige Umgebung, weil er an sie nicht herankonnte.
Mrs. Evelyn Dyke war fünf Jahre lang Sekretärin und die rechte Hand des verstorbenen Sir Benjamin in seinem Zeitungskonzern gewesen, und eine letztwillige Verfügung hatte ihr diese Stellung lebenslänglich gesichert. Hyman war wütend über dieses Vermächtnis, das seine Selbstherrlichkeit einschränkte und seiner launenhaften Willkür eine Grenze setzte. Die Einsicht, daß er ohne dieses Erbe unendlich viel mehr Zeit und Mühe hätte verwenden müssen, sich in die komplizierten Verhältnisse des großen Zeitungsunternehmens einzuarbeiten, stimmte ihn womöglich noch schlechter. Tatsächlich kannte Mrs. Evelyn alles, wußte alles, und sie war zu Lebzeiten Sir Benjamins die eigentlich leitende Persönlichkeit gewesen, und das gesamte Personal, von den Chefs der einzelnen Blätter bis zum letzten Laufboy, hatte sich stillschweigend darauf eingestellt. Und wenn man auch heute den ungemütlichen Anwalt, dessen Tage im Haus infolge der besonderen Umstände allerdings gezählt waren, als unumschränkten Herrn gelten lassen mußte, weil er sich mit rücksichtsloser Energie als solcher gebärdete, vermochte dies der bisherigen Stellung der tüchtigen Mrs. Dyke doch keinen Abbruch zu tun. Man wußte, daß sie nach wie vor in allen wesentlichen Fragen das entscheidende Wort hatte, und es gab einige warnende Beispiele dafür, daß die Ungnade dieser noch immer schönen Frau mit dem regelmäßigen, kühlen Gesicht und dem energischen Mund mindestens ebenso verhängnisvoll werden konnte wie die des vierschrötigen Chefs.
»Drei neue Telegramme«, sagte Evelyn Dyke ohne weitere Einleitung mit ihrer dunklen Stimme. »Perth, Adelaide, Sydney. Alle negativ. Mr. Lawrence ist seit seinem Aufbruch von Urandang spurlos verschwunden.«
Sie legte die Blätter auf den Schreibtisch und ließ sich anmutig in einen der Klubsessel fallen. Sie tat dies vom ersten Tag an aus Prinzip, um dem unhöflichen neuen Chef zum Bewußtsein zu bringen, daß sie eine Dame und eine leitende Persönlichkeit und nicht eine seiner Korrespondentinnen war. Hyman hatte zwar beim erstenmal etwas Wütendes geknurrt, aber der unerschrockene, kampfbereite Blick, der auf ihn gerichtet war, hatte ihn abgehalten, das zu sagen, was er auf der Zunge hatte. Es ging etwas Bezwingendes von dieser gescheiten, tatkräftigen Frau aus, dem selbst seine urwüchsige Grobheit nicht standhielt.
Hyman nahm die Telegramme mechanisch auf und überflog sie, aber er war nicht wie sonst bei dieser wichtigen Sache. Das Ereignis der letzten Nacht und die Unterredung, die er eben gehabt, hatten ihm eine weit drückendere Sorge gebracht, die ihn unaufhörlich beschäftigte.
Die Frau, die vor ihm saß, wußte das. Sie wartete geduldig und sah angelegentlich auf die Spitze ihres eleganten Pumps, mit dem sie im Takt wippte. Aber es entging ihr nicht die leiseste Regung in dem finsteren Gesicht des Anwalts.
»Wann haben wir den Aufruf veröffentlicht?« unterbrach er endlich das Schweigen.
»Am 28. Oktober. Am Tag nach der Testamentseröffnung. Mr. Lawrence hat allerdings bereits am 15. September den Marsch in das Innere angetreten, aber nach den ursprünglichen Dispositionen hätte er spätestens Ende Januar wieder an der Küste sein müssen. Und da viele englische, amerikanische und australische Blätter den Aufruf gebracht haben und auch alle Auslandsstellen verständigt worden sind, hätte er bei seinem Eintreffen in dem erstbesten größeren Ort unbedingt sofort davon erfahren müssen.« Sie faltete die gepflegten schmalen Hände über dem Knie und richtete ihre grauen Augen mit eigenartigem Ausdruck auf Hyman. »Die Sache fängt an, rätselhaft zu werden.«
Der Anwalt hatte darauf nur ein Achselzucken. Bis heute morgen hatte ihn diese vergebliche Jagd nach dem Neffen und Universalerben Sir Benjamins einigermaßen in Atem gehalten, aber jetzt stand weit mehr auf dem Spiel. »Haben Sie die Notiz über den Tod Sir Nicholas' gelesen?« fragte er unvermittelt.
Mrs. Evelyn nickte gleichmütig, als ob es sich um eine ganz alltägliche Todesanzeige handelte, und Hyman mußte sich dazu bequemen, sein lebhaftes Interesse an dieser Sache etwas deutlicher zum Ausdruck zu bringen.
»Was sagen Sie zu der Geschichte?« schnaufte er, indem er die Hände in die Hosentaschen versenkte und nervös mit einem Schlüsselbund klapperte.
»Daß sie natürlich sehr viel Staub aufwirbeln wird und daß man wahrscheinlich fragen wird, weshalb wir nicht schon längst etwas unternommen haben, wenn uns die Umstände, unter denen Sir Benjamin gestorben ist, bedenklich schienen.«
»Wer sagt Ihnen, daß nichts unternommen wurde?« platzte der Anwalt wütend heraus, wandte sich aber sofort mit einem jähen Ruck ab, so daß Mrs. Evelyns seltsam flimmernde Augen nur seinen Rücken trafen.
»Das wußte ich natürlich nicht«, meinte sie gelassen, »und den anderen dürfte es wohl noch weniger bekannt sein. Sie werden sich an das halten, was in und zwischen den Zeilen der heutigen ›London Sensations‹ zu lesen ist und das nicht nur geheimnisvoll, sondern wie eine förmliche Anklage klingt.«
»Was wissen Sie von diesem Wellby?« sprang Hyman plötzlich vom Thema ab.
»Nicht viel. Er hat uns bei Ausbruch der Wirren in Afghanistan einige sehr interessante Artikel über die dortigen Verhältnisse gebracht, und der leitende Redakteur hat ihn später auf seine dringende Bitte in den Reporterstab des Blattes aufgenommen. Der Mann scheint viel in der Welt herumgekommen zu sein und ganz gut zu schreiben, aber es ist ihm offenbar in der letzten Zeit nicht zum besten gegangen.«
Alles das interessierte den Anwalt sichtlich nicht im mindesten, und er unterbrach Mrs. Dyke sehr schroff und ungeduldig.
»Glauben Sie alles, was er gesehen und gehört haben will?«
Die schöne Frau hob die Schultern und vermied es, auf diese Frage eine direkte Antwort zu geben.
»Es ist nicht anzunehmen, daß ein Mensch mit gesundem Menschenverstand so etwas bei einem derart tragischen Anlaß erdichtet. — Aber es ist möglich, daß die Episode im Haus von Lord Etheridge mit den Ereignissen in der letzten Nacht gar nichts zu tun hat.«
Hyman verriet nicht, wie er über diesen Punkt dachte, sondern nagte eine Weile an den wulstigen Lippen und kam dann in seiner sprunghaften, abgehackten Art plötzlich auf eine Reihe geschäftlicher Angelegenheiten zu sprechen.
Mrs. Evelyn war sehr nachdenklich, als sie in ihr Zimmer zurückkehrte, und fand es notwendig, neuerlich die Türen zu verschließen, um ungestört zu bleiben. Eine flüchtige Bemerkung, die dem Chef entschlüpft war, hatte sie etwas aus der Fassung gebracht, denn sie kannte seine Verschlagenheit nur zu gut und mußte wissen, woran sie war. Der findige Reporter hatte einen Stein ins Rollen gebracht, der zu einer verheerenden Lawine werden konnte, und es hieß nun doppelt auf der Hut sein.
»Pat«, sagte sie eine halbe Stunde später zu dem kleinen breitschultrigen Mann, der aus seinen blitzenden Augen schlau und ergeben zu ihr aufblickte, »ich möchte einiges über Mr. Wellby erfahren. Sie kennen ihn doch wohl? So rasch als möglich. — Haben Sie mich verstanden?«
Der Ire verzog den breiten Spalt zwischen seinem in allen möglichen Farben spielenden Bartwald, was bei ihm ein Grinsen bedeutete, und nickte lebhaft. Er wußte ganz genau, was das hieß, denn es war nicht der erste Auftrag dieser Art, den er von Mrs. Dyke empfing, und es gab nichts, was er lieber getan hätte. Er war in diese schöne Frau so schwärmerisch verliebt, daß es ihm stets ein Vergnügen war, ihr einen derartigen Dienst leisten zu können, und außerdem pflegte Mrs. Evelyn geradezu fürstlich zu honorieren. Wenn er seine schwärmerische Verehrung bezeigen und außerdem noch Geld verdienen konnte, war Pat Coppertree von doppeltem Eifer, und er brachte seiner Auftraggeberin stets reiches, brauchbares Material. Wie er es anstellte, so genaue und erschöpfende Auskünfte erteilen zu können, blieb sein Geschäftsgeheimnis. Jedenfalls konnte man sich auf ihn verlassen, und Mrs. Dyke durfte daher hoffen, binnen vierundzwanzig Stunden über den Mann, der die ›Königin der Nacht‹ gesehen haben wollte, manches zu erfahren, was ihr nützlich sein konnte.
Noel Wellby ahnte nichts von dem lebhaften Interesse, das die einflußreiche Frau, von deren Existenz er bisher nur vom Hörensagen wußte, an ihm nahm, aber als er sich am selben Abend im Cartwright-Haus einfand, konnte er die Beobachtung machen, daß er plötzlich zu einer Persönlichkeit geworden war. Schon im Vestibül legte Pat die Hand höflich an die Mütze, was er sonst nur bei jenen Herren tat, von denen er ein monatliches Geschenk von mindestens einem Pfund bezog, und im Reporterzimmer wechselte man bei seinem Eintritt bedeutsame Blicke. Mr. Fish bequemte sich sogar zu so etwas wie einem gönnerhaften Kopfnicken, und in seinen Augen lag die scheue Bewunderung, die man etwa einem Mann zollt, der unversehrt aus einem Löwenkäfig herausgekommen war. Noch vor einer Viertelstunde hatte der stets unternehmende ›Fliegenpilz‹ allerdings eine Wette vorgeschlagen, daß man den aufgeblasenen Burschen nicht mehr zu sehen bekommen werde, aber es war niemand darauf eingegangen, und Mr. Fish hatte zu seiner größten Entrüstung hören müssen, daß er sich am Vormittag höchst unfair benommen habe.
Wellby vergrub sich sofort in seinen Zeitungen und konnte feststellen, was er mit seinen wenigen Zeilen in den ›London Sensations‹ angerichtet hatte. Die kurze Notiz hatte in Fleet Street wie eine Bombe eingeschlagen, und die Spalten der Abendblätter verrieten, mit welcher Gier sich das aufgescheuchte Reporterheer auf die geheimnisvolle Angelegenheit gestürzt hatte. Man wußte zwar in der Sache selbst nichts Neues zu berichten, erging sich aber dafür um so ausführlicher in Nebensächlichkeiten und Vermutungen. Eins der Blätter teilte mit, daß zur selben Stunde, da Sir Nicholas vom Tod ereilt wurde, an der Mauer des Hauses ein polizeibekannter Dieb leblos zusammengebrochen war. Überall erinnerte man sich auch an den Tod von Sir Benjamin Cartwright, der vor ungefähr fünf Monaten eines Morgens in seinem Haus in Bayswater starr und steif an seinem Schreibtisch aufgefunden worden war. Der ›Evening Messenger‹ hatte sich sogar auf irgendwelche Weise den seinerzeitigen Obduktionsbefund zu beschaffen gewußt, den er nun in großer Aufmachung veröffentlichte. Das Gutachten war lediglich dadurch bemerkenswert, daß es einen trotz seiner gelehrten Weitschweifigkeit über die eigentliche Todesursache völlig im unklaren ließ. Der einzige einigermaßen auffallende Befund war eine eigenartige Affektion der Luftwege und der Lunge, doch wurden daraus keine besonderen Folgerungen gezogen.
Wie Mr. Hyman und Mrs. Dyke vermutet hatten, konnte es sich kein Blatt versagen, das seltsame Verhalten des Cartwright-Konzerns zu kritisieren, dessen leitende Persönlichkeiten doch offenbar längst gewisse Verdachtsmomente haben mußten, aber mit diesen viele Monate zurückgehalten hatten, bis das Schicksal Sir Mortons sie plötzlich zu einer schlecht angebrachten versteckten Anklage veranlaßte.
Der bereits genannte ›Evening Messenger‹ benützte die günstige Gelegenheit auch, um in einem fetten zweispaltigen Titel die äußerst herausfordernd und verfänglich klingende Frage aufzuwerfen: ›Wo bleibt der Erbe Sir Benjamin Cartwrights?‹ Das Blatt erinnerte daran, daß der Zeitungsmagnat ohne direkte Nachkommen gestorben sei und zu seinem Universalerben seinen Neffen Gordon Lawrence, den Sohn seiner verstorbenen älteren Stiefschwester, eingesetzt hatte, die mit einem Amerikaner, dem Grubenbesitzer Frank Lawrence, verheiratet gewesen war. Der junge, etwas abenteuerlustige Lawrence habe einige Wochen vor dem plötzlichen Ableben seines Onkels eine Reise in das innere Australien angetreten und sei seither trotz aller Bemühungen unauffindbar geblieben. Daran war in äußerst vorsichtigen Wendungen eine Bemerkung geknüpft, die die Leser mit geheimem Gruseln aufmerken ließ, weil sie die Möglichkeit andeutete, daß das unerklärliche Verschwinden von Gordon Lawrence vielleicht ein neues Glied in der Kette der rätselhaften Umstände bilden könne, unter denen der Tod von Benjamin Cartwright und Nicholas Morton erfolgt war.
Zum Schluß hatten so ziemlich alle Zeitungen das seinerzeit erschienene interessante Buch Sir Benjamins über seine afrikanische Jagdexpedition erwähnt und sogar einige der Bilder, wie Gruppenaufnahmen der Teilnehmer, wildromantische Landschaften und Fotografien seltener Trophäen, reproduziert. Aus den beigefügten Kommentaren war zu entnehmen, daß von den Mitgliedern dieses Jagdausflugs nur mehr drei am Leben waren: Mr. Arthur Bryans auf Threecourts und die beiden bekannten Londoner Kluberscheinungen Charlie Selwood und William Osborn.
Der Mann von den ›London Sensations‹, auf dessen Stichwort hin diese tolle Fontäne von Spürsinn, Phantasie und Druckerschwärze hochgeschossen war, hatte sich mit gelangweiltem Gesicht durch den ungeheuren Wust durchgelesen und nicht eine Zeile übersprungen, obwohl es für ihn dabei vorläufig nichts mehr zu tun gab. Mr. Hyman hatte die strikte Weisung ergehen lassen, daß die Blätter seines Konzerns in dieser Sache nur jene Nachrichten bringen dürften, die ihnen direkt vom Chefbüro zukamen, und die Reporter waren darüber nicht sonderlich böse. Man ersparte sich eine Menge Mühen und die unaufhörliche Angst, von der Konkurrenz geschlagen zu werden.
Wellby entnahm seinem abgenützten Etui eine Zigarette, setzte sie in Brand und sah dann nach der Uhr. Es ging gegen acht, und um neun hatte er einer Versammlung der Heilsarmee beizuwohnen, die sich augenblicklich für und wider ihren General in den Haaren lag, woran alle echten englischen Bürger dasselbe lebhafte Interesse nahmen wie an jedem außergewöhnlichen Fußballspiel. Es blieb ihm also Zeit, noch vorher in einem der billigen Restaurants in der Nähe von Old Bailey ein einfaches Abendbrot einzunehmen, was sich bei der zu gewärtigenden Redseligkeit der streitbaren Versammlung dringend empfahl.
Als er im Vestibül an Clarisse Avery, einer seiner Kolleginnen, mit einem kurzen Gruß vorüber wollte, sprach sie ihn plötzlich an. Es hatte den Anschein, als ob sie auf ihn gewartet habe, und sie vermochte eine gewisse Befangenheit und Unruhe nicht zu verbergen.
»Verzeihen Sie«, sagte sie hastig, »aber ich habe gehört, daß Sie ebenfalls zu der Versammlung in der Cartershall gehen. Ich habe einige der weiblichen Offiziere zu interviewen und wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich mitnehmen würden. Wir können uns dann auch gleich in die Abfassung des Berichts teilen«, schloß sie schüchtern, und Wellby stimmte höflich zu.
Er war von dieser plötzlichen Vertraulichkeit des jungen Mädchens einigermaßen überrascht, denn Miss Avery galt als ein verschlossenes Wesen, das wie ein Schatten im Haus ein und aus ging. Sie arbeitete, soviel er wußte, bereits über ein halbes Jahr bei den ›London Sensations‹ und erwies sich als sehr geschickt, aber ihre Erscheinung war nicht danach angetan, einen besonders für sie einzunehmen. Während der Fahrt im Bus hatte er bei dem gleichgültigen Gespräch, das sie führten, zum erstenmal Gelegenheit, sich diese Kollegin näher anzusehen, und er war betroffen von dem widersinnigen und grausamen Spiel, das die Natur hier getrieben hatte. Das feingeschnittene, regelmäßige Gesicht mit dem kleinen, etwas üppigen Mund war durch ein häßliches Feuermal verunstaltet, das vom linken Ohr über die untere Wange bis an den Hals lief, und dazu kam noch, daß eine dicht anliegende, große dunkle Sonnenbrille die Augen völlig verbarg und den Zügen etwas Unpersönliches und Altjüngferliches gab. Auffallend schön war ihre Gestalt, wenn sie sich hie und da aus ihrer schlechten Haltung aufrichtete, und wenn man die gesunde Wange mit dem frischen, brünetten Teint vor sich hatte und sich durch die schauderhaften toten Brillengläser nicht stören ließ, war man von dem Reiz des regelmäßigen Profils außerordentlich überrascht und gefesselt. Aber Clarisse Avery tat gar nichts dazu, um ihre Vorzüge wenigstens einigermaßen zur Geltung zu bringen. Sie ließ die Schultern nach vorne hängen, trug unter einem engen, unmodernen Mantel ein hochgeschlossenes, altmodisches Kleid, und die Haarlocke von dunklem Kupferglanz, die sie unter dem einfachen verblichenen Hut kokett hervorgedreht hatte, war das einzige an ihr, was von weiblicher Eitelkeit sprach.
Wellby mußte das Mädchen an seiner Seite immer wieder verstohlen betrachten, und er fragte sich, ob dieses arme Geschöpf wohl unter seiner Häßlichkeit litt.
Und wie als Antwort auf seine stumme Frage sagte Miss Avery plötzlich: »Sie sind mir doch hoffentlich nicht böse, daß ich mich Ihnen angeschlossen habe. Ich weiß, daß ich keine gute Figur mache, aber das läßt sich leider nicht ändern. Denken Sie einfach, daß Sie mit Mr. Fish fahren, der auch nicht vorteilhafter aussieht, obwohl er es sich wahrscheinlich einbildet.«
Daß sie förmlich seine Gedanken erraten hatte, setzte Wellby in einige Verlegenheit, aber noch verwirrter war er über ihren Ton, der so gar nicht zu ihrem ganzen trübseligen Aussehen paßte. Es lag ein frischer, überlegener Humor in ihren Worten, und als er sich ihr jäh zuwandte, sah er für Sekunden einen etwas spöttisch lächelnden Mund mit wundervollen Zähnen und leicht vibrierende Nasenflügel, und er verwünschte die Gläser, die ihm die Augen seiner Begleiterin verbargen.
Miss Avery schien über diese ›Entgleisung‹ selbst erschrocken, denn ihr Gesicht nahm wieder seinen gewöhnlichen kalten, nichtssagenden Ausdruck an, und ihr Oberkörper fiel noch mehr als sonst in sich zusammen. Sie war während der weiteren Fahrt plötzlich sehr einsilbig und nachdenklich, doch dem Reporter kam es vor, als ob sie ihn hinter ihrer dunklen Brille hervor scharf beobachtete und immer wieder zu einer Bemerkung ansetzte, die aber nicht über ihre Lippen kommen wollte.
Als sie die Endstation erreichten, von der das Versammlungslokal nur mehr eine kurze Strecke entfernt war, fühlte sich Wellby, der ehrlichen Hunger verspürte, veranlaßt, die Kollegin zu einem kleinen Imbiß einzuladen, und sie war ohne weiteres einverstanden. Sie wählten ein einfaches, nettes Restaurant, aber das Mädchen legte nicht erst ab, sondern drückte sich in die nächste dunkle Ecke und konnte sich, als er dagegen protestierte, eine kleine Selbstironie nicht versagen.
»Lassen Sie mich nur. Wenn mich die Leute im Licht sehen würden, könnte Ihr Geschmack arg in Mißkredit kommen.«
Er hörte ein leises melodisches Lachen, und die Gegensätze in diesem eigenartigen Wesen setzten ihn immer mehr in Erstaunen. Während sie speisten, entdeckte er plötzlich, daß das unscheinbare Mädchen ihm gegenüber die wunderbarsten und gepflegtesten Hände besaß, die er je gesehen hatte, und er starrte so bewundernd darauf, daß Miss Clarisse, sichtlich erschrocken, ihre Hände unter dem Tisch verbarg.
»Sie haben mit Ihrer Nachricht über den Tod von Sir Nicholas Morton sehr viel Staub aufgewirbelt«, sagte sie mit einer gewissen Hast, als ob sie durch das nächstbeste Gesprächsthema über ihre Verlegenheit hinwegkommen wollte. »Die Sache las sich auch furchtbar aufregend. Besonders die Geschichte von der ›Königin der Nacht‹. — Haben Sie selbst diese Episode beobachtet?«
Wellby nickte lächelnd.
»Allerdings. Ich war der geheimnisvollen Frau so nahe, wie ich jetzt Ihnen bin.«
Die dunklen Augengläser ruhten sekundenlang auf ihm, dann begann Miss Avery langsam ihre gewirkten, an den Spitzen sorgsam gestopften Handschuhe anzuziehen.
»Das nenne ich Reporterglück«, meinte sie leichthin. »Wer weiß, welch wichtige Dienste Sie nun in dieser rätselhaften Geschichte noch leisten können. — Es dürfte Ihnen ja vielleicht möglich sein, die Frau wiederzuerkennen?«
Der junge Mann mit den leicht angegrauten Schläfen zündete sich eine Zigarette an und hob die Schultern.
»Das traue ich mir nicht zu«, erwiderte er bedächtig, »denn ich habe leider so gut wie gar keinen Anhaltspunkt.«
Er sprach, wie am Vormittag im Zimmer Mr. Hymans, nicht ganz die Wahrheit, aber das konnte ja die Kollegin nicht interessieren.
Als Wellby die Rechnung beglichen hatte, wurde das junge Mädchen plötzlich sehr energisch.
»Machen Sie keine Dummheiten«, tuschelte sie ihm zu. »Sie sehen mir nicht danach aus, als ob Sie sich das leisten könnten, und wenn es so wäre, so würde ich es mir erst recht nicht gefallen lassen. Ich mag niemandem verpflichtet sein.« Sie nahm den Zettel auf und überflog ihn. »Sie bekommen von mir einen Schilling neun Pence«, schloß sie sachlich und bestimmt.
Noch vor dem Hause zählte sie den Betrag ab und reichte ihm das Geld, obwohl ein strömender Regen niederging. Zum Glück hatten sie nur etwa hundert Schritte zu gehen, aber als sie bei der Cartershall anlangten, rann das Wasser förmlich in Bächen von ihren Mänteln und Hüten, und sie schüttelten sich, während sie unter der großen Lampe im Flur standen.
Wellby, der sich hinter Clarisse Avery befand, beugte sich plötzlich blitzschnell vor und starrte betroffen auf den Hals seiner Begleiterin, aber diese hatte es sehr eilig, ihre nasse Garderobe loszuwerden, und entschlüpfte ihm, ehe er sich noch vergewissern konnte, ob ihn seine Augen nicht getäuscht hatten.
»Scheren Sie sich hinaus«, brüllte Hyman wütend, als sein Boy mit einer Visitenkarte in der Hand in der Tür erschien. Er hatte eben die Abendzeitungen mit den ersten Sensationsmeldungen über den Fall Morton gierig verschlungen und war dabei, die Bescherung, die seine schlimmsten Befürchtungen übertroffen hatte, zu verdauen. Sein breites Gesicht war blaß, und das Weiß seiner Augen war wie von einem roten Spinngewebe durchzogen.
»Mr. Miles Sayer von Scotland Yard«, schnarrte der Bursche an der Tür unbeirrt, und Thomas Hyman wurde noch um einen Ton fahler. Wenn in dieser Stunde noch etwas gefehlt hatte, um ihn vollends aus der Fassung zu bringen, so war es das Eingreifen der Polizei, und er bemühte sich nicht einmal, dem Beamten gegenüber zu verbergen, wie wenig erfreut er über seinen Besuch war. Er empfing ihn mit den Händen in den Hosentaschen, einem kurzen Kopfnicken und einem starren, fragenden Blick, der zur Eile drängte.
Inspektor Sayer, ein gewandter junger Mann, den man eigens für diese etwas heikle Mission ausgewählt hatte, überzeugte sich, daß man ihm von der Eigenart des Chefs des Cartwright-Konzerns nicht zu viel erzählt hatte, und war froh, daß sein Auftrag so begrenzt war.
»Ich möchte Sie um einige Auskünfte ersuchen«, sagte er höflich und gelassen und kam sofort zur Sache, da Hyman mit seinen breiten Schultern so etwas wie eine auffordernde Geste machte.
»In einem der heutigen Morgenblätter Ihres Konzerns ist die erste Nachricht über den Tod von Sir Nicholas Morton erschienen. — Können Sie mir sagen, auf welchem Wege Ihnen diese Meldung zugekommen ist?«
»Durch einen Reporter«, knurrte der Anwalt bissig, und wenn er Wellby in diesem Augenblick in Reichweite gehabt hätte, wäre er ihm unbedingt an die Gurgel gefahren.
»Sein Name, bitte.«
»Wellby. Wenn Sie noch mehr über ihn wissen wollen, erkundigen Sie sich in der Redaktion oder beim Pförtner.«
»Danke«, sagte der Beamte und notierte sich den Namen. »Und dann waren dieser Nachricht noch einige Bemerkungen angefügt. Die eine betraf eine geheimnisvolle Begegnung, die Morton im Hause von Lord Etheridge gehabt haben soll, und die zweite erwähnte gewisse Gerüchte, die angeblich bereits nach dem Tode von Sir Benjamin in Umlauf gekommen sind. — Wer hat das geschrieben?«
»Alles derselbe Mann«, erklärte Hyman mit einem grimmigen Grinsen. »Er hat die ganze nette Pastete fix und fertig geliefert. Und leider hat sie niemand zu Gesicht bekommen, bis sie auf dem Präsentierteller lag.«
Der Inspektor sah in den Hut, den er in den Händen drehte, und suchte die letzte Frage, die er noch zu stellen hatte, so unauffällig und doch so zweckdienlich wie möglich zu fassen.
»Aus Ihren Mitteilungen entnehme ich, daß die so eigenartig gehaltene Notiz in den ›London Sensations‹ nur von einem Ihrer Redakteure stammt und daß auch die gewissen Andeutungen eigentlich nur seine persönliche Auffassung wiedergeben...«
»Von einem meiner Reporter«, stellte Hyman mit Nachdruck richtig. »Meine Redakteure haben, wie ich hoffe, so viel Verstand, daß sie der Öffentlichkeit nicht mit solchem Blödsinn kommen!«
Der junge Beamte verneigte sich verbindlich, was alles mögliche heißen konnte, und sah dann dem großen Mann plötzlich voll in das mürrische und ungeduldige Gesicht.
»Wir würden großen Wert darauf legen, Mr. Hyman«, sagte er langsam und in besonders höflichem Ton, »zu erfahren, wie Sie selbst über diesen ganzen Fall denken.«
»Ich?« Der Anwalt warf betroffen den Kopf zurück und zog die wulstigen Brauen so hoch, daß die Augen wie zwei starre feuchtschimmernde Glaskugeln hervortraten. »Was wollen Sie von mir? — Ich denke mir gar nichts«, fuhr er dann plötzlich wütend los. »Ich habe andere Dinge zu tun, als mir über solche Sachen den Kopf zu zerbrechen. Dazu ist doch die Polizei da.«
Er schnappte nach Luft, und der Inspektor gab ihm durch eine kurze Geste recht.
»Allerdings.« Er sah wieder in seinen Hut und drehte ihn langsam durch die Finger. »Wir dachten nur, daß wir von Ihnen vielleicht irgendeine wichtige Andeutung erhalten könnten. Bezüglich des einen oder des andern besonderen Umstandes, der dem Tode von Sir Benjamin vorangegangen ist. — Vielleicht erinnern Sie sich, daß Cartwright wenige Stunden vor seinem Tod mit Ihnen telefonisch ein Gespräch geführt hat, in dessen Verlauf er unter anderem beiläufig sagte: ›Die Sache mit der ››Königin der Nacht‹‹ läßt mir keine Ruhe. Ich muß ihr endlich auf den Grund kommen, und es tut mir leid, daß Sie sich heute nicht frei machen konnten. Jedenfalls sende ich Ihnen sofort das Buch, damit Sie wissen, unter welchen Umständen sich die Episode damals abgespielt hat.‹«
Inspektor Sayer blickte auf, aber Hyman hatte seinen mächtigen Schädel gesenkt und stand regungslos wie ein Steinblock.
»Woher haben Sie das?« fragte er nach einer Weile ruhig.
»Von dem Diener des Verstorbenen. Er hat sich heute vormittag selbst bei Scotland Yard gemeldet, da ihm die Erwähnung der ›Königin der Nacht‹ in den ›London Sensations‹ das Gespräch in Erinnerung gebracht hat. Er hatte damals die Verbindung mit Ihnen hergestellt und will das, was ich Ihnen eben wiederholte, aus dem Mund Sir Benjamins gehört haben, bevor er das Zimmer verließ.«
Das Gesicht des Anwalts war zu einer spöttischen Grimasse verzogen.
»Natürlich. Das ist etwas für diese Leute. Ich kann mir denken, mit welcher Gänsehaut der alte Bursche nun herumläuft und wie wichtig er sich plötzlich vorkommt.« Er blickte aus seiner ansehnlichen Höhe auf den Beamten herab, und in seinen Augen lag eine offene Herausforderung. »Aber ich kann mich leider an dieses Gespräch nicht erinnern. Ich habe Tag für Tag ungezählte Male mit Sir Benjamin telefoniert, und wenn der Diener es behauptet, ist es ja möglich, daß Sir Benjamin einmal etwas von einer ›Königin der Nacht‹ erwähnt hat, aber jedenfalls war das eine ganz belanglose Sache.«
Der gewandte Inspektor erwiderte seinen Blick und verbeugte sich zum Abschied.
»Natürlich«, gab er verbindlich zu. »Aber«, er hob ein wenig die Stimme und betonte jedes Wort, »vielleicht wird es Ihnen möglich sein, sich das betreffende Gespräch doch noch genauer in Erinnerung zu rufen.«
Mr. Hyman nagte an seinen wulstigen Lippen und nickte nur kurz. Erst als der Beamte bereits die Tür öffnete, rief er ihm nach: »Vielleicht.«
Dann hieb er mit seiner mächtigen Faust auf den Tisch und fegte mit einem Ruck den Berg von Zeitungen zu Boden.
Mrs. Dyke überlegte, ob es Zweck habe, den Chef in diesem Augenblick aufzusuchen, kam aber schließlich davon ab. Es war das beste, vollkommene Ruhe zu bewahren und die Dinge sich entwickeln zu lassen, bis man einigermaßen überblicken konnte, welche Richtung sie nahmen und wie weit sie gedeihen würden. Der Alarm der Blätter und die plötzlich erwachte Neugierde der Polizei waren wohl unangenehm, aber das bedeutete noch lange nicht, daß nun die Enthüllungen einander Schlag auf Schlag folgen würden. In dem unendlichen Wust von Nachrichten war auch nicht ein wirklicher Anhaltspunkt, und Scotland Yard hatte lediglich die Aussage eines Dieners, die Mr. Hyman in eine etwas peinliche Lage brachte.
Evelyn hatte an dem winzigen Kopfhörer in ihrem Schreibtisch, der selbst das leiseste Wort mit voller Deutlichkeit wiedergab, auch die letzte Unterredung mit fieberhafter Spannung verfolgt, und sie hatte sich trotz des Ernstes des Augenblicks eines befriedigten Lächelns nicht erwehren können, als der bärbeißige Koloß so in die Enge getrieben worden war.
Das waren aber schließlich alles Dinge, die sie nicht direkt betrafen, wenn es auch gut war, davon zu wissen. Weit wichtiger erschienen ihr einige Fragen, die mit dem Reporter Noel Wellby zusammenhingen und auf die sie trotz allen Grübelns keine Antwort fand. Wie Scotland Yard trug auch sie schon seit dem heutigen Morgen Verlangen, zu erfahren, wie der Mann so rasch von dem nächtlichen Geschehen am Porchester Square Kenntnis erhalten hatte, und wie er dazu gekommen war, klipp und klar Dinge auszusprechen, über die man zwar seinerzeit getuschelt hatte, die aber schwarz auf weiß und in diesem Zusammenhang geradezu zu einer öffentlichen Anklage wurden. Das, was er geschrieben hatte, war keine einfache Zeitungsnachricht, sondern ganz darauf angelegt, mit einer peinlichen Untersuchung des Falles Morton auch eine solche des Falles Cartwright herbeizuführen. Wer hatte diesem unbedeutenden Zeitungsmenschen diese Idee eingegeben?
Mrs. Evelyn hatte schon frühzeitig alles in Bewegung gesetzt, um über ihn zu erfahren, was zu erfahren war, und dann hatte sie eine günstige Gelegenheit benützt, um sich ihn näher zu betrachten. Er war ihr bisher noch nie begegnet, und als sie ihn sah, war sie nichts weniger als beruhigt. Dieser schlanke, sehnige Dreißiger mit dem kühlen Blick und dem beherrschten Bronzegesicht wußte genau, was er wollte und was er tat, und wenn sie davon noch nicht überzeugt gewesen wäre, so hätten es ihr die Ruhe und Gewandtheit verraten, mit der er eine halbe Stunde später dem gefürchteten Chef standhielt.
Deshalb schien es ihr wichtiger als alles andere, sich mit diesem Mann zu beschäftigen, und sie sah dem Bericht, den der tüchtige Pat ihr am nächsten Tage liefern sollte, mit ungeduldiger Spannung entgegen.
Ein dumpfer Krach aus dem Nebenraum sagte ihr, daß Hyman seinen geräuschvollen Abgang vollzogen habe, und eine Viertelstunde später lenkte auch sie ihre kleine Limousine aus der Garage des Cartwright-Hauses. Sie wohnte ziemlich weit draußen in Nottinghill in einem niedlichen Haus inmitten eines kleinen Gartens mit uralten Bäumen. Das Häuschen bestand nur aus wenigen Räumen, aber ihr Geschmack hatte es behaglich eingerichtet. Sir Benjamin hatte seiner Sekretärin ein Gehalt ausgesetzt, das ihr diesen Luxus gestattete, und andere kostspielige Bedürfnisse schien Mrs. Dyke nicht zu haben. Sie ging immer sehr elegant gekleidet, trieb aber auch in dieser Beziehung keinen auffallenden Aufwand und trug selbst in Gesellschaft nur wenige Schmuckstücke. Hie und da lud sie einige Freunde und Bekannte zu sich ein, und jeder der Angestellten des Konzerns empfand es als besondere Auszeichnung, zu diesen Gesellschaften eingeladen zu werden. Es ging hierbei stets sehr angeregt und gemütlich zu, und Evelyn erwies sich als vollendete Hausfrau, obwohl sie aus einfachen Verhältnissen kam. Mr. Fish hatte durch seine vielfachen Beziehungen einwandfrei festgestellt, daß ihre Eltern in Packham ein Milchgeschäft betrieben hatten und daß der verstorbene Mr. Dyke Anwaltsgehilfe gewesen war.
Wie sich dann ihr Aufstieg vollzogen hatte, war nie bekanntgeworden. Manche versuchten, die Frage mit einem vielsagenden Lächeln und der Bemerkung abzutun, daß Mrs. Dyke eben eine schöne Frau sei, aber so willig sonst solche einfachen pikanten Deutungen aufgenommen werden, in diesem Fall wirkten sie nicht ganz überzeugend. Sir Benjamin war ein verschlossener, halb gebrochener Mann gewesen, seit er nach kaum dreijähriger Ehe seine abgöttisch geliebte Frau verloren hatte und weder zu seinen Lebzeiten noch nach seinem Tod hatte die Lebensführung von Mrs. Evelyn auch nur den geringsten Anlaß zu irgendeinem kleinen herzerfreuenden Klatsch gegeben. Im Gegenteil, man wunderte sich, daß diese kaum dreißigjährige Frau, die in ihrer rassigen Reife für die Männerwelt etwas Verführerisches hatte, sich in einen kleinen Freundeskreis einspann, von dem sie niemanden in besonderer Weise auszuzeichnen schien. Einigermaßen auffallend war es nur, daß zu diesem Kreis vor allem Charlie Selwood und William Osborn gehörten, zwei der Begleiter Sir Benjamins auf seinem afrikanischen Jagdausflug. Allerdings mochten die beiden gut um zehn Jahre jünger sein als der große Zeitungsmann, und auch sonst gab es wohl einige Unterschiede, weshalb Cartwright in den letzten Jahren mit ihnen nur mehr in losen Beziehungen gestanden hatte. Man wußte übrigens schon vor Aufbruch der Expedition, daß die Wahl Sir Benjamins nur deshalb auf diese zwei jungen Leute gefallen war, weil sie kühne Burschen waren und von der Büchse bis zum Ballschläger mit jedem Sportgerät umgehen konnten.
Die Gesellschaft war knapp vor Ausbruch des Weltkrieges zurückgekehrt, und schon nach wenigen Monaten hieß es, daß Charlie Selwood und William Osborn durch glückliche Spekulationen sehr viel Geld gemacht hätten. Man wunderte sich zwar, daß aus den beiden Vettern, die außer dem Sport nie eine andere Beschäftigung gekannt hatten, plötzlich so smarte Geschäftsleute geworden sein sollten, aber tatsächlich verfügten sie mit einemmal über Mittel, die ihnen gestatteten, auf größtem Fuß zu leben. Im Lauf der Jahre schien es mit beiden allerdings wieder abwärts zu gehen, denn sie bauten ihren Wagenpark und ihren Haushalt wesentlich ab und schränkten sogar das Spielen ein. In der letzten Zeit jedoch hatte Osborn durch eine arg bekrittelte Heirat offenbar wieder festen Boden unter den Füßen gewonnen, da er im Klub neuerlich Einsätze wagte wie in seinen glänzendsten Tagen.
Es war einige Minuten nach acht Uhr, als Evelyn in Nottinghill anlangte, und sie wurde sehr nervös, als sie hörte, daß Selwood bereits vor ihr angekommen war. Sie hatte ihn und die Osborns erst für neun zu sich gebeten und damit gerechnet, vorher noch mit aller Sorgfalt Toilette machen zu können. Sie nahm es damit sehr genau, seitdem sie vor kurzem in ihrem welligen braunen Haar bedenkliche weiße Fäden entdeckt hatte und in ihren Augenwinkeln winzige Fältchen zum Vorschein kamen. Das konnte sie vorläufig nicht brauchen, und es durfte niemand davon wissen.
Ihr Mädchen hatte es in der nächsten halben Stunde schwer, mit ihr fertig zu werden, aber dafür sah Mrs. Dyke, als sie den kleinen Salon betrat, wirklich blendend aus, und Selwood sagte ihr das mit einem Blick, der sie sehr befriedigte.
»Ich kann mir denken, weshalb du so früh gekommen bist«, begrüßte sie ihn hastig mit. gedämpfter Stimme. »Aber wenn du von mir eine Aufklärung erwartest, so muß ich dich enttäuschen. Ich weiß gar nichts. Trotz der seltsamen Notiz.«
Sie berichtete ihm erregt und eifrig, was sich im Cartwright-Haus abgespielt hatte, und man merkte, daß die tagsüber mit aller Energie aufrechterhaltene Fassung sie nunmehr im Stich ließ. Ihr Gesicht bekam einen hilflosen, ängstlichen Ausdruck, und ihre Augen irrten unruhig umher, als ob sie nach einer drohenden unheimlichen Gefahr Ausschau hielten.
Charlie Selwood hörte ihr gespannt zu, und ihre Aufregung schien sich auch auf ihn zu übertragen. Er war ein großer, breitschultriger Mann mit frischem, bartlosem Gesicht, das ihn weit jünger erscheinen ließ, als er tatsächlich war. Aber in diesem Augenblick sah er fahl und verfallen aus.
»Das wird ja immer rätselhafter und beklemmender«, sagte er, als Evelyn ihren Bericht abgehackt und zum Schluß fast flüsternd beendet hatte. »Ich lebe seit heute morgen in einer Aufregung, die mich fast um den Verstand bringt, aber ich wagte nicht, dich anzurufen.« Er brach ab und starrte eine Weile vor sich hin. »Ich habe das Gefühl«, fuhr er dann plötzlich apathisch fort, »daß die Sache nun nicht mehr aufzuhalten ist. Nach dem Tod des armen Cartwright hoffte ich, daß alles abgetan sei, aber das Schicksal Mortons beweist, daß es nur ein Aufschub war. Und der Gedanke, daß beide vielleicht zu retten gewesen wären, wenn...«
Evelyn Dyke machte eine kurze ungeduldige Bewegung, und auf ihrem Gesicht lag plötzlich wieder die kühle, überlegene Ruhe, die sie ständig zur Schau trug.
»Es hat keinen Zweck, Charlie, sich mit solchen Dingen zu quälen. Das alles läßt sich nicht mehr ungeschehen machen, aber das andere muß verhindert werden, und nun erst recht, da bereits ein solcher Preis dafür gezahlt worden ist.« Sie beugte sich zu ihm und streichelte mit einem zärtlichen Blick seine Hand, die kraftlos über die Lehne des Sessels hing. »Und ich werde es verhindern, denn ich würde alles für dich tun, obwohl...«
Sie schwieg unvermittelt und sah zu Boden, und als sie seinen fragenden Blick auf sich gerichtet fühlte, färbte eine leichte Blutwelle ihr brünettes Gesicht noch dunkler.
»Das klingt wie ein Vorwurf«, meinte er betroffen. »Hast du dich über mich zu beklagen?«
»Nein«, gab sie leichthin zurück, »aber zuweilen denke ich daran, daß wir uns nun schon volle sechs Jahre kennen und daß wir in dieser langen Zeit eigentlich sehr wenig voneinander gehabt haben. Selbst in den knapp bemessenen Stunden, die wir uns sahen, mußten wir zumeist vor den anderen Komödie spielen. Das ist sehr traurig, denn die Zeit verfließt« — es klang etwas wehmütig und bitter —, »und unsere sogenannten besten Jahre sind gezählt. Die meinen und auch die deinen. Soll das wirklich unser ganzes Leben so fortgehen?«
Sie sah ihn unter halbgeschlossenen Lidern hervor an, aber er wich ihrem Blick aus und konnte nicht verbergen, daß ihm dieses Thema unangenehm war.
»Gewiß nicht«, versicherte er mit verlegenem Eifer. »Du weißt ja, daß ich genauso denke wie du. Und wenn ich erst einmal von diesem furchtbaren Alpdruck wirklich befreit sein werde... Mir ist ja der ganze Zusammenhang unfaßbar« — er sprang plötzlich wieder ab —, »aber eines scheint mir besonders auffällig: daß die ›Königin der Nacht‹ nie die Frist abwartete, die sie selbst stellt. Bei Cartwright ist die Katastrophe drei Tage früher eingetreten, bei Morton zwei Tage...«
Er wurde durch die Ankunft des Ehepaares Osborn unterbrochen, aber schon fünf Minuten später war man wieder bei diesem Thema. Diesmal war es William, der die Angelegenheit mit nervöser Ungeduld aufs Tapet brachte.
»Eine verdammte Geschichte«, stieß er mit seiner schleppenden, näselnden Stimme hervor und ließ seine verschleierten dunklen Augen forschend zwischen Evelyn und Selwood hin- und hergehen, als ob er schon aus ihren Mienen entnehmen wollte, wie weit das Unheil gediehen war. »Nun können wir uns auf einige recht unangenehme Wochen gefaßt machen, denn wenn diese Pressemeute erst einmal losgelassen ist, schnüffelt sie überall herum, und man kann nie wissen, was dabei herauskommt. Unseren afrikanischen Ausflug haben sie ja schon ausgegraben, und ich war bereits heute darauf vorbereitet, daß der eine oder der andere dieser zudringlichen Presseleute mir auf den Leib rückt.« Er fuhr sich über den sorgfältig gezogenen Scheitel, der bereits stark gelichtet und angegraut war, und sah Mrs. Dyke und seinen Vetter bedeutsam an. »Natürlich ist aus mir nichts herauszubekommen«, sagte er nachdrücklich, »wenn ich überhaupt zu Hause bin. Falls es halbwegs möglich ist, werde ich nämlich unsichtbar bleiben und es Helen überlassen, diese sympathischen Leute abzufertigen. — Ich glaube, dabei besteht keine Gefahr.«
Er lächelte etwas bissig und blickte auf seine Frau, aber diese nickte sehr lebhaft und schien die Anspielung auf ihre Schwerfälligkeit nicht zu verstehen. Konversation zu führen, war nicht gerade ihre starke Seite, und wenn sie einmal den Versuch machte, so fiel dies meist nicht sehr glücklich aus. Sie sprach mit starkem Dialekt, und in dem Bestreben, sich gebildet auszudrücken, passierten ihr zuweilen die übelsten Entgleisungen. Das wußte sie, und deshalb beschränkte sie sich in Gesellschaft auf einige geschraubte, aber unverfängliche Phrasen, die sie sich fest eingeprägt hatte und mit denen sie auskam. Man machte sich darüber lustig, wie man sie überhaupt nicht ernst nahm, und die überraschende Heirat hatte Osborn seinerzeit in den Augen seiner Kreise sehr deklassiert. Man verübelte es ihm, daß er, um sich über Wasser zu halten, skrupellos nach dem erstbesten Rettungsanker gegriffen und die Tochter eines Mannen zur Frau genommen hatte, der in dem Ruf stand, einer der übelsten Wucherer Londons zu sein. Dabei war Mrs. Osborn durchaus keine Schönheit, ohne allerdings ausgesprochen häßlich zu sein. Ihre Figur war sogar von einem vollendeten fraulichen Ebenmaß, aber ihr Gesicht mit den starken Backenknochen, der etwas breiten Nase und dem aufgeworfenen Mund hatten einen fast negroiden Einschlag. Es mochte sein, daß von dieser Frau ein eigenartiger sinnlicher Reiz ausging, aber das ließ man um so weniger als Entschuldigung gelten, als sie ansonsten unwahrscheinlich hausbacken und langweilig war. Auch Osborn schien sie bereits nach kurzer Zeit auf die Nerven zu fallen, denn er genierte sich selbst vor der Öffentlichkeit nicht, sie unablässig mit bissigen Bemerkungen zu traktieren, was aber ihrer aufdringlichen Verliebtheit keinen Abbruch zu tun vermochte.
Außer ihrem Mann und ihrem Hund, den sie ständig mit sich herumschleppte, vermochte ihr offenbar nichts Interesse abzugewinnen, und auch jetzt, da die andern in sichtlichem Unbehagen und mit vorsichtigen Andeutungen immer wieder um das Rätsel der ›Königin der Nacht‹ herumredeten, erwachte sie nicht aus ihrer Teilnahmslosigkeit. Sie wußte, worum es bei der Sache ging, und daß ihrem Gatten die gleiche Gefahr drohte wie den anderen, und sie begriff auch, daß der heutige Tag die Lage kritischer denn je gestaltet hatte, aber trotzdem langweilte sie sich unendlich, und wenn nicht das Hündchen auf ihrem Schoß gewesen wäre, das fortwährend gekrault werden wollte, wäre sie wahrscheinlich eingeschlafen.
Nur als Evelyn immer wieder auf den Reporter Noel Wellby zu sprechen kam, dessen seltsame Rolle sie besonders zu beunruhigen schien, horchte Helen mit einiger Aufmerksamkeit auf.
»Könnten Sie diesen Polizisten nicht einmal einladen, damit...«, begann sie stockend, aber ein ärgerlicher Blick ihres Mannes ließ sie ängstlich sofort wieder innehalten.
»Ein Reporter ist kein Polizist, sondern ein Zeitungsmensch«, korrigierte er sie übellaunig.
»Ach so«, meinte sie naiv, »das wußte ich nicht. Ich wollte nur vorschlagen, daß Mrs. Dyke den Mann zu sich einlädt und daß wir auch zufällig herkommen und ihn uns ansehen. — Ich schwärme für solche Leute, um die so etwas wie ein Geheimnis herum ist«, gestand sie mit einem verlegenen Lächeln.
»Schwärme lieber für deinen Hund und störe uns nicht«, wies sie ihr gereizter Gatte zurecht, und sie ließ sich das nicht zweimal sagen. Schließlich hatte sie ja nun ihr Scherflein zur Unterhaltung beigetragen, und man konnte ihr nicht nachsagen, daß sie den Mund überhaupt nicht aufgemacht habe, was dem ewig unzufriedenen Osborn auch nicht recht gewesen wäre.
Während des einfachen, aber vorzüglichen Dinners mußte man wegen des Personals über die verschiedensten gleichgültigen Dinge sprechen, aber nach Tisch hielt man dann förmlich Kriegsrat.
»Ich weiß nicht, was kommen wird«, meinte Mrs. Evelyn und sah auf ihre schönen Hände, »aber es scheint mir geraten, daß wir auf alle Möglichkeiten vorbereitet sind. Irgendwelche Tatsachen oder auch nur Indizien, die uns in Ungelegenheiten bringen könnten, gibt es ja vorderhand nicht, und es ist auch kaum anzunehmen, daß welche gefunden werden. Sie müssen nur unbedingt dabei bleiben, Charlie, und auch Sie, Osborn, daß Sie nie von einer ›Königin der Nacht‹ gehört haben. Man wird Sie wahrscheinlich danach fragen, denn man ist ja nun daran erinnert worden, daß Sie seinerzeit Cartwright begleitet haben, und die Bezeichnung hat etwas Romantisches. Natürlich darf man noch weniger ahnen, daß wir von dem plötzlichen Auftauchen dieser geheimnisvollen Person gewußt haben und daß uns bekannt war, was sie von Cartwright und von Morton wollte. Das wäre schrecklich.«
»Jawohl, schrecklich«, platzte Helen heraus, sah sich aber sofort um, ob sie nicht wieder eine Dummheit gesagt habe, und war zufrieden, daß man sie nicht gehört zu haben schien.
»Wie geht es Bryans?« fragte Evelyn plötzlich, um das bedrückende Schweigen, das eingetreten war, zu unterbrechen.
»Ausgezeichnet«, berichtete Osborn mit einem zynischen Lächeln. »Wir sind vor einigen Tagen bei ihm vorbeigekommen und haben uns eine Weile aufgehalten. Er war quietschvergnügt und schon vor dem Lunch nicht mehr ganz nüchtern. Sein Diener vertraute mir an, daß er ihn Tag für Tag bereits am Nachmittag zu Bett bringen müsse, weil er um diese Zeit nicht mehr auf den Füßen stehen kann. Ich glaube, daß er es in Kürze mit den weißen Mäusen zu tun bekommen wird.«
Helen horchte wieder einmal mit einigem Interesse auf.
»Ich hatte auch einen Onkel, der getrunken hat und um den dann die weißen Mäuse herumgesprungen sind«, verriet sie, und ihr Mann kam diesmal zu spät, um ihr den bedenklichen Faden abzuschneiden. Er bekam vor Wut einen roten Kopf, aber Evelyn enthob ihn der peinlichen Verlegenheit.
»Kann er in diesem Zustand nicht gefährlich werden?« fragte sie besorgt. »Derartige Leute reden über alles, was ihnen gerade durch den Kopf geht, und es ist anzunehmen, daß man sich auch an ihn heranmachen wird.«
»Es wird nichts dabei herauskommen«, beruhigte sie Osborn. »Der Mann faselt solch einen Unsinn, daß man nicht ein Wort ernst nehmen wird. Und die Erinnerung an die gewissen Ereignisse scheint er bereits völlig in Alkohol ertränkt zu haben. Ich habe unlängst davon angefangen, aber er wußte nicht einmal, was ich meinte. Ich mußte eine volle Viertelstunde auf ihn einreden, bevor er darauf kam, daß er einmal in Afrika gewesen war. Da wäre es ein Wunder, wenn solch eine flüchtige Episode, wie jene am Brunnen der sieben Palmen, in seinem Gedächtnis haften geblieben wäre. Aber man kann ihn ja für alle Fälle im Auge behalten, damit er keine Dummheiten macht. Threecourts liegt auf dem Weg nach Weybridge, wohin wir wöchentlich einige Male fahren, und es macht uns weiter nichts aus, abzusteigen und nach Bryans zu sehen. Der Mann hat einen Whisky, wie ich ihn noch selten getrunken habe, und sogar Helen hat sich ganz ordentlich daran gehalten. Wahrscheinlich hat sie das von dem Onkel mit den weißen Mäusen«, fügte er sarkastisch hinzu.
»Ich bin neugierig«, bemerkte plötzlich Selwood, der die ganze Zeit über schweigsam und nachdenklich dagesessen hatte, »wer von uns nun an die Reihe kommt.«
Sein Vetter sah ihn betroffen an.
»Was willst du damit sagen?«
»Das Selbstverständlichste von der Welt. Erst hat sich die ›Königin der Nacht‹ an Cartwright gehalten, der der ganzen Expedition seinen Namen gegeben hatte, und dann an Morton, der seinerzeit hie und da neben ihm genannt worden war. Wir anderen drei waren ja nur simple Mitläufer, von denen niemand etwas wußte. Nun aber steht heute schwarz auf weiß in den Blättern zu lesen, daß auch Arthur Bryans, William Osborn und Charlie Selwood mit von der Partie waren, und wir müssen daher wohl damit rechnen, daß sich das rätselhafte Wesen demnächst an uns heranmachen wird.«
Der Abend nahm ein ziemlich frühes und einsilbiges Ende, denn als man das beklemmende Thema durchgesprochen hatte, waren alle mit ihren wenig erfreulichen Gedanken beschäftigt, und Helen hatte mehr denn je mit ihrem Hündchen zu tun.
Die Osborns waren die ersten, die etwas eilig aufbrachen, und auch die knappe Stunde, die Selwood noch blieb, verlief mehr peinlich als unterhaltsam. Evelyn erwartete, daß er vielleicht doch noch darauf zurückkommen würde, was sie ihm heute so unverblümt zu verstehen gegeben hatte, und er mochte das fühlen, denn er war plötzlich von einer geradezu krampfhaften Gesprächigkeit und schien aufzuatmen, als sie ihn schließlich etwas verstimmt und kühl zum Gehen drängte.
Um bei seinen häufigen Besuchen nicht immer auf den Diener angewiesen zu sein, hatte er einen eigenen Schlüssel zu der kleinen Garage und der Ausfahrtspforte. Er ließ den Motor an, schaltete die Scheinwerfer ein und brachte den Wagen ans Tor. Dann öffnete er, fuhr die wenigen Schritte bis zur Straße und kehrte zurück, um abzuschließen.
Ringsum war alles still und menschenleer, denn es standen hier nur einige Häuser, die in nächtlicher Ruhe lagen.
Selwood versicherte sich, daß er das Tor gut verschlossen hatte, steckte den Schlüssel in die Tasche, schritt wieder zu seinem Wagen und setzte sich am Volant zurecht.
In diesem Augenblick war es ihm, als ob ein Schatten auf die Scheibe falle. Er wandte blitzschnell den Kopf, und vielleicht zum erstenmal im Leben verließ ihn seine oft erprobte Kaltblütigkeit: Er sah, nur durch ein dünnes Glas getrennt, eine silberne Mondsichel, umgeben von drei flimmernden Sternen vor sich, und in derselben Sekunde hörte er eine gedämpfte, eindringliche Stimme sagen: »Charlie Selwood, die ›Königin der Nacht‹ vom Brunnen der sieben Palmen wartet noch bis zum Tage, da der Mond in sein letztes Viertel tritt.«
Das letzte Wort war noch nicht verhallt, als der überraschte Mann seine Fassung bereits wiedergewonnen hatte. Er riß den Schlag auf, sprang ins Freie und stürzte, die Hand an der Waffe in seiner Tasche, um den Wagen herum. Dann lauschte er angestrengt in die Nacht, lief die Straße ein Stück hinauf und hinunter, aber sein Ohr vernahm nicht den geringsten verdächtigen Laut, und sein Auge sah auch nicht den kleinsten beweglichen Schatten. Nur der Märzwind fuhr stoßweise in die sprießenden Äste.
Die ›Königin der Nacht‹ war spurlos verschwunden, als ob sie mit dem undurchdringlichen Dunkel eins geworden wäre.
Einen Augenblick dachte Selwood daran, Evelyn sofort mitzuteilen, was ihm eben begegnet war. Aber dann überlegte er es sich und lenkte seinen Wagen in rasender Fahrt in Richtung Bayswater.
Kaum einen Büchsenschuß weiter, zu seiner Rechten, glitt ein zweites Auto fast lautlos und mit Standlicht in derselben Richtung. Am Steuer saß, wie aus Erz gegossen, eine schmale, sehnige Gestalt, deren Augen gebannt durch die Windschutzscheibe starrten, und hinter ihr in der Ecke lehnte eine zweite Gestalt.
Beim Cleveland Square bog der erste Wagen in Richtung Paddington ab, der zweite aber fuhr noch eine Weile geradeaus und wendete dann nach Süden.
In der Ecke raschelte es leise, und in das Summen des Motors klang eine gedämpfte Stimme: »Es ist geglückt, Ali.«
Der Mann am Steuer wandte den Kopf nicht um Haaresbreite.
»Du bist flink wie die Antilope und schmiegsam wie der Schatten, Herrin. Niemand vermag dir zu folgen und dich zu greifen.«
»Wenn es aber doch einmal geschähe?«
Die sanfte Stimme vibrierte, und die dünne Gestalt drückte sich tiefer in die Polster.
»Dann wäre mein Messer noch rascher als die Hand, die nach dir faßt.«
»Das darf nie geschehen, Ali«, klang es zitternd zurück. »Nie, was immer sich auch ereignen mag. Ich habe es dir verboten. Denke daran.«
»Und ich habe zweimal einen heiligen Eid geschworen, dich in jeder Gefahr zu beschützen, Herrin«, klang es ehrerbietig, aber bestimmt zurück. »Und alles steht bei Allah.«
In Brompton fuhr der Wagen durch eine Reihe enger Gassen, bog dann auf einen düstern Platz ein und schoß pfeilschnell in eine dunkle Toröffnung, die sich rasch und geräuschlos, wie sie sich aufgetan hatte, wieder hinter ihm schloß. Aus den verwitterten Mauern drang nicht ein Laut, und die einstöckige Fassade mit den dicht verhangenen Fenstern warf nicht den winzigsten Lichtschimmer in die Nacht.
In einem Raum, der nach einem stillen Hof mit einem verfallenen, ausgetrockneten Springbrunnen ging, hob eine Frau mit einer jähen Bewegung den silberweißen Kopf und lauschte eine Weile mit klopfendem Herzen. Dann flog ein Lächeln über ihr trauriges Gesicht, und ihre zarte Gestalt sank fröstelnd in die Kissen des Lehnstuhls zurück, der dicht an das flackernde Kaminfeuer gerückt war.
Das junge Mädchen in der Tür sah erschreckt auf das Bild der müden Frau und stand im nächsten Augenblick neben ihr.
»Mami, weshalb wartest du auf mich?« Sie schmiegte ihre jugendfrische Wange zärtlich an das blasse Gesicht der andern, und neben dem Silberhaar leuchtete dunkles kupferrotes Haar. »Es hätte noch viel, viel später werden können, und du sollst Ruhe haben.«
Die alte Frau schüttelte mit einem wehen Lächeln den Kopf.
»Ich habe keine Ruhe, wenn ich dich unterwegs weiß.« Sie sah in scheuer Sorge zu der schlanken, geschmeidigen Gestalt auf, und der heitere, unbefangene Blick aus strahlenden Augen, dem sie begegnete, vermochte sie ebensowenig zu beruhigen wie der harmlose Ton der weichen Stimme.
»Meine Wege sind weit und manchmal mühsam, Mami, aber sie sind ohne Gefahr, und Ali ist stets bei mir.«
Die Frau blickte eine Weile schweigend in die Glut, und das junge Mädchen schob fürsorglich die Kissen in ihrem Rücken zurecht und breitete behutsam den Schal über die schmalen Schultern.
»Ich werde Nara rufen, damit sie dich zu Bett bringt. Morgen aber kehre ich recht früh heim, und wir werden den ganzen Abend miteinander verbringen.«
Die alte Frau nickte lebhaft und dankbar.
»Das soll ein schöner Tag werden, mein Kind«, sagte sie glücklich. »Ich habe dich ja so wenig um mich, seitdem wir hier weilen, und doch bist du alles, was mir vom Leben geblieben ist. Wenn ich daran denke, wie es früher war — und ich muß immer daran denken, da ich so viel allein bin —, so wünschte ich, daß wir nie hierhergekommen wären. Und daß ich nie zu dir von dem gesprochen hätte, was dich ruhelos gemacht hat und mich einsam. Es hätte ja noch andere Wege gegeben, als jenen, auf den du verfallen bist.«
»Sie hätten uns nie zum Ziel geführt«, stieß das Mädchen schroff hervor, und ihr schönes Gesicht war plötzlich hart und entschlossen. »Man hätte uns verlacht oder gesteinigt, wenn wir mit unserer ungeheuerlichen Anklage aufgetreten wären, ohne zu wissen, gegen wen wir sie zu richten hätten.«
»Und weißt du das jetzt?« fragte die alte Frau begierig. »Ich lasse dich seit Monaten gewähren und frage dich nicht. Aber wenn es soweit ist...«
»Es ist noch nicht soweit.« Zwischen den feinen Brauen über der schmalen geraden Nase stand eine scharfe Falte, aber sie verschwand plötzlich, und ein lachendes Mädchengesicht beugte sich über die leidende Frau.
»Das sind keine Geschichten für eine so späte Stunde. Gute Nacht, Mami.«
Sie drückte einen liebevollen Kuß auf den welken Mund und griff nach der Klingel.
Unhörbar schob sich eine braune Gestalt aus den Falten der verhangenen Wände und rollte den Stuhl mit der müde lächelnden Frau durch das totenstille Haus. Nach einer Weile kehrte die Dienerin leise zurück und setzte mit einem besorgten Blick auf das schöne junge Mädchen ein Tablett auf den kleinen runden Tisch beim Kamin.
Das Mädchen nickte freundlich, kauerte sich dann neben das Feuer und sah mit starren Augen auf die seltsamen Reflexe an den bunten Wänden.
Das weite Gemach des düstern Hauses in Brompton umschloß die farbenfreudige Pracht einer anderen Welt. Kostbare Stoffe und Gewebe verdeckten die Mauern und die wurmstichige Diele. Auf weichem Samt blinkten seltsames Geschmeide und der scharfe Stahl tödlicher Waffen. Was der Orient an köstlicher Üppigkeit und an wilden Schrecken kennt, schien hier zusammengetragen, und jedes Stück sprach eine fremde und beklemmende Sprache.
Aber das Mädchen mit dem Kupferhaar hörte nicht auf diese ihr wohlvertraute Sprache einer geheimnisvollen romantischen Welt, sondern ihre Gedanken kreisten unaufhörlich grübelnd um das furchtbare Rätsel, das ihr die nüchterne Riesenstadt vor den Mauern dieses Hauses aufgegeben hatte.
Noch nie war ein Wort davon über ihre Lippen gedrungen, denn die kränkelnde Frau wäre dadurch um den letzten Rest ihrer Ruhe gekommen. Sie mußte allein mit der grauenvollen Gewißheit fertig werden, daß sich an ihre Fersen unsichtbar und unerbittlich der Tod geheftet hatte, und daß er meuchlerisch Zugriff, wo sie ihre Sendung begann. Das erstemal hatte sie an einen verhängnisvollen Zufall geglaubt, der sie so erschreckt hatte, daß sie Monate wartete, bevor sie zum zweitenmal ans Werk ging. Aber auch diesmal war die furchtbare andere Macht jäh dazwischengetreten und hatte ihr eigenes Spiel wiederum nutzlos gemacht.
Lähmendes Entsetzen war über sie gekommen, und die Furcht, die das Unheimliche auslöst, hatte sie fast veranlaßt, ihren Plan aufzugeben. Aber dann war sie sich der unanfechtbaren Berechtigung ihres Tuns bewußt geworden, und der Trotz ihres ererbten abenteuerlichen Blutes war Sieger geblieben.
Wenn an ihrer Seite noch ein anderer unbarmherziger Rächer schritt, so war das nicht ihre Sache.
Und rascher, als sie es sonst getan hätte, war sie heute dem dritten der Männer vom Brunnen der sieben Palmen in den Weg getreten. Und Schlag auf Schlag sollten sie nun ihre unheimliche Botschaft hören.
Pat Coppertree, der von Mrs. Nettie Coppertree selbst in ihrer übelsten Laune aus unerforschlichen Gründen nur ›mein Süßer‹ genannt wurde, hielt nicht viel von der Kunst des Schreibens, aber er besaß den Stumpf eines etwa daumenstarken Zimmermannsbleistiftes, der von ihm ebenso unzertrennlich war wie der Kautabak. Mit dem abgekauten Ende dieses Stifts pflegte er zur Unterstützung seines Gedächtnisses auf der in seiner Pförtnerstube aufliegenden Personalliste des Hauses die freigebigen weißen Schafe von den knickrigen schwarzen zu scheiden, vor allem aber trug er damit in den Familienkalender, der mit dem Bildnis seines Schutzpatrons geschmückt war, die guten und die schlechten Tage gewissenhaft ein. Waren die Einnahmen zufriedenstellend, so malte Pat mit dem dicken Bleistift, der sich in seinen Fingern wie ein Zahnstocher ausnahm, umständlich aber deutlich einen Stern, manchmal auch zwei, war aber das Geschäft flau gegangen oder war ihm gar ein Schuldner durchgebrannt — Mr. Coppertree half gegen gute Worte und ungefähr dreihundert Prozent Zinsen vertrauenswürdigen Angestellten des Hauses stets gerne aus —, so kam hinter den betreffenden Tag ein mächtiges schwarzes Kreuz, das von der düsteren Gemütsverfassung des Iren kündete.
Im allgemeinen sah aber der Kalender wie ein Sternenzelt aus, und nur ungefähr auf jedem dritten Monatsblatt gab es ein vereinzeltes Wahrzeichen schmerzlicher Trauer.
Das sollte jedoch mit einemmal anders werden, denn an dem Morgen nach dem unseligen Tag, an dem er von der schönen Mrs. Dyke seinen letzten Auftrag erhalten hatte, meißelte Pat Coppertree unter endlosen halblauten Flüchen einen ganzen Friedhof auf die Märzseite, und er ging dabei so grimmig zu Werk, daß selbst noch auf dem Dezemberblatt die unheilvollen Kreuze mit tiefen Furchen eingegraben waren.
Wie das Verhängnis gekommen war, wußte der verstörte Pat nicht zu sagen. Es war in dem Augenblick hereingebrochen, da er im allerschönsten Zuge war und da es für ihn eigentlich nur noch wenig zu tun gab, um Mrs. Dyke, wie immer auch diesmal, völlig zufriedenzustellen.
Unmittelbar nachdem er Mr. Wellby durch seinen strammen Gruß zum erstenmal seiner besonderen Hochachtung versichert hatte — man konnte ja nicht wissen, was das plötzliche Interesse von Mrs. Evelyn bedeutete, und besser war besser —, hatte Pat unternehmend seinen Mantel angezogen und die etwas mißtrauische Mrs. Nettie Coppertree telefonisch wissen lassen, daß er eine sehr wichtige dienstliche Besorgung zu erledigen habe und daher nicht sagen könne, wann er heimkehren werde. Schon früher hatte er in Erfahrung gebracht, daß er den Reporter um neun Uhr in dem Versammlungslokal der Heilsarmee sicher antreffen konnte, und es war daher nicht notwendig, daß er ihn schon jetzt abpaßte und sich ununterbrochen an seine Fersen heftete. Er konnte vielmehr die Zwischenzeit dazu benützen, gewisse Erkundigungen einzuziehen und sich zunächst ein Bild von den Verhältnissen und der Lebensführung des Mannes zu verschaffen. Vielleicht lag Mrs. Evelyn daran, auch darüber etwas zu erfahren, denn Frauen sind nun einmal Frauen, und wenn Pat solch eine Sache auf sich nahm, lieferte er nichts Halbes.
Etwa eine Dreiviertelstunde später stand er bereits vor dem niedrigen unscheinbaren Haus bei der Vauxhall-Brücke in Kennington, das Mr. Wellby als seine Wohnung ausgegeben hatte, und so wenig ermunternd der Empfang durch die mürrische und reizlose Hauswirtin auch war, Pat ließ sich dadurch nicht abschrecken. Er besaß eine so einschmeichelnde, unterhaltsame und ausdauernde Beredsamkeit, daß selbst das herbste Frauengemüt sich ihr höchstens fünf Minuten zu verschließen vermochte, und vor allem konnte der kleine Mann mit den gebogenen Beinen lügen wie gedruckt. Nachdem er die Hauswirtin in einem einzigen Satz um Entschuldigung für seine Zudringlichkeit gebeten, zu ihrem prächtigen Aussehen beglückwünscht, nach ihrem Gatten und ihrer Familie befragt und dann wegen ihres einsamen Witwentums mit mitleidsvoll verdrehten Augen bedauert hatte, kam er schließlich auf den Grund seines Besuches zu sprechen. Er habe von einem gemeinsamen Bekannten vom Land eine Bestellung für Mr. Wellby erhalten, könne dessen aber in dem großen Zeitungshaus nie habhaft werden. Nun habe man ihn hergewiesen, und wenn ihn Madame unterstützen wollte, würde sie ein gutes Werk tun, denn er sei bereits ganz abgehetzt, und die Sache sei einigermaßen dringend.
Madame war bereits weich wie Wachs und so voll Verständnis und Mitgefühl, daß sie dem bedauernswerten Mann vorerst einmal aus einer vielversprechenden Flasche eine Stärkung kredenzte, die Pat mit solcher Behutsamkeit und Geschicklichkeit hinuntergoß, daß auch nicht ein Tropfen an dem üppig wuchernden Bart hängenblieb.
Aber helfen könne sie ihm leider nicht, meinte die Witwe mit einem vielsagenden Seufzer und einem beredten Blick. Mr. Wellby zahle zwar pünktlich, aber das beweise noch nichts, denn er wohne erst ungefähr zwei Monate bei ihr. Die erste Zeit pflegten ja diese jungen Leute alle gut zu tun, aber dann... Nun, man werde ja sehen. Offen gestanden habe sie gewisse Bedenken, denn ein Leben, wie es ihr Mieter führe, könnte kein gutes Ende nehmen. Er komme täglich höchstens auf eine oder zwei Stunden nach Hause und das nicht einmal bei Nacht. Die Stimme von Madame wurde sehr spitz und ihr Blick von verschämter Anzüglichkeit. Aber schließlich gehe sie das alles nichts an, solange sie dadurch nicht zu Schaden komme. Leider habe sie für den schlimmsten Fall aber so gut wie gar nichts in der Hand, denn die paar Stückchen Wäsche, die Mr. Wellby im Schrank habe, seien nicht viel wert und der eine Anzug sei bereits zweimal gestopft. Dann sei allerdings auch noch ein Gummimantel da, aber der lasse bestimmt Wasser durch, und das eine Paar Schuhe sei auch nicht mehr besonders. — So habe jeder seine Sorgen, und so gerne sie einem Gentleman, wie ihrem Besucher, dienlich sein würde, könne sie ihm beim besten Willen nicht sagen, wann ihr Mieter anzutreffen sei. Einmal komme er früh, einmal abends.
Mr. Coppertree saß mit sittsam gefalteten Händen und von vollem Verständnis sprechenden Augen da, um ja nicht ein Wort zu verlieren.
Und wenn Pat Coppertree nicht schon längst überzeugt gewesen wäre, daß bei allem, was er unternahm, sein mächtiger Schutzpatron die Hände über ihn halte, weil er ihm alljährlich an seinem Festtag zwei dicke teure Kerzen spendete, die er dem Cartwright-Konzern dann als Notbeleuchtung verrechnete, so hätte ihm dies unbedingt in der nächsten Stunde zum Bewußtsein kommen müssen. Er war nämlich eben im Begriff, seinen Posten bei der Cartershall zu beziehen, als plötzlich wenige Schritte vor ihm Mr. Wellby mit seiner Begleiterin aus einer Seitengasse auftauchte und etwa in der Mitte der Straße in einem kleinen Restaurant verschwand.
Der tüchtige Ire sah bei Tag wie ein Falke und bei Nacht wie eine Eule, und er wußte sofort, wer an der Seite des Reporters schritt. Er hatte dieser Figur mit dem hängenden Kopf und den nach vorn fallenden Schultern schon oft verstohlen nachgeblickt und dabei sogar gewisse Vergleiche gezogen. Mrs. Nettie hatte eine Warze unter dem Auge und die eine Seite ihres Halses war etwas dicker als die andere, und außerdem war sie um gute fünfundzwanzig Jahre älter, aber wenn er vor die Wahl gestellt worden wäre, hätte er sich um nichts in der Welt für ein Wesen wie Miss Avery, sondern trotz gewisser Erfahrungen unbedingt für Mrs. Nettie entschieden. Aber Pat war ein einsichtsvoller und gerechter Mann, der ohne weiteres zugab, daß das schließlich Geschmackssache sei, und während er sich einerseits wunderte, daß ein so auffallend hübscher und fescher Mann wie Mr. Wellby sich mit einer Vogelscheuche wie Miss Avery herumschleppte, gab er andererseits die Möglichkeit zu, daß dieser Mr. Wellby es sich vielleicht überlegen würde, mit Mrs. Nettie ein Restaurant zu besuchen. Aber die Hauptsache war schließlich, was Mrs. Dyke zu dieser Neuigkeit, die ihm da in den Weg gelaufen war, sagen würde.
Da plötzlich ein Sturzregen vom Himmel kam, suchte der Ire unter dem Torbogen eines gegenüberliegenden Hauses Zuflucht, und erst als der Reporter und seine Begleiterin das Restaurant verlassen hatten und, von seinen scharfen Blicken verfolgt, in der Cartershall verschwunden waren, gönnte er sich einen etwas gemütlicheren Unterschlupf, indem er in das freundliche Gasthaus hinüberwechselte. Er wußte, daß die beiden nun für eine geraume Weile versorgt waren, denn auch Mrs. Nettie hatte in ihrem bewegten Leben einige Monate der Heilsarmee angehört, und wenn man annahm, daß in der Versammlung nur drei oder vier Frauen von ihrer Beredsamkeit sprechen würden, so durfte er in aller Gemütsruhe ein Abendbrot einnehmen und sich ein oder zwei Glas gestatten. Schließlich bezahlte ja Mrs. Dyke immer sehr anständig, und es wäre nicht besonders ehrenhart gewesen, das Geld einzustecken, ohne irgendwelche Auslagen gehabt zu haben.
Pünktlich um elf Uhr war Coppertree, neu gestärkt und scharfsichtiger denn je, wieder am Platz, aber er mußte noch zweimal seine Pfeife stopfen, bevor die Versammlung zu Ende war.
Aus einer Entfernung von etwa zwanzig Schritten musterte er jedes Gesicht der lärmend ins Freie strömenden Menge, und Miss Avery und Wellby hatten kaum die Nase aus dem Portal gesteckt, als er ihrer auch schon ansichtig wurde. Einen Augenblick verhielt Pat den Atem und wartete gespannt, was nun geschehen würde, dann nahm Miss Avery nach einem kurzen Händedruck ihren Weg eiligst auf die Southwark Bridge zu, der Reporter aber wandte sich ebenso eilig zum Tower, und Pat fand das begreiflich und anständig.
Wellby war ein flotter Fußgänger, aber auch der kleine Mr. Coppertree ließ sich nicht lumpen. Er trottete in immer gleicher Entfernung hinter seinem Schutzbefohlenen drein und machte seine Sache so geschickt, daß dieser ihn kaum bemerken konnte, obwohl er sich von Zeit zu Zeit aufmerksam umsah.
Der Ire war plötzlich sehr neugierig, wohin die Reise gehen würde. Da dieser lebenslustige junge Herr keine Nacht in seiner Wohnung schlief, mußte er wohl anderwärts ein warmes Nest haben, und vielleicht war es eben das, was Mrs. Dyke wissen wollte. Nun, sie sollte es erfahren, denn sie hatte sich an den richtigen Mann gewandt.
Bis zur London Bridge verlief alles wie am Schnürchen. Der Weg war zwar weit, und die zeitweiligen Regenschauer und der dichte Nebel machten ihn nicht gerade angenehm, aber Pat war zu Beginn seiner ehrenvollen Laufbahn vier Jahre auf einem Fischkutter in der Bantry-Bay und dann fast ein Jahrzehnt auf einem Schlepper zwischen Ramsgate und dem Londoner Pool gefahren, und solche Dinge machten ihm daher nichts aus.
Nur verdammt aufpassen mußte er, um seinen Mann nicht aus den Augen zu verlieren. Fast wäre ihm das passiert, als sie zu den St.-Katharinen-Docks kamen, denn hier bog Wellby plötzlich scharf zum Fluß ein, und sein Verfolger wunderte sich nicht wenig, was er wohl in dieser Gegend zu suchen hätte. Es gab hier nichts als riesige Lagerhäuser und Werftanlagen und hie und da eine Kneipe, und unter den Schiffsleuten und Fischern trieb sich allerlei lichtscheues Gesindel herum. Dieser Mr. Wellby mußte eine gehörige Portion Courage besitzen, daß er sich zu nächtlicher Zeit hierherwagte, und kaum war Pat dieser Gedanke gekommen, als ihm auch schon die Ereignisse recht zu geben schienen. Der scharfäugige kleine Mann sah plötzlich zwei riesige Gestalten aus dem Dunstmeer auftauchen, und im nächsten Augenblick hatten sie den Reporter in der Mitte und rempelten ihn an. Bevor aber Mr. Coppertree sich noch darüber schlüssig werden konnte, wie er sich in diesem unvorhergesehenen Fall verhalten sollte, war der geschmeidige Wellby bereits ausgebrochen und irgendwo im Dunkel verschwunden. Pat hörte einige derbe Späße und Freundlichkeiten, die dem Entwischten nach hallten, und dann kamen die beiden Gestalten auch schon näher.
Es waren wirklich auffallend große Leute, und der vorsichtige Pat musterte sie bereits aus der Entfernung mit kritischen Blicken. Ihr Äußeres war nicht sehr vertrauenerweckend, und außerdem schienen sie etwas angeheitert zu sein. Jedenfalls spuckte Mr. Coppertree zunächst einmal gehörig aus und klemmte den Priem fest in die linke Wange, um Luft zu haben.
Dann standen die Burschen auch schon dicht vor ihm und legten ihm fast gleichzeitig ihre schweren Hände auf die Schultern. Der Ire wollte sie wütend abschütteln, aber er steckte wie in einem Schraubstock. Er sah in zwei sonnverbrannte junge Gesichter, die ihn grinsend musterten, aber bevor er noch fluchen konnte, hatten sich die beiden schon wieder zu ihrer ganzen Länge aufgerichtet und brachen in schallendes Gelächter aus.
»Kamerad«, grölte der eine entzückt und liebenswürdig, »auf dich haben wir gewartet! So etwas findet man nicht alle Tage. Du mußt mit uns kommen. Wir haben zwar augenblicklich keinen Penny in der Tasche, aber wenn wir dich in den Schenken sehen lassen, gibt's ganze Mützen voll. — Wir werden sagen, wir hätten dich frisch aus den Urwäldern von Borneo mitgebracht...«
Der Mann schüttelte sich vor Vergnügen, und der andere wollte auch seinen Anteil an dem Spaß haben.
»Jetzt fangen wir uns noch einen Köter«, schlug er vor, »und den lassen wir dann durch deine schönen Beine Reifen springen. Wie ich sehe, kann es ja auch ein etwas größeres Vieh sein.«
Die kleinen Schlitzaugen des armen Pat blitzten. Er war vor Wut förmlich gelähmt, und deshalb wehrte er sich anfangs nicht, als sie ihn an den langen, muskulösen Armen faßten und den Weg wieder zurückschleppten, den er gekommen war. Er vertrug ja manches und verstand auch einen Spaß, aber mit so unverschämten Anzüglichkeiten durfte man ihm nicht kommen.
Plötzlich zog er mit einem kräftigen Ruck die breiten Schultern ein, und im nächsten Augenblick flogen seine Arme wie stählerne Hebel auseinander, so daß die beiden Riesen an seiner Seite fast ins Wanken gerieten. Aber sofort packen sie etwas fester zu, und der arme kleine Mann fühlte, daß es so kein Entkommen gab.
Die beiden Burschen machten mit ihrem strampelnden und lärmenden Opfer halt und sahen sich etwas ratlos an. Plötzlich aber schienen sie mit sich ins reine gekommen zu sein.
Wenige Schritte weiter lief ein kleiner Kanal zu einem der Speicher, und kaum eine Minute später klatschte er aufs Wasser.
Zwei schmunzelnde Gesichter starrten gespannt und hilfsbereit in die wogenden Kreise, bis der Ire wieder aus der nicht allzu gefährlichen Tiefe auftauchte und schnaufend und prustend wie ein Seehund zur rettenden Ufermauer paddelte.
»Gute Nacht, Kamerad«, sagte der eine der Riesen höflich. »Steck deinen schönen Bart gut unter die Bettdecke, damit er keine Erkältung bekommt.«
»Besser wäre es aber, du bleibst so lange im Wasser, bis deine Beine so weich werden, daß du sie geradebiegen kannst«, riet der zweite, worauf sich beide eiligst davontrollten.
Glücklicherweise hatte Pat Coppertree zuviel Wasser in den Ohren, um sich über diese neuerlichen Anzüglichkeiten aufregen zu können.
Nicht allzuweit wußte der triefende Pat von früher her ein gemütliches Lokal, und dorthin setzte er sich eiligst in Trab.
Sein Erscheinen ›Bei den freundlichen Winden‹, wo eine trinkfeste Runde beisammen saß, erregte einiges Aufsehen, denn es strömte noch immer von ihm, als ob er einen halben Meerbusen intus hätte. Es hätte vielleicht eine Panik gegeben, wenn die unförmige, aber resolute Wirtin hinter dem Schanktisch nicht ein so wunderbares Gedächtnis für alle Gäste gehabt hätte, die jemals den Fuß über die Schwelle ihres Lokals gesetzt hatten. Es waren ihrer im Laufe der letzten dreißig Jahre eine Legion, aber das machte ihr nichts aus.
»Pat«, sagte sie, ohne auch nur einen Augenblick nachzudenken, indem sie verwundert die etwas glasigen Augen aufriß, »wonach tauchst du mitten in der Nacht in der Themse? Es ist doch nichts drin als Dreck und Steine.«
Dann blickte sie mißmutig auf die riesige Lache, in der er klappernd stand, und überlegte blitzschnell, was da zu tun war.
»Lola«, befahl sie ihrer Nichte, die an einem Tisch saß und über das ganze rot- und weißgeschminkte Gesicht grinste, »gib diesem Gentleman die Hose und den Rock vom Seligen. Du findest die Sachen in meinem Schrank. Und dann suche meine Winterstrümpfe heraus und die hohen Filzschuhe. Sieh aber erst nach, ob nicht eine Maus drin ist. Und das Hemd gibst du von dir. Du hast ja gerade eins geplättet. Die Sachen von Mr. Coppertree kommen über den Herd zum Trocknen, aber gib acht, daß sie nicht in das Grogwasser tropfen.«
Das Mädchen warf trotzig den Kopf zurück, aber die dicke Frau beugte sich etwas zur Seite, und Lola sprang gehorsam auf. Die Tante konnte sich wegen ihrer zweihundertsechzig Pfund zwar nicht allein aus dem Lehnstuhl erheben, aber sie hatte immer irgend etwas neben sich stehen und traf damit todsicher.
»Mr. Coppertree«, sagte die hilfsbereite, gutherzige Frau, »gehen Sie mit dem Mädchen. Sie wird aus Ihnen wieder einen anständigen Menschen machen. Genieren Sie sich nur nicht. Sie ist nicht so.«
Während Pat drinnen in eine trockene Haut kroch, erzählte draußen die Wirtin ihren aufhorchenden Gästen von seiner märchenhaften Laufbahn. Noch vor sechs Jahren habe er selbst am Sonntag so von Teer und anderem Schmutz gestarrt, daß er überall klebenblieb, wo er sich hinsetzte, und jetzt gehe er sogar an Wochentagen mit goldenen Borten am Rock und an der Kappe herum.
Pat wurde dank dieser Einführung bei seiner Wiederkehr mit größter Hochachtung empfangen, und er hatte solch eine Aufmunterung nötig. Man räumte ihm den wärmsten Platz ein und behandelte ihn wie eine Respektsperson, obwohl er aussah wie eine Vogelscheuche. Man getraute sich nicht einmal zu fragen, was ihm widerfahren war, und auch er sprach nicht davon. Er hielt sich zunächst schweigend an den sehr steifen Grog, und da ein Glas natürlich nicht genügte, einen so kräftigen Körper wie den seinen zu erwärmen und den ekelhaften Geschmack von dem dreckigen Themsewasser aus dem Mund zu spülen, trank er noch ein. zweites und drittes. Und dann kam er erst darauf, daß der Grog ›Bei den freundlichen Winden‹ ganz besonders gut war. Er trank daher noch ein viertes, fünftes und sechstes Glas, und da er jetzt erst in die richtige Stimmung geriet, setzte er noch ein siebentes, achtes und neuntes darauf. Und die freundlichen Leute, und die freundliche Wirtin stießen alle mit ihm an und tranken mit, und die freundliche Lola setzte sich sogar auf seinen Schoß und kraulte seinen Bart, was Mrs. Nettie noch nie getan hatte.
Diese unwillkürliche Erinnerung an Mrs. Nettie kam Pat einigermaßen ungelegen, denn sie gemahnte ihn daran, daß er, so nett es ›Bei den freundlichen Winden‹ auch war, doch einmal die Anker lichten und dem heimatlichen Hafen zusteuern mußte. Aber ein oder zwei Gläser zum Abschied konnte er sich schließlich noch leisten, und erst, als er diese hinter die Binde gegossen hatte, machte er klar.
Es war nicht so leicht, denn Mr. Coppertree stand etwas unsicher auf den Füßen, und nicht nur die freundliche Lola, sondern auch die ganze übrige Tafelrunde mußte diesmal mit heran, um ihm wieder in seine Kluft zu helfen, und es ging dabei begreiflicherweise etwas eilig und zerfahren zu.
Mehr infolge seines sicheren Instinkts als aus klarer Berechnung landete der Ire gegen vier Uhr morgens vor seiner Tür und öffnete diese so geräuschvoll, daß Mrs. Nettie ihr tiefes Schnarchen plötzlich abbrach und energisch den Lichtschalter drehte.
Die plötzliche Helligkeit fuhr Pat wie ein Stich durch das Hirn, und die Folge davon war, daß sich das ganze Zimmer wie ein Reigen von verrückt gewordenen Kommoden, Betten, Tischen, Stühlen um ihn zu drehen begann.
»Mein Süßer, du hast getrunken«, hörte er Mrs. Netties scharfe Stimme, aber sie schien von weit her zu kommen, daß er darauf gar nicht antworten zu müssen glaubte. Er hatte auch augenblicklich andere Dinge zu tun, denn er focht einen förmlichen Kampf mit seinen Kleidern aus, die ihm absolut nicht vom Leib wollten. Dabei war es ihm, als ob er ununterbrochen die Stimme von Mrs. Nettie höre, aber er konnte sich nicht erklären, wie sie zu den ›Freundlichen Winden‹ kam, mit wem sie sprach und was sie soviel zu erzählen hatte.
Plötzlich aber hörte er einen gellenden Schrei und verspürte ein paar Fäuste, die wild auf seinen Schädel trommelten. Und als er überrascht auffuhr, erwischte ihn eine energische Hand am spitzenbesetzten Ausschnitt von Lolas Hemd, das erst heute geplättet worden war, und die andere Hand fuhr in seinen Bart, aber bei weitem nicht so sanft wie Lolas.
In dieser Nacht gab es bei Coppertrees Krach, und am nächsten Morgen hatte Mrs. Nettie um das Auge über der großen Warze einen mächtigen blauroten Fleck, Mr. Pat aber verließ das Haus mit einer großen Beule am Hinterkopf.
»Ich schwöre Ihnen«, schloß Pat mit etwas belegter Stimme, aber überzeugender Treuherzigkeit in den blinzelnden Augen, »der verdammte Nebel war so dick wie ein Sack. Das muß man gesehen haben. Aber es war ein schönes Stück Weg, das ich hinter ihm drein war. Und wenn nicht —«
Er wollte wieder auf den Nebel zu sprechen kommen, weil er von den anderen Hindernissen nicht reden mochte, aber Mrs. Dyke hob leicht die Hand, und Mr. Coppertree brach gehorsam ab. Seine Zunge war heute etwas schwer, und im Schädel verspürte er ein derartiges Brummen und Hämmern, daß ihm sogar das Lügen einige Anstrengung bereitete. Er hatte eine volle halbe Stunde gebraucht, bevor er sich den Bericht für Mrs. Evelyn, die ja nicht alles wissen mußte, zurechtgelegt hatte, und solche Kleinigkeiten machte er doch sonst aus dem Stegreif, er war mit dem Garn, das er eben abgesponnen, auch nicht recht zufrieden, denn es schien ihm, als ob er dabei aus sich und seiner Leistung diesmal viel zu wenig gemacht hätte. Wenn da nun andrerseits die verehrte Mrs. Dyke daraus vielleicht den Schluß zog, daß sie sich dafür auch einmal weniger erkenntlich zeigen könne, so saß er gehörig in der Patsche. Denn selbst bei einem Geschenk in der gewöhnlichen Höhe zahlte er diesmal noch immer drauf. Er hatte am heutigen Morgen in nüchternem Zustand mit Ingrimm festgestellt, daß ihn der Unterschlupf in den ›Freundlichen Winden‹ zehn Schilling sieben gekostet hatte, und wenn er dazu den Wert des Geschirrs rechnete, das Mrs. Nettie und er einander an den Köpfen zerschlagen hatten, so kam er auf eine so schreckliche Summe, daß es ihm ganz übel wurde.
Es war daher nur zu begreiflich, daß er in Mrs. Evelyns Gesicht zu lesen versuchte, wie hoch sie seinen Bericht wohl einschätzte. Aber wie einfach es für den geriebenen Iren war, Mr. Hyman die jeweilige Laune von der Nase abzugucken, bei der schönen Frau versagte sein sicherer Blick vollständig. Sie hatte nicht eine Miene verzogen, als er ihr, von dem Besuch in der Wohnung Mr. Wellbys angefangen, bis zu dem Zusammentreffen des Reporters mit Miss Avery und dann bis zu dem Augenblick, in dem der dicke Nebel eingetreten war, alles haarklein erzählt hatte. Und sie verzog auch jetzt, da er schon längst fertig war, keine Miene, sondern sah angelegentlich zu Boden und schien die Anwesenheit von Mr. Coppertree überhaupt völlig vergessen zu haben.
Aber plötzlich machte sie eine Handbewegung nach dem Schreibtisch, und Pat schielte angestrengt und hielt den Atem an, um sich wenigstens nach den verschiedenen Griffen im voraus ein Bild von dem zu machen, was kommen würde. Aber es war nur ein einziger kurzer Griff, der die schlimmsten Befürchtungen rechtfertigte.
»Sie haben Ihre Sache gut gemacht, Pat«, sagte sie und streckte ihm die Hand entgegen. »Aber ich erwarte nun von Ihnen, daß Sie über die ganze Sache reinen Mund halten.«
Der Ire legte die eine seiner großen Hände auf den Mund, und mit der anderen griff er lässig nach den zarten Fingern. Und um zu zeigen, daß er alles einzig und allein doch bloß aus Verehrung für Mrs. Dyke getan habe und daß er das Geschenk lediglich deshalb annehme, weil es ihm so aufgedrängt werde, schob er es schleunigst in die Westentasche. Er hatte die Banknoten in aller Geschwindigkeit mit Daumen und Zeigefinger prüfend befühlt, war sich aber nicht recht klargeworden, und solange er nicht wußte, wie er daran war, konnte er keine Ruhe finden. Er sah daher nicht ein, weshalb er seine Ungewißheit bis in die Pförtnerloge hinuntertragen sollte, sondern stellte sich mitten in den Gang und begann mit zitternden Fingern zu zählen. »Eins« — seine Augen blitzten auf, denn darnach kam noch etwas —, »zwei« — dem überraschten Pat begannen vor Erregung die Knie zu zittern —, »drei.« Drei Pfund!
Er hob tänzelnd eins seiner krummen Beine, dann das andere und flog im nächsten Augenblick an die Wand, weil Mr. Hyman grundsätzlich niemandem auswich und diesmal außerdem noch besondere Eile zu haben schien, da er mit Riesenschritten dem Aufzug zustürmte.
Der Bericht Pats hatte Mrs. Dyke so außerordentlich in Anspruch genommen, daß sie den hastigen und zu dieser Stunde ungewöhnlichen Abgang Mr. Hymans völlig überhört hatte, und sie war deshalb auch um ein kurzes, interessantes Telefongespräch gekommen, das diesem plötzlichen Aufbruch vorangegangen war.
Sie wäre dadurch wohl noch mehr beunruhigt worden, als sie es ohnedies bereits war. Was sie eben über Noel Wellby erfahren hatte, war nichts Positives, aber es genügte, um sie in dem Verdacht zu bestärken, den sie gegen diesen Mann vom ersten Augenblick an gehegt hatte. Wo war er, wenn er in seiner angeblichen Wohnung immer nur für Stunden erschien, und was trieb ihn zu nächtlicher Zeit auf so abgelegene Wege, wie er sie gestern gegangen war? Mrs. Evelyn hatte scharfe Ohren und ein feines Gefühl, und sie ahnte, daß in dem weitschweifigen Bericht des Iren dort, wo der dicke Nebel eingetreten war, irgend etwas nicht gestimmt hatte. Aber sie wollte nicht in Pat dringen, denn für die Arbeit, die nun weiter zu tun war, schien er ihr nicht geschickt und verläßlich genug.
Für sie bestand zur Stunde kein Zweifel mehr, daß Noel Wellby nicht bloß einfache Reporterarbeit geleistet, sondern in voller Kenntnis der Dinge einen in seinen Auswirkungen wohlberechneten Alarmschuß abgegeben hatte. Der Zweck, den er damit verfolgt haben mochte, war erreicht.
Noch lagen nach den letzten Morgenblättern keine neuen Tatsachen vor, aber in allen Berichten kam bereits übereinstimmend die Überzeugung zum Ausdruck, daß weder Morton noch Cartwright eines natürlichen Todes gestorben, sondern mit außerordentlichem Raffinement und mit nicht alltäglichen Mitteln ermordet worden waren. Die Obduktion der Leiche Mortons, zu der die namhaftesten medizinischen Kapazitäten beigezogen worden waren, hatte nämlich überraschenderweise so ziemlich dasselbe klinische Bild ergeben wie seinerzeit bei Sir Benjamin. Kein Symptom, das als unmittelbare Ursache einer letalen Erkrankung oder eines gewaltsamen Todes hätte angesprochen werden können, aber wie dort äußerst seltsame Reizungserscheinungen in den Luftwegen und an der Lunge, ohne daß jedoch diese Veränderungen den Charakter jener Verätzungen aufgewiesen hätten, wie sie gewisse Giftgase verursachen. Die Internisten, Chirurgen und Pathologen, von denen jeder bereits Hunderte von menschlichen Organismen untersucht hatte, mußten zugeben, daß ihnen ein so spezifisches Bild noch nie untergekommen war, und auch die Chemiker, an die sie sich fragend wandten, versagten mit einem sicheren Urteil. Immerhin war man sich darüber klar, daß man hier vor dem Rätsel stand, das es zu lösen galt, und ein von Wissenschaft und Verantwortungsgefühl nicht allzusehr beschwerter Reporter faßte zum Neid seiner Kollegen und zur gruseligen Befriedigung seiner Leser die ungeklärte Sachlage kurz entschlossen in folgende Sensationstitel zusammen:
›Eine neue Geißel der Menschheit? — Ein unbekanntes Giftgas von schrecklichster Wirkung?‹
Über die kriminelle Seite schwiegen sich die Blätter noch völlig aus, und man merkte, daß es ihnen an jeder Information und Orientierung mangelte. Scotland Yard hatte vorläufig nichts zu sagen, und was die ziel- und planlos herumstöbernden Berichterstatter zusammentrugen, war nicht sonderlich wichtig und aufregend. So wußte ein Blatt zu melden, daß in der kritischen Zeit ein kleines graues Auto in der Nähe des Porchester Square gesehen worden sei, und ein ehrsamer Bürger war um die in Betracht kommende Stunde einer mittelgroßen, in einen dunklen Mantel gehüllten Gestalt begegnet, die aus der Gegend von Mortons Haus gekommen war und die Richtung zum Porchester Square eingeschlagen hatte. Sie hatte einen breitkrempigen Hut tief ins Gesicht gedrückt und den Kragen hochgeschlagen und war fast fluchtartig gelaufen, aber alles das sei weiter nicht auffallend gewesen, da bei dem unfreundlichen Wetter eben jeder eiligst unter Dach zu kommen trachtete.
Nur einer der kleinsten Zeitungen war es vorbehalten, eine Meldung zu bringen, die vielleicht von wesentlicher Bedeutung war und allgemeines Interesse erweckte. In einem der Anatomiesäle hatte man der Form halber und ohne viel Aufhebens die Leiche Jack Beerys obduziert, und ohne zu wissen, was man damit sagte, denselben Befund festgestellt, zu dem das ansehnliche Kollegium bei Sir Nicholas Morton gekommen war.
Alle diese Dinge interessierten Mrs. Dyke außerordentlich, aber sie schienen ihr nicht sonderlich gefährlich, und sie atmete erleichtert auf, als sie trotz eifrigsten Suchens diesmal keine weitere Bemerkung über die ›Königin der Nacht‹ finden konnte. Man schien dieses geheimnisvolle Wesen völlig vergessen zu haben oder die Geschichte nicht ernst zu nehmen.
Mrs. Dyke war einen Augenblick unschlüssig, ob sie Selwood oder Osborn anrufen sollte, um sie davon in Kenntnis zu setzen, daß in der Person Noel Wellbys unbedingt eine neue Gefahr drohe, die weit ernster war als der ganze Lärm der Presse und die polizeilichen Erhebungen, die er zur Folge gehabt hatte. Denn während man hier blindlings herumriet und auf zeitraubende Nachforschungen und schwierige Kombinationen angewiesen war, wußte jener Mann unbedingt etwas. Und zwar mehr, als er in jener folgenschweren Notiz angedeutet hatte. Er machte nicht den Eindruck, als ob er zu einem wohlberechneten Angriff ohne weiteren Rückhalt übergegangen wäre, und man mußte stündlich mit einem neuen Geschoß rechnen. Die ›London Sensations‹ waren ihm zwar durch die Verfügung Hymans verschlossen, aber es gab für ihn nicht nur ungezählte andere Blätter, sondern auch andere Wege, um seine geheimnisvollen Zwecke weiter zu verfolgen. Das mußte um jeden Preis verhindert werden, und es war hoch an der Zeit, Wellby nicht mehr aus den Augen zu lassen, um jeder weiteren verhängnisvollen Überraschung vorzubeugen.
Dazu schien Mrs. Dyke ihr Freund Selwood mit seiner Schwerfälligkeit allerdings nicht der richtige Mann, und sie zog es daher vor, sich mit seinem tatkräftigeren Vetter in Verbindung zu setzen. Er hatte sich in der ganzen Sache bisher weit rühriger und vorsichtiger erwiesen als Charlie, wußte alles sehr geschickt und schlau anzupacken und schien über seltsame Helfer zu verfügen, über die sich Evelyn schon oft verwundert hatte, die aber vielleicht gerade in diesem Fall ganz zweckdienlich waren.
Sie war etwas enttäuscht, als sich Helen am Telefon meldete, denn es war kein Vergnügen, mit ihr ein Gespräch zu führen. Die sonst so schläfrige Frau war furchtbar erregt, wenn sie den Hörer in der Hand hielt, sie schrie minutenlang ›Hallo‹, verstand nicht ein Wort von dem, was man sagte und antwortete überhaupt nicht oder ließ einen unhemmbaren Schwall von konfusem Zeug los.
Nach einer Weile gelang es Evelyn aber doch, ihr verständlich zu machen, daß sie Osborn in einer dringenden Angelegenheit zu sprechen wünsche, die keinen Aufschub dulde.
Helen fragte erst noch einige Male ratlos: »Was wünschen Sie?«, aber endlich kapierte sie doch, und die verzweifelte Evelyn vernahm, wie sie krampfhaft kicherte, als ob sie heftig gekitzelt würde. Aber dann nahm sie einen mächtigen Anlauf und erzählte in einem Atem, daß William noch schlafe, weil er gestern nacht noch im Klub gewesen und erst um fünf Uhr nach Hause gekommen sei, und daß er nicht geweckt werden dürfe, weil ihm das schaden könnte. Wahrscheinlich würde er erst am Nachmittag aufstehen, aber manchmal schlafe er auch bis zum Abend, und dann würden sie in ein Theater gehen, wo ein Stück gegeben werde, in dem ein Messer vorkomme, von dem man aber nicht wisse, wer es geworfen habe.
Zum Glück ging Mrs. Helen an dieser Stelle der Atem aus, und Mrs. Dyke konnte wieder zu Wort kommen. Sie hatte nicht das Gefühl, sich mit der aufgeregten und schwerfälligen Dame wirklich verständigen zu können, aber sie wollte Osborn unbedingt eine Warnung wegen Wellby zukommen lassen. Vielleicht behielt seine Frau doch einiges von dem, was sie ihr mitteilen würde, und wenn Osborn daraus nicht klug werden sollte, konnte er sie ja selbst anrufen. Sie wollte nur erreichen, daß er über die neue Gefahr unterrichtet würde, und faßte sich daher so kurz und deutlich als möglich, und Helen schien ihr wirklich aufmerksam zuzuhören. Aber wahrscheinlich drückte sie dabei den Hörer so fest ans Ohr, daß sie ihren King Charles unter dem Arm empfindlich quetschte, denn plötzlich erscholl ein jämmerliches Gewinsel, dem eine Flut von tröstenden Koseworten folgte. Und dann fragte Mrs. Helen wieder: »Bitte, was haben Sie gesagt?«
Mrs. Dyke war mit ihrer Ruhe und Geduld zu Ende, aber sie beherrschte sich und wiederholte alles Wort für Wort noch einmal.
»Haben Sie mich verstanden, Helen?« fragte sie dann so gelassen und höflich, wie es ihre Verfassung zuließ.
»Natürlich habe ich verstanden«, kam es etwas pikiert zurück. »Es handelt sich um diesen — wie heißt doch der Mann?«
»Noel Wellby«, erwiderte Mrs. Dyke verzweifelt und akzentuierte jede Silbe.
»Richtig. Und ich soll das William sagen. Sie sehen, ich weiß alles. Auf Wiederhören, meine Liebe.«
Evelyn legte mit einem Seufzer der Erleichterung den Hörer auf, rechtzeitig, um den Boy, der bescheiden klopfte, einzulassen. Sie nahm gleichgültig den Briefumschlag entgegen, der ihre Adresse trug, und öffnete ihn mechanisch. Kaum aber hatte sie die wenigen Worte gelesen, als ihr Gesicht sich jäh verfärbte und ihre zitternde Hand das Blatt krampfhaft zusammenknüllte.
Einen Augenblick war ihr, als ob ihr der Boden unter den Füßen entglitte und alles um sie herum zusammenstürze.
An diese Möglichkeit hatte sie nie gedacht, und nun, da sie eingetreten war, stand sie ihr völlig fassungslos und in lähmendem Schrecken gegenüber. Es waren nur nichtssagende Einleitungsworte eines Satzes, die das Papier in nüchterner Maschinenschrift enthielt, aber sie wußte, daß sie eine furchtbare Gefahr bedeuteten. Sie kannte den Satz, der so begann, nur zu gut, denn sie hatte ihn ungezählte Male gelesen, und er war ihr im Gedächtnis haftengeblieben wie alles, was ihm weiter folgte und den Schlüssel zum Geheimnis der ›Königin der Nacht‹ vom Brunnen der sieben Palmen barg. Aber bis zu dieser Stunde hatte sie in dem festen, beruhigenden Glauben gelebt, daß nur sie und die andern, die es unmittelbar anging, davon Kenntnis hätten, und daß das Wissen um dieses Geheimnis nie mehr über diesen Kreis hinausdringen könnte. Ein glücklicher Zufall hatte ihnen das Tagebuch Cartwrights im ersten kritischen Augenblick in die Hände gespielt, und es schien ihr so sicher geborgen, daß sie das, wovon es sprach, für immer begraben hielt.
Und nun erreichte sie plötzlich von irgendwem und irgendwoher ein Blatt, sinnlos für jeden andern, aber für sie eine Drohung, wie sie raffinierter, deutlicher und wirkungsvoller nicht gut erdacht werden konnte: »In jener Nacht beim Brunnen der sieben Palmen spielten sich Dinge ab...«
Evelyn Dyke war sich völlig klar darüber, was diese harmlosen Worte ihr Furchtbares sagen sollten: »Ich kenne das Geheimnis der ›Königin der Nacht‹ vom Brunnen der sieben Palmen, das du um jeden Preis zu hüten suchst. Aber wenn ich will, kann meine Hand jederzeit den Schleier lüften.«
Die schöne Frau hatte das beklemmende Gefühl, als ob sich ein unsichtbares gefährliches Netz um sie spänne, und ihre Gedanken arbeiteten fieberhaft, um noch rechtzeitig einen Ausweg zu finden.
Über die Person des hinterhältigen Gegners war sie nicht mehr im Zweifel. Noel Wellby tat offenbar planmäßig und berechnend Zug um Zug, wie sie es erwartet hatte.
Auch Hyman dachte aus einem ähnlichen Grund an Noel Wellby, wenn er auch seiner Sache nicht so sicher war wie Evelyn Dyke. Aber zwischen der verdammten Notiz, die den ganzen Staub aufgewirbelt hatte, und dem Wisch, der ihm gestern in später Abendstunde in seinem Klub zugestellt worden war, schien ihm ein gewisser Zusammenhang zu bestehen.
»Weshalb verleugnen Sie die ›Königin der Nacht‹?« hatte auf dem Zettel gestanden, und Hyman hatte ihn mit seinen dicken Fingern in winzige Stücke zerrissen und die Schnitzel mit peinlicher Sorgfalt in das Kaminfeuer gestreut. Die Sache begann ihm Unbehagen zu bereiten, und nachdem er unaufmerksam und schlampig gespielt und drei Schilling verloren hatte, war das Maß seiner üblen Laune voll. Er war dann die halbe Nacht in seiner Junggesellenwohnung, die ebenso massiv und unfreundlich aussah wie er selbst, wütend umhermarschiert, um zu einem Entschluß zu kommen, und befand sich jetzt auf dem Weg, ihn auszuführen. Irgend etwas mußte geschehen, wenn er bei dieser Geschichte nicht eins abbekommen wollte. Bisher hatte er geglaubt, allein damit fertig zu werden, aber nun drohten ihm die Dinge mit ihrer raschen Entwicklung plötzlich über den Kopf zu wachsen. Davon durfte jedoch niemand wissen. Auch der Mann nicht, bei dem er sich nach längerem Schwanken eben angesagt hatte, um Beistand zu suchen. Das heißt, zunächst wollte er sich einmal über die Angelegenheit aussprechen, soweit ihm dies eben gut schien, und die Meinung eines anderen hören. Clive Boyd sollte ein fabelhaft findiger Kopf sein, und er hatte in seiner Anwaltspraxis manches von ihm gehört, was dieses Urteil zu bestätigen schien.
Als er ihm eine halbe Stunde später in dem kleinen, sauberen Haus in Camden Town gegenübertrat, wurde er an diesem Urteil allerdings irre. Der elegante, liebenswürdige Herr sah nicht gerade gefährlich aus. Er hatte das frische, faltenlose Gesicht eines Jungen, der eben ein Morgenbad genommen hat, weiches, weißes Haar, das tadellos geschnitten und frisiert war. Er konnte fünfunddreißig oder auch fünfzig Jahre alt sein, aber Hyman interessierte das nicht weiter, sondern er machte Miene, sich in den Stuhl fallen zu lassen und sofort auf sein Anliegen zu kommen.
Aber Boyd hielt ihn mit einer etwas ängstlichen Geste zurück und betastete die Sitzgelegenheit vorher mit besonderer Gründlichkeit.
»Bitte, wollen Sie Platz nehmen, Mr. Hyman«, sagte er dann beruhigt. »Ich habe nämlich eben, bevor Sie mit mir telefonierten, meine Fliegen instand gesetzt, und da heißt es vorsichtig sein. Es kommt zuweilen vor, daß solch ein winziges Ding irgendwohin fällt und das größte Unheil anrichtet. Man muß dann gewöhnlich die Hose durchschneiden, um den Haken herauszubekommen.«
Der Chef des Cartwright-Konzerns verstand zwar nichts von der Fliegenfischerei und den Dingen, die man dazu braucht, aber er ließ sich doch mit einer Vorsicht nieder, die er sonst nicht zu beobachten pflegte.
»Ich komme wegen des Falles Morton«, sagte er kurz und sah den anderen aus seinen starren Augen so grimmig an, als ob dieser den Fall auf dem Gewissen hätte.
Aber Boyd lächelte sehr freundlich zurück und erlaubte sich nur eine kleine Ergänzung.
»Wegen des Falles Morton-Cartwright.«
»Schön, meinetwegen«, gab der Anwalt etwas ungeduldig zurück. »Wollen Sie mir dabei behilflich sein? — Ja oder nein?«
»Nein«, sagte der liebenswürdige Mann mit dem weißen Kopf, und Hymans vierschrötiges Gesicht verriet Mißvergnügen und Verwunderung.
»Warum nicht?«
»Weil wir bereits Ende März haben und man ja nicht absehen kann, wie lange die Sache dauern würde«, erklärte der ehemalige Oberinspektor von Scotland Yard etwas zusammenhanglos, aber mit einer Selbstverständlichkeit, die den anderen einigermaßen verwirrte.
»Nun, darauf soll es nicht ankommen«, knurrte Hyman ungeduldig. »Meinetwegen können Sie sich auch bis zum Herbst damit herumschlagen.«
Boyd hob in rascher Abwehr eine seiner feinen Hände, und zum erstenmal zeigte sich in seinem verbindlichen rosigen Gesicht so etwas wie Entschiedenheit.
»Ausgeschlossen«, sagte er bestimmt.
Hyman bekam allmählich Knoten an den Schläfen und eine immer schlechtere Meinung von seinem Gegenüber. Das Frage- und Antwortspiel paßte ihm nicht, und wenn der Mann nicht wollte, so sollte ihn der Teufel holen.
»Sir, ich komme mit einem Geschäft«, polterte er vorwurfsvoll und wütend los, »und es ist an Ihnen, einen Preis zu nennen. Wir werden darüber rasch einig werden.«
Der Detektiv hob mit einem bedauernden Lächeln die Schultern.
»Es tut mir leid, Mr. Hyman, wirklich sehr leid, aber in der Forellenzeit bin ich für Geschäfte nicht zu haben.« Seine grauen Augen begannen zu strahlen, während er an den Fingern abzählte: »Mai, Juni, Juli, August.«
Der Anwalt schenkte ihm einen Blick, wie man ihn für einen halben Narren übrig hat, und schob den mächtigen Unterkiefer verächtlich vor.
»Deshalb lassen Sie eine solche Sache laufen?«
»Oh«, gestand Boyd etwas verlegen, »deshalb habe ich schon ganz andere Dinge laufen lassen. — Ich glaube, ich könnte heute einer der ersten Männer von Scotland Yard sein, wenn die Forellen nicht gewesen wären«, fügte er bescheiden hinzu.
Hyman hatte auch schon gehört, daß Boyd eine glänzende Karriere hätte machen können, wenn er gewollt hätte, aber er hatte bisher nicht gewußt, daß die Forellen daran schuld waren. Wenn der Mann einerseits die beste Spürnase von London hatte, so hatte er andrerseits offenbar auch den absonderlichsten Spleen dieser spleenigen Stadt. Aber das war dem Anwalt schließlich gleichgültig. Es lag ihm nicht so sehr daran, ob Boyd etwas ausrichtete, als daran, daß er die Sache übernahm. Mit Scotland Yard wollte er nichts zu tun haben, weil die Leute vom Yard gar zu neugierig waren, aber er konnte nicht tagelang nach einem Detektiv herumsuchen. Nachdem er schon einen kostbaren halben Vormittag geopfert hatte und hier saß, mußte er mit dem komischen Kauz irgendwie ins reine kommen. Er nahm sich daher zusammen und versuchte es mit dem Verhandeln.
»Fisch ist Fisch«, legte er dem besessenen Forellenangler nahe. »Wenn es Ihnen nur auf das Fangen ankommt, so suchen Sie sich eben heuer einmal solche Flossentiere aus, auf die man auch im Herbst ausgehen kann. Meinetwegen Haifische.«
»Haifische...«, stammelte der Privatdetektiv äußerst betroffen, und Hyman kam in diesem Augenblick zu der Überzeugung, daß in dem schneeweißen Kopf entschieden etwas nicht richtig war. Boyd saß wie eine Statue in seinem Sessel und sah mit einem leuchtenden Blick traumverloren in die Ferne.
»Kennen Sie Captain Mitchell Hedges?« fragte er plötzlich lebhaft.
»Nein«, gab der Anwalt schroff zurück. Seine Geduld ging zu Ende, denn es hatte offenbar gar keinen Zweck, weitere Zeit zu verlieren.
»Schade«, meinte der andere und begann sich zu begeistern. »Der einzige Mann, den ich bewundere und beneide. — Haben Sie sein Buch ›Kämpfe mit Riesenfischen‹ gelesen?« Er wartete die Antwort nicht erst ab, sondern eilte zu einem Regal und brachte ein Buch angeschleppt, das er seinem Besucher dicht vor die Augen hielt. »Meine Lieblingslektüre«, erklärte er. »Ich lese darin jeden Abend vor dem Schlafengehen. Man kann immer wieder von vorne anfangen.«
Hyman schielte unwillig auf ein buntes Bild mit einem unendlichen grünen Meer und einem unendlichen blauen Himmel, und mitten zwischen Wasser und Luft schnellte ein Riesentier, das einen Angelhaken von der Größe eines Ankers in seinem drohenden Rachen hatte.
»Das ist Mitchell Hedges«, begann der Privatdetektiv eifrig zu dozieren, ohne sich um das bedenkliche Gesicht seines Gastes zu kümmern, und deutete auf ein Bild. »Hier sitzt er mit seinem Gehilfen auf einem Korallenfelsen im Karibischen Meer und ißt Zwieback. Sehen Sie sich ihn genau an. Der gewaltigste Angler aller Zeiten und aller Länder.« Er begann in dem Buch zu blättern, daß die Seiten nur so flogen, und geriet dabei immer mehr in sportliche Begeisterung. »Hier haben Sie einen Sandhai von fast dreihundert Pfund, mit der Rute und einer gewöhnlichen Leine gefangen. Mr. Hedges pflegt so nette kleine Fischchen als Köder für Tiger- und Schaufelnasenhaie, für Stachelrochen und Sägefische zu verwenden. Länge vier bis neun Meter, Gewicht eintausendfünfzig bis fünftausend siebenhundert Pfund. — Können Sie sich das vorstellen? Ich habe einige Trophäen in der Britischen Seeangler-Gesellschaft gesehen. Was ist dagegen unsere ganze Fischerei, auch wenn man noch so erfolgreich ist! Ich habe volle vier Jahre den Lachsrekord mit einundachtzig Pfund gehalten — natürlich mit der Fliege. — Aber davon wollen wir lieber gar nicht sprechen.«
»Nein, davon wollen wir nicht sprechen«, stöhnte Hyman, der endlich genug hatte, und traf Anstalten, seinen gewaltigen Körper aus dem tiefen Klubsessel aufzuheben. »Hai- und Sägefische gehen mich nichts an, und ich wüßte nicht, welcher Zusammenhang zwischen diesen scheußlichen Bestien und dem besteht, weshalb ich hierhergekommen bin.«
Boyd sah den aufgeregten Koloß etwas verwundert und vorwurfsvoll an.
»Aber, Mr. Hyman, Sie haben doch selbst von den Haifischen angefangen«, stellte er fest. »Ich wäre, offen gestanden, nie darauf gekommen. Leider. Denn die Idee ist nicht schlecht; sie ist sogar großartig, und unter dieser Bedingung könnte ich mich vielleicht entschließen, ›ja‹ zu sagen.«
»Unter welcher Bedingung?« forschte der Anwalt überrascht und mißtrauisch, indem er halbaufgerichtet blieb.
»Unter der Bedingung, daß für mich dabei so eine Jagd auf Großfische herausschaut«, sagte der Privatdetektiv klar und bestimmt, und sein Gesicht hatte plötzlich einen sehr nüchternen und geschäftsmäßigen Ausdruck. »Ich will es ja gewiß Captain Hedges nicht gleichtun, sondern mir würden schon einige Monate am Panamakanal und der eine oder der andere Hai von dreihundert bis vierhundert Pfund genügen. Wenn man richtiges Anglerblut in den Adern hat, sehnt man sich danach, so etwas einmal mitzumachen. — Um hier angenehm zu leben und Forellen zu fangen, habe ich ja genug, aber für die andere Sache reicht es selbst bei meinen bescheidenen Ansprüchen nicht. Wenn sich mir daher eine Gelegenheit bieten würde... Sie verstehen mich, Mr. Hyman...«
Der Chef des Cartwright-Konzerns verstand plötzlich sehr gut und ließ sich befriedigt in den Sessel zurückfallen, weil er statt Fischwasser nun wieder festen Boden unter sich fühlte.
»Ich verstehe«, sagte er fast zuvorkommend, »und darüber läßt sich reden.« Der Anwalt war ein Geizhals, solange es um Schillinge ging, aber er konnte auch großzügig sein. »Wir schicken Reporter um die ganze Welt und werfen drei Viertel von dem, was sie zusammenschmieren, in den Papierkorb, weil es nicht zu gebrauchen ist. Da macht es wirklich nichts aus, wenn wir Sie auf ein Jahr nach dem Panamakanal zu Ihren Haifischen gehen lassen. Machen Sie mir eine Aufstellung.«
Boyd war schon auf dem Weg zu seinem Schreibtisch und kehrte strahlend mit einem Bogen Papier zurück.
»Ich habe mich mit der Sache bereits seit langem beschäftigt«, gestand er etwas verlegen. »Es war so eine Art Steckenpferd von mir. Sie finden hier jeden einzelnen Posten. Zuerst die Spezialausrüstung nach dem Katalog von den Gebrüdern Hardy...«
Mr. Hyman hörte nicht zu, sondern wandte das engbeschriebene Blatt um und sah nach der dick unterstrichenen Endsumme.
»Ich runde den Betrag noch um zweihundert nach oben ab«, erklärte er kurz. »Sind wir einig?«
Er sah Boyd wieder mit seinem gewöhnlichen starren, ausdruckslosen Blick an, und dieser nickte gelassen.
»Abgemacht.«
»Dann werde ich Ihnen also jetzt sagen, worum es sich handelt«, begann der Anwalt nach einigem Räuspern, aber der rosige Herr mit dem weißen Haar unterbrach ihn höflich.
»Um den Fall Cartwright-Morton. Sie haben mir das ja schon mitgeteilt. Das genügt mir. Ich möchte mich vorläufig nicht durch subjektive Darstellungen beeinflussen lassen. Es ist mir bereits einiges bekannt, und das andere werde ich mir schon zusammentragen. Sie können sich ganz auf mich verlassen. Nur um die Erlaubnis möchte ich Sie bitten, im Cartwright-Haus ungehindert ein und aus gehen zu dürfen. Ich werde nicht viel Aufsehen erregen, denn man dürfte mich kaum persönlich kennen.«
Hyman nickte zustimmend. Er war zwar sehr erstaunt und skeptisch, weil der andere die Sache so leicht nahm, aber eigentlich war er damit gar nicht so unzufrieden. Er hatte nun seine Pflicht und Schuldigkeit getan, ohne der einen oder anderen peinlichen Frage ausgesetzt gewesen zu sein.
Boyd geleitete seinen Besucher höflich zur Tür, und der Anwalt war schon in dem kleinen Flur, als er noch aufgehalten wurde.
»Nur der Ordnung halber, Mr. Hyman: Bleibt es auch bei unserer Vereinbarung, wenn es mir gelingen sollte den Fall noch vor Beginn der Forellensaison zu erledigen?«
»Selbstverständlich«, schrie der Koloß ungeduldig zurück, und als er in sein Auto kroch, ließ er einen halblauten Fluch los. Der Teufel mochte sich in diesem Gemisch von Narr, Komödiant und Sportsmann auskennen.
Mr. Jacob Fish war der erste, der bereits am nächsten Tag den gepflegten, weißhaarigen Herrn zu Gesicht bekam. Er saß plötzlich gemütlich im Reporterzimmer und tat so, als ob er hier schon seit undenklichen Zeiten zu Hause wäre.
Der ›Fliegenpilz‹ ließ sich aber dadurch nicht täuschen.
»Fish«, sagte er höflich und rückte den steifen Hut, den er nur bei besonders feierlichen Gelegenheiten abzunehmen pflegte, mit zwei Fingern noch um einen Grad weiter in den Nacken. »Wohl neu eingetreten. Mr....?«
»Boyd. Clive Boyd«, befriedigte der andere ebenso höflich Mr. Fishs Wißbegierde. »Jawohl. Das heißt, nicht so ganz...«
Der fünfundzwanzigjährige Jüngling zog verständnisvoll die spärlichen gelben Augenbrauen hoch.
»Aha. Weiß schon. Gelegentlicher Mitarbeiter. Auch nicht schlecht, wenn man die Sache versteht. Wellby hat auch so angefangen und ist dann hereingeschlüpft. Aber ich gebe nicht einen Schilling dafür, daß er nicht schon heute oder morgen wieder fliegt, und dann haben Sie Aussichten, nachdem Sie schon einmal hier sitzen.«
»Glauben Sie wirklich, daß er fliegt?« fragte der nette Herr mit begreiflichem Interesse.
Mr. Fish schob die Hände in die Hosentaschen und hob zuerst die rechte, dann die linke Achsel, womit er sagen wollte, daß die Dinge nicht so einfach lagen.
»Das ist so eine Sache«, meinte er bedächtig. »Eigentlich sollte er nämlich schon draußen sein. Sie müssen wissen, daß er es war, der uns das Kuckucksei der Morton-Notiz ins Blatt gelegt hat, wenn ich mich so ausdrücken darf... Nun frage ich Sie: Spricht man im Haus eines Gehenkten vom Strick und im Cartwright-Haus über das Gerede, das nach dem Tode von Sir Benjamin herumgegangen ist? Was mich nicht brennt, das lösche ich nicht, und wieso kommt ausgerechnet dieser aufgeblasene Affe dazu, plötzlich so ein Geschrei zu erheben, wo das doch die Sache von Mr. Hyman gewesen wäre oder meinetwegen auch von Mrs. Dyke? Fragen Sie ihn, was in ihn gefahren ist. Aber der Alte hat ihm den Kopf gewaschen, daß es sich gelohnt hat, und ich will nicht Jacob Fish heißen, wenn man ihm deshalb nicht doch noch den Stuhl vor die Tür setzt.«
Mr. Fish stellte diese Behauptung mit großer Gelassenheit auf, denn das Risiko war schließlich gering. Aber plötzlich fiel ihm ein, daß es gar keinen Sinn hatte und eigentlich auch nicht seine Art war, so zwecklose und uneinträgliche Gespräche zu führen. Der Mann mit dem weißen Haar war doch neu und vielleicht sah bei ihm etwas heraus. Der tüchtige Jüngling zog nachdenklich die sommersprossigen Wülste über den Augen zusammen und starrte sein Gegenüber durchdringend an.
»Wissen Sie, Mr....«
»Boyd«, kam ihm dieser beflissen zu Hilfe.
»Mr. Boyd, sehr richtig. In Namen bin ich zwar nicht so ganz sicher, aber sonst habe ich ein geradezu fabelhaftes Personengedächtnis. Ich wollte nämlich eben sagen, daß ich Sie schon irgendwo gesehen habe.«
»Das wohl kaum«, bezweifelte der freundliche Herr bescheiden.
Mr. Fish kramte eifrig in der Westentasche, und nachdem er die stets bereiten fünf Schilling rasch und unauffällig so sortiert hatte, daß die einwandfreien zuoberst und -unterst, die anderen drei aber in der Mitte lagen, stieß er die Rolle energisch auf den Tisch.
»Ich sage das nicht nur so, Mr. Boyd«, äußerte er entschieden. »Fünf Schilling, wenn's beliebt. Dann werden Sie sofort hören.«
Der weiße Herr zog bereitwilligst eine Handvoll Silber aus der Tasche, was den ›Fliegenpilz‹ vollends überzeugte, daß er es mit einem Gentleman zu tun hatte, bei dem man nicht erst aufpassen mußte, ob er nicht etwa eine Spielmarke dazwischenschmuggelte.
»Also«, sagte Mr. Fish, indem er völlig in Gedanken beide Rollen in allernächste Greifweite zu sich heranzog und die Stirn in dicke Falten legte, »wir werden es gleich haben... Wir haben uns bereits gesehen... Das heißt, ich habe Sie gesehen« — er starrte in die Luft, als ob es dort geschrieben stünde —, »jawohl, am 12. Dezember in der Untergrundbahn...«
»Allerdings«, erinnerte sich nun auch Boyd und sah Mr. Fish mit dem fabelhaften Gedächtnis staunend an, aber dieser hatte bereits das Geld eingestrichen und wehrte die Bewunderung bescheiden ab.
»Na ja, es ist ja einigermaßen überraschend«, meinte er leichthin, »aber nichts als Training des Gehirns. Unsereiner braucht das. Sie werden es auch noch lernen. Und wenn ich Ihnen in der ersten Zeit irgendwie behilflich sein kann...«
»Ich wäre Ihnen sehr verpflichtet«, beeilte sich der nette Herr zu versichern. »Vielleicht machen Sie mir einmal das Vergnügen, mit mir ein einfaches Abendbrot einzunehmen.«
Der Jüngling dachte angestrengt nach. »Das wird sich machen lassen. — Sagen wir heute. Da habe ich gerade nichts Besonderes vor. Und wenn ich Sie ansehe, weiß ich, daß Sie nur im Cecil- oder Princes-Restaurant speisen. Dafür habe ich einen Blick. Also, sagen wir um neun Uhr im ›Princes‹. Sie werden staunen, wenn ich mit meinem Frack anrücke. Ein Prachtstück. Gebaut für einen Lord, der genau meine Figur hatte. Und ganz auf Seide natürlich. Also, vergessen Sie nicht: heute um neun Uhr«, schloß er nachdrücklich. »Ich pflege pünktlich zu sein«, versicherte er, und um Mr. Boyd seine besondere Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen, zog er den etwas löchrigen Handschuh ab, bevor er dem netten Herrn umständlich und kräftig die Rechte schüttelte.
Da er noch eine Weile Zeit hatte, nahm Boyd an einem der kleinen Tische in der ausgedehnten Halle Platz, um sich das interessante Getriebe im Cartwright-Haus einmal ein bißchen näher anzusehen. Die Drehtür kam keinen Augenblick zur Ruhe, denn mit den Angestellten kamen und gingen ununterbrochen alle möglichen Leute, die in den Redaktionen oder den Verwaltungen der Konzernblätter irgend etwas zu fragen oder zu bestellen hatten, und auch rings an den Tischen saßen Vertreter der verschiedensten Berufsklassen, die aufmerksam in dicken Bänden blätterten oder über einer Anzeige brüteten.
Der gelangweilt und griesgrämig dreinschauende Mr. Coppertree ließ, würdevoll an seine Loge gelehnt und das eine Säbelbein über das andere geschlagen, den Menschenstrom gleichgültig an sich vorüberziehen, und nur hie und da hob er gnädig einen Finger an seinen Kappenschirm. Einmal schnellte er sogar blitzschnell auf beide Beine und legte drei Finger mit weit ausgespreiztem Ellbogen ehrerbietig an die Mütze, dann versank er jedoch sofort wieder in seine erhabene Gelassenheit und in seine Gedanken, die, wie der aufmerksame, rosige Herr schloß, nicht sehr heiterer Art sein mochten. Tatsächlich beschäftigte sich Mr. Coppertree eben wieder mit Mrs. Nettie, die dafür sorgte, daß sie ihm nicht aus dem Gedächtnis kam. Ihr Auge über der großen Warze schimmerte nun rot, gelb, grün und blau, und wenn er zu Hause war, vergingen nicht fünf Minuten, ohne daß sie nicht vorwurfsvoll auf dieses unschöne Auge getippt und ihn mit einem Schwall von Unliebenswürdigkeiten überschüttet hätte, die regelmäßig mit ›Lump‹ und ›Wüstling‹ begannen und mit ›krummer Hund‹ und ›gemeiner Mörder‹ endeten. Aber alles das hätte Pat geduldig über sich ergehen lassen, wenn Mrs. Nettie nicht auf den geradezu teuflischen Einfall gekommen wäre, Lolas verhängnisvolles Hemd selbst anzulegen und nun darin vor ihm unausgesetzt herausfordernd auf und ab zu spazieren. Diesen Anblick vertrug Mr. Coppertree nicht, und wenn er, wie eben jetzt, daran dachte, sah er aus wie ein Mann, der einen sehr unangenehmen Geschmack im Mund hat.
In dieser Verfassung auch noch den Anblick Noel Wellbys ruhig hinzunehmen, konnte man von dem armen Pat nicht verlangen, und er hatte daher die Gestalt des Reporters kaum in der Eingangstür erblickt, als er sich auch schon blitzschnell um seine Achse drehte und den Kopf tief und geschäftig in seine Loge vergrub. Seit der stürmischen Nacht in den ›Freundlichen Winden‹ hielt er es immer so, und sein Unbehagen schwand stets erst dann, wenn der gewisse Instinkt, den er sogar in seinem breiten Rücken hatte, ihm verriet, daß der unangenehme Mensch vorüber war.
Heute wollte sich aber dieses befreiende Gefühl lange Zeit nicht einstellen, und als Mr. Coppertree endlich mißtrauisch und äußerst vorsichtig den Kopf aus der Loge zog und ein ganz klein wenig zur Seite wandte, um zu ergründen, was da eigentlich los sei, blickte er mit einem Auge wirklich gerade in das gebräunte Gesicht des Reporters. Er fuhr zwar sofort wieder herum, aber das hatte keinen Zweck mehr.
»Mr. Pat«, sagte Noel Wellby harmlos, aber so laut, daß es mit Boyd alle Leute ringsum deutlich hören konnten, »Sie sind ja, wie ich mir sagen ließ, eine alte Themseratte. Halten Sie es für möglich, daß einer bereits um diese Jahreszeit ein Bad im Pool nimmt? Man hat mir das erzählt, aber ich kann es nicht glauben. Der Bursche müßte geradezu die Haut eines Walrosses haben, um das auszuhalten.«
Pat fand es unter seiner Würde, auf so eine alberne Frage eine Antwort zu geben, und der Reporter mußte mit einem verwunderten Achselzucken über diese unbegreifliche Unhöflichkeit seines Weges gehen.
Als sich Mr. Coppertree endlich wieder umwandte, war sein Bart nach allen Richtungen gesträubt, und der Herr mit dem weißen Haar sah in ein Paar wütend blitzende Augen, die ihm zu denken gaben.
Er erhob sich gemächlich, schlüpfte durch die Tür ins Freie und schlenderte zunächst einmal die Front des Hauses ab. Er war ganz in das riesige Blatt vertieft, das er eben gekauft hatte, aber seine Blicke suchten dabei Schritt für Schritt die gegenüberliegende Straßenseite ab, wo er anscheinend irgend etwas zu sehen erwartete. Einmal machte er für einige Augenblicke halt, suchte in seinen Taschen umständlich nach einem Bleistift und strich mit wichtiger Miene eine Stelle in der Zeitung gründlich an. Nach etwa hundert Schritten betrat er einen Tabakladen, kaufte einige Zigarren, von denen er eine sofort in Brand setzte, überquerte dann die Straße und kam auf der andern Seite ebenso langsam zurück.
Clive Boyd kannte die Verbrecherwelt Londons unbedingt wie kein zweiter. Nicht nur die einzelnen Köpfe, sondern auch deren Anhang bis zum letzten ›Schlepper‹ und Schmierensteher, und er wußte aus dieser Wissenschaft sehr wertvolle Schlüsse zu ziehen. Auf dem kurzen Weg, den er eben zurückgelegt hatte, war er an vier unscheinbaren Passanten vorübergekommen, die gewiß nicht der Zufall zusammengefegt hatte. Er wußte genau, wohin sie gehörten, und wunderte sich einigermaßen über das Interesse am Cartwright-Haus, da es für das Metier des ›Professors‹, ihres Herrn und Meisters, hier doch kaum Arbeit gab.
Aber schwerwiegender als alle Logik und alle Schlußfolgerungen waren für Boyd seit jeher feststehende Tatsachen, und er erkannte die Notwendigkeit, der Paradies-Bar einen Besuch abzustatten. Am liebsten hätte er dieses Geschäft bereits heute besorgt, aber es fiel ihm rechtzeitig ein, daß er Mr. Fish im Princes-Restaurant zu Gast hatte, und er machte sich daher auf den Heimweg, um neben dem auf Seide gearbeiteten Frack nicht allzu unvorteilhaft abzustechen.
Es war wirklich ein Zufall, der Noel Wellby an diesem Abend, als er das Haus verlassen wollte, auf einem der Korridore mit Clarisse Avery zusammentreffen ließ. Der Reporter hatte das häßliche Mädchen seit dem Vortrag der Heilsarmee nicht mehr gesehen, und er hatte sich einigermaßen darüber gewundert, denn sonst war ihre gebeugte Gestalt täglich am Morgen und gegen Abend im Reportersaal aufgetaucht und hatte sich irgendwo in einem stillen Winkel verkrochen.
»Wo stecken Sie denn?« fragte er, als sie mit einem flüchtigen Kopfnicken hastig an ihm vorüber wollte. »Hoffentlich waren Sie nicht krank?«
Sie war über die Begegnung nicht sehr erfreut und hätte es gern vermieden, sie auszudehnen, aber seine Frage klang so herzlich, daß sie sich verpflichtet fühlte, ihm Rede zu stehen.
»Nein«, erklärte sie in verlegener Hast, »aber ich hatte in den letzten Tagen sehr viel zu tun. Ich mußte alle unsere weiblichen Tennisgrößen wegen der Strumpffrage ausholen. Vielleicht haben Sie darüber gelesen.«
»Selbstverständlich«, erwiderte er mit ernstem Gesicht. »Eine so wichtige Sache! Und wenn es Sie interessiert: Ich bin unbedingt dafür, daß die Damen mit Strümpfen antreten.«
Sie richtete ihre großen undurchsichtigen Gläser auf ihn, und um ihren kleinen Mund zuckte es leicht.
»Weshalb?«
»Weil ein Paar schöne Beine in Strümpfen lange kein solches Malheur sind, wie unschöne Beine ohne Strümpfe.« In seinen Augen blitzte es auf, und sie sah zwei Reihen starker weißer Zähne, die durch die sonst so energisch geschlossenen Lippen schimmerten. »Man verliert wenig, und es bleibt einem sehr viel erspart«, setzte er blinzelnd hinzu. »Haben Sie nie Tennis gespielt, Miss Avery?«
Sie hob mit einem Ruck den Kopf, und seine unvermittelte Frage schien sie ziemlich in Verlegenheit gebracht zu haben.
»Wie kommen Sie darauf? Wollen Sie sich über mich lustig machen?« Es klang mehr mißtrauisch als verletzt, aber er ging sehr rasch und leicht darüber hinweg.
»Ich meinte nur — weil wir eben bei diesem Thema waren. Aber ich halte Sie auf. Gehen Sie oder kommen Sie?«
Sie wußte einen Augenblick nicht, was sie antworten sollte.
»Ich gehe«, sagte sie endlich und hielt ihm rasch die Hand in dem gestopften Handschuh hin, aber er übersah diese Verabschiedung.
»Das trifft sich gut, ich bin auch fertig«, sagte er so selbstverständlich, daß sie unwillkürlich an seiner Seite weiterschreiten mußte.
»Ich habe aber nur eine ganz kurze Strecke zu gehen«, beeilte sie sich vorzubeugen.
»Wohnen Sie in der Nähe?«
»Nein, das nicht«, gab sie ausweichend zurück. »Aber ich habe einige Besorgungen zu machen.«
Sie schlurfte mit vorgeneigtem Kopf und schlenkernden Armen neben ihm her und machte gar kein Hehl daraus; daß ihr seine Begleitung nicht willkommen war. Am ersten Abend hatte sie doch hie und da einen gesprächigen Augenblick gehabt, aber heute öffnete sie nicht den Mund, wenn er sie nicht fragte, und auch dann antwortete sie nur kurz und widerwillig.
»Haben Sie Ihre Eltern hier in London oder Verwandte?« wollte er plötzlich wissen.
»Ja«, sagte sie rasch und unklar, und wie um über dieses Thema schleunigst hinwegzukommen, begann sie plötzlich mit auffallendem Eifer zu erzählen, daß sie sehr beschäftigt sei, da sie auch noch Kurse höre und verschiedenes für sich zu arbeiten habe. Sie drückte sich darüber nicht näher aus und leierte alles mit monotoner Stimme und einer Geläufigkeit herunter, als ob sie es auswendig gelernt hätte.
Noel Wellby sah ununterbrochen auf das garstige Mal auf ihrer Wange, und sie schien seinen Blick zu fühlen, denn sie wurde immer unruhiger und wandte den Kopf nach allen Seiten.
»Diese anstrengende Arbeit kann Ihnen nicht guttun«, meinte er, und abermals hörte sie in seinen Worten einen warmen, teilnehmenden Unterton mitklingen. »Dabei müssen ja Ihre Augen leiden, und auch Ihre Haltung wird dadurch nicht besser. Seien Sie mir nicht böse, daß ich Ihnen das sage, aber es kommt mir so vor, als ob Sie sehr wenig für sich tun. Sie sollten Sport und Gymnastik treiben. Schließlich sind Sie ja ein junges Mädchen.«
Wieder flogen ihre dunklen Gläser blitzschnell herum und blieben einen Augenblick starr an seinem harmlosen Gesicht haften.
»Das nützt alles nichts«, stieß sie schroff hervor und schüttelte mißmutig mit dem Kopf. »Ich bleibe wohl mein Leben lang, wie ich bin.«
»Sie haben eben noch nie den Versuch unternommen, anders zu werden«, setzte er ihr hartnäckig zu. »Man sollte Sie eigentlich dazu zwingen.«
Er schwieg einen Augenblick und schien «über etwas nachzudenken, und Clarisse blickte ihn aus den Augenwinkeln mit gespannter Aufmerksamkeit an.
»Wenn wir den ersten schönen Tag haben«, sagte er plötzlich, »und das kann ja nicht mehr allzu lange dauern, nehme ich Sie einmal mit auf die Themse. Ein paar Stunden werden Sie sich ja frei machen können, und Sie dürfen sich mir ruhig anvertrauen. Ich kann noch von meiner Jugendzeit her mit dem Segelboot umgehen, und ich getraue mich sogar, Sie aus dem Wasser zu ziehen, wenn Sie hineinfallen sollten. Hoffentlich...«
Er vernahm neben sich ein so frisches und herzliches Lachen, daß er jäh abbrach und seine Begleiterin wieder einmal ganz verwundert anstarrte.
»Da gibt es nichts zu lachen«, meinte er. Sie verstummte sofort, aber ein Lachen erschütterte ihren ganzen Körper.
»O doch«, gluckste sie, und es klang wie das Gurren einer Taube. »Stellen Sie sich vor: ich auf der Themse — womöglich in strahlendem Sonnenlicht... Ich glaube, alle Fische und Schiffe würden scheu werden bei diesem Anblick.«
»Wir wollen einmal den Versuch machen, dann werden wir ja sehen«, sagte er ruhig und bestimmt, und sie fühlte mit einer gewissen Beklemmung, daß es ihm mit seinem sonderbaren Vorschlag ernst war. Der Mann gefiel ihr ja ganz gut, denn er hatte etwas Gerades und Entschlossenes in seiner Art und etwas Bezwingendes in seinem Auftreten, aber Clarisse sagte sich, daß er kein Umgang für sie sei. Sie paßte so gar nicht zu ihm, und es entging ihr nicht, daß immer wieder der eine oder andere der Passanten verwundert auf das seltsame Paar blickte, das sie bildeten. Und außerdem hatte sie an ganz andere Dinge zu denken, als dem eigenartigen Geschmack Mr. Wellbys an unvorteilhaft aussehenden jungen Mädchen Rechnung zu tragen.
Sie hatten schon längst das Cartwright-Haus verlassen und waren die Fleet Street ein Stück hinuntergegangen, dann in die New Bridge Street eingebogen und nun bei der Ludgate Hill Station angelangt.
Hier hielt sie es an der Zeit, ihren Begleiter abzuschütteln, und zeigte auf das nächstbeste Haus.
»Ich bin am Ziel. Gute Nacht«, sagte sie einfach.
»Gute Nacht. Und vergessen Sie nicht unsere Verabredung. Sowie die Sonne herauskommt, schleppe ich Sie einfach mit.«
Sie gab keine Antwort, sondern verschwand lächelnd in dem Haus, während er seinen Weg gegen die Themse fortsetzte.
Hinter ihm drein bummelten, harmlos und in immer gleichem Abstand, zwei auf der rechten, zwei auf der linken Seite, die vier unscheinbaren Gestalten, die lediglich dem scharfen Auge des erfahrenen Mr. Boyd vor dem Cartwright-Haus aufgefallen waren. Einmal hielt einer von ihnen, ein großer, dicker Mann einen Zeitungsverkäufer an, der die Straße mit seinem monotonen Geschrei hinabtrabte, kaufte ein Blatt und ließ sich dann Feuer geben.
»Es wird noch eine gute halbe Stunde dauern, bis es halbwegs dunkel wird«, flüsterte er, während er mächtig an seiner Pfeife zog. »Nun hängt alles davon ab, was er tut. Halte jedenfalls den Sack bereit, und wenn du meinen ersten Pfiff hörst, so mach dich dicht an ihn heran. Dann kommt auch Ed von der anderen Seite herüber. Und wenn ich zum zweitenmal pfeife, wirfst du ihm das Zeug über den Kopf, und Ed sticht zu. Ich werde schon einen günstigen Platz aussuchen. Aber dann wie der Blitz auseinander.«
Aus der Pfeife des Großen stiegen mächtige Rauchwolken, und er setzte seinen Weg fort; der Zeitungsverkäufer war jedoch weit schneller als er und ihm bald wieder voran.
Aber den Spuren Noel Wellbys folgten nicht bloß vier, sondern gleich sieben Schatten. Einige Schritte hinter dem großen, dicken Mann stapfte breitspurig ein Bursche mit krebsrotem Gesicht und strohblondem Haar unter einer Sportmütze, und seine Gliedmaßen waren so lang, daß die Ärmel seines großkarierten Anzuges vier Finger vorm Handgelenk und die Hose am oberen Rand der schweren Stiefel endeten. Ihm gegenüber schritt ein breitschultriger, schmieriger Geselle mit einer Werkzeugtasche und einem kurzen Bleirohr in der Hand, und zwischen beiden ging ein junger Tagedieb, der bald nach vorne, bald nach hinten sah, und auf den jede Auslage eine besondere Anziehung auszuüben schien. Und eben als sich der große, dicke Mann von dem Zeitungsverkäufer Feuer geben ließ, schlängelte er sich dicht an jenem vorbei, um einen Blick in ein Geschäft zu tun, in dem Batterien von Whiskyflaschen zu sehen waren.
Der Reporter stellte seine Verfolger auf eine harte Geduldsprobe. Er schlenderte, die Hände tief in die Taschen des Mantels vergraben, scheinbar ohne bestimmtes Ziel durch die unendliche Thames Street und hatte jedenfalls keine Eile.
Allmählich stellte sich bereits die Dämmerung ein, und vom Strom her kam die erste Brise der feuchten muffigen Nachtluft.
Plötzlich bog Wellby gerade gegen den Fluß ab, und Hanson, der große, dicke Mann hinter ihm, reckte sich tatbereit auf. Wenn der Verfolgte wirklich seinen Weg durch dieses enge Gassengewirr nahm, mußte sich bald eine passende Gelegenheit ergeben, und es galt jetzt, die Augen offenzuhalten und den Augenblick blitzschnell auszunützen. Die Luft konnte schon in der nächsten Minute völlig rein sein, denn die drei Männer, deren feste Schritte er hinter seinem Rücken vernahm, hatten es offenbar sehr eilig, heimzukommen, und sie waren tatsächlich auch schon an ihm vorübergehe er ihnen eingehendere Aufmerksamkeit schenken konnte.
Nun hieß es rasch die eigenen Leute sammeln. Hanson machte vor einem der schmutzigen Häuser halt, spähte nach den Fenstern hinauf und stieß einen schrillen Pfiff durch die Finger, als ob er jemanden herbeirufen wolle. Als sich nichts zeigte, schüttelte er verwundert den Kopf und ging rasch weiter.
Noel Wellby war etwa dreißig Schritt vor ihm, hatte vor sich einen kleinen, hageren Menschen, hinter sich einen Zeitungsverkäufer und an der Seite, nur durch die schmale Gasse getrennt, einen muskulösen Hafenarbeiter.
Der große, dicke Mann machte plötzlich halt und überprüfte das Terrain. Unmittelbar vor dem Reporter bildete eine Hofmauer einen Vorsprung, und wenn die Burschen schnell waren...
Abermals schrillte ein kurzer, scharfer Pfiff durch die Stille, und Hanson stand mit angehaltenem Atem sprungbereit und starrte in das Dunkel: Er sah plötzlich einen dichten Menschenknäuel, hörte einige dumpfe Schläge, einen wilden Schmerzenslaut und einer schweren Fall...
Der zweite Pfiff war noch nicht verhallt, als der Zeitungsverkäufer auch schon den bereitgehaltenen Sack über Wellbys Kopf hielt und sein schmächtiger Genosse mit einem katzenartigen Sprung herumfuhr, um mit dem Messer in seiner Rechten den Stoß zu tun. Und von der Flanke war der schwere Hafenarbeiter gegen das Opfer geschnellt...
Aber die Hände des ›Zeitungsverkäufers‹ mit dem Sack sanken kraftlos herab, denn der Mann erhielt einen Hieb über den Kopf der ihn lautlos zusammenbrechen ließ; den Arm mit dem Messer traf trotz seiner Flinkheit auf halbem Weg ein kurzes, schweres Bleirohr, das ihn für immer erledigte, und den Hafenarbeiter traf vor dem Ziel ein kräftiges Bein mit zu kurzer Hose, das gegen seinen Bauch stieß und ihm schmerzhafte Übelkeit bereitete.
Trotzdem war er der erste, der wieder auf die Füße kam und die enge Gasse hinauflief. Als er an dem großen, dicken Mann vorüberschoß, keuchte er trotz seiner Eile und Atemlosigkeit wütend: »Hol dich der Teufel mit deinen dreckigen Geschäften«, und Hanson verstand ihn sofort und schlug sich behende um die nächste Ecke.
»Sie sehen, auf mich kann man sich verlassen«, sagte Mr. Fish, indem er die riesige Taschenuhr aus goldähnlichem Metall, die er eine Viertelstunde lang möglichst auffallend in der Hand gehalten hatte, nachlässig in die Westentasche schob und den eben in die Halle des Princes-Restaurants tretenden Boyd mit freundschaftlicher Herablassung begrüßte. »Wir gehen selbstverständlich in den großen Speisesaal. Man sieht da alle möglichen interessanten Leute, und es kann für Sie nur nützlich sein, wenn ich Sie mit einigen von ihnen bekannt mache. Ich bin schon etwas früher gekommen, um uns einen möglichst guten Tisch zu sichern.«
Er ging ohne weiteres voran und bewegte sich mit der Sicherheit und Selbstgefälligkeit eines Mannes, der gewohnt ist, auf kostbaren Teppichen zu schreiten und seinen auf Seide gearbeiteten Frack von dem grellen Licht mächtiger Lüster bestrahlen zu lassen. Daß ihm das für einen Lord angefertigte fabelhafte Kleidungsstück um die Schultern etwas zu weit und in der Taille zu eng war und daß es auf dem Revers einige umfangreiche Flecken hatte, kümmerte Mr. Fish nicht sonderlich, denn diese kleinen Schönheitsfehler wurden durch eine prallsitzende weiße Weste und zwei riesige Perlen in der vorquellenden Hemdbrust ausgeglichen. Zwar hatten die Beinkleider die Gewohnheit, ständig in die Höhe zu rutschen, ließen dafür aber ein Paar prächtige schwarze Seidenstrümpfe und die erst vor einer Stunde frisch geputzten Halbschuhe zu besonderer Geltung kommen.
Als sie an dem kleinen Tisch an der Stirnwand des großen Saales Platz genommen hatten, griff der ›Fliegenpilz‹ zunächst einmal ohne weiteres nach der Speisekarte.
»Sie gestatten wohl, daß ich bestelle«, meinte er höflich. »Selbstverständlich können Sie nach Belieben wählen, aber ich muß leider auf meinen Magen Rücksicht nehmen.«
Das erschwerte ihm natürlich die Wahl einigermaßen, und er benötigte eine geraume Weile, bis er sich für frischen Hummer, Hammelkoteletts mit Mixed Pickles, jungen Truthahn, Konfitüren-Omelett, Käse und Obst entschieden hatte. »Die Getränke überlasse ich Ihnen«, sagte er entgegenkommend, »aber bitte etwas Kräftiges, weil mir das die Verdauung erleichtert.«
Der nette weißhaarige Herr, der bis jetzt noch nicht zum Sprechen gekommen war, kam dem Wunsch seines Gastes nach, und das wiederholte anerkennende Nicken Fishs bewies, daß er das Richtige getroffen hatte.
»Nur noch eine Kleinigkeit vorher, sagen wir Sherry oder Madeira«, erlaubte sich Fish bescheiden zu ergänzen. »Meine Magennerven bedürfen immer einer derartigen Anregung.«
Mr. Boyd war schon dabei, diesem Bedürfnis der Magennerven Mr. Fishs Rechnung zu tragen, und der ›Fliegenpilz‹ fand, daß er sich in seinem neuen Kollegen nicht getäuscht hatte. Der Mann sah noch frischer und rosiger aus als sonst und machte in seinem tadellosen Abendanzug eine Figur, die selbst vor den kritischen Augen des Reporters bestand.
»Wir müssen Freunde werden«, erklärte dieser mit einer, Bestimmtheit, die jeden Widerspruch ausschloß, »und Sie werden dabei nicht schlecht fahren. Einen Menschen muß man ja in der Redaktion haben, auf den man sich verlassen kann, und wer sollte das sein, außer mir? Was Sie sonst noch bei uns treffen, ist nicht der Rede wert. Ein paar ältere Herren, die nichts im Kopf haben als ihre Familie und ihren langweiligen Klub, und außerdem züchtet der eine Kakteen, und der andere ist hinter alten Spazierstöcken oder Briefmarken her. — Ist das ein Verkehr, frage ich Sie? Nicht einmal das Derby kann so jemand aufrütteln, und wenn Oxford und Cambridge auf der Themse um die Wette rudern, sitzen sie womöglich und spielen Bridge.«
Mr. Fish erhielt in diesem Augenblick glücklicherweise seinen Madeira und konnte seine unsägliche Verachtung hinunterspülen.
»Und was Sie bei uns an jüngeren Leuten, finden«, fuhr er nach einem lauten befriedigten Schnalzen neugestärkt fort, »taugt ebensowenig. Nichts Seriöses. Nehmen Sie zum Beispiel diesen Wellby. Einfach ein Hochstapler.« Der ›Fliegenpilz‹ blähte gereizt die Nüstern. »Abgewetzte Hosen, aber ein Getue wie ein Pair. Haben Sie schon beobachtet, wie er sich die Zigarette anzündet? Nein? Nun, dann passen Sie einmal auf, und Sie werden wissen, woran Sie sind.«
Mr. Fish war so empört, daß er nach Luft schnappen mußte, wodurch Boyd Gelegenheit fand, eine bescheidene Frage zu tun.
»Ist Mr. Wellby schon lange bei den ›London Sensations‹?«
»Lange? Was heißt lange?« Er dachte einen Augenblick nach. »Sagen wir sechs oder sieben Wochen. Ich erinnere mich noch heute, wie er eines Morgens ganz plötzlich dagesessen und sofort angefangen hat, sich unbeliebt zu machen Der Mann hat keine Ahnung von Benehmen. Glauben Sie, daß er sich mir vorgestellt hat? — Nein! Was sagen Sie dazu? Eine halbe Stunde habe ich ihm Zeit gegeben und ihn angesehen, daß er unbedingt hätte darauf kommen müssen, was sich schickt, aber er hat nichts dergleichen getan. Nun, der Gescheitere gibt nach. Ich bin also schließlich zu ihm gegangen und habe gesagt: ›Fish‹. Und was glauben Sie, daß er darauf getan hat? Anstatt ebenfalls einfach zu sagen: ›Wellby‹, hat er mich erst von oben bis unten gemustert und dann genickt. Und erst dann hat er das ›Wellby‹ herausgebracht.«
»Ein ganz interessanter Name«, fand der weißhaarige Herr, aber der kritische Jüngling war anderer Ansicht.
»Lassen Sie mich in Ruhe mit diesem ›interessanten Namen‹«, meinte er wegwerfend. »Mit arrogantem Gesicht zu sagen: ›Ich heiße Noel Wellby‹ ist sehr leicht, aber weiß man, was dahintersteckt? Wer und was ist er denn schon, dieser Mr. Wellby, und wo kommt er her?«
»Ja, wer ist er und wo kommt er her?« gab Mr. Boyd nachdenklich zu. Aber der ›Fliegenpilz‹ überhörte diese höfliche Zustimmung, denn man servierte ihm eben den wunderbaren Hummer, der seine Aufmerksamkeit völlig in Anspruch nahm. So gesprächig er bisher gewesen, so stumm wurde er plötzlich, und nur hie und da, wenn er gerade den Mund ganz voll hatte, legte er den Daumen und den Zeigefinger seiner Rechten zusammen, um seinem Gastgeber durch diese verzückte Geste zu verstehen zu geben, daß das Gericht wirklich delikat sei. Auch die Hammelrippchen schienen Mr. Fishs ungeteilten Beifall zu finden, und als er damit fertig war und ungeduldig des jungen Truthahns harrte, fand er einen Augenblick Zeit, seiner Befriedigung Ausdruck zu geben.
»Eines der wenigen Londoner Lokale, in denen man halbwegs anständig speist. Nur die Bedienung läßt zu wünschen übrig. Man könnte sich an den vornehmen Privathäusern ein Beispiel nehmen. Dort geht alles so schnell, daß man das Besteck überhaupt nicht aus der Hand zu legen braucht. Ich liebe das.«
Der Truthahn hinderte ihn an weiterem Tadel, und Boyd war nun wieder längere Zeit darauf angewiesen, seine Mahlzeit ohne den würzenden Redestrom Mr. Fishs fortzusetzen. Der weißhaarige Herr verhielt sich still und bescheiden und schien nur auf das Wohl seines Gastes bedacht zu sein. War Mr. Fish befriedigt, so schweiften Boyds graue Augen gelangweilt durch den großen Raum, der sich immer mehr gefüllt hatte. Nur wenige Tische waren noch unbesetzt, und der Schluß der Vorstellungen in Piccadilly brachte immer neue Gäste. Von irgendwoher klangen diskret gedämpft die aufreizenden Weisen einer Original-Negerkapelle, und die Luft war erfüllt von dem Duft feiner Parfüms und frischer Blumen.
Zwischen dem dritten und vierten Gang hatte sogar der beschäftigte ›Fliegenpilz‹ einen interessierten Blick für dieses glänzende gesellschaftliche Bild übrig, und die Art, wie er seine etwas widerspenstige Hemdbrust zurechtrückte und an seinen großen Perlen herumfingerte, zeigte, wie angemessen er diese illustre Umgebung fand.
»Ganz nett, was?« meinte er, indem er sich mit blinzelnden Augen zurücklehnte. »Alles erste Gesellschaft. Und fast durchwegs Bekannte. Sie werden schon bemerkt haben, daß ich es vermeide, allzuviel herumzublicken, denn dann nähme die Grüßerei kein Ende, und mit unserer Gemütlichkeit wäre es vorbei. Lord Shellam, der große blonde Herr dort unten links, wendet kein Auge von mir, um mir zuzunicken, aber er kann lange warten. Ich bin mit ihm ziemlich befreundet, und er ist mir ganz sympathisch, aber...«
Mr. Fishs großer Mund blieb plötzlich halb offen, und seine wäßrigen Augen hingen gespannt an einer Gruppe von zwei Damen und zwei Herren, die eben an einem schräg gegenüberliegenden Tisch Platz nahmen. Die Erregung des blasierten jungen Mannes war so groß, daß er sogar das eben aufgetragene Omelett übersah. Er hatte offenbar das Bestreben, die Aufmerksamkeit der kleinen Gesellschaft auf sich zu lenken, und versuchte alles, um diesen Zweck zu erreichen. Er hob sich in seinem Sessel ununterbrochen wie ein Reiter im Sattel, räusperte sich vernehmlich, zog kokett und unternehmend an seinen Manschetten und war sichtlich darauf vorbereitet, jede Sekunde elastisch aufzuschnellen. Dabei wiegte er zum Zeichen seiner Überraschung leicht den Kopf, schnalzte diskret mit der Zunge und führte ein leises, abgehacktes Selbstgespräch, wobei er jedoch in seiner Höflichkeit darauf Rücksicht nahm, daß Mr. Boyd auch jedes Wort verstand.
»Natürlich... Wie ich mir gedacht habe...« Er lächelte befriedigt über seine unfehlbare Voraussicht und fuhr sich, weit ausholend, durch den strähnigen roten Haarschopf. »London ist doch eigentlich ein kleines Nest. Man trifft einander überall.« Seine Blicke ruhten dabei unausgesetzt auf der kleinen Gruppe, die seiner noch immer nicht gewahr geworden war.
»Fabelhaft«, flüsterte er, indem er die eine der Damen mit Kennermiene fixierte. »Kunststück, so auszusehen, wenn man so ein Gehalt hat. Was glauben Sie, was Mrs. Dyke monatlich bekommt?« wandte er sich mit wichtiger Miene an Boyd.
»Ist eine der Damen Mrs. Dyke?« fragte dieser mit höflichem Interesse.
Der Reporter nickte und legte dem weißhaarigen Herrn die Hand jovial auf den Arm. Der Mann sah fast aus wie ein Diplomat, und es konnte nicht schaden, wenn man an der maßgebendsten Stelle des Cartwright-Hauses davon Kenntnis erhielt, daß Mr. Fish nicht nur in den vornehmsten Restaurants zu speisen, sondern dort auch mit Persönlichkeiten von Welt in höchst familiärer Art zu verkehren pflegte.
»Die große dunkle Dame«, erklärte er. »Nicht ganz mein Geschmack, denn ich ziehe das Zarte vor, aber immerhin... Wenn Sie dagegen Mrs. Osborn anschauen... Allerdings soll sie eine Menge Geld gehabt haben. Die Tochter vom alten Robbins, sicher haben Sie von ihm schon gehört. Unter hundert Prozent war von dem Halsabschneider nicht ein Penny zu haben. Mrs. Osborn mag nicht schlecht geerbt haben, als er vor einem halben Jahr gestorben ist. Aber sie kann es brauchen und ihr Mann auch. Er spielt — was soll er auch tun, wenn er eine solche Frau zu Hause hat...«
Trotz seiner Mitteilsamkeit hatte Mr. Fish den Tisch schräg gegenüber nicht eine Sekunde aus den Augen gelassen, und da er nun endlich dem erkennenden Blick von Mrs. Dyke zu begegnen glaubte, fuhr er blitzschnell empor, um ihr eine höchst förmliche Verbeugung zu machen.
Mrs. Dyke dankte mit einem leichten Lächeln, und der Reporter verbeugte sich nochmals.
»Da haben Sie es«, hauchte er resigniert, als er endlich wieder saß, und wischte sich mit dem farbenfreudigen, seidenen Taschentuch den Schweiß von der Stirn. »Man müßte die Augen zumachen, um vor diesen gesellschaftlichen Verpflichtungen Ruhe zu haben. — Haben Sie übrigens bemerkt, wie freundlich Mrs. Dyke gelächelt hat? Wir verstehen uns nämlich ausgezeichnet, und wenn ich nicht in Gesellschaft wäre, hätte sie mich sicher an ihren Tisch hinübergeholt. Sie tut das immer, wenn wir uns irgendwo treffen«, fügte er ganz nebenbei hinzu. »Aber so sympathisch sie mir ist, die beiden Afrikaner können mir gestohlen werden. Die Aufgeblasenheit, die die besitzen, möchte ich haben. Dabei haben sie nie etwas anderes gemacht in ihrem Leben, als Cartwright damals zu begleiten.« Plötzlich gewahrte er das kalt gewordene Omelett und begann es mit weltmännischer Gelassenheit zu verspeisen.
»Wer ist der reizende Junge, dem Sie es angetan zu haben scheinen?« fragte Osborn mit einem vergnügten Grinsen. »So etwas Nettes habe ich noch nicht oft gesehen.«
»Der Reporter Fish von den ›London Sensations‹«, gab Mrs. Dyke leise zurück, ohne den Blick vom Teller zu heben.
»Sind alle Ihre Reporter von diesem Schlag? Auch der gewisse Wellby?«
Evelyn sah Osborn unter halbgeschlossenen Lidern hervor an und dämpfte ihre Stimme noch mehr. »Leider nicht. Der Mann ist ganz anders. — Haben Sie etwas veranlaßt?«
»Was notwendig war«, gab er kurz und leichthin zurück, aber der harte Blick in seinem etwas schwammigen Gesicht verriet ihr, wie er das meinte. Sie legte das Besteck so hastig nieder, daß es auf dem Teller einen leisen Klang gab, und ihre Nasenflügel vibrierten in verhaltener Erregung.
»Ich hoffe, daß Sie sich nicht zu einer Unvorsichtigkeit verleiten ließen... Das wäre das letzte, was wir augenblicklich brauchen könnten. Was zu tun ist, muß in aller Ruhe, ohne Aufsehen und vor allem ohne Gewalttätigkeiten geschehen. Stellen Sie sich den Lärm vor, wenn dem Urheber der Morton-Notiz plötzlich etwas widerfahren sollte.«
Osborn zuckte ungeduldig mit den Achseln, und es fiel ihm sichtlich schwer, seine nervöse Gereiztheit zu beherrschen.
»Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ich habe doch nur gesagt, daß ich das veranlaßt habe, was notwendig war. Sie selbst haben mich doch wissen lassen, daß der Mann für uns eine große Gefahr bedeutet und daß etwas geschehen müsse. Was wollen Sie denn nun mit Ihren sonderbaren Redensarten? Es sagt sich leicht: Es muß etwas geschehen, aber das und das darf nicht geschehen. Vor allem verwahre ich mich auf das entschiedenste dagegen, für alles, was dem Mann passieren könnte, verantwortlich gemacht zu werden. Ich lasse ihn einfach überwachen, wie Sie es ja selbst vorgeschlagen haben. Wenn er bei seinen nächtlichen Wanderungen in der Hafengegend oder sonstwo zu Schaden kommen sollte, so hat dies damit nichts zu tun. Solche Fälle kommen in London täglich vor.«
Er sah Evelyn herausfordernd an, und seine Frau, die sichtlich ihren King Charles vermißte und sich langweilte, fand die Sache so heiter, daß sie zu kichern begann.
»Evelyn hat ganz recht«, mischte sich Selwood plötzlich entschieden ein. Er hatte bisher schweigsam und verdrießlich auf seinem Teller herumgestochert, und erst die Andeutungen seines Vetters hatten ihn aus seiner Teilnahmslosigkeit aufgerüttelt. »Ich bin jedenfalls für solche Dinge nicht zu haben und will auch nichts davon wissen«, fügte er nachdenklich hinzu. »Wenn etwas Derartiges geschehen sollte, so werde ich diesmal unbedingt sprechen, mag kommen, was will. Die Geschichte hat schon genug Unheil angerichtet.«
Sein Gesicht verriet, daß es ihm mit seinen Worten ernst war, und William zog eine leichte Grimasse.
»Schön. Tu, was du willst«, sagte er bissig. »Aber bilde dir nicht ein«, fuhr er drohend fort, »daß ich mich von dir so ohne weiteres hineinreiten lasse. Es geht um meine Haut genauso wie um deine, und ich werde mich schon irgendwie zu sichern wissen. Lächerlich, diese Skrupel, mit denen du es plötzlich zu tun bekommst«, lenkte er, noch immer ärgerlich, aber schon wieder völlig beherrscht, ein. »Du weißt doch ganz gut, daß wir jetzt erst vor der eigentlichen Entscheidung stehen und unsere Nerven nicht verlieren dürfen. Deine Begegnung hat dir ja gesagt, daß nun wir an die Reihe kommen und daher verdammt auf unserer Hut sein müssen.«
»Wann hat sie gesagt, daß sie Sie wieder aufsuchen wird?« flüsterte Helen, und ihre Frage klang so kindlich naiv, daß Selwood trotz seiner üblen Laune sich eines Lächelns nicht erwehren konnte.
»Wenn der Mond in sein letztes Viertel tritt. Das wäre in neun Tagen«, gab er halblaut zurück, und Mrs. Osborn empfand ein furchtsames Kribbeln.
»Du darfst nicht vergessen, daß sie es mit ihren Terminen nicht so genau zu nehmen scheint«, warnte ihn der Vetter, aber der andere hatte dafür nur ein gleichmütiges Achselzucken.
»Sie brechen auf«, raunte Mr. Fish eine halbe Stunde später seinem Gastgeber aufgeregt zu und traf umständlich Anstalten, um sich für diesen großen Augenblick entsprechend in Szene zu setzen. Er verwischte mit der Serviette eilig die verschiedenen Flecken, die die einzelnen Gänge auf seiner Hemdbrust hinterlassen hatten, und fuhr dann mit geschäftigen Fingern bald an die Krawatte, bald über die Weste, die nun noch praller saß als vorher.
»Grüßen Sie mit, Mr. Boyd, das kann nur einen guten Eindruck machen, und man kann nicht wissen...« Er sprach nicht aus, was man nicht wissen konnte, sondern machte ein betretenes Gesicht, da Mrs. Dyke mit ihrer Gesellschaft den Saal verließ, ohne nur einen flüchtigen Blick für ihn zu haben. Dann hob er die Achseln und lächelte verständnisvoll. »In Gedanken und etwas schlechter Laune«, erklärte er vertraulich. »Natürlich nicht meinetwegen. Wahrscheinlich wieder eine kleine Auseinandersetzung mit Mr. Selwood.« Er blinzelte vielsagend. »Das soll öfter vorkommen. Man weiß zwar nichts Bestimmtes, aber Sie verstehen mich...«
An dem Wagen Selwoods, der Mrs. Dyke nach Hause bringen sollte, machte die kleine Gruppe noch einen Augenblick halt.
»Wir fahren morgen zum Weekend nach Weybridge und werden nachsehen, ob es in Threecourts etwas Neues gibt«, sagte Osborn. »Wenn hier etwas geschehen sollte«, wandte er sich an den Vetter, »so weißt du ja, wo ich zu erreichen bin.«
Während der Heimfahrt gab es zwischen dem Ehepaar noch eine etwas ungemütliche Auseinandersetzung, als Helen auf ihre schüchterne Frage, ob er bereits zu Hause bleibe, ein schroffes: »Ich denke nicht daran«, zur Antwort erhielt.
»Du denkst überhaupt an nichts, was mich angeht«, beklagte sie sich in dem weinerlichen Ton eines gekränkten Kindes. »Und jetzt weiß ich auch warum«, fügte sie spitz hinzu, indem sie ihn lauernd von der Seite beobachtete. »Du hast nämlich eine Geliebte. Eine dicke, blonde Person, und sie wohnt...«
Der wütende, gehässige Blick, der sie aus seinen Augen traf, ließ sie erschreckt verstummen.
»Halte den Mund«, zischte er leise durch die Zähne und riß so heftig am Steuer, daß der Wagen in ein gefährliches Schlingern geriet. »Also, du spionierst«, fuhr er dann mit kaltem Hohn fort. »Das sieht dir ähnlich. Ganz Familie Robbins. Aber ich bin kein Krämer aus einem Vorort, meine Liebe, der dafür Verständnis hätte. Ich glaube, ich habe dir das schon einige Male sehr deutlich gesagt, und du würdest gut daran tun, es dir endlich zu merken.«
»Du kannst ja tun, was du willst, aber daß du eine Geliebte hast, dulde ich nicht«, gab sie heftig und hartnäckig zurück.
Er nahm sich gar keine Mühe, ihre Behauptung in Abrede zu stellen oder sie zu beruhigen, sondern blieb bei seinem aufreizenden Hohn. »So, das duldest du nicht? Du wirst wirklich von Tag zu Tag alberner. Als ob ich mich je darum gekümmert hätte, was du gestattest oder nicht.«
»Nein«, fauchte sie heftig. »Du hast dich nur um mein Geld gekümmert.«
»Mache keine großen Worte«, sagte er noch ruhiger und schneidender als bisher. »Dazu hast du wirklich keine Veranlassung. Bis jetzt habe ich dir dadurch, daß ich dich zur Frau nahm, weit mehr gegeben als du mir. Du weißt, wie ich das meine. Dein Vater hat mich bei dem Handel um dich ebenso übers Ohr gehauen, wie er jeden betrogen hat, der sich mit ihm in ein Geschäft einließ. Die paar tausend Pfund, die wir zu seinen Lebzeiten erhielten, waren kaum der Rede wert, und von dem, was er hinterließ, habe ich auch noch sehr wenig gesehen.«
»Ich gebe dir immer Geld, wenn du welches verlangst«, wandte sie hastig ein.
»Sehr nett von dir, mir hie und da einen Brocken zuzuwerfen«, spottete er. »Aber es paßt mir nicht, auf deine Gnade angewiesen zu sein, und ich hatte mir schon längst vorgenommen, in dieser Angelegenheit einmal ein ernstes Wort mit dir zu reden. Gut, daß du mich daran erinnert hast.«
Helen wurde plötzlich sehr schweigsam, und Osborn vernahm während der weiteren Fahrt nur ihre erregten Atemzüge.
»Mr. Bryans hat eine sehr schlechte Nacht gehabt«, erklärte der etwas schlampige Diener verlegen, indem er an seiner gestreiften Drillichjacke herumzupfte, »und ich weiß nicht, ob er zu sprechen sein wird.«
Die Osborns zählten zwar zu den wenigen Bekannten des Hauses, aber sein Herr befand sich wirklich in einem Zustand, daß ihm ein Besuch wohl kaum willkommen war.
»Machen Sie keine Geschichten und melden Sie uns«, sagte Osborn scharf und half seiner Frau aus dem Wagen. »Oder«, er blinzelte ihn mit einem vielsagenden Lächeln an, »ist er heute am Morgen schon so weit, wie sonst erst am Nachmittag?«
»Das nicht«, versicherte der Diener hastig. »Im Gegenteil, Mr. Bryans hat heute noch sehr wenig zu sich genommen. Viel weniger als sonst. Aber « — er war sichtlich verwirrt und ratlos —, »er benimmt sich sehr eigen und erzählt ganz konfuse Geschichten.«
Osborn sah den Mann forschend an und nagte eine Weile an den Lippen.
»Ist das so plötzlich gekommen?« fragte er endlich.
»Heute in der Nacht«, erklärte der Diener eifrig und war sichtlich froh, jemandem davon Mitteilung machen zu können. »Kurz nach Mitternacht hörte ich plötzlich einen furchtbaren Schrei aus dem Schlafzimmer des Herrn, und als ich hinstürzte, saß er aufrecht im Bett und starrte mit unheimlichen Augen um sich. Er muß über irgend etwas sehr erschrocken sein, denn er wollte nicht mehr allein bleiben, und ich mußte mich an sein Bett setzen. Nach einer Weile hat er mir dann geheimnisvoll zugeflüstert, daß die ›Königin der Nacht‹ bei ihm gewesen sei und daß sie wiederkommen werde. Er wisse auch, warum, könne sich aber nicht mehr so genau erinnern, doch werde er schon noch darauf kommen. Und plötzlich hat er dann angefangen, von Afrika zu erzählen, aber es war lauter unzusammenhängendes Zeug. Dazwischen schrie er immer wieder, daß er es nicht gewesen sei und daß er auch nicht geschossen habe, sondern ein ganz anderer. Er trieb es so arg, Sir, daß ich mich schließlich gefürchtet habe, und ich wollte schon einen Arzt rufen, aber plötzlich wurde Mr. Bryans wieder ganz ruhig und vernünftig, und ich habe es sein lassen, denn ich weiß, daß er furchtbar zornig wird, wenn man von einem Arzt spricht.«
William Osborn hatte mit gelbem, steinernem Gesicht zugehört, und nur die schweren Lider, die die verschleierten Augen halb bedeckten, hatten kaum merklich gezuckt.
»Gehen Sie also und sagen Sie Mr. Bryans, daß wir hier sind«, befahl er ruhig. »Und wenn Ihr Herr Mrs. Osborn nicht empfangen kann, so werde ich allein nach ihm sehen.«
Der Diener geleitete den Besuch in ein großes düsteres Zimmer zu ebener Erde, das nur notdürftig mit altem Möbelkram angefüllt und gerade kein würdiger Empfangsraum war. Das kleine Gut hatte das Schicksal so ziemlich aller Landsitze in der Umgebung Londons geteilt. Die wachsende Riesenstadt hatte allmählich den Grund und Boden für ihre Zwecke an sich gerissen, und nur die Baulichkeiten waren als unschöne und unnütze Überreste geblieben.
Als der Diener gegangen war, begann Osborn mit verkniffenen Mienen auf und ab zu wandern, und Helen wandte keinen Blick von ihm.
»Sie ist auch schon bei ihm gewesen«, hauchte sie endlich, und es schien, als ob sie nun doch einmal aus ihrem unerschütterlichen Phlegma aufgestört worden sei. Sie trippelte aufgeregt umher und trat dann zu dem vergitterten Fenster, das Ausblick auf einen holperigen Feldweg und eine spärliche Rasenfläche bot. Dann begann sie mit ihren gepflegten Nägeln auf den Scheiben einen wilden Marsch zu trommeln, der Osborn durch Mark und Bein ging.
»Laß das«, herrschte er sie an und hielt sich verzweifelt die Ohren zu. »Du bist wirklich nur dazu da, einem gerade in den unangenehmsten Augenblicken auf die Nerven zu fallen.«
Sie brach gehorsam ab und wandte sich um.
»Du mußt mich mitnehmen«, drängte sie. »Ich bin so schrecklich neugierig, zu hören, was es gegeben hat. Und du erzählst es mir nachher doch nicht. Wenigstens nicht so genau.«
Er machte jäh halt, und sein Blick ließ einen neuerlichen Ausbruch seiner üblen Laune fürchten, doch er zuckte nur mit den Achseln und murmelte: »Alberne Gans.«
Es dauerte ziemlich lange, bis der Diener zurückkehrte, aber dann kam er mit großer Eile und Lebhaftigkeit angestürzt.
»Mr. Bryans läßt bitten. Auch Madame. Er ist jetzt wieder ganz ruhig und vernünftig«, fügte er vertraulich hinzu, »und ich glaube, daß nichts mehr zu befürchten ist.«
Er führte die Gäste durch einen langen, muffigen Gang, der nur mit rohen, abgetretenen Ziegeln ausgelegt war, und öffnete dann eine schwere Tür, die in ein gewölbtes Gemach führte, das anscheinend das Speisezimmer war, denn es wies eine massive Anrichte auf und einen großen Tisch, der zum Teil mit einem fleckigen weißen Tuch bedeckt war. In einem riesigen Kamin brannten einige Holzscheite, und an den Wänden standen mehrere alte Truhen, die mit einigen wurmstichigen Kästen und einem alten, zerschlissenen Armsessel die gesamte Einrichtung bildeten. Trotz des sonnigen Frühjahrstages herrschte in dem unbehaglichen Zimmer ein beklemmendes Halbdunkel, da uralte Bäume gerade über das einzige Fenster tiefe Schatten warfen.
Erst nach einer Weile tat sich die Tür zu einem Nebenraum auf, und der Besitzer von Threecourts schob seine gedrungene Gestalt schwerfällig herein. Er war kaum mittelgroß, aber sehr umfangreich, und das Trinken hatte sein aufgedunsenes, unreines Gesicht mit einem dunklen, ungesunden Rot gefärbt.
»Entschuldigen Sie bitte, daß ich Sie warten ließ«, stieß er unter Schnaufen mit einiger Verlegenheit hervor, »aber ich empfange so wenig Besuch, daß ich nicht darauf vorbereitet bin. Ich freue mich dann doppelt, wenn jemand zu mir kommt.«
Er machte eine einladende Handbewegung, die seine Gäste auffordern sollte, Platz zu nehmen, bemerkte aber plötzlich, daß eigentlich keine richtige Sitzgelegenheit vorhanden war und schleppte eigenhändig zwei Stühle an den Tisch.
»So, bitte. Ich bin etwas primitiv eingerichtet, und es sieht hier nicht zum besten aus«, fuhr er entschuldigend fort, »aber wir Männer verstehen das eben nicht anders.« Er wischte mit seinen etwas zittrigen Händen einige Male glättend über das schmierige Tischtuch und sah dann seine Gäste aus den verschwommenen Augen etwas schüchtern und erwartungsvoll an. »Darf ich Ihnen vielleicht eine kleine Erfrischung anbieten? Was ich eben im Hause habe«, fügte er bescheiden hinzu.
»Tun Sie das, lieber Freund«, sagte Osborn und klopfte dem kleinen, dicken Mann freundschaftlich auf die Schulter. Er wußte, was nun kommen würde, und es lag ihm daran, daß der andere in Stimmung geriet.
Bryans klatschte wie ein Pascha in die Hände, und der Diener schien nur auf dieses Zeichen gewartet zu haben, denn er stürzte schon in der nächsten Minute mit einem Tablett mit Flaschen und Gläsern herein. Die Augen des Säufers begannen begehrlich zu funkeln, und er machte sich mit unsicheren Händen daran, einzuschenken.
»Zu essen habe ich leider nichts im Hause«, meinte er mit einem verlegenen Blick auf Mrs. Helen, »denn ich halte darauf nicht sehr viel, und zu beschaffen ist hier nichts. Aber wahrscheinlich haben die Herrschaften auch schon gefrühstückt, und da schmeckt nachher ein kleiner Schluck ganz gut.«
Bevor noch seine Gäste ihre Gläser recht an die Lippen gesetzt hatten, hatte er das seine bereits in einem Zuge geleert und mit Hast auch schon wieder gefüllt.
»Wie geht es Ihnen?« fragte Osborn unbefangen, indem er sich eine Zigarre anzündete. »Wenn man nicht zu Ihnen kommt, hört und sieht man ja überhaupt nichts von Ihnen.«
Bryans schüttelte mit einem resignierten Lächeln den Kopf.
»Nein. Allerdings nicht. Ich mache ja fast keinen Schritt aus dem Haus. Es geht auch so. Ich fühle mich dabei ganz wohl.« Er griff wieder nach dem Glas, das er hastig hinunterschüttete und neuerlich füllte. »Gewiß«, bekräftigte er fortfahrend und wischte sich mit dem Handrücken den ungepflegten blonden Bart. »Aber hie und da plaudere ich doch gern einmal von den alten Zeiten«, versicherte er lebhaft. »Von den schönen nämlich, die wir zusammen verlebt haben.« Es schien ihm plötzlich etwas einzufallen, denn er dachte eine Weile angestrengt nach, und« sein Gesicht bekam einen traumverlorenen Ausdruck. »Sie sind der einzige, der sich meiner noch zuweilen erinnert«, sagte er plötzlich wehmütig. »Ihr Vetter war noch nie bei mir.«
»Charlie hat sehr viel zu tun«, bemerkte Osborn entschuldigend und blies eine Rauchwolke gegen die Decke.
Bryans nickte lebhaft.
»Natürlich. Wenn man es nicht macht wie ich und sich verkriecht, hat man keine Ruhe. Er war ein netter Junge, Ihr Vetter. Wir sind immer gut miteinander ausgekommen. Und es war überhaupt wunderbar. Mein Gedächtnis ist zwar schlechter geworden«, gestand er, »aber manchmal erinnere ich mich doch noch an verschiedenes. Zum Beispiel an Sir...« Er konnte nicht weiter und sah Osborn hilflos an. »Die Namen geben mir besonders zu schaffen«, klagte er, »aber Sie werden schon wissen, wen ich meine. Er war ein vollendeter Gentleman.«
»Sir Benjamin ist bereits tot«, bemerkte Osborn leichthin. Er hatte das Bryans bereits einige Male mitgeteilt, aber dieser schien es nicht behalten zu haben, und es machte auch jetzt keinen Eindruck auf ihn. Bryans war offenbar schon wieder mit einer anderen Sache beschäftigt, und sein sprunghaft arbeitendes, krankes Gehirn konnte damit nicht so rasch ins reine kommen. Er griff zweimal hastig nach dem Glas, aber plötzlich hatte er den Faden erhascht, den er suchte. Er befand sich offensichtlich in dem Stadium alkoholischer Geschwätzigkeit, und während er seine Hand vertraulich auf den Arm seines Gastes legte, kam in seine Augen ein flackerndes Feuer.
»War sie auch bei Ihnen?« fragte er geheimnisvoll und rückte dicht an Osborn heran. Mrs. Helens Anwesenheit schien er völlig vergessen zu haben, und er wartete auch die Antwort Osborns nicht erst ab, sondern beeilte sich, das, was in seinem Kopf vorging, mit lallender Zunge so rasch als möglich hervorzusprudeln. »›Die Königin der Nacht‹, Sie wissen ja. Es muß zwar schon sehr lange her sein, und eigentlich habe ich nie mehr daran gedacht, aber ich habe sie doch sofort erkannt.« Er zog schaudernd die Schultern ein und deutete scheu nach dem Nebenraum. »Da drinnen war sie. Genauso, wie wir sie in jener Nacht gesehen haben, in der wir dann so furchtbare Angst hatten. Sie, Ihr Vetter und ich, weil der Herr wissen wollte, warum geschossen worden war.« Sein verängstigtes Gesicht bekam einen verschmitzten Ausdruck, und er begann unvermittelt zu kichern. »Draußen vor dem Lager in der kleinen Schlucht, wissen Sie noch? — Mir haben sie am wenigsten gegeben, aber ich habe ja auch nicht viel dabei getan. — Nein, ich beklage mich gar nicht. Es war ganz recht so.« Er bemühte sich sichtlich, die Vorgänge, die ihn beschäftigten, in der Erinnerung einzufangen. »Wie war es doch gleich? Wer hat das Zeug gefunden und uns gesagt, daß wir ihm helfen sollen? Und wer hat auf die ›Königin der Nacht‹ und ihre Leute geschossen?« Er schüttelte verzweifelt den Kopf und sah Osborn hilflos an. »Sehen Sie, da komme ich nicht weiter. Aber es wird mir schon einfallen. Und wenn die ›Königin der Nacht‹ wiederkommt, werde ich ihr sagen, sie soll mich in Ruhe lassen. Ich gebe ihr zweitausend Pfund oder auch dreitausend, obwohl ich damals nur wenig für die Sachen bekommen habe, weil man mir sagte, ich dürfe nicht gleich verkaufen, und ich brauchte doch Geld.«
Die Worte kamen immer schwerer und verworrener aus ihm heraus, und als er nach der Anstrengung wieder ein Glas Whisky hinuntergeschüttet hatte, saß er ganz starr.
»Ich fürchte mich, William«, flüsterte Helen mit großen entsetzten Augen, die unaufhörlich herumirrten, als ob sie den kürzesten Weg zur Flucht suchten.
Auch Osborn fand den Augenblick für den Aufbruch gekommen. Der Zweck, den sein Besuch gehabt hatte, war erreicht, und er war sich nun völlig klar darüber, daß dieser durch den Schrecken plötzlich so geschwätzig gewordene Bryans ebenso zu fürchten war wie der rätselhafte Wellby und die geheimnisvolle ›Königin der Nacht‹.
Während der Fahrt nach Weybridge saß Osborn mit finsterem Gesicht, und seine verschüchterte Frau wagte nicht, ihn auch nur durch ein Wort zu stören. Erst, als sie fast schon am Ziel waren, faßte sie Mut zu einer Frage.
»Glaubst du, daß sie ihn wirklich noch einmal aufsucht?«
»Ich hoffe es«, erwiderte er mit einem grimmigen Lächeln, denn er hatte kein Interesse daran, daß Bryans noch lange seine konfusen Erinnerungen seinem Diener und vielleicht jedem, der ihm sonst noch in den Weg kam, zum besten gab.
Aber der Herr auf Threecourts tat nichts dergleichen, sondern schien die aufregende Nacht und alles, was mit ihr zusammenhing, völlig vergessen zu haben. Er sprach nicht ein Wort mehr von der Sache, trank schweigsam und mit Genuß wie früher und schlief dann ruhig und sorglos seinen Rausch aus.
Als ihm am übernächsten Tag sein Diener mit ratlosem Gesicht eine Karte überreichte und meldete, daß der Herr, sich nicht abweisen lasse, war er zwar nicht mehr imstande, den Namen zu lesen, aber noch zu lallen: »Schmeiß ihn hinaus!«
Nichtsdestoweniger betrat einige Augenblicke später ein rosiger Herr mit weißem Haar das Speisezimmer und ließ sich ohne weiteres neben dem etwas verlegen und hilflos blinzelnden Mr. Bryans nieder, der es nicht wagte, die Tragfähigkeit seiner Beine auch nur auf die geringste Probe zu stellen. Im übrigen störte ihn der Besuch auch gar nicht, denn der Herr hatte ein sehr freundliches Gesicht, und seine Stimme klang ganz angenehm, obwohl Bryans nicht verstand, was sein Besucher eigentlich sagte. Aber plötzlich fing er ein Wort auf, das einen Hebel in seinem Kopf auslöste, und er begann zu lallen.
»›Die Königin der Nacht‹... Jawohl... Weiß schon. Warum kommt sie nicht selbst? Sagen Sie ihr, daß ich mich vergleiche. Mit zweitausend Pfund. Das ist viel Geld, da ich doch am wenigsten bekommen habe. Und geschossen habe ich auch nicht. Was will sie von mir?«
Seine Stimme bekam plötzlich einen weinerlichen Klang, und er begann heftig zu schlucken, was ihn ganz außer Atem brachte. Als er sich dann von seinem Besucher Antwort holen wollte, war dieser verschwunden, und Bryans meinte, einen seiner häufigen Wachträume gehabt zu haben. Er trank daher beruhigt weiter, bis der Abend herabsank und der Diener die bescheidene Petroleumlampe über dem Tisch anzündete. Sie reichte gerade aus, das Glas zu finden und die Flasche nicht ins Leere zu stellen.
Der Besitzer von Threecourts fühlte sich sehr behaglich und erschrak nicht einmal, als er am Fenster gegenüber seinem Platz plötzlich eine leuchtende Mondsichel und drei flimmernde Sterne zu sehen glaubte. Er lächelte sogar überlegen, denn er kannte diese netten Streiche, die ihm seine Sinne manchmal spielten, wenn er etwas getrunken hatte. Und auch den kleinen, milchweiß schimmernden Ballon, der mit einem Male vor ihm auf dem Tisch tanzte und dicht vor seinem Gesicht wie eine Seifenblase platzte, beäugte er höchst belustigt.
Aber gleich darauf schlug Arthur Bryans mit dem Kopf und den Armen so heftig nach vorne, daß Glas und Flasche splitternd zu Boden fielen.
Boyd erhielt von dem Geschehen in Threecourts erst zwei Tage später durch eine kurze, nichtssagende Todesanzeige in der ›Times‹ Kenntnis, die ein weitläufiger Verwandter eingesetzt hatte. Aber schon die Abendblätter kamen auf den Kern der Sache und berichteten in alarmierender Aufmachung, daß nun auch noch ein dritter Teilnehmer an der seinerzeitigen Cartwright-Expedition eines plötzlichen rätselhaften Todes gestorben sei. Einzelheiten gab es auch diesmal so gut wie gar keine, aber dafür begann die gesamte Presse einen Ton anzuschlagen, der in Scotland Yard eine gewisse Nervosität auslöste. Die Kriminalpolizei hatte seit dem theatralischen Aufrollen der Sache ihre besten Kräfte eingesetzt und fieberhaft gearbeitet, aber man war nicht einen Schritt weitergekommen. Es unterlag nach dem Spruch des Leichenschaugerichts im Falle Morton kaum einem Zweifel mehr, daß man einer Reihe mit außerordentlichem Raffinement ausgeführter Verbrechen gegenüberstand. Wegen des Beweggrundes tappte man ebenso im dunkeln wie wegen der Täterschaft. Es fehlte selbst die winzigste greifbare Spur, die man hätte aufnehmen können, und als man sich anschickte, der geheimnisvollen ›Königin der Nacht‹ nachzugehen, stieß man auf ein Phantom, das in der Luft zerrann.
Nach einer langen Konferenz mit dem Chef der Polizei nahm Oberst Terry den schnellsten Wagen und fuhr nach Camden Town. Kurz vor ein Uhr kam er vor dem netten Häuschen an, nicht eine Minute zu früh, denn Boyd trat eben aus der Tür. Er sah in seinem tadellosen Anzug mit dem unternehmend aufgesetzten Hut über dem strahlenden Gesicht aus wie ein älterer Herr, der auf dem Weg zu einer angenehmen Verabredung ist, und der Oberst stieg mit einem etwas verlegenen und enttäuschten Gesicht aus dem Wagen.
»Ich fürchte, ich störe Sie«, sagte er, aber der Detektiv hatte nur mit einem leichten Lächeln die Brauen etwas hochgezogen und dann schon die Tür einladend wieder geöffnet.
»Im Gegenteil, Sie kommen mir wie gerufen, denn Sie können mich mitnehmen, wenn wir fertig sind. Ich fahre lieber in einem bequemen Auto als mit meinem kleinen Vehikel oder dem Bus.« Er geleitete den Besucher in sein Arbeitszimmer, legte ab und wartete geduldig, bis der andere sich die Zigarre angezündet hatte.
»Was wissen Sie von der ›Königin der Nacht‹, Boyd?« fragte Terry ohne weitere Einleitung und mit einer Bestimmtheit, als ob er unbedingt eine Antwort erwarte, mit der etwas anzufangen war. »Existiert sie oder nicht?« Er sah seinen ehemaligen Untergebenen gespannt an und strich nervös über den buschigen Bart. Er mußte sich lange gedulden, bevor Boyd seine versonnenen Augen von der Decke wendete.
»Sie existiert«, sagte er kurz und entschieden. »Und ich glaube sogar...«
Er brach plötzlich ab, aber der Oberst ließ nicht mehr locker.
»Rücken Sie heraus, Boyd«, drängte er lebhaft. »Oder noch besser, übernehmen Sie die Geschichte. Deshalb bin ich eigentlich hier. Sie gehören ja immer noch zu uns, und man würde es nur verständlich finden, daß wir in diesem außerordentlichen Fall unseren tüchtigsten Mann herangezogen haben. Ich sage es Ihnen ganz offen: Wir sind ratlos wie noch nie, und ich fürchte, daß sich unsere Leute an dieser harten Nuß die Zähne ausbeißen werden. Zudem fängt die sogenannte öffentliche Meinung bereits an, ungeduldig zu werden, und wenn wir nicht rasch vorwärtskommen, wird man uns wieder einmal gründlich mit Druckerschwärze besudeln. Natürlich erhalten Sie völlig freie Hand und die weitestgehenden Vollmachten. Ich habe bereits mit dem Chef darüber gesprochen. Er ist mit allem einverstanden. — Also, wann fangen Sie an?«
»Ich habe schon angefangen«, erklärte Boyd lächelnd. »Auftrag von einer anderen Seite. Sie kommen daher zu spät.«
Terry sah ihn überrascht und betroffen an und machte aus seiner Enttäuschung und Verstimmung kein Hehl.
»Das konnte ich natürlich nicht ahnen«, meinte er etwas pikiert. »Ich wußte bisher nicht, daß Sie sich auch mit Privataufträgen befassen. Sie sagten doch damals, daß Sie den Dienst nur deshalb verließen, um sich ganz Ihrem Angelzeug und Ihren Fischen widmen zu können.«
»Sehr richtig«, bestätigte Boyd und schmunzelte über das ganze rosige Gesicht. »Aber da dieser Fall eben mit meinem Angelzeug und meinen Fischen etwas zu tun hat, habe ich ihn ausnahmsweise übernommen.«
»Das verstehe ich nicht«, meinte Terry und machte Anstalten, sich zu erheben, aber der liebenswürdige Boyd drückte ihn mit einem verschmitzten Lächeln in den Sessel zurück.
»Das erkläre ich Ihnen später. Es gehört auch nicht ganz zur Sache. — Sie wollen von mir etwas anderes hören, und wenn ich mich Ihnen auch nicht mehr ganz verschreiben kann, so sollen Sie doch nicht umsonst gekommen sein.«
Terry horchte auf, und seine Miene wurde freundlicher.
»Ich wußte ja, daß Sie uns nicht im Stich lassen werden.«
»Nein. Ich bin bereit, Ihnen behilflich zu sein. Das ist nicht nur eine Redensart, denn ich bin, wie ich annehme, Ihren Leuten bereits um ein paar beträchtliche Pferdelängen voraus. Allerdings noch nicht auf einer direkten Spur«, fügte er einschränkend hinzu, als er die lebhafte Spannung im Gesicht des anderen bemerkte, »aber ich habe einige Fäden aufgestöbert, an denen sich vielleicht der verwickelte Knäuel abrollen läßt. Über den Anfang wäre ich also hinaus, und die Sache in Threecourts hat mich sogar ein hübsches Stück weitergebracht. Näheres kann ich Ihnen augenblicklich nicht mitteilen, Oberst, aber Sie dürfen sich auf mich verlassen. Wenn es soweit ist, werde ich Ihnen einen Fingerzeig geben, und dann haben Sie nur zuzugreifen. Bis dahin lassen Sie Ihre Leute ruhig weiterarbeiten. Je mehr Lärm sie auf den falschen Fährten schlagen, desto ungestörter kann ich arbeiten. Mit diesem Vorschlag ist uns beiden gedient. Sie erfahren, was Sie wissen müssen, ich bin jedoch nicht verpflichtet, Ihnen alles zu sagen, was ich weiß. — Vielleicht kann das eine Rolle spielen«, schloß er bedächtig. —
Oberst Terry war mit diesem Erfolg seiner Mission sehr zufrieden und behandelte Boyd auf der gemeinsamen Fahrt nach London mit besonderer Herzlichkeit.
»Je mehr ich darüber nachdenke«, sagte er, »desto mehr bin ich überzeugt, daß wir so wirklich am raschesten vorwärtskommen. Denn Sie werden es als Privatmann viel leichter haben als wir. Uns begegnet man überall mit einer mißtrauischen Zurückhaltung, die ich nicht recht verstehe. Sogar an Stellen, die doch ein Interesse daran haben sollten, daß wir in der Angelegenheit zunächst einmal klarsehen. Da haben wir zum Beispiel gleich am ersten Tag Sayer zu Mr. Hyman vom Cartwright-Konzern geschickt, um vielleicht irgend etwas zu erfahren, aber der Mann rollte sich ein wie ein Igel... Ja, er hat sogar direkt gelogen. Er behauptete, nie etwas von der ›Königin der Nacht‹ gehört zu haben, während wir bestimmt wissen, daß Cartwright am Tage seines Todes mit ihm über diese mysteriöse Persönlichkeit telefoniert hat. Wir haben den Diener, der das ganz unaufgefordert ausgesagt hat, nun nochmals ins Gebet genommen, und er ist steif und fest dabei geblieben. — Können Sie sich das erklären? Das Nächstliegende wäre natürlich, daß wir Hyman energisch zu Leibe rücken, aber man überlegt sich das bei einem Gewaltigen der Presse. Da kann der kleinste Mißgriff verhängnisvoll werden, und man hängt doch an seinem Beruf und möchte noch einige Jahre mitmachen.«
Der Oberst seufzte bedrückt, aber Boyd blinzelte aus halbgeschlossenen Augen behaglich in die Frühlingssonne, die sich eben wieder hinter einer Wolkenwand hervorgeschoben hatte.
»Sehen Sie, auch diese Sorge sind Sie nun durch unseren Pakt los«, tröstete er den anderen. »Jetzt geht alles auf meinen Buckel, und mir kann nicht viel geschehen, da ich nicht mehr beim Yard bin.«
Als sich Boyd bei Lincoln's Inn Fields absetzen ließ, hatte der Polizeioffizier noch eine vertrauliche Frage auf dem Herzen.
»Ist es die Familie Morton, die sich an Sie gewandt hat?« wollte er wissen.
»So etwas Ähnliches«, gab Boyd mit einem Augenzwinkern zurück, und Terry konnte nun daraus seine Schlüsse ziehen.
Als der elegante weißhaarige Herr allein war, zog er sein Notizbuch zu Rate und überlegte eine Weile. Er hatte eine Reihe von Besuchen zu machen und mußte es so einrichten, daß er nirgends allzu ungelegen kam.
Es war einige Minuten vor drei Uhr, und um diese Zeit pflegte der vielbeschäftigte Mr. Hyman in seiner Privatwohnung zu weilen. Eine Viertelstunde später läutete Boyd an der Tür Alarm, und obwohl der aufgebrachte Diener nur den Kopf heraussteckte, gelang es Boyd doch, sich durch den Spalt schnell in das Vorzimmer zu schieben. Er ahnte, daß dies die einzige Möglichkeit war, überhaupt hereinzukommen, und atmete befriedigt auf, als er soweit war.
Aber der Mann in Hemdsärmeln, der ebenso robust und unfreundlich aussah wie sein Herr, hatte sich wieder gefaßt, und seine Gebärden ließen über seine Absichten keinen Zweifel.
»Scheren Sie sich hinaus«, knurrte er wütend, aber Boyd begann gemütlich abzulegen.
»Melden Sie Mr. Hyman, daß ihn der Forellenfischer in einer dringenden Angelegenheit zu sprechen wünscht«, sagte er, indem er bedächtig die Handschuhe abstreifte. »Der Forellenfischer, merken Sie sich das.«
Der mißtrauische Blick des Dieners verriet, daß er den Besucher nicht für ganz zurechnungsfähig hielt, und er versuchte daher, den Mann möglichst rasch und ohne viel Lärm loszuwerden. Wenn sein Herr in seinem kurzen Nachmittagsschlaf gestört wurde, war er noch unverdaulicher und grober als sonst.
»Mr. Hyman empfängt zu Hause keine Besuche«, erklärte er bedauernd und öffnete bereits wieder die Tür. »Sie müssen es am Vormittag oder gegen Abend im Cartwright-Haus versuchen.«
»Das paßt mir nicht«, erwiderte Boyd bestimmt. »Gehen Sie also und wecken Sie Ihren Herrn, oder ich werde so laut, daß er davon aufwacht, und dann werden Sie etwas erleben.«
Der Diener wußte das nur zu gut, und der weißhaarige Herr sah ganz danach aus, als ob er seine Drohung wahr machen würde. Es wäre für den armen Mann eine schwere Entscheidung gewesen, wenn er nicht plötzlich zwischen den Fingern des Besuchers ein lockendes Geldstück erblickt hätte, das die Sachlage mit einem Male klärte. Ein Donnerwetter mit einem derartigen Pflaster war einem Rüffel unbedingt vorzuziehen, und er brachte daher zunächst einmal die Münze mit einem raschen Griff in Sicherheit.
»Ich werde sehen«, sagte er dann mit einem wenig verheißenden Achselzucken und verschwand auf leisen Sohlen.
Eine Weile blieb es völlig still, dann aber war plötzlich irgendwo ein heiseres Bellen zu vernehmen und hierauf das Krachen einer nahen Tür, aus der zunächst der Diener mit einer etwas unnatürlichen Beschleunigung herausstürzte, worauf die grimmig schnaufende, massive Gestalt des Anwalts selbst erschien.
»Was, zum Teufel...«, legte er mit seiner fetten, heiseren Stimme los, aber er kam nicht dazu, seine freundliche Begrüßung fortzusetzen, denn der Herr mit dem weißen Haar schob ihn mit seiner feinen Hand über die Schwelle zurück, als ob er eine Nippfigur wäre, und schloß sofort die Tür.
»Guten Tag, Mr. Hyman«, sagte er liebenswürdig und unbefangen und ließ sich in den nächsten bequemen Sessel fallen. »Sie werden vielleicht etwas überrascht sein, mich hier zu sehen.«
»Sehr überrascht, Sir«, schnaubte der Anwalt, der in seinem alten karierten Hausrock und ohne Kragen noch massiger aussah als sonst. »Ich bin nicht gewohnt, auch noch in meinen vier Wänden belästigt zu werden, und hätte gute Lust...«
Boyd lächelte verständnisvoll und deutete so höflich auf einen der Sessel, daß Hyman die Augen aus den Höhlen zu springen drohten.
»Das brauchen Sie mir nicht erst zu sagen«, fiel er entgegenkommend ein. »Ich sehe es Ihnen am Gesicht an. Aber Sie werden doch nicht glauben, daß ich hierhergekommen bin, um mich von Ihnen sofort wieder hinauswerfen zu lassen. Nein. Mein Zweck ist natürlich ein ganz anderer. — Ich bin nun in der gewissen Sache so weit, daß mir einige Auskünfte von Ihnen erwünscht wären.«
»Dafür hätten Sie sich eine andere Zeit und einen anderen Ort aussuchen sollen«, gab der Anwalt mit hartnäckiger Grobheit zurück, aber in seinen Augen spiegelte sich plötzlich so etwas wie Unsicherheit und Mißtrauen.
»Die Zeit paßt mir ganz gut, denn am Vormittag pflege ich Zeitungen zu lesen und gegen Abend gehe ich regelmäßig zwei Stunden spazieren. In meinen Jahren muß man unbedingt etwas für seinen Körper tun. — Und auch den Ort finde ich ausgezeichnet gewählt. Ihr Diener ist nicht sehr intelligent.«
»Mir genügt er«, schrie Hyman, und alles deutete darauf hin, daß seine Selbstbeherrschung nur an einem dünnen Faden hing.
»Das habe ich nicht bezweifelt«, erwiderte der weißhaarige Herr trotzdem mit unerschütterlicher Ruhe. »Ich wollte mit meiner Bemerkung bloß andeuten, weshalb ich hierhergekommen bin. Es ist mir unangenehm, intelligente Leute in der Nähe zu wissen, wenn ich über gewisse Dinge spreche, denn sie sind neugierig und haben die garstige Gewohnheit, zu horchen. Das ist bei Ihrem Diener nicht zu befürchten, und deshalb können wir uns ganz offen Unterhalten. — Sagen Sie mir vor allem, Mr. Hyman, ob Sie nach dem Telefonanruf Cartwrights wegen der ›Königin der Nacht‹ noch dazu gekommen sind, mit ihm über diese Sache zu sprechen?«
»Nein«, entfuhr es dem Anwalt schroff, aber er erkannte sofort, daß er in eine Falle gegangen war, und begann wieder loszupoltern. »Ich weiß überhaupt von einem derartigen Gespräch nichts. Der Teufel hole den alten Esel von einem Diener, der das aufgebracht hat. Und ich habe Sie nicht mit der Sache beauftragt, damit Sie sich mit so albernem Gewäsch beschäftigen.«
Boyd lächelte schon wieder sehr liebenswürdig, und Hyman begann sich bei diesem Lächeln allmählich höchst unbehaglich zu fühlen. Es kam ihm vor, als ob Boyd mit ihm wie die Katze mit der Maus spiele, und er erkannte immer deutlicher, daß er den Mann, der so harmlos scheinen konnte, unterschätzt hatte.
»Also, sprechen wir nicht weiter davon«, meinte der Detektiv leichthin. »Es genügt mir, zu wissen, daß Sie nicht mehr Gelegenheit hatten, die gewisse Geschichte mit Sir Benjamin zu erörtern, weil mittlerweile die Katastrophe eingetreten war. Die Sache ist für mich sehr wichtig«, fuhr er bedächtig fort und richtete seine Augen zur Decke, »weil sie mich ein ansehnliches Stück weiterbringt. Sir Benjamin hat mit Ihnen telefoniert...«
»Er hat nicht mit mir telefoniert.«
Die Stimme des Anwalts überschlug sich vor Wut, und sein Gesicht war bleigrau.
»... hat mit Ihnen telefoniert«, wiederholte Boyd unbeirrt, »daß sich etwas abgespielt habe, was er sich nicht zu erklären wisse, aber vielleicht mit einer Episode seiner Afrikareise in Zusammenhang stehen könne. Sie sollten ihm darüber Ihre Meinung sagen. Zu diesem Zweck schickte er Ihnen ein gewisses Buch, Mr. Hyman. Haben Sie es vielleicht bei der Hand?«
»Nein«, kam es verbissen zurück, »ich weiß auch nichts von einem Buch. Wenn Sie sonst nichts mehr zu fragen haben...«
»O doch, noch einige Kleinigkeiten. Wie stehen Sie mit William Osborn und Charlie Selwood?«
»Stehen? — Ich kenne sie kaum«, knurrte Hyman verächtlich und ließ sich mit aller Schwere in einen der Sessel fallen.
»Und wie war das Verhältnis der beiden zu Sir Benjamin?«
»Das weiß ich nicht. Ich war bloß der Anwalt Cartwrights und habe mich um andere Dinge nie gekümmert.«
Die Antworten des Kolosses klangen ebenso bärbeißig wie früher, aber er schien doch etwas weniger erregt, und da er merkte, daß Boyd zum Aufbruch rüstete, schwang er sich sogar zu einer gewissen Höflichkeit auf.
»Ich bedauere, daß ich Ihnen nicht mehr sagen konnte.«
Boyd sah ihn mit seinen grauen Augen seltsam an, aber erst an der Tür kam er auf diese Bemerkung zurück.
»Wenn Sie mich in das Buch Einblick nehmen lassen, so brauche ich wahrscheinlich nichts mehr von Ihnen zu wissen.«
Der Anwalt fuhr diesmal nicht auf, sondern starrte eine Weile vor sich hin und hob dann mit einem ärgerlichen Ruck die breiten Schultern.
»Ich habe es nicht.«
»Nicht mehr«, korrigierte ihn Boyd mit einem befriedigten Lächeln. »Das habe ich mir nämlich gedacht.«
Er machte eine sehr höfliche Verbeugung und verschwand.
Osborn war in einer derartigen Laune, daß Helen sich scheu in das entlegenste Zimmer zurückgezogen hatte und sich hier mit ihrem King Charles die Zeit vertrieb.
Mittlerweile wanderte ihr Gatte mit fahlem Gesicht ruhelos durch das ganze Haus und versuchte, mit der Nachricht vom Tode Bryans' fertig zu werden. Hatte ihm die Geschichte der ›Königin der Nacht‹ schon genug ernste Sorgen bereitet, so wuchs die Spannung, die das allmähliche Nahen einer unsichtbaren Gefahr hervorruft. Osborn war nichts weniger als feige, aber das jähe Ende Bryans' unter so seltsamen Begleitumständen hatte ihm doch Furcht eingejagt. Er mußte sich mit dem Gedanken vertraut machen, daß, wie Selwood, nun auch ihm schon in den nächsten Stunden die Erscheinung in den Weg treten werde, und daß dann die Dinge ihren unheimlichen Lauf nehmen würden. Aber er war entschlossen, sich nicht überrumpeln zu lassen. In seinem Köpf wirbelten die verwegensten Pläne, wie er dem drohenden Unheil begegnen und dem bösen Spuk ein für allemal ein Ende bereiten könnte. Er hatte vor den bisherigen Opfern das eine voraus, daß er auf der Hut war, und wenn ihn seine Kaltblütigkeit nicht verließ, so hatte er einen Vorsprung, den er ausnützen konnte. Die ›Königin der Nacht‹ pflegte immer zuerst zu warnen, er aber wollte sofort handeln. Und mit dem Phantom war auch die ganze Sache wohl für immer aus der Welt geschafft.
Das Bewußtsein, daß Ruhe und Entschlossenheit das einzige Mittel zur Rettung seien, ließ ihn seine Fassung wiedergewinnen, und als er nach einer Stunde zu Helen ins Zimmer trat, war er wieder ganz gefaßt.
»Es muß Montag nachts geschehen sein«, bemerkte er ohne weitere Einleitung, »denn als wir gegen Mittag von Weybridge zurückfuhren, sah ich den Diener noch ganz gemütlich unter dem Tor stehen.«
Helen zog die Schultern ein, wie immer, wenn von so aufregenden Dingen gesprochen wurde, und dachte nach.
»Montag nachts, jawohl«, plapperte sie dann los. »Da bist du bereits kurz nach vier Uhr nach Hause gekommen...«
»Natürlich«, höhnte er, »das scheint dein Kalender zu sein. Weiß der Kuckuck, wie du es anstellst, das immer so genau auf die Minute zu wissen. Ich gebe mir alle Mühe, damit du durch mein Kommen nicht gestört wirst.«
»Oh, ich habe scharfe Ohren«, sagte sie lächelnd und schien darauf sehr stolz zu sein, aber seine Antwort verdarb ihr die Freude.
»Auch schon etwas. Ich wünschte, du hättest andere Vorzüge, die einem weniger auf die Nerven fallen. Im übrigen« — er sah sie mit seinem verschleierten Blick an —, »bin ich bereits um vier Uhr nach Hause gekommen, weil ich ganz niederträchtiges Pech hatte. Und der gestrige Abend hat mir den Rest gegeben. Du wirst mir also wieder einmal aushelfen müssen.«
Sie schrak sichtlich zusammen, und in ihre Augen kam plötzlich ein unruhiges Flackern.
»Ich habe dir doch erst vor einigen Tagen...«, begann sie nach einer Weile stockend, aber er schnitt ihr wütend das Wort ab.
»Mit Vorträgen aus deinem Kassabuch ist mir nicht gedient, sondern ich brauche Geld. Du scheinst ja den Schatz, den dein Vater zusammengescharrt hat, wie ein Drache hüten zu wollen. Bis heute weiß ich nicht einmal, wieviel es war.«
»Die Erbschaftsabhandlung ist noch nicht ganz beendet«, erklärte sie hastig und setzte sofort gefügig hinzu: »Wieviel brauchst du?«
»Sagen wir dreitausend Pfund«, warf er unbefangen hin, als ob es sich um eine Bagatelle handle, aber sie war über diese Summe so entsetzt, daß sie ihrem Hündchen ziemlich unsanft ins Fell fuhr, was ihr wehleidiger Liebling mit einem verzweifelten Satz und einem kläglichen Geheul erwiderte.
»Wegen dieser Kleinigkeit mußt du deinen Köter nicht gleich massakrieren, obwohl er es verdient«, schrie Osborn sie an und hielt sich die Ohren zu. »Das Vieh ist genauso unausstehlich wie du. Aber wenn sich, wie ich hoffe, das Blatt wendet, werfe ich dir den Bettel vor die Füße. Und dann werden wir miteinander endgültig abrechnen. Ich habe nicht die Tochter eines Wucherers geheiratet, um mit ihr um jedes Pfund zu feilschen.«
Ihr dunkles Gesicht verfärbte sich jäh und bekam einen erschreckend wilden und tückischen Ausdruck. Aber schon im nächsten Augenblick war sie wieder das untertänige, verschüchterte Wesen. »Ich verstehe dich nicht, William«, jammerte sie. »Ich habe dir doch gesagt, daß du das Geld haben kannst. Schon morgen. Jawohl«, fügte sie hastig hinzu.
Osborn fuhr sich über die Stirn, und in dem Gefühl, wieder einmal zu weit gegangen zu sein, suchte er nach einer Beschönigung für seine Roheit.
»Es ist furchtbar, daß man mit dir nicht ein vernünftiges Wort reden kann. Anstatt einfach ›ja‹ zu sagen oder ›nein‹, kommst du immer mit deiner larmoyanten Art und bringst mich in Harnisch. Wo ich doch augenblicklich den Kopf wirklich mit anderen Dingen voll habe. Es geht alles schief. Auch der Mann, den du mir für diesen Wellby so dringend empfohlen hast, hat versagt. Der Bursche wird obendrein noch frech und verlangt mehr als ausgemacht war.«
»Ich werde mit ihm reden«, erklärte sie eifrig und in einem Ton, der ihm sagen sollte, daß er sich um diese Angelegenheit nicht mehr zu kümmern brauche. Aber er mußte seinen Sarkasmus erst an ihr auslassen. »Eine nette Sippschaft, mit der ich mich da eingelassen habe. Woher kennst du diesen Kerl überhaupt?«
Helen sah einen Augenblick verwirrt und ratlos drein.
»Mein Vater hat ihm einmal geholfen.«
Osborn brach in ein schallendes Gelächter aus. »Großartig. Ein Mann, dem der alte Robbins einmal geholfen hat! Der Kerl könnte sich in London geradezu für Geld sehen lassen. Nun, für diese Hilfe scheint er sich jetzt erkenntlich zeigen zu wollen, indem er dem Herrn Schwiegersohn seines Wohltäters die Daumenschrauben ansetzt. Er behauptet, daß seine Leute schauderhaft verprügelt worden seien und von ihm Schadenersatz verlangen. Es soll sehr wüst dabei zugegangen sein. Jedenfalls ist dieser verdammte Wellby diesmal glücklich entwischt, und wir haben weiter mit ihm zu rechnen. Du mußt nur irgendwie die Hand mit im Spiel haben«, schloß er anzüglich, »so ist das Malheur fertig.«
Helen sank schuldbewußt in sich zusammen und war auf weitere Liebenswürdigkeiten gefaßt. Aber der eintretende Diener enthob sie dieser unangenehmen Aussicht.
Man war im Hause Osborn seit dem Fall Morton an den Besuch aller möglichen fremden Leute gewöhnt, denn es gab kein Blatt, das nicht einen Reporter entsendet hätte, um den ehemaligen Reisebegleiter der auf so geheimnisvolle Weise aus dem Leben geschiedenen Männer gründlich auszuholen. Aber Osborn war entweder nicht zu Hause oder krank oder sonstwie verhindert, diese Besuche zu empfangen, und überließ es seiner Frau, mit ihnen fertig zu werden. Und Helen zog sich hierbei nicht nur glänzend aus der Affäre, indem sie in großartiger Haltung und mit dem pathetischen Englisch einer Schauspielschülerin ihre eingelernten Phrasen herunterleierte, sondern sie fand mit der Zeit an der Sache sogar Gefallen. Seitdem eine der Zeitungen von der ›interessanten und liebenswürdigen Mrs. Osborn‹ berichtet und ein zweites Blatt sie sogar ›eine entzückende, geistreiche Frau‹ genannt hatte, mit der es ein Vergnügen sei zu plaudern, war Mrs. Helen auf derartige Besuche geradezu versessen und hätte sich sehr gekränkt, wenn Osborn sie ihr vorenthalten hätte. Er dachte aber nicht daran, sondern hatte kaum einen flüchtigen Blick auf die Karte geworfen, als er sie ihr auch schon gelangweilt zuschob.
»Wahrscheinlich wieder einer von der gewissen Sorte. Das ist etwas für dich. Aber lege endlich einmal eine andere Walze ein, daß ich nicht immerfort lesen muß, daß ich zu Bett liege oder nicht zu Hause bin. Streng deinen Kopf an, damit dir etwas Gescheiteres einfällt.«
Helen hörte ihm nur mit halbem Ohr zu, denn sie war bereits eifrig mit Puderquaste und Lippenstift beschäftigt, und erst als auch ihr King Charles empfangsfähig und malerisch auf ihrem Schoß placiert war, erteilte sie dem Diener mit hoheitsvoller Geste die Weisung, den Besucher einzulassen.
Der frisch aussehende Herr mit dem weißen Haar sah nicht so aus wie die anderen Reporter, die sie zu sehen gewohnt war, und das brachte sie etwas aus dem Konzept.
»Mr. Osborn ist in eine wissenschaftliche Arbeit vertieft«, begann sie stockend. »Jawohl. In eine sehr gelehrte Sache. Jawohl. Und es tut ihm sehr leid, nicht erscheinen zu können.« Sie hatte ihre Befangenheit nun ganz abgestreift und sprach so flüssig und gespreizt, daß Boyd interessiert aufhorchte. »Aber deshalb sollen Sie Ihre kostbare Zeit nicht vergeblich aufgewendet haben. Gewiß wünscht Ihr Blatt Informationen über die afrikanische Sache. Damit kann ich Ihnen dienen. Mr. Osborn und ich haben diese interessanten Tage an Hand seiner Aufzeichnungen und Erinnerungen ungezählte Male gemeinsam durchlebt, und ich weiß alles. Sie brauchen nur zu fragen.«
Mrs. Helen atmete tief auf und lehnte sich erleichtert zurück, denn sie war auf die letzten Sätze sehr stolz, denn sie machten ihr immer einige Schwierigkeiten.
»Sehr liebenswürdig«, sagte der weißhaarige Herr verbindlich. »Ich möchte aber feststellen, daß es sich nicht um eine Zeitung handelt, sondern...«
Mrs. Osborn war nicht gesonnen, sich wegen solcher Kleinigkeiten lange aufzuhalten.
»O bitte, das macht gar nichts«, fiel sie ihm zuvorkommend ins Wort. »Also, wahrscheinlich um etwas anderes Gedrucktes. Ich verstehe. Solche Herren sind auch schon hier gewesen.«
Der Detektiv verneigte sich. Wenn die Frau so darauf erpicht war, aus ihm einen Zeitungsmenschen zu machen, so wollte er ihr das Vergnügen nicht nehmen.
»Ich bin eigentlich nur wegen einer Frage gekommen«, sagte er bescheiden.
»Alle Herren kommen nur wegen einer Frage«, verriet sie ihm mit verschmitztem Lächeln. »Ich weiß schon. Wegen der ›Königin der Nacht‹. Aber Sie können Ihrem Blatt mitteilen, daß wir darüber gar nichts wissen. Mr. Osborn meint, daß es sich dabei überhaupt nur um einen Zeitungsvogel oder eine große Schlange handeln dürfte.«
Sie tat sich auf diese beiden Ausdrücke, die sie irgendwo aufgeschnappt hatte, sichtlich sehr viel zugute, aber Boyd mußte überlegen, was sie damit sagen wollte.
»Sehr gut«, pflichtete er ihr dann plötzlich mit einem verständnisvollen Lächeln bei. »Eine Zeitungsente oder eine Seeschlange. — Ich bin auch der Ansicht, daß sich die ›Königin der Nacht‹ schließlich als so etwas entpuppen wird. Die ganze Geschichte klingt unglaublich, und es ist unmöglich, in ihr einen Sinn zu finden. — Ob dieses Gerücht wohl auch anläßlich des plötzlichen Todes von Mr. Bryans wieder auftauchen wird?«
Helen neigte den Kopf und machte ein sehr geheimnisvolles Gesicht. »Oh, ich habe diese Kolportage schon vernommen«, flüsterte sie mit wichtiger Vertraulichkeit. »Der Diener von Mr. Bryans, hat sie uns zugetragen, als wir den armen Mann vor einigen Tagen aufsuchten.«
»Was Sie nicht sagen!« Der nette weißhaarige Herr zog die Brauen hoch, und Mrs. Helen war sehr befriedigt, daß er ein so dankbarer Zuhörer war. »Wie interessant! Also bereits vor der Katastrophe hat man davon gesprochen? Aber Sie haben es gewiß nicht ernst genommen?«
»O doch«, sagte sie mit einem etwas ängstlichen Blick. »Wenn ich solche Dinge höre, bekomme ich gleich eine Gänsehaut, das heißt, es läuft mir eiskalt über den Rücken. Auch als Mr. Selwood erzählte, daß ihm die ›Königin der Nacht‹ erschienen sei, hatte ich dasselbe gruselige Gefühl.«.
»Mr. Selwood hatte auch bereits eine Begegnung mit ihr?«
»Jawohl, vor einigen Tagen.« Sie sprach so leise, daß er sie kaum verstehen konnte, und ihre Hände strichen ruhelos durch das Fell des gähnenden Hündchens.
»Dann käme also als nächster Mr. Osborn an die Reihe«, sagte Boyd nach einer kleinen Pause und sah sie forschend an, aber sie schüttelte sehr energisch mit dem Kopf.
»Ich habe Ihnen doch schon gesagt, daß wir der ganzen Sache sehr zweifelhaft gegenüberstehen«, meinte sie in ihrer geschraubten Ausdrucksweise und machte ein erstauntes Gesicht. »Mr. Selwood hat wahrscheinlich nur einen Scherz gemacht, weil er weiß, wie solche Geschichten an meinen Nerven reißen. Und auf das, was in den Zeitungen stand und was der ungebildete Diener Bryans' erzählte, ist doch nichts zu geben.«
Boyd fand, daß die Ansichten von Mrs. Osborn ebenso unausgeglichen und widerspruchsvoll waren wie ihre gedrechselten Redewendungen und ihre sonderbare Aussprache.
»Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Güte hätten, mir Mr. Selwoods Adresse anzugeben. Vielleicht ist er bereit, mir selbst einiges mitzuteilen.«
»Sehr gerne«, sagte sie. »9, Sussex Street, Paddington.«
Der weißhaarige Herr entnahm seinem Notizbuch eine kleine Karte und schrieb sie auf.
»Habe ich Sie richtig verstanden?« fragte er dann und reichte ihr das Blatt.
Sie griff mit zwei Fingern danach, überlas es und gab es ihm dann wieder zurück.
»Jawohl. Soviel ich weiß, werden Sie ihn am sichersten zwischen elf und zwölf Uhr vormittags antreffen.«
Als der Detektiv langsam die Treppe hinabstieg, machte er einen Augenblick halt, nahm die Karte vorsichtig an den Rändern aus dem Notizbuch und bettete sie sorgfältig in eine kleine Blechschachtel.
Als Noel Wellby an diesem Tag sein Haus betreten hatte, stieß er im Flur auf seine Wirtin, die wie ein Schatten aus ihrem Zimmer geglitten war. Die magere, blasse Dame hatte ein Tuch um die Schläfen gewunden, und ihr Gesichtsausdruck verriet, daß sie unter körperlichen Schmerzen litt, sonst hätte sie ihren Mieter vielleicht ungeschoren gelassen, denn er hatte schon wieder einen vollen Monat vorausbezahlt, aber augenblicklich brauchte sie eine Aussprache, die ihr Blut etwas in Wallung brachte.
»Mr. Wellby«, sagte sie unfreundlich, »ich kümmere mich zwar sonst nicht darum, was meine Mieter treiben, aber ich will meine Ruhe haben. Meinetwegen bleiben Sie den ganzen Tag zu Hause oder kommen Sie gar nicht«, fuhr sie unliebenswürdig fort, nachdem sie tief Atem geschöpft hatte, »das geht mich nichts an. Aber daß ich deswegen ununterbrochen Scherereien haben soll, das paßt mir nicht. Seitdem der Mann mit dem großen Bart hier gewesen ist, rennen mir die verschiedensten Leute das Haus ein...«
»Werfen Sie sie hinaus«, riet Wellby lakonisch und wollte an ihr vorüber, aber sie machte Miene, ihre Hand auf seinen Arm zu legen, und da wich er lieber wieder zurück.
»Das sagt sich leicht«, meinte sie bissig und vorwurfsvoll, »aber ich bin eine alleinstehende Frau und kann es nicht darauf ankommen lassen, daß mir eines Tages etwas passiert. Von dem ersten Herrn, der nach Ihnen fragte, will ich ja nicht reden, denn er war wirklich ein Gentleman«, räumte sie mit einem leichten Seufzer ein, »aber mit den anderen, die seither gekommen sind, möchte ich nichts zu schaffen haben. Sie sind ja nicht der erste Mieter, den ich habe, und jeder hat seine Freunde und Bekannten gehabt, aber ich muß schon sagen, daß die anders ausgesehen haben. Na, schließlich ist das Ihre Sache. Aber anstatt zu kommen, wenn Sie hier sind, trommeln sie an die Tür, wenn ich allein bin. Ich kann dann sehen, wie ich sie wieder los werde. Dafür werde ich nicht bezahlt, Mr. Wellby. Wenn Sie schon eine so große und zudringliche Bekanntschaft haben, so lassen Sie sie wissen, wann Sie zu Hause sind. Kleben Sie meinetwegen einen Zettel an die Haustür, daß ich nicht ständig bei Nacht und bei Tag in Angst sein muß. Bei Ihnen weiß man eigentlich nie, was im Hause vorgeht. Dabei lassen Sie auch noch die Fenster offen. Heute nacht ist wahrscheinlich eine Katze hineingesprungen, weil ich einen Plumpser gehört habe und dann ein paarmal ein Miauen. Auch vorhin, als ich an der Tür gehorcht habe, habe ich es wieder gehört. Ich hätte ja das Vieh hinausjagen können, aber ich kann Katzen nicht leiden. Wenn es wirklich eine Katze ist, wird es oben sauber ausschauen, und ich sehe nicht ein, wie ich dazu komme...«
Die bedauernswerte Hauswirtin lehnte sich erschöpft und erleichtert an die Wand, und Wellby benützte die Gelegenheit, um die schmale Treppe hinaufzusteigen. Er hatte dem fließenden Redeschwall der verärgerten Frau sehr aufmerksam gelauscht und ihn stellenweise ganz interessant gefunden.
Der enge Gang, der zu seinem bescheidenen Zimmer führte, war selbst bei Tag stockdunkel, und der Reporter hatte es sich schon längst angewöhnt, ihn nur mit einer Taschenlampe zu betreten. Auch seine Tür pflegte er, bevor er sie öffnete, aus irgendwelchen Gründen vorerst immer sorgfältig abzuleuchten, und erst dann steckte er den Schlüssel ins Schloß und öffnete.
Heute ließ er sich damit noch länger Zeit als sonst und fand es geraten, eine Weile mit angehaltenem Atem zu lauschen. Er vernahm aber keinen Laut, und nach einigen Minuten schob er die Rechte in die Manteltasche und stieß mit der Linken die Tür auf, wobei er mit einem blitzschnellen Sprung zur Seite hinter der Korridorwand Deckung suchte. Erst als alles ruhig blieb, beugte er vorsichtig den Kopf vor und sah in das Zimmer. Es war mit wenigen alten Möbeln primitiv eingerichtet und so kahl, daß jeder Winkel zu überblicken war.
Schon wollte er eintreten, als er die Vermutung seiner Wirtin bestätigt fand. Er hörte ein gereiztes Fauchen und gleich darauf sprang eine Katze mit schillernden Augen von dem einfachen Bett und machte angriffslustig einen Buckel.
Wellby besah das ausgewachsene Exemplar forschend und überlegte eine Weile. Dann zog er schnell die Rechte aus der Tasche, es gab einen kaum hörbaren Knall, und das Tier schnellte in die Höhe und überschlug sich.
Der Reporter schloß die Tür, und als der seltsame Eindringling die letzten Zuckungen getan hatte, trat er an den Kadaver heran und untersuchte ihn sorgfältig. Er ging dabei äußerst behutsam zu Werke, und als er die im Todeskampf gestreckten Krallen gewahrte, nahm, er eine Lupe zur Hand und blickte lange auf den ungewöhnlichen, lackartigen Glanz, mit dem die scharfen Spitzen überzogen waren. Dann lächelte er eigentümlich, nahm ein altes Wäschestück, breitete es auf dem Boden aus und wickelte, nur unter Zuhilfenahme des Fußes, das tote Tier hinein. Hierauf schleppte er eine große Schachtel herbei, hob das Paket vorsichtig hinein und verschnürte den Karton. Dann ging er zum Fenster, blickte eine Weile hinaus und zündete sich eine Zigarette an.
Wenige Minuten später sah die schlechtgelaunte Wirtin von ihrem Ausguck einen großen Mann das Haus betreten und vernahm dessen schwere Tritte, bis sie sich über ihr verloren. Nicht lange darauf kamen die Schritte wieder herunter, und der Fremde entfernte sich mit einer umfangreichen Schachtel unter dem Arm. Der Bursche war jung und machte einen sehr vertrauenerweckenden Eindruck, und da sie sich in einer Stimmung befand, in der ihr nichts recht war, ärgerte sie sich nun, daß ihr Mieter gerade diesmal zu Hause gewesen war.
Als der Mann gegangen war, begann Wellby hinter verschlossener Tür an einem kleinen Kästchen zu hantieren, das die neugierige Wirtin für ein Radio hielt und immer mit ärgerlichem Kopfschütteln betrachtete, da es doch eigentlich ganz unnütz herumstand. Der Reporter drückte in Intervallen und taktmäßig auf einzelne Taster, die kaum sichtbar in das Gehäuse eingelassen waren, und als nach wenigen Minuten ein leises Surren erklang, öffnete er eine kleine Kappe und ließ einen schmalen Papierstreifen ablaufen, den er ablas und dann in winzige Stücke zerriß.
Mr. Fish führte wieder das große Wort, als Wellby etwa zwei Stunden später in das Reporterzimmer kam. Er thronte, den Hut im Genick, die Hände in den Hosentaschen, mit übergeschlagenen Beinen auf einem Schreibtisch und klagte über die lästigen gesellschaftlichen Verpflichtungen, denen er sich nicht entziehen könne. Vor einigen Tagen hatte er mit dem englischen Botschafter in Washington im Princes-Restaurant das Dinner einnehmen müssen und war dann noch von Mrs. Dyke und ihrer Gesellschaft in Anspruch genommen worden, am nächsten Abend war ein Empfang bei Lord Liverstone gewesen, von dem er sich trotz aller Anstrengungen nicht hatte frei machen können, am nächsten Tag wieder hatte ihn ein bekannter Politiker förmlich in seinen Klub geschleift und dort einer Menge einflußreicher, aber langweiliger Persönlichkeiten vorgestellt, und gestern mußte er einem millionenschweren jungen Sportsmann bei einem Bummel Gesellschaft leisten, bei dem es ein bißchen toll hergegangen war.
Der ›Fliegenpilz‹ gähnte zur Bekräftigung seiner begreiflichen Müdigkeit höchst ausgiebig, und die Art, wie er die sommersprossigen Wülste über den Augen hochzog, sollte andeuten, daß ihm dieser Rummel furchtbar zuwider war.
»Dreimal, viermal in der Woche, schön, aber jeden Abend in Frack und Lackschuhen, das ist ein bißchen zu viel. Ich bin gewiß ein Gesellschaftsmensch, aber zuweilen, hat man doch das Bedürfnis, sich selbst zu gehören und ordentlich auszuschlafen.« Er gewahrte plötzlich, wie Wellby mit gespreizten Fingern seinem Etui eine Zigarette entnahm und zwischen die seltsam verkniffenen Lippen schob, und der mißtrauische Jüngling empfand das als Herausforderung. »Dabei gibt es wahrscheinlich Leute«, fuhr er daher mit erhobener Stimme und verächtlich geblähten Nüstern höchst anzüglich fort, »die wer weiß was darum gäben, wenn sich die Gesellschaft so um sie reißen würde. Aber dazu gehört etwas mehr, als ein vornehmes Getue, hinter dem nichts steckt. Darauf fällt kein wirklicher Mann von Welt herein. Ich würde ihn doch nicht für einen geborenen Pair halten. — Genauso, wie ich Miss Avery nicht für eine Gräfin halte, obwohl sie in der Nacht in einem Privatauto herumfährt.«
Wellby blies den Rauch seiner Zigarette in einer langen Säule gegen die Decke, und einer der Reporter brach in helles Gelächter aus.
»Großartig. Miss Avery in einem Auto. Da haben Sie sich wohl verschaut.«
Mr. Fish sah den Sprecher mitleidig an und zuckte mit den Schultern. »Solche Augen sollten Sie haben wie ich«, sagte er selbstbewußt. »Und wenn es Miss Avery hundertmal bestreitet, weil sie wohl selbst einsieht, daß es eine komische Sache ist, weiß ich doch, was ich gesehen habe. Zehn Schritte vor mir ist sie heute nacht beim Regents Park in einen wartenden Wagen gestiegen. Ich wollte sie schon anrufen, aber das Auto fuhr bereits los. Glauben Sie, daß ich Miss Avery nicht erkannt hätte? Bei dem Gesicht? Weiß ich, warum sie es nicht gewesen sein will?« Er verzog seinen breiten Mund zu einem Grinsen. Wenn sie etwas netter wäre, könnte man fast glauben... Jedenfalls muß sie ihre Gründe haben, denn schließlich, es ist zwar nichts Besonderes, was ich gefunden habe, aber immerhin...« Er zog ein kleines Notizbuch aus der Tasche und ließ die Blätter ablaufen. »Vier Schilling mag die Sache gekostet haben. Echtes Leder und feines Papier und gut zur Hälfte noch unbeschrieben. Ich würde so etwas nicht so ohne weiteres laufen lassen, wenn es mir gehörte. Und es gehört ihr, denn ich habe genau gesehen, wie es aus ihrer Handtasche fiel, als sie in den Wagen schlüpfte. Deshalb habe ich sie auch aufhalten wollen. Beweisen kann ich es allerdings nicht, denn es steht kein Name darin, und das andere kann man auch nicht lesen. Wenigstens ich nicht«, fügte er hinzu und sah sich herausfordernd im Kreise um, »denn es ist, wie ich glaube, Hebräisch, und da bin ich nicht sachverständig. Ausgerechnet so etwas muß ich finden«, schloß er verdrießlich, »und der Besitzer muß die Annahme ablehnen. Ich wünschte, es wären in dem Buch wenigstens noch ein oder zwei Pfund gewesen.«
»Drei Pfund für das Buch«, sagte in diesem Augenblick der schweigsame Wellby so klar und deutlich, daß Mr. Fish wie eine Sprungfeder vom Tisch schnellte und den Sprecher mit offenem Mund anstarrte. Aber sein Mißtrauen gegen diesen unsympathischen Mann wurzelte zu tief, um durch solch eine Redensart völlig beseitigt zu werden.
»Machen Sie keine schlechten Witze«, begann er daher gereizt, aber die letzten Worte kamen eigentlich kaum noch über seine Lippen, denn der andere hatte tatsächlich drei Pfundnoten vor sich auf den Tisch gelegt und streckte nun die Hand aus, um das Notizbuch in Empfang zu nehmen.
Angesichts der Scheine wich der Argwohn des ›Fliegenpilzes‹ bald, und als er vorsichtshalber rasch die Hand auf die Banknoten legte, war er sich des Ernstes der Sache vollkommen bewußt.
»Drei Pfund sind eigentlich etwas wenig«, meinte er und schob dabei das Geld auch schon in die Westentasche, »aber weil Sie es sind, lieber Wellby...« Das schlechte Geschäft machte ihn so zerstreut, daß er auch das Buch in Gedanken wieder einstecken wollte, aber er ließ es plötzlich mit einem leichten Aufschrei fallen, weil sich fünf Finger wie ein eiserner Reif um sein armes Handgelenk gelegt hatten.
»Was Sie für Manieren haben«, stieß er ärgerlich hervor. »Mich wegen nichts und wieder nichts so zu quetschen. Morgen wird die ganze Hand blau sein, und man wird mich fragen, in was für einer Gesellschaft ich verkehre, daß ich so zugerichtet bin.« Er rieb sich umständlich das Gelenk, und bereute, daß er wieder einmal zu bescheiden gewesen war. Wenn er statt ein oder zwei, drei oder vier Pfund gesagt hätte, so hätte dieser aufgeblasene Dummkopf von einem Wellby statt drei auch fünf Pfund auf den Tisch gelegt.
Miss Avery, um deren angebliches Eigentum es hierbei ging, war wieder einmal nicht zu sehen gewesen, aber zu seiner größten Überraschung sollte Wellby an diesem Abend noch von ihr hören. Er hatte sich wegen eines Berichts über eine Regatta länger in der Redaktion aufgehalten, und es ging bereits auf neun Uhr, als er die Treppe hinabstieg. Die weite Halle war völlig leer.
Als aber Wellby an der Pförtnerloge vorüberschritt, streckte sich ihm plötzlich ein langer knochiger Arm mit einem Brief entgegen, und der Arm hatte es so eilig, wieder zu verschwinden, daß der Umschlag zu Boden fiel, bevor der Reporter noch dazu gekommen war, ihn zu ergreifen. Wellby hob den Brief verwundert auf, aber die Handschrift der Adresse vermochte ihm nichts zu sagen. Erst als er das Schreiben geöffnet und einen Blick auf die Unterschrift geworfen hatte, war er sich im klaren, aber seine Überraschung war deshalb nicht geringer.
»Mr. Wellby«, schrieb Clarisse Avery, »wenn Sie sonst nichts anderes vorhaben und wenn Sie sich meinetwegen wirklich nicht genieren, so würde es mich freuen, mit Ihnen heute ein Stündchen plaudern zu können. Vor allem möchte ich Sie auf einen Umstand in den Fällen der ›Königin der Nacht‹ aufmerksam machen, der mir aufgefallen ist und der sich vielleicht journalistisch sehr interessant verarbeiten ließe. Ich habe bis ungefähr neun Uhr in der afrikanischen Mission zu tun und werde dann in dem Restaurant gegenüber der County Hall zu Abend essen. Es soll dies ein Vorschlag sein und kein Zwang, und deshalb sage ich auch nicht, daß ich mich freuen würde, wenn Sie kämen.«
Der Reporter las die wenigen Zeilen einige Male durch, bevor er sie mit nachdenklichem Gesicht zusammenfaltete und in die Tasche steckte.
Pat, der mit grimmigen Augen über Wellbys Schulter schielte, hoffte, daß der Mann, der ihn an das ärgste Mißgeschick seines Lebens erinnerte, nun endlich gehen würde, aber sein Wunsch sollte sich nicht erfüllen. Wellby drehte sich vielmehr so blitzschnell um, daß Mr. Coppertree den Blick nicht mehr abwenden konnte und direkt in die scharfen, dunklen Augen dieses unangenehmen Menschen sehen mußte.
Der Reporter trat so nahe heran, daß sein Oberkörper das Schiebefenster der Loge völlig ausfüllte, und seine Stimme klang so gedämpft, daß sie gerade nur so weit zu hören war, wie der kleine krummbeinige Ire stand.
»Mr. Pat — das Doppelte von dem, was Sie bekommen haben, wenn Sie mir sagen, wie der Arzt heißt, auf dessen Anordnung Sie so weite nächtliche Spaziergänge unternehmen.«
Mr. Coppertree starrte nach dem dunklen Gesicht im Fenster wie ein entsetzter, glaubensstarker Mann nach dem Versucher, der ihn vom rechten Wege abbringen will. Einen Augenblick wirbelten die Worte in seinem Kopf. »Das Doppelte von dem, was...«, hatte jener gesagt, und der süße Pat bemühte sich, möglichst rasch darauf zu kommen, wieviel das eigentlich gewesen war. Wenn er sich recht erinnerte, waren es drei Pfund gewesen, aber wenn er das andere dazuschlug und allen Ärger mit Mrs. Nettie, so hätten es wenigstens fünf Pfund sein sollen...
Als ob er Pats geheimsten Gedanken erraten hätte, fragte der Versucher am Fenster mit seiner leisen Stimme auch schon: »Wieviel war es also?« Und der arme schwache Mann konnte dieser teuflischen Lockung nicht widerstehen. Er spreizte zunächst die fünf Finger seiner Rechten so deutlich, daß sie nicht zu übersehen waren, und damit auch die Linke nicht zu kurz kam, hob er noch deren dicken Daumen.
»Also zwölf Pfund«, sagte Wellby geschäftsmäßig. »Und damit Sie es nicht mit Ihrem Gewissen zu tun bekommen, müssen Sie mir den Namen nicht einmal nennen, sondern, wenn ich ihn ausspreche, machen Sie einfach kehrt. Dann können Sie bei Ihrem Schutzpatron und jedem anderen Heiligen beruhigt schwören, daß nicht ein Wort über Ihre Lippen gekommen ist.«
Mr. Coppertree starrte den Reporter mit einer Scheu und Ehrfurcht an, als ob er der oberste Teufel selbst wäre, denn nur dieser konnte auf eine so großartige Idee kommen. Das mit dem Schwören war verdammt schlau und richtig, und wenn Mr. Wellby vielleicht auch nicht der Teufel war, so war er sicherlich ein Ire, der wußte, daß es mit dem Gewissen und dem Schwören eine sehr ernste Sache ist. Und wenn Mrs. Dyke auch eine Dame war und er viel für sie übrig hatte — da es um zwölf Pfund und einen Landsmann ging und er außerdem beruhigt schwören durfte, konnte ihm niemand einen Vorwurf machen.
»Legen Sie los«, brummte er daher leise, »aber zuerst...«
Der andere verstand ihn, und während Pat mit scharfen Augen mitzählte, legte jener durch das Fenster zwölf Pfundnoten auf den Tisch und zog sich zu Mr. Coppertrees Beruhigung etwas zurück.
»Mr. Hyman?«
Pat stand wie ein Felsblock und starrte den Teufel an.
»Mrs. Dyke?«
In diesem Augenblick gab es dem Iren einen so gewaltigen Ruck, daß er um seine krumme Achse flog, und als er sich nach einigen Augenblicken wieder vorsichtig umwandte, war der Versucher verschwunden, aber die Scheine, an die er sich plötzlich mit Schrecken erinnerte, waren, Gott sei Dank, noch da.
Als Wellby sich in dem Restaurant gegenüber der County Hall einfand, mußte er noch eine ganze Weile warten, bevor Miss Avery etwas atemlos erschien, und er war überrascht, als er sie sah. Sie trug diesmal statt des unkleidsamen Mantels, in dem sie wie in einem Regenschirmfutteral steckte, ein sehr geschmackvolles Sportkostüm und einen dazu passenden neuen Hut, und wenn ihre Erscheinung dadurch auch nicht viel anziehender wurde, so wirkte sie doch weniger auffallend.
»Mir scheint, ich gefalle Ihnen«, sagte sie ironisch, als sie seinen Blick bemerkte, und wieder einmal hörte er das leise, weiche Lachen, das so gar nicht zu dem unschönen Mädchen passen wollte. »Ich habe auch das neue Kostüm nur Ihretwegen angezogen«, gab sie unbefangen zu, »denn es ist etwas zuviel verlangt, daß Sie sich mit einer vollendeten Vogelscheuche zeigen sollten. Ich weiß, was sich gehört, und nachdem ich heute darauf vorbereitet war, mit Ihnen zu Abend zu essen, so konnte ich mich etwas herrichten.«
Er bemerkte, daß tatsächlich sogar auch die kupferbraune Locke unter dem Hütchen mit besonderer Koketterie hervorgezogen war, und er mußte lächeln, daß Miss Avery trotz allem die weibliche Eitelkeit nicht ganz verleugnen konnte.
Seine Begleiterin entwickelte diesmal von Anfang an eine auffallende Gesprächigkeit, und er ahnte, daß sie etwas auf dem Herzen hatte, wofür sie eine entsprechende Einleitung suchte. Sie erzählte ihm von der Sitzung in der afrikanischen Mission, und ihre treffenden Bemerkungen über die dort vorgebrachten seltsamen Anträge sagten ihm, daß sie sehr viel Geist und Witz besaß und eine gehörige Portion schalkhafter Bosheit.
»Wenn Sie die Sachen so niederschreiben, wie Sie sie mir eben berichteten, können Sie vom ›Puck‹ sehr viel Geld bekommen«, meinte er, aber sie wehrte lächelnd ab.
»Ich glaube, die Redakteure des ›Puck‹ würden weit weniger entzückt sein als Sie. Und solche Sachen interessieren mich auch nicht. Aber«, fuhr sie leichthin fort und spielte dabei mit ihren Fingern, von denen sie die Handschuhe abzustreifen vergessen hatte, »es ist schade, daß wir in dem gewissen Fall so ganz kaltgestellt sind. Sie wissen ja, was ich meine. Da hätte sich, glaube ich, manches machen lassen.«
»Fühlen Sie das Zeug zu einem Detektiv in sich?« fragte er und richtete seinen Blick aus halb geschlossenen Lidern auf die großen dunklen Gläser, die ihm aber sofort auswichen.
»Das gerade nicht«, gab sie mit verlegener Hast zurück, »aber so geheimnisvolle Dinge regen mich zum Nachdenken an. Ich habe etwas gefunden, was sehr auffällig und vielleicht von größter Wichtigkeit ist.« Sie brach ab und schien eine Aufmunterung zu erwarten, aber Wellby sah sie nur mit einem leichten Zucken um den Mund an, und sie wurde plötzlich so nervös, daß das Besteck in ihrer Hand leicht zitterte.
»Es gibt doch bei jedem Verbrechen eine gewisse Logik der Geschehnisse«, begann sie nach einer Weile plötzlich von neuem, »und diese vermisse ich hier. Ich weiß nicht, ob wirklich eine ›Königin der Nacht‹ existiert, aber wenn alles sich so verhält, wie die Zeitungen berichten, so ist mir das Verhalten dieser geheimnisvollen Frau völlig unverständlich. Sie erscheint und stellt, wie es heißt, eine Frist, aber noch bevor diese um ist, tritt bereits die Katastrophe ein. — Warum tötet die ›Königin der Nacht‹ nicht schon das erstemal, wenn sie es unbedingt auf das Leben derer, die sie aufsucht, abgesehen hat? Und warum stellt sie eine Frist, wenn sie nicht gewillt ist, sie einzuhalten? Können Sie sich das erklären?«
Sie sah von ihrem Teller auf und wandte ihm das Gesicht zu, und wieder einmal bemühte sich Wellby vergeblich, die toten Augengläser zu durchdringen.
»Was schließen Sie daraus?« fragte er.
»Oh, man könnte verschiedenes vermuten«, meinte sie, »aber alles das sind nur Theorien. Zum Beispiel...«
Sie vollendete nicht, denn seine Interesselosigkeit benahm ihr anscheinend den Mut, das zu sagen, was sie dachte. Und Wellby fiel es nicht ein, in sie zu dringen. Als sie eine Weile in ihrer Schweigsamkeit verharrte, begann er selbst von allen möglichen gleichgültigen Dingen zu sprechen, und sie beschränkte sich darauf, ihm nachdenklich zuzuhören.
Plötzlich griff er in die Tasche und legte das Notizbuch, das er vor einigen Stunden von dem geschäftstüchtigen Mr. Fish erstanden hatte, vor sie auf den Tisch.
»Ich stelle Ihnen hier Ihr Eigentum zurück, Miss Avery«, sagte er.
Sie sah ihn erst völlig verständnislos an, als sie aber das kleine Buch erblickte, verfärbte sie sich jäh und schob es mit einer energischen Bewegung von sich.
»Es gehört nicht mir«, sagte sie gereizt. »Ich habe das doch schon Mr. Fish erklärt. Was soll das heißen, daß man es mir mit aller Gewalt aufdrängen will? — Haben Sie hineingesehen?«
Er schüttelte den Kopf und blickte sie so offen an, daß sie ihm glaubte.
»Nein. Aber wenn es wirklich nicht Ihnen gehören sollte, so nehme ich es wieder an mich und werde mich für den Inhalt interessieren. Ich glaube nämlich, zum Unterschied von Mr. Fish, diese gewissen hebräischen Schriftzeichen entziffern zu können.«
Sie legte unwillkürlich ihre Hand auf das Notizbuch, und es trat ein langes Schweigen ein.
»Weshalb haben Sie es mir gebracht?« fragte sie endlich leise.
»Weil mir der Gedanke unangenehm war, eine Sache, die Ihnen gehört, im Besitz von Mr. Fish zu wissen«, erklärte er ausweichend. »Und weil vielleicht Dinge darin stehen könnten, die nur Sie angehen.«
Sie riß in einem jähen Impuls den gestopften Handschuh herunter und reichte ihm eine zarte, weiche Hand, die er einen Augenblick in der seinen hielt.
»Ich möchte Sie aufmerksam machen«, sagte er unbefangen, »daß wir nach der Prognose schönes Wetter bekommen, und da wird unsere verabredete Segelpartie fällig. Würde Ihnen der Sonntag passen? Da können Sie einen vollen Tag frische Luft schöpfen, was Ihnen sicherlich sehr guttun wird.«
Sie nickte lebhaft, und ihr Lächeln verriet, daß ihr die Sache Spaß zu machen begann. Erst als er sie fragte, ob er sie abholen solle, wurde sie wieder etwas verlegen.
»Bitte, machen Sie sich keine Umstände«, sagte sie. »Bestimmen Sie irgendeinen Ort, der nicht zu verfehlen ist.«
Er dachte einen Augenblick nach.
»Also sagen wir um neun Uhr beim Battersea Park. Wir werden übrigens darüber noch sprechen.«
Als sie nach einer halben Stunde aufbrachen und er sie ein Stück begleiten wollte, lehnte sie sehr entschieden ab. Er durfte mit ihr nur bis zum nächsten Bus gehen, aber schon an der folgenden Haltestelle stieg Miss Avery wieder aus und fuhr in der entgegengesetzten Richtung zurück, bis sie endlich in einer kleinen Gasse in ein wartendes Privatauto schlüpfte.
Der Mann auf dem Motorrad, der ihr folgte, mußte sehr aufpassen, aber er war äußerst findig und geschickt und blieb ununterbrochen auf ihrer Fährte.
Als Clive Boyd nach langer Fahrt gegen Mitternacht in St. John's Wood von seinem Motorrad stieg, war er sehr zufrieden, daß er wieder einmal einer seiner plötzlichen Eingebungen gefolgt war.
Er hatte sich eigentlich an diesem Abend der Persönlichkeit Wellbys widmen wollen, aber als dieser Mann mit seiner seltsamen Begleiterin aus dem Restaurant bei der County Hall getreten war, hatte das Mädchen seine besondere Aufmerksamkeit erweckt. Es bildete zu der Erscheinung des Reporters ein krasses Gegenstück, daß sich dem Detektiv unwillkürlich die Frage aufdrängte, was die beiden wohl verband, und auch sonst gab es an ihr einiges, was ihm auffiel, während er anscheinend nur mit der Bändigung seines widerspenstigen Motors beschäftigt war. Er hatte dabei einige neugierige Zuschauer, aber deren Interesse und Ausdauer waren so aufdringlich, daß er bald weghatte, worum es sich handelte.
Wellby und das junge Mädchen hatten sich kaum dreißig Schritte entfernt, als die Leute den weißhaarigen Herrn im Stich ließen, aber da der Motor plötzlich zu laufen begann, konnte auch Boyd aufsitzen. Das Rad machte zwar noch Schwierigkeiten, und er kam immer nur eine kurze Strecke vorwärts, konnte aber dabei feststellen, daß es eine regelrechte Eskorte war, die hinter dem ungleichen Paar herschritt. Er kannte keines der Gesichter, und die Leute sahen auch gar nicht bedenklich aus. Es waren durchwegs große kräftige Burschen, und der breitspurige, wiegende Gang sagte dem Detektiv, wo er sie einzureihen hatte.
Unter solchen Umständen Wellby zu folgen, war eine schwierige Sache, und diese Einsicht veranlaßte Boyd zu dem Entschluß, lieber zunächst hinter dem Bus herzurattern, den das Mädchen bestiegen hatte. Es wurde eine umständliche Fahrt auf vielen Umwegen, aber als sich das Tor des stillen alten Hauses in Brompton hinter dem Auto geschlossen hatte, bedauerte der Detektiv nicht, sie gemacht zu haben. Die Begleiterin Wellbys war unbedingt eine ebenso interessante Persönlichkeit wie dieser selbst, und während Boyd den langen Weg von Brompton hinauf nach St. John's Wood fuhr, um sich wieder einmal nach dem ›Professor‹ umzusehen, gingen ihm die mannigfaltigsten Mutmaßungen und Schlußfolgerungen durch den Kopf.
Die Paradies-Bar lag im Kellergeschoß eines nüchtern aussehenden Geschäftshauses, und es wäre für einen Fremden schwer gewesen, den Weg dorthin zu finden. Man kam zunächst in einen spärlich erhellten Flur, mußte dann einen dunklen Hof überqueren, und erst hier kündete die erleuchtete Türscheibe, die von der Hand eines phantasievollen Malers mit Adam, Eva, dem gewissen Apfelbaum und einer schauerlichen Riesenschlange geschmückt war, daß man seinem Ziele nahe sei.
Boyd kannte die Gegend und ihre Sitten und schob daher sein Rad nicht nur bis in den dunklen Hof, sondern auch noch durch die Eingangspforte zum ›Paradies‹, wo in einem kleinen Vorraum ein Hausmeister von herkulischem Wuchs ihn mit kritischen Blicken empfing. Aber kaum hatte der Ankömmling die Kappe von dem schneeweißen Scheitel genommen, als die mißtrauischen Mienen des Riesen sich zu einem ehrerbietigen Grinsen verzogen, wie er es nur für die wenigsten Stammgäste seines Lokals übrig hatte. Er erhob seine zweihundertzehn Pfund mit einer gewissen Hast aus dem massiven Stuhl, um dem Besucher bei der Unterbringung des Rades zu helfen.
»Guten Abend, Sir. Sie sind lange nicht hier gewesen. Mrs. Emerson wird sich sehr freuen.«
Es war dies die längste Rede, die Denny seit erdenklicher Zeit gehalten hatte, und sie hatte ihn sehr angestrengt, aber er wußte, daß er diesem Gentleman besondere Höflichkeit schuldig war. Nicht bloß deshalb, weil Mrs. Emerson noch tagelang mit verträumten Augen umherging, wenn dieser Gast hier gewesen war, sondern auch, weil dieser weißhaarige Herr, der kaum hundertfünfzig Pfund wiegen mochte, Dinge konnte, die selbst ihm, Denny, der doch im Ring der Schwergewichtler manchen auf die Schulter gelegt hatte, gewaltig imponierten. So vermochte dieser unscheinbare Mann mit seinen feinen weißen Händen ein Silberstück glatt entzweizubrechen, mit den Zähnen einen Stuhl aufzuheben und mit seiner Faust Schläge auszuteilen, gegen die kein Kraut gewachsen war. Denny selbst war Zeuge gewesen, wie Mac Potter, der berüchtigtste Raufbold und Messerstecher Londons seit Menschengedenken, von ihm einen solchen Hieb unter das Kinn erhalten hatte, daß er melancholisch alle Vorderzähne ausgespuckt hatte und dann wie ein Sack zu Boden gefallen war. Seit jenem Tag war der weißhaarige Herr in der Paradies-Bar eine Persönlichkeit, der die Stammgäste mit außerordentlichem Respekt begegneten, und wenn ein Neuling auch nur eine harmlose Frage nach diesem Besucher tat, so wurde er wohlwollend aufmerksam gemacht, sein Gebiß nicht unnütz in Gefahr zu bringen.
Boyd legte den wasserdichten Mantel ab, unter dem er einen tadellosen dunklen Anzug trug, und machte sich vor dem kleinen Spiegel sorgfältig zurecht.
»Großer Betrieb heute?« fragte er Denny, der ihm behilflich war.
»Wie immer«, flüsterte der ehemalige Ringkämpfer mit strahlendem Gesicht, und als Boyd die schmale Treppe hinabgestiegen war und von der Schwelle aus den Raum überblickte, fand er, daß der Portier nicht zu viel gesagt hatte. Die kleinen Logen und der Bartisch waren dicht besetzt, und in der Mitte der Diele tanzten ungefähr zwölf Paare. Es war dasselbe Bild, das alle anderen Vergnügungsstätten dieser Art boten, und beim Anblick dieser gutgekleideten Männer und Frauen, die sich tadellos benahmen, wäre niemand auf die Vermutung gekommen, daß die Paradies-Bar das bevorzugte Lokal der Größen der Londoner Verbrecherzunft war.
Der Detektiv kannte so ziemlich alle Gesichter und wußte, was jeder dieser harmlos aussehenden Herren und jede dieser eleganten, koketten Damen auf dem Kerbholz hatte, und er berechnete lächelnd, daß diese illustre Gesellschaft insgesamt wohl auf mindestens zweihundert Jahre Gefängnis zurückblicken konnte. Von dem kleinen Kreis, dem eigentlich sein heutiger Besuch galt, gewahrte er aber zu seiner Enttäuschung niemanden, und als er den schmalen Gang hinter den offenen Logen langsam entlangschritt, sagte er sich, daß er entweder zu früh oder überhaupt vergeblich gekommen war.
So unauffällig Boyd seinen Auftritt auch vollzogen hatte, war er doch nicht unbemerkt geblieben. Sogar die tanzenden Paare wandten den Kopf nach dem eleganten weißhaarigen Herrn, der zwar hier kein Fremder war, dessen Erscheinen aber immer ein Ereignis bedeutete. Man wußte bis heute nicht genau, ob er zum eigenen oder zum feindlichen Lager gehörte, aber alle diese schweren Jungen hatten instinktiv das Gefühl, daß sie sich nicht mit ihm messen konnten. Nicht nur wegen seiner unangenehmen Schlagfertigkeit, sondern vor allem, weil die Vornehmheit und Ruhe, die an den Tag zu legen ihnen oft so schwerfiel, bei ihm echt waren.
Das fand auch Mrs. Emerson, und deshalb hatte sie Boyd eine Sonderstellung unter ihren Gästen eingeräumt. Wenn er kam, erschien sie selbst in der Bar, die sie sonst nur von ihrem Büro aus leitete, und das war dann auch für die anderen Gäste stets ein besonderes Ereignis. Denn die schöne, schlanke Frau mit den wunderbaren Augen war für diese hartgesottene Gesellschaft eine Erscheinung aus einer anderen Welt, und wehe dem, der gewagt hätte, ihr irgendwie nahezutreten. Selbst die Damen mußten sich hüten, eine anzügliche Bemerkung über Mrs. Emerson zu äußern, da sonst ihre Kavaliere böse wurden.
Boyd hatte noch nicht das Ende des Saales erreicht, als ihm die Besitzerin auch schon mit einem herzlichen Lächeln entgegenkam.
»Ich dachte schon, Sie würden sich überhaupt nicht mehr sehen lassen«, begrüßte sie ihn, und das wehmütige Lächeln um ihren Mund sagte ihm, wie nahe ihr das gegangen wäre. »So lange sind Sie noch nie ausgeblieben. Volle fünf Wochen und drei Tage.«
Sie errötete wie ein junges Mädchen, weil er sie so überrascht anblickte, und ließ es gerne geschehen, daß er ihre Hand in der seinen behielt, während sie weiterschritten.
»Daran sind die dummen Geschäfte schuld«, sagte er etwas verlegen. »Aber wenn ich gewußt hätte...«
Sie ließ ihn nicht ausreden, sondern drängte ihn in eine Loge, die eben von einigen Gästen geräumt wurde. Man fand es selbstverständlich, daß Mrs. Emerson in ihrem Etablissement einen guten Platz beanspruchen konnte, und rechnete es sich zur besonderen Ehre an, ihr ihn abtreten zu dürfen.
»Die Sache macht sich, wie ich sehe«, meinte der weißhaarige Herr, indem er in den überfüllten Raum blinzelte, wo die teuersten Getränke serviert wurden.
Die hübsche Frau hob mit müdem Lächeln die Schultern.
»Oh, darüber kann ich wirklich nicht klagen. Aber ich wünschte, daß...« Sie vollendete nicht, sondern sah mit einem traumverlorenen Blick an ihm vorüber.
»Haben Sie gute Nachrichten von Ihrer Tochter?« fragte er mit warmer Anteilnahme, und sie wurde plötzlich sehr lebhaft.
»Danke, ja. Das Kind schreibt mir begeisterte Briefe, und es ist mir eine Beruhigung, sie in so guter Hut und in einer solchen Umgebung zu wissen.«
Boyd hatte etwas für diese seltsame Frau übrig, sogar mehr als seinen Beziehungen dienlich war. Es verging kein Tag, an dem es ihn nicht nach St. John's Wood gezogen hätte, aber er war ein korrekter, nüchterner Mann, der den Verhältnissen Rechnung trug. Je mehr Zwang er sich auferlegen mußte, desto näher ging ihm das Schicksal dieser stillen, feinen Frau, die die grausame Ironie des Lebens zur Inhaberin einer Verbrecherbar gemacht hatte. Nach dem Tode ihres Gatten, der in Flandern gefallen war, hatte Mrs. Emerson nach einer Gelegenheit gesucht, die ihr und ihrem Kind einen Lebensunterhalt bieten konnte, und in ihrer Unerfahrenheit war ihr die Paradies-Bar als diese Gelegenheit erschienen, deren Erwerb sie mit ihren bescheidenen Mitteln gerade noch erschwingen konnte. Hier hatte sie dann, in ihren Hoffnungen betrogen und an der Zukunft verzweifelnd, monatelang vor leeren Tischen gesessen, bis eines Nachts eine Bande nach einem glücklichen Raubzug in dieses leere, stille Lokal eingefallen war. Die Leute fanden hier alles, wie sie es wünschten, und wie auf ein geheimes Losungswort kam ein Gast nach dem anderen plötzlich die enge, steinerne Treppe herunter, und zuweilen hatte sie Mühe, für die Menge der Besucher Platz zu schaffen.
Es währte lange, bis sie zu der erschreckenden Erkenntnis kam, welchen Kreisen die Gäste angehörten. Erst als die Polizei einmal mit drohenden Revolvern im Eingang stand und die so harmlos aussehenden Herren und sogar einige ihrer eleganten Begleiterinnen etwas betreten, aber mit sichtlicher Übung, gehorsam die Hände erhoben, wurde ihr dies klar.
Von diesem Tag datierte ihre nähere Bekanntschaft mit dem liebenswürdigen weißhaarigen Herrn, der, einsam und nachdenklich wie immer, an einem der Tische gesessen und gleich den übrigen rasch die Hände hoch genommen hatte. Als zwei der Gentlemen abgeführt worden waren und ein grimmiger Polizeioffizier die an allen Gliedern zitternde Barinhaberin in ihrem Büro sehr unsanft ins Gebet nahm, steckte der Herr plötzlich den Kopf herein und hatte mit dem Beamten eine längere leise Unterredung, worauf man Mrs. Emerson mit einem Male viel rücksichtsvoller und netter behandelte.
Für die völlig verstörte Frau bedeutete diese Episode einen furchtbaren Schlag, aber wenn sie nicht alles, was sie besaß, aufs Spiel setzen wollte, konnte sie nicht mehr zurück. Sie tat nach wie vor so, als ob sie nicht wüßte, wer ihre Gäste seien, und diese machten ihr das leicht, denn sie benahmen sich korrekt, und wer gerade einen kritischen Konflikt mit der Polizei hatte, vermied es um Mrs. Emersons und der übrigen Gesellschaft willen, die Paradies-Bar aufzusuchen. Nur Mac Potter hatte sich nicht daran gehalten und war erschienen, obwohl man ihm dicht auf den Fersen war, und im letzten Augenblick hatte er auch noch den Streit mit dem weißhaarigen Herrn begonnen, der für ihn so übel enden sollte.
Seither war es zu keinem Zwischenfall mehr gekommen, aber Mrs. Emerson konnte den Augenblick nicht erwarten, wo sie dieses gefährliche Geschäft ohne Schaden losschlagen konnte. Nun schien diese Möglichkeit nahe, und sie überlegte, ob sie ihrem Gast davon Mitteilung machen sollte. Er war der einzige, den sie in ihre Privatverhältnisse einigermaßen eingeweiht hatte, und schließlich hatte er sogar ein gewisses Recht darauf, von der Sache zu erfahren, denn sonst konnte es geschehen, daß er sie überhaupt nicht mehr hier antraf, wenn er wieder einmal längere Zeit ausblieb...
Mrs. Emerson begann bei diesem Gedanken schwer zu schlucken.
»Ich werde vielleicht schon demnächst verkaufen«, flüsterte sie ihm vertraulich zu und beobachtete mit einem schüchternen Blick, wie er diese Nachricht aufnehmen würde.
Er schien gar nicht überrascht, sondern nickte nur, aber dann sah er sie forschend an. »Nichts übereilen, Mrs. Emerson«, meinte er eindringlich. »Nur wenn das Angebot gut und das Geld wirklich sicher ist, würde ich Ihnen dazu raten. Sonst warten Sie lieber noch zu.«
»Man bietet mir eine große Summe«, vertraute sie ihm mit wichtiger Miene an. »Viel mehr, als ich je zu bekommen hoffte.«
»Wer?«
»Der Professor.«
Boyd lehnte sich in seinem Stuhl zurück und nippte bedächtig an seinem Cocktail. »Der Professor«, wiederholte er mechanisch. »Ich habe mich schon gewundert, ihn nicht hier zu sehen. Er war doch sonst täglicher Gast.«
»Das ist er noch, aber er kommt jetzt immer erst spät. Er scheint sehr viele Geschäfte zu haben.«
»Wissen Sie etwas davon?«
Sie beantwortete die gleichgültig klingende Frage mit einem zögernden Achselzucken und sah sich eine Weile im Lokal um. Dann beugte sie sich plötzlich über den Tisch, und während ihre Finger glättend über das Tuch strichen, flüsterte sie: »Man hat ihn im Verdacht, daß er mit der ›Königin der Nacht‹, wie sie sie nennen, in Verbindung steht. Ich kümmere mich zwar nicht um das, was hier gesprochen wird, aber manches dringt doch zu mir. Besonders wenn es die Leute so beschäftigt wie diese Sache. Fast jede Woche gibt es einen neuen Fall, der sie in Angst und Schrecken versetzt.«
Der weißhaarige Herr zog bedächtig seine Zigarettendose heraus und bot Mrs. Emerson höflich eine Zigarette an.
»Da muß es sich allerdings um etwas ganz Außergewöhnliches handeln.«
»Gewiß«, bestätigte sie, und man merkte kaum, daß sie die Lippen bewegte. »Niemand vermag sich zu erklären, wie es dabei zugeht, und das verbreitet eine lähmende Furcht. Wenn wieder etwas geschehen ist, herrscht hier manchmal stundenlang Totenstille, und die einzelnen Gruppen stecken die Köpfe zusammen wie die Schafe bei einem Gewitter.«
Für Boyd waren das interessante und äußerst wichtige Neuigkeiten, aber er wußte sich zu beherrschen.
»Hat Ihnen der Professor bezüglich der Kaufsumme irgendwelche Garantien geboten?« fragte er abschweifend.
»Jawohl. Er will mit mir bei einem Anwalt, den ich mir wählen kann, einen regelrechten Kaufvertrag machen und bei der Unterschrift den Betrag bar bezahlen. Wir sind bereits völlig einig, und es liegt nur an mir, das letzte Wort zu sprechen.«
Der Detektiv strich sich nachdenklich über das glatte Kinn.
»Tun Sie es bald, Mrs. Emerson. Am besten schon morgen oder spätestens übermorgen.«
Sie sah ihn betroffen an.«
»Weshalb?«
»Weil er sich die Sache vielleicht überlegen könnte oder...« Der weißhaarige Herr vollendete nicht, sondern stieß den Rauch seiner Zigarette umständlich aus. »Jedenfalls tun Sie, wie ich Ihnen rate. Sie sind damit das Geschäft, das doch nicht zu Ihnen paßt, glücklich los und haben genügend Mittel, um etwas anderes beginnen zu können.«
Sie nickte lebhaft und blickte ihn dankbar an.
»Sie haben recht, und ich werde Ihnen folgen. Der Professor wird ja gewiß heute wieder darauf zu sprechen kommen, und ich werde ihm also endgültig zusagen. Das wird das beste sein, denn bei der Stimmung, die gegen ihn herrscht, ist es möglich, daß ihm eines Tages etwas widerfährt, und dann hätte ich wirklich das Nachsehen.«
»Was hat er verbrochen?« fragte Boyd harmlos.
»Nun, eben wegen der ›Königin der Nacht‹«, erklärte sie im Flüsterton. »Man behauptet, daß er für sie die Gelegenheiten ausspioniert. Das ist ihm ja bei seinem Verkehr ein leichtes. Und dann hat sie nur den Leuten ihre Beute abzunehmen.«
Er sah sie mit einem verständnislosen Kopfschütteln an, und die hübsche Frau geriet in Eifer.
»Das geht nun schon einige Monate so. Haben Sie vielleicht von dem Raub in der City Bank gehört?«
»Flüchtig«, bemerkte er leichthin.
»Sehen Sie, das war einer der ersten Fälle, aber man ist erst viel später auf die seltsamen Zusammenhänge aufmerksam geworden. Die Polizei wußte die längste Zeit nicht, wer den Einbruch verübt hatte, den Leuten hier war es jedoch bekannt, und man wunderte sich, daß die drei Täter plötzlich spurlos verschwunden waren. Und als eines Nachts irgendwer die Nachricht brachte, daß die Burschen aus der Themse gezogen worden seien, war das Rätsel noch größer. Was war geschehen und wo war die Beute geblieben? Ich glaube, es waren an dreißigtausend Pfund. Man zerbrach sich darüber lange den Kopf, bis die zweite Sache kam. Der rote John und noch einer hatten einen Juwelierladen in Belgravia ausgeplündert, aber als sie sich mit vollen Taschen davonmachen wollten, trat ihnen plötzlich eine maskierte Gestalt mit einer Mondsichel und drei Sternen auf der Stirn in den Weg, machte eine rasche Bewegung mit dem Arm, und John stürzte, wie vom Blitz getroffen, zu Boden. Sein Begleiter aber bekam es so mit dem Entsetzen zu tun, daß er davonlief. Er hat dann die Geschichte überall herumerzählt, und seither ist die ›Königin der Nacht‹ der Schrecken der ganzen Londoner Unterwelt. Die Leute trauen sich nicht mehr etwas Größeres zu unternehmen, weil sie nicht nur für die Beute, sondern auch für ihr Leben fürchten müssen. Die ›Königin der Nacht‹ soll wie ein Schatten auftauchen und ebenso rasch wieder verschwinden, und die Angst vor ihr ist so groß, daß schon wiederholt Einbrecher alles von sich geworfen und die Flucht ergriffen haben, weil sie den Schleier mit der Mondsichel und den drei Sternen zu erblicken glaubten.«
»Und warum bringt man gerade den Professor mit diesen Geschichten in Verbindung?« wollte Boyd wissen, aber Mrs. Emerson konnte darauf keine bestimmte Antwort geben.
»Das vermag ich nicht zu sagen. Ich merke nur, daß man ihm in der letzten Zeit sehr mißtrauisch begegnet. Selbst die leiseste Unterhaltung verstummt, wenn er das Lokal betritt. Das war früher nicht so. Er hat im Gegenteil hier immer das große Wort geführt, und jeder hat sich an seinem Tisch Rat geholt.« Sie sah den weißhaarigen Herrn mit ihren großen schönen Augen vielsagend an. »Er soll ja in gewissen Dingen sehr geschickt sein. — Nun sitzt er meistens allein oder mit einigen seiner Kreaturen und schneidet der übrigen Gesellschaft höhnische Grimassen. Er weiß offenbar, daß man etwas gegen ihn hat, kümmert sich aber nicht darum. Er reizt sogar die Leute noch, indem er herausfordernde Bemerkungen macht und mit dem Geld nur so um sich wirft. Man erzählt sich auch, daß er in Hackney ein kleines Haus gekauft haben soll, und dieser plötzliche Wechsel in seinen Verhältnissen, den man sich nicht erklären kann, hat wahrscheinlich den Verdacht auf ihn gelenkt. Ich glaube, man hätte ihm längst etwas angetan, wenn man ihn und die ›Königin der Nacht‹ nicht so fürchten würde.«
Mrs. Emerson war froh, daß sie endlich einmal mit jemandem von der Sache sprechen konnte, denn sie fühlte sich mehr beunruhigt, als sie sich selbst gestehen wollte. Die ganze Atmosphäre um sie herum war von einer kritischen Spannung erfüllt, und der geringste Anlaß konnte eine Entladung bringen.
Das sagte sich auch Boyd, und während er mit gleichgültiger Miene dasaß, überlegte er, was zu tun wäre, um die Frau davor zu bewahren, daß sie von der Katastrophe in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Dinge, die sie ihm erzählt hatte, waren für ihn weit weniger rätselhaft und überraschend, als sie sich anhörten. Sie bestätigten nur eine Vermutung, die er schon längst gehegt hatte, und er war auch überzeugt gewesen, in der Paradies-Bar irgendeinen Anhaltspunkt für die Richtigkeit seiner Annahme zu finden. Seitdem ihm Hanson, der große, dicke Mann, vor dem Cartwright-Haus aufgefallen war, ahnte er, daß dessen Chef, der ›Professor‹, die Hand irgendwie im Spiel hatte, und die Persönlichkeit Cummings', dieses entgleisten Genies, ließ ihn plötzlich in den geheimnisvollen Fällen der ›Königin der Nacht‹ viel klarer sehen. Was ihm noch an Zusammenhängen gefehlt hatte, ging aus dem aufgeregten Bericht der jungen Frau hervor. Boyd sah nach der Uhr.
»Glauben Sie, daß Cummings bald erscheinen wird?« fragte er. »Ich möchte Sie bei Ihrem Geschäft nicht stören, denn es ist wirklich sehr dringend.«
Der Nachdruck, mit dem er dies sagte, machte sie unruhig, und sie bemühte sich, in seinem Gesicht zu lesen, begegnete aber nur einem harmlosen Lächeln.
»Das läßt sich schwer sagen«, erwiderte sie. »Er kann jeden Augenblick hier sein, es kann aber auch noch eine Stunde vergehen. Er ist jetzt ziemlich unpünktlich.«
Sie hatte gehofft, daß ihn diese Bemerkung veranlassen würde, noch eine Weile zu bleiben. Aber Boyd enttäuschte sie. Er hatte ihr bereits die Hand gereicht und war im Begriff, das Lokal zu verlassen, als er plötzlich noch einmal zurückkam.
»Es wäre möglich, Mrs. Emerson«, meinte er leichthin, »daß Sie in den nächsten Tagen vielleicht eines Rates oder Beistandes bedürfen. Dann rufen Sie mich einfach an.« Er schrieb seine Telefonnummer auf den Rand einer Getränkekarte. »Sie können mich jederzeit erreichen. Wenn ich aber nicht zu Hause sein sollte, so sagen Sie der Person, die sich melden wird, nur ruhig, was Sie wünschen. Ich werde es dann raschestens erfahren.«
Er nickte ihr nochmals freundlich zu, und sie sah ihm mit verträumten Augen nach, bis er verschwunden war. Dann trennte sie die Nummer von der Karte und ging in ihr Kontor.
Der Detektiv war bereits in seinen Mantel geschlüpft, als er sich plötzlich entschloß, sein Motorrad in der Obhut Dennys zu lassen, um möglichst unauffällig aus dem Haus zu kommen. Schon auf dem dunklen Hof zeigte es sich, daß er gut daran getan hatte, denn als er von dem Flur des Vorderhauses her Schritte vernahm, konnte er sich bequem in einen Winkel drücken, um die Kommenden an sich vorüber zu lassen. Die beiden Männer machten wenige Schritte vor ihm halt, und obwohl er nur die Umrisse wahrzunehmen vermochte, wußte er doch sofort, wen er vor sich hatte.
»Tu, was du willst«, sagte der Kleinere gereizt, »aber komm mir nicht mit Drohungen. Du solltest doch schon wissen, daß das bei mir nicht verfängt. Hundert solche Burschen wie ihr bringen mich nicht ins Mauseloch. Was geht mich überhaupt die ganze Geschichte an? Ich habe dir und den anderen doch nur ein Geschäft zugeschanzt...«
»Ein schönes Geschäft«, knurrte sein großer, dicker Begleiter. »Ed hat es den Arm gekostet. Man hat ihn ihm gestern abgenommen. Und dafür verlangt er natürlich nun Schmerzensgeld und hält sich an mich. Es war ja wirklich auch ein Bettel, den wir für diese verdammte Geschichte bekommen haben.«
»Es war viel zuviel für eure Stümperei«, gab der andere höhnisch zurück, »und ich wünschte, Ed hätte den Hieb statt auf den Arm auf seinen albernen Schädel bekommen.«
»Mit fünfzig Pfund läßt sich die Sache aus der Welt schaffen«, drängte der Große. »Du weißt, wie es um dich steht, und ich an deiner Stelle möchte mir nicht noch mehr Feinde machen. Dabei soll es nicht einmal aus deiner Tasche gehen. Sage mir nur, wo der Mann, für den wir gearbeitet haben, zu finden ist. Ich werde alles selbst in Ordnung bringen. Daß wir nicht zufrieden sind, habe ich ihn schon wissen lassen, als wir nach der Geschichte an dem vereinbarten Ort zusammentrafen. Er hat auch versprochen, etwas zuzulegen, hat sich aber seither nicht mehr blicken lassen. Nun will ich ihn zu fassen kriegen, und du mußt mir dabei behilflich sein. Das bist du uns schuldig.«
Die schmächtige Gestalt ließ ein aufreizendes Lachen hören und machte einige Schritte gegen den Eingang zur Bar.
»Hol dich der Teufel mit deinem ›schuldig‹«, stieß er zwischen den Zähnen« hervor. »Wenn ich euch etwas schuldig bin, so eine gehörige Tracht Prügel, daß ihr euch so jämmerlich verhauen ließet. Feine Garde! Wenn ich mir ein paar alte Weiber zusammentrommle, so machen die es besser. Nur wenn es ums Geld geht, da seid ihr tüchtig. Aber wenn der Mann noch etwas herausrücken will, kann es mir recht sein. Du mußt ihn dir suchen, denn meine Kunden pflegen nicht ihre Visitenkarte mit der Adresse zu hinterlassen. Wenn du etwas mehr Grütze in deinem Riesenschädel hättest, könntest du dir das denken.«
Er stand bereits vor der erleuchteten Tür, und zwischen Adam, Eva und der Schlange erschien ein hageres Gesicht mit einem gepflegten dunklen Bart und tiefliegenden Augen.
»Und jetzt komm herein, aber nicht ein Wort mehr von dieser Sache. Ich habe genug davon.«
Der große, dicke Mann rührte sich nicht vom Fleck.
»Nein«, gab er trotzig zurück. »Es ist keine besondere Ehre mehr, sich mit dir zu zeigen. Man verdirbt sich's nur mit den andern. Und wenn du dich so gegen deine Leute verhältst, lohnt es sich nicht, deinetwegen etwas zu riskieren. Den gewissen Herrn aber werde ich auch ohne dich finden«, schloß er drohend und ging mit schweren Schritten davon.
»Viel Glück«, rief ihm der Schmächtige nach und griff nach der Türklinke, ließ jedoch plötzlich die Hand sinken und ging leise hinter dem anderen her.
Boyd heftete sich blitzschnell und wie ein Schatten an seine Fersen, aber kaum erreichte er das Vorderhaus, da sah er den ›Professor‹ vor dem Tor stehen und gespannt die Gasse hinaufspähen. Plötzlich zog er eine Taschenlampe hervor, knipste sie an, beschrieb damit dreimal einen geschlossenen Kreis in der Luft und stürzte dann so schnell ins Haus, daß der Detektiv sich kaum noch in Deckung bringen konnte.
Wenige Sekunden später schoß Boyd ins Freie, aber so sehr er auch alle seine Sinne anspannte, er vermochte nichts Auffälliges wahrzunehmen. Es war eine ziemlich helle Nacht, und die Gasse war nach der einen wie nach der anderen Seite gut auf etwa fünfzig Schritte zu überblicken.
Der Detektiv nahm die Richtung, in der Cummings das Signal gegeben hatte. Kurz darauf sah er auch den großen, dicken Mann vor sich herstapfen. Hanson befand sich eben im Lichtkegel einer Straßenlampe, und Boyd vermochte seine Umrisse und auch jede seiner Bewegungen genau wahrzunehmen. Der Mann ging mit weit ausgreifenden Schritten und bog eben um eines der vorgelagerten Häuser, als er plötzlich die Arme in die Luft warf, zu taumeln begann und in sich zusammenstürzte.
Boyd ahnte sofort, daß die ›Königin der Nacht‹ kaum fünfzig Schritte vor ihm wieder einmal ihre Arbeit getan hatte, aber er wußte auch, daß dieser Vorsprung zu groß war, um ihm irgendwelche Chancen zu geben.
Er ging daher im gleichen Tempo weiter, bis er auf den Toten stieß, den er flüchtig untersuchte und den Boden Zoll für Zoll ableuchtete. Dann schüttelte er ratlos den Kopf und ließ den Schein seiner Lampe auf die dunkle Ecke spielen, aus der der Tod über den Mann gekommen sein mußte. Aber die ›Königin der Nacht‹ pflegte keine Spuren zu hinterlassen, und Clive Boyd setzte mißmutig seine Polizeipfeife an die Lippen, um die Arbeit, die hier zu tun war, anderen zu überlassen.
Selwood war der erste, der die Nerven zu verlieren drohte. Je näher der Tag kam, den die ›Königin der Nacht‹ ihm als Frist gesetzt hatte, desto unruhiger wurde er, und Evelyn Dyke nahm mit Entsetzen wahr, daß er sich kaum mehr zu beherrschen vermochte und daß er auch körperlich verfiel.
»Ich hätte dich nie für so feige gehalten, Charlie«, sagte sie etwas gereizt, als er ihr bereits zum ersten Frühstück ins Haus platzte und sofort wieder von der Sache begann.
Er sah sie mit einem bösen Blick an, der sie ängstlich machte.
»Ich bin nicht feige, aber ich habe die Geschichte satt«, erklärte er. »Was mit mir geschieht, ist mir gleichgültig. Ich wünschte nur, daß es schon vorüber wäre, denn ein solches Leben zu führen, ist ärger als alles, was kommen kann.«
Sie hatte ihn noch nie in einer derartigen Verfassung gesehen und wußte sich keinen anderen Rat, als bei Osborn Beistand zu suchen. Es war zwar erst neun Uhr morgens und ihr Beginnen daher ziemlich aussichtslos, aber sie rief trotzdem an. Zuerst kam irgendein dienstbarer Geist an den Apparat, und dann meldete sich endlich Helen, der sie den Stand der Dinge auseinandersetzte. Osborn möge doch unbedingt sofort kommen, um seinen Vetter zur Vernunft zu bringen.
Zu ihrer Überraschung erschien aber nach einer reichlichen Stunde, in der sie sich vergeblich bemüht hatte, Selwood auf andere Gedanken zu bringen, nicht Osborn, sondern Helen, die sich wie zu einer Spazierfahrt im Hyde-Park angetan hatte. Kokett drehte und wendete sie sich, daß ihr Evelyn notgedrungen einige bewundernde Worte über ihre neue Frühjahrstoilette und ihr Aussehen sagen mußte.
»Oh«, wehrte die junge Frau sehr befriedigt, aber bescheiden ab, »das ist gar nichts. Einfache Londoner Arbeit. Nur etwas über dreißig Pfund. Aber in der nächsten Woche bekomme ich ein Kostüm aus Paris, in dem ich Ihnen sicher gefallen werde. Etwas ganz Neues und Apartes. Auffallende Farben und Muster kleiden mich nämlich am besten«, versicherte sie. »Natürlich habe ich mir auch einen neuen Hut und entsprechende Schuhe bestellt. Das gehört unbedingt dazu, wenn man wirklich gut angezogen sein will. Auf die paar Pfund, die man mehr bezahlt, kommt es da nicht an und...«
Sie war sichtlich im besten Zuge, das interessante Thema ausführlich zu erörtern, aber Evelyn schnitt ihr etwas ungeduldig den Faden ab. »Was hat Osborn zu Charlies komischen Anwandlungen gesagt?« fragte sie.
Helen rückte sich umständlich im Sessel zurecht, damit King Charles es sich bequem machen konnte, und sah mit großen Augen verlegen um sich. »Natürlich hat er nichts gesagt«, kicherte sie und verkrampfte ihre Rechte im Fell des Hündchens, »weil er doch noch schläft. Vor Mittag pflegt er nie aufzuwachen. Und dann müssen wir erst warten, bis er läutet. Früher darf niemand zu ihm. Aber da ich glaubte, es sei sehr dringend, bin ich selbst gekommen. Ich werde aufmerksam zuhören und William alles genau erzählen, wenn ich nach Hause komme.«
Mrs. Dyke war von diesem Vorschlag nichts weniger als entzückt, denn es schien ihr zwecklos, die schwerfällige Frau als Vermittlerin in Anspruch zu nehmen. Osborn sollte selbst sehen, wie es um seinen Vetter stand und diesem in seiner brüsken, energischen Art die Grillen austreiben. Aber wenn ihm seine Frau erst des langen und breiten davon berichtete, würde er wohl der Sache keine besondere Bedeutung beimessen. Selwood war offenbar peinlich berührt, daß seine Stimmung zum Gegenstand einer so umständlichen Erörterung gemacht werden sollte, und seine verkniffenen Lippen und nervös zuckenden Augenlider ließen es Evelyn geraten erscheinen, ihn nicht noch mehr zu erregen.
»Es war sehr nett von Ihnen, Mrs. Helen, sich zu bemühen«, sagte sie liebenswürdig, »aber gar so sehr eilt es nicht, und es wird wohl am besten sein, wenn die Herren die Sache unter sich besprechen. Charlie kann ja Osborn am Nachmittag besuchen. Sagen wir um fünf Uhr. — Ich hoffe, daß Sie bis dahin nichts Unbesonnenes anstellen werden«, wandte sie sich mit einem gezwungenen Lächeln an Selwood.
»Was soll er anstellen?« fragte Helen mit der Lebhaftigkeit eines neugierigen Kindes und rückte erwartungsvoll auf ihrem Platz hin und her, so daß King Charles in seiner behaglichen Ruhe gestört wurde.
»Er will wieder einmal die Flinte ins Korn werfen«, erklärte Evelyn, und Mrs. Osborn sah einen Augenblick verständnislos von einem zum anderen, weil ihr nicht recht klar war, was die Geschichte von der Flinte und dem Korn zu bedeuten hatte.
»Wozu? Wieso? Warum?« fragte sie dann vorsichtig.
Mrs. Dyke vermochte sich einen belustigten Blick auf Selwood nicht zu versagen, und sogar über dessen ernste Miene glitt ein flüchtiges Schmunzeln.
»Weil ihn die Begegnung mit der ›Königin der Nacht‹ völlig außer Fassung gebracht hat. Aber darauf mußten wir ja schließlich vorbereitet sein, und ich finde die Situation heute weit weniger gefährlich als vordem. Wir haben es nun mit dem Gegner unmittelbar zu tun und können unsere Maßnahmen treffen, während wir früher stets in Sorge waren, durch irgendein Ereignis überrascht zu werden. Es war mehr als ein Wunder, daß wir durch einen glücklichen Zufall nicht nur von dem Zusammentreffen der geheimnisvollen Persönlichkeit mit Cartwright, sondern auch mit Morton erfuhren. Und nachdem diese weit größere Gefahr glücklich vorüber ist, wäre es unverantwortlich, das Spiel plötzlich verlorenzugeben.«
Evelyn hatte nur für Selwood gesprochen, aber dieser trommelte mit den Fingern ungeduldig auf der Stuhllehne.
»Ihr versteht mich nicht«, sagte er aufgeregt und gereizt, als sie geendet hatte. »Ich bin einfach soweit, daß mein Gewissen sich dagegen sträubt, länger zu schweigen und den Dingen weiter ihren Lauf zu lassen. Ich weiß, daß ich dadurch das Furchtbare nicht mehr ungeschehen machen kann, aber ich will wenigstens meinen Teil der Verantwortung tragen. Ich bin nicht so hart gesotten, um über meine Schuld hinwegzukommen. Weder für die frühere, die mir nun auf so seltsame Weise in Erinnerung gebracht worden ist, noch über jene, die ich jetzt auf mich geladen habe, um die alte Verfehlung zu verdecken. Ich gebe das Spiel nicht auf, weil ich an seinem Ausgang verzweifle, sondern weil es mich anwidert. Und wenn ich mir den letzten Schritt noch überlege«, schloß er zögernd und halblaut, »so nur deshalb, weil ich dadurch nicht allein betroffen würde.«
Er fuhr sich nervös über die Stirn, und Evelyn betrachtete ihn ängstlich, da er den Eindruck eines Menschen machte, der keine Widerstandskraft mehr hat und zu allem fähig ist.
Sogar Helen schien von der Veränderung des kraftvollen, lebenslustigen Mannes überrascht, denn sie sah ihn mit einer gewissen Scheu an und drückte sich befangen in die Kissen. Dann fühlte sie das Bedürfnis, auch etwas zu sagen, aber sie mußte sich erst umständlich die grellroten Lippen befeuchten, bevor sie den Mut dazu fand.
»Ich werde es Osborn ausrichten«, stotterte sie hastig. »Ich habe schon verstanden.« Sie dachte einen Augenblick ernsthaft nach und begann dann wie eine ablaufende Sprechmaschine weiterzuplappern. »Mr. Selwood hat gesagt, daß sich sein Gewissen sträubt und daß er nicht mehr weiterspielen will, sondern alles ausplauschen wird.« Sie blickte schüchtern von einem zum anderen, ob sie ihre Lektion auch richtig aufgesagt habe, und atmete erleichtert auf, als niemand Widerspruch erhob. Selwood starrte teilnahmslos nach der Decke, und Evelyn ließ erregt ihre Halskette durch die Finger gleiten.
Mrs. Osborn benützte die günstige Gelegenheit, sich zurechtzumachen, klemmte ihr Hündchen behutsam unter den Arm und verabschiedete sich mit einem allerliebsten Lächeln.
Evelyn fand Selwood noch immer in seiner apathischen Haltung, und zum ersten Male empfand sie gegen diesen Mann, für den sie bisher mit fast abgöttischer Hingebung gelebt hatte, Verachtung und Zorn. Es schien ihr unfaßbar und unverzeihlich, daß er im entscheidenden Augenblick versagte und mit seiner Schwäche sich und die anderen in Gefahr brachte. Es ging hierbei um alles, und sie vermochte sich nicht auszudenken, was geschehen würde, wenn er die wahnwitzige Idee, in die er sich verbissen zu haben schien, zur Ausführung brachte.
»Du beginnst eine jämmerliche Rolle zu spielen«, sagte sie hart und kalt, als sie lange vergeblich auf ein Wort von ihm gewartet hatte. »Habe ich deshalb alle die gewissen Dinge auf mich genommen und mich bloßgestellt, damit du in einer erbärmlichen Anwandlung alles zunichte machst? Weshalb hat sich dein empfindliches Gewissen nicht früher geregt? Hat es damals geschwiegen, so mußt du es eben auch jetzt zur Ruhe bringen, denn ich werde nie dulden, daß du dich und mich verdirbst, nur weil deine Nerven dich im Stich lassen. Du hattest dein Leben seit jeher nur auf Annehmlichkeit eingestellt«, fuhr sie bitter fort, »und bei der ersten großen Widrigkeit hast du es mir überlassen, für dich zu handeln. Ich habe es getan, gerne getan; hätte ich geahnt, daß du auf die Dauer nicht einmal einen passiven Widerstand aufbringen kannst, hätte ich dich ohne weiteres deinem Schicksal überlassen. Jawohl«, bekräftigte sie mit trotzig zurückgeworfenem Kopf, als sie seinem betroffenen Blick begegnete, »ich gestehe das ganz offen, und ich sage dir ebenso offen, daß du dich aufraffen mußt, wenn dir daran gelegen ist« — sie zögerte etwas, und ihre Stimme bekam einen unsicheren Klang —, »daß wir die alten bleiben. Bisher habe ich dein sonderbares Verhalten ruhig hingenommen, weil ich es einer Laune zuschrieb, wie sie über jeden einmal kommen kann, aber nun ist Schluß damit. Verstehst du mich?«
Er nickte, und auf seinem Gesicht lag so etwas wie der Versuch zu lächeln, als er sich aufrichtete und ihr die Hand entgegenhielt. Er verstand ihre Erregung und war wütend auf sich selbst, daß er sich und die anderen mit seinen Grillen quälte.
»Du hast recht«, gab er zu. »Es heißt wirklich, sich zusammenzunehmen, da es kein Zurück mehr gibt und die ›Königin der Nacht‹ ganze Arbeit zu leisten scheint.«
Er reckte sich, und Evelyn war überrascht über die gründliche Wirkung, die sie mit ihren Vorwürfen erzielt hatte.
»Nun kann man wieder mit dir reden«, sagte sie mit einem warmen Lächeln, das ihre frühere Schärfe vergessen lassen sollte. »Wir müssen die Sache wirklich einmal in aller Ruhe gründlich besprechen, damit wir uns über alles klarwerden. Du wirst dann selbst einsehen, daß die Dinge jetzt viel günstiger liegen als früher, da wir unsere Aufmerksamkeit nach allen Seiten richten mußten. Jetzt haben wir es nur mit dem Phantom zu tun und...« Sie brach mitten im Satz ab und schien sich lebhaft mit einem Gedanken zu beschäftigen, der ihr eben gekommen war. »Wir haben mit diesem Wellby einen großen Fehler begangen. Wir hätten eine Verbindung mit ihm suchen sollen, anstatt ihn kopfscheu zu machen. Wahrscheinlich wüßten wir dann heute schon manches, was uns nützlich wäre.«
»Glaubst du wirklich, daß der Mann in der Sache eine Rolle, spielt?« fragte er interessiert.
»Ich bin fest davon überzeugt. Nur über seine Absichten bin ich mir nicht im klaren, ebensowenig über die Zusammenhänge, die zwischen ihm und der rätselhaften Person bestehen. Erst nahm ich an, daß sie Hand in Hand arbeiten, aber dann kam ich auf zu viele Widersprüche. So viel steht fest, daß er ihr und unser Geheimnis kennt. Wenn ich offen sein soll, fürchte ich ihn mehr als die ›Königin der Nacht‹. Bei dieser weiß man, wessen man sich zu versehen hat, bei ihm nicht. Er hält sich im Hintergrund und schnellt nur hie und da einen Pfeil ab. Erst die eigenartige Notiz über den Tod Mortons, dann die Zeilen an mich, und je länger er mit dem nächsten Schuß wartet, desto mehr bangt mir davor. Aber ich werde ihm nicht mehr viel Zeit lassen«, erklärte sie entschieden, »sondern werde ihn so oder so zwingen, seine Karten aufzudecken.«
Selwood mußte wieder einmal den Mut dieser schönen Frau bewundern, und ihre Entschlossenheit ging auch auf ihn über.
»Sehr gut«, pflichtete er bei. »Was soll ich dabei tun?«
»Nichts«, gab sie lächelnd zurück. »Das ist Frauenarbeit. Du sollst lediglich das unnütze Grübeln aufgeben und nur darauf bedacht sein, dich von der ›Königin der Nacht‹ nicht überrumpeln zu lassen. Ich hoffe, daß du ständig eine Waffe bei dir hast?« fügte sie besorgt hinzu.
Er klopfte bedeutsam auf seine Tasche, und sie nickte zufrieden.
»Du darfst dir nicht eine Sekunde überlegen, davon Gebrauch zu machen«, schärfte sie ihm ein. »Denke an Cartwright, Morton und Bryans. Dir kann niemand einen Vorwurf machen, wenn du rasch handelst.«
Sie sah ihn vielsagend an, und der entschlossene Zug in seinem Gesicht bewies, daß er sie verstanden hatte.
Während der Fahrt zum Cartwright-Haus schmiedete Evelyn Dyke ihren Plan, und als sie mit Hyman, der wieder einmal besonders ungenießbar war, die wichtigsten Dinge durchgesprochen hatte, ging sie sofort an die Ausführung.
Mr. Fish war sehr melancholisch, denn er befand sich bereits seit einer halben Stunde mutterseelenallein im Reporterzimmer, und es wollte sich absolut keine Gelegenheit ergeben, sich in Szene zu setzen oder ein bescheidenes Geschäft zu machen. So nutzlose Stunden liebte der ›Fliegenpilz‹ nicht, und er war bereits im Begriff, sich nach einem lohnenderen Schauplatz umzusehen, als ihn durch einen Diener die Mitteilung erreichte: »Mrs. Dyke läßt Mr. Fish zu sich bitten.«
Der sommersprossige Jüngling klappte den großen Mund auf und stand einen Augenblick wie eine Steinsäule, dann steckte er den Zeigefinger der Rechten ins Ohr und begann damit heftig zu beuteln. »Sagen Sie das noch einmal«, forderte er den Boy mißtrauisch auf und erst, als er sich vergewissert hatte, daß kein Irrtum vorlag, fand er sich wieder. Sein erster Griff galt dem Hut, den er mit einem Klaps auf den Hinterkopf drückte. Er wußte, was er diesem großen Augenblick schuldig war, und wenn etwas seine Genugtuung und seine feierliche Stimmung beeinträchtigte, so war es nur, daß niemand die höfliche Einladung gehört hatte und niemand hatte sehen können, mit welch vornehmer Gelassenheit er ihr nachkam. Erst auf dem Flur gelang es dem ›Fliegenpilz‹, einen ankommenden Reporter am Knopf zu fassen und sich so einen Zeugen dieses wichtigen Ereignisses zu sichern.
»Mrs. Dyke hat mich wieder einmal zu sich gebeten«, sagte er leichthin. »Wahrscheinlich eine sehr wichtige Sache. Verbreiten Sie das im Büro, damit man weiß, wo ich bin. Vielleicht werde ich gesucht.«
Er griff mit einem Finger an den Hutrand, nickte dem Kollegen herablassend zu und überlegte, was Mrs. Dyke von ihm wollen konnte. Er stand ja sehr gut mit ihr, und sie lächelte immer liebenswürdig und vielsagend, wenn sie ihn sah, aber direkt hatte sie eigentlich noch nie mit ihm gesprochen, und daher mußte ein wichtiger Grund vorliegen, daß sie ihn so dringend zu sehen wünschte. Sollte sie vielleicht gar...
Mr. Fish verzog den breiten Mund von einem Ohr zum anderen und wiegte lächelnd den Kopf.
Nun, es war ganz gut möglich, denn er hatte an jenem Abend im Princes-Restaurant wirklich vornehm ausgesehen, und sie mußte bemerkt haben, daß er ein Mann war, der sich zu benehmen weiß. Sie war zwar nicht mehr ganz jung, aber immerhin noch eine schöne Frau, und wenn man noch in Betracht zog, wieviel ihr Wort im Cartwright-Haus galt... Jedenfalls war der gerissene Jüngling entschlossen; nicht unbedingt ›nein‹ zu sagen, und das weitere würde man ja sehen.
»Verzeihen Sie, daß ich Sie bemüht habe«, empfing ihn Mrs. Evelyn mit einem berückenden Lächeln. »Ich möchte Sie um eine große Gefälligkeit bitten.«
Mr. Fish legte seinen Hut auf den Schreibtisch und gab durch eine ausdrucksvolle Geste zu verstehen, daß von einer Bemühung keine Rede sein könne und daß er selbstverständlich zur Verfügung stehe.
Mrs. Dyke kam sofort auf ihr Anliegen zu sprechen.
»Wie Sie vielleicht schon gehört haben, pflege ich hie und da einige der Damen und Herren unserer Blätter zu mir zu laden. Leider muß ich mich dabei sehr beschränken, denn mein Haus ist nicht allzu geräumig, und ich kann nur wenige Gäste auf einmal empfangen. Deshalb bitte ich die Herrschaften immer gruppenweise, und nächstens möchte ich vor allem Sie, Mr. Fish, einmal bei mir sehen.«
Der Reporter war ganz Ohr, und als sein Name fiel, begann er sich feierlich mit dem Oberkörper zu wiegen.
»Es wird mir eine besondere Ehre sein«, versicherte er eifrig.
»Selbstverständlich erhalten Sie noch eine schriftliche Einladung«, fuhr Mrs. Evelyn fort, und Mr. Fish nahm dies mit besonderer Befriedigung zur Kenntnis, »bis ich die Liste meiner Gäste zusammengestellt habe. Hierzu erbitte ich Ihre Mithilfe. Ich kenne leider die jüngeren Mitglieder der Redaktion zu wenig und möchte nicht irgendwelche Verstimmung hervorrufen. — Damit wir Zeitungsleute nicht in das langweilige Fachsimpeln geraten, werde ich auch noch einige andere Bekannte bitten, insgesamt etwa acht Personen. Von unseren Herren also zunächst Sie, dann Mr. Lawton, der auch noch nie bei mir war — aber weiter müssen Sie mir helfen. Ich weiß eigentlich nur noch von jenem Herrn, der über den Fall Morton berichtet hat. Wie heißt er doch gleich?«
Der ›Fliegenpilz‹ wackelte sehr kritisch mit dem Kopf und blähte seine Nasenflügel.
»Wellby«, half er widerwillig nach, aber plötzlich kam ihm ein Einfall, und er war mit einemmal Feuer und Flamme. »Ausgezeichnet«, bemerkte er. »Ich kann Ihnen zwar nicht garantieren, wie er sich benehmen wird, denn es ist nicht jedem gegeben, sich in großer Gesellschaft tadellos zu bewegen, aber was kann schließlich passieren? Höchstens blamiert er sich vor den Leuten, was ihm nicht schaden würde. Zu meinem Kopf möchte ich mir seine Aufgeblasenheit wünschen. Aber ich habe ihn unlängst gründlich hineingelegt«, stellte er befriedigt fest.
Der smarte Jüngling grinste Mrs. Evelyn vergnügt an, die ein derartiges Interesse verriet, daß er nicht umhin konnte, ihr die Geschichte von dem Notizbuch von Miss Avery zu erzählen, wobei er betonte, daß er die hebräischen Schriftzeichen selbstverständlich nicht habe entziffern können. Mrs. Dyke hörte wirklich aufmerksam zu und sah ihn lange schweigend an.
»Vielleicht sollte ich da auch an Miss Avery eine Einladung schicken?« meinte sie endlich.
Der ›Fliegenpilz‹ fand diese Idee offenbar nicht sehr glücklich, und sein Gesicht verriet die Bedenken, die er hegte.
»Sie ist nicht gerade schön, wenn Sie sie nicht kennen sollten«, wandte er ein. »Das heißt, von schön darf man da überhaupt nicht reden. Aber wenn es Ihnen nichts ausmacht, mir kann es recht sein«, schloß er großmütig.
»Das wären also drei«, bemerkte Mrs. Dyke, und in demselben Augenblick fiel Mr. Fish auch schon ein vierter Mann ein. Er war seinem neuen Freund unbedingt eine Revanche für den reizenden Abend schuldig, und auf diese Weise kostete ihn die Sache nicht einen Penny.
»Laden Sie noch Mr. Boyd ein«, schlug er daher vor. »Der Herr ist zwar nur Externist bei uns, aber in jeder Beziehung ein Gentleman. Vielleicht haben Sie ihn mit mir im Princes-Restaurant gesehen. Wir pflegen dort sehr oft zusammen das Dinner einzunehmen. Ein entzückender Mensch! Ehemaliger Diplomat, wie ich gehört habe«, flocht er vertraulich ein, »aber er selbst ist zu bescheiden, um davon zu sprechen.«
Mrs. Evelyn war sehr begierig, diesen netten Mann kennenzulernen, und Mr. Fish verabschiedete sich hochbefriedigt. Sie hatte zwar nicht direkt von dem gesprochen, was sie auf dem Herzen hatte, aber er kannte die Frauen und wußte, daß sie nie den geraden Weg einschlugen. Wahrscheinlich würde sie erst an dem gewissen Abend etwas mehr aus sich herausgehen, und er würde es ihr so leicht als möglich machen.
Der ›Fliegenpilz‹ war an diesem Vormittag noch lauter als sonst und kam überhaupt nicht zur Ruhe. Immer wieder stellte sich ein Kollege im Reporterzimmer ein, der noch nicht gehört hatte, wie liebenswürdig Mrs. Dyke eine halbe Stunde lang zu Mr. Fish in ihrem Kontor gewesen war, und je öfter der junge Mann diese Geschichte erzählte, desto länger und bedeutsamer wurde sie. Man sah ihm allmählich an, wie sehr es ihm widerstrebte, die allgemeine Wißbegierde zu befriedigen, aber er zwang sich doch zu einer Wiederholung, als endlich der lang erwartete Wellby erschien. Dieser tat natürlich wieder so, als ob ihn die Sache nicht interessierte, und Mr. Fish fand dies so unerhört, daß er seinen Trumpf viel früher ausspielte, als er beabsichtigt hatte. Er zog plötzlich seine abgegriffene Brieftasche, nahm mit gespitzten Fingern eine Pfundnote heraus und legte sie wortlos vor Wellby hin.
»Was soll das?« fragte dieser kühl und hob die Brauen hoch.
»Ein Pfund, daß Sie in den nächsten Tagen von einer schönen Frau eine Einladung erhalten werden.«
Wellby zuckte mit den Achseln und sah wieder in seine Zeitung.
»Ausgeschlossen.«
Der ›Fliegenpilz‹ stieß kurz die Luft aus den Wangen. »Ein Pfund habe ich gesagt. Halten Sie?«
»Meinetwegen, ich halte«, sagte Wellby etwas ungeduldig, und er war seiner Sache offenbar so sicher, daß er den Schein aus der Westentasche kramte, worauf Mr. Fish ihn samt seinem Einsatz sofort in der Brieftasche verschwinden ließ. Das schien selbst dem gelassenen Reporter zu viel zu sein. »Erlauben Sie«, wandte er befremdet ein, »was soll das heißen?«
Der ›Fliegenpilz‹ war bereits an der Tür und drückte seinen Hut noch etwas mehr auf die abstehenden Ohren.
»Das soll heißen, daß Sie verloren haben«, sagte er hastig über die Schulter. »Sie werden von Mrs. Dyke eine Einladung erhalten. Ich habe Sie vorgeschlagen und selbst auf die Liste gesetzt. Die Sache geht in Ordnung.«
Unterwegs traf er auch noch Miss Avery, und wenn er von dem unschönen Mädchen auch nicht gerade entzückt war, so glaubte er der Kollegin die interessante Neuigkeit von dem Plauderstündchen mit Mrs. Dyke doch nicht vorenthalten zu dürfen. Auch daß er sich für ihre Einladung sehr eingesetzt habe, bemerkte er nebenbei, aber er war zu sehr Gentleman, um von einer Dame für diesen Dienst eine Gegenleistung zu verlangen, sei es auch nur in Form einer ganz fairen Wette.
Miss Avery war von der Mitteilung sichtlich überrascht, aber bevor sie noch recht begriffen hatte, war Mr. Fish bereits davongeeilt, und sie hätte doch gerne etwas Näheres erfahren.
Seltsamerweise kam Wellby ganz unvermittelt auf die Sache zu sprechen, als sie im Reporterzimmer allein geblieben waren.
»Ich nehme an, daß Sie auch eine Einladung von Mrs. Dyke erhalten sollen. Werden Sie hingehen?«
Sie sah ihn etwas erstaunt an und überlegte eine Weile.
»Ich weiß noch nicht. Offen gestanden hielt ich die Bemerkung von Mr. Fish für einen Scherz.«
Wellby schüttelte den Kopf.
»Nein. Es ist ernst.«
Sie glaubte, in seinen Worten einen eigenartigen Unterton mitklingen zu hören, und versuchte, in seinen Mienen zu lesen, aber er beschäftigte sich angelegentlich mit seiner Zigarette, und sie begann plötzlich leise zu lachen.
»Können Sie sich das vorstellen? Ich glaube, ich würde mich nicht gerade vorteilhaft ausnehmen. Außerdem habe ich nichts anzuziehen«, fügte sie hastig hinzu, als sie seinen Blick auf sich gerichtet fühlte.
»Trotzdem sollten Sie sich nicht ausschließen«, meinte er. »Mrs. Dyke legt sicher größten Wert darauf, daß Sie kommen.«
Sie kramte eine Weile in ihrer Aktentasche.
»Ich werde es mir noch überlegen«, sagte sie dann und wollte sich verabschieden, aber er hielt sie an der Hand zurück.
»Einen Augenblick noch. Wir machen also morgen die verabredete Partie auf der Themse. Und da Sie es nicht anders wünschen, treffen wir uns um neun Uhr beim Battersea Park. Von dort fahren wir mit einer Droschke nach Mortlake.«
»Sie werden sich meinetwegen noch ruinieren«, spottete sie, und ihre undurchdringlichen Augengläser starrten ihn herausfordernd an. »Glauben Sie übrigens, daß ich es wagen darf, eine Hose anzuziehen?« fragte sie plötzlich. »Ich glaube, ich habe so etwas in meinen Sachen. Eine Freundin hat sie mir einmal zurückgelassen...«
»Wagen Sie es immerhin. Wenn es zu schrecklich sein sollte, werde ich es Ihnen schon sagen.«
»Grobian«, gab sie empört zurück und rümpfte das feine Naschen. »Also, morgen um neun Uhr...«
Sie nickte kurz und schlürfte mit hängenden Schultern davon.
Wellby ließ seinen Blick nicht von ihren Füßen und lächelte befriedigt, als sie dies zu fühlen schien und immer unruhiger zu trippeln begann, bis sie fast fluchtartig durch die Tür schoß.
Boyd saß, frisch und rosig wie immer, am Schreibtisch und telefonierte mit Mrs. Emerson, die ihm erregt eine Menge Neuigkeiten mitteilte.
Sie habe eben vor einer Stunde den Verkauf abgeschlossen und auch tatsächlich den vollen Betrag richtig erhalten...
»Was haben Sie mit dem Geld gemacht?« fragte der Detektiv lebhaft.
»Es liegt bereits auf der Bank.«
»Sehr gut«, bemerkte er beruhigt, und die hübsche Frau am anderen Ende der Leitung konnte in ihrem Bericht fortfahren.
Sie sei sehr froh darüber, denn gestern nacht habe sich in unmittelbarer Nähe der Bar wieder ein geheimnisvoller Vorfall ereignet, indem einer der Freunde des ›Professors‹ tot aufgefunden worden sei. Und es wäre im Lokal zu offenen Feindseligkeiten gegen diesen gekommen, als die Sache bekannt wurde. Man sei nämlich fest davon überzeugt, daß dabei wiederum die ›Königin der Nacht‹ die Hand im Spiele gehabt habe.
Die aufgeregte Mrs. Emerson machte eine Atempause, und Boyd fand Gelegenheit, zu Worte zu kommen.
»Ich freue mich, daß Sie das unangenehme Geschäft glücklich losgeworden sind«, sagte er. »Was werden Sie nun tun?«
Er vernahm im Telefon ein leises Lachen. »Zunächst einmal gar nichts, denn ich kann mir das nun erlauben. Das heißt, morgen oder übermorgen fahre ich zu meiner Tochter«, fuhr sie glückselig fort. »Ich habe ja das Kind über ein halbes Jahr nicht gesehen. Und nach den Ferien werde ich sie überhaupt bei mir behalten.«
Der weißhaarige Herr machte ein sehr ernstes Gesicht und war so in Gedanken, daß ihn erst ein mehrmaliges verwundertes »Hallo« wieder aufzurütteln vermochte.
»Jawohl, ich bin noch am Apparat«, bestätigte er. »Entschuldigen Sie — eine kleine Ablenkung —, wo kann man Sie denn erreichen?«
Sie lispelte etwas verlegen ihre Adresse und ihre Telefonnummer in den Apparat, und er beeilte sich, beides zu notieren.
»Sie gestatten doch, daß ich mich gelegentlich erkundige, wie es Ihnen geht?«
»Ich werde mich sehr freuen«, kam es schüchtern zurück, und das Gesicht Boyds wurde noch rosiger.
»Ich glaube, daß Cummings mit dem Kauf der Bar ein schlechtes Geschäft gemacht haben dürfte«, meinte er plötzlich. »Nachdem die Leute ihm mißtrauen, werden sich die bisherigen Gäste wahrscheinlich rasch verlieren.«
»Oh, er behauptet, daß er nur vermittelt habe. Der Name des Käufers ist in dem Vertrag vorläufig offengeblieben. Es soll niemand wissen, daß die Sache durch ihn zustande gekommen ist. Ich mußte mich heute verpflichten, darüber zu schweigen — aber ich hatte Ihnen bereits gestern davon erzählt.«
Boyd fühlte sich gedrängt, die gewissenhafte Mrs. Emerson zu beruhigen.
»Ich werde keinen Gebrauch davon machen. Sagten Sie nicht, daß der Professor kürzlich auch ein Haus gekauft haben soll?«
»Ja. Irgendwo in Hackney. Näheres weiß ich nicht. Man hat sich eines Abends darüber unterhalten, als er mehrere Stunden über einem Plan saß. Das Haus soll früher einem Wucherer gehört haben. Aber der Name ist mir entfallen.«
»Robbins?«
»Jawohl, ich glaube, so hieß er. Aber der Professor wohnt, soviel ich weiß, nicht dort, sondern in Whitechapel.«
Der Detektiv interessierte sich aber schon wieder für etwas anderes.
»Werden Sie es mich wissen lassen, wenn Sie zurückkehren?«
»Gerne«, erwiderte sie sanft. »Ich glaube, länger als eine Woche werde ich nicht bleiben. Ich darf das Kind nicht zu sehr aus seiner gewohnten Lebensweise bringen.«
»Nein, das würde sich gewiß nicht empfehlen«, beeilte sich Boyd beizustimmen, und vom anderen Ende der Leitung her klang ein leises Kichern, das den Herrn mit dem weißen Haar erröten ließ.
»Ich suche ein Haus in Hackney, das dem verstorbenen Robbins gehört hat«, sagte Boyd eine Stunde später zu Oberst Terry, der ihn lebhaft begrüßt hatte. »Sie werden den Mann wohl gekannt haben.«
Der Oberst nickte und setzte sich sofort ans Telefon.
»Haben Sie guten Wind?« fragte er gespannt, während er auf die Antwort der Polizeistation wartete.
»Ich bin zufrieden. Und wenn es so weitergeht, werden Sie es auch sein.«
Terry atmete tief auf und strich sich nervös den Bart.
»Tun Sie Ihr möglichstes, Boyd, damit wir die verdammte Geschichte bald vom Hals haben. Unsere Leute schießen noch immer durcheinander wie eine Meute, die keine Spur finden kann, und wenn wir nicht wüßten, daß wir uns auf Sie verlassen können, wäre es zum Verzweifeln. Die Presse verhält sich zwar vorläufig abwartend, aber ich kenne diese Ruhe vor dem Sturm. Wenn wir ihr nicht in spätestens vierzehn Tagen eine Beute auf den Tisch legen...«
»Ich glaube, acht Tage werden genügen«, meinte der Detektiv nachdenklich, und der andere fuhr mit einem Ruck herum.
»Donnerwetter«, meinte er strahlend. »Sie haben aber doch hoffentlich nicht vergessen, was Sie mir versprochen haben?«
»Nein. Wenn es soweit ist, erfahren Sie alles Nötige. Aber wahrscheinlich werde ich Ihre Leute schon früher zu einigen Kleinigkeiten brauchen.«
Der Oberst nickte lebhaft, während er den Hörer von dem schrillenden Telefon nahm.
»Hackney Marsh«, sagte er, nachdem er aufgehängt hatte. »Einige hundert Schritt östlich vom Victoria Park. Gehört dieses Haus zu unserer Sache?«
»Vielleicht«, erwiderte der Detektiv ausweichend, »aber kümmern Sie sich vorläufig nicht darum. Es könnte mich nur stören. — Haben Sie in der letzten Zeit irgend etwas mit Cummings zu tun gehabt?« fragte er dann plötzlich. »Ich meine den sogenannten Professor, den wir damals in dem großen Bankskandal wegen Beihilfe ausgehoben haben. Er hatte die wunderbaren Mixturen und Tinten für die Radierungen und Fälschungen in den Büchern und auf den Wechseln geliefert und hätte sich mit seiner Schlauheit fast herausgedreht, wenn er nicht einen ganz winzigen Fehler begangen hätte. Das hat ihn die Kleinigkeit von drei Jahren gekostet.«
Der Oberst erinnerte sich, aber seither hatte seines Wissens nichts gegen diesen Mann vorgelegen. Auch Boyd überzeugte sich davon, als er später im Archiv in die Akte ›Cummings‹ Einsicht nahm. Dann stöberte er noch in einem anderen vergilbten Aktenbündel mit der Aufschrift ›Robbins‹ herum, wobei er plötzlich auf ein Briefblatt stieß, das ihn außerordentlich interessierte. Er las die wenigen Zeilen sehr aufmerksam durch, obwohl sie eigentlich nichts Besonderes enthielten. Es war eine jener anonymen Zuschriften, wie sie Scotland Yard täglich in Massen zugehen und die nach flüchtiger Durchsicht abgelegt werden, wenn sie nicht wirkliche Anhaltspunkte bieten. Der vorliegende Brief war überhaupt völlig unverständlich, denn er enthielt nur die Worte: »Erkundigen Sie sich einmal bei Robbins nach dem 8. Februar.« Eine Unterschrift fehlte natürlich, dafür trug das Schreiben zur größten Befriedigung des Detektivs ein Datum, das er sich notierte. Am Rand des Blattes waren dann noch zwei amtliche Vermerke: »Der Bezirksstation Stepney abgetreten«, und von dieser die Erledigung: »Die Recherchen nach ergebnisloser Einvernahme Robbins' wegen mangelnder Unterlagen eingestellt.«
Ein weiteres Schreiben dieser Art fand sich nicht in den Akten, und der Detektiv hatte dies auch nicht erwartet. Nach dem Vermerk der Bezirksstation war der Zweck, den die seltsame Denunziation verfolgt hatte, offenbar erreicht worden, und die Leute, die um die Dinge vom 8. Februar wußten, hatten mit dem eingeschüchterten Wucherer leichtes Spiel gehabt.
Als Boyd Scotland Yard verließ, lag ein sanftes, freundliches Lächeln auf seinem frischen Gesicht, und die ehemaligen Kollegen, die ihm begegneten, wußten, was das zu bedeuten hatte. Wenn dieser Mann mit dem schneeweißen Haar, der in Wirklichkeit kaum vierzig Jahre alt war, mit seinen grauen Augen so harmlos und vergnügt dreinsah, dann hatte er die Karten zu einem großen Spiel in der Hand.
Aber vorläufig beschäftigte er sich mit ganz unschuldigen nichtigen Dingen. Zuerst besetzte er wenigstens eine halbe Stunde einen Telefonautomaten, dann gönnte er sich ein sorgfältig ausgewähltes Frühstück, das ihm ausgezeichnet mundete und das er mit einer dicken schwarzen Zigarre beschloß.
Pünktlich um zwei Uhr war er bei der London Bridge und ließ sich von einem Motorboot der Flußpolizei aufnehmen, das ihn zu einer Rundfahrt durch den Pool erwartete.
»Geht bei uns etwas vor?« fragte der führende Offizier lebhaft, als er den alten Bekannten begrüßte, aber der Detektiv schien es überhört zu haben.
»Eigentlich ein ganz angenehmer Dienst, so im Sonnenschein auf dem Wasser herumzugondeln«, meinte er.
»Ja, vier Monate«, knurrte der andere. »Und dann acht Monate in Nebel, Regen und Sturm.«
Er spuckte übellaunig ins Wasser und griff nach dem Steuer.
»Halten Sie möglichst nahe an den Docks vorbei«, bat Boyd. »Wenn man, wie ich, droben in Camden Town wohnt, sieht man so etwas nicht alle Tage.«
Das Motorboot mit dem Polizeiwimpel schnitt ratternd und zischend durch das Wasser, und der Detektiv ließ seine Blicke unausgesetzt nach links und rechts gehen. Der Hafen wimmelte von Fahrzeugen aller Art, von den größten Ozeandampfern bis zu den kleinsten Frachtenschonern, und stellenweise gab es eine derartige Stauung, daß das Boot einen Umweg machen mußte. Dann erhob sich Boyd immer und sah in das Gewirr, als ob er die einzelnen Schiffe zählen wollte. Die Fahrt ging an der linken Uferseite hinunter bis zum Regent's Canal Dock.
»Wenn es Ihnen recht ist, wechseln wir jetzt auf die andere Seite«, schlug Boyd vor, und gleich darauf überquerte das Boot in weitem Bogen die freie Fahrtrinne und nahm dann wieder den Weg gegen die London Bridge zurück.
Der Herr mit dem weißen Haar ließ während der langen Fahrt nur hie und da eine gleichgültige Bemerkung fallen, und nichts verriet, daß irgendeines der Fahrzeuge sein besonderes Interesse erweckt hätte. Als aber die Landungsstelle in Sicht kam, zog er einen Zettel aus der Tasche, auf dem die Namen von acht Schiffen standen und machte hinter zweien ein Fragezeichen. Aber dann dachte er eine Weile nach, strich beide wieder aus und setzte hinter einen der Namen drei dicke Ausrufungszeichen.
Damit war aber die Arbeit für diesen Tag noch lange nicht beendet. Wie in seinen glänzendsten Jahren war wieder einmal das Jagdfieber über ihn gekommen, und da pflegte er stets ein rasendes Tempo zu entfalten.
In der Lower Thames Street suchte er ein Taxi und ließ sich nach Whitechapel bringen. Er kannte diesen Stadtteil ziemlich genau. Einige Straßen vor der Wohnung des ›Professors‹ hielt er an, um die letzte Strecke zu Fuß zurückzulegen.
Das einfache Mietshaus bot nichts Besonderes, und Boyd erwartete es auch nicht, als er es betrat und gemächlich durch das Treppenhaus schlenderte. Er hatte nicht die Absicht, Cummings einen Besuch abzustatten, und es wäre ihm gar nicht angenehm gewesen, ihn zufällig zu treffen, aber er wollte sich einmal die Umgebung etwas näher ansehen, in der dieser hauste.
Wie in allen diesen Vorstadthäusern gab es auch hier im Treppenhaus wenig Licht, und er mußte seine Taschenlampe zu Hilfe nehmen, um die primitiven Türschilder entziffern zu können. Erst in der zweiten Etage stieß er zur Linken auf den Namen, den er suchte, und unwillkürlich ließ er das Licht über die ganze Tür spielen. Oberhalb der schmierigen Visitenkarte befand sich ein einfacher Briefkasten aus Blech, und die Augen des Detektivs blieben an einem Telegramm haften, das aus der Vergitterung hervorsah.
Boyd hatte nie unter Hemmungen gelitten, wenn er auf einer Fährte war, und verstand so ziemlich alles, was man bei seinem Beruf brauchen konnte. Wenige Sekunden später hielt er das Telegramm auch schon in der Hand, öffnete es behutsam und las es durch.
»Vorbereitet vier 11.30 Hackney.«
Der weißhaarige Herr verschloß das Telegramm kunstgerecht, sperrte den Briefkasten gewissenhaft wieder ab und stieg leise pfeifend die Treppe hinunter. Er hatte es ziemlich eilig, aus dem Haus und dessen Umkreis zu kommen, denn wenn der ›Professor‹ sich so dringende Nachrichten in die Wohnung zustellen ließ, so konnte er jeden Augenblick zurückkehren.
Das kleine Gebäude in Hackney, das angeblich Cummings gehörte und das Boyd eine Stunde später vorsichtig umkreiste, sah geheimnisvoll und romantisch aus. Es lag abseits an einem Feldweg, und der Zugang führte durch dichtes Gestrüpp, das bis knapp an die Mauern heranreichte. Das Haus war einstöckig, hatte zu ebener Erde zwei und darüber vier Fenster, die alle mit wettergebleichten Rolläden verschlossen waren. Über ausgetretene Steinstufen gelangte man zur Tür. Links und rechts erhob sich ausgedehntes mannshohes Gebüsch, das anscheinend den Garten ersetzen sollte. Es war ein verwahrloster, düsterer Ort. Weit und breit hatte man hier keinen neugierigen Nachbar und konnte treiben, was man wollte.
Als der Detektiv sich die Vorderfront zur Genüge besehen hatte, zwängte er sich durch das Gestrüpp an einer der Seitenmauern und konnte schon nach wenigen Schritten feststellen, daß um das ganze Haus ein sorgfältig ausgehauener schmaler Pfad führte. Ferner stieß er an jeder der Seitenmauern und an der rückwärtigen Fassade, die ganz ohne Fenster war, auf je eine kleine eiserne Tür, jedoch keine gab seinem vorsichtigen Druck nach. Das Haus schien völlig ausgestorben, und Boyd ging wenigstens eine halbe Stunde ununterbrochen rundherum und versuchte sich hierbei jeden Fußbreit dieses Weges einzuprägen. Schließlich unternahm er den Rundgang sogar einige Male mit geschlossenen Augen und erst, als er dabei lautlos und ohne auch nur einmal die Mauer oder einen Ast zu streifen, vorwärts kam, gab er seine eigenartige Beschäftigung auf und schlug einen Pfad ein, der an der rückwärtigen Seite des Hauses in das Gebüsch führte. Er übersah einen gut verkleideten Seitenweg und kam ziemlich weit ab, so daß er bis zum nächsten Taxistand einen beträchtlichen Fußmarsch zurücklegen mußte.
Trotzdem war er pünktlich um neun Uhr, wie er sich angekündigt hatte, in tadellosem Abendanzug im Klub Hymans und setzte sich zu dem bereits ungeduldig wartenden Anwalt. Die Mienen des Kolosses ließen ihn nicht darüber im Zweifel, daß er auch diesmal ungelegen kam, aber er schnitt ihm jede Bemerkung von vornherein ab.
»Sie brauchen mir nicht zu sagen, daß Sie nicht in den Klub gehen, um mit mir zu plaudern, sondern um Karten zu spielen, das weiß ich. Aber nachdem Sie zu Hause nicht gestört sein wollen, weil Sie dort schlafen, und ich nicht in das Cartwright-Haus gehen will, weil ich mich dort unbehaglich fühle, habe ich es heute einmal hier versucht. Sie werden ja dann beurteilen können, ob es Ihnen angenehmer ist, im Schlaf oder beim Kartenspiel gestört zu werden, und ich bitte Sie, mir das unumwunden zu sagen, damit ich mich darnach richten kann. — Im übrigen habe ich heute fast vier Pfund für Autofahrten ausgegeben.«
Mr. Hyman wußte wieder einmal nicht, wie er den Mann nehmen sollte, und es begann in ihm zu kochen.
»Ist das alles, was Sie mir zu sagen haben?« knurrte er. »Das interessiert mich nämlich nicht.«
»Aber mich«, versicherte Boyd lebhaft. »Über die Spesenfrage haben wir doch noch nicht gesprochen, und ich glaube, daß wir das nachholen müssen.«
»Halten Sie mich nicht mit dem Geschwätz auf«, fauchte Hyman. »Deshalb sind Sie doch nicht hergekommen?«
»Nein, nicht ausschließlich. Aber nachdem ich sehe, daß es Ihnen auf die Spesen nicht ankommt, können wir ja von den anderen Dingen sprechen. — Haben Sie etwas Neues von dem jungen Lawrence gehört?«
Hyman warf überrascht den Kopf zurück und starrte den Detektiv mißtrauisch an.
»Was hat das mit unserer Sache zu tun?« fragte er unsicher.
»Nichts. Es war nur so eine Frage, weil mir die Geschichte seltsam vorkommt. Eine ganze Expedition — ich glaube, es waren elf Leute — kann doch heutzutage nicht mehr spurlos vom Erdboden verschwinden. Selbst wenn sie irgendwo aufgefressen wird, findet man wenigstens die Knochen und die ungenießbaren Hosen und Röcke oder sonst etwas. Und in Australien soll es nicht einmal mehr Menschenfresser geben, habe ich mir sagen lassen. Wie reimen Sie sich das zusammen?«
Der Chef des Cartwright-Konzerns nagte an seinen blutleeren Lippen und zuckte mit den breiten Schultern.
»Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Und soviel ich weiß, habe ich Sie auch nicht beauftragt, sich um diese Sache zu kümmern«, fuhr er grob fort. »Ich habe Sie wegen der gewissen anderen Dinge engagiert.«
Boyd nickte lebhaft.
»Wegen der ›Königin der Nacht‹, jawohl. Aber Sie machen mir die Geschichte verdammt schwer. Geben Sie mir auf drei Fragen eine kurze Antwort, und ich glaube, Ihnen versprechen zu können, daß wir darin rasch vom Fleck kommen werden.«
Der Detektiv neigte sich ganz nahe zu Hyman und sah ihn so seltsam an, daß dieser höchst unruhig zu werden begann. Der Teufel hatte ihn geritten, daß er sich mit diesem unangenehmen, hartnäckigen Menschen eingelassen hatte.
»Warum wollen Sie sich an das Gespräch mit Cartwright wegen der ›Königin der Nacht‹ nicht mehr erinnern? — Weshalb verschweigen Sie, daß das Buch, in das Sie Einblick nehmen sollten, Ihnen abhanden gekommen ist? — Warum haben Sie nicht sofort nach dem Tode Cartwrights Lärm geschlagen, da Sie doch wußten, daß es dabei nicht mit rechten Dingen zugegangen war?«
Boyd hatte seine Stimme zu einem kaum vernehmbaren Flüstern gedämpft, aber jede dieser verfänglichen Fragen drängte den Anwalt mehr in die Enge. Einen Augenblick schien es, als ob er ohne Rücksicht auf die Umgebung wütend lospoltern wollte, aber dann begann er plötzlich an seinem Hemdkragen zu reißen und lehnte sich mit einem höhnischen Grinsen in seinen Sessel zurück.
»Das alles sind Dinge, die Sie nicht beweisen können«, preßte er heiser hervor.
»Noch nicht beweisen können«, stellte Boyd gelassen richtig. »Aber in einigen Tagen werde ich bestimmt soweit sein. Es ist nur schade um die Zeit, die ich wegen dieses rein psychologischen Moments verliere, und um die erhöhten Spesen, die Ihnen daraus erwachsen.« Er strich mit seinen feinen Händen über das rosige Kinn und sah Hyman mit einem Ausdruck an, der ebenso unverschämt wie liebenswürdig war. »Sie sind, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, ein ausgezeichneter Anwalt«, fuhr er verbindlich fort, »aber ich glaube, Sie haben sich in diesem Fall auf eine falsche und sehr bedenkliche Taktik festgelegt. Sie mögen Gründe dafür gehabt haben, aber Sie haben dabei zu viel gewagt. Wenn ich noch in Scotland Yard wäre, hätte ich ohne weiteres die Hand auf Sie gelegt. Jetzt arbeitet man dort bedächtiger, aber eines Tages wird man doch darauf kommen, daß Sie eine eigenartige Rolle gespielt haben. Sie sind ja ein sehr bekannter und mächtiger Mann, aber alle Rücksichten haben ihre Grenzen, wenn die Polizei auf Verdachtsmomente stößt, mit denen sich halbwegs etwas anfangen läßt. — Stellen Sie sich dieses Aufsehen vor.«
»Haben Sie vielleicht etwas gehört?« fragte er fassungslos, und jedes Wort kam so schwer heraus, als ob ihm ein eiserner Reif um die Kehle säße.
»Nein«, gab Boyd zögernd zurück und sah an Hyman vorbei. »Ich halte es nur für möglich. Hoffentlich gelingt es mir, rascher zu arbeiten als Scotland Yard, dann haben Sie wahrscheinlich nichts zu befürchten. Wenn ich mich auch getrauen würde, Ihnen mit den Indizien, die gegen Sie vorliegen, einen peinlichen Prozeß zu machen, so bin ich doch nicht sicher. Es muß etwas anderes dahinterstecken. Das ganze Problem der ›Königin der Nacht‹ hat mir nicht so viel Kopfzerbrechen verursacht wie Ihr Verhalten.«
»Wenn ich reden soll, so muß ich eine Bedingung stellen«, sagte der Anwalt plötzlich mit geschäftsmäßiger Gelassenheit, und der Detektiv wunderte sich, welche Beherrschung dieser ewig polternde und aggressive Mann aufzubringen vermochte.
»Ich hoffe, daß ich sie erfüllen kann«, meinte Boyd.
»Sie müssen sie erfüllen, denn dafür bezahle ich Sie«, brauste Hyman auf, aber dann schien er einzusehen, daß dies nicht der passende Ton war, um die heikle Angelegenheit zu erledigen, und er lenkte sofort wieder ein. »Ich glaube auch, daß Ihnen dies nicht allzu schwerfallen wird. Es betrifft nämlich Cartwright.« Seine Stimme wurde leise, aber scharf und bestimmt. »Ich weiß nicht, was die Geschichte der ›Königin der Nacht‹ eigentlich zu bedeuten hat, aber wenn das Andenken von Sir Benjamin dadurch irgendwie leiden könnte, so darf die Sache um keinen Preis aufgerührt werden. Wenigstens von uns nicht. Verstehen Sie mich? — Richten Sie sich also darnach. — Und nun fragen Sie meinetwegen, was Sie wollen.«
Thomas Hyman hatte mit einem Male die Fessel, die ihn seit Monaten bedrückt hatte, gesprengt, und damit schien auch all das Unsympathische an seinem äußeren Menschen und in seinem Wesen abgestreift. Er brachte sogar ein schadenfrohes Schmunzeln zustande, als er das überraschte Gesicht des Detektivs sah, und es gab ihm eine gewisse Befriedigung, daß Boyd eine Weile brauchte, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen.
»Das ist es also«, meinte Boyd endlich etwas kleinlaut. »Eigentlich hätte ich selbst darauf kommen können, wenn ich nicht noch immer von dem üblen Polizeigeist besessen wäre. Wir suchen stets nur nach niedrigen oder wenigstens selbstsüchtigen Motiven. — Sie sind also wirklich gar nicht dazu gekommen, sich mit Cartwright über die Sache näher auszusprechen?«
»Nein.« Der Anwalt schüttelte nachdenklich seinen Kopf. »Es war damals alles wie verhext«, stieß er abgehackt hervor. »Cartwright fühlte sich wieder einmal nicht wohl — er hatte immer mit dem Herzen zu tun —, und ich hatte eine große Fusion vor, die eine Menge Besprechungen erforderte. Es ging dabei um Millionen. Plötzlich rief er mich eines Nachts in meiner Wohnung an und erzählte mir von einer seltsamen Begegnung, die er gehabt habe und über die er mit mir sprechen müsse. Er schien ungewöhnlich aufgeregt, und wir verabredeten einen Besuch am nächsten Tag. — Das war das erste Telefongespräch, das ich mit ihm in dieser geheimnisvollen Angelegenheit hatte. Damals habe ich zum erstenmal von der ›Königin der Nacht‹ gehört, ganz flüchtig, zusammenhanglos, daß ich schließlich nicht wußte, worum es sich eigentlich handelte. Cartwright deutete mir immer wieder an, daß er ganz außer sich sei, weil er einen furchtbaren Skandal fürchte.«
Boyd hatte mit regungslosem Gesicht zugehört. »Und das zweite Gespräch?« fragte er nach einer langen Pause.
»Fand am nächsten Tag statt. Es war sehr kurz, und Sie kennen es ja, weil der Diener geplaudert hat. Ich hatte meine Verabredung nicht einhalten können, und Cartwright rief mich in meinem Büro an. Die Sache mußte ihm sehr dringlich sein, denn er wollte mich unbedingt noch am selben Abend sprechen. Aber es ging beim besten Willen nicht. Schließlich sagte er, er würde mir sein afrikanisches Tagebuch in die Wohnung schicken, und ich sollte darin das Kapitel über die Nacht beim Brunnen der sieben Palmen lesen. Ich kam aber auch dazu nicht, denn das Buch ist zwar gegen acht Uhr abends bei mir abgegeben worden, aber als ich kurz nach elf heimkehrte, war es verschwunden. Man hatte den Diener durch einen Anruf weggelockt und war dann eingedrungen. So denke ich es mir wenigstens. Und am nächsten Morgen erfuhr ich vom Tode Cartwrights. — Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann«, schloß er und schlug bekräftigend auf die Armlehne seines Sessels.
Boyds Mienen strahlten vor Behagen und Liebenswürdigkeit.
»Glauben Sie, daß Cartwright auch noch zu jemand anderem von der Geschichte gesprochen hat?«
Der Anwalt hob langsam die Schultern. »Vielleicht zu Morton. Sie waren sehr befreundet, und der war ja damals mit dabei. Da kann man wohl annehmen, daß Sich Cartwright mit ihm in Verbindung gesetzt hat.«
»Und was ist mit Mrs. Dyke?« fragte der Detektiv plötzlich leichthin. »Ist es möglich, daß sie von dem Vorfall wußte, der Cartwright so in Aufregung versetzt hatte, oder wenigstens von den Gesprächen, die er mit Ihnen darüber geführt hat?«
»Möglich ist alles«, meinte Hyman ausweichend, und sein Gesicht hatte wieder einen höchst mißmutigen Ausdruck.
»Sie mögen Mrs. Dyke nicht«, sagte Boyd geradeheraus, und Hyman wußte nicht recht, was er darauf erwidern sollte.
»Ich mag Frauen überhaupt nicht«, stieß er hervor, und der Ton, in dem er dieses Bekenntnis ablegte, ließ keinen Zweifel über den Ernst seiner Worte.
»Wie ist Mrs. Dyke in das Cartwright-Haus gekommen?« wollte Boyd wissen, aber der Anwalt vermochte ihm keine bestimmte Auskunft zu geben.
»Ich glaube, sie ist Cartwright empfohlen worden.«
»Von Selwood oder von Osborn?«
Hyman sah etwas ungeduldig nach der Uhr.
»Das kann ich Ihnen nicht sagen. Über solche Dinge habe ich mit Cartwright nie gesprochen — Ist sonst noch etwas?«
»Nein. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Und ich hoffe, daß ich Sie nun überhaupt nicht mehr belästigen muß. Sie dürfen mir glauben, daß es auch für mich kein Vergnügen war. Bis heute abend. Da haben Sie mir allerdings in jeder Hinsicht eine sehr angenehme Überraschung bereitet.«
Der weißhaarige Herr machte bereits Miene, sich zu verabschieden, als ihm noch etwas einfiel.
»Vergessen Sie nur nicht unsere Verabredung, Mr. Hyman«, sagte er eindringlich. »Es bleibt bei meinem Haifischfang auf Ihre Kosten, auch dann, wenn ich nicht um meine Forellensaison komme. So haben wir es ausdrücklich vereinbart. Und ich werde nicht darum kommen. Heute in — nun sagen wir spätestens acht Tagen hoffe ich an meinem idyllischen Fischwasser zu sein und mich mit angenehmeren Dingen zu beschäftigen als mit der ›Königin der Nacht‹ vom Brunnen der sieben Palmen. Gute Nacht, Mr. Hyman.«
An einem der morschen Fensterläden zu ebener Erde des einsamen Hauses in Hackney zeichnete sich plötzlich ein fadendünner Lichtschein ab, und im Gestrüpp gegenüber knackte im selben Augenblick ein dürrer Ast.
Der ›Professor‹ war gekommen,« ohne daß das leiseste Geräusch die nächtliche Stille dieses öden Platzes unterbrochen hätte, und das leise Schnappen des Lichtschalters im Laboratorium war das erste Zeichen, das seine Anwesenheit verriet.
Der niedrige, nicht allzu große Raum mit den geschwärzten Wänden und der verräucherten Decke bot ein Bild der Unordnung und Unsauberkeit. An den Wänden standen rohe Tische, die mit den verschiedensten Apparaten, Instrumenten, Flaschen und Tiegeln bedeckt waren. In die Tischplatten und den abgetretenen Fußboden waren tiefe Flecke eingeätzt. In der Mitte unter einer Schirmlampe befand sich ein runder Tisch mit einer Decke, die nebenbei auch als Wischtuch zu dienen schien. Darauf lag ein hoher staubiger Stoß von Büchern, den offenbar seit undenklichen Zeiten keine ordnende Hand berührt hatte. Daneben gab es als einzige Sitzgelegenheiten zwei einfache Holzstühle.
Fred Cummings zog seinen Mantel aus, hängte ihn mit peinlicher Sorgfalt an einen Haken neben der Tür und stülpte dann ebenso pedantisch seinen Hut darauf. Seine Erscheinung war mit dem verwahrlosten Raum nicht recht in Einklang zu bringen. Er war mittelgroß, hager, etwa vierzig Jahre alt, mit scharfgeschnittenem Gesicht, dem ein Paar tiefliegende dunkle Augen und ein gepflegter schwarzer Bart einen besonderen Reiz gaben. Die tadellose Kleidung vervollständigte den Eindruck einer interessanten Persönlichkeit.
Er sah nach der Uhr und merkte, daß er sich zu beeilen habe, denn er ging plötzlich mit großer Hast zu Werke. Zunächst nahm er aus einer tiefen Tischlade eine seltsam geformte Kopfhaube, die er mit einem verkniffenen Lächeln untersuchte, und dann schob er einen kleinen auf Rädern laufenden Kasten von der Wand, bis der Fleck, auf dem er gestanden hatte, völlig frei war. Der ›Professor‹ hob mit einem geschickten Griff ein Stück des Bretterbelages aus, stülpte sich dann die Gasmaske über und entnahm der Öffnung mit größter Behutsamkeit eine hölzerne Schatulle, die er zu einem der Tische an der Wand trug. Hier schaltete er eine Wandbeleuchtung ein und öffnete die Schachtel. Sie enthielt zuoberst eine dicke Watteschicht, die er vorsichtig entfernte, worauf zwei Reihen etwa pfirsichgroßer Ballons aus einer milchfarbigen Masse sichtbar wurden. Cummings streifte ein Paar weiche, wollige Handschuhe über, holte aus einer Lade eine kleinere Schachtel, legte sie sorgfältig mit Watte aus und entnahm der ersten Schatulle mit zwei Fingern einen der Ballons, um ihn hauchzart in die zweite zu betten. Diese äußerst behutsame Manipulation wiederholte er noch dreimal, worauf er die größere Schachtel wieder an ihren Platz brachte, den Kasten darüberschob und die zweite bis an den Rand mit Watte füllte und sorgfältig verschnürte.
Er war mit diesen Vorbereitungen fertig und hatte gerade die Maske abgenommen, als unter einer Retorte eine winzige farbige Birne in kurzen Intervallen dreimal aufleuchtete. Der ›Professor‹ sah nochmals auf seine Uhr, entnahm seiner Rocktasche einen handlichen Browning, den er nach gründlicher Prüfung wieder verstaute, und setzte dann wieder die unförmige Haube auf. Hierauf rückte er an einem kleinen Hebel an der Wand, löschte das Licht und öffnete die Tür.
Der ganze Raum lag in undurchdringlichem Dunkel, und nur von einigen der Glasbehälter ging ein schwacher Schimmer aus.
Die Person, die kam, mußte das Haus ebenso genau kennen wie Cummings, denn sie nahte so lautlos, daß plötzlich ihre Stimme aus allernächster Nähe erklang.
»Machen Sie Licht.«
Die Lampe über dem runden Tisch flammte auf, und der ›Professor‹ stand, die Rechte in der Rocktasche, hinter der schlanken Gestalt, die in dem dunklen, enganliegenden Mantel einem Schatten glich. Das fußfreie knopflose Kleidungsstück war aus einem glatten Stoff von toter Farbe, und die kleinen Füße steckten in hohen Schnürschuhen mit Gummisohlen. Alles an dieser Erscheinung war geschmeidig und aalglatt, und die Bewegung, mit der sie beim Aufflammen des Lichtes herumschnellte, hatte etwas Katzenartiges.
»Müssen diese dummen Geschichten immer sein?« kam es gereizt hinter dem dichten, silbergestickten Gewebe hervor, das den ganzen Kopf einhüllte und nur zwei schmale Schlitze für die Augen frei ließ. Die Stimme klang durch die Verhüllung breit und dumpf, und es war nicht zu unterscheiden, ob sie einem Mann oder einer Frau gehörte.
»Unbedingt«, hallte es aus der Gasmaske ebenso zurück. »Aus Vorsicht. Man kann nicht wissen, was geschieht.«
Die dunkle Gestalt warf ärgerlich den Kopf zurück und ließ sich auf einen der Stühle fallen.
»Haben Sie die Sache vorbereitet?« fragte sie ungeduldig.
Cummings blieb mit der Hand in der Rocktasche stehen und gab eine ausweichende Antwort.
»Sie brauchen etwas viel davon«, sagte er, »und ich fürchte, bald nicht mehr nachkommen zu können, da die Herstellung sehr langwierig und umständlich ist.«
Der Besuch war offenbar auf eine derartige Bemerkung nicht vorbereitet, denn er machte eine überraschte Wendung, und die leuchtenden Augen richteten sich sekundenlang mit einem lauernden Ausdruck auf die Kopfmaske.
»Ich werde Sie nun längere Zeit in Ruhe lassen. Aber die vier Ballons muß ich dringend haben.«
»Sie stehen Ihnen zur Verfügung. Unter den üblichen Bedingungen. Das wären also vierhundert Pfund.«
Die verhüllte Gestalt machte eine unwillige Geste.
»Gut. Aber Sie müssen sich etwas gedulden. Augenblicklich kann ich einen derartigen Betrag nicht entbehren.«
»Dann nehmen Sie eben weniger«, schlug er vor. »Um unserer guten Beziehungen willen möchte ich nicht, daß Sie in mir Ihren Gläubiger sehen müssen. Das könnte Sie gegen mich einnehmen, und wer weiß, was daraus entstehen würde.«
»Sie sind ein erbärmlicher Blutsauger«, stieß der Schatten hervor. »Habe ich Ihnen nicht schon Tausende gegeben?«
»Immer nur als meinen wohlverdienten Anteil«, stellte Cummings fest und geriet in Erregung. »Habe ich Ihnen dafür nicht etwas geliefert, was eigentlich unbezahlbar ist? Aber das können Sie nicht beurteilen. Wenn ich das, wofür ich von Ihnen lumpige hundert Pfund verlange, der Allgemeinheit übergebe, kann ich das Tausendfache verdienen. Schon mit den Ballons allein, ohne Füllung.« Er redete sich immer mehr in Feuer und begann lebhaft gestikulierend auf und ab zu gehen. »Wieviel Zeit und Mühe und wieviel vergebliche Versuche hat es mich gekostet, um diese Masse zu finden! Widerstandsfähig gegen einen atmosphärischen Druck und doch so empfindlich und spröde, daß der geringste Aufschlag genügt, um die runden Dinger als unsichtbaren Staub in alle Winde zersplittern zu lassen. Von dem, was sie enthalten, will ich gar nicht reden. Wenn ich wollte, könnte ich mich damit zum Herrn der Welt auf werfen. Ich könnte London zu einem riesigen Totenhaus machen, ganz England, den ganzen Kontinent. Sie wissen das ja ebensogut wie ich. Trotzdem wollen Sie mit mir plötzlich feilschen.«
»Ich habe augenblicklich wirklich kein Geld«, versicherte der Besuch.
»Dann wirtschaften Sie sehr schlecht«, bemerkte er tadelnd. »Sie haben in der letzten Zeit gute Geschäfte gemacht.«
»Von denen Sie ehrlich die Hälfte erhalten haben«, kam es gereizt zurück.
»Allerdings. Für meine wertvollen Tips, ohne die Sie nie zu den guten Gelegenheiten gekommen wären. Jedenfalls sind Ihnen recht nette Summen geblieben, und ich verstehe nicht, daß da vierhundert Pfund eine Rolle spielen sollen.«
»Sie spielen aber eine Rolle«, sagte die schwarze Gestalt hartnäckig und verbissen. »Wenn Sie nicht warten wollen und um Ihren Lohn fürchten« — die Stimme wurde plötzlich lockend und schwül —, »so machen Sie sich auf eine andere Weise bezahlt. Wie Sie es ja früher zuweilen getan haben...«
Cummings blieb mit einem Ruck stehen und sah aus den Gläsern seiner Maske starr auf seinen Besuch. Dann ließ er ein kurzes, höhnisches Lachen hören.
»Früher, ja. Aber nun scheint es mir doch ratsamer, mich mit Geld zu begnügen. Ich traue mich ja gar nicht mehr, in Ihrer Gegenwart diesen unbequemen Kopfschmuck abzulegen. Das würde ein sehr unbehagliches Schäferstündchen werden.«
»Feiger Schurke!«
Der schlanke, geschmeidige Körper schnellte wie eine Feder empor, und einen Augenblick schien es, als ob er sich auf den Professor stürzen wollte, aber dieser stand unbeweglich, und nur die Hand, die er in der Tasche hielt, zuckte leicht.
»Echauffieren Sie sich nicht«, sagte er kühl. »Es hat keinen Zweck. Lassen Sie uns lieber mit unserem Geschäft zu Ende kommen. — Also, vierhundert Pfund in bar.«
Der verschleierte Gast riß an einem seiner Handschuhe und brachte ein Bündel zusammengeknüllter Banknoten zum Vorschein, das er wortlos auf den Tisch warf.
Cummings zählte bedächtig und deutete dann mit einem Kopfnicken auf die vorbereitete Schachtel.
»Alles in Ordnung«, sagte er höflich. »Ich möchte Ihnen nur wie immer äußerste Vorsicht empfehlen, denn...«
»Lassen Sie das«, unterbrach ihn die verhüllte Gestalt wütend, indem sie das kleine Paket aufriß, an sich nahm und unter dem Mantel verschwinden ließ. »Ich weiß mit diesen Dingen ebensogut umzugehen wie Sie.«
Sie schlüpfte eilig zur Tür, machte aber an der Schwelle nochmals halt und wandte den Kopf.
»Wegen des heutigen Abends werden wir noch abrechnen«, klang es schneidend hinter dem dichten Schleier mit der silbernen Mondsichel und den flimmernden drei Sternen hervor.
Der ›Professor‹ hob gleichmütig die Schultern.
»Ich glaube, Sie hätten an wichtigere Dinge zu denken«, sagte er. »Man spricht bereits zu viel von der ›Königin der Nacht‹, als daß Sie noch lange ungeschoren bleiben können.«
Schon wenige Minuten später sollte die ›Königin der Nacht‹ an diese Worte erinnert werden.
Sie war aus der kleinen Tür an der rechten Hauswand geglitten und dicht an der Mauer nach rückwärts geschlüpft, um den schmalen Pfad im Gebüsch zu erreichen, als ihr an der Ecke plötzlich eine dunkle Masse den Weg versperrte.
Die Verhüllte vermochte in der Winzigkeit des Augenblicks nichts zu unterscheiden, aber das Bewußtsein der Gefahr ließ ihre Rechte jäh emporschnellen.
Um den Bruchteil einer Sekunde früher fuhr die dunkle Masse zu Boden, und zum erstenmal verfehlte eines der tödlichen Geschosse der ›Königin der Nacht‹ sein Ziel und flog irgendwohin ins Leere.
Und zum erstenmal entglitt auch Clive Boyd eine Beute, die er bereits mit eisernen Händen gefaßt hatte. Er erhielt mit der Spitze eines Schuhs einen so derben Stoß zwischen die Augen, daß sich seine Finger, die einen feinen Knöchel umklammerten, unwillkürlich lockerten. Das genügte der geschmeidigen Gestalt, sich zu befreien und das Gebüsch zu erreichen.
Der Herr mit dem weißen Haar dachte nicht an eine Verfolgung, sondern lauschte, hart an die Mauer gedrückt, dem leisen Rascheln der Äste, das sich immer weiter entfernte.
Dann schlich er in der entgegengesetzten Richtung, aus der die Gestalt gekommen war, gegen die Vorderfront des Hauses und war im Begriff, um die Ecke zu biegen, als von der Spitze eines Strauches her ein matter Schein sein Auge traf. Er ließ vorsichtig das Licht seiner Taschenlampe auf die Stelle fallen und besah sich neugierig den schimmernden Gegenstand.
Es war ein kleiner milchfarbiger Ballon, der in das sprießende Blätterwerk einer Astgabelung gebettet war.
Über Boyds Züge glitt ein strahlendes Lächeln, und er verlöschte rasch sein Licht. Dann zählte er mit peinlicher Genauigkeit die Schritte bis zum Weg und hatte nur den einen Wunsch, daß er die seltsame Kugel noch unversehrt vorfinden möchte, wenn er entsprechend ausgerüstet wiederkehrte.
Und sein Glück blieb ihm auch diesmal treu.
Clarisse Avery mußte am nächsten Morgen erfahren, daß Pünktlichkeit ihren Kollegen Wellby nicht gerade auszuzeichnen schien. Sie schlenderte, vornübergeneigt und mit einwärts gestellten Füßen, bereits seit neun Uhr an dem verabredeten Treffpunkt bei der Albert Bridge auf und ab, aber obwohl es schon eine Viertelstunde über die vereinbarte Zeit war, konnte sie Wellby noch immer nicht sehen.
Endlich — es war bereits gegen halb zehn — kam er in einem Taxi angefahren und half ihr unter lebhaften Entschuldigungen in den Wagen. Sie war zwar schon sehr ungeduldig geworden, aber da er doch gekommen war, verflog ihre Verstimmung schnell.
»Machen Sie wegen der halben Stunde nicht so viele Worte«, neckte sie ihn. »Wenn ich ein Mann wäre und mit einer Dame von meinen Reizen ein Rendezvous hätte, würde ich noch später kommen.«
Er hatte für ihre Bemerkung nur ein flüchtiges, zerstreutes Lächeln und sah sich, während sie losfuhren, immer wieder nach rückwärts um. Er sagte ihr nicht, daß er auf der bisherigen Fahrt bereits dreimal den Wagen gewechselt hatte, um die drei Leute, die sich am Hafen plötzlich an seine Fersen hefteten, loszuwerden. Das schien ihm nun wirklich gelungen zu sein. Das kleine Auto, das er ununterbrochen hinter sich gehabt hatte, war verschwunden, und als er dessen gewiß zu sein glaubte, rückte er sich behaglich zurecht.
»Wir haben Glück, Miss Avery. Es wird der herrlichste Tag, und wir wollen ihn gründlich genießen. Ich hoffe, daß Sie sich ganz frei gemacht haben.«
Sie nickte lächelnd, und er gewahrte nun erst, daß sie sich wirklich sehr nett hergerichtet hatte. Sie trug einen Trenchcoat und einen Südwester aus demselben Stoff, unter dem wieder die gewisse kupferbraune Locke herausfordernd hervorblickte, aber das furchtbare blaurote Mal und die schrecklichen Augengläser verdarben schließlich doch wieder alles.
Die Fahrt dauerte ziemlich lang, und als sie am Themseufer bei Mortlake angelangt waren, berechnete der Chauffeur eine recht hübsche Summe.
»Das haben Sie davon«, sagte Clarisse vorwurfsvoll, als sie zusammen am Wasser hinschritten. »Wir hätten ganz gut mit der Bahn herausfahren können. Aber natürlich trage ich die Hälfte. Wie kämen Sie dazu, für mein Vergnügen Ihr Geld auszugeben? Ich muß Ihnen ja schon sehr dankbar dafür sein, daß Sie sich meiner überhaupt annehmen.«
»Gut«, bemerkte er leichthin, »wenn Sie unbedingt darauf bestehen, werden wir gelegentlich abrechnen. Aber jetzt wollen wir uns mit solchen Dingen nicht aufhalten. Es ist schade um jede Minute, die wir verlieren.«
Er wechselte einen kleinen Korb mit starken Ledergurten, den er im Auto mitgebracht hatte, von der einen Hand in die andere und schlug ein flottes Tempo ein.
»Was haben Sie denn da?« fragte sie neugierig.
»Einen kleinen Imbiß. Wir können also die ganze Zeit auf dem Wasser bleiben und sind nicht auf das fragwürdige Essen angewiesen, das man hier draußen vorgesetzt bekommt.«
»Sie scheinen ja sehr verwöhnt zu sein«, meinte sie herausfordernd.
»Oh, durchaus nicht«, lachte er. »Wenn Sie wüßten, welche unmöglichen Gerichte ich in meinem Leben schon mit größtem Appetit verschlungen habe. Aber wenn es sich machen läßt, bin ich für eine halbwegs genießbare Kost.«
»Den Korb haben Sie wohl aus Ihrem Stammgeschäft oder von Ihrer Hauswirtin?« fragte sie wißbegierig weiter, aber er nickte nur stumm, denn sie schienen an ihrem Ziel angelangt zu sein. Das Ufer bildete hier eine Bucht, in der eine große Zahl von Booten und Kähnen vertäut war. Weiterhin gab es ein rohes Blockhaus für den Wächter, aber in ihrer unmittelbaren Nähe stand ein großer, junger Bursche, mit dem Wellby sofort einen leisen Handel begann, der nur sehr kurz währte. Sie bekamen ein stattliches Segelboot, das sowohl durch seinen Bau, wie durch seine ganze Ausstattung von den übrigen Fahrzeugen auffallend abstach, und als sie den schwankenden Laufsteg passiert hatten, konnte sich Miss Avery nicht enthalten, darüber eine Bemerkung zu machen.
»Ich hätte nie gedacht, daß man so etwas Feines zu leihen bekommt«, sagte sie verwundert. »Das Ding muß mindestens...«
Sie brach plötzlich ab und schob umständlich ihre Brille fest, als ob sie fürchtete, daß diese ihr heruntergleiten könnte.
»Verstehen Sie denn etwas davon?« fragte Wellby, indem er mit sichtlicher Übung die Takelage in Ordnung brachte und das Boot flottmachte. Er hatte seinen gewöhnlichen Büroanzug an, den sie schon längst kannte, aber statt des Hutes setzte er nun eine etwas mitgenommene Bordkappe auf, die zu seinem schmalen, wettergebräunten Gesicht ausgezeichnet paßte.
»Können Sie steuern?«
Sie nickte mit lächelndem Gesicht, schränkte aber ihre lebhafte Bejahung sofort wieder ein.
»Zur Not wird es wohl gehen.«
»Haben Sie es schon einmal versucht?«
»Ja«, gab sie verlegen zu. »Vor vielen Jahren. Wir wohnten damals an einem Wasser.«
»Wo?« fragte er rasch und sah sie so interessiert an, daß sie ganz verwirrt wurde.
»An einem Fluß«, gab sie stockend zur Antwort und war froh, daß sie aus der Bucht hinausglitten und Wellby seine ganze Aufmerksamkeit der Leinwand zuwenden mußte, um die Brise abzufangen. Er war dabei sehr geschickt, und schon nach wenigen Minuten schnitt der scharfe Kiel des Bootes rauschend durch das Wasser.
Der herrliche Sonntag hatte eine Menge Fahrzeuge mobil gemacht, und es hieß in dem Gewimmel vorsichtig Kurs nehmen. Clarisse handhabte das Steuer ganz gewandt, aber bald wurde sie unter seinen beobachtenden Blicken unsicher.
»Sie müssen den Mantel ablegen«, sagte er und turnte auch schon heran, um ihr behilflich zu sein. »Die Sonne brennt ja so, daß Sie absolut keine Abkühlung zu befürchten haben.«
»Meinen Sie?« fragte sie ängstlich, aber plötzlich hörte er wieder das leise, dunkle Lachen, das ihn immer so eigenartig berührte, und etwas linkisch half er ihr aus dem Trenchcoat.
Dann aber ließ er sogar die Leine für einen Augenblick locker, weil ihn das, was er sah, gar zu sehr überraschte. Das unschöne Mädchen saß in einem blütenweißen Pullover und einer ebensolchen engen Sporthose vor ihm, und zum erstenmal konnte er wahrnehmen, welch prachtvolle Figur sich unter den unkleidsamen Hüllen verbarg, die sie sonst zu tragen pflegte. Alles an diesem jugendlichen Körper schien von vollendetem Ebenmaß und kräftiger Frische, und Wellbys Erstaunen war so groß, daß es fast ein Malheur gegeben hätte. Ein kräftiger Windstoß ließ das schlanke Boot plötzlich hart überholen, aber ehe der Reporter noch recht wußte, was eigentlich vorging, hatte ihm Miss Avery die Stelleine aus der Hand gerissen und war wie der Blitz backbord geglitten, so daß der aufschnellende Mast fast den Himmel einzuschlagen drohte.
»Bravo«, sagte er höchst verdutzt. »Sie verstehen die Sache. Machen wir also weiter.«
Und ohne ihre Zustimmung abzuwarten, steuerte er mitten in den Strom, wo die Brise am steifsten wehte, und Clarisse bekam alle Hände voll zu tun... Und bei dem Eifer und der Gewandtheit, die sie entfaltete, ging plötzlich eine überraschende Veränderung mit ihr vor: Ihre Gestalt begann sich zu recken, ihre hängenden Schultern flogen zurück, und ihr ganzer Körper spielte in graziöser Geschmeidigkeit.
Wellby saß mit steinernem Gesicht schweigend am Steuer, denn er wußte, daß eine Miene, ein Wort dieses sportliche Mädel wieder in ein unscheinbares Aschenbrödel verwandeln würde. Er ließ sie durch den Zickzackkurs, den er nahm, nicht zur Besinnung kommen, und so jagten sie in zuweilen äußerst toller Fahrt kreuz und quer über das Wasser, bis er endlich wieder gegen die Bucht steuerte.
»Nun werden wir frühstücken und dann Fortsetzung«, sagte er und begann seinen kleinen Korb auszupacken. Sie hatte ein glühendes Gesicht, auf dem das häßliche Mal weit weniger sichtbar war, ihr Atem flog, und die kokette Locke unter dem Südwester flatterte in Wind und Sonne.
»Das ist keine Arbeit für Männer«, lachte sie, als sie die Unbeholfenheit sah, mit der er den Frühstückstisch improvisierte, und machte sich selbst daran, alles herzurichten. Dabei betrachtete sie aufmerksam Teller und Besteck und steckte ihr Näschen in alle die appetitlichen Metallschüsseln, äußerte aber kein Wort. Erst als sie beim Essen waren, begann sie anerkennend mit den vollen roten Lippen zu schnalzen.
»Sie müssen bei Ihrer Wirtin ausgezeichnet aufgehoben sein«, meinte sie mit einem gewissen Neid in der Stimme. »Wo wohnen Sie eigentlich?«
Er nannte kurz das Haus in Kennington, aber Clarisse hörte nur mit halbem Ohr zu und nahm, während sie es sich schmecken ließ, eine gründliche Untersuchung des Tafelzeugs vor.
»Jedes Stück aus Silber mit einem Monogramm«, konstatierte sie bewundernd. »Sogar die Gläser. Gibt Ihre Wirtin jedem Mieter für einen Ausflug einen so kostbaren Eßkorb und so einen delikaten Imbiß mit?« fragte sie naiv.
Wellby blickte sie erst mißtrauisch an, dann brach er in ein belustigtes Lachen aus.
»Jawohl«, erklärte er. »Ich glaube, daß heute ungefähr vier bis fünf solcher Körbe unterwegs sein dürften.«
»Ich hätte nie geglaubt, daß ein Mann mit einem so ehrlichen Gesicht so unverfroren lügen könnte.«
Sie gerieten in immer übermütigere Laune, und Clarisse konnte sich an herausfordernden Neckereien nicht genug tun.
»Was arbeiten Sie nun eigentlich bei der Zeitung?« fragte sie plötzlich. »Ruhen Sie noch immer auf den Lorbeeren aus, die Sie mit dem Fall Morton eingeheimst haben?«
»Jawohl«, sagte er nach einer kleinen Pause und sah sie dabei so seltsam an, daß sie sich plötzlich beklommen fühlte. »Dabei sammle ich aber Kräfte für eine neue große Tat.«
»Was soll das werden?« forschte sie und versuchte unbefangen zu lächeln.
»Die Geschichte der ›Königin der Nacht‹ vom Brunnen der sieben Palmen«, gab er leichthin zurück und blickte angelegentlich der Zigarette nach, die er ins Wasser schleuderte, so daß ihm die Wirkung seiner Worte auf Miss Avery entging. Sie zuckte wie unter einem Schlag zusammen und starrte ihr Gegenüber fassungslos an. Erst nach einer geraumen Weile hatte sie sich so weit in der Gewalt, daß sie wieder sprechen konnte, aber ihre Stimme klang plötzlich unsicher und spröde.
»Das verstehe ich nicht.«
»Ich werde es Ihnen erklären. Ich kenne nämlich den eigentlichen Grund für das plötzliche Auftauchen der ›Königin der Nacht‹. Das heißt«, verbesserte er sich rasch, »noch nicht ganz genau, aber ich vermute ihn. Ich habe Aufzeichnungen, die in dieser Hinsicht gewisse Schlüsse zulassen.«
Sie hörte ihm mit ängstlicher Spannung zu und war verzweifelt, daß sie alle Einzelheiten aus ihm herausholen mußte.
»Aufzeichnungen? Von wem?«
»Von Benjamin Cartwright. Es ist eine Stelle aus seinem Tagebuch, die er offenbar damals unter dem unmittelbaren Eindruck der Ereignisse geschrieben hat. — Aber interessiert Sie die Sache überhaupt?« fragte er höflich.
Sie nickte krampfhaft, und er entnahm seiner Tasche ein Notizbuch und begann darin zu blättern.
»Am besten ist es, ich lese Ihnen die Geschichte vor«, sagte er eifrig. »Sie können sich dann selbst ein Urteil bilden.«
Dann begann er in dem geheimnisvollen Tonfall eines Märchenonkels: »In einer Nacht beim Brunnen der sieben Palmen spielten sich Dinge ab, die mir bis heute ein Rätsel geblieben sind. Ich habe Osborn, Selwood und Bryans wiederholt darüber befragt, aber sie antworteten mir immer ausweichend. Ich war damals durch ein tropisches Fieber so geschwächt, daß ich mich nach dem anstrengenden Tagesmarsch nicht von meinem Lager rühren konnte, und dem armen Morton ging es nicht viel besser. Nur die drei anderen kannten keine Müdigkeit. Kaum hatten wir knapp vor Sonnenuntergang die Zelte aufgeschlagen, als es sie schon wieder hinaustrieb. Wir hatten auf der letzten Strecke unseres Weges Großwild gespürt, und sie wollten es aufstöbern. Es wurde sehr spät, bevor sie zurückkehrten, aber sie kamen ohne Beute und waren sehr wortkarg. Bald darauf ging alles zur Ruhe, aber um Mitternacht gab es vor dem Lager plötzlich einen wilden Lärm, und gleich darauf fielen Schüsse. Ich versuchte mich zu erheben, um nachzusehen, was los sei, kam aber nur bis vor das Zelt, wo meine Füße versagten. Ich fiel Morton in die Arme, der auch herausgeeilt war, und er hatte Mühe, mich auf mein Lager zurückzubringen. Endlich erschien Osborn und teilte uns ziemlich erregt mit, daß wahrscheinlich ein Überfall auf unser Lager beabsichtigt gewesen sei, den er aber mit Selwood und Bryans abgeschlagen habe. Es sei aber nicht geraten, länger zu bleiben, und er habe daher den Befehl zum sofortigen Aufbruch gegeben. Tatsächlich wurden auch bereits alle Vorbereitungen für den Weitermarsch getroffen, und Morton und ich bemerkten, daß die Eingeborenen eine geradezu fieberhafte Hast entwickelten. Sie zeigten plötzlich eine Scheu, die wir an ihnen bisher noch nie beobachtet hatten, und als wir der Sache nachgehen wollten, begegneten wir überall einem verlegenen Schweigen. Nur einer von ihnen ließ sich zu einer geheimnisvollen Andeutung herbei, die wir aber nicht verstanden. ›Es war die Königin der Nacht‹, flüsterte er erschauernd. ›Sie steht unter dem Schutze Allahs und des Propheten, aber man hat gegen sie die Hand erhoben, und das bringt Verderben.‹ — Mehr war weder jetzt noch später herauszubekommen, und Osborn führte die Andeutung auf die rege Phantasie und die Geisterfurcht unserer Leute zurück. In Wirklichkeit habe es sich um irgendwelches Raubgesindel gehandelt, das wohl eine günstige Gelegenheit für einen Überfall zu finden glaubte, aber durch die Schüsse, die er abgegeben habe, verscheucht worden sei. — Seine Erzählung schien mir trotz ihrer Einfachheit nicht ganz der Wahrheit zu entsprechen, aber ich mußte sie glauben, da ich nie eine andere Erklärung für diese rätselhafte Episode erhalten habe...
Das steht in dem Tagebuch Benjamin Cartwrights«, schloß Wellby, indem er seine Aufzeichnungen in die Tasche steckte. »Was meinen Sie zu der Geschichte, Miss Avery?«
Sie schreckte wie aus einem Traum auf, und ihre Augen wanderten unruhig hin und her.
»Sie klingt sehr seltsam«, brachte sie endlich leise und stockend hervor und stellte dann eine hastige Gegenfrage. »Welchen Zusammenhang glauben Sie zwischen diesen Aufzeichnungen und dem Wiederauftauchen der ›Königin der Nacht‹ gefunden zu haben? Ich meine die gewissen letzten Fälle...«
Er hielt ihr sein abgenütztes Zigarettenetui hin, und sie griff mit zitternden Fingern zu.
»Ich glaube«, sagte er bedächtig, nachdem er ihre und seine Zigarette in Brand gesetzt hatte, »daß damals wirklich so etwas wie eine ›Königin der Nacht‹ vor dem Lager erschienen ist. Eine Person, die die Eingeborenen so nannten, aus irgendwelchem nebensächlichen Grund. Und zwar denke ich, daß sie wegen einer Sache gekommen war, die sich abgespielt haben muß, während Osborn, Selwood und Bryans außerhalb des Lagers herumstreiften. — Hier liegt für mich das Rätsel. Denken Sie darüber nach, Miss Avery, und helfen Sie mir.«
Sie lachte gezwungen und zuckte mit den Schultern.
»Wie könnte ich das? Wenn Sie selbst nicht daraus klug werden...
»Oh, ich habe mir bereits eine Ansicht gebildet«, meinte er leichthin, »aber ich weiß nicht, ob sie zutrifft. Ich nehme an, daß der ›Königin der Nacht‹ irgend etwas Schlimmes zugefügt worden war und daß sie zum Lager kam, um ihr Recht zu suchen. Man hat sie aber mit Schüssen empfangen und verjagt. — Erst zwölf Jahre später ist sie dann durch Zufall in einem anderen Erdteil wieder auf die Männer vom Brunnen der sieben Palmen gestoßen, und Cartwright und Morton sind ihre ersten Opfer geworden — obwohl sie völlig unschuldig waren...«
»Das ist nicht wahr...!«
Die Worte gellten wie ein verzweifelter Schrei über das Wasser, und Clarisse Avery war so heftig aufgeschnellt, daß sie aus dem Boot gestürzt wäre, wenn Wellby sie nicht im letzten Augenblick aufgefangen hätte. Sie lag sekundenlang schwer atmend in seinen Armen, und es war ihm, als ob ein mühsam unterdrücktes Schluchzen ihren ganzen Körper erschüttere. Aber plötzlich machte sie sich mit einer raschen Bewegung frei und glitt auf die Bordwand nieder.
»Sie haben sich zu sehr übernommen«, meinte er unbefangen und herzlich. »Für das erste Mal war es doch etwas zu viel. Ruhen Sie sich nun ordentlich aus, bis Sie sich wieder kräftig fühlen. Wir können auch das Segeln ganz sein lassen; schon der Aufenthalt auf dem Wasser ist ja eine Erholung.«
»O nein«, wehrte sie mit einer müden Geste und einem gezwungenen Lächeln hastig ab. »Wir fahren natürlich wieder aus. Sie brauchen auf mich gar keine Rücksicht zu nehmen. Ich fühle mich bereits wieder völlig wohl. Es muß die ungewohnte Sonne gewesen sein«, erklärte sie verlegen und wandte ihm ihre dunklen Augengläser zu, aber er schien die Szene bereits vergessen zu haben und beeilte sich, das Boot in den Wind zu bringen.
Sie übernahm wieder das Steuer, aber ihre übermütige Lebhaftigkeit war verschwunden. Sie saß in ihrer alten schlechten Haltung teilnahmslos am Heck und war nicht mehr bei der Sache, so daß Wellby Mühe hatte, in glatter Fahrt zu bleiben.
Plötzlich hob er überrascht den Kopf und spähte aus halbgeschlossenen Augen über das Wasser. Ein klobiges Boot mit einem entsetzlich ratternden Außenbordmotor hatte bereits früher zweimal seinen Kurs gekreuzt, und da es eben wieder durch sein Kielwasser geknattert war, hatte es seine Aufmerksamkeit erregt. Die beiden Insassen waren offenbar betrunken, denn sie lavierten unter lautem Johlen auffallend unbeholfen und rücksichtslos, und wiederholt hatte es den Anschein, als ob sie im nächsten Augenblick eines der vielen Fahrzeuge, die den Strom bevölkerten, überrennen würden.
Der Reporter sah diesem Treiben eine Weile aufmerksam zu und zog dann plötzlich mit einem eigentümlichen Lächeln einen seltsam geschnittenen scharlachroten Wimpel am Mast auf. Sie befanden sich ziemlich weit von der Bucht inmitten des Flusses, und er ließ das Boot abfallen, um näher an das Ufer zu gelangen. Das Manöver währte einige Minuten, und bevor es noch ganz ausgeführt war, war auch schon wieder der Lärm des verrückten Bootes zu vernehmen. Es war zwar noch etwa einen halben Kilometer entfernt und schoß, von lauten Verwünschungen begleitet, ungeschickt hin und her, aber seitdem Wellby in einem der Insassen einen seiner Verfolger vom Morgen erkannt hatte, ahnte er, was kommen würde.
»Können Sie schwimmen, Miss Avery?« fragte er ernst.
Sie sah ihn überrascht an und zögerte mit der Antwort, aber er wurde plötzlich sehr ungeduldig.
»Sagen Sie es mir aufrichtig, damit ich weiß, was ich zu tun habe. — Können Sie schwimmen?«
»Ja«, kam es verständnislos, aber entschieden zurück.
»Gut?«
»Sehr gut sogar.«
Er nickte befriedigt und wandte den Kopf nach dem Boot, das nun freies Fahrwasser hatte und rasch näher kam.
»Wir werden vielleicht ein unfreiwilliges Bad nehmen müssen«, erklärte er lächelnd. »Es sieht ganz so aus, als ob die Burschen uns rammen wollten. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie darauf vorbereitet sind. Vorläufig ist es noch nicht soweit, und wenn wir Zeit gewinnen, kann alles noch anders kommen.«
Er lächelte grimmig, sah nach dem heranklappernden Fahrzeug und richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf die Bucht.
»Haben Sie keine Angst und achten Sie genau auf meine Weisungen.«
Das Mädchen am Steuer saß mit einem Male wieder kraftvoll aufgerichtet und blickte nun ebenfalls aufmerksam auf das lärmende Boot, das eben an ihnen vorüberschoß. Es hielt eine Strecke geradeaus, schlug dann einen Bogen gegen das Ufer und kam hierauf in torkelndem Kurs wieder zurück. Plötzlich schien am Motor etwas nicht in Ordnung zu sein, denn er stampfte lärmender denn je und setzte dann aus, worauf die beiden Insassen sich an ihm zu schaffen machten.
Aber Wellby ließ sich nicht täuschen. Er ahnte, daß nun der entscheidende Augenblick gekommen war, und während er das große Segel herumriß, raunte er dem Mädchen zu, wieder gegen die Flußmitte zu halten.
Das prächtige Fahrzeug stieß wie ein flinker Fisch in den neuen Wind, aber im selben Augenblick war auch drüben der Motor wieder zu Atem gekommen und begann ein wütendes Geklapper. Der alte Kahn schoß ruckweise vorwärts, und sein Steuermann schien nun völlig den Kopf verloren zu haben, denn er führte die tollsten Dinge aus. Was an Booten in der Nähe war, suchte schleunigst das Weite, um nicht in Mitleidenschaft gezogen zu werden, aber die kleine Segeljacht mit dem roten Wimpel kam bald in eine gefährliche Lage. Sooft sie auch den Kurs änderte, immer hielt der klobige Kasten gegen ihre Breitseite und kam näher und näher.
»Springen Sie vom Heck ins Wasser, wenn ich Ihnen das Zeichen gebe«, sagte Wellby hastig. »Möglichst weit, damit Sie nicht in die Leinen geraten. Ich werde mich schon um Sie kümmern.«
Seine Stimme und seine Blicke verrieten, wie besorgt er war, aber Clarisse beruhigte ihn durch ein tapferes Lächeln. Sie hatte plötzlich wieder frische Wangen, und die Sache schien ihr so viel Spaß zu machen, daß sie ihren Humor wiederfand.
»Was wird Ihre Wirtin sagen, wenn Sie ohne den kostbaren Eßkorb nach Hause kommen?« fragte sie, und er lachte erleichtert auf, als er hörte, daß sie in diesem Augenblick keine anderen Sorgen hatte.
Der Zusammenstoß konnte jede Minute erfolgen, denn die beiden Männer ließen nun an ihrer Absicht keinen Zweifel mehr, und Wellby unternahm einen letzten Versuch, ihnen zu entkommen. Er gewann auch wieder einigen Vorsprung, aber plötzlich ließ er das Boot abfallen, hockte sich gemächlich nieder und starrte mit einem schadenfrohen Lächeln auf seine Verfolger, die offenbar das Spiel bereits für gewonnen hielten. Sie steckten die glühenden Köpfe zusammen und überlegten nur noch, wie die Sache möglichst unauffällig und geschickt zu machen war. Allem Anschein nach sollte das Boot mittschiffs breit angerannt und einfach umgekippt werden, ein Manöver, das ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm und sie nicht darauf achten ließ, was sonst um sie vorging.
Ein kleines, schnittiges Motorboot war schon seit Minuten dicht hinter ihnen her, und als der klobige Kahn der zierlichen Jacht in die Rippen rennen wollte, bekam er steuerbord einen Puff, der sein Heck mitsamt dem brummenden Motor in die Tiefe sinken ließ. Auf dem Wasser trieb ein jämmerliches Wrack, und als das kleine Fahrzeug beidrehte, um zu sehen, was es angerichtet hatte, tauchten aus der Tiefe zwei triefende, prustende Köpfe auf. Zwei Männer reckten ihre sehnigen Arme aus dem Boot und faßten zu, nahmen sich aber nicht erst die Mühe, die beiden strampelnden Gesellen über Bord zu holen. Sie wurden in gemächlicher Fahrt an Land bugsiert, und hin und wieder verschwand einer der Köpfe für längere Zeit unter dem Wasser. Der eigenartige Transport ging unter zahlreicher heiterer Eskorte vor sich, denn man gönnte den Störenfrieden ihr Mißgeschick.
»Was sollte das alles bedeuten?« fragte Clarisse neugierig, denn sie glaubte in einem der Männer, die das Unheil angerichtet hatten, den großen, jungen Burschen erkannt zu haben, der ihnen ihr Boot zugewiesen hatte.
»Das sollte bedeuten, daß manche Leute schrecklich hartnäckig sind«, gab Wellby orakelhaft, aber höchst vergnügt zur Antwort. Aber dann wurde er plötzlich sehr ernst und sah sie mit einem langen, eindringlichen Blick an. »Und daß alle, die mit der ›Königin der Nacht‹ irgend etwas zu schaffen haben, nicht vorsichtig genug sein können, Miss Avery.«
Als sie nach einer Stunde in die Bucht einliefen, half ihnen der junge, kräftige Bursche fürsorglich aus dem Boot.
»Wie haben Sie die Leute herausgebracht?« fragte der Reporter lächelnd.
»Danke, gut, Sir«, erwiderte der Mann höflich. »Sie hatten zwar etwas viel Wasser geschluckt, aber wir haben sie auf den Kopf gestellt und ein bißchen gequetscht, damit das ungesunde Zeug wieder aus ihnen herauskommt.«
Clarisse Avery saß in dieser Nacht lange Stunden grübelnd und träumend und ließ die Erlebnisse des Tages an sich vorüberziehen. Aber lebhafter als alles, sogar mehr als die geheimnisvolle Geschichte der ›Königin der Nacht‹ vom Brunnen der sieben Palmen beschäftigte sie das Bild eines jungen Mannes mit angegrauten Schläfen und einem kühnen Gesicht, das ihr ebenfalls eine Fülle von Rätseln aufgab.
»Hast du etwas von Selwood gehört?« fragte Mrs. Helen beim zweiten Frühstück in ihrer verschüchterten Art. Aber so belanglos und bescheiden die Frage klang, Osborn geriet dadurch wieder einmal außer Rand und Band.
»Hol ihn der Teufel!« schrie er, indem er das Besteck heftig auf den Tisch warf, »und dich dazu. Was liegst du mir fortwährend mit diesem Burschen in den Ohren? Ich habe ihn seit Tagen nicht gesehen und mag ihn auch nicht sehen.«
Die junge Frau kroch ängstlich in sich zusammen.
»Ich meinte nur...«, stotterte sie verwirrt und zaghaft. »Wegen der Sache, die ich dir unlängst ausgerichtet habe. Daß er alles ausplaudern will...«
»Ja, ich weiß«, schnitt er ihr wütend das Wort ab. »Und ich traue ihm das auch zu, denn er ist immer eine feige Memme gewesen. Schon damals. Aber mir ist es völlig gleichgültig, was geschieht, verstehst du? Im übrigen habe ich keine Lust, deine albernen Fragen zu beantworten.«
Osborn befand sich in äußerst übler Laune, und er hatte wirklich Grund hierfür. Es schien sich, plötzlich alles wider ihn verschworen zu haben, denn was er auch unternahm, ging schief. Sein Pech im Spiel hatte geradezu groteske Formen angenommen und ihn in Verpflichtungen gestürzt, die weit über seine verfügbaren Mittel gingen. Er mußte sich notgedrungen heute oder morgen wieder an Helen wenden, aber das war so unangenehm, daß er es bis zur letzten Minute verschob.
Schließlich war das auch nicht die dringlichste und gefährlichste Sache, die ihm zu schaffen gab. Weit mehr bedrückte ihn der Fall Wellby, den er in aller Stille in die Hand genommen und in seiner gründlichen Art zu erledigen gedacht hatte. Er war nicht der Mann, der viel Worte machte, aber er hatte einen raschen und scharfen Blick, und kaum war der Stein ins Rollen gekommen, so wußte er auch schon, wo der Feind stand, der am meisten zu fürchten war. Die anderen hatten sich über die Persönlichkeit des Reporters und dessen Absichten die Köpfe zerbrochen, er aber war ihm sofort zu Leibe gerückt.
Allerdings hatte er sich die Sache nicht so schwierig vorgestellt, wie sie sich gestalten sollte. Als der Überfall beim Hafen mißlungen war, hatte er noch an einen mißlichen Zufall geglaubt, aber daß auch der Anschlag mit der Katze und die Jagd auf der Themse erfolglos endeten, hatte ihm zu denken gegeben. Osborn war nicht der Mann, der sich Selbsttäuschungen hingab, und er war sich zur Stunde völlig klar, daß er es mit einem Gegner zu tun hatte, der ihm gewachsen war und der über Helfershelfer verfügte, die seinen bezahlten Leuten eine jämmerliche Schlappe nach der anderen beibrachten.
Dieses Bewußtsein machte ihn nervös und unruhig, dazu kam noch das vergebliche Warten auf die ›Königin der Nacht‹. Seit Tagen war er jeden Augenblick gefaßt, die Erscheinung neben sich auftauchen zu sehen, und hatte seine Vorbereitungen getroffen. Das leiseste Geräusch begann ihn zu schrecken und drohte ihn um seine Kaltblütigkeit zu bringen.
Er grübelte unausgesetzt darüber nach, warum wohl die geheimnisvolle Persönlichkeit gerade ihm noch nicht in den Weg getreten war. Wenn sie vielleicht auch nicht wissen mochte, daß er damals am Brunnen der sieben Palmen die Hauptrolle gespielt hatte, so mußte er ihr doch zumindest ebenso beteiligt erscheinen wie die übrigen, nach denen sie bereits die Hand ausgestreckt hatte, und wie Selwood, der als nächster an der Reihe schien. Sollte sich vielleicht erst dessen Schicksal erfüllen, bevor das gleiche heimtückische Spiel mit ihm begann?
Osborn würde diese furchtbare Spannung nicht mehr lange ertragen können, und als es ihn gegen fünf Uhr aus dem Hause trieb, sah er tatsächlich so verstört und verfallen aus, daß sich Boyds Lippen zu einem bedenklichen leisen Pfeifen spitzten. Der elegante, weißhaarige Herr war nur ein bißchen um das Haus herumgeschlendert, um nachzusehen, ob die Leute von Oberst Terry auf ihren Posten waren, und er hatte, wie bei Selwood und Mrs. Dyke, auch hier alles in Ordnung gefunden. Das Netz war also gespannt, und schon in Kürze mußte es sich erweisen, ob es zweckdienlich und zuverlässig war.
Der Detektiv schwang sich befriedigt in seinen kleinen Wagen und fuhr nach Scotland Yard.
»Was bringen Sie da Besonderes?« fragte Terry neugierig, als der ehemalige Oberinspektor mit einer Handtasche angerückt kam und diese mit größter Behutsamkeit auf den Tisch stellte.
»Ein Geschoß der ›Königin der Nacht‹«, erklärte Boyd, indem er ein kleines Holzkästchen hervorzog. »Einmal etwas, was Sie noch nie gesehen haben und vorläufig auch nicht sehen sollen. Es ist am besten, Sie nehmen das Ding so, wie ich es verpackt habe, unter sicheren Verschluß, bis Sie es brauchen. Dann sollen sich die Chemiker damit beschäftigen, die ja gewohnt sind, mit so gefährlichem Zeug umzugehen. Unsereiner könnte dabei das größte Unheil anrichten. Im übrigen weisen Sie auch Ihre Leute an, die mit der Überwachung betraut sind, sehr vorsichtig zu sein, wenn ihnen eine vermummte Gestalt in den Weg laufen sollte. Die Sache könnte, wie ich selbst erfahren habe, sehr schlimm ausgehen, und es hat gar keinen Zweck, daß einer von unseren braven Jungen dabei sein Leben aufs Spiel setzt. Wir werden sie schon in einem günstigen Augenblick zu fassen kriegen.«
Dem Oberst brannten hundert Fragen auf den Lippen, aber er wußte, daß Boyd mit ungeduldigem Drängen nicht beizukommen war.
»Sie sind ihr begegnet?«
Boyds Gesicht bekam einen verlegenen Ausdruck, und er schnippte umständlich einige Stäubchen von seinem Anzug.
»Wir standen uns auf etwa zwei Schritte gegenüber, aber ich hatte gerade keinen besonders guten Tag. Das heißt, ich darf nicht undankbar sein. Es war immerhin etwas, dem Schuß auszuweichen und dann auch noch das Geschoß zu finden.«
»Boyd, spannen Sie mich nicht so auf die Folter«, jammerte der Polizeioffizier. »Wie war die Geschichte?«
Der weißhaarige Herr sah auf die Uhr und ließ erkennen, daß er große Eile hatte.
»Wie ich Ihnen sagte. Wir stießen zusammen, und sie hat auf mich geschossen.«
»Geschossen?« fragte der Oberst verständnislos.
»Allerdings. Jedenfalls kann man es so nennen. Wahrscheinlich hat sie ein äußerst geschickt konstruiertes handliches Rohr, aus dem die niedlichen Ballons durch komprimierte Luft herausgeschleudert werden. Das Ding muß ein kleines Kunstwerk sein und erfüllt unbedingt seinen Zweck, denn ich habe wahrnehmen können, daß es zehn Schritte weit trägt. Das genügte sowohl bei Cartwright wie bei Morton und Bryans. Ich habe mich heute an Ort und Stelle davon überzeugt. Alles in allem bin ich seit dem frühen Morgen unterwegs und habe seit dem ersten Frühstück keinen Bissen zu mir genommen. Deshalb gedenke ich zunächst einmal etwas für meinen Magen zu tun, und dann habe ich noch einige andere Dinge vor«, schloß er und machte sich eiligst davon.
Zu diesen anderen Dingen gehörte vor allem ein Besuch im Reporterzimmer des Cartwright-Hauses, um wieder einmal nach dem netten, redseligen Mr. Fish zu sehen, von dem er vielleicht einige neue wertvolle Fingerzeige erhalten konnte.
Aber Mr. Fish war noch nicht da, und als er, unternehmend wie immer, erschien, gab es eine höchst frostige Begrüßung.
»Das nennen Sie Freundschaft?« sagte der sommersprossige Jüngling und pflanzte sich mit den Händen in den Hosentaschen vor Boyd auf. »Ich opfere mich für Sie auf und lasse mich von Ihnen trotz meiner anderweitigen Verpflichtungen zu einem langweiligen Abendessen schleppen, und Sie tun plötzlich nichts dergleichen! Wo stecken Sie denn eigentlich die ganze Zeit? Seit Tagen warte ich auf Sie.«
»Ich hatte wirklich dringend zu tun«, versuchte der weißhaarige Herr sich zu entschuldigen, aber der ›Fliegenpilz‹ hatte dafür nur ein verächtliches Achselzucken.
»Wenn einer zu tun hat, so bin ich es«, stellte er mit so lauter Stimme fest, daß man es im ganzen Zimmer hören konnte. »Was wissen Sie, was ich zu tun habe. Trotzdem vernachlässige ich dabei meine Freunde nicht«, fuhr er anzüglich fort und begann in seinen sämtlichen Taschen zu kramen, »sondern tue für sie, was ich kann.« Er hatte endlich gefunden, was er suchte und warf mit einer nachlässigen Handbewegung einen Briefumschlag vor Boyd auf den Tisch. »Hier. Das danken Sie mir.«
Der völlig geknickte Detektiv besah sich interessiert das schmierige und zerknitterte Kuvert, das seinen Namen trug, und zog dann eine Karte heraus, die er hastig überflog:
»Mrs. Evelyn Dyke beehrt sich, Mr. Boyd für Donnerstag, den 9. April, zum Dinner einzuladen. 8 Uhr. 7, Stainsby Street, Nottinghill.«
»Das ist übermorgen«, machte Mr. Fish seinen Freund aufmerksam. »Sie können sich denken, wie ich auf Sie gewartet habe. Die Sache beginnt um acht Uhr, aber wir werden ein paar Minuten früher dort sein. Man kann sich dann ein bißchen umsehen, um zu wissen, wo man den Whisky und die Zigarren finden kann. Wenn wir ein Viertel nach sieben von meiner Wohnung abfahren, wird es genügen. Holen Sie mich also um diese Zeit ab: 19, High Street, Hoxton. Bringen Sie aber einen bequemen Wagen mit, denn wenn ich im Frack bin, drücke ich mich nicht gerne. Man sieht dann zu derangiert aus, und das macht keinen guten Eindruck.«
Mr. Boyd nahm die Wünsche seines Gönners mit der gebührenden Aufmerksamkeit zur Kenntnis, und das versöhnte den ›Fliegenpilz‹ wieder etwas.
»Sie werden sich sehr gut unterhalten«, versicherte er. »Natürlich erste Gesellschaft. Wahrscheinlich wie immer Osborns und Selwood — Sie wissen ja, die beiden Afrikaner — und von uns ich und Sie. Miss Avery und Wellby haben zwar auch eine Einladung erhalten«, bemerkte er obenhin, »aber nur durch meine Verwendung. Wellby ist schließlich ein ganz erträglicher Mensch, wenn man ihn zu nehmen weiß. Er hat in den letzten Tagen vier Pfund an mich verloren, bar bezahlt, ohne mit der Wimper zu zucken. Immerhin ganz anständig.«
Der Herr mit dem weißen Haar hörte mit solchem Interesse zu, daß der ›Fliegenpilz‹ nicht umhin konnte, die Vorgeschichte rasch, aber ausführlich zu erzählen, um einerseits seine Freundschaft mit Mrs. Dyke, andererseits seine Gerissenheit ins rechte Licht zu setzen. Und er konnte mit dem Eindruck auf seinen Zuhörer vollauf zufrieden sein.
»Wenn ich nicht in eine wichtige Sitzung des Reederverbandes müßte«, meinte er bedauernd, »würde ich Ihnen vorschlagen, daß wir zusammen speisen... Es gäbe wegen übermorgen noch so verschiedene Dinge zu besprechen.«
»Allerdings«, pflichtete Boyd bei. »Also, vielleicht morgen.«
»Gut«, nickte Fish und stellte bereits blitzschnell das Dinner zusammen, das er diesmal im ›Savoy‹ einnehmen wollte, als er sich noch rechtzeitig erinnerte, daß er den Frack und was dazugehört, beim Reinigen hatte und erst am übernächsten Tag erhalten sollte. »Aber«, schränkte er daher entgegenkommend ein, »diesmal ohne viel Umstände. Ich gehe auch ganz gerne in ein bescheidenes Lokal. Man speist dort ebenso gut und um fünfzig Prozent billiger. Es ist sehr liebenswürdig von Ihnen, aber ich möchte wirklich nicht, daß Sie sich meinetwegen immer zu einem Luxusrestaurant zwingen.«
Er reichte Boyd huldvoll den Zeigefinger und fuhr dann damit verabschiedend an die Hutkrempe. Es war zwar nicht viel, was er in dieser Viertelstunde erreicht hatte, aber immerhin etwas, und er war nichts weniger als unbescheiden.
Auch Boyd war es nicht, und als er eine Weile später in der Halle Platz nahm, um Wellby abzupassen, lag ein sehr zufriedenes Lächeln auf seinem Gesicht.
Pat hatte, seitdem ihn der höllische Versucher mit ganzen zwölf Pfund versucht hatte, für sein Verhalten gegenüber dem Reporter einen sehr glücklichen Kompromiß gefunden. Er sah zwar noch immer weg, wenn der unangenehme Mann seine Loge passierte, aber dafür flogen sämtliche Finger seiner Rechten so stramm und mit so hochachtungsvoll abgestrecktem Ellbogen an die Mütze, wie dies nicht einmal bei Mr. Hyman geschah.
»Clive Boyd«, sagte der Detektiv sehr höflich, aber die Miene, mit der Wellby die Vorstellung entgegennahm, war keineswegs ermunternd. Er hatte dieses junge, frische Gesicht unter dem weißen Haar schon einige Male flüchtig gesehen, empfand aber nicht das Bedürfnis, neue Bekanntschaften zu schließen, und ließ dies deutlich erkennen.
»Würden Sie mich eine Viertelstunde anhören?« wagte Boyd trotzdem unbefangen und verbindlich vorzuschlagen. »Wir können uns hier in einer ungestörten Ecke niederlassen.«
Der Reporter warf ungeduldig den Kopf zurück, und der hochmütige Zug um seinen Mund trat noch schärfer hervor.
»Das wird wohl nicht notwendig sein«, meinte er frostig. »Wollen Sie mir kurz sagen, worum es sich handelt, ich bin in Eile.«
»Wie Sie wünschen«, meinte Boyd mit unerschütterlicher Liebenswürdigkeit und zog jenes Blatt Papier aus der Tasche, mit dem er sich während der Rundfahrt durch den Pool beschäftigt hatte. »Es handelt sich darum«, sagte er und tippte mit dem Finger auf den Schiffsnamen, der von ihm mit drei Ausrufungszeichen versehen worden war.
Noel Wellby blickte flüchtig auf das eine Wort und vermochte nicht zu verbergen, daß er davon betroffen war.
»Wer sind Sie?« fragte er nach einer Pause weit höflicher als bisher.
»Clive Boyd. Ich glaube, ich habe mich bereits vorgestellt. Früher Oberinspektor von Scotland Yard. Jetzt arbeite ich auf eigene Faust — wenn es mir Vergnügen macht.«
Der Reporter fand es plötzlich doch angezeigt, die Unterredung in einem abgelegenen Winkel fortzusetzen.
»Bitte«, forderte er den Detektiv auf. »Was haben Sie mir zu sagen?«
»Für heute nur wenig. Ich möchte Sie bloß auf die Gefahr aufmerksam machen.«
»Danke«, sagte Wellby kurz und lächelte.
Auch Boyd lächelte und richtete die grauen Augen scharf auf sein Gegenüber. »Das habe ich mir gedacht. Sie unterschätzen die Sache. Was bis jetzt war, war ein Kinderspiel.«
In dem Reporter begann doch einiges Interesse zu erwachen.
»Was wissen Sie davon?«
»Verschiedenes«, gab Boyd zurück. »Ein guter Bekannter von mir hat kürzlich einen Arm eingebüßt, nachdem er einige Stunden vorher frisch und munter vor dem Cartwright-Haus auf und ab gebummelt war. Und von Ihrer liebenswürdigen Wirtin weiß ich unter anderem, daß Sie die üble Gewohnheit haben, die Fenster offenzulassen, so daß vor einigen Tagen sogar eine Katze Ihrer Wohnung einen Besuch abstatten konnte.« Der weißhaarige Herr blickte angelegentlich zur Decke und strich sich das glatte Kinn. »Dieser Trick ist niederträchtig«, meinte er nebenbei, »aber nicht neu. Ich selbst habe auch einmal mit solch einem Tier zu tun gehabt, aber damals wußte ich nicht, wem ich diese Aufmerksamkeit zu danken hatte. Zu dumm es war doch so naheliegend. Ich hoffe, daß Sie als kluger Mann wenigstens die Pfoten aufbewahrt haben. Wir werden sie brauchen, wenn wir dem ›Professor‹ auf den Leib rücken. Und dann weiß ich auch von der netten Geschichte auf der Themse.« Man stößt auf so verschiedenes, wenn man die Berichte unserer gewissenhaften Bobbys aufmerksam liest. Aber wie gesagt, alles das waren Kleinigkeiten. Wenn Sie es mit der ›Königin der Nacht‹ selbst zu tun bekommen werden — und ich nehme an, daß dies demnächst der Fall sein wird —, nützen Ihnen alle Ihre Vorkehrungen und Ihre tüchtigen Leute nichts. Sie schleudert Ihnen aus dem erstbesten Hinterhalt eine ihrer niedlichen Gaskugeln ins Gesicht, und Sie sind erledigt. Davor wollte ich Sie warnen.«
»Sie scheinen viel zu wissen«, bemerkte Wellby nach einer nachdenklichen Pause.
Der andere hob bescheiden die Schultern.
»Ich glaube, ich weiß alles. Bis auf einige Kleinigkeiten, die aber nicht von Belang sind. Und deshalb halte ich es für überflüssig, daß sich noch irgend jemand wegen dieser Sache einer Gefahr aussetzt. Sagen Sie dies auch Miss Avery. Ich würde es selbst tun, glaube aber, daß es aus Ihrem Mund mehr Eindruck machen wird.«
Der Reporter richtete sich mit einem Ruck halb auf und sah Boyd betroffen an, aber dieser saß mit dem gleichgültigsten Gesicht der Welt da.
»Was halten Sie von Miss Avery?« fragte Wellby plötzlich.
Der Detektiv dachte eine Weile nach, dann lächelte er vergnügt und überraschte den Reporter durch eine Gegenfrage.
»Woran haben Sie sie wiedererkannt?«
»Wen?«
»Ihre ›Königin der Nacht‹, die Sie bei Lord Etheridge gesehen haben, als sie Morton die gewissen Worte zuflüsterte.«
Wellby fühlte sich mit einem Male diesem weißhaarigen Herrn gegenüber höchst unbehaglich, und gab es auf, vor ihm Verstecken zu spielen.
»An einem kleinen Mal hinter dem linken Ohr und am Haar«, erklärte er offen. »Diese beiden nicht alltäglichen Dinge in einer zweiten Ausgabe wären ein zu seltsames Spiel der Natur gewesen.«
Boyd nickte zustimmend, aber Wellby genügte das nicht.
»Sie sind also ebenfalls überzeugt, daß Miss Avery die ›Königin der Nacht‹ ist?« fragte er unsicher.
»Ja.«
»Und daß...« — der junge Mann stockte plötzlich, und seine Stimme klang gepreßt und tonlos —, »Cartwright, Morton und...«
»Nein«, sagte Boyd nun ebenso kurz und entschieden, wie er vor her »ja« gesagt hatte. »Das wollen wir streng auseinanderhalten. — Hier war nicht Ihre, sondern meine ›Königin der Nacht‹ im Spiel.«
Von Wellby war schon längst die Gelassenheit gewichen, die so unerschütterlich schien.
»Kennen Sie sie?« stieß er hastig hervor.
Der Herr mit dem weißen Haar spitzte pfiffig den Mund und wiegte den Kopf. »Vielleicht«, sagte er ausweichend. »Jedenfalls wissen Sie aber nun, wie ernst die Dinge liegen, und daß Sie auf der Hut zu sein haben. Dasselbe gilt für Miss Avery. Wenn Mr. Fish die gewisse Geschichte von dem Notizbuch mit den hebräischen Schriftzeichen außer mir auch noch anderen Leuten erzählt haben sollte, wird der Tanz wohl bald beginnen. Aber wahrscheinlich kaum vor übermorgen«, fügte er beruhigend hinzu, »wenn Miss Avery nicht irgendeine Unvorsichtigkeit begeht. Und das müssen Sie eben verhindern.«
Wellby erledigte an diesem Abend seine Arbeiten in fieberhafter Eile, und seine ewig ängstliche und mißvergnügte Wirtin glaubte ihren Augen nicht zu trauen, als sie ihn plötzlich aus einem Auto springen und ins Haus stürzen sah. Sie vermutete sofort, daß wahrscheinlich die Polizei hinter ihm her sei, und sie empfand darüber eine gewisse Befriedigung, denn sie hatte sich schon immer gedacht, daß ein Mann mit derartigem Lebenswandel unbedingt ins Zuchthaus gehöre.
Während sie erregt am Fenster stand und gespannt in den Abend hinausblickte, um das große Ereignis ja nicht zu versäumen, ließ Wellby oben in seinem Zimmer über eine Viertelstunde die Tasten an dem kleinen Kästchen spielen. Dann harrte er ungeduldig, bis das Papierband abzulaufen begann, und erst, als er die Zeichen aufmerksam entziffert hatte, atmete er auf und zündete sich zur Beruhigung eine Zigarette an.
Dann verließ er, sehr zum Ärger seiner enttäuschten Wirtin, gemächlich und unbehelligt wieder das Haus.
Pünktlich um elf Uhr, wie ihm aufgetragen worden war, öffnete in dieser Nacht der sehnige, braune Ali das Tor des düsteren Hauses in Brompton und lenkte seinen Wagen über den ausgestorbenen Platz in eine der nächsten Seitengassen.
Es war alles so lautlos geschehen, daß nicht das leiseste Geräusch zu den Ohren der blassen Frau gedrungen war, die oben träumend in ihrem Lehnstuhl saß. Nur das junge Mädchen an ihrer Seite hatte verstohlen lauschend den Kopf geneigt und auf das winzige Zifferblatt an ihrem Handgelenk geblickt.
»Der Tag ist um, Mami«, sagte sie zärtlich, aber entschieden. »Wir gehen schlafen.«
Die schmächtige Frau mit den feinen Zügen nickte zustimmend, und um ihren Mund spielte ein müdes Lächeln.
»Das höre ich nun von dir fast Tag um Tag, Liebling, und es fällt mir manchmal schwer, mich zu fügen. Was soll ich alte, einsame Frau mit den langen Nächten beginnen? Aber ich bin folgsam und warte geduldig, bis du mir eines Tages etwas anderes sagen wirst.«
»Was, Mami?« fragte das junge Mädchen lebhaft.
»Unsere Zeit hier ist um — wir fahren heim«, lispelte die Frau mit sehnsuchtsvoller Stimme, und das Mädchen senkte den Blick vor dem ergreifenden Flehen in den Augen der Mutter.
»Auch das wird kommen«, versicherte sie hastig. »Bald, sehr bald sogar.«
Die Frau lächelte glücklich.
»In unserem wundervollen Garten werde ich rasch wieder gesund werden. Nur dieses Land ohne Sonne hat mich krank gemacht. Wir kamen für einige Wochen her, und nun ist fast ein volles Jahr daraus geworden.«
»Daran trage ich die Schuld.«
Das hübsche Mädchen mit dem kupferbraunen Haar neigte sich über die zarte Hand der Frau und küßte sie stürmisch.
»Mami«, brach es dann plötzlich unter wildem Schluchzen hervor, »warum hast du mir die Geschichte der ›Königin der Nacht‹ vom Brunnen der sieben Palmen erzählt?«
Die Frau war fassungslos wie das weinende Mädchen vor ihr, und sie hielt die bebende Gestalt zärtlich umfangen.
»Ich habe dir davon erzählt wie von allem anderen«, flüsterte sie endlich, erschüttert von dem jähen Ausbruch der Tochter, für den sie keine Erklärung fand. »Du hattest ein Recht darauf, alles von deinem Vater zu hören, den du so wenig gekannt hast. Ich konnte ja nicht wissen, was daraus entstehen würde. Ich habe dich gewarnt, von deinem wahnwitzigen Vorhaben abzulassen, aber du wolltest nicht hören.«
»Es war ein Verbrechen«, stieß das Mädchen in wildem Zorn hervor. »Ein abscheuliches, niedriges Verbrechen.«
»Ja«, bestätigte die Frau hart, »es war ein unmenschliches Verbrechen, sich um den todkranken Mann der eigenen Rasse nicht zu kümmern. Vielleicht hätte es dann für ihn noch Rettung gegeben. Wir waren alle unterwegs, um von irgendwo Hilfe herbeizuholen aber sie kam zu spät.«
»Dafür hat man den Sterbenden beraubt«, fiel das Mädchen erbittert ein und vergrub das glühende Gesicht in den Händen. »Welch eine Roheit. — Europäer! — Leute von Rang und Stand!«
Sie brach plötzlich in ein unnatürliches, schneidendes Lachen aus, und die sanfte Hand der Frau mußte lange über ihren braunen Scheitel streichen, bis sie sich beruhigte.
»Laß diese Dinge endlich, Kind. Ich mag nicht wissen, was du bisher unternommen und erreicht hast — ich kann dich nur immer wieder bitten, alles aufzugeben.« In die müden Augen kam ein Schimmer von Furcht, und die Stimme sank zu einem scheuen Flüstern herab. »Es haftete Unglück an dem seltsamen Geschmeide, vom ersten Tag an. Wir hatten es in einer der Höhlen des Dschebel Sedina gefunden, die wir nach Tiffinschriften durchforschten, aber wir hätten es nie an uns nehmen sollen. Ich empfand sofort ein geheimes Grauen, als ich das seltsame Feuer der Steine in der kleinen kostbaren Truhe sah, und beschwor deinen Vater, sie an ihrem Ort zu lassen, aber er wollte dem Museum in Washington damit ein Geschenk machen. — Kaum eine Woche später kam Unheil auf Unheil über uns. Erst machte sich der größte Teil unserer eingeborenen Führer und Träger davon. Es sah fast wie Flucht aus, und dann zogen sich auch die Stämme von uns zurück, mit denen wir viele Monate in Eintracht und Frieden gelebt hatten. Sie hatten deinem Vater in allem beigestanden, und mich vergötterten sie. Irgendeiner der Scheichs mochte mich einmal in meinem Burnus mit dem silbergestickten Schleier im flackernden Schein des Lagerfeuers gesehen haben und hatte für mich den Namen ›Die Königin der Nacht‹ geprägt. Die Bezeichnung war dann von Brunnen zu Brunnen, alle Karawanenstraßen entlanggelaufen. Ich hätte damals völlig allein weites Gebiet durchstreifen können und wäre sicher gewesen. — Aber alles das änderte sich nach dem Fund in der Höhle des Dschebel Sedina. Die Stämme begannen uns zu meiden, und als eines Nachts eine Raubkarawane unser Lager überfiel, blieben wir ohne Hilfe. Es gelang uns zwar, den Angriff abzuschlagen, aber dein Vater trug in dem Kampf eine tödliche Wunde davon...«
Die Frau schwieg, erschüttert von den Erinnerungen, und in den Zügen des schönen Mädchens lag ein düsteres Grübeln. Sie wußte, daß der Fluch, der auf den Steinen zu ruhen schien, wieder lebendig geworden war, aber solange er Osborn und Selwood nicht erreicht hatte, war ihre Sendung noch nicht zu Ende...
Selwood hatte an diesem Abend nach längerer Zeit wieder einmal seinen Klub aufgesucht und war nach dem Dinner durch die Spielzimmer geschlendert, um die quälende Unruhe durch irgendwelche Eindrücke zu betäuben. Er hatte das Spiel, dem er früher Unsummen geopfert hatte, auf Evelyns hartnäckiges Drängen bereits seit Jahren aufgegeben, aber der Reiz der oft schicksalsschweren Entscheidungen, die an diesen kleinen grünen Tischen fielen, wirkte noch immer auf ihn.
Er blieb bald hier, bald dort stehen, wo es um hohe Einsätze ging, und als er seinen Vetter sah, schritt er langsam zu dessen Platz. Osborn schien sich in außerordentlicher Erregung zu befinden, und Selwood blieb über den Grund derselben nicht lange im unklaren. Der Mann spielte mit der verzweifelten Waghalsigkeit eines Besessenen und verlor Schlag um Schlag. Seine Barmittel waren offenbar schon längst erschöpft, denn er schrieb nach jedem Spiel mit zitternder Hand Bons, die er aus seinem Taschenbuch riß und die bereits in Stößen vor seinen Partnern lagen. Dabei stürzte er Glas um Glas von dem schweren Portwein hinunter, der neben ihm stand, und sog in tiefen Zügen an der dunklen Zigarre. Selwood schauderte davor, wie sich hier ein Schicksal erfüllte, und unwillkürlich gedachte er dankbar der Frau, die ihn vor diesem Ende bewahrt hatte.
In diesem Augenblick trat eine Spielpause ein, und Osborn wandte mechanisch den Kopf, aber seine verglasten Augen erkannten Selwood erst nach einer langen Weile.
»Ach, Charlie«, sagte er mit lallender Zunge, indem er sich schwerfällig erhob und Selwood unter den Arm faßte. »Hast du zugesehen? Pech über Pech.« Er fuhr sich durch das schüttere Haar, und sein Gesicht verzog sich zu einer krampfhaften Grimasse. »Es dürften ungefähr sechstausend Pfund sein, die von mir auf dem Tisch liegen. Schauderhaft. Es ist allerhöchste Zeit, daß das Blatt sich endlich wendet«, stieß er dann verzweifelt hervor, indem er den Vetter etwas beiseite zog. »Aber man beginnt mir wegen der Bons Geschichten zu machen. Kannst du mir nicht mit einem größeren Betrag aushelfen? Sagen wir mit tausend Pfund. Das würde mir vielleicht genügen, die Schlappe wieder auszuwetzen.«
Er sprach mit großer Eindringlichkeit, und seine Augen ruhten auf Selwood, der entschieden ablehnte.
»Nein«, sagte er und bemühte sich nicht einmal, seiner Antwort den Ton des Bedauerns zu geben. »Du weißt, daß ich über derartige Mittel zu solchen Zwecken nicht verfüge.«
Osborn starrte ihn sekundenlang wütend an, dann versetzte er ihm einen Stoß und grinste verächtlich.
»Natürlich. Das hätte ich mir denken können. Gentleman! Du scheinst völlig vergessen zu haben«, zischte er, »daß ich dir einmal ein Geschenk von vielen Tausenden gemacht habe.«
Selwood stand hoch aufgerichtet, und in seinem bleichen Gesicht zuckte es bedrohlich.
»Ein Geschenk, das du geraubt hattest. Wenn ich gewußt hätte, wie du in den Besitz der Steine gekommen bist...«
»Weshalb hast du damals nicht darnach gefragt?« stieß William mit beißendem Hohn hervor. »Nicht mit einem Wort. Es genügte dir, ein wohlhabender Mann zu werden...«
Er zischte dem Vetter ein rohes Schimpfwort ins Gesicht und wandte sich brüsk ab, um wieder zu seinem Spieltisch zurückzukehren, und Selwood mußte alle seine Selbstbeherrschung aufbieten, um ihn nicht niederzuschlagen.
Die Szene hatte ihm den Aufenthalt im Klub gründlich verleidet, und auch als er eine Viertelstunde später den Heimweg antrat, zitterte die Erregung noch in ihm nach. Die Beschimpfung hatte ihn wie ein Peitschenhieb getroffen, und er empörte sich von neuem gegen die erbärmliche Rolle, die er in der ganzen Angelegenheit tatsächlich gespielt hatte. Als während des Streifzuges, den sie vom Brunnen der sieben Palmen aus unternommen hatten, William plötzlich scheu und gehetzt mit der kostbaren Schatulle und ihrem noch kostbareren Inhalt aus den Felsen aufgetaucht war und zur schleunigen Rückkehr ins Läger gedrängt hatte, war ihm wirklich nicht eingefallen, darnach zu forschen, wie dieser Schatz seinem Vetter in die Hände gefallen war. Er hatte sich mit der Erklärung begnügt, daß Osborn ihn in einer Höhle gefunden habe, und war gleich Bryans ohne weiteres dafür zu haben gewesen, den anderen gegenüber strengstes Stillschweigen über die Sache zu bewahren. Auch das Auftauchen der ›Königin der Nacht‹ vor dem Lager hatte ihn nicht bedenklich gestimmt. Und wenn er mit dem Empfang, den Osborn ihr und ihren wenigen völlig friedlichen Begleitern bereitete, auch nicht einverstanden war, so vermied er es doch, dem mißtrauisch forschenden Cartwright durch ein unbedachtes Wort einen Anhaltspunkt zu bieten. Er befand sich damals in einem fieberhaften Glücksrausch, da er sich aller Sorgen um die Zukunft enthoben wähnte, und erst mit den späteren Enttäuschungen kamen ihm gewisse Bedenken. Bei der Veräußerung des alten Schmucks war größte Vorsicht notwendig gewesen, sollte nicht unerwünschtes Aufsehen erregt werden, und sie hatte sich daher weit weniger gewinnbringend gestaltet, als man erwartet hatte. Auch die mit diesem Betriebskapital unternommenen Spekulationen schlugen nach anfänglichen Erfolgen fehl, und Osborn konnte sich schließlich nur durch seine Heirat, Bryans durch seine Erbschaft über Wasser halten.
Selwood war allerdings haushälterischer umgegangen, aber was übriggeblieben war, genügte gerade, um ihm ein sehr bescheidenes Auskommen zu sichern. Ungezählte Male hatte die tüchtige Evelyn Dyke, die er vor Jahren kennengelernt und durch seine Fürsprache bei Cartwright untergebracht hatte, versucht, ihn zu irgendeiner geregelten Arbeit anzuhalten, aber alle ihre Versuche waren an seiner Schwäche gescheitert.
Diese Schwäche hatte er auch bewiesen, als Evelyn eines Tages völlig ahnungslos die Nachricht von der rätselhaften Begegnung Cartwrights mit der ›Königin der Nacht‹ gebracht hatte. Sie erzählte die Geschichte, die ihr der erregte Chef anvertraut hatte, so ganz nebenbei, aber Osborn erkannte sofort die Gefahr, die plötzlich nach so langen Jahren wieder drohte, und Selwood erfuhr zum erstenmal ohne Beschönigung, wie sein Vetter in den Besitz des Schmuckes gelangt war. Er hatte ihn nicht als herrenloses Gut gefunden, sondern vom Lager eines todkranken Mannes geraubt. Um keinen Preis durfte die Geschichte an die Öffentlichkeit kommen. Auch Mrs. Dyke war dieser Ansicht, und sogar Helen, die mit großen scheuen Augen zugehört hatte, schloß sich ihr mit lebhaftem Kopfnicken an.
Osborn und Evelyn nahmen die Sache in die Hand. Während Evelyn die Überwachung Cartwrights und Mortons organisierte, um über die weiteren Schritte der ›Königin der Nacht‹ unterrichtet zu bleiben, sorgte Osborn dafür, daß das Tagebuch verschwand, bevor Hyman Einblick nehmen konnte.
Selwood ließ alles ohne Einspruch geschehen, und erst der geheimnisvolle Tod Cartwrights und Mortons rüttelte sein Gewissen wach, ohne daß er sich auch jetzt zu einem befreienden Schritt hätte entschließen können. Er ließ sich auch weiter von den Ereignissen treiben, und nur die neuerliche Begegnung mit der ›Königin der Nacht‹, auf die er vorbereitet sein mußte, weckte in ihm eine gewisse Energie. Wenn beim Brunnen der sieben Palmen auch ein verabscheuungswürdiges Unrecht begangen worden war, die Rache dafür war ein weit ärgeres und heimtückischeres Verbrechen und hatte völlig Unschuldige getroffen. Charlie hatte sich förmlich in den Gedanken verbohrt, daß er etwas von seiner Mitschuld an dem tragischen Geschick Sir Benjamins und Sir Nicholas' sühnen könne, wenn er deren Mörderin Gleiches mit Gleichem vergalt, und wie Osborn war er hierfür gerüstet.
Das erste nächtliche Zusammentreffen mit der geheimnisvollen Person vor dem Haus Evelyns hatte ihn gelehrt, jeden Augenblick auf seiner Hut zu sein. Auch jetzt, da er verdrossen durch die kühle Frühlingsnacht schritt. Sein Blick suchte die fast menschenleeren Gassen ab, und unwillkürlich hielt er sich am Rand der Gehsteige, um vor einer Überrumpelung aus dem Dunkel sicher zu sein.
Der Weg zu seiner Wohnung betrug kaum zwanzig Minuten, aber bei seiner Vorsicht brauchte er mehr als eine halbe Stunde, bevor er die nicht sehr lange und nicht sehr breite Gasse erreichte, die fast durchwegs aus nüchternen einstöckigen Häusern mit kleinen Vorgärten, die einander wie ein Ei dem anderen glichen, bestand.
Selwoods Heim lag an der unteren Ecke, und er schien sich plötzlich unsicher zu fühlen, daß er vom Gehsteig auf die Mitte der Fahrbahn ging. Die Gasse war nur spärlich erleuchtet und völlig ausgestorben, und seine Schritte klangen hart und wuchtig in der unheimlichen Stille.
Knapp vor seinem Haus machte er im Schein einer Laterne halt und zog seinen Schlüsselbund hervor, um an der Tür zwischen den Sträuchern des Vorgärtchens keinen unnötigen Aufenthalt zu haben. Dann schritt er, immer noch in der Mitte der Fahrbahn, weiter.
Als er den dunklen Zugang zu seinem Haus zur Linken durchquert hatte, machte er eine rasche Wendung, aber in diesem Augenblick schoß hinter ihm von der gegenüberliegenden Seite der Gasse ein greller Lichtstrahl herüber, der die Tür und deren Umgebung taghell erleuchtete. Und in diesem stechenden Licht gewahrte Selwood eine verhüllte Gestalt, an deren Stirn eine Mondsichel und drei flimmernde Sterne leuchteten. Sie war dicht an das Gestrüpp geschmiegt, und der Blitz, der so plötzlich aufgeflammt war, schien sie in einen Zustand der Erstarrung versetzt zu haben. Aber dann duckte sie sich jäh zusammen, schoß hervor und glitt mit der Behendigkeit eines flüchtigen Wildes um das Haus herum in die anstoßende Gasse.
Selwood sah noch, wie das seltsame Licht bis zur Ecke an ihren Fersen haftete, dann verlöschte es so plötzlich, wie es aufgeflammt war, und als er sich endlich gefaßt hatte und nach der Stelle blickte, woher der Schein gekommen war, lag die jenseitige Gassenfront still und dunkel.
Charlie Selwood ging in fester Haltung zur Tür seines Hauses und schloß sie mit erzwungener Ruhe und Umständlichkeit auf. Aber im Nacken saß ihm das Grauen, denn er ahnte, daß eben der Tod auf ihn gelauert hatte und daß nur eine andere gleich geheimnisvolle Macht ihn gehindert hatte, sein Werk zu vollenden.
In den nächsten Minuten begann von zwei verschiedenen in unmittelbarer Nähe gelegenen Punkten eine rasende Wettfahrt zweier Wagen, die beide dem gleichen Ziele zustrebten.
In dem kleineren, der lautlos wie ein Pfeil dahinschoß, saß eine unkenntliche Gestalt tief über den Volant gebeugt, der zweite, ein großer Thunderbird, wurde von dem ortskundigsten und sichersten Fahrer von Scotland Yard gelenkt. Zwischen den starken Scheinwerfern leuchtete eine kleine blaue Scheibe, und die Polizeiposten, an denen das Auto vorüberflog, wußten, daß für solche Wagen die Geschwindigkeits- und sonstigen Verkehrsvorschriften nicht galten und daß sie an jeder Kreuzung sofort durchzulassen waren.
»Wir haben ganz besonderes Glück gehabt«, sagte Boyd nachdenklich, indem er sich eine seiner schwarzen Zigarren anzündete und einige tiefe Züge tat. »Darauf war ich eigentlich nicht vorbereitet, und ich weiß mir augenblicklich auch nicht zu erklären, was da eigentlich los ist. — Es sei denn, daß Selwood...« Er vollendete nicht, sondern ließ einen leisen gedehnten Pfiff hören, aber Oberst Terry achtete nicht weiter darauf.
»Sie sind eben immer ein Glückspilz gewesen«, meinte er, und es klang fast so etwas wie Neid aus seinen Worten. Wie schon früher oft, mußte er auch diesmal wieder die Ruhe und Raschheit bewundern, mit der Boyd in diesem rätselhaften Fall, der eigentlich nicht den winzigsten Anhaltspunkt geboten hatte, vorwärtsgekommen war. Er war bis vor einer Viertelstunde, trotz des Vertrauens in die Tüchtigkeit seines Mitarbeiters, noch immer skeptisch gewesen, aber seitdem er die geheimnisvolle ›Königin der Nacht‹ in dem scharfen Lichtkegel des Scheinwerfers mit eigenen Augen erblickt hatte, zweifelte er nicht länger, daß Boyd tatsächlich die Spur aufgestöbert hatte. Das bedeutete für Scotland Yard unendlich viel.
»Vielleicht hätten wir die Falle doch jetzt zuklappen sollen«, äußerte er bedenklich. »Man soll nicht übermütig werden, und was man hat, das hat man. Wenn sie uns nun entwischt...«
»Kann ich sie Ihnen jederzeit wieder zur Stelle schaffen«, beruhigte ihn der Detektiv gelassen. »Das ist das wenigste. Augenblicklich kommt es darauf an, meine Annahmen auf ihre letzte Richtigkeit zu prüfen. Deshalb rasen wir jetzt mit höchster Geschwindigkeit. Ob sie genügt, werden wir ja sehen. Die ›Königin der Nacht‹ wird aus ihrem Wagen auch herausholen, was herauszuholen ist, und einen Thunderbird darf man nicht unterschätzen. — Ich hoffe, daß Ihre Leute an unserem nächsten Ziel ebenso zuverlässig arbeiten, wie sie es hier getan haben.«
»Darauf können Sie sich verlassen«, versicherte der Oberst. »Ich habe sie genau nach Ihren Wünschen instruiert. Allerdings«, fügte er etwas gekränkt hinzu, »wäre mir dies leichter geworden, wenn Sie ein bißchen deutlicher gewesen wären.«
Boyd stieß eine dichte Rauchwolke in den Wagen, und seine Stimme klang unbefangen, aber einigermaßen verwundert.
»Bin ich undeutlich gewesen? Das tut mir leid. Ich glaubte wirklich, mich ganz klar ausgedrückt zu haben: Ihre Leute sollten nichts anderes tun — was immer auch geschehen mag — als genau beobachten, ob irgend jemand sich in das Haus begibt. Sei es durch den Haupteingang oder durch die Garage an der rückwärtigen Gassenfront, oder durch das Gitter, das ringsherum läuft. Und sie sollten in jedem dieser Fälle genau die Zeit feststellen. — Wieviel Uhr haben Sie, Oberst?«
Terry sah nach dem leuchtenden Zifferblatt seiner Armbanduhr.
»Ein Uhr achtundvierzig Minuten.«
Der Detektiv blickte angelegentlich durch die Scheiben des Wagens und versuchte sich zu orientieren.
»Wir sind bereits in Park Lane«, sagte er, »und Wunder kann die ›Königin der Nacht‹ auch nicht vollbringen. Die kritische Zeit wird frühestens um zwei Uhr zehn eintreten.«
Eine Weile herrschte in dem Wagen tiefes Schweigen, dann begann der Oberst sich ungeduldig zu räuspern. »Weshalb machen Sie eigentlich noch immer so ein Geheimnis aus der Geschichte, wenn die Dinge schon so weit gediehen sind?«
»Weil ich wünsche, daß die Sache so ausgehen soll, wie ich es mir vorstelle.«
Terry wurde plötzlich mißtrauisch. »Wie meinen Sie das?«
»Daß der Fall ohne allzuviel Aufsehen rasch und gründlich erledigt wird und Sie Ihren großen Erfolg erreichen, ich aber meinen Zweck.«
»Hören Sie, das ist eine etwas verzwickte Antwort«, brummte der Oberst mit einem verdrießlichen Lachen. »Daraus kann kein Mensch klug werden.«
Der Detektiv ließ sich nicht aus seiner Gelassenheit bringen.
»Warten Sie noch vierundzwanzig oder achtundvierzig Stunden, und Sie werden erkennen, wie einfach sie war. Ebenso einfach wie der ganze Fall der ›Königin der Nacht‹.«
»Davon habe ich nichts bemerkt«, seufzte Terry verzweifelt. »Weiß der Teufel, wie Sie es angestellt haben, diese verdammte Nuß zu knacken.«
Die Zigarre im Munde Boyds glomm so hell auf, daß der andere sein behaglich lächelndes Gesicht sehen konnte.
»Auf die einfachste Weise. Ich habe bloß alles gründlich überdacht. Schon nach den ersten Zeitungsberichten und noch bevor Sie zu mir kamen, hatte ich mir eine Meinung gebildet, die sich als zutreffend erwies. Einen wichtigen Fingerzeig gab mir das unverständliche Verhalten der ›Königin der Nacht‹, den zweiten das Werkzeug, mit dem sie arbeitete. Dann kamen die gewissen glücklichen Zufälle dazu, ohne die wir nun einmal überhaupt nichts erreichen können.«
»Also wirklich alles völlig klar?« fragte der Oberst mit einem letzten leisen Zweifel.
»So klar, daß ich Ihnen schon jetzt die ganze Geschichte bis in die kleinste Einzelheit erzählen könnte. Nur das Ende kenne ich noch nicht, aber da sollen Sie selbst mit dabei sein. Morgen oder übermorgen — je nachdem, was es heute noch gibt — komme ich zu Ihnen, und dann besprechen wir die letzten Maßnahmen.« Boyd spähte wieder durch die Scheiben und wurde plötzlich sehr lebhaft. »Weiß der Mann genau, wo er zu halten hat? Wir müssen gleich an Ort und Stelle sein.«
Terry hatte noch nicht Zeit gefunden zu antworten, als der Wagen auch schon hielt und der Chauffeur den Schlag öffnete. Sie befanden sich am Ausgang einer schmalen Gasse, und vor ihnen lag ein kleiner Park.
»Es ist genau zwei Uhr sieben Minuten«, sagte der Detektiv nach einem Blick auf seine Uhr, »und wir haben noch vier Minuten zu gehen. Was ich erwarte, kann jeden Augenblick eintreten, aber ich wünschte, es geschähe erst, wenn wir an Ort und Stelle sind, damit wir selbst eine Kontrolle haben.«
»Was erwarten Sie eigentlich?« fragte sein Begleiter, während sie mit eiligen Schritten den Park durchquerten und jenseits in eine breitere Gasse einbogen, in der kleine Privathäuser standen.
»Ich erwarte, daß die ›Königin der Nacht‹ hierherkommt, wenn sie sich nicht verfolgt wähnt«, gab Boyd zur Antwort. »Und da wir sie während der Fahrt völlig ungeschoren gelassen haben, wird sie wohl kaum Verdacht hegen. — Ist Ihr Kordon völlig undurchlässig?«
»Unbedingt«, versicherte der Oberst. »Ich habe fünfzehn Leute hier, und es kann zwischen ihnen keine Maus unbemerkt durchschlüpfen. Wir befinden uns bereits mitten unter ihnen, und «Sie müssen zugeben, daß die Sache ganz unauffällig ist. Wenn wir draußen sind, werde ich mir Rapport erstatten lassen, ob bereits etwas Besonderes vorgefallen ist. Kleine helle Punkte heißen ›Alles in Ordnung‹, rote Punkte, ›Es liegt etwas vor‹. Ich selbst habe ein blaues Licht in meiner Taschenlampe. Und weil Sie es ausdrücklich so wünschen, darf kein Mann sich von seinem Platz rühren, solange ich nicht den Wink zur Ablösung gebe oder Alarm pfeife. Inspektor Jeffney leitet die Sache, und er ist verläßlich.«
Die Gasse mündete in eine breite Allee. Jenseits derselben stand eine Reihe von Villen, die voneinander durch Gärten und Zufahrtswege getrennt waren. Die wenigen Bogenlampen vermochten den tiefen Schatten der mächtigen Baumkronen nicht zu durchdringen, und es herrschte ein derartiges Dunkel, daß Terry und Boyd einige Augenblicke brauchten, um einen Überblick zu gewinnen. Rechts von ihnen zog sich der Häuserblock, in dem sie standen, noch etwa dreißig Schritte hin, dann schob sich der Park, den sie vorher passiert hatten, mit seinem Randgebüsch bis dicht an die Allee vor.
»Es ist das dritte Haus dort drüben«, erklärte der Detektiv leise. »Das mit den zwei Türmchen. Der Haupteingang ist auf der anderen Seite, aber vor uns haben wir die Garage. Sie ist erst später gebaut worden und nimmt sich nicht gerade gut aus. Das Gebüsch zu beiden Seiten des Einfahrtstores soll wahrscheinlich die unschöne Fassade etwas verdecken.«
Der Oberst hatte mit scharfen Augen die Front abgesucht, auf der er seine Leute wußte, und war befriedigt, auch nicht den winzigsten beweglichen Schatten wahrzunehmen. Er flüsterte Boyd zu, wie seine Postenkette um das Haus lief und trat dann vorsichtig etwas vor und ließ seine Taschenlampe dreimal kurz hintereinander aufleuchten.
Es vergingen einige Sekunden, dann glomm oben in dem Randgebüsch des Parks ein winziger heller Punkt auf und flatterte wie ein vagabundierender Leuchtkäfer langsam die Front herab. Bevor er aber noch in die Nähe des Hauses mit den zwei Türmchen kam, wurde er plötzlich rot, und der Oberst faßte seinen Begleiter hastig am Arm.
»Es muß etwas geschehen sein«, flüsterte er hastig. »Glauben Sie, daß wir zu spät gekommen sind?«
»Nein«, erwiderte Boyd entschieden. »So rasch kann sie nicht gewesen sein, da sie sich auf keinen Fall mit dem Auto bis zum Haus wagt. Sie stellt es jenseits in einer alten Werkstatt ein, von der sie bis hierher gute sechs Minuten zu Fuß hat. Wenn ich diesen Weg mit einrechne, konnte sie uns bei unserem Tempo gar nicht schlagen. Es muß etwas anderes in der Luft liegen.« Er schwieg plötzlich, und Terry beobachtete, daß er das Gesicht verkniff und sehr ungeduldig wurde.
»Es wird das beste sein«, raunte er hastig, »ich mache mich so nahe als möglich an das Haus heran, denn ich weiß, worum es geht. Lassen Sie sich durch nichts, was auch geschehen sollte, beirren, und halten Sie Ihre Leute so lange in Schach, bis ich Ihnen zurufe, daß ein Eingreifen notwendig ist. Sie können mich ja aus dieser kurzen Entfernung sehr gut hören.«
Der Polizeioffizier wollte noch etwas fragen, aber in diesem Augenblick tauchten in der Allee die Lichter eines Autos auf, der Detektiv schnellte bereits über die Fahrbahn und drüben von Baum zu Baum gegen das Haus mit den zwei Türmchen.
Was nun geschah, spielte sich im Zeitraum von wenigen Sekunden ab, und Boyd mußte es später dem Oberst mehrmals wiederholen, bevor dieser es begriff, obwohl er doch Augenzeuge der Vorgänge gewesen war.
Das Auto stoppte gegenüber der Garage, und Osborn verließ den Wagen, um aufzuschließen. Er sah sich mißtrauisch nach allen Seiten um, bevor er die wenigen Schritte bis zum Tor machte, und seine Rechte steckte in der Manteltasche.
Er öffnete, kehrte zum Auto zurück, setzte den Fuß auf das Trittbrett und schob den Oberkörper in die Limousine.
In dieser Sekunde löste sich aus dem Gebüsch vor der Garage blitzschnell ein Schatten, und der Mann im Wagen hörte in seiner unbeholfenen Lage eine Stimme an sein Ohr schlagen:
»Die ›Königin der Nacht‹ vom Brunnen der sieben Palmen...«
Seit Tagen hatte er sich auf diesen entscheidenden Augenblick vorbereitet, und hunderte Male hatte er die rasche Handbewegung geübt, mit der er diese Begegnung erledigen wollte, aber nun überraschte sie ihn in völliger Hilflosigkeit...
Er mußte sich erst wieder aus dem Wagen herauszwängen, und wenn dies auch mit größter Gewandtheit geschah, die Situation hatte sich mittlerweile bereits geändert, und Osborn sah sich einer Szene gegenüber, die ihn völlig außer Fassung brachte: Die verhüllte Gestalt, die eben noch dicht neben ihm gestanden war, wurde von zwei riesigen Männern in Windeseile über die Allee ins Dunkel geschleift, aber dafür sah er längs der Gartenmauer eine gleiche Erscheinung mit der Mondsichel und drei flimmernden Sternen auf der Stirn auf sich zufliegen.
Er begriff zwar nichts, aber seine Hand fuhr in die Tasche, und in der nächsten Sekunde zuckte ein Feuerstrahl gellend gegen den nächtlichen Himmel und jagte die zweite schwarze Gestalt in wilder Flucht um die Ecke.
»Es scheint hier etwas unsicher zu sein«, sagte der weißhaarige Herr, der Osborns sichere Hand durch einen blitzschnellen Schlag abgelenkt hatte, »und Sie würden gut daran tun, Ihren Wagen möglichst rasch unterzustellen.«
William Osborn war so verstört, daß er den Sprecher ganz entgeistert anstarrte, dann aber kroch er gehorsam in das Auto und lenkte es in die Garage. Hierauf verschloß er das Tor und ging durch den Garten in das Haus, das er hell erleuchtet fand.
Am oberen Ende, der Treppe stand, mit einem schreiend grellen Pyjama angetan, verschlafen und zitternd, Helen.
»Ich hörte einen Schuß fallen«, stotterte sie atemlos, »und bin so furchtbar erschrocken. Was ist geschehen?«
»Leg dich aufs Ohr und alarmiere nicht das ganze Haus«, schrie er sie wütend an und schmetterte seine Zimmertür zu.
Draußen vor der Garage verharrte Boyd noch eine Weile, dann schritt er der Stelle zu, an der er Terry verlassen hatte.
Der Oberst befand sich in einem Zustand höchster Erregung und konnte es nicht erwarten, eine Aufklärung über die Vorgänge zu erhalten.
»Wenn ich nicht solches Vertrauen zu Ihnen hätte«, stieß er hervor, »wäre ich unbedingt dreingefahren. Wissen Sie, daß eine der beiden verschleierten Gestalten weggeschleppt worden ist? Von zwei riesigen Burschen; und zwei andere Kerle haben ihnen den Rücken gedeckt.«
Er sprach hastig und gedämpft, aber sein Begleiter fand es nicht mehr notwendig, besondere Vorsicht walten zu lassen.
»Sie können Ihre Leute heimschicken«, sagte er laut und zündete sich in aller Gemächlichkeit eine frische Zigarre an. »Die Sache ist vorüber, und wir können sehr zufrieden sein. Sie haben sogar mehr gesehen, als ich Ihnen zeigen wollte.«
»Der Teufel soll mich holen, wenn ich auch nur das geringste davon verstehe«, brummte Terry ärgerlich und gab mit seiner Taschenlampe ein Zeichen, das sofort abgenommen wurde, worauf nach etwa zwei Minuten aus allen Winkeln dunkle Gestalten schlüpften und lautlos verschwanden.
»Nun legen Sie endlich los«, drängte der Oberst ungeduldig, als sie zu ihrem Wagen schritten. »Was hatte dieser aufregende Tanz zu bedeuten?«
»Das so schwierig scheinende Rätsel der ›Königin der Nacht‹ zu einem lebenden Bild gestellt, das alles verständlich macht,« erklärte Boyd schmunzelnd, aber Terry schnitt ein verzweifeltes Gesicht und faßte ihn heftig am Arm.
»Mir nicht. Da müssen Sie schon nachhelfen.«
»Gut. — Also, Sie haben soeben die beiden ›Königinnen der Nacht‹ gesehen.« Der Oberst blieb mit einem Ruck stehen und starrte seinen Begleiter verblüfft an.
»Die beiden ›Königinnen der Nacht‹?«
»Jawohl. Die richtige, aber harmlose und die falsche, aber gefährliche. Die erste bringt die gewisse Botschaft von der ›Königin der Nacht‹ vom Brunnen der sieben Palmen, die zweite aber gestaltet diesen unschuldigen Theatercoup zu furchtbarem Ernst. Dabei hatte eine die andere bis zu dieser Nacht nie gesehen, und der Überfall kam gerade noch rechtzeitig, um einen Zusammenstoß zwischen beiden zu verhüten.«
»Welche hat man entführt?«
»Die harmlose.«
»Weshalb gerade die?« fragte Terry hartnäckig und verwundert. Boyd kam aus dem Schmunzeln nicht heraus.
»Das ist wieder eine andere Sache. Man muß in diesem Fall sehr vorsichtig sein, weil es dabei verschiedene Dinge gibt, die nichts weniger als krimineller Natur sind. Aber das alles erzähle ich Ihnen am besten erst, wenn wir mit der ganzen Geschichte wirklich zu Ende sind. Nach dem, was Sie heute gesehen haben und morgen oder übermorgen noch sehen werden, wird es nicht vieler Worte bedürfen. Jetzt lassen Sie mich wohl nach Hause bringen, denn ich bin furchtbar müde.«
Boyd gähnte zur Bekräftigung sehr heftig, und Terry schob sich enttäuscht und wütend neben ihn in den Wagen.
Um diese Zeit hatte das Auto, in das die eine der ›Königinnen der Nacht‹ von kräftigen Armen gehoben worden war, in rasender Fahrt bereits einen weiten Weg zurückgelegt. Einer der riesigen Burschen, die sie so plötzlich gefaßt und im Sturmschritt weggeschleppt hatten, saß neben dem Chauffeur, der andere neben ihr, aber die Gefangene empfand trotz ihrer Lage seltsamerweise keine allzu beklemmende Furcht. Der Mann an ihrer Seite machte sich so dünn, als er nur konnte, und jener neben dem Lenker saß mit der korrekten Steifheit eines geschulten Bedienten und rührte sich nicht.
Die Scheiben an den Seiten des Wagens waren dicht verhangen, und das junge Mädchen vermochte nicht zu erkennen, welche Richtung sie nahmen. Nur einmal sah sie in dem Nebelschleier vor dem Führersitz die lange Lichterreihe einer Brücke, und dann schien es nach den häufigen Wendungen durch ein sehr winkliges Viertel zu gehen. Die Entführte hatte noch immer den silbergestickten Schleier um, der ihr Gesicht und den ganzen Kopf verhüllte, und ihre Hände nestelten unausgesetzt daran herum, als ob sie verhüten wollte, daß er heruntergleite.
Als die Fahrt so lange währte, stieg in ihr doch so etwas wie Furcht auf, und sie suchte sich darüber klarzuwerden, in wessen Hände sie gefallen war. Sie hatte ihre Rolle heute noch einmal spielen wollen, um auch dem letzten, William Osborn, das Verbrechen vom Brunnen der sieben Palmen in Erinnerung zu rufen, aber ihr Glück hatte sie diesmal verlassen. Sie war trotz aller Vorsicht in eine Falle gegangen, und alles hatte sich so rasch abgespielt, daß sogar der getreue Ali, der doch über jeden ihrer Schritte wachte, nicht mehr zurechtkommen konnte. Sie malte sich aus, in welcher Verzweiflung er nun umherirren mochte, und ihr Herz stockte bei dem Gedanken, daß eine arme leidende Frau vielleicht schon in dieser Stunde eine Schreckensbotschaft erhielt, die sie tödlich treffen konnte.
»Wir werden gleich aussteigen, Madame«, sagte eben der Mann an ihrer Seite sehr respektvoll. »Haben Sie keine Angst und schreien Sie nicht, denn es geschieht Ihnen gar nichts. Auch wenn Sie ein paar Stufen hinuntergetragen werden, hat das nichts zu bedeuten.«
Das Mädchen versuchte gefaßt und entschlossen zu sein.
»Ich werde selbst gehen«, erklärte sie bestimmt und sah durch den kleinen Spalt, der die Augen freiließ, ihren Wächter herausfordernd an, aber der schüttelte energisch mit dem Kopf.
»Das ist kein Weg für eine Lady«, meinte er, und sie sah in ein breites, gutes Gesicht, das belustigt die Zähne zeigte.
Einige Minuten später hatte das junge Mädchen ein dichtes Tuch über dem Kopf, und schon nach wenigen Schritten wußte sie, wohin es ging. Sie fühlte plötzlich die durchdringende Kühle des Wassers, noch ehe sie behutsam in das schwankende Boot gehoben wurde, das gleich darauf, von taktmäßigen Ruderschlägen getrieben, dahinflog. Das dauerte etwa eine Viertelstunde, dann machte das Fahrzeug irgendwo fest, und sie schwebte, von starken Armen getragen, in die Höhe. Dann verspürte sie den scharfen Geruch von Teer und Lack, hörte ein kurzes Flüstern und den Widerhall fester Schritte auf hartem Holz. Hierauf ging es wieder irgendwo eine Treppe hinunter, einige Schritte auf weichen Teppichen, und dann fühlte sich die ›Königin der Nacht‹ sanft in eine Öffnung in der Wand gedrängt, und eine Schiebetür glitt lautlos ins Schloß.
Irgend jemand nestelte an dem dichten Tuch, das den Kopf der Gefangenen noch immer verhüllte, und dann schloß sich ein Paar neugieriger, ängstlicher Augen vor der blendenden Helle, die sie plötzlich traf. Erst nach einer Weile vermochte die ›Königin der Nacht‹ das Bild der geräumigen, prunkvollen Kajüte völlig aufzunehmen, und die schüchterne Frau an ihrer Seite wartete ehrerbietig, bis die andere sich satt gesehen hatte.
»Ich bin zu Ihrer Bedienung bestimmt, Madame«, sagte sie endlich. »Und vor allem habe ich Ihnen mitzuteilen, daß Sie dort auf dem Tisch Schreibzeug finden. Sie werden vielleicht irgend jemandem eine Mitteilung machen wollen, daß Sie sich wohl befinden. In längstens einer Stunde wird der Brief zuverlässig zugestellt sein.«
Das Mädchen war von den Ereignissen der letzten Stunde und ihrem vorläufigen Abschluß völlig verwirrt, aber das verstand sie doch, und diese seltsame Rücksichtnahme war ihr mehr Beruhigung als alle Versicherungen. Sie setzte sich, wie sie war, an den kleinen Schreibtisch, um die geliebte Mami mit einer harmlosen Erklärung ihres Ausbleibens zu beruhigen, und als sie fertig war, machte sich die Dienerin beflissen davon. Sie eilte durch einen hellerleuchteten Kajütengang an Deck, wo im Schatten des Kamins ein Mann mit hochgeschlagenem Mantelkragen und tief in die Augen gedrückter Mütze stand. Er nahm den Brief entgegen, und gleich darauf wurde in lautloser Stille eines der schlanken Boote klargemacht.
Seit fast zwei Stunden saß Ali vor dem stillen Haus in Brompton und starrte verzweifelt in die Nacht. Sein Wagen hielt im Schatten der Mauer, und er getraute sich nicht den Fuß über die Schwelle zu setzen, weil er seinen Schwur nicht gehalten hatte. Er war wie ein Besessener gerast, als er die Gefahr gesehen hatte, aber die anderen waren schneller gewesen. Und ehe er seinen Wagen erreichen konnte, um die Verfolgung aufzunehmen, war jede Spur verloren.
Der braune Mann war so erschüttert, daß sogar seine scharfen Sinne versagten. Sein Ohr vernahm nicht die nahenden leisen Schritte, und seine Augen sahen nicht den Schatten, der an ihn heranglitt. Erst als die Gestalt dicht vor ihm stand, fuhr Alis Hand instinktiv nach dem Messer, aber sie blieb am Griff haften, denn er meinte, daß ihn ein Spuk äffe: Der Mann vor ihm war braun und sehnig wie er selbst und erst, als er dessen Stimme vernahm, wich die Betäubung von ihm.
»Allahs Gnade sei mit dir und diesem Hause. Ich bringe dir Worte deiner jungen Herrin, die unter sicherem Schutze ist, und du sollst sie der Herrin mit dem weißen Haar geben, damit keine Wolke der Sorge ihre Stirn umdüstere. Aber du sollst damit bis zum Morgen warten, und über deine Lippen soll nicht ein Wort von dem kommen, was deine Augen heute nacht gesehen haben. Deine Herrin ist wohlbehütet, ich schwöre es, und sie wird heimkehren, sobald es Zeit ist.«
Der Fremde hatte seine Botschaft mit Ruhe und Würde hergesagt, und Ali fing jedes Wort mit gierigem Ohr auf. Aber der andere glitt bereits wieder davon, als er endlich zu sich kam.
»Allah segne dich und die Deinen bis ins zehnte Glied«, rief er dem Boten dankbar nach, dann drückte er den Brief ehrfurchtsvoll an Brust und Stirn.
Oberst Terry verging vor fieberhafter Spannung und Ungeduld, aber er mußte bis zum übernächsten Morgen warten, bevor sich Boyd wieder bei ihm blicken ließ. Er sah noch strahlender und zufriedener aus als sonst und brachte zunächst ein Stück einer Glasscheibe zum Vorschein.
»Das habe ich schon vor einigen Tagen aus dem Hause Mortons mitgenommen«, erklärte er. »Es sind Fingerabdrücke darauf, aber ich weiß nicht, ob sie uns etwas nützen werden. Lassen Sie sie jedenfalls präparieren, dann werden wir ja sehen. Ich habe das Glas aus dem Fenster geschnitten, vor dem in der kritischen Nacht Jack Beery tot aufgefunden wurde.« Dann entnahm er seinem Notizbuch einen dicht beschriebenen Zettel und reichte ihn dem Oberst. »Hier haben Sie die Anordnungen für den heutigen Abend. Die Sache beginnt um acht Uhr und dürfte gegen zwölf oder vielleicht noch früher zu Ende sein. Sie werden am besten tun, wenn Sie wieder bei dem Haus mit den zwei Türmchen Aufstellung nehmen. Ich habe nämlich das Gefühl, daß dort die Entscheidung fallen wird. Natürlich kann ich mich auch irren.«
Terry überflog das Papier sehr aufmerksam und sah dann seinen Mitarbeiter erwartungsvoll an.
»Glauben Sie nicht, daß noch im letzten Augenblick etwas geschehen kann?«
»Das ist natürlich nicht ausgeschlossen«, gab der Detektiv mit einem gleichmütigen Achselzucken zu, »aber es kann unseren Erfolg kaum mehr in Frage stellen. Geben Sie daher jedenfalls noch an die Abendblätter eine Mitteilung aus, daß Scotland Yard in dem rätselhaften Cartwright-Morton-Fall bereits eine einwandfreie Spur gefunden hat und daß die Verhaftung der geheimnisvollen ›Königin der Nacht‹ unmittelbar bevorsteht. Das macht sich sehr gut und kann uns sehr viel nützen. Was das Haus in Hackney betrifft«, fügte er dann hinzu, »so kommt dasselbe erst morgen an die Reihe. Da möchte ich nämlich gerne selbst dabei sein. Aber den ›Professor‹ lassen Sie unbedingt heute festnehmen. Je früher, desto besser.«
»Und wo kann ich Sie erreichen, wenn ich Sie brauchen sollte?« fragte Terry.
»Ich werde mich schon selbst bei Ihnen melden«, erwiderte Boyd ausweichend. »Ich bin heute abend zu einer Gesellschaft geladen, in der ich mich ausgezeichnet zu unterhalten hoffe.«
Wenn Boyd nicht selbst an dieses wichtige Ereignis gedacht hätte, so wäre er von Mr. Fish daran erinnert worden, der ihn sofort, als er das Reporterzimmer des Cartwright-Hauses betrat, an einem Knopf erwischte. Mr. Fish war bereits seit dem frühen Morgen durch die Vorbereitungen für den Abend bei Mrs. Dyke in Anspruch genommen. Zunächst hatte er sich so sorgfältig rasiert, daß dabei einige Streifen seiner sommersprossigen Haut abgegangen waren, dann hatte es eine ziemlich heftige Auseinandersetzung mit seiner Plätterin gegeben, die damit endete, daß die Frau um einen Schilling acht Pence weniger erhielt, weil sie ihre Sache so schlampig gemacht hatte, daß ein Mr. Fish sich unmöglich darin zeigen konnte. Nichtsdestoweniger steckte dieser selbe Mr. Fish sofort die mächtigen Perlenknöpfe in die blütenweiße Hemdbrust und stäubte dann auf Weste, Frack und Beinkleider, ja sogar auf die Seidenstrümpfe mit den Ajours etwas von einer Flüssigkeit, die nach einigen Stunden angeblich einen diskreten und vornehmen Duft verbreitete. Auch die Lackschuhe hatten eine gründliche Auffrischung erfahren, und es war dem ›Fliegenpilz‹ höchst angenehm, daß er seinem Freunde Boyd, mit dem er am verflossenen Abend wieder sehr gut und ausgiebig gespeist hatte, die Sache mit dem Wagen nochmals gehörig einschärfen konnte.
»Fünf Schilling, daß Sie sich meine Adresse nicht gemerkt haben«, sagte er mißtrauisch und vorsichtig und begann in der Westentasche zu kramen, aber Boyd legte den Betrag bereitwilligst auf den Tisch. Dann dachte er angestrengt nach.
»Hoxton, High Street 19.«
»Siebzehn«, stellte Mr. Fish mit einem mißbilligenden Wiegen des Kopfes nachdrücklich richtig und ließ die fünf Schilling verschwinden. »Das habe ich mir doch gedacht. Also, merken Sie sich endlich: Nummer siebzehn. Pünktlich um Viertel nach sieben. Ich liebe es nicht, in Frack und Lackschuhen über die Straße zu gehen.«
Boyd hörte sehr höflich, aber doch nur mit halbem Ohr zu, weil er ziemliche Eile hatte und gerne noch mit Wellby einige Worte gewechselt hätte. Dieser saß, teilnahmslos und gelangweilt wie immer, hinter seinen Zeitungen, aber zur größten Verwunderung von Mr. Fish setzte er sofort eine verbindliche Miene auf, als Boyd neben ihm Platz nahm.
»Mr. Wellby«, begann dieser mit großer Förmlichkeit, »ich habe gehört, daß Miss Avery seit vorgestern nicht im Cartwright-Haus erschienen ist.«
Der Reporter stieß gelassen den Rauch seiner Zigarette zur Decke.
»So? Vielleicht fühlt sie sich nicht wohl.«
»Das wäre nach dem Schrecken der vorgestrigen Nacht begreiflich, aber sehr schade. Ich rechne nämlich bestimmt damit, sie heute bei Mrs. Dyke zu treffen. Allerdings scheint sie auch gestern abend in Anspruch genommen gewesen zu sein, denn sie ist erst gegen zwei Uhr nachts in einem Auto heimgekommen. — Das Ganze war eine sehr prompte und geschickte Arbeit«, fügte Boyd anerkennend hinzu, »und meine Mahnung ist gerade noch zurechtgekommen.«
Der Reporter vermied es, auf diese unverständliche Anspielung irgendwie einzugehen.
»Glauben Sie, daß nun alle Gefahr vorüber ist?« fragte er.
»Ich nehme es an. Jedenfalls solange ich dabei bin. Ich möchte Sie aber schon jetzt darauf aufmerksam machen, daß wir wahrscheinlich eine sehr nervöse und gedrückte Stimmung vorfinden werden. Wenn Sie die Abendzeitungen lesen, die ja bald erscheinen, werden Sie wissen warum.« Er lächelte sehr zufrieden und blitzte Wellby mit seinen lebhaften grauen Augen schalkhaft an. Aber plötzlich fiel ihm etwas anderes ein. »Haben Sie je etwas von dem Reisetagebuch Sir Benjamins gehört?« fragte er gespannt.
»Ich besitze eine Abschrift davon«, erklärte der Reporter, und Boyd rieb sich befriedigt die Hände.
»Ausgezeichnet«, meinte er nicht sonderlich überrascht. »Ich darf mir diese wohl noch heute für einige Stunden ausbitten? — Kennen Sie übrigens das Karibische Meer und die Gegend um den Panamakanal?«
»Einigermaßen«, gab der andere etwas verwundert zurück.
»Und haben Sie vielleicht schon einmal etwas von Captain Mitchell Hedges gehört?«
Wellby nickte.
»Kämpfe mit Riesenfischen.«
Boyd war mit einem Male wie elektrisiert.
»Glauben Sie, daß das alles wirklich wahr ist? Und daß unsereiner auch so ein Petriheil haben könnte? Ich bin nämlich kein Neuling«, versicherte er lebhaft, »aber solch eine Fischerei ist natürlich etwas ganz anderes.«
»Wollen Sie sie versuchen?«
»Ich werde sie versuchen«, gab der weißhaarige Herr entschieden zurück. »Im Herbst. Vorläufig werde ich mich noch mit meinen Forellen begnügen, aber dann...« Er reckte sich und blinzelte Wellby herausfordernd an. »Und die Geschichte wird der Cartwright-Konzern bezahlen.« »
»Wieso?« entfuhr es dem Reporter in lebhafter Überraschung.
»Weil ich das mit Mr. Hyman so ausgemacht habe«, erklärte Boyd leichthin. »Für die Erledigung des Falles der ›Königin der Nacht‹.«
»Mr. Hyman...« Wellby vermochte nicht zu verbergen, daß ihn diese Mitteilung außerordentlich überraschte, und es entschlüpfte ihm daher etwas mehr, als er wohl sonst gesagt hätte. »Ich dachte, daß der Mann sich in dieser Sache ganz passiv verhalten hätte. Und deshalb...«
Er brach mitten im Satz ab, aber Boyd war nicht begierig, mehr zu hören.
»Sie kennen Mr. Hyman nicht. Unverdaulich, aber ein Prachtmensch. — Ich nehme an, daß Sie Miss Avery nach dem heutigen Abend sicher nach Hause bringen werden«, sprang er dann plötzlich um und reichte dem Reporter die Hand. »Und hier haben Sie einige Zeilen, die Sie aber erst öffnen wollen, wenn Sie von mir Nachricht erhalten, daß alles in Ordnung ist. Machen Sie, bitte, alles so, wie ich es vorschlage, denn ich habe jede Einzelheit genau überlegt und glaube, daß es so am besten sein wird. Und vielleicht wird es auch sehr nett und gemütlich werden«, schloß er und blinzelte Wellby seltsam an.
Es war kurz vor sieben Uhr, als Mr. Fish den Kopf vorsichtig aus dem Tor des Hauses High Street 19 steckte und nach kurzer Umschau in den Flur des Hauses Nummer 17 hinüberwechselte. Er tänzelte behutsam auf den Zehenspitzen und staubte seine glänzenden Lackschuhe sorgfältig mit dem grellen seidenen Taschentuch ab, als er sein Ziel erreicht hatte.
»Sie sehen, ich bin bereits zur Stelle«, sagte er unverfroren zu Boyd, der pünktlich um Viertel nach sieben bei Nummer 17 vorfuhr. »Es ist mir peinlich, jemanden warten zu lassen, denn ich vertrage das auch nicht.« Dann betrachtete er kritisch den Wagen, aber er schien zufrieden zu sein, denn er nickte seinem Freund gnädig zu und bemühte sich, seinen Frack und die Lackschuhe mit möglichster Schonung unterzubringen. »Geben Sie acht, daß Sie sich nicht auf meine Schöße setzen«, ermahnte er seinen Begleiter ängstlich. »Ich habe sie etwas ausgebreitet, denn Mrs. Dyke hält sehr viel auf die äußere Erscheinung, und ich möchte mich daher entsprechend präsentieren.«
Er zog sein buntes Seidentuch, um einige Stäubchen von den Beinkleidern zu putzen, und Boyd fing eine Duftwolke auf, die eine Komposition von ausgerauchtem Lackspiritus und ranziger Pomade zu sein schien.
Evelyn Dyke hatte sich bereits nach dem Lunch nach Hause begeben, um die Vorbereitungen für den Abend zu treffen, aber sie war damit noch lange nicht zu Ende, als Selwood sie anrief und ihr aufgeregt die Sensationsmeldung der Abendzeitungen von der unmittelbar bevorstehenden Verhaftung der ›Königin der Nacht‹ mitteilte.
Die Nachricht traf Evelyn völlig unvorbereitet und machte sie so verstört, daß sie Charlie eine ganze Weile ohne Antwort ließ. Erst auf sein wiederholtes ungeduldiges Hallo stotterte sie endlich hervor, er möge unverzüglich kommen, und rannte dann, unfähig, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen, ziel- und planlos durch die Zimmer. Wenn diese furchtbare Überraschung einige Stunden früher gekommen wäre, hätte sie den Abend unbedingt abgesagt, denn sie fühlte sich in ihrer augenblicklichen Verfassung außerstande, die aufmerksame Hausfrau zu spielen, und außerdem würde die ganze Sache wahrscheinlich überhaupt keinen Zweck mehr haben. Sie wollte mit Noel Wellby und Clarisse Avery in Verbindung treten, um vielleicht auf diese Weise den Schleier etwas lüften zu können, der dieses ungleiche Paar offenbar umgab. Sie wollte die beiden mit ihrer gewandten Überlegenheit so in die Enge treiben, daß sie einen Blick in ihre Karten tun konnte. Es bestand für sie kein Zweifel, daß sowohl der angebliche Reporter wie das häßliche Mädchen in der Sache der ›Königin der Nacht‹ irgendeine Rolle spielten und je nachdem, welcher Art diese war, hatte sie ihre weiteren Schritte einrichten wollen. Ein Feind, den sie kannte, machte sie weniger ängstlich als ein schattenhafter Gegner im Hinterhalt, aber nun schien sich plötzlich von anderswoher eine weit größere Gefahr zu nahen. Wenn Scotland Yard tatsächlich in der Lage war, nach der geheimnisvollen ›Königin der Nacht‹ die Hand auszustrecken, mußte das Unheil auch über Selwood, Osborn und sie selbst in kürzester Zeit hereinbrechen, und es gab diesmal wohl keine Gelegenheit mehr, im letzten Augenblick noch einen verzweifelten Gegenzug zu tun.
Charlie, der sich schon nach kurzer Zeit einstellte, war viel mehr gefaßt als Evelyn, denn er hatte nach der rätselhaften Episode vor seinem Haus in der verflossenen Nacht eine derartige Entwicklung der Dinge geahnt und sich damit vertraut gemacht, bevor ihm noch der kurze Bericht in den Abendzeitungen seine Vermutung bestätigte. Er vermied es aber, von dieser Sache zu sprechen, um die völlig erschütterte Frau nicht noch mehr aufzuregen, und zum ersten Male in den langen Jahren, die sie sich kannten, tauschten sie ihre Rollen. Sie hing unter krampfhaftem Schluchzen an seinem Hals, und er versuchte sie zu trösten, so gut er es vermochte. »Den Kopf wird es nicht kosten, und das andere müssen wir auf uns nehmen«, sprach er ihr liebevoll zu. »Die Hauptsache ist, daß wir nicht voneinander lassen, was immer auch kommen mag.«
Sie schlang die Arme noch inniger und leidenschaftlicher um ihn, und ihre stürmischen Liebkosungen sagten ihm mehr als die beredtesten Beteuerungen.
Verabredungsgemäß kam auch Osborn etwas früher, und wenn Evelyn auch versucht hatte, die Spuren der letzten Stunde aus ihrem Gesicht zu tilgen, ihre müden Augen und der belegte Ton ihrer Stimme verrieten Helen sofort, was vorgegangen war. Die sonst so teilnahmslose, schläfrige Frau war heute wie ausgewechselt. Sie schien mit Lebendigkeit geladen, ihre Wangen glühten, und in ihren Blicken lag der Glanz spannungsvoller Erregung.
»Ihr wißt es also schon«, stieß sie hastig hervor und statt sich, wie sonst, schleunigst in einem behaglichen Eckchen einzurichten, begann sie mit ihrem King Charles unter dem Arm nervös auf und ab zu trippeln und in ihrer naiven, unbeholfenen Art weiterzuplappern. »William hat es mir aus der Zeitung vorgelesen. Aber ich glaube es nicht. Das ist wieder so eine erfundene Geschichte, damit die Leute der Polizei Ruhe geben sollen. Wenn etwas Wahres daran wäre, hätte man sicher nicht so viel Lärm gemacht. Wir werden ja sehen.«
Sie sprach mit solchem Eifer, daß sie in ihren unverfälschten Londoner Dialekt verfiel, aber keiner achtete auf sie, jeder war mit seinen eigenen ernsten Gedanken beschäftigt.
Osborn sah noch verstörter und verfallener aus als in den letzten Tagen, da sich alles gegen ihn verschworen zu haben schien. Seine Spielschulden hatten die Höhe eines netten kleinen Vermögens erreicht, und er mußte sie in den nächsten vierundzwanzig Stunden regeln, wenn er nicht unmöglich werden und seine gesellschaftliche Stellung für immer einbüßen wollte. Seine letzte Rettung war Helen, aber seltsamerweise hielt ihn eine gewisse Scheu ab, von dieser dringenden Sache mit seiner Frau zu sprechen. Es war nicht nur die Höhe der Summe, die ihn zögern ließ, sondern auch ein anderes hemmendes Gefühl, über das er sich keine Rechenschaft zu geben vermochte. Er war sonst nicht gewohnt, mit Helen große Geschichten zu machen, aber diesmal fand er weder die Sammlung noch die Gelegenheit für den überrumpelnden brutalen Angriff. Er schob dies den Aufregungen der letzten Zeit zu, denen sich selbst seine robuste Natur nicht gewachsen erwies. Besonders das Erlebnis der verflossenen Nacht hatte ihn arg mitgenommen, da er sich die Zusammenhänge nicht zu erklären vermochte. Statt der längst erwarteten einen ›Königin der Nacht‹ hatte er plötzlich klar und deutlich zwei vor sich gesehen, und das Zusammentreffen war ganz anders verlaufen, als er sich vorgestellt hatte. Und daß just im entscheidenden Augenblick ein Fremder wie ein Schatten neben ihm aufgetaucht war und seinen Arm mit der sicheren Waffe abgelenkt hatte, wollte ihm am allerwenigsten gefallen. Er hatte über diesen höchst eigenartigen Zufall lange nachgedacht und dabei ein unbehagliches Gefühl gehabt. Es lag entschieden irgendeine Gefahr in der Luft, und die offenbar von Scotland Yard inspirierten Andeutungen in den Abendblättern hatten ihm dies bestätigt. Das waren zu viel Sorgen auf einmal, und sie gaben Osborn so sehr zu schaffen, daß ihn seine berechnende Kaltblütigkeit diesmal völlig verließ. Er wußte nicht, wo und wie er zunächst vorbeugen sollte, und diese verzweifelte Ratlosigkeit machte ihn unausstehlicher denn je. Auch er war der Ansicht, daß der Abend nun eigentlich keinen Zweck mehr hatte, und er war trotz seiner üblen Laune eigentlich nur gekommen, weil er die ersehnte Gelegenheit erhoffte, seiner Frau die Daumenschrauben anzulegen. Wenn Helen an ihre gesellschaftliche Unzulänglichkeit erinnert wurde, war sie seinen Anzapfungen stets am zugänglichsten, und er beobachtete mit Befriedigung, daß sie heute in einer Verfassung war, die unbedingt zu einer Entgleisung führen mußte.
Während die anderen zurückhaltend, verstimmt und wortkarg ihre Meinung über die kritische Lage austauschten, rannte sie nervös umher. Ihr King Charles war über das ungewohnte Verhalten seiner Herrin so ärgerlich, daß er zu winseln und mit allen vieren zu strampeln begann. Mrs. Helen mußte einen schlimmen Tag haben, da sie ihren Liebling mit einem derben Klaps bestrafte, und sie war auch so ganz anders als sonst, als sie plötzlich vor Selwood stehenblieb und ihn förmlich ins Verhör nahm.
»Haben Sie die ›Königin der Nacht‹ wiedergesehen?«
»Nein«, gab er leichthin zurück, aber der stechende Blick ihrer dunklen Augen brachte ihn in Verlegenheit.
Sie verzog den üppigen Mund und ließ ein krampfhaftes Kichern hören. »Wahrscheinlich haben Sie doch der Polizei gepetzt«, fuhr sie dann lauernd fort, und ihr Ton hatte etwas so Tückisches und Herausforderndes, daß alle überrascht und betreten aufhorchten. Sie war nicht wiederzuerkennen, und sogar Osborn hatte seine Frau noch nie in einer derartigen Erregung gesehen.
Selwood tat ihre anzügliche Bemerkung mit einem Achselzucken ab. Er war über den gestrigen Zwischenfall im Klub noch so empört, daß er es vermieden hatte, mit Osborn auch nur ein Wort zu wechseln, und er hatte keine Lust, sich vielleicht mit Helen in eine unerfreuliche Streiterei einzulassen.
Sein Vetter mochte das Verletzende dieses Schweigens fühlen, und er kam in die richtige Stimmung, seine völlig außer Rand und Band geratene Frau zu bearbeiten.
»Was sollen diese Albernheiten?« schrie er sie an. »Du wirst von Tag zu Tag unmöglicher. Verkrieche dich in einen Winkel und halte den Mund.«
Zum ersten Male knickte Helen nicht demütig und furchtsam zusammen, sondern warf trotzig den dunklen Kopf zurück und nahm ihren ruhelosen Marsch durch das Zimmer mit herausfordernder Absichtlichkeit wieder auf.
Es war eine mit Gereiztheit, Spannung und quälenden Befürchtungen geladene Atmosphäre, in die Mr. Fish und Boyd als erste Gäste gerieten, und der Empfang war kühl und zerstreut. Aber der sommersprossige Jüngling rettete die Situation einigermaßen, denn er war entschlossen, heute alle seine gesellschaftlichen Talente spielen zu lassen. Er hatte sich die selbstbewußte Pose und die großen Gesten eines Generalmusikdirektors beigelegt, der eine Filmkamera auf sich gerichtet weiß, und schwätzte unaufhörlich. Dabei drehte er die großen Perlen in seiner Hemdbrust, äugelte auf die Seidenstrümpfe mit den weißen Ajours und fächelte sich zuweilen mit dem bunten Seidentuch Kühlung zu.
»Sehr nett haben Sie es hier, Mrs. Dyke«, äußerte er rückhaltlos seine Anerkennung, nachdem er die Flucht der Räume mit kritischer Kennermiene in Augenschein genommen hatte. »Wirklich sehr nett und vornehm. Man findet leider in den besten Häusern nicht immer auch den besten Geschmack.«
Nach den Lobreden über ihr Heim machte er Mrs. Evelyn Komplimente über ihr wundervolles Aussehen.
Mrs. Dyke nahm die dicken Schmeicheleien mit einem etwas matten Lächeln entgegen, was ja bei der Anwesenheit Dritter nur zu verständlich war, und der junge Salonlöwe wußte sehr gut, daß er nun auch Mrs. Osborn einige Artigkeiten zu sagen hatte, um die Sache nicht allzu auffallend zu machen. Helen saß mit zusammengezogenen Brauen und verkniffenen Lippen so versunken da, daß die ersten Komplimente an ihrem Ohr vorüberglitten, aber dann beugte sich der galante Mr. Fish so nahe zu ihr und wurde so laut und eindringlich, daß sie endlich aufhorchte. Über ihr mürrisches Gesicht flog ein kokettes Lächeln, und indem sie sich eiligst an ihrer Puderdose zu schaffen machte, begann sie belustigt und erfreut zu kichern.
Während der ›Fliegenpilz‹ so die Damen in Atem hielt, führten die drei Herren ein schleppendes Gespräch über allerlei alltägliche Dinge, aber außer dem liebenswürdigen Mr. Boyd, der ebenso nett zu plaudern wie zuzuhören verstand, war keiner von ihnen bei der Sache.
Pünktlich mit dem Schlag acht betrat Noel Wellby den kleinen Salon, und unter anderen Verhältnissen hätte sein Erscheinen wahrscheinlich eine Sensation hervorgerufen. Der unbedeutende Reporter der ›London Sensations‹ präsentierte sich in der sicheren Haltung eines Weltmannes, und alle Augen, die erwartungsvoll und prüfend auf ihn gerichtet waren, mußten feststellen, daß der schlanke vornehme Mann mit dem braunen Gesicht und den leicht angegrauten Schläfen eine fabelhafte Figur machte. Mr. Fish schrieb dies allerdings einzig und allein der wundervollen Orchidee im Knopfloch zu und war wütend, daß er nicht auch auf diesen Einfall gekommen war.
Mrs. Dyke fand für den neuen Gast unwillkürlich eine verbindlichere Begrüßung als für die beiden ersten, und auch Osborn und Selwood nahmen eine korrektere Haltung an als Evelyn sie mit diesem rätselhaften Mann bekannt machte. Nur der ›Fliegenpilz‹ blieb ostentativ sitzen und beschränkte sich darauf, Wellby herablassend zuzuwinken. Er ärgerte sich, daß man solches Wesen von dem aufgeblasenen Burschen machte, und Mrs. Dyke sollte sehen, daß er noch arroganter sein konnte, wenn er wollte. Mrs. Helen starrte den neuen Gast mit großen glänzenden Augen an, und die Lebhaftigkeit, mit der sie sich plötzlich zurechtrückte, verriet, daß er auch ihr Interesse erweckt hatte.
Als letzte kam Miss Avery, die in dem hochgeschlossenen unmodernen Seidenkleid und ohne Hut geradezu unmöglich aussah. Sie schien ihr Haar stark befeuchtet und krampfhaft zurechtgebürstet zu haben, denn es lag dicht und strähnig an, und es war unmöglich, dessen Farbe zu bestimmen. Von der kleinen Locke, die sonst unter dem Hut hervorgedreht war, war heute nicht das mindeste zu sehen, und um Wellbys Mund ging ein flüchtiges Zucken, als er bemerkte, wie sie sich hergerichtet hatte. Dazu kam noch, daß das häßliche Mal in dem hellen Lampenlicht des kleinen Raumes greller denn je hervorstach und daß sie noch linkischer als sonst einherstolperte. Sie bot ein solches Bild der Dürftigkeit, der Verlegenheit und Unbeholfenheit, daß der sommersprossige Fish nicht umhin konnte, diskret mit den Achseln zu zucken und Mrs. Dyke einen Blick zuzuwerfen, der sie daran erinnern sollte, was er gesagt hatte, als sie auf die Idee verfallen war, Clarisse Avery einzuladen.
Mrs. Evelyn übersah diesen Blick, denn sie war mit anderen Gedanken beschäftigt. Sie hatte nun die beiden Personen in ihrem Haus, die, wie sie vermutete, in der geheimnisvollen Geschichte der ›Königin der Nacht‹ eine bedeutsame Rolle spielten, und die Partie hätte beginnen können. Aber mittlerweile war die starke Hand von Scotland Yard bereits zum letzten entscheidenden Zug gekommen, und es hatte keinen Zweck mehr, sich mit den beiden Figuren abzugeben, so interessant sie auch sein mochten. Jeder Augenblick konnte den Zusammenbruch bringen, und es war völlig nutzlos, hier die Zeit zu verlieren.
Auf diese Erkenntnis Evelyns war das ganze Dinner eingestellt. Es wurde in Hast und Eile serviert, und Mr. Fish kam diesmal wirklich nicht dazu, das Besteck aus der Hand zu legen, wofür er nicht genug Worte der Anerkennung finden konnte. Wenn der ›Fliegenpilz‹ mit dem Essen zu tun hatte, was fast ununterbrochen der Fall war, herrschte ein peinliches, gedrücktes Schweigen, und nur einmal wurde ein Thema angeschlagen, das bei allen gespanntestes Interesse auslöste.
Die unruhige Mrs. Osborn hatte plötzlich in ihrem netten, weißhaarigen Tischnachbarn zur Rechten einen jener Herren wiedererkannt, die sie interviewt hatten, und sie begann wieder von der Sache zu sprechen, die sie sehr zu beschäftigen schien.
»Glauben Sie, daß das, was heute von der ›Königin der Nacht‹ in den Zeitungen stand, wahr ist?« fragte sie lebhaft.
Der höfliche Boyd legte Messer und Gabel beiseite, denn das Stichwort hatte er schon den ganzen Abend erwartet.
»Gewiß. Ich glaube es sogar nicht nur, sondern ich weiß es bestimmt. Die langgesuchte ›Königin der Nacht‹, die den Tod Cartwrights, Mortons, Bryans' und noch einiger anderer Personen auf dem Gewissen hat, wird sich in wenigen Stunden in den Händen der Polizei befinden.«
»Wer hat Ihnen das gesagt?« flüsterte sie und befeuchtete sich die Lippen.
»Ein hoher Beamter von Scotland Yard, mit dem ich gesprochen habe, bevor ich hierher kam. Es soll der Polizei in der verflossenen Nacht gelungen sein, die Identität der geheimnisvollen Persönlichkeit festzustellen. Für heute sind alle Vorbereitungen getroffen, sie zu verhaften. Ihr Haus ist umstellt, und sie steht schon seit dem Morgen unter einer so zuverlässigen Überwachung, daß ihr jeder Weg zur Flucht abgeschnitten ist.«
An der Tafel herrschte eisiges Schweigen, und aller Augen waren gespannt auf den weißhaarigen Herrn gerichtet, der so aufregende Dinge zu erzählen wußte. Nur Mr. Fish interessierten sie nicht, denn er war gerade bei einem Ragout, das ihm so ausgezeichnet mundete, daß er sich trotz seines schwachen Magens bereits die fünfte Muschel auf den Teller legte.
Ein schrilles, albernes Auflachen von Mrs. Osborn und ein klägliches Geheul ihres Hündchens unterbrachen die unheimliche Stille, aber die Stimmung war noch düsterer als vordem, und es war erst wenige Minuten nach elf Uhr, als die Gäste sich verabschiedeten. In der kleinen Halle nahm Boyd den etwas verdrießlichen und enttäuschten Mr. Fish beiseite.
»Ich kann Sie leider nicht begleiten, da ich in einer anderen Richtung zu tun habe, aber mein Wagen steht Ihnen natürlich zur Verfügung, die ganze Nacht.«
Der ›Fliegenpilz‹ ließ sich das nicht zweimal sagen und stürzte eiligst davon, denn er hatte keine Lust, vielleicht auch noch diesen unausstehlichen Wellby und die unmögliche Miss Avery mitnehmen zu müssen. Der ganze Abend hatte ihn ohnehin schon genug verstimmt. Das Essen war zwar gut und reichlich gewesen, und auch zu trinken und zu rauchen hatte es in Hülle und Fülle gegeben — Mr. Fish fühlte, ob die Zigarren und Zigaretten in der Brusttasche seines Fracks auch wohl geborgen seien —, aber eigentlich hatte er mehr erwartet. Der Teufel mochte sich in den Frauen auskennen.
»Was ist nun mit Ihnen, Miss Avery?« fragte Boyd fürsorglich, als Mr. Fish verschwunden war. »Wie werden Sie nach Hause kommen?«
»Ich werde mir in der Nähe einen Wagen nehmen«, sagte sie nach einer Weile und wollte sich verabschieden. Aber der weißhaarige Herr blieb hartnäckig.
»Das wird Ihnen schwerfallen. Hier in der Nähe gibt es keinen Wagen.«
»Oh, vielleicht doch«, widersprach sie hastig. »Ich werde schon einen finden.«
Der Detektiv lächelte verschmitzt, ließ es sich aber nicht nehmen, sie mit Wellby auf die Straße zu begleiten.
»Geben Sie uns wenigstens zur Beruhigung ein Zeichen, wenn Sie ein Auto aufgetrieben haben«, rief er ihr nach, als sie mit einem hastigen »Gute Nacht« in die Dunkelheit stürmte.
Wirklich klang schon nach wenigen Minuten von irgendwo ganz in der Nähe ein Hupsignal, und gleich darauf rief eine helle, frische Mädchenstimme »Auf Wiedersehen!«
Boyd sah den Reporter, mit dem er allein geblieben war, mit einem höchst anzüglichen und vielsagenden Schmunzeln an.
»Um Sie habe ich keine Angst. Ihnen wird kaum etwas geschehen. Und es ist wohl überhaupt keine Gefahr mehr. Wahrscheinlich werde ich Ihnen noch in dieser Nacht mitteilen können, daß alles in Ordnung ist. Wo kann ich Sie erreichen?«
»Rufen Sie im Savoy-Hotel an«, erwiderte Wellby nach einiger Überlegung. »Appartement Nummer 7.«
Der weißhaarige Herr nickte.
»Schön. Und dann öffnen Sie meinen Brief. Er wird Ihnen alles erklären, was Sie wissen müssen, und das übrige erfahren Sie morgen. Ich bin um vier Uhr bei Ihnen. Die anderen laden Sie für fünf oder halb sechs.«
Sie schüttelten sich herzlich die Hände, und während Wellby zu einem wartenden Taxi schritt, schlug sich Boyd um die nächste Ecke, wo ihn das Auto mit der kleinen blauen Scheibe zwischen den Scheinwerfern erwartete, das ihn und Oberst Terry bereits in der verflossenen Nacht gefahren hatte.
Kaum zwanzig Minuten später schritt der Detektiv wieder durch den kleinen Park und bog in die Gasse ein, die zu der Allee und Villa mit den zwei Türmchen führte.
Der Oberst war auf dem Posten und begrüßte ihn mit großer Lebhaftigkeit und sichtlicher Erleichterung.
»Ist es soweit?« fragte er hastig.
»Wir werden uns wohl noch eine halbe oder auch eine ganze Stunde gedulden müssen. Aber darauf kommt es ja nicht mehr an. Die Hauptsache ist, daß Ihr Apparat wieder tadellos funktioniert. Besonders die Sache mit den Polizisten.«
Terry machte eine etwas ungeduldige Geste.
»Darauf können Sie sich verlassen. Sowie der Wagen in die Allee einbiegt, werden sich die Leute so aufstellen, daß sie unbedingt gesehen werden müssen. Ich hab: zwanzig Mann aufgeboten, das wird wohl genügen. Ich tue ja alles, was Sie für gut halten, obwohl mich, offen gestanden, Ihre Geheimniskrämerei allmählich zur Verzweiflung bringt.«
»Dafür werden Sie noch in dieser Nacht die Genugtuung haben, einen der geheimnisvollsten und schwierigsten Kriminalfälle aufzuklären, der Scotland Yard je beschäftigte«, tröstete ihn Boyd gelassen, und diese Aussicht ließ die Verstimmung Terrys rasch wieder schwinden.
»Die Verhaftung wird Jeffney vornehmen«, erklärte er eifrig. »Es ist sein Rayon. Wer soll nun festgenommen werden?«
»Die Frau, die aus dem Wagen steigt. Ich werde das schon arrangieren, wenn es so weit kommen sollte.«
Der Oberst horchte überrascht und mißtrauisch auf.
»Hegen Sie noch irgendeine Befürchtung?«
»Nein, aber eine Hoffnung«, gab Boyd kurz zurück, und es war unmöglich, mehr aus ihm herauszubekommen.
Es war genau ein Viertel nach Mitternacht, als der stellvertretende Chefinspektor und sein ehemaliger Oberinspektor wie auf Kommando gleichzeitig den Kopf herumwarfen und mit scharfen Augen gegen das obere Ende der langen Allee spähten; wo zwei winzige Lichtpunkte erschienen waren...
William Osborn war eben dabei, den Erpressungsversuch an seiner Frau in Szene zu setzen. Er wollte diese Angelegenheit noch während der Fahrt erledigen, denn da ging es vielleicht rascher und jedenfalls ohne die larmoyanten Szenen ab, die daheim zu befürchten waren. Wenn er Glück hatte und von Helen vorläufig wenigstens etwas Bargeld oder einen Scheck erhielt, konnte er sogar noch in den Klub fahren. Sonst mußte er den Rest des Abends daheim verbringen, und dieser Gedanke war für ihn so entsetzlich, daß er mit rücksichtsloser Brutalität zu Werke ging. Helen hatte ihre Unbildung und Einfalt, ihre Fehler und Schwächen noch nie so eindringlich und mit so derben Worten vorgehalten bekommen, wie in der letzten Viertelstunde, aber sie hatte alles mit überraschender Gelassenheit über sich ergehen lassen. Sie saß kerzengerade und reglos wie eine Statue neben ihrem Mann, der das Steuer führte, und nur ihre glänzenden schwarzen Augen wanderten unstet und scheu nach vorne und rechts und links durch die Scheiben.
Osborn brachte dieses unheimliche verstockte Schweigen in Wut, und er begann förmlich zu fauchen. Der Wagen bog bereits in die Allee ein, und er mußte die Sache kurz machen.
»Wenn ich schon dazu verdammt bin, mich mit einer so unmöglichen Frau herumzuschleppen, so will ich wenigstens etwas davon haben, verstehst du? Deshalb habe ich dich doch nur geheiratet. Es war ein ganz regelrechter, klarer Pakt, aber du scheinst dies vergessen zu haben. Hol's der Teufel, daß ich dich immer wieder daran erinnern muß. — Ich brauche fünfzehntausend Pfund. Noch diesen Abend oder spätestens morgen früh. Ohne Widerrede.«
Er schielte erwartungsvoll nach Helen, aber diese schien ihn überhaupt nicht gehört zu haben. Sie hatte das Gesicht dicht an die Scheibe gepreßt und starrte in die dunkle Allee.
Osborn sah im Vorbeirasen einen riesigen Schutzmann, dann noch einen zweiten und einen dritten, aber es fiel ihm weiter nicht auf. Er mußte seine Frau herumbekommen, bevor sie bei der Garage anlangten, und er stieß sie daher ziemlich unsanft mit dem Ellbogen an.
»Bist du etwa auch noch taub geworden?« brüllte er.
In diesem Augenblick hatte Helen mit starren Augen den siebenten Mann mit Helm in der stillen Allee gezählt, und sie fuhr blitzschnell herum. Osborn sah in ihr wachsbleiches verzerrtes Gesicht, aber er dachte nur an das eine, daß er unbedingt Geld haben mußte.
»Fünfzehntausend Pfund habe ich gesagt«, schrie er sie an. »Mach keine Geschichten, denn diesmal ist es Ernst.«
Sie beugte ihr Antlitz dicht zu dem seinen, und selbst der rohe William Osborn erschrak vor dem Übermaß von Wut, Haß und Hohn, das ihm entgegengrinste. Er hörte eine fremde heisere Stimme, die ihm kreischend »Verdammter Schurke« ins Ohr schrie, dann vernahm er ein schneidendes Lachen, und dann sah er noch, wie Helen blitzschnell den Arm hob...
Oberst Terry wollte mit einem Satz in die Allee springen, als das nahende Auto plötzlich seltsam zu schlingern begann, aber Boyd hielt ihn zurück.
»Auslaufen lassen«, sagte er ruhig. »Da ist nichts mehr zu machen.«
Der in voller Fahrt befindliche Wagen kippte einen der starken Alleebäume um, fuhr an den nächsten und zerschellte unter Krachen.
Bei der Menge der zusammengezogenen Polizeimannschaften ging die Hilfeleistung sehr rasch vonstatten, aber zu helfen war eigentlich nichts mehr. William Osborn und seine Frau wurden als Leichen unter den Trümmern hervorgezogen, aber sie wiesen seltsamerweise keine wesentlichen äußerlichen Verletzungen auf.
»Können Sie das verstehen?« fragte Terry verwundert.
»Gewiß«, gab Boyd zurück, indem er an der Unfallstelle eifrig herumsuchte. »Sie lagen eben bereits als lebloses Bündel im Wagen, als das Unglück geschah. Die ›Königin der Nacht‹ hat die letzte ihrer tückischen Kugeln verschossen.«
Er bückte sich plötzlich und hob ein kurzes Rohr mit einem Handgriff auf, mit dem er eine Weile behutsam manipulierte, worauf er es in die Tasche gleiten ließ.
»Ich hatte mir die Sache anders vorgestellt«, meinte der stellvertretende Chefinspektor verdrießlich, als sie sich auf dem Heimweg befanden.
»Ich nicht«, gab der weißhaarige Herr offen zu. »Ich muß sogar gestehen, daß ich ein wenig mit dazu beigetragen habe, damit die Sache diesen Ausgang nimmt. Wenn es um eine Frau geht, werde ich immer ein bißchen sentimental, und es widerstrebt mir, sie der sogenannten irdischen Gerechtigkeit zu überliefern, die in einem Strick besteht. Diese Helen Osborn war ja gewiß eine äußerst skrupellose und verschlagene Verbrechernatur, aber man muß da auch die besonderen Umstände und die Motive mitsprechen lassen. Eigentlich hat sie alles nur für ihren Mann getan, der der weitaus größere Verbrecher war. Sie hat die Rolle der ›Königin der Nacht‹ zunächst übernommen, um alle jene zu beseitigen, die die alte böse Geschichte vom Brunnen der sieben Palmen aufzurühren drohten, aber sie hat sie dann auch bei anderen Gelegenheiten gespielt, um das Geld für die kostspieligen Leidenschaften Osborns herbeizuschaffen. Tatsächlich hat nämlich der alte Robbins seiner Tochter nicht einen Penny hinterlassen. Er muß etwa ein Jahr vor seinem Tod, am 8. Februar, irgendeine gefährliche Dummheit begangen haben und einer Erpresserbande in die Hände gefallen sein, die das Geschäft noch besser verstand als er, denn von seinem ansehnlichen erwucherten Vermögen ist nichts übriggeblieben. Ich glaube, darüber wird uns der ›Professor‹ nähere Auskunft geben können. Haben Sie ihn?«
»Jawohl«, gab der Oberst kurz angebunden zurück, da er sich mit diesem Ausgang des sensationellen Falles noch immer nicht recht abfinden konnte. »Er wurde um sieben Uhr auf der Charing-Cross-Station festgenommen.
Boyd ließ einen leisen Pfiff hören.
»Da haben Sie Glück gehabt, denn ich glaube, der schlaue Fuchs war im Begriff, auszukneifen. Die kurze Notiz in den Abendzeitungen dürfte ihm nicht gefallen haben. Aber er ist diesmal doch ein bißchen zu langsam gewesen, und wenn wir zusammen den Bericht abfassen, werden Sie erst sehen, welch ein guter Fang Ihnen da gelungen ist. Das muß Sie für das andere entschädigen. Man kann nicht alles so haben, wie man es sich wünscht, und ich glaube, Sie werden auch so genug Anerkennung und Ehren einheimsen.«
Oberst Terry hörte das gern, und seine Stimmung besserte sich sofort.
»Und Sie, lieber Boyd?« fragte er herzlich. »Sie müssen doch auch etwas davon haben.«
»Werde ich auch«, nickte der weißhaarige Herr und lächelte traumverloren vor sich hin. »So eine Hochzeitsreise ins Karibische Meer mit Haifischfang ist eine Sache, die sich nicht jeder leisten kann.«
Der Oberst wußte zwar nicht, was er aus dieser seltsamen Antwort machen sollte, aber er war zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, um sich näher dafür zu interessieren. Eine Viertelstunde später saß er mit rotem Kopf in seinem Büro in Scotland Yard und notierte sich, was Boyd ihm diktierte, und je weiter der Bericht fortschritt, desto gespannter und befriedigter wurden seine Mienen. Das war wirklich ein Fall, der die Tätigkeit von Scotland Yard im glänzendsten Licht zeigte, und es fehlte auch nicht ein Glied in der Beweisführung.
Es war bereits drei Uhr morgens, als Clive Boyd das Büro Oberst Terrys verließ, aber er suchte trotzdem noch das Telefonzimmer auf, um das Savoy-Hotel anzurufen. Er erhielt sofort Verbindung, und auch das Appartement 7 meldete sich so rasch, daß der Betreffende unmittelbar am Apparat gewartet haben mußte.
»Sind Sie es, Mr. Wellby?« fragte der Detektiv, und als er eine hastige Bejahung erhielt, berichtete er kurz über den Autounfall, dem William Osborn und seine Frau zum Opfer gefallen waren.
»Es ist also alles in Ordnung«, fügte er nachdrücklich hinzu, »und Sie können die Sache so arrangieren, wie ich Ihnen geschrieben habe.«
Vom anderen Ende des Drahtes kam eine Flut von erregten Fragen, aber das rosige Gesicht des weißhaarigen Herrn wurde etwas mißmutig.
»Lieber Mr. Wellby«, sagte er höflich, aber bestimmt, »es ist drei Uhr früh, und ich fühle das Bedürfnis nach Ruhe. Morgen stehe ich Ihnen stundenlang zur Verfügung, wenn Sie es wünschen.«
Es kam aber doch noch eine Erwiderung.
»Nur noch eine kurze Frage?« wiederholte Boyd. »Bitte sehr.«
Es mußte eine sehr komische Frage sein, denn der Detektiv begann plötzlich zu schmunzeln und hörte trotz seines Ruhebedürfnisses eine ziemliche Weile geduldig zu.
»Darüber eine Meinung zu äußern, getraue ich mich wirklich nicht«, sagte er bedächtig, als der andere geendet hatte. »Die Verantwortung wäre zu groß. Wenn ich mich irrte, würden Sie sich Ihr ganzes Leben mit einer Frau mit einem häßlichen Feuermal herumschleppen müssen. Gute Nacht, Mr. Wellby.«
Er hängte mit einem höchst belustigten Lächeln in den großen grauen Augen den Hörer auf, machte sich aber sofort wieder mit dem Apparat zu schaffen und schien mit einem Entschluß zu ringen.
Er war schon im Begriff, den Automaten neuerlich in Tätigkeit zu setzen, als seine Hand jäh wieder herabsank. Es war ihm eben noch in letzter Minute eingefallen, daß drei Uhr morgens doch nicht die schickliche Zeit sei, einer Frau einen Heiratsantrag zu machen und eine Hochzeitsreise in das Karibische Meer vorzuschlagen. Außerdem wußte er nicht, wie weit Mrs. Emerson in der Geographie bewandert war und wie sie über den Angelsport im allgemeinen und den Fang von Haifischen im besonderen dachte, und die Auseinandersetzung hierüber hätte vielleicht die ganze Nacht in Anspruch nehmen können.
Der weißhaarige Herr mit; dem jungen rosigen Gesicht beschloß daher, diese Sache doch lieber auf den kommenden Tag zu verschieben, obwohl er für diesen schon genug andere Arbeit vorhatte.
Der Mann, der am nächsten Morgen mit dem Schlag elf so fieberhafte Erregung in das Cartwright-Haus brachte, hatte absolut nichts Beunruhigendes oder auch nur Besonderes an sich. Er maß zwar gut einen Meter achtzig, war aber ein schmucker Bursche mit einem gesunden, freundlichen Gesicht, und seine Matrosenkleidung blitzte von der bebänderten Mütze bis zu den derben Schuhen vor Sauberkeit. Er trug sogar weiße Handschuhe und eine kleine Ledermappe unter dem Arm, aber kaum war Pat seiner ansichtig geworden, als er sich wie ein Raubtier zum Sprung duckte und den Fremden aus seinen funkelnden Schlitzaugen tückisch anstierte. In Pat Coppertree war nämlich blitzgleich die Erinnerung an eine gewisse böse Märznacht lebendig geworden, da er dreckiges Themsewasser hatte schlucken müssen, und er hätte ohne jede Entschädigung den heiligsten Eid darauf geschworen, daß dieses gesunde, freundliche Gesicht dabei eine sehr niederträchtige Rolle gespielt hatte.
Der baumlange Matrose schien sich aber an nichts dergleichen zu erinnern. Er blickte mit dienstlicher Höflichkeit auf den kleinen Iren herab und legte dann die gewaltige Rechte so stramm und vorschriftsmäßig an die Mütze, daß auch die Hand des anderen unwillkürlich mit weit gespreiztem Ellbogen emporfuhr.
»Ein Schreiben von Mr. Gordon Lawrence von mir persönlich an Mr. Thomas Hyman abzugeben«, sagte der Mann mit militärischer Kürze, und aus den Mienen von Pat Coppertree war auch schon der letzte Anflug von Feindseligkeit gewichen. Er wußte sehr wohl, was der Name Lawrence für das Cartwright-Haus bedeutete, von Mr. Hyman gar nicht zu reden. Ein Mann, der von Mr. Lawrence zu Mr. Hyman kam, war unbedingt eine Respektsperson, und der wackere Ire fand es plötzlich für gut, lieber nichts dergleichen zu tun. Der Sicherheit halber salutierte er sogar nochmals sehr stramm, was der Fremde ebenso stramm erwiderte, und dann bequemte er sich, diesem mit höflicher Beflissenheit den Weg zu weisen.
Der Gewaltige des Cartwright-Konzerns war eben dabei, mit großen eckigen Buchstaben seinen Namen unter einen Scheck zu malen. Er hatte in der letzten halben Stunde aus dem Munde Clive Boyds die Geschichte der ›Königin der Nacht‹ von ihrem Anfang beim Brunnen der sieben Palmen bis zu ihrem Ende in der Allee bei der Villa mit den zwei Türmchen haargenau vernommen, aber außer einem gewaltigen Faustschlag auf die Platte des Schreibtisches hatte er keine Meinungsäußerung getan. Dann war sofort der Griff nach dem Scheckbuch gekommen, und während Hyman mit schwerer Hand Ziffern und Wort kritzelte, sah der Detektiv wohl zum zehntenmal in den letzten fünf Minuten nach seiner Uhr.
»Ich hoffe, daß Sie nicht die Spesen vergessen haben«, sagte er hastig und besorgt, als der andere eben zu der Unterschrift ansetzte. »Es waren achtzehn Pfund, drei Schilling und neun Pence.«
Der Anwalt hob den Kopf, und in seinem grauen, schwammigen Buldoggengesicht lag so etwas wie ein launiges Grinsen.
»Die habe ich schon einkalkuliert, mein Lieber«, gurgelte er. »Und weil Sie die Leute mit Ihrem einfältigen Getue so dumm machen können, habe ich sie auf fünfzig Pfund aufgerundet.«
In diesem Augenblick erschien in der Tür der selbstbewußte Boy mit der schnarrenden Stimme und leierte monoton seine Meldung herunter:
»Ein Matrose von Mr. Gordon Lawrence...«
Thomas Hyman schnellte mit seinen achtundfünfzig Jahren und seinen zweihundertzehn Pfund empor wie ein Jüngling, und nur die Wucht, mit der sein Stuhl an die Wand flog, verriet, welch ein Kraftaufwand dabei verbraucht worden war.
Im nächsten Augenblick stand der riesige Matrose bereits im Zimmer, und der Anwalt riß ihm den großen weißen Briefumschlag förmlich aus den Händen.
Der Bote war schon längst wieder gegangen, als Hyman noch immer auf die Karte starrte, die er in den Händen hielt; dann reichte er sie wortlos Boyd, der sie mit bedächtigem Interesse überflog.
»Um halb sechs Uhr an Bord der ›Barracuda‹ im Westbassin des St.-Katharinen-Docks...«, las er halblaut vor sich hin und legte dann die Karte auf den Schreibtisch. »Ich habe Ihnen ja gesagt, daß man heutzutage nicht mehr spurlos verschwinden kann. Im übrigen ist der neue Herr nicht einen Tag zu früh gekommen.«
»Nein«, gab der Anwalt schnaufend zu und manipulierte in der Lebhaftigkeit, die plötzlich über ihn gekommen war, energisch am Haustelefon.
»Hundert Pfund von meinem Konto für die Armen von London«, grölte er in den Apparat, und der Mann, der die Weisung empfing, konnte nicht im Zweifel sein, wer sie erteilt hatte. »Ich bin zwar sonst nicht so«, glaubte der aufgeregte Koloß Boyd erklären zu müssen, »aber wenn es zu dick kommt, muß man etwas tun. An einem Tag die verdammte Sache der ›Königin der Nacht‹ und den ganzen Krempel hier loszuwerden, ist fast zu viel des Guten.« Er schob die Hände tief in die Hosentaschen und spitzte die wulstigen Lippen, als ob er pfeifen wollte, und dem weißhaarigen Herrn schien es, als ob sich sogar die gewaltigen Elefantenfüße Mr. Hymans zu einem Freudentanz anschickten.
Mittlerweile machte der Bote von Mr. Lawrence im Cartwright-Haus die Runde. Er erschien bei Mrs. Dyke, tauchte im Reporterzimmer auf, wo er für Miss Avery, Mr. Fish und Mr. Noel Wellby große Briefumschläge aus seiner Ledermappe zog, und als er wieder in der Halle anlangte, steckte er sogar Pat Coppertree einen solchen Umschlag in die Linke, da dessen Rechte mit weit gespreiztem Ellbogen zu einem strammen hochachtungsvollen Gruß an der Mütze lag.
Ein so bedeutsames Ereignis das plötzliche Auftauchen des neuen Chefs für Mrs. Evelyn auch war, es vermochte sie in ihrer augenblicklichen Stimmung lange nicht so in Atem zu halten, wie dies wohl sonst der Fall gewesen wäre. Ihre Gedanken und Sorgen galten noch immer der Lösung, die das geheimnisvolle Rätsel der ›Königin der Nacht‹ finden sollte, und je länger die Entscheidung auf sich warten ließ, desto mehr versagten ihre Nerven. Die Einladung an Bord von Mr. Lawrences Jacht ›Barracuda‹, die sie in Händen hielt, hätte sie noch gestern aufgestört, heute berührte sie sie kaum. Immerhin wollte sie Selwood und Osborn von der Sache Mitteilung machen. Es überraschte sie, daß Charlie schon davon wußte und mit einer gleichen Karte bedacht worden war, aber er hielt dies für eine Aufmerksamkeit des Cartwright-Erben gegenüber dem ehemaligen Reisebegleiter seines Onkels. Evelyn war es lieb, daß sie Selwood an ihrer Seite haben würde, und sie erwartete nun auch von Osborns zu hören, daß sie mit dabei sein würden. Aber sooft sie auch anrief, die Nummer meldete sich nicht, und sie mußte schließlich annehmen, daß an dem Apparat in der Villa mit den zwei Türmchen etwas nicht in Ordnung sei.
Tatsächlich saß die Polizei im Haus und hatte alle Vorkehrungen getroffen, um über den Fall der ›Königin der Nacht‹ auch nicht ein Wort in die Öffentlichkeit dringen zu lassen, bevor Oberst Terry die Zeit nicht für gekommen erachtete.
Ebenso gleichmütig wie Mrs. Dyke nahm nach mehrmaligem vernehmlichen Räuspern und einiger Überlegung Mr. Fish die Einladung von Mr. Lawrence hin. Es wäre dies zwar entschieden eine Sache gewesen, aus der sich etwas ganz Besonderes hätte machen lassen, aber da offenbar auch Miss Avery und der ekelhafte Wellby derselben Ehre teilhaftig geworden waren, war es schwer, daraus Kapital zu schlagen. Der ›Fliegenpilz‹ fand es daher gut, lediglich höchst laut und gelangweilt zu gähnen und die Karte mit einem Gesicht in die Tasche gleiten zu lassen, das deutlich besagte, wie zuwider ihm diese ewigen gesellschaftlichen Inanspruchnahmen schon waren, selbst wenn es sich um einen Empfang auf einer Jacht und bei seinem neuen Chef handelte.
Sehr aufgeregt war Miss Avery. Sie rückte unausgesetzt an ihrer schauderhaften Brille, während sie las, und dann benützte sie eine günstige Gelegenheit, um sich bei Wellby Rat zu holen.
»Ich kann mir nicht erklären, wie gerade ich zu dieser Einladung komme«, meinte sie verwirrt, aber der Reporter fand daran gar nichts Besonderes.
»So wie Mr. Fish und ich. Vielleicht sind den anderen die Karten in ihre Wohnungen zugestellt worden. Jedenfalls können Sie nicht gut ausbleiben.«
Sie sah das ein und beschäftigte sich sofort mit der nächstliegenden Frage, die sie etwas verlegen und zögernd vorbrachte.
»Wie soll man da gehen? Ich meine, was soll man da anziehen?«
»Machen Sie sich einmal recht nett«, schlug Wellby mit ernstem Gesicht vor. »Nicht so unmöglich wie gestern abend. Ich glaube, wenn Sie den guten Willen haben, wird es gewiß gehen.«
Zum erstenmal ließ Clarisse Avery in den Räumen des Cartwright-Hauses das leise dunkle Lachen hören, das den Reporter schon wiederholt so eigentümlich berührt hatte, und es klang so melodisch und lockend, daß selbst der ›Fliegenpilz‹ mit verwundertem Gesicht herumfuhr.
»Es wird ein schweres Stück Arbeit werden«, meinte sie kichernd, »aber ich werde es versuchen.« Und wieder einmal hätte Noel Wellby viel darum gegeben, einen Blick hinter die toten Brillengläser tun zu können.
Am längsten brauchte Pat Coppertree, um mit dem großen Ereignis fertig zu werden. Aber nachdem er unter Zuhilfenahme eines alten Klemmers und seines dicken Zeigefingers herausbuchstabiert hatte, daß er von Mr. Lawrence ersucht wurde, sich um halb sechs dort und dort einzufinden, und nachdem er sich der Sicherheit halber dasselbe noch von einem gebildeten Laufburschen dreimal hatte vorlesen lassen, wußte er, was zu tun war. Er telefonierte mit Mrs. Nettie, ihm seinen Galarock und seine Galamütze zurechtzulegen, und als er eine etwas spitze und mißtrauische Antwort bekam, beeilte er sich zu versichern, daß er die gewisse Karte natürlich mitbringen werde. Er hatte ohnehin die Absicht, diesem Schriftstück einen besonderen Ehrenplatz hinter dem Spiegel einzuräumen, hinter dem bisher nur zwei Bildnisse von Mrs. Nettie steckten, und zwar erfreulicherweise aus einer Zeit, da sie noch jünger und ihre Warze unter dem Auge noch nicht so groß war.
Getreu seinem Grundsatz, bei solchen Anlässen lieber etwas früher als später zu kommen, tauchte Mr. Fish bereits kurz nach fünf Uhr im Westbassin des St.-Katharinen-Docks auf. Wie Miss Avery hatte auch ihm die Kleidungsfrage Kopfzerbrechen verursacht, aber schließlich war er auf eine Zusammenstellung verfallen, die unbedingt eine äußerst glückliche Lösung dieses schwierigen Problems bedeutete. Er trug zu seinen Lackhalbschuhen und den Seidenstrümpfen mit den breiten Ajours ein doppelreihiges Bordsakko, dessen blitzende Knopfreihen mit einem Anker geziert waren, eine etwas zu kurze und zu enge Leinenhose und eine ausrangierte Marineoffizierskappe, die erst an seinen etwas abstehenden Ohren einigen Halt fand. Diese fabelhafte Adjustierung war ihm von einer Kleiderleihanstalt zu der ansehnlichen Gebühr von zwei Schilling für den Tag überlassen worden, aber der ›Fliegenpilz‹ wußte, was er sich schuldig war, und außerdem gab er sich der Hoffnung hin, diese beträchtliche Auslage, wenn schon nicht direkt, so wenigstens indirekt wieder hereinzubringen.
Vorläufig hielt er Ausschau nach der ›Barracuda‹. Die schmucke Viertausend-Tonnen-Jacht war nicht zu übersehen. Sie lag knapp an der Schleuse, und die halbmannshohen Silberbuchstaben an ihrem Bug leuchteten weithin über das Wasser. Um den schlanken dunklen Rumpf lief ein breites weißes Emailband, das in der strahlenden Frühlingssonne wie ein Perlmutterreif schimmerte, und die beiden niedrigen, gedrungenen Kamine kündeten von der Riesenkraft, die in diesem schnittigen Fahrzeug lebte. Am Flaggenmast wehten der amerikanische und der englische Wimpel, und auf dem weißlackierten Deck standen steif und starr wie riesige Statuen die Bordwachen.
Sonst schien die Jacht wie ausgestorben, aber kaum hatte Mr. Fish den soliden, bequemen Laufsteg mit der entsprechenden Vorsicht betreten, als er drüben plötzlich das rosige Gesicht seines Freundes Boyd auftauchen sah. Er war zwar etwas befremdet, aber als er das sichere Deck unter seinen Füßen fühlte, legte er gönnerhaft einen Finger an den Kappenschirm.
»Das hätten Sie sich wohl nicht träumen lassen, als Sie vor einigen Tagen mutterseelenallein in unserem Zimmer saßen, ha? Sie sehen, wenn ich jemanden unter meine Fittiche nehme, so macht er seinen Weg.«
Er ließ seine Augen sofort mit großem Sachverständnis über das blinkende Verdeck gleiten, nickte mehrmals sehr anerkennend mit dem Kopf und lehnte sich dann malerisch an die Reling, um mit seinem riesigen Glas das Dock nach irgend etwas abzusuchen.
Um ein Viertel sechs stapfte Pat Coppertree goldstrotzend und stramm salutierend über den Steg, dann kamen Mrs. Dyke und Selwood und schließlich Clarisse Avery. Sie hatte sich den Rat Wellbys sichtlich zu Herzen genommen und war geradezu elegant gekleidet, machte aber trotzdem keine glücklichere Figur als sonst.
Als pünktlich auf die Minute Mr. Hyman erschien, löste sich der freundliche weißhaarige Herr von der erwartungsvollen Gruppe, um ihn zu begrüßen.
»Ich werde Sie zu Mr. Lawrence führen«, sagte er, und der Anwalt folgte ihm mit weit ausholenden wuchtigen Schritten. Über die Kajütentreppe ging es für den Koloß etwas schwer, und er mußte in dem mit dicken Teppichen belegten Gang einige Sekunden verschnaufen. Dann klopfte Boyd an eine Tür und ließ Hyman eintreten...
Wie an jenem gewitterschwülen Morgen im Cartwright-Haus, standen der junge Mann mit dem scharf geschnittenen Gesicht und den angegrauten Schläfen und der massive Anwalt einander wieder gegenüber. Hyman bedurfte einiger Augenblicke, um über diese Überraschung hinwegzukommen, dann schob er die dicke Unterlippe herausfordernd vor, und er sah noch bärbeißiger aus als sonst.
»Also, so ist die Geschichte«, stieß er heiser hervor, während er sich ohne weiteres in einen Sessel fallen ließ, daß dieser in allen Federn knackte. »Wollen Sie mir vielleicht sagen, was diese nette Maskerade bezwecken sollte?«
Gordon Lawrence lächelte, aber der Blick auf den ergrimmten Anwalt sprach eine ernste Sprache.
»Vielleicht können Sie sich diese Frage selbst beantworten, wenn Sie an die Entwicklung denken, die die Dinge in den letzten Wochen genommen haben. Unter der ersten Post, die mich wieder erreichte, befand sich ein Brief meines Oheims, in dem er mir aufgeregt und besorgt von der seltsamen Begegnung berichtete, die er gehabt hatte. Gleichzeitig erhielt ich die Nachricht von seinem plötzlichen Tod. Ein Gefühl sagte mir, daß da etwas Geheimnisvolles geschehen war, aber während der Fahrt nach England wartete ich vergeblich auf eine Aufklärung. Ich beschloß daher, selbst der Sache nachzugehen. Das Tagebuch Cartwrights, von dem er mir bereits vor Jahren eine Abschrift hatte zukommen lassen, da ich mich für solche Dinge interessierte, bot mir einen kleinen Anhaltspunkt. Ich fand Eingang in unser Zeitungshaus, horchte herum und überwachte Morton. So wurde ich Zeuge seines Zusammentreffens mit der ›Königin der Nacht‹, und ich patrouillierte um sein Haus, als ihn das gleiche Schicksal ereilte wie Cartwright. Da entschloß ich mich, den Alarmschuß in den ›London Sensations‹ loszulassen, und Sie müssen zugeben, Mr. Hyman, daß er seine Wirkung getan hat. Wer weiß, ob sonst das Rätsel je gelöst worden wäre.«
Der Anwalt nagte an seinen Lippen, und es war ihm plötzlich nicht wohl zumute, aber Lawrence kam ihm zu Hilfe.
»Sie müssen mir nichts sagen, denn Mr. Boyd hat mir bereits alles erklärt, und ich bin Ihnen aufrichtig dankbar für Ihre Rücksichtnahme. Es war wirklich eine heikle Sache. Ich rechne auch weiter mit Ihrem Beistand, und wir werden darüber noch sprechen. Vorläufig bitte ich Sie, eine kleine Erfrischung einzunehmen und eine Zigarre zu rauchen. Mr. Boyd wird Ihnen zeigen, wo beides zu finden ist.«
Hyman erhob sich so rasch, wie sein ansehnliches Gewicht dies gestattete. Er fühlte sich in der niedrigen Kajüte wie ein Elefant in einem Hühnerstall, und gegen eine Erfrischung und eine Zigarre hatte er in seiner augenblicklichen Verfassung auch nichts einzuwenden.
Evelyn und Selwood wurden zusammen zu Mr. Lawrence gebeten, aber bevor sie die Situation noch recht begriffen hatten, begann letzterer bereits zu sprechen.
»Ich kenne die testamentarische Verfügung meines Oheims und achte sie«, wandte er sich kühl an Mrs. Dyke, »aber ich glaube, daß Sie unter den gegebenen Verhältnissen einen anderen Wirkungskreis vorziehen werden. Ich habe drüben in meinen Unternehmungen eine Stelle, die Ihnen gewiß zusagen wird, und auch für Mr. Selwood wird sich etwas finden. Da Mr. Osborn und seine Frau gestern tödlich verunglücken, werden Sie beide den Wunsch hegen, England so bald als möglich zu verlassen, und ich werde die Sache daher beschleunigen. Bis dahin wollen Sie sich als beurlaubt betrachten, Mrs. Dyke.«
Er neigte verabschiedend den Kopf, und beide verließen die Kajüte und schritten wie Traumwandelnde über das Deck und über den Steg. Sie hatten von allem nur verstanden, daß die Entscheidung gefallen war und daß sie weit weniger in Mitleidenschaft gezogen werden sollten, als sie gefürchtet hatten.
Dann stolperte ängstlich und verwirrt Clarisse Avery über die Schwelle, aber kaum hatte sie ihr Gegenüber erblickt, als sie sich jäh aufrichtete und ihre dunklen Augengläser starr auf den jungen Mann mit den angegrauten Schläfen richtete.
»Miss Avery«, sagte Lawrence, aber seine Stimme klang bei weitem nicht mehr so bestimmt und selbstsicher, wie den früheren Besuchern gegenüber, »ich bin bereit, die gewisse Sache vom Brunnen der sieben Palmen nach besten Kräften gutzumachen. Wollen Sie mir Ihre Ansprüche nennen.«
Sie hatte die Handbewegung, die sie zum Sitzen einlud, übersehen und war bei jedem seiner Worte größer geworden. Nun stand sie hochaufgerichtet vor ihm, und ihr Kopf lag förmlich im Nacken.
»Haben Sie mir sonst noch etwas zu sagen?« fragte sie, und der Ton, in dem sie sprach, brachte ihn vollends in Verwirrung.
»Gewiß; noch sehr viel«, sagte er schnell. »Vor allem möchte ich Ihnen das Schiff zeigen, wenn es Sie interessiert.«
Sie nickte leicht, und Gordon Lawrence hatte wirklich nichts Dringenderes zu tun, als das unschöne Mädchen durch den schwimmenden Prachtbau zu führen. Sie besah sich alles mit Gründlichkeit, aber ohne ein Wort zu verlieren; erst als er eine der Kabinentüren öffnete und sie einen Blick hineingetan hatte, brach sie endlich das Schweigen.
»Was ist das hier?«
»Die Kajüte der künftigen Herrin«, erwiderte er kühn.
»So«, gab sie etwas anzüglich zurück. »Ich dachte, daß hier die Opfer untergebracht würden, die Ihre Leute heimbringen, wenn Sie sie auf Mädchenraub ausschicken.«
Lawrence machte Miss Avery rasch auf einen anstoßenden kleinen Musiksalon aufmerksam, und als sie schließlich an Deck kamen, bat er sie, zum Dinner zu bleiben.
»Ich werde es mir noch überlegen«, gab sie zur Antwort. »Die Sache könnte mich nur deshalb reizen, weil ich sehen möchte, ob Ihnen Ihre Hauswirtin wieder ihr nettes Tafelzeug und ihre ausgezeichnete Küche zur Verfügung gestellt hat.«
Während Miss Avery das Oberdeck inspizierte, als sei sie von Jugend an auf Schiffsplanken herumgetrippelt, begrüßte Lawrence den äußerst ungeduldigen Mr. Fish, der mit einer Zigarre von riesigen Dimensionen in der Linken und einem ebenbürtigen Whiskyglas in der Rechten auf ihn zusteuerte.
»Gewünscht hätte ich Ihnen, das verdutzte Gesicht von Mr. Hyman zu sehen«, sagte der sommersprossige Jüngling und wackelte so vergnügt mit dem Kopf, daß die ausgemusterte Marineoffizierskappe von einem Ohr zum anderen tanzte. »Manche Leute haben eben gar keinen Blick. Am ersten Tag hätte ich eine Wette von einem Pfund, was sage ich, von zehn Pfund, aufgelegt, daß Sie Mr. Lawrence sind. Aber man ist fair und diskret.«
Da Mr. Fish fürchtete, daß seine Zigarre ausgehen und sein Whisky verdunsten könnte, tat er aus beiden einen gehörigen Zug, und Lawrence konnte Pat freundschaftlich auf die Schulter klopfen. Der krummbeinige Ire stand stramm wie ein Baumstrunk, wandte aber den Kopf zur Seite, denn er war ein guter Christ, und sein neuer Herr erinnerte ihn immer wieder an den Augenblick, da ihm der höllische Versucher erschienen war. Außerdem hatte er ein schlechtes Gewissen, und Mr. Lawrence blinzelte so eigentümlich.
Das Dinner, das in einem sehr prunkvollen Speiseraum serviert wurde, nahm einen äußerst animierten Verlauf. Mr. Hyman hatte ungeduldig auf die Uhr geblickt, als er sich zu Tisch setzte, aber dann schien er ganz vergessen zu haben, daß seine Partie im Klub auf ihn wartete, und begann launig Anekdoten aus seiner Anwaltspraxis zu erzählen. Endlich war es Mr. Fish zu viel, mit seinen gesellschaftlichen Talenten völlig in den Hintergrund gestellt zu werden, und er wollte nun das Wort an sich reißen, aber Miss Avery kam ihm zuvor. Das unschöne Mädchen hatte mit einem Male alles Verlegene und Linkische abgestreift, gab sich mit der Sicherheit und Grazie einer vollendeten Dame und begann plötzlich mit einer sehr süßen Stimme lebhaft daraufloszuplaudern. Sie erzählte eine etwas unklare Geschichte von einem Jachtbesitzer, der ein junges Mädchen auf sein Schiff hatte schleppen lassen, und kam dann auf eine ebenso geheimnisvolle wie abenteuerliche Bootsfahrt auf der Themse zu sprechen. Dabei warf sie den schmalen Kopf mit dem schillernden Kupferhaar zu Mr. Lawrence herum und starrte ihn mit ihren undurchdringlichen Gläsern herausfordernd an, daß der Cartwright-Erbe sichtlich in Verlegenheit geriet.
Nach Tisch schlug der strahlende Boyd dem schnaufenden Anwalt eine Bridgepartie vor, bei der der Kapitän und der Schiffsarzt mittun würden, und Hyman sah zuerst entsetzt nach der Uhr, die bereits auf neun wies, erklärte sich aber dann brummend einverstanden. Mr. Fish entschied sich, bei der Partie zuzusehen, weil dabei vielleicht etwas herausschaute, und Clarisse Avery und Lawrence begaben sich an Deck. Sie kamen eben dazu, wie dort in aller Stille ein Verkehrshindernis aus dem Wege geräumt wurde. Pat Coppertree war von seinen alten Bekannten, von beiden baumlangen Matrosen, zu einem Imbiß eingeladen worden, und dann hatte man Bruderschaft getrunken. Dem Tempo der Matrosen war selbst die ausgepichte Kehle Pats nicht gewachsen, und nachdem er erst mächtig gelogen, dann bitterlich geschluchzt und schließlich seine neuen Freunde stürmisch umarmt hatte, bekam er es mit dem Gefühl der Hochachtung für alles, was ihn umgab, zu tun. Er wankte auf seinen krummen Beinen an Deck, stellte sich dort stramm in Positur und warf die mächtige rechte Flosse mit weit ausgestrecktem Ellbogen an den Mützenschirm. So stand er als steinerne Verkörperung der Ehrenbezeichnung wenigstens eine Viertelstunde lang und war nicht wegzubekommen, bis ihn seine neuen Freunde einfach beim Kopf und bei den Füßen erwischten und davonschleppten, um ihn wohlbehalten zu Mrs. Nettie zu bringen.
Es war eine herrliche, aber frische Vorfrühlingsnacht, und Gordon Lawrence machte sich immer wieder umständlich mit dem Mantel zu schaffen, den er Clarisse Avery fürsorglich umgehängt hatte. Zuweilen versuchte er auch, ein Gespräch zu beginnen, aber er kam damit nicht recht weiter, denn das unschöne Mädchen starrte sehr angelegentlich in das Wasser, obwohl es dort nichts zu sehen gab.
Plötzlich tauchte Mr. Jacob Fish neben ihnen auf, der die Kartenpartie verlassen hatte, weil er zu der Erkenntnis gekommen war, daß ihm das Kiebitzen kaum etwas einbringen würde. Außerdem war ihm Mr. Hyman, der bereits vier Schilling gewonnen hatte, viel zu laut und zu gesprächig. Der ›Fliegenpilz‹ überschlug eben die Spesen, die er für diesen Abend gehabt hatte und was ihm dafür geboten worden war, und er war von der Bilanz höchst unbefriedigt.
Da erblickte er vor sich seinen neuen Chef und Miss Avery, und sein Gehirn begann fieberhaft zu arbeiten. Er berechnete rasch die Barschaft, die er bei sich hatte, einschließlich der gewissen drei Schilling, um. beschloß, alles auf eine Karte zu setzen. Er legte einen Finger an die Marineoffizierskappe und verzog seinen breiten Mund von einem Ohr bis zum anderen. »Zehn Pfund, Mr. Lawrence, daß das geschehen wird, was ich mir eben denke.«
Der junge Mann mit den leicht angegrauten Schläfen schrak aus seinen Träumereien auf und starrte den ›Fliegenpilz‹ einige Augenblicke betroffen an. Dann sagte er nur das eine Wort »Gewonnen«, wandte sich blitzschnell zu Clarisse Avery, schlang den Arm um sie, zog ihr mit einem raschen Griff die große schwarze Brille von dem feinen Näschen, warf das Unding ins Wasser und drückte dann seine Lippen auf den kleinen üppigen Mund, den er vor sich hatte.
Das unschöne Mädchen stieß keinen Schrei aus und sträubte sich auch nicht, sondern zog es vor, für einige Zeit das Bewußtsein zu verlieren. Erst als Gordon Lawrence in seiner glückseligen Befangenheit meinte, daß es für den Anfang genug sei, erwachte sie wieder und sah ihn aus empört blitzenden Augen an. Aber da sie nichts sagte, fand er den Mut, seine Unverschämtheit auf die Spitze zu treiben.
»Du würdest mich sehr glücklich machen, Clarisse, wenn du endlich auch dieses schauderhafte Mal beseitigen wolltest. Es kleidet dich wirklich nicht.«
Sie sagte noch immer nichts, sondern kramte in ihrer Tasche, zog ein kleines Fläschchen und einen Schwamm hervor, befeuchtete diesen und fuhr rasch damit über Wange und Hals. Dann setzte sie ihre Puderquaste in Tätigkeit und sah Gordon Lawrence mit dem durchdringenden Blick eines Großinquisitors an. »Seit wann weißt du das?«
»Eigentlich bereits seit dem verregneten Abend, an dem wir zusammen nach der Cartershall wanderten«, gestand er.
»So«, meinte sie spitz und unverfroren. »Das war hinterhältig und sieht dir ganz ähnlich. Du kannst mich jetzt nach Hause bringen, denn ich möchte dir gerne unter vier Augen meine Meinung über deine Komödie und dein Benehmen sagen.«
Mr. Jacob Fish stand mit offenem Mund und weit ausgestreckter offener Hand, aber die letztere schloß sich sofort automatisch, als Gordon Lawrence sie mit einer Zehnpfundnote berührte.
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.