
RGL e-Book Cover©
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover©
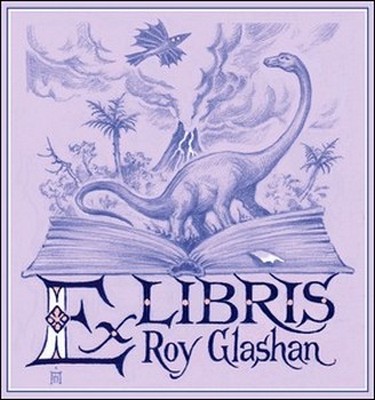
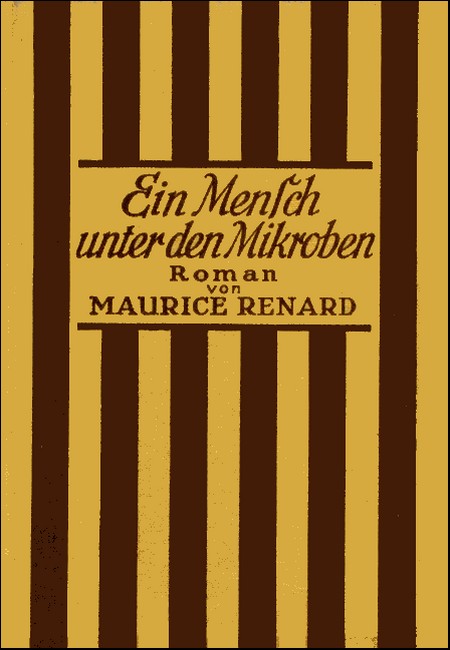
"Ein Mensch unter den Mikroben,"
Neue Berliner Verlagsgesellschaft, 1928
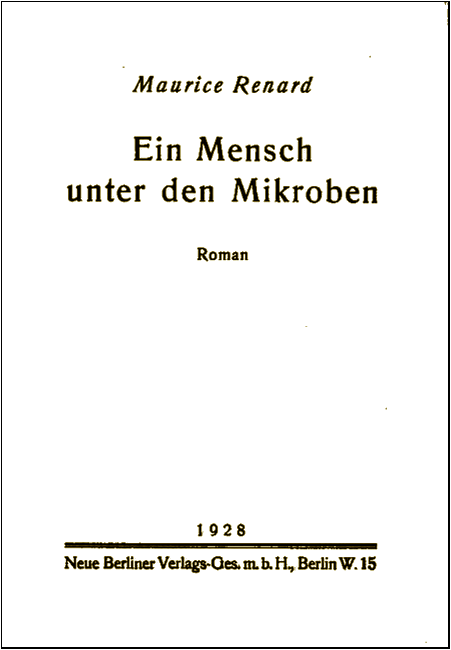
"Ein Mensch unter den Mikroben,"
Neue Berliner Verlagsgesellschaft, 1928
Ein Mensch unter den Mikroben ist ein faszinierender Science-Fiction-Roman, der die Geschichte eines Wissenschaftlers erzählt, der sich auf eine unglaubliche Reise in die Welt der Mikroben begibt. Der Protagonist, Dr. Jean, entwickelt eine Methode, um sich selbst auf mikroskopische Größe zu schrumpfen und so das Leben der Mikroben aus nächster Nähe zu erforschen.
Während seiner Reise entdeckt Dr. Jean eine völlig neue Welt, die von erstaunlichen Kreaturen und komplexen Ökosystemen bevölkert ist. Er begegnet intelligenten Mikroben, die in einer hochentwickelten Gesellschaft leben, und lernt ihre Kultur und Technologie kennen. Doch seine Anwesenheit bleibt nicht unbemerkt, und bald gerät er in Konflikte, die seine Rückkehr in die menschliche Welt gefährden.
Der Roman thematisiert die Grenzen der menschlichen Wahrnehmung und die Möglichkeiten der Wissenschaft, das Unbekannte zu erforschen. Maurice Renard schafft es, eine spannende und zugleich nachdenkliche Geschichte zu erzählen, die den Leser in eine fremde und faszinierende Welt entführt.
C'est avec des comtes qu'on rend partout les hommes attentifs à la véritée.
Bernardin de Saint-Pierre.
Messer Lodovico, dove mai avete pigliato tante coglionere?
Kardinal Hippolyt d'Este an Ariosto.
Der Saal ist in das blau-silberne Licht einer Vollmond-Beleuchtung getaucht. Fauteuils von unvergleichlicher Üppigkeit nehmen einen mit liebevoller Fürsorge auf. Alles steckt in Festkleidung. Im Einklang damit stehen auch die Preise der Plätze, die nach dem Smoking schreien. Mädchen von bestrickender Schönheit nehmen sich unserer mit abwesendem Blicke an: die Logenschließerinnen.
Drei Schläge ertönen, die üblichen Zeichen, und dennoch fühlt man sich überrascht und gehoben. Drei Schläge, von denen man faktisch nicht weiß, woher sie kommen. Glockenzeichen wie Aveläuten. Daran denkt aber zum Kuckuck niemand. Das nach Bayreuther Vorbild unsichtbare Orchester fällt übrigens plötzlich mit einem Tusch von Dissonanzen ein, deren bunte Zusammensetzung einen sprachlos macht. Und gleichzeitig — Bim — verblaßt das Licht um eine Schattierung.
Ein zweites Zeichen — Bam — und es herrscht Halbdunkel.
Finsternis? Nein. Die Leinwand, ein viereckiger Mond, ein leeres leuchtendes Parallelogramm.
Doch jetzt füllt es sich und wird bewohnt.
Der Herr Prologus bewegt sich darin.
(Und das Orchester stürzt sich fessellos in ein heiteres, phantastisches Tonstück, kräftig unterstützt vom neckischen Fagott und von den Klapphorn- und Saxophonbläsern.)
Der Herr Prologus ist eine altehrwürdige Persönlichkeit, sowohl des Dramas als der Posse. Eine allbekannte Gestalt. Seit es Schauspieler gibt, trägt er die Toga, wallende Gewänder und die verschiedensten Masken. Heute legte er den Gehrock an, mimt einen Sonderling von altem Gelehrten und nennt sich »Dr. Prologus«.
Er arbeitet in einem sechseckigen Zimmer, an dessen Wänden von unten bis oben nichts als Bücher, Bücher und wieder Bücher zu sehen sind.
Auf Griffweite stehen rechts und links neben ihm zwei drehbare Bibliothekständer, und ein dritter befindet sich hinter ihm. Diesen kann er erreichen, indem er seinen Mahagonisessel um einen Mittelzapfen sich drehen läßt.
Auch der Tisch ist sechseckig und drehbar.
Bedeckt mit alten Schmökern, Zettelkatalogschachteln und bunt durcheinanderliegenden Notizen, dreht sich der Tisch, wie Herr von Lamartine gesagt hätte, »unter dem Impulse des Gelehrten ganz unwillkürlich« und präsentiert ihm so auf das bequemste den Schmöker, den Zettel oder die Notiz, die er einzusehen wünscht. (Man kannte derartige Einrichtungen bereits im Mittelalter.)
Dr. Prologus' Antlitz strahlt vor Freude, und diese Freude ist sicherlich wohlbegründet, denn er sieht ungeheuer klug aus, wahrlich, ungeheuer klug!
Seine Freude ist denn auch restlos gerechtfertigt.
Seit zwanzig Jahren arbeitet unser Mann rastlos an einem Werke, das auf ewige Zeiten dem Verfasser, seinem Vaterlande und der ganzen Menschheit zum Ruhme gereichen wird.
Titel: »Physiologie der Sinne«.
Nun aber bitte ich, zur Kenntnis zu nehmen, daß Dr. Prologus gerade bei der letzten Seite seiner Abhandlung angelangt ist. Welches Datum?! Welche Stunde?!
Einen Moment lang sieht man ihn in der Vollarbeit seines Genies. Die Buchdrehständer wirbeln wie Kreisel um ihre Mittelachse herum, der Doktor selbst beginnt, hingerissen von seiner Begeisterung, auf seinem Mahagoniesessel zu kreisen, ohne im Studium des Lexikons, das er ergriffen, innezuhalten. Wird er zum Stillstande kommen?
Während eine »Großaufnahme« seine Theaterglatze und sein Komödiantenauge, dem er einen tiefwissenschaftlichen Ausdruck zu verleihen trachtet, in das grellste Licht rückt, flucht er innerlich über diese verdammten Merkurlampen, die wie nichts anderes die Sehkraft zu verderben imstande sind.
Dann erblickt man eine große Hand, die mit einem Riesengriffel nachstehenden, sozusagen unsterblichen Satz hinschreibt:
»Nach dem heutigen Stande der physiologischen Wissenschaft und, wohlverstanden, unter Berücksichtigung der Diathesen und Idiosynkrasien, glauben wir keinerlei andere Schlußfolgerungen ziehen zu können.«
Und darunter, groß geschrieben, das magische Wort, das zugleich »Sieg« und »So!« bedeutet:
Jetzt muß man sich betrachten, wie Dr. Prologus zufrieden ist! Er erhebt sich. Dankerfüllt blickt er zu Gott in die Luft empor, und damit das Publikum auch alles richtig kapiert, nimmt er sein Manuskript auf, betrachtet den Titel »Physiologie der Sinne«, und dann nimmt er aus einer Schublade eine Notiz vom Jahre 1907, welche das Datum 30. Juli trägt und lautet:
Heute angefangen mit meiner »Physiologie der Sinne«.
Dann richtet er den von seliger Wehmut erfüllten Blick nach einem imaginären, irgendwo hängenden Kalender:
»28. Oktober 1927.«
Mehr als zwanzig Jahre!... Welch eine Stunde!... Welch eine Minute!...
Und während das Gesicht des Dr. Prologus den unaussprechlichen Stumpfsinn des Zurückblickens in die Vergangenheit widerspiegelt, sehen wir die nebelhaften Schemen seiner Arbeit der Reihe nach vor unseren Augen auftauchen.
Es zeigt sich ein schönes Frauenantlitz, ernst und geheimnisvoll, einen Finger an den Lippen. Es stellt die Menschheit dar. Von diesem Gesicht treten zuerst die Augen klar hervor und verschwimmen dann wieder. Jetzt das Ohr... die Nase, der sich eine Rose nähert... nun der Mund... und der Finger: Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack, Gefühl...: »Physiologie der Sinne«.
An Stelle des Antlitzes erscheint jetzt der Dr. Prologus der Erinnerung. Er nimmt eine Autopsie vor, seziert eine Zunge, studiert die Augen eines Nachtvogels, beugt sich über einen Ameisenhaufen, betrachtet durch ein Vergrößerungsglas eine Schnecke, folgt querfeldein einem Hunde, der mit hohem Windfange sucht, gibt sich mit der Zucht und Dressur von Brieftauben ab...: »Physiologie der Sinne«.
Die ganze Vision verschwindet. Mit männlicher Geste hat der Gelehrte sie verscheucht. Er nimmt wieder sein Manuskript zur Hand, blättert darin... zum Teufel: ein mit sieben Siegeln verschlossenes Buch... Radierungen, Korrekturen, Darübergeschriebenes machen daraus etwas völlig Unleserliches — ausgenommen für den Verfasser.
»Vorwärts!« muntert er sich auf. »Noch ist es nicht fertig. Dieses Kryptogam muß noch maschinengeschrieben werden!«
Und höchst gemächlich nimmt er einer wundervollen Schreibmaschine die Hülle ab.
Das sieht eigentlich nach gar nichts aus, aber das Orchester muß darüber mehr wissen, denn sofort exekutiert es eine wilde, russische, außergewöhnlich leidenschaftliche, sozusagen alarmierende Weise. Wer in die Geheimnisse der russischen Musik eingeweiht ist, gewinnt sofort den Eindruck, daß die Schreibmaschine — Achtung! Bitte aufpassen! — eine eigene Rolle spielen wird, ganz sicher keine gewöhnliche! Die Pikkoloflöte pfeift wie eine Mutter-Kobra, der die Manguste Rickiticki-Tavi ihre quabbligen Eier raubte. Ein Duo dumpf klingender Signalhörner stößt dazu mißtönige Rufe aus. Violinen und Bratschen, Baß und Kontrabaß fallen mit ein. Um in sarkastischer Weise das Geräusch der Schreibmaschine nachzuäffen, vollführen die Geigenspieler erstickte Pizzikati, während andere mit dem Holzteile ihrer Streichbögen auf den Resonnanzboden der Instrumente loshämmern. Ach, Teuerste, ich sage Ihnen, wie das packend, illusionistisch, ja geradezu Hoffmannsthalisch wirkt, können Sie sich kaum vorstellen. Es ist das »Kommende«, so wie ehemals Saint-Saëns... doch Schwamm darüber! Als Kind haben Sie sich doch oft damit unterhalten, Dinge zu suchen, die Ihre kleinen Gefährten versteckten? Erinnern Sie sich noch an das Konzert der jugendlichen Stimmen, das bald ein Gemurmel war, bald zu lautem Gekreisch ausartete. »Kalt... kalt!... sehr kalt! Warm... heiß... glühend!« und dann plötzlich: »du brennst!... du brennst!... du brennst!«
Aber der Dr. Prologus merkt nicht, daß er »brennt«, denn er achtet nicht auf die prophetischen Weisen des Orchesters, schließlich und endlich ist er ja nur eine Photographie, ein konventioneller Mime.
Er beschränkt sich darauf, von oben herab die Schreibmaschine zu betrachten, ohne sich vor die Tastatur zu setzen. Langweile malt sich auf seinen Zügen.
»Hm!« grübelt er vor sich hin. »Wie? Jetzt, wo ich ein epochales Werk vollendet habe, soll ich mich gleich wieder einspannen? Hab' ich mir nicht etwas Erholung verdient? Acht Tage Ferien?... Und ob! Wir werden die ›Physiologie der Sinne‹ so in acht Tagen mal abklappern. Bis dahin wollen wir ein wenig leben, zum Satan!«
Er überdeckt wieder die Schreibmaschine, der arme Sterbliche, der nicht in die Zukunft zu schauen vermag und ist taub für die Mahnschreie des Orchesters, das hier den antiken Chor darstellt und ihm nun, leiser werdend, zuruft: »Kalt... kalt... sehr kalt!«
Doch im Schatten dort erscheint — oh ausdrucksvolles Wunder! — die Schreibmaschine unter ihrer Hülle in purpurnem Flammenscheine! Sofort lassen wieder die Musikanten eine vielsagende Kakophonie erschallen.
Ehe Dr. Prologus sein Manuskript in die Schublade stopft, hält er einen Moment zögernd inne. Er schielt nach der Schreibmaschine hinüber, die sich beeilt, zu verlöschen, und er sieht nur ihre harmlose, nüchterne Hülle. Mit einem Rundblick überfliegt er noch sein Arbeitszimmer, dessen weitgeöffnetes Fenster die Aussicht auf einen höchst angenehmen Boulevard gewährt und durch welches das Orchester die verführerischen Klänge der Melodien des Lebens hereinfluten läßt.
»Es bleibt dabei! In acht Tagen! Gehen wir!« Die Schublade schließt sich über der »Physiologie der Sinne« und die Türe hinter dem Dr. Prologus.
Da ist er wieder! Tadellos angezogen, die rote Kommandeur-Rosette im Knopfloch. Obwohl er einen Gelehrten darstellt und Prologus ist und bleibt, macht er keinen lächerlichen Eindruck, denn er bewahrt die etwas unverschämte Sicherheit und das Selbstbewußtsein, das stets die Prologusse, die Lustigmacher der Bühne und Sprecher zum Publikum charakterisiert.
Als Feinschmecker fröhlichen Festes weilt er in Paris.
Jeder Urlaub verfliegt blitzschnell. Man wird sich dessen bewußt, sieht man voraus, was folgt. Kaum erscheint ein Bild, verschluckt es ein Nebel und ein anderes taucht auf der Leinwand auf, so daß oft zwei sich übereinanderschieben, was zumeist recht lästig ist. So erblickt man immer zwei Dr. Prologusse, von denen der eine deutliche Gestalt annimmt, während der andere sich verflüchtigt. Aber das Sonderbarste dabei ist, daß sich all dies im Rahmen eines großen Auges, eines Riesenmundes oder eines Kolossalohres einem nähert oder den Blicken entschwindet. Das sichtbare Leitmotiv. Halten wir uns nicht auf. Ihr habt ja verstanden, wißt sogar, liebe Leser, daß ständig das Klangleitmotiv der Schreibmaschine sich hartnäckig durch die Musik hindurchringt.
Dr. Prologus durchmißt die Herbst-Gemälde-Ausstellung. Saal an Saal reiht sich bis ins Unendliche aneinander. Tausende Bilder defilieren in Massen vorbei, als sähe man sie durch das Fenster eines Expreßzuges vorüberfliegen. Das gleiche gilt, mutatis mutandis, von den Skulpturen. Prologus trifft Freunde. Lebhafte höfliche Zwiegespräche über Kunst: Schulen, Farben, Preise, Zeichnung, Personalität, Gefühl für Natur usw.
Pomphaftes Diner bei der ewig schönen Madame Dupont, genannt »du Pont des Arts«, weil diese Brücke nach dem Institute der schönsten Künste führt. Saftige Geschichtchen, Klatsch, Schick, Geist, nackte Brüste, zuweilen geradezu Ärgernis erregend. Einzelne Literatur-, Kunst- oder Wissenschaftshanswurste. Wahrnehmung unter dem Tische: die sich miteinander unterhaltenden Füße der Damen und Herren. Dr. Prologus, gewohnt, sich auf den Untergrund des Planeten und die Kulissen der Gesellschaft einzustellen, lächelt philosophisch.
Konzerte. Dr. Prologus hat seine Liebhabereien. Er gustiert namentlich die etwas burlesken Tonwerke und symphonische Darstellungen: »Totentanz« — »Zauberlehrling« — »Gänsekönigin«... erfüllen ihn mit Behagen. Er bewundert den Kapellmeister, wie geistreich er mit seinen Armen herumfuchtelt und gerät in Ekstase, als er »Petruschka« hört, zum Entzücken von Tänzerinnen und Tänzern gegeben, die den Bolschewiken entkamen.
Trauliche Spaziergänge im »Bois«. Die Herbstzeit, die alte Blondine, atmet den Duft von Nüssen aus. Sehr viele schöne Leute und Dummköpfe jeder Gattung. Natur. Saison. »Ganz Paris«, Liebeleien, Weltluft.
Dann: Empfänge, Tees, künstlerische und literarische Salons. Bälle, selbst »Dancings« mit Negern. Jazz. Wirbel. Anstrengendes Hüpfen. Tanzepilepsie. Zahllose Gecken. Wenn man schon Urlaub hat, muß man überall ein wenig hingehen.
Doch was liest Dr. Prologus, wenn er den nächtlichen Schlaf erwartet? Am meisten entzückten ihn stets »Micromégas«, »Die Insel der Freuden«, »Gulliver«.
Die folgenden Tage: Theater, Kinos, Zirkusse, Tingeltangels... und unaufhörlich galoppiert, zusammengepfercht auf der Leinwand, die ganze Heerschar des Zeitalters, Männer, Zuhälter und Frauen, vorüber.
Ein jähes »Halt!« Der wahnwitzige Lauf stoppt. Gebieterisch, keine Widerrede zulassend, zeigt der Kalender in Riesenschrift den
Die acht Tage Ferien sind um.
Mit triumphaler Furie ertönt wie eine Fanfare, näselnd und höhnisch, das Leitmotiv der Schreibmaschine. Diabolische Lachsalven lösen sich aus den Instrumenten und begrüßen den Dr. Prologus, als er wieder sein Arbeitszimmer betritt.
Um Himmelswillen, was wird ihm zustoßen, daß ein derart infernalischer Musikhexensabbath losbricht, bei dem die verruchteste aller Trommeln einen disharmonischen Wirbel schlägt und die Klarinetten dazwischenkreischen wie eine Herde närrisch gewordener Enten?
Seelenruhig durchschreitet Dr. Prologus den friedlichen Raum und nimmt jetzt Platz, um die »Physiologie der Sinne« abzutypen.
Wie ein zärtliches Vorspiel streicht er mit den Fingern über die Maschine hin.
Das Manuskript neigt sich von der schiefen Fläche eines Pultes ihm zu.
Man liest die Aufschrift:
»Es ist sehr bedauerlich, daß Cournot in seiner Abhandlung ›Von der Ordnung und Zusammengehörigkeit der grundlegenden Ideen in der Wissenschaft und Philosophie‹, nicht minder übrigens Bonier in seiner ›Audition‹ und Laures in seinen ›Synesthesien‹, vollkommen mit Schweigen über das hinwegging, was doch schon Descartes und Condillas vorausahnten. Ich will sagen... etc....«
Auf einem Tischchen erhebt sich der Stoß akkurat zugeschnittener weißer Blätter und daneben liegen die blauen Karbonpapiere, die dem Dr. Prologus gestatten, gleichzeitig zwei Exemplare seines Werkes abzutippen.
Sorgsam legt er ein Karbonpapier zwischen zwei weiße Blätter. Krack — die drei Blatt sind von der Walze ergriffen und — tack — tack — tack... geht's los, und das Farbband gleitet, die Typen schlagen, das jungfräuliche Weiß der Bogen bedeckt sich mit den Titelworten:
Dr. Prologus lächelt behaglich. Er träumt von den Dingen und Wesen, die sich im polierten Schwarz der Maschine widerspiegeln: Diners, Gemälde, Konzerte, Tanz, Swift im Smoking, Voltaire im Besuchsanzuge... das alles mischt sich in den Ideengang seiner Physiologie, in die Erinnerung an seine Vorarbeiten und Beobachtungen. In einem astronomischen Himmel, wo bevölkerte Welten kreisen, exekutieren Paare ihren »Black-bottom«. Mit den Netzaugen eines Insektes sieht Prologus wieder die Herbstausstellung.
»Zum Kuckuck! Aufpassen!« murmelt er, lächelt abermals und fährt in seiner Tätigkeit fort.
»Es ist sehr bedauerlich, daß Cournot...«
Bachanal im Orchester.
Endlich gelangt der Physiologist, zerstreut und ohne irgendeinen Schreibschnelligkeitsrekord aufzustellen, an das Ende der ersten Seite.
Das Resultat ist nicht allzuschlecht. Dies Blatt sieht gut aus. Wie schaut es mit dem Karbondurchschlag aus? Ist er sauber ausgefallen?
Verblüffung! Was ist das?!
Völlig verdutzt liest er:
Wunder über Wunder! Das Karbonpapier hat nicht die »Physiologie der Sinne« kopiert, sondern ganz etwas anderes. Dr. Prologus hat unter einem den Anfang seiner streng wissenschaftlichen Abhandlung und darunter — was? — abgetippt? Den Anfang einer Art Märchen...
Ist's ein Traum? Ist er verhext?...
Dr. Prologus fängt zu lachen an, die Violinen spielen dazu in Akkorden.
»Überraschendes Phänomen von Urzeugung«, murmelt er. »So wie Macduff — wenigstens nach Shakespeare — nicht wie alle anderen Menschen von einem Weibe geboren ward, so wird auch diese Geschichte nicht wie sonst alle Geschichten einem menschlichen Hirne entspringen.«
Und mit Feuereifer nimmt er wieder seine fabelhafte doppelte Tätigkeit auf und lacht, lacht, lacht. Seine Finger rivalisieren an Fixigkeit miteinander. Er ist der reinste Klavierkünstler, ein Kollege Paderewskis. Wie er so arbeitet, hallt es, als ob ein Platzregen auf das Dach niedertrommle. Weiter, weiter, weiter! Die Blätter türmen sich zum Stoße auf, auf der einen Seite die »Physiologie«, auf der andern »Ein Mensch unter den Mikroben«.
Verehrter Herr Prologus, jetzt können Sie abtreten. Über das Wissenswerte und Notwendige haben Sie uns unterrichtet. Ziehen Sie Ihren doktoralen Gehrock aus, schminken Sie sich ab und spielen Sie unter anderer Maske Ihre Mimenrolle weiter. Wir wissen ja, wer der »Mensch unter den Mikroben« ist.
Dem Leser steht es völlig frei, anzunehmen, daß sich das Kino, das unentwegte, mit ihm einen Witz erlauben will, oder daß jenes Büchlein, das die unwiderstehlichen Logenschließerinnen jetzt im Saale zum Verkaufe herumreichen, nur ein Märchen enthält. Er kann sich aber auch brummend an die Pantomime halten, wenn er die Zeit der Märchen für vorüber hält und glaubt, daß niemand mehr an den Erzeugnissen argloser Phantasie Gefallen finden kann.
»Saint-Jean de Nèves«, Sitz einer Unterpräfektur, ein kleines Nest am Fuße des Hochgebirges, glich einer vor Urzeiten niedergegangenen Erdlawine, auf der nach und nach die Kultur erblühte.
Den Mittelpunkt der Ortschaft bildete ein freier Platz mit einem Brunnen von schlichter Monumentalität, den die allegorische Figur der Republik, ein Weib mit riesigen Brüsten, krönte.
Dort wohnte Pons, der junge Dr. Pons, zwischen einem Perückenmacher und einem Notar, in einem echt savoyardischen Häuschen, dessen Front völlig unter Glyzinien verschwand, und dessen großes Dach alte Ziegel deckten. Ein Schriftsteller von gestern oder vorgestern würde zweifelsohne seine Geschichte damit beginnen, die große Enttäuschung Dr. Pons' zu schildern, als er bei seinem Schulaustritt von einem seiner Lehrer erfuhr, sein gesundheitlicher Zustand würde es nicht erlauben, daß er in Paris oder in einer anderen Großstadt die ärztliche Kunst ausübe, beziehungsweise daß er sich dort, wie er es wünschte, dem Studium ruhmvoller klinischer Forschungen hingebe, was zur Folge hatte, daß Dr. Pons nach »Saint-Jean-de Nèves, seinem Geburtsort, zurückkehrte, wo nur zwei Kollegen waren, die ihn hochschätzten, weil er sich sehr wenig aus Patientenzulauf machte.
Ein etwas modernerer Schriftsteller, wenn auch kein viel modernerer, würde seine Erzählung mit der Ankunft Fléchambeaus, eines Freundes von Dr. Pons, bei diesem beginnen; er würde berichten, daß Fléchambeau, Amtsnotar beim Pariser Obersten Gerichtshofe, ursprünglich nur ein paar Wochen in »Saint-Jean-de Nèves« zur Erholung und zum Vergnügen bleiben wollte, nach drei Monaten aber noch immer dort war, und zwar dank des unwiderstehlichen Eindrucks, den Fräulein Olga Monempoix, älteste Tochter des Herrn Emil Monempoix, Präsidenten des Zivilgerichts, und dessen Gattin, geborene Sanson-Darras, auf ihn gemacht hatte.
Wir dagegen gehen ohne lange Umschweife in medias res. —
»Viel Glück, Alter!« sagte Pons.
Sie standen in der Halle. Durch die offene Tür sah man auf den Platz hinaus, auf die vollbusige Brunnen-Marianne und gerade gegenüber auf das Haus des Herrn Präsidenten Monempoix.
Fléchambeau schüttelte seinem Freunde die Hand.
Lang wie ein Besenstiel — maß er doch von der Sohle bis zum Scheitel einen Meter sechsundneunzig Zentimeter —, zeichnete sich Fléchambeau noch durch brennrotes Haar aus — »Haar à l'a Crécy«, wie Pons sich im Spaße auszudrücken pflegte. Er war so hoch gewachsen, daß er zwanzig Sekunden brauchte, um das Kreuzzeichen zu machen, und wenn er den Hut auf sein flammrotes Haupt setzte, glich er einer brennenden Kerze, die sich selbst auslöscht.
Momentan trug er einen wundervollen blitzenden Zylinder. Sein tadellos geschnittenes Jackett von schwarzer Farbe stach vorteilhaft von dem rosenholzfarbenen Beinkleid ab. Lackschuhe Nr. 47 bekleideten die Füße des Riesen, und das Leder seiner Handschuhe (Nr. 9¾), die er über die dicken Finger gezogen hatte, glänzte wie frische Butter. Drei Nelken, die Fléchambeau sich ins Knopfloch gesteckt, glichen im proportionalen Verhältnisse einer einzigen.
Das Monokel ins Auge klemmend und sich den gestutzten Schnurrbart — ein rotes Zahnbürstchen — wischend, schnitt der Goliath ein Gesicht wie ein Schwimmer, der gerade in zu kaltes Wasser hinabtaucht, und meinte:
»Ich zieh' mich in meine Haut zurück, mein Alter!«
Nichtsdestoweniger verließ er das Haus und dirigierte sich langsam nach dem Heim des Herrn Präsidenten Monempoix, so langsam, daß ihn Dr. Pons erst drüben anläuten sah, als er selber nach seinem Laboratorium, das im zweiten Stock lag, zurückgekehrt war. Dabei hatte sich Pons Zeit gelassen, als er, tief in Gedanken versunken, die Treppe emporgestiegen war.
Breites Fenster. Ein Meer von Licht. Laboratorium neuesten Modells. Denn Dr. Pons verzichtete durchaus nicht darauf, daß man von ihm rede. Er hatte nach einem Studium gesucht, das seine Zurückgezogenheit nicht abträglich zu beeinflussen imstande sei und ihn in Saint-Jean-de Nèves beschäftigen könne, und das Studium der Parasitologie gewählt, nämlich, um mich Damen und Kindern verständlicher zu machen, die Wissenschaft der Parasiten.
Aber die Parasitologie befriedigte ihn nur mäßig und war für seinen Eifer ein recht unproduktives Betätigungsfeld.
Und doch war das Laboratorium geradezu ein Schmuckkästchen. Weiße Schränke, blitzende Vitrinen, angefüllt mit blauen, roten, gelben, grünen und noch andersfarbigen Phiolen und Gläsern, drei Mikroskope, die wie Strandbatterien scharf ausgerichtet nebeneinander standen, und drei vernickelte Tische, auf denen ein ganzes Arsenal von Pinzetten, Coupellen, Fläschchen und optischen Kästchen standen, ebenfalls in Reih' und Glied, gleich Soldaten in Paradestellung.
Noch immer in Träumereien versunken, streichelte Dr. Pons mechanisch mit der Hand die Glasglocken, mit denen die Mikroskope bedeckt waren. Als dies die Hauskatze »Maria-Stuart«, die ihm nachgeschlichen war, sah, rieb sie ihre Nase an seinen Beinen, um auch etwas von diesen Zärtlichkeiten abzubekommen.
Er nahm sie in die Arme.
Dreifarbig und die schmachtenden Augen umrändert, schielte sie ein wenig, weshalb sie ihr Herr »Maria-Stuart« getauft hatte, zum Andenken an die unglückliche Fürstin, die, wie allbekannt ist, auch geschielt hat.
Fast wäre einmal aus dem guten Tier ein Kaninchenfrikassee geworden. Ein gütiges Geschick hatte ihm diese posthume Verwandlung erspart. Es hatte sich zu Pons geflüchtet.
»Maria-Stuart« verdiente ehrlich ihren Ruheposten. Wie ein ostasiatisches Porzellanding, aber aus Pelz, schmückte sie die Gesimse der Bücherregale und nahm dabei Stellungen ein, denen wir einen besonderen Ausdruck unterschieben. Sie zeigte sich, wie es sich gebührt, myophag und kynophob, das heißt, sie fraß gern Ratten und haßte das Hundegeschlecht. Sich sauber haltend wie ein Grisettchen, strich sie sich unaufhörlich ihr Muffpelzchen, an welchem man sich die Hände wärmt, schnurrte — das »inwendige Lachen« der Katzen —, rollte sich mit graziösem Wohlbehagen von der einen auf die andre Seite und stieß dabei mit umflortem Blicke rauhe Schreie aus, tanzte auf den Hinterbeinen Mücken nach und ging auf heimliche Abenteuer aus, ohne das Haus davon zu benachrichtigen, so daß man sich ängstigte, Sorge hatte und sie suchte, und erschien dann wieder, als sei gar nichts los gewesen, plötzlich und wie durch Hexerei, zusammengerollt beim Ofen, oder auf einer Tischdecke hockend, mit eingezogenen Pfoten und Schweif, das Auge halb geschlossen und schläfrig. Dann wiederum bevölkerte sie zur Belustigung des Hauses das Heim mit einer Schar junger Kätzchen, die sich höchst komisch gebärdeten und »Entrées lustiger Clowns« zum Besten gaben. Das eine springt mit allen vier Pfoten zugleich in die Luft, das andre kommt schief daher, gesträubt das Buckelhaar und die Rute senkrecht aufgerichtet, widerborstig wie ein »Samurai« auf japanischen Kakemonos. Zur Belustigung aller stürmt ein drittes jäh vorwärts, daß es sich schier den Kopf an der Mauer einrennt, ein viertes verfolgt mit dem Blicke seiner wasserblauen Augen irgend etwas Unsichtbares, das im All herumfliegt. Zwei umstricken sich auf der Erde, bohren sich eines in den Bauch des andern ein und strampeln mit den Hinterpfoten, daß es zum Brüllen ist. —
»Komm,« sagte Pons, »du, die mir leben hilft! Komm, Muni, komm!« und er schickte sich an, sie zu necken, indem er der Katze mit Altweiberstimme die bekannte Phrase sagte: »Was für ein komisches Kaninchen? Man könnte es für eine Katze halten!« Da bemerkte er erst, daß »Maria-Stuart« sich in den Friseurladen gegenüber begeben hatte. Dieser Nachbar war nämlich mit einer Horde Rangen behaftet, für die — es ist ganz unerklärlich, wieso — die Katze geradezu schwärmte.
Oft kehrte sie von dort mit einer bunten Masche um den Hals oder irgendein Flitterwerk hinter sich herschleifend zurück. Die Fratzen staffierten sie aus, ohne daß sie dagegen Widerspruch erhob. Heute hatten sie ihr den Kopf einpomadisiert, um ihr einen Scheitel zu ziehen. Sie roch auf hundert Schritte nach Heliotrop.
Als Pons dies wahrnahm und roch, expedierte er sie unter Spott und Hohn zur Türe hinaus und versprach ihr zum xten Male, sie nach ihrem Hinscheiden ausstopfen zu lassen.
Er war eine Type für sich, dieser Pons. Gutes, numismatisches Profil; auch von vorn war sein Gesicht schön, aber in ganz andrer Art. Wenn er sich umdrehte, war man immer erstaunt, weil man sich ein anderes Gesicht erwartet hatte. Nur die Augen blieben sich immer gleich — diese dunklen Augen, aus denen ein finsteres Feuer hervorloderte, und die so tief in den Höhlen lagen, daß sie mitten im Schädel zu stecken schienen, der sich durch eine derartige Größe auszeichnete, daß er auch die allerweitesten Hüte ausfüllte.
Pons kehrte zu dem von der Sonne überfluteten Fenster zurück. Zuvor aber hatte er mit raschem Blicke festgestellt, daß die Wanduhr ihre Pflicht und Schuldigkeit tat, mit dem Daumen die beiden Zeiger des Barometers übereinander ausgerichtet, den Thermometer und Hygrometer konsultiert und den Kalender inspiziert. Bei ihm gab es keine Nachlässigkeit. Alles war stets auf dem Posten, auf die Stunde, auf den Tag, bei jeder Witterung.
Die Glyzinien umrahmten mit ihren lila Blütentrauben den »Platz der Republik«. Liebesdürstend wie junge Witwen, die noch kaum in Trauer sind, erschauerten die Blumen nervös und lebenshungrig bei dem Flügelschlage der Vögelchen, die so klein waren, daß man sie im Fluge kaum sah.
Pons betrachtete das Haus des Präsidenten Monempoix, das Fenster Olgas, der Tochter, das auf Kußweite vor ihm lag, und die Eingangstür des Gebäudes, die sich eben hinter dem riesigen Fléchambeau geschlossen hatte; alles gedeckt von der Bronzefigur, welche die französische Republik darstellte.
»Glücklicher, glücklicher Fléchambeau!« murmelte Pons, der gern mit sich selbst sprach. »Jetzt schlug's in den Blitzableiter ein! Das Ehepaar Monempoix steht im Begriffe, seine Werbung huldvollst entgegenzunehmen und ihm die Hand des Erbtöchterleins zu geben. Und ich... ich hocke hier mitten unter meinen Mikroben und Wanzen! Und ich... der ich darauf stolz bin, Physiognomiker zu sein... ich... empfinde Ekel über mein Gesicht!... Das ist das Höchste! Ach, wie schön wäre es jetzt, eine Luxusreise antreten zu können, im ›Sleeping‹, mit einer entzückenden kleinen Frau, die mich vergöttern würde, weil ich ein Genie wäre und sie es wüßte! Oder nach einer epochemachenden Erfindung, den Ruhm im Sack, nach Paris abzufahren, nach der Stadt der tausend Kraftstücke, meinem Lakai zu sagen: ›Rasch! Man fliegt aus! Tinte in meine Füllfeder, Benzin ins Feuerzeug, Parfüm ins Schnupftuch! Paris, hörst du, Paris erwartet mich! Und dorthin zu drahten: Obelisk mit Bimstein abputzen! Invalidendom mit Brillantine abreiben! Eiffelturm polieren! Ich komme!...‹«
Das Wort blieb ihm in der Kehle stecken, denn er sah Fléchambeau den Platz mit Riesenschritten überqueren. Wütendes Anläuten... man stürmte die Treppe herauf... die Türe des Laboratoriums flog auf, als habe sie ein Sowjetkommissär eingerannt... Fléchambeau erscheint, zornbebend schleudert er seinen Zylinder gegen einen Schrank, der aber von dem Hute nichts wissen will und ihn höhnisch zu Boden fallen läßt.
Stumm und verblüfft glotzte Pons ihn an. Fléchambeau kreuzte die Arme, stampfte wie wahnsinnig mit dem Fuße in maßloser Verzweiflung auf (allegro furioso) und stieß nur das eine Wort zwischen den Zähnen hervor:
»Abgefahren!«
Es sah aus als stünde das Rothaar hoch droben auf der Stirne des Goliaths in Flammen.
»Bitte?« stammelte Pons, der seinen Ohren nicht traute.
»Idiot! Abgefahren bin ich, sage ich dir! Abgewiesen hat man mich, auf feine Art mir die Türe gewiesen! Diese alten Monempoix sind zwei Ölgötzen, zwei Kaffern, zwei —«
»Was für Gründe brachten sie vor?«
»Was für Gründe?... Olga sei noch zu jung. Dabei ist sie seit dem Sonntag schon achtzehn Jahre alt. Das sind doch nichts als faule Ausreden, böser Wille, leerer Vorwand... Aber ich lasse noch nicht locker, sie werden mich nicht so schnell los, diese dreckigen Republikaner!«
»Verzeih, du vergißt, daß auch ich...«
»Du? Ich pfeif' auf dich!«
Beide Fäuste in die Hosentaschen versenkend, daß man den Stoff krachen hörte, begann Fléchambeau wie ein gefangener Bär in seinem Käfige auf und ab zu rennen. Er war ganz blaß und schnaufte. Wie eine Schildwache im Winter stampfte er auf, preßte die Ellenbogen an den Leib und zog den Kopf ein.
Pons hob den Zylinder auf und reichte ihn seinem Besitzer.
»Gib ihm den Rest, bitte. Aus Mitleid... er atmet noch!«
Von harter Ohrfeige getroffen, flog der Hut ins Weite.
»Willst du meinen?« fragte Pons, »Ich werde ihn dir holen.«
Fléchambeau mußte unwillkürlich lächeln.
»Setz' dich, großer Gimpel, und berichte!« sagte der Doktor.
Ein Lederfauteuil nahm den verzweifelten Jüngling in seinen gepolsterten Schoß auf, der sich beim Setzen in der Mitte wie ein Zweimetermaßstab abbog.
»Ach,« seufzte er, »du weißt ja, wie ich zu lieben imstande bin, daher wirst du auch wissen, wie ich zu hassen vermag... und ich liebe und werde trotz allem wiedergeliebt!«
»Die Sache ist tiefgehend,« bemerkte Pons.
»Ja, Olga liebt mich, dessen bin ich sicher. Damals in der Nacht, als wir bei Godbillons tanzten, schwur sie es mir hundertmal im Lichte des Vollmonds. Es war im Gemüsegarten... ganz hinten.
Ich sagte ihr allerhand Liebes ins Ohr und hielt ihre Taille umfangen. Auf die weiße Gartenmauer warfen die Zweige der Obstbäume ihre Schatten, die sich wie Spitzenstickereien ausnahmen, und der Mond, der wohlwollende Schützer aller Liebenden, lächelte auf uns herab. Ich murmelte...«
»Wissen wir,« unterbrach ihn Pons. »Ich kenne sowohl Fräulein Olgas Schönheit als auch ihr Gefühlsleben. Was ihre körperlichen Vorzüge anbelangt, verdient sie den Preis, denn ihre Gestalt ist wundervoll modelliert, schlank und ebenmäßig. Sie hat knospende Brüste, entzückende weiche Linien, ein kleines Näslein, das beim Küssen nicht stört, und ihre Wangen gleichen den reifen Äpfelchen der Normandie im Monate Fructidor. Mit ihrer glatten Haut und dem zartüppigen Fleische ist sie wie eine aufblühende Rose. Sie atmet weniger ein Parfüm aus, als eine duftige Frische. Ihre Finger erinnern an jene der rosafarbenen Eos, an die Morgenröte, die mir aus meiner Studentenzeit wohl bekannt ist. Seitdem die Süße auf Erden niederstieg, gibt es im Olymp nur mehr zwei Grazien. Kurzum, Olga ist ›das Weib‹, und sicherlich ward sie nicht von einem Kusse auf die Stirn erzeugt.«
Begeistert hatte Fléchambeau seinem geriebenen Freunde zugehört. Aber bei den letzten Worten, die ihn irgendwie an das Ehepaar Monempoix gemahnten, hob er abwehrend die Hand.
»Laß die Eltern aus dem Spiele,« sagte er angegraust. »Vor allem die alte Madame!«
»Die Tochter erhebt sich himmelhoch über das Niveau der Mutter!« bemerkte Pons.
»Ich werde Olga schreiben, einen recht herzlichen, aus meinem Innersten kommenden Brief.«
»Mach' erst einen Entwurf!«
»Nein, ich werde ihr doch nicht schreiben. Ich will sie selber sehen.«
»Nur Ruhe und etwas Methode!« meinte der Doktor. »Man kennt sich ja nicht mehr aus.«
»Oder noch besser. Du mußt jetzt in Aktion treten, Pons!«
»Ich? Welcher Hintergedanke leitet dich?«
»Nun. Die ›Jugend‹ Olgas ist Unsinn. Und wenn man mir vorsäuselt: ›Wir wollen sie bis zu ihrem zwanzigsten Lebensjahre im Hause behalten‹, so ist das auch Kaff... Ich glaube nicht daran.«
»Warum?«
»Na, das ist doch klar wie dicke Tinte!«
»Wieso?«
»Ich glaube kein Jota davon, du doch auch nicht und niemand. Das ist die übliche Abschiedsphrase, die dilatorische Antwort. Nein, nein, etwas ganz anderes steckt dahinter, und zwar: Diese Leute sind Republikaner und müssen es aus Avancementsrücksichten sein...«
»Warum so gehässig? Frau Monempoix ist doch die Urenkelin des Konventmitgliedes Sanson-Darras!«
»Gut!... Bürgerpflicht. Das hindert aber nicht, daß ich, Fléchambeau, für ›Gott und König‹ bin. Ich mache daraus kein Geheimnis. Sie wissen es, und daher wollen sie von solch einem Schwiegersohn nichts sehen und hören.«
»Möglich,« meinte Pons. »Und du hältst an deinen Ansichten sehr fest?«
Fléchambeau entrüstete sich.
»Ich werde doch nicht wegen der schönen Augen eines ›Sansculotten‹ und einer ›Trikoteuse‹ die ›Carmagnole‹, das Freiheitslied, singen und die ›Capucine‹ tanzen? Es lebe der König, Herr!«
»Glücklich, wer es so weit brachte wie die königliche Lilie!« erklärte Pons mit geheuchelter Feierlichkeit.
»Dein Spott läßt mich kalt,« entgegnete der andre. »Die republikanische Staatsform ist nichts anderes als eine verkappte Anarchie. Selbst die beste Republik gewährt den Menschen weniger Glück als die schlechteste Monarchie. Und was Gott betrifft, an den du leider nicht glaubst...«
Pons entschuldigte sich artig.
»Wir gehören nicht demselben Klub an, er und ich. Ich kenne ihn nur dem Namen nach, so wie die meisten Menschen. Immerhin hege ich für ihn große Sympathie, aber...«
»Aber... das sind lauter Redensarten,« unterbrach ihn Fléchambeau. »Und ich will das Wesentliche nur herausschälen.«
»Das wäre?«
»Daß du genau wie die Monempoix auf Backbord stehst!«
»Nun, und?«
»Begib dich zu ihnen, Kleiner. Du kennst sie gut. Trachte den wahren Grund herauszubekommen, weshalb sie mich abwiesen, und wenn der Grund zutrifft, den ich vermute...«
»Dann...?«
»Aber Menschenskind, du hast doch so gute Beziehungen zu links orientierten Politikern, um den Abgeordneten X oder den Minister Y bewegen zu können, ein gutes Wort für mich bei den Monempoix einzulegen.«
Pons erhob den Blick himmelwärts, nämlich nach dem Kopfe seines Freundes, der sich ihm genähert hatte und mit überzeugungskräftiger Gewalt an den obersten Westenknöpfen des Doktors herummanipulierte.
»Es genügt dir nicht, daß dir die gebratenen Tauben in den Mund fliegen, du möchtest sie auch noch von den Knochen losgelöst haben!« sagte Pons.
»Du machst dich über mich lustig!« rief Fléchambeau.
»Reg' dich nicht auf, großes Kind. Wahre Liebe muß Scherz erdulden.«
»Du, na ja, mein Junge, du bist mit Züchtigkeit geschlagen, frönst der Klugheit!«
»Der Klugheit, was Leidenschaften anbelangt. Aber auch ich habe meine Passion — die Wissenschaft!«
»Etwas Wissenschaft und viel Ehrgeiz!«
»Ich besitze Selbstvertrauen und den Glauben an mich selbst. Das ist alles.«
»Du gehörst zu jenen Glückspilzen, die, ohne irgend etwas im Leben erreicht zu haben, hundert Jahre alt werden und immer wieder behaupten: In mir steckt etwas!« bemerkte Fléchambeau. »Aber gib nur acht, wenn du einmal im Höllenpfuhl sitzen wirst, ehrgeiziger, ruhmsüchtiger Pons, wird dein Schädel ein Pfeifenkopf sein, aus dem ein gehörnter Teufel in alle Ewigkeit glühenden Tabak schmauchen wird.« Dann fügte er, einlenkend, hinzu: »Sag' mir, Pons, sag' mir, guter Freund, würdest du nicht so lieb sein, dich zu den Monempoix zu begeben?«
Er hielt ihn bei den Schultern, und seine Blicke senkten sich im Gleitfluge flehend auf ihn herab.
»Ich werde nicht hingehen,« erklärte der Doktor entschlossen.
Und er verfügte sich unverzüglich nach dem Hause des Präsidenten.
Der Wanduhr nach währte Pons' Abwesenheit fünfunddreißig Minuten; will man aber Fléchambeau Glauben schenken, so dauerte sie die bekannten »zwei Stunden«, von denen immer die übelgelaunten, ungeduldigen Menschen reden, die es mit der Genauigkeit nehmen, wie es ihnen gerade paßt.
Fléchambeau begab sich in sein Zimmer hinab, setzte sich hin, stand wieder auf, nahm wieder Platz, lief hin und her, klemmte sich hundertmal das Monokel ins Auge und trat vom Fenster, von dem er nach der Rückkehr seines Gesandten ausspähte, zum Spiegel über dem Kamin, um als letztes verzweifeltes Mittel irgendein sympathisches Gesicht zu sehn.
Er lächelte höflich seinem Spiegelbilde zu und zeigte dabei sein blendend weißes Gebiß, in dem nur die zwei oberen Eckzähne aus Gold waren. Aber dies Lächeln war nur äußerlich und durchdrang nicht sein von Unruhe gesättigtes Inneres. Es war nur eine Maske. Fléchambeau setzte wie eine falsche Nase einen falschen Mund auf.
Unwiderstehlich zog ihn die Sicht auf den großen Platz an, und das Beobachten des Hauses gegenüber, wo sich sein Schicksal entscheiden sollte. Seine Überreiztheit verlieh dem Gebäude etwas Persönliches, etwas Monströses, der menschlichen Natur entlehnte Züge, rechteckige Augen unenträtselbaren Ausdrucks.
Eines dieser Augen öffnete sich plötzlich. Die schöne Olga erschien am Fenster.
Fléchambeau bemerkte sie unter dem Arme der »Republik« hindurch. Jetzt zeigte auch er sich.
Das arme Kind kannte sich jedenfalls nicht mehr aus, was los sei. Wie? Fléchambeau war gekommen, um sich zu erklären, und hatte sich wieder stumm entfernt, und jetzt war es sein Freund Dr. Pons, der im Salon mit den Eltern sprach. Sie machte einen fragenden Eindruck.
Fléchambeau zermarterte sich das Hirn, wie er ihr sein Pech auf lufttelegraphischem Wege erklären könnte, ward aber durch das Auftauchen der jungen und unerträglichen Bobiche an Olgas Seite von allem weiteren Nachdenken entbunden.
Bobiche, ein verflixter, zehnjähriger Fratz, war die zweite Tochter des Ehepaars Monempoix, ein gescheites Kind, das sich aber immer zur unrichtigen Zeit einstellte. Bobiche schwärmte für Fléchambeau, weil er ihr stets nette Geschichtchen erzählte und ihre Puppensammlung bereicherte. Sie war der ärgerlichste Spielverderber, den man sich denken konnte, und, ohne es zu wollen, der grimmigste Tugendwächter ihrer älteren Schwester.
»Also, da haben wir schon wieder die Klette,« knurrte Fléchambeau.
Die Kleine reichte Olga ein rotes Ding hin, in welchem Fléchambeau den Toreador erkannte, den er eigens für Bobiche aus Spanien sich hatte schicken lassen.
Olga schien unangenehm berührt und antwortete zerstreut. Endlich folgte Bobiche der Blickrichtung ihrer Schwester...
Fléchambeau machte sich dünn, trat ins Dunkel des Zimmers und paffte eine Zigarette nach der anderen.
Seinen Zorn verbeißend, legte er sich aufs Bett und ließ die Beine über das Fußende herabhängen. So traf ihn Pons.
»Nun,« rief Fléchambeau, aufspringend. »Du sagst nichts?«
»Es gibt Dinge, über die man mit lächelndem Munde schweigt!« erwiderte der Doktor. »Doch brause nicht auf. Ein schwacher Hoffnungsstrahl leuchtet dir noch.«
»So rede doch! Was für einer? Du spannst mich auf die Folter!«
Pons nahm gelassen Platz.
»Hast du meine Sache gut vertreten?« fuhr Fléchambeau fort. »Die Leute herumgekriegt? Dich ins Zeug gelegt?«
»Hm! Wie kann man sich bei solchen eigensinnigen, rechthaberischen Menschen ins Zeug legen? Ebensogut könnte man sein Herz einem marmornen Giebel ausschütten. Diese traurige Rolle spielte ich nicht, sondern ging gerade aufs Ziel los. Ich erhielt...«
»Was?...«
»Einen Aufschub... eine Bedenkzeit eingeräumt, und das nur mit großer Mühe. Dreißig Tage. In einem Monat bist du ohne Gnade und Barmherzigkeit erledigt, oder man wird dich mit Blumen bedecken. In der Zwischenzeit ist es meine Aufgabe, mich zu ›entwickeln‹.«
»Versteh' nicht?... Wie? Sollte ich mich getäuscht haben?... Hat die politische Richtung...?«
»Zwecklos, mich auszufragen! Ich glaube, gut gearbeitet zu haben. Schon ist es nicht mehr die glatte Ablehnung, welche dir wurde. Gratuliere also deinem Freunde Pons und überlasse alles Weitere ihm, da alles, ich wiederhole es, jetzt von ihm abhängt. Was dich anbelangt, junger Mann, so kann ich dir nur den Rat erteilen, zu verduften. Bleib' nicht in Saint-Jean-de Nèves. Deine Position hier ist derzeit unhaltbar. Mach', daß du fortkommst.«
»Wohin soll ich denn gehen?«
»Was weiß ich! Ans Meer, in ein Bad, ins Gebirge! Zerstreue dich. Treibe Sport! Geh' an die Küste, unterhalte dich mit Taubenschießen, Tennis...«
»Aber Olga...?«
»Es ist natürlich vorzuziehn, daß du darauf verzichtest, sie zu sehn.«
»Und in vier Wochen?« stotterte Fléchambeau kläglich.
»In einem Monat wirst du, ohne daß du dich deshalb aufzuregen brauchst, erfahren, ob du die Großjährigkeit Olgas abwarten mußt oder nicht.«
»Was?! Drei Jahre soll ich warten?! Nein, nein, davon will ich nichts wissen. Pons, du mußt zum Ziel gelangen! Unverzüglich mußt du deine Freunde bearbeiten... doch, sei lieb, sag' mir, wie sich die Sache abspielte. Wie gingst du vor, was für Argumente führtest du an?«
Durch die halbgeöffnete Türe hatte sich die Katze »Maria-Stuart« hereingeschoben.
»Muni, Muni, Muni!« rief Pons, immer mit Altweiberstimme.
Mit vertikalem Satze spang ihm die Katze auf die Knie und bewegte ein wenig die Schwanzspitze. Dann begann sie ihr Zahnfleisch an einem Finger Pons' zu reiben, der ihr den Buckel kraute.
»Maria-Stuart,« sagte der Doktor neckisch, »ich werde mir noch schließlich einen Hund anschaffen, verstehst du? Aber kein so kleines zitterndes und vornehmes Vieh, das ›heraldisch‹ herumwinselt und dabei eine Vorderpfote hebt, sondern einen von Zärtlichkeit überquellenden Stöberhund, der bei meinem Anblick in ein Freudengeheul ausbricht. Ich werde ihn Amarynthos nennen, wie der Lieblingshatzhund des großen Jägers Aktäon hieß. Denn ihr vom Katzengeschlechte denkt nur immer an euch selbst. Ihr seht eure Herren als Buckelkratzer, Zahnbürsten und Sofas an. Die Hunde sind menschenfreundlicher, Maria-Stuart. Ich werd' mir einen kaufen.«
»Pons!« flehte Fléchambeau.
Die Katze schnurrte gemütlich vor sich hin. Sie war das personifizierte Wohlbefinden. Mit ihrer rauhen Zunge glättete sie eifrig ihren dreifarbigen Pelz.
»Dein Fell hat so viele Haare,« fuhr der Doktor fort, »als Menschen auf der Erde leben. Die Differenz wird keine große sein. Und dazu sicherlich einige Flöhe. Aber letzteres kann einen Parasitologen nicht in Schrecken versetzen. Übrigens ist man immer der Parasit von jemandem; der Floh ist der deine, du der meine, ich der der Erde, die Erde der irgendeines größeren Weltkörpers.«
»Pons!« stöhnte Fléchambeau.
»Pack' deine Siebensachen!« sagte der Doktor.
In diesem Moment wies Fléchambeau nach dem Platze.
»Schau! Dort geht der zweite Staatsanwalt Bargoulin, dieser blöde ›Rote‹, der auch Olgas Hand begehrt. Ein widerlicher Kerl. Ich hasse ihn. Wenn ich weg bin, wird der aufgeblasene Truthahn sein Rad schlagen. Er wird die Gelegenheit benützen, um... doch, was seh' ich? Der Herr Präsident Monempoix tritt aus seinem Hause. Gott, ist er unsympathisch! Bargoulin spricht ihn an. Sie reden miteinander. Monempoix fuchtelt derart mit den Händen herum, daß man glauben könnte, er spräche mit einem Taubstummen. Worüber unterhalten sie sich? Jedenfalls handelt es sich um Olga! Pons! Pons! Pons! Dreißig Tage und dazu die Ungewißheit und die Geheimnistuerei. Komm, Alter, offenbare dich? Vielleicht könnte ich dir aus der Entfernung helfen? Wer weiß? Ich kenne auch einige demokratische Machthaber.«
Pons schnitt ihm alle weiteren Erörterungen mit den langsam und scharf betonten Worten ab:
»Pack' — deine — Sie—ben—sa—chen — und — fahr' — ab!«
Fléchambeau wartete nicht die Revolution der 30 Tage ab, um nach Saint-Jean-de Nèves zurückzukehren. Keinerlei Vergnügungen und Spiele, noch Strapazen welcher Art immer vermochten ihn auf andere Gedanken zu bringen. Obwohl er wußte, daß Pons dafür Sorge getragen hatte, Fräulein Olga über die Geschehnisse zu informieren, litt er doch unsäglich unter der Trennung. Das ist die Liebe, und es ist nicht nötig, sich näher darüber auszulassen, denn jeder von uns hat diesen Zustand mehr oder minder häufig durchgemacht und weiß, wie er sich auswirkt. Die Liebe liebt die Liebenden (schöner Stabreim, der alles sagt), und wer sich von dem Gegenstande seiner Liebe entfernt, auf den übt er eine Anziehungskraft aus, die ihm den Kopf verdreht und ihn unaufhörlich beschäftigt. Die Herzen laden sich gegenseitig mit einem sympathischen Fluidum, und so hatte Fléchambeau das seine mitgenommen, wie ein Kompaß seine Nadel mit sich trägt, nur mit dem Unterschiede, daß für ihn der Nordpol in Savoyen lag.
Schon nach knappen drei Wochen sah ihn Pons wieder landen.
Der Ankömmling ließ etwas den Kopf hängen, denn er fürchtete sich vor einer Strafpredigt, aber die joviale Miene seines Freundes gab ihm Mut.
»Gewiß, eigentlich sollte ich dich auszanken,« meinte Pons. »Doch sei willkommen. Die Sache macht sich. Die Hauptarbeit ist getan. Mit 95 Prozent Wahrscheinlichkeit werden wir siegen. Und wenn du mir versprichst, vernünftig zu sein, will ich dir gern anvertrauen, wieso.«
»Vernünftig soll ich sein?«
»Ich meine damit: verschwiegen. Es darf zu keinem Menschen auch nur das leiseste Wort gesagt werden, ehe nicht auch noch die uns widrigen 5 Prozent eliminiert sind.«
Fléchambeau trat in die Mitte des Zimmers, um beim Emporheben der Schwurhand nichts umzustoßen.
»Ich gelobe, stumm zu sein wie das Grab eines Karpfens!« sagte er. »Doch glaubst du, nach Ablauf der Bedenkzeit die Einwilligung der Monempoix erlangen zu können?«
»Zweifelsohne, wenigstens um diese Zeit herum. Wenn nicht — bedeutet es eine Niederlage, was ich dir nicht verheimlichen möchte. Warte ein wenig. Ich komme gleich wieder.«
Sie befanden sich in Fléchambeaus Zimmer.
Pons empfahl sich und kehrte bald darauf mit einem winzigen Kätzchen auf der Schulter zurück.
»Schau mal an,« meinte er. »Maria-Stuart hat schon wieder geworfen? Und dieses Kind kann sie nicht verleugnen, was? Betrachte dies Schnäuzchen. Ganz die Mama. Es schielt auch und ist dreifarbig. Die gleiche Zeichnung, dasselbe Dirnengesichtchen. Das genaue Ebenbild der Alten, nur ein Miniaturporträt von ihr.«
»Erstaunlich!« bemerkte Fléchambeau ohne Interesse. »Aber mich quälen andre Sorgen, und ich bin pressiert... es drängt mich, offen gestanden, zu erfahren...«
»Dummkopf! Du hast es ja schon erfahren, du weißt alles.«
»Was weiß ich?« stotterte Fléchambeau verwirrt.
Ein »Jokunda«-Lächeln auf den geschlossenen Lippen, wie es Leonardo da Vinci gemalt haben könnte, weidete sich Pons an der Verblüffung seines Freundes.
»Dummkopf,« wiederholte er grausam. »Es ist doch Maria-Stuart selbst, die du hier siehst!«
»Ah!«
»Hör' zu! Du hattest ganz recht. Das mit Olgas ›Jugend‹ war ein leerer Vorwand. Die Monempoix — vor allem sie, die Frau — verweigerten dir ihre Tochter, weil du zu groß bist. Sie wollten es dir nicht sagen, um dich nicht zu kränken, was schließlich verständlich ist. Olga mißt nur 1,55 m, mein Lieber. Daran hast du wohl nicht gedacht, Tambour-Major? Aber die Eltern, die Mutter, haben sich daran gestoßen. Der Größenunterschied von 42 cm bedeutet für sie eine unüberwindliche Schranke. Tatsächlich ist die Differenz auch eine gewaltige, das mußt du selbst zugeben.«
»Nun und?«
»Nun... dann haben sie sich auf mein Bitten hin mir offenbart, ihre innersten Gedanken vor mir entschleiert, und plötzlich fiel mir eine elegante, ja geradezu wunderbare Lösung ein. Man muß dich kleiner machen! Schon als ich noch vor den Monempoix stand, wälzte sich ein Chaos von Ideen durch mein Hirn... Zunächst brachte ich der Form halber vor, deine Frau könnte ja hohe Stöckel tragen, die hohen Stöckel zur Zeit Ludwigs XIV. seien ja nicht für Hunde erfunden worden. Aber Herr Monempoix biß auf den Zopf nicht an. ›Das ist ja kein Mann, Ihr Fléchambeau!‹ rief er, ›das ist ein Berg, ein Gatte für Hochtouristinnen!‹ und ich selber sagte mir, als ich an jene dachte, die du liebst: ›der Vater ist kurz, die Mutter ist klein, dies Kind kann nicht mehr wachsen, nie größer werden‹... und dann... lockte mich die wissenschaftliche Forschung.... Endlich sagte ich: und wenn ich Ihnen in vier Wochen einen Bräutigam vorstelle, der nicht größer ist, als Ihr Bedienter, und wenn dieser Bräutigam alle Eigenschaften Fléchambeaus aufweist, würden Sie ihn in Gnaden aufnehmen?
›Mit Vergnügen, natürlich, falls er unserer Tochter zusagt.‹
Gut, erwiderte ich. Wollen Sie mir auf dieser Basis einen Aufschub gewähren und mir versprechen, einen Monat zuzuwarten, ehe Sie einen anderen Bewerber berücksichtigen?
Sie nahmen den Gedanken auf. ›Es ist zwar lächerlich,‹ meinte der Präsident, ›da Sie aber so hartnäckig sind, lieber Doktor... gut... einverstanden! Ist Ihr Freund, der andre, auch Advokat, gute Kinderstube, aus achtbarer Familie, bei Vermögen?‹
Genau wie Fléchambeau!
Ich antizipierte... aber heute glaube ich nicht übertrieben zu haben, denn... bitte!«
Pons hob mit beiden Händen die kleine Maria-Stuart empor.
»Ich glaube, in mir steckt was! Feine Arbeit, nicht? Die Sache hängt mit der Schilddrüse zusammen!«
Pons ließ die Katze los. Ihrer Kleinheit noch ungewohnt, sprang sie ungeschickt zu Boden. Pons zog aus der Tasche eine runde Pappschachtel und öffnete sie. Sie enthielt eine Anzahl Pillen, nicht größer als Schrotkörner Nr. 2 und von scharlachroter Farbe.
»Jeden Morgen erhielt Maria-Stuart zwei solcher Pillen,« sagte er. »Und den Erfolg siehst du. Innerhalb einer Woche ist sie so klein geworden. Wenn meine Schlußfolgerungen stimmen, muß ein Mensch bei gleicher Behandlung täglich um 2 cm an Größe verlieren. Ich messe 1,76 m. Um dieses mein Größenmaß zu erreichen, mußt du 20 Pillen innerhalb zehn Tage schlucken, wenn...«
»Zeig' her!« meinte Fléchambeau, nahm die Schachtel neugierig in die Hand und ließ die roten Pillen hin und her rollen. »Zum Henker, ich versteh's zwar nicht...« — und ehe es Pons zu hindern vermochte, hatte Fléchambeau zwei Pillen gepackt und — verschluckt.
»Du bist wahnsinnig!« rief Pons. »Wenn die Pillen auf eine Katze wirkten, so ist damit noch nicht gesagt, daß sie auch bei Menschen Erfolg haben. Ich hoffe es, selbstredend. Aber sicher bin ich dessen schließlich und endlich nicht. Ich hätte zuvor noch gern einige Versuche angestellt.«
»Dazu haben wir keine Zeit mehr,« erwiderte Fléchambeau. »In zehn Tagen läuft der Termin ab. Und was riskiere ich schließlich? Wir werden es ja früh genug erfahren, wenn ich nicht kleiner werde.«
»Stimmt, aber du könntest daran erkranken.«
»Gefährlich erkranken, Pons?« — Fléchambeau blickte den Doktor scharf an. Dieser senkte verlegen den Blick.
»Ich hätte es vorgezogen, wenn du noch etwas zugewartet hättest,« meinte er. »Morgen abend hätten mich meine Arbeiten darüber aufgeklärt. Doch, was geschehen ist, ist geschehen. Was empfindest du?«
»Nichts.«
»Kein Schwindelgefühl?... laß mich deinen Puls fühlen.«
»1,76 m ist noch immer eine anständige Größe,« bemerkte Fléchambeau. »Glaubst du, daß sie mich dennoch lieb behalten wird?«
»Dessen kannst du versichert sein. Ich zog sie ins Vertrauen. Doch warte erst ab, ob du kleiner wirst. Sicher ist nichts auf der Welt.«
»Wenn sie mich lieb hat, ist mir alles andere Wurst.«
»Puls ist gut! Kein Bauchweh?«
»Nein, mein Freund. Nur eine leichte Migräne keimt auf... aber, hast du nicht auf deinem Speicher einen Größenmesser? Laß ihn herunterschaffen, bitte.«
Das Holzmöbel ward gebracht. Fléchambeau stellte sich darunter. Er maß genau 1,96 m.
Die Uhr zeigte 8 Uhr abends.
Tags darauf maß er nur mehr 1,94 m, ohne etwas anderes verspürt zu haben, als ein wenig Schwindel, Übelkeit und Benommenheit von keinerlei Bedeutung.
Zur Beruhigung ängstlicher Seelen wollen wir gleich vorausschicken, daß die Befürchtungen des Dr. Pons unbegründet waren. Alles verlief glatt. Keinerlei Unfall, keinerlei unangenehme Überraschung trat ein. Diese außerordentliche Kur, die den Zweck verfolgte, Fléchambeaus Körpergröße jener Fräulein Olgas anzugleichen, ward durch keinen Stillstand, keine Komplikation unterbrochen. In harmonischer Weise folgten einander die zehn Tage.
Gleich vom ersten Abend an hatte sich der Doktor im Schlafzimmer seines interessanten Versuchskaninchens Fléchambeau ein Feldbett aufstellen lassen und bei dieser Gelegenheit kurz und bündig seinem Faktotum, dem Diener Valentin, auf die Seele gebunden, strengstes Stillschweigen zu beobachten über alles, was er sehen, hören oder erleben würde. Valentin war übrigens eine Vertrauensperson, ein arbeitsamer und verschlossener Mensch, der sich nicht um die Welt kümmerte, sondern gleichmütig und gleichgültig durchs Leben wandelte und von dem sein Herr zu behaupten pflegte, daß er mit seinem Zeitalter unlöslich verbunden sei.
Valentin stellte in Fléchambeaus Zimmer das hölzerne Meßinstrument an passendem Platze auf und legte auf den Tisch alles mögliche Zeug aus dem Laboratorium: Registrierapparate, Flakons, Spritzen, Anwärmer, Kluppen, ärztliche Bestecke und Schalen, um allen pathologischen Eventualitäten gegenüber gewappnet zu sein.
Mit einem Thermometer in der Achselhöhle, ruhte Fléchambeau zumeist auf einem bequemen Sofa. Pons nahm ihm die Temperatur ab, kontrollierte seinen Blutdruck mittels pneumatischen Armringes, stellte mit einer Art Telephon die Herztätigkeit fest, hob ihm die Lider auf, um die Augen zu betrachten, sog seinen Atem ein (»riecht nach Tabak«, bemerkte er), ließ ihn von einer Tafel, näher und weiter entfernt, Sätze mit verschieden großen Buchstaben ablesen, kitzelte seine Fußsohlen und stellte dann allerhand chemische Analysen an, deren Einzelbeschreibung wir uns zu erlassen bitten.
Einen gewissen blinden Lärm rief Pons selber hervor. Indem er nämlich den Patienten in einemfort fragte, ob er nicht dies oder jenes verspüre, brachte er es schließlich zuwege, daß Fléchambeau jedes Gefühl für die Wirklichkeit verlor. Die Frage, die er stündlich sechsmal an ihn richtete: »Hast du keine Kolikschmerzen?« bewirkte es, daß der Befragte schließlich purgiert wurde, ärger, als hätte er Rhabarber oder Sennesblätter eingenommen. Das erstemal antwortet man auf derartiges mit einem harmlosen »Nein«. Später befragt man sich selbst, steigt sozusagen in Gedanken in den eigenen Bauch hinab, der sich eines restlosen Wohlbehagens erfreut. Noch etwas später sagt man sich dann: Teufel, sollte nicht doch?... Und das Unglück ist geschehen — oder das Gute. Man nehme sich in acht und ziehe daraus die Lehre.
Am zweiten Tage fand Olga, die man heimlich über den guten Erfolg der Kur benachrichtigt hatte, Mittel und Wege, Fléchambeau ein paar Blumen und ein Briefchen zukommen zu lassen mit der Botschaft: »Ich liebe Sie. Um 5 Uhr werde ich am Fenster sein!«
Fléchambeau sah sie also zwischen dem Arme der »Republik« hindurch und genoß das Glück, aus ihren Gesten herauslesen zu dürfen, daß sie ihm mit Leib und Seele angehöre, getreu bis in den Tod, und was die Seele anbelange, auch über das Grab hinaus.
Am dritten Tage stellte Fléchambeau fest, daß ihm sein Siegelring zu weit wurde und das Monokel die Dimension der Augenhöhle überschritt. Er steckte beides in eine Schatulle und nahm sich vor, den Ring enger machen zu lassen und sich ein kleineres Einglas zu kaufen, sobald er seine Standardgröße erreicht haben würde. Einstweilen bat er seinen Freund, ihm mit einer Brille auszuhelfen.
Er aß mit Appetit, zechte brav und zeigte sich restlos glücklich und wohlgelaunt.
Abend für Abend führte er sich zwei Pillen zu Gemüte. Dann schlief er wie ein Kind, bis sich die Sonne in Valparaiso erhob, d. h. bis gegen 10 Uhr.
Am vierten Tage wachte er jedoch früher auf. Er hatte Zahnweh, fürchterliches Zahnweh.
Pons, der nur oberflächlich schlummerte, beunruhigten Fléchambeaus Seufzer.
»Was gibt's? Es ist ja noch kaum grau!«
»Ich hab' so Zahnweh,« sagte Fléchambeau.
»Was für Zähne tun dir denn weh?«
»Ich glaube... ich glaube, es sind meine Goldzähne.«
»Natürlich!« rief Pons beruhigt. »Ich hab' nicht daran gedacht. Deine Goldzähne gehören nicht zu deiner Anatomie. Es fehlt ihnen das Anpassungsvermögen. Mein Mittel wirkt auf sie ebensowenig ein, wie z. B. eine Fontanelle auf ein Holzbein. Deine natürlichen Zähne werden von selbst mit der Reduktion des Kiefers kleiner... verstehst du?«
»Ich verstehe, daß man mir die Goldzähne wird ausreißen müssen!« versetzte Fléchambeau konsterniert.
»Was liegt daran. Du läßt dir einfach in sechs Tagen andere einsetzen, denn wir brauchen uns nur noch sechs Tage zu gedulden. Heute abend wirst du nicht mehr als 1,88 m messen, d. h. um 8 cm kleiner geworden sein.«
Fléchambeau erhob sich, ein Taschentuch an die Wange haltend.
Wie jeden Morgen, krempelte er die Ärmel seines Schlafrockes um eine neue Umdrehung auf und schnitt unten 2 cm Stoff ab.
»Gott, wie bin ich zerstreut!« sagte er. »Meine Anzüge! Man muß sie ja auch zurechtstutzen, denn ich will doch anständig gekleidet sein... nicht wahr, am Montag enden doch die zehn Tage?«
»Jawohl, am Montag,« erwiderte Pons und fügte — da er ein fanatischer Liebhaber improvisierter Reime war — in Versen hinzu:
»Oh Montag, du seliger, feiner!
Da bist du erlöst, mein Kleiner!«
Damit wollte er auch seinen etwas niedergeschlagen aussehenden Freund ein wenig erheitern.
»Aber ausgehen, zum Schneider gehen, kannst du nicht. Da wir aber so ziemlich eine Größe und Statur haben werden, werde ich die Anzüge angeblich für mich zurichten lassen.«
»Pons, das ist eine glänzende Idee, und schau, daß du bald hinkommst, denn ich möchte in tadelloser Adjustierung vor meinen künftigen Schwiegereltern erscheinen. Montag! Ach, dieser Montag!... aber, Himmelsakrament, hab' ich Zahnschmerzen!«
»Ich werde sie dir ausreißen,« erklärte der Doktor. »Du kannst keine Eckzähne tragen, die für dich zu groß sind. Das geht nicht. Es würde eine unliebsame Unordnung in deinem Gebiß verursachen.«
»Auf so etwas war ich bei Gott nicht gefaßt,« knurrte Fléchambeau.
Und er grübelte, nicht ohne Beklommenheit, nach, welcher Fremdkörper ihm wohl noch einen ähnlichen Streich spielen könnte. Pons half ihm nachdenken. Sie stellten unisono fest, daß mit Ausnahme der Zähne, des Monokels und des Ringes nichts sonstiges Parasitisches ihnen größere oder kleinere Unannehmlichkeiten bereiten könnte.
Unerwähnt darf jedoch nicht bleiben, daß Fléchambeau die Füllfeder unhandlich wurde; sie erschien ihm plötzlich zu groß, man merkte es auch an der Schrift ihres Besitzers. Ebenso drückte die Pfeife, aus der er, um sein Zahnweh zu lindern, tüchtig dampfte, zu gewichtig auf die Mundwinkel.
»Hm, hm!« brummte er bei dieser Wahrnehmung.
Und als er seine Turnhanteln aufhob, mußte er sich eingestehn, daß ihm das Üben mit ihnen sauer wurde.
»Ekelhaft das!«
Da erschien Pons, bewaffnet mit einer heimtückischen Zange. Fléchambeau nahm auf dem Sofa Platz und die schönen Goldzähne verließen, einer nach dem andern, ihren Sitz.
Mit Lesen und Konversation verliefen die nächsten Tage in Ruhe und Frieden. Pons' Besorgnis schwand allmählich und seine Freude gewann die Oberhand. Er hatte eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Wozu konnte sie wohl gut sein? Er war sich darüber nicht recht klar. Der Fall Fléchambeau schien eine Ausnahme zu sein und zu bleiben, denn man stößt nicht jeden Tag, nicht einmal alle Jahre, auf Leute, die kleiner gemacht zu werden wünschen. Doch das war ohne Bedeutung. Die Anwendung der Entdeckung kam erst in zweiter Linie in Betracht. Die Hauptsache war, daß sie überhaupt gemacht wurde. Das bedeutete Berühmtheit!... Stolz!... Lebt wohl, Läuse, Flöhe, Ungeziefer aller Schattierungen, ihr traurigen Parasiten! Nun hatte Saint-Jean-de Nèves einen gefeierten Mann geboren! Und wer weiß, vielleicht erhob sich eines Tages sein Standbild irgendwo, z. B. gegenüber dem Gymnasium oder gar an Stelle der »Republik« mit den großen Ammenbrüsten, deren Statue man mangels weniger allegorischer und mehr persönlicher der Verewigung würdiger Vorwürfe errichtet hatte.
Die Katze, welche die Ereignisse kalt ließen, schlich auf leisen Sohlen umher. Von nun ab mußte sie sich angewöhnen, in einer größeren Welt zu leben und höher zu springen, wollte sie ihr Siestaplätzchen erreichen.
Was Fléchambeau anbelangte, so ging es ihm ähnlich. Noch immer bückte er sich, wenn er durch die niedrige Tür seines Toilettezimmers schritt, obwohl dies jetzt völlig überflüssig geworden war. Sein Rasiermesser genierte ihn wegen dessen Dimensionen. Er handhabte es ungeschickt. Die Pantoffeln verlor er ein dutzendmal täglich. Andrerseits bemerkte er nicht, daß sich seine dünner gewordenen Haare feiner anfühlten, denn seine Finger, die an der allgemeinen Reduzierung seines »Ich« in gleicher Weise teilnahmen, bekamen ein viel delikateres Tastgefühl.
Bei Tisch aß er weniger, schnitt sich kleinere Stücke ab.
Statt wie ehedem vier, genügten jetzt drei Glas Wein, um ihn in behagliche Stimmung zu versetzen. Und wenn er auch den Arm weiter ausstrecken mußte, um die Flasche oder ein Salzfaß zu erreichen, so empfand er dafür die größere Raumweite seines Sessels umso angenehmer, und auch den Umstand, daß er nicht mehr, wie früher, seine Riesenbeine unter dem Tische herumzwängen mußte.
Das Bemerkenswerteste an dem Ganzen war, daß Fléchambeau ohne die geringste Runzel, ohne das kleinste Fältchen im Gesichte hinschwand. Er wurde, alles in allem, in der vollendetsten Weise die kleinere Ausgabe dessen, was er zuvor gewesen war.
Endlich tagte der zehnte Morgen. Die 20 Pillen waren verschluckt. Um 11 Uhr vormittags zeigte der Meßapparat schwach 1,77 m.
Um 8 Uhr abends würde Fléchambeau zweifelsohne nicht mehr als 1,76 m groß sein. Er und Pons waren dann einander gleich.
Der Schneider brachte die umgeänderten Kleider. Hemden-, Hut- und Schuhmacher kramten eine Auswahl der modernsten Artikel ihrer Branche aus. Man traf peinlichst seine Auswahl; ein Paar etwas knappe Schuhe, einen etwas engen Mantel usw., alles vorsichtshalber ½ cm kleiner.
Der schmachtende Liebhaber sang vor gehobener Freude, als er in einem schwarzen Jackett und den rosenholzfarbenen Beinkleidern stak.
Auch Pons zog sich auf das feinste an.
Gegen 5 Uhr, der Schicksalstunde, in der die vierwöchige Frist ablief, umschritten die beiden Freunde den Brunnen der Republik.
Die Hausglocke des Herrn Präsidenten Monempoix glich einer kleinen kreisrunden Zielscheibe. Pons drückte mit der Spitze des Zeigefingers entschlossen auf den Knopf.
»Punkt!« sagte der Doktor.
»Mitten ins Schwarze!« lächelte Fléchambeau selig.
Monempoix' Dienstmädchen, ein Trampel mit roten Händen und geschwollenen Füßen, merkte nichts. Durch die Anforderungen, die ihre Herrin an sie im Hause stellte, war sie bereits völlig vertiert.
»Treten Sie ein!« sagte sie und führte Pons und Fléchambeau nach einem Salon Napoleon III., der nicht ohne Reiz gewesen wäre, hätte man ihn nicht mit allerhand Deckchen, Bändern und Etageren im Stile Ludwigs XV. und mit kitschigen Porzellan-Nippes vollgestopft.
An der Wand prangte ein recht gutes Porträt des Konventsmitgliedes Sanson-Darras: sprechende Haltung, interpellierende Geste, halb geöffneter Mund, wie zu einer Apostrophe, auf die es keine Antwort gibt, die Haare im Winde des Volkssturmes fliegend — und dicht daneben ein durchaus mittelmäßiges Gemälde, eine kolorierte Photographie, das den Großvater Monempoix' darstellte, den Herrn Rat Monempoix in roter Robe, ein ganz unpersönliches Machwerk, das durch seine Nichtigkeit geradezu aufreizend wirkte.
Pons wandte den Blick ab, um Fléchambeau zu betrachten, sozusagen »sein« Werk, seinen künstlichen Sohn, hatte er doch die Arbeit von dessen Vater etwas retuschiert. Und er sagte: »Es ist gut«, genau wie Gott, als er den ersten Menschen erschaffen hatte.
Fléchambeau sah in der Tat brillant aus. Jetzt genügten ihm zwei Nelken im Knopfloche. Der Optiker am Platze hatte ihm ein Lorgnonglas verkauft, das täuschend ähnlich die Funktionen eines Monokels erfüllte. Und was den unglücklichen Zylinder Fléchambeaus anbetraf, so bereute sein Besitzer nicht, ihm den Garaus gemacht zu haben, da es ja heutzutage für schick gilt, mit nichts in den Händen seine Aufwartung bei anderen Leuten zu machen.
Herr Monempoix erschien zuerst. Schon auf der Schwelle verspürte er eine innere Hemmung. Verständnislos blickte er bald auf Pons, bald auf Fléchambeau. Er glaubte, der Doktor bringe ihm einen Doppelgänger Fléchambeaus in kleinerer Ausgabe. Er fühlte das lebhafteste Bedürfnis, klar zu sehen, fürchtete aber andererseits, für einen Idioten angesehen zu werden, wenn er sich selber Gewißheit verschaffen würde.
Pons befreite ihn aus dem Dilemma, indem er sagte:
»Herr Präsident, hier stelle ich Ihnen den Kandidaten vor, den Sie in Gnaden aufzunehmen mir versprachen, falls er Ihrem Fräulein Tochter zusagen würde. Wenn Ihnen auch die Sache ziemlich unglaublich erscheinen sollte, ist der Kandidat dennoch mein Freund Fléchambeau in Person. Seine hohe Gestalt bildete das einzige Hindernis auf dem Wege zu seinem Glück. Ich suchte also diesem Übel abzuhelfen, und wie Sie sehn, tat ich es mit Erfolg. Nun ist es an Ihnen, Ihr Versprechen zu halten.«
»Ist's denn menschenmöglich!« rief Monempoix.
Verblüffung und Mißtrauen verzerrten sein Gesicht.
Herr Monempoix war ein aufgeblasener, eher unbedeutender Spießer von bleicher Gesichtsfarbe, die den Anschein erweckte, als habe man ihrem Besitzer Stearin injiziert. Auf niedrigen Beinen wölbte sich ein dicker Bauch, und sein runder, vollkommen kahler Schädel gemahnte an irgend etwas Unanständiges. Um diese Kahlheit etwas zu mildern — allerdings ein vergebliches Bemühen —, ließ er die letzten Haare, die ihm wie ein Kränzchen im Genick lagen, übermäßig lang wachsen.
Stellen Sie sich eine Büste aus Wachs vor — oder noch besser, aus Talg —, die fallen gelassen und beim Sturze deformiert wurde und in diesem kläglichen Zustande verblieb, mit plattgequetschter Nase, schiefem Kinn und Schrammen da und dort: In seiner Verblüffung, seinem Ärger und maßlosem Erstaunen gewährte Herr Monempoix momentan diesen Anblick.
Fléchambeau ergriff das Wort und bestätigte alles, was sein Freund vorgebracht hatte, und obwohl seine Stimme gleichfalls eine dünnere Klangfarbe bekommen hatte (wie ein Stück für Bratsche, das man für Violine transponierte), ließ sich der Herr Präsident nach und nach überzeugen. Er öffnete die Tür und rief in das Stiegenhaus.
»Bichonne! Komm doch in den Salon!«
»Bichonne« — Frau Monempoix erschien. Niemand als sie hätte bei einer Sylvesterfeier so treffend Klöße oder Knödel personifizieren können. Ihre Gesichtsblässe und das auffallend Ätherische ihrer Gestalt hatten etwas Gespenstisches. Wenn man sie sah, raunte man sich ins Ohr: Eine arme Seele im Anfangsstadium der Materialisation! Ihre karikaturenhafte Ähnlichkeit mit einer berühmten Tragödin ließ die Vermutung aufkommen, daß man, wenn sie die Lippen öffne, eine Stimme von Gold, zumindest von Plattgold, vernehmen würde.
Doch welcher Irrtum! Nichts Melodisches kam über diese Lippen von durchsichtiger Blässe.
Sie drückte sich höchst plebejisch aus und besaß ein rauhes Organ. Ihre Rede untermischte sie mit seltsamem Gegrunze, als stecke ihr in der Kehle etwas, das lebhaft an die Stimme eines in der Nähe befindlichen Schweines erinnerte. Dazu kam, daß sie ein unstillbares Bedürfnis empfand, ihr Gegenüber anzurühren, seine Hände zu packen, sich an seine Schulter zu lehnen, in das Weiße seiner Augen zu blicken und in seinen Mund hineinzusprechen. Wohl die meisten hätte eine solche Schwiegermutter in spe zurückgeschreckt, und nichts ist imstande, Fléchambeaus große Liebe besser zu charakterisieren als das. Fräulein Olga konnte sich auf eine Leidenschaft etwas einbilden, die nicht einmal das Dazwischentreten ihrer Gebärerin abzuschwächen vermocht hatte.
»Schau her!« sagte der Präsident. »Ich stelle dir unseren Freund, den Herrn Amtsadvokaten beim Pariser Appellationsgerichte, Fléchambeau vor. Herr Dr. Pons hat ihn eine Kur durchmachen lassen. Ist das nicht wunderbar, Bichonne?«
»In der Tat,« zierte sich Frau Monempoix. »Ich bin ganz aus dem Häuschen. Wie brachten Sie das fertig, Doktor?«
»Was liegt an dem ›Wie‹« zuckte Pons die Achseln, »das Faktum genügt.«
»Wird es aber auch anhalten?« meinte Frau Monempoix. »Wird Ihr Freund nicht wieder wachsen, so von Tag zu Tag?«
»Nein, gnädige Frau, ich bürge dafür.«
»Wenn dem so ist...«
Das Ehepaar wechselte einen beratenden Blick.
»Na also,« erklärte der Präsident. »Hol' unsere Tochter,« und an Fléchambeau sich wendend, sagte er mit feinem Lächeln: »Seien Sie mir als Sohn willkommen, lieber Junge. Wir geben sie Ihnen.«
Inzwischen hatte Frau Monempoix ihre Tochter hereingeführt, die hinter der Tür gelauscht.
»Machen Sie sie glücklich!« seufzte die Präsidentin, wie sie das einmal in irgendeinem Küchenromane gelesen hatte.
Herr Monempoix betrachtete die Liebenden, die sich in die Arme sanken. Olga erhob den Blick ihrer seelenvollen Augen zu dem feurigen Sehorgan Fléchambeaus, und der Herr Präsident erklärte salbungsvoll:
»Man könnte kein Pärchen passender zusammenstellen.«
»Und du bleibst stumm, Pons?« fragte Fléchambeau. »Du sagst mir gar nichts?«
Pons sann ein wenig nach und erwiderte schüchtern:
»Ich grüße dich, Herr Gemahl.«
»Gott, ist er komisch!« rief Frau Monempoix.
»Er ist ebenso geistreich wie gelehrt!« setzte der Herr Präsident den Punkt auf das »i«.
Den Zeigefinger auf die Brust seines Freundes pflanzend, machte Pons seinen Gefühlen mit einem seiner üblichen Verschen Luft:
»Herzt euch voll Liebesglut,
Küßt euch voll Liebeswut!
Wer immer im Liebesspiel
Des Guten nicht tut zu viel,
Der liebt zu wenig, der liebt nicht genug,
Seine Leidenschaft ist nur Lug und Trug!«
Man mußte sich Gewalt antun, um nicht zu applaudieren.
Fléchambeaus Gesicht ging vor lauter seligem Lachen fast aus dem Leim. Er schwamm in einem Meere von Glück und er hatte das Gefühl, als ob Wasserstoff — oder ein anderes Gas, das leichter als Luft ist, ihn erfülle und ihn von der Erde emporhebe.
»Gib acht!« ermahnte ihn Pons. »Mach's nicht wie jener Greis, dessen weißes Haar in einer Nacht vor lauter Glück und Seligkeit schwarz wurde!«
Alles platzte heraus, denn jeder fühlte ein unwiderstehliches Bedürfnis, seiner Heiterkeit Luft zu machen, und ergriff daher die Lachgelegenheit beim Schopfe. Bei Pons lief man keine Gefahr, darin zu kurz zu kommen.
Das Ehepaar Monempoix erschöpfte sich wechselseitig in lauten »Hm! Hm!«, denn die Verlobten waren nicht voneinander loszukriegen. Eins ans andre geschmiegt, saßen Fléchambeau und die reizende Olga auf dem Sofa und gaben sich konharmonischen Beweisen gegenseitiger Zärtlichkeit hin. Vielleicht nur, um diesem anscheinend nicht endenwollenden Idylle ein Ziel zu setzen, rief plötzlich der Herr Präsident:
»Zum Henker, warum solltet ihr eigentlich nicht alle zwei, Pons und Fléchambeau, heute abend bei uns mit ein paar intimen Freunden unseres Hauses speisen?... Du könntest doch ein kleines Verlobungssouper improvisieren, Bichonne?... Der Traiteur Digermal wird uns alles Nötige besorgen. Die Choderpils kommen ohne weiteres, auch die Chabosseaus und Dézormets!«
»Gewiß, gewiß!« stimmte die Frau Präsidentin zu, die für solche improvisierte Festchen eine große Vorliebe hegte. »Werfen Sie sich in Smoking, meine Herren, und kommen Sie um acht Uhr wieder. Wir wollen den freudenreichen Tag mit einem schönen Abend festlich begehn. Paßt es Ihnen?«
»Gemacht!« erwiderte Pons, während Fléchambeau statt aller Antwort die Präsidentin umarmte und dem Präsidenten gerührt die Vorderflosse drückte. Dabei warf er seiner Verlobten einen jener langen, verschleierten und liebesschwangeren Blicke zu, die heiß und unverbrüchlich die Liebe und Treue von tausend Generationen in sich bergen.
*
Punkt acht Uhr erschienen die beiden Freunde wieder in der Wohnung des Präsidenten. Warmer Küchengeruch schlug ihnen entgegen, und man vernahm das Geräusch von Tellern und Geschirr.
Fléchambeau fühlte sich wie in den siebenten Himmel versetzt. Die Schlußstunde seines Kleinerwerdens hatte geschlagen. Der nach den Maßen von Pons umgearbeitete Smoking beengte ihn nicht im mindesten, und die mit breiter Seidenborte verzierte Hose fiel schick, nicht zu lang, nicht zu kurz, auf seine Lackschuhe herab. Das physiologische Wunder war geschehen.
Im Salon war noch niemand. Aber eine Sekunde später erschien bereits Olga, leider in Begleitung von Bobiche, die in ihren Armen eine ganze Karnevalsgesellschaft Puppen mitschleppte.
Olga trug ein himmelblaues, mit silbernen Sternchen übersätes Kleid. Verzückt hob sich ihr fester, zarter Busen, und ihre Frühlingsbrüstchen waren wie junge Tauben, der Göttin Venus heilige Vögelchen. Fléchambeau liebkoste mit den Blicken die entzückenden Formen des Fräuleins, die rundlich wogenden Hüften und deren obere weiche Doppelwölbung, die einen Armand Sylvestre begeistert haben würde, und die gewiß nicht dem Erfinder der Autobusse, dieser anscheinend nur für Skelette berechneten Fuhrwerke, als Modell vorgeschwebt hat.
Bebend verstrickte das Pärchen seine zwanzig Finger ineinander.
Bobiche paßte das aber gar nicht. Da im Wachsen begriffene Kinder für Proportionen nur ein diffuses Auffassungsvermögen besitzen, fiel ihr die äußerliche Veränderung ihres Freundes Fléchambeau nicht weiter auf. Sie wollte absolut Pons die Puppen, die sie der Generosität seines Freundes verdankte, eine nach der anderen vorstellen und ihn dann bitten, ihr die Geschichte vom König Turbul und dem Prinzen Mirobol, die er neulich angefangen, aber nicht fertig erzählt hatte, weiter zu erzählen.
Fléchambeau zuliebe opferte sich also der Doktor. Er ließ die Puppen in Parade an sich vorüberziehen und miteinander reden; den Torero mit dem Fischer von Dieppe, den Matrosen mit dem Mädchen von Arles, und fragte dann Fléchambeau:
»Wo waren wir denn stehngeblieben?«
»Wo die Feen zur Tauffeier der Prinzessin Kuckuck erscheinen, die einen auf Engelsschwingen, die andern in fliegenden Karossen...«
»Richtig!« nickte Pons. »Also hör' weiter, Bobiche!... Plötzlich sah man die Fee Piane-Pianne rittlings auf einem Camembert daherkommen. Sie hatte sich natürlich verspätet. Zur Wiege der kleinen Prinzessin tretend, hob sie ihren Zauberstab und sprach zum Baby: Du wirst langsam sein! Auf dieses fatale Wort hin riß sich König Turbul die letzten drei Haare, die ihm noch geblieben waren, vor Entsetzen aus und rief: ›Wie könnte man wohl das Schreckliche verhüten, das ein derart düsteres Geschenk mit im Gefolge hat. O meine Feendamen, welch namenloses Unglück! Meine Tochter soll jeglicher Flinkheit und Schnelligkeit beraubt bleiben! Geben Sie mir Ihren Rat? Was kann ich tun, um das Furchtbare, das Harte dieser Gabe zu mildern?‹ — ›Geben Sie der Prinzessin viel Sellerie zu essen. Das ist das einzige Mittel!‹ erklärte die Fee Morgan. Und die Fee Carabosse fügte hinzu: ›Sie soll möglichst viel Hunyady-Janos trinken...‹ — In diesem Moment erblickte der König ein hübsches junges Ding, das in Lumpen gehüllt war, die kaum ihren grazilen Körper bedeckten. ›Hallo!‹ wandte sich Se. Majestät an den Hofnarren. ›Wer ist das Mädel mit dem entzückenden kleinen Popo?‹ — ›Sire,‹ entgegnete der Leibzwerg, ›die schöne Meerschweinchenhirtin Nigaudinossa ist es.‹ — ›Palababumssa!‹ rief der König. ›Dann verstehe ich allerdings, daß...«
Bobiche platzte vor Lachen heraus. Da öffnete sich die Tür, und das Dienstmädchen ließ das Ehepaar Choderpil eintreten. Diesem folgten die Chabosseaus und Dézormets. Zu deren Empfang eilten jetzt auch Herr und Frau Monempoix herbei. Es erhob sich nun ein Tohuwabohu von Ausrufen, Gekicher und Küssen. Jeder versicherte, wie unendlich er sich freue, und wie er sich vor Staunen ob des beispiellosen Phänomens des Kleinergewordenseins des Herrn Fléchambeau gar nicht fassen könne.
Man hätte glauben können, daß alle diese Herren und Damen nur auf diesen einen Moment uferloser Seligkeit in ihrem Leben gewartet hätten, daß sie keine andre Sorge gehabt, als die Zukunft Olgas, der herzigen Kleinen.
»Und jetzt heiratet sie ein Naturwunder!« erklärte die Frau Präsidentin.
Man näherte sich Fléchambeau mit einer gewissen Scheu, einer Scheu, wie man sie etwa einem Monstrum gegenüber auf Jahrmärkten oder in Museen empfindet. Frau Monempoix gebärdete sich mit einer durch Erziehung etwas abgedämpften Raserei. Ihr glimmerhaft schillerndes Kleid von lila Farbe mühte sich vergeblich, violett zu erscheinen. Pons sagte ihr, sie gleiche einer Glyzinie, versprach sich aber und sagte »Glyzerin«. Sie glaubte, er mache ihr irgendeine »medizinische« Schmeichelei, welche die Damen nicht verstehen.
Der Lohndiener von Digernal unterbrach die gesellschaftliche Unterhaltung, indem er die Türe zum Speisezimmer aufriß und meldete:
»Es ist serviert!«
Der Präsident bot seinen henkelförmig gebogenen Arm Madame Dézormet. Staatsanwalt Dézormet führte, ein blöd-galantes Lächeln auf den Lippen, die Hausfrau; Richter Choderpil folgte mit der Gattin seines Kollegen Chabosseau usw. Fléchambeau und Olga glichen Paul und Virginie, und den Schluß des vorhochzeitlichen Reigens bildeten Pons und Bobiche. Der Doktor machte sich innerlich nicht wenig lustig über die »Herrschaften« und konnte nur mit Mühe ein homerisches Lachen unterdrücken. Es war ein lukullisches Mahl. Obwohl Digernal gar nicht darauf gefaßt gewesen, hatte er sich selbst übertroffen. Das ist immer so. Nur von langer Hand vorbereitete Dinge krachen.
Zur größten Freude unseres Pons hatte der Herr Präsident Monempoix den Vorsitz an sich gerissen; selbstbewußt thronte er auf seinem Stuhle und servierte seinen Gästen, ohne jedoch dabei auch nur im mindesten seinen Magen zu kurz kommen zu lassen, Anekdoten aus seinem Leben.
»Als ich eines Tages in Strafsachen den Vorsitz führte, richtete, stellen Sie sich vor, der Angeklagte folgende Frage an mich: Und Sie, Herr Präsident, haben Sie sich nie etwas vorzuwerfen gehabt? O doch, mein Herr — erwiderte ich —, die Ernennung von Sachverständigen und Geschworenenobmännern!«
Die Tafelrunde hielt sich die Rippen, denn Monempoix hatte eine drollige Art zu reden.
Selbst im Gerichtssaale schien er immer jemanden zu parodieren, wen, wußte man nicht, aber irgendeinen komischen Kauz. Er war wie einer jener Schauspieler, die einen bloß durch ihr Erscheinen auf der Bühne zum Lachen reizen.
Fléchambeau war nur Herz. Man hatte ihn neben Olga gesetzt, und er erklärte sich unfähig, etwas zu essen oder zu trinken. Mit ihrer sanften, aber unerbittlichen Hand würgte ihm die Glückseligkeit die Kehle zu. Olgas Augen faszinierten ihn. Sie waren auch einzig in ihrer Art. Es gab keine zweiten, die so samtweich, klar und unvergleichlich gefühlvoll dreinblicken konnten. Wenn sie die langen, seidenen Wimpern senkte und wieder hob, war es, als ob das leuchtende Morgenrot die finstere Nacht ablöse. Diesen Blick konnte man nicht mit Worten schildern, es war weniger ein Blick als ein drahtloser Kuß.
»Erbarmen!« flehte Fléchambeau, »lassen Sie Ihre süßen Augen ein wenig schlummern!«
Doch sie vermochte es nicht, denn ein inneres Triebwerk beherrschte auch ihr Herz, Kopf und Blut.
Ernst, blaß, steif, überselig, fast leidend unter der Gewalt restloser Befriedigung, saßen sie da und weilten, fernab von dieser lärmenden Tafelrunde, wie auf einer von Watteau gemalten Insel.
»Nunc est bibendum!« erklärte der Präsident.
»G'soffen!« übersetzte Pons republikanisch.
»Er ist unbezahlbar!« meckerte die Präsidentin.
Pons hatte ihr Herz erobert. Sie verschlang ihn förmlich mit den Augen, bedauerte, daß er nicht ihr Tischnachbar war. Ihre Füße tasteten im Leeren herum.
»Was werden Sie jetzt beginnen?« fragte sie. »Saint-Jean-de Nèves verlassen? Morgen sind Sie eine Berühmtheit!«
»Ich gehe mit keinen großen Plänen mehr um,« erwiderte der Doktor. »Ich will's mir fortab gut sein lassen und mich nur mit der Muse der Dichtkunst ein wenig herumnecken:
Was kümmern den Dichter des Lebens Sorgen? Er lebt für das ›Heute‹ und denkt nicht ans ›Morgen‹.«
»Entzückend,« seufzte sie.
Und ihr Zwiegespräch setzte sich über die von Blumen und Blattwerk strotzenden Tafelaufsätze hinweg fort.
Die Zeit verstrich; ein Gericht folgte dem andern, ein guter Tropfen dem nächsten, die angenehme Musik des Schlemmermahles ertönte fortissimo. Die Wangen röteten sich, die Gesprächsthemata wurden gewagter. Wie schön war es, zu leben! Man empfand es immer mehr. Der Lärm der Gesellschaft verschwamm und versank für die beiden in ihren egoistischen Träumen versunkenen Liebenden wie ein Narrengestade im Meere des Alls. Aber die andern, meine Herren! Wie gaben sie sich der Lust hin, vor allem die Männer, selig, mindestens für einige Zeit die Amtsmiene ablegen zu dürfen.
Wie wohl tat es, ja wie wundervoll wohl, Herrn Emil Monempoix zu sehen, wie er, nicht mehr Amtsperson, sondern dickbauchiger Privatmann, ein Riesenmesser zückte, groß genug, um einen Ludwig XV. abzumurksen, und wie er mit lüsternem Munde damit eine prachtvoll gelungene Kalbskeule in saftige Scheiben zerlegte.
Doch wir armen Schriftsteller mit unserem leeren Bauche, die wir nur in unserer Phantasie schlemmen können und nur am Kellergitter der Erinnerung den Bratenduft einer kulinarischen Fata Morgana einatmen dürfen, wollen uns bei solchen Schilderungen, die einem das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen, nicht länger aufhalten. Wir gehören zu den Bedauernswerten, die ihre Feder gern für eine Gabel und das Papier vor sich für einen vollen Teller ansehen. Schlagen wir ihn in Trümmer, Herr Histograph! Ihr Löschblatt ist kein Tischtuch, Ihr Tisch keine Tafel. Es braucht nicht mehr viel, und Sie leeren Ihr Tintenfaß! Presto, presto! Übergehen Sie glatt die Gänge: Vorspeisen, Braten, Wild, Geflügel, Gemüse und Salate — der Fisch ist schon längst abserviert — halten Sie sich nicht beim Käse und der Eisbombe auf, erwähnen Sie nur den Johannisberger, den Barsac, Chambertin, Pommery und Samos. Lassen Sie rasch die »Petits fours« vorbeiflitzen. Erzählen Sie meinetwegen, wie Bobiche ihrem »Fischer von Dieppe« zu trinken geben wollte, Herr Monempoix mit lustiger Miene eine pikante Geschichte unter Deckworten vom Stapel läßt, die Frauen vergnügt gackern und die Männer aus sich herausgehen. Teilen Sie mit, daß elf Uhr nachts vorbei ist (welch lange Nährsitzung!), malen Sie in Ihren wirkungsvollsten Farben aus, wie eine leichte Konfusion entsteht, als die Servietten, zum Knäuel geballt, hingeworfen werden und man die heißgesessenen Stühle, diese dienstbaren Vierfüßler, die dabei ein kleines Adieugeräusch von sich geben, fortrückt, und führen Sie uns mit ein paar schnellen Pinselstrichen den Reigen vor Augen, der sich jetzt nach dem »Schwarzen« und den Likören hinbewegt. (Für die Nervösen gibt es Kamillentee.)
Fléchambeau erhob sich. Verzückt fühlte er, wie ein molliges Ärmchen sich in seinen schob, und folgte seinem Laboratoriumskameraden. Pons machte sich vor ihm den Spaß, gebückt einherzugehen, um mit Bobiche in einer Kopfhöhe zu sein.
Da — an Fléchambeaus Absatz mußte sich anscheinend etwas festgeklebt haben, ein Stück Brot oder sonst irgendein Speiserest! Er wischte mit dem Fuße auf den Teppich hin. Das Ding blieb, ließ sich nicht entfernen!... Ekelhaft!
Fléchambeau hob das Knie und tastete rasch mit der Hand nach seinem Absatze... und ward von jäher Blässe befallen. Pons drehte sich lustig um. Aber es war ihm, als wehe ihn ein eisiger Unglückswind an. Er richtete sich auf, ließ Bobine los...
»Was gibt's?«
»Mein Beinkleid ist mir zu lang geworden,« stotterte Fléchambeau. »Ich trete darauf... ich... fahre fort, kleiner zu werden... auch mein Kragen... meine Ärmel... schau her!«
»Kreuzdonnerwetter!« brummte Pons.
»Fluche nicht!« erwiderte Fléchambeau. »Machen wir lieber, daß wir schleunigst wegkommen. Eine schöne Geschichte das!«
Pons war wie zu einer Salzsäule verwandelt. Er schwitzte vor Entsetzen.
Unter dem Vorwande, ein gewisses Plätzchen aufsuchen zu müssen — sie waren nicht die einzigen —, empfahlen sie sich auf Französisch.
Die Klarheit des Himmels wirkte aufreizend. Die Luft war friedlich und mild, das Firmament wolkenlos...
Es war eine dramatische und groteske Stunde zugleich.
Kaum daheim, setzte sich Pons an den Schreibtisch und schrieb Herrn Monempoix einige Zeilen der Entschuldigung: infolge eines leichten Unwohlseins Fléchambeaus seien sie gezwungen gewesen, sich auf Französisch zu verabschieden. Das Unwohlsein sei jedenfalls eine Folge der harten Kur, der er sich dem Herrn Präsidenten zuliebe unterzogen habe. Dann weckte er den trefflichen Valentin auf und befahl ihm, den Brief hinüberzutragen und bei dieser Gelegenheit die Mäntel und Hüte mitzunehmen, die man im Vorzimmer habe hängen lassen.
Als das Faktotum draußen war, blickten die beiden Männer sich in die Augen. Fléchambeau voller Angst, Pons völlig perplex. Ein ungeheures Schweigen herrschte — die Stummheit von dreitausend Klavieren, auf denen niemand spielt.
»Irgend etwas muß geschehen,« sagte sich Pons.
Fléchambeau, der in seinem Smoking hin und her schlotterte, sah aus wie einer aus jener Welt.
»Was windest du dich denn so?« fragte Pons, gezwungen lächelnd.
Heftig und verächtlich mit den Schultern zuckend, begann Fléchambeau ziellos umherzuirren. Er biß die Zähne aufeinander und hatte einen verlorenen Blick, wie ein Matrose, der voller Verzweiflung in einem gesunkenen Unterseeboote herumrennt.
»Du schaust aus, wie ein Hund, der seinen Blinden verloren hat!« begann Pons von neuem. »Wozu diese Angst? Für alles gibt es ein Mittel. So kannte ich einen Einäugigen, der sich betrank, um alles doppelt zu sehen. War er voll, unterschied er sich in nichts von dir und mir.«
Fléchambeau begnügte sich, seinem Freunde das bekannte Zitat aus »Götz von Berlichingen« an den Kopf zu werfen, und knurrte dann:
»Messen!«
Sie begaben sich in sein Zimmer. Fléchambeau zog Schuhe und Strümpfe aus und stellte sich auf den Apparat.
Ein Meter dreiundsiebzigeinhalb!
Pons runzelte beide Brauen — weil er nur zwei hatte. Er hätte hundert haben müssen wie der alte Argus, um seinen Ärger richtig zum Ausdruck bringen zu können.
Maria-Stuart beschielte sie mir ekelhafter Seelenruhe.
Fléchambeau knurrte.
»Es ist auch mit deine Schuld,« erklärte Pons angstzermürbt. »Ich hatte dir nicht erlaubt, die Pillen zu schlucken. Du hast die Kur ohne meine Zustimmung begonnen. Ich sagte dir ausdrücklich, daß meine Untersuchungen noch nicht beendet seien, die Entdeckung noch nicht restlos geglückt. Was Katzen, Tiere überhaupt, anbelangt, war ich ja meiner Sache sicher. Du siehst ja, daß Maria-Stuart nicht mehr kleiner wird, nicht wahr? Sie ist stabilisiert. Du aber nicht. Es ist also klar, daß mein Mittel auf Tiere und Menschen verschieden wirkt.«
»Du sagst mir nichts Neues,« entgegnete Fléchambeau. »Das Schreckliche aber ist, daß ich innerhalb vier Stunden um zweieinhalb Zentimeter abnahm.
Außerstande, mit Worten seine Verzweiflung zum Ausdrucke zu bringen, erging er sich in ohnmächtigen Zornausbrüchen.
»So tu doch etwas, beim Zeus!« schrie Fléchambeau auf. Er war ganz außer sich. »Tu doch etwas! Steh' nicht da wie ein Kretin! Gib mir irgend etwas zu trinken oder ein Bad... Es muß doch irgendein Gegenmittel geben. Mach mir eine Einspritzung. Massiere mich. Laß mich zur Ader, gib mir ein Abführmittel, auskultiere mich, mediziniere!... Betaste mich, beraume ein Konsilium an, wenn nötig. Willst du meine Zunge sehn?...«
»Jedenfalls ist sie nicht gelähmt,« versetzte der also hart Angeredete. »Überhaupt nur Ruhe, nicht so aufgebracht. Stellen wir einmal fest: Durch deine ›Flucht‹ brachtest du uns um den Schnaps und den ›Schwarzen‹. In Anbetracht deiner Verzweiflung, die mich selbst schon enerviert, halte ich Kaffee für kontraindizierend, aber Schnaps...« und Pons holte eine Flasche Kognak herbei, auf deren Etikette die drei bekannten Sterne leuchteten, wie der Sirius, der Atair und die Wega, und sie tranken miteinander mehrere Gläschen dieses wundervollen alten Charente-Alkohols.
Es herrschte wieder Schweigen. Da vernahm man auf dem Platze der Republik eilige Schritte, und wenige Minuten später erschien Olga, die sich über alles gesellschaftliche Herkommen hinweggesetzt hatte, gefolgt von Valentin, der die Garderobe der Herren trug.
»Nun?« rief sie angstvoll.
Statt aller Antwort nahm Fléchambeau Valentin den Hut aus der Hand, setzte sich ihn auf. Er fiel ihm über die Ohren und bis auf die Nase hinab.
»Ist er verrückt geworden?« dachte sich das junge Mädchen und blickte den Doktor fragend an.
»Ihr Verlobter fährt fort, kleiner zu werden, mein Fräulein,« sagte dieser. »Und ich zerbreche mir den Kopf darüber, wie man dem Halt gebieten könnte. Doch es wird mir gelingen, seien Sie unbesorgt. Sie werden eben die Gattin eines hübschen, sehr hübschen Gentlemans mittlerer Größe werden. Das ist alles.«
»Wenn's nur das ist,« meinte Olga vergnügt. »Fléchambeau, mein Freund, ich liebte Sie trotz Ihrer Größe, aber eigentlich habe ich kleine Männer lieber.«
Das gute Herzchen! Ja, es gibt noch Frauen, die im richtigen Moment das richtige Wort finden! Und dann... über ihre nackten Schultern hatte sie eine der verführerischsten »Sortie de Bal« geworfen...
Gerührt umarmte sie Fléchambeau, so gut er konnte, und zwang sich trotz seiner Verstimmung zu einem gemütlichen Lächeln. Doch — war der Kognak so adstringierend? — seine Lippen blieben aufeinandergepreßt, und er schloß beim Lächeln den Mund, um nicht seine Zahnlücken zu verraten.
Vollkommen beruhigt zog sich Olga zurück.
Fléchambeau aber floh der Schlaf. Und auch Pons gab sich nicht der Bettruhe hin. Die ganze Nacht arbeitete er in seinem Laboratorium, stöberte in seiner Bücherei herum, manipulierte mit einer Masse gefährlicher Substanzen, knetete Pasten von abscheulichem Aussehen und zerbrach sich den Kopf.
Als der Tag graute, erschien Fléchambeau — jetzt noch kleiner als Pons — in düsterer Stimmung und jammerte:
»Es geht weiter! Keinerlei Besserung! Ich werde närrisch. Ich wollte mein Zahnwasser nehmen, das Seifennetz an seinem Platze aufhängen, aber...« und plötzlich wütend werdend, brüllte er: »Jetzt hab' ich's satt, verstehst du? Du bist ja ein Vieh! Ehe man eine Autotour macht, überzeugt man sich, ob die Bremse in Ordnung ist, und man dreht nicht einen Hahn auf, wenn man nicht weiß, wie man ihn wieder schließen muß! Ich... ich... spuck' dich an!...«
»Du bringst mich noch ganz aus dem Häuschen,« erwiderte Pons gelassen. »Du bist wie ein Polizeiagent, der kein Wort sagen kann, ohne den ›wilden Mann‹ zu spielen. Alles wird sich geben. Komm, trink' das!«
Er reichte seinem Freunde in einem Reagenzglase einen scheußlichen, mißfarbenen, bleigrau geäderten Sirup. Mit einer greulichen Grimasse schüttete ihn Fléchambeau, so rasch er konnte, hinunter.
»Das ist ja ein Brechwurzelabsud!« rief er.
Pons zuckte die Schultern.
»Natürlich!... Wenn du glaubst, daß es Ipekakuanha ist, wäre es sinnlos gewesen, es zu schlucken. Nur die Idee, daß es Ipekakuanha ist... ah, was sage ich denn?...«
Bleich sank Fléchambeau in einen weichen Fauteuil. Jetzt, wo er den Trank hinabgewürgt hatte, machte der arme Junge eine noch traurigere Miene. Ärmel und Hose seines Pyjamas waren schon dreifach umgekrempelt worden. Das viel zu weit gewordene Kleidungsstück selbst hatte etwas »Abgeschwollenes« an sich, was immer einen peinlichen Anblick gewährt. Das Wetter war auch unfreundlich, der Barometer sank, und über die ohnehin nicht sehr lichtvolle Stadt, der im Norden das Hochgebirge den Himmel versperrte, rieselte eintönig der Regen herab.
Eine Kirchenglocke ertönte.
»Wen begräbt man denn?« erkundigte sich Fléchambeau.
»Es läutet nicht zu einem Begräbnisse, sondern zu einer Hochzeit!
Wer mürrisch ist und schlechter Laune,
Vernimmt — daß du's nicht weißt, ich staune —
In jedem Tone, jedem Klang
Ein Grabgeläute, dumpf und bang!«
»Trottel!« erwiderte Fléchambeau, und sie reichten sich brüderlich und mitfühlend die Hände.
Der vormals »Lange« betrachtete die verschiedenen Apothekergeheimnisse, die sich hinter den Scheiben der Glasschränke befanden.
»So ein Pech!« knurrte er, »wenn man sich vorstellt, daß das rettende Mittel da ist — wir aber es nicht kennen. Irgendeine Mischung von dem Zeug könnte meinen Zustand des Immerkleinerwerdens zum Stillstande bringen...«
»Du wirst nicht kleiner, sondern du resorbierst dich, saugst dich auf!« verbesserte Pons doktrinär. Ohne darauf zu achten, fuhr Fléchambeau in einem philosophischen Selbstgespräche fort: »Wenn man bedenkt, daß die Natur rings um uns Steine, Pflanzen und was weiß ich aufbaut, die zu unserer Gesundung geschaffen wurden, und daß sich Unheilbare, vielleicht auf dem Grase und den Kräutern selbst liegend, die sie retten könnten, ums Leben bringen. Mein Gott! Mein Gott! Mein Gott!«
Pons senkte unter dem Drucke des gewaltigen Schicksals das Haupt. Aber er warf es gleich wieder empor, wie unter der Wirkung eines »Uppercut«, als habe ihm die Hoffnung einen Hieb unters Kinn versetzt.
»Mut! Zum Henker!« rief er. »Schau nur, die Sonne durchdringt den grauen Flutmantel und
Um zu gefallen dem Maler und Architekten zugleich, Wölbt siebenfarbig den Regenbogen das Wolkenreich.«
»Ich bitte dich, hör' mit deiner Reimerei auf!« flehte Fléchambeau. »Ich bin viel zu unglücklich, als daß ich Sinn für deine Späße haben könnte. Ich geh' lieber!« — Und er empfahl sich.
Im Laufe des Vormittags ließen die Choderpils, Dézormets und Chabosseaus sich nach dem Befinden Fléchambeaus erkundigen. Die Leute wußten, was sich schickt. Auch erhielt man den Besuch des Ehepaares Monempoix samt Tochter. Die Alten zeigten sich äußerst zugeknöpft, blieben auch nur ein paar Sekunden. Immerhin hatte Olga, die ganz verzweifelt war, von ihren Eltern die Erlaubnis erwirkt, zu kommen, so oft sie wollte.
Selbstredend kannten nur die Monempoix' die volle Wahrheit. Alle anderen glaubten an ein vorübergehendes Unwohlsein Fléchambeaus. Ein paar Tage später aber argwöhnte man bereits, daß Dr. Pons' Haus irgendein Geheimnis in sich berge, und Fléchambeau wurde der Gegenstand besonderen Interesses. Es gibt Dinge, die man nicht unter hermetischem Verschluß halten kann, die mit unwiderstehlicher Gewalt an die Öffentlichkeit dringen, und die, von Mund zu Mund gehend, um so mehr aufgebauscht werden, je weniger wissen, um was es sich eigentlich handelt. Ein Statistiker hätte festgestellt, daß jetzt viel mehr Leute, männliche und weibliche Wesen, über den Platz der Republik schritten, die sich den Anschein von Gleichgültigkeit und Zerstreutheit gaben, aber heimlich nach dem »geheimnisvollen Hause« hinüberschielten. Manchmal rumpelten sie dabei zusammen, rannten sich an einem Brett, das irgendein Schreinergehilfe auf der Schulter trug, das Auge ein, stolperten über den Rand des Brunnengehsteiges oder fielen mit der Nase in das Wasser des Bassins, wie es zum Beispiel dem alten Baron Cormoranche passierte, der nur von Getratsch, Geschwätz und Altweibergerede lebte.
Inzwischen nahm die Marter Fléchambeaus ihren Fortgang oder, besser gesagt, seine »Passion«, denn es gibt auch Kalvarienberge, die man nicht emporgeht, sondern herabsteigt, die deshalb aber nicht weniger schmerzensreich sind. Nun, Fléchambeau stieg einen solchen unaufhaltsam herab.
Der Gedanke, vielleicht innerhalb Monatsfrist zum Zwerge zu werden, erfüllte ihn mit Raserei. Er war bei unausstehlicher Laune. Von seinen Nächten wollen wir schweigen. Sein Aufwachen glich dem eines zu Tode Verurteilten. Und seine Tage, ach, seine Tage, erst recht. Keine Guillotine erwartete ihn, aber der Meßapparat, das entsetzliche hölzerne Meßinstrument, das eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Richtmaschine annahm. Dieser Meßschragen, der den armen Fléchambeau vom Morgen bis zum Abend wohl fünfzigmal hinrichtete, dies Holzgestell, das den Fortschritt seines Unglücks und den Weg seines Martyriums bezeichnete, verkürzte ihn wöchentlich um einen Kopf.
Auch andre, mehr nebensächliche Unannehmlichkeiten verursachten ihm Qualen und Wutanfälle, z. B. seine Garderobe. Zuerst schaffte man fertig gemachte Anzüge aus den »Vereinigten Werkstätten« an. Anfangs wollte Pons Anzüge aus einem Kleiderverleihgeschäfte beziehen. Aber Fléchambeau haßte das; er bekam eine Gänsehaut, seine Haare sträubten sich bei dem Gedanken, etwas anzuziehen, was schon andere getragen hatten. Inzwischen wechselte er Anzug auf Anzug, wie ein Reisender die Hotels.
Bald brauchte er Knabenanzüge. Valentin, der mit der Besorgung derselben beauftragt wurde, gefiel ein Erstkommunikantenanzug wegen der langen Beinkleider. Als Fléchambeau dieses Gewand erblickte, geriet er derart außer sich, daß man ihn schon fesseln wollte. Kleine Leute, namentlich rothaarige, sind immer cholerisch. Unser Held war niemals ein gemütlicher Mann gewesen. Daher ist es begreiflich, daß er jetzt, wo er sich keine Illusionen mehr darüber machen konnte, was er geworden war, noch viel ungemütlicher wurde. Kurz gesagt: er war jetzt ein Zwerg, ein Knirps, ein Wichtlein. Das Knabenkostüm bewies es ihm um so unangenehmer, als »Die Vereinigten Werkstätten« in bester Absicht der Sendung eine wundervolle, weißseidene Armbinde mit breiter Masche und schönen Fransen beigefügt hatten.
Olga kam oft. Ihre sanfte Gegenwart dämpfte ein wenig Fléchambeaus Zorn, erfüllte ihn aber mit noch größerer Trauer und einer dumpfen Ironie. Er konnte sie nicht mehr um die Taille nehmen, ohne sich lächerlich zu machen. Eines Tages wollte sie ihn auf den Schoß nehmen. Da bekam er einen derartigen Wutrückfall, daß ihr die Tränen in die Augen traten. Und sie hörte, wie er mit dünner, sarkastischer Stimme, die einem das Herz zusammenschnürte, sang:
»Mein Vater gab mir einen Mann.
Gott, ist mein Gatte klein!
Was fang ich mit dem Männlein an?
Wie kann so klein man sein?«
Und dann schaute er sie wehmütig an und sagte bitter: »Der Däumling ist da! Kuckuck — der Däumling ist da!«
Was sollte sie erwidern? Armer Fléchambeau!
Das Sonderbarste an der Sache war, daß er absolut regelmäßig abgenommen hatte. Seine Proportionen hatten sich nicht verändert. Er zeigte keine Falte, keine Runzeln. Würde man ihn ohne ein Vergleichobjekt daneben photographiert haben, wäre auf der Platte sein allgemeines Kleinergewordensein nicht ersichtlich geworden.
In Wirklichkeit aber war er ein Zwerg, ein Zwerg mit den Proportionen, dem Gesichte, den Gesten, dem Gange, ja selbst den Gewohnheiten eines Riesen. Also, das war wirklich etwas ganz Ungewöhnliches. Man stelle sich einen Elefanten von der Größe eines Schettlandponys vor oder eine Basilika als kleine Hütte. Das reizt unwillkürlch zum Lachen. Warum, weiß man nicht, aber es erregt unsere Heiterkeit, und nichts ist schrecklicher, als wenn man über etwas Trauriges lachen muß.
Olgas Rolle war schwierig und delikat. Jede Frau fühlt sich zu Kleinen hingezogen, weil sie Kindern gleichen. Klein zu sein, ist schon an und für sich nicht lustig, wenn man aber vordem groß war, so bedeutet es einfach den Sturz aus der Höhe, die Degradierung.
Frau Monempoix zog sich immer mehr zurück, machte sich rar, war pikiert, unzufrieden, eisig. Nur einer Revolte verdankte Olga ihre Freiheit, nach Herzenswunsch Fléchambeau pflegen zu können. Und Herr Monempoix war wieder präsidentenhaft geworden, machte nur kurze Anstandsbesuche und wiederholte ohne Unterlaß »Capitis diminutio... Capitis diminutio!« und dachte dabei in seinem Innern, daß sich der Staatsanwalt Bargoulin einer stabilen und herkömmlichen Statur erfreue. »Niemals,« sagte er sich, »niemals wird Fléchambeau wieder wachsen und einen Schwiegersohn von Stiefelgröße mag ich nicht.«
Wieder wachsen! Pons tat, was er vermochte, um die Formel zu finden, die seinen Freund zum Himmel aufschießen lassen könnte. Kisten voller Bücher waren von Paris angekommen. Er vertiefte sich in eine Masse von Abhandlungen über Histologie, Osteologie und Physiologie, magerte ab, verlor den Schlaf, hatte keinen Durst, keinen Hunger mehr, büßte seinen Humor ein und wurde sich kaum mehr bewußt, daß er überhaupt noch lebe. Seine Augen zogen sich noch tiefer in ihre Höhlen zurück, man mußte besorgen, daß sie ihm einmal beim Hinterhaupte heraustreten würden.
Was Fléchambeau betraf, durchkostete er alle Bitternisse seines unseligen Geschickes. Inbrünstig betete er immer wieder zu seinem Herrn und Heilande: »Herrgott, erhöre mich, indem du mich erhöhst!« Und er empfing — ein Umstand, der sehr bemerkenswert erscheint — alle Augenblicke kindliche Eindrücke. Er war wieder zum kleinen Kerlchen geworden, dem das Gewicht eines Stuhles eine Kraftanstrengung abfordert, und das auf einen Schemel steigen muß, um aus dem Fenster schauen zu können. Aber diese Eigentümlichkeiten bereiteten ihm nicht einmal ein intellektuelles Vergnügen. Von Tag zu Tag wuchs sein Entsetzen. Anfangs hatte er nur gefürchtet, als Zwerg dem Spotte anheimzufallen. Jetzt als Zwerg beschäftigten ihn ganz andre, fürchterlichere Sorgen. Wie würde das alles enden? Wann würde sein Immerkleinerwerden zum Stillstande kommen? Ging er nicht ganz einfach dem Nichts, dem Tode entgegen?...
Es kam der Tag, an dem der hölzerne Meßgalgen überflüssig wurde. Das Richtholz reichte nicht mehr tief genug herab. Derartige Apparate werden nur für das, was existiert, gebaut, nicht für Produkte närrischen Zufalls.
Fléchambeau maß 25 cm. Er war so klein, daß er aussah, als sei er unter einem Kohlkopfe zur Welt gekommen. Seit einiger Zeit schlief er in der Wiege, die einst Olga und Bobiche als erste Liegestatt gedient hatte. Dann wählte man unter Bobiches Spielsachen ein Puppenbett aus, wo Fléchambeau sich wohl oder übel entschließen mußte, die Nacht zu verbringen, Nächte, wie sie entsetzlicher noch kein Sterblicher durchgemacht. Kein menschliches Kleidungsstück war für ihn winzig genug. Olga ward es müde, immer wieder die Anzüge umzuändern, die sie ihm angefertigt hatte. Sie zog eine Puppe Bobiches nach der andern aus. So legte Fléchambeau z. B. die Uniform einer Puppe an, die einen Husarenrittmeister darstellte. Er trug noch keine halbe Stunde die rote Hose und die blaue Attila, als ihn Pons dabei ertappte, wie er einen Bindfaden an einen Stuhl knüpfte, um sich aufzuhängen.
Der brave Doktor war aufs tiefste erschüttert.
»Was, Selbstmord willst du begehn?« rief er. »Schluß machen? Bist du verrückt? Du weißt doch, daß wir dich noch aus der peinlichen Situation ziehen werden!«
»Das einzig Vernünftige, was ich auf dieser Welt noch tun kann, ist, mich in jene zu expedieren,« schrie Fléchambeau. »Wer sich umbringt, macht von seinem vornehmsten Rechte Gebrauch, das darin besteht, einen Ort verlassen zu dürfen, wo man nicht hinzukommen wünschte.«
»Die erste Pflicht des Menschen ist, das nicht zu tun!« versetzte Pons. »Deine Religion verbietet dir überhaupt, dich unserer Gesellschaft auf diese Art und Weise zu entziehn. Und dann... und dann... man wird dich schon noch retten... Du wirst wieder groß werden... Olga heiraten und mit ihr Kinder haben, die sehr glücklich sein werden...«
»Das beste Mittel, das Glück seiner Kinder zu begründen, ist, keine Kinder in die Welt zu setzen.«
»Dummheit!... Deine Pflicht...«
»Pflicht reimt sich auf Wicht.«
»Ruhig! Du bist ein Miesmacher! Höre zu, Fléchambeau. Es lebten einmal zwei Zwillingsbrüder. Sie sahen sich so ähnlich, daß einst die Frau des einen ihn mit seinem Bruder verwechselte. Die Konfusion war so groß, daß die Gattin unbewußt diese ›Untreue‹ weiterbetrieb. Ihr Mann erfuhr davon und wollte seinen Bruder töten. Aber durch die fatale Ähnlichkeit, die sie miteinander hatten, wurde er selbst irregeführt und schoß auf sich selbst, weil er glaubte, den Revolver gegen seinen verräterischen Doppelgänger von Bruder gerichtet zu haben. Zum Glück blieb er am Leben. Die Kugel war durch sein Gehirn gesaust, ohne einen edlen Teil verletzt zu haben. Nun also, Du...«
»Laß mich in Frieden,« unterbrach ihn Fléchambeau. »Ich versprecht dir's, ich werde kein Attentat
Buchseite 100 fehlt!
herum mit einer Bretterwand umgeben, denn ein Luftzug eines durch Zufall offengebliebenen Fensters genügte, um das leichte Geschöpfchen wegzufegen, wenn es sich innerhalb der Einfriedigung erging.
Aber diese Schutzvorkehrungen genügten noch nicht. Fast hätten eine dicke Hummel und dann eine große Spinne sich Fléchambeaus bemächtigt und ihm den Garaus gemacht. Die Villa wurde gegen ein Vogelbauer ausgetauscht, das Valentin mit einem Fliegennetz aus feinem Draht umgab. Zur Vorsicht bewaffnete noch Pons seinen bedauernswerten Freund mit einer sehr spitzen Stecknadel, die einen blauen Kopf aus Glas hatte. Sie konnte ihm nötigenfalls als Lanze dienen und gestattete ihm, sich eventuell auch gegen eine Fliege zur Wehre zu setzen, wenn sich etwa eine solche hinterlistigerweise in diese Art »Speisekammer« einschleichen sollte.
Man fütterte den Eingesperrten mit Krümelchen und Brotkrumen. Von Grillengröße war er bereits zu Blattlauskleinheit herabgesunken. Eines Abends geriet Pons in größte Bestürzung. Er sah ihn nicht mehr, aber eine haarige Raupe kroch, wie ein wandernder Schnurrbart, über das Gitter hin. Es war ein falscher Alarm. Fléchambeau schlummerte hinter einem Brotkrümelchen. Schon mußte man sich eines Hörrohrs bedienen, um mit ihm reden zu können. Man steckte sich das eine Ende ins Ohr und Fléchambeau sprach in das andre hinein. Als seine Stimme noch dünner wurde, nahm man einen Schallverstärker zu Hilfe.
Endlich vermochte kein Mikrophon mehr das Gewisper Fléchambeaus verständlich zu machen. Auch die Lupe, durch welche man ihn bisher betrachtete, wurde zwecklos. Man ersetzte sie durch ein Linsenglas, wie es sich die Uhrmacher bei ihrer Arbeit ins Auge klemmen, und die einzige Art des persönlichen Verkehrs beschränkte sich jetzt darauf, abzulesen, was Fléchambeau auf extra feinem Papiere mit einem in dünnste Tinte getauchten Stückchen Haar aufschrieb. Rasieren konnte er sich natürlich auch nicht mehr. Er trug daher einen Bart, der ihn sehr entstellte. Kleiner und immer kleiner werdend, erschöpfte er sich in fruchtlosen, verzweifelten oder wütenden Pantomimen. Mit Ausnahme eines kleinen Fetzens aus weiß Gott welchem Stoff, der weiß Gott wie festhielt und was Sie sich denken können verhüllte, bestand seine Kleidung aus — Luft.
Pons hatte auf jeden Rettungsversuch verzichtet.
Dem Kleinerwerden Fléchambeaus Einhalt zu tun, erschien ihm endgültig unmöglich. Auch schloß die Winzigkeit des Objektes jegliches Herummedizinieren aus. Zudem fühlte sich Pons viel zu traurig und unglücklich, um arbeiten zu können. Er verließ kaum den Tisch, der Fléchambeaus Domäne geworden war, eine Domäne, die für ihn von Tag zu Tag umfangreicher wurde. Auch Olga weilte morgens und abends stundenlang hier und beide betrachteten durch die Uhrmacherlupe das winzige, fein ziselierte Gesichtchen des Männleins, dessen rotes Haar den Kopf krönte, wie der Phosphor ein Streichhölzchen.
Welches würde wohl die Lösung sein?
Resigniert gab Fléchambeau seinen letzten Willen bekannt.
»Koste es, was es wolle,« schrieb er, »ich will christlich begraben werden. Macht das, wie Ihr wollt.«
»Aber du bist doch nicht krank,« erwiderte Pons. »Du bist nicht krank! Was redest du vom Sterben?«
Er bemühte sich dabei, möglichst die Stimme zu dämpfen und benützte ein kleines Sprachrohr aus Papier, dessen weite Trichteröffnung seinem eigenen Munde zugewandt war.
»Sie befinden sich glänzend wohl, Geliebter!« fügte Olga bei.
»Aber ins Undenkliche kann ich doch nicht kleiner werden!«
»Warum nicht?« erwiderte Pons, der mit dieser furchtbaren Antwort gezögert hatte.
Die Miene Fléchambeaus drückte finsteren Ernst aus. Schon lange beschäftigte alle Drei der nämliche Gedanke.
»Was dir begegnet,« fuhr Pons fort, »liefert den unumstößlichen Beweis, daß das menschliche Gewebe plastischer ist, als man je zu ahnen vermochte, mindestens nach ›unten‹ hin. Nachdem du bisher in keiner Weise Schmerzen erduldetest, will es mir nicht einleuchten, weshalb dein Organismus nicht noch eine weit bedeutendere Reduktion vertragen sollte. Statt daran zu denken, daß du kleiner wirst, mußt du dir vorstellen, daß du dich entfernst, dann bekommt die Sache ein ganz anderes Gesicht.« Ach, wie schnürten ihm diese Worte die Kehle zu.
»Ich entferne mich also?« schrieb Fléchambeau langsam.
»Ja, ohne dich zu bewegen.«
»Und ohne Hoffnung, je wieder zurückzukehren?«
»Wer kann das sagen?« meinte Pons. Doch er fühlte, wie seine Augen sich mit Tränen füllten, und auch Olgas Lupe wurde trüb und sie nahm sie aus dem Auge, um sich die Tränen abzuwischen.
»Du hättest auch Pillen schlucken sollen!« schrieb Fléchambeau. »Mich allein fortzuschicken, ist feig.«
»Anders kann ich dir nützlicher sein,« rechtfertigte sich Pons. »Wäre auch ich kleiner geworden, wer hätte dich dann geschützt und auf dich achtgegeben?«
»Stimmt. Verzeih... doch wohin gehe ich?... was wird mir zustoßen?... ich bin ja ganz mutterseelenallein und unbewaffnet... kann nichts mitnehmen... denn alles disproportionierte sich im gleichen Maßstabe...«
»Sicherlich! Aber ein Schlaumeier wie du wird sich immer aus der Schlamastik ziehen. Und... du wirst eine wunderbare Entdeckung machen, Fléchambeau. Ich habe immer behauptet, daß man die herrlichsten Abenteuer an Ort und Stelle erlebt und die schönsten Reisen nicht auf geographischem Wege macht. Doch niemals hätte ich mir einfallen lassen, daß sich meine Ideen so verwirklichen könnten, wie in deinem Falle.«
Fléchambeau schien nachzudenken.
»Pons,« erwiderte er endlich. »Ich weiß, daß die Grenzen der Welt nicht mit unseren menschlichen Sinnen wahrgenommen werden können. Es gibt zwischen Himmel und Erde eine Unmenge von Dingen, die wir entweder wegen ihrer Größe oder wegen ihrer Kleinheit nicht auf natürlichem Wege erfassen können. Einzelnes hat uns ja die Wissenschaft aufgedeckt: die Sterne und die Mikroben. Nicht zu den Sternen erhebe ich mich — zu den Mikroben gehe ich ein. Nun denn, Doktor, sag' mir einiges über die Welt, in die ich mich unfreiwillig begebe. Zuvor aber sage mir: glaubst du, daß wir alle Mikroben kennen? Nicht wahr, nein?«
»Ich glaube an das Unendliche,« gab Pons zur Antwort. »An das Unendliche im Großen und Kleinen. Das All ist unbegrenzt. Die Erde bildet nur ein Lehmkügelchen irgendwo im unendlichen Raume. Was wir ›Atom‹ nennen, weist einen Durchmesser von einem zehnmillionsten Millimeter auf. Das Atom aber ist ein Sonnensystem, gleich dem unsern — ein Sonnensystem, in welchem Planeten, die wieder fünfzigtausendmal kleiner sind als ein Atom, um ein Zentralgestirn kreisen, wie die Erde um die Sonne. Und die unendlich kleinen Sonnen, die kleiner sind als ihre Planeten, sind wiederum eine Milliarde Millionen winziger als ein Millimeter. Und alles läßt darauf schließen, daß auch diese minutiösen Welten abermals andere in sich bergen, und diese wieder andre und so fort ohne Ende.
Unser Sonnensystem ist wahrscheinlich im Verhältnis zu dem großen unendlichen Raume nur ein Atom, zu dem Weltenraume, der so ungeheuer ist, daß das Licht gewisser Sterne trotz einer Geschwindigkeit von 300000 Kilometern in der Sekunde uns erst nach zehn Millionen Jahren erreicht. Es ist wahrscheinlich, daß das All nur eines der kreisenden Systeme ist, von denen eins in das andre eingeschachtelt ist und deren Dimensionen, sowohl wegen ihrer Größe als auch wegen ihrer Kleinheit, zum Großteil von unseren Sinnen nicht erfaßt werden können, ja, sich überhaupt unserer Vorstellung entziehen. Nordmann prägte den Satz: ›Die Wirklichkeit geht über alle Traumbegriffe und erdrückt sie.‹«
Olga zog sich diskret zurück. Fléchambeau blickte ihr nach, der unerreichbaren Riesin, von der er doch in seinem Innern ein mit seinen eigenen Proportionen äquales Bild bewahrte.
Als sie fort war, frug er.
»Was ist's aber mit den Mikroben!... den Mikroben?«
Pons merkte die Angst seines Freundes. War es wirklich notwendig, ihn restlos und wahrheitsgemäß über das aufzuklären, was er zu wissen begehrte? Würde er nicht sozusagen Schiffbruch erleiden, noch ehe er das Land der Mikroben erreichte? Sollte man ihn mit der Bazillenwissenschaft bekannt machen? So wie man einen Reisenden über die Sitten und Gebräuche der Völker unterrichtet, die er zu besuchen vorhat?
»Ich höre!« kritzelte Fléchambeau ungeduldig hin.
Pons begann.
»Noahs Arche beherbergte weit mehr Lebewesen, als ein menschliches Auge wahrzunehmen vermochte...« — Und nun verbreitete er sich über die mikroskopische Fauna und Flora, indem er, was Fléchambeau hätte erschrecken können, milderte und »ad usum delphini« die üblen Gewohnheiten und bösen Eigenschaften gewisser Würmer, Stabtierchen, Algen und Pilze, die man mit freiem Auge nicht sehen kann, überging. Zufällig besaß er einige Präparate, die er Fléchambeau durch das Mikroskop betrachten ließ. Fléchambeau klammerte sich ganz oben auf dem Instrumente fest. Er nahm sich aus, wie ein irrsinnig gewordener Astronom, der die beiden Enden des Teleskopes miteinander verwechselt und verkehrt hineinschaut. Er machte auch den Eindruck eines Forschers, der verurteilt ist, eine Reise nach dem Monde zu unternehmen, und den fernen Himmelskörper betrachtet, auf dem er bald zu landen plant.
Hierauf wurde Fléchambeau mit allergrößter Vorsicht auf seinen Platz zurückgebracht und der Unterricht ging weiter.
Als Olga, leise die Tür öffnend, um keinen Luftzug zu verursachen, zurückkehrte, vernahm sie, wie Pons gerade sagte:
»Je nach der Berechnungsmethode zählt man in einem Gramm Wasserstoffgas 650-683 000 Milliarden Milliarden Atome. Wären nur 500 000 Milliarden Milliarden darin, hätte der Himmel eine grüne Farbe und bei 700 000 Milliarden Milliarden eine violette. Übrigens — Wasserstoff! Ich werde vielleicht gut daran tun, dir das Proutsche Gesetz bekanntzugeben.«
»Hm, hem!« machte Olga, fälschlich etwas Unanständiges witternd.
»Oh, mein Fräulein... Sie?«
»Ja,« flüsterte sie. »Ich konnte nicht anders, bin zurückgekommen. Es quält mich die Angst, daß eine Katastrophe eintreten könnte, gerade wenn ich nicht da bin. Valentin, Herr Doktor, möchte Sie sprechen. Es ist etwas aus Paris angekommen.«
»Ich weiß, was es ist,« flüsterte Pons ebenso leise zurück. »Ein Übermikroskop, ein Mikroskop für ultraviolette Strahlen, mit Quarzprismen und Linsen. Es hat eine Vergrößerung von 14 000fachem Durchmesser. Mit diesem Apparat können wir ihn noch lang beobachten.«
»Wen? Fléchambeau?«
»Gewiß. Wen denn sonst?«
»Schrecklich!... entsetzlich!«
Pons staunte, wie man so bleich sein könne, ohne tot zu sein.
Anfangs genügte ein gewöhnliches Mikroskop. Wir wollen nicht gerade behaupten, daß es restlos seinen Zweck erfüllte, denn diese Instrumente sind ja nicht zu einem Gebrauche, wie im speziellen Falle, eingerichtet. Immerhin erkannte man Fléchambeau im Objektiv und sah, wie er durch höchst geistreiche Mimik sich verständlich zu machen abmühte. Hier wollen wir die Episode mit der Krätzmilbe einflechten. (Sarcoptes scabiei.)
Ein verdammt ekliges Tier, so eine Krätze- oder Räudemilbe. Sie gehört, wie Sie wissen, nicht zu den Mikroben, ist aber immerhin ein häßliches, kleines Scheusal, ein winziges Ungeziefer, das die Dunkelheit liebt und ein boshaftes Vergnügen darin findet, sich in die Haut der Menschen oder der Tiere einzubohren. Hier vermehrt sie sich mit einer geradezu atemberaubenden Fixigkeit und macht ihre Opfer räudig, krätzig in kürzester Zeit. (Ein einziges »Pärchen« erzeugt innerhalb dreier Monate 1 000 000 weibliche und 500 000 männliche Nachkommen.)
Pons konnte sich nicht vorstellen, wie diese Milbe aus seiner kleinen Versuchsmenagerie entkommen war und wieso das Tier sich gerade an dem Orte befand, wo es nicht hingehörte, nämlich auf der kleinen Glasplatte, die Fléchambeau und sein Unglück trug. Wir nehmen ganz einfach an, daß die Milbe nach einer parasitologischen Untersuchung darauf kleben geblieben war. Alles, was man sagen kann, ist, daß diese Milbe ein zähes Leben besaß.
Während Pons einen kleinen Gesundheitsspaziergang absolvierte, befand sich Olga am Mikroskope des Laboratoriums allein auf der Wache. Sie sah ihren Bräutigam — jenen, den sie edel denkend nie anders nannte —, wie man Passanten vom dreißigsten Stockwerke eines Wolkenkratzers aus sieht. Um die Augen Fléchambeaus nicht zu sehr anzustrengen, warf der Spiegel des Mikroskopes nur einen sehr schwachen Reflex auf ihn. Es herrschte somit unter dem Objektiv eine gewisse Dämmerung. Plötzlich erschien die Milbe: riesig, fahl, von spitzen Seidenstacheln starrend, mit Fühlhörnern und Saugpfoten, und öffnete den Rachen, dessen Kinnladen den Scheren eines Hummers glichen. Mit unerhörter Raserei bewegte sie alle ihre gefährlichen Glieder und tastete sich — sie besaß allerdings keine Augen, aber einen ungemein entwickelten Orientierungssinn — auf Fléchambeau los. Damals war Fléchambeau so klein geworden, daß ihn die Milbe (es handelte sich um ein weibliches Tier, das viermal den Umfang eines männlichen hat) wie ein Mammut unsere vorgeschichtlichen Altvordern überragte. Den Vergleich können wir aber nicht weiterspinnen, denn unsere Vorfahren hatten Pelze an und Steinbeile, während Fléchambeau waffenlos war und als Kleidung nichts als die zur mikroskopischen Beobachtung notwendige dünne Ölschicht besaß, die ihn vor Kälte schützte, und die ihm etwa auch in einem Kampfe »Mann gegen Mann« wegen ihrer Schlüpfrigkeit von Vorteil sein konnte.
Olga stieß einen gellenden Schrei aus. Bei diesem Getöse, das Fléchambeau wie Donnergeroll vorkommen mußte, hob er den Kopf und man las ihm das Entsetzen vom Gesichte ab.
»Was tun?« fragte sich Olga.
Die Lage war in der Tat kritisch. Die elefantische Milbe setzte ihren blinden, aber zielbewußten Vormarsch unentwegt fort. Was hätte Fléchambeau Flucht genützt? Die Milbe bewegte sich unaufhaltsam vorwärts!
Unwillkürlich ließ das junge Mädchen die Maschinerie des Spiegels spielen. Denn das erste, wonach die Menschen, überhaupt alle mit der Gabe des Sehens ausgestatteten Geschöpfe trachten, ist, klar zu sehen, wenn irgendetwas da ist, was nicht stimmt.
Es war eine glänzende Idee. Denn eine intensive Helligkeit verbreitete sich jäh über beide Gegner. Die Walstatt war grell beleuchtet. Mehr bedurfte es nicht, um die Milbe abzuschrecken, denn obwohl sie blind sind, diese Räudeerreger, fliehen sie doch merkwürdigerweise das Licht wie die Pest.
Auf ihren acht Beinen machte die Milbe sofort kehrt und verschwand aus dem Lichtkreise, wo Fléchambeau nunmehr froh aufatmete.
In diesem Augenblick trat Pons wieder ein. Olga berichtete ihm, was sich abgespielt hatte. Sein gewohnter Umgang mit Parasiten ermöglichte es ihm ohne Schwierigkeiten, die Milbe aufzuspüren und sofort umzubringen.
Dank Olgas Intervention war die Geschichte mit der Krätzmilbe gut abgelaufen. Aber sie brachte einem zum schrecklichen Bewußtsein, welchen furchtbaren Gefahren und Angriffen ähnlicher Art Fléchambeau bei seinem ständigen Kleinerwerden ausgesetzt sei. Welches würde wohl sein Los sein bei den Mikroben, wenn ihn — ein armer, verlassener Schiffbrüchiger auf öder Insel — nichts als geheimnisvolle Tiere umgeben?...
Die Tage gingen ins Land und das unerbittliche Schicksal Fléchambeaus erfüllte sich mehr und mehr. Er ward zum Molekül, zum Atom. Man mußte zu dem Übermikroskop Zuflucht nehmen, das stärkste Wahrnehmungsinstrument, das man bisher erfunden hatte.
Düstere Trauer lag über Pons' Haus. Herr und Frau Monempoix ließen sich nicht mehr blicken. Man hätte sie übrigens gar nicht in das Laboratorium eingelassen. Außer Pons, Olga und dem treuen Valentin, der alle Anstrengungen listiger Reporter, die gern herausgebracht hätten, was eigentlich los sei, zuschanden machte, betrat niemand den Raum.
Aber das Getratsch hatte seine Arbeit getan. Die Presse berichtete über das rätselhafte Verschwinden eines jungen Mannes, der sich in Saint-Jean-de Nèves aufgehalten habe. Es lag etwas Geheimnisvolles, Wunderbares in der Luft.
Pons erwiderte jedesmal, wenn man ihn fragte, Fléchambeau sei abgereist. Wohin, wisse er nicht.
Nichts konnte wahrer sein. Wie aber sollte man die langen Besuche Olgas plausibel erklären? Das war nicht leicht. Diese Besuche allein straften Pons Worte Lügen. Erst als sie aufhörten, glaubte man ihm endlich.
Der letzte Besuch gestaltete sich über alle Maßen rührend.
Es wäre für Fléchambeau zu gefährlich gewesen, ihn der Bestrahlung auszusetzen, welche der Gebrauch des Übermikroskopes bedingt. Pons hatte daher die Zahl der Beobachtungssitzungen streng geregelt.
Eines Sonntagsmorgens sagte er zu Olga.
»Kommen Sie bestimmt heute nachmittag, ich glaube, daß heute abend...«
Tag der Trauer. Längst hatte man ihn vorausgeahnt und gefürchtet. Zum letzten Male sollte sie heute ihren Herzallerliebsten sehen, der ihretwegen, weil er sie anbetete, jene verhängnisvollen Pillen verschluckt hatte und jetzt zur Unterwelt hinabstieg, aus der es keine Wiederkehr gibt.
Sah sie ihn? Konnte sie unter der Masse der durcheinander wirbelnden Stäubchen und Formen, die von dem runden Lichtkreise des Objektivs beleuchtet wurden, den ultramikroskopischen Menschen unterscheiden? Sie bildete es sich mindestens ein, als sie einen kaum sichtbaren Punkt entdeckte, der sich nicht bewegte.
Fléchambeau vermied es nämlich seit einiger Zeit, sich von der Stelle zu rücken. Pons ängstigte sich sogar wegen dieser Unbeweglichkeit. Was war der Grund? Krankheit? Ein System? Klebte er wie ein Bazillus auf seinem Glasplättchen fest? Tot konnte er nicht sein, da er fortfuhr, immer noch kleiner zu werden.
»Ich sehe ihn!« sprach Olga und hob den Kopf.
Dann setzte sie ihre Beobachtung fort und sagte nach einer Weile traurig.
»Jetzt sehe ich ihn nicht mehr... Ah, doch!... nein...«
Pons blickte seinerseits durch das Übermikroskop, konnte aber nichts mehr von Fléchambeau entdecken.
Er war verschwunden.
In Tränen aufgelöst, sank Olga in einen Fauteuil. Pons stand wortlos neben ihr. Was sie im Geiste sahen, würgte ihnen die Kehle zu.
Ein neuer Horizont verbarg vor ihren Augen den Reisenden, der sich immer weiter von ihnen entfernte — entfernte in einer noch unbekannten Weise, in das Unendliche, doch ohne einen Schritt zu tun, ohne sich vom Platze zu bewegen.
»Nie, nie wird er zurückkehren,« jammerte Olga.
Pons erhob die Arme zum Himmel und ließ sie schlaff wieder herabfallen. Olga sah, wie er sanft und pietätvoll — als drücke er einem teuern Entschlafenen die Augen zu — das Mikroskop mit einer Glasglocke bedeckte.
»Ich werde morgen kleine Keile unter den Rand des Glassturzes schieben, damit die Luft Zutritt hat,« sagte er.
Tränen in den Augen, blickte ihn Olga an, während sie den Hut aufsetzte.
An seiner Stimme merkte sie, wie bewegt er war. Zum ersten Male nahm sie den sinnberückenden Umfang seines »Gehirnkastens« wahr. Aber sie weilte ja nicht seinetwegen hier, vermochte ihren braven Eltern gegenüber nicht mehr ein Dableiben zu rechtfertigen.
Andachtsvoll betrachtete sie ein paar Sekunden die glänzende Glasglocke, unter der ihr Verlobter eben die Grenze menschlichen und wissenschaftlichen Sehfeldes überschritten hatte.
Pons fand sie eines großen Glückes würdig. Verständnisinnig gaben sie sich die Hände; dann entfernte sie sich schlicht und natürlich.
Dr. Pons blickte Fräulein Olga nach, als sie den Platz der Republik überschritt, um sich zu Vater und Mutter zurückzubegeben. Dieser liebliche Anblick hemmte ein wenig die ungeheure Verlassenheit, die nun jäh über ihn hereinbrechen sollte.
Die Glyzinien waren verwelkt. Inmitten goldgelben Blattwerks lag der Platz der Republik, und die allegorische Gestalt der Republik verzichtete darauf, ihr Antlitz im Spiegelbild des Bassins zu betrachten (hätte sie es bei einem solchen Busen überhaupt vermocht?), und quer über diesen Platz bewegte sich Olga mit graziöser Würde heimwärts.
»Sie ist wirklich ganz reizend,« murmelte Pons.
Nicht ungestraft sieht ein junger Mann ein junges Mädchen vorübergehen, und noch viel weniger ungestraft kann er täglich, eindrucksvolle Stunden lang, mit ihr allein zusammensein. Als Olga ihm die Rechte gedrückt, hatten sich sein Blick und ihr Blick miteinander »vermählt« — wenn Pons sich so ausdrücken durfte. Er bewunderte sie. Wie selbstlos, wie mutig hatte sie der üblen Nachrede getrotzt und bis zum bittern Ende Fléchambeau gegenüber ihre Pflicht erfüllt, indem sie täglich zu Pons kam und sich nicht darum kümmerte, daß es alle bösen Klatschbasen sahen und wußten.
Wieso gedachte Pons jetzt nicht ohne Gehässigkeit des Staatsanwalts Bargoulin? Wieso fragte er sich, wie wohl der Herr Präsident und die Frau Präsidentin über seine eigene Person denken mochten?
Warum bereute er es, in »Bichonnes« Gemüt nicht jene Schrulle genährt zu haben, die eines Abends seine komische Art in ihr geweckt hatte?
Aber Olga verschwand, die Galgenfrist war abgelaufen. Die Einsamkeit senkte ihre grauen Fittiche auf ihn herab.
Doch war er wirklich so einsam? Dort stand ja das Mikroskop mit Fléchambeau darunter!
Apropos —
Fléchambeau... was reimt sich doch darauf?... Pons mußte sich Gewalt antun, um nicht in diesem unpassenden Momente irgendeinen läppischen Reim zu schmieden, denn so niedergeschlagen er vorher gewesen war, um so lichter fühlte er sich jetzt im Geiste.
»Fléchambeau,« seufzte der Doktor melancholisch, »Du nimmst jetzt mehr Raum ein, als wenn du wirklich da wärest!« — Doch, war Fléchambeau nicht gleichzeitig da und nicht da? Sonderbar dieses gleichzeitige Dableiben und Sichentfernen. Sonderbar auch diese Gegenwart und zugleich diese Abwesenheit! »To be and not to be«, realisiertes Paradoxon. Erfüllte Unmöglichkeit! Fléchambeau — niemand mehr und doch jemand! Jemand — wie lange? Wer wird jemals die Minute seines Hinscheidens erfahren? Lebte er überhaupt noch?
Er war Waise und ohne Familie. Das vereinfachte die Sache. Nicht einmal ein weitläufiger Verwandter war zu benachrichtigen. Vorerst brauchte man nur ein paar Monate herumzuerzählen, Fléchambeau habe eine Reise angetreten, wohin, wisse man nicht. Später hatte man noch immer Zeit, sich etwas anderes auszudenken, zu sagen, Fléchambeau habe niemandem geschrieben; was aus ihm geworden sei, hatte man nicht erfahren. Das Gericht würde ihn für verschollen erklären. Verschollenheit ist ein legaler Zustand wie jeder andre. Man ist dem Gesetze nach »verschollen«, wie man minderjährig, geschieden oder der bürgerlichen Ehrenrechte beraubt ist. Damit ist alles gesagt.
Pons hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht, nämlich ohne seine Zeitgenossen, ohne das Faktotum Valentin, ohne sich selbst.
Er fing an, sich zu langweilen. Seine Parasitologie sagte ihm gar nichts mehr. Er empfand vor seinen Arbeiten einen unwiderruflichen, untilgbaren Ekel. Sein Laboratorium erfüllte ihn überdies wegen des Übermikroskopes und dessen Glasglocke — es schien ihm das reinste Ehrengrab — mit Trauer. Wenig fehlte, und er hätte einen Kranz Immortellen darauf gelegt.
Auch seine Enttäuschung hatte einen bitteren Nachgeschmack in ihm zurückgelassen. Seinen verzückten Blicken hatte sich bereits die Pforte des Ruhms halb geöffnet — aber nur für einen Moment. Seine Entdeckung war nun gerade gut genug, um ihn lächerlich zu machen. Die Menschen in ihrer Dummheit und Bosheit widerten ihn an. So ist's immer. Erleidet jemand Schiffbruch, sind stets die andern daran schuld.
Doch kommen wir auf das Faktotum Valentin zurück. Höchst ehrerbietig gab er seinem Herrn bekannt, daß er seine »acht Tage machen« wolle, da er zu heiraten gedenke und sich zur Bewirtschaftung eines kleinen Gutes, das er im Département Aube, in der Nähe von Troyes, besaß, dorthin zurückziehe.
Pons fluchte den Weibern, der Landwirtschaft und dem Département Aube. Doch was konnte er machen?
Und nun zu den Zeitgenossen!
Sie benahmen sich unausstehlich. Die Geschichte von der »Abreise« schluckten sie nicht so mir nichts, dir nichts. Sie wollten durchaus wissen, was aus Fléchambeau geworden sei, und was sich innerhalb der vier Mauern des Hauses abgespielt hatte, in das man ihn eintreten, nie aber herauskommen gesehen hatte. Pons wurde mit Fragen bestürmt, und die Leute sparten nicht mit faustdicken Anspielungen und doppelsinnigen Ausdrücken.
Er hatte es satt.
Und eines Tages hätte er sich fast auf die Suche nach Fléchambeau gemacht. Schon schaukelte er in der hohlen Hand zwölf der verhängnisvollen roten Pillen. Aber der Gedanke an Olga hielt ihn vom Äußersten zurück. Er fühlte sich glücklich, als er sich dabei ertappte. Aber das war kein Hindernis, um abzufahren... für ein paar Monate, natürlich nicht in das Reich der Mikroben, sondern nach irgendeinem anderen Teile des Planeten Erde, seinerseits eine Reise anzutreten, diesmal wirklich, ohne eine Adresse zu hinterlassen, irgendwohin eine Wallfahrt zu unternehmen, nach Italien, Kalifornien, in ein Land, wo die Orangen blühen. Es mußte sein. Es war zwar blöd, aber, wie gesagt, es war notwendig. Not bricht Eisen. Eine kleine Luftveränderung konnte ihm nur wohltun. Schon der Gedanke an eine neue Umgebung regte seine dichterische Phantasie an und ließ ihn singen:
»Sattle, Knappe, mir den Hengst
Oder mein Freilaufrad,
Denn es wird mir hier schon längst
Über die Maßen fad.«
In der Nacht nach Valentins Abschied packte Pons etwas Wäsche in einen Rucksack ein, vergewisserte sich, daß die Glocke vorschriftsmäßig das Übermikroskop bedeckte, schloß sämtliche Fensterläden, verließ das Haus durch eine Hintertüre, schwang sich aufs Fahrrad und verließ nächtlicherweile Saint-Jean-de Nèves, um in der nächsten Station den Zug zu besteigen und nach der neuen Welt abzudampfen.
Im Februar kehrte Pons nach Saint-Jean-de Nèves zurück. Amerika hatte ihn in keiner Weise befriedigt, und er verstand nicht, weshalb man ein so großes Getue mit Christoph Kolumbus oder, wenn auch etwas weniger, mit Amerigo Vespucci mache.
Überdies fehlte ihm die innere Ruhe, die selbst die banalste Landschaft interessant erscheinen läßt. Eine Menge Dinge gingen ihm im Kopfe herum. Fléchambeau, den er in der unendlich großen Welt des unendlich Kleinen verloren, »Maria-Stuart«, die er Valentin geschenkt hatte, sein im Stich gelassenes Heim, das er geflohen wie ein Schuldbewußter.... Sein Briefkasten mußte übergehen... und auf der Post sich die Masse der Einschreibsendungen zu einem Turme aufgehäuft haben.... Was sollte man dort von ihm denken?... Und Olga, sapperment, und Bargoulin, dieser ekelhafte Bargoulin!
Er hätte ja schreiben können, gewiß, aber er hatte sich geschworen, es nicht zu tun, und jeder Meineid war ihm ein Greuel.
Er fühlte sich daher recht unsicher, als er aus dem Bahnhofe in Saint-Jean-de Nèves trat und sich dem Platze der Republik zuwandte.
Es schneite. Fast niemand war im Freien. Der Himmel war dunkel wie ein Hangardach. Lähmendes Schweigen herrschte. Der Pulverschnee knirschte unter seinen Tritten, und die Flocken wirbelten vom Himmel und sangen ihr stummes Lied.
Der Gedanke an sein kaltes, verstaubtes und düsteres Haus machte ihm wenig Spaß. So stapfte er durch den Schnee, die Hauptstraße entlang. Aus dem kahlen Geäste der Chausseebäume herab spotteten die Raben, dieses schwarze Himmelsungeziefer, ihm krächzend nach. Und die Dohlen umflatterten mit entrüstetem Geschrei die Kirche von Saint-Jean-de Nèves.
Der Bronzerepublik hatte der Winter einen weißen Hermelinmantel umgeworfen. Hoheitsvoll blickte sie drein wie eine Negerkönigin.
»He!« brummte Pons und zog die Stirn in krause Falten.
Verdutzt stehenbleibend, blies er den Rauch seines Atems von sich. »Was soll das bedeuten?«...
Die Läden seines Hauses waren geöffnet.
Er stürzte vorwärts und klinkte mit fiebernder Hand die Haustüre auf.
»Teufel, ist's da kalt!«
Die Türe knirschte auf.
Im Parterre alles in Ordnung. Staub, Leere.
Erster Stock — sein Schlafzimmer ebenso.
Aber in Fléchambeaus Stube herrschte eine bange Atmosphäre.
Pons mußte seinen ganzen Mut zusammennehmen und dem Schlage seines Herzens gebieten, sein Ohr einer innern Stimme verschließen, die ihm zurief: »Du träumst!«
Wenn das große Unbekannte durch eine Türe verschlossen wäre, könnte man sie nicht mit größerem Entsetzen, größerer Aufregung und Ängstlichkeit aufstoßen, als Pons jetzt die Pforte seines Laboratoriums öffnete.
Sollte vielleicht zufällig...?
Aber Unsinn! Jedenfalls hatte sich nur irgendein Vagabund, am Ende ein Dieb, oder ein xbeliebiger armer Teufel eingeschlichen, um, Pons' Abwesenzeit benützend, sich ins warme Nest zu setzen. Aber Fléchambeau... zum Henker... vorwärts, vorwärts!
Er stand im Zimmer.
Sofort fiel ihm der bewohnte Eindruck, den der Raum machte, auf. Auf dem Ofen, in dem das Feuer ausgegangen war, standen zwei Kochtöpfe. Das Bett zog seine Aufmerksamkeit auf sich. Es lag jemand darin.
Den Traum verschluckte die Wirklichkeit.
Der Betreffende, ein alter Kerl, sah aus, als habe es auch auf ihn herabgeschneit, so schlohweiß waren seine Haare und der Bart, der sein ganzes Gesicht bedeckte. Der Greis lag ganz keck in Fléchambeaus Bett! Er sah blaß aus und hatte die Augen geschlossen. Trotz der Kälte stand sein Hemd vorn auf der Brust offen, deren fahle Haut mit Tätowierungen über und über bedeckt war.
Pons bestaunte die Füße des Unbekannten, nicht wegen ihrer grünlichen Farbe und weil sie nackt waren, sondern ob ihrer riesigen Größe und da sie weit über die Liegestatt hinausragten.
Auf seine ursprüngliche Idee zurückkommend, doch nicht daran zu glauben wagend, rief Pons mit erstickter, keuchender Stimme:
»Fléchambeau!«
Der Mann hob die Lider und lächelte matt.
Seine langen Arme streckten sich aus.
»Pons,« murmelte er, »alter, lieber Pons!«
»Du bist es wirklich, Fléchambeau? Ist's denn möglich?«
Der Mann gab keine Antwort. Er ließ den Kopf zur Seite herabhängen.
Um Himmelwillen, der Mensch schien im Verscheiden!
Pons erinnerte sich seiner ärztlichen Kunst. Er untersuchte den Kranken und ward sich klar, daß Fléchambeau das Charakteristische eines hohen Alters — mindestens 90 Jahre — zeigte und ganz einfach im Begriffe stand, an Altersschwäche zu sterben.
Mit 25 Jahren an Altersschwäche zu sterben! Ein 90jähriger Greis zu sein, wenn man 25 Jahre zählte — das war bisher noch nicht dagewesen! Und was bedeuteten alle diese Tätowierungen!
Doch ehe er irgendwelche Fragen an diesen sonderbaren Altvordern stellen konnte, war es unumgänglich notwendig, ihm erst wieder die Sprache zu verschaffen und ihn zu hindern, in ein Land abzufahren, von wo noch niemand zurückkehrte. Pons eilte in den zweiten Stock, rannte ins Laboratorium und stieg wie aus der Kanone geschossen wieder die Stiege herab, nachdem er sich durch einen flüchtigen Blick überzeugt hatte, daß die Glasglocke noch immer das Übermikroskop bedeckte.
Er machte Fléchambeau an passender Stelle eine Einspritzung — wahrscheinlich mit Coffein oder Kampheröl, das ist irrelevant. Wesentlich für uns ist nur, daß Fléchambeau zu niesen begann, was immer ein Zeichen wiedererwachender Lebensgeister ist.
Pons zündete den Ofen an und stellte Wasser auf.
»Komm,« sagte Fléchambeau, »neige dich zu mir herab... Du siehst, wie alt ich geworden bin!«
»Allerdings, aber... wie kommt das?«
»Ich war ja so klein... so furchtbar klein, die Zeit verstrich für mich... Viel rascher... die Eintagsfliege durchlebt ja auch ein ganzes Leben im Verlaufe, eines einzigen Tages...«
»Gewiß, doch sag' mir...«
Schmerzlich lächelnd hauchte der alte Mann:
»Ich glaube nicht, daß ich dir noch viel zu erzählen vermag. Meine Minuten sind gezählt.«
»Tatata!« widersprach Pons. »Was redest du da? Jedes Menschen Minuten sind von der Sekunde der Geburt an gezählt. Die deinen...«
Fléchambeau schüttelte den Kopf.
»Bei meinem Begräbnis möchte ich Musik haben.«
Pons reimte mit Galgenhumor:
»Senkt ihr mich in schwarzer Truhe
In das Grab zur letzten Ruhe,
Soll es mit Musik geschehen,
Möchte alles lustig sehen.
Aber so weit sind wir noch nicht, beim Kuckuck! Hundertfünfzig Jahre wirst du noch leben, so wie die Papageien, deren Zungengeläufigkeit du besitzest. Überhaupt, du magst tun und sagen, was du willst. Dein Ergreisen ging nicht auf natürlichem Wege vor sich. Ich betrachte es vielmehr als eine Art Krankheit, die man kurieren kann. Und ich werde dich wieder gesund machen.«
»Deine Behandlungen sind nichts für mich,« lehnte Fléchambeau höflich ab. »Ich habe genug von ihnen. Es kann ja sein, daß du mich von meinem hohen Alter heilst, aber es erginge mir wie schon einmal: ich würde unaufhaltsam jünger und jünger werden und schließlich, lieber Freund, in fünf oder sechs Wochen wieder zum Wickelkinde... nein, Pons, verzeih', ich verzichte auf dies Vergnügen, weißt du?... Ich ziehe lieber den gegebenen Zustand vor.«
»Aber lieber Alter...« — Pons hielt inne. Das Wort »Alter« klang hier etwas unschicklich. Er ging rasch auf ein anderes Thema über. —
»Olga...« sagte er. »Ich weiß, sie ist noch unvermählt.«
»Ich wollte dich fragen, ob ich sie benachrichtigen soll?«
»Hüte dich! Seit meiner Rückkehr tat ich alles, um nicht mit ihr zusammenzutreffen. Ich könnte ja ihr Ur-Urgroßvater sein, lieber junger Freund. Olga ist für mich eine Jugenderinnerung, eine liebliche Erinnerung, aber auch nur eine Erinnerung.«
»Und du bist schon lange zurück?«
»So lange, daß ich schriftlich meine Reiseerlebnisse in großen Zügen niederlegen konnte. Dort auf der Kommode, das Heft... es gehört dir.«
Pons ergriff das Heft.
»Lies es, lies es jetzt, Pons. Später bin ich vielleicht nicht mehr imstande, dir nähere Aufklärungen zu geben.«
»Unsinn! Wenn dein letztes Stündlein nahe wäre, könntest du nicht so viel schwätzen. Doch was bedeuten diese Tätowierungen, Fléchambeau?«
»Lies das Heft, da wirst du es erfahren. Aber schieb' es nicht auf die lange Bank, bitte. Ich fühle mich jetzt behaglich und warm. Lies, sag' ich dir!«
Obwohl Pons überzeugt war, daß seinem Freunde noch ein langes, sorgenloses und friedliches Leben und ein gesundes Alter bevorstand, wollte er ihm in diesem Moment doch nicht widersprechen, um ihn nicht aufzuregen. Daher setzte er sich zum Ofen hin, schnitt ein vergnügtes Gesicht und deklamierte, auf das Herz klopfend:
»Welch großer Bucherfolg, auf Ehre,
Hier dieses Tagebuch doch wäre!«
Fléchambeau setzte eine gottergebene Duldermiene auf — er kannte ja die schwache Seite seines Freundes —, und dieser las, was man jetzt lesen wird.
Mein lieber Pons!
Ich kehre aus einer unendlich kleinen Welt zurück. Ich tauche aus dem Unsichtbaren auf, das die Menschen »das Nichts« nennen. Aber der Raum, den ich wieder betrete, ist leer. Du bist nicht da. Wo bist du? Und werde ich noch dasein, wenn du zurückkommst, werde ich noch leben? Einen Greis hättest du progressiv aus dem Nichts erstehn und mit einer dich verblüffenden Geschwindigkeit seine ursprüngliche Gestalt wieder annehmen sehen können, einen Greis an der Schwelle des Grabes.
Groß ist meine Enttäuschung, denn groß war meine Freude, wieder mit dir zusammenzukommen, um dir alle meine Abenteuer, die ich erlebte, zu erzählen. Solltest du von deinem Fléchambeau nur mehr einen stummen, leblosen Überrest vorfinden, so möge mindestens diese Schrift dir in großen Zügen das Nötige bekanntgeben. Ich flehe zu Gott, daß er mir die Kraft verleihen möge, mein Werk zu Ende führen zu können.
Zunächst magst du erfahren, daß ich in dem Momente das Bewußtsein verlor, als ich unter den von den Gelehrten mehr oder minder bekannten Kleinwesen untertauchte, über deren Natur und Eigentümlichkeiten du mir etwas mitgeteilt hattest. War ich in diesem Stadium des Kleinerwerdens noch sichtbar für deine Augen? Wenn ja, muß dir die Regungslosigkeit meines Körpers keinen üblen Schreck eingejagt haben.
Schuld an meinem Schwächeanfall trugen sicherlich die Veränderungen, die sich in meiner Physis einstellten, zweifelsohne auch die Schwierigkeit, die ich beim Einatmen einer für mich zu dicht gewordenen Luft hatte, dann meine mangelhafte Ernährung, an der ich schon längere Zeit laborierte. Das eine steht fest: als meine Umgebung anfing, einen tatsächlich phantastischen und höchst beachtenswerten Anstrich zu bekommen, fühlte ich mich der Wahrnehmungsfähigkeit beraubt. Unter meinen Füßen schwankte der Boden aus poliertem Glase, das mir wie eine unermeßlich weite chaotische Fläche, wie ein riesiges Felsenplateau, vorkam. Sich herabsenkende Nebel verhüllten mir den Anblick der seltsamen Pflanzen und Lebewesen, welche dir atomhaft, mir aber riesig erschienen. Ich mußte mich niederlegen um nicht hinzufallen. Es ward mir dunkel vor den Augen, eine Ohnmacht lähmte meine Glieder. Ich glaubte, jetzt sei es aus, und es war mir, als sei — außer dir — niemals etwas gewesen.
Plötzlich keimten vage Eindrücke in mir auf und weckten mich aus meiner Starrheit. Ich wähnte, das Objektiv des Mikroskopes zu sehn — eine ungeheure Scheibe voller dunkler Reflexe —, und dann nahm ich die Spitze einer jener feinen Nadeln wahr, mit denen du den Staub aus meiner Nähe entferntest. Sie erschien mir als rauhe, mit Hökern und Gruben gespickte Masse.
Ein Gemurmel erhob sich.
Ich öffnete ein wenig die Lider.
Noch immer befand ich mich in liegender Stellung, aber auf einem weichen Bett, das in einem kahlen Zimmer stand, welches von einem violetten Lichte ganz erfüllt war.
Vier Männer umstanden mich, von denen einer sich über mich beugte, als ich erwachte.
Ich staunte. Menschen! Wie ich! Hatte ich alles nur geträumt?... Oder träumte ich jetzt erst?
Regungslos beobachtete ich die Männer zwischen meinen halbgeschlossenen Lidern.
Der sich über mich beugte, war ein ziemlich alter Mann mit angenehmem Gesicht und freundlicher Miene, aber mit ziemlich ausdruckslosen Zügen, wie ich sie später auch bei den anderen wahrnahm. Er trug eine Brille von mir unbekannter Konstruktion.
Der zweite, ein hübscher Mensch mit kleinem Schnurrbärtchen, schien mir seinem Äußern nach noch jung zu sein.
Die andern beiden, die sich etwas abseits hielten, zeichneten sich durch grüne Farbe aus, ein Grün, wie es matte Bronze aufweist.
Alle vier trugen russische Blusen und schottische Knieröckchen. Die Beine waren nackt. Ihre Füße steckten in pantoffelartigen Sandalen, welche die Fersen freiließen. Ihre Kleidung zeigte verschiedene Muster in neutralen Schattierungen, die bei den grünen Männern noch neutraler waren. Die Haare, auch die des alten Herrn, waren rund geschnitten und verhüllten die Ohren. Das Sonderbarste aber an ihnen war ein Pompon — ein Gebilde, ähnlich der kugelförmigen Dolde einer blühenden Zwiebel —, der ihnen an einem Stiele mitten auf dem Scheitelpunkte des Schädels saß und bei dem alten Herrn rot, bei den jüngeren grün und bei den andern braun gefärbt war.
Diese von keiner Mütze bedeckten Pompons erregten mein Interesse. Mit ihren kurzen Stielen machten sie mir den Eindruck von Rangabzeichen, wie zum Beispiel die verschiedenfarbigen Knöpfe auf den Kopfbedeckungen der Mandarinen. Zweifelsohne befand ich mich inmitten von Mandarinen. Doch wie waren diese Dinger auf ihrem Haupte befestigt? Darüber konnte ich mir nicht klar werden.
Bald ward ich dessen inne. Der gütige alte Herr streckte die Hand aus und hob eines meiner Lider in die Höhe.
Da bemerkte ich, daß er an jeder Hand sechs Finger hatte statt fünf. Doch vorsichtshalber rührte ich mich nicht und begnügte mich, festzustellen, daß auch die andern an jeder Hand sechs Finger besaßen.
Inzwischen konstatierte mein Beobachter, daß ich aus meiner Ohnmacht erwachte. Er drehte sich nach seinem jüngern Kollegen um und neigte dabei ein wenig den Kopf, so daß ich erkannte, daß der Pompon aus seinen Haaren herauswuchs wie eine Blume aus Gras. Und dieser Pompon, diese Quaste, Blume, Dahlien- oder Chrysanthemenart, begann auf seinem kurzen, dicken Stengel zu schwingen, während die andern mit jeder Bewegung geizten, dafür aber ein ganz leises Summen vernehmen ließen.
Sie gruppierten sich dicht um mein Bett, das mitten im Zimmer stand.
Nun öffnete ich die Augen vollends und sah folgendes merkwürdige Bild: Vier Männer, zwei davon von grüner Farbe, alle mit zwölf Fingern an den Händen, die aufmerksam auf mein Wiedererwachen zum Leben lauerten. Ich erkannte sofort, daß sie mich weniger mit den Augen als mit den Pompons wahrnahmen. Diese kugelförmigen, gesträubten Gebilde waren zweifellos Bestandteile ihres Körpers. Sie streckten ihre Stiele und starrten mich an. Dabei erinnerten sie an die Augen der Languste und der Schnecke mit ihrem vorn an der Spitze angebrachten Sehorgane — einem menschlichen Augensterne — oder einer Seeanemone. Denn dieser außerordentlich seltsame Pompon schwang und bewegte sich hin und her, streckte sich und ließ seine sämtlichen Fühlfäden oder, besser ausgedrückt, seine schön gefärbten Antennen nach allen Richtungen hin flattern. Er richtete sie auf, kräuselte oder legte sie zu einem steifen Büschel zusammen nach einem bestimmten Zielpunkte. Dabei zeigten sie einen dunkleren Mittelpunkt, den sie, wie die Blätter einer Chrysantheme das Herz der Blume, oder die Iris des Auges die Pupille, umgaben. Und wie bei der Meeranemone trat diese wunderbare »Pupille« zuweilen für einen Moment mit harmonischer Kreisbewegung in ihren Tubus zurück, verschwand wie ein zwinkerndes Auge und breitete sich dann wieder in wundervoll strahlender Spirale aus.
Momentan richteten sich die vier Pompons auf mich hin und wurden von meiner Verblüffung angezogen. Dabei blieben die vier Gesichter ihrer Besitzer merkwürdig ausdruckslos. Diese Menschen, die nicht meinesgleichen waren, »windeten« — wie der Weidmann vom Wilde sagt, das die Luft durch den »Windfang« einzieht —, sie beschnüffelten mich um die Wette, indem sie die Nasenflügel auf das Ungenierteste hochzogen. Ihre Riechorgane waren groß, ihre Augen klein und ohne Feuer, der Mund fast lächerlich winzig mit ganz dünnen Lippensäumen. Auch ihre Ohren — ich entdeckte sie, als einer der Leute durch eine Kopfbewegung sein Haar schüttelte — waren wie die eines Säuglings. Aus dem Gesagten, Pons, wirst du verstehn, weshalb ihre Gesichter nicht das Mienenspiel aufwiesen, das uns eigen ist, um unseren Gefühlen Ausdruck zu verleihn.
Ich ahnte ja gleich, daß der Pompon ein uns fehlendes Sinnesorgan war. Es ward mir dies aber zur Gewißheit, als ich wahrnahm, daß diese Menschen da eine vorzügliche »Nase«, ein großartig entwickeltes Witterungsvermögen, aber ein schlechtes Sehvermögen besaßen, und daß sie halbtaub und halbstumm sein mußten.
Ich erhielt darüber einen näheren Beweis, als der gütige alte Herr, müde, mich zu betrachten, seine Brille abnahm und sie an seiner weichen Bluse abwischte, was er dann auch mit gewissen Federchen aus einem glänzenden Metall vornahm, das er aus seinem Pompon herauszog, und das jene silberne Schattierung hervorrief, welche ich anfangs für natürlich angesehn hatte. Diese Metallfederchen versahen die Funktion einer Brille in dem durch das Lebensalter schon etwas schwächlich gewordenen Pompon.
Hierauf zog der alte Herr aus einer Tasche, die ihm am Gürtel hing, einen kleinen Zerstäuber und vaporisierte sich damit den Pompon, während sein jüngerer Kollege eine offene Schachtel herumreichte, die in verschiedenen Fächern irgendein Pulver enthielt, von dem die Anwesenden je eine Prise nahmen und aufschnupften. Dabei bewegten sich ihre Nasenflügel in einer Art, die offensichtlich glückseliges Lächeln bedeutete.
So wie wir durch den Ausdruck unserer Blicke jemandem danken oder unsere Freude kundgeben, so taten diese Wesen es, indem ihre Pompons sich schüttelten und hin und her hüpften. Auch ihre Mienen hellten sich etwas auf.
All das beruhigte mich. Deshalb richtete ich mich in sitzender Stellung auf und sagte:
»Meinen Gruß, ihr Herren!« worauf ich mehrmals nieste. Beim fünften Male stieß ich mit dem Ellbogen gegen ein Tischchen, das neben mir stand, und auf welchem sich verschiedene Medizinflaschen befanden. Eine fiel um und zerbrach. Sie enthielt einen smaragdgrünen Likör, der einen ziemlich starken Geruch verbreitete.
Du hättest glauben können, daß die vier Burschen plötzlich einen »Swing« mitten auf die Nase bekommen hätten, derart fuhren sie unter der Wucht des Geruches in die Höhe. Sie waren wie von jäher und vehementer Lichterscheinung geblendet. Mit ihren zwölf Fingern verstopften sie sich die Nase, mit Ausnahme eines der grünen Männer, der nach dem Fenster stürzte und es aufriß. Das ansonsten kreisrunde Zimmer wies nämlich ein Fenster auf, ein einziges, dessen Scheiben aber weich waren und sich wie Vorhänge aufziehn ließen.
Was der grüne Mann tat, klärte mich über die Natur des im Raume herrschenden violetten Lichtes auf. Ich dachte, es stamme von der Färbung der Scheiben her. Weit gefehlt. Ein wundervoller, nicht goldener, sondern lila Sonnenstrahl drang in die Stube, und gleichzeitig ward es so warm, daß mich sofort der Schweiß bedeckte. Ich fuhr mir mit der Hand durch das Haar. Dessen Länge und mein langgewachsener Bart versetzten mich in Staunen.
Meine »Mandarinen« (da ich keinen besseren Namen für sie weiß, behalte ich diese Bezeichnung bei) hatten sich von ihrem Unwohlsein erholt. Der alte Herr (ich will ihn »Agathos« nennen) sah, wie mir heiß wurde, und ließ seinen Pompon eine Drehung machen. Sofort beeilte sich der zweite grüne Neger, die Hähne eines Ventilators in Tätigkeit zu setzen, während der andre das Fenster schloß. Agathos hielt seine Hände über den Ventilator, oder besser gesagt, über den Kälteerzeuger, um sich an dessen wohltuenden Ausstrahlungen die Hände zu kühlen.
Er wandte mir hierbei den Rücken zu, aber mit seinem Pompon ließ er mich nicht »aus dem Auge«. Bewunderung erfüllte mich für dieses Organ, das die schwache Seite unseres menschlichen Körpers korrigiert, unseren Rücken, unsere mit Wahrnehmungswerkzeugen nicht ausgestattete Kehrseite, die uns zur Hälfte kraft- und machtlos macht und jeden von uns zum Halbgelähmten stempelt. Denn der Mensch ist (ein geborener Soldat!) zum Front- und Kehrtmachen geschaffen. Seinen armen Rücken, der wie die dunkle, armselige Leinwand der Rückseite eines Gemäldes ist, darf er niemals betrachten, muß ihn aber zeitlebens hinter sich herziehen.
»Meine Herren, erklären Sie mir, bitte, was mit mir geschehen ist?« begann ich wieder.
Noch dichter drängten sie sich an mich heran. Ihre Mienen verrieten äußerste Gespanntheit. Um besser zu hören, hoben sie ihr Haar von den Ohren ab. Ihre Blicke fixierten meinen Mund, ihre Pompons sträubten alle ihre Fühlhörner mir entgegen.
»So ein Pech!« dachte ich mir. »Sie verstehen kein Sterbenswörtchen, und ich werde, immer, immer kleiner werdend, ihre Welt verlassen, ohne davon etwas kennengelernt zu haben!«
Agathos wandte sich jetzt mit seinem Pompon an den jungen Mann, den ich, trotz seiner Riesennase, als schön bezeichnete, und den ich beschloß, »Kalos« zu benamsen.
Kalos bedeckte jetzt den eigenen Pompon mit einer Art Helm, der als Bekrönung einen lyraförmigen Empfänger trug. Du hättest, so wie ich, ohne weiteres begriffen, daß er sich mit irgend jemandem mittels der stummen Sprache des Pompons in »Telekorrespondenz« setzte. Und du würdest dich nicht getäuscht haben.
Wenige Sekunden später erschien auf einem Plateau, das auf einem Wandpostament angebracht war, ein anderer Apparat. Durch irgendeine übernatürliche Erfindung war er auf wunderbare Weise dorthin geschafft worden, wahrscheinlich auf Fernübertragungswege durch Auflösung des Objektes und Wiederzusammensetzung im Angesichte des Adressaten.
Agathos nahm den Apparat, den ihm Kalos reichte. Stelle dir eine geheimnisvolle Maschinerie vor in einem Kästchen, aus welchem zwei trompetenartige kleine Trichter herausragen. Agathos führte die eine Schallöffnung an seine, die andre an meine Stirne, und nun, lieber Pons, erlebte ich das Wunderbare eines wortlosen Zwiegespräches, das Unerhörte, die Gedanken eines andern ohne Vermittlung einer Zeichen- oder Lautsprache zu vernehmen. Diese Unterhaltung, die sozusagen von Gehirn zu Gehirn gepflogen wurde, entbehrte natürlich auch jeglicher Form und jeden Stils.
Auf diese wunderbare und herrliche Art der Übertragung ließ mich Agathos wissen, daß eines Tages ein riesiges Ding, etwas, das wie ein überproportionales Gestirn aussah und sich auf seinem Wege zusammenzog, auf ihrem Himmel erschien. Man hätte glauben können, daß sich der unendliche Raum kondensiere. Aber die Astronomen verkündeten, daß es sich um einen Himmelskörper handle, der sich im Stadium des Festwerdens befinde und herabstürze auf...
Hier vermochte ich Agathos' gedanklichen Ausführungen nicht ganz zu folgen, bzw. nicht genau zu verstehen, auf »was« der Himmelskörper »herabstürze«, ich nehme an, auf den Planeten der »Mandarinen«, den ich »Ourrh« nenne, und zwar weil ihn Agathos später, als ich ihm die Rudimente unserer Sprache beigebracht hatte, so benannte.
Doch weiter im Texte!
Ich war auf »Ourrh« als Mikromegas gelandet, aber als kleiner werdender Mikromegas. Bis zu meinem apokalyptischen Erscheinen am Firmamente der Mandarinen war ich ihnen im unendlich Großen ebenso unsichtbar gewesen, wie du mich im unendlich Kleinen, das jenseits der Grenze unseres mikroskopischen Sehfeldes liegt, nicht mehr wahrnehmen konntest.
Einmal auf einer gewissen Stufe der Winzigkeit angelangt, war es verständlich, daß mich die »Ourrh« anzog. Und als ich auf diesen Planeten herabfiel, war ich für die Mandarinen nicht größer, als uns zum Beispiel eine junge Pappel erscheint.
Durch wissenschaftlich-künstliche Mittel wurde die Wucht meines Sturzes — der Platz, wo ich niedergehen würde, war errechnet worden — paralysiert.
Agathos, der eine ähnliche Stellung bekleidete, wie bei uns ein Direktor der medizinischen Schule oder ein Minister für öffentliche Gesundheit, erhielt vom Ersten Minister die Vollmacht, sich mit mir zu beschäftigen. Er ließ um mich ein leichtes Gebäude errichten und ging sofort daran, meinem weiteren Kleinerwerden Einhalt zu gebieten.
Es gelang ihm in dem Momente, wo ich glücklich und zufällig die Statur eines zwar mageren, aber wohlgestalteten Mandarins erreicht hatte. Ich hatte nämlich seit langer Zeit nichts mehr zu mir genommen und Agathos war genötigt gewesen, mich subkutan zu ernähren.
Einmal stabilisiert, wurde ich in das Haus von Agathos geschafft und hier war es, wo ich dank der Bemühungen des Herrn Direktors und seiner Gehilfen endlich wieder zu mir kam.
Hatten sich je die Augen eines Menschen solch ungeahnten Dingen wieder geöffnet?
Du mußt dich nicht darüber ärgern, lieber Pons, daß andern meine Stabilisierung gelang. In der Wissenschaft sind uns die Mandarinen weit überlegen. Wie du weißt, habe ich von Chemie keine blasse Ahnung. Ich hätte mir daher auch nicht die Formel merken können, die es dem alten Agathos ermöglichte, meinem rasenden Lauf quer durch die Welt der Mikroben Einhalt zu tun. Aber dank einem Auskunftsmittel, von dem ich dir später berichten werde, hoffe ich, daß du in den Besitz dieser Formel gelangen wirst.
Agathos fuhr in seiner Erzählung fort, und jedesmal, wenn ich im Geiste eine Frage stellte oder wenn ich nicht recht begriff, merkte es Agathos, erwiderte darauf und klärte mich durch einfache Gedankenübertragung auf.
Oh, welch nicht zu beschreibendes Zwiegespräch! An diesem ersten Tage stellte er an mich nur wenig Fragen und ließ mir immer Zeit zu überlegen, wenn er mir etwas mitgeteilt hatte.
Es fiel mir der bekannte Ausspruch von Leibnitz ein, den er Bernouilli gegenüber tat, und den du mir einmal zitiertest.
»Was mich anbelangt, trage ich keinen Augenblick Bedenken, zu behaupten, daß es im All Tiere gibt, die an Größe unsere so überragen, als die unsern an Kleinheit die Aufgußtierchen, die wir nur durch das Mikroskop wahrnehmen können, denn in der Natur gibt es keine Grenzen. Demgemäß ist es möglich und sogar sicher, daß in den Sonnenstäubchen, in den winzigsten Atomen, Welten enthalten sind, die der unsrigen an Schönheit und Mannigfaltigkeit in keiner Weise nachstehen.«
So war ich denn zweifelsohne in meiner Lethargie, doch ohne in meinem Kleinerwerden innezuhalten, unbewußt durch das Reich der uns bekannten Kleinlebewesen hindurchgegangen und in die Welt noch viel winzigerer Mikroben eingegangen, für die jene ebenso ungeheuer groß waren, als für sie selbst unsichtbar klein. Und diese unbekannten Kleinwesen, die Mikroben der Mikroben, wiesen menschliche Art auf. Mit Schrecken grübelte ich darüber nach, welche Geschöpfe wohl, welche Welten, eine immer größer als die andere, das unermeßliche All erfüllen, und von heiligem Schauer ergriffen, betrachtete ich die winzigen Stäubchen, die in den herrlichen violetten Strahlen der Liliputsonne rhythmisch auf und ab wogten.
Und ich dachte an dich, Pons, an dich und Olga, die Ihr vielleicht da wäret, ganz nahe bei mir, während ich im proportionellen Maßstabe weit, weit weg war, weiter entfernt, als der Nebelfleck im Orion von den Bewohnern der Erde.
Mein Größenverhältnis? Wie hätte ich es mit Zahlen ausdrücken können, mit welch phantastischem Meßinstrumente bestimmen können? In welchem in Milliarden von Mikromillimetern berechneten Abstande befand sich mein Kopf von meinen Füßen?
Und doch war ich bei den Mandarinen wie ein Mensch unter Menschen. Und dieses schwindelerregend mikroskopische Zimmer erschien mir geräumig und das rote Hemd (besser gesagt, mein Hemd, das mir unter der Einwirkung des violetten Lichtes einen roten Eindruck machte), dieses Hemd, womit ich bekleidet war, bestand aus dem feinsten Gewebe, das man sich vorstellen kann.
Mein Grübeln machte jedenfalls auf meine freundlichen Wirte einen ehrfurchtgebietenden Eindruck, denn sie verhielten sich absolut stumm. Nicht nur, daß sich ihre Lippen nicht bewegten, auch ihre Pompons regten und rührten sich nicht. So dachte ich mindestens zu Anfang meines Séjours, denn ich wußte noch nicht, daß eine gegenseitige Verständigung der Mandarinen keinerlei Bewegung dieses Organs bedingte, daß sich die Mandarinen durch den Pompon wie durch eine Art Radiopathie unterhalten können und die »Fleisch-Chrysantheme« nur bewegen, um sich zu orientieren oder ihrer Radiorede mehr Ausdruck durch Gesten zu verleihen und Wichtiges besser zu unterstreichen.
Später lernte ich Mandarinen kennen, die sich in solch unnötigen Grimassen nicht genug tun konnten. Man lachte darüber und sie machten die verzweifeltsten Anstrengungen, sich diese Unart abzugewöhnen. Sie erinnerten mich an den Präsidenten Monempoix, der auch im Gestikulieren schwelgte, so wie schlechte Redner den Eindruck erwecken, als übten sie rekrutenhaft die Zeichen der optischen Telegraphie.
Agathos, Kalos und die zwei grünen Neger waren nicht so. Und in der Folgezeit schätzte ich alle Vier um so mehr, denn ich sagte mir immer: Wer viel gestikuliert und Gesichter schneidet, wird wohl kaum reden, noch weniger schreiben können, denn in einem Briefe kann man weder die Nase rümpfen, noch die Lippen spitzen, noch sonst die geringste Pantomine vom Stapel lassen. Ich habe zwar nicht die Ehre, Mitglieder der Akademie persönlich zu kennen, aber ich bin fest überzeugt, daß sie alle ebenso kühl und vornehm sich benehmen, wie Agathos und Kalos, ja selbst wie die beiden grünen Neger.
Auf ein unsichtbares Zeichen, das ihnen jedenfalls ihr Herr gab, ging dies Dienerpaar rasch an meine Toilette.
Man rasierte, duschte, frottierte mich in Gegenwart von Agathos und Kalos, schnitt mir die Haare »à la Jeanne d'Arc« mittels Instrumenten, die ich dir, so Gott will, im »Anhang« näher beschreiben werde, und legte mir eine sehr schön gearbeitete und gut passende russische Bluse von wundervoller rosa Farbe an und einen schottischen »Kilt«, der etwas von einer griechischen »Fustanella« an sich hatte. Dies eigelbe Röckchen reichte mir bis zu den Knien. Es war, glaube ich, aus feinster Surah-Seide gewebt. An die nackten Füße steckte man mir Pantoffeln, aus was, weiß ich nicht, aber sie waren weich und kostbar, ähnlich russischem, mit »Crème Simon« eingefettetem Leder.
Als sie mich auf »mandarinisch« angezogen erblickten, umspielten die schmalen Lippen von Agathos und Kalos das erste schwache Lächeln, das ich an ihnen bemerkte. Und sie taten etwas, was mich verblüffte... Jeder schleuderte mit dem linken Bein seinen Pantoffel in die Luft und fing ihn sehr geschickt mit dem Fuße wieder auf. Darin besteht ihr Gruß. Wegen des Pompons kennen sie keinen Hut. Eine Mütze aufzusetzen wäre bei ihnen gleichbedeutend mit dem Tragen eines Knebels im Munde oder undurchsichtiger Brillen vor den Augen. Statt also, wie wir, um zu grüßen, das Haupt zu entblößen, entblößen sie einen Fuß. Ich fand das praktisch.
Auch Stühle gibt es bei den Mandarinen, weil diese Wesen in vieler Beziehung Menschen ähnlich sind. Agathos ließ mich auf einem tatsächlich wundervollen Sessel Platz nehmen, den man je nach Bedarf einstellen konnte. Dann montierte er mir wieder den Gedankenübertrager auf und hielt mir folgende »Strom«-Rede:
»Jetzt sind Sie präsentabel, mein Freund. Wir können Sie also der Gesellschaft vorstellen und Ihnen die Honneurs der ‹Ourrh› erweisen. Meine Frau sehnt sich danach, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ehe ich Sie aber einführe, ist es unumgänglich notwendig, daß Sie einiges wissen und daß wir gewisse Vorsichtsmaßregeln treffen.
Sie sind nicht ganz so wie wir organisiert. Sie besitzen nur 10 Finger und haben keinen Pompon.
Es ist nun höchst wünschenswert, daß Sie nicht als ›Wundertier‹ auftreten. Es würde Ihnen dies wohl viele Unannehmlichkeiten eintragen und Sie sogar Gefahren aussetzen, auf die ich später zurückkommen werde.
Obwohl ich durch die Gnade des ersten Ministers Sie rasch der allgemeinen Neugierde entziehen konnte, bemerkten doch meine Mitbürger, daß Sie nur 10 Finger besitzen. Wir brauchen uns wohl darüber nicht allzusehr aufzuregen, denn es gibt unter uns arme Teufel, die an dem gleichen Mangel leiden, und zwar von Geburt aus, und diese Anomalie ruft lediglich ein Gefühl von Mitleid, gemischt mit etwas Ekel, hervor, ohne daß man weiter darüber erstaunt ist, in Schrecken gerät oder gar eine ungesunde Neugierde an den Tag legt.
Anders verhält es sich aber mit dem Pompon, der Ihnen fehlt und der unser Hauptsinnesorgan darstellt. Es gibt natürlich auch auf der ‹Ourrh› beklagenswerte Mandarinen, deren Pompon seinen Zweck nicht erfüllt oder nicht mehr erfüllt, mit dem sie nichts wahrnehmen und nichts zum Ausdrucke bringen können. Mißbildung, Krankheit oder Unfall beraubte sie des Organs, das Sie überhaupt nicht haben. (Ebenso gibt es unter uns Individuen, die den Geruchsinn und das Sehvermögen einbüßten und daher stumm oder taub sind.) Bei dieser Gelegenheit möchte ich erwähnen, daß zu ihrem Gebrauche jener Gedankenübertragungsapparat erfunden wurde, dessen ich mich jetzt bei der Unterhaltung mit Ihnen bediene.«
»Verzeihen Sie,« dachte ich. »Leistet der Pompon auch die gleichen Dienste zwischen Fremden, die verschiedene Sprachen reden?«
»Das gibt es bei uns nicht,« dachte Agathos zurück. »Unser Pompon übermittelt die reinen Gedanken eines Individuums einem oder mehreren andern, ohne sichtbare, lautliche oder andere Zwischenhilfe, genau so wie der Gedankenübertragungsapparat. Die reinen Gedanken und, wohlgemerkt, auch die Gefühle, kurzum alle Regungen des Gedanken- und Seelenlebens. Ich sehe, daß man sich in der Welt, aus der Sie kommen, um miteinander in Verbindung zu treten, der Lippenlaute und des Schallempfängers der Ohren bedient. Sie müssen mir gestatten, an Ihnen diese sonderbare Art des Miteinander-in-Verbindung-tretens studieren zu dürfen. Doch kommen wir, bitte, auf das Notwendigste zurück: Ich sagte also, daß einige unter uns, wenn Sie diesen Ausdruck verstehen, Pompon-blind und Pompon-stumm sind. Immerhin, merken Sie wohl auf, haben sie einen Pompon, aber einen leblosen, gelähmten, einen Pompon, der zuweilen zum Stengel zusammenschrumpft oder nurmehr aus dem Stiele besteht. Mag aber auch der Zustand ihres Pompons noch so erbärmlich sein, sie besitzen davon doch noch immer eine Spur. Aber Sie haben gar nichts! Sie sind für mich wie ein Gesicht ohne die Spur von Augen, oder ohne das geringste Stümpfchen von Nase, oder ohne die leiseste Andeutung eines Mundes.
So können Sie nicht ausgehen!
Infolgedessen beschlossen Kalos und ich folgendes: Niemand außer uns Vieren, die wir absolut diskret sind, weiß, daß Sie keinen Pompon haben. Sie können darüber beruhigt sein. Ich bemerkte es als erster, und sofort umwickelte ich Ihnen das Haupt mit Bettüchern unter dem Vorwande, Ihnen Kompressen zu machen. Wir werden Ihnen also einen falschen Pompon verschaffen, so wie ihn die traurigen Mandarinen zu tragen pflegen, die den ihrigen, sei es durch eine Katastrophe oder infolge einer notwendigen Operation einbüßten und aus leicht begreiflicher und verzeihlicher Eitelkeit auf dem Stengel des verlorenen Pompons einen künstlichen aufsetzen.
Bitte, hier ist das Ding! Es hat eine himmelblaue Farbe, die, wie es die Natur erfordert, zu Ihren Augen paßt. Dieses Ersatzstück wurde eigens für Sie bei mir angefertigt und auf einen sehr sauber nachgemachten Stiel aufmontiert, der an seinem Fußende mit einem Saugringe versehen ist.
Man wird Ihnen auf dem Scheitel eine kleine Tonsur ausrasieren, damit sich der Saugring gut anpressen kann, und das Ganze wird tadellos sitzen. Ich schwöre es Ihnen. So wird man Sie für einen Kranken halten, der den Schein wahren will, nicht aber für eine unannehmbare Mißgeburt. Man wird Sie überall empfangen und Ihnen jede Rücksicht angedeihen lassen. Nur dürfen Sie ja nicht Ihren Gedankenübertragungsapparat zu Hause vergessen, sonst wären Sie auf der ‹Ourrh› wie auf einem von lauter Taubstummen bevölkerten Planeten.«
Gern hätte ich Agathos über die weiteren Eigenschaften dieses sechsten Sinnes befragt, um noch tiefer in die Geheimnisse des Pompons einzudringen, denn es entging mir nicht, daß der Pompon eine ganz außerordentliche Wahrnehmungsschärfe besaß. Wieso? Welcher Kraft verdankte er diese Eigenschaft? Kannte ich sie, wie ich z. B. das Licht, den Schall, Geschmack oder Geruchsinn kannte? Oder, auf indirektem Wege, die Elektrizität oder die Radio-Energie?
Später erfuhr ich, daß ich sie nicht kannte, auch niemals kennenlernen könnte und daß mir der Sinn für dieselbe fehlte, so wie dem Blindgeborenen der Begriff des Lichtes. Und wie der ohne Augen Blindgeborene, der sich durch Tasten davon überzeugen würde, daß gewisse Geschöpfe unerklärliche Organe, die Augen, besitzen, die unter dem Einflusse irgendeiner ihm unbegreiflichen Kraft reagieren, immer nur auf armselige Vorstellungen angewiesen bleibt, also erging es auch mir angesichts des Rätsels des sechsten Sinnes.
Agathos fühlte sich gedrängt, mich jener vorzustellen, die ich irdisch »Frau Agathos« nannte.
Man beeilte sich daher, aus mir einen richtigen Mandarin zu machen, indem man mir den falschen Pompon aufsetzte. Während dieser Prozedur bemerkte ich, daß das violette Licht abflaute. Es trat keine Abenddämmerung ein, sondern es hatte eher den Anschein, als menge es sich mit einer gelblichen Beleuchtung und fließe mit einer solchen zusammen.
War es eine Halluzination? Lebewesen und Gegenstände hatten jetzt zwei Schatten statt eines. Und nach und nach verdrängte das gelbe das violette Licht.
»Was bedeutet das?« fragte ich Agathos mittels des Gedankenübertragers.
»Wie? Das nimmt Sie wunder? Die violette Sonne geht unter, die gelbe geht auf.«
»In entgegengesetzten Himmelsrichtungen!« dachte ich ganz baff.
»Natürlich. Ein Vorgang, der sich täglich wiederholt.«
»Was ist's denn mit der Nacht?... wann ist es Nacht?... nie?«
»Ich werde Ihnen das erklären,« bedeutete mir Agathos wohlwollend.
Der künstliche Pompon genierte mich gar nicht. Übrigens war es eine echt mandarinische Bewegung, zuweilen nach der Kopfquaste zu greifen, bei welcher Gelegenheit ich mich durch die allgemein übliche und instinktive Geste überzeugen konnte, ob das Ding noch festsitze.
Wir begaben uns in einen andern Raum, der nichts Laboratoriumartiges hatte. Man hatte das Gefühl eines gewissen Luxus'. Die Luft war diskret parfümiert. Die Wandbespannung jedoch zeigte — was mir sofort beim Eintreten auffiel — ein reizloses Muster.
Sie bestand aus Zement oder Beton, welche Masse mit Eisenfeilspänen bespickt war. Von der Decke herab hingen an Knotenstricken halbkugelförmige Gegenstände herab, mit der offenen Seite nach oben, mit der gerundeten nach abwärts, die ebenfalls wahllos und ohne Harmonie in den Farben oder der Zeichnung mit Metallteilchen inkrustiert waren. Es gewährte einen barbarischen, unangenehmen, peinlichen unverständlichen Anblick.
Die zwei grünen Neger waren uns nicht gefolgt. Nur Agathos und Kalos leisteten mir Gesellschaft. Ich blickte mich in einemfort im Saale um und stellte fest, daß alles in diesem Salon in der Dreizahl auftrat. Die hängenden Halbkugeln sowohl als die Wandbespannungen und die verschiedenen Gegenstände, die auf den Tabletten und dem Kälteerzeuger (er vertritt die Stelle unseres Ofens) herumstanden und lagen. Es waren teils kleine Statuen, teils Objekte, deren Bedeutung nicht recht erfindlich schien, deren Flächen, Rundungen, Kanten und Winkel das Auge aber durch ihre vollendete Grazie entzückten. Andere wiederum stellten nur Stücke von verschiedener Masse dar, die fein poliert oder gestrichelt waren. Aber alles, alles folgte dem System von Drei.
Bei den Chinesen geht alles nach fünf, erinnerte ich mich. Im übrigen ist »12« durch »3« teilbar. Die Mandarinen, die, wie alle Menschenarten, sicherlich auch bei ihren Fingern zu zählen anfingen, nahmen sicher das Duodezimalsystem an, was mich darauf schließen läßt, daß auch die Engländer in der Urzeit 12 Finger besaßen.
Gerade wollte ich diesbezüglich und wegen der hängenden Halbkugeln einige Fragen an Agathos richten, als aus einer Bodenfalltüre zwei neue Mandarinen auftauchten.
Sie trugen, wie alle, das kurze Röckchen und die russische Bluse und ihr Haar war ein ganz klein wenig kürzer als das von Kalos, der es seinerseits wieder nicht so lang trug wie Agathos und ich. An ihren nackten Armen, dem Busenausschnitte der Bluse und ihren entzückenden Beinen erkannte ich, daß ich es mit Mandarininnen zu tun hatte.
Agathos und Kalos ließen den Pantoffel ihres rechten Fußes (bei Begrüßung von Damen immer des rechten Fußes) emporsausen. Voller Eifer versuchte ich dasselbe, aber ich bin kein Jongleur, namentlich kein Fußjongleur, und verlegen lächelnd verfehlte ich mein Ziel.
Frau Agathos und ihre Freundin, die goldblond war, ließen ihre Pompons — das eine leuchtete korallenrot, das andere violett — einen frenetischen und lustigen Revolutionsreigen vollführen. Frau Agathos marschierte hinter einer riesigen Nase einher, die andere, die ich Fräulein Kala nennen will, hatte aber — so wie Olga — ein entzückendes, zum Anbeißen niedliches Stumpfnäschen, weshalb sie sicherlich in der Mandarinenwelt für häßlich galt.
Beide hielten in ihren Händen ein paar jener Gegenstände, deren unförmiges Äußere ich eben erwähnte, und streichelten sie in einem fort.
Ich glaube daher, daß es auf »Ourrh« eine Wohllust des Anrührens und sachverständigen Antastens gibt.
Obwohl ich etwas verblüfft darüber war, die beiden Damen aus einer Klapptüre auftauchen zu sehen — eine recht banale Art des Eintretens, die aber hier letzte Mode war —, tat ich doch das Möglichste, um den »verfluchten Kerl« zu spielen und entfaltete, wie Kalos, dieser strahlende Cherub, dieser russisch-schottische Raphael Sanzio, meine Bluse und blähte die Bauschen meines Röckchens auf, das in der gelben Beleuchtung seine Farbe gewechselt hatte.
Es ist galant, mit Damen von Toiletten zu sprechen.
Mittels des Gedankenübertragers sagte ich also zu Frau Agathos: »Meine Gnädigste, ich komme aus einem Lande, das nur über eine einzige Sonne verfügt. Es muß für Sie recht umständlich sein, Stoff zu finden, der sich sowohl in violettem als safrangelbem Lichte gut ausnimmt?«
»Oh,« meinte sie mit etwas verächtlichem Schmunzeln. »Das Umkleiden macht nicht viel Nachdenken. Toiletten für verschiedene Gelegenheiten sind sehr selten.«
Ich glaubte jetzt zu verstehen, warum die Damen nicht ein bißchen geschminkt waren.
»Die Farbe...,« wollte ich fortfahren. Aber Frau Agathos unterbrach mich, indem sie sagte:
»Oh, die Farbe, mein Herr, spielt gar keine Rolle. Die Hauptsache ist der...«
Ich begriff, daß sie vom Pompon sprechen wollte und dem Reize, der von ihm ausging, den ich aber zu erfassen außerstande war. Ich will ihn »Dounn« nennen nach dem Gestammel Agathos', wenn er sich mit mir in rudimentären Sprachversuchen unterhalten wollte. Er glich bei diesen Redeversuchen jenem Professor, der die Sprache der Affen erlernen wollte, nur waren hier die Verhältnisse umgekehrt gelagert, denn die Mandarinen laborieren an einer ungelenken Kehle und einer schweren Zunge und können höchstens ein Gemurmel, Gekreisch und Gegluckse hervorbringen. Das tun denn auch die Mandarinen oft so ausgiebig, daß ich von fern oft glaubte, irgendwelche Pariser Lautäußerungen zu vernehmen... zum Beispiel, mich im »Jardin des Plantes«, dem großen Tiergarten, zu befinden.
Lieber Pons, verzeihe mir, wenn mein Bericht etwas unzusammenhängend ist, denn ich kann mich tatsächlich einer Menge Fakten nicht mehr entsinnen, die sich vor etwa 65 Jahren zutrugen, wenn ich nämlich nach Mandarinenjahren rechne. Da ich innerhalb weniger Monate ein ganzes Leben durchlebte, verschwimmt auch in meinem Gedächtnisse mehr und mehr jene Szene im Salon der Frau Agathos. Dieses Leben, das nur Tage kannte, ließ mich die Verbannung noch länger erscheinen, als sie in Wirklichkeit währte.
Immerhin erinnere ich mich noch sehr genau gewisser Einzelheiten, die auf mich einen besonderen Eindruck machten, und sehe noch deutlich Frau Agathos und ihre Freundin, Fräulein Kala, ihren Kram, den sie in den Händen hielten, liebkosen und streicheln, wie man bei uns kleinen Katzen oder Seidenpintschern schön tut. Auch Agathos und Kalos gaben sich dieser neckischen Beschäftigung hin. Ich unterließ dies wohlweislich, denn ich wollte nicht die Aufmerksamkeit auf meine Hände lenken, welche Ärgernis erregt hätten, weil ich nur 10 Finger besaß.
Die Temperatur hatte sich fühlbar abgekühlt. Die gelbe Sonne strahlte weniger Wärme aus als die violette. Daraus ergibt sich, daß auf »Ourrh« stets einem Hundstage ein Herbsttag folgte. Einen andern Sommer oder Winter kennen die Mandarinen nicht. Es existieren dort nur zwei Jahreszeiten, die täglich mit einander abwechseln. Ich konnte nicht genug darüber staunen und trat zum Fenster, um die Wirkung des gelben Lichtes im Freien zu studieren. Kala folgte mir und vaporisierte sich ihren Pompon mit einem allerliebsten kleinen Zerstäuber, den sie aus dem Busen zog.
Aus Höflichkeit streifte ich nur mit einem kurzen Blick den mandelgrünen Himmel und die Straße, deren sphärische Architektur mich geradezu abstieß. Dafür atmete ich um so entzückter den Parfüm der Mandarinin ein und es ward mir klar, daß ich mich sehr rasch an die Eigentümlichkeit der 12 Finger und des Pompons gewöhnen würde.
Der Schmuck, den Kala an den Armen und Beinen trug, zeichnete sich mehr durch seine Formen, als durch Feuer und Farbtöne aus. Auf jedem ihrer reizenden Pantöffelchen erblickte ich ein mit Juwelen besetztes zifferblattähnliches Viereck. Das eine stellte — wie sie mir mittels des Gedankenübertragers erklärte — eine Art Zeitmesser dar. Sie zog den winzigen Schuh vom Fuße, um mir diese Uhr zu zeigen. Rings um das Innere der Einrahmung, die eine höchst phantastische Einteilung aufwies, lief beständig ein tiefschwarzes Kügelchen.
Ich frage die schöne Kala, wie man das Ding aufziehe, denn ich bemerkte an dem Kleinod keinerlei derartige Einrichtung. Sie schien höchlich verwundert zu sein über meine Frage.
»Aber das zieht man überhaupt nicht auf!« entgegnete sie. »Die Zeit selbst treibt das Gangwerk der Uhren.«
Schon wieder etwas, das mich verblüffte. Die Mandarinen hatten also die Zeit »isoliert«, in ihren Arbeitsdienst gestellt, eingefangen! Sie verfügten über sie wie über den Raum, das Wasser, die Luft, das Feuer. Und wie das Wasser das Mühlrad treibt, also drehte die Zeit diese Mühle: die Uhr. Und wie die Magnetnadel vom Nordpol angezogen wird, also lief das Kügelchen, von der Zeit getrieben, in der Runde herum.
»Und was ist das?« fragte ich, auf den Schmuck des andern Pantöffelchens zeigend.
Leider, lieber Pons, vermochte ich, obwohl sich der alte Agathos mit in das Gespräch mischte, niemals, nicht einmal im Laufe von 65 Jahren, herauszubekommen, was dieser schmucke Registrierapparat eigentlich anzeigte und maß. Dies Ding blieb für mich ein mit sieben Siegeln verschlossenes Buch.
Inzwischen traten wieder die grünen Neger ein. Sie trugen auf einem Servierbrette kleine Näpfe, die — wie in den Konditorauslagen — zwanzig verschiedene Arten von Bonbons, Zuckersachen und Pralinés enthielten, in den Saal, und diese Leckereien waren, dem Mundumfange der Mandarinen sich anpassend, winzig klein. Jeder von uns wählte sich eines, und zwar ein einziges, aus und schluckte es. Dies bildete das Frühstück. Kaum aber hatte ich das schokoladenbraune Ding unten, so fühlte ich mich auch schon vollkommen gesättigt. Es schmeckte nach ranzigem Petroleum. Mit Mühe würgte ich es hinab. Übrigens bekundeten meine Mandarinen und Mandarininnen auch keinerlei gastronomisches Wohlbehagen, als sie ihre Bonbons zu sich nahmen. Sie hatten sich chemisch Nahrung zugeführt, und basta.
Hierauf reichten die grünen Neger verschiedene Schnupfpulver herum, von denen jeder eine Prise nahm. Für mein bescheidenes Riechorgan rochen sie, wie ich gestehen muß, fast alle gleich.
»Was sind das eigentlich für Leute, diese Grünen,« erkundigte ich mich bei Agathos.
Seine Antwort hätte ich mir eigentlich schon selbst geben können.
»Es sind grüne Mandarinen, die sich sehr gut zur Bedienung der weißen Mandarinen eignen. Sie haben eine angeborene Indolenz, der man nur mittels des Knüttels Herr wird. Natürlich bedient man sich nur im Notfalle dieses äußersten Mittels. Aber« — fügte er hinzu (natürlich immer durch den Gedankenübertrager), — »die grünen Mandarinen sind hauptsächlich wegen ihres Geruches sehr gesucht. Namentlich wenn sie schwitzen, duften sie außerordentlich lieblich. Nach dem, was Sie mir über Ihr Vaterland berichteten, könnten Sie unsere Grünen mit liebenswürdigen Bedienten vergleichen, die bei Erfüllung ihres Dienstes gleichzeitig Geige oder ein anderes Instrument spielen. Unsere Musik aber ist die Harmonie des Geruches.«
Und um die Grünen zum Schwitzen und Duften zu bringen, bat er die beiden (er dachte »Grüne«, wie wir »Schwarze« sagen), uns einen ihrer Volksreigen vorzutanzen. Sofort gaben sie sich den tollsten Luftsprüngen hin, die immer rasender und wahnwitziger wurden, als berauschten sie sich selbst an ihren künstlerischen Ausdünstungen.
Ich riß Augen und Nasenlöcher auf, ohne mehr zu sehen, als zwei grüne Clowns, die, was ihre »Musik« anbelangt, mehr als unangenehm ranzig rochen.
Ich teilte dieses Agathos durch den Gedankenübertrager mit.
Das Wort »ranzig« ließ ihn emporfahren.
»Behalten Sie diese Ansicht bei sich,« sagte er. »Sie würden in der allgemeinen Achtung abgrundtief sinken. Wissen Sie denn nicht, daß man jene für Trottel ansieht, die vom Geruch andere Begriffe haben, als man selbst hat?«
Tief beschämt wollte ich das Gesprächsthema in andere Bahnen lenken und gerade Agathos fragen, wieso hier alles nach dem »Dreisystem« gehe, als man einen Besuch meldete.
Der Pompon Agathos' krempelte sich zusammen und verfinsterte sich.
»Nehmen Sie sich in acht!« legte er mir ans Herz. »Seien Sie auf Ihrer Hut. Der Mandarin, dessen Bekanntschaft Sie gleich machen werden, ist ein unangenehmer Herr. Er ist Direktor des Museums, eine ›Leuchte‹, aber höchst exzentrisch. Ich dachte mir schon, daß er kommen würde. Sie interessieren ihn nämlich lebhaft, und wenn ich nicht beim ersten Minister hoch in der Gnade stünde, hätte er sich Ihrer bemächtigt. Vorsicht! sage ich Ihnen! Es wäre Ihr Unglück gewesen. Trachten Sie, möglichst zu maskieren, daß Ihr Pompon nur ein künstlicher Kopfschmuck ist. Spielen Sie den Bedauernswerten, den Kranken, der durch einen Unglücksfall seine ‹Dounn› einbüßte. Oder nein, benehmen Sie sich lieber wie einer, der von Geburt aus Pompon-stumm und -taub ist.«
Kaum hatte Agathos dies zu mir »gedacht«, als der Museumsdirektor eintrat.
Das Eigentümliche der Rassen und noch mehr der Gattungen aller Wesen, zu denen wir nicht gehören, besteht darin, daß sich deren einzelne Mitglieder alle gleich sind. Beim Europäer, namentlich bei den Franzosen, Deutschen oder Italienern hat jeder auf den ersten Blick etwas unbestreitbar Persönliches an sich, namentlich, was die Gesichtszüge anbetrifft. Schwerer schon fällt es uns, unter den Chinesen das einzelne Individuum vom anderen zu unterscheiden, ebenso bei den Senegalnegern. Und was vollends unsere Brüder aus dem Tierreiche anlangt, so bestätigen nur einige Ausnahmen die Regel. Es muß jemand schon einen sehr feinen Blick besitzen, um einen Karpfen vom andern zu unterscheiden.
Die Mandarinen sehen nun, was das Gesicht anbelangt, dem irdischen Menschen wenig ähnlich. Das kommt von ihren sehr großen Nasen, den winzigen Ohren und Augen, dem kleinen Munde und der allgemeinen Ausdruckslosigkeit ihrer Züge. Daher war ich auch stets versucht, sie miteinander zu verwechseln, ausgenommen natürlich meine Freunde und meine — Feinde.
Aber den Museumsdirektor würde ich, nachdem ich ihn zum ersten Male gesehen, sofort selbst unter Tausenden Mandarinen herausgefunden und auch ohne Agathos' Warnung als gefährlichen Jungen angesehen haben.
Du wirst dich nach dem Gesagten nicht mehr wundern, wenn ich den Museumsdirektor fortab »Kakos« nennen werde.
Graubärtig, schlich er fuchsartig einher und grüßte fortwährend nach rechts und links und bewegte ständig seine 12 Finger, als wollte er etwas packen und an sich raffen... was?... wen?... man wußte es nicht, aber unwillkürlich wich jeder zurück. Und die ekelhaften Augen, die er hatte, diese Nase, dieser Mund, der bebrillte Pompon, der aschgrau, ungesund und tränend aussah. In der Tat, ein abscheulich häßlicher Kerl.
Unverzüglich steuerte er auf mich zu und schickte sich an, mich von allen Seiten zu beschnüffeln.
»Achtung auf meinen Pompon!« sagte ich mir.
Ich drehte mich ihm zu, indem ich mit erhobenem Haupte seinem Pompon und den forschenden Blicken seiner Augen stets meine Front zuwandte, so wie der Mond die Erde umwandelt, was ein ebenso neckisches wie astronomisches Spielchen ist.
Dieser Kakos war ein großer Gelehrter. Er hatte eine neue wissenschaftliche Richtung begründet und stützte sich bei der Erklärung des Universums auf die »Dounn«, so wie Einstein seine berühmte Theorie auf das Licht basiert. Er genoß, was »Dounnlogie« und Pompon anbetraf, großes Ansehen. Außerdem hatte er sich durch Fabrikation von dem, was ich »Pompon-Brillen« nenne, ein großes Vermögen erworben, und auch ohne die Warnung Agathos' würde ich sofort bemerkt haben, daß mich dieser verfluchte Kerl voller Verachtung musterte, so wie z. B. ein Schuhmacher einen Beinlosen betrachtet.
Als er erkannte, daß er über meinen Pompon heute nichts Näheres erfahren könnte, verzichtete Kakos auf alles Weitere, nahm Platz und beteiligte sich an der Unterhaltung. Aber ich fühlte es, daß er nach mir stets voller Lüsternheit und Begehrlichkeit herüberschielte. Alle Welt erstarb ihm gegenüber in Höflichkeit. Ich weiß nicht, wie lange sein Besuch dauern sollte, doch plötzlich nahmen die fünf anwesenden Personen die Haltung von Leuten ein, deren Ohr ein grelles Signal vernommen hat.
Ich hatte nichts gehört. Kakos beeilte sich, Abschied zu nehmen, ebenso die schöne Kala.
Als sie fort waren, teilte mir Agathos mit:
»Schlechte Sache! Er weiß oder ahnt mindestens, daß Sie keinen Pompon besitzen. Seien Sie wachsam, mein Freund. Er wollte mit Ihnen sprechen, doch sagte ich ihm, Sie seien hierzu noch zu schwach. Aber ich fürchte, daß Ihnen diese Bestie noch recht viel Unannehmlichkeiten bereiten dürfte.«
»Er hat nichts gesehen,« entgegnete ich, »denn ich kehrte ihm niemals den Rücken zu, wie dies ja auch das Gebot der Höflichkeit vorschreibt, so daß mein Benehmen nicht sein Mißtrauen erregen konnte.«
»Sie irren sich gewaltig! Wieso meinen Sie übrigens, daß es unhöflich sei, jemandem den Rücken zuzukehren?«
Ich biß mir auf die Lippen. Tatsächlich hat bei den Mandarinen die Rückseite nichts Verächtliches an sich, da sie ja durch den Pompon geadelt und zur Frontpartie erhoben wird.
»Aus welchem Grunde empfahlen sich Kakos und Kala so rasch?« erkundigte ich mich.
»Der Nationalsender verkündet den künstlichen Regen. Das geschieht, damit man Zeit hat, nach Hause zu gehen. Schon seit Jahrhunderten haben wir den natürlichen Regen abgeschafft. Er war uns zu wetterwendisch. Kurz nach Aufgang der gelben Sonne läßt der öffentliche Dienst alle zwei Tage eine Stunde lang regnen. Das ist sehr nützlich. Sofort danach reinigen die Straßenarbeiterabteilungen dann die Stadt und hierauf wird die Nacht angezündet.«
»Wie, bitte?... die Nacht wird angezündet?... was heißt das?«
Der Schatten eines Lächelns umspielte die Lippen Agathos'.
»Kommen Sie,« meinte er.
Er schob mich auf einen Balkon hinaus, und ich genoß den Anblick einer Großstadt mit unzähligen Terrassen. Nirgends aber grünte zwischen den Gebäuden ein Fleckchen Erde. Auch die Nähe des Horizontes verursachte mir einige Beklemmung. Zweifelsohne war die »Ourrh« ein sehr kleiner Planet, entsprechend den Proportionen ihrer Bewohner, der Mandarinen.
»Sehen Sie die mächtigen Türme, die sich, soweit das Auge reicht, in gewissen Abständen voneinander erheben?« fragte er mich. Auf den Plattformen dieser Türme funktionierten die regenerzeugenden Prismen und die Nebelgeneratoren.
»Sehen Sie die Spiegelungen? Die Prismen werden gestellt, welche die Atmosphäre umwandeln.«
Bald darauf bildeten sich Wolken. Auf den Straßen entstand ein eiliges Gewimmel, und dann lagen sie öde und verlassen da. Der Regen begann niederzugehn.
Wir kehrten in den Salon zurück. Das Neuartige, dessen Zeuge ich gewesen, hatte mich auf Kakos vergessen lassen. Ich wandte mich an Frau Agathos.
»Sind Sie tatsächlich noch nie vom Regen überrascht worden?« erkundigte ich mich.
»Doch, wenn wir Beamten uns auf Planet-Inspektionsreisen befinden,« erwiderte Agathos.
»Zur Freude der Regenschirmmacher!« erkühnte ich mich zu »denken«.
»Regenschirmmacher?... was sind das für Leute?«
Da er nicht imstande war, sich einen Regenschirm vorzustellen, zeichnete ich ihm die Form eines solchen mit dem Finger auf seiner Handfläche ab, denn nichts befand sich in meiner Nähe, das Papier oder Bleistift glich.
Jäh ließ Agathos den Gedankenübertrager sinken. Ich glaubte, er verzweifle daran, mich zu verstehen, und um mich deutlicher auszudrücken, hob ich mit beiden Armen ein breites Stück Stoff über mich in Form eines Regendaches.
Frau Agathos stieß einen entsetzten Ruf aus. Sie wies nach meinem Schatten an der Wand, den ein schwacher dämmernder Strahl dort hinmalte und der der Silhouette eines riesigen Pilzes glich.
Verständnislos blickte ich die Drei an. Ihre Blässe verblüffte mich.
Agathos hob den Gedankenübertrager auf und bat mich in äußerster Verwirrung:
»Niemals, niemals darf man das Ding erwähnen, das Sie abzeichneten. Wenn ich mich von meinem Schrecken erholt haben werde, will ich Ihnen erklären, warum. Später, nach Eintritt der Dunkelheit, sollen Sie erfahren, welches furchtbare, schreckenerregende Geheimnis auf den Mandarinen lastet. Für den Moment, bitte, lassen Sie uns nicht darüber reden. Folgen Sie mir lieber auf den Balkon. Nach der Angst, die Sie mir einjagten, muß ich etwas frische Luft schöpfen. Jedenfalls interessieren Sie sich auch lebhaft für das Anzünden der Nacht, denn es ist Ihnen, wie ich in Ihren Gedanken las, etwas ganz Neues.«
Der Regen hatte aufgehört. Sonderbare Maschinen reinigten die Straßen, andre folgten ihnen, die nichts anderes waren als Vaporisierungsautos. Sie verbreiteten einen Sprühnebel, der nach allen Richtungen hinpfiff. Obwohl wir uns hoch befanden, erhielten auch wir unsern Teil. Es war eine Art kalter Staub, der nach Chemikalien roch.
»Sterilisation,« bemerkte Agathos ernst.
Ich achtete im Augenblick nicht sehr auf diesen Ausdruck, denn nach dem künstlichen Regen erschien auf erleuchtetem Wolkenhintergrunde ein Regenbogen, der anders als unserer war und den ich wegen seiner Farben und Biegung bestaunte.
Agathos las in meinen Gedanken und wunderte sich über mein naives Staunen. Meiner Frage zuvorkommend, teilte er mir mit, daß die gelbe und die violette Sonne ein Doppelgestirn darstellten, das umeinander gravitiere, während die »Ourrh« sich in der Mitte befinde und sich am Fleck um ihre Längsachse drehe, was den violetten und den gelben Tag verursache.
Ich erinnerte mich an die Doppelsterne unseres Firmamentes und dachte speziell an den Stern Gamma in der Andromeda, der aus einer orange- und einer smaragdgrünen Sonne gebildet wird, oder an die Beta des Schwans, die Vereinigung eines goldfarbenen und saphirblauen Gestirnes. Offensichtlich wiederholte sich Derartiges auch im unendlich Kleinen.
»Achtung!« übermittelte mir Agathos. »Der Staatssender beginnt zu arbeiten. In wenigen Augenblicken wird die Nacht beginnen.«
Tatsächlich begannen zahlreiche Türme dunkle Strahlen auszusenden. Es waren Dunkeltürme. Unter ihrer Einwirkung senkte sich ein unvergleichlicher Abend herab, und langsam wurde es Nacht.
»Es werde Nacht!« murmelte ich.
Dann sagte ich, mich des Gedankenübertragers bedienend, zu Agathos:
»Ganz verstehe ich die Sache, offengestanden, nicht. Wir auf Erden müssen den Einbruch der Finsternis wohl oder übel über uns ergehn lassen und können dagegen nur mittels Lampen ankämpfen. Die Nacht wird auf der Erde als Unannehmlichkeit, als eine kleine Gottesgeißel angesehen.«
Agathos versetzte:
»Der Schatten, den die Dinge werfen, das Innere der Höhlen, Bergwerke und Häuser machten uns mit dem Dasein der Dunkelheit bekannt und den Wohltaten, die sie uns erweist. Wir trachteten daher, Mittel und Wege zu finden, um sie restlos und zu einer bestimmten Stunde allüberall auszubreiten. Während unsere kühlere Sonne die Welt bescheint — wir lieben sehr die Wärme! —, sind alle zwei Tage ein paar Stunden Dunkelheit unserm Schlafe und unserer Gesundheit sehr förderlich. Aber ich mache mich nur halb verständlich. Es genügt nicht, daß die Dunkelheit unsere ›Augen blendet‹, beziehungsweise daß unsere Sehorgane sich ausruhen. Das wäre für uns viel zu wenig. Die Dunkelheit hemmt auch die Tätigkeit unseres Pompons, dem Sinnesorgane der ›Dounn‹«.
Ein ungeheures Schweigen breitete sich über die Stadt. Das letzte Fünkchen Licht versank in finstern Schleiern. Ehe es stockfinster wurde, sah ich, wie Agathos aus seiner Bluse etwas herauszog, das einem Taschenfeuerzeug zum Verwechseln ähnlich sah. Ich werde das Ding »Taschenlampe« nennen. Er ließ den Mechanismus spielen... ein leises Geschnarr ließ sich hören.
Dichteste Finsternis umgab uns. Agathos nahm mich beim Arm und führte mich hinab. Er befand sich im Lichte. Seine Lampe ermöglichte es seinem Pompon, seiner »Dounn«, alles wahrzunehmen. Es war keine Leuchte für die Augen, die Sehorgane, denn bei den Mandarinen ist der »Dounn-Sinn« weit entwickelter als das Gesicht, und deshalb existieren leuchtende Lampen nur für jene Mandarinen, die den »Dounn-Sinn« verloren haben. Agathos versprach mir, einen beim Orthopäden für mich zu besorgen. Momentan aber war ich wie ein Blinder in dem Gebäude, das, wie er mir versicherte, durch die »Dounn« glänzend erhellt wurde.
»Sie vermögen also niemals die Sterne zu sehen, da ja Ihre finstere Nacht Ihre Sicht sowohl Ihren Augen als Ihrem Pomponwahrnehmungsvermögen entzieht?« meinte ich.
»Unser Pompon nimmt sie bei Tage sehr gut wahr,« erwiderte er. »Sie müssen sich abgewöhnen, bester Freund, stets unseren Pompon mit Ihren Augen zu vergleichen. Sie haben gar nichts miteinander gemeinsam. Es gibt gewisse Sterne, die für unseren Pompon weit ‹glänzender› schimmern, wenn ich mich so ausdrücken darf, als unsere beiden Sonnen.«
»Ich aber werde niemals eure Sterne sehen!« rief ich per Gedankenübertrager. »Wie mag wohl dieser mir ganz fremde Himmel mit seinen mannigfaltigen Sternbildern aussehen?«
Mit einem leisen Untertone traurigen Bedauerns entgegnete Agathos: »Ich werde Ihnen das Firmament beschreiben. Übrigens kann man, wenn die violette Sonne eine gewisse Stellung einnimmt, ganz gut auch mit freiem Auge zwei oder drei Sterne erkennen, und zwar beim gelben Sonnenaufgange und bei violettem Sonnenuntergange. Jetzt müssen wir uns aber zur Ruhe begeben. Kommen Sie.«
Durch eine Flucht dunkler Räume brachte er mich in ein Schlafzimmer, wo ein sehr komfortables Bett stand.
»Gute Nacht!« sagte er. »Schlafen Sie wohl. Wenn Sie erwachen, werden Sie uns auf den Ball meines Freundes begleiten, des Direktors der Richterschule. Dann wollen wir die Radioausstellung besuchen, und hierauf will ich Ihnen einige Panoramen unseres Planeten zeigen. Gute Nacht also, und träumen Sie mir nicht vom bösen Kakos.«
Ich hörte, wie er seiner großen Nase eine tüchtige Prise Schnupfpulver einverleibte und seinen alten Pompon ein wenig vaporisierte.
»Und Sie,« erwiderte ich vergnügt, »träumen Sie nicht von Regenschirmen und Pilzen.«
Seine kleinen, verkümmerten Zähne klapperten unheimlich.
»Bitte, reden Sie nicht von Derartigem... namentlich nicht im Finstern... namentlich nicht im Finstern!«
»Beim Zeus!« gab ich zur Antwort. »Auf Erden hauste einst ein Volk, das aus Angst und Aberglauben niemals das Wort ‹Tod› aussprach. Sie erinnern mich an dasselbe.«
»Sie haben das Richtige getroffen,« übermittelte mir als Antwort Agathos in der Dunkelheit. »Der Tod ist es... der Tod!«
»Beim Henker,« grübelte ich im Einschlafen nach. »Kakos... die Champignons... Hm!... ‹Ourrh› ist sicher nicht der Ort ungestörtester Ruhe. Und wenn ich mir dabei vorstelle, daß ich mich im friedlichen Laboratorium meines guten alten Pons auf einer Mikroskopenglasplatte befinde!... Schließlich und endlich sind Saint-Jean-de Nèves, Europa, die Erde, ja das ganze sichtbare All vielleicht nichts als ein Miasma, ein Mikrobe unter Millionen anderen, in den Adern irgendeines gigantischen Wesens, dessen Blutkreislauf das auslöst, was wir den ›ewigen Gang der Gestirne‹ nennen, die Wärme unserer Sonne und das Leben der Generationen...«
Die Mandarinenbälle werden immer im Scheine der gelben Sonne, die schmeichelhafter wirkt, abgehalten. »Schein« bedeutet hier Licht, Strahlung. Denn die Mandarinen legen weniger Gewicht auf die Frische der Gesichtsfarbe als auf die Vollendung des geheimnisvollen Reizes, den sie mit ihrem Pompon wahrnehmen.
Die gelbe Sonne stand noch hoch über dem Horizonte, als sich die künstliche Nacht auflöste.
Agathos, seine Gattin, der schöne Kalos und ich bestiegen ein kugelförmiges Auto: zwei Kugeln, eine in der andern. Die äußere rollte auf dem Boden hin, die innere blieb dank irgendwelcher gyroskopischer Achsenanordnungen stabil. Jedenfalls befand man sich wohl in dem Gefährt.
Wir hatten für diese Gelegenheit Blusen und Knieröcke von besonderer Feinheit angelegt, die sich so angenehm trugen, daß ich — wenn ich mich nicht geniert hätte — ständig die Falten meiner Bekleidung gestreichelt hätte.
Agathos entging dies nicht, und es machte ihm Spaß. Um ins Gespräch zu kommen, fragte ich ihn, was eigentlich diese »Richterschule« sei, deren Direktor uns zum Ball eingeladen hatte.
Agathos war über alles konsterniert, was ihn zwang, sich mit Sitten und Gebräuchen der Erde und meiner eigenen geistigen Inferiorität zu beschäftigen.
»Wie?« meinte er. »Ich nehme doch an, daß es auch auf Ihrem Planeten Mitbürger gibt, die sich einer Verletzung der Gesetze schuldig machen, und andere, deren Beruf es ist, den Gesetzen Geltung zu verschaffen? Ich bin ganz erstaunt über das, wessen Sie sich von Ihrer Erde her erinnern. Wie? Jene Beamten, die, um allen gerecht zu werden, eigentlich unfehlbare Götter sein müssen, werden bei euch Erdenmenschen weder ausgesucht noch ausgebildet? Es gibt auf der Erde keine Schulen, in denen die Richter jahrelang die Komplikationen des menschlichen Wesens studieren müssen? Keine Lehrkurse für die verschiedenen Klassen von Leidenschaften, Narrheiten und Verirrungen? Keine Kurse über den Einfluß von Krankheiten, den Wert der Zeugenaussagen?... Das ist ja verabscheuungswürdig!... Wie? Was suchen Sie mir noch zu verheimlichen?... In schweren Strafsachen fällen bei Ihnen die erstbesten Leute, die einfach aus der Masse wahllos herausgegriffen werden, als ‹Geschworene› Urteile? Oh, oh, oh!«
Agathos barg sein Gesicht in den Händen und verhüllte sich zum Zeichen tiefster Niedergeschlagenheit den Pompon mit einer Schärpe. Und ich schämte mich, diesen höheren Artgenossen über die menschlichen Verhältnisse auf der Erde weinen zu sehen.
Kalos und seine Frau versuchten ihn zu trösten, indem sie ihn mit ihren entblößten Armen umfingen. Sie trugen reichen Schmuck, der sich aneinander wetzte, und um den Stengel ihrer Pompons eine mit Juwelen besetzte Goldkette, die man ebensogut Armband, Ring oder Kollier hätte nennen können.
Mein braver, alter Agathos wischte sich die Augen und die Brille ab, ebenso die Gläser seines Pompons. Es war höchste Zeit, daß er sich beruhigte, denn die Autokugel stoppte. Wir waren an unserem Ziele angelangt.
Das Fest war in vollem Gange. Man tanzte wie rasend. Es herrschte ein lebhaftes Gemurmel, nicht von Gesprächen, aber von Gesumm und Ausrufen. Allerhand Düfte schwängerten die Luft. Dieses tiefe Schweigen in einer derart bewegten und animierten Gesellschaft überraschte mich. Ich suchte instinktiv nach dem Ballettmeister, der mangels jeglichen Orchesters den Takt schlug, dem sich alle so gefügig unterwarfen.
Eine Enttäuschung harrte meiner.
In einer Ecke des Salons gaben sich grüne Neger allen möglichen Körperverdrehungen und Gliederverrenkungen hin und manipulierten mit Apparaten herum, denen die verschiedensten Gerüche entströmten. In rhythmischen Bewegungen, wie Zirkusjongleure mit Kugeln spielend, wie Clowns mit den Beinen, Schultern und dem Gesäße arbeitend, schwangen diese sonderbaren Musikanten eine lange Phiole hin und her und hoben unter epileptischen Verrenkungen Deckel von dampfenden Pfannen ab oder entkorkten oder verschlossen Flaschen und Räuchergefäße. Einer von ihnen thronte auf einem Sessel, der unter ihm hin und her tanzte wie ein dürrer Klepper, und bearbeitete die Tasten einer Orgel, deren Pfeifen duftspendende Substanzen enthielten.
»Um so etwas zu sehen, verlohnte es sich nicht der Mühe, eine derartige Reise zu unternehmen,« dachte ich bei mir. »Im achtzehnten Jahrhundert erfand Castel das Farbenklavier und Pater Poncelet das des Geschmackes, und seit dieser Zeit wimmelt die Literatur von derartigen Geschichten. Aber tanzen ließ noch keines dieser Klaviere einen Menschen.«
Agathos wich nicht von meiner Seite. Als alter Mann, der an dem festhielt, was in seiner Jugend Mode und Brauch war, beklagte er auf das bitterste die Geruchsnarreteien der grünen Jazz.
»Zu meiner Zeit würde man derartige wüste Dinge nicht geduldet haben,« seufzte er, »die Duftmelodien waren würzig, blumig, einfach wie die Natur und — vornehm! Riechen Sie nur einmal diese Mißdüfte.«
Tatsächlich bemerkte ich bei einiger Achtsamkeit, daß sich unter die lieblichen Gerüche auch ganz vulgäre mischten. Zuweilen keimten zwischen den Düften feuchter Wälder oder feenhafter Gärten abscheuliche, an Küche und Apotheke erinnernde auf. Und nicht ohne Interesse erinnere ich mich gewisser Akkorde, in denen der Duft von Rosen und Nelken mit jenem von Knoblauch, Hammelragout, Jod und verbranntem Papier wetteiferten. Aber ich war zufolge meiner Natur unfähig, alle kleinen Nuancen zu unterscheiden, und was den Rhythmus anbetraf, so entging er mir restlos.
Was mich aber dafür sehr gefangen nahm, war, daß ich aus den Betrachtungen Agathos' über die moderne Musik der Gerüche ersah, daß auf »Ourrh« die Duftkunst stets eine repräsentative gewesen war. Jedes dieser Musikstücke war einer Landschaftsmalerei oder einem Porträt zu vergleichen. Die Komponisten-Parfümeure arbeiteten zugleich als Musiker und Maler. Agathos beichtete mir, daß ein Parfümhumorist von ihm eine Karikatur entworfen habe, die auf die witzigste Art seinen typischen persönlichen Geruch wiedergab.
»Ein glänzender Scherz,« sagte er mir. »Beim Einatmen dieses Parfüms erkennt mich alle Welt, trotz der Verzerrung des Wirklichen. Bei dieser Gelegenheit muß ich Ihnen bekennen, daß die gegenwärtige Schule eine schlimme Richtung verfolgt und derart übertreibt, daß man oft nicht weiß, ob man die Ausdünstungen eines Sumpfes oder den Duft des Meeres einatmet. Die ›Jungen‹ besitzen eine unerhörte Kühnheit. Doch was sagen Sie zum Tanze?«
Ich blickte auf den bunten Reigen. All diese Mandarinen und Mandarininnen mit ihren Pompons und großen Nasen walzten. Eine Art Boston. Aber nicht zwei und zwei, sondern drei und drei. Das sah wie ein recht nettes Ballett aus. Bald einander zugekehrt, bald sich den Rücken wendend, dann Seite an Seite, glitten sie, die Hände ineinander verschlungen, harmonisch dahin. Je mehr ich aber ihre Körperbewegungen studierte, um so klarer erkannte ich, daß diese Art des Tanzes schrecklich schwer war, denn es gehört dazu, lieber Pons, daß man eine erste Leuchte integraler Mathematik ist. Das verursacht aber den Mandarinen keinerlei Schwierigkeiten, denn alle beherrschen diese Disziplin so, wie du weißt, daß zweimal zwei vier ergibt. Der Sinn hierfür ist bei ihnen derart entwickelt, daß man eigentlich von einem siebenten Sinn sprechen kann. Du wirst jedenfalls auch schon die Beobachtung gemacht haben, daß ein Mathematiker Dinge im All feststellt, die anderen gewöhnlichen Sterblichen stets verborgen bleiben.
»Möchten Sie nicht tanzen?« meinte Agathos.
»Danke, verehrter Meister. Zum Tanzen habe ich allerdings die Anlage, aber für Mathematik nicht die geringste. Ich ziehe es vor, mich mit Fräulein Kala zu unterhalten, die das ›Mauerblümchen‹ spielt, weil ihre Nase für die Schönheitsbegriffe auf ›Ourrh‹ zu klein ist. Bitte um den Gedankenübertrager.«
Fräulein Kala schien entzückt. Inzwischen war der Boston zu Ende. Ich war das Objekt allgemeiner Aufmerksamkeit. Mit dem Fremden, der aus dem unendlich Großen kam, mittels des Gedankenübertragers eine Unterhaltung zu pflegen, war auch etwas ganz Besonderes, und ich glaube, daß Fräulein Kala, trotz ihres winzigen Näsleins, sich sehr gern einem musikalisch-geruchlichen Gespräche mit mir hingegeben hat.
»Der intensive Duft der Mandarinen versetzt Sie in Erstaunen?« fragte sie mich. »Ich meine deren Geruchssinn?«
»Nicht doch, liebes Fräulein,« erwiderte ich. »Auf Erden gibt es gewisse Insekten, die Ameisen, deren Hauptsinn der Geruchssinn ist. Es gibt unter ihnen blinde, aber sie besitzen sozusagen an jeder Fingerspitze eine Nase, und ich bin fest überzeugt, daß sie die Umwelt geradeso gut wahrnehmen, wie Sie mit Ihrem Pompon und ich mit meinen Sehwerkzeugen. Alles übersetzt sich bei ihnen in Duft: Wasser, Lebewesen, Häßlichkeiten, die übel duften, Schönheiten, die wohlriechen. Und was geruchlos ist, halten sie für nicht existent.«
Kalas Pompon bewegte sich. Sie wedelte damit, wie ein liebenswürdiger Hund mit dem Schwanze.
»Finden Sie, daß ich heute abend schön rieche?«
Eine Evastochter hätte gesagt: »Finden Sie, daß ich heute abend hübsch aussehe?«
O Launen der Schöpfung! Dieses Persönchen mit dem winzigen Näschen, das den Mandarinen häßlich erschien, übte auf mich eine verführerische Anziehungskraft aus. Wie sie nur konnte, suchte sie mir zu gefallen. Und das durch den Charme gewisser Ausstrahlungen, die sie für äußerst reizvoll hielt, die für mich aber nur ein Schein blieben, ein Schönheitsprinzip, aber keine eigentliche Liebeserklärung.
Der Tanz hatte wieder begonnen. Doch trotz allem Durcheinanderwirbeln der choreographischen Figuren blieben die Pompons sämtlicher Paare auf mich gerichtet. Die Mandarinen exekutierten jetzt eine unnatürlich aussehende Mazurka. Sie tanzten immer zu dritt.
Ich offenbarte Kala, daß mich dies sehr wundere. Sie errötete heftig, und der Gedankenübertrager enthüllte mir ihre heftige Gemütsverwirrung.
Überrascht und verlegen drang ich nicht weiter in sie und begnügte mich, den stummen Ball zu beobachten.
Etwas Auffallendes nahm ich da wahr.
Die zahlreichen eleganten Mandarinen zerfielen in drei Typen, mochten sie nun grün oder weiß sein. Lassen wir die untergeordneten Grünen beiseite.
Drei charakteristische Typen: Männer, Frauen und einer Art »Cherubim«, die Zwittern ähnelten. Letztere glichen teils als in Knaben verkleideten Frauen, teils weibischen Männern. Und obwohl sämtliche Mandarinen ganz gleich gewandet waren, fiel es nicht schwer, diesen Bastardtypus, zu welchem zweifelsohne auch der schöne Kalos gehörte, von den andern zu unterscheiden.
Du kannst dir die Verblüffung vorstellen, lieber Pons, die sich meiner bei dieser Entdeckung bemächtigte. (Bei Ameisen oder anderen irdischen Lebewesen hätte mich die Sache weiter nicht erstaunt.) Noch mehr war ich baff, als ich feststellte, daß jedes »Dreipaar« aus einem Mann, einer Frau und einem »Cherub« bestand.
In meiner Naivität, mit der ich stets irdische Vergleiche anstellte, dachte ich zuerst, daß diese »Cherubim« bei den Mandarinen das vorstellten, was die »Arbeiter« bei den Ameisen.
Kala ließ mich nicht lange darüber nachgrübeln. Sie setzte mir den Gedankenübertrager an die Schläfe, um mich zu benachrichtigen, daß sie mich dem Hausherrn vorstellen wolle. (Auf »Ourrh« zählen die Hausherren überhaupt nicht mit. Kommt man mit ihnen zusammen, so ist's gut, trifft man sie nicht, ist's auch gut.)
Der Direktor der Richterschule war ein hochgewachsener alter Mann, dessen trauriger Pompon auf einem kahlen Schädel den Eindruck einer Trauerweide machte. Er nährte in seiner Seele einen tiefen Schmerz, denn tags zuvor hatte die gesetzgebende Kammer die Strafe der Pompon-Exekution abgeschafft, die darin bestand, daß man den Verurteilten den Pompon abschnitt. Er drückte jedem die Hände wie mit Trauerhandschuhen an den Fingern und sagte jedem, der es hören wollte: »Wohin steuern wir! Wohin steuern wir!«
Ich ließ ihn bekümmert weiterziehen. — Und doch war dieses Ballfest zu Ehren seiner einzigen Tochter gegeben worden, die sich verheiratete. Kala teilte mir dies mit, indem sie sich über die Leichenbittermiene dieses alten Spaßverderbers lustig machte.
Als Kala von Heiraten sprach, konnte sie ein gewisses Feuer nicht verheimlichen, das sie noch schöner erscheinen ließ. Brüderlich legte ich meine Rechte auf ihre zitternde Hand, ohne an die sechs Finger derselben zu denken, noch an die amethystfarbene Chrysantheme, die sich auf ihrem blonden Haupte leidenschaftlich bewegte. Gott ist mein Zeuge, und das Andenken an meine Olga wurde nicht alteriert, ich wollte nur die Hoffnung wieder im Herzen dieser sanften Kala wecken, die wegen ihres kleinen Näsleins Gefahr lief, eine alte Jungfer zu werden.
»Sie werden sich auch verehelichen, Kala,« sagte ich zärtlich.
Sie senkte die Augenlider. Ihr Pompon zog sich in seinem Tubus zurück. Leicht erbleichend, drückte sie mir bebend die Hände.
Dann öffneten sich wieder ihre Augen und ihr Pompon.
»Danke!« seufzte sie etwas enttäuscht. »Danke... doch zum Heiraten gehören drei!«
Ich fiel vor Schreck rücklings nieder. Mit zelluloidartigem Geschepper rollte mein falscher Pompon über das Parkett. Schnell pflanzte ich ihn wieder auf und hoffte, daß niemand meinen krankhaften »Defekt« gesehen habe. Aber hinter mir begann jemand höhnisch zu grinsen, und schaudernd gewahrte ich den scheußlichen Kakos.
»Zum Heiraten gehören drei!«
Alles, was uns Menschen ungewöhnlich vorkommt, Pons, halten wir für ungeheuerlich. Und doch lehrt uns schon die Mannigfaltigkeit der irdischen Erscheinungen, daß es in dem immensen Universum, wo so viele Welten kreisen, die sich von der unsrigen wesentlich unterscheiden, sicherlich für uns ganz unbegreifliche Dinge und Stoffe geben muß. Lebewesen, die ganz und gar von uns in ihrer Art und in ihren Funktionen abweichen, und zwar auf eine Weise, die wir uns schlechterdings nicht vorstellen können. In den Sonnen, auf den Planeten und den Monden des unendlich Großen und des unendlich Kleinen gibt es eine Unzahl von Lebewesen, die nichts mit uns gemein haben. Ich weiß es, wie du es weißt. Und wenn die Mandarinen auf mich einen so ungeheuerlichen Eindruck machten, so waren es nicht die Abweichungen, die sie von uns aufweisen, sondern die Ähnlichkeit, die sie uns annähern. Ein Mensch, der nicht ganz Mensch ist, verblüfft uns weit mehr als ein ganz anders geartetes Geschöpf, dessen Kenntnis uns doch in ein Meer von Erstaunen und ehrfürchtiger Bewunderung versenken müßte.
Nehmen wir an, daß eines jener irdischen Wesen, die sich ganz von selbst vermehren, mit Vernunft begabt wäre, was würde wohl ein solches Geschöpf von der Vermehrungsart der Säugetiere denken? Speziell der Mensch würde ihm ekelhaft und tiefstehend erscheinen. Das stimmt. Dennoch können, ja müssen wir annehmen, daß es Sphären, Welten gibt, wo sich das Leben nur durch die Zusammenarbeit einer gewissen Menge gleichartiger, aber in der äußeren Form verschiedener Individuen fortpflanzt. Als Gott die Mandarinen schuf, diese originellen Wesen, tat er es nicht mit Rücksicht auf den Menschen. Auf einen oder tausende mehr oder weniger kommt es nicht an. Die glückliche Entdeckung bestand darin, seine Rassenfortpflanzung nicht mehr einem einzelnen Individuum anzuvertrauen.
In dem Momente, wo die Natur die Mitarbeit hierbei erfand, bleibt, philosophisch gesprochen, die Anzahl der »Mitarbeiter« ohne Belang. Ob zwei oder tausend, ändert, vor dem kalten Auge der Wissenschaft, an dem Prinzipe nichts.
Nun war ich auf dieses Neuartige nicht gleich gefaßt. Und die Sache hatte mich sozusagen niedergedonnert, und dies um so brutaler, als ich mir das Ding ganz falsch vorstellte, sowohl die dreifache Vereinigung der Mandarinen, als die drei Kategorien derselben, die sich in die Vereinigung teilen. Meine Gewohnheit, zu denken, und mein irdisches Vorstellungsvermögen hatten mich wieder einmal irregeführt. Tatsächlich gibt es auf »Ourrh« drei Geschlechter. Auch gibt es auf »Ourrh« »Arbeiter«. Die wirklichen Männchen aber sind die schönen verführerischen Cherubim. Die mir ähnlich sehenden Mandarinen, die dem irdischen Menschen gleichen: Agathos, Kakos, waren, so männlich sie auch erschienen, nur »Arbeiter«. Sie »werkten« und nährten ihre Familie und spielten bei ehelicher Verbindung nur eine verschwommene Rolle, obwohl sie dabei sein mußten, so wie z. B. die Nähe gewisser chemischer Bestandteile erforderlich ist, um andere zu kombinieren und zu erzeugen. Ihr Gelehrten nennt diesen Prozeß »Katalyse«.
Doch selbst wenn ich all das gewußt hätte, glaubst du nicht, lieber Pons, daß ich dennoch rücklings umgefallen wäre — und dir wäre sicher das gleiche passiert! —, als ich Vorgänge kennenlernte, die von jenen, die wir auf Erden kennen, so grundverschieden sind?
Aus meiner Verwirrung und Verblüffung, in welche mich Kalas Mitteilung gestürzt hatte, wurde ich durch Agathos, den trefflichen, der gerade daherkam, emporgezogen. Er war der Aufdringlichkeit Kakos inne geworden und hatte von fern meinen unglücklichen Sturz beobachtet. Nun eilte er herbei und erging sich ausnahmsweise in heftigsten Gestikulierungen.
Fortab passen jedoch die Namen »Agathos« und »Kakos« nicht mehr. Da sie sächlichen Geschlechtes sind, nenne ich ihre Träger nunmehr »Agathon« und »Kakon«.
Der — die — das: Maskulinum, Femininum, Neutrum; Bonus, bona, bonum. O diese Fremden, diese Alten mit ihren drei Geschlechtern, welche Perspektiven eröffnen sie damit auf das, was man nicht weiß, oder nicht mehr weiß! Soll man in Agathos — Agatha — Agathon eine Erinnerung daran erblicken, was der Mensch in längst versunkenen Urzeiten gewesen ist. Läßt doch schon Plato in seinen »Tischreden« Aristophanes sagen: »Ehedem zerfiel das Menschengeschlecht in Männer, Weiber und Zwitter.«
Aber ich werde doch nicht den Namen »Kakos« und »Agathos« ins Neutrum umwandeln, ich bin nun einmal an ihr männliches Geschlecht gewöhnt. Überdies war es ja nicht das erste Mal, daß ich Leute Männer nannte, die es in Wirklichkeit nicht waren.
»Gehen wir,« meinte Agathos. »Es war ein bedauerlicher Zufall. Kakos ist sehr pfiffig. Vielleicht ist er schon überzeugt in seinem Innern, daß Sie niemals einen Pompon besaßen. Auch steht die violette Sonne im Begriffe aufzugehen. Der Ball ist bald zu Ende. Ziehen wir uns zurück.« Dann wandte er sich an Kalos und sagte: »Sie haben vielleicht die Güte, unsere Frau nach Hause zu bringen? Herr Fléchambeau und ich begeben uns in die Rundausstellung.«
Spitzbübisch blickte uns Kakos nach und sein Pompon zeigte Verräterpläne.
Die Rundausstellung füllte das ganze Innere eines monumentalen Palastes aus, den aus Stein und Marmor gehauene Boskette umrahmten.
»Warum keine natürlichen Pflanzenanlagen?« erkundigte ich mich.
»Sterilisation!« erwiderte Agathos. »Diese Skulpturen wirken dekorativ. Wirkliche Bäume wären zu gefährlich.«
Diese flüchtige Bemerkung verriet ein gewisses Unbehagen, das ich bereits einmal wahrgenommen hatte. Ohne weitere Äußerungen zu machen, ließ ich mich in das Innere des Palastes mitschleppen. »Das ist ja eine Ausstellung von Hängeobjekten,« dachte ich mir in meinem Innern.
Die Flucht der schlecht erleuchteten, fast dunklen Säle bot keine Abwechslung. Von der Decke herab hingen halbkugelförmige Systeme in großer Anzahl herab, wie ich sie schon bei Agathos und im Hause des Direktors der Richterschule gesehen hatte. Ob klein oder groß, alle hatten die Rundung dem Boden zugekehrt. Ohne plastisches oder zeichnerisches Interesse, waren die Halbkugeln mit verschiedenen, fast farblosen Eisenfeilspänen übersät. Mit weit auseinandergefalteten Pompons bewegte sich eine summende Menge unter ihnen herum. Unter gewissen Halbkugeln stauten sich die Besucher. Manche hörte man knurren, andere ekstatische Ausrufe ausstoßen.
»Verzeihung,« wandte ich mich an Agathos, »aber diese Ausstellung ist mir schleierhaft. Wenn Sie sich mit mir einen Scherz erlauben wollen...«
»Zu meiner und zu Ihrer Belehrung wünschte ich Ihren Besuch hier, mein Freund. Es ist eine wunderbare Philosophiestunde. Denn es gibt auf der Welt nichts Köstlicheres, nichts Entzückenderes für einen Mandarin, der sich der ›Dounn‹ erfreut, als diese Kunstwerke, die wir dem Genie unserer berühmtesten Rundisten verdanken.«
»Ich sehe, fühle und höre nichts,« brummte ich. »Kein Wunder, mir fehlt ja der Pompon. Ich komme mir wie ein Blinder in einer Gemäldeausstellung vor, der nur die mit Farben beklexte Leinwand betasten und sagen kann: ›Diese hier ist rauher als diese.‹ Ich möchte fort. Man muß mich für einen Idioten ansehen.«
Agathos betrachtete die Hängeobjekte, über denen ich elektrischen Kontakten ähnliche Apparate erblickte.
»Wundervoll!« rief er mir durch den Gedankenübertrager zu. »Anbetungswürdig! Welche Kraft und dort, welche Gewandheit! Diese Interieurstudie! Dieser Aufbau! Diese ›Träumerei‹! Dieser Zorn! Diese ›Ungewißheit‹!... ach, mein Freund, diese Klassiker, was sind das für Meister!«
Und er zitierte mir in Gedanken Gedanken, die Namen waren. Dann:
»Wir befinden uns jetzt in den Sälen der Ältern. Nebenan befinden sich die Arbeiten der Modernen, der Jungen.«
Lautes Kampfgetöse erscholl von dort. Man schien miteinander handgemein zu sein.
Zwei Mandarinen mit riesigen Händen, vierschrötigem Äußern und hinterlistigen Gesichtern »schmissen« eine Mandarinin, die sich verzweifelt gebärdete, hinaus. Sie hatte eben eines der Ausstellungsobjekte vernichtet.
Herzlichst lachend bemerkte Agathos:
»Es ist das bekannte Fräulein X. Sie hat ihr amtliches Porträt, das sie beleidigend fand, zertrümmert...«
Andere Mandarinen, die verschiedenen Richtungen huldigten, stritten heftig miteinander. Ich fühlte mich ungemein beschämt, traurig und angeärgert.
»Nun, was halten Sie davon?« fragte mich endlich Agathos.
»Ich glaube, daß wohl die Hälfte meiner Artgenossen Ihnen zum Munde reden würde, ohne sich anmerken zu lassen, daß sie von der Sache keinen Deut verstehen. Bei uns zieht man sich auf diese Art und Weise aus der Klemme. Eine Masse Schöngeister mimt vor einem Werke, von dem sie nichts verstehen, die Kunstverständigen. Darunter befinden sich, wohlgemerkt, oft professionsmäßige Kritiker. Ich lernte zwei oder drei solcher Leute kennen, die nicht einmal lesen konnten. Statt nun lesen zu lernen, zogen sie es vor, in die Welt hinauszuposaunen, daß kein Mensch mehr schreiben könne. Und wie viele Leute gibt es bei uns, die mit dem Nagel an den Gemälden herumkratzen, um das erlösende Wort zu finden, ob sie glatt oder rauh sind, statt sich darüber klar zu werden, daß es sich um die Zeichnung, die Farben, die Auffassung handelt. Nochmals gesagt, Agathos, ich verstehe von ihrer Rundausstellung weniger als nichts. Ich erblicke hier nur völlig uninteressante runde Dinger, die eins dem andern so ziemlich gleich sehen. Ich habe keinen Pompon, und alles, was mit der ‹Dounn› in Verbindung steht, ist mir fremd. Für mich ist hier nur ein gähnendes Nichts. Ich sag' es ganz offen heraus.«
Da fühlte ich, wie sich im Gedränge ein indiskreter Finger am Saugringe meines Pompons zu schaffen machte. Ich drehte mich rasch um und gewahrte zu meinem Schrecken den infamen Kakos an meiner Seite. In der Meinung, mich durch den Gedankenübertrager mit Agathos zu unterhalten, hatte ich in Kakos seinen »hineingedacht« und ihm meine geheimsten Gedanken und meinen Mangel jeglichen Pompons verraten.
Agathos vermochte mein Mißgeschick nicht wahrzunehmen, denn er sprach gerade mit einem Mandarinen, dem er große Hochachtung bezeigte und den er mir dann vorstellte. Es war ein berühmter Rundist, ein Meister, dessen Ruf fest begründet war und der sich bemühte, stets eine steinerne Miene aufzusetzen, um sich irgendetwas Ewiges zu verleihen.
Agathos bat ihn um die Erlaubnis, seine Werkstatt mit mir besuchen zu dürfen und der Künstler willigte gern ein.
Das Atelier lag in einem geräumigen Keller, durch dessen Lichtschachte um diese Tageszeit Strahlenbündel violetter Beleuchtung einfielen. Natürlich strotzte das Lokal überall von den mir bereits bekannten halbkugelförmigen Objekten und den Wandvertäfelungen, die ich schon in Agathos' Salon bestaunt hatte. Auch sie waren mit Eisenfeilspänen bespickt, und alles zusammen hieß: Rundkunsterzeugnisse oder, wenn man den Ausdruck vorzieht, Dounnkunstwerke.
In der Mitte des Ateliers erhob sich ein Dreifuß, auf welchem eine Halbkugel aus schwärzlicher Masse aufmontiert war, die nur teilweise mit Eisenfeilspänen inkrustiert war und die runde Seite dem Boden zukehrte.
Agathos und der Rundist stellten sich zwischen die drei Beine des Gestells und betrachteten mit dem Pompon lange den Entwurf. Inzwischen besichtigte ich das Handwerkszeug des Rundisten. Da lagen auf einem Brett eine Unmasse von Zangen und Hämmern und in geneigten Fachkästen, geheimnisvoll geordnet, Häufchen von Metallspänen. Diese Fachkästen stellten »Paletten« dar.
Auf Agathos' Bitte hin willigte der Meister ein, von mir eine Skizze anzufertigen. Ich gefiel ihm, war doch auch ich eine Berühmtheit in meiner Art.
Er stellte auf den Dreifuß eine noch nicht mit Eisenteilen, jedenfalls aber mit ihrer elektrischen Einrichtung bereits versehene Halbkugel und begann, ihrer Oberfläche Metallteilchen, die er bald aus diesem, bald aus jenem Fache der »Paletten« auswählte, einzuverleiben. Er beschnitt sie zum Teil, zum Teil drehte er sie und machte daraus winzige, pfropfenzieherartige Spiralen, ehe er sie einsetzte, nicht ohne vorher reiflich nachgedacht und den Punkt dieses mir unverständlichen Mosaikwerkes sorgsam ausgewählt zu haben.
Nach beendeter Sitzung hängte er die Halbkugel an Schnüren auf und zog sie hinauf, nachdem er zuvor überlegt hatte, welches Niveau wohl am besten sei. Dann gestattete er mir einen Händedruck, während der brave Agathos, trunken von Begeisterung, seine Pantoffel, einen nach dem andern, in die Höhe schleuderte.
»Die Ähnlichkeit ist verblüffend,« sagte er mir. »Ein unvergleichliches Meisterwerk! Solch eine Kunst! Solch eine Kunst! Überhaupt!...«
Ich sah leider nur ein ganz banales Ding, das, menschlich gesprochen, auch nicht das geringste Menschliche aufwies. Stelle dir einen wilden, einen primitiven Analphabeten vor, dem man eine Beschreibung seines Gesichtes und seiner Psyche vorlegt, die ein berühmter Dichter oder Schriftsteller verfaßte...!
Der Meister führte uns dann als freundlicher Hausherr in seinem Heime herum und wir stiegen hierauf wieder an das Tageslicht empor. Als ich meiner Verwunderung darüber Ausdruck verlieh, daß das Atelier in einem Keller untergebracht sei, erklärte mir Agathos, es sei dies für die Auswirkung der »Dounn« günstiger, und demgemäß auch für die Ausübung der Rundkunst.
Mein »Porträtist« war ein feiner Künstler. Er suchte stets neue Anregungen, selbst in den gröbsten Machwerken primitivster »Kunst«. So besaß er auch einige Gemälde und unterhielt sich sogar öfters damit, selbst etwas zu malen, wie bei uns die großen Meister des Pinsels sich manchmal damit unterhalten, zu kochen.
Die Malerei steht bei den Mandarinen nicht sehr im Ansehen, ebensowenig wie die Tonkunst, da sie ja über sehr mangelhafte Seh- und Hörorgane verfügen. Zudem ist das doppelte Licht der gelben und der violetten Sonne der Farbentechnik sehr hinderlich. Bei den mir heute vorgelegten Schwarten bemerkte ich übrigens, daß mein guter Mandarin vor allem suchte, dem Geschmack des Pompons gerecht zu werden, statt dem des Auges, und daß seine Malereien ganz im Banne dieses Zieles standen, so wie bei uns auf Erden gewisse Gemälde nichts als Literatur ausatmen.
Ich zweifelte nun nicht mehr, daß auf »Ourrh« nur das für schön gilt, was mit dem Pompon wahrnehmbar war, und erhielt dafür während der 65 Jahre, die ich dort verlebte, noch zahlreiche Beweise.
Der Rundist, der Cherub sowie die Gattin des Hauses boten uns eine Prise an. Agathos sparte nicht mit Lobpreisungen auf das Pomponvaporisierungsparfum, das der Meister erfunden hatte. Als man sich bei mir über die Sitten und Gebräuche auf Erden erkundigen wollte, legte sich Agathos als aufmerksamer Impresario ins Mittel, denn er scheute Kakos Machenschaften und wollte das Geheimnis wahren, daß kein Irdischer sich eines Pompons erfreue.
Als wir das gastliche Haus verließen, fragte ich Agathos:
»Ist Kala für Euren Pompon häßlich?«
»Ja, das Uninteressanteste, das es gibt,« erwiderte mein Freund.
»Arme Kleine!... Und ich, Agathos? Wie finden Sie mich? Natürlich im ›dounnistischen‹ Sinne.«
»Offen gestanden, nicht gut, nicht übel. Aber bei einem ›Arbeiter‹ kommt es ja absolut nicht darauf an, daß er schön sei. Und ich ziehe vor, daß man Sie für einen ›Arbeiter‹ halte. Es wird Ihnen größere Ruhe gewähren und wir können Indiskretionen leichter vorbeugen.«
»Kakos weiß alles,« meinte ich schüchtern. »Er hat alle meine Gedanken gelesen. Er kennt mich von A bis Z.«
»Das mußte so kommen,« meinte Agathos betrübt, »nehmen Sie sich in acht, mein Freund. Dieser erbärmliche Mann sinnt auf Ihr Verderben. Ich kenne ihn. Er wird keine Ruhe geben, bis er Ihnen nicht den Schädel öffnen kann, um zu sehen, was darin ist. Sie können sich diesem fürchterlichen Schicksal nur durch die Flucht entziehen.«
»Wohin soll ich fliehen, Agathos? Wo mich verstecken?«
»Auf ›Ourrh‹ wird Sie Kakos überall finden. Er ist schlau und mächtig. Hören Sie, Fléchambeau. Ich kann in wenigen Tagen das Band lösen, das Ihr Kleinerwerden sistierte. Wollen Sie Ihre Wanderung durch das unendlich Kleine wieder aufnehmen?«
»Niemals! Lieber sterben!«
»Dann bleibt mir nur das eine übrig, mich hinzusetzen und das Mittel zu suchen...,« er verstummte, dachte nach und rieb sich nervös seine große Nase.
»Welches Mittel, Agathos?«
»Ei!... das Mittel, um Sie wieder zu den Ihrigen expedieren zu können. Sie wieder wachsen zu lassen. Vielleicht werd' ich dazu lange brauchen, Fléchambeau, aber finden werde ich die Formel. In der Zwischenzeit wird Kalos Ihnen unsern Planeten zeigen. Aber ich sage es Ihnen nochmals, seien Sie auf der Hut, seien Sie auf Ihrer Hut!«
»Sorgen Sie sich nicht, lieber Alter!«
Ich war närrisch vor Freude.
»Mögen die allmächtigen zwei Götter alles zum Guten lenken!« meinte Agathos besorgt. »Mögen sie uns erhören!«
Denn auf »Ourrh« betete man zu zwei Göttern, so wie zwei Sonnen dort leuchteten.
Ehe sich Agathos an die Arbeit setzte, beharrte er darauf, mich dem Ersten Minister vorzustellen und auf einen Besuch der Anstalt für »Undounnisten« und das Museum.
»Was?« entsetzte ich mich, »Ich soll das Museum besuchen, dessen Direktor Kakos, mein größter Feind, ist?«
»Es muß sein. Wir werden schon unsere Vorsichtsmaßnahmen treffen. Aber wenn Sie nicht unser Museum kennenlernen, werden Sie so gut wie nichts von unserer Welt kennengelernt haben. Und jemand, der eine Reise tat, der muß doch was erzählen, womöglich wahrheitsgetreue Dinge berichten können.«
»Ach, teurer Agathos! Ist es denn möglich, daß ich jemals wieder den irdischen Himmel wiedersehe? Einen saftigen Rindsbraten essen werde und Olga heiraten...?«
»Ich will's jedenfalls versuchen!« erwiderte Agathos.
Der Erste Minister empfing uns auf das liebenswürdigste. Er schien mir ein Mandarin zu sein, wie alle andern, nur war sein Pompon dreifarbig (allerdings mit künstlicher Nachhilfe). Die Audienz währte nur ein paar Minuten. Man konnte sich kaum etwas Offizielleres und Hohleres vorstellen. Se. Exzellenz bezeigte nur für das, was direkt mit seinem Planeten zusammenhing, Interesse, vor allem für die Politik und die Wahlen. Was den Himmel und das unendlich Große anbetraf, ließ ihn völlig kalt. Mehrere Minister und Abgeordnete der gesetzgebenden Kammer befanden sich bei ihm. Ihre Pompons waren rot, nur zwei oder drei zeigten eine mehr rosa Färbung. Diese hielten sich jedoch bescheiden im Hintergrunde.
»Welch entzückender Plauderer!« bemerkte Agathos. »Es ist ein alter Freund von mir. Wenn Sie verstanden hätten, was er mir alles mitteilte, wären Sie von ihm berauscht. Er gehört einer Mandarinenrasse an, die ehedem am Äquator saß. Ihre Angehörigen sind geradezu Meister des Pompons. Ich versichere Ihnen, Fléchambeau, sich mit diesen Leuten geistig zu unterhalten, ist geradezu eine Wollust. Auch die gesetzgebende Kammer setzte sich fast durchwegs aus Angehörigen der Äquatorrasse zusammen, deren Musik die Wähler faszinierte. Das hindert nicht, daß manche von ihnen sogar Geist und Verstand offenbaren, denen man dann um so lieber Beifall spendet, als solches bei Leuten, die das Rednerpult erklimmen, um diesen oder jenen Speech loszulassen und sich dem erstaunten Publikum zu zeigen, sehr selten ist.«
»Lassen Sie uns jetzt die Taubstummenanstalt, Ihre ›Undounnisten‹ besuchen,« meinte ich, »nämlich das Institut, wo Ihre Mandarinen, die der ›Dounn‹ beraubt sind, jenes Wahrnehmungsorganes, das ich entbehre, erzogen werden. Wollen Sie?«
»Bitte!«
Die Anstalt beherbergte zwei- bis dreihundert Angehörige aller drei Geschlechter — nicht mehr, lauter junge Leute.
»Finden Sie nicht, daß sie Ihnen ähnlich sehen?« fragte Agathos. »Damit rechnete ich, um Kakos hinters Licht zu führen.«
Tatsächlich befanden sich unter den von Geburt aus adounnistischen Mandarinen, deren Pompons verkümmert oder nicht vorhanden waren, Individuen mit großen Augen und Ohren und einem Munde, der mich an meine irdischen Mitbrüder erinnerte. Da sie aber große Nasen hatten, beurteilte ich sie nicht so günstig, wie Agathos es tat.
Man bestrebte sich, ihre Sehkraft zu vervollkommnen und sie eine — scheußlich klingende — Sprache zu lehren. Ihr Geruchssinn hatte sich so wunderbar entwickelt, daß sie als Parfumkomponisten sehr gesucht waren. Man zeigte mir ein junges Mädchen, das zu den schönsten Hoffnungen seines Professors berechtigte, eines Parfumorganisten der Nationalkapelle.
Als wir das Haus besichtigten, wurde gerade in einem Sanitäts-Kugelautomobil ein Mandarin eingeliefert, dem in einer Fabrik der Pompon glatt vom Kopfe getrennt worden war. Obwohl die Wunde verbunden war, wankte der Unglückliche wie ein Trunkener hin und her.
Er konnte nicht mehr gerade gehen, tastete wie ein Blinder mit den Armen herum, riß entsetzt die Augen auf und heulte gotteserbärmlich.
Einer der Institutsinsassen war am selben Morgen infolge übermäßigen Schnupfens mit Tod abgegangen. In einem fürchterlichen Anfalle von Niesen hatte er seinen Geist aufgegeben. Einer der Anstaltsärzte schickte sich an, eine Autopsie des Schädels vorzunehmen, um festzustellen, weshalb der Betreffende adounnistisch gewesen war. Ich benützte die herrliche Gelegenheit, um mich über die Anatomie der Mandarinen, namentlich über deren Pompon, zu unterrichten und bat, der Sektion beiwohnen zu dürfen.
Stelle dir mein Erstaunen vor, als ich feststellte, das jenes Organ, das ich »Pompon« nenne, nichts anderes war, als die entwickelte Zirbeldrüse, die jeder Erdenmensch im Innern seines Gehirnes besitzt und deren geheimnisvolle Struktur ein verkümmertes Sehwerkzeug verrät.
Du wirst nun schon begriffen haben, lieber Pons, daß dieses Organ, um sich ausbreiten und entfalten zu können, aus dem Schädel der Mandarinen heraustreten mußte, und zwar aus der Fontanelle, die sich beim heranwachsenden Menschen schließt und verknöchert, zuweilen aber nicht völlig verhärtet.
Ich teilte Agathos meine Entdeckung mit und gestand ihm, wie mich diese Verwandtschaft zwischen den irdischen Riesen und den mikroskopischen Mandarinenwesen verwirre. Es entzückte und erschreckte mich zugleich und löste in meinem Innern Begeisterung aus. Die merkwürdigsten Perspektiven eröffneten sich aus dem Nebelmeere der Hypothesen über die Vergangenheit der menschlichen Rasse, deren Geschlecht sicherlich Millionen von Jahren alt war. Da unsere Zirbeldrüse für ein rückgebildetes Organ gilt, die Fontanelle ein Überbleibsel der Urzeit darstellt, verfügten vielleicht unsere vorgeschichtlichen Vorfahren über den sechsten Sinn der Mandarinen, kannten dessen Wohltaten und die Wirkungen des Pompons. Wie und wodurch hatten sie ihn verloren? Waren im dunklen Schoße der Zeiten die Mandarinen einst groß gewesen? Die Menschen aber mikroskopisch klein? Diese Frage beschäftigte mich lebhaft. Ich forschte in meinem Unterbewußtsein, ob nicht irgendeine vage Erinnerung in mir auftauche an etwas Atavistisches, das sich durch die Billionen Zeitalter hindurch bis auf meine Tage herübergerettet habe.
Agathos, der anfangs begeistert schien, ward plötzlich ernst.
»Ich schaudere, wenn ich daran denke, Kakos könnte hiervon eine Ahnung haben. Nun zögere ich selbst, Ihnen das Museum zu zeigen.«
»Nein, nein, Agathos! Ehe ich abreise, will ich alles sehen.«
»Nun gut, aber die Stunde schlug, wo es mir notwendig erscheint, Ihnen ein Geheimnis zu enthüllen, von dem man niemals redet.«
»Die Pilze?«
Agathos nickte. Später, als seine arme kleine verkümmerte und vertrocknete Zunge sich auskegelte, um ein paar Brocken meiner Sprache zu stammeln, vermochte er dennoch niemals den Namen »Champignon« auszusprechen, sondern sagte immer nur »Hons« und dieser Ausdruck fügt sich so trefflich in die Bezeichnungen ein, deren er sich im Gespräche mit mir bediente, daß ich dich um die Erlaubnis bitte, lieber Pons, dies Wort beibehalten zu dürfen.
Nun denn, der alte Mandarin erzählte mir:
»Als vor undenklichen Zeiten die Mandarinen noch nicht die Herren der ›Ourrh‹ waren, hatten sie gegen andere Geschöpfe, welche die Oberherrschaft anstrebten, schwer zu kämpfen. Unter diesen ihren Widersachern waren die Hons die hartnäckigsten und gefährlichsten. Scheußliche, riesige Pilze waren es, die alles überschwemmten und sich mit unheimlicher Schnelligkeit ausbreiteten. Sie wurden besiegt. Aber der entsetzliche Kampf, in welchem fast das ganze Geschlecht der Mandarinen unterzugehen drohte, legte unseren Vorfahren den Gedanken nahe, den Boden von allem zu reinigen, was derartigen Feinden Vorschub leisten könnte. Man beschloß, die ›Ourrh‹ zu entkeimen. Heute werden Sie auf unserm Planeten keinem einzigen Tiere begegnen, das sich etwa durch Weiterentwicklung vervollkommnen könnte, auch keinem einzigen verbotenen Gewächse. Nur Staatsforste haben wir für die Chemie, von der unsere Existenz abhängt, erhalten. Diese Waldungen sind aber derart beaufsichtigt, daß nichts darin keimen und wachsen kann, was wir nicht wünschen.
Die Erinnerung an die ›Hons‹ blieb lebendig. Sie bildet das Schreckgespenst aller nachfolgenden Generationen. Jeder von uns trägt diese Angst mit sich herum in seinem Herzen und sie begleitet ihn als Erbteil durchs ganze Leben. Denn seit unserm biologischen Siege, seit unserm vieltausendjährigen Triumphe, schmolz leider die Bevölkerung der ›Ourrh‹ auf eine Handvoll Mandarinen zusammen. Die Volksmassen der ersten Zeiten lösten sich in Nationen auf, die Nationen selbst zogen sich zusammen, und eines Tages gab es nur mehr einen einzigen Staat. Die Geburtenziffer ging dann ohne moralisches, fiskalisches oder anderes Zutun rapid zurück. Heute existiert, lieber Fléchambeau, nur mehr eine einzige unserer ehemals so zahlreichen, herrlichen Städte. Alle andern starben aus und verschwanden. Von den Dörfern wollen wir gar nicht reden, denn sie wurden aus sozialen Gesundheitsrücksichten schon vor Jahrhunderten eliminiert, denn der Bauer ist ein fahrlässiges Individuum, und es könnte auf seinem Misthaufen der Keim unserer Todfeinde sich ansiedeln und groß werden.
Dennoch verehren wir die Natur und das Lebensprinzip. Und so werden Sie denn bald Gelegenheit haben, in einem riesigen Parkgarten und Museum Vertreter der Tier- und Pflanzenwelt, die wir einst vernichten mußten, zu erblicken, über deren Arterhaltung wir pietätvoll wachen.«
»Lebend oder ausgestopft?«
»Lebend, ausgenommen solche, die in unserem Zeitalter nicht mehr zu existieren vermögen.«
»Aber was ist es mit den ›Hons‹, Agathos? Ich kann wohl nicht annehmen, daß Ihr auch sie weiterzüchtet?«
»Niemals!« rief Agathos mit antiker Geste. »Niemals,... allein...«
»Allein... was? Sie machen mich neugierig.« Stolz erhobenen Hauptes erwiderte er:
»Wir Mandarinen sind vornehme Wesen. Verstehen Sie mich, Fléchambeau, wenn ich Ihnen erkläre, daß wir uns nur das Recht der Selbstverteidigung zuerkennen, nicht aber das Recht des Vernichtens.«
»Genau so denkt man in meiner Heimat.«
»Nun, dann werden Sie sich nicht weiter darüber wundern, daß wir in unserem Museum eine kleine Menge Samen der ›Hons‹ aufbewahren, auf daß unsere Götter uns nicht vorwerfen können, etwas vernichtet zu haben, was sie schufen.«
»Verflucht gefährliches Beginnen!« meinte ich.
»Doch nicht, denn Kakos wacht peinlichst über alle Schätze des Museums, und der Mann ist ein treu ergebener Diener des Mandarinengeschlechtes... Für wissenschaftliche oder fortschrittliche Zwecke der Nation ist er zu allem fähig, selbst Ihnen den Schädel zu öffnen, um mit neuen Erkenntnissen das heilige Erbe der Väter zu bereichern.«
»Sie reden ja wie ein Mitglied des gesetzgebenden Körpers, Agathos! Dieser Kakos ist also eigentlich sympathisch?...«
»Er ist ein übler Vogel, dabei grausam und rechthaberisch, aber das eine muß man anerkennen: er ist Mandarin von reinstem Wasser. Für den Ruhm unserer bald dahinsterbenden Rasse, wenn es die Ehre der Nation gilt, scheut er vor keinem Verbrechen, keinem Sakrileg zurück.
Nun, Sie werden ihn ja kennenlernen. Die Höflichkeit erfordert es, denn ich kann das Museum nicht besichtigen, ohne ihn zu bitten, uns zu begleiten. Ihm aus dem Wege zu gehen, wäre viel gefährlicher, denn er könnte sich sofort allerhand Gedanken machen.«
Als Agathos glaubte, daß ich nach meiner Rückkehr auf die Erde meinen Mitmenschen alles erzählen könnte, was ich auf der »Ourrh« und namentlich im Museum gesehen, ahnte er natürlich nicht, daß er 65 Jahre brauchen würde, um die Formel meines Wiedergroßwerdens zu finden und daß ich bei meiner Ankunft unter Meinesgleichen nur mehr über ein kurzes Restchen Lebenszeit verfügen würde. Auf detaillierte Beschreibung alles Einzelnen kann ich mich leider nicht einlassen, da ich vielleicht sonst das Wesentliche nicht mehr berichten könnte, denn ich fühle, daß meine tödliche Schwäche unheimliche Fortschritte macht und ich muß mich beeilen, das Wichtigste niederzuschreiben.
Im großen und ganzen stellte das Museum einen riesigen Nationalpark dar, mit großen und weitläufigen Bauten, in denen die Mandarinen nach Möglichkeit alle Reliquien der verschwundenen Fauna und Flora ihres Planeten aufbewahrten. Es war eine Welt der Gegenwart und Vergangenheit, eine ganze Natur in Musterexemplaren.
Stelle dir vor, daß die Menschen die ganze Erde gerodet und sterilisiert hätten, so daß kein Tier, keine Pflanze mehr vorhanden wäre, außer — im zoologischen und botanischen Garten.
Namen- und Sachregister lasse ich fort. Ich will nur bemerken, daß ich tausend Sorten von Vögeln, Fischen und anderen Tierwesen sah, von denen manche nur phosphoreszierende, körperlose Erscheinungen bildeten, während sich andere nur durch Murmellaute, ohne wahrnehmbare Formen, manifestierten. Aquarien, Vogelhäuser und Gehege boten ihren Insassen alle natürlichen Lebensbedingungen. Die Tiere waren klein. Es gab auch reißende Tiere darunter. Die höheren Arten paarten sich zu Dritt und wiesen Pompons auf.
Eine hohe Mauer umfriedete das Ganze. Überall waren Wachposten aufgestellt. Da und dort erhoben sich Sterilisier-Fontänen mit aufgerollten Schläuchen und Spritzenmundstück. Beim geringsten Alarm, das heißt, wenn sich nur der winzigste, verdächtige Pilz irgendwo zeigte, wurde die Stelle sofort reichlich mit einer entkeimenden, vernichtenden Flüssigkeit übergossen.
Auf einem kleinen Fuhrwerke, das Agathos selbst lenkte, bewegten wir uns langsam durch die Baumreihen und gelangten zu den Gebäuden, wo uns Kakos, nachdem wir mehrere Vorzimmer durchschritten hatten, empfing. Wir sahen auf unserem Wege Dutzende von Aufsehern, von denen einer mißtrauischer war als der andere.
»Bleiben Sie immer an meiner Seite!« legte Agathos mir nahe.
»Und ob!« erwiderte ich ihm, denn alle Hindernisse, die man überwinden mußte, um zu Kakos zu gelangen und auch von ihm wieder loszukommen, machten mir einen tiefen Eindruck.
Als der Museumsdirektor mich erblickte, konnte er seine wissenschaftliche Begehrlichkeit nur schlecht verhüllen, aber er bemühte sich, liebenswürdig zu sein und erschöpfte sich in Höflichkeit. Bereitwilligst begleitete er uns durch alle Hallen, wo die wundervollsten Sammlungen ausgestellt waren. Ich machte mit der phantastischen Flora und Fauna der Urzeit Bekanntschaft, konnte sogar einige lebende Veteranen jener Epoche bewundern, die man künstlich erhalten hatte und fütterte. Dann folgte ich meinen Führern durch eine Flucht von Galerien, welche die fabelhaftesten photographischen Abbildungen jeder einzelnen Tierspezies und Pflanzenart enthielten, sowie phonographische Platten, auf denen die Schreie, Rufe, das Gebrumm und der Gesang verewigt waren, und Parfumaufnahmsscheiben, die den Geruch, angefangen von den Blumen bis zum Büffel, wiedergaben. Andere Apparate lösten in einem das Gefühl aus, als berühre man Schuppen, Pelz, Federn oder Früchte. Die kostbarsten Einrichtungen aber waren jene, die nur dem Pompon-Organe die Erinnerungen an ehedem überlieferten.
Wir stiegen auch in die Keller hinab, welche Muster alles dessen beherbergten, was als schädlich vernichtet worden war. Diese Keller stellten geradezu bombensichere Unterstände dar und waren mit Panzertüren versehen. Nur mit einem gewissen Schaudern betrat ich sie. Aber Agathos hielt mich bei der Hand und versicherte mir ein ums anderemal, daß ich mich nicht zu fürchten brauche.
Rezipienten enthielten da verdächtige Nährbouillons. Besiegt, eingesperrt befanden sich hier die Erreger der fürchterlichsten Krankheiten und Epidemien, die einst das Mandarinenvolk dezimiert hatten.
Agathos erzählte mir bei dieser Gelegenheit, daß bei der bis aufs Äußerste durchgeführten Entkeimung fast das ganze Mandarinengeschlecht zugrunde gegangen wäre, weil hierbei auch die zur Lebenserhaltung notwendigen, die nützlichen Bakterien — die vielleicht das Leben selbst sind — Gefahr liefen, umzukommen. Man hatte also schon Jahrhunderte früher gegen die allzu rigorose Hygiene Front machen müssen.
Ich weiß nicht, worüber ich mehr erstaunte, ob darüber, daß diese Mikrobe von Mikroben sprach, oder über die mysteriöse und seltsame Noblesse, die das Mandarinenvolk davon abhielt, die Feinde seiner Rasse bis auf den letzten zu vernichten.
Endlich erklärte uns Kakos, daß wir alles besichtigt hätten, und mit einem Seufzer der Erleichterung überschritt ich die Ausgangsschwelle dieser finstern Höhle, welche die »dounnistischen« Lampen zwar den Mandarinen erhellten, in denen aber ich mich nur dank einer Art von Photophoren, die für den Gebrauch der »Undounnisten« bestimmt waren, zurechtfand.
»Er hat uns die Samen der ›Hons‹ nicht gezeigt,« übermittelte mir Agathos durch den Gedankenübertrager. »Wo, zum Teufel, hebt er sie auf? Ich werde ihn fragen.«
Sie wechselten ein paar stumme Worte. Dann teilte Agathos mir mit, daß Kakos sich entschlossen habe, niemandem je den Ort zu verraten, wo er die entsetzlichen Keime der todbringenden Pilzsamen verwahre.
Ich vernahm dies mit aufrichtigem Bedauern, denn ich hätte gern meine Blicke an diesen historischen Dingen geweidet, die noch heute die Bewohner der »Ourrh« wie eine Gottesgeißel fürchten.
Agathos aber hatte den sakrosankten Aufbewahrungsort des teuflischen Schatzes erspäht, und zwar ganz im Hintergrunde des Kellers, wo unter Kakos Führung nur Bevorzugte sich dem Nervenkitzel des Betrachtens jener Kapsel, die den Samen enthielt, hingeben durften. Seiner Beschreibung nach mußten sie in einer Art schwarzer Bonbonniere verschlossen sein, die einen roten und einen weißen Kreis auf ihrem Deckel aufwies.
»Immerhin hätte ich die ›Hons‹, als ihr sie in eurer Gewalt hattet, restlos ausgerottet. Nicht eine einzige Keimspore hätte ich übrig gelassen,« sagte ich kopfschüttelnd zu Agathos.
»Dazu haben wir zu viel Herz!« entgegnete Agathos, ebenfalls den Kopf schüttelnd. »Wir glauben zu fest an die Wunder der Welt in all ihrer Mannigfaltigkeit.«
Kakos ging hinter uns drein.
Er begleitete uns bis zum Haupteingange des Museums. Es schien mir seinerseits nicht nur Höflichkeit zu sein, denn sein Pompon wandte sich von meinem keinen Augenblick ab. Der ekelhafte Mensch verschlang mich förmlich mit seinem Pompon und seinen Augen. Er zitterte vor fieberhafter Neugierde.
Nur mit Gewalt vermochte er sich von mir loszureißen. Seine knochigen Finger krampften sich zusammen, als packte er irgendeine Beute, und als wir uns zum Abschiede auf mandarinisch grüßten, schleuderte er seinen Pantoffel derart impulsiv in die Luft, daß der Schuh in den Zweigen eines steinernen Baumes verschwand.
Während der Hausmeister eine Leiter holte, um den Pantoffel des Herrn Direktors wieder herabzuholen, zwang sich dieser zu einem verlegenen Lächeln, dessen teuflischen Klang ich heute noch im Ohr habe.
Sobald Agathos sich an seine wissenschaftlichen Forschungen machte, nahm sich Kalos meiner an. Eskortiert von wachsamen und robusten grünen Negern, besuchten wir gemeinschaftlich die Stadt und die Gegend. Die Kugelautomobile beförderten einen ebenso sicher und rasch durch die Luft, wie auf dem Wasser oder dem Boden.
Trocken und rationell dehnte sich die Mandarinenstadt weithin aus. Sie war etwa viermal so groß wie Paris. Das kam von der Entvölkerung der »Ourrh« und war das Resultat der Zentralisation. Was den Planeten selbst anbetrifft, glaube ich nicht, daß er größer war als unser Mond. Seine Oberfläche war brach und öde. Nur einzelne hygienische Forste standen da und dort; ferner die regenerzeugenden Türme. Unzählige Wachtposten, die mit mächtigen antiseptischen Reservoirs, Sterilisierpumpen und Spritzen ausgerüstet waren, verteilten sich ringsherum. Diese grauen, nackten, traurigen Landschaften, wo nicht der kleinste Vogel zwitscherte, nicht das winzigste Insekt summte, gewährten einen trostlosen Anblick. Kalos erzählte mir, daß die Vogelwelt innerhalb weniger Wochen verschwunden war. Als Übertrager von Sämereien flößten die Vögel den Mandarinen große Besorgnis ein. Mittels vergifteter Körner gelang es, den Schwingenträgern die Seekrankheit und Schwindel in der Luft einzuimpfen. Tollwütig fielen sie übereinander her, brachten sich schwere Wunden bei und infizierten damit auch ihre Artgenossen, und als sie, vom Fliegen angewidert, sich zur Erde herabließen, wurden sie mühelos in Massen umgebracht und verendeten, indem sie ein letztes Mal ihre wertlosen Flügel ausbreiteten.
Auf meinen neuen Gefährten machte die namenlose Trauer der wüsten Gefilde einen tiefen Eindruck. Sein Herz war sehr empfänglich, und seine Gemütsbewegung löste in seiner Seele verzückte Harmonien aus. Er sang zuweilen im Geiste Gedichte, die ich um so mehr schätzte, als sie mir an der Quelle offenbar wurden, ohne durch irgendwelche Lautsprache verunstaltet zu werden.
Immerhin stieß mich Kalos ein wenig ab, und zwar wegen seines Sichgehenlassens — etwas, das er mit allen Cherubim gemein hatte —, und weil er so auf Kosten Agathos' dahinlebte. Ich konnte es mir nicht versagen, ihm darüber eine Bemerkung zu machen, worauf er mir entgegnete, er gehorche damit nur einem mandarinischen Naturgesetze.
»Übrigens,« meinte er, »ich werde an Jahren zunehmen und meinerseits zum ›Arbeiter‹ werden, wenn ich nicht ausnahmsweise — was wenig wünschenswert wäre — Cherub bleibe und als greisenhafter Jüngling ein greuliches Alter mit mir herumschleppen muß, wovor mich die Götter in Gnaden bewahren mögen.«
»Sie machen also verschiedene Entwicklungsstadien durch?« fragte ich neugierig.
»Selbstredend! Es gibt Mandarinen, die als ›Arbeiter‹ zur Welt kommen und es ihr ganzes Leben bleiben. Andere, die, wenn sie mannbar werden, sich zum Cherub entwickeln, bleiben es nur ganz ausnahmsweise. Was nun unsere Frauen anbetrifft, so verändern sie sich, vom Puppenzustande angefangen, aber so wie Ihre irdischen Frauen.«
»Puppenzustande?... Was ist denn das wieder?«
Da führte mich Kalos in eine Anstalt, die, mindestens für einen Irdischen, wohl das Merkwürdigste darstellte, was man sich denken kann.
Die Mandarinen werden nicht als solche geboren. Sie kommen als höchst anspruchsvolle, blöde und unreinliche Larven zur Welt. Diese Larven ähneln absolut nicht erwachsenen Mandarinen, die ihnen aber innigste Zärtlichkeit erweisen. Während des Puppenzustandes werden sie von eigenen Funktionären, die oft große Witzbolde sind, gewartet und einer Behandlung unterworfen, die sie je nach dem Wunsch der Eltern oder des Staates in eine gewisse Lebensbahn lenken soll. Je nachdem man Handarbeiter, Läufer, Intellektuelle oder was sonst aus ihnen zu machen wünscht, sucht man der Entwicklung ihrer Hände, Beine oder des Schädels Vorschub zu leisten. Die zu Hütern des Gesetzes Bestimmten werden in ihrer Muskulatur gefördert, den späteren Chirurgen sucht man rohe und herrische Gesichtszüge zu verleihen, ihre Fäuste werden so eng verschnürt, daß sie sie nie mehr aufmachen können.
In diesem Entwicklungsstadium sucht man auch, zu bestimmen, wer Cherub und wer Arbeiter werden soll.
Aber die Larven spielen allen Berechnungen Possen und machen einem einen Strich durch die Rechnung. Es existiert da eine geheimnisvolle Umwandlungsperiode. Aus dem Ei, in welchem die Mandarinenlarve einige Monate schlummerte, kriecht häufig ein ganz unerwartetes Wesen, und die ganze Geschlechtsspezialisierung wird dadurch umgestoßen.«
»Und das ist ganz gut,« fügte Kalos hinzu, »denn die Spezialisierungsbeamten sind arme Kerle, somit revolutionär angehaucht, und arbeiten oft nach ihrem eigenen Schädel und in gewissenloser Weise, nur im Interesse der eigenen Kaste.«
Ich fand es sonderbar, daß diese »Menschenschmiede«, diese Bildhauer Lebender, schlecht bezahlt werden, hatten sie doch die Aufgabe, das Werk des Schöpfers, der die Ware sozusagen nur in halbfertigem Zustande lieferte, marktfähig zu machen. Gelassen stopfte sich Kalos die Nasenlöcher mit einem kostbaren Schnupftabak voll und vergewisserte sich, daß seine schicke Frisur in Ordnung sei.
»Als ich Larve war, wollte man mich anscheinend zum Mediziner vorbereiten,« sagte er, »einen Pompon-Spezialisten aus mir machen. Wohin das führte, sehen Sie... ich wurde Cherub, und es ist besser so.«
»Für wie lange noch, Kalos?«
»Für hundert Jahre.«
»Teufel, die Mandarinen werden also sehr alt?«
»Ihr durchschnittliches Lebensalter beträgt zweihundert Jahre.«
Das erklärt dir, lieber Pons, weshalb der gute Agathos, der nicht mehr jung war, fünfundsechzig Jahre an der Entdeckung der von ihm gesuchten Formel arbeiten konnte, ohne ein hartleibiger, mürrischer Greis geworden zu sein.
Allabendlich, nämlich vor Einbruch der künstlichen Nacht, fragte ich Agathos, wie weit seine Studien gediehen seien. Eines Tages teilte er mir etwas niedergeschlagen mit, daß er sicher sei, die erlösende Formel zu finden, daß er aber zur Berechnung derselben sechzig Jahre benötigen werde. Dabei war er eine erste mathematische Größe, und zehn andere Mandarinen von Fach arbeiteten mit ihm zusammen, gegen die unsere größten Leuchten am mathematischen Himmel die reinsten Trotteln sind. Immerhin bewahrte ich mir für die Mandarinen größtes Interesse, für diese Welt, in die ich mich freiwillig verbannt hatte, bis mir des Agathos Wissenschaft den Paß ausstellen würde zur Abreise auf die Erde, von der ich so weit entfernt war, ohne dieselbe je verlassen zu haben. Täglich erwarteten mich neue Überraschungen.
Wäre nicht das furchtbare Heimweh gewesen, hätte ich ganz glücklich dahingelebt. Aber ich sehnte mich nach dir, teurer Freund, und der Schmerz, Olga auf immer verloren zu haben, und die Angst vor Kakos nagten an meinem Herzen.
Dieses Scheusal stellte mir auf die mannigfaltigste Art nach. Alle möglichen Fallen richtete er für mich auf. Oft währten seine Verfolgungen ununterbrochen und ließen mir nicht einen Tag Ruhe. Schlag auf Schlag harrten meiner Hinterhalte, Nachstellungen, Überfälle. Ich traute mich kaum, einzuschlafen, und schreckliches Alpdrücken folterte mich im Halbschlummer. Ich sah mich von Kakos in die Tiefe seiner Keller geworfen, schmachtete zwischen greulichen Bazillenkulturen und der furchtbaren schwarz-weiß-roten Bonbonniere, und dann öffnete er mir bei lebendigem Leibe den Schädel, um mein Gehirn zu studieren.
Dann folgte nach langen, langen Jahren eine Zeit der Ruhe. Kakos schien der Sache überdrüssig geworden zu sein. Das war zu jener Epoche, als Agathos zu der Schlußberechnung der von ihm gesuchten Formel kam. Seit einigen Monaten hatte sich die Berechnung vereinfacht. Die Milliarden Lösungen, die anfangs in Betracht gekommen waren, hatten sich auf einige tausend vermindert, und es rückten Tag, Stunde und Minute näher, wo die Menschen die endgültige Lösung in einer Buchstabenzeile hätten niederschreiben können.
Dieser Tag leuchtete auf, diese Stunde schlug, diese Minute brach an.
Es geschah, daß Agathos, sehr gealtert und gebeugt, mir zwei waschblaufarbige Pillen reichte und mir mit sehr begreiflicher Gemütsbewegung sagte: »Hier, Fléchambeau, ist die Frucht meiner angestrengtesten Studien. Eine einzige dieser Pillen gibt Ihnen Ihre ursprüngliche Gestalt zurück. Aber ich drehte deren zwei, im Falle Sie eine verlieren sollten.«
Ich verwahrte die Pillen in meiner Schnupftabakdose, denn ich hatte die Gewohnheit angenommen, zu schnupfen, wie alle Welt.
»Gemacht!« erwiderte ich. »Wir haben Zeit.«
Tatsächlich, jetzt, wo ich meinen »Paß« und mein Visum besaß, stand es mir frei, mich zu empfehlen, wann ich Lust haben würde. Ich fühlte mich nicht mehr gedrängt. Die Beschwerden des Alters peinigten mich. Das Andenken an Olga war nur mehr ein kleines Häuflein Asche. Sie mußte jetzt eine sehr dürre oder eine sehr dicke alte Dame sein, falls sie nicht schon in den Himmel eingegangen war. Und du, Pons, warst du nicht auch schon ein griesgrämiger Alter geworden? Zudem hatte ich mich auf »Ourrh« eingewöhnt. Ich ertappte mich dabei, daß feste Bande mich geistig und seelisch hier fesselten.
Lange schob ich die Abreise von einem Tag auf den andern auf. Noch einmal wollte ich gewisse Leute, gewisse Gegenden sehen. Ja, unglaublicherweise, manche öden Gefilde, traurige, brache Landstriche hatten mein Herz unwillkürlich gefangengenommen. Ich stand im Banne ihrer urigen Größe, ihrer tückischen Trostlosigkeit. Und da mich Kakos in Frieden ließ, machte ich oft ganz allein Ausflüge, um in der düstern Einsamkeit mich meinen traurigen Gedanken hemmungslos hinzugeben.
Namentlich ein furchtbar ödes Tal zog mich an, denn ich fühlte es, wie dessen rötliche Erdhänge und der fette Boden danach lechzten, sich mit Wiesen und Kornfeldern zu bedecken. Aber einmal mußte wohl geschieden sein.
Ich stieg auf einen Hügel, ließ mich auf einem Felsblock nieder und verlor mich in tiefstem Nachgrübeln.
Fernab am Horizonte zog die riesige Stadt der Mandarinen mit ihren vielen Kuppeln ihre gebrochene Linie. Nirgends bewegte sich ein Ast, nirgends ein Halm. Grabesstille lag über dem wüsten Tale.
So vieles ging mir im Kopf herum, so vieles schnürte mir das Herz zusammen. War mein Greisenalter daran schuld? Oder mein törichtes weiches Gemüt? Ich vergrub meine Stirne in meine Handflächen und weinte über die Kleinwelt, auf der mein Leben sich abgerollt, und die ich nun auf immer, auf immer verlassen sollte.
Plötzlich wurde mir mein falscher Pompon brutal entrissen. Ich sprang in die Höhe... mein Blut wallte... alle meine Nerven spannten sich.
Mit eisernem Griffe hielt Kakos meine Linke umkrampft, und mit der Rechten schwang er höhnisch lachend meinen falschen Pompon in der Luft herum.
Ich verabreichte ihm einen wuchtigen Fausthieb auf die Nase. Er brach zusammen.
Nun suchte ich meine Linke zu befreien, aber die Faust dieses Mannes umklammerte mich wie ein Eisenband. Er warf meinen falschen Pompon fort und zog eine kurze Knochensäge hervor. Ich schlug ihm nochmals mit der Faust gegen das Kinn.
Er wankte, fing sich aber grinsend auf. Da stürzte ich mich auf ihn und überhäufte ihn mit Rippenstößen, Püffen und Fußtritten. Wir stürzten beide zu Boden.
Er stieß den fürchterlichsten Schrei aus, der je aus einer Mandarinenkehle kam, was viel sagen will.
Ich glaubte ihn schwer getroffen. Da fühlte ich, wie er sich unter mir mit aller Macht zu dehnen suchte und seinen Arm ausstreckte, und blickte hin.
Zu meinem Schrecken gewahrte ich, daß ihm während des Kampfes die furchtbare schwarz-weiß-rote Bonbonniere aus der Tasche gefallen und im Rollen an einen Stein angestoßen war und sich geöffnet hatte, und daß sich auf dem fetten, roten Boden die Samen wie ein weißes, mehliges Pulver ausbreiteten.
Dieser alte Narr hatte also bei sich selbst die Sporen der »Hons« versteckt. Unglück über Unglück!
Kakos benützte meine Verblüffung, um mir einen schmerzhaften Hieb an die Schläfe zu versetzen. Um mich zu rächen, begann ich ihn zu würgen, als mich der Schmerz zwang, mein Opfer loszulassen. Wie zwischen einem Nebelschleier hindurch sah ich meinen Gegner regungslos daliegen. In der Nähe der Bonbonniere erscholl ein leises Knistern. Das waren meine letzten Eindrücke, ehe ich die Besinnung verlor. Immerhin scheine ich noch ein paar Schritte getan zu haben, bevor ich mich vollkommen »knock-out« niederkauerte.
Hatte mich Kakos, meine Ohnmacht sich zunutze machend, wieder gepackt? Ich erstickte... ah, er würgte mich!... er lag auf meiner Brust!...
Finsternis... Lähmung... Atemnot...
Dumpfe Detonationen, wie hinter dickem Gemäuer, schlugen an mein Ohr.
Stand ich im Begriffe, im Bauche des Museums erstickt zu werden?...
Ein scharfer, pestartiger Geruch beleidigte meine Nase.
Die Detonationen steigerten sich. Ich machte eine Riesenanstrengung, mich zu bewegen. Meine Glieder schienen von einer zähen Hülle umgeben zu sein, die sie immobilisierten. Ich schüttelte mich energisch. Kein Zweifel! Ich stak in einer dunklen, kalten, schwammigen Masse, die mich dicht umgab.
Wahnsinnig vor Angst, schlug ich wie ein Tollwütiger um mich, überallhin mit den Fäusten und Füßen stoßend.
Die Masse wich und zerriß. Meine Faustschläge hallten dumpf wie gegen faules Holz. Ich konnte mich aufrichten und den Kopf aus der schwammigen Masse herausstrecken. Nun drehte und wandte ich mich pfropfenzieherartig empor, und plötzlich gelangte ich ans Tageslicht. Mit wütender Freude zerfetzte ich die klebrige, aufgedunsene Masse, die mich umgab, und befreite mich aus ihrer Umarmung. Ich hatte mich von einem riesigen, ekelhaften Pilz befreit, der mich beim Emporschießen während meiner Ohnmacht verschluckt hatte. Er war am Stengelende mehrere Meter hoch und hatte einen Hut, so groß wie ein Hausdach.
Er stand nicht allein da, sondern mindestens achtzehn andere, ebenso riesige, gelbliche und pockennarbige Champignons umgaben ihn im Kreise.
Ein schmutziger Dunst verhüllte das gelbe Tageslicht. Die Sonne leuchtete auf dem höchsten Punkte des Firmamentes mit mattem Scheine, glanz- und strahlenlos, wie eine dürftige goldene Scheibe. Auf allen Seiten krachte und donnerte es. Zwischen den Stämmen der Pilze, die mir zunächst standen, schossen andre aus dem Boden auf. Man sah sie mit unerhörter Geschwindigkeit wachsen.
Plötzlich erdröhnte auf dem Hute des Goliaths, der mich beim Emporwachsen in sich aufgenommen hatte, direkt ein »Minenschlag«. In tausend Fragmente zerfetzt explodierte der Hut, und eine Wolke weißlichen Staubes stob nach allen Windrichtungen auseinander und senkte sich auf den Boden herab. Augenblicklich tauchten dann hier Unmassen von winzigen, ebenso fahlen und pockennarbigen, jungen Champignons auf und knatterten und knisterten dabei. Und aus den Köpfen der großen Pilze folgten Entladungen auf Entladungen. Die reifen Champignons schossen ihren Samen ab. Der Staubnebel verdichtete sich. Mehr und mehr rollte der sich verstärkende »Geschützdonner«. Ich mußte fürchterlich husten und niesen, die Übelkeit erzeugende Schärfe dieser vehementen Vermehrungsart griff mir an die Kehle. Und sogleich empfand ich wieder Atemnot. Selbst meine Hände bedeckten sich mit Samen und verursachten mir ein unerträgliches Juckgefühl.
Jetzt hieß es, unverzüglich ausreißen, trachten, die Stadt zu erreichen, Alarm zu schlagen, falls dies nicht schon geschehen wäre. Das Gedröhn der Entladungen mußte die Mandarinen bereits aufgeschreckt haben, auch befand sich unweit des Tales ein Sterilisierposten.
Der Vormarsch der »Hons« vollzog sich mit furchtbarer Geschwindigkeit. Ich sah mich inmitten eines großen Waldes weißlicher Säulen, deren klebrige Oberfläche mit ekelhaften Pusteln bedeckt war, aus denen eine schmutzige Flüssigkeit herabtroff. Und unaufhörlich schossen weitere Säulen auf, drängten sich und verschmolzen ineinander und errichteten kolossale Palisaden und unerhört dicke Mauern, die sich ineinander verankerten und allmählich auf der »Ourrh« eine dicke, alles verschlingende Schicht bildeten, als ob ein fester Ozean den Boden überschwemme.
Ich suchte mich zu orientieren, denn man konnte die Stadt nicht mehr sehen. Ich blickte mich im Todesringe um. Da bemerkte ich einen Arm, der in der Faust eine Knochensäge hielt, starr und mit sechs Fingern an der Hand, deren Nägel bereits ganz blau waren.
Quer durch den Wald, der unter Gedröhn und Geknatter heranwuchs, nahm ich meinen Lauf. Hustend und tränenden Auges drängte ich mich durch die Stämme, wobei mich Gesicht und Hände gräßlich juckten. Ab und zu gewahrte ich die Stadt. Mein Gott, hatten sich die »Hons« schon so weit vorgeschoben! Trotz meines hohen Alters sprang ich in weiten Sätzen dahin, und die jungen Pilze rings um mich wurden immer seltener. Der von den Alten abgeschossene Samen verfinsterte nicht mehr so arg den Himmel. Auf meiner Flucht zerquetschte ich ganze Nester von »Hons« und rannte Pilzjünglinge mit der Schulter über den Haufen.
Rauschend wie ein Wasserfall ergoß sich hinter mir ein Regenstrom. Ich erkannte an dem Desinfektionsgeruche der Flüssigkeit, daß die Mandarinen die Verteidigungsoffensive ergriffen hatten. Gleichzeitig begannen die Leuchttürme zu spielen und sandten rotflammende Strahlen aus. Künstliche, kupfrige Wolken ballten sich zusammen. Ein braunroter Gewitterregenguß, der stark nach Phenol roch, prasselte auf das Tal der »Hons« herab. Dieses neue Verteidigungsmittel war mir unbekannt gewesen. Es war nie davon gesprochen worden. Es bildete ein militärisches Geheimnis, das man nur im Ernstfalle preisgibt. Unglücklicherweise bemerkte ich, daß es nicht recht klappte. Man hatte es zu wenig ausgeprobt, und so verfehlte es mehr oder minder seinen Zweck. Die Wolken luden sich mit Elektrizität, spieen Blitze — und verdunsteten. Man versuchte es nochmals, aber die Blitze unterbrachen stets die Aktion. Auch schlugen sie in mehrere Türme ein und zerstörten sie.
Als ich die Stadt erreichte, brachte gerade die Wehrmacht große Apparate für antiseptische Gase in Stellung, und ein Regiment Sterilisierartillerie rückte mit seinen Spritzen aus. Diese Mandarinen sahen sehr kriegerisch aus. Man feuerte sie durch Zurufe an. In den äußeren Vorstädten und auf den Terrassen ballten sich die Volksmassen zusammen und starrten nach dem Tale hinüber, von wo die schrecklichen »Hons«, deren Namen man nicht einmal auszusprechen wagte, anmarschierten.
Außer Atem und in Schweiß gebadet, traf ich beim alten Agathos ein. Ich bot einen traurigen Anblick. Mein Gewand war von dem ekelhaften Zeug, das mich umfangen hatte, besudelt.
In stummer Resignation fand ich Agathos, Kalos und deren Frau versammelt. Ich berichtete ihnen wahrheitsgetreu mein Abenteuer und fügte hinzu, daß Kakos, der Schuldige, mit seinem Leben seine Unvorsichtigkeit bezahlt hatte.
»Wir sind verloren,« erklärte Agathos. »Diesmal hilft nichts mehr. Seit den Jahrtausenden, wo wir die ›Hons‹ besiegten, schmolz die Bevölkerung der ›Ourrh‹ zu sehr zusammen. Sie hatten recht, Fléchambeau, man hätte sie restlos vernichten sollen. Wir ›machten in Gefühl‹!... Morgen nicht mehr, das sage ich Ihnen, denn morgen werden wir nicht mehr sein. Ich sah sie eben, diese ›Hons‹, von der Terrasse aus. Sie stellen eine Naturgewalt dar, gegen die das Häuflein Mandarinen machtlos ist.«
»Es handelt sich hier um ›Boviste‹, sagte ich. Auf Erden nennt das Volk diese Staubpilze auch ›Wolfslosung‹, mit Respekt zu sagen. Es gibt Arten, die die Größe eines Kindes erreichen, und deren Hut zwei Meter im Durchmesser mißt. Ich habe sie an ihrem Geknall erkannt. Sie sind deshalb so gefährlich, weil sie in Massen auftreten, sich zu einem geschlossenen Ganzen vereinigen und sich so rasch vermehren, daß man ihr Sichausbreiten fast mit dem Auge verfolgen kann.«
»Es ist um uns geschehn,« nickte Agathos. »Sie aber, Fléchambeau, werden die Katastrophe überleben. Jetzt dürfen Sie nicht mehr zögern und lange fackeln, mein Freund. Rasch! Schlucken Sie eine meiner Pillen und verlassen Sie diese Welt, wo fortab die ›Hons‹ herrschen werden. Die Mandarinen sind entthront.«
»Wieviel Zeit bleibt mir?« fragte ich mit gepreßter Stimme.
»In höchstens sechs Stunden werden die ›Hons‹ in der Stadt sein, und Sie sind in kürzerer Zeit als sechzig Minuten ihrem Angriffe entrückt.«
Kala, die mehr tot als lebendig auf dem Teppiche lag, stieß rauhe Klagerufe aus. Sich erhebend, zeigte sie mit ausgestreckter Hand auf kleine Pilze, die mit kräftigem Geknatter auf meinem Pantoffel aufsprossen.
Kalos riß von der Wand einen Sterilisierungsapparat und übergoß mich, ohne eine Sekunde zu zögern, vom Kopf bis zu den Füßen mit dessen Inhalt.
Ich ging mich umkleiden. Agathos folgte mir. Als ich ganz nackt war, bedeutete er mir, daß es völlig unnütz sei, mich wieder anzuziehen, da ja meine Kleider nicht mit mir zugleich wachsen könnten.
Da kam es mir zum verzweifelten Bewußtsein, daß ich keinerlei Andenken an die Mandarinen und ihren Planeten mit mir nehmen konnte.
»Doch!« sagte Agathos, »einige Lichtbilder.«
»Wieso das?«
»Schon seit langer Zeit beschäftigte ich mich mit diesem Probleme. Und Gott sei Dank können wir die Sache durchführen, ehe die Stadt von den ›Hons‹ überschwemmt wird. Ich werde Ihre Haut mit etwas präparieren, wie man photographische Platten erzeugt, und auf diese Weise können wir die interessantesten Bilder aufnehmen, die Sie dann später nur zu entwickeln und zu kopieren brauchen. Ihre Haut wird wachsen, und mit ihr werden auch die Negative größer werden.«
Und so geschah es. Drei Stunden später war ich mit photographischen Aufnahmen auf meiner Haut bedeckt. Das Porträt Agathos' befindet sich gegenüber demjenigen von Kala, das auf meiner linken Brust, wo das Herz sich befindet, abgebildet steht. Du wirst, lieber Pons, auf meiner Körperoberfläche wie in einem Ansichtenalbum lesen können, auch quer über der Brust die Formel des Größerwerdens. Ich bedaure nur, daß alles so schnell gehen mußte, aber wir hatten Eile und konnten keine allzu große Auswahl der aufzunehmenden Objekte treffen.
Kaum war ich tätowiert, zog ich mein Lieblingsröcklein an und nahm unter Tränen Abschied von Kalos und von den zwei Frauen.
Andauernder Lärm dröhnte von außen herüber. Die Kanonade der »Hons« rückte näher. Dazwischen rollten die Salven der mandarinischen Sterilisierungsgeschütze.
In Kissen vergraben, jammerte Kala herzzerbrechend. Ihr hübsches Gesicht begann zu altern. Kalos umarmte die andere Frau.
Agathos und ich stiegen in den Garten hinab. Ich öffnete meine Tabakdose und entnahm dem parfümierten Schnupfpulver die beiden blauen Kügelchen.
»Agathos,« sagte ich, »es sind zwei Pillen. Eine einzige genügt, so sagten Sie, um mir meine frühere Gestalt wiederzugeben. Agathos, begleiten Sie mich! Nehmen Sie die andre Pille zu sich, alter Freund!«
Mich zärtlich anblickend, erwiderte der Biedere:
»Ich bezweifle die Möglichkeit. Sie, Fléchambeau, waren groß. Für Sie kommt es nur darauf an, wieder zu werden, was Sie waren. Aber ich?... meine Gewebe zogen sich nicht wie die Ihrigen zusammen; sie besitzen nicht die Kraft, ein altes Entwicklungsstadium wieder zu erlangen. Gern würde ich Sie begleiten, Fléchambeau. Sehen Sie, hier wird alles, was Mandarin heißt, zugrunde gehn. Und dann... und dann... es ist schließlich nicht sehr lustig, sein ganzes Leben ein ›Arbeiter‹ zu bleiben, sein ganzes Leben für die Weiber und die Cherubim zu schuften. Doch wozu versuchen, abzufahren. Diese Pille kann nur die Todesart ändern, die mir bestimmt ist.«
»Sterben, um zu sterben, Agathos! Versuchen Sie's! Schön wäre das. Doch wer weiß... wer weiß... vorwärts, Mut, Agathos, Mut!«
Lautlos ließ Agathos seinen Pompon kreisen, um noch einen Rundblick auf alles zu werfen, was ihn umgab. Dann nahm er zwischen Daumen und Zeigefinger eine der Pillen, und ich nahm die andre.
»Auf Ihre Gesundheit!« rief ich.
Wir stießen mit den zwei Pillen zusammen und schluckten sie hinab.
Sofort spürte ich, wie es mich raketenartig in die Lüfte hob. Ich sah das Heer der »Hons«, das sich unbesiegbar der Mandarinenstadt näherte, sah, wie die Türme, als letztes, verzweifeltes Mittel, die künstliche Nacht über die »Ourrh« ausgossen, damit nicht die Mandarinen das schreckliche Ende wahrnehmen könnten, und in meiner Hand schrumpfte meine Tabaksdose zu einem lächerlichen Nichts zusammen.
Mir zur Seite wuchs Agathos auf und wuchs ins Riesenhafte.
Aber je größer er wurde, desto durchsichtiger wurde er, und bald war er nur mehr ein sich verflüchtigender Schatten. Ich unterschied noch im Unendlichen eine vage Silhouette, die mir mit schemenhaftem, gigantischem Arme ein Lebewohl zuwinkte, und ich befand mich mutterseelenallein inmitten eines Universums, wo Gestirne auftauchten und andere verschwanden.
Wie ein Expreßzug eine Gegend durchrast, also durcheilte ich die Welten voller Bewegung und unfaßbaren, unbegreiflichen Geschöpfen. Dann erblickte ich, zuerst riesenhaft, dann unansehnlich die niedern Lebewesen und winzigen Vegetabilien, die unsere Wissenschaft bereits kennt.
Endlich erschien im Nebelmeere die erdrückende Form und das Okular eines Objektivs. Ich faßte auf dem Glasplättchen Fuß, das Mikroskop trat wieder in den Wahrnehmungskreis meiner Sinne, und ich sah mich bald unter der Lupe von der Größe eines Menschen, der auf dem Montblanc steht und vom Tal aus gesehen wird.
Es tagte, aber dämmerig, denn du hattest die Läden geschlossen. Ich stellte jedoch fest, daß eine Glasglocke den Mikroskopkopf bedeckte, ein Glassturz, unter den kleine Keile geschoben waren.
An einem Spinnwebfaden gelang es mir, auf den Tisch zu steigen. Ich verließ den Glassturz durch den unter seinem Rande freigebliebenen Raum.
Zwei Tage darauf war ich dein alter Fléchambeau wieder geworden. Aber das Meßinstrument zeigte nicht mehr die hundertsechsundneunzig Zentimeter meiner Jugendjahre an. Mein Alter hatte mich gebeugt.
Aber Gefühle seligen Glückes schwellten meine Brust.
Meine Abenteuerfahrt war beendet. Heil und gesund war ich wieder in meiner Heimat angelangt. Schon hatte ich gefürchtet, daß man das Mikroskop vielleicht weggestellt haben könnte, und überlegte mir, wo ich mich wohl befände. Gott sei Dank bei mir zu Hause. Ich hatte niemanden als Bakterie oder Bazillus getötet.
Immerhin staunte ich, alles so vorzufinden, wie ich es verlassen hatte. Ich öffnete ein Fenster des Laboratoriums.
Olga ging vorüber. Olga in der strahlenden Schönheit ihrer vollen Jugend!
Pons, alter Pons, o dies furchtbare Greisenalter! Nun ward es mir klar, jetzt verstand ich alles. Doch was ist das Verstehen des gesamten Universums angesichts einer einzigen kleinen Träne, die zurückzuhalten nicht der Verstand der ganzen Welt vermag!«
Pons klappte das Heft zu.
Er schüttete in den Ofen, der nahe am Ausgehen war, einen Eimer Anthrazit.
Fléchambeau machte ein Zeichen.
»Etwas verstehe ich nicht,« bemerkte Pons nachdenklich. »Papageien sind viel kleiner als Elefanten, und doch erreichen beide das gleich hohe Alter.«
»Ich konnte den Anhang nicht mehr schreiben, war zu müde,« murmelte Fléchambeau. »Ich bin zu rasch wieder gewachsen. Und mein Alter... mein hohes Alter!... Mach' mir einen Grog.«
Vor sich hingrübelnd, warf Pons das Heft auf den Tisch.
»Vorsicht!« sagte Fléchambeau. »Denk' an die Katastrophen, die du im unendlich Kleinen entfesseln kannst!«
Während Pons heißes Wasser für den Grog zubereitete, fuhr er fort:
»Die Landsleute Mikromegas hatten tausend Sinne. Trotzdem meinte Mikromegas: ›Wir haben ein unbestimmtes Ahnen, eine gewisse Unruhe in uns, die uns unaufhörlich zuflüstert, daß es Wesen gibt, die viel vollkommener sind als wir.‹ Der Mensch, lieber Pons, ist ein monströses und rührendes Geschöpf. Von den hunderttausend Spiegelflächen des Alls sehen wir nur jene fünf, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Wer die hunderttausend sehen würde, würde Gott schauen. Wir haben von Gott nur einen höchst unklaren Begriff, so etwa wie vom Unendlichen und Ewigen, das wir mit unseren Sinnen weder erfassen noch begreifen können, ebensowenig wie mit unserem Geiste. Du kannst nicht die Luft durchfliegen, nicht im Wasser leben. So vermagst du auch nicht mit deinen Gedanken in Sphären herumzuschweifen, welche deine Sinne nicht kennen. Ich glaube, die Mandarinen nehmen Dinge wahr, die wir mit dem infraroten Lichte oder den ultravioletten Strahlen vergleichen können.«
»Trink' jetzt deinen Grog!« meinte Pons, ihm das Glas reichend.
»Teufel, ich hab' mich verbrannt!... die Mandarinen verbrannten sich niemals. Davor bewahrte sie ihr Pomponsinn.«
»Denk' jetzt nicht mehr an deine Mandarinen, Fléchambeau, sag' mir lieber, wie du bis zu meiner Rückkehr gelebt hast?«
»Ganz im geheimen,« entgegnete Fléchambeau. »Niemand erkannte mich wieder. Ich ging übrigens nur nach Schwinden des Tageslichtes aus. Alle Leute waren sehr nett zu mir, aber das kommt daher, daß ich wohl in der Mandarinengesellschaft viel nachsichtiger geworden bin, mehr... großdenkend. Der Erdenmensch hat, ohne etwas davon zu wissen, etwas vom Mandarin an sich. Unseresgleichen wie unseresgleichen zu behandeln, ist ein schwerer Fehler, die ewige Quelle von Mißverständnissen, Ungerechtigkeiten und Verdruß.«
Beunruhigt fühlte Pons ihm den Puls. Fléchambeau hub wieder an:
Von manchen unserer Sinne behauptet man, daß sie auf höherer Stufe stehen. Warum, weiß man nicht. Aber man verzeiht ihnen alles. Es gibt Musiknarren und Malereibegeisterte... Dilettanten und Künstler... und weil einer ein besonders stark entwickeltes Gefühlsleben besitzt oder einen verfeinerten Geschmackssinn, schimpfst du ihn einen sittenlosen Kerl oder einen Schlemmer. Man redet von Todsünden, Lastern. Ist das vernünftig?...
Um den Kranken zu beruhigen, sagte Pons:
»Schon gut, schon gut. Aber sag' mir lieber, was du getrieben hast, während ich nicht da war?«
»Ich las, habe Bücher gelesen, alte Schmöker, die ich früher nicht verstand. Es gibt sehr viele Werke, deren Verfasser einen unendlich weiten oder einen unendlich beschränkten Blick haben, was auf das gleiche herauskommt. Manche sind auch ganz unverständlich geschrieben, Pons, und wenn wir sie nicht an das Licht unseres Geistes näher heranrücken, um die Kleinarbeit...«
»Du hast eine lange Fahrt hinter dir, du mußt dich jetzt ausruhn!« unterbrach ihn der Doktor.
»Stimmt,« nickte Fléchambeau, »eine lange Fahrt durch alle drei Dimensionen... ›Die Fahrt ohne Fahrt‹ eines Autors, dessen Namen mir nicht einfällt... Pons, bist du deiner Sache sicher, daß wir uns nicht unter der Glasglocke irgendeines riesigen Mikroskopes befinden?... Bist du sicher, daß uns nicht ein gigantisches Auge durch das Okular betrachtet?...«
»Ein Auge innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks?« lächelte Pons. »Was du da sagst, ist alt wie die Welt.«
»Pons,« begann wieder Fléchambeau, dessen Gedanken sich etwas verwirrten. »Es wird gut sein, wenn du Olga heiratest. Aber nimm dich in acht. Die Frauen sind uns nicht so ähnlich, wie wir den Mandarinen. Zwischen einer Frau und einem Mann ist der Unterschied größer, als zwischen einem Zitronenfalter und einem Hecht.«
»Gewiß, Alter, verstanden! Aber jetzt gib deinen Gedanken Urlaub. Schlafe, schlafe, Fléchambeau.«
Und Fléchambeau schlummerte wie ein Kind ein.
Das Kinn in der Hand, grübelte Pons lange vor sich hin. Ein starker Wind hatte sich aufgemacht. Die dürren Äste der Glyzinien rasselten wie Knochen.
»Marionetten sind wir!« murmelte Pons. »Kleine Püppchen, aus Brotkrume geknetet, die ein Meisterphilosoph auf einem Teller tanzen läßt. Mit einem Puster kann er uns in den Staub des Nichts wegblasen.«
Der Sturm begann zu heulen.
Pons blickte nach dem Bett... Fléchambeau lag nicht mehr darin. Unter der Wucht des Orkans geriet alles ins Wanken. Das Haus flog davon. Saint-Jean-de Nèves entwich samt seinen Bergen, wie ein Spielzeug vor der Macht des Sturmes. Ein geheimnisvoller Mund blies über die Bildfläche hin und fegte die Männlein hinweg, die eine humoristische Hand einst geformt hatte. Pons ward sich klar, daß er selbst in Wahrheit nichts war. Er wollte ausrufen:
»Was hab' ich gesagt!«
Aber schon hatte ihm der Schöpfer (Autor) das Wort entzogen und Leben und Gedanken.
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.