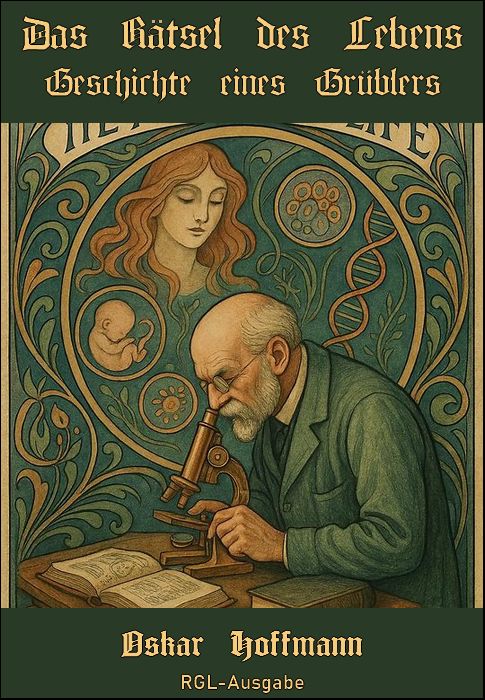
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.
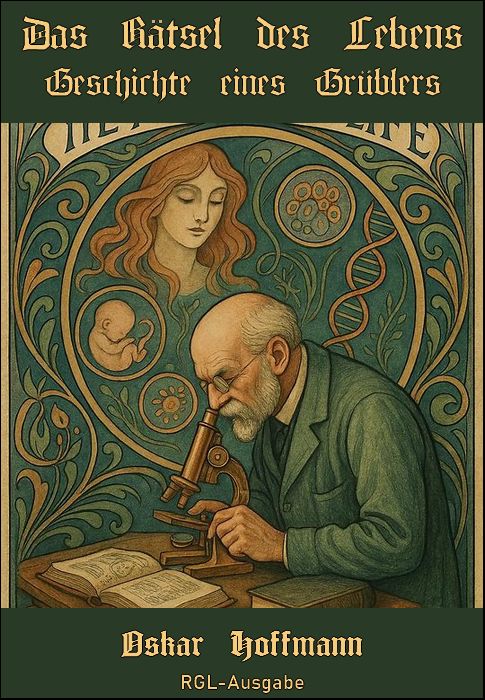
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software

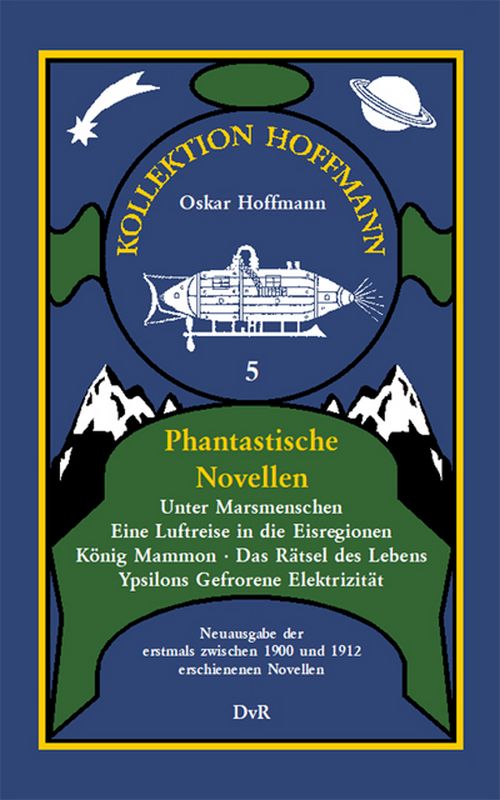
Titelbildgestaltung: Dieter von Reeken
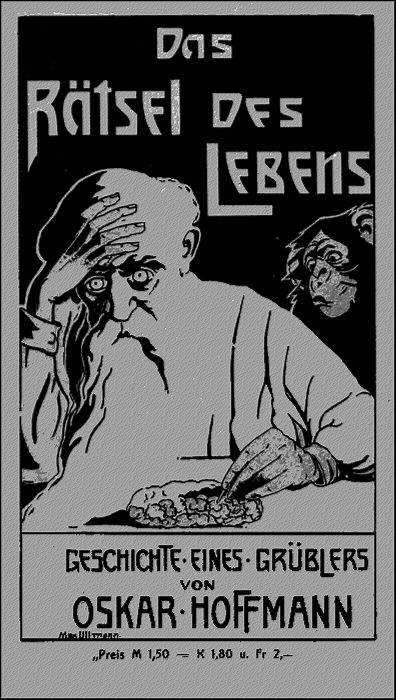
Das Rätsel des Lebens. Geschichte eines Grüblers.
Leipzig: Verlag von F. E. Bilz 1911; S. 148:
Einbanddeckel, mit einer Zeichnung von Max Ullmann.
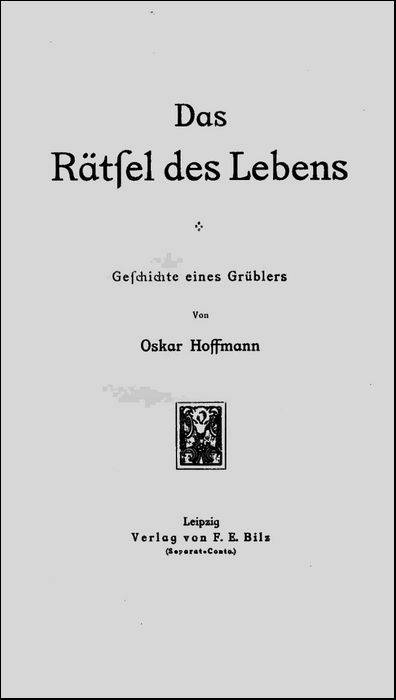
Das Rätsel des Lebens. Titelseite.
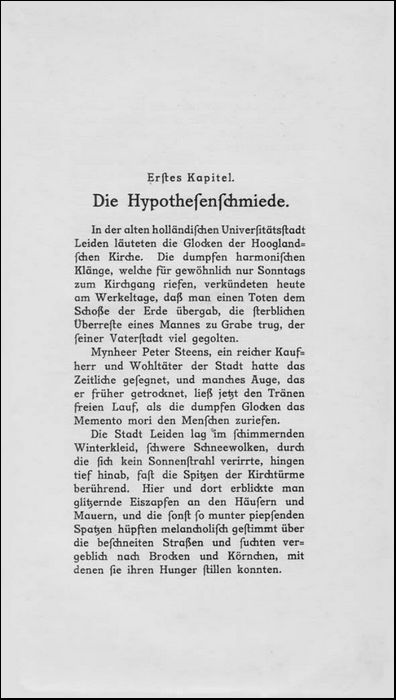
Das Rätsel des Lebens. Beginn des ersten Kapitels.
In der alten holländischen Universitätsstadt Leiden läuteten die Glocken der Hooglandschen Kirche. Die dumpfen harmonischen Klänge, welche für gewöhnlich nur Sonntags zum Kirchgang riefen, verkündeten heute am Werkeltage, daß man einen Toten dem Schoße der Erde übergab, die sterblichen Überreste eines Mannes zu Grabe trug, der seiner Vaterstadt viel gegolten.
Mynheer Peter Steen, ein reicher Kaufherr und Wohltäter der Stadt hatte das Zeitliche gesegnet, und manches Auge, das er früher getrocknet, ließ jetzt den Tränen freien Lauf, als die dumpfen Glocken das Memento mori den Menschen zuriefen.
Die Stadt Leiden lag im schimmernden Winterkleid, schwere Schneewolken, durch die sich kein Sonnenstrahl verirrte, hingen tief hinab, fast die Spitzen der Kirchtürme berührend. Hier und dort erblickte man glitzernde Eiszapfen an den Häusern und Mauern, und die sonst so munter piepsenden Spatzen hüpften melancholisch gestimmt über die beschneiten Straßen und suchten vergeblich nach Brocken und Körnchen, mit denen sie ihren Hunger stillen konnten.
Die dicken Schneeflocken, die vereinzelt fielen, tanzten in der undurchsichtigen Luft, und winterfreudig wurden sie von der Jugend der Straße gehascht.
In dieser in Grau und Weiß getauchten Morgenstimmung schritten zwei in Pelze gehüllte Männer über den Platz an der St. Pancraskirche. Ihrem Äußeren nach gehörten beide zu den guten Ständen. Es waren ein älterer und ein jüngerer Mann, ersterer mit langem grauen Bart, letzterer mit wohlgepflegtem Schnurrbart, dessen Enden von seinem Besitzer häufig gezwirbelt wurden. War die Statur des alten Herrn untersetzt und gebeugt, so war die des Jüngeren als hochgewachsen und schlank zu bezeichnen, und verriet eine Elastizität, die sich besonders bemerkbar machte, dazu kamen noch der lebhafte Blick der Augen und die temperamentvollen Gesten, welche sein Gespräch mit dem älteren Herrn begleiteten.
Herr Meermann und Sohn, die hier nebeneinander herschritten und sich in lebhaftester Unterhaltung befanden, waren von der Beerdigung des Mynheers Steen zurückgekehrt, was die schwarze Kleidung und die trauerumflorten Zylinderhüte bezeugten.
»Der Bischof von Haarlem hielt eine gute Rede,« meinte der Alte zum Sohne. Bei diesen Worten strich sich der Sprecher übers Kinn, eine Bewegung, die ihm zur Gewohnheit geworden war, so oft er sich in der Unterhaltung befand.
»Seine Worte kamen nicht vom Herzen, Vater,« entgegnete Meermann junior.
»So — meinst du ... hm.«
»Steen war nie ein Freund der Kirche.«
»Weiß es, weiß es ... aber seine Wohltaten werden die Armen und die Jansenisten(*) nie vergessen,« versetzte Meermann der Vater und hustete.
(*) Altkatholiken
»Der Bischof hofft auf große Summen für seine Kirche. Steen soll seine Millionen den Jansenisten vermacht haben.«
Meermann der Vater zuckte mit den Achseln und faßte sich nachdenklich ans Kinn.
Eine kleine Weile schritten Vater und Sohn wortlos nebeneinander her. Dann ergriff letzterer wieder das Wort.
»Steen war ein begeisterter Anhänger Darwins. In seinen letzten Jahren hat er sich mit Dingen beschäftigt, die ganz außerhalb seiner sonstigen Beschäftigungen lagen.«
»Daran ist der Grübler Nieuwenhuis schuld,« gab Meermann senior zur Erwiderung und stapfte durch den Schnee, wie einer, der ingrimmig an etwas zurückdenken muß und seinem Groll nicht Luft machen darf.
»Herr Nieuwenhuis ist ein geistreicher Kopf, Vater. Ich schätze ihn sehr, leider nimmt er von meiner Person herzlich wenig Notiz.«
»Gott sei Dank!« rief aufatmend der alte Herr. »Er steckt gerade genug Leute an. Sein Evangelium möchte ich nicht auch noch in meine Familie getragen sehen.«
»Seine Bücher über Naturphilosophie und Naturreligion haben aber doch großes Aufsehen erregt, und die Professoren stehen nicht an ...«
Weiter kam Meermann junior nicht, denn sein alter Herr machte eine unwillige Bewegung und sagte: »Die Professoren! Überhaupt die ganze Schulgelahrsamkeit, geh' mir damit weg. Die Herren spintisieren und grübeln über Dinge nach, die ein für allemal außerhalb des Horizontes menschlicher Erkenntnis liegen.« Das alles klang so knorrig, als würde ein harter Ast vom Stamme gesägt.
Vater Meermann schien, danach zu urteilen, ganz grimmig auf die Wissenschaft zu sprechen zu sein. Er hatte auch allen Grund dazu. Seinen einzigen Bruder hatte sie ja auf dem Gewissen, ihr war er zum Opfer gefallen, indem er über sein philosophisches Studium seinen gesunden Menschengeist eingebüßt hatte und nun seit Jahr und Tag den Rest seines Daseins in einer Irrenanstalt verbrachte.
Aus diesem Grunde hatte Meermann junior auch nicht studieren dürfen und war, wie er selbst sagte, in die Reihe der Krämerseelen gesteckt worden. Das Hocken hinter dem Haupt- und Kassabuch, das Summieren der Zahlen und was sonst noch alles mit diesem an sich sehr ehrwürdigen Berufe zusammenhing, behagte dem jungen Mann absolut nicht. Er hatte ganz die Ader seines Oheims geerbt, spintisierte lieber und ließ seinen Geist in Regionen schweifen, die einem rechten Kaufmann ebenso fern lagen, wie einer Kuh das Lateinlernen.
Auf ihrem Heimwege kamen beide durch die Lakengracht und an einem Hause vorüber, an dessen Tür ein Messingschild mit der Aufschrift »Dr. Nieuwenhuis. Nervenarzt« angebracht war.
»Hier ist die Hypothesenschmiede,« brummte Meermann senior und sah zu den Fenstern des genannten Hauses hinauf.
Da die Schneeflocken jetzt dichter fielen, so schritten die beiden Männer schneller. Unter lebhaftem Meinungsaustausch über den Nervendoktor und seine darwinistischen Ansichten und Bestrebungen erreichten sie ihr Heim, ein verwittert aussehendes Haus mit mittelalterlicher Fassade, hinter dessen breitem Portal beide nun verschwanden.
Kehren wir jetzt zu der »Hypothesenschmiede« in der Lakengracht zurück, welche im weiteren Verlauf der Erzählung den Mittelpunkt aller Geschehnisse bildet.
Hier hauste der Grübler Nieuwenhuis, der soeben der Gegenstand des Gespräches zwischen Meermann senior und junior gewesen war.
Nieuwenhuis entstammte einer alten angesehenen Familie, deren Ahnen schon im Mittelalter in Leiden ansässig waren, und es hieß, daß ein Nieuwenhuis des großen Rembrandts Freund gewesen sei.
Mit dem jetzigen Stammhalter dieser uralten Familie schien aber die letztere aussterben zu sollen, denn es war kein weiterer Erbe des Namens vorhanden, der Letzte seines Stammes sorgte jedoch nach Kräften für seine eigene Unsterblichkeit.
Es soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, daß Dr. Nieuwenhuis ehemals der geheimnisvollen »Liga der Geistesriesen« in London angehört hatte, einem Klub, der in seinen Kreis nur solche Persönlichkeiten aufnahm, die irgendeine welterschütternde Großtat auf dem Gebiet der Wissenschaft oder Technik zu vollbringen gedachten. Leider hat die famose Liga nach kurzem Bestehen durch das Ableben ihres originellen Präsidenten ihre Tätigkeit einstellen müssen. Der Held unserer Erzählung bewahrte ihr aber immer sein Angedenken.
Dr. Nieuwenhuis war ein sehr gescheiter Kopf und als Nervenarzt gesucht. Da aber die gute Stadt Leiden kaum ein halbes Hunderttausend Einwohner besaß und diese sich zumeist der besten Gesundheit erfreuten oder besser gesagt, keine nervenkränkelnden Großstadtmenschen waren, so kam es, daß der alte Doktor ein recht beschauliches Leben führen konnte, soweit eine Inanspruchnahme seiner Kunst seitens leidender Mitbürger hier in Betracht kommt. Nieuwenhuis war seit Jahren in die Reihe der Naturforscher getreten. Er hatte sich eine wichtige Aufgabe gesteckt, eine Aufgabe über die Gelehrte und Laien die Köpfe schüttelten, sobald von des Doktors stiller Tätigkeit etwas in die Öffentlichkeit sickerte.
Nieuwenhuis rückte nämlich dem Problem des Lebens auf den Leib und tat dies mit einer Ausdauer und Spitzfindigkeit, die einer aussichtsreicheren Sache würdig gewesen wäre. Eins muß hier zu seinem Lobe nachgesagt werden, Nieuwenhuis war kein Phantast. Zwar nannte man ihn einen Hypothesenschmied, aber dies tat seinem Rufe als exakten Forscher keinen Abbruch.
Das Ziel, welches sich der Doktor gesteckt hatte, spottete eigentlich seiner Erreichung. Ob sich Nieuwenhuis dessen bewußt war, wollen wir hier nicht untersuchen, jedenfalls steuerte er unentwegt darauf hin, der letzten Erkenntnis der Dinge möglichst nahe zu kommen.
Eine ungeheure Menge Arbeitsmaterial hatte sich im Laufe der Zeit in des Doktors Zimmer aufgehäuft; eigene und fremde Forschungsresultate, die den Schleier von dem Lebensrätsel ein wenig zu lüften schienen.
Ein Speicher irdischer Weisheit, ein Stapelplatz menschlichen Scharfsinnes, diese Namen verdiente Nieuwenhuis' Arbeitsstätte. Hier wurde die ganze Entwickelungsskala vom Embryo bis zum Greis intensiv verfolgt, hier wurden Mensch, Tier und Pflanze auf ihre physischen und psychischen Regungen untersucht, kurz alles, was in irgendeiner Form Leben äußerte, in den Kreis der Beobachtung gezogen.
Um auf den richtigen Weg zu gelangen, der Lösung des Lebensproblems näher zu kommen, entwarf er eine Reihe Hypothesen, von denen er dann die treffendste zur Grundlage seiner weiteren Forschung auswählte, bis er schließlich an Hand seiner und fremder Experimente zu dem Endergebnis kam, daß er den rechten Kurs eingeschlagen hatte.
Anfänglich nahm man Dr. Nieuwenhuis' wissenschaftliche Tätigkeit weniger ernst, bis daß er mit seiner physikochemischen Theorie an die Öffentlichkeit trat, um dem ihm zu Ohren gekommenen Gespött, er sei ein Hypothesenschmied, ein Ende zu machen.
Nach reiflicher Erwägung beschloß er, in einem Vortrage der Mitwelt zur Kenntnis zu bringen, zu welchen Ergebnissen er in bezug auf die Lösung des Lebensproblemes gelangt sei. Das eigenartige Thema interessierte natürlich jedermann, weshalb viele Leute mit Neugier und Spannung auf den Tag warteten, an dem Nieuwenhuis den Schleier von dem größten Naturgeheimnis reißen wollte.
Der alte Doktor wurde zum Tagesgespräch und erhielt von vielen Seiten Zuschriften und Besuche, worüber er im großen und ganzen nicht sonderlich erbaut war, da er nicht an dem Übel allzu großer Redseligkeit litt und auch kein Lüstchen verspürte, Laienhirnen seine Theorie vom Wesen des Lebens so und so oft von A bis Z aufzutischen und naive Fragen zu beantworten.
Gewisse Besucher konnte er freilich nicht so ohne weiteres abspeisen. Mit einigen Gelehrten von der Universität hatte er längere Auseinandersetzungen und rege Dispute, vor allem aber bekam er es mit der hohen Geistlichkeit zu tun, die mit feiner Nase wittern mochte, daß hier dem Christenglauben eine Gefahr drohe, die nicht unterschätzt werden dürfe.
So rückten denn nacheinander die Diener der Kirche bei dem alten Doktor heran, zuletzt der Bischof der Jansenistengemeinde.
Nieuwenhuis war im allgemeinen ein verträglicher Charakter, seiner Natur nach Phlegmatiker, und er hielt eine gute Weile den Worten derer stand, die er als Gegner oder krasse Neider erkannt hatte. Dann aber, wenn es ihm zu bunt wurde, legte er los und focht mit scharfen Waffen. In solchen Momenten zuckte jede Muskel an ihm und er bemühte sich nicht, seine helle Entrüstung zu bemeistern.
Bischof Scaligers wußte, daß Nieuwenhuis neben der Jansenistenkirche als Miterbe der großen Hinterlassenschaft des vor drei Tagen verstorbenen Millionärs Steen in Frage kam; genaueres war ihm zwar darüber nicht bekannt, da die Testamentseröffnung noch nicht stattgefunden hatte. So hatte denn der Bischof zwei Gründe, Nieuwenhuis aufzusuchen.
Der Doktor empfing das Oberhaupt der Jansenisten mit gemischten Gefühlen, als dieser sich in der elften Morgenstunde am Tage vor dem Vortrag bei ihm einstellte.
Nach der etwas steifen und förmlichen Begrüßung nahm der Bischof neben dem Doktor Platz.
»Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs?« begann Nieuwenhuis in höflichem Tone, trotzdem er noch von den vorangegangenen Kontroversen mit dem Pastor seiner eigenen Glaubensgemeinde und dem Superintendenten reichlich verärgert war.
»Ich komme in zwei Angelegenheiten zu Ihnen, Herr Doktor,« gab der Jansenistenoberst mit salbungsvoller Stimme, der aber eine leise Schärfe beigemischt war, zur Erwiderung.
»Einmal jedenfalls in Sachen meines angekündigten Vortrages ...« ließ sich Nieuwenhuis weiter vernehmen.
»Ah! Sie ahnen schon,« fiel ihm der Bischof schnell ins Wort. »Um so besser, dann bedarf es keiner langen Einleitung und ich kann direkt mein Anliegen ohne Umschweife vorbringen.«
»Das Anliegen Euer Hochehrwürden wird auf ein Haar dem ähneln, welches der Herr Superintendent im Auftrage des evangelischen Konsistoriums an mich hatte.«
Der Bischof räusperte sich vernehmlich und runzelte ein wenig die hochgewölbte Stirn. »So wurde schon von anderer Seite ...«
»Sehr wohl — schon von anderer Seite suchte man auf mich einzuwirken, den bewußten Vortrag über das Problem des Lebens nicht zu halten. Auch Sie, Herr Bischof, fürchten, daß bei meinen Aufklärungen das Seelenheil Ihrer Pfarrkinder zu Schaden kommt. — Ist es nicht so?«
»Da Sie den Kernpunkt meines Anliegens sofort herausgefunden haben, so erübrigt sich jedes weitere Wort, um Sie zu verständigen, welche Pflichten als oberster Seelenhirt mich zu einer Aussprache mit Ihnen drängen. Ich hoffe, daß Ihr Vortrag in keiner Weise so gehalten ist, daß er gegen die Lehren der christlichen Religion verstößt und die Menschen an Gottes Existenz irre macht.«
Des Bischofs letzten Worte hatten eine reichliche Beimischung von Schärfe.
Der alte Doktor lächelte fein.
»Die Ergebnisse meiner wissenschaftlichen Untersuchungen sind allerdings derart, daß der Theologie der Boden unter den Füßen weggezogen wird,« versetzte er dann. »Dem Fortschritt in der Naturerkenntnis wird sich keine Kirchenmacht entgegenstemmen können ...«
Der Bischof sprang von seinem Sitz erregt auf.
»Ah! Sie bekennen von vornherein Farbe!« rief er mit starker Entrüstung. »Mit naturwissenschaftlichen Irrlehren wollen Sie in die Schranken treten, das Göttliche in den Staub zu treten!«
»Ich denke nicht daran, Herr Bischof. Die Menschheit soll ihren Glauben wie vordem behalten. Mein Bestreben geht nicht dahin, ihn ihr zu entreißen,« versetzte mit Seelenruhe Nieuwenhuis und trommelte gleichmütig ob der heftigen Erregung des Kirchenoberst mit den Fingern auf die Tischplatte.
»Gleichviel! Sie rütteln an dem Dogma der christlichen Kirche, ob mit oder ohne Absicht!«
»Es kommt auf die Auffassung derer an, die meine Ausführungen über das eigentliche Wesen alles Lebendigen anhören. Mein Vortrag wird alle kirchlichen Dinge ebensowenig berühren als ihnen schaden.«
»Die Zuhörer werden aber ihre Schlüsse ziehen, und es wird sich dann zeigen, daß Sie in unserem Christenglauben eine Bresche schlagen wollen!« rief Bischof Scaligers, sich mehr und mehr ereifernd.
»Hat die hohe Geistlichkeit so wenig Vertrauen auf die Festigkeit des Fundamentes ihrer Kirchenlehre, daß sie befürchtet, die Glaubensfreudigkeit könne durch meine wissenschaftlichen Darlegungen starke Einbuße erleiden?«
Es klang fast wie leiser Triumph aus den Worten heraus, die Angst des Seelenhirten dokumentiert zu haben.
»Sie sündigen wider Gott, wenn Sie sich erdreisten Behauptungen über den Ursprung allen Lebens aufzustellen, die gleichzeitig eine Verneinung des Gottprinzips enthalten.«
»Herr Bischof, ich bin ein Diener der Wissenschaft und gehe meine Wege, die Wege, welche der fortschrittliche Menschengeist sich selbst bahnt, um der Erkenntnis der Dinge, die um ihn und in ihm sind, nahe zu kommen.«
»Ich sehe ein, daß weitere Worte hier vergeblich sind,« sprach der hohe Seelenhirt weiter und setzte eine eisige Miene auf. »Ich will darum auf mein zweites Anliegen zu sprechen kommen.«
»Bitte —« entgegnete Nieuwenhuis. »Brechen wir das Thema ab.«
»Sie waren ein Freund von Mynheer Steen, den der Herr in Gnaden zu sich genommen hat?« fuhr Scaligers fort.
Der alte Arzt bejahte.
»Steen hat mir vor Jahren versprochen, sein ganzes Vermögen meiner Kirche zu vermachen, und nun höre ich, daß auch Sie als Miterbe in Frage kommen. Wie verhält sich das?«
Nieuwenhuis machte ein erstauntes Gesicht.
»Ich weiß von nichts ... ich soll Miterbe werden?«
»Nun, man munkelt davon. Ob es tatsächlich der Fall ist, kann ich natürlich nicht sagen, das wird die Testamentseröffnung lehren. Die älteren Ansprüche meiner Kirche werden Sie doch gegebenenfalls respektieren?«
»Ich kann Ihnen hierauf keine Antwort geben, ehe ich nichts positives erfahren habe. Dabei wollen wir es jetzt bewenden lassen.«
»Gut, so werde ich wiederkommen, wenn die Sache es erheischt,« versetzte der Bischof.
»Es würde für Euer Hochehrwürden das beste sein, wenn Sie meinen Vortrag über das Problem des Lebens mit anhören. Vielleicht fassen Sie dann eine andere Meinung oder denken milder ...«
Das würdige Kirchenoberhaupt hatte sich inzwischen erhoben und schüttelte ob des Ansinnens den Kopf, wobei seine Miene einen entrüsteten Ausdruck zeigte. Dann verneigte sich der fromme Mann in steifer, kühler Form und verließ das Gemach.
Nieuwenhuis sah der hohen Gestalt des Bischofs lächelnd nach, bis dieselbe hinter der Tür verschwand.
Hierauf vertiefte er sich wieder in die Arbeit, bei der er durch den Besuch gestört worden war. Er feilte mit Eifer an seinem Vortragsmanuskript herum, in welchem er eine Stelle, welche von dem Experiment der Bütschlischen Ölseifenschäume handelte, abänderte, um diese dem großen Publikum verständlicher zu machen.
Dann begann er den Entwurf seines Vortrages zu repetieren, wobei er mit dem Manuskript in der Hand im Zimmer auf und abging.
»Meine verehrten Damen und Herren! ...« sprach Nieuwenhuis halblaut vor sich hin, weiter kam er aber nicht, denn in diesem Augenblick wurde ihm gemeldet, daß jemand im Wartezimmer säße.
Der Arzt legte das Manuskript zur Seite, warf einen Blick auf die Uhr, welche soeben in dumpfen Gongschlägen die zwölfte Mittagsstunde ankündete und öffnete die Tür zum Nebenzimmer.
Drinnen saß ein dickleibiger Herr mit stark ergrautem Haar, der sich eilig von seinem Sitze erhob, als er Nieuwenhuis ansichtig wurde.
»Ah! — Was führt dich zu mir ... lange nicht gesehen, alter Freund!« rief Nieuwenhuis und streckte dem Besucher die Hand zum Gruß entgegen.
Der Angeredete war der Schuldirektor Simonszoon, ein alter Studienfreund des Arztes. Er schien ganz außer Atem zu sein, so gebärdete er sich, als er die Begrüßung erwiderte. Nieuwenhuis stutzte über das erregte Wesen, welches jener zur Schau trug.
»Ho! Was ist passiert?« frug er den verschnaufenden Direktor, der auf ihn zugeeilt war.
»Ich stehe mit meiner halben Lehrerschaft in Konflikt ... Deinetwegen!« rief Simonszoon nach Luft schnappend aus.
»Meinetwegen?« frug der Arzt verwundert. »Ah! — Natürlich des Vortrags wegen.«
»Dein verflixtes Lebensrätsel! Das kann mir noch das Amt kosten!«
Nieuwenhuis mußte lachen.
»Meine Primaner haben sich samt und sonders Karten gekauft zu deinem Vortrag ... die Lehrerschaft und die Eltern sind dagegen und machen es mir zur Pflicht, den Jungens den Besuch zu deinem Vortrag zu verbieten. Das habe ich getan, um Ruhe zu bekommen. Hinterher wirft man mir aber vor, ich sei ein Verteidiger deiner Hypothesen, ich verbreite deine unreifen Ideen und ...«
Dem biederen Direktor ging die Luft jetzt aus und stöhnend ließ er sich auf einen Sitz nieder.
»Sind sie denn alle des Teufels!« rief Nieuwenhuis aus. »Noch weiß ja kein Mensch außer dir, was ich bei meinem Vortrage zutage fördern werde.«
»Oh! Man ahnt es. Deine Schriften lassen die Leute nicht so ganz im unklaren. Deine famose Naturphilosophie gibt Anhaltspunkte genug, wohin du hinaus willst. Die Kirche bezeichnet deine Hypothesen als wissenschaftliche Ketzerlehren, welche die Gemüter und Sinne verwirren ...«
»Lächerlich!« brummte Nieuwenhuis.
»Sag' den Vortrag ab. Schreibe meinetwegen was du willst, aber rede nicht öffentlich,« entgegnete der Direktor.
»Der Vortrag wird gehalten und damit basta! Wenn du deinen Schülern verbietest, meine Ausführungen anzuhören, so hast du deine Pflicht als Erzieher der Jugend getan und man kann dir meinetwegen nichts mehr am Zeuge flicken.«
»Doch ... alle Welt weiß, daß du mein Freund bist und daß ich bisher für deine wissenschaftlichen Anschauungen eine Lanze gebrochen habe, wo man sich über den Hypothesenschmied Nieuwenhuis lustig gemacht hat.« Das hatte Simonszoon in einem Atem herausgebracht. Dann strich er sich nervös durchs Haar und lief mit verschränkten Armen im Zimmer auf und ab.
»Es steht ja in deinem Belieben, jetzt die Farbe zu wechseln,« versetzte Nieuwenhuis.
»Indem ich ausposaune, daß ich nicht mehr in deinem Fahrwasser segle ... Das rätst du mir?! — Es würde mir niemand glauben,« sagte Simonszoon, indem er in seinem Laufe durch das Zimmer einhielt und sich vor dem Arzt hinpflanzte.
»Dann weiß ich keinen Rat für dich. Übrigens bist du viel zu ängstlich. Glaubst du, daß der Schulrat dir meinetwegen Späne machen wird? So unvernünftig wird er nicht sein.«
»Du willst also den Vortrag halten?«
»Ja. Es sind wissenschaftliche Forschungsergebnisse und wichtig genug, daß sie bekannt gegeben werden. Ich will endlich öffentlich den Beweis antreten, daß ich nicht bloß auf Hypothesen herumreite, sondern auf Grund ernst zu nehmender Experimente und Forschungsergebnisse anderer Gelehrter Licht in das Dunkel des Lebensrätsels zu werfen vermag.«
»So mag das Unheil seinen Weg gehen —« murmelte der erregte Schuldirektor so laut vor sich hin, daß es von Nieuwenhuis verstanden wurde.
»Ist denn alles aus dem Häuschen geraten? Die Menschen tun ja so, als sei ich ein Anarchist auf geistigem Gebiet, der mit Bomben alle geheiligten Anschauungen zerschmettern will. Es ist wahrhaftig zum Lachen!«
Nieuwenhuis kam jetzt auch in Rage und lief mit verschränkten Armen gleich seinem Freund, dem Direktor, im Zimmer auf und ab.
»Das will ich dir noch sagen, Doktor,« begann Simonszoon wieder. »Bringst du morgen keine stichhaltigen Beweise für das was du behauptest, so blamierst du dich sterblich. Mit Hypothesen füttere die Masse ja nicht ab.«
»Höre auf! Ich bin kein Hypothesenschmied. Meine Theorie über das Wesen des Lebens fußt auf Experimenten und Forschungsergebnissen, denen sich vernünftig denkende Menschen nicht verschließen können.«
Als Simonszoon einsah, daß Nieuwenhuis zu einer Absage des Vortrages keinesfalls zu bewegen war, verabschiedete er sich höchst mißmutig und ging seiner Wege.
Nieuwenhuis war nach diesem Besuch eine Weile recht nachdenklich geworden, dann aber griff er wieder nach seinem Vortragsmanuskript und repetierte seine Rede weiter, die so großes Aufsehen erregen sollte.
D, ie Aula der Universität in Leiden war gefüllt mit Menschen. Alle Stände waren vertreten, vorzugsweise diejenigen, welche mit der Wissenschaft in Beziehungen standen, auch alle Gesellschaftsklassen hatten sich eingefunden, Leute, welche mit Recht auf Bildung Anspruch machen konnten, Leute, welche die Intelligenz gepachtet zu haben schienen, und dann die Zwischenkasten, die mehr die Neugier als die Wißbegier hergeführt hatte, um zu hören, was der alte Grübler Nieuwenhuis über das Rätsel des Lebens zu sagen habe.
Eine Stunde hindurch hatte der Redner bereits gesprochen und seine Ansichten, unterstützt von Experimenten, dargelegt, als ihn ein plötzliches Unwohlsein zwang, den Vortrag abzubrechen. Die drückend heiße Luft in dem überfüllten Saale hatte dem alten Herrn geschadet und eine Anwandlung von Schwindel und Benommenheit bei ihm herbeigeführt, Und mitten in seinen interessantesten Ausführungen war das erfolgt. Nach einer Erholungspause von reichlich zehn Minuten erschien Nieuwenhuis wieder im Saale und begab sich langsamen Schrittes zur Tribüne, um zu versuchen, seinen Vortrag zu Ende zu führen.
Man merkte es dem alten Herrn an, daß ihm die Worte nicht so leicht über die Lippen fließen wollten, daß er sich anstrengte, um vernehmlich zu bleiben.
»Meine verehrten Anwesenden!« begann Nieuwenhuis von neuem. »Ich blieb bei meinen Ausführungen dabei stehen, daß ich die Fälle aufzählte, in denen es gelungen ist, Leben künstlich zu erzeugen. Bei einer Nachprüfung dieser Fälle fand ich aber jedesmal, daß sich die betreffenden Forscher geirrt hatten, denn die von ihnen angeblich künstlich erzeugten Lebewesen zeigten immer nur einzelne Leistungen der Organismen. Ein Gebilde aber, das mit Recht als lebendig bezeichnet werden soll, muß eine ganze Reihe Leistungen aufweisen, es muß Nahrung aufnehmen, diese verdauen, unverbrauchte wieder abscheiden und eigene Substanz nebenbei verbrauchen. Ferner muß bei dem Gebilde eine Erhaltung der Substanz trotz des Verbrauchs und eine Vermehrung derselben stattfinden. Weiterhin muß es eine Eigenbewegung, eine Vermehrung und Vererbung seiner Eigenschaften auf seine Nachkommenschaft dartun. Diese Eigenschaften alle kennzeichnen erst ein wirklich lebendes Gebilde. Daß es bis jetzt noch nicht gelungen ist, Leben künstlich aus anorganischer Materie, aus totem Stoff zu erzeugen, ist darauf zurückzuführen, daß ...«
Wieder überkam jetzt dem Redner erneutes Unwohlsein, das ihn zwang abzubrechen. Abermals verließ Nieuwenhuis den Saal, um sich in frischer Luft zu erholen. Hilfsbereite Hände führten ihn hinaus und bemühten sich um ihn.
Drinnen in der Aula hatte der Vorgang eine starke Erregung unter dem Publikum ausgelöst. Diese äußerte sich in einem Tohuwabohu von Stimmen. Man bedauerte den Zwischenfall, diskutierte über das Gehörte und nahm Stellung zu diesem und jenem, was auf die Enthüllungen über das Lebensrätsel Bezug hatte. Noch hatte Nieuwenhuis nicht zu Ende gesprochen, noch standen die Grandeffekte aus, die ihre Schlaglichter in das Dunkel des Lebensproblems werfen sollten.
Nachdem eine Viertelstunde verflossen war und Nieuwenhuis noch immer nicht in den Saal zurückgekehrt war, bestieg ein Professor der Physiologie namens Engelbrechtsen die Tribüne und bat um Gehör für einige Ausführungen zum Thema des Lebensproblemes.
Nur allmählich kamen die erregten Geister im Saale zur Ruhe.
»Meine hochverehrten Anwesenden! Gestatten Sie mir für einige Augenblicke das Wort zur Sache zu ergreifen ...« begann Engelbrechtsen mit seiner sonor klingenden kräftigen Stimme. »Als Fachmann auf dem Gebiet, welches Herr Dr. Nieuwenhuis heute hier beackert, erlaube ich mir zu dem Stellung zu nehmen, was der Redner in bezug auf die Lösung des Lebensrätsels soeben ausgeführt hat — — Dr. Nieuwenhuis stellte unter anderem die Behauptung auf, daß der lebende tierische Körper sich aus Zellen als kleinsten Elementarbestandteilen aufbaut. Diese Anschauung stimmt, die Wissenschaft hat sie längst akzeptiert. Des weiteren aber sagt der Redner, daß die Leistungen einer Einzelzelle rein physikochemischer Natur seien. Diese Annahme ist einstweilen nur eine bloße Arbeitshypothese ...«
»Sehr richtig!« rief eine Stimme.
»Nieuwenhuis unterscheidet bei den Leistungen einer lebendigen Zelle das Mechanische von dem, was psychischen Faktoren zugeschrieben werden muß,« fuhr Engelbrechtsen mit gehobener Stimme fort, »und behauptet, daß solche Faktoren, zu denen wir den Schmerz, die Lust, den Durst und so weiter rechnen, nur Ausflüsse der physikochemischen Leistungen der Zelle sind. Den Beweis für diese Behauptung ist der Redner uns aber schuldig geblieben.«
Hier wurde der Sprecher wieder unterbrochen. Eine zweite Stimme aus dem Auditorium rief: »Nieuwenhuis ist ja auch noch gar nicht zu Ende gekommen!«
»Er wird der Wissenschaft trotzdem den Beweis schuldig bleiben,« setzte der Professor seine Rede fort. »Die psychischen Motive, nach denen der Mensch handelt, können unmöglich bloße Funktionen sein, die zufolge des chemischphysikalischen Arbeitsprozesses im lebenden Körper in Erscheinung treten.«
»Für diese Behauptung, Herr Kollege,« rief der Professor Keulenschlag, der in unmittelbarer Nähe der Tribüne saß »können Sie aber auch keinen Gegenbeweis erbringen. Ich möchte mich eher zu Nieuwenhuis' Anschauung bekennen. seine Theorie ist —«
Weiter kam der Sprecher nicht, Eine dritte Stimme fiel ihm kräftig ins Wort. Professor van den Hoff erhob sich. »Nieuwenhuis' Theorie verdient alle Beachtung, sie trägt zweifellos zur Erklärung des gewaltigen Lebensproblemes bei, aber ihr haften Schwächen und Mängel in bedenklichem Maße an.«
Unterdessen war Nieuwenhuis wieder in den Saal getreten, und wurde durch begeisterte Zurufe von einigen Seiten empfangen.
Engelbrechtsen verließ jetzt sofort die Tribune, um dem alten Arzt Platz zu machen.
Nieuwenhuis bestieg langsam das Rednerpult. Er schien sich völlig erholt zu haben, wenn auch noch eine starke Blässe sein sonst gerötetes Gesicht überlagerte.
Alles verstummte im Saale, als er sich anschickte seine Rede erneut fortzusetzen. Viele Augen hingen mit hochpotenzierter Spannung an den schmalen Lippen des Forschers, der hier die Quintessenz einer jahrelangen stillen Tätigkeit der Menschheit zu Gehör und Gemüt führte.
Nachdem Nieuwenhuis sein wiederholtes Abbrechen des Vortrages zu entschuldigen versuchte, fuhr er in seinen Ausführungen über die Erforschung des Lebensrätsels fort.
»Bevor ich meine Theorie des weiteren entwickle, möchte ich den verehrten Anwesenden mitteilen, daß ich Experimente, welche andere Forscher gemacht haben, wiederholt nachprüfte. Es ist in weiteren Kreisen bekannt geworden, daß Quinton, Loeb und Bertrand, drei hervorragende Naturforscher unserer Zeit, hochbedeutsame Entdeckungen gemacht haben. — Zunächst will ich auf diejenige des französischen Physiologen Quinton zu sprechen kommen. Dieser Gelehrte hat bekanntlich einen auffälligen Zusammenhang zwischen dem Tierblut und dem Meerwasser nachgewiesen. Mit der hochempfindlichen Wage des Chemikers hat er gezeigt, daß im Blut wie im Seewasser ein und dieselben Stoffe enthalten sind, also Natrium, Magnesium, Chlor, Kohlenstoff, Schwefel, Phosphor, Jod, Mangan und andere Elemente. Diese Tatsache wäre an sich nicht verblüffend, wenn der genannte Forscher nicht gleichzeitig auch bewiesen hätte, daß das Meerwasser das Blut im lebenden Körper auch zu ersetzen imstande ist. Quinton hat durch verschiedenfach wiederholte Experimente an Tieren gezeigt, daß diese ohne Beeinträchtigung ihres Befindens weiterzuleben vermögen, wenn man denselben einen großen Teil ihres Blutes entzogen und an Stelle desselben ein entsprechendes Quantum Seewasser in die Adern gefüllt hat. Ich habe das Experiment nachgeahmt und präsentiere Ihnen hier ein Kaninchen, welches nachweislich zu dreiviertel seiner Blutmenge Seewasser in den Adern hat.«
Bei den letzteren Worten gab Nieuwenhuis einem Diener einen Wink, und dieser entnahm einem Kasten ein zappelndes Kaninchen, welches er dem Redner reichte.
»Hier ist der lebendige Beweis für das eben gesagte. Inwieweit in diesem Versuchstiere die Blutkörperchenbildung vor sich geht, ist noch nicht Gegenstand einer Untersuchung gewesen. Ich werde mich aber demnächst mit dieser Frage beschäftigen und meine Ergebnisse öffentlich bekannt geben. — Ich berühre nun die zweite Entdeckung, welche Professor Loeb in Chikago gemacht hat. Es handelt sich in diesem Falle um eine künstliche Befruchtung von unbefruchteten Eiern eines Tieres und zwar eines Seeigels. Eine solche ist durch Berührung der Eier mit einer Mischung von Meerwasser und Magnesiumchlorid möglich. Die daraus entstandenen jungen Seeigel wachsen zu ebenso stattlichen Tieren aus, als wenn sie aus dem Schoße der Natur hervorgegangen wären.«
Eine allgemeine Erregung und Verblüffung machte sich jetzt in dem andächtig lauschenden Auditorium bemerkbar. Nur die Gelehrten zeigten eine unveränderte Ruhe, ihnen waren die von dem Redner hier angezogenen Experimente wohl bereits bekannt.
Nach kurzer Pause ergriff Nieuwenhuis wieder das Wort. Man merkte es ihm an, daß er mit vollster Hingabe an sein Thema redete. Seine Augen leuchteten oft und seine Gesten waren zumeist recht lebhafte, er schien jung zu werden bei seinen Ausführungen über ein Problem, dessen Lösung ihn seit Jahr und Tag bereits in Atem gehalten hatte.
»Ein weiteres Experiment nun, meine hochverehrten Anwesenden, wird Ihnen dartun, daß ich mit meiner Theorie, daß alles Lebendige in der Einzelzelle, der Amöbe, sowohl als auch in einem ganzen Zellenstaate, wie solche Mensch und Tier repräsentieren, physikalischchemischer Natur ist, auf den richtigen Wegen wandle.«
Einige ältere Herren in den vordersten Reihen des Auditoriums, Professoren und Dozenten, hüstelten und tuschelten sich Worte zu. Sie gehörten zu den Gegnern des Redners, dessen Theorie sie nicht akzeptierten.
»Das dritte Experiment,« fuhr Nieuwenhuis fort, »ist von dem französischen Chemiker Bertrand gemacht worden. Dieser Forscher hat zum erstenmal mit Hilfe anorganischer Substanz, also toter Materie, die Lebenskraft arbeitend gezeigt. Es handelt sich in diesem Falle also nicht wie bei den anderen zwei eben angezogenen Experimenten um eine Umwandlung unbelebten Stoffes in belebten. Der menschliche Körper ist mit einer belebten Maschine zu vergleichen, deren Arbeitstätigkeit durch den Atmungsprozeß zustande kommt ... Letzterer besteht bekanntlich darin, daß die Lunge unausgesetzt Sauerstoff aus der Luft nimmt, diesen gegen die im Blute angesammelte Kohlensäure, welche wir ausatmen, vertauscht und daß der auf solche Weise ins Blut gelangte Sauerstoff den unbrauchbaren Kohlenstoff wieder zu Kohlensäure verbrennt ... Hier steht nun die Frage an, wer besorgt das Atmungsgeschäft? Welcher geheimnisvolle Motor treibt die Maschine? ...« Bertrand beantwortet uns diese Frage mit seinem Experiment. Er läßt das Atmungsgeschäft, das uns als eine der geheimnisvollsten Tätigkeiten dessen, was wir Leben nennen, erscheint, von toter Materie ausführen!«
Wiederum vermochte man ein Staunen im Publikum zu registrieren. Gar viele schüttelten die Köpfe und sahen sich einander verwundert an, obgleich das Experiment selbst noch nicht erörtert war.
»Was Bertrands toter Stoff vollbringt,« fuhr Nieuwenhuis mit gehobener Stimme fort, »ist mehr als ein bloßer chemischer Prozeß! ... Der Forscher benutzt eine Mangansalzlösung, der er eine leicht oxydierbare Substanz zufügt, wodurch eine freie Säure und eine andere Verbindung des Mangans gebildet wird, die sofort aus der Luft Sauerstoff anzieht,, mit anderen Worten, Sauerstoff einatmet! — Hierdurch wird wieder eine andere Verbindung des Mangans gebildet, der Sauerstoff verwandelt die oxydierbare Substanz in Oxyd, die Folge ist, daß der Kohlenstoff in Kohlensäure umgesetzt und als solche ausgestoßen — ausgeatmet wird ... Sofort verbindet sich nun wieder die vorhandene Manganverbindung mit der freien Säure, welche zu Beginn dieses chemischen Prozesses aufgetreten ist. Der Schlußeffekt ist, daß nun genau wieder dasselbe Mangansalz, mit welchem das Experiment begonnen wurde, entsteht. Fügt man jetzt abermals etwas von dem leicht oxydierbaren Stoff hinzu, so beginnt das chemische Wechselspiel, welches wir einen künstlichen Atmungsprozeß nennen können, von neuem ... Man kann die Manganverbindung als eine künstliche Lunge betrachten, denn mit ihrer Hilfe kann die Atmung bei Tier und Mensch genau nachgeahmt werden ... Sehen Sie, dieser Versuch bringt uns der Lösung des Lebensrätsels schon ein gut Stück näher!«
Hier wurde Nieuwenhuis durch Professor Engelbrechtsen unterbrochen, welcher ihm zurief: »Gestatten Sie mir eine Einwendung zu machen! Sie versuchen den Schleier von den geheimnisvollen Lebensvorgängen zu lüften und glauben damit das Rätsel des Lebens aufzuhellen. Sie bleiben aber die Aufklärung schuldig über das, was wir Seele nennen. Das Geheimnis der Menschenseele ist nicht bloß das Geheimnis dessen, was wir mit Leben bezeichnen! Eine Maschine, die über sich selbst nachdenkt, ist nicht aus Kraft und Stoff erklärbar!«
Als Engelbrechtsen sich wieder setzte, nickten ihm einige Kollegen lebhaft zu, wahrend unter den übrigen Zuhörern ein Getuschel vernehmbar wurde.
Einige Augenblicke sah Nieuwenhuis hilflos vor sich hin. Er wußte ersichtlich nicht, was er auf die Einwendung entgegnen sollte.
»Meine Theorie,« begann der alte Arzt wieder, ohne eine Spur von Verlegenheit zu zeigen, welche ihm der Einwand Engelbrechtsens bereitet hatte, »hat das Seelische natürlich als Hauptfaktor mit in Rechnung gezogen, und stehe ich, ohne ein krasser Materialist zu sein, auf dem Standpunkt, daß die seelischen Tätigkeiten nur Wirkungen körperlicher Vorgänge sein können.«
»Beweisen! beweisen!« riefen flugs eine Anzahl Stimmen aus den ersten von der Gelehrsamkeit besetzten Reihen des Auditoriums.
Nieuwenhuis hustete.
»Materialist!« schrie eine Stimme.
»Er verleugnet das Göttliche im Menschen!« rief ein anderer.
Die Versammlung wurde tumultarisch, und Nieuwenhuis fühlte sich auf seinem Rednerpult recht ungemütlich.
»Meine Herren!« begann er mit Stentorstimme wieder, um das Stimmengewirr zu übertönen. »Meine Herren! Die Psyche des Menschen ...«
Jetzt entstand im Auditorium ein Zischen und Trampeln mit den Füßen, daß Nieuwenhuis seine Rede nicht fortzusetzen vermochte. Kurzerhand verließ der alte Arzt die Tribüne und mit gekränkter Würde kehrte er seinen Zuhörern den Rücken. Einige Augenblicke später hatte sich die Tür hinter ihm geschlossen.
Bei einer Wählerversammlung konnte es nicht tumultarischer zugehen als hier, wo sich die Köpfe über das Gehörte erhitzt hatten. Die Anwesenden hatten sich sämtlich erhoben und standen nun in Gruppen umher, laut debattierend und gestikulierend.
Die Laienelemente scharten sich um die hohe Gelehrtenschaft, um aus deren Disput herauszuhören, was an Nieuwenhuis' Vortrag eigentlich wahres gewesen wäre.
Engelbrechtsen führte in der Hauptsache das Wort. Er stand als notorisch beglaubigter Dualist dem krassen Materialisten Nieuwenhuis als schärfster Gegner gegenüber.
Fast eine Stunde lang wurde nun ein Wortkrieg geführt, der die Gemüter noch mehr erhitzte und Nieuwenhuis neue Gegner erstehen ließ.
Als sich die Versammlung endlich auflöste, war über den verspotteten Helden des Tages der Stab gebrochen und seine Theorie abgetan. Über dem Rätsel des Lebens blieb nach wie vor der undurchdringliche Schleier gebreitet — es war nicht gelungen auch nur einen Zipfel zu lüften.
Mynheer Steens Testament war eröffnet worden. Sein Inhalt erregte ein gewaltiges Aufsehen. Hieß es doch darin wörtlich wie folgt:
»Zu meinem alleinigen Erben setze ich Herrn Dr. Nieuwenhuis in
Leiden ein, mit der Bestimmung, daß dieser über mein Vermögen frei
verfügen kann, soweit er es ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken,
welche die Lösung des Lebensproblems anstreben, verwendet.«
Die Testamentseröffnung hatte am Tage nach dem Vortrage des Dr. Nieuwenhuis stattgefunden, ihr Ergebnis überraschte und tröstete den alten Arzt zugleich.
Zwei volle Millionen Gulden wurden in seine Hand gelegt, er durfte diese für seine wissenschaftlichen Studien über das Lebensrätsel verwenden. Nieuwenhuis gedachte mit Rührung des verstorbenen Freundes, des einzigen Menschen, der ihn und sein wissenschaftliches Wirken stets ernst genommen.
Geld ist ja immer eine schöne Sache. Inwieweit er aber damit der Lösung des großen Problems näher kommen konnte, das war ihm vorläufig noch unklar. Und doch war er fest entschlossen, die Millionen bis auf den letzten Heller für die Beackerung seiner Geistesdomäne zu verausgaben.
Er überlegte hin und her und konnte zu keinem Resultat kommen. Es schien ihm, als könne er mit dem Mammon überhaupt nichts anfangen. — — — Während er noch in Gedanken versunken war, wurde ihm durch seine Haushälterin die eingegangene Tagespost überbracht.
Nieuwenhuis war nicht wenig über den Stoß Briefe, den er mit einem Male empfing, erstaunt, er erinnerte sich aber dann seines Vortrages und witterte in den vielen Schreiben Angriffe auf sich und seine Theorie.
Er begann die Briefe der Reihe nach zu öffnen und überflog deren Inhalt.
»Mein Herr Doktor!« hieß es in dem ersten, »Sie pilgern auf Irrwegen. Sie versuchen den geistigen Horizont, welchen die Schöpfung dem Menschen gesteckt hat, nieder zu reißen. Sie sind bar jedes Gottesgefühls! Ihre Argumente, die Sie in bezug auf das gewaltige Lebensproblem vorgebracht, sind absolut nicht stichhaltig und kennzeichnen Sie ...«
Nieuwenhuis las gar nicht weiter. Noch einen flüchtigen Blick auf die Unterschrift, welche Anonymus lautete, und das Schreiben flog mit Eleganz in den gähnenden Schlund des gerade ausgeleerten Panierkorbes.
Der zweite Brief entstammte der Feder eines näheren Bekannten. Der alte Herr Meermann schrieb ihm mit sichtlicher Entrüstung:
»Geehrter Herr Doktor! Ein Vater macht Sie für seines Sohnes Seelenheil verantwortlich. Mit Ihrer wissenschaftlichen Schwarzkunst haben Sie verderblich auf meines Sohnes Gemüt und Denkart eingewirkt. Sie haben den Jungen auf dem Gewissen! Ihr Vortrag über das Lebensrätsel wird noch manches Unglück in den Familien herbeiführen.«
In dieser Tonart ging der Brief noch weiter. Nieuwenhuis war über den Inhalt des Schreibens betroffen und beschloß, den jungen Meermann heimlich einmal zu sich zu bescheiden.
Der dritte Brief, den er nun erbrach und mit einem gewissen Ingrimm zu lesen begann, lautete:
»Mein hochgelahrter Herr! Der Unterzeichnete wünscht von Herzem, daß Ihnen die künstlichen Seeigel und blutleeren Kaninchen gelegentlich Ihrer Nachtruhe kein Alpdrücken bereiten, die Lösung des Lebensrätsels könnte ansonsten doch noch ausbleiben. — Einer, der Ihren Gedankengängen nicht zu folgen vermag.«
Auch dieses mehr als impertinente Schreiben versank in die Tiefe des hungrigen Papierkorbes.
Nieuwenhuis war bereits gründlich verärgert, als er die nächsten Briefe erbrach.
Einer derselben war ernst und sachlich gehalten und bezog sich natürlich auch auf das famose Lebensproblem. Er stammte aus der Feder eines Universitätsdozenten aus Amsterdam. Der Briefschreiber bekannte offen, daß er sich zwar nicht zu der Gemeinde Nieuwenhuis' rechne, aber viele Gesichtspunkte über das Lebensproblem mit ihm teile.
Des Doktors Gesicht erhellte sich ob dieser Anerkennung wieder etwas und er beschloß mit dem Dozenten in Korrespondenz zu treten.
Dann bekam Nieuwenhuis einen Brief unter die Finger, worin er von einem Unbekannten der Erbschleicherei in Steens Nachlaßsache bezichtet wurde. Das brachte des Alten Blut in Wallung. Die ererbten Millionen sollten ihm aber noch mehr Ärger und Scherereien bereiten.
Der Jansenistenbischof mit zwei seiner Pfarrkinder, glaubenseifrige Männer seiner Kirche, meldeten sich soeben bei ihm an.
Nieuwenhuis hätte lieber den Teufel in persona empfangen als den bissigen Oberhirten der Jansenisten, der es doch nur auf die Millionen Steens abgesehen hatte. Er wußte im voraus, daß es jetzt einen Kampf geben würde. Die Stimmung, in der der Alte sich gerade befand, war grimmig genug, um den Empfang der Besucher wenig liebenswürdig erscheinen zu lassen.
Nach einer kühlen Begrüßung kam der Bischof auf sein Anliegen zu sprechen.
»Mynheer Steen hat in der Verblendung seines Geistes Ihnen also doch sein Vermögen vermacht,« begann Scaligers in seiner salbungsvollen Redeweise und kniff dabei die Augen halb zu.
»Mir nicht, sondern der Wissenschaft, der ich diene,« entgegnete Nieuwenhuis, jenen korrigierend.
»Das ist in diesem Falle völlig gleich,« versetzte der Bischof. »Unsere arme Kirche hat das Nachsehen. Aber wir geben unsere Sache nicht verloren, und ehe wir den Rechtsweg beschreiten, wollen wir den Versuch machen, in gütlicher Weise mit Ihnen zu verhandeln.«
»Das Testament ist unanfechtbar,« versetzte der Arzt gelassen.
»Oho!« rief einer der Herren, die sich in des Bischofs Begleitung befanden. »Hier liegt ein älteres persönliches Versprechen an die Kirche vor.«
»So ... hm —« kam es über Nieuwenhuis' Lippen.
»Ihr gestriger Vortrag muss Ihnen doch die Augen geöffnet haben,« begann der Bischof wieder, »daß die Lösung des Lebensrätsels mit Hilfe Ihrer Theorie unter den Gelehrten keine Anerkennung findet. Ein Beweis, daß Sie auf ungangbaren Wegen wandeln. Weshalb wollen Sie diese noch weiter beschreiten und Steens Millionen dabei opfern, eine Geldsumme, die in den Händen der Kirche unendlichen Segen stiften könnte, während sie so die Sinne vieler Menschen verwirren wird.«
Nieuwenhuis lächelte. »Meine Herren, es ist wirklich vergeblich, mich gütlich irgendwie zu bestimmen, den letztwilligen Verfügungen meines alten Freundes entgegen zu handeln.«
Der Bischof richtete sich in seiner ganzen Größe auf und seine Augen begannen zu blitzen.
»Ich werde meinen Fuß nicht wieder über die Schwelle eines Gottleugners setzen,« rief er zornig aus.
»Sie wissen auch ganz genau, daß ich wenig davon erbaut zu sein pflege, Herr Bischof,« erwiderte Nieuwenhuis mit ganzer Seelenruhe.
»Kommen Sie, meine Herren,« sagte Scaligers zu seinen Begleitern. »Verlassen wir einen für die ewige Seligkeit verlorenen Mann.« Seine Stimme hatte einen eisigen Tonfall angenommen.
Der Bischof ging ohne Gruß durch die Tür, und seine Begleiter folgten ihm in ehrerbietiger Weise. Nieuwenhuis sah den Dreien nach und war herzensfroh, diese so schnell wieder los zu sein.
Eine Stunde später hatte sich sein Ärger bereits verflogen und er entwarf vor seinem Schreibtisch allerlei Pläne, in welcher Form die Millionen Steens verwendet werden könnten.
Er fand schließlich verschiedene Wege. Aber keiner genügte, der Lösung des Lebensrätsels führten sie ihm nicht entgegen. So saß Herr Nieuwenhuis ratlos da und konnte mit seinen Millionen absolut nichts anfangen. Das war fast betrübend.
Schließlich ergriff er die Feder und wendete sich mit einem Schreiben an den Amsterdamer Dozenten, von dem er soeben einen Brief erhalten hatte. Er unterbreitete ihm den merkwürdigen Fall, bei welchem er sich keines Rates wußte, und erbat sich seine Ansicht darüber.
Die Haushälterin servierte ihm in diesem Augenblick das Frühstück. Sie hatte natürlich von der Millionenerbschaft ihres Herren Doktor bereits gehört und dienerte darum heute in einer auffälligen Weise vor ihm.
»Frau Dorothee,« redete Nieuwenhuis sie an. »Haben Sie schon mal einen reichen armen Mann gesehen?«
Die Haushälterin war über die Frage verblüfft und starrte Nieuwenhuis an.
»Sehen Sie, ein solcher reicher armer Mann bin ich. Ich sitze jetzt mit rund zwei Milliönchen Guldenstücken da und kann nichts, rein nichts damit anfangen.«
Frau Dorothee begriff anscheinend noch immer nicht.
Der Doktor sah sie an. »Sie können das nicht verstehen, nun ich verstehe es auch nicht. Es ist zum Verzweifeln! — — Gießen Sie mir etwas Tee ein, vielleicht kommen mir die Gedanken dabei.«
»Ei, Herr Doktor,« begann die Haushalterin, trotzdem es noch keineswegs bei ihr dämmerte, was Nieuwenhuis mit seinen Worten gemeint hatte. »Das viele Geld! Und dabei nicht recht froh! ... Na, es ist ja immer so. Hat man's nicht, so sehnt man es herbei, hat man's dann, weiß man's nicht zu würdigen.«
»Frau Dorothee, hier steht die Sache anders. Das Geld gehört meiner Wissenschaft, nicht mir.«
»Na, das is doch wahrhaftig gleich, Herr Doktor.«
»Sie irren sich. Ich bin so arm wie zuvor.«
»Sie machen doch wohl nur Ihren Spaß, Herr Doktor?«
»Frau Dorothee, lösen Sie das Rätsel des Lebens und die zwei Millionen gehören Ihnen,« sagte Nieuwenhuis und schlürfte seinen Tee hinunter.
Frau Dorothee war keine beschränkte Person, aber mit dem Begriff Lebensrätsel wußte sie nichts anzufangen. Sie hatte das Wort so und so oft schon im Hause gehört, sie wußte, daß Nieuwenhuis nur Sinn und Interesse für dies eine Wort hatte, daß er wie besessen auf dem Lebensrätsel herumritt, welche innere Bedeutung dasselbe aber hatte, darüber grübelte sie nie nach.
»Was ist's nur mit dem ewigen Lebensrätsel, Herr Doktor,« wagte sich die Haushalterin zu fragen und schenkte dabei die von Nieuwenhuis geleerte Tasse voll Tee.
»Liebe Frau, haben Sie nie darüber nachgedacht, was das Leben eigentlich ist?« Der Doktor blinzelte über seine Tasse hinweg die Gefragte an.
»Darüber habe ich mir nie Kopfzerbrechen gemacht,« meinte die Haushälterin.
»Aber ich,« versetzte Nieuwenhuis.
»Das haben Sie aber nun doch nicht mehr nötig, wo Sie das viele Geld gekriegt haben?«
»Jetzt erst recht, Frau Dorothee.«
»Nanu!« erwiderte verwundert die Frau. »Wenn ich die Millionen in die Tasche bekommen hätte, ließ ich das Lebensrätsel Lebensrätsel sein. Da könnten sich andere den Kopf darüber zerbrechen.«
»Na, lassen wir's genug sein, Frau Dorothee ... sagen Sie mal, fressen die beiden Kaninchen noch gut?«
»Das eine Karnickel scheint wenig Appetit zu haben, Herr Doktor.«
»So ... hm ...«
»Die Karnickel würden einen guten Braten geben ... Das Fleisch ist schön weiß, ein bißchen trocken, aber mit Majoran ...«
Der Doktor schlug eine Lache an.
»Braten möchten Sie die Viehcher? Guten Appetit!« rief er. »Die Tiere haben Meerwasser in den Adern.«
Frau Dorothee faßte das natürlich als einen Scherz auf, und da es soeben im Vorsaal klingelte, klärte Nieuwenhuis sie nicht weiter über die Blutleere seiner Versuchskaninchen auf, sondern hieß ihr nachzusehen, wer draußen Einlaß begehre.
»Nehmen Sie den Brief hier mit und befördern Sie ihn zur Post,« sagte der Doktor und reichte ihr das Schreiben an den Amsterdamer Dozenten.
Frau Dorothee verschwand.
Nieuwenhuis schlürfte seinen Tee weiter und nahm eine Zeitung zur Hand. Es war das Tageblatt »Nieuws van den Dag«. Er suchte in den Spalten derselben nach einer Kritik über seinen Vortrag. Als er diese gefunden, überflog er sie mit Hast und nickte halbwegs zufrieden mit dem, was er gelesen hatte. Es freute ihn, daß er nicht auch von der Presse verrissen wurde. Einige Grundsätze seiner angefeindeten Theorie wurden in dem Bericht als durchaus richtig anerkannt, so hieß es unter anderem darin, daß Nieuwenhuis zu Recht annehmen dürfe, daß das Leben aus anorganischem Material künstlich erzeugt werden könne. Hierfür spreche der Umstand, daß alle Lebensäußerungen Energie verbrauchen.
»Die Zuführung der Energie erfolgt in Gestalt von Nahrung und Sauerstoff, welche letztere innerhalb der Organe verbrennen und die Energie frei geben. Als eigentliche Energiequelle betrachtet Nieuwenhuis die Sonne, sie erzeugt die Lebensäußerungen, indem sie in den Pflanzen eine Zerlegung der Kohlensäure in Kohlenstoff und Sauerstoff vor sich gehen läßt. Die Wiedervereinigung beider macht dann die Energie, die zur Zerlegung aufgewendet wurde, frei. Sobald der Energiestrom der Sonne nicht mehr durch den Körper des Menschen geht, hört dieser zu leben auf. Selbst für das Denken macht sich solche Energie erforderlich, ein Beweis, daß psychische Tätigkeiten ihren Ursprung im Physischen haben. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, darf Dr. Nieuwenhuis' Theorie vom Wesen des Lebens keinesfalls über Bord geworfen werden. Im Gegenteil, die Wissenschaft hat ihr die größte Beachtung zu schenken.«
So stand in dem »Nieuws van den Dag« zu lesen. Diese Anerkennung tat Nieuwenhuis fast wohl. Er hätte gern in Erfahrung gebracht, wer ihm diese Gerechtigkeit zuteil werden ließ.
Wahrend der alte Doktor noch über das eben Gelesene nachdachte, meldete ihm die Haushälterin, daß ein junger Herr ihn zu sprechen wünsche.
»Fortgesetzt diese Störungen,« brummte Nieuwenhuis und warf einen Blick nach der Uhr. »Ich lasse bitten.«
Frau Dorothee entfernte sich, um gleich darauf den Besucher ins Zimmer treten zu lassen.
»Entschuldigen Sie vielmals, Herr Doktor!« klang es an Nieuwenhuis' Ohren, als er von seiner Zeitung aufblickte.
»Treten Sie näher, Herr Meermann,« entgegnete der Doktor und erhob sich von seinem Platze.
»Ich störe doch wohl nicht? Es wäre mir peinlich ...« begann Meermann junior.
»Keineswegs,« versetzte Nieuwenhuis freundlich und bot seinem Besucher einen Stuhl an. »Es schneit draußen noch lustig, wie ich bemerke.«
»Ein tüchtiger Winter dieses Jahr — mehr Schnee als Frost, Herr Doktor.«
»Herr Meermann, ist es Ihnen bekannt, daß Ihr Herr Vater einen wenig freundlichen Brief Ihretwegen an mich geschrieben hat,« sagte Nieuwenhuis, ohne abzuwarten, was sein Besucher weiter äußern werde. »Ich hatte deshalb schon die Absicht, Sie einmal zu mir bitten zu lassen. Da Sie nun heute selbst kommen, so paßt die Gelegenheit zu einer kleinen Aussprache vortrefflich ... Darf ich Ihnen eine Zigarre anbieten? Eine leichte Manilla ... meine alte Lieblingssorte ...«
Bei dieser Frage hielt er Meermann eine Kiste Zigarren hin und freute sich, daß sein Besucher zugriff.
»So ... also Papa hat Ihnen geschrieben,« begann Meermann junior, indem er seine Zigarre in Brand setzte. »Er war sehr böse, daß ich Ihren Vortrag mit angehört habe.«
Nieuwenhuis lächelte. Er kannte den alten Meermann von früher her gut und wußte, daß dieser für wissenschaftliche Ideen weder Interesse noch Verständnis besaß.
»Meine Irrlehren sollen Ihrem Seelenheil verderblich geworden sein ... so ungefähr lautete der Brief Ihres Vaters,« sagte er dann.
»Herr Doktor, Ihr Vortrag hatte mich begeistert. Daraus habe ich zu Hause kein Hehl gemacht, und wenn ich nun ein Grübler geworden bin, so braucht niemand zu befürchten, daß ich in Ihrem Fahrwasser untergehe. Ist es nicht so, Herr Doktor?«
Meermann hatte das in einem Ton gesprochen, der eine innere Entrüstung durchblicken ließ.
»Recht so! ... also in meinem Fahrwasser segeln Sie? Das freut mich zu hören. Das Rätsel des Lebens scheint Sie besonders zu interessieren. Sind Sie meinem Vortrage gefolgt?«
Meermann bejahte eifrig. »Leider hat man Sie nicht zu Ende kommen lassen.«
»Der Zweifler und Gegner waren zuviele. Die Zeit wird aber noch kommen, und ich glaube an meine Theorie. Das Lebensproblem ist eine harte Nuß, mein junger Freund.«
»Mynheer Steen hat doch wohl dafür gesorgt, daß sie nun geknackt wird,« warf Meermann ein.
»Aha! Sie haben auch schon von der Erbschaftsgeschichte gehört,« versetzte Nieuwenhuis. »Die Spatzen pfeifen diese Neuigkeit wohl schon von allen Dächern?«
»Steens Millionen sind bereits Stadtgespräch,« bekräftigte Meermann des Alten Voraussetzung. »Es war ein wunderbarer Gedanke, für die Lösung des größten Problems der Wissenschaft eine solche Geldsumme zu stiften!«
»Meinen Sie — wie nun, wenn ich gar nicht weiß, was ich mit dem vielen Geld anfangen soll?« frug Nieuwenhuis und blinzelte den jungen Mann, der in diesem Augenblick eine recht naive Grimasse aufsetzte, lustig an.
»Herr Doktor! ... Sie wissen nicht ...«
»Nein, wirklich nicht, mein junger Freund. Ich sitze jetzt auf eines Nabobs Geldsäcken und zerbreche mir den Kopf, wie man die Millionen zum Fenster hinauswerfen kann, um einer Lösung des Lebensrätsels etwas näher zu kommen.«
»Aber ...« begann Meermann verblüfft.
»Geld haben und nichts damit anfangen können, das ist bitter,« unterbrach ihn der Doktor, und man sah es ihm an, wie ihn dies Faktum bekümmerte.
»Sie spaßen wohl, Herr Doktor?« frug Meermann, dem die Wahrheit des Gesagten nicht in den Kopf wollte.
»Nicht im geringsten. Ich wüßte wirklich nicht, wie und wo ich zur Förderung der Erforschung des Lebensproblems auch nur einen Gulden verausgaben könnte.«
»Jede wissenschaftliche Tätigkeit kann doch durch Geld gefördert werden ...«
»Oho! hier haben wir's gleich. Die Erforschung des Lebensproblems ist Denkarbeit, mein Lieber.«
»Sie könnten doch ein Spezialinstitut für diese Sache einrichten.«
»Junger Freund! Das ist ein Gedanke. Ich werde ihn aufgreifen. Die hervorragendsten Gelehrten werde ich heranziehen und mit diesen gemeinsam die Spuren weiter verfolgen.«
Meermann freute sich, daß er den Alten auf eine Idee gebracht hatte. Er wagte es deshalb, mehr mit der Sprache heraus zu gehen und einige Fragen zu stellen, die seine Neugier befriedigen sollten.
Im weiteren Verlauf des Gespräches kam Nieuwenhuis darauf zu sprechen, daß er einen Sekretär anstellen wolle, der ihm hilfreiche Hand leiste.
Meermann lauschte, als er davon vernahm. Nach einem solchen Posten verlangte ihm und er wagte danach zu fragen, welche Qualifikationen ein Bewerber besitzen müsse.
Nieuwenhuis erwiderte, daß er eine vertrauenswürdige Persönlichkeit in erster Linie benötige, der er die Verwaltung des Steensschen Fonds in die Hände legen könne.
Meermann gab nun zu erkennen, daß er für sein Leben gern die Sekretärstellung übernehmen möchte.
»Ei, Herr Meermann!« versetzte Dr. Nieuwenhus. »Was würde Ihr Vater für ein Gesicht machen, wenn Sie ihm diesen Wunsch äußern. Er ist ja ein geschworener Feind der Wissenschaft und auf meine Geistesdomäne insbesondere nicht zu sprechen. Ich glaube, er würde Sie enterben, wenn ich Sie zu meinem Sekretär machte.«
Der junge Kaufherr kannte den starren Sinn seines Vaters, der keinesfalls zu brechen war. Wenn er es nicht auf eine völlige Entzweiung mit dem Elternhaus ankommen lassen wollte, mußte er auf den Posten unbedingt Verzicht leisten.
»Herr Meermann, bleiben Sie, wo Sie sind,« sagte Nieuwenhuis. »Ich möchte nicht den Zorn Ihres Vaters auf mich laden. Mein Vortrag hat schon genug Unfrieden zwischen uns gestiftet.«
Der junge Kauftnann, der einsah, daß wenig Hoffnung vorhanden war, seinen Wunsch in Erfüllung gehen zu sehen, verabschiedete sich mit der Bitte, gelegentlich einmal wiederkommen zu dürfen.
Zwei Tage darauf empfing Nieuwenhuis abermals ein Schreiben des alten Herrn Meermann, worin derselbe sich wiederholt in ungehaltenem Tone über den verderblichen Einfluß beklagte, den er auf seinen Sohn ausübe.
Nieuwenhuis hielt es diesmal für das beste, den Brief unbeantwortet zu lassen, wie er denn auch all die anderen Schreiben, welche er in bezug auf seinen Vortrag erhalten hatte, keiner Rückäußerung würdigte.
Tage und Wochen gingen dann ins Land, und nur selten ließ sich der alte Arzt, der seine Privatpraxis inzwischen gänzlich aufgegeben hatte, in den Straßen der Stadt sehen. Unausgesetzt forschte er weiter, die Lösung des Lebensrätsels herbeizuführen oder ihr wenigstens nahe zu kommen. Die Millionen Steens setzten ihn in den Stand ein chemischphysikalisches Laboratorium mit allen denkbaren Hilfsmitteln der Wissenschaft zu errichten, in welchem er nun vom frühesten Morgen bis in die spätesten Abendstunden grübelte und experimentierte. Die Außenwelt schien für ihn fast gar nicht mehr zu existieren, so vertiefte er sich in seine mystische Tätigkeit.
Was hatte aber alle theoretische Arbeit für einen Zweck, wenn er die Ergebnisse derselben der Menschheit nur als nackte Hypothesen präsentieren konnte. Dieser Gedanke bewegte ihn unausgesetzt und ließ schließlich den Entschluß in ihm reifen, den Versuch zu machen Leben künstlich zu erzeugen.
Das führte Nieuwenhuis auf das Gebiet der praktischen Tätigkeit. Er wurde ein moderner Alchimist, einer, der sich im Gegensatz zu den Goldmachern des Mittelalters mit einem ungleich gewaltigeren Problem befaßte.
Von diesem seinem jüngsten Entschluß durfte die Welt beileibe nichts erfahren. Öffentlich durfte er es nicht wagen, dem Schöpfer aller Dinge ins Handwerk zu pfuschen, das mußte insgeheim geschehen.
Ob es ihm auch jemals gelingen würde? —
Allerdings hatte er Ideen, welche ihm den Weg wiesen, aber das Ziel lag sonnenfern!
Des Ungeheuerlichen seiner künftigen Tätigkeit war sich Nieuwenhuis gar wohl bewußt. Das Problem erschien auch ihm titanenhaft. Was er sich vermaß, war die künstliche Erzeugung eines niedrigsten Lebewesens, nicht daß er daran dachte, die Krone der Schöpfung, einen Menschen, künstlich zu erschaffen. Wenngleich er der Ansicht war, daß ein Menschenei gleich einem Seeigelei durch Magnesiumchlorid könne befruchtet werden.
Der werte Leser wird neugierig sein, welche neue Idee den kühnen Lebensforscher beherrschte und ihn auf die Bahn leitete, die, wie es den Anschein hatte, zur Lösung des Problems künstlicher Lebenserzeugung führen mußte oder, seien wir im Ausdruck vorsichtiger, führen konnte. — — Die phänomenale Idee wollen wir unbeanstandet hier verraten. Die Urquelle seines Schaffens sollte das seltsame Element Radium werden. Der Stoff, dessen geheimnisvolle Tätigkeit sich so vielfach in den Wirkungsäußerungen der Mutter Natur zu erkennen gibt und über dessen Beschaffenheit und Strahlungsvermögen sich zurzeit die genialsten Naturforscher die Köpfe zerbrechen.
Nieuwenhuis hatte dieses Element schon lange im Auge, aber er hatte bislang keine Experimente damit unternehmen können, da dasselbe für ihn unerschwinglich gewesen war. Jetzt jedoch, wo ihm riesige Geldmittel zur Verfügung standen, hatte er sich für eine halbe Million Gulden eine gewisse Menge dieses kostbaren Stoffes erworben und war nun in der Lage umfangreiche Versuche mit demselben vornehmen zu können.
Das Radium ist bekanntlich der teuerste Stoff der Erde. Ein einziges Gramm wird mit Hunderttausenden aufgewogen, und selten besitzt ein Forscher oder ein Wissenschaftliches Institut mehr als zehn oder zwanzig Milligramm. Völlig reines Radium ist überhaupt in niemandes Besitz, stets wird es in einer Verbindung mit Brom dargestellt.
Dr. Nieuwenhuis verfügte über die größte Menge Radiumbromid, die je ein Forscher in Händen gehabt hatte. Es hatte ihm natürlich sehr viele Mühe gekostet, ein solches immense Quantum schnellstens herstellen zu lassen. Wenn man bedenkt, daß zur Erzeugung eines einzigen Gramms Radiumbromid 1000 Kilo Erz verarbeitet werden müssen, so wird man erwägen können, welche Schwierigkeiten es hatte, jene Menge des kostbaren Stoffes aus dem spröden Pechblendenerz zu gewinnen.
Ehe nun Nieuwenhuis seinem Problem zu Leibe ging, begann er die Natur des Radiums aufs genaueste zu erforschen, wobei ihm die vielen Voruntersuchungen anderer Gelehrter die Wege ebneten.
Einige Wochen waren über diese Tätigkeit verflossen, als er eines Tages den Besuch eines Dr. Rex empfing, der sich unerwartet bei ihm eingestellt.
Nieuwenhuis war bei der Anmeldung des genannten Herrn gerade in seinem Laboratorium eifrig beschäftigt und wenig erbaut über den Besuch, der ihm zugedacht war.
»Was wünscht der Herr?« frug er seine Haushälterin in etwas mürrischem Tone.
»Er hat mir nur angegeben, daß er Sie dringend sprechen müsse. Es handle sich um eine wichtige wissenschaftliche Angelegenheit,« versetzte Frau Dorothee.
»So ... so ... hm — einen Augenblick. Ich komme gleich.« gab Nieuwenhuis zur Erwiderung.
Nach einigen Minuten verfügte er sich dann in sein Sprechzimmer, in welchem er einen Herren mittleren Alters vorfand, den er nicht kannte. Sein Blick glitt schnell prüfend über den Besucher, der sich mit einer tadellosen Verbeugung ihm soeben vorstellte.
Es war eine schlanke Erscheinung von germanischem Typus. Ein brauner Vollbart umrahmte ein blasses Gesicht, aus dem ein paar blaue Augen lebhaft blickten. Die Züge waren ernst, fast streng zu nennen, die hohe Stirn trat frei hervor, und ein wohlgepflegter Schnurrbart überschattete ein Paar fleischige Lippen.
Nachdem die ersten Höflichkeiten gewechselt, ließ sich der Gast auf einen Sitz nieder und begann mit dünner aber wohllautender Stimme den Zweck seines Besuches anzugeben.
»Herr Doktor, was mich hierher führt, ist der Umstand, daß wir beide einem Ziele zusteuern, dem, das Lebensrätsel zu ergründen,« begann Rex. Er bediente sich seiner Muttersprache, da er merkte, daß Nieuwenhuis die deutsche Sprache vollauf beherrschte.
»Ah! das freut mich zu hören,« gab der alte Arzt zur Antwort und betrachtete sein Visavis mit bedeutenderem Interesse als vorher.
»Sie werden von mir noch nichts gehört haben,« fuhr Rex fort, »da ich die Öffentlichkeit gemieden habe.«
»Ich wollte, ich hätte das gleiche getan,« murmelte Nieuwenhuis.
»Gedanken und Theorien, die nicht ein völlig reifes Gepräge tragen, taugen nicht für die großen Massen.«
»Stimmt! ... Also Sie wandeln auch in den Fußstapfen eines Grüblers, so wie ich? Es ist eine harte Nuß, die wir knacken wollen.«
Doktor Rex nickte lebhaft. »Ich fürchte, daß wir uns die Zähne daran ausbeißen werden. Doch nun zur Sache. Ich bin gekommen, um mit Ihnen einmal über meine Anschauungen zu diskutieren und Ihnen meine Theorie darzulegen. Hoffentlich finden Sie Ihre Zeit nicht zu kostbar, um ...«
»Durchaus nicht, Herr Doktor!« rief Nieuwenhuis. »Bitte, entwickeln Sie mir Ihre Ideen einmal. — Kennen Sie meine Theorie?«
»Bis in alle Details,« entgegnete Rex eifrig. »Die meine fußt jedoch auf anderer Basis.«
»Ich bin neugierig ...«
»Ich habe mich von der Zellentheorie abgewandt und eine eigne mechanistische aufgestellt,« fuhr Rex fort.
»Interessant zu hören. Also eine mechanistische Theorie ... hm — lassen Sie hören.«
»Sie wissen, daß die Entwickelung der gesamten Naturerkenntnis unablässig zur Annahme einer Urzeugung drängt.«
Nieuwenhuis bestätigte dies durch ein Kopfnicken.
»Die Urzeugung leugnen, hieße das Wunder verkünden ...«
»Sagt Nägeli — ganz recht,« unterbrach Nieuwenhuis den Sprecher.
»Die Lehre von der Urzeugung tritt daher in den schärfsten Gegensatz zu der religiösen Überzeugung, daß das Leben durch göttliche Schöpferkraft erzeugt sei.«
»Richtig!« sagte Nieuwenhuis.
»Aus der konsequenten Verfolgung der Entwickelungsgedanken ergibt sich, wie Haeckel und andere strikte behaupten, die Notwendigkeit, eine Urzeugung anzunehmen. Die Gegner der Theorie verlangen den experimentellen Nachweis, daß eine Selbstgestaltung der Materie zum Organismus möglich ist. Dieser Nachweis ist bekanntlich noch nicht erbracht, da es noch nicht gelungen ist, eine Zelle in der Retorte zu erzeugen.«
»Und trotzdem müssen wir an einer Urzeugung im Prinzip festhalten, wenn wir nicht mit dem Entwickelungsgedanken vor einem Schöpferwort Halt machen wollen,« warf Nieuwenhuis ein.
»Ich leugne die Urzeugung nicht,« fuhr Rex rasch fort. »Nach meiner Auffassung können die Urlebewesen aber keine Zellengebilde gewesen sein.«
»Hm ... das läßt sich leichter behaupten als beweisen, mein verehrter Herr Kollege.«
»Mit meiner mechanistischen Theorie möchte ich den Beweis eben erbringen, Herr Doktor!« rief Rex, dessen Gesicht sich jetzt leicht zu röten begann.
»Die Zelle als Urorganismus leugnen, heißt die Tatsache leugnen, daß alle Lebewesen aus Keimzellen entstehen.«
»Meine mechanistische Theorie ...«
Rex brach seine Ausführungen plötzlich ab, weil soeben ein donnerähnlicher Knall durch das ganze Haus dröhnte und Nieuwenhuis zum Aufspringen brachte.
»Um Himmels willen! was ist passiert?« frug Rex dem davoneilenden Arzt erschrocken nach. Doch dieser war bereits aus dem Zimmer verschwunden.
Nieuwenhuis stürmte hinüber in sein Laboratorium — instinktiv.
Im Flur des Hauses sammelte sich schnell ein weißlicher Rauch an. Frau Dorothee eilte zu Tode erschrocken aus der Küche herbei und rief um Hilfe. Nieuwenhuis öffnete die Tür zu dem Laboratorium und beschwichtigte die geängstigte Frau.
»Die Sache hat nicht viel auf sich!« rief er ihr zu. »Eine kleine Explosion. Sie brauchen keine Furcht zu haben.«
Nieuwenhuis verschwand im Rauche wieder.
Dr. Rex war ebenfalls auf den Flur hinausgetreten und befrug nun die Haushälterin nach der Ursache des Knalles.
Ehe Frau Dorothee eine Antwort geben konnte, stand Nieuwenhuis wieder an ihrer Seite und befahl ihr alle Flurfenster zu öffnen, um den Rauch hinaus zu lassen.
»Eine Fernwirkung der Radiumstrahlen, Herr Doktor,« klärte Nieuwenhuis Rex auf. »Ein explosives Gemisch in einer Phiole ist in die Luft gegangen. Ein Glück, daß ich nicht im Laboratorium war, es hätte mir unter Umständen das Leben kosten können.«
»Dann freue ich mich, daß ich Sie mit meinem Besuch belästigt habe, er hat Sie von dort ferngehalten,« sagte Rex und lugte nach der geöffneten Tür, durch welche sich die weißen Rauchwolken Ausgang verschafften.
»Ihr Besuch, Herr Doktor, ist mir jetzt doppelt willkommen. Das Radium hat mir einen üblen Streich gespielt.«
»Besitzen Sie viel von dieser Substanz?« frug Rex.
»Zehn Gramm.«
»Wa—a—s ... zehn Gramm?!« Rex riß die Augen weit auf.
»Ein hübsches Quantum. Es hat mir aber auch viel Mühe und viel Geld gekostet, es zu bekommen.«
»Das ist ja ungeheuer! ... Wozu benötigen Sie eine solche Menge?«
»Zu den physikochemischen Versuchen, die ich zur Ergründung dieses ominösen Lebensrätsels anstelle.«
»Glauben Sie, daß das Radium Sie auf die Spur verhilft?« frug Rex stark interessiert.
»Ich hoffe wenigstens.«
»Aber die Untersuchungen haben doch bereits dargetan, daß das Radium lebensfeindliche Strahlungen aussendet. Wollen Sie Zellengebilde damit beeinflussen?«
Nieuwenhuis lächelte über die naive Art, mit der ihn der konkurrierende Lebensforscher aushorchen wollte.
»Meine Radiumexperimente stecken noch in den Anfängen. Ich weiß selbst noch nicht recht, wo und wie ich den Hebel ansetzen soll ... vorläufig taste und fühle ich noch ... tappe ganz im Dunkeln. — Doch hoffe ich bald den richtigen Pfad zu finden.« Nieuwenhuis hütete sich vorsorglich, dem anderen seine wahren Absichten zu verraten; er verschwieg, daß er darauf ausgehe Leben künstlich zu erzeugen.
»Wie schützen Sie sich vor den Ausstrahlungen einer solchen Riesenmenge von Radium? Ich möchte beileibe nicht Ihr Laboratorium betreten.«
»Ich habe die nötigen Vorsichtsmaßregeln natürlich getroffen,« versetzte Nieuwenhuis. »Doch, werter Herr Kollege, wollen wir uns nicht wieder in mein Zimmer hinüber begeben? Sie sollen mir Ihre Theorie weiter entwickeln.«
Nieuwenhuis schritt jetzt seinem Gaste voraus und ließ ihn in das Sprechzimmer eintreten. »Ich komme sofort wieder,« sagte er und eilte hinüber zum Laboratorium.
Hier betrachtete er rasch den Schaden, den die kleine Explosion angerichtet hatte und räumte die Trümmerstücke hinweg, welche Frau Dorothee dann völlig beseitigen mußte.
Dr. Rex spazierte unterdessen im Sprechzimmer nachdenklich auf und ab. Nieuwenhuis wollte dem Problem des Lebens also mit Radium auf den Leib rücken. — — Er wollte damit Licht in die Urzeugung bringen — ob er Glück hatte? — — Gern hätte Rex ihm ein wenig in die Karten geschaut.
Als Nieuwenhuis wieder ins Zimmer trat, stellte ihm der deutsche Forscher die Frage, wie er über das Exeriment der Bütschlischen Ölseifenschäume denke, das berufen zu sein schien, in das Dunkel des Lebensrätsels einiges Licht zu bringen.
»Bütschli vermochte die willkürliche Bewegung lebender Zellen an künstlichen Tropfen famos nachzuahmen,« versetzte der alte Arzt und ließ sich auf einen Stuhl nieder. »Das Exeriment hat gezeigt, daß solche Bewegungen leblosen Stoffes infolge einer vorhandenen Verschiedenheit in der Oberflächenspannung möglich sind.«
»Das spricht für meine mechanistische Theorie!« rief Rex. »Es ist danach durchaus wahrscheinlich, daß die Oberflächenspannung auch bei der Bewegung der lebenden Zellen, zum Beispiel bei den Amöben, der wirkende Faktor ist. Ein anderer Versuch beweist dies auch aufs deutlichste ...«
»Welcher?« frug Nieuwenhuis.
»Die Nachahmung der rollenden Bewegung der Amöben mit Hilfe von Chloroformtropfen auf einer schellacküberzogenen Glasplatte.«
»Dieser Versuch ist mir nicht bekannt,« entgegnete Nieuwenhuis.
»Für meine mechanistische Theorie spricht auch der Rhumblersche Versuch der Vakuolen- und Gehäusebildung an toten Öltropfen. Er beweist, daß Lebenserscheinungen solcher Art auf Adhäsionserscheinungen zurückzuführen sind, also rein mechanischen Ursprungs sind.« Rex redete sich jetzt in Eifer hinein und seine Gesten wurden immer lebhafter.
»Entwickeln Sie mir doch bitte einmal Ihre Theorie. Ich bin wirklich gespannt, wohinaus Sie steuern,« sagte Nieuwenhuis.
»Meine Theorie ist mit wenigen Strichen gekennzeichnet. Zunächst der Kardinalsatz, den ich ihr zugrunde lege. — Aller Stoff befindet sich in einem Zustand, der sich als Kraft äußert ...«
Nieuwenhuis horchte auf. Er fand diese materialistische Vorstellungsweise recht naiv.
»Die Vorstellung des mit Kraft begabten Stoffes führt naturgemäß dazu, das Leben auf Bewegungen zurückzuführen,« fuhr Rex fort. »Die rhythmischen Bewegungen der Ausdehnung und Zusammenziehung sind ein hervorragendes Charakteristikum des Lebens.«
»Das ist nicht anzuzweifeln,« warf Nieuwenhuis ein.
Des weiteren kam nun Rex darauf zu sprechen, durch welche äußerlichen mechanischen Ursachen diese Bewegungsformen zustande kommen und führte für die Ursache des Lebens in seiner einfachsten Weise die Eigenwärme des Erdplaneten und die ihr entgegenwirkende Bestrahlungswärme der Sonne an. Dann kam er auf die Urlebewesen zu sprechen und erging sich zum Schlusse seiner Ausführungen in Erörterungen über den Entwickelungsgang der Einzelwesen.
Nieuwenhuis fand das alles sehr scharfsinnig und hochinteressant, meinte aber, daß eine aufgestellte Theorie so lange eine nackte Hypothese bleibe, bis praktische Beweise dafür beschafft seien.
»Aber, Herr Doktor, auch Sie sind bis jetzt jeglichen Beweis für Ihre Theorie schuldig geblieben!« rief Rex hastig aus.
»Ich werde die Beweise aber noch erbringen. Ich werde Leben auf künstlichem Wege erzeugen und dann werde ich die Zweifler an meiner Theorie eines Besseren belehren.« Nieuwenhuis hatte sich allmählich auch in Eifer hineingesprochen und war nun mit dem herausgeplatzt, was er eigentlich nicht verraten wollte. Es ärgerte ihn, daß er so unvorsichtig gewesen und seine Pläne dem anderen mitgeteilt hatte.
»Leben wollen Sie künstlich erzeugen, Herr Doktor?« frug Rex erstaunt und verblüfft zugleich und sah den alten Herrn mit einem Blicke an, als wolle er sagen: Du bist wohl nicht ganz bei Verstand.
»Ein kühnes Unterfangen ... aber ich habe eine Idee, und es ist nicht ausgeschlossen, daß ich mein Ziel erreiche. Nun, werter Herr Kollege, Sie werden noch davon hören.«
Eine kleine Weile noch nahm das Gespräch seinen Fortgang, dann hielt es der deutsche Gelehrte an der Zeit seinen Besuch zu beenden. Er verabschiedete sich von Nieuwenhuis und verließ das Haus des Grüblers mit der Überzeugung, daß er seine Zeit bei einem Phantasten verbracht habe.
Der Frühling war nach einem langen und strengen Regiment des Winters ins Land gezogen. Auf den holländischen Fluren begann es zu grünen und sprossen. Die letzten Reste Schnee schmolzen in der warmen Maisonne, und die Lerchen jubilierten in sonnigen Höhen; alles Lebendige empfand mit innigem Behagen den Einzug des wonnigen Lenzes.
Nur einer, ein einziger unter den Menschen begrüßte den Frühling nicht. Er nahm von seinem Kommen kaum Notiz. Es war der vielbeschäftigte Nieuwenhuis, der seit Monden in seinem Hause hockte und über seine geheimnisvolle Tätigkeit die Außenwelt fast vergaß.
Frau Dorothee waltete noch nach wie vor ihres Amtes und schüttelte über ihres Herrn Tun und Treiben fortgesetzt den Kopf. Seitdem er sie einmal grob angefahren, als sie gefragt, warum er den Abend seines Lebens in so unausgesetzt angestrengter Tätigkeit verbringe und sich so wenig Ruhe gönne, hütete sie sich für die Folge, Fragen ähnlicher Art zu stellen.
Wer den alten Nieuwenhuis tagsüber hinter seinen Retorten und Instrumenten hocken sah, und eine blasse Ahnung von seinem Tun und Streben bekommen hatte, der mußte annehmen, daß der gelahrte Herr es dem Dr. Faust nachmachen wollte, daß er auf die künstliche Hervorbringung eines Menschleins, des vielberühmten Homonunculus, bedacht sei.
Doch unser moderner Doktor hatte mit dem Teufel keinen Pakt geschlossen, in seiner Retorte sollte kein Menschenembryo erstehen, nur ein Lebewesen in seiner einfachsten und niedrigsten Form suchte er aus toter Materie zu erschaffen.
Draußen in der Welt war es durch Rex bekannt geworden, welcher Dinge sich Nieuwenhuis vermaß, daß er Leben in der Retorte erzeugen wolle, um seiner Theorie von der Entstehung und dem Wesen des Lebens Geltung zu verschaffen.
Die Theologen und alle Gottgelahrten, denen die Seelsorge für die gläubige Menschheit oblag, mochten wohl zittern bei dem Gedanken, daß es dem ruchlosen Forscher in Leiden, der dem Schöpfer aller Dinge gewaltsam ins Handwerk pfusche, gelingen könne, Leben in irgendeiner Form künstlich zu erzeugen.
Doch die Zeit floß dahin, und kein Dr. Nieuwenhuis trat vor das Forum der Wissenschaft, um zu verkünden, daß er sein Ziel erreicht habe. Die Seelenhirten konnten also allmählich ihre Angst fallen lassen und lächelnd in die Zukunft schauen. Der furchtbare, gewaltige Augenblick würde wohl nie kommen.
In der guten Stadt Leiden kümmerte man sich wenig um das Tun des alten Narren, wie man Dr. Nieuwenhuis respektlos zu bezeichnen pflegte; es kam auch niemand mit ihm in Berührung, da er sorgfältig allen Umgang mied.
Der junge Meermann war der einzigste, welcher von Zeit zu Zeit bei ihm mit vorsprach und dem Nieuwenhuis gern einmal ein Plauderstündchen widmete. Meerman sen. grollte noch immer und hätte die geheimen Besuche seines Erstgeborenen und geschäftlichen Thronerben bei dem Narren in der Lakengracht sicherlich nicht gebilligt, wenn er davon gewußt hätte.
Meermann jun. verschwieg wohlweislich, daß er noch Sympathien für jenen besaß, er ließ daheim alle in dem Glauben, er sei mit der Zeit »vernünftig« geworden.
Eines Tages überbrachte Meermann jun. seinem väterlichen Freunde die Nachricht, daß er sich verlobt habe, und fügte leise hinzu, daß er seine Besuche jetzt wohl einstellen müsse.
Nieuwenhuis war darüber etwas verwundert, wurde aber bald aufgeklärt.
»Meine Braut, Fräulein Opzoomer, zählt zu Ihren Gegnern, Herr Doktor. Sie meint, Ihre Theorie schlüge eine furchtbare Bresche in allen Gottglauben und da ...«
»Und da Ihre Fräulein Braut eine gute Christin ist, so wird sie immer meine Gegnerin bleiben,« sagte Nieuwenhuis, ihm ins Wort fallend. »Sehen Sie, junger Mann, das ist das Los eines Naturforschers, der seine eigenen Wege zu gehen sucht. Gegner und Feinde in allen Lagern, selbst bei der holden Weiblichkeit.«
Der alte Doktor hatte die letzten Sätze mit einer gewissen Erbitterung gesprochen und sah nun nachdenklich vor sich hin.
»Es ist der Lauf der Dinge,« erwiderte seufzend Meermann. »Steuern Sie noch unentwegt dem Ziele zu, das Sie sich gesteckt haben, Herr Doktor? Ich meine der Lösung des Lebensrätsels.«
Nieuwenhuis sah ein Paar Augen auf sich gerichtet, aus denen ein helles Interesse für sein Tun und Forschen sprach.
»Unentwegt! Schon um des seligen Steens willen. Was sollte aus dem vielen Geld werden, das er eigens für diesen einen Zweck in meine Hände gelegt hat.«
»Sagten Sie früher nicht einmal, daß Sie nicht wüßten, was Sie mit den Millionen anfangen sollten?« frug Meermann.
Nieuwenhuis bejahte. »Die Hälfte der Erbschaft ist jedoch inzwischen glücklich im Interesse der Sache verwendet.«
»Wirklich? Haben Sie ein Institut gegründet oder ...«
»Nein, ein Laboratorium, ausgestattet mit den besten Instrumenten der Physik und Chemie. Es hat mir rund viermalhunderttausend Gulden gekostet.«
»Ah! so haben Sie sich jetzt auch auf praktische Untersuchungen verlegt. Ich glaubte immer, daß die Forschung nach dem Lebensrätsel eine reine Denkarbeit präsentiere.«
»Um die Lehrsätze meiner Theorie zu dem Grade wissenschaftlicher Axiome zu verhelfen, sehe ich mich gezwungen, praktische Beweise zu liefern.«
»Ist dies möglich, Herr Doktor?"
»Ob es mir gelingen wird, weiß ich nicht. Vielleicht sterbe ich über alledem.«
»Die Zeitungen berichteten vor einiger Zeit, daß Sie sich mit der Erzeugung künstlichen Lebens befaßten. Ist an dieser Notiz wirklich etwas wahres?« frug Meermann.
»Allerdings, mein junger Freund. Gelingt mir das, so kann ich der Menschheit den Beweis für die Richtigkeit meiner Theorie erbringen. Haben Sie einmal etwas von dem Wunderstoff Radium gehört?"
Meermann bejahte.
»Im Radium liegt das Geheimnis des Lebensproblems. Ich werde den Schleier zu lüften versuchen. Ich besitze die größte Menge des Wunderstoffes, die einem Forscher zur Verfügung steht. Für eine halbe Million Gulden habe ich sie erworben.«
»Eine halbe Million Gulden!« replizierte der junge Kaufherr und war über die hohe Summe weidlich erstaunt.
»Um das Lebensproblem zu ergründen, muß ich erst die Natur des Radiums völlig kennen lernen. Diese Untersuchungen habe ich aber jetzt so ziemlich beendet und kann nun daran denken, an die große Aufgabe zu gehen ... es wird eine Sisyphusarbeit werden, aber ich schrecke nicht davor zurück.«
Meermann sah den Alten, dessen Augen bei seinen Worten leuchteten, ehrfurchtsvoll an, er war ja kein Zweifler, er gehörte der kleinen Gemeinde des als Phantasiestrategen verspotteten Forschers an.
Nieuwenhuis freute sich stets darüber, daß Meermann jun. sich so treu zu ihm bekannte und widmete ihm gern ein Stündchen oder gar zwei. So auch diesmal. Was dem jungen Manne an wissenschaftlicher Bildung abging, ersetzte er durch rege Wißbegier und starkes Interesse, wobei auch noch sein gesunder Menschenverstand und ein logisches Denken kräftig in die Erscheinung traten.
Als Meermann nach seinem heimlichen Besuche bei Nieuwenhuis am selben Abend mit seinem Vater und seiner Braut beim Tee zusammen saß, kam zufälligerweise, ohne daß Meermann jun. die Anregung dazu gegeben, das Gespräch auf den Alten in der Lakengracht.
»Von Nieuwenhuis und seinen famosen Ideen hört und sieht man jetzt nichts mehr,« sagte Meermann sen., der sich, behaglich in seinem Lehnstuhl sitzend, dem Genusse einer echten Havanna hingab. »Der alte Narr scheint sein Pulver endlich verschossen zu haben.«
Meermann jun. zog bei den Worten alter Narr die Stirn kraus, er unterdrückte aber eine innere Aufwallung und schwieg wohlweislich.
»Nie wird es einem Menschen gelingen, das Wesen des Lebens aufzudecken,« meinte Maria Opzoomer und rührte nachdenklich in ihrer Teetasse, wobei sie mit flüchtigem Blick zu ihrem Bräutigam aufsah.
»Unser Herrgott läßt sich nicht in die Karten gucken, er hat schon dafür gesorgt, daß die Bäume nicht bis in den Himmel wachsen,« fuhr der alte Kaufherr fort.
»In der Erkenntnis gewisser Dinge ist dem Menschen ein für allemal ein Horizont gezogen, über den wir nie hinausblicken werden, und wenn noch zahllose Jahrtausende eifrigster Naturforschung vergangen sind, wird man in bezug der Aufhellung der letzten Dinge nach wie vor eine undurchdringliche dunkle Mauer vor sich sehen.«
Das war Marias unerschütterliche Überzeugung, die auch der alte Herr Meermann voll und ganz teilte.
Cornelis Meermann schwieg hierzu noch immer, löffelte seinen Tee hinunter und ließ die andern reden. Gar zu gern hätte er ja ein Wörtchen dazwischen geworfen, aber er war in puncto des Lebensrätsels gewitzigt worden, wenn im Kreise der Seinen die Rede hierauf kam.
»Mynheer Steen hätte sein Geld lieber einem nützlichen Zwecke vermachen sollen, als es in die Hände eines phantastischen Grüblers zu legen mit der Bestimmung, es lediglich zur Lösung des Lebensrätsels zu verwenden.«
»Steen war auch so ein Narr!« rief Meermann sen. aus. »Wieviel Segen hätten die zwei blanken Millionen Gulden unter den Armen stiften können, während sie so nur Unheil zeitigen.«
»Wenn das Geld wissenschaftlichen Studien die Wege ebnet, ist es doch nicht nutzlos angelegt,« entgegnete endlich Cornelis.
»Dann hätte es Steen wenigstens zu einer realen Forschung bestimmen sollen. Zum Beispiel zur Bekämpfung von Krankheiten oder meinetwegen auch zu astronomischen Zwecken,« sagte Maria.
»Natürlich! Ein Siechenhaus oder eine Sternwarte hätte er stiften sollen,« warf Meermann sen. ein und blies den Dampf seiner Zigarre energisch von sich. »Er hätte Preise aussetzen sollen für die Entdeckung des Nordpols, für die Erfindung künstlichen Gummis oder Kautschuks u. dgl.; aber so, nein! das war zu borniert! Na, der Alte in der Lakengracht hatte ihn ja mit seinen verrückten Ideen geradezu verdummt.«
In Cornelis nagte der Wurm des Ärgers, daß man so von Nieuwenhuis sprach, aber er wagte es nicht, auf die Worte seines herrischen Vaters etwas zu erwidern, denn er hätte damit Ö1 ins Feuer gegossen.
»Die Jansenistengemeinde hätte es auf einen Prozeß mit dem Doktor ankommen lassen sollen,« erwiderte Maria, und wieder streifte ein Blick das Gesicht ihres Bräutigams, der ein Stückchen Papier in der Hand zerknüllte und seiner Meinung gern weiter Luft gemacht hätte.
»Das Testament war vollgültig, die Jansenisten hätten ihren Prozeß zweifellos verloren,« meinte Meermann sen.
»Wollen wir nicht ein anderes Thema zur Unterhaltung wählen?« frug Cornelis plötzlich.
»Wenn dich alte Erinnerungen zwicken sollten, mein Junge, warum nicht,« gab der alte Herr zur Erwiderung. »Nieuwenhuis ist ja sowieso zwischen uns beiden eine abgetane Sache ... ich denke wenigstens, oder nicht?"
Des Alten Blick ruhte forschend auf dem Gesicht des Jungen.
»Wie du willst, Vater,« versetzte Gornelis und suchte Gleichmütigkeit zu heucheln.
»Schön ... gehen wir zu anderen Dingen über.«
Da die neue Unterhaltung Cornelis nach der inneren Verärgerung, die er erlitten, auch nicht recht schmeckte, so ging er früher als sonst auf sein Zimmer, um sich zur Ruhe zu legen.
Am folgenden Tag traf Cornelis Meermann, als er einen Geschäftsweg zur Filiale der Niederländischen Bank unternahm, zwei alte Bekannte aus seiner Schulzeit, Pieter Andrießen und Dr. de Vries. Ersterer hatte in Leiden eine Stellung als Fabrikchemiker inne und galt als ein hochbegabter Mensch und gewiegter Praktiker in seinem Fache. Herr de Vries war Bibliothekar an der Universität und Andrießens bester Freund. Mit Meermann hatten beide, als sie noch redlich die Schulbank drückten, stets gern verkehrt: sie hatten ein dreiblättriges Kleeblatt gebildet, das unzertrennlich zu sein schien. Als sie dann in das Leben hinausgetreten waren, erlitt die dicke Kameradschaft aber eine Lockerung insoweit, als Meermann durch seine geschäftliche Tätigkeit so stark in Anspruch genommen wurde, daß ihm fast keine Mußestunde verblieb, um mit seinen Schulfreunden den alten geselligen Verkehr aufrecht zu erhalten. Selten führte ein Tag die drei wieder zusammen, meist blieb es bei einer flüchtigen Begegnung, und als Andrießen dann von der Verlobung Meermanns mit der niedlichen Maria Opzoomer, auf die er auch ein Auge geworfen hatte, erfuhr, da hatte das der alten Kameradschaft zwischen ihm und Meermann einen Stoß gegeben. Andrießen besaß die unschöne Eigenschaft gehässig zu sein, wenn ihm ein anderer seine Ziele durchkreuzt hatte. Das sollte nun auch sein alter Schulkamerad erfahren.
Andrießen war ein Heuchler, wo es hieß seine Gefühle herauszukehren. Als er Meermann zum Gruß die Hand drückte, ließ er keineswegs durchblicken, daß er jenem gram war.
Ein lebhaftes Gespräch kam bald in Fluß, und die drei jungen Leute tauschten mancherlei Erlebnisse der letzten Zeit miteinander aus und schließlich wurden auch Nieuwenhuis' Ideen in den Bereich einer lebhaften Erörterung gezogen. Andrießen hatte das Thema zuerst angeschlagen, ohne daß er eine Ahnung davon hatte, daß er damit in das Fahrwasser Meermanns geraten war.
»Den alten Nervendoktor nimmt doch keiner mehr für ernst,« sagte de Vries. »Die Wissenschaft hat den Hypothesenschmied längst abgetan.«
»Oho!« rief Meermann aus. »Für den möchte ich noch eine Lanze brechen!«
»Für diesen Phantasiestrategen!« versetzte mit leisem Spott Andrießen und schlug eine kurze Lache an.
»Nieuwenhuis' Buch über das Problem des Lebens steht seit Monden in einem Winkel unserer Bibliothek, und kein Mensch verlangt nach dem staubigen Schmöker. Ein Beweis, daß sich niemand mehr um ihn und seine hahnebüchenen Theorien kümmert,« fügte Dr. de Vries hinzu.
»Ich bin besser unterrichtet,« entgegnete Meermann leicht gereizt. »Wenn ihm sein Experiment, künstlich Leben zu erzeugen, erst gelungen ist, wird man ihn nicht mehr verspotten.«
»Wa—a—as? Künstliches Leben?!« rief Andrießen und sah Meermann mit einem Gemisch von Spott und Mitleid an.
»Allerdings ... er wird der Welt den Beweis noch liefern. Ich habe Nieuwenhuis selbst gesprochen und er hat mir versichert, daß er auf dem richtigen Wege ist,« gab Meermann, sich ereifernd, zur Antwort.
»Er wird Steens Millionen in seiner Hexenküche verpulvern und sich noch weiterhin lächerlich machen,« erwiderte Andrießen.
»Brecht nur voreilig den Stab über die Sache. Ich bin etwas besser unterrichtet.« Meermann wurmte es, daß Andrießen so überaus abfällig von Nieuwenhuis sprach.
»Du bist ja ein bis auf die Knochen überzeugter Jünger des alten Phantasten,« bemerkte de Vries mit einem Lächeln.
»Und er wird doch noch das Rätsel lösen. Er wird künstlich Leben erzeugen und seine Theorie dann beweisen.«
»Eher fallen die Sterne vom Himmel,« sagte de Vries.
Das Gespräch hatte noch nichts von dem Charakter eines heftigen Disputs verloren, als sich die drei jungen Leute trennten. Meermann fühlte, daß Andrießen fortgesetzt Spott auf ihn ergossen hatte, doch ließ er sich nicht durch diese Gegnerschaft beirren, wie denn auch sein Ärger, den die Unterhaltung hervorgerufen hatte, bald verrauscht war.
Tage waren seitdem wieder ins Land gezogen, als Meermann die Nachwirkung jenes Disputs mit seinen ehemaligen Schulkameraden daheim zu verspüren bekam. Sein Vater stellte ihn plötzlich einmal zur Rede. Er ließ durchblicken, es sei ihm zu Ohren gekommen, daß er Verkehr mit Dr. Nieuwenhuis pflege. Cornelis Meermann war eine zu ehrliche Natur, um zu leugnen.
Natürlich entlud sich nun in dem sonst so friedlichen Hause des Kaufherrn ein Donnerwetter, dessen Wirkungen auch der alte Grübler in der Lakengracht verspüren sollte.
Meermann sen. hielt es diesmal unbedingt für nötig, energisch vorzugehen. Er machte sich darum auf den Weg, um mit Nieuwenhuis ein kräftiges Wörtchen zu reden.
Der Alte in der Lakengracht war ein wenig überrascht, als er den unerwarteten Besuch seines ehemaligen Duzfreundes erhielt, ahnte aber im voraus, daß dieser wohl nicht mit guten Absichten kam. Darüber ließen denn auch die Begrüßung und die seitens des Kaufherrn aufgesteckte Miene keine weiteren Zweifel übrig.
»Ich komme heute zu dir, um Aufschluß über Dinge zu erhalten, die mir nicht behagen,« begann Meermann mit knurriger Stimme, ohne der Aufforderung, Platz zu nehmen, Folge zu leisten.
»So ... es handelt sich natürlich wieder um deinen Sohn?« entgegnete Nieuwenhuis mit großer Gelassenheit.
»Allerdings — — du übst auf ihn einen unheilvollen Einfluß aus. Die Sache wird mir jetzt doch zu bunt! Ich verbiete dir ein für allemal, daß du meinen Sohn in deinem Hause empfängst und ihm deine närrischen Ideen einpflanzest!« Meermann hatte diese Worte im zornigen Tone gesagt und schritt nun erregt im Zimmer auf und ab.
»Du machst mich für Dinge verantwortlich, die mir im Grunde eigentlich wenig angehen, da ich nie einen Finger gerührt habe, um deinen Sohn in meine Ideensphäre zu locken.«
»Mein Sohn besucht dich aber zuweilen, und das dulde ich nicht, da deine Irrlehren sein Gemüt und seinen Geist vergiften!"
»Lächerlich!« brummte Nieuwenhuis.
»Absolut nicht lächerlich!« schrie Meermann.
»Du tust gerade so, als sei ich ein Ketzer, der es auf die Seele deines Sohnes abgesehen hat. Wenn der junge Mann Interesse an wissenschaftlichen Sachen hat, so ist das für deinen Hausfrieden doch nicht von Belang.«
»Das muß ich besser wissen! Dein Lebensrätsel hat genug böses Blut gemacht!"
»Das Lebensrätsel ... das wehleidige Lebensrätsel ... scheint dir mehr Kopfschmerzen zu machen als mir, der ich es ergründen will.«
»Die Welt nennt dich nicht umsonst einen Phantasten ... Du willst Dinge enträtseln, über die unser Herrgott einen Schleier gebreitet hat, den keines Menschen Hand zu lüften versuchen soll.«
»Das ist doch wohl meine Sache und geht andere nichts an.«
Der Kaufherr lachte grimmig.
»Im übrigen werde ich bald einen Trumpf gegen die ausspielen, die mich bisher verlacht und verspottet haben. Ich bin nämlich der Lösung des Lebensrätsels nahe. Es wird mir bald gelingen, Leben künstlich zu erzeugen ... Leben, richtiges Leben!«
Wieder schlug Meermann eine Lache an.
»Ich sehe, du wirst alt, man muß dir darum etwas zugute halten,« versetzte er.
Jetzt war die Reihe zu lachen an Nieuwenhuis.
»Sei unbesorgt, alter Freund, ich erfreue mich wirklich noch einer seltenen Geistesfrische und kreuze in dieser Hinsicht die Klinge mit jeder jugendlichen Koryphäe der Wissenschaft.«
»Und ich prophezeie dir, daß du über dem Lebensrätsel noch das bißchen Verstand verlieren wirst,« rief Meermann und legte sich nicht für einen Pfifferling Zwang an, seinem Grimm gründlich Luft zu machen.
Während die beiden Alten noch eine geraume Weile miteinander haderten, meldete Frau Dorothee, daß zwei fremde Herren gekommen seien, die dringlich vorgelassen zu werden wünschten.
Nieuwenhuis warf einen Blick auf die ihm überreichten Visitenkarten und gab dann seiner Haushälterin den Bescheid, er stehe in längstens fünf Minuten den Herren zu Diensten.
Dieser strikte Bescheid bedeutete auch dem Kaufherrn, daß er zu gehen hätte.
»Steen hast du damals den Kopf schon verdreht, daß er dir seine Millionen zu einem Zwecke vermachte, der den schärfsten Tadel jedes vernünftig denkenden Menschen herausfordert, und ...« sagte Meermann und stellte seine Wanderung durch das Zimmer ein.
»Darüber hat sich niemand ein Urteil zu erlauben,« versetzte Nieuwenhuis und ließ sich durch die Äußerungen seines ehemaligen Freundes keinen Augenblick aus der Fassung bringen.
»In der ganzen Presse ist es oft betont worden, daß es überaus bedauerlich sei, daß so viel Geld in die Hände eines Phantasiestrategen gelegt worden sei,« fuhr Meermann fort, ohne Miene zum Aufbruch zu machen.
»Genug!« unterbrach Nieuwenhuis, ungeduldig werdend, die Rede des ungemütlichen Kaufherren. »Meine Zeit ist bemessen. Deine Wünsche in betreff deines Sohnes sind mir bekannt, wir hätten somit nichts weiter zu besprechen.« Mit diesen Worten erhob sich Nieuwenhuis von seinem Sitz. »Mag die ganze Welt den Phantasiestrategen in Leiden verlachen, was liegt mir daran. Lach' auch du, wer zuletzt von uns lacht, lacht am besten. Nun, adieu! die Herren drüben dürften ungeduldig werden.« Nieuwenhuis öffnete jetzt die Tür zum Sprechzimmer und bat die beiden neuen Besucher einzutreten.
Zornig über diese schnelle Abfertigung verließ Meermann grußlos das Zimmer. Nieuwenhuis sah ihm einen Augenblick halb ungehalten, halb mitleidig nach und wendete sich dann an die Eintretenden.
Vor Nieuwenhuis standen zwei Söhne des fernen Ostens, nach europäischer Sitte gekleidete Japaner, die dem Ä ußeren nach dem gebildeten Stande ihres Volkes anzugehören schienen.
Auf den Karten, die sie abgegeben hatten, standen ihre Namen. Kussáka hieß der eine, Fujiwarano Tsunetaka der andere.
Nachdem sich Nieuwenhuis dessen versichert hatte, daß die Besucher der holländischen Sprache nicht mächtig waren, Deutsch aber ziemlich fließend sprechen konnten, frug er nach dem Begehr der beiden Japaner.
Kussáka ergriff daraufhin zunächst das Wort.
»Es ist zu unserer Kenntnis gelangt, daß Sie den Spuren des Lebens bis an das letzte Ende nachgehen. Sie wollen in das Dunkel der Weltschöpfung Licht bringen. Es ist eine gewaltige Aufgabe für den Menschengeist. Zu Zeiten des Taiko sama soll in Japan bereits das Rätsel des Lebens gelöst sein, doch nichts ist uns davon verblieben. Schwarze Schatten lagern auf dem Geheimnis alles Lebendigen.«
Nieuwenhuis hatte aufmerksam den Worten des kleinen schwarzhaarigen Japaners gelauscht.
»Wir haben Ihre Schriften gelesen,« begann jetzt Fujiwarano Tsunetaka mit leiser ölig klingender Stimme. »Sie haben große Gedanken und wir sind gekommen, Ihnen noch einige Winke zu geben. Auch wir forschen dem Lebensgeheimnis nach und wollen deshalb mit Ihnen arbeiten.«
»Ah!« entgegnete überrascht Nieuwenhuis. »Ich bin bereit Ihre Gedanken zu hören. Was haben Sie bisher erreicht?«
»Der Pfad ist dunkel und lang, aber wir sind nicht fern vom Ziel,« sagte Kussáka. »Wir arbeiteten mit Kraft und Stoff der Natur. Ein geheimnisvolles Element, das ihr Europäer Radium nennt, haben wir uns dienstbar gemacht ...«
»Radium!« rief Nieuwenhuis.
»Dieser Stoff ist's,« versetzte Kussáka.
»Damit arbeite ich ja auch, um Leben künstlich zu erzeugen.«
Die beiden Japaner sahen sich gegenseitig verblüfft an.
»Und welche Methode bringen Sie in Anwendung?« frug Kussáka und blinzelte mit seinen kleinen Augen.
»Das ist mein Geheimnis,« gab Nieuwenhuis zur Erwiderung.
»Geheimnis gegen Geheimnis! Wollen wir zusammen arbeiten?«
Auf diese Frage Fujiwarano Tsunetakas entgegnete der alte Arzt, daß er erst orientiert sein müsse, ob seine Besucher schon einige Erfolge bei ihrer Forscherarbeit gehabt hätten und welcher Art diese seien.
»Wir haben den Urstoff der Einzelwesen künstlich erzeugt,« lautete die Antwort Kussákas.
»Das Protoplasma?«
Kussáka nickte.
»Das ist mir auch gelungen,« sagte Nieuwenhuis.
»Wenn das Protoplasma in seiner Zusammensetzung nicht dem der Natur völlig gleich ist, wird seine Belebung zur Unmöglichkeit,« ließ sich jetzt Fujiwarano Tsunetaka vernehmen.
»Das Protoplasma als Eiweißstoff ist ein sehr komplizierter Körper,« meinte Nieuwenhuis.
»Ein Gemisch von Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel,« fügte Kussdka hinzu.
»Ist Ihnen eine Belebung dieses Elementengemenges schon geglückt?« frug Nieuwenhuis mit reger Neugier.
»Wir suchen noch ... im Prinzip sind wir wohl auf dem rechten Weg,« antwortete Kussáka.
»Mit dem Radium?«
Kussáka bejahte.
»Sind Sie im Besitz genügender Mengen dieses Stoffes?«
»Ein Gramm haben wir zur Verfügung.«
»Zu wenig,« gab Nieuwenhuis zur Antwort. »Ich komme mit einer Quantität von zwanzig Gramm besser aus.«
Die Japaner sperrten Mund und Augen auf.
»Soviel halte ich aber zu den Versuchen der Beseelung toter Protoplasmasubstanz unbedingt für nötig. Es bedarf zweifellos einer intensiven Bestrahlung, um in das leblose Eiweißprodukt unserer Kunst Leben zu zaubern.«
»Da wir über solche Mengen Radium nicht verfügen, werden Sie Ihrem Ziele schneller näher kommen als wir,« sagte Kussáka.
»Sofern der von mir eingeschlagene Weg der richtige ist, meine Herren. Sie nehmen, wie es mir scheint, eine Belebung toter Materie als gar nicht so überaus schwer an ... hm ... ich bin skrupelhafter,« erwiderte Nieuwenhuis. »Ich möchte Ihnen nun einen Vorschlag machen. Haben Sie beide eine Stunde Zeit übrig, so folgen Sie mir in mein Laboratorium. Dort wollen wir einige Experimente anstellen.«
Die Söhne des Mikado folgten nur zu gern dieser Aufforderung.
Nieuwenhuis führte die Besucher hinüber zu seiner Arbeitsstätte, die ebenfalls im Erdgeschoß des Hauses lag.
Die Japaner staunten nicht wenig über das mit allen Mitteln der Wissenschaft ausgestattete Laboratorium und musterten die physikalischen und chemischen Gerätschaften und Instrumente mit größtem Interesse.
Nieuwenhuis präsentierte ihnen dann einige Exemplare seiner auf chemischem Wege ins Leben gerufenen Seeigel von stattlicher Größe und lenkte das Gespräch sodann auf die Versuchstiere, denen er das Blut aus den Adern abgezapft und dafür die entsprechende Quantität Meerwasser eingespritzt hatte.
»Sie haben solche Versuche aber noch nicht auf den Menschen ausgedehnt?« frug Kussáka.
»Ich würde mich damit eines Verbrechens schuldig machen,« gab der alte Arzt zur Erwiderung. »Es würde sich wohl auch niemand finden, der die Rolle eines Versuchskaninchens übernehmen möchte.«
»Es wäre interessant, zu erfahren, ob ein derartiger Versuchsmensch am Leben erhalten würde,« meinte Fujiwarano Tsunetaka.
»Das hängt von der Blutkörperchenbildung ab,« versetzte Nieuwenhuis.
»Erleidet diese bei den Versuchstieren eine Unterbrechung?«
»Meine Erfahrungen in dieser Hinsicht sind noch unzulänglich. Jedenfalls funktionieren die Organe, welche die Blutkörperchen erzeugen, bei den Versuchstieren in alter Weise weiter ... Sind Sie Mediziner, meine Herren?«
Kussáka bejahte die Frage. »Wir sind beide Dozenten an der Universität zu Tokio.«
Nieuwenhuis schweifte nunmehr auf das Thema der Radiumforschung über und frug, ob man in Tokio die Natur des Wunderelementes eifrig erforsche.
Kussáka erwiderte: »Wir sind mit der Leitung eines eigens für diesen Zweck errichteten Instituts betraut.«
Im Verlaufe des Gespräches erfuhr nun Nieuwenhuis, daß die Japaner in dem Zersetzungsprodukt des Radiums, dem Heliumgas, die lebenerzeugende und lebenerhaltende Kraft entdeckt zu haben glaubten. Das war ein wissenschaftliches Bekenntnis von hohem Wert.
Nieuwenhuis brachte nun ein gläsernes Gefäß herbei, in welchem sich eine feinkörnige, eiweißähnliche Substanz befand.
»Hier ist mein Kunstprodukt, der Grundstoff der tierischen und pflanzlichen Zellen,« sagte er.
»Totes Protoplasma?« frug Fujiwarano Tsunetaka und beäugte das Gefäß mit seinem Inhalt.
»Aus ihm will ich das Leben zaubern. Daß ich auf dem richtigen Wege bin, das will ich Ihnen jetzt an einem kleinen Experiment beweisen und dann sollen Sie Ihr Urteil abgeben.«
Mit diesen Worten entnahm der alte Forscher aus einer durch besondere Vorrichtungen hermetisch verschließbaren Wandnische eine Porzellandose.
»Bitte, entfernen Sie sich jetzt etwas aus meiner Nähe, meine Herren,« sagte Nieuwenhuis.
Die beiden Japaner folgten der Aufforderung.
»Das Radium ist ein Teufelszeug. Hier sind zwanzig Gramm, eine lebensgefährliche Menge! ... Nun, Sie kennen ja die Wirkungen aus eigener Erfahrung.«
Kussáka nickte und sagte: »Schützen Sie sich auch genügend?«
»Das Elektronenbombardement kann mir nichts anhaben. da ich es durch einen Strahlenrichter nach einer bestimmten Stelle hin entlade.«
Nieuwenhuis postierte sich jetzt vor das Glasgefäß, welches die zu belebende tote Materie, das Protoplasma, enthielt und ließ die Radiumstrahlen auf das körnige Gemenge wirken.
Kussáka und sein Landsmann hefteten ihre Blicke darauf. Ob sich die tote Masse dort in dem Glasgefäß beseelen ließ?
Würde das Bombardement der elektrischen Atome Leben in die tote Masse zaubern?
Die beiden japanischen Gelehrten mochten nicht recht daran glauben. Ja, hätte Nieuwenhuis, wie sie es taten, das leblose Protoplasma einer langen Einwirkung von Heliumgas, jenem Zersetzungsprodukt des Radiums, ausgesetzt, so wäre wohl eher ein Resultat die Folge gewesen.
Nieuwenhuis begann nun die Protoplasmamasse mit einem Holzstäbchen umzurühren. Dann betrachtete er mit gespannter Aufmerksamkeit den von ihm erfundenen Strahlengleichrichter, den er über die Radiumdose gestülpt hatte.
Wenige Minuten nach diesen Vorbereitungen konnten die Japaner zu ihrem grenzenlosen Erstaunen bemerken, daß in die körnige Protoplasmasubstanz Bewegung kam. Es fand ein Heben und Senken darin statt. Die Masse schien aufzuquellen, an Volumen zuzunehmen.
Selbst Nieuwenhuis war über das Resultat erstaunt, da er bislang immer nur eine schwache Bewegung der Masse bei Bestrahlung erzielt hatte. Er jubelte innerlich, ohne dies den Japanern zu verraten. Der heutige Versuch hatte ihm bewiesen, daß er zweifellos der Lösung des großen Lebensproblemes nahe war.
Nach einer viertelstündigen Bestrahlung der Substanz entfernte Nieuwenhuis die Radiumdose und verschloß sie wieder sorgfältig in der Wandnische. Hätte er jetzt ein aufmerksames Auge auf seine beiden Besucher gehabt, so hätte er bemerken können, wie sich diese heimlich etwas zuflüsterten und dabei ihre Blicke auf die Wandnische richteten.
»Jetzt wollen wir das Protoplasma mit meinem Ultramikroskop einmal näher betrachten, meine Herren,« sagte der alte Arzt und brachte das erwähnte Instrument herbei.
»Ultramikroskop?« frug Kussáka in einem Tone, als wisse er nicht, was er aus diesem Instrument machen solle.
»Oh! Sie haben davon noch nichts gehört,« erwiderte Nieuwenhuis. »Das Instrument zeigt dem Auge noch Strukturelemente, welche kleiner sind als %000stel Millimeter.«
»Großartig !« rief Kussáka. »Damit würde man also die Atome erkennen können?«
»An dieser Grenze macht das Mikroskop gerade Halt.« Nieuwenhuis entnahm nunmehr dem Glasbehälter die Protoplasmamasse und sonderte davon eine kleine Menge ab, um dieselbe auf den Objektträger des Ultramikroskopes zu bringen.
Dann betrachtete er einige Augenblicke die Plasmaprobe unter dem Vergrößerungsglas und rief freudestrahlend: »Das große Werk ist endlich gelungen, in dieser Stunde gelungen! Ich habe künstlich Leben erzeugt!« Nieuwenhuis zitterte fast vor freudiger Erregung und er sah seine Besucher mit glänzenden Augen an.
Kussáka traute ebenso wie sein Landsmann dem Gehörten nicht. Schnell warf er einen Blick in das Mikroskop. Richtig, er sah wie die Masse darin lebte, wie sie sich zellenartig angeordnet hatte.
»Die ersten Zellprodukte,« sagte Nieuwenhuis stolz. »So, jetzt mag die Wissenschaft kommen und mir das Gegenteil ins Gesicht behaupten. Hier ist das Leben, das ich künstlich erzeugt! so werde ich allen zurufen. — Oh! ich wußte, daß ich auf dem rechten Wege war.«
Auch der andere Japaner überzeugte sich, daß Nieuwenhuis die Wahrheit gesprochen. Die Masse hatte Leben gewonnen, zweifellos. Die Zellen konnten einzeln gut unterschieden werden und ihre mechanische Bewegung ebenfalls.
»Das Rätsel des Lebens ist gelöst, meine Theorie hat sich bestätigt,« sagte hoch erregt über das erhaltene Resultat Nieuwenhuis und betrachtete wiederholt die beseelte Masse im Mikroskop.
»Wenn es aber nur eine vorübergehende Erscheinung ist, wenn die Zellen wieder zerfallen und die Bewegung aufhört, dann ...« begann Kussáka und sah zweifelnden Blickes auf die übrige in dem Glasgefäß befindliche Protoplasmamasse.
»Gleichviel, das große Problem ist endgültig gelöst!« rief Nieuwenhuis, und hätte es wohl nicht viel gefehlt und er wäre in dem Laboratorium herumgetanzt. »So, meine Herren, nun gehen Sie hinaus und verkündigen der Welt, daß es einem Menschen in Leiden gelungen ist, das Daseinsrätsel zu lösen und daß dieser nun dem Schöpfer aller Dinge ins Handwerk pfuschen wird.«
»Sie werden auch heute noch auf Widerspruch stoßen, denn Ihre Einzellmasse kann sehr wohl nur eine spontane Belebung besitzen,« meinte Kussáka und warf wiederholt einen Blick in das Mikroskop.
»Sie gehören wie alle zu den Erzzweiflern!« rief Nieuwenhuis.
»Keineswegs, aber das Problem ist zu ungeheuerlich, als daß es im Handumdrehen gelöst werden könnte.«
»Tun Sie mir den Gefallen, meine Herren, und verlassen Sie mich jetzt. Ich bin so erregt und brauche Ruhe. Kommen Sie wieder ... morgen, übermorgen, wann Sie wollen.«
Die beiden Japaner baten nunmehr um eine kleine Probe des belebten Plasmas, welche sie auch ohne weiteres erhielten. Dann verabschiedeten sie sich, Nieuwenhuis gedankenvoll zurücklassend.
Im Verlaufe der nächsten Stunde prüfte der alte Arzt Dutzende von Malen das erzielte Resultat. Wenn die Belebung der Masse doch nur eine vorübergehende war? — — — Dann war das Problem allerdings nicht gelöst. Dieser Gedanke griff allmählich bei Nieuwenhuis Platz und dämpfte seine Freude und Erregung.
Bis spät in die Nacht hinein hockte der Alte in seinem Laboratorium und wiederholte das Experiment mit der Beseelung toter Protoplasmamasse. Doch seltsam, nicht ein einziges Mal erzielte er aber wieder das gleiche Resultat wie am Nachmittag in Gegenwart der Japaner. Verzweifelt starrte Nieuwenhuis die trotz aller Radiumbestrahlung leblos bleibende Masse an. Beging er irgendwie einen groben Fehler? — — —
Vergeblich suchte er nach einem solchen. Dann, als er nichts entdecken konnte, wendete er sich der Betrachtung der Protoplasmamasse zu, die in dem Glasgefäß aufbewahrt, in ein lebendiges Produkt umgewandelt worden war. Noch zeigte diese eine schwache Bewegung, und auch die Zellbildung war noch vorhanden. Das tröstete ihn, wenngleich er fürchtete, daß die Japaner recht behalten konnten hinsichtlich ihrer Behauptung, daß die Belebung nur eine spontane sein könne. War dies wirklich der Fall, so blieb immer noch die eigentümliche Zellenbildung in dem Protoplasma übrig. Diese konnte keine scheinbare sein, selbst wenn die Zellen sich wieder auflösen würden.
Weit nach Mitternacht erst begab sich Nieuwenhuis, der Grübler, zur Ruhe, voll von Zweifeln darüber, ob er das große Lebensrätsel gelöst, oder ob nur ein Trugbild ihn geäfft hatte — — — — — — — —
Der Telegraph alarmierte am folgenden Tage die ganze Kulturwelt. Von Nord nach Süd, von Ost nach West, rings um den Erdball flatterte die Nachricht: Das Rätsel des Lebens ist gelöst!
Millionen Menschen glaubten es, ebensoviele stritten es ab. Die letzteren hielten eine Aufhellung des Lebensproblems überhaupt für zu absurd, als daß sie darüber sonderlich viele Worte verloren.
Einem sterblichen Menschen sollte es gelungen sein, das dunkle Tor zu öffnen, durch welches man einen Blick auf das Wesen der letzten Dinge werfen konnte — unmöglich! unglaublich!
Alle Zeitungen griffen mit Begierde die in ihren gewaltigen Folgen gar nicht ausdenkbare Neuigkeit auf. Wäre diese von dem Urheber selbst in die Öffentlichkeit lanciert worden, so hätte man ihr wohl weit weniger Glauben beigemessen, da Dr. Nieuwenhuis, nachdem er seine Theorie vom Wesen des Lebens in einem Vortrag bekannt gegeben hatte, von allen Seiten, besonders von den Gelehrten stark angefeindet worden war. So aber war die Nachricht über die Erzeugung künstlichen Lebens von den beiden japanischen Dozenten ausgegangen und gewann dadurch einen gewissen Wert, wenn man den Dingen auch nicht so ohne weiteres Glauben schenkte.
Nieuwenhuis hatte von diesem Augenblick an keine ruhige Stunde mehr. Wenngleich die gelehrten Kreise ihn trotz der Tatsachen noch immer nicht ernst nehmen wollten, so bildete das unscheinbare Haus in der Lakengracht jetzt das Ziel vieler Leute aus den höchsten Ständen. Unter allerlei Vorwänden fanden sich diese ein; jeder wollte das Lebenswunder zuerst in Augenschein nehmen. Dazu wurde er mit einer Flut Briefe und Telegramme überschüttet.
Soeben überbrachte Frau Dorothee wieder eine Depesche, deren Außenseite erkennen ließ, daß diese als eigne Angelegenheit des königlichen Hauses im Haag, durch besonderen Extraboten befördert worden war. Nieuwenhuis stutzte. »Ein Telegramm vom königlichen Hofe im Haag ... was soll das bedeuten — — ?«
Frau Dorothee lugte mit brennender Neugier hinüber zu dem Schriftstück, welches Nieuwenhuis schnell erbrach.
»Ich bin zum Vortrag bei der Königin befohlen worden,« sagte er dann, und Freude und Stolz leuchteten ihm aus dem faltigen Antlitz.
»Sie werden noch der berühmteste Mann aller Zeiten werden, Herr Doktor. Ihre Brust wird sich mit Orden schmücken und Sie werden endlich die Früchte ernten, die Sie gesät haben.«
Nieuwenhuis lachte. »Sie entrollen eine schöne Perspektive. Aber ich geize nicht nach Ruhm und Titeln. — — Haben Sie noch etwas zu sagen?«
»Drüben ist ein Herr ... er möchte Sie dringend sprechen,« versetzte Frau Dorothee.
»Lassen Sie ihn in mein Sprechzimmer treten.«
Nieuwenhuis betrachtete jetzt die Protoplasmamasse, die auf einer Glasscheibe vor ihm ausgebreitet war. Die rhythmischen Bewegungen der Ausdehnung und Zusammenziehung, welche die belebte Substanz ausführte, erinnerte den Alten an die Theorie des Dr. Rex. In dieser Hinsicht hatte seine Hypothese auffallende Berührungspunkte mit der von Rex aufgestellten Theorie von den Urformen des Lebens.
Auch die Tatsache war unverkennbar, daß sich der Stoff in einem Zustand befindet, der sich als Kraft äußert. Das Radium hatte ihm hierfür Beweispunkte geliefert.
Während er so in Gedanken versunken war, erschien Frau Dorothee und meldete die Ankunft eines zweiten Besuchers.
Jetzt fiel es Nieuwenhuis ein, daß er im Sprechzimmer bereits erwartet wurde. Er begab sich darum hinüber.
Drüben fand er zwei Herren vor, welche ihm völlig unbekannt waren.
Der zuerst gekommen zu sein schien, bewegte sich auf ihn zu, machte eine leichte Verbeugung und stellte sich als Vertreter der »Times« in London vor.
»Sie sind Berichterstatter ... hm, ich empfange eigentlich keine Vertreter der Presse,« sagte Nieuwenhuis, der gegen Reporter eine Antipathie besaß.
Der Spezialberichterstatter der »Times« war aber nicht einzuschüchtern. In fließendem Holländisch trug er sein Anliegen vor.
»Sie wollen mich interviewen?«
Mr. Dicksee, so nannte sich der englische Pressevertreter, nickte eifrig. »Wir wollen eine Biographie über Sie bringen. Darf ich um Angaben bitten? — — Ihr voller Name?« Der Sprecher hatte ein Notizbuch aus der Tasche gezogen und begann zu schreiben.
»Sie verfahren mit mir recht summarisch ... da Sie mir aber doch keine Ruhe lassen werden, so will ich Ihnen einige Angaben machen. Aber beeilen Sie sich, meine Zeit ist riesig knapp. Sie sehen, hier wartet bereits noch jemand auf mich.«
»Also Ihr voller Name, bitte?«
Nieuwenhuis machte seine Angabe.
»Holländer von Geburt?«
»Jawohl ...«
»Sie haben einen reichen Kaufherrn beerbt, nicht wahr?«
»Ein gewisser Mynheer Steen war so gütig, mir zwei Millionen Gulden zu hinterlassen.«
»Zwei bloß ... zu wenig —« murmelte halblaut Mr. Dicksee und notierte sich sechs Millionen, weil diese Ziffer eine intensivere Wirkung auf die Leser der »Times« haben mußte. »Sie haben Medizin studiert?«
»Mit Ihrer gütigen Erlaubnis, ja.« Nieuwenhuis gab dieses in kategorischer Weise sich entwickelnde Interview reichlich Spaß.
»Bei Ihrer ungewöhnlichen Begabung haben Sie natürlich auch noch Physik und Chemie studiert ... vielleicht noch etwas?« Der Reporter notierte fortgesetzt.
»Nehmen Sie doch den Mund nicht zu voll ...«
»Sie sind Ritter hoher Orden? ... Natürlich ...«
»Herr! Nichts dergleichen!« rief Nieuwenhuis.
Mr. Dicksee sah verwundert auf. »Einerlei ... Sie werden solche sicher noch erhalten. Ein Mann von Ihrer Bedeutung! ... Nun zu der Entdeckung, die Sie berühmt gemacht hat. Sie haben Leben fabriziert?«
Nieuwenhuis lachte. »Fabriziert?! Famoser Ausdruck für künstliche Erzeugung auf chemischphysikalischem Wege.«
»Sie haben eine Hypothese über das Rätsel des Lebens aufgestellt?« frug Mr. Dicksee in seiner unverfrorenen Weise weiter.
»Ich nahm mir die Freiheit.«
»Sie haben experimentiert ... mit was, bitte?«
»Mit fünfzig Pfund Radium,« gab Nieuwenhuis zur Entgegnung, ohne mit einer Wimper zu zucken. Er hatte im stillen beschlossen, dem zudringlichen Reporter unglaubliche Angaben zu machen.
Die fünfzig Pfund wurden notiert, nur wurden auf dem Papier hundert daraus.
»Wie fabrizierten Sie dann künstliches Leben? ... Bitte, um recht genaue und knappe Angaben.«
Nieuwenhuis erwiderte, daß dies sein Geheimnis sei.
Mr. Dicksee war über diese Verschwiegenheit nicht sonderlich erbaut. »Sie sind der ganzen Menschheit ein offenes Bekenntnis schuldig,« sagte er dann.
»So? ... meinen Sie? — — Hören Sie mal. Ich habe wirklich keine Lust, Ihnen hier noch länger Rede zu stehen. Meine Zeit ist überaus bemessen und ...«
»Wann darf ich wieder vorsprechen?« fiel ihm der Spezialberichterstatter ins Wort. »Morgen vielleicht? Ich brauche unbedingt nähere Angaben. Die ›Times‹ ist ein Blatt von Weltbedeutung, und Sie sind diesem im eigensten Interesse schuldig Ihre epochale Entdeckung darin zu schildern. Details können ja Geheimnis bleiben.«
Nieuwenhuis gelang es endlich, den unliebsamen Fragesteller auf später zu vertrösten, dann erst verschwand Mr. Dicksee von der Bildfläche.
Der andere im Zimmer anwesende Besucher, ein Herr in mittleren Jahren, welcher das interessante Interview mit angehört hatte, stellte sich nunmehr vor.
»Ich komme mit einem eigenartigen Anliegen zu Ihnen, Herr Doktor,« begann der Fremde. »Mein Name ist Schaepman, ich stamme aus Batavia und wohne zur Zeit in Amsterdam.«
»Und was ist Ihr Wunsch?« frug Nieuwenhuis, den Sprecher musternd.
»Ich habe von Ihren wissenschaftlichen Versuchen gehört. Sie experimentieren mit Kaninchen, denen Sie an Stelle des entzogenen Blutes Meerwasser in die Adern gefüllt haben. Ich möchte mich Ihnen nun zu einem gleichen Versuch anbieten. Das Studium am Menschen wird Ihnen weitaus wertvoller sein, als an Tieren.«
Nieuwenhuis traute seinen Ohren nicht. Er starrte den Fremden an, wie jemanden, den er für nicht ganz richtig im Oberstübchen hielt.
»Es ist mein voller Ernst,« fuhr Schaepman fort. »Brauchen Sie einen Versuchsmenschen?«
»Sind Sie bei Sinnen? Ich würde mich damit eines Verbrechens an Ihrem Leben schuldig machen!« rief Nieuwenhuis aus.
»Bitte, eine Frage. — Sterben die mit Meerwasser injizierten Kaninchen regelmäßig?«
»Allerdings ... Sie wären zweifellos ein Kind des Todes, wollte ich Ihren Wünschen nachkommen und Sie als Versuchsobjekt benutzen.«
»Dieser Endzweck würde mich befriedigen. Wenn ich im Interesse der Wissenschaft mein Leben verliere, so ist mein Dasein wenigstens nicht ein ganz verfehltes gewesen.«
»Ich hoffe doch nicht, daß Sie schlechte Scherze machen, mein Herr?« gab Nieuwenhuis zur Erwiderung. »Oder wollen Sie geradezu einen Selbstmord begehen?«
»Ja ... das Leben hat keinen Wert für mich, ich bin es weidlich überdrüssig, und so ist mir der Gedanke gekommen, mich Ihnen als Versuchsobjekt anzubieten, um auf eine Art aus der Welt zu scheiden, die es mir erspart, Hand an mich selbst zu legen.«
Der Fremde sagte das alles mit einerr Seelenruhe, als handle es sich um die gleichgültigsten Dinge der Welt. Nieuwenhuis wußte nicht, was er denken sollte. Stand hier ein Wahnsinniger oder ein wirklich des Lebens Überdrüssiger als Selbstmörder vor ihm? — — —
»Mein Herr,« sagte er dann zu dem unheimlichen Fremden, »ich bedaure, Ihnen in keiner Weise dienen zu können.«
»Die Gelegenheit zu einem solchen freiwilligen Versuchsobjekt wird sich Ihnen so leicht nicht wieder bieten.«
»Ach, kommen wir doch zu Ende. Ich fördere nun einmal nicht Ihre Selbstmordgedanken und damit bescheiden Sie sich gefälligst.«
Der ominöse Fremde sah sich kategorisch abgefertigt. Er verlor darum kein Wort weiter, machte eine Verbeugung und entfernte sich.
Nieuwenhuis atmete auf. Erst war ihm der unerträgliche Reporter auf die Nerven gefallen, und jetzt dieser Selbstmordkandidat. Frau Dorothee wurde nun von ihm dahin verständigt, niemand vorzulassen, der sein Anliegen vorher nicht spezifiziert habe. Dann eilte Nieuwenhuis wieder in sein Laboratorium und ging von neuem an die Arbeit.
Die Zweifel, welche ihm am vergangenen Tage in Betreff des künstlich erzeugten Lebens überkommen waren, hatte er noch nicht zu verscheuchen vermocht, trotzdem das Protoplasma seine rhythmische Bewegung beibehalten hatte. Es hatte dies seinen Grund darin, daß die Bewegung allmählich eine Abschwächung erfuhr. Nieuwenhuis sann über dieses Abflauen nach. — — Der künstlich beseelte Stoff war vielleicht kurzlebiger Natur, und die langsame Abnahme der Bewegung repräsentierte sein Absterben. Die Kurzlebigkeit war zweifellos darin begründet, daß die organische Substanz keine Nahrungszufuhr hatte. Den Eintagsfliegen mit ihren verkümmerten Mundteilen ergeht es ja ebenso, sie vermögen keine Nahrung aufzunehmen, weshalb ihre Lebensdauer nur nach Stunden zählt.
Dies alles überlegte sich der geniale Forscher und kam nun zu der Überzeugung, daß sein Kunstprodukt im Sterben lag. Ob nach dem Tode der Masse eine Neubelebung durch das Radium möglich war, das mußten spätere Versuche erst dartun.
Plötzlich kam Nieuwenhuis auf die Idee, dem Absterben der Substanz durch eine Neubestrahlung Einhalt zu tun.
Gedacht, getan!
Eiligst traf er seine Vorbereitungen für das Experiment. Das Radium wurde herbigeholt, die Protoplasmamasse auf ihrer gläsernen Unterlage sorgfältig ausgebreitet und der Bestrahlung ausgesetzt. Nieuwenhuis nahm sodann ein Vergrößerungsglas zur Hand und beobachtete die Wirkung, welche die Strahlung auf das Protoplasma ausübte. Die letzten mißlungenen Versuche ließen ihn jetzt nicht viel erhoffen.
Minute um Minute verstrich, ehe er bemerkte, daß die vielen kleinen Zellen lebendigere Bewegungen als bisher ausführten.
Ein Freudestrahl glitt über des Forschers Gesicht. Die Neubelebung schien geglückt zu sein. — Wieder ein Fortschritt!
Plötzlich erinnerte er sich der Andeutungen, welche die beiden Japaner hinsichtlich einer Verwendung von Heliumgas gemacht hatten. Das mußte er ausprobieren. Nachdem er die Protoplasmamasse hinreichend neu belebt zu haben glaubte, ging er daran, Radium zur Zersetzung zu bringen, um auf solche Weise Heliumgas zu gewinnen.
Eine Zersetzung dieses geheimnisvollen Elementes war natürlich nicht im Handumdrehen zu bewirken, dazu gehörte Zeit. Das war Nieuwenhuis hinreichend bekannt, weshalb er darüber nachsann, in welcher Weise sich der Zersetzungsprozeß beschleunigen ließe.
Mitten in seinem Sinnen wurde er durch ein vernehmliches Klopfen an die Tür gestört. Brummend stand Nieuwenhuis auf und öffnete.
Draußen standen wieder die beiden Japaner, welche tags zuvor ihn aufgesucht hatten. Frau Dorothee wollte gerade nach den Wünschen der Herren fragen, als Nieuwenhuis ihr das Wort abschnitt.
Die gelben Söhne des fernen Ostens machten eine Verbeugung.
»Habe ich wieder das Vergnügen, meine Herren?« frug der Arzt und lud die beiden Japaner durch eine Handbewegung ein, in das Laboratorium zu treten.
Kussáka frug überaus höflich, ob er und sein Freund nicht zu ungelegener Zeit kämen.
Nieuwenhuis verneinte und ließ die Herren sich setzen.
»Wir bringen Ihnen einige Exemplare von Urtieren,« sagte Kussáka.
»Zu welchem Zweck?« frug Nieuwenhuis.
»Zum Vergleich von Kunstprodukt und Naturprodukt ... Doch eine Frage! Ist Ihre Protoplasmamasse noch am Leben? Kussáka heftete seine Augen gespannt auf den Arzt.
»Ja, ich habe aber die sich abgeschwächte Bewegung wieder aufgefrischt.«
»Durch Bestrahlung?«
Nieuwenhuis nickte.
»Bitte, zeigen Sie mir Ihre Urtierchen,« sagte er dann. »Es ist interessant, deren Protoplasma einmal zu studieren.«
Kussáka zog ein in Papier gewickeltes Gefäß aus der Tasche und öffnete es behutsam.
»Mein Kunstprotoplasma möchte ich zwar eher als ein pflanzenartiges Produkt ansehen als wie ihm eine animalische Natur zuerkennen,« meinte Nieuwenhuis. »Deshalb werden beide Plasmas sehr unterschiedlich sein.«
»Diese Urtiere hier sind aus der Klasse der Wurzelfüßer,« versetzte Kussáka.
»Haben Sie einmal die Vakuolenbildung bei den Urtieren studiert?«
Der Japaner verneinte.
»Die äußere Masse der Leibessubstanz bei solchen enthält in verschiedener Anzahl blasenartige Räume, welche mit einem gewissen Rhythmus erscheinen und wieder verschwinden. Diese Räume sind rund und mit einer hellen Flüssigkeit gefüllt. Mein Kunstprotoplasma enthält ebenfalls solche Hohlräume, sie scheinen aber mehr pflanzenartiger Natur zu sein.«
Bei dieser Erklärung schob Nieuwenhuis die Glasplatte mit dem Plasma vor die Japaner. Kussáka entnahm mit Hilfe eines kleinen zarten Stäbchens etwas Flüssigkeit aus dem Gefäß, welches er mitgebracht hatte, und tropfte diese auf eine Glasplatte.
Nieuwenhuis holte inzwischen ein Mikroskop herbei.
Bei der nun folgenden Untersuchung der Urtiere entging es dem beschäftigten Auge des alten Forschers, daß Fujiwarano Tsunetaka einen Teil der Protoplasmamasse von der Glastafel nahm und diese in ein mitgebrachtes Kästchen praktizierte, welches er dann blitzschnell in seiner Tasche verschwinden ließ.
Das Gespräch drehte sich nun weiterhin um die Unterschiedlichkeit des pflanzlichen und animalischen Protoplasmas. Nieuwenhuis hätte die Urtiere gern behalten, um sie zu Vergleichszwecken mit seinem Kunstprodukt zu benutzen.
Kussáka bedeutete ihm aber, daß die Wurzelfüßer sehr wertvoll seien.
»Ich bemesse ihren Wert sehr hoch,« antwortete der schlaue Sohn des Mikado.
»Tausend Gulden, wenn Sie mir die Urtiere alle überlassen,« erwiderte der Arzt.
»Wenn Ihnen so viel an den Tierchen liegt, nun, so sollen Sie dieselben für tausend Gulden haben,« sagte Kussáka und schob jenem das Gefäß mit den so kostbar bewerteten Infusorien hin.
Nieuwenhuis erhob sich erfreut und verließ für einige Augenblicke das Laboratorium, um das Geld zu holen.
Unmittelbar darauf trat Nieuwenhuis ein, in der Hand eine Banknote haltend.
»Hier ist der Betrag für die Urtiere, meine Herren,« sagte er zu Kussáka und händigte diesem das Geld aus.
Der Japaner ließ den Schein gleichmütig in seiner Tasche verschwinden. Darauf wurden noch einige Worte gewechselt, dann empfahlen sich die Besucher mit auffälliger Eile.
Nieuwenhuis war die schnelle Verabschiedung angenehm, da er noch Vorbereitungen für die Reise nach dem Haag treffen mußte. Er hatte einen Vortrag für die Königin auszuarbeiten, und dies erforderte immerhin einige Stunden Zeit.
Beim Verlassen des Laboratoriums warf er einen flüchtigen Blick auf das Protoplasma und stutzte dann. Die Masse erschien ihm mit einem Male recht zusammengeschmolzen. Kopfschüttelnd betrachtet er sie aufmerksamer, vermochte aber für die augenfällige Schrumpfung keine Erklärung zu finden.
Nieuwenhuis begab sich hierauf in sein Arbeitszimmer und vertiefte sich in Gedanken über den abzufassenden Vortrag. Zuvor hatte er jedoch der Haushälterin anbefohlen, niemand vorzulassen, da er völlig ungestört bleiben wolle.
Zur selbigen Zeit als Nieuwenhuis seine Reise nach Haag antrat, um dem besonderen Wunsche Ihrer Majestät Folge zu leisten, fand in einem Beratungszimmer der Universität zu Leiden eine Sitzung von etwa zehn Kapazitäten der Landeshochschulen statt.
Den Vorsitz hatte der Rektor Magnificus von Amsterdam übernommen, Professor der Chemie A. Vosmaer, ein alter im Dienste der Wissenschaft grau gewordener Herr, dem man eine hohe Gelehrsamkeit nachrühmte.
Von anderen Professoren waren erschienen. der Physiologe Scheltema, der Physiker Geel, der auf dem Gebiet der Radiumforschung als Autorität geltende Dr. Blok, der Philosoph Stijl, der Chemiker te Water und die berühmten Mediziner Mulder und Ysbrand.
Der Zweck der Konferenz bildete die Frage, ob Nieuwenhuis das Rätsel des Lebens in Wirklichkeit gelöst habe.
Rektor Vosmaer hatte von Kussáka, dem Japaner, eine Probe des künstlich belebten Protoplasmas erhalten und dieses genau untersucht. Er war dabei zu dem Resultat gelangt, daß in dem künstlichen Lebensprodukt nur ein Scheinleben erweckt sei, daß also die gesamte Welt mit der von Nieuwenhuis »beseelten« Substanz düpiert war.
Dieses Ergebnis seiner Untersuchung hatte Vosmaer soeben zur Kenntnis der anwesenden Konferenzmitglieder gebracht, und daran reihte sich nun eine äußerst lebhafte Diskussion der holländischen Vertreter irdischer Gelehrsamkeit und Weisheit. In Sachen der letzteren führte der Philosoph Stijl das Wort. Er suchte mit zwingender Logik darzutun, daß das, was man Leben nennt, nie und nimmer bloß Funktionen organischer Materie repräsentiere, und daß eine Maschine, die über sich selbst nachdenkt, sich nicht aus Kraft und Stoff erklären oder gar gestalten lasse. Damit gelangte der Philosoph zu dem Resümee, daß Nieuwenhuis' Theorie vom Wesen des Lebens ein wahrer Irrgarten phantastischer Anschauungen sei, geeignet die Gemüter zu verwirren und die Wissenschaft auf falsche Pfade zu drängen.
Stijl erntete von verschiedenen Seiten vollsten Beifall.
Nun erhob sich der Physiologe Scheltema. Er gehörte in das Lager der überzeugten Gegner Nieuwenhuis'.
»Das Rätsel des Lebens! ... Meine Herren! — —« begann Scheltema mit seiner immer umflort klingenden Stimme. »Es ist ein wehleidiges Problem, welches meiner unmaßgeblichen Ansicht nach sicher nicht eher gelöst werden wird, bis daß es Menschenhänden gelungen ist, ein Perpetuum mobile zu konstruieren, daß die Ewigkeit überdauert. Ich will damit sagen, daß beide Probleme unlösbar sind. — Ohne mich über das Thema vom Wesen des Lebens hier weiter auszulassen, möchte ich nur auf gewisse Punkte zu sprechen kommen, die Nieuwenhuis' Theorie von der Entstehung allen Lebens aus Kraft und Stoff zu einer phantastischen Hypothese herabdrücken werden ... Das Handeln des Menschen kann nie und nimmer auf physikochemischen Ursachen beruhen. Bei allem unserem Handeln spielen wir nicht die müßigen Zuschauer etwaiger in uns sich vollziehender chemischer Prozesse; unsere seelischen Tätigkeiten, wie Wille, Lust, Unlust u. dgl. spielen eine unabhängige und gewichtige Rolle. Keine Theorie des denkenden Menschengeistes wird jemals die Psyche des Lebenden aus Kraft und Stoff allein erklären können und wenn die Wissenschaft in der Erkenntnis der Dinge noch um weitere hunderttausend Jahre fortgeschritten sein sollte!«
»Bravo! ... Meine Ansicht — meine Ansicht!« rief der Mediziner Ysbrand.
»Nun, Herr Kollege, die Urzeugung werden Sie wohl als annehmbar betrachten müssen!« meinte der Chemiker te Water, ein noch in jüngeren Jahren stehender Mann mit energischem Blick.
» Warum?« frug Scheltema.
»Die Wissenschaft muß die Hypothese einer Urzeugung anerkennen, will sie nicht mit dem Entwickelungsgedanken vor einem Schöpferwort stehen bleiben,« versetzte te Water.
»Der experimentelle Nachweis der Urzeugung ist noch nicht erbracht, Herr Kollege.«
»Und wenn ihn Nieuwenhuis vielleicht doch erbracht hätte,« warf soeben der Mediziner Mulder ein.
»Herr Kollege! Ich glaube gar, Sie nehmen Nieuwenhuis für ernst!« rief Rektor Vosmaer und riß die Augen weit auf ob der Gläubigkeit seines Amsterdamer Studienfreundes.
»Meine Herren ...« begann Scheltema abermals. »Ich möchte den Faden wieder aufnehmen, wo ich ihn fallen gelassen habe ... Ich sprach davon, welche große Rolle die seelischen Tätigkeiten wie das Denken und der Wille im Menschen spielen. Sie können niemals als Ausflüsse der physikalischen oder chemischen Prozesse, die sich im lebenden Körper unausgesetzt vollziehen, gelten. — Ziehen wir einmal einige Beispiele hier heran. Wer möchte behaupten, daß die Schöpfung der Raffaelschen Madonna oder die Newtonsche Entdeckung der Schwerkraft aus einen bloßen chemischphysikalischen Vorgang im Innern jener beiden Menschen zurückzuführen sei?! — Sehen Sie, meine Herren! Mit solchen Erwägungen fällt vor uns die Nieuwenhuissche Theorie vom Wesen des Lebens und seiner Entstehung wie ein Kartenhaus zusammen.«
Scheltema fand bei den meisten seiner Kollegen ungeteilten Beifall. Nur der Physiker Geel, Dr. Blok und Mulder nahmen eine Sonderstellung ein. Diese drei sahen zwar die Lösung des Lebensrätsels noch keineswegs erbracht und betrachteten auch Nieuwenhuis' Entdeckung mit kritischen Augen, waren aber doch keine Gegner des Leidener Forschers. Das belebte Protoplasma hatte ihnen sehr zu denken gegeben.
»Davon ausgehend,« begann jetzt Dr. Blok, »daß wir früher viele Leistungen, welche reine chemische Vorgänge waren, als Lebensäußerungen ansahen — ich erinnere hier nur an die künstliche Erzeugung von Veilchenduft und Harnstoff und an die Entdeckung der Gärstoffe — wage ich es nicht, neue Errungenschaften auf dem Gebiete der künstlichen Herstellung organischer Stoffe als in der Retorte erzeugtes Leben anzusprechen. Wir müssen in der Beurteilung solcher Erfolge vorsichtig sein. Ein Pariser Gelehrter hat sich kürzlich über die Erzeugung künstlichen Lebens dahin geäußert, daß eine Lösung des Lebensproblemes in unseren Tagen soviel bedeute, wie eine Überspringung von gewaltigen Zeitepochen einer Zukunftsforschung. — Nun, in der Wissenschaft ist schon oft ein Sprung vorwärts getan worden, der zu einem Ziele gelangen ließ, das vordem für uns noch in jahrhundertweiter Ferne lag.«
Hier wurde der Redner, der offensichtlich für Nieuwenhuis eintreten wollte, durch Rektor Vosmaer unterbrochen.
»Und ich behaupte,« rief er, »daß beim Abschluß der Menschheitsgeschichte, an dem Tage, an welchem der letzte Mensch der Erde seinen Atem aushaucht, das Wesen der letzten Dinge noch nicht aufgehellt ist!«
Dr. Blok zuckte mit den Achseln. »Ich meinerseits möchte der Wissenschaft doch eine günstigere Prognose stellen,« meinte er dann.
»Damit wollen Sie wohl sagen, daß eine Lösung des Lebensproblems zu den Möglichkeiten gehört?« frug Professor Ysbrand und im Tonfall seiner sonoren Stimme drückte sich eine leise Schärfe aus.
»Die moderne Naturforschung hat schon in die seltsamsten Dinge Licht gebracht,« erwiderte Dr. Blok.
»Mit Hypothesen!« warf Scheltema ein.
»Hypothesen, die alle Wahrscheinlichkeit für sich haben, bilden die erste Stufe der Erkenntnis,« entgegnete Mulder.
»Hypothesen sind und bleiben nichts weiter als Lückenbüßer in der Wissenschaft,« sagte Vosmaer.
»Und doch kommen wir ohne sie nicht aus,« entgegnete Mulder.
»Ein klassischer Beweis, wie dürftig es mit dem menschlichen Erkenntnisvermögen bestellt ist!« rief der Philosoph Stijl dazwischen.
»Schon manche Hypothese ist später experimentell bewiesen worden — und wenn die Anzeichen nicht trügen, hat sich auch Nieuwenhuis' Hypothese durch das Experiment der künstlichen Belebung toter Materie als stichhaltig erwiesen,« sagte Dr. Blok.
»Unsinn!« rief Ysbrand. »Die Beseelung des Protoplasmas zweifle ich an!«
»Und wie erklären Sie uns die andauernde rhythmische Bewegung der Masse? Einer Masse, die vorher tot war,« frug Dr. Blok mit Nachdruck.
»Scheinleben!« brummte Vosmaer.
»Das Rätsel des Lebens ist eine so harte Nuß, liebe Kollegen, daß wir wohl annehmen können, daß sie nie geknackt werden wird,« warf jetzt te Water in den Disput ein.
»Und das letzte Wort in dieser Rätselfrage haben nicht die Naturforscher, sondern wir Philosophen,« sagte Stijl.
»Doch nun zur Sache, meine Herren!« rief Vosmaer. »Wir verlieren uns hier in Allgemeinbetrachtungen über das Lebensproblem, ohne den wahren Zweck unserer Konferenz zu verfolgen. — — Nehmen wir jetzt Stellung zu Nieuwenhuis und seiner Sache ... Zunächst der Kardinalsatz seiner Theorie. Alle Entstehung des Lebens ist mechanisch. Nieuwenhuis will die Wahrheit dieses Satzes durch sein Experiment bewiesen haben. Ich erkläre, daß er sich irrt!«
Außer Blok, Geel und Mulder stimmten die Gelehrten der Vosmaerschen Ansicht zu.
»Und weiter. — Nieuwenhuis betrachtet das Element Radium als die Quelle der Lebenskraft, die tote Materie beseelen kann. — Auch in dieser Hinsicht wird er irren ...«
Vosmaer wurde hier unterbrochen.
»Die Rätselnatur des Radiums zeitigt täglich neue Überraschungen,« warf Dr. Blok hastig ein. »Es ist gar nicht so von der Hand zu weisen, daß dieses geheimnisvolle Element Kräfte in sich birgt, mit denen man bei der Lösung des Lebensproblems in erster Linie zu rechnen hat. Meine neusten Untersuchungen haben dies wieder bestätigt. Besonders diktiere ich dem Heliumgas, jenem Zersetzungsprodukt des Radiums, große Wirkungen im Wechselspiel von Leben und Tod zu.«
Trotzdem Blok eine anerkannte Autorität auf dem Gebiet der Radiumforschung war, wagten doch einige Gelehrte Einwendungen zu machen. So kam es eine längere Zeit hindurch zu Auseinandersetzungen, die ihres trocknen wissenschaftlichen Charakters wegen hier nicht wiedergegeben werden sollen.
Im Verlaufe der weiteren Diskussion spaltete sich die Gelehrtenschaft in zwei getrennte Lager, und als die Meinungsgefechte zu Ende gekommen, gingen die wissenschaftlichen Kampfhähne beider Lager als geschworene Feinde auseinander.
Das gewaltige Rätsel des Lebens brachte der Irrungen und Wirrungen so viele, daß es an der Zeit war, daß eine Klärung in Erscheinung trat.
War die Lösung des Lebensproblems wirklich in die Wege geleitet, oder war das Werk des alten Grüblers in Leiden der Gipfel menschlicher Täuschung?
Und ein Glück für die Kulturwelt war es, daß diese Frage gar bald ihre Antwort fand.
»Genie und Irrsinn berühren sich« — In dieser Weise hat sich einmal der berühmte, jetzt leider verstorbene italienische Kriminalpsychologe Lombroso in einem seiner Werke ausgesprochen.
Zwischen beiden Geisteszuständen ist wohl eine tiefe, tiefe Kluft, doch ein einziger Schritt genügt, um diese zu überschreiten. Die Welt hat die Wahrheit dieses Erfahrungssatzes des öfteren verspürt, nicht zuletzt an dem großen Philosophen Nietzsche, dessen gewaltige Denkarbeit in geistiger Umnachtung endete.
Es ist, als wenn sich die Natur an dem Menschen räche, der es wagt weit hinaus zu denken über den Horizont, der seinem Geist gesetzt ist.
Viele Wochen waren seit dem Tag verflossen, an dem Nieuwenhuis das große Problem des Lebens gelöst zu haben glaubte. Im Vollgefühl, seinem Ziele nahe gekommen zu sein, hatte der Grübler von der Lakengracht der Königin einen Vortrag über die künstliche Erzeugung von Leben halten dürfen.
Als er dann heimkehrte, zierte seine Brust der Orden vom Niederländischen Löwen mit der Inschrift: »Virtus nobilitat«.
Doch nun kam der große Rückschlag. Einmal starb sein Protoplasma, und kein Radiumstrahl vermochte die Masse zu neuem Leben zu erwecken. Des weiteren schlug jeder neue Versuch Nieuwenhuis', tote Materie zu beseelen, fehl, so daß er sich über diese Mißerfolge und ihre Ursachen vergeblich das Hirn zermarterte. Dann fiel die Wissenschaft in corpore über ihn her und seine bisherige Anhängerschaft verließ ihn.
Seine Theorie wurde zum Tode verurteilt und er selbst als Hypothesenschmied und Phantast in die dunkle Ecke gestellt — ein für allemal.
Von Stund' an war er für die Wissenschaft ein abgetaner Mann. Doch Nieuwenhuis gab seine Theorie nicht verloren. Er suchte unausgesetzt nach neuen Beweisen für dieselbe. Jetzt war er darauf aus, die Seelentätigkeit im Menschen, die Psyche, in ihrem Wesen zu ergründen und sie als Ausflüsse chemischphysikalischer Vorgänge im lebenden Körper hinzustellen. In letzter Hinsicht suchte er den experimentellen Beweis zu liefern. Konnte er das, so mußten die Menschen schließlich doch noch seine Theorie anerkennen.
Das war also das neue Arbeitsprogramm unseres Helden, der mit der Erzeugung künstlichen Lebens einstweilen gründlich Schiffbruch erlitten hatte.
Der einzigste Gelehrte, der zu Nieuwenhuis noch hielt, war jener Dr. Rex, der ihm einmal seine Theorie vom Wesen des Lebens vorgetragen hatte. Der alte und der junge Doktor arbeiteten nunmehr also Hand in Hand, und kein Mensch wußte darum. Nieuwenhuis lebte seit seinem Fiasko gänzlich zurückgezogen und pflegte mit niemand Verkehr. So kam es, daß er von seiner Mitwelt gar bald vergessen wurde und nur hier und da einmal die Erinnerung an ihn erwachte.
Nieuwenhuis' neue Tätigkeit lag jetzt auf anatomischem Gebiet und beschränkte sich speziell auf die Funktionen des Gehirns sowie auf den Bau des letzteren. Er wollte der Denkfähigkeit des Menschen in ihren Ursachen nachspüren, die Nerven und Gehirnpartien ermitteln, die diese Verrichtung üben, und letztere dann auf mechanischem Wege beeinflussen, um den Dingen, denen er nachforschte, auf den Grund zu kommen.
Nachdem Nieuwenhuis in dem früheren Fahrwasser, in welchem er gesegelt, Schiffbruch erlitten hatte, betrachtete er die Erforschung der menschlichen Psyche in ihrer Entstehungsursache als die vornehmste und aussichtsreichste Aufgabe, die er zur Geltendmachung seiner Theorie sich stecken konnte.
Der neuen Forschungstätigkeit kam nun die Steensche Erbschaft zugute. Hier fanden die restlichen anderthalb Millionen Gulden eine rasche Verwendung. Die neuen Experimente verschlangen nämlich riesige Geldsummen. Es mußten unter anderem Affen als Versuchstiere angekauft werden, die Gehirne verstorbener Menschen machten ungewöhnlich große Ausgaben nötig, und auch in anderer Hinsicht waren allerlei Aufwendungen erforderlich.
Nieuwenhuis' Laboratorium glich fast einer Menagerie. In allen Ecken standen Käfige mit Tieren, zumeist waren es Affen und Papageien, die als Versuchsobjekte im Dienste der Wissenschaft ihr Leben lassen mußten. In der Mitte des Raumes stand ein langer Tisch, auf welchem sich neben mehreren Mikroskopen zahlreiche Präparate befanden.
Der Lärm, den die Tiere machten, war bei Tage so erheblich, daß es Nieuwenhuis vorzog bei Nacht zu arbeiten, zu welcher Zeit er weit weniger gestört wurde. Unter den Affen, die der alte Forscher sich beschafft hatte, befand sich ein Exemplar, das ihm seiner Trolligkeit und Klugheit wegen zu schade erschien, um als Versuchsobjekt zu dienen, weshalb er ihn von den andern absonderte.
Joko, So hieß der bevorzugte Affe, war ein sehr schlauer Geselle und richtete manches Unheil an, sobald er seinem Käfig zu entwischen vermochte. Einmal hatte ihn der Doktor dabei ertappt, wie er gerade das auf einer Glasplatte liegende Gehirn eines verstorbenen Menschen mit Hilfe seiner Finger einer eingehenden Besichtigung unterzog und dann Kostproben anstellen wollte. Nieuwenhuis konnte das Hirnpräparat für die Folge nicht verwenden und hatte dadurch einen Verlust von rund 1000 Gulden — soviel hatte ihm das Gehirn nämlich gekostet.
Von diesem Tage ab wurde Joko strengstens in Haft gehalten und durfte die Dinge und Vorgänge in dem Laboratorium nur von seinem Käfig aus betrachten.
Ab und zu arbeitete Nieuwenhuis mit Rex zusammen, für gewöhnlich an drei Abenden der Woche. Bei diesen Zusammenkünften fand in der Regel ein sehr lebhafter Gedankenaustausch statt, der sich aber ganz auf die gemeinschaftliche Tätigkeit bezog. Selten, daß etwas erörtert wurde, was nicht die Arbeit im Laboratorium betraf.
Rex war ein starker Denker und besaß eine vorzügliche Logik, dabei klebte sein reger Geist nicht an der verbrieften Hochschulweisheit und in puncto Meinungsfreiheit nahm er nie ein Blatt vor den Mund.
Nieuwenhuis schätzte bei ihm den elastischen Gedankengang, und er, der Alte, ließ sich gelegentlich auch einmal von dem Jungen belehren, holte sich zuweilen Rat von ihm und legte auf seine Kritik stets einen gewissen Wert.
Wochen hindurch hatte dies Verhältnis schon fortgedauert und es schien auch von Bestand zu bleiben, denn Nieuwenhuis freundete sich Rex geradezu an.
Eines Abends saßen die beiden Forscher wieder gemeinschaftlich bei der Arbeit, und Rex wollte eben einige Nervenfäden, die einem Affenhirn entstammten, mikroskopisch näher untersuchen, als Nieuwenhuis plötzlich aufsprang und rief: »Doktor! ich bin auf der rechten Spur! In den Windungen des Hirnmittellappens liegt das Zentrum für alles logische Denken.«
Rex sah von seiner mikroskopischen Tatigkeit auf.
»Wie haben Sie das festgestellt?« frug er verwundert.
»Durch elektrische Beeinflussung der betreffenden Nervenenden, die in den Mittellappen münden.«
»Ich begreife aber noch nicht recht, wie Sie aus der Reaktion der Gehirnpartie erkennen können, daß sie der Sitz des Denkvermögens ist,« gab Rex, welcher sich Nieuwenhuis genähert hatte, zur Erwiderung.
Die Erklärung, welche der alte Arzt nun folgen ließ, wirkte auf Rex nicht ganz überzeugend.
»Tote Gehirnmasse kann doch keine Denkfähigkeit mehr äußern?« sagte dann Rex und gab sich keine Mühe seine Zweifel zu verbergen.
»Allerdings nicht ... meine Entdeckung ist auch nur eine Vermutung, könnte aber leicht am lebenden Gehirn nachgewiesen werden.«
»Wem gehörte Ihr Versuchshirn an?« frug Rex.
»Einem Selbstmörder.«
»Interessant ...« versetzte Rex und betrachtete die auf der Glasplatte liegende Hirnmasse, an welcher Nieuwenhuis seine Studien machte. »Was war der Mensch von Beruf?«
»Musiker ... ein sehr befähigter Cellist, wie mir von seinen Angehörigen mitgeteilt wurde.«
»Sie haben dort in den Glastuben noch fünf Gehirne. Es würde mich lebhaft interessieren zu wissen, von welchen Menschen diese entstammen,« sprach Rex weiter und schritt zu dem Tisch hin, auf dem sich die von ihm erwähnten fünf Glastuben befanden.
Nieuwenhuis war an seine Seite getreten und gab ihm nun die gewünschte Auskunft. Beim Ankauf eines Gehirnes orientierte er sich stets peinlich danach, wer der Verstorbene war, wie er befähigt gewesen und woran er gelitten, als ihn der Tod ereilt habe. Er hatte also förmliche Biographien oder besser gesagt Nekrologe in den Händen, um bei der Untersuchung der Hirne wichtige Anhaltspunkte zu haben, die ihm gestatteten, aus dem Befund der Windungen seine Schlüsse zu ziehen.
»Hier haben Sie das Gehirn eines Raubmörders vor sich,« begann Nieuwenhuis und wies mit der Hand auf die erste Glastube. »Ich erwarb es vor einigen Tagen, kurz nach der Hinrichtung. Die Angehörigen des Verbrechers überließen es mir nach einem wahrhaft jüdischen Feilschen. 600 Gulden zahlte ich ... das Hirn ist es aber wert.«
»Wie alt war der Verbrecher?« frug Rex interessiert.
»34 Jahre.«
»Sein Beruf?«
»Färber.«
»Das Studium dieses Gehirnes würde mich sehr interessieren. Vielleicht lassen Sie mich an Ihren Untersuchungen teilnehmen?« sagte Rex.
»Gern. — Übrigens will ich hierbei zum erstenmal einen Versuch machen, die letzten Gedanken dieses Menschen vor seinem Tode zu photographieren.«
Rex schaute Nieuwenhuis verblüfft an. »Gedanken photographieren?« frug er mit einer Miene, die aufs deutlichste besagte, daß er über diese Absicht mehr als erstaunt war.
»Eine neue Idee von mir.«
»Wie, um aller Welt willen, wollen Sie das anfangen? Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit!« Rex sah Nieuwenhuis mit zweifelnden Blicken an.
»Durch langes Studium der menschlichen Gehirne habe ich herausgefunden, daß alles Denken auf der Hirnrinde Grübchen und Furchen hinterläßt, die in ihrer Gesamtheit ein bestimmtes Bild abgeben, ein Bild, wie es etwa die Oberfläche einer Phonographenwalze zeigt. Wie sich auf dieser Töne in Linien- und Wellenform eingraben, so graben sich auf der elastischen Hirnrinde Gedanken in einer ähnlichen Form ein und können diese Eindrücke natürlich photographiert werden.«
»Großartig!« rief Rex voll Ektase. »Wie aber enträtseln Sie diese Hirnhieroglyphen?«
»Den Schlüssel zu dieser Gehirnschrift suche ich zurzeit noch. Leider besitze ich eine noch viel zu geringe Anzahl derartiger Gedankenphotographien, um die, übrigens sehr mühseligen Vergleiche der Linien, Furchen und Grübchen auf der Hirnrinde unternehmen zu können. Um hier zu einem Ziel zu gelangen, werde ich wohl noch etliche Hunderttausende Gulden für Menschenhirne opfern müssen.«
»Wenn ich bedenke, welche Arbeit Ihnen noch bevorsteht, ehe Sie die psychischen Vorgänge auf ihre Ursachen ergründet haben, so fürchte ich, daß Ihre Lebenszeit dazu kaum ausreichen wird,« sagte Rex.
»Sterbe ich über diese Dinge, so setze ich Sie zum Erben meiner Theorie und meiner Ideen ein,« entgegnete lächelnd Nieuwenhuis.
»Ich befürchte, daß auch ich das Ziel nicht erreichen werde, welches uns beiden heute vorschwebt und auf das wir seit Monden zusteuern.«
»Dann freilich bleibt es einem anderen hellen Kopf der Nachwelt überlassen, das Rätsel des Lebens zu lösen,« meinte Nieuwenhuis und schob die zweite Glastube mit ihrem Inhalt vor Rex hin.
»Eine Frage ... Herr Doktor,« sagte jetzt Rex. »Erleiden diese Gehirne hier während der Dauer Ihrer Untersuchungen, die sich doch auf Wochen ausdehnt, keine Veränderungen, die zu Trugschlüssen Veranlassung geben könnten?«
Nieuwenhuis verneinte. »Die Gehirne sind alle präpariert und werden unter völligem Luftabschluß in einem Vakuum aufbewahrt. So erhalten sie sich unverändert eine lange Zeit hindurch.«
»Sie wissen sich doch in allen Fällen zu helfen.«
»Sehen Sie hier,« begann Nieuwenhuis wieder. »Das ist das Gehirn eines ertrunkenen Knaben. Auf die Photographie seiner letzten Gedanken bin ich besonders neugierig.«
»Warum?«
»Nun, es ist doch bekannt, daß Menschen, die am Ertrinken sind, in wenigen Sekunden ganze Zeitläufte ihres Lebens neu durchleben, oder besser ausgedrückt, es ziehen mit blitzartiger Geschwindigkeit Erlebnisse der Vergangenheit in ihrer Erinnerung vorüber, bevor ihnen das Bewußtsein schwindet.«
»Das war mir bisher noch nicht bekannt,« entgegnete Rex.
»Ertrunkene, die wieder zum Leben erweckt worden sind, haben mir dies selbst bestätigt,« versicherte Nieuwenhuis seinem jungen Kollegen.
»Und nun dieses dritte Gehirn — — ?« frug Rex und warf einen Blick auf die nächste Glastube. »Es hat ein so verschiedenes Aussehen zu den anderen Präparaten.«
»Es ist das Hirn eines schwindsüchtig gewesenen Studenten aus Löwen, der mir in Begeisterung für meine Forschungen seinen Kopf vermachte, bevor er seinen letzten Atemzug tat. Dieses Hirn ist für mich das kostbarste meiner Sammlung, da das photographische Bild seiner letzten Gedanken mir den Schlüssel zu den Gedankenhieroglyphen auf der Hirnrinde liefern wird.«
»Warum gerade dieses Hirn?« frug Rex.
»Ich hatte mit dem jungen Manne persönlich die Vereinbarung getroffen, daß er in den allerletzten Augenblicken seines Lebens über etwas nachdenken sollte, was mir bekannt war. Wir einigten uns, daß der Gegenstand seines letzten Denkens ein im Krankenzimmer vorhandener zerbrochener Regenschirm sein sollte. — —«
»Mit einem solchen trivialen Gedanken ist der arme Kerl aus dem Leben geschieden?«
»Er schied freudig aus dem Leben, im Bewußtsein dessen, daß er der Wissenschaft mit seinem frühen Tode einen wichtigen Dienst erweise,« gab Nieuwenhuis zur Erwiderung, und man konnte es dem alten Herrn ansehen, daß er des Toten mit Mitleid gedachte.
Nachdem Nieuwenhuis, wie es den Anschein hatte, still eine Träne im Auge zerdrückt hatte, zog er die vierte Glastube ans Licht.
»Dies hier ist ein sehr interessantes Präparat. Es ist das Hirn eines Mannes, der durch Haschischrauchen zugrunde gegangen ist. Ein seltenes Exemplar. Ich habe es durch einen bekannten Arzt aus Bombay erhalten. Der Verstorben war ein Hindukuli ... 35 Jahre alt und dem Haschischgenuß im stärksten Maße ergeben. Die Photographie seiner Hirnrinde wird ein hochinteressantes Bild geben, da der Betreffende mitten im Haschischrausch aus dem Leben geschieden ist. Der Genuß indischen Hanfes versetzt den Raucher bekanntlich in einen Zustand, in welchem er, der Wirklichkeit für Stunden entrückt, die märchenhaftesten Vorgänge wie in einem Traume durchlebt.«
»Und Sie glauben, daß sich diese paradiesischen Traumbilder auf der Hirnrinde des Hindu eingegraben haben?« frug Rex mit Staunen.
Nieuwenhuis bejahte dies. Dann wendete er sich der letzten Glastube zu, die ein im Umfang kleineres Gehirn barg.
»Das ist doch wohl das Gehirn einer weiblichen Person?« frug der junge Doktor.
»Stimmt. Die Masse ist geringer. Beim Manne wiegt sie durchschnittlich 1400 Gramm, bei der Frau stets 125 Gramm weniger. Auch dieses Hirn ist ebenso interessant wie wertvoll. Es gehörte einer Unglücklichen an, einer Wahnsinnigen. Auch ihre Lebensgeschichte will ich Ihnen erzählen. Sie ist sehr traurig. Die Arme! — — — Sie war eine junge und schöne Frau, verlor ihren Mann und ihre Kinder an einem Tage, darüber verfiel sie in Irrsinn und starb bald darauf.«
»Es erinnert mich dies an einen ähnlichen Fall aus meiner Bekanntschaft,« versetzte Rex mit tiefer Wehmut und blickte auf das Hirn in der Tube so nachdenklich, als berühre ihn die Erinnerung an früher Geschehenes. »Es ist noch gar nicht so lange her ... zwei Monate — — da passierte ein solcher Fall in meiner Heimat. Die Betreffende war meine erste Jugendliebe einst gewesen, hatte sich verheiratet und dann kam das gewaltige Unglück, das ihren Geist umnachtete ... eigentümlich, daß hier ein ähnliches Menschengeschick vorgelegen hat.«
»Der Name der jungen Frau ist mir nur noch im Gedächtnis geblieben,« sagte Nieuwenhuis. »Wenn ich nicht irre, nannte sie sich Karsfeld ...«
Rex stand plötzlich wie vom Schlag gerührt da und starrte Nieuwenhuis entsetzt an. »Karsfeld sagten Sie ... Karsfeld! Herr Doktor!« rief er mit tonloser Stimme. Dann legte er beide Hände vor seine Augen und wandte sich erschüttert ab.
Nieuwenhuis mochte ahnen, daß Rex in jener Person, deren Gehirn hier vor ihm lag, seine einstmalige Geliebte wiedererkannt hatte. Voll Mitleid ruhten seine Augen auf dem schmerzerfüllten Gesicht seines jungen Kollegen, der stumm auf die graue Masse in der Glastube schaute.
»Furchtbar! — — — Elly! So bist du geendet?« murmelte Rex wie geistesabwesend vor sich hin.
Eine geraume Weile war es nun still im Laboratorium. Dann richtete sich Rex auf und erfaßte die Hand des alten Arztes. »Es war meine Jugendgeliebte,« begann er mit umflorter Stimme.
Nieuwenhuis verstand den tiefen Schmerz des Mannes, der hier wie betäubt jene graue Masse anstarrte, in deren Windungen einst die Liebesregungen pulsiert hatten, die ihm — ihm gegolten, und die er erwidert hatte mit der ganzen Glut, deren ein junges Herz fähig war. Dieses kleine graue Häufchen hatten einst Gedanken durchflutet, deren Mittelpunkt er gewesen — — —
»Armer Freund ...« sagte Nieuwenhuis leise zu Rex und drückte ihm teilnehmend die Hand. »Welche Gefühle müssen Sie beherrschen beim Anblick dieser sterblichen Reste ... O hätte ich gewußt, daß Sie der Unglücklichen einst so nahe gestanden, ich hätte geschwiegen — — —«
»Nein ... nein! es war besser so. Ich weiß nun wenigstens, daß sie tot ist, daß sie von ihren Leiden erlöst ist ...« gab Rex tonlos zur Antwort. Dann schwieg er wieder eine kleine Weile.
»Mein lieber Freund, ich ehre Ihren großen Schmerz um die Unglückliche — —« begann Nieuwenhuis mit gedämpfter Stimme. »Nehmen Sie als Beweis dafür diese Tube mit dem für Sie so kostbaren Inhalt von mir als Geschenk an.« Mit diesen Worten schob der alte Arzt das Gefäß, welches das Hirn derjenigen enthielt, die des jungen Gelehrten einzigste Liebe gewesen war, Rex behutsam zu.
Dieser ergriff die beiden Hände des Alten und drückte sie an seine Lippen. »Dank! tausend Dank! Ich werde es bis an meinen Tod bewahren.«
An eine Weiterarbeit für diesen Abend dachte Dr. Rex nicht. Es wäre ihm unmöglich gewesen nach solchem Seelenschmerz. Darum verabschiedete er sich nun. Das kostbare Geschenk sorgfältig verpackt unter dem Arm nehmend, ging der junge Gelehrte fort, und Nieuwenhuis blieb allein zurück.
Draußen schlug die Turmuhr der Peterskirche und verkündete die Mitternachtsstunde.
Die tiefe Stille im Laboratorium wurde ab und zu durch die Geräusche unterbrochen, welche die Tiere in ihren Käfigen verursachten. Nieuwenhuis hing eine geraume Weile noch seinen Gedanken nach, dann erhob er sich, um die Arbeit von neuem aufzunehmen.
Er stellte zunächst die Glastube mit dem Gehirn des indischen Haschischrauchers auf seinen Experimentiertisch, öffnete das Gefäß und hob das Präparat heraus. Alsdann betrachtete er dasselbe lange mit einem scharfen Vergrößerungsglas, wie man solche zuweilen auch zum Lesen feiner Pulverschrift verwendet.
Der Forscher verfolgte mit den Augen die zahllosen Linien und Furchen, welche die Hirnrinde aufwies und die seiner bestimmten Meinung nach Gedankenkurven sein mußten. Sie boten in ihrer Gesamtheit ein unübersehbares Gewirr. Die Phantasie des haschischberauschten Hindus mußte ein gewaltiges Gaukelspiel vollführt haben, so schloß Nieuwenhuis aus dem Relief der Hirnoberfläche, welche die Denksphäre repräsentierte.
Nach der eingehenden okularen Betrachtung begann der Forscher damit, das Gedankenrelief photographisch aufzunehmen. Mit dem Resultat der Aufnahme war Nieuwenhuis überaus befriedigt: er hatte ein Negativbild erhalten, das eine sehr scharfe Mikrophotographie repräsentierte.
Unverzüglich ging er nun weiter daran, auch von der Hirnrinde des schwindsüchtigen Studenten eine vergrößerte Aufnahme zu machen und erzielte zu seinem größten Erstaunen ein Bild, welches nur etliche Furchungen, Linien und Grübchen im Detail aufwies.
Welcher enorme Gegensatz in beiden Bildern!
Das eine zeigte ein Labyrinth von Gedanken, während das andere nahezu gedankenarm erschien.
Nieuwenhuis ergriff das letztere Negativ und fing an die Linien desselben zu beobachten. Des Studenten Gedankenrelief sollte das Vergleichsbild für alle anderen Hirnaufnahmen werden, weshalb dessen Kurven und Gruben mit größter Sorgfalt daraufhin geprüft werden mußten, welche Gedanken sie repräsentierten. Gelang dies, so hatte Nieuwenhuis den gewünschten Hieroglyphenschlüssel für die Gehirnaufzeichnungen in den Händen und ein gewaltiger Fortschritt in der Enträtslung der Seelentätigkeit war getan.
Nieuwenhuis zog nun ein Notizbuch aus seiner Brusttasche und blätterte darin herum. Endlich schien der Forscher das Gesuchte gefunden zu haben. Er las eine von seiner Hand gemachte Notiz und begann dann nachzusinnen. Eine Weile darauf rekapitulierte er, was in der Notiz gestanden hatte: Zerbrochener Regenschirm — steht in der Ecke — nicht mehr verwendbar — brauche auch keinen mehr.
Das sollten nach der Vereinbarung die letzten Gedanken des Studenten sein, bevor ihn das Bewußtsein verließ.
Nieuwenhuis grübelte darüber nach, ob sich die Gedanken wortweise oder sätzeweise aufzeichneten.
Da saß er nun, der modernste aller »Cumberlands« und grübelte und zermarterte sich das eigne Hirn über das anderer. Das Rätsel der menschlichen Psyche schien auch auf diesem einzigen gangbaren Pfade seiner Lösung zu spotten.
Vergeblich kramte der alte Forscher in dem Gedankenfach des in die Ewigkeit eingegangenen Studenten herum, um den Schleier von dem gewaltigen Naturgeheimnis zu lüften. Die »Regenschirmgedanken« des bis zu seinem letzten Atemzug gefällig seienden Todeskandidaten waren nicht zu einem System zu ordnen.
Nieuwenhuis geriet für Momente in eine helle Verzweiflung. Wenn es ihm nicht einmal gelang, die wenigen Gedankenkurven des Studentenhirnes zu entziffern, wie sollte es ihm da möglich sein, in das Gedankenchaos des indischen Haschischrauchers Ordnung zu bringen.
So ging Stunde um Stunde dahin, und als es auf der Petrikirche vier Uhr schlug, übermannte den alten Forscher eine große Müdigkeit. Wenige Augenblicke später versank er dann in einen tiefen Schlaf — — —
Im Traum tanzten Legionen Gedankenhieroglyphen als Stäbchen und Punktgebilde um ihn herum, und die Geister der Toten, deren Gehirne er in seinen Glaskäfigen verwahrte, forderten von ihm ihr Leben wieder.
Und in bleichem Schimmer sah er im Dunst unendlicher Ferne die Worte erglänzen: Das Rätsel des Lebens! Sterblicher, du löst es nicht!
Dann versank alles um ihn in tiefste Nacht, das Trugspiel seiner im Schlafe noch erhitzten Phantasie erstarb — — —
Wieder war der Winter ins Land gezogen, und dichte weiße Flocken wirbelten auf Dächer und Straßen nieder. Unter der Schneelast bogen sich die Zweige der Bäume und Sträucher, und wenn sich ein Sonnenstrahl einmal durch die tief hängenden Wolken stahl, so flimmerten und glitzerten ringsum Myriaden von Schneekristallen.
Just so hatte auch der Winter im vorigen Jahre fast zur selben Zeit sein Regiment angetreten, damals, als man den Mynheer Steen unter dem Glockengeläute der Hooglandschen Kirche in Leiden zu Grabe trug.
In dem Hause an der Lakengracht, an dessen Tür das jetzt von einer Schicht Grünspan überzogene Messingschild mit der kaum leserlichen Aufschrift: Dr. Nieuwenhuis sich befand, war es seit einigen Wochen gänzlich still geworden. Die geschäftige Haushälterin, Frau Dorothee, hatte bei dem immer »schnurriger« und ungemütlicher werdenden, bis zur Unerträglichkeit überreizten Doktor den Dienst quittiert und den Alten seinem Schicksal überlassen. Auch der junge Gelehrte Dr. Rex war mit der Zeit fortgeblieben, da er allmählich eingesehen hatte, daß die Pfade, welche der alte Grübler wandelte, um das Problem des Lebens zu lösen, in die Unendlichkeit führten.
So saß Nieuwenhuis völlig verwaist in seiner Klause, keine Menschenseele kümmerte sich um ihn, und die Folge davon war, daß er zum Misanthropen und Einsiedler wurde. Noch immer hockte er nächtlicherweile in seinem Laboratorium und grübelte über die Hirnhieroglyphen nach. Er grübelte unausgesetzt — bis er sich um seinen Verstand gegrübelt hatte.
An einem trüben Januarmorgen führte der Weg den jungen Meermann am Hause des Alten vorbei. Da er diesen lange nicht besucht hatte, so faßte er kurzerhand den Entschluß dazu, dies jetzt zu tun.
Er schritt die wenigen Stufen hinauf, die zur Tür des Hauses führten, klingelte und harrte nun eine geraume Weile, daß geöffnet werde.
Nichts im Hause regte sich. Meermann drückte mit der Hand auf die Klinke und die Tür ging auf. Etwas zögernd trat er in den Flur hinein, dann schritt er die Stufen zum ersten Stockwerk hinauf, wo, wie ihm bekannt, Nieuwenhuis sein Laboratorium liegen hatte.
Da im ganzen Hause kein Laut vernehmbar war, wurde Meermann stutzig. Eine Weile horchte er, dann ging er auf die Tür zu, welche in das Laboratorium führte.
Er klopfte erst leise, dann noch einmal etwas stärker an.
Von drinnen heraus vernahm er jetzt ein Geräusch. Der junge Kaufmann drückte auf die Klinke und öffnete die Tür. Sein Blick fiel in das Gemach, in welchem trotz des Tageslichtes drei Gasflammen brannten. Hier bot sich ihm nun ein seltsames Bild. Der alte Nieuwenhuis saß an seinem Experimentiertisch und vor ihm hockte der Affe Joko.
Meermann blieb auf der Schwelle stehen und sagte mit vernehmlicher Stimme: »Guten Morgen, Herr Doktor!«
Zu seiner Verwunderung erwiderte der Angeredete den Gruß nicht, noch nahm er sonst von dem Besucher irgendwelche Notiz. Er begann vielmehr dem Affen einen Vortrag zu halten, wobei er an einem Hirnpräparat hantierte.
Meermann wurde es jetzt unheimlich zumute. Er hörte den Alten allerlei verwirrtes Zeug reden. Noch einmal wagte er Nieuwenhuis beim Namen zu rufen.
Der alte Doktor wendete darauf den Kopf langsam um und sah Meermann mit stieren Augen an, ohne ihn zu erkennen oder über die Ankunft des Besuchers erfreut zu sein.
»Ah! Doktor, es ist gut, daß Sie kommen,« begann dann Nieuwenhuis in einem schleppenden Tone zu Sprechen, während seine Augen gläsern und ausdruckslos Meermann ansahen. »Eben habe ich das Rätsel des Lebens gelöst ... die Menschen werden mir eine Krone aufsetzen, eine goldene Krone —«
Zu Tode erschrocken erkannte jetzt Meermann, daß Nieuwenhuis den Verstand verloren hatte. — — Was sollte er tun? — —
»Herr Doktor!« rief er voll Angst dem Alten zu. »Sie sind krank!«
»Ja ... das Lebensrätsel war eine harte Nuß, Doktor ...« fuhr halblaut Nieuwenhuis fort. »Mit dem Regenschirm meines armen Studenten habe ich sie aber aufgeschlagen ... und der Schirm ist dabei — — — zerbrochen ...«
Starr richtete der Wahnsinnige seine Augen auf Meermann, dann rief er. »Ach! Sie sind es, Herr Bischof! — — — Die Millionen sind nun alle —« Bei diesen Worten schritt Nieuwenhuis auf den jungen Kaufherrn zu. Dieser schlug aber voll Entsetzen die Tür hinter sich ins Schloß und stürzte wie betäubt von den Dingen, die er gesehen, die Treppe hinab. Er alarmierte sogleich die Polizei und Sanitätswache, und dann, als er seine Pflicht getan, eilte er nach Hause, um dort das Schreckliche zur Kenntnis seiner Angehörigen zu bringen.
Meermann sen. murmelte, nachdem er alles erfahren hatte, vor sich hin: »So und nicht anders mußte es einmal kommen. Das Lebensrätsel hat ihn um seinen Verstand gebracht ... ja, ja! unser Herrgott läßt sich nicht ins Handwerk pfuschen ...«
Am folgenden Tage flatterte die Nachricht durch fast alle Zeitungen des europäischen Kontinents, daß der bekannte Forscher und Phantast Dr. Nieuwenhuis durch andauerndes Grübeln irrsinnig geworden und in die Landesirrenanstalt untergebracht worden sei.
So ist denn bis zum heutigen Tage das gewaltige Rätsel des Lebens ungelöst geblieben und wird es auch in aller Zukunft bleiben.
Fred W. Hamilton. [Pseudonym, = Oskar Hoffmann]
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.