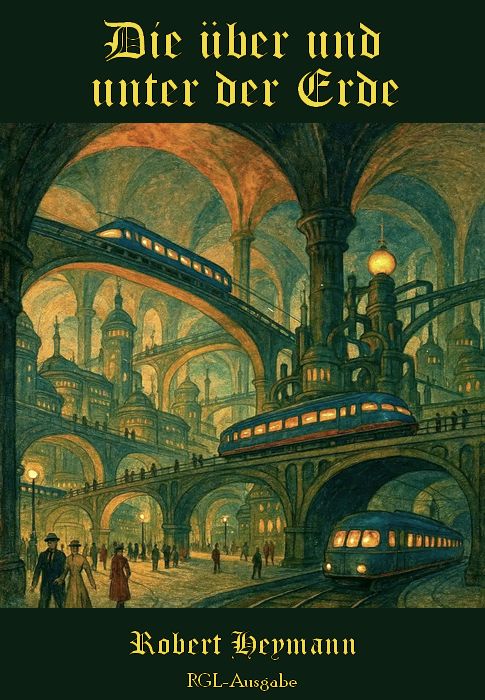
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.
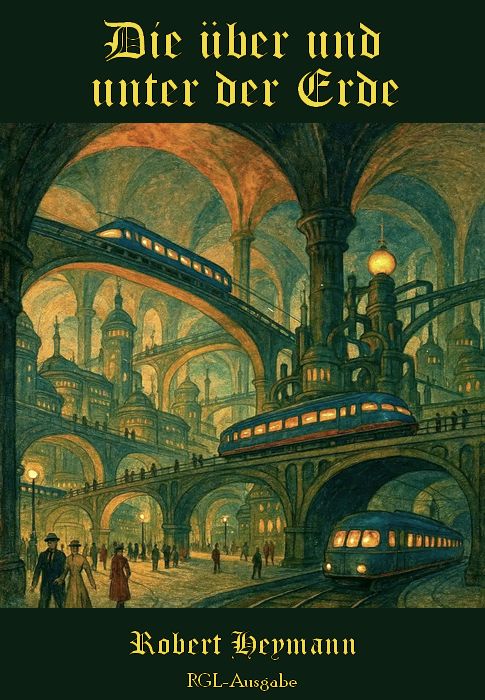
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software


Fotografie von Robert Heymann aus Band 1 der Originalausgabe.

Unschlagseite 4 der vier Originalausgaben.
Band 5 und 6 sind nie erschienen.

Umschlagseite 1 des Bandes 3 der Originalausgabe
mit einer Zeichnung von Julius Schlattmann.

Seite 1 (unpaginiert) des Bandes 3 der Originalausgabe.
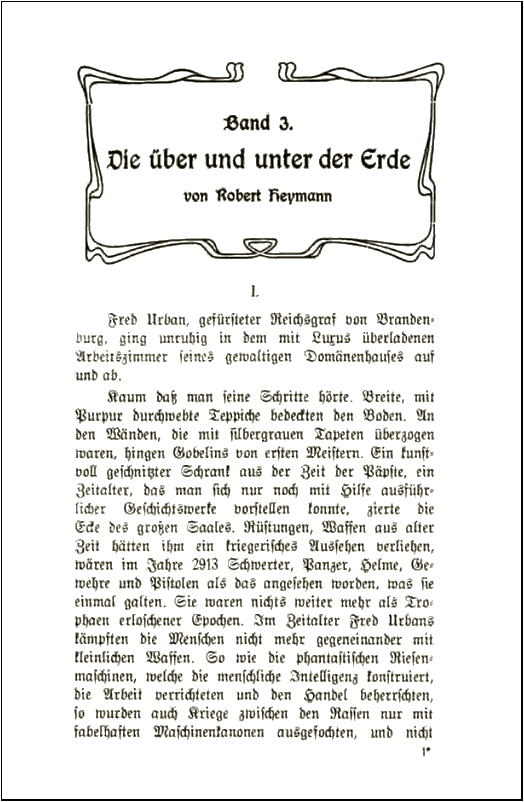
Seite 3 (unpaginiert) des Bandes 3 der Originalausgabe.
Die moderne Zeit hat neben neuen ethischen und sozialen Werten eine eigene Art geistiger Tätigkeit geschaffen. Der Gedanke der im wirren Trubel der Tageskämpfe erstarkten Realisten findet keine Befriedigung mehr in stiller Muße sonntäglicher Familienlektüre. Der Geist fliegt mit der Zeit; und wie alle Ideen ihrer Verwirklichung vorauseilen, in der Technik, der Industrie, dem Handel und der Politik, so auch in der Literatur. Düstere Probleme sind aufgeworfen worden. Das Grauen kroch in die Illusionen mit der Aussicht ins Unfassbare und doch Geahnte. Wohin?, heißt die Losung der Generation, die prüfend den Blick in eine von goldenen Verheißungen klingende Zukunft richtet. Man spekuliert und sinnt und schmiedet Hypothesen...
N u n w o h l ; h i e r h a b t i h r e i n B u c h d e r Z u k u n f t !
Es war mir nicht darum zu tun, Jules Vernes unzeitgemäßer Epigone zu sein. Nicht ein neues Buch zu denen wollte ich legen, die in phantastischen, kokettierenden Sentenzen das Gruseln des Backfisches suchen.
E. A. P o e, d e r g r o ß e A m e ri k a n er, w a r m e i n Z i e l.
Die metaphysische Ahnung unserer Seele, ihre hellseherischen Hoffnungen und ihre Furcht, bizarre Launen nächtlich grauenvoller Träume, mathematisch sezierte Hypothesen riesenhafter Erwartungen — dies, das nur Empfundene, nie Versagte, Vorausgelebte wollte ich geben. Was Poe andeutete; was seine Zeit verlachte; was wir heute suchen; was wir wünschen und fürchten — hier lege ich es vor euch hin.
Doch keine Sorge. Ich wollte euch nicht mit wissenschaftlichem Witz langweilen. Wer nur zu lesen sucht, der lese. Wer aber hinüberträumen will in die funkelnde Zukunft, in jene Zeit der Erfüllung — oder der letzten Enttäuschung? — leuchtender Kulturen, in die letzte Dimension menschlich-göttlicher Spekulationen der unmöglichen Wahrscheinlichkeiten, der möge mir folgen auf dem Wege durch tausend Jahre. Eine lange Straße, doch ich hoffe, sie ermüdet nicht.
Der Verfasser
Fred Urban, gefürsteter Reichsgraf von Brandenburg, ging unruhig in dem mit Luxus überladenen Arbeitszimmer seines gewaltigen Domänenhauses auf und ab.
Kaum dass man seine Schritte hörte. Breite, mit Purpur durchwebte Teppiche bedeckten den Boden. An den Wänden, die mit silbergrauen Tapeten überzogen waren, hingen Gobelins von ersten Meistern. Ein kunstvoll geschnitzter Schrank aus der Zeit der Päpste, ein Zeitalter, das man sich nur noch mit Hilfe ausführlicher Geschichtswerke vorstellen konnte, zierte die Ecke des großen Saales. Rüstungen, Waffen aus alter Zeit hätten ihm ein kriegerisches Aussehen verliehen, wären im Jahre 2913 Schwerter, Panzer, Helme, Gewehre und Pistolen als das angesehen worden, was sie einmal galten. Sie waren nichts weiter mehr als Trophäen erloschener Epochen. Im Zeitalter Fred Urbans kämpften die Menschen nicht mehr gegeneinander mit kleinlichen Waffen. So wie die phantastischen Riesenmaschinen, welche die menschliche Intelligenz konstruiert, die Arbeit verrichteten und den Handel beherrschten, so wurden auch Kriege zwischen den Rassen nur mit fabelhaften Maschinenkanonen ausgefochten, und nicht der persönliche Mut, nicht die Anzahl der Soldaten entschied mehr einen Kampf, sondern die Qualität der Explosivgeschosse, die Kraft der Maschinen und bestenfalls noch die Intelligenz der Führer. Aber seit Menschengedenken hatte man keinen Krieg mehr gekannt. Der letzte war zwischen der weißen und gelben Rasse ausgefochten worden. Wäre das Schlachtfeld nicht so weitab von China und Japan gelegen, so würde vielleicht der Ausgang für Deutschland zweifelhaft gewesen sein, denn die germanische und romanische Rasse waren erschöpft von den Arbeiten einer Kultur, die eine geradezu schwindelnde Höhe erreicht hatte.
Amerika aber hatte immer noch an dem Schutz- und Trutzbündnis mit der gelben Rasse festgehalten, um seine eigenen Vorteile daraus zu ziehen, ohne zu ahnen, dass die Zeit nicht allzu fern mehr war, wo zwischen Japan und China einerseits und Amerika andererseits der Kampf um die Daseinsberechtigung ausgefochten werden sollte.
Als Fred Urban vor den alten Waffen stehen blieb, gingen ihm wohl diese und ähnliche Gedanken durch den Kopf. Er mochte bedenken, dass, wenn es Japan und China noch einmal einfallen würde, ihre riesigen Kriegsschiffe gegen die deutsche und englische Flotte zu schicken, die drei europäischen Westvölker: Deutschland, England und Frankreich, jedenfalls unterliegen würden, und dass damit eine Kultur von mehr als 5000 Jahren vernichtet wäre. Nur an der Unmöglichkeit, sich schnell zu verproviantieren, war die japanische Kriegskunst bis jetzt gescheitert.
Die Gedanken des Reichsgrafen aber wanderten schnell. Seine Augen blieben an einem Gemälde haften, das die Mittelwand des Saales füllte.
Es stellte eine junge Frau von etwa sechsundzwanzig Jahren vor. Sie war von jener ätherischen Schönheit, die die Frauen zu Ende des dritten Jahrtausends alle auszeichnete. Schlank, graziös, zierlich wie eine Lilie wuchs der feingliedrige Körper empor, an dem weißseidene Gewebe duftig herabflossen. Der Kopf war klein, das Gesicht von unbeschreiblicher Anmut und Würde. Dabei hätte sich aber doch ein Mensch früherer Jahrhunderte nicht des Empfindens erwehren können, dass sich in diesen Zügen eine tiefe Krankheit spiegelte, die umso peinlicher und mystischer berührte, als sich wohl kein Ausdruck für sie finden ließ. In Wahrheit litten im dritten Jahrtausend die Menschen über der Erde an einem Verfall, den keine ärztliche Kunst aufhalten konnte.
Sie waren eigenartige Wesen geworden. Die Männer hatten noch eher ihren kraftvollen Wuchs und die Stärke ihrer Nerven bewahrt. In dem erbitterten Kampfe der Konkurrenz, in dem hastigen Wettstreit, der seit Jahrhunderten die Völker fieberhaft rivalisieren ließ, hatten sie es verstanden, neben den psychischen Eigenschaften und Vorzügen auch den physischen ihre Aufmerksamkeit zu schenken.
Nicht so die Frauen, die nach einem kurzen, vorübergehenden Aufschwung, während welchem sie versucht hatten, dieselbe Stellung wie der Mann zu erringen, wieder auf ihre reine Naturbestimmung zurückgekommen waren. Sie hatten sich im Laufe der Jahrhunderte unter dem Einfluss der Mode und einer raffinierten, aber unzweckmäßigen Körperpflege zu Wesen entwickelt, die so zierlich und fein waren, dass sie in Wahrheit zerbrechlich erschienen.
Hatten ehedem große Naturhistoriker eine Parallele zwischen Menschen und Tieren festgestellt, so schienen jetzt die ursprünglichen Erscheinungen des Lebens, aus denen die Schönheit sich entwickelt, wieder zutage zu treten; die Übertreibungen, in denen sich einmal die Dichter gefallen hatten, wurden Wahrheiten: Die Frauen des dritten Jahrtausends glichen in der Tat den Blumen, so zart und duftig waren sie, und kurz war auch die Blütezeit, die ihnen gegeben war. Kein Wunder also, dass die Männer, von doppelter Leidenschaft zu diesen zarten Wesen erfüllt, sie mit grenzenloser Hingebung liebten.
Und doch war es durchaus nicht Liebe, was aus dem Blicke des etwa Fünfzigjährigen sprach. Er besaß ein eigenartiges Auge, ein Auge, in das noch niemand zu blicken gewagt, in dem sich der Wille, die Kraft von vielen starken Generationen gesammelt hatte. Sein blasses Gesicht umrahmte ein rötlicher, wohl gepflegter Vollbart, der den unsympathischen Eindruck, den die aufgeworfenen Lippen erweckten, milderte.
Nachdem Fred Urban das Bild der jungen Frau eine Weile schweigend betrachtet hatte, kräuselte diese Lippen ein beinahe höhnisches Lächeln.
»Ja, die unter uns werden einmal das Erbe antreten!«, murmelte er. »Und nicht die Männer werden es sein, die uns erobern, sondern die Frauen!«
Und er setzte seinen Rundgang fort, ihn teilweise durch geheimnisvolle Selbstgespräche unterbrechend, bis ganz leise ein Gong ertönte und ein malaiischer Diener eintrat.
»Herr, die Uhr ist sieben.«
Der Reichsgraf nickte. Es war die Zeit, wo er die riesigen Fabrikanlagen zu inspizieren pflegte. Er war nicht nur einer der einflussreichsten Männer Deutschlands, sondern auch der reichste, und hatte vielleicht nur dem letzteren Grunde den Fürstentitel zu verdanken. Die Zeiten waren vorbei, wo Geburt, Tradition oder Gewohnheit die Menschen auszeichneten. Die eigene Kraft, die nur ihren Sitz in der Intelligenz haben konnte, entschied für die Zukunft eines jeden.
So war Fred Urban, der von seinem Vater einen kleinen Teil der riesigen Besitzungen unter der Erde geerbt, aufgestiegen von Stufe zu Stufe. Mit zwanzig Jahren im Parlament, mit dreißig im großen königlichen Rat, mit vierzig Minister und mit fünfzig Kronrat. — —
Er verließ den prachtvollen Saal und schritt durch eine Reihe von Gängen, die mit Mosaik eingelegt waren. Zitterndes Purpurlicht umkoste die Wände. Schließlich betrat er eine Art Coupé, dessen Schlag der malaiische Diener weit geöffnet hatte.
»Wohin wünschen Sie zu fahren, Herr?« Fred Urban sann nach.
»Wo befindet sich mein Sohn?«
»Der Herr Reichsrat dürfte gerade die Arbeitsmaschinen inspizieren.«
»Gut. Ich will wieder einmal eine ausführliche Kontrolle vornehmen. Ich werde von unten anfangen und dann nach oben gehen. Also siebenundzwanzigstes Stockwerk nach unten!«
Für einen Menschen, der den Anfang des dritten Jahrtausends noch nicht erlebt hatte, hätte die Möglichkeit, dass die Menschheit sogar das Innere der Erde erobern und für ihre Zwecke ausnutzen würde, etwas durchaus Fabelhaftes, vielleicht geradezu Lächerliches an sich gehabt.
Und doch hatte sich das ganze Leben in gigantischer Weise verändert. Zwei große Klassen kannte die Menschheit des dritten Jahrtausends, und man konnte sie kurzweg folgendermaßen charakterisieren:
D i e ü b e r u n d d i e u n t e r d e r E r d e .
Die über der Erde, das waren die Regierenden, die Herrschenden, die, welche sich durch Ansammlung unermesslicher Reichtümer zu Herren emporgeschwungen hatten. Die wohnten über der Erde mit ihrem ganzen großen Stabe; letzterer setzte sich wieder aus denen zusammen, die im engen Kreise des Reichtums schafften, die Beamten, die Männer der Intelligenz, alle, die im Bannkreise der Gehirne standen. Sie besaßen Häuser, die teilweise bis in die Wolken hineinragten. Sie genossen alles, was die Erde an Schönheiten im dritten Jahrtausend zu spenden vermochte: blendendes Licht, kristallklare Luft, Freiheit der Bewegung, kurz, alles das, was den Menschen, die in früheren Zeiten kunterbunt zusammen mit den Sklaven der Arbeit hatten leben müssen, erstrebenswert erschienen war.
Kein Ruß, kein Rauch verdunkelte die Luft. Kein Nebel senkte sich mehr über Berlin. Alles, was zur großen Armee der Arbeit gehörte, war verbannt worden seit mehr als vier Jahrhunderten, unter der Erde zu leben.
Hatte sich noch vor einem halben Jahrtausend der gesamte Verkehr teils auf, teils über den Straßen abgespielt, hatte die Hauptstadt noch vor nicht gar zu langer Zeit ein Riesenspinngewebe von Aluminiumschienen überspannt, wo die elektrischen Bahnen in schwindelnder Eile dahinsausten, so wölbte sich jetzt über den Häusern, deren Zinnen und Türme hängende Gärten zierten, nur der Äther.
Der Gesamtverkehr Berlins dagegen spielte sich unter dem Boden ab. Nicht weniger als dreißig Etappen tief konnte man bis ins Innere der Erde hinabsteigen. Jede dieser Etappen schlang ihre dunklen Arme rund um ganz Berlin und zog sich enger und enger schneckenartig zusammen, sodass schließlich in der Mitte unter der Hauptstadt, wo vor vielen Jahrhunderten Castans Panoptikum gestanden, ein Zentrum war.
Hier befanden sich die Riesenbahnhöfe, von denen aus man nach jedem beliebigen Punkte der unterirdischen Stadt gelangen konnte, indem man entweder die elektrische Rundbahn oder die Tiefbahn benutzte, die, liftartig gebaut, die Strecke von dreißig unterirdischen Vierteln in der Tiefe, die einer Entfernung von fünf Kilometern gleichkam, in sechzig Minuten durchmaß.
Fred Urban war also in die dreißigste Tiefe gefahren. Seine Riesenfabrik bildete nur einen kleinen Teil der unheimlichen unterirdischen Stadt, kaum ein Tausendstel. Denn außer ihm gab es noch Hunderte von reichen Fabrikkönigen in Berlin, und ein großer Teil dieser modernen Katakomben war ausgefüllt von Verkehrsanlagen, von den Häusern der Arbeiter, von Schulen, Krankenhäusern, Konsumanstalten, Bädern und Kirchen.
Der Lift, in dem Fred Urban seine Fahrt angetreten hatte, hielt. Er trat aus dem Coupé und stieg etwa zehn Stufen hinab, begleitet von seinem Diener, der in der Tiefe seines Rockes stets mehrere jener kleinen Sprengbomben verbarg, die, nach malaiischer Art geschleudert, imstande waren, tausend Menschen zusammen in Schach zu halten, denn ihre Explosivkraft war entsetzlich.
Es war nicht ganz ungefährlich, unter die zu gehen, welche das Erdinnere bewohnten.
Die Sklaven der Arbeit murrten seit Jahrhunderten.
Während Fred Urban, der Herr, durch die Riesenhöfe schritt, wo sich die Beleuchtungsanlagen für die Fabrik befanden, tauchte da und dort aus den Schatten, die zwischen den von elektrischen Strömen durchleuchteten Höfen lagen, eine dunkle, massige Gestalt auf. Die Männer der Tiefe waren robust, groß und breitschultrig. Unterschieden sie sich auf diese Weise schon von denen über der Erde, so wurde der Abstand noch größer durch die eigenartige Gesichtsbildung, welche der jahrhundertelange Aufenthalt in den Tiefen hervorgerufen hatte.
Sie waren nicht mehr weiß zu nennen; eine graue Schicht schien die Wangen zu bedecken. Jene Farbe, die die Urerde gehabt, hatte sich den Sklaven der Arbeit mitgeteilt, und man konnte sie so eher mit jener der ausgestorbenen Rasse der Neger vergleichen als mit der der Germanen.
Dazu hatten sie weißliche Haare und seltsame grünliche Augen, Augen, die durch die Dunkelheit dringen konnten, und die, wenn die elektrischen Lichter teilweise erloschen, wie Smaragde schimmerten.
Fred Urban schritt, unter den halbgeschlossenen Lidern alles überblickend, durch die Brandhöfe, an den Wasserleitungsanlagen vorbei, über eiserne Brücken, die mit Riesengläsern eingedeckt waren, durch Tunnel, welche die Brandmauern mitsammen verbanden.
Er inspizierte die ausgedehnte Glühlichtbeleuchtung und die Dampfheizung, durch welche sämtliche Fabrikräume warmgehalten wurden. Sie kostete ihn am wenigsten, denn hier unten herrschte eine bedeutend wärmere Temperatur als oben. Die Fabrikfeuerwehr stand salutierend vor ihrem umfangreichen Wachlokal, als der Herr, der über mehr als siebzigtausend Arbeiter befahl, vorüberschritt. Nachdem er über eine große Zufahrtsstraße hinweggegangen, erreichte er die Riesenwasserwerke und Kühlanlagen. Einen Kilometer höher lagen die eigentlichen Fabrikgebäude, die eine Stadt für sich bedeuteten. Es wäre unmöglich gewesen, sie in kurzer Zeit zu durchmessen. Man gelangte durch einen festungsartigen Haupteingang, der von bewaffneten Portiers bewacht wurde, in die eigentlichen Fabrikhöfe. Alle Öffnungen der starken Mauer, die die Fabrik umgab, waren durch Rohglastafeln abgeschlossen. Da dehnten sich endlos die Maschinen, die Schlosser, Schmiede- und alle anderen Werkstätten aus, die Lagerräume, in denen die gefährlichen brennbaren Stoffe aufbewahrt wurden, und die Büros.
Wieder fuhr Fred Urban einen Kilometer höher, indem er mehrere Etagen übersprang.
Auf einem großen Zugang, der in die Triebwerke führte, trat ihm ein junger Mann von etwa fünfundzwanzig Jahren entgegen, der eine unleugbare Ähnlichkeit mit Fred Urban besaß. Es war Wolf, sein Sohn.
»Alles in Ordnung?«, fragte Fred Urban kurz, Wolf durch einen Händedruck begrüßend. Die Männer verstanden sich und hingen mit zärtlicher Liebe aneinander.
»Ja, Vater. Ich habe befohlen, dass demnächst leichtere Triebwerke konstruiert werden. Wir sind imstande, diese bedeutend schneller laufen zu lassen als die bisherigen, wodurch sie weit weniger von der auf sie übertragenen Energie beansprucht werden. Ich glaube, in ein paar Jahren sind wir so weit, die amerikanische Konkurrenz im nächsten Wettbewerb wenigstens um eine Nasenlänge schlagen zu können!«
Fred Urban nickte. Ein Stab von Ingenieuren und Betriebsleitern scharte sich um die beiden Männer und folgte ihnen. Sie schritten an riesenhaften Maschinen vorüber, die ihre zackigen Räder in drohenden, mysteriösen Umrissen hineinreckten in das Meer von blendendem Licht, das alle unterirdischen Räume erfüllte. Da waren ungeheure Metallbearbeitungsmaschinen, die bis zu zweihundert Umdrehungen in der Minute machten, Holzbearbeitungsmaschinen mit vierhundert, solche für Baumwollspinnereien mit fünfhundert Umdrehungen in der Minute. Die Königswellen lagen in fest vermauerten Schächten, um Feuergefahr zu verhüten. Elektromotoren, deren Anlage ein ganzes Viertel beanspruchte, sorgten für die Kraft, die diese Rieseneinrichtung benötigte.
Vater und Sohn statteten noch den Transportanlagen einen Besuch ab und fuhren dann zum letzten Teil der Anlagen, um die Betriebskraft zu inspizieren. Dort befand sich eine Art Riesenbassin mit elektrischen Kraftwellen, die durch dicke Gummischleusen reguliert werden konnten.
Hier waren mehrere hundert Arbeiter zu gleicher Zeit tätig, darunter viele Frauen. Fred Urban wollte dem Sohne, der den Platz schon wieder verlassen hatte, folgen, nachdem er einen gleichgültigen Blick über die Arbeiter geworfen, als sein Auge plötzlich auf eine Arbeiterin fiel.
Am Ende des Hofes, dem letzten Ausläufer der elektrischen Station gegenüber, arbeitete ein junges Weib. Sie mochte siebzehn Jahre zählen und besaß ganz und gar die Eigenheiten der Rasse unter der Erde. Sie war groß, von kräftigem Körperbau. Die erdgraue Farbe, welche die Wangen der anderen bedeckte, war bei ihr nur in einem fahlen Schimmer sichtbar, sodass sie aussah wie ehedem die Kreolinnen, was ihr in den Augen Fred Urbans einen besonderen Reiz verlieh. Das weißblonde Haar hob sich schimmernd von diesem Teint ab. Es war dicht und schwer und hing in einem breiten Knoten über den kräftigen Nacken. Da sie im Schatten stand, so funkelten ihre grünen Augen unheimlich faszinierend, geheimnisvoll. Ein herausforderndes Lächeln lag auf ihren Lippen, als ihr Blick Fred Urban, den Herrn, traf.
Er war einen Moment ganz befangen; gebannt blieb er stehen. Sie war die Erste, die seinen Blick ertrug. Er trat auf sie zu.
»Wer bist du?«
»Ich heiße Clea!«
»Clea — das ist eigentlich kein Name, wie sie bei denen hier unten gebräuchlich sind. Wer nennt dich so?«
»Friedrich hat mich so getauft, Herr! Er behauptet, der Name wäre viel schöner als alle anderen. Es müsste nicht jede Liese oder Grete oder Maria heißen.«
Dabei lachte sie und stemmte die Hände in die Hüften. Das Blut stieg langsam in Fred Urbans weißliches Gesicht.
»Wer ist Friedrich?«
»Friedrich ist mein Mann!«
»Wie, du hast einen Mann? Wo ist er? Zeige ihn mir!«
Der Fürst hatte die Worte hastig hervorgestoßen.
Er bemerkte das eigenartige Lächeln nicht, das über Cleas Gesicht huschte. Sie war gewiss nicht schön nach den Begriffen von denen da oben. Es lag etwas ganz Fremdes in ihrem Gesicht, das herb und kräftig geschnitten war. Aber der Eindruck, den sie auf Fred Urban machte, war gleichwohl begreiflich. Es ging etwas Faszinierendes von ihrer gesunden Sinnlichkeit aus, und ihre grünen Augen schimmerten noch viel intensiver als die ihrer Schwestern. Sie hob den Arm und wies nach der Station hinüber, wo ein muskulöser, untersetzter Mann mit einem Stiernacken an einem Hebel stand.
Er hob ihn mit Riesenkräften empor und ließ ihn wieder fallen und hob ihn wieder empor und ließ ihn wieder fallen, offenbar, um die Triebkraft einer Maschine zu probieren. Wenn er die schwere Eisenstange wuchtete, dann spannten sich seine Muskeln an, dass sie wie rotleuchtende Kugeln aus den grauen Armen hervortraten. Alle Sehnen des nackten Oberkörpers entfalteten ihre Kraft und zogen sich zusammen, dass der Leib sekundenlang wie aus Erz gegossen schien, ein Monstrum, das weit eher an die Körperkonstruktion eines Tieres als an die eines Menschen erinnerte. Clea mochte erwarten, dass Fred Urban, der Herr, zu Friedrich hinübergehen würde. Sie sah ihn erwartungsvoll an. Aber Fred Urban war das letzte Glied einer zur höchsten Vollkommenheit gelangten Generation. In seine stahlharten Augen war ein Wille eingespannt, der alles übertraf, was man bis jetzt in dieser Beziehung Wunderbares gesehen hatte. Er hob nur die Lider und sah hinüber zu dem Arbeiter. Sein Blick klammerte sich an diesen nackten Stiernacken, über den das weiße Licht der Lampen zitterte, und augenblicklich drehte Friedrich den Kopf.
Cleas Gesicht nahm einen verwunderten Ausdruck an.
»Wie eigentümlich!«, sagte sie. »Es ist, als ob er es gemerkt hätte, dass Sie sich für ihn interessieren, Herr!«
Fred Urban lachte kurz. Nicht vor seinem König hätte er das seltsame Gefühl empfunden, welches ihn in Gegenwart dieses Weibes, das nichts weiter für ihn war als eine Sklavin, übermannte.
»Er musste sich umsehen!«, sagte er. »Er musste, weil ich es wollte!«
Dabei sah er wieder dem Weibe in die grünlich schimmernden Augen. Aber in deren Tiefe lag etwas, das selbst Fred Urbans gigantischen Willen schwächte. Woher kam das? Was war das für eine Macht, die sich auf dem opalfarbigen Grunde dieser Augen konzentrierte, dass sein Wille sich daran zersplitterte?
Sie zeigte zwischen den Lippen, die wie Korallen glühten, die machtvollen weißen Zähne.
»Ihr könnt alles, was Ihr wollt, Herr?«
Er nickte und sah wieder zu dem Arbeiter hinüber. Der ließ die langen Arme schlaff an dem untersetzten Körper herabsinken und starrte den Herrn mit verblödeten Augen an.
»Wie er mich hasst!«, murmelte Fred Urban, während er dabei eine heimliche Freude empfand. Er kreuzte die Arme und sah, ohne auf den halb neugierigen, halb furchtsamen Ausdruck Cleas zu achten, unentwegt zu Friedrich, dem Arbeitssklaven, hinüber. Sein Blick bohrte sich in dessen Auge, und Clea merkte deutlich, wie Friedrich zu zittern begann. Aber Fred Urban ließ sein Opfer nicht locker. Sein Blick krallte sich förmlich in den des andern ein.
Schließlich beugte Friedrich den Kopf, und sein Auge glitt hilflos zu dem Weibe hinüber. Die war plötzlich vorgestürzt und hatte den Arm erhoben; ihr Lächeln war verschwunden.
»Was tut Ihr, Herr? Friedrich ist mein Mann! Ich dulde nicht, dass ihm ein Leid geschieht!«
Ein furchtbares Lächeln kräuselte die aufgeworfenen Lippen des Eisenkönigs.
»So? Ihr duldet's nicht? Nun, wenn Ihr mir aber gefielet?«
Sie lächelte.
»Ich? Ich gehöre doch zu denen hier unten, und Ihr, Herr, seid einer von denen da oben! Seit Jahrhunderten hat man nicht gehört, dass eine Gemeinschaft bestanden hätte zwischen denen da oben und denen da unten! Ihr habt doch Frauen genug da oben, die Euch gefallen können!«
»Schweig!«, sagte der Fabrikkönig zornig. Er wollte noch etwas hinzusetzen, aber er konnte nicht. Das grüne Auge Cleas ruhte groß auf dem seinen, und da war es wieder zu Ende mit seinem Willen.
Er schüttelte sich und wollte gehen. Plötzlich aber blieb er wieder stehen, drehte sich um und sagte:
»Ich glaube, du könntest die Sonne gar nicht vertragen! Ich habe noch nie gesehen, dass jemand mit grünen Augen in ihren goldenen Grund blicken kann!«
»Meint Ihr, Herr? Ach, Ihr täuscht Euch!« Sie hob die Arme in die Luft und dehnte und reckte sich, dass der wundervolle Leib, der über der Brust frei war von jeder Hülle, emporzuwachsen schien und seine kräftigen Formen plastisch hervortraten. »Ah, Herr, was wisst Ihr von unserer Sehnsucht? Nicht in die Sonne sehen? Seit ich geboren bin, seit ich hier unten umherlaufe, ewig zwischen Nacht und Finsternis, die nur unterbrochen wird von diesem schrecklichen Licht, das das Herz frisst, seitdem sehne ich mich bis zum Wahnsinn einmal nach oben! Kann die Sonne etwas anderes sein als die Lichter, die wir hier haben? Ja und nein, nicht wahr? Sie ist ein Riesenball, dessen Licht nicht weh tut, das sich kosend und wärmend über uns breitet und alles in Gold taucht, in Glut, Schimmer und Purpur! In der Schule habe ich's gelernt, Herr! Gott, wenn ich das einmal sehen könnte! Dort hinauf, Herr, das müsste wie im Paradiese sein!«
Fred Urban betrachtete sie mit großen Augen.
»Nun — vielleicht — man kann nicht wissen —«, sagte er und wollte sich entfernen. Sie aber vertrat ihm den Weg, legte die Hand auf seinen Arm und beugte sich so nahe zu ihm, dass ihr Atem seine Lippen streifte.
»Ihr liebt mich, Herr?«
Er trat halb erschrocken, halb verblüfft einen Schritt zurück.
»Das habe ich nicht gesagt — du gefällst mir — ja — aber ihr seid ja Sklaven!«
Ihre Augen wurden ganz dunkelgrün.
»Sagt das nicht, Herr! Und merkt Euch — wenn ich mich auch sehne — als das, was Ihr vielleicht denkt, gehe ich nicht nach dort oben! Nur als Euer Weib, Fred Urban!«
Sie ging zurück.
Fred Urban aber, der Eisenkönig, lachte, dass die Ingenieure und Betriebsleiter, die abseits standen, verblüfft die Köpfe nach ihm drehten. Aber dieses Lachen hatte nichts Natürliches an sich. Es klang gereizt, gezwungen und endete schließlich in einem Zähneknirschen, mit dem der Reichsgraf verriet, wie wenig er sich diesmal in der Gewalt hatte.
Er war kaum von der Station gegangen, da verließ Clea blitzschnell ihren Platz und flog zu Friedrich hinüber. Der stand immer noch gebückt, wie ein geschlagenes Tier, neben dem Hebel.
»Hast du gemerkt, Friedrich, was er will? Oh, wie ich ihn hasse! Wie ich sie alle hasse, die da oben, die uns das Licht und die Sonne stehlen! Aber wir werden uns rächen! Alle sagen es! Alle, die da unten sind und fronen und darben müssen, alle zittern auf den Augenblick, wo sie die Herrschaft derer da oben stürzen können! Wir werden uns rächen! Töte ihn! Er soll der Erste sein — töte ihn in dem Moment, wo ich es dir befehlen werde! Er soll uns Gelegenheit geben, durch eines der zehn großen Tore hinaufzukommen zu denen dort oben!«
Sie stieß alles blitzschnell hervor, während ihr kräftiger Busen sich rasch hob und senkte und ihre Augen wieder wie flüssiges, grünliches Feuer schimmerten. Aber obwohl sie den klotzigen Mann hin und her schüttelte, schien er doch gar nicht auf ihre Worte eingehen zu wollen.
Sie bemerkte es und rief:
»Was hast du? Bist doch sonst einer der größten Schreier und Wühler! Sagst doch selbst immer, die Stunde muss kommen, wo die Sonne wieder uns gehört — was hast du jetzt, dass du so stumm bist?«
Clea ahnte nicht, dass in Friedrichs Seele der Wille wühlte, den Fred Urban mit hypnotischer Kraft durch seine Augen hineingepflanzt hatte.
»Ich muss sterben!«, entgegnete er nach einer Weile, dumpf und stier zu Boden starrend.
Clea lachte.
»Sterben? Du? Du bist ein Narr! Du wirst genauso alt werden wie die anderen hier — nun ja, kein Greis, aber in der Jugend stirbt hier unten keiner!«
»Doch! Ich werde sterben! Ich sage dir, Clea, ich lebe keine drei Tage mehr!«
Erst sah sie ihn erschrocken dann verächtlich an.
»Mir scheint, Friedrich, du willst ein Weib werden! Pfui, schäme dich!«
»Und ich werde doch sterben!«, entgegnete der Arbeiter beinahe trotzig. Ich werde sterben, denn ich will nicht länger leben. Ja, ja, so ist es! Ich will nicht! Und weil ich nicht will, ist's wohl am besten, ich bringe mich um!« Dabei zeigten seine Augen keinen Verstand, selbst Clea merkte, dass das nicht Friedrich war, der sprach, sondern dass ein geheimer, fremder Wille in ihn gefahren war und ihm befahl, so zu reden.
Und sie erinnerte sich wieder an das furchtbare Auge des Eisenkönigs, und sie begriff, dass er das Gift seines Willens in Friedrichs Seele geträufelt hatte.
Der Hass, den sie seit frühester Jugend gegen die dort oben im Herzen trug, wuchs ins Unendliche gegen Fred Urban.
»Höre, Friedrich«, begann sie. »Du bist doch kein Narr! Ich weiß, wie es kommen wird! Die dort oben glauben, sie seien so klug! Aber wir sind auch nicht dumm! Ich werde Fred Urban um ein Stückchen Sonne bitten! Er wird eines der zehn Tore öffnen und mich hinaufkommen lassen. Du kennst sie ja, die zehn Tore, die Tag und Nacht und Jahr um Jahr geschlossen sind, wo sie furchtbare Maschinen errichtet haben, um uns zu zermalmen, wenn wir mit Gewalt nach oben drängen sollten. Durch jedes dieser zehn Tore laufen die elektrischen Ströme, welche ihnen das Licht für die Nacht geben. Überall sind solch riesige Bassins wie dieses hier, wo die elektrische Kraft aufgespeichert wird. Wenn ich nun Fred Urban bitte, mich gerade durch das Tor zu lassen, welches über diesem Bassin hier liegt, und wenn du die Schleusen öffnest und plötzlich die elektrischen Ströme ohne Hindernis und ohne Einschränkung hinauflässt, so wird Fred Urban eines furchtbaren Todes sterben, und mit ihm wird sein Haus in Brand geraten und ein ganzes Viertel von denen da oben wird zugrunde gehen! Wenn dann die Verwirrung am größten ist, sammelt ihr euch und drängt nach und richtet ein Blutbad an und holt euch die Sonne, die sie uns geraubt haben — begreifst du denn nicht, Friedrich, dass das ein großartiger Plan ist? Wir werden uns rächen! Rächen, Friedrich!«
Er begriff.
»Ja, das wäre wohl eine teuflische Idee«, sagte er, breit lachend. Schließlich bekam sie ihn so weit, dass er es versprach. Und er ging zu seinen Kameraden und flüsterte mit ihnen, und die sagten es anderen, und wieder speicherte sich neuer Hass zu dem alten auf, und es gärte und wallte, und sie warteten auf die Stunde, wo sie hinaufkonnten, um Rache zu nehmen, dafür, dass man sie seit vier Jahrhunderten unter die Erde gesperrt hatte.
Fred Urban kam von dem Bilde nicht mehr los, das sich in seiner Erinnerung festgesetzt hatte. Er ging wieder in dem großen Arbeitszimmer auf und nieder, sah wieder das blumengleiche Bild seiner ersten Gattin, die seinen Sinnen so wenig zu geben vermocht hatte, und musste dann immer wieder von Neuem zurückdenken an Clea, die Sklavin.
Das war ein Weib! Ein Weib aus Fleisch und Blut, wie man es seit Jahrhunderten hier oben nicht mehr kannte!
Nachdem er lange mit sich selbst gekämpft, beschloss er, sie wiederzusehen.
Drei Tage nach den oben geschilderten Ereignissen fuhr er wieder hinab. Er traf Clea an derselben Stelle.
»Guten Tag, Herr!«, sagte sie gleichgültig.
Er trat an sie heran. Sie musste lachen, als sie das Feuer in seinen Augen sah, als sie bemerkte, dass sein weißes Gesicht wieder von Blut übergossen wurde.
»Möchtest du gerne die Sonne sehen, Clea?«
Sie nickte.
»Was diese Männer samt ihrem gigantischen Willen sind«, dachte sie. »Ein Blick von mir genügt, und dieser tut, wie ich will!«
»Ja, Herr, ich möchte die Sonne sehen! Einmal! Ein einziges Mal!«
»Könntest du mich lieben, wenn ich dir die Sonne zeigen würde?«
»Vielleicht, Herr —« Sie hob die Lider und sah ihn groß mit den grünen Augen an.
»So folge mir! Ich werde dich gerade durch das Tor führen, welches über diesem Bassin liegt. Du wirst aber niemandem etwas sagen. Dieses Tor gehört mir und wird von meinen eigenen Leuten bewacht. Sie werden dich auf meinen Befehl hindurchlassen, obgleich es einen Paragraphen im Gesetzbuch gibt, der streng verbietet, dass einer von euch hier unten jemals nach oben kommt!«
Er lachte, während er das sagte.
»Wir wissen wohl, Clea, was kommen würde, wenn wir euch die Sonne zeigten!«
Clea drehte sich halb um und sah Friedrich an. Der ging mit schweren, massigen Schritten auf das Bassin zu, während Fred Urban sie durch seinen malaiischen Diener in das Coupé heben ließ, das sie beide nach oben führen sollte. Der Eisenkönig vergaß, einen Blick zurückzuwerfen, wie er es sonst zu tun pflegte. Darum sah er nicht, wie auf den freien Plätzen, wo das weiße Licht gleich Schneeflocken lag, sich dunkle massige Punkte zusammenballten.
Das waren die von unten, die da hofften, ein Loch zu finden, um durchbrechen zu können. Sie trugen schwere eiserne Schmiedehämmer in den wuchtigen Fäusten und warteten. Clea lachte und ihr Herz klopfte zum Zerspringen bei dem Gedanken, dass sie nun endlich einen Blick hinauswerfen sollte zu denen da oben.
Endlich hielt das Coupé. Fred Urban führte sie durch einen dunklen Gang. Der Malaie drückte auf einen elektrischen Knopf, und eine Riesentür, eine gigantische Felsplatte, die in den Erdboden eingelassen war, drehte sich in ihren Angeln.
Im Scheine des goldenen Lichtes, das hereinflutete, erblickte man breite, nach oben offene Röhren, die, zu Dutzenden nebeneinanderlaufend, die elektrischen Ströme aufnahmen, welche von unten nach oben geleitet wurden, um die Nacht zu durchleuchten.
Clea wusste, dass sie selbst verloren war, wenn die Ströme kamen. Und sie mussten jeden Moment hereinbrechen, ohne jedes Geräusch, sich nur durch ein furchtbares Leuchten ankündend, mussten alles überfluten und sie und den Verhassten verbrennen und halb Berlin in Brand stecken.
Das alles bedachte sie in dem Augenblick, als das Riesentor sich öffnete. Im ersten Augenblick war Clea von dem sie umgebenden Tageslicht ganz geblendet. Nun sah sie die Stadt von denen da oben vor sich liegen. Eine Stadt, die genau so aussah, wie alle anderen auch, die weder Fred Urban noch den Tausenden von Einwohnern, welche Berlin beherrschten, als etwas Besonderes vorkam: breite Straßen aus Granit; riesenhohe Häuser mit Hunderten von Augen, die mit Gläsern überzogen waren; grüne Alleen, schimmernde Gärten, in denen glutrote Rosen leuchteten.
Das alles sah Clea mit einem Blick. Und in diesem Moment war alles versunken, was bis jetzt in ihr gelebt hatte. Der Hass war tot, das Verlangen, sich selbst zu opfern und die anderen da oben zu töten, war erloschen. In ihr lebte nichts mehr als die brennende Begierde, hier zu sein, hier zu genießen, unter der Sonne spazieren zu gehen, zu lieben, sich zu freuen und nicht mehr zurückzukehren in diese Hölle mit den glühenden Hochöfen, wo der Ruß und die Asche und der Staub und der Nebel ewig lagerten, wo selbst des Nachts hindurch die Hämmer klangen und die Maschinen fauchten. Sie sprang daher plötzlich beiseite, fasste Fred Urban am Arm und rief:
»Lasst das Tor schließen, Herr; denn man plant einen Anschlag!«
Fred Urban begriff sofort. Herrschte doch seit Jahrhunderten Tag und Nacht der Kriegszustand zwischen denen da oben und denen da unten! Das Tor flog zu, gerade zur rechten Zeit; denn eine Viertelstunde später wälzten sich riesige elektrische Ströme gegen den Granit, den sie nicht durchbrechen konnten. Sie fluteten zurück, sprangen aus ihren Behältern und ergossen sich knatternd, knirschend und leuchtend in die Fabriken und töteten in einer Minute mehr als fünftausend Menschen. Auch Friedrich war unter ihnen. In dem Augenblick, da er verbrannt, vernichtet, in entsetzlichem Todeskampf die Augen schloss, begriff er, was geschehen war. Und er fluchte Clea, er fluchte Fred Urban und dem Bunde der beiden mit fürchterlichen Verwünschungen.
Die Katastrophe, welche sich in der Fabrik des Eisenkönigs ereignet hatte, machte es Clea zunächst unmöglich, zurückzukehren.
Zehntausende hatten sich dort unten zusammengerottet. Aber sie waren nicht imstande, eines der zehn Tore zu sprengen. Und wäre ihnen dieses wirklich gelungen, so würden die riesigen Schleudermaschinen, die vor jedem Tore aufgestellt waren, in Tätigkeit getreten sein. Diese Maschinen hätten ganze Tonnen von explosivfähigem Pulver gegen die Anführer geschleudert, und sie wären in Atome zerrissen und zerstückelt worden.
Das wussten die da unten, und darum gingen sie zähneknirschend wieder an ihre Arbeit.
Nachdem Clea einen Tag über der Erde gewesen war, sagte Fred Urban, der sie in seinen Gemächern vor den Blicken der anderen, besonders aber vor denen des Sohnes verborgen hielt:
»Willst du meine Sklavin bleiben?«
Aber Clea schüttelte energisch den Kopf. Auch sie war ein letztes Glied von Generationen. In ihr hatte sich alles aufgespeichert, was an Raffinement, Hass, List, Sehnsucht und Begierde nach einem neuen Leben in der Rasse von denen da unten enthalten war.
Und so oft in den nächsten Tagen Fred Urban heimlich ihr Zimmer aufsuchte und bat und flehte, ebenso oft entgegnete sie, ihn mit spöttischem Lächeln und halb zusammengekniffenen, grünlich schillernden Augen betrachtend:
»Ich will dein Weib werden!«
Tag und Nacht hatte der Fürst mit sich selbst gekämpft. Er begriff, dass sie alle sich gegen ihn erheben würden: der Sohn, die, welche unter ihm standen, die eigenen Freunde, die Kapitalisten, das Gesetz. Nie war es vorgekommen, dass einer von denen da oben eine von denen da unten zum Weibe genommen hatte.
Schließlich kam er auf einen Ausweg. Er begab sich wieder zu Clea, die mit jedem Tag, da ihr Gesicht der Sonne ausgesetzt war, weißer und schöner geworden, und sagte:
»Ich habe gelesen, dass vor kurzer Zeit in der Nähe von Memphis eine neue Schule für junge Mädchen errichtet wurde. Ich werde dich dorthin bringen, damit du in unseren Sitten unterrichtet wirst. Ich werde dir alles beschaffen, was du brauchst, die schönsten Kleider und blitzende Edelsteine, und wenn du nach einem Jahre zurückkehrst, werde ich dich zu meinem Weibe machen.«
Clea war's zufrieden.
In Nacht und Nebel, nur von seinem treuen Malaien begleitet, jagte Fred Urban auf seinem schnellsten Flugschiff mit Clea nach Ägypten. Er brachte sie in der Schule zu Memphis unter und jagte dann zurück, um seine Arbeit wieder aufzunehmen und zu versuchen, in angestrengter Tätigkeit das Jahr herumzubringen. — — —
Es ging um. In jedem Monat besuchte er Clea, und immer, wenn er nach Berlin zurückkehrte, war er rasend vor Liebe, Leidenschaft und Sehnsucht nach ihr. Als sie endlich nach Berlin kam, da hatte Fred Urban schon dafür gesorgt, dass sie einen eigenen neuen Namen führen konnte; niemand ahnte, dass sie von denen da unten abstammte. Sie galt als Ägypterin, und es fiel auch nicht weiter auf, dass sie anders aussah als die Frauen des dritten Jahrtausends; denn die reichen Berliner hatten viele Villen in Ägypten und wussten, dass die Frauen Afrikas die Kraft ihrer Rasse bis heute bewahrt hatten.
Wolf, Fred Urbans Sohn, wunderte sich zwar über des Vaters späte Neigung, aber er schwieg. So zog Clea, die Tochter von denen da unten, in den Märchenpalast des Reichsgrafen als Herrin ein.
Damit begann dort ein anderes Leben, neu und eigenartig, der Anfang einer großen Katastrophe.
Fred Urban, Clea, Wolf und seine Gattin Flora saßen zusammen des Abends in dem wundervollen Garten, der sich auf der höchsten Terrasse des Urban'schen Palastes ausbreitete. Über ihnen zitterten die farbigen Lichter durchsichtiger Lampions und warfen ihre purpurnen Reflexe über den weißgedeckten Tisch.
Der stahlblaue Äther, der die schwindelnde Terrasse umgab, sah aus wie ein riesiges Meer, und die Hunderte und Tausende von azurnen, roten, grünen und gelben Lichtern, die aus den Fenstern der Häuser brachen, starrten wie Inseln durch die Nacht.
Dann und wann zog, in einen Lichtkreis gehüllt, ein Luftschiff vorüber.
Clea lehnte sich in ihren Schaukelstuhl zurück, jung, schöner als je ein Weib, strahlend und herrlich.
Neben ihr verschwand Floras zierliche, blumenhafte Gestalt. Die beiden Frauen saßen sich gegenüber, und manchmal, wenn ihre Blicke sich trafen, war es Wolf, als knisterte ein Funke in der Luft.
Durch Fred Urbans Bart zogen sich graue Silberfäden.
»Weißt du«, sagte er plötzlich, das Sektglas hebend, »der Name Clea gefällt mir nicht. Nenne dich Cleopatra!«
»Nun, wenn du willst, so nenne ich mich Cleopatra!«, entgegnete sie lachend. Sie saß zwischen Vater und Sohn, und während sie sprach, blickte sie zu Wolf hinüber, der die Finger zusammenballte, so oft ihr Blick ihn traf; wenn sie es merkte, dann lachte sie.
Nach dem Diner fragte der Reichsgraf:
»Ich denke, die beiden Damen erlauben, dass ich mir eine Zigarette anzünde. Ich kann ohne Zigaretten nicht sein! Der Duft des Tabaks ist für mich ein zweites Leben!«
Cleopatra nickte. Flora aber meinte leise:
»Du hast sonst nicht geraucht, Vater. Du weißt, dass ich nicht atmen kann, wenn ich im Qualm des Tabaks sitze.«
Fred Urban steckte ärgerlich das Etui wieder in die Tasche, das er schon zwischen den Fingern gehabt hatte. Wolf, sein Sohn, wunderte sich, dass der Vater in letzter Zeit eine gewisse Brutalität gegen alle Frauen zur Schau trug; nur nicht gegen Cleopatra, die ein solches Benehmen wohl eher vertragen hätte als die sanfte Flora.
»Hast du die neue Bahn schon angesehen, Vater, die zwischen dem Berliner Südostbahnhof und Bagdad gebaut wurde?«, fragte Wolf.
»Ja, ich trage mich sogar mit dem Gedanken, ein eigenes Geleise für mich zu erwerben. Die Möglichkeiten, die diese rasche Verbindung mit dem Orient uns eröffnet, sind fabelhaft!«
»Aber ich denke, man käme auch mit dem Luftschiff rasch genug nach Bagdad!«, meinte Cleopatra.
Fred Urban schüttelte den Kopf.
»Die neue Bahn bedeutet jedenfalls die höchste Geschwindigkeit, welche der Verkehr überhaupt annehmen kann. Ein Amerikaner hat sie erfunden. Sie läuft überhaupt nur auf einem einzigen Gleise!«
Cleopatra zog die Brauen hoch.
»Wie ist denn das möglich? Sie kann sich doch auf diese Weise gar nicht im Gleichgewicht halten!«
»Doch! Darin liegt eben das wunderliche Geheimnis! Die ganze Bahn besteht nur aus einem einzigen Wagen, der sowohl in Bewegung wie im Stillstand ohne fremde Hilfe aufrecht steht. Bei Kurven neigt sich der Wagen nach innen, und bei Belastung auf einer Seite hebt er sich, anstatt sich zu senken. Der Mechanismus ist merkwürdig: Die vier Räder stehen nämlich in einer Linie auf der Schiene. Im Innern des Wagens befinden sich zu beiden Seiten des Mittelpunktes zwei Schwungräder in einem Gehäuse, und diese Schwungräder bewegen sich in entgegengesetzter Richtung. Dadurch wird die Balance hergestellt, während der Wagen selbst durch einen Elektromotor betrieben wird. Das Ganze ist nach dem System eines Kreisels gebaut. Denkt euch diesen in schnellste Bewegung gesetzt, so weiß jedes Kind, dass er nicht umfällt. Denkt euch um diesen in schnellster Bewegung befindlichen Kreisel einen Rahmen gebaut, so wird dieser Rahmen sich mit dem Kreisel bewegen; da habt ihr das Geheimnis der neuen Bahn; der Unterschied besteht nur darin, dass der Waggon sich infolge elektrischer Eigenkraft vorwärtsbewegt, während der Kreisel das Gleichgewicht aufrechterhält!«
»Fabelhaft!«, bemerkte Cleopatra. In diesem Augenblick trat der malaiische Diener vor, verneigte sich tief und meldete:
»William Scott!«
Hinter dem breiten Rücken des Malaien kam ein kleiner, beweglicher junger Mann hervor. Er war nicht größer als Flora und wohl auch nicht viel stärker, degeneriert durch die Kultur, an welcher seine Vorfahren sowie er selbst zu innigen Anteil genommen hatten.
Wolf sprang auf und eilte ihm entgegen.
»Das lässt sich hören, mein Freund, dass du uns wieder einmal besuchst!«
William Scott beugte sich auf Floras diamantensprühende Hand nieder und verneigte sich vor Fred Urban. Der machte eine vorstellende Bewegung zu Cleopatra hinüber:
»William Scott, unser großer Künstler! Er hat das letzte große Gemälde für unsern Reichstag gemalt. Das erste, welches unsere Abgeordneten seit fünfhundert Jahren einstimmig angenommen haben!«
William Scott verneigte sich tief vor Cleopatra, die ihn mit ihren großen, grünen Augen musterte. Dabei wichen die letzten Spuren der Röte aus seinem Gesicht und Wolf beobachtete, dass er zitterte.
Die Tafel wurde aufgehoben. Fred Urban entschuldigte sich, dass er sich auf eine halbe Stunde zurückziehen müsse, um seine Geschäfte zu regeln.
»Lasst Cleopatra nicht allein!«, wandte er sich an Wolf, und dieser reichte der Gattin des Vaters den Arm.
Beide gingen, ohne auf Flora und Scott zu achten, tiefer in den Garten hinein, der den Umfang eines Parkes hatte, denn die Terrasse auf dem Palaste Fred Urbans maß etwa vierhundert Meter im Durchmesser.
William bot Flora den Arm an; sie legte ihre schmale, kleine Hand hinein; in dem Augenblick aber, wo er den beiden anderen folgen wollte, blieb sie stehen.
»Haben Sie sie genau angesehen?«, fragte sie, während tiefer Hass in ihren großen, märchenhaften, feuchten Augen schimmerte. »Haben Sie dieses Geschöpf, das aus der Urzeit der Welt zu stammen scheint, betrachtet?«
Der Maler nickte. Auf eine einladende Bewegung Floras hin ließ er sich wieder auf einen kleinen Sessel nieder, während sie selbst sich auf einem niederen chinesischen Diwan ausstreckte.
»Ganz Berlin spricht ja von nichts anderem mehr als von Cleopatra!«, fuhr sie fort. »Mir läge nichts daran, wenn ich nicht deutlich auf der Stirne dieses Weibes lesen würde, dass sie uns alle vernichten wird!«
Scott lächelte. Er hatte nebelhaft feine Hände und ein geisterbleiches Gesicht. Wenn seine weißen Lippen sich auseinanderzogen, dann sah der Kopf aus wie der Schädel eines Toten; der unheimliche Eindruck wurde noch erhöht durch die großen Augen, die mit einem unnatürlichen Glanz ausgestattet waren.
»Wo denken Sie hin, Frau Flora!«, entgegnete er mit einer gewissen Vertraulichkeit, indem er näher zu ihr rückte. »Fred Urban ist nicht der Mann, der sich zugrunde richten lässt! Sie verkennen die Gewalt seines Blickes und die Kraft seiner Energie!«
Die Gattin Wolfs lachte.
»Sie sprechen von seiner Energie! Sehen Sie ihn an, und sagen Sie mir, ob Sie noch einen Funken von Kraft in seinen Augen finden können!«
Der Künstler zuckte die Achseln.
»So werden Sie und Ihr Gatte darauf bedacht sein müssen, Frau Flora, Gegenminen zu legen, um den Einfluss Cleopatras einzudämmen, vorausgesetzt, dass Sie sie wirklich für so gefährlich halten!«
»Ich halte sie für mehr als gefährlich!«, entgegnete die junge Frau. »Doch sei dem, wie ihm wolle: Ich hasse sie, hasse sie aus glühender Seele, genauso, wie sie stets das Feuer ihrer inneren Wut auf mich schleudert, wenn sie mich anblickt. Ach, wenn ich sie vernichten könnte!«
»Das wird sich wohl nicht machen lassen!«, lächelte William Scott zynisch.
»Oder wenn man sie von ihm trennen könnte!«, fuhr Flora fort. »Ich fürchte für Wolf, fürchte für unser Vermögen und für unsere Zukunft!«
»Das wäre etwas anderes!«, entgegnete der Maler, dem plötzlich eine Idee durch den Kopf schoss. Er schob seinen Stuhl so nahe zu Frau Floras Sitz hin, dass seine Hand die sylphidenhafte Gestalt berührte. »Es wäre wohl nicht unmöglich, Frau Flora, dass man auf ein Mittel kommen könnte, Ihren Wunsch in die Tat umzusetzen!«
Sie richtete sich halb auf, während das Blut in ihre Wangen schoss.
»Wirklich? Könnten Sie es, William Scott? Man sagt, Sie seien ein Mensch, der mit vielen Kräften begabt ist. Ja, denken Sie, Wolf hat mich sogar einmal vor Ihnen gewarnt! Er sagte, Sie seien gefährlich!«
»Er hat nicht Unrecht!«, entgegnete der Künstler, während seine Augen eine dunkle Färbung annahmen. »Ich bin Ihnen wohl gefährlich, denn ich hege heute noch ebenso sehr das Verlangen, Sie zu besitzen, wie damals, als Sie meine Werbung zurückwiesen.«
Flora zuckte zusammen, während die Lider mit den unnatürlich langen Wimpern sich wie schützend über ihre leuchtenden Augen senkten.
»Das wusste ich nicht!«, hauchte sie. »Sie wissen, ich liebe Wolf!«
William Scott war in Berlin berüchtigt wegen seines Zynismus und seiner Gewissenlosigkeit. Man wusste auch, dass er seine Gesundheit durch sein ausschweifendes Leben zerrüttete. Seine Augen glitten liebkosend über ihre feine Gestalt.
»Das mag sein, Frau Flora, doch wie gesagt, es wäre nicht unmöglich, Fred Urban von Cleopatra abzubringen!«
So furchtbar war der Hass, der in Floras Herz brannte, so ungewöhnlich waren die Leidenschaften, welche das Erscheinen Cleopatras in allen Herzen entzündet hatte, dass die tugendhafte Flora der Gefahr nicht achtete, in die sie sich begab.
»Sie könnten es? Wissen Sie das Mittel?«
William Scott sah eine Weile zu Boden und spannte sein raffiniertes Gehirn bis zum äußersten an. Das dauerte etwa fünf Minuten, dann schien er einen Plan ausgesonnen zu haben, von dem er sich die nötige Wirkung versprach.
Flora las es von seinen Augen ab. Sie legte zitternd die Hand auf seinen Arm und flüsterte:
»Sagen Sie es mir! Helfen Sie mir! Schließen Sie mit mir ein Bündnis zum Schutz und Trutz gegen dieses Weib, das wie ein Dämon in unser Leben getreten ist! Mein Gott, wenn man sie trennen könnte von Fred Urban, wäre alles gewonnen!«
»Auf geradem Wege geht es nicht, Frau Flora. Es würde unmöglich sein, Cleopatra zu bestimmen, den Fürsten zu verlassen. Aber man könnte ihn wohl dazu bringen, Cleopatra zu meiden, und dann wäre sie verloren!«
Flora schüttelte den Kopf.
»Das ist unmöglich! Der Fürst wird nie mehr von ihr lassen, wenn man ihn nicht mit Gewalt dazu zwingen würde! Er ist Cleopatras Sklave geworden, er, der bis vor kurzem alle Welt regiert hat!«
»Es käme wohl nur darauf an, wie man es anfasst, Frau Flora! Man müsste ihn zum Beispiel davon überzeugen, dass er absolut nicht zu Cleopatra passt. Bedenken Sie, dass er eine Eigenschaft besitzt, die alle anderen überragt: den Stolz, die Eigenliebe! Zeigen wir ihm sich selbst, so wie er ist, dass er erschrickt über den Unterschied zwischen sich und Cleopatra, so wird er keinen Augenblick zögern, aus der Nähe dieses Weibes zu fliehen, die ihm die Kraft aus den Augen trinkt!«
Flora sah mit weit geöffneten Augen zu diesem kleinen, pierrothaften Manne hinüber, der in seinem Hirn eine Welt von Lastern und alles durchdringender Intelligenz barg.
»Wie meinen Sie das?«
»Ich habe einen Spiegel«, entgegnete William Scott leise, »einen Spiegel, wie kein Mensch ihn besitzt. Ich selbst habe ihn konstruiert, und niemand weiß bis jetzt von meinem Geheimnis. Ich möchte ihn nicht hergeben um alles in der Welt und ich weiß nicht, was geschehen würde, wenn die Allgemeinheit von ihm wüsste.«
»Einen Spiegel?«, wiederholte Flora voll Staunen. »Einen Spiegel... was soll's mit ihm?«
»Er besitzt außergewöhnliche Kräfte! Es ist ein Zauberspiegel!«
Flora lächelte.
»Sie treiben Scherz mit mir! Sie wissen, dass wir modernen Menschen längst verlernt haben, an Märchen zu glauben!«
Er nickte.
»Weil alle Märchen zur Wahrheit geworden sind, durch die Kraft unserer Gedanken, Frau Flora. Deshalb ist es doch ein Zauberspiegel, wenn seine Wirkung auch auf natürlichen Grundlagen beruht. Ich will ihn Ihnen erklären. Es ist ein Spiegel von außerordentlicher Art, keiner von der Sorte, die uns unsere Züge in lässigen Umrissen zeigt. Es ist eine Fläche von feinstem zyprischem Silber von fabelhafter Glätte, die mit einer ätzenden Flüssigkeit überstrichen wird. Mein Spiegel ist vollständig unempfindlich für lichte Stellen, Frau Flora, doppelt empfindlich aber für Schatten und Schraffierungen. Fred Urbans Antlitz wird sich also in der Platte nicht so zeigen, wie Sie und er und wir alle es sehen. Er wird nur die tiefen Schatten, also das Gerippe des Kopfes, losgelöst von Fleisch und Helligkeiten, erblicken. Allerdings, Frau Flora, der Spaß ist teuer; denn das Bild, das der Spiegel zeigt, verschwindet nicht, sondern ätzt sich ein für alle Zeiten! Lassen Sie Fred Urban in einen solchen Spiegel sehen, und warten Sie ab, was er zu seinem Gesichte, zu seinen Augen sagen wird!«
»Das wäre wohl eine Idee! Ich kenne Ihren Spiegel nicht, William Scott. Darum müssen Sie verzeihen, wenn ich noch einige Zweifel in die Wirkung Ihres Planes setze!«
»Man kann ihn ja unterstützen!«, fuhr William Scott fort. »Fred Urban leidet an chronischer Nikotinvergiftung; er raucht zu viel. Wenn wir diesen Umstand für eine mysteriöse Erscheinung benutzen, wird die Wirkung doppelt sein. Mit ein paar Strichen kann ich das Bild, das der Spiegel ihm zeigen wird, unterstützen! Ich male seine Augen auf die Fläche, ehe er sie im eigenen Bilde sehen kann, so wie sie sind, verglimmt, Asche, kraft- und lebenslos! Wie ich Ihnen sage, Frau Flora: Warten Sie ab, was Fred Urban tut, wenn er erkennt, dass er ein Greis geworden ist!«
»Ja, das ist das wahre Wort: ein Greis! Sie haben recht, William Scott! Ich glaube, er wird Cleopatra hassen, wenn er sieht, was sie aus ihm gemacht hat! Er ist stolz und rachsüchtig! Nur so weit müssen wir ihn bringen: zur Erkenntnis, zum Hass gegen dieses Weib!«
Nun entwarfen die beiden einen Plan, der darauf abzielte, Cleopatra zu vernichten. Die Mittel, zu denen sie griffen, entsprachen ganz und gar dem phantastischen Gedankengang Floras und der bizarren Verderbtheit William Scotts.
»Aber Sie wissen, was ich als Bedingung stelle!«, schloss er flüsternd. »Sie wissen es, Frau Flora: Sie müssen auf mein Atelier kommen! Ich brauche ein Modell für die Venus des dritten Jahrtausends. Sie werden kommen, nicht wahr? Es ist die Revanche für die Hilfe, die ich Ihnen biete!«
Flora Urban war bis zu dieser Stunde eine vornehme, sittenstrenge Frau gewesen. Aber so groß war der Hass gegen Cleopatra in ihr, dass sie skrupellos ihre Ehre und alles, was sie besaß, hinwarf, nur, um dieses Weib zu vernichten.
Sie war die Erste aus Fred Urbans todgeweihtem Hause, die der natürlichen Vergeltung von denen unter der Erde zum Opfer fiel.
William Scott ging langsam den Park entlang, in dem Wolf und Cleopatra verschwunden waren. Diese hatten inzwischen eine Lichtung erreicht; unter der Statue des Apollo ließ sich Cleopatra auf eine Bank nieder. Sie überragte Wolf beinahe um Haupteslänge; er sah voll Bewunderung und heimlichem Feuer zu dieser prachtvollen Gestalt auf, die aus einer andern Welt zu stammen schien.
»Sehen Sie die blaue Lebensblume dort, Wolf?«, fragte sie, auf eine Blume deutend, die nickend am hohen Stängel hing. Er folgte ihrem Blick. In dem Moment aber, da er die Blume ansah, wurde die Blüte rot. Es war eine neue Pflanze, welche der Gärtner Fred Urbans erst vor Kurzem aus Indien eingeführt hatte, die Lebensblume, wie die Gelehrten sie nannten, die sich die seltsame Erscheinung nicht erklären konnten.
Selbstverständlich änderte die Blume nicht ihre Farbe. Sie besaß vielleicht überhaupt keine, nur das Auge des Menschen sah die Blüte anders, sobald es länger auf ihr ruhte. Erst erschien sie blau, dann, fester ins Auge gefasst, purpurrot. Dieses Rot brachte Wolf stets aus seinem Gleichgewicht. Er warf einen scheuen Blick auf Cleopatra. Zwischen den halbgeöffneten, granatroten Lippen schlummerten die weißen Zähne.
»Wie schön du bist!«, murmelte er. Er wollte das Wort zurücknehmen, kaum dass es seinen Lippen entflohen, aber es war zu spät. Sie streckte plötzlich ihre Arme nach ihm aus, und er glitt auf die Knie vor ihr nieder.
»Findest du mich schön, ja?«, fragte sie lächelnd. »Ja, es ist wahr! Ich bin schön! Hundertmal schöner als alle eure Frauen aus diesem Jahrtausend! Ich glaube, ich stamme aus einer ganz anderen Zeit, hundert Jahre zurück! Und ich liebe die Jugend! Du kannst nicht begreifen, Wolf, was ich in der Umgebung deines Vaters leide!«
»Es mag wahr sein!«, gab der junge Mann kleinlaut zu, »er ist ein Greis!«
Sie beugte sich ganz vor, dass ihre Lippen sein Ohr berührten, und flüsterte:
»Ja, ein Greis! Darum sollte er fort!«
Wolf zuckte zusammen.
»Wie meinst du das, Cleopatra?«
»Nun, ich meine es so, wie ich es spreche! Er sollte fort, weg! Was will er? Würden die Geschäfte nicht ebenso laufen, wenn er nicht mehr wäre? Du bist klug und durch seine Schule gegangen! Du weißt alles genau so wie er, vielleicht besser! Und denke, was das für ein Leben werden könnte, Wolf, du und ich, wir beide zusammen im Glanze dieses unermesslichen Reichtums, den der Alte angesammelt hat in drei Jahrzehnten, seit er die Herrschaft über die Fabriken übernommen!«
Wolf ging auf den Gedanken Cleopatras nicht näher ein. Er war bezaubert, betäubt von dem Anschein ihrer Liebe, von dem Duft ihrer Haare. Als sie sah, dass er nicht antwortete, fuhr sie fort, ihren rechten Arm um seinen Hals legend:
»Du wärest der Mann dazu! Es gibt ja so wenig Männer mehr unter euch! Ihr habt kein Blut mehr in den Adern! Nimm ein Gift oder ein Schwert, was immer du willst, und töte ihn!«
Wolfs Verständnis erwachte. Er riss sich los von ihr und sprang empor. In seinen Augen lag grenzenlose, ehrliche Entrüstung — so groß seine Leidenschaft zu Cleopatra auch sein mochte, so war sie doch viel zu verworren, um eine solche Wirkung zuzulassen. Noch hing er fest an dem Vater und liebte ihn.
»Ist es möglich?«, stieß er keuchend hervor. »Du willst dich seiner entledigen? Du willst ihn töten?«
Cleopatra begriff, dass sie ihn ganz in ihre Gewalt bekommen musste. In dem Augenblick, da er zu fliehen versuchte, sprang sie auf und hielt ihn zurück. Sie warf die Schleier, die ihren Oberkörper verhüllten, zu Boden und tanzte. Sie hatte es nie gelernt. Hier oben tanzten die Frauen ganz anders. Das war ein schüchternes, leises Bewegen der Glieder, denn die Frauen des dritten Jahrtausends durften ihrem Körper keine großen Kraftanstrengungen zumuten. Cleopatra tanzte anders. Das war ein Gedicht rasender Leidenschaft, ein Gemälde von Kraft und Schönheit. Wolf vergaß seine Flucht. Er blieb stehen, hingerissen von ihrer Erscheinung, ganz und gar wieder in Ketten geschlagen, gebannt von diesem Tanz, der den letzten Widerstand, der in seinem Herzen sich gegen Cleopatra gewehrt hatte, besiegte. Er vergaß Flora und den Vater und alles andere. Sie aber war zu klug, noch einmal von Fred Urbans Tod zu sprechen, und entließ ihn, als sie die kleine Gestalt William Scotts zwischen den Büschen auftauchen sah.
»Geh zurück zu Flora, Wolf«, sagte sie. »Sie könnte Verdacht schöpfen, und der Hass dieser kleinen Frau ist gefährlicher als meine Liebe!«
Wolf gehorchte.
Er war kaum verschwunden, als der Künstler auftauchte. Langsam, mit pathetischen Bewegungen näherte er sich Cleopatra.
»Die Toren«, sagte er lachend, ihre Hände küssend. »Sie stellten mir heute Cleopatra vor! Mir, William Scott, dem Künstler! Ich sollte von Cleopatra gehört und sie noch nicht bewundert haben! Wenn Fred Urban geahnt hätte, dass du längst mein bist — seine Augen möchte ich gesehen haben!«
Sie lachte.
»Du musst vorsichtiger sprechen, William! Noch ist die Stunde nicht gekommen, da ich dein sein darf für alle Zeiten! Noch lebt Fred Urban!«
William Scott nickte.
»Er wird wahnsinnig werden und dann steht dir nichts im Wege, mein Weib zu werden!«
Sie riss groß die smaragdenen Augen auf.
»Wahnsinnig? Wer sagt dir das? Fred Urban hat klare Sinne, mein Freund!«
»Die klarsten können verwirrt werden!«
Er ging nicht näher auf Cleopatras Fragen ein, denn er wollte das Geheimnis seines Spiegels nicht preisgeben. Aber der Wirkung seines Planes war er sicher.
Scott übte keinen geringen Einfluss auf sie aus, denn in ihren beiden lasterhaften Seelen fanden sich viele Berührungspunkte, wenn sie auch zwei verschiedenen Rassen angehörten. Sie sagte plötzlich:
»Das Werk ist nur halb getan, auch wenn Fred Urban nicht mehr zählen sollte!«
William Scott kniff die Augen zusammen:
»Wieso, Cleopatra?«
»Flora ist gefährlich wie Gift.«
Er nickte.
»Ja. Gefährlich, weil sie hasst. Sie würde dich auf der Stelle töten, Cleopatra, wenn sie die Macht dazu besäße!«
»Darum soll sie fort! Sie und der Alte! Mit Wolf werden wir fertig! Der ist mein Sklave! Aber Flora müssen wir fürchten! Kannst du sie nicht beiseiteschaffen, William?«
Er sah sie schweigend an.
»Warum beauftragst du immer andere mit der Ausführung deiner Pläne, Cleopatra?«
Sie schüttelte sich.
»Ich kann kein Blut sehen! Nein, das kann ich nicht! Aber der Gedanke, dass auf einen Wink meiner Augen hin Menschen getötet werden, hat etwas Wundervolles für mich, mein Freund!«
»Du hast einen eigenen Geschmack, liebe Cleopatra!«, entgegnete er lachend. »Doch du sollst mich deiner heißen Liebe würdig sehen! Ich werde auch Flora beseitigen und dann können wir beide herrschen! Du sollst Königin sein über die Riesenwerke Fred Urbans, und ich will mich dann gern deinen Sklaven nennen!«
Sie nickte.
Langsam schritten sie zurück. Der Maler eilte, ehe sie in den Bannkreis des Lichtes traten, voraus. Cleopatra blieb einige Augenblicke stehen, kreuzte die Arme über der Brust und sah dem Manne nach, dessen Hang zum Verbrechen in dem Moment geweckt worden war, wo er in Cleopatra Berührungspunkte für seine Laster gefunden hatte; ein tiefes Lachen schüttelte ihre Brust.
»Tor! Narr! Du glaubst, dass ich dich liebe? Ich habe nie einen geliebt und liebe keinen von euch! Ich hasse euch alle, denn ihr steht mir im Licht! Ich will Königin sein in Fred Urbans Reiche, das ist alles!«
Mit leise wiegenden Schritten ging sie weiter.
Die Augen Floras glühten durch das Halbdunkel, als die Feindin an dem gedeckten Tisch vorüberging.
Zwei Tage nach diesen Ereignissen saß Fred Urban in seinem Arbeitszimmer. Die noch vor Monaten kraftvolle Gestalt kauerte zusammengebrochen in einem großen, geschnitzten Armstuhl; traumverloren ruhte sein Blick auf dem großen Gemälde der Mittelwand, welches des Fürsten erste Gattin als Sechsundzwanzigjährige darstellte.
Der Rauch aus seiner Zigarette stieg langsam zur Decke empor.
Die blauen Wolken ringelten sich und belebten sich und formten sich zu seltsamen Gestalten.
Eingehüllt in diesen Nebel von Rauch und Duft träumte der Eisenkönig.
Er zog sich öfters jetzt zurück vor Cleopatra; etwas wie dunkle Furcht vor ihr bedrückte ihn. Dann nahm er Zuflucht zur Zigarette.
»Sie ist eine Philosophie für sich«, dachte er. »Sie gibt sich ganz, Leib und Seele, ihren Duft und ihre Märchen. Gibt sich, bis sie zu Asche wird. So gibt sich kein Weib. Nichts auf Erden.«
Wenn die schaukelnden Duftwolken ihn umschwebten — keine Frauenhand konnte zärtlicher sein —, nahmen seine Gedanken merkwürdige Gestalten an. Und er glaubte Erinnerungen zu finden aus längst erloschenen Zeiten.
Dichter wurde der blaue Nebel.
Da zuckte Fred Urban plötzlich zusammen. Er hatte nie die Furcht gekannt. Nachdenklich strich er mit der gepflegten weißen Hand über die Augen und heftete sie dann wieder von Neuem auf das große Gemälde an der Wand.
Das Bild lebte!
Er konnte beginnen, was er wollte —, er konnte die Augen schließen und sie wieder öffnen —, er hätte sie aus den Höhlen reißen mögen — es wäre doch das gleiche geblieben! Das Bild bewegte sich!
Langsam erhob er sich von seinem Sessel, fand aber nicht die Kraft, auf die seltsame Erscheinung zuzuschreiten. Was sollte das bedeuten?
Träumte er? Hatte der Wahnsinn ihn erfasst?
Bilder konnten nicht leben — das war sicher! Hatte man im dritten Jahrtausend die größten Rätsel der Natur gelöst und die schimmerndsten Märchen zur Wahrheit gemacht — das war nicht möglich!
Und doch lebte die elfengleiche Gestalt. Jetzt neigte sie sich nieder, und plötzlich sah er, dass sie durch den blauen Nebel des Tabaks einen kleinen, runden Spiegel, nicht größer als ihr zarter Oberkörper, ihm entgegenhielt.
Blitzschnell schoss dem Eisenkönig durch den Kopf: Man plant ein Attentat gegen dich! Was auch immer hier vorgegangen ist — ein Anschlag steckt hinter dieser plötzlichen Erscheinung und man will dich töten!
Er spannte seine Kräfte an, sprang empor und stürzte auf das Bildnis zu, das unbeweglich in dem goldenen Rahmen stand — da prallte er zurück.
Lähmendes Entsetzen legte sich über seine Glieder. Ja, der Schrecken, der ihn augenblicklich erfasste, war so groß, dass ein unartikulierter Schrei seinen bleichen Lippen entfloh.
Er sah sich selbst in dem Spiegel. Sein eigener Kopf grinste ihm entgegen, von Angst und Schrecken verzerrt, der Schädel eines kraftlosen Greises!
Er hob bebend die mageren, blutleeren Hände. Er öffnete die Lippen und schloss sie wieder und konnte doch nicht mehr zweifeln, dass das sein Spiegelbild war, denn der Kopf ahmte getreulich jede seiner Bewegungen nach.
Er sah eine weit vorspringende Stirn, bedeckt von spärlichem, mit weißen Fäden durchzogenem Haar. Diese Stirn wurde getragen von zwei Schläfen, die so tief zusammengebrochen waren, dass man den Finger in die Löcher hätte legen können. Er sah die spitze, fleischlose Nase und darunter zwei eingesunkene, schmale, blutleere Lippen. Er sah den grauen Vollbart sich um das hagere Antlitz winden, aus dem die Knochen hervorstanden.
Er sah überhaupt nichts als Schatten und Knochen und Löcher in diesem Schädel, der schon von den Würmern der Verwesung zerfressen zu sein schien.
Nur die Augen lebten, dieselben Augen, auf die er vierzig Jahre lang so stolz gewesen, vor denen alle gezittert hatten. Sie leuchteten willen- und kraftlos aus ihren Höhlen hervor, in deren tiefsten Schatten sie lagen.
Vergebens erprobte Fred Urban die Kraft seines Willens. Noch wollte er nicht glauben, dass er das selbst war, dass er ein Greis geworden in Monaten.
Er heftete den Blick auf die schemenhafte Erscheinung und befahl ihr, hinwegzugehen, befahl dem Spuk zu verschwinden — aber sein Wille wirkte nicht! Seine Energie war zerbrochen, seine Augen waren kraftlos, sein Blick versagte!
Da wandte er sich schluchzend ab, und schwer fiel sein Kopf auf die Tischplatte nieder.
Als er ihn wieder hob, da war die Erscheinung verschwunden. Das Bild seiner Gattin hing steif und stumm an der Mittelwand und die Fetzen des bläulichen Rauches klebten an dem Rahmen.
Er fuhr sich über die Augen. Er richtete straff den alten Körper auf und schritt von Zimmer zu Zimmer.
Vor jedem Spiegel blieb er stehen und starrte hinein; und je weiter er ging und je öfter er sich ansah, desto klarer begriff er, dass er ein Greis geworden, dass er nicht mehr Fred Urban war, der Mächtige, der Eisenkönig, der alle Beherrschende.
Und plötzlich zitterten seine Nerven und er murmelte:
»Cleopatra! Cleopatra und ich! Die Jugend und ein Greis!« Und er knirschte mit den Zähnen vor ohnmächtiger Wut.
Verzweifelt ließ er sich in einen Sessel sinken und drückte auf die Klingel.
Der malaiische Diener trat ein.
»Faringo, die Zeitungen!«
Der Sklave brachte die letzten Ausgaben der Berliner Tagesblätter.
»Ich muss mich zerstreuen«, dachte Fred Urban. »Ich muss meinen Gedanken eine andere Richtung geben, sonst packt mich der Wahnsinn! Ohne Zweifel ist das das Schicksal unserer ganzen Rasse! Ich bin nicht der einzige! Unsere Kultur hat uns entnervt und wir stehen am Rande eines Abgrundes, der uns alle verschlingen wird! Unsere Kräfte zehren sich fieberhaft auf und wir welken dahin, ehe wir sie recht haben entfalten können! Wehe denen, die nach uns kommen!«
Er las, was ihn interessierte. Plötzlich weiteten sich seine Augen, und der Nagel seines Zeigefingers blieb auf einem Artikel haften, den er in fieberhafter Gier verschlang. Langsam hob er den Kopf und sah über das Blatt hinweg. Es flatterte rauschend zu Boden.
Eine Stunde saß er so und dachte nach. Dann ergriff er die Zeitung von Neuem und las den Artikel zum dritten Male. Er lautete:
Professor Prometheus behauptet, den Stein der Weisen gefunden zu haben, den die größten Geister der drei Jahrtausende vergeblich suchten!
Schon vor Jahren hörten wir, dass Professor Prometheus die Bazillen entdeckt hat, welche unser frühes Ende herbeiführen. Seitdem wir über die höchsten Errungenschaften der medizinischen Wissenschaft verfügen, gibt es kaum mehr eine Krankheit unter uns. Wir können uns gegen alles schützen und haben es so weit gebracht, selbst erkrankten Organen die höchste Lebensfähigkeit zu geben.
Aber im Laufe von drei Jahrtausenden wurde unsere Lebenszeit immer kürzer, und seit fünfhundert Jahren kommen die ältesten Menschen kaum mehr über sechzig hinaus.
Professor Prometheus behauptet nun, dass die Altersschwäche, die sich so früh bei uns einstellt, von bestimmten Bazillen herbeigeführt werde, die in unserem Körper leben und unsere besten Kräfte verzehren. Er will das Geheimnis gefunden haben, diese Bazillen zu töten, und er hat in seinem Sanatorium, welches die Staatsanwaltschaft trotz ausgedehntester Erkundigungen nicht finden konnte, Experimente gemacht, die angeblich fabelhafte Erfolge gezeitigt haben sollen.
Bis dahin ist Professor Prometheus unbehelligt geblieben, wenn auch unsere Ärzte ihm keinen Glauben geschenkt haben. Nun aber hat er die Behauptung aufgestellt, er könne jedem, dessen Körper gesund und des sen Energie ungeschwächt sei, die Jugend wiedergeben! Man höre: die Jugend! Kein Greis von sechzig Jahren braucht mehr zu verzweifeln angesichts des nahenden Todes! Professor Prometheus verspricht, ihm durchseine Methode das Alter von zwanzig Jahren wiederzugeben und ihn in den Stand zu setzen, den Kreislauf seines Lebens von Neuem zu durcheilen!
Man wird begreifen, dass sich viele Leute fanden, die sich bereit er klärten, das Experiment zu erproben. Nun sind bei der Staatsanwaltschaft nicht weniger als fünf Anzeigen eingelaufen, welche den Professor des Mordes bezichtigen, und wir stehen somit am Anfang eines Prozesses, der sicherlich zu den sensationellsten Erscheinungen dieses Jahres gehören wird.
Professor Prometheus wurde heute während seines kurzen Aufenthaltes in Berlin in dem Augenblick verhaftet, als er in seinem Luftschiff die Rückreise in sein bis jetzt noch nicht gefundenes Sanatorium antreten wollte.
Fred Urban sprang auf und eilte mit großen Schritten in dem Zimmer auf und ab.
»Diese Zeitungsschreiber sind Narren!«, murmelte er. »Warum soll uns die Wissenschaft nicht die Jugend wiedergeben können? Warum soll das unmöglich sein? Wenn wir auf Grund eines ganz natürlichen Prozesses altern, warum sollte dann dieser Prozess nicht rückgängig gemacht werden können?
Warum sollte die Kraft der Jugend nicht mehr erneuert werden können?
Die Natur wird alt und von selbst wieder jung. Unser Kreislauf ist also eigentlich ein unnatürlicher, denn wir sterben, statt dass sich unsere Jugend erneut! Warum sollte Professor Prometheus nicht das letzte Geheimnis der Natur ergründet haben?«
Er drückte auf die Klingel und befahl Faringo, sein Flugcoupé in Bereitschaft zu setzen.
Fünf Minuten später fuhr Fürst Urban vor dem Zentralgefängnis vor.
Der Eisenkönig war eine Macht in Berlin. Vor ihm taten sich alle Tore auf; ein Wort von ihm genügte, um ihm Einlass in die Zelle zu verschaffen, wo Professor Prometheus gefangen saß, um am selben Tage noch einem eingehenden Verhör durch drei Untersuchungsrichter unterworfen zu werden.
Es war ein eigenartiges Bild, als Fred Urban die schwere Eisenpforte hinter sich zuschlug und Professor Prometheus gegenüberstand.
Verborgener Neid und Erstaunen zugleich malte sich in den Zügen des Eisenkönigs; so war er früher und vor Kurzem noch gewesen, so wie dieser Mann, der da vor ihm stand, groß, kräftig, das jugendliche Gesicht von grauem Barte umrahmt.
»Ich habe die Ehre, den berühmten Professor Prometheus vor mir zu sehen?«, fragte Fred Urban.
Der Gelehrte richtete sein durchdringendes, pechschwarzes Auge, in dem eine gefährliche Kraft lag, auf den Greis.
»Ich bin Professor Prometheus. Sind Sie ein Richter?«
»Nein. Ein Bittender, der bereit ist, Ihnen gegen eine Gefälligkeit die Freiheit wiederzugeben.«
Bei dem Worte Freiheit blitzte es in Professor Prometheus' Augen auf. Er wusste wohl, dass er lebend das Zentralgefängnis nicht mehr verlassen würde, selbst wenn die Richter sich überzeugten, dass ihm die Absicht, die Menschen zu töten, ferngelegen. Wer nachweisbar einen Menschen ums Leben gebracht, musste wieder getötet werden, so lautete das Gesetz.
Der Gelehrte antwortete daher rasch:
»Sprechen Sie, wer Sie auch sein mögen — wenn es in meiner Macht liegt, Ihnen zu dienen, mögen Sie über mich verfügen!«
Fred Urban setzte sich auf den kleinen Holzschemel, der in der Mitte der Zelle stand, und begann:
»Mein Name ist Fred Urban. Ich bin der Herr über siebzigtausend Arbeiter; mein Vermögen ist so groß, dass ich nicht imstande bin, es zu zählen. Ich bin fünfzig Jahre alt und nähere mich mit einer Schnelligkeit, die unbeschreiblich ist, dem Greisenalter.«
»Man sieht es!«, warf Professor Prometheus ein!
»Nun wohl! Ich bin ein Greis, aber jung geblieben in meinen Wünschen! Ich liebe ein Weib, dessen Schönheit alles überragt, was jemals menschliche Augen erblickt. Diese Frau liebt mich wieder. Doch wie lange wird diese Liebe noch dauern? Ist es möglich, dass die blühende Jugend sich an das zusammenbrechende Alter klammern kann?«
»Nein«, entgegnete Professor Prometheus ruhig. »Es ist unmöglich, dass ein junges Weib ihre Liebe einem Greise schenkt, denn es widerspricht den Gesetzen der Natur!«
Fred Urban sprang auf.
»Nun also! Sie sagen es selbst! Ich kann aber nicht verzichten! Ich will nicht! Weder auf Cleopatra noch auf alles andere, was die Welt mir bietet! Die Welt ist ja so schön, Professor Prometheus, wenn man reich ist, wenn man mächtig ist und wenn man Kraft besitzt! Ich will alles noch genießen, was sich mir bietet — mit einem Wort: ich will wieder jung werden, jung, begehrenswert, schön, ein Mann von zwanzig, dem alle Welt zu Füßen liegt!
Professor Prometheus hatte die Arme über der Brust gekreuzt und seinen Blick in das Auge Fred Urbans gesenkt.
»Sie besitzen Energie, mehr als ein gewöhnlicher Mensch«, murmelte er. »Ich sehe es. Ihr Körper ist so schwach, dass ich Ihnen höchstens ein Jahr noch zum Leben geben würde! Und Sie wollen wieder jung werden?«
»Ja, noch einmal zwanzig! Man behauptet, Professor Prometheus, Sie besäßen die fabelhafte Kraft, die Jugend wiederzugeben! Ist es wahr? Ist es möglich?«
»Es ist möglich und wahr!«, entgegnete der Gelehrte mit dumpfer Stimme, während seine Augen brannten. »Fünfzig Jahre habe ich über diesem Geheimnis gebrütet. Die ersten Versuche sind missglückt, Fred Urban, — doch ich frage Sie: Ist damit der Beweis erbracht, dass meine Hypothesen falsch sind? Kein Wurf glückt auf das erste Mal! Es ist wahr — ich habe fünf Menschen ermordet — aber wiegen fünf Menschenleben nicht ein Geheimnis auf, welches Millionen von Greisen in Jünglinge verwandeln wird?«
Fred Urban, der niemals Wert auf fremde Menschenleben gelegt hatte, rief enthusiastisch:
»Sie haben recht, Professor Prometheus! Hundert Menschenleben sind nichts gegen eine große Idee! Doch erklären Sie mir nur das Eine: Auf welchem Geheimnis beruht Ihre Erfindung? Ich bin sofort bereit, das Leben zu wagen, wenn mein Geist Ihrer Hypothese zu folgen vermag!«
Der Gefangene ging ein paar Mal mit großen Schritten in der engen Zelle auf und nieder. Sein großzügiges Gesicht geriet in Bewegung, seine Augen rollten und er begann mit tiefer, sonorer Stimme seine Erklärungen:
»Die Menschen, die mich in kleinlichem Wahn hierher gebracht haben, sind Narren! Sie wissen nicht, dass sie ihren größten Wohltäter, der mehr für sie getan hat als der Messias, töten wollen! Was verspreche ich den Menschen? Unsterblichkeit! Nicht die geistige Unsterblichkeit meine ich, nicht das ewige Leben eines Namens, den eine Illusion erhält und wiederum nur eine Illusion für wünschenswert erachten kann! Nein! Das physische, reale, nackte Leben soll, wenigstens in einem bestimmten Rahmen, von Neuem in seine Bahn zurückgeführt werden! Mit einem Worte, Fred Urban: Ich bin mächtiger als der Tod!«
Er schrie den Satz hinaus und stand nun hochaufgerichtet, mit blitzenden Augen:
»Es dreht sich um ein Serum, Fred Urban, welches ich erfunden habe, ein Serum, das natürlich nur wirken kann, wenn zu gleicher Zeit der Patient ein Jahr hindurch unter schärfster ärztlicher Kontrolle steht. Zwei Bedingungen sind an den Erfolg des Heilmittels geknüpft: Einmal dürfen Sie Ihrem Körper keinerlei Stoffe mehr zuführen, die irgend stärkere Verwesungsprodukte hervorbringen; zweitens müssen Sie Ihre Seele einer eigenen Methode unterwerfen, die ich ersonnen habe; denn ich behaupte, dass die größte Einwirkung auf den Körper nicht durch diesen selbst, sondern auf dem Wege der Psyche ausgeübt werden kann.
Dass die sogenannten weißen Zellen unseren Körper erhalten, weiß heute jedes Kind, denn sie vernichten die vielen Mikroben, die ihren Sitz im Dickdarm haben und von hier aus den menschlichen Körper untergraben, das heißt das Alter herbeiführen, dem schließlich der Tod folgt.
Mein Serum gilt der Vernichtung dieser Mikroben. Während ich also dem Körper seine Lebenskraft wiedergebe, unterwerfe ich den Leib gleichzeitig einer Art medizinischer Massage, die in Verbindung mit besonders präparierten Einspritzungen dahin wirkt, dass die Muskeln wieder steif werden, die Sehnen sich wieder zusammenziehen, das Fleisch wieder wächst und die Haut wieder ihre Tätigkeit in vollem Umfang aufnimmt, mit einem Wort, dass mit fortlaufender geistiger und körperlicher Gesundung zu gleicher Zeit eine Wiederherstellung des Blutes beginnt und die Jugend zurückkehrt!«
»Das erscheint mir so einfach, wie Sie das sagen, Professor Prometheus«, entgegnete Fred Urban, »dass ich nicht verstehe, wie fünf Menschen an Ihren Experimenten zugrunde gehen konnten.«
Professor Prometheus nickte; seine Stimme dämpfend, entgegnete er:
»Sie vergessen etwas, Fred Urban. Eines: das Herz! Meine Methode stellt die höchsten Anforderungen an das menschliche Herz, das die sämtlichen Konsequenzen der unglaublichen Anstrengungen, welche der Körper macht, zu tragen hat. Ich nehme Sie nur in meine Kur, Fred Urban, wenn Ihr Herz gesund ist! Aber wie sollte ich imstande sein, nachzuweisen, ob Ihr Herz auch die nötige Kraft besitzt? Es kann gesund sein, braucht keinen Makel zu besitzen und ist doch vielleicht nicht stark genug, die ungeheuerlichen Anstrengungen des ganzen Organismus auszuhalten. Besitzt Ihr Herz diese Kraft nicht, Fred Urban, lässt die Spannkraft Ihrer Energie auch nur eine Sekunde in diesem Jahre nach, so ist das Experiment missglückt und Ihr Herz bleibt in dem Augenblick stehen, wo Sie die Kraft verlieren!«
»Es ist wie ein Märchen...«, murmelte Fred Urban.
»Es ist kein Mittel gegen den Tod!«, entgegnete Professor Prometheus. »Würde ich das behaupten, so wäre ich ein Scharlatan. Zweimal kann ich niemandem Jugend geben, denn kein Organismus würde das ertragen. Aber einmal kann ich die Menschen vor dem Tode retten, aber einmal den Greis zurückführen in die lachenden Gefilde der Schönheit, die ihm verschlossen schienen.«
»Und die Seele? Und der Geist? Und das Gehirn?«, fragte Fred Urban atemlos.
»Die behalten die Erfahrungen der Vergangenheit!«, entgegnete lächelnd der Gefangene. »Sie werden ein Jüngling sein mit den Schätzen des Geistes und der Seele, welche Sie im Laufe der fünfzig Jahre gesammelt haben!«
»Sie sind ein Gott, Professor Prometheus!«, rief Fred Urban in ausbrechender Ekstase.
Er stürzte auf den Professor zu, umklammerte mit beiden Händen die seinen und rief:
»So geben Sie mir die Jugend wieder und Sie sind frei!«
Professor Prometheus nickte nur kurz mit dem mächtigen Kopf, dann verließ der Eisenkönig die Zelle.
In derselben Nacht öffnete sich wie durch Geisterhand das Gefängnis des Gelehrten. Fred Urban hatte die Wächter durch große Geldsummen bestochen. Neben dem festungsartigen Gebäude wartete das Luftschiff des Eisenkönigs, in dem er mit Professor Prometheus zusammen die Reise nach dessen Sanatorium antrat.
In dem luxuriösen Domänenpalast des Eisenkönigs ging alles seinen gewohnten Gang.
Fred Urban hatte in den letzten Stunden, ehe er mit Professor Prometheus die folgenreiche Fahrt nach dem Sanatorium für neue Jugend angetreten hatte, alle seine Angelegenheiten geordnet.
Cleopatra befand sich bereits in ihrem wundervollen Schlafzimmer, als ihr Gatte eintrat.
Dieser Raum war das fabelhafteste an Prunk und Luxus, was man sich denken konnte: Die Wände waren mit Edelsteinen eingelegt; kostbare Venezianer warfen vielfältig das Bildnis der schönen Frau zurück; ihr Lager bestand aus einer großen Muschel, in die sich die feinen Daunen und Linnen des Bettes schmiegten. Ein Baldachin aus glänzender Seide wölbte sich darüber und reizende Engel trugen die Ampel, hinter deren blauen Gläsern das elektrische Licht verschwiegen und diskret hervorschimmerte.
Fred Urban trat zu ihr. Wie immer, wenn er sie so erblickte, kreiste sein Blut siedend durch die Adern, und in seine Augen, die halb erloschen waren, trat ein jugendlicher, feuriger Schimmer.
Er ergriff ihre Hand und sagte:
»Cleopatra, du weißt, dass ich dich aus den niedersten Verhältnissen zum höchsten Glanz emporgezogen habe. Du warst eine von denen da unten, eine Sklavin der Arbeit, eine Null, ein Weib, das früher oder später verwelkt wäre in den brutalen Armen eines ewig nach Schweiß und Fusel riechenden Arbeiters.
Und was ist aus dir geworden? Eine Fürstin! Eine Frau, die ganz Berlin vergöttert, die kraft ihrer Schönheit und ihres Reichtums die ganze Stadt beherrscht! Du bist mir also zum größten Dank verpflichtet!«
»Das ist wahr!«, entgegnete Cleopatra, indem sie sich wie eine Schlange zusammenringelte und ihre kirschroten Lippen auf Fred Urbans abgezehrte Hand drückte.
Hätte der Eisenkönig noch wie ehedem in den Mienen eines Menschen zu lesen verstanden, so würde er bemerkt haben, dass Cleopatra ganz anders dachte, als sie sprach.
»Warum soll ich dir zu Dank verpflichtet sein?«, sagte sie sich. »Weil du mich geliebt hast und mich zu dir emporzogst? Warum hast du das getan? Weil du nach mir Verlangen trugst und weil deine Eitelkeit es nicht zugelassen hat, dass du dich mit einer Sklavin abgabst! Du würdest mich, wäre ich wieder eine von denen da unten, heute mit derselben Gleichgültigkeit wieder in diese Hölle von Ruß, Rauch und Schrecken hinabstoßen. Ich habe keinen Grund, dir dankbar zu sein.«
Fred Urban fuhr fort:
»Du schwörst mir bei deiner Ehre, Cleopatra, dass du mir treu sein willst, wenn ich dich auf ein Jahr verlasse?«
Cleopatra lächelte ihr verführerischstes Lächeln.
»Kannst du daran zweifeln, Fred?«
»Nein! Ich zweifle nicht!«, entgegnete er enthusiastisch, und sie nickte befriedigt. »Ich muss eine lange Reise unternehmen, die mich ein volles Jahr von Berlin entfernt halten wird. Ein Jahr — nicht länger — nicht kürzer. Du weißt aber selbst, Cleopatra, dass wir heutzutage allen möglichen Gefahren ausgesetzt sind; ich habe daher für den Fall, dass ich nicht mehr zurückkehren sollte, meine Verhältnisse in Ordnung gebracht. Sollte das Schlimmste eintreten, so wird mein Sohn Wolf das Erbe antreten und Herr sein über die Fabriken. Er ist angewiesen, dir diesen Palast nebst einer angemessenen Witwenpension zu überlassen. Sollte aber wider Erwarten auch mein Sohn Wolf bald sterben und du ihn überleben, so würdest du die Herrin all meines Besitztums werden!«
»Wir wollen keine von diesen beiden Möglichkeiten annehmen«, entgegnete Cleopatra heuchlerisch.
Fred Urban merkte nichts.
Er begab sich in den Palast seines Sohnes und verabschiedete sich von ihm mit einem langen Händedruck. So weit war es schon mit Fred Urban gekommen, dass er nicht bemerkte, wie Wolf an ihm vorübersah, weil er nicht die Kraft fand, ihm ins Auge zu blicken.
Nun begab sich der Eisenkönig auf die Reise.
Mit fabelhafter Schnelligkeit legte das Luftschiff, welches ein vertrauter Führer Fred Urbans dirigierte, den Weg zu dem Sanatorium des Professors Prometheus zurück.
Dieser gab die Richtung an; das Coupé kreuzte über das Mittelländische Meer, flog über die Sahara hinweg, ließ den Nil unter sich und landete schließlich auf einem Berge, der gerade in der Mitte zwischen dem Rudolf- und dem Viktoria-Nyanza an der Westseite Afrikas liegt.(*)
(*) »Rudolf-See« ist eine alte Bezeichnung für den heutigen Turkana-See, der überwiegend zu Kenia und teilweise zu Äthiopien gehört. Mit »Viktora Nyanza« ist der Victoria-See gemeint, der heute zu Uganda, Kenia und Tansania gehört. Die beiden Seen und damit auch der ungenannte Berg (in Frage kommt der im Grenzgebiet zwischen Uganda und Kenia liegende Mount Elgon) liegen allerdings nicht in West, sondern in Ostafrika; D.v.R.
Hier befand sich das verborgene Sanatorium des Professors Prometheus.
Gleich am ersten Tage nach seiner Ankunft musste Fred Urban seine Kur beginnen. Er hatte die Nacht in einem kleinen Häuschen zugebracht. Mit anbrechendem Morgen führte ihn der Gelehrte über gewaltige Marmorstufen hinweg zu dem Sanatorium. Es war in der Form eines gigantischen heidnischen Tempels gebaut. Umgeben von ewigem Eis, reckte es seine gewaltigen Säulenspitzen in die Wolken.
In der Mitte des großen Saales brannte ein Feuer, welches zwei Priesterinnen, die gleichzeitig die Kranken bedienten, unterhielten, sodass es niemals verlöschen konnte.
Der Tempel war nach allen Seiten hin offen und gewährte der Luft freien Zutritt. Fred Urban, der die von ewig gleicher Atmosphäre durchfluteten Räume seines Palastes gewohnt war, schüttelte sich vor Frost.
»Wo ist das Zimmer, das Sie mir anweisen werden, Professor Prometheus?«, fragte er. Der Gelehrte zog einen weißen Vorhang, der rings um das ewige Feuer lief, beiseite; der Eisenkönig erblickte etwa zwei Dutzend Männer und Frauen, welche auf langgezogenen, einfachen Betten schliefen. Etwa zwölf von ihnen sprangen auf, als das Licht des Tages hell in ihre Augen fiel.
Die Übrigen aber regten sich nicht.
»Sie scheinen einen tiefen Schlaf zu haben!«, bemerkte Fred Urban schüchtern. Professor Prometheus entgegnete:
»Sie sind zu schwach gewesen, die Kur zu überstehen. Sie sind tot!«
Ein heimlicher Schauder fasste den Eisenkönig. Doch mit dem Rest seiner alten Energie zwang er die Feigheit nieder, die ihn ergriff, und begann die Kur.
Er erhielt eines der Lager angewiesen, auf dem kurz vorher ein anderer eingeschlafen war, um nicht mehr zu erwachen.
Es bestand aus einfachen Palmenstämmen, die durch Zweige und Äste verbunden waren. Eine durchsichtige Decke milderte die Härte des Bettes, eine zweite hielt den Frost ab.
Umsonst begehrte Fred Urban Speise und Trank, um seinen Hunger zu stillen. Von dieser Stunde an erhielt er nichts mehr als die Milch von Ziegen und Schafen, die Professor Prometheus etwa vierundzwanzig Stunden stehen ließ, bis sie säuerlich wurde. Das bildete seine und seiner Genossen Nahrung von Tag zu Tag.
Die erste Zeit hindurch glaubte Fred Urban, vor Hunger sterben zu müssen. Bald aber gewöhnte er sich an diese neue Kost; schon nach Wochen empfand er, dass in seinem Körper gewaltige Veränderungen vorgingen, dass sich sein Blut allmählich verjüngte. Nachdem er etwa vier Monate in solcher Behandlung gewesen war, ohne auch nur für eine Minute des Tages die Luft zu entbehren, ging Professor Prometheus daran, ihm das Serum der Jugend einzuspritzen.
Nach dieser Operation verfiel Fred Urban in einen todesähnlichen Schlaf, der acht Tage währte. Als er erwachte, sagte der Gelehrte:
»Sie haben das Schlimmste jetzt überstanden, Fürst, und es besteht alle Hoffnung, dass Sie die Kur ertragen werden!«
Mit dieser Stunde begann Professor Prometheus den zweiten Teil seines Experiments, das sich nur auf die Seele erstreckte.
Dieser gewaltige Arzt hatte in seinem Geist eine solche Unmenge von magischer Kraft und elektrischer Energie angesammelt, dass er jederzeit imstande war, anderen so viel davon mitzuteilen, dass ihr Körper vollständig damit ausgefüllt wurde.
Fred Urban fühlte seine Energie, seine Tatkraft, seinen Mut, kurz — seine Jugend wachsen von Woche zu Woche. Und in dem Maßstabe, da die innere Reorganisation seines Körpers und seines Geistes vor sich ging, veränderte sich auch sein Äußeres.
Die ergrauten Haare bekamen ihr ursprüngliches Aussehen wieder. Die Augen wurden glänzend, der Bart nahm wieder die Farbe des Goldes an. Seine Lippen, erst welk und schlaff, wurden straff und rot, die Haut überspannte prall die Wangen, Runzeln und Falten verschwanden; die Muskeln wuchsen und dehnten sich, bis Professor Prometheus ihm eines Tages einen Spiegel vor die Augen hielt.
»Wer ist das?«, fragte Fred Urban.
»Das sind Sie!«
Aus dem Spiegel sah dem Eisenkönig ein Jüngling von etwa fünfundzwanzig Jahren entgegen. Als er seine Züge näher betrachtete, da erkannte er sich selbst aus der Zeit her, da er ein Jüngling war, da er durch die Kraft seiner Energie und seines Körpers den Grund gelegt hatte zu all seinem späteren Reichtum und Glück.
»Aber ich bin doch erst vor Kurzem zu Ihnen gekommen, Professor Prometheus!«, stammelte er.
Der große Gelehrte schüttelte den Kopf.
»Sie sind genau ein Jahr bei mir, Fürst! Ich habe mein Wort gehalten! Kehren Sie zurück und...«, hier nahm sein Antlitz einen eigentümlichen Ausdruck an..., »nutzen Sie sie gut, Ihre Jugend!«
»Kann man Sie anders nutzen, Professor Prometheus?«, entgegnete Fred Urban lachend, indem er voll Gelenkigkeit in seine alten Kleider schlüpfte und sich von dem Führer seines Automobils den kostbaren Mantel um die Schultern hängen ließ. Aber der Arzt blieb die Antwort schuldig. Der Abschied zwischen den beiden Männern war herzlich und rührend. Wie ein Riesenvogel hob sich das Luftschiff von dem Gipfel des Berges aus in den Äther und flatterte mit fieberhafter Geschwindigkeit der Heimat entgegen. —
Dort hatten sich inzwischen schreckliche Ereignisse zugetragen; Ereignisse, die vollständig im Zeichen von Cleopatras Seele und Wünschen standen, des Weibes von denen unter der Erde. — — —
William Scott stand in seinem Atelier, das sich freischwebend, nur auf mächtigen Eisenpfeilern ruhend, etwa siebzehn Stockwerke hoch über dem ehemaligen Tempelhofer Felde befand. Er arbeitete.
Rauschend hielt ein kleines Luftcoupé vor dem Eingang; der indische Diener eilte hinaus, um zu öffnen. In dichte Schleier gehüllt, trat Frau Flora ein.
Auf einen Wink des Malers entfernte sich der Sklave. Flora warf die duftigen Gewebe von sich. In ihren Mienen lag Zorn und Entrüstung. Sie eilte auf den Künstler zu, hob drohend die Hände und rief:
»Was haben Sie getan? Ist das Ihre ganze Kunst gewesen, William Scott? Sie haben, anstatt Cleopatra zu vertreiben, Fred Urban verdrängt, und die Gefahr, in der wir uns alle befinden, ist größer geworden denn je!«
Scott zog die weiße Leinwand, die den neu präparierten Spiegel verdeckte, tiefer über den Rahmen und entgegnete:
»Ich begreife weder Ihre Bestürzung noch Ihre Furcht, Frau Flora! Indem ich es dahin gebracht, dass Fred Urban Cleopatra verließ, habe ich ihren Einfluss gebrochen, und wir können sicher sein, dass der Fürst von ihr geheilt ist, wenn er zurückkehrt.«
»Und Sie wissen auch nicht, William Scott, wohin Fred Urban sich gewendet hat?«
Der Maler schüttelte den Kopf; in seinem Gesichte spiegelte sich gleichfalls etwas wie heimliche Besorgnis.
»Ich weiß es nicht, und Cleopatra weiß es nicht, und niemand weiß es in ganz Berlin!«, entgegnete er.
Flora ließ sich auf einen Diwan nieder, während der Maler vor ihr kniete und ihre Hand streichelte. Er bemerkte sehr wohl, wie ein Ausdruck des Ekels ihre Züge überzog, und eine feindliche Grimasse spiegelte sich in seinem Gesicht.
»Ich möchte Sie noch einmal zu Hilfe rufen!«, begann Frau Flora plötzlich, nachdem sie lange Zeit geschwiegen und dem vor ihr Knieenden wie geistesabwesend ihre Hand überlassen hatte.
»Sprechen Sie, Frau Flora!«
»Ich bemerke, dass mein Gatte von Tag zu Tag kälter gegen mich wird!«, begann sie mit klagender Stimme. »Ich kann nicht mehr zweifeln, dass Cleopatra, die ich nur mit einer blutdürstigen Kreuzspinne vergleichen kann, nun auch ihn in ihr Netz gezogen hat. Wolf ist Ihr Freund, William Scott! Sie können mir sicherlich ein Mittel angeben, durch welches ich von meinem neuen, großen Leid befreit werde!«
Während sie sprach, wurde der Künstler zerstreut. Mit unwiderstehlicher Gewalt drängte sich der Gedanke in sein Hirn, dass er nicht länger zaudern dürfte, Cleopatras Befehl auszuführen. Dieser Gedanke, der ihn in demselben Augenblick beherrschte, da ihn eben wieder die Leidenschaft für Flora ergriffen, kam von Cleopatra selbst. Sie saß in dem Palast des Eisenkönigs und übertrug ihren Wunsch mit der ganzen Kraft ihrer Energie auf William Scott.
»Ich glaube wohl, dass ich ein Mittel habe, Sie von allem Leid, das Sie bedrückt, zu befreien, Frau Flora«, entgegnete der Maler, indem er sie langsam vom Diwan hob und in die Mitte des Ateliers führte. Dort griff er mit der Rechten nach drei langstieligen Rosen, die in einer Vase aus Nymphenburger Porzellan standen.
Sie folgte seinen Bewegungen mit verwunderten Blicken.
»Die Rosen sind schön!«, flüsterte sie.
»Sie werden ihren Duft einziehen, Frau Flora, und all Ihre Wünsche werden in Erfüllung gegangen sein!«
Sie blickte ihn lächelnd an, ihr schönes Köpfchen auf dem feingliedrigen Hals zurückneigend.
»Welch ein Scherz, William Scott! Können Blumen heilen?«
»Je nachdem!«, entgegnete der Maler brutal und presste die Rosen plötzlich mit Gewalt gegen Floras Gesicht. Im Augenblick fühlte sie, wie ein furchtbarer Duft in ihre Sinne stieg, der sich heftig und schmerzend in alle ihre Nerven drängte. Es gelang ihr noch einmal, sich von dem Angreifer loszureißen; bei dieser gewaltsamen Bewegung, da sie den Arm des Mörders zurückschlug, riss sie unwillkürlich die Leinwand von dem Spiegel. Sekundenlang wandte sie der Silberfläche ihr von wahnsinnigem Schmerz und furchtbarer Verzweiflung verzerrtes Antlitz zu, dann sank sie mit einem tiefen Seufzer zu Boden nieder.
Sie war tot.
William Scott warf, ohne einen Augenblick zu zögern, einen bunten Schal um die Leiche und schleppte sie in eine kleine Vorratskammer, um sie später unter dem Schutz der Nacht in irgendein Versteck zu bringen.
Etwa zur selben Stunde öffnete sich die breite Flügeltüre, welche in Cleopatras geheime Gemächer führte, und ein Mann, dessen Gesicht von einer roten Larve bedeckt war, trat ein.
Cleopatra, abergläubisch, wie alle waren, die unter der Erde in Finsternis gelebt, streckte mit einem Schrei beide Arme gegen die Erscheinung aus und entfloh. Der kraftvoll gewachsene junge Mann nahm jetzt die Larve vom Gesicht und Cleopatra erkannte Wolf, den Sohn des Eisenkönigs.
»Wie du mich erschreckt hast!«, rief sie, sich ihm wieder nähernd.
Wolf entgegnete:
»Du musst dich daran gewöhnen, Cleopatra, dass ich von jetzt ab in dieser Maske bei dir erscheine. Solange mein Vater in Berlin weilte, konnte niemand bei meinen häufigen Besuchen Verdacht schöpfen. Jetzt aber, da er abwesend ist und er mir deine Sicherheit und deine Ehre noch ausdrücklich ans Herz gelegt, wachen hundert hämische Augen über dich und mich, und es ist nötig, dass ich dir nur mehr in Verkleidung nahe!«
Cleopatra wusste, dass in dieser Stunde William Scott sein Werk an dem Weibe beendete, welches sie bis jetzt von allen Mitgliedern des Urban'schen Hauses am meisten gefürchtet hatte. Sie selbst fühlte nichts von der schrecklichen Tragödie, die sich in dem Atelier des Malers abspielte. Aber sie erkannte an der plötzlichen Unruhe, die Wolf ergriff, dass das Werk gerade in diesem Augenblick geschah. Er zuckte zusammen und griff mit der rechten Hand gegen das Herz.
»Ich weiß nicht, was das ist!«, wandte er sich erbleichend an Cleopatra. »Ich habe die Empfindung, als würde man meinen Namen rufen, und meine Brust ist erfüllt von einem unsagbaren Schmerz!«
Er ahnte nicht, dass die sterbende Flora noch einmal mit all ihrer erlöschenden Kraft an ihn gedacht und ihn instinktiv zu Hilfe gerufen hatte. Die Nerven der Menschen des dritten Jahrtausends waren so sensitiv und ausgebildet, dass sie selbst auf die größte Entfernung hin auf die feinsten Schwingungen reagierten.
Cleopatra hatte mit William Scott vereinbart, dass auch Wolf so schnell wie möglich beseitigt werden müsste. Sie wollte nicht abwarten, bis Fred Urban plötzlich wieder zurückkehrte; sie hoffte überhaupt, dass er nie mehr kommen würde, nachdem bereits ein halbes Jahr seit seiner Abreise verflossen war.
Sie wandte sich also an Wolf, der noch immer wie lauschend neben ihr stand, die Hand am Herzen, alle Sinne angestrengt, um zu erraten, welchen Sinn die geheime Botschaft enthielt, die seine Nerven soeben aufgenommen hatten.
»Du könntest mir einen Gefallen tun, Wolf! Dein Freund William Scott hat mir versprochen, ein großes Gemälde zu malen, wo ich inmitten der drei Grazien als die Reizendste stehen soll. Dieses Bild kommt in den neuen Palast der Schönen Künste, wo der neu ernannte Minister der Kunst Wohnung nehmen soll. Möchtest du das Werk einmal ansehen, ehe es ganz vollendet ist? Möchtest du mir sagen, ob es wirklich meiner Schönheit entspricht? Ob William Scotts Können an das Problem, das er sich stellte, herangereicht hat?«
Wolf, von Eifersucht gepackt und zugleich begierig, dieses Gemälde zu sehen, entschlossen, die strengste Kritik daran zu üben, ging augenblicklich in die Falle, die Cleopatra ihm stellte. Er erklärte, das Atelier seines Freundes sogleich aufsuchen zu wollen, und verließ Cleopatra mit dem Versprechen, in einer halben Stunde zurück zu sein.
»Du kehrst nie mehr wieder!«, murmelte sie mit einem teuflischen Lächeln und öffnete weit die Fenster, um ihre blutigen Gedanken mit aller Kraft der Energie zu William Scott, ihrem Vertrauten, hinüberzusenden.
Dieser war schon entschlossen, Wolf zu töten, als dessen Gestalt, die die des Malers um mehr als Haupteslänge überragte, in das luxuriöse Atelier trat.
Da er aber auf das plötzliche Erscheinen seines Freundes nicht vorbereitet war, so musste er erst einen Plan entwerfen, auf welche Weise er ihn beseitigen könnte, um endlich in den alleinigen Besitz Cleopatras zu gelangen.
Er entschloss sich, ihn durch dieselbe List zu töten, die Frau Flora das Leben gekostet hatte. Er goss rasch aus einer kleinen Phiole den giftigen Staub über die leuchtenden Blumenkelche und wandte sich dann Wolf zu, der vor das Gemälde getreten war, an dem der Künstler soeben gearbeitet hatte. Es stellte aber nur das Bildnis einer vornehmen Dame der Berliner Gesellschaft dar.
»Wo ist das Bild der drei Grazien?«, fragte Wolf ungeduldig, Scott mit prüfenden Augen messend. Er war eine bis in die kleinsten Regungen ehrenhafte und vornehme Natur, wenn er auch, der bis dahin Unbesiegte, Cleopatras furchtbarer Macht zum Opfer gefallen war.
Er versuchte in den Zügen seines Freundes zu lesen und entdeckte mit Erstaunen, dass dieser zerstreut, verwirrt, ihm ohne Zweifel unehrlich gegenübertrat.
Der Maler wusste nichts von den drei Grazien, denn das war nur eine spontane Erfindung Cleopatras gewesen.
»Was für drei Grazien?«, fragte er daher verblüfft, Wolf das goldene Etui zur Bedienung reichend. Dieser entzündete sich eine der duftenden Zigaretten, steckte die Hände in die Taschen und entgegnete misstrauisch:
»Nun, ich denke, du malst die drei Grazien, und die mittlere Figur soll Cleopatra sein!«
Jetzt begriff Scott, dass Cleopatra eine List gebraucht hatte, ihr Opfer in sein Atelier zu locken; er entgegnete daher rasch:
»Ah so! Ganz recht! Das Bild kannst du leider nicht sehen, lieber Wolf!«
»Warum?«, fragte jener, indem er sich mit prüfenden Blicken in dem Atelier umsah. Plötzlich entfiel die Zigarette seinen Fingern. Eisesstarre durchrieselte seine Glieder; doch mit dem Aufwand seiner ganzen Kraft schüttelte er die Schwäche ab, die ihn zu übermannen drohte, und trat auf den Spiegel zu, von dem Frau Flora im Todeskampf die Leinwand ergriffen hatte.
William Scott war dies in der Aufregung und Eile entgangen, darum begriff er auch nicht, welche furchtbare Wandlung sich in Wolfs Innerem vollzog. Indem er eine lächerliche Ausrede stammelte, trat er rasch entschlossen auf die Vase zu, hob die Rosen heraus und sagte:
»Ziehe den Duft dieser Blumen einmal ein, Wolf, und sage, ob sie nicht das höchste Erzeugnis künstlicher Zucht sind, das unsere Gärten bis jetzt...«
Er brach ab. Er vergaß die Lippen wieder zu schließen und stand wie ein Steinbild hinter dem Freunde, die Augen weit geöffnet, ein Bild lähmenden Entsetzens und starren Schreckens. Wolf Urban kauerte mit geballten Fäusten, den Oberkörper weit vorgebeugt, die Augen verglast, die Unterlippe wie ein wildes Tier nach vorn geschoben, vor dem Spiegel William Scotts. Die Silberfläche hatte das Bild festgehalten, das sich zuletzt in ihr gespiegelt. Und Wolf Urban erkannte das Gesicht seiner Gemahlin. Er sah, dass ihre Züge zu einer grauenvollen Fratze verzerrt waren. Er sah, dass ihre Lippen im letzten, qualvollen Schmerz sich verzogen hatten, sah die aufgeblähten Nasenflügel, das sich zuspitzende Kinn, die Pupillen, die im letzten Todeskampfe sich förmlich unter die Lider verkrochen.
In diesem Augenblick begriff Wolf Urban alles.
Er erkannte, dass seine Gattin Flora einem tückischen Anschlag William Scotts zum Opfer gefallen war, dass sie sich hatte hierher locken lassen, dass sie die Ehre seines Hauses preisgegeben. Er erkannte, dass William Scott die unglückliche Flora ermordet hatte, ohne allerdings den tieferen Beweggrund zu erfassen, ohne auch nur zu ahnen, dass Cleopatra, die Allmächtige, hinter dieser furchtbaren Tat stand.
Und in diesem Augenblick, in dessen winzig kurzer Spanne Zeit sich ein Meer von Gedanken durcheinander wälzte, stieg in Wolf Urbans Herzen von Neuem die tiefe Liebe zu Frau Flora auf, die darin geschlummert hatte, und er ward von einem Hass gegen William Scott ergriffen, der ohne Grenzen war.
Das ereignete sich in dem Moment, da der Maler, von Schreck gelähmt, als auch sein Auge auf den verhängnisvollen Spiegel fiel, hinter dem Wolf Urban stand. Noch klangen die letzten Worte in dessen Ohr. Er drehte sich blitzschnell um. Seine männlich kraftvolle Gestalt reckte sich auf, sein Gesicht war verzerrt, die Brauen liefen beinahe in einem schiefen Winkel zu den Schläfen; seine Augen waren nur mehr zwei stechende Edelsteine in dunklen Höhlen. Die Leidenschaft, die in ihm aufgerissen worden, war so groß, so fürchterlich, dass er nicht die Kraft fand, zu sprechen. Seine dröhnende Anklage gegen William Scott wälzte sich nur in fiebernden Gedanken durch sein Hirn, und der Maler, der die anklagenden Worte Wolf Urbans empfand, ohne sie zu hören, antwortete ebenso schweigend durch eine Flut von Lügen und Ausflüchten, welche sein Gegner endlich mit einem entsetzlichen, höllischen Hohngelächter beantwortete.
Er warf sich auf ihn. Vergeblich versuchte der Maler sich zu wehren; mit einem Fausthieb warf der Sohn des Eisenkönigs ihn zu Boden, presste seine Arme um den zitternden Körper und fesselte ihn mit einer Schnur so fest, dass er nicht mehr imstande war, auch nur ein Glied noch zu rühren.
Nur seine Augenlider gingen fieberhaft auf und nieder. Draußen senkte sich die Dämmerung in blauen Schatten über Berlin. Wolf Urban stieß einen leisen Pfiff aus. Die Tür öffnete sich und Faringo, der treue malaiische Diener des Eisenkönigs, der seine Ergebenheit jetzt auf den Sohn übertrug, trat ein.
»Packe diesen Elenden und trage ihn ins Coupé!«
Der Malaie hob den kleinen, schwächlichen Körper William Scotts empor, legte ihn über die Schulter und trug ihn wie ein lebloses Bündel in das Luftschiff. Wolf Urban war so von Hass durchflutet, dass er gar nicht daran dachte, nach Floras Leichnam zu suchen.
Ehe er das Atelier des Malers verließ, gerade als er den Fuß in sein Luftschiff setzte, warf er eine kleine Feuerkugel, die er für seine Zigaretten benötigte, auf den kostbaren, schweren Teppich. Während das Luftschiff leise schaukelnd dem Palast des Eisenkönigs entgegenfuhr, flammte William Scotts kostbares Atelier empor und bildete einige Minuten später eine einzige, hoch aufschlagende Feuersäule, in deren Gluten Frau Floras blumenhafter Körper zu Asche verbrannt wurde.
Ohne Cleopatra erst zu besuchen, die unruhig, nicht wissend, was geschehen war, in ihrem Zimmer auf und ab ging, ließ Wolf Urban den Körper seines gefesselten Feindes in das Arbeitszimmer seines Vaters bringen.
Drei Betriebsführer der großen Fabrik erwarteten ihn. Sie warfen einen erstaunten Blick auf dieses menschliche Paket.
Ohne Wolf Urbans Befehl, zu sprechen, abzuwarten, trugen sie ihm die Gefahr vor, welche von Neuem unter der Erde entstanden war.
»Herr!«, sagte der eine, »wir haben es wieder mit einer Streikbewegung zu tun, die diesmal weit größere Dimensionen angenommen hat als je zuvor. Sie verlangen nicht gerade Lohnerhöhungen; es sind Kräfte unter ihnen aufgestanden, welche ganz andere Ziele verfolgen, und die siebzigtausend Arbeiter unserer Fabrik fordern stürmisch, dass einige Stunden des Tages eines der zehn Tore geöffnet wird, damit sie Anteil nehmen können an dem Leben derer, die hier oben regieren!«
Wolf Urbans Gesicht blieb unbeweglich. Nur eine Falte grub sich zwischen die Brauen. Er war ein Herrenmensch durch und durch, das Abbild des Vaters.
»Wissen die da unten nicht, dass das unmöglich ist? Dass wir unsere Zukunft, unsere Nachkommen preisgeben würden, wenn wir ihnen Anteil an unserem Leben gewährten? Sie sollen weiterarbeiten, wie es ihre Bestimmung ist! Es kann keine Gemeinschaft bestehen zwischen denen über der Erde und denen unter der Erde! Wir brauchen Sklaven für die Arbeit, nicht aber Brüder! Sagt ihnen dies als Botschaft!«
»Die Worte sind hart gewählt, Herr!«, entgegnete einer der Betriebsleiter. »Wäre es nicht angängig, wenigstens vorläufig einige Konzessionen zu machen? Sie verlangen die Sonne, Herr! Es ist ein gefährlicher Wunsch! Es hat Menschen gegeben, die schon wahnsinnig wurden, weil sie die Sonne sehen wollten. Ist es empfehlenswert, die da unten zum Äußersten zu reizen?«
Aber Wolf Urban wusste, was er sagte und wollte. Er wusste sehr genau, dass die da unten, welche an Zahl denen über der Erde wohl um das Zwanzigfache überlegen waren, machtlos blieben; denn in ihren Händen befanden sich nichts als Maschinen und wieder Maschinen, die der Arbeit dienten. Die über der Erde aber hatten furchtbare Waffen in Händen, alle Machtmittel der Kultur, mit denen sie die unter der Erde niederringen konnten, mit denen sie sie schon niedergerungen und in das Innere der Erde verbannt hatten.
»Es bleibt bei dem, was ich sagte!«, entgegnete er kurz.
Die Betriebsleiter kehrten mit dieser Botschaft zurück zu den Aufständischen.
Eine Weile ging Wolf Urban mit gekreuzten Armen in dem Zimmer auf und nieder, während William Scott in unbeschreiblicher Angst von Zeit zu Zeit die Lippen öffnete und einen heiseren Schrei ausstieß.
Endlich klingelte Wolf Urban um Faringo.
»Nimm das Opfer und folge mir!«
Faringo, dessen eiserne Muskeln wie geschnitzt aus den prallen Armen hervorstanden, hob den Gefangenen, der nicht mehr die Kraft fand, zu schreien, empor und folgte dem Herrn.
Wolf Urban schritt zu einem der zehn Riesentore, zu demselben, durch das Cleopatra zu denen über der Erde gelangt war, und befahl, es zu öffnen. Der Befehlshaber der Leute, welchen die Bewachung dieses Tores anvertraut war, entgegnete:
»Herr, es ist unmöglich, dass Ihr Euch in die Tiefe begebt! Ihr würdet zerrissen werden, denn die Arbeiter feiern! Hört Ihr das Surren ihrer Stimmen?«
In der Tat vernahm man aus der Tiefe der Erde, aus welcher sonst nur das Geräusch der arbeitenden Maschinen heraufdrang, ein dumpfes Brausen und Dröhnen. Es hörte sich an, als rollten die Donner unter der Erde. Aber Wolf Urban ließ sich nicht irre machen.
»Öffnen Sie das Tor so weit, dass zwei Menschen hindurch schlüpfen können!«, befahl er kurz, und die Männer, die unter seinem direkten Befehl standen, gehorchten.
Das Tor öffnete sich ganz langsam, einem Riesenmaul vergleichbar, das einen schwachen Versuch macht, sich auseinander zu ziehen. Wolf Urban stieg die Treppen hinab, vorbei an den trockenen Röhren der elektrischen Ströme. Hinter ihm her ging Faringo. Sein Schatten zeichnete sich riesengroß und drohend an den granitenen Wänden ab.
Der Sohn des Eisenkönigs eilte den finsteren Gang entlang, bis er die Treppe erreicht hatte, welche in die erste Etage der Tiefe hinabführte. Dort unten dehnten sich im glühenden Scheine lodernder Feuer Hunderte und Tausende von furchtbaren Körpern, auf deren erdfarbener Haut das Feuer blutige Reflexe warf.
Die zwei Männer, welche am Aufgang der Treppe erschienen waren, wurden augenblicklich von den Streikenden bemerkt. Das Geschrei dort unten verstummte, und während die Vordersten Miene machten, die Treppe empor zu stürzen und sich der Tollkühnen zu bemächtigen, beugte Wolf Urban sein Gesicht weit über das Dunkel vor und schrie hinab:
»Ihr da unten! Gebt acht! Wir werfen euch Wolf Urban, den Sohn des Eisenkönigs hinunter!«
Einen Augenblick herrschte Totenstille. Im nächsten Moment hob Faringo die kraftvollen Arme empor und schleuderte William Scott, das lebende Paket, in großem Bogen mitten unter die Schar von lebenden Teufeln, in deren Hirn der Branntwein wütete.
Sie fragten sich gar nicht erst, ob das wirklich Wolf Urban war, der mit einem gellenden, knirschenden Schrei mitten unter sie hineinfiel. Sie sahen nur, dass es einer von denen da oben war, ein hilfloser, kleiner, schwächlicher Mensch, von Lastern und Genüssen verdorben.
Die, welche die Treppe erreicht hatten, zauderten. Wolf Urban und Faringo liefen in eilender Hast den Gang hindurch, glitten durch die Öffnung der Erde und verschwanden, während das granitene Tor sich langsam wieder schloss.
Die unter der Erde aber hatten sich zu Dutzenden, nein, zu Hunderten über das Opfer geworfen, das die da oben ihnen preisgegeben hatten.
Das Ende, welches William Scott erlitt, war unbeschreiblich.
Cleopatra war nicht wenig verblüfft, als sie Wolf Urban bei sich eintreten sah. Da dieser nicht ahnte, welche schreckliche Rolle sie bei dem Verbrechen gespielt, das er in so raffinierter Weise gesühnt, erzählte er ihr alles.
Cleopatra, zu schwach und zu feige, selbst ihre Pläne durchzuführen, fand sich mit dem Gedanken ab, dass Wolf Urban vorläufig über sie gesiegt hatte.
Sie ertrug seine Besuche, und über das kleine Königreich Fred Urbans herrschten Wolf und Cleopatra gemeinsam.
B i s F r e d U r b a n z u r ü c k k e h r t e...
Das geschah unter eigenartigen Umständen.
Um die Seinigen vollständig zu überraschen, hatte der Eisenkönig sein Luftschiff einige Stunden vor der Hauptstadt auf die Felder niedersinken lassen und den Chauffeur dadurch entlohnt, dass er ihm das prächtige Fahrzeug zum Geschenk machte.
Dieser, außer sich vor Freude über diesen Besitz, der ihn zum vermögenden Manne machen musste, erhob sich sofort wieder in die Luft und verschwand in der Richtung gegen Paris.
Fred Urban hatte kaum den Augenblick erwarten können, wo er die Kraft seiner Jugend wieder erproben durfte. Er legte den Weg bis Berlin zu Fuß zurück. Rüstig schritt er vorwärts. Von Zeit zu Zeit erhob er die Arme und reckte und dehnte sie in unbeschreiblicher Lust zur Sonne empor. Das Kraftgefühl, welches ihn durchrieselte, erfüllte ihn mit unsagbarem Glück.
»Jetzt erst werde ich imstande sein, all das auszunutzen und auszukosten, was ich in dreißigjährigem Ringen mir aufgebaut habe«, dachte der Eisenkönig, während er als fünfundzwanzigjähriger Jüngling durch die Straßen Berlins schritt, in denen kein Verkehr mehr die Passanten belästigte.
»Ist es nicht eine Ungerechtigkeit der Natur, dass sie den Menschen durch das Alter ein Ziel all ihrer Hoffnungen gesetzt hat? Was ist der Mensch in der Jugend ohne die jahrzehntelange Tätigkeit und Arbeit? Nichts! Und hat er sich sein Leben aufgebaut auf Kraft und Energie und Hoffnung, so kommt urplötzlich das Alter und entreißt ihm die Früchte, die er gesammelt hat und jetzt erst genießen könnte.
Dank dir, Professor Prometheus! Ich habe der Natur einen Strich durch die Rechnung gemacht! Ich habe dreißig Jahre lang alles gesammelt, was Menschen begehrenswert erscheint! Ich habe das schönste Weib, das je die Natur geschaffen, und ich stehe am Anfang meines Lebens! Ich schreite jetzt erst durch das Tor der Kraft, der Hoffnung und aller Erfüllung und werde imstande sein, noch einmal dreißig Jahre des Genusses zu leben!«
Unter solchen Gedanken erreichte Fred Urban seinen Palast. Unten vor dem Tore stand der Portier, ein riesenhafter Inder in kleidsamer Livree. Gleichgültig sah er dem Manne entgegen, der, in kostbare Gewänder gehüllt, sich dem Tore des Palastes näherte. Fred Urban wollte an ihm vorüber, doch der Wächter senkte den breiten Stab und versperrte die Türe.
»Wohin wollt Ihr?«
Fred Urban sah den Portier mit großen, kraftsprühenden Augen an; aber der wich nicht von der Stelle.
»Narr! Siehst du nicht, dass ich Fred Urban, der Eisenkönig bin?«
Keine Miene verzog sich in dem Gesicht des Inders.
»Weicht, wenn Ihr nicht wollt, dass ich die Wache rufe! Ihr seid nicht Fred Urban!«
»Ich bin es! Sieh mich an, Sklave, ehe du wagst, meinen Worten zu widersprechen!«
Der Inder lächelte.
»Fred Urban ist fünfzig, Ihr aber seid ein Knabe!«
Der Eisenkönig lachte laut auf und drehte sich um.
»Das ist ein Hauptspaß«, dachte er. »Nun bist du in Berlin vor deinem eigenen Haus und wirst nicht eingelassen! Niemand kennt dich!«
Er überlegte, ob er nicht mit Hilfe seiner Papiere und alles dessen, was er besaß, seine Identität amtlich feststellen lassen sollte, was ja schließlich keine große Schwierigkeiten bereitet hätte.
Nach kurzem Nachdenken verzichtete er darauf. Er besaß Geld genug, denn seine Unterschrift und sein Siegel genügten für alle Banken. Er begab sich also in das Innere der Stadt, mietete in einem Hotel ein prächtiges Appartement und begab sich dann von Neuem zurück zu seinem Palast. Er überreichte dem Portier eine Karte, auf welcher ein neuer, phantastischer Name stand, und befahl ihm, ihn Cleopatra, der Herrin des Hauses, zu melden.
Der Portier gab die Karte weiter und ließ den Träger des fremden Namens gleichzeitig in sein eigenes Haus eintreten. Diener empfingen ihn und geleiteten ihn in seinen eigenen Salon, während Cleopatras Kammerdiener ihr als letzter die Karte des Besuchers überreichte.
Sie las den Namen, zuckte die Achseln und befahl, den Besucher vorzulassen.
Sie empfing Fred Urban in ihrem prachtvollen Salon. Er kannte ihn wohl und trat wie ein Vertrauter über die Schwelle.
Die berückende Frau reichte dem Heimkehrenden die ringgeschmückte Hand, ohne ihn zu erkennen. Aber in ihren Augen glühte es auf. »Wie schön dieser Jüngling ist!«, dachte sie. »Alles ist Kraft an ihm, sein Blick, sein Gang, jede Bewegung.«
»Nehmen Sie Platz!«, sagte sie, auf einen Sessel deutend. »Ich freue mich, Sie kennen zu lernen, wenngleich ich bis jetzt nicht weiß, was...«
Sie sah ihn erwartungsvoll an.
Fred Urban schwieg eine Weile. Er begnügte sich damit, von Neuem die fabelhafte Schönheit dieser Frau auf sich wirken zu lassen. Seine bewundernden Blicke glitten an ihrer Gestalt empor und hinab, bis sie eine ungeduldige Bewegung machte. Da sagte er:
»Ich komme ziemlich weit her, Frau Cleopatra, und bin beauftragt, Ihnen die Grüße Ihres Gatten zu überbringen!«
Sie lächelte. »Das freut mich, mein Herr! Zur besonderen Genugtuung aber gereicht es mir, dass ich einen Freund meines Gatten beherbergen darf! Betrachten sie dieses Haus als das Ihrige, Sie sind mein Gastfreund!«
Fred Urban nickte, während ein heimliches Lächeln seine Lippen kräuselte.
Er war also glücklich Gast in seinem eigenen Hause! Was ihn aber einerseits mit Erstaunen, andererseits mit Ärger erfüllte, war die Tatsache, dass Cleopatra mit keinem Worte weiter nach dem Befinden ihres Gatten fragte.
»Fred Urban hat mir noch einiges aufgetragen!«, begann er daher, abwartend, was sie sagen würde. Sie machte eine schnippische Bewegung.
»Ach, das interessiert mich nicht!«
»Er lässt Sie grüßen, Frau Cleopatra, und versichert Sie nach wie vor seiner unwandelbaren Liebe!«
Sie stand auf und trat ans Fenster. Fred Urban hörte deutlich, wie sie zwischen den Zähnen murmelte:
»Der Narr!«
Einige Augenblicke blieb er wie gebannt sitzen. Er war also ein Narr! Da er aber sah, dass sie verstimmt war und dass ihr sein Benehmen nicht gefiel, so verschwanden alle anderen Bedenken, denn er hatte nur das Bestreben, sie lächeln zu sehen und sich daran zu weiden.
Er trat also auf sie zu und flüsterte:
»Wahrlich, Fred Urban hat recht gehabt, als er Sie als die schönste Frau der Erde schilderte! Ich kenne Indien und Afrika, ich habe am Hofe des ägyptischen Kaisers gelebt, von dem man sagt, er habe eine Sammlung von Königinnen — aber niemals fand ich eine Frau, die so schön, so begehrenswert war wie Sie, Frau Cleopatra!«
Dabei ließ er sich wie huldigend auf ein Knie nieder und küsste heiß ihre Hand.
Und Cleopatra entzog sie ihm nicht! Es war unverkennbar, dass dieser Jüngling einen großen, tiefen Eindruck auf sie machte; Fred Urban triumphierte...
Endlich zog sie ihre Hand zurück und sagte, sich leicht verneigend:
»Ich hoffe, mein Freund, ich sehe Sie heute Abend zur Tafel wieder! Ich werde dafür sorgen, dass wir allein zusammen speisen!«
»Dann werde ich Ihnen von Ihrem Gatten erzählen!«, rief Fred Urban schadenfroh. Sie aber entgegnete:
»Ach, lassen Sie den Esel ruhen! Ich will nichts, aber auch gar nichts von ihm hören!«
Damit ging sie. Das Rauschen ihrer Schleppe glitt hinter ihr her und ein berauschender Duft erfüllte die Luft. Fred Urban blieb wie angewurzelt auf seinem Platze stehen.
»Wer ist nun ein Esel?«, überlegte er. »Ich oder Fred Urban? Fred Urban bin ich — folglich bin ich ein Esel! Und doch bin ich nicht Fred Urban! Sie will nichts von Fred Urban wissen, und ich habe, das fühle ich, einen Eindruck auf sie gemacht, mit dem ich zufrieden sein kann. Bin ich nun Fred Urban oder bin ich es nicht?«
Aber die quälenden Gedanken, die über ihn kamen, unterdrückte er rasch. Sein Herz war ausgefüllt von einem großen Glücksgefühl, dass Cleopatra ihn liebte, dass sie ihm mit einer Empfindung entgegengetreten war, mit einem Feuer, das er nie an ihr bemerkt hatte, ehe er Berlin mit Professor Prometheus verließ.
Er begab sich in die Gemächer, welche die Herrin des Hauses ihm hatte anweisen lassen, kleidete sich um und erschien dann zum Diner.
Cleopatra trug ein Kleid aus fast durchsichtiger Seide. Das schmiegte sich knisternd und schmeichelnd um ihre wundervollen Glieder; goldene Kämme leuchteten in ihrem weißblonden Haar, das das bronzene Antlitz wie ein phantastischer Rahmen umgab. Das Licht an der Tafel schwankte zwischen bläulichem Dämmern und zitterndem Purpur; durch dieses Halbdunkel funkelten Cleopatras Augen wie die Pupillen einer Katze. Faringo selbst bediente die Herrin. Der Blick des malaiischen Dieners heftete sich von Zeit zu Zeit halb neugierig, halb drohend auf den geheimnisvollen Gast.
Er war der einzige, der die Ähnlichkeit mit Fred Urban in den Zügen des Fremden las. Aber er war ein Sklave und schwieg; im Übrigen hätte er auch nicht begriffen, wie dieser Fremde zu gleicher Zeit sein früherer Herr sein konnte.
Man hätte ihn für einen Halbbruder Wolfs halten können; nur war Fred Urban, der Fünfundzwanzigjährige, kräftiger noch, trotziger und bei weitem schöner als sein Sohn.
Das Diner verlief in angeregter Unterhaltung.
Cleopatra war witzig, geistreich, ausgelassen, von einer Liebenswürdigkeit, die sich schmeichelnd um Fred Urbans Sinne legte. Nie hatte er sie früher so gekannt, und er jubilierte im Innern über die Verwandlung, die seine Jugend bei ihr hervorgerufen.
Die Lichter erloschen. Fred Urban zog sich zurück, von Faringo in seine Gemächer geleitet.
Er blieb der Freund und Gast im Hause Cleopatras. Wolf befand sich auf einer längeren Reise; er wusste nichts von den Wandlungen, die in dem Hause seines Vaters vorgegangen waren.
Fred Urban war der Geliebte seiner Gattin geworden!
Tage vergingen in einem Rausche, der ihn nicht zur Besinnung kommen ließ. Bis er in einer stillen Nachtstunde seine Gedanken sammelte und über alles nachdachte, was geschehen war.
Er konnte und wollte auf keinen Fall länger die Täuschung aufrechterhalten, als sei er ein Freund Fred Urbans, den er doch selbst verkörperte. Er war entschlossen, nach der kurzen Zeit eitlen Genusses wieder zu seiner alten Tätigkeit zurückzukehren. Die gewohnte Arbeitskraft entfaltete ihre Schwingen; in seinem jungen Hirn wälzten sich gigantische Ideen durcheinander. Er wollte arbeiten, seine Werke ausdehnen und neue Pläne schmieden, Ungeahntes ausführen.
Er wollte in seinem Hause nicht als Gast mehr, sondern als der schalten, der er war, als Fürst Urban, der Eisenkönig. Als er in seinem Zimmer, welches der Mond mit weißlichem Licht erfüllte, auf und nieder ging, dachte er nach, auf welchem Wege er am schnellsten zum Ziele gelangen konnte. Da legte sich plötzlich eine dunkle Empfindung, die sich seiner bemächtigte, wie eine Eisenklammer um sein Herz.
Er schlug sich mit der Faust vor die Stirn und seine Hände krampften sich an die Füllung des Fensters, durch das sein Blick hinauswanderte in die Nacht.
Cleopatra betrog ihn!
Gewiss, er war Cleopatras Gatte! Cleopatra war sein Weib, sie liebte ihn und er liebte sie!
Aber war er denn Fred Urban hier?
Nein! Er war ein Fremder! Er war nicht Fred Urban, sondern sein Freund, ein beliebiger Mensch, und Cleopatra hatte keinen Augenblick gezaudert, sich ihm in die Arme zu werfen. Cleopatra hatte Fred Urban geschmäht, ja, sie hatte die Lauge ihres hässlichen Spottes über seine Erinnerung ausgegossen!
Und doch war er Fred Urban!
Er griff sich mit den Händen nach dem Kopf
Da drinnen hämmerte es und die Gedanken glitten wirr durcheinander. Es war, um wahnsinnig zu werden!
Aber das eine stand fest:
Cleopatra hielt ihn für einen Fremden! Cleopatra gab die Ehre seines Hauses preis, Cleopatra liebte ihn nicht! Cleopatra hatte ihn betrogen, die ganze Zeit hindurch, da sie seine Gattin gewesen war! Cleopatra war eine Lügnerin, eine Dirne!
C l e o p a t r a b e t r o g i h n m i t s i c h s e l b s t!
Von solchen Gedanken gequält, schritt Fred Urban wieder unruhig in dem Zimmer auf und ab. Plötzlich stieg etwas wie Reue in ihm auf.
Wie hatte er an Cleopatra geglaubt! Er hätte es nie für möglich gehalten, dass dieses Weib, das er von denen da unten emporgezogen hatte zu sich, dem er die Sonne gezeigt und geschenkt, ihn hätte verraten können!
Nein, das hätte er niemals geglaubt! Sonst wäre er nicht mit solcher Ruhe fortgegangen, um ein Jahr lang von Berlin fern zu bleiben!
Und nun betrog sie ihn!
Nun musste er erkennen, dass Cleopatra nicht würdig war, sein Weib zu sein! Ein bitterer Schmerz ergriff ihn.
Wäre ihm diese Erkenntnis gekommen, solange er ein Fünfzigjähriger, vielleicht ein Sechzigjähriger war? Kaum!
Dem Fünfundzwanzigjährigen blieb es vorbehalten, einen Blick in Cleopatras wahre Seele zu werfen! Jetzt kannte er sie! In diesen Tagen, da sie ganz sein eigen geworden, in dieser kurzen Spanne Zeit, da sie seine Geliebte war, da hatte er ihre Seele durchschauen können wie Glas!
Sie war schlecht, bodenlos schlecht!
Und wie sie Fred Urban verachtete! Sie hasste ihn sogar! Kaum, dass er das Gespräch auf ihn brachte, da verbog sie die Lippen zu einem abscheulichen, gemeinen, elenden Lächeln!
U n d e r w a r F r e d U r b a n!
Er wurde betrogen! Jede Nacht hinterging sie ihn mit einem Freunde, mit einem Menschen, den er hätte umbringen können vor Wut darüber, dass er das Werkzeug dieses Betruges war.
A b e r e r w a r e s s e l b s t!
Sein Hass richtete sich gegen seine eigene Person!
Er war es, der s i c h s e l b s t betrog!
Er stieß mit dem Kopfe gegen die Wand, um sich ferner selbst zu erinnern.
Als aber die Sonne wieder siegreich am Himmel heraufstieg, als ihr goldenes Licht die Räume durchflutete und vor ihren Strahlen die dunkle Nacht mit ihren Schatten schwand, da zitterte Fred Urban der Stunde entgegen, wo er Cleopatra wiedersehen würde
Da vergaß er, dass er Fred Urban war! Da war er wieder die zweite Person, der, der über Fred Urban triumphierte, der ihn lächerlich machte vor Cleopatra, der ihn betrog, der seine Ehre schändete, der glücklich war, wenn Cleopatra über ihn, den andern, lachte!
Schön wie eine Göttin trat sie ihm wieder entgegen; und alles war vergessen.
Bis der Abend kam; bis Fred Urban einige Stunden für sich hatte.
Da schwor er sich, dieses Gewebe von Lug und Trug sofort zu zerreißen.
Am nächsten Tage schon wollte er vor Cleopatra treten und sagen:
»Ich bin Fred Urban! Ich bin der, über den du lachst! Du hast mich betrogen! Fort aus meinem Hause, hinunter zu denen, zu welchen du gehörst!«
Aber er fühlte sich zu schwach zu einer solchen Handlung! Er, der Fünfundzwanzigjährige, liebte dieses Weib bis zum Wahnsinn! Und sicher war, dass sie ihn wieder liebte!
Er bebte vor der Wahrheit zurück! Wenn er Cleopatra sagte, dass er Fred Urban war — schien es sicher, ob sie ihn dann noch liebte? Würde sie nicht mit seiner Gestalt die Vorstellung des Fünfzigjährigen verbinden? Würde er ihr am Ende nicht lächerlich vorkommen? Gleichviel! Dieser Komödie musste er ein Ende machen! Dieses Weib durfte nicht länger in dem Hause bleiben, wo Fred Urban regierte! Sicherlich machte sich schon ganz Berlin darüber lustig, dass Cleopatra ihren Gatten betrog. Die Leute wussten ja nicht, dass sie ihn mit sich selbst hinterging! Das konnten sie nicht wissen! Aber sie sollten es erfahren!
Als der Morgen kam, war alles wieder vorbei. So ging das fort.
Inzwischen erfuhr Fred Urban, dass sein Sohn Wolf sich auf der Rückreise nach Berlin befände. Er hatte Verbindungen angeknüpft mit Bagdad.
Der Eisenkönig freute sich wie ein Kind auf den Augenblick, da er den Sohn wiedersehen würde.
Herrgott, dachte er, was wir beide zusammen schaffen werden! Er, jung, kräftig, gesund, kaum ein paar Jahre älter als der Vater!
Er selbst, der Vater, fünfundzwanzigjährig! Ein paar Jahre jünger als der Sohn, gesund, voll neuer Pläne, stark und tatkräftig!
Was musste ihnen nicht alles glücken!
Wie zwei Freunde würden sie zueinander sein, Vater und Sohn!
Da die Ermordung Floras und alles, was damit zusammenhing, das Verschwinden William Scotts und der Brand seines Ateliers, bereits nahezu ein Jahr zurücklag, so fiel es niemandem mehr ein, in dieser raschlebigen Zeit davon zu sprechen, und Fred Urban dachte nicht anders, als dass Flora ihren Gatten auf der Reise begleitet hatte.
Es war ein wundervoller Tag, als er wieder mit Cleopatra zusammen in ihrem lauschigen Boudoir saß. Sie trug ein Gewand aus Pfauenfedern und ihre kleinen, herrlichen Füße steckten in goldenen Pantoffeln.
Durch das offene Fenster herein drang der Duft der Rosen aus den hängenden Gärten. Mattes Dämmerlicht herrschte in dem kleinen Raume.
Fred Urban war wieder ganz und gar in Cleopatras Gewalt, vergaß seine Pläne und alles, was er sich vorgenommen hatte. Mochte Fred Urban zum Teufel gehen! Mochte er gestorben und begraben bleiben, dieser Narr, über den Cleopatra so hübsch zu lachen pflegte.
E r lebte! E r war Cleopatras Geliebter — was wollte er mehr?
Sie sprach von allem Möglichen. Nie war sie so schön, so bezaubernd, so hinreißend gewesen wie in dieser Stunde. Alle Flammen der Liebe und der Leidenschaft loderten in Fred Urbans Brust.
Plötzlich entzog sie ihm seine Hand und flüsterte:
»Wir werden uns nun nicht mehr so oft sehen können, Geliebter!«
Er sprang auf.
»Wie? Ich soll dich verlassen?«
»Du wirst gehen müssen! Du wirst auf alle Fälle nur sehr, sehr selten zu mir kommen können! Die schönen Stunden unserer Liebe werden der Vergangenheit angehören, und du wirst gezwungen sein, dieses Haus zu verlassen!«
Fred Urban schäumte. Was fiel ihr ein? Er sollte sein eigenes Haus verlassen? Er sollte von der Seite seiner eigenen Gattin hinweggehen?
»Und warum? Warum?«
»Ich muss dir ein Geständnis machen, mein Freund!«, begann sie. »Du weißt, dass ich Fred Urban verabscheute! Ach, verabscheute ist gar nicht der richtige Ausdruck! Jetzt erst hasse ich ihn, dieses wandelnde Skelett, diesen lebendigen Leichnam, seit ich dich kennengelernt. Aber ich habe dich leider zu spät gesehen! Und da meine Sehnsucht nach Liebe und Glück so groß war wie meine Schönheit, so ließ ich mich hinreißen, die Geliebte eines andern Mannes zu werden, ehe ich von dir wusste!«
Sie hielt erschrocken inne. Ein Feuerstrahl war aus Fred Urbans Augen gebrochen.
»Was? Du hast einen Geliebten? Außer deinem Gatten einen Geliebten?«
» N o c h einen Geliebten!«, korrigierte Cleopatra ruhig. Fred Urban sprang auf und rannte wie ein Rasender umher.
»Noch einen Geliebten? Du hast n o c h einen Geliebten außer mir? O, ich Tor! Ich Narr! Und ich habe geglaubt, Cleopatra, du würdest niemals deinen Gatten betrügen!«
Sie sah ihn verblüfft an.
»Ich denke, mein Freund, du konntest das nicht mehr gut glauben!«
Er blieb stehen und schlug sich mit der Faust vor die Stirn.
»Natürlich! Es ist wahr! Ich bin ja nicht...«
Er brach ab.
»Und warum soll ich dich verlassen?«
»Weil der zurückkommt, welcher ältere Rechte hat. Ich liebe ihn nicht! Glaube mir, mein Freund, ich hasse ihn, verabscheue ihn — aber was soll ich tun? Wie soll ich mich von ihm befreien?«
Fred Urban sah sie fragend, erwartungsvoll an. Plötzlich neigte sie sich ganz dicht zu ihm herüber, dass ihre Lippen sein Ohr berührten, und flüsterte:
»Liebst du mich wirklich so grenzenlos, wie du sagst?«
»Kannst du noch daran zweifeln, Cleopatra?«
»Dann befreie mich! Erlöse mich von ihm, den ich verabscheue, und ich bin dein für alle Zeiten! Niemand und nichts soll uns mehr trennen! Bist du nicht imstande, mein Freund, dieser großen Liebe wegen ein kleines Opfer zu bringen?«
Fred Urban befand sich wieder vollständig in jenem Taumel, in den ihn Cleopatras Augen versetzten, so oft er bei ihr war. Er entgegnete hastig:
»Ich bin bereit, alles zu tun, was du verlangst, denn ich kenne nur mehr einen Wunsch im Leben: dich allein zu besitzen für alle Zeiten!«
Sie hauchte:
»Töte ihn!«
»Wen?«
»Den andern! Ist es nicht gleichgültig, wer er ist? Ein Mann, der mich liebt, der mich rasend liebt und mich anbetet!«
Glühende Eifersucht stieg in Fred Urban auf.
»Ja, ich werde ihn töten! Niemand soll das Recht haben, dich zu lieben, dich anzubeten, außer mir! Wann kommt er?«
Sie lehnte sich wieder in ihren Sessel zurück. Ein grausames Lächeln huschte über ihre granatroten Lippen. Sie liebte den Mann, in dem sie keinen Augenblick den Eisenkönig erkannte, mit der tiefen, heißen, unüberwindlichen Leidenschaft, deren ihr Herz, das bis zu dieser Zeit mit keinem Gefühle ausgefüllt gewesen, überhaupt fähig war.
Sie entgegnete:
»Es ist ein Mann, der sich stets einer roten Larve bedient, mich zu besuchen!«
»Einer roten Larve?«, wiederholte Fred Urban verblüfft. »Das ist seltsam! Warum trägt er sie?«
»Weil er nicht will, dass man ihn erkennt! Doch nimm dich in acht! Er ist groß und stark, keiner von jenen niedlichen und schwächlichen Menschen, die uns heute auf Schritt und Tritt begegnen! Er wäre imstande, dich zu überwältigen! Das wäre die letzte Stunde meines Lebens, mein Freund!«
Fred Urban besaß Mut. In diesem Augenblick aber scheute er sich nicht, zu einem schändlichen Plane seine Zuflucht zu nehmen, einzig nur von dem Gedanken beseelt, so schnell wie möglich diese unheimliche Angelegenheit zu erledigen und in den unbestrittenen Besitz Cleopatras zurückzukehren. Er griff in die Tasche und zog einen kurzen, scharfgeschliffenen Dolch.
»Du wirst mich verstecken, Cleopatra! Ich werde den Moment benutzen, da er mir den Rücken zukehrt...« Er vollendete nicht, denn er schämte sich wahrlich vor sich selbst, den Gegner von rückwärts zu töten. Aber es drehte sich um keinen Zweikampf. Es handelte sich ganz einfach darum, ein Individuum zu beseitigen, das nicht mehr auf der Welt sein durfte, so lange er lebte.
Cleopatra war zufrieden.
»Du wirst dich hinter der blauen Gardine verbergen, mein Freund! In einer Stunde vielleicht wird er kommen! Ich werde alle Lichter niederschrauben, dass das Zimmer ausgefüllt ist von dunklen Schatten, damit er an den Falten der Gardine keinen Anstoß nehmen kann. Du wirst den Augenblick benutzen, wo ich einen leisen Schrei ausstoße — das andere überlasse ich dir!«
Fred Urban nickte.
Dahin waren all' seine Pläne, alle Vorsätze. Sein Kopf, sein Herz waren nur mehr ausgefüllt von dem Verlangen, diesen Unglücklichen zu töten, der es gewagt, den Blick zu Cleopatra zu erheben.
Nach einer Weile legte sie ihre Hand auf seinen Arm und sagte:
»Es ist Zeit!«
Und Fred Urban verschwand hinter der blauen Gardine. Das Dunkel, die Ruhe, die ihn einhüllte, gaben seinen Gedanken wieder eine sichere Richtung.
War er erst außer sich vor Eifersucht und Wut gewesen, dass ein zweiter ihm die Geliebte streitig machen wollte, so empfand er jetzt eine grenzenlose Empörung über den, der es gewagt, die Augen zu Fred Urbans Weib zu erheben!
So weit war es also gekommen! So wenig Respekt hatten sie vor dem Fünfzigjährigen gehabt, so nichtig war ihnen der Eisenkönig erschienen, er, dessen Wink in Berlin ein Befehl war, dass sie verwegen genug geworden, seine Ehre in den Staub zu treten. Hatte erst nur der Liebhaber in ihm gesprochen, so reckte sich jetzt der alte Fred Urban in ihm auf, der beleidigte Gatte.
Wahrlich, der Elende durfte das Zimmer nicht mehr lebend verlassen!
Dann dachte er allerdings auch darüber nach, wie schmählich Cleopatra gehandelt. War sie nicht eine Dirne? War es nicht eine Schande für ihn selbst, dass er noch den traurigen Mut fand, sie zu lieben?
Doch konnte er dafür? War er noch Herr seiner selbst?
Ein fester, energischer Schritt ließ ihn aufhorchen. Cleopatra hatte die Tür ihres Zimmers geöffnet. Ein hochgewachsener junger Mann trat ein. Er hatte eine schlanke, elastische Figur und mochte etwa dreißig Jahre zählen. Seine Hände waren schneeweiß und gepflegt, sein Anzug elegant. Sein Gesicht war nicht zu erkennen, denn eine große rote Larve bedeckte es; sie verlieh ihm etwas Unheimliches und Mystisches. Auch seine Stimme konnte Fred Urban nicht unterscheiden, denn er sprach nur im Flüsterton.
»Endlich bin ich zurück!«, sagte er leise zu Cleopatra, während seine Arme sich um ihren schönen, schimmernden Nacken schlossen. »Hast du mich nicht vergessen? Bist du treu geblieben?«
Sie lachte, dass der Eisenkönig unwillkürlich erschauerte.
Der Mann mit der roten Maske fuhr fort:
»Fred Urban ist noch nicht zurückgekehrt?«
»Nein, Fred Urban kehrt auch nicht wieder, mein Freund! Ich wette, den haben irgendwo die Wölfe gefressen, oder er ist in einem fremden Lande gestorben und verdorben!«
Der andere schwieg. Der Fürst, hinter der blauen Gardine verborgen, erwartete, dass jener ein Schmähwort für ihn finden würde. Aber nichts dergleichen kam. Der Mann mit der roten Maske blieb eine Weile wie sinnend stehen und seine Arme hatten sich von Cleopatras Hals gelöst. Sie aber eilte von Neuem auf ihn zu, umarmte ihn und rief:
»Wie, du bist doch kein Träumer geworden? Alles wartet auf dich: die Liebe, die Arbeit, die Zukunft!«
Der Duft ihres Haares schien ihn von Neuem zu berauschen. Er zog sie in seine Arme, beugte sich nieder und presste seine Lippen auf die ihren — es hätte ihres leisen Schreies gar nicht erst bedurft, um Fred Urban, der sprungbereit, das Messer in der Faust, in seinem Versteck gelauert, zu veranlassen, in diesem Augenblick hervorzubrechen.
Der Mann mit der roten Maske hörte das Geräusch. Er wollte sich umdrehen, aber Cleopatra ließ es nicht zu. Ihre Arme umklammerten seinen Hals wie Eisenfesseln und ihr schwerer Körper zog ihn machtvoll nieder. So konnte er nicht sehen, was hinter ihm geschah.
Sie aber sah es. Ihre Augen leuchteten wie Phosphor; das grüne Licht schnitt förmlich durch das Halbdunkel, als sie Fred Urban, den Fünfundzwanzigjährigen, mit hassverzerrter Miene hervorspringen sah.
Sekundenlang blitzte das Messer in der Luft, dann grub es sich in den Rücken des Mannes mit der roten Maske. Dieser stieß einen gurgelnden Schrei aus, der in einem langgezogenen Röcheln erstarb.
Er drehte sich um sich selbst, streckte die Arme nach dem Mörder aus, verlor aber in dem gleichen Augenblick die Kraft und stürzte schwer zu Boden.
Er lag so, dass das Gesicht mit der roten Maske nach oben sah. Der Körper blieb regungslos und nur das Blut, das aus der Wunde drang und den Teppich färbte, hatte Leben.
Fred Urban stand wie ein Steinbild mitten im Zimmer. Von dem Dolche tropfte roter Lebenssaft.
Doch Cleopatra ließ ihn nicht zur Besinnung kommen. Sie erstickte ihn fast mit ihren Armen und flüsterte:
»Nun bin ich dein! Ganz dein! Mehr noch! Wir sind die Herren von Fred Urbans Besitzungen! Bis heute habe ich es dir verschwiegen! Du wirst mein Gatte sein und wir werden ein unbegrenztes Glück genießen! Niemanden gibt es mehr, der uns hindern könnte, uns anzugehören — du wirst der Eisenkönig sein und der Herr über siebzigtausend Arbeiter; du wirst...«
Sie brach jäh ab. Fred Urbans verzerrtes Gesicht erschreckte sie.
»Was heißt das?«, stieß er hervor. »Ich soll Herr sein über Fred Urbans Besitz? Fred Urban lebt doch!«
»Und wenn? Es wird dir ein Leichtes sein, ihn für immer verschwinden zu lassen, wenn er je zurückkehrte! Er ist ein Greis, ein lächerlicher, kraftloser Greis, der sicherlich längst gestorben ist, sonst hätte er ein Lebenszeichen gegeben. Fred Urban hat nie sein Wort gebrochen — und schon sind vierzehn Tage über das Jahr verflossen, das er ausbleiben wollte!«
»Nun gut!«, murmelte Fred Urban. »So vergisst du, dass Wolf, sein Sohn, der Erbe der Fabriken ist! Er und seine Gattin Flora!«
»Seine Gattin Flora ist tot!«
»Was sagst du? Tot? Dieses junge, schöne, blühende Geschöpf soll tot sein? Und ich weiß nichts davon?«
Sie lachte. Und immer noch rann das Blut aus der Wunde des Toten und überströmte mehr und mehr den Teppich.
»Was kann dich das interessieren, mein Freund? Was geht dich Flora an, diese Puppe!«
»Doch an was ist sie gestorben? An was?«
»Ich weiß es nicht!«, entgegnete Cleopatra ausweichend. »Man sagt, sie sei getötet worden! Behaupten lässt sich nur, dass sie William Scott in seinem Atelier besuchte!«
»William Scott? Was ist's mit William Scott? Wie kommt Flora zu ihm?«
»Weiß ich es?«, entgegnete sie ungeduldig. »Du fängst an, mich zu langweilen, mein Freund! Was mag William Scott dich kümmern? Er ist verschwunden, kein Mensch weiß, wohin, und sein Atelier ging in Flammen auf!«
Fred Urbans Arme hatten sich langsam von Cleopatra gelöst. Er trat einen Schritt zurück; unbewusst tauchte ein gigantisches Grauen in seiner Seele auf.
»Was ist da alles vorgefallen? Und Wolf? Wo ist Wolf?«
»Wolf Urban? Wolf Urban ist tot, mein Freund!«
Sie wandte den Blick zur Seite und sah auf den Mann mit der roten Maske. Der lag regungslos an der gleichen Stelle. Die Arme schienen länger geworden zu sein, die Glieder hatten sich gestreckt und nichts regte sich mehr an ihm; nur das Blut rann weiter,
Fred Urban war ihrem Blick gefolgt. Und plötzlich packte es ihn; er wollte nicht glauben, was er ahnte! Gewaltsam kämpfte er es nieder, erfasste mit beiden Fäusten die Halskrause, die ihn einengte, und riss sie entzwei. Sein Atem ging fliegend, die Brust hob und senkte sich in rasender Schnelligkeit.
»Der da...«, stieß er hervor..., »der da... wer ist der da?«
Er war ganz verändert. Er war der alte Fred Urban, der Mann aus Eisen, der alte Eisenkönig, nur jünger, voll sprühender Leidenschaft, durchsetzt von riesiger Kraft.
Cleopatra sah ihn mit weit geöffneten Augen an. Ihre Pupillen schimmerten dunkelgrün wie Blätter. Sie streckte den Kopf und hielt den Atem an. In diesem Augenblick, da namenloser Schrecken und heißes Entsetzen Fred Urban ergriffen, schien er plötzlich um drei Jahrzehnte gealtert, seine Wangen wurden fahl und Falten zogen sich um die Augen, die tief in die Höhlen gesunken waren. Ja, das Entsetzen beugte seinen Rücken, und in einer Sekunde, die ausgefüllt war von unbeschreiblichem Grauen, erkannte ihn das Weib.
»Fred Urban!«, rief sie mit so gellender Stimme, dass der Schrei sich durch alle Räume des Palastes fortpflanzte. Er aber war auf den Leblosen zugestürzt, der auf dem Teppich lag. Er glitt in dem Blute aus, warf sich über den Leichnam, packte mit zitternden Händen die rote Larve und riss sie von dem Gesichte des Toten.
Ein gurgelndes Stöhnen entrang sich seiner Kehle.
»Wolf! Wolf, mein Sohn!«, brüllte er vor Schmerz, riss den Körper empor und hielt ihn fest mit seiner gigantischen Kraft, als könnte er ihm das Leben so wiedergeben. Aber der Leichnam sank zusammen und hing schlotternd in seinen Fäusten.
Er ließ ihn zurückgleiten zur Erde.
Blitzschnell wandte er sich um. Nichts mehr war in ihm als entsetzlicher Hass. Namenlose Begierde, zu töten, sich zu rächen! Alles andere war vergessen — kein Augenblick blieb ihm übrig zu irgendwelchen Reflexionen, wie es möglich war, dass Wolf herbeigekommen, dass er sich in Cleopatras Banden befunden.
Was Fred Urban nicht dachte, das empfand und fühlte er intuitiv: Cleopatra personifizierte alles, was Grässliches geschehen war! Cleopatra war der Dämon des Hauses Urban. Cleopatra hatte eine entsetzliche Rache an dem Eisenkönig vollzogen! Der Fluch von denen da unten, die vergeblich seit Jahrhunderten die da oben verwünschten, die umsonst seit dreißig Jahren gegen Fred Urban gekämpft, hatte sich durch sie erfüllt!
Das Rauschen ihres seidenen Kleides verriet, dass sie floh. Und es entspann sich eine wilde, entsetzliche Jagd.
Cleopatra rannte die Treppen empor bis zum Mittelpunkt des Palastes. Sie hörte den keuchenden Atem ihres Gatten hinter sich. Beide waren sich an Kraft so ziemlich gleich — er, der Jüngling von denen über der Erde, sie, das entwickelte Weib aus der Rasse von denen da unten.
Sekundenlang blieb sie auf der breiten Balustrade stehen, welche den Giebel des Treppenhauses schmückte. Bis sie ihn heranfliegen sah, den Dolch in der Faust.
Sie raffte die Röcke und jagte auf der gegenüberliegenden Seite die Treppen hinab. Kein Diener begegnete ihnen. Sie fand nicht die Kraft, um Hilfe zu rufen. So oft sie auch zu einem Schrei ansetzte, ebenso oft erstarb die Stimme in ihrer Kehle. Zu groß war das Entsetzen, welches die plötzliche Erscheinung Fred Urbans hervorgerufen, diese unbeschreibliche Wandlung, die in ihm vorgegangen war. Sie hatte die letzte Treppe erreicht. In fieberhafter Eile ergriff sie den kleinen Schlüsselbund, der an ihrem Gürtel hing, und öffnete ein schweres, eisernes Tor.
Es führte in die unteren Gemächer des Palastes, in jene tiefen Tresore, von denen aus man auf geheimen Wegen unter die Erde gelangen konnte.
Das Tor flog auf. Sie vergaß, es zu schließen. Wie der Wind flog sie hinab über die hundert steinernen Stufen. Fred Urban schlüpfte durch den Eingang und eilte ihr nach. Sie durchjagte diesen großen Keller, öffnete ein zweites Tor und stürzte wieder hinab über hundert Stufen.
Jetzt gab es keinen Ausweg mehr. Kein Fenster ließ Luft oder Licht in den Raum, in dem sie sich befand. Riesige Stahlplatten bildeten die Wände. Rückwärts befand sich eine Eisentüre von zwei Metern Durchmesser. Nicht die Kraft eines Riesen wäre imstande gewesen, sie zu sprengen. Cleopatra besaß auch einen Schlüssel zu dieser Türe. Sie kannte ihre Bedeutung: Hinter ihr lag die große Treppe, welche direkt hinabführte in die Fabriken zu denen unter der Erde. Fred Urban benutzte sie in ruhigen Zeiten, wenn er plötzlich mitten unter den Arbeitern erscheinen wollte.
Cleopatra aber wusste, was ihr bevorstand, wenn sie diese Türe öffnete. Kein Schutz, keine Hilfe bot sich ihr bei denen unter der Erde. Hatte sie doch Tausende von ihnen preisgegeben in dem Augenblick, da sie zum ersten Mal die Sonne gesehen.
Sie sprang auf die Türe zu, durch welche sie eingetreten war. Es war ein großes Tor. In der Mitte befand sich ein drei Zoll dickes Glas, groß genug, um hindurchsehen zu können und zu beobachten, was in dem Raume vorging. Das war eine Einrichtung, die alle Eisentüren trugen.
In dem Augenblick, da Cleopatra Fred Urban nahen fühlte, schlug sie die Türe zu. Dann duckte sie sich in den äußerten Winkel und horchte.
Fred Urban versuchte eine Weile, das Tor zu sprengen. Dann aber zuckte ein furchtbares Lächeln über seine Züge. Er kreuzte die Arme und presste sein rechtes Auge gegen das kleine Glas. Gleichzeitig drückte er gegen einen kleinen Knopf, und das Innere der Stahlkammer ward taghell erleuchtet. Er verschränkte die Arme und blieb unbeweglich.
Im ersten Moment begriff Cleopatra nicht, was er wollte. Sie fühlte sich umflossen von einem grellen Licht und sah sein glühendes Auge hinter dem Glas.
Ihr Herz ging langsamer, da sie sich für den Moment gerettet fühlte. Plötzlich aber setzte es in wütenden Schlägen ein und raste und jagte in fiebernder Eile das Blut durch ihre Adern.
Entsetzen und Schrecken packte sie. Der Atem versagte ihr. Schwer hob und senkte sich die Brust unter den furchtbaren Anstrengungen der Lunge.
Und nun begriff sie!
Sie war eingeschlossen in dem Tresor, eingeschlossen in der Stahlkammer ohne Luft! Sie war dem Ersticken preisgegeben! Und Fred Urban stand draußen mit gekreuzten Armen und beobachtete ihren Kampf! Sah, ohne eine Miene zu verziehen, wie ihre Atemnot stärker und stärker wurde! Wie sie von Ecke zu Ecke lief, als könnte sie die Luft einfangen, die nicht vorhanden war. Ihr Antlitz färbte sich blau, die grünen Augen glühten aus den dunklen Höhlen, in die sie tiefer und tiefer zurücksanken. Sie warf die Arme in die Höhe und krallte die Finger zusammen. Sie sprang, als habe sie eine tödliche Kugel getroffen, beinahe meterhoch empor vor rasendem Schmerz. Schließlich warf sie sich gegen die Stahlplatten, stemmte die Knie dagegen, rieb sie wund, schlug mit den Fäusten an die Mauern und versuchte, sich an die aalglatten Platten zu klammern, reckte die Arme höher und höher und kratzte die Nägel der Finger blutig.
Fred Urban draußen lächelte.
Plötzlich, da sie schon taumelte, da der Schmerz aufs äußerste stieg, da ihre Lunge sich zusammenkrampfte und das Herz den Schlag aussetzte, erinnerte sie sich der letzten Türe.
Sie riss mit zitternden Händen den Schlüssel vom Bunde, steckte ihn in das Eisenschloss und riss das Tor weit auf. In tiefen Atemzügen zog sie die rußdurchschwängerte Luft ein, die von denen unter der Erde heraufdrang. Sie stand umstrahlt von dem Lichte, das die Stahlkammer durchflutete, und sah hinab, fünfhundert Stufen tief auf die Männer, die sie vor Jahren verlassen hatte, um die Sonne zu sehen, um Rache zu üben an denen dort oben!
Aber auch die unter der Erde, welche im Scheine von rotglühenden Lichtern die fauchenden Maschinen bedienten, erblickten sie.
Ein einziger Wutschrei hallte durch die riesigen Arbeitsräume. Dann stürmten sie herauf, die schweren Eisenhämmer in den schwieligen Fäusten, Flüche und Verwünschungen ausstoßend, ein brandendes Meer von Hass, Schmutz, Rauch und Ruß und rotglühenden Leibern.
Was dann geschah, wartete Fred Urban nicht ab. Unter einem Lachen, das aus den Tiefen der Hölle zu kommen schien, griff er in die Tasche und zog eine der kleinen schwarzen Kugeln hervor, die er noch aus der Zeit bei sich führte, da er Berlin verlassen hatte. Er sprang zurück, jagte die Treppen empor und schleuderte die kleine Waffe zu gleicher Zeit gegen die Eisenpforte, hinter der er zuletzt gestanden hatte.
Krachend, zischend, feurige Funken versprühend, explodierte die Kugel. Die meterdicken Eisenplatten bogen und wanden sich unter der Gewalt der Explosion und stürzten zusammen.
Und durch die entstandene Öffnung hindurch, unbekümmert um Feuer, Rauch, Flammen und Glut, ergossen sich die dunklen Körper der Arbeitssklaven, hinein in den Palast Fred Urbans.
Der aber war längst geflüchtet. Pfeilschnell fuhr er mit dem Lift hinauf zu den höchsten Höhen des riesigen Palastes, wo Tag und Nacht Cleopatras Luftschiff verankert lag.
Er traf Faringo, den treuen Diener, der auf den ungewohnten Lärm hin, der aus der Tiefe drang, herbeigestürzt kam.
»Frage nichts!«, rief der Eisenkönig ihm entgegen. »Ich bin Fred Urban, dein Herr!«
Vielleicht hätte Faringo gezögert, vielleicht hätte er Widerstand geleistet! Aber eine so große dämonische Kraft, ein so unwiderstehlicher Wille leuchtete aus Fred Urbans Augen, dass er schweigend gehorchte. Er eilte auf das Luftschiff zu. Der Eisenkönig sprang in das Coupé und Faringo setzte es in Bewegung.
»Wohin, Herr?«
»Über das Mittelmeer hinweg, Faringo!«
Brausend, mit wuchtigen Flügelschlägen jagte das Luftschiff durch den Äther. Hinter ihnen ging der stolze Riesenpalast Fred Urbans in Flammen auf und die unter der Erde ergossen sich, ein lebendiger Lavastrom, über die Besitzungen derer über der Erde.
Vierundzwanzig Stunden nach diesen Ereignissen kam Fred Urban vor dem Sanatorium des Professors Prometheus an. Der würdige Greis, dessen Blicke wie die Augen Jupiters lohten, trat dem unerwarteten Besucher an der Pforte des Tempels entgegen, wo das ewige Feuer der Jugend glühte.
Der Fünfundzwanzigjährige stürzte atemlos die steinernen Stufen empor, warf sich vor dem stolzen Gelehrten nieder, umschlang seine Knie und rief verzweifelt:
»Ich habe eine Bitte, Professor Prometheus!«
»Wenn es in meiner Kraft steht, Fred Urban, dann...«
»G e b t m i r d a s A l t e r w i e d e r! «
Da schüttelte Professor Prometheus das mächtige Haupt.
»Die Jugend konnte ich Euch geben, Fred Urban — das Alter kann ich nicht zurückrufen gegen das Gesetz der Natur. Wartet dreißig Jahre ab, bis Euer Leben wieder den alten Weg zurückgelegt hat!«
Fred Urban sprang wild empor.
»Das kann ich nicht, Professor Prometheus! Welch ein Verbrechen habt Ihr begangen, als Ihr zum zweiten Male mir die Jugend gabt! Was ist sie, Professor Prometheus? Eine herrliche Gabe der Natur für die, welche nichts wissen von den Erfahrungen des Alters, — ein Danaidengeschenk(*) aber für den, der das Leben erfasst hat und es noch einmal zu lieben versucht!«
(*) Richtig müsste es »Danaergeschenk« heißen; darunter versteht man ein unheilbringendes Geschenk; D.v.R.
»Das mag wohl das Geheimnis unseres Daseins sein!«, entgegnete der große Arzt leise, den Blick in weite Fernen gerichtet.
Fred Urban wandte sich schweigend ab. Er gebot Faringo zurückzubleiben und schritt einsam, das Haupt auf die Brust gesenkt, einen schmalen Weg durch schimmernde Gletscher hindurch. Der Pfad hörte auf; er aber schritt weiter, von Höhe zu Höhe, von Fels zu Fels, an schwindelnden Wänden entlang, hinauf zu den höchsten Firnen des Eises.
Es wird abergläubische Menschen geben, die vielleicht behaupten, sie hätten ihn wiedergesehen; die werden ihn Ahasverus nennen, den ewigen Juden. Das ist aber nur ein Aberglaube; denn Fred Urban stürzte von der höchsten Zinne eines Felsens tausend Meter tief hinab in eine eisgefüllte Schlucht, wo sein zerschmetterter Körper liegen blieb.
Den Nachdrucken liegen die Erstausgaben zugrunde. Die Texte wurden auf die seit 1996 geltende und danach oft geänderte »neue deutsche Rechtschreibung« umgestellt. Hierbei wurden offensichtliche Rechtschreib- oder Drucksatzfehler stillschweigend berichtigt. Im Übrigen ist der Text aber unangetastet geblieben.
Die farbigen Umschlagbilder der vier Originalbände wurden von Julius Schlattmann (* 1857 in Borken i. W.) gezeichnet. Der Illustrator, der vor allem für den Weichert-Verlag tätig war und dort neben der Charles-Dickens-Werkausgabe auch die Neuausgabe von Werken Jules Vernes illustrierte, war noch lange nach dem Ersten Weltkrieg tätig. Ab dem Ende der 1920er Jahre verlieren sich aber seine Spuren. Das Todesjahr konnte nicht ermittelt werden.
Abschließend bedanke ich mich für die geleistete Vorarbeit bei Eric Hantsch, für die Korrektur und vor allem den umfangreichen Beitrag(*) über Robert Heymann bei Lars Dangel und für die Unterstützung durch Informationen, Bilder und ebenfalls Korrektur bei Gerd-Michael Rose. Sie alle haben dazu beigetragen, dass die Romane und auch das Leben und Wirken des Verfassers wieder in Erinnerung gerufen werden konnten.
(*) Aus urheberrechtlichen Gründen wird dieser Beitrag in den RGL-Ausgaben der vier Romane weggelassen.
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.