
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software

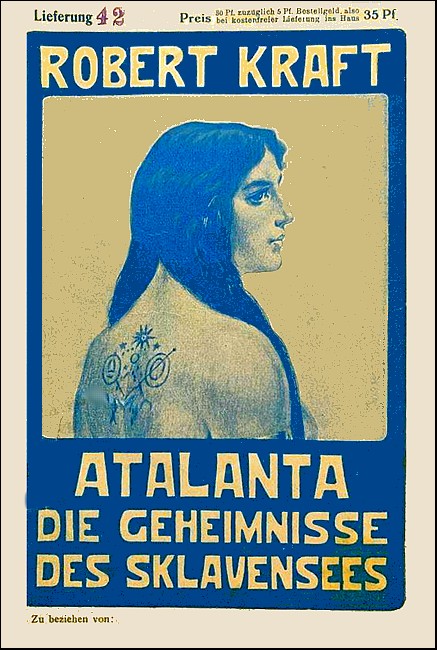
Atalanta, Cover von Lieferung 42
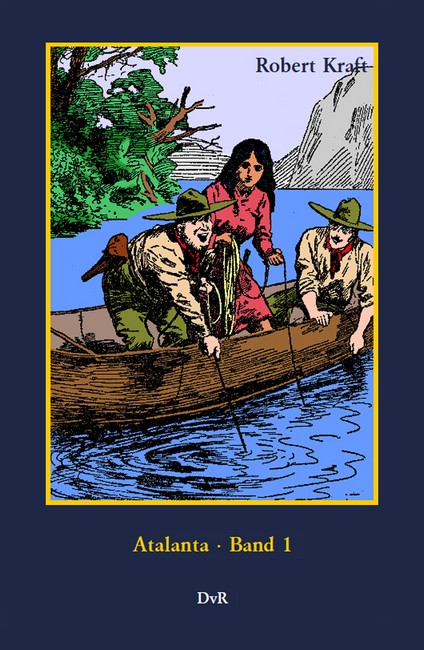
Atalanta, Band I
Verlag Dieter von Reeken, 2023
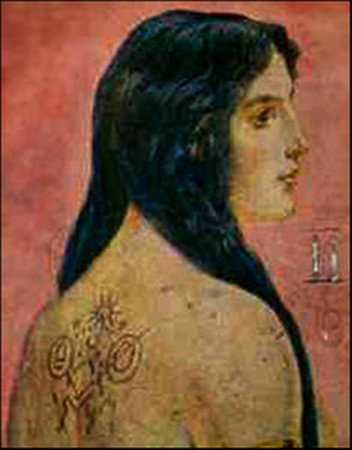
Portrait von Atalanta
Die erste Vorstellung - Der Einzug - Ein Rechenexempel mit Hindernissen - Der Kugelwurf - Sechs Revolverschüsse, drei Pfeile und ein Speerwurf - Ein schaudererregendes Kunststück - Das Phänomenalste der Sprungkraft - Ein lebendiges Schachspiel - Ein unerfüllbares Verlangen - Das Geheimnis der Indianerin - Die Ringkämpfe - Atalanta besiegt! - Graf Arno von Felsmark, der Champion-Gentleman von New York - Ein seltsamer Nachtbesuch - Professor Dodds Offenbarung - Die Herrin des Sklavensees - Der Handschuh - Der Schatz im Sklavense - Miss Marwood Morgan
Beim Menschenschlächter - Die erste Falle - Von den Toten auferstanden - Die sprechende Wand - Die Wahnsinnige - Der weiße Schleier - Die Spuren von Damenstiefeln - Ein erleuchtetes Fenster - Der Führer unter Wasser - Die Geheimnisse des hohlen Felsens - Indische Gauklerspiele - Das Völkermuseum - Ein alter Bekannter - Die goldene Kapsel
Eine schreckliche Entdeckung - Die Flucht durch den See - Das Hohelied der Liebe - Die Mohawk erwacht - Ein Prachtmensch - Im Raubtierkäfig - Die Versuchung - Ausgezogen!
Vom Wahnsinn erfasst - Weitere seltsame Maßnahmen - Der erste Fund - Das Pergament
Weitere Vorbereitungen - Der Handschuh der Spanierin - Die Exhumierung - Das neue Verhältnis - Der Engel der Nacht - Atalantas Erzählung - Littlelu
Die Kleinigkeit, die Atalanta besorgt hatte - Der Fund im Sklavensee - Gern geb' ich Glanz und Reichtum hin - Der Taucher - Atalanta offenbart sich
Der Werwolf - Der Spieß wird umgedreht - Die Sklavin bekommt einen Sklaven - Neue Überraschungen
In der Kur - Die Folgen der Kur - Der letzte Vorschlag - Wie sich Littlelu versichert - Im blauen Alligator - An Bord des Frachtdampfers
Ein fürchterlicher Empfang - Atalanta vollendet ihr Werk - Der werbende Kuss
Unter der Maske der Beduinen - Am Pisgaberge
Die vorliegende Neuausgabe enthält in sechs Bänden den ungekürzten Text der ersten Auflage 1911 des von Robert Kraft (1869-1916) verfassten im Dresdener Romanverlag in insgesamt 60 Lieferungen erschienenen Kolportageromans Atalanta. Die Geheimnisse des Sklavensees. Lieferungs-Roman von Robert Kraft. Dresden: Dresdner Roman-Verlag (Druck und Verlag) 1911, 60 Lieferungen mit je 64 fortlaufend nummerierten Seiten (Gesamtumfang 3839 Seiten), illustriert (60 Frontispize, 125 weitere Illustrationen).
Die Lieferungen der 1. Auflage wurden auch in sieben bzw. sechs Bänden (blaues Leinen mit farbiger Atalanta-Abbildung) vertrieben. Die Seiten 3330-3456 waren in den Ausgaben von 1911 und 1919 falsch mit 2330-2456 nummeriert). Die letzte Seite, S. 3840, enthält ein Nachwort von Robert Kraft. Es konnte leider bisher nicht ermittelt werden, wer den Roman illustriert hat.
Außer der zu Lebzeiten des Autors erschienenen Erstausgabe 1911 gab es noch weitere (bis auf ganz wenige Ausnahmen) textgleiche Ausgaben in den Jahren 1919, 1922 und 1924 sowie eine französische (Atalanta, la femme énigmatique, 1912/13) und eine osmanische Ausgabe (Altin gölü, 1911/12).
Zu Robert Krafts Leben und Werk verweise ich auf die umfassende reich farbig illustrierte Bibliografie von Thomas Braatz (1), die ebenfalls farbig illustrierte Biografie von Walter Henle und Peter Richter (2), ein umfangreiches Buch von Arnulf Meifert (3) und auf die Tagungsbände (4) zu den Robert-Kraft-Symposien.
(1) Thomas Braatz: Robert Kraft — Farbig illustrierte Bibliographie zum 100. Todestag. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer, 3., erweiterte Aufl. 2016. — 1032 S. mit über 1000 farbigen Abb.
(2) Walter Henle, Peter Richter: Unter den Augen der Sphinx. Leben und Werk Robert Krafts zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2005. — Das Buch ist vergriffen; eine Neuausgabe ist für 2025 geplant.
(3) Arnulf Meifert: Robert Kraft. Avanturier und Selbstsucher. Eine Annäherung. Leipzig, Wien: Edition Braatz & Mayrhofer 2018.
(4) Robert Kraft 1869-1916. 1. Robert-Kraft-Symposium. 15.-16.10.2016. Mit Beiträgen von Thomas Braatz, Arnulf Meifert, Achim Schnurrer sowie historischen Texten von Dr. S. Friedlaender und Robert Kraft. Leipzig: Thomas Braatz im Rahmen des Freundeskreises Science Fiction Leipzig 2016; Wenn ich König wäre! Robert Kraft zum 150. Geburtstag. 3. Robert-Kraft-Symposium. 12.-13.10.2018. Mit Beiträgen von Jakob Bleymehl, Gerhard W. Bleymehl, Thomas Braatz, Matthias Käther, Walter Mayrhofer, Arnulf Meifert, Karlheinz Steinmüller und Hans Wollschläger. A. a.O. 2019; 4. Robert-Kraft-Symposium. 16.04.2022. Serienheld Nobody. 100 Jahre Kraft—Film von Thomas Braatz, u. a. mit Beiträgen von Michael Bauer, Aurel Lupastean und Franziska Meifert. A.a.O. 2022.
Der im Original in Fraktur gesetzte Text ist in Antiqua (Garamond Standard) umgewandelt und an die seit 1996 geltenden neuen Rechtschreibregeln angepasst worden. Aus ›Neuyork‹ wurde also ›New York‹, aus ›Bureau‹ ›Büro‹, aus ›Bollauge‹ ›Bullauge‹, aus ›Telephon‹ ›Telefon‹, aus ›so schnell als möglich‹ ›so schnell wie möglich‹ usw. Offensichtliche Rechtschreibfehler und Schreibweisen sind stillschweigend berichtigt worden (z. B. ›Donna‹ in ›Doña‹ und ›Sennor‹ in ›Señor‹), soweit sie nicht (z. B. mundartlich bedingt wie — seemännisch — ›Pütze‹ für ›Eimer‹) als beabsichtigt erscheinen.
Die 1911 übliche, heute als herabsetzend empfundene Bezeichnung ›Neger‹ ist beibehalten worden, weil die Bezeichnung ›Afro-Amerikaner‹ aus dem Mund der handelnden Personen im Textzusammenhang verkrampft wirken würde; allerdings ist die bewusst abfällige Bezeichnung ›Nigger‹, wenn sie nicht etwa Teil eines Dialoges ist, durch das schwächere Wort ›Neger‹ ersetzt worden, ebenso wie ›Japs‹ durch ›Japaner‹.
Fußnoten mit Sternchen (*) stehen so auch im Originaltext, solche mit Zahlen in Klammern () sind vom Herausgeber eingefügt worden.
Da die 64-seitigen Original-Lieferungen oft mitten in einem Absatz enden, der dann in der Folgelieferung unmittelbar fortgesetzt wird, wird in der vorliegenden Ausgabe der Text im Wege der ›Ab- oder Aufrundung‹ jeweils an der vorigen oder nächsten Kapitelüberschrift abgeschlossen. Hierauf wird bei den Lieferungs-Überschriften jeweils hingewiesen.

Erstaunt sah Graf Felsmark auf die durchs Fenster
eingedrungene
Dame. Als diese nun ihren Schleier zurückschlug, erkannte Arno
in ihr Atalanta, welche ihm zurief: »Du hast mich besiegt und ich
bin infolgedessen Dein Eigentum, Du kannst über mich verfügen!«
Das Hippodrom, der größte Zirkus New Yorks, war bis auf den letzten Platz gefüllt. Wie bei allen besonderen Gelegenheiten waren die Plätze nach amerikanischer Sitte verauktioniert worden, auch der elendeste Stehplatz auf der Galerie war nicht unter einem Dollar zu haben gewesen, es waren aber auch fünf Dollar dafür bezahlt worden. Ein Logensitz hatte mindestens hundert Dollar gekostet.
Wolle der geneigte Leser nun immer bedenken, dass er sich in einem amerikanischen Zirkus befindet, einer amerikanischen Vorstellung beiwohnt.
Die aus achtzig Mann bestehende Kapelle hatte einen einleitenden Marsch beendet.
In der Manege erschien ein kleiner, magerer, ältlicher Herr im Frackanzug, verbeugte sich nach allen Seiten und dann hub er an:
»Hochgeehrte Herrschaften, Ladies und Gentlemen! Ich habe die Ehre, mich Ihnen vorstellen zu dürfen: Antonio Ramoni ist mein Name, ich bin der Begründer des noch jetzt existierenden Zirkus Ramoni, der durch meine rastlosen Bemühungen und noch mehr durch die Gunst des kunstverständigen amerikanischen Publikums eine Weltberühmtheit wurde, von dessen Leitung ich aber schon vor fünfzehn Jahren zurückgetreten bin. Schon mein Vater hatte die Ehre, ein freier Bürger der Vereinigten Staaten von Nordamerika zu sein, meine Mutter war eine freie Amerikanerin, und mir selbst wurde die Ehre zuteil, das Licht der Welt in Cincinnati im Staate Ohio zu erblicken.«
Schon hierfür begeistertes Händeklatschen, die Musik intonierte den Anfang des Yankee Doodles,(*) brach kurz ab, und das patente Männchen, nachdem es sich dankend verbeugt hatte, fuhr fort:
(*) Die bizarre Nationalhymne der Amerikaner.
»Gestatten Sie mir, acht Namen zu nennen, die jeder echte Amerikaner kennt. Doktor Elias Wilson, Professor der Mathematik an der Columbia-Universität, Professor Huxley, erster Bibliothekar des Staatsarchivs in Washington...«
Und so zählte er noch sechs andere auf, lauter Namen von Klang, darunter auch zwei Senatoren und Parlamentsmitglieder.
,,Hat jemand der Herrschaften gegen die Glaubwürdigkeit dieser acht Männer etwas einzuwenden?«
»Nein, nein, niemals!!«, erklang es vieltausendstimmig.
»Vor sechzehn Jahren machten diese acht Männer im Staatsauftrage eine wissenschaftliche Expedition nach dem Sklavensee im Staate Colorado, hart am Fuße des Felsengebirges gelegen.
Dort hauste damals der Indianerstamm der Mohawks, welche die eigentümliche, sonst unter den Indianern gar nicht vorkommende Sitte hatten, dass sie sich gegenseitig zu Sklaven machten. Zwei wetteten etwa, wer am besten schießen könnte — der Verlierer wurde des anderen Sklave mit Leib und Seele, bis er jenen wieder übertrumpft hatte. Manchmal blieb das Sklavenverhältnis aber auch lebenslänglich. Daher bekam dieser See seinen Namen.
Die Mohawks waren sehr kriegerische, raublustige Indianer. Als sie wieder einmal eine Farm überfallen hatten, sollten sie ernstlich gezüchtigt oder gleich ganz ausgerottet werden, denn unterjochen ließen sie sich nie.
Sie rüsteten sich gegen unsere herrliche, unbesiegbare Grenzmiliz zum Verzweiflungskampf. Entsetzlich ist es zugegangen! Alle Weiber, Greise und Kinder, die kein Gewehr abdrücken konnten, haben sie vorher abgeschlachtet! Pardon wurde nicht gegeben und nicht genommen. Noch im Sterben kämpften sie mit einer wahren Berserkerwut — und dann gab es keinen Mohawk mehr.
Ein Vierteljahr später trafen die acht Gelehrten dort ein, um den Sklavensee auszumessen, zu erforschen. Eines Tages, es war der 14. Juni, wurde im nahen Gebirge ein Bär aufgespürt. Jene acht Herren machten sich zur Jagd auf, der Bär wurde gestellt, erhielt einige Schüsse, konnte noch fliehen und flüchtete in eine Höhle.
Mutvoll drangen die Jäger ein. Es war eine Bärin, die soeben ihren letzten Atem aushauchte. Und sie war Mutter. Vier kleine, junge Bären, welche noch nicht wussten, dass die treue Mutter tot war, schmiegten sich an ihren noch warmen Leib!«
Der Impresario wischte sich mit einem Tuche die Augen und fuhr dann fort:
»Und da kroch noch ein fünftes Geschöpfchen aus der Ecke hervor, um an der noch warmen Brust zu saugen. Aber was war das? Das war doch kein junger Bär?... Wunder, es war ein kleines Menschenkind, ein kleines Mädchen, das kräftig an den Zitzen saugte.
Das Wunder blieb bestehen. Es war eine kleine Indianerin. Die besten Sachverständigen schätzten sie auf vier Monate. Aber ein sehr, sehr kräftiges Kind. Natürlich — Bärenmilch!
Sie trug die Tätowierung der Mohawks. Da erklärte sich alles. Die Liebe einer Mutter hatte über den indianischen Stolz gesiegt. Sie war mit ihrem Baby geflohen. Dann war sie wahrscheinlich umgekommen. Da hatte eine Bärin, die Junge stillte, das verlassene Menschenkind gefunden, es in ihre Höhle genommen, nicht um es zu fressen, sondern um es ebenfalls zu säugen. Solche Fälle sind tatsächlich schon wiederholt vorgekommen. Die Mutterliebe kann auch ein Tier vollkommen verwandeln. Wollen Sie nur daran denken, wie oft sich eine säugende Hündin verlassener Kätzchen, die sie sonst hasst, annimmt oder umgekehrt.
Die Gesellschaft kam in die größte Verlegenheit. Die tote Milchquelle erkaltete natürlich schnell, andere Milch war nicht aufzutreiben, irgendwelche präparierte Nahrung wollte die kleine Indianerin durchaus nicht nehmen, und bis zur nächsten Farm hätte ein Reiter zwei Tage und Nächte jagen müssen.
Da sah man in der Ferne Rauch aufsteigen. Es waren meine Lagerfeuer. Ich befand mich mit meinem Zirkus auf der Wanderung von Stadt zu Stadt. Und ich konnte denn auch Hilfe bringen.
Ladies und Gentlemen, ich muss offen sprechen, und ich darf es auch, es ist ein allgemein menschlicher Fall, gar von wissenschaftlicher Bedeutung. Bei meiner Truppe waren viele Frauen, es kam immer einmal ein Kindchen an. So waren auch jetzt zwei stillende Mütter da. Aber vergebens wurde das kleine Indianermädchen an ihre Brust gelegt. Es wollte durchaus nichts davon wissen, schrie Zeter und Mordio. Da aber geschah das zweite Wunder. Zu meinem Zirkus gehörte auch eine ganze Menagerie. Unter anderen war auch eine Bärin vorhanden, ein ganz zahmes Tier, das frei umherlief. Es hatte eben erst drei Junge geworfen. Und da, wie das rothäutige Kindchen auf die Erde gesetzt wurde und die säugende Bärin erblickte, rutschte es sofort hin, wurde mit freundlichem Grunzen empfangen und saugte kräftig mit.
Ladies und Gentlemen, von jenen acht Herren, die von alledem Zeuge wurden, leben heute noch sechs. Ich hatte sie alle eingeladen, meiner heutigen ersten Vorstellung beizuwohnen. Vier der Herren hatten die Güte, der Einladung Folge zu leisten. — Meine Herren, darf ich Sie bitten, sich von mir dem geehrten Publikum vorstellen zu lassen, dass Sie die Wahrheit meiner Worte bezeugen?«
Vier meist ältere Herren erhoben sich in verschiedenen Logen, die sie zum Teil mit ihren Familien besetzt hatten, und begaben sich in die Manege. Eine Vorstellung wäre gar nicht nötig gewesen, sie waren schon bekannt genug, besonders der wegen seiner originellen Einfälle beliebte Professor Wilson, der aber auch für den Dienst der öffentlichen Wahrheit eine furchtbar scharfe Feder führte, wurde mit tosendem Beifall begrüßt, die Kapelle spielte »Heil Dir Columbia«, die ernstere Nationalhymne, alles sang den ersten Vers mit.
»Im Namen dieser meiner Kollegen«, nahm dann Professor Wilson das Wort, »erkläre ich alles, was Signor Ramoni hier über das Indianerkind erzählt hat, für buchstäbliche Wahrheit.«
Wieder begeistertes Händeklatschen, dann fuhr Ramoni in seinem Vortrage fort:
»Ich danke Ihnen sehr, meine Herren. Bitte, wollen Sie Ihre Plätze wieder einnehmen. Nun, Ladies und Gentlemen, komme ich zum Schlusse meines Berichtes.
Ein Jahr lang habe ich das Kind noch mit Bärenmilch genährt, dann nahm ich dasselbe, sobald es laufen konnte, in meine Erziehung. Deshalb habe ich meinen Zirkus verkauft, um mich intensiver mit ihm beschäftigen zu können. Auf welche Weise ich aber das Mädchen sechzehn Jahre lang trainiert habe, das — verzeihen Sie — muss mein Geheimnis bleiben. Die wunderbaren Erfolge werden Sie jetzt sofort selbst sehen. — Bitte, Herr Kapellmeister, Atalantas Einzugsmarsch!«
Achtzig Trompeten und Posaunen schmetterten los, und unter den Klängen eines faszinierenden Marsches trotteten vier riesige Elefanten herein, prachtvoll angeschirrt, die darauf reitenden Inder prachtvoll kostümiert.
Und dann kamen mindestens hundert indische Reiter auf prachtvollen Rossen und mit glänzenden Panzern angetan.
Alsdann tanzten durch die Manege eine ganze Anzahl indische Bajaderen, die schönsten Mädchen, in prachtvollen Seidengewändern und Schleiern, alles gleißend und funkelnd und schillernd.
Hierauf kamen ganze Herden von Zebras, Giraffen, Straußen, Hirschen und anderen Tieren, von Negern in prachtvollen Kostümen geführt.
Und dann wieder eine nicht enden wollende Reiterschar, dann zweihundert schwarze Dahomeyweiber, die Leibgarde des Königs, in zwei Reihen, die eine ganz in goldenen, die andere ganz in silbernen Schuppenpanzern. Sie führten in aller Schnelligkeit unter den Klängen des schmetternden Marsches einen Lanzen- und Schwerterkampf auf.
Dann tauchten wieder ein Paar ungeheure Elefanten auf, ein zweites Paar, ein drittes, ein viertes... vierundzwanzig Paare wurden gezählt, achtundvierzig Stück!
Sie alle waren durch Stränge miteinander verbunden, sie zogen etwas. Und da endlich kam dieses Etwas — ein herrlicher Blumenwagen, für den eine ganze Gärtnerei ihren schönsten Schmuck hatte lassen müssen, umringt von einer Horde Indianer im herrlichsten Federschmuck.
Dann kam nichts mehr. In diesem Blumenwagen sollte doch offenbar Atalanta sitzen. Aber da befand sich niemand drin.
Das kleine Männchen im Frackanzug hatte, seitwärts stehend, mit seinen funkelnden Augen immer das Publikum beobachtet.
Jetzt, als der Blumenwagen hinausfuhr und das Trompetengeschmetter mit einem Schlag verstummte, machte er ein ganz verdutztes Gesicht und blickte sich in komischer Bestürzung in der leeren Manege um.
»Ja, wo ist denn nun Atalanta?«
Ein Herr im Reitfrack kam herein, der Direktor.
»Nun, Signor Ramoni, sind Sie mit meinen Arrangements zufrieden?«
»Das wohl, Herr Direktor, das war ja prächtig, aber — aber — — Sie haben doch vergessen, meine Atalanta in den Blumenwagen zu setzen!«
»O«, lächelte der Direktor, »Sie wissen doch selbst am besten, wie die ist — die kommt bescheiden zu Fuß hinterher.
Ja, da kam sie.
Der Pflegevater ging ihr entgegen, nahm unter einer Verbeugung ihre Hand und führte sie in die Manege.
»Meine Pflegetochter, Miss Atalanta.«
Ein schmetternder Trompetentusch mit Trommelwirbel und Paukenschlag ertönte, seitens des Publikums ein donnernder Applaus.

Atalanta war eine mittelgroße Gestalt, schlank, aber doch mit vollen Formen, ganz in graues, weichgegerbtes Leder gekleidet. Sie trug lederne Beinkleider, darüber ein bis an die Knie reichendes Lederröckchen, ein ledernes Hemd, am Halse geschlossen, auch die Arme bedeckend. Ohne jeden Schmuck, auch die indianischen Stickereien und Fransen fehlten. Das schwarze Haar trug sie offen. Das Gesicht war dunkelbraun mit einem rötlichen Untergrund. Ja, von klassischer Schönheit war es, aber auch unbeweglich, wie aus Bronze gegossen. Dem applaudierenden Publikum hatte sie auch nicht mit einem Kopfneigen gedankt, und bei dieser Gleichgültigkeit blieb sie, blickte immer wie gelangweilt vor sich hin.
»Ladies und Gentlemen«, nahm der Impresario wieder das Wort, nachdem sich der Tumult gelegt hatte, »gestatten Sie mir erst noch eine Erklärung. Atalanta war bekanntlich(*) eine altgriechische Heroine, wurde gleich nach ihrer Geburt im arkadischen Gebirge ausgesetzt, sollte von Raubtieren gefressen werden, eine Bärin nahm sich ihrer an, säugte sie, so wurde sie von Jägern gefunden.
(*) Man wolle im Konversationslexikon nachlesen. welche die Erde von Ungeheuern befreite, war Meisterin in allen körperlichen Übungen, besonders als Schnellläuferin unüberwindbar. Nun hatte sich das bildschöne Mädchen, für Männerliebe ganz unempfänglich, in den Kopf gesetzt, nur dem Manne zu gehören, der sie im Schnelllauf besiege, was dann dem Hippomenes gelang, allerdings auch nur durch eine List.
Nun ist leicht begreiflich, weshalb ich die kleine Indianerin Atalanta nannte. Es kommt aber auch noch etwas anderes dazu.
Meine Pflegetochter wuchs heran und hörte von dieser Sage. Jene Atalanta war also eine gewaltige Heldin geworden.
Diese Geschichte hat meiner Pflegetochter mächtig imponiert. So wollte sie es auch halten. Außerdem mag hier noch der indianische Charakter zum Vorschein kommen, die ihr angeborene Sitte der Mohawks, sich durch eine Wette mit Leib und Seele zu verkaufen. Nun ist Atalanta allerdings eine gute Christin geworden, aber hiermit ist es doch ihr völliger Ernst: Sie wird mal nur den heiraten, der sie in irgend einem Wettkampfe besiegt.
Nun, meine Herrschaften, wird Ihnen Miss Atalanta die erste Probe von ihrer körperlichen und zugleich geistigen Kraft geben.
Ein Diener brachte eine große schwarze Tafel, ein zweiter eine schwere Kanonenkugel, ein dritter einen Porzellanteller mit einer Apfelsine.
»Ich brauche einen Herrn, der ein guter Rechner und bei dem es ausgeschlossen ist, dass ich mich mit ihm verständigt haben könnte.«
»Professor Wilson!«, wurde sofort von allen Seiten gerufen.
Der alte Mathematiker musste wieder in die Manege.
»Hier haben Sie ein Stück Kreide. Nun brauche ich noch eine Streichholzschachtel — danke bestens — ich nehme die Streichhölzer heraus, behalte nur eines — und nun vielleicht noch einen Spazierstock? — Danke sehr — und vielleicht noch ein Taschentuch — danke bestens — — hier, meine liebe Atalanta, hast Du eine zwanzigpfündige Kanonenkugel, einen Teller, eine Apfelsine, einen Spazierstock, ein Taschentuch, eine leere Streichholzschachtel und ein einziges Streichholz — nun amüsiere Dich mit diesen sieben Sachen... so, das geht ja vortrefflich.«
Das Mädchen begann mit diesen sieben so gänzlich verschiedenen Gegenständen zu jonglieren, es war schon ganz fabelhaft, wie sie das überhaupt fertig brachte. Und die Kanonenkugel von zwanzig Pfund war echt, das sollte man besonders noch später erkennen!
»Nun, Herr Professor, wollen Sie einmal hier an diese Tafel zwei recht lange Zahlen schreiben, die multipliziert werden sollen. Irgendwelche!«
Der Professor schrieb groß und deutlich.
»64 271 184 mal 37 812 753!«, las Signor Ramoni. »Atalanta?«
»Ist 2430 Billionen, 771 605 Millionen, 609 552!«, antwortete die Jonglierende sofort.
»Bitte, sage es noch einmal langsam; Herr Professor, wollen Sie nachschreiben.«
Es geschah. Dann multiplizierte der Professor mit Kreide, und viele rechneten im Notizbuch nach.
Das Resultat stimmte.
»Ach, das ist ja gar nicht möglich, die hat das schon gewusst!«, klang es hier und da.
Klirrend zerbrach der Teller, das Mädchen hatte alles fallen lassen.
Signor Ramoni zupfte an seiner Weste, räusperte sich, blickte um sich — aber der Professor kam ihm zuvor.
»Alle die, welche das jetzt gerufen haben, sind ganz gemeine Ehrabschneider, verstanden?!«, rief er mit blitzenden Augen. »Signor Ramoni«, wandte er sich ruhig an diesen, »ich stehe staunend vor einem gründlichen Rätsel! Ich habe schon manchen wunderbaren Kopfrechner kennen gelernt, aber so etwas — nein! Wie ist das möglich?!«
»Ja, Atalanta ist von jeher ein mathematisches Wunderkind gewesen, wie sie überhaupt ein phänomenales Gedächtnis hat. — Aber nun, meine geehrten Herrschaften, ich hätte Ihnen gern noch weitere mathematische Kunststückchen vorgeführt, noch ganz, ganz andere Sachen, doch das ist jetzt vorbei. Miss Atalanta fühlt sich durch jene Bemerkungen beleidigt. Nun, so gehen wir zu anderem über.«
Lächelnd setzte Signor Ramoni seinen Fuß auf die Kugel.
»Ich sagte Ihnen vorhin, das sei eine zwanzigpfündige Kanonenkugel. Sie haben Miss Atalanta mit ihr jonglieren sehen, und zwar mit einer so großen Leichtigkeit, dass Ihnen gerechte Bedenken aufgestiegen sein mögen, ob das auch wirklich eine Kanonenkugel ist. Und diesmal haben Sie recht. Das ist nämlich ein ganz leichter Gummiball. Die Diener haben vorhin nur so getan, als wäre es eine schwere Kanonenkugel. Atalanta, wirf den Gummiball einmal in die Höhe.«
Die Indianerin bückte sich, nahm den Ball zwischen beide Hände, und im schnellen Aufrichten schleuderte sie ihn in die Höhe, bis er fast die Decke des zwanzig Meter hohen Zirkus erreichte, also vier Etagen hoch, fing ihn dann mit beiden Händen wieder auf.
Nun, ein Gummiball war das nicht. Das hatte man besonders beim Auffangen bemerkt. Aber von einer vollen Kanonenkugel konnte erst recht keine Rede sein. Es war einfach eine hölzerne Kegelkugel, und mit der so zu jonglieren und sie so hochzuwerfen, das war schon erstaunlich.
»Meine Herren, starke Männer Amerikas! Zehntausend Dollars zahle ich sofort demjenigen, der diesen Wurf der Miss Atalanta nachmacht!«
Oho!! Ja, es gab hier starke Männer genug, von denen gleich ein Dutzend aufsprangen und in die Manege eilten. Einer nach dem anderen hob die Kugel auf, ein jeder machte dabei ein ganz bestürztes Gesicht — es war tatsächlich eine zwanzigpfündige Kanonenkugel!
»Zehntausend Dollars — wer macht es nach?!«
»I das wäre ja zum Teufel, wenn so etwas dieses Mädel allein könnte!«, rief jemand auf der Galerie.
Ein kolossaler Fleischklotz arbeitete sich durch das Publikum nach der Manege, ein in New York stadtbekannter Mann, ein Fleischermeister, der gar nicht wusste, wohin mit seiner furchtbaren Kraft, der stärkste Mann Amerikas, sagte man. Zum Ringkämpfer eignete er sich weniger, dazu war er nicht mehr gelenkig genug.
Der Riese Goliath zog seinen Rock aus, schlug das Hemd über die unförmlich dicken Arme zurück, spuckte in die Hände, bückte sich, nahm die Kugel und... machte genau so ein verdutztes Gesicht wie alle anderen.
Ja, hochwerfen konnte er die Kugel, aber nicht höher als drei Meter, und dann vermochte er sie nicht wieder aufzufangen, er wurde von ihr zu Boden gerissen.
»Das ist Zauberei!«, schrie er. »Oder das Mädel hat vorhin eine andere Kugel gehabt!«
»Atalanta, dasselbe noch einmal, aber nur mit einer Hand!«, rief Ramoni der Indianerin zu.
Atalanta schob die rechte Hand unter die Kugel, schleuderte sie wiederum bis zur Decke empor, fing sie mit einer Hand wieder auf und präsentierte sie dem Fleischermeister.
»Bitte!«
Aber der wollte nichts mehr von der Kugel wissen, gar nichts, drehte sich schnell um und riss aus.
Das Publikum brach in ein unbändiges Gelächter aus. Noch viel größer freilich war sein Staunen.
»Jetzt wird Miss Atalanta den geehrten Herrschaften ihre Unfehlbarkeit im Schießen beweisen, und zwar erst mit einem Revolver, was wohl etwas ganz anderes zu sagen hat, als mit einer langen Büchse.
Hierbei muss ich — leider — den Herrschaften eine Aufklärung geben. Als der beste Kunstschütze Amerikas, wenn nicht der Welt, gilt wohl der berühmte Buffalo Bill. Aber der schießt nach den in die Höhe geworfenen Tonkugeln mit Schrot! Und zwar aus einer Büchse, deren sehr langer Lauf sich nach vorn etwas erweitert, sodass sich die tausend Schrotkörnchen noch viel mehr zerstreuen! Miss Atalanta dagegen schießt nur mit Kugeln! Bitte, ist hier ein Herr, der den Revolver laden will?«
Es geschah. Der Zirkus hatte an der Seite etwa zehn Meter über der Manege auch eine Bühne, für theatralische Aufführungen. Auf diese wurde die schwarze Tafel gesetzt, Ramoni stellte sich darunter, warf schnell hintereinander sechs weiße Tonkugeln hoch, so groß wie Taubeneier, auf der anderen Seite der Manege stand Atalanta, etwa zweiundzwanzig Meter von der hochstellten Tafel entfernt, und wenn an dieser eine weiße Kugel vorübersauste, feuerte sie.
Alle sechs Tonkugeln wurden zerschmettert, dann Löcher in der Scheibe gezeigt. Diese Sicherheit im Schießen war einfach nicht mehr zu übertreffen.
Doch, sie ließ sich noch übertreffen.
»Atalanta wird Ihnen jetzt zeigen, wie sie noch die alten Waffen ihrer Väter, Pfeil und Bogen, zu handhaben versteht!«, meldete der Impresario.
Ramoni heftete auf die schwarze Tafel eine weiße Visitenkarte, die Indianerin erhielt einen großen Bogen und drei befiederte Pfeile, ließ prüfend die Sehne schnellen, spannte sie etwas lockerer, legte einen Pfeil darauf und schoss ihn ab, und noch ehe dieser aufschlug, war schon der zweite unterwegs, im nächsten Moment folgte der dritte — der erste hatte die Visitenkarte in der Mitte durchbohrt, war vom zweiten Pfeil gespalten worden, dieser vom dritten.
Die drei mit gespaltenen Schäften zusammensteckenden Pfeile wurden mit der vorn daran haftenden Visitenkarte im Publikum herumgegeben.
Das Staunen lässt sich denken, nicht schildern.
»Das ist keine Schießkunst mehr, das ist Hexerei!«, rief man allgemein.
»Meine Herrschaften, nur einen einzigen Speerwurf!«, meldete Ramoni.
Wieder wurde eine Visitenkarte an die schwarze Tafel geheftet, diese jetzt aber an zwei Stricke gehängt und in starke Schwingungen versetzt.
Atalanta erhielt einen Speer von zwei Meter Länge mit Stahlspitze, anscheinend sehr schwer, wog ihn prüfend in der Hand, beugte den Oberleib zurück und schleuderte den Speer nach der schwingenden Scheibe.
Mit zitterndem Schafte blieb er stecken, er hatte die Visitenkarte genau in der Mitte durchbohrt.
»Fabelhaft, fabelhaft!«
»Meine Herrschaften, jetzt wird Ihnen Atalanta noch ein spezielles Beispiel für ihre unfehlbare Berechnungsgabe vorführen. Erschrecken Sie nicht, es ist keine Gefahr vorhanden, Miss Atalanta ist ihrer Sache absolut sicher. Ich werde meine geliebte Pflegetochter und so kostbare Schülerin doch keiner Todesgefahr aussetzen.«
Ein dickes, spitzes Eisen und ein leichtes Bambusrohr wurden gebracht und Ramoni rief aus:
»Meine Herrschaften, hier sehen Sie eine Harpune, ungefähr zehn Pfund schwer, mit haarscharf geschliffener Spitze. Das ist ein ganz leichtes Bambusrohr. Auf dieses stecke ich das schwere Eisen mit der Höhlung. So. Nun nehme ich hier eine kleine Rose mit ganz kurzem Stiel, befestige sie auf dem Scheitel der jungen Dame. So. Nun bitte, Atalanta.«
Das Mädchen nahm die Harpune, schleuderte sie mit Riesenkraft bis zur Decke des Zirkus empor. Dort, als die Lanze ihre höchste Höhe erreicht hatte, drehte sie sich natürlich sofort um, dass die schwere Spitze nach unten kam, sie sauste herab, das leichte Rohr schwirrte langsam nach.
Aber noch ehe es so weit war, gerade wie sich das Eisen hoch oben in der Luft umdrehte und sich ablöste, tat Atalanta, die Lanze scharf beobachtend, einige Schritte, blieb mit auf der Brust verschränkten Armen stehen. beugte Oberkörper und Kopf etwas vor... und da kam das schwere, spitze Eisen herabgesaust und schlug ihr die Rose vom Scheitel.
Nur einige Millimeter falsche Berechnung, und die Harpune hätte ihr den Kopf gespalten!
»Das ist ja entsetzlich!«, wurde so allgemein gehaucht und gestöhnt, dass es bei dieser vieltausendköpfigen Menge wie ein gellender Schrei klang.
Eine geschlossene Kutsche von gewöhnlicher Größe, mit einem starken Pferde bespannt, fuhr herein; sie wurde von der Mitte der Manege aus von einem Bereiter mit der Peitsche gelenkt.
Das Pferd trabte im Kreise, bog aber immer einmal ab und zog den Wagen quer durch die Manege.
Atalanta nahm einen Anlauf, sprang auf das Pferd, wieder herab, sprang über das Pferd, lief der Kutsche nach und sprang mit gleichen Füßen auf das mindestens zwei Meter hohe Verdeck, wieder herunter, lief dann dem Gefährt nach, sprang von hinten über den Wagen und den Bock auf das Pferd, und wieder herunter, rannte dann dem Pferde entgegen und sprang über dessen Kopf über die ganze Kutsche hinweg.
Das Staunen war so groß, dass kein einziger an ein Applaudieren dachte. Das war auch alles so furchtbar schnell gegangen. Und dabei diese spielende Leichtigkeit und Eleganz!
»Sprung über zwanzig indische Riesenelefanten! Mehr gehen leider in die Manege nicht hinein!«, rief Ramoni, eine neue Kunstleistung ankündigend.
Die Tiere wurden von ihren Wärtern hereingetrieben, zwanzig Stück der ungeheuren Dickhäuter stellten sich dicht nebeneinander auf.
»Ach, das ist ja gar nicht möglich!«
Nun, diesmal sprang sie allerdings anders. Sie ging die nach der Bühne führende Treppe hinauf, wo sie noch einen guten Anlauf hatte.
»Fertig! Los!«
Sie sprang ab, sauste mit hochgezogenen Knien, diese mit den Armen umschlingend und sich duckend, wie ein Ball durch die Luft, mit lang nachflatternden Haaren, über die zwanzig Elefanten hinweg, in den gegenüberliegenden Stalleingang hinein.
Jetzt, als die Elefanten wieder fortgeführt wurden, brach der donnernde, nicht enden wollende Jubel los.
Nur Signor Ramoni bedankte sich, das Mädchen war und blieb gegen jeden Applaus ganz unempfindlich.
»Meine geehrten Herrschaften, jetzt möchte ich Ihnen etwas ganz Phänomenales vorführen. Miss Atalanta besitzt nämlich einen ganz besonderen Knochenbau. Daran ist aber nicht die Bärenmilch schuld, sondern das ist die Folge meiner Erziehung, das Geheimnis einer besonderen Ernährungsweise, welche wunderbare Knochen gebildet hat, so hart wie Stahl, wie Diamant, und dennoch wie Gummi. Miss Atalanta wird jetzt von der Zirkusdecke in die Manege herabspringen, und zwar auf eine Eisenplatte.«
Und schon kam ein Seil herab, schon setzte das Mädchen einen Fuß in die Schlinge und ward hochgezogen, schon wurde eine Eisenplatte hereingetragen und nach Ramonis Anweisung in die Mitte der Manege gelegt.
Da endlich begriff man im Publikum, was jetzt geschehen sollte, da endlich wurde das Todesschweigen gebrochen.
»Nun, das ist nicht möglich! — Um Gottes willen, nur das nicht! — Das ist ein gotteslästerlicher Frevel! — Das darf nicht erlaubt werden!«
So und anders erklang es durcheinander.
Da aber sah man das Mädchen schon oben an der himmelhohen Decke als kleines Figürchen an einer Stange hängen, und man wusste, dass jetzt alles zu spät war.
»Fertig?«, rief der Impresario hinauf.
»Fertig!«, klang es von oben zurück.
»Los!«
Und da kam es von der Höhe herabgesaust, schmetterte krachend auf die Eisenplatte und... Atalanta erhob sich wieder, tat einige Schritte seitwärts, strich die Haare zurück und stand gleichgültig wie immer da.
Es war der Jubel der Befreiung von der Todesangst, der jetzt losbrach, nur durch den schmetternden Tusch der Pauken und Posaunen konnte er noch übertönt werden.
»Nun, meine Herrschaften, wollen wir zur Abwechslung wieder etwas Geist einschieben. Der größte Scharfsinn des menschlichen Geistes wird wohl im Schachspiel offenbar. Wollen wir unsere Atalanta einmal daraufhin prüfen. Es sind doch gewiss starke Schachspieler unter Ihnen.«
»Professor Wilson, Professor Wilson!«, erlang es sofort von allen Seiten.
Der Mathematiker war ja gerade keine Weltberühmtheit, aber doch als sehr starker, geistreicher, scharfsinniger Spieler bekannt.
»Wollen Sie ein Partiechen mit Miss Atalanta riskieren, Herr Professor?«
»Ei gewiss, warum denn nicht.«
»Wollen Sie, wenn Sie gewinnen, lieber zehntausend Dollars ausgezahlt haben oder wollen Sie die junge Dame heiraten?«
»Nun, das kommt darauf an, da muss ich erst mit meiner Frau sprechen, ob wir Ende dieses Jahres die goldene Hochzeit feiern wollen oder uns lieber scheiden lassen!«, entgegnete der alte, glatzköpfige Professor und löste ein allgemeines Gelächter aus.
In der Manege wurde jetzt ein riesiger Teppich ausgebreitet, in weiße und schwarze Felder geteilt, und unter den Klängen eines Marsches kamen die zweiunddreißig Schachfiguren hereinmarschiert, junge Mädchen, die kleinen reizend als Weinbauern gekleidet, die Springer mit Pferdeköpfen, die Türme in Rokokotracht, die Läufer als solche charakterisiert, der stolze König und die Königin. Die eine Partei in Schwarz mit Silber, die andere in Weiß mit Gold.
Die lebendigen Schachfiguren stellten sich auf. Auf eine Seite des Teppichs wurden die Buchstaben A bis H gelegt, die Längsreihen werden durch 1 bis 8 markiert. Auf diese allgemein übliche Weise konnte man die Figuren, die schon vorzüglich eingeübt waren, durch Zuruf lenken.
»Herr Professor, links oder rechts?«, sagte der Impresario, beide Fäuste hebend.
»Links.«
Er hatte den schwarzen Stein gewählt und Weiß zieht regelmäßig an.
»Können Sie von Ihrer Loge aus die Figuren gut überblicken?«
»Ganz vorzüglich.«
Gegenüber seiner Loge befand sich die Bühne. Auf diese stellte sich Atalanta.
»Meine Herrschaften, das Schachturnier ist eröffnet! Miss Atalanta hat Weiß und zieht an!«
Wir wollen es kurz machen, wie es auch die junge Indianerin machte. Denn es dürfte bekannt sein, dass eine einzige Schachpartie unter Umständen tagelang währen kann.
Atalanta wusste es dadurch so kurz wie möglich zu machen, dass sie sofort möglichst viele Bauern schlug. Geistreich ist das nun freilich nicht, vielmehr der allerplumpste Anfang. Aber die Hauptsache war dabei, dass es dadurch schnell ging, denn der Professor musste natürlich immer wieder schlagen.
Nachdem auf diese Weise sofort acht Bauern vom Brette entfernt waren, rückte Atalanta mit Springer, Läufer, Turm und Königin mächtig gegen den feindlichen König vor, und beim dreizehnten Zug rief sie:
»Schach und matt!«
Wieder brach ein tosender Beifall los. Man muss die Begeisterung der Amerikaner für das Schachspiel kennen. Und der Erfolg liegt im Erfolg, sagt ein französisches Sprichwort. Der scharfsinnige Professor hatte sich vollständig überrumpeln lassen. Verlegen kratzte er sich hinter den Ohren.
»Ja, wenn die freilich so toll spielt...«
»Herr Professor, haben Sie etwas an dem Spiele auszusetzen?!«
»Nein, o nein, ganz ehrlich ist es ja gewonnen worden. Aber... mit der spiele ich nicht wieder.«
Da erlang eine Stimme ans dem Zuschauerraum:
»Darf ich mit der Dame eine Partie spielen?«
»Bitte sehr. Wollen Sie sich herunter bemühen, damit ich Sie vorstellen kann.«
Ein noch sehr junger Herr trat in die Manege.
»Wie ist Ihr werter Name?«
»Ferrara — Diaz Ferrara!«, lächelte das zierliche Herrchen.
Ein Ruf des Erstaunens ging durch den Zirkus. Ja, diesen jungen Spanier kannte man! Das war der jetzige Weltmeister des Schachspiels, der erst neulich auf einem internationalen Turnier sämtliche Geistesheroen mit spielender Leichtigkeit besiegt hatte.
Und Signor Ramoni erschrak. Jetzt war er es, der sich verlegen hinter den Ohren kratzte. Daran hatte er freilich nicht gedacht, dass dieser Mann hier sein würde.
Signor Ramoni machte ein ganz verzweifeltes Gesicht. Spielen musste er seine Schülerin unbedingt lassen, sonst wäre er von den Amerikanern gelyncht worden. Und so fragte er denn den Meisterschaftsspieler:
»Wollen Sie zehntausend Dollars haben, wenn Sie gewinnen, oder Miss Atalanta heiraten?«
»Das werde ich mir später noch überlegen.«
»Nein, das muss vorher gesagt werden.«
»Gut, dann werde ich sie heiraten.«
Der Spanier wollte ebenfalls von der Bühne aus die Figuren dirigieren und stieg hinauf.
Und unter atemloser Spannung des Publikums begann das Spiel.
Der Weltmeister hatte Weiß und rückte, wie es beim Beginn erlaubt ist, gleich mit zwei Bauern gleich zwei Felder vor. Atalanta tat denselben Doppelzug. Der Spanier führte den einen Bauer wie üblich mit dem Springer. Atalanta aber schlug ihm kurzerhand einen Bauer — — ein sehr, sehr schlechter Zug.
Eine Pause von drei Minuten, was hier eine kleine Ewigkeit zu bedeuten hatte. Jetzt entwarf der Spanier seinen Feldzugsplan. Dann hob er seinen Arm.
»Ich sage an: In sechs Zügen matt!«
Wenn das dieser Schachspieler sagte, so war Atalantas Schicksal bereits besiegelt. Denn im Schachspiel gibt es keinen Zufall. Jetzt konnte sie spielen wie sie wollte — in mindestens sechs Zügen war sie matt gesetzt. Freilich, kein einziger im Publikum konnte das schon sehen. Aber dieser Weltmeister irrte sich nicht.
»Spielen, spielen!«
Der Spanier rückte einen Läufer. Atalanta ging gleich mit der Königin vor.
»Oooh!!«, erscholl es bedauernd durch den ganzen Zirkus.
Sie hatte sich versehen, hatte durch einen falschen Zug die Königin verloren!
Aber ein Zurücknehmen gibt es in diesem Kriegsspiel natürlich nicht. Der Spanier nahm ihr diese Hauptfigur kaltblütig weg, die schwarze Königin musste von dem Teppich verschwinden.
Wütend stampfte Ramoni mit dem Fuße auf, dann ging er auf die Bühne hinauf.
»Señor Ferrara, Sie beabsichtigen wirklich, die Indianerin zu heiraten?«
»Nun, was sonst?«
»Wie viel fordern Sie?«
»Schlagen Sie vor!«
»Zwanzigtausend Dollars!«
»Fünfzigtausend Dollars.«
»Abgemacht. Miss Atalanta bleibt mein.«
Ramoni zog Scheckbuch und Füllfederhalter, schrieb einen Scheck aus, den der Spanier kaltblütig in seine Brieftasche verschwinden ließ.
Da hob Atalanta ihren Arm.
»Ich sage an: In vier Zügen matt!«
Niemand im Publikum verstand, was sie eigentlich wollte. Das braune Gesicht des Spaniers aber färbte sich plötzlich aschgrau. Ja, der sah es nun sofort. Dieses Weib hatte ihm durch Aufopferung der Königin eine ganz niederträchtige Falle gestellt, und er war denn auch richtig glatt darauf hineingefallen!
Beim vierten Zuge setzte ihn die Indianerin matt.
Ach, dieser Tumult, der jetzt losbrach! Dagegen war all der frühere Spektakel gar nichts. Und dieses Pfeifen, als der spanische Weltmeister, der schon seinen Sieg angesagt hatte, die Treppe hinuntereilte und gleich im Stall verschwinden wollte. Aber Ramoni eilte ihm nach und hielt ihn am Rockzipfel fest.
»Sie, sehr geehrter Herr, wollen Sie mir nicht gefälligst meinen Scheck wiedergeben?«
Das hatte nun bloß noch gefehlt! Dieses Gelächter! Endlich konnte Ramoni wieder zu Wort kommen.
»Ich bitte für Miss Atalanta um fünfzehn Minuten Pause. Nach der Pause finden die Ringkämpfe statt. Herren, die sich daran beteiligen wollen, stehen in der Garderobe Trikots zur Verfügung.«
Signor Ramoni begab sich sofort in sein kleines Privatbüro und ließ sich erschöpft auf einen Stuhl fallen. Er war ein alter Mann, hatte schon seit fünfzehn Jahren keine solche Anstrengung mehr durchgemacht. Sein Herz klopfte furchtbar.
»Es sind viele Herren und Damen da, die Sie sprechen möchten«, meldete ein Diener, »hier auch eine ganze Menge Briefe und Karten...«
»Ach, um Gottes willen, nichts hören und sehen!«
Als erster ließ sich gleich der berühmte Professor Dodd melden.
Ramoni wurde stutzig. Da bekam er wirklich einen weltberühmten Namen zu hören.
Professor Dodd war in Amerika der berühmteste Arzt, Chirurg und Anatom. Aber auch aus Europa kamen Leute, um sich bei ihm einer Operation zu unterwerfen, die kein anderer Chirurg auszuführen wagte.
Dieser Professor Dodd hatte eine wunderbare Geschicklichkeit, zwei wunderbar leichte Hände, denn er konnte die linke genau so sicher gebrauchen wie die rechte. Der schnitt einen ganzen Menschen lebendig auseinander und flickte ihn wieder zusammen.
Nur er selbst war gar kein richtiger Mensch. Ein unheimlicher Gesell. Unausgesetzt war er auf der Suche nach Leichen, um sie zu sezieren. Die sind aber in Amerika gar nicht so leicht zu haben. Nur hingerichtete Verbrecher, die aber doch nicht so häufig sind und auch in die öffentlichen Institute kommen. Keine Selbstmörder. In Amerika muss jeder Mensch freiwillig seine Erlaubnis geben, dann darf er nach seinem Tode seziert werden.
Und auf diese Weise bekam Professor Dodd nun freilich genug Objekte für seinen Seziertisch. Er suchte Menschen, die ihre einstige Leiche ihm schon bei Lebzeiten verkauften und... ermordete sie!
Das heißt, er suchte mit Vorliebe Schnapsbrüder, behielt sie bei sich, gab ihnen so viel Branntwein wie sie wünschten, und es dauerte selten länger als acht Tage, so starben sie am Delirium. Ja, er fahndete auch auf andere Personen, die irgend ein besonderes Leiden oder einen besonderen Körperbau hatten, wusste sie zum Schnapstrinken zu verführen, bis er sie so weit hatte, wie er sie haben wollte. Dann zersägte und zerschnitt er sie auf seinem Operationstisch.
Ist das nicht so gut wie Mord? Aber öffentlich angeklagt konnte er deswegen natürlich nicht werden.
»Professor Dodd? Den muss ich empfangen, der hat mir einmal durch eine Operation das Leben gerettet. Ich lasse ihn bitten!«, sagte Ramoni.
Der Angemeldete trat ein. Es war ein unheimlicher Mensch — ein wahres Mephistophelesgesicht mit schwarzem Knebelbart, weiß wie der Tod.
»Herr Direktor Ramoni? Sie haben nur noch zehn Minuten Zeit, deshalb fasse ich mich so kurz wie möglich: Ich möchte gern einmal diese Miss Atalanta sezieren.«
Ramoni reckte den Kopf weit vor, er glaubte nicht recht gehört zu haben.
»Se... zieren?!«
Der Professor versuchte zu lächeln, allein vergebens, dieses Teufelsgesicht aus weißem Marmor, in dem die schwarzen Augen wie scharf geschliffene Dolche blitzten, war keines Lächelns fähig.
»Habe ich sezieren gesagt? Untersuchen habe ich natürlich gemeint. Was dürfte eine gründliche Untersuchung des ganzen Körpers kosten? Fordern Sie einen genügenden Preis. Mir kommt es gar nicht darauf an.«
»Herr Professor Dodd! Ebenso kurz und bündig wie Sie anfragen, will ich Ihnen auch antworten. Abgesehen davon, dass ich über Miss Atalanta ganz und gar nicht zu verfügen habe, dass Sie da mit ihr selbst sprechen müssten — sage ich Ihnen gleich, machen sich nicht die geringste Hoffnung. Und wenn Sie ihr Millionen aufzählen — sie wird Ihnen die Millionen verächtlich vor die Füße werfen und — gleich ganz offen gesprochen — sie würde Sie mit der Reitpeitsche traktieren.
Ich will Ihnen auch gleich sagen, weshalb so etwas bei dieser jungen Indianerin ganz und gar ausgeschlossen ist. Sie hat ein äußerst stark entwickeltes Schamgefühl. Als Kind ging es ja. Aber mit ihrem elften Jahre fing es an. Sie entkleidet sich auch nicht vor einer Frau. Und vor einem Mann entblößt sie kaum den Unterarm!«
»Nun, da gäbe es schon noch ein Mittel.«
»Was für ein Mittel?«
»Ein Tränklein, das sie bewusstlos macht, und wenn sie erwacht, ist schon alles geschehen, sie weiß gar nichts davon.«
Hoch richtete sich Ramoni empor.
»Herr Professor!«, sagte er mit schneidender Stimme. Sie haben mir einst das Leben gerettet, haben mir ein Magengeschwür operiert. Und Sie sind ein Mann der Wissenschaft. Deshalb will ich Ihnen das jetzt verzeihen, will gar nichts gehört haben.«
»Ist das Ihr letztes Wort?«
»In dieser Angelegenheit mein allerletztes Wort!«
»Adieu.«
Draußen auf dem dunklen Korridor murmelte der Chirurg:
»Und diese junge Indianerin kommt doch noch auf meinen Seziertisch, und zwar lebendig! Das bin ich der Wissenschaft schuldig.«
Erschöpft, mit der Hand nach dem Herzen greifend, hatte sich Ramoni wieder auf den Stuhl fallen lassen.
Da trat wieder ein Mann ein, ein kleines, verhutzeltes Männchen, sehr schäbig angezogen, mit aufgedunsenem Gesicht und roter Nase, nach Alkohol duftend.
»Wer sind Sie? Was wollen Sie? Wie kommen Sie hier herein?!«, herrschte ihn der Impresario an.
»Signor Ramoni«, brachte der verkommene Mansch, sich scheu umsehend, mit heiserer Stimme hervor, »ich wurde nicht vorgelassen — ich schlich mich herein — schmeißen Sie mich nicht hinaus, es handelt sich um ungezählte Millionen!«
Da hielt Ramoni allerdings noch einmal die Hand zurück, die schon auf den Klingelknopf drücken wollte.
»Ungezählte Millionen? Da sehen Sie gerade danach aus! Was wollen Sie?«
»Ich war einst ein anderer, als ich jetzt hin, ich war Sheriff, Richter, dann ein berühmter Advokat...«
»Was wollen Sie hier?! Fassen Sie sich kurz!«
»Hat diese Indianerin nicht eine Tätowierung auf dem Rücken?«
Mit grenzenlosem Staunen blickte Ramoni den Mann an.
»Mensch, was wissen denn Sie hiervon?«
»Figuren und Striche und Punkte, aber noch nicht als Kind, sondern diese kamen erst in ihrem elften oder zwölften Jahre auf ihrem Rücken zum Vorschein.«
»Mensch«, wiederholte Ramoni in immer größerem Staunen, »wie kommen Sie zur Kenntnis dieses Geheimnisses?«
Da begann das Männchen in dem engen Raum einen sonderbaren Freudentanz aufzuführen.
»Endlich gefunden!«, jauchzte er auf. »Der Pferdedieb hat mich damals nicht belogen — der Schlüssel zu der Geheimschrift ist gefunden — die Indianerin trägt ihn auf dem Rücken — wir können den Schatz im Sklavensee heben — Hunderte von Tonnen Gold, sie sind unser!«
Da schrillten überall Klingeln, sie meldeten das Ende der Pause. Ramoni sprang auf und schob den Kerl hinaus.
»Ich muss in die Manege, kommen Sie nach Schluss der Vorstellung wieder!«
Atalanta war wieder in dem grauen Lederkostüm erschienen, während man gehofft hatte, sie jetzt im Trikot zu sehen.
Wir wissen nun, dass dies bei diesem Mädchen ausgeschlossen war.
»Nun, erklären sich einige gewandte Ringer bereit, es mit Atalanta zu versuchen?«, fragte Ramoni.
Es war eine ganze Menge! Sie alle hatten sich schon in Trikot geworfen.
Gleich der erste war ein bekannter Ringer, der Meisterschaftsringer vom Staate New York, ein kolossaler Hüne, ein Herkules mit strotzenden Muskeln.
»Wie soll das Schiedsgericht gebildet werden?«
Das Publikum erklärte, dass es selber Schiedsgericht genug sei.
»Wie soll gerungen werden? Das hat immer der Gegner zu bestimmen. Nur jedes Schlagen ist verboten.«
»Ach, bei mir kann jeder Griff angewendet werden!«, sagte der Riese, geringschätzend die schmächtige Indianerin musternd.
Sie stellten sich einander gegenüber.
»Los!«
Der Ringkämpfer bückte sich und streckte schulgerecht die Hände vor — in demselben Moment aber war Atalanta auch schon mit einem blitzähnlichen Satze bei ihm, und in demselben Moment lag der Meisterschaftsringer schon wie ein geprellter Frosch auf dem Rücken.
Wie es eigentlich gekommen war, das wusste niemand zu sagen. Aber köstlich war es anzusehen, wie der Riese langsam aufstand und sich ganz verdutzt umblickte.
»Ja, was war denn das?!«
Genau so erging es noch zwei anderen. Ein Sprung, ein Ruck, und da lagen sie auf dem Boden. Schon hatte niemand mehr Lust.
»Dös is nix, dös is ka Kunst!«, rief da eine Stimme auf der Galerie. »Packen muss man's Dirndl halt können, a Schwyzer Gürtelringkampf!«
»Wer hat das gerufen? Bitte sehr! Jede Kampfesweise ist erlaubt.«
Ein baumlanger Kerl mit wahren Pferdeknochen erschien in der Manege, in Tiroler Tracht, mit Kniehosen und Wadenstrümpfen, ein Holzknecht, eben erst nach Amerika gekommen.
Es wurde der Indianerin erklärt, sie war mit allem einverstanden. Der Tiroler hatte schon einen Gürtel um, Atalanta bekam ebenfalls einen umgeschnallt. Wer den Boden anders berührte als mit den Füßen, nur mit einer Hand, hatte verloren.
»Na da komm halt her, mein Püppel. Nu sollst schaun, wie an Alpgäuer sein Dirndl im Tanz schwingt. Eins — zwei — drei — jubb!«
Jawohl, jubb! Die Indianerin wollte eben nicht jubb machen. Der riesenhafte Älpler zog hinten an ihrem Gürtel, riss und würgte, stemmte sich immer fester, die Adern schwollen wie dicke Stricke an seiner Stirn — alles vergebens, die Indianerin war wie am Boden festgewurzelt.
»Sakra — Sakra — Kruzifix! — Malefizdirndl — — eins — zwei — drei — jubb!«
Das Publikum lachte immer stärker.
»Mach ein Ende mit ihm«, sagte Ramoni, »jetzt werde ich einmal kommandieren: Eins — zwei — drei — jubb!«
Jubb und da flog der Tiroler in großem Bogen über den Kopf Atalantas weg und lag auf Knien und Händen am Boden. Wenige Minuten später war er sang- und klanglos aus der Manege verschwunden.
Nun aber wollte erst recht niemand mehr mit diesem »Malefizdirndl« ringen. Jetzt hatte man ja deutlich gesehen, dass sie nicht etwa ein Bein stellte, sondern dass es nur ihre Riesenkraft war, verbunden mit artiger Gewandtheit.
»Wirklich niemand mehr?«
Schon immer war durch das Publikum ein Murmeln gegangen, ein Name war genannt worden und lauter wurde er jetzt gerufen:
»Graf Felsmark! Graf Arno von Felsmark soll mit ihr ringen!«
Der Betreffende war leicht in der Menge herauszufinden, denn die Augen aller wendeten sich ihm zu.
Es war ein junger Mann, der im Parkett saß, mit einem blondlockigen Achilleskopf, schön wie ein Gott.
Und immer stürmischer wurde es gerufen, gebrüllt, bis das ganze Publikum tobte:
»Graf Arno von Felsmark soll mit der Indianerin ringen!«
Signor Ramoni ging hin.
»Bitte, wollen Sie einen Gang wagen?«
Der junge Mann, den man so in der Menge sitzend nicht weiter beurteilen konnte, schüttelte seinen klassischen Lockenkopf.
»Ich ringe nicht öffentlich, produziere mich überhaupt nicht öffentlich.«
Schon seit einiger Zeit hatte die junge Indianerin mit ihren großen, glänzenden, so melancholischen Augen nach ihm hingestarrt. Jetzt kam sie langsam heran, zum ersten Male, dass sie für irgend etwas Interesse zeigte
»Sie sind Ringkämpfer?«, fragte sie leise mit melodischer Stimme.
»O nein. Ich bin Sportmeister des Athletikklubs.«
»Alles hofft auf Sie, dass Sie mich besiegen könnten.«
»Möglich!«, war die kühle Antwort.
»Sie wollen nicht mit mir ringen?«
»Nein. Es geht gegen meine Prinzipien.«
»Sie sind feig!«, sagte die Indianerin verächtlich und wandte ihm den Rücken.
Jäh sprang der junge Mann empor.
»Ich feig? Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Herr Direktor, ich ziehe mich in der Garderobe um.«
Es war eine sechs Fuß hohe, schlanke, aber breitschultrige Gestalt, die durch die Manege nach dem Stalleingang schritt, und als das Publikum seine Absicht merkte, da erbrauste es jetzt vieltausendstimmig mit donnerndem Jubel:
»Hipp hipp hurra für den Grafen von Felsmark! Hipp hipp hurra für den Champion-Gentleman von New York!«
Die Indianerin musste das Publikum noch durch einige Kraftkunststückchen unterhalten. Doch nur wenige Minuten dauerte es, dann erschien der Graf im Trikot wieder, und Rufe des Erstaunens, der Bewunderung gingen durch den ganzen Zirkus.
Man wusste ja, dass dieser Mann, der fürstlich bezahlte Trainer des Athletikklubs, ausschließlich der Ausbildung seines Körpers lebte, dass er Meister in jeder Art von Sport war, dass von weit her die berühmtesten Maler und Bildhauer kamen, um seinen Körper zu studieren — aber so etwas von harmonischer Schönheit hätte man doch nicht erwartet!
Man hatte heute Abend ja schon viel von kolossaler Muskulatur gesehen. Das hier war etwas ganz, ganz anderes. Kein plumper Herkules, sondern ein schlanker Achilles. Keine Oberarmmuskeln wie Kanonenkugeln, aber am ganzen Körper auch die kleinste Muskel wie von gottbegnadeter Künstlerhand herausgearbeitet. Die ganze Gestalt eine Vollendung der herrlichsten Harmonie, an deren Anblick sich ein künstlerisch gebildetes Auge nicht satt sehen konnte. Und nun noch dazu dieser prächtige, germanische Lockenkopf!
»Los!«
Wie immer sprang die Indianerin wie ein Panther, nein, mit der Schnelligkeit eines Gedankens gegen ihren Gegner an, aber mit sicherem Griff hatte dieser sie sofort gepackt.
Und nun bekam das mit Ringkämpfen doch so verwöhnte Publikum einen Kampf zu sehen, wie es einen solchen noch nie geschaut hatte.
Es war ein fürchterlicher Kampf! Das Fürchterliche bestand darin, dass auch die Indianerin jetzt zum ersten Male den Gegner richtig packte, wo sie ihn packen konnte, und da erst erkannte man, was dieses junge Mädchen, nach einer geheimnisvollen Methode trainiert, für eine fürchterliche Kraft besaß, und zwar auch in den Händen, in jedem Finger.
Man sah deutlich, wie sich ihre Finger immer tiefer und tiefer in das nackte Fleisch des Oberarms ihres Gegners eingruben, und wenn die Indianerin ihren Griff löste, dann waren die Stellen, wo ihre Finger geruht, nicht nur blutunterlaufen, sondern das Blut rieselte sogar am Körper herab.
Nein, so etwas hatte man nicht erwartet, das war selbst für dieses amerikanische Publikum zu viel.
»Aufhören, aufhören! Bringt sie auseinander!«
Aber nur für einen Teil, für den kleinsten, war dieser Anblick zu grauenerregend. Der größere Teil des Publikums war Boxerkämpfe gewöhnt, wobei das Blut noch ganz anders fließt.
»Weiter ringen, weiter ringen!«, wurden jene Stimmen zehnfach übertönt.
Und sie rangen weiter. Natürlich griff die Indianerin nicht umsonst so furchtbar zu. Sofort hatte sie gemerkt, dass sie hier einen ebenbürtigen Gegner gefunden.
Es gab keinen wilden Tanz. Fast immer standen sie unbeweglich, versuchten sich gegenseitig auszuheben.
So vergingen wohl fünf Minuten, und nichts hatte sich geändert. Nur dass immer reichlicher das rote Blut an des Mannes fleischfarbenem Trikot herabrann.

Da endlich hob die doch nur kleine Indianerin den sechs Fuß hohen Achilles empor, schmetterte ihn nieder — — aber er war nur auf die Knie gestürzt. Und so blieb er liegen. Er probierte es jetzt auf andere Weise, versuchte seine Gegnerin zu sich nieder zu ziehen. Das war kein Ringen mehr, sondern ein entsetzliches Würgen. Aber erlaubt.
Und Zoll für Zoll, aber zu jedem Zoll wohl eine Minute gebrauchend, zog er sie zu sich herab. Man sah, wie furchtbar sie sich dagegen stemmte, man hörte ihr furchtbares Stöhnen.
Doch tiefer und tiefer ging es mit ihrem Körper — und da plötzlich schnellte der Graf empor und warf sich über sie, drückte sie mit dem Rücken zu Boden, dass ihn ihre beiden Schultern berührten.
Achtzig Trompeten, Posaunen und Pauken schmetterten zum Triumph des Siegers einen ohrenbetäubenden Tusch, aber diesmal wurde dieser Höllenspektakel doch noch von dem donnernden Jubel des Publikums übertönt.
Von allen Seiten stürmte das Publikum in die Manege, um den Sieger auf die Schultern zu nehmen.
Der Graf, blutüberströmt, war schnell aufgestanden, taumelte und stürzte den ersten, die ihn erreichten, bewusstlos in die Arme.
Auch die Indianerin war sofort, als sie freigegeben, aufgesprungen, sie eilte in den Stall. Der langgezogene, gellende Schrei, den sie dabei ausstieß, ging in dem allgemeinen Tumult verloren.
Und ihr Meister sollte nichts von dem Ausgang dieses Kampfes, von der Niederlage seiner Schülerin erfahren.
Signor Ramoni hatte nur sein »Los!« kommandiert, dann hatte er sich schnell in sein Büro begeben. Er konnte es vor Herzpochen nicht mehr aushalten, ließ sich in einen Lehnstuhl fallen — um sich daraus nicht wieder zu erheben.
Ein Herzschlag hatte sein abenteuerliches Zirkusleben nach langer Pause für immer beendet!
Er war in Deutschland ein flotter Gardeleutnant der Kavallerie gewesen, der einzige Sohn eines vielfachen Millionärs. Danach hatte er gelebt, er brauchte keine Schulden zu machen. Wenn er einmal im Spiel ein paar lumpige tausend Mark verlor — sein Wechsel wurde sofort eingelöst. Es kam ja doch nur bedürftigeren Kameraden zugute. Als einer, der den Dienst quittierte und sich ein Gut kaufte, ihn um Bürgschaft über zwanzigtausend Mark bat, hatte Arno sofort zugesagt.
Da starb der alte Graf. Und es war absolut nichts vorhanden! Alles an der Börse verspekuliert! Außerdem noch große Verpflichtungen.
Schon jene Bürgschaft, deren Zahlung jetzt fällig war, die Arno einlösen sollte und nicht konnte, genügte, um ihm als Offizier das Genick zu brechen.
Er war nach New York gegangen, der vorzügliche Reiter war gleich in einem Reitinstitut angekommen. Allerdings in einem sehr bescheidenen, dritter Güte. Nach einem halben Jahre war es das erste von New York. Nur durch diesen neuen Reitlehrer. Besonders die Damen wollten nur noch von diesem schneidigen Bereiter in den Sattel gehoben werden. Noch schöner aber war das Herunterheben. Zuletzt stiegen die Damen bloß noch auf und ab. Und immer schwerer wurden sie. Wer in New York unter zehn Millionen Dollars wog, der kam nicht mehr an, da gab es keine unbelegte Stunde mehr.
Obgleich sich der Reitlehrer wie ein Minister stand — aber ohne Trinkgeld, das gab's bei dem nicht — hatte er diese ewige Hochheberei und Herabheberei bis spät in die Nacht doch bald satt. Er nahm die ihm angebotene Stelle eines Trainingmasters im Athletikklub an. Verschlechtert hatte er sich dadurch freilich nicht. Jetzt bekam er das Gehalt eines Premierministers. Denn der Athletikklub ist der vornehmste Klub, da kann kein lumpiger Millionär mitmachen. Das Klubhaus, ein riesiger Palast, steht in der fünften Avenue, in der nur Milliardäre wohnen.
Hier übernahm der ehemalige preußische Gardeleutnant wieder den Reitunterricht, erteilte auch Fechtlektionen, beteiligte sich persönlich auch gern am Schwimmunterricht und hatte als erster Master noch gegen vier Sportlehrer aller Art unter sich, wofür er jährlich fünfzehntausend Dollars bekam.
Aber erst eine heroische Tat, die allerdings auch jeder andere, der die Courage und die Fähigkeit dazu besaß, ausgeführt hätte, machte ihn so populär.
Eines Sonntags stießen nahe der Küste von Long Island zwei Dampfer zusammen, sanken sofort, ehe ein einziges Boot ausgesetzt werden konnte. Der eine war voll Kinder, die einen Schulausflug machten! Es war einen halben Kilometer von der Küste entfernt, auf der Hunderte von Sonntagsausflüglern standen, und weit und breit kein Boot zu haben!
Unter denen, die sofort ins Meer sprangen, war auch Graf von Felsmark. Achtmal schwamm er den halben Kilometer hin und her, brachte neun Kinder und vier Erwachsene lebendig an Land, also einige Male gleich zwei, einen im Arm und einen auf dem Rücken. Dann war nichts mehr zu retten gewesen.
Hoch klang das Lied vom braven Mann! In Amerika gibt es keine Orden. So etwas wird mit Geld belohnt. Die Regierung überwies ihm aus der Staatskasse eine große Summe, es wurde aber auch für ihn gesammelt. Die Höhe dieser Summe wollen wir nicht nennen. Jedenfalls hätte er von ihren Zinsen sehr gut leben können.
»Niemals werde ich auch nur einen Cent annehmen dafür, dass ich ein Menschenleben gerettet habe, jeder Bissen Brot würde mir im Munde quellen!«, sagte der Graf und überwies das Geld einem Waisenhaus.
Das verstand der Yankee zu würdigen. Sein Lied klang nur desto lauter.
Dann aber, als man sich nun näher mit diesem deutschen Grafen beschäftigte, nun etwas mehr über seine Vergangenheit wissen wollte, da erfuhr man etwas, was völlig über das Verständnis der Amerikaner ging.
Sofort, als er in New York eine Stellung bekam, zuerst eine so bescheidene, hatte er mit der Abzahlung seiner in Deutschland hinterlassenen Schulden begonnen. Zuerst mit der seiner Bürgschaft, dann mit der seiner sonstigen Schulden, und dann mit denen seines Vaters.
So etwas ging über die Begriffe der Amerikaner. Aber zu würdigen wussten sie so etwas dennoch! Und da prägten sie für den Grafen Arno von Felsmark den Titel: Der Champion-Gentleman von New York.
Muss erst noch gesagt werden, dass dieser Mann an keiner Tür New Yorks als Freiersmann vergebens geklopft hätte? Nein! Aber er brauchte gar nicht zu klopfen. Sie kamen ja von ganz allein gerannt. Und wie!
Da war besonders die Miss Marwood Morgan, eine Tochter des verstorbenen Stahlkönigs, Besitzerin von mindestens hundert Millionen Dollars, schön, geistreich, mit tadelloser Vergangenheit, bisher sehr spröde gegen die Männer — die war durch den deutschen Bereiter einfach toll geworden. Er hatte sich vor den Zudringlichkeiten des sonst so stolzen Weibes nicht retten können, hauptsächlich ihretwegen hatte er jene erste Stelle aufgegeben.
Wie er über das Heiraten dachte, das hatte er einmal ausgesprochen, und es war bekannt geworden.
»Meine Frau braucht einmal nichts mitzubringen. Wenn wir beide uns nur lieben. Kaufen lasse ich mich nicht, weder für fünf Cents noch für fünf Milliarden Dollars.« — —
Als die Ringkämpfe begannen, da hatte niemand an den Grafen Felsmark gedacht, obgleich sie ihn alle sitzen sahen. Sie wussten, dass er Meister in allen ritterlichen Leibesübungen war, aber als Ringkämpfer hatte er noch nie von sich reden gemacht, davon wussten auch die Mitglieder des Klubs nichts.
Aber als nun das doch eigentlich so unansehnliche Indianermädchen einen Fleisch- und Knochenkoloss nach dem andern zu Boden schmetterte, da entstand in allen den Tausenden immer mehr jenes dunkle Bewusstsein: Wenn irgend ein Mensch dieses rote Teufelsweib besiegen kann, so ist das jener Mann, der mit Riesenstärke zugleich das sonnige Herz eines naiven Kindes verbindet, dieses beides zusammen muss dem Menschen eine Gotteskraft geben, die einfach unbesiegbar ist!
Und er hatte in der Tat den Sieg davongetragen!
Es war nur eine momentane Schwäche gewesen, die den Grafen von Felsmark nach seinem schwer errungenen Sieg übermannt hatte, der er aber rasch wieder Herr wurde. Die von den stählernen Fingern gebohrten Fleischwunden, die er gar nicht beachtete, wurden ihm kunstgerecht verbunden, dann fuhr er nach Hause. Aber der Wagen wurde nicht von Pferden, sondern von Hunderten von Menschen gezogen und geschoben, die vor Begeisterung tobten.
Endlich war es ihm gelungen, in das prächtige Klubhaus zu schlüpfen, wo er in der dritten Etage eines Seitenflügels eine ganze Flucht von wahrhaft fürstlich eingerichteten Zimmern bewohnte.
Er befand sich in der vorzüglichsten Laune und rieb sich vergnügt die Hände.
»Endlich, endlich ist der Bann gebrochen!«, jubelte er immer wieder.
Arno fühlte sich nämlich in seiner jetzigen Stellung gar nicht so sehr glücklich. Er hatte ein ganz anderes Ideal vor Augen. Die Welt hätte er sich gern besehen mögen, die ganze weite, schöne Welt.
Dazu hat man nicht unbedingt Geld nötig. Arno wusste, wie er dabei auch noch viel Geld verdienen konnte. Jeder Zirkus und jede Varietébühne nahm ihn auf. Er konnte sich als Schul- und Kunstreiter produzieren, als Kraftturner, als Akrobat, in einem Glasbassin als Fischmensch, mit einem Partner als Fechtkünstler — er wollte dem verwöhntesten Publikum immer wieder ganz neue Tricks vormachen, Mund und Nase sollten sie aufsperren.
Und nicht etwa, dass er sich geniert hätte, sich für Geld öffentlich zu zeigen. Tut dies denn überhaupt nicht jeder Mensch? Der Beruf des Artisten ist so ehrenwert wie jeder andere, durch den das Geld auf ehrliche Weise verdient wird.
Und doch, er genierte sich. Nur in anderer Weise. Das Lampenfieber! Er konnte sich nicht vorstellen, wie er das erste Mal im Zirkus oder auf einer Bühne auftreten sollte. Davor hatte er eine schreckliche Angst. Das war Charakter, hatte natürlich nichts mit Feigheit zu tun.
Da hatte heute Abend die Indianerin nur das Wörtchen »feige« zu sagen brauchen — mit einem Male war das alles vorbei. Jetzt konnte er wieder gar nicht begreifen, dass das jemals anders gewesen war.
Deshalb seine selige Stimmung.
»Jawohl, das wird gemacht! Ich gehe immer aus einem Zirkus in den andern, kleppere auf diese Weise erst einmal ganz Amerika ab, besichtige die Städte — und dazwischen immer einmal für ein paar Wochen mit der Büchse unterm Arm in den grünen Wald, in die blumige Prärie, im Boot auf einen See — — ach, soll das ein herrliches Zigeunerleben werden.«
Das Haustelefon, das ihn mit der Portiersloge verband, klingelte.
»Graf Felsmark. Was gibt es?«
»Eine Dame wünscht Sie zu sprechen.«
»Ihr Name?«
»Sie will ihn nicht nennen.«
»Dann soll sie doch ihre Karte mit der Rohrpost heraufschicken.«
»Will sie auch nicht.«
»Na, was will sie denn eigentlich?«
»Sie sagt, der Herr Graf erwarte sie.«
»Ich? Ich erwarte keine Dame.«
»Sie hätten sie bestellt.«
»Ist mir nicht eingefallen. Ich habe überhaupt noch nie eine Dame hierher bestellt. Sie soll mir schreiben, was sie will. Ich bin für jeden zu sprechen — aber solche geheimnisvolle Besuche gibt's nicht! Und wer sich unter einem falschen Namen anmeldet, der kann hier oben etwas erleben! Das sagen Sie immer gleich! Schluss!«
»Ach, diese verflixten Weiber«, sagte er ärgerlich, als er den Hörtrichter wieder anhing, »Tag und Nacht lassen sie einem keine Ruhe. Na, und ich sehe morgen früh schon diese Säcke voll Briefe! Es ist zu traurig.«
Dann aber, als er zwischen den offen stehenden Fenstern hin und her ging, war er doch wieder recht heiter. Nur dauerte es eine Weile, ehe sein Selbstgespräch wieder laut wurde.
»Ja, und von Amerika gehe ich wieder einmal nach Europa, nach London, Paris und so weiter, besichtige die Kunstschätze, habe ja den ganzen Tag Zeit dazu, von Marseille geht es nach Algier, dann nach Kairo — — natürlich auch nach Madrid, nach Rom, Neapel, Venedig — — dann nach Indien, Australien — überall wird geritten und geturnt und geschwommen — und dazwischen immer einmal ein Tiger und ein Löwe und ein Elefant gehascht — und dann... halloh!«
Plötzlich hatte sich durch das Fenster eine Gestalt geschwungen, vor ihm stand eine Dame im langen, dunklen Wettermantel, unter der Reisemütze einen undurchdringlichen Schleier vor dem Gesicht.
»Na, wie kommen Sie denn hier herein?! Wer sind Sie denn?! Was wollen Sie denn?! Sie wollen mich doch nicht etwa überfallen und berauben?«
Die Dame schlug den Schleier hoch — und da erst, als Arno dieses schöne Antlitz von rotbrauner Farbe sah, prallte er erschrocken zurück.
»Miss Atalanta!«
»Du hast mich besiegt!«, sagte sie mit melodischer Stimme.
Da zum ersten Male dachte Arno an die Prämie, die er sich ja verdient hatte — an die zwei Prämien, zwischen denen er wählen konnte.
»Ach sooo! Sie bringen mir wohl gleich auf diese ungewöhnliche Weise die zehntausend Dollars?«
»Nein.«
»Was denn sonst?«
Die dunklen, großen, glänzenden Augen, die einen so schwermütigen Ausdruck hatten, waren starr auf ihn geheftet.
»Mich selbst.«
Für Arno genügten diese zwei Worte und er war furchtbar betroffen, denn er sah da schon eine böse Verwicklung kommen.
»Ich soll Sie wohl heiraten?«
»Wie Du bestimmst.«
»Was soll das heißen?«
»Du hast mich besiegt — Du hast über mich zu befehlen.«
»Hm. Was sagt denn Signor Ramoni dazu?«
»Er ist tot.«
»Tot?!«, stieß Arno bestürzt hervor.
»Ein Herzschlag.«
»O Gott! Aus Schreck über Ihre Niederlage?!«
»Nein. Der Schlag muss ihn in seinem Büro schon getroffen haben, als wir eben erst zu ringen begannen. Er hat es immer schon befürchtet, litt in letzter Zeit immer so an Herzklopfen.«
»Na, dann ist es gut. Wenn ich mir ja auch keine Vorwürfe zu machen brauchte. Ach, da wollen Sie nun wohl einen anderen...«
Arno brach ab, schnippste mit den Fingern, machte einige Gänge durchs Zimmer. Eine herrliche Idee war ihm gekommen. Er blieb wieder vor der Indianerin stehen.
»Was hatten Sie mit Signor Ramoni für einen Kontrakt gemacht?«
»Gar keinen.«
»Wirklich nicht?«
»Ich habe ihn immer als meinen Vater betrachtet. Am 14. Februar dieses Jahres wurde ich sechzehn Jahre. So ist taxiert worden, damals, als mich Signor Ramoni als seine Adoptivtochter gesetzlich registrieren ließ. Als ich nun mit meinem sechzehnten Jahre mündig wurde, wollte er mich veranlassen, einen Kontrakt auf viele Jahre zu unterschreiben. Das habe ich nicht getan. Auch würde sein Tod ja einen Kontrakt aufheben.«
»Haben Sie sonst keine anderen Verpflichtungen?«
»Ja.«
»O weh. Welche?«
»Ich gehöre jetzt Dir.«
»Ach so war das gemeint!«, lachte Arno. »Das lässt sich hören. Miss Atalanta, wollen wir beide uns verbinden?«
»Wie Du befiehlst.«
»Ich habe Ihnen gar nichts zu befehlen.«
»O doch!«
»Na meinetwegen«, lache Arno, »also ich befehle Ihnen, sich mit mir zu verbinden.«
»Ich gehorche!«, entgegnete sie tiefernst wie immer.
»Wir beide bereisen als Athleten und Akrobaten die ganze Welt.«
»Ich gehorche.«
»Was wir verdienen, wird brüderlich geteilt.«
»Wie Du bestimmst.«
Arno sagte sich, dass er diesen indianischen Charakter erst näher kennen lernen musste, ehe er mit dem Mädchen weiter unterhandeln konnte. Er hielt ihr die Hand hin.
»Dann einstweilen einen kräftigen Handschlag, der unseren Pakt und unsere gute Freundschaft besiegelt.«
Gleichgültig wie immer legte sie ihre Hand in die seine. Arno stutzte, er erschrak fast über diese leicht Berührung.
Er hatte heute Abend sie doch noch in ganz anderer Weise angefasst, angepackt, und da war er ja zuerst ebenfalls ganz erschrocken gewesen, aber da hatte er zu solchen Überlegungen denn doch keine Zeit gehabt, hatte sich gegen die Kraft dieser eisernen Glieder fürchterlich wehren müssen.
Jetzt befühlte und betrachte er die Hand, und sein Staunen wuchs.
Die rotbraune Hand war klein, sogar zierlich, aber eben... eisern!
Man spricht oft von einem eisernen Körper, von eisernen Gliedern, von eisernen Muskeln, von einer eisernen Hand und so weiter. Das ist natürlich nur ein Vergleich, ist zur Redensart geworden.
Man kann doch in jedem Fleische, auch in der durch Arbeit härtesten Muskel, mit der Fingerspitze einen Abdruck erzeugen. Bei dieser Hand hier war das nicht möglich. Zum Beispiel auch nicht bei dem Daumenballen. Arno nahm sogar einen Bleistift — vergebens, nicht einmal mit der Spitze konnte er das Fleisch auch nur einen Millimeter niederdrücken.
»Ja um Gottes willen, was ist denn nur mit Ihnen gemacht worden?!«, stieß er bestürzt hervor.
»Ich weiß es nicht.«
»Darf ich einmal Ihr Gesicht anfühlen?«
»Wie Du willst.«
Hier ganz genau dasselbe. Alles eisern! Die Wangen nicht einzudrücken, die rotbraune Haut nicht zu verschieben. Und die Ohren?
Wir wollen nicht mehr von »eisern« sprechen. Das Mädchen bestand aus Gummi oder unvulkanisiertem Kautschuk, der in dickerer Lage doch ebenfalls nicht einzudrücken ist, es sei denn mit einem Meißel, einem Nagel oder einer Nadel.
Ja, aus solchem harten Gummi bestanden auch die Ohren. Wohl beweglich, biegsam, aber doch nicht so wie menschliche Ohren. Eben aus hartem Gummi.
»Signor Ramoni muss mit Ihnen etwas Besonderes gemacht haben! Er sprach doch auch mehrmals von einer anderen Ernährung.«
»Davon weiß ich nichts. Ich habe immer gegessen, was alle anderen Menschen essen. Möglich, dass er etwas beimischte. Nur eines kann ich berichten: Bis zu meinem elften Jahre hat er mich täglich mehrmals am ganzen Körper mit Öl eingerieben. Dadurch wurde mein Fleisch härter und immer härter, bis es schon in meinem elften Jahre so war, wie es jetzt ist.«
»Dann hat er Sie nicht mehr massiert?«
»Nein.«
»Und wie sind die Knochen?«
»Das weiß ich nicht. Aber verwandelt müssen wohl auch die worden sein. Wenn ich überhaupt Knochen habe. Du kannst mich mit der schwersten Eisenstange schlagen, wie Du willst, mir wird nichts gebrochen. Probiere es, nimm eine schwere Eisenstange, schlage mich mit aller Kraft über den Kopf...«
»Um Gottes willen!«
»Signor Ramoni hätte es morgen Abend im Zirkus mit mir vorgeführt. Es mag ja Grenzen für meine Unzerbrechlichkeit geben, die ich aber nicht kenne. Oder nur für einzelne Fälle. Höher als zwölf Meter darf ich nicht mit dem Kopf aufschlagen...«
»Um Gottes willen!«, konnte Arno immer nur hervorbringen.
Sie nahm ihre Mütze ab und duckte sich wie zum Sprunge.
»Was wollen Sie tun?!«, rief er hastig, ihr entgegentretend.
»Mit einem Satz gegen die Wand springen, mit dem Kopf dagegen schmettern.«
»Auf keinen Fall, das erlaube ich nicht!«
»Ich gehorche!«, entgegnete sie demütig, sich aus ihrer Sprungstellung wieder emporrichtend.
»Wissen Sie, ob Signor Ramoni das Rezept zu dieser Fleisch- und Knochenerzeugung schriftlich niedergelegt hat?«
»Ich weiß nur, dass er dann, nachdem er mich dem Publikum vorgeführt hatte, eine Schule gründen wollte, um besonders dazu geeignete Kinder ebenso wie mich zu präparieren. Er nannte es immer ›präparieren‹.«
»Wie wurden Sie sonst als Athletin ausgebildet?«
»Ich musste von früh bis abends Gewichte heben, turnen, reiten, springen, schießen und anderes mehr. Aber ohne jede Überanstrengung. Auch nie unlustig durfte ich dazu sein.«
»Darf ich einmal Ihren Arm befühlen?«
»Wie Du befiehlst.«
Der volle Arm war ebenfalls hart wie Gummi. Aber eigentlich keine Muskeln. Oder die schwellenden, eisenharten Muskeln waren eben immer da, auch beim gestreckten Arm.
»Darf ich den Arm einmal sehen? Wollen Sie den Ärmel zurückstreifen? Da müssen Sie aber wohl erst den Mantel ausziehen.«
Sie knöpfte auf, ließ den Mantel zu Boden fallen und stand in ihrem grauen Lederkostüm mit dem kurzen Röckchen da. Und so blieb sie stehen, den Grafen mit ihren melancholischen Augen unverwandt ansehend.
»Nun, kann ich nicht einmal Ihren Arm sehen? Nur den Unterarm bis zum Ellenbogen. Die Ärmel sind ja weit genug.«
Der Lederärmel war am Handgelenk mit Riemchen zugeschnallt. Sie senkte den Kopf und begann, diese Riemchen zu lösen.
Da bemerkte Arno plötzlich, wie sich ihr dunkles Gesicht noch dunkler färbte, wie ihre stählernen Finger immer mehr zu zittern begannen, welches Zittern sich nach und nach dem ganzen Körper mitteilte — und der junge Edelmann war so feinfühlig, um sofort alles zu verstehen, was in dem Mädchen vor sich ging.
»Komisches Mädchen!«, lachte er in seiner offenen, herzgewinnenden Weise, aber doch selbst etwas verwirrt »Nein, nein, lassen Sie nur zu! Denken Sie denn etwa, ich will Sie zwingen?!«
»Wie Du befiehlst!«, entgegnete sie demütig wie immer und schnürte die Riemchen wieder zu.
»Ja, wie sind Sie denn nur eigentlich hier heraufgekommen bis in die dritte Etage?!«
»An der Wand.«
Arno blickte zum Fenster hinaus und hinab. Es war eine sehr einsame Seitenstraße.
»Am Blitzableiter? Hier ist doch gar keiner!«
»Es sind doch überall kleine Vorsprünge, an denen man sich festhalten kann.«
Ja, wenn man nach solchen Vorsprüngen suchte, sah man sie allerdings. Aber sonst nicht.
»Und da sind Sie wie eine Spinne hier die drei Etagen hoch heraufgeklettert?! Das ist doch nicht möglich! Das müssen Sie mir einmal vormachen!«
»Wie du be...«
»Neneneneee!«, lachte Arno, das Mädchen zurückhaltend, das schon zum Fenster hinaus wollte. »So war das nicht gemeint! — Ja, geehrte Miss, da werden wir alles Weitere morgen besprechen, jetzt gehen Sie doch wieder in den Zirkus und...«
Das Telefon klingelte.
»Graf Felsmark.«
»Herr Professor Dodd bittet den Herrn Grafen in wichtiger Angelegenheit sprechen zu dürfen.«
Arno nahm den Mund vom Trichter.
»Professor Dodd? Das ist der berühmte Menschenschneider — was will der von mir? Mich in Spiritus setzen? Nun, ich werde ihn empfangen, vielleicht muss ich mir von diesem Schneider auch einmal etwas am Zeuge flicken lassen. — Sein Besuch ist mir angenehm!«
Arno wandte sich wieder an das Mädchen, er musste sich beeilen, denn in wenigen Minuten war der Besuch oben und wurde vom Diener ohne Weiteres vorgelassen.
»Also, Miss Atalanta, Sie gehen doch jetzt in den Zirkus zurück?«
»Was soll ich im Zirkus?«
»Ja — das müssen Sie doch am besten wissen. Sie können doch nicht hier bleiben und... bitte, treten Sie doch erst einmal hier ins Nebenzimmer, ich fertige den Professor so schnell wie möglich ab, dann lasse ich Sie in den Zirkus fahren.«
Er schloss hinter Atalanta die Tür des Nebenzimmers, ein Diener meldete den Professor, dieser trat sofort ein.
»Herr Graf von Felsmark, wenn ich nicht wüsste, dass es in diesem Klubhaus keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht gibt, hätte ich nicht einen so späten Besuch gemacht. Der Portier sagte, Sie seien noch zu sprechen. Und was ich Ihnen zu sagen habe, duldet auch keine Minute Aufschub, denn es dient zum Heile der ganzen Menschheit.«
»Dann, Herr Professor, lasse ich mich auch gern aus dem tiefsten Schlafe rütteln. Bitte, wollen Sie Platz nehmen.«
»Danke sehr.«
Der Professor stellte seinen Zylinder, der nach englischer Sitte wie der Spazierstock stets mit ins Empfangszimmer gebracht wird, auf den Tisch und legte die Glacéhandschuhe daneben.
»Bei Ihnen befindet sich doch die Miss Atalanta.«
Verwundert hob Arno den Kopf.
»Woher ist Ihnen das bekannt?«, fragte er gleich mit seiner gewöhnlichen Offenheit.
»Das kann ich mir kombinieren.«
»Was heißt kombinieren?«
»Sie haben sie doch im Ringkampf besiegt.«
»Nun — und?«
»Und es wäre doch wunderbar, wenn die Mohawk-Indianerin nicht sofort zu Ihnen gekommen wäre.«
»Ja warum denn nur?«
»Nun, die ist doch jetzt Ihre Sklavin.«
»Meine — — Sklavin?!«, wiederholte Arno mit ganz großen Augen.
»Nun ja, das war doch öffentlich in großen Plakaten bekannt gemacht worden. Wer diese Indianerin in irgend einem der genannten Wettkämpfe besiegt, dessen Sklavin ist sie.«
»Den ist sie zu heiraten bereit!«
»Ach!«, erklang es in maßloser Verachtung von den Lippen des weißen Teufelsgesichtes. »Was weiß denn so eine rote Squaw, so eine Indianerin vom Heiraten! Gerade so viel wie eine Hündin. Na ja, das konnte nicht so öffentlich gesagt werden, das erlaubt die Polizei und die allgemeine Moral nicht, weil's eben keine Sklaverei mehr gibt.
Geehrter Herr Graf, ich will Ihnen sagen, woher ich dies alles so genau weiß. Ich bin viel, viel älter, als ich aussehe. Ich habe viele, viele Jahre unter Indianern gelebt. Ich habe dreihundertvierundachtzig Indianer seziert, darunter zweiundvierzig lebendig.
Da lernt man die Indianer kennen. Und zwar auch psychologisch, der Seele nach. Und ich versichere Ihnen: Diese Atalanta ist dem Charakter nach eine echte Mohawk-Indianerin, wenn sie auch die Bibel von vorn und von hinten auswendig kann! Und ich kenne doch die Mohawk-Indianer! Wenn die einmal gesagt hat: Wer mich besiegt, dessen Sklavin bin ich — da können Himmel zusammenbrechen und Welten untergehen — daran wird nichts mehr geändert!
Probieren Sie's doch einmal. Sagen Sie zu ihr: Springe zum Fenster hinaus! — sie wird sofort hinausspringen. Sagen Sie zu ihr: Stecke Deinen Arm ins Feuer! — sie wird ihren Arm verbrennen lassen, ohne mit einer Wimper zu zucken. Nur eines können Sie ihr nicht befehlen: Verlasse mich! Die geht nicht wieder von Ihnen. Noch viel weniger als ein Hund. Ein Hund lässt sich verkaufen, gewöhnt sich mit der Zeit an einen neuen Herrn — die niemals. Ihr Tod ist auch dieser Indianerin Tod. Sie verhungert auf Ihrem Grabe. Lehren Sie mich diese Mohawks nicht kennen.«
Schier fassungslos blickte Arno in das weiße Teufelsgesicht. Ja und doch — jetzt erst fiel ihm auf, wie das Mädchen ihm vorhin immer geantwortet hatte — »wie Du befiehlst« — »ich gehorche«.
»Ja, Herr Professor, wollten Sie mich nur hierüber aufklären?«
»Nein, jetzt kommt die Hauptsache. Ich möchte dieses Indianermädchen einmal sezieren... ääh, pardon — untersuchen, wollte ich sagen. Ihren Knochenbau und so weiter. Ich war vorhin deshalb schon bei Signor Ramoni — als er noch lebte, jetzt ist er tot. Dem trug ich denselben Wunsch vor. Er sagte, dass dies nicht möglich sei, weil seine Pflegetochter seit dem elften Jahre, wahrscheinlich als in ihr die Jungfrau erwachte, so schamhaft geworden sei, dass sie nicht einmal ihren Unterarm entblöße...«
»Ja, das habe ich auch schon bemerkt.«
»Haben Sie? Sehen Sie. Sie brauchen ihr es aber doch nur zu befehlen, dann tut sie es.«
»Meinen Sie?«
»Ganz sicher. Ich gehe jede Wette mit ein. Also sie ist hier bei Ihnen? Rufen Sie sie, befehlen Sie ihr, sie soll sich gänzlich entkleiden, in meiner Gegenwart, und ich gebe Ihnen fernerhin mein ganzes ärztliches Jahreshonorar, wenn sie es nicht sofort tut.«
Der junge Graf legte die rechte Hand auf den Tisch, ganz ruhig, aber der Tisch bebte; er begann mit den Fingern zu trommeln, und es klang wie fernes Donnergrollen.
»Herr Professor, Sie verlangen Unmögliches von mir. Nie werde ich die Macht, die ich über einen Menschen habe, so missbrauchen.«
»Aber es handelt sich doch um eine wissenschaftliche Untersuchung, welche für die ganze Menschheit...«
»Kein Wort weiter! Es ist zwecklos. Ich ehre solch eine Schamhaftigkeit und damit genug.«
»Nun, da gäbe es noch ein anderes Mittel.«
»Was für ein anderes Mittel?«
»Wir geben ihr ein Tränklein, das sie in tiefen Schlaf versetzt, und wenn sie erwacht, ist es schon geschehen, sie erfährt gar nichts davon.«
Arno erhob sich. Er machte es viel kürzer als vorher Signor Ramoni.
»Herr Professor, stehen auch Sie auf!«
»Warum?«, fragte der verwundert.
»Weil Sie nicht auf meinem Stuhle hinausreiten können. Sie sollen hinausgehen, aber ein bisschen fix!«
Ganz gelassen stand der Professor auf, griff nach Hut und Handschuhen. Aber er ging noch nicht.
»Dann noch einen anderen Vorschlag. Ich habe Sie heute Abend im Trikot gesehen, so gut wie nackt. Sie haben einen herrlichen Körper! Den möchte ich in meinem Museum haben. Was fordern Sie, wenn ich Sie sezieren darf? Es gereicht auch Ihnen selbst zur höchsten Ehre. Ich schäle Ihre Muskeln, Knochen, Sehnen, Adern und alles andere aufs sauberste heraus, so wie nur ich es verstehe, setze alles einzeln in Spiritus und schreibe unter die Flaschen: Graf Arno von Felsmark, Champion-Gentleman von...«
Er kam nicht weiter, Arno platzte ihm mit schallendem Lachen direkt ins Gesicht.
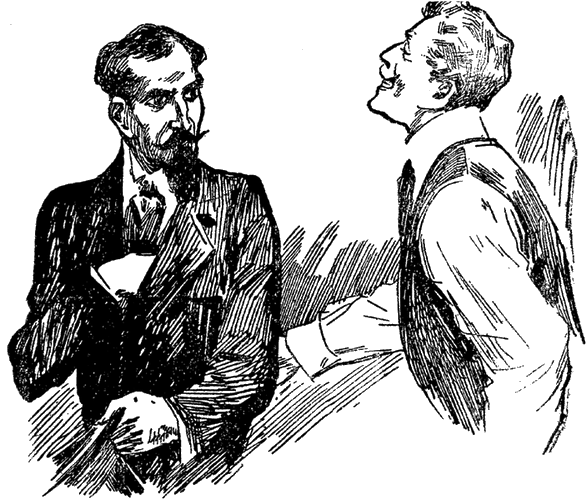
»Herr Professor, es tut mir eigentlich leid, dass ich Sie hinauswerfen muss. Sie können ja gar nicht anders handeln und sprechen, Sie sind ein echter Yankee vom Scheitel bis zur Sohle, und Ihr Herz haben Sie sich eben selbst herausoperiert. Gehen Sie, gehen Sie!«
Er schob ihn hinaus und schloss hinter ihm die Tür.
Als sich Professor Dodd mit dem Fahrstuhl in die Tiefe hinabsenkte, murmelte er mit einem teuflischen Grinsen:
»Und Dich bekomme ich ebenfalls auf meinen Seziertisch, und zwar ebenfalls lebendig! Erst dann kommst Du als Präparat in den Spiritus.«
Als sich Arno immer noch lachend umwandte, sah er auf dem Tisch einen der Handschuhe des Professors liegen, und sein Lachen verstummte.
»Da hat der Kerl einen Handschuh liegen lassen. Pfui Deibel! Schon dieser Handschuh verpestet mir die ganze Stube.«
Er fasste den Handschuh mit den äußersten Fingerspitzen, wollte ihn zum Fenster hinausschlenkern, verlor ihn aber schon vorher und stieß ihn mit dem Fuß unter den Tisch.
Dann öffnete er die Tür des Nebenzimmers Ein tiefes, tiefes Mitleid erfasste ihn, als er das Indianermädchen in einer Ecke kauern sah, sie erhob sich bei seinem Eintritt, und noch großer ward seine Rührung, wie sie jetzt wieder so demütig vor ihm stand. Er brauchte nicht erst zu fragen, ob sie sich denn wirklich als seine Sklavin mit Leib und Seele betrachte, er zweifelte nicht mehr im Geringsten an jener Erklärung des Professors, schon diese ihre Stellung sagte ihm alles.
»Mein armes, liebes Kind«, sagte er mit überquellendem Herzen, seine Hand auf ihren Scheitel legend, »danke Gott oder Deinem großen Geiste, der Dich gerade in meine Hände gegeben hat!«
»Ich weiß es!«, flüsterte sie und ein Zittern ging duch ihren ganzen Körper.
»Was weißt Du?«
»Ich habe alles gehört.«
»Nun, dann hast Du mich ja kennen gelernt. Ja, man soll mich nicht umsonst den Champion-Gentleman nennen, so unangenehm mir auch so ein marktschreierischer Titel ist. Von meiner Macht, die ich über Dich bekommen habe, werde ich aber dennoch sofort Gebrauch machen. Du wirst mir gehorchen!«
»Ich gehorche!«, flüsterte sie demütig wie immer.
»So gebiete ich Dir«, fuhr Arno in befehlendem Tone fort, »mich nicht als Deinen Herrn, sondern als Deinen Bruder zu betrachten!«
Mit einer schnellen Bewegung hob sie den Kopf und da blitzte es in ihren sonst so schwermütigen Augen freudig auf.
»Ich gehorche!«, sagte sie immer noch einmal, schon nicht mehr flüsternd.
»Spricht man so zu einem Bruder?!«, fragte er streng, sogar schroff.
Aber das nützte ihm nichts. Noch jeder, der ihm in nähere Berührung gekommen war, hatte versichert, dass dieser riesenstarke Mann in der Hünenbrust ein sonniges Kinderherz habe, dessen warmen Hauch man ganz deutlich fühle. Natürlich musste man selbst ein fühlendes Herz haben. Jener Professor hatte ja überhaupt gar keines.
Wohl aber diese Indianerin, mochte sie sonst auch noch so teilnahmslos gegen alles sein und ihr äußerer Körper aus Eisen bestehen. Immer verklärter leuchteten ihre schönen Augen auf.
»Ich will Dir eine treue Schwester sein!«, sagte sie jetzt, und sie konnte auch lächeln, glücklich lächeln.
Lachend schlug ihr Arno auf die Schulter, unter welchem Schlage jeder andere Mensch gleich zusammengebrochen wäre.
»Na, das war eine Antwort! Also von jetzt an sind wir Bruder und Schwester! Und ich heiße Arno. Und so gehen wir in die schöne Welt und wollen ihr einmal zeigen, was wir beiden Geschwister können, was?«
Mit heiterem Lachen schlug sie in die dargebotene Hand ein, jetzt aber ganz anders als vorhin. Sie war plötzlich ganz umgewandelt. Der warme Strahl seines Herzens hatte das ihre mit einem Schlage aufgetaut.
»Aber in den Zirkus gehe ich nun nicht erst zurück, ich weiß ja gar nicht, was ich dort noch soll!«, sagte sie jetzt aus freien Stücken, immer noch mit lachendem Munde, dass die weißen Zähnchen blitzten.
»Gott bewahre! Du bleibst gleich hier bei mir! Ich habe eine ganze Masse Fremdenzimmer zu meiner Verfügung. Und morgen gehen wir zusammen in den Zirkus, Arm in Arm, und erledigen, was zu erledigen ist. Hast Du denn viele Sachen, die...«
Wieder klingelte das Telefon.
»Ach, ich geplagter Mann! Und empfange ich in der Nacht nicht, da kommen sie eben morgen am Tage. Na, das soll bald ein Ende haben! — Was gibt es?«
Wieder ein Herr, der den Trainingmaster in allerdringendster Angelegenheit zu sprechen wünscht. Es handele sich um ein Geschäft von mindestens hunderttausend Dollars.
»Die ich verdienen kann? Ja? Sofort? Die nehme ich in aller Schnelligkeit noch mit. Mister Ritchy heißt er? Er ist mir sehr angenehm, er soll die hunderttausend Dollars nur gleich mitbringen, meinetwegen in Kupfer, aber sagen Sie ihm auch gleich, dass er hoffentlich hinten genügend wattiert ist, falls er mir einen unsauberen Geschäftsvorschlag macht. — Na, was gibt's denn da zu lachen?«
Das letztere war an Atalanta gerichtet, die herzlich aufgelacht hatte.
»Wegen der Wattierung hinten? O, man muss mit diesen Yankees nur immer gut deutsch reden, wenn auch in englischer Sprache. Ach, was hat man mir hier schon für Vorschläge gemacht, wie viele habe ich schon hinausgeworfen! Aber hübsch ist es wieder von diesen Yankees, dass sie so gar nichts übel nehmen. Die haben alle eine nickelstahlgepanzerte Rhinozeroshaut. — Jetzt bleibst Du aber hier drin, Atalanta, jetzt haben wir nur noch gemeinsame Geschäfte.«
Mister Ritchy trat ein, ein langer, hagerer Mann mit großer Brille, hinter deren Gläsern die Augen listig funkelten. Er wurde eingeladen, Platz zu nehmen, und die Indianerin hatte sich so schnell in ihre neue Rolle gefunden, dass sie sich ebenfalls ohne weitere Aufforderung mit an den Konferenztisch setzte.
»Nun, Mister Ritchy?«
»Aaah, da ist ja die Miss Atalanta! Mit der habe ich das Geschäft zu machen.«
»Ich denke mit mir?«
»Nun... wie man's nimmt.«
»Na, da legen Sie mal los.«
»Nicht wahr, Miss, Sie sind die gesetzlich registrierte Besitzerin des Sklavensees mit Umgebung?«
»Die bin ich!«, entgegnete die Indianerin sofort.
»Wie?!«, staunte Arno. »Du bist die Besitzerin des Sklavensees?!«
»Ja selbstverständlich. Ich bin doch eine Mohawk. Und die Ufer des Sklavensees bildeten das Jagdgebiet der Mohawks. Als ich nun gefunden wurde, erkannte man mich aus der Tätowierung und aus allem gleich als eine Mohawk, Signor Ramoni ist dann mit jenen Herren bei der ersten Gelegenheit nach der nächsten Distriktsstadt, nach Pittville, gegangen und hat mich als eine Mohawk registrieren lassen. Und erst vor vier Wochen, als ich bald öffentlich auftreten sollte, sind wir beide in Washington gewesen, da wurde ich auf dem Indianeramt als alleinige Besitzerin des ehemaligen Jagdgebietes der Mohawks urkundlich eingetragen.«
Atalanta sagte etwas, was jeder Amerikaner weiß. Die Zeiten haben sich geändert. Seit 1848 können die Indianer nicht mehr enteignet werden. Es geht gegen die allgemeinen Menschenrechte. Alle noch heute in Nordamerika existierenden Indianer sind schwerreiche Menschen. Allerdings nicht an barem Gelde, sondern an Grundbesitz. Und dieser kann ihnen nicht mehr für ein Butterbrot abgenommen werden. Der Verkauf kann nur notariell in der nächsten Distriktsstadt geschehen, der Landverkäufer muss erst eine amtliche Belehrung über den Wert seines Besitzes bekommen.
Atalanta hatte sich etwas zur Seite gewendet, knüpfte ihr ledernes Hemd auf und zog aus dem Busen ein zusammengefaltetes Pergamentpapier.
»Hier ist meine Urkunde. Es ist das Einzige, was ich als mein Eigentum mitnehmen durfte.«
Arno faltete das Papier auseinander, sah außer einer Schrift auch eine große Kartenzeichnung mit Angabe der Breiten- und Längengrade und Maßstab, er stutzte, staunte, maß mit den gespreizten Fingern und las dann:
Im Namen der Bundesregierung der Vereinigten Staaten von Nordamerika.
Nach dem Gesetz vom 12. April 1848 ist Atalanta Ramoni als letzte Mohawk
zur alleinigen rechtskräftigen Eigentümerin des untenverzeichneten Gebietes der
Mohawks, aufgemessen und kartografiert von...
»Mädel, Du bist ja die reine Fürstin!«, rief Felsmark. »Das sind doch... mehr als zwölf Quadratmeilen!«
»Es ist ja alles gar nichts wert!«, lächelte Atalanta.
Arno besah sich die Karte näher, auf welcher auch die Terrainbeschaffenheit markiert war. Der See war ungefähr zwei Meilen lang und eine Meile breit, zum Gebiete der Mohawks war noch ein Uferstreifen von einer Meile Breite angenommen worden. Westlich war das Felsengebirge, alles andere mit Urwald bestanden. Der See hatte einige Inseln, einige Zuflüsse, aber keinen Abfluss.
Nein, dann war dieses Gebiet wirklich nichts wert. Urwald ist absolut wertlos. Das Ausroden der ungeheuren Wurzeln wird nicht gedeckt durch den Verkauf des Holzes zu den höchsten Marktpreisen. Und da muss ganz in der Nähe ein flößbarer Strom sein. Der fehlte hier. In solchen Urwäldern können sich nur kleine Farmer ansiedeln, die nur sich und ihre Familie ernähren wollen, Hinterwäldler.
»Nein, das ganze Gelumpe ist gar nichts wert!«, sagte jetzt auch Mister Ritchy mit möglichster Verachtung.
»Aber Sie möchten das Gelumpe wohl kaufen, wie?«, fragte Felsmark.
»Ich will's Ihnen abnehmen. Was wollen Sie dafür haben?«
»Schlagen Sie vor.«
»Hunderttausend Dollars.«
Nun, das war ein recht annehmbares Gebot! Regierungsland wird an die Einwanderer nur in zwei Sorten abgegeben: Gut bewässertes Land, der Acker zu zweiundeinhalb Dollars; und solches Land, welches zum Ackerbau künstlich bewässert werden muss, Weide, Heide und Urwald, der Acker zu anderthalb Dollars. Andere Sorten und Preise gibt es nicht. Größere Wasserflächen werden nicht mitgerechnet.
Ja, hunderttausend Dollars waren ein recht annehmbares Angebot, wie man sich leicht berechnen konnte.
»Nun, Atalanta, willst Du?«
»Wie Du befiehlst!«, entgegnete sie, in ihre frühere Demut zurückfallend.
»Atalanta! Ich verbiete Dir als Bruder, so zu sprechen! Sprich ganz offen!«
Da schnellte die Indianerin von ihrem Stuhl empor.
»Für hunderttausend Dollars? Nicht für hunderttausend Millionen Dollars verkaufe ich den Besitz meiner Väter!«
»Bravo!«, zollte Arno erfreut Beifall. »Also, geehrter Herr, wenn Sie nicht zufällig hunderttausend Millionen, auch hundert Milliarden genannt, bei sich haben, dann ist nichts zu machen.«
»Ich gebe das Doppelte — zweimal hunderttausend Dollars.«
»Fehlen noch immer neunundneunzig Milliarden neunundneunzig Millionen achthunderttausend Dollars!«
»Na dann eine Million!«
»Hallo, Sie sind wohl Kunstspringer! Erst schimpfen Sie über das Gelumpe und dann bieten Sie gleich das Zehnfache? Was gefällt Ihnen denn so sehr an diesem Gelumpe?«
»Ich will dort ein Sanatorium gründen.«
»Ach so! Wohl für arme Kranke zur unentgeltlichen Benutzung?«
»So ist es!«, ging der Mann richtig in die gestellte Falle.
»Hab ich mir doch gleich gedacht! So sehen Sie nämlich auch gerade aus. Sie haben so verschmitzte Augen.«
»Herr, Sie wollen mich wohl foppen?!«
»Merken Sie's nun endlich?«
»Na, da will ich gleich zwei Millionen bieten.«
»Hoho, hohoooh! Sie sind tatsächlich Kunstspringer! Aber höher müssen Sie springen, mein lieber Freund, immer noch viel höher, bis in die Milliarden hinauf!«
»Drei Millionen Dollars!«
Arno wurde doch etwas verdutzt.
»Atalanta?!«
»Nein, das Erbe meiner Väter ist mir für alles Geld der Welt nicht feil!«, entgegnen diese. »Am Golde haftet ein Fluch, den ich selbst schon kennen gelernt habe — mit allem Golde der Welt kann man keinen einzigen Hungrigen satt machen — sondern nur mit dem Brote, welches dem Boden im Schweiße des Angesichts abgerungen wird.«
»Herrlich gesprochen, ganz aus meinem eigenen Herzen heraus!«, rief Arno enthusiastisch. »Mister, haben Sie's gehört?«
»Ihr seid Narren...«
»Mister Ritchy, soll ich Sie einmal mit steifem Arm dort zum Fenster hinaushalten?«
Der Mann stand auf und wandte sich der Tür zu.
»Vier Millionen, das ist mein letztes Angebot. Morgen früh komme ich wieder, überlegen Sie es sich bis dahin. Diese vier Millionen werden sofort auf den Tisch gezahlt, aber kein Cent mehr. Ich empfehle mich. — Na, ich will fünf Millionen sagen. Fünf Millionen.«
Hinter ihm hatte sich die Tür geschlossen.
Arno war doch sehr verdutzt.
»Von hunderttausend Dollars innerhalb dreier Minuten bis zu fünf Millionen? Ja zum Teufel, was ist denn nur in diesem Sklavensee los?! Was ist denn von dort zu holen?
Atalanta konnte sich das ebenso wenig erklären wie er.
»Warst Du schon einmal dort?«
»Nein, nie wieder, und Signor Ramoni selbst hat mir mehrmals gesagt, dass ich höchst zufrieden sein könnte, wenn sich einmal ein Käufer fände, der mir für dieses Gebiet hunderttausend Dollars böte. Denn es fehle jeder Grund, nach dorthin eine Eisenbahn zu legen, und so dürfte es, soweit hinaus ein Mensch jetzt rechnen kann, wohl nie der Kultur erschlossen werden.«
Sie bückte sich und hob etwas unter dem Tische Liegendes auf.
»Hier hat der Herr einen Glacéhandschuh verloren.«
»Nein, der gehört dem vorhergehenden Besucher, dem Professor Dodd.«
»Nein, der gehört diesem Mister Ritchy.«
Betroffen wandte sich Arno nach ihr um. So ein Widerspruch von diesem Mädchen! Was war denn das für ein Charakter?
»Kind, ich habe ja selbst gesehen, wie diesen gelben Glacéhandschuh Professor Dodd hat liegen lassen, ich selbst habe ihn dann dorthin geworfen, dann erst kam der andere Mann, der überhaupt gar keine Handschuhe hatte.
»Nein, dieser Handschuh ist von Mister Ritchy.«
Na, das war denn doch toller als toll! Man lässt sich ja besonders von Damen einigen Widerspruch gefallen, aber so etwas... Arno wurde mit einem Male ganz misstrauisch gegen diese Indianerin, er bereute schon. Das hätte er von der nun freilich nicht erwartet. Da passten die beiden schlecht zusammen. So ist es aber. Der Mensch braucht bloß aufzutauen.
Da sah Arno, wie merkwürdig die Indianerin den Handschuh in Kopfeshöhe vor sich hinhielt, wie seltsam sie ihn betrachtete, so mit starren Augen, und wie sich dabei die Nüstern ihres stolzen Näschens blähten.
»Gewiss, mein Bruder, ich glaube Dir, dass der Professor diesen Handschuh hat liegen lassen, aber... auch der Geruch von Mister Ritchy haftet daran. Und nicht etwa, dass dieser nur den Fuß darauf gesetzt hat. Nein, diese beiden Männer haben sich erst vor ganz kurzer Zeit die Hand gegeben.«
»Was, Mädel, das willst Du diesem Handschuh anriechen können?!«, staunte Arno.
»Ja, das kann ich sofort riechen. Ich habe eine wunderbar feine Witterung, viel, viel schärfer als der beste Jagdhund. Ich verfolge jede Spur, die nicht gar zu alt ist, mit verbundenen Augen, nur durch den Geruch, brauche mich dabei gar nicht so sehr zu bücken. Das mag bei mir Erbschaft sein, indem die Mohawks wohl die besten Jäger und Pfadfinder der Erde waren — ich mag es auch mit der Bärenmilch eingesogen haben, denn der Bär hat eine Witterung, von der sich selbst die kundigen Bärenjäger gar nichts träumen lassen. Jedenfalls besitze ich diese mir selbst ganz unbegreifliche Gabe. Auch hierin wollte Signor Ramoni mit mir Vorstellungen geben. Wenn Du einen Menschen nur einmal flüchtig mit der Fingerspitze berührst, finde ich ihn sofort unter Tausenden heraus, ganz schnell, indem ich erst Deine eigene Spuren durch den Geruch verfolge, was aber niemand merkt.«
Arno konnte über diese neue Offenbarung nur staunen. Und was mochte dieses Mädchen sonst noch alles können?
»Diese beiden«, setzte Atalanta noch hinzu, »haben sich noch vor keiner halben Stunde die Hand gereicht.«
»Hm. Da ginge dieses Kaufgesuch also wohl von Professor Dodd aus? Was hat der am Sklavensee zu suchen? Da klingelt der Portier schon wieder.«
»Hier ist ein Mann, der sich Advokat Alkara nennt von einigen hundert Millionen phantasiert, die er mit Ihnen teilen will.«
»Oho! — Du, Atalanta, heute ersticken wir noch in den Millionen. — Bringt der Herr das Geld gleich mit? Wenigstens meine Hälfte?!«
»Er sieht gar nicht danach aus«, lachte der Portier, »er ist recht verkommen, hat keine Sohlen unter den Stiefeln.«
»Herr Portier, wenn man Hunderte von Millionen hat, braucht man weder vollkommen zu sein noch Sohlen unter den Stiefeln zu haben, merken Sie sich das gefälligst! Der Herr ist mir sehr angenehm. Ist der Lastaufzug in Ordnung? Er steht dem Herrn zur Verfügung, er soll das Geld nur immer gleich einschaufeln lassen!
Atalanta, Schwesterchen!«, wandte sich der Graf schmunzelnd an diese. »Da bringt uns einer schon wieder einige hundert Millionen. Was fangen wir denn nur damit an? Da kaufen wir uns Schokoladenplätzchen dafür, was? — Ach, da ist er ja schon.«
Herein stolperte jenes verhutzelte Männchen mit der roten Nase.
»Ich gratuliere«, fing er unter Verbeugungen an, »ich gratuliere, ich gratuliere, ich gra...«
»Wissen Sie was, gratulieren Sie mir lieber erst nachher, wenn Sie mir meine hundert Millionen abgeliefert haben.«
»...tuliere. Die haben Sie schon so gut wie in der Tasche.«
»Ach nee! Na, da setzen Sie sich erst mal, sonst könnten Sie mir umfallen, Sie scheinen etwas wacklig auf den Beinen zu sein. Übrigens müssen Sie eine feine Nummer trinken. Sie riechen ganz genau wie ein denaturiertes Brennspiritusfässchen.«
»Haben Sie etwas Besseres da? Ich habe schon seit einer Viertelstunde nichts mehr getrunken.«
»O ja, wollen mal sehen!« Arno nahm aus einem Schränkchen Flasche und Glas. »Das ist aber kein Brennspiritus, das ist allerfeinster Kognak.«
»Das ist mir egal.«
Arno hatte das Glas vollgeschenkt, die Flasche daneben gesetzt, der verkommene Advokat griff zu.
»Höööh, Herr, Sie haben sich vergriffen, Sie haben aus Versehen die Flasche erwischt!«
»Das ist mir egal. Prost! Aaaah! Sie denken wohl, ich bin besoffen? Irrtum. Kann ich gar nicht mehr werden. Sie glauben nicht, dass ich Advokat bin? Werde es Ihnen durch meine Erzählung beweisen. Kurz, sachlich, schneidig. Los!
War vor fünfzehn Jahren Sheriff in Ongata, drei Tage vom Sklavensee. Kitschen wir eines Tages einen Pferdedieb. Muss gehangen werden. Wie sein letztes Stündlein kommt, will er dem Sheriff noch etwas beichten. Ich in seine Zelle. ›Sheriff, wenn Ihr mich entschlüpfen lasst, fülle ich Euch diese große Zelle und noch einige Dutzend andere mit purem Gold.‹ — ›Füllt mal los!‹, sage ich. — ›Das Gold muss erst geholt werden.‹ — ›Wo?‹ — Er erzählt.
Vor den Indianern, die heute auch wieder bald ausgestorben sind, hat es in Nordamerika doch schon ein anderes Urvolk gegeben. Stand auf ziemlich hoher Stufe, von diesem rühren die gewaltigen und merkwürdigen Bauwerke her, von denen man hier und da noch Ruinen findet. Hat auch schon Eisen bearbeiten können. Diese Urbewohner sind von den von Westen, wahrscheinlich aus Asien kommenden Indianern besiegt und vollständig ausgerottet worden. Vielleicht sind die Eskimos noch Nachkommen von ihnen. Dann aber soll sich auch von ihnen ein Rest am Sklavensee erhalten oder sich dort mit den Indianern vermischt haben, was sonst nie vorgekommen ist. Das wären also die Mohawks gewesen, historisch.
Nun geht unter den Indianern noch heute die Sage, dass diese Urbewohner schon damals die Goldschätze Kaliforniens und des Coloradogebietes ausgebeutet haben. Als die fremden Krieger, die jetzt so genannten Indianer, kamen, glaubten sie, diese hätten es auf das rotgleißende Metall abgesehen, weil das bei ihnen selbst das Wertvollste war. Da haben sie alles Gold, was sie hatten, über das Felsengebirge geschafft und im Sklavensee versenkt.
Und nun berichtete mir der Pferdedieb, dass dies auf Tatsache beruhe. Wo die Urbewohner die Goldschätze hingebracht haben, davon weiß überhaupt auch die Sage nicht zu berichten. Sie ruhen auf dem Boden des Sklavensees, die Mohawks sind von jeher ihre Hüter gewesen.
Der Pferdedieb war Trapper am Sklavensee gewesen, hatte eine Mohawksquaw geheiratet, hatte zu ihnen gehört, aber doch nur so halb. Die Mohawks rüsteten sich zum letzten Verzweiflungskampfe. Vorher fand in einer Nacht eine große Beratung der Häuptlinge statt — gerade unter dem Baume, auf dem der Trapper auf Anstand saß. So belauschte er alles, von dem Golde, welches ganze Berge bildete.
Wenn nun doch einige Mohawks dem Tode entgingen? Man wollte doch lieber ein Merkmal hinterlassen, an welchen verschiedenen Stellen das Gold versenkt lag. Es wurden zwei Zeichnungen gemacht. Die eine auf einem Stück Leder, die andere auf dem Rücken eines kräftigen Kindes, eines Mädchens — bei fast allen Indianerstämmen bestimmt das weibliche Geschlecht die Erbfolge. Aber die Tätowierung erfolgte mit einer Farbe, welche erst zu gewisser Zeit, in der Periode der Mannbarkeit, wobei doch in den Säften des Menschen gewaltige Veränderungen vor sich gehen, zum Vorschein kommt. Vorher ist sie ganz unsichtbar. Auf diese Weise wissen sich die misstrauischen Indianer vor Kindesvertauschungen zu schützen.
Diese beiden Situationspläne ergänzten sich. Eine Zeichnung ohne die andere war wertlos. Das Leder wurde in einer Kupferröhre an einer gewissen Stelle vergraben, das kleine Mädchen wurde von ihrer Mutter in Begleitung eines Kriegers zu dem befreundeten Stamme der Tinonen gebracht.
Sie haben ihr Ziel nie erreicht, müssen im Gebirge verunglückt sein. Das kleine Mohawkmädchen aber hat man in einer Bärenhöhle gefunden, es wurde vom Zirkusdirektor Ramoni in Obhut genommen.
So erzählte mir der Pferdedieb. Ich schwor ihm zu, ihm zur Flucht zu helfen, wenn er die Wahrheit berichte, verschob die Hinrichtung, die ohne mich nicht vollzogen werden konnte, schützte eine unumgängliche Reise vor, warf mich aufs Pferd — jagte nach dem Sklavensee, grub unter dem genau bezeichneten Baum den Kupferzylinder mit der Zeichnung aus. Und in Pittville hörte ich von dem gefundenen Bärenmädchen, das von Signor Ramoni adoptiert worden war.
Ich zurück. Wollte mein Wort einlösen. War nie ein Lump, bin's auch heute noch nicht, wenn ich auch saufe. Da hatte man den Pferdedieb schon gelyncht.
Wo war nun der Zirkusdirektor Ramoni? Seinen Zirkus fand ich gleich, aber er selbst war mit dem Mohawkmädchen verschwunden, spurlos. Fünfzehn lange Jahre habe ich mich in ganz Amerika herumgesoff..., geschlagen wollte ich sagen, habe dabei mein ganzes Vermögen verbraucht. Ich fand ihn nicht. Da wurden gestern die Plakate angeklebt, Atalanta, die rote Athletin, die letzte der Mohawks — Signor Ramoni... heidideldeideidumdum...«
Das Männchen begann in der Stube herumzutanzen.
Erstaunt blickte Arno nach der Indianerin, und sein Erstaunen wuchs, als diese noch ohne Fragen schon bejahend den Kopf senkte.
»Du weißt von diesem Schatze?!«
»Nein, das nicht. Da bekomme ich etwas ganz Neues zu hören. Aber solch eine Tätowierung habe ich auf dem Rücken, die erst in meinem elften Jahre zum Vorschein gekommen ist.«
»Heidideldeideidumdum!«, sang und tanzte das Männchen, hörte aber gleich auf damit, griff nach seinem Hute.
»Jetzt gehe ich und hole erst das Leder. Ich kann doch heute Nacht noch wiederkommen?«
»Selbstverständlich. Wenn ich schlafen sollte, werde ich einfach geweckt. Wo wohnen Sie denn?«
»Bei Professor Dodd.«
»Wie, bei Professor Dodd?!«, staunte Arno, dem nun überhaupt schon eine Ahnung aufgegangen war, worüber es aber mit diesem Manne gar nicht zur Aussprache kommen sollte.
»Na ja, dem habe ich vor einem Vierteljahre, als ich mir gar nicht mehr zu helfen wusste, für hundert Dollars meinen Leichnam verkauft, wie es noch manch anderer getan hat. Dann ist man auch gleich bis zum Tode in Kost und Logis bei ihm. Der hat mich ja auch erst auf den Schnaps gebracht, um mich recht bald auf seinen Seziertisch zu bekommen. Nur dass es bei mir nicht so schnell geht wie bei den anderen, hahaha!«
»Sie haben dem Prozessor Dodd von dieser Sache erzählt?«
»Ich? Fiel mir gerade ein! Keinem Menschen ein Sterbenswörtchen!«
»Wo haben Sie denn das Leder?«
»Na nicht etwa bei Professor Dodd. Das habe ich wo ganz, ganz anders versteckt, wo es auch die beste Spürnase nicht findet, wo kein Mensch auch nur im Traume denkt, dass da etwas versteckt sein könnte! In spätestens einer halben Stunde bin ich wieder da. Berge von Gold — heidideldeideidumdum...«
Damit war der Mann hinaus.
»Also Du hast wirklich solch eine Tätowierung auf dem Rücken?«, wandte sich Arno jetzt erst recht mit größtem Staunen an die Indianerin.
»Ja, die zwischen meinem elften und zwölften Jahre über Nacht plötzlich zum Vorschein kam, während vorher keine Spur davon zu sehen war.«
»Hat sie Signor Ramoni gesehen?«
»Ja, der sah sie zuerst, wer sollte sie überhaupt sonst gesehen haben. Damals massierte er mich noch täglich. Dann — dann... sagte er, es sei nicht mehr nötig, mein Körper wäre jetzt so weit, er ließe sich durch diese Öleinreibung nicht weiter ausbilden.«
Atalanta war sehr verlegen geworden. Sie hatte sich dann diese körperliche Behandlung auch nicht mehr gefallen lassen, aus dem Kinde war über Nacht eine Jungfrau geworden.
»Und was sagte Signor Ramoni dazu?«
»Er wusste sich die Tätowierung nicht zu erklären.«
»Wie sieht sie eigentlich aus?«
»Sie besteht aus den verschiedensten Figuren, die im Kreise geordnet sind, dazwischen noch Striche und Punkte.«
»Ja, nun ist es auch erklärt, wie jener Mister Ritchy für den wertlosen Sklavensee die ungeheure Summe von fünf Millionen Dollars bieten kann. Er ist der Agent des Professor Dodd, der hat von dem Advokaten dennoch das Geheimnis erfahren, hat es ihm herausgelockt, wahrscheinlich in betrunkenem Zustande, der Mann weiß nur nichts davon.«
»So ist es ohne Zweifel.«
»Nun, da soll sich dieser Professor Dodd irren. Der soll das Nachsehen bekommen. Der Advokat hat von einer Teilung gar nicht gesprochen, das hält der für ganz selbstverständlich, und darin hat er auch ganz recht. Ja, Atalanta, was machst Du denn nun mit dem Golde, wenn wir da ganze Berge finden?«
»Es gehört Dir.«
»Ach was! Na gut, sprechen wir vorläufig gar nicht darüber, erst müssen wir es ja doch haben! Jetzt wollen wir erst einmal auf die Rückkunft des Advokaten warten. Wenn der mit seinem bezechten Kopfe nur nicht etwa unter die Räder kommt. Denn bezecht war er ja tüchtig.«
»Mein Bruder, Du verübelst mir doch nicht, wenn ich Dich um etwas bitte!«, sagte die Indianerin, wieder etwas in ihre frühere Demut zurückfallend.
»Ich Dir verübeln?«, lachte Arno. »Heraus damit! Was hast Du denn auf Deinem Herzen?«
»Ich bin nicht gewohnt, so spät zu Bett zu gehen, bin sehr, sehr müde, aber wenn Du befiehlst...«
»Aber Kind, warum sagst Du das erst jetzt?!«, rief Arno erschrocken. »Komm, ich will Dir Dein Schlafzimmer zeigen.«
Er führte sie durch eine ganze Flucht von Zimmern, die immer luxuriöser wurden. Jedes Mal, wenn die Tür geöffnet wurde, drehte sich das elektrische Licht von selbst an. Das letzte Zimmer, wie das vorhergehende mit einem großen Himmelbett ausgestattet, hatte weiter keinen Ausgang, keine andere Tür.
»Hier bist Du so sicher aufgehoben wie in Abrahams Schoß, und als Dein treuer Wächter werde ich auch in dem Nebenzimmer schlafen. Sonst ziehe ich als Lager ein möglichst hartes Feldbett vor.«
»O, mein Bruder, glaubst Du denn, ich fürchte mich?«, lächelte sie, aber doch sehr befangen. »Ja, und wenn nun der Advokat wiederkommt?«
»O, der mag warten, bis Du ausgeschlafen hast. Der kann ja auch gleich hier bleiben.«
»Nein, nein, ich stehe jederzeit zur Verfügung. Eben deshalb will ich ja auch... soll ich Dir gleich die Tätowierung zeigen?«
Arno wurde ganz unwirsch, und er hielt ihr die Hände fest, als sie das Jagdhemd aufschnüren wollte.
»Halt! So eilig haben wir es nicht! Nein, Mädchen, gezwungen sollst Du nicht dazu werden...«
»Aber es ist doch gar kein Zwang, Ihr müsst es doch auch sehen.«
»Nein, nein, darüber sprechen wir noch, wie wir das arrangieren. Jetzt lege Dich schlafen und schlummere unbesorgt. Wegen allen Goldes der Welt soll Dir keine Minute Schlafes verkürzt werden und... ich selbst könnte überhaupt ganz darauf verzichten — vorausgesetzt, dass ich überhaupt eine Teilhaberschaft daran hätte. Schlafe wohl, mein liebes Kind. Heute musst Du Dich einmal so behelfen, eine weibliche Bedienung gibt es hier nicht, morgen schaffen wir alles an.«
Er machte schnell, dass er hinaus kam.
»Merkwürdig!«, brummte er, als er durch die vielen Zimmer zurückging. »Ich bin doch sonst gar nicht so? Aber diesem Mädchen gegenüber bin ich wie wie — wie — vor den Kopf geschlagen. Der reine Joseph. Und wenn dort unten am Boden des Sees alle Schätze der Welt lägen, deretwegen würde ich nicht ihren Arm zu entblößen wagen. Ja, wie soll das dann werden? Da sehe ich schon die schwierigsten Verwicklungen kommen.«
Er öffnete die letzte Tür, die in das Empfangszimmer führte, und... wenn dieser Mann auch keines Schrecks vor Furcht fähig war, so durch eines solchen vor Überraschung.
Mitten in dem Empfangszimmer stand eine schwarzgekleidete Dame, eine schlanke und doch üppige Gestalt, mit einem Antlitz von wahrhaft dämonischer Schönheit.
»Miss Marwood Morgan!«, stieß Arno erstaunt hervor »Wie kommen Sie unangemeldet...«
»Eine Miss Marwood Morgan wagt der Portier nicht am Vorgehen zu hindern!«, unterbrach ihn ihre Altstimme, die jetzt vor Erregung zitterte. »Herr Graf, Sie haben in Ihrer Wohnung jenes Indianermädchen, das Sie vorhin im Ringkampf besiegten!«
Das war in einem Tone gesagt worden, und ihre Augen funkelten ihn dabei so an, dass Arno gleich trotzig die Arme über der breiten Brust verschränkte und erwiderte.
»Ja, die ist und bleibt bei mir. Nun und?«
»Bleibt bei Ihnen?«
»Jawohl, wir haben einen Bund als Bruder und Schwester geschlossen.«
Arno bereute schon, dies gesagt zu haben.
»Als Bruder und Schwester, hahaha!«, lachte sie furchtbar höhnisch auf. »Herr Graf, setzen wir uns kurz auseinander. Sie wissen, dass ich Sie liebe, wie nur jemals ein Weib einen Mann geliebt hat. Ich war der Liebe unzugänglich, hatte noch nie etwas davon gespürt, gewusst, geträumt — da kreuzten Sie meinen Weg...«
»Konnte ich denn etwas dafür?«
»Sie haben meine Liebe entflammt. Ich versuchte alles, alles, um mich Ihnen zu nähern, ja, ich habe alle weibliche Scham vergessen — bis ich Ihnen ganz offen meinen Liebesantrag machte, mich selbst und alles, was ich besitze, Ihnen anbot. Sie sagten, dass Sie mich nicht liebten und wohl auch schwerlich jemals lieben könnten, weil... die Liebe eben keine Handelsware sei. Ja, das war groß und edel von Ihnen. Ich glaube kaum, dass es noch einen solchen Mann auf der Erde gibt. Aber was ich dann durchgemacht habe, danach fragen Sie mich nicht.
Doch ich trat zurück. Ich wollte warten, eine günstige Gelegenheit erspähen, hoffte Sie doch noch zu erringen. Und wenn es doch nicht sein sollte — hören Sie, Herr Graf: Damals habe ich den Schwur abgelegt, dass Sie dann auch von keinem anderen Weibe besessen werden sollen! Daraufhin habe ich jeden Ihrer Schritte bewachen lassen!«
»Ja, Miss, wie kommen Sie dazu, solch einen Schwur abzulegen?«, fragte Arno kühl zurück. »Bin ich denn nicht Herr meiner Handlungen?«
»Fragen Sie nicht nach dem Warum. Ich liebe Sie — grenzenlos! Entfernen Sie diese Indianerin so schnell wie möglich hier aus Ihrer Wohnung!«
»Oho, Miss Morgan, wie können Sie wagen, mir...«

Blitzschnell hatte sie einen langläufigen Revolver aus der Tasche gezogen und auf ihn angeschlagen.
»Also wollen Sie diese Indianerin aus Ihrer Wohnung entfernen?«
Arno sah sich verloren. Hier half kein schneller Sprung mehr. Sie drückte einfach ab und er hatte die Kugel im Herzen. Und sie war fähig dazu, er kannte dieses exzentrische Weib zur Genüge.
»Miss, nehmen Sie Vernunft an und...«
»Entfernen Sie dieses Indianermädchen sofort aus Ihrer Wohnung!«
Da verschränkte er die Arme noch trotziger über der Brust und erwiderte kalt:
»Nein, auf keinen Fall!«
»Es ist Ihr Tod!«
»Das glaube ich Ihnen schon.«
»Ich schreite über Ihre Leiche, suche die Indianerin und schieße sie gleichfalls nieder!«
Einen Augenblick wurde er unschlüssig — nur einen einzigen Augenblick. Dann richtete er seine Hünengestalt noch höher empor.
»Sie taxieren dieses Mädchen falsch. Es ist eine Indianerin, das sagt genug. Immer werden Sie zur doppelten Mörderin. Vorschriften lassen wir uns beide nicht die geringsten machen.«
Da senkte sie die Waffe.
»Nein, so leicht sollen Sie es nicht haben. Mit Ihrem Tode ist mir nicht gedient. Lebendig sollen Sie zu meinen Füßen im Staube liegen und mich um meine Liebe betteln. Verstehen Sie? Das soll mein Triumph sein. Und ich weiß, wie er zu erreichen ist. Sie und diese Indianerin sollen mich kennen lernen!«
Ohne Weiteres verließ sie das Zimmer, und dieser Mann verschmähte es, ihr auch nur ein »Niemals!« nachzurufen.
Aber was dieses Weib ihm noch für Schicksale bereiten sollte, das ahnte er freilich nicht.

Graf Arno von Felsmark legte das Ohr an die steil in den See abfallende
Felswand und was er da hörte, erschien ihm geradezu ungeheuerlich.
Am andern Morgen saß Graf Arno Felsmark mit Atalanta beim Frühstück. Advokat Alkara war nicht gekommen.
Noch eine Stunde hatte Arno gewartet, dann hatte er sich schlafen gelegt, und er war nicht geweckt worden.
»Wenn dem Trunkenbolde nur nichts zugestoßen ist, gerade im letzten Moment, da er nach fünfzehn Jahren sein Ziel endlich erreicht hat. Es ist wohl das Einfachste, ich gehe selbst einmal zu Professor Dodd, selbst auf die Gefahr hin, dass er mich hinauswirft, wie ich es mit ihm gemacht habe. Doch nein, der hat alle Gründe, mich höflich zu empfangen.«
Wo der weltberühmte Operateur wohnte, wusste Arno wie jedes Kind in New York. In der Water Street, einer der ältesten Straßen, dicht am Hafen, die verrufenste dazu, das Paradies der verkommensten Weiber und ihrer Beschützer, die auf Seeleute mit vollen Taschen lauern, eine Lasterhöhle neben der andern.
Für den »Menschenschlächter«, wie er allgemein hieß, war ja auch hier das passendste Quartier. Hier bekam er wohl die meisten Opfer für seinen Seziertisch.
Er selbst war freilich sehr selten zu Hause. Immer in ganz Amerika unterwegs, überall und nirgends, um zu schneiden und zu sägen. Doch das tat er nur, wenn er dafür horrend bezahlt wurde. Unter tausend Dollars zog er sein Messer gar nicht aus dem Besteck.
Unbemittelte behandelte Professor Dodd zwar kostenlos. Aber den Ruf eines Menschenfreundes hatte er sich dadurch nicht etwa erworben. Denn das tat er nur, wenn es einmal ein ganz interessanter Fall war. Und der Betreffende musste ihm vorher regelmäßig seine einstige Leiche verschreiben. Sonst rührte er keinen Finger, mochte sich der Unglückliche auch in Schmerzen krümmen wie er wollte.
»Oder ich kann ja erst einmal telefonisch anfragen«, meinte Arno, »aber nicht, ob der Professor Dodd, sondern ob der Advokat Alkara zu Hause ist. Denn mit jenem habe ich ja überhaupt gar nichts zu tun.«
Die Verbindung wurde hergestellt. »Hier Professor Dodd. Wer dort?«
»Graf Felsmark. Wohnt bei Ihnen ein Advokat Alkara?«
Es kam keine Antwort, im Telefon summte es, andere sprachen, die Verbindung war gestört. Arno konnte den Anschluss nicht wieder bekommen, nach einigen Minuten gab er seine Bemühungen auf.
»Gut, so fahre ich gleich selbst hin.«
In einer Stunde spätestens wollte er zurück sein, aufhalten ließ er sich nicht. Ganz allein blieb die junge Indianerin nicht, sie konnte sich die Zeit unterdessen mit Lullu vertreiben, des Grafen niedlichem Zwerghund, der in dieser Nacht unbekümmert um die Vorgänge um ihn herum sanft geschlafen hatte.
Wegen ihres Alleinseins machte sich Arno nicht die geringsten Sorgen. Warum auch? In diesem Hause war sie sicherer aufgehoben, als irgendwo anders, sicherer als im bestbewachten Gefängnis, in welches eine Marwood Morgan auch einzudringen gewusst hätte. Und dass dies ihr hier nicht nochmals gelang, dafür wollte er schon Maßregeln treffen. Außerdem standen ihm genug Diener zur Verfügung, absolut sichere Leute, die er deswegen instruierte.
Und überhaupt war dieser Graf eine viel zu kühne Natur, als dass er sich wegen anderer Personen, mochten sie seinem Herzen noch so nahe stehen, viel Sorge gemacht hätte. Hierin hatte er eben noch keine Erfahrung, besonders schlechte Menschen hatte er noch gar nicht kennen gelernt, er war noch zu sehr geneigt, von sich auf andere zu schließen. Diese Erfahrung musste erst noch kommen.
Nach seiner Rückkehr wollten sie zusammen in den Zirkus und in Atalantas Hotel gehen, um zu erledigen, was zu erledigen war, es handelte sich doch auch um das Begräbnis ihres Pflegevaters, für den sie allerdings sehr wenig Teilnahme zu haben schien.
Arno benutzte ein ihm immer zur Verfügung stehendes Luxusautomobil des Klubs. In zwanzig Minuten hatte er sein Ziel erreicht. Es war das größte, ein vierstöckiges Haus in dieser alten Straße, auch schon baufällig und ganz verwahrlost aussehend, unheimlich, alle Fenster stark vergittert. Arno stieg aus und klingelte. Alsbald öffnete ein Neger die Tür, die innen schwer mit Eisen beschlagen und mit vielen Riegeln versehen war.
»Was wollen Sie?«, fragte der fast zerlumpt gekleidete und wie ein brutaler Sklaventreiber aussehende Schwarze grob.
»Ist Herr Professor Dodd zu sprechen?«
Es war ihm nur so herausgefahren. Er hatte ja nach dem Advokaten Alkara fragen wollen. Aber es war wohl gut, dieses Versehen; hätte er nach dem verkommenen Pensionär gefragt, der mit Leib und Seele dem Professor gehörte, so wäre ihm sicher die Tür gleich vor der Nase zugeschlagen worden, denn die vornehme Erscheinung des Fragenden und das Luxusautomobil machte auf den Neger nicht den geringsten Eindruck.
»Der Herr Professor ist wohl da, aber... was wollen Sie denn? Wer sind Sie denn?«
Arno musste sich mit aller Macht bezwingen, um ruhig zu bleiben. Er hätte diesem Kerl lieber eine ganz andere Antwort gegeben.
»Graf von Felsmark ist mein Name.«
Aber auch dieses machte nicht den geringsten Eindruck auf den Neger. Dieser schwarze Pförtner hatte wohl schon ganz andere Personen so abgefertigt.
»Haben Sie sich denn schon angemeldet?«
»Ich werde vom Herrn Professor erwartet!«, hielt Arno jetzt zu sagen für das Beste, sonst kam er hier nicht hinein, und er durfte dies wohl auch behaupten.
»Also, Sie sind herbestellt worden. Sie haben an den Herrn Professor wohl Ihre Leiche verkauft, was?«
Jetzt musste Arno dem schwarzen Kerl aber doch ins Gesicht lachen.
»Das nun weniger. Und ich sage Ihnen: Professor Dodd ist ganz ungeduldig, mich zu empfangen.«
»Ach so, das hätten Sie gleich sagen sollen, da hat er wohl nur vergessen, mich zu instruieren!« Und nun wurde der schwarze zweibeinige Kettenhund ein klein wenig freundlicher. »Na da brauchen Sie auch nicht draußen zu warten, kommen Sie nur herein.«
So durfte Arno endlich eintreten, hinter ihm schob der Neger vier mächtige Riegel vor, die er auch noch durch ein stählernes Geldschrankschloss sperrte.
»Warten Sie einen Augenblick, Graf von Felsmark? Ich werde Sie melden.«
Also wenigstens in den Hausflur war Arno gekommen, ein ganz nackter Raum, nur mit einer Holzbank ausgestattet, die dem Wartenden wenigstens eine Sitzgelegenheit bot.
Himmel, wie roch es hier nach Schnaps! Die reine Branntweinatmosphäre. Und dieser Spektakel, dieses Brüllen! Dort oben musste Mord und Totschlag geschehen. Es wurde zeternd um Hilfe geschrien, dazwischen wurde gelacht, Weiberstimmen kreischten vor Vergnügen.
Natürlich, es war ja das Deliriumhaus, wie es allgemein genannt wurde. Hier brachte der gelehrte Menschenschlächter seine zweibeinigen Versuchskaninchen, deren zukünftige Leichen er für billiges Geld gekauft hatte, mittels Schnaps möglichst schnell vom Leben zum Tode.
Der Neger kam wieder und legte nun ein ganz anderes Benehmen an den Tag.
»Professor Dodd lässt den Herrn Grafen höflichst bitten.«
Es ging eine Treppe hinauf, Treppenhaus und Korridore waren kahl, öde und ärmlich, und das Zimmer, welches Arno betrat, enthielt auch nur eine Reihe Stühle.
Hier empfing ihn der Professor, angetan mit einem langen, weißen Kittel, der über und über mit ganz frischen Blutflecken besät war, die Ärmel wie ein Fleischer hochgekrempelt. Es waren magere, aber äußerst muskulöse, sehnige Arme, die da sichtbar wurden, wie man sie dieser hageren Figur nimmermehr zugetraut hätte.
»Ihr Besuch freut mich, Herr Graf!«, begann er, unbeleidigt durch die gestrige Abweisung. »Sie bringen mir sicher die fröhliche Kunde, dass Sie anderen Sinnes geworden sind, dass Sie mir eine Untersuchung ihrer Sklavin gestatten?«
»Nein, Herr Professor, das ist eigentlich nicht der Zweck meines Besuches. Ich selbst...«
»Aaah, Sie bringen sich selbst!! Herr Graf, seien Sie versichert, ich werde Ihren Körper in die feinsten Teilchen zerlegen, jedes Äderchen so fein herausschälen, dass Sie selbst stolz darauf sein würden, wenn Sie in der Lage wären...«
»Nein, nein, auch meinen eigenen Kadaver bringe ich nicht!«, unterbrach ihn Arno, und er musste doch lachen. »Mein Besuch gilt eigentlich einem Advokaten Alkara. Nicht wahr, der wohnt doch bei Ihnen?«
Der Professor blieb ganz ungerührt, dass diese unerwartete Wendung kam. Jetzt hätte er seinerseits ja diesen Besuch gleich hinauswerfen können, Arno war schon darauf gefasst, aber dies geschah nicht.
»Ein Advokat Alkara? Bei mir wohnen? Hm. Ja, dieser Herr befindet sich bei mir.«
»Ist der Herr anwesend?«
»Anwesend? Hm. Ja, der ist anwesend.«
»Darf ich ihn einmal sprechen?«
»Sprechen? Hm. Ja, Sie können ihn sprechen. Aber er wird Ihnen wohl keine Antwort geben.«
»Warum denn nicht?«
»Weil er... hm... weil er nicht kann.«
»Er schläft wohl?«
»Ja, der schläft.«
»Er ist wohl besinnungslos betrunken?«
»Besinnungslos? Hm. Ja, der ist besinnungslos. Aber bitte, Sie können ihn ja selbst sehen.«
Der Professor öffnete die Nebentür und ließ Arno eintreten.
Doch kaum war Graf Felsmark im angrenzenden Raum angelangt, da wusste er, weshalb der Professor immer so eigentümlich gesprochen hatte — da wusste er, weshalb der Advokat ihm keine Antwort geben konnte.
Zunächst aber wurde Arno von einem Entsetzen gepackt, das ihm ein eiskaltes Schaudern über den Rücken hinablaufen ließ. Er befand sich in einem ärztlichen Laboratorium, und auf dem Seziertisch lag der nackte Leichnam eines Mannes, schon aufgeschnitten, die Eingeweide schon herausgenommen, sie lagen wohlgeordnet auf einem Nebentischchen, und — das Gesicht dieses Leichnams gehörte dem Advokaten Alkara an, Arno erkannte es auf den ersten Blick wieder.
»Um Gottes willen — tot? Ja, wie ist denn das gekommen?«, flüsterte Arno.
»Er ist gestern Nacht oder eigentlich heute früh in der ersten Stunde von einem Wagen überfahren worden. Brustkasten eingedrückt, auf der Stelle tot. Wurde von der Polizei aufgehoben. Wenn er auch keine Papiere bei sich hatte, so konnte man seine Personalien doch sofort feststellen, man brauchte ihn nur zu entkleiden, dann wusste man auch sofort, wo die Leiche hinzubringen war. Für so etwas sorge ich, ich bin überhaupt sehr ordnungsliebend!«
Der Professor fasste die Leiche unter den Schultern, hob sie etwas empor, drehte sie mit einem Rucke herum, sodass der Rücken nach oben zu liegen kam.
Auch dieser Rücken hatte eine Tätowierung, aber keine besonders geheimnisvolle, im Gegenteil, in großen, deutlichen Buchstaben, mit blauer Farbe dick eingeritzt, war da zu lesen:
»Edward Alkara, Eigentum von Professor Dodd, New York.«
Arno blickte den unheimlichen Amerikaner sprachlos an.
»Ja, dieser Mann war und ist mein persönliches Eigentum!«, fuhr der Professor fort, liebevoll den nackten Rücken streichelnd. »Ich hatte seine zukünftige Leiche vor einem Vierteljahr gekauft, das ist amtlich registriert worden. Gestern hat er seinen Tod gefunden. Glücklicherweise ist seine Verletzung für mich ohne weitere Bedeutung. Ich habe es hauptsächlich immer auf Muskeln und Sehnen abgesehen, ein paar zerbrochene Knochen und ein zerquetschtes Herz genieren mich nicht weiter.«
Arno raffte sich aus seiner Erstarrung auf. Er wollte diesem Menschen, der gar kein richtiger Mensch war, keine Anschuldigungen ins Gesicht schleudern, das hatte bei dem keinen Zweck, er wollte bei der Sache bleiben.
»Hatte der Tote nicht ein Lederfell bei sich?«
»Was für ein Lederfell?«
»Mit einer eigentümlichen Zeichnung darauf, das in einem Kupferzylinder verwahrt war!«
»In seiner Tasche? Nein. Was er in den Taschen gehabt hat, ist mir abgeliefert worden, es liegt dort drüben, Sie können es ja besichtigen, auch alles andere, was der Advokat sonst noch bei mir liegen hat, es ist herzlich wenig.«
Arno wollte es anders, kürzer machen.
»Herr Professor, Sie wissen doch recht gut, um was für eine Zeichnung auf einem Lederfell es sich handelt.«
»Ich? Was meinen Sie denn für eine Zeichnung?«
»Sie wollen doch von der Indianerin den Sklavensee kaufen!«
»Ich?«, erklang es in immer größerer Verwunderung. »Ich den Sklavensee kaufen? Ich verstehe Sie durchaus nicht.«
»Jener Mister Ritchy war doch nur Ihr vorgeschobener Agent.«
»Wer ist denn das? Ich kenne keinen Mister Ritchy.«
Nun brach dem jungen Mann endlich die Geduld.
»Sie lügen!«, fuhr er empor.
Die beiden Männer blickten sich an. Wie kalter, zweischneidiger Stahl blitzten die Augen in dem Teufelsgesicht des Amerikaners, aber so eiskalt blieb auch der ganze Mann.
»Herr, ich halte Sie für krank. Sie phantasieren. Sie müssen sich gestern überanstrengt haben. Soll ich Ihnen ein Beruhigungspulver geben?«
Arno wusste sofort, dass hier gar nichts weiter zu machen war. Der Arzt fing jetzt auch noch zu höhnen an.
»Ich gehe, ehe Sie mich hinauswerfen...«
»O nein, ich bin nicht so grob wie andere Menschen, ich bin ein Gentleman. Bitte, wollen Sie sich setzen?«
»... Aber vergebens sollen Sie versuchen, sich das anzueignen, worauf Sie es abgesehen haben! Dass Ihnen das nicht gelingt, dafür werde ich schon Vorkehrungen treffen, das merken Sie sich!«
Damit hatte sich Arno zum Gehen gewendet. In diesem Augenblick wurde wieder eine andere Nebentür geöffnet, und Arno bekam etwas zu sehen, was ihn wiederum erstarren ließ.
Auch dieses Nebenzimmer war ein Operationsraum, hier waren auch noch zwei Gehilfen tätig, und Arno sah auf dem Seziertisch ein Kind liegen, festgeschnallt — das heißt, soweit sich überhaupt noch ein menschliches Wesen erkennen ließ, eine rohe, blutige Masse mit Kopf, Armen und Beinen, augenscheinlich hatte man vom ganzen Körper, auch vom Gesicht, die Haut abgezogen, und... dieses Kind lebte noch! Denn der blutige Körper zuckte furchtbar, machte krampfhafte Bewegungen.
»Um Gott, Sie sezieren lebendig!«, schrie Arno auf.
»Jawohl, wenn Sie nichts dagegen haben. Um die Hautnerven zu studieren, dazu muss das Geschöpf noch lebendig sein.« — »Unhold!«
»Meinen Sie mich? Ich habe hierzu die polizeiliche Erlaubnis, sogar von der Regierung.«
Arno wusste nicht mehr, was er davon denken sollte.
»Das ist nicht wahr, das ist nicht möglich!«
»Warum denn nicht? Ach so, Sie dachten wohl, das sei ein menschliches Kind? Nein, das ist ein ausgewachsener Affe, ein Pavian, und einen Affen lebendig zu sezieren, das ist erlaubt.«
Diese Erklärung konnte aber den Grafen nur ein klein wenig beruhigen.
»Und Sie sind und bleiben dennoch ein Menschenschlächter und Menschenschinder, ein Teufel sind Sie!«, brach Felsmark jetzt los. »Vergebens suchen Sie sich mit dem Mantel der Wissenschaft zu schützen, als täten Sie dies alles nur zum Wohle der Menschheit. Nein, aus Lust zur blutigen Grausamkeit tun Sie dies, es ist dennoch der reine Egoismus, sonst würden Sie auch den Armen helfen! Pfui über Sie Abschaum der Menschheit. Wehe Ihnen, wenn wir uns einmal am Sklavensee begegnen sollten!«
Mit diesen Worten stürzte Arno hinaus. Er hatte aber doch noch gesehen, wie der Professor eine höhnische Verbeugung gemacht hatte, und besonders deshalb war er so hinausgestürzt, um nicht in Versuchung zu kommen, jenen mit der Faust niederzuschlagen.
Auf der Rückfahrt beruhigte sich Graf Felsmark wieder. Mochte jener treiben, was er wollte, Arno konnte es doch nicht ändern. Über die Vivisektion wollte er überhaupt nicht richten, das überließ er anderen.
Aber auch auf jene andere Zeichnung, welche nötig war, um die Tätowierung auf Atalantas Rücken zu enträtseln, wollte er gleich ganz verzichten. Wenn dem Mädchen so wenig an dem Goldschatze gelegen war — so konnte er sich erst recht damit zufrieden geben, denn gefundene Schätze haben noch keinen Menschen glücklich gemacht. Aber unglücklich desto mehr. Alles, was man wirklich besitzen will, muss man erst durch Fleiß und Schweiß verdienen.
Ein anderer freilich sollte dann diesen Goldschatz auch nicht heben, dafür wollte Arno schon sorgen!
Unter solchen Gedanken erreichte er das Klubhaus, ging an der Loge des Portiers vorüber, ohne zu merken, wie ihn dieser erstaunt ansah, und fuhr mit dem Lift in seine Wohnung.
»Wo ist denn Miss Atalanta?«, fragte er schon mit einiger Verwunderung einen Diener, als ihm nur das Hündchen entgegensprang.
»Herr Graf haben doch die Dame bestellt.«
»Was? Ich? Bestellt?«, stutzte Arno.
»Vor einer halben Stunde. Ein Dienstmann brachte ein Briefchen für Miss Atalanta, sie solle sofort nach dem Hotel ›Bristol‹ kommen.«
In diesem Hotel hatte Signor Ramoni mit seiner Pflegetochter logiert, deshalb ahnte Arno noch nichts, er glaubte, ein anderer habe sie nach dort bestellt, was ihm vorläufig nur sehr unangenehm war.
»Wer hat sie dorthin bestellt?«
»Nun, der Herr Graf doch selbst.«
»Ich? Ist mir nicht eingefallen!«
»Miss Atalanta sagte so. Sie hätten ihr selbst geschrieben.«
»Haben Sie den Brief gesehen?«
»Nein, das allerdings nicht.«
»Das ist mir unbegreiflich. Ich habe nicht geschrieben. Und Miss Atalanta ist gegangen?«
»Sofort. Es war schon ein Wagen vorgefahren.«
»Was für ein Wagen?«
»Ein Mietwagen.«
»Das verstehe ich nicht. Ich habe nicht geschrieben.«
Ehe sich Arno noch den Kopf zerbrach oder weitere Sorge machte, kam Atalanta schon wieder, so ruhig wie immer, als wäre gar nichts vorgefallen.
»Wie, ich soll Dir geschrieben haben. Du solltest nach dem Hotel ›Bristol‹ kommen?«
Wortlos zog das Indianermädchen das Briefchen aus der Tasche, und Arno verlor jetzt vor Bestürzung fast die Sprache, als er wörtlich las:
Komme sofort nach Hotel ›Bristol‹, ich erwarte Dich, schicke Dir einen Wagen.
Graf Arno von Felsmark.
Arno war deshalb so furchtbar bestürzt, weil er seine eigene Handschrift erkannte, Zug für Zug, nicht nur in der Unterschrift. Hätte er nicht bestimmt gewusst, dass er's nicht geschrieben, so hätte er doch gleich darauf schwören können, es wäre seine eigene Schrift.
»Ja, um Gottes willen, was ist denn das?! Du bist gefahren?«
Mit ganz schlichten Worten erzählte die Indianerin ihr Erlebnis, woraus jede andere einen ganzen Roman gemacht hätte.
Ahnungslos war sie in die geschlossene Droschke gestiegen. Mit einem Male, aber gleich hier an der Ecke, hatte sich in dem Wagen ein ganz eigentümlicher Geruch bemerkbar gemacht, so süßlich und betäubend, Atalanta drohte einzuschlafen.
Aber ehe es dazu kam, hatte sie noch die Kraft besessen, die Tür zu öffnen und ins Freie zu springen. Der Kutscher hatte sie ganz entsetzt angestarrt, hatte dann auf sein Pferd eingehauen und war schnell davongejagt. Atalanta hatte sich in der frischen Luft sofort wieder erholt, war zu Fuß nach dem Hotel ›Bristol‹ gegangen, und als man hier nichts von des Grafen Anwesenheit wusste, war sie in das Klubhaus zurückgegangen.
Arno war erstarrt.
»Du hast betäubt werden sollen!«
»Ganz sicher. Und zwar muss es ein furchtbar betäubendes Gas gewesen sein, welches plötzlich irgendwo ausströmte, da ich sehr schnell davon müde wurde.«
»Bist Du denn gegen solche Betäubungsmittel besonders indifferent?«
»Ja, so ziemlich. Signor Ramoni sprach mehrmals davon, dass seine Körperausbildung auch dies bei mir bewirkt habe und machte verschiedene diesbezügliche Experimente mit mir. Mehr weiß ich hierüber nicht. Jedenfalls aber wäre ein anderer Mensch sofort in tiefsten Schlaf gefallen.«
»Du bist der Droschke nicht gefolgt?«
»Nein, dazu war ich nicht sofort fähig, ich musste mich erst etwas erholen. Auch über die Droschke und den Kutscher kann ich gar nichts sagen. Überhaupt ist mir erst hinterher eingefallen, dass man mich hat betäuben und entführen wollen.«
Also das ahnte auch schon diese Indianerin. Aber mit ihr darüber zu sprechen, wer sie habe entführen wollen, das war ganz zwecklos.
Atalanta war dieser Gefahr glücklich entgangen. Und die Hauptsache war, dass man jetzt gewarnt war. Nun hatte Arno schon seine Erfahrung gemacht, und er gehörte nicht zu denen, die immer und immer wieder Schaden erleiden und doch nicht klug werden. Wenn nur diese so überaus täuschende Nachahmung seiner Handschrift nicht gewesen wäre!
»Ja, da hilft es eben nichts, Du darfst niemals wieder etwas anerkennen, was Dir schriftlich überreicht wird. Das ist freilich fatal, es können doch Gelegenheiten kommen, wo man sich einmal trennen muss, wo man sich eine schriftliche Mitteilung zu machen hat.«
»Nun, da gibt es doch ein Mittel, um seine Schrift zu beglaubigen.«
»Was für ein Mittel?«
»Einen Stempel.«
»O Atalanta, wo denkst Du hin! Einen Stempel kann man doch erst recht nachahmen!«
»Ich meine einen ganz besonderen Stempel. Signor Ramoni benutzte ihn selbst und hat mir erzählt, dass dieses Verfahren bei den Chinesen schon seit uralten Zeiten allgemein üblich ist. Man reibt seinen Daumen mit Stempelfarbe ein und drückt ihn als Beglaubigung mit zur Unterschrift. So viele Menschen gibt auf der Erde, so viele anders geformte Daumenabdrücke sollen entstehen!«
»Wahrhaftig, da hast Du recht!«, rief Arno.
Ja, so ist es auch. In diesem Falle zeigt die schöpfende Naturkraft wieder einmal ihre wunderbare Vielseitigkeit, über die man nicht genug staunen kann.
Atalanta und Graf Felsmark machten jetzt gegenseitige Erkennungszeichen untereinander aus, in dieser Hinsicht war also Arno wieder beruhigt.
Die zweite Post hatte für Arno ein Paket gebracht, flach und rund, das seinen Inhalt gleich verriet.
»Ah, da ist eine Torte drin, die wollen wir uns schmecken lassen!«, rief er vergnügt, als er sich nach einem raschen Blick auf die Adresse vom Namen des Absenders überzeugt hatte.
Eine weitere Erklärung gab er nicht, wie er früher mit solchen Paketen jeden Tag geradezu überhäuft worden war, die Geschenke für ihn enthielten, hauptsächlich die in Amerika so beliebten Torten, Pies genannt, welche jede amerikanische Hausfrau mit einer Leidenschaft bäckt, ferner aber gestickte Morgenschuhe und dergleichen Handarbeiten in Unmenge, von zarter Damenhand gefertigt. Einen Handel hätte er mit solchen Sachen treiben können. Als man erfuhr, dass der göttlich verehrte »Champion-Gentleman von New York« alle diese Geschenke prinzipiell sofort einer wohltätigen Anstalt übergab, dann hatte er Ruhe vor diesen Gunstbezeugungen gehabt.
Nur dieses eine Geschenk nahm er immer noch an, regelmäßig in jedem Monat am bestimmten Datum, das heute war, kommend. Als er vor einem Jahre die Massenrettung ausgeführt, hatte er auch einen des Schwimmens unkundigen Mann und sein Kind an Land gebracht, die Gattin und Mutter der Geretteten hatte ihm dann eine Fruchttorte geschickt, obgleich ja schon bekannt gewesen war, dass er alle Anerkennung zurückwies, aber das war denn doch etwas anderes gewesen als ein Scheck oder gar bares Geld, es hatte auch so ein reizender Brief dabei gelegen, diesen selbstgebackenen Kuchen also hatte er angenommen, er hatte sich bedankt, und seit dieser Zeit kam jeden Monat so eine Torte an.
Er öffnete das Paket, las das beiliegende Briefchen der in bescheidenen Verhältnissen lebenden Frau, die ohne ihn jetzt keinen Mann und kein Kind mehr hätte, ließ vom Diener einen großen und zwei kleine Teller bringen und balancierte den diesmal mit Mandelcreme gefüllten Kuchen auf die porzellanene Unterlage.
Mehr noch als sein Herr freute sich Lullu. Das Hündchen wusste ganz genau, was das Paket enthielt, es brauchte den Kuchen noch gar nicht gesehen zu haben.
»Jawohl, Lullu, Du sollst wie immer den ersten Bissen bekommen, hier...«
Bei dem Herausheben aus dem Karton war trotz aller Vorsicht der flache Kuchen etwas in die Brüche gegangen. Lullu bekam einen großen Brocken und fraß ihn gierig.
Der Diener hatte das bestellte Messer vergessen, es vergingen noch einige Minuten, ehe er es brachte.
Mit einem Male fiel den beiden das Verhalten des Hundes auf. Das glatte Rückenfell begann plötzlich heftig zu zucken, das Tier bekam Krämpfe, dann die Maulsperre, warf mit einem furchtbaren Ruck, als wollte es sich selber das Genick brechen, den Kopf zurück, und war tot. Innerhalb einer halben Minute hatte sich das abgespielt.
»Die Torte ist vergiftet!«
So hatte Arno natürlich gleich gerufen, sagte sich aber dann sofort, dass er mit solch einer Behauptung doch vorsichtig sein müsse. Natürlich, Gift enthielt diese Torte. Der Zwerghund war an einem Bissen sofort gestorben. Aber die Füllung bestand, wie man gleich sehen und riechen konnte, aus gewiegten Mandeln. Bittere Mandeln, die auch zwischen süßen vorkommen können, enthalten Blausäure, das furchtbarste Gift, das wir kennen.
Arno rief telefonisch sofort einen ihm bekannten Gerichtschemiker herbei, der auch bald kam.
Nachdem Graf Felsmark ihm von dem Vorkommnis Mitteilung gemacht, erwiderte der Chemiker:
»Ja, Blausäure werde ich natürlich finden, es kommt darauf an, wie viel. Und der Hund hat dabei die Maulsperre und die Genickstarre bekommen? Das sieht allerdings mehr wie eine Strychninvergiftung aus.«
Er nahm dann die ganze Torte mit, ebenso erbat er sich auch den toten Hund, um ihn von einem Gerichtsarzt sezieren zu lassen.
Aruo packte sein treues Hündchen in eine Pappschachtel ein.
Noch an demselben Tage teilte ihm der Chemiker das Resultat seiner Untersuchung mit. Ja, Blausäure hatte er nachweisen können, aber nur in Spuren, für eine Mandeltorte normal. Strychnin hatte er nicht gefunden. Doch da müsse man erst die Sezierung des Hundes abwarten.
Arno machte sich weiter keine Gedanken darüber. Was er sonst vorhatte, darüber war sein Entschluss schon gefasst gewesen. Er hatte monatliche Kündigung, machte davon Gebrauch und nahm für diesen Monat gleich Urlaub. So war er schon jetzt ein freier Mann.
Bei Signor Ramonis Begräbnis fanden sich viele Verwandte ein, die den sehr reichen Mann zu beerben hofften und die indianische Adoptivtochter meist mit wütenden Augen anblickten. Es wäre zu bösen Streitigkeiten gekommen, zumal kein Testament vorhanden war. Sie entstanden nicht, weil Atalanta kurzerhand auf alle Ansprüche auf Ramonis Nachlass verzichtete.
Dann bereitete Arno die Ausrüstung zur Expedition nach dem Sklavensee vor, den er mit Atalanta doch erst einmal besichtigen wollte, ehe sie ihre Tournee als Zirkusakrobaten antraten.
Am dritten Tage nach jenem Vorfall mit der Torte probierte Arno die ihm soeben gebrachten langen Jagdstiefel an, auf die er nur noch gewartet hatte. Eine Stunde später wollte er schon mit Atalanta im Pacificzug sitzen. Das Telefon klingelte.
»Na, das ist wohl das letzte Mal, dass mich dieses Marterinstrument aufhält. Wer ist dort?«
Es war jener Gerichtschemiker.
»Sind Sie's, Herr Graf? Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ihr Hund ist wieder lebendig geworden.«
»I machen Sie keine Witze!«
»Tatsache. Der Gerichtsarzt hat ihn zu sezieren vergessen, oder er ist noch nicht dazu gekommen — kurz und gut, die Pappschachtel mit der Hundeleiche hat bisher uneröffnet in einem Schranke gestanden. Vorhin hörten wir — ich selbst war gerade in dem betreffenden Zimmer — ein merkwürdiges Rascheln und Rumoren in dem Schranke — dann ein Quieken, schließlich ein leises Bellen. Wir öffneten den Schrank und die Pappschachtel, die selber etwas lebendig wurde — und da sprang frisch und fröhlich Ihr Hund heraus. Es scheint ihm gar nichts zu fehlen. Sie glauben's nicht?«
O ja, Arno glaubte es. In diesem Augenblick aber hatte er eine furchtbare Vision, die ihm das Blut erstarren ließ.
Gesetzt nun den Fall, die Mandelfüllung hätte nicht nur so auf ein kleines Tier gewirkt, sondern auch auf den Menschen — was dann, wenn auch Arno und Atalanta davon gegessen hätten? Dann wären auch sie beide gestorben und begraben worden, wenn man sie nicht vorher seziert hätte, und dabei wären sie vielleicht gar nicht einmal richtig tot gewesen.
Arno wollte sich diese Gedanken nicht weiter ausmalen. Es war eben nur eine Vision gewesen.
In dem schmalen Schattenstreifen, den die aus dem blauen Wasser himmelhoch emporsteigende Felswand warf, lag ein Boot, und in diesem Boote wieder lag behaglich ausgestreckt ein baumlanger Mann, die kurze Pfeife zwischen den Zähnen, während im Vorderteil ein braunes, schwarzhaariges Mädchen im kurzen Lederröckchen saß und die Angelrute handhabte.
Schon seit einer Woche hausten die beiden — Atalanta und Graf Arno Felsmark — hier am und auf dem Sklavensee. Von der nächsten Eisenbahnstation aus waren sie vier Tage lang zu Fuß marschiert, weil sie hier ja doch keine Pferde gebrauchen konnten, und das Schwerste, was sie dabei zu tragen gehabt, war dieses Boot gewesen, das aber auch nur dreißig Pfund wog.
Es war das modernste Expeditionsboot, aus dünnem, wasserdicht imprägniertem Leder bestehend, das wie ein Sack zusammengerollt werden konnte; beim Gebrauch wurde es einfach mittels einiger Hölzer, die man irgendwo abschnitt, straffgespannt.
Den ganzen Tag streiften Arno und Atalanta durch den Wald, fuhren auf dem See herum und besuchten die vielen Inselchen. — Wenn sie Hunger hatten, wurde ein möglichst kleines Wild erlegt, für Abwechslung in der Kost sorgten Wasservögel und Fische — und an besonders idyllischen Plätzchen legten sie sich hin und träumten.
Es war ein herrliches Zigeunerleben! Allerdings auch immer vom sonnigsten Wetter begünstigt. Arno glaubte vorläufig, dieses faule Leben für immer aushalten zu können. Freilich wusste er schon, dass sich das einmal ändern würde. Dann konnte man aber auch das wieder ändern, dann konnte man eine Hütte bauen, erst aus Zweigen, um sich vor Regen zu schützen, dann ein richtiges Blockhaus, dazu mussten erst Baumstämme gefällt werden — ach, was es da alles zu tun gab, wenn man sich hier häuslich einrichten wollte!
Noch keinen einzigen Menschen hatten sie erblickt, nur Spuren alter Lagerfeuer, die verrieten, dass doch ab und zu Jäger hierher kamen. Und an den Flussmündungen, wo Biber bauten, fanden sie Anzeichen, dass sich hier in der Saison Fallensteller ansiedelten.
Warum siedelte sich hier kein Farmer an, ein Hinterwäldler, dem es genügt, dem Boden nur so viel Brot abzuringen, als er für sich und seine Familie braucht, immer bereit, auf Geheiß des Grundbesitzers das bestellte Land nach der nächsten Ernte wieder zu verlassen?
Den Grund hierzu erkannte ein Sachverständiger sofort. Es war ein herrlicher Urwald, wie ein Park, ohne jedes Unterholz, der Boden mit einem samtweichen Rasen bedeckt. Aber das war kein richtiges Futtergras, das war »Sprigging«, eine Queckenart, ein höllisches Unkraut, das metertief im Boden wurzelt und keine andere Pflanze aufkommen lässt, die nicht noch tiefere Wurzeln treibt. Nur mit dem Tiefpflug kann dieses Unkraut ausgerodet werden, und dazu gehört Großbetrieb. Ein Glück, dass dieses Unkraut sich nur durch seine Wurzeln vermehrt und nur im Waldesschatten gedeiht, sonst würde es wie eine Pest ganz Amerika unfruchtbar machen.
Dieses ganze Gebiet von zwölf deutschen Quadratmeilen war also absolut wertlos. Wenn man freilich das nötige Kapital hatte, einige Millionen hineinstecken konnte, dann musste sich hier etwas schaffen lassen! Und hiervon träumte Arno doch manchmal, von einem Asyl, von einer Freistatt für arme, bedauernswerte Menschen, die so gern arbeiten möchten und keine Arbeit finden, er träumte von einer paradiesischen Insel inmitten der geldgierigen Welt, allerdings einem Arbeitsparadiese.
Nun, dort unten im See sollten ja die dazu nötigen Millionen liegen. Er hatte noch nichts davon gesehen.
»Sie wollen hier an der Felswand nicht anbeißen!«, sagte jetzt Atalanta.
»Ach, lass die armen Fischchen schwimmen. Ich habe überhaupt gar keinen Appetit mehr nach Fisch. Ich komme mir schon wie ein Seehund vor. Ich schmachte schon längst nach einer harten Kommissbrotrinde oder nach irgend einer anderen Mehlspeise.«
Atalanta rollte die Angelschnur auf und legte sich ebenfalls ins Boot, um zu träumen.
Das Boot brauchte nicht festgemacht zu werden, es entfernte sich nicht von der Wand. Der See hatte nämlich von Osten nach Westen eine Strömung, so schwach sie auch sein mochte, dass man sie auf freiem Wasser gar nicht merkte. Auch im Osten war die Umgegend noch gebirgig, nur von dort kamen einige Zuflüsse, so durfte man vermuten, dass hier auf der Westseite ein Abfluss war, der aber nur ein unterirdischer sein konnte.
Nach einer Weile hob Atalanta den Kopf.
»Wie sagtest Du?«
»Ich? Ich habe nicht gesprochen.«
»Du fragtest doch, was wir heute Abend machen wollen?«
»Du hast geschlafen und geträumt, Atalanta. Ich habe kein Wort gesprochen.«
Die Indianerin legte sich wieder hin, den Kopf dicht an der Bordwand, welche wieder die Felsenmauer berührte.
Da richtete sie sich wieder empor.
»Ich höre hier immer sprechen. Vorhin wurde auf Englisch gefragt, was man heute Abend machen wolle, jetzt ist es eine fremde Sprache. Es sind Menschenstimmen, die ich ganz deutlich vernehme. Lege Dein Ohr hier an die Bootswand.«
Der Graf äußerte nicht erst Zweifel, sondern folgte der Aufforderung, stand auf, ging in dem schwankenden Boote nach vorn, kniete nieder und legte an der bezeichneten Stelle sein Ohr gegen die Lederwand des Bootes.
Dass er nichts hörte, darüber wunderte er sich nicht, als er merkte, dass sich das Boot durch das Schwanken etwas von der Wand entfernt hatte.
Atalanta musste zum Schaufelruder greifen, Arno legte, den einzigen Grund einer Möglichkeit, hier wirklich etwas hören zu können, schon ahnend, das Ohr gleich direkt gegen die Felswand.
»Sei keine Närrin, Gertrud. Führst Du hier nicht ein glänzendes Leben, wie es sich nur eine Prinzessin wünschen kann? Bist Du nicht von Glanz und Reichtum umgeben? Vermissest Du hier irgend etwas, was Dir die Welt irgendwie bieten kann, die größte Stadt? Kannst Du nicht jede Stunde ins Theater, ins Konzert, in die Oper, ins Ballett gehen, kannst Du nicht...«
»Nein, Johanna, es ist doch nur ein Käfig, in den ich gesperrt worden bin, und mag es auch ein goldener Käfig sein...«
»Still, Rodrigo kommt!«
Eine Tür fiel ins Schloss.
Arno war sprachlos vor Staunen. Er hätte gleich schwören können, dass hier in seiner dichten Nähe gesprochen worden war, dass die beiden weiblichen Personen nicht einmal durch eine Scheidewand von ihm getrennt waren. Sie hatten deutsch zusammen gesprochen, die eine mit etwas bayerischem Dialekt, die andere war offenbar eine Hannoveranerin gewesen. So deutlich hatte er alles unterscheiden können! Die letzte Warnung war im leisesten Tone geflüstert worden! Und wie dann die Tür ins Schloss fiel, das war vollends von größter Deutlichkeit gewesen! Dann hörte Arno nichts mehr.
Sein nächstes war, ohne noch das Ohr von der Wand zu nehmen, dass er in seinen Taschen suchte, indem er sich entsann, ein Stückchen Kreide bei sich zu haben, und dass er mit dieser genau dort, wo sein Ohr an dem Felsen gelegen hatte, ein Kreuzchen machte, dieses dann durch einen größeren Ring markierend.
Hierdurch bewies Arno, dass er diese Sache von der jedenfalls richtigen Seite aus betrachtete, und er gab seiner Gefährtin hierüber die nötigen Aufklärungen.
Dass hier gleich dahinter ein hohler Raum sei, von dem er nur durch eine ganz dünne Wand getrennt, das war doch ausgeschlossen. Dann hätte er die Worte noch immer nicht mit solch handgreiflicher Deutlichkeit gehört.
Hier handelte es sich um eine akustische Täuschung. Besser als Luft leitet den Schall das Wasser, besser als dieses noch feste Materie. Freilich ist das nicht so einfach. Da kommen physikalische Gesetze in Betracht, die sich noch nicht in Regeln haben zwingen lassen. Dem Leser dürfte bekannt sein, dass es hier und da in der Welt eine Mauer oder eine sonstige Baulichkeit gibt, etwa eine Kirchenwand, welche das leiseste Wort, an einer bestimmten Stelle dagegen gesprochen, auf eine Entfernung fortpflanzt, die bei einfachem Luftwiderstand ganz unmöglich ist. Arno hatte solch ein Phänomen in seiner engsten Heimat gehabt, eine uralte Kirchhofsmauer von fast zweihundert Meter Länge. Wenn man an einer ganz bestimmten Stelle gegen diese sprach, ganz leise, nur hauchend, so vernahm ein anderer, der sein Ohr in zweihundert Meter Entfernung wieder an eine ganz bestimmte Stelle presste, das leiseste Wort so deutlich, als würde es direkt in sein Ohr geflüstert.
Ohne Zweifel hat jedes Bauwerk wie auch jede natürliche Felsmasse solche korrespondierenden Stellen. Aber der allergrößte Zufall ist es, wenn sie einmal gefunden werden. Der Physiker kann wohl die Ursache erklären, vermag solche Stellen aber nicht zu berechnen.
So hatte Arno der Indianerin erklärt und — — diese schüttelte den Kopf.
»Du glaubst es nicht?«
»Gewiss, ich glaube schon, was Du sagst, aber... wo sollen denn die beiden Frauen gesprochen haben?«
»Ja, wenn ich das wüsste!«
»Sie müssen doch hier drin im Felsen sein.«
»Das ist nicht nötig. Sie können auf der anderen Seite des Felsens sein.«
»Und dort gegen die Felswand sprechen?«
»Das ist ebenfalls nicht nötig. Ich entsinne mich, dass es im Dom zu Florenz eine unterirdische Gruft gibt, in der man das leiseste Wort hört, welches oben im höchsten Turmzimmer geflüstert wird, und umgekehrt, und da braucht man nicht direkt gegen die Wand zu sprechen und nicht sein Ohr daran zu legen. — Nun, sehen wir einmal auf der Karte nach, was hier in Betracht kommen könnte.«
Er entnahm einer Ledertasche die Spezialkarte dieses Coloradogebietes. Doch diese machte das Rätsel nur noch viel größer.
Die nächste Ortschaft von hier war Puebla, allerdings nur zwei geografische Meilen westlich entfernt, aber da lag eben das ganze Felsengebirge dazwischen, das sich hier einmal bis auf nur zwei Meilen zusammenpresste, dafür hier auch umso höher werdend.
Ja, »nur« zwei Meilen! Dass die Felsmasse den Schall so weit fortpflanzt, das ist natürlich ganz ausgeschlossen. Sonst war hier herum nicht einmal ein ständiges Blockhaus angegeben.
»Ich stehe vor einem unergründlichen Rätsel!«, sagte Arno, die Karte zusammenfaltend, so ergebungsvoll wie ein Mann, der sich ins Unvermeidliche zu schicken weiß.
Da ließ Atalanta ein leises Zischen hören und winkte ihm. Sie hatte ihr Ohr unterdessen immer an der Wand auf dem Kreuzchen liegen gehabt.
»Ist wieder etwas zu hören?«, flüsterte Arno.
Sie nickte, wollte ihm Platz machen, doch Arno legte sein Ohr daneben gegen die Felswand, und er hörte es gleichfalls, wieder mit größter Deutlichkeit.
Es wurde gesungen, wieder von einer Frauenstimme, wieder auf Deutsch. Eine leise, schwermütige Melodie.
»Ich bin ein kleines Vögelein — — ich bin ein kleines Vögelein — —«
Was war denn das?!
Nicht nur zweimal, sondern schon viermal hatte Arno diese selben Worte gehört, immer mit derselben Melodie. Und so ging das weiter. Dazwischen stets eine längere Pause, und dann immer wieder die schwermütige Melodie mit denselben Worten: »Ich bin ein kleines Vögelein —«
Was sollte denn das bedeuten? Dann aber kamen doch auch andere Worte dazwischen, noch klagender gesprochen:
»Ach, mein Kopf, mein armer Kopf... wie das brennt und glüht... und ich kann die Fortsetzung nicht finden... ich bin ein kleines Vögelein...«
Nun wusste Arno genug, und er war furchtbar erschüttert. Ein armes Menschengehirn, das sich umnachtet hatte, das sich nur noch damit abquälte, die zweite Strophe eines Liedes zu finden, welches überhaupt vielleicht ein selbstgemachtes war. Denn Arno kannte dieses Lied nicht, am wenigsten diese ganz eigentümliche Melodie.
»Ich bin ein kleines Vögelein —«
»Und fliege in den Wald!«, sang jetzt eine andere Frauenstimme.
»Nein, nein, Gertrud, das ist nicht das Richtige, gib Dir keine Mühe mehr, Du findest die Fortsetzung ebenso wenig wie ich. Und doch muss ich sinnen und sinnen... ich bin ein kleines Vögelein —«
In dem Boote an der Felswand erklang ein schluchzender Laut. Der hünenhafte Mann hatte ihn nicht unterdrücken können.
»Komm, meine arme Thekla, wir wollen das Ballett tanzen lassen, das zerstreut Dich immer am meisten. Auch eine dressierte Löwengruppe ist angekommen, wir wollen sie uns gleich jetzt vorführen lassen!«, ertönte die Stimme wieder von neuem.
Arno hätte schwören mögen, ganz deutlich sich entfernende Frauenschritte zu vernehmen, so unhörbar sie auch in Wirklichkeit sein mochten. Er hörte deutlich das leise Quietschen einer Tür und wie die Klinke zuschnappte, das war keine Täuschung gewesen.
Ein Ballett vorführen lassen? Eine dressierte Löwengruppe? Sofort? Auf Wunsch? Auf Befehl sich sofort eine Vorstellung geben lassen? Wer kann sich denn so etwas leisten?
Ja, so ein Yankee, bei dem der Mensch erst mit hundert Millionen anfängt, der kann sich so etwas leisten. So ein amerikanischer Krösus hat — wenn er nicht vor Geiz hungert — in seiner »Residenz« Einrichtungen, nur zu seinem eigenen Vergnügen, von denen sich kein europäischer Fürstenhof etwas träumen lässt.
Wir wissen aus historisch beglaubigten Berichten, dass der Hofhalt des persischen Königs Darius immer mindestens fünfzehntausend Personen umfasste, darunter dreihundertsechzig eigene Frauen, deren jede ihre eigenen Dienerinnen haben wollte, und nicht zu wenig, dreihundert Köche, hundert Kellerbeamte, achtzig Kranzflechter und ähnliche Individuen, deren Funktion nur die lebhafteste Phantasie eines Mannes ersinnen kann, der nicht weiß, wohin mit seinem Gelde.
Das klingt märchenhaft. Doch was ist märchenhaft? Märchenhaft ist für einen schlesischen Weber oder erzgebirgischen Holzschnitzer, dass in Nordamerika jeder Arbeiter täglich drei große Fleischmahlzeiten haben will, sonst pfeift er auf die ganze Arbeit.
Aber solche Erwägungen lösten das hier vorliegende Rätsel nicht.
Nachdem die beiden hier noch stundenlang mit dem Ohre an der Felswand gelegen hatten, ohne noch etwas gehört zu haben, gaben sie endlich diese Geduldsprobe auf. Es war gegen vier Uhr geworden, vor sechs Stunden hatten sie einen kleinen Lachs im Kessel gekocht, der Magen verlangte wieder seine Rechte.
Das nächste Land war wieder eine kleine Insel, kaum einen halben Kilometer von hier entfernt. Diese hatten sie noch nicht betreten. Es waren gar zu viele Inselchen, aber meist doch so groß, dass sich recht gut ein Rittergut hätte daraus etablieren können. Dann freilich auch wieder solche winzige Dingerchen, auf denen nur ein Häuschen mit einem Gärtchen Platz gehabt.
Wenn man das nötige Geld hatte, was musste sich hier schaffen lassen!
Sie ruderten hin. Auf allen diesen Inseln wimmelte es von Wasservögeln aller Art.
Auf dem Wege blickte Arno noch einmal zurück. Glatt wie gemeißelt, so weit das Auge nach links und nach rechts reichte, stieg die Felswand bis in die Wolken empor, ohne jeden Sprung, ohne Riss. Die Karte gab eine Höhe von dreitausendzweihundert Metern an. Freilich lag dieser See selbst achthundert Meter über dem Meeresspiegel. Das musste hier einen harten Winter geben. Und dann also immer noch zweitausendvierhundert Meter hoch. Wie sah es dort oben wohl aus? Dort oben war sicherlich noch kein Mensch gewesen, und es war sehr, sehr die Frage, ob man da irgendwo einen Kletterweg fand. Die Pässe, welche durch das Felsengebirge führen, kann man an den Fingern herzählen, sie werden von Eisenbahnen benutzt, und alles andere ist noch gänzlich unbekannt.
»Du, Atalanta, diese Felsenmasse gehört auch noch uns, bis vier englische Meilen vom Seeufer entfernt.«
Er musste bei solchen Gelegenheiten immer von »unserem« Eigentum sprechen, sonst nahm sie es übel.
»Ja«, fuhr Arno in seiner humoristischen Weise fort, »dort muss ich bald einmal hinauf. Das ist doch gewissermaßen das Dach unseres Hauses, und man muss doch wissen, wie es auf seinem Dache aussieht. Und wenn ich mich auch nur dort oben zwischen die Wolken setze und in einer Höhe von dreitausendzweihundert Metern die Beine herabbaumeln lasse, das muss doch ein herrliches Gefühl sein, so als Hausbesitzer auf dem Dache seines tausendstöckigen Hauses... halloh, was für ein weißer Vogel kommt denn da geflogen?!«
Von oben herab kam etwas Weißes geflattert. Es war ein Gewebe, das konnte man sofort erkennen. In welcher Höhe sie es zuerst gesehen, konnte dann weder Arno noch Atalanta sagen. Aber die Hauptsache war, dass sich das Boot kaum zwanzig Meter von der Felswand entfernt hatte und dass der weiße Schleier dicht daneben ins Wasser fiel. Mit dem Ruder holte Atalanta ihn heraus.
Ja, es war ein weißer Schleier, von normaler Größe, wie ihn Damen vor dem Gesicht tragen, ein sehr feines Gewebe aus bester Seide.
»Der riecht nach Parfüm!«, sagte Arno.
»Er riecht nach Menschen, er ist noch vor kurzem getragen worden!«, ergänzte die Indianerin, ohne ihre Nase dem Gewebe besonders nahe zu bringen.
Fassungslos blickte der Graf zum blauen Himmel empor, an dem sich das Ende der Felswand als scharfe Linie markierte. Er behielt aber doch seinen Humor.
»Ja, nun ist mir alles klar: Dort oben auf unserem Hausdache hat sich einfach eine Kolonie niedergelassen, mit Theater, Oper, Ballett, dressierten Löwen und allem, was sonst noch zum Tingeltangel einer Stadt, in der man sich nicht langweilt, gehört. Na, die wollen wir wohl kriegen, die müssen uns doch Miete zahlen!«
»Spricht mein Bruder im Ernst?«, fragte die Indianerin.
»Ja und nein. Der Schleier kann doch nur von dort oben kommen. Dort oben sind Menschen. Deren Stimmen haben wir gehört. Sonst freilich... diese Erklärung ist eigentlich noch viel märchenhafter als das Rätsel selbst. — Na, wollen wir uns die Sache einmal beim Diner überlegen, ich habe rechten Appetit auf ein Paar knusprig gebratene Reiherbeine.«
Arno und Atalanta hatten die Insel erreicht, an deren Ufer besonders Sykomoren, die prächtigen amerikanischen Eichen, ihre Zweige bis zum Wasser hinabneigten.
»Ach, ist das herrlich, herrlich hier!«, jubelte Arno immer wieder, wie er im Laufe dieser Woche schon einige hundert Mal gejubelt hatte.
Sie stiegen aus, schoben oder vielmehr hoben das leichte Lederboot auf den flachen Strand, der ebenfalls mit jenem samtweichen Grasunkraut bedeckt war.
Wohl hingen sie sich die Repetiergewehre um, denn es konnte doch einmal die Begegnung mit einem Panther stattfinden, selbst die mächtigen Hirsche konnten jetzt zur Brunftzeit gefährlich werden, sonst aber wurde zur Jagd auf Vögel und kleineres Wild immer Pfeil und Bogen benutzt, welche die Indianerin gleich im Anfang dieses Jägerlebens mit wahrer Begeisterung geschnitzt hatte, und dem Grafen machte es das größte Vergnügen, diese Waffe, heute nur noch für Kinder bestimmt, zu handhaben. Es ist auch tatsächlich ein viel edleres Weidwerk, ein Wild — von einem Vogel im Fluge ganz abgesehen — mit einem selbstgeschnitzten Pfeil zu erlegen, als mit Streuschrot, was doch eine verteufelte Ähnlichkeit hat mit der vom »weidgerechten« Jäger sonst so verachteten Schlingenstellerei.
Ein Schwarm Wildgänse flatterte vor ihnen auf, von Arnos Bogensehne entschwirrte ein Pfeil. Es war nur ein gerader Zweig, von allen Unebenheiten befreit, eine starke Rute, hinten ohne Federn, vorn nur mit dem Messer zugespitzt. Das genügte vollkommen. Solch ein Pfeil, mit genügender Kraft abgeschnellt, durchbohrt jedes Tier, das nicht eine gar zu harte Haut hat, und ob die Durchbohrung von einem Holzpfeil oder einer Bleikugel mit Spitzstahlmantel erzeugt wird, das bleibt sich doch gleich.
Die Hauptsache bei der ganzen Schießerei ist immer, dass man sein Ziel trifft — und das war bei Arno nicht der Fall gewesen.
Die Wildgänse hatten sich dem Wasser zugewendet, beschrieben einen Bogen, kamen in größerer Höhe nach der Insel zurück, und jetzt legte Atalanta einen ihrer unfehlbaren Pfeile auf den starken Bogen.
Aber sie entsandte ihn nicht. Sie hatte dabei noch einmal nach unten geblickt, und so verharrte sie, ohne sich noch weiter um die Gänse zu kümmern.
Dann ließ sie den Bogen vollends sinken, um vor sich auf den Boden zu deuten.
»Menschenspuren! Stiefelabdrücke!«
Arno sah nichts in dem Grase, so deutlich es ihm auch Atalanta machen wollte. Was diese Indianerin für ein fabelhaftes Auge besaß, hatte er schon während der langen Eisenbahnfahrt gemerkt.
»Können es nicht unsere eigenen Spuren sein?«
»Nein, es ist ja doch immer eine Hacke dabei.«
»Ich habe auch Hacken.«
»Aber es ist doch ein kleiner Frauenfuß. Hier, siehst Du ihn denn nicht ganz deutlich im Grase?«
Nein, Arno sah absolut nichts, obgleich er sonst auch ein recht scharfes Auge besaß. Na ja, ein paar umgeknickte Grashalme — aber die sah er eigentlich überall.
»Überhaupt ist diese Spur schon älter, wenn wohl auch nicht älter als vierundzwanzig Stunden, sonst hätten sich die Halme schon wieder aufgerichtet.«
»Und wirklich ein Frauenfuß mit Hacke? Du meinst einen Damenstiefel?«
»Ja, ein sehr zierlicher Damenstiefel.«
Atalanta, welche selbst Mokassins trug, kniete nieder, um die Spur noch genauer zu besichtigen und... vielleicht auch zu beriechen, obgleich sie dazu die Nase nicht dicht an den Boden zu bringen brauchte.
Dass diese Indianerin an feinster Witterung es mit dem besten Jagdhund aufnahm, davon hatte sich Arno durch angestellte Experimente schon mehrmals überzeugt.
»Gib mir den Schleier, Arno.«
Er hatte ihn in die Tasche gesteckt, sie roch daran, beugte sich wieder über die unsichtbare Spur, man sah, wie sich die Nüstern ihrer feinen Nase blähten.
»Ja, es ist derselbe Geruch. Die Person, welche diesen Schleier längere Zeit getragen hat, ist gestern hier gegangen.«
Arno durfte nicht mehr an der Richtigkeit dieser Behauptung zweifeln. Dass der Schleier auch parfümiert war, dass er ihn schon in der Tasche getragen, das hat doch alles auch für eine gute Hundenase nichts zu sagen. Die unterscheidet an jedem Gegenstand viele Gerüche, ohne sich beirren zu lassen. Seine Grenzen hat natürlich alles.
Hierdurch aber wurde das Rätsel nur noch größer. Der Schleier kam von dort oben herabgeflattert, und seine Besitzerin lustwandelte hier unten auf der Insel — was sollte man davon denken?
»Verfolgen wir die Spur.«
Atalanta erhob sich und schritt weiter. Nach einiger Zeit bückte sie sich und hob etwas auf, und als Arno es zwischen den Fingern hatte, sah er es auch: ein langes, blondes Haar.
Und dann an einer sandigen Stelle sah er auch die Spur. In den feinen Sand hatte sich mehrmals ganz deutlich ein kleiner, zierlicher Damenstiefel abgedrückt.
Die Spur führte auf dem Inselchen — das in zehn Minuten abzuschreiten war — hin und her, Atalanta konnte konstatieren, dass sich die Person mehrmals auf niedrige Baumäste gesetzt hatte, jedenfalls um sich zu schaukeln. Atalanta gab darüber auch noch andere Andeutungen, die Arno aber gar nicht verstand — doch ein Anfang und Ende der Spur konnte nicht gefunden werden, was dadurch erklärlich war, dass die Erzeugerin dieser Spur eben ein Boot benutzt hatte. Indem sie aber nun nochmals bis dicht an das Ufer gegangen war, konnte diese Stelle auch noch bestimmt werden.
Sonst war etwas Bemerkenswertes auf dieser Insel noch ein Baumstumpf, der ziemlich in der Mitte stand und glatt abgesägt war, was aber schon vor vielen Jahren geschehen sein mochte. Auch auf diesen Baumstumpf hatte sich die betreffende Dame gesetzt, sie musste dann mehrmals um ihn herumgegangen sein, hier war das Gras ganz zertreten, Atalanta behauptete sogar, um diesen Baumstumpf habe sie getanzt.
Der Abend brach an. Arno erlegte mit dem Pfeil doch noch eine fette Wildente, sie stürzte hundert Meter vom Ufer entfernt ins Wasser, und er dachte gar nicht erst an das Boot, sondern ging sofort ins Wasser, um das Tier schwimmend zu apportieren, als habe er das Zeit seines Lebens nicht anders gekannt.
Unterdessen hatte Atalanta schon ein Feuer angemacht, und zwar am Ufer in der Nähe des Bootes, das man unter solchen Verhältnissen doch lieber nicht aus den Augen lassen wollte. Eine riesige Sykomore bot hier mit ihrer dichten Belaubung Schutz vor dem fallenden Nachttau.
Die Ente wurde abgebalgt, ausgenommen, ausgewaschen, mit Salz eingerieben und am eisernen Putzstock gebraten. Diese am Wasser lebenden Wildenten schmecken sehr tranig, weil sie viele Fische fressen, ja sie sind manchmal ganz ungenießbar. Aber sie müssen wie die jungen Möwen nicht nur gerupft, sondern sogar abgebalgt werden, dann ist keine Spur von Fischgeschmack zu merken, der sitzt nur in den Hautdrüsen und teilt sich erst beim Braten dem Fleische mit.
Die mondlose Nacht war angebrochen, die Mahlzeit beendet.
»Unter solchen Umständen wollen wir doch lieber Nachtwachen einrichten, Atalanta!«, sagte Arno.
»Ich werde gleich die erste übernehmen!«
»Aber in vier Stunden weckst Du mich.«
»Ich werde Dich wecken!«, entgegnete die Indianerin, einen Blick nach dem funkelnden Sternenhimmel werfend.
Er brauchte ihr nicht seine Uhr zu geben, diese Indianerin konnte die Zeit von den Sternen ablesen, ohne zu wissen, wie sie das eigentlich gelernt hatte.
Arno wickelte sich in seine Decke, die so federleicht und dünn war und dennoch eine Gummifütterung enthielt, daher warm und wasserdicht war. Aber so bequem er sich auch gelegt hatte, lange Zeit floh ihn doch der Schlaf. Er hatte zu viel am Tage geschlafen.
Wie sich Atalanta die Zeit vertreiben würde, wusste er schon. Sie brachte denn auch richtig aus dem am Gürtel hängenden Lederbeutel ein kleines Kästchen ähnlich einer Schnupftabaksdose zum Vorschein, entnahm ihm ein Brettchen, das sie noch zweimal auseinander schlagen konnte, stellte winzige Schachfigürchen darauf und spielte für sich allein. Das heißt, jetzt spielte sie anders als damals im Zirkus, jetzt verging manchmal lange Zeit, ehe sie einen Zug tat.
»Und das ist nun eine echte Indianerin, eine ganz waschechte Rothaut, die nur darauf wartet, den Tomahawk auszugraben und den Kriegspfad zu betreten, und ich zweifele auch gar nicht, dass sie den getöteten Feind sofort skalpieren würde.«
So dachte Arno manchmal, wenn er das rotbraune Mädchen am Lagerfeuer so beim Schachspiel beobachtete.
Endlich schlief er doch ein, und er musste eine gute Zeit geschlafen haben, als er durch ein leichtes Rütteln an der Schulter geweckt wurde.
Atalanta brauchte nichts zu sagen, nicht zu deuten, er selbst sah sofort das wunderbare Phänomen.
Ja, war denn hier in dieser Gegend der Vollmond viereckig?
Denn dort am westlichen Himmel hing ein viereckiger Mond.
»Ein erleuchtetes Fenster in der Felsenwand!«, flüsterte Atalanta.
Ja, zu dieser Ansicht war Arno inzwischen auch gekommen.
»Wie lange ist es schon erleuchtet?«
»Soeben erst flammte das Licht auf, ich habe Dich sofort geweckt.«
Und jetzt war an diesem erleuchten Fenster, so weit es auch entfernt sein mochte, ganz deutlich der scharf begrenzte Schatten eines Mannes zu sehen — in demselben Augenblick erlosch das Licht und kam nicht wieder.
»Nun«, sagte Arno, »jetzt wissen wir, dass wir jene Personen, deren Stimmen wir hörten, nicht in großer Entfernung und auch nicht oben auf dem Felsen zu suchen haben, sondern in diesem selbst. Der Felsen ist hohl, hat Fenster, die maskiert werden können, sicher ist auch eine Ausgangstür nach dem Wasser vorhanden, die müssen wir suchen. Das ist unser gutes Recht, sogar unsere Pflicht, denn diese Leute wohnen ja in unserem Eigentum. Morgen davon mehr. Es ist gleich Mitternacht. Willst Du Dich jetzt schlafen legen?«
Als wäre es ein Befehl gewesen, so hüllte sich die Indianerin sofort in ihre Decke und war dem Anschein nach augenblicklich eingeschlafen.
An dem verglimmenden Feuer saß Arno, vergaß ganz, seine Pfeife anzuzünden. Er sann und sann.
Auf dem Grunde des Sees die goldenen Schätze, dort der hohle Felsen, hier die Abdrücke eines zierlichen Damenstiefelchens — — würden sich alle diese Rätsel noch lösen?
Es war gegen drei Uhr, die schwarzen Schatten der Nacht begannen zu verblassen, als Atalanta jäh empor fuhr und in lauschender Stellung verharrte.
»Hörst Du etwas?«, flüsterte Arno nach einer Weile.
»Ja — nein — ich — fühle es, hier ist etwas, was nicht hierher gehört.«
»Ein Mensch?«
»Nein, ein Mensch ist es nicht — ein Tier.«
»O, Atalanta, wenn Du wegen jedes Tieres empor schrecken willst...«
»Das stört mich nur, dann aber auch im tiefsten Schlafe, wenn es mir mit Gefahr droht oder wenn es nicht in die Umgebung passt, es ist dann bei mir ein instinktives Gefühl, das mich... da, hörst Du?!«
Ja, Arno vernahm ein Plätschern im Wasser, von dem sie nur zehn Schritt entfernt saßen.
»Unser Boot!«
Er wollte aufspringen, wurde aber von der Indianerin zurückgehalten.
»Es wird uns nicht gestohlen, es ist ja kein Mensch, ein Tier.«
»Was für ein Tier?«
»Ein mir fremdes. Ich rieche etwas...«
Da erschollen Laute, mehrmals hintereinander — ein Bellen und doch nicht das Bellen eines Hundes, ein ganz anderes — und Arno kannte dieses seltsame Bellen und wusste es doch nicht gleich unterzubringen.
Sie standen leise auf und schlichen sich ans Ufer. Richtig, da sah Arno in der jetzt herrschenden Dämmerung eine dunkle Masse im Wasser herumschwimmen. Erkennen konnte er nichts deutlicher, dazu war es doch noch zu dunkel.
»Ein Seehund!«, sagte dagegen Atalanta sofort. Sie hatte einen solchen schon gesehen, aber noch nicht seine Stimme gehört.
Jetzt wurde es rasch heller, auch Arno erkannte den Kopf mit dem schnauzbärtigen Gesicht.
»Wahrhaftig, ein Seehund! Wie kommt der hier her? Der Seehund kann im Süßwasser allerdings leben, aber freiwillig begibt er sich nicht hinein, Salzwasser ist ihm lieber. Man hat noch in keinem Süßwassersee Seehunde gefunden.«
»Er ist hier eingesetzt worden, es ist ein zahmer.«
So betrug sich auch das Tier. Es hatte schon den Menschen kennen gelernt, und zwar ausnahmsweise nur von seiner besten Seite, d. h. es war von allen immer nur freundlich behandelt worden.
Nun hatte der Seehund bei seinem frühen Morgenausfluge auf dem Inselufer fremde Menschen gewittert, er machte sich bemerkbar, suchte Anschluss, wollte nähere Bekanntschaft machen, wusste nur noch nicht recht, wie er das möglichst geschickt anstellen solle, er war gewissermaßen etwas schüchtern.
So tummelte sich das Tier in der Nähe des Ufers herum, zeigte den beiden Zuschauern mit unverkennbarer Absicht seine erstaunlichen Schwimmkünste, jedes Mal, wenn er aus dem durchsichtigen Wasser wieder auftauchte, blickte das so überaus drollige, schnauzbärtige Gesicht mit den großen, klugen, schönen Augen nach den beiden Menschen, ob sie es auch gesehen hätten, bellte jauchzend, nieste in komischer Weise — und dann blieb er einmal längere Zeit unter Wasser, man sah ihn wie einen Pfeil hin und her schießen, und wie er wieder auftauchte, hatte er im Maule einen großen Hecht. Aber er verschlang ihn nicht, sondern brachte ihn ans Ufer, legte den zappelnden Fisch dicht zu den Füßen der beiden Zuschauer nieder und machte eiligst, dass er wieder in sein Element kam, aber jauchzend vor Vergnügen.
Und da plötzlich jubelte auch Atalanta auf, wie es Arno von dieser immer so tiefernsten Indianerin noch nie gehört hatte.
»Er ist dressiert, für seinen Herrn Fische zu fangen! Ach, ist das reizend!«
»Dazu braucht ein Seehund gar nicht dressiert zu werden!«, entgegnete Arno. »Das tut jeder Seehund von ganz allein, sobald er nur einmal in einem Menschen seinen Herrn oder besser seinen Freund erkannt hat, der ihm wohl will. Dem bringt er dann von ganz allein immer Fische, und zwar macht er da eine sorgfältige Auswahl, er bringt ihm immer nur die besten, fettesten, überhäuft seinen menschlichen Freund in jeder anderen Weise mit Aufmerksamkeiten und Zärtlichkeiten. O, ich kann etwas über Seehunde erzählen! Ich habe einmal auf Spiekeroog, einer Nordseeinsel, einen Mann kennen gelernt, einen sehr gebildeten Herrn, der sein Leben nur noch den Seehunden widmete, ihnen aber ihre Freiheit lassend. O, da habe ich etwas zu sehen bekommen! Man wagt es gar nicht zu erzählen, es klingt fast märchenhaft. — Sieht das nicht ganz so aus, als wollte uns das Tier auffordern, ihm zu folgen?«
Auf dieser Insel wollten sie sowieso nicht bleiben. Sie hoben das Boot ins Wasser. Ja, der Seehund schwamm voraus, blickte sich um, bellte einladend, ihm zu folgen, und wenn man es tat, so zeigte er schnell wieder einmal seine Kunstfertigkeit, tauchte unter dem Boote durch und brachte Fische, die er sich aus dem Maule nehmen ließ, sie waren ganz unversehrt.
* Der Seehund schwamm der Felswand zu. In einiger Entfernung, als er noch bequem hinaufblicken konnte, musterte Arno durch sein Taschenfernrohr die Wand. Aber noch zuverlässiger, wie er schon wusste, waren die unbewaffneten Augen seiner indianischen Gefährtin, und auch die konnte in der glatten Mauer nicht die geringste Fuge entdecken.
Immer weiter lockte der Seehund in spielender Weise nach der Felswand, bis er dicht an dieser für längere Zeit unter Wasser verschwand, wieder auftauchte, um zu sehen, ob man ihm auch gefolgt war.
Und dann erkannte man seine Absicht. Er zeigte den beiden Menschen das Loch, das der göttliche Steinmetz für ihn gelassen, lud sie ein, ihn doch einmal zwischen seinen vier Wänden zu besuchen.
Die Stelle war eine bedeutende Strecke von jener entfernt, die Arno als natürliches Telefon durch ein Kreuzchen markiert hatte. Der See hatte zwar sehr klares Wasser, aber auf den Grund konnte man doch nur an flachen Stellen sehen, weil er eben sehr tief war und einen ganz schwarzen Basaltboden hatte.
Hier gewahrte man in einer Tiefe von etwa sechs Metern in der noch immer ganz glatten Felswand ein ziemlich kreisrundes Loch von etwa einem Meter Durchmesser. Das heißt, man sah es erst, wenn man wusste, dass sich dort ein solches Loch befand, wenn man es suchte. So beim zufälligen Hineinblicken in das dunkelblaue Wasser hätte man es schwerlich entdeckt.
Der Seehund drückte sie gewissermaßen mit der Nase darauf, indem er mehrmals in das Loch hineinschwamm und wieder zum Vorschein kam, immer längere Zeit ausbleibend, und wenn er dann wieder an die Oberfläche kam und mit den klugen Augen die Menschen anblickte, unter dem dem Seehunde eigentümlichen Niesen, glaubte man ihn ganz deutlich fragen zu hören: »Habt Ihr mich verstanden?«
»Ja, wir haben Dich verstanden!«, entgegnete Arno denn auch. »Ja, Atalanta, da werde ich einmal die Schwimmpartie antreten.«
Mit unverkennbarer Angst in den großen Augen beobachtete ihn die Indianerin, wie er schon seinen Gürtel fester schnallte, ohne von diesem das Revolverfutteral zu entfernen.
»Lass mich den unterseeischen Tunnel untersuchen, Arno!«, bat sie dann.
»Kannst Du gut tauchen?«
Sie bejahte. Dass sie ausgezeichnet schwimmen konnte, hatte er schon beobachtet. »Wie lange hältst Du unter Wasser aus?«
»Das... weiß ich nicht. Ich glaube drei Minuten.«
»Oho, Mädchen. was glaubst Du wohl, drei Minuten!«
»So lange habe ich den Atem schon angehalten.«
»Kannst Du das? Aber unter Wasser, wenn man dabei arbeiten muss, ist das doch etwas ganz anderes. Bist Du schon sechs Meter tief getaucht?«
»Schon oft, noch viel, viel tiefer.«
»Mädchen, jetzt flunkerst Du, ich sehe es Dir gleich an den Augen an!«, lachte Arno, und sie senkte denn auch beschämt den Kopf.
»Nein, Atalanta. das kannst Du nicht verlangen, dass Graf Felsmark seinen Gefährten, ob nun männlich oder weiblich, vorausschickt, um erst eine Gefahr untersuchen zu lassen, ob's nicht vielleicht dabei ans Leben gehen kann. Sofort, wenn ich ins Wasser springe, fange ich sekundenweise an zu zählen, bin ich bei dreißig noch nicht durch den Tunnel, dann drehe ich um, eine Minute kann ich es aushalten...«
»Du kannst in diesem Tunnel nicht umdrehen.«
»Hm, da hast Du recht. Dann schwimme ich eben rückwärts, stoße mich immer mit den Händen nach hinten. Ich werde auch nur bis fünfundzwanzig zählen, ehe ich den Rückweg antrete. Zähle Du selbst bis sechzig, und wenn ich dann nicht zurück bin, dann — dann...«
»Dann kommst Du nie wieder.«
»Nein, ganz im Gegenteil, dann bin ich schon drüben wieder an der Oberfläche.«
»Oder bist unterwegs stecken geblieben.«
»Wie denn stecken geblieben?«
»Was gibst Du mir für eine Garantie, dass das nicht passieren kann?«
»Ja, Atalanta, da nützt doch gar kein Reden — kurz und gut, ich gehe natürlich voraus, um die Sache erst einmal zu untersuchen, dann kommst Du nach...«
Plötzlich war die Indianerin mit einem Satze, der aber das Boot kaum ins Schwanken brachte, kopfüber ins Wasser gesprungen, schoss wie ein Pfeil hinab und verschwand in dem Loch.
Nun war nichts mehr zu machen. Erst nachträglich fing Arno an zu zählen, hauptsächlich, um an nichts anderes denken zu müssen.
»21 — 22 — 23 — 24 —«
Da tauchte Atalantas Kopf aus dem Loche schon wieder auf, ihr ganzer Körper folgte nach, sie arbeitete sich durch Schwimmbewegungen schnell empor.
»Eine Kleinigkeit — der Tunnel ist kaum zwei Ellen lang — erweitert sich sogar noch.«
Zunächst aber nahm Arno den aus dem Wasser sehenden Kopf in komischer Weise beim Ohr.
»Ist das der Gehorsam, den meine Sklavin mir zugeschworen hat, wie? Nennt man das Subordination, he? Ich gebe Dir drei Tage Mittelarrest und außerdem den Hosenbandorden für Kunst und Wissenschaft in und außerhalb des Krieges. — Na, wie sah's denn da drüben im Jenseits aus?«
Die junge Indianerin zeigte wieder einmal, dass sie auch herzlich lachen konnte.
»Wie in einem Märchenlande.«
»Das ist eine sehr weitbegrenzte Beschreibung.«
»Nein, Arno, ich will nichts verraten. Ich möchte dann Dein Staunen sehen.«
»Ist es denn gar so wunderbar?«
»Fabelhaft.«
»Sind Menschen drüben?«
»Nein, keine Menschen, davon hätte ich Dir natürlich gesagt.«
»Nicht? Schade. Dann müssen wir sie suchen. Die müssen uns doch Miete zahlen. Kann man drüben auch etwas sehen? Ich mache Dich nämlich darauf aufmerksam, dass ich keine solchen Katzenaugen wie Du habe, die im Finstern sehen können.«
»Es ist hell genug.«
»Künstliche Beleuchtung?«
»Ja. Eine Petroleumlampe brennt.«
»Atalanta, jetzt flunkerst Du schon wieder, das sehe ich Dir immer gleich an!«
»Bitte, ich möchte nichts verraten.«
»Na dann Bahn frei! Jubb!«
Auch Arno war mit einem Kopfsprung über Bord gegangen.
Arno schwamm durch den kurzen Tunnel, tauchte wieder auf und... glaubte seinen Augen nicht trauen zu dürfen.
Es war ein Wasserbassin von etwa dreißig Meter Durchmesser. Oben an der hohen Kuppeldecke strahlte eine elektrische Bogenlampe intensives Licht aus. Ringsherum lief eine breite Galerie. An dieser lagen drei Fahrzeuge: ein gewöhnliches Boot, eine venezianische Gondel und ein modernes Motorboot. Auf der Galerie selbst standen zwei Automobile von verschiedenen Größen. Links und rechts befanden sich in der Wand je eine schmiedeeiserne Tür. Das Wasserbassin verlief nach Westen in einen schnurgeraden Tunnel, der ebenfalls hüben und drüben von einer breiten Galerie begleitet war. Etwa alle dreihundert Meter brannte an der Decke eine Bogenlampe. Arno zählte fünf oder sechs, dann verloren sich die Lampen in der Ferne als Fünkchen.
Als auch Atalanta auftauchte, saß Arno auf der niedrigen Galerie und hatte nur noch seine Wasserstiefel in dem nassen Elemente baumeln. Sie setzte sich neben ihn.
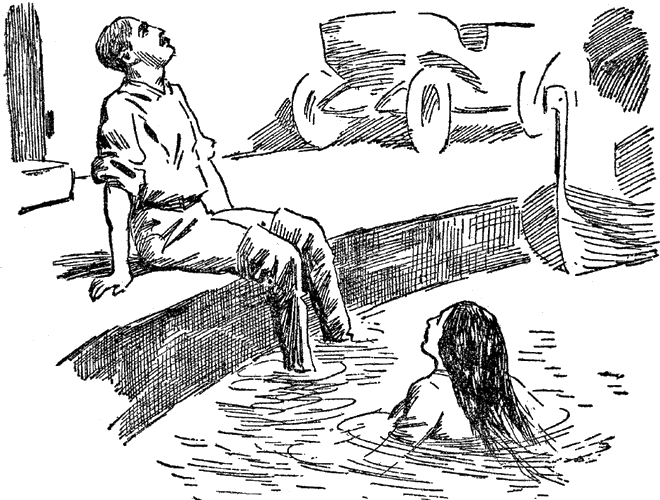
»Nun, was sagt mein Bruder dazu?«
»Dein Bruder«, entgegnete Arno, »kann hierzu nur eines sagen: da staunt der Laie, selbst der Kenner stutzt!«
Durch so etwas ließ sich der Graf also nicht aus der Fassung bringen, er behielt auch noch seinen Humor dabei.
»Ja«, fuhr er in demselben Tone fort, »da hat man nun so etwas in seinem Hause und hat gar keine Ahnung davon! Wo ist denn unser Seehund geblieben?«
Der ließ sich nicht mehr blicken.
»Gut, dann sehen wir uns ohne seine weitere Führung um. Benutzen wir erst einmal die Türen. Und denke immer daran, Atalanta, dass wir hier in unserem eigenen Hause sind. Wer uns begegnet, der soll erst einmal seinen Mietkontrakt zeigen — ist der Mann höflich, gut, dann lassen wir mit uns reden — setzt er sich aber auf die Hinterbeine, dann rufen wir sofort die Polizei und lassen ihn an die frische Luft setzen — und wenn zufällig kein Schutzmann in der Nähe ist, dann schmeißen wir den Kerl einfach selber hinaus.«
Unter solchen Worten hatte sich Arno nach der ihm nächsten Tür begeben, mehr ein Tor zu nennen, aus schmiedeeisernen Platten zusammengefügt, wenn nicht aus einem Stück gewalzt. Aber die Tür zeigte kein Schloss, nicht einmal eine Klinke, sie ließ sich nicht zurückdrücken.
»Auch keine Klingel, kein Klopfer? Das wird hier anders werden, wenn ich die Administration erst übernehme. Außerdem gehört sich ein Schild mit dem Namen des Einmieters daran. Nun, ehe wir uns mit Nachdruck anmelden, wollen wir erst einmal die Tür der Nachbarpartei besehen, ob dort mehr Ordnung herrscht.«
Sie gingen nach der anderen Seite hinüber. Hier war die Tür ebenso beschaffen, aber — sie ließ sich aufdrücken!
Eine breite Steintreppe, die ebenfalls wieder durch eine elektrische Bogenlampe erleuchtet war, führte empor.
»Arno, wie ist das möglich?!«, flüsterte die Indianerin, wenn auch ohne Erregung.
»Kind, frage mich nicht.«
»Wo bekommen die das elektrische Licht her?«
»Bist Du auch schon so modern, dass dies Dein erster fragender Gedanke ist? Meiner auch. Aber, wie gesagt, Du fragst mich vergeblich. Und was helfen da alle Erörterungen? Lass uns mit nüchternen Augen Umschau halten und die Erklärung möglichst an der richtigen Quelle suchen!«
In der Wand, welche nach der Seeseite lag, waren ab und zu tiefe Nischen, und als Arno in ihnen Handgriffe sah, ging er in eine solche und untersuchte den Handgriff; er musste erst einen Riegel zurückschieben, dann konnte er eine Platte umlegen, wodurch eine Fensteröffnung entstand. Vor und unter ihm lag der inselreiche See in seiner ganzen Pracht.
Es war eine dünne Eisenplatte, die außen mit einer grauen Farbe angestrichen war, ganz dem Aussehen der Felswand entsprechend. Offenbar war es auch dieselbe Gesteinsart, Basalt, pulverisiert und so zu einer Farbe hergerichtet, dass sich dieser Anstrich auch mit der Umgebung veränderte, mit ihr verwitterte, denn jeder Stein sieht ja überhaupt im trockenen Zustande anders aus als im nassen. Diese Fenstermaskierung hier aber machte alle solche Veränderungen mit.
Arno setzte die vorzüglich eingepasste Platte wieder ein und stieg mit Atalanta die Treppe weiter empor.
Sie endete in einem ganzen Labyrinth von Gängen, zu deren Beleuchtung hier auch einmal elektrische Glühbirnen verwandt waren, alle brennend.
»Die haben hier nicht nötig, mit dem elektrischen Licht zu sparen, und es soll mich gar nicht wundern, wenn die sich die elektrische Kraft selbst erzeugen. Übrigens sind diese Glühbirnen von einer Art, wie ich sie noch gar nicht kenne. Da ist kein Glühfaden darin zu sehen, sondern die ganze Kugel scheint zu glühen. Die müssen hier ihre eigene Erfindung haben.«
Dass sie sich in dem Labyrinth verirrten, deswegen brauchte sich Arno nicht zu sorgen, er brauchte auch keine Zeichen zu machen. Die Indianerin fand den Weg, den sie einmal gegangen, mit unfehlbarer Sicherheit einfach durch ihren instinktiven Orientierungssinn.
Übrigens war ein breiterer Gang vorhanden, den durchschritten sie und kamen wieder in eine weite, kreisrunde Halle, die ganz offenbar zum Theater eingerichtet war, und zwar war es ein Amphitheater.
Ringsherum zogen sich steinerne Stufen, zum Teil mit Kissen belegt, im Hintergrunde war die Bühne, mit einem dunklen Vorhang verschlossen.
»Ja, um Gottes willen, wer hat denn dieses gewaltige Amphitheater, das doch mindestens dreitausend Zuschauer fasst, aus dem Felsen ausgemeißelt?!«, rief jetzt Arno staunend aus.
Vergebliche Frage! Und ebenso vergeblich war es, jetzt zu fragen, ob sich dieses Theater manchmal vielleicht mit Zuschauern füllte, mit Tausenden.
Den Kissen nach war dies allerdings zu bezweifeln. Denn es mochten nicht mehr als zwei Duzend sein, welche auf den steinernen Stufen lagen.
»Ja, hier ist das Theater, von dem wir gestern haben sprechen hören, die lassen sich hier Vorstellungen geben, Opern und Konzerte und Balletts und alles. Wo sie nur die Schauspieler und sonstigen Künstler herbekommen? Na, die holen sie einfach per Automobil hierher.«
»Von wo?«, fragte Atalanta.
»Irgendwo von der Außenwelt, jedenfalls aber von Westen her. Der Wassertunnel geht doch jedenfalls durch das ganze Felsengebirge, mindestens bis nach Puebla.«
»Die fremden Schauspieler würden dieses Geheimnis hier dann aber doch bald an die Öffentlichkeit bringen.«
»Hm. Da hast Du eigentlich recht. Da möchte man bald an eine eigene Truppe denken, die entweder hier gefangen gehalten wird oder die überhaupt mit zu dem ganzen Geheimnis gehört. Was steht denn dort unten für ein Ding?«
Unten in der Mitte des Trichters, mit dem man dieses Amphitheater wohl vergleichen konnte, stand ein orgelähnliches Instrument, ein kleines Harmonium.
Arno und Atalanta schritten hinab, sie brauchten nicht die breiten und hohen Stufen, die als Sitze dienten, zu benutzen, hin und wieder war auch noch eine richtige, bequeme Treppe eingemeißelt.
Ja, es war ein kleines Harmonium. Aber doch ein ganz besonderes. Zu wenig Tasten und zu viele Register.
Arno wollte, sorglos wie immer, einen Akkord anschlagen. Doch die Tasten ließen sich nicht niederdrücken. Wohl aber eine einzige Taste, die dann in dieser Lage verharrte.
Einen Ton hatte sie nicht von sich gegeben, dagegen erlöschte plötzlich die Bogenlampe, die auch hier an der Drecke strahlte, Finsternis erfüllte den weiten Raum.
Dafür aber flammten auf dem Vorhang leuchtende Buchstaben auf. Die dadurch gebildeten Worte lauteten:
Abendsonne die Szenerie einer indischen Stadt, vielleicht Delhi, die Straße vor einem halb in Trümmern liegenden Buddhatempel.
Straßenpassanten gingen hin und her, reichgekleidete Inder, halbnackte Kulis, europäische Herren und Damen, zu Fuß und zu Pferd und in Equipagen.
Da eine lärmende Musik von Pfeifen, Trommeln und anderen misstönenden Instrumenten, eine indische Gauklerbande zog auf, aus Männern, Weibern und Kindern bestehend, mit ihren Habseligkeiten beladen, von einigen Ziegen, dürren Hunden und einem Mitleid erweckenden Kamel begleitet.
Ein durchlöcherter Teppich wurde ausgebreitet, noch einmal möglichst viel Spektakel gemacht, die indische Straßenjugend kam herangestürmt, auch Erwachsene stellten sich hin.
Der Guru, der Meister der Bande, begrüßte das hochverehrte Publikum mit einer halb indischen, halb englischen Anrede, wobei die widerwärtigsten Zoten nie fehlen dürfen. Und die Vorstellung begann, wie gewöhnlich immer eingeleitet durch das Experiment mit den unerschöpflichen Wasserkrügen.
Wir wollen der Vorstellung nicht beiwohnen, nicht hier. Wir werden uns noch an anderer Stelle mit indischen Gauklern beschäftigen, in der Wirklichkeit.
Ja, aber war denn das hier nicht Wirklichkeit?
Arno war wieder einmal starr vor Staunen.
Er zweifelte ja nicht, dass es sich nur um eine kinematografische Wiedergabe handelte — und doch, er hätte daran zweifeln mögen.
Er hatte schon viel Kinematografie gesehen, aber so etwas von Deutlichkeit noch nie. Hier fehlte jedes Flimmern, hier... es waren dennoch richtige Menschen, die dort spielten!
Mit einem Male glaubte Arno dies wirklich, er musste hingehen.
Nein, er fühlte mit der Hand einen festen Untergrund. Und dann glaubte er doch wieder, dass dies nur eine Glasscheibe sei, hinter welcher sich die Schauspieler produzierten. Denn auch hier in der dichtesten Nähe verlor nicht das Geringste an Wirklichkeit. Auch die Sprache nicht, jedes andere Straßengeräusch, das Knallen der Peitsche und so weiter.
Arno begab sich nach dem Schaltinstrument zurück. Der Gaukler war eben dabei, einen dürren Hund in ein fettes Schwein zu verwandeln, und als er den Korb wieder hob, hatte die Sau sieben junge Ferkel, die munter und quiekend herumliefen — eine hypnotische Suggestion, die auf die Zuschauer nur innerhalb eines gewissen Kreises wirkt, für den, der dieser Suggestion unterliegt, nicht das Geringste an Wirklichkeit einbüßt, sich aber selbstverständlich nicht fotografieren lässt.
Eine Taste ließ sich nicht mehr niederdrücken, wohl aber ein Register ziehen. Die Vorstellung brach nicht plötzlich ab, das Lichtbild erlosch nicht, wie man erwarten konnte, sondern über den sich noch bewegenden Personen rollte wieder der Vorhang herab, was aber auch nur eine kinematografische Täuschung war.
Eine Taste gedrückt, und der Vorhang rollte wieder auf, ohne diesmal das Folgende angekündigt zu haben.
Ein Wald. Von links kam eine Elfe gesprungen, von rechts ein Kobold.
»He, Geist, wo geht die Reise hin?« Und die Elfe antwortete:
Über Täler und Höhn,
Durch Dornen und Steine,
Über Gräben und Zäune,
Durch Flammen und Seen,
Wand'l ich, schlüpf ich überall,
Schneller als des Mondes Ball...
Shakespeares »Sommernachtstraum«. Aber schon der zweite Aufzug. Arno bemerkte, dass er das Register nicht weit genug herausgezogen hatte. Als er es nun wieder etwas hineinschob, verschwammen die Lichtbilder einmal und dann kam gleich eine Szene aus dem dritten Akte.
Jetzt endlich hatte er es richtig bemerkt, dass es wirklich nur Lichtbilder waren, die aber immer noch nicht das Allergeringste an Realität einbüßten.
»Das ist fabelhaft!«, staunte er immer wieder.
Er zog ein anderes Register, und da erbrauste die weite Halle von mächtigem Orgelklang und Chorgesang, und dazwischen wieder sangen süße Engelsstimmen.
Schnell schob Arno das Register wieder zurück, und das Kirchenkonzert verstummte.
»Nein«, sagte er ganz kleinlaut. »wir wollen lieber gar nicht erst anfangen. Hier würde man niemals fertig. Das heben wir uns für später auf.«
»Diese mächtigen Klänge müssen doch von den anderen gehört worden sein!«, meinte Atalanta.
»Das ist noch die Frage. Atalanta, wer das alles hier erfunden und konstruiert hat, das muss ein Geist sein, gegen den der Erfinder Edison ein Waisenknabe ist. Schon dieses kinematografische und phonographische Theater sagt mir genug, aber ich möchte noch mehr sehen.«
Sie verließen das Amphitheater wieder, kamen an eine andere, weiter nach oben führende Treppe, benutzten sie aber nicht, denn sie wollten erst in dieser Etage gründlich Umschau halten.
Wieder kam eine schwere, eiserne Tür, die sich jedoch zurückdrängen ließ, und wiederum wartete ihrer die größte Überraschung.
Es war ein Museum, welches die Völkertypen der ganzen Erde enthielt, und zwar dieser Saal hier die der wilden oder doch noch unzivilisierten Völker.
Viele Hunderte von Menschen präsentierten sich in ihrer natürlichen Gestalt, sie waren zu Szenen aus ihrem Leben arrangiert.
Hier sah man einen Kaffernkral, die Männer fertigten Waffen oder lungerten herum, die Weiber buken Durrabrot, die Kinder spielten mit Hunden oder miteinander — dort das Lager von zwerghaften Buschmännern, auch wieder eine ganze Familie — dort trugen Fidschiinsulaner ein Boot — dort ließ sich ein Papua sein üppig wucherndes Haar frisieren — dort untersuchte ein Australneger die Rinde eines Gummibaumes nach schmackhaften Würmern — dort in und vor einem Wigwam eine Apachenfamilie, die Krieger rauchten gravitätisch, die Weiber stickten und gerbten, eine junge Mutter gab ihrem Baby die Brust...
Es lässt sich nicht beschreiben! Viele, viele Hunderte von Figuren, alle in Lebensgröße mit der Szenerie ihrer Heimat, ja die ganze Erde war hier vertreten, der Eskimo Grönlands und der Eskimo Kamtschatkas, der Patagonier wie der Feuerländer.
Woraus waren diese Figuren? Natürlich aus Wachs oder aus einer sonstigen Masse.

Doch bald änderte Arno seine Ansicht, und Atalanta hatte es überhaupt sofort erkannt, Arno hatte es ihr zuerst nur nicht glauben wollen, musste sich aber doch überzeugen lassen.
Es waren echte Menschen aus Fleisch und — Blut, möchte man fast sagen. Das waren echte Haare, echte Hautporen, echte Augen. Freilich alles steinhart. Mit Ausnahme der Haare.
Ja, das waren echte Menschen, die einst gelebt hatten, die man mitten im Leben hatte erstarren lassen oder wohl vielmehr im Tode, sie dann noch nachträglich in natürliche Stellungen bringend und dann erst sie erstarren lassend.
So hatte sich Arno geäußert.
»Nein, die leben wirklich noch, die sind nur in Starrkrampf versetzt!«, ließ sich da eine Stimme vernehmen.
Wie vom Blitz getroffen fuhren die beiden herum.
Auch Atalanta war in die Betrachtung dieser Figuren so versunken gewesen, dass sie das Nahen des Fremden nicht gemerkt hatte.
Sie kannte ihn auch nicht, höchstens der Stimme nach — und dem Geruche — wohl aber war es für Arno ein alter Bekannter, freilich kein »guter«.
»Professor Dodd!!«, stieß Arno in grenzenlosem Staunen hervor.
Der Mephistopheles im eleganten Gehrockanzug verbeugte sich, versuchte dabei zu lächeln, woraus aber nur eine grinsende Fratze wurde
»Ich habe die Ehre, Sie in Ihrem eigenen Hause begrüßen zu dürfen.«
»Professor Dodd! Ist es möglich?!«
»Sie zweifeln doch nicht, dass ich es in Fleisch und Blut bin, was von diesen Schaustücken ja allerdings auch gilt...«
»Was sagten Sie vorhin?! Diese Gestalten wären noch lebendig, nur in Starrkrampf versetzt?!«
»So ist es.«
»Nicht möglich!«
»Ich versichere es Ihnen. Einige sind schon mehr als zwanzig Jahre so erstarrt, und ich werde Ihnen dann beweisen, dass ich sie doch wieder lebendig machen kann. Natürlich ist es kein gewöhnlicher Starrkrampf, sondern ich verstehe dabei alle Lebensfunktionen aufzuheben.«
»Es — ist — nicht — möglich!«, flüsterte Arno nochmals, und dabei fühlte er kaltes Entsetzen über seinen Körper rieseln, fühlte schon seinen eigenen Leib in ewigem Scheintod erstarren.
»Darf ich Sie bitten, mir in mein Studierzimmer zu folgen. Über alles Weitere werden wir uns wohl leicht einigen. Ja, ich bin Ihr Mieter, und mit dem Preise, den ich Ihnen dafür zahle, werden Sie wohl zufrieden sein.«
Halb im Traume folgte Arno, noch ganz unter dem Eindruck des soeben Gehörten und Gesehenen stehend, dessen Fürchterlichkeit er nun erst ganz erfasste.
Sie traten in ein enges Kabinett, das nur einen Schreibtisch und einige mit Büchern besetzte Regale enthielt.
»Bitte, wollen Sie Platz nehmen?«
Sie setzten sich auf die vorhandenen Stühle, der Professor sich ihnen gegenüber, dabei gentlemanlike, wie es die Yankees lieben, die Hände in den Hosentaschen.
»Also Sie hausen hier?!«, eröffnete Arno das Gespräch.
»Ja. Nun wissen Sie auch, weshalb mir so viel am Besitz des Sklavensees und seiner Umgebung gelegen ist. Im Übrigen wollen wir die Sache ganz kurz machen. Es fällt mir gar nicht mehr ein, Sie jetzt noch um Ihre Zustimmung zu bitten, sondern das mache ich jetzt ganz einfach so...«
Blitzschnell zog er die Hände aus den Hosentaschen, in jeder funkelte etwas. Er hielt sie dicht vor die Gesichter der beiden, ein leises Knacken, und zwischen seinen Fingern sprudelte es wie weißer Gischt, wie ein Nebel hervor.
Bei Arno war die Wirkung die, dass er sofort im Stuhle zurücksank und dann auch noch zu Boden schlug. Ebenso war Atalanta sofort zurückgesunken, saß Momente mit geschlossenen Augen da, dann aber schlug sie diese wieder auf, sprang empor und schaute mit wirren Blicken um sich.
Die Folge dieses Aufstehens war nun wieder, dass auch der Professor aufsprang und mit allen Zeichen der Bestürzung die Indianerin anblickte.

»Himmel und Hölle«, zischte er, »bei diesem Weibe wirkt das unfehlbare Mittel nicht, da muss ich...«
Er wollte wieder in die Tasche greifen, aber noch schneller griff die Indianerin nach ihrem Messer, riss es aus der Scheide, allerdings mit sehr unsicheren Bewegungen — jetzt aber hatten ihre irrenden Augen den Professor wieder gefunden, furchtbar flammte es in diesen Augen auf, sie taumelte auf ihn zu, das Messer zum Stoße erhoben... und da zog es der Professor vor, mit einem schnellen Satze aus dem Zimmer zu springen und hinter sich die eiserne Tür zuzuschmettern. Im nächsten Moment hätte ihn das Messer durchbohrt.
Atalanta taumelte nochmals, raffte sich empor, dann stürmte sie mit erhobenem Messer nach der Tür, prallte dagegen, als wäre sie blind; nun schien sie ihre Schwäche aber auch überwunden zu haben, sie suchte nach einer Klinke, versuchte die Tür aufzudrücken, doch vergeblich. Dann eilte sie zu Arno, der regungslos am Boden lag. Mit einem unartikulierten Schrei beugte sich die Indianerin über ihn.
Tot war er nicht, er atmete, sein Puls ging regelmäßig. Nur eine Betäubung hatte ihn befallen, aus der ihn Atalanta aber auch nicht zu wecken vermochte.
Da klopfte es gegen die Tür. Die Indianerin richtete sich auf und machte auch ihren Revolver schussbereit.
»Miss Atalanta!«, erklang draußen Professor Dodds Stimme, nur wenig gedämpft.
»Was gibt es?«
»Sie wollten mich wohl erstechen?«
Atalanta blieb dieser törichten Frage die Antwort schuldig.
»Das wäre eine schöne Geschichte geworden! Ich habe doch nur einen Scherz gemacht.«
»Ach so!«, ging diese moderne und dem Charakter nach dennoch ganz echte Indianerin gleich darauf ein.
»Ja, ich habe Sie betäuben wollen, aber nur, um Ihnen dann die größte Überraschung zu bereiten.«
»Das hätten Sie aber vorher sagen sollen.«
»Dann wäre es doch keine Überraschung gewesen. Ich wollte Sie, während Sie schliefen, in ein Märchenland versetzen.«
»Wohl in Ihr Völkermuseum?«
»In mein Völkermuseum? Was meinen Sie damit?!«
»Nun, sie wollten uns auch präparieren und konservieren, nicht tot und nicht lebendig.«
»Aber mein Fräulein, wo denken Sie hin! Halten Sie mich solch einer Schandtat für fähig?«
»Ich bitte Sie um Entschuldigung, wenn ich solch einen Verdacht gefasst hatte!«, konnte diese Indianerin auch höhnisch werden.
»Nein, ich wollte Ihnen wirklich nur eine angenehme Überraschung bereiten.«
»Ja, ja, ich bin jetzt völlig davon überzeugt. Bitte, kommen Sie doch wieder herein, setzen Sie Ihr Experiment fort.«
»Sie wollen mich töten.«
»Ich? Weshalb denn?«
»Sie sind eine Indianerin.«
»Das bin ich allerdings der Geburt nach, aber.... wie können Sie denn argwöhnen, dass ich Sie töten wollte. Bitte, kommen Sie doch herein.«
»Nein, Miss, ich kann Ihnen nicht trauen. Es handelt sich nur um eine kleine goldene Kapsel, die ich dort drin verloren haben muss.«
Atalanta hatte das glänzende Ding, so groß wie eine Walnuss, schon auf dem Teppich liegen sehen.
»Ja, die liegt hier.«
»Bitte, wollen Sie mir dieselbe geben.«
»Gewiss, sehr gern.«
Aber Atalanta hob sie nicht auf, sondern blieb mit Revolver und Messer bereit stehen.
»Ja, nun müssen Sie aber die Tür aufmachen!«, sagte sie.
»Geehrte Miss, das... ist eine heikle Geschichte, das mit der Tür aufmachen.«
»Ach, Sie denken wohl, ich tue Ihnen etwas?«
»Jawohl, das denke ich. Also ich öffne die Tür lieber nicht. Sie müssen mir die Kapsel auf eine andere Weise geben.«
»Auf welche Weise?«
»Sie werfen sie durch das Fester.«
»Ich sehe doch gar kein Fenster!«, stellte sich Atalanta unwissend.
»In der Nische, die Sie doch sehen, ist ein Handgriff, an dem brauchen Sie nur zu ziehen.«
»Gut, das werde ich machen.«
»Unten ist der See. Ich lasse ein Boot vorfahren. Es ist Ihnen doch eine Kleinigkeit, die Kapsel in das Boot zu werfen. Oder es würde auch nichts schaden, wenn sie ins Wasser fällt, ich habe einen Taucherapparat, dann lasse ich sie...«
»Nein, nein, ich werde das Boot schon treffen. Ja, und was dann weiter?«
»Nun, dann öffne ich eben die Tür.«
»Und dann?«
»Dann können Sie gehen, wohin Sie wollen. Der Herr Graf wird sehr bald aus seiner Betäubung wieder erwachen.«
»Hm. Und wenn ich Ihnen die Kapsel nun nicht gebe?«
»Machen Sie keine Geschichten!«, erklang es draußen ungeduldig, ja, Atalanta konnte auch eine große Angst heraushören. »Was wollen Sie denn mit der Kapsel?«
»Und wenn ich sie Ihnen nun nicht gebe?«, wiederholte Atalanta.
»Dann... müssen Sie hier drin einfach verhungern. Oder ich habe auch noch genug andere Mittel, mich in den Besitz der Kapsel zu setzen.«
»So tun Sie es doch.«
»Jawohl, werde ich auch gleich. Ich leite einfach ein betäubendes Gas in dieses Zimmer.«
Die Indianerin wusste sofort, dass er dies nicht konnte. Dazu war jedenfalls keine Öffnung vorhanden. Sonst hätte er nicht erst von Verhungern gesprochen, hätte doch überhaupt nicht erst zu bitten brauchen, die Kapsel zum Fenster hinauszuwerfen.
Das war hier ein Fall, wo er sich festgefahren hatte.
»Na, dann leiten Sie doch das Gas herein.«
»Es erfordert einige Zeit und ich muss die Kapsel augenblicklich haben.«
»Wozu denn?«
»Das... interessiert Sie nicht. Faktisch nicht. Ich muss sofort nach Pueb... anderswohin.«
Nach Puebla hatte er sagen wollen. Nach dort ging natürlich der Tunnel, mit dem Motorboot wie mit dem Automobil zu benutzen, dort hatte er Bahnanschluss.
Jetzt hob Atalanta die goldene Kapsel auf, war aber dabei rückwärts gegangen, die Tür nicht aus dem Auge lassend.
»Nein, ich gebe Ihnen die Kapsel nicht!«, sagte sie, diese dabei zu öffnen suchend, was ihr auch sofort gelang.
Sie enthielt ein ganz dünnes, vielfach zugefaltetes Pergamentpapier, das mit Zahlen bedeckt war.
»Ja warum denn nur nicht, die Kapsel ist Ihnen doch gar nichts nütze!«, erklang es draußen immer ungeduldiger.
»Erst will ich einmal sehen, was darin ist.«
»Ach, Sie bekommen sie ja gar nicht auf, höchstens mit Gewalt, und der Inhalt interessiert Sie nicht.«
Hiermit wusste Atalanta, dass der Professor sie draußen nicht beobachten konnte.
Sie las die Zahlen langsam, manchmal dabei die Augen schließend. Durch schnelles Öffnen der Tür konnte sie dabei aber nicht etwa überrascht werden, und ihre Hand wäre sicher die allerschnellste gewesen.
»Zum Teufel noch einmal, wollen Sie mir die Kapsel nun geben oder nicht!«, erklang es draußen mit wahrer Verzweiflung, wie man sie diesem die Situation immer und überall beherrschenden Mann gar nicht zugetraut hätte.
Diese Kapsel musste für ihn einen ungeheuren Wert besitzen, und noch mehr: Er hatte sicher wirklich gar keine Zeit mehr zu verlieren, musste wahrscheinlich noch einen bestimmten Zug erreichen, und ohne diese Kapsel hatte die Reise keinen Zweck.
Atalantas Entschluss war gefasst. Dem ersten Anschein nach handelte sie sehr töricht, in Wirklichkeit war es das Klügste, was sie tun konnte.
»Gut, ich werde die Kapsel zum Fenster hinauswerfen, sorgen Sie für ein Boot. Aber dann lassen Sie uns doch frei?!«
»Selbstverständlich.«
»Das ist mir nicht so selbstverständlich. Glauben Sie an einen Gott?«
»An einen Gott? Nnnnnein!«, erklang es zögernd.
Das war auch klug gewesen, es hätte nämlich komisch geklungen, wenn dieser Mann ja gesagt hätte.
»An was glauben Sie sonst?«
»An... ich gebe Ihnen einfach mein Ehrenwort, das ich noch nie gebrochen habe.«
»Das lässt sich hören. Also wir sind dann frei?«
»Auf mein Ehrenwort.«
»Sie öffnen uns hier die Tür?«
»Auf mein Ehrenwort.«
»Sie werden uns nicht im Geringsten mehr belästigen?«
»Nein, auf mein Ehrenwort.«
»Gut. Ich aber verlange außerdem noch, dass Sie selbst uns bis ins Freie begleiten.«
»Schön, auch das!«
»Dann lassen Sie das Boot vorfahren...«
»Dazu habe ich bereits den Befehl gegeben.«
»So öffne ich jetzt das Fenster und werfe die Kapsel hinab.«
Während dieser Unterhaltung hatte Atalanta immer auf das mit Zahlen bedeckte Papier geblickt; sie faltete es jetzt wieder zusammen und barg es in der Kapsel.
Ehe sie das Fenster öffnete, begab sie sich noch einmal zu Arno und beschäftigte sich mit ihm, aber immer mit halbem Auge die Tür beobachtend.
Ja, er kam langsam wieder zu sich, machte schon selbstständige Bewegungen, murmelte etwas.
»Haben Sie die Kapsel hinabgeworfen?!«, erklang es draußen mit nervöser Ungeduld.
»Sofort!«
Jetzt betrat sie die Nische, die hier nur sehr wenig tief war, sie konnte dabei auch die Tür im Auge behalten, entfernte die Klappe, und da sah sie denn auch unten, etwa zehn Meter tief, auf dem Wasser ein Boot liegen, das mit Decken belegt war. Ein Mensch befand sich nicht darin, wohl aber hing es an einem langen Seile.
Atalanta warf die Kapsel in das Boot, sofort ward dieses an dem Strick zurückgezogen — wohin, das konnte sie nicht sehen, oder sie hätte sich weit vorbeugen müssen, was sie nicht tat, um keinen Moment die gefährliche Tür aus den Augen zu lassen.
»Ich habe die Kapsel hinabgeworfen.«
»Ja, das habe ich selbst gesehen, nun einen Augenblick, ob... jawohl, auch der Inhalt stimmt. So, geehrtes Fräulein, ich danke Ihnen bestens.«
»Nun öffnen Sie die Tür!«
»Ich die Tür offnen? Ich denke nicht daran!«, hohnlachte es draußen.
»Sie haben Ihr Ehrenwort gegeben.«
»Kann man denn einem Toten sein Ehrenwort geben? Denn Sie sind bereits schon so gut wie tot — Sie und Ihr Herr Graf. Morgen liegen Sie beide auf meinem Seziertisch, so wahr ich der Professor Dodd bin. Bis dahin genießen Sie noch Ihr Leben, lassen Sie sich die Zeit nicht lang werden, hähä!«
Das höhnische Lachen und die Schritte entfernten sich.
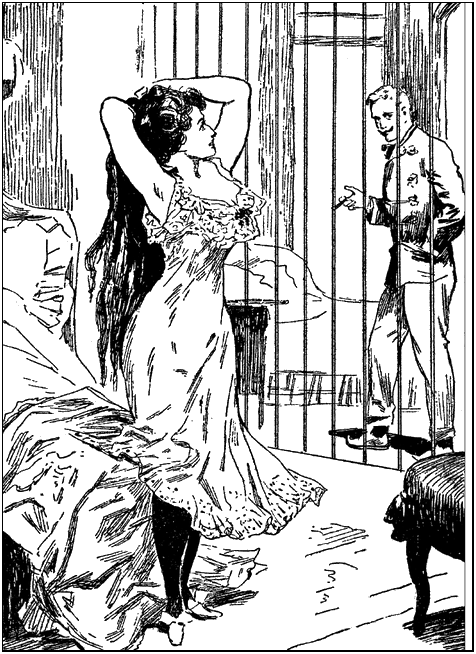
Während Graf Felsmark noch in zynischer Weise auf
das durch die Gitterstäbe von ihm getrennte schöne Weib
einsprach, begann dieses sich plötzlich zu entkleiden.
Was ist denn da gewesen?«, ließ sich da Arnos Stimme vernehmen. Er war wieder zu sich gekommen, fühlte sich aber wohl noch sehr schwach. Mühsam hatte er sich halb aufgerichtet, blieb jedoch noch am Boden sitzen, mit dem Rücken gegen den Schreibtisch gelehnt. Atalanta wollte ihm berichten — es war aber gar nicht nötig.
»Ich habe alles gehört, alles! Ich bin gar nicht bewusstlos gewesen, nur der Kraft meiner Glieder war ich nicht mächtig. Ach, das war ja ein entsetzlicher Zustand! Ich habe alles gehört, konnte mich aber nicht regen, nicht sprechen, keinen Ton hervorbringen, was ich auch für verzweifelte Anstrengungen machte. Meine Füße und meine Beine sind auch jetzt noch gelähmt. Das wird auch wieder vorbeigehen.«
Er stemmte die Hände gegen den Boden, um sich noch etwas höher zu richten, dabei die Beine wie tote Körper nachschleifend.
»So ein Schuft!«, stieß er dann grimmig hervor. »Na ja, was ist denn diesem Menschen anderes zuzutrauen! Du hättest ihm die goldene Kapsel, an der ihm so ungeheuer viel gelegen war, nicht so ohne Weiteres geben sollen. Vergebens machte ich die furchtbarsten Anstrengungen, um dazwischen zu sprechen, ich glaube, ich habe es wohl nur bis zu einem Murmeln gebracht.«
»Was sollte ich anderes tun?«, entgegnete Atalanta auf diesen Vorwurf. »Musste ich nicht alles versuchen, um unsere Freiheit zu erkaufen? Konnte ich wissen, dass ihm sein Ehrenwort nichts gilt?«
»Du hättest darauf bestehen sollen, dass wir unsere Freiheit schon vorher erlangten, dass wir die Kapsel dann an irgend einem ausgemachten Orte im Freien niederlegten.«
»Das hätte mein Bruder wohl so gemacht?«
»Gewiss, darauf hätte ich bestanden, ich hätte die ihm so wertvolle Kapsel nicht eher aus den Händen gegeben, als bis wir in Sicherheit gewesen wären.«
»Ja, und zweifellos wäre der Professor sofort darauf eingegangen. Und an jenem Orte wären wir niedergeschossen worden, oder schon auf dem Wege nach dort.«
Natürlich hatte sie recht, Arno sah es sofort ein, er hatte ganz unbedacht gesprochen und gab dies auch gleich beschämt zu.
»Nein, ich konnte nicht anders handeln, ich musste mich erst überzeugen, ob ihm sein Ehrenwort etwas gilt oder nicht. Nun wissen wir, woran wir sind. Wir haben ihm gegenüber ehrlich gehandelt, und wenn er uns nun noch einmal in den Weg kommt, dann... mag er sich hüten.«
»Du hast recht, Atalanta, völlig recht. Ja, wie sieht es aber nun mit einer Gelegenheit zur Flucht aus?«
In dieser Beziehung stand es freilich sehr hoffnungslos. Das Fenster war auf, unten lag der freie See. Aber an diesen Fluchtweg war nicht zu denken. Der Sprung zehn Meter hinab hatte für die beiden ja nichts zu bedeuten, aber mochten sie auch hundert Meter weit unter Wasser schwimmen können, ein Boot holte sie doch sofort ein, ein Boot war gar nicht nötig, ihre auftauchenden Köpfe boten von den Fenstern aus sichere Zielscheiben.
Und einen anderen Fluchtweg gab es nicht. Die mondlose Nacht musste abgewartet werden, dann musste man es eben riskieren.
»Wenn dieser Teufel mit seinen Gehilfen uns bis dahin nur nicht auf andere Weise zu Leibe zu rücken weiß, und wenn nur erst in meine Beine das Gefühl wiederkehren wollte!«, meinte Arno.
Ja, das war für ihn jetzt die Hauptsache. Nicht nur, dass ihm die Beine eingeschlafen waren, sondern er hatte in ihnen bis zum Leibe absolut kein Gefühl, er konnte überall mit der Messerspitze stechen, er fühlte nicht das Geringste davon, obwohl Blut kam.
Vergebens kneteten er und Atalanta, und als so eine Stunde vergangen war, ohne dass sich an diesem Zustande etwas geändert hatte, da kam Arno zu der schrecklichen Erkenntnis, dass er durch das Betäubungsmittel an beiden Beinen gelähmt worden war.
Natürlich konnte das Gefühl ja jede Minute wiederkommen, aber Arno machte sich gar nicht viel Hoffnung.
Er nahm das Unvermeidliche wie ein Mann hin. Dass er dabei mit gesenktem Kopfe finster vor sich hin brütete, war begreiflich. Es mochten schwarze Gedanken sein, die ihn beherrschten.
Atalanta kauerte in einer Ecke, unverwandt nach der Tür blickend, mit den ruhigen Augen einer Katze, die auf die Beute lauert.
»Horch!«, flüsterte sie da.
Auch Arno hatte schon ein Geräusch vernommen. An der Wand kratzte es.
»Das ist ein Bohrer«, flüsterte Arno, »sie bohren ein Loch durch die Wand, um ein betäubendes Gas einzuleiten, wovon der Professor ja schon gesprochen hatte. Und ich muss hier gelähmt sitzen!«
Der letzte Zusatz wäre nicht nötig gewesen. Auch mit gesunden Beinen hätte er nichts dagegen machen können.
»Das Fenster ist ja auf!«, meinte Atalanta.
»Das wird wenig nützen, auch nicht, wenn wir uns direkt hineinsetzen und den Kopf hinaushalten. Nach dort muss doch das Gas abziehen, und dieser Teufel, der einen Mann wie mich nur anzuspritzen braucht, um ihn über den Haufen zu werfen, wird auch schon ein entsprechendes Gas haben.«
»Was sollen wir tun?«
»Da ist nichts zu machen. Das Beste wäre, wir begingen gleich Selbstmord, ehe wir betäubt dem in die Hände fallen. Denn ich zweifle nicht daran, dass dieser Teufel uns lebendig sezieren wird.«
»Da versuchen wir es doch lieber erst mit einem Sprung ins Wasser.«
»Ja, wenn ich meine Beine nur gebrauchen könnte.«
»Ich nehme Dich auf den Rücken!«, tröstete Atalanta ihren Leidensgenossen.
»Warten wir bis zur letzten Minute!«, seufzte Arno.
Das bohrende Geräusch währte fort. Es musste dicht über dem Boden sein, aber noch in der dem See abgekehrten Wand, wie sich Atalanta überzeugte.
Um elf Uhr hatte es begonnen, und abends um sieben, als es zu dunkeln begann, kratzte es noch immer im Felsen, jetzt aber in ganz dichter Nähe.
Plötzlich splitterte die Felswand dicht über dem Boden, ein zollweites Loch entstand. Dieses schnell mit irgend etwas zu verstopfen, hätte gar keinen Zweck gehabt. Erst wurde ein Eisenstab durchgesteckt, vorn mit einer scharfen Spitze, aber nicht so weit, dass man ihn hätte fassen können.
Nun hieß es für die beiden Gefangenen sich zu eilen, ehe das betäubende Gas kam! Es war ja hin wie her, in den Tod ging es doch, aber es musste eben bis zum letzten Augenblick gegen den Tod gerungen werden.
Alles war bereits im Flüsterton verabredet worden, es gab kein Wort mehr zu verlieren.
Atalanta kauerte sich nieder, Arno umschlang von hinten ihren Hals, sie fasste seine Beine, so richtete sie sich auf, ihn nun auf dem Rücken tragend.
Wenige starke Männer hätten diese Last tragen, geschweige denn sich mit ihr so aufrichten können. Denn der riesenhafte Mann wog fast zwei Zentner. Diese rote Athletin aber hatte sich aus der Kniebeuge aufgerichtet, als fühle sie gar kein Gewicht.
Da machte sich auch schon ein süßlicher Geruch bemerkbar.
Doch schon stand Atalanta in der hohen Fensternische. Vor ihr war die schwärzeste Finsternis, hinter ihr an der Decke strahlte noch immer die Bogenlampe intensiv weißes Licht aus.
Bereits am Tage hatte sich die Indianerin hin und wieder am Fenster gezeigt und hatte Umschau gehalten. Nichts war zu sehen gewesen, natürlich auch ihr Boot nicht.
Als sie sich mit ihrer Bürde jetzt vor dem hellen Hintergrunde zeigte, schwirrte sofort ein Pfeil an ihrem Kopfe vorbei, ohne jedoch das beabsichtigte Ziel zu treffen. — Noch eine Menge anderer Pfeile folgte nach, da war Atalanta mit ihrem Schützling bereits unterwegs, sauste sie schon hinab.
Eine Tiefe von zehn Metern hat ja für einen Schwimmer und Springer nichts weiter zu bedeuten, auch nicht, wenn er noch einen anderen auf dem Rücken hat. Und so landete auch Atalanta mit Arno glücklich unten auf dem Wasser und sauste in die Tiefe.
Als sie wieder auftauchten, hörten sie keine Rufe, gar nichts, wohl aber huschte auf dem Wasser schon ein breiter Lichtschein hin und her, der Strahl eines elektrischen Scheinwerfers.
Mit diesem hatten sie von vornherein gerechnet, danach hatten sie den Plan zur Flucht verabredet. Deshalb schwamm Atalanta nicht in den See hinaus, sondern hielt sich dicht an der Felswand, wohin der Strahl von oben aus nicht gerichtet werden konnte.
Nun hätte ja auch das verfolgende Boot, das doch sicher vorhanden war, einen Scheinwerfer haben können oder doch eine Lampe mit starkem Reflexspiegel.
Aber auf dem offenen Wasser ein Licht zu zeigen, davor hütete man sich natürlich. Professor Dodd hatte doch im Zirkus diese Indianerin schießen sehen, ihr Revolver und die Patronen wurden im Wasser nicht unbrauchbar — die schoss einfach weg, was auf der anderen Seite innerhalb eines Lichtscheines kam. Wenn der Professor selbst nicht anwesend war, so hatte er doch seine Leute dementsprechend instruiert. Das verfolgende Boot musste unbedingt im Finstern bleiben.
Atalanta stieß den an den Füßen Gelähmten nicht vor sich her, sondern behielt ihn auch beim Schwimmen auf dem Rücken.
Wie ausgemacht, ging die Schwimmpartie nach Süden. Die Entfernung bis nach diesem Ufer betrug etwas über drei Kilometer, die ein guter Schwimmer in einer Stunde zurücklegen konnte. Dass Atalanta dabei noch einen Menschen auf dem Rücken trug, hatte hierbei nicht viel zu bedeuten, nur dass sie vielleicht eine Viertelstunde länger dazu brauchte.
Nach den ersten zwei Minuten hielt Atalanta mit den Schwimmstößen einmal inne.
»Ein Boot kommt!«, flüsterte sie. »Die Ruder sind umwickelt, aber ich höre es doch.«
Sie blickte sich um, und Arno hatte schon mehrmals konstatiert, dass diese Indianerin in der schwärzesten Finsternis besser sah als mancher Mensch am hellen Tage.
Das oder eines der verfolgenden Boote fuhr die Felswand entlang, in der richtigen Überzeugung, dass die Flüchtlinge diesen Weg wählen würden.
Atalanta schwamm einfach etwas in den See hinein, wohin der Blendstrahl von einem Fenster aus aber immer noch nicht dirigiert werden konnte, dazu war er doch noch zu nahe an der Wand.
»Sieht mein Bruder das Boot?«, fragte die Indianerin.
Nein, Arno sah und hörte absolut nichts.
»Wir müssen doch einen Blendstrahl herumschicken, man sieht ja die Hand vor den Augen nicht!«, erklang da leise eine Stimme in der Finsternis, so nahe, dass Arno den Sprecher mit dem Arm erreichen zu können glaubte.
Das Boot fuhr wirklich kaum drei Meter an ihnen vorbei, wie Atalanta ihm dann versicherte, und doch war nicht das allergeringste Plätschern oder ein Geräusch der Riemen zu hören, so vorsichtig wurde gerudert.
»Unmöglich, die Indianerin soll ja im Schießen die reine Teufelin sein.«
»Dann soll ein anderer die beiden suchen!«
»Warte nur, bis der Mestize mit den Hunden kommt.«
Das Boot hatte sich entfernt, man verstand die weiteren Worte nicht mehr, aber es war schon genug, was man gehört hatte.
O weh, auch Hunde hatten sie. Die Spur im Wasser konnten diese ja nicht verfolgen, aber schon ihre Witterung genügte.
Die Schwimmpartie wurde fortgesetzt. Das Boot kam zurück, nur von Atalanta bemerkt, die ihm daher auch wieder auszuweichen wusste.
Da ertönte hinter ihnen ein Hundebellen, kurz abbrechend, weil den Tieren das Bellen offenbar verboten wurde.
Bisher war die Flucht über Erwarten gut geglückt, jetzt aber begann die Gefahr für sie erst richtig, und es gab für sie noch eine ganz andere, als dass sie hier im Wasser von den Hunden aufgespürt würden.
Die Boote brachten die Hunde einfach ans Ufer, jedenfalls nach beiden Seiten, dort wurden die Schwimmenden erwartet, dort nahmen die Hunde einfach ihre Spur auf. So hatte sich Arno geäußert. Atalanta aber ließ nur ein verächtliches Zischen vernehmen.
»Pah, Hunde! Es mögen so viele Bluthunde kommen, wie hier aufzutreiben sind. Sie sollen mich kennen lernen.«
Arno hatte keine Ahnung, weshalb sich die Indianerin schon so sicher fühlte.
»Du glaubst, dass wir gerettet sind?«, fragte er verwundert.
»Zweifelst Du daran? Ich hatte nichts weiter gefürchtet als den Moment, wo ich mit Dir in dem erleuchteten Fenster erscheinen musste, denn ich hatte schon vergiftete Pfeile oder Kugeln oder ein anderes Geschoss erwartet. Nun wir dieser Gefahr entgangen sind, sind wir gerettet, jetzt hat sich das Ganze überhaupt schon umgekehrt, jetzt sind wir es, vor denen sich jene zu hüten haben. Wehe dem zwei- oder vierbeinigen Hunde, der jetzt noch als Feind meinen Weg kreuzt, er soll die letzte Mohawk kennen lernen!«
In einem unbeschreiblichen Tone hatte die Indianerin dies gesagt, Arno fühlte es eiskalt über seinen Körper rieseln, er wusste selbst nicht warum — eben unbeschreiblich dieser Ton, diese furchtbare Ruhe. Zugleich aber fühlte er auch plötzlich eine Sicherheit über sich kommen, die ein Misslingen dieser Flucht gar nicht mehr kannte.
Er wusste plötzlich, eine höhere Stimme sagte es ihm, dass er auf dem Rücken dieser jungen Indianerin ebenso sicher durchs Feuer, durch jede Glut getragen worden wäre wie hier durchs Wasser, und er hätte plötzlich aufjauchzen mögen.
Ach, wenn er doch selbst hätte kräftig mitschwimmen können. Aber seine Füße, die Beine, was sollte daraus noch...
Er wagte den Gedanken an die Zukunft gar nicht auszudenken.
In weiterer Entfernung ging wieder ein Boot an ihnen vorüber, und zwar, wie einem leisen Knattern zu entnehmen war, ein Motorboot.
»Und da sind die Hunde drin«, sagte Atalanta noch, »ich rieche es, habe einen auch winseln hören. Das Maul wird ihnen zugehalten. Ha, wie ich mich freue, die zu empfangen!«
Weiter ging die Schwimmpartie. Arno bat vergeblich, sie möge sich doch einmal ausruhen. Mit unermüdlicher Kraft und Ausdauer machte die Indianerin weite Schwimmstöße.
Für Arno war schon eine kleine Ewigkeit vergangen, in Wirklichkeit war es eine halbe Stunde, als Atalanta die Füße im Wasser sinken ließ und auch wirklich Grund fand. Das Wasser reichte ihr nur bis zur halben Brust.
»Gib mir auch Deinen Revolver!«, flüsterte sie im leisesten Tone.
»Sind wir schon am Ufer?«
»Keine zwanzig Schritt mehr davon entfernt.«
»Merkst Du eine Gefahr?«
»Merken? Ich sehe dort vier große Bluthunde hin und her laufen und sechs, sieben Männer stehen mit Gewehren in der Hand dabei!«
Arno wollte es kaum glauben. In dieser mondlosen Nacht herrschte bei dichtbedecktem Himmel eine undurchdringliche Finsternis, er konnte tatsächlich nicht die Hand dicht vor den Augen erkennen.
»Wir wollen das Ufer an einer anderen Stelle betreten.«
»Warum?«
»Weil...«
Nein, er mochte es nicht sagen: um Menschenleben zu schonen.
Er hatte ihr seinen Revolver gegeben.
»Sind es aber auch wirklich unsere Feinde?«
»Wer soll es sonst sein? Dort liegt auch das Motorboot — nein, es bewegt sich, es kommt heran, das dürfen wir gar nicht abwarten...«
Da hatte ein Hund die Menschen im Wasser gewittert, wütend schlug er an, wütend fielen drei andere Hundestimmen ein.
Aus der Indianerin beiden Händen knatterte es wie aus zwei Maschinengewehren. Doch wenn ein Zählen möglich gewesen wäre, so hätte man nur acht Schüsse gezählt.

Hundeheulen, Menschenschreie, Ächzen, Röcheln — dann war alles wieder still. Auch das leise Knattern des Motorbootes war verstummt.
»Die vier Hunde sind nicht mehr, und von den sieben Männern leben nur noch drei — bitte, lade Deinen Revolver wieder!«, sagte die Indianerin seelenruhig, ihm die Waffe über die Schulter reichend und ihre eigene wieder ladend, dabei schon weiter watend.
Arno wurde von einem wahren Entsetzen erfasst. Er hatte noch nie auf einen Menschen geschossen. Und wie die Indianerin dies nun gesagt hatte, und überhaupt, diese todessichere Gewissheit!
Sie hielt es gar nicht für nötig, die Richtung zu ändern, falls man jetzt das Wasser mit Kugeln bestrich. Sie wusste eben, dass jetzt niemand an so etwas dachte, dass sofort alles, was noch lebte, vor Entsetzen wie gelähmt war.
Sie erreichte das Ufer. Noch zwei Schüsse krachten aus ihrem Revolver wie ein Doppelschuss. Nur ein stöhnender Aufschrei war gefolgt.
»Wieder zwei weniger.«
Jetzt aber blitzte es auch auf dem Wasser auf, auch aus dem Motorboot wurde geschossen.
»Ach, wo die uns vermuten!«, sagte Atalanta verächtlich. »Ihr wollt auch etwas haben? Da — und da!«
Schreie des Entsetzens vom Wasser her, jedenfalls von Lebenden ausgestoßen, die Zeugen wurden, wie zwei ihrer Gefährten plötzlich tot zusammenbrachen.
»Höre auf — schone ihr Leben!«, stöhnte Arno entsetzt.
Es war eine Torheit von ihm, eine Schwäche, er wusste es, aber diese furchtbare Plötzlichkeit, innerhalb einer viertel Minute acht Menschen und vier Bluthunde vom Leben zum Tode befördert zu sehen in dieser stockfinsteren Nacht — und dies alles nur so nebenbei, dazu den schweren Mann auf dem Rücken — ja, es war entsetzlich.
Atalanta schritt in den Wald, entfernte sich aber gar nicht so weit vom Ufer, dann ließ sie ihre menschliche Bürde zu Boden gleiten, unter ihren Händen flammten einige trockene Ästlein auf, sie schürte sie zu einem großen Feuer auf, fertigte im Handumdrehen einen Bogen und einen Pfeil, kam mit einem Male mit einer fetten Wildgans zurück, obgleich Arno gar nicht gemerkt, dass sie sich entfernt hatte, bereitete den Braten, alles mit einer Ruhe, als ob überhaupt gar nichts geschehen wäre.
Nein, die brauchte auch hier im Walde, in der freien Natur keine Feinde zu fürchten! Die war als Gegnerin einfach unnahbar!
In dem allen lag aber eben etwas Furchtbares, das sich gar nicht weiter definieren lässt. Jedenfalls begann sich Arno vor der jungen Indianerin förmlich zu fürchten.
Verwundert, wenn nicht erstaunt, sahen die Bewohner von Pittville zwei Tage später ein in Leder gekleidetes Mädchen im Geschwindschritt durch die Straßen marschieren, tief gebückt, auf dem Rücken einen großen, starken Mann, der seine Arme um ihren Hals geschlungen hatte, während sie seine Beine unter ihren Armen trug.
Man erinnerte sich dieser beiden noch recht gut. Vor genau zehn Tagen hatten sie hier den von Osten kommenden Pacific-Zug verlassen, zur Jagd ausgerüstet. Sie hatten sich gar nicht aufgehalten, nirgendwo einen Imbiss genommen, keine Frage gesellt, sondern waren gleich nach Nordwesten in die angrenzende Prärie hineinmarschiert.
Das also war das Ende dieser Jagdexpedition! Dem Manne musste etwas zugestoßen sein. Damals hatte er den größten Teil des Gepäcks getragen. Jetzt trug ihn selbst seine Begleiterin auf dem Rücken zurück.
Ja, wie war das nur möglich, dass dieses junge, schlanke, doch fast zart aussehende Mädchen diesen riesenhaften Mann, der doch sicher zwei Zentner wog, in solchem Geschwindschritt tragen konnte, wobei ihr Gang sogar noch elastisch zu nennen war?
Vier Tage hatten die beiden damals gebraucht, um von Pittville nach dem Sklavensee zu gelangen. Und sie hatten, wie gesagt, ganz tüchtige Tagesmärsche geleistet, da hätten wenige mitmachen können. Sie beide waren doch schulgemäß ausgebildete Athleten, und wenn das Fußmarschieren auch nicht mit zu ihrem Berufe gehörte, so durfte man doch glauben, dass sie mit ihren stählernen Körpern, die ganz dem Willen gehorchten, auch hierin Erstaunliches leisteten.
Und Atalanta hatte, den schweren Mann auf dem Rücken, zu dieser selben Strecke noch nicht einmal die Hälfte dieser Zeit gebraucht, nur zwei Tage und eine Nacht war sie marschiert!
Aber wie war sie marschiert! Arno mochte es, obgleich er doch immer auf ihrem Rücken gesessen, manchmal selbst nicht recht glauben.
Vom ersten bis zum letzten Sonnenstrahl, das bedeutete zu dieser Jahreszeit von früh um vier bis abends um acht Uhr, war sie rastlos gewandert, in diesem Geschwindschritt auch Hügel und selbst ein Gebirge erklimmend, auf der abfallenden Seite und auf der Ebene in Dauerlauf fallend, der Geschwindschritt war ihr ab und zu nur eine Erholung, und so durch Urwald und Prärie und durch die sonnendurchglühten Ausläufer der großen amerikanischen Sandwüste, über Gräben und Bäche springend und durch reißende Ströme schwimmend, immer den schweren Mann auf dem Rücken, täglich ihn nur zweimal absetzend, um irgend ein kleines Wild zu erlegen und es schnell am Feuer zuzubereiten, und dann nach rasch eingenommener Mahlzeit den Mann wieder auf den Rücken genommen und weiter, immer weiter! Und in der letzten Nacht hatte sie sich überhaupt keine Ruhepause gegönnt. Dabei hatte zwischen den beiden ein recht eigentümliches Verhältnis geherrscht. Die Indianerin schien die Sprache verloren zu haben.
»Ruhe Dich doch aus, das kannst Du ja nicht mehr aushalten!«
Wie oft hatte dies Arno gesagt, doch sie hatte ihm darauf gar keine Antwort gegeben.
Einmal hatte er sich gewehrt, er wollte sich nicht wieder auf den Rücken nehmen lassen.
»Fühlst Du Dich zu schwach, um Dich an mir festzuhalten?«, hatte sie gefragt.
»Das nicht, aber Du kannst ja nicht mehr...«
Da hatte sie sich wie gewöhnlich niedergekauert, um ihn auf den Rücken zu nehmen, er aber hatte sich gewehrt, als sie seine Arme um ihren Hals legen wollte, es war zwischen den beiden zu einem förmlichen Ringkampf gekommen; in diesem Zustande freilich konnte der Hüne gegen das riesenstarke Mädchen nicht viel ausrichten, mit einem Ruck und Schwung hatte sie ihn auf dem Rücken gehabt, seine Arme waren vor ihr auf dem Busen wie von eisernen Klammern festgehalten worden, und weiter war es gegangen im Laufschritt, immer weiter!
Das Ziel und ihre Absicht kannte er, sie wollte nach Pittville zu einem Arzt!
Weshalb sie mit einem Male die Sprache verloren zu haben schien, das konnte gerade dieser Athlet, der selbst andere zu Athleten trainiert hatte, am besten verstehen.
Jeder Mensch, der irgend eine besonders große Leistung ausführen will, eine körperliche wie auch geistige, wird während dieser Periode sehr schweigsam sein und mit jedem Worte geizen. Meist ist er ja überhaupt ein schweigsamer Mensch. Wer von Natur dazu bestimmt ist, etwas Großes, Gewaltiges zu leisten, das seine Mitmenschen in Erstaunen setzt, der ist ganz gewiss kein Schwätzer, mag er neue Kometenlaufbahnen berechnen oder auf der Radrennbahn neue Rekorde aufstellen.
»Sitzest Du bequem? Bist Du hungrig? Hast Du Durst? Bist Du müde? Gleich kommen wir in eine Ebene, ich werde so ruhig gehen, dass Du meine Schritte gar nicht merkst.«
Ja, solche Worte sprach sie hin und wieder und sie legte dann stets eine seltene Zärtlichkeit in ihre Stimme.
Mit sinkender Sonne hatte sie Pittville erreicht. Dieses Mädchen hatte das Menschenmöglichste oder eigentlich Unmöglichste vollendet!
Direkt in das Eisenbahnhotel ging sie. Der Portier saß in seiner Loge.
»Ein Zimmer mit zwei Betten! Gibt es hier mehrere Ärzte? Dann holen Sie mir den besten, aber sofort!«, rief Atalanta aus.
Was war das? Dieser Portier saß in seiner kleinen Loge wie ein König auf dem Throne, so ziemlich in unnahbarer Majestät. Das findet man in Amerika noch viel mehr als in Deutschland. Weil es dort keine Trinkgelder gibt. Es ist dies genau wie auf dem Schiffe. Auf einem deutschen ist der Steward eben ein dienender Kellner, auf dem englischen und amerikanischen Dampfer ist der Steward nach dem Kapitän der Generalgewaltige, der die Passagiere nach Möglichkeit tyrannisiert.
Dieser Hotelportier war noch ganz besonders als ein aufgeblasener Pfau bekannt. War es der Ton oder waren es diese dunklen Augen, deren Blick der Mann nicht vertragen konnte, dass er sich plötzlich so verwandelte, ganz außer Fassung geriet, nach dem Telefon sprang und einen Arzt anrief, dem er aber in seiner plötzlichen Kopflosigkeit die Anweisung gab, den beiden Herrschaften das beste Hotelzimmer in Bereitschaft zu setzen?
Atalanta gelangte doch noch zum Ziele, und zwar schnell.
»Lassen Sie uns allein!«, sagte sie, als sich der Kellner unnötigerweise noch im Zimmer zu schaffen machte. Sie hatte es durchaus nicht herrisch gesagt, aber der dienstbare Geist ließ doch gleich das Handtuch fallen, um schnell zu verschwinden.
Sie legte ihre Bürde auf das Sofa, deckte ein Bett ab, ging zurück, begann Arno zu entkleiden, mit den langen Stiefeln anfangend.
Arno versuchte sie abzuwehren.
»Nein, Atalanta, das kann ich nicht...«
»Still!«, gebot sie, diesmal wirklich herrisch.
Er wehrte sich doch noch, aber das half ihm wenig, er musste es dulden.
Sie entkleidete ihn wie ein Kind, hob ihn wie ein Kind auf, legte ihn wie ein Kind ins Bett, alles ohne ein Wort zu sagen. Nur zuletzt brach sie das Schweigen.
»Hast Du Geld bei Dir?«
»In meiner linken Hosentasche steckt ein Beutelchen mit wenigen Silber- und Goldstücken und in meinem Jagdhemd sind acht Hundertdollarscheine eingenäht. Es ist alles, was ich besitze.«
Wieder ohne ein Wort zu sagen, suchte sie das Geldbeutelchen, blickte hinein, trennte sodann das in Wachsstoff gehüllte Papiergeld aus dem ledernen Hemd und ließ beides im eigenen Busen verschwinden.
Der Arzt kam und Atalanta sagte ziemlich kurz:
»Dieser Herr ist seit drei Tagen an beiden Beinen gelähmt. Bitte, wollen Sie ihn untersuchen.«
Der Arzt machte wenig Worte, fragte vorläufig nichts, schlug die Bettdecke zurück, begann seine Untersuchung, strich und kniff und stach mit einer Nadel.
Daneben stand mit über der Brust gekreuzten Armen die Indianerin und schaute zu, wie eine Bronzestatue stand sie da.
»Ist das plötzlich gekommen?«
»Ganz plötzlich!«, erklärte Atalanta statt Arnos.
»Ein Schlaganfall?«
»Nein, ich glaube nicht.«
»Welche Symptome sind vorausgegangen?«
»Gar keine.«
»In vollster Gesundheit sind ihm die Beine plötzlich gelähmt worden?«
»Nein, so einfach ist es nicht gewesen. Er hat ein Betäubungsmittel ins Gesicht gespritzt bekommen, das ihn sofort bewusstlos machte. Als er aus seiner Ohnmacht wieder erwachte, waren seine Beine vollständig gelähmt und empfindungslos, und dies nun seit drei Tagen.«
»Ah, ich ahnte fast so etwas. Hat er dieses Betäubungsmittel öfters gebraucht?«
»Gebraucht? Niemals. Er ist überfallen worden.«
»Fällt der Herr manchmal in Schlaf, ganz plötzlich, ohne dass er vorher besonders müde gewesen ist?«
In der Tat, das war der Fall! Arno schlief manchmal urplötzlich ein, mitten im Wort, mitten in der Bewegung. Die Dauer dieses Schlafes war gänzlich verschieden. Manchmal dauerte er nur wenige Minuten, manchmal viele Stunden lang.
»Wissen Sie, was das für ein Betäubungsmittel gewesen ist?«
»Nein. Keine Ahnung.«
»Hat er aber vielleicht in diesem Schlafe Empfindung in den Beinen?«
In der Tat, das war wiederum der Fall! Wenn Arno schlief, reagierte er darauf, wenn er in die Beine gestochen oder gekniffen wurde. Das hatte Atalanta schon beim Tragen ganz deutlich bemerkt. Wenn Arno auf ihrem Rücken einmal einschlief, dann wurden seine Beine ganz andere, dann baumelten sie nicht mehr so schlaff unter ihren Armen hervor. Das hatte sie oftmals ganz deutlich bemerkt, Arno selbst wusste es. Sobald er aber erwachte, waren die Beine wieder empfindungslose, für ihn ganz fremde Gegenstände.
Darüber gesprochen hatten die beiden nicht weiter.
»Ja, es ist paralytisches Koma!«
»Was ist das? Wir sind nicht medizinisch gebildet.«
»Unter Paralyse verstehen wir eine Lähmung, die vom Gehirn ausgeht Das ist ja eigentlich bei jeder Lähmung der Fall, hier handelt es sich aber um eine spezielle Lähmung der betreffenden Nerven, die vom Gehirn ausgehen. Koma nennen wir Ärzte die Schlafkrankheit. Es gibt verschiedenartige Erscheinungen der Schlafsucht. Hier handelt es sich um dasjenige Koma, bei welchem die Lähmung innerhalb des Schlafes wieder aufgehoben wird.
»Woher kommt das?«
»Da, geehrte Miss, stehen wir Ärzte noch vor einem Rätsel. Wir kennen die Ursache und die Erscheinung, aber nicht den inneren Zusammenhang der Sache. Es ist ein Zufall, dass Sie sich gerade an mich wenden. Ich habe das Koma zu meinem speziellen Studium gemacht und habe ziemlich viel Erfahrung darin. Ich war nämlich viele Jahre lang erster Assistenzarzt im Living'schen Institut zu New Orleans. In und um New Orleans, im ganzen Mississippidelta, tritt das paralytische Koma unter der weißen Bevölkerung sehr häufig auf. Es ist die Folge der zu starken Benutzung des Kokains und des Kauens der Kokablätter. Es ist dies ein vorzügliches Mittel gegen das gelbe Fieber, welches dort im Sommer grassiert. Bei zu häufiger Benutzung stellt sich dann aber paralytisches Koma ein. Also Schlafsucht, in Verbindung mit Lähmung von Extremitäten. Merkwürdig ist, dass immer nur eine Art von Extremitäten gelähmt wird. Entweder nur die Beine oder nur die Arme und Hände, niemals beides zusammen. Ganz merkwürdig ist es auch, dass nur die weiße Rasse davon befallen wird, das heißt durch inneren Gebrauch des Kokains. Die dort hausenden Indianer und Neger kauen doch ihr ganzes Leben lang Kokablätter, denen schadet das nichts. Die sind aber auch ohne dieses Mittel ganz indifferent gegen das gelbe Fieber. Woher das kommt, das wissen wir nicht.«
Hiermit war also die Erklärung gegeben, weshalb bei der Indianerin das Betäubungsmittel nicht gewirkt hatte. Es sei noch ausdrücklich bemerkt, dass hier Tatsachen berichtet werden. Unzählige Versuche sind schon angestellt worden, zu ergründen, weshalb alle farbigen Rassen nicht auf die Miasmen des gelben Fiebers reagieren! Dafür aber sterben die stärksten Neger und Indianer wie die Fliegen an unseren Kinderpocken, an den für uns doch ganz unschuldigen Masern. Die Schlafkrankheit, die unter den Negern herrscht, ist wieder eine vollkommen andere, ohne Lähmung.
»Ist diese Krankheit heilbar?«, fragte Atalanta nach wie vor mit unbeweglichem Gesicht.
Der Arzt machte einen Ansatz, bedauernd die Schultern zu heben, unterließ es aber und winkte der Indianerin, ihm zur Seite zu folgen.
»Nein, bleiben Sie hier. Bitte, sprechen Sie ganz offen!«, sagte Atalanta.
»Nein denn, sie ist nicht heilbar. Wenigstens habe ich unter vielen hundert Fällen von paralytischem Koma, die ich beobachtet, noch keine Heilung konstatieren können.«
Es war gesprochen. Tief ließ der Unglückliche das Haupt sinken. Atalanta blieb unbeweglich.
»Werden die Beine noch gänzlich absterben?«
»Nein, sicher nicht. Isst der Herr gut?«
»Ganz normal.«
»Ist sein Geist, sein Gedächtnis normal?«
»Völlig. Ganz wie sonst.«
»Stimmt alles. Die Lähmung erstreckt sich nur auf die Beinnerven. Im Schlafe wird diese Lähmung wieder aufgehoben. Es ist eine Art Wechselwirkung. So zirkuliert auch das Blut ganz normal. Eben nur das Gefühl fehlt, und daher auch die Bewegungslosigkeit. Dieser Herr kann unter Umständen noch alt wie Methusalem werden. Aber — wenn Sie es hören wollen — nach meiner ehrlichen Überzeugung wird er seine Füße und Beine niemals wieder benutzen können, ohne dass sie äußerlich absterben.«
»Ist irgend eine besondere Behandlung nötig?«
»Gar nicht.«
»Er darf essen und trinken, was er will?«
»Wonach er Appetit hat. Auch geistige Getränke, wenn er daran gewöhnt ist, schaden ihm weder noch helfen sie ihm.«
»Ich danke Ihnen, Herr Doktor. Was bin ich Ihnen schuldig?«
»Zwei Dollars.«
Atalanta bezahlte aus dem Beutelchen Arnos und begleitete den Arzt dann bis an die Tür. Draußen sah sie den Zimmerkellner vorbeigehen.
»Kellner, bringen Sie uns zwei Soupers hier auf das Zimmer. Dazu eine Flasche Limonade und eine Flasche Champagner!«
Jetzt erst kam es dem Unglücklichen richtig zum Bewusstsein, was er soeben zu hören bekommen hatte.
Er ließ sich in die Kissen zurückfallen und bedeckte das Gesicht mit den Händen.
»Gelähmt für immer!«, stöhnte er schluchzend.
»Na, was ist denn da weiter dabei?«, erklang es neben ihm.
Erstaunt, förmlich erschrocken blickte er auf, sah in das Gesicht Atalantas, die sich auf sein Bett gesetzt hatte, und dieses schöne, dunkle Antlitz lächelte auch noch ganz heiter, wie er es noch niemals beobachtet.
Und jetzt nahm sie seine Hand in die ihren und streichelte sie liebkosend.
»Du wunderst Dich, dass ich so spreche!«, fuhr sie lächelnd und mit schmeichelnder Stimme fort. »Ja, es ist auch etwas Egoismus dabei. Sieh, Arno, ich bin doch auch als Indianerin ein Mädchen, ein Weib. Und wir Frauen pflegen nun einmal so gern. Ja, ich bin so ehrlich, es gleich zu sagen. ich freue mich ordentlich, dass ich nun Gelegenheit habe, Dich wie ein kleines Kind zu pflegen und zu warten. Und wirklich, was ist denn da so furchtbar Schlimmes dabei? Du sollst nichts vermissen. Was hattest Du vor? Du wolltest Dir die schöne Welt besehen. Gut, Du sollst sie sehen, und jetzt erst recht. Hast gar nicht mehr nötig, viel zu laufen und Strapazen auszustehen. Wir kaufen einen bequemen Fahrstuhl, und wo wir nicht mit der Eisenbahn oder mit dem Schiffe hinkönnen, da fahre ich Dich hin, und wo der Fahrstuhl nicht fahren kann, da trage ich Dich. Du weißt doch nun, dass ich Dich bequem tragen kann. Du bist mir wie ein Kind. Ich trage Dich auch auf den Armen. O, das soll ja nun erst recht ein schönes Leben werden! So bereisen wir die ganze Welt zusammen, besehen uns alles Schöne. An Geld kann's uns ja niemals fehlen. Ich gebe in jeder Stadt, in der ein Zirkus oder ein Varieté ist, einmal eine Vorstellung und verdiene auf diese Weise mehr als wir brauchen. Und dann fahre ich Dich in die Museen und in die Umgegend, in die Wälder und Felder, wohin Du willst...«
Und so plauderte sie weiter, wie eine Mutter zu ihrem armen, unbeholfenen Kinde.
Und Arno? Er zog ihre Hände an sein Gesicht und weinte hinein.
»Atalanta, Du bist so gut...«
»Gut? Ich gut?«
Sie zog ihm die Hände weg, beugte sich tiefer zu ihm hinab, ihr Mund lächelte noch, aber ihre Augen waren ernst, tiefernst.
»Mein lieber, lieber Arno, ist es sündhaft, zu gestehen, dass ich mich fast freue, dass alles so gekommen ist? Kann ich es Dir jetzt gestehen? Ja, jetzt kann ich es, was ich bisher niemals gewagt hätte. Es wäre auch sonst nie, nie dazu gekommen. Jetzt aber darf ich es Dir sagen. Weißt Du denn nicht, wie es um mich steht? Ich habe Dich ja so lieb, mein Arno — ja, ich liebe Dich, ich liebe Dich...«
Und sie beugte sich noch weiter zu ihm hinab und bedeckte seinen Mund mit heißen Küssen; dem Manne, der sich soeben noch so todunglücklich gefühlt hatte, überkam ein seliger Wonnetaumel, und vor sich sah er plötzlich die Zukunft im rosigsten Lichte liegen.
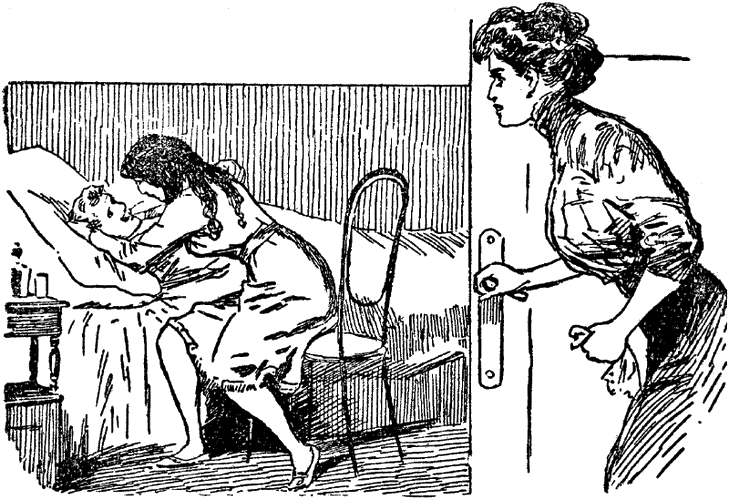
»Meine Atalanta, mein liebes, liebes Mädchen!«, flüsterte er und erwiderte ihre glühenden Küsse.
Da ging die Türe auf, eine Dame trat ein und blieb verwirrt stehen. Sie hatte sich in der Tür geirrt, sie logierte im Nebenzimmer.
Aber die Richtige, die der Zufall gerade jetzt hier herein führen musste, war es dennoch: Miss Marwood Morgan — hier allerdings unter dem Namen einer Missis Elliot auftretend.
Heute Morgen war sie hier eingetroffen, allein, ganz einfach auftretend. Sie wollte eine Jagdexpedition nach dem Sklavensee machen, hatte sie gesagt und sich wegen geeigneter Leute erkundigt. Möglichst schnell.
Es war ihr von sachverständiger Seite geraten worden, bis heute Abend zu warten. Da kam ein bekannter Jäger zurück, der sich gern in fremde Dienste stellte. Der würde auch für die weitere Begleitmannschaft sorgen. Betrieb sie die Ausmusterung auf eigene Faust, so bekam sie nur zweifelhaftes Gesindel zusammen, mit dem sie dann die größten Unannehmlichkeiten haben konnte. Deshalb hatte sie warten wollen.
Jetzt führte sie der Zufall in dieses Zimmer. Und in dieser Situation vernahm auch die scharfsinnige Indianerin ihren Eintritt nicht, sie merkte nichts von der Anwesenheit einer dritten Person.
Miss Morgan brauchte das Gesicht des Mannes, der im Bette lag, und das des jungen Weibes, das auf dem Bettrand saß, nicht zu sehen.
»Mein lieber, lieber Arno!«
»Meine Atalanta, mein liebes, süßes Mädchen!«
Diese Worte genügten der Milliardärstochter, um sofort die ganze Situation zu erkennen.
Die Indianerin hörte nicht einmal das Zischen, und so leise entfernte sich die Dame auch wieder, sie schloss geräuschlos hinter sich die Tür.
Um die Ecke des Korridors kam soeben der Kellner mit dem ersten Gange des Soupers; er setzte das Präsentierbrett erst noch einmal auf das Anrichtetischchen, das auf dem Korridor stand, und ordnete noch etwas.
»Wer ist der Herr und die Dame in dem Jagdkostüm, die eben erst gekommen sein können?«, fragte Miss Morgan oder vielmehr Missis Elliot, und sie hatte sich vollkommen wieder in der Gewalt.
»Sie haben sich noch nicht eingeschrieben. Dem Herrn muss etwas zugestoßen sein, die junge Dame, eine Indianerin, hat ihn getragen.«
»Getragen?«
»Ja, sie brachte ihn auf dem Rücken hierher!«
»Was fehlt ihm?«
»Ich weiß es nicht. Wohl eine Fußverletzung, scheint nicht viel zu bedeuten zu haben. — Ach, ich habe ja ein Glas vergessen.«
Er eilte noch einmal zurück, sich dabei eigentlich gar nicht so sehr beeilend, das Beefsteak, das den ersten Gang bildete, inzwischen einfach draußen im Korridor auf dem Tische stehen lassend.
Miss Morgan warf einen raschen, scheuen Blick um sich — sie war allein. Behend zog sie eine winzige Phiole aus der Tasche, entstöpselte sie und goss die farblose Flüssigkeit über das Beefsteak.
»So, das genügt, und diesmal haben sie keinen Hund, der erst prüft!«, flüsterte oder dachte Miss Morgan, als sie sich in ihr Zimmer zurückzog.
Der Kellner servierte den ersten Gang. Atalanta nahm ihm das Präsentierbrett ab, setzte es auf das Bett, sich daneben auf einen Stuhl, schnitt dem hochgerichteten Kranken vor, schenkte ihm Champagner ein, während sie Limonade trank, sie plauderten weiter zusammen, malten sich die Zukunft aus, und wirklich, Arno befand sich trotz seiner gelähmten Beine in einer glücklicheren Stimmung, als er sie je in seinen gesunden Tagen gehabt hatte.
Der zweite Gang kam, ein ganzer Kalbsbraten mit nur einer einzigen Kartoffel, aber fast so groß wie ein Kindskopf, und mit nur einer einzigen Möhre, so lang und dick wie der Unterarm eines starken Mannes war. Der Amerikaner, das heißt der Yankee, will alles großartig, pyramidal haben.
Der dritte Gang bestand aus einem ganzen Truthahn, garniert mit jungen Tauben und als Beilage ein riesiger Pilz.
»Was kommt denn dann?«, lachte Arno, obgleich er ja diese amerikanische Tafelei gewohnt war.
»Ein Hecht.«
»So groß wie ein Walfisch?«
»Nein, so groß ist er nicht. Aber es ist ein schöner, großer Fisch, ich habe ihn gesehen.«
»Und was gibt's dann?«
»Einen getrüffelten Schweinskopf.«
»Na, dass der aber auch nur groß genug ist!«
»Ich werde es extra bestellen.«
»Und dann bestellen Sie gleich ein Bad!« fügte Atalanta noch hinzu, ehe der Ganymed ging.
»Very well, Miss.«
»Was, Du willst dann hinterher baden?!«, lachte Arno immer belustigter. Er befand sich überhaupt in so lachlustiger Laune.
»Du nicht? Du musst, mein liebes Kind.«
»Mit dem vollen Magen? Mit dem Riesenbeefsteak und mit dem Truthahn und den Täubchen und dem Hechte und dem Wildschweinskopf und mit der ungeheuren Kartoffel und der noch ungeheureren Runkelrübe im Leibe?!«
»Nun ja, ist da das Baden nicht am gesündesten?«, fragte Atalanta verwundert, weil sich jener über diese Badezeit wunderte.
Vielleicht hatte sie recht. Diese Indianerin hielt es trotz aller Kultur noch so wie alle Naturvölker, die sich mit Vorliebe baden, wenn sie gut und viel gegessen.
Aber Atalantas Pflegling sollte nicht mehr zu seinem Bade kommen, auch nicht mehr zu dem Hechte, er schlief schon beim Verzehren des Truthahns so plötzlich ein, wie es jetzt öfters der Fall war.
Atalanta setzte das Präsentierbrett auf den Tisch, bettete ihren Pflegling besser, bestellte beim Kellner die weiteren Gänge ab, vorläufig auch das Bad, das ja keiner Vorbereitung bedurfte. Sie kauerte sich neben dem Bette auf den Teppich nieder und verharrte so regungslos.
Es wurde dunkel, es wurde Nacht, und nichts regte sich in dem Zimmer.
Die Nacht verging, ein neuer Tag begann zu grauen, auf der Straße wurde es lebendig, doch in diesem Zimmer regte sich nichts.
Endlich erhob sich die Indianerin. Ihr Schützling lag so da, wie er eingeschlafen war, wie sie ihn zuletzt gelegt hatte.
Doch wie sah denn sein Gesicht aus? Plötzlich so eingefallen!
Atalanta hob seine Hand — eiskalt — und schlaff fiel sie wieder zurück.
Sie beugte sich über ihn, schlug sein Hemd zurück und legte ihr Ohr auf seine Brust.
Kein Herzschlag, kein Pulsschlag, kein Leben.
»Tot.«
Ganz gleichgültig, teilnahmslos hatte sie es gesagt.
Teilnahmslos? Sie war eine Indianerin, war trotz aller geistigen und sonstigen Ausbildung eine echte Indianerin geblieben.
Sie nahm die erste beste Decke, verhüllte ihr Gesicht samt dem ganzen Kopf und kauerte sich nieder. Keine Bewegung, kein Erschüttern des Körpers, kein Schluchzen war bemerkbar.
Nach einigen Minuten erhob sich Atalanta wieder. Noch einmal überzeugte sie sich, dass er wirklich tot war. Dann klingelte sie dem Kellner.
»Der Herr ist tot, bitte, rufen Sie einen Arzt!«, sagte sie ganz ruhig.
»Tot?!«, prallte der Kellner, der kein besonderer Held war, zurück und stürzte davon.
Der Arzt kam, es war derselbe wie gestern. Er untersuchte den angeblich Toten.
»Ja, eine Herzlähmung. Ich habe es gleich geahnt, diese Möglichkeit ist bei paralytischem Koma immer vorhanden, wollte Ihnen gestern nur nicht gleich das Schlimmste sagen.«
Auch ein Polizeiarzt kam und bestätigte dasselbe.
»Wer ist der Herr?«, fragte er.
Die Indianerin berichtete: Arno von Felsmark, zuletzt Trainer im Athletik-Klub zu New York, geborener Deutscher.
Dass er den Ehrentitel »Champion-Gentleman of New York« führte, fügte sie nicht hinzu, und dass dieser ein Graf Arno von Felsmark war, wusste man hier nicht. Sonst hätte der Tote hier ein ganz anderes Begräbnis gefunden, das sollte erst später nachgeholt werden, wie noch erzählt werden wird.
Jetzt handelte es sich hier um einen unbekanntem Mann, der an Herzschlag oder Herzlähmung verschieden war, der wirklich tot war, der begraben werden musste, und da kam zunächst eine andere wichtige Frage in Betracht. Denn der Tod ist durchaus nicht umsonst.
»Haben Sie Geld für ein anständiges Begräbnis?« — »Ja.«
Atemlos kamen gleich drei »Undertaker« angestürzt, Unternehmer, welche Hochzeit, Kindtaufe, Begräbnis arrangieren. Diese suchten sich gegenseitig den Rang abzulaufen.
Atalanta nahm den ersten, den Schnellfüßigsten, obgleich der zweite schwur, für wenige Dollars mehr alles weit feierlicher zu machen, und der dritte versicherte, die Leiche mit parfümierter Seife waschen zu lassen.
Die junge Indianerin war so pietätlos, für ihren Geliebten das billigste Begräbnis zu wählen, und so wurde schon wenige Stunden später ein einfacher Holzkasten gebracht, die Leiche hineingepackt und der Kasten zugenagelt.
Teilnahmslos hatte die Indianerin dem allen zugeschaut.
Nachdem sie nun noch die Hotelrechnung bei dem Kellner beglichen, folgte sie als einzige Leidtragende dem Sarge Arnos, der auf einem höchst einfachen Leichenwagen nach dem Friedhof geschafft wurde.
In Pittville war heute Markt und alles draußen auf der Festwiese, deshalb wohnten dem Begräbnisse keine Neugierigen bei, kein einziger kam.
Der Pfarrer war ein Methodist, er machte es am billigsten. Über den Verstorbenen hatte er sich gar nicht erkundigt. Dieselbe Leichenrede, die er hielt, hatte er gestern einer Jüdin gehalten, die im Wochenbett gestorben war. Es war eine Universalleichenpredigt, die auf alle passte, ob Mann, Weib oder Kind, ob Christ, Jude, Türke oder Sonnenanbeter.
»Amen!«, sagte er, und die Schollen fielen auf den Sarg, die »Feier« war beendet.
Die Nacht brach an, der Mond ging auf.
Einsam und menschenleer lag der immer offen bleibende Friedhof da.
Neben dem frischen Grabhügel, mit den spärlichen, dürftigen Kränzen bedeckt, kauerte die junge Indianerin.
In der Ferne knatterte Feuerwerk, manchmal stieg eine Rakete empor, das Volk johlte.
Stundenlang kauerte sie so da, unbeweglich, starr vor sich hinblickend.
Dann begann sie leise zu singen, fremde Worte, eine fremde, ganz eigentümliche Melodie. Halb schwermütig, von einer furchtbaren Wildheit. Und dazwischen ab zu merkwürdige Laute, kurz hervorgestoßen — so ungefähr wie ein Hund bellt.
Es war das Kriegslied der Mohawks, welches sie sangen, ehe sie in den Kampf gingen.
Als damals vor 16 Jahren Signor Ramonis Zirkus in der Nähe des Sklavensees lagerte, war ein aus seinem Stamme gestoßener Titone aufgenommen worden. Die Titonen waren die Nachbarn der Mohawks gewesen. Der vorzügliche Reiter, Lassowerfer und Bogenschütze war dann auch bei ihm geblieben, als sich Ramoni ganz der Spezialausbildung der kleinen Indianerin widmete, wozu ja noch andere Hilfskräfte nötig gewesen waren, die auch zum Teil noch lebten.
Das heranwachsende Kind hatte sich instinktiv ihrem roten Stammesbruder am engsten angeschlossen, bis er ein Jahr vor ihrem öffentlichen Auftreten gestorben war.
Von ihm hatte die kleine Atalanta die Sprache ihrer Väter gelernt, immer hatte der Titone von den Sitten und Gebräuchen der Mohawks erzählen müssen, von denen sie nun die letzte Repräsentantin war.
Nun also sang sie das Kriegslied ihrer roten Brüder, die jetzt in den ewigen Jagdgründen weilten, wo der Büffel nicht aussterben kann.
»Und wenn mein Feuer seinen Leib versengt, will ich sein Herz noch zuckend essen!«, ertönte es von Atalantas Lippen, dann war das Kriegs- und Rachelied beendet.
Jetzt nahm sie aus dem am Gürtel hängenden Lederbeutel, der eine ganze Masse der verschiedensten Utensilien beherbergte — der Medizinbeutel aller nordamerikanischen Indianer, der aber alles andere aufnimmt, nur keine »Medizin« nach unseren Begriffen — ein kleines Nähzeug. Aus diesem wiederum wählte sie eine feine Nadel und etwas weißen Zwirn, fädelte ihn ein, legte Nadel und Zwirn aber einstweilen in den Schoß.

Dann nahm sie aus dem Busen ein zusammengebundenes Büschel blonder Locken, die sie dem Toten abgeschnitten hatte. Von diesen zog sie drei Haare heraus, nahm sie in den Mund und steckte die Locke in den Busen zurück.
Jetzt streifte sie den linken Ärmel ihres Jagdhemdes bis zur Schulter zurück, zog ihr langes Jagdmesser, befeuchtete die scharfe Spitze mit Speichel — das beste antiseptische Mittel — stieß sie zolltief in die linke Oberarmmuskel, machte einen zwei Zoll langen Schnitt, aus dem merkwürdigerweise nur ganz wenig Blut floss, nicht mehr, als wenn sich ein anderer Mensch ganz leicht ritzt, stopfte schnell mit der Messerspitze die drei Haare hinein, netzte den Zwirnsfaden mit Speichel und nähte die Fleischwunde zu, etwa wie man einen Riss in einem Kleidungsstück zunäht.
Dann barg sie die Nadel gewissenhaft wieder, streifte den Ärmel zurück, schnürte ihn am Handgelenk bedächtig zu, erhob sich und verließ den Friedhof.
Im Geschwindschritt eilte sie durch die Straßen. Sie schlug dieselbe Richtung ein, von der sie gestern Nachmittag mit ihrer menschlichen Bürde gekommen war — nach dem Sklavensee zurück.
Zu derselben Zeit, als Graf von Felsmark in einen Schlaf fiel, der zu seinem Todesschlaf wurde, stellte sich der Missis Elliot der erwartete Jäger vor, den sie als Führer für ihren Ausflug nach dem Sklavensee in ihre Dienste nehmen wollte.
Der Mann, der eine Garantie dafür bieten sollte, dass zu der Jagdexpedition keine zweifelhaften Individuen kamen, machte selbst einen sehr wenig Vertrauen erweckenden Eindruck, abgesehen davon, dass sein Lederanzug von Fett und Schmutz starrte wie der ganze Mann. Letztes war übrigens ein Umstand, den man bei den meisten dieser Waldläufer beobachten konnte, die auf ihr Äußeres nur sehr wenig geben.
Dieser schon ältere Mann hatte aber auch ein recht unsympathisches Gesicht, von Leidenschaften durchwühlt; so eisern die verwitterten Züge auch sein mochten, die listig funkelnden Augen wichen scheu dem scharfen Blicke eines anderen aus. Der Grundzug im Charakter dieses Mannes war jedenfalls Habgier.
Das hatte auch die jetzige Missis Elliot sofort erkannt, und sie nahm sich Zeit, diesen Mann erst einmal gründlich zu mustern, jeden Zug in seinem Gesicht zu studieren.
»Na, Madam, habt Ihr mich nun endlich lange genug angestarrt?«, knurrte er schließlich verdrossen, offenbar nur, um seine Verlegenheit zu verbergen.
»Sie sind Mister Renald?«
»Ich bin der Wald- und Prärieläufer Renald, den es nicht zum zweiten Male gibt, und das Mister könnt Ihr ruhig weglassen.«
»Was nehmt Ihr für Eure Dienste?«
»Pro Tag einen halben Adler.«
Der ganze Adler, der bei der Goldrechnung als Münzeinheit gilt, wie in England das Pfund Sterling, hat zehn Dollars.
»Ich werde meine Jagdpartie nach dem Sklavensee wohl aufgeben!«, sagte die Dame gelassen, den Mann immer scharf beobachtend.
»Was zum Teufel bestellt Ihr mich dann erst hierher?!«, fuhr der grimmig auf.
»Um Euch zu sagen, dass ich Euch zu etwas anderem brauchen möchte.«
»Wozu?«
»Könnt Ihr morgen früh wiederkommen?«
»Weshalb?«
»Dann werde ich Euch engagieren, wollt Ihr so lange warten?«
»Hm. Wenn aber jetzt ein anderer kommt, der auf meine Diente reflektiert...«
»Ich zahle Euch Wartegeld.«
»Wie viel?«
Die Dame zog eine Börse und gab jenem zwei Doppeladler.
»Nur als Wartegeld bis morgen früh. Genügt das?«
Der Jäger war erst ganz sprachlos, als er die beiden schweren Goldstücke in der schmutzigen Hand wog, und über sein hageres Gesicht ging ein ganz eigentümliches Zucken, seine Augen begannen unheimlich zu glühen und zu funkeln.
Dieser Mensch war vom Teufel der Habgier ganz und gar besessen.
»Wirklich als Wartegeld, nur dass ich mich bis morgen früh von keinem anderen mieten lasse?«
»Nur als Wartegeld bis morgen früh.«
Jetzt riss der Jäger seine Lederkappe vom Kopfe, was solch einem Hinterwäldler gar nicht entsprechend war.
»Madam, Ihr seid das nobelste Frauenzimmer, das ich je gesehen habe — und das schönste dazu, in Euch muss sich ja jeder gleich verlieben!«, setzte er grinsend mit einer linkischen Verbeugung hinzu.
Er hatte offenbar als Führer von amerikanischen Sportsdamen schon seine Erfahrung gemacht, das war alles Berechnung von ihm.
»So geht jetzt und kommt morgen früh sobald wie möglich. Ich bin immer zu sprechen. — Halt, noch eins! Dass Ihr aber nüchtern kommt. Dass Ihr das Geld nun nicht gleich vertrinkt, wie Ihr Jäger es alle mit Vorliebe tut!«
»Ich? Hahaha, da kennt Ihr den alten Renald aber schlecht. Der ist schlauer. Ich trinke nur, wenn ich freigehalten werde, und dann immer nur mit Maßen.«
»Nun geht.«
Er ging. Dieser Mann war auch noch vom Geiz besessen, und das hatte Miss Morgan nur noch erfahren wollen. Denn Habgier und Geiz ist doch zweierlei. Ein habgieriger Mensch kann auch ein Verschwender sein.
»Der ist gerade so, wie ich ihn brauche, der macht für Geld alles, ist absolut zuverlässig, nur... muss man sich hüten, an einsamen Orten mit ihm allein zu sein. — Ja, wann aber werde ich nun das Resultat erfahren?«
Miss Morgan verbrachte eine schlaflose, eine fürchterliche Nacht. Rastlos wanderte sie in ihrem Zimmer auf und ab, manchmal lauschend stehen bleibend, manchmal dabei auch die Korridortür öffnend.
Sie hörte nicht, was sie zu hören wünschte.
Als der neue Tag zu grauen begann, glaubte sie freilich nicht, dass dadurch ihrer Qual schon ein Ende bereitet würde.
Als es drüben nach dem Kellner klingelte und sie die Stimme der Indianerin hörte, erschrak sie freilich furchtbar, ihr Gesicht verzerrte sich vor Wut.
»Wieder dem Schicksal entronnen, das Mittel hat wieder nichts genützt, diese beiden sind gegen alles Gift gefeit...«
So dachte sie, brach aber ihren Gedankengang schnell ab. Die Indianerin sagte, dass ihr Begleiter tot sei, ein Arzt solle gerufen werden.
»Also doch! Wenigstens bei ihm hat es gewirkt! Gelobt sei... der, dem ich dieses Mittel zu verdanken habe! Mag die Indianerin laufen. Wenn ich nur ihn habe.«
Dann schrak sie wieder zusammen.
»Ja, wenn sie ihn aber nun sezieren?! Wie soll ich das verhindern?«
Sie brauchte sich nicht darum zu sorgen. Sie vernahm die Erklärung des Arztes, dass er diese Herzlähmung vorausgesehen, nur nicht davon gesprochen habe, und an ein Sezieren der Leiche dachte niemand.
Heute Nachmittag um zwei Uhr sollte die Leiche abgeholt werden.
Jetzt fehlte nun wieder der Jäger. Er kam um acht, hielt das schon für sehr früh, bei einer so vornehmen Dame.
Die Unterhaltung wurde wieder aufgenommen. Die Dame brauchte nur ihre Stimme zu einem Flüstern herabzudämpfen, so tat dies der Jäger ebenfalls ohne Aufforderung.
»Wollt Ihr für immer in meine Dienste treten?«
»Wenn Ihr mich danach bezahlt, warum nicht?«
»Ihr sollt zufrieden sein, und ich glaube, Ihr seid ein zuverlässiger Mann.«
»Verlangt von mir, was Ihr wollt.«
»Ihr führt es aus?«
»Alles. Wenn es danach bezahlt wird.«
»Auch wenn ich sage, mordet den und jenen Menschen?«
Ganz gleichgültig hatte es Miss Morgan gesagt, nur das Gesicht des Mannes beobachtend.
Starr blickte dieser die Fragerin an, dann verzog sich sein Gesicht zu einem überaus schlauen Lächeln.
»Hm. Wenn Ihr mir sagt: tötet den und jenen Mann, so setze ich natürlich voraus, dass er ein gerichtlich zum Tode verurteilter Verbrecher ist, dessen man nur nicht habhaft werden kann, der daher als Desperado für vogelfrei erklärt worden ist, wie?«
Schlauer hätte das dieser Mann wirklich nicht anfangen können. Der wusste seinen Rücken frei zu halten.
»Sehe ich aus wie eine Mörderin?«
»Das kann man niemandem ansehen, sonst gäbe es keine Mörder und Spitzbuben, und wer spricht denn hier überhaupt von Mord? Habe ich Euch nicht eben gesagt, wie ich das halte? Wenn Ihr mir schwört, dieser oder jener Mann ist ein nach allen Regeln des Gesetzes zum Tode verurteilter Verbrecher, dann ist es nach amerikanischem Gesetz sogar meine Pflicht...«
»Schon gut, schon gut, habe Euch schon verstanden Nein, an so etwas denke ich gar nicht.«
»Was erzählt Ihr es mir da erst?«
»Es handelt sich um etwas anderes.«
»Um was?«
»Habt Ihr gehört, dass hier im Hotel ein Herr gestorben ist?«
»Ja, ich habe es gehört.«
»Was habt Ihr gehört?«
»Er hat am Sklavensee gejagt, hat da einen Schlaganfall oder so etwas bekommen, ist an den Füßen gelähmt worden, eine Indianerin, die ihn begleitete, wahrscheinlich seine Geliebte, hat ihn hierher getragen, und nun ist auch sein Herz gelähmt worden, er ist heute Nacht gestorben.«
Der Mann wusste fast noch mehr als Miss Morgan, die hier im Zimmer nebenan logierte. Sie hatte sich nicht zu erkundigen gewagt.
Jetzt zog sie ein Tüchelchen hervor und tupfte auf ihre Augen, die nass geworden waren.
»Ich habe diesen Mann geliebt!«, flüsterte sie.
»Ja, ja, wie das so kommt!«, stimmte der verlotterte Jäger bei. »Ich habe auch schon einige Liebespärchen zusammengebracht und dadurch schweres Geld verdient. Doch das kommt nun hier nicht in Frage, denn der Gegenstand Eurer Liebe ist ja tot. Und nun wollt Ihr wohl seine Leiche haben, ihn aus der Erde puddeln, was?«
Miss Morgan erschrak. »Mann, wie kommt Ihr...«
»Na, nur ruhig. Also ich habe das Richtige getroffen. Habe mir so etwas doch gleich gedacht. Unsereins ist doch nicht so dumm.«
»Was soll ich denn mit der Leiche beginnen?«
»Sie in einem Erbbegräbnis beisetzen oder sonst was. Denkt Ihr etwa, es ist die erste Leiche, die ich auspuddele? Ach, was unsereins manchmal hier in der Wildnis als Jäger erlebt. Da wird einer getötet, durch die Kugel eines Indianers oder durch einen Bären oder sonst wie, man muss ihn doch begraben — na, und dann kommen seine Angehörigen und wollen ihn wieder ausgegraben haben, um seinen Leichnam mit nach Hause zu nehmen. So was tut man ja gern, aber Geld kostet's natürlich.«
»Hier liegt doch etwas ganz anderes vor.«
»Wieso?«
»Hiervon darf kein Mensch etwas wissen.«
»Madam, was geht mich denn das an?«
»Die Sache ist nämlich die, dass die Leiche wahrscheinlich von seinen Verwandten aus Deutschland abgeholt werden wird, ich möchte aber den mir teuersten Mann, den ich auf Erden gehabt...«
»Wozu erzählt Ihr mir denn das alles? Sagt kurz und bündig, ob Ihr mich für den verlangten Dienst entsprechend bezahlen wollt und die ganze Sache ist erledigt!«
»Wie viel fordern Sie dafür?«
»Na... sagen wir rund tausend Dollars.«
Für diesen Mann mochte das eine ungeheure Summe sein — die Tochter des Milliardärs hatte sich auf Zehnfache gefasst gemacht, und es gab wohl keinen Preis, den sie für diesen Zweck nicht bezahlt hätte.
»Das ist zu viel!«, sagte sie dennoch, um sich für später nicht ausbeuten zu lassen.
»Nicht zu viel für mich.«
»Fünfhundert Dollars.«
»Madam, nicht handeln! Bedenkt nur, was ich sonst noch für Auslagen dabei habe.«
»Was denn für welche?«
»Nun, ich muss doch vor allen Dingen den Totengräber spicken, der tut das doch auch nicht umsonst.«
»Ach, das ist auch mit bei den tausend Dollars?!«, begann die Dame förmlich freudig zu staunen.
»Alles, alles — für diese tausend Dollars liefere ich Euch die Leiche franko ins Haus, inklusive Verpackung, hähähä! Ich bin ein tadelloser Geschäftsmann.«
Ja, das war wirklich ein prachtvoller Mensch!
»Abgemacht! Aber ins Haus liefern? Wie meinen Sie das?«
»Ja, wo wollen Sie den toten Kerl sonst hin haben?«
»Das ist es eben. Ich weiß noch gar nicht recht, wie ich das arrangieren soll. Ich muss den Toten mit in die Eisenbahn nehmen.«
»Hm. Ich verstehe. Sie müssen überhaupt erst aus der Stadt heraus. Der Bahnhof ist immer belebt. Nun, ich will Euch für die tausend Dollars gern auch noch weiter behilflich sein...«
»Ich möchte Euch gern für immer engagieren.«
»Darüber wollen wir später weiter sprechen. Jetzt erst diesen Fall erledigen. Hm. Den Sarg könnt Ihr nicht mitnehmen. Ich werde schon eine andere Kiste auftreiben.
Da fällt mir ein, heute und morgen ist hier Jahrmarkt. Da ist auch ein Wachsfigurenkabinett ausgestellt. Kauft so eine Wachsfigur, natürlich gleich mit der Kiste, das wird stadtbekannt, und wir packen einfach die Leiche in diese Kiste und die Wachsfigur in den Sarg, was?«
»Der Gedanke ist nicht so übel. So könnte es gehen!«
Und in der Tat reiste am anderen Morgen Missis Elliot von Pittville wieder ab. Ihr Gepäck hatte sich um eine große, lange Kiste vermehrt, welche, wie die ganze Stadt wusste, die Wachsfigur enthielt, die sie gestern Nachmittag in der Schaubude für 400 Dollars gekauft hatte.
Und seit dieser Zeit war auch der Jäger Renald aus dieser Gegend verschwunden, nebst einem seiner Gehilfen, den er bei Ausrüstung von Jagdexpeditionen bevorzugte.
»Entschuldige, meine liebe Atalanta, dass ich wieder einmal eingeschlafen bin!«, sagte Arno, noch ehe er die Augen aufgeschlagen hatte.
Denn so plötzlich, wie sein Einschlafen erfolgte, war dann auch immer das Erwachen. Es war wie ein Ruck in seinem Gehirn, dann war er immer sofort bei ganz klarer Besinnung.
Als er aber jetzt die Augen aufschlug, da glaubte er doch nur zu träumen.
Er lag doch nicht mehr in dem Hotelbett? Das war doch auch nicht mehr das Hotelzimmer?
Ja, wo befand er sich denn eigentlich?
Es war ein geräumiges Gemach, höchst luxuriös gerichtet, etwas orientalisch, mit einer Unmenge Polster und Kissen, aber auch mit modernen Möbeln ausgestattet.
Das Seltsamste aber war ein Eisengitter aus zollstarken Stäben, welches die eine Wand dieses Zimmers bildete, von der Decke bis zum Boden, und hinter diesem Gitter befand sich wieder solch ein Zimmer, ebenso eingerichtet, ebenfalls elektrisch erleuchtet und auch solch ein breites, elegantes Bett enthaltend.
Doch in dem Bett seiner eigenen Abteilung lag Arno nicht, sondern auf einer Chaiselongue, angetan mit einem prachtvollen türkischen Schlafrock.
»Na, so ein kurioser Traum«, murmelte Arno, »alles so natürlich und...«
Unwillkürlich hatte er im Liegen seine Füße gehoben, sie von dem Schlafsofa herabgleiten lassen, und er stand auf, ging hin und her, kam vor einen großen Wandspiegel, sah sich darin, wie er sich einmal an den Ohren zupfte, wie er mit den Beinen schlenkerte, und dann sah er, wie sich sein Gesicht immer mehr in staunender Seligkeit verklärte, und dann jubelte es aus ihm heraus.
»Ich kann wieder gehen, die Gelenkigkeit meiner Beine ist zurückgekehrt und das ist nicht nur ein Traum!«
Minutenlang war er von dieser Erkenntnis ganz überwältigt, er wagte an dieses Glück noch gar nicht recht zu glauben, obgleich er doch nicht an der Tatsache zweifelte.
Dann sah er sich wieder um.
»Ja, wo bin ich denn nur eigentlich?!«
Er fand sofort eine Erklärung, wie der Mensch nun einmal für alles, was er nicht gleich begreifen kann, sofort eine Erklärung haben muss und sie auch immer findet — natürlich immer eine falsche.
»Ich habe diesmal längere Zeit geschlafen, bin bewusstlos gewesen, vielleicht tagelang, Atalanta hat mich in eine Anstalt gebracht, da bin ich auf besondere Weise behandelt worden.«
So, jetzt war alles erklärt. Das heißt, das war ihm nur so durch den Kopf geschossen. Aber es war doch eben eine Lösung des Rätsels. Auf die »Anstalt« war er durch das Gitter gekommen, er dachte wohl so unbestimmt an eine »Tobzelle«, in die Geisteskranke gesperrt werden, obgleich ihm wegen seiner selbst nicht die geringste Sorge aufstieg. Das hatte doch alles Atalanta arrangiert.
»Atalanta, meine liebe Atalanta, ich bin erwacht!«, rief er nun laut aus, doch keine Antwort erfolgte.
»Nun, sie wird schon noch kommen. Ach, meine Atalanta! Na, sehen wir uns bis dahin weiter um.«
Der von einem elektrischen Kronleuchter erhellte Raum hatte keine Fenster. Nur oben an der Decke entdeckte Arno eine kleine Öffnung und dann auch unten am Boden künstliche Ventilation.
Dann waren zwei Türen vorhanden, mit künstlerischen Messingbeschlägen belegt.
Arno öffnete die, der er am nächsten stand. Sie führte in einen Baderaum. Die Marmorwanne war mehr ein kleines Bassin zu nennen, zwei kurze Schwimmstöße konnte man darin ausführen, darüber mehrere blanke Hähne, einer sogar für Seewasser — was Arno jetzt aber nicht bemerkte — eine Chaiselongue, alles aufs komfortabelste.
»Das lasse ich mir gefallen, hier kann man es aushalten. Untersuchen wir die andere Tür.«
Auf dem Wege durch das Gitterzimmer, wie wir es nennen wollen, sah er ein Rauchtischchen mit drei Zigarrenkisten. Deren Deckel mussten noch eher als jene Tür geöffnet werden.
»Ah, Vegueros, Regalia und Panatelas! Die feinsten Importe, würden wir in Deutschland sagen, was aber in Amerika nicht ganz zutrifft. Nun, so eine Tobzelle lasse ich mir gefallen! Da werde ich mir erst eine Regalia ins Gesicht stecken.«
Rasch hatte Arno die Spitze abgeschnitten und mittels des vorhandenen Feuerzeugs die Zigarre in Brand gesetzt. Für einige Minuten gab er sich mit seligträumendem Gesicht ganz dem Genusse hin, den nur der echte Raucher kennt.
»So. Das Andachtsgebet des Rauchers ist beendet. Nun wieder ans Geschäft — wohin führt dort die zweite Tür?«
Als er diese öffnete, da hatte er einen Anblick, da kam ihm etwas entgegen, was zu dieser Regalia nur noch gefehlt hatte!
Goldene Morgensonne und köstliche Morgenluft waren es, die ihm entgegenfluteten. Und vor ihm, so weit das Auge reichte, ein blauer Wasserspiegel! Allerdings auch tief, tief unter ihm.
Wir wollen uns gleich mit nüchternen Augen umschauen, was Arno erst später tat, während er jetzt ob dieses unerwarteten Anblicks ganz trunken war.
Der Platz, auf dem er sich befand, war ein vorspringendes Felsplateau von etwa acht Meter Durchmesser, durch Palmen, Efeuwände und andere Blattpflanzen in einen Garten verwandelt, aber auch mit herrlichen Blumen geschmückt, nur dass alles in Töpfen und Kästen stand, wenn man diese auch zu verbergen gewusst hatte. Dazu noch elegante Gartenmöbel, mit Kissen belegt, in einer Efeulaube ein Tisch und ein Sofa, neben einem Faullenzerklappstuhl auch hier wieder ein Rauchtischchen — alles aufs Reizendste und Bequemste vorgerichtet.
Nun aber die Hauptsache: Auch diese künstliche Gartenanlage mindestens 200 Meter über dem Wasser — ob Meer oder ein Binnenwasser, das war ja noch gar nicht zu bestimmen — war wieder mit einem starken Gitterwerk umgeben, und zwar auch oben geschlossen.
Das ganze Plateau fasste es nicht ein, rechts war noch ein freier Platz, auf dem nur ein einziger Lehnstuhl stand.
»Wieder ein Käfig? Wozu das? Doch natürlich, man könnte sich ja sonst dort hinunter stürzen. Hier wurden doch offenbar auch Geisteskranke interniert. Das hat man bei mir ja nun weniger zu befürchten, dass ich da hinunter springe!«
Also das Gitterwerk beeinflusste seine glückliche Stimmung nicht im Geringsten.
»Ach, ist das herrlich, herrlich! Und diese Regalia! Nun möchte ich bloß noch eine Tasse Mokka haben. — Ja, war da nicht auch ein Telefon?«
Er begab sich in das Käfigzimmer zurück. Richtig, da war ein Telefon. Er klingelte.
»Sie wünschen, Herr Graf?«, wurde sofort gefragt, als hätte man nur auf seinen Anruf gewartet, und zwar war es eine Frauenstimme.
»Wer ist dort?«
»Die Telefonbeamtin.«
»Das sagt mir sehr wenig. Wo bin ich hier?«
»Das... darf ich nicht verraten.«
»Weshalb nicht?«
»Sie sollen überrascht werden.«
»Das finde ich sehr merkwürdig.«
»Sie werden staunen.«
»Bin ich in einer Anstalt?«
»Ja.«
»Für Geisteskranke?«
»Nein. Oder nur selten wird ein Geisteskranker hier in Pflege genommen. Sie haben gerade solche Räumlichkeiten bekommen, es waren keine anderen frei.«
Also alles gleich richtig erraten, sagte sich Arno mit einigem Stolze.
»Ist Miss Atalanta Ramoni auch hier?«
»Ja, die befindet sich auch hier.«
»Na, dann ist es ja gut. Wo ist sie?«
»Sie wird gleich zu Ihnen kommen.«
»Schön, nun bin ich beruhigt. Wo sich diese Anstalt befindet, das wollen Sie mir also nicht verraten?«
»Nein, das darf ich nicht!«
»Ist das ein Binnensee oder das Meer?«
»Ich... darf Ihnen gar keine Erklärung geben.«
»Aber eine Tasse Kaffee dürfen Sie mir doch geben.«
»Ja, die darf ich Ihnen geben!«, wurde auf der anderen Seite gelacht. »Wünschen der Herr Graf auch etwas zu speisen?«
»Bestellen Sie nur erst eine Tasse Mokka, danach habe ich jetzt den größten Appetit.«
»Ist bereits bestellt, in einer Minute ist er oben.«
»So. Na, dann können Sie mir auch noch etwas zu essen bestellen, dass ich es in einer halben Stunde habe. Geht das?«
»Gewiss. Was befehlen der Graf?«
»Was es ist. Nur kein Heu.«
»Heu?«
»Ich meine. ich bin kein Vegetarier. Mir genügt schon ein Rumpsteak, nicht so sehr groß, höchstens eine viertel Elle lang.«
»Ist schon bestellt!«, wurde wieder gelacht.
»Wie ist Ihr werter Name, Fräulein?«
»Ich heiße Lucy — Lucy Engel.«
»Engel? Sehen Sie, das habe ich mir doch gleich gedacht! Wie lange bin ich denn schon hier?«
»Seit... Sie sind zwölf Tage bewusstlos gewesen, das darf ich Ihnen verraten.«
»Zwölf Tage?! Sapperlot! Hören Sie, Fräulein Engel, Sie können mir das Rumpsteak noch ein paar Zoll länger machen.«
»O, Sie sind immer künstlich ernährt worden.«
»Davon habe ich aber doch nichts gemerkt. Geben Sie nur noch ein paar Zoll zu. Wissen Sie, dass ich gelähmt gewesen bin?«
»Selbstverständlich ist das hier bekannt.«
»Dass ich meine Füße wieder gebrauchen kann?«
»Natürlich wissen wir das. Deshalb sind Sie doch hierher gekommen, die Heilung ist geglückt.«
»Die Lähmung kann nicht zurückkommen?«
»Sicher nicht.«
»Da möchte ich nun erst recht wissen, wo ich mich hier befinde!«
»Sie werden alles erfahren.«
»Die junge Indianerin hat mich hierher gebracht?«
»Jawohl. Verzeihen Herr Graf... der Kaffee ist schon oben.«
»So, wo denn?«
»Auf dem Fahrstuhl. Sie sehen doch gleich neben dem Telefon den Handgriff. Öffnen Sie die Klappe, da steht er drin. Herr Graf müssen sich vorläufig selbst bedienen. Wenn es in einer halben Stunde klingelt, so steht dort drin das Rumpsteak. Im Übrigen bin ich Tag und Nacht zu Ihrer Verfügung.«
Arno öffnete die bezeichnete Klappe, fand in einer Nische ein silbernes Servierbrett mit Kaffeekännchen und was sonst noch dazu gehört, alles aus feinstem Porzellan, trug es auf die vergitterte Gartenveranda, ließ sich in einen Lehnstuhl nieder, gab sich dem durch ausgezeichneten Kaffee verstärkten Genusse der Zigarre hin und nicht minder dem Genusse, die Beine nach Belieben übereinander schlagen zu können und die türkischen Saffianpantoffeln auf den Fußspitzen wippen zu lassen.
»Ja, ja, wenn man das einmal einige Zeit nicht hat machen können, dann merkt man erst, wie schön das ist!«, seufzte er voll stiller Behaglichkeit.
Auch die Szenerie beglückte ihn noch so. In der Ferne einige Segel, noch weiter ein kleiner Dampfer. Arno empfand es gerade recht amüsant, nicht zu wissen, ob das ein Binnensee oder das Meer war, und er konnte sich gerade so gut an der Küste des Atlantischen wie des Großen Ozeans befinden.
Eine andere Küste war also nicht zu erblicken. Er stand einmal auf, trat auf beiden Seiten dicht an das Gitter, konnte aber immer noch nichts sehen. Er befand sich eben auf einem ganz spitzen Vorsprung. Es konnte ein Küstenvorgebirge, es konnte aber auch eine kleine Insel sein. Da half es nichts, sich jetzt darüber den Kopf zu zerbrechen, da musste er die Erklärung abwarten.
Nur das konnte er schon jetzt beurteilen, dass er sich vorhin in einem Irrtum befunden hatte. Das war nicht die Morgensonne, sondern die Abendsonne! Sie näherte sich dem Horizonte.
So, nun wusste er ungefähr, wo Westen war. Aber das sagte ihm noch gar nicht, welches Meer das sein könne, wenn auch die Abendsonne darüber stand. Es gibt doch viele Meeresbuchten, von Halbinseln eingeschlossen. Und dann konnte es ja überhaupt ein Binnensee sein.
»Nicht grübeln, ich muss warten.«
Dadurch kam er nur darauf, einmal nachzusehen, was man ihm von seinen früheren Sachen gelassen habe. Absolut gar nichts. Kein Revolver, keine Brieftasche, keine Uhr und nichts. Unter dem pompösen Schlafrock, dessen sich der Sultan der Türkei nicht hätte zu schämen brauchen, trug er Unterkleider aus grauer Seide.
»Hier in dieser Anstalt geht's ja hochfein zu, das wird was Nettes kosten. Na, da müssen wir eben in einem Zirkus einmal tüchtig akrobatieren. Ach, bin ich glücklich, dass das wieder so gekommen ist!«
Es klingelte, anders als das Telefon.
»Aha, mein Rumpsteak!«
Richtig, hinter der Klappe stand ein Servierbrett mit mehreren Schüsseln, Arno tauschte es gegen das Kaffeeservice um.
Ja, eine Viertelelle war es lang, mit Kaviarschnitten garniert, eine große Schüssel mit Champignons und was sonst noch dazu gehört, in Amerika zum Beispiel auch einige Fläschchen mit pikanten Saucen.
Arno nachte es sich gemütlich, aß hier in diesem Zimmer, schnalzte öfters mit der Zunge und gab seiner Zufriedenheit noch lauteren Ausdruck.
»Solche Raubtierfütterung lasse ich mir gefallen. Hier kann ich es einige Zeit aushalten. Dann wird mir doch wohl auch Atalanta Gesellschaft leisten. Wo sie nur bleibt? Nun, sie wird schon kommen. So, nun mag das Geschirr wieder hinter den Kulissen verschwinden, ich werde mir noch eine Veguero Exquisito zu Gemüte führen.«
»Darf ich Ihnen Feuer geben, Herr Graf?«
Die Hand, die sich nach dem Zigarrenabschneider ausstreckte, stockte in der Bewegung, langsam, als wolle er nicht glauben, dass es wirklich die ihm bekannte Stimme sei, wandte er den Kopf, nach der Gitterwand zu und verwundert rief er aus:
»Miss — Marwood — Morgan!«
Sie war es, sie stand hinter dem Gitter, drüben in dem anderen Raume, trug ebenfalls einen Morgen- oder Schlafrock, aber einen so pompösen, dass ihn jeder gute, gebildete Deutsche unbedingt »Negligé« genannt hätte. Himmelblau mit weißen Spitzen und roten Schleifchen — Fähnchen würde der Seemann sagen.
»Darf ich Ihnen Feuer geben, Herr Graf?«, wiederholte die Amerikanerin.
»Danke verbindlichst!«, sagte Arno, sich seine Zigarre mit aller Gemütsruhe selbst anzündend. »Hören Sie, Miss, Ihr Kaviar ist ausgezeichnet. Wo beziehen Sie denn den her? Und das Rumpsteak zerfloss wie Butter auf der Zunge. Bei Ihnen bleibe ich länger in Pension!«
Das schöne Antlitz des verführerischen Weibes wurde ganz verdutzt, und das war begreiflich. Einen solchen Empfang hatte Miss Morgan natürlich nicht erwartet. Und der Graf hatte das Klügste getan, was er hatte tun können. Jetzt war sofort er der Herr der Situation.
»Sie haben mich erwartet?«, fragte die Amerikanerin.
»Erwartet? Nein!«, blieb Arno ganz bei der Wahrheit. »Ich denke, ich bin hier in einer Heilanstalt und erwartete den Besuch eines Arztes und vor allen Dingen den meiner indianischen Begleiterin. Indem aber Sie nun hier auftauchen, verwandelt sich für mich sofort dieser Raum, den ich erst für die Sicherheitszelle eines Geisteskranken hielt, in einen Käfig, und damit ist mir auch alles andere klar.«
»Nun?«
»Sie haben sich meiner in bewusstlosem Zustande bemächtigt.«
»Sie sind tot.«
Arno sagte zunächst nichts, sondern hob sein linkes Bein, schlenkerte es etwas, setzte den Fuß wieder hin und machte das gleiche Manöver mit dem rechten Beine.
»Tot? Ich? Nee. Ich fühle mich ganz lebendig.«
Schade, dass Miss Morgan jetzt gar keinen Sinn für diesen Humor hatte.
»Sie sind tot und begraben.«
Behaglich blies Arno den Rauch seiner Zigarre vor sich hin.
»Ich merke wirklich nichts davon.«
»Sie liegen auf dem Friedhofe von Pittville.«
»Ach, erzählen Sie mir keine Geschichten.«
»Davon ist alle Welt überzeugt.«
»Wovon alle Welt überzeugt ist, das ist mir ganz gleichgültig. Die Hauptsache ist dabei, dass es nicht wahr ist. — Diese Havanna ist wirklich ausgezeichnet. Darf man fragen, was so eine Veguero kostet?«
Miss Morgan wollte sich wohl auf die Lippen beißen — unterließ es aber.
»Interessiert es Sie denn gar nicht, wie Sie hierher gekommen sind?«
»O doch. Bitte, wollen Sie Platz nehmen?«
Sie folgte der Aufforderung, die ja nicht anderes sein konnte als spöttisch, wirklich. Er ließ sich gleich behaglich auf einen Lehnstuhl nieder und Miss Morgan begann zu erzählen.
»Ich bin Ihnen nach dem Sklavensee gefolgt, hatte nur die Reise bis nach Pittville nötig. Da kamen Sie schon zurück — in gelähmtem Zustande. In einem geeigneten Moment mischte ich Ihrem Essen ein Betäubungsmittel bei oder vielmehr ein Mittel, welches Scheintod erzeugt. Noch an demselben Tage wurden Sie begraben. Und in derselben Nacht noch habe ich Sie wieder ausgraben lassen, brachte Sie hierher und habe Sie wieder lebendig gemacht.«
Ganz ruhig hatte Arno dies angehört. Jetzt machte er erst eine höfliche Verbeugung.
»Besten Dank, dass Sie mich wieder lebendig gemacht haben. Das könnten Sie eigentlich auch später einmal bei mir besorgen, wenn ich wirklich abgefahren bin. — Also so ist die Geschichte. Einiges ist mir allerdings noch zweifelhaft dabei, worüber ich um nähere Auskunft bitte.«
»Fragen Sie. Ich werde ganz offen antworten. Sie sollen alles erfahren.«
»Mich interessiert nur, was aus Miss Atalanta, der Indianerin, geworden ist, die haben Sie natürlich nicht wieder lebendig gemacht.«
»Auf die Indianerin hat dieses Mittel seltsamerweise gar nicht gewirkt!«, erwiderte die Amerikanerin.
»Nicht? Das freut mich. Doch das wundert mich gar nicht mehr so sehr. Die ist über solches Zeug, dem wir anderen schwächlichen Menschen unterliegen, erhaben. — Also die lebt noch.«
»Die lebt noch. Sie hat Ihrem Begräbnis beigewohnt und ist dann gegangen.«
»Gegangen. So. Und wohin ist sie gegangen?«
»Was kümmert das mich?«
»Sie werden sich schon noch genug darum kümmern.«
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Sie werden... nun, lassen wir das vorläufig.«
»Nein, lassen wir das nicht. Sie glauben wohl, diese Indianerin hat besondere Teilnahme gezeigt?«
»An meiner scheintoten Leiche? Bei meinem Begräbnis? Nein, das glaube ich nicht. Sie wird schwerlich eine Träne vergossen haben.«
»Woher sind Sie davon so überzeugt?«
»Weil es eben eine Indianerin ist, wenn sie auch Schach spielen und mit Logarithmen rechnen kann.«
»Ich verstehe, was Sie hiermit meinen. Nein, hierbei liegt doch etwas ganz anderes vor. Atalanta, wie die Dirne heißt, hat Sie sicher sehr geliebt. Aber sie hat sich schnell über ihren Verlust zu trösten gewusst.«
»Wie, zu trösten gewusst?«
»Wie es eben so eine indianische Squaw macht.«
»Na, wie macht denn das so eine indianische Squaw? Ich bin nämlich mit den indianischen Sitten durchaus nicht vertraut!«
»Sie hat sich einfach einen anderen Liebhaber genommen. Diese Indianer wissen sich aber schon recht gut die Vorteile der Zivilisation zunutze zu machen. Oder sie geben eben etwas aufs Äußere. Sie hat gleich geheiratet, zwei Tage nach Ihrem Begräbnis, und die Kosten der Hochzeit von dem Gelde bestritten, das sie aus Ihren Taschen genommen hat.«
Der Graf riss die Augen weit auf.
»Ach nee!«, brachte er nur hervor.
Miss Morgan wurde etwas unwirsch. Sie wusste nicht recht, ob der Graf sich nicht nur so stellte.
»Sie glauben's nicht?«
»Nun, wenn Sie's sagen, muss ich's wohl glauben. Mit wem hat sie denn Hochzeit gemacht?«
»In Pittville fand sich ein Cowboy ein, der früher mit bei einer Zirkustruppe gewesen war und sich unter Signor Ramoni weiter ausgebildet hat. Übrigens noch jetzt ein junger Mensch. Zwischen den beiden mag schon immer ein Liebesverhältnis bestanden haben. Als er in Pittville auftauchte, ist die Indianerin ihm gleich an den Hals geflogen.«
»Gleich an den Hals? Ach nee!«
Das hielt Miss Morgan nicht mehr aus, sie stand auf. Sie hatte ihren letzten Trumpf noch nicht ausgespielt. Auch in ihrer Abteilung befand sich ein Telefon, daneben konnte ebenfalls eine Klappe geöffnet werden, und Miss Morgan entnahm der Öffnung einige Zeitungsblätter.
»Bitte, lesen Sie selbst, es ist der New York Herald!«, sagte sie, auf eine Stelle deutend, ihm dann das Blatt durch das Gitter zusteckend, wobei es ganz ersichtlich war, wie sie sich hütete, diesem gar zu nahe zu kommen.
»Sie denken wohl, ich beiße? Dann müssen Sie auch eine dementsprechende Warnungstafel an meinen Käfig machen!«, sagte Arno ironisch.
»Lesen Sie nur!«
Arno tat ihr den Gefallen und las halblaut:
Unserem gestrigen Berichte über das Begräbnis des deutschen Grafen Arno von
Felsmark, bekannt unter dem Ehrennamen »Champion-Gentleman von New
York«, der in Pittville ein so trauriges Ende genommen hat, fügen wir noch hinzu, dass sich seine indianische Begleiterin, die bekannte Artistin Atalanta, über
den Tod ihres Geliebten schnell zu trösten gewusst hat. Schon zwei Tage später
feierte sie Hochzeit mit einem Cowboy, der...
Es war dasselbe, was ihm schon Miss Morgan erzählt hatte. Hinzugefügt wurde nur, dass,
wie unser Spezialberichterstatter aus Pittville meldete, in dem Städtchen die
größte Entrüstung geherrscht hatte, als man erfuhr, dass die Indianerin die
Hochzeitsfeierlichkeit mit dem Geld bezahlt hatte, das sie dem Toten abgenommen. Die beiden wären vom empörten Volke beinahe gelyncht worden, hätten
sie sich nicht durch schnelle Flucht diesem Schicksal entzogen.
So hatte Arno halblaut gelesen.
»Nun, was sagen Sie dazu?«
»Ich danke Gott, dass er mir durch diese Zeitungsnotiz die ganze Verworfenheit Ihres Charakters gezeigt hat. — So, hier haben Sie Ihre Zeitung wieder.«
Verdutzt und immer verdutzter hatte Miss Morgan den Sprechenden angesehen.
»Sie glauben's nicht?«
»Nein.«
»Das kann doch nicht erfunden sein.«
»O, die Zeitungen erfinden noch etwas ganz anderes. Das haben Sie doch überhaupt selbst hineinsetzen lassen!«
»Sie meinen, ich selbst hätte das berichtet?«
»So ähnlich.«
»Die Unwahrheit müsste doch sehr bald an den Tag kommen.«
»Das ist nicht nötig.«
»Wieso nicht?«
»Steht das noch in anderen Zeitungen?«
»Bitte, hier sind noch drei andere.«
Arno nahm sie. Der Text dieser Notiz war verschieden, der Inhalt immer derselbe.
Der Leser nickte zufrieden.
»Ja, nun ist der Betrug offenbar. Ich bin nämlich in letzter Zeit, durch den Verkehr mit der Indianerin, sehr scharfsinnig oder doch sehr scharfsichtig geworden. Alle diese vier Artikel in den vier verschiedenen Zeitungen sind immer mit denselben Typen gedruckt worden. Hier das i hat immer eine Kapuze anstatt einen Punkt, das a mit dem unterbrochenen Striche kommt immer wieder. Was daraus zu folgern ist? Diese Artikel haben Sie ganz einfach in die fertigen Zeitungen mit der Handpresse in freigelassene Stellen selbst hineingedruckt!«
Das Weib sah sich entlarvt. Es gab sich auch gar keine Mühe, das zu verbergen. Arno hatte sofort das Richtige erkannt.
Es ist dies nämlich bei amerikanischen und englischen Zeitungen, welche meist den Text mit Annoncen und Reklamen durcheinander bringen, um für letztere mehr Interesse zu erwecken, sehr leicht möglich. In diesen Zeitungen sieht man immer hier und da einen freien Platz. Manchmal ist nur ein Stichwort hineingedruckt, oftmals aber auch gar nichts. Mit diesen freien Plätzen ist schon mancher Unfug getrieben worden.
»Nein, Miss Morgan«, fuhr Arno fort, »das haben Sie nicht sehr geschickt gemacht. Hätten Sie da hineingedruckt, die Indianerin habe ihren Tod gefunden, das hätte ich vielleicht geglaubt. Warum nicht. Aber diese Liebesgeschichte mit dem Cowboy... wissen Sie, ich will Ihnen etwas sagen: Ich will mich hier nicht mit theatralischer Pose hinstellen und Ihnen etwas von unwandelbarer Treue und Liebe vordeklamieren. Das passt eben auf die Bühne, aber nicht in einen Raubtierkäfig. Ich will es Ihnen ganz nüchtern sagen. Wenn Sie mir erzählen, dass draußen vom blauen Himmel roter Schnee herunterfällt, aus dem man Pudding backen kann, das will ich Ihnen glauben. Das ist dann eben ein Wunder. Aber dass diese Indianerin mir untreu wird, dass sie einem Cowboy oder sonst einem anderen an den Hals fliegt, ob ich nun lebendig oder tot bin, das kann nicht passieren. Das ist einfach gänzlich ausgeschlossen. So, nun wissen Sie meine Meinung. Nun brauchen wir hierüber auch nicht weiter zu sprechen.«
Es war alles ganz anders gekommen, als das Weib erwartet hatte. Dieser Mann hatte den Spieß umgekehrt.
»Nun gut denn«, stieß sie hervor, »ich lasse meine Maske fallen! Sie sind mein Gefangener!«
»Deshalb brauchen Sie keine Maske erst fallen zu lassen, diese Erkenntnis habe ich schon immer gehabt.«
»Wissen Sie, was ich Ihnen damals geschworen habe, als ich Sie zuletzt in Ihrer Klubwohnung aufsuchte?«
»Nein!«
»Noch zu meinen Füßen sollen Sie liegen und mich um meine Liebe anflehen!«
»Ach ja, jetzt entsinne ich mich!«, blieb der Graf immer ganz ehrlich. »Damals hatten Sie das aber noch viel schöner gesagt als jetzt, noch viel effektvoller — mit der Knallpistole in der Hand.«
»Noch zu meinen Füßen sollen Sie liegen und mich um meine Liebe anflehen!«, wiederholte sie, seinen Spott überhörend.
»Darauf können Sie lange warten.«
»Es wird nicht so lange dauern.«
»Da bin ich gespannt, wie Sie mich dazu zwingen wollen.«
»Nicht zwingen — freiwillig sollen Sie zu mir kommen!«
»Tue ich nicht. Miss Morgan, Sie sind überhaupt ein eigentümliches Weib.«
»Eigentümlich?«
»Na, Sie blitzen mich doch jetzt mit einer wahren Wut an, der reine Hass spricht ja aus Ihren Augen. Und dabei sprechen Sie immer noch von Liebe?«
»Können Sie sich das nicht zusammenreimen?«
»Nein.«
»Demütigen will ich Sie!«
»Da können Sie lange warten.«
»Und außerdem Sie besitzen.«
»Nun ja, ich kann es mir schließlich zusammenreimen. Bei Ihnen ist die Liebe eben so so. Mit wahrer edler Liebe hat die Ihrige nichts zu tun.«
».Mir gleichgültig. Herr Graf, auf Ihr Ehrenwort kann man doch unverbrüchlich bauen.«
»Das können Sie. Aber geben tue ich es nicht so leicht. Und worauf denn?«
»Wollen Sie mich heiraten...«
»Ich? Nee. Ich denke ja gar nicht daran!«, lachte der Graf, sich eine neue Zigarre aus der Kiste nehmend.
»... wenn Sie sich mir in Liebe nähern?«, ergänzte sie ihren unterbrochenen Satz.
»In Liebe nähern?«, wiederholte er mit ehrlicher Verwunderung.
»Vergehen Sie nicht? Wenn Sie zu mir kommen oder wenn Sie mich zu sich rufen.«
Der Graf blickte auf, hob den Finger und pfiff leise.
»Aha! Ja, jetzt verstehe ich. Sie wollen mir hier wohl ständige Gesellschaft leisten?« — »So ist es.«
»Eigentlich habe ich mir das ja gleich gedacht, aber jetzt durchschaue ich das Ganze doch klarer. Gut, wenn ich Ihren Verführungskünsten unterliege, dann wird Sie der sogenannte Champion-Gentleman von New York vor den Altar führen. Denn auf den haben Sie es doch nur abgesehen.«
»Abgemacht, ich habe Ihr Ehrenwort!«, rief das Weib mit blitzenden Augen.
»Abgemacht!«, wiederholte Arno. »Wollen wir unsere Wette — denn um eine solche handelt es sich doch gewissermaßen — gleich präziser festlegen. wenn ich mich Ihnen in sinnlicher Absicht nähere oder Sie bitte, mich zu erhören, so verpflichte ich mich, Sie zu heiraten. Ist es das?« — »So ist es.«
»Gut. Und Sie werden einen sehr braven Ehemann bekommen. Denn was ich einmal tue, tue ich auch immer und ganz. Ich werde Sie, wie es sich für einen braven Ehemann geziemt — vorausgesetzt, dass er die nötigen Kräfte dazu besitzt und seine Gattin nicht über zwei Zentner wiegt — immer auf den Händen tragen — mit Ruhepausen natürlich — ich werde Ihnen als gehorsamer Pudel aufwarten, Sie können mich sogar, was ja das Zukunftsideal aller echten Amerikanerinnen ist, auf der Straße an der Leine spazieren führen. Aber eines schicke ich voraus. Ich bin nun schon dreimal mit Gift und Betäubungsmitteln beglückt worden. Das erste Mal war's eine vergiftete Torte; das zweite Mal hat mir der Kerl etwas ins Gesicht gespritzt, auch noch dazu etwas Süßes, obwohl ich kein Freund von Süßigkeiten bin; und das dritte Mal haben Sie mich mit so einem Zeuge sogar unter die Erde gebracht. Nun muss das aber endlich aufhören. Aller guten Dinge sind drei. Nun lasse ich mir so etwas nicht mehr gefallen, sonst werde ich eklig!«
»Ich denke nicht daran, nochmals ein Betäubungsmittel zu benutzen. Dass Sie mein Gefangener sind, das genügt mir jetzt.«
»Es braucht nicht gerade ein Betäubungsmittel zu sein.«
»Was meinen Sie sonst?«
»Sobald ich merke, dass mir ein Aphrodisiakum beigebracht wird, ist diese Wette ungültig!«
»Ein Aphrodisiakum? Was ist denn das?«
»Verstellen Sie sich doch nicht! Sie wären doch die erste Amerikanerin aus besseren Ständen, die das nicht wüsste, da ja hier die Zeitungen von solchen Geheimmitteln wimmeln. Früher nannte man so etwas Liebestrank.«
»Ah, ich verstehe. Nein, ganz freiwillig sollen Sich mich um meine Liebe anflehen.«
»Da werden Sie lange warten müssen!«, konnte Arno nur wiederholen.
Draußen war es dunkel geworden. Und plötzlich begann sich das schöne Weib zu entkleiden.
Arno stutzte, er war erst ganz sprachlos. Er hatte ja erwartet, dass die sich dort drüben häuslich niederlassen würde, ihm immer Gesellschaft leisten wollte, aber so etwas, und wie das nun so plötzlich kam — nein, das hatte er nicht erwartet.
»Sie wollen wohl zu Bett gehen?«
»Gewiss, ich bin müde!«, entgegnete sie, in einer duftigen Wolke von weißen Spitzengeweben dastehend, die nackten Arme hebend und mit einem Griff die schwarzen Haare lang herabfallen lassend.
Arno machte eine Bewegung, als wolle er hinauf auf die Veranda, besann sich, streckte sich auf dem Schlafsofa aus, ihr den Rücken zukehrend.
»Sie haben recht, ich bin auch müde. Na, da gute Nacht. Vergessen Sie nicht, das elektrische Licht auszublasen!«, sagte er noch ironisch.
Von Pittville bis an den Sklavensee sind es rund 30 geografische Meilen.
In der Nacht um zehn Uhr hatte Atalanta Pittville verlassen, am anderen Abend um sechs Uhr war sie schon wieder an jener Stelle, wo sie schwimmend das Ufer erreicht, die Männer und Hunde getötet hatte.
Zu den 30 deutschen Meilen hatte sie also nur 20 Stunden gebraucht, natürlich ohne Schlaf, ohne auch nur einmal wenige Minuten zu ruhen, die ja überhaupt gar keine Erholung gewesen wären, immer im gleichmäßigen Dauerlaufe, ohne einen Bissen zu essen, nur beim Durchschwimmen von Flüssen trinkend.
Die Sonne stand noch hoch über dem Horizonte, als Atalanta jene Stelle erreicht hatte. Die Toten lagen natürlich nicht mehr da, und in den nun schon verflossenen vier bis fünf Tagen war über den Spuren auch wieder frisches Gras gewachsen.
Sie hielt sich mit einer Untersuchung des Kampfplatzes auch gar nicht auf, sondern ging sofort ins Wasser, schwamm mit langen Stößen an der Felswand entlang, bis sie in weniger als einer halben Stunde wieder jene Stelle erreicht hatte, wo sich unter Wasser der Tunnel befand, und sofort tauchte sie unter.
Was hatte sie vor? War sie denn von Sinnen, ganz blind vor Rachsucht, dass sie so ohne Weiteres direkt in die Höhle des Löwen eindrang?
Nun, diese rote Indianerin wusste schon, was sie tat. Sie hatte ja innerhalb des langen Dauerlaufes Zeit genug gehabt, sich ihren Plan zurechtzulegen, sie war auch auf alle Eventualitäten gefasst, selbst darauf, jetzt diesen unterseeischen Tunnel geschlossen zu finden. Aber das war nicht der Fall.
Als sie auf der anderen Seite wieder auftauchte, strahlte ihr kein elektrisches Licht mehr entgegen. Die undurchdringlichste Finsternis herrschte. Doch nicht undurchdringlich für diese Augen.
Die drei Boote lagen nicht mehr da. Und die Augen dieser Indianerin erkannten sogar, dass an der Decke, so hoch diese auch sein mochte, überhaupt keine Lampe mehr vorhanden war.
Weiter sah sie in dieser Finsternis, dass der Tunnel, der vor dem Wasserbassin nach Westen führte, verschüttet worden war. Ein schräger Schutthaufen füllte ihn bis zur Decke aus. Doch das musste sie näher untersuchen, das war auf diese Entfernung im Finstern doch nicht so deutlich zu erkennen, auch nicht für solche Augen.
Aber ehe sie an diese Untersuchung ging, wandte sie sich der Tür zu, die sie schon einmal benutzt hatte.
Wiederum war diese nur angelehnt, und als Atalanta sie zurückdrückte, sagte sie sich mit kalter Überlegung, dass jetzt vielleicht eine Explosion erfolgen konnte, die ihren Körper in Stücke riss.
Doch wie hätte sie sich davor schützen sollen? Oder was für unsäglich umfangreiche Vorkehrungen hätte sie dagegen erst treffen müssen. Gefasst also war sie auf so etwas, sie hatte nichts vergessen, aber sie zögerte niemals einen Moment, weder mit Fuß noch Hand.
Es erfolgte keine Explosion, nichts knallte, jetzt nicht und später nicht.
Sie schritt die Treppe hinauf. Als sie dann ein Fenster öffnete, drang das Tageslicht in das Amphitheater. Die steinernen Stufen hatte man nicht so schnell entfernen können — warum sollte man auch? — aber der Registrierapparat stand nicht mehr in der Mitte.
Als sie dann nach weiterem Gang ein zweites Fenster öffnete, drang das Tageslicht in den großen Raum, in dem sie vor fünf Tagen die Hunderte von menschlichen Figuren hatte stehen sehen. Sie alle waren verschwunden. Es war alles ausgeräumt worden, alles. Nur die Türen und Fenster waren zurückgelassen worden, sonst hatten die, die hier einst gehaust, alles mitgenommen, auch die elektrischen Lampen und Kupferdrähte.
Die weiteren Räumlichkeiten dieses Felsenlabyrinths, die vielleicht bis oben hinauf auf das Plateau gingen — ihren Ursprung werden wir später erfahren — besah sich die Indianerin nicht, für so etwas hatte sie jetzt kein Interesse, sie begab sich wieder nach dem Wasserbassin hinab, nach der zweiten Tür, die damals verschlossen gewesen war.
Jetzt ließ sie sich aufdrücken. Das sagte der Indianerin schon genug. Sie blickte nur in zwei Räume, ebenso viele Fenster öffnend. Auch hier war alles ausgeräumt. Man sah noch an den Farbenschattierungen, wo Möbel gestanden und Teppiche gelegen hatten, wo elektrische Leitungen an den Wänden entlang gelaufen waren. Alles, alles war beseitigt worden.
Wohin war das alles gekommen? Dort hinter den Schutthaufen, der den abzweigenden Tunnel verschloss. Atalanta ging einmal hin, kehrte aber gleich wieder um. Diese durch Sprengung gebildete Wand hätte sie nicht abtragen können.
Sie nahm den Weg unter Wasser zurück. Ihr nochmaliger Besuch hier war zwecklos gewesen.

Nachdem Atalanta große Mengen Reisig gesammelt und
um die Füße
des an den Baum Gefesselten aufgehäuft hatte,
holte sie ihr Feuer-
zeug hervor und entzündete den Brennstoff, der sofort hell aufloderte.
Auf der westlichen Seite des Felsengebirges im Staate Colorado liegt Puebla, ein kleines Städtchen, eigentlich nur eine Villenkolonie. Ganz zerstreut liegen die Villen an und auf den hier weniger steilen Abhängen.
Sie gehören meist den höheren Beamten des nahen Kupferbergwerks, ein ganz gewaltiges Unternehmen, das aber wegen der Terrainverhältnisse nicht durch Schienenstrang verbunden werden kann.
Auf der Karte ist diese Stadt dem Sklavensee ja viel, viel näher als Pittville, sie ist aber von dem See durch einen unübersteigbaren Gebirgszug getrennt.
Es war früher Nachmittag. In dem Café des einzigen Hotels saßen um den Marmortisch ein Dutzend Herren und pokerten, ein beliebtes Kartenspiel. Jeder von ihnen hatte hier eine Villa, war hier gegenwärtig mit oder ohne Familie, sie kannten sich flüchtig und waren sich dennoch fremd. Echt amerikanisch. Es war eine bunt zusammengewürfelte Gesellschaft, die hier am Spieltisch saß und dem Spiel mit zäher Ausdauer huldigte.
Der eine, ein alter Herr, war ein steinreicher Seifenfabrikant aus San Francisco, ein zweiter, der seine plumpen, schmutzigen Finger mit Brillanten geschmückt hatte, war ein Agent, der chinesische Arbeiter besorgte, einfach ein Sklavenhändler.
Der dritte beglückte die Menschheit mit künstlichen Kaffeebohnen. Es war ein junger, stutzerhafter Fant.
Dann war da ein semmelblonder Herr, Mister Hampton war sein Name, der ganz die Physiognomie eines Pferdehändlers hatte. In Wirklichkeit war er Versicherungsinspektor oder so etwas Ähnliches. Auch er hatte hier eine hübsche kleine Villa, die er aber selten bewohnte. Er war immer auf Reisen, war manchmal ein halbes Jahr lang weg, blieb immer nur wenige Tage hier, verschwand wieder, dann kam er auch in einem Monat mehrmals — ganz verschieden. Wie es eben seine Geschäftsreisen mit sich brachten. In seiner Villa hatte er zwei Diener, einen weißen und einen schwarzen, die hielten alles in Ordnung. Ob er verheiratet war, wusste man gar nicht. Das heißt, dass er in dieser Villa keine Frau und Familie hatte, das wusste man freilich. Aber ihn zu fragen, ob er anderswo verheiratet sei, das war in dieser amerikanischen Gesellschaft ganz ausgeschlossen.
Trotzdem darf man nicht glauben, dass diese Herren etwa für die Außenwelt abgestorben gewesen seien. Durchaus nicht. Nur für den persönlichen Verkehr, gerade wenn man sich kennt, gilt diese Gleichgültigkeit, es gehört mit zum »Gentleman«, welches Wort man ja überhaupt gar nicht definieren kann.
»Wer ist denn das dort?«, sagte der Seifenfabrikant, beim Kartengeben einmal durch das offene Fenster, dem er gegenüber saß, blickend.
Das war nun allerdings auch eine sehr auffallende Gestalt, die dort die Bergstraße heraufkam.
Ein Weib, offenbar ein junges Mädchen, mit rotbraunem Gesicht, soweit sich das jetzt schon erkennen ließ, in Leder gekleidet, das Röckchen nur bis an die Knie gehend, darunter Gamaschen, das lange, schwarze Haar offen, am Gürtel zwei große Revolver — das war in der Tat sehr auffallend.
Alle blickten hin, sogar der eben sein Geld zählende Chinesenhändler, und der war es auch, der sie erkannte. Er war erst vor einigen Tagen aus New York gekommen, wohin er einen Schub chinesischer Kulis gebracht hatte.
»Bei Gott, das ist die Atalanta, die rote Athletin, die im Hippodrom auftrat und dort von dem New Yorker Champion-Gentleman im Ringkampf geworfen wurde.«
Nun wussten sie's alle. Denn sämtliche Zeitungen hatten diesem roten »Wunder der Menschheit« damals spaltenlange Artikel gewidmet, sie hatten sogar ihr Konterfei gebracht.
»Wie kommt die hierher?«
»Was will die hier?«
»Ob der deutsche Graf sie begleitet?«
So schwirrten die Fragen durcheinander.
Und wieder war es der Chinesenhändler, der hier die richtige Antwort zu geben vermochte.
»Dieser deutsche Graf, der unter dem Namen ›Champion-Gentleman von New York‹ in den östlichen Vereinigten Staaten allgemein bekannt war, ist tot. Er ist auf einer Jagd am Sklavensee verunglückt, erlitt einen Schlaganfall oder so etwas, und liegt in Pittville begraben!«
Bei diesen Auseinandersetzungen wurde immer weiter gespielt und das Geld hin und her geschoben. Sie spielten nicht billig und dabei beobachteten sie auch noch die Indianerin.
Diese ging langsam auf der anderen Seite der Straße dahin, sonst hätte man sie ja auch nicht sehen können, und betrachtete die Häuser, die da auf dem Bergabhang verstreut lagen.
Jetzt verließ sie das Trottoir und ging über die Straße, wodurch man sie aus den Augen verlor.
»Die kommt hier herein.«
Die Indianerin ging an dem offenen Fenster vorüber, und damit war sie auch schon an der Haustür des Hotels vorbei. Da aber tauchte sie nochmals an dem offenen Fenster auf, warf einen Blick herein, verschwand wieder und kam gleich darauf zur Tür herein.
Sie setzte sich an das andere Fenster, den Spielenden das Gesicht zukehrend. Der Kellner kam, sie bestellte ein Glas Zitronenwasser, rührte es dann aber gar nicht an, sondern saß ganz in Gedanken versunken da.
»Ich höre auf!«, sagte Mister Hampton, als wieder Karte gegeben wurde.
Nach dem gemachten Spiele strich er sein Geld ein, das sich sehr vermindert hatte, erhob sich, stellte sich zwischen den beiden Tischen vor den Wandspiegel, ordnete seinen grünen Schlips, griff an dem gelbkarierten Anzuge herum und strich den weißblonden, hochgebürsteten Schnurrbart. Es war ein jüngerer, recht hübscher Mann, die blauen Augen in dem gebräunten Gesicht verrieten einen harmlosen Charakter. Er zeichnete sich durch nichts Besonderes aus, war aber auch kein Spaßverderber.
»Heiß heute, Miss«, wandte er sich dann an die Indianerin.
»Sehr heiß, Sir«, gab diese zur Antwort, und das war eigentlich erstaunlich.
»Habe ich nicht die Ehre, die berühmte Athletin Miss Atalanta vor mir zu sehen?«
»Ich bin es!«
»Hampton ist mein Name, freier Berichterstatter einiger der größten amerikanischen Zeitungen.«
Die anderen hatten es ebenfalls gehört. Wie, Berichterstatter war er? Sie glaubten, Versicherungsbeamter. Nun, es war sehr leicht möglich, dass er die beiden Berufe miteinander verband, auf seinen weiten Reisen hatte er ja die beste Gelegenheit, interessante Berichte zu schreiben, und er hatte ja auch das »frei« betont.
»Gestatten Sie, dass ich an ihrem Tische Platz nehme?«
»Bitte sehr.«
Sapristi! Das hätten die andern dem gar nicht zugetraut. Er war sonst so zurückhaltend.
»Darf ich Sie interviewen?«
»So weit ich antworten darf, so weit es sich nicht um Geheimnisse handelt!«
Der Herr zog ein dickes Notizbuch und begann zu fragen, hauptsächlich erst wegen ihrer gymnastischen Ausbildung; die Indianerin gab bereitwilligst Auskunft.
»Und als Sie nun von dem deutschen Grafen besiegt worden waren?«, fuhr der Interviewer fort.
»Über alles Weitere spreche ich nicht.«
»Weshalb denn nicht?«
»Ich habe meine Gründe dazu.«
»Das ist sehr schade.«
»Darf ich hoffen, dass auch Sie mir nun einige Fragen beantworten werden?«, nahm nun die Indianerin das Wort.
»Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung.«
»Sind Sie hier in Puebla bekannt?«
»Ich bin hier sogar zu Hause, habe eine Wohnung hier, eine Villa.«
»Ah! Da müssen Sie ja bekannt sein. Wohnt hier auch der Professor Dodd?«
»Professor Dodd?«, wiederholte der Herr verwundert. »Sie meinen den berühmten Operateur?«
»Jawohl, den meine ich. Wohnt der hier?«
»Hier wohnen? Nein. Der lebt in New York.«
»Er ist doch so viel auf Reisen, und es könnte doch sein, dass er auch hier eine Villa hat.«
»Ja, es könnte wohl sein, warum nicht. Aber es ist nicht der Fall.«
»Hat er sich nicht manchmal hier gezeigt?«
»Nicht dass ich wüsste. Meine Herren«, wandte sich Hampton zurück, »hält sich manchmal der bekannte Operateur Professor Dodd hier auf?«
Niemand wusste etwas davon, und der gerade anwesende Wirt, der dieses Hotel schon ein halbes Menschenalter hatte, konnte am besten versichern, dass sich Professor Dodd nie hier aufgehalten habe.
»Vielleicht unter einem anderen Namen!«, meinte die Indianerin.
»Ausgeschlossen!«, erwiderte der Wirt. »Das blasse Gesicht Professor Dodds mit dem schwarzen Knebelbart ist gar zu bekannt. Ich kenne ihn sogar persönlich.«
»Dann bin ich vergeblich hierher gekommen!«, begann die Indianerin wieder zu flüstern.
»Sie haben den Professor hier erwartet?«
»Gesucht.«
»Wegen einer Operation?«
»Ja.«
»Sie selbst müssen sich doch nicht operieren lassen?«
»Nein. Ich bin es, die den Professor operieren, oder besser gesagt, lebendig verbrennen will!«
»Den Professor Dodd lebendig verbrennen?! Wie meinen Sie das?«, fragte Mister Hampton entsetzt.
»Ist denn das noch nicht deutlich ausgedrückt. Ich will ihn an den Marterpfahl binden und ihn dort lebendig verbrennen.«
»Ja, um Gottes willen, weshalb denn nur?!«
»Weil ich eine Indianerin bin.«
Das war nun absolut keine Erklärung und überhaupt ganz unlogisch. Hätte dieses Mädchen wie eine echte Indianerin gehandelt — oder richtiger wie ein echter Indianer, denn sie repräsentierte ja jetzt den ganzen Stamm, musste also den Charakter nach mehr als Mann genommen werden — so hätte sie über so etwas doch nicht erst gesprochen.
Und überhaupt, es war einfach ganz unbegreiflich, wie Atalanta jetzt handelte und sprach. Es lag auch so ein seltsamer Ausdruck in ihren Augen, den sie früher noch nicht gehabt hatte, so etwas katzenartig Lauerndes.
»Aber weshalb wollen Sie ihn denn verbrennen? Hat er Ihnen ein Leid zugefügt?«
»Ja.«
»Was denn?«
»Er hat mir das Liebste auf Erden geraubt.«
»Und das war?«
»Das muss meine Sache bleiben.«
Mister Hampton wurde fast belustigt, so grausig das auch alles war.
»Ja aber — so etwas ist doch nicht erlaubt.«
»Was ist nicht erlaubt?«
»Jemanden am Marterpfahl lebendig zu verbrennen!«, fuhr der Herr fast lächelnd fort.
»O, daraus mache ich mir nichts.«
»Sie werden dafür bestraft, sehr, sehr schwer. Das ist doch so gut wie Mord.«
»Nein, ich werde nicht dafür bestraft.«
»Weshalb denn nicht?«
»Professor Dodd wird mich nicht anzeigen.«
»Weshalb nicht?«
»Erstens weil er dann tot ist, und zweitens, weil er sich überhaupt hüten würde.«
»Er hat etwas auf dem Gewissen?«
»Er hat mir noch etwas ganz anderes zugefügt.«
»Trotzdem — Sie werden von der Staatsanwaltschaft zur Verantwortung gezogen und bestraft.«
»Nein, das werde ich nicht.«
»Das verstehe ich nicht.«
»Wenn Professor Dodd aber nun damit einverstanden ist, dass ich ihn lebendig verbrenne?«
»Damit einverstanden?!«, staunte der andere. »Das verstehe ich noch viel weniger!«
»Ich vermag es Ihnen auch nicht zu erklären. Es ist aber so.«
Sie trank ihr Zitronenwasser zur Hälfte und rief dann den Kellner.
»Gestatten Sie, dass ich für Sie bezahle?«, fragte Mister Hampton.
»Bitte sehr.«
»Sie wollen doch nicht schon gehen?«
»Ja. Da ich nun einmal hier bin, möchte ich mir Puebla etwas näher besehen.«
»Gestatten Sie, dass ich Sie begleite?«
»Es ist mir sehr angenehm.«
Mister Hampton bezahlte, beide erhoben sich.
Zu ihrem Zitronenwasser war eine Schale mit Zucker hingestellt worden, darauf lag eine vernickelte Zuckerzange. Atalanta nahm dieselbe und betrachtete sie aufmerksam.
»Kellner. Was kostet diese Zange?«
»Das weiß ich nicht.«
»Ich möchte sie mitnehmen, ich brauche sie.«
»Ich werde den Wirt fragen.«
Einen halben Dollar. Atalanta bezahlte und steckte die kleine Zange in ihren Medizinbeutel, dann verließ sie mit Mister Hampton das Lokal.
»Passt auf, der nimmt sie mit nach Hause«, hieß es am Spieltisch.
»Das hätte ich dem Mister Hampton gar nicht zugetraut, dass der sich gleich so heranmacht. Wetten wir, dass er sie mit nach Hause nimmt?«
»Ich wette dagegen.«
Die beiden, von denen die Spieler drin im Klublokal so sprachen, waren auf die Straße getreten.
»Ich nehme Ihre Begleitung aber nur unter der Bedingung an, dass Sie mich über die Angelegenheit, die ich mit Professor Dodd auszufechten habe, nicht weiter fragen, mit keinem Worte!«, sagte Atalanta noch.
Wohl oder übel musste sich der Herr hiermit einverstanden erklären.
Sie bummelten durch das Städtchen, das gar keine offenen Läden hatte. Mister Hampton erklärte der Indianerin, wem dies und jenes hübsche Haus gehöre, erzählte ihr etwas vom Besitzer, zeigte ihr besonders schöne Gärten, dann deutete er auf eine höher am Bergabhang liegende kleine Villa.
»Das dort ist meine Villa.«
Atalanta zeigte gar kein Interesse dafür.
»Gibt es hier in der Umgegend hübsche Spaziergänge?«
»Das wohl. Allerdings beschränkt. Dicht daneben beginnt immer gleich die Wildnis. Es ist schon häufig vorgekommen, dass man auf einem wohlgepflegten Spazierwege einem Baribalbären begegnet ist, der ja allerdings harmlos ist!«
»Ich möchte mir die Umgegend etwas näher ansehen.«
Mister Hampton führte sie in eine Schlucht hinein, wohl wild, aber mit geebnetem Wege, bis dieser plötzlich aufhörte, obgleich die Schlucht weiterging.
»Weiter ist der Weg noch nicht geführt worden.«
Die Indianerin blickte sich um — und plötzlich ergriff sie die beiden Hände ihres Begleiters an den Gelenken, im Nu hatte sie ihn zu Boden geworfen, in demselben Augenblick waren ihm auch schon die Hände mit einer Lederschlinge zusammengeschnürt.
»Wa... —«
Der tödlich Erschrockene konnte nicht einmal die erste Silbe aussprechen, da pfropfte sie ihm auch schon in den halbgeöffneten Mund ein Tuch, stopfte es erst mit dem Finger, dann mit dem Griffe ihres Jagdmessers tiefer in den Schlund, fesselte ihm mit eben solcher schier zauberhaften Geschwindigkeit die Füße, hob den großen Mann wie ein Kind auf, als habe er überhaupt gar kein Gewicht, warf ihn wie einen Sack auf den Rücken und drang in die Wildnis ein, tiefer und tiefer, zwischen Bäumen und Buschwerk und Felsblöcken hindurch, wohl eine Viertelstunde lang. Kein Wort wurde hörbar, nur ab und zu ertönte auf ihrem Rücken, wo der unglückliche Mann wie ein Stück Wild mit zusammengeschnürten Händen und Füßen hing, ein Gurgeln und heiseres Stöhnen.
Endlich blieb die Indianerin stehen. Auf einer Lichtung, umringt von steilen Felswänden, erhob sich ein mäßig dicker Nadelbaum, unten frei von allen Ästen.
Hier ließ sie den Mann, den sie aus ganz unbegreiflichen Gründen zum Opfer gewählt hatte, zu Boden gleiten, richtete ihn aber mit Riesenkraft gleich auf, stellte ihn auf die Füße, lehnte ihn mit dem Rücken gegen den Baumstamm und band ihn so mit einem andren Riemen, den sie um die Hüften gewickelt trug, daran fest.
Der Unglückliche konnte absolut nicht begreifen, was das bedeuten sollte. Oder wusste er es vielleicht doch?
Hilfesuchend rollten seine herausgequollenen Augen wild umher, er machte die verzweifeltsten Anstrengungen, mit der Zunge den Knebel aus dem Munde zu stoßen, um nur einmal etwas sagen zu können, vielleicht weniger um Hilferufe auszustoßen, aber es gelang ihm nicht.
Und wie mochte dem Unglücklichen erst zumute werden, als er sah, wie die Indianerin trockene Äste sammelte und diese rings um seine Füße herum aufhäufte! Denn nun war ja alles klar, was sie beabsichtigte.
Und jetzt nahm sie ein Feuerzeug aus dem Lederbeutelchen. Ehe sie aber das Holz entzündete, begann sie endlich zu sprechen.
»Mann! Du magst die ganze Welt durch Deine Maske täuschen, aber die letzte Mohawk vermagst Du nicht zu täuschen! Du bist Professor Dodd. Ich habe gesprochen.«
Ja, sie hatte gesprochen. Und wie hatte sie gesprochen! Diese leise Stimme, und mehr noch diese Augen!
Wie konnte sie nur auf diesen furchtbaren Irrtum kommen?
Dass die beiden ungefähr die gleiche Größe hatten, das war das Allereinzigste, worin sie sich ähnelten. Sonst glich der Professor Dodd diesem Manne so, wie ein blasser Spanier mit schwarzem Knebelbart einem blonden sonnverbrannten Germanen oder einem Skandinavier gleicht. Das heißt, sie glichen sich eben absolut gar nicht. Mit allen Mitteln der Kunst wäre hier keine Ähnlichkeit zu schaffen gewesen. Ganz abgesehen davon, dass der Professor große, tiefschwarze Augen hatte und dieser hier kleine, hellblaue.
Die Indianerin musste einfach den Verstand verloren haben, sie war gewiss irrsinnig geworden.
Aber wer soll einen Irrsinnigen über seinen Wahn aufklären, vorausgesetzt, dass der Unglückliche hierzu die Möglichkeit gehabt hätte.
Atalanta entzündete also den aufgetürmten Ring aus Reisig an mehreren Stellen, am äußeren Kreise, kauerte sich in einiger Entfernung nieder und begann leise zu singen, wieder ein Lied ihrer roten Brüder, wieder halb melancholisch, halb von einer furchtbaren Wildheit erfüllt und in wildem Triumphe hervorgestoßen.
Weiter und weiter krochen die Flammen nach dem inneren Ringe, leckten schon bald an den Beinen des Unglücklichen empor, der das Opfer einer Wahnsinnigen werden sollte, vergeblich riss er an seinen Banden, machte die verzweifeltsten Anstrengungen, den Knebel herauszustoßen, um nur einmal ein Wort sagen zu können. Doch nur ein Gurgeln und Röcheln wurde vernehmlich.
Das Lied war verstummt, und die ersten Flammen wollten die Kleider des Gefesselten ergreifen.
Da stand die Indianerin schnell auf und riss den Brand auseinander.
»Genug! Ich habe es mir anders überlegt. Oder es war von vornherein so meine Absicht. Nein, Du sollst nicht sterben. Der unvergleichliche Operateur soll der Menschheit erhalten bleiben. Jetzt hast Du aber wohl einmal gesehen, dass mit mir nicht zu spaßen ist. Du wolltest mich wohl in Deine Wohnung locken, wie? Du willst sprechen? Was willst Du mir sagen? Dass Du nicht Professor Dodd bist? Dass ich wahnsinnig bin? Hahaha, ich und wahnsinnig! Du bist Professor Dodd! Und nun weißt Du, was Du von mir zu halten hast! Wehe Dir, wenn Du mir nun noch einmal begegnest, absichtlich oder nicht! Dann trete ich das Feuer nicht wieder aus! Wehe Dir, wenn Du noch ein einziges Mal etwas gegen mich unternimmst! Und wenn Du Dich in einen wirklichen Hund, der Du als Mensch schon bist, verwandeln kannst — ich finde Dich unter allen Hunden der Erde heraus und martere Dich langsam zu Tode, Deine Qualen sollen jahrelang dauern! Ja, ich zweifle gar nicht daran, dass Du Dich wirklich in einen Hund und in einen Wolf und in eine leichenausgrabende Hyäne verwandeln kannst. Und dass ich mich nicht getäuscht habe, dafür will ich der Welt, falls es einmal nötig ist, doch einen Beweis geben!«
Sie schürte die noch brennenden Äste wieder auf einen Haufen zusammen, aber abseits, entnahm ihrem Medizinbeutel einen kleinen Gegenstand, der hinten einen kurzen Handgriff hatte, wie ein Petschaft aussehend, legte es auf die Glut, wartete einige Minuten, nahm die vorhin gekaufte Zuckerzange, holte mit dieser das hellrot glühende Petschaft heraus, trat auf den Unglücklichen zu und — presste ihm den glühenden Stahl gegen die Stirn.
Es zischte und qualmte und stank nach verbranntem Fleische, und der Gefesselte krümmte sich und versuchte zu brüllen.
Als sie den Stempel wieder zurückzog, zeigte es sich, dass die ziemlich breite Platte einen Fisch, der von einer Schlange umwunden war, hinterlassen hatte. Es war bei dieser frischen Brennung etwas undeutlich, würde noch mehr verschwimmen, um dann nach der Heilung jedenfalls ganz deutlich zum Vorschein zu kommen.
»So. Das ist mein Totem, das Zeichen der Mohawks. Du bist gebrandmarkt. Du bist mein Eigentum. Gleichgültig, in was für einen Menschen oder in was für ein Tier Du Dich verwandelst, dieses Brandmal kannst Du nicht bannen. Fange ich also einen Hund oder einen Wolf oder einen Schakal, der dieses Zeichen auf der Stirn trägt, so bist Du es, und Du weißt, was Du von mir zu erwarten hast. Deine Kunst als Operateur beeinträchtigt dieses Brandmal ja nicht. Erzähle irgend ein Märchen, wie Du dazu gekommen bist. Ich selbst werde kein Wort darüber sprechen. Wehe Dir aber, wenn Du es durch Deine Kunst zu verwischen suchst! Ich finde Dich auch ohne dieses Brandmal immer sofort heraus, und wehe Dir dann!«
Sie durchschnitt ihm die Fesseln der Hände und ging in der anbrechenden Dämmerung davon, ohne sich noch einmal nach ihm umzublicken.
Hinter ihr erklang alsbald ein gellendes Geheul.
Zwei Tage später betrat Atalanta in San Francisco, welches von den Amerikanern selbst kurz Frisco genannt wird, einen eleganten Modewarenladen.
Die empfangende Geschäftsdame hatte sich jetzt nicht zu wundern über die merkwürdige Erscheinung in dem strapazierten Lederkostüm mit Revolvern und Skalpiermesser, sondern nur nach deren Begehr zu fragen.
»Mit was kann ich dienen, Miss?«
»Ein elegantes Kleid möchte ich haben!«
»Sie wünschen sich neu zu equipieren, Miss?«, meinte die Verkäuferin.
»Equipieren? So ein Kleid will ich haben, wie es die anderen Frauen tragen.«
Auf einen Wink der Geschäftsdame wurden sofort von einigen Ladenmamsells eine ganze Anzahl eleganter Kostüme gebracht.
»Wie wäre es mit diesem blauen Samt? Der müsste Ihnen ausgezeichnet stehen.«
O, diese Verkäuferin hatte ihre Erfahrung, die brauchte einen Menschen nur anzusehen und wusste dann sofort, was für ihn passend war und welche Farbe ihn am besten kleidete.
Diese tiefernste Indianerin schien also auch einmal der weiblichen Eitelkeit zu unterliegen.
»Ja, dieses Kleid möchte ich haben!«, rief sie mit leuchtenden Augen. »Aber das ist mir doch viel zu lang und zu weit, da müsste doch eine halbe Elle davon abgeschnitten werden!«
Nun wusste die Geschäftsdame, dass dieses indianische Mädchen noch nie ein Kleid gekauft und wahrscheinlich ein modernes Kostüm noch nie getragen hatte, und darin hatte sie recht. Bisher hatte sich Atalanta nur bis zu einem Regenmantel verstiegen, den sie, wenn es sein musste, über ihrer Lederkleidung trug.
»Dieses Kostüm ist in jedem Maße vorhanden. — Bitte, wollen Sie mir nach den Anproberäumen folgen.«
Sie betraten ein kleines Boudoir.
»Darf ich Ihnen beim Ausziehen behilflich sein.«
»Ausziehen? Ich will mich nicht ausziehen, sondern das neue Kleid anziehen.«
»Sie müssen aber doch erst Ihr Lederkostüm ablegen.«
»Nein, das möchte ich darunter behalten. Oder geht das nicht?«
»O doch, dann müssen wir aber eine Nummer größer nehmen. Doch wollen Sie nicht wenigstens ein Korsett tragen?«
»Korsett?«
Das rote Mädchen sah starr vor sich hin, machte ein tiefsinniges Gesicht, als überlege sie einen ausschlaggebenden Schachzug, bis sie heiter wieder aufblickte.
»Ach ja, jetzt weiß ich — nein, so ein Ding mag ich nicht.«
Sie zog das Kostüm also gleich so an, oder vielmehr es wurde ihr angezogen, denn ohne kundige Hilfe wäre sie wohl schwerlich so leicht damit fertig geworden, ein Todessprung von der Decke des Zirkus und ein Salto mortale über zwanzig Elefanten ist doch viel einfacher als das Anziehen solch eines Kleides und es saß ihr wie angegossen, und als die Verkäuferin Atalanta noch den dazu gehörigen silbernen Schuppengürtel angezogen hatte, hätte wirklich niemand vermutet, dass diese darunter einen ziemlich dicken Lederanzug ohne Korsett trug.
Merkwürdig war auch, dass ihr der dunkelblaue Samt plötzlich eine ganz andere Farbe gab. Das war jetzt keine rotbraune Indianerin mehr, sondern nur noch eine bräunlich angehauchte Italienerin oder Spanierin.
Das hatte die erfahrene Geschäftsdame, in ihrem Fache eine Künstlerin, natürlich im Voraus gewusst.
»Sie wünschen doch auch Stiefel.«
»Jawohl, Stiefel. Aber keine Jagd- und Wasserstiefel. Solche richtige kleine Stiefel mit hohen Hacken, mit denen hier alle Damen herumlaufen.«
Diese Bemerkung wäre gar nicht nötig gewesen. Außer Stiefelchen wurden auch gleich noch Strümpfe in großer Auswahl gebracht.
»Wünschen Sie frisiert zu werden, während ich Ihnen die Strümpfe anziehe und Stiefel anpasse?«
»Frisiert? Die Haare gemacht, meinen Sie. Ja, ich möchte meine Haare so haben wie die anderen Damen.«
Sofort war eine Friseuse zur Stelle, die oben am Kopfe arbeitete, während die Verkäuferin unten an den Füßen hantierte. Nach Atalantas Wünschen wegen der Frisur wurde nicht gefragt, ihr keine Musterabbildungen vorgelegt, man wusste schon, wie so eine Indianerin zu behandeln war. Das Haar wurde gewaschen, pneumatisch im Handumdrehen getrocknet, gebrannt, gewellt und nach derjenigen Mode, welche dieser Figur und diesem Gesicht am besten stand, frisiert, und als die Füße bekleidet waren, war auch der Kopf fertig.
Nun kam die Hutfrage daran.
»Zu ihrer Figur und dieser Frisur kann ich Ihnen nur zu diesem Hute raten.«
Es war ein kleines Wagenrad von Filzhut, mit wallenden Straußenfedern geschmückt.
»Ich habe sie noch größer gesehen!«, sagte die Indianerin, die sich jetzt langsam zu verwandeln begann.
»Wir haben sie noch bedeutend größer, aber ich möchte Ihnen aufrichtig zu dieser Façon raten, sie steht Ihnen am besten, unter einem größeren Hute verlieren Sie.«

Atalanta ergab sich, und als sie sich im Spiegel besah, machte sie einen Ansatz zum fröhlichen Lächeln.
»Den werde ich behalten.«
»Der Hut kostet hundertfünfzig Dollars!«, erlaubte sich die Dame zum ersten Male im Voraus zu bemerken.
»Schön!«, war die kurze Antwort.
Die Indianerin machte die ersten Schritte, knickte dabei immer um, machte ein verdutztes Gesicht, gewöhnte sich aber schnell an diese Stelzerei. Sie war ja eine Akrobatin.
»Brauche ich sonst noch etwas?«
»O gewiss! Handschuhe, Taschentücher, Riechfläschchen — —«
Sie zählte noch weiter auf, und alles wurde immer schnellstens gebracht.
»Das ist der feinste Batist, kann ich Ihnen sehr empfehlen.«
»Ja, so ein Taschentuch möchte ich haben.«
Dann kamen Glacéhandschuhe und andere unumgänglich notwendige Artikel daran, auch ein Fächer und eine Lorgnette am ellenlangen Stiele.
»Was ist das?«
»Das ist ein Augenglas.«
»Wozu braucht man das?«
»Das lässt man so herausschnipsen — sehen Sie, so.«
»Wozu lässt man das herausschnipsen?«
»Um die beiden Gläser vor die Augen zu halten.«
»Wozu hält man die beiden Gläser vor die Augen?«, fragte Atalanta wissbegierig mit tiefstem Ernste weiter.
»Nun, um etwas zu betrachten, eine Person — oder ein Bild.«
»Ach so, das ist wohl ein Visier?«
»Ja, das ist ein Visier. Das hat jetzt jede vornehme Dame immer bei sich.«
»Dann will ich auch so ein Ding haben.«
Es war bereits mit auf die Rechnung geschrieben.
»Der Griff ist hohl, kann hier aufgemacht werden, sehen Sie, so — das dient als Bonbonniere.«
»Bonbonniere? Was ist das?«
»Nun, da tut man Konfekt hinein.«
»Dann will ich auch Konfekt hinein haben.«
Die Verkäuferin füllte in den hohlen Lorgnettengriff winzige Schokoladenplätzchen, aromatische Pillen und ähnliches Zeug.
Diese Sache war nun auch erledigt, und die Geschäftsdame wusste nichts mehr, was sie jener noch anhängen könne.
Atalanta besah sich im Spiegel. Dass sie in dem dunkelblauen Samtkleide mit dem großen Federhute ganz reizend aussah, so verführerisch, wie nur jemals in den Straßen dieser Goldstadt eine junge, elegante Dame gewandelt war, das konnte sie sich nicht selbst sagen, dazu fehlte ihr das Urteil. Das sollte sie später von anderer Seite noch oft genug zu hören bekommen.
Jetzt vermisste sie nur noch eines an ihrer Toilette. Auf dem Tische lag ihr Gürtel mit den beiden mächtigen Revolvern in Futteralen, mit dem Jagdmesser, dem Medizinbeutel und noch anderen daran hängenden Gegenständen. Den schnallte sie um, und jetzt erst war sie zufrieden mit ihrer Erscheinung im Spiegel.
»So, das wäre wohl alles. Was habe ich zu zahlen?«
Die Geschäftsdame war über jedes Lächeln erhaben. Denn diese elegante Dame mit den beiden Revolvern und dem Skalpiermesser sah ja ganz kurios aus.
»Sie wollen doch nicht diesen Gürtel mit den Waffen tragen.«
»Warum nicht?«
»Das ist nicht modern. Das trägt auch keine andere Dame.«
»Nicht? Dann will ich's auch nicht. Ja, wo soll ich dann das aber lassen? Immer in der Hand tragen?«
»Haben Sie keine Handtasche?«
Die Indianerin verneinte.
Da wurde ihr auch noch eine größere, aber sehr elegante Handtasche aufgehängt, in der sie alles verpacken konnte, was sie abgelegt, zum Beispiel auch ihre Mokassins und die Gamaschen.
»Sechshundertvierundsiebzig Dollars«, rechnete die Dame zusammen. »Bitte an der Kasse zu zahlen.«
O weh! Nur noch zwanzig Dollars mehr, und Atalanta hätte schon nicht mehr bezahlen können. Sie hatte das von Arno hinterlassene Geld, das sie ohne Testament geerbt, schon mehrmals stark angreifen müssen.
Aber sie verzog keine Miene, fragte nicht, wie diese horrende Summe zusammenkam, obgleich sie wusste, jetzt nur noch zwanzig Dollars ihr eigen zu nennen. Sie wusste auch, woher sie sofort wieder anderes Geld bekam, wieder Hundertdollarscheine und sogar Tausender. Sie war ja jetzt in San Francisco, oder vielmehr eben in Frisco. Denn San Franciscos gibt es in Nord- und Südamerika noch eine ganze Menge, aber es gibt nur ein einziges Frisco.
»Sechshundertundvierundsiebzig Dollars. Gut. Nun habe ich gleich noch eine Frage, die Sie mir vielleicht beantworten können.«
».Bitte sehr«, entgegnete die Dame in dem stolzen Selbstbewusstsein, dass hier in diesem Geschäft keine einzige Frage unbeantwortet und kein einziger Wunsch unerfüllt blieb — wenn man nur das nötige Geld dazu hatte.
»Bitte sehr. Brauchen Sie vielleicht ein Jagdgewehr? Oder ein Pferd. Oder — —«
»Nein. Ich möchte eine geografische Ortsbestimmung in zehntel Sekunden machen. Wo kann man das hier lernen?«
Das war nun freilich etwas, was diese Dame Atalanta nicht sagen konnte! Sie wusste überhaupt gar nicht, was die wollte.
»Eine geo... — Was wünschen Sie zu machen?«
»Eine geografische Ortsbestimmung nach zehntel Sekunden.«
»Sie wünschen eine gute Uhr? Bitte, wollen Sie sich mit nach der betreffenden Abteilung bemühen — —«
»Nein, eine gute Uhr habe ich. Zu solch einer astronomischen Bestimmung reicht sie allerdings auch nicht aus, längst nicht. Die kostet Tausende, das weiß ich schon. Ich möchte erst einen Mann sprechen, einen Gelehrten, einen Astronomen, der mir erklärt, wie man so etwas macht, ob eine Bestimmung bis zur Zehntelsekunde überhaupt möglich ist.«
Die Verkäuferin wusste sich zu helfen, sie schickte einfach einen anderen, einen Herrn, der hier ebenfalls eine leitende Rolle spielte. Der wusste denn auch den vorgetragenen Wunsch richtiger aufzufassen.
»Es handelt sich um eine astronomische Frage?«
»Jawohl, wenn auch in Bezug auf Geografie.«
»Eine geografische Ortsbestimmung, jawohl, ich verstehe schon. Da gehen Sie doch direkt an die Sternwarte, wenden Sie sich an Professor Doktor Elsman, den berühmten Astronomen. Er ist auch unser Kunde, ein sehr freundlicher Herr.«
Atalanta dankte für diese Auskunft, die sie sich selbst hätte geben können, nahm ihre Handtasche und ging an die Kasse, wo sie den Betrag ihrer Rechnung erlegte.
»Wollen Miss fahren?«
»Jawohl, fahren.«
»Automobil?«
»Jawohl, Automobil.«
Ein solches fuhr vor. Es war nur ein sehr kleiner Weg, den sie zu Fuß zu machen hatte, nur über das Trottoir, aber er genügte, um alle in der Nähe befindlichen Männerköpfe und nicht minder auch Weiberköpfe sich verdrehen zu lassen. In dem blauen Samtkleid mit dem gewaltigen Federhut war sie eben wirklich eine ganz auffallende, eine ganz reizende Erscheinung, und beim Einsteigen hob sie das Kleid, als habe sie ihren regelrechten Kursus beim Anstandslehrer durchgemacht, als sei ihr dies alles etwas Altes.
»Wohin?«
»Nach der Sternwarte!«, sagte der schon instruierte Portier.
»Nein, nach dem Zirkus Lanhazzy!«, sagte aber die Eingestiegene.
Das war nun freilich ein großer Unterschied. Doch dem Chauffeur war es egal, er fuhr nach Zirkus Lanhazzy, dessen Plakat überall prangte, verkündend, dass heute wie jeden Abend die große Raubtiergruppe und Miss Soundso als ans Pferd gefesselter Mazeppa auftrat, und zum Schluss die Sensation des Tages: Ein ganz echter Zusammenstoß zweier echter Eisenbahnen, mit richtigen Menschen besetzt.
Der runde Prachtbau war erreicht, Atalanta stieg aus.
»Was kostet das Automobil?«, fragte sie, als sie Arnos Geldbeutel zog.
»Einen halben Dollar.«
»Ich meine, was dieses ganze Automobil kostet.«
»Dreitausend Dollars«, entgegnete der Wagenlenker, fast ein Knabe noch, ohne eine Miene zu verziehen. Es gehörte zwar gar nicht ihm, aber er hätte es sofort um diesen Preis verkauft und hätte dabei natürlich ein gutes Geschäft gemacht.
Atalanta bezahlte den halben Dollar und ging.
»Zweitausendfünfhundert!«, rief ihr der Knabe nach, aber die Dame reagierte nicht darauf.
Sie wendete sich an einen im Vestibül stehenden Portier.
»Ist Herr Direktor Lanhazzy zu sprechen?«
»Nein, der ist schon seit fünfzehn Jahren tot.«
»Wer ist Besitzer des Zirkus?«
»Eine Aktiengesellschaft. Direktor ist Mister Kock.«
»Wo ist der Herr zu sprechen?«
»Zu sprechen? Hm. Sind Sie Artistin?«
»Ja.«
»Da müssen Sie sich ins Sekretariat begeben, wo aber jetzt keine Sprechstunde ist.«
»Ich muss sofort eine Auskunft haben.«
»Direktor Kock spielt um diese Zeit hier im Restaurant immer Billard. Sie können es ja einmal probieren. Aber ich glaube nicht, dass er sich sprechen lassen wird.«
Man muss nämlich wissen, dass so ein Zirkusdirektor sich als eine Majestät fühlt, der für sein Personal und für die Artisten einfach unnahbar ist. Er verkehrt überhaupt gar nicht mit ihnen, das Engagement erfolgt ausschließlich durch Agenten, welche die eigentlichen Generalgewaltigen sind.
Atalanta hätte nur einen einzigen Tag in der Zirkuswelt zu verleben brauchen, so hätte sie das sofort erkennen müssen.
Trotzdem begab sie sich in das Restaurant, fragte nach dem Direktor und wurde ins Billardzimmer gewiesen.
»Was wollen Sie?«, fragte ein weißhaariger Herr, dem weder ein mit At-las gefüttertes Samtkleid noch das schönste, interessanteste Gesicht irgendwie imponieren konnte, dessen ganzes Denk-und Gefühlsvermögen einzig und allein im Geldsack saß, gleich mit grimmigem Gesicht.
»Atalanta Ramoni ist mein Name.«
Ausnahmen gibt es überall. Wenn es einmal passieren kann, dass zwei Himmelskörper, die sich seit Billionen Jahren ausgewichen sind, im Weltenraum zusammenprallen, so kann wohl auch einmal ein Zirkusdirektor gegen einen Artisten herablassend werden und mit ihm direkt verkehren.
»Atalanta Ramoni?! Aus dem New Yorker Hippodrom?!«
»Ja.«
»Die rote Athletin?!«
»Bin ich.«
»Es — ist — nicht — möööglich!!«
Der eine Spieler hatte noch einen Ball geschoben, dieser kam auf Atalanta zugelaufen, sie nahm ihn in die linke flache Hand, hob die rechte zur Faust geballt, schlug zu, und der Elfenbeinball war verschwunden, war zu Atomen zersplittert.
Dieses Kunststück, einen Elfenbeinball mit einem Fausthieb zu zerschmettern, hat auch der berühmte Taschenspieler Bosko, seiner Zeit ein wirklich berühmter Mann, fertig gebracht, niemand hat es ihm nachmachen können, man hat es auch nicht wieder zu sehen bekommen. Es muss ein ganz besonderer Schlag, ein besonderer Trick dazu gehören, und wer es nicht kann, wird es wahrscheinlich nie lernen, und besäße er auch die Kraft eines Herkules.
Atalantas Glacéhandschuhe waren dabei freilich ebefalls in die Brüche gegangen.
»Genügt Ihnen diese Legitimation, dass ich es wirklich bin?«
Der Direktor war sprachlos vor Staunen. Doch schnell wurde er wieder Geschäftsmann, sein Herz wanderte aus der Brust, wohin es sich nur einmal verirrt hatte, sofort in die Hosentasche zurück. Es war auch mehr ein freudiges Staunen über solch ein unverhofftes Glück gewesen.
»Sind Sie frei?«
»Ich bin frei.«
»Sie wollen sich engagieren lassen?«
»Ja.«
»Welche Gage verlangen Sie?
»Bieten Sie.«
»Den ganzen Abend füllend?«
»Ja, und ich kann jeden Abend und zu jeder Vorstellung immer wieder etwas ganz anderes bringen.«
»Zweitausend Dollars für jede Vorstellung, auch des Nachmittags.«
Das war nicht besonders viel für einen Stern der Artistenwelt. Eine Tänzerin wie die australische Saharet und die spanische Otero tritt nicht unter zehntausend Francs auf, und die verdient sie sich in noch nicht einer halben Stunde, während diese hier den ganzen Abend ausfüllen wollte.
»Ich nehme an. Aber nur für einige Vorstellungen.«
»Auf wie viele?«
»Auf drei Vorstellungen.«
Dieser Mann erkannte sofort, dass man mit der nicht viel handeln durfte, sonst sprang sie gleich wieder ab.
»Abgemacht! Wir werden schon länger zusammen bleiben.«
Er zog sein Notizbuch, schrieb mit dem Füllfederhalter in einer einzigen Zeile einen bindenden Kontrakt hinein, wenn auch nur vorläufig, Atalanta las die Zeile und unterschrieb.
»Ich bedarf zweier Tage zur Vorbereitung der Reklame.« sagte der Direktor.
»Das ist mir angenehm.«
»Wann wollen Sie proben?«
»Zu jeder Zeit.«
»Heute Nacht um elf Uhr nach der Vorstellung.«
In den großen Zirkussen wird jede Nacht bis gegen früh geprobt.
»Ich werde halb elf da sein.«
»Wo wohnen Sie?«
»Ich habe noch keine Wohnung.«
»Hotel ›Alhambra‹, hier gleich schräg gegenüber, melden Sie sich beim Portier«, fiel der Direktor schon wieder in seine Selbstherrlichkeit zurück.
Dass er das Hotel auch bezahlte, war ganz selbstverständlich. Atalanta war damit noch nicht zufrieden, sie stellte noch einige weitere Bedingungen, in Sonderheit wünschte sie, dass ihr während ihres Engagements nicht wie üblich eine Equipage, sondern ein Automobil zur Verfügung gestellt werde.
Der Direktor zog die Brauen hoch. »Equipage? Automobil? Das haben nur noch die Clowns.«
So ist es. Es sind dies uralte Verhältnisse im internationalen Zirkusleben. Jeder Clown bekommt eine Equipage mit zwei Dienern und ein Reitpferd mit Stallknecht zur Verfügung gestellt, die er aber regelmäßig an irgend einen Lebemann weiter vermietet, der nun diese gemietete Equipage meist wieder einer Kunstreiterin zur Verfügung stellt, die ein ganz erbärmliches Gehalt, einen Hungerlohn bekommt, während sich ein guter Spring- und Sprechclown selten unter dreitausend Mark den Monat steht, aber als zerlumptes Genie regelmäßig am zweiten jeden Monats schon wieder den Zahlkellner anpumpt.
»Gut, ich werde mit Ihnen eine Ausnahme machen. Sie sollen ein Automobil haben, ich werde dann gleich Anweisung geben.«
»Ich möchte es sofort benutzen.«
»Herr Sekretär, gehen Sie mit der Dame.«
»Ich bitte um Vorschuss.«
»Vorschuss? Gibt es nicht. Der Kontrakt ist auch ohne Handgeld bindend.«
»Ich brauche aber Geld.«
Da huschte über das eiserne Gesicht des alten, weißköpfigen Herrn doch ein eigentümliches Lächeln, als er seine Brieftasche zog.
»Ich bin im Zirkus alt und grau geworden, und ich hoffte immer, einmal einen Artisten zu engagieren, der keinen Vorschuss braucht, aber es soll eben nicht sein. Wie viel?«
»Hundert Dollars.«
»Sie sind sehr bescheiden, Miss, das findet man selten.«
»Tausend Dollars.«
»Hier haben Sie fünfhundert. Unterschreiben Sie hier. Nun, Mister Fry, ich war wohl am Stoß. Wie viele Points hatte ich schon gemacht?«
Der befohlene Sekretär begleitete die Dame hinaus, fünf Minuten später saß sie in einem prachtvollen Luxusautomobil, an dem ein Schild möglichst auffallend verkündete, dass es dem Zirkus Lanhazzy gehöre. Dass die darin sitzende Dame Atalanta, die rote Athletin sei, das brauchte nicht angeschrieben zu werden, im Gegenteil, jetzt mussten sich erst alle fragen, wer die Darinsitzende sei. Das Automobil knatterte, der Chauffeur blickte fragend zurück.
»Nach der Sternwarte.«
»Nach der Sternwarte von Frisco?«
»Ja.«
»Da kann ich nicht hinfahren.«
»Warum nicht?«
»Weil die ganz dort oben auf dem Berggipfel liegt, da geht eine Zahnradbahn hinauf.«
»So fahren Sie mich bitte nach dieser Station.«
»Dann können Sie gleich wieder aussteigen, die ist hier dicht nebenan.«
Atalanta brauchte nur über die Straße zu gehen, zahlte am Schalter, benutzte einige Minuten die Untergrundbahn, stieg um und fuhr mit der Zahnradbahn einen himmelhohen Berg hinauf.
Auf einem weiten Plateau, von dem aus man den herrlichsten Rundblick hatte, im Westen der Stille Ozean und im Osten die schneebedeckten Gipfel des Felsengebirges, lag sie, eine der großartigsten Sternwarten der Welt.
Es war bald Mittag, hier oben war alles wie ausgestorben. Atalanta sah sich um und betrat einen offenen Torweg. Eine Portiersloge war vorhanden, aber niemand darin. Jedoch hörte sie ein Geräusch, das nur von einem Menschen herrühren konnte. Sie brauchte nur einige Schritte zu gehen, so blickte sie in eine kleine Schlosserwerkstatt, in der ein Mann im blauen Monteuranzug an einem Schraubstock feilte.
Noch ehe sie sich an diesen Menschen wenden konnte, kam den Gang ein älterer, bebrillter Herr entlang; er wollte die junge Dame wohl gar nicht beachten, blieb nur deswegen dicht neben ihr stehen, um einen über einem Ausguss befindlichen Wasserhahn aufzudrehen und sich die Hände zu waschen.
».Was wollen Sie? Wer sind Sie? Wie kommen Sie hier herein?«, fragte er nur so nebenbei, durch die Brille einmal einen Blick auf Atalanta werfend.
Dieser Empfang konnte keine große Ermutigung erwecken.
»Ich möchte Herrn Professor Elsman sprechen —«
»Der bin ich selber. Was wünschen Sie?«
»Ich möchte gern eine geografische Ortsbestimmung — —«
»Wie heißen Sie denn?«
»Atalanta Ramoni.«
»Atalanta Ramoni? Kenne ich nicht. Haben Sie sich denn angemeldet?«
»Nein, ich — —«
»Jetzt ist keine Besuchszeit. Kommen Sie heute Nachmittag um vier wieder, da werden Sie herumgeführt.«
Die junge Indianerin ließ sich noch nicht abschrecken, was bei manch anderem Menschen der Fall gewesen wäre.
»Es handelt sich bei mir um etwas Wissenschaftliches — —«
»Wissenschaftliches? Was denn?«
»Ich möchte die Kunst lernen, geografische Ortsbestimmungen zu machen.«
Der alte Herr schlenkerte seine nassen Hände, sich nach einem nicht vorhandenen Handtuche umsehend, dann nach einem Taschentuche suchend, und jetzt erst betrachtete er die vor ihm Stehende, und der Eindruck, den das junge, elegante, reizende Dämchen in dem blauen Samtkleid mit dem großen Federhute auf ihn hervorrief, war ein ganz besonderer.
»Aaah, geografische Ortsbestimmungen wollen Sie machen! Jaa sooo! Sie wollen wohl Weltreisende werden, wie? Forschungsreisende? Noch unbekannte Erdteile entdecken? Wissen Sie denn auch schon, wenn's Kaffeewasser kocht? Das wird ja immer besser mit den Damen! Nein, Fräulein, lernen Sie lieber erst mal eine Suppe kochen.«
Sprach's, ließ die Indianerin stehen und ging seines Weges.
Atalanta stand sprachlos da und als sie sich mit einem förmlichen Ruck wieder aufraffte, trat der Schlosser aus der Werkstatt.
Es war ein kleiner, untersetzter Mann von vielleicht dreißig Jahren, mit einem ganz possierlichen Mopsgesicht, das immer aussah, als wolle es in ein schallendes Gelächter ausbrechen, obgleich das niemals geschah.
»Nehmen Sie es dem Professor Elsman nicht übel, Fräulein«, wandte er sich gutmütig, wie dieser Mann überhaupt die Gutmütigkeit selbst sein musste, an die junge Dame. »Dem ist heute etwas schief gegangen, er hat einen ganzen Kasten mit fotografischen Platten, an denen er seit einer Woche arbeitet, fallen lassen, da hat er schlechte Laune. Sonst ist der gar nicht so. Sie möchten lernen, wie man eine geografische Ortsberechnung macht? Na, da kann ich Ihnen vielleicht helfen.«
Von dem Gefühl ihrer Niederlage hatte sich Atalanta schon wieder befreit, jetzt sah sie den kleinen Mann mit großen Augen an.
»Sie könnten es mich lehren?«
»Ja, das kann ich.«
»Können Sie denn solch eine geografische Ortsbestimmung nach Sonne oder Mond oder Sternbildern machen?«
»Warum denn nicht?«
»Sie sind doch — —«
»Arbeiter!«, ergänzte der Schlosser, als jene einen Augenblick stockte. »Ja, ich bin hier nur Arbeiter. Aber so eine Ortsbestimmung ist doch ganz einfach.« — »Einfach?!«
»Gewiss! Dazu gehören nur einige mechanische Handgriffe mit dem Sextanten und mit den nautischen und astronomischen Handbüchern. Etwas Buchstabenrechnung, Logarithmen, die Anfangsgründe der Trigonometrie — das ist alles. Ja, Fräulein, wer diese Tabellen und Handbücher berechnet und zusammengestellt hat, der musste freilich etwas gelehrter sein! Das sind Geistesheroen gewesen! Aber mit diesen gegebenen Hilfsmitteln so eine Bestimmung ausführen — das ist gar nichts weiter.«
»Und ich habe immer gedacht, das setzte die größten astronomischen Kenntnisse voraus!«
»I wo. Alles rein mechanisch. Wie ich sagte. Nun kommt es ja darauf an, wie es mit Ihren mathematischen Kenntnissen steht.«
»O, ich habe eine recht gute Schulbildung gehabt.«
»Können Sie die Buchstabenrechnung? Nur die einfache.«
»Die kann ich.«
»Trigonometrie?«
»Die Anfangsgründe habe ich wenigstens gehabt.«
»Die genügen. Können Sie mit Logarithmen rechnen?«
»Kann ich.«
»Haben Sie schon mit dem Sextanten gearbeitet?«
»Nein. Ich habe zwar solch ein Instrument schon gesehen, habe aber noch nie eines in der Hand gehabt, kenne nicht einmal die Theorie.«
»Nun, das ist das Wenigste. In anderer Hinsicht wieder die Hauptsache. Es handelt sich nur um Übung. Üben, immer üben. Haben Sie jetzt Zeit? Soll ich es Ihnen gleich jetzt einmal vormachen?«
»Ach, wenn Sie so freundlich sein wollten!«
»Warten Sie eine halbe Minute, ich hole die Bücher und Instrumente.«
Mit freudigem Staunen blickte Atalanta dem Schlosser nach, der sich im Fortgehen die schmutzigen Hände hinten an der Hose energisch abwischte.
Er kam sofort wieder, sie traten hinaus ins Freie, wo er die mitgebrachten Bücher und zwei Kästen auf eine Bank legte. Der eine Kasten enthielt einen Sextanten, der andere eine kleine Chronometeruhr.
Der Unterricht begann. Wir schildern ihn nicht, wollen durchaus nicht sachlich werden, nur einige wenige Andeutungen geben.
Sie machten zusammen mehrere Bestimmungen der Lage dieser Sternwarte nach ganzen Breiten- und Längengraden. Der Schlosser zeigte ihr, wie sie durch das Fernrohr des Sextanten nach der Sonne zu blicken und gleichzeitig nach der scharfen Linie zu spiegeln habe, welche das Meer mit dem Horizont bildet, auch wenn es noch so aufgeregt ist. Sieht man kein Meer, so bestimmt man den Winkel zwischen der Sonne und ihrem Spiegelbilde in irgend einer anderen Wasserfläche. Ist keine solche vorhanden, so schafft man sich eine, aber nicht durch Wasser, sondern durch eine mit Quecksilber gefüllte Dose. Das nennt man eine Bestimmung nach dem künstlichen Horizont.
Im Grunde genommen war das alles doch nicht so einfach. Atalanta wunderte sich, staunte manchmal, mit welch spielender Leichtigkeit dies alles dieser simple Schlossergeselle ausführte und ihr beizubringen wusste, und es war leicht begreiflich, dass sie sich in den Wahn verrannte, auf so einer Sternwarte könne das jeder stationierte Arbeiter. Und dieser Schlosser wiederum wunderte sich, wie leicht diese junge Dame alles begriff und ihm nachmachte.
»Sie haben wirklich noch gar keinen Sextanten in der Hand gehabt?«
»Nein, auf Ehre nicht.«
»Schier unbegreiflich. Nun ja, es kommt einmal so eine Ausnahme vor. Es ist eben immer die alte Geschichte: Der eine kann's sofort, und der andere nie — oder nur mangelhaft. Sie haben ein fabelhaftes Geschick, den Winkel im gegebenen Moment festzustellen. So, nun wissen Sie, wie's gemacht wird. Nun könnte ich Sie schon sich allein überlassen. Kaufen Sie sich einen Chronometer und dann üben Sie recht fleißig.«
»Ich habe einen Chronometer, der fünftel Sekunden anzeigt.«
»Was?! Fünftel Sekunden!«
»Ich habe ihn hier.«
Sie entnahm ihrer Handtasche Arnos wasserdichte Uhr.
Der Schlosser öffnete die beiden hinteren Deckel, zog ein Vergrößerungsglas hervor und blickte ins Werk.
»Ja, das ist eine recht gute Uhr. Die Feder ist mit Palladium angelötet. Aber das ist kein Chronometer, sondern ein Chronograf. So eine Uhr braucht man zum Wettrennen und dergleichen.«
»Aber die Uhr zeigt doch fünftel Sekunden an.«
»Das wohl, aber man weiß doch nicht, ob sie auch richtig anzeigt. Nein, sie geht ja überhaupt zwei Minuten vor. Das macht bei der Bestimmung dreißig Meilen Breite Unterschied. Was hat die Uhr gekostet?«
Atalanta wusste es nicht.
»Vielleicht fünfzig Dollars!«, ergänzte dann der Schlosser seine eigene Frage. »Ja, es gibt Taschenchronometer, die für gewisse Zeit bis zur fünftel Sekunde genau gehen, die höchste Präzisionsarbeit, welche die Uhrmacherkunst bisher erreicht hat. Hier haben Sie solch eine Uhr.«
Er zog unter seiner Bluse an einer Lederschnur eine ganz einfache silberne Uhr hervor und öffnete den Deckel. Hier sprang ein großer Zeiger ruckweise im Kreise herum.
»Das ist ein wirklicher Chronometer, mit welchem Wort viel Unfug getrieben wird. Der geht wirklich bis zur Sekunde genau.«
»Was kostet so eine Uhr?!
Noch bevor der Mann antworten konnte, kam aus dem kleinen Stationsgebäude ein älterer Herr im schwarzen Gehrockanzug, mit Lackschuhen und weißen Gamaschen, überhaupt äußerst patent, gebügelt und geschniegelt, nahm, als er über das Plateau ging, schon von Weitem den Zylinder vom Glatzkopf, näherte sich mit trippelnden Schritten und nach vorn übergebeugt dem Schlosser, so blieb er demütig mit dem Zylinder in der Hand stehen.
»Seine Herrlichkeit, Lord Nottingham, lässt Eure kaiserliche Hoheit alleruntertänigst fragen, wie weit die Berechnung ist.«
».Bitte, bedecken Sie sich«, entgegnete der Schlossergeselle, der einen Fuß auf die Bank gestellt hatte. »Die Berechnung? Die habe ich schon vor einer halben Stunde hinuntergeschickt.«
Katzbuckelnd und rückwärts gehend entfernte sich der alte Herr wieder. Der Schlosser hatte ihm nachgesehen, bis er verschwunden war.
»Dieser Kammerdiener — halt, Kammerherr wollte ich sagen — ist nur glücklich, wenn er den Mund recht voll Herrlichkeiten und kaiserlichen und königlichen Hoheiten und Durchlauchten nehmen und darauf herumkauen kann. Er ist selbst ein Baronet, aber so eine richtige Lakaienseele. Dagegen sein Herr, der Lord von Nottingham, das ist ein tüchtiger Mensch, ein tüchtiger Astronom. Wir beide lösen hier zusammen einen Nebelfleck auf, der große Refraktor ist uns zur Verfügung gestellt worden.«
Jetzt aber war es doch grenzenloses Staunen, mit dem die junge Indianerin in das possierliche Mopsgesicht des Schlossers blickte, der an seinen wenigen unter der Nase befindlichen Härchen herumzupfte.
»Sie sind — eine kaiserliche Hoheit?!«
»Ich bin ein Sohn des Mikado, des Kaisers von Japan!«, erklang es leichthin. »Aber nun fallen Sie nicht etwa in den Ton dieses Lakaien! So etwas zu hören ist mir grässlich, ich schäme mich fast. Kann ich denn etwas für meine Geburt? Könnte ich denn etwas dafür, wenn mein Vater ein Raubmörder gewesen wäre? Ich bin einfach der Doktor Hikari. Sehen Sie, dass ich Doktor bin, darauf hin ich wirklich stolz. Denn ich habe mir diesen Doktortitel auch nicht erworben, was höchst einfach ist, wenn man die nötigen Schulen besucht hat, sondern ich bin von mehreren europäischen und amerikanischen Universitäten zum Doktor honoris causa ernannt worden, zum Ehrendoktor, wegen einiger astronomischer Entdeckungen und Berechnungen, und damals ahnte niemand, dass ich ein japanischer Prinz, ein Sohn des Mikado sei.
Ja, darauf darf man wohl stolz sein. — Na, lassen wir das. Wozu wollen Sie denn eine Bestimmung nach Zehntelsekunden machen, wenn ich fragen darf?«
»So eine Ortsbestimmung ist mir gegeben worden, ich mochte wissen, was sich dort befindet!«, erwiderte Atalanta kurz.
»Wo ungefähr befindet sich denn dieser Punkt?«, fragte Doktor Hikari wieder.
»Hier in San Francisco.«
Der Japaner reckte seinen Kopf vor, als habe er nicht recht gehört, er machte jetzt erst recht ein possierliches Gesicht.
»Ja, mein Gott, da brauchen Sie aber doch keine astronomische Berechnung dazu! Da messen Sie einfach mit dem Zirkel auf der Karte nach, nehmen Sie ein Messband und messen sich den Punkt ab. Verstehen Sie?«
Die Indianerin blickte den Sprecher groß an und schlug sich dann mit der flachen Hand vor die Stirn.
»Wahrhaftig, dass ich daran nicht gleich gedacht habe! Ist denn so eine Karte so ganz genau?«
»Ganz, ganz genau. Da stimmt jeder Meter. Darf ich dabei behilflich sein?«
»Ja, Herr Doktor, wenn ich es wagen darf — —«
»Bitte, ich stehe Ihnen zu jeder Zeit, Tag und Nacht, zur Verfügung. Wir kennen keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht, d. h. nicht in der Lebensweise, die Zahnradbahn geht die ganze Nacht durch. Ich kann auch jederzeit abkommen. Fragen Sie nur nach Doktor Hikari. Es freut mich wirklich außerordentlich, so eine geniale Schülerin zu haben. Ohne jede Schmeichelei. Die gibt's bei mir gar nicht. Sie sind Italienerin, Miss?«
»Ich bin eine geborene Indianerin.« — »Ach was!«
Hierauf wurde noch eine etwa viertelstündige Unterhaltung zwischen den beiden gepflogen, dann verabschiedete sich Atalanta mit vielen Dankesworten von dem sonderlichen Gelehrten.
Atalanta begab sich aus dem geistigen Reiche der Sterne wieder hinab auf die irdische Ebene, wo man es nur gar zu gern hätte, wenn sich alle diese noch ganz zwecklosen Sterne in Goldstücke verwandeln und herabfallen wollten, obgleich es dadurch auch nicht einen Hungrigen weniger auf der Erde geben würde.
Sie benutzte nicht ihr eigenes Automobil, mit dem sie noch etwas ganz anderes vorhatte, sondern ließ ein einfaches Mietautomobil rufen.
»Spaniola Street!«, sagte sie beim Einsteigen.
Der Chauffeur fuhr nicht gleich los, betrachtete Atalanta erst etwas misstrauisch, als habe ihm diese Straße auch sonst recht spanisch geklungen. »Spaniola Street?«, wiederholte er.
»Ja, Spaniola Street.«
»In der Altstadt?«
»Gibt es denn noch eine andere Spaniola Street?«
»Nein, das nicht, aber — welche Nummer?«
Erst hatte er wohl fragen wollen, was wollen Sie denn dort, er hatte es aber verschluckt.
»Fahren Sie nur los und sagen Sie es mir, wenn wir in der Spaniola Street sind, dann fahren Sie ganz langsam.«
Bald kam das schnelle Gefährt aus dem Gewühl des Zentrums heraus, die prächtigen Geschäftspaläste verwandelten sich in prächtige Wohnhäuser, diese schrumpften immer mehr zusammen, bis aus den Häusern schließlich Hütten wurden.
»Halt!«, rief jetzt Atalanta, die unterwegs immer die Stadtkarte studiert und nur zuletzt sich aufmerksam umgesehen hatte.
Sie hatte richtig die Spaniola Street schon erkannt, bevor der Chauffeur sie darauf aufmerksam gemacht hatte.
Nun fuhr sie nur noch bis zur nächsten Straßenecke, dann stieg sie aus, bezahlte, und das Automobil knatterte wieder davon.
Atalanta aber trat an ein baufälliges Häuschen und ließ den eisernen Klopfer erschallen.
Nach einer Weile öffnete eine ältere, ungewaschene und ungekämmte Frau.
»Lassen Sie mich mit Ihrem Häre Jäsus zufrieden!«, sagte sie beim ersten Blick auf die elegante Dame und warf Atalanta die Tür vor der Nase zu.
Die in der Weltabgeschiedenheit ausgewachsene Indianerin konnte natürlich nicht wissen, dass sie für eine Dame von der inneren Mission gehalten wurde, welchem Berufe sich die reichen Amerikanerinnen mit einer wahren Leidenschaft hingeben. Diese betreiben die Sache förmlich sportmäßig, sie arbeiten um einen Heiligenschein, und um diesen zu verdienen, darf man kein Geld ausgeben, keinen Cent, höchstens das Verteilen von Bibeln ist erlaubt.
Atalanta klopfte noch einmal mit dem eisernen Hebel und ließ nicht locker, bis die Tür wieder geöffnet wurde.
Jetzt aber hatte die alte Frau einen Besen in der Hand und holte auch schon zum Schlage aus.
»Ist sich doch ein miserables Weibsstücke — —«
Aber die irischen Worte verstummten und der Besen schlug nicht zu, als ihr die Dame zwischen den Fingern einen blanken Silberdollar entgegenhielt.
»Ist sich Dollar meiniges? Will sich Madam hereinkommen?«
Die Alte haschte geschickt nach dem Dollar, Atalanta trat ein, kam mit dem ersten Schritt gleich ins gute Zimmer, in dem es aber wie in einer Lumpenkammer aussah und roch.
Es waren noch zwei andere menschliche Wesen zugegen, zwei neugeborene Babys, mit roter Wolle auf dem Kopfe, die in einer Apfelsinenkiste unter Lumpen schliefen.
Das eine erwachte gerade, wollte zu schreien anfangen, die Frau beschwichtigte es aber sofort mit äußerster Zärtlichkeit, nahm es heraus, öffnete den Kittel und gab ihm die Brust, worüber sich das junge Mädchen doch etwas wunderte.
»Ist denn das Ihr Kind?«
»Ja — vielleicht — ich weiß es nicht.«
»Das wissen Sie nicht?«
»Nein — das ist eine verwickelte Geschichte — vor acht Tagen bekam meine Tochter ein Mädchen und ein paar Stunden später ich auch eins — wir haben sie zusammen gelegt — und nun haben wir sie verwechselt.«
Ja, das war allerdings eine verwickelte Geschichte. Jetzt wusste man nicht, wer hier die Tante war und wer die Nichte.
Die Indianerin behielt ihren unerschütterlichen Ernst und kam gleich zur Sache, die sie hierher geführt hatte.
»Wie lange wohnen Sie schon hier?«
»Seit vier Jahren.«
»Gehört dieses Haus Ihnen?«
Daran war nicht zu denken.
»Wem gehört es?«
Das wusste die Frau nicht. Jedenfalls einer großem Baugesellschaft. Jeden Sonnabend Abend kam ein Kollektor und sammelte von Tür zu Tür die Miete ein, die Rente, wie es dort heißt.
»Kennen Sie einen Professor — —«
Atalanta verschluckte den Namen und fragte weiter:
»Aufgefallen an diesem Hause ist Ihnen wohl niemals etwas.«
»Was denn aufgefallen?«
Das genügte.
»Frau, ich glaube, in diesem Hause ist etwas vergraben.«
Jetzt horchte die Frau aber mit großen Augen auf.
»Geld?«
»Das kann ich nicht sagen, ich weiß es absolut nicht!«
Das war nicht klug von der Indianerin gewesen. Wenn sie auch nicht wusste, ob sie hier überhaupt etwas finden würde, so hätte sie doch gleich direkt behaupten müssen, hier sei ein Schatz vergraben. Diese Erfahrung musste ihr erst noch kommen.
Doch diesmal hatte sie noch Glück. Bei diesem Weibe genügte schon die angedeutete Hoffnung. Zunächst bettete sie das kleine Kind, das an ihrer Brust wieder eingeschlafen war, in die Apfelsinenkiste neben Tante oder Nichte zurück, zwar so schnell wie möglich, aber dennoch mit liebevoller Zärtlichkeit, welche Mutterliebe bei allen solchen tiefstehenden Menschen so versöhnend wirkt, dann freilich stürzte sie wie eine Furie davon, gleich mit einem Spaten und einer Spitzhacke zurückkommend, bereit, sofort das ganze Haus einzureißen.
»Ich muss erst ausmessen.«
Mit großer Mühe öffnete Atalanta das verquollene Fenster, durch dessen Scheiben man beim besten Willen nicht blicken konnte, visierte nach der Stelle des Trottoirs, wo sie vorhin stehen geblieben war, maß mit den ausgespannten Fingern die Stärke der Hausmauer, machte dann zwei Meterschritte zurück, einen seitwärts und blieb stehen.
»Hier muss es vergraben sein.«
Sofort spuckte die Alte in die Hände, hob die Spitzhacke und hackte zu, ja, sie hätte der Indianerin, wäre diese nicht schnell zurückgesprungen, sogar in die Füße gehackt, so genau nahm sie es mit der bezeichneten Stelle. Sie hackte in die Stubendiele, dass die Holzsplitter flogen, bis sie eine Fuge erwischt hatte, an der sie dann die Dielenbretter herausbrach.
Koksasche, noch mit ganzen Stücken vermischt, kam zum Vorschein. Nachdem diese herausgeschaufelt worden waren, zeigte sich gelber Sand. Das war schon der eigentliche Erdboden. Keller besitzen diese Hütten nicht.
»Wie tief ist zu graben?«, fragte die Frau einmal, als sie schon ein ganz hübsches Loch geschaffen hatte, den Sand natürlich daneben in der guten Stube aufhäufend.
»Das, liebe Frau, weiß ich nicht.«
Unverdrossen schippte die Alte weiter, als sei sie bereit, sich bis zum Mittelpunkt der Erde durchzuschippen.
Die Indianerin sah ihr geduldig zu, zwei zugleich konnten auch gar nicht arbeiten, bis ihr sinnendes Gesicht einen starren Ausdruck annahm.
»Halt!«, rief sie da. »Frau, ich muss gestehen, dass ich mich geirrt habe. Ich habe einen Fehler in meiner Berechnung begangen.«
Atalanta begann noch einmal auszumessen, diesmal machte sie viel mehr Schritte, die sie durch die Tür bis in die angrenzende Küche führten, eine wahre Zigeuner- oder Hexenküche, dort schwenkte sie wieder ab und kam mit dem letzten halben Schritte dicht an den Küchenofen zu stehen, einen niedrigen Herd, halb in die Wand eingemauert.
»Diesmal irre ich mich nicht. Hier ist die Stelle. Gerade wo der Herd steht.«
»Unter dem Herde ist es?«, fragte die Alte, gar nicht ungeduldig darüber, dass sie schon so lange umsonst gearbeitet hatte.
»Ja, gerade unter diesem Herde. Der Ofen müsste weg. Ich bezahle alles, was hier ruiniert wird.«
»O, das haben Sie nicht nötig, das Haus ist ja nicht unser«, sagte dieses Ideal von einer Mieterin und hackte auch schon auf den Ofen los, dass die Eisenplatten splitterten und die Kacheln krachten. Sie hieb auch die darauf stehenden Töpfe in Trümmer, die sie gar nicht erst weggenommen hatte. Na ja, wenn man einen großen Schatz finden kann, da kommt es doch nicht auf so ein paar lumpige Töpfe an.

Wenn die Alte das so selbstverständlich fand, gleich den ganzen Ofen in Trümmer zu legen, so fand die junge Indianerin auch nichts weiter dabei.
Emsig arbeitete die Bewohnerin der Hütte darauf los, und als sie endlich ermüdet inne hielt, wurde sie sofort von Atalanta abgelöst, die mit noch größerer Energie und weit mehr Geschick das Erdreich aufhackte und aus dem immer tiefer werdenden Loch herausschaufelte. Da ihr dabei der große Hut und das elegante Samtkostüm sehr im Weg gewesen war, hatte sie kurz entschlossen Kleid und Hut und die Hackenstiefelchen abgelegt, die sich zudem bereits in einem sehr derangierten Zustand befanden.
Nach etwa halbstündiger Arbeit traf Atalanta auf felsigen Grund, in dem die »Schatzgräberin« nach Freilegung einer größeren Fläche eine kreisrunde Fuge entdeckte. Offenbar war hier ein Stein oder eine Platte eingelassen. Die Indianerin war, wenn man ihr auch nichts davon anmerkte, selbst sehr überrascht davon. Jetzt erst wurde die Sache geheimnisvoll, auch für sie. Denn bisher hatte sie nicht im Geringsten wissen können, ob sie hier irgend etwas finden würde. Weshalb sie hier nachgrub, von wo sie die Kenntnis dieser Stelle hatte, das wird später erklärt werden, falls es der geneigte Leser nicht selbst schon erraten hat. Es hing alles mit dem Sklavensee zusammen.
Als nun Atalanta mit dem Hammer einen Meißel in die Fuge keilte, da war ihr letzter Zweifel gelöst. Es war wirklich ein Steindeckel, der sich schon jetzt etwas hin und her bewegen ließ.
Ihrer Kraft und Geschicklichkeit gelang es, auch ohne Handhabe die schwere, dicke Steinplatte zu lüften und zur Seite zu legen, ohne dass Sand nachrutschte.
Ein rundes Loch zeigte sich, Atalanta blickte hinein, konnte aber auch mit ihren Augen nichts sehen. Ein hineingeworfener Stein fiel bald plätschernd ins Wasser.
Es war ein Brunnen.
»Wussten Sie nicht, dass hier ein Brunnen ist?«
Die Frau hatte keine Ahnung davon gehabt, in der ganzen Umgebung hier war kein Brunnen. Nach dem, wie solche Arbeiterhäuschen so ganz oberflächlich gebaut werden, konnte es sogar sein, dass auch die einstigen Erbauer von diesem Brunnenschachte nichts bemerkt hatten.
Atalanta forderte eine Lampe und eine Leine. Eine Waschleine war denn auch in diesem Hause vorhanden, wenn auch geflickt genug.
Die brennende Lampe, gerade zum Aufhängen eingerichtet, wurde hinabgelassen. In sechs Meter Tiefe beleuchtete sie einen Wasserspiegel.
Oder war es dem Mädchen mehr darauf angekommen, zu untersuchen, ob die Lampe dort unten nicht etwa verlösche? Hatte sie schon von giftigen Kohlenwasserstoffgasen gehört, welche so oft am Grunde von Brunnen lagern? Denn dieser Indianerin, die sich als »Wunder der Menschheit« produzieren sollte, auch in geistiger Hinsicht, schienen doch nicht nur solche mathematische und andere Kunstkniffe eingetrichtert worden zu sein, sie musste auch sonst eine recht gute Bildung besitzen, was sich immer mehr offenbaren sollte.
Die brennende Lampe wurde wieder heraufgeholt, statt ihrer ein größerer Stein an das Ende gebunden, dieser ins Wasser gelassen, sehr schnell, um beobachten zu können, wann er Grund fand.
»Kaum vier Meter«, sagte Atalanta, als sie den nassen Teil der Leine mit den ausgestreckten Armen abgemessen hatte. »Nun eine lange Leiter.«
Eine solche aber war nicht vorhanden, die Frau bezweifelte auch, in einem anderen Hause eine auftreiben zu können, und solch eine Nachfrage wünschte auch Atalanta nicht erst.
In die Stubendecke war ein starker Haken eingeschraubt, an diesem befestigte sie die Waschleine, hing sich daran, prüfte so in verschiedenen Teilen die Länge, welche sie brauchte, verbesserte einige Knoten, welche nachgeben wollten. Dann nahm sie die Leine wieder ab, schlang das eine Ende um den starken Spatenstiel, legte diesen quer über das Loch und ließ sich in den Brunnenschacht hinab.
»Zieht die Leine hinauf und bindet einen kleinen Korb oder so etwas Ähnliches daran«, erklang es nach einer halben Minute aus der finsteren Tiefe herauf.
Ein solcher Korb war vorhanden, und dass das Geflecht mehrere Löcher hatte, war für diesen Zweck vielleicht gerade recht gut. Er verschwand in der Tiefe.
»Zieht den Korb hinauf!«, erklang es eine Minute später wieder.
Der triefende Korb war halb mit gelbem Sand gefüllt, aber wie ward der alten Irländerin zumute, als sie zwischen dem Sande auch viele Goldstücke funkeln sah, gemünzte Goldstücke. Schon vorhin bei der Arbeit hatte sie wiederholt von Whisky und Butter phantasiert, denn was kann sich sonst ein irisches Herz wünschen, als Whisky und Butter, die zusammen den beliebten Buttergrog ergeben.
»Den Korb wieder herab!«
Noch zweimal schaufelte ihn die Taucherin am Boden des Brunnens mit den Händen voll Sand und Gold, dann kletterte sie an der dünnen Waschleine wieder hinauf, was ihr nicht jeder Turner nachgemacht hätte.
»Es liegt noch mehr Gold unten, das muss gründlich untersucht werden.«
Die Alte hatte den nassen Inhalt der drei Körbe auf den Tisch geschüttet. Er musste getrennt werden, wie man Linsen liest, und zwar war es bedeutend mehr Sand als Gold, in dem letzten Korbe waren nur noch wenige Goldstücke enthalten gewesen. Im Ganzen zählte man dann etwa sechsundachtzig Stück, welche nach der Größe zu beurteilen einen Goldwert von etwa zweitausend Mark repräsentierten.
Es waren spanische sogenannte Pistolen (von Piastola = Plättchen), etwas größer aber dünner als unsere Zwanzigmarkstücke, einige sehr verbogen. Die jüngste Prägung zeigte die Jahreszahl 1504, die meisten trugen das Bildnis der Königin Isabella, es waren aber auch noch viel, viel ältere Münzen darunter, selbst noch unter arabischen Herrschern in der spanischen Maurenzeit geprägt.
Nur deshalb, um dies zu konstatieren, nahm die Indianerin der Alten ein Goldstück nach dem anderen aus den Fingern, das vorhergehende ihr aber immer gleich zurückgebend.
Dann erhob sie sich von ihrem Stuhle, nahm aus der Handtasche Mokassins und Gamaschen, zog diese an, schnallte wieder ihren Waffengürtel um ihr Ledergewand — das Samtkostüm hatte sie ja ausgezogen, sie brauchte es nun auch nicht mehr und ließ es deshalb mit all dem andern Tand hier zurück. Sich zum Gehen wendend, sagte sie noch zu der Alten:
»Wie gesagt, es müssen auf dem Boden noch mehr solche Dinger liegen. So sehr viel freilich sind's nicht mehr. Wechselt das Geld nicht einfach ein, geht erst zu einem Antiquitätenhändler oder wer sonst etwas von alten Münzen versteht. Da dürftet Ihr bedeutend mehr dafür bekommen, es steckt vielleicht ein großer Wert drin.«
Jetzt blickte die Alte aber doch verwundert auf. Dann teilte sie das Gold schnell in zwei Teile, und zwar war es der größere, den sie der Indianerin hinschob.
Denn ehrlich sind die Irländer, grundehrlich, das muss man ihnen lassen. Sie sind noch viel mehr als ehrlich, sie sind — in ihrer Naivität beschränkt, möchte man fast sagen. Immerhin, es war auch hübsch, dass die Alte gar nicht auf den Gedanken kam, die Taucherin hätte sich vielleicht schon im finsteren Brunnen die Taschen mit dem Löwenanteil vollstopfen können.
Doch Atalanta wollte von einer Teilung nichts wissen.
Zuletzt aber nahm sie wenigstens zwei Stücke an, das mit der jüngsten und das mit der ältesten Jahreszahl der Prägung, dann verließ sie die Hütte wieder als das einfache Indianermädchen, das sie vor ihrer Neuequipierung in dem großen Friscoer Warenhaus gewesen. Ihr war zumute, als sei eine große Last von ihr genommen.
Es sei hier gleich das Weitere über diesen Schatz erzählt. Drei Tage später waren die alte Frau und ihr Mann tot. Er ertrank im Brunnen, sie im Buttergrog. Sie hatten die Münzen bei einem Winkelbankier richtig zum Goldwerte verkauft und 500 Dollars dafür erhalten, wozu dann noch einige Münzen mehr kamen, die ihnen also immer als einfache Goldstücke eingewechselt wurden.
Nach dem Tode der Eltern machte sich die einzige Tochter mit der Hälfte dieses Geldes, das ihr glücklicherweise noch geblieben war, sofort auf nach Irland, die beiden Kinder mitnehmend, wovon eines das ihrige war, entweder dieses oder jenes, das andere jedenfalls ihre Schwester.
Der Winkelbankier sollte sich seiner billigen Beute aber nicht lange erfreuen. Die Baugesellschaft, der alle diese Häuser gehörten, bekam schnell Wind davon, beanspruchte den Münzfund als ihr Eigentum, machte jenem den Prozess und gewann ihn. Und die Gesellschaft bekam für dieselben Münzen den mehr als hundertfachen Goldwert bezahlt. Es waren ganz besondere Raritäten darunter.
Doch kehren wir nun wieder zu Atalanta zurück.
Diese hatte sich noch nicht weit von dem Hause der Irländerin entfernt, als sie eine silberne Büchse, so groß wie eine mittelmäßige Schnupftabaksdose, aus der Tasche zog, die sie vorher noch nicht darin gehabt. Die hatte sie erst in dem Brunnenschachte eingesteckt und der Alten nichts davon gesagt.
Sollte unsere Heldin aber wirklich solch einen habgierigen, hinterlistigen Charakter haben?
Wir können diese Indianerin nicht murmeln und nicht flüstern lassen, was sonst so beliebt ist, um Gedanken für den Leser hörbar zu machen, wir können sie wirklich nur denken lassen.
»Mit diesem ganzen Funde mag ich nichts zu tun haben, und wenn es Perlen und Diamanten gewesen wären. Ich kalkuliere, die jetzigen Besitzer werden alles sofort verkaufen, obwohl ich sehr bezweifele, dass sie hierzu das Recht haben. Hierüber sie zu belehren, bin ich nicht verpflichtet, bin überhaupt gar nicht imstande dazu, ich kann mich auch irren. In dieser Silberdose scheint aber etwas anderes zu sein. Man hat sie zugelötet, um sie wasserdicht zu machen. Deren Inhalt will ich doch erst einmal selbst untersuchen. Ist etwas Wertvolles darin, so liefere ich es natürlich dem aus, dem es rechtmäßig gehört und zukommt!«
So dachte sie. Und ehrlicher hätte sie wohl nicht denken können — und auch nicht klüger.
Jetzt also betrachtete sie die silberne Dose. Diese war stark verbeult, zeigte aber auf dem Deckel eine deutliche Gravierung, die ganze Fläche einnehmend. Links ging über einem Berge die strahlende Sonne auf oder unter, rechts stand ein Mann im langen Gewand, offenbar ein Pilger, hatte einen langen Stab in der Hand, streckte beide Arme sehnsüchtig nach der Sonne aus, von der er, oder von dem Berge, durch eine gut markierte Kluft getrennt war. Nichts weiter.
Der Deckel war also zugelötet; wenn man die Dose schüttelte, war nichts zu hören, was Atalanta schon im Brunnen probiert hatte, und gerade das hatte ihr die Überzeugung gegeben, dass da etwas ganz Besonderes drin sein müsse.
»Wegen Edelsteinen hätte die Dose nicht verlötet zu werden brauchen, ich vermute etwas Schriftliches darin«, sagte sie sich.
Als sie nun in eine Gegend kam, wo ab und zu wieder ein Mietwagen auftauchte, rief sie den ersten an und ließ sich nach Hotel »Alhambra« fahren. Und als sie hier ausstieg, waren ihre ausgewrungenen und in einen Knoten geschlungenen Haare schon wieder getrocknet.
Trotz des strapazierten Lederkostüms ward die Atalanta Ramoni in dem Hotel wie eine Fürstin empfangen.
Ihr Kommen war von dem Zirkusdirektor bereits avisiert worden, sie konnte unter einigen Zimmern wählen, und mit Scharfblick, der hierbei durch keine Bescheidenheit getrübt wurde, hatte sie alsbald das beste herausgefunden.
»Haben Sie die englische Enzyklopädie?«, war ihre erste Frage an den Zimmerkellner.
Es ist dies ein englisches Konversationslexikon, das ausführlichste, welches existiert, umfasst dreihundert kolossale Bände, die sich durch Nachträge fortwährend vermehren und schon zu einer ganzen Bibliothek angeschwollen sind.
»O gewiss. Im Lesesalon.«
»Gut. Dann bringen Sie mir mal — —«
Der Kellner retirierte etwas zurück, weil diese ganz waschechte Indianerin ihr langes Skalpiermesser zog und prüfend dessen Spitze betrachtete und befühlte.
»— — einen scharfen Meißel oder ein ähnliches Instrument, mit dem man Metall schaben und brechen kann.«
Das hatte der Kellner ja nun nicht erwartet, er hatte doch geglaubt, sie wolle einen Band des Lexikons haben, aber dieser Auftrag war ihm doch lieber, als dass ihm die Indianerin seinen Skalp abgezogen, wo er sowieso nur noch wenige Haare darauf hatte.
Der Meißel wurde gebracht, und Atalanta begann an der Dose zu schaben, bis sie die Silberlötung abgeschabt hatte und den Deckel öffnen konnte.
Richtig, in der Dose befand sich ein ganz dünnes, zusammengefaltetes Pergament, also eine dünngeschabte und besonders präparierte Tierhaut, wohl zu unterscheiden von Pergamentpapier, einer neueren Erfindung, bedeckt mit schwarz geschriebenen Buchstaben, ein ziemlich umfangreiches Schreiben.
Es war, wie jeder in so etwas einigermaßen Bewanderte gleich beurteilen kann, Spanisch. Atalanta konnte kein Spanisch. Und wenn sie des Spanischen mächtig gewesen, hätte sie es dennoch nicht verstanden, nicht lesen können. Dieses Schreiben war, wie darunter stand, im Jahre 1533 abgefasst worden.
Über dieses Manuskript gebeugt saß sie eine halbe Stunde mit indianischer Unbeweglichkeit, und wie sie dann ihre Stellung veränderte, nicht mehr auf das Pergament blickend, starrte sie eine ganze Stunde lang auf ein und denselben Punkt des Teppichs, so völlig unbeweglich, wie es Arno oftmals beobachtet hatte, wenn sie am Lagerfeuer für sich selbst Schach gespielt, oder eben wie ein Indianer, der äußerliche und innerliche Unbeweglichkeit für die höchste Tugend des wahren Mannes hält und es in dieser Kunst gar weit bringt.
Dann endlich erwachte sie aus diesem seltsamen Zustande, sie drehte das elektrische Licht an, denn es war unterdessen finster geworden, und klingelte dem Kellner.
»Besorgen Sie mir eine Bibel.«
Da hatte der Kellner in dem angloamerikanischen Hotel nicht weit zu laufen. Eigentlich gehört die Bibel sogar mit zum Zimmerinventar des Hotels. Sie wurde ihr gebracht.
»Halt!«, rief sie, ehe sich der Kellner wieder entfernt und sie flüchtig darin geblättert hatte. »Ich wollte die Apokryphen haben, die fehlen hier.«
Auch solch eine vollständige Bibel wurde ihr gebracht.
»Wissen Sie hier in San Francisco einen Mann, einen Gelehrten, der altes Spanisch versteht?«
»Die Hälfte von Frisco spricht spanisch, ich kann's auch, wenn Sie etwas wissen wollen.«
»Nein. Es muss ein Gelehrter sein. Schriftspanisch aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts. Wer kann das hier wohl übersetzen?«
»Nun, das kann man leicht erfahren.«
»Wo erfahren?«
».Bei einer Zeitungsredaktion. Die weiß alles.«
»So, die weiß alles, dann fragen Sie dort an. Geschriebenes Spanisch aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts. Verstanden?«
»Sehr wohl, Miss, ich werde sofort anfragen.«
Der Kellner entfernte sich etwas unwirsch. Diese rote Artistin, diese junge Indianerin hatte doch eine Art und Weise, mit einem Menschen umzuspringen, die man ihr so beim ersten Anblick gar nicht zugetraut hätte.
Atalanta schlug das zweite Buch der Makkabäer auf und studierte darin.
Dann musste sie sich doch einmal Bewegung verschaffen, sie begann im Zimmer auf und ab zu gehen. Oder wurde sie vielleicht von einer derartigen Erregung ergriffen, der auch ihr indianischer Gleichmut unterlag?
»Himmel, wenn sich das bewahrheitet, was dieser Rabbi Eleazar da berichtet oder behauptet oder vermutet — Himmel, was für eine Aufregung würde das unter allen Juden der Erde geben! Das könnte das Volk Israels noch einmal zu einer neuen politischen Nation erstehen lassen!«, sprach sie vor sich hin.
Weiß der geneigte Leser, was das zweite Buch der Makkabäer für ein Geheimnis enthält? Wer es zu lösen versteht, dem geben gern alle jüdischen Geldfürsten die Hälfte ihrer Schätze.
Der Kellner kam wieder.
»Levi Cohen, Privatgelehrter, vereidigter Dolmetscher beim Gerichtshof, Prince Square, General Building!«, las er von einem Zettelchen ab.
»Ich danke Ihnen. Haben jetzt noch die Geschäfte auf?«
»Nein, die schließen alle um acht Uhr. Aber dieser Gelehrte ist ein Privatmann — —«
»Ich weiß es, ich danke Ihnen.«
Atalanta begab sich ins Lesezimmer, benutzte verschiedene Bände der Enzyklopädie, bis sie in den Zirkus musste, kam nachts um zwei zurück, ging wieder ins Bibliothekzimmer, das immer geöffnet war, und las weiter, bis die Morgensonne durch die Fenster schien.
Dann schlief sie einige Stunden, frühstückte und verließ das Hotel, um einige Einkäufe zu machen. Was sie einkaufte, wollen wir noch nicht verraten. Es waren nur billige Kleinigkeiten.
Ins Hotel zurückgekehrt, hielt sie sich noch zwei Stunden in ihrem Zimmer auf. Als der Kellner dieses betrat, um zu melden, dass ihr Automobil, das sie unterdessen durch ihr eigenes Zimmertelefon bestellt hatte, vorgefahren sei, wunderte er sich, was die Indianerin da mache. Sie führte mitten im Zimmer einen Freudentanz auf, trampelte und stampfte mit den Füßen, sprang manchmal hoch in die Höhe und fing wieder zu stampfen an, immer auf ein und demselben Flecke, und die Anwesenheit des Kellners genierte sie gar nicht.
»Eben eine Indianerin, noch eine heidnische, so hält die ihre Morgenandacht«, sagte sich dieser, das erzählte er seinen Kollegen und Kolleginnen, die, obgleich in Amerika, von den Sitten und Gebräuchen der Indianer gerade so viel oder wenig wissen wie wir in Europa.
Atalanta begab sich inzwischen hinaus zu ihrem Automobil.
»Prince Square, General Building«, sagte Atalanta beim Einsteigen und der Kraftwagen sauste davon, dem Judenviertel zu. Dort angekommen hielt der Chauffeur vor einem sogenannten Wolkenkratzer, der die ihm angegebene Nummer trug.
Der befragte Hausmeister schlug in der Liste nach, ein ansehnliches Buch. Ja, Mister Levi Cohen, Privatgelehrter und vereidigter Gerichtsdolmetscher für Hebräisch und Armenisch, achte Etage, Zimmer Nummer 172.
»Nicht auch für Altspanisch?«
»Davon steht hier nichts.«
»Ist der Herr zu Hause?«
»Das weiß ich nicht.«
Einen Aufzug gab es nicht. Atalanta erstieg die acht oder vielmehr sechzehn Treppen, auf denen es wie in einem Ameisenhaufen hin und her ging.
Die achte Etage war erreicht, noch nicht unter dem Dache gelegen, wenn es auch kein so ungeheurer »Wolkenkratzer« war, die Zimmertür Nummer 172 gefunden. Atalanta klopfte an.
»Herein!«, ertönte es von drinnen.
Gelbes Lampenlicht schien ihr entgegen. Denn das Fenster war mit einem schwarzen Lappen verhangen. Schon das machte auf die Eintretende, die aus dem sonnigen Sommermorgen kam, einen eigentümlichen Eindruck. Dann auch das ganze Zimmer. Alle Wände mit Büchern bedeckt, alt und zerrissen, wenn sie nicht in Schweinsleder gebunden waren, liederlich durcheinander stehend, auch am Boden waren überall solche Folianten ausgestapelt.
An dem Schreibtisch, gebildet aus einer auf Sägeböcken liegenden Holzplatte, saß ein Mann im schmierigen Kaftan mit schwarzem Käppi. Wie alt oder wie jung, das konnte nach diesem blassen, bartlosen Gesicht niemand beurteilen. Der gehörte nicht dieser Welt an. Entweder wusste er nicht, dass draußen schon längst die Sonne schien, oder er arbeitete immer auch am Tage beim Scheine einer Lampe, gespeist mit dem billigsten, übelriechenden Petroleum. Er übersetzte einen russischen Geschäftsbrief ins Englische, das vor ihm liegende Wörterbuch aber behandelte die assyrische und chaldäische Sprache. Neben ihm auf einem Foliantenstoß stand ein schmutziger, zerbrochener Teller mit einem Stück Brot und einem Klecks Pflaumenmus, und viel mehr und anderes schien dieser jüdische Gelehrte wohl auch nicht zu essen, das sah hier alles danach aus.
»Womit kann ich dienen?«, fragte er, nur halb den Kopf wendend, mit müder Stimme, und müde blickten auch die von vielem Lampenlicht blöde gewordenen Augen.
Mit einem Blicke hatte die junge Indianerin das ganze Milieu erfasst, dann studierte sie das Gesicht des Mannes und sie brauchte etwas lange Zeit dazu.
»Sie wünschen, Miss? Ich bin stark beschäftigt!«, wiederholte der Gelehrte nochmals.
»Ich möchte etwas übersetzt haben.«
»Was?«
»Können Sie Spanisch?«
»Aus welchem Jahrhundert?«
»Aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts.«
»Ja. Haben Sie es mit? Bitte, wollen Sie Platz nehmen. Einen Stuhl kann ich Ihnen nicht anbieten.«
Er war jetzt bedeutend höflicher, freundlicher geworden, denn er nahm den Teller von dem Bücherstoß und machte eine einladende Handbewegung, darauf Platz zu nehmen.
Während die Indianerin im Sitzen ihr Jagdhemd aufknöpfte, um daraus jenes Pergament zu ziehen, fiel ihr Blick auf eine Stelle der Wand, die sie vorhin nicht hatte sehen können.
Über dem Schreibtisch hing an der Wand ein altes, verräuchertes Holztäfelchen, auf das in englischer Sprache die Worte eingebrannt waren:
»Du sollst keine Geschenke annehmen.«
Es ist ein Spruch aus dem Talmud. »Weil«, wird unnötiger Weise noch erläuternd hinzugesetzt, »Du dadurch zum Geber in ein abhängiges, Dich demütigendes Verhältnis kommst.«
Eine sehr billige Weisheit. Anderseits wieder eine der höchsten Weisheiten. Wer hiernach aus innerster Überzeugung handelt, wird natürlich auch nicht in der Lotterie spielen, wird sogar auf jede Erbschaft als auf etwas Unverdientes verzichten. Baruch Spinoza hat das fertig gebracht. Der verzichtete auf die Erbschaft seines Vaters, eines reichen Bankiers, schliff in seiner Dachkammer optische Gläser, dafür täglich fünfzig Pfennige verdienend und damit auskommend, weil er, wie er sagte, ein freier Mann bleiben wollte. Ein freier Mann! Wer kann das von sich sagen?
Und über diesem Spruche hing denn auch der Kopf dieses holländischen Philosophen, ein alter Kupferstich.
Für den, der das alles begriff, gab das viel zu denken. Dieser blasse, verhungert aussehende jüdische Gelehrte hätte wahrscheinlich nicht hier oben in der achten Etage zu hausen brauchen, sich von Brot und Pflaumenmus nährend, aber — er nahm keine Geschenke an.
Als nun Atalanta das auseinandergefaltete Pergament dem Gelehrten darreichte, da hatte sie nur noch Augen für sein Gesicht.
Und da sah sie, wie im nächsten Moment dieses Gesicht staunend aufblitzte. Und zwar musste es allein die Unterschrift gewesen sein, der Name »Rabbi Eleazar«, wohin er zuerst geblickt, der dieses grenzenlose Staunen erzeugt hatte.
Ja, grenzenlos war es gewesen. Aber doch wohl nur für das Auge dieser Indianerin erkenntlich. So unmerklich war es im Grunde genommen gewesen. Und dann war in diesem verhungerten Gesicht das Leben wieder völlig erloschen. Aber die Indianerin hatte doch schon genug gesehen.
»Wie kommen Sie zu dieser Schrift?«, fragte er ganz ruhig, Atalanta anblickend, in deren Zügen er nun freilich auch nicht das Geringste merkte.
»Ich habe sie gefunden.« — »Wo?«
»Das bleibt mein Geheimnis!«, war die offene Erklärung.
Der Gelehrte warf ihr einen Blick zu, dann untersuchte er das Pergament, hielt es gegen das Licht, als hinge es von der Beschaffenheit desselben ab, ob er dies übersetzen könne oder nicht.
»Ja, das stammt aus dem Ausgange des 16. Jahrhunderts!«, sagte er dann. »Können Sie es nicht übersetzen?«
»Dann würde ich doch nicht erst zu Ihnen kommen.«
»Haben Sie dieses Pergament schon einem anderen gezeigt?«
»Nein, keinem einzigen. Aber warum stellen Sie solche Fragen?«
»Wissen Sie, was in dieser Schrift gesagt wird?«
»Herr, ich sagte Ihnen doch, dass ich kein Spanisch kann, sonst brauchte ich doch nicht zu Ihnen zu kommen!«, wurde oder stellte sich jetzt das junge Mädchen ungeduldig. »Erklären Sie mir also kurz und bündig, ob Sie meinem Wunsche willfahren wollen oder können?«
»Ja, das kann ich übersetzen.«
»Bitte.«
»Ich bedarf einiger Zeit dazu.«
»Weshalb?«
»Nun, weil die Übersetzung eben nicht so einfach ist, ich muss im Wörterbuch nachschlagen, es kommen auch genug mir ganz fremde Wörter vor. So gut ich auch sonst das Altspanische kann.«
Er log! Doch wohl nur der Blick dieser Indianerin vermochte das zu erkennen, wie sein Auge dabei etwas flackerte, wie seine blasse Gesichtsfarbe sich ein wenig rötete. Ein anderer hätte hiervon nichts bemerkt.
»Aber um was es sich handelt, das können Sie doch schon herauslesen.«
»So ungefähr.«
»Nun?«
»Wo der unterschriebene Rabbi Eleazar in dieser Gegend hier seine Berichte verborgen hat.«
»Haben Sie von diesem Rabbi Eleazar schon gehört?«
»Ja.«
»Ein berühmter Mann?«
»Ja. Er hat Fernando Cortez auf seinem mexikanischen Eroberungszuge begleitet.«
Der jüdische Gelehrte wollte offenbar von der Indianerin herauslocken, was sie sonst noch von diesem Manne wisse, aber diese ging nicht darauf ein.
»Ich weiß es. Bis wann können Sie die Übersetzung anfertigen?«
»Bis heute Nachmittag um vier, eher ist es mir nicht möglich.«
»Da kann ich nicht kommen. Erst morgen früh wieder um diese Zeit.«
»Die Übersetzung wird bereit liegen. Holen Sie sie selbst ab?«
»Ich selbst. Dieses Dokument scheint ein großes Geheimnis zu enthalten.«
»Das kann sein.«
»Es muss demnach aber auch einen großen Wert besitzen!«
»Sicherlich.«
»Inwiefern?«
»Nun, die hinterlassenen Berichte dieses spanischen Rabbis, der als erster Europäer von Süden her bis nach Kalifornien vorgedrungen ist, dürften, wenn sie wirklich gefunden werden, den höchsten Wert besitzen. Die Museen und wissenschaftlichen Institute werden sich gegenseitig überbieten.«
»Das glaube ich auch. Dieses Geheimnis gehört mir — dieses Dokument ist mein ausschließliches Eigentum!«
»Nun ja. Was wollen Sie damit sagen?«
»Dass Sie diese Schrift nicht etwa anderen Leuten geben oder auch nur zeigen.«
»Ausgeschlossen. Ich verstehe überhaupt Ihre Sorge. Und sie ist gerechtfertigt. Nur bei mir nicht. Ich bin gerichtlich vereidigter Dolmetscher und Übersetzer. Genügt Ihnen diese Erklärung? Soll ich Ihnen mein Zertifikat zeigen?«
»Es ist nicht nötig, Ihre Erklärung genügt mir.«
Atalanta erhob sich, blieb aber noch stehen.
»Was kostet die Übersetzung?«
»Davon können wir ja morgen sprechen.«
»Es wäre mir lieb, den Preis gleich jetzt zu erfahren.«
»Nach Belieben.«
»Haben Sie denn keinen festen Honorarsatz für so etwas?«
»Nein. Ich arbeite überhaupt nicht gegen Geld. Nach Belieben.«
Atalanta hatte bereits ein Fünfdollarstück in der Hand gehabt, legte es jetzt auf den Tisch und sagte:
»Bitte, nehmen Sie einstweilen dies hier!«
Der Jude brachte unter dem Tische einen Holzkasten zum Vorschein, mit Bindfaden umschnürt und versiegelt, oben mit einem Schlitz versehen, in diesen steckte er das Goldstück.
»Danke!«, sagte er trocken.
»Sie müssen verzeihen, wenn meine Neugierde rege wird.«
».Bitte sehr.«
»Dieses Geld ist wohl für einen wohltätigen Zweck bestimmt?«
»Woraus schießen Sie das?«
»Ich vermute es.«
»So ist es auch. Für die jüdische Armenkasse.«
»Sie begnügen sich mit dem Gehalte, das Sie als gerichtlicher Dolmetscher beziehen?«, fragte Atalanta immer dreister.
»Das überweise ich gleichfalls unserer Armenkasse.«
»Sie sind vermögend?«, konnte die Neugierige nun auch noch fragen.
»Ich habe gar nichts!«
»Ja, wovon leben Sie denn da, wenn Sie alles weggeben?«
»Eben von der Unterstützung dieser Armenkasse.«
»Der Sie alles, was Sie verdienen, zuweisen?« — »So ist es.«
Die Indianerin schüttelte leicht den Kopf, hob die Schultern, wünschte guten Morgen und ging.
Kaum hatte sie die Tür hinter sich geschlossen, als der Jude sich jäh erhob und ihr auf unhörbaren Sohlen nacheilte, aber nur, um an der Tür den Riegel vorzuschieben. Und dann, wie er sich auf die Knie niederwarf, strahlten sein abgezehrtes Antlitz und die sonst so blöden Augen in flammender Begeisterung.
»Gott meiner Väter, Jehova, der Du einst der starke Schirmherr der Kinder Israels gewesen bist — —«
Das Gebet ging in hebräische Sprache über.
In der Montgommery Street, der vornehmsten Straße San Franciscos, erhob sich der Palast von Siegfried Herzl, des größten Importeurs von Tee, Kaffee und Zucker für Nordamerika.
Dieser Herzl, nur dem Namen nach ein Deutscher, dessen jährliches Einkommen sich auf Millionen belief, war ein großer Philantrop, ein Menschenfreund, unterstützte und stiftete aber nur im Stillen, hören tat man nicht viel davon.
Siegfried Herzl war der Vorsitzende des Zionsbundes für Amerika. Dieser internationale jüdische Bund mag schon immer bestanden haben, im Jahre 1870 trat er zum ersten Male an die Öffentlichkeit. Man glaubt mehr als man weiß, dass er eine Ansiedlung aller zerstreut lebenden Juden in ihrer ursprünglichen Heimat, in Palästina, erstrebt. Dort sollen alle Juden wieder zur Nation vereinigt werden, das alte Zion in neuer Pracht und Herrlichkeit erstehen.
So sagt man. So mögen auch die ärmeren, ungebildeten Juden glauben und hoffen. Die an der Spitze dieser Bewegung stehenden Führer, die mächtigsten Geldfürsten, sind wohl zu klug, um daran zu glauben, dass so etwas so schnell ginge. Eine politische Nation zu schaffen, das ist denn doch etwas anderes, das lässt sich nicht mit Geld machen. Aber das Bestehen des Bundes ist Tatsache. Die Zionisten sind die jüdischen Freimaurer, die sich nicht in ihre Karten blicken lassen, ihre jährlichen Kongresse jedenfalls nur deshalb öffentlich abhalten, um über ihr Treiben und ihre Absichten falsche Nachrichten in den Zeitungen zu verbreiten. Ihr Hauptsitz ist London, wo sie eine eigene Bank haben unter dem Namen »Jewish Colonial Trust«, mit einem eingezahlten Kapital von zwei Millionen Pfund Sterling, das aber gar nicht arbeitet, nicht verzinst wird.
Mister Herzl hatte in einem Zimmer, dessen prachtvolle Einrichtung diesem ganzen Marmorpalaste entsprechend war, eine Unterredung mit dem Oberrabbiner von San Francisco gehabt und entließ ihn soeben.
Es musste etwas Besonderes vorgefallen sein. Der kleine, unansehnliche und doch so große Kaufmann war höchst ungnädig gelaunt, und der majestätische, sonst so stolze Oberrabbiner war die Zerknirschung selbst.
Nach diesem trat der halbverhungerte Sprachgelehrte Levi Cohen ein, der schon gemeldet worden war, in einen schäbigen Bratenrock gekleidet, und da geschah das Wunder, dass sich der eben noch so herrisch auftretende Kaufmann gegen diesen armseligen, unbekannten Privatgelehrten in die unterwürfigste Demut selbst verwandelte.
»Levi Cohen! Was ist die Veranlassung, dass die Leuchte der Wissenschaft mein Haus zu betreten würdigt?«
Auf der Straße hatte sich der Gelehrte sicher beherrscht, da war ihm nichts von Erregung anzumerken gewesen. Hier aber durfte er sich gehen lassen, und wieder brach die Begeisterung bei ihm durch, als er, zum Himmel emporblickend, beide Arme ausstreckte, und in der einen Hand hielt der vereidigte Dolmetscher und Übersetzer das ihm anvertraute Pergament.
»Das Ziel taucht auf! Jehova will sein Volk, das er im Zorne von sich gestoßen, gnädig wieder unter seine Fittiche nehmen! Die Schuld ist gesühnt — das Allerheiligste ist wiedergefunden!«

Mit einer Gewandtheit und Sicherheit ohnegleichen schwang
sich Atalanta auf den Rücken der wildesten Pferde, die nach
wenigen Augenblicken unter der kraftvollen Hand der
In-
dianerin sich lammfromm in allen Gangarten reiten ließen.
Fahren Sie mich nach der Evan'schen Motorenfabrik Ocean View«, sagte Atalanta zum Chauffeur, als sie wieder in ihr Automobil stieg. Es ging südlich in die einzige Ebene hinein, welche sich in der Umgebung von San Francisco befindet. Sonst ist dort ja auch alles Wasser, es liegt auf einer Landzunge.
In dem Büro der einsam gelegenen Fabrik wurde Atalanta mit entsprechender Hochachtung empfangen, wie sie dem Wesen gebührt, das in solch einem Luxusautomobil vorfährt, und die Hochachtung wuchs, als sich die in Leder gehüllte Indianerin als die in allen Zeitungen besprochene rote Athletin zu erkennen gab.
»Sie verfertigen doch auch Flugmaschinen.«
»Jawohl!«
Seit etwa einem Jahre hatte sich die Motorenfabrik zeitgemäß auch auf den Bau von Flugmaschinen gelegt. Sie fertigte Eindecker, System Evan, eigenes Patent, äußerst leicht und stabil, konkurrenzlos besonders dadurch, dass die Maschine in lauter kleine einzelne Teile zerlegt, also bequem transportiert und ebenso schnell wieder montiert werden kann.
Natürlich war es überhaupt die beste Flugmaschine der Welt, und ebenso »natürlich« wurde der Kauflustigen verschwiegen, dass sich mit diesem Dinge innerhalb des Jahres schon ein viertel Dutzend Flieger das Genick und ein halbes Dutzend verschiedene andere Gliedmaßen gebrochen hatten, Nasenbeine und ähnliche Kleinigkeiten nicht mitgerechnet.
»Sind Sie schon geflogen?«, wurde Atalanta von dem Beamten der Fabrik, mit dem sie unterhandelte, jetzt gefragt.
»Nein. Noch nie.«
»Sie wünschen es zu lernen?«
»Ja.«
»Da kann ich Ihnen unseren Eindecker aufs Wärmste empfehlen.«
»Was kostet so einer?«
»Das ist verschieden. Ein vierzigpferdiger, der einen Passagier mitnimmt, fünftausend Dollars. Bitte, wollen Sie die Apparate besichtigen.«
Sie wurde in eine Halle geführt, in der einige Flugmaschinen fertig standen.
»Ich möchte es sofort lernen!«, sagte Atalanta.
Auch diesem Wunsche konnte sofort entsprochen werden. Ein Aeroplan wurde auf das Übungsgelände gefahren, das an das Meer grenzte. Dieses war sogar das Hauptgebiet. Dieser wässerige Untergrund kostete nichts und tat beim Aufschlagen nicht so weh.
Ein Monteur, ein professioneller Flieger, speziell auf dieser Maschine, erklärte der Kauflustigen erst das Technische, dann setzte er sich in den Sattel, zeigte ihr die zur Bedienung des Motors, der Steuervorrichtung, der Ölspritze — als er aber nun fliegen sollte, da verzichtete der edle Mann auf diese Ehre zu Gunsten eines guten Freundes.
Der gute Freund kam, stieg in den Sattel und drehte den Motor an. Der machte eine Viertelstunde lang einen Höllenspektakel, ohne dass irgend etwas von Fliegerei zu bemerken war, bis sich der Drachen endlich besann und wenigstens etwas zu laufen anfing, hin und wieder einen Hops wie ein Riesenfrosch machte.
Weiter aber ging es nicht. Andere Apparate wurden vorgefahren, aber kein einziger Drachen wollte fliegen.
Nun hatte es aber auch Atalanta gesehen, wie man es macht — oder nicht macht. Ihr scharfes Auge hatte die dazu nötigen Handgriffe abgelauscht. Also jetzt setzte sie sich in den Sattel und stellte den Motor an.
Die Indianerin brachte den Apparat sofort ins Rollen, dann sah man, wie sie, erst zusammengeduckt, plötzlich den Oberkörper zurückwarf, und augenblicklich stieg die Maschine empor. Im nächsten Augenblick glaubte man den Apparat sich überschlagen zu sehen, so steil ging es empor, aber sofort hatte Atalanta ihn wieder in der Gewalt und flog weiter und weiter, beschrieb über dem Meere elegante Kurven, ging wohl hundert Meter hoch, bis sie nach zehn Minuten auf derselben Stelle, von der sie aufgestiegen, glatt wieder landete.
Die Zuschauer waren erst sprachlos vor Staunen gewesen. Hier gab es nur eine Erklärung.
»Sie sind schon zur Fliegerin ausgebildet!«
»Nein. Es ist überhaupt die erste Flugmaschine, die ich richtig in der Nähe sehe.«
Der mit Atalanta verhandelnde Geschäftsleiter der Fabrik machte ein recht ungläubiges Gesicht. Doch jetzt kam für ihn erst etwas anderes in Betracht.
»Also Sie sind mit dem Apparat doch zufrieden.«
»Was kostet er?«
»Fünftausend Dollars.«
»Das ist mir zu viel. Es gibt viel billigere. Ich werde mir doch erst andere Systeme ansehen.«
»Einen Augenblick.«
Der Geschäftsführer entfernte sich. Unter den leitenden Männern war bereits eine Beratung abgehalten worden, man hatte telefonisch schon erfahren, dass Zirkus Lanhazzy für die rote Athletin eine ungeheure Reklame vorbereitete, und dabei wurde nicht vergessen, dass mit den verschiedenen Eisenbahngesellschaften schon Extrazüge vereinbart worden waren.
Der betreffende Geschäftsführer kam zurück.
»Sie werden mit dem Flugapparat öffentlich auftreten?«
Atalanta bejahte, obgleich sie nicht das meinte, was jener annahm. Doch durfte sie bejahen, denn mit Luftschiffen und Flugmaschinen kann man sich noch nicht in geschlossenen Gesellschaftszimmern produzieren.
»Wir stellen Ihnen den Apparat kostenlos zur Verfügung.«
»Was heißt zur Verfügung stellen? Gehört er mir?«
»Ja. Wenn Sie uns erlauben, mit Ihrem Namen jede Reklame machen zu dürfen.«
Atalanta unterzeichnete den schriftlich gemachten Vertrag und war Besitzerin der Flugmaschine, mit der sie den ganzen Tag auf dem Gelände übte, bis sie am Abend zur zweiten und letzten Probe musste.
Am andern Morgen um zehn Uhr klopfte sie in der achten Etage des General Building wieder an der Tür des jüdischen Gelehrten, aber sie klopfte vergebens.
»Mister Cohen ist gestern Abend mit all seinen Büchern, die einen ganzen Möbelwagen füllten, ausgezogen!«, sagte eine Nachbarin.
»Wohin ist er gezogen?«
»Das weiß ich nicht. Es war schon sehr spät, mitten in der Nacht.«
Atalanta begab sich zum Hausmeister, der ihr nur dasselbe sagen konnte.
Der vereidigte Übersetzer, der keine Geschenke annahm, um sich nicht zu demütigen, der sogar alles, was er verdiente, der Armenkasse überwies, war mit ihrem Pergamente durchgebrannt. Er war ein edler Raubritter von altem Schrot und Korn, nur in moderner Aufmachung.
Es machte auf die Indianerin nicht den geringsten Eindruck. Sie gab sich auch gar keine Mühe, zu erforschen, wo diese Leuchte der Wissenschaft mit dem Möbelwagen geblieben sei, tat keinen einzigen Schritt deswegen. Ja, es war gewesen, als habe sie zufrieden genickt.
Und, das wollen wir gleich verraten, sie konnte auch zufrieden sein. Denn diejenigen, welche glaubten, diese junge Indianerin sei ein naives Mädchen, dem man das geheimnisvolle Dokument so einfach entwenden könne — mochte sie dann nur zur Polizei laufen — die befanden sich in einem gewaltigen Irrtume, und das Hohngelächter dieser Indianerin sollte ihnen dereinst schrecklich in den Ohren gellen.
Nein, Atalanta ging nicht erst zur Polizei, sie kümmerte sich um den Mann und um ihr verschwundenes Pergament gar nicht mehr, fuhr sofort zur Sternwarte hinauf, brachte schon ihren eigenen Sextanten und ihre eigenen Handbücher mit.
Der japanische Astronom stellte sich ihr sofort zur Verfügung, sagte, er habe sie gestern Nacht und den ganzen Tag vergebens erwartet.
Die Übungen wurden wieder vorgenommen.
»Nun habe ich noch eine andere astronomische Frage«, sagte dann Atalanta in einer Pause. »Der Schatten jenes Berggipfels dort fällt jetzt, zehn Minuten nach elf, auf einen bestimmten Punkt. Ist dieser Schatten, den wir ganz scharf begrenzt annehmen wollen, in jedem Jahre an demselben Tage zu derselben Minute auf demselben Punkte?«
»Selbstverständlich. Allerdings ist eine kleine Abweichung vorhanden, indem die wahre Umlaufzeit der Erde um die Sonne 365 Tage 6 Stunden, 9 Minuten und 9,35 Sekunden beträgt, was man alle vier Jahre durch den Schalttag ausgleicht.«
»Ist diese Abweichung bedeutend?«
»Handelt es sich um eine wissenschaftlich-astronomische Bestimmung bis auf Bruchteile von Sekunden?«
»Nur um eine geografische Ortsbestimmung, die in ganzen Minuten angegeben ist.«
»Dann ist diese Abweichung gar nicht auszumessen.«
»Wenn man nun die Schattengrenze an einem Tage für eine bestimmte Zeit kennt, kann man dann den Schatten auch für jede andere Zeit berechnen, wohin er fallen wird, so lange die Sonne scheint?«
»Ich verstehe, was Sie meinen. Sagen wir: Am 1. Juli nachmittags um vier fällt der Schatten jener Bergspitze da und da hin. Wo liegt die Schattengrenze mit demselben Punkte am 13. September morgens um acht. Meinen Sie das?«
»Das meine ich.«
»Das nennt man eine Schattentransmutation. Gewiss, das ist für uns Astronomen eine ganz einfache Rechnung.«
»Ja, für Sie als Astronom. Kann ich das erlernen?«
»Mit Ihren Vorkenntnissen, ja.«
»Wollen Sie es mich lehren?«
»Herzlich gern. Das will ich Ihnen in wenigen Stunden beigebracht haben!«
Der Unterricht wurde sofort begonnen und täglich fortgesetzt, dabei auch noch geografische Ortsbestimmungen gemacht, die geniale Schülerin auch schon in die Lavoir'sche chronometrische Methode eingeweiht.
Dazwischen übte sie auf dem Flugplatze, gerade bei böigstem Winde, ohne einmal ein Malheur zu haben, und abends produzierte sie sich im Zirkus.
Gleich nach der ersten Vorstellung, schon nach der ersten Probe, hatte ihr der Zirkusdirektor eine ganz andere Gage geboten, die doppelte, das vierfache und noch einen großen Teil der Kasseneinnahme, wenn sie den Kontrakt mit ihm verlängern wolle.
Aber die Indianerin war durch nichts dazu zu bewegen. Ja, sie war bereit, auch Vor- und Nachmittagsvorstellungen zu geben, das war ihr sogar sehr, sehr lieb — aber bei dem dreimaligen Auftreten blieb sie. Es war ihr eben nur darauf angekommen, einige tausend Dollars zu verdienen, und dann wieder fort von hier! Und hätte sie auch am Tage auftreten können, so hätte sie eben San Francisco nur umso eher wieder verlassen können.
Da aber zog der Direktor doch lieber Abendvorstellungen vor, sie brachten doch bessere Kassenerfolge.
Der letzte Abend kam.
Am Nachmittage war sie noch einmal auf der Sternwarte, nahm Unterricht wie sonst, und erst dann, als sie ihre Instrumente zusammenpackte, erfuhr ihr Lehrer, dass dies das letzte Mal gewesen sei, dass sie nun nicht wiederkommen würde.
Der Japaner war äußerst betroffen, wurde plötzlich ganz niedergeschlagen. Aber er war eben ein Japaner, dessen Charakter dem des nordamerikanischen Indianers in gewisser Beziehung ähnelt, der von kleinauf zur strengsten Selbstbeherrschung erzogen wird.
»Wo gehen Sie denn hin?!«
»Ich habe etwas vor.«
Bei solch einer Antwort durfte der Sohn des östlichen Inselreiches auch nicht weiter fragen. Andere Fragen konnte er ja noch stellen.
»Aber Sie kommen doch wieder!«
»Schwerlich. Ich habe hier in San Francisco nichts mehr zu suchen.«
»So werden wir uns niemals wiedersehen?«
»Doch.«
»Ja? Wann? Wo?«
»Das weiß ich nicht.«
Ihr großes, träumerisches Auge verfolgte die am Himmel ziehenden Wolken, als sie noch hinzusetzte:
»Ich weiß nur, dass wir uns noch einmal wiedersehen werden. Fragen Sie mich nicht, woher ich das weiß. Leben Sie wohl, ich danke Ihnen.«
Und sie nahm ihre Handtasche, welche die Instrumente und Bücher barg, und schritt der Station der Zahnradbahn zu, ohne sich noch einmal umzublicken.
Sie war feinfühlig genug gewesen, nicht erst zu fragen, ob sie für den Unterricht etwas zu zahlen habe. Aber sie hatte ihren Lehrer auch niemals eingeladen, einer ihrer Vorstellungen beizuwohnen, hatte gar nicht vom Zirkus und ihrer Artistik gesprochen, kein einziges Wort, und dieser Japaner war nun auch so ein sonderbarer Kauz, so heiter und lebhaft er sonst auch sein mochte.
Die Zahnradbahn kam aus der Station heraus, Atalanta saß am Fenster, sie hatte noch einmal einen freien Blick auf das Plateau, das wusste sie, sie wusste, dass dort der Japaner noch stand, aber sie wendete nicht den Kopf.
In der an diesem Tage stattfindenden letzten Vorstellung im Zirkus produzierte sich die rote Athletin zum ersten Male als Cowgirl, als weiblicher Cowboy.
Schon an den vorhergehenden Tagen waren in den hier in Betracht kommenden Zeitungen große Aufforderungen erschienen, die Farmer und Viehzüchter der Gegend sollten unzähmbare Pferde für heute Abend nach den Zirkus bringen, unheilbare Bocker und Wälzer und besonders sogenannte Menschenfresser, welche den Zureiter immer in die Beine zu beißen versuchen, ihm auch schon vorher gleich direkt zu Leibe gehen, was man ihnen wohl durch mit Stacheln besetzte Gamaschen und mehr noch mit glühenden Eisen austreiben kann, aber ein so behandeltes Tier ist dann nichts mehr wert.
Man hatte solche Pferde genug gebracht, mit eisernen Beißkörben und die Beine so zusammengekoppelt, dass sie kaum laufen konnten — in wirklichen Käfigen waren sie angefahren worden, prachtvolle Tiere darunter, aber für den Besitzer ganz wertlos.
Auch die Manege war in einen großen Käfig verwandelt worden. Von der Decke konnte für Raubtiervorführungen ein eisernes Gitter herabgelassen werden.
In diesen Käfig wurden die unbändigen Tiere getrieben, eines nach dem anderen, und eines nach dem anderen wurde von der jungen Indianerin mit dem Lasso gefangen, an den Füßen mit weiten Schlingen gefesselt, niedergeworfen, gesattelt und gezäumt und — zugeritten.
Der vorführende Zirkusdirektor zählte mit der Uhr in der Hand die Minuten laut, alles kontrollierte mit, und wenn die Reiterin »all right!«, rief, galt die Dressur für beendet, sie musste das Pferd in Schritt und Galopp vorreiten und es verschiedene Evolutionen ausführen lassen.
Es lässt sich dies leichter sagen als es in Wirklichkeit war. Langweilig wurde die Sache jedenfalls nicht. Jeder Dressurakt war anders als der vorhergehende, jeder brachte ganz neue Szenen, und zwar fürchterliche Szenen, dass sich auch dem kaltblütigsten Yankee und dem blutlüsternsten Spanier, durch Stierkämpfe verwöhnt, manchmal das Haar auf dem Kopfe sträubte und manche elegante Dame, die sonst nicht genug Nervenkitzel bekommen konnte, ohnmächtig aus dem Zirkus hinausgebracht werden musste.
Wie die junge Indianerin das wilde Ross einfing und niederwarf, mit einer Schnelligkeit, dass man gar nicht sah, wie sie schon die Schlingen angebracht hatte, wie sie das furchtbar um sich beißende Tier zäumte, wie sie ihm mit der Hand ins Maul fuhr und ihm die Zunge weit herauszog, wie das Tier, die Reiterin schon auf dem Rücken, aufsprang und sich sofort überschlug und wälzte und wieder aufsprang, aber schon wieder die Reiterin auf dem Rücken habend, und sich immer wieder rückwärts überschlug, wie sie es mit der Peitsche bearbeitete, wie sie ihm dann die Augen verkappte und es immer mit dem Kopfe gegen eine eiserne Wand bremsen ließ — es war fürchterlich. Und es waren nur Tiere, an denen die besten Cowboys bisher ihre Kunst umsonst probiert hatten.
Dann nach einer Pause kamen akrobatische Gaukeleien daran, besonders auf einer freistehenden Leiter ausgeführt, gleichzeitig verbunden mit Taschenspielerkunststückchen, worin diese Indianerin ebenfalls Fabelhaftes leistete und ganz neue Tricks vorführte.
Hierzu brauchte sie manchmal kleine Gegenstände, Taschentücher und dergleichen, die sie sich aus dem Publikum selbst holte, wohl darum bittend, sonst aber dabei keine Worte weiter machend. Natürlich kamen da hauptsächlich die vorderen Parkettreihen in Betracht.
In San Francisco ist das spanische Element stark vertreten. Besonders die spanischen Damen waren an der Spintella erkenntlich, an der Maske, die sie alle vor dem Gesicht trugen.
Das öffentliche Tragen von Masken und Larven ist ja auch im sonst so freien Amerika nicht erlaubt, aber das Verbot lässt sich umgehen. Der Schleier ist doch erlaubt, und der wird einfach oben nur für die Augen ganz dünn gehalten, unten ist das Gewebe sehr dicht und die Maske ist fertig.
Dass die Spanierinnen der besseren und reichen Klassen außerhalb des Hauses ihr Gesicht verhüllen, das mag noch aus der Maurenzeit stammen, als Spanien unter arabischer Herrschaft stand, wo es gefordert wurde, dass auch die christlichen Weiber das Gesicht nicht offen zeigten. Es gibt hierfür auch noch eine andere Erklärung, und die dürfte wohl die richtigste sein. Der Spanier ist außerordentlich eifersüchtig, wozu er ja auch allen Grund haben mag. In Spanien und im spanischen Amerika, das heißt in einer spanischen Gesellschaft, gibt es an der Tafel keine bunte Reihe. Der Gatte sitzt neben seiner Frau, der Bräutigam neben seiner Verlobten, oder eben überhaupt der Herr neben seiner Dame, und diese sitzt wieder neben der Dame des benachbarten Herrn. Also immer zwei Herren und zwei Damen zusammen. Daran erkennt man sofort die Gesellschaft, in der es spanisch zugeht.
Manche englische Amerikanerin mochte ja ebenfalls den maskierenden Schleier tragen, dann aber war sie sicher alt oder hässlich oder beides zugleich, während sich unter der echten spanischen Spintella manch wunderbares Antlitz von Milch und Blut verbergen mochte.
Wieder schritt Atalanta die Reihen entlang.
»Bitte, wollen Sie mir ein Taschentuch — —«
Es war, als ob sie stutzte, wenigstens stockte ihr Fuß plötzlich, sie hatte den Satz nicht beendet.
Sie ging zwei Schritte zurück, wandte sich an eine Spanierin, pompös und vor allen Dingen farbenprächtig wie alle ihresgleichen gekleidet, die hier in den vordersten Logen saßen.
»Bitte, wollen Sie mir Ihr Taschentuch geben — und einen ihrer Handschuhe, bitte.«
Der zweite Wunsch war erst nachträglich gekommen.
Es sah fast aus, als ob die Dame diesem Wunsche gar nicht gern nachkäme, als ob sie hoffe, eine andere gebe das Verlangte.

Und ihre Nachbarin, ob zu ihr gehörend oder nicht, beeilte sich denn auch, aus einem winzigen Handtäschchen ein Spitzentuch zu nehmen und auch den Handschuh abzustreifen.
Das Taschentuch nahm die Indianerin, nicht aber den Handschuh, da beharrte sie bei der anderen Dame mit indianischem Gleichmut.
»Darf ich um Ihren Handschuh bitten?«
Was sollte die Dame machen? Es war ja gerade kein Zwang vorhanden, aber — sie streifte den linken Glacéhandschuh ab, nach der Mode nur wenig über das Gelenk gehend. An den feinen, schlanken Fingern trug sie einige prachtvolle Brillanten und Rubine.
Hierfür interessierte sich die Taschenspielerin nicht, nicht etwa, dass sie auffallend die Hand betrachtet hätte, sie stülpte den Handschuh sofort um, zeigte, dass er leer war, und ging zurück, den Handschuh immer in die Höhe haltend, kletterte diesmal ohne Benutzung der Hände eine freistehende Stange empor, die oben mit einer Stahlspitze versehen war, deren Schärfe sie schon vorher bewiesen hatte, legte sich oben mit dem Leibe auf diese Spitze, drehte sich langsam darauf und begann dabei aus dem Handschuh die verschiedensten Gegenstände zu ziehen, die weder der Größe nach und noch viel weniger nach der Menge in einen großen Sack gegangen wären.
Das war ja gerade kein neuer Taschenspielertrick, hier staunte besonders das Zirkuspersonal darüber. Das wusste nämlich ebenfalls nicht, wo sie das alles her hatte und bei sich versteckt getragen hatte.
Für das Publikum war ja die Hauptsache die akrobatische Leistung, wie sich das Mädchen auf der scharfen Stahlspitze der freistehenden Lanze drehte, schneller und schneller, bis sie, die Füße hintenüber bis auf die Schultern gelegt, wie ein Kreisel herumwirbelte. Und jetzt stach sie sich die Spitze auch noch in den Leib, das heißt, diese kam oben wieder zum Vorschein. Natürlich war das nur optische Täuschung. Sie wirbelte um die Stange herum, ließ sich herab und schraubte sich wieder empor, und es sah genau so aus, als ob die Lanze durch ihren Leib ginge — ein Kunststück, das man in Indien überall auf den Straßen von den Gauklern zu sehen bekommt. Dort blickt gar niemand mehr hin. Wie sie's machen, das weiß man nicht.
Wieder sauste sie herab, sich scheinbar die Lanze durch den Leib drehend, schleuderte sie ohne Benutzung der Hände hoch empor, bis zur Decke des Zirkus, wohl nur durch eine schnellende Bewegung des Leibes, ließ sich im Herabsturz von der Spitze eine Schleife vom Kopfe reißen und brachte dann Taschentuch und Handschuh zurück.
Den tobenden Applaus hatte sie verdient, und immer staunenswertere Exerzitien führte sie aus, welche auch die New Yorker damals nicht von ihr gesehen hatten, bis wieder eine Pause eintrat.
»Schnell Stallmeister!«, wandte sich Atalanta, hinter einem Vorhang stehend, sofort an einen solchen, der in ihrer Nähe stand. »Wer ist die Dame, die mir vorhin den Handschuh gab?«
»Bedaure, das habe ich nicht beobachtet.«
»Dort, die Dame in dem schwarzen Atlaskleid mit dem weißen Einsatz und den gelben Ärmeln, mit dem roten Hute — da, jetzt steht sie auf.«
»Jawohl, ich sehe sie schon.«
»Wer ist die Dame?«
»Ja, wenn ich das wüsste!«
»Ich muss es wissen!«
»Ja, wie soll man das erfahren. Wie soll man das der anriechen können. Das ist eine verschleierte Spanierin, die jeden Tag ihre Toilette wechselt, und ein Pfau gleicht doch — dem anderen.«
»Ich muss es wissen, wer diese Dame ist, wo sie wohnt«, wiederholte Atalanta mit noch einem Zusatz. »Herr Stallmeister, ich habe Sie für einen intelligenten Mann gehalten — —«
»Ah, Sie appellieren an meine Intelligenz? Ich werde sofort Ihre Wissbegierde befriedigen.« Er wandte sich zum Gehen.
»Aber unauffällig!«
Hiermit noch nicht genug, gab die Indianerin auch dem Clown, der ihr als bester Werfer und Fänger manchmal bei ihren Produktionen behilflich war, der sich aber jetzt wieder als Gentleman kostümiert hatte, denselben Auftrag: wer die Dame dort, welche den Zirkus verlassen wollte, aber noch im Gedränge stand, sei und wo sie wohne.
Auch der Clown, auf dessen diskrete Geschicklichkeit sie sich ebenfalls verlassen konnte, entfernte sich eiligst.
Das Klingelzeichen hatte das Ende der Pause noch nicht gemeldet, als zuerst der Stallmeister wiederkam.
»Hätte sie nicht ihr Automobil hier gehabt und sie nicht mit ihrem Chauffeur gesprochen, hätte ich's doch nicht so leicht erfahren können. Man kann die doch nicht gleich nach Namen und Wohnung fragen.«
»Nun, wer ist es?«
»Das ist die Doña Inez Rafaela, ein steinreiches Weib, ledig oder verheiratet oder verwitwet, das weiß ich freilich nicht, obgleich sie sonst hier in Frisco sehr bekannt ist. Eben eine Weltdame.«
»Und wo wohnt sie?«
»Auf Westcliff bei Cemetery.«
»Wo ist das?«
»Die dritte Station von hier, das heißt mit der Vorortbahn, dieselbe, die Sie nach Ocean View benutzen. Dann kommt Colmac, dann Cemetery. Zwanzig Minute von hier. Nach Westcliff ist es von dort noch eine halbe Stunde zu Fuß. Eine herrliche Besitzung.«
Es klingelte, Atalanta musste in die Manege. Vorher noch kam der Clown und teilte ihr kürzer genau dasselbe mit.
Doña Rafaela aber hatte ihren Platz nicht wieder eingenommen, und auch ihre Nachbarin nicht, die also sicher zu ihr gehört hatte.
Atalanta kümmerte sich nicht weiter darum, sie absolvierte den letzten Teil ihres Programms, begab sich sofort nach Abwicklung desselben nach dem Bahnhofe, wo sie ihren auseinander genommenen und verpackten Flugapparat schon aufgegeben hatte, und fuhr mit dem nächsten Zuge nach Pittville zurück.
Der Präsident des New Yorker Athletikklubs hatte in einer Klubversammlung eine gewaltige Rede geschwungen, die in den Worten gipfelte:
»Die Menschheit hat sich von jeher undankbar bewiesen. Von jeher hat sie die größten Geister und die hehrsten Charaktere, deren Früchte sie schon bei ihren Lebzeiten genoss, verhungern lassen, um ihnen dann Denkmäler zu setzen. Auch wir Amerikaner haben oftmals nicht anders gehandelt. Jetzt aber ist Gelegenheit, zu beweisen, dass wir zu würdigen verstehen, was in der Welt groß und stark und schön und edel ist. Ein Mann, der lange Zeit in unserer Mitte geweilt hat, bei uns eine führende Rolle spielte, hat fern von seiner Heimat in amerikanischer Erde sein Grab gefunden. Seinen Tod konnten wir nicht hindern. Und er ist nicht zu beklagen, denn wen die Götter lieben, den lassen sie jung sterben; auch der hier in Rede Stehende ist dahingegangen in voller Jugendpracht. Aber an uns ist es, noch seine Gebeine zu ehren. Der Mann, über den ich nichts weiter zu sagen brauche, als dass wir ihm den höchsten Ehrentitel gaben, der im freien Amerika zu erlangen ist — Champion-Gentleman of New York — er ruht im fernen Pittville im Staate Colorado in einem einsamen, schmucklosen Grabe. Es ist eine Ehrensache für uns, diesem Champion-Gentleman eine würdige Ruhestätte zu geben.«
Das war der Kernpunkt der Rede gewesen, oder so ungefähr.
Sie fand ihren Widerhall in ganz New York, in ganz Nordamerika. Die Gebeine des Toten sollten exhumiert und nach New York übergeführt werden, und es schien eine nationale Feierlichkeit daraus werden zu wollen. So schnell ging das aber nicht. Da musste erst eine andere Grabstätte geschaffen werden, und nicht nur ein Erdloch.
In dem herrlichen Orange bei New York, wo auch Edison seine ganze Laboratoriumsstadt für sich hat, besaß der Athletikklub seinen eigenen Sportpark. Hier sollte dem löwenstarken Champion-Gentleman ein seiner würdiges Mausoleum errichtet werden. So schnell ging das nun freilich nicht, aber doch immer noch zauberhaft schnell, wie es nur im Lande des Dollars möglich ist. Am Abend wurde das Preisausschreiben veröffentlicht, und am anderen Morgen schon reichten hundert Bildhauer und Architekten ihre Entwürfe ein.
In allen Entwürfen spielte bei der Ausschmückung der Löwe, der nun einmal das Sinnbild der Kraft und des Edelmutes ist, die größte Rolle, und der die meisten und größten Löwen hatte und dessen Ausführung am meisten kostete, der wurde angenommen, und der Künstler erhielt einen Preis, von dessen Zinsen er recht behaglich hätte leben können.
Dann ging es sofort an die Ausführung! Marmorblöcke wurden herbeigeschafft und in Tag- und Nachtschichten wurde an der Fertigstellung des Monuments gearbeitet. Unterdessen wurde schon zur Fahrt nach Pittville gerüstet.
Endlich war es so weit. Von allen Seiten liefen in dem kleinen Pittville die Extrazüge ein, und jeder Pacificzug brachte neue Scharen.
Die Exhumierung begann. In erster Reihe umringten das Grab natürlich die Mitglieder des Athletikklubs, dann kamen die Staatenrepräsentanten, die Senatoren, die Bürgermeister der größeren Städte und die anderen in weiten Reihen. Von den Tribünen brach glücklicher Weise keine zusammen.
Die allerersten Mitglieder des Athletikklubs schaufelten selbst im Schweiße ihres Angesichts das Grab auf. Alle die vielen Reden sollten erst geredet werden, wenn der Sarg ans Tageslicht befordert worden war. Das gebot der schnarrende Kinematograf, der heute überhaupt den Gang solch einer Feierlichkeit bestimmt. So waren denn alle Beteiligten bestrebt, möglichst imposante Stellungen einzunehmen und noch imposantere Bewegungen zu machen, um sich dann selbst später im Kino bewundern zu können. Als der Brettersarg schon zum Vorschein kam, trat eine Störung ein. Eine junge Dame in einem Wettermantel und mit kleinem Hütchen bekleidet, durchbrach die gezogenen Schranken; sie ließ sich von der Bürgerpolizei nicht aufhalten; dies geschah auch nicht, sobald sie ihren Namen genannt hatte, und es gab genug, die auch ihr Gesicht wieder erkannten.
»Atalanta, die rote Athletin!«
So wurde auch in den ersten Reihen geflüstert, zwischen die sie sich drängte, ganz vorn am Grabe sich aufstellend.
Man kannte ihr Verhältnis zu dem Toten, hatte gewusst, dass sie zuletzt in San Francisco aufgetreten war, und der Athletikklub hatte nicht etwa vergessen, ihr eine Einladungskarte zu schicken.
Wir haben das gar nicht erwähnt, weil auch die Indianerin diese Einladung so gleichgültig gelesen und weggelegt oder weggeworfen hatte, als ginge sie das gar nichts an.
»Atalanta, die rote Athletin, das ist sie!«
Schade, dass sie erst jetzt kam. Die hätte anders gestellt, ganz anders kostümiert werden müssen, mit der hätte man noch etwas Besonderes gemacht. Aber der Kinematograf schnarrte schon, und es ließ sich nicht einmal mehr machen, dass sie ihm wenigstens das Gesicht zukehrte.
Der Sarg kam also unten in der Erde zum Vorschein. Man musste darauf gefasst sein, dass die Geruchsnerven sehr beleidigt würden. Doch deshalb standen schon Ärzte mit ihren Gehilfen bereit, den Sarg sofort mit einem desinfizierten und stark parfümierten Wachstuch zu umhüllen. Erst aber musste er herausgeholt werden.
Als es so weit war, sprang ein Mann in das Grab und schlang um die Bretterkiste zwei Seile. Die befrackten Athleten zogen an, brachten den Sarg in die Höhe und schwangen ihn heraus. Die Ärzte wollten ihn schnell mit der Decke verhüllen, kamen aber nicht dazu.
Der Kinematograf schnarrte, noch lauter aber begann es plötzlich in dem Sarge zu schnarren, und dann plötzlich verwandelte sich das Schnarren in eine quäkende Menschenstimme.
»Ich bin ein künstlicher Mensch und heiße David.«
Das war etwas gedämpft, aber doch ganz deutlich und quäkend in dem Sarge gesagt worden, darüber herrschte gar kein Zweifel, und die Folge davon war, dass die vier befrackten Athleten, deren Stärke überhaupt mehr im Geldsack als in den Muskeln saß, den Sarg sofort fallen ließen, nicht in das Grab zurück, sondern schon daneben auf den Boden, doch auch diese Höhe konnte der morsche Bretterkasten nicht vertragen, er löste sich aus den Fugen, und zum Vorschein kam ein Herr im altholländischen Kostüm mit Kniehosen und Schnallenschuhen, der mit dem seligen Grafen Arno von Felsmark nicht die geringste Ähnlichkeit hatte.
Er lag auf dem Rücken, starrte mit den gläsernen Augen in die Sonne und nun wirkte der aufgezogene und durch die Erschütterung ausgelöste Mechanismus zum zweiten Male, aber durch den Sturz war etwas in Unordnung gekommen, jetzt fing der Kerl auch zu stottern an.
»I—i—i—i—ich bi—bi—bin ein künstlicher Mensch und heiße Da—da—da—da— vid.«
Das Weitere wollen wir nicht zu schildern versuchen. Jedenfalls kam der exhumierte Tote nicht in das New Yorker Löwenmausoleum hinein. Und die Zeitungen hatten wieder etwas zu erzählen und über Rätsel zu grübeln.
Konnte die Indianerin nicht gleich Auskunft geben?
Nein, die war bereits verschwunden.
Es war für Arno ein schreckliches Erwachen aus dem ersten Schlafe, den er auf dem Diwan in seinem komfortablen Gefängnis gehalten hatte.
Als er die Augen aufschlug, sah er durch die offen gebliebene Tür auf der umgitterten Veranda die Morgensonne liegen, er wollte, ohne erst einen Blick nach dem Nachbarraum zu werfen, mit gleichen Füßen aufspringen — und konnte nicht.
Wieder waren seine Beine völlig gelähmt, er fühlte gar nichts von ihnen.
»Atalanta!«, stöhnte er. »Miss Morgan!«, verbesserte er sich.
Vor ihrem Bett war jetzt von der Decke herab ein Vorhang herabgelassen.
»Sie wünschen, Herr Graf?«, erklang es hinter diesem sofort.
»Ich bin wieder gelähmt!«
»Doch nicht wieder an den Füßen gelähmt?!«, erklang es jetzt erstaunt.
Über diese Sache war gestern ja gar nicht gesprochen worden, die beiden hatten etwas anderes zu besprechen gehabt.
Bald kam die Amerikanerin zum Vorschein, sie hatte hinter dem Vorhang etwas Toilette gemacht, wenigstens die Haare geordnet, und trug wieder das Negligé. Dass sie nur für das Aufstehen den Vorhang benutzte, das war begreiflich. Oder es wäre kein kluges Weib gewesen.
»Gelähmt sind Sie wieder?!«
Sie wollte es erst gar nicht recht glauben. In Pittville war ja alles so schnell gegangen, sie hatte nur gehört, dass der Herr im Hotel während eines Jagdausfluges von einer Krankheit, die den Namen paralytisches Koma führte, befallen worden sei, unter Lähmungserscheinungen der unteren Extremitäten, aber das war so ziemlich alles. Weitere Erkundigungen hatte sie gar nicht einzuziehen gewagt, sie hatte auch ganz anderes zu tun gehabt. Und der Scheintote hatte ihr doch nichts erzählen können. Als er erwachte, da war er ja wieder ganz normal gewesen. Und das hatte sie alles so selbstverständlich gefunden, dass sie deswegen mit ihm gar nicht darüber gesprochen hatte.
Auf diese Weise erfuhr Arno erst jetzt, dass sie mit seiner Heilung, die er zuerst natürlich für eine vollständige, dauernde gehalten, also gar nichts zu tun gehabt.
»Was haben Sie denn mit mir gemacht?«
»Was ich mit Ihnen gemacht habe? Gar nichts!«
»Sie haben mich doch in Scheintod versetzt.«
»Das ja!«, erklang es mit grausiger Naivität zurück.
»Was war das für ein Mittel?«
»Das wird nicht verraten. Eine Lähmung aber erzeugt es jedenfalls nicht.«
»Und mit welchem Mittel haben Sie mich wieder ins Leben gerufen?«
»Mit gar keinem Mittel. Da habe ich geduldig warten müssen. Elf Tage lang.«
Dann war durch diesen langen, todesähnlichen Schlaf die paralytische Lähmung nur vorübergehend einmal aufgehoben worden. Im ersten natürlichen Schlafe war sie wieder gekommen, und sicher hätte sie auch ein längeres Wachen wieder gebracht.
Es war ja auch schon merkwürdig gewesen, dass Arno doch erst am späten Nachmittage aufgewacht und gleich nach Sonnenuntergang schon wieder eingeschlafen war.
»Sind Sie denn wirklich an beiden Beinen ständig gelähmt?«, wiederholte das Weib mit ungläubigem Zweifel.
Ja, wenn man diesen blühenden, kraftstrotzenden Mann ansah, mochte man es wirklich nicht recht glauben.
»Kommen Sie herein, überzeugen Sie sich, stechen Sie mich mit Nadeln.«
»Ich soll zu Ihnen hineinkommen?«
»Na ja, kommen Sie.«
»Wissen Sie, was Sie jetzt getan haben?«
»Was denn?«
»Sie rufen mich zu sich, Sie haben Ihre Wette verspielt.«
»Ach was, Unsinn! Treiben Sie in dieser meiner schrecklichen Situation keine Wortklaubereien.«
»Ich traue Ihnen nicht, Graf!«
»Inwiefern trauen Sie mir nicht?«
»Sie haben etwas gegen mich vor, wollen sich meiner Person bemächtigen, Sie erheucheln Ihre Lähmung, um mich sicher zu machen. Geben Sie mir Ihr Ehrenwort, dass Sie nicht tätlich gegen mich werden.«
Da brach bei dem Unglücklichen der Unmut hervor, und es war begreiflich.
»Ja denn«, rief er, die Arme nach ihr ausstreckend und die Fäuste ballend und wieder öffnend, »bei meinem Ehrenwort, sobald Du in meine Griffnähe kommst, so erwürge ich Dich, Teufelsweib!«
Sie kreuzte die Arme über der Brust und presste erst die Lippen zusammen, ehe sie spöttisch sagte:
»Auf diese Weise wird unsere Ehe eine wenig glückliche werden.«
»Ja, komme nur herein, Du — Metze!«
Sie grub die weißen Zähne in die Unterlippe.
»Wie nennen Sie mich?«
»Eine Metze! Denn schamlos wie eine solche haben Sie sich betragen. Ich schimpfe nie — aber bei Ihnen ist diese Bezeichnung angebracht.«
»Wenn Ihre Atalanta — —«
»Weib, nimm diesen Namen nicht in Deinen unsauberen Mund!«, fuhr Arno auf.
»So, also aus diesem Tone soll es jetzt gehen!«, entgegnete sie nach kurzer Überlegung. »Well, so werde ich Sie jetzt als wildes, gefährliches Raubtier betrachten, das aber doch auch zu zähmen geht, man muss nur die nötige Geduld dazu haben, und je mehr Mühe es mir macht, desto mehr Freude werde ich dann daran haben.«
Mit diesen Worten verließ sie den Raum.
Wenn dieser Mann an Selbstmord gedacht hätte, um dieser mehr seelischen als körperlichen Qual ein schnelles Ende zu bereiten, so hätte er ihn jetzt begangen, jetzt, im Augenblicke seiner tiefsten Verzweiflung. Die Schnur seines Schlafrockes hätte genügt, er hätte deshalb gar nicht aufzustehen brauchen.
Aber an Selbstmord dachte er nicht. Nur der Gedanke zuckte ihm einmal durchs Hirn, alle Nahrung zu verweigern, doch auch dieser Gedanke wurde im Momente des Entstehens gleich wieder verworfen.
Wenn Bildung wirklich frei macht, so wird dies in solchen Situationen bewiesen, wenn die Verzweiflung den Menschen überwältigen will, wenn der Wille zum Leben auf ein Minimum zusammengeschrumpft ist. Das heißt: die wahre Bildung. Mit vielem Wissen hat die ja gar nichts zu tun.
Arno hätte an viele Beispiele denken können, um sich zu ermutigen, an alle diejenigen, welche unschuldig im Zuchthaus sitzen, und wie viele mögen ihrer sein. —
Im Augenblicke dachte er aber nur an Polarforscher, die sich mit erfrorenen Gliedmaßen durch die Eiswüsten schleppen. Warum machen die denn nicht durch einen Schuss ihren namenlosen Qualen ein Ende? Warum schleppen die sich weiter, solange sie sich noch schleppen können? Etwa weil sie sich vor dem Tode fürchten? Weil sie das Leben noch zu sehr lieben? Lächerlich! Eben weil es männliche Charaktere sind, Helden, die so etwas wie Selbstmord verachten, die sich vor sich selbst schämen, wenn ihnen einmal solch ein Gedanke auftaucht.
Nein, gelähmte Beine sind der Übel größtes nicht.
»Ich will leben und jede Gelegenheit, die sich mir bietet, meine Freiheit und den vollen Gebrauch meiner Gliedmaßen wieder zu erreichen, benutzen!«, sagte sich Arno, und damit hatte er seine Gemütsruhe wieder. Ja, indem er aus dem kurzen, aber furchtbaren Kampfe siegreich hervorgegangen war, überkam ihn sogar eine Heiterkeit. Höchstens ärgerte er sich selbst, dass er jenes Weib vorhin so behandelt hatte. Schließlich aber schadete es gar nichts, ihr einmal die Wahrheit gesagt zu haben.
Bald kam sie wieder.
»Kann man schon ein Frühstück bekommen?«
Miss Morgan wunderte sich sehr über diese erste Frage und überhaupt über seine Verwandlung.
»Sie scheinen sich in Ihr Schicksal gefunden zu haben.«
»Habe ich.«
»Das freut mich.«
»Mich freute es mehr, wenn ich bald mein Frühstück bekäme.«
»Es ist bereits bestellt und wird sofort kommen.«
Das ihm schon bekannte Klingelzeichen ertönte.
»So, es steht in Ihrer Servierecke. Bedienen müssen Sie sich selbst. Wir frühstücken wohl draußen zusammen auf der Veranda.«
Sie selbst nahm aus ihrer Aufzugsnische ein Servierbrett, trug es hinaus, blieb aber dabei immer in ihrer abgegrenzten eigenen Abteilung.
»Nun, wollen Sie sich nicht bedienen?«, fragte sie, als sie weiter hereintrat. »Es ist ein so herrlicher Morgen.«
»Wollen Sie meiner spotten oder haben Sie ein so kurzes Gedächtnis? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass meine Lähmung wiedergekehrt ist und dass ich nicht aufstehen kann!«
»Sprechen Sie die Wahrheit, Herr Graf?«
Sie wollte es immer noch nicht glauben. Es war einfach Furcht, die sie so misstrauisch machte.
»Sie eignen sich schlecht zur Raubtierbändigerin.«
»Geben Sie mir Ihr Ehrenwort, dass Sie wirklich gelähmt sind, und ich selbst werde Sie bedienen.«
»Das tue ich nicht, wegen so etwas gibt kein Ehrenmann sein Ehrenwort. Das ist Frevel. Schicken Sie jemand anders, der mich bedient. Wenn mir das Frühstück nicht gebracht wird, dann kann ich's eben nicht bekommen. Ich vermag mich nicht zu erheben. Was dann daraus werden soll, weiß ich nicht. Ich brauche einen kräftigen Mann, der mich manchmal hebt.«
Unschlüssig blickte Miss Morgan nach dem Liegenden, dann sprach sie leise ins Telefon. Bald trat in ihre Abteilung ein Mann — Renald, der Jäger, jetzt ganz manierlich aussehend, das heißt, anständig gekleidet.
Er bekam Anweisungen, mochte solche auch schon vorher erhalten haben, denn er ging gleich auf die Veranda, Arno hörte — sehen konnte er es von hier aus nicht — wie draußen das Gitter rasselte, dann trat der Mann auf dieser Seite in Arnos abgeschlossenes Gemach.
So vorsichtig war das Weib. Auch hier befand sich ja eine Gittertür, aber sie war in des Gefangenen Nähe, er hätte sie mit einem Sprunge erreichen können, deshalb hatte der Mann diesen Umweg machen müssen.
Nach kurzem Zögern und vorsichtigem Umherspähen trat der Jäger, der ja wirklich ein unverzagtes Herz besitzen mochte und hauptsächlich für Geld alles tat, vollends heran, entnahm dem Mauerwinkel das Servierbrett mit dem Kaffee und Backwerk, sowie Butter, Honig und Fleisch, setzte es auf einen kleinen Tisch und diesen an das Schlafsofa.
Aufmerksam hatte Miss Morgan jenseits des Gitters dies alles beobachtet. Der Graf packte also den Man nicht, er erwürgte ihn nicht.
»Wünschen Sie sonst noch etwas von dem Diener?«
»Jetzt nicht. Übrigens ist er nicht kräftig genug, um mich aufzuheben.«
»Es wird Ihnen dann noch ein anderer zur Verfügung gestellt werden, ein Herkules. Dann wird auch ein Rollstuhl kommen. Nur diesmal müssen wir noch im Innenraum frühstücken.«
Der Mann nahm denselben Weg zurück und entfernte sich, Miss Morgan brachte ihr Frühstücksservice wieder herein und nahm ebenfalls an einem Tischchen Platz, aber natürlich jenseits des Gitters, auch noch armweit davon entfernt.
Arno musste ihre Gesellschaft wohl oder übel dulden, und so wollte er diese Gelegenheit gleich benutzen, um zu erfahren, was er erfahren konnte.
»Wo befinde ich mich hier?«
»In meinem Besitztum.«
»Hätten Sie gesagt: in meiner Gefangenschaft — so wäre es dasselbe gewesen. Sie wollen mir das nicht sagen?«
»Nein.«
»Auch nicht, ob dies das Meer oder ein Binnensee ist.«
»Hierüber verrate ich gar nichts.«
»Gut. Haben Sie diese Gittervorrichtung erst meinetwegen anfertigen lassen? Es interessiert mich.«
»Nein. Das war früher wirklich ein Raubtierzwinger, er ist dann nur für Sie schnell eingerichtet worden.«
Über diese Erklärung wunderte sich Arno nicht.
Es war wieder einmal Mode, dass sich die reichen Amerikanerinnen, die auf die phantastischsten Ideen kommen, um die Zeit totzuschlagen und noch mehr, um von sich sprechen zu machen, in ihren Wohnungen Raubtiere hielten, Löwen und Tiger und Panther, sich mit ihrer Dressur zu beschäftigen, die jungen Biester wie menschliche Babys herumzuhätscheln. Und die Hauptsache ist, sich mit solch grimmigen Raubtieren fotografieren zu lassen, als Venus auf einem Königstiger zu liegen, mit einer ganzen Löwenfamilie am Kaffeetisch zu sitzen, die Jungen auf dem Schoße habend — und dann so in die illustrierten Zeitungen zu kommen.
Aber diese Mode flaute schon wieder ab. Die Zeitungen nahmen solche Bilder schon nicht mehr an, das Angebot war gar zu groß, und damit verlor die Sache ihren Reiz.
In solch einen ehemaligen Raubtierkäfig war Arno gesteckt worden. Man hatte den Raum nur für einen Menschen wohnlich eingerichtet.
Miss Morgan hatte aus ihrer Mauernische Zeitungen genommen.
»Wünschen Sie Zeitungen zu lesen, Herr Graf?«
»Danke, bin jetzt nicht in der Stimmung«, entgegnete der Gefragte mit kauenden Backen. »Ich erlebe sensationelle Abenteuer, Skandalgeschichten und Romane überhaupt lieber selbst.«
»Sie lesen gar nicht?«
»O doch, ich habe lesen gelernt.«
»Es stehen Ihnen auch Bücher zur Verfügung.«
»Davon werde ich später Gebrauch machen.«
Miss Morgan blätterte in den Zeitungen und fing plötzlich zu lachen an.
»Herr Graf, Sie werden exhumiert.«
»In Pittville? Ich soll ausgegraben werden? Zeigen Sie her. Das interessiert mich. Das muss ich mir erst noch überlegen, ob ich dazu meine Erlaubnis gebe.«
Er nahm die Zeitung, las die Rede des Klubpräsidenten, die Vorbereitungen zu der Ausgrabefeierlichkeit, die Beschreibung seines Mausoleums und musste herzlich lachen.
»Das freut mich von diesen athletischen Brüdern! Und es ist doch wirklich hübsch, wenn man so sein eigenes Begräbnis liest, und wie man wieder ausgegraben und dann in einem Mausoleum beigesetzt wird. Noch lieber aber möchte ich selber dabei sein, hinter meinem Sarge herfahren. Ginge das nicht zu machen?«
»Na, die werden etwas erleben!«, lachte das Weib.
»Was denn? Einen leeren Sarg!«
»Nicht leer. Ich habe eine Puppe hineingelegt.«
»Eine Puppe? Was denn für eine Puppe? Habe ich denn Ähnlichkeit mit einer Kinderpuppe?«
»In Pittville war damals gerade Jahrmarkt, da habe ich eine Wachspuppe aus so einem Kabinett gekauft, oder vielmehr aus Holz, und zwar eine die spricht, einen sprechenden Automaten, als Holländer gekleidet. ›Ich bin ein künstlicher Mensch und heiße David‹, konnte er mit quäkender Stimme sagen. Na, wenn die jetzt den Sarg öffnen und die Puppe sehen! Und nun sollte es bloß noch fehlen, dass die Puppe zu sprechen anfinge. Ach, das wäre ja kostbar!«
So sehr dies alles den lebendig Begrabenen und Wiederauferstandenen auch interessieren musste, hatte er jetzt doch erst einen anderen Gedanken.
Wie mit stiller Verwunderung, als könne er etwas nicht begreifen, blickte er erst einige Zeit nach der Lesenden hinüber.
»Ja, Miss, fürchten Sie denn gar keine Folgen von alledem?«
»Was gibt es da für Folgen zu fürchten?«, erklang es gleichmütig zurück.
»Das wird doch entdeckt, dass ich nicht in dem Sarg liege.«
»Natürlich. Nun, und was ist da weiter dabei?«
»Wo bin ich denn geblieben. Es werden doch alle Hebel in Bewegung gesetzt, dieses Rätsel zu lösen.«
»Das wird geschehen.«
»Sie glauben nicht, dass es gelingt, alles an den Tag zu bringen?«
»O doch, das ist schon möglich.«
»Dann werden Sie doch bestraft. Schon dass Sie mich in Scheintod versetzt haben, mich wieder ausgruben, das ist Leichenschändung oder doch Kirchhoffrevel, und Gott weiß, was da alles noch hinzukommt.«
»Ehe man mich bestrafen kann, muss man mich haben.«
»Ist es denn unmöglich, Sie zu bekommen?«
»So leicht ist das nicht. Schon hier bin ich sehr sicher. Niemand ahnt, dass die Besitzerin dieses Hauses hier die Miss Morgan ist.«
»Sie halten sich hier unter einem anderen Namen auf?«
»Ja, hier bin ich wieder eine ganz andere Person. Das bin ich aber eigentlich auch noch nicht, das ist in Wirklichkeit meine Gesellschafterin. O, das ist alles so geschickt arrangiert — das kann ich Ihnen gar nicht schildern.«
»Sie waren selbst in Pittville?«
»Jawohl, ich habe Ihre wirkliche Ausgrabung persönlich geleitet, wenn auch hinter den Kulissen.«
»Wenn Sie aber nun doch einmal hier gefasst werden?«
»Entdeckt, meinen Sie wohl erst. Ja, das ist möglich. Da werde ich mich und Sie schon vorher in Sicherheit zu bringen wissen.«
»Mich?«
»Nun, Sie nehme ich natürlich mit. Und so geht die lustige Jagd immer weiter. Und wenn man mich doch endlich einmal gestellt hat? Na, was ist denn da weiter dabei? Ich werde vor Gericht schon fertig werden.«
Nun brauchte Arno gar nicht weiter zu fragen, nun wusste er genug.
Diesem Weibe war es zuletzt ganz lieb, wenn es doch noch einmal gefasst wurde. Darauf war ja alles abgesehen. Vorher aber ging eine lustige Jagd, wie sie sich selbst ausgedrückt hatte. Und wegen der Strafe ängstigte sie sich nicht. Diese Milliardärin kam höchstens bis in die komfortabelste Untersuchungszelle, weiter nicht. Das kennt man doch, wie das in Amerika gemacht wird. Und dann renommierte sie mit ihrer heißen Liebe zu dem Champion-Gentleman, was sie seinetwegen alles ertragen hatte, und das kam dann alles an die Öffentlichkeit, in die Zeitungen. Ach, würde das herrliche, sensationelle Gerichtsverhandlungen geben! Vielleicht auch vorher noch eine Flucht oder eine geheimnisvolle Entführung aus dem Untersuchungsgefängnis!
»Hm. Nun weiß ich alles. Dass freilich gerade ich der Spielball Ihrer Hysterie sein muss, das gefällt mir wenig!«, sagte Graf Felsmark resigniert.
»Hysterie? Sie halten mich für hysterisch?«
»O nein, Sie sind ganz normal!«, spottete er. »Na, wünschen Sie sich lieber nicht, dass Sie einmal meine Frau werden.«
»Das werde ich doch noch.«
»Dann gratulieren Sie sich.«
»O, Sie sollen schon noch sehen, wie ich Sie zähme.«
»Da bin ich gespannt darauf.«
»In diesem Käfig waren schon noch weit unbändigere Wesen als Sie.«
»Na, großen Mut als Raubtierbändigerin haben Sie bisher nicht gerade gezeigt.«
»Nur Geduld, nur Geduld Hier, das wird Sie ebenfalls interessieren.«
Sie reichte ihm ein anderes Zeitungsblatt.
In einem spaltenlangen Artikel wurde berichtet, wie die nun schon bekannte Atalanta, die rote Athletin, sich gegenwärtig in San Francisco aufhielte und demnächst im Zirkus Lanhazzy einige Vorstellungen gehen würde. Nebenbei treibe sie jetzt auf der Sternwarte astronomische Studien und übe auf einem Evan'schen Flugapparate.
Wenn all diese Neuigkeiten auf den Leser großen Eindruck machten, so war ihm davon doch nichts anzumerken.
»So. Also das Fliegen lernt sie. Das macht sie recht. Will wohl nach den Sternen fliegen, orientiert sich schon vorher.«
»Interessiert Sie das so wenig?«
»Im Gegenteil! Sie hören es doch, wie ich mich dafür interessiere!«
»Wenn die nun erfährt, dass Sie gar nicht unter dem Grabhügel liegen.«
»Das wird sie schon erfahren, früher oder später.«
»Was die wohl denken wird?«
»Das möchte ich auch wissen.«
»Na, Herr Graf, nun geben Sie einmal Ihre Reserve auf, sprechen Sie Ihre Meinung über den Fall offen aus.«
Arno hatte bereits die Geduld verloren.
»Miss Morgan, ich bin ein Narr, dass ich Sie warne — aber es treibt mich, es Ihnen zu sagen — hüten Sie sich vor dieser Indianerin! Sie dürfte noch schrecklich über Sie kommen!«
Diese Worte waren in halb warnendem, halb drohendem Tone gesprochen worden, machten aber auf die Amerikanerin nicht den geringsten Eindruck. Sie lachte verächtlich.
»Ich erwarte sie. Es wäre mir sehr lieb, wenn sie meinen Aufenthalt aufspürte und hierher käme, allerdings alles von selbst, ohne Hilfe der Polizei, dass ich nicht vorher flüchten muss. Ja, nichts wäre mir lieber, als mich mit dieser roten Athletin einmal messen zu können. Ich wollte ihr beweisen, dass es noch mächtigere Kräfte gibt als rohe körperliche. Die wollte ich nicht schlecht heimschicken.«
Mit unsäglicher Verachtung hatte sie es gesagt. Arno blieb die Antwort schuldig. Hier war ja doch jedes Wort vergebens. Ihr zu erzählen, wie die Indianerin schon einmal mit ihren Gegnern umgesprungen war, wie ein Würgengel ihnen begegnend, das fiel ihm natürlich nicht ein.
»Sagen Sie, Herr Graf, lieben Sie diese Indianerin wirklich?«
»Ich ersuche Sie, diesen Namen nicht mehr in den Mund zu nehmen, und ich werde Ihnen auf solche Fragen auch keine Antwort geben.«
Zwei Tage vergingen.
Der gelähmte Gefangene hatte noch einen zweiten Wärter bekommen, einen herkulischen Neger, der ihm viel sympathischer war als der andere mit dem rasierten Spitzbubengesicht, und da die Kraft des auch sehr geschickten Negers genügte, um dem Gelähmten in jeder Weise behilflich zu sein, so wünschte Arno, dass er den anderen gar nicht mehr zu sehen bekäme, und der ehemalige Jäger kam denn auch nicht wieder.
Arno fragte nach den versprochenen Büchern.
»Haben Sie einen besonderen Wunsch? Alles wird sofort besorgt.«
»Ist denn hier eine Stadt in der Nähe?«
»Das lassen Sie meine Sache sein. Bestellen Sie nur Ihre Bücher.«
»Ich frage nur deshalb, weil es im Buchhandel und in kleineren Leihbibliotheken vielleicht nicht zu haben ist, nur in großen staatlichen oder städtischen Bibliotheken.«
»Bestellen Sie nur, alles Gewünschte wird in kürzester Zeit besorgt.«
»Meryon, die Memoiren der Lady Esther Stanhope.«
Miss Morgan notierte sich den Titel und sagte:
»In einer Stunde können Sie das Buch haben.«
Lady Esther Stanhope war auch unter dem Namen »die Königin von Tadmor« oder »die Zauberin von Dschihun« oder »die Sibylle des Libanon« bekannt. Geboren war sie 1776 zu London als Tochter des bedeutenden Staatsmannes Lord Charles Stanhope und als Nichte von William Pitt, des englischen Staatskanzlers, des englischen Bismarcks, dessen Privatsekretärin sie viele Jahre lang war, viele diplomatische Noten selbst ausarbeitend, bis sie nach dem Libanon ging und sich unter den Drusen zu einer mysteriösen Königin aufschwang, vor deren persönlicher Macht selbst der furchtbare Ibrahim Pascha auf seinem Siegeszug demütig umkehrte. Sie war wohl die exzentrischste Abenteuerin und das rätselhafteste Weib, das jemals gelebt hat.
Ihr Leibarzt James Meryon, der ihr allein treu bis zu ihrem jämmerlichen Tode blieb, hatte ihre Memoiren herausgegeben oder diese wohl selbst verfasst. Arno hatte in seiner Offizierszeit einmal das englische Werk in den Händen gehabt, ein wunderbares Buch, in welchem besonders das geheimnisvolle, noch so gänzlich unbekannte Sektenwesen der Drusen eingehend geschildert wird. Gleich nach dem Lesen der ersten beiden Kapitel hatte er es wieder abliefern müssen. Und es war ihm nicht gelungen, die deutsche Übersetzung aufzutreiben, und ehe er sich das englische Original verschaffen konnte, war er nach Amerika gegangen, wo er gar keine Zeit zum Bücherlesen gehabt hatte.
Jetzt war ihm gerade dieses Buch eingefallen. Eben weil sich seine Gedanken so häufig mit ihm beschäftigt hatten. Und er knüpfe auch gleich noch einen besonderen Plan daran.
Eine Stunde später hatte er das Buch. Sofort sah er, dass es aus einer öffentlichen Bibliothek stammte und dass man alle Stempel und sonstige Zeichen, die seine Herkunft verraten konnten, sorgfältig herausradiert hatte. Miss Morgan betrachtete es gleich als Eigentum. Was machte sie sich daraus. Sie ersetzte es einfach.
Arno begann sofort zu lesen, wieder versetzten ihn gleich die ersten Seiten in atemlose Spannung, und er beschloss, dieses Buch ins Deutsche zu übersetzen. Er sah darin für sich schon einen neuen Lebensberuf entstehen, bei dem es manchmal sogar ganz gut ist, wenn man gelähmte Beine hat, den man auch in jeder Kerkerzelle ausüben kann, wenn man nur das Wenige bekommt, was man braucht, und Herr seiner Zeit ist. Arno wollte tiefere Umschau in der englischen und amerikanischen Literatur halten und das Beste, was er fand, ins Deutsche übersetzen.
Wer jedes gegebene Verhältnis so aufzufassen und für sich auszunutzen versteht, der ist ein wirklich glücklicher Mensch!
Arno ließ sich Papier, Tinte und Feder geben, fing sofort an, ohne an einen späteren Verleger und an Honorar zu denken — und fühlte sich nicht nur befriedigt, sondern wahrhaft glücklich. Und dieses Glück wuchs mit der fortschreitenden Arbeit.
Jenseits des Gitters hauste Miss Morgan. Sie bot sich als lebendiges Wörterbuch an, wurde aber nicht gebraucht. Wollte sie eine Unterhaltung anknüpfen, so antwortete ihr Gefangener gar nicht oder ganz zerstreut.
Am nächsten Tage war sie dieses Lebens offenbar schon überdrüssig. Wollte sie immer in seiner Nähe sein, so war sie ja selbst eine Gefangene, und außerdem war sie für den, dessen Liebe sie durch Gewohnheit erringen wollte, auch noch Luft.
»Herr Graf, hören Sie denn nicht?!«, rief sie eben zum dritten Male.
»Gleich, gleich.«
»Übermorgen werden Sie exhumiert.«
»Gleich, gleich.«
»Interessiert Sie denn gar nicht, dass Sie übermorgen früh ausgegraben werden?«
»Nein. Gar nicht. Die Geburt dieser Lady Esther interessiert mich viel mehr als meine Auferstehung. Man kann mich überhaupt ruhig unter der Erde liegen lassen, ich fühle mich sehr wohl im Sarge.«
»Ich werde Ihnen das Buch wieder wegnehmen.«
»Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Wenn ich immer mit Ihnen sprechen soll, kann ich es ja doch nicht gebrauchen. Aber hoffen Sie dann nicht auf eine angenehme Unterhaltung.«
»Ich werde nach Pittville reisen. Den Spaß muss ich doch erleben.«
Jetzt horchte Arno doch auf.
»Und mich mitnehmen?«
»Nein, das tut mir leid!«, lachte sie.
»Schade. Ich hätte meiner Ausgrabung gern persönlich beigewohnt.«
»Anderthalb Tag hin, anderthalb Tag zurück — in drei Tagen bin ich wieder hier«, rechnete Miss Morgan in Gedanken für sich.
»Diese drei Tage Ihrer Abwesenheit werden mir sehr wohl tun«, suchte Arno durch Spott sie immer wieder zu reizen.
»Ja, ich fahre hin. Sie sind hier sicher aufgehoben.«
»Na — na! Dass ich Ihnen unterdessen nur nicht abhanden komme.«
»O, da brauche ich keine Sorge zu haben. Und geben Sie sich nicht etwa mit Fluchtplänen ab!«
»Miss Morgan, reden Sie doch keinen Unsinn! Wie soll ich denn auf meinen lahmen Beinen fliehen?«
»Aber Sie könnten doch eine Flucht einleiten wollen.«
»Wie denn?«
»Nun, indem Sie zum Beispiel einen Zettel schreiben und ihn zur Veranda hinabwerfen, in der Hoffnung, dass er aufgefischt wird.«
»Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mich hierauf aufmerksam gemacht haben. Das ist wirklich ein genialer Gedanke, auf den ich allein gar nicht gekommen wäre.«
»Ich warne Sie nochmals, denn die Folgen würden für Sie höchst unangenehme sein.«
»Inwiefern?«
»Erstens würde man Ihnen sofort alles Papier nehmen und jede andere Schreibgelegenheit, und zweitens würden Sie niemals wieder auf die Veranda kommen.«
»Das hätte ich auch nicht mehr nötig, wenn das Zettelchen seinen Zweck erreicht haben würde!«, spottete Arno weiter, aber nur, um jene zu weiterem Sprechen zu veranlassen.
»Ja, es könnte sein«, erwiderte Miss Morgan, »dass der Zettel aufgefischt würde und in die richtigen Hände käme. Aber ich habe meine Vorkehrungen getroffen. Sobald jemand auch nur ahnt, dass Sie sich hier befinden, werden Sie auf meine Dampfjacht gebracht und fortgeführt, und es gibt noch keine schnellere Jacht als die meine.«
»Wohin werde ich dann gebracht?«
»Das werde ich Ihnen nicht verraten!«
»Nun, ich bin doch so gut wie tot, und einem Toten kann man doch alles anvertrauen!«
»Nein, ich habe meine Gründe, Sie über Ihren Aufenthalt gänzlich im Unklaren zu lassen.«
»Es gibt aber doch viele Menschen, welche um Ihr Geheimnis wissen.«
»Welche denn?«
»Nun, Ihre Diener hier.«
»Ach«, erklang es verächtlich, »die habe ich mir mit Leib und Seele gekauft, das sind meine willenlosen Maschinen.«
»Aber die können doch einmal etwas verraten.«
»Nein, das können sie nicht.«
»Warum nicht?«
»Einfach weil ich das meiste Geld habe. Das heißt, andere mögen noch mehr haben, aber niemand ist bereit, für diese Sache so viel Geld auszugeben wie ich.«
»So fest sind Sie von der Allmacht des Geldes überzeugt?«
»Gewiss. Sie etwa nicht?«
»So etwas wie ein Gewissen, das erwachen kann, ist Ihnen wohl ganz unbekannt.«
»A bah, Gewissen! Ich habe mir doch meine Leute ausgesucht.«
»Ach so! Verzeihen Sie.«
»Also sobald jemand auch nur ahnt, dass Sie sich hier befinden, er braucht sich gar niemand persönlich zu nahen, kommen Sie auf meine Jacht — —«
»Mir wäre eine kleine Erholungsreise zu Wasser ganz angenehm.« erwiderte Arno ironisch.
»Auf der Jacht haben Sie nicht diesen Komfort wie hier.«
»O, ich bin nicht verwöhnt. Ich bin von Hamburg nach New York sogar im Zwischendeck gefahren!«
»Sollte man aber dieses Haus umstellen, dass keine Flucht zu Lande oder Wasser mehr möglich ist, dann — werden Sie getötet!«
»Oho!«, stellte sich Arno erschrocken. »Warum denn das?«
»Weil Sie der anderen nicht lebendig wieder in die Hände fallen sollen.«
»Welcher anderen?«
»Jener Indianerin.«
»Ach so. Sie sind eifersüchtig.«
»Zweifeln Sie noch, dass ich eifersüchtig bin?«, fragte sie mit funkelnden Augen.
»Dann machen Sie mich doch lieber einstweilen wieder scheintot, das ist mir angenehmer als richtig tot.«
»Sie werden doch einmal zu sich kommen.«
»Und da schrecken Sie nicht einmal vor einem Morde zurück?«
»Nein!«, war die ganz einfache Antwort.
»Sie werden dann als Mörderin verfolgt.«
»Wieso denn? Niemand ahnt, dass die Miss Morgan hier haust. Hier bin ich eine ganz andere.«
»Sie können aber doch einmal entdeckt werden.«
»Unmöglich. Das ist alles so geschickt und verwickelt arrangiert, dass — doch lassen Sie das meine Sorge sein. Also: Sobald Sie hier entdeckt sind und Ihr Forttransport von hier nicht mehr möglich ist, werden Sie niedergeschossen. Das lassen Sie sich gesagt sein.«
»Ich danke Ihnen. Aber weshalb erzählen Sie mir das erst?«
»Nur, um Sie zu warnen. Dass Sie nichts tun, um Ihre Anwesenheit hier der Außenwelt mitzuteilen.«
»Ich werde mich hüten. Und wer wird diese Henkerarbeit eventuell verrichten? Mein schwarzer Diener sieht viel zu harmlos aus, als dass er einen Menschen gleich niederknallen könnte.«
»Ich werde noch einen besonderen Mann hier anstellen, der Tag und Nacht bei Ihnen bleibt und der keine Sekunde zögert, meinen Befehl auszuführen.«
»Den Renald? Das ist mir ein unangenehmer Mensch — ich weiß selber nicht warum — den möchte ich nicht immer um mich haben.«
»Es wird ein anderer sein. Wenn Ihnen dessen Gesellschaft nicht passt — tut es mir leid — doch es sind ja auch nur drei Tage. Leben Sie wohl, Herr Graf, auf Wiedersehen. Ich hoffe, Ihnen bei meiner Rückkehr viel Amüsantes berichten zu können.«
»Ja, grüßen Sie meinen Sarg und den hölzernen Holländer, der als mein Stellvertreter darin liegt.«
Sie ging sofort und kam nicht wieder. Dafür erschien ein Mann, wohl als Gentleman gekleidet, der aber einen noch viel widerwärtigeren Eindruck machte als jener Jäger. Ja, dem galt das Leben eines Menschen so viel wie das einer Fliege, das konnte man diesem von Leidenschaften durchwühlten und doch so eisernen Gesicht gleich ansehen.
Er setzte sich, ohne ein Wort zu sagen, jenseits des Gitters bequem in einen Lehnstuhl, schlug die Beine übereinander, untersuchte eine Browningpistole mit zölligem Kaliber, dann biss er ein Stück Kautabak ab.

Arno hatte sich ihn einmal angesehen, würdigte ihn dann aber keines Blickes mehr. Es war ihm doch nicht so humoristisch zumute. Wenn er noch etwa daran gezweifelt, so wusste er es jetzt, dass dieses Weib zu allem fähig war.
Was sollte hieraus werden? Man würde entdecken, dass der Graf von Felsmark nicht auf dem Friedhofe von Pittville lag. Auch Atalanta würde es doch sicher erfahren. Denn mit dieser beschäftigten sich hauptsächlich seine grübelnden Gedanken.
Was würde die Indianerin glauben und tun? Arno erkannte erst jetzt, dass er einmal einen großen Fehler begangen hatte. Als ihn Miss Morgan damals in seiner Wohnung besuchte und die Szene machte, hatte Atalanta in einem entfernten Zimmer schon geschlafen, und Arno hatte ihr später nichts davon erzählt, überhaupt gar nichts von diesem Weibe, das ihn mit seiner Liebe verfolgte. Weshalb hätte er das auch tun sollen?
Als sein Hund an dem Stückchen Torte krepiert war, hatte er ja gar nicht an Miss Morgan gedacht. Erst jetzt hatte er es von ihr selbst erfahren, dass sie diese Torte präpariert hatte, um ihn in Scheintod zu versetzen. Wie sie es fertig gebracht, die in einem friedlichen Bürgerhaus gebackene Torte zu vergiften, das freilich hatte sie ihm nicht verraten, Arno hatte es auch gar nicht wissen wollen.
Hatte er der Indianerin eigentlich erzählt, dass sein Hund nach drei Tagen wieder lebendig geworden war? Das wusste er gar nicht. Auf der Reise nach dem Sklavensee war über ganz andere Sachen geredet worden.
Wenn Atalanta erfuhr, dass in dem Sarge nur eine Puppe lag, so konnte sie — wenn sie überhaupt eine bestimmte Person gleich im Auge hatte — nur an Professor Dodd denken. Der hatte es doch immer schon auf den prächtigen Körper des Athleten abgesehen gehabt, also musste die Indianerin annehmen, dass dieser Arnos Leiche geraubt habe. So kam sie von vornherein auf eine ganz falsche Spur.
Es sah also für Arno verzweifelt aus. Wenn ihm am Leben gelegen war, so konnte er nur hoffen, hier niemals entdeckt zu werden. War seine Entführung vorher nicht mehr möglich — der Kerl dort schoss ihn augenblicklich nieder, was später Miss Morgan zweifellos mit eigener Hand tat. Die gab ihre Beute nicht mehr her. Oder er musste sie heiraten, dann war die ganze Sache wieder in Ordnung.
Endlich gelang es ihm, sich solchen zwecklosen Grübeleien zu entschlagen, indem er sich wieder in seine Arbeit versenkte. Sobald er freilich einmal aufblickte, musste er immer wieder an Atalanta denken und er wurde von einer ihn unglücklich machenden Sehnsucht erfasst.
So vergingen drei Tage. Der riesenhafte Neger, der durch seine geistige Beschränkung einen harmloseren Eindruck vortäuschte, kam nur, wenn Arno ihm klingelte. Drüben aber der Gentleman mit dem Verbrechergesicht wich nicht von seinem Stuhle, auf dem er auch des Nachts angekleidet schlief.
Die dritte Nacht kam. Arno hatte sich angewöhnt, bis spät in die Nacht zu arbeiten und dafür einen ausgiebigen Mittagsschlaf zu halten. Bezüglich seiner früheren Schläfrigkeit war überhaupt eine große Veränderung eingetreten. Dass er so wie in der ersten Periode seiner Krankheit plötzlich einschlief, das kam jetzt niemals mehr vor. Wenn die Lähmung seiner unteren Extremitäten auch vom Gehirn ausging, so merkte er davon doch absolut nichts. Seit er diese ruhige Lebensweise führte, konnte er klarer und schärfer denken denn je. Dass in seinen Beinen das Blut ganz normal zirkulierte, davon kam er manchmal im Schlafe zur Überzeugung, da hatte er manchmal so ganz deutlich das Bewusstsein, dass er seine Beine bewegen konnte. Sobald er erwachte, war die Nervenlähmung wieder da. Aber es war wenigstens ein Glück im Unglück, dass die Beine nicht abstarben.
Die Uhr drüben zeigte die elfte Stunde.
»Na, noch eine Stunde, dann bin ich erlöst!«, brummte da einmal der Wächter.
»Um Mitternacht kommt Miss Morgan zurück?«, ließ sich Arno doch einmal zum Fragen herbei.
»Wer? Ich kenne nur eine Doña Rafaela.«
Arno horchte hoch auf. Diesen Namen hatte er überhaupt noch gar nicht gehört. »Miss Morgan nennt sich hier Doña Rafaela?«
»Oho, Ihr wollt mich wohl aushorchen?«, höhnte der Mann. »Da gebt Euch keine Mühe.«
Arno ärgerte sich schon, nur ein Wort mit diesem Menschen gewechselt zu haben. Jenem aber wäre eine kleine Unterhaltung ganz angenehm gewesen, um sich die letzte Stunde seines Wächteramtes schneller zu vertreiben.
»Ja, sie hat schon telegrafiert, dass sie Punkt zwölf hier sein wird.«
Da Arno nichts mehr fragte, war diese Unterhaltung wieder beendet.
Die Stunde verging. Der Zeiger hatte genau die zwölf erreicht, als draußen Stimmen und Schritte erklangen, die sich schnell näherten. Man hörte die Hast heraus.
»Na endlich!«, seufzte der Wächter, sich erhebend.
Dann stutzte er. Diese Hast fiel ihm auf.
»Schnell doch — wo, wo, wo, wo?«, erklang es draußen.
»Hier, Madam, hier — —«
Die Tür wurde aufgerissen.
Arno glaubte zu träumen, als er in der Eintretenden das Mädchen in dem Lederkostüm — Atalanta erkannte.
Das Nachfolgende lässt sich kaum schildern.
Die Indianerin gebärdete sich, als ob es brenne, als ob im nächsten Augenblick das ganze Haus in die Luft fliegen müsse.
»Da ist er ja — schnell fort mit ihm — um Gottes willen, schnell, schnell, kein Moment darf verloren gehen, das ist ja ein grässlicher Irrtum — die Doña Rafaela, meine beste Freundin — wie so ein furchtbarer Irrtum nur möglich ist — —«
Sie hatte an dem Gitter herumgetastet, nach einer Tür suchend an den Stäben gerüttelt.
Ein Mann war ihr gefolgt, wahrscheinlich der Hausmeister, ein großes Schlüsselbund in der Hand.
Gegen diesen fuhr sie jetzt herum.
»Zum Henker noch einmal, schlaft Ihr denn, Mann?!«, fuhr sie ihn wütend an. »Die Türe auf, die Türe auf!!!«
Seinem Gesichte nach war der Hausmeister vollkommen perplex. Er half sich dadurch aus seiner Verlegenheit, dass er jetzt ebenso den Wächter anschnauzte.
»Mensch, so macht doch die Gittertüre auf!!!«
Das sonst so raffinierte Spitzbubengesicht des Wächters hatte momentan einen unsäglich dummen Ausdruck angenommen.
Aber er drehte sich sofort um, löste an der Wand einen Mechanismus aus, und sofort ging an dem Gitter eine Falltür empor.
Atalanta sprang sofort in den Käfig hinein, legte ihren Rücken an Arnos Brust, schlang seine Arme um ihren Hals und nahm seine Beine unter ihre Arme. Dabei flüsterte sie erregt:
»Festgehalten, Graf — fort, fort! — Um Gottes willen, kein Augenblick darf verloren gehen — die Doña Rafaela will Euch haben — na, das wäre ja beinahe etwas Schönes geworden — —«
Nun ging's zum Käfig hinaus, draußen aber wurde erst noch einmal der Hausmeister vorgenommen.
»Na, Mann, was steht Ihr denn da und schlaft! Ist denn das Tor unten offen? Schnell, schnell, die Doña wartet! Na, Ihr Schlafmützen könnt ja was erleben, wenn die wiederkommt — —«
Sie hatte dem Hausmeister den Schlüsselbund aus der Hand gerissen und eilte zur Türe hinaus.
»Hier steht der Fahrstuhl!«, rief der Hausmeister. —
»Ach, ehe der in Bewegung kommt — schnell, schnell, die Doña wartet, sie ist außer sich — —«
Atalanta war an eine Treppe gekommen, sprang sie hinab, immer vier, fünf Stufen auf einmal nehmend, als habe sie keine Last von zwei Zentnern auf dem Rücken.
Ach, waren das eine Masse Stufen! Diese Akrobatin freilich brauchte auf diese Weise nicht länger Zeit, als wenn ein anderer die Treppen von vier Etagen leichtfüßig herabspringt. In Wirklichkeit mochte sie eine Höhe von zwanzig Etagen zu durchmessen haben. Alles war elektrisch erleuchtet.
Weitere Umschau hielt Arno nicht. Er glaubte noch immer zu träumen. Und in diesem Traume hatte er auch die Sprache verloren, er hatte noch kein einziges Wort gesagt.
Das Ende der Treppe war erreicht, Atalanta eilte nun durch einen langen Gang, der an einem großen, eisenbeschlagenen Tore endete.
Hier standen einige Männer, alle mit denselben verdutzten Gesichtern, wie solche die Leute oben gezeigt hatten.
Die Indianerin aber schwatzte und skandalierte, als habe sie ihre Erziehung in einer Judenschule genossen.
»Aufgemacht, aufgemacht — Himmel noch einmal, wenn wir zu spät kommen — die Doña Rafaela ist schon ganz rasend vor Ungeduld — —«
»Ja aber, Miss —«, fing da ein Mann zu sprechen an und wollte ihr wohl den Weg vertreten. Aber der kam schön an.
»Mensch, Ihr seid ja der größte Esel, der auf zwei Beinen herumläuft!«, fuhr ihn Atalanta an. »Begreift Ihr denn immer noch nicht, worum es sich handelt? Die Doña Rafaela windet sich schon in Krämpfen — na, Ihr Einfaltspinsel könnt ja etwas erleben, wenn sie wiederkommt — —«
Unter solchen Worten hatte sie die Schlüssel probiert, den passenden gefunden und schloss das Tor auf.
Arno sah — vorausgesetzt, dass er dies alles nicht nur träumte — vor sich im Vollmondscheine einen langen, schmalen Weg, auf beiden Seiten von Wasser bespült, so schmal, dass sich kaum ein Automobil darauf umdrehen konnte. Einen Kilometer mochte diese Landzunge lang sein, die Indianerin durchrannte ihn mit ihrer Last in wenigen Minuten, bis sie die ebene, langgestreckte Küste erreichte, an der sich eine Landstraße hinzog, auf der einen Seite von mächtigen Bäumen bestanden.
»Littlelu!«, rief sie.
»All right!«, erklang aus dem Baumschatten eine tiefe Männerstimme, mit kurzem Knattern kam ein Automobil heran und hielt vor der Indianerin.
Atalanta kletterte hinein und ließ Arno auf den Rücksitz gleiten. Gegenüber saß eine kleine, dicke Männergestalt, soweit sich das jetzt unterscheiden ließ.
»Da habe ich ihn. Graf Arno von Felsmark. Und das ist mein ehemaliger Lehrer Little — —«
»Ludovikus Maximus, Spiritist und Geisterforscher«, stellte sich der kleine Dicke mit der fürchterlichen Bassstimme selbst vor, seinen steifen Hut ziehend. Atalanta befahl nun:
»Fahren Sie los, Chauffeur! Aber nicht so schnell, wir wollen diese herrliche Mondscheinnacht genießen.«
Das Automobil fuhr ab.
Auf Arno hatte die seltsame Vorstellung seines Gegenübers Eindruck gemacht.
Es war ja überhaupt ein ganz seltsamer Traum.
Wenn nur nicht alles von so handgreiflicher Deutlichkeit gewesen wäre.
Dort, von wo er gekommen, sah er am Ende der kilometerlangen Landzunge eine imposante Felsmasse liegen, gekrönt von einer Burg — Westcliff bei Cemetery, einer der herrlichsten Punkte an der kalifornischen Küste, einst eine spanische Festung, von der Militärverwaltung der Vereinigten Staaten aus strategischen Gründen aufgegeben, jetzt Privatbesitz. Denn den Stahlgranaten der Panzerschiffe kann dieser weiche Kalkfelsen doch nicht widerstehen, die erfordern dicke Erdbastionen, und ein Gibraltar war es denn doch nicht.
Arno konnte diesen schönen Anblick im Mondschein nicht lange genießen, Atalanta verdarb ihm die Aussicht, indem sie ihn nämlich nur in den Polstern zurecht gerückt hatte, dann ihm gleich um den Hals fiel und seinen Mund mit Küssen bedeckte.
»Arno, mein Arno! Du lebst noch und ich habe Dich wieder!!«
Die Küsse waren geräuschvoll.
»Wünsche gesegnete Mahlzeit!«, ließ sich die würdevolle Bassstimme vernehmen.
»Ist es nicht nur ein Traum?«, ächzte Arno, als läge er auf der Guillotine und erwarte das herabsausende Fallbeil.
»Du lebst noch und ich habe Dich wieder!«, jauchzte die Indianerin, wie Arno sie noch niemals hatte jauchzen hören.
Da gab er den Glauben, dass dies alles nur ein Traum sein könne, doch lieber auf.
»Miss Morgan ist Deine Freundin?«
»Miss Morgan? Wer ist denn das?«
»Die sich hier Doña Rafaela nennt.«
»I wo, die kenne ich gar nicht.«
»Ja, ich denke, Du bringst mich hin zu ihr.«
»Das war nur eine List!«, lachte die Indianerin herzlich auf.
»Eine List? Mir unverständlich!«
Sie setzte sich ihm gegenüber, behielt aber seine Hände in den ihren.
»Ich will Dir alles kurz erzählen. Chauffeur, fahren Sie doch nicht so schnell! Vor drei Tagen gab ich in San Francisco meine letzte Abendvorstellung im Zirkus. Ich führte auch Taschenspielerkunststückchen aus, wozu ich manchmal unter das Publikum ging, um mir Taschentücher und andere Gegenstände zu erbitten.
Wie ich wieder einmal so an der vorderen Parkettreihe vorüberschritt, musste ich plötzlich lebhaft an Dich denken, da sah ich Dich ganz deutlich vor mir stehen. Weshalb? Das, Arno, ist eine schwierige Erklärung. Du kennst ja meine feine Nase. Ich könnte sagen: Ich habe Deinen Geruch wahrgenommen. Aber das ist nicht das Richtige.
Kurz, ich sah Dich plötzlich lebendig vor mir stehen! Und es war eine Dame, die dieses Bild in meiner Phantasie erzeugt hatte. Ich war an ihr schon einige Schritte vorübergegangen und drehte mich plötzlich wieder um. Jawohl, die verschleierte Dame in dem schwarzen Atlaskleid mit den gelben Ärmeln, von der ging Deine Atmosphäre aus. Nimm meinetwegen an, dass ich es wirklich riechen konnte.
Wie kam das? Wie konnte diese Dame Dein Lebensfluidum ausströmen? Ich glaubte mich zu irren. Ich musste von der Dame etwas haben, das sie auf ihrer Haut trug, und bat deshalb um ihren Handschuh, den ich zu einer meiner Vorführungen zu brauchen vorgab. Ich erhielt ihn, sog seinen Geruch ein, wobei ich ihn aber nicht an die Nase zu führen brauche. Es liegt bei mir sogar im Gefühl.
Jawohl, diese Dame verband mit ihrer eigenen Lebensatmosphäre die Deine. Wie war das möglich?
Es gab nur eine einzige Erklärung. Ich hatte damals in dem Hotel zu Pittville Dein Jagdkostüm zurückgelassen. Diese Dame musste sich das angeeignet haben, musste das Ledergewand immer bei sich tragen, es zu Hause in ihrem Zimmer hängen haben. Doch diese Erklärung war ja bei den Haaren herbeigezogen! Und überhaupt war das Dein ganz echter Lebensgeruch, den ich an ihr und an dem Handschuh wahrnahm. Das heißt, ich sah Dich ja ganz, ganz deutlich in vollem Leben vor mir stehen!
Aber Du lagst ja in Pittville begraben. Ich glaubte also an einen Irrtum meinerseits. Trotzdem erkundigte ich mich sofort, wer die Dame sei. Eine Doña Inez Rafaela, wohnhaft in Westcliff bei Cemetery, die dritte Vorortstation von San Francisco, wurde mir berichtet. Gut, ich wollte die Dame einmal aufsuchen, um zu konstatieren, woher dieser Irrtum bei mir entstanden sei. Aber nicht am selben Abend noch. Ich wollte nach der Vorstellung sofort nach Pittville, um Deiner Ausgrabung beizuwohnen, ich hatte überhaupt in Pittville etwas Besonderes vor.
Ich musste mich beeilen, um nach der Vorstellung auf den Bahnhof zu kommen. Schon viele hatten deshalb den Zirkus vorher verlassen.
Der Perron war voll Menschen. Wie ich mich durchdrängte, da standest Du plötzlich wieder leibhaftig vor meinem geistigen Auge, jetzt aber in Gesellschaft jener Doña Rafaela in dem schwarzen Atlaskleide mit den gelben Ärmeln. Doch so sehr ich auch um mich schaute, ich konnte die Dame in dem genannten Kostüm nicht erblicken. Dafür aber sah ich in meiner unmittelbaren Nähe eine Dame in grauem Kleid und nun wusste ich's, das war Doña Rafaela, sie hatte sich umgezogen. Sie stieg gerade in einen angehängten Privatwagen des Zuges. Ich hatte mich nicht erst noch einmal zu erkundigen brauchen, in diesem Falle irrte ich mich nicht, fragte aber ganz überflüssiger Weise doch noch einmal. Jawohl, dieser Privatwagen gehörte der Doña Rafaela von Westcliff!
Fünfunddreißig Stunden währte die Fahrt. Die Passagiere mussten sich beeilen, wenn sie von der Exhumierung noch etwas sehen wollten. Wohl nur mir gelang es noch, ganz vorn an Deinem Grabe einen Platz zu bekommen. Den ganzen Vorgang will ich Dir ein andermal erzählen. Der Sarg ging beim Herausheben auf, statt einer Leiche lag eine hölzerne Figur darin, die auch noch zu sprechen anfing.
Was ich da dachte, kann ich Dir nicht schildern. Nur eines stand jetzt bei mir felsenfest: Arno lebt noch! Du warst gar nicht richtig tot, Du bist wieder ausgegraben worden, und Du hieltst Dich nirgends anderswo auf als in jenem Westcliff bei San Francisco. Erwähnen will ich nur noch, dass ich auch sofort an Deinen Hund dachte, der an der giftigen Torte starb und nach drei Tagen wieder lebendig wurde, und natürlich an Professor Dodd, der sich uns ja schon offenbart hatte, der für sein Museum Menschen sammelt, die nach seiner Behauptung tot sind und doch noch leben.
Also zurück nach San Francisco! In einer halben Stunde schon ging der nächste Zug. Auch die Doña Rafaela stieg mit ihrer Begleiterin und einem Herrn wieder in ihren Anhängewagen. Ob sie mich gesehen hat, weiß ich nicht. Ob ich sie vor meinem Besuch in Westcliff, den ich sofort nach der Ankunft des Zuges in Frisco auszuführen entschlossen war, noch sprechen sollte, das musste ich mir erst noch überlegen.
Hierzu hatte ich ja wiederum fünfunddreißig Stunden Zeit. Wie ich mir den Plan zurecht legte, den ich dann ausführte, das vermag ich Dir nicht zu schildern, kurz, ich kam zu dem Entschluss, jene Dame vorher nicht zu sprechen, sondern ich musste eher als sie in Westcliff sein, musste dort eindringen und Dich herausholen.
In dem Zuge sah ich meinen ehemaligen Lehrer wieder, der mich in verschiedenen Künsten ausgebildet hat, hier der vortreffliche und ehrenwerte Little — halt, Mister Ludovikus Maximus, wollte ich sagen. Ich vertraute mich ihm an, indem ich ihm den Vorschlag machte, ganz bei mir zu bleiben, er ging mit Freuden darauf ein, und was das für eine Bedeutung hat, das, lieber Arno, wirst Du noch später erfahren.
Ich führte meinen Plan aus, ganz am Ende der Fahrt, vor kaum einer halben Stunde. Dass es möglich war, darüber mich zu orientieren, hatte ich ja in den vielen Stunden der Eisenbahnfahrt Zeit genug gehabt.
Wir waren noch eine Viertelstunde von San Francisco entfernt, kamen schon durch Vororte. Der Zug hatte noch einmal einen langen Tunnel zu passieren. Schon stand ich auf der Plattform des letzten Wagens. Das heißt, dann waren immer noch vier Privatwaggons angehängt, und der vorletzte war der der Doña Rafaela.
Im Freien hätte es seine Schwierigkeiten gehabt, es war so heller Mondschein, man hätte mich bemerken können — hier in diesem qualmerfüllten Tunnel aber hätte jemand dicht neben mir stehen können, ich hätte mich unsichtbar zu machen gewusst.
Also ich voltigierte über die beiden nächsten Wagen hinweg, auf der anderen Seite hinunter und kuppelte die beiden letzten Wagen los — —«
Hier wurde die Erzählerin einmal unterbrochen. Bisher hatte es Arno noch mit keinem Worte getan, jetzt aber konnte er nicht mehr an sich halten.
»Es — ist — nicht — möglich!«
»Was ist nicht möglich? Dass ich die Kuppelung löste? O, da ist doch nichts weiter dabei, das ist doch ganz einfach. Natürlich hatte ich mir vorher so eine Verkuppelung genau angesehen, hatte einen Schaffner, der mir keinen besonders intelligenten Eindruck machte, etwas ausgehorcht, falls es dabei gewisse Handgriffe gebe, aber das ist gar nicht der Fall, man dreht einfach die Kurbel herum — —«
»Nein, nein, das meine ich ja nicht, sondern die Gefahr, diese furchtbare Gefahr!«
»O, für die beiden stehen bleibenden Wagen war gar keine Gefahr vorhanden. Wir, mein Freund hier und ich, hatten uns im Kursbuch orientiert, hatten auch jenen Schaffner deswegen so etwas ausgehorcht. Erst zwei Stunden später wurde dieser Tunnel wieder von einem Zuge passiert. Und in zehn Minuten waren wir doch schon auf dem Bahnhof von San Francisco, da wurde das Fehlen der beiden letzten Wagen doch natürlich sofort bemerkt, und natürlich ging alsbald eine Lokomotive ab. Nein, für die beiden abgekuppelten Wagen und ihre Insassen bestand nicht die geringste Gefahr, die sind jetzt ebenfalls schon in San Francisco.«
Arno hatte natürlich an eine ganz andere Gefahr gedacht, an ihre eigene, als sie in dem Tunnel über die Wagen kroch, während der schnellsten Fahrt die Kuppelung löste. Das war ja ein tolles Stückchen gewesen! Aber Atalanta wollte ihn nicht verstehen oder wahrscheinlicher verstand sie ihn wirklich nicht, und so ließ es Arno vorläufig dabei bewenden.
»Ich hatte meinen Zweck erreicht«, fuhr die Erzählerin fort, »hatte eine Stunde oder doch mindestens eine halbe Stunde Vorsprung, und das genügte. In San Francisco nahmen wir beide sofort ein Automobil und fort ging's nach Westcliff!
Vorher hatte ich mich nur etwas über diese alte Meeresburg orientiert, jetzt sah ich sie im Mondschein vor mir liegen. Mein Plan war gefasst. Und jetzt gab es bei mir keine Grübeleien mehr, ob ich mich irren könne oder nicht. Jetzt war es mir zur Gewissheit geworden. Du befandest Dich lebendig in jener Burg und musstest herausgeholt werden. Natürlich wurdest Du gefangen gehalten. Zwei Wege gab es, um Dich herauszubringen: entweder, indem ich mit dem Revolver in der Hand auftrat, oder durch eine List, durch eine schnelle Überrumpelung ohne Anwendung einer Waffe. Ich zog diesen letzteren Weg als den aussichtsreicheren vor.
Wie ich diese Überrumpelung ausführte, hast Du wohl bemerkt, wenn Du auch nur Zeuge des Rückzuges wurdest. Einfach eine totale Überrumpelung, ich habe die Menschen dort gar nicht zur Besinnung kommen lassen! Und nicht etwa, dass ich mir die Worte erst zurecht gelegt hätte. Ich schwatzte immer und schwatzte, was mir gerade einfiel. Also ich ließ das Automobil auf der Landstraße halten, rannte in gestrecktem Galopp die Landzunge entlang, erreichte das Tor, klingelte, donnerte dagegen und machte einen Heidenspektakel.
›Aufgemacht, aufgemacht, ich habe einen Brief von Doña Rafaela an den Grafen von Felsmark, aufgemacht, aufgemacht!‹ So skandalierte ich noch, als schon geöffnet war und eine ganze Schar von Männern mir gegenüber stand. Ich ließ sie nicht zur Besinnung, noch weniger zu einem einzigen Worte kommen. ›Schnell doch, schnell, wo ist der gefangene Graf — die Doña will ihn sprechen — das ist ja eine grässliche Geschichte, wie kann nur so ein Irrtum passieren — —‹ Na, Du hast ja selbst gesehen und gehört, wie ich's machte. Und es gelang ausgezeichnet. Sie ließen sich düpieren. Der Hausmeister rannte mit mir nach dem Fahrstuhl, verlor unterwegs seinen Pantoffel, und ich ließ ihn zu keiner Frage kommen. So gelangte ich in das Zimmer, in dem Du hinter dem Gitter saßest. Alles andere hast Du ja selbst miterlebt.«
Die Erzählerin hatte nichts mehr zu sagen.
Und der Zuhörer war lange Zeit ganz sprachlos vor Verwunderung.
Er dachte an alle die Vorbereitungen und Sicherheitsmaßregeln, die seinetwegen Miss Morgan getroffen hatte — an die Dampfjacht und an das sofortige Niederschießen — und dieses junge Mädchen drang einfach ein, schwatzte den Wächtern etwas vor, nahm ihn auf den Rücken und trabte mit ihm ab!
Arno musste es wohl glauben, dass er wirklich auf diese Weise befreit worden war. Sein grenzenloses Staunen wurde dadurch freilich nicht vermindert.
»Nun aber erst noch einige Fragen, Arno. Du bist doch gefangen gehalten worden?«, fuhr Atalanta fort.
»Na und wie! In einem Raubtierkäfig.«
»Ich meine, Du hast Dich doch auch wirklich entführen und befreien lassen wollen?«
»Ach, Du dachtest, ich wäre dort gern gewesen, sehnte mich nach dem Raubtierkäfig zurück? Nein, das ist nun weniger der Fall.«
»Wer ist denn nun diese Doña Inez Rafaela?«
»Die Miss Marwood Morgan.«
»Und wer ist das?«
Arno berichtete jetzt offen. Wie er von diesem Weibe schon immer verfolgt worden sei. Nur zu solch verzweifelten, verbrecherischen Mitteln habe sie früher noch nicht gegriffen.
»Seitdem wir beide zusammengekommen sind, scheint sie vor nichts mehr zurückzuschrecken, sie hat es schon bewiesen. Auch jene Torte, an der mein Hund starb, war von ihr vergiftet worden. Schon damals hat sie mich unter die Erde bringen wollen, um mich dann wieder auferstehen zu lassen — und Dich mit. Du warst ihr wenigstens noch eine ganz angenehme Zugabe.«
»Ah so, schon jene Torte!«, sagte Atalanta. »Und Professor Dodd?«
»Was ist mit dem?«
»Bist Du dem in jener Burgvilla begegnet?«
Arno klärte sie über diesen Irrtum, den er schon vorausgesehen, auf. Nein, Professor Dodd kam hierbei gar nicht in Betracht, der ging wieder seine eigenen Wege.
Atalanta erzählte ihm nichts von ihrer seltsamen, rätselhaften Handlungsweise in Puebla, wo sie einen ganz fremden, unschuldigen Menschen für den Professor gehalten und ihn gebrandmarkt hatte, das sollte erst später geschehen. Jetzt fiel sie in ein tiefes Sinnen.
Ein Automobil brauste ihnen entgegen. Die beiden Wagen fuhren so schnell aneinander vorbei, dass in dem Mondlicht gar nichts von den Insassen zu unterscheiden gewesen war.
Atalanta aber blickte aufmerksam zurück.
»Das war sie.«
»Die Miss Morgan?«
»Ja, meine Doña Rafaela.«
»Hast Du das gesehen oder gerochen?«
»Ich weiß es, sie war es.«
»Was die wohl sagen wird, wenn sie den Raubtierkäfig leer findet?«
»Ich habe es den Leuten ja wiederholt gesagt.«
»Was denn?«
»Du hast es doch selbst gehört. ›Na, Ihr könnt ja etwas erleben, wenn die Doña wieder nach Hause kommt!‹ Habe ich das nicht wiederholt gesagt?«
Arno musste herzlich lachen.
San Francisco war erreicht, Atalanta ließ wieder am Hotel »Alhambra« vorfahren, nahm den Grafen auf den Rücken und brauchte ihn jetzt nur bis zum Fahrstuhl zu tragen, dann noch einmal ein Stückchen auf dem Korridor.
Dass der Mann auf ihrem Rücken einen türkischen Schlafrock und Pantoffeln trug, hatte in diesem amerikanischen Hotel nichts weiter zu sagen.
»Die zwei besten Zimmer, die noch frei sind.«
In diesem Falle hätte der Mann auf dem Rücken der roten Athletin überhaupt gar nichts anzuhaben brauchen.
Atalanta ließ ihre Bürde auf das Sofa gleiten. Mister Ludovikus Maximus war ebenfalls eingetreten und harrte des Weiteren.
»So. Das war die erste Station, oder soll ich Dich gleich zu Bett bringen?«
»Ich möchte erst etwas essen.«
»Das kannst Du ja auch im Bett.«
»Ein Bett habe ich auch dort im Löwenkäfig gehabt, und ich möchte mich erst noch etwas dem Genusse hingeben, mich außerhalb eines Raubtierzwingers zu befinden.«
»Nun, mein lieber Arno, muss ich Dich erst noch ein Stündchen oder zwei allein lassen. Das heißt allein mit diesem Herrn. Ich will Dir auch gleich erklären, was es mit diesem Herrn für eine Bewandtnis hat. Wie er mein Lehrer wurde, mag er Dir selbst erzählen. Etwas anderes will ich Dir erklären. Niemals wieder hätte ich Dich auch nur für eine Sekunde aus den Augen gelassen. Da wollte es eine Fügung, dass ich in dem Eisenbahnzug meinen alten Littlelu wiederfinden musste. Er war kurz vor meinem ersten öffentlichen Auftreten in New York von Signor Ramoni entlassen worden, die beiden hatten sich im Bösen getrennt. Das hatte aber Ramoni mit Absicht herbeigeführt. Er hatte ihn nun unnütz weggeekelt, wie man sagt. Mein Pflegevater war nämlich nicht etwa der beste Mensch! Oft habe ich an meinen alten Lehrer gedacht, der nicht einmal Abschied von mir genommen hatte, sondern stolz gegangen war, und ich — ich bin eben eine Indianerin, die nicht so leicht jemandem nachlaufen kann. Ich wusste ja auch gar nicht, wo sich Littlelu aufhält.
Da also sah ich ihn im Zuge wieder. Und als ich ihn freudig begrüßte, da fing er vor Freude zu weinen an und sogar zu — —«
Ein unbeschreiblicher Laut unterbrach die Sprecherin, der kleine dicke Mann hatte auch eine entsprechende Handbewegung dazu gemacht.
»Schon gut, schon gut. Wir haben uns geeinigt. Littlelu — das ist und bleibt er — wird fernerhin der dritte in unserem Bunde sein. Und dadurch gewinne ich die Möglichkeit, Dich ab und zu doch einmal allein zu lassen — mit ihm. Denn dieser Littlelu ist der einzige Mensch, dem ich Dich anvertraue. Wenn der bei Dir ist, dann habe ich keine Sorge um Dich. Also ich bin so bald wie möglich zurück, habe nur noch eine Kleinigkeit zu besorgen. Lass Dich unterdessen von Littlelu gut unterhalten.«
Sie verließ das Zimmer. Ihr Begleiter näherte sich dem Sofa. Jetzt erst betrachtete ihn Arno sich richtig.
Es war ein kleiner, dicker Herr mit einem Bäuchlein, in einen dunklen, eleganten Jackettanzug gekleidet. Das runde, glattrasierte Gesicht war unverkennbar das eines Schauspielers, im Übrigen war er eine ernste, würdevolle Erscheinung.
»Gestatten Herr Graf, dass ich Platz nehme?«
»Aber bitte sehr.«
Er hatte sich gesetzt. Und da begann dieses Schauspielergesicht in ganz eigentümlicher Weise zu lächeln oder nur mehr zu schmunzeln.
»Nun, Herr Graf, Sie kennen mich vielleicht schon, haben Sie noch nichts von dem Clown Littlelu gehört?«
»Ich bedaure — —«
»Ich verzeihe Ihnen. Es ist auch schon lange her, dass ich meine grandiose Kunst der Öffentlichkeit entzogen habe, schon sechzehn Jahre. Da müssen Sie noch sehr jung gewesen sein.«
»Sie haben den Unterricht der Miss Atalanta geleitet?«
»Nur in einer Spezialität. Ich habe ihr die Knochen gebrochen.«
»Sie gelenkig gemacht, meinen Sie.«
»Ja, ihr die Knochen gebrochen, Sämtliche, vom Rückgrat an bis zum Knochen des kleinen Fingers. Das ist als Artistentrainer meine Spezialität.«
Kellner kamen, deckten den Tisch für drei Personen, brachten auch schon den ersten Gang des wohl von Atalanta bestellten Soupers.
»Was trinken Sie, Herr Graf?«
»Mir wäre einmal Rotwein recht lieb.«
»Kellner, die Weinkarte.«
»Château Lafite.«
»Eine Flasche Château Lafite. Aber nur zwei Gläser.«
Die beiden Kellner waren wieder gegangen und die zwei Herren begannen zu essen. Plötzlich aber legte Arno Messer und Gabel beiseite und sagte:
»Wir hätten auf Miss Atalanta warten sollen.«
»O nein, das können wir nicht.«
»Weshalb dann drei Couverts?«
»Nun ja, wir sind doch zu dritt. Ach so, verzeihen Sie, ich habe ja ganz vorzustellen vergessen. — Mister Knipperdolling.«
Der ehemalige Clown hatte eine vorstellende Bewegung in die Luft gemacht, und Luft sah Arno auch nur.
»Der Herr ist recht durchsichtig«, ging Arno auf den Scherz ein.
»Wie die Geister alle sind.«
»Ach so, es ist ein Geist!«
»Selbstverständlich, ein ganz luftiger Geist sogar. Bitte, Mister Knipperdolling, wollen Sie Platz nehmen.«
Er rückte einen Stuhl neben dem seinen an den Tisch und machte eine einladende Handbewegung.
Arno konnte sich nunmehr eines spöttischen Lächelns nicht erwehren, was sein Gegenüber jedoch gewaltig übel nahm, und ärgerlich sagte er:
»Sie glauben nicht, dass ich einen Geist aus der vierten Dimension zur Verfügung habe? Antworten Sie offen. Glauben Sie an Geister?«
»Nein.«
»Ich werde es Ihnen beweisen, dass es Geister gib, dass ich mir einen Geist dienstbar gemacht habe. Knipperdolling, lasse es einmal ein bisschen regnen — aber nicht gleich platz.«
In demselben Augenblick kam von der Decke herab ein feiner Sprühregen, benetzte den Tisch und Arno.
Dieser wischte sich die Tropfen vom Gesicht und blickte verdutzt nach seinem Gegenüber. Das Männchen hatte seine Hände auf dem Tische liegen.
»Wie haben Sie das gemacht?«
»Ich — ich. Das war mein Geist. Genügt Ihnen dieser Beweis nicht?«
»Nein, ganz und gar nicht. Ich vermute eine Schlipsnadel oder so etwas Ähnliches, woraus sie einfach etwas spritzen. Da müssen Sie mir erst noch ganz andere Beweise bringen.«
»Werde ich. Bitte, wollen Sie aufstehen. Oder erlauben Sie, dass ich Sie hier auf den Lehnstuhl setze.«
Der ehemalige Clown hob den Gelähmten mit Leichtigkeit vom Sofa auf und setzte ihn in den daneben stehenden Lehnstuhl, wobei Arno stählerne Muskeln wie Kanonenkugeln zu fühlen bekam.
Der Lehnstuhl wurde in die Mitte des großen Zimmers gerollt, Littlelu setzte sich ihm gegenüber.
»Sie sind doch nicht schreckhaft, Herr Graf.«
»Durchaus nicht.«
»Waren Sie schon einmal in einer spiritistischen Sitzung?«
»Nein.«
»Wissen Sie, was man einen spiritistischen Apport nennt?«
»Das Herbeitragen eines Gegenstandes durch unsichtbare Geisterhand!«
»So ist es. Ich werde Ihnen als erstes einige spiritistische Apporte vorführen, ohne dass ich vorher das Zimmer verdunkle. Einen Ring tragen Sie nicht? Schade. Haben Sie nicht sonst einen kleinen Gegenstand bei sich, der ganz unverwechselbar ist?«
»Nein, ich bin ganz blank, höchstens ein Taschentuch — :«
»Das möchte ich nicht verwenden. Wenigstens jetzt nicht. Ich nehme aus meiner Tasche einen Dollar. Bitte, machen Sie sich daran mit diesem Messerchen ein Zeichen.«
»Versichern Sie auf Ehrenwort, dass es immer derselbe Dollar bleibt?«
»Auf mein Ehrenwort. Oder halt — wollen Sie aus Ihrem Taschentuche ein Stück herausschneiden? Möglichst zackig. Dann muss das Stück doch immer wieder genau hineinpassen.«
Das konnte geschehen. Arno schnitt aus seinem Tuche ein Stückchen mit verschiedenen Ecken heraus.
»So. Nun lege ich Ihnen dieses Stück Leinwand auf den Kopf, jetzt geben Sie mir Ihre Hände, sehen mir in die Augen — Dolling, hole das Stück Tuch von des Herrn Kopf herab — es ist geschehen.«
Arno hatte nichts auf seinem Kopfe gespürt, aber Littlelu knöpfte sein Jackett auf und brachte den weißen Fleck aus seiner Westentasche zum Vorschein.
»Ist es derselbe?«
»Ja, er passt in das Loch. Wie haben Sie das gemacht?«
»Nun, wie wohl?«
»Sie haben mir den Fleck gar nicht auf den Kopf gelegt, ihn gleich in ihre Westentasche praktiziert.«
»Diese Erklärung ahnte ich. Es ist immer die alte Geschichte. Legen Sie sich das Stückchen Tuch selbst auf den Kopf.«
Arno tat es.
»Ist es noch darauf?«
Arno fühlte noch einmal nach.
»Ja, es liegt auf meinem Kopfe.«
»Sie irren. Es ist bereits in meiner Westentasche.«
So war es. Und Arno hatte es natürlich nicht mehr auf seinem Kopfe.
»Wie machen Sie das nur?«, fing Arno jetzt doch zu staunen an.
»Mit Hilfe meines Geistes. Der nimmt es Ihnen einfach vom Kopfe und steckt es in meine Westentasche.«
»Ach gehen Sie!«
»Ich werde Sie dennoch zwingen, dass Sie an Geister glauben müssen. Wiederholen wir dasselbe nun noch mit der Geldmünze.«
Der gezeichnete Dollar wurde auf Arnos Kopf gelegt, er fühlte ihn deutlich — und ebenso deutlich fühlte er, wie der Dollar, während ihm Littlelu die Hände hielt, ihm wieder vom Kopfe genommen wurde. Im nächsten Augenblicke war er wieder in des kleinen Herrn Westentasche.
Jetzt begann es dem Grafen aber doch fast unheimlich zu werden.
»Wie machen Sie das nur?!«
»Ich mache gar nichts, das besorgt alles mein dienstbarer Geist.«
»Muss der denn den Dollar immer in Ihre Westentasche stecken?«
»O nein, das ist nicht nötig. Allerdings ist das seine liebste Gewohnheit, und gerade die Wesen des Geisterreiches sind Sklaven der Gewohnheit, weshalb sie auch überall auf der Erde den gleichen Spuk ausüben, Lichter ausblasen, mit Pantoffeln schmeißen und dergleichen geistreiche Spielereien treiben. Jetzt soll er aber den Dollar anderswo hinbringen.«
Er nahm ein Tellerchen und setzte es auf das weit entfernte Fensterbrett. Arno musste sich umdrehen, um es sehen zu können.
Littlelu setzte sich ihm wieder gegenüber, Arno selbst musste sich den gezeichneten Dollar auf den Kopf legen, dann wurden seine beiden Hände ergriffen.
»Knipperdolling, nimm von des Herrn Kopfe den Dollar und lege ihn auf den Teller!«
In der nächsten Sekunde fühlte Arno, wie ihm das gewichtige Geldstück vom Kopfe genommen wurde, gleich darauf klirrte am Fenster Silber und Porzellan zusammen.
Littlelu drehte, ohne sich mit einem Schritt zu entfernen, den Lehnstuhl herum und rollte ihn ans Fenster — auf dem Teller lag ein Dollar, Arno nahm ihn selbst, es war der gezeichnete.
»Wie ist das nur möglich?!«, staunte er immer mehr.
»Jetzt soll mein Geist den Dollar auch wieder zurück bringen. Bitte, legen Sie ihn wieder auf den Teller — so — ich komme ihm gar nicht zu nahe, bleibe hinter ihrem Stuhle, rolle ihn zurück, drehe ihn um, fasse Ihre Hände — Dolling, bringe den Dollar zurück und lege ihn wieder auf des Herrn Grafen Kopf — halt, erst zeige einmal, dass der Dollar wirklich noch auf dem Teller liegt, hebe ihn an und lasse ihn wieder fallen — einmal, zweimal, dreimal — —«
Dreimal hatte es am Fenster hell geklungen.
»So, nun lege ihn wieder auf den Kopf des Herrn Grafen.«
In der nächsten Sekunde fühlte Arno, wie ihm das Geldstück wieder auf den Kopf gelegt wurde, er musste es selbst herabnehmen — es war der gezeichnete Dollar, der vom Teller verschwunden war.
Jetzt begann sich Arno doch fast zu fürchten. Er wusste absolut keine Erklärung für dieses Rätsel.
»Ja, da möchte ich wirklich glauben, dass Sie einen dienstbaren Geist haben.«
»Nein. Herr Graf, das sollen Sie nicht.«
Ernster konnte das markante Gesicht des Clowns nicht werden, als es schon immer war, obgleich es manchmal so listig schmunzelte. Jetzt aber war es tiefernst, als er sagte:
»Ich bin nicht Spiritist, sondern Anti-Spiritist. Ich will die Menschheit aufklären. Es gibt kein von einem sogenannten Medium ausgeführtes spiritistisches Phänomen, das ich nicht auf ganz natürliche Weise durch Taschenspielerei nachmache, und noch ganz, ganz andere dazu.
Dabei kämpfe ich mit der schärfsten Waffe, die es gibt: mit der Waffe der Ironie, des Spottes. — Ahnen Sie nicht, Herr Graf, wie ich das mache? Es ist so einfach!«
Nein, Arno konnte nichts ahnen.
Der Taschenspieler gab die Erklärung und ließ den Grafen dabei hinblicken.
Arno war starr vor Staunen, wusste aber nicht, ob er mehr über die Einfachheit oder mehr über dieses Raffinement staunen sollte.
Wir wollen nicht vorgreifen, dem Leser wird die Erklärung später gegeben werden.
»Ich war im Zirkus Ramoni Sprech- und Springclown!«, begann Littlelu zu erzählen. »Dann beteiligte ich mich mit an der körperlichen Ausbildung der kleinen Indianerin. Als ich mich alt werden fühlte — das ist aber schon wieder vorbei, es war nur ein rheumatischer Anfall, jetzt bin ich gelenkiger denn je, — beschloss ich, da ich dem Artistenleben doch nicht entsagen kannte, mich als Taschenspieler auszubilden, wozu ich schon immer großes Talent gehabt hatte. Als ich einmal einer spiritistischen Sitzung beiwohnte, fiel mir ein, dass man all diesen Humbug doch durch natürliche Taschenspielerei fertig bringen müsse, die Tricks müssen nur ausgetüftelt werden.
Und ich begann zu tüfteln. So habe ich Tricks ausgesonnen, die alles, was solche hysterische Medien leisten, weit in den Schatten stellen. Das, was ich Ihnen jetzt zeigte, war der allerkleinste Trick. Und waren Sie, Herr Graf, nicht fast schon geneigt, an Geister zu glauben? Sehen Sie, und so handhabe ich die Sache. Ich habe erst ein einziges Mal in einer Privatgesellschaft eine Vorstellung gegeben. Aber, verstehen Sie wohl, nicht als Anti-Spiritist, sondern mit einem spiritistischen Medium. Erst habe ich lange von der Theorie des Geisterreiches erzählt, habe meinen unsichtbaren Diener vorgestellt, und dann fing ich an. Es waren die gelehrtesten, aufgeklärtesten Herren dabei, die an nichts glaubten, was sie nicht mit Händen fassen konnten — und sie wurden überzeugt, dass ich so etwas nur mit Hilfe von Geistern fertig bringe. Und als ich sie so weit hatte, da gab ich meine Erklärung. Und sie gingen nach Hause — beschämt, aber auch geheilt für immer. Sehen Sie, so mache ich es. Und nun will ich Ihnen noch einige andere Experimente vorführen.«
Er tat es. Wir wollen sie jetzt nicht schildern. Arno kam aus dem grenzenlosen Staunen nicht heraus, manchmal entsetzte er sich, und bei der Erklärung lachte er dann stets laut auf.
Endlich trat Atalanta wieder ein.
»Nun, hat Dich Littlelu gut unterhalten?«
»Ach, das ist ja ein Teufelskerl!«, lachte Arno. »Verzeihen Sie, aber einen anderen Ausdruck gibt es nicht für Sie.«
»So hast Du Dich in den drei Stunden also nicht gelangweilt.«
»Was, drei Stunden sind vergangen?! Ich dachte eine halbe! Wo bist Du so lange gewesen?«
»O, es war nur eine Kleinigkeit, die ich zu besorgen hatte. Nun wollen wir aber schlafen gehen. Morgen, wenn Du wieder ausstaffiert bist, fahren wir nach Pittville zurück. Im Zuge erzähle ich Dir alles!«

»Es beißt! Es beißt!«, schrie Littlelu, dessen ausgeworfene Leine sich plötz-
lich straffte, ein Zeichen, dass sein Unternehmen von Erfolg gekrönt war.
Miss Morgan raste, tobte, weinte und wütete. Hatten diese elenden Narren der Indianerin den gelähmten Gefangenen einfach so herausgegeben!
»Hält man so etwas denn nur für möglich?!«
Dies konnte sie sich aber nur selbst fragen. Der Hausmeister hatte ihr Bericht erstattet, dann war er geflohen, ehe er sich einer Lebensgefahr aussetzte. Und mit ihm waren auch alle anderen Diener und sonstigen Männer, die hier angestellt waren, verschwunden, auch ihre Gesellschafterin, die wirkliche Doña Inez Rafaela, die hier nur scheinbar die Besitzerin dieser Burg war, für die sich Miss Morgan nur unter dem spanischen Schleier ausgab.
Das heißt, geflohen war dieses ganze Gesinde und Gesindel nicht. Alles hatte sich nur unsichtbar zu machen gewusst, was in dieser winkligen Burg und in dem von vielen Gängen und Treppen durchzogenen Felsen so leicht möglich war. Miss Morgan konnte klingeln, so viel sie wollte, es kam niemand. Sie hatte schon einmal gezeigt, dass mit ihr schlecht Kirschen essen war, und damals war sie gegen jetzt noch ein Lamm gewesen.
»Ich will ihn schon wiederbekommen, jetzt aber vor allen Dingen gilt es dieser Indianerin! Bisher habe ich die noch gar nicht weiter beachtet, sie war ein Nichts in meinen Augen, jetzt erst beginne ich sie zu hassen — ja, die soll meine Rache zu fühlen bekommen!«
Wenn Miss Morgan keine geborene Spanierin war, so hatte sie doch solch einen Charakter. Sie hatte ein Stilett in der Hand, das sie aus dem langen Lorgnettengriff gezogen, hatte schon immer mit der gefährlichen Waffe in der Luft herumgefuchtelt, und bei diesen Worten stieß sie die Spitze immer in die roten Atlaspolster eines Sofas.
»So — so — so — und so will ich diese rote Teufelin durchbohren! Aber so schnell soll sie mir nicht daran sterben! Und der Graf soll ihren Qualen zusehen!«
Die Tür wurde geöffnet und der Kopf des Hausmeisters steckte sich vorsichtig durch die Spalte.
»Miss, tun Sie mir nichts — es geschehen noch Zeichen und Wunder — die Indianerin ist wieder da!«
Das war allerdings eine Meldung, welche die Wut der Miss vergessen machte. Sie wollte es nicht glauben.
»Die Atalanta, die rote Athletin?!«
»Dieselbe Indianerin, die den Grafen vor einer Stunde abgeholt hat, steht schon wieder unten. Sie ist zurückgekommen, hat am Tor geklingelt und fragt, ob Doña Rafaela zu sprechen sei?«
»Es ist nicht möglich!«
»Es ist Tatsache. Sie steht unten im Hausflur.«
Miss Morgan musste es wohl glauben.
»Hat sie den Grafen wieder mitgebracht?«
»Nein, das freilich nicht.«
»Ist sie allein?«
»Ganz allein.«
»Wie ist sie denn gekommen?!
»Zu Fuß. Wenigstens über die Landzunge.«
»Was will sie denn?«
»Die Doña Rafaela sprechen.«
Miss Morgan raffte sich zusammen, um ihre Gedanken ordnen zu können.
Es gab nur eine einzige Erklärung. Die Indianerin kam zurück, um sich mit ihr im Guten auseinander zu setzen. Das heißt nicht etwa, um ihr Vorschläge zum Guten zu machen, sondern um ihr den Grafen zurückzubringen. Sie hatte sich in der Entführung geirrt, der Graf war damit gar nicht einverstanden gewesen, er selbst wollte wieder zurück.
Eine andere Erklärung gab es nicht. Hätte die Indianerin andere Vorschläge zu machen gehabt, so hätte sie doch erst geschrieben oder sich in ganz anderer Weise genähert, hätte der Feindin auf neutralem Boden zu begegnen versucht, wo sie gesichert war und gleiche Waffen wie jene besaß.
Wenn sie sich jetzt sofort nach jenem kecken Eindringen zum zweiten Male direkt in die Höhle des Löwen begab, so musste sie auch den befreiten Gefangenen sofort wiederbringen, eine andere Möglichkeit gab es einfach nicht, oder — man hatte es mit einer Wahnsinnigen zu tun.
Das war der Gedankengang des Weibes gewesen, wenn es auch nur wenige Sekunden dazu gebraucht hatte.
»Ich will sie empfangen. Trägt sie Waffen bei sich?«
Das konnte der Hausmeister, der unterdessen völlig eingetreten war, freilich nicht sagen.
»Nun, mag sie bewaffnet sein wie sie will. Ich begegne dieser hinterlistigen Dirne natürlich mit der nötigen Vorsicht. Führe sie in das Turmzimmer, da ist sie so wie so gefangen, ich spreche zu ihr durch eine Klappe, und bei der geringsten verdächtigen Bewegung, die sie macht, ehe sie noch die Hand an eine Waffe legen kann, drücke ich auf den Knopf und sie stürzt durch die Falltür in die Tiefe...«
»Diese Vorsichtsmaßregeln sind unnötig!«, erklang da eine fremde Stimme; in der Tür erschien die Indianerin und stand mit zwei Schritten vor Miss Morgan.
»Doña Rafaela oder wie Du heißen mögest, Du sollst nicht sagen können, dass Atalanta, die letzte der Mohawks, feige gewesen sei. Zu der Befreiung des Grafen gebrauchte ich eine List, weil ich um den Grafen besorgt sein musste. Ich hätte schon vorhin Dein Automobil anhalten und Dich herausreißen können — aber ich komme direkt in Deine Wohnung, um Dich mitten zwischen Deinen Wächtern zur Verantwortung zu ziehen. Weib, Du wirst uns fernerhin keinen vergifteten Kuchen mehr schicken, wirst uns nichts mehr unter das Essen mischen, und wenn Du Dich wirklich in eine leichenausgrabende Hyäne verwandeln kannst, ich will Dich doch wiedererkennen!«
Während Atalanta dies sprach, hatte Miss Morgan wie erstarrt dagestanden, weniger durch den Blick dieser Augen in Bann gehalten, als weil sie dies alles eben gar nicht zu fassen vermochte, sie stierte der Indianerin in das bronzefarbene Antlitz und lauschte ihren Worten, vielleicht gar nicht glaubend, dass ihre Todfeindin da wirklich in Fleisch und Blut vor ihr stand.
Es war eben abermals die verwegenste Überrumpelung, nur wieder in ganz anderer Weise ausgeführt.
Und ehe Miss Morgan nur daran dachte, dass sie ja ein Stilett in der Hand hatte, wurde diese Hand am Gelenk mit eisernem Griffe gepackt, und in der anderen Hand der Indianerin glühte es plötzlich auf, es war ein Stempel, durch zwei grünumsponnene Drähte mit ihrem Gürtel verbunden, und dieser glühende Stempel brannte sich in eine weißte Stirn ein, es zischte und qualmte.

Ein gellender Schrei des Schmerzes und der Wut, das blitzende Stilett in der wieder freigelassenen Hand zuckte durch die Luft — traf aber auch nur die Luft, die Gebrannte stürzte vorwärts nach der Tür und — stieß mit dem Hausmeister zusammen, taumelte, raffte sich wieder auf und rannte auf den Korridor.
Da sah sie die Indianerin ganz unten auf der Treppe schon um die Ecke biegen. Die holte sie nicht mehr ein.
»Haltet sie, verschließt das Tor, schießt sie nieder!«, heulte es durch die Treppengänge.
Miss Morgan stürzte in den nächsten Raum, in dem sich ein Telefon befand, und verband sich mit der Torwache.
Ja, dort war man bereit, diese tolle Indianerin im Hinterhalte zu empfangen.
Nur schade, dass sie nicht kam.
»Sie ist durchs Fenster ins Meer gesprungen — dort taucht sie auf — dort schwimmt sie!«, wurde gerufen.
Miss Morgan stürzte in ein Waffenzimmer, stand im nächsten Augenblick mit einer langen Entenflinte am Fenster, andere folgten ihrem Beispiel.
Ja, dort schwamm sie, oder war nur einmal aufgetaucht, um Luft zu schöpfen, tauchte fünfzig Meter entfernt wieder auf, ein Dutzend Schüsse krachten.
Aber diese Indianerin war im Wasser nicht zu schießen. Dort, wo ihr Kopf eben noch gewesen war, hagelten die Kugeln und Schrotkörner ein, da aber tauchte der Kopf schon wieder an einer ganz anderen Stelle auf, und dieses neue Ziel musste in dem unsicheren Mondschein doch erst wieder genommen werden.
»Das Motorboot klar!«
Wieder wurde es eine Verfolgung im Wasser. Aber eine ganz andere als damals im Sklavensee. Jetzt hatte die Schwimmerin keinen gelähmten Mann auf dem Rücken zu tragen!
Natürlich hatte das Motorboot die Schwimmerin schnell eingeholt. Wenn man überhaupt von einer Schwimmerin sprechen konnte. Sie war ja gar nicht zu sehen, nur ihr Kopf tauchte alle Minuten einmal auf, um sofort wieder zu verschwinden.
»Nicht schießen, fangt sie lebendig!«, kommandierte Miss Morgan, im Vorderteile des offenen Fahrzeug stehend, dem Steuernden, der hinten frei am Ruderrad stand, immer die Richtung angebend.
Nur noch dreißig Meter war man von der Stelle entfernt, wo der Kopf zuletzt aufgetaucht war.
»Der linke Arm!«, erklang es da hinter dem Boote, gleichzeitig krachte ein Schuss, und der Steuermann ließ unter einem Wehelaut seinen linken Arm von den Speichen sinken, eine Kugel hatte ihn zerschmettert.
Dieser einzige Schuss genügte. Da erkannte auch Miss Morgan in ihrer maßlosen Wut, dass sie gegen diese Indianerin, wenn sie so schwimmen und tauchen konnte, gar nichts ausrichten konnte. Diese hatte im Wasser einen zu großen Vorteil. Und wie die schießen konnte, das hatte sie schon im Zirkus zu New York gesehen, sie hatte jetzt eben wieder einen Beweis davon bekommen. Die tauchte hier und da auf, immer gerade dort, wo man sie am wenigsten vermutete, und schoss einen nach dem anderen weg. Sie war noch großmütig gewesen und hatte das Leben des Steuermanns geschont.
Da gab es nur noch eines.
»Nach der Küste!«
Als sich kein anderer Mann zum Steuern des Bootes hergab, ergriff Miss Morgan selbst die Speichen.
Sie erreichten die Küste, fuhren an dieser hin und her — warteten und schmiedeten vergebens Pläne, wie die Schwimmerin im sicheren Hinterhalte zu empfangen sei. Man sah keine Schwimmerin sich nähern, keinen Kopf mehr auftauchen.
Dass aber die Indianerin wohlbehalten das Ufer erreichet hatte, das erfuhr Miss Morgan am anderen Tage in aller Frühe, als sie, noch im Bett liegend, sich den hundertsten kühlenden Verband um die Stirne legte, viel zu sehr erschöpft, um noch wüten zu können.
Der Postbote hatte der Doña Inez Rafaela einen Brief gebracht, der folgendermaßen lautete:
Sie tragen an Ihrer Stirn das Todestotem der Mohawks. Sobald Sie mir noch
einmal begegnen, muss ich Sie töten. Das ist eine mir heilige Pflicht. Ich hätte
es schon in dieser Nacht tun müssen, als Sie mich verfolgten. Noch einmal
schonte ich Sie, weil ich Sie vorher noch nicht gewarnt hatte. Jetzt wissen Sie es.
Bei unserer nächsten Begegnung sind Sie des Todes! Atalanta.
Am Ufer des Sklavensees auf einer großen Waldblöße, aber auf der einen Seite direkt vom Wasser begrenzt, grasten zwei Pferde und sechs Maultiere, die mit alledem bepackt gewesen waren, was hier aufgestapelt lag. Hauptsächlich waren das große Benzinbehälter, ein ansehnlicher Handwerkskasten und ferner ein Tragstuhl, welcher, gewissen Vorrichtungen nach, leicht zwischen zwei Tiere gehängt werden konnte.
Es lagen noch verschiedene andere Gegenstände herum, zu dem allen brauchte man aber nicht sechs Maultiere, denn man muss so ein Maultier im Gebirge oder im spanischen Amerika gesehen haben, was dieses Tier trotz seiner schlanken Beine im Gepäcktragen Fabelhaftes leistet.
Nein, diese paar Benzinbehälter und der Tragstuhl und alles andere, was hier lag, hatten für die sechs Maultiere gar nichts zu bedeuten gehabt. Waren sie nicht leer mitgekommen, so hatten sie noch etwas ganz anderes tragen müssen.
Weiter saßen auf der Waldblöße zwei Männer in neuen Jagdkostümen, Arno und Littlelu; sie waren damit beschäftigt, aus abgeschnittenen Ästen einen käfigähnlichen Kasten zusammenzunageln und mehr noch zusammenzubinden.
»Hören Sie, Littlelu, ich glaube nicht, dass da ein Schakal hineingeht.«
»Warum denn nicht?«
»Nun, weil er sich hüten wird, in dieses vergitterte Stübchen zu kriechen. Die haben hier anderes zu fressen als das Stückchen Fleisch, das Sie da als Köder hineinhängen wollen.«
»Er muss hinein, er muss, er muss! Ich werde mir doch nicht von den Viechern die ganze Nacht die Ohren voll heulen lassen.«
»Schießen Sie sie doch weg.«
»In der Nacht? Ich bin ein solider Mann, Bummelant, ich schlafe in der Nacht.«
»Dann stellen Sie doch Schlingen.«
»Stelle ich auch noch. Aber auch hier in den Kasten will ich einen hinein haben.«
»Wozu denn nur?«
»Das werden Sie sehen, wenn ich das Vieh habe.«
»Wozu soll der Kasten aber denn nur so ungeheuer lang werden?«
Denn das wurde die Gitterfalle. Wie ein Sarg, ein Mensch hätte drin Platz gehabt.
»Weil es der Schakal drin bequem haben soll! — Doch da kommt sie wieder!«
In weiter Ferne war hinter einer bewaldeten Insel ein großer Vogel aufgetaucht, der bald riesenhafte Dimensionen annahm — ein Aeroplan.
Tags zuvor war die Flugmaschine hier montiert worden, seit dem ersten Sonnenstrahl flog heute Atalanta über dem See hin und her, immer strichweise, als wolle sie jeden Punkt des zwei Quadratmeilen großen Wasserspiegels einmal mit den Drachenflügeln beschattet haben. Nur hin und wieder beschrieb sie auch große Bogen, veränderte manchmal die Höhe, flog aber selten höher als vierzig Meter, sodass es von Weitem aussah, als ob sie ganz dicht über dem Wasser schwebe.
Schon seit sechs Stunden trieb sie das so und war unterdessen zweimal hier auf dieser Waldblöße gelandet, um ihren Benzinvorrat zu erneuern.
Landung und Abflug waren stets glatt verlaufen, der Apparat funktionierte überhaupt ausgezeichnet, die Fabrik konnte jetzt mit Recht kolossale Reklame für ihn machen.
»Hat diese Indianerin eine Ausdauer!«, meinte Arno kopfschüttelnd.
»Haben Sie je gezweifelt, dass die Ausdauer hat? Was die sich in den Kopf gesetzt hat, setzt sie durch.«
»Ich glaube aber nicht. dass sie auf diese Weise etwas findet.«
»Warum denn nicht? Sie hat ja erst den vierten Teil des Sees abgeflogen. Doch sehen Sie, sie kommt hierher, sie zeigt die Flagge, sie will landen!«
Knatternd schwebte der Aeroplan heran, zum dritten Male erfolgte auf der Waldblöße, die dazu wie geschaffen war, eine glatte Landung.
»Gefunden!«, sagte die Indianerin in ihrer phlegmatischen Weise, als sie aus dem Sattel stieg.
Arno hätte auch gern so aufschnellen mögen, wie es der Clown tat.
»Gefunden?!«, konnte er nur in den staunenden Ruf mit einstimmen.
Wenn sie ihre Behauptung nicht zurücknahm oder sich getäuscht hatte, so hatte diese Indianerin durch eigene Überlegung und Tatkraft das Geheimnis gelöst, das sie auf dem Rücken trug, sie brauchte keinen Schlüssel mehr dazu.
Es gibt eine optische Erscheinung, mit der sich die Physik aber noch gar nicht beschäftigt hat, denn es fehlt jede Handhabe, sie nach Regeln zu ordnen. Man beobachtet Tatsachen, die man trotzdem nicht aneinander reihen kann. Das Wasser in den geschlossenen Schwimmbassins ist oft nicht so reinlich und klar, wie es sein möchte. Hinten im tiefen Teil kann man den Grund meistens nicht erkennen, mag das Wasser auch spiegelglatt sein. Hat nun die Halle eine Galerie, vielleicht sechs bis acht Meter hoch, geht man hinauf und blickt von dort oben herab, so ist das dunkle Wasser plötzlich ganz durchsichtig, man erkennt auf dem Grunde jeden größeren Gegenstand, durch ein gutes Opernglas jede Stecknadel.
Wie kommt das? Einerseits ist es ganz einfach, anderseits wieder kompliziert. Die Physik hat sich mit diesem Phänomen, dass eine Wasserschicht durchsichtiger erscheint, wenn man sie aus einer gewissen Höhe betrachtet, noch gar nicht beschäftigt. In größerer Höhe schwindet diese Durchsichtigkeit wieder, und diese Grenzen kennt man nicht. Es kommt dabei auch gar zu viel in Betracht, das Wasser muss ganz still sein, es kommt auf die Farbe des Grundes, auf die Beschaffenheit des Wassers und auf vieles andere an, was sich nicht so leicht kontrollieren lässt.
Austernfischer und Seeleute, die den Anker verloren haben, kennen diese Erscheinung längst, sie spähen von einer Rahe herab ins Meer, aber der Erfolg ist doch sehr zweifelhaft.
Atalanta hatte von dieser Erscheinung gar nichts gewusst, hatte sie von selbst entdeckt. Damals, als sie wiederholt aus den Fenstern jener Felswand herabblickte, hatte sie beobachtet, dass sie den tiefen Grund ganz deutlich sehen konnte, was vom Boot aus nicht möglich gewesen war.
Allerdings war sie zu einem falschen Schlusse gekommen, nämlich zu dem, dass sie den Grund des Sees überall sehen konnte, wenn sie sich nur hoch genug darüber in der Luft befand.
Erst hatte sie hier ein hohes Gerüst bauen wollen, das herumgezogen werden sollte. Aber wie lange hätte das gedauert, diesen großen See abzufahren, da brauchte sie doch viele Hilfskräfte dazu. Dann hatte sie an einen Luftballon gedacht. Das war noch komplizierter. Dann war sie auf die Flugmaschine gekommen.
Sie hatte bei ihren heutigen Flügen trübe Erfahrungen gemacht. Das war doch nicht so einfach. Nur selten sah sie Grund, die Tiefe war untaxierbar, und flog sie über genau dieselbe Stelle zum zweiten Male, nur etwas tiefer oder höher als vorhin, so war wieder nichts zu sehen.
Aber sie hatte die Energie und Ausdauer nicht verloren — und sie hatte gesiegt.
»Du hast etwas auf dem Grunde liegen sehen?!«, fragte Arno.
»Ja. Ich sah auf dem dunklen Boden einen großen, ziemlich kreisrunden Fleck von gelber Farbe, jedenfalls auch erhöht, also einen Haufen, soweit ich das aus solcher Höhe beim schnellen Fliegen beurteilen konnte. Daneben verstreut noch mehrere kleinere gelbe Punkte.«
»Gefunden, der Goldschatz ist gefunden, kein Zweifel mehr!«, jubelte Arno, obgleich er doch früher von diesem Goldschatze gar nicht viel hatte wissen wollen. »Wo war es?«
»Gar nicht weit entfernt von jener der Felswand gegenüberliegenden Insel, auf der wir damals kampierten und auf der wir die Spur des Damenstiefels fanden.«
»Hast Du den Fleck durch die Boje markiert?«
»Ich ließ sie fallen, und sie fiel sehr gut. Als ich noch einmal darüber flog, sah ich die schneeweiße Eisenkugel dicht neben dem gelben Haufen liegen.«
»In welcher Tiefe?«
»Das zu beurteilen war mir unmöglich. Es können drei, es können aber auch dreißig Meter Wassertiefe sein. Es ist auch der reine Zufall, dass ich diese Stelle gefunden habe. Ich hatte einmal mein gradliniges System verlassen, hatte einen weiten Abstecher gemacht.«
»Atalanta, sei nicht zu bescheiden. Du hättest Dein System durchgeführt und wärest auch über diese Stelle gekommen.«
»Hätte aber vielleicht nichts gesehen. Ich bin viermal über diese Stelle geflogen. Das erste Mal sah ich den gelben Fleck und ließ die Boje fallen. Das zweite Mal hielt ich mich einige Meter höher und sah nichts. Das dritte Mal kam ich zu tief und sah wieder nichts. Das vierte Mal zeigte mir der empfindliche Manometer dieselbe Höhe an wie beim ersten Male, und da sah ich den gelben Fleck wieder, daneben die weiße Kugel. Es ist mit dieser Durchsichtigkeit des Wassers wie bei einem Teleskop, einem Fernrohr, das für jede Entfernung verschieden und ganz genau eingestellt werden muss, will man etwas sehen.«
»Trotzdem, Du darfst von keinem Zufall sprechen. Wollen wir hin?«
»Sofort. Mindestens um erst die Tiefe zu loten und zu sehen, was wir für Apparate brauchen, um das Gold zutage zu fördern.«
Am Strande lag wieder solch ein Lederboot, von Atalanta in San Francisco neu angeschafft. Es hatte schon zu ihrer Ausrüstung gehört, als sie diese Expedition allein hatte machen wollen, fasste aber doch bequem drei und auch vier Mann, ja, es trug im Notfall eine größere Last.
Bis nach jener Insel mochte ungefähr eine Stunde Wasserfahrt sein. Nach kurzer Beratung wurde beschlossen, dass alle drei hinfuhren, während sie das Gepäck einfach hier liegen ließen ohne jede Vorsichtsmaßregel. In den unkultivierten Gegenden Amerikas wird, wie wohl überall in der Welt, wo noch keine Schutzleute postiert sind und Gendarmen patrouillieren, herrenloses Gut ganz anders respektiert als ein in der Straße einer Stadt verlorenes Portemonnaie.
Die Pferde und Maultiere erhielten an langen Lassos, an denen sie auch das Wasser erreichten, neue Grasflächen angewiesen, Arno wurde ins Boot gehoben, Atalanta nahm ein großes Seilbündel und einige hakenförmige Instrumente mit, zu denen ja auch ein Hammer gehört, das Boot selbst war diesmal mit einem kleinen Anker ausgestattet, und fort ging es. Der eifrigste Ruderer war Arno, der sich ausarbeiten wollte.
Schon nach zwanzig Minuten Fahrt war jene Insel erreicht. Es war natürlich nicht nur eine weißgefärbte Eisenkugel gewesen, die Atalanta als Markierzeichen hatte fallen lassen, die hätte allein zu wenig Zweck gehabt, sondern es war eine Boje, an der kleinen Kanonenkugel war eine lange Schnur befestigt und am anderen Ende wieder eine rote, kopfgroße, hohle Holzkugel.
Und dort schwamm die rotleuchtende Kugel auf dem Wasser, keine dreißig Meter vom Ufer der Insel entfernt, viel abgetrieben konnte sie wohl auch nicht sein, es herrschte Windstille, die Wasserströmung, die von Osten nach Westen ging, war, wie schon früher gesagt, kaum zu merken.
Trotzdem wurde die hundert Meter lange Schnur ganz vorsichtig eingeholt. Zuletzt spannte sie sich doch etwas schräg, es musste vorsichtig gerudert werden, bis sie senkrecht hinabging, dann ließ man den Anker fallen, er fasste Grund, und aus der Länge der nötigen Ankerleine konnte man erkennen, dass hier das Wasser sechsundzwanzig Meter tief war.
»So tief kann kein Mensch ohne Apparat tauchen!«, sagte Arno.
»Nein, auch ich nicht!«, entgegnete Atalanta etwas eigentümlich.
So tief gehen auch die malaiischen Perlentaucher an der Küste von Aripo auf Ceylon nicht hinab. Was unter zweiundzwanzig Meter ist, gilt als unerreichbar, das ist ja auch recht gut, das sind eben die Schonstätten der Muscheln. Apparattauchen ist dort nicht erlaubt. Und den Tauchern, welche bis zwanzig Meter hinabgehen, kommt dann das Blut aus Mund, Nase, Ohren und Augen, obgleich es doch geborene Fischmenschen sind.
»Erst wollen wir einmal angeln!«, sagte Atalanta.
Jeder nahm einen anders geformten Haken, Leine war genügend vorhanden. Atalanta selbst benutzte erst ein Bleigewicht, unten mit einer Höhlung, in die sie aus einer Büchse ein stark klebendes Fett schmierte. Das ist das Lot der Seeleute, mit dem sie außer der Tiefe auch die Beschaffenheit des Meeresbodens untersuchen, die in erreichbarer Tiefe auf den Seekarten verzeichnet ist. An dem Fett bleibt der Sand- oder Kies- oder Schlamm- oder Muschelgrund kleben.
Aber an diesem Lote hier wollten keine Goldstücke hängen bleiben, weder gemünzte noch ungemünzte, nur klebten kleine Steinchen daran. Bald gab Atalanta diesen Versuch auf und griff ebenfalls zu einem hakenförmigen Eisenstab.
»Es beißt, es beißt, es beißt!«, schrie Littlelu.
Seine Angelleine hatte sich straff gespannt. Vorsichtig wurde sie in die Höhe gezogen. Bald tauchte im Wasser ein gelber Schein auf, er wurde immer leuchtender, bekam Formen, und schließlich konnten die sonderbaren Angler einen riesenhaften Pantoffel ins Boot ziehen — — aber keinen gewöhnlichen, sondern einen, der aus purem Gold gefertigt war.
Der Gegenstand glich der Form nach ganz einem Holzpantoffel, der nicht weiter beschrieben zu werden braucht. Zwischen der dicken Sohle und dem oberen Teile hatte er auch eine Höhlung, für den Fuß eines Riesen berechnet. Das Ding war eine halbe Elle lang und wog mindesten fünfundzwanzig Pfund. Für das Kilogramm Feingold zahlt die Münze etwas über zweitausend Mark, darunter sinkt der Goldwert niemals. Und nach gediegenem Golde sah das ganz aus.
Das Nächste war, dass Littlelu den schön gearbeiteten Pantoffel in seine Arme nahm und ihn mit verklärten Augen betrachtete.
Arno musste zuerst eine Erklärung geben.
»Das sieht ganz danach aus, als wäre das die Fußbekleidung einer Statue, eines Götzen gewesen!«, rief Arno aus. »Dass die alten Mexikaner ihre Göttergestalten mit goldenen Gewändern bekleideten, ist erwiesen, so wie es die alten Griechen taten, zum Beispiel bei der Göttin Athene auf der heiligen Akropolis.«
Die Richtigkeit dieser Ansicht wurde bestätigt, als Atalanta jetzt an ihrem Haken eine für einen Riesen berechnete Jacke zum Vorschein brachte, mit kurzen Ärmeln, aus lauter kleinen Kettengliedern bestehend, also ein Kettenhemd, ebenfalls aus Gold. Wäre nicht alles so dünn und zierlich gearbeitet gewesen, hätte man die Last gar nicht heben können. Aber vierzig Pfund wog das Ganze doch noch.
Wenige Augenblicke später wurde Arnos Anglertätigkeit von Erfolg gekrönt. Diesmal aber war es kein Bekleidungsstück, sondern ein Topf mit Henkel, den der Haken Arnos gefasst hatte, ein gewöhnlicher Kochtopf von mittlerer Größe — oder auch nicht so ganz gewöhnlich, denn er war ebenfalls aus starkem Gold.
Dann wurde ein goldener, fingerdicker Stab, oben mit einem Ring versehen, zutage gefördert, hierauf eine riesenhafte Hand, dem Pantoffel entsprechend, einen halben Meter lang, hohl, doch nicht etwa von Blech, sondern von gediegenem Gold und etwa dreißig Pfund schwer.
Atalantas starker Haken hatte inzwischen schon wieder etwas gefasst, was sie nicht heben konnte oder das Boot wäre gekentert.
Die Leine wurde nach der Insel ausgefahren, Atalanta und Littlelu begannen am Ufer zu ziehen, erst ohne Erfolg, bei noch größerer Kraftanwendung drohte die Leine zu reißen, bis der Widerstand plötzlich doch nachgab.
Groß genug war die Last doch noch, bis es mit einem Male einen Ruck gab und ganz leicht ging. Der Haken schien abgeglitten zu sein oder das Seil war gerissen. Dem war aber nicht so. Der Haken kam zum Vorschein, und daran hing eine goldene Kette, etwa einen Meter lang, aus sechs spannenlangen Gliedern bestehend, also aus zusammengebogenen Goldstäben, mehr als zollstark, jedes Glied etwa fünf Pfund schwer.
Hierzu möge folgende kurze Erklärung dienen. Als Fernando Cortez mit seinen spanischen Räuberscharen Mexiko eroberte, brachten die Azteken als Lösegeld für ihre gefangenen Fürsten goldene Tempelgerätschaften. Alles Gold schien für die Tempel verwendet zu werden. Das Gold in den Häusern der Fürsten und Reichen kam dagegen gar nicht in Betracht. Diese Tempelgerätschaften gaben die Mexikaner hin. Nicht aber die goldenen Ketten, die in allen Tempeln die Hauptrolle spielten. Diese Ketten waren den Azteken ein heiliges Symbol, genau wie uns Christen das Kreuz.
Und so war es auch in Peru, das von Pizarro erobert und ausgeplündert wurde. Auch hier spielten in den Tempeln goldene Ketten die Hauptrolle. Alles gaben die Peruaner her, die Inkas und Priester, um sich vor den weißen Teufeln zu retten, nur diese Ketten nicht. Von solch einer Kette sind uns mehrere Beschreibungen überliefert worden, von spanischen Gefangenen gemacht, unabhängig voneinander und doch ganz übereinstimmend.
Auf dem Hochplateau von Oberperu, viertausend Meter über dem Meere, liegt der Titicacasee. Auf seinen zahlreichen Inseln hatten die Peruaner ihre heiligsten Tempel, kolossale Bauten, zum Teil heute noch sehr gut erhalten. Was dort für Schätze angehäuft gewesen sind, davon können wir uns heute keine Vorstellung mehr machen. Der gefangene Inka Atahualpa versprach, das große Gemach, in dem er sich gerade befand, mit goldenen Gerätschaften zu füllen, wenn man ihn freiließe. Pizarro verlangte viermalige Füllung. Innerhalb weniger Stunden wurde der große Raum viermal mit goldenen Schüsseln gefüllt. Trotzdem wurde der Inka dann von den schurkischen Spaniern verbrannt, angeblich weil er kein Christ werden wollte.
Der nächste Tempel hatte dies alles geliefert. Und in den Heiligtümern am Titicacasee sollen noch andere Schätze aufgehäuft gewesen sein. Aber davon bekamen die Spanier nichts. Das ist alles im See versenkt worden. Darunter nach glaubwürdigen Berichten eine goldene Kette von 233 Ellen Länge mit armstarken Gliedern. Ums Jahr 1840 wurde solch ein Kettenglied zufällig aufgefischt. Es brach ein Goldfieber aus wie jedes Mal, wenn dort irgend ein kleiner goldener Gegenstand aufgefischt wird. Auch dort ist eine Erforschung des Grundes schon mit dem Luftballon versucht worden. Aber der Titicacasee ist 252 deutsche Quadratmeilen groß und im Durchschnitt 160 Meter tief, es gibt aber auch Tiefen von 300 Metern, und an den flachsten Stellen werden die peruanischen Priester die Heiligtümer wohl nicht versenkt haben.
Diese Kette hier im Sklavensee, welche bei ihrer Hebung riss, war offenbar viel länger.
Für Littlelu genügte schon dieser Meter mit den sechs Gliedern.
»Meine Uhrkette!«, jubelte er und hing sich das mächtige Ding vor den Bauch.
Atalanta lud die goldenen Gerätschaften aus dem Boote, das auch nichts mehr hätte tragen können, Littlelu nahm sie in Empfang, legte sie aber nicht ans Ufer, sondern wusste sie sehr schnell anderweit zu verwerten.
Den goldenen Topf setzte er sich als Zylinder auf den Kopf, dann schlüpfte er in das Panzerhemd, das ihn wie ein Schlafrock umgab, befestigte sich die dreißig Pfund schwere Kette am Gürtel, trat mit dem rechten Fuß in den Pantoffel, griff mit der linken Hand in den großen goldenen Handschuh, nahm aus der Tasche einen Doppeladler und klemmte sich das große Goldstück als Monokel ins Auge, nahm in die rechte Hand den Goldstab — und spazierte so gravitätisch am Ufer hin und her.
»Kinder, ich bin doch ein feiner Kerl!«, rief er ein über das andere Mal.
Er bückte sich, um eine rote Blume abzupflücken, hatte aber die größte Mühe damit, denn er trug ja an die zwei Zentner Gold am Leibe. Endlich gelang es ihm, er steckte sich die Blume an den goldenen Schlafrock und humpelte mit seinem ungeheuren Pantoffel auf die Indianerin zu, dabei einen ungemein komischen Anblick darbietend.
Erst zog er einmal den Topf am Henkel vom Schädel und wackelte mit der ungeheuren Hand.
»Miss Atalanta — äh — Sie wissen — ich habe für Sie stets geschwärmt — Sie waren von jeher der Traum meiner Nächte —«
Und so fuhr er fort in seiner Liebeserklärung, er machte Atalanta einen regelrechten Heiratsantrag.
Während die bronzenfarbene Indianerin wie eine Bronzefigur dastand, brüllte Arno vor Lachen.
»Hören Sie auf, hören Sie auf, ich kann nicht mehr, mein Kopf, mein Kopf!«
So heulte er, richtete sich auf und — sprang plötzlich aus dem Boote ans Ufer.
Den folgenden Schrei hatte die Indianerin ausgestoßen.
Das Goldmännchen war erstarrt, noch starrer stand Arno da, sprachlos.
Dann hob er langsam beide Arme zum Himmel empor, das verstummte Lachen verwandelte sich in ein verklärtes Lächeln.
»Ich — habe — den Gebrauch meiner Füße — wieder. Gelobt seist Du, gnädiger Gott!«
Da durfte der Clown seine Bemerkung nicht unterlassen, und sie war auch gar nicht so unangebracht. Der Prophet Jesaias sagte einmal beim Anblick zweier Spaßmacher, dass diese trotz aller Sünden großen Anspruch auf das Himmelreich hätten, weil sie die Menschen zu erheitern wüssten.
»Und ich! Warten Sie, ich werde Ihnen gleich die Doktorrechnung ausschreiben.«
Aber es sollte nicht so spaßig weitergehen.
Beim ersten Schritt, den Arno machen wollte, stieß er einen Schrei aus und brach wieder zusammen.
Und es war ein Schrei der furchtbarsten Seelenqual gewesen.
Nur für einen Moment hatte er den vollständigen Gebrauch seiner Beine wieder erhalten, ganz zweifellos durch das erschütternde Lachen bewirkt, es hätte ihm ein Trost sein können — aber wer vermag gleich so zu urteilen? Sein Unglück hatte ihn wieder einmal gepackt.
Laut aufschluchzend drückte er sein Gesicht in den grasigen Boden.
Der Komiker machte ein tödlich erschrockenes Gesicht, riss die Goldsachen schnell ab, gab dem Schlafrock noch einen verächtlichen Tritt, dann stand er finster und unbeholfen da. Solch einer Situation war er nicht gewachsen.
Atalanta war schnell zu dem Gestürzten hingesprungen und kniete neben ihm nieder. Diesmal tröstete sie ihn nicht mit Worten, wie die Mutter ihr Kind, sie fragte auch nichts — sie begnügte sich, ihm sanft das Haar zu streicheln.
Dann aber begann sie leise zu singen, sie fing mit dem Refrain eines bekannten deutschen Liedes an.
Gern geb' ich Glanz und Reichtum hin,
Für Dich, für Deine Liebe.
Hierauf erst setzte sie mit dem zweiten Verse ein.
Ich werde Deiner stets gedenken,
Dein Bild vergessen nicht.
Der Himmel soll die Kraft mir schenken,
Dass mir das Herz nicht bricht,
Die Zukunft bringt mir kein' Gewinn,
Bleibt hoffnungslos und trübe.
Gern geb' ich Glanz und Reichtum hin,
Für Dich, für Deine Liebe.
Erstaunt hob Arno den Kopf.
Ja, das Staunen darüber, die Indianerin so singen zu hören, ließ ihn sofort alles andere vergessen
»Kannst Du denn Deutsch, Atalanta?«
Es wäre angebracht gewesen, dass die Indianerin jetzt ein höchst erstauntes Gesicht gemacht hätte.
»Nein. Nur einige Brocken!«, entgegnete sie sachgemäß.
»Woher kennst Du dieses deutsche Lied?«
»Welches deutsche Lied?«
»Das aus Lortzings ›Waffenschmied‹.«
»Ich verstehe Dich nicht, Arno.«
»Du hast doch soeben dieses Lied gesungen.«
Die Indianerin strich ihm nochmals über das Haar, nur dass ihre Hand etwas länger auf seiner Stirn verweilen blieb.
»Ich habe nicht gesungen, Arno.«
Wir selbst sagten es vorhin, Atalanta habe gesungen. Wir hörten es nur mit Arnos Ohren.
»Wie, Du hättest nicht gesungen?!«
»Nein.«
»Miss Atalanta hat nicht das leiseste Tönchen von sich gegeben!«, sagte jetzt auch der sich nähernde Littlelu. Das Lied aus Lortzings ›Waffenschmied‹ soll sie gesungen haben? Nein, das hat sie nicht!«
»Und ich kann schwören, dieses Lied ganz deutlich vernommen zu haben, erst den Refrain und dann den zweiten oder letzten Vers. Ich kenne dieses Lied so wörtlich überhaupt gar nicht. Aber ich habe doch jedes Wort vernommen!«
»Ist es nicht möglich, dass Du Dich getäuscht hast, dass Du eine Gehörhalluzination hattest?«
Sofort legte sich die Indianerin hin, teilte das Gras, presste das Ohr dicht an den Boden. Da erst ahnte Arno etwas, folgte ihrem Beispiel. Und da — —
»Ich bin ein kleines Vögelein — ich bin ein kleines Vögelein«, sang es dort unter der Erde klagend, und dann fuhr es noch klagender im Sprechen fort: »Und ich kann nicht auf den zweiten Vers kommen — ach, mein Kopf, ach, mein armer Kopf!«
»Die Irrsinnige, von der Sie mir erzählt haben!«, flüsterte Littlelu, gleichfalls am Boden liegend.
Atalanta machte ihm ein gebietendes Zeichen, still zu sein. Aber man hörte nichts weiter und sie erhob sich.
»Also jene Personen sind doch noch in der Nähe. Aber wir wollen nicht gleich schließen, dass sich die Sängerin hier direkt unter uns befinden muss. Es kann sich wieder um eine akustische Leitung handeln. Wir wollen uns jetzt überhaupt gar nicht weiter darum kümmern. Ich will nicht jetzt schon nach Spuren suchen. Erst wollen wir dieses Geldgeschäft erledigen, um dann unsere ganze Aufmerksamkeit dieser zweiten Sache zu widmen. Vorausgesetzt, dass sie es überhaupt wert ist.«
Sie hatte während der letzten Worte nach Arno geblickt.
Der saß mit gefalteten Händen da, blickte wieder zum Himmel empor und machte wiederum ein recht glückliches Gesicht.
»Gott, ich danke Dir, dass Du den Erdgeist hast zu mir sprechen lassen, und ich will nie wieder so unglücklich sein, Dir nie wieder solche Vorwürfe machen wie vorhin. Amen!«
»Amen!«, wiederholte Littlelu, lüftete seinen breitrandigen Schlapphut, den er wieder trug, steckte die Hände in die Hosentaschen und schlenderte nach dem Strande.
Dieser Clown und Komiker hatte ihn verstanden. Atalanta sicher auch. Aber mit Worten lässt sich nicht erklären, was Arno gemeint, es lässt sich nur fühlen. Jedenfalls gibt es noch größeres Unglück als gelähmte Beine. Doch dies war es auch nicht, er hatte ja von einem oder von dem Erdgeist gesprochen, dessen Stimme er gehört habe.
»Und auch Deine Stimme habe ich gehört«, setzte er lächelnd hinzu, als er mit der Indianerin allein war, »Du hast dennoch gesungen — durch den Erdgeist, der mir näher steht als Gott, den ich nicht begreifen kann. Aber einen Erdgeist kann ich begreifen.«
Sofort verwandelte sich das ernste, gewöhnlich starr zu nennende Antlitz der Indianerin, es wurde weich und freundlich, es lächelte heiter, als sie sich jetzt neben ihn setzte.
»Was habe ich Dir durch den Erdgeist gesungen?«, ging sie sofort darauf ein, als fände sie das ganz selbstverständlich.
»Soll ich es Dir vorsingen?«
»Bitte, singe.«
»Es ist nur der erste Vers, den ich im Kopfe habe.«
Sie hatte seine Hände in die ihren genommen, und mit leiser und doch so voller, prächtiger Baritonstimme begann er:
Du lässt mich kalt von hinnen scheiden,
Misstraust der Treue Schwur,
O gönne mir als Trost im Leiden
Den Schein der Hoffnung nur.
Verschmähst Du, weil ich vornehm bin,
Nur meines Herzens Triebe?
Gern geb' ich Glanz und Reichtum hin
Für Dich, für Deine Liebe.
»Die ersten beiden Zeilen passen gar nicht auf uns beide«, fügte er lächelnd hinzu, »und wiederum die letzten beiden Strophen müsstest eigentlich Du singen. Denn ich habe nicht viel Glanz und Reichtum hinzugeben, bei Dir aber scheint er sich jetzt anzuhäufen. Und doch ist es so schön!«
»Ja, es ist so schön, es passt dennoch so gut!«, wiederholte und ergänzte die Indianerin ganz verklärt.
Noch einige Zeit saßen die drei seltsamen Menschen schweigend am Ufer beisammen, dann ermahnte die Indianerin zur Wiederaufnahme der Arbeit des Schatzhebens und ihre beiden männlichen Begleiter waren damit einverstanden.
Sie gingen wieder ins Boot. Auch Arno musste hinein. Atalanta hätte ihn nicht allein am Ufer gelassen, wenn dieses auch mit einem Sprunge zu erreichen gewesen wäre, oder Littlelu hätte bei ihm zurückbleiben müssen.
Aber wie sie die Haken auch warfen, diese wollten die Kette nicht wieder fassen. Und auch an der durch die Boje bezeichneten Stelle hatten sie gar kein Glück mehr. Erschöpft konnte der Goldschatz noch nicht sein. Arno brachte noch einmal einen sehr großen und sehr schweren Gegenstand herauf, alle drei mussten Hand anlegen, aber ehe man ihn richtig erkennen konnte — nur einen gelben Schein sah man — schnippte er wieder vom Haken ab und konnte nicht wieder gefasst werden.
»Ich muss aus San Francisco doch einen Taucherapparat kommen lassen!«, sagte Atalanta. »Ich habe mich deswegen in so einem Geschäft schon erkundigt, brauche nur hinzuschreiben, er wird sofort geschickt. Ehe ich den teuren Apparat kaufte, wollte ich mich aber doch erst vergewissern, ob an der ganzen Sache überhaupt etwas ist. Der Apparat wird von einem geschulten Taucher gebracht. Es ist nicht nötig, dass wir ihn in unser Geheimnis einweihen. Aber wir müssen uns erst von ihm ausbilden lassen. Das Tauchen will gelernt und geübt sein, und 26 Meter sind schon eine ganz beträchtliche Tiefe. Der Mann wird uns also im Tauchen unterrichten —«
»Uns?«, unterbrach Littlelu die Sprecherin. »Mich nicht. Ich bin wasserscheu. Ich gehe jährlich nur zweimal ins Wasser, zu Pfingsten und zu Weihnachten. Und nur mit der nötigen Vorsicht!«
»Sie werden mir Luft zupumpen.«
»Luft zupumpen? Das tue ich gern. Ich pumpe Luft, ich schenke sie Ihnen sogar. Ich — halloh!«
Littlelu hatte dabei ins Wasser geblickt immer den Haken dirigierend — und plötzlich kam in dem Wasser etwas Graues pfeilschnell emporgeschossen, ein schnauzbärtiges Gesicht tauchte auf, ein heftiges Niesen, dicht vor dem Gesicht des Komikers, ein jauchzendes Bellen, die Erscheinung war wieder verschwunden.
»Der Seehund — unser Seehund ist wieder da!«, rief Arno fröhlich, musste dann aber erst über Littlelu lachen.
Der sprudelte und wischte sich krampfhaft das Gesicht ab.
»Ihr Seehund? Hören Sie, wenn das Ihr Seehund ist, den haben Sie aber schlecht erzogen. Niest mir der Kerl direkt ins Gesicht, und mit was für einer Ladung!«
Da erschien der Seehund wieder, hatte einen großen Fisch im Maule, richtete sich auf, klammerte sich mit den flossenähnlichen Vorderfüßen an den Rand des Bootes, ließ den noch zappelnden Fisch hineinfallen, blieb noch hängen, blickte die Indianerin an, als erwarte er einen Dank und ließ sich von ihr streicheln. Littlelu hatte von ihm bereits erzählt bekommen.
Nach dieser empfangenen Liebkosung ließ er wieder ein jauchzendes Bellen erschallen, dann verschwand er abermals und brachte diesmal einen Aal.
»Hier, Seal, bleibe hier!«, rief Atalanta, als sich der Seehund wieder entfernen wollte.
Er blieb denn auch, schwamm im Wasser auf der Stelle, aufmerksam nach der Indianerin blickend.
Diese nahm einen großen Eisennagel, zeigte ihn dem Tiere, warf ihn in einiger Entfernung ins Wasser — der Seehund tauchte ihm sofort nach, hatte den sinkenden Nagel bald gefasst, brachte ihn zurück, ließ ihn sich aus dem Maule nehmen, jauchzte vor Freude und forderte dadurch die Indianerin gewissermaßen auf, ihn noch mehr apportieren zu lassen.
»Littlelu, Ihr goldenes Monokel!«, rief Atalanta.
Die beiden anderen wussten sofort, woran sie dachte.
Man sah, wie das große Goldstück schnell hinabsank, etwas schaukelnd, man sah, wie der Seehund ihm nachtauchte, danach schnappte und es zurückbrachte.
»Wie kann man ihn veranlassen, dass er von allein leichtere Goldsachen vom Grunde heraufbringt?«
Das musste allerdings überlegt werden. Das Tier war klug genug, es kam nur auf den Menschen an, seinen Wunsch ihm verständlich zu machen.
»Ich werde ihn einmal festhalten, bis das Goldstück schon den Grund erreicht hat. Ob er aber auch sechsundzwanzig Meter tief hinab kann?«
»Es ist an gezähmten Seehunden«, erklärte Arno, der sich also hierfür einmal interessiert hatte, »denen man Tiefmesserinstrumente anband, konstatiert worden, dass sie bei der Jagd auf Fische bis achtzig Meter tief hinabgehen. Vielleicht aber auch noch viel tiefer!«
Littlelu sollte währenddessen seine Leine mit dem daran befestigten Haken wieder auswerfen und rief nun plötzlich aus: »Halt, bei mir hat etwas gebissen!«
Es war wieder ein goldener Henkeltopf, den er zutage förderte, kleiner als der erste, aber mit viel dickeren Wänden.
Aufmerksam hatte der Seehund diesem Manöver zugeschaut, dann tauchte er unter, kam so schnell wieder, dass man kaum glauben konnte, er sei unterdessen schon auf dem Grunde gewesen — und es war doch so, er präsentierte einen goldenen Teller. Dem klugen Tiere hatte das Auffischen jenes Topfes genügt, er brauchte weiter keine Aufforderung.
Nun aber ein freundliches Streicheln und anerkennende Worte, er dankte durch Niesen und jauchzendes Bellen, verschwand wieder und brachte abermals solch einen Teller geschleppt.
Und so ging das fort und fort. Unausgesetzt holte der Seehund solche goldene Teller herauf, oder mehr flache Schalen, alle von ganz gleicher Form und Größe, jeder mindestens zwei Pfund schwer.
Von den Ureinwohnern des nördlichen Amerikas wissen wir gar nichts, sie haben uns nur wenige Gerätschaften und einige ganz rätselhafte Bauwerke hinterlassen, von denen noch später berichtet werden soll — die alten Peruaner und Mexikaner sind uns hingegen sehr gut bekannt geworden.
Man darf nicht sagen, dass das Gold bei ihnen keinen Wert gehabt hätte. Sie benutzten es nur nicht als Geld, sondern als Tauschmittel.
Den Wert des Goldes wussten sie sonst schon zu schätzen. Es wurde von allen Metallen am seltensten gefunden, so häufig es auch bei ihnen vorkam, es hatte von allen ihnen bekannten Substanzen das größte Gewicht, war dabei dennoch so weich, ließ sich so leicht bearbeiten, so schön polieren und behielt seinen Glanz — es war den Göttern geheiligt. Nur die höchsten Personen durften sich bei Feierlichkeiten damit schmücken, sonst kam alles Gold in die Tempel.
Diese Götter mussten gefüttert werden. Man setzte ihnen in goldenen Schalen Speisen vor — die dann von den Priestern und Tempeldienern verzehrt wurden. Je mehr gefüllte Schüsseln den Götzen vorgesetzt wurden, auf desto mehr Gnade durfte man hoffen. So kam es, dass das meiste Gold immer wieder zu neuen Schüsseln verarbeitet wurde. Solche Schüsseln und Teller waren es, fast alle von der gleichen Form und Größe, welche den Spaniern schiffsladungsweise ausgeliefert wurden, von den Peruanern wie von den Mexikanern.
Bei den Urbewohnern des benachbarten Kaliforniens wird es nicht anders gewesen sein. Die Mexikaner versicherten, dass dort oben noch viel, viel mehr Gold sei. Cortez konnte es nicht erreichen. Die mit Donnerbüchsen und Bluthunden kommenden Spanier haben nur kurze Zeit gebraucht, um blühende, unter höchster Kultur stehende Länder wieder in eine Wildnis zu verwandeln. Die Vernichtung der nördlichen Ureinwohner Amerikas durch das von Nordosten kommende Jägervolk, das wir Indianer genannt haben, dürfte Jahrhunderte gedauert haben. Da hatten diese Eingeborenen mehr Zeit, ihre Schätze oder vielmehr Heiligtümer in Sicherheit zu bringen. Es waren also solche goldene Tempelschalen, welche der Seehund unermüdlich zum Vorschein brachte. Die konnte er am leichtesten fassen. Manchmal brachte er auch gleich zwei, die übereinander gelegen hatten. Auch einmal einen Topf, ein oder zwei Kettenglieder, aber sonst doch nur solche gleichförmige Schüsseln. Und er wollte nicht müde werden, er hoffte nur auf einen freundlichen Dank, dann ein Niesen und ein Jauchzen, und er tauchte wieder unter. Es machte ihm das größte Vergnügen.
Gold ist Gold. Es beherrscht nun einmal diese Erde, wie es jetzt ist. Arno konnte seine Aufregung nicht unterdrücken, wie er in dem Boote die gleißenden Schätze sich aufhäufen sah.
»Atalanta, wie soll das enden?!«
»Das kann ich Ihnen ganz genau sagen«, entgegnete Littlelu, der seit einiger Zeit seine Taschenuhr beobachtete. »Jeder Teller wiegt mindestens zwei Pfund, es ist sehr weiches, sehr reines Gold, und jeder dieser Teller ist unter Brüdern mindestens fünfhundert Dollars wert. Mindestens alle zwei Minuten bringt der Seehund einen herauf — ich will ganz bescheiden, wie ich immer bin, damit rechnen, dass er jedes Mal nur einen einzigen heraufbringt. Das sind in der Stunde dreißig Teller oder fünfzehntausend Dollars. Das sind pro Tag zu vierundzwanzig Stunden — oder ich will dem Tiere täglich vier Stunden Ruhe gönnen — das sind täglich dreimalhunderttausend Dollars. Sonntags wird nicht gearbeitet, dazu die anderen großen Feiertage — ich will nur dreihundert Tage rechnen — das sind pro Jahr neunhundert Millionen Dollars. Ein feines Geschäft, nicht wahr?«
Die beiden anderen lachten über das Finanzgenie Littlelus, dann ruderten sie ans Ufer, luden die Schüsseln aus, ohne sie zu zählen.
Nach wie vor brachte der Seehund einen goldenen Teller nach dem anderen, legte ihn am Ufer nieder, wollte von der Indianerin nur ein freundliches Wort hören und verschwand dann wieder. Die größere Entfernung spielte dabei gar keine Rolle, er brauchte dazu nicht längere Zeit als vorhin.
»Eigentlich«, begann Littlelu wieder, seine Uhr betrachtend, »bleibt der Kerl doch immer recht lange aus. Wenn ich mir den Weg hin und her berechne — ich würde nur die Hälfte der Zeit dazu gebrauchen. Es sitzt gar kein Trieb dahinter. Aber sagt man was, wird's gleich übel genommen. So, da ist wieder ein Tellerchen. Aber warum der nur immer bloß so kleine Tellerchen bringt?! So ein großer, kräftiger Bursche. Da liegen doch noch ganz andere Dinger unten. Aber das kennt man ja. Nur immer das Leichteste aufheben. Doch wo bleibt denn nun der Bummelant?«
Der Seehund kam nicht wieder.
»Dort schwimmt er!«, rief Arno aus.
Er schwamm wahrhaftig davon und kehrte nicht zurück.
»Da sehen Sie! Diese Kanaillen! So sind sie alle. Erst erbarmt man sich ihrer, gibt ihnen Arbeit, und wenn es richtig anfangen soll, dass man selbst endlich etwas verdient, dann gehen sie ab und streiken.«
Schon längst hatte sich die Sonne hinter finsteren Wolken verborgen, in einer Stunde musste es Nacht sein.
»Wir müssen an die Tiere denken, in der Nacht muss jemand dort bleiben!«, sagte Atalanta.
»Dieser jemand werde ich sein!«, bestimmte Littlelu, sich schon anschickend, ins Boot zu steigen. »Ich will dort heute überhaupt noch meine Mausefalle aufstellen.«
»Es wird regnen.«
»Kann ich es ändern? Es wird hier genau so regnen wie dort. Gute Nacht, wünsche wohl zu ruhen.«
Er ruderte ohne Weiteres davon, hielt aber nach den ersten Schlägen noch einmal inne und blickte zurück.
»Das heißt — dass ich's nicht vergesse — ich komme morgen früh wieder und hoffe Sie beide hier noch zu finden. Oder wenigstens meine Hälfte Gold. Gute Nacht.«
Sie blickten ihm noch einige Zeit nach, Arno lachend, die Indianerin tiefernst wie immer.
»Dem sein Kopf steckt voll Schrullen wie das Ei voll Dotter!«, sagte sie dann, als sie sich umkehrte, und es hatte aus ihrem Munde komisch genug geklungen.
»Ein guter Kerl!«, meinte Arno fast gerührt. »Wie eilig er es hatte, dass Du nicht etwa auf den Gedanken kämest, dort die Nachtwache zu übernehmen. Und es ist doch gar keine Kleinigkeit, dort so einsam in der Regennacht zu kampieren. Er ist doch kein Hinterwäldler.«
»Er ist ein Mann!«, entgegnete die Indianerin kurz und doch so inhaltsvoll.
Sie trug Arno unter einen Baum, dessen dichtes Laubdach dem Regen wohl lange Zeit trotzen würde, später spannte sie auch noch eine wasserdichte Decke auf, jetzt suchte sie erst genügend trockene Äste zusammen, machte ein Feuer, nahm einen der goldenen Topfe, füllte ihn mit Wasser und tat ein Stück von dem mitgenommenen getrockneten Fleisch hinein. Auch der Tee wurde in Gold bereitet, ebenso wurde von goldenen Tellern gegessen.
Der goldene Topf auf dem Feuer sah merkwürdig genug aus, noch merkwürdiger aber war eigentlich, wie Atalanta das so ganz selbstverständlich fand und gar keine Bemerkung deswegen machte.
So mögen auch die erobernden Indianer diese goldenen Gerätschaften benutzt haben, wenn sie einmal solche fanden, sie mögen darüber gemurrt haben, dass sich das Zeug so schnell abnutzte, so leicht verbeulte, dass man daraus nicht einmal eine Pfeilspitze machen konnte.
Es wurde finster und begann zu regnen. Desto traulicher aber war es hier am Feuer. Sein Widerschein spiegelte sich dort in dem aufgehäuften Golde.
»Ja, Atalanta«, begann dann Arno, »wir dürfen uns als reiche Leute betrachten. Wahrscheinlich als solche von unerschöpflichem Reichtum. Wie wollen wir das Gold benutzen? Wollen wir hier eine blühende Kolonie entstehen lassen? Für gute, fleißige Menschen ein Paradies schaffen, soweit ein solches auf dieser Erde möglich ist?«
Unverwandt starrte die Indianerin in das Feuer. Es dauerte lange, ehe sie Antwort gab. Und dann machte sie zwischen jedem Satze eine größere Pause.
»Auf diesem See und seinen Ufern liegt ein Fluch und sehr bald wird sich dieser Fluch bemerkbar machen, gleich im Anfang in heftigster, fürchterlichster Weise.
Wir können diesen Goldfund nicht verheimlichen. Es wird bekannt werden, auch wenn wir selbst kein Wort darüber sprechen. Die Winde werden es flüsternd verraten. Gold, rotes, gleißendes Gold, dort im See des Felsengebirges ist es gefunden worden!
Und sie werden kommen. In hellen Scharen werden sie kommen. Verwegene Männer, die nichts weiter besitzen, als was sie auf dem Leibe tragen, dazu noch ein Bowiemesser und einen Revolver mit einigen Dutzend Patronen. Die sonst nichts als ihr Leben zu verlieren, aber alles zu gewinnen haben.
Ich brauche kein Gold. Ich will gern alles verschenken, aber rauben lasse ich mir nichts. Ich werde für mein Eigentum kämpfen. Ich habe nicht nötig, um Militär zu bitten, dieses kommt von selbst. Die Abenteurer werden mit Messer und Revolver unter sich wüten, und — ich sehe die Zukunft ganz deutlich vor mir liegen — diese amerikanischen Soldaten werden sich in Räuber verwandeln, mit denen ich zu kämpfen habe. Denn es ist Gold, rotes, gleißendes Gold, das sie beschützen sollen.
Doch einmal wird hier wieder Ordnung und Sicherheit herrschen.
Dann werden die Ansiedler kommen, denen ich den Boden freigebe, denen ich die modernsten Maschinen zur Verfügung stelle, dass sie den Urwald ausroden können.
Doch der Fluch des Goldes bleibt bestehen.
Es ist alles nur Lug und Trug.
Erst kam die rohe Gewalt, sie unterlag der größeren Macht — dann versucht man es mit List.
Die Ansiedler arbeiten hier nur, um sich hier aufhalten zu können. Bei jeder Gelegenheit wird nach dem Golde gefischt.
Ja, dieser Gedanke wird einschlummern. Aber es braucht nur einmal ein einziges Stückchen Gold zufällig aufgefischt zu werden, so wird die alte Gier mit doppelter Gewalt erwachen.
Sie werden das Säen vergessen und die Ernte verfaulen lassen.
Sie werden das Messer und den Revolver gegeneinander erheben.
Und so wird es hier bleiben, so lange Gold als Gold gilt.
Auf diesem See und seinen Ufern ruht durch das in ihm verborgen liegende Gold ein Fluch, den niemand bannen kann.
Ich habe gesprochen.«
Das junge Mädchen hatte wie ein alter Indianerhäuptling am Beratungsfeuer gesprochen.
»Du irrst, Atalanta!«, erwiderte ihr Arno nach kurzem Überlegen.
Da zeigte diese Indianerin einmal, dass sie auch des Staunens fähig war. Urplötzlich war sie emporgezuckt und staunend blickte sie den an, der diese drei Worte gesprochen hatte.
»Ich — irre mich?!«
»Ja. Jetzt lass mich einmal sprechen.
Es sind noch nicht zwei Jahre her, ich sehe mich noch, als wäre es gestern gewesen, meine Eskadron abreiten.
Und ich sehe sie alle noch deutlich, diese sonnenverbrannten Germanengesichter — die meisten mit einem kaum sichtbaren Bärtchen — die meisten so scharf und kühn und doch so treuherzig — ich sehe noch, wie die meist blauen Augen mir folgten und dann mit einem Ruck, den man zu hören meinte, wieder geradeaus sahen.
Die meisten waren Bauernsöhne, Bauernknechte. In den meisten hatte bisher eine Intelligenz geschlummert, die beim Militär nur geweckt werden musste.
Atalanta, ich kann Dir den Charakter dieser Männer nicht schildern. Du brauchst nur so ein Gesicht zu sehen, dann weißt Du es selbst.
Diese und solche Männer wollen wir hierher kommen lassen, sie hier ansiedeln. Sie sind meist schon entlassen, sind durch ganz Deutschland verstreut. Schadet nichts, ihre Adresse kann man leicht erfahren. Die meisten werden verheiratet sein, seine Braut hatte schon jeder. Desto besser. Sie sollen nur möglichst viel mitbringen, Frauen und Bräute und Kinder, Geschwister und gleichgesinnte Freunde. Auch die Urgroßmutter sollen sie nicht einzupacken vergessen. Desto fester hält dann der Kitt.
Diese Männer wollen wir kommen lassen. Jeder soll so viel Land bekommen, wie er bebauen will und kann. Natürlich als sein Eigentum. Und dann sollst Du einmal sehen, was hier für ein Leben wird. Ich sage Dir, Atalanta: Auch meine Arme sollen verdorren, wenn sich diese Männer um das auf dem Grunde liegende Gold kümmern. Das gehört nicht ihnen, und damit basta! Hierüber darf man eigentlich kein weiteres Wort verlieren, es klingt wie eine Beleidigung.
Diese Männer wollen nichts weiter als ihre freie Scholle haben. Und diese ihre Scholle wissen sie zu verteidigen, und das, was wir unter ihren Schutz stellen, dazu.
Du sollst einmal sehen, Atalanta, wenn so eine Schwadron deutscher Dragoner mit geschwungenem Pallasch angefledert kommt — wie da Deinen amerikanischen verwegenen Abenteurern das Herz auf Nimmerwiedersehen in die Hosen rutscht!
Ich habe gesprochen.«
Er hatte so wie die Indianerin gesprochen, in deren Augen es immer freudiger aufgeblitzt war. Sie tat auch deswegen keine Frage mehr, nur noch wegen der Ausführung.
»Wie kannst Du sie benachrichtigen?«
»Das ist sehr einfach. Im Regimentsbüro bekommt man die Adresse jedes Einzelnen. Aber ich weiß noch einen besseren, kürzeren Weg. Ich hatte einen guten Freund, den Leutnant von Bernsdorf. Er ist jetzt noch dabei, muss noch fünf Jahre warten, ehe er Aussicht hat, Oberleutnant zu werden. Er ist fünf Jahre zurückversetzt worden, wegen einer bösen Affäre, in die er verwickelt wurde, obgleich er mit tadelloser Ehre daraus hervorging. Kurz bevor ich mit Dir diese abenteuerliche Fahrt antrat, bekam ich einen Brief von ihm. Er möchte des Königs Rock gern an den Nagel hängen, möchte Landwirt werden. Aber nicht in Deutschland. Er fragte mich, wie es in Amerika wäre. Er verfügt über ziemliches Kapital. Ich konnte nichts weiter tun als ihm eine Adresse nennen, an die er sich deswegen zu wenden habe. Der würde die ganze Sache in die Hand nehmen, würde sofort selbst mitkommen.«
»Er passt zu Dir?«
»Und wie! Paul war überhaupt mein einziger Freund. Ein prächtiger Mensch! Und er hat einmal bewiesen, dass er bereit ist, für mich durchs Feuer zu gehen, für mich alles zu opfern.«
»Und auch jene Leute werden kommen?«
»Atalanta — Du weißt, ich spreche nicht gern über meine Person — und doch, ich darf es mit Stolz sagen — alle jene Leute, die damals in meiner Schwadron gestanden haben, brauchen nur einen Ruf zu vernehmen: Leutnant Graf von Felsmark ist es, der Euch wirbt! — und sie werden alles im Stich lassen, um nach Amerika zu gehen. Mancher mag schon sein eigenes Gütchen haben, aber er wird es ohne Bedenken sofort verkaufen. Leutnant von Bernsdorf wirbt für den Leutnant von Felsmark — da kommen sie gelaufen! Oder es gibt keine Treue mehr. Dass ein Offizier im Regiment bei den Leuten so beliebt gewesen ist, dessen darf er sich wohl mit Stolz erinnern und auch einmal davon sprechen. Es sind meine glücklichsten Erinnerungen.«
Sinnend blickte die Indianerin in das Feuer.
Hätte Arno geahnt, was die sich jetzt für Zukunftsbilder ausmalte, wie dieses junge Mädchen, dessen ganzes Leben nur ihm gewidmet war, ihn noch einmal zu überraschen dachte! Es war gut, dass er nichts ahnte.
»Wir dürfen die Sache nicht übereilen!«, sagte sie dann.
»O nein.«
»Ein ganzes Jahr muss jeder Ansiedler aushalten können. Hier in dieser Gegend, wo Urwald ausgerodet werden muss, kann man mit zwei Jahren rechnen, ehe dem Boden etwas abzuringen ist. Zum schon bestellten Acker gehört ein Betriebskapital von mindestens fünfzig Dollars. Ich habe mich in letzter Zeit darüber etwas erkundigt. Dort mögen drei Zentner Gold liegen, das sind fünfundsiebzigtausend Dollars. Damit kann man nicht viele Familien zwei Jahre lang durchbringen. Und was nun sonst noch alles dazu gehört. Das ist kein Prärieland; zur Ausrodung der Sprigging gehört ein Tiefpflug, der vierundzwanzig Pferde oder achtzehn Stiere erfordert, die können hier aber wegen der Bäume oder Baumstümpfe gar nicht ziehen, da müssen Lokomobile angeschafft werden.«
Ja, die Regierung verschenkt das Urwaldland nicht umsonst! Der kultivierte Urwaldboden im wildesten Amerika kommt am Ende noch viel, viel teurer zu stehen als der fetteste Boden in Altenburg.
»Nun, wir werden doch noch viel mehr Gold finden.«
»Wer sagt Dir, dass der Seehund vorhin nicht das letzte Stückchen Gold heraufgebracht hat?«
Sie hatte recht. Der Advokat Alkara hatte von Hunderten von Millionen gesprochen. Was aber hatte der davon gewusst? Der Vertreter des Professor Dodd hatte für den Sklavensee fünf Millionen Dollars geboten. dem aber war es vielleicht nur darauf angekommen, seine Geheimnisse zu wahren, die er dort in dem hohlen Felsen geborgen hatte.
Jedenfalls war es ganz richtig, nur das als vorhandene Tatsache anzunehmen, was man dort liegen hatte und mit Händen greifen konnte. Alles andere war nur zwecklose Phantasterei.
»Wir setzen unsere Versuche hier natürlich noch fort, dann aber möchte ich erst einmal nach dem Libanon gehen.«
Arno machte große Augen. Er glaubte nicht recht gehört zu haben, fand aber schnell eine Erklärung. In Amerika führen sehr viele Gegenden, Ortschaften, Berge usw. biblische Namen, wie der Amerikaner ja auch seinen Kindern gern biblische Vornamen gibt.
»Ist das ein Berg?«
»Ein ganzer Gebirgszug.«
»Wo liegt er?«
»Nun, in Palästina.«
Arno machte wieder große Augen.
»Was willst Du denn in Palästina?!«, lachte er erstaunt.
»Du entsinnst Dich doch der kleinen, goldenen Kapsel, an der dem Professor Dodd so viel gelegen war und die ich ihm ins Boot werfen musste?«
Ja, deren erinnerte sich Arno. Aber sonst wusste er nichts. Atalanta hatte ihm nichts weiter berichtet, absolut nichts. Oder nur, dass sie damals nach seinem Begräbnis nach dem Sklavensee zurückgewandert und in den Wassertunnel eingedrungen war, dort in dem hohlen Felsen alles ausgeräumt und den fahrbaren Tunnel verschüttet gefunden hatte.
Sonst hatte ihm Atalanta noch nichts erzählt. Nichts von der Affäre in Puebla, nichts von dem Fund im Brunnen, nichts von dem geraubten Pergament.
Arno glaubte nicht anders, als dass sie sich damals sofort nach San Francisco gewandt habe, um dort im Zirkus einige Vorstellungen zu geben, nebenbei sich auf dem Aeroplan übend und Unterrichtsstunden im Bestimmen geografischer Breite- und Längegrade nehmend, was sie hier wohl am Sklavensee benutzen wollte.
Diese Indianerin sprach und berichtete erst, wenn die richtige Zeit dazu gekommen war, wenn es einen Zweck hatte. Darin war sie ganz ein indianischer Charakter. Schade, dass es nicht alle Menschen so machen. Arno hatte sich schon daran gewöhnt, musste sich aber doch oftmals noch über sie wundern.
»Ja. Was war mit der goldenen Kapsel?«
»Ich öffnete sie, sie enthielt ein Blättchen Papier oder ganz dünnes Pergament, das mit Zahlen bedeckt war, und sofort erkannte ich geografische Ortsbestimmungen. Es war ja immer dabei angegeben, ob nördliche oder südliche Breite, ob westliche oder östliche Länge, mit den Anfangsbuchstaben, wie üblich. Es waren acht solcher Bestimmungen, zwei davon bis zur zehntel Sekunde angegeben. Ich las sie zweimal durch und hatte sie für immer im Kopf.«
Hierüber wunderte sich Arno nicht. Das fabelhafte Gedächtnis dieser Indianerin hatte er schon öfters kennen gelernt. Doch etwas Fabelhaftes ist eigentlich gar nicht dabei. Es handelt sich nur um Mnemotechnik, um eine Gedächtniskunst, um Hilfsmittel, etwas für immer im Gedächtnis zu behalten. Wer die nötige Intelligenz und vor allen Dingen Phantasie hat, begreift es sofort, braucht sich nur noch zu üben, und er leistet dann in Sachen des Gedächtnisses Kunststücke, die ein Uneingeweihter womöglich für Hexerei hält. Zahlen lassen sich dabei in Worte verwandeln, die zu einem Geschichtchen zusammengereiht werden. Mehr kann hier darüber nicht gesagt werden. Es ist höchst einfach — — wenn man es kann!
»Ich tat das Zettelchen wieder in die Kapsel«, fuhr Atalanta in ihrer Erzählung fort, »und lieferte sie aus. Dass ich den Inhalt untersucht, konnte der Professor schwerlich vermuten, oder doch sicher nicht, dass ich die Zahlen unterdessen abgeschrieben oder gar auswendig gelernt hätte. Es war ja alles viel zu schnell gegangen, und ich hatte mich mit Absicht dabei mit ihm immer unterhalten.
In San Francisco zog ich zunächst auf der Sternwarte einige Erkundigungen ein, wie man so eine geografische Ortsbestimmung macht, obgleich ich das zu meinem ersten Versuche gar nicht nötig hatte. Denn eine der Bestimmungen galt für die Stadt San Francisco, bis zur zehntel Sekunde gegeben, was einem Rechteck von drei Meter Länge und zwei Meter Breite entspricht, und das kann man doch auf jedem größeren Stadtplane ausmessen.
Die Aufsuchung dieses ersten gegebenen Punktes führte mich in ein Häuschen, das von armen Irländern bewohnt war. Es konnte sich wohl nur um etwas Vergrabenes handeln. Ich ließ die Diele und den Boden aufhacken. Ein Brunnen kam zum Vorschein, von dessen Vorhandensein die langjährigen Bewohner des Häuschens keine Ahnung hatten. Ich tauchte hinab, fand am Grunde gegen fünfzig Stück alte spanische Goldstücke und außerdem eine silberne, zugelötete Dose. Diesen letzteren Fund behielt ich für mich. Die Dose enthielt ein größeres Pergament, beschrieben mit altspanischer Schrift, unterzeichnet von einem Rabbi Eleazar am 12. März 1533. Hast Du von diesem Rabbi Eleazar schon gehört?«
»Nein.«
»Dieser jüdische Gelehrte, ein eminenter Kopf, ein wundersames Sprachengenie, der nur wenige Wochen mit einem fremden Volke zu verkehren brauchte, um dessen Sprache zu verstehen, begleitete den Fernando Cortez als Dolmetscher nach Mexiko, wurde dann einer jener Expeditionen beigesellt, die Cortez nach Norden schickte. Die meisten dieser Expeditionen sind nicht zurückgekehrt, auch die des Rabbis nicht. So weit die historische Tatsache. Für die Spanier spielt dieser Rabbi Eleazar aber noch heute eine große Rolle. Du kennst doch die Sage vom ewigen Juden!«
»Was, nun fängst Du sogar vom ewigen Juden an?«, musste Arno lachen, so spannend er auch diesem Berichte lauschte.
Atalanta gab ihm eine kurze Erklärung, wie sie sich in jener Enzyklopädie darüber orientiert hatte.
Die erste Erwähnung eines ewigen Juden finden wir bei dem englischen Chronisten Wendower, gestorben 1237, der berichtet, er kenne einen armenischen Erzbischof, der den Türhüter des Pontius Pilatus namens Cartophilus noch persönlich kenne, welcher damals den Heiland geschlagen habe und deshalb so lange leben müsse, bis Christus wiederkäme, also bis zum jüngsten Gericht.
Und diese Sage findet man bei allen Kulturvölkern auf der ganzen Erde wieder. Nur mit kleinen Abänderungen wegen der Entstehung des Fluches. Nach der deutschen Sage, ebenfalls bis ins 13. Jahrhundert verfolgbar, ist der ewige Jude der Schuster Ahasverus, welcher, als Christus auf dem Wege nach Golgatha sich mit seinem Kreuze einmal auf der Bank vor dem Hause des Schusters ausruhen wollte, ihn mit dem Leisten fortjagte, worauf Christus zu ihm sagte: »Ich werde ruhen, Du aber sollst wandern, bis ich wiederkomme.«
In Italien wird der ewige Jude Buttadeu genannt, d. h. von Gott verstoßen; in Spanien Espera en Dios, d. h. hoffe auf Gott; der Belgier nennt ihn Isaac Laquedem;: im Arabischen heißt er Fadhila — und so gibt es also kein Volk, das nicht seinen ewigen Juden hat.
Einer so weit verbreiteten Sage muss doch etwas Tieferes zugrunde liegen. Der ewige Jude ist eine allegorische Figur, das ganze jüdische Volk ist damit gemeint, ruhelos und vaterlandslos und dennoch von unverwüstlicher Lebenskraft — eines der größten Rätsel der ganzen Weltgeschichte.
Das breite Volk kann sich nie mit dem Geist einer Sache begnügen. Es muss immer Gestalten von greifbarer Deutlichkeit haben. So ist auch die Person des ewigen Juden entstanden, über den in früheren Jahrhunderten die Religions- und Geschichtsgelehrten allen Ernstes debattierten, als handle es sich um das Wohl und Wehe der Menschheit. Das machten sich zahlreiche Gauner zunutze, überall tauchten ewige Juden auf, die unter dieser Maske besser betteln oder Hokuspokus treiben konnten, bis die Aufklärung des 18. Jahrhunderts mit diesem ruhelosen Geiste aufzuräumen begann. Aber gelungen ist dies doch nur in wenigen Teilen Europas. In Russland, Italien, Spanien wird noch heute steif und fest an den ewigen Juden geglaubt. Und in manchen Gegenden Deutschlands ist es nicht anders.
Im Anfang des 16. Jahrhunderts tauchte in Spanien ein Mann auf, der sich Rabbi Eleazar nannte, ein Mensch, der alles wusste und alles kannte, nur eine einzige Frage nicht beantwortete: die über sein Herkommen.
Dieser Eleazar war jedenfalls ein Zigeuner. Denn zu seiner Zeit sind nachgewiesenermaßen in Spanien die ersten Zigeuner aufgetaucht. Er zog es vor, sich für einen Juden auszugeben und zwar gleich für den ewigen Juden. Entsprechend seiner Zeit befasste er sich auch viel mit Astrologie, wollte Gold machen können usw. Er galt als Zauberer, war und ist heute noch für die Spanier das, was für uns der Doktor Faust bedeutet. Wiederholt wurde er von der Inquisition eingezogen, er sollte als Zauberer, der mit dem Teufel im Bunde stand, gefoltert und verbrannt werden. Aber dieser Jude oder Zigeuner war viel zu gerissen, unter Entschuldigungen entließ man ihn wieder.
Dann also ging er mit Fernando Cortez nach dem neuentdeckten Weltteil, wohl nur, um seinen Wissenshunger zu stillen, drang mit vor nach Norden, nach dem heutigen Kalifornien, und ist dort verschollen.
Das ist vor nun fünfhundert Jahren geschehen. Für die Spanier, und nicht nur für das ungebildete Volk, lebt er heute noch als der spanische Hexenmeister Doktor Faust, als der ewige Jude, über den eine ganze Literatur existiert. — —
So hatte Atalanta berichtet.
Als sie geendet, fragte Arno wieder.
»Und was stand auf dem gefundenen Pergament?«
»Ich kann nur ein wenig Spanisch, und im 16. Jahrhundert wurde ein ganz anderes Spanisch gesprochen und mehr noch geschrieben. Aber es gab doch auch viele Worte dazwischen, die ich verstand, die heute noch modern sind. Vor allen Dingen wurde auf eine Bibelstelle hingewiesen. Kennst Du das Buch der Makkabäer?«
»Es gibt deren drei oder sogar vier, gelesen habe ich die wohl einmal.«
»Wie lauten die ersten acht Verse des zweiten Kapitels des zweiten Buches?«
»Da verlangst Du zu viel von meinen Bibelkenntnissen! Ich kann nicht einmal mehr die Namen der großen Propheten hersagen.«
»Sie lauten: ›Man findet auch in den Schriften, dass Jeremia, der Prophet, die, so weggeführet waren, geheißen habe, dass sie vom Feuer sollten nehmen, wie oben angezeigt, ihnen das Gesetz mitgeben, und befohlen habe, dass sie des Herrn Gebote nicht vergäßen, und sich nicht ließen verführen, wenn sie die goldenen und silbernen Götzen und ihren Schmuck sähen.
Und habe ihnen dergleichen viel mehr befohlen, dass sie das Gesetz nicht aus ihrem Herzen wollten lassen.‹
So stand das auch in derselben Schrift, dass der Prophet nach göttlichem Befehl sie geheißen habe, dass sie die Hütte des Zeugnisses und die Lade sollten mitnehmen.
Als sie nun — jetzt passe auf, Arno! — an den Berg kamen, auf dem Mose gewesen, und des Herrn Erbland gesehen hatten, fand Jeremia eine Höhle; darin versteckte er die Hütte und die Lade und den Altar des Rauchopfers und verschloss das Loch.
Aber etliche, die auch mitgingen, wollten das Loch — also eine Höhle — merken und zeichnen, sie konnten es aber nicht finden.
Da das Jeremia erfuhr, strafte er sie und sprach: ›Diese Stätte soll kein Mensch finden, noch wissen, bis der Herr sein Volk wieder zuhauf bringen und ihm gnädig sein wird.
Dann wird es ihnen der Herr wohl offenbaren, und man wird dann des Herrn Herrlichkeit sehen in einer Wolke, wie er zu Moses Zeiten erschien und wie Salomo bat, dass er die Stätte wollte heiligen.‹«
Die Indianerin schwieg und wartete den Eindruck ab, den ihre Worte auf Arno machten.
Zuerst hatte dieser gar keinen gehabt, er wunderte sich, weshalb ihm Atalanta denn dies vordeklamiere. Dann begann er zu stutzen, und das immer mehr.
»Alle Wetter!«, flüsterte er dann. »Es handelt sich um die Bundeslade?!«
»Und um die Bundes- oder Stiftshütte, die Moses während des Zuges durch die Wüste vorläufig als tragbaren Tempel bauen ließ, und um einen Räucheraltar. Die Hauptsache aber ist die Bundeslade.«
»Wie sah die eigentlich aus?«
»Es war ein Kasten von zweieinhalb Ellen Länge und anderthalb Ellen Breite und Höhe, von Akazienholz, mit feinem Gold inwendig und auswendig überzogen, oben ringsum mit einem goldenen Kranze gefasst, an den vier Ecken mit goldenen Ringen versehen. Zwei Tragstangen von Akazienholz, gleichfalls vergoldet, waren durch diese Ringe gesteckt und durften nie herausgenommen werden. Der Deckel der Lade war von feinem Golde, von gleicher Länge und Breite wie der Kasten selbst: auf demselben waren zwei Cherubim — also Engel — von massivem Golde angebracht, deren Antlitze gegeneinander gekehrt und deren Flügel über den Deckel ausgebreitet waren. Über ihre Größe fehlen die Angaben, das kann man sich aber berechnen. Vielleicht die Hälfte der Größe eines erwachsenen Menschen. Der Deckel der Bundeslade hieß Gnadenstuhl, und unter den Flügeln der Cherubim dachte man sich Jehova thronen, immer oder doch dann, wenn er durch den Mund der Hohepriester seinem Volke seine Gebote kundtat.«
»Woher weißt Du das alles?«
»Aus der englischen Enzyklopädie, es ist ja auch wiederholt in der Bibel beschrieben, am ausführlichsten im zweiten Buch Mosis 25, 10—22.«
»Und was enthielt der Kasten?«
»Die beiden steinernen Tafeln mit den zehn Geboten, ein goldenes Gefäß mit Manna zum Andenken an den Zug durch die Wüste und den Stab Aarons, der gegrünt hatte.«
»Diese Bundeslade, ihr Allerheiligstes, ist den Juden abhanden gekommen?«
»Ja, bei der Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar, unter dem jüdischen König Zedekia, gegen sechshundert vor Christi Geburt. Der Prophet Jeremias, der damals auftrat, der den Fall Jerusalems weissagte, brachte sie rechtzeitig in Sicherheit. Wie es in jenem Kapitel der Makkabäer beschrieben ist.«
»Dass aber so etwas ganz unbekannt ist?«, meinte Arno kopfschüttelnd.
»Ganz unbekannt? Nur Euch... uns Christen. Wir Christen, wenn wir nicht gerade Bibel- und Geschichtsforscher sind, kümmern uns so viel um die jüdische Bundeslade, wie etwa die morgenländischen Juden sich um den deutschen Kaiser Barbarossa gekümmert haben, der in einer Höhle des Kyffhäuers schlafen sollte, bis er bei der Kaiserkrönung zu Versailles erwachte.«
Ein besseres Gleichnis hätte Atalanta nicht herbeiziehen können. Arno hatte aber auch noch einen anderen Grund, die Sprecherin mit einem fast ängstlichen Staunen anzublicken. Diese Indianerin, so waschecht sie auch sonst war, musste eine sehr, sehr gute »Höhere-Töchter-Schulbildung« besitzen. Er hatte schon mehrmals bemerkt, dass er mit der nicht fortkonnte.
»Den Juden«, fuhr sie fort, »sind diese acht Verse aus dem Makkabäerbuche ganz geläufig, und nicht etwa nur den Schriftgelehrten, nicht nur den Männern, sondern auch den Weibern aus den niedersten Schichten der Bevölkerung!«
Nach dieser kurzen Belehrung fuhr Arno weiter zu fragen fort, was denn sonst noch alles auf dem Pergament gestanden habe, und prompt erwiderte Atalanta:
»Wo am 7. Februar nachmittags vier Uhr der Schatten der Nadelspitze des Berges Pisga hinfällt, dort ist der Zugang zu der Höhle, in der Jeremias die Bundeslade verborgen hat.«
Jäh fuhr Arno empor, so weit er konnte. »Alle Wetter!«
»So behauptet jener Rabbi Eleazar.«
»Woher will der das wissen?«
»Da fragst Du mich zu viel.«
»Gibt es sonst noch eine Erklärung?«
»Lass Dir erst erzählen, was ich mit diesem Pergament erlebte. Diese eine Stelle konnte ich also ganz deutlich übersetzen. Es kamen darin so viele Zahlen vor, die sich doch nicht ändern, und Worte, die allgemein verständlich sind. Der Berg, auf dem Moses gestanden und das gelobte Land noch vor seinem Tode wenigstens aus der Ferne geschaut hatte, wurde hier Pisga genannt. Ich brauchte nur in der so ausführlichen englischen Enzyklopädie nachzuschlagen. Jawohl, so hieß dieser Berg. Im 34. Kapitel des 5. Buches Mosis wird er namentlich angeführt, dort wurde Moses auch begraben, ebenfalls ganz geheimnisvoll. — Und es hat niemand sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag. — Er gehört zum Anti-Libanon, östlich vom Jordan, nahe dem Toten Meere, gegenüber lag das alte Jericho. Auch sonst war in der Enzyklopädie dieser Berg sehr genau beschrieben. Das Auffallendste daran ist eine auf einem Nebengipfel stehende Felsensäule, wie eine Nadel aussehend, auch mit einem Öhr, für den Menschen unerreichbar. Alles stimmte.
Die vorangehende Einleitung aber konnte ich nicht übersetzen. Ich erkundigte mich nach einem Gelehrten, der Altspanisch beherrschte. Dass der mir genannte Mann einen echt jüdischen Namen führte, Levi Cohen, war mir gerade sehr lieb. Ich wollte sehen, was dieses Dokument auf einen Juden, der es sofort lesen konnte, für einen Eindruck machte. Der Eindruck war denn auch ein ganz kolossaler, so sehr sich dieser gelehrte Asket, denn ein solcher war er, auch zu beherrschen wusste. Ja, es war ein Asket, ein Märtyrer der Wissenschaft — und der Religion. Ein hochedler Mann! Er nahm nichts geschenkt an, wollte nicht einmal für seine Arbeit bezahlt sein, gab alles, was er sonst bekam, den Armen und lebte nur von Brot und Pflaumenmus. Wirklich ein hochedler Mann, wie ich ihn noch nie getroffen habe. Nur einen einzigen Fehler hatte er: Er mauste —«
Die Erzählerin brach ab, weil Arno erst einmal herzlich lachen musste. Es war gar zu drollig heraus gekommen, bei diesem tiefen Ernste, nach dieser Einleitung.
Dann aber machte auch er ein sehr ernstes, erschrockenes Gesicht.
»Du willst doch nicht etwa sagen, dass der Jude Dir das Pergament gestohlen hat?!«
»Natürlich hat er das getan. Am andern Morgen sollte ich wiederkommen und mir die kostenlose Übersetzung abholen. Ich kam. Aber ich klopfte vergebens an die Tür Nummer 17 in der achten Etage des Building auf dem Prince Square. Herr Levi Cohen war in der Nacht ausgezogen, mit allen seinen Büchern, mit seinem Pflaumenmus und mit meinem Pergament.«
»Und was hast Du da getan?«
»Ja, was sollte ich da tun? Sollte ich etwa zum nächsten Schutzmann rennen und ihm sagen: Hören Sie, Herr Konstabler, der Levi Cohen hat mir die Bundeslade gestohlen, die der Prophet Jeremias vor dem König Nebukadnezar im Pisgaberge versteckt hat?!«
Arno hatte schon wiederholt bemerkt, dass diese Indianerin einen guten Witz besaß, der durch ihren Ernst nur umso drastischer wirkte. Er lachte aus vollem Halse.
»Ja, hast Du Dich denn gar nicht weiter erkundigt, wo der Kerl geblieben ist?«
»Hatte ich nicht nötig. Ich hatte meine Vorsichtsmaßregeln getroffen. Ich hatte mir vorher ein Stück Pergament gekauft und was ich sonst brauchte, pauste das Original durch, übertrug es, malte sauber nach, dann faltete ich das Pergament zusammen, trampelte mit den Füßen darauf herum und behandelte und präparierte es in anderer Weise, sodass es ganz aussah, als ob es fünfhundert Jahre dort im Brunnen gelegen hätte. Nur mit dieser Kopie ist mir der Jude durchgebrannt.«
»Das war sehr vorsichtig, dass Du das Original zurückbehalten hast, aber — nun wissen doch noch andere, was dort zu finden ist, man wird Dir zuvorkommen, Du hast das Nachsehen.«
»Nein, auch das wusste ich zu verhindern. Ich habe mir erlaubt, in der Kopie ein Wort zu fälschen, ein Datum. In dem Original steht: wo der Schatten der Nadelspitze am 7. Februar hinfällt. Ich habe statt dessen den November eingetragen. Und das genügt. Du kannst Dir wohl vorstellen, was das für ein Unterschied ist. Die mögen dort am Pisgaberge nur den Schatten beobachten und berechnen, die finden die Höhle mit der Bundeslade im ganzen Leben nicht!«
Arno starrte die Sprecherin einige Zeit an, bis er endlich hervorbrachte:
»Atalanta — Du bist doch mit allen Hunden gehetzt!«
»Nun, sind wir nicht schon einmal mit Hunden gehetzt worden?«
An jene Wasserjagd hatte Arno bei seinen Worten freilich nicht gedacht. Er äußerte sich hierüber nicht weiter.
»Und Du meinst, jener Jude wird nach Palästina gehen und nach der Höhle suchen?«
»Das ist doch ganz zweifellos. Der arme Gelehrte freilich nicht allein, nicht auf eigene Faust. Der wird sich schon gleich an die richtige Quelle gewandt haben. Hast Du noch nichts von einem Zionsbund gehört?«
»Ja. Das ist eine internationale jüdische Vereinigung, deren Bestreben dahin geht, alle Juden im gelobten Lande wieder anzusiedeln, sie wieder zu einer politischen Nation zu vereinen.«
»Und ein besserer Zeitpunkt als der Fund der Bundeslade könnte doch nicht gewählt werden.«
»Natürlich nicht. Ach, das würde ja eine kolossale Begeisterung unter den Juden geben. da würden auch die mitgerissen werden, die sich in der Fremde sonst wohl fühlen, die die Idee mit der nationalen Vereinigung sogar lächerlich finden.«
»So ist es. Nun, ich möchte ebenfalls hingehen und die Bundeslade suchen.«
»Meinst Du, dass wirklich etwas daran ist?«
»Das wird sich ja finden. Dass aber die Juden, welche diese Sache jetzt in die Hand nehmen, nichts unversucht lassen, das ist doch sicher.«
»Zweifellos. Also sie müssten den 7. November abwarten, nachmittags um vier Uhr.«
»Halt! Das ist nicht nötig. Hast Du schon von einer Schattentransmutation gehört?«
»Ah so! Ich weiß, was Du meinst. Ich habe einmal davon gelesen, in einer Erzählung, wo es auch so etwas nach einer Schattenbestimmung zu suchen gab. Der Astronom kann eine gegebene Schattenbestimmung auch für jede andere Zeit umrechnen.«
»So ist es. Bis zum November ist noch lange hin. Die Juden werden einen Mann mitnehmen — es braucht ja gar kein richtiger Astronom zu sein — der diese Umrechnung versteht. An dem bestimmten Punkte werden sie natürlich keine Höhle oder doch mindesten keine Bundeslade finden. Und mag es der gelehrteste Astronom sein, den sie mitgenommen, mag der noch so beteuern, dass er sich nicht irren kann — sie werden es ihm nicht glauben. Sie werden den 7. November abwarten und Punkt vier Uhr auf den Schatten lauern, den die Nadelspitze wirft. Dann werden sie wiederum nichts finden. Dann aber werde ich vortreten und mir den Levi Cohen, der doch sicher dabei ist, vornehmen, werde ihm die Hand auf die Schulter legen, werde ihn freundlich ansehen und freundlich zu ihm sagen: Mein lieber Levi Cohen, iss nicht so viel trocken Brot mit Pflaumenmus, iss lieber jeden Tag ein Beefsteak, nimm es ruhig an, auch wenn Du es geschenkt bekommst — aber stehle nicht. Den Spaß muss ich mir machen, das ist diese Reise allein schon wert. Und dann werden wir selbst die Bundeslade suchen.«
Wiederum musste Arno herzlich lachen.
»Und was berichtet der Rabbi Eleazar nun sonst noch? Hast Du die Schrift anderweitig übersetzen lassen?«
»Ich selbst tat es. Ich kaufte mir ein Wörterbuch der neuen und der alten spanischen Sprache, es gelang mir ganz leicht.
Eleazar berichtet kurz, dass er mit dem Feldherrn Almansor und dem Hauptmann Diego so weit wie möglich nach Norden vorgedrungen sei. Gegenwärtig seien sie von roten Kriegern umzingelt, ihre Lage sei hoffnungslos, alle wären sie dem Tode verfallen. Da müsse er sich eines Versprechens entledigen. Er habe dem Oberrabbi von Salamanca versprochen, durch astrologische Berechnung herauszubringen, wo Jeremias die Bundeslade verborgen habe. Es sei ihm gelungen. Also dort und dort. Nun könne er aber diese Berechnung dem Oberrabbi nicht mehr überbringen. Er selbst würde zwar dem Tode entgehen, aber er müsse sich dazu in einen Wolf verwandeln, in dieser Gestalt durch die Reihen der Feinde schleichen, und in Wolfsgestalt dürfe er nichts mitnehmen, was er als Mensch bei sich getragen —«
»Was, das steht auf dem Pergamente?!«, staunte Arno.
Ruhig zog Atalanta das Pergament aus dem Busen hielt es ihm hin.
»Überzeuge Dich selbst.«
»Ja, ja, ich glaube es schon. Aber in einen Wolf verwandeln — das ist doch der höhere Blödsinn, davon kann man doch auf alles andere schließen, was das Ganze wert ist.«
»Kann ich dafür?«
»Du hast recht. Fahre nur fort.«
»Also er will sich in einen Wolf verwandeln und als solcher durch die Reihen der Feinde schleichen. Aber dann ist er nicht mehr imstande, sein Geheimnis den Menschen mitzuteilen. Denn er hat den Schwur abgelegt, dass er sich, wenn er sich noch einmal in einen Wolf verwandelt, fünfhundert Jahre lang der strengsten Buße unterzieht, auf dem Gipfel des Himalaja-Gebirges. So schreibt er dies nieder, tut das Pergament in eine silberne Dose, schmilzt deren Deckel zu, wirft sie in den Brunnen, an dem sie lagern, in der Hoffnung, dass sie dereinst gefunden wird, was auch das Wiederfinden des Allerheiligsten des jüdischen Volkes zu bedeuten hat, der Bundeslade, worauf Jehova sein auserwähltes Volk wieder zur alten Herrlichkeit zurückführen wird. Geschrieben am 14. März 1533. Rabbi Eleazar.«
»Na ich danke! So ein Blödsinn! Sich in einen Wolf verwandeln!«
»Du glaubst nicht, dass es Menschen gibt, die sich in einen Wolf verwandeln können?«
Verwundert blickte Arno die Fragerin an. »Um Gottes willen, Atalanta — Du glaubst doch nicht etwa an den Werwolf?!«

Der Werwolf. Diese Bezeichnung rührt vom altgermanischen wer — d. i. der Mann — her. Seit uralten Zeiten bis auf den heutigen Tag geht bei allen Völkern der Erde die Sage, dass es Menschen gibt, die sich zeitweilig in Wölfe verwandeln — oder in entsprechende Raubtiere, bei den Negern spielt dieselbe Rolle die Hyäne, wir bleiben hier beim Wolfe — wie Wölfe leben, Menschen anfallen, Kinder rauben und fressen, und so weiter, bis sie sich wieder zurückverwandeln.
Die Entstehung dieser Sage, dieses Wahnes, ist vollkommen erklärbar. Man findet diesen Aberglauben bei allen tiefstehenden Völkern und Menschen, deren ganze Gedankenwelt sich um die Viehzucht und deren Feinde, die Wölfe, dreht. Sie haben nichts anderes weiter im Kopfe. Dann ist dieser Aberglaube am stärksten in sumpfigen Gegenden verbreitet, wo das Malariafieber herrscht.
Ein Franzose erzählt, wie bei Padua ein Feldarbeiter, der von Lykanthropie befallen wurde, sich in einen Heuhaufen verkroch und seinen Kollegen warnend zurief, sie sollten sich vor ihm hüten, er habe sich in einen Wolf verwandelt.
Wenn es also Menschen gibt, die sich selbst solcher Zauberei und Untaten anklagen, was sollen dann die anderen tun, die auf derselben geistigen Stufe stehen, auch wenn sie nicht an Wahnsinn leiden. Die müssen es dann doch glauben.
»Um Gottes willen, Atalanta, Du glaubst doch nicht etwa an den Werwolf?!«, rief Arno nochmals ganz erschrocken.
»Nein!«, entgegnete sie kurz und fing gleich von etwas ganz anderem an, und das war doch etwas seltsam.
»Hast Du Dich eigentlich schon von einem Arzte untersuchen lassen?«
Nein, Arno hatte hierzu noch gar keine Gelegenheit gehabt, wenigstens hatte er noch keinen Spezialarzt befragt.
»Hätte ich das gewusst, dass ich Dich lebendig wiederfinden würde, hätte ich den Professor Dodd natürlich anders behandelt!«, meinte Atalanta sinnend.
»Anders behandelt?«, wiederholte Arno verwundert. »Bist Du denn mit ihm noch einmal zusammengekommen?«
»Lass Dir erzählen. Nachdem ich hier die Felsenräume ausgeräumt gefunden hatte, wandte ich mich nach Puebla. Denn nach dieser Richtung führte der mit Automobil und Motorboot befahrene Tunnel durch den Felsen. Von Puebla aus drang der Professor und seine Gesellschaft, die er hier unterhält, hier ein. Anders konnte ich es nicht annehmen. Und ich wollte diesen Bösewicht wegen Deines Todes zur Rechenschaft ziehen.
Ich traf in Puebla ein. Mein erster Weg durch die kleine Ortschaft führte mich an einem Kaffeehause vorbei. Da sah ich in dem Salon einen Mann sitzen, der mit anderen Herren Karten spielte. Es war Professor Dodd. Er hatte sich ein total anderes Aussehen zu geben gewusst, aber mein Auge konne er nicht täuschen. Ich erkannte ihn sofort. Ich betrat das Café. Da hatte er die Kühnheit, sich mir auch noch gleich zu nähern und mich dann zu einem Spaziergang durch die Stadt einzuladen.
Ich ging mit ihm. Hätte sich mein Auge noch täuschen können — meine Nase konnte es nicht. Ich machte es kurz, lockte ihn in eine Schlucht, trug ihn zuletzt, band ihn an einen Baum und traf Vorbereitungen, ihn lebendig zu verbrennen.
Meine erste Absicht war dies auch, denn ich bin eine Indianerin. Dann kam ich auf andere Gedanken. Was gilt diesem Manne der Tod? Ich kenne solch einen Charakter. Verachtung — oder vielmehr Nichtachtung, das ist für solch einen selbstbewussten Charakter, der sich über alles erhaben dünkt, die allerschwerste Strafe. Ich drückte meine Nichtachtung gegen ihn dadurch aus, dass ich ihn nichts fragte, gar nichts — gleichzeitig aber drückte ich auf seine Stirn auch mein Totem. Du kennst das Totem der Mohawks, den Fisch, der von einer Schlange umwunden ist. Und weshalb ich ihn so brandmarkte, das sagte ich ihm allerdings: In welche Gestalt Du Dich auch verwandeln magst, ob als Mensch oder als Wolf, der Du schon jetzt bist — ich werde Dich immer wieder erkennen! Du hast mein Totem an der Stirn! Und trittst Du mir noch einmal in den Weg, so muss ich Dich töten! — So sprach ich, schnitt ihn los und ließ ihn liegen.«
Verwundert hatte Arno dieser kurzen Erzählung gelauscht.
»Gebrandmarkt hast Du ihn?«
»Ja.«
»Mit einem Stempel?«
»Ja.«
»Damit Du ihn immer wieder erkennst, falls er sein Aussehen verändert?«
»Ja.«
Diesen Stempel wischt er aber doch einfach wieder ab.«
»Abwischen? Das kann er nicht.«
»Weshalb denn nicht? Hast Du eine so unauslöschliche Farbe?«
»Nicht gebrandmarkt, sondern gebrannt habe ich ihn. Mit dem glühenden Stempel.«
»Du hast ihm den glühenden Stempel auf die Stirn gepresst?!«, flüsterte Arno entsetzt.
Weshalb er sich so entsetzte, das wusste er eigentlich selbst nicht. Verdient hatte jener Unhold ja noch etwas ganz anderes. Es war eben nur das Bild, das er sich jetzt so ausmalte.
Hätte er aber nun gewusst, dass auch die Miss Morgan von der Indianerin auf der Stirn mit dem glühenden Stempel gebrandmarkt worden war — doch das sollte er erst viel später erfahren. Diese Indianerin war nicht so freigebig mit ihren Enthüllungen.
»Wie hatte er sich denn maskiert?«, fragte Arno jetzt, nur um erst auf andere Gedanken zu kommen.
»Er hatte sein Haar blond gefärbt, statt des schwarzen Knebelbartes einen blonden, hochgebürsteten Schnurrbart, sein sonst so blasses Gesicht war sonnenverbrannt und gesund — selbst seine schwarzen Augen hatte er blau zu färben verstanden.«
Arno starrte die Sprecherin groß an.
»Was, seine schwarzen Augen blau gefärbt?«
»Ja.«
»Blaue Augen hatte er?!«
»Ja.«
»Atalanta — hältst Du denn so eine Veränderung der Augen für möglich?«
»Ich halte diesen Professor Dodd noch ganz anderer Kunststückchen für fähig.«
Arno musste es wohl glauben. übrigens erinnerte er sich, dass man sein Auge recht wohl verändern kann, besonders Schauspielerinnen experimentieren oft an ihren Augen herum. Nicht nur durch schwarze Pinselstriche verändern sie das Aussehen, sondern durch Einspritzungen. Eine solche von Belladonna vergrößert die Pupille ungemein, macht das ganze Auge groß und feurig. Von kundiger Hand eingeführt, soll dieses sonst so furchtbare Pflanzengift für das Auge ganz unschädlich sein. Das ist aber wohl nicht möglich. Die Folgen machen sich nur nicht so schnell bemerkbar.
Hätte Arno selbst freilich damals jenen Mister Hampton gesehen, er wäre wohl bereit gewesen, jeden Schwur abzulegen, dass sich Atalanta geirrt haben müsse, dass sie damals geradezu wahnsinnig gewesen sei. Nach ihrer Beschreibung konnte er solch eine Umwandlung schon eher glauben.
»Hatte er in Puebla ein Haus?«
»Eine kleine Villa am Bergabhang. Er zeigte sie mir, schien mich mit hineinnehmen zu wollen.«
»Du bist nicht drin gewesen?«
»Nein. Was kümmerte mich das alles? Dieses Haus stand auf Grund und Boden, der mir nicht gehört. Ich wollte ihn nur bestrafen und ihm meine Nichtachtung beweisen, ihn für künftighin warnen, dass er nicht wieder unsere Wege kreuzt, nichts weiter. Hätte ich freilich gewusst, dass Du noch am Leben bist, hätte ich ihn anders vorgenommen.«
»Inwiefern?«
»Nun, ich denke doch, dass dieser Professor, der Dich gelähmt hat, auch am ehesten ein Mittel kennt, diese Lähmung wieder aufzuheben.«
»Da magst Du recht haben!«, seufzte Arno. »Wo mag sich Professor Dodd jetzt aufhalten?«
»Ich habe bereits nach New York telefoniert, direkt nach seiner Wohnung, natürlich unter anderem Namen, ich tat, als handele es sich um eine Operation, die ihm hoch bezahlt würde. Von dort wurde mir gesagt, dass man jetzt nicht wisse, wo sich der Professor aufhalte.«
»Der Gebrannte wird sich vor den Menschen verbergen.«
»O, das glaube ich nicht. Der bindet sich einfach ein Tuch um die Stirn oder klebt ein Pflaster darauf. Dass er von mir nichts weiter zu fürchten hat, wenn er selbst mir nur nicht wieder in den Weg kommt, das weiß er bestimmt. Nun, ich werde ihn zu finden wissen. Willst Du jetzt nicht schlafen, Arno? Mitternacht ist schon vorüber.«
Der Regen fiel in Strömen, er begann schon durch das Laubdach zu dringen, und so begaben sich denn die beiden unter die schützende Wachstuchdecke.

»Und das ist der Mann, den ich liebe!«, sagte Atalanta, indem
sie neben Arno niederkniete und ihn mehrmals zärtlich küsste.
Arno träumte von Menschen, die sich in die verschiedensten Gestalten verwandelten, er selbst wurde ein Wolf, der aber weiter keine Untaten beging, sondern freute sich nur, dass er so schnell laufen konnte.
Also es war ein ganz angenehmer Traum. Bös aber die Sache, als berittene, russisch gekleidete Jäger auftauchten, die ihn zu hetzen begannen, worauf plötzlich seine Beine den Dienst versagten, oder er lief noch vorwärts, kam aber dabei immer rückwärts, bis ein Schuss krachte und eine Kugel seinen Qualen ein rasches Ende machte.
Dieser Tod war so natürlich, dass er darüber aufwachte, denn das bringt der Traumgott ja alles fertig.
Es dämmerte und wäre wohl schon heller gewesen, wenn nicht solcher Nebel geherrscht hätte. Dabei rieselte es noch immer.
Neben ihm stand Atalanta.
»Ein Schuss ist gefallen.«
Dann hatte Arno dies alles wohl nur in dem Augenblick geträumt, da er im Schlafe diesen Schuss gehört. Denn jeder normale Traum — der im Fieber ist wieder etwas ganz anderes — währt sicher nur einen einzigen Moment.
»Hat Littlelu geschossen?«
»Aus dieser Richtung kam der Schuss wohl. Die Entfernung wage ich nicht zu bestimmen. Der Nebel täuscht sehr.«
»Wenn er unserer Hilfe bedürfte?«
Atalanta blieb die Antwort schuldig. Was hätte sie auch antworten sollen? Man musste warten.
Es begann wieder stärker zu regnen, dadurch wurde der Nebel herabgedrückt, der Wasserspiegel des Sees ward wieder sichtbar, wenn auch noch wie mit einem Schleier verhangen.
»Dort kommt er!«
»Gelobt sei Gott«, seufzte Arno. »wir wollen uns doch lieber nicht wieder trennen, wenn es nicht notwendig ist.«
Das Boot tauchte aus dem Nebelschleier auf, Littlelu ruderte mit Macht und wenige Augenblicke später war er bei dem seiner harrenden Paare angelangt.
»Ihr seid wirklich noch da mit dem Golde?«, stellte er sich erstaunt, als er ans Ufer sprang.
Dann aber hatte er es eilig, etwas Besonderes zu berichten.
»In meine Mausefalle ist richtig etwas hineingegangen, aber kein Schakal, sondern ein Wolf!«
»Ein Wolf?«, rief Arno erstaunt.
Darüber, dass sich ein Wolf gefangen hatte, wunderte er sich nicht. Er wusste, dass es auch in Amerika Wölfe gibt. Sie sind etwas kleiner als die europäischen und asiatischen, sind entweder schwarz und weiß gefleckt wie die schottischen Schäferhunde, denen sie überhaupt sehr ähneln, oder ganz schwarz. Im Sommer ziehen sie sich zwar nach dem kälteren Norden zurück, aber es gibt auch einzelne Exemplare, Einsiedler, vom Rudel ausgestoßene, die ihr Jagdrevier nie wechseln.
Littlelu fuhr nun, auf Arnos Frage eingehend, fort:
»Ein ganz schwarzer Wolf. Aber die Hauptsache ist nun. wie ich mir den Burschen, der die Stäbe zu zerbeißen sucht, näher betrachte, da sehe ich, dass er etwas Merkwürdiges vorn auf dem Kopfe hat, wie eine Figur. Ich musste ihn totschießen. Er hat sich wohl erst kurz vor Tagesanbruch gefangen, hätte sich bald durchgebissen. Wie er gegen mich den Rachen aufsperrte, schoss ich hinein, die Kugel ging durch den Kopf und kam oben am Schädel wieder heraus. Nun zog ich ihn am Schwanze heraus und betrachtete mir das Ding näher, das er am Kopfe hatte. Der Wolf war vorn an der Stirn gezeichnet, gebrannt, so wie man hier die Rinder und Pferde brennt, und zwar mit einem Fische, um den sich eine Schlange windet!«
Arno blickte nach der Indianerin. Auf die schien diese Nachricht nicht den geringsten Eindruck gemacht zu haben.
»Wissen Sie, Littlelu, dass dies das Totem der Mohawks ist?«, sagte sie kurz.
»Das Totem der Mohawks? Das ist mir neu. Sie trugen keine solche Tätowierung auf Ihrem Körper, den ich in Ihrer Kinderzeit mit Öl einzusalben mehrmals die Ehre hatte.«
»Es ist das Totem der Mohawks. Sollte ein Wolf sechzehn Jahre und älter werden können? Sollten die Mohawks auch Tiere mit ihrem Totem gezeichnet haben?«
Also auf diese Weise suchte sie sich den Fall gleich zu erklären. Das gefiel Arno. Keine Spur von Aberglauben.
»Nun, fahren wir hin, ich möchte den Wolf selbst sehen!«, entschied sie dann.
Sie fuhren hin, immer im strömenden Regen.
»Ich habe die Falle gestern Abend weiter dort hinten aufgestellt!«, sagte Littlelu, gleichzeitig mit der Indianerin am Landungsplatz aussteigend, und dabei hatten sie schon den Gelähmten auf ihren Armen, durch Handgriff miteinander verbunden.
Immer mehr gewöhnte sich Arno daran, keine zehn Schritt weit allein zurückgelassen zu werden, er musste mit, Atalanta wollte es nicht anders, sie konnte sehr energisch werden, wenn er sich einmal widersetzen wollte, sie wandte einfach Gewalt an, und durch diese Gewöhnung schwand ihm immer mehr das Bewusstsein für seine Hilflosigkeit, das ihn anfangs manchmal unglücklich gemacht hatte.
Der lange Kasten war schon zu sehen.
»Gleich hinter dem Baume liegt das Tier!«, sagte Littlelu.
Sie hatten den Baum umgangen und — blieben mit stockendem Fuße stehen, ihren Augen nicht trauend.
Statt des Wolfes lag da ein Mensch, ein Neger, nackt bis auf einen Streifen Fell, den er um die Lenden geschlungen trug, er lag auf dem Rücken, mit blutigem, weitaufgerissenem Munde, aber man sah auch noch das blutige Loch am Hinterkopf, und vorn an der schwarzen Stirn zeigte er mit weißen Umrissen, wie sie Brandwunden hinterlassen, ganz deutlich einen Fisch, um den sich eine Schlange wand.
Der erste, der Worte fand, war Littlelu, und wenn dieser Anblick wohl auch nicht seinen Humor wecken konnte, so war es eben seine angewöhnte Ausdrucksweise.
»Jetzt hat sich der schwarze Wolf in einen Neger verwandelt!«
»Ja, da möchte man wirklich an einen Werwolf glauben!«, flüsterte Arno.
Diesmal hätte Atalanta allen Grund gehabt, ihn groß anzusehen, aber sie tat es nicht.
»Halt! Nicht glauben, sondern prüfen! Absetzen!«
Arno wurde auf einer trockenen Decke niedergelassen, Atalanta begann nach fremden Spuren zu suchen. Sie fand keine. Einmal hatte es auch hier unter dem Laubdache schon tüchtig geregnet, dann war Littlelu hier schon ordentlich herumgetrampelt, und außerhalb des einzeln stehenden Baumes hatten die schweren Regentropfen vollends alles wie niedergehagelt. Da versagte auch dieser Indianerin Spürsinn.
»Könnte dieser Neger nicht ein Wolfsfell umgehabt haben?«, suchte Arno nach einer Erklärung, die für ihn am nächsten lag.
Littlelu durfte mit Recht etwas spöttisch werden.
»Wo soll denn das geblieben sein? Oder meinen Sie, hier mit diesem Schurzfell, das er als Feigenblatt benutzt, hätte er sich ganz eingehüllt? Und überhaupt, Herr Graf, glauben Sie denn, ich kann einen in ein Wolfsfell eingenähten Menschen nicht von einem richtigen Wolfe unterscheiden? Es war schon hell genug, als ich das Viech in der Falle herumtoben sah.«
Atalanta hatte die Falle untersucht.
»Es war ein Wolf, hier an dem Holze sind deutlich seine Zähne.«
»Ja, er versuchte sich durchzubeißen, deshalb eben schoss ich ihn tot.«
Die Indianerin kniete neben dem toten Neger nieder und untersuchte kaltblütig die Wunden.
»Ist es wirklich Dein Stempel?«, flüsterte Arno.
»Linie für Linie, bis in das Kleinste nachgeahmt. Littlelu, geben Sie mir eine der Patronen, mittels der Sie den Wolf erschossen haben.«
Als sie eine solche erhalten, steckte sie die Kugel samt der Hülse in das Loch der Schädeldecke.
»Passt sie?«, flüsterte Arno. Es begann ihm etwas zu grauen.
»Littlelu, Ihren Revolver.«
Sie betrachtete die Waffe, entsicherte sie, und jetzt wurde Arno von wirklichem Grauen befallen, als er sah, wie die Indianerin die Revolvermündung in den Mund des toten Negers steckte.
»Atalanta, um Gottes willen — «
Schon krachte der Schuss. Und die Ruhe war fürchterlich zu nennen, mit der die Indianerin diesen weiten Schusskanal untersuchte, mit einer Patrone, mit dem Finger.
Dann stand sie phlegmatisch auf und strich das lange Haar zurück.
»Der Beweis ist erbracht. Eines konnte in dieser Schnelligkeit doch nicht fertig gebracht werden. Littlelus Revolverkugel ist kleiner als die, durch welche dieser Neger getötet wurde, wenn auch nur um eine halbe Linie — mir genügt es. Und überhaupt, wie soll es denn anders sein. Meine Väter und Brüder mochten noch daran glauben, dass sich Menschen in Wölfe, Schakale und andere Tiere verwandeln können — ich glaube es nicht mehr. Während Littlelu hier schlief, wurde in seine Falle ein Wolf gesteckt, ein gezähmter oder ein wilder, den man schon vorher mit meinem nachgemachten Stempel präpariert hatte. Während Littlelu zu uns ruderte, hat man diesen Neger an Stelle des Wolfes gelegt, hat ihm einen ebensolchen Schuss durch den Mund und durch den Kopf gegeben, und noch vorher hatte man ihm ebenfalls mein nachgeahmtes Totem in die Stirn gebrannt, sodass die Brandwunde bis heute schon wieder ausgeheilt ist. Das ist die ganze einfache Erklärung.«
»Und wozu dies alles?«, konnte Arno nach wie vor nur flüstern.
»Wozu? Um uns diesen See und seine Umgebung zu verleiden. Man hat versucht, ihn mir abzukaufen. Meine Feinde haben dies sowohl mit Gewalt wie mit List versucht, jetzt versuchen sie es durch magischen Hokuspokus. O, ich durchschaue alles. Man hält mich für eine abergläubische Indianerin, die an den Werwolf und dergleichen glaubt. Ich selbst bin es ja gewesen, die den Professor Dodd darauf gebracht hat. Indem ich ihm sagte, er möge sich nur in einen Wolf oder in einen Schakal oder in eine Hyäne verwandeln; immer würde ich ihn wiedererkennen. Das hat er wörtlich genommen, auf diesen meinen vermeintlichen Aberglauben spekuliert er jetzt. Ich bin fest überzeugt, dass, wenn dieser Werwolf noch nicht genügen sollte, hier auch noch Gespenster auftauchen werden.«
»Zunächst tauchen dort Reiter auf!«, ließ sich da Littlelu vernehmen.
Es mochten ein halbes Dutzend Reiter sein, die sich zwischen den vereinzelt stehenden Bäumen des parkähnlichen Urwaldes zeigten, noch weit entfernt, aber offenbar sich hierher nähernd.
Littlelu hatte sie zufällig zuerst gesehen, und impulsiv, ohne sich dabei vielleicht etwas zu denken, zog er über die Leiche eine Decke.
Auch die Indianerin spähte scharf in die Ferne, aber mit ganz anderen Augen.
»Professor Dodd!«, sagte sie dann ruhig.
»Es ist nicht möglich!«, stieß Arno hervor.
»Er ist es, der linke von den beiden ersten, der mit dem gelben Regenmantel und dem grünen Sombrero, er reitet einen fahlen Hengst.«
»Das wäre ja das Tollste, was ich je erlebt!«
»Er kommt hierher, um es mit einer neuen List zu versuchen. Lasst mich allein mit ihm sprechen. Werft nie ein Wort dazwischen. Denn es wird wohl einen verzweifelten Wortkampf geben, bei dem jede Silbe zu erwägen ist.«
Die Reiter kamen näher. Acht Mann waren es. Aber sie mochten noch immer in Schussweite entfernt sein, als sie hielten und nach und nach absaßen; nur einer ritt weiter, der mit dem gelben Mantel.
Jetzt erkannte ihn auch Arno. Ja, es war das lange, hagere, fast weiße Mephistophelesgesicht mit dem schwarzen Knebelbarte — Professor Dodd!
In zwanzig Schnitt Entfernung hielt er, stieg langsam ab, warf die Zügel über einen Ast und kam langsamen Schrittes auf die drei Freunde zu.
»Ist es gestattet, näher zu treten?«, fragte er, den breitrandigen Sombrero lüftend.
Man sah die hohe, schneeweiße Stirn mit keinem Fleckchen daran.
»Ja.«
Es war auch nur eine Frage der Höflichkeit gewesen. Er befand sich auf unbebautem, uneingezäuntem Lande. Selbst der Durchgang durch ein Zeltlager konnte von einem Fremden von Rechts wegen mit der Waffe in der Hand erzwungen werden.
»Guten Morgen, verehrte Lady und Gentlemen!«
Atalanta erwiderte den Gruß nicht, den anderen war jedes Wort verboten.
Da nahm der Professor wieder das Wort.
»Dieser Empfang bereitet mich darauf vor, was ich hier zu erwarten habe. Ich fasse mich deshalb kurz.
Vor vier Tagen noch war ich in San Francisco, ich hatte dort eine Operation auszuführen. Da kam eine Dame zu mir, eine verschleierte Spanierin; sie hatte auf der Stirn eine furchtbare, ganz frische Wunde. Ungefähr konnte ich erkennen, dass es eine Figur war, die ihr eingebrannt worden, einen Fisch darstellend, der von einer Schlange umwunden war. Sie fragte, ob ich ihr dieses Brandmal unsichtbar heilen oder operativ entfernen könnte.
Die Dame wollte mir ihren Namen nicht nennen, mir ihr Gesicht nicht zeigen. So etwas gibt es bei mir aber nicht. Ich verlange immer offenes Gesicht, so auch ich es stets zeige. Erst nannte sich die Besucherin Doña Inez Rafaela. Sie musste den Schleier abnehmen, da erkannte ich Miss Marwood Morgan aus New York, die bekannte Milliardärin.«
Der Sprecher machte eine Pause, nahm den triefenden Sombrero ab und wischte sich mit einem Taschentuch die weiße Stirn.
Ein eigentümlicher Laut ließ Atalanta seitwärts blicken. Arno starrte sie an. Und sie senkte bestätigend den Kopf. Jetzt erst hatte Arno erfahren, dass die Indianerin auch die Miss Morgan gebrandmarkt hatte.
»Miss Morgan berichtete mir«, fuhr der Professor fort, »dass eine Indianerin — dass Sie, Miss Atalanta Ramoni, ihr auf die Stirn einen glühenden Stempel gedrückt hatten. Das interessierte mich nicht. Ich habe anderes zu tun, als mich um jeden Tratsch und Klatsch zu kümmern. Ohne dass ich sie irgendwie fragte, gestand sie nun weiter, dass sie es gewesen sei, welche den als tot begrabenen Grafen von Felsmark entführt habe, sie habe ihn gefangen gehalten, er sei an beiden Beinen völlig gelähmt gewesen, Miss Ramoni habe ihn ihr wieder entführt.
Auch das alles interessierte mich nicht im Geringsten. Mag auch jetzt alle Welt von nichts anderem sprechen als von dem Verschwinden der Leiche des Champion-Gentlemans von New York, der jedoch schon wieder lebendig gesehen worden ist, mögen auch alle Zeitungen davon voll stehen — ich habe nicht einmal Zeit, die wichtigsten politischen Nachrichten zu lesen, mein Kopf ist mit anderen Gedanken angefüllt, und gönne ich mir eine Ruhepause, so schlafe ich, um mich mit neuer Kraft der leidenden Menschheit widmen zu können.
Da aber fängt die Miss Morgan etwas zu erzählen an, was mich doch interessieren musste, weil es dabei um meinen ehrlichen Namen ging!«
Der Sprecher wandte sich mehr gegen Arno.
»Da erzählte mir Miss Morgan, Sie, Herr Graf von Felsmark, hätten ihr berichtet, ich sei an Ihrer Lähmung schuld. Ich, Professor Benjamin Dodd, der weltbekannte Arzt und Operateur — ich hätte Ihnen hier am Sklavensee ein Betäubungsmittel beigebracht oder ins Gesicht gespritzt. Haben Sie der Dame so etwas wirklich berichtet?«
Arno war ganz konsterniert. Was mit dem vor sich ging, was der dachte, kann leider nicht geschildert werden.
»Ja, Herr Professor, Sie haben es aber doch wirklich getan.«
Der mephistoähnliche Mann beugte sich Arno zu und rief ganz entsetzt:
»Ich — ich soll Sie betäubt haben?!«
»Ja, Sie waren es doch —«
»Wo denn nur in aller Welt?!«
»Hier am Sklavensee, dort in der hohlen Felswand —«
»Hohle Felswand? Ich habe mich in meinen jungen Jahren lange Zeit hier aufgehalten, habe mit den Mohawks verkehrt, ich spreche ihre Sprache, das habe ich Ihnen ja alles schon einmal berichtet — aber ich weiß nichts von einer hohlen Felswand. Wann soll denn das geschehen sein?«
»Vor etwa vier Wochen!«
Vor vier Wochen? Da war ich in Halifax, oben im östlichen Kanada, da habe ich dem bekannten Pelzhändler Allan Deloe eine künstliche Nase angesetzt.«
»Der Mann sah Ihnen aber ganz ähnlich«, musste Arno nun auch zu sprechen fortfahren, und Atalanta erhob keinen Einspruch, die stand wie eine Bronzestatue da, den gelben Regenmantel und das Mephistogesicht unverwandt anstarrend, als sei sie hypnotisiert.
»Sah er mir ähnlich?«
»Ganz und gar.«
»Nun und?«
»Ich hielt ihn für Sie.«
»Sie hielten ihn für mich?«
»Er selbst nannte sich Professor Dodd.«
»Er behauptete, dass er Professor Dodd sei, der bekannte Arzt und Chirurg aus der Water Street in New York?!«
»Gewiss. Er sprach ja auch wieder davon, dass er mich und diese Indianerin nun doch noch sezieren würde.«
»Das sagte er? Und er hat Sie betäubt?«
»Ja, uns beide. Bei der Indianerin gelang es nicht.«
»Und was haben Sie dann getan?«
»Das benötigt eine lange Erklärung!«
»Ich meine: Haben Sie den Fall sobald wie möglich der Polizei angezeigt, der Staatsanwaltschaft übergeben?«
»Ich konnte ja nicht, ich wurde —«
»Sobald wie möglich, sagte ich. Jetzt hatten Sie doch schon genug Zeit dazu. Haben Sie die Sache der Staatsanwaltschaft übergeben? Ja oder nein!«
»Nein!«, musste Arno antworten, und es klang sehr, sehr kleinlaut.
»Gut. Nach dem Warum will ich nicht fragen. Das geht mich gar nichts an. Jetzt werde ich den Fall natürlich selbst vor die Staatsanwaltschaft bringen. Es muss sich doch aufklären, wer sich da für mich ausgegeben hat. Aber das gehört jetzt nicht hierher. Jetzt möchte ich Ihnen nur noch etwas anderes sagen.
Ich weiß, dass man mich allgemein den Menschenschlächter nennt. Weshalb? Weil ich sehr viele Leichname seziere. Weil ich mir die zukünftigen Leichen von lebenden Menschen durch Kauf schon sichere. Weshalb tue ich das? Weil Leichen gerade hier in Amerika so äußerst schwer zu haben sind. Weshalb seziere ich sie? Um an ihnen zu studieren, um durch meine gesammelten Kenntnisse wieder anderen, noch lebenden, kranken Menschen helfen zu können.
Deshalb nennt man mich einen Menschenschlächter. Aber das ist mir ganz gleichgültig. Ich bin, der ich bin, und ich weiß, was ich zu tun und zu lassen habe. Aber auch hierin gibt es wie für alles eine Grenze, die nicht überschritten werden darf.
Es ist einmal öffentlich behauptet worden, dass ich auch lebendig sezierte. Da bin ich einmal aus meiner Reserve herausgetreten und habe solche Schwätzer gerichtlich belangen lassen. Als dann nichts bewiesen werden konnte, als jeder Schwätzer gestehen musste, dass er einem anderen Schwätzer nur nachgeschwatzt habe, da habe ich auf der Höchststrafe bestanden, und da ist die mindeste Strafe wegen infamer Verleumdung — verstehen Sie wohl: wegen Infamie! — sechs Monate schwere Zwangsarbeit gewesen! Die Mindeststrafe!
Und nun zu Ihnen, Herr Graf! Sie haben einer Dame erzählt, also öffentlich behauptet, ich hätte Sie der Freiheit beraubt, hätte Sie wider Ihren Willen betäubt, wovon Sie an den unteren Extremitäten paralytisch geworden seien. Also Sie haben mich eines Verbrechens bezichtigt.
An alledem ist kein Wort wahr, Sie haben mich verleumdet. So behaupte ich, und das werde ich beweisen. Sind Sie überführt, so werden Sie bestraft, und zwar schwer bestraft, indem Sie unterlassen haben, den Fall der Justiz anzuzeigen und unwahres Zeug — geschwatzt haben!
Herr Graf! Noch einmal will ich es versuchen, diese Sache in Güte zu regeln! Noch will ich Ihnen Gelegenheit geben, mich um Verzeihung zu bitten. Dann soll dies alles beigelegt sein. Was sonst noch weiter geschwatzt wird, lässt mich kalt.
Aber weigern Sie sich, mich jetzt sofort um Verzeihung zu bitten, dann — dort steht der Sheriff von Pittville, der Bürgermeister von Pittville, ferner ein Kapitän der Gendarmerie dieses Bezirkes mit seinen Leuten. Noch wissen diese nicht, um was es sich handelt. Ich wollte wieder einmal den Sklavensee besuchen, diese Herren haben mich aus Gefälligkeit begleitet. Aber ich habe einen rechtskräftigen Verhaftungsbefehl in der Tasche, wie ein solcher nur den einwandfreiesten Personen von der obersten Justizbehörde für einen Fall der Not ausgehändigt wird — ich brauche nur Ihren Namen einzuschreiben — dann gehe ich hin zu dem Sheriff — — und, Herr Graf, ich lasse Sie hier auf der Stelle verhaften, lasse Sie sofort abführen, Sie kommen sofort ins Untersuchungsgefängnis und kommen nicht eher wieder aus der Zelle heraus, als bis Sie über diese Sache Rechenschaft abgegeben haben! Und wiederum werde ich die höchste Strafe wegen infamer Verleumdung beantragen, wenn Sie mich jetzt nicht sofort um Verzeihung bitten!«
Wenn man sagen wollte, Arno wäre wie vom Donner gerührt gewesen, so würde das nicht im Entferntesten den Gemütszustand ausdrücken, in dem er sich befand.
Hilfesuchend irrten seine Augen nach der Indianerin.
Die aber stand nach wie vor gleich einer Bronzestatue da, erhaben über Schreck oder Staunen oder Bestürzung oder Unglauben oder sonst etwas, immer nur den gelben Regenmantel anstarrend, genau so, wie sie beim Schachspiel bewegungslos auf ihr Schachbrett blickte.

Der Professor hatte diesen hilfesuchenden Blick bemerkt.
»Miss Ramoni geht mich nichts an. Von der würde ich niemals so etwas wie eine Entschuldigung verlangen. Das ist eine Indianerin, noch dazu eine Mohawk. Die ließe sich lieber vierteilen als ein Wort der Entschuldigung auszusprechen. Und überhaupt, Miss Ramoni hat mich ja auch gar nicht beleidigt, hat mir nichts getan. Ich habe es nur mit Ihnen zu tun, Herr Graf. Also wollen Sie mich um Verzeihung bitten oder nicht? Machen Sie es kurz. Ich kann die Herren dort nicht länger warten lassen.«
Arno öffnete den Mund, er bewegte die Lippen, im nächsten Moment erklangen klar und deutlich die Worte:
»Ich bitte Sie um Verzeihung, Herr Professor, ich habe mich in einem Irrtum befunden.«
Der Professor zog den Hut.
»Ich verzeihe Ihnen, Herr Graf. Es ist erledigt. Adieu.«
Er setzte den Hut wieder auf, drehte sich um und wäre wohl mit wenigen Schritten in dem grauen Nebel verschwunden gewesen, der sich wieder herabgesenkt hatte, wäre jetzt nicht laut und befehlend der Ruf »Halt!« ertönt.
Er blieb stehen und drehte sich um.
Atalanta war es gewesen, die dies gerufen. In die Bronzestatue war wieder Leben gekommen, sie trat einen Schritt vor.
»Herr Professor Dodd!«
»Sie wünschen?«
Noch einen Schritt trat Atalanta vor, sie streckte die Hand halb nach dem auf der Decke sitzenden Arno aus und sagte langsam mit ihrer tiefen, melodischen Stimme:
»Herr Professor Dodd — — können Sie diesen Mann wieder gesund machen?«
Und da plötzlich geschah ein Wunder.
Da plötzlich wurde der dicke Nebel von einer unsichtbaren Hand emporgezogen, als wäre es ein festes Schleiergewebe — plötzlich stand dort über der hohen Felswand die strahlende Sonne — und ihr erster goldener Strahl küsste die braune Indianerin und wob aus dem Nebel, der noch um ihr Haupt lagerte, einen goldenen Heiligenschein.
Was hatte sich diese junge Indianerin darum gekümmert, was die beiden Männer sprachen?
Was kümmerte die sich darum, ob dieser Mann da mit den gelähmten Füßen um Verzeihung bat oder nicht?
Für sie hatte es nur einen einzigen Gedanken gegeben:
»Können Sie diesen Mann wieder gesund machen?«
Und nun ereignete sich eine seltsame Szene.
Der Professor kam zurück.
Und jetzt hatte er wieder ein ganzes Teufelsgesicht. Das war kein Hohn, das war kein Grimm und kein fürchterliches Lachen — und doch war es dies alles zusammen, was sich in diesen totenblassen, scharfen Zügen ausprägte.
»Ich will es versuchen. Was zahlen Sie, wenn es mir gelingt?«
»Was Sie fordern.«
»Was haben Sie zu geben?«
»Alles.«
»Den Sklavensee?«
»Ja.«
»Sich selbst?«
»Ja.«
»At...« — Arno hatte es gerufen, geschrien, hatte aber nur die erste Silbe aussprechen können. Plötzlich verwandelte sich der Professor, der immer die eisige Kälte selbst gewesen war, zornentflammt wie ein Wilder fuhr er gegen die Indianerin los.
»Weib, was wagst Du mir da für einen Vorschlag zu machen!!«, donnerte er sie an.
Und ebenso fuhr er dann gegen den Grafen herum.
»Mann, wie kommen Sie dazu, mir so etwas zuzutrauen?! Wodurch habe ich das verdient? Ich bin als anständiger Mensch zu Ihnen gekommen und habe Ihnen in klarer, ruhiger Weise die Sache auseinandergesetzt, habe Sie um Ihre Erlaubnis gebeten, diese Indianerin, deren Herr Sie waren, untersuchen zu dürfen. Ich habe Sie klar und offen gefragt, ob Sie etwas dafür bezahlt haben wollen und eventuell wie viel. Wenn Sie das für gemein halten, dann schießen Sie sich eine Kugel durch den Kopf und fahren Sie in Ihren Himmel, aber bleiben Sie nicht auf dieser Erde! Ja, ich habe Ihnen auch den Vorschlag gemacht, die Indianerin zu betäuben und sie in diesem Zustand zu untersuchen, wenn sie sich geniert. Finden Sie dabei etwas? Ich nicht!
Sie haben mich aus Ihrer Wohnung förmlich hinausgeworfen, und ich wusste nicht, warum! Dann sind Sie in meine Wohnung gekommen und ich habe Sie höflich empfangen. Sie fingen an von einem Leder zu erzählen, das ich dem Advokaten Alkara abgenommen haben soll. Was weiß ich denn von einem Leder? Dann phantasierten sie von einem Agenten, den ich zu Ihnen geschickt hätte, der den Sklavensee für fünf oder ich weiß nicht für wie viele Millionen Dollars kaufen sollte. Sie phantasierten von Gold und Schätzen, die im Sklavensee liegen sollten. Herr, erzählen Sie Ihre Phantasien doch anderen Menschen, aber mir nicht! Ich habe anderes zu tun! Ich brauche kein Gold, keinen Sklavensee! Lassen Sie mich in Frieden meiner Arbeit nachgehen!
Sie haben mich damals, als ich bei Ihnen war, wie einen räudigen Hund behandelt!
Ich verzeihe Ihnen, Herr Graf! Aber das eine müssen Sie noch anhören: Sie sind eben solch ein schwatzender Narr wie alle die anderen, die über mich herziehen! Was will man denn nur von mir? Was tue ich denn? Ich reise ständig umher, um meine durch unsägliche Mühen erlangte Kunst in den Dienst der leidenden Menschheit zu stellen. Oft sehe ich monatelang kein Bett, schlafe nur im Eisenbahnwagen. Nehme ich von den Milliardären und vielfachen Millionären ein fürstliches Honorar, dann schreien die Leute: Ja, der Professor Dodd, der versteht sein Geschäft, der nimmt's von den Lebendigen! — Verlange ich ein kleines Honorar, dann schreien meine begüterten Kollegen: Dieser Professor Dodd verdirbt uns das ganze Geschäft! Und sie feinden mich an nach allen Regeln der Kunst! — Operiere ich Unbemittelte kostenlos, dann schreien meine kleineren Kollegen: Dieser Professor Dodd, der Lump, nimmt uns armen Teufeln das Brot weg! — Verweigere ich solchen Kranken meine Hilfe, schicke ich sie zu Kollegen, die es nötig haben, dann schreien wieder die Leute: Da seht den Professor Dodd, den Reichen hilft er, aber die Armen lässt er in ihren Schmerzen zappeln! — Ja, zum Henker noch einmal, was soll man denn da eigentlich tun?! Diese jämmerlichen Narren schwatzen lassen!! Ich weiß am besten, was ich zu tun und zu lassen habe!«
Erschöpft hielt der Professor inne. Er musste ganz erschöpft sein, so hatte er gesprochen.
Und es waren furchtbare Wahrheiten gewesen, die er gesagt.
Der Professor hatte einige Gänge hin und her gemacht, um sich zu beruhigen, bis er wieder vor Arno stehen blieb. Jetzt war er nur noch der Arzt.
»Haben Sie sich von einem Arzte untersuchen lassen?«
»Nur damals, bevor ich in Scheintod fiel.«
»Was sagte der?«
»Es sei paralytisches Koma.«
»Sie haben in den Beinen kein Gefühl?«
»Gar nicht.«
»Schlafen Sie manchmal plötzlich ein?«
»Anfangs, jetzt nicht mehr.«
»Wissen Sie, was es für ein narkotisches Mittel gewesen ist, mit dem Sie betäubt wurden?«
»Nein, keine Ahnung. Es roch süßlich.«
»Hat auch nichts zu sagen. Untersuchen kann ich Sie jetzt nicht, ich könnte nur zu falschen Schlüssen kommen. Ich muss Ihren Blutkreislauf genau messen, dazu bedarf ich besonderer Instrumente und Einrichtungen. Nur noch einige Fragen. Haben Sie im Schlafe manchmal das Bewusstsein, die Empfindung, als könnten Sie Ihre Beine gebrauchen?«
»Ja, ganz deutlich.«
»Funktionieren die Beinnerven gleich ganz kurz nach dem Erwachen?«
»Ja, das ist mir manchmal so. Und als ich aus einer elftägigen Betäubung erwachte, konnte ich sie einen ganzen Tag lang vollkommen gebrauchen.«
»Stimmt. Und dies ist vielleicht auch momentan der Fall, wenn Sie einmal einen recht heftigen Gemütsaffekt haben?«
»Erst gestern. Ich musste furchtbar lachen, konnte plötzlich aufspringen, brach aber gleich wieder zusammen.«
»Stimmt. Nun aber noch eine andere Frage, die Hauptsache.«
Der Professor blickte nach der Indianerin.
»Bitte, Miss, wollen Sie uns einmal allein lassen!?
»Ich bleibe!«, entgegnete Atalanta.
»Ich habe eine besondere Frage zu stellen.«
»Ich kann sie und die Antwort hören.«
»Wie Sie wollen. Herr Graf, sind Sie im Besitze Ihrer Mannbarkeit?«
»Ja.«
»Gut. Wenn es so ist, dann kann ich Ihnen die sichere Hoffnung geben, dass ich Sie von der Paralyse dauernd befreien werde. Ich muss Sie einige Tage in Behandlung nehmen, in meiner Klinik. Können Sie in zehn Tagen in New York sein?«
»Ja, gewiss!«, brachte Arno vor Aufregung kaum heraus.
Sollte er auch nicht freudig aufgeregt sein bei dieser Sicherheit des Professors?!
»Gut. So sprechen Sie in vierzehn Tagen in meiner New Yorker Klinik vor. Auf Wiedersehen!«
Es war ein wahrhaft teuflisches Grinsen, mit dem er sich jetzt an die Indianerin wandte.
»Ich mache diese Kleinigkeit kostenlos — Sie sollen dem Herrn Grafen ungevierteilt und ganz lebendig angehören. Nur etwas Hochzeitspudding bitte ich mir aus — mit recht viel Rosinen — adieu!«
Die Stimmung, die zwischen den drei Zurückgebliebenen herrschte, lässt sich schwer schildern.
Die Indianerin hatte sich wieder in eine Statue verwandelt, blickte tiefsinnig vor sich hin, Littlelu kratzte sich energisch hinter dem Ohr und zog dabei ein schiefes Maul, das am rechten Auge anfing und links unten am Kinn aufhörte, und Arno saß mit gefalteten Händen da, nahm immer einen Anlauf, etwas zu sagen, und brachte nichts heraus. Endlich glückte es ihm doch.
»Atalanta, wie konntest Du nur diesen furchtbaren Irrtum begehen?!«
Die Indianerin erwachte aus ihren Träumen.
»Irrtum? Ich irre mich nicht — er ist es dennoch gewesen!«
»Aber Atalanta, ich bitte Dich um Gottes willen —«
»Er ist es dennoch gewesen. Jetzt triumphiert er, jetzt ist er der Sieger geblieben, wir haben eine furchtbare Niederlage erlitten. Aber ich werde ihn doch noch zur Strecke bringen!«
Arno wurde ganz fassungslos.
»Aber er hat doch —«
»Bitte, Arno, sprich nicht mehr darüber.«
»Er hat eben einen Doppelgänger, der sich —«
»Bitte, schweige!«, erklang es etwas energischer.
»Er müsste sich doch —«
Sie trat einen Schritt auf ihn zu.
»Schweige!!«
Ganz erschrocken blickte Arno in die starren und doch so blitzenden Augen der Indianerin.
Sie drehte sich um, und er ergab sich, ohne sich gekränkt zu fühlen.
Nur Littlelu musste noch eine diesbezügliche Bemerkung machen, indem er sagte:
»Meine zukünftige Frau dürfte mich nicht so anschnauzen!«
Atalanta kehrte um, kniete neben Arno nieder, küsste ihn und erhob sich wieder, ohne ein Wort gesprochen zu haben, alles mit ihrer stillen Ruhe, und doch so zärtlich.
Dann ging sie nach dem großen Lagerplatz, kam mit einem Spaten zurück und fing an zu graben.
»Du willst den Toten gleich hier begraben?«
»Ja.«
»Wäre es nicht besser, wenn —«
»Nein.«
Arno unterließ lieber weitere Fragen und Bemerkungen. Er dachte daran, was das für Verwicklungen ergeben hätte, wenn der Sheriff und die anderen hierher gekommen wären und die Leiche des Negers gefunden hätten, mit den beiden verschiedenen Schüssen im Kopf, wenn man erklären sollte, wie dies erst ein Wolf gewesen...
Er wollte sich das Bild lieber gar nicht weiter ausmalen.
Atalanta hatte die beträchtlich tiefe Grube ganz allein ausgeworfen, hüllte den toten Neger, einen jüngeren Mann, sorgfältig in eine zweite Decke, legte ihn in das Grab und schaufelte es wieder zu.
Erst als sie begann, die Erde festzutreten, war ihr Littlelu dabei behilflich, trampelte mit darauf herum, ohne die Hände aus den Hosentaschen zu nehmen.
»Ich hätte mir den Beruf eines Totengräbers nicht so schwer vorgestellt!«, sagte er dabei.
Der Grabhügel wölbte sich. Atalanta dachte nicht daran, diese Leiche, die ihnen hier vielleicht noch die größten Unannehmlichkeiten bereiten konnte, spurlos unter der Erde verschwinden zu lassen. Sie schnitt zwei Äste zurecht, falzte sie durch Kerbschnitte zu einem Kreuze zusammen, steckte dieses auf den Hügel, kniete neben dem Grabe nieder, den Männern den Rücken zukehrend.
Mit einiger Verwunderung hatte Arno dies alles beobachtet.
»Ich hätte gar nicht geglaubt, dass sie so religiös gesinnt ist, so viel auf solche Zeremonien hält!«, flüsterte er dem neben ihm stehenden Littlelu zu.
»Sssssst!«, machte dieser. »Irrtum vorbehalten! Wer weiß, was sie betet. Und das Kreuz? Hm. Einer ihrer Lehrer war doch ein Tinone, ein Indianer. Da habe ich manches erlauscht. Bei den Mohawks war das Kreuz das Symbol der Rache.«
Dann freilich konnte diese Zeremonie ihre eigene Bewandtnis haben.
Die Indianerin erhob sich, strich die Haare zurück und machte ausnahmsweise ein recht heiteres Gesicht.
»Nun, da wollen wir wieder ins Boot.«
»Wohin?«
»Wohin? Du kannst noch fragen? Nach der Goldinsel. Gold wollen wir fischen. Gold, Gold, Gold! Ich kann gar nicht genug Gold bekommen. Wozu ich es brauche? Um einen recht großen Plumpudding mit recht vielen Rosinen zu backen.«
Im heitersten Tone, dem keine Ironie anhaftete, hatte sie es gesagt, und so heiter blieb sie auch fernerhin.
Als die Goldinsel, die diesen Namen nun wohl verdiente, auftauchte, kam über das Wasser pfeilschnell eine graue Kugel angeschwommen.
»Der Seal, mein Seal!«, jauchzte Atalanta.
Der Seehund jauchzte noch viel mehr, verschwand, tauchte wieder auf und präsentierte einen armlangen Fisch.
»Das ist unser Frühstück!«
»Schon wieder ein Lachs«, murrte Littlelu, »egal Süßwasserfische! Kann der denn nicht einmal einen richtigen Kabeljau bringen? Und ausgenommen und abgeschuppt ist der Lachs auch noch nicht, das muss ich nun wieder machen.«
Das Boot war von der Insel immer noch ziemlich weit entfernt, als der Seehund, der einige Zeit verschwunden gewesen war, schon wieder einen goldenen Teller brachte, und zwar einmal einen weit größeren und von ganz anderer Form. Also nicht etwa, dass ihn der Seehund von der Insel gebracht hätte, sondern schon wieder vom Grunde. Er konnte gar nicht erwarten. das für ihn so lustige Spiel zu erneuern.
»Der Teller hat ja ein Loch!«, schimpfte Littlelu. »Und das Gold ist überhaupt viel zu fein, das kann man ja biegen!«
»Ob der Seehund wohl auch schon seinem richtigen Besitzer solche goldene Sachen fischen musste?!«, meinte Arno.
»Ja, mein lieber Arno, wenn ich das wüsste!«, war die ein klein wenig zurechtweisende Antwort der Indianerin.
Die Insel war erreicht, der Seehund brachte einen Goldteller nach dem anderen angeschleppt, wieder vom alten Formate, alle zwei Minuten mindestens einen.
Atalanta lobte ihn, was ihm die Hauptsache war, Arno sah zu, auch dem Clown, der den Lachs zubereitete und dabei schimpfte. Er war nun einmal ins Schimpfen gekommen und kam nicht wieder heraus.
»Hören Sie, Mister Littlelu, haben Sie von dem Rabbi Eleazar gehört?«
»Ei gewiss! Kennen Sie den auch?«
»Was wissen Sie von ihm?«
»Sie, aushorchen lasse ich mich nicht!«
»Wann hat er denn gelebt?«
»Ich will Ihnen sogar genau den Tag seiner Geburt sagen. Als damals die totale Sonnenfinsternis war und gleichzeitig auf Honolulu das furchtbare Erdbeben... kosten Sie mal. Ist die Fischsuppe schon zu sauer? Dann nehme ich wieder ein bisschen Essig heraus.«
»Schmeckt gerade gut. Der Rabbi Eleazar war mit Pizarro in Peru.«
Aber Littlelu ging nicht so leicht in eine Falle.
»Ja, er war ein merkwürdiger Mann, dieser Rabbiner! Wissen Sie, dass er ein Jude gewesen ist? Ich habe ihn nämlich persönlich gekannt. Schade, dass der sonst so schöne Mann über dem rechten Auge so einen großen Leberfleck hatte und beim... dort kommt ein Boot!«
Es kam vom Südufer her, man konnte noch nicht einmal genau die Zahl der Insassen bestimmen.
Doch diese Ungewissheit galt nur für die beiden Männer, und als Arno durch den ausgezeichneten Feldstecher fünf Mann zählte, hatte diese Indianerin mit ihren Falkenaugen schon etwas ganz anderes erkannt.
»Das sind japanische Physiognomien — — Doktor Hikari!!«
Sie hatte es richtig gejauchzt.
»Doktor Hikari?«, wiederholte Arno, schon über diesen Jubel der Indianerin verwundert.
»Der Astronom, der mir auf der Sternwarte Unterricht erteilte. Ich erzähle Dir später mehr von ihm. Ach, Doktor Hikari kommt — ich habe nicht umsonst von ihm geträumt!«
Arno wusste nicht — er hatte im Herzen mit einem Male ein recht merkwürdiges Gefühl. Es tat nicht gerade weh, aber es stieg da drin etwas so heiß empor und schmeckte dann im Munde so bitter.
Jetzt erst sah man, mit welcher Schnelligkeit das Boot heranschoss. Wie ein Pfeil. Es war ebenfalls ein transportables, ein auseinandernehmbares Boot, aber aus Holzplatten, die durch eine besondere Erfindung schnell gedichtet werden konnten, die Riemen in Gabeln, die vier Ruderer arbeiteten rückwärts.
»Ist das Wasser tief genug zum Anlegen?«, rief der Steuernde in noch ziemlicher Entfernung.
»Überall! Hierher!«
Im Nu war das schießende Boot an der von der Indianerin bezeichneten Stelle, man sah es schon zerschellen oder auf den Strand schusseln, so ziemlich mitten auf der Insel umgekippt liegen — da im letzten Moment ein fremdes Kommando, mit einem Ruck abgestoppt, dass sich die langen Stangen wie Gerten bogen, in demselben Moment lag das Boot beigedreht längsseits des Ufers, nur der eine sprang heraus, um es zu befestigen, die anderen drei Ruderer saßen mit blitzschnell hochgestellten Riemen wie die Statuen da.
»A la bonne heure!«, staunte Arno. »Besser klappt's in Kiel bei der großen Regatta auch nicht!«
Die vier Männer in den dunkelblauen Baumwollanzügen waren alle von zwerghaft kleiner Gestalt, über ein Meter fünfzig war keiner groß, und sie erschienen umso kleiner, weil sie fast ebenso breit wie hoch waren, mit mächtigen Schultern, und die Oberarmmuskeln so dick wie ihre dicken Schädel.
Die Bevölkerung Japans besteht aus acht Kasten, deren Vermischung ganz unmöglich ist. Wer sie einmal gesehen hat, kann jede Kaste von der anderen auf den ersten Blick unterscheiden. Unter den Japanern gibt es auch sehr hohe Gestalten, die der dritten Kaste, der Priester. Diese zwerghaft kleinen, deren ganzes Wachstum in die Breite geht, sind die Fischer und Schiffer, der untersten Kaste angehörend. Das sind die, denen die Russen zwei Kriegsflotten zuschickten, um sie von ihnen in aller Geschwindigkeit kleinhacken zu lassen.
Wenn hier gesagt wird, dass der beste Seemann der Deutsche ist, so wird das nicht etwa gesagt, weil hier ein Deutscher für Deutsche schreibt. Einen derartigen Patriotismus gibt es nicht. Wir Deutsche stehen in mancher Hinsicht anderen Nationen weit nach. Aber der deutsche Matrose ist der tüchtigste. Das wird jeder englische Kapitän bestätigen. Vielleicht noch besser wäre der Skandinavier, zumal der Norweger, wenn der Kerl nur nicht gar so sehr söffe. Dann kommt der Engländer und dann gleich der Spanier, der in Seemannschaft noch vor dem Holländer rangiert, der Türke noch vor dem Franzosen und Italiener, während den Griechen in seinem schwarzen Trikot kein Kapitän umsonst haben will.
Das sind nicht nur so leere Betrachtungen, sondern hierbei handelt es sich um die Sicherheit, um Sein oder Nichtsein von Milliarden, die auf dem Meere schwimmen.
Besonders den Versicherungsgesellschaften ist es nicht gleichgültig, was für Mannschaft an Bord ist. Es ist ein Unterschied, ob die Matrosen das lecke Schiff in den Booten verlassen — ob sie die Hände zum Gebet falten oder ob sie diese Hände an den Pumpen zu blutigen Fetzen verwandeln, um Schiff und Fracht auf den Strand zu setzen.
Jene Rangordnung galt für die seefahrenden Nationen Europas, wobei der Deutsche an der Spitze marschiert. Der beste Matrose der Welt aber ist der japanische. In Pflichttreue und Ausdauer — Kraft, Unerschrockenheit und Seemannskunst wird als etwas Selbstverständliches vorausgesetzt — sind die japanischen Matrosen unerreichbar.
Außerhalb ihrer Inseln mustern sie nur noch auf englischen Schiffen an. Es scheint eine Erlaubnis oder sogar ein Befehl »von oben« zu sein. Nie einzeln, immer in Gruppen, ein geschlossenes Korps bildend. Im Hafen gehen sie nicht an Land, man bekommt sie gar nicht zu sehen.
Der Schreiber dieses hat mit japanischen Matrosen eine Reise von Bombay nach Konstantinopel gemacht, mit monatelanger Quarantäne. Nicht als Passagier, sondern als Matrose. Da lernt man den Menschen wohl kennen. Das ist nun schon mehr als zwanzig Jahre her. Als sich dann im fernen Osten die Gewitterwolken zusammenballten, aber als noch kein Schuss gefallen war, hat er von diesen seinen ehemaligen Schiffskameraden erzählt, was diese Zwerge leisten können. Man hat ihm nicht geglaubt, hat ihn ignoriert oder ausgelacht.
»Wir brauchen nur einmal zwei gute Erntejahre hintereinander zu haben, und die Welt soll staunen!«, sagte damals zu ihm so ein Japaner, der auf dem englischen Dampfer als gewöhnlicher Matrose fuhr, der in Wirklichkeit aber ein hoher Seeoffizier war, ein Siomi, ein Krieger aus der zweiten Kaste, ein Fürst, und als im Roten Meere die indischen Heizer draufgingen, arbeitete er mit vorm Feuer — und zeichnete nebenbei die Maschinen ab, die patentierte Ventilsteuerung.
Der Steuernde des der Goldinsel nahenden Bootes war Doktor Hikari mit dem possierlichen Mopsgesicht, das immer ein schallendes Gelächter verkniff — eigentlich auch nur ein kurzer, dicker Stöpsel, aber im Gegensatz zu jenen vier Ruderern groß und schlank zu nennen.
Er trug ein sehr elegantes Sportkostüm, an den Gamaschenstiefeln noch Sporen.
»Ich wollte nur Ihre Prophezeiung wahrmachen!«, sagte er, als er der Indianerin herzlich die Hand schüttelte.
»Was für eine Prophezeiung?«
»Dass wir uns noch einmal wiedersehen.«
»Nun, Sie machen's einem leicht, dass man Prophetin wird!«, lachte Atalanta.
Arno spitzte die Ohren. Was, die Indianerin lachte? Und was hatte dieser fremde Kerl denn die lachen zu machen?
»Wussten Sie denn, dass ich hier bin?«
»Es steht doch in allen Zeitungen, dass Sie hier am Sklavensee fliegen. Sie haben doch nach Pittville einen Aeroplan mitgebracht, und wohin anders konnten Sie sich von dort aus gewendet haben als nach Ihrem Besitztum?«
»Das zu hören ist mir unangenehm. Da könnten wir vielleicht noch mehr Besuch bekommen.«
»Hören Sie, Miss — von Pittville bis hierher sind hundert englische Meilen ohne Weg und Steg. Diesen Strapazen unterzieht sich jetzt niemand mehr, um jemanden fliegen zu sehen, auch nicht, wenn — ganz offen gesagt — es Atalanta, die rote Athletin ist, die von der Decke des Zirkus springt und mit Zentnergewichten spielt und ein Pferd auf dem Rücken trägt.«
»Sie tun ja gerade, als ob Sie mich im Zirkus gesehen hätten.«
»Habe ich auch.«
»Wo denn?«
»Nun, in San Francisco.«
»Sie waren in einer Verstellung?«
»In allen dreien.«
Die beiden passten zusammen! Die Indianerin hatte ihm kein Wort davon gesagt, dass sie im Zirkus aufträte, und der Japaner ihr kein Wort, dass er jeden Abend im Zirkus gewesen war.
Jetzt freilich hatte sich die Indianerin in eine plaudernde Gesellschaftsdame verwandelt, der nur die entsprechende Toilette und Frisur fehlte. Arno konnte es nicht fassen. War denn das wirklich seine Atalanta, die da so heiter mit dem Herrn konversierte?
Auch ihrem alten Lehrer war diese Umwandlung ganz neu.
»Das habe ich mit der auch noch nicht erlebt!«, murrte er, als er seinen Kochtopf verließ und an den Strand ging, um dem Seehund wieder einen goldenen Teller abzunehmen.
Doktor Hikari blickte nach den beiden, jetzt musste er auch, was vom Boot aus vielleicht nicht möglich gewesen war, den gleißenden Goldhaufen sehen, die Kette, den Pantoffel, die Riesenhand und alles andere, er sah, wie Littlelu dem Seehund den goldenen Teller aus der bärtigen Schnauze nahm, doch etwas höchst Seltsames — aber kein Wort deswegen, kein staunender Ausdruck im Auge drückte seine Verwunderung aus. Nur den beiden Begleitern des jungen Mädchens galt sein Interesse — einfach anstandshalber.
»Ich komme als Fremder — wollen Sie mich den beiden Herren nicht vorstellen?«
Nur darum war es ihm zu tun gewesen, und die verwandelte Indianerin ging genau auf den selben Ton ein.
»Bitte sehr.«
Die Vorstellung war nicht anders, als wenn sie auf dem Parkett eines Salons stattfände. Der Komiker kam gerade mit dem goldenen Teller zurück, die beiden standen sich gerade passend gegenüber, Atalanta so halb dazwischen, etwas seitwärts, und sie vergaß die entsprechenden Handbewegungen nicht.
»Doktor Hikari, Astronom, der mir in San Francisco einige Unterrichtsstunden erteilte — Mister Maxim, einst ebenfalls mein Lehrer...«
Bis hierher war es also nicht anders gewesen, als fände die Vorstellung in einem Salon statt. Dann aber kam die überraschende Wendung, die niemand für möglich gehalten hätte.
»Und das...«, mit einem Schritte stand sie neben Arno, kniete nieder, »... und das ist der Mann, den ich liebe!«, sagte sie, umschlang seinen Hals und küsste ihn mehrmals zärtlich.
Die Wirkung dieser plötzlichen Wendung ist nicht zu beschreiben.
Jedenfalls machte der auf seiner Decke sitzende Mann, den sie liebte, nicht gerade ein geistreiches Gesicht.
Mit einem Male aber war ihm das unangenehme Gefühl im Herzen, das sich im Munde als bitterer Geschmack bemerkbar machte, geschwunden.
Dafür hatte er plötzlich ein ganz anderes, rätselhaftes Gefühl. Mit einem Male war es ihm, als ob aus dem Körper der neben ihm knienden Indianerin, die ihn umschlungen hielt, ein anderer Körper heraustrete, der den seinen durchdrang, was ihn mit einem seligen Behagen erfüllte.
Und gleichzeitig schoss ihm noch ein anderer Gedanke durch den Kopf, wie eine Erkenntnis überkam es ihn plötzlich,
Arno kam zu der Erkenntnis, dass die Schöpfung hier einmal einen Irrtum begangen hatte, nämlich betreffs dieser beiden Männer, die mit abgezogenen Kopfbedeckungen sich noch immer gegenüberstanden.
Diese beiden Männer ähnelten einander sehr. Beide waren klein, untersetzt und etwas korpulent. Aber die Schöpfung hatte bei der Ausgabe der Köpfe einen Missgriff begangen, hatte versehentlich den Kopf des Komikers auf die Schultern des japanischen Astronomen und dessen Kopf auf die Schultern des Komikers gesetzt.
Ganz gewiss, der Japaner hätte eigentlich die scharf markierten, unbeweglichen, ernsten, fast finsteren Züge des amerikanischen Clowns haben müssen, dieser das lachende Mopsgesicht des Japaners.
Aber wieder in demselben Momente erkannte Arno, dass sich die Schöpfung doch nicht in den Köpfen vergriffen hatte. Das waren ja gar nicht die richtigen Gesichter, das waren ja nur Masken, die sich diese beiden Männer vorgehängt hatten. Der Komiker verbarg hinter der finsteren Maske seinen angeborenen Witz, seinen nicht totzuschlagenden Humor — dieser Japaner verbarg vorsichtig hinter der Masre eines lachenden Mopses seinen gewaltigen, alles durchdringenden Geist, seine furchtbare Energie und — die allerraffinierteste Schlauheit!
Dies alles hatte Arno in dem einzigen Momente ganz klar und deutlich erkannt. Aber nicht etwa, dass er sich dieser Erkenntnis dann noch hinterher bewusst war. Nein. Nur für den hundertsten Teil eines Momentes hatte der Erdgeist für ihn einmal den Schleier gelüftet, ihn hinter die Masken blicken lassen.
»Und das ist der Mann, den ich liebe.«
Da ließ der Erdgeist den Schleier wieder fallen, Arno war sich nicht mehr bewusst, was Wunderbares er im Scheine eines Zuckblitzes geschaut hatte.
Und auch die scharfen Augen dieser Indianerin hatten nicht im Geringsten bemerkt, was für eine furchtbare Verzweiflung diese ihre Worte und ihre zärtlichen Küsse, die dem gelähmten Manne galten, in diesem Japaner hervorriefen, der ihretwegen seine Sternwarte verlassen hatte, um sie hier aufzusuchen.
Das fidele Mopsgesicht lachte und die kleinen Schlitzaugen funkelten scheinbar lustig. Und dann brachte Atalanta den Mund an das Ohr Arnos, flüsterte aber nicht, sondern sagte es ganz laut, fast übermäßig laut:
»Das ist aber kein gewöhnlicher Astronom mit dem Doktortitel, das ist ein japanischer Prinz, sogar eine Hoheit, ein Sohn des Mikados — Du darfst es aber nicht verraten, dass ich es Dir gesagt habe — er will inkognito bleiben — einfach Doktor Hikari.«
So hatte die Indianerin übermäßig laut in Arnos Ohr gesprochen.
Nicht jeder hätte diesen scheinbar so plumpen und in Wirklichkeit doch so feinen Witz verstanden. Der erste war der sonst so ernste, mürrische Komiker, der in ein schallendes Gelächter ausbrach, dann zeigte der japanische Doktor, dass er nicht nur so ein Gesicht hatte, sondern wirklich lachen konnte, dann stimmten Arno und sogar die Indianerin mit ein.
»Atalanta, das hast Du sehr fein gemacht!«
Die vier ungeschlachten Zwerge blickten nach der lachenden Gesellschaft und fingen plötzlich wie auf ein Kommando ebenfalls zu lachen an; sie hüpften dabei wie dicke Riesenfrösche herum und klatschten sich auf die Schenkel und Knie, alsdann warfen sie sich auf den Rücken, rückten die kurzen Beinchen in die Luft und wälzten sich.
Dieser seltsame Anblick konnte nicht dazu beitragen, die andere Gesellschaft ernst zu stimmen. Nur die Indianerin brachte es gleich fertig.
»Ihre Leute haben es doch nicht gehört?«
Der Doktor hatte sich mit an dem Feuer niedergelassen und war ebenfalls gleich wieder der Sprache mächtig.
»O nein. Es würde aber auch nichts schaden. Die wissen am besten, wer ich bin. Sie lachen nur aus Höflichkeit mit. Und als ich mich niedersetzte, mögen sie geglaubt haben, ich sei vor Lachen umgefallen, und sie halten es für ihre Pflicht, mir das gleichfalls nachzumachen. Es sind Kinder.«
Ja, es sind Kinder, aber ganz gefährliche. Es sind die Produkte der vieltausendjährigen Erziehung eines Volkes, das immer isoliert geblieben ist, nach streng geregeltem Prinzip, hauptsächlich nach dem Grundsatze: Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.
Unter den Kaufleuten, die den Handel zwischen Europa und Asien vermitteln, gibt es ein Sprichwort: Ein Grieche betrügt zehn Juden; ein Armenier betrügt zehn Griechen; und ein Chinese betrügt zehn Armenier.
Und die Chinesen klagen, dass mit dem Japaner kein Geschäft zu machen sei. Nämlich weil er sich nicht übervorteilen lässt. Der Japaner selbst betrügt nicht. Der ist grundehrlich. Aber er lässt sich nicht betrügen. Das ist die Sache.
Als die vier Matrosen merkten, dass dort drüben nicht mehr gelacht wurde, verstummte auch ihr Lachen wieder wie auf Kommando. Sie hockten sich im Kreise zusammen und begannen unter lebhaften Gestikulationen wie die Affen zu schnattern. Sie hatten überhaupt etwas Affenähnliches an sich.
»Nun, ich habe wohl die Ehre, den Herrn Grafen von Felsmark kennen zu lernen!«, sagte nunmehr Doktor Hikari, sich an Arno wendend.
Dieser, der vorläufig ja nur als der Mann vorgestellt worden war, den die Indianerin liebte, durfte es bestätigen.
Der Japaner tat jedoch keine Frage wegen Arnos Auferstehung von den Toten, wegen seiner Lähmung, worüber ja auch schon die Zeitungen berichtet hatten.
»Der Fisch muss gegessen werden oder er zerkocht!«, sagte nunmehr Littlelu.
»Ich störe doch nicht?«, fragte Doktor Hikari.
»Selbstverständlich sind Sie unser Gast!«, entgegnete Arno.
Der Seehund humpelte wieder heran, einen goldenen Teller im Maule. Littlelu nahm ihn ab, wischte ihn mit dem Ellenbogen ab und füllte ihn mit einem Löffel aus dem Topfe mit Fisch.
»Wir speisen immer nur von Gold, Herr Doktor«, sagte er dabei, »Teller stehen Ihnen haufenweise zur Verfügung, oder Sie können auch dort aus dem goldenen Holzpantoffel essen, aber mit Messer und Gabel sieht es bei uns traurig aus. Haben Sie nicht einen Löffel bei sich?«
In der Tat, der Japaner zog aus der Brusttasche ein Etui, das ein silbernes Besteck enthielt.
»Wundern Sie sich denn gar nicht über unsere goldenen Schätze?«, fing jetzt Arno an.
»Ja, ich wundere mich sehr!«, war die Antwort mit entsprechendem Gesicht und Tonfall.
»Ich darf doch darüber sprechen, Atalanta?«
»Selbstverständlich.«
»Wir erfuhren durch Zufall, dass auf dem Grunde dieses Sees goldene Schätze liegen, von den Ureinwohnern dieses Landes hier versenkt. Jetzt beginnen wir mit ihrer Hebung.«
»Das ist ja höchst interessant!«
Es war einfach eine Redensart der Höflichkeit gewesen.
»Essen Ihre Leute nicht etwas Fisch mit?«, fragte Atalanta.
»O, das würde sie ungemein freuen!«, erlang es diesmal mit unerkünstelter Freudigkeit. »Sie leben nur von Fischen, und sie haben nur etwas Reis mitgenommen.«
»Wollen Sie sie rufen —«
»Ich bitte um Verzeihung, Miss, das ist nicht möglich!«, fiel er ihr schnell ins Wort.
»Was ist nicht möglich?«
»Dass ich mit diesen Matas zusammen esse. Sie gehören einer anderen Kaste an. Es ist nicht etwa Verachtung — das gibt's bei uns nicht, aber die Kastengesetze sind unumstößlich. Wenn mich eine Situation dazu zwänge, mit ihnen zusammen zu essen, müsste ich ihnen den Rücken zukehren. Bitte, geben Sie mir den Topf.«
Er nahm den großen goldenen Topf, den Atalanta mit Fisch gefüllt hatte. Mit ihnen zusammen essen durfte er nicht, das hätte auch kein Hausierer oder Gaukler getan, welcher der siebenten Klasse angehört — aber ihnen das Essen eigenhändig hinzubringen, sie also zu bedienen, dabei fand der kaiserliche Prinz nichts. Von einer Verachtung oder auch nur Minderachtung ist also bei dem japanischen Kastenwesen gar keine Rede. Diese Art von Kastengeist existiert in Europa, ganz besonders im lieben Deutschland, nicht in Japan.
Und auch die Matrosen fanden nichts dabei, dass ihnen ein Sohn ihres Kaisers den dampfenden Topf brachte. Sie ließen ihn zwischen sich setzen und schmunzelten. Als ihnen dann aber Littlelu, ein Fremder, keiner ihrer Rasse, noch einige Teller brachte — und es hätten auch irdene sein können — da sprangen sie wie auf Kommando auf, und ihre dankbaren Verbeugungen, mit der Hand auf der Stirn, wollten kein Ende nehmen, sie komplimentierten noch, als der ehemalige Clown ihnen schon wieder den Rücken gekehrt hatte.
Dann zeigte es sich, dass auch jeder von ihnen ein modernes Essbesteck bei sich hatte, wenn auch nicht von Silber; sie putzten die Löffel und Gabeln eifrig, aßen dann mit dem größten Anstand, aber ununterbrochen schnatternd, immer alle vier gleichzeitig sprechend, sich immer gegenseitig nötigend. Es ist spaßhaft, ihnen zuzusehen. Und doch sind es ganze Männer vom Scheitel bis zur Sohle.
»Es sind Matrosen?«, fragte Arno.
»Ja. Sie sind mit einem englischen Segler von Australien gekommen. Das Schiff ging in San Francisco in Dock und musterte ab. Der Kapitän hatte die Verpflichtung, sie in die Heimat zurückzuschicken. Ich erfuhr davon, ich suchte einige Begleiter für meine Reise und nahm gleich die ganze Mannschaft — vierzehn Mann. Sie haben noch ein Jahr Urlaub.«
»Urlaub?«
»Nun ja, sie gehören doch zur Kriegsmarine, sind nur als Reservisten beurlaubt, müssen sich an- und abmelden, wie es doch auch bei Ihnen in Deutschland ist.«
»Der Herr Doktor ist wohl selbst Marineoffizier?«
»Ja.«
»Ich dachte es mir gleich, als ich Sie das Boot steuern sah. Da sind diese Matrosen wohl doppelt gern mit Ihnen gegangen?«
»O gewiss.«
»Ich habe einmal gehört«, nahm Littlelu das Wort, »dass in Japan noch die Leibeigenschaft existiert.«
»Leibeigenschaft? Noch?« Der Japaner wiegte sinnend den Kopf. »Ja und nein, wie man's nimmt.«
»Jede Kaste soll ihren eignen Herrn haben?«
»Ihren Usabi. Ihren Schutzherrn — ihren Protektor — nun ja.«
»Der sie im Parlament vertritt?«
»Nein, solch eine politische Vertretung gibt es nicht. Das ist ganz familiär durch Tradition.«
»Solch ein Usabi, wie Sie ihn nennen, soll aber eine furchtbare Macht über die nach Millionen zählenden Mitglieder seiner Kaste besitzen?«
»Eine furchtbare Macht? Er hat gar keine Macht!«
»Mir ist so berichtet worden.«
»Dann hat man Ihnen falsch berichtet.«
»Solch ein Usabi ist immer ein Prinz aus der kaiserlichen Familie?«
»So ist es.«
»Sie sind ein Sohn des Mikados?«
»Ja.«
»Beherrschen — protegieren Sie auch eine Kaste?«
»Ja.«
»Welche?«
»Die achte.«
»Die der Matrosen?«
»Die der Küstenbewohner, soweit sie Fischer und Schiffer sind.«
»Und Sie hätten diesen Leuten gar nichts zu befehlen?«
»Absolut gar nichts.«
»Hm.«
Littlelu rieb sich nachdenklich das Kinn, er mochte etwas ahnen.
»Gesetzt den Fall, Sie gehen mit einem Matrosen dort auf die zweitausend Meter hohe Felswand hinauf, stellen sich an den Rand, deuten in die Tiefe und befehlen: ›Spring!‹, würde der Mann springen?«
»Ich habe dem Manne gar nichts zu befehlen.«
»Hm. Wenn Sie aber nun zu ihm in recht liebevollem Tone sagten: ›Bitte, mein lieber Freund, huppe hinunter‹ — würde der Mann springen?«
»Sofort.«
Es war ausgesprochen. Dieser Japaner sprach immer die Wahrheit, verheimlichte nichts — aber er musste erst entsprechend gefragt werden.
»Er würde springen?!«, rief Arno. »Ohne jeden Grund?«
»Er würde mich etwas verwundert ansehen, dann würde er sich stramm aufrichten, würde salutieren und — in der Tiefe zerschmettern.«
Eine Pause trat ein. Littlelu schüttelte den Kopf, die Indianerin sah den Japaner mit ihren großen Augen starr an und Arnos Gedanken schweiften in die graue Vorzeit zurück, nach Germaniens Urwäldern. Er hatte eine Vision, sah ein Bild.
Der Herzog — der erwählte Führer, der vor dem Heere herzog — ist in der Schlacht gefallen. Und an seinem Grabe oder kolossalem Scheiterhaufen geben sich jene Krieger, die seine Leibgarde bildeten, die ihm unter der heiligen Eiche Treue bis zum Tode zuschwuren, selbst den Tod — um ihres Herzogs Einzug in Walhalla verherrlichen zu helfen!
Es ist heute für uns unverständlich — es ist zu gewaltig für unsere Zeit.
»Und das nennen Sie keine furchtbare Macht?!«, sagte Littlelu dann.
»Nein. Ich habe diesen Matas nichts zu befehlen.«
»Aber Ihr Wunsch ist ihnen Befehl.«
»Sie brauchen ihn nicht auszuführen.«
»Na, dann tun sie es freiwillig.«
»Ja. Aus Tradition.«
»Und diese Art von Treue, dieser freiwillige Gehorsam, der kein fragendes ›Warum‹ kennt, das ist das Herrlichste, was es auf dieser Erde gibt!«, rief Arno ganz begeistert.
»Na, ich danke!«, meinte hingegen Littlelu. »Wenn nun einmal ein Mann solch eine Macht bekommt, der sie missbraucht, der seine grausame Freude daran hat, einen nach dem anderen in den Abgrund huppen zu lassen?«
Diesmal blieb der Japaner doch die Antwort schuldig, und das mit Recht. Dieser Amerikaner, ein Yankee, hatte für so etwas ja gar kein Verständnis. Und es war ihm kein Vorwurf daraus zu machen, der war ebenfalls in seinem Rechte, wenn er das lächerlich fand.
Der Doktor blickte zu der himmelhohen Felswand empor, von der sich diese Insel ja nur einen halben Kilometer entfernt befand.
»Hier ist es herrlich! Dort oben möchte ich meine Sternwarte haben. Ich suche schon immer nach einem idyllischen und geeigneten Platze, wo ich mir eine hinbaue!«
»Das können Sie!«, sagte Atalanta sofort.
»Wie sieht es dort oben aus?«
»Ich war noch nicht oben.«
»Kann man überhaupt hinaufgelangen?«
»O, sobald der Wille dazu vorhanden ist.«
»Ich meine, ob es schon einen Weg gibt?«
»Ich glaube, es ist einer vorhanden, eine Treppe. Ich vermute es. Das wollen wir dann gleich untersuchen.«
»Weshalb bauen Sie sich nicht in Ihrer Heimat eine Sternwarte, weshalb hier in Amerika?«, fragte Littlelu.
»Ich darf mein Vaterland nicht betreten.«
Es war ganz gleichgültig gesagt worden, aber besonders auf Arno machte es einen tiefen Eindruck.
»Ah! Sie leben im Exil?«
»Ja, ich bin verbannt.«
»Aus politischen Gründen? Verzeihen Sie, wenn ich —«
»Bitte. Da ist nichts zu verheimlichen. Das erzählt Ihnen jeder Japaner — wenn Sie ihn zu fragen verstehen. Jospihito Haru no mija, der Thronnachfolger, ist der Sohn des Mikados mit einer Nebenfrau, der Prinzessin Janagiwara Sawarabi, und ist durch deren Vater der Protektor der zweiten Kaste geworden, der Siomis, der erblichen Adligen. Dieser Usabi ist stets Kronprinz gewesen. Nun sind aber die Matas der achten Kaste, die mehr als den dritten Teil der ganzen Bevölkerung bilden, durch den letzten Krieg sich ihrer Kraft bewusst geworden. Sie wollen ihren Usabi auf den Thron haben — mich. Da habe ich mein Vaterland verlassen, freiwillig.«
»Es könnte zu einer Revolution kommen?«
»Ja. Aber nicht ohne mich.«
»Sie haben keine Neigung, den Thron einzunehmen?«
»Nein.«
»Sie wollen ganz Ihrer Wissenschaft leben?«
»Das ist es nicht. Solch eine Revolution würde das größte Unglück für das Land bedeuten, das ich über alles liebe, über das schon der l66. Kaiser aus derselben Dynastie herrscht, seit dem Jahre 600 vor Ihrer Zeitrechnung. Der Adel muss das Ruder in der Hand behalten.«
»Trotzdem«, ließ sich Littlelu vernehmen, »wenn Sie doch noch einmal Kaiser von Japan werden sollten — wollen Sie sich meiner gefälligst erinnern — ich empfehle mich Ihnen als Minister. Ich werde ministern, dass Sie vor Lachen nicht regieren können.«
Atalanta blickte nach den vier japanischen Matrosen. Sie harten ihre Mahlzeit beendet, wuschen sich am Strand Hände und Gesicht und bearbeiteten dann mit einer wahren Wut die goldenen Teller mit Wasser und Sand.
»Ihre Diener scheinen —«
»Bitte, Miss!«, fiel ihr der Doktor schnell ins Wort. »Diese Matrosen verstehen Englisch. Und sie sind maßlos stolz. Das sind keine Diener, keine Servants. Die servieren niemandem, auch dem Mikado nicht. Die verdingen sich als Arbeiter, aber nicht als Diener. Auch beim Militär müssen als Stewards und aufwartende Ordonnanzen Leute aus der siebenten Kaste angestellt werden. Das sind meine Begleiter, meine Leute — aber nicht meine Diener.«
»Bezahlen Sie sie?«
»Ja. Sie fordern sogar sehr viel. Englische Heuer. Den Monat vier Pfund Sterling und volle Beköstigung.«
»Das wundert mich. Ich glaubte, die Japaner arbeiteten sehr billig.«
»In ihrer Heimat. Außerhalb derselben in fremden Diensten ist ihnen der höchste Lohn gerade gut genug!«
Das sind keine Streikbrecher, und dies hängt auch mit ihrem Stolze zusammen.
»Und was machen diese Matrosen mit dem vielen Gelde, das in ihrer Heimat erst recht einen hohen Wert hat?«
»O, die haben nichts.«
»Warum denn nicht? Ich glaube doch nicht, dass sie alles gleich verprassen?«
»Ganz im Gegenteil. Sie geben alles, was sie nicht für das Notwendigste brauchen, ab.«
»An wen?«
»An ihren Usabi.«
»Das wären doch Sie?«
»Für diese Matas — ja.«
»Alles, was diese mehr als zehn Millionen Menschen verdienen, gehört Ihnen?!«, staunte Arno.
»Was sie nicht verbrauchen — ja. Sie geben es mir freiwillig.«
»Das lasse ich mir gefallen!«, lachte Littlelu. Dann können Sie diesen Leuten ja auch fürstliche Gehälter zahlen, wenn Sie alles wieder bekommen!«
»Nun, ich muss auch danach Steuern bezahlen. Es ist ein Irrtum, wenn es immer heißt, in Japan gebe es keine Einkommensteuer. Es ist eben der Usabi, der für die ganzen Gemeinden und für jeden einzelnen Kopf die Steuern bezahlt. Das nennt man Feudalwirtschaft, die am ausgeprägtesten noch in Japan ist. Der hat auch bei Erkrankungen, bei Hungersnöten und dergleichen für seine Leute zu sorgen. Falsch ist es aber wiederum, wenn man das mit Leibeigenschaft vergleicht. Es ist alles ganz und gar freiwillig.«
»Nun, Sie kommen aber dabei wohl auf Ihre Kosten?«
»O ja, das kommt man!«, lächelte der Astronom und kaiserliche Prinz.
In Japan gibt es schwerreiche Menschen, wie in China, in Russland und in allen Ländern, in denen Hunderttausende oder auch Millionen Menschen gar nichts haben, und einer hat alles. Gerade in Japan aber fühlt sich hierbei niemand unzufrieden. Es ist ein patriarchalisches System von harmonischster Einheit und Einigkeit. Freilich gehört dazu wohl das Kastenwesen.
Die Indianerin war die einzige von den dreien, die sogleich, nachdem sich dieser Japaner als einen immens reichen Mann offenbart hatte, auf einen praktischen Gedanken kam.
»Herr Doktor, können Sie uns dieses Gold abkaufen?«
Es machte recht den Eindruck, als ob der Japaner nur auf diesen Vorschlag gewartet habe. Sehr schnell griff er nach einem der goldenen Teller, obgleich er solche beim Essen doch schon immer in der Hand gehabt hatte. Jetzt aber prüfte er ihn aufmerksam, suchte ihn zu biegen, ritzte und schnitt mit einem Messer, suchte sich einen schwarzen, glatten Stein, zog darauf mit dem goldenen Teller einen Strich, links und rechts daneben ebenfalls Striche mit zwei verschiedenen Goldmünzen, die er seiner Tasche entnahm, einer amerikanischen und einer japanischen.
»Das scheint fast ganz reines Gold zu sein. Die Münze wird für das Kilogramm mindestens fünfhundert Dollars zahlen.«
»Und wie viel geben Sie dafür?«
»Weshalb bringen Sie es nicht nach der Münze?«, war die etwas versteckte Frage.
»Weil ich möchte, dass von diesem Goldfunde die Welt gar nichts erfährt.«
»Das habe ich mir gedacht!«, war jetzt die offene Erklärung. »Wie viel Gold liegt hier noch auf dem Grunde?«
Atalanta schilderte, wie die Verhältnisse lagen. Wie sie davon erfahren, wie sie auf den Gedanken mit dem Aeroplan gekommen war, wie sie diese Stelle aber eigentlich nur durch Zufall gefunden hatte, wie dieser Seehund, dessen Herrn sie gar nicht kannten, mit jedem Teller den letzten heraufbringen konnte. Sie war ganz ausführlich gewesen. Nur von ihren Erlebnissen in jener hohlen Felswand hatte sie nicht gesprochen, das gehörte jetzt noch nicht hierher.
»Wir können das Gold, das wir hier schon gefunden haben und vielleicht noch finden werden, wohl unbemerkt von hier fortbringen, es aber nicht unbemerkt verkaufen. Ich habe schon an eine Gesellschaft oder an einen anderen Mann gedacht, dem ich dies alles übergebe. Aber das ist doch immer dieselbe Geschichte. Es müssten fremde Arbeiter kommen, deren Schweigen doch gar nicht zu erkaufen ist.«
»Das würde ich gern übernehmen, und auf mich und meine vierzehn Matas können Sie sich verlassen.«
»Vierzehn?«
»Nun ja, ich sagte Ihnen doch, dass ich die ganze Besatzung des englischen Seglers, die nur aus Japanern bestand, in meine Dienste gekommen habe.«
»Sie haben sie alle mitgebracht?«
»Jawohl. Die anderen zehn liegen drüben auf dem jenseitigen Ufer. Ich kann ja aber, wenn es nötig ist, noch viel mehr hierher zitieren.«
»Sie würden das Gold nach Japan bringen?«
»Nach Tokio für die Münze. Aber hiervon wird die Welt nichts erfahren, davon erfährt auch der schlaueste Zeitungsspion nichts.«
»Das glaube ich wohl!«, ließ sich wieder einmal Arno vernehmen, und er lächelte sinnend.
»Und was zahlt die japanische Münze?«, fragte Atalanta.
»Jedenfalls mehr als die der Vereinigten Staaten.«
»Und was wollen Sie dabei verdienen?«
»Ich? Nichts! Ich bin kein Kaufmann, kein Händler.«
»Ja, wo bleibt denn da aber überhaupt der Verdienst?«
»Der Münze, meinen Sie? Nun, die verdient doch schon dadurch, dass sie aus Gold Münzen prägt, die doch nicht dem eigentlichen Goldwerte entsprechen.«
»Und die Transportkosten?«
»Die kommen doch gar nicht in Betracht! Was ist denn ein Zentner dem Gewicht nach! Die ganze Tonne kostet von San Francisco nach Tokio vier Dollars, und ob das Lumpen sind oder Goldbarren, das ist dabei doch ganz gleichgültig.«
»Ja, Sie müssen aber doch Ihre Leute bezahlen, müssen Taucher kommen lassen und so weiter; denn ich müsste die ganze Angelegenheit Ihnen übergeben. Fordern Sie einen Prozentsatz.«
Der Japaner wollte etwas sagen, er schwieg aber und blickte den Grafen fest an.
»Herr Graf, erlauben Sie, dass ich mit Miss Ramoni etwas seitwärts gehe, um allein mit ihr etwas zu besprechen?«
Es war eine recht merkwürdige Frage gewesen. Oder aber: Dieser Japaner hatte sich sofort in das Verhältnis der beiden gefunden.
»Bitte sehr. Da müssen Sie aber vor allen Dingen Miss Atalanta selbst fragen.«
Sofort erhob sich Atalanta, der Japaner folgte ihr. Sie hatte ihn in die Mitte der Insel geführt, dort, wo der Baumstumpf stand.
»Bitte!«
Auch jetzt vermochten ihre scharfen Augen nicht das Geringste zu erkennen, was gegenwärtig im Innern dieses Japaners vor sich ging, sonst wäre sie jedenfalls furchtbar erschrocken gewesen.
»Es hat«, begann er, »in letzter Zeit über Sie ja sehr viel in den Zeitungen gestanden, man hat sich mit Ihrer Vergangenheit beschäftigt, über die Sitten der Mohawks. Ist es wahr, dass sich die Mohawks gegenseitig als Sklaven verdingten?«
»Als Sklaven ist nicht der richtige Ausdruck. Einer trat zum anderen in ein absolut abhängiges Verhältnis.«
»Das ist es auch, was ich meine. Wissen Sie, dass dasselbe allgemein auch in Japan üblich ist, dass sich jeder Mann eine andere Person suchen muss, der er ganz freiwillig absoluten Gehorsam zuschwört? — Sie sehen es an diesen Matas, wie ich es Ihnen schilderte. Dieses freiwillig gewährte Dienstverhältnis geht durch alle Kasten bis hinauf zur ersten. Dieses Verhältnis hat aber nichts mit Politik oder Nationalität zu tun, es ist ganz privat. Jeder von uns muss seinen persönlichen Herrn haben, dem er bedingungslos gehorcht, sonst fehlt ihm das Beste im Leben. Mein bisheriger Herr war mein Oheim. Er ist gestorben. Wollen Sie mich in Ihre Dienste nehmen?«
Diese Indianerin fragte nicht: Warum gerade ich? Ich, ein Weib? Sie fragte gar nichts.
»Ich nehme Sie an!«, sagte sie einfach. Auch der Japaner machte keine Zeremonie daraus.
»Sie haben über mich zu befehlen.«
»Ich brauche nicht zu bitten, sondern Ihnen gegenüber kann ich befehlen?«
»Befehlen! Denn Sie sind nicht mein Usabi durch Geburt, sondern ich habe Sie freiwillig dazu erwählt.«
»Wenn ich Ihnen befehle, Sie sollen...«
»Ich werde in die Tiefe springen.«
»... Sie sollen sich an die Spitze Ihrer zehn Millionen Matas stellen und sich auf den Thron —«
»Ich werde es nicht tun.«
»Dann ist das kein absoluter Gehorsam.«
»Doch.«
»Wie das?«
»Ich bin nicht imstande, Ihren Befehl auszuführen.«
»Weil Sie sich selbst töten?«
»Ja.«
»Meinetwegen brauchen Sie sich nicht zu töten. Ich bitte Sie nur —«
»Sie haben mir zu befehlen.«
»Ich befehle Ihnen nur, dass Sie die von mir begonnene Arbeit hier fortsetzen, im Aeroplan den See weiter absuchen, erspähtes Gold zutage fördern und es unbemerkt verkaufen.«
»Ich gehorche.«
»Denn ich selbst verlasse mit meinen Begleitern diese Gegend.«
Das hatte der Japaner wohl nicht zu hören erwartet, aber nichts von einem Zusammenzucken oder dergleichen wurde in seinem unbeweglichen Gesicht bemerkbar.
»Wohin begeben Sie sich, wenn ich fragen darf?«
»Erst nach New York, wo sich der gelähmte Graf einer Kur unterziehen wird. Dann treten wir wahrscheinlich eine Reise nach Palästina und noch weiter an.«
»Ich werde Ihnen schreiben können?«
»Sie werden immer meine Adresse haben, wo ich Ihre Briefe rechtzeitig erhalte. Und wo bleiben Sie?«
»Ich möchte gern für immer hier bleiben, es ist mein Ernst — wenn Sie mir gestatten, hier eine Sternwarte zu bauen!«
»Das gestatte ich Ihnen natürlich gern. Darüber sprechen wir gleich noch. Also Sie wollen für immer hier bleiben?«
»Wenn Sie mich nicht fortweisen.«
»Davon ist doch gar keine Rede. Kehren Sie denn nie wieder in Ihre Heimat zurück?«
»Nie wieder.«
»Sie denken schon daran, hier zu sterben?«
»Ja.«
»Sich hier mit vielen Ihrer Landsleute anzusiedeln?«
»Mit vielen Japanern? Das hängt ganz von Ihnen ab, denn wenn Sie mich rufen, so werde ich zu Ihnen eilen, wo Sie auch weilen.«
»Gut. Kann ich von diesem unserem Verhältnis anderen erzählen?«
»Wie sie wollen.«
»Da braucht nichts geheim gehalten zu werden?«
»Nein. Warum denn?«
»Werden Sie davon zu anderen sprechen?«
»Zu keinem Menschen.«
»Nun, dass ich keine Schwätzerin bin, das dürfen Sie mir wohl glauben. Aber wenn so gar kein Geheimnis dabei ist, warum haben Sie mir das dann nicht in Gegenwart der andern gesagt?«
»Weil es ganz an Ihnen liegen soll, ob davon andere wissen dürfen oder nicht.«
»Sie haben recht. Haben Sie mir sonst noch etwas unter vier Augen zu sagen?«
»Nein.«
»Dann können wir uns ja wieder zu unseren Freunden gesellen und das Weitere in ihrer Gegenwart besprechen.«
Atalanta wandte sich zum Gehen, aber der Japaner vertrat ihr halb den Weg.
»Bitte, noch ein Wort.«
»Ja?«
»Ich hatte doch noch einen besonderen Grund, Ihnen diese Erklärung unter vier Augen zu geben.«
»Nun?«
»Noch ein Nachsatz —«
Der Japaner trat noch einen Schritt auf sie zu, und da war es, als ob ein grimmiges Zähneknirschen erklänge, obgleich sich sein Gesicht dabei gar nicht veränderte — es war und blieb das lustige Mopsgesicht.
»Wissen Sie, weshalb ich mich zu Ihrem Sklaven gemacht habe? Weil ich sonst Sie hätte töten müssen — Sie und den Grafen!«
Nur ein klein wenig zogen sich die Brauen der Indianerin zusammen, als sie den so Sprechenden starr anblickte.
»Weshalb uns töten?«, fragte sie ganz ruhig.
»Weil ich zu Ihnen in leidenschaftlicher Liebe entflammt bin — und deshalb den anderen Mann hassen muss. Indem ich mich aber zu Ihrem Leibeigenen gemacht habe, darf ich Sie nicht mehr lieben — und jener Mann, den Sie lieben, ist mir hierdurch gleichgültig geworden. Sie beide sollen mich jetzt nicht mehr in meinen Studien stören.«
Es war etwas echt Japanisches, was die Indianerin zu hören bekommen hatte. Die leidenschaftliche Liebe durch freiwillige Entsagung in sklavischen Gehorsam verwandelt — und das nur aus reinstem Egoismus!
Die Indianerin erwiderte nichts, sah Hikari nur noch einmal starr an, dann hob sie etwas die Schultern und ging zurück. Der Japaner folgte ihr.
»Es ist alles in Ordnung. Doktor Hikari wird unsere Arbeit hier tatkräftig fortsetzen. Wir könnten sofort abreisen. Erst muss ich ihn aber doch in der Bedienung des Aeroplans unterweisen, und zweitens ihm noch manches erzählen, auf was für Überraschungen er hier gefasst sein muss!«
»Auf was für Überraschungen?«
»Das erzähle ich Ihnen nachher. Ich will erst noch einmal dort in die hohle Felswand eindringen. Das hängt auch eng damit zusammen, dass ich gleich wegen Ihrer Sternwarte Umschau halten will.«
»Du willst noch einmal durch den Wassertunnel schwimmen?«, fragte Arno.
»Ja. Aber ich glaube, es ist das letzte Mal. Wie gesagt, ich muss nur einmal Umschau halten.«
»Und ich möchte noch einmal zu meinen anderen Leuten hinüber!«, sagte Hikari.
»Wollen Sie nicht gleich alle mit herüberbringen?«
»Alle wohl nicht. Ich möchte Wachen ausstellen.«
Er ging sofort ins Boot, nahm alle vier Ruderer mit, was ja nicht gerade nötig gewesen wäre. Auch diese Japaner wollten wohl alle zusammen erst einmal beraten.
»Was hatte er Dir denn unter vier Augen zu sagen?«, fragte Arno.
Atalanta erzählte alles unumwunden, wenn sie sich auch noch kürzer fasste, als der Japaner es getan.
Auch seine letzten Worte verschwieg sie nicht.
Arno machte ein etwas finsteres Gesicht.
»Das finde ich seltsam! Das ist ja ein ganz gefährlicher Mensch!«
»Findest Du? Ich denke gerade das Gegenteil. Kann es denn einen offeneren, ehrlicheren Charakter geben?«
Während Littlelu hiermit nicht ganz einverstanden zu sein schien und etwas Unverständliches vor sich hin brummte, hellte sich Arnos Gesicht gleich wieder auf.
»Du hast recht, Atalanta! Gewiss, so ist es. Wir sind solch eine Offenheit nur nicht mehr gewohnt. Nun, sprechen wir nicht weiter darüber. Auf diesen Japaner und seine Matas können wir uns jedenfalls verlassen.«
»Und ich bitte Euch, auch sonst nicht weiter darüber zu sprechen!«, sagte Atalanta noch.
Sie stieg ins Boot und ruderte davon, der Felswand zu. Arno und Littlelu waren allein auf der Insel. Eine Unterhaltung wollte nicht recht in Fluss kommen. Beide dachten an Professor Dodd. Aber es hatte gar keinen Zweck, jetzt darüber zu sprechen.
»Die Bekleidungsgegenstände des Götzen wollen wir doch lieber nicht einfach als Gold verkaufen!«, meinte Arno, und darüber unterhielten sie sich eine Zeit lang.
Dann bat Arno, ihm eine höher sitzende Stellung zu geben. Auch der ehemalige Clown brachte es fertig, den schweren Mann auf den Rücken zu nehmen. Er trug ihn nach der Mitte der Insel und ließ ihn dort auf den Baumstumpf nieder. Da Arnos Füße nicht als Stütze dienen konnten, war dieses Sitzen mehr ein Balancieren des Oberkörpers, das er mit der Zeit gelernt hatte.
Was machte jetzt Atalanta? War sie schon durch den Wassertunnel eingedrungen? War nicht jeder neue Besuch der Felsräume mit der größten Lebensgefahr verbunden? Konnten jene geheimnisvollen Menschen nicht immer noch eine Explosion herbeiführen, um unliebsame Besucher für immer zu beseitigen?
Solche Gedanken waren auch nicht danach beschaffen, ein Gespräch aufkommen zu lassen, eben weil niemand so etwas aussprechen wollte und jeder doch immer daran denken musste.
»Nun, diese Japaner werden den hier hausenden Geistern schon das Handwerk legen!«, meinte Littlelu.
»Glauben Sie?«
»Nicht durch ihren Scharfsinn werden sie alle Geheimnisse ausspähen, sondern durch ihre Geduld, durch ihre grenzenlose Geduld. Die legen sich wie eine Katze vor dem Mauseloch auf die Lauer, brauchen nur ein Säckchen Hartbrot und ein paar Gurken, und sie liegen wochenlang bewegungslos da. Merkwürdige Menschen, diese Japaner.«
»Sie haben ihre Bekanntschaft schon früher gemacht?«
»Man kommt ja manchmal mit Japanern zusammen, gerade hier im Westen Amerikas. Bei solchen gelegentlichen Bekanntschaften erfährt man freilich nichts von ihnen. Aber in unserem Zirkus war einmal eine Truppe von japanischen Gauklern, mit denen wurde ich etwas intim. Ihr Führer war ein aus der Kaste gestoßener Priester. Große Geheimnisse konnte er freilich auch nicht verraten. Ein kurioser Kauz. Er war ein absoluter Freigeist, glaubte an nichts, was er nicht mit Fäusten packen konnte, und trotzdem behauptete er steif und fest, dass es in Japan und vielleicht auch anderswo Menschen gebe, die sich unsichtbar machen könnten. Er selbst sei oftmals Zeuge davon geworden. Und dabei handele es sich nicht etwa um eine besondere Ausbildung, um höhere Kräfte und dergleichen, sondern um Menschen, die hierzu von Natur aus disponiert seien. Und so einfach ist die Geschichte, dass es genügt, nur ein Wort auszusprechen, und der zur Unsichtbarkeit Disponierte zerfließt sofort in Luft.«
»Ist es vielleicht das Wort Omahatwa?«
»Ha—hazieh!«, nieste Littlelu, drehte sich um und gebrauchte das Taschentuch. »Sehen Sie, ich habe es beniest. Woher wissen denn Sie etwas von diesem Wort?«
Arno antwortete nicht gleich, und Littlelu, ihm den Rücken kehrend, beschäftigte sich noch eingehend mit seiner Nase.
»Ich glaube, ich habe den Ansatz zu einem Schnupfen. Der Knipperdolling, der Kerl, muss mich angesteckt haben, der hat schon lange einen ätherischen Geisterstockschnupfen. Woher kennen denn Sie dieses Wort? Haben Sie auch schon von dem Blödsinn —«
Littlelu drehte sich um. Und das Wort erstarb ihm im Munde.
Der Baumstumpf war leer, der Daraufsitzende verschwunden.
Littlelu starrte nicht schlecht.
Dass der Graf plötzlich den Gebrauch seiner Füße bekommen und sich davongeschlichen hätte, davon konnte keine Rede sein, an so etwas dachte Littlelu gar nicht.

Obgleich es dem Komiker jetzt durchaus nicht humoristisch zumute war, drückte er sich doch so durch Bewegungen und Worte aus, das Clownartige war ihm schon in Fleisch und Blut übergegangen.
So schlich er zunächst auf den Zehenspitzen um den Baumstumpf herum, meinend, der Graf könnte nach der anderen Seite hin heruntergepurzelt sein. Dann aber hätte er schon von hier aus zu sehen sein müssen, so dick war der Baumstumpf gar nicht.
»Herr Graf, wo sind Sie denn?«, flüsterte er ängstlich.
Ebenso ängstlich trat er näher heran, fuhr mit der Hand in verschiedenen Höhen über dem Baumstumpf hin und her.
Aber Arno hatte sich durch das Zauberwort nicht nur unsichtbar, sondern auch gefühllos gemacht.
»Luft, alles Luft!«, murmelte Littlelu, mit der Hand immer hin und her fahrend. »Herr Graf, liebster, bester Herr Graf, wo stecken Sie denn nur?!«
Er flüsterte, schrie und brüllte es. Aber da kam keine Antwort.
»Sie sind doch nicht etwa — disponiert? Ach, das ist ja Unsinn! So etwas gibt's ja gar nicht. Aber wo sind Sie denn nur? Bitte, machen Sie sich doch wieder sichtbar. Sprechen Sie das Gegenzauberwort aus. Das wissen Sie nun wohl nicht? Na, das ist ja eine schöne Geschichte!«
Das heißt, humoristisch war ihm dabei durchaus nicht zumute. Der gelähmte Graf war ihm von Atalanta anvertraut worden mit dem Auftrag, streng über seine Sicherheit zu wachen, und der war jetzt verschwunden. Ob er auf natürliche oder übernatürliche Weise verschwunden, das war dabei ganz Nebensache.
»Herrgott, wenn jetzt die Indianerin zurückkommt und sie sieht den Grafen nicht, skalpiert sie mich. Wenn ich mich dann nur auch gleich... Omahatwa, Omahatwa, Omahatwa... ich merke nichts, dass ich unsichtbar oder gefühllos werde. Zum Teufel, Graf, so machen Sie sich doch wieder undurchsichtig und gefühlvoll, was soll denn nur so ein Unsinn. Ich bin ein alter Mann, den dürfen Sie nicht so veralbern!«
Stimmen wurden laut, die Japaner kamen zurück.
Littlelu rannte an das Ufer. Dass das Boot jetzt mit acht Mann besetzt war, sah er gar nicht — er sah nur den aussteigenden Doktor Hikari.
Die Sache war nämlich die, dass Littlelu allein durch den Gedanken, jetzt könne Atalanta kommen und ihn nach dem Grafen fragen, ganz und gar den Kopf verloren hatte.
»Herr Doktor, Herr Doktor, der Graf ist verschwunden!«
»Verschwunden?«
»Er hat sich unsichtbar gemacht!«
»Unsichtbar? Er hat sich versteckt?«
»Ja, aber in der Luft, in der Luft! Er hat sich durchsichtig gemacht, hat sich in Luft aufgelöst.«
»Was, er könnte sich unsichtbar machen?«, wiederholte der Doktor in berechtigtem Staunen.
»Jawohl, und gefühllos dazu! Er hat das Wort Omahatwa ausgesprochen, und weg war er!«
»Omahatwa? Das ist ja das japanische Zauberwort, mit dem man sich angeblich unsichtbar machen kann.«
»Na ja, und der Graf hat es eben ausgesprochen, und weg war er.«
»Ach, das ist doch nur das bekannte japanische Märchen, wo die beiden Liebenden —«
»Nee, das ist eben kein Märchen, es ist eine Tatsache, dass mein Graf sich unsichtbar und gefühllos gemacht hat; Ihr albernes Liebespaar geht mich gar nichts an!«, wurde Littlelu jetzt böse.
Doktor Hikari blickte den Sprechenden etwas zweifelnd an. War der geistig auch ganz normal? Die Bekanntschaft war noch eine sehr kurze.
»Wo soll er denn verschwunden sein?«
»Dort auf dem Baumstumpf hat er gesessen, wo Sie vorhin mit der Atalanta hingegangen sind. Fühlen Sie selber nach, ob Sie noch etwas fühlen, und dann können Sie mir Ihr Märchen weitererzählen!«
Der Japaner brauchte nur wenige Schritte zu machen, so sah er zwischen den Bäumen ohne Unterholz den einzelnen Baumstumpf.
»Da sitzt er ja!«
Ja, da saß Arno auf dem Baumstumpf, jetzt sah ihn auch der nachkommende Littlelu. Und jetzt mochte es doch wirklicher Humor sein, wie er sich benahm.
Er schlich langsam auf ihn zu, zuletzt auf den Zehenspitzen, streckte die Hände aus und betastete ihn vorsichtig von allen Seiten.
»Aah! Ich sehe Sie nicht nur, sondern Sie sind auch wieder gefühlvoll! Ja, Graf, wie machen Sie denn das nur?«
»Das ist ganz einfach«, lachte Arno, obgleich er sich wohl zum Ernste zwingen wollte, »da brauche ich nur das Wort Oma...«
Schnell legte ihm Littlelu die Hand auf den Mund.
»Bscht, bscht! Mit solchen Zauberworten darf man nicht so leichtsinnig umgehen!«
»Halten Sie sich nur fest an mich, dann verschwinden Sie mit mir. Herr Doktor, treten Sie etwas zurück — Omahatwa — da sehen Sie, jetzt zerfließen wir beide in nichts —«
Der Baumstumpf senkte sich in die Tiefe hinab und mit ihm seine nähere Umgebung, ein quadratisches Stück Rasenland von etwa zwei Meter Durchmesser.
Es war ein ganzer Block, in dem dies alles ruhte, in eisernen, senkrecht stehenden Schienen laufend. Oben war das Ganze so gut zusammengearbeitet, dass auch das Auge der Indianerin nichts davon gemerkt hatte, wie sich hier der Rasenboden teilen konnte. Eingelegte, aber unsichtbare Eisenschienen verhinderten ein Zusammenwachsen der Wurzeln.
Als sich der Kopf des stehenden Mannes etwa vier Meter unter der Erdoberfläche befand, hielt der Block. Man sah im hellen Scheine von elektrischem Licht, dass er auf dem Boden stand oder nur auf einem Absatz, denn eine Treppe führte noch tiefer hinab.
Auf diesem Absatz stand Atalanta und hantierte an einigen Hebeln, die aus der Felsenwand hervorsahen.
Die Indianerin war also durch den Unterwassertunnel geschwommen. Beim Emportauchen auf der anderen Seite erwartete ihrer eine große Überraschung. Wieder erstrahlte das weite Felsengewölbe mit dem Wasserbassin in elektrischem Lichte, von der Decke ausgehend. Wieder lagen da ein Motorboot und zwei Ruderboote, das eine von venezianischer Bauart. Auch in den anderen Gängen und Räumen, soweit sie Atalanta in dieser kurzen Zeit besucht hatte, waren die elektrischen Leitungsdrähte wieder gelegt worden, leuchteten wieder Bogenlampen und Glühbirnen.
Doch, wie gesagt, mit einer näheren Umschau hatte sich Atalanta gar nicht aufgehalten. Sie war hierher gekommen, um den unterirdischen Tunnel zu suchen, der, wie sie vermutete, von hier aus nach der Goldinsel führte. Und diese Indianerin ging immer auf ihr Ziel los, das sie zurzeit vor Augen hatte. Was links und rechts neben diesem Wege lag, das war ihr jetzt gleichgültig.
Schon bei ihrem ersten und zweiten Besuche hatte sie gesehen, dass es auch eine noch tiefer führende Treppe gab. Sie hatte diese damals nicht weiter untersucht, so wenig wie sie damals höher gestiegen war. Damals hatte sie eben wieder ein anderes Ziel vor Augen gehabt, und von diesem ließ sie sich durch nichts ablenken.
Um zu dieser Treppe zu kommen, musste sie die rechte Eisentür benutzen. Sie ließ sich öffnen. Auch hier war wieder alles elektrisch beleuchtet. Sie stieg die Treppe hinab, die in einen Gang mündete, der nach Osten führte, also dorthin, wo die Goldinsel lag, und zwar unter dem Seeboden hin. Auch dieser Tunnel war hell erleuchtet.
Atalanta zählte gegen siebenhundert Schritte, bis sie wieder an eine nach oben führende Treppe kam. Diese war nur kurz, brachte sie hier auf diesen Absatz mit den senkrechten Eisenschienen und den aus der Wand hervorsehenden Hebeln, wie bei einer Eisenbahnweiche.
Dass sie sich hier unter der Goldinsel befand, konnte sie sich aus der Richtung und Schrittzahl berechnen. Dass sich aber der Gang auch auf der anderen Seite fortsetzte, interessierte sie jetzt nicht. Sie drehte an den Hebeln — da kam zwischen den Schienen der mächtige Steinblock herabgefahren mit dem Baumstumpf, auf dem Arno saß.
Durch die unvermutete Rutschpartie verlor der Gelähmte die Balance, er war von seinem Sitze herabgefallen, aber erst unten, Atalanta hatte ihn aufgefangen. Da sie einen anderen Hebel schon wieder herumgeklappt hatte, ging der Steinblock mit dem Baumstumpf gleich wieder in die Höhe.
Atalanta berichtete dem Geliebten ihre Entdeckungen mit weniger Worten, als wir hier gebraucht haben. Das Staunen Arnos lässt sich denken.
»Die Ausgezogenen haben also von ihrer Felsenwohnung wieder Besitz ergriffen?«, meinte Arno.
»Das bezweifele ich!«, entgegnete Atalanta. »Ich glaube eher, sie wollen sich mit uns aussöhnen. Sie wollen sich auf die andere Seite beschränken, die nicht mehr zu meinem Gebiete gehört, und möchten mit uns in friedlicher Nachbarschaft leben. Während unserer Abwesenheit haben sie wieder die elektrische Lichtleitung angelegt, sie stellen uns sogar ihre Boote zur Verfügung, die sie auf der Landseite nicht gebrauchen können.«
»Atalanta, das ist eine kühne Mutmaßung!«
»Gewiss, es ist nichts weiter als eine Mutmaßung, und man sollte überhaupt nie mutmaßen, sondern das Unbekannte immer nur erforschen.«
Unter ihrem Hebeldruck kam der Baumstumpf herab, sie untersuchte ihn genau.
»Wonach siehst Du?«
»Dieser Fahrstuhl muss doch wohl auch von oben in Bewegung gesetzt werden können. Da ist es ja schon. Daran konnte man freilich nicht denken, wenn man nichts davon ahnte.«
In dem Baumstumpf war ein alter Astansatz, der sich herausnehmen ließ, in der Höhlung, also in einem Astloch, zeigte sich ein metallener Knopf, der sich zurückdrücken ließ. Manches scharfe Auge und manche suchende Hand hätte aber auch diesen geheimen Mechanismus nicht gefunden.
»Ich möchte lieber hier unten bei den Hebeln bleiben. Du kannst ja wieder in die Höhe fahren und oben an dem Knopfe drücken? Dass Du nicht etwa herabfällst!«
»Wenn ich weiß, dass ich festsitzen muss, dann sitze ich auch ganz fest.«
So fuhr Arno wieder in die Höhe, wurde von Littlelu als wieder sichtbarer Mensch betastet und nahm dann diesen durch einen Druck auf den Knopf mit sich in die Tiefe. Diesmal blieb der Baumstumpf unten.
»Ist Doktor Hikari wieder da?«, fragte Atalanta.
Der Japaner zeigte nicht das geringste Staunen, er beobachtete nur alles scharf mit seinen klugen Schlitzaugen und trat jetzt dicht an den Rand des Loches.
»Hier bin ich, Miss.«
»Mit ihren Leuten?«
»Acht habe ich mitgebracht. Die anderen sechs sollen drüben am Ufer bleiben.«
»Jetzt möchte ich die Felsenräume näher untersuchen. Willst Du mitkommen, Arno?«
»Da möchte ich selbstverständlich mit dabei sein.«
»Dann wollen wir doch lieber Deinen Tragkorb holen lassen.«
Alle drei fuhren wieder in die Höhe, Atalanta bat, dass das japanische Boot von ihrem Lagerplatz den Tragkorb holen möchte, auch könnten gleich die Pferde und Maultiere mit neuen Weideplätzen versehen werden.
Sie beschrieb die Lage des Platzes genau, zu verfehlen war er gar nicht, man brauchte ja nur das Ufer entlang zu fahren; das Boot ging mit vier Ruderern ab, das war nun freilich etwas anderes als das Lederboot mit den Schaufelrudern, schon in einer halben Stunde war es mit dem Tragstuhle zurück, die Japaner hatten auch den angebundenen Tieren neue Grasflächen angewiesen.
In dieser halben Stunde hatte Atalanta ihrem japanischen Stellvertreter alles erzählt, was er über jene Felsenräume wissen musste. Auch über Professor Dodd und über das heute früh erlebte Abenteuer mit dem gezeichneten Wolfe, der sich dann in einen Neger verwandelt hatte.
Was sie nicht erzählt hatte, das brauchte dieser Japaner eben auch nicht zu wissen.
»Haben Sie sonst noch etwas zu fragen?«
Doktor Hikari hatte die Erzählerin mit keinem einzigen Worte unterbrochen.
»Sie sind bei aller Kürze so ausführlich gewesen, dass mir beim besten Willen keine Frage mehr einfällt. Vielleicht dass ich bei der Besichtigung zu fragen Anlass finde!«
»So wollen wir unsere Forschungsreise antreten. Nur darauf mache ich Sie noch einmal besonders aufmerksam, Herr Doktor, dass es mein Gebiet ist, auf und in dem wir uns befinden — mein Gebiet, mein rechtmäßiges Eigentum!«
Diese Worte hatten wieder einmal das Verhalten der Indianerin erklärt, die immer ohne Weiteres in ein ihr ganz unbekanntes Reich eindrang, scheinbar gar nicht an irgend eine Gefahr denkend, ihr ganz gleichgültig, oh sie auf Menschen stieß oder nicht. Es war der indianische Charakter. Lieber sterben als das Kleinste von seinem Rechte aufgeben.
Sie fuhren in die Tiefe, Arno in dem bequemen Stuhle, den die Träger sowohl an den Seiten wie vorn und hinten anfassen konnten. Das Tragen besorgten zwei japanische Matrosen und zwei andere begleiteten sie. Alle trugen am Gürtel den großen Marinerevolver und das gewaltige Schiffsmesser in der Scheide. Natürlich schloss sich auch Littlelu an.
»Wo ist die Quelle des elektrischen Lichtes und wo geht der finstere Gang nach jener Seite hin?«, fragte Hikari.
»Das müssen Sie erst erforschen. Wir haben bis zu unserer Abreise keine Zeit mehr dazu. Aber halt —«
Atalanta ging einige Stufen nach der anderen, finsteren Seite hinab, blieb stehen und bückte sich.
»Hier sind noch vor kurzem Menschen gegangen, und zwar weibliche.«
»Die beiden Sängerinnen, die wir gestern hörten, als wir das Ohr auf den Boden legten!«, sagte Arno.
»Jedenfalls. Also dieser Gang wird noch immer von jenen fremden Menschen benutzt. Ob ich ihnen das fernerhin erlaube, muss ich mir erst noch überlegen. Und hier —«
Sie tastete an die Wand, eine Reihe von elektrischen Lampen flammte auf, auch den anderen Gang erleuchtend, der sich fortsetzte, so weit das Auge reichte.
»Das ist nett von den geheimnisvollen Unbekannten, dass sie die elektrischen Lichtleitungen zurückgelassen oder wieder angelegt haben!«, meinte Arno.
»Nett von ihnen? Das ist doch ganz einfach ihre Pflicht! Alles, was vom Mieter in eine Wohnung eingebaut oder sonst wie befestigt wird, muss, wenn keine besondere Abmachung getroffen ist, beim Auszug zurückgelassen werden. Ausgenommen sind nur Möbel und Schmuckgegenstände wie Bilder und dergleichen. Nicht aber, was zur Heizung und zur Beleuchtung gehört. Das verfällt beim Auszug, wenn keine besondere Abmachung vorliegt, dem Besitzer des Grundstückes. Das alles gehört mir.«
Da hatte sie allerdings recht. So steht es im Gesetzbuch, in dem sie sich orientiert haben musste. Aber merkwürdig war es doch, wie sie dies alles gleich für diesen doch ganz ungewöhnlichen Fall anwendete.
Sie drehte das elektrische Licht wieder aus, der schon erleuchtet gewesene Gang wurde verfolgt.
Sonst war in diesem Unterwassertunnel nichts Auffälliges zu bemerken. Die Treppe wurde erreicht. Sie führte seitwärts hinauf, der Gang setzte sich noch bedeutend weiter fort.
»Verfolgen wir ihn erst.«
Nach etwa hundert Schritten kam man an eine Wand, der Tunnel endete blind.
»Nein, ich vermute, dass sich hier eine Tür befindet, wenn auch keine Fuge zu sehen ist. Herr Doktor, ich bitte Sie, noch einen geheimen Mechanismus zu suchen. Es wird Sie wohl selbst interessieren. Sie können ja dabei auch unvermeidliche Gewalt anwenden — nur nicht meißeln, bohren oder sprengen! Das bitte ich bis zu meiner Rückkehr zu unterlassen.«
»Wie Sie befehlen, Miss.«
»Und wenn Sie weiter vordringen können, so erinnern Sie sich immer, dass die Grenze meines Besitzes vier englische Seemeilen oben vom Ufer entfernt rings um den See gezogen ist, dies gilt natürlich auch für hier unten, und diese Grenze dürfen Sie mit keinem Schritt überschreiten, sobald Sie durch diesen Schritt in umzäuntes oder gar ummauertes Gebiet kommen.«
»Ich werde die Entfernung immer ganz genau berechnen.«
»Oho«, lachte Arno, »Du gehst ja mit einem Mal außerordentlich gesetzmäßig vor!«
»Tue ich das nicht immer?«
Na, eigentlich nicht. Ihr zweimaliger »Besuch« bei der Doña Rafaela in Westcliff war auch nicht so ganz »gesetzmäßig« gewesen. Hier war es aber etwas anderes, hier wollte sie durch Einhalten von anderen Rechten nichts von ihren eigenen hergeben.
Sie gingen zurück, erstiegen die Treppe und kamen auf die Galerie, die sich um das Wasserbassin zog.
»Wahrhaftig, da liegen noch die drei Boote!«, rief Arno erstaunt.
»Nicht noch, sondern wieder. Sie gehören nicht mir, aber wir dürfen sie benutzen. Erst wenn sie innerhalb von zwei Jahren nicht abgeholt oder sonst wie reklamiert worden sind, verfallen sie mir als mein Eigentum.«
»Du hast Dich ja recht gut im Gesetzbuch orientiert!«
»Habe ich auch.«
»Aber die Fortsetzung des Wassertunnels ist noch verschüttet.«
»Ja, das zu beseitigen haben die mir unbekannten Mieter vergessen. Herr Doktor, das werden Sie von Ihren Leuten besorgen lassen. Die Kosten werden jene Mieter tragen, wenn der Einsturz nicht durch höhere Gewalt erfolgt ist.«
»Sollte es von hier aus nicht schon der Boote wegen einen freien Ausgang nach dem See geben?«
»Danach werden wir wohl hier zu suchen haben.«
Sie brauchten sich nur umzudrehen, und sie sahen in der Felsenwand eine kleine Nische, in der ein Hebelgriff metallisch glänzte.
»Ist denn dieser auffallende Hebelgriff schon bei unserem ersten Besuche vorhanden gewesen?«, wunderte sich Arno.
»Das wohl sicher. Aber die Nische war unsichtbar gemacht. Dass meine widerrechtlichen Mieter uns diesen Griff jetzt so deutlich zeigen, das ist nun wirklich nett von ihnen, und deshalb werde ich ebenfalls rücksichtsvoll gegen sie sein, wenn es zu einer Aussprache kommt.«
Sie drehte an dem Hebel.
Wenn jetzt, dachte Arno, nur keine Explosion erfolgt, die uns unter den Trümmern begräbt!
Er konnte sich von diesem Gedanken nicht freimachen, und der war ja auch sehr berechtigt.
Aber es explodierte nichts, knallte nichts — ganz geräuschlos drehte sich ein großes Stück der Felswand langsam um eine Achse nach innen, das Wasser zurückdrängend — vor ihnen lag der See mit seinen Inseln und Ufern.
»Das ist ja reizend!«, sagte die Indianerin wie eine Gesellschaftsdame.
»Das ist alles Omahatwa!«, musste sich auch Littlelu einmal vernehmen lassen.
Doktor Hikari zeigte kein Staunen, keine Verwunderung, er war ganz Beobachtung, und ebenso verhielten ich seine Matrosen.
»Ich werde das Wassertor einstweilen wieder schließen.«
»Wollen wir nicht gleich untersuchen, ob es sich von draußen öffnen lässt?«, fragte Hikari
»Das, Herr Doktor, müssen Sie selbst später tun, so ausführlich können wir jetzt nicht vorgehen!«
Der Hebel brauchte nur nach der anderen Seite gedreht zu werden und die Felswand schloss sich wieder.
»Verstehen Sie etwas von Ingenieurkunst, Herr Doktor?«, fragte Atalanta nur noch.
»Ja, ich habe einige Semester Ingenieurwissenschaften studiert.«
»Ist die Ausführung solch einer beweglichen Felswand unserer heutigen Technik möglich?«
»O gewiss, weshalb denn nicht?«
»Haben Sie hier sonst schon etwas gesehen, was der modernen Technik unmöglich wäre?«
»Nein, noch nicht. Ich mochte nur wissen, wo die elektrische Kraft herkommt. Und dann machen mir auch die Bogenlampen und Glühbirnen einen fremden Eindruck. Und wenn die hier immer brennen, Tag und Nacht seit Wochen, ohne nachgesehen und erneuert zu wenden, so dürfte das auch eine besondere, mir bisher unbekannte Konstruktion sein.«
»Das müssen Sie später untersuchen. Gehen wir weiter nach oben.«
Die linke Tür blieb unberücksichtigt, sie benutzten die rechte, durch welche sie nach kurzem Aufstieg in das Amphitheater kamen, das zu kinematografischen Vorstellungen gedient hatte.
Dass die verschwundenen Bewohner dieser Felsenbehausung der rechtmäßigen Besitzerin alles oder doch manches, womit sie sich früher amüsiert hatten, übermitteln wollten, zeigte sich auch hier.
Bei ihrem zweiten Besuche hatte Atalanta diesen Raum finster gefunden, der in der tiefen Mitte stehende Registerapparat war entfernt gewesen. Jetzt stand er wieder dort unten, alles erstrahlte in elektrischem Lichte.
Atalanta wandte sich nun an Doktor Hikari mit den Worten:
»Setzen wir uns, ich werde Ihnen und Ihren Leuten eine Überraschung bereiten.«
Denn von diesem kinematografischen Theater hatte sie vorhin dem Japaner nichts berichtet, so weit war es denn doch nicht gegangen. So etwas hatte sie an Ort und Stelle erzählen wollen.
Ohne Wahl zog Atalanta ein Register. Sofort verdunkelte sich das Theater, der Vorhang rollte empor, unter leiser Musik zogen an den Zuschauern die schönsten Täler Tirols vorbei. Als zweites dann Szenen auf einer Rollschuhbahn, mit viel Humor, wobei auch gesprochen wurde.
Jetzt machte Doktor Hikari aus seinem Staunen kein Hehl.
»Ich habe viele kinematografische Vorstellungen gesehen, aber Bilder von solcher Vollendung noch nie! Und diese Sprache! Ja, hier liegt eine Erfindung oder doch Verbesserung vor, von der wir noch nichts wissen. Wo ist der Phonograph oder sonstige Apparat, der die Musik liefert?«
»Den müssen Sie sich selbst suchen, ich habe ihn damals nicht gefunden, habe mich allerdings auch nicht lange damit aufgehalten.«
Hikari ging vor nach der Bühne. Dass er eine feste Wand fand, wie von Milchglas, das hatte er ja wohl erwartet, aber an einen richtigen Vorhang hatte er wohl gedacht.
»Kann ich untersuchen, was sich dahinter befindet, wie die lebenden Lichtbilder erzeugt werden?«
»Das können Sie, das sollen Sie. Nur nichts dabei zertrümmern, weil es noch nicht mein Eigentum ist. Darüber müsste in diesem Falle doch erst entschieden werden. Gehen wir weiter.«
Sie betraten den weiten Saal, in dem einst die Hunderte von menschlichen Figuren gestanden hatten. Diese waren jetzt verschwunden, alles war ausgeräumt.
Von diesen Figuren hatte Atalanta vorhin erzählt, besonders auch deshalb, weil sie hiermit begründen wollte, dass es ganz sicher der wirkliche Professor Dodd sei, der hier hause. Diese Liebhaberei für tote Menschen stimmte ja so ganz mit dem Charakter dieses Chirurgen überein.
»Die hat er mitgenommen, das habe ich mir gleich gedacht.«
»Und er hat wirklich behauptet, dass diese Menschen noch lebten, sich nur in erstarrtem Zustande befänden?«
»Das sagte er. Aber das halte ich nur für eine Renommage, als verstehe er eine geheimnisvolle Kunst. Allerdings, wenn man bedenkt, dass er auch — doch geben wir uns keinen nutzlosen Grübeleien hin. Die Zeit wird schon Licht in diese Dunkelheit bringen — wenn wir die Zeit fleißig und geschickt benutzen.«
Sie wanderten weiter, kamen in das kleine Zimmer, dessen Wände einst mit Büchern bedeckt gewesen, in dem der Schreibtisch gestanden, in dem Arnos Unglück begonnen hatte. Es war vollständig ausgeräumt.
Dann stiegen sie unausgesetzt höher, nur ab und zu in leere Räume blickend, die seitwärts der Treppe lagen. Ob diese bis hinauf auf das Plateau führte, das wollte Atalanta jetzt zunächst erfahren.
Wer hatte diese zahllosen Räume aus dem Felsen herausgehauen? Das würde wohl immer eine offene Frage bleiben.
Aber wo die Quelle der Elektrizität lag, die Tausende von Lampen speiste, wie diese Elektrizität erzeugt wurde, diese Frage konnte wohl dereinst gelöst werden.
Erst als man wieder in ein Amphitheater blickte, das wieder solch einen Registerapparat zeigte, verstand sich Atalanta zu einer näheren Besichtigung.
Es war kleiner als jenes erste, auch dadurch verschieden, dass hier die seitwärts angebrachte Bühne fehlte. Dafür befand sich hier unten in dem trichterförmigen Bau ein freier Kreis, eine Manege, das Ganze glich also einem richtigen Zirkus.
Nur auf der einen Seite wurden die Sitzstufen von einer Felswand unterbrochen, gegenüber auf der untersten Stufe stand der kleine Registerapparat.
Atalanta zog einen Hebel heraus. Sofort ließ ein unsichtbares Orchester eine faszinierende Tanzmelodie ertönen, in der fugenlosen Felswand entstand eine Öffnung, heraus sprang eine Spanierin in reizender, koketter Nationaltracht, begann zu tanzen, den Leib zuckend zu drehen und die Beine zu werfen, dabei Kastagnetten klappern lassend.
Hier gab es nur eine einzige Möglichkeit.
»Es ist ein Mensch!!«
So riefen Arno, Littlelu und Hikari. Nur die Indianerin sagte:
»Nein, es ist nur eine Figur, ein Automat!«
Man glaubte es ihr nicht, da irrte sie sich einmal. Wie konnte sie überhaupt nur auf solch einen Gedanken kommen?
Diese Gliederbewegungen, diese Grazie bis in die Fingerspitzen, die man die Kastagnetten handhaben sah, dieses Rollen der blitzenden Augen, ja selbst diese beweglichen Gesichtszüge, einmal glücklich lächelnd, dann wieder zornig, wie es Melodie und Tanz ergab — das sollte ein Automat sein?! Eine künstliche Figur?!
»Atalanta, wo denkst Du hin!!«
»Und es ist dennoch nur eine tote Puppe!«
Woher wollte das die Indianerin so bestimmt wissen? Aus den Bewegungen konnte sie es sicher nicht schließen, die waren vollkommen menschlich, natürlich, da war auch nicht das geringste Tote daran. Aber ob sich wohl ein Hund durch irgend einen Automaten täuschen lässt, und sei es auch der denkbar vollkommenste? Nein, der Hund, der schon Erfahrung hat, lässt sich nicht täuschen. So wenig wie durch sein Spiegelbild! Es ist die Witterung, die fehlt. Und da hilft es nichts, die Puppe mit Gewändern zu bekleiden, die soeben noch ein Mensch getragen hat. Dann ist es für den klugen Hund eine »tote Witterung«, die lebendige Atmosphäre kann durch nichts ersetzt werden.
Nun, Atalanta wusste ein sehr einfaches Mittel, die Richtigkeit ihrer Behauptung zu beweisen.
Sie sprang auf, eilte nach der Tänzerin und wollte sie packen. Da, noch ehe sie dieselbe berührt hatte, sah man knisternde Funken überspringen, Atalanta prallte zurück und wäre fast gestürzt. Sie hatte einen starken elektrischen Schlag erhalten.
»Um Gottes willen, sieh Dich vor!«, schrie Arno entsetzt.
Es schien ihr nichts geschadet zu haben. Sie raffte sich auf, ging aber nicht nochmals vor, sondern trat zurück auf die Sitzstufe.
Doch was sich diese Indianerin in den Kopf gesetzt hatte, führte sie durch!
Der immer feuriger werdende Tanz war beendet, das reizende Mädchen zog sich, nach allen Seiten graziöse Kusshändchen werfend, nach der Felswand zurück, die sich vorhin hinter ihr geschlossen hatte und sich jetzt erst wieder öffnete.
Da schwirrte ein Lasso durch die Luft, die Lederschlinge legte sich um den Oberkörper der Tänzerin, mit einem Ruck war sie, ob nun Mensch oder Puppe, auf die unterste Sitzstufe befördert, und hier ging keine Elektrizität mehr von ihr aus.
Ja, es war nur eine Puppe. Alles steif und dennoch beweglich bis in das vorderste Glied des kleinen Fingers. Jetzt freilich lag sie tot da, die dunklen Augen, die vorhin so fröhlich und so zornig und so schmachtend geblitzt hatten, starrten gläsern.
»So etwas ist ja gar nicht möglich!!«
Weshalb soll so etwas nicht möglich sein?
Es hat eine Zeit gegeben, da sich die genialsten Erfinderköpfe und die geschicktesten Hände, die ein Haar vielmals spalten und auch noch ein Schraubengewinde drehen, ihr ganzes Leben der Anfertigung solcher beweglicher Figuren widmeten, ein ganzes Leben nur einer einzigen. Mit der Erfindung der Taschenuhren von Peter Hele (1) in Nürnberg ums Jahr 1500 begann die Blütezeit dieser — Modesache. Das vollendetste Kunstwerk dieser Art ist die Ente des französischen Mechanikern Vaucanson, angefertigt im achtzehnten Jahrhundert. Sie war im Besitz des gelehrten Sonderlings Professor Brioris in Helmstedt, wurde nach dessen Tode vom Amsterdamer Nationalmuseum angekauft, wo sie noch heute zu sehen ist und gegen ein kleines Entgelt aufgezogen wird. Sie funktioniert noch tadellos.
(1) Andere Namensbezeichnung für ›Henle‹ oder — wohl am bekanntesten — ›Henlein‹.
Diese hölzerne Ente bewegt sich ganz wie eine natürliche, putzt sich, sträubt die Flügel, macht noch viele andere Bewegungen durch, schnattert, säuft Wasser und frisst Körner. Auf einem Entenhofe wäre sie für das menschliche Auge nicht von einer natürlichen zu unterscheiden.
Die Zeiten dieser Automaten sind vorbei. Damals wurde solch ein Automat im Salon besprochen wie heute ein berühmtes Gemälde, ein berühmtes Buch. Um so einen Automaten zu sehen, machte man die weitesten Reisen in der Postkutsche. Sonst konnte man eben in der Gesellschaft nicht mitsprechen, man zählte nicht zu den »Gebildeten«.
»Haben Sie den künstlichen Menschen des Engländers Frederick Ireland gesehen?«, fragte Doktor Hikari.
Er selbst hatte ihn gesehen. Im Jahre 1906 wurde er zum ersten Male in London gezeigt. Dieser menschliche Automat läuft frei herum, macht alle oder doch viele Bewegungen eines Menschen, spricht einige Worte, lacht, blinzelt, fährt Rad und schreibt sogar seinen Namen. Als er einmal nicht mehr funktionieren wollte, verzichtete der Verfertiger auf eine Reparatur. Es brachte ihm nichts ein, er kam nicht auf seine Kosten. Das Interesse für so etwas ist vorüber.
So hatte der Japaner erzählt.
»Wie wurden denn die Bewegungen zustande gebracht?«
»Durch Elektromagnetismus. In dem Körper und durch alle Glieder rollte wie Blut durch die Adern Quecksilber hin und her, welches den elektrischen Strom schloss und unterbrach. Wie freilich sonst die Bewegungen zustande kamen, das war das Geheimnis des Erfinders und Verfertigers. Und mit dieser Tänzerin konnte sich jener künstliche Mensch auch nicht vergleichen. In einiger Entfernung gesehen, machte er wohl ganz natürliche Bewegungen, in der Nähe war die Täuschung vorbei. Diese Tänzerin hier aber — ich hätte geschworen, es sei eine richtige, eine lebendige!«
Atalanta hatte entdeckt, dass man die Hand abschrauben konnte. Aus dem hohlen Arm ergoss sich bei unvorsichtigem Halten ein Strom von Quecksilber. Also auch hier dasselbe. Doch die Tatsache blieb bestehen, dass man es hier mit Menschen zu tun hatte, die über wunderbare Kenntnisse und eine eminente Geschicklichkeit verfügten, von der die übrige Welt noch nichts wusste.
Das vergossene Quecksilber konnte bis zum letzten Tröpfchen aufgelöffelt werden, es wurde wieder eingefüllt, die Hand aufgeschraubt, die Puppe wieder dorthin gelegt, von wo sie der Lasso weggerissen hatte.
Sobald ihre metallenen Sohlen den Boden berührten, der ebenfalls aus einem dunklen Metall bestand, erhielt Atalanta einen heftigen elektrischen Schlag; sofort setzte die vorhin abgebrochene Musik wieder ein.
Aber die Puppe sollte sich nicht wieder erheben, um ihren Rückzug mit Kusshändchen zu vollenden. Und erst jetzt sah man, dass sich unterdessen auch wieder die Tür geschlossen hatte, von der nicht die geringste Fuge zu bemerken war.
Die Musik spielte die Weise zu Ende, dann konnte Atalanta ein Register ziehen, welches sie wollte, es kam nichts mehr, und dort lag die tote Puppe. Durch den gewaltsamen Eingriff der Indianerin war der elektrische Mechanismus gestört, vielleicht beschädigt worden.
»Gehen wir weiter!«, sagte Atalanta gleichgültig.
Immer höher ging es hinauf. Die Treppen führten wirklich bis auf das Plateau. Zweitausend Meter wollen erstiegen sein, dazu der schwere Mann im Tragstuhl, und die führende Indianerin machte keine Ruhepause mehr. Aber die den Stuhl tragenden beiden Japaner schienen gar nichts von einer Last zu merken, wollten nichts von einer Ablösung durch die beiden anderen Matrosen wissen.
Zuletzt kam man in einen geschlossenen Raum, der einen Fahrstuhl enthielt, von dem man bisher noch gar nichts bemerkt hatte. Der senkrechte Schacht nahm natürlich einen andern Weg als die windige Treppe. Ein Druck auf einen Knopf und die große Platte ging in die Tiefe, während eine andere im Nebenschachte offenbar schon wieder heraufkam. Auch hier oben war noch alles elektrisch erleuchtet.
Die Hauptsache aber war, dass die weiterführende Treppe oben blind an der Decke endete. Doch nur ein Hebelgriff und der ebenso einfache wie sinnreiche Mechanismus ließ eine große Steinplatte etwas herab und kippte sie dann zur Seite. Über ihnen lachte der blaue Himmel.
Sie hatten die Höhe des Felsengebirges erreicht. Es hätte ja ein scharfer Grat sein können, dem war aber nicht so. Soweit das Auge reichte, zog sich eine ebene Steinfläche hin, wie asphaltiert, mit keinem Steinchen darauf. Da sie nach Norden ein wenig geneigt war, musste jeder Regenguss allen sich bilden wollenden Humus abspülen, sodass ohne künstliche Hilfe hier nie eine Vegetation entstehen konnte. Und nun nach Osten hin zu ihren Füßen die grandiose Szenerie des Sees mit seinen vielen Inselchen, in seinem ganzen Umfange übersehbar.
»Hier ist es schön, hier lasst uns Hütten bauen!«, flüsterte Arno, ganz hingerissen von diesem Anblick.
»Und Sie wollen sich hier also eine Sternwarte bauen?!«, wandte sich Atalanta an den japanischen Doktor, der ganz dicht an dem scharfen Grat stand, mit den Fußspitzen noch etwas darüber hinaus, den Kopf vorgereckt, und so in die furchtbare Tiefe blickte.
»Ja, hier oben möchte ich eine Sternwarte haben!«
»Dann bauen Sie los. Dass Sie dabei meine Geheimnisse wahren, brauche ich Ihnen nicht erst zu sagen. Ich möchte nicht gezwungen sein, Zeitungsreportern die Tür zu weisen —«
»Ich nehme nur japanische Arbeiter.«
»Mir recht. Den nötigen Grund trete ich Ihnen für Ihre Lebenszeit als Eigentum ab. Oder wie Sie sonst wünschen. Steine haben Sie hier ja genug. Wenn Sie einen Steinbruch anlegen, so schlage ich vor, dass Sie hier oben gleich ein großes Bassin schaffen, das sich mit Regenwasser füllt. Natürlich dürfen Sie mit dem Steinbruch nicht unten in die gute Stube hineinkommen. Ich habe auch sonst noch vielerlei mit Ihnen zu besprechen, was der Graf aber nicht zu hören braucht. Erlaube, Arno.«
Sie führte den Japaner seitwärts außer Hörweite. Wohl eine Stunde sprachen die beiden zusammen. Dann wurde der Rückmarsch angetreten. Den Fahrstuhl mochte Atalanta nicht benutzen.
Ohne Aufenthalt ging es wieder die endlosen Treppen hinab. Gewiss gab es in den Kammern und Sälen, an denen sie vorüber kamen, noch mancherlei Interessantes zu sehen, jene Räume, in denen ihnen die Überraschungen, die mechanischen Vorstellungen zuteil geworden, hatten sie ja immer nur zufällig betreten, aber diese Erforschung sollte dem japanischen Stellvertreter überlassen bleiben. Die Gedanken der jungen Indianerin weilten — — in der Klinik in der New Yorker Water Street. Und Arno mit sehnsuchtsvoller Hoffnung wohl nicht minder.
Auch den mechanischen Zirkus hätte Atalanta wohl nicht wieder betreten. Aber sie musste hineinblicken, weil die weite Tür gerade vor ihr auf einem Treppenabsatz lag. Und da sah Atalanta, die den anderen ein gutes Stück voraus war, wie dort unten in der Manege eine weißgekleidete Männergestalt gerade die Tänzerin aufhob und mit ihr schnell nach der geöffneten Felswand eilte.
»Halt, Sir — steh oder ich schieße!«
Aber sie wäre gar nicht zum Schusse gekommen.
Schon hatte sich die Öffnung hinter dem Manne wieder geschlossen.
Und der Mechanismus funktionierte wieder, jeder Zug an dem Registerapparat brachte neue Überraschungen, die immer mehr bewiesen, dass hier im Verborgenen erfinderische Köpfe und Hände arbeiteten, von deren Kunstfertigkeiten sich die Welt noch nichts träumen ließ.

»Da sind Sie ja, seien Sie mir als Gäste auf meinem Schiff
herzlich willkommen!«, rief der joviale Kapitän des
»Albatros«, Atalanta und Arno die Hand entgegenstreckend.
Zwei Wochen später hielt vor der Klinik des Professor Dodd in der Water Street zu New York eine Automobildroschke, der eine verschleierte Dame entstieg, Atalanta, mit einfacher Eleganz gekleidet.
Von ihrem Hotel aus hatte sie sich nur vergewissert, dass Professor Dodd zu Hause und für sie zu sprechen sei, nichts weiter, der Professor hatte auch gar nicht selbst ans Telefon kommen können.
Auf ihr erstes Klingeln wurde die innen eisenbeschlagene Tür geöffnet, immer noch von dem zerlumpten Neger.
»Miss Atalanta Ramoni. Ich habe mich angemeldet und werde erwartet.«
»Bitte.«
Sie wurde vom Professor in dem nackten Zimmer mit den vielen Stühlen empfangen. Diesmal hatte der lange weiße Kittel keine Blutflecken, die Ärmel waren nicht hochgekrempelt. Dagegen stachen die schwarzen Augen hinter den scharfen Gläsern einer Brille, die er sonst nie trug, wie Dolche.
Es erfolgte keinerlei Begrüßung. Atalanta lüftete nur den Schleier und der Professor sagte kalt:
»Miss Ramoni! Gut. Wo ist der Graf?«
»Im Hotel.«
»Ja, ich denke doch, Sie bringen ihn gleich mit!«, erklang es ungeduldig, wenn auch durchaus nicht barsch.
»Ich habe erst einige Fragen zu stellen.«
»Haben Sie?! Bedingungen? Hier bin ich der Einzige, der Bedingungen zu stellen hat, ohne dass ich Sie kränken will, Miss.«
Es war wirklich staunenswert, dass das junge Mädchen, ob es nun eine rote oder eine weiße Haut hatte, noch den Mut zu weiteren Einwendungen besaß. Mit so einem Arzte, der selbst dem Kaiser kommandiert: »Marsch ins Bett!«, ist doch nicht zu spaßen.
»Bitte, Herr Professor!«, sagte die melodische Stimme.
»Nun?«, ließ sich der Allgewaltige noch einmal herab.
»Darf ich bei dem Grafen bleiben?«
»Das müssen Sie. Das verlange ich von Ihnen. Sie dürfen während der ganzen Behandlung nicht von seiner Seite weichen. Und es wäre mir sehr lieb, wenn Sie noch eine andere Person mitbringen, die abwechselnd mit Ihnen wacht und...«
»Ich werde nicht müde«
»... und zwar eine Person, die den Grafen lebhaft zu unterhalten versteht, ihn womöglich zum Lachen bringt.«
Besser konnte es ja gar nicht kommen. Aber es war doch etwas unverständlich.
»Ich erkläre Ihnen gern, was ich mit dem Paralytischen für eine Kur vorhabe!«, sagte nunmehr Professor Dodd zuvorkommend. »Wissen Sie, wie der natürliche Schlaf entsteht?«
»Durch Blutleere im Kopf.«
»Ja. Diese möglichste Blutleere im Gehirn kann man auf künstliche und dennoch natürliche Weise erzeugen durch heiße Fußbäder und gleichzeitige kalte Umschläge um den Kopf. Das werde ich bei dem Grafen anwenden. Nun aber kommt es darauf an, ihm gleichzeitig durch andere natürliche Mittel dennoch wieder das Blut in das Gehirn zu treiben. Das geschieht schon durch Denken. Und je angestrengter der Mensch denkt, desto mehr fließt dem Gehirn Blut zu. Noch mehr ist dies bei Gemütsaffekten der Fall, z. B. im Zorn. Aber der Zorn ist schädlich, er vermindert in gefährlicher Weise das Blut. Besser ist das Lachen. Das kann übertrieben werden, dass das Gehirn vor Blutüberfüllung gesprengt wird, aber in unserem Falle kann das nicht passieren. Die andere Regelung, durch verschiedene Temperaturgrade erzeugt, treibt das Blut immer wieder in entgegengesetzte Richtung.
Diese Wechselwirkung muss bei wachem Bewusstsein so lange wie möglich fortgesetzt werden. Wann ist der Graf heute Morgen erwacht?«
»Es mag gegen sechs Uhr gewesen sein.«
»Und er hat inzwischen nicht wieder geschlafen?«
»Nein.«
»Gut. Wir müssen versuchen, ihn so lange wie nur irgend möglich wach zu halten. Dreißig, vierzig, fünfzig Stunden lang. Aber durch ganz natürliche, harmlose Mittel, um dann einen möglichst tiefen, natürlichen Schlaf zu erzeugen. In diesem, oder schon vorher, ändere ich seine jetzt falsche Blutzirkulation, mache sie auf künstliche Weise normal, indem ich die Temperaturen wechsele. Linke Hand heiß, rechter Fuß heiß — rechte Hand kalt, linker Fuß heiß — und so fort, immer abwechselnd, bis meine Apparate konstatieren, dass das Blut im ganzen Körper normal funktioniert. Sobald dies das Galvanometer anzeigt, muss die Lähmung beseitigt sein, muss der Graf seine Beine und Füße in der Gewalt haben oder die Kur ist missglückt. Aber ich halte einen Misserfolg für ausgeschlossen. Ich habe mir die Sache überlegt, sie mit fast mathematischer Sicherheit berechnet. Die Blutzirkulation muss normal geregelt werden können, sie muss! Und dann kommt es nur auf einen möglichst tiefen Schlaf an, durch kein anderes Mittel herbeigeführt als durch Ermüdung, und die Paralyse wird dauernd beseitigt sein.«
Mit größerer Überzeugungskraft hätte kein Arzt, kein Mensch sprechen können.
»Holen Sie den Grafen, es ist alles vorbereitet!«
Eine halbe Stunde später wurde Arno von Atalanta und Littlelu in ein Zimmer getragen, das nichts weiter enthielt als einen verstellbaren Krankenstuhl und ein Tischchen, auf dem ein kleiner, unscheinbarer Apparat stand, an dem grüne Drähte sichtbar waren. Für die beiden Begleiter Arnos wurden erst später, nachdem sie lange genug gestanden hatten, zwei Lehnstühle hereingetragen.
Ohne ein Wort zu verlieren, begann der Professor seine Untersuchung. Arno brauchte nur seine Füße zu entkleiden, bis zu den Knien, und die Ärmel etwas zurückzuschlagen. Der Professor schnallte ihm an die Hand- und Fußgelenke elektrische Pulsmesser, der Puls schlug dabei gegen eine empfindliche Membrane und der leiseste Blutschlag war an dem Apparat bemerkbar, er wurde auf einem laufenden Papierstreifen registriert.
Dann brachten Laboratoriumsdiener zwei gewöhnliche Eimer mit heißem Wasser, in das des Grafen Füße gesteckt wurden, das Wasser wurde manchmal erneuert, alles auf primitivste Weise, jede bequeme Einrichtung dazu fehlte hier, die Diener mussten die Eimer und Töpfe schleppen, dazu kalte Umschläge um den Kopf des Patienten machen.
Das hatte gegen Mittag begonnen, und zehn Stunden später hatte sich daran noch nichts geändert. Der Professor ging während dieser Zeit durch die offene Tür hin und her, blickte auf den Registrierstreifen, sagte aber kein einziges Wort.
Nach Ablauf dieser zehn Stunden sagte er:
»Ich bleibe jetzt sechs Stunden weg. Dass Sie ihn mir nicht etwa einschlafen lassen! Nicht, dass es ihm etwas schaden würde, aber die bisherigen Stunden wären umsonst gewesen, es müsste von vorn begonnen werden.«
Er ging. Die drei ließen sich zum zweiten Male von einem Diener Essen aus dem Hotel holen. Die sich ablösenden Wärter erneuerten unausgesetzt das heiße Fußwasser und die kalten Kopfumschläge, ohne aber die Temperatur zu messen.
Bisher hatte den Grafen die seelische Spannung wach gehalten, jetzt wurde er müde. Sie plauderten, Littlelu las ihm vor, erzählte Anekdoten, die manchmal ein herzliches Lachen auslösten, Atalanta spielte einmal mit ihm Schach, zeigte ihm einige Tricks — so gelang es mit leichter Mühe, ihn wach zu halten.
»Das hätte auch jeder andere Arzt mit mir vorgenommen!«, flüsterte er einmal.
»Du, Arno, das sage nicht. Ich glaube, das ist eine ganz genial ausgedachte Kur!«, verteidigte die Indianerin den Professor.
Morgens gegen vier Uhr kam Dodd wieder.
»Hat er geschlafen?«
»Nein.«
»Nein. Ich sehe es auch hier am Streifen. Nun den zweiten Teil.«
Jetzt bekam nur der linke Fuß heißes Wasser, der rechte eiskaltes, die Hände wurden entgegengesetzt behandelt, ebenso die beiden Kopfseiten, links ein heißer Verband, auf die rechte Schläfe eine Eiskompresse, und so wurde das immer kreuzweise und parallel verschoben.
Hiermit lassen sich unbeschreibliche Effekte erzielen. Die Ärzte scheinen es nicht zu wagen, dies in gewissen Fällen anzuwenden. Es ist eine Pferdekur, der Erfolg kann ein total verschiedener sein.
Der Professor wich jetzt nicht mehr von dem Registrierapparat.
»Herr Graf, heben Sie Ihr rechtes Bein.«
Zu seinem eigenen grenzenlosen Staunen konnte es Arno heben, vollständig bewegen. Nicht aber das linke.
Wieder eine Stunde verging, ununterbrochen bekamen die äußeren Extremitäten und die Schläfen andere Temperaturen, direkt entgegengesetzt. Aber das ging nach einem ganz genauen System.
Schon längst hatte Arno das Gefühl im rechten Bein wieder verloren.
»Jetzt müssen Sie Ihr linkes Bein heben können.«
Es war der Fall. Arno selbst hatte es vorher nicht gewusst. Und der Professor las es nur von dem Papierstreifen ab, der die Pulsschläge zählte.
»Heiß linke Schläfe, linke Hand, rechter Fuß — — jetzt können Sie beide Beine bewegen.«
Es war der Fall.
»Es ist mir noch zu zeitig. Linke Schläfe wieder kalt. Sind Sie müde?«
»Ja, ich bin sehr, sehr schläfrig.«
»Ich kann Ihnen nicht helfen, Sie müssen unter allen Umständen noch bis heute Abend wach bleiben.«
Es gelang den beiden Gesellschaftern, Arno so lange wach zu halten.
Atalanta kannte keinem Schlaf, Littlelu hatte dazwischen einige Stunden wie eine Dampfsäge geschnarcht.
So waren diese sechsunddreißig Stunden vergangen. Immer öfter fielen Arno die Augenlider herab, kein Witz wollte mehr wirken, wie der Komiker und Zirkusclown auch wieder zu bombardieren anfing.
»Ich kann nicht mehr, ich —«
»Herr Graf«, sagte der vor ihm stehende Professor, »wollen wir jetzt doch einmal von Ihrem Erlebnis am Sklavensee sprechen!«
Da freilich riss Arno die Augen wieder auf und konnte sie offen behalten.
»Bitte, wollen Sie mir ausführlich erzählen.«
Eine Viertelstunde brauchte er dazu, die Müdigkeit war momentan vergessen.
»So; jener Mann sah mir also vollkommen ähnlich und gab sich für mich aus? Nun will ich Ihnen eine Erklärung geben. Schon einmal, vor nunmehr zwanzig Jahren, ist ein Doppelgänger von mir aufgetreten. Er hat meinen Namen und mein Ansehen in betrügerischer Weise benutzt. Ich weiß auch, wer es ist. Es ist mein eigener Bruder, mein Zwillingsbruder. Ein hochgenialer Mann, noch ein Jüngling, als er auf die schiefe Ebene kam. Schon seit mehr als dreißig Jahren halte ich ihn für tot. Er ist aber eben doch noch einmal aufgetaucht. Und nun also scheint er dort am Sklavensee wieder sein Wesen oder vielmehr Unwesen zu treiben. Haben Sie dort vielleicht etwas von besonderen mechanischen Kunstwerken gesehen?«
»Jawohl, jawohl!«, murmelte Arno.
»Automaten?«
»Ja, ja —«
»Dann ist er es auch. Das war seine Liebhaberei von jeher. Ja, das ist allerdings ein ganz gefährlicher Mensch, ein — Verbrecher, will ich gleich sagen — obgleich er mein Bruder ist. Da werde ich mich selbst einmal nach dem Sklavensee begeben, dieser Mann muss unschädlich gemacht — Herr Graf, Sie schlafen ein!«
Noch einmal gelang es Arno, die Augen aufzureißen.
»Ja, jetzt könnte er einschlafen; wenn es nur gelänge, ihn noch einmal recht herzlich zum Lachen zu bringen, um noch einmal dem Gehirn möglichst viel Blut zuzuführen.«
»Würde nicht auch ein tiefer Seelenschmerz dasselbe tun?«, fragte Littlelu.
»Seelenschmerz?«
»Durch Tragik, dass er zu Tränen gerührt wird?«
»Hm. O ja, einen starken Blutandrang zum Kopf hat das ebenfalls zur Folge. Aber Lachen wäre mir lieber.«
»Ich weiß nur ein Mittel, um ihm kummervolle Tränen zu entlocken.«
»Tun Sie es.«
Mit der gravitätischsten Feierlichkeit erhob sich Littlelu.
»Herr Graf, ich werde mir erlauben, Ihnen eine tragische Szene vorzuführen. Es handelt sich um einen — Salontrick, will ich sagen, um einen spiritistischen Trick, den ich als Anti-Spiritist ausführe, von einer furchtbaren Tragik. Es gibt ja so viele Menschen, die lieber weinen als lachen. Die ganze Idee ist von mir selbst erdacht und ausgearbeitet, sie ist noch nicht gesetzlich geschützt, ich gebe die Szene hier zum ersten Male zum Besten. Sind Sie munter genug, Herr Graf, mir zu folgen?«
Ja, hierdurch war Arnos Interesse wieder geweckt worden, die Müdigkeit war momentan verschwunden.
»Ich kann es hier nicht so arrangieren, wie ich es in einer Gesellschaft ausführen würde. Ich würde mir ein ganz leeres Zimmer geben lassen, in dem es unmöglich ist, vorher etwas zu verstecken. Stellen Sie sich also einen Salon vor, der ebenso luxuriös eingerichtet ist wie dieser hier, nur dass darin diese drei Stühle und dort das Tischchen fehlen. Sonst als Wandschmuck nichts weiter als dort links in der Ecke die schön drapierte Spinnenwebe, dort rechts an der Wand die tote Fliege, im Vordergrund der Nagel, der tatenlustig den Kopf hebt. In diesen so ausgestatteten Salon lasse ich mich führen, lasse mich einschließen. Vorher habe ich mich visitieren lassen. Ich habe nichts weiter bei mir als diese dünne Brieftasche, in der man doch keine großartige Möbeleinrichtung verbergen kann. Oder meinen Sie?«
Er zog die dünne Brieftasche hervor und zeigte sie.
»Was ich nun in dem Zimmer im Geheimen vornehme, das führe ich hier vor Ihren Augen aus, es ist auch ganz gut, damit Sie dann nicht etwa vor Entsetzen laut aufbrüllen und sich hierauf blind weinen. Also ich nehme aus der Brieftasche zunächst dieses kleine Kuvert.«
Es war ein ganz kleines, dünnes Kuvertchen, etwa von der Art derer, in denen man Heftpflaster hat. Aus diesem brachte Littlelu etwas Gelbes zum Vorschein, faltete es auseinander, es war ein ganz dünnes Tuch, wohl das allerfeinste Seidengewebe, kreisrund, so wie der Mond, auch mit solchen schwarzen Stellen.
Dieses gelbe Tuch heftete Littlelu in Kopfhöhe an die Wand.
»Wissen Sie, was das ist?«
»Das soll wohl den Mond vorstellen?«, musste Arno lächeln.
»Nicht vorstellen, sondern das ist wirklich der Mond. Noch ein viel wirklicherer als ich. Zu tragischen Szenen gehört immer der Mond, der Vollmond. Nun nehme ich hier ein zweites Kuvertchen —«
Aus diesem brachte er ein grünes Gewebe zum Vorschein, faltete es auseinander, und es war schier unglaublich, was aus der Winzigkeit für eine Unmenge von Stoff wurde. Aber ein indisches Seidentuch der häuslichen Handindustrie, mit dem man ein großes Zimmer bedecken kann, vermag man durch einen Fingerring zu ziehen.
Mit diesem grünen Stoff drapierte Littlelu die Hälfte der Wände, so weit sie der in der Mitte sitzende Graf vor sich sah, bis zu Meterhöhe.
»Wissen Sie, was das ist?«
»Nein.«
»Das habe ich mir bei Ihrem blutleeren Gehirn gleich gedacht, dass Sie das nicht wissen. Sollen Sie gar nicht wissen, das ist alles magisch — Omahatwa — und nun hier ein drittes Kuvertchen.«
Wieder ein ungemein großes, grünes Gewebe, das er auf dem Fußboden ausbreitete.
»Und hier ein viertes Kuvertchen.«
Wieder etwas gelbes Gewebe, wieder kreisrund, von einem Meter Durchmesser, mit weißen Punkten und Strichen besetzt. Es wurde in der Mitte des grünen Teppichs ausgebreitet.
»Hier ein fünftes Kuvertchen.«
Was er daraus zum Vorschein brachte, war schwer erkennbar. Lauter dünne Schnüre, die er rings an der grünumhängten Wand und auch auf dem grünen Teppich ordnete.
»Wissen Sie, was das ist?«
»Keine Ahnung.«
»Nun, das schadet nichts! Herr Professor, gestatten Sie, dass das elektrische Licht ausgedreht wird?«
Es geschah. Nur durch die Fenster von der erleuchteten Straße her drang einiges Licht herein.
Littlelu machte sich an dem Mond zu schaffen, steckte unter das Tuch wohl eine starke elektrische Taschenbatterie, der Mond begann zu leuchten, ein ziemlich helles Licht ausstrahlend.
Dann trat Littlelu zur Seite, steckte etwas in den Mund und begann mit geschwollenen Backen zu blasen. Und überall aus den Wänden und aus dem grünen Boden schossen kurz- und langstielige Blumen hervor, weiße und gelbe und blaue und rote.
Es war ein verzweigtes System von ganz dünnen Gummischläuchen mit Blumen, die sich so aufblasen ließen.
»Aaaah!«, erklang es mit bewunderndem Staunen.
Ja, es war auch wirklich großartig! Eine ganze Mondscheinlandschaft, ein Teich mit Schilf und üppigwuchernden Blumen, in zwei Minuten aus nichts hervorgezaubert! Der große gelbe Fleck war eine riesenhafte Sumpfdotterblume, jetzt freilich sah man es ganz deutlich.
»Jetzt aber kommt das Schmerzlichste von der Sache. Bitte, wollen Sie gefälligst Ihre Tränendrüsenschleusen füllen. Gestatten Sie, dass ich mich entkleide.«
Er tat es. Es zeigte sich, dass er unter seinem Anzuge ein enganliegendes Trikot von grüner Farbe trug. Nun noch einige winzige Gummifleckchen aufgeblasen und er streifte über die Hände große, grüne Finger, vorn mit Knorpeln, über die Füße ebensolche Zehen, über den Kopf den entsprechenden Teil, und der Laubfrosch war fertig. Um die Täuschung zu vollenden, besaß dieser Mann auch ganz die Figur eines Frosches, das sanftgewölbte Bäuchlein, im Gegensatz zu den ziemlich starken Schenkeln dünne Waden, wie es solche Männergestalten ja genug gibt.
Und nun vor allen Dingen die Bewegungen! Der hatte den Frosch studiert!
Er kauerte sich nieder, ganz wie ein Frosch, schleppte sich langsam vorwärts, die Beine mit den langen Zehen nachschleifend, hob den Kopf, pustete die Kehle mehrmals auf und ließ sie wieder einsinken, dann einige Sprünge, Zuletzt ein mächtiger Satz, der ihn auf die große Dotterblume brachte, hier stierte er einige Zeit den Vollmond an, sogar die Augen konnte er hervortreten lassen, der Kehlsack schwoll immer mehr an, und dann begann das schönste Froschkonzert.
Diese hervortretenden Augen, wie sie sehnsuchtsvoll den Vollmond anblickten — diese schwellende und wieder einfallende Kehle — dieses schmachtende Brüllen — diese Inbrunst...
Der Professor mit den Dolchaugen und dem todblassen Mephistophelesgesicht lachte, dass ihm die Tränen über die Wangen liefen, und die
Indianerin klammerte sich vor Lachen an der Armlehne an und brach sie ab. Von Arno gar nicht zu sprechen.

»Hören Sie auf, hören Sie auf — mein Kopf — mein Kopf —!«, rief Felsmark endlich, der in einen förmlichen Lachkrampf verfallen war.
Und trotzdem schlief er mitten in diesem maßlosen Lachen ein.
»Mister Maximus«, wandte sich der Professor, sich die Augen trocknend, an diesen, als er sich wieder ankleidete und die Sachen einpackte, »die Kur wird zweifellos gelingen — die größere Hälfte der Ehre trete ich Ihnen ab!«
Arno gähnte herzhaft, dehnte sich und schlug die Augen auf. In das Zimmer schien die Morgensonne. Neun Stunden hatte er in einem todesähnlichen und doch ganz natürlichen Schlafe gelegen.
Seine Füße standen nicht mehr in Eimern, sie waren schon wieder bekleidet. Erst ein vorsichtiges Probieren, und dann schnellte er mit einem Jubelschrei empor.
Dann wieder ein misstrauisches Stutzen, ob er nicht abermals zusammenbräche, aber es geschah nicht.
Professor Dodd trat ein.
»Ich gratuliere. Die Kur ist gelungen, und ich garantiere für eine dauernde Heilung.«
Noch ein Jubelschrei, unter dem Arno seine Hand zu haschen suchte, was ihm aber nicht gelang.
»Herr Professor, entziehen Sie sich nicht meinem Danke —«
»Er ist nicht nötig, ich habe nur meine Pflicht getan, habe an Ihnen auch sehr viel gelernt. Adieu, ich muss sofort gehen.«
Und er ging. Es beeinträchtigte Arnos jubelndes Glück nicht. So wandte er sich an seine Gefährtin.
»Atalanta, meine Atalanta!«
Er nahm sie in seine Arme, tanzte mit ihr ohne Weiteres im Zimmer herum, ob sie wollte oder nicht.
Schon einmal hatte er sich ja dauernd im Besitze seiner vollen Kraft geglaubt, nach jenem Erwachen aus dem Todesschlafe, aber da war ihm das so selbstverständlich vorgekommen, mit seinem heutigen Glück ließ sich das damals nicht im Entferntesten vergleichen.
»Atalanta, jetzt heiraten wir uns!«
Es war etwas merkwürdig, gleich dieses erste Wort, aber ganz begreiflich. Was konnte er denn diesem treuen Mädchen anderes bieten.
»Ja, heiraten wir uns.«
Das hatte aber nicht Atalanta gesagt, sondern Littlelu, der sich noch in seinem Lehnstuhl herumflezte.
»Wie Du befiehlst.«
»Atalanta!«, erklang es im Tone des tiefsten Vorwurfs.
Nein, sie wollte ihm das Glück durch nichts beeinträchtigen, es nur noch vergrößern helfen.
»Arno, mein Arno!«
»Also heiraten wir uns«, ergänzte Littlelu, »einen Priester her und was sonst noch dazu gehört.«
»Littlelu, Sie sind doch ein unausstehlicher — — Frosch!«
»Na warten Sie nur, Ihnen quake ich gleich wieder was vor.«
»Nein, nein, mein Littlelu, Sie sind der beste, treueste, goldenste Mensch, auch Sie haben mich gepflegt, getragen —«
»Na warten Sie nur, wenn meine Rechnung kommt. Ob Sie dann auch noch so sprechen werden. Also wie steht's nun mit der Hochzeit?«
»Doch nicht in diesem Zimmer?«
»Nee, da haben Sie recht. Also nehmen wir ein Automobil und fahren —«
»Ach was, ein Automobil! Ich bin froh, in diesem goldenen Sonnenschein zu Fuß gehen zu können!«
»Da haben Sie wiederum recht. Also gehen wir zu Fuß in die nächste Destille und dann weiter nebenan in die Kirche. Ein Zeuge ist schon vorhanden, eine Frau werden wir auch schon auftreiben. Es soll in New York mehrere geben.«
»Sprechen Sie im Ernst?«
»Hören Sie, das Heiraten ist gar keine so lustige Sache, wie Leichtsinnige manchmal denken.«
»Aber gar so plötzlich —«
»Na warum denn nicht? Wenn schon, denn schon.«
Arno sah ein, dass es wirklich das Beste sei, sofort zu heiraten. Er wollte diese Indianerin zu seiner legitimen Gattin machen, zur Gräfin von Felsmark. Mehr konnte er nicht mit in die Ehe bringen. Er sprach ja gar nicht hierüber, es wäre ihm lächerlich vorgekommen, und doch war es ihm jetzt die Hauptsache. Und warum dann lange zögern? In Amerika ist ebenso wenig wie in England ein Aufgebot nötig. Nur muss, je kürzer die Frist zwischen Anmeldung und Ausführung ist, desto mehr bezahlt werden. Und waren die beiden denn nicht lange genug verlobt, waren sie nicht durch etwas ganz anderes zusammengeschweißt worden als durch Verlobungsringe?
»Also gehen wir zur Trauung. Bist Du damit einverstanden?«
»Mein Geliebter!«
»Also gehen wir zur Trauung!«, wiederholte Littlelu, sich noch behaglicher zurücklehnend.
»Ja, so kommen Sie doch!«
»Wisst Ihr was — jetzt könnt Ihr beide mich mal ein bisschen tragen. Mir tun meine Froschschenkel noch recht weh!«, sagte der Clown mit dem ernsthaftesten Gesicht.
Endlich erhob er sich. Sie gingen die Treppe hinab, ohne noch einmal aufgehalten zu werden, ohne einem Menschen zu begegnen.
»Einen Augenblick, ich habe noch etwas vergessen!«, sagte Atalanta unten im Hausflur und sprang wieder die Treppe hinauf.
Littlelu blickte ihr nach.
»Die und etwas vergessen? Das glaube ich nimmer.«
Die Indianerin ging durch mehrere Zimmer, bis sie auf einen Wärter stieß.
»Ich möchte den Herrn Professor noch einmal sprechen.«
»Der Herr Professor zieht sich um.«
»Ich bitte ganz dringend.«
Bald kam er.
»Sie wünschen, Miss?«
Die Indianerin hielt ihm die Hand hin.
»Herr Professor, wir wollen uns doch vertragen!«, sagte sie mit ihrer weichsten Stimme, und so bittend konnten die großen Augen blicken.
Er machte ein erstauntes Gesicht.
»Vertragen?«
»Wir wollen gute Nachbarn sein.«
»Nachbarn? Ich verstehe Sie nicht.«
»Ich will Ihnen den linken Teil der Felswohnung abtreten — ja auch den rechten. Ich will Sie ganz ungestört lassen. Aber auch Sie müssen uns fernerhin in Ruhe lassen.«
Das musste wohl genügen. Er kreuzte die Arme über der Brust, seine Dolchaugen stachen.
»Sie befinden sich immer noch in dem Wahne, ich sei es wirklich gewesen?«
»Sie waren es, Sie sind es.«
»Sie befinden sich in einem Irrtum.«
»Ich irre mich nicht.«
»Dann sind Sie eben unheilbar.«
Sie sah, dass mit diesem Manne nichts anzufangen war und zog ihre Hand zurück.
»Gut. Was Sie uns bisher zugefügt haben, verzeihe ich Ihnen. Wir sind quitt. Und das Brandmal haben Sie ja vorzüglich aus der Stirn zu entfernen gewusst. Aber hüten Sie sich, dass ich Ihnen nicht ein anderes aufdrücken muss, das keine menschliche Kunst verwischen kann. Adieu.«
Sie ging.
»Sie sind eine Närrin!«, erklang es ihr nach. Aber sein Gesicht bekam sie nicht mehr zu sehen.
»Haben Sie gefunden, was Sie vergessen hatten?«, fragte Littlelu. — »Ja.«
»Dann wollen wir uns trauen lassen. Aber bitte — ein etwas freundlicheres Gesicht. Ja, fotografieren lassen müssen wir uns auch.«
An der Tür stand der zerlumpte Neger und riegelte auf.
Arno drückte ihm ein großes Goldstück in die Hand.
»Damit bin ich nicht zufrieden, das ist recht wenig!«, sagte der Kerl.
Atalanta überschüttete ihn mit einem Regen von Silber- und Goldstücken.
»Danke schön, Miss, wünsche vergnügte Reise!«, grinste der Kerl, schloss die Tür und schob die drei Riegel vor.
Die drei Freunde aber gingen die sonnige Straße hinab und kamen bei der nächsten Ecke schon in ein belebteres, anständigeres Viertel.
Eine ältere Frau stand da, sicher eine Irländerin, die Rosen in einem Körbchen zum Verkauf ausbot.
Arno blieb stehen, suchte die schönste Rose aus und steckte sie an die Brust der Geliebten. Dann fuhr seine Hand in die Hosentasche, kam aber leer wieder heraus.
»Ach so, das war vorhin mein letztes Goldstück, überhaupt meine einzige Münze. Ich muss Dich schon bitten, Atalanta, diese Rose selbst zu bezahlen. Oder gib mir mal was.«
Die elegant gekleidete Indianerin suchte vergebens in mehreren Taschen.
»Ich habe tatsächlich alles, was ich hatte, dem Neger geschenkt. Bitte, Littlelu, geben Sie mir etwas.«
Aber Littlelu trat einen Schritt zurück und machte ein unbeschreibliches Gesicht.
»Nee, nee!«, sagte er, immer auf seine Hosentasche klopfend. »Die Hochzeiten von anderen bezahle ich nicht. Ja, wenn's meine eigene wäre! Na, das ist ja gut! Der Bräutigam kauft der Braut eine Rose, die Braut soll sie selber bezahlen und pumpt erst den Leichenbitter an! Nee, von mir bekommt Ihr nischt, feiert Eure Hochzeit nur so weiter.«
»O, Sie glauben wohl, wir sind auf Sie angewiesen?«, lachte Arno.
Er hatte einen Einfall. Es war so herrlicher Sonnenschein und ihm so sonnig ums Herz. Er hätte hier auf der belebten Straße springen und tanzen mögen. Und es fielen ihm auf dieser Straße viele Passanten auf, die aber den anderen schon nicht mehr auffielen.
Also er nahm seinen spiegelblanken, funkelnagelneuen Zylinder, den er sich erst vorgestern früh, von der Station kommend, in New York gekauft hatte, und hielt ihn der Alten hin.
»Wollen Sie meinen Zylinder als Bezahlung annehmen?«
Die alte Irländerin war schon lange genug in New York, im exzentrischen Amerika. Da passieren noch ganz andere Dinge.
»Für die Rose? Ja. Aber herausgeben tue ich nichts!«
Arno stülpte ihr den Zylinder auf das graue Haupt und machte schnell, dass er fortkann Auffallen tat er ohne Kopfbedeckung durchaus nicht. Es wurde immer mehr Mode, ohne Kopfbedeckung zu gehen, auch mit Damen Arm in Arm. Dort ging ein sonst tadelloser Gentleman barfuß, die Flanelljacke über dem Arm. Eine Hitzewelle des indianischen Sommers nahte heran.
Aber gelacht wurde doch.
»Diese Hochzeit kann ja noch gut werden!«, sagte Littlelu. »Ich sehe schon, bis Sie in die Kirche kommen, haben Sie nur noch Stiefel und Hemd an, und dann drücken Sie dem Pastor als Honorar Stiefel und Hemd in die Hand. Behalten Sie nur wenigstens Manschetten und Kragen an.«
Er stellte schließlich seine Börse zur Verfügung, machte aber doch noch darauf aufmerksam, dass man hier in New York sei und nicht am Sklavensee.
»O, wir brauchen Ihr Geld nicht«, sagte Atalanta, »ich sehe mich nur nach einem Bankgeschäft um — da ist ja schon eins — wartet fünf Minuten.«
Sie kam noch eher wieder heraus.
»So, nun sind wir wieder bei Kasse.«
»Wie hast Du denn das Geld bekommen?«
»Durch einen Scheck. Doktor Hikari hat mir vier Scheckformulare gegeben, unausgefüllt, nur mit seiner Namensunterschrift. Ich schrieb zehntausend Dollars aus, sie wurden mir anstandslos ausgezahlt!«
Davon hatte Arno auch noch nichts gewusst.
»Dann hätte ich gleich mehr eingeschrieben, auf das bisschen mehr Tinte kommt es doch nicht an!«, meinte Littlelu. »Wenn Sie übrigens noch so einen Japaner wissen, der Blankoschecks austeilt, den können Sie mir empfehlen, es braucht nicht gerade ein Kaisersohn zu sein. Und hier ist ein Register Office.«
Ein Standesamt, ein Büdchen. Das heißt ein Büro, in dem sich ebenso gut ein Käsehändler mit einem Dutzend Käsen hätte etablieren können. Doch Kleinheit oder Größe hatte dabei ja nichts zu sagen, es war ein gesetzliches Standesamt.
In Amerika erfolgt die Trauung wie in England entweder nur standesamtlich oder nur kirchlich. Beides zusammen gibt es nicht. Die standesamtliche Trauung wird immer mehr bevorzugt, weil sich bei den zahllosen Sekten die Fälle immer mehr häufen, dass so ein Geistlicher gar nicht das Recht hat, eine Trauung zu vollziehen. Das stellt sich oft erst nach vielen Jahren heraus, nach einem Menschenalter, alle Ehen, die er geschlossen hat, sind ungültig, alle aus diesen Ehen hervorgehenden Kinder illegitim.
Vor der Haustür der Registratur standen eine Menge von Individuen, männliche und weibliche, die alle auf den Titel eines Gentleman und einer Lady Anspruch machen und das in ihrem Äußeren zum Ausdruck bringen wollten, was aber allen kläglich misslang. Alle zeigten so eine schäbige, heruntergekommene Eleganz, alle hatten dieselben eigentümlichen Gesichter, besonders die rote Nase war in allen Schattierungen vertreten, nicht zum Wenigsten bei den »Damen«. Man konnte ganz deutlich mehrere Klassen unterscheiden.
Es waren Tagediebe, die sich professionell als Trauzeugen anboten. Doch waren es, wie schon gesagt, in der Hauptsache ziemlich fragwürdige Elemente, die hier Posto gefasst hatten. Vor besseren Registraturen in eleganteren Stadtvierteln stehen wieder elegantere Individuen, die auf Wunsch auch Tafelreden halten.
»Hier haben wir die Auswahl für die noch fehlende Trauzeugin!«, sagte Littlelu. »Wie wäre dort die Dame mit der Purpurnase, an deren Spitze Phöbus beim Morgenkuss ein Tautröpfchen zurückgelassen hat?«
Arno erhob Bedenken. Was für eine Registratur, das sollte ihm ganz gleichgültig sein. Die waren sich alle gleich, keine billiger oder teurer als die andere. Aber so eine gekaufte Trauzeugin — nein, dazu war ihm die Sache denn doch zu feierlich.
»Sie haben recht. Es war auch nur ein Scherz von mir. Aber ich kann in wenigen Minuten eine Dame besorgen. Ich bin in New York zu Hause, weiß eine ganze Menge Damen, an deren Ehre nicht das Geringste auszusetzen ist. Allerdings aus der Artistenwelt.«
»Das hat nichts zu sagen. Zu dieser rechne ich mich selbst, auch wenn ich noch nicht öffentlich aufgetreten bin. Mein Entschluss war schon gefasst, das gibt den Ausschlag.«
Sie betraten die Salon-Bar einer Restauration, Littlelu ging ans Telefon und kam bald wieder zurück.
»Gleich die erste, bei der ich anfragte, sagte zu. In einer Viertelstunde ist sie hier. Eine Miss Adelina — so war wenigstens ihr Künstlername, ihren richtigen weiß ich gar nicht — aber eine hochehrenwerte Frau, schon ältlich, hat den Artistenberuf schon seit einem Vierteljahrhundert an den Nagel gehängt, eine Witwe, lebt in sehr guten Verhältnissen, hat sechs bis zwölf Kinder großgezogen, lauter ehrenwerte Menschen. Ein Sohn von ihr ist Senator.«
Bald kam sie vorgefahren. Ja, eine hochwürdige Dame mit grauen Haaren. Littlelu redete sie Miss Adelina an und stellte sie auch so vor, er vergaß, sie nach ihrem richtigen Namen zu fragen. Bei solchen Künstlern und Artisten ist das Pseudonym eben der eigentliche Name. Er fragte sie, wie es ihren Kindern ginge, die füllten auch ihre Gedankenwelt aus, sie sprach von nichts anderem.
»Nun, da wollen wir uns trauen lassen.«
Sie gingen hinüber. Zwischen Anmeldung und Vornehmung der Zeremonie waren nur zehn Minuten Wartezeit. Kein Papier war nötig, gar nichts. Nur eine kleine Belehrung ging der Trauung voraus. Vor allen Dingen wurde dem jungen Paar mitgeteilt, dass die Gebühr von fünfzehn Dollars im Voraus zu entrichten sei, dann kamen die Fragen, ob Braut und Bräutigam dem Alter wie dem Stande nach zur Heirat berechtigt seien, ob sie ledig oder verwitwet, ob die Zeugen auch wirklich zeugen dürften.
»Ihre Unterschrift gilt als Eid. Auch eine unwissentlich falsche Angabe macht die Ehe ungültig, eine wissentlich falsche Angabe kann für jeden einzelnen Fall bis zu sechs Jahren Zuchthaus eintragen.«
Dann war es in fünf Minuten geschehen, das heißt, erst nachdem der Bräutigam aus der Tasche der Braut die fünfzehn Dollars für diese schnelle Spezialtrauung abgeladen hatte.
Einer nach dem anderen trat vor an das Pult und unterschrieb, was auch zwei Beamte taten, eine Stempelmarke darauf, sie wurde entwertet, und das fertige Dokument erhielt die junge Frau ausgehändigt.
Erst im Vorraum bekam es Arno zu sehen, und er las, was wenigstens die Namen der Beteiligten anbetrifft, folgendes:
Graf Arno von Felsmark, Deutscher, Offizier, ledig.
Atalanta Ramoni, indianische Mohawk, Athletin, ledig.
Louis Maxim, Kanadier, Clown, ledig.
Adele Frankini, Französin, Schlangendame, verwitwet.
Als Arno diesen seinen Trauschein gelesen hatte, musste er sich schnell auf die Lippen beißen. Er sah sich im Geiste wieder in Deutschland. wieder als Offizier — ein Traum, der ihn mit leiser Sehnsucht verfolgte — er meldete sich beim Regimentskommandeur an und präsentierte dem Herrn Oberst diesen Trauschein.
Er musste sich noch krampfhafter auf die Lippen beißen — um nicht in ein schallendes Gelächter auszubrechen.
Nunmehr gingen alle vier nach ihrem Hotel, wo sie in einem separierten Speisezimmer das Hochzeitsmahl einnahmen.
Als es beendet, war es mittags ein Uhr.
»Wir wollen aufbrechen«, sagte Arno, sich erhebend, kommen Sie, Frau Gräfin. Ich habe einen Wagen bestellt. Wir machen eine Partie an den Strand nach Darlington, dann fahren wir mit dem Dampfer nach Long Island.«
Erst spät in der Nacht kehrten sie von der fröhlichen Partie zurück.
Am anderen Morgen in der neunten Stunde ging an der Portiersloge ein Herr vorüber, aus dem Hotel kommend, in dem der Portier nur der Gestalt nach den Grafen Arno von Felsmark erkannte, nicht dem Gesicht nach. So verwandelt war dieses Gesicht, so finster waren die sonst so heiteren Züge.
»Der scheint keine glückliche Hochzeitsnacht verlebt zu haben!«, meinte der Portier zu einem Kellner.
»Ja, wer weiß, was da passiert ist — ich habe ihn schon den ganzen Morgen stöhnen hören.«
Nach einer Stunde kam der Graf zurück und sein Gesicht war finsterer denn zuvor.
Die neue Frau Gräfin hatte in dem neben dem Schlafzimmer gelegenen Salon schon das Frühstück servieren lassen, nur der Spiritus brauchte entzündet zu werden, der Kessel enthielt schon heißes Wasser, und in wenigen Minuten machte die Maschine den Tee selbsttätig fertig.
Atalanta wusste als junge Frau Gräfin auch recht gut schon das elegante und doch so bequeme Morgenkleid zu tragen, sie wusste, dass dazu die offenen Haare nicht gepasst hätten, sie hatte sich deshalb eine entsprechende Frisur gemacht — sie repräsentierte eine tadellose Gräfin in der Morgentoilette, dem bronzefarbenen Gesicht nach hätte man sie für eine Italienerin, für eine Neapolitanerin gehalten.
Dass dieses dunkle Gesicht sehr ernst war, das konnte man von der Indianerin nicht anders verlangen, auch am Morgen nach der Hochzeit nicht.
Aber es verklärte sich sofort zu einem heiteren Lächeln, und zwar ohne jeden Zwang, als ihr Gatte eintrat.
»Nun?«
Keine Antwort. Und ihr heiteres Lächeln änderte die Stimmung Arnos nicht. Ächzend ließ er sich auf einen Stuhl fallen, um dann finster vor sich hin zu stieren.
»Nun, was sagte Professor Dodd?«
»Er ist nicht zu Hause, schon gestern verreist, wie es heißt nach Europa. So hat ja überhaupt alles gar keinen Zweck.«
Was hatte keinen Zweck? Weshalb war er nochmals bei dem Professor gewesen, in so früher Morgenstunde? Weshalb diese verzweifelte Stimmung?
Professor Dodd hatte damals am Sklavensee nicht umsonst jene Frage gestellt, welche die Ohren eines Mädchens nicht hatten hören sollen.
Die Kur war geglückt, die Lähmung beseitigt. Dafür hatte der Professor an dem Grafen einen neuen Schurkenstreich begangen, wovon dieser jedoch zunächst keine Ahnung gehabt hatte, denn hätte er es gewusst, so wäre er nie und nimmer eine Ehe eingegangen.
Atalanta ging zu ihrem ganz gebrochen in einem Fauteuil sitzenden Gatten, schlang ihre Arme um seinen Nacken und schaute ihn zärtlich an, indem sie ihm ins Ohr flüsterte:
»Ja, Arno glaubst Du denn, dass ich Dich deswegen weniger liebe?«
Die Unterredung der jungen Eheleute ward durch ein Klopfen an der Tür unterbrochen.
Arno stand auf, schon deswegen, weil er aus einem inneren Drang Bewegung haben musste. Und jetzt war sein Gesicht wieder ein ganz anderes, glückliche Heiterkeit prägte sich darin aus, wenn auch mit einem schwermütigen Zuge vermischt.
»Habe Dank, Atalanta, Du hast mich wieder aufgerichtet, das werde ich Dir nicht vergessen. Du sollst einen treuen Mann kennen lernen. — Herein!«
Der Zimmerkellner brachte auf einem Teller ein Schreiben.
»Ein Herr wünscht den Herrn Grafen von Felsmark und Frau Gemahlin zu sprechen, er hat auch diesen Brief abgegeben.«
»Um diese Morgenstunde?«
»Es sei äußerst dringlich, er habe es auch geschrieben.«
Arno erbrach das Kuvert, das eine Visitenkarte enthielt. L.H. Frary stand darauf und darunter mit Bleistift:
Bitte in wichtiger Angelegenheit um eine Unterredung.
»Ich empfange den Herrn. Aber sagen Sie gleich noch — wenn es sich nicht wirklich um etwas Wichtiges handelt — wenn er ein Versicherungsagent ist oder von so einem Abzahlungsbasar kommt — dann kann der Mann etwas erleben.«
Er trat ein. Ein noch junger Mann, anständig gekleidet, aber — der ausgesprochenste Todeskandidat! Nur Haut und Knochen, auch das ausgezehrte Gesicht, die Augen tief in den Höhlen — dessen Lebenslichtchen konnte jede Minute ausgeflackert haben.
»Guten Morgen. Ich habe den Lungenkrebs.«
Das war sehr traurig, aber als Einleitung wirkte es geradezu komisch.
»Sie brauchen aber keine Angst zu haben, es ist nicht ansteckend. Ja, die Ärzte geben mir nur noch ein paar Wochen.«
Das war fatal, dass man den empfangen hatte! Da musste man ganz energisch sein.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte Arno, während Atalanta schon ihre Handtasche öffnete.
»O, Sie glauben, ich komme um eine Unterstützung? Im Gegenteil, ich bin es, der Ihnen ein glänzendes Angebot machen will.«
Jetzt freilich stutzte Arno. Eine Ahnung durchzuckte ihn. Nämlich weshalb sich der Mann gleich als Todeskandidat vorgestellt hatte. Und seine Ahnung sollte sich auch sofort bestätigen.
»Warum ich Ihnen gleich sage, dass ich nur noch wenige Wochen, wenige Tage zu leben habe? Weil das bei meiner Mission die Hauptsache ist. Unterwerfen Sie mich nur der Folter — von mir erfahren Sie nichts, was ich Ihnen nicht freiwillig sage. Ich verschlucke ein Kügelchen, das ich bereits im Munde habe, erst durch den Magensaft wird die Umhüllung aufgelöst, aber auch sofort, ebenso schnell wirkt das darin enthaltene Pülverchen — meine Leiden sind schon jetzt beendet.«
Atalanta hatte gefunden, was sie gesucht, sie ging zu dem Manne hin und streckte die Hand aus.
»Einen kleinen Betrag zu Ihrem Begräbnis!«, sagte sie in ihrer phlegmatischen Weise, und als der Mann nicht danach griff, ließ sie das Goldstück fallen, ging nach der Tür, öffnete sie und machte eine einladende Handbewegung.
Stärker hätte sie ihre gänzliche Nichtachtung nicht ausdrücken können. Was der Mann mit seiner vielsagenden Einleitung wollte, war ihr vollständig gleichgültig.
Arno dachte anders.
»Bitte, Atalanta, es interessiert mich.«
Sofort schloss sie wieder die Tür und Arno wandte sich an den sonderbaren Fremden mit den Worten:
»Bitte, setzen Sie sich.«
Der Mann setzte sich, Atalanta ging wieder ans Fenster.
»Nun, was wollen Sie?«, begann Arno.
»Herr Graf von Felsmark! Sie sind jetzt der Gatte der bisherigen Miss Atalanta Ramoni. Ich biete Ihnen zehn Millionen Dollars, wenn Sie mir von der Tätowierung, die Ihre Gattin auf dem Rücken trägt, eine Pause machen.«
Das war kurz und bündig gewesen. Arno wollte mehr hören.
»In wessen Auftrag kommen Sie?«
»Das erfahren Sie nicht. Ich bin es, der Ihnen zehn Millionen Dollars bietet, sofort zahlbar in Papieren, Goldbarren oder gemünzt, ganz wie Sie wünschen, sobald ich überzeugt bin, dass es wirklich die getreue Kopie der Rückentätowierung Ihrer Gattin ist.«
»Wie überzeugen Sie sich von dieser Richtigkeit?«
»Meine Sache. Ich kann es auf den ersten Blick unterscheiden, ob alles stimmt oder ob Sie daran irgend etwas verändert haben.«
»Und wenn Sie nur einen Blick darauf geworfen haben, dann wissen Sie alles, brauchen Sie die Kopie gar nicht mehr?«
»Nein, so einfach ist es nicht. Sie meinen, dann kämen Sie um das Geld? Das wird Ihnen sogar vorher ausgezahlt. Ihr Wort genügt uns; denn wir haben es mit dem Champion-Gentleman von New York zu tun.«
»Hm. Also jetzt werden schon zehn Millionen für den Sklavensee —«
»Für den Sklavensee?«, fiel der Todeskandidat schnell ein. »Nein, mit dem Sklavensee haben wir gar nichts zu tun. Zehn Millionen Dollars für die Tätowierung Ihrer Gattin!«
Wieder verschob sich das Bild.
»Wissen Sie denn, dass —«
Arno wusste nicht, wie er fragen sollte, um sich nicht zu verraten.
»Ja, wir wissen es!«, kam ihm jener zu Hilfe. »Wir wissen, dass im Sklavensee Gold liegt. Wir wissen, dass Sie bereits welches gefunden haben. Wir wissen, dass jetzt dort Japaner in Ihrem Auftrage fischen. Wir sind über alles ganz genau orientiert. Aber der Sklavensee kümmert uns ganz und gar nicht. Zehn Millionen Dollars für die Tätowierung Ihrer Gattin, der letzten Mohawk.«
»Also jetzt sind Sie im Besitze jenes Leders?«
»Welches Leders?«
»Das die Gegenzeichnung enthält, den Schlüssel zu dem Geheimnis der Tätowierung.«
»Was für einen Schlüssel?«
»Verstellen Sie sich doch nicht!«
Ja, das konnte auch Arno in den Augen dieses Mannes lesen, dass er sehr wohl darum wusste, dass er jetzt seine Unkenntnis nur heuchelte.
Aber was half dies alles, wenn er nicht sprechen wollte?
»Die Tätowierung bezieht sich doch nur auf den Sklavensee.«
»Zehn Millionen Dollars für diese Tätowierung!«, wiederholte der Mann einfach.
Da gab Arno sein Bemühen auf, noch etwas zu erfahren. Er blickte nach Atalanta. Diese hatte schon vorher die Tür des Nachbarzimmers weit geöffnet. In diesem sah man Littlelu in Hemdsärmeln vor dem Spiegel stehen, mit zwei Bürsten energisch sein kurzes Haar bearbeitend, das jetzt aber nicht schwarz, sondern schneeweiß war. Der sicher schon alte Knax, freilich untaxierbar, hatte es noch nicht gefärbt.
Atalanta wollte, dass er alles mit anhörte.
»Zehn Millionen Dollars für die Tätowierung Ihrer Gattin!«, sagte der Mann nochmals.
»Und fünf Cents!«, ließ sich Littlelu drüben vernehmen. »Ich biete fünf Cents mehr. Aber ich will die Tätowierung auch selber durchpausen.«
Arno blickte also nach der Indianerin.
»Atalanta! Hierüber hast Du zu bestimmen!«
»Nein, Du!«
Er wusste, dass bei der jedes weitere Wort zwecklos war.
»Nein denn«, sagte er, »unter keinen Umständen!«
»Du hast für mich gesprochen!«, bestätigte die Indianerin jetzt doch noch. »Nein denn, unter keinen Umständen!«
»Warum nicht?«, fragte der Mann, durch diesen so felsenfest ausgedrückten Entschluss doch etwas außer Fassung gebracht.
Atalanta ging einige Schritte auf ihn zu.
»Diese Antwort lass mich geben, Arno. Weil dieses Geheimnis mir gehört — oder jetzt uns, mir und meinem Gatten. Es ist mein ureigenstes Eigentum. Meine Väter und Brüder haben es mir als der letzten der Mohawks unter den größten Vorsichtsmaßregeln auf den Rücken gegraben, in mein Fleisch und Blut — — und da soll ich dieses Geheimnis gegen schnödes Geld verkaufen? Geben Sie sich keine Mühe mehr.«
»Aber es nützt Ihnen doch gar nichts.«
»Gleichgültig. Oder einen Vorschlag will ich Ihnen noch machen. Gewiss, ich möchte gern wissen, um was es sich eigentlich handelt, was die Tätowierung bedeutet, was mir ihre Enträtselung einbringt. Geben Sie mir den Schlüssel dazu. Aber ich verspreche Ihnen nichts vorher. Sie dürfen sich darauf verlassen, dass ich sehr nobel sein werde. Vielleicht gebe ich Ihnen hundert Millionen Dollars, vielleicht aber auch nur hundert Dollars, vielleicht auch gar nichts. Je nach dem, was mir der Fund oder was es sonst sein mag, wert ist. Sie müssen sich auf meine Rechtlichkeit und Noblesse verlassen. Jede weitere Verhandlung ist überflüssig.
»Zehn Millionen Dollars für die Kopie Ihrer Tätowierung!«
»Bitte, verlassen Sie uns jetzt.«
Der Mann erhob sich, blieb aber noch stehen.
»Da muss ich es noch einmal anders versuchen. Ich will Sie warnen. Vielleicht ändert sich doch noch Ihr Entschluss. Dass Sie gegen Betäubungsmittel und selbst gegen starke Gifte gefeit sind, haben Sie schon bewiesen. Aber Sie sind doch nicht gegen eine Kugel gefeit. Sie werden einfach getötet, an einer Stelle, wo Ihre Leiche unbedingt in unsere Hände fallen muss. Dann haben wir Ihre Tätowierung, von der wir wissen, dass sie sich durch kein Mittel entfernen lässt, oder man müsste die ganze Haut abziehen. Und haben zehn Millionen erspart.«
Ja, der Mann war klug gewesen, sich gleich als Todeskandidat mit dem Krebs in der Lunge und einer Giftpille im Munde vorzustellen. Denn sonst wäre man jetzt anders mit ihm umgesprungen. Aber was sollte man denn mit solch einem Menschen anfangen, der schon so gut wie tot war.
Auf die Indianerin machte diese Drohung natürlich keinen Eindruck.
»Verlassen Sie uns jetzt, wir wollen frühstücken.«
Da erhob der Mann den Finger und schüttelte ihn drohend.
»Und ich warne Sie doch noch einmal! Unterschätzen Sie uns nicht! Es braucht nicht gerade eine Kugel zu sein! Es kann auch eine Bombe sein! Oder es dürfte doch ein Gift geben, gegen das Sie nicht gefeit sind! Und wir können nicht so genau direkt auf Ihre Person zielen! Denken Sie auch etwas an Ihre Gefährten! Zehn Millionen Dollars für Ihre Tätowierung! Nun?«
Die Indianerin war nicht zusammengezuckt. Nur ihre Augen wurden plötzlich ganz starr. Und so drehte sie langsam den Kopf nach dem Manne, den sie liebte.
Der verstand sofort. Jetzt wäre sie bereit gewesen, das Opfer zu bringen. Aber das gab es nun wieder bei einem Grafen von Felsmark nicht. Er machte es kurz, indem er in ein heiteres Lachen ausbrach und nun sagte:
»Ah, auf diese Weise fangen Sie jetzt an! Nun ist's aber genug! Nun aber hinaus mit Ihrem Krebse oder ich treibe Ihnen die Giftpille — — Hinaus, sage ich, hinaus!«
Der Todeskandidat war schon draußen.
Arno war nachträglich doch sehr aufgeregt.
»Nein, der Gewalt wird nicht gewichen! Drohungen sind ganz wirkungslos! Ehe ich da nur mit dem kleinen Finger nachgebe, will ich lieber alle meine Gliedmaßen verdorren lassen, soll eine krepierende Bombe mich in Stücke reißen — — Mensch, wie sehen Sie denn aus?!«
Littlelu war hereingekommen. Er hatte sich seine Haare hellgrün gefärbt.
»Ich will zu einer Versicherungsgesellschaft gehen und will dort mein Leben versichern lassen. Ihnen ist es gleichgültig, ob Sie an Gift sterben, ob sie von einer Bombe zerrissen werden — mir ist es nicht gleichgültig. Sie freilich haben ja auch nichts weiter zu verlieren — ich bin es der Menschheit schuldig, mich ihr zu erhalten. Sie können sagen: Sie haben ja gar nichts mit uns zu tun, gehören nicht zu uns, diese Anschläge gelten nur unserem Leben. So sagen Sie! Aber die Bombe, die zwischen uns fällt, fragt nicht erst: habe ich die Ehre, Mister Littlelu vor mir zu sehen? Gehören Sie mit zu dieser Bande? Nein? Dann bitte, wollen Sie sich gefälligst entfernen, ich möchte krepieren. — Das sagt die Bombe nicht erst. Die platzt einfach — und ich platze mit. Ich gehe jetzt mein Leben versichern.«
»Und dazu färben Sie sich Ihre Haare grasgrün?«, lachte Arno.
»Gewiss, und zwar deshalb, weil ich ein kluger Kopf bin. Sie natürlich würden, wenn Sie sich versichern lassen wollten, Ihr blondes Haar weiß färben. Aber man muss bei so einer Lebensversicherung möglichst jung erscheinen. Je jünger, desto billiger wird die Prämie. Ich werde denen doch nicht sagen, dass ich schon stark auf die hundert losgehe. Das Alter wird überhaupt nicht verraten. Die mögen nur selbst taxieren. So habe ich mich mit jungfräulichem Frühlingsgrün geschmückt. Adieu. In einer halben Stunde bin ich wieder da.«
»Ein seltsamer Kauz, nichts als Schrullen im Kopf!«, lachte Arno, als sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte.
»Ja, aber sie bringen ihm etwas ein!«, versetzte Atalanta.
»Ob er denn nur wirklich mit den grünen Haaren auf die Straße geht?«
»Er wird sie wohl verhüllen, soweit es nicht schon sein Hut tut, ich sah so etwas in seiner Hand. Und doch, warum nicht? Dann aber tut er es jedenfalls nicht umsonst.«
Sie nahmen das unterbrochene Frühstück wieder auf.
»Ja, Atalanta«, begann Arno alsbald, »was mag denn das mit Deiner Tätowierung für eine Bewandtnis haben?«
»Soll ich Dir Honig aufstreichen?«, war die Gegenfrage der jungen Gattin mit der roten Haut.
Diese Andeutung genügte. Arno sprach nicht mehr davon, er ließ sich Honig aufs Frühstücksbrot streichen.
Bald kam Littlelu zurück. Er trat wieder durch sein Zimmer herein und hatte einen großen Tragkorb am Arme hängen.
»Uff, heute wird's heiß!«, sagte er, als er den Hut abnahm.
Jetzt hatte sich das grasgrüne Haar purpurrot gefärbt.
»Wie ist denn das gekommen?!«
»Was denn?«
»Dass sich Ihr Haar so verändert hat?«
Littlelu blickte in den Spiegel, als wollte er erst etwas davon merken, und dann wurde er wild.
»Soll man da auch nicht rote Haare bekommen! Denkt Euch, ich will mein Leben für eine halbe Million versichern, da sagt mir der Kerl, mehr als anderthalb Dollar wäre ich nicht wert, ich hätte Gehirnerweichung! Da ist mir vor Wut das Blut in den Kopf gestiegen! Was Wunder, wenn man da rote Haare bekommt!«
Er setzte sich an den Tisch und stellte den großen Korb neben sich.
»Was haben Sie denn da eingekauft?«
»Sollen Sie gleich sehen. Ich habe mich doch noch versichert, aber auf eigene Faust.«
Er schob das Geschirr auf seiner Seite zurück, griff in den Korb, brachte ein Meerschweinchen zum Vorschein, setzte es auf den Tisch, ein zweites, ein drittes, dann erschien ein junger Mops, dann ein zweiter, dann wieder ein Meerschweinchen, dann wieder ein junger Mops — bis auf dem Tische sechs Meerschweinchen und sechs Möpse herumkrochen, junge Tiere, die eben erst allein fressen konnten, billiges Zeug, das man geschenkt bekommt.
»So. Nun soll man uns nur Gift zuschicken. Ich bin versichert. Wollen gleich einmal sehen —«
Er nahm vom Teller ein Bündelchen Wasserkresse, die auf keinem amerikanischen Frühstückstisch fehlt, und hielt es einem Mopse vor. Der wollte natürlich von dem grünen Gemüse nichts wissen.
»Da — sehen Sie? Der kluge Hund mit seiner feinen Nase wittert schon etwas. Die Brunnenkresse scheint nicht ganz koscher zu sein. Immer essen Sie, ich esse sie nicht. Ich bin vorsichtig geworden. Sieht der Mops übrigens nicht gerade wie Doktor Hikari aus? Nur sein Schnurrbart ist größer, sonst Zug für Zug dasselbe Gesicht. Und nun Du? Sehen Sie, das Meerschweinchen will auch die Salamiwurst nicht fressen. Dann mag ich sie auch nicht. Mir ist mein Leben lieber als Salami. Ich bin versichert.«
Er packte die Tierchen wieder ein, die er natürlich für einen ganz anderen Zweck gekauft hatte.
Wir betreten das Schifferstübchen einer New Yorker Seemannsherberge. Die Wände sind geschmückt mit alten Kupferstichen aus dem Seeleben im Frieden und im Kriege, überall ausgestopfte fliegende Fische und andere merkwürdige Seetiere, die Waffen von Schwert- und Sägefischen, zahlreiche Modelle von Dampfern und noch Segelschiffen, und als Hauptsache an der Decke, durch die ganze Stube gehend, das Wahrzeichen dieses Gasthauses, ein großes Krokodil der amerikanischen Art, ein Alligator, himmelblau angestrichen.
An dem Tisch, über dem ein viermastiger China-Segler hing, saßen sich zwei Männer gegenüber. Der eine war ein älterer Gentleman, am linken kleinen Finger und im Schlips den unvermeidlichen Kapdiamanten — der andere ein herkulisch gebauter jüngerer Mann im blauen Anzug mit trichterförmigen Hosen, seinen schwieligen Fäusten nach vor dem Mast fahrend, also ein Matrose oder auch ein Bootsmann, der etwas auf sein Äußeres hielt, der blaue Anzug nicht mehr neu, aber fleckenlos und sauber gebürstet, der Umlegekragen blendend weiß, worauf die Kapitäne bei der Anmusterung, wenn das Angebot groß ist, sehr wohl etwas geben.
Sonst war das sonnenverbrannte, verwitterte Gesicht nicht gerade Vertrauen erweckend. Brutale Rücksichtslosigkeit war der Hauptcharakter dieses Matrosen, während der alte Gentleman ein ausgesprochenes Fuchsgesicht hatte.
Die beiden mussten in diesem separierten Zimmer schon längere Zeit gesessen haben und waren darauf gefasst, noch länger zu warten. Eine Flasche Portwein hatten sie schon geleert, die zweite ging auch schon bald zur Neige, der Abstreicher war mit Zigarrenasche gehäuft.
Schon seit längerer Zeit war zwischen den beiden die Unterhaltung ins Stocken geraten.
Der Gentleman blickte nach der Telleruhr an der Wand und ließ seine goldene Taschenuhr repetieren.
»Um zehn. Jetzt muss sich's in jeder Minute entscheiden, ob Ihr einen Auftrag bekommt oder nicht.«
»Der Frary ist's?«, fragte der Matrose, der zu dem vornehmen Herrn in durchaus keinem abhängigen Verhältnis stehen konnte, danach benahm er sich.
»Ja, der Frary bringt die Entscheidung.«
»Habe ihn lange nicht gesehen, er soll auf dem letzten Loche pfeifen.«
»Ja, der kann jeden Tag abfahren. Deswegen eben kann man ihn zu gewissen Missionen so gut gebrauchen.«
»Weiß schon. Er kommt selbst?«
»Wo denkt Ihr hin!«, lachte der Gentleman. »Damit ihm nachspioniert wird, was? Tom, seid Ihr naiv!«
»Na was gibt's denn da zu lachen und zu höhnen?«, war die grobe Antwort des Matrosen. »Habe ich denn eine Ahnung, um was für eine Schurkerei es sich wieder handelt?«
»Um ein Geschäft, bei dem Ihr ein schönes Stück Geld verdienen könnt!«, begütigte der andere.
»Sollte mich freuen, habe es sehr nötig.«
Eine unsichtbare Klingel schrillte, gleich darauf trat der Wirt ein, der Wirt einer Seemannsherberge, ein Boarding Master, ein Heuerbaas, ein Seelenverkäufer, auch so ein mit allen Hunden gehetzter Fuchs, zu allem fähig, wobei Geld zu verdienen ist. Gerade für die Betreffenden ist es so bedauerlich, dass sich so etwas den Gesichtszügen einprägt, und da gibt es keine Verstellung.
»Eine Stadtdepesche für Sie.«
»Na endlich!«
Ein Postmann trat ein, der Herr erbrach das für ihn bestimmte Telegramm.
Einige Zahlen, nichts weiter. Eine Geheimschrift.
»Es ist gut.«
Die beiden waren wieder allein.
»Es ist so gekommen, wie es bei dem roten Weibe nicht anders zu erwarten war. Desto besser, da gibt's noch etwas ganz Besonderes zu verdienen.
Also hört, Tom Snyder, im Namen des Meisters erteile ich Euch den Auftrag.
Heute Mittag zwischen eins und zwei mustert im blauen Alligator, unten im Saal, der deutsche Dampfer ›Albatros‹, Kapitän Schönbart, für Algier an.
Ihr habt Euch anmustern zu lassen. Vor dem Mast — wenn nicht als Matrose, dann höchstens als Koch oder Bootsmann. Gelingt es Euch nicht, direkt anzukommen, so macht einen schon angemusterten Matrosen besoffen, lasst Euch von ihm —«
»Das lasst nur meine Sache sein!«, fiel der Matrose dem so vornehm aussehenden Herrn ins Wort. »Sagt mir nur kurz, was der Meister von mir verlangt, die Ausführung überlasst mir!«
Unbeleidigt zog der andere aus der Brusttasche eine kleine, starkwandige Glasflasche, gefüllt mit einer hellen Flüssigkeit, gut verkorkt und versiegelt.
».Hier nehmt. Es ist ein —«
Er wurde unterbrochen. Ein widerliches Grinsen ging über das verwitterte Gesicht des Jüngeren, als er nach dem Fläschchen griff.
»Ein Gift!«, ergänzte er. »Nun weiß ich alles. Hab's mir doch auch gleich gedacht. Es handelt sich wieder um Bergelohn. Famos, da gibt's wieder einmal etwas zu verdienen.«
»Falsch habt Ihr gedacht!«, triumphierte der andere »Ja, Bergelohn wird's wohl geben, aber der kommt erst in zweiter Linie in Betracht. Es ist kein Gift, kein tötendes, sondern nur ein starkes Betäubungsmittel. Bei passender Gelegenheit, an einer Stelle, die noch zu besprechen ist, aber nicht mit mir, schüttet Ihr dieses Zeug in das gemeinsame Essen. Es ist eine ganz neue Erfindung, die in unserem Höllenlaboratorium gemacht worden ist, es wirkt erst nach zwei bis drei Stunden. Vorher zeigt sich nicht die geringste Beschwerde, kein Geschmack und gar nichts. Dann aber schläft alles plötzlich ein, auch ein Ochse, wenn er nur ein paar Tropfen in's Saufen bekommen hat, und zwar nicht später als ein Hühnchen. Alles schon ausprobiert. Der Todesschlaf hält drei bis vier Tage an, dann erwacht man wie aus einem gesunden Schlafe ohne die geringsten Nachwehen. Dem ›Albatros‹ wird der Seewolf folgen —«

»Aaah, der Seewolf!«, freute sich der Matrose. »Endlich komme ich wieder mit dem zusammen!«
»Ja, der Seewolf. Er bleibt dem ›Albatro‹ in der nötigen Entfernung auf den Hacken sitzen. Sobald Ihr Euren Zweck erreicht habt und alles eingeschlafen ist, gebt Ihr ihm ein Signal. Dies und alles Weitere habt Ihr mit dem Seewolf selbst auszumachen, der ebenfalls unterrichtet wird. Ich habe Euch nur noch zu instruieren, falls der Seewolf Euch verliert, was ja doch einmal passieren kann.
An Bord des ›Albatros‹ werden sich drei Kajütenpassagiere befinden. Ein deutscher Graf Arno von Felsmark, ein ehemaliger Zirkusclown namens Louis Maxim, genannt Littlelu, und eine junge Indianerin, bisher Miss Atalanta Ramoni, jetzt —«
»Aaah, die rote Athletin!«
»Habt Ihr von der schon gehört?«
»Na, wer hat von der nicht schon gehört und gelesen?«
»Wisst Ihr auch etwas von einer Tätowierung derselben?«
»Einer Tätowierung? Diese Indianer sind doch alle tätowiert.«
»Also Ihr wisst nichts davon. Woher solltet Ihr auch, wenn Ihr hierüber die erste Instruktion bekommt. Diese Atalanta ist jetzt die Frau des Grafen von Felsmark, er hat sie geheiratet, aber das ist Nebensache. Die Hauptsache ist, dass sie auf ihrem Rücken eine große Tätowierung hat. Wenn nun alles eingeschlafen ist, also auch die Indianerin, und der Seewolf kommt, dann erledigt sich alles von allein, dann habt Ihr nichts weiter damit zu tun, der Seewolf weiß viel mehr als Ihr — und ich.
Wenn aber der Seewolf nicht kommt, dann muss Euer erstes sein, die schlafende Indianerin auszuziehen und das Bild, das sie auf dem Buckel hat, genau abzumalen. Ihr sollt gut zeichnen können, he?«
»Ich kalkuliere, dass wissen diejenigen, denen auch Ihr ganz einfach blindlings zu gehorchen habt, am allerbesten, sonst wäre ich zu so etwas nicht ausgewählt worden. Ich bin Kapitän auf einem Küstenvermesser gewesen, verstanden?«
So sprach der Matrose mit einem Stolz, der seine Wirkung nicht verfehlte. Es war also durchaus kein gewöhnlicher Matrose, der sich hier Tom Snyder nannte.
»Dann ist's ja gut. Also Ihr malt die Tätowierung ab oder paust sie durch — macht eine genaue Kopie davon. Das sagt Euch auch noch der Seewolf.
Nun könnte es aber doch sein. dass die Indianerin nicht einschläft. Die hat nämlich schon mehrmals bewiesen, dass ihr Betäubungsmittel und selbst starkes Gift gar nichts anhaben können. Unser Chemiker behauptet zwar, diesem Schlaftrunke müsse sie unterliegen, und wenn's des Teufels Großmutter wäre, aber — es könnte doch der Fall sein.
In diesem Falle müsst Ihr sie unschädlich machen, um doch noch ihren Rücken zu sehen. Ihr müsst ihr eins auf den Kopf geben oder sonst was, dass sie betäubt wird, aber um Gottes willen sie nicht töten!«
Mit größerem Nachdruck hätte es der Gentleman nicht sprechen können, so sehr er auch seine Stimme dämpfte.
»Ja, weshalb denn nicht? Warum wird denn nicht gleich alles vergiftet, mit Zyankali, wie ich's schon mal machen musste, um den Bergelohn zu sichern?«
»Weil die Tätowierung mit dem Tode erlischt! Sobald das Herz kein Blut mehr durch die Adern pumpt, ist die Tätowierung spurlos verschwunden! Seht, das ist die Sache.«
»Das ist ja eine merkwürdige Tätowierung!«
»Ja, ich habe mit unserem Chemiker, der doch alles weiß und kann, was mit so etwas zusammenhängt, auch schon darüber gesprochen. Der meint, so etwas sei recht wohl möglich, indem sich die roten und weißen Blutkörperchen in jeder Sekunde mehrmals erneuern. Es ist unausgesetztes Werden und Vergehen. Und da könnte es recht wohl eine Farbe geben, die, in die Haut eingeritzt, nur so lange sichtbar ist, wie dieser natürliche Wechsel im Blut stattfindet. Sobald das Blut selbst tot ist, die Blutkörperchen sich nicht wieder erneuern, verschwindet auch die Farbe. Doch das ist für uns Nebensache. Ihr habt die Tätowierung abzuzeichnen, wobei die Indianerin nicht getötet werden darf. Das Wie ist Eure Sache. Und was das für ein Weib ist, das wisst Ihr schon. Die spielt mit Zentnergewichten wie mit Gummibällen, die wirft den stärksten Mann —«
»Das lasst nur meine Sorge sein!«, lachte der Matrose verächtlich, sich die herkulischen Fäuste reibend. »Und was soll dann aus den Schlafenden werden?«
»Na, wenn der Seewolf kommt, dann kriegen die Schläfer einfach ein Kohlensäckchen an die Füße gebunden und werden über Bord geworfen. Nur die Indianerin kommt lebendig an Bord des Seewolfs, natürlich gehörig gefesselt, wofür Ihr wohl Sorge tragen werdet.«
»Darauf könnt Ihr Euch verlassen. Und wenn der Seewolf nicht kommt, wenn er uns verloren hat?«
»Zwei Tage dürft Ihr warten. So lange hält der Schlaf allermindestens an. Hat Euch der Seewolf bis dahin nicht gefunden, oder schon vorher, wenn sich ein Schiff nähert und es augenscheinlich auf den stillliegenden Dampfer abgesehen hat, dann —«
Der ehrenwerte Gentleman brachte aus seiner Brusttasche ein zweites Fläschchen zum Vorschein, ein viel kleineres als das vorige.
»Dann sperrt Ihr den Schlafenden den Rachen auf und träufelt jedem einige Tropfen von dieser Sache ein. Es kann auch noch stark verdünnt sein, wirkt augenblicklich. Dann ist alles tot. Und in diesem Falle müsst Ihr auch die Indianerin töten. Sollte sie auch diesem Mittel widerstehen, na, dann beseitigt Ihr sie eben auf andere Weise, stranguliert sie und schmeißt sie über Bord, wenn nicht jedes Zeichen eines gewaltsamen Todes vermieden werden kann. Auf die eine Person kommt es ja nicht an.«
»All right!«, sagte der andere gelassen, das Fläschchen einsteckend. »Und die anderen Toten?«
»Die müssen natürlich an Deck liegen bleiben, oder wo sie sonst umgefallen sind.«
»Und wie wird der Tod maskiert?«
»Ihr bekommt vom Seewolf noch einige Dosen Bratheringe. Die sind vergiftet. Das heißt, es ist eine ganz natürliche Zersetzung. Alle haben von diesen Fischkonserven gegessen und sind daran gestorben. Nur Ihr wolltet nichts von dem sauren Zeuge wissen. Das arrangiert Ihr eben so, macht ein paar Dosen auf, setzt die Fische auf Teller, als hätten alle davon gegessen, und so weiter. Das versteht Ihr doch besser als ich. Und gesetzt den Fall, ein Toter würde seziert, sein Magen untersucht, so würde man in seinem Magen wirklich solches Fischkonservengift finden. Denn dieses Fläschchen enthält so etwas, nur von einer fürchterlichen Wirkung. Es ist wieder eine ganz neue Erfindung unseres genialen Giftmischers!«
»Aber in dem Magen findet man doch keine Überreste von Fischen.«
»Ah pah! Die haben nur einmal daran geleckt und sind umgefallen. Und überhaupt, wer denkt denn da an eine Öffnung des Magens.
Nun will ich Euch noch einmal alles Gesagte kurz wiederholen. Also die Indianerin dem Seewolf lebendig ausliefern, sie erst im Notfall töten, aber auf keinen Fall eher töten, als bis Ihr die Tätowierung abgezeichnet habt! Denn sobald sie tot ist, oder wahrscheinlich nur dem Sterben nahe, dass das Blut nicht mehr ganz normal zirkuliert, ist von der ganzen Tätowierung keine Spur mehr zu sehen!«
Der »Albatros«, ein Dampfer von fünftausend Tonnen — das ist für einen einschlotigen Frachtdampfer eine normale Größe — steuerte aus dem Hafen von New York, an der Freiheitsstatue vorbei.
An Bord befanden sich als Passagiere Graf von Felsmark, seine junge Gattin und Littlelu — als einzige Passagiere — und mehr wären auch nicht mitgenommen worden.
Jeder Frachtdampfer, auch jedes Segelschiff, nimmt gern einige Passagiere mit, zwei bis vier. Jeder Kapitän hat nach alter Tradition das Recht, seine Familie frei mitzunehmen oder Freunde oder eben Gäste. Dieses Recht wird er sich nie nehmen lassen. An Bord eines jeden Schiffes sind einige besondere, gut eingerichtete Kabinen, ursprünglich allerdings nur dazu bestimmt, um Schiffbrüchige aufzunehmen, für den Kapitän und die Steuerleute, für die geretteten Offiziere, die auch als Offiziere behandelt werden müssen und nicht in die Segelkammer oder ins Matrosenlogis gesteckt werden können.
Vor der Abreise aber hat der Kapitän über diese Kabinen frei zu verfügen. Er kann sie auch an Passagiere vermieten. Zu bezahlen hat er nur, was vom Schiffsproviant für sie verwendet wird. Sonst kann er an ihnen so viel verdienen wie er will.
Wer einmal solch einen Frachtdampfer benutzt hat, wird, wenn er kein Herdenmensch und kein gar zu großes Leckermaul ist, ihn immer wieder jedem Passagierdampfer vorziehen. Obgleich es nicht etwa billiger ist. Im Gegenteil, diese Kapitäne halten auf Preise! Wer so eine Kabine verschleudern wollte, um ein paar Mark zu verdienen, könnte mit seinen Kollegen nicht mehr verkehren. Unter diesen Fürsten des Meeres herrscht eine scharfe Routine, sie sind dem strengsten Ehrenkodex unterworfen, wenn dieser auch ungeschrieben ist.
Die ganze Seereise auf einem guten Passagierdampfer erster und auch zweiter Kajüte ist ja nur eine einzige — Schmauserei. Ein Frachtdampfer fordert denselben Passagierpreis, gibt wohl auch ausgezeichnetes Essen, aber keine Diners und Soupers von sechs bis zehn Gängen. Solche Umstände können nicht gemacht werden mit den wenigen oder gar nur einem Passagier, das ist unmöglich. Dafür aber ist man als Passagier auf einem Frachtdampfer Hahn im Korbe. Das ganze Schiff steht einem zur Verfügung. Man kann sich neben dem Kapitän auf die Kommandobrücke setzen, kann hinunter in den Maschinenraum gehen, kann in seiner Kabine rauchen — was es auf einem Passagierdampfer alles nicht gibt — man kann sich seine eigenen Getränke mitbringen, kann des Nachts aufstehen, in die Proviantkammer gehen und sich vom saftigsten Schinken eine Scheibe abschneiden, kann sich an Deck ausziehen und sich eine Pütze Wasser über den Kopf gießen, kann sich dann zum Trocknen an einer Rahe aufhängen und so weiter und so weiter. Es ist viel gemütlicher, ganz zwanglos.
Freilich kann man auch fürchterlich dabei hereinfallen. An Land lernt man einen honetten Kapitän kennen und an Bord entpuppt er sich als ein brutaler Mensch, der in sinnloser Trunkenheit den Passagier mit dem Revolver bedroht, ihn zur Kajüte hinauswirft, ihn misshandelt, und man ist ganz ohnmächtig gegen ihn.
Littlelu hatte als fahrender Artist manche Seereise auch einmal auf einem Frachtdampfer, und es hatte ihm darauf so gefallen, dass er dem jungen Ehepaar vorschlug, zu der geplanten Reise nach Palästina einen solchen zu benutzen. Die beiden waren damit einverstanden gewesen, sie hatten ja auch einen ganz triftigen Grund, das so enge Zusammensein auf einem Schiffe mit vielen fremden Menschen zu meiden. So sagte sich wenigstens Arno. Jene Drohungen des Schwindsüchtigen hallten ihm doch immer noch in den Ohren.
Littlelu hielt Umschau unter Schiffen und Kapitänen. Direkt nach einem Hafen Palästinas ging von hier aus kein Dampfer. Aber unter solchen, die bald nach Mittelmeerhäfen gingen, besonders nach Marseille, Genua, Neapel, Alexandrien, Port Said und Konstantinopel, von wo ja immer Verbindung nach Jaffa, dem größten Hafen an der palästinensischen Küste, war, hatte er die Auswahl.
Littlelu selbst hatte, wie gesagt, noch keine trübe Erfahrung damit gemacht, wohl aber schon davon gehört, wie furchtbar man mit solch einem Frachtdampfer hereinfallen kann. Als er in einem Schifferhotel den Kapitän Schönbart vom »Albatros« kennen lernte, der schon am nächsten Tage nach Algier abdampfte, stand sein Entschluss sofort fest, nur diesen zu benutzen. Wenn das Gesicht dieses Kapitäns log, dann gab es überhaupt keine Redlichkeit und Gemütlichkeit mehr auf der Erde.
Auch von Algier aus würde es jederzeit eine direkte Gelegenheit nach Jaffa oder doch nach Alexandrien geben.
Um Mitternacht mussten sie an Bord sein. Ein Wagen brachte die drei mit ihrem wenigen Gepäck nach dem Hafen. Doch seine Meerschweinchen und Möpse hatte Littlelu schon wieder abgeschafft, er habe sich mit ihnen verspekuliert, sagte er.
Da noch Fracht eingenommen wurde, verzögerte sich die Abreise bis zum Morgen. Der Kapitän war nicht zu sprechen, der Steward nahm die Passagiere in Empfang, fragte, ob er noch ein Abendbrot servieren solle, und als das abgeschlagen wurde, wies er ihnen ihre Kabinen an, dem Ehepaar eine gemeinschaftlich.
Atalanta kam in eine ihr ganz neue, fremde Welt, und man sah es ihr an, wie diese ihr gefiel, sie machte daraus kein Hehl, die sonst so tiefernste, schweigsame Indianerin veränderte sich überhaupt wieder einmal ganz und gar.
»Ach, hier ist es aber schön!«, hatte sie schon beim Betreten der traulichen Kajüte gerufen, und in der geräumigen Kabine machte sie ihrem Entzücken erst recht Luft. Viel älter als sechzehn Jahre war sie ja nicht, und sie wurde hier tatsächlich zum Kind. Alles musste sie gleich untersuchen.
»Ach, hier ist es ja himmlisch! Diese kleinen runden Fensterchen, wie nennt man die? Bullaugen? Sieh nur, Arno, dieser Waschtisch, was man da alles herausziehen kann! Und so wird's ein Schreibtisch! Sogar ein Tintenfass mit Federhaltern ist drin! Und das Tintenfass schaukelt nach allen Seiten! Wie ist das nur möglich? Und auch hier wieder eine elektrische Lampe! Sogar auf dem Meere elektrisches Licht! Wo sind denn nun unsere Betten? Ah, hier in diesen Kojen. O, das ist ja alles prächtig! Alles Mahagoniholz, und diese Schnitzereien! Und wie's da drin aussieht! Diese Decken, die sind ja alle von Seide, und diese prachtvolle Stickerei! Überall ein großer Albatros darauf, von Silber!«
Ja, diese Kabine des einfachen Frachtdampfers, der manchmal nur Kohlen beförderte oder aus der Türkei Knochen und Lumpen abholte, nahm es mit der erstklassigen Kajüte jedes Passagierdampfers auf. Daneben befand sich eine Toilette mit zwei Marmorwannen und anderen hygienischen Einrichtungen. Diese Kapitäne wissen zu leben und ihre Gäste zu bewirten! Und warum sollen sie auch nicht! Es sind viele Millionen, die man ihnen anvertraut. Ein einziges falsches Kommando, eine Unachtsamkeit, und alles ist vielleicht für immer verschwunden.
Freilich kostete die Bewirtung hier auf dem »Albatros« auch zwanzig Mark pro Tag und pro Kopf.
Atalanta jubelte weiter, auch als sie schon in der Koje lag. Bis der benachbarte Littlelu gegen die Eisenwand donnerte.
»Na, nun haltet endlich die Luft an! Ihr stört ja mit Eurem Gepiepse den ganzen Frieden der Natur!«
Das war Littlelus gewöhnliche Ironie. Es herrschte ein Höllenspektakel. Ununterbrochenes Kettengerassel, die Dampfwinde stöhnte, Kisten krachten, die Kohlen polterten in die Bunker, über den Köpfen an Deck rannten dröhnende Schritte hin und her, Matrosenflüche der schauderhaftesten Art, gellende Pfiffe, die Dampfsirenen heulten — ein schrecklicher Spektakel die ganze Nacht hindurch!
Aber ganz merkwürdig ist es, dass dieses Getöse, das der Abfahrt eines Schiffes stets vorausgeht, auch Nervenleidende vertragen können. Es ist wie eine Jubelouvertüre zur Einleitung einer glücklichen Reise. Jeder empfindet es ganz unbewusst. Wenn es still ist im Schiff, dann wird es unheimlich, dann fühlt man sich wie in einem eisernen Riesensarge begraben.
Unter dieser Radaumusik schliefen die drei Passagiere sanft ein.
Zeitig am Morgen war's, als Atalantas Stimme ertönte.
»Wache auf, Arno, wir sind auf dem Meere!«
Die Schraube, von viertausend Pferdekräften getrieben, ließ die eisernen Schiffsplanken erzittern, an den starken Glasscheiben der Bullaugen rauschte und spritzte das Wasser, goldener Morgensonnenschein drang in die Kabine.
Als die beiden das Deck betraten, wurden sie erst recht von dem Anblick überwältigt.
Hinter ihnen lag die riesige Freiheitsstatue mit erhobener Fackel, vor ihnen das offene Meer, wenn hier auch noch eine Bai, von Fahrzeugen aller Art belebt, die scheinbar so ruhig durch das in der Sonne glitzernde Wasser schnitten.
Auf dem schneeweiß gescheuerten Deck stand schon Littlelu. Er unterhielt sich mit einem älteren, hünenhaften Manne, dessen schäbigem blauem Anzuge man nicht ansah, dass er dieses Schiff kommandierte. Es war Kapitän Schönbart, er hatte aber weder einen Bart, noch war er schön. Sein dickes Gesicht sah ganz aus wie ein braungebackener Pfannkuchen, besonders weil die Nase darin fast ganz verschwand.
»Da sind Sie ja!«, rief er, Atalanta und Arno die braune, haarige Bärentatze entgegenstreckend. »Seien Sie mir als meine Gäste herzlich willkommen. Also das ist der Graf von Felsmark, der Champion-Gentleman von New York. Ja, ja, weiß schon. Und das ist die Atalanta, die rote Athletin. Ja, ja, weiß schon. Und die haben Sie geheiratet? Das haben Sie recht gemacht. Sie können mir dann mal was vorturnen. Erst aber wollen wir frühstücken.«
Die Hauptsache bei diesem ersten Frühstück bildeten weiche Eier, ein abgezähltes Schock weiche Eier. Denn Kapitän Schönbart aß zum ersten Frühstück regelmäßig ein Dutzend weiche Eier, und er mochte wohl glauben, dass es andere Menschen auch so hielten, und anstandshalber mussten doch einige übrig bleiben. Zwei Stunden später, zum zweiten Frühstück, aß er dann regelmäßig ein tellergroßes Beefsteak, aus dem Eisraum, und da darf man wohl glauben, dass er schon am Vormittag eine halbe Flasche des stärksten Jamaika-Rums trinken konnte, ohne dass man ihm weiter etwas davon anmerkte, als dass er immer eine Rumatmosphäre um sich verbreitete.
Schnell war die Unterhaltung im Gange.
»Was hat Ihr Schiff eigentlich geladen?«, begann Littlelu.
»Tabak, Messingdraht und Merikani. Das ist blauer Baumwollenstoff, in Afrika allgemein so genannt. Lauter Karawanenware. Geht mit nur einem kleinen Zoll ins Innere Afrikas.«
»Wozu der Messingdraht?«
»Daraus machen sich die Neger Schmuck, er dient ihnen auch als Zahlungsmittel, als Geld. Tausend Tonnen Draht.«
»Tausend Tonnen — — zwanzigtausend Zentner!«, staunten alle drei.
»Ja, Afrika ist groß und hat mindestens hundertfünfzig Millionen (1) schwarze Einwohner. Da käme auf jeden Neger nicht viel Draht. Da werden noch ganz andere Posten importiert.«
(1) Im Original heißt es ›hundertfünfzigtausend Millionen‹ — das wären 150 Milliarden! Eine schwarzafrikanische Bevölkerungszahl von 150 Millionen dürfte für die Zeit um 1900 realistisch gewesen sein.
»Was kostet eigentlich so ein Schiff?«, fragte diesmal Atalanta.
»Wenn Sie die Zahl der Registertonnen mit hundert Dollars oder vierhundert Mark multiplizieren, so bekommen Sie immer ein ungefähres Bild vom Werte eines Schiffes — eines Frachtdampfers! Mit Maschine und allem. Der ›Albatros‹ mit seinen fünftausend Tonnen ist denn auch mit zwei Millionen Mark versichert, und eine Überversicherung gibt es nicht im Seewesen. Das ist der gegenwärtige Wert dieses Schiffes.«
»Da ist auch die Fracht dabei?!«
»O nein! Die Fracht besteht allein schon aus zweitausend Tonnen Tabak, recht gutem Tabak! Die ganze Ladung ist mit anderthalb Millionen Dollar versichert. Das ist ganz unabhängig vom Schiffe.«
Später, als man aus dem belebten Wasser heraus war, führte der freundliche Kapitän seine drei Passagiere im ganzen Schiff herum, bis in den letzten Winkel.
Zuletzt schloss er, überall das elektrische Licht andrehend, ganz unten und ganz vorn eine schwere Tür auf.
»Das ist die berühmte Pulverkammer, die sogenannte!«, sagte er lächelnd.
Die enge Kammer, die auch von oben durch Luken erreicht werden konnte, enthielt nur eine sehr große Kiste, fast den ganzen Raum einnehmend, gezeichnet mit »New York 404«.
»Da ist Munition drin?«, fragte Arno.
»Nein. Das ist eine gewöhnliche Frachtkiste, nach Algier bestimmt. Wahrscheinlich ist ein Klavier oder ein Harmonium drin. Ich habe sie nur hier unterbringen lassen, weil sie hier am besten Platz hatte. Die paar Pfund Pulver, die wir für den kleinen Böller brauchen, falls doch einmal Notschüsse abzugeben sind, obgleich die Dampfsirene viel mehr Spektakel macht, darf ich in der Kajüte aufheben. Und dann noch einen Kasten Patronen für mein Gewehr und für sechs Revolver. Das ist vorschriftsmäßig. Und auch diese Pulverkammer ist noch heute vorschriftsmäßig, immer ganz vorn und ganz unten im Schiffe. Aber nicht mehr zur Aufnahme von Granaten und Pulverfässern bestimmt, sondern wenn als Fracht Explosivstoffe mitgenommen werden. Hier mündet das Rohr, durch das von der Kommandobrücke aus Wasser eingelassen werden kann.«
»Kanonen haben Sie nicht an Bord?«, fragte Atalanta mit Interesse.
»Nein. Kanonen gibt's heute nicht mehr auf Frachtdampfern.«
»Wenn Sie aber nun einmal angegriffen werden?«
»Angegriffen, von wem?«
»Meine Frau denkt an Seeräuber!«, lachte Arno. »Nein, Atalanta, die Zeiten der Seeräuber sind schon längst vorbei.«
»Nun, das ist nicht so ausgemacht!«, war der alte Kapitän anderer Meinung. »Das Segelschiff, das bei Windstille an einer einsamen Stelle einer chinesischen, malaiischen oder arabischen Küste liegt, kann sicher sein, von eingeborenen Piraten angegriffen zu werden. Daran hat sich im Laufe der Zeit nicht das Geringste geändert. Deshalb sind die nach jenen Gegenden gehenden Segelschiffe recht gut bewaffnet. Allerdings nicht mit Kanonen, aber mit Büchsen und Revolvern und Entersäbeln. Die Matrosen müssen manchmal Übungsmanöver machen.«
»Wenn aber nun in der Nähe solch einer Piratenküste die Maschine versagt, dann ist ein Dampfer doch in derselben Lage, sogar in einer noch viel schlimmeren, er hat nicht einmal zur Abwehr die nötigen Waffen.«
»O, wir haben noch ein viel besseres Mittel, um den gelben und braunen Halunken den Kopf heiß zu machen.«
»Welches?«
»Das heiße Kesselwasser. Ein Schlauch wird angeschraubt und losgespritzt. Da sollen Sie mal sehen und hören, wie die Kerls juchzen. Nur deshalb fällt es denen nicht ein, einen Dampfer anzugreifen. Aber ich habe es doch einmal erlebt. Ich fuhr auf einem großen Segler, der einen Donky an Bord hatte, eine Hilfsmaschine zum Treiben der Winde. Aber das wussten die doch nicht. Es waren Chinesen, bei Formosa kamen sie mit ihren Stinktöpfen angerudert. Wie die hopsten und juchzten, als wir mit der siedenden Bouillon losspritzten. Die haben nie wieder ein Segelschiff angegriffen. Jeder Segler sollte einen großen Kessel an Bord haben, in solchen Gegenden immer gefüllt und geheizt. Ich glaube, das machte die ganze Piratenwirtschaft bald unmöglich.«
Der Erzähler blickte längere Zeit nachdenklich vor sich hin.
»Und doch«, fuhr er dann fort, »warum soll denn ein regelrechter Seeraub nicht heute noch möglich sein? Das Meer ist groß und verschwiegen. Ich habe voriges Jahr, als der ›Albatros‹ im Dock lag, einen Segler von Bremen nach New York geführt. Als wir aus dem Kanal heraus waren, bin ich wegen des Westwindes acht Wochen zwischen Grönland und Spanien hin und her gekreuzt, immer durch die befahrensten Dampferlinien hindurch, und während sechs Wochen haben wir kein einziges Fahrzeug zu sehen bekommen! So groß ist das Meer!
Nun nehmen wir an, es findet sich eine Verbrechergesellschaft zusammen. Sie mustern auf einem Dampfer an, Kapitän und Offiziere gehören mit dazu, sonst werden sie eben beseitigt. Ein anderer Dampfer taucht in der einsamen Wasserwüste auf. Die Piraten signalisieren: ›Höchste Not, unser Schiff sinkt!‹ Sie gehen in die Boote. Sie werden doch ganz ahnungslos aufgenommen. Weshalb denn ein Misstrauen? Und sind sie drüben auf dem Dampfer, wird im Handumdrehen alles abgeschlachtet. Ich habe erst neulich mit Kollegen darüber gesprochen, dass so etwas noch heute recht wohl möglich ist.«
»Ja, wie wollen sie aber das Schiff verkaufen?«, fragte Littlelu.
»Das Schiff mit ganzer Fracht verkaufen? Nun, das ist heute allerdings ausgeschlossen. Aber der Bergelohn, der genügt. Sie schleppen das Schiff nach dem nächsten Hafen und bekommen ein Drittel vom Wert des Schiffes und der Ladung. Das wären hier beim ›Albatros‹ zum Beispiel zwei Millionen Mark. Jeder von der Bande wäre ein wohlhabender Mann. Und wenn sie nicht selber schwatzen, da kann nichts herauskommen.«
»Wohin ist dann aber die Besatzung des Dampfers verschwunden?«
»Das Schiff war ausgestorben — an Cholera, Pest oder sonst etwas, melden diese Halunken. Und die vorgefundenen Leichen müssen doch sofort versenkt werden. Wer soll das Gegenteil beweisen? Wer darf denn zweifeln? Ich habe selbst einmal ein ausgestorbenes Schiff geborgen. Nicht weit von Para ab sahen wir eine italienische Feluke ruderlos vor dem Winde treiben. Zehn Mann Besatzung und dreißig Passagiere. Was nicht tot war, lag im Sterben. Sie hatten Makrelen gefangen und gegessen, die sich in der Laichzeit befanden und dann manchmal sehr giftig sind. Das elende Schiff hatte nur Holz geladen, aber immerhin bekam der Kapitän 80 000 Mark, jeder Matrose, der ich damals noch war, 3500 Mark. Ohne dieses Geld wäre ich niemals zum Besuche der Steuermannsschule gekommen, ich war damals ein lustiger Bruder.«
Die Tage vergingen in Sonnenschein und in Regen. Drei Tage wütete ein Sturm, bei dem es in der traulichen Kajüte nur umso gemütlicher war, die kältere, salzgeschwängerte Luft erzeugte nur noch einen viel größeren Appetit, und als sich der Ausblick wieder klärte, waren hinter dem »Albatros« doch immer noch am Horizont zwei Mastspitzen zu erblicken, manchmal auch eine aufwirbelnde Rauchsäule.
Seit einer Woche, von New York an, war ein Dampfer dem »Albatros« treu gefolgt, aber immer in weitester Entfernung. Ein einziges Mal hatte man über dem Horizont seinen Rumpf auftauchen sehen, sonst waren am Tage nur die Mastspitzen zu erblicken, in der Nacht das weiße Licht der Toplaterne, und die auch nicht immer.
Während sich die drei Passagiere über diese treue, so halb und halb unsichtbare Begleitung wunderten, fand Kapitän Schönbart nicht das Geringste dabei.
»Das kann vorkommen. Warum nicht? Der Dampfer hat eine Stunde nach uns New York verlassen, steuert denselben Kurs, wenigstens auch nach der Meerenge von Gibraltar, macht dieselbe Fahrt wie wir, vierzehn Knoten in der Stunde. Es kann ja auch ein Grund vorhanden sein, dass der uns mit Absicht immer auf den Hacken sitzen bleibt. Jener Kapitän dort ist ein Schlauberger. Kapitän Schönbart dort vorn versteht direkten Kurs zu steuern — sagt er sich, bei aller meiner Bescheidenheit gesprochen — er braucht nur einmal am Tage die Sonnenhöhe zu berechnen, und wenn die nur ungefähr stimmt, dann ist alles im Lote, solange dort vorn der ›Albatros‹ dampft. Das macht mancher Kapitän, dass er sich einen kostenlosen Piloten sucht.«
»Warum kommt der Dampfer nicht näher?«, fragte Atalanta interessiert.
»Weil er nicht kann. Weil er wahrscheinlich schon alle Kraft anzustrengen hat, um nur in Sichtweite zu bleiben. Viel lieber möchte er in unserem Kielwasser folgen.«
»Halten Sie doch einmal an — lassen Sie stoppen, wie der Seemannsausdruck lautet.«
»Ja, wenn ich das dürfte!«, lachte Kapitän Schönbart.
»Weshalb dürfen Sie denn das nicht?«
»Wir Kapitäne sind nicht so unabhängig wie gewöhnlich geglaubt wird. Ja, auf der einen Seite besitzen wir die denkbar höchste Macht — den Matrosen oder Offizier, der nur einen Finger gegen mich erhebt, kann ich niederschießen, und ich werde vom Seegericht freigesprochen — auf der anderen Seite sind wir die ärgsten Sklaven — man möchte sagen Dividendensklaven.
Alles, was dieses Schiff betrifft, muss ich in das Logbuch eintragen, in das Schiffsjournal, auf das ich vereidigt bin. Gesetzt nun den Fall, ich stoppe jetzt eine Stunde oder lasse die Maschine auch nur eine Minute still stehen, so muss ich das eintragen und auch den Grund dazu angeben: weil ich wissen möchte, was das dort hinten für ein Dampfer ist. Eine andere Angabe kann ich als Ehrenmann doch nicht machen, und würde ich eines anderen Grundes überführt werden, würde man mich des Meineides anklagen.
Erreiche ich glücklich meinen Bestimmungshafen, so hat diese Stunde oder Minute, die ich meiner Neugier opferte, ja gar nichts zu sagen, dann natürlich kümmert sich niemand drum. Gesetzt aber nun den Fall, ich kollidiere in der Straße von Gibraltar mit einem anderen Dampfer, mein Schiff wird schwer beschädigt — dann wird mir klipp und klar bewiesen, dass dies nicht passiert wäre, wenn ich damals nicht die Minute gestoppt hätte. Denn da wäre ich doch eine Minute vorher vor dem Dampfer vorbeigegangen. Das stimmt ja auch — wenn es auch auf der anderen Seite Unsinn ist. Wir wissen nicht, wie das Verhängnis oder Schicksal arbeitet, wie die Pläne Gottes sind. Die Versicherungsgesellschaft aber philosophiert nicht über Verhängnis und Schicksal und Gott, die richtet sich nach meinem Logbuch. Ich würde ganz böse dabei hineinfallen. Nein, ohne einen triftigen Grund, den mir das Seegesetz oder mein Gewissen vorschreibt oder erlaubt, darf ich nicht eine Sekunde stoppen. Und solch ein Grund liegt wegen jenes Dampfers dort hinten nicht vor.«

Ganz entsetzt starrte der gefesselte Matrose nach dem Schiffe, auf
dem plötzlich eine Feuergarbe zum Himmel emporschoss. In zwei
Teile geborsten sank der Dampfer dann binnen weniger Sekunden.
Dieses Gespräch hatte am siebenten Tage der Reise während der Mittagstafel stattgefunden. Der »Albatros« näherte sich den Azoren, würde sie morgen um dieselbe Zeit nördlich passieren und befand sich dennoch in einer der einsamsten Gegenden des Atlantischen Ozeans. Denn die Azoren werden doch nur von wenigen Dampfern angelaufen, die anderen machen, wie noch mehr die Segelschiffe, einen großen Bogen um die gefährliche Inselgruppe.
Eben war der Nachtisch serviert worden, als sich Littlelu in dem Drehstuhl zurücklehnte, herzhaft gähnte, dabei die Hand zu spät vorhaltend. Er hatte sich vorher gebückt, um die Serviette aufzuheben.
»Ich glaube wirklich, ich werde alt, ich kann mich nicht mehr bücken, mir steigt mit einem Male das Blut so zu Ko...«
Die Augen fielen ihm zu, mitten im Worte war er eingeschlafen, fing an zu schnarchen, wie er gewöhnlich schnarchte, die Hände über dem Bäuchlein gefaltet.
Erstaunt blickte Kapitän Schönbart nach ihm, dann nach Arno.
»Ja, was in aller Welt ist denn das?!«
Auch der Graf war bereits in seinem Lehnstuhl eingeschlafen, wohl noch vor Littlelu.
Dann konnte nur noch Atalanta staunen — nämlich dass auch die mächtige Gestalt des Kapitäns schwer zurückgesunken war. Auch er war plötzlich eingeschlafen, auch er fing an zu schnarchen.
Und da lehnte sich auch Atalanta zurück, schlaff fiel ihre Hand herab, der Kopf neigte sich seitwärts — auch sie war eingeschlafen.
Einige Minuten vergingen. Nichts regte sich. Schwächer und schwächer ward das Zittern der Schiffsplanken, bis es ganz aufhörte. Die Maschine stand. Die tiefste Todesstille hätte geherrscht, wenn der Kapitän und Littlelu nicht so fürchterlich geschnarcht hätten.
Da ward die Tür aufgerissen, ein Matrose stürmte herein.
Es war Tom Snyder. Wir haben uns mit ihm an Bord nicht zu beschäftigen brauchen. Er war ein Matrose, nichts weiter.
»Herr Kapitän, an Bord schläft alles ein!«, schrie er jetzt.
Keine Antwort, keine Bewegung.
»Sind Sie denn auch eingeschlafen?«
Er ging hin, rüttelte den Kapitän kräftig, auch die anderen — ohne jeden Erfolg.
Da freilich huschte über die verwetterten Züge ein tückisches Lächeln.
Er eilte wieder hinaus.
Nach zwei Minuten kam er zurück.
»So. Das Signal ist aufgezogen. In einer Stunde kann der Seewolf hier sein. Nun will ich mir aber die Tätowierung doch erst einmal selber ansehen!«
Atalanta trug wieder solch ein Lederkostüm, aber ein neues, das sie sich hatte anfertigen lassen.
Mit schneller Hand begann der Matrose das Jagdhemd auf der Brust aufzuschnüren.
Er kam nicht weit.
Plötzlich erhielt er einen Schlag gegen die Schläfe, gar nicht so stark, der aber genügte, ihn sofort bewusstlos zu Boden zu werfen.
Nur wenige Sekunden währte die Ohnmacht, dann kam er wieder zu sich. Da aber war er schon an Händen und Füßen mit Lederriemen gebunden, neben ihm kniete die Indianerin, sie zog soeben die Schlinge um die Handgelenke noch fester zusammen.
Mit staunendem Entsetzen starrte er in das bronzefarbene Antlitz.
»Bist Du Teufelsweib denn nicht...«
»Still! Bist Du außer mir der einzige an Bord, der nicht schläft?«
Natürlich war der Mann nicht so leicht geneigt, Rede und Antwort zu stehen, er knirschte mit den Zähnen und riss an seinen Banden.
Atalanta zog einen Revolver und setzte die Mündung gegen seine Stirn.
»Sprich, oder es ist Dein Tod!«
»Von mir erfährst Du nichts!«, knirschte der Matrose.
»Nicht? Du fürchtest Dich nicht vor dem Tode? Gut, dass Du mir das gleich sagst.«
Sie nahm ihm die Mütze vom Kopfe. Er hatte halblanges Haar, zu kurz, um es sich um die Hand schlingen zu können. Atalanta konnte es eben so fassen, nicht nur mit den Fingerspitzen. Und sie tat es, mit der linken Hand hob sie den Mann langsam empor, dabei auf seine Fußgelenke tretend, dass er sich mit den Füßen nicht abstützen konnte.
»Hast Du noch Komplizen an Bord?«
Das Kopfhaar trägt den menschlichen Körper, aber niemand mag es versuchen. Chinesische Artisten, die sich an ihren Zöpfen aufhängen, sind eben nur Ausnahmen. Diesen Schmerz hält niemand aus. Dazu mag ja auch durch den Blutandrang im Gehirn eine Veränderung vor sich gehen. Jedenfalls dachte der Mann nicht mehr daran, eine falsche, irreführende Antwort zu geben, und hätte er auch sonst jede andere Folter ertragen.
Furchtbar brüllte er auf, als er so an den Haaren in die Höhe gezogen wurde.
Die Indianerin ließ ihn wieder herab.
»Hast Du noch Komplizen an Bord?«
Als noch einmal der Trotz zurückkehren wollte, brauchte sie nur die Hand nach seinen Haaren auszustrecken.
»Erbarmen! — Erbarmen! — Nur das nicht wieder, ich will alles tun, was Ihr von mir verlangt!«
»Dann antworte. Hast Du noch Komplizen an Bord?«
Zur Vorsicht krallte sie ihre Hand doch noch einmal in sein Haar ein und rückte nur etwas daran.
»Nein — nein... ich bin ganz allein!«, heulte der Mann.
»Wie heißt Du?«
»Tom Snyder.«
»Ist es Gift oder nur ein Schlaftrunk?«
»Nur ein Schlaftrunk!«, wimmerte der Matrose, immer wieder einen schmerzenden Zug am Kopfe fühlend.
»Wachen die Schlafenden wieder auf?«
»Ja — ja!«
»Wann?«
»Nach drei bis vier Tagen.«
»Wann hast Du uns diesen Schlaftrunk beigemischt?«
»Heute im Tee beim zweiten Frühstück.«
»Und das wirkt erst jetzt nach drei Stunden?«
»Ja — ja! O Gott, zieht doch nicht mehr, ich will ja alles gestehen!«
»Der ganzen Mannschaft?«
»Ja — ja!«
»Alles schläft?«
»Alles — alles!«
»Woher weißt Du das so genau? Du kannst doch nicht in der kurzen Zeit im Feuerraum und überall gewesen sein.«
»Die Maschine steht doch. Wer nicht schläft, käme doch gleich an Deck gestürzt!«
Da hatte er recht. Er brauchte nicht persönlich nachzusehen.
»Wer ist das, der Seewolf, der in einer Stunde hier sein kann?«, examinierte Atalanta weiter, den Liegenden wieder etwas an den Haaren emporhebend.
»Nicht ziehen, um Gottes Barmherzigkeit, nur nicht ziehen!«, jammerte dieser, obgleich der gar nicht danach aussah, als ob er sonst viel jammere. »Ich will ja alles gestehen — nur nicht ziehen! — Der Kapitän Wolf — Ned Wolf — wir nennen ihn nur den Seewolf!«
»Der dort hinten den Dampfer kommandiert?«
»Ja — ja!«
»Was ist das für ein Dampfer?«
»Die ›Undine‹.«
»Ein vorschriftsmäßiger Frachtdampfer?«
»Ja — ja!«
»Aber er geht wohl hauptsächlich auf Seeraub aus.«
Als nicht sofort eine Antwort erfolgte, brauchte der Mann nur etwas an den Haaren geliftet zu werden.
»Ja — nur nicht ziehen! — Ja, wir treiben Seeraub.«
»Wie macht Ihr das?«
»Wir vergiften die Mannschaft, beanspruchen den Bergelohn oder, damit dies nicht zu häufig vorkommt, dass es nicht auffällt, teilen den Raub mit richtigen Piraten, mit Chinesen und arabischen Riffpiraten.«
Das genügte der Indianerin vorläufig. Ein so ausführliches Geständnis hatte sie gar nicht verlangt. Und diese Seeräuberei interessierte sie auch gar nicht, sie hatte es jetzt nur mit diesem einen Falle zu tun.
Durch das hintere Kajütenfenster sah sie den Rumpf des treuen Dampfers eben erst über dem Horizonte auftauchen. Da hatte sie noch Zeit genug.
»Was weißt Du von meiner Tätowierung?«
»Gar nichts weiter — nur nicht ziehen!«, jammerte der Mann schon wieder.
Atalanta glaubte es ihm. Und sie wusste, dass man die Folter nicht übertreiben darf. Denn in seinen Qualen gibt der Mensch schließlich alles zu, auch was er gar nicht begangen hat.
»Aber jener Seewolf weiß darum.«
»Ich kann es nicht sagen!«
»Nur meiner Tätowierung wegen ist die ganze Mannschaft dieses Schiffes betäubt worden?«
»Ja — ja!«
»Ich wäre dem Seewolf ausgeliefert worden?«
»Ja — ja!«
»Und was hätte man mit den Betäubten getan? Na — wird's bald?«
»Über Bord hätte man sie geworfen!«, heulte der Mann nach einem kleinen Zuge.
»Ihr hättet sie vorher getötet?«
»Nein — nur ein Kohlensäckchen hätten wir ihnen an die Füße gebunden!«
Das genügte für diese Indianerin.
»Du hast ein Signal aufgezogen, dass der Dampfer kommen kann?«
»Ja — ja. Die gelbe und die rote Flagge.«
Atalanta brauchte sich nur etwas zu bücken, so sah sie durch das vordere Fenster der Kajüte, die ein Aufbau war, vorn am Maste die beiden Flaggen wehen.
»Das ist also eine Verbrechergesellschaft!«
»Ja — ja!«
»Besitzt sie noch mehr Schiffe?«
»Das weiß ich nicht!«
»Wer ist das Haupt dieser Verbrechergesellschaft?«
»Das weiß ich nicht!«
»Das musst Du doch wissen.«
»Wir nennen ihn den Meister, aber ich kenne ihn nicht, ich bin noch nicht so hoch, dass man mich in alles eingeweiht hat!«
»Kennst Du den Professor Dodd?«
»Den berühmten Operateur?«
Atalanta brauchte ihn nicht weiter zu fragen. Sie sah dem Manne sofort an den Augen an, dass er diesen Professor mit seiner Gesellschaft gar nicht in Beziehung brachte.
Vorläufig wusste Atalanta genug. Sie sah noch einmal die Fesseln nach, dann ließ sie den Mann liegen, wie er lag, ging in ihre Kabine und kam mit einer langläufigen Doppelbüchse zurück.
Es war ein auf 24 Schuss repetierendes Henry-Gewehr. In jedem Laufe ist eine Patrone, eine zweite liegt auf dem sogenannten Löffel, der das Laden selbst besorgt, zehn weitere Patronen liegen unter dem Lauf im Magazinrohr, hier also immer doppelt. Dasselbe Gewehr führt die deutsche Marine, aber einläufig und auf elf Schuss repetierend. Dieses hier war viel kleinkalibriger, daher mit voller Ladung nicht viel schwerer.
»Deine Genossen werden sofort an Bord kommen?«
Wenn der Gefesselte erst überlegen wollte, ob er Antwort geben solle oder nicht, so brauchte sie nur ihre Hand auszustrecken, und er fühlte schon wieder seine Haare wehtun, die Zunge war ihm gelöst.
»Ja, ganz sicher.«
»In einem Boote?«
»Das weiß ich nicht, da war nichts ausgemacht, das richtet sich nach dem Wetter und nach dem Seegang!«
»Bei dieser ganz ruhigen See wird der Dampfer gleich längsseit anlegen?«
»Jedenfalls!«
»Solltest Du erst noch irgend ein anderes Signal geben, dass auch wirklich alles in Ordnung ist?«
Bei dieser Frage griff ihm die Indianerin doch lieber einmal in die Haare und hob ihn etwas empor.
»Nicht ziehen — nicht ziehen! — Nein — nein — ich sollte kein anderes Signal geben — das genügt!«
»So sollst Du Zeuge werden, wie ich Deine Genossen empfange. Du sollst auch leben bleiben, damit, falls es mir gelingt, alle zu vernichten, wenigstens Du den anderen berichten kannst, wie ich solches Gesindel abfertige. Das ist für mich nur Spielerei.«
Sie sah sich weiter um, wie sie die Verteidigung dieses schlafenden Schiffes am zweckmäßigsten ins Werk setzen konnte.
Diese obere Kajüte war also ein Aufbau. Als Eingang hatte sie noch einen Vorbau. Dort hatte die Kajüte als Fenster richtige Bullaugen, durch die man eben den Kopf stecken kann, hier im Vorbau waren viele kleinere Fenster eingelassen, nur Gucklöcher. Sie brauchten nur geöffnet zu werden, und die Schießscharten waren fertig. Das Gewehr beherrschte von hier aus das ganze Schiff und beide Seiten, nur nach hinten zu hätte sie sich an die großen Bullaugen stellen müssen.
Mitten auf Deck lagen einige Matrosen und Heizer, neben ihnen lagen Kessel mit verschüttetem Essen. Sie hatten mittschiffs aus der Kombüse das Mittagessen geholt, mitten im Gehen waren sie, von plötzlicher Müdigkeit überwältigt, umgefallen. Es war natürlich eine ganz besondere Müdigkeit, eben die Wirkung eines narkotischen Betäubungsmittels, das aber erst nach gewisser Zeit wirkte, wahrscheinlich, wenn es durch die Saugfähigkeit eines Darmes wirklich ins Blut gelangte. Bei Flüssigkeiten ist das bei allen Menschen ganz gleich.

Schnell näherte sich der Dampfer. Es dauerte bei weitem keine Stunde, bis er dicht heran war. Offenbar wollte er direkt von hinten herauf steuern und sich sofort längsseit legen, wie es dann auch geschah.
Atalanta hatte sich in den sieben Tagen recht gut über alle Schiffsverhältnisse orientiert.
»Wie viel Knoten macht die ›Undine‹?«
»20 Knoten.«
»Ist das nicht auffallend für einen einfachen Frachtdampfer?«
»Er hat noch eine maskierte Maschine im Bauche!«, gestand der Matrose gleich offen.
»Wie ist das möglich?«
»Der große Kondenskessel ist nur eine Maske, er enthält eine kleine Dampfturbine, die aber genügt, die Fahrt um 5 Knoten zu vermehren.«
»Aha, eine Turbine — ich verstehe. Wie viel Mann Besatzung sind darauf?«
»40 Mann.«
»Das ist wohl normal für diesen Dampfer?«
»Ganz normal. 12 Matrosen, 12 Heizer und Kohlenzieher, Bootsmann und Zimmermann, Koch und Kochsmaat, zwei Stewards, zwei...«
»Schon gut, schon gut. Die gehören alle mit zu der Verbrechergesellschaft?«
»Gewiss.«
»Sind Passagiere auf dem Schiff?«
»Nein.«
Der Dampfer näherte sich langsam von hinten.
Wer glaubte, diese Indianerin könnte etwas vergessen, der irrte sich.
Während sie nach einem der hinteren Fenster ging, pfropfte sie dem Gefangenen ein Tuch in den Mund, nur im Vorbeigehen, aber dieser Knebel saß fest!
Der andere Dampfer legte glatt an, zwei dünne Taue genügten zum Festhalten, ein Dutzend Männer schwangen sich über die Bordwand, Matrosen und Offiziere, aber keiner von ihnen trug Uniform.
Die an Deck liegenden Gestalten, Tote oder Schläfer. hatten sie ja schon von Weitem gesehen, sie bestätigten das Flaggensignal.
»Tom — Tom Snyder, wo bist Du?!«
»Hei, der Kerl schnarcht ja nicht schlecht!«
»Die Kohlensäcke her!«
»Wo ist denn Tom Snyder?«
»Erst die Leichen weg!«
So und ähnlich tönte es durcheinander.
Dass Tom Snyder nicht zu sehen war, fiel nicht weiter auf. Der hielt jedenfalls schon weitere Umschau im Schiffe, musterte die Beute, von der ihm doch sicher ein größerer Teil zufiel. Die Hauptsache war jetzt, schnellstens die Besatzung des erbeuteten Schiffes zu beseitigen. Sobald über dem Horizonte noch ein anderes Schiff auftauchte, war das Gelingen des Ganzen in Frage gestellt.
Die Kohlensäckchen waren drüben schon fertig gewesen, sie wurden herüber geworfen und sofort begann man sie den Schlafenden an die Füße zu binden. Ein Steuermann teilte andere Leute ab, die sich unter Deck begeben sollten, die anderen Schläfer heraufzuholen.
Aber so weit, dass jemand außerhalb des Bereiches kam, durfte und sollte es nicht kommen.
Plötzlich ein Gewehrgeknatter, aus einem der runden Fensterlöcher zuckten unaufhörlich die Feuerstrahlen. Elf Mann waren es gewesen, die dieses Deck betreten, und neben den Schlafenden lagen elf Leichen, alle durch den Kopf geschossen, mit durchbohrtem Gehirn. Keiner hatte sich entfernen können.
Auch drüben auf der »Undine« standen noch genug Männer an Deck und auf der Kommandobrücke. Ob diese ihren Ohren und Augen wirklich trauten, war zweifelhaft.
Und wie die noch so erstarrt dastanden, öffnete sich die Kajütentür, ein braunes Mädchen im Lederkostüm mit kurzem Röckchen sprang heraus, das Gewehr schon im Anschlag.
»Ich bin es, die Ihr sucht, Atalanta, die letzte Mohawk!«
So rief sie mit durchdringender Stimme, dabei aber knatterte auch schon wieder ihr Gewehr, drüben stürzten die Männer zu Boden, an Deck und auf der Kommandobrücke.
Erst als die Überlebenden hinter Deckungen sprangen, verschwand auch sie schnell wieder in der Kajüte. Sie hatte sich nur einmal persönlich zeigen wollen, sie, um die es sich doch handelte.
Dann stand sie aber schon wieder vor einer Schießscharte, hatte unter den einen Lauf schon wieder ein gefülltes Magazin geschoben, und wo sich ein Kopf zeigte, nur eine Stirn auftauchte, da war sie sofort durchbohrt.
Drüben schrie und heulte es, dazwischen klingelte der Signalapparat.
Der Dampfer setzte sich wieder in Bewegung, die dünnen Taue rissen sofort, er fuhr an dem »Albatros« entlang und kam frei.
Auf der Kommandobrücke zeigte sich niemand mehr, und das Ruderhaus, in dem der steuernde Matrose steht, war geschlossen. Als aber hinter der Kombüsenwand noch einmal ein Kopf auftauchte, war er von der Indianerin Kugel sofort durchlöchert.
Dann war die »Undine« überhaupt außer Schussweite. Noch ein Stück war sie weiter gedampft, dann aber blieb sie wieder liegen.
Ruhig ging Atalanta hin zu ihrem Gefangenen, nahm ihm den Knebel aus dem Munde.
»21 Patronen habe ich verschossen — von jenen 40 Mann leben nur noch 19. Nun, Tom Snyder, was meinst Du dazu?«
Der konnte nur mit entsetzten Augen in das bronzene Gesicht starren.
»Weib, Du hast den Teufel im Leibe!«, ächzte er dann.
Dabei kannte er die furchtbare Tragik noch nicht einmal in ihrer ganzen Größe!
Atalanta blickte nach den Schlafenden in dieser Kajüte. Sie schlummerten sanft in ihren bequemen Lehnstühlen, Littlelu und der Kapitän schnarchten noch immer, während Arno im Traume glücklich vor sich hin lächelte.
Ach, es war wirklich humoristisch! Wenn man es von dieser Seite aus betrachtete.
Hier die friedlichen Schläfer — dort ein regelrechtes Seegefecht mit 21 Toten!
Der Dampfer »Undine« blieb in der Entfernung einer Seemeile ruhig liegen, Atalanta behielt ihn immer im Auge und hätte genau sehen können, wenn dort ein Boot abstieß.
»Was wird der Dampfer mit seinen übrig gebliebenen 19 Mann nun machen?«
Als nicht gleich eine Antwort kam und Atalanta auch einen hinterlistigen Blick bemerkte, brauchte sie den Mann nur etwas an den Haaren zu heben, und die Zunge ward sofort geläufig, das Auge auch gleich ganz anders.
»Nicht ziehen — um Gottes Barmherzigkeit — mich nicht heben! Ich kalkuliere, sie werden nach dem nächsten Hafen gehen, wahrscheinlich nach Lissabon, und den Dampfer schnellstens verkaufen.«
»Weshalb?«
»Weil die ganze Geschichte doch nun verraten ist.«
»Weil sich die ›Undine‹ unmöglich gemacht hat.«
»Ja.«
»Weil ich noch am Leben bin.«
»Ja. Und die anderen doch auch noch, die schlafen nur.«
»Sollten sie es nicht doch noch versuchen, sich unseres Schiffes zu bemächtigen?«
»Ich weiß es nicht.«
»Es liegt dort still.«
»Sie werden sich erst beraten.«
»Hat die ›Undine‹ Geschütze an Bord?«
Wieder funkelte es tückisch im Auge des Verbrechers, dieses Funkeln erlosch aber sofort, als Atalanta nur eine Handbewegung machte.
»Nur zwei kleine Revolverkanonen, die kann jeder Frachtdampfer führen, wegen eingeborener Strandpiraten, das fällt nicht auf.«
»Kann man mit solch einer Revolverkanone so einen eisernen Dampfer wie diesen in den Grund schießen?«
»Das wohl. Es wird nur etwas lange dauern.«
Die Stunden vergingen, und nichts änderte sich. Ruhig lag dort der Dampfer auf dem stillen Wasser, in solcher Entfernung wagten sich die übriggebliebenen Männer wieder hervor, sie blickten nach dem Teufelsschiffe, unternahmen aber nichts.
Unterdessen aber war Atalanta zur klaren Erkenntnis gekommen, was die dort beabsichtigten.
Ehe sie davongingen, um — höchstwahrscheinlich — ihr Schiff, das nun seine Maske hatte fallen lassen, zu verkaufen, wollten sie die Nacht abwarten, um noch einen letzten Versuch zu machen, sich der kostbaren Beute und mehr noch der geheimnisvollen Tätowierung zu bemächtigen. In der finsteren Nacht ließ sich ja alles ganz anders arrangieren. Da war auch eher Möglichkeit, das Schiff durch Schüsse mit den kleinen Revolvergranaten zu versenken, wenn es nun einmal sein musste. Auf solche Entfernung hin waren die kleinen Dinger ganz wirkungslos.
Die Hauptsache aber war, dass inzwischen kein anderer Dampfer, auch kein Segler auftauchte. Wenn der sich näherte und etwa gar nachsehen wollte, was hier los war, weil man doch die regungslosen Männer an Deck liegen sah, dann musste unter allen Umständen der schleunigste Rückzug angetreten werden. Ob das Schiff dann verkauft wurde oder nicht, das war ja dabei ganz gleichgültig.
So kalkulierte die Indianerin die Pläne der Feinde, und sicher war ihre Annahme keine falsche.
Sie ging hinaus, besichtigte die Toten, schleifte auch den Gefangenen an Deck, damit dieser sie sehe.
Jetzt erst befiel diesen das Entsetzen mit ganzer Macht, als er alle diese Kopfschüsse sah. Zuvor mochte er noch etwas daran gezweifelt haben.
»Kennst Du diese Männer?«, fragte die Indianerin. Ja, Tom Snyder wusste von allen den Namen, selbst ihren Rang kannte er. Der erste Steuermann, der Bootsmann und neun Matrosen waren es.
»Also der Seewolf ist nicht mit dabei?«
»Nein.«
Die Indianerin sagte kein »Schade«, sie hoffte nicht, dass dieser Piratenführer dann wenigstens drüben seinen Tod gefunden hatte.
Die Nacht brach an. Der Mond stand schon längst am Himmel, das erste Viertel, würde um elf wieder untergehen.
Regungslos hatte die Indianerin immer am Fenster verharrt, keinen Blick von dem Dampfer wendend. Jetzt hätte er schon die Seitenlichter und die Toplaterne brennen müssen, aber es geschah nicht. Nur der Mond sorgte für Beleuchtung.
Atalanta glaubte ganz bestimmt zu wissen, was die dort vorhatten. Nur zweierlei gab es. Entweder sie machten von mehreren Seiten einen Angriff in Booten oder sie kamen nochmals mit dem ganzen Dampfer heran, um die Revolverkanone zu gebrauchen oder um zu entern. Auf alle Fälle aber warteten sie dazu die Finsternis ab, den Untergang des Mondes.
»Und ich werde ihnen zuvorkommen.«
Das hatte die Indianerin einmal halblaut gesagt, als sie sich halb umdrehte. Den Dampfer ließ sie deswegen nicht aus dem Auge.
Friedlich schlummerten und schnarchten die drei, der gefesselte Matrose blickte mit blutunterlaufenen Augen wie ein verbissener Kettenhund nach seiner Meisterin.
»Was hat die ›Undine‹ geladen?«
»Gar nichts, sie hat nur Ballast im Bauche, Sand.«
»Wie groß ist der Dampfer?«
»4500 Tonnen.«
»Ist er ebenso gebaut und eingerichtet wie dieser?«
Das konnte auch ein Seemann nicht so ohne Weiteres beantworten.
»Ist die Pulverkammer auch ganz unten und ganz vorn?«
Der Matrose zuckte zusammen und hob gespannt den Kopf.
»Ihr denkt doch nicht etwa daran...«
Nur ein Griff nach seinen Haaren, und er dachte nur noch an die Antwort.
»Ja — ja! Nur nicht ziehen! Die ist überall so eingebaut, das ist so Vorschrift!«
Auf diese seine Wahrheitsliebe hatte ihn Atalanta, die das ja schon aus bester Quelle erfahren, nur einmal prüfen wollen.
»Und ich denke doch, dieses Piratenschiff ist besser mit Pulver und sonstigen Sprengmitteln versehen als der ›Albatros‹ hier.«
Bei diesen Worten hatte sie aber doch lieber einmal in seine Haare gegriffen, liftete ihn auch ein klein wenig.
»Erbarmen, mich nur nicht heben! Ganz sicher — — ganz sicher — ganz sicher!«
»Du weißt nicht bestimmt, ob die Pulverkammer mehr von dem enthält, wonach sie ihren Namen hat?«
»Ich war nicht drin, mir ist es nicht gesagt worden, aber ganz sicher enthält sie eine gute Portion Dynamit.«
»Dynamit?!«
»Der Seewolf arbeitet immer viel mit Dynamit, um zu beseitigen, was nicht mehr auf der Oberfläche des Meeres zu schwimmen braucht.«
»Wo ist der Eingang zur Pulverkammer?«
»Mittschiffs unter der Kommandobrücke, wie hier.«
»Wo hängt der Schlüssel?«
»In der Instrumentenkammer.«
»Wo ist diese?«
»Ebenfalls unter der Kommandobrücke, genau so wie hier. Das ist auf allen Schiffen gleich.«
Die Indianerin blickte nach den Schläfern. Doch nur für ihre Augen waren diese deutlich sichtbar. Das schwache Mondlicht genügte nicht, um durch die kleinen Fenster die Kajüte zu erhellen.
Dann ging sie einmal in ihre Kabine, kam wieder heraus und hatte ein Bündel unter dem Arme. Dann verließ sie die Kajüte. Das hatte der Matrose beobachten können, dazu langte das Licht noch.
Erst nach einer halben Stunde trat sie wieder ein und drehte sofort das elektrische Licht an.
»Tom Snyder, ich will Dir etwas zeigen und Dir dabei etwas erzählen.«
Als sie sich über ihn beugte, fiel ihm eine Strähne ihres Haares ins Gesicht. Das Haar war etwas feucht. Das war das einzige, woraus man schließen konnte, dass sie, wie sie dann erzählte, wirklich im Wasser gewesen war. Sonst war sie vollkommen trocken, sonst konnte man nur noch aus dem Seifengeruch erkennen, dass sie sich soeben gewaschen haben musste.
Sie packte ihn am Gürtel, hob den großen, schweren Mann mit einer Hand wie eine Puppe empor und trug ihn nach einem der runden Fenster. Dort stellte sie ihn so, dass er das im Mondschein daliegende Schiff sehen konnte.
»Ich war drüben, bin hingeschwommen. Auf der anderen Seite lag am herabgelassenen Fallreep ein Boot. Wohl befanden sich an Deck Wächter, aber sie sahen mich nicht, ich war ein schwarzer Schatten. In der Kajüte saßen sechzehn Männer und hielten eine Beratung ab. Durch das geöffnete Oberfenster sah und hörte ich sie. Sobald der Mond untergegangen ist, wollen sie in drei Booten von verschiedenen Seiten den ›Albatros‹ angreifen, ihn entern. Es müsste doch gelingen, des Teufelsweibes Herr zu werden, so oder so, und sollten auch noch ein Dutzend daran glauben müssen. Der Meister habe es befohlen, sie müssten dem Meister gehorchen.
Ich hatte genug gehört. Nun suchte ich in der Instrumentenkammer den Schlüssel und fand ihn, fand auch die Pulverkammer. Ja, da lagen Kisten mit Dynamit und auch Pulversäcke. Ich hatte eine Flasche Petroleum und ein Stearinlicht und anderes mitgenommen, was ich zur Ausführung meines Vorhabens brauchte. Rasch hatte ich das Petroleum ausgegossen und darauf den brennenden Lichtstumpf gesetzt, es hat — — da — da...«
Plötzlich schoss aus dem Deck des Dampfers eine mächtige Rauchwolke wie eine Fontäne empor, ein furchtbarer Knall, der Rauchwolke folgte eine Feuergarbe nach, und in zwei Teile geborsten sank der große Dampfer innerhalb weniger Sekunden; dort, wo er soeben noch gelegen hatte, rauschte nur noch das Wasser, bis es sich wieder beruhigt hatte.
Der Matrose fühlte, wie sich sein Haar vor Entsetzen sträubte. Dann hörte er wieder die tiefe, ruhige Stimme der Indianerin.
»Es ist geschehen. Du bist Zeuge geworden, wie sich Atalanta, die letzte Mohawk, ihrer Feinde entledigt. Und Du sollst als Zeuge leben bleiben. Damit Du dann Deinem Meister und Deinen sonstigen Genossen erzählen kannst, was sie zu erwarten haben, wenn sie noch einmal feindlich meine Wege kreuzen. Ganz frei sollst Du fernerhin an Bord dieses Schiffes sein. Erst aber möchte ich von Dir noch mehr erfahren.«
Sie setzte ihn auf seinen Stuhl, nahm ihn wieder ins Verhör, ihm ab und zu auch wieder ins Haar fassend. Aber ihn zu heben, das hatte sie nicht mehr nötig.
Wir wollen es nicht hören, was sie ihn fragte, was alles sie von ihm erfuhr. Eine Stunde währte das Verhör, und da kann gar viel gesprochen werden.
Sie wusste genug.
»Du bist frei. Was ich beabsichtige, weißt Du nun. Wir alle haben etwas genossen, was uns in plötzlichen Schlaf versetzte. Nur bei Dir und bei mir hat das Mittel nicht angeschlagen, oder wir beide haben davon zufällig nichts genossen. Tue, was Du sonst in diesem Falle tun würdest. Dass Du selbst nichts mehr gegen uns unternimmst, davor brauche ich Dich wohl nicht noch besonders zu warnen. Ich will nicht einmal wissen, was Du vielleicht in den Taschen hast, was für Waffen, ob Gift oder sonst so etwas. Du bist mir gegenüber ein harmloses Kind, das ich gar nicht beachte.«
Und dieser Nichtachtung gab sie erst noch einmal Ausdruck, oder sie zeigte ihm, wie er ihr gegenüber wirklich ein kleines Kind war.
Sie legte den Gefesselten wieder an den Boden, bückte sich, packte ihn am Gürtel, hob ihn mit steifem Arm empor, warf ihn in die Höhe, fing ihn am Gürtel wieder auf, und wiederholte das mehrmals, als wäre er eine Puppe, ein Bündel Wäsche.
Dann löste sie seine Fesseln, deutete nach der Tür — der Mann flüchtete hinaus.
Dass sie diesen Mann so ohne jede Vorsichtsmaßregel freiließ, das war mehr als Tollkühnheit, schier unbegreiflich.
Aber diese Indianerin wusste schon, was sie tat, wusste, dass er nichts mehr gegen sie oder das Schiff unternahm. Sie hatte ihn vollkommen gebrochen, und vielleicht gerade durch diese gänzliche Nichtachtung.
Noch in derselben Nacht trug sie die an Deck schlafenden Matrosen in ihre Kojen, band die Kohlensäckchen, die für diese Schläfer bestimmt gewesen waren, an die Füße der elf Leichen, versenkte sie im Meer, dann scheuerte sie von Deck die wenigen Blutspuren, welche die Kopfschüsse erzeugt hatten, hierauf ging sie durch das ganze Schiff, auch durch den Heiz- und Maschinenraum, den Schläfern, die bei ihrer Arbeit umgefallen waren, nur manchmal eine bequemere Lage gebend.
Um Tom Snyder kümmerte sie sich gar nicht. Er ließ sich nicht blicken. Aber sie wusste, wo er war. Er war wie ein bestraftes Kind ins Bett gekrochen, in seine Koje. Mochte er da nur über das Weitere nachdenken.
Kapitän Schönbart gähnte und räkelte sich, schlug die Augen auf, starrte auf den vor ihm stehenden Teller, der Brot, Butter und Käse enthielt, blickte nach den beiden anderen Schläfern, nach Atalanta, die ihn ruhig ansah.
»Ja, wie ist denn das gekommen, dass wir alle plötzlich eingeschlafen sind?!«
»Ich bin nicht eingeschlafen.«
»Sie nicht? Wie lange habe ich denn geschlafen?«
»Zwei Tage und zwei Nächte.«
Es dauerte lange, ehe es der Kapitän glauben wollte. Zuerst machte es ihm das Weißbrot glaubhaft, das steinhart geworden war, und die Butter ranzig. Aber richtig glauben tat er es erst, als er ein vorübersegelndes Schiff durch Flaggensignale um Angabe des Datums gebeten hatte, so selten es auch einmal an Bord passiert, dass man aus dem Kalender kommt.
Wir wollen das Folgende nicht zu schildern versuchen.
Ein Schläfer erwachte nach dem anderen. Die völlig erkalteten Kessel wurden wieder geheizt. Es wurde ja viel über dieses Rätsel gesprochen, unaufhörlich, aber gelöst wurde es nicht.
Und von der Indianerin erfuhren sie nichts, was unterdessen passiert war, auch von Tom Snyder nicht, den Atalanta übrigens noch nachträglich instruiert hatte, er solle lieber aussagen, auch er habe geschlafen, also konnte auch er nichts erzählen.
Und auch Arno und Littlelu bekamen von der Indianerin nichts zu erfahren. Das aber war vielleicht das Fürchterlichste bei der ganzen Sache.
An Deck dieses Schiffes ein mörderischer Kampf, der elf Menschen das Leben gekostet, dort einen ganzen Dampfer mit Mann und Maus versenkt, in die Luft gesprengt, jetzt geborsten auf dem Meeresgrunde ruhend — und von alledem kein Anzeichen, kein Gedanke daran, dass so etwas stattgefunden habe!
Ja, das war das Furchtbarste an der ganzen Sache!
Der »Albatros« setzte seine Fahrt fort. Kapitän Schönbart freilich hatte sich sehr verändert. Er war ganz kopfscheu geworden. Und das war begreiflich.
Nach vier Tagen wurde Algier erreicht. Gleich in der ersten Stunde wurde Tom Snyder vermisst. Er war desertiert, wie es Matrosen häufig tun.
Der von Algier kommende Küstendampfer legte am Kai von Port Said an.
Diese ägyptische Hafenstadt machte so gar keinen orientalischen Eindruck. Schnurgerade zog sich die Kaistraße hin, ein europäischer Palast am andern, meist Hotels, dazwischen Konsulate, die Büros der Schiffsagenturen und Handelshäuser, lauter Prachtgebäude im modernsten architektonischen Stile.
Wenn es lebendig ist am Hafen, dann freilich zeigt sich da das orientalische Gepräge. Aber jetzt war die zweite Mittagsstunde, furchtbar glühte die afrikanische Sonne zwischen den weißen Häusern, alles war wie ausgestorben. Diesen Küstendampfer unter englischer Flagge kannte man, er kam jede Woche einmal, man wusste, dass er erst am Abend zur bestimmten Stunde löschte und neue Fracht einnahm, die abzugebende Post wurde von einem besonderen Beamten besorgt — niemand kümmerte sich um ihn.
Nur drei Passagiere begaben sich ans Land, zwei Herren und eine Dame.
Da freilich änderte sich wie durch Zauberei die Szenerie. Aus dem schmalen Schattenstreifen einer Nebenstraße lösten sich Esel ab, die von zerlumpten Araberjungen durch Schläge und mehr noch durch Stiche mit einem spitzen Stocke zu einem allgemeinen Wettrennen veranlasst wurden; das Ziel waren die drei Fremden, die sich ohne Schutz eines Dragomans, eines Führers, an Land gewagt hatten.
Im Nu waren sie umringt. Da die drei doch ganz offenbar zusammengehörten, erfolgte das Angebot nur an den, der sich durch seine Größe und auch sein sonstiges Auftreten auszeichnete, das war doch jedenfalls der Ausschlaggebende der Gesellschaft, der zu bestimmen hatte, ob von dem Angebot Gebrauch gemacht werden sollte oder nicht, und das war Arno.
Dass sie einen echten Grafen vor sich hatten, wussten diese Eseljungen natürlich nicht, aber dass es ein Deutscher war, das erkannten sie auf den ersten Blick, und nun ging es los auf Deutsch:
»Mein Esel, Herr von Hochwürden, mein Esel gut Esel! — — Mein Esel noch guter Esel, Herr Baron, mein Esel Baronesel! — Mein Esel noch mehr guter Esel, Herr Graf, nickt mit die Kopf...«
So schrie es durcheinander, immer auf Deutsch. Mit Hochwürden fangen die Titulaturen des Fremden immer an, mit Durchlaucht und Majestät hören sie auf. Eins muss doch endlich ziehen.
Die beste Anpreisung seines Grauschimmels aber verstand ein kleiner Wicht.
»Mein Esel gutster Esel, Eierexzellenz, mein Esel Bismarckesel, Eierexzellenz, nickt mit die Kopf, nickt mit die Schwanz und pfeift die Wacht am Rhein.«
Das konnte nicht mehr übertroffen werden. Aber die Eierexzellenz nahm auch den pfeifenden Bismarckesel nicht, ging, eingedenk aller der Ratschläge, die er sich in letzter Zeit für das erste Betreten dieses Bodens hatte geben lassen, stumm und stolz geradeaus, ebenso folgten ihm die beiden anderen, und da ließ man von ihnen ab, und niemand hatte gewagt, auch nur ihre Kleider zu streifen.
Wehe aber dem unglücklichen Fremdling, der einer Gruppe von ägyptischen Eseljungen winkt! Der hat in der nächsten Minute keinen Fetzen mehr auf dem Leibe! Ehe man dazu kommt, mit dem Stocke drein und mit den Fäusten um sich zu schlagen, ist es schon zu spät.
Das Ziel der drei Reisenden war das nächste Hotel, wohin alsbald von Matrosen ihr Gepäck nachgebracht wurde.
Nachdem alle drei ein kühles Bad genommen hatten, ließen sie sich im Speisesaal an der Tafel nieder. Zwei Tage mussten sie in Port Said bleiben. Der nächste Dampfer nach Jaffa ging erst übermorgen, es gab gar keine andere Gelegenheit.
Nun, sie wollten sich schon die Zeit vertreiben.
Die neue Stadt bietet zwar nichts, nur die skandalösesten Tingeltangels, aber dahinter das alte arabische Hüttenviertel, das ist sehr interessant. Nur darf man es nicht des Abends allein betreten, sonst wird man ganz sicher ausgeplündert, wenn man überhaupt lebendig wieder herauskommt.
Dann sollte auch eine Fahrt auf dem Suez-Kanal unternommen werden.
So hatten die drei schon ausgemacht. Aber es sollte alles ganz anders kommen.
Sie hatten ihre Mahlzeit noch nicht ganz beendet, als den Speisesaal ein Araber betrat, den ein Neuling für einen Pascha halten musste, der nur einmal seine drei Rossschweife abgelegt hatte. So strotzte sein seidener Kaftan von Goldstickereien, und am goldenen Schuppengürtel trug er einen mächtigen krummen Säbel, dessen Scheide ebenfalls von Gold strotzte — und die mit flimmernden Edelsteinen in allen Farben übersät war. Ganz gewiss war das ein Pascha!
Doch der Kellner, mit dem er leise sprach, behandelte ihn ohne besondere Hochachtung, nahm ihm ein Briefchen ab, gab es ihm zurück und nickte nach dem Tisch, an dem die drei einzigen Gäste saßen.
Der sich diesem Tische nähernde Pascha, übrigens ein bildschöner junger Mann, hatte nämlich vorn auf der Brust zwei amerikanische Sternenbanner eingestickt. Es war der Dragoman vom Konsulate der Vereinigten Staaten, ein Diener, ein Laufbote. Die europäischen und amerikanischen Konsuln müssen im Orient großen Aufwand treiben, ganz besonders mit ihren Dienern, sonst werden sie nicht für voll angesehen. Doch es ist ja nicht alles Gold und Edelstein, was glänzt und funkelt. Ihre Diener dürfen auch — eine große Ehrung — Waffen tragen, Säbel und Pistolen, so viel sie wollen.
»Monsieur le Comte Arno de Felsmark«, sagte der Araber mit tadelloser Aussprache.
Arno nahm den Brief; er erbrach das Konsulatssiegel der Vereinigten Staaten und las:
Hochgeehrter Herr Graf! Soeben erfahre ich, dass der Champion-Gentleman
von New York mit Frau Gemahlin in Port Said weilt. Bitte, geben Sie mir die
Ehre, während Ihres Aufenthaltes hier mein Haus als das Ihrige zu betrachten.
Mit devotester Hochachtung unterzeichnet von Muley ben Hassan, Konsul
der Vereinigten Staaten von Nordamerika.
Diese Einladung konnte gar nicht abgeschlagen werden.
»Schade, dass wir schon unsere Zimmer fest bestellt haben.«
Der Oberkellner näherte sich.
»Der Herr Konsul hat mich soeben telefonisch instruiert. Die Herrschaften nehmen die Einladung an? Dann sind die Zimmer schon wieder abbestellt. Nein, es ist nichts zu begleichen, die Herrschaften sind auch hier die Gäste des Herrn Konsuls.«
Während der Dragoman die Besorgung des Gepäcks übernahm, fragte Arno den Oberkellner in angemessener Weise, wer dieser amerikanische Konsul mit dem arabischen oder türkischen Namen sei, was wohl erlaubt war.
Der reichste Kaufmann in Port Said, wenn in ganz Ägypten. Import und Export, Transithandel zwischen Amerika und Asien. Ein echter Araber, aber ein ebenso echter Bürger der Vereinigten Staaten. Warum nicht. Die Generalkonsulate sind ja in Kairo, aber viel wichtiger ist der Konsul in Alexandrien, am wichtigsten aber der in Port Said, wo es wegen des Suezkanals oft zu internationalen Streitigkeiten auf kaufmännischem Gebiete kommt. Die Vereinigten Staaten aber wissen ganz genau, dass sie dort eine ganz besonders raffinierte Persönlichkeit als Vertreter ihrer Handelsinteressen haben müssen.
»Natürlich trenne ich mich nicht von meinem Freunde, diesem Herrn hier!«, sagte Arno zu dem Oberkellner, der ja manchmal die Rolle eines vertraulichen Ministers spielen muss.
»Herr Graf, und wenn Sie hundert Freunde und Diener bei sich hätten, keinen dürften Sie zurücklassen. Bei Muley ben Hassan herrscht mohammedanische Gastfreundschaft, er ist ein vorzüglicher Mensch, und sein Palais ist groß genug, um mehr als hundert Gäste aufzunehmen. Ich glaube übrigens, er beherbergt jetzt auch eine kleine Beduinenkarawane.«
»Er ist Mohammedaner?«
»Ein ganz strenggläubiger. Wenn er auch Bier trinkt. Das hat ja der Prophet zu verbieten vergessen. Als christlicher Gast bemerkt man aber in seinem Hause nichts von mohammedanischem Zwang.«
Als die drei Freunde fünf Minuten später vom Tisch aufstanden, wartete ihrer schon eine Equipage, mit Rossen bespannt, wie solche Arno als Kutschpferde noch nicht gesehen hatte.
Die Fahrt währte keine Minute, der Wagen bog nur in die zweite Seitenstraße ein, eine schöne Allee, und hielt vor einer großen, prächtigen Villa, die im Vordergrunde eines parkähnlichen Gartens lag, welcher wie alle andern auf dieser sandigen Landzunge mit enormen Kosten angelegt worden war.
Der Treppenaufgang war so europäischmodern wie der luxuriöse Salon, in dem sie von dem Hausherrn empfangen wurden, einem würdevollen, älteren, glatzköpfigen Manne, der sich nur dadurch als Orientale verriet, dass er, sobald er sich setzte, die Füße mit auf den Stuhl hochzog.
Der persönliche Empfang war dem Einladungsschreiben entsprechend. Der arabischamerikanische Konsul legte das stärkste Gewicht auf den Titel »Champion-Gentleman von New York.« Er wusste, dass der Graf schon einmal begraben gewesen war, dass seine Gattin eine indianische Artistin war, aber keine Frage deshalb — sie war für ihn nur die Frau Gräfin von Felsmark.
»Sie wollen übermorgen nach Jaffa? Das ist schlecht! Da müssen Sie den ›Diomedes‹ von der Ottomanischen Linie benutzen. Dieser Dampfer ist wenig zu empfehlen. Alle besseren Kabinen liegen um den Schornstein, die anderen kommen für Sie nicht in Betracht. Der nächste Dampfer ist der ›Achilles‹, der ist ausgezeichnet, geht aber erst in sechs Tagen.«
»Das ist doch etwas sehr lange für uns.«
»Sie wollen doch nach Jerusalem, wenn ich fragen darf?«
»Das würden wir nur unterwegs besichtigen. Unser Ziel ist der Antilibanon.«
Der Araber machte ein überraschtes Gesicht.
»Welchen Teil des Antilibanons wollen Sie besuchen? Bitte, es ist nur Ihr eigenes Interesse, wenn ich danach frage.«
Arno hatte keine Ursache, das direkte Ziel zu verheimlichen.
»Wir wollen dem berühmten Pisgaberge einen Besuch abstatten.«
Das Gesicht des amerikanischen Konsuls drückte eine immer größere Überraschung aus.
»Im Nebugebirge, wo sich das Grab Mosis befinden soll?«
»Jawohl, diesen Pisgaberg, von dem aus Moses das gelobte Land sah, ehe er starb.«
»Ach, das ist ja wirklich ein ganz merkwürdiger Zufall! Da hätten Sie Gelegenheit, in kürzester Zeit hinzukommen, schneller als mit dem schnellsten Dampfer. Hören Sie nur! Bei mir befinden sich gerade Beduinen zu Gaste, meine wirklichen mir heiligen Freunde vom Stamme der Busetos, zu deren Gebiet das ganze Nebugebirge gehört. Der Scheich Mustafa selbst ist hier. Er hat seinem Neffen Achmed, seinem Nachfolger — Mustafa selbst ist kinderlos — bei dem blutbefreundeten Stamme der Beni Suefs in der Wüste Ammon eine Gattin gefreit. Sie brechen morgen früh auf, und sie haben vier Hedjins leer mitgehen — — ach...«
Der alte Herr unterbrach sich und schlenkerte wie ärgerlich lachend über sich selbst die Hand.
»Ach, ich dachte, ich wäre noch jung und sah mich wieder auf dem Kamel von Kairo nach Timbuktu reiten und zurück.«
Man verstand ihn nicht, Arno wenigstens nicht.
»Wie meinen der Herr Konsul?«
»Ich brauchte nur das Wort Hedjin auszusprechen, so sah ich die Unmöglichkeit ein, dass Sie diese Gelegenheit benutzen können.«
Das war schade! Arno hatte sich schon darauf gefreut, hatte sich schon hoch zu Kamel durch die Wüste reiten sehen, in Gesellschaft echter Wüstensöhne.
»Die Beduinen nehmen uns nicht mit?«
»O, das täten sie herzlich gern, aber... sind Sie schon auf einem Kamel geritten?«
»Das allerdings noch nicht, und ich weiß, dass es gelernt sein will, ich habe schon von dem Schaukeln gehört, von dem man seekrank wird, aber wir alle sind... professionelle Reiter, möchte ich sagen, allerdings nur Pferdereiter...«
»O, das wäre das Wenigste, das Kamelreiten kann jeder in einer Stunde lernen. Nein, diese Busetos haben für diese Hochzeitsreise ausschließlich Hedjins benutzt, sogar Aascharis, das ist die Sache.«
»Was ist das, ein Hedjin?«
»Ein Rennkamel. Nicht nur ein besonderes Reitkamel, sondern... eben ein Hedjin. Es entspricht dem englischen Vollblutpferde — oder noch richtiger einem arabischen Rosse, dessen Ahne eine der fünf Stuten des Propheten gewesen ist. Ja, es sind sogar lauter Aascharis, wörtlich ›Zehner‹. Nämlich weil sie an einem Tage auf den Poststraßen zehn Stationen durchlaufen können und müssen, sonst verlieren sie diesen Ehrentitel, und eine Station liegt von der andern dritthalbe geografische Meile entfernt, das sind täglich 25 Meilen.«
»Täglich 25 geografische Meilen!«, staunte Arno. »Schier unglaublich!« (*)
(*) Alfred Brehm berichtet in seinem ›Tierleben‹ über diese Schnelligkeit und Ausdauer
»Tatsache. Und das vier Tage lang ohne Wasser, zwei Tage ohne Futter. Nun sind es von hier aus, oder vielmehr von Kantara am Suezkanal, woder Rennkamele ausführlich und erzählt viele Beispiele. die Hedjin erst richtig gefüttert und getränkt werden, bis nach den Nebubergen, wo die Busetos jetzt lagern, genau 50 geografische Meilen. Diese macht eine Handelskarawane in zehn Tagen mit dreimaligem Tränken; ein gutes Reitkamel, schon ein Hedjin, wenn auch noch kein spezieller Renner, legt sie mit zweimaligem Trinken in sechs Tagen zurück; ein Aaschari aber braucht dazu nur zwei Tage mit einmaliger Nachtruhe von 10 Stunden, ohne Wasser und Futter. Und diese Busetos haben für diese Reise nur Aascharis mitgenommen. Es geht gegen die Beduinenehre, zu diesen 50 Meilen mehr als zweimal vierundzwanzig Stunden zu gebrauchen. Oder es handelt sich vielmehr um die Ehre der Tiere, besonders auch um ihren pekuniären Wert. Ein Aaschari, das dies nicht aushält, rangiert sofort zum gewöhnlichen Hedjin herab, verliert gleich um hundert Ochsen, um 10 000 Franken und viel mehr, und das muss im Stammbaum verzeichnet werden. Auch die Kinder sind entwertet.«
Mit großem Interesse hatten die drei das angehört. Nur eines verstanden sie nicht.
»Ja, was ist aber der Grund, dass wir da nicht mitreiten können?«, fragte Arno.
»Sie müssten mitmachen, die 50 Meilen in zweimal 14 Stunden auf dem Kamelrücken.«
»Ja, warum denn nicht?«
»Oooh, wo denken Sie hin!«, lächelte der Konsul. »Das hält kein Franke aus, auch kein Araber wie ich, und ich war ein gar ausdauernder Kamelreiter. Dazu muss man ein geborener Beduine sein, und auch noch ein gelernter Hedjan und sogar Aascharan, wie die heißen, die solche Tiere reiten können, das heißt auszunutzen verstehen.«
»Oooh!«, machte jetzt aber auch Arno. »Zweifeln Sie, dass wir das nicht aushalten können?«
»Herr Graf, ich weiß ja, dass Sie ein ausgezeichneter Reiter sind, Sie waren doch nicht umsonst Reitlehrer, aber... hierzu gehört eine ganz besondere Ausdauer.«
»Nichts weiter als Ausdauer?«
»Nichts weiter. Nur zweimal 14 Stunden sich auf dem Höcker des im Passe trabenden Kamels festklammern, früh, mittags und abends ein Tässchen Kaffee, sonst wird im Sattel gegessen, Datteln und Zwieback, nichts weiter.«
»Und Sie meinen, das können wir nicht aushalten?«, lächelte Arno wieder.
»Nein, Herr Graf, ich zweifle durchaus nicht an Ihrer Ausdauer, aber... das ist rein unmöglich, wenn Sie nicht von Kindesbeinen an daran gewöhnt sind, und es gehört überhaupt eine Beduinennatur dazu.«
»Kommt denn«, nahm da Atalanta zum ersten Male das Wort, »auch die Braut mit?«
»Die Frau — die Trauung ist bereits vollzogen, wenn auch ohne Beisein des Gatten — gewiss, Fatme reitet mit.«
»Diese Frau also hält es aus, und wir sollen es nicht können?«
»O, das ist erstens eine Beduinin, an glühende Wüstenritte von Wochenlänge gewöhnt, und zweitens die erste Tochter eines Scheichs, dazu bestimmt, einen neuen Stamm zu gründen, den der Beni Fatmes, denn der der Beni Suefs muss sich spalten, er wird zu groß — danach ist sie von Jugend an erzogen, ist zur Aascharan ausgebildet. Die kann drei Aascharis hintereinander totreiten.«
»Herr Konsul, wissen Sie, dass ich eine Vollblutindianerin bin, eine Mohawk?«
»Ja, Frau Gräfin, ich weiß es, aber es handelt sich nicht allein um Reitkunst, sondern um...«
»Genug, ich bin eine Mohawk!«, wurde er stolz unterbrochen.
Gerade hier im Salon konnte die Frau Gräfin recht die Indianerin herauskehren.
»Werden die Beduinen uns mitnehmen?«, fragte Arno wieder.
»Herzlich gern. Ja, gerade deswegen, weil — weil — — — es ist mir unangenehm, es auszusprechen, gerade mir als Araber...«
»Bitte, sprechen Sie doch.«
»Die Beduinen werden ihre Tiere umso weniger schonen, weil — weil...«
»In der Hoffnung, uns Franken demütigen zu können.«
»So ist es!«, wurde zugegeben.
»Gesetzt nun den Fall, wir bereiteten ihnen die Freude, um Erbarmen zu bitten, dass sie nicht mehr so eilten oder gar eine längere Rast machten?«
»Es würde Ihnen sofort gewährt werden. Eben zur größten Freude der Beduinen. Der Scheich müsste mit der Frau den Weg allerdings fortsetzen. Aber einige Mann würden bei den Erschöpften zurückbleiben. Die Ehre der Tiere würde dadurch auch nicht geschädigt, solche Zwischenfälle können vorkommen.«
»Herr Konsul, wollen Sie die Beduinen bitten, dass sie uns mitnehmen.«
»Herzlich gern werden sie es tun!«, lachte dieser.
»Ich möchte Ihren Stammesbrüdern aus der Wüste doch eine bessere Meinung von einem deutschen Dragoneroffizier beibringen, für meine Frau kann ich garantieren und... ach so, Littlelu — Mister Maxim — wie ist es denn aber mit Ihnen?«
Littlelu, der bisher nur wenig oder gar nichts gesagt hatte, richtete sich stolz auf seinem Stuhle empor und steckte die Hand in den Westenausschnitt.
»Herr Konsul, können Ihre Beduinen pufferreiten?«
»Pufferreiten? Was ist denn das?«, lächelte der Araber verwundert.
»Herr Konsul, Sie haben die Ehre, den berühmtesten Pufferreiter der Welt vor sich zu sehen. Ich habe im Pufferreiten einen noch ungebrochenen Rekord aufgestellt. Ich bin quer durch ganz Nordamerika, von New York bis nach San Francisco, auf dem Puffer geritten, hinten am letzten Wagen. Und zwar ganz freiwillig. Nur weil ich in New York ein Engagement nach Frisco bekommen und keinen roten Cent in der Tasche hatte. Herr Konsul, ich werde Ihren Wüstenbeduinen einmal zeigen, was so ein Pacific-Pufferreiter auf dem Trampeltier leisten kann. Ich sage Ihnen — sie werden den Turban vor mir ziehen.«
»Na, dann ist ja alles gut!«, lachte der Araber. »Also morgen früh in der achten Stunde wird aufgebrochen. Erst geht es nach Kantara, das ist die Karawanenstation am Suez-Kanal mit der Fähre, vierzig Kilometer von hier. Dort werden die Kamele erst richtig gefüttert und getränkt. Die edlen Hedjins wollen hier im Stalle und überhaupt in der Stadt nicht ordentlich fressen. Dann gönnt man ihnen noch drei Stunden Ruhe, hierauf werden sie noch einmal getränkt, und dann geht der Parforceritt los. In drei Tagen, zu derselben Stunde, da von hier der Dampfer abgeht, den Sie nach Jaffa benutzen wollten, sind Sie schon am Pisgaberge!
Nun, Sie wollen wohl erst etwas Siesta halten. Dann führe ich Sie den Beduinen zu. Sie bleiben doch heute Abend hier. Wir verbringen zusammen einen gemütlichen Abend — mit den Beduinen. Da lernen Sie gleich deren Sitten etwas kennen. Es wird Sie sehr interessieren. Ich habe die Ehre.«
Arabische Diener nahmen die drei in Empfang, führten sie in ihre prachtvollen Schlafzimmer, die immer durch einen kleinen, gemeinschaftlich zu benutzenden Salon von einander getrennt waren, und dann stand noch ein größerer zu ihrer Verfügung.
Es war gegen fünf Uhr, die drei Freunde hatten sich schon bemerkbar gemacht, dass sie wieder auf seien, als der Hausherr durch einen Diener anfragen ließ, ob er seinen Gästen in diesem größeren Salon seine Aufwartung machen dürfe.
»Scheich Mustafa und seine Leute freuen sich ungemein auf Ihre Begleitung, freuen sich besonders auch, eine echte Indianerin kennen zu lernen. Das, Frau Gräfin, habe ich ihnen natürlich sagen müssen.
Vier von ihnen, inklusive der jungen Frau, sitzen bereits am Tisch und erwarten Sie, mehr werden es auch nicht, die anderen drei haben eine andere Einladung erhalten.
Nun verzeihen Sie mir, wenn ich Sie erst etwas in die Zeremonien einweihe.
Man macht sich im Auslande von diesen Beduinen gewöhnlich einen ganz falschen Begriff. Das sind keine halbwilden Nomaden, wenn sie auch ein Nomadenleben in unbeschränkter Freiheit führen. Besonders die Scheichs sind durchweg hochgebildete Männer, haben hohe Schulen, meist auch die Universität besucht. Erst dann kehren sie wieder in die Wüste zurück. Die jüngeren Söhne der Scheichs bleiben gewöhnlich in der Stadt, treiben die Wissenschaft weiter, studieren Medizin, Philosophie, Dichtkunst und mit Vorliebe Mathematik.
So ist auch Scheich Mustafa ein hervorragender Mathematiker. Und dennoch ist er ein echter Ritter der Wüste, jede Bequemlichkeit verachtend. Er gebietet über 400 Lanzen, das heißt kriegsfähige Männer, und das ist für europäische Begriffe lächerlich wenig. Aber solch ein Scheich, und gebietet er auch nur über ein Dutzend Lanzen, dünkt sich selbstherrlicher als jede europäische Majestät. Und nicht mit Unrecht. Denn sein tadelloser Stammbaum geht weit über tausend Jahre zurück, und kein anderer Fürst ist so selbstherrlich, so frei, so unabhängig wie solch ein Wüstenscheich. Die Herrschaft der Türkei steht nur auf dem Papiere. Der Sultan ist nur der Papst, der Stellvertreter des Propheten, nichts weiter, und auch das noch nicht einmal.
Diese Busetos kommen soeben von Kairo; sie waren Gäste des Khediven, des Königs von Ägypten. Scheich Mustafa rangierte dicht hinter den königlichen Prinzen, kraft seines Stammbaumes. Und Fatme, die er seinem Neffen gefreit, saß sogar neben dem König. Denn sie ist die Schwester der Königin...«
»Alle Wetter«, musste Littlelu staunend unterbrechen, »kommen wir denn mit lauter japanischen Prinzen und arabischen Prinzessinnen zusammen?«
»Nein, geehrter Herr«, lächelte der Konsul, »sie ist keine Prinzessin. Sie ist die Tochter eines ganz einfachen Wüstenscheichs, der jeden Morgen seine Ziegen selbst melkt, und dennoch ist seine zweite Tochter die Königin von Ägypten geworden. Das ist eben Wüstenadel. Und seine erste Tochter, die Fatme hier, übrigens nur ein Jahr älter und noch viel hübscher, hat in Kairo ein französisches Pensionat besucht. Dann ist sie wieder eine echte Wüstentochter geworden, hat wieder die Ziegen gemolken und die Pferde getränkt, Kamelhaare gewebt und Brotfladen zwischen heißen Steinen gebacken.
Ich teile Ihnen das gleich jetzt mit, weil nämlich keine Vorstellung stattfindet und dann über so etwas doch auch nicht gesprochen wird. Und das ist es eben, worauf ich Sie aufmerksam machen möchte. Es herrscht absolut kein Zwang. Jeder isst und trinkt, was ihm beliebt. Trinken die Herren Wein?«
»O, bitte, keine Umstände...«
»Sie können alles haben!«
»Was trinken Sie, Herr Konsul?«
»Ich trinke Bier, echtes Münchner, das hat der Prophet zu verbieten vergessen!«, war die lächelnde Antwort.
»O, das trinken wir auch!«, riefen Arno und Littlelu wie aus einem Munde freudig aus.
»Und die Frau Gräfin?«
»Ich trinke eigentlich nur Wasser — oder Limonade.«
»Das passt vortrefflich. Auch die Beduinen trinken Limonade. Die sind darin rechtgläubiger als ich. Also nur immer zugreifen! Die Sache ist nämlich die, dass nur aus einem einzigen Glase getrunken wird. Das geht nicht anders. Aber nur kein Genieren, nur immer schnell nach dem vollen Glase greifen...«
»Das Münchner Bier und die Limonade aus ein und demselben Glase?«, musste erst einmal Littlelu mit seinem dümmsten Gesicht fragen.
»Nein, so war das nicht gemeint!«, lachte der Konsul. »Jedes Getränk hat sein eigenes Glas. Aber nur schnell ohne Zögern immer zugreifen, wer zu spät kommt, kriegt nichts.
Nun aber die Unterhaltung. Deshalb muss ich um Entschuldigung bitten. Wir dürfen nicht eher sprechen, als bis der Scheich das Wort genommen hat. Es ist beim besten Willen nicht anders möglich...«
»Aber selbstverständlich, das wird befolgt!«, sagte Arno.
»Dann ist es nur noch wegen der anwesenden Beduinin. Die junge Frau darf überhaupt kein Wort sprechen. Dafür hat sie ein besonderes Recht. Sie allein darf, wenn sie will, die anderen Gäste bedienen. Ihnen auch sonst Aufmerksamkeiten erweisen. Es ist nun sehr leicht möglich, dass sie besonders Ihnen, Herr Graf, solche erweist. Nicht wahr, Frau Gräfin, da gibt es doch keine Eifersucht?«
Atalanta hob einfach die Achseln, es sah etwas verächtlich aus. Der Konsul hatte es ja nur scherzhaft gefragt.
»Es ist ja auch nichts weiter als arabische Höflichkeit, nur der sonst zum Schweigen verurteilten Frau gestattet. Weiter hat sie nichts von der Gesellschaft. Und dann kann sie auch Geschenke verteilen. Diese Geschenke müssen unbedingt angenommen werden, und zwar ohne jeden Dank, ohne das geringste Kopfneigen, ohne einen dankenden oder gar erstaunten Blick — als etwas ganz Selbstverständliches...«
»O, sie soll mir nur immer schenken«, ließ sich Littlelu vernehmen, »recht wertvolle Preziosen, ich will alles schon als selbstverständlich annehmen.«
»Nun, dann ist alles in Ordnung. Darf ich die Herrschaften bitten, mir zu folgen?«
»Schon jetzt?!«
»Nun ja, die Beduinen erwarten Sie bereits.«
»Wir sind ja gar nicht angezogen?«
Das heißt, sie hatten ihre bequemen Sportkostüme angelegt, die für diese Reise erst angeschafft worden und für die größten Strapazen berechnet waren. Sie hatten geglaubt, sich noch einige Zeit ungezwungen bewegen zu können, ehe sie wieder die modernen Straßenkleider anlegen mussten, in denen sie das Hotel verlassen hatten.
»Ja, meine Herrschaften, sind das nicht die Kostüme, die Sie während des Rittes tragen werden? Bitte, nur ja keinen Zwang! Die Beduinen sind doch auch so, wie sie morgen reiten werden. Und dann mache ich Sie noch darauf aufmerksam, dass Sie sich auch mit gekreuzten Beinen an den Tisch setzen müssen. Das ist bei diesem Tische nämlich auch gar nicht anders möglich. Sie werden es gleich sehen.«
Wenn es so war, dann konnte man gleich folgen.
Diesmal war es ein orientalisch eingerichtetes Zimmer, in das sie geführt wurden. Auf dem kostbaren Teppich, in den man wie in einen schwellenden Rasen versank, lagen sehr viele Kissen, sonst gab es an den Wänden nur noch ganz niedrige Polster. Ganz niedrig war auch der in der Mitte stehende, sonst sehr große, runde Tisch, über dem eine rote Ampel brannte, denn obgleich es draußen noch ganz hell war, hatte man die Fenster schon mit Teppichen verhangen. Dabei aber herrschte hier eine ausgezeichnete Ventilation mit kühler Luftzufuhr.
An dem niedrigen Rundtisch hockten auf Kissen vier arabische Gestalten in weißen Burnussen. Die braunen Gesichter der drei Männer hatten jene Adlernasen und edlen Züge, wie man sie bei den Beduinen durchweg findet. Zwei von ihnen trugen dunkle Vollbärte, der des dritten spielte schon ins Graue.
Die vierte Gestalt war ein Weib, nur durch das verschleierte Gesicht als solches erkenntlich. Aber es trug nicht wie die Türkinnen und die arabischen Stadtbewohnerinnen die Gille, die goldene oder vergoldete Nasenschiene, an die der Schleier befestigt wird, sodass nur der untere Teil des Gesichts verhüllt ist, sondern vom Kopf herab fiel ein dichtes, weißes Tuch, in dem sich nur Augenlöcher befanden.
Dieser Unterschied der Verschleierung zwischen den Beduinenweibern und den anderen Araberinnen ist sehr bemerkenswert. Da auch die männlichen Beduinen sehr oft ihr Gesicht verhüllen, so sind die Frauen von den Männern oft gar nicht zu unterscheiden, am wenigsten im Sattel. Alle anderen Araberinnen sind gezwungen, die Gille zu tragen, um sie eben von den Männern zu unterscheiden.
Wenn die Verschleierte wirklich einmal die Hände aus den weiten Ärmeln schlüpfen ließ, was sie aber auch beim Zugreifen zu vermeiden wusste, so sah man, dass sie auch seidene Handschuhe trug, sodass gar nichts Nacktes an ihr zu sehen war.
Auf dem runden Tische standen silberne Teller mit Konfekt aller Art, mit Pralinen und überzuckerten Rosenblättern und Veilchen und Gott weiß was, desgleichen zehnerlei verschiedene Sorten Mixpickles, kleine Käsewürfel und Biskuits, Zigarren, Zigaretten, türkischer Tabak und Zigarettenpapier, ein geschliffenes Glas mit Bier und ein anderes mit Brauselimonade.
Es war ein Drehtisch. Die Teller standen im Kreise geordnet am äußeren Rande, und jeder drehte, bis er den gewünschten Teller vor sich hatte, so wurde auch gemeinsam aus dem Limonadenglase getrunken, was dann für den Hausherrn und die beiden Europäer in Bezug auf das Bier galt. Die sonst unsichtbaren Diener kamen nur, wenn sie gebraucht wurden, der eine um Limonade einzuschenken, der zweite Bier, der dritte hatte die glimmende Lunte unter sich.
Die Dreherei war schon in vollem Gange und erlitt durch den Eintritt der neuen Gäste keine Unterbrechung. Es erfolgte gar kein Aufblicken deshalb, die Ankömmlinge schienen den schon Anwesenden vollkommen Luft zu sein. Der Wirt deutete mit stummer Einladung auf einige freie Kis-sen, jedem einzeln seinen Platz bezeichnend, und sie ließen sich mit gekreuzten Füßen nieder. Arno war gerade der Verschleierten gegenüber gekommen. Ihr linker Nachbar war jedenfalls der Scheich, schon dadurch ausgezeichnet, dass er aus einem überaus kostbaren Tschibuk rauchte, das Weichselrohr mit goldenen Ringen verziert, diese wieder mit farbigen Edelsteinen besetzt, und das hier waren echte! Außerdem war es eine wirklich majestätische Erscheinung, auch so im Sitzen, das braune Gesicht mit dem prachtvollen schwarzen Vollbart die stolze Ruhe selbst.
Und nun ging die Unterhaltung los. Das heißt, nur darin bestehend, dass man immer an dem Tische herumleierte, von dem süßen oder sauren Zeuge naschte und einmal das Bier- oder Limonadenglas zu erhaschen suchte.
Das währte eine Viertelstunde, und es hatte sich daran noch nichts geändert. Vorläufig fand es Arno noch immer ganz interessant. Hauptsächlich deshalb, weil er sich für die Verschleierte interessierte. Wie die ihn durch ihre Augenlöcher unausgesetzt anblitzte! Das hätte in besserer europäischer Gesellschaft eine Dame nicht tun dürfen. Die Araber mussten das doch endlich auch bemerken. Die Sache aber war die, dass diese junge Frau es eben durfte. Dafür hatte sie ihren Schleier. Übrigens wurde mit eben solch blitzenden Blicken auch die Indianerin gemustert, die Frau Gräfin, und das war begreiflich. Oder diese Araberin wäre kein Weib gewesen.
Der Scheich rauchte also Pfeife, die beiden anderen Beduinen drehten sich selbst Zigaretten, die fertigen verachtend, der Hausherr rauchte eine Zigarre aus kostbarer Bernsteinspitze, auch Littlelu hatte sich eine angebrannt, das hätte Arno gern nachgeahmt, er konnte aber keine Zigarre erwischen. Zum gemeinsamen Bierglas war er schon zweimal gekommen, aber mit der Zigarre wollte es ihm nicht glücken. Das war auch gar nicht so einfach. Man musste sehr aufpassen bei dieser Dreherei. Schon dreimal hatte Arno den Teller mit den Zigarren zu sich herbeigedreht und dreimal an sich vorbeigedreht, und wenn er nochmals drehen wollte, so drehte schon wieder ein anderer und die Zigarren rutschten abermals an ihm vorüber.
Dass er es auf die Zigarren abgesehen hatte, schienen die anderen gar nicht zu bemerken, sie sahen auch nur auf den Tisch oder geradeaus.
Höchstens Littlelu hatte es bemerkt. Aber den hatte Arno im Verdacht, dass er ihm mit Absicht die Zigarren entzog. Jetzt griff Arno abermals danach und jetzt sah er auch, es war Littlelu, der ihm die Zigarren wieder an der Nase vorbeigedreht hatte!
So ein Schlingel! Und dabei dieses ernste Gesicht!
O ja, amüsieren konnte man sich dabei! Eben weil der Ernst gewahrt werden musste. Das galt wenigstens für Arno. Wenn er nur erst seine Zigarre gehabt hätte! Leider aber sollte es für ihn nicht allein bei der Entziehung der Zigarren bleiben.
Monsieur Muley ben Hassan hatte seine Gäste wiederholt instruiert, immer möglichst schnell nach dem Glase zu greifen, und er selbst ging jetzt mit gutem Beispiele voran, er zeigte sich dabei als ein Meister der Fixigkeit. Also auch Arno hatte das gemeinsame Bierglas schon einige Male erwischt, aber immer nur, wenn es höchstens noch halbvoll war. Sobald der Diener es wieder vollgeschenkt hatte, konnte man sicher sein, dass es der Hausherr schleunigst zu sich herumdrehte und die Blume abtrank, das Glas bis zur Hälfte leerte, die andere Hälfte seinen europäischen Mittrinkern überlassend.
Wieder hatte der Diener das Glas aus der Flasche vollgeschenkt. Der Konsul und Littlelu äugten schon wie die Jagdhunde nach dem Wilde. Und der Hauswirt war der Glückliche, der am fixesten gedreht hatte. Aber es sollte anders kommen. Wie er schon die Hand ausstreckte, das Glas schon zwischen seinen Fingern wähnte, begann plötzlich die Verschleierte zu drehen, und mit einem Ruck stand das schäumende Glas vor Arno.
Der konnte dieses Glück erst gar nicht recht fassen. Es war gut, dass die Verschleierte die Drehplatte einstweilen festhielt. Dann begriff er es doch, bedauerte nur, dass er das Glas nicht dankend gegen seine Wohltäterin heben konnte. Dafür aber leerte er es jetzt ebenfalls bis zur Neige.
Dies war die erste Gunstbezeugung gewesen. Das Glas wurde frisch gefüllt. Jetzt wusste es Littlelu zu sich zu dirigieren, so sehr sich auch sein Rivale darum bemüht hatte.
Darauf nahm die Verschleierte mit den äußersten Fingerspitzen eine der schon abgeschnittenen Zigarren vom Teller, sofort eilte der Diener mit der glimmenden Lunte herbei, sie beugte sich tief und seitwärts. als sie den Schleier lüftete, um die Zigarre in den Mund zu stecken, es qualmte, sie hüstelte etwas, legte die angebrannte Zigarre auf den Tischrand und drehte, bis sie vor Arno lag.
Das war die zweite Gunstbezeugung gewesen, welche die Verschleierte dem Grafen erwies, und nun sollte es schnell weitergehen.
Jetzt nahm sie, ohne die Hand aus dem Ärmel schlüpfen zu lassen, von dem gerade vor ihr stehenden Teller ein Praliné, führte es mit der unsichtbaren Hand unter den Schleier, dort, wo die Nase saß, wackelte es etwas, und als der Ärmel unter dem Schleier wieder zum Vorschein kam, hielten die behandschuhten Fingerspitzen nur noch die Hälfte des Pralinés. Diese legte sie vor sich auf den Tisch, drehte ihn, bis der halb abgebissene Schokoladenbonbon gerade vor Arno lag.
Die Blicke waren nicht nötig, die ihm der Wirt unter einem Räuspern zuwarf, gehorsam steckte dieser das halbe Praliné, an dem noch die Spur von Zähnchen zu sehen war, in den Mund. Und nicht nur gehorsam tat er es.
»Ach, das ist ja zu reizend!«, dachte er.
Gleichzeitig aber war es ihm doch etwas fatal, da er seine junge Frau bei sich hatte. Diese tat ihm jetzt sehr leid. Und das wieder gereichte seinem Herzen nur zur Ehre.
Merken ließ sich die Indianerin natürlich nichts. Aber sollte nicht auch dieses indianische Herz etwas fühlen? Ja, es tat ihm sehr, sehr leid, und das immer mehr, als die Verschleierte jetzt fortfuhr, ihn mit halb abgebissenen Bonbons und Schokoladenplätzchen und überzuckerten Rosenblättern und kandierten Veilchen zu versorgen. Stets führte sie das Konfekt erst unter den Schleier, biss davon ab und schob ihm dann die andere Hälfte zu. Da wurde Arnos Knie, das noch etwas unter dem niedrigen Tische lag, berührt. Es konnte nur Atalantas Hand sein. Sie tippte immer mit dem Finger darauf, ihn bald länger, bald kürzer darauf liegen lassend, und der ehemalige Offizier, der auch das Telegrafieren durch Winken mit Flaggen hatte lernen müssen, verstand sofort. Atalanta telegrafierte — ein kurzer Tipp war ein Punkt, ein längerer ein Strich.
Jetzt tippte sie Worte, und Arno buchstabierte:
»Ich — bin — nicht — eifersüchtig. Schluss.«
Die Indianerin hatte gesprochen.
Es war so naiv gewesen und doch so charaktervoll. So kindlich und doch so klug.
Arno hätte sie in seine Arme schließen mögen.
Hinterher ärgerte er sich, dass er es nicht wirklich getan hatte. Er schämte sich, dass er sich geniert hatte, er klagte sich der Feigheit an.
Und nur Feigheit war es auch gewesen. Dieselbe Feigheit, die man überall beobachten kann, in jeder Gesellschaft wie auf der Straße. Die moralische Feigheit.
Einem ins Wasser gestürzten Kinde nachzuspringen, dazu gehört verflucht wenig Courage!
Aber einer alten Frau, die sich auf der belebten Straße vergebens abmüht, den schweren Tragkorb auf den Rücken zu bekommen, helfend beizuspringen, auch wenn man Glacéhandschuhe anhat, dazu gehört wahrer Mut!
Für den Drehtisch brach jetzt eine neue Ära an, endlich sollte das Schweigen gebrochen werden, und gerade durch die Verschleierte, obgleich sie nicht sprechen durfte, es auch wirklich nicht tat.
Sie neigte sich gegen ihren Onkel, flüsterte, hauchte ihm etwas zu.
Der strich sich den prächtigen Bart, und endlich nahm er das Wort, sich gegen Arno wendend.
»Meine Nichte fragt, ob der fränkische Graf seine Frau liebt?«, sagte er in tadellosem Französisch.
Es war eine arabische Frage gewesen, von einer Araberin gestellt, also gar nicht verwunderlich.
Und jetzt nahm Arno wenigstens Atalantas Hand in die seine, als er die Antwort gab.
»Ja, ich liebe meine Frau!«
Wieder neigte sich die Verschleierte gegen den Scheich, hauchte ihm etwas zu, dessen Mund ward der ihre:
»Meine Nichte möchte gern wissen, ob Du auch noch andere Frauen liebst?«
Wieder war absolut nichts Verwunderliches dabei. Dass der Christ nicht mehrere Frauen haben darf, das wussten sie, das war ja auch nicht gefragt worden. Aber sie wussten auch, dass der Christ ebenso wie der Araber neben seiner Ehefrau manchmal noch andere Frauen liebt, und es war sogar recht hübsch, dass das hier ganz offen ausgesprochen wurde.
»Nein, ich liebe nur diese eine Frau.«
Wieder hauchte die Verschleierte etwas und prompt gab es der Scheich weiter.
»Meine Nichte fragt, ob Du eine Fotografie von Dir habest.«
Die hatte Arno leider nicht.
»Oder eine Fotografie von Deiner Frau?«
Auch das nicht. Der Vorschlag Littlelus, dass sich die beiden gleich nach der Trauung fotografieren ließen, war nicht befolgt worden.
Kaum aber hatte Arno verneint, als ihm ein Gedanke kam.
Schnell nahm er sein Notizbuch aus der Tasche, zog den Bleistift, richtete Atalantas Kopf etwas und begann zu zeichnen.
Er konnte recht gut skizzieren und porträtieren. Es war ein angeborenes Talent, er hatte es durch Übung etwas ausgebildet.
In drei Minuten hatte er den Kopf mit flüchtigen Strichen hingeworfen, riss das Blatt heraus, legte es auf den Tisch und drehte es dem Scheich zu.
Der fiel ganz aus seiner Würde.
»Ah!«, rief er erstaunt.
Ebenso erstaunt waren auch die anderen beiden Beduinen und der Hausherr. Die flüchtige Skizze war auch wirklich trefflich gelungen, die sprechendste Ähnlichkeit des indianischen Gesichts mit den markanten und doch so schönen, jungfräulichen Zügen.
»Herr Graf, Sie sind ja ein gottbegnadeter Künstler!«, rief Muley ben Hassan.
»O nein, ein Künstler bin ich nicht. Es ist mir nur deshalb so gut gelungen, weil ich nichts anderes als diese Züge im Kopfe habe.«
Ein heimlicher Händedruck unterm Tisch war der Dank für dieses gute Wort.
Wenn der Hausherr jetzt sprechen durfte, dann durfte es Littlelu auch, und der hatte auch gleich etwas bemerkt.
»Aber ein nichtswürdiger Heuchler sind Sie, ich möchte Ihnen unter dem Tische etwas ganz anderes geben als einen zarten Händedruck!«
»Weshalb verdiene ich denn das?«, lachte Arno.
»Sie hätten mich schon längst porträtieren können. In meinen Glanzstellungen. Na, warten Sie nur. Das kommt nun noch. Spitzen Sie nur schon immer Ihre Bleistifte.«
Wieder wollte die Verschleierte den Mund ihres Oheims gebrauchen.
»Fatme fragt, ob sie dieses Bild behalten darf?«
»Bitte sehr — selbstverständlich — ich habe es ja für sie gemacht.«
Sie ließ das Blatt in ihrem Ärmel verschwinden, behielt die Hand noch etwas länger darin, dann brachte sie ein funkelndes Armband zum Vorschein, hielt es in die Höhe und warf es dem Grafen zu, der es auffing.
Einen Augenblick hatte er Lust, das prächtige Armband, das er sich jetzt aber nicht weiter besah, Atalanta zu geben, hielt es aber für besser, es nicht zu tun, es wäre vielleicht ein Vorstoß gewesen; er steckte es deshalb in die Brusttasche, wie befohlen ohne jedes Wort oder Zeichen des Dankes.
Die anderen Beduinen hatten davon gar keine Notiz genommen, obgleich jetzt doch das Eis gebrochen war.
Der Hausherr klatschte in die Hände, andere Diener kamen, vor jeden Gast ward auf den Tisch, dessen Drehbarkeit durch einen Mechanismus jetzt abgestellt wurde, ein rauchendes Tässchen gesetzt. Arno glaubte zunächst natürlich an Kaffee, aber schon der Geruch belehrte ihn, dass es Bouillon war.
Die Beduinen schienen die kräftige Fleischbrühe leidenschaftlich gern zu trinken, zwei Diener gingen mit silbernen Töpfen ständig im Kreise herum, die mit einem Zuge geleerten Tässchen immer wieder füllend, auch Fatme führte eines nach dem anderen unter den Schleier, Arno wunderte sich nur, wie die das kochend heiße Getränk immer gleich so hintergießen konnten.
Da nahm der älteste Beduine, der mit dem grauen Barte, zum ersten Male selbstständig das Wort: Er wandte sich an Arno, neben dem er saß.
»Dort, wo in diesem Lande die Sonne sinkt, wohnt ein Volk, das sich Marokkana nennt. Kennst Du es, Effendi, der Du schon so weit gereist bist?«
»Ich kenne es, bin aber noch nicht selbst dort gewesen, nur vorbeigefahren.«
»Ich war dort, brachte zwei Saklawys hin, Nachkommen der Prophetenstuten, die der Padischah von Marokkana von uns kaufen wollte, zwei edle Tiere, deren Rücken zu besteigen sich der Prophet nicht geschämt hätte. Ich nahm sie wieder zurück. Der Padischah feilschte wie ein verschnittener Hund.«
Der Sprecher machte eine Pause, trank sein Tässchen aus, blies den Rauch der Zigarette durch die Nase und strich den Bart.
»Diese Leute von Marokkana sind Araber und sind doch keine. Sie gleichen uns, wie ein Schakal einem edlen Hunde gleicht, einem Antilopenjäger, dessen Stammbaum noch über den des Propheten reicht. Die Marokkani sind so viehisch, dass sie auch den Schakal fressen. Sie kochen ihn und trinken das Wasser.«
»Fleischbrühe von Schakalen?«
»Du sagst es. Sie fangen einen Schakal in der Schlinge, machen ein großes Feuer, hängen einen sehr großen Kessel mit Wasser darüber, und wenn das Wasser kocht, so tauchen sie den am Schwanze aufgehängten Schakal lebendig in das kochende Wasser...«
»Er ist noch lebendig?!«, rief Arno. — »Noch lebendig.«
Ernsthaft hatte es der Beduine gesagt, auch die anderen hatten an dieser Zwischenfrage und Antwort nichts weiter gefunden. Nur hinter dem Schleier war wieder so ein merkwürdiger, schluchzender Laut erklungen. »Drei Stunden lang«, fuhr der Beduine fort, »wird der Schakal mit Fell und allen Eingeweiden gekocht. Diese erste Bouillon wird fortgegossen, der Schakal kommt dann in anderes kochendes Wasser...«
»Nun ist er aber doch nicht mehr lebendig.«
Ganz harmlos hatte Arno diese Bemerkung gemacht, in etwas fragendem Tone gestellt, nicht ahnend, was er damit für eine Katastrophe beschwor.
»Nein«, entgegnete der Beduine ganz ernst, »er hat ja schon drei Stunden gekocht.«
Da kam die Katastrophe. Und zwar von einer Seite, von der man es am wenigsten erwartet hätte.
Plötzlich sprudelte Atalanta, die eben einen großen Schluck Bouillon genommen hatte, diese über den ganzen Tisch weg — und dann schlug sie die Hände vors Gesicht und lachte, lachte — und da plötzlich warf die Verschleierte ihren Oberkörper zurück, bis sie mit dem Rücken platt auf dem Teppich lag, und lachte erst recht, was sie lachen konnte — und da brach auch der würdevolle Scheich in ein dröhnendes Lachen aus — und die anderen Beduinen und der Hausherr und Littlelu stimmten mit ein — und da erst wurde sich Arno bewusst, was er da unbeabsichtigt für einen guten Witz geliefert hatte — und nun die trockene Antwort des Beduinen: »Nein, er hat ja schon drei Stunden gekocht« — und auch Arno schloss sich den Lachern aus vollem Halse an.
Die ganze zeremonielle Würde war über den Haufen geworfen worden, das Auseinandergehen wurde ganz anders, als wie es sonst geschehen wäre. Die Beduinen standen und sprangen auf, liefen lachend, mit den Fingern schnipsend, im Zimmer umher, sich wirklich vor Lachen krümmend, nicht viel anders verhielten sich Littlelu und Arno, die Indianerin lachte noch in ihre Hände hinein, lachend lag die Verschleierte noch auf dem Rücken. Lachend richtete sie der Scheich empor, führte sie lachend hinaus, lachend folgten die anderen Beduinen.
Nur der Hausherr war zurückgeblieben, der alte Herr wischte sich die Augen und brach immer wieder in ein schallendes Gelächter aus.
»Der arme Schakal — kocht schon drei Stunden — und Sie verlangen, dass er immer noch lebt — Herr Graf, Sie sind der wahre Hexenmeister — Sie haben diese Wüstenbeduinen zum Lachen gebracht — zu einem herzlichen Lachen, dass sie darüber sich selbst und alles andere vergaßen. — Wenn Sie vorhin mit mir gewettet hätten, dass Sie das fertig bringen könnten, ich hätte gleich mein ganzes Vermögen dagegen gesetzt — nehmen Sie's mir nicht übel, aber ich kann nicht mehr, ich fürchte für meinen alten Schädel...«
Lachend verließ er das Zimmer. Eine halbe Stunde später, als das junge Ehepaar und Littlelu sich in dem herrlichen Parke ergingen, immer noch in der ausgelassensten Laune, von der auch Atalanta angesteckt wurde, meldete ihnen ein Diener, der Herr Konsul bäte für heute Abend um Entschuldigung, er habe eine geschäftliche Pflicht zu erfüllen. Auch die Beduinen würden sich heute wohl nicht mehr sehen lassen, sie bereiteten sich
schon auf die morgigen Strapazen vor, daran möchten doch auch die drei etwas denken, denn bei dem Wüstenritt bliebe es doch. Jetzt freuten sich die Beduinen erst recht auf diese angenehme Begleitung.
Die drei gingen einmal in die Stadt, kauften Verschiedenes ein, statteten auch dem arabischen Viertel einen kurzen Besuch ab, ohne etwas Besonderes zu erleben, dann befolgten sie den Rat ihres Hausherrn und gingen zeitig schlafen.
Arno lag in seinem prächtigen Himmelbett, Atalantas Schlafzimmer war also von dem seinen durch einen kleinen Salon getrennt, dann kam wieder ein Salon, dann Littlelus Schlafzimmer. Natürlich hätten die Türen geschlossen werden können, sodass wenigstens das Ehepaar allein gewesen wäre, aber auch Littlelus Türen blieben offen. Die drei waren ja Kriegskameraden, und im Kriege kommt ein noch viel intimeres Zusammenleben vor.

»Gute Nacht, Atalanta!«
»Gute Nacht, mein Geliebter, träume von mir.«
»Und ich wette, dass Sie von Ihrem gekochten Schakal träumen!«, ließ sich Littlelu vernehmen.
Dann ward es sofort still. Arno war sehr müde, er schlief gleich ein. Und seine Frau hatte befohlen — er gehorchte. Aber auch Littlelu schnarchte bald wie ein Sägewerk.
Arno sah im Traume einen großen Kessel mit kochendem Wasser, in das von einem Galgen ein zappelnder Schakal hinabgelassen wurde, die Henkerin und Köchin war eine verschleierte Araberin, plötzlich aber hatte sie keinen Schleier mehr, und da war es Atalanta, sie ging auf ihn zu, küsste ihn...
Arno erwachte, war sich dieses Traumes bewusst.
Aber hatte er wirklich nur geträumt?
Gewiss doch. Aber hatte ihn nicht wirklich jemand geküsst? Er glaubte noch ganz deutlich die warmen, feuchten Lippen auf den seinen zu fühlen.
Und da vernahm er auch ein leises Geräusch. Es huschte jemand hinaus.
Atalanta war bei ihm gewesen, hatte ihn geküsst. Er wollte sie rufen, aber er unterließ es.
Ein großes Weh überkam ihn plötzlich. Es war nicht von langer Dauer, er schlief gleich wieder ein, war überhaupt noch ganz schlaftrunken gewesen.
Um sechs Uhr, als der Tag zu grauen begann, schrillte im Zimmer eine Klingel, auch wurde geklopft. Es war Zeit zum Aufstehen.
Als Arno seine Toilette, zu der er nur fünf Minuten brauchte, vollendete, trat Atalanta schon fertig angezogen bei ihm ein. Er hatte sich schon vorher durch die offene Tür etwas mit ihr unterhalten, jetzt erst bei ihrem Anblick fiel ihm sein Traum wieder ein.
Lachend erzählte er ihn. Ruhig hörte Atalanta zu.
»Ich war nicht bei Dir!«, sagte sie dann.
In diesem Augenblick trat auch Littlelu ein.
»Wie, Du wärest nicht bei mir gewesen, hättest mich nicht geküsst?!«
»Nein.«
Dann konnte Arno nur an eine Dienerin denken, der es der vornehme, schöne Franke angetan, die ihm heimlich des Nachts einen Besuch abgestattet hatte, sich mit einem gestohlenen Kusse begnügend.
Ehe er aber dieses noch richtig hatte ausdenken können, fuhr Atalanta schon fort:
»Aber ich weiß, dass jemand in der Nacht bei Dir gewesen ist, nur für eine halbe Minute, sich nur einmal hereingeschlichen hat und sofort wieder hinaus huschte. Ich weiß auch, wer es gewesen ist.«
»Du weißt es?!«
»Jene Scheichstochter war es, die verschleierte Fatme.«
Arno wollte es nicht glauben. Jetzt sprach er von einer Dienerin.
»Nein, es war jene Verschleierte, die mit uns am Tisch gesessen. Ich hörte, wie sie sich einschlich, und ich wusste es sofort, roch es, fühlte es. Und außerdem — hier...«
Atalanta hatte sich umgeblickt, ging an das Bett, nahm von der Oberdecke ein Blatt Papier, welches Arno übersehen hatte.
Es war seine Skizze. Atalantas Kopf. Nun musste er es wohl glauben. Sie hatte das Blatt Papier bei ihrem Besuche, als sie sich über ihn beugte, verloren.
Er war ganz bestürzt. »Die jungfräuliche Frau, die erst ihrem Gatten zugeführt wird — was soll man davon denken?!«
»Die hat sich offenbar in der Zimmernummer geirrt, die wollte zu mir, wollte mich küssen!«, meinte Littlelu, ernsthaft wie immer.
Unten brüllten Kamele, ein Diener fragte durch die geschlossene Tür, ob die Gäste bereit zum Frühstück seien.
»Wäre es da nicht besser, diesen Wüstenritt mit den Beduinen aufzugeben?«, meinte Arno.
»O, Geliebter, wo denkst Du hin, wegen solch einer Kleinigkeit!«, sagte Atalanta.
Nun, wenn sie damit einverstanden war, dann war es ja gut. Und natürlich, diese Indianerin trat doch wegen einer Rivalin nicht einen einzigen Schritt zurück!
Sie begaben sich in den größeren Salon, in dem schon das Frühstück serviert war und weiter serviert wurde, wie solch ein aus mehreren Gängen bestehendes Déjeuner sonst im Hotel nach französischem Muster um elf Uhr serviert wird.
Als die Diener abgeräumt hatten, stellte sich der Hausherr ein, erkundigte sich, wie seine Gäste geschlafen hätten und entschuldigte sein gestriges Fernbleiben.
»Es vergeht noch eine Stunde bis zum Aufbruch. Haben Sie denn nun auch alles bei sich, was Sie dort in dem einsamen Gebirge gebrauchen wollen?«
»Das wohl, es sind nur ein paar Köfferchen. Aber wie weit sollen wir denn nun eigentlich begleitet werden, wo und wann trennen wir uns wieder? Darüber ist ja noch gar nicht gesprochen worden.«
»Nun, die Beduinen bringen Sie direkt bis an Ihr Ziel, zwei oder drei bleiben dort auch bei Ihnen und bringen Sie wieder zurück.«
»Auch wieder zurück?!«
»Selbstverständlich. Diese Beduinen finden das so selbstverständlich, dass sie darüber gar nicht sprechen. Sie haben doch mit Ihnen an einem Tische gegessen, also sind Sie bereits ihre Gastfreunde, wenn auch noch ohne Salz und Brot, was aber auch noch kommt. Die Beduinen können Sie doch nicht etwa absetzen, so wie man einen Eisenbahnzug verlässt. Sie sind dort in einem unwirtlichen, menschenverlassenen Gebirge, rings von Wüsten umgeben. Sie stehen unter dem Schutze des Scheichs, dem dieses Gebiet gehört. Der sorgt natürlich auf alle Weise für Sie. Der stellt Ihnen Leute zur Verfügung, schon wegen des Wassers, das Sie allein kaum finden werden. Und wenn Sie ein ganzes Jahr lang dort verweilen, so werden Sie ein ganzes Jahr gehütet und gepflegt. Und dann werden Sie unter sicherer Bedeckung dorthin gebracht, wohin Sie wollen, mindestens bis zur nächsten Karawanenstation, wo Sie guten Anschluss haben, und dann muss der neue Karawanenführer dem Scheiche oder dessen Stellvertreter mit seinem Kopfe für Sie bürgen, dass Ihnen kein Haar gekrümmt wird, sonst verfällt er der Blutrache, denn Ihrer und Ihrer Begleiter Blut ist sein eigenes. Dass dies alles unentgeltlich geschieht, dass Sie auch keinem dienenden Araber auch nur eine Kupfermünze in die Hand drücken dürfen, brauche ich Ihnen wohl nicht erst zu sagen.«
»Das ist ja großartig!«, rief Arno mit aufrichtiger Bewunderung.
»Ja, lernen Sie mal erst die Gastfreundschaft der Wüste kennen! Diese Beduinen sind noch echte Ritter. Wohin wollen Sie sich dann begeben?«
»Das ist noch gar nicht ausgemacht.«
»Und wie lange wollen Sie dort verweilen?«
»Auch noch ganz unbestimmt.«
»Wenn Ihr Aufenthalt dort nur ein kurzer ist, nur ein oder zwei Wochen währt, und Sie begeben sich wieder hierher zurück, oder nach Alexandrien oder nach Kairo, dann könnten Sie in derselben Gesellschaft auch wieder zurückreisen.«
»Wieder mit dem Scheich?«
»Jawohl, und wieder mit seiner Nichte.«
»Die geht auch wieder zurück?«
»Die wird wieder zurückgebracht.«
»Ich denke, die soll den zukünftigen Scheich der Busetos heiraten, oder hat ihn sogar schon geheiratet. Bleibt sie dann nicht dort?«
»Nein. Sie geht in ihre Heimat zurück, als jungfräuliche Frau. Ich will Ihnen den hier vorliegenden Fall erklären, er ist sehr interessant. Es handelt sich um eine beabsichtigte Scheinheirat, die erlaubt ist, wenn sie auch sehr selten vorkommt.
Nach einer uralten Tradition muss der Scheich der Busetos eine Scheichstochter oder eine nächste Verwandte aus dem Stamme der Beni Suefs heiraten, mit denen sie Blutschwur haben. Sie tauschen sogar ihre Pferde, was bei den Beduinen noch etwas ganz anderes zu bedeuten hat als der Austausch der Mädchen durch Heirat.
Auch Scheich Mustafa hatte eine Schwester der Fatme zum Weibe, eine Stiefschwester. Die ist schon lange tot, die Ehe ist kinderlos geblieben, er heiratet nicht wieder. So wird sein Nachfolger sein Neffe Achmed. Wenigstens der Tradition nach.
Aber dieser Achmed ist, so jung er auch noch ist, ein sehr frommer Mann, ein schwärmerischer Jüngling, ein Kopfhänger, er will in ein Derwischkloster gehen und wird es auch sicher tun. Doch die Tradition muss erfüllt werden. Erst hat er die Tochter des Scheichs der Beni Suefs zu heiraten.
Die Trauung ist im Lager der Beni Suefs vollzogen worden, der Gatte war dabei nicht nötig, der Oheim hat ihn vertreten. Die junge Frau wird ihm zugeführt. Aber im Lager der Busetos ist auch schon der Scheidebrief fertig. Den überreicht ihr der Gatte Achmed beim ersten Zusammentreffen.
Die verheiratete Jungfrau ist wieder frei. Und ein größeres Glück könnte ihr nicht zuteil werden. Denn jetzt genießt Fatme eine Freiheit, wie sie sonst bei Beduinenweibern und Mädchen gar nicht vorkommt, obgleich die schon viel freier sind als Türkinnen und Stadtaraberinnen. Denn jetzt kann sie sich ihren zweiten Gatten selbst wählen, was sonst ausgeschlossen ist. Mit einem Male besitzt die Scheichstochter eine kolossale Macht und kann solche verleihen. Und wenn sie den armseligsten Sklaven erwählt — er wird als ihr Gatte ein Scheich, ein Stammesoberhaupt. Denn die Beni Suefs wollen sich spalten. Die Beni Suefs haben eine Spaltung auch einmal sehr nötig. Ein neuer Beduinenstamm wird entstehen, die Beni Fatmes. Mit diesem Erwählen eines Gatten ist auch eine reizende Sitte verbunden, aber eben nur die abgewiesene jungfräuliche Frau ist dazu berechtigt. Sie schleicht sich in das Zelt, in dem der Auserwählte schläft und küsst ihn heimlich, ein Zeichen zurücklassend, dass sie bei ihm gewesen ist.«
Arno hatte sich eben eine der auf dem Tisch liegenden Zigarren anbrennen wollen, blickte aber plötzlich ganz erstaunt auf und ließ das Streichholz zwecklos verbrennen.
»Alle Wetter, die Geschichte wird ja nett!«, dachte er erschrocken, vermied es aber, mit den anderen auch nur einen Blick zu wechseln.
Er zwang sich zur Ruhe, da musste er sich doch näher erkundigen, obgleich er als bestimmt voraussetzte, dass der Hausherr von jenem nächtlichen Besuche nichts wusste, worin er sich auch nicht irrte.
»Gesetzt nun der Fall, der Betreffende ist schon verheiratet?«
»O, das hat bei uns doch nichts zu sagen«, lächelte der arabische Kaufmann, »uns sind doch fünf Frauen gestattet. Eigentlich sogar so viele, wie der Mann ernähren kann. Natürlich rangiert eine Scheichstochter vor den anderen Frauen.«
»Wenn der Erkürte nun aber nicht will?«
»Bitte, was nicht will?«
»Die Scheichstochter heiraten.«
»O, das ist doch ganz ausgeschlossen!«
»Weshalb denn?«
»Nun, wenn eine Scheichstochter wirbt, eine Fürstin der Wüste!«
»Es kann aber doch einmal vorkommen, dass ihre Werbung abgeschlagen wird.«
»Nein, das kann wirklich nicht vorkommen!«
»Sie denken nur an einen Beduinen, an einen Araber, an einen Mohammedaner. Aber nehmen wir einmal an — es ist ein christlicher Sklave, in den sich die freigewordene Frau verliebt — oder ein Fremder weilt einmal bei den Beduinen, ein Europäer, der zu Hause Frau und Kinder hat, die ledige Jungfrauwitwe verliebt sich in ihn, küsst ihn im Schlafe — was dann?«
»Ja, dann muss er sie natürlich heiraten.«
»Wenn er aber nun nicht will, der christliche Europäer? Der darf sie doch überhaupt gar nicht heiraten, sonst macht er sich der Bigamie schuldig und wird mit Zuchthaus bestraft.«
»Ja, allerdings — aber er muss — dann muss er eben Mohammedaner werden — er muss sie heiraten, die ihn durch diesen Kuss geworben hat — sonst verfällt er der Rache — die Empörung ob solch einer grenzenlosen Schmach, die den ganzen Stamm trifft, wäre eine ungeheure — der würde massakriert werden.«
»Na, ich danke, ich reite nicht mit!«, sagte sich Arno.
Doch das war nur so eine gedachte Äußerung gewesen. Da musste er erst einmal mit den beiden anderen sprechen.
»Aber«, fuhr Muley ben Hassan fort, »es ist ebenso ausgeschlossen, dass Fatme durch ihren Kuss einen anderen als einen Beduinen erkürt, der nicht gerade für den ganzen Zweck passt. Denn das ist ja alles schon von langer Hand vorbereitet worden, dazu ist sie erzogen worden. Der Stamm soll und muss sich spalten, und das ist nur möglich, wenn eine freie Scheichstochter durch ihre Wahl einen neuen Scheich schafft, so also eine neue Dynastie begründet. Also wird ihre Wahl auch auf den edelsten, tapfersten, klügsten Beduinen ihres Stammes fallen, dem zum Scheich nichts weiter als die Geburt fehlt, was durch solch eine Werbung aber eben umgangen werden kann. — Apropos, Herr Graf, gestatten Sie mir eine Bitte... darf ich das Armband einmal sehen. welches Ihnen gestern Fatme als Gegengeschenk für Ihre Zeichnung verehrte? Es wird ein altarabischer Schmuck sein, für den ich mich sehr interessiere.«
Arno hatte das Armband noch in der Brusttasche stecken, hatte noch gar nicht wieder daran gedacht, auch die anderen hatten deswegen keine Frage gestellt.
Er zog es heraus. Ein breiter Goldreif, mit roten und grünen Steinen bedeckt. Auch einem Laien musste gleich die altertümliche Fassung auffallen. Dass große Rubine und Smaragde — vorausgesetzt, dass dies solche waren — die schönsten Diamanten von gleicher Größte im Werte weit hinter sich lassen, dürfte bekannt sein. Ein schöner Rubin von zwei Karat ist schon viermal so viel wert wie der reinste Diamant in Brillantschnitt von gleicher Größe oder Gewicht, und das wächst mit dem Karat. Dasselbe gilt vom Smaragd, der eben wie der Rubin viel, viel seltener ist als der Diamant — allerdings nur von bestimmter Größe an.
Der arabische Kaufmann zog ein Vergrößerungsglas aus der Westentasche, betrachtete das Armband, besonders aufmerksam aber die erbsengroßen Steine.
»Tadellose Rubine und Smaragde! Die Fassung ist aus dem 13. Jahrhundert. Offenbar von dem berühmten Damaszener Goldschmied Ispan el Mazar. Wunderbar! Wissen Sie, was dieses Dingelchen wert ist? Ich selbst wage es nicht zu beurteilen. jedenfalls aber ein Vermögen, von dessen Zinsen man recht gut als reicher Mann leben kann.«
Der bescheidene Graf, der erfahren hatte, wie schwer es ist, Schulden zu bezahlen, also den Wert des Geldes kannte, hatte sofort nur einen Gedanken.
»Es könnte sie doch nicht etwa reuen, und ich habe nichts, was ich...«
»O, Herr Graf! Wie beurteilen Sie denn diese Beduinen! Diese freien Söhne der Wüste! Lassen Sie so etwas ja nicht verlauten! Und diese Fatme kann sich das überhaupt leisten, das ist ihr eine Kleinigkeit. Der ihr Vater, der Scheich der Beni Suefs, der eigenhändig die Ziegen melkt und dem ein Stück Durrabrot mit einer Gurke ein lukullisches Mahl dünkt, ist einer der reichsten Männer des ganzen Orients, und zwar an barem Golde — von den Edelsteinen und sonstigen Juwelen ganz abgesehen.«
»Wie ist das möglich?«
»Haben Sie von den beiden Barbarossas gehört, den Brüdern Horuk und Dschereddin?«
»Ja, ich weiß, dass auch die Araber ihren Barbarossa haben, sogar zwei. Das waren doch die schrecklichen Piratenanführer im Anfange des 16. Jahrhunderts.«
»So ist es. Und der Scheich der Beni Suefs stammt direkt von ihnen ab. Er ist der Hüter aller der ungeheuren Schätze, welche diese beiden Piraten an den Küsten der Türkei, Griechenlands, Italiens und Frankreichs zusammengeraubt haben. Hauptsächlich haben sie ja Kirchen geplündert. Diese enormen Schätze existieren heute noch. Der Scheich der Beni Suefs ist ihr jetziger Besitzer, der einfache Mann nennt sich zwar nur ihren Hüter!«
»Na, ich danke!«
Der arabische Kaufmann hatte sofort verstanden, was jener meinte.
»Ja, in Ihrer Heimat ist der Adel ja allerdings in anderer Weise in den Besitz seiner großen Güter und Vermögen gekommen.«
Graf von Felsmark wollte auf diese negative Beistimmung lieber nichts äußern. Man darf nicht forschen, woher der Besitz der meisten Adelsgeschlechter stammt. Sie sind die Nachkommen der alten Raubritter.
»Von diesem Schatze«, fuhr der Hauswirt fort, »bekommt die junge Frau ein gutes Teil mit. Nicht als Mitgift, die es bei uns, wo die Frau gekauft werden muss, ja nicht gibt, sondern als Brautschatz. Doch das ist im Grunde genommen ja genau dasselbe. Fatme hat ein Anrecht auf diesen Schatz. Und obgleich die ganze Trauung nur eine Zeremonie war, die Abweisung schon beschlossen, muss die Zeremonie doch so weit getrieben werden, dass sie diesen ihren Brautschatz auch mitnimmt.«
»Sie hat ihn bei sich?«
»Auf den Kamelen verteilt, in kleinen Blechkästen verpackt, führt sie viele Millionen mit sich!«
»Ist denn das nicht gefährlich?«
»Dieser Transport, meinen Sie? Sie denken an Wegelagerer, an Wüstenräuber? Nein. Der Weg geht nur durch Gebiete, in denen blutsbefreundete Beduinen hausen. Da kann gar nichts passieren. Und diese sechs Beduinen, die auserwähltesten Krieger, wüssten sich auch zu wehren.«
Der Hausherr erhob sich. Unten brüllten die Kamele in schrecklicher Weise.
»Es scheint so weit zu sein, die Hedjins werden gesattelt. Ich werde Ihnen die Kostüme bringen lassen, damit sie auch äußerlich ganze Beduinen werden.«
Er verließ das Zimmer. Jetzt erst blickten sich die Zurückgebliebenen an. Wenigstens Arno und Littlelu.
»Das ist ja eine nette Geschichte!«, sprach es Arno jetzt auch aus, was er vorhin nur gedacht hatte.
»Sie will Sie zum Scheich eines neuen Beduinenstammes machen, der Beni Fatmes!«, sagte Littlelu.
»Atalanta, sollen wir unter solchen Umständen diese Wüstenreise nicht lieber aufgeben?«
Ruhig blickte ihn die Indianerin an. »Wie Du willst.«
»Nein, sage erst Dein Urteil.«
»Ich werde wegen einer Gefahr niemals zurücktreten oder einen einmal gefassten Entschluss aufgeben, und das umso weniger, je mehr eine Drohung vorliegt, was hier der Fall ist.«
Da sprang Arno auf. »Recht so! Nein, die Reise wird deswegen nicht aufgegeben! Wir wollen doch sehen, was daraus wird!«
Wer Abenteuer liebte, der konnte ja allerdings auch freudig darauf gefasst sein, solche zu erleben. Umsonst hatte die jungfräuliche Frau den Grafen doch nicht im Schlafe geküsst.
Die drei brauchten darüber nicht weiter zu sprechen.

»Inschallah — alschallah!«, riefen die Beduinen und machten
aus ihrem Staunen gar kein Hehl, sie wollten es nicht glauben,
dass die drei Freunde nicht schon perfekte Kamelreiter waren.
Der Hausherr kam mit zwei Dienern zurück, die für jeden einen Burnus aus weißer Baumwolle brachten. Zu dem Wüstenkostüm gehörten auch solche Handschuhe, welche der vornehme Beduine beim heißen Ritt stets trägt, und sie sind manchmal auch sehr nötig, wie die drei selbst noch merken sollten.
Sie begaben sich hinab. Im Hofe knieten elf Kamele, sehr magere Tiere, klein und dürftig aussehend, nur mit sehr, sehr langen Hälsen, durch die sie sichtbar das schon einmal gefressene Futter in Kugeln wieder heraufwürgten, es behaglich nochmals kauend.
Ihre Rücken waren mit rot oder blau gefärbten Lederdecken belegt. Der muldenförmige Sattel aus Holz war über den Höcker gestülpt und wurde durch freie Gurte festgehalten. Die ganze Polsterung ist auf die Innenseite verlegt, nur da, wo man sitzt, noch ein kleines Polster aus Rosshaar. Der Zügel ist ein einfacher Strick, um das Maul geschnürt. Nur unheilbare Galoppierer haben auch noch eine Nasenkandare. Denn wenn das Kamel in Galopp fällt, liegt auch der beste Reiter sofort am Boden. Zwei Tiere zeigten an den Kniegelenken furchtbare Narben. Denen war das Galoppieren durch eine besondere Vorrichtung, bei der glühende Eisenstücke die Hauptrolle spielten, ausgebrannt worden. Trotzdem trugen sie noch die Kandare, welche die Nase quetscht und sie durch einen Ruck zermalmen kann.
Zu den drei Beduinen, die sie gestern kennen gelernt, hatten sich noch drei andere gesellt. Eine Vorstellung oder Begrüßung fand so wenig wie gestern statt, die Wüstensöhne schienen die Ankommenden gar nicht zu bemerken, sie waren mit dem Anhängen des Gepäcks beschäftigt. Auch die Koffer und Waffen unserer drei Freunde waren schon herbeigeschafft.
Die Verschleierte saß auf einem Teppich und schaute dem geschäftigen Treiben zu, doch beobachtete sie wohl mehr noch die drei fremden Gäste, besonders Arno fühlte ihren Blick immer auf sich ruhen.
Die Reitkamele wurden so bepackt, wie es immer geschieht. An dem vorderen Sattelknopf hing das Gewehr, Munitionslasten, Proviantsack, Wasserschlauch mit verstöpselter Flaschenmündung — gewöhnlich ein kleiner Ziegenbalg, die Öffnung ist ein Beinstück — und was sonst der Reiter zur Hand haben wollte, am hinteren Sattelknopfe hingen zu beiden Seiten die sonstigen mitzunehmenden Gepäckstücke, hier besonders kleine Kästen, mit starker Leinewand umnäht, wohl den Brautschatz der jungfräulichen Frau enthaltend.
»Instruktionen brauchen Sie nicht zu bekommen!«, sagte der Konsul. »Ein Tier geht hinter dem andern, nur Galoppierer brechen manchmal aus, und so einen bekommen Sie natürlich nicht. Der Djemmelan, der Bereiter, der Rittmeister, der die Tiere unter sich hat, wird Ihnen dann zeigen, wie Sie sich zu setzen und den Zügel zu halten haben. Alles andere lernen Sie dann in kurzer Zeit von selbst. Nur der Passschritt ist so unangenehm, im Trab geht das Hedjin ruhiger als ein Pferd, und es wird ja nur getrabt. Freilich wie getrabt! Es ist nur wegen des Aufsteigens. Wollen Sie eine Leiter benutzen oder vom Parterrefenster aus aufsteigen?«

»Was, beim Aufsteigen eine Leiter benutzen?!«, staunte Arno mit halber Empörung.
»Das geht nicht anders. Und da genieren Sie sich ja nicht. Ich habe noch keinen Sportsman gesehen, der nicht auf irgend eine Weise emporgeklettert wäre — oder über den Kopf geschleudert wurde. Ich habe ganz Afrika mehrmals im Kamelsattel durchkreuzt, und ich war ein gar gewandter Reiter — aber das Aufsteigen habe ich nie gelernt. Dazu muss man in der Wüste zwischen Kamelen geboren worden sein. Die drei Rucke, die das Kamel beim Aufstehen macht, hält sonst niemand aus. Und sobald man ein Bein um den Höcker legt, steht das Kamel mit einer schauderhaften Plötzlichkeit auf. Weshalb eigentlich, da es sich doch sonst ganz ruhig bepacken lässt, das weiß man nicht.
Und da ist die Dressurkunst der Beduinen vergeblich, es ist noch bei keinem Kamele gelungen, ihm diese Untugend auszutreiben. Sobald es den geringsten Druck des lebendigen Reiters verspürt, schnellt es empor. — Da, der Djemmelan will Ihnen zeigen, wie man sich zurecht setzt.«
Dem einen Tiere, welches Arnos Waffen und Gepäck trug, waren unter dem Leibe die Füße gefesselt worden. Der Djemmelan winkte den Fremden, sprach bei der Belehrung kein einziges Wort. Er war der jüngste der Beduinen, fast noch ein Knabe zu nennen.
Er schwang sich in den Sattel, klammerte die gekreuzten Beine vorn um den Höcker, die gekreuzten Füße gegen den Hals des Tieres klemmend. Dann blickte er fragend die drei an.
»Ja, wir haben begriffen!«, sagte Arno.
Ebenso wurde ihnen gezeigt, wie der Zügel zu halten sei, nichts weiter.
Der Beduine löste die Fesseln wieder, gab dem Tiere einen leichten Schlag gegen den Hals, und sofort erhob es sich mit drei ruckenden Bewegungen, es stand im Nu auf den Beinen.
Himmel, war das im Liegen so unansehnliche Kamel ein mächtiges Tier! Das machten die langen Beine, nur aus Knochen und Sehnen bestehend.
Auch die beiden anderen Kamele brachte er so ohne Reiter zum Aufstehen; er ging seitwärts, nahm eine am Baum lehnende Leiter, stellte sie gegen Arnos Kamel und machte eine einladende Handbewegung.
»Was, ich soll da hinaufklettern?!«, rief Arno mit rotem Kopfe. »Nimmermehr!«
»Ja, aber es ist nicht anders möglich, Sie werden abgeschleudert!«, sagte der Konsul.
»Dann lasse ich mich lieber ein Dutzend Mal abschleudern und küsse den Boden, ehe ich mit einer Leiter hinaufklettere!«
»So steigen Sie aus einem Fenster hinauf.«
»Das ist genau dasselbe, das wäre für mich eine Schmach, die ich nicht ertrage.«
»Das lernen Sie aber erst nach einem Jahre fortgesetzter Übung.«
»Herr, das wollen wir doch erst einmal sehen!«, mischte sich Littlelu ein.
Der Konsul zuckte die Schultern, ging zum Scheich und sprach mit ihm arabisch. Der zuckte ebenfalls die Schultern.
»Arrek!«, rief er dann. »Aufgesessen!«
Erst ließ der Bereiter jene drei Tiere wieder niederknien, was sie auf ein Kommando und auf einen gewissen Schlag sofort gehorsam taten, dann nahm er wie die anderen seine lange Lanze, auch die Verschleierte hatte sich erhoben und stellte sich links neben ihr Tier.
»Arrek!«
Das rechte Bein übergeworfen, und ehe noch das linke trotz affenartiger Geschwindigkeit nachgezogen werden konnte, waren die sechs Kamele schon blitzschnell aufgestanden.
Bei dem Weibe hatte es vielleicht am graziösesten ausgesehen. Der eine Beduine aber, der sich dann als ein vorzüglicher Reiter erwies, auch einen Galoppierer beherrschen musste, wurde dabei nach vorn abgeschleudert, blieb am Halse hängen, voltigierte zurück und ließ sich mit dunkelrotem Kopfe die verlorene Lanze reichen.
»Haben Sie es gesehen?«, fragte der Konsul.
Arno hatte gut aufgepasst. Den Oberkörper krampfhaft vor, zurück und wieder vorgeworfen, aber die Bewegungen des aufstehenden Kamels nicht etwa mitmachend, sondern ihnen entgegenkommend.
»Das soll ich nicht nachmachen können?«
»Der Scheich ist damit einverstanden, dass Sie es, wenn Sie Ihren Willen behalten wollen, sieben Mal machen. Sitzen Sie beim siebenten Male nicht oben, geht es ohne Sie fort. Es tut mir leid, ich kann gegen diesen Entschluss des Scheichs nichts machen.«
»Habt Ihr gehört?«, wandte sich Arno an die beiden anderen. »Es geht um die Ehre — vorwärts!«
Er ging schnell hin zu seinem Tiere, es sah fast wie ein Anlauf aus, warf denn auch nicht erst das eine Bein über, sondern sprang gleich mit einem Satz in den Sattel, wozu allerdings ein ganz bedeutender Satz gehörte und federnde Sprunggelenke nötig waren.
Es sei hier etwas gesagt, was mit allem, was man sonst gehört hat, in Widerspruch stehen mag: nämlich dass die Beduinen gar keine guten Reiter sind! Das heißt, reiten können sie natürlich ausgezeichnet, sie sind mit ihrem Pferde verwachsen. Aber mit anderen geborenen Reitervölkern, wie den Tscherkessen, Kirgisen, Kalmücken und so weiter, oder gar mit den nord- und südamerikanischen Indianerstämmen, den Sioux, Pawnees und Penchuenchen, können es die Beduinen nicht aufnehmen, von den Cowboys und Gauchos gar nicht zu sprechen. Das macht, sie haben gar keine Gelegenheit, eine besondere Reitfertigkeit auszubilden. Das edle Wüstenross ist von Natur lammfromm. Von der Geburt an wird es wie ein Hund behandelt und erzogen, dressiert, es muss seinem Herrn wie ein Hund folgen, und im zweiten Jahre lässt es sich den Sattel geduldig auflegen, lässt sich sofort besteigen, ist sofort zugeritten, kennt kein Bocken und andere Mucken. Diese geduldige, vorsichtige Behandlung aber wird zur Gewohnheit. Wie ein Beduine auf- oder absteigt, das sieht in den Augen eines deutschen Kavalleristen einfach jämmerlich aus. Natürlich ist das alles ja ganz zweckentsprechend. In der Wüste spottet der Beduine auf seinem Rosse jedem Verfolger; es fliegt wie ein Vogel, klettert wie eine Gemse, vergräbt sich wie eine Schlange im Sande. Aber auf einem anderen, ihm unbekannten Pferde ist der Beduine ein ganz elender Reiter, er wird bei jedem Bocken aus dem Sattel geworfen.
In den Sattel war Arno gekommen, wie es diese Beduinen gar nicht kannten. Dann freilich, so sehr er auch seine Energie auf die Gegenbewegungen konzentriert hatte, glaubte er schon über den Kopf des Kamels wegzuschießen, dann fühlte er sich schon rückwärts einen Salto mortale schlagen, dann wollte er wieder über den Kopf hinweg — dann aber war es vorbei, er saß hoch oben im Sattel des stehenden Tieres, und das war die Hauptsache bei der ganzen Geschichte. Und als er sich nach seinen beiden Begleitern umblickte, sah er auch diese schon auf dem Rücken der aufgestandenen Kamele thronen.
Die Beduinen machten aus ihrem grenzenlosen Staunen gar kein Hehl.
»Inschallah — alschallah!«, klang es durcheinander.
Der Scheich sprach auf Arabisch zu dem Hausherrn, dieser wandte sich an Arno.
»Die Beduinen bezweifeln, dass Sie und Ihre Gefährten nicht schon perfekte Kamelreiter seien.«
»Ich erkläre auf mein Ehrenwort, dass wir noch kein Kamel bestiegen haben.«
Es wurde dem Scheich auf Arabisch mitgeteilt, obgleich er doch so gut Französisch verstand. Er schüttelte etwas den Kopf, was ihm nicht übel zu nehmen war.
»Ha, Ihr sollt mal auf 'nem Pacificpuffer reiten!«, rief Littlelu. »Und ich glaube, wir machen Euch noch etwas ganz anderes vor!«
Mit etwas finsterem Gesicht lenkte der Scheich sein Hedjin dem schon geöffneten Hoftore zu. Die anderen Kamele schienen sich anzuschließen, wie es ihnen beliebte. Hinter dem Scheich schaltete sich gleich das von Atalanta ein, dann kam Littlelu, dann Arno, dann die Verschleierte, dann schlossen sich die sechs Beduinen an. Und diese Reihenfolge ward während des ganzen Rittes beibehalten.
Der Hausherr und seine Diener riefen den Abziehenden eine Unmenge von arabischen Segenssprüchen nach, die von den Beduinen nicht beantwortet wurden. Die hatten den Abschied schon vorher abgemacht, unsere drei Freunde waren gar nicht dazu gekommen.
Die Hauptstraße war erreicht. Nachdem sich Arno an das infame Schaukeln etwas gewöhnt hatte, beobachtete er ein grandioses Schauspiel. Er bemerkte etwas, wovon er auch noch nichts gehört oder gelesen hatte.
Beduinen, freie Ritter der Wüste, ritten durch die belebten Straßen!
Wenn der Khedive, der Vizekönig, mit glänzendem Gefolge durch die Straßen ritt oder in der Equipage daher rollte — die ihm zuteil werdende Ovation war nichts gegen die Ehrfurcht, die man diesen Beduinen zollte, obgleich man sie gar nicht kannte. Und es hätten auch wirklich die ärmsten Söhne der Wüste sein können, nur in Lumpen gehüllt — man wäre ihnen ebenso begegnet.
Freie Beduinen, die keine Steuern zahlen, die keinen König über sich haben, die den Padischah in Stambul nur als Nachfolger des Propheten, nicht als Sultan anerkennen!
Die Strenggläubigen im Turban und Kaftan verbeugten sich vor der Karawane bis zur Erde, Segenssprüche murmelnd. Die Jungaraber und Jungtürken im schwarzen Gehrock mit rotem Fez, modernen Anschauungen huldigend, nahmen schnell die Zigarette aus dem Munde, damit sie ihnen nicht herausgeschlagen würde; und die arme Bevölkerung vollends warf sich vor dem Zuge gleich in den Staub nieder, als ritte an der Spitze der Prophet selbst. Viele rissen ein Kleidungsstück ab, warfen es den Kamelen unter die Füße, zogen es dann nicht wieder an, nahmen es als ein Heiligtum mit nach Hause. Kamele freier Beduinen waren darauf getreten!
Die Europäer mussten vorsichtig sein. Wegen solch einer kleinen Beduinenkarawane, wohl zu unterscheiden von einer Handelskarawane — ja nur wegen eines einzigen zerlumpten Beduinen, der durch die Stadt ritt, ist schon manchmal der mohammedanische Fanatismus entflammt, ist es zu Christenmetzeleien gekommen. Die Equipagen hielten lieber, ehe sie diesen Zug kreuzten oder überholten, Entgegenkommende bogen lieber in eine Seitenstraße und ließen ihn vorüber. Den Pferden eines Wagens, in dem zwei Engländer saßen, fielen, als er den Zug überholen wollte, sofort arabische Arbeiter in die Zügel. Aus einer Seitenstraße brauste eine elektrische Straßenbahn heran, im Nu sprangen von allen Seiten Araber herbei, auch Weiber, besonders aber viele Kinder, Eseltreiber, Bettler warfen sich auf die Schienen und wären überfahren worden, wenn der Wagenführer nicht schnell gebremst hätte. Der geschlossene Zug der freien Wüstenritter, die schon vor Tausenden von Jahren ebenso geritten waren, durfte nicht von solch einem modernen Vehikel dieser verfluchten Franken unterbrochen werden!
Und wirklich großartig ist es, wenn so ein Beduine aus der Wüste nach der Stadt reitet, wenn er in das bebaute Niltal kommt. Für den gibt es keine gebahnten Wege, keine »Kommunikationsmittel«. Immer geradeaus! Er kommt an einen Fluss, einen Kanal, zehn Schritt seitwärts von ihm befindet sich die Brücke, aber sie liegt außerhalb seiner schnurgeraden Richtung, also existiert sie nicht für ihn, er schwimmt dicht daneben durchs Wasser, dann lässt er sein Ross weiter durch Saaten und hochstehendes Getreide stampfen. Jeder andere Reiter wird von den Fellahs, den arabischen Bauern, sofort festgenommen, der muss tüchtig Strafe zahlen und allen Schaden ersetzen. Aber die zerstampfenden Hufspuren des Beduinenrosses werden ehrfürchtig geküsst.
Sollte diese Verehrung der Beduinen seitens der arabischen Stadt- und Landbevölkerung nicht einen politischen Hintergrund haben, sollte man von ihnen eine Befreiung von dem Fremdenjoch, mag dieses vorläufig auch noch so indirekt sein, erhoffen? Ein Wiederaufblühen der alten Sarazenenherrlichkeit? Wer weiß es!
Die letzten Hütten von Port Said kamen, immer noch ließ der Scheich sein Hedjin im Schritt gehen. Gleichmäßig pendelten die Oberkörper der Reiter hin und her.
Da sah Arno, wie sich vor ihm Littlelu etwas zur Seite neigte und... unter stöhnenden Lauten kam aus seinem Munde eine Materie heraus.
»Um Gottes willen, was ist denn das?!«, rief Arno erschrocken.
Littlelu blieb während seiner Beschäftigung die Antwort nicht schuldig.
»Das ist — — — das Gabelfrühstück — — — das war der erste Gang, jetzt kommt der zweite — — — Ragout fin — — — und nun folgt der dritte Gang: Wiener Schnitzel mit Sardellen — — — da haben Sie's schon — — — ooöhh...«
»Sie sind doch nicht krank?!«
»Krank? Ich? Nee! Ich verwachse nur immer mehr mit meinem Kamele, ich lerne schon das Wiederkäuen — — — oööhh — — — das Herauswürgen habe ich schon heraus, nur mit dem nochmaligen Hinunterschlucken hapert's noch — — — öööhh!«
Der arme Kerl war nicht schlecht seekrank geworden. Das stampfende Schaukeln auf dem Kamel ist ja wieder ein ganz anderes als das des Schiffes. Arno blieb verschont davon, umso mehr hatte es Littlelu gepackt. Doch seinen Humor behielt er.
Endlich hatte er seinen Magen geleert und er richtete sich wieder auf.
»Kommt nicht bald eine Restauration? Ich habe einen mächtigen Hunger!«
Die Sandwüste begann.
»Errreeehhh!«, rief der Scheich langgedehnt, gleichzeitig die bisher aufrecht getragene Lanze senkend, von allein fielen alle Kamele in Trab, und vorbei war das infame Schaukeln. Im Trab waren die von unten kommenden Stöße viel leichter als auf einem trabenden Pferde.
Hinter einem Sandhügel tauchte ein schmales Flüsschen auf, dessen stilles Wasser ein Riesendampfer mit drei Schornsteinen zum stürmischen Fluten brachte — der Suezkanal.
So sehr schmal ist er ja gerade nicht, 75 bis 90 Meter breit, aber wenn man so ein großes Seeschiff mit hohen Masten darauf dampfen sieht, dann schrumpft diese Breite scheinbar ganz zusammen.
Dicht am Kanal ging der Trab entlang, dem Süden zu, durch völlige Wüste. Der in gleicher Richtung fahrende Dampfer blieb schnell zurück. Er darf in der Stunde nur 5 Seemeilen, das sind 9000 Meter, machen. Es war ein Passagierdampfer von 10 000 Tonnen und hatte für die Durchfahrt, die 19 Stunden währt, 70 000 Franken zu zahlen gehabt. Die Tonne kostet 7 Franken, jeder Passagier 5 Franken extra.
Alle anderthalb Kilometer eine Station — gare — mit Ausbuchtung zum Ausweichen der sich begegnenden Schiffe, mit Signalmasten, telegrafisch miteinander verbunden. Am Kanal läuft ein dickes Wasserleitungsrohr entlang.
Dieses westliche Ufer wird ziemlich begangen, außer von Fellahs, die bei den Baggern Arbeit suchen, besonders von Hausierern, die zwischen Port Said und Suez ständig hin und her kleppern, auf Eselchen, von denen sie nie herabfallen können, denn sie brauchen nur die hochgezogenen Beine auszustrecken, so läuft das Tierchen unter ihnen durch. Und das arme Grauschimmelchen trottet mit seiner schweren Waren- und Menschenlast unermüdlich den ganzen Tag.
Dann wieder tauchte ein reisender Handwerksbursche auf, das Felleisen auf dem Rücken, den Knotenstock in der Hand. Natürlich ein Deutscher oder Österreicher. Andere reisende Handwerksburschen gibt es nicht. Schnell noch einen Schluck aus der Pulle, dann stellte er sich mit abgezogenem Hute hin, und focht die Beduinen an.
Ein Europäer auf sehr gutem Pferde — minderwertige gibt es dort gar nicht — wurde überholt. Der wollte sich nicht überholen lassen, schlug kurzen Galopp an. »Errreeehhh — ramm ramm!«, kommandierte der Scheich, und die Hedjins gehorchten.
Hei, wie die jetzt mit ihren dürren, endlos langen Beinen abgriffen! Immer im eleganten Passgang.
Der Reiter gab seinem Rosse die Sporen. In gestrecktem Galopp kam es wohl mit, zehn Minuten etwa, dann aber fiel es ab und blieb bald zurück. Es gibt kein Pferd, welches dem Hedjin nur für eine halbe Stunde folgen kann. Ein Rennpferd für wenige Minuten — das ist etwas ganz anderes.
Ein glühender Südwind setzte ein, wuchs und wollte zum Sturm ausarten. »Das ist der Samum!«, denkt dann ein jeder, der ihn zum ersten Male erlebt. Es ist der regelmäßige Mittagswind.
Arno sah, dass die Beduinen ihre Kopftücher vor das Gesicht gelassen hatten, er tat dasselbe, etwas zu spät. Er hatte schon das Gesicht voll Brandblasen. Der entgegenspritzende Flugsand wirkt wie glühende Funken, er erzeugt Brandbläschen.
Weiter ging es, dem »erreh ramm« wurde noch ein »maha, maha« hinzugesetzt, und die Rennkamele griffen immer noch ganz anders aus. Merkwürdigerweise werden durch dieselben Worte, die sonst nichts weiter bedeuten, in Indien auch die Elefanten angefeuert, bis zur Wut, wie früher die Kriegselefanten. Bei der Dressur werden sie unter diesen Worten hinten geschlagen und gestochen — dann sollen sie wohl laufen und wütend werden, wenn sie diese Worte hören.
Nach drei Stunden tauchte Kantara auf, hier auf dieser Hauptseite nichts weiter als eine Restauration und Telegrafenstation nach Kairo und el Arisch, einem Hafenstädtchen, dann weiter nach Jerusalem, drüben ein elendes Hüttendorf, von griechischen und italienischen Kanalarbeitern bewohnt, und eine große Karawanserei. Hier setzen die Handelskarawanen mit einer Fähre über den Suezkanal, vielleicht aus Timbuktu kommend, vielleicht nach Persien, nach Indien gehend. Denn der rechtgläubige Muselmann kauft nichts im Basar, was mit dem Dampfschiff oder der Eisenbahn der Giauren gekommen ist, von hier aus gehen auch die kolossalen Pilgerkarawanen nach Mekka und Medina.
Schon von Weitem sah man an der weißen Mauer dieses einzigen Hauses zwei angemalte sich kreuzende Billardstäbe, links und rechts ein schäumendes Bierglas und eine Weinflasche, und darunter — von oben nach unten — auf Französisch, Italienisch, Englisch und Deutsch: Treffpunkt aller Fremden!
In Kantara wurde drei Stunden gelagert. Nicht drüben in der Karawanserei, sondern hier auf dieser Seite. Ein großes Sonnensegel war auf der Station vorhanden, es wurde vom Hausdach aus herabgespannt, am Boden angepflockt und nahm Menschen und Tiere in seinem Schatten auf. Von drüben wurden nur einige mächtige Heubündel geholt, die Kamele, die in der Stadt nur wenig gefressen hatten, schmausten mit wahrem Heißhunger und leerten die großen Wassereimer wie die Fingerhüte.
Zwischen ihnen ließen sich die Beduinen nieder, jeder für sich, aßen aus ihrem Sack eine Hand voll Datteln und Hartbrot und streckten sich dann zum Schlafen aus. Um ihre Gäste hatten sie sich nicht gekümmert, kein Wort mit ihnen gewechselt. Zwischen ihnen bestand eben noch keine Gastfreundschaft, das musste erst noch kommen; und überhaupt, sie waren auf der Reise, wobei jedes unnütze Wort vermieden wird.
Unsere drei Freunde begaben sich in das Innere des Hauses. Die Restauration in der Wüste war recht hübsch eingerichtet, mit Marmortischen, sogar ein Klavier war vorhanden, und ein Plakat zeigte an, dass die Stunde Billard einen halben Franken kostete. Abends und besonders an Lohn- und Feiertagen mochte es hier recht lebhaft zugehen, da kamen hier wohl die Aufseher und anderen Beamten der in der Nähe arbeitenden Baggerboote zusammen.
Jetzt befand sich nur ein einziger Gast darin, ein eleganter Herr, der Telegrafenbeamte. Er plauderte mit einem bildschönen, glutäugigen Mädchen, wahrscheinlich einer Italienerin, im hochmodernen Hauskleide, die an seinem Tische stand.
»Bestellen Sie, Herr Graf«, sagte Littlelu, als sie sich setzten, »ich darf nicht einmal in Gedanken Speisenamen aussprechen, sonst zieht sich mein Magen jedes Mal schmerzhaft zusammen. Der will Taten, keine Worte — große Taten.«
Die glutäugige Italienerin, das tiefschwarze Haar pompös frisiert, wiegte sich in den Hüften langsam heran, als wenn sie's gar nicht nötig hätte, fragte auch nicht nach den Wünschen, sondern blieb herausfordernd stehen.
»Sprechen Sie französisch?«, begann Arno in französischer Sprache, worauf die Schöne kokett in fließendem Französisch erwiderte:
»Jawohl, mein Herr, ich spreche aber auch Englisch, Italienisch, Arabisch und Deutsch!«
»Donnerwetter! Allen Respekt, auch Deutsch sprechen Sie?«
»Jawohl, mein Herr.«
»Wo haben Sie denn das gelernt?«
»Ich bin eene Deitsche.«
»Ach was! Doch nicht aus Sachsen?«
»Nu allemal, ich stamme aus Leipzg!«
Arno musste sich schnell auf die Lippen beißen. Entpuppte sich dieses bildschöne, glutäugige, brünette Mädchen hier in dem einsamen Wüstenhause als eine Leipzigerin.
»Wie kommen Sie denn hierher?«
»Nu, wie's ähm so gommt.«
»Sind Sie die Frau Wirtin oder die Tochter?«
»De Gellnerin.«
Ja, Handwerksburschen, Kellner und Kellnerinnen! Und außerdem deutsche Bäckergesellen! Wo in der Welt sind die nicht zu finden! Und immer die Sprache beherrschend. Groß ist der Wörterschatz ja selten, zum Briefschreiben kommt es nie, aber zur Unterhaltung reicht es vollkommen.
»Was haben Sie zu essen?«, fragte Arno nun.
»Schinken, Salami, Gäse, Schbiegeleier, Riehreier, harte Eier, weiche Eier, saure Eier...«
»Haben Sie nicht Fleisch?«, unterbrach Arno den Eierspeisezettel und musste sich wieder auf die Lippen beißen, weil Littlelu jedes Mal, wenn ein neues Eiergericht genannt wurde, in unbeschreiblicher Weise mit dem ganzen Körper ruckte.
»Nu Schinken un Salami, is das etwa gee Fleisch bei Sie?«
»Entschuldigen Sie gütigst, — ich meinte frisches Fleisch, gebraten, etwa ein Beefsteak.«
»Nee, Bäffschteck hammer nich. Schinken un Salami. Un Gäse. Der Schinken is sehr scheene.«
»Dann bringen Sie uns, bitte, drei Portionen Schinken und Salami. Un Gäse.«
Die Kellnerin wiegte sich hinaus.
»Schbiegeleier«, fing da Littlelu an, immer seinem ganzen Körper einen Ruck gebend, als stieße ihn heftig der Schlucken, der aus dem Magen kommt, »Riehreier, harte Eier, weiche Eier, saure Eier — un Gäse...«
Die Kellnerin kam wieder herein.
»Der Schinken is alle.«
»Dann nur Salami.«
»De Salamiwurscht is verdorben!«
»Na, dann bringen Sie uns Ihre Eier in verschiedener Zubereitung!«, lachte Arno.
»Eier gibt's och nich mehr. Alles is alle geworden. Das gommt alles erscht heite amd mit 'n Broviantboot widder.«
Jetzt aber platzte Arno ärgerlich los: »Das ist ja eine traurige Wirtschaft hier, wenn man überhaupt nichts zu essen bekommen kann. Und da schreiben Sie in allen Sprachen auch noch: ›Treffpunkt aller Fremden‹ an das Haus?!«
Da aber wurde die »Gellnerin« aus Leipzig ausfallend, sie hatte es auch schon lange genug zurückgehalten.
»Wissen Se, wenn Se was zu essen hamm wolln. da gehn Se niewer ins Dorf, da geheern die Beduinersch iewerhaupt niewer, das hier is nur fier feines Buwligum, die Nassauer gennen wir, immer rin mit die in de Wieste!«
Die drei Freunde gehorchten, verließen das Lokal, auch Atalanta lachte herzlich, denn wenn sie die Worte auch nicht verstanden, so hatten doch Stellung, Gebärden und Ton der Zürnenden nichts an Deutlichkeit wünschen lassen. So wurden die in der Stadt vergötterten Beduinen, zu denen die drei doch jetzt gehörten, hier in diesem Wüstenlokal von der sächsischen Kellnerin quasi hinausgeworfen!
»Nun haben Sie aber nichts zu essen, armer Littlelu.«
»O, ich mache es wie mein Kamel, ich fresse einige Bündelchen Heu. Übrigens war diese Szene einige Hungertage wert, daraus mache ich einen burlesken Einakter.«
Auch sie lagerten sich unter dem Sonnensegel, aßen Datteln und Hartbrot, bekamen wenigstens eine Flasche Rotwein, mit dem sie das Wasser verbessern wollten. Doch erwies sich der Rotspon trotz seiner Spottbilligkeit so gut, dass sie ihn lieber ohne Wasser tranken.
Eine Stunde verging in Siestaruhe. Da plötzlich tauchte im Norden, auf demselben Uferwege, den auch sie gekommen waren, eine Kavalkalde weißgekleideter Reiter zu Pferde auf. Es dauerte einige Zeit, ehe man sie näher unterscheiden konnte, denn sie ließen ihre Tiere gemächlichen Schritt gehen.
Es waren zwanzig Beduinen. Sie ritten alle die gleichen braunen Pferde, auch einige Hengste, klein und mager und dennoch von sehr gutem Aussehen, eine edle Rasse — Berberpferde, am häufigsten in Nordwestafrika vorkommend, ausdauernd und genügsam wie die echten Araber Nordostafrikas und Westasiens, nur nicht so schnell, vor allen Dingen nicht so klug, nicht so selbstständig, und der arabische Beduine reitet, wenigstens auf der Reise, ausschließlich Stuten.
Arno hielt es für angebracht, sich doch einmal an den Scheich zu wenden.
»Was sind das für Beduinen?«
»Ich weiß es nicht!«, war die kurze, aber ganz freundlich gegebene Antwort.
Er wusste es wirklich nicht, was sollte er da anders antworten. Sich in Vermutungen ergehen? Das hatte keinen Zweck.
Die ankommenden Reiter hatten die Gesichtstücher herabgelassen. Durch den Schnitt der Burnusse sind Beduinen verschiedener Stämme nicht zu unterscheiden. Für die Lanzen entscheidet ganz der Geschmack, dasselbe gilt für das Gewehr, welches auch, wie hier bei allen der Fall, wegen des feinen Flugsandes meist in einem Leinwandfutteral steckt. Ebenso wenig unterscheidet sich West- und Ostafrika und Asien durch Zäumung und Sattelung.
»Verraten Dir auch die Pferde nichts?«
»Nein, Effendi. Es ist die zweitklassige Rasse, die überall immer mehr gezüchtet wird. Die Kohhelis (echte Araber), die wir nicht verkaufen, dürfen sich gar nicht mehr vom Stamme entfernen, weil uns die Anglesis schon zu viele gestohlen haben.«
Die zwanzig fremden Beduinen blickten wohl aufmerksam nach den Lagernden, ritten aber schweigend vorüber.
Ihr Ziel war die Fähre. Hier stiegen sie langsam aus dem Sattel und schickten sich an, nacheinander ihre Pferde auf das große Floß zu führen. Nur der eine sprach mit dem Fährmann.
Da erhob sich Littlelu mit ganz seltsamem Gesicht.
»Sapristi! Atalanta!«
»Ja?«
»Haben Sie gesehen, wie die abstiegen?«
»Ich habe es gesehen.«
»Wissen Sie, woran ich da dachte?«
»An Texas-Tim.«
Jetzt machte Littlelu erst recht ein grenzenlos erstauntes Gesicht.
»Was? Auch Sie haben gleich an den gedacht?!«
»Die meisten von den Beduinen warfen das Bein genau so aus dem Sattel, wie es Texas-Tim immer tat. Auch unter dem Burnus war es noch deutlich zu erkennen.«
»Und so machen es überhaupt alle Cowboys!«
Jetzt wurde auch Arno aufmerksam.
»Was sagten Sie da?! Cowboys?«
»Hören Sie, Graf!«, flüsterte Littlelu. »Wir halten diese Beduinen dort für verkappte nordamerikanische Cowboys. Alle diese Pferdebändiger haben nämlich beim Auf- und Absteigen ein und dieselbe eigentümliche Bewegung. Mitten in der Bewegung stocken sie einen Moment und lassen das gestreckte Bein über den Pferderücken schweben. Dies tun sie, falls sich der Gaul wirft und sich wälzen will. Es kommt eben vom Pferdebändigen her, das tun sie aber nun auch bei ganz lammfrommen Tieren, so ist ihnen diese Gewohnheit in Fleisch und Blut übergegangen. Atalanta ist im Reiten von einem Cowboy namens Texas-Tim unterrichtet worden. An den hat sie auch sofort gedacht. Und ich habe in meiner Jugend jahrelang unter Cowboys gelebt, ich bin selber professioneller Pferdebändiger gewesen. Auch ich mache diese stockende Bewegung beim Auf- und Absteigen noch immer. Das kann man sich gar nicht wieder abgewöhnen.«
»Sollten die Beduinen aber nicht dieselbe Angewohnheit haben?«
»Nein, ausgeschlossen. Für so etwas interessiert sich unsereiner doch ebenso wie ein Wolljude für die Schafsfelle, und man kommt immer einmal mit einem Manne zusammen, der sich daraufhin in der ganzen Welt umgesehen hat, ja nur deshalb die ganze Welt bereist hat, und da lauscht man und fragt man. Der Araber kommt als Pferdebändiger überhaupt gar nicht in Betracht. Der südamerikanische Gaucho und der mexikanische Vaquero lässt den Gaul sich nach rechts werfen, ebenso wie alle asiatischen Reitervölker. Nur die nordamerikanischen Cowboys springen samt und sonders nach links ab.«
»Und außerdem«, setzte Atalanta hinzu, »machten vier Mann diese Bewegung beim Absteigen nicht, und diese vier ritten Hinterhand, die andern sechzehn saßen auf Vorderhand, obgleich ihre Tiere auf Hinterhand zugeritten sind.«
»Das haben Sie beobachtet?!«, rief Littlelu überrascht.
»Ganz deutlich. Deshalb auch behielt ich dann die vier ganz besonders im Auge, als sie abstiegen, ich verglich sie mit den anderen.«
»Da sehen Sie! Die Cowboys sind die stärksten Vorderhandreiter, sie suchen das ganze Gewicht möglichst nach vorn zu legen, was ihnen die amerikanischen Jockeys immer mehr nachahmen, wovon ihre sensationellen Erfolge kommen sollen. Bis sie zuletzt auf dem Halse sitzen. Und alle Araber, die ich hier zu Pferde gesehen habe, sind ausgeprägte Hinterhandreiter, daher der stolze Gang ihrer Tiere. Das dort sind amerikanische Cowboys, dafür setze ich meinen Kopf zum Pfand!«
»Dann haben die es auf den Brautschatz der Scheichstochter abgesehen!«, sagte Arno gleich direkt, freilich auch gleich einen gewaltigen Sprung machend.
»Haben Sie auch gleich daran gedacht?«, bestätigte Littlelu. »Allerdings ein etwas kühner Gedanke?«
»Wieso? Diese ganze Heiraterei ist doch schon seit langer Zeit besprochen worden, und da wird gar nichts geheim dabei gehalten, das hat doch der Konsul bewiesen, der uns gleich alles erzählte. Die Millionen in den Blechkisten bilden vielleicht schon seit einem Jahre in Kairo und Alexandrien und überall hier das Tagesgespräch, das hört ein Amerikaner, der hat einen Einfall, nach Amerika muss er so wie so, dort wirbt er eine Bande Cowboys. — ›Hört, Jungens, dort in Syrien ist schrecklich viel Geld zu verdienen — eine Beduinenkarawane führt einen großen Schatz mit sich — — kommt, Jungens, den nehmen wir ihnen ab — zeigt mal diesen Beduinen, was Ihr Cowboys im Sattel mit dem Revolver in der Faust leisten könnt!‹«
»So ist's, so wird's schon sein!«, bestätigte Littlelu. »Das wären doch keine echten Cowboys, die da nicht gleich mitgingen. Der geschäftskundige Yankee braucht sie auch bloß bei der Ehre zu fassen und zu sagen, die gelben Burschen drüben in Arabien hätten behauptet, solche Cowboys könnten ja gar nicht reiten und schießen. Dann machen die sofort mit, um denen das Gegenteil zu beweisen, wenn sie nur freie Reise und hinterher ein paar hundert Dollars bekommen. Die Entfernung spielt ja heute gar keine Rolle mehr; drei Wochen hin, drei Wochen zurück — was ist das weiter. Und unter dem Burnus und hinter dem Gesichtstuch sind sie ja von einem Beduinen nicht zu unterscheiden, sie dürfen nur nicht sprechen. Zu einem verwegenen Räuberstückchen ist doch jeder Cowboy bereit. — Ja, so wird's sein, die haben es auf den Brautschatz abgesehen. Aber auch noch auf etwas anderes könnten sie es abgesehen haben.«
»Auf was?«
»Auf die wertvolle Gemäldegalerie, die Ihre wertgeschätzte Frau Gemahlin auf ihrem allerwertesten Buckel trägt.«
Groß blickte Arno den Sprecher an und dann nach Atalanta.
»Atalanta, hältst Du es für möglich, dass man Dich Deiner Tätowierung wegen bis hierher in die Wüsten Afrikas und Asiens verfolgt?«
Wenn die beiden nur gewusst hätten, was damals auf hoher See passiert war, während sie sanft geschlummert hatten!
Sie sollten es so bald nicht erfahren. Die Indianerin hielt das nicht für nötig — weshalb die Freunde beunruhigen?
Jetzt hob sie in ihrer Weise die Schultern.
»Ich weiß es nicht, wir können aber annehmen, dass es möglich ist.«
»Wir hätten mit ihnen doch einmal sprechen sollen!«, meinte Arno.
Dazu war es jetzt zu spät — wenigstens auf dieser Seite. Die sehr breite Fähre nahm bequem immer zehn Pferde mit ihren Reitern auf, schnell war der ganze Trupp in zweimaliger Fahrt drüben.
Dann aber sah man gleich, dass sie in dem Dorfe längere Rast machen wollten. Zum Füttern und Tränken der Pferde wurden umfangreiche Vorkehrungen getroffen, die dabei nicht beschäftigten Männer suchten nach einem günstigen Lagerplatz, besichtigten die Karawanserei und verschmähten die fensterlose Lehmbaracke, sie lagerten lieber im Freien, sich der Sonne aussetzend.
»Das wundert mich!«, sagte Arno, und Littlelu stimmte ihm bei.
»Was wundert Euch?«
»Dass die nicht sofort weiterreiten, um in der Wüste zu verschwinden.«
»Weshalb sollen sie das tun?«, fragte die Indianerin in ihrer Weise weiter.
»Es muss ihnen doch daran gelegen sein, uns vorauszukommen, um uns einen Hinterhalt zu legen. Mindestens ihre arabischen Führer wissen doch ganz genau, dass sie die Hedjins nicht einholen können.«
»Ich bin da anderer Meinung.«
»Welcher?«
»Dieser Trupp soll hinter uns bleiben. Sonst wäre es überhaupt unbegreiflich, weshalb sie erst hierher kommen. Sie müssen doch damit rechnen, dass wir durch irgend einen Zufall dennoch erraten, wer hinter den Burnussen steckt, dass es wenigstens keine Beduinen sind, und jeder andere Charakter muss uns stutzig und misstrauisch machen. Meiner Überzeugung nach gibt es noch einen anderen Trupp von Cowboys, der einen anderen Weg genommen hat, jenseits des Kanals, der bereits im Hinterhalt liegt, vielleicht eine Linie von vielen Meilen Länge bildend. Jeder Mann beherrscht mit seinem modernen Gewehr doch 500 Meter nach beiden Seiten, da kommen bei zwanzig Mann schon mehr als 20 englische Meilen heraus, die sind nicht so leicht zu umgehen, und jeder Schuss genügt, um ein Kamel lahm zu legen. Meiner Ansicht nach sollen diese Cowboys nur auf unserer Spur bleiben, um uns einen eventuellen Rückweg abzuschneiden.«
Mit grenzenloser Bestürzung blickten die beiden anderen die Sprecherin an. An solche Möglichkeiten hatten sie gar nicht gedacht, und die Indianerin hatte so bestimmt gesprochen. Natürlich wurde in entsprechend leisem Tone geredet.
»Wir müssen den Scheich sprechen, ihn warnen!«, flüsterte Arno.
»Nein, das wollen wir nicht, wenigstens jetzt noch nicht!«, sagte aber Atalanta. »Es ist ja möglich, dass er sich beraten lässt, einen weiten Umweg zu machen, eher aber ist es möglich, dass er seine Feinde missachtet und erst recht den einmal geplanten Weg nimmt. Und wir werden uns doch nicht etwa von solchen Cowboys abschrecken lassen. Ja, ins Vertrauen ziehen müssen wir ihn wohl, aber nicht eher, als bis wir selbst unser Möglichstes getan haben, die vorliegende Gefahr abzuwenden oder doch mehr über sie zu erfahren. Und gelingt es uns, sie überhaupt ganz zu beseitigen, so braucht er ja gar nicht zu erfahren, dass eine solche existiert hat, weshalb ihn und seine Begleiter und die junge Frau da erst beunruhigen.«
Die Indianerin wollte also genau so handeln, wie sie schon mehrmals gegen ihre eigenen Freunde gehandelt hatte. Nur niemanden beunruhigen, wenn es nicht nötig war. Alles im Stillen abmachen und dann, wenn es gelungen, gar nicht darüber sprechen. Nur dass die beiden gar nicht wussten, dass die Indianerin auch ihnen gegenüber schon so gehandelt hatte.
»Wir wollen die Cowboys sprechen?«
»Ihren Führer, in dem ich einen Amerikaner vermute. Aber nicht wir, sondern ich allein. Ich werde allein hinübergehen. Bitte, verhaltet Euch ganz unauffällig.
Und sofort schritt sie der Fähre zu. Und die beiden wussten, dass man dieser Indianerin nicht folgen dürfe, am wenigsten, wenn sie sich auf dem Kriegspfade befand. Da wäre jeder Vorschlag zu einer Begleitung zwecklos gewesen.
Mit unverhülltem Gesicht, wie sie es hier immer getragen, ging die Indianerin an den Strand hinab, rief mit einem »hallo« die drüben liegende Fähre an, wartete geduldig, bis die Fährleute es der Mühe für wert hielten, wegen der einzigen Kupfermünze, die sie nur zu erwarten hatten, herüberzukommen. Doch geschah es bald genug, und dann suchten sie die Hand zu küssen, die ihnen ein großes Silberstück zugeworfen hatte.
Die fremden Beduinen, für die man sie hier doch hielt, lagerten also, soweit sie nicht mit den Pferden beschäftigt waren, im Freien, sie hatten es sich in dem schmalen Schattenstreifen von vorspringenden Hüttendächern auf Heubündeln bequem gemacht.
Die näherkommende Indianerin wurde von ihnen gar nicht beachtet. Warum auch. Erstens ließ sie sich unter dem weiten Burnus gar nicht als Weib erkennen, zweitens konnte auch ihr bronzefarbenes Gesicht recht gut für das eines schönen arabischen Jünglings durchgehen.
»Parlez-vous français?«, wandte sie sich an den ersten Daliegenden.
Der schüttelte nur den Kopf und blickte anderswo hin.
»Taraf arabi?«, fragte sie weiter, obgleich sie selbst kein Arabisch sprach und wenig mehr als diese Frage konnte.

Wieder nur ein Kopfschütteln. Das wurde auffällig. Wie wussten die Cowboys diese Sache zu umgehen?
Da richtete sich ein anderer Burnusmann etwas empor.
»Sprich diese Beduinen nicht an!«, sagte er schroff auf französisch. »Sie stehen im Blutschwur, dürfen also nicht sprechen!«
Da war die Erklärung schon gegeben. Sie hatten einfach einen Schwur abgelegt, bis zur Erfüllung irgend eines Gelübdes kein Wort zu sprechen. Da war die Sache gleich abgemacht.
»Wer ist der Führer dieser Schar?«, wandte sich Atalanta an jenen.
»Was willst Du?«, klang es schroff wie zuvor zurück.
»Den Führer dieser Schar sprechen.«
»Was Du von ihm willst?«
»Ihm sagen, dass Ihr erkannt seid — dass wir wissen, dass unter diesen Burnussen nordamerikanische Cowboys stecken.«
Es war Atalanta, die Indianerin, die dies gesagt hatte.
Wären Arno und Littlelu zugegen gewesen, sie hätten es unbegreiflich gefunden.
Die hätten die Sache ganz, ganz anders eingeleitet, wären viel, viel vorsichtiger zu Wege gegangen.
Diese Indianerin ging wie immer ganz direkt auf ihr Ziel los. Und ob es nicht vielleicht das Allerklügste war, jede andere Schlauheit bei Weitem übertreffend?
Vielleicht nur, dass sie genau wusste, dass dies kein fremdes Ohr gehört hatte.
Die Wirkung ihrer Worte war denn auch eine gewaltige. Alle diese im Heu liegenden Beduinen zuckten zusammen und zuckten empor, der französisch Sprechende erhob sich halb, ein anderer schnellte gleich ganz in die Höhe.
»Komm mit mir!«, rief dieser letztere in englischer Sprache, sich wohl vergessend.
Noch zwei andere Beduinen folgten ihm wie Atalanta, er nahm den Weg nach der Karawanserei, blickte durch die Tür in die Halle, trat ein, ging nach der Mitte und ließ sich auf einer Bastmatte mit gekreuzten Füßen nieder.
»Hier sind wir sicher!«, sagte er, wieder auf Französisch. Die anderen drei folgten seinem Beispiel.
»Wie kommen Sie dazu, diese Beduinen für nordamerikanische Cowboys zu halten?«
»Weil sie sich verrieten, als sie aus dem Sattel stiegen.«
Allgemein große Bestürzung, so sehr sie sich auch zu beherrschen suchten.
»Sie haben richtig gesehen!«, nahm dann jener Sprecher wieder das Wort, und zwar sprach er sein Französisch noch mehr durch die Nase, als es der Franzose tut, wodurch er sich als geborener Yankee verriet. »Lassen Sie sich eine Erklärung geben. Ich bin ein Amerikaner, ein Altertumsforscher. Harry Douglas ist mein Name — falls Sie ihn schon kennen. Ich habe mehrere Werke über orientalische Ruinenstädte geschrieben. Jetzt will ich wiederum solche in Syrien besuchen. Es sind darunter den Mohammedanern sehr heilige Stätten. Niemals würde ich als Christ eine mohammedanische Begleitmannschaft dazu bekommen, ja ich würde mich deswegen den größten Gefahren aussetzen. Deshalb habe ich Cowboys geworben, sie als Beduinen gekleidet, Burnus und Gesichtstuch schützen sie vor dem Erkanntwerden, zu sprechen brauchen sie nicht, wenn sie daraufhin ein Gelübde abgelegt haben, die Wüste ist frei, oder sie gehört dem, der die größte Macht hat, mit diesem anderthalb Dutzend Cowboys, die jedem Gegner gewachsen sind, habe ich eine große Macht — auf diese Weise hoffe ich zum Ziele zu gelangen und der Wissenschaft unschätzbare Dienste erweisen zu können.«
Es war für die Vermummung der Cowboys eine vollständig genügende Erklärung. Nur schade, dass Atalanta sie nicht glaubte.
»Mister Douglas. darf ich einmal Ihr Gesicht sehen?«
»Bitte, warum denn nicht?«
Er blickte nur einmal nach der einzigen Tür, dann wandte er seinen Kopf von dieser noch etwas mehr ab und schlug das Tuch zurück. Das glattrasierte Gesicht eines echten Yankees mittleren Alters kam zum Vorschein.
»Kennen Sie den Seewolf von der ›Undine‹?«
Konnte es denn eine einfachere und trotzdem größere List geben als diese so gänzlich unvermutete Frage?!
Dieser Yankee, den man doch nicht umsonst hierher in die Wüste geschickt, hatte sein Gesicht ganz gewiss außerordentlich in der Gewalt — aber solch einer plötzlichen Frage war er denn doch nicht gewachsen, da unterlag er der Überraschung, dem Schreck!
So zuckte es in seinem Gesicht, wenigstens für einen Moment, bis es gleich wieder eisern war.
»Seewolf von der ›Undine‹? Was nennen Sie da für Namen?«, fragte er mit größtem Gleichmut.
Da zeigte diese Indianerin wieder einmal, dass sie auch lachen konnte — und was für ein spöttisches Lachen war das!
»Mister Harry Donglas, wie Sie natürlich gar nicht heißen — Sie sind köstlich! Mit Ihrem Munde sagen Sie nein und mit Ihren Augen, mit Ihrem ganzen Gesicht bejahen Sie meine Frage zehnmal. Wissen Sie schon, dass ich die ganze ›Undine‹ in die Luft gesprengt und auf dem Meeresgrunde versenkt habe?«
Nein, er wusste es noch nicht. Das konnte ihm die Indianerin doch wiederum gleich ansehen. Und das war denn doch zu viel für den Mann. Zunächst sperrte er nur den Mund auf und behielt ihn offen. Hinter den Gesichtstüchern der beiden anderen aber erklangen unterdrückte Schreie, eine heftige Bewegung — ein Zeichen, dass auch sie in alles eingeweiht waren.
»Es ist — nicht — möglich!«, ließ der Unmaskierte jetzt auch jede weitere Verstellung fallen.
»Es ist so. Tom Snyder...«
»Tom Snyder!«, musste der andere zunächst ächzen.
»Jawohl. Tom Snyder hat uns alle eingeschläfert, nur bei mir gelang es nicht, doch stellte ich mich so, das Piratenschiff kam, ich schoss zunächst möglichst viele weg, dann schwamm ich des Nachts hinüber, schlich mich in die Pulverkammer, legte Feuer an — der ganze Dampfer barst auseinander und ist mit Mann und Maus versunken. Nur jenen Tom Snyder ließ ich am Leben, damit er Eurem Meister von mir erzählen konnte. Also das wissen Sie noch nicht?«
Der Yankee konnte Atalanta nur mit weit aufgerissenen Augen anstarren.
»Nun, Sie werden es schon noch erfahren. Mir kommt es allerdings so vor, als ob auch der Meister noch nichts davon wisse — oder Ihr Verbrecher müsst in Eurer Leitung gespalten sein, denn mich wundert, dass man immer noch etwas gegen mich unternimmt, und kommt Ihr denn jetzt... doch das kümmert mich alles gar nichts, ich interessiere mich immer nur für das, was ich sehe und wirklich weiß. Mir fällt es auch gar nicht ein, Sie zu fragen, wer Sie denn nun wieder gegen mich zu Felde geschickt hat. Nur eines möchte ich wissen. Wie viele Banditen liegen denn schon vor uns in der Wüste in einem Hinterhalt?«
Der Yankee hatte die Sprache wiederbekommen.
»Vor uns... in der Wüste...?«
»Verstellen Sie sich doch nicht! Ihr Mund braucht ja gar nicht zu bejahen, Ihre Augen erzählen mir genug. Ich brauche nur zu fragen, Ihre Augen antworten von ganz allein, und zwar immer die Wahrheit. Sind es ebenfalls Cowboys? Ja, Ihre Augen haben bereits bejaht. Mehr als diese? Ja. Viel mehr? Nein, nicht so sehr. Mehr als dreißig? Nein. Vielleicht zwei Dutzend? Ja. Ich danke Ihnen für gütige Auskunft, Mister Harry Douglas.«
Der Yankee starrte und starrte. Sie hatte alles erraten. Sie hatte seine Gedanken gelesen.
»Sie — sind — mit — dem Teufel im Bunde!«, brachte er dann hervor.
»Das nicht, aber ein Teufelsweib bin ich schon oft genannt worden, ich soll den Teufel im Leibe haben, welcher Ausdruck mir in diesen Fällen immer nur zur Ehre gereicht. Und nun, Mister Douglas, bitte ich Sie, diese anderen 24 Cowboys zurückzuziehen, diese ganze Campagne gegen mich aufzugeben...«
»Was denn nur für Cowboys zurückziehen?!«, versuchte es jener noch einmal mit Staunen.
Da hob die Indianerin warnend den Finger gegen ihn, ihre bronzenen Züge veränderten sich etwas, sie wurden unheilvoll.
»Jetzt, Sir, geben Sie endlich Ihre Verstellung auf! Sie haben wohl bemerkt, dass ich mich noch eines höflichen Tones befleißige! Aber der kann sich ändern. Ich will Ihnen gleich noch etwas anderes sagen. Haben Sie mich im Zirkus gesehen? Ihre Augen bejahen, während sich Ihre Lippen schon wieder zu einem Nein verziehen. Sie haben mich über zwanzig Elefanten springen sehen. Sie, Mann, können kaum über einen Ziegenbock hüpfen. Was ich hiermit meine? Dass Sie in meinen Augen ein Kind sind, noch viel weniger. Ich zerquetsche Sie zwischen meinen Fingern wie eine Fliege. Und dann gehe ich hinaus und zerquetsche alle Ihre Cowboys ebenso zwischen meinen Fingern...«
»Oho!«, erklang es dreistimmig.
»Sie glauben es nicht? Da, Ihr Mücken...«
Drei schmetternde Schläge, mit beiden Händen scheinbar gleichzeitig geführt... Als die drei wieder zu sich kamen, saßen sie noch an ihren alten Plätzen, nur die Beine nicht mehr so bequem gekreuzt — an Händen und Füßen gebunden, im Munde einen Knebel.
»Nun, meine Herren, was sagen Sie jetzt?«
Die konnten ja nichts sagen. Wahrscheinlich auch nichts denken. Konnten nur etwas stöhnen und die Indianerin anstarren. Und mit was für entsetzten Augen!
»Sehen Sie, meine Herren, da sitzen wir nun noch immer ganz ruhig zusammen. Und nun rufe ich einen der Cowboys nach dem anderen herein und verfahre mit ihnen ebenso. Oder, wenn Sie wünschen, gehe ich auch hinaus. Das Resultat wird immer dasselbe sein. Und dann reite ich in die Wüste hinein, schieße die anderen Cowboys über den Haufen — oder hasche sie — ganz wie mir beliebt. Ich dressiere sie mir, lege sie erst einmal übers Knie und gebe ihnen wegen ihrer Ungezogenheit die Rute. Und dasselbe werde ich mit Ihnen machen, wenn Sie jetzt nicht ganz still sind. Denn ich möchte mich mit Ihnen weiter unterhalten. Sobald Sie aufstehen wollen, ohne dass ich es Ihnen erlaube, liegen Sie wieder da.«
Bei diesen Worten hatte ihnen Atalanta schon wieder den Knebel herausgezogen und die Lederfesseln abgenommen.
»Teufelsweib!«, stieß der Yankee hervor.
»Danke. Aber unterlassen Sie jetzt solche Schmeicheleien. Noch einmal dieses Wort und... Sie werden es bereuen.
Mister Douglas, ich möchte ganz geschäftlich mit Ihnen reden, antworten Sie mir ebenso, und Ihr Entsetzen vor mir wird sich in freudiges Staunen verwandeln. Aber der Wahrheit die Ehre!
Sollen Sie sich meiner Person wegen einer Tätowierung bemächtigen?«
Der Yankee tat das Klügste, wenn auch er ganz geschäftsmäßig wurde, das lag überhaupt in seiner Natur.
»Ja.«
»Sie sollen die Tätowierung, die ich auf dem Rücken trage, abzeichnen?«
»Ja.«
»Dürfen Sie mich dabei töten?«
Jetzt zögerte er doch etwas mit der Antwort.
»Antwort! Ich weiß nämlich alles!«
»Nun, wenn Sie alles wissen...«
»Sie dürfen mich nicht töten, weil sonst die Tätowierung verschwindet.«
»So ist es, so bin ich instruiert worden.«
»Gut. Sind Sie ermächtigt, mir unter Umständen auch einen anderen Vorschlag zu machen?«
»Was für einen anderen Vorschlag?«
»Ob ich mein Geheimnis nicht vielleicht doch noch in Güte verkaufe.«
Schon ging ein freudiges Staunen über das Yankeegesicht, und das hatte Atalanta nur sehen wollen. »Nein, das bin ich nicht, aber wenn Sie...«
»Kennen Sie einen Mann namens Frary?«
»Ja, den kenne ich.«
»Wissen Sie, dass er sich mir vor vier Wochen in New York genähert hat?«
»Ich weiß es.«
»Was er mir für einen Vorschlag machte?«
»Ich weiß es.«
»Dürfen diese beiden anderen Männer hiervon hören?«
»Sie dürfen es.«
»Wie viel bot mir dieser Frary für die Tätowierung?«
»Zehn Millionen Dollars.«
»Glauben Sie, dass mir dieser Preis für mein Geheimnis noch immer geboten wird?«
Immer stärker wurde das freudige Staunen in dem Yankeegesicht. Atalanta hatte es ihm ja auch gleich gesagt.
»Ganz sicher — sofort!«
»Sind Sie ermächtigt, deswegen mit mir in Unterhandlungen zu treten?«
»Nein, das bin ich allerdings nicht. Aber ich kann mir die Erlaubnis dazu sofort erteilen lassen.«
»Auf telegrafischem Wege?«
»Ja.«
»Von wem?«
»Von dem, der hierüber zu entscheiden hat.«
»Gut. Nun hören Sie. Mein Entschluss hat sich geändert. Die Warnungen und Drohungen jenes Mister Frary konnten mich natürlich nicht einschüchtern, und ich habe es ja schon bewiesen, wie ich mit solchen Leuten, die man gegen mich hetzt, umspringe, ich würde es auch weiterhin beweisen. Aber ich habe keine Lust mehr, fortwährend Menschen wegen einer Sache zu töten, die gegen schnödes Geld zu kaufen, zu verkaufen ist, und noch weniger Lust habe ich, deswegen Menschenleben auf's Spiel zu setzen, die mir teuer sind.
Kurz, ich bin bereit, das Geheimnis meiner Tätowierung gegen zehn Millionen Dollars zu verkaufen.«
»Angenommen!«, rief der Yankee sofort mit strahlendem Gesicht, jener die Hand zum Geschäftsabschluss hinhaltend.
Sie wurde nicht genommen. Die Indianerin tat etwas, was alle seine Erwartungen noch weit übertraf.
Atalanta zog aus ihrem Busen eine dünne Ledertasche, entnahm ihr ein weißes, zusammengefaltetes Papier und gab es jenem ohne Weiteres.
»Dies ist die Kopie meiner Rückentätowierung, von meinem Gatten ganz genau durchgepaust, auch noch mit dem Zirkel nachgemessen, obwohl solche Längenmaße gar nicht in Betracht kommen, da diejenigen, welche mir als Kind die erst unsichtbare Tätowierung einstachen, meine späteren Größenverhältnisse noch nicht beurteilen konnten.«
Der Yankee nahm das Papier mit einem Gesicht, als traue er der Sache nicht recht. Es ging ihm zu schnell, viel zu einfach, die fragte ja gar nicht nach Garantien wegen der Bezahlung. Denn jeder beurteilt den anderen doch immer nach sich selbst.
Und sein Gesicht wurde denn auch sehr enttäuscht, als er das Papier auseinander gefaltet hatte. Der Bogen war so groß, um einen menschlichen Rücken bequem zu bedecken, und bestand aus sehr dünnem, aber auch sehr festem Papier.
Doch vergebens drehte Mister Douglas den Bogen dreimal hin und her.
»Da ist ja gar nichts drauf!«
Nein, da war keine einzige Linie und kein Punkt zu sehen.
»Doch, es ist die vollkommene Zeichnung. Wir haben nur die Vorsicht gebraucht, sogenannte sympathetische Tinte anzuwenden, welche erst zum Vorschein kommt, wenn das Papier erwärmt wird. Erlauben Sie...«
Sie nahm den Bogen noch einmal, zog ein silbernes Büchschen aus der Tasche, entnahm ihm ein Wachsstreichholz, riss es an, hielt die Flamme in vorsichtiger Entfernung unter das Papier — da kamen an der erwärmten Stelle auf dem weißen Grunde blaue Linien zum Vorschein.
»Sehen Sie? Mit dem Streichholz muss man aber vorsichtig sein, es darf auch nicht am offenen Feuer gemacht werden, sonst kann das ganze Papier in Flammen aufgehen. Am besten hält man es an einen warmen Kachelofen, oder es wird erst eine Platte erhitzt. Es ist nur eine mäßige Wärme nötig. Nur die der Sonne genügt nicht. Jetzt verschwindet die Farbe schon wieder. Bitte, hier.«
Sie hatte den Bogen zurückgegeben. Der Yankee wusste noch gar nichts Rechtes damit anzufangen, er glaubte noch gar nicht, es war ihm eben alles viel zu einfach gekommen.
»Ist das aber auch wirklich die getreue Zeichnung?«
»Jawohl, nun zweifeln Sie erst ein bisschen!«, spottete die Indianerin.
Dieser Spott war auch das Beste gewesen, er beseitigte den Zweifel sofort.
»Und Sie geben diese kostbare Zeichnung so ohne Weiteres aus der Hand?«
»Ja, ich will sie doch verkaufen. Ich habe sie bereits verkauft. Wann erhalte ich die zehn Millionen Dollars?«
Jetzt musste jener wohl glauben, dass das Geschäft perfekt geworden war.
»Ich werde bei der betreffenden Stelle sofort anfragen. Erlauben Sie jetzt, dass ich mich erhebe?«
»Ich hebe den Bann auf.«
Alle erhoben sich.
»Ich gehe sofort hinüber und telegrafiere.«
»Schön. Sie erhalten auch gleich Antwort?«
»Umgehend.«
»Wo wird mir das Geld angewiesen?«
»Auch danach werde ich mich gleich erkundigen. Aber ich glaube, dass Sie hierüber selbst zu bestimmen haben werden.«
»So telegrafieren Sie gleich, dass ich es nach dem Sklavensee haben möchte, Nordamerika, Colorado, an die Adresse des Doktor Hikari.«
»Ja, ich weiß schon — es wird besorgt.«
»Und natürlich ziehen Sie die Cowboys zurück, die im Hinterhalte liegen, auch diese hier...«
»Selbstverständlich. Ich kann Ihnen schon jetzt die Versicherung geben, dass nicht das Geringste mehr gegen Sie unternommen wird. Doch muss ich, ehe ich für diese Leute den betreffenden Befehl gebe, mich erst mit jener Person in telegrafische Verbindung setzen.«
Sie hatten die Fähre erreicht und fuhren hinüber. Mister Douglas wurde nur von einem Mann begleitet, der ein echtes Beduinengesicht gezeigt hatte. Jetzt hatte er es schon wieder verhüllt.
»Und natürlich haben Sie dann doch auch nichts mehr gegen uns vor?«, wurde noch gefragt.
»Ich denke nicht daran, wenn ich nur in Ruhe gelassen werde.«
Die beiden gingen in das an das Gastzimmer angrenzende Telegrafenamt, Atalanta schritt auf Arno und Littlelu zu, die sie natürlich mit höchster Spannung erwarteten.
»Ich habe die Kopie meiner Tätowierung für zehn Millionen Dollars verkauft.«
Die Überraschung war natürlich eine sehr große. Doch wussten die beiden sofort, dass Atalanta hauptsächlich ihretwegen es getan hatte. Im Übrigen war es ja ganz ihre Sache.
Atalanta erzählte ausführlicher, auch wie sie recht gehabt hatte mit den schon im Hinterhalt liegenden Cowboys.
»Hast Du irgend eine Garantie, dass Dir das Geld auch wirklich ausgezahlt wird?«, war dann auch Arnos erste Frage eine ganz berechtigte.
»Solch eine Garantie ist wohl kaum möglich. Mit derartigen vorsichtigen Austauschereien will ich mich auch nicht erst einlassen. Entweder... oder. Wenn ich etwa betrogen werde, dann sollen die mich weiter kennen lernen.«
»Es handelt sich doch offenbar um irgend etwas, was in Deinem See versenkt worden ist.«
»Das, lieber Arno, geht mich gar nichts an. Für die Kopie meiner Tätowierung sind mir zehn Millionen Dollars geboten worden, ich bin darauf eingegangen, und damit basta.«
»Es ist aber doch noch Verschiedenes zu erwägen.«
»Nun?«
»Der See ist und bleibt doch Dein Eigentum.«
»Selbstverständlich.«
»Du könntest immer noch verbieten, dass fremde Personen auf Deinem See fischen.«
»Nein, das kann ich nicht. In ganz Amerika ist das Fischen auf allen uneingezäunten Gewässern frei.«
»Nun ja, das Fangen von Fischen! Aber sonst alles, was im Wasser schwimmt oder auf dem Grunde liegt, gehört dem Eigentümer, darf von fremder Hand nicht entfernt werden, das zufällig Gefundene muss ihm ausgeliefert werden.«
»Ich weiß, was Du meinst. Wir werden ja sehen, wie sich die Sache entwickelt. Natürlich habe ich gar keine Hintergedanken dabei, ich werde jenen nichts in den Weg legen, wenn sie selbst nur ehrlich vorgehen. Und ich habe schon bemerkt, dass mich darin auch meine Feinde, diese Verbrecher, ehren, sie trauen meinem Wort, und darin sollen sie sich nicht irren.«
Zehn Minuten waren vergangen, die beiden kamen wieder aus dem Hause.
»Es ist alles in Ordnung, die Zustimmung ist erfolgt. Heute in vier Tagen werden zehn Millionen Dollars in gemünztem Gelde in Pittville zu Ihrer Verfügung stehen, und wenn Sie wünschen, wird das auch nach dem Sklavensee gebracht.«
»Das ist nicht nötig. Ich werde Doktor Hikari anweisen, dass er das Geld dort in Empfang nimmt.«
»Ich bitte darum. Dass dieser japanische Gelehrte dazu berechtigt ist, das habe ich bereits angemeldet.«
»Dann ist ja alles in Ordnung. Und jene Cowboys ziehen Sie doch nun aus dem Hinterhalte zurück.«
»Selbstverständlich, es gehen sofort zwei Reiter ab. Sollten Sie dem ganzen Trupp doch noch begegnen, so sind es für Sie einfach fremde Beduinen, Sie können gänzlich ohne Sorge sein, Sie haben daraufhin mein Ehrenwort. Alles, alles ist von jetzt an gänzlich niedergeschlagen. Doch werden jene Beduinen einen ganz anderen Weg nehmen, sie kommen gar nicht hierher. Ich habe nichts weiter hinzuzufügen.«
»Auch ich nicht.«
Der Beduine, welcher der Yankee hier doch wieder war, legte mit leichter Verbeugung die Hand gegen die verhüllte Stirn, wandte sich und fuhr mit seinem Begleiter wieder über.
Eine Minute später sah man zwei Reiter nach Norden davon sprengen und bald in der Wüste verschwinden.
»Von dieser und von allen anderen Sorgen sind wir endlich befreit und das für immer!«, atmete Arno erleichtert auf. »Habe Dank, Atalanta — ich weiß, was Du geopfert hast.«
»Nur mein Starrsinn war ja schuld an alledem, und ich werde ja dafür bezahlt.«
»Nein, nein, um das Geld ist es Dir nicht zu tun gewesen.«
»Mir imponiert nur mächtig«, nahm Littlelu das Wort, »wie gemütlich das hierbei zugegangen ist. Denn das ist doch eine ganz gefährliche Verbrechergesellschaft! Und sogar mit seinem Ehrenwort hat der Kerl renommiert.«
»Da ist nichts Neues dabei!«, lachte Arno. »Zwischen den Verbrechern und Gaunern einerseits und den Kriminalbeamten anderseits besteht tatsächlich immer ein ganz gemütliches Verhältnis. Wenigstens so lange, bis der Verbrecher gefasst ist. Dann freilich ist's mit der Gemütlichkeit vorbei.«
»Ja, bis der Verbrecher gefasst ist!«, wiederholte Atalanta bedeutungsvoll. »Wollen wir nun unseren Beduinen etwas von den Cowboys mitteilen?«
Der Scheich und seine Leute hatten für alles das gar kein Auge gehabt. Sie lagen oder kauerten da, schliefen oder rauchten ihre Pfeife. Diese Teilnahmslosigkeit war natürlich eine erkünstelte.
Ja, es ging nicht anders, man musste ihnen davon Mitteilung machen, soweit dies nötig war. Schon fühlten die drei, dass sich zwischen ihnen und den Beduinen eine Kluft aufgetan hatte, die sich immer mehr verbreiterte.
Atalanta selbst übernahm es, sie begab sich hin zu dem Scheich.
»Ich habe Dir etwas zu offenbaren.«
»Ja?«
»Du hast gesehen, wie ich mich mit jenen Beduinen unterhalten...«
»Es interessiert mich nicht!«, wurde sie kurz unterbrochen.
Nicht im Tone, sondern in den Worten selbst hatte die geradezu beleidigende Abweisung gelegen.
Ruhig wandte sich die Indianerin um und ging zurück. Die beiden hatten es selbst gehört.
»Nein, es ist keine Beleidigung gewesen«, erklärte aber Atalanta, »ich halte diesen Beduinenscheich nicht für fähig, dass er seinen Reisebegleiter, der doch wenigstens schon sein halber Gastfreund ist, mit Absicht beleidigt. Es interessiert ihn tatsächlich gar nicht, und er hat es kurz und offen in seiner Wüstensprache ausgedrückt, die auch im Französischen nicht geschmeidiger wird — er hat gesprochen, wie ich es liebe.«
Sie begab sich in das Telegrafenamt, auch sie gab eine Depesche auf. Über Frankreich und England nach Nordamerika, nach Pittville, an Doktor Hikari. Der Text bestand nur aus einigen Zahlen, von denen jede sechs Franken wie ein Wort kostete. Der Beamte hier konnte das Telegramm freilich nur nach Port Said beordern.
So waren jetzt alle Schwierigkeiten und Verwicklungen beseitigt.
So glaubten die drei wenigstens annehmen zu dürfen, aber es sollte alles ganz anders kommen.
Zwei Tage war durch die Wüste geritten worden.
Diese hatte sich manchmal verändert. Die gelbe Sandfläche war hin und wieder wellig geworden, ganze Hügelgegenden waren passiert worden, Gebirgszüge tauchten auf, man kam mitten durch Gebirge, durch Pässe mit himmelhohen Felswänden, breite Wadis, eingetrocknete Flussläufe, Strombetten wurden gekreuzt — aber die braunen Söhne dieser Wüste hatten sich niemals geändert.
»Errreeehhh — ramm — ramm — maha, maha!«
Das waren die einzigen Worte, welche man manchmal aus dem Munde des Scheichs gehört hatte.
Die Beduinen selbst wechselten kein einziges Wort untereinander, sie richteten kein Wort an ihre Gäste.
Eine achtstündige Nachtruhe, eine zweistündige Mittagsrast unter einem kleinen Sonnenzelt, vor dem Aufbruch stets ein Schälchen Kaffee, frisch gebrannt und gekocht auf einem modernen Spiritusapparat, und dann ging es weiter, immer weiter. Wer Hunger hatte, konnte ja essen, jeder hatte auch seinen eigenen Wasserschlauch. Wenn aber die Beduinen geglaubt oder gar gehofft hatten, die Franken und die Indianerin demütigen zu können, dass sie um Erbarmen bitten würden, so hatten sie sich geirrt. Wohl hatte sich Arno am ersten Abend, als er nach sechsstündigem Ritt, schon beim Sternenglanz, aus dem Sattel gestiegen war, wie gerädert gefühlt, aber merken hatte er sich nichts lassen, und Littlelu hatte dann auch noch die Beduinen durch einige Luftsprünge in Erstaunen gesetzt, dann hinterher freilich von ihnen ungesehen eine schauderhafte Grimasse geschnitten.
Am nächsten Nachmittage, nachdem es immer ziemlich direkt nach Osten gegangen war, ohne dass man auch nur von Weitem eine Oase oder einen Menschen gesehen hatte, wurde eine meilenbreite Einsenkung durchkreuzt, in der auf grünen, wenn auch dürftigen Triften hier und da eine Rinder- oder Schafherde weidete.
Da zeigte es sich einmal, dass der Scheich seine Gäste durchaus nicht ignorieren wollte.
»Das Wadi Araban«, rief er mit schallender Stimme zurück, »durch welches in vorhistorischer Zeit das Tote Meer mit dem Busen von Akaba in Verbindung gestanden hat.«
Hier sah man auch Menschenansiedlungen — die Beduinen wichen ihnen aber aus.
In der folgenden Nacht wurde schon wieder in völliger Wüste gelagert.
Am andern Morgen wurde eine direkt nördliche Richtung eingeschlagen, es ging immer dicht an einem hohen Gebirgszuge entlang, der linker Hand jäh aus der Wüste emporstieg, die sich nach Osten als unübersehbare Fläche hinzog.
»Einst das so fruchtbare Land der Moabiter«, rief der Scheich, als es schon wieder in sausendem Fluge dahin ging, »jetzt die Wüste el Kerak. Das Gebirge ist Dschebel Lot, das Lots Gebirge, dahinter liegt das Bahr Lot, der See Lots, Euer Totes Meer!«
Wohl kam man an Schluchten und Pässen vorüber, keiner gewährte einen freien Durchblick nach diesem Naturwunder, dem Toten Meere, und man war ja auch mehr als drei Meilen von ihm entfernt.
Auch von rechts kam ein Gebirgszug heran, man ritt durch Täler, die aber selbst immer langgestreckte Wüstenstreifen waren.
Mit Aufgang der Sonne war man aufgebrochen, und fünf Stunden später, gegen elf Uhr, deutete der Scheich auf eine isolierte Bergkuppe.
»Der Berg Mosis, der Pisga!«
Ein scharfes Auge konnte auch am blauen Horizont schon die steile Felssäule unterscheiden, die sich etwas seitwärts auf der Kuppel wie eine Nadel erhob, und immer deutlicher trat sie hervor.
Noch eine halbe Stunde, und da, wo dieser breite Pass von einer Querschlucht gekreuzt wurde, ließ der Scheich sein Kamel in Schritt fallen, hielt, und alle Tiere taten desgleichen.
Er lenkte sein Hedjin zurück bis zu Arno.
»Hier müssen wir uns trennen, edler Effendi. Ich reite weiter nach Sonnenaufgang, und Du bist am Ziel. Direkt über Dir reckt sich die Nadel Mosis auf dem Dschebel Pisga empor. Außer dem Djemmelan Hammid bleibt auch der kluge Sadi bei Euch zurück, so lange Ihr seiner bedürft. Mit ihm könnt Ihr französisch sprechen, vertraut ihm alles ohne jedes Bedenken an, als sprächt Ihr zu mir. Er kennt einen Aufstieg zu diesem Berge, er kennt hier jeden Weg und Steg. Er wird Euch Wasser zeigen und Reis und Gerste geben und auch Feuerung. Er wird Euch nicht nur bringen, sondern er wird Euch selbst hinführen, obgleich es unsere großen Geheimnisse sind. Proviantmagazine, würdet Ihr sagen. Ich lege diese Geheimnisse in Eure Hände, denn Ihr seid auf der Reise meine Gäste gewesen. Ihr sollt auch in meinem Zelt sein. Nur drei Stunden lagern die Busetos von hier entfernt und so oft Ihr dorthin kommt, sollt Ihr willkommen sein. Bedürft Ihr etwas, was wir geben können, so schickt den Djemmelan, und er wird hin und her sein Aaschari zur höchsten Eile antreiben. In einigen Tagen, deren Zahl ich noch nicht bestimmen kann, reite ich wieder durch diesen Pass, zurück nach Port Said oder Masr el Kahira, und seid Ihr noch hier, könnt Ihr Euch wieder anschließen. Sonst werdet Ihr nach der nächsten Karawanenstation gebracht, wenn Ihr wollt.«
Eine leichte Verneigung im Sattel, die rechte Hand berührte flüchtig Mund, Stirn und Herz, und der Scheich lenkte sein Hedjin herum und trabte in die nach Osten führende Seitenschlucht hinein, gefolgt von nur noch drei Beduinen, und hinter ihm die Verschleierte.
»Habe Dank, für alle Deine Güte, edler Scheich!«, konnte ihm Arno nur noch nachrufen.
Nur die Verschleierte wandte noch einmal den Kopf, noch einmal sah Arno ihre Augen blitzen, und ein Kamel nach dem anderen verschwand hinter der nächsten Felsecke.
Arno wurde etwas von Beschämung erfasst. Er hatte immer so deutlich die Kluft gefühlt, die zwischen ihnen und diesen Beduinen bestand. Ja, aber wo war diese eigentlich? Hätte der Scheich denn höflicher, liebenswürdiger, gastfreundlicher sprechen und handeln können?
Und doch, das Richtige war es auch jetzt noch nicht gewesen!
Doch die neue Umgebung und Situation verscheuchten schnell solche Gedanken.
Also der jüngste und der älteste der Beduinen war zurückgeblieben. Der letztere, Sadi mit Namen, der damals die Geschichte mit der Schakalbouillon erzählt hatte. wurde jetzt gleich gesprächig.
»Nur noch wenige Minuten«, sagte er, sein Tier wieder antreibend, ohne noch eine Reihe einzuhalten, »dann kommen wir in ein weites Tal, in dem gleich alles zusammen ist, was wir zum Leben bedürfen. Nur muss man es zu finden verstehen.«
Die Schlucht führte denn auch bald in solch ein weites Tal, von etwa zwei Kilometer im Durchmesser, der völlig ebene Boden mit gelbem Sand bedeckt, eine kleine Wüste, rings von hohen Felswänden umgeben, die nur ab und zu von einer schmalen Schlucht durchbrochen wurde.
»Wo befindet sich hier der Pisgaberg?«, fragte Atalanta.
»Hier linker Hand reiten wir jetzt an seiner Wand entlang.«
»Ist die Nadel von diesem Tale aus zu sehen?«
»Du siehst sie soeben!«, lächelte der Alte.
»Wo denn?«
»Hier vor Dir. Zügele Dein Kamel, dass nicht sein Huf in das Öhr hineintritt, hängen bleibt und stürzt.«
Die Kamele hielten. Sadi deutete in ganz kurzer Entfernung vor sich auf den Boden.
Es war Mittag kurz vor ein Uhr. Die senkrecht wie gemeißelt aufsteigende Felswand warf einen ganz schmalen Schatten, in einer scharfen Linie abgegrenzt. Nur ein runder Knopf hob sich von dieser Schattenlinie hervor, und auf diesen deutete Sadi.
»Das ist schon die Kuppe der Nadel, und wenn Du noch eine Stunde wartest, wenn sich der Knopf mit einem langen Stiel nach dort verschoben hat, so kannst Du auch ganz deutlich das Öhr erkennen.«
Ein leichter Schlag auf den Hals, ein zischender Laut, den die Indianerin schon recht gut abgelauscht hatte, und ihr Kamel kniete gehorsam nieder, sie schwang sich aus dem Sattel.
»Dann bin ich am Ziel, meine Arbeit kann sofort beginnen!«, sagte sie, den kleineren ihrer beiden Koffer hinten vom Sattelknopf lösend und ihn auf den Boden setzend.
»Du willst sofort mit der Umrechnung beginnen?«, fragte Arno.
»Sofort. Da ist keine Minute, kein Augenblick zu verlieren, wenn ich morgen Mittag um zwölf Uhr fertig sein will, es handelt sich tatsächlich um jede einzelne Sekunde.«
Bei diesen Worten hatte sie schon ein langes Dolchmesser am äußersten Rande des schwarzen Schattenknopfes in den Sand gesteckt, zog unter dem Burnus Doktor Hikaris goldenen Chronometer für 5000 Mark hervor und ließ den Deckel aufspringen.
»So, der Anfang ist gemacht. Ist es weit von hier, Monsieur Sadi, wo Sie Wasser und Lebensmittel finden?«
»Wir sind eigentlich schon an Ort und Stelle, wir brauchen nur in jene Schlucht einzudringen.«
»Also Ihr entfernt Euch gar nicht weit?«
»Du kannst hier bleiben, wenn Du willst, wir sind dennoch so gut wie bei Dir.«
So war es gar keine Trennung, als die vier weiterritten, auch Atalantas Kamel wieder aufstehen lassend und mitnehmend.
Es ging nur ein kurzes Stück an der Felswand entlang, die immer öfter durch Schluchten unterbrochen wurde, dann bog der führende Sadi in eine solche ein, so schmal, dass sich zwei Kamele, auch zwei Pferde nicht ausweichen konnten. Auf beiden Seiten zeigten sich zahlreiche größere und kleinere Löcher, Eingänge zu Höhlen, und nicht lange, so stießen die Tiere ein besonderes Brüllen aus, von allein setzten sie sich in Trab, ließen sich nicht halten, bis das Leittier von allein vor solch einer niedrigen Höhle stehen blieb und auch einzudringen suchte, wenigstens den Kopf in den Eingang steckte, so weit es möglich war, brüllend und am ganzen Körper zitternd.
»Schäme Dich, Wüstenbraut!«, tadelte Sadi. »Darf ein edles Aaschari schon nach zwei Tagen so ungeduldig zittern, wenn es Wasser wittert?«
Die Tiere mussten niederknien, Sadi hatte eine ganz moderne Taschenlampe bei sich, freilich nicht elektrisch, sondern mit Benzin gespeist, er drang gebückt ein, auch gleich einen großen Eimer aus Segeltuch mitnehmend.
Im Hintergrunde der Höhle entsprang dem Stein eine Quelle. Freilich war es nur ein ganz, ganz dünner Strahl, die Tropfen blieben kaum zusammenhängen. Doch wurden sie in einem großen, ausgehauenen Bassin aufgefangen, das hatte sich natürlich gefüllt. Als die Wasserschläuche frisch gefüllt worden waren und die fünf Tiere so viel gesoffen hatten, als ihr Magen fassen konnte, war das Bassin fast erschöpft, und wieder würde es Tage dauern, bis das Bassin vollgelaufen war.
Die Tiere blieben zurück, Sadi führte die Fremden nach dem Proviantmagazin, das die Busetos in der Nähe dieser unschätzbaren Quelle angelegt hatten, und machte besonders den jungen Beduinen auf die Merkmale des Wegs aufmerksam.
War die Höhle schon für einen Kundigen sehr schwer aufzufinden, so ist der Weg noch weniger zu beschreiben. Den beiden Fremden wurde schließlich nichts verraten, die hätten die Höhle niemals wiedergefunden.
Sie enthielt einige Dutzend Zentnersäcke Gerste und Reis, in einem Nebenraume war eine große Quantität des kostbaren Brennmaterials der Wüste aufgestapelt: getrockneter Kamelmist, hart und völlig geruchlos, besser brennend als Torf. Hinter jeder Karawane gehen einige Männer, die in Säcken alles sammeln, was die Kamele fallen lassen. Es kann vorkommen, dass sich auch der mitreisende Europäer, obgleich er bezahlt, vor Antritt der Wanderung verpflichten muss, sich zeitweilig diesem »Ehrendienste« zu unterziehen.
Die Kamele wurden in eine geräumige Höhle geführt, hier bekamen sie Gerste vorgeschüttet, der junge Hammid blieb bei ihnen zurück, schon die benachbarte Höhle wohnlich vorrichtend, Sadi geleitete die Gäste wieder nach dem Tale zurück, sie begaben sich zu Atalanta.
Die hatte während der Stunde, welche unterdessen verflossen, schon fleißig gearbeitet. Das Köfferchen hatte alles enthalten, was sie dazu brauchte, zum Teil merkwürdige Sachen.
Sie hatte eine Art von kleinem Galgen aufgerichtet, also ein Winkelholz, etwa einen Meter hoch, und darunter ein großes, kreisrundes Leder von weißer Farbe ausgebreitet. Über dessen Mitte hing von dem Galgen an einem Seidenfaden eine Bleikugel herab, ein Lot, schon warf der Seidenfaden einen Schatten, die angehende Astronomin markierte und verlängerte ihn auf dem weißen Untergrunde mit Bleistift und Lineal, dabei immer nach ihrem Chronometer blickend — sie entwarf eine Sonnenuhr und führte die Lavoir'sche chronometrische Berechnung aus, mit welcher man durch Winkelmessung von Schattenlinien die Zeit noch genauer bestimmen kann als es durch den besten Chronometer möglich ist, wodurch man eben einen Chronometer justieren kann.
Außerdem hatte sie auch ein Stativ zusammengeschraubt, auf dem ein Fernrohr ruhte, durch Lote und Wasserwaage geregelt, durch welche sie öfters blickte, dann wieder den Schatten des Seidenfadens nachziehend, dann wieder in einem Buche mit endlosen Zahlenreihen und ganz gefährlich aussehenden Formeln rechnend.
Der zuschauende Arno wurde etwas wie von heiliger Ehrfurcht erfüllt. Und den anderen ging es wohl nicht anders. Daher das allgemeine Schweigen, das stumme Beobachten, bis Littlelu plötzlich in ein Lachen ausbrach.
»Wissen Sie, Graf, weshalb ich lache?«
»Ja, das möchte ich wissen.«
»Ist Ihnen bekannt, dass ich damals, als Atalanta öffentlich auftreten sollte, von Signor Ramoni im Bösen gegangen bin, dass es zwischen uns eine heftige Szene gegeben hat?«
»Ich habe davon gehört.«
»Wissen Sie, was ich dem Direktor für heftige Vorwürfe gemacht habe?«
»Nein.«
»Dass er diese Indianerin nur zu einer Athletin, zu einem Kraftweibe ausgebildet hat. Sie hätte die höchsten Schulen, Universitäten besuchen sollen. Das wäre eine Heroin der Wissenschaft geworden! Das hatte ich Ramoni schon oft gesagt, und bei unserem Abschied kam es noch einmal zum Durchbruch, da lief mir die Galle über.«
»Nun, sie hat doch ihre geistigen Fähigkeiten schon ganz hübsch ausgebildet und kann es immer weiter tun. Es ist ganz gut, dass sie nicht gleich direkt zum Bücherwurm erzogen worden ist.«
»Sie haben recht. Aber wenn es nach jenem Italiener gegangen wäre, so hätte er aus ihr halb eine Schlange, halb einen weiblichen Herkules gemacht. Um ihre geistige Weiterbildung hätte der sich den Teufel was gekümmert! Nur durch einen glücklichen Zufall hat sie sich von allein auch geistig weiter entwickelt. Ramoni hätte sie geistig verkümmern lassen. Das war ein Geizkragen der schlimmsten Sorte, der an nichts als an seinen Geldbeutel dachte. Er hat meine Vorwürfe recht wohl verdient.«
Arno dachte an etwas anderes.
Sein Blick schweifte empor.
Vor rund 3500 Jahren hatte dort oben Moses gestanden und das Land der Verheißung erblickt.
Das ist wohl eine historische Tatsache, die unanfechtbar ist.
Dann hatte ganz sicher das jüdische Volk auch hier in diesem Tale gelagert. — 3500 Jahre!
Ein Nichts in der Ewigkeit, und dennoch was für eine gewaltige Spanne Zeit in der Menschheitsgeschichte!
Wie hat es damals in Europa, in Deutschland ausgesehen? Das wissen wir nicht. Jedenfalls aber war damals dort noch alles Urwald und Sumpf und jedenfalls haben damals noch keine Germanen dort den Bären und den Urstier gejagt.
3500 Jahre! Und was wird wieder nach 3500 Jahren sein?
Dass 1000 Jahre später, jetzt vor 2500 Jahren, Nebukadnezar Jerusalem zerstörte, wobei das Allerheiligste der Juden, die Bundeslade, verschwand, das ist gleichfalls eine historische Tatsache.
Und wenn nun damals wirklich, wie im zweiten Buche der Makkabäer erzählt wird, der Prophet Jeremias diese Bundeslade mit den Gesetzestafeln hier versteckt hatte, und jener sagenhafte Rabbi Eleazar wirklich...
Atalanta erhob sich aus ihrer knienden Stellung und strich sich die Haare aus dem Gesicht.
»Die Schattengrenzen sind so scharf, dass ich keine Kontrolle zu machen brauche, was erst morgen Vormittag möglich wäre. Jetzt, Arno, gehe in dieser Richtung durch das Tal dort nach der abgeböschten Felswand, blicke Dich manchmal nach mir um, ich werde Dich durch Handbewegungen dirigieren, links und rechts, mehr hinaus und wieder etwas abwärts, nimm Dein Taschenfernrohr zu Hilfe, und wenn ich den Arm länger hebe, dann bleibst Du stehen. Mach Dir ein Zeichen. Dort ist es, wo am 7. Februar nachmittags 4 Uhr der Schatten der Nadelspitze hinfällt. Geht nur alle mit.«
Arno wurde von der größten Aufregung befallen, als er den Weg antrat, begleitet von Littlelu und dem Beduinen.
»Besteht über dieses Wüstental eigentlich irgend eine Sage?«, fragte er diesen unterwegs einmal.
»Dass hier um den Dschebel Pisga herum Moses begraben liegt.«
»Sonst nichts weiter?«
»Nein.«
»Ist nicht schon einmal versucht worden, dieses unbekannte Grab aufzufinden?«
»Mir ist nichts davon bekannt.«
Dann brauchte der Beduine auch nicht erst gefragt zu werden, ob er etwas davon wisse, dass erst vor kurzem eine Expedition hier gewesen sei.
Man hatte doch mit denen zu rechnen, welche der Indianerin das im Brunnen gefundene Dokument entwendet hatten. Ob sie vielleicht schon hier gewesen waren, das konnte man nicht so ohne Weiteres beurteilen, deswegen musste man noch genauere Umschau halten.
Das Tal war in der bezeichneten Richtung, nach Nordosten, durchschnitten. Auf dieser Seite war das einschließende Gebirge weniger steil, die geneigte Felswand konnte erklommen werden. Freilich mit großen Schwierigkeiten. Hier musste einmal ein Bergsturz erfolgt sein, es sah fürchterlich aus, es war eigentlich nur ein einziger Schutthaufen von kleineren und großen Steinen bis zu mächtigen Felsblöcken.
Arno blickte zurück, wie er unterwegs schon mehrmals getan hatte. Atalanta winkte mehr nach links. Dann begann der Aufstieg, immer unter Zurückblicken. Jetzt stand die Indianerin hinter dem Fernrohr, visierte hindurch, immer höher winkend.
Doch sehr hoch brauchte Arno nicht zu klettern. als sie noch etwas rechts winkte und dann den Arm hob.
Er stand auf einer Stelle, die sich von einer anderen durch nichts unterschied. Lauter Steingeröll, zwischen dem hier und da ein dorniger Busch, der gar keinen Regen braucht, Wurzel gefasst hatte.
Im Dauerlauf kam die Indianerin angerannt und erklomm die Böschung.
»Hier also muss die Stelle sein.«
»Das sieht aber gar nicht danach aus, als ob hier der Zugang zu einer Höhle sein könne!«, meinte Arno.
»Warum nicht? Das ist hier vielmehr gerade so beschaffen, dass man solch einen Zugang, den man einmal verschüttet hat, nicht wiederfinden kann. Räumen wir die Steine zur Seite.«
Die Arbeit begann. Die kleineren Steine wurden aufgehoben und hinabgeworfen, die größeren hinabgewälzt, auch mit vereinten Kräften.
So verging eine Stunde, und es waren nur immer neue Steine zum Vorschein gekommen.
»Ich kalkuliere«, sagte Littlelu, »wir werden morgen noch...«
»Hier ist eine Höhle!«, rief da Atalanta. Sie hatte ihre Hand unter einen größeren Stein zwängen wollen und war mit dem ganzen Arm in ein Loch gefahren. Als der Stein beseitigt war, zeigte sich wirklich eine größere Öffnung.
Jetzt erst trat die richtige Spannung ein. Denn auf dieser abschüssigen Halde eine Höhle zu finden, das hatte man nicht geglaubt.
Der Zugang musste von oben an freigelegt werden. Steine rollten hinab, immer größer wurde die Öffnung, bis Atalanta bequem hineinkriechen konnte. Arno, der ebenfalls eine Taschenlampe bei sich hatte, folgte alsbald nach, einen Blendstrahl vorausschickend.
Es war eine ziemlich geräumige Höhle, und da im Hintergrund...
Ja, das war ein Anblick, den man zwar erhofft hatte, der jetzt aber doch ganz und gar überwältigte.
Die Mär war zur Tatsache geworden!
Der Blendstrahl fiel auf eine gleißende Gestalt, einen Menschen darstellend, nicht viel unter Lebensgröße, mit Flügeln — ein Engel — und in einiger Entfernung davon lag noch ein solcher am Boden — die Cherubim der Bundeslade — und dort stand diese selbst!
Unsere drei Freunde wären keine gebildeten Menschen mit fühlenden Herzen gewesen, wären sie nicht von schauernder Ehrfurcht überwältigt worden. Minutenlang währte diese, dann traten sie näher.
Es war eine Lade von demselben Maße und Aussehen, wie es uns in der Bibel überliefert worden ist und sie schon einmal beschrieben wurde. Es sei nochmals gesagt: zwei und eine halbe Elle lang, ein und eine halbe Elle breit und hoch, zwar von Akazienholz, aber ganz mit Gold überzogen, der Deckel selbst ganz von Gold, oben ringsum von einem goldenen Kranze eingefasst, an jeder Ecke ein goldener Ring zum Durchstecken der beiden Tragstangen, die ebenfalls aus Akazienholz angefertigt waren.
Diese riesenhafte Lade, die den Kindern Israels schon bei ihrem Zuge durch die Wüste immer vorangetragen worden war, stand jetzt vor ihnen! Nur die beiden Cherubim hatte man abgenommen. Dort, wo sie stehend befestigt wurden, waren Vertiefungen und eine Art von Klammern. Die beiden Tragstangen, sechs Ellen lang und für solch ein Gewicht entsprechend dick, steckten noch in den Ringen. Sie selbst waren ohne Schmuck, zeigten nur dort, wo sie auf den Schultern geruht hatten, Vertiefungen, wonach die Lade von zwölf Männern getragen worden war.
»Dass dieses Holz sich so lange gehalten hat?«, brach Littlelu endlich das ehrfürchtige Schweigen.
Nein, darüber brauchte man sich nicht zu wundern. Erstens gibt es versteinertes Holz, welches vielleicht Hunderttausende von Jahren alt ist. Allerdings liegt da ein Durchtränken mit meist flüssiger Kieselsäure vor. Zweitens aber finden wir doch auch im Sande des Ost- und Nordseeufers Boote und ganze Schiffe der alten Wikinger, die ebenfalls Tausende von Jahren alt sind, und die haben sogar der Feuchtigkeit getrotzt. In gewissen Ländern nun, wo bei großer Hitze die größte Trockenheit herrscht, hält sich Holz erst recht. In den ägyptischen Gräbern findet man alle möglichen Holzsachen, tadellos erhalten. Ganz richtiges Holz ist es freilich nicht mehr. Die organische Zusammensetzung ändert sich, die Kohle speichert sich auf, dadurch wird es leichter, poröser und förmlich zerbrechlich — dieser vermehrte Kohlenstoff aber ist dann auch die Ursache, dass es vor Wurmfraß geschützt ist.
Die drei Freunde schlugen den Deckel zurück, mussten dabei aber alle Kraft anwenden. Denn der Deckel war zwei Zoll dick und von massivem Gold.
Innen sah man, dass der Riesenkasten eigentlich aus zusammengefügten Holzplanken bestand. Und am Grunde lagen zwei steinerne Tafeln, meterlang und einen halben breit, und der Blendstrahl fiel auf hebräische Buchstaben, die in den Stein eingemeißelt waren! — Die Gesetzestafeln!
Die zweiten. Denn die ersten, die Moses auf dem Berge Sinai anfertigte, innerhalb von 40 Tagen und Nächten, hatte er ja wieder zerschmettert, weil sich die Juden unterdessen das goldene Kalb gemacht hatten. Da ging er, nachdem er 3000 Mann hatte »mit dem Schwerte erwürgen« lassen, zum zweiten Male 40 Tage und Nächte hinauf und brachte neue Tafeln mit.
Und man glaube doch ja nicht, dass dies alles nur ein Märchen sei! In dem konservativen Orient ist die Erinnerung an diesen Wüstenzug der Juden, die den Ägyptern die goldenen Tempelgerätschaften gestohlen hatten, noch so lebendig! Viel, viel hat ja die spätere Sage ausgeschmückt, aber der Hintergrund ist historisch. Und wer das rote Meer kennt, wo sich heute unsere tiefgehenden Dampfer immer ganz dicht an der Küste halten müssen, weil es sonst überall von Sandbänken und Untiefen wimmelt, der hält auch so einen Durchgang zu Fuß nicht für unmöglich.
»Herrgott«, brach da Littlelu wieder das Schweigen, »was mag das wohl wert sein?!«
Ja, was war das wohl wert? Das Gold war dabei ganz Nebensache.
»Wir wollen die Steintafeln einmal herausheben!«, sagte Arno.
»Ja, heben wir!«, stimmte Littlelu bei.
»Steigen Sie hinein.«
Littlelu blickte vorläufig nur noch einmal hinein, dann kratzte er sich hinter dem Ohre.
»Ich? Nee. Ich lasse Ihnen den Vortritt.«
Aber auch Arno hatte keine Lust, in den Kasten zu klettern.
Weshalb nicht? Wir wollen da lieber nicht von Aberglauben sprechen. Wäre es ein Sarkophag mit einer Mumie gewesen, die hätten sie sofort herausgeholt. Aber hier... es war doch eine eigentümliche Sache. Gewiss, diese heilige Scheu würde noch einmal überwunden werden, nur jetzt nicht gleich, die Sache war noch zu neu.
»Ob die Engel massiv sind?«
Arno war bereit, einen zu heben.
»Effendi, o Effendi, rühre ihn nicht an!«, schrie es da entsetzt hinter ihm, und es war begreiflich, dass Arno gleich zurückprallte.
Der Beduine stand noch am Eingange und machte ein sehr ängstliches Gesicht, er stieß immer die linke Hand vor und zog sie wieder zurück.
Es ist dies das Kreuzschlagen der Mohammedaner gegen böse Einflüsse. Denn die linke Hand gehört dem Teufel — deshalb isst man auch nicht mit ihr — aber mit ihr drängt man den Teufel und andere böse Geister zurück.
»Weißt Du etwas von dieser Bundeslade?«, wandte sich Atalanta an den Beduinen.
Nein, er wusste nichts. Die ganze Geschichte war ihm nur nicht recht geheuer. Die Mohammedaner glauben ja an reichlich viele gute und noch mehr böse Geister.
»Ich dachte, er wüsste, dass der, welcher die Bundeslade berührt, des Todes ist!«, meinte Atalanta zu ihren Gefährten.
Littlelu machte ein langes Gesicht.
»Tot?!«, brachte er dann hervor und Atalanta erwiderte belehrend:
»Ich habe in letzter Zeit viel darüber gelesen. Ja, wer die Bundeslade unbefugter Weise anrührte, war des Todes, wurde von Gott selbst getötet. So zum Beispiel wird im zweiten Buche Samuelis erzählt, wie ein Mann namens Usa sie berührte, nur zufällig — ›da ergrimmte des Herrn Zorn über Usa und schlug ihn daselbst, dass er starb bei der Lade Gottes.‹ Nur die Leviten durften sie tragen und auch sonst berühren.«
»Na ja«, sagte Littlelu beruhigt, »dann schadet's mir auch nichts, ich bin ein Levite — ich führe nämlich, von so reinchristlicher Geburt ich auch bin, auch noch den Vornamen Levi — Levi Louis Maxim. Habe mich manchmal darüber geärgert, jetzt aber freue ich mich. Heißen Sie auch Levi, Herr Graf? Nicht — dann sieht es für Sie und Ihre Frau Gemahlin traurig aus, Sie haben beide die Lade angefasst.«
»Bitte, keine Witze!«
»Lassen wir alles so stehen!«, entschied Atalanta. »Das alles muss von einem kompetenten Gelehrten untersucht werden. Steht uns ein Fundrecht zu, so werden wir uns dieses schon zu sichern wissen.«
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.